
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software

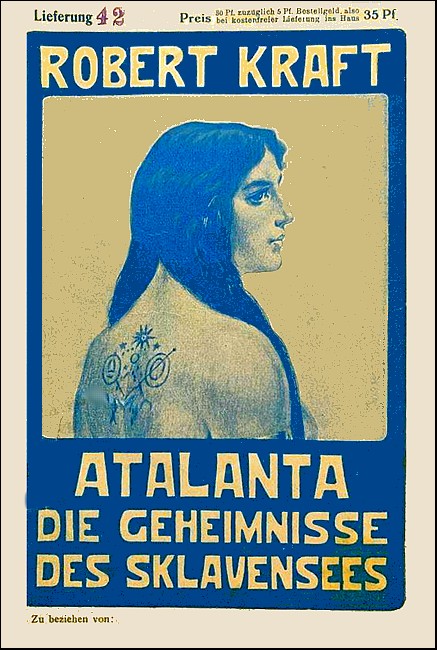
Atalanta, Cover von Lieferung 42
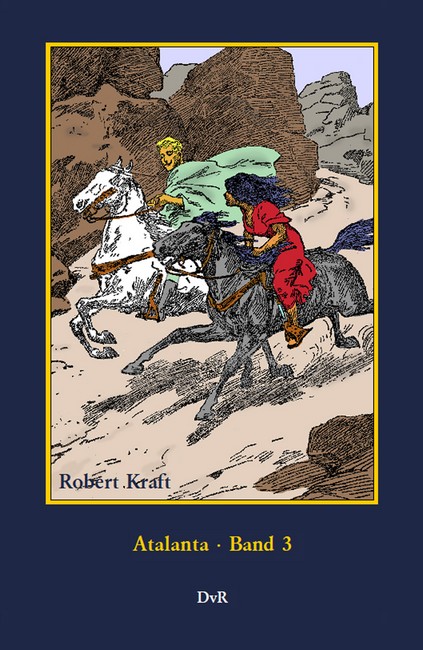
Atalanta, Band 3
Verlag Dieter von Reeken, 2023
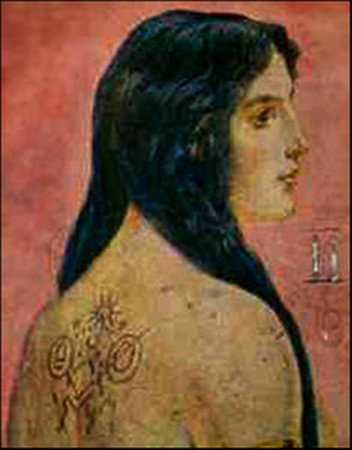
Portrait von Atalanta
Die verlassene Insel - Der Blutregen - In der Burg - Der Spuk wird handgreiflich
Ein böser Empfang - Wieder erwacht - Die Flucht - Miss Ohnefurcht - Auf dem Wege nach dem Irrenhause - Hunderttausend Dollars Belohnung!
Das falsche Signal - Das böse Gewissen - Die Indianerin geht um - Erklärungen
Die Wildnis in den Felsen - Das Erwachen - Die Kriegserklärung - Der schlafende Tod - Die indischen Gaukler
Das Haus mit den zehntausend Zimmern - Stockfisch und Seehundspeck - O Himmel der Heimat, wie bist Du so hart!
Die Rekrutierung der Lumpengarde - Die guten Kameraden - Auf der Festung - Der Defensive-Spieler - Auf dem Todesweg
Die Masken fallen - Wie Miss Morgan befreit wurde - Oberst Eisenfausts Ehrenwort - Zwei Fliegen mit einem Schlage
Im maurischen Garten - Der erste Kiosk - Der zweite Kiosk - Die Katastrophe im Paradies
Hinter den Kulissen - Der rätselhafte Zimmerherr
August Schulze - Nähere Bekanntschaft - Familienanschluss - Der Teufel entpuppt sich

»Steh oder ich schieße!«, donnerte Hagen der gespenstischen Gestalt
entgegen, indem er gleichzeitig den Revolver aus dem Futteral riss.
Zwei Tage später hatten die beiden den Insel-Archipel unter sich, welcher der griechische heißt, aber meist den Türken gehört. Auf diesen reizenden Inselchen, meist vulkanischen Ursprungs, erhebt sich in der Mitte immer ein Berg, nach allen Seiten gleichmäßig abfallend, mit Wald bestanden, wo dieser ausgerodet ist — leider viel zu viel, sodass schon die früheren Quellen versiegt sind — wuchert üppig der Weinstock, die flachen Küsten sind grün mit weidenden Herden, weniger häufig ist hier der Getreidebau. Auf den größeren Inseln sieht man Städtchen mit weißen Häusern, auch auf der kleinsten, wenn es nicht gerade ein Felseneiland ist, einige Hütten, deren Bewohner Weinbau betreiben und dem Fischfang nachgehen oder der Schwammtaucherei.
»Wie wär's, wenn wir einmal den heurigen Wein probierten?«, meinte Hagen.
Littlelu war sofort mit dabei.
Aus ihrer Höhe von mehr als zweitausend Metern hatten sie die Auswahl.
»Dort die kleine Insel, da ist das Weinlaub am schönsten rot gefärbt, diese schon gekelterten Trauben wollen wir einmal kosten. Es ist nur ein Dörfchen, und ehe dessen Bewohner sich von ihrem Schrecken über unseren Anblick erholt haben, dass sie uns mit Fragen belästigen, schwirren wir schon wieder davon, hoffentlich mit der nötigen Balance. Oder wir suchen einen einsamen Weinbauern auf.«
Sie senkten sich hinab.
»Steht da auf dem Berge nicht eine Burg?«, fragte Littlelu nach einer Weile.
»Das ist sehr wohl möglich. Jawohl, es ist so. Fast alle diese Inseln haben ihre Ruinen. Teils sind es die Überreste von Prachtbauten der alten Griechen und Römer, die auf diesen Inseln ihre Sommer- und noch mehr Winterfrischen verlebten, hier Orgien feierten, teils sind es Burgen, welche einst die Ritterorden hier anlegten, die Templer, Johanniter, Malteser und so weiter, weniger um von hier aus die Heiden als sich unter einander zu bekämpfen.«
»Wozu dienen diese Burgen jetzt?«
»Zu gar nichts. Sie sehen ja, man erblickt sie kaum, so überwuchert sind sie. Sie mussten wahrscheinlich wegen Wassermangels aufgegeben werden, können deswegen noch jetzt nicht bewohnt werden, will man das Wasser nicht zutragen.«
»Wie ist denn dieser Wassermangel entstanden?«
»Durch Ausrodung der Wälder. Schon die alten Griechen haben da schwer gesündigt, indem sie überall die Bäume gleich mit den Wurzeln aushoben, um schöne Gärten anzulegen. Sie haben die Bedeutung des Waldes im Haushalt der Natur nicht verstanden. Und die christlichen Ritter haben die Bäume weggeschlagen, um von ihren Burgen freien Überblick zu bekommen. Wohl haben sich die Berge mit der Zeit wieder bewaldet, aber das Regenwasser, das sich nicht mehr ansammeln konnte, hat sich unterdessen andere Abläufe gesucht. — Ja, die Insel scheint doch ganz verlassen zu sein?«
Es war auffallend. Auf allen anderen Inseln herrschte jetzt um diese Vormittagsstunde das regste Leben, und gerade auf dieser hier war kein Mensch zu erblicken. Auch kein Vieh auf der Weide. In dem kleinen Hafen vor dem Dörfchen kein einziges Boot. Jetzt erblickten sie in einiger Entfernung von dem Dorfe eine Villen-Kolonie, die weißen Häuser waren ihnen bisher durch buschige Platanen verborgen gewesen — ebenfalls wie ausgestorben. Auch hier und da auf dem Berge zwischen den Weingärten eine Hütte, eine Villa — kein Mensch, kein Tier, kein Rauch.
»Das ist sehr merkwürdig. Ist die ganze Insel in einen Zauberschlaf versenkt wie weiland Dornröschens verwunschenes Schloss? Nun, untersuchen wir die Sache.«
Die beiden Aeroplane, die sich immer dicht zusammen hielten, sodass eine ganz bequeme Unterhaltung möglich war, gingen mitten auf dem Dorfplatz nieder. Sonst wären sie unbemerkt gelandet, aber dieses Ausgestorbensein hatte ihren Entschluss geändert. Hier musste man nicht Menschen ausweichen, sondern solche suchen.
Kein erstaunter Ruf, kein Hundegebell ertönte.
Aber jetzt merkten sie doch gleich etwas, was ihnen in der Höhe entgangen war.
Sehr viele Hüttentüren standen offen, und ein Blick ins Innere belehrte sie, dass die Wohnungen alle ausgeräumt waren. Nur wertloses Gerümpel war zurückgelassen worden.
»Die Insel ist verlassen worden«, sagte Littlelu.
»Weshalb wohl?«
»Wegen Wassermangels.«
»Dort ist ein Brunnen.«
»Ja, aber es wird nichts drin sein.«
Sie begaben sich hin. Es war ein Ziehbrunnen. die Eimer gingen an einem über eine Winde gelegten Seile auf und ab.
Erst warfen sie einen Stein in den ummauerten Brunnen, aus dem ihnen schwarze Finsternis entgegengähnte. Es plätscherte.
»Da ist Wasser drin.«
»Ja, aber was für welches.«
Sie ließen einen der unten mit einem Stein beschwerten Holzeimer hinab; als er wieder heraufkam, war er mit einer intensiv roten Flüssigkeit gefüllt.
»Das ist Blut!«, flüsterte Littlelu.
»Na, na, werden Sie mal nicht gleich schwach!«, spottete Hagen. »Nicht jede rote Flüssigkeit braucht gleich Blut zu sein. Überhaupt ist das Zeug viel zu dünnflüssig. Aber wegen dieses roten Wassers hat man die Insel verlassen, das stimmt. Es mag auch giftig sein.«
»Woher mag sich das Brunnenwasser so rot gefärbt haben?«
»Ja, wenn ich das wüsste! Vielleicht ein Schurkenstreich, vielleicht nur der schlechte Witz eines Spaßvogels.«
Hagen beugte das Gesicht dichter über den Eimer, roch daran, tauchte den Finger hinein und betrachtete ihn aufmerksam.
»Nein, Rotwein ist es nicht. Der Spritgeruch fehlt. Denn ich dachte vorhin eben so schnell an Rotwein wie Sie an Blut. Ich hoffte schon, man fände hier den Rotwein gleich im Brunnen.«
An dem Finger auch zu lecken, darauf verzichtete er doch lieber.
»Was ist das für eine Insel?«
Hagen hatte die nötigen nautischen Instrumente und Handbücher bei sich, er machte eine geografische Ortsbestimmung und verglich die Landkarte.
»Chila heißt sie, sie gehört der Türkei. Den Namen kenne ich übrigens, ein ganz vorzüglicher Wein, der chilenische. Es wird immer geglaubt, er käme aus dem südamerikanischen Chile, stammt aber von dieser Insel.«
Sie blickten noch in einige Hütten und Häuserchen, betraten auch solche. In einer stand in einer Ecke ein Fass, sehr schwer, gefüllt. Hagen schlug das Spundloch auf und roch daran.
»Ha, das ist Wein, und da ist kein Irrtum dabei! Den haben sie mitzunehmen vergessen. Das Zeug ist ja überhaupt hier so billig, dass es gar nicht des Mitnehmens wert ist.«
Er blickte sich nach einem Trinkgefäß um, sah keines — da bückte er sich, packte das Fass mit beiden Händen.
Es mochte ein halber Hektoliter sein, wog also mit dem Holze mehr als einen Zentner — aber der knöcherne Riese hob das Fass mit steifen Armen empor, als wäre es ein für zwei Hände bestimmter Pokal, ließ sich den Rotwein kunstgerecht aus dem Spundloch in den Mund laufen.
Kein Tröpfchen ging daneben.
»Aaah«, seufzte er dann tief auf. »Ja, das ist Chilener. Also sind wir doch nicht umsonst hier gelandet. Nun kommen Sie dran, Littlelu.«
Der ehemalige Zirkusclown konnte noch heute mit einem anderen Menschen, der weit mehr als einen Zentner wog, Fangball spielen, aber Voraussetzung war, dass dieser andere ebenfalls ein aus Gummi bestehender Akrobat war. Dieses Fass hier vermochte er nicht so ohne Weiteres zu heben, dass er daraus trinken konnte, dazu gehörte eine Riesenkraft.
»Na warten Sie, ich werde Ihnen Ammendienste tun.«
Hagen hob das Fass nochmals, Littlelu bog sich hinten über und sperrte den Mund auf. Einen Teil des roten Stromes bekam er auch hinein, mehr noch aber über den Kopf, zumal Hagen dabei zu lachen anfing. Denn es sah zu possierlich aus, wie der alte Clown da stand, den Bauch vorgereckt, und wie der nun seinen großen Mund aufreißen konnte, wie ein Frosch, da konnte man wirklich nur von einem Maule oder Rachen sprechen, und nun tat er mit Absicht, als ob es ihn gar nicht geniere, wie ihm der Rotwein immer in Strömen über das Gesicht und den ganzen Körper lief, er schluckte immer brav weiter.
Es hatte bei der ledernen Jagdkleidung ja auch wirklich nichts zu sagen.
»Aaaah«, machte jetzt auch Littlelu, als der rote Strom endlich versiegte. »So eine Dusche wirkt doch höchst erfrischend, zumal wenn man nebenbei davon auch trinken kann.«
Sie begaben sich nach der angrenzenden Villenkolonie, Hagen immer noch aus vollem Halse lachend, Littlelu eine feuchte rote Spur hinter sich lassend.
Es waren schöne, kleine Wohnhäuser, ungefähr ein Dutzend, durchweg von weißem Marmor erbaut, der hier wohl gebrochen wurde. Allerdings konnte dieser Marmor nicht mit dem von Carrara und anderen bekannten Steinbrüchen konkurrieren, sodass sich die geschäftliche Ausbeutung und Ausfuhr nicht lohnte. Auch die Trottoirs waren aus weißen Marmorplatten. Zwischen und hinter den Villen herrliche Gärten. Diese reichen Südländer wissen zu wohnen, und da braucht es nicht erst Preisausschreiben für Architekten, das hat dort jeder Maurer und Steinmetz in den Fingerspitzen.
Auch hier dasselbe. Alles ausgeräumt. Aber doch nicht so gründlich wie in den Dorfhütten. Dort stand zum Beispiel noch ein schöner Spieltisch aus Mahagoni, hier und da auch noch andere Möbel. Bei weiterem Suchen fanden sie Zimmer, die noch vollständig eingerichtet waren. In anderen zeigte es sich, dass man unter den Möbeln und sonstigen Sachen gewählt hatte, alles war wild durcheinander geworfen. Aber die meisten Villen waren doch vollständig ausgeräumt.
»Was mag die Bewohner nur zu dieser Flucht veranlasst haben?«, fragte Littlelu nochmals.
»Eben das rote Wasser.«
»Nein, das sieht doch wie eine wirkliche Flucht aus.«
»Hm, Sie haben Recht.«
»Ein Erdbeben?«
»Danach sieht es nun wieder nicht aus. Nirgends eine Spalte, keine Fensterscheibe zerbrochen.«
»Nur einige Erdstöße.«
»Das könnte eher sein. Da nimmt man aber nicht die Zimmereinrichtungen mit.«
»Die Möbel sind nachträglich abgeholt worden.«
»Warum da nicht gleich alles?«
»Sie kommen wieder.«
»Dann wundert mich noch eines: Die Flucht der Bewohner muss doch auch auf anderen Inseln bekannt geworden sein. Weshalb finden sich da nicht hier Räuber ein, die noch abholen, was des Abholens wert ist?«
»Sie fürchten sich vor einem nochmaligen, heftigeren Ausbruch des Erdbebens.«
»Davor haben sich räuberische Naturen noch nie gefürchtet. Denken Sie an Messina, wie da geplündert wurde, während die Erde noch erzitterte.«
Hagen hatte recht. Das fluchtähnliche Verlassen dieses Ortes und wahrscheinlich der ganzen Insel und die Abwesenheit jedes Menschen wurde weder durch das rotgefärbte Wasser noch durch ein Erdbeben erklärt. Hier lag ein vorläufig unlösbares Rätsel vor.
Sie fanden ein Bauer mit einem toten Kanarienvogel. Der kleine Fressnapf war leer, aber der größere Saufnapf enthielt noch einiges Wasser, das noch nicht verdunstet war, der abgemagerte Leichnam war noch nicht in Verwesung übergegangen. Ein Kanarienvogel verhungert in zwei Tagen. Daraus konnte man ungefähr auf die Zeit schließen. Vor drei bis vier Tagen war die Insel verlassen worden.
»Sst«, zischte Hagen, »da kommt ein Mann, der gar nicht den Eindruck eines kühnen Räubers macht! Beobachten wir ihn erst, verstecken wir uns.«
Sie standen gerade an dem offenen Fenster eines Parterrezimmers, das bis auf die Gardinen ausgeräumt war, und verbargen sich hinter diesen.
Aus der Seitenallee kam ein schwarzbärtiger Herr in modernem Straßenanzuge hervor. Sein Benehmen war ganz seltsam. Es war ja möglich, dass er ein böses Gewissen hatte, etwas stehlen wollte, aber mehr noch sah es aus, als ob er sich selbst vor Räubern oder vor irgend etwas anderem fürchtete.
So kam er angeschlichen, sich immer ängstlich umschauend, fortwährend Kreuze gegen die Brust schlagend, dann wieder einen Rosenkranz durch die Finger gleiten lassend.
Sein Ziel war das Haus, in dem sich die beiden Aviatiker befanden. Da erblickte er auf dem weißen Trottoir die roten Fußspuren, die Littlelu hinterlassen hatte, und da war es mit seinem furchtsamen Schleichen vorbei.
»Jesus und Maria!«, kreischte er auf, machte kehrt und rannte, was er laufen konnte.
»He, hallo, bleiben Sie mal stehen!«, schrie ihm Hagen nach.
Aber der blieb nicht stehen, er beschleunigte nur noch seinen Lauf. Da sprang Hagen einfach zum Fenster hinaus und rannte ihm nach. Mit seinen langen Beinen hatte er ihn bald eingeholt und hielt ihn hinten am Rockzipfel fest.
Wohl oder übel musste sich der Herr umwenden, er zitterte an allen Gliedern, doch wohl weniger wegen des riesigen Mannes mit den Revolvern am Gürtel.
»Was hat es denn eigentlich hier gegeben?« eröffnete Hagen das Gespräch, sich des Französischen bedienend, das jeder gebildete Grieche versteht, und einen solchen hatte er unbedingt vor sich.
Der Mann klapperte noch einige Male mit den Zähnen, bis er endlich zwei Worte hervorbrachte:
»Hier spukt's.«
»Aha, aha, hier spukt's! Das also ist die Ursache der allgemeinen Flucht!«
Hatte es Hagen schon in belustigtem Tone gesagt, so musste er dann aus vollem Halse lachen. Nämlich über Littlelu, der ihm nachgeeilt war.
»Hier spukt's!«, wiederholte der, und der ehemalige Zirkuskomiker sah sich mit rollenden Augen in einer nicht zu beschreibenden Weise um, dabei an allen Gliedern wie Espenlaub zitternd, nicht nur seine Ohren, sondern sogar seine Nasenspitze konnte er wackeln lassen, und mit den Zähnen klapperte er, dass es klang, als sei in der Nähe eine Mühle in voller Tätigkeit.
»Hier spukt's!«, klapperte er hervor, seinen Gummihals nach allen Richtungen verdrehend.
Hagen musste sich erst auslachen. Der kleine, dicke Kerl war wieder einmal von überwältigender Komik.
»Wo soll es denn hier spuken?«, forschte Hagen dann weiter.
»Überall!«, ächzte der Grieche.
»Gespenster?«
»Gespenster — Geister — Leichen — Blut — alles.«
»Am helllichten Tage?«
»Zur Mittagszeit.«
Endlich brachte man den zitternden Helden so weit, dass er zusammenhängend erzählen konnte.
Dort oben in der alten Malteserburg hatte es schon immer gespukt. Der letzte Bewohner, vor zwei- oder dreihundert Jahren, ein Ordensmeister, hatte sich verbotenen und unnatürlichen Lüsten hingegeben, hatte gefangene Sarazeninnen in seiner Burg behalten und auch christliche Jungfrauen an sich gelockt, er, der ewige Keuschheit gelobt, und zuletzt war der Kerl so tief gesunken, dass er den holden Mädchen bei lebendigem Leibe das Blut aussaugte, teils, weil er überhaupt daran Geschmack fand, teils, weil er hoffte, sich dadurch ewige Jugend zu sichern. Seine Opfer hatte er immer in den Brunnen geworfen, bis der Unhold und die anderen Ritter, die ihm dabei Gesellschaft geleistet, auf irgend eine Weise von der Rache des Himmels getroffen worden waren.
So weit die Sage — für den Griechen eine Tatsache. Vielleicht gar nicht so mit Unrecht. Diese mönchischen Ritter, denen es durch die angehäuften Reichtümer immer wohler wurde, haben sich erwiesener Maßen schwere Verfehlungen zu Schulden kommen lassen, es war die höchste Zeit gewesen, dass sie aus der Weltgeschichte verschwanden.
Und seit dieser Zeit spukt es auf der Insel. Die blutsaugenden Ritter hatten keine Ruhe im Grabe und die unschuldigen Jungfrauen ganz ungerechtfertigter Weise keine Ruhe in ihrem Brunnen. Jede Nacht gaben sich die weißgekleideten Seelen in der alten Burg ein Stelldichein. Die ersäuften Jungfrauen forderten ihr Blut zurück, und die schattenhaften Rittergeister konnten doch keines geben, weil sie selber keines mehr hatten. Und da war immer viel Heulen und Zähneklappern. Und wenn die Geister dort oben einmal einen ganz besonderen Spektakel machten, ächzten und heulten und mit Ketten rasselten und Sargdeckeln klapperten, dann färbte sich regelmäßig auch hier unten das Brunnenwasser dunkelrot, es verwandelte sich einfach in Blut, und nicht nur das, sondern dann regnete es sogar vom blauen Himmel Blut herab, alles Lebendige tötend.
So hatte der Grieche berichtet — freilich mit anderen Worten, durchaus nicht spöttisch — und nun lassen wir ihn persönlich erzählen.
»Das ist so zwei- oder gar dreihundert Jahre gegangen. Und heute vor fünf Tagen hat der Spuk wieder eingesetzt. Der alte Kyriakos war der erste, der in der Nacht die weißen Gestalten um die Burg hat herumschweben sehen, was sie sonst nie tun, sonst bleiben sie immer drin. Wir glaubten es ihm nicht. Aber in der folgenden Nacht sahen wir alle die Gespenster selbst. Wie sie in den Weingärten herumschwebten, bis an den Fuß des Berges kamen sie, sogar noch hier in der Kolonie hörte man ihr schreckliches Klagen — grässliche Stimmen. Am nächsten Morgen hatte sich alles Brunnenwasser in Blut verwandelt. Und wie wir aus der Kolonie noch an dem Brunnen stehen und beraten, was da zu machen sei, ob wir uns an das Kloster des heiligen Stephanos wenden wollen oder ob nicht eine Prozession mit dem Schenkelknochen des Johannes besser wäre, da kommt plötzlich vom blauen Himmel ein Regen von rotem Blut herab —«
Der Grieche begann wieder zu zittern, dass er nicht weiter sprechen konnte, und da auch Littlelu wieder wie eine Mühle mit den Zähnen zu klappern begann, so übernahm Hagen das Verhör, und zwar mit ernstem Interesse.
»Na, und da?«
»Der Blutregen hörte bald wieder auf, aber wir alle waren schon über und über voll Blut, ganz rot.«
»Na und weiter?«
»Ja, wir werden uns doch nicht verbrennen lassen. Da sind wir in die Boote geflüchtet, zuerst ohne etwas mitzunehmen, als was wir auf dem Leibe trugen. Aber Pater Hyronimos hielt eine Rede, er meinte, wir sollten nur mitnehmen, was wir könnten, wenn die Gespenster unseren guten Willen sähen, die Insel zu verlassen, dann würden sie einstweilen den feurigen Blutregen auch einstellen. Wiederkommen dürften wir freilich nicht. Und da haben wir schnell in die Boote gepackt, was hinein ging. Es waren einige große Fischerboote da, auch drei Motorfahrzeuge. Nur wenige haben etwas zurücklassen müssen.«
»Wo begaben sich die Flüchtlinge hin?«
»Nach Pampos!«
»Wo ist das?«
»Die benachbarte Insel, eine ziemlich große, mit einer Stadt. Dort bin auch ich noch mit meiner Familie. Wir wissen ja noch gar nicht, was nun anzufangen ist.«
»Weshalb kommen Sie jetzt noch einmal hierher?«
»Ich habe einen Schreibtisch zurückgelassen, es fehlte an Arbeitern, ihn noch zu transportieren, ich glaubte, ich hätte ihn ganz ausgeräumt. Gestern Abend fiel mir aber ein, dass in dem Geheimfache noch einige Hypothekenbriefe seien. Die wollte ich noch holen, das ging nicht anders.«
»Wie sind Sie hergekommen?«
»In einem Segelboote.«
»Sie allein?«
»Ganz allein. Wer sollte mich denn begleiten? Für alles Geld der Welt hätte sich kein anderer gefunden.«
Dann mussten die Hypothekenbriefe einen hohen Wert für den Mann besitzen, vielleicht waren auch noch andere Papierchen dabei, im Geheimfache, die diesem Griechen eine solche Courage eingeflößt hatten, dass er es gewagt, noch einmal die Insel zu betreten.
»Wann ist das geschehen mit dem Blutregen?«
»Heute vor drei Tagen, um dieselbe Morgenstunde wie jetzt.«
»Und Sie behaupten, dass innerhalb dieser drei Tage kein anderer Mensch diese Insel wieder betreten habe?«
»Von uns keiner, und sicher auch niemand anders. Wer soll denn das wagen?«
»Aber Sie haben es doch gewagt.«
»Jaaa, meine Hypothekenbriefe —«
»Nun, bleiben wir erst einmal bei dem Blutregen. Es ist wirklich ein roter Regen vom Himmel herabgekommen?«
»Wie ich sage.«
»Vom blauen Himmel herab?«
»So blau wie jetzt.«
»Wie lange hat er angehalten?«
»Wenigstens eine Minute, ein tüchtiger Schauer, die ganze Gegend war über und über rot so wie wir selbst.«
»Aber davon ist doch jetzt keine Spur mehr zu sehen.«
»Ja, das war eben das Merkwürdige dabei. Wir hatten Pampos noch nicht erreicht, also noch nicht nach einer Stunde, da war das Blut wieder verschwunden, unsere Hemden waren wieder schneeweiß. Ach, noch viel schneller ging das.«
»Wie ist denn das möglich?«
»Das Blut bleichte wieder aus, sogar im Schatten.«
»Blut bleicht nicht einmal in der Sonne aus, es bleiben immer rote Flecke zurück.«
»Ja, es ist eben ganz besonderes Blut, Geisterblut, es ist — imaginäres Blut.«
Hagen schüttelte den Kopf.
»Hören Sie — wie heißen Sie?«
»Achilles Papapopulos.«
»Achilles Papapopulos — das habe ich mir doch gleich gedacht!«, sagte der Kapitän trocken. »Hören Sie, Monsieur Papapopulos, diese ganze Geschichte ist doch nicht etwa nur imaginär, nur Einbildung?«
»Sie glauben es nicht? Gehen Sie nach Pampos, da sind mehr als hundert Menschen, die alle dasselbe erzählen werden. Und weshalb hätten wir denn unsere Insel verlassen?«
Ja, Hagen musste es wohl glauben. Irgend etwas musste doch daran sein. Eine Erklärung hatte er auch schon dafür — weil der Mensch nun einmal für alles eine Erklärung haben muss.
»Waren es kleine oder große Tropfen?«
»Zuerst ein feiner Sprühregen, die Tropfen wurden immer größer, zuletzt regnete es platz.«
»War er kalt?«
»Kalt wie gewöhnlicher Regen. Das war erst eine Warnung für die Menschen. Aber das nächste Mal kommt er glühend heiß herunter, in feurigen Tropfen, alles verbrennend.«
Angstvoll musterte der Grieche den Himmel, der in prachtvoller Bläue strahlte.
»Ist der Stoff, auf den die roten Tropfen nieder fielen, schon von einem Chemiker untersucht worden?«
»Jawohl, in Pampos ist ein Apotheker, ein tüchtiger Chemiker, der hat Stücke von unseren Hemden und von anderen Anzügen untersucht.«
»Nun, und was hat er gefunden?«
»Gar nichts. Keine Spur von einer fremden Substanz, die nicht in den Gewebstoff gehört. Höchstens Staubpartikelchen. Aber auch in dem Wasser findet er nichts.«
»In welchem Wasser?«
»In dem des Brunnens, von dem wir eine Probe mitgenommen hatten.«
»Auch dieses verlor die rote Färbung?«
»Nein, das blieb rot und ist es heute noch.«
»Und der Chemiker hat nichts darin gefunden?«
»Gar nichts. Es ist scheinbar ganz reines Trinkwasser.«
»Auch kein übermangansaures Kali hat er darin gefunden?«
»Keine Spur. Und der Apotheker hat auch sofort an übermangansaures Kali oder an ein ähnliches Salz gedacht, das in den geringsten Quantitäten ganz intensiv färbt.«
»Versteht dieser Apotheker auch wirklich etwas davon?«
»Honokos ist sogar ein ganz tüchtiger, ein berühmter Chemiker, er bekommt Brunnen- Quellwasser von weither geschickt, macht die allerfeinsten quantitativen Analysen, es ist seine Spezialität und er hat alle Einrichtungen dazu.«
»Hm, dann könnte man dieses rote Wasser also doch trinken, es ist ganz unschädlich.«
»Trinken? Unschädlich?«, rief der Grieche erschrocken. »Das ist imaginäres Geisterblut, wer weiß, was da für ein furchtbares Gift drinsteckt.«
»Ist irgend ein Gift drin gefunden worden?«
»Gar nichts, sagte ich ja schon.«
»Sind Versuche an Tieren damit gemacht worden, die es trinken mussten?«
»Nein, dazu war die Probe zu klein, sie war schon bei den Analysen verbraucht worden.«
»Hm. Und dieser Blutregen ist hier schon öfters vorgekommen?«
»In den dreihundert Jahren schon wiederholt.«
»Dann hat sich auch stets das Brunnenwasser so rot gefärbt?«
»Stets.«
»Und dann haben die Bewohner die Insel immer verlassen?«
»Natürlich. Wenn sie nicht gingen, so wurden sie ja verbrannt.«
»So heiß war der Regen?«
»Zuletzt verwandelt er sich in glühende Tropfen, als wäre es geschmolzenes Eisen, und da gibt es doch keinen Schutz dafür. Die Häuser brennen ab, der ganze Wald, wohin soll man sich denn da flüchten?«
»Merkwürdig«, sagte Hagen kopfschüttelnd, »das ist hier wirklich schon öfters vorgekommen?«
»Schon wiederholt.«
»Merkwürdig! So etwas passiert in der Welt und man erfährt gar nichts davon. Wann ist es denn das letzte Mal passiert?«
Jetzt aber kam der heikle Punkt. Von den Menschen, die jetzt noch lebten, hatte es noch niemand selbst gesehen, auch der älteste nicht. Vor vielleicht hundert Jahren war es das letzte Mal passiert. So meldete die Chronik, aber auch keine schriftliche. Nur eine Sage, die von Mund zu Mund ging, der Großvater erzählte es dem Enkel.
»Ach sooo! Es ist nur eine Sage! Ja dann freilich!«
»Ist es aber nicht eine Tatsache, dass es vor drei Tagen hier Blut geregnet hat?«
»Na, rotes Wasser, wollen wir zur Vorsicht lieber sagen. Hm, daran möchte ich jetzt nicht mehr zweifeln. Aber es war nicht heiß, nicht einmal warm.«
»Das nächste Mal kommt ein warmer Blutregen, zur Warnung, dass er das dritte Mal ganz heiß kommt, wenn nicht schon glühend, dass selbst die Steinhäuser schmelzen. Und das Erscheinen der Geister außerhalb der Burg hat uns schon vorher davor gewarnt.«
»Richtig, da kommen ja die Geister wieder! Die hatte ich ganz vergessen. Sie selbst haben die Geister in der Nacht gesehen?«
»Ich selbst. Wir alle.«
»Wie sahen die denn aus?«
»Es waren weiße Gestalten.«
»Was machten sie?«
»Sie schwebten in den Weinbergen herum!«
»Und gaben Töne von sich?«
»Die ganze Insel war von einem schrecklichen Wehklagen und Winseln und Wimmern erfüllt, dazwischen ein furchtbares Kettengerassel, weit entfernt und dennoch wie in dichter Nähe von uns, eben ganz geisterhaft.«
»Und wann in der Nacht war das?«
»Um Mitternacht fing es an und Punkt eins verschwanden die weißen Gestalten wieder.«
»Also pünktlich die Geisterstunde eingehalten. Monsieur Papapopulos, lassen Sie sich eines sagen: Ich halte es für möglich, dass sich Brunnenwasser plötzlich rot färben kann. Ich glaube sogar an einen sogenannten Blutregen. Aber an Gespenster glaube ich ein für alle Mal nicht, und auch nicht, dass so ein Blutregen siedend heiß vom Himmel herab...«
Erstaunt, sogar erschrocken brach Hagen ab.
Plötzlich kam es von dem blauen Himmel rot herabgerieselt, immer größer wurden die Tropfen und auch immer wärmer, im Nu waren die drei und die ganze Umgebung purpurrot gefärbt.
Mit dieser Beobachtung hielt man sich freilich nicht lange auf. Alle drei sprangen schleunigst in das nächste Haus.
»Alle Wetter«, sagte Littlelu, »da habe ich vorhin zu früh mit den Zähnen geklappert, jetzt kommt's wirklich!«
Dafür holte jetzt der Grieche das Zähneklappern nach. Er hatte sich in eine Ecke gekauert.
»Wir sind verloren, jetzt kommt der glühende Blutregen!«, wimmerte er.
Am kaltblütigsten fasste Hagen die Sache auf. Er trat dicht an die Türschwelle und hielt die Hand hinaus.
Ja, auffallend warm war der rote Regen, aber wärmer wurde er nun nicht mehr, und heiß konnte man das noch lange nicht nennen.
Dann zog Hagen ein Notizbuch aus der Tasche, riss ein Blatt Papier heraus und legte es draußen auf das Trottoir. Die roten Tropfen fielen spritzend darauf, bald hatte es sich ganz rot gefärbt.
Da aber hörte der Blutregen auch schon wieder auf. Er hatte noch lange keine Minute gewährt, und noch weniger dauerte es eine Stunde, bis die rote Färbung wieder verblasste. Wie die wenige Feuchtigkeit schnell unter der heißen Sonne verdunstete, so bleichte die rote Farbe immer mehr, bis sie beim Trocknen wieder ganz verschwunden war. Auch das Papier war wieder ganz weiß geworden.
Der Grieche hatte gemerkt, dass die Gefahr vorüber war.
»Das nächste Mal kommt Feuer vom Himmel herunter!«, schrie er, sprang auf und rannte hinaus, aber nicht in sein gegenüberliegendes Haus, sondern nach der Richtung, wo der Hafen und sein Boot lag.
»Was sagen Sie zu diesem Blutregen, Mister Maxim?«
»Ich hin einfach paff. Ja, da passieren also heutzutage noch immer solche polizeiwidrige Wunder?«
»Haben Sie denn noch nichts von Blutregen gehört?«
»Ich? Nee. Sie?«
»Gewiss. Das ist gar nichts so Wunderbares. In den Alpen kann man so einen Blutregen manchmal erleben, noch öfters im nördlichen Skandinavien, in Lappland.«
»Wie ist denn das möglich?«
»Es handelt sich um eine Flechte oder Alge, deren Sporen nach der Reife als federleichte Fasern in der Luft herumschweben. Im trockenen Zustande sind sie farblos, im Wasser färben sie sich purpurrot, dabei ungeheuer aufquellend. So kommt es, dass es in jenen Gegenden manchmal scheinbar Blut regnet. Beim Trocknen schrumpfen die Sporen wieder zusammen und werden farblos.«
»Hm«, brummte Littlelu, »mir ist diese Erklärung nicht ganz plausibel. Wie können denn die roten Wassertropfen vom blauen Himmel herabregnen?«
»Weil diese Sporen äußerst hygroskopisch sind, sie saugen Wasser auf, das sich doch immer in der Atmosphäre befindet, werden dadurch schwer und fallen als Tropfen herab.«
»Wir sind hier aber weder in den Alpen noch im nördlichen Skandinavien. Kommt denn so etwas auch in dieser Gegend vor?«
»Allerdings ist davon bisher nichts bekannt, diese Flechten gedeihen nur in kalten Gebirgsgegenden. Es mag eine ganz andere Flechte sein, die sich hier einmal kultiviert hat, mit ganz denselben Eigenschaften. Da fällt mir übrigens ein, dass dasselbe Phänomen auch in Australien beobachtet worden ist, in Weingegenden, und zwar immer zu der Zeit, wenn sich die Weinblätter rot zu färben beginnen. Man steht noch vor einem Rätsel, ist aber bereits zu der Ansicht gekommen, dass das Rotfärben der Weinblätter von einer Flechte herrührt. Aber nur eine neu gezüchtete Rebensorte Australiens soll diese Eigenschaft besitzen. Und richtig, jetzt entsinne ich mich, dass man auf einigen dieser Inseln, als vor etlichen Jahren der ganze Weinbau durch die Reblaus vernichtet wurde, australische Rebensorten eingeführt hat. Sehen Sie, Mister Maxim, nun ist die Erklärung gleich gegeben.«
»Na, für mich noch nicht so ganz. Wie hat sich denn das Grundwasser so rot gefärbt?«
»Auch durch diese Flechten.«
»Weshalb bleicht denn dieses nicht aus?«
»Weil das wieder eine andere Flechte ist.«
»Um eine Antwort sind Sie nie verlegen, das muss man Ihnen lassen.«
Hagen lachte.
»Nein, weil sich hier die Sporen doch noch aufgequollen im Wasser befinden, deshalb bleibt dieses auch rot. Dieser Blutregen ist aber doch sofort wieder aufgetrocknet.«
Littlelu betrachtete aufmerksam das weiße Blatt Papier.
»Ich kann hier nichts von Sporen bemerken.«
»Die sind mikroskopisch klein.«
»Nun soll es aber doch auch früher hier schon Blut geregnet haben?«
»Na ja, das Phänomen hat sich schon früher einmal hier gezeigt.«
»Vor hundert Jahren? Damals soll der Blutregen doch kochend heiß oder gar feurig gewesen sein, dass sogar die Steinplatten schmolzen.«
»Nicht unmöglich. Da war der Blutregen von einem furchtbaren Gewitter begleitet, die Blitze fielen wie Feuer herab, überall zündeten sie, große Waldbrände, vom Blitze getroffene Steinmassen schmolzen, vielleicht auch gleichzeitig ein starker Sternschnuppenfall, glühende Meteoriten sausten herab und expplodierten krachend. Dieses Naturereignis hat sich der hiesigen Bevölkerung als Sage erhalten, natürlich ist sie sehr ausgeschmückt worden, sie wurde mit den Malteserrittern in Verbindung gebracht, die hier gar arg gehaust haben mögen.«
»Aha, ahaaa!«, machte Littlelu. »Nun ist mir alles klar. Nur eines noch nicht.«
»Das wäre?«
»Und die Geister, welche alle die Leute neulich hier gesehen haben?«
»Auch das ist ganz einfach zu erklären.«
»Nun?«
»In den Köpfen dieser Griechen und Türken sieht es einfach genau so verschroben aus wie in dem Ihren.«
»Herr, werden Sie nicht beleidigend!«
»Na, Sie glauben doch nicht etwa an Gespenster?«
»Und wenn ich Ihnen nun versichere, dass ich schon einmal einen Geist gesehen habe?«
»Haben Sie? Wo?«
»In einem Boardinghouse zu Greentown, Michigan. In der Bodenkammer, in der wir Artisten schliefen, hatte es schon immer gespukt. Und eines Nachts sahen wir das Gespenst. Es war ganz weiß, und hinten auf seinem Buckel stand mit großen, schwarzen Buchstaben: ›Dieses Betttuch ist gestohlen aus Mac Browns Boardinghouse‹. Ich hatte eine mit Schweinsborsten geladene Pistole bei mir und jagte damit dem Gespenst einen Schuss hinten hinein, da quiekte es und verschwand. Am andern Morgen musste der Hausdiener ins Spital gehen, das Sitzfleisch tat ihm so weh.«
Hagen lachte. Unter solchem Gespräch, das immer humoristischer wurde, waren sie wieder auf die sonnige Straße getreten.
»Aber Spaß beiseite«, sagte Littlelu, »nach jenes Mannes Erzählung muss man doch wirklich weiße Gestalten gesehen haben, so viele Menschen können sich da doch nicht täuschen.«
»Massensuggestion tut viel, oder es können ja auch Nebel gewesen sein, die in den Weinbergen geschwebt haben, und die Gestalten wurden von der Phantasie gebildet.«
»Oder es haben sich einige Kerls als Gespenster maskiert.«
»Auch möglich. Dann sind das aber sicher keine Griechen und keine Türken gewesen.«
»Weshalb nicht?«
»Weil die orthodoxen Griechen wie die mohammedanischen Türken durch und durch von Gespensterfurcht verseucht sind. Auch der sonst verwegenste Bandit ist nicht Freigeist genug, um einmal die Rolle eines Gespenstes zu spielen. Der beschworene Geist könnte selbst über ihn kommen.«
»So könnte man daraus schließen, dass andere diesen Geisterspuk in Szene gesetzt haben, um die Bewohner dieser Insel wegzuekeln.«
»Oho, Mister Maxim, das ist ein kühner Schluss! Wie kommen Sie auf diese Vermutung?«
Littlelu gab zu, dass es ein voreiliger Schluss gewesen war.
»Wollen wir nun einmal der Burg einen Besuch abstatten?«
»Ja, da wir nun einmal hier sind, und was sollen wir sonst anderes tun?«
Nach einer kurzen Beratung bestiegen sie wieder ihre Aeroplane und flogen auf.
Die Burg lag auf dem Gipfel des ziemlich hohen und steilen Berges, auf einem geräumigem Plateau, umgeben von Wald, Busch und Felsenformationen.
Von einer Burgruine durfte man eigentlich nicht sprechen. Das ganze Mauerwerk schien noch vollständig erhalten zu sein. Nur war alles überwuchert, aus den Mauerspalten wuchsen ganze Büsche.
In der Umgebung war kein Landungsplatz zu finden. Am besten eignete sich dazu wohl das flache Dach neben dem Turm, auf dem nur Graswuchs sprosste.
Sie gingen darauf nieder, mit der nötigen Vorsicht, um nicht etwa einzubrechen. Aber das war alles massiv und hielt noch zusammen.
Eine türlose Öffnung führte in den Turm, eine Treppe ging hinab. Die kleinen, schmalen Fenster waren so zugewachsen, dass mehr Nacht als Dämmerung herrschte.
Littlelu ging zufällig voran, er war schon auf der Treppe, hatte aber den Blendstrahl seiner elektrischen Lampe noch nicht aufflammen lassen, als er plötzlich zurückprallte.
Es war begreiflich, dass der hinter ihm gehende Hagen heftig erschrak, oder er wäre kein fühlender Mensch gewesen. Die ganze Umgebung war ja danach beschaffen, die modrige Luft, und die Einbildung tat das Übrige.
»Was gibt es?«, flüsterte Hagen.
Littlelu deutete die Treppe hinab in die schwarze Finsternis.
»Da — da — sehen Sie — sehen Sie's nicht?«
»Was denn nur?«
»Die weiße Gestalt — da schwebt sie —«
»Ich kann nichts sehen.«
»Ich auch nicht. Ich wollte Sie nur einmal prüfen. Ganz geisterfest sind Sie nicht, sonst wären Sie nicht so erschrocken. Dagegen fehlt Ihnen die nötige Einbildungskraft, Sie lassen sich nicht bereden, sonst hätten Sie gleich wirklich eine weiße Gestalt in der Finsternis sehen müssen — auf welche Weise alle Gespenstergeschichten entstehen.«
»Lassen Sie doch Ihre schlechten Witze!«, sagte Hagen ärgerlich.
Aber es war ein ganz gutes Experiment gewesen. Und in die richtige Stimmung waren sie nun auch gekommen.
Mit dem vorausgeschickten Blendstrahl setzten sie ihren Weg fort, stiegen die Treppe hinab und durchwanderten verschiedene Räume. Alles nackt, die Mauern von Spinnweben überzogen. Durch das Licht wurden zahllose Fledermäuse aufgescheucht, die geblendet manchmal heftig gegen sie anstießen.
»Möchten Sie hier allein herumkriechen?«, fragte Littlelu.
»Möchten? Nein, das möchte ich nicht. Wenn ich keinen ganz besonderen Grund dazu hätte.«
»Es ist unheimlich hier, was?«
»Sehr unheimlich.«
Beide hatten der Wahrheit die Ehre gegeben. Einem unheimlichen Gefühl unterlagen sie beide. Sich »fürchten«, das ist wieder etwas ganz anderes.
»Möchten Sie hier wohnen?«, forschte Littlelu weiter.
»Wenn mir die Burg zum Geschenk gemacht würde und ich die nötigen Mittel zu ihrem Unterhalt hätte! Aber sofort! Sie müsste sich überhaupt ganz hübsch einrichten lassen, das Mauerwerk ist ja noch tadellos erhalten.«
»Weshalb lässt man nur so ein vorhandenes, in guter Beschaffenheit befindliches Bauwerk so unbenutzt liegen?«
»Sie stellen diese Frage immer wieder, können das nicht begreifen, weil Sie ein Amerikaner sind, weil es in dem neuen Erdteile keine solche verlassenen Burgen gibt, während hier alles davon wimmelt. Außerdem wird, wie ich schon sagte, wohl das Wasser fehlen. Suchen wir einmal den Brunnen, den wir wohl an der tiefsten Stelle finden werden, im Keller.«
Sie kamen an eine nach unten führende Treppe, stiegen tief hinab und befanden sich in dem fensterlosen Keller, der in den Felsen gehauen war.
Hier machten sie Entdeckungen, die ein schreckhaftes Gemüt, mit lebhafter Phantasie verbunden, nur noch mehr beunruhigen mussten.
In einem kleinen Verlies waren in der Wand Ringe eingelassen, an denen jetzt noch verrostete Ketten hingen.
Der Zweck dieser Ketten wurde klar, als man nebenan in solchen Ketten noch ein menschliches Skelett hängen sah, wenigstens noch die Armund Fußknochen von Ringen umschlossen, alles andere war ja auseinander gefallen.
Wieder in einem anderem Raume stand ein Gerümpel, verrostetes Eisen und vermodertes Holz, daneben lagen menschliche Skelette, und den meisten waren die Schienbeine gebrochen, zum Teil auch die Arme.
»Das ist die Folterkammer gewesen«, flüsterte Littlelu, »das hier war so ein Marterinstrument.«
»Ja, da zeigt es sich, wie die hier damals gehaust haben! Und diese Ritter sind nun die Beschützer des Christentums gewesen, wollten das Leben Christi nachahmen, wenn auch als streitbare Männer. Es ist eine Schmach!«
Ein anderer Raum war ganz mit Skeletten oder vielmehr Knochen angefüllt.
»Und wissen Sie, wem diese Knochen angehört haben?«, fragte Hagen, nachdem er einige aufmerksam betrachtet hatte.
»Menschen. Einstigen Gefangenen oder vielleicht Malteserrittern selbst, die sich etwas zuschulden haben kommen lassen.«
»Nein. Jene Sage findet hier schon einige Bestätigung. Ich verstehe etwas von Anatomie, vom menschlichen Knochenbau. Das sind lauter Skelette von Frauen. Ich sehe keinen einzigen männlichen Schenkelknochen.«
Es war begreiflich, dass der ehemalige Zirkusclown nur noch scheuer den gewaltigen Knochenhaufen betrachtete.
»Entsetzlich! Dass die das hier nur so einfach haben liegen lassen!«

»Mir machte es schon vorhin den Eindruck, als sei die Tür einmal zugemauert gewesen. Sie ist wieder aufgebrochen worden, aber auch schon vor so langer Zeit, dass dies nicht mehr deutlich erkennbar ist.«
Littlelu schüttelte sich.
»Herr Kapitän, ich glaube nicht an Gespenster, graue mich nicht vor Leichen und Skeletten, bin auch sonst gerade kein Furchthase — aber ich habe das Bedürfnis, wieder etwas Sonnenlicht zu atmen.«
»Erst aber wollen wir den Brunnen aufsuchen!«
Sie fanden ihn in einem anderen Teile des Kellers. Er war eine kreisrunde Öffnung, mit einer niedrigen Mauer eingefasst, die aber schon ganz zerbröckelt war. Darüber war die Decke durchbrochen, hier waren einst die Seile mit den Eimern auf und ab gegangen, die Windevorrichtung befand sich oben, wohl neben der Küche.
»Also in diesen Brunnen sind die Jungfrauen geworfen worden, nachdem die Ritter ihnen das Blut ausgesaugt haben!«, flüsterte Littlelu.
»Ja, nachdem wir schon so viele weibliche Skelette gefunden haben, kann man auch so etwas wirklich für möglich halten. Man muss nur bedenken, dass diese Ordensritter unter Klostergesetzen standen, es waren streitbare Mönche, die durften in ihre Burg auch keinen weiblichen Gefangenen bringen.«
»Aber wenn sie Leichname oder die blutleeren Mädchen da hinabwerfen, da konnten sie doch nicht mehr das Wasser trinken?«
Es hatte nicht etwa eine humoristische Frage sein sollen.
»Vielleicht sind sie einmal überrascht worden und mussten die Leichen schnell beiseite bringen. Schließlich ist das doch nur eine Sage, auch wenn etwas Reelles dahinter steckt.«
Der Blendstrahl ging dreißig Meter tief hinab, ohne einen Wasserspiegel zu treffen. Ein hinabgeworfener Stein plätscherte nach vier Sekunden. Hagen verstand aus dieser Zeit nach der Beschleunigung des Falles und den zurückkehrenden Schallwellen die Tiefe zu berechnen, aber für Brunnenschächte ist so eine Berechnung ganz unzuverlässig. Da war das Knäuel Garn besser, das er für alle Fälle in der Tasche hatte.
Ein Stein wurde daran gebunden und hinabgelassen. Der für Messungen bestimmte Faden war genau hundert Meter lang. Als er wieder heraufgezogen wurde, hatten sich ungefähr zehn Meter genässt. Also lag der Wasserspiegel neunzig Meter unter dem Brunnenrande. Der Stein und der andere Teil des Fadens waren rot geworden, also war auch hier das Wasser rot gefärbt.
Während Hagen noch maß, starrte Littlelu unverwandt in den finsteren Schlund hinein, leuchtete hinab und blickte wieder ins Finstere hinein.
»Herr Kapitän, nehmen Sie mir's nicht übel?«
»Was soll ich Ihnen denn nicht übel nehmen?«
»Ich mache keinen schlechten Witz — ich glaube dort unten ganz deutlich eine weiße Gestalt zu sehen.«
Auch Hagen blickte hinab, längere Zeit, leuchtete ebenfalls, zog den Blendstrahl wieder zurück und starrte wieder in den schwarzen Schlund.
»Ja — wenn ich ehrlich sein soll — auch ich sehe dort unten eine weiße Gestalt!«, sagte er dann.
»Wie eine Frau, die heraufblickt, das weiße Haar fließt ihr am Rücken hinab.«
»Dasselbe sehe ich.«
»Und jetzt hebt sie den Arm und winkt.«
»Wahrhaftig, sie tut's! Da sehen Sie, was die Einbildung macht. Ich sehe dasselbe, wie Sie es mir beschreiben.«
»Herr Kapitän, das möchte ich nicht für Einbildung halten.«
Wieder blickte Hagen längere Zeit aufmerksam hinab.
»Nein, ich auch nicht!«, gestand er dann. »Das ist wirklich eine weiße Gestalt.«
»Was kann das sein?«
»Einfach ein weißer Stein.«
»Aber winkt da nicht wirklich ein weißer Arm?«
»Ein weißes Etwas — ja, ich muss es zugeben.«
»Wie ist das möglich?«
»Ein weißes Band, eine Flechte, eine Wasserpflanze, die sich hin und her bewegt. Nun kommt noch unsere Einbildung dazu und —«
Erschrocken brach er ab. Aus dem Brunnen war ein langer, klagender Ton hervorgekommen, er wiederholte sich noch einige Male, immer schwächer werdend, bis er verklang.
»Alle Teufel, das war keine Einbildung!«, flüsterte Littlelu.
»Es war eine Gasblase, die platzte!«, wusste auch hierfür Hagen sofort eine Erklärung, obgleich er nicht minder erschrocken gewesen war.
»Eine Gasblase, die beim Platzen so seufzt?«, fragte Littlelu. »Wollen Sie mir das nicht einmal vormachen?«
»Bedaure, ich bin keine Gasblase. Aber Tatsache, in Sümpfen, in denen große Gasblasen entstehen, hört man oft solche seufzenden Töne, die schon zu vielen Spukgeschichten Veranlassung gegeben haben.«
»Die hat vier- oder fünfmal hintereinander geseufzt.«
»Einfach das sich wiederholende Echo an den Brunnenwänden.«
»Sie mögen recht haben. Aber eine neugierige Frage: Würden Sie wagen, sich da hinabzulassen? Es ist eine philosophische Wissbegierde.«
»O ja, das würde ich sofort machen. Wenn auch, gestehe ich offen, mit einigem Herzklopfen. Sonst wäre ich eben kein Mensch. Und behauptete ich, ich würde dabei kein Herzklopfen haben, so wäre ich ein Lügner oder mindestens ein Renommist, der sich selbst belügt. Freilich müsste ich mich erst vergewissern, dass dort unten keine giftigen Gase sind. Die sind mehr zu fürchten als Gespenster. Übrigens spricht man ja auch von mordenden Brunnengeistern, worunter man eben solche Gase versteht.«
Sie begaben sich wieder hinauf, durchschritten enge und weite Räume des Erdgeschosses, in dem sich wohl Fensteröffnungen befanden, die aber so zugewachsen waren, dass kein Lichtstrahl durchdrang.
Plötzlich ward Hagen von seinem Freunde hastig am Arme gepackt.
»Haben Sie's gesehen?«, flüsterte Littlelu mit ganz entgeistertem Gesicht.
»Was gibt's denn nun schon wieder?«
»Die weiße Gestalt, die dort hinten huschte!«
»Hören Sie, mich senken Sie nicht wieder hinein.«
»Wahrhaftig, ich sah eine weiße Gestalt huschen — auf Ehre — obgleich ich zugebe, dass es Einbildung gewesen sein mag.«
»Natürlich war's nur Einbildung.«
»Ich glaube aber nicht, ich sah es ganz, ganz deutlich.«
Da riss auch Hagen seine Augen weit auf. Jetzt hätte auch er schwören können, dort hinten im Finstern eine weiße Gestalt huschen zu sehen.
»Und doch ist's nur Einbildung!«, beruhigte er sich selbst. »Sie haben es sich zuerst eingebildet, und nun muss ich im Finstern dasselbe sehen.«
»Ja, ich glaube auch«, gab Littlelu jetzt zu, »es war nur Einbild...«
Mit einem Male machte Littlelu einen Satz nach vorn, als wolle er sich mit dem Kopfe in den Boden bohren, und blieb dann auf Händen und Füßen liegen.
»Himmeldonnerwetter, das war aber keine Einbildung!«, ächzte er.
Wie er sich wieder aufrichtete und sich umblickte, machte er aber wirklich ein zu Tode erschrockenes Gesicht.
»Was hat's denn nun wieder gegeben?«, fragte Hagen misstrauisch. »Was wollen Sie mir denn nun wieder vormachen?«
»Vormachen? Na ich danke!«
»Weshalb machten Sie denn den Sprung?«
»Ich? Nicht etwa freiwillig. Ich bekam von hinten einen furchtbaren Stoß.«
»Ach, gehen Sie weg!«
»Nein, ich bleibe hier. Sie denken, ich spaße? Kriegen Sie mal so einen Puff in den Rücken, dann wird Ihnen der Spaß vergehen.«
Und mit ebenso kläglichem wie bestürztem und sogar ängstlichem Gesicht rieb sich Littlelu sein Hinterteil, dabei immer nach allen Seiten blickend.
»Sie glauben's immer noch nicht? Bei Gott — auf Ehrenwort — ich habe einen furchtbaren Puff in den Rücken bekommen.«
»Ja von wem denn nur?!«
»Wenn Sie nicht vor mir gestanden hätten, würde ich schwören, Sie wären's gewesen.«
»Mister Maxim, wenn Sie immer weiße Popanze sehen, das will ich verzeihen, davon lasse auch ich mich anstecken — aber wenn Sie jetzt behaupten, diese weißen Einbildungen könnten auch handgreifliche Püffe austeilen, da mache ich nicht —«
Auch Hagen knickte nach hinten über und wurde dabei nach vorn geschleudert, nur dass er nicht zum Sturz kam, bei dem Hünen war es mehr ein Taumeln gewesen, und dann fuhr auch er mit den Händen nach seinem Rücken und machte aus seinem furchtbaren Schreck kein Hehl.
»Klüverbaum und Katzenschwänze, was war das?«
»Haben Sie's auch bekommen?«
»Na und wie? Einen ganz gewaltigen Stoß in den Rücken!«
Die beiden sahen sich mit entsprechenden Gesichtern an. Jetzt wurde die Sache wirklich unheimlich!
Wie sie auch die Blendstrahlen ihrer Lampen herumwandern ließen, da war nichts zu sehen. Jetzt auch keine weiße Erscheinung in finsterer Ferne mehr.
»Kapitän, sollte man da doch nicht lieber an überirdische Mächte glauben?«, flüsterte Littlelu ganz ängstlich.
Der Gefragte zuckte zusammen und fasste blitzschnell seines Freundes Arm.
Da schwebten aus der Finsternis zwei glühende Punkte heran, eine weiße Gestalt.
Im nächsten Moment war das Blendlicht darauf gerichtet, nur ein momentanes Staunen, und dann brachen beide gleichzeitig in ein schallendes Gelächter aus.
Ein stattlicher, schneeweißer Ziegenbock war es, der auf die beiden losmarschierte, jetzt noch den Kopf kampfeslustig erhoben, jetzt die Hörner zum Stoße senkend, wie er es schon zweimal hinter den beiden getan hatte, die sich hier in sein Gebiet eingeschlichen.
Als ihn aber der Blendstrahl traf, zog er es vor, mit lustigem Meckern davon zu springen, in der Finsternis verschwindend.
Das Tier, eine wilde oder doch verwilderte Ziege, mochte hier sein Nachtquartier haben, es wusste jedenfalls in der Nähe ein Schlupfloch.
Die beiden lachten noch lange Zeit, dass das Echo zwischen den Mauern schallte, es klang ganz schauerlich, aber die beiden Geistersucher hatten nun das Gruseln verlernt.
»Da sehen Sie, wie die Gespenstergeschichten entstehen!«, sagte Hagen endlich, sich die Augen trocknend. »Wenn sich der Ziegenbock uns nun nicht persönlich vorgestellt hätte, dann hätten wir uns die Sache nicht auf natürliche Weise erklären können? Wer denkt denn an so einen Ziegenbock, dass der sich hier im Finstern herumtreibt.«
»Ja, so mögen die meisten Gespenstergeschichten entstehen!«, bestätigte Littlelu. »Aber wer sagt denn, dass der Ziegenbock nicht ein ganz regelrechter Geist war? Oder ein in den bösen Künsten bewanderter Mensch, der sich in einen Bock verwandelt hat?«
Hagen verstand sofort, was jener meinte.
»Da haben Sie wiederum recht. Für einen Griechen und einen Türken und für noch manche andere Menschen wäre hiermit noch lange keine Erklärung gegeben, für die fänge die Gespenstergeschichte erst richtig an. Man hat dem Teufel ja immer eine Bocksgestalt gegeben, ihm mindestens einen Bocksfuß gelassen. Ja, für eine abergläubische Person wäre es noch immer der Teufel, der hier sein Wesen treibt.«
»Und müssen wir nicht ehrlich gestehen, dass wir uns auch etwas gefürchtet, sogar schon an Gespenster geglaubt haben?«
»Allerdings, wir müssen es gestehen.«
»Soll ich Ihnen einen Vorschlag machen?«
»Nun?«
»Uns kommt es doch auf einen Tag nicht an. Jetzt scheint draußen die freundliche Mittagssonne, das hat immer etwas zu meiner Beruhigung gedient. Sollen wir hier einmal eine Nacht verbringen? Das ist erst der richtige Prüfstein, ob wir gespensterfest sind oder nicht.«
Hiermit war Hagen sofort einverstanden. Er freute sich schon darauf, die Mitternachtsstunde einmal in einer regelrechten Geisterburg zu verbringen.
Wieder ins Sonnenlicht gekommen, sahen sie zwischen den Felsen eine Horde Ziegen, die beim Anblick der Menschen die Flucht ergreifen wollten. Auf allen diesen Inseln, die nicht ganz und gar kultiviert sind, gibt es noch wilde Ziegen.
Ein gutgezielter Schuss aus Hagens Revolver streckte ein junges Tier nieder, es wurde geschlachtet und die festen Stücke davon gebraten.
Nach dem Essen hielten sie eine ausgiebige Mittagsruhe, um, wie sie scherzhaft sagten, desto munterer in der Geisterstunde zu sein, dass ihnen ja nichts von dem Spuk entging, mit dem ihnen die Ritter und die blutleeren Jungfrauen aufwarten würden.
Am Nachmittag strichen sie in der Umgegend umher, besuchten einige einsam liegende Wohnhäuser, die wohl nur deshalb nicht ausgeräumt worden waren, weil es hier an Trägern gefehlt hatte.
»Ob die Bewohner denn niemals wieder hierher zurückkehren wollen, da die am Hafen wohnenden gleich alle ihre Möbel mitgenommen haben?«, fragte Littlelu bei dieser Gelegenheit.
Kapitän Hagen, der in den Mittelmeerländern recht gut Bescheid wusste, konnte nur eines sagen. Alle diese romanischen Völkerschaften sind gegen elementare Gewalten und Schrecknisse von bewundernswerter Gleichgültigkeit. Das beweisen zum Beispiel die Umwohner des Vesuvs. So oft auch ein Ausbruch des Vulkans ihre Felder verwüstet, Dörfer und ganze Städte niederbrennt — unverdrossen bauen sie alles immer wieder auf. Aber mit übersinnlichen Dingen, so mit Geisterspuk und dergleichen, wollen sie absolut nichts zu tun haben, denn dabei geht's um die Seligkeit. Das bildet für die Kirchen und Klöster eine reiche Einnahmequelle. Wenn in einem Hause jemand ermordet worden ist oder nur sonst wie einen plötzlichen, unnatürlichen Tod gefunden hat, verunglückt ist, ohne die letzte Ölung bekommen zu haben, von einem Selbstmord gar nicht zu sprechen — dann muss ein Geistlicher kommen und den Weihrauchkessel schwingen, Beschwörungen ausführen, die selbst schon sehr an heidnische Abgötterei grenzen. Und hilft das nichts, lässt sich etwa immer noch ein unerklärliches Klopfen hören, dann ist so ein Haus wie verflucht, ist völlig entwertet, kein Mensch will es mehr bewohnen. Es gibt in ganz Italien wohl keine Ortschaft, die nicht so ein Spukhaus hat. Ein Fremder, gewöhnlich ein Engländer oder Deutscher, meist ein Maler, kann es umsonst bewohnen. Aber der Mann wird dann wie die Pest gemieden, er darf kein Lokal, keinen Laden betreten, er bekommt nichts.
Bevor hier nicht eine kirchliche Zeremonie stattgefunden hat, kehrt niemand zurück, und wenn den Geistlichen so ein Teufelbock ins Kreuz stößt, dann ist's für immer vorbei, höchstens, dass sie noch ihre Sachen abholen. Aber da ist nun wieder der Blutregen zu fürchten, der das nächste Mal kochend heiß oder gar gleich feurig sein soll.
»Aber diese so fruchtbare, bewässerte Insel kann doch nicht für immer verlassen bleiben?«
»Na, wenigstens so lange, bis über diese Geschichte wieder Gras gewachsen ist. Erst werden sich einige Fischer von anderen Inseln hier ansiedeln, und wenn die nichts von neuen Spukvorgängen zu berichten haben, kommen so nach und nach die anderen zurück.«
»Da könnte man doch auf recht billige Weise in den Besitz solch einer ganzen Insel kommen. Man inszeniert einen Spuk und ist alleiniger Herr von ihr.«
»Jawohl, das wäre eine Idee, das müsste man einmal probieren.«
»Ist so ein Fall noch nicht vorgekommen?«
»Mir ist nichts davon bekannt.«
»Ob sich da nicht die Regierung einmischte, die Sache untersuchte?«
»Die türkische Regierung? Ja, sie könnte eine Kommission schicken, auf einem Kriegsschiffe, die Matrosen sollen hier einige Zeit kampieren, das kann die Regierung befehlen. Aber ich kenne die Türken. Vor der Kriegstüchtigkeit der türkischen Soldaten habe ich allen Respekt, aber mit Geistern wollen sie nichts zu tun haben. Die Matrosen würden den Gehorsam verweigern, mit ihnen die Offiziere.«
Diese Unterhaltung wurde dadurch beendet, dass sie in der Bergvilla, in der sie sich gerade befanden, einen ganz besonderen Fund machten. In der in die Felswand gehauenen Vorratskammer, in der es fast kalt wie in einem Eiskeller war, stand eine große Kiste, den angeklebten Zetteln nach von Triest mit der Post gekommen, die man wohl eben hatte öffnen wollen, als der einsetzende Blutregen die allgemeine Flucht veranlasst hatte.
Die Kiste war angefüllt mit geräucherten Fleischwaren und Konservenbüchsen aller Art, nur die feinsten Delikatessen.
»Aaaah!«, machte Hagen mit strahlendem Gesicht, als er aus der Kiste seine beiden Hände wieder auftauchen ließ, an deren einer ein großer Schinken, an der anderen eine lange Zervelatwurst baumelten. »Diesen lieblichen Anblick habe ich schon lange vermisst! Da lacht einem das Herz im Leibe!«
»Und hier eine Gänseleberpastete, hier etliche Büchsen allerfeinste Ölsardinen, hier eine Zweipfunddose Astrachaner Kaviar —«
»Und hier frischgeräucherte Ochsenzungen, hier Hummer, hier ein ganzer Laib Schweizerkäse — Littlelu, das soll aber eine Geisterwache werden, die sich gewaschen hat! Wir laden die sämtlichen Ritter und Jungfrauen dazu ein, die sollen wohl wieder Blut in die Leiber bekommen.«
Um das Glück voll zu machen, fanden sie dann noch in derselben Villa ein reichassortiertes Wein- und Schnapslager, selbst Rheinweine waren vertreten, französischer Champagner und Kognak, Jamaikarum und noch vieles andere.
Als die Sonne sich dem Horizonte näherte, zogen sie schwerbepackt wieder nach der Burg. Sie hatten auch den Zucker, einige Zitronen und den Spiritusapparat nicht vergessen. Gutes Wasser lieferten ihnen die geheimnisvollen Kästen ihrer Aeroplane.
»Wollen wir uns im Keller einquartieren?«, fragte Littlelu.
»Nein, da unten riecht es doch gar zu modrig. Als Probe für unsere Geisterfestigkeit genügt wohl schon, wenn wir uns im Parterregeschoss häuslich einrichten. Spuken die Geister im Keller, so werden sie auch schon zu uns heraufkommen, und kommen sie nicht, dann allerdings können wir ihnen ja einmal einen Besuch abstatten.«
So ließen sie sich im Refektorium, im ehemaligen Speisesaal der Ritter, nieder, breiteten gerade in der Mitte ihre beiden Decken aus. Wenn sie das Gruseln lernen oder eben den Beweis geben wollten, dass sie sich nicht gruselten, so war dieser Platz auch am besten gewählt. Es gab Nebenkammern, in deren einer sie sich viel gemütlicher hätten einrichten können. Sie wäre von den elektrischen Lampen, die ihr Licht auch nach allen Seiten ausstrahlen konnten, vollständig erleuchtet worden, eine Decke hätte den offenen Eingang abgeschlossen. Hier aber saßen sie nur in einem Lichtkreise von wenigen Metern Durchmesser, ringsherum herrschte die schwärzeste Finsternis, da schwirrten noch die Fledermäuse und machten sich andere Nachttiere bemerkbar.
Trotzdem wurde es bald gemütlich. Auf dem Spiritusapparat sang der Wasserkessel, köstlicher Punschduft durchzog die weite Halle.
Während sie schmausten und tranken, wollten sie sich gegenseitig Gespenstergeschichten erzählen, um sich auf die Geisterstunde würdig vorzubereiten, so hatten sie ausgemacht, aber es wurde nichts daraus. Es war gar zu gemütlich. Hagen erzählte Abenteuer aus seinem Seemannsleben, Littlelu gab Schnurren zum besten, und sie lachten, dass zwischen den öden Mauern zahllose Echos erweckt wurden. Doch Unheimliches hatten diese nichts für sie.
Die Zeit verging im Fluge. Wieder hatte Hagen über einen Witz des Clowns sich ausgeschüttet vor Lachen, als dieser nach seiner Uhr sah.
»Halb zwölf — in einer halben Stunde muss der Spuk losgehen.«
»Was, schon halb zwölf?!«
»Ja, ja, die Stunden sind schnell hingegangen. Nun wollen wir uns aber doch etwas in die nötige Stimmung versetzen. Kapitän, wollen Sie die erste Probe Ihrer Geisterfestigkeit geben, oder soll ich's tun? Wie Sie wollen!«
»Was für eine Probe?«
»Ich mache einen Vorschlag. Sobald es zwölf ist, geht einer von uns in den Keller hinab, nimmt das Garn und diesen Becher mit, lässt ihn in den Brunnen und bringt ihn mit Wasser gefüllt zurück. Wollen Sie?«
»Ja warum denn nicht? Was ist denn da weiter dabei?«
»Gut, so sollen Sie der erste sein. Erst aber will ich Ihnen eine Geschichte erzählen, die ich wirklich erlebt habe.«
Und Littlelu begann eine Gespenstergeschichte. Er dichtete sie wohl jetzt erst zusammen, verstand das aber auch meisterhaft. Er wusste ein Spukhaus in einer alten Stadt zu schildern, warf mit Gerippen und Totenschädeln und abgehauenen Händen um sich, dass einem Zuhörer, der nicht gänzlich geisterfest oder eben ein geborener Frosch war, sich das Haar auf dem Kopfe sträuben musste.
»... Kurz vor Mitternacht betrat ich die verfallene Kapelle des Schlosses, in jeder Hand ein brennendes Licht, ging, in das Leichenhemd gewickelt, langsam auf den großen Wandspiegel zu, den man auf den Altar gestellt hatte, und gerade, wie ich davor stand, wie ich mich darin erblickte, hob die Kirchturmuhr zum Schlage aus, um die Mitternachtsstunde zu verkünden — baum —«
»Baum —«
Den Mund etwas verziehend, hatte der ehemalige Zirkusclown einen reinen, tiefen Glockenton hervorgebracht, wie aus weiter Ferne kommend.
Den zweiten Glockenton aber brachte er nicht mit seinem Munde hervor, der war von anderer Seite gekommen, wie unten aus dem Keller heraus.
Und das ging weiter.
»Baum — baum — baum —«
Betroffen blickten sich die beiden an, Hagen, das Punschglas in der Hand, Littlelu noch den Mund verzogen.
»Eine Kirchturmuhr!«
»Der Glockenschlag kommt aber aus dem Keller.«
»Ja, als ob es direkt unter uns wäre!«
»War denn da eine Uhr mit Schlagwerk?«
»Und wenn auch — wer sollte sie denn aufziehen?«
Unterdessen hatte es immer geschlagen.
»Baum — baum — baum —«
Der letzte Schlag mochte der zwölfte gewesen sein, es kam nichts mehr.
Dafür erklang jetzt ein langgedehnter Seufzer — wo erschollen, das war nicht zu bestimmen. Überall und nirgends.
Und dann ein langanhaltendes Kettengeklirr, dieses Rasseln aber war ganz sicher unten im Keller.
Wie die beiden sich ansahen und dann um sich blickten, lässt sich besser denken als beschreiben.
Noch einmal ein Kettenklirren, dem ein kurzes Poltern folgte — unten im Keller.
»Alle guten Geister!«, flüsterte Littlelu, dessen sonst so brünettes, gesundes Gesicht plötzlich aschgrau geworden war.
Hagen setzte sein Punschglas hin, nahm dafür jenen Lederbecher, der oben am Rande einige Löcher hatte und stand auf.
»Was wollen Sie?«, flüsterte Littlelu.
»In den Keller hinab. Aus dem Brunnen den Becher Wasser schöpfen, wie wir ausgemacht hatten. Es ist um zwölf.«
Wie fassungslos starrte ihn Littlelu an.
»Mensch, freveln Sie nicht!«, stieß er dann hervor.
Ja, der junge deutsche Kapitän hatte ein ganz anderes Gesicht als der alte amerikanische Zirkusclown. Es drückte die vollste Gelassenheit aus — und trotzdem war in den tiefgebräunten Zügen auch noch etwas anderes zu lesen: der furchtbarste Trotz! Und da brach dieser auch höhnend los:
»Ha, Männlein, glauben Sie denn etwa, ich werde wegen solch eines Seufzens und Kettenklirrens oder durch irgend welches Gespenst auch nur eine Linie von dem Wege abweichen, den ich mir einmal vorgenommen habe? O, da taxieren Sie den deutschen Kapitän Karl Hagen zu niedrig!«
Und er ging, den Blendstrahl seiner Lampe vorausschickend, dorthin, wo der Treppeneingang zum Keller lag.
»Mensch, freveln Sie nicht!«, rief aber Littlelu nochmals, und wieder zitterte ein langer Seufzer hier oben durch den Raum.
»Bleiben Sie hier oben!«, herrschte ihn Hagen rau an. »Ich gehe allein, um aus dem Kellerbrunnen zu schöpfen!«
»Nehmen Sie mich mit!«, flehte Littlelu. »Ich bleibe unter keinen Umständen hier allein!«
Da gab Hagen nach und ließ sich seine Begleitung gefallen. Dieser junge deutsche Kapitän hatte selbst Geist genug, um sofort einzusehen, dass hier die Sache doch nicht so einfach lag. Es muss immer noch einmal wiederholt werden: Der Betreffende wäre kein richtiger Mensch gewesen, der sich hier nicht gefürchtet hätte! Tiere freilich fürchten sich nicht vor Gespenstern — und auch blödsinnige Menschen nicht. Das ist erwiesen!
Wer aber bei solch einer Gelegenheit, wie hier eine vorlag, mit der Hand auf dem Herzen sagt: Ich kenne keine Furcht — der ist ein Lügner oder eben ein zweibeiniges Tier.
Der Schauer vor dem Übernatürlichen, Unfassbaren ist dem Menschen tief, tief ins Herz gegraben und wird ihn nie verlassen, solange diese Welt besteht.
Aber es gibt auch noch eine andere Furcht. Erschrecken vor einer weißen Gestalt kann wohl auch jeder echte Mann — aber wer dann dieser weißen Gestalt nicht sofort zu Leibe geht, der ist ein Feigling! Für solche Feigheit gibt es dann keine Entschuldigung mehr!
Auch Hagen war durch das Seufzen und Kettengerassel von Furcht gepackt worden. Sein Herz erzitterte vor Schreck. Aber dass er deshalb nicht in den Keller hinab ging, das gab es nun freilich nicht bei ihm! Da lieber gleich direkt in die Hölle hineinspaziert und mit allen Geistern und Gespenstern Brüderschaft gemacht, als sich dann solche Feigheit vorwerfen zu müssen!
Als sie die Kellertreppe hinabstiegen, also dem Spuk schon zu Leibe rückten, fand auch Littlelu seine Courage wieder, und ein Feigling war der überhaupt nicht. Nur der Schreck hatte ihn etwas übermannt.
»Was mag das nur für ein Seufzen und Kettengerassel gewesen sein?«, fragte er jetzt.
»Das wollen wir eben untersuchen. An Geister oder ruhelose Seelen von Verstorbenen und dergleichen glaube ich ein für allemal nicht. Die Sache ist doch ganz einfach. Hier hält sich jemand versteckt, der uns und jedem anderen Menschen den Aufenthalt in dieser Burg und wahrscheinlich auf der ganzen Insel verleiden will. Also suchen wir den Kerl. Und Gnade ihm Gott, wenn ich ihn erwische!«
Diese Worte richteten Littlelu vollends wieder auf.
Kaum hatten sie den Grund des Kellers erreicht, als das Kettengeklirr zum dritten Male erscholl, und diesmal folgte ein ganz schauderhaftes Seufzen und Stöhnen nach.
»Jawohl, hier unten ist es, und zwar dort hinten ertönt es. Vorwärts!«
Eilenden Schrittes drangen sie vor. Noch einmal das Kettengerassel und Stöhnen. Hier drin musste es gewesen sein.
Die Lampen erleuchteten den Raum, in dem an der Wand die Ketten hingen, mit den Knochen daran.
Und diese Ketten und Knochen bewegten sich noch!
Es machte auf Hagen keinen Eindruck.
»Natürlich, hier hat der Kerl den Lärm hervorgebracht, er ist schon wieder hinaus.«
Schnell sprang er auf den Korridor hinaus — und starrte erschrocken in die Finsternis.
Denn nochmals: Er wäre kein richtiger Mensch gewesen, wäre er nicht furchtbar erschrocken.
Dort in der Finsternis wandelte eine weiße Gestalt, ein Ritter, besonders durch den Helm mit wehendem Federbusch als solcher charakterisiert, sonst in einen langen Mantel gehüllt, durch einen Gürtel zusammengehalten, von dem ein breites Schwert herabhing.
Sofort war bei Hagen der momentane Schreck wieder vorüber.
»Steh oder ich schieße!«, donnerte er, den Revolver aus dem Futteral reißend.
Die Gestalt stand auch wirklich, wandte sich um, hob den Arm und schüttelte wie drohend die Hand.
In diesem Augenblick drehte Littlelu seinen Blendstrahl herum, er fiel auf die Gestalt. Sie blieb weiß, wie sie gewesen, behielt ihre scharfen Konturen — also war es kein Lichtbild, sondern etwas ganz Reelles, und jetzt sprang Hagen mit einigen Sätzen hin, um es mit seinen Fäusten zu packen.
Aber er griff ins Leere. Plötzlich war die Gestalt verschwunden.
»Also war es doch nur ein Lichtbild!«, sagte Hagen mit einem Gleichmut, den Littlelu doch nicht recht fassen konnte.
»Hahahaha!!«, lachte es da schallend, ganz in der Nähe. Es machte auf Hagen keinen Eindruck mehr.
»Immer lacht nur, es war doch nur ein Lichtbild. Dieses Lachen aber stammt aus einer menschlichen Kehle, oder aus einem Phonographen, in den aber doch erst ein lebendiger Mensch hineingelacht hat.«
»Was, Phonograph?«, staunte Littlelu.
»Natürlich. Warum denn nicht? Wenn hier mit der Laterna magica experimentiert wird, warum nicht auch mit einem Phonographen?«
Jetzt aber ging der Spektakel erst richtig los. Überall ein Kettenklirren, ein dumpfes Rollen wie von Kanonenkugeln auf hochgelegten Brettern, ein Lachen und Heulen, ein Quieken und Kreischen.
Und da kam es den finsteren Gang entlang. Weiße Gestalten. Die wilde Jagd. Voran ein Weib, in fliegenden Gewändern, das Haar lang nachwehend, alles weiß, leuchtend und geisterhaft und doch so deutlich, dass man jeden Zug in dem vor Entsetzen verzerrten Gesicht erkennen konnte — ein zweites, ein drittes — dann ein Ritter, das letzte Weib mit den Händen zu greifen suchend — ein zweiter, ein dritter — sie wurden von weißen Hunden überholt — dann eine Hexe, auf einem Besen reitend.
So brauste es heran, wirklich sausend und brausend, unter einem Höllenspektakel, zeternd und quiekend und brüllend, einen Sturmwind vor sich her fegend.
Was hätten wohl die meisten lebendigen Menschen aus Fleisch und Blut getan? Das Beste wäre wohl gewesen, gleich in Ohnmacht zu fallen, um von diesem ganzen Teufelsspuk gar nichts mehr zu wissen.
Littlelu drückte sich wenigstens etwas gegen die andere Seite der Wand.
Hagen blieb ruhig stehen, wo er stand, ließ sich von dem kalten Winde umbrausen und die ganze Jagd durch sich hindurchgehen.
Hinter ihm verschwand alles wieder in der Finsternis, die tiefste Stille herrschte.
»Famos arrangiert, diese Illusion!«, sagte Hagen gleichmütig. »Nur wenn man erhitzt ist, könnte man sich von dem kalten Winde einen Schnupfen holen.«
»Illusion?!«, wiederholte Littlelu.
»Na, was dachten Sie denn sonst? Das sind doch ganz einfach Lichtbilder, die hier herumgejagt werden.«
»Wie sollen denn die zustande gebracht werden?«
»Jawohl, nun fragen Sie so! Wurde denn auf der Illusionsbühne an Bord des ›Mohawk‹ nicht noch etwas ganz anderes gezeigt? Und dort im Felsengebirge am Sklavensee soll es noch viel großartiger sein, was sich da alles für Spuk ermöglichen lässt.«
»Ja, dort hat man alle Einrichtungen dazu —«
»Na, die hat man hier eben auch. Vielleicht hat sich auch hier jener Professor Dodd oder Señor Tenorio oder wie sich der Kerl nun nennt, häuslich eingerichtet — was haben Sie?«
Littlelu hatte einen kurzen Schrei ausgestoßen, griff schnell in die Brusttasche und zog sein Notizbuch.
»Herrgott, da fällt mir ein —«
»Diese Insel könnte auch so eine Stelle sein, die auf dem Blättchen Papier, das sich in der goldenen Kapsel befand, verzeichnet war!«, ergänzte Hagen.
Während seines langen Aufenthalts an Bord des »Mohawk« hatte ihm Littlelu ja alles erzählt, alles.
Littlelu hatte die acht geografischen Bestimmungen in seinem Notizbuche stehen.
»Welche Lage hat hier diese Insel?«
Hagen brauchte nicht erst in seinem Buche, in dem er die Berechnung ausgeführt hatte, nachzusehen, er hatte die Zahlen noch im Kopfe.
»Es stimmt! Hier stehen dieselben Zahlen!«
Dann war das ganze Rätsel auch schon so gut wie gelöst. Man hatte es hier wiederum mit jenem geheimnisvollen Manne zu tun. Er erschreckte, veralberte hier wiederum die Menschen.
»Professor Dodd!!«, rief Hagen mit schallender Stimme. »Señor Tenorio oder wie Sie sonst heißen mögen — kommen Sie zum Vorschein, Sie sind erkannt!«
Ein höhnisches Gelächter antwortete, neues Kettengerassel und andere unheimliche Töne.
»Der gibt es noch nicht auf, uns mit seinem Hokuspokus bange machen zu wollen!«, sagte Hagen.
»Sollen wir weiter forschen?«
»Gewiss doch. Tritt der nicht aus seinem Inkognito hervor, so müssen wir der Sache ganz und gar auf den Grund gehen.«
»Haben wir auch ein Recht dazu?«
»Ich verstehe Sie nicht.«
»Diese Burg kann ihm ja gehören.«
»Und wenn auch diese Burg — er hat mit seinem Spuk die rechtmäßigen Bewohner von der ganzen Insel weggegrault. Das sieht diesem rücksichtslosen Kerl, wie er mir immer geschildert wurde, überhaupt ganz ähnlich.«
»Da müssen wir aber nun etwas vorsichtiger sein.«
»Weshalb?«
»Weil wir nun wissen, wen wir vor uns haben. Es ist Ihnen doch bekannt, wozu dieser Mensch fähig ist.«
»Sie haben recht. Geister braucht man nicht zu fürchten, die können ja gar nicht handgreiflich werden, sie gehen als wesenlose Schatten durch einen hindurch. Lebendige Menschen sind viel, viel gefährlicher. Vor allen Dingen wollen wir da unsere Aeroplane besser sichern. Wenn nur nicht etwa schon etwas passiert ist.«
Eilig machten sie sich auf den Rückweg. Als sie aber an dem Brunnenraum vorbeikamen, wurde ihr Interesse durch eine neue Erscheinung doch wieder gefesselt.
Schon in einiger Entfernung hatten sie wieder ein Stöhnen und Wimmern gehört, und als sie nun hineinblickten, sahen sie auf dem Brunnenrand eine weiße Gestalt sitzen, ein geisterhaftes Weib.
Jetzt hob es den Arm, machte abwehrende Bewegungen gegen die beiden, die in der sehr schmalen Türöffnung standen, ein qualvolles Stöhnen hören lassend.
Die beiden betrachteten die Erscheinung jetzt mit ganz ruhigen Augen, suchten ihre Ursache zu erforschen. Man konnte auch den Blendstrahl darauf richten, deshalb verschwand das Lichtbild nicht.
»Das ist doch sehr merkwürdig!«, meinte Hagen. »Wie wird das nur zustande gebracht? Hier ist doch keine andere Öffnung als diese Tür. Oder sind es wieder ganz besondere Lichtstrahlen, die auch durch dicke Mauern gesandt werden können? Ist das auf jenen Illusionsbühnen möglich?«
»Nein, davon ist mir nichts bekannt!«, entgegnete Littlelu. »Die Lichtstrahlen müssen ungehindert dorthin fallen, wo das Bild erzeugt werden soll.«
»Ist denn dann die Lichtquelle zu sehen?«
»Das allerdings nicht. Wie das möglich ist, das weiß ich selbst nicht — ich bin kein Ingenieur. Diese Rätsel haben aber auch die japanischen Ingenieure nicht lösen können, unter denen doch gar findige Köpfe sind. Wir haben eben nur die Apparate, wissen sie zu handhaben, doch der Kern der Sache ist uns unbegreiflich. Sirbhanga Brahma weiß ja alles, sonst könnte er die Apparate doch nicht reparieren, wenn es einmal nötig ist. Aber der verrät nichts.«
Hagen schaute sich noch aufmerksamer um, jedoch ohne aus der Türöffnung herauszutreten.
»Hm, das ist sehr merkwürdig, wie in diesem engen Raume so ein bewegliches Lichtbild entsteht. Schade, dass die Gräfin nicht hier ist. Ich glaube, die könnte mit ihrem Spürsinn eine Aufklärung geben, oder wir müssten einen guten Hund mit einer feinen Nase hier haben.«
»Was sollte denn der helfen?«
»Mister Maxim, mir geht ein Lichtchen auf. Stellen Sie sich doch einmal recht breitbeinig hier in die Tür. Tun Sie, als wollten Sie niemanden hier herauslassen.«
Littlelu tat es, obgleich nicht wissend, nicht ahnend, was jener beabsichtigte.
Hagen benahm sich auch recht seltsam. Mit ausgebreiteten Armen ging er um den Brunnenrand herum, sodass seine eine Hand noch die Wand des runden Raumes berührte, nicht darauf achtend, dass die weiße Gestalt, um die er sich überhaupt gar nicht gekümmert hatte, plötzlich verschwand.
Immer schneller bewegte er sich um den Brunnen herum, bis er zu rennen begann. dann machte er plötzlich kehrt.
»Siehst Du, Kerl, jetzt habe ich Dich, ich dachte mir's doch gleich!«
Ja, er hatte etwas zwischen seinen Fäusten, mit höchstem Erstaunen sah Littlelu, wie er an irgend einem unsichtbaren Gegenstand herumgriff, als aber nun plötzlich zwischen Hagens Händen ein menschlicher Kopf auftauchte, da ging auch dem Kanadier eine Ahnung auf, die sofort zur Gewissheit wurde.
»Die haben hier auch schon so ein Tarngewand, mit dem man sich unsichtbar machen kann!«
Nichts anderes war es. Zu dem Kopf mit dem glattrasierten Gesicht, das grimmig und mehr noch angstvoll den Kapitän anstarrte, gesellte sich nach und nach der übrige Körper. Hagen schälte ihn aus dem Gewebe heraus, die unsichtbaren Stücke in seine Tasche pfropfend.
Es war ein noch junger Mann, ganz in schwarzes Trikot gekleidet, gegen welches das blasse, fast weiße Gesicht nur umso mehr abstach.
»Das also ist des Pudels Kern! He, Bürschchen, wer bist Du denn?«
Die Angst schwand aus dem blassen Gesicht mit sehr energischen Zügen, nur der Grimm blieb darin, und man sah deutlich, wie der junge Mensch die Zähne zusammenpresste, erst nachträglich die Lippen — ein Zeichen, dass er fest entschlossen war, keine Antwort zu geben.
»Du willst nichts verraten? Na warte, Dich wollen wir wohl zum Sprechen bringen. Aber nicht hier.
Schnell, Littlelu, seien Sie mir behilflich, den Kerl zu — oder nein, entsichern Sie lieber Ihren Revolver. Bleiben Sie in der Tür stehen, aber herumgedreht, als Schildwache — jetzt dürfte sich der Spuk ändern, der entlarvte Geist hier könnte Hilfe von seinen Kameraden bekommen.«

Hagen hatte schon immer die beiden Hände des Mannes festgehalten, wozu er nur seine eine Faust brauchte, jetzt band er sie ihm schnell mit einem Strick, den er aus der Tasche zog.
Der junge, schmächtige Mann mochte ja sofort gefühlt haben, dass gegen diese Bärenkraft gar nichts auszurichten war, aber merkwürdig war es doch, dass er sich so gänzlich widerstandslos binden ließ, dass er auch nicht den geringsten Versuch zu einer Gegenwehr gemacht hatte. Oder es war auch verdächtig. Er mochte schnellste Hilfe von seinen Kameraden erwarten.
»So. Deine Taschen untersuche ich nachher. Du hast doch nichts weggeworfen? Nein. Zu sehen ist wenigstens nichts am Boden. Nun, Littlelu, gehen Sie voraus, den Revolver in der Hand — oder nein, tragen Sie ihn lieber, es ist ja nur ein leichtes Bürschchen, ich werde die Bedeckung übernehmen.«
Littlelu nahm den Mann liebevoll auf seinen Arm, ihn wie ein Kind tragend. Hagen ging hinterher, auch oft zurückblickend, in jeder Hand einen Revolver.
Aber alle Vorsicht war unnötig. Kein Angriff erfolgte, weder von unsichtbaren Menschen noch von sichtbaren Geistern, und diese waren jetzt auch verstummt. sie machten keinen Spektakel mehr, gaben kein Seufzerchen mehr von sich.
Sie passierten ihren Lagerplatz im Refektorium, brauchten sich nicht aufzuhalten, um etwas mitzunehmen. Was sie hier zurückließen, fanden sie ja alles in jener Villa wieder, die große Kiste hatte nur einen geringen Bruchteil ihres Inhaltes hergeben müssen.
Als sie die zweite Treppe erstiegen hatten und aus dem Turm auf das Dach traten, sahen sie im Mondschein ihre Aeroplane stehen. Erleichtert atmete Hagen auf. Er hatte schon gefürchtet, sie gar nicht wiederzusehen. Dann brauchte man auch nicht erst zu untersuchen, ob eine fremde Hand sonst etwas an ihnen gemacht hatte.
Der Gefangene, der noch kein Wort gesprochen hatte, wurde auf Hagens Aeroplan festgebunden.
»Wohin wollen wir uns begeben, Mister Maxim, um das Verhör in Ruhe anstellen zu können?«
»Wo wir am sichersten vor einem Überfall sind!«
»Ja, und wo ist das? Das frage ich eben.«
»In jener Bergvilla, wir verbarrikadieren uns in einem hochgelegenen Zimmer.«
»Und werden belagert, sitzen in einer Mausefalle.«
»Also lieber auf einem freien Platze, wo wir nach allen Seiten Umschau halten können.«
»Na, wir brauchen gar nicht so vorsichtig zu sein. Es hat keinen Zweck. Die haben schon dieselbe Erfindung, können sich uns unsichtbar nähern, und wollen sie uns beseitigen, so schießen sie uns ganz einfach weg.«
»Dann können wir uns ja auf eine andere Insel begeben.«
»Nein, das möchte ich nicht. Das ist die Vorsicht zu weit getrieben, ist schon mehr Feigheit. Ich will auch hier in der Nähe bleiben. Und ich glaube überhaupt fast, diese Geister haben von ihrem Oberhaupt strengen Befehl, fremde Besucher dieser Burg nur durch Spuk zu schrecken, nicht aber handgreiflich gegen sie zu werden. — Ist es nicht so, Sir?«
Er hatte die letzte Frage an den Gefangenen gerichtet, bekam aber keine Antwort.
»Dürfen Sie nicht sprechen? Geben Sie nur daraufhin ein Ja oder Nein in irgend einer Sprache, zum Zeichen, dass Sie mich wenigstens verstanden haben.«
Aber der Mann kniff die Lippen nur noch fester zusammen und blickte zur Seite — und das war schließlich auch eine Antwort.
»Geben Sie sich keine Mühe, Sie bringen diesen Mann nicht zum Sprechen«, sagte da eine andere Stimme, »und wenn Sie ihn durch eine Tortur dazu zwingen wollen, so weiß er sich in einen Starrkrampf zu setzen, in dem er nichts fühlt. Auch haben Sie recht, wir dürfen Ihnen nicht das geringste Leid zufügen, also können Sie gleich hier bleiben.«
Aus dem Schatten des Turmes war ein Mann getreten, ebenfalls in einen schwarzen Trikotanzug gekleidet, auch mit so einem bartlosen, hageren, auffallend blassen Gesicht, aber bedeutend älter.
In sehr unterwürfiger Haltung stand er da.
»Wer sind Sie?«, übernahm wieder Hagen das Verhör.
»Ein Diener des Mannes, der sich zuletzt Señor Tenorio nannte.«
»Aha! Wo befindet der sich jetzt?«
»Er ist abwesend. Ich habe soeben von ihm Befehl erhalten, Ihnen Rede und Antwort zu stehen, soweit es angängig ist.«
»Was treiben Sie hier eigentlich?«
»Señor Tenorio hat auf Befehl des Mannes, dem wieder er zu gehorchen ha, den wir den Meister nennen, seine alte Wohnung am Sklavensee im Coloradogebirge räumen müssen, hat aber auf seine Bitte die Erlaubnis erhalten, sich hier auf dieser Insel niederlassen zu dürfen.«
»Und dazu arrangiert er hier solchen Spuk, dass die Bewohner aus ihrer Heimat unter Zurücklassung ihrer Habe entfliehen?«
»Dem Señor ist von seinem Meister jedes Mittel erlaubt worden, sich in den bedingungslosen Besitz dieser Insel zu bringen, nur nicht Anwendung irgend welcher Gewalt, er darf niemandem Schaden zufügen.«
»Und da hat er das Brunnenwasser rot gefärbt Ist denn das etwa kein gewaltsames Mittel, um jemanden zu vertreiben?«
»Nein. Das Brunnenwasser ist noch vollkommen trinkbar. Die rote Farbe ist absolut unschädlich. Das braucht bloß durch Experimente konstatiert zu werden, nachweisbar ist die rote Substanz gar nicht, es ist überhaupt gar kein Chemikal, und die Bewohner könnten ruhig hierher zurückkehren.«
»Ach, das ist ja der höhere Jesuitismus... doch lassen wir das zunächst. Und der Blutregen, was ist das mit dem?«
»Wir verstehen es, an jedem Punkte in der Atmosphäre, allerdings nur in einem begrenzten Umkreise, die in der Luft stets vorhandene Feuchtigkeit zu konzentrieren, sodass sie schließlich als Regen zu Boden fällt, ohne dass sich dabei eine sichtbare Wolke bildet.«
»Das ist ja wunderbar!«, musste Hagen zunächst ehrlich staunen. »Mit dieser Erfindung wäre ja eine Dürre gar nicht mehr möglich!«
»Nein, so bedeutend ist der Regenniederschlag nicht, den wir erzeugen können, um eine ausgetrocknete Gegend zu befruchten. Sie haben es selbst gesehen, wie wenig Regen es ist, der jedes Mal fällt, und dann muss wieder gewartet werden, bis wieder genügend Feuchtigkeit in der Atmosphäre vorhanden ist. Darüber vergehen oftmals einige Tage.«
»Nun gut. Bleiben wir bei der Sache. Wie mischen Sie denn aber dem Regen die rote Farbe bei?«
»Es ist gar keine rote Farbe, keine Substanz. Es sind nur rote Lichtstrahlen, die wir diesem atmosphärischen Wasser beizumischen wissen, auch dem Brunnenwasser. Sie entweichen im hellen Tageslicht sehr schnell wieder.«
»Ja, aber ist denn so ein Blutregen kein Gewaltmittel, um jemanden von seinem Besitz zu vertreiben?«
»Nein. So ein kurzer, erfrischender Regen kann in diesen heißen Gegenden immer nur sehr erwünscht sein. Und die rote Färbung schadet ja nichts, sie verschwindet sofort wieder, macht auch auf dem blendend weißen Oberhemd nicht das geringste Fleckchen.«
Plötzlich brach Hagen in ein Lachen aus, er hatte sich nicht helfen können, und Littlelu verstand sofort den Grund.
»Ich habe Ihnen ja immer gesagt, was dieser Señor Tenorio für ein Jesuit ist. Nichts als Wortverdrehereien oder vielmehr — vielmehr — es lässt sich überhaupt gar nicht schildern, was das für ein Charakter ist. Alles Lüge, Betrug, Täuschung — und in anderer Hinsicht doch wieder ganz ehrlich — eben ein Gaukler. Er kann vom Gaukeln nicht lassen, sein ganzes Streben geht dahin, den Menschen irgendwie Sand in die Augen zu streuen. Das ist seine einzige Freude.«
»Ist denn sein Meister mit solch einem Vorgehen einverstanden?«, examinierte Hagen weiter.
»Das weiß ich nicht.«
»Vorläufig hat sich dieser Meister, der den Tenorio schon einmal zum Tempel hinausgejagt hat, nicht wieder eingemischt?«
»Nein. Warum soll er auch? Wir befolgen ja genau seine Gebote, tun keinem Menschen auch nur das Geringste zu Leide, rühren ihn nicht mit dem kleinen Finger an.«
»Jawohl, jawohl, so sprechen und denken Sie — weil bekanntlich der Knecht immer wie der Herr ist!«, spottete Hagen.
»Außerdem«, verteidigte der schwarze Mann seinen Herrn weiter, »sollen die Bewohner der Insel für alles, was sie im Stich gelassen haben, auf das reichlichste entschädigt werden. Sie bekommen noch nachträglich von unbekannter Hand einen Kaufpreis bezahlt, den sie niemals für die ganze Insel zu fordern gewagt hätten.«
»Bekommen sie? Nun, das lässt sich schon eher hören, das gefällt mir. Aber da verstehe ich nur eines nicht, was Sie mir noch erklären müssen.«
»Bitte!«
»Weshalb hat er denn da nicht von vornherein die ganze Insel gekauft?«
»Das kann ich Ihnen erklären!«, mischte sich Littlelu ein. »Weil es eben ein Seiltänzer ist, der unbedingt seine Gauklersprünge machen muss. Er kann nicht anders handeln. Wenn der irgend ein Haus kaufen will, kann er nicht wie jeder andere Mensch einen Preis dafür bieten, sondern erst muss er die Bewohner hinausgaukeln, ihnen das Haus verleiden — dann hinterher gibt er dem Geprellten das Doppelte von dem, was das Haus wert ist. Oder ist es nicht so?«
Ja, Littlelu hatte diesen rätselhaften Mann ausgezeichnet charakterisiert, aber sein Diener war anderer Meinung.
»Nein, es ist ein anderer Grund vorhanden gewesen. dass er gar nicht erst für diese Insel etwas bot.«
»Nun?«
»Den Fischern, Bauern und Kolonisten hätte er ihren Grund und Boden und alles, was darauf steht, ja abkaufen können. Aber die Burg wie der ganze Berg gehört der türkischen Regierung, und es ist ein unumstößliches Gesetz, dass solche alte Burgen und sonstige Plätze, die noch einmal eine strategische Bedeutung haben könnten, nicht an Privatpersonen verkauft werden dürfen. Höchstens vermietet, aber auch nur auf unbestimmte Zeit, sie müssen auf einen Befehl ohne vorherige Kündigung sofort wieder geräumt werden. Auch können jederzeit türkische Beamte den Platz besuchen, alles kontrollieren, überall herumschnüffeln. Und mein Herr will natürlich unumschränkter Besitzer dieser Insel sein, deshalb hat er den Geisterspuk in Szene gesetzt. Hier kommt kein türkischer Beamter her, oder er soll etwas erleben.«
»Aha! Hm, jetzt gefällt mir die Sache schon besser, dieser ganze Plan hat sogar etwas meine Sympathie. Der Señor Tenorio hat natürlich die Sage gekannt, die sich um diese Insel dreht, und danach hat er seinen Plan eingerichtet. Ganz recht, wenn man eine derartige Dummheit der Menschen geschickt zu benutzen versteht. Jetzt ist aber doch diese ganze Geschichte zu Wasser geworden.«
»Wieso?«
»Nun, ich gehe jetzt einfach hin nach Pampos und erzähle den Geflüchteten, was es mit dem ganzen Spuk für eine Bewandtnis hat.«
Das bartlose Gesicht des alten Mannes verzog sich zu einem spöttischen Lächeln.
»Immer gehen Sie nur hin und erzählen Sie, deswegen kommt von den Griechen und Türken doch kein einziger wieder.«
»Hm, von den Griechen und Türken, da mögen Sie allerdings recht haben. Dann würde durch meine Erklärung die ganze Geschichte ja nur noch viel unheimlicher, weil sie mich gar nicht verstehen würden. Dann wäre es eben erst recht der Teufel, der in Menschengestalt hier haust, womit sie schließlich gar nicht so unrecht hätten. Es werden aber doch noch andere von meiner aufklärenden Erzählung erfahren, Fremde, Deutsche und Engländer, und ich versichere Ihnen, dass es unter diesen genug gibt, die sich nicht nur vor keinem Gespenste fürchten, sondern jedem vorgeblichen Spuke mit aller Macht auf den Grund zu gehen suchen, da sind wir beiden nicht etwa die einzigen Helden.«
»Das wissen wir auch.«
»Nun und? Wie werden Sie da die Sache arrangieren?«
»Solche aufgeklärte Geisterforscher werden einfach gar keinen Spuk erleben, sodass sie enttäuscht wieder abziehen.«
»Ach so — auch wieder sehr schlau ausgedacht!«, lobte Hagen lachend. »Aber wir sind doch auch Fremde, weshalb ist denn uns mit solchem Spuk aufgewartet worden?«
»Es lag ein Irrtum von uns vor. Wir haben Ihren Begleiter für einen türkischen Beamten gehalten. Denn ein solcher wird hier erwartet, von der türkischen Regierung zur Untersuchung des Falles hergeschickt. Und dieser hohe türkische Beamte benutzt, wie wir wissen, sehr oft einen Aeroplan, seinen eigenen, lässt ihn aber von einem Chauffeur steuern. «
Dieser Irrtum war umso begreiflicher, als Littlelu tatsächlich ein etwas orientalisches Gesicht hatte.
»Und diesem türkischen Beamten«, setzte der Mann noch hinzu, »musste der Aufenthalt hier nach Möglichkeit verleidet werden, der musste seiner Regierung dann etwas erzählen können.«
»Haben Sie diesen Herrn hier noch nicht gesehen?«
»Nein, sonst hätte ich ihn doch gekannt.«
»Das ist nicht unbedingt nötig. Sie werden viele tausend Menschen gesehen haben, die Sie nicht wieder erkennen.«
»Ich nicht!«, lächelte der Alte vielsagend.
Hagen verstand — wer wusste, in welchem Verhältnis dieser Mann zu seinem Herrn stand, was er für ein Leben führte — aber er wollte sich jetzt nicht hierbei aufhalten.
»Ich dachte, Sie hätten ihn schon am Sklavensee gesehen.«
»Nein.«
»Waren Sie damals nicht auch im Coloradogebirge?«
»Nein.«
»Wo hielten Sie sich sonst auf?«
»Das — darf ich nicht sagen.«
»Waren Sie schon hier auf dieser Insel?«
»Herr, über solche interne Angelegenheiten ist mir absolutes Schweigen geboten. Martern Sie mich, wie Sie wollen, ich —«
»Ach, ich denke ja nicht daran! Wenn man mir anständig entgegenkommt, bin auch ich ein guter Kerl. Jenen freilich hätte ich etwas an den Ohren gezogen, das wäre aber etwas ganz anderes gewesen. Bitte, Mister Maxim, lösen Sie ihm die Fesseln. Wie haben Sie erfahren, wer wir in Wirklichkeit sind?«
»Wir hörten doch, wie Sie sich gegenseitig mit Namen anredeten.«
»Und?! Das ist noch keine Erklärung.«
»Ich telefonierte Ihre Namen an Señor Tenorio.«
»Sie haben natürlich auch solche drahtlose Telefonuhren?«
»Jawohl.«
»Wo befindet sich Señor Tenorio jetzt?«
»Das ist auch so ein Geheimnis. Und doch, das darf ich verraten: in Konstantinopel.«
»Was tut er da?«
»Er versucht, sich dennoch mit der türkischen Regierung zu einigen, dass er in den unumschränkten Besitz dieser Burg gelangt, dass er hier nicht belästigt wird.«
»Natürlich hat er da einen Vermittler?«
»Ja — oder auch nicht so ganz —«
»Er hat sich direkt an den Sultan gewandt.«
»Woher wissen Sie —?«, stutzte der andere.
»Das kann ich mir lebhaft denken — na, der wird ja dem Sultan einen schönen Hokuspokus vorgaukeln!«, lachte Hagen. »Nun, und was sagte er, als er unsere Namen erfuhr?«
»Er befahl uns, den beiden Herren allen Spuk vorzumachen.«
»Und als ich nun jenen Mann dort fasste?«
»Das erfuhr er sofort. Wir mussten ihn immer auf dem Laufenden halten.«
»Und da sagte er?«
»Ich sollte mich Ihnen zur Verfügung stellen, was ich hiermit tue.«
»Sollen Sie uns nicht das Versprechen abnehmen oder uns wenigstens bitten, dass wir von unserer Entdeckung nichts verraten?«
»Nein.«
»Das wundert mich.«
Von allein gab der Mann hierüber keine Erklärung. Hagen musste fragen, und der junge Kapitän hatte schon oft genug seinen Scharfsinn bewiesen.
»Sie dürfen wohl solch ein Versprechen gar nicht abfordern?«
»Nein!«, wurde nach einem kleinen Zögern zugegeben.
»Auch Señor Tenorio selbst nicht?«
»Nein.«
»Das ist strenger Befehl von dem sogenannten Meister, dem auch er unbedingt zu gehorchen hat?«
»So ist es.«
»Und wenn er nicht gehorcht, so fliegt er auch hier wieder hinaus?«
»Ja. Er muss gehorchen.«
»Und zu diesen strengen Geboten gehört auch, dass er niemandem ein Leid, keinen fremden Menschen auch nur mit einem Finger anrühren darf?«
»So ist es.«
»Aber Spuk darf er hier so viel machen wie er will?«
»Gewiss, das ist doch eine ganz harmlose Sache.«
»Na ich danke!«, lachte Hagen. »Da kann einer doch vor Schreck gleich tot hinschlagen!«
»Ja, er braucht doch nicht diese Insel oder gar diese Burg zu betreten, er weiß doch, dass es hier spukt. Wenn er sich auf solch ein Risiko einlässt, dann muss er auch auf alles gefasst sein.«
»Wenn es aber nun ein Fremder ist, der ahnungslos hierher kommt?«
»Ich sagte ja schon, dass wir Fremden nichts vormachen werden.«
»Ein Hiesiger, der etwa im Boot durch die Strömung hier angetrieben wird?«
»Der würde höchstens einen kleinen Blutregen bekommen, bei Nacht in den Weinbergen eine weiße Gestalt sehen, und das genügte!«
»O ja, das genügte!«, lachte Hagen wieder. »Ich sehe, dass Sie auf alles vorbereitet sind. Nun gut, diese eine Sache wäre für mich erledigt. Was treibt nun Señor Tenorio hier?«
»Er studiert.«
»Was studiert er?«
»Dasselbe, was er in Amerika getrieben hat.«
»Er experimentiert in Chemie und Physik?«
»Ja.(1)«
(1) Hier folgen im Original die beiden folgenden Zeilen, die hier weggelassen worden sind, weil sie den beiden ihnen nachfolgenden Zeilen widersprechen:
»Ist er hier vollkommen eingerichtet?«<
»Das — ist wieder etwas, wovon ich nicht sprechen darf.«
»Schön. Ich respektiere das Ihnen gebotene Schweigen. Wie erzeugen Sie nun diese Spukerscheinungen?«
»Das ist erst recht völliges Geheimnis.«
»Schade, das hätte ich nun freilich zu erfahren gesucht.«
»Einfach mit einer Laterna magica!«, ließ sich Littlelu auch wieder einmal vernehmen.
»Nun, so ganz einfach ist das denn doch nicht. Wie hat denn jener Mann — geben Sie doch einmal den Apparat her, den Sie in der Tasche haben.«
Aber der junge Mann, der noch daneben stand, jetzt von seinen Fesseln befreit, rührte sich nicht. Dagegen ließ er es sich auch ruhig gefallen, dass Littlelu ihm die Taschen visitierte. Die Hauptsache war ein Kasten mit einer Glaslinse und mehreren Knöpfen, etwa einem Fotografenapparat gleichend.
»Ja, das ist die Laterna magica. Wie wird die gehandhabt?«
»Das darf ich nicht zeigen.«
»Ist hier vollkommen eingerichtet?«
»Ja.«
Hagen probierte es selbst, auch Littlelu beteiligte sich dann daran. Aber vergebens drückten sie die Knöpfe, kein Lichtstrahl entquoll der Linse. Übrigens hielt sich Hagen nicht lange damit auf, es schien ihn auch nicht sehr zu interessieren.
»Mit diesem Apparate können Sie auch in der Ferne bewegliche Figuren erzeugen?«
»Für größere Entfernungen ist wieder ein anderer Apparat nötig.«
»Wo befindet sich der?«
»In unserem Laboratorium.«
»Und wo ist das? Wo hausen Sie eigentlich?«
»In der Burg.«
»Wohl unterirdisch?«
»Hierüber darf ich absolut nicht sprechen.«
»So werde ich sie suchen.«
»Herr, geben Sie sich keine Mühe, Sie werden unsere Behausung niemals finden.«
»Ich trage die ganze Burg ab, wühle die ganze Insel wie ein Maulwurf um und um.«
»Sie würden trotzdem niemals unsere Werkstätten und Wohnungen finden.«
»Da stößt man wohl auch wieder auf solche Omnihilitplatten, die aller irdischen Gewalt spotten?«
»Ich darf hierüber kein Wort verlieren.«
»Nun gut. Es interessiert mich auch gar nicht. Also sagen Sie Ihrem Herrn, wir beide sind keine Spaßverderber, wir werden nichts verraten, wir haben unsere Freude daran, wenn er hier die Menschen nach Möglichkeit veralbert. Nur bösen Schaden darf er ihnen nicht zufügen. Verstanden?«
»Ich habe verstanden und werde es ausrichten.«
»Dann sind wir hier fertig. Mister Maxim, wollen wir die herrliche Mondscheinnacht benutzen, um noch ein gutes Stück weiter zu kommen?«
»Meinetwegen!«, brummte dieser, nicht ganz einverstanden, hier so schnell abzubrechen, er hätte noch mehr erfahren mögen.
Zehn Minuten später befanden sich die beiden schon wieder in den Lüften. Sie hatten ihre Aeroplane nur noch mit einigem Proviant und mit Flaschen bepackt.

Ehe die Posten recht zur Besinnung kamen, hatte Atalanta
mit katzenartiger Gewandtheit die Höhe der Mauer
erklommen und war auf der anderen Seite verschwunden.
Zum Hafen von San Francisco jagte ein kleines Dampfboot hinaus. Am Heck wehte die Kontorflagge der Reederei Atkins & Söhne. Es war dies eine der wenigen Reedereien heutzutage, die sich noch keiner großen Aktiengesellschaft, keinem allmächtigen »Trust« angeschlossen haben. Noch im unumschränkten Familienbesitz, wenn sie auch nur drei Dampfer und zwei Segler gehen hatte. Aber da steckt doch ein Kapital drin, und diese fünf Schiffe befrachtete sie sogar auf eigene Rechnung.
Ach, waren die letzten Tage sorgenvoll für diese ganze Familie gewesen!
Der »Darling«, ihr bester und größter Dampfer, war von Melbourne nach dem Heimathafen unterwegs, mit 3000 Tonnen Baumwolle. Und die ganze Welt war erfüllt von den schrecklichen Verheerungen, die ein furchtbarer Taifun in den Polynesischen Gewässern angerichtet hatte. Und gerade zu jener Zeit hatte der »Darling« diese Gegend passieren müssen, das war mit unumstößlicher Gewissheit zu berechnen. Seit vier Tagen war er schon überfällig.
Kann man sich vorstellen, was es zu bedeuten hat, wenn ein Dampfer vier Tage über die Frist ausbleibt? Heutzutage, wo solch ein Dampfer unter normalen Verhältnissen pünktlich, wenigstens bis zur Stunde pünktlich, eintrifft?
Wohl waren Schiff und Ladung versichert, aber —
In solch eine gewagte Spekulation hatte sich die Familie Atkins noch nie eingelassen. Alles hatten sie aufs Spiel gesetzt, alles!
Sein oder Nichtsein!
Und der Taifun, der Taifun!!
Da, nach vier schlaflosen Nächten taucht am westlichen Horizonte ein Schiff auf, ein Dampfer.
Und er zeigt Flaggen, durch das Fernrohr schon erkennbar.
»Darling, San Francisco!« Und die Hausflagge.
Schon ein Jubelschrei. Aber es genügt noch nicht, er kann die ganze Fracht über Bord geworfen haben.
Ja, ist denn das überhaupt der »Darling«? Statt der beiden Masten nur noch einer, keine Kommandobrücke mehr, kein Boot hängt mehr in den Davits, kein Schornstein, der Rauch quillt aus einem unförmigen Notgerüst.
Da klettert eine weiße Flagge mit einem blauen Kreuze empor, sie drückt nur ein einziges Wort aus, aber das genügt.
»All right!«
Und da bricht der Jubel los. Unbeschreiblich. Der Binnenländer, der auch sonst solche Verhältnisse nicht kennt, ahnt nicht, was es für die daran Interessierten zu bedeuten hat, wenn ein Schiff nach langer Fahrt in den Heimathafen zurückkehrt. Da gerät alles außer Rand und Band. Man muss es gesehen haben, wenn so ein alter, verknöcherter Handelsherr, aus dessen steinernem Herzen kein Lächeln mehr kommt, an Bord eilt und den Kapitän immer wieder umarmt und ihn küsst. Freilich ist es ja nur schnödes Geld, welches das steinerne Herz so zu schmelzen versteht, aber immerhin, es ist großartig. Und die Hauptsache ist: Da erkennt man erst, was für eine Rolle solch ein Kapitän spielt! Dann braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn der sich einen Tausendmarkschein wechseln lässt, von dem seine Frau nicht unbedingt wissen muss. —
Der jüngste Atkins war es, dem nach alter Familientradition diesmal die Ehre zuteil wurde, als erster und allein den heimkehrenden Kapitän zu begrüßen. Bei dieser ersten Gratulation darf nichts über Geschäftliches gesprochen werden — erst »Gott die Ehre.«
Das Dampfboot jagte hinaus, legte an dem langsamer fahrenden Riesen bei, James Atkins schwang sich das Fallreep hinauf.
Kapitän Steinert, der aber nicht mehr wusste, dass er ein geborener Deutscher war, ließ sich umarmen und die Hände schütteln und wieder umarmen.
»All right, all right.«
»Gelobt sei Gott, gelobt sei Gott. Wie war die Fahrt?«
»Bös, bös. Bei den Cook-Inseln in den Taifun gekommen, aber auch wieder raus. Nur Großmast, Brücke und Boote weg.«
»Gelobt sei Gott, gelobt sei Gott!«
»Und zwei Matrosen über Bord gewaschen, einem dritten wurde von einer herabkommenden Rahe der Schädel zertrümmert.«
»Gelobt sei Gott, gelobt sei Gott!«
»Steward — Champagner und Portwein!«
»Wer ist denn das?«
Eine auffallende Gestalt ging über Deck, ein junges Weib mit schönen, rotbraunen Zügen, ganz in Leder gehüllt, mit einem kurzen Röckchen, das schwarze Haar lang herabfallend.
Ohne sich um den Besuch zu kümmern, ging sie nach der Bordwand und blickte auf das Dampfboot hinab, ziemlich entfernt von den beiden.
»Ja, wir haben zwei Passagiere unterwegs bekommen. Schiffbrüchige. Zuerst waren's vier. Zwei sind vor Erschöpfung nachträglich gestorben. Feine Fracht. Kennen Sie die denn nicht?«
»Das ist doch nicht die — die —«
»Die Atalanta, die rote Athletin.«
»Bei Gott, sie ist es! Schiffbrüchig?«
»Jawohl, ihr Schiff, der ›Mohawk‹, früher der ›Bansai‹ — weg! Bei den Cook-Riffen zerschellt.«
»Aber das war doch gepanzert, und noch ganz anders als das schwerste Kriegsschiff, mit jener rätselhaften Masse —«
»Haha!«, lachte der vierschrötige Kapitän kurz auf. »Was Panzerung! Was Omnihilit! Gegen Sturm und Klippen ist noch nichts erfunden worden und wird nie etwas erfunden werden. Das wissen Sie doch ebenso gut wie ich. Es ist mitten zwischen den Cook-Riffen in den Taifun gekommen. Da war's natürlich vorbei. Wie ein hohles Ei ist es zertrümmert worden. So hat's die Gräfin, die sie ja ist, selbst erzählt. Damals, als sie noch sprach. Weil ich dazu verpflichtet wäre, es ins Logbuch einzutragen, sonst würde ich bestraft, nur deshalb hat sie einige Angaben gemacht, sonst tut sie den Mund nicht auf.«
»Wie ist sie an Bord gekommen?«
»Zwei Tage nach dem Taifun sichteten wir ein Boot. Ein furchtbarer Regenguss hatte die tobende See schnell wieder beruhigt. Vier Mann waren drin. Vier Personen.. Die Gräfin Atalanta, ihr Gatte und zwei japanische Matrosen —«
»Was, ihr Gatte?! Der Graf Arno von Felsmark?!«
»Jawohl, einst der Champion-Gentleman von New York genannt.«
»Der ist doch tot!«
»Der ist schon ein paarmal tot gewesen. Der ist eben damals nicht in Syrien von der Sandtrombe verschüttet worden. Ich kenne ja die ganze Geschichte. Sie hat ihn an der Sklavenküste wiedergefunden. Das heißt, so ganz lebendig ist er auch noch nicht. Kein richtiger Mensch. Er hält sich für einen Pavian oder für einen Gorilla, ist also total wahnsinnig. Er war mit Stricken umschnürt, dass es aussah, als läge er in einem Netze. So lag er im Boot. Na, was die überhaupt durchgemacht haben müssen! Der eine Japaner hatte sich die rechte Hand zerschmettert, hatte sie sich selber abgehackt, den Armstumpf in siedendes Teer gesteckt. Und der andere Japs hatte beide Beine gebrochen. Und dennoch ruderten die beiden Kerls noch wie die Teufel. Aber am anderen Tage, als wir sie an Bord hatten, sind sie beide gestorben. Vor Erschöpfung. Die haben sich selber das Leben aus dem Leibe gepumpt.«
Es war ein noch sehr junger Mann, der das jetzt mit trockenen Worten zu hören bekam, hatte aber auch noch für etwas anderes Interesse als nur fürs Geschäft — er war furchtbar erschüttert.
»Schrecklich! Schrecklich! Und die Gräfin?«
»Na, die ist all right. Die hat ein Leben wie eine Katze. Nur die Sprache scheint sie verloren zu haben. Oder sie ist immer so gewesen. Es ist eben eine Indianerin.«
»Und ihr Gatte?«
»Ein netter Gatte! Es ist ja fürchterlich, es tut einem leid, aber — dann ist es doch besser gleich tot. Ich hab's ja gesagt, er hält sich für einen Affen. Na, was wir mit dem in den zehn Tagen durchgemacht haben! Er ist im Kabelgatt mit Ketten festgelascht — mit zollstarken Ketten. Erst hatten wir ihn nur mit Stricken gebunden. Dreimal hat er sich losgerissen. Der Kerl hat ja eine Bärenkraft. Und nun gar in seinem Wahnsinn. Ein Glück nur, dass er sonst harmlos ist. Er will nur immer fort, nur fort. Verfolgungswahn. Der hätte sonst, wenn er bösartig wäre, das ganze Schiff aufgeräumt. Sechs Mann konnten ihn nicht überwältigen. Wenn seine Frau nicht dabei gewesen wäre — es ist fabelhaft, was diese Indianerin für eine Kraft hat. Er wie ein Bär, und sie wie drei Bären. Und einmal jumpte er über Bord — mitten zwischen die Haifische hinein — und sie ihm nach. Und nun ging's im Wasser los, immer zwischen den Haifischen. Ehe wir die wieder herausbekamen. Na ich danke! Gegen diese Szene und Arbeit waren die fünf Stunden im Taifun gar nichts.«
»Schrecklich! Entsetzlich! Und die anderen? Es waren doch über 250 Köpfe an Bord.«
»Alles ersoffen.«
»Der indische Brahmane, der damals den Tod des Töchterchens des Senators voraussagte?«
»Mit dem seiner Hellseherei wird es wohl nicht so weit her gewesen sein, sonst wären die bei dem Taifun doch nicht gerade zwischen den Cook-Riffen gewesen.«
»Und der Doktor Hikari? Das war doch ein Sohn des Mikados!«
»Ja, das ist doch dem Taifun und den Klippen ganz egal. Alles ersoffen oder zerschmettert. Das heißt, die Gräfin hat's natürlich nicht mit eigenen Augen gesehen. Die weiß selber nicht, wie sie in das Boot gekommen ist, die hatte eben nur mit ihrem verrückten Manne zu tun.«
Die Unterhaltung musste abgebrochen werden, der »Darling« dampfte in den Hafen. Der Kapitän suchte noch einmal die rote Gräfin auf.
»Wollen Madame das Schiff bald verlassen?«
»Sofort.«
»Ich kann Ihnen aber wegen Ihres Gatten für die nächsten drei Stunden niemanden von meinen Leuten zur Verfügung stellen, es tut mir leid.«
»Ich werde doch andere bekommen können?«
»Dafür werde ich sorgen, oder Mister Atkins wird's tun, der ist noch eher an Land als ich. Und dann Ihre Adresse, Madame.«
»Gräfin Felsmark, Sklavensee, Pittville, Colorado.«
»Das dachte ich mir. Sie werden vielleicht von der Reederei eine Rechnung zugeschickt bekommen. Heutzutage ist nicht einmal der Tod umsonst — der kostet sogar manchmal schrecklich viel Geld.«
»Selbstverständlich. Nur jetzt habe ich keinen Cent bei mir, aber ich habe auf der Bank in San Francisco ein Konto —«
»O, so eilig ist es nicht. Das geht mich überhaupt nichts an. Nur nach Ihrer Adresse musste ich fragen, 's ist meine Pflicht. Na, da machen Sie's gut.«
»Ich danke Ihnen, Herr Kapitän. Ich werde Sie nie vergessen.«
»Well, well.«
Der Dampfer legte am Kai an, das Hasten begann.
Sechs handfeste Männer kamen, von Mister Atkins schon bestellt, und brachten eine starke Tragbahre mit.
»Wo ist der Verrückte?«
Atalanta instruierte sie, ehe sie die eisenbeschlagene Tür öffnete. Die Matrosen lugten bei ihrer Arbeit und waren herzensfroh, dass sie mit diesem Transport nichts zu tun bekamen, sie hatten schon genug mit dem durchgemacht. Den an Land bringen — na, das konnte ja eine Strapaze werden!
Aber es kam anders. Der Irrsinnige, schwer gefesselt und mit Ketten an starken Balken befestigt, lag auf dem Gesicht.
»Atalanta. — Atalanta!«, wimmerte er leise in die Matratze hinein, wie er es schon unablässig getan hatte, wenn er nicht beim Anblick eines Menschen raste.
Unter Atalantas Leitung waren alle Vorsichtmaßregeln getroffen worden, um ihn aufheben zu können, nun aber blieb er gerade ganz ruhig liegen, ließ sich willenlos aufheben, auf der Bahre festschnallen. Nur auf dem Gesicht wollte er liegen, nichts sehen, dann war ihm alles gleichgültig.
Auch ein großes Automobil war schon geholt worden, auch wenn es nicht gebraucht würde.
»Wohin, Madame?«
»Nach dem Bahnhof.«
»Wohin wollen Sie denn?«
»Nach Pittville.«
»Hören Sie, das geht aber nicht so einfach!«, sagte der Führer der Arbeiter, ein in solchen Sachen bewanderter Mann. »Der wird in keinem Personenwagen genommen, da müssen Sie erst mit der Bahn sprechen. Da muss ein gesondertes Coupé eingerichtet werden. Das dauert eine Weile. Wo wollen Sie denn mit dem Gentleman auf dem Bahnhof hin?«
»Sie haben recht. Ich muss ja auch erst Geld holen. Also erst in irgend ein Hotel.«
»Hören Sie, lassen Sie das mit dem Hotel. Gott ja, Sie werden aufgenommen, für Geld tut man alles. Aber wenn der nun seine Anfälle bekommt? Wir wollen ihn doch einstweilen ins Krankenhaus transportieren, oder lieber gleich ins Irrenhaus. Da sind alle Einrichtungen vorhanden, es ist ein solches auch gar nicht weit von hier.«
Bei dem Worte »Irrenhaus« war die Indianerin wild mit sprühenden Augen aufgefahren — doch war es nur ein Zuckblitz gewesen, sofort war es wieder vorbei.
»Ja, ins Irrenhaus. Es ist das Beste. Auch ich bedarf einiger Stunden Ruhe.«
Es war doch ein ziemlich weiter Weg. Und nun das Publikum, wie sich das immer mehr um die Bahre drängte!
Denn ganz Frisco wusste schon, wen der »Darling« als Schiffbrüchige gebracht hatte. Durch Mister Atkins war schon alles verbreitet worden, ein Mund hatte es dem anderen erzählt. In einem halben Dutzend Zeitungsdruckereien kamen schon die ersten Extrablätter feucht aus der Presse.
Das also war das Ende der Herrlichkeit!
Na, gar so schlimm war es nicht. Die hatte ja Geld, viel, viel Geld. Ihre dressierten Seehunde beförderten noch immer aus ihrem See goldene Schätze ans Tageslicht. Die war wirklich mal eine, die nicht wusste, wie viele Millionen sie eigentlich hatte.
Aber eine arme Frau, die ihren Mann ins Irrenhaus bringen muss, die ist schlimm daran.
Endlich war das Irrenhaus erreicht, außerhalb der Stadt auf einer schönen Anhöhe gelegen.
Unterwegs war schon telefoniert worden, alles war zur Aufnahme vorbereitet.
Der neue Ankömmling wurde in eine gepolsterte Zelle getragen, die aber auch ein Bett mit einer Vorrichtung zum Festschnallen hatte. Ruhig wie noch nie ließ sich der Irrsinnige alles gefallen.
»Atalanta — Atalanta!«, wimmerte er.
Die Arbeiter hatten sich wieder entfernt, sie waren schon instruiert worden, sich ihren Lohn in dem Büro der Reederei zu holen. Das bedauernswerte Weib hatte gleich einen vortrefflichen Gönner gefunden.
Jetzt sprach ein Arzt in sie hinein, er stellte tausend Fragen.
»Lassen Sie mich allein, bitte, bitte, lassen Sie mich mit ihm allein!«
Bisher war sie ganz ruhig gewesen, ganz normal, ihre klangvolle Stimme hatte sich nicht geändert.
Jetzt aber war der Jammer hervorgebrochen. Förmlich erschrocken vor solch furchtbarer Seelenqual flüchtete der Arzt hinaus. Solch einen Blick aus diesen großen, schönen Augen mochte er nicht zum zweiten Male sehen.
»Atalanta — Atalanta!«, wimmerte und stöhnte der Unglückliche.
Das noch viel, viel unglücklichere Weib, das diesen Namen führte, kauerte sich in eine Ecke der Zelle nieder und starrte vor sich hin.
So vergingen Stunden. Die Indianerin regte sich nicht, sie zuckte mit keiner Wimper. Und das Wimmern des Irrsinnigen war verstummt. Er war wohl eingeschlafen, wie er gelegen hatte.
Niemand kam. Beamte der Anstalt blickten wohl manchmal durch die Klappe an der Tür, aber gestört wurde sie nicht. Es war eine vielfache Millionärin, die wird anders behandelt als irgend ein gewöhnlicher Mensch. Wenn sie etwas brauchte, so konnte sie ja klingeln, die Tür war auch nicht verschlossen. Und sie saß der Tür so nahe, dass man das Heben und Senken ihres Busens sah.
Endlich wurde die Tür geöffnet. Nicht weniger als sechs Männer traten in geschlossener Ordnung ein. Ihr schneller, starker Schritt war durch die dicken Gummiläufer unhörbar gemacht worden. Lauter kräftige, breitschultrige Männer mit kühnem Blick; in Zivil, aber mit gewissen Beamtenabzeichen.
Der erste trat vor die Kauernde hin, die anderen hielten sich kampfbereit hinter ihm.
»Frau Gräfin Atalanta von Felsmark?«
Sie hob die Augen, sah jetzt erst den Mann, oder ob sie ihn überhaupt sah?
»Ja?«, fragte eine tonlose Stimme.
»Stehen Sie auf!«
Sie gehorchte, erhob sich, mechanisch wie ein Automat.
Der Beamte legte die Hand auf ihre Schulter.
»Im Namen des Gesetzes der Vereinigten Staaten von Nordamerika — Sie sind verhaftet!«
Kein Zeichen des Staunens, des Schrecks, gar nichts.
»Verhaftet?«, wurde nur tonlos wie zuvor wiederholt.
Der Mann griff nach ihren Händen, man sah gar nicht, dass er eine Kette hatte — da ein doppeltes Knacken, und ihre Hände waren gefesselt.
»Keinen Widerstand!«
»Widerstand?«
»Folgen Sie mir!«
Sie wurde von den Männern in die Mitte genommen. Im Hofe stand ein geschlossenes Automobil. Hinein und fort. In ein großes Haus, in eine Zelle mit schwervergitterten Fenstern. Sobald sie allein war, kauerte sich die Indianerin wieder in eine Ecke.
Innerhalb von vierundzwanzig Stunden muss jeder Untersuchungsgefangene verhört werden. Sie wurde es schon in der nächsten Stunde.
Sachgemäß beantwortete sie alle Fragen, heute und an allen anderen Tagen, vor den Richtern und vor den Geschworenen, gelassen hörte sie ihr Urteil an.
»Nun, Frau Gräfin, noch einmal kann ich Sie besuchen. Ich hoffe, dass Sie mit mir zufrieden sind. Mehr konnte ich nicht tun, als die Strafe noch unter das Mindestmaß herabdrücken.«
Die an dem einfachen Tischchen sitzende Indianerin blickte den Sprecher an. Heute zum ersten Male hatte der starre Ausdruck sie verlassen, ihr großes Auge war träumerisch geworden.
Sinnend strich sie das Haar aus der Stirn.
Sie wusste alles, alles — und anderseits wusste sie gar nichts.
»Wer sind Sie?«
Der Herr wunderte sich nicht über diese Frage, obwohl er doch mit seiner Klientin hier in dieser Zelle stundenlange Gespräche geführt hatte, und die Gräfin war ganz normal gewesen.
Nein, der wunderte sich nicht. Er war der berühmteste Verteidiger der Weststaaten, der für jede Sitzung tausend Dollars forderte und bekam, wobei aber seine Verteidigungsreden noch nicht mitgerechnet waren. Für deren Ausarbeitung berechnete er pro Zeile drei Dollars.
Nein, dieser Jurist, der nicht umsonst so horrend bezahlt wurde, wunderte sich nicht über diese Frage seiner Klientin. Der hatte schon immer gewusst, dass diese Indianerin seelisch nicht ganz normal war, dass sie überhaupt mit offenen Augen schlief, seelisch. Aber er hatte sich gehütet, die Richter hierauf aufmerksam zu machen. Und ganz mit Recht. Eben infolge dessen hatte er noch niemals einen größeren Triumph feiern können, er hatte seine Klientin tatsächlich glänzend verteidigt, hatte ihr Strafmaß mehr als um die Hälfte herabgedrückt, was niemand für möglich gehalten hätte.
»Rechtsanwalt Moore, ich war Ihr Verteidiger.«
Wieder strich die Indianerin sinnend über ihre Stirn.
»Rechtsanwalt Moore, mein Verteidiger — ja, ja, ich weiß — wie lange bin ich doch schon in Untersuchungshaft?«
»Acht Tage hat der ganze Prozess gewährt.«
»Acht Tage — ja, ja, ich weiß, es ist sehr schnell gegangen. Wie lautete doch gleich die Anklage gegen mich?«
»Wegen Aufruhr und Hochverrat.«
»Aufruhr?«
»Damals an Bord Ihres Schiffes der Kampf mit dem Militär, Sie gingen mit Ihrem Schiffe sofort davon —«
»Ja, ja, ich weiß. Es ist ja genug darüber gesprochen worden. Aber ich hatte doch Amnestie erhalten?«
»Das war für den vorhergehenden Fall, das war doch wieder —«
»Ach ja, richtig, ich weiß schon. Aber Hochverrat? Was soll ich denn verraten haben?«
»Das Delikt des Aufruhrs fällt unter die Akte des Hochverrats, denn damals war —«
»Ach ja, ja, ich entsinne mich. Ganz recht — Hochverrat — selbstverständlich. Und ich bin also zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt?«
»Nein. So lautete der Antrag des Staatsanwaltes. Die Geschworenen einigten sich das erste Mal auf fünfzehn Jahre. Ich focht das Urteil an, das Verfahren wurde wieder aufgenommen, und das Urteil lautete diesmal auf die Mindeststrafe, die es für Hochverrat gibt: auf zwölf Jahre. Noch einmal entdeckte ich eine Unregelmäßigkeit in dem Verfahren, und nach einer vierstündigen Rede gelang es mir, sogar von dieser Mindeststrafe noch zwei Jahre abzuzwacken. Sie sind nur zu zehn Jahren verurteilt.«
»Nur zu zehn Jahren Zuchthaus! Na, das geht ja. Ja, ich weiß, es war eine herrliche Rede, die sie hielten. Alles auf den Galerien weinte und schluchzte. Ich habe auch sehr geweint, nicht wahr?«
»Sie? Hm. Nein —«
»Nicht? Dann — dann — hat man es mir wohl nur nicht angemerkt. Ja, ich habe geweint — sehr geweint. Ja, statt lebenslänglichem Zuchthaus nur zehn Jahre. O, die hält man schon aus. Ich danke Ihnen, Herr Rechtsanwalt, ich danke Ihnen herzlich.«
»O bitte. Ich tue immer, was ich kann.«
»Und — wie viel haben Sie eigentlich zu bekommen?«
»Zweiunddreißigtausend Dollars.«
»Zweiunddreißig — tausend — Dollars. Ich finde das nicht viel. Wie Sie geredet haben.«
»Es ist mein normaler Satz. Ich habe Ihnen ja die Rechnung schon vorgelegt, Sie unterschrieben sie.«
»Haben Sie? Habe ich? Ja, ich entsinne mich. Ich habe auch gehört — nicht von Ihnen, jemand anders erzählte es mir, wohl ein Geistlicher, der mich besuchte — das letzte Mal hätten Sie eine Kindesmörderin verteidigt.«
»Ja, und anstatt dass sie gehenkt wurde, das Urteil war schon gesprochen, bekam ich sie frei, vollständig frei — ihre Entlassung aus dem Untersuchungsgefängnis war ein Triumphzug, an dem sich ganz San Francisco beteiligte.«
»Und Sie waren verreist?«
»Ich musste sofort verreisen, mich gleich nach der Verkündigung des Freispruchs in ein Automobil werfen und davonjagen.«
».Es war ein armes Mädchen?«
»Eine Fabrikarbeiterin.«
»Sie bekamen aus der Staatskasse für Ihre Verteidigung, die zwei Wochen währte, Tag für Tag viele Stunden, vierzig Dollars?«
»So viel hatte ich zu verlangen.«
»Eine reiche Dame vermachte Ihnen für diese Verteidigung ein Ehrengeschenk von 10 000 Dollars. Sie überwiesen dasselbe dem Armenhaus.«
»Weil ich nichts geschenkt nehme. Nicht etwa, weil ich zu großartig bin. Geschäftsprinzip. Damit man niemals den kleinsten Anhalt hat, mir den Vorwurf der Bestechlichkeit zu machen. Und schließlich ist auch das für mich Reklame.«
»Ich danke Ihnen, Herr Rechtsanwalt.«
Zum ersten Male leuchtete es in den Augen der Indianerin warm auf, als sie jenem die Hand hinhielt.
Der Mann mit den eisernen, unbeweglichen Zügen nahm sie und drückte sie herzlich.
Ja, eiserne und unbewegliche Züge. Dem Gesicht nach sah dieser Mann aus, als könne er seinen eigenen Bruder wegen Fünf Groschen pfänden lassen. Aber sein Händedruck hatte etwas anderes gesagt.
Wo ist der Verteidiger, der Vertreter des wohl herrlichsten Menschenberufes, der einen Erfolg hätte, wenn nicht sein warmes Herz mitspräche?
Die Worte machen es sicher nicht.
»Und wenn ich tausend Zungen hätte, und ich hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts als ein tönend Erz —«
Aber die eisernen, unbeweglichen Züge blieben, und die gehörten ebenfalls mit zum Berufe des Verteidigers.
»Bei Ihnen war das etwas anderes. Ich hatte Ihnen die Kostenberechnung doch vorher vorgelegt, Sie waren damit einverstanden. Ich hatte vierzigtausend Dollars auskalkuliert.«
»Ja, ja, ich weiß.«
»Es hat nur zweiunddreißigtausend gemacht.«
»Gut, bringen wir das gleich in Ordnung. Haben Sie ein Blättchen Papier bei sich? Und einen Bleistift. Oder es muss wohl Tinte sein? Einen Füllfederhalter?«
»Bitte, wozu?«
»Ich will Ihnen eine Anweisung ausschreiben.«
»Worauf eine Anweisung?«
»Nun, ich habe doch zum Beispiel hier auf der Bodenkreditbank ein Guthaben von sieben Millionen Dollars.«
»Aber darüber können Sie nicht mehr verfügen.«
»Nicht?«, erklang es ganz ruhig, und bei dieser Ruhe, die jetzt aber keine Teilnahmslosigkeit mehr war — ein großer Unterschied — blieb sie.
»Ihr Vermögen ist konfisziert.«
»Konfisziert?«
»Als Hochverräterin muss Ihr Vermögen konfisziert werden.«
»Es verfällt dem Staate?«
»Nein. Es ist nur beschlagnahmt, Sie können während Ihrer Strafzeit als Hochverräterin nicht darüber verfügen. Sonst kann man das ja vom Zuchthaus aus, aber nicht bei Hochverrat. In diesem Falle sogar schon dann nicht, sobald der Verhaftungsbefehl ausgesprochen ist. Ihr Vermögen wird unterdessen vom Staate verwaltet, nach Verbüßung der Strafe erhalten Sie es mit den normalen Zinsen ausgezahlt. Da ist nicht die geringste Ungerechtigkeit dabei.«
»Nein. Nicht die geringste Ungerechtigkeit. Und mein Besitz an Grund und Boden?«
»Der ist bereits verkauft.«
»Wie?«
»Sobald Sie verurteilt waren, vor zwei Stunden, wurde Ihr Besitz an Grund und Boden dem Fiskus zum Verkauf zugesprochen.«
»Mein Sklavensee?«
»Ja. Das heißt nicht das südliche Ufer, das Sie ja den deutschen Kolonisten geschenkt haben, worüber eine regelrechte Schenkungsurkunde existiert. Alles übrige hat der Fiskus konfisziert, und zwar für immer. Das geht ja auch nicht anders. Nach Verbüßung Ihrer Strafe haben Sie die Vereinigten Staaten sofort mit der schnellsten Gelegenheit zu verlassen, ein Hochverräter darf auch sonst keinen Grund und Boden in den Vereinigten Staaten haben, ein indirekter Kauf ist ungültig.«
»So. Da gehört also mein — der Sklavensee dem Fiskus, bis auf das südliche Ufer.«
»Ja. Das heißt, er hat das, was ihm gehört, schon wieder verkauft.«
»An wen?«
»Es wurde ihm sofort ein Angebot gemacht und er hat denn auch gleich den ganzen Sklavensee wieder verkauft, um diese Last loszuwerden. Für eine Million Dollars.«
»Und wer war der Bieter? Wem gehört der jetzt?«
»Sie werden die Dame wohl kennen. Miss Marwood Morgan.«
Schnell blickte die Indianerin nach dem vergitterten Fenster, wozu sie den Kopf wenden musste, sonst aber auch nichts weiter. Als sie das Gesicht wieder wendete, war dieses ruhig wie zuvor.
»Miss Marwood Morgan. So. Ja, diese Dame kenne ich. Also der gehört jetzt der ganze See — bis auf das südliche Ufer. Auch die Felsenwohnungen?«
»Gewiss. Die liegen ja auf dem westlichen Ufer.«
»Die sind geschlossen.«
»Was heißt geschlossen?«
»Es kann niemand hinein, diese Felsenwohnungen sind von acht japanischen Matrosen unter Führung eines Seeoffiziers besetzt.«
»Die müssen sie eben räumen.«
»Und wenn sie sich zur Wehr setzen?«
»Dann werden sie mit Gewalt entfernt. Die Besitzerin kann, um ihr Hausrecht zu wahren, polizeiliche oder gar militärische Hilfe requirieren.«
»So. Und was sich in den Felswohnungen befindet?«
»Gehört natürlich alles der Käuferin.«
»Die Camera obscura, das mechanische Theater?«
»Alles, alles. Übrigens soll das ja nicht mehr funktionieren.«
»Nein. Und die Sternwarte, die sich Doktor Hikari oben gebaut hat?«
»Gehört diese wirklich urkundlich ihm?«
»Nein, deswegen sind wir noch nicht beim Notar gewesen.«
»Dann gehörte sie noch Ihnen, jetzt also der Miss Morgan.«
»Und die kostbaren Fernrohre und sonstigen Instrumente?«
»Die hat Doktor Hikari von seinem eigenen Gelde gekauft?«
»Ja.«
»Das muss er nachweisen.«
»Er ist tot.«
»Nun, darüber wird das Gericht noch entscheiden.«
»Und das Gold, das auf dem Grunde des Sees gefunden wird? Das gehört jetzt ebenfalls der Miss Morgan?«
»Nein. Dieses einzige Recht hat sich der Fiskus beim Verkauf des Sees vorbehalten. Alles, was in ihm gefunden wird, gehört dem Fiskus.«
»So. Das wird mir also einfach genommen.«
»Frau Gräfin, sprechen Sie nicht etwa von einer Ungerechtigkeit! Der Grund und Boden muss dem Hochverräter genommen werden. Aber bei Berechnung seines Wertes wird nicht taxiert, was er an Erzen oder sonstigen Werten enthalten könnte. Lesen Sie im Gesetzbuch nach, Paragraphen 162 bis 167. Sie bekommen eine Million Dollars dafür, und das ist eigentlich sehr hoch für diesen Besitz.«
»Ja, das ist sehr hübsch. Und das Gold, das ich bisher gefunden habe?«
»Ja, wo haben Sie das eigentlich?«
Durch das bronzefarbene Gesicht der Indianerin ging ein Zucken, es sah aus, als müsse sie im nächsten Augenblick ein überaus schlaues Gesicht machen — aber es geschah nicht.
»Dieses Gold habe ich immer gut verkauft und das Geld angelegt.«
»Das müssen doch viele Millionen gewesen sein?«
»Sicher, viele Millionen.«
»Und wo haben Sie dieses Geld angelegt?«
»Das verrate ich nicht.«
»Frau Gräfin, denken Sie nicht etwa, dass ich Sie hier aushorchen will. Mich geht diese Sache absolut nichts an. Ich möchte Sie nur warnen.«
»Warnen? Wovor?«
»Bisher hat der Gang der Gerichtsverhandlung nicht erlaubt, dass man Sie über den Verbleib Ihrer Gelder und sonstigen Besitztümer, die Sie innerhalb der Vereinigten Staaten haben, ausfragte. Das beginnt nun erst, während Sie schon Ihre Strafe abbüßen. Man wird Ihnen deswegen im Zuchthause keine Ruhe lassen.«
»Ich danke Ihnen sehr für Ihre Warnung. Ich bin darauf gefasst, dass man mir das Leben schwer machen wird.«
»Sie werden wahrscheinlich —«
»Wo ist mein Gatte? Wie befindet er sich?«, unterbrach ihn die Indianerin, zum Zeichen, dass sie dieses Gespräch hierüber für abgeschlossen halte.
Sie hatte täglich nach Arno gefragt. Wusste sie es wirklich nicht mehr?
»Er ist noch in Irvinghill.«
»So heißt das Irrenhaus, nicht wahr?«
»Jawohl.«
»Ja, ja, ich weiß es. Er ist dort sehr gut aufgehoben?«
»Ausgezeichnet.«
»Ja, Sie sagten es mir schon häufig. Und wie befindet er sich sonst?«
»Nach Möglichkeit gut. Besonders das letzte Beruhigungsmittel, das man probierte, hat vorzüglich angeschlagen.«
»Was für ein Mittel war das doch gleich?«
»Nun, man hat ihm eine große Puppe gegeben — lebensgroß — mit — mit — einem bräunlichen Gesicht — mit — mit — nun, Sie wissen ja, ich habe es Ihnen wiederholt erzählen müssen — mit Ihren Zügen — sehr kunstvoll modelliert.«
Dieser Jurist wusste recht gut, dass diese Indianerin es erst jetzt richtig erfasste und dass die jetzt auch gleich alles verstand.
Und jetzt erstarrte denn auch das bronzene Gesicht, ein Zug des furchtbarsten Wehes huschte darüber.
»Und — und —«
»Nun, Sie können es sich doch denken — ich habe es Ihnen doch überhaupt alles schon erzählt.«
»Und er hält diese Puppe für mich?«
»Natürlich. Und hierauf kam es ja auch an. Er seufzte doch immer Ihren Namen. Er sehnt sich nach Ihnen, aber Sie selbst erkennt er nicht. Mit der Puppe ist nun die Täuschung gelungen. Er herzt und liebkost sie — und seitdem kehren seine Tobsuchtsanfälle nicht wieder — er ist sogar ganz glücklich — wenn man so sagen darf.«
Immer starrer war das bronzene Gesicht geworden.
»Er ist — glücklich — mit der — Puppe — herzt und — liebkost sie —«
Mit einem Ruck hatte sie ihr Gesicht wieder in ruhige Falten gelegt.
»Ich danke Ihnen, Herr Rechtsanwalt. Wann trete ich meine Strafe an?«
»Morgen früh werden Sie abgeholt.«
»Wohin?«
»Sie verbüßen Ihre Strafe in Belltown, eine Stunde von hier mit der Eisenbahn, speziell für weibliche Sträflinge. Die Behandlung ist dort eine äußerst humane. Ich kann auch noch etwas für Sie tun. Ich bin gut bekannt mit dem Zuchthausdirektor. Mit was für einer Arbeit wünschen Sie beschäftigt zu werden? Danach werden die Gefangenen sonst nicht gefragt, aber das kann ich arrangieren. Wollen Sie eine leichte Arbeit haben? Im Büro? Das ist auch möglich. Oder eine schwere?«
»Was ist die schwerste?«
»Das Zupfen der Schiffstaue. Es erfordert zwar keine besondere körperliche Anstrengung, aber — es geht dabei äußerst über die Finger. Es ist die gefürchtetste Arbeit. Zu der Anstalt gehört auch ein Steinbruch, von weiblichen Gefangenen betrieben. Das ist die allerschwerste Arbeit: Trotzdem gehen viele ganz gern hinein, wenigstens zeitweilig. Es ist die einzige Gelegenheit, dass sie in frischer Luft arbeiten. Sobald sie sich erschöpft fühlen, brauchen sie es nur melden. Dann allerdings müssen sie erst noch eine Zeit lang Taue zupfen.«
»Ja, ich bitte um Arbeit im Steinbruch, um die allerschwerste.«
»Schön, Sie werden sie bekommen. Da erhalten Sie auch das beste Essen. Ja, wegen des Essens. Wissen Sie, dass Sie hier während der acht Tage nur Brot gegessen haben, und zwar äußerst wenig?«
»Ich — glaube es.«
»Sie hätten ja fordern können, was Sie wollten, in der Untersuchungshaft steht Ihnen für Ihr Geld alles frei, jede Delikatesse — aber Sie verlangten immer die Kost der gewöhnlichen Untersuchungsgefangenen, und dann rührten Sie sie nicht an, genossen höchstens einen Bissen Brot. Nun mache ich Sie darauf aufmerksam, dass Ihnen heute Abend, gleich jetzt, die letzte Mahlzeit angeboten wird, die Sie für Ihr Geld noch einmal haben können, obgleich Sie schon verurteilt sind. Es ist noch einmal eine Gnade —«
»Die Henkersmahlzeit.«
»Nun ja — wenn Sie auch nicht gehangen werden!«, versuchte der Herr zu lächeln, was ihm aber schlecht gelang. »Sie werden doch davon Gebrauch machen?«
»Ich denke.«
»Dann empfehle ich mich. Und nun Mut, Frau Gräfin. Mut! Zehn Jahre gehen auch vorüber.«
Mit auffallender Schnelligkeit ging der Rechtsanwalt nach der Tür und drückte den Klingelknopf, blieb dort auch stehen, ohne noch ein Wort zu sagen oder zurückzublicken, bis der Schließer kam und ihm öffnete. Was sollte er auch von der, die jetzt für zehn Jahre hinter Zuchthausmauern verschwand, noch weiteren Abschied nehmen? Etwa ihr Worte des Trostes, des Mitleids sagen? Dazu war dieser Mann zu feinfühlig. Nur schnell sie allein lassen!
Draußen vor der Tür stand sein vertrauter Mann, der Wache hatte halten müssen. Das Gespräch des Verteidigers mit seinem Klienten darf nicht belauscht werden.
Atalanta war allein.
Mitten in der Zelle stand sie und blickte nach der Tür, die sich hinter jenem geschlossen, und jetzt hatte ihr Auge eine furchtbare Starre angenommen.
»Aufruhr und Hochverrat«, murmelte sie, »zehn Jahre Zuchthaus — im Steinbruch — und er herzt und liebkost eine Puppe, die er für mich hält, während er mich selbst grimmig zurückstößt — Du allgütiger Gott der Liebe, an den ich glauben soll, hast Du nicht vielleicht noch mehr für mich?«
An der Tür rasselte es, die Wärterin trat ein, ein herkulisches Weib, sie hatte aber hinter sich auch noch eine weibliche Sicherheitswache.
»Was wollen Sie heute Abend essen? Wieder Anstaltskost? Es ist das letzte Mal, dass Sie wählen dürfen.«
»Ich weiß es. Ich möchte — Roastbeef haben.«
»Na endlich, das machen Sie recht. Also eine Portion Roastbeef. Was dazu?«
»Nichts weiter. Ein recht großes Stück, im Ganzen gebraten.«
»Ein Pfund?«
»Zwei — drei Pfund.«
Die Wärterin lachte. Außerdem freute sie sich schon. Was übrig blieb, gehörte ihr.

»Das machen Sie recht. Essen Sie sich noch mal tüchtig satt. Im Zuchthaus gibt's kein Roastbeef, überhaupt selten Fleisch, sonst werden die Mädels zu wild. Also drei Pfund Roastbeef. In einer Stunde können Sie's haben.«
Sie wollte gehen.
»Halt! Und etwas zu trinken möchte ich haben. Das kann ich doch auch bekommen?«
Sicher. Was sie haben wollte. Die Wärterin hatte nicht mehr gefragt, weil sie früher immer gar keine Antwort bekommen hatte.
»Branntwein.«
»Branntwein? Schnaps?«, machte das Weib, sicher eine Irländerin, mit verdutztem Gesicht.
»Whisky.«
»Irischen? Das ist der beste.«
»Ja, irischen. Ein ganzes Quart.«
»Ein ganzes Quart? Das machen Sie recht, besaufen Sie sich erst noch einmal. Im Zuchthaus gibt's keinen Whisky mehr.«
Aber wundern tat sich die Wärterin doch. Erst immer nur von Brot und Wasser gelebt, und jetzt drei Pfund Fleisch und einen ganzen Liter Schnaps.
Nach einer Stunde kam der große Braten und eine Flasche Whisky. Auf dem Teller lag nur ein Löffel.
»Wo ist das Messer?«
»Das gibt's nicht, das wissen Sie doch.«
»Dann wenigstens eine Gabel.«
»Auch mit der Gabel könnten Sie sich die Pulsader aufstechen.«
»Ich kann den Braten doch nicht mit dem Suppenlöffel essen.«
»Ja, warum haben Sie gesagt, ich soll ihn ganz bringen? Sonst hätte ich ihn doch gleich in Scheiben geschnitten.«
Die Wärterin nahm ihn noch einmal mit hinaus und brachte ihn in Scheiben geschnitten wieder.
Dann blickte sie mehrmals durch die Klappe, um zu kontrollieren, wie viel für sie von dem Braten übrig bleiben würde. Na, zwei Drittel doch sicherlich. Ein Mensch kann doch nicht drei Pfund Fleisch auf einen Sitz aufessen. Da aber erlebte sie ihr blaues Wunder. Die Frau Gräfin verspeiste mit bestem Appetit eine Scheibe nach der andern, bis die drei Pfund Roastbeef verschwunden waren.
»Na, so eine Indianerin! Erst acht Tage hungern und dann drei Pfund Fleisch hinunterschlingen.«
Da hatte sie recht. Das war eben indianisch. Und bei der Frau Gräfin war wieder einmal ganz die Indianerin hervorgebrochen.
Die aufgemachte Flasche Whisky hatte sie noch nicht angerührt, das kam wohl erst später.
An der Decke hatte schon die elektrische Glühbirne gebrannt, von einem eisernen Korbe umgeben, um acht Uhr wurde sie von draußen ausgedreht.
Tiefste Finsternis herrschte in der Zelle. Die Indianerin lag auf dem Bett. Nach zwei Stunden stand sie auf, entkleidete sich, nahm die Flasche, goss in ihre hohle Hand Whisky und rieb sich den ganzen Körper damit ein.
Wozu tat sie das? Ehe die griechischen Athleten in den Wettkampf von Olympia gingen, wurden sie von ihren Trainern, den Aleipten, am ganzen Körper mit feurigem Weine eingerieben, massiert, was überhaupt während des ganzen Trainings täglich geschah. Diese äußerliche Anwendung des Alkohols ist fast ganz vergessen worden. Und dabei ist die Wirkung eine wunderbare. Man wird davon berauscht. Die Hautporen saugen den Alkohol auf, es geht etwas ins Blut, der Geist steigt ins Gehirn. Aber es ist ein vollständig anderer Rausch, als der durch innere Anwendung, durch Trinken. Die Muskeln und Sehnen erhalten die äußerste Spannkraft, die Sinne verschärfen sich, und dabei tritt hinterher nie eine üble Folge auf.
So verrieb die Indianerin fast die ganze Flasche Whisky an ihrem Körper. Dann kleidete sie sich wieder an, trug geräuschlos den Tisch unter das Fenster, stieg hinauf und griff mit beiden Händen in die Eisenstäbe.
»Steinbruchsarbeit!«. flüsterte sie.
Wollte sie etwa diese zwei Zoll starken Eisenstangen mit den Händen herausreißen? Da konnte sie lange rütteln. Hier hatte man doch mit jeder Eventualität gerechnet, und was für Ein- und Ausbrecher hatten hier schon dringesessen! Herkules, der wirkliche Herkules, der schon in der Wiege die Riesenschlangen spielend erwürgte und später dem Atlas das Himmelsgewölbe abnahm, hätte sich ebenfalls vergeblich angestrengt, hier diese Eisenstangen herauszureißen.
Aber sie rüttelte gar nicht. Ein Beobachter hätte überhaupt gar nicht gewusst, was sie eigentlich wollte.
Sie stand da oben auf dem Tisch, die Knie an der Wand, mit den Händen das Gitter ergriffen, den Oberkörper zurückgeneigt, und so verharrte sie völlig regungslos.
Wer freilich ihre Glieder befühlt hätte, der wäre wohl förmlich erschrocken gewesen über diese steinerne Härte.
So verging eine Viertelstunde und nichts änderte sich. Da aber geschah plötzlich das Wunder.
Die starken Eisenstäbe begannen sich zu biegen.
Mehr und mehr — und mit einem Mal hatte Atalanta das ganze Gitter frei in den Händen. Es hatte sich aus den Mauerwänden herausgelöst. Aber wie das eigentlich geschehen und überhaupt möglich gewesen war, das hätte kein Mensch sagen können. Hier musste ein ganz besonderer Trick und Kniff vorliegen, wozu freilich vor allen Dingen auch eine Riesenkraft nötig war.
Sie stieg herab, legte das schwere Gitter leise hin, zog ihre Mokassins aus, goss den Rest des Branntweins in diese hinein, mit der letzten Neige befeuchtete sie auch unten die Sohlen, zog sie wieder an, erstieg wieder den Tisch, machte einen Klimmzug, schob ihren Oberkörper in die enge Fensteröffnung und blickte hinab. Am Himmel stand der halbe Mond.
Drei Stockwerke hoch befand sich die Zelle Atalantas. Unten lag ein gepflasterter Hof, auf dem drei Wachtposten mit Gewehren patrouillierten, allein auf dieser Seite. Diese selbst lösten sich beständig ab, indem die beiden äußersten Wachen immer von ihren Partnern auf den anderen Seiten gesehen werden mussten — es waren somit die denkbar besten Sicherheitsmaßregeln getroffen. Der Hof war überdies von einer Mauer umgeben, die Atalanta auf sechs Meter Höhe taxierte, und die oben mit zahllosen Eisenspitzen besetzt war.
Und wieder geschah ein rätselhaftes Wunder. Jetzt zog die Indianerin auch ihre Füße nach. Die Fensteröffnung war keinen halben Meter hoch und noch schmaler, und dennoch brachte sie es fertig, ihren ganzen Leib, wie eine Kugel zusammengerollt, in diesen engen Raum hineinzuzwängen.
So kauerte sie am Rande der dicken Mauer und spähte in die Tiefe.
Mit einem Male sauste sie hinab. Wo sich die Wachtposten gerade befanden, war ihr gleichgültig gewesen; nur dass sie keinem auf den Kopf sprang.
Furchtbar schmetterte die menschliche Gestalt auf das Steinpflaster nieder.
Die Posten stutzten, starrten, der Mechanismus ihres Gehirns musste erst in Funktion gesetzt werden.
Da aber schnellte die menschliche Gestalt schon wieder wie ein Gummiball auf, es sah wirklich genau so aus, als ob ein riesiger Gummiball von höchster Elastizität in drei Sprüngen gegen fünfzehn Meter durchhüpfe, jetzt war sie an der sechs Meter hohen Mauer, schnellte an ihr bis zur Hälfte empor, lief an ihr mit Händen und Füßen weiter empor, genau so, wie eine Katze eine Mauer hinaufläuft, natürlich noch die Schnelligkeit der Bewegung, das Beharrungsvermögen benutzend.
Ehe die Posten ihre Gewehre herunterreißen oder heben konnten, war sie schon über der Mauer verschwunden.
Jetzt Rufe, Brüllen und Signalpfiffe.
»Arrestant entwichen, Nordseite!!«
Alarm überall, mit einem Zuck war der ganze mächtige Steinbau elektrisch illuminiert, eine Glocke heulte und gleich darauf ertönte wütendes Hundegebell.
Die amerikanische Polizei hat von jeher spanische Bluthunde gehabt, jetzt englische genannt. Die tobende Meute, niemals richtig gesättigt, immer von Heißhunger geplagt, wurde gleich außerhalb der Mauer gebracht.
»Über die Mauer gesprungen? Das ist ja gar nicht möglich!«, sagte der zweibeinige Hundekönig, der die Verfolgung zu leiten hatte.
Wollte er der Versicherung der Posten nicht glauben, so musste er es wohl seinen Augen, als er jenseits der Mauer die Spuren in dem feinen Sand sah.
Denn die ganze Gefängnisanstalt lag in einer kleinen Sandwüste, vielleicht erst künstlich geschaffen. Ringsherum auf eine Entfernung von einem Kilometer lag feiner, weißer Sand, der täglich zweimal geharkt wurde. Auf dieser Seite grenzten dann Wohnhäuser mit Gärten daran, dorthin führten die Spuren, deren Hackenlosigkeit den erfahrenen Augen sofort auffiel.
»Aber der Mann muss sich doch dort oben aufgespießt haben, mindestens furchtbar bluten!«
»Nummer 243, die Indianerin!«, erklang da der Ruf.
»Ach so, die Indianerin, die Atalanta, die Athletin! Ja, nun kann man's glauben — dieses Teufelsweib! Vorwärts, die Hunde!«
Vorläufig waren sie ja noch gar nicht nötig. Bis an die Gärten, welche der Flüchtling natürlich zuerst aufgesucht hatte, um sich unsichtbar zu machen, konnte man ja die Spur mit bloßem Auge verfolgen. Dann aber mussten die Hunde in Funktion treten, und das würde wieder einen schönen Skandal dort mit den Villenbesitzern geben.
»Los, treiben Sie doch Ihre Hunde an!!«, schrie der Inspektor wütend.
Da aber geschah wiederum ein Wunder.
Die ausgezeichneten Spürhunde versagten.
Kein Hund nimmt eine Fährte auf, die nach Alkohol riecht.
Aber für diese Männer, deren ganzes Leben in ihren Hunden aufging, lag vorläufig ein unerklärliches Wunder vor. »Diese rote Teufelin hat die Hunde behext!!«
Bis sie dann erfuhren, dass die Untersuchungsgefangene zur letzten Mahlzeit eine ganze Flasche des stärksten Branntweins gefordert und geleert hatte, da wussten sie's auch, denn so ganz unbekannt war diesen Männern dieser Trick ja nicht.
Nun, man konnte die Spur ja bis an die Gärten verfolgen, dann aber hörte es auf. Die Hunde waren nicht dazu zu bringen, innerhalb der Gärten, die geöffnet werden mussten, die jetzt unsichtbare Spur aufzunehmen.
So durchstöberten jetzt einige Dutzend Männer die Gärten und Parks, obwohl sie wussten, dass man diese Indianerin doch nicht wieder bekäme, wenigstens nicht hier. Aber man musste unter den Augen von hohen Vorgesetzten doch seine Pflicht tun.
Solch ein hoher Vorgesetzter, der zweite Direktor, überschritt soeben, weit hinter der absuchenden Linie, einen kleinen Grasplatz, von hohen Büschen eingefasst. Etwas theatralisch oder auch aus wirklicher Vorsicht hatte er in der rechten Hand ein langes Bowiemesser, in der linken einen mächtigen Revolver, und sein Gürtel war mit Ersatzpatronen gespickt.
»Rücksichtslos schießen, rücksichtslos schießen!«, schrie er in einem fort.
Ganz unnötigerweise. Diese Anstaltsbeamten kannten doch ihre Instruktionen. Bei einem Zuchthäusler, auch wenn er die Strafe noch nicht angetreten hatte, gab es natürlich keine Schonung. Auf alles, was einer Indianerin mit oder ohne kurzem Röckchen glich, wurde geschossen. Hoffentlich waren aus den Gärten schleunigst alle Liebespärchen verschwunden, dass nicht etwa ein unschuldiges Dienstmädchen oder eine Köchin eine blaue Bohne bekam.
Aber der Herr Direktor hielt es wohl für seine Pflicht, möglichst zu brüllen.
»Rücksichtslos schießen, rücksichtslos schieß...«
Die letzte Silbe erstickte in seiner Kehle. Plötzlich tauchte vor ihm aus dem Gebüsch eine dunkle Gestalt auf, hatte mit einem Griff seine beiden Handgelenke gepackt, im nächsten Moment ihm mit einer merkwürdigen Bewegung Messer und Revolver aus der Hand gewunden, dann ein Griff nach der Brust, ein Ruck, ein Reißen, die Tuchjacke war in Fetzen gegangen, im zweiten Moment hatte der Herr Direktor solch einen Fetzen im Munde, er wurde nachgestopft, und gleichzeitig fühlte er, dass ihm auch schon seine Hände gebunden waren und seine Füße ebenfalls, er lag am Boden.
»So ein kurioser Traum!«, mochte der Herr Direkter denken — vielleicht.
»He, Jim, was machst Du denn da am Boden?«, fragte nicht weit von ihm eine Stimme.
Ein Gurgeln antwortete.
Aber nicht etwa der Direktor war gefunden worden, der hatte noch gar keine Zeit zum Gurgeln gehabt.
Wir wollen es kurz machen.
Sechsundzwanzig Mann waren bei der Suche beschäftigt. Von diesen versammelten sich dann nur noch fünfzehn. Die anderen elf wurden nach und nach gefunden, in den verschiedensten Teilen der Gärten, gebunden und geknebelt.
Die entflohene Indianerin hatte den ersten Beweis gegeben, was von ihr noch zu erwarten war.
Sie war immer mitten zwischen ihren Verfolgern gewesen, hatte einen nach dem andern aus ihrer Mitte herausgeholt, einen nach dem andern unschädlich gemacht, regelrecht gebunden und geknebelt.
Wenn das so weiter gegangen wäre und wenn man die erste Entdeckung nicht bald gemacht hätte, so wäre schließlich von diesen sechsundzwanzig Mann gar keiner mehr übrig geblieben.
Ja, diese Indianerin hatte mit einem kleinen Anfang gezeigt, was von ihr noch alles zu erwarten war, wenn man sie weiter verfolgte.
Was hier eigentlich Fürchterliches vorlag, das lässt sich wohl besser denken als schildern.
Diese Männer waren jedenfalls nicht mehr fähig, die Verfolgung fortzusetzen, denen war vor Schreck das Blut in den Adern erstarrt.
Noch hinter jenen Villen zog sich die Straße entlang, auf der einst die ersten Pioniere von Osten nach Westen drangen, denen dann der ganze Auswandererstrom folgte, damals ein Indianerpfad, jetzt eine chaussierte Straße, an deren Seite auch die Pacificbahn entlang braust.
Unter einer großen Eiche stand eine dunkle Gestalt, nur in allernächster Nähe erkennbar, und lauschte dem Spektakel, der dort in den Gärten herrschte, nachdem sie schon beobachtet hatte, wie die Gefängnisanstalt plötzlich illuminiert worden war.
Sonst war die Entfernung doch zu weit, als dass sie die Worte selbst vernehmen könnte, die dort geschrien wurden.
»Oooo«, flüsterte eine Stimme, die nur einer jungen Dame angehören konnte, »da ist sicher jemand geflohen, wenn das nur nicht etwa gerade unsere —«
Erschrocken brach sie ab. Plötzlich stand vor ihr eine andere dunkle Gestalt, hier im Mondschatten des dichtbelaubten Baumes auch in Armeslänge nur an den äußeren Konturen erkennbar.
»Miss Norma O'Fear, genannt Miss Nofear, in Ihnen habe ich hier gerade die Richtige gefunden — Sie werden einer in Not Befindlichen Ihre Hilfe nicht entziehen.«
Die Angeredete führte wirklich diesen Namen, war die Tochter, überhaupt das einzige Kind eines der reichsten Großkaufleute und Fabrikanten in Frisco, ein äußerst exzentrisches Dämchen, das schon oft Amerika, wenn nicht die ganze Welt von sich reden gemacht hatte, denn es verging selten ein Tag, an dem Miss Norma, Meisterin in allen gymnastischen Künsten, nicht irgend eine tolle Wette austrug, entweder ein waghalsiges Reiterstückchen, das sonst so leicht auch der beste Reiter, ein verwegener Cowboy, nicht riskiert hätte, etwa wie neulich mit ihrem Gaul den kilometerlangen Steinrutsch im Steinbruch von Sissirra hinunterzuschusseln, direkt ins Wasser hinein, oder wie in der Woche zuvor den Turm der St. Pauls-Kirche von außen zu erklettern und oben an den Kopf des Blitzableiters eine große Wurst zu hängen, die sie dann von unten mit dem Revolver wieder abschoss.
N. O'Fear. So unterschrieb sie sich. Was Wunder, wenn man da die »Miss Nofear« aus ihr gemacht hatte, d. h. Miss Ohnefurcht.
Und dabei war sie eine Seele von einem Weibe, so herzensgut, dass ihr Papa in den Zeitungen hatte veröffentlichen müssen, dass er nicht mehr für seine ungeratene Tochter gut sei. Damals, als sie, um einem Bekannten aus großer Geldverlegenheit zu helfen, auf einen Wechsel den Namen ihres Vaters fein säuberlich gemalt hatte.
»Denkt Euch«, erzählte sie dann, als sie mit knallroten Backen in ihren Klub gekommen war, »Papa sagte, ich gehörte ins Zuchthaus. Wegen lumpiger zehntausend Dollars, wegen so eines lumpigen Namens. Aber er wollte Gnade für Recht ergehen lassen — da und da, hat er gesagt — na, sehe ich nicht hübsch gesund aus? Habe ich nicht dicke, rote Bäckchen? Aber warte nur, Papa, wenn Du Dir heute Abend Deine Pfeife ansteckst — — ich habe ihm in den schon gestopften Pfeifenkopf eine Rakete mit Leuchtkugeln praktiziert. Na, der fällt doch vor Schreck auf den Rücken und kann dann vor Lachen nicht wieder aufstehen.«
Die Sache war nämlich die, dass Mister Dan O'Fear, ein geborener Schotte, in seiner Jugend nicht anders gewesen war, er hatte ebenfalls Dan Nofear geheißen, Dan Ohnefurcht, war wegen seiner tollen Streiche berühmt und berüchtigt gewesen. Das war nun freilich schon lange vorbei. Aber auf seine »ungeratene« Tochter war er doch maßlos stolz, in ihr lebte er wieder auf, sah sich selbst wieder, und er bedauerte durchaus nicht, dass es kein Junge geworden war, denn bei einem Sohne sind solche Charakterveranlagungen doch etwas gefährlicher, sie können den Eltern viel Kummer und Sorge machen. —

Jetzt freilich war Miss Ohnefurcht erschrocken gewesen, und es war begreiflich — wie da die dunkle Gestalt plötzlich vor ihr auftauchte und sie mit ziemlich tiefer Stimme ansprach.
Im nächsten Augenblick hatte sie einen kleinen Revolver in der Hand.
»Was wollen Sie?«, fragte sie ruhig. »Wenn Sie sich als Straßenräuber etabliert haben, so kommen Sie bei mir an die unrechte Adresse, ich bin selbst schon einmal Banditenanführerin gewesen, bin es eigentlich heute —«
»Ich bitte um Ihre Hilfe.«
»Was wollen Sie?«
»Ihre Kleider.«
»Meine Kleider? Sie sind wohl verrückt!«
Wegen der tiefen Stimme dachte die Miss immer noch an einen Mann.
»Was wollen Sie denn mit meinen Kleidern? Wer sind Sie denn?«
»Ihnen, Miss Norma O'Fear, vertraue ich mich ohne Weiteres an: Atalanta, Gräfin von Felsmark —«
Ein unterdrückter Jubelruf unterbrach sie, aber es hatte auch etwas wie Ärger darin gelegen.
»Also Sie sind's wirklich?! Sie sind der Gefangene, der ausgebrochen ist? Ahnte ich's doch gleich! Verflucht und zugenäht, Sie haben uns ja den ganzen Spaß verdorben!«
»Welchen Spaß?!«
»Na, wir wollten Sie doch herausholen!«
»Mich herausholen?«
»Na freilich.«
»Wer denn?«
»Na wir, der ganze Sportingklub. Wissen Sie's denn noch nicht? Nein — ich dumme Gans — woher sollen Sie's denn wissen? Der Athletikklub wollte Sie aus dem Zuchthaus herausholen — hier, unser Athletikklub in Frisco — denn der lässt sich doch nicht etwa von dem New Yorker Athletikklub lumpen — und der hätte doch natürlich die Gattin seines Trainers, des Champion-Gentlemans von New York, nicht im Zuchthause spinnen lassen — also mussten Sie gleich am ersten Tage herausgeholt werden — nun aber lässt sich doch unser Sportingklub nicht etwa von den Friscoer Athleten lumpen — also beschlossen wir, Sie schon morgen früh zu befreien, wenn Sie nach Belltown überführt würden — wir wollten den Zug durch falsche Signale zum Halten bringen oder Ihren Wagen abkuppeln oder eventuell auch, wenn's nicht anders ging, die Schienen aufreißen. — Da aber erfuhren wir, dass sich schon eine andere Bande gebildet hat, die dasselbe beabsichtigt, Sie morgen früh aus dem Zuge herauszuholen — ja, wir haben sogar schon drei solche Banden ausspioniert, die alle dasselbe wollen, Sie morgen beim Transport befreien — und vielleicht sind's noch viel, viel mehr — lauter Arbeiter —«
»Lauter Arbeiter?«, unterbrach einmal Atalanta die Sprecherin, welche die Worte nur so hervorsprudelte.
»Lauter Arbeiter. Ja, wissen Sie denn gar nicht, wie's in Frisco aussieht? Ach, ich alberne Gans, woher sollen Sie's denn wissen! Und doch, Sie könnten's ja erfahren haben. Sie wissen's nicht, wie's jetzt in Frisco aussieht? Schrecklich, entsetzlich, grässlich — einfach schauderhaft. Und doch so schön, wunder-, wunder-, wunderschön! In ganz Frisco herrscht Anarchie! Niemand denkt mehr an Arbeit — die Schiffe werden nicht ein- und ausgeladen — die meisten Geschäfte sind geschlossen — alle Arbeitervereine ziehen mit ihren Fahnen durch die Straßen — überall werden Reden geschwungen und Demonstrationen abgehalten — überall Radau mit Musik — und die Arbeiterfrauen haben im Justizpalast alle Fensterscheiben eingeschmissen — großartig war es, ich habe auch mit geschmissen und geschossen — und die zwölf Geschworenen können, wenn sie sich abkratzen, gleich einen Handel mit zermatschten Apfelsinen und faulen Eiern anfangen, so sind sie bombardiert worden — ich allein habe zwei Schock faule Eier verfeuert — und was die kosteten! — Zehn Dollars das Schock — es waren gar keine faulen Eier mehr aufzutreiben —«
»Ja um Gottes willen, weshalb denn nur?!«
»Sie fragen noch? Na Ihretwegen! Vor Gericht mussten Sie kommen, nachdem die Anklage einmal erhoben war, das stimmt — der Richter konnte auch lebenslängliches Zuchthaus beantragen — aber die Geschworenen mussten Sie unbedingt freisprechen, unbedingt, und weil das nicht geschehen ist, deshalb herrscht in Frisco Revolution, es wird nicht mehr gearbeitet, hunderttausend Arbeiter, Männer und Frauen des Volkes, sind entschlossen, Sie mit Gewalt zu befreien, Sie im Triumph durch die Straßen zu tragen —«
»Ja weshalb denn nur?!«
»Sie fragen immer noch? Na, weil Sie alles, was Sie damals mit Ihren Vorstellungen auf dem Zauberschiffe verdienten, den Armen gegeben haben, weil Sie die Krüppel- und Waisenkinder gespeist haben — da, hören Sie?«
Plötzlich erbrauste in der wieder still gewordenen Nacht ein vieltausendstimmiger Chor, geschliffen und rhythmisch wie im Theater auf der Bühne sprechend, nur eben mit kolossaler Macht, ein einziger Ruf aus vielen Tausenden von rauen Männerkehlen:
»Hip, hip, hip, hurra für die Gräfin Atalanta von Felsmark!! Keine Begnadigung, sondern Gerechtigkeit!! Wiederaufnahme des Verfahrens und Freispruch!! Achttausend Hafenarbeiter von Frisco für das Gentlewoman von Amerika: hip, hip, hip, hurra!!«
Mit einem Schlage war das brüllende, ausgezeichnet gelungene Deklamieren verstummt, wieder herrschte totenstille Nacht. Nur ein leises Dröhnen in der Ferne verriet, dass die achttausend Männer in geschlossenen Reihen wieder abmarschierten.
»Haben Sie's gehört? Großartig, was? Und das waren nur die Hafenarbeiter, und so haben Sie alle, alle, und nicht nur die Arbeiter — Jesus Christus und General Jackson!«
Plötzlich flog über den Himmel ein mächtiger Meteor, eine Sternschnuppe, nicht allzu schnell, mit blendend weißem Lichte, für einige Sekunden Tageshelligkeit verbreitend. Das weiße Licht drang auch unter die große Eiche, beleuchtete das junge, kaum achtzehnjährige Dämchen, im eleganten Automantel mit entsprechendem Hut, beleuchtete das reizende, etwas knabenhafte Mädchengesicht, in dem die Augen vor Erregung funkelten, beleuchtete auch die andere Gestalt, die in dem ledernen Kostüm mit dem kurzen Röckchen.
Und aus deren Munde erscholl jetzt ein schluchzender Laut, plötzlich entstürzten Tränen ihren Augen — ihr, die sonst auch beim größten Weh und Leid keine Tränen hatte.
Das machte: Der glühende Meteor war ihr vom Himmel ins Herz gefahren!
»Na, was haben Sie denn? Was fangen Sie denn zu heulen an?«, erklang es naiv, aber mit einer herzigen Stimme, die auch wieder in jedes Herz dringen musste.
»Und ich habe geglaubt, ich sei von aller Welt verraten und verlassen!«
»Verraten und verlassen? Von aller Welt? Na warten Sie mal ein bisschen! Das ist erst Frisco! Lassen Sie erst mal Ihre Verurteilung weiter bekannt werden. Ganz Amerika steht für Sie auf —«
In der Ferne erscholl das gräuliche Geschrei einiger verliebter Katzen.
»Himmeldonnerwetter«, unterbrach sich das Dämchen erschrocken, »da stehen wir und schwatzen, und meine Freunde — miaaauuu —«
Auch sie ahmte ausgezeichnet das Katzengeschrei nach, und dann setzte sie noch ein mächtiges »ook—ook—ook—uuuaaah« hinzu, das furchtbare Gebrüll des Ochsenfrosches.
»So, nun wissen die, wer das Signal gegeben hat, gleich werden sie hier sein — der Ochsenfrosch bin ich.«
Atalanta, noch die Augen mit Tränen gefüllt, musste plötzlich herzlich lachen.
»Aber der Ochsenfrosch brüllt doch um diese Jahreszeit gar nicht mehr!«.
»Äh, das ist mir egal — der hat sich mal in der Jahreszeit geirrt — und überhaupt, wenn ich ein Ochsenfrosch wäre, ich ließ mir da keine Vorschriften machen, wann ich zu brüllen habe und wann nicht. Na, die werden sich ja nicht schlecht ärgern, dass Sie selber schon ausgebrochen sind.«
»Wie wollten Sie mich denn befreien?«, fragte Atalanta immer noch lachend.
»Na wir hätten Sie eben einfach aus dem Käfig herausgeholt.«
»Ja aber wie denn? Haben Sie die Aufseher und meine Wärterinnen bestochen?«
»Ach wo! Bestochen!!«, erklang es entrüstet zurück. »Das könnte doch jeder Hanswurst. Nein, wir wollten die ganze Wache überwältigen und dann eindringen. Und falls uns das nicht gelänge, so sollte gleichzeitig von hier draußen operiert werden. Wenn die drei Posten auf dieser Seite nicht nach vorn eilten, so würden sie eben niedergeschlagen, bei nur drei Mann ist das doch eine Kleinigkeit — dann würde nach Ihrem Fenster, das wir natürlich kannten, eine Bola geschleudert, ein Kugellasso — das versteht Fred Ugly — Sie wissen, der Sohn von dem Pelzkönig — der ist in Argentinien einmal Gaucho gewesen, was bei uns Cowboy ist — der schleudert die Bola wie kein zweiter — hinaufgeklettert wäre ich — denn klettern kann ich am besten — und ich habe nur diesen Mantel an, darunter nur Hosen — und eine Diamantfeile habe ich bei mir, die zersägt den härtesten Stahl wie Butter — faktisch lauter kleine Diamanten — sie gehörte früher dem Tom Nicker, dem Sohne des jetzigen Börsenkönigs, die beiden, Vater und Sohn, haben früher doch nur vom Einbruch gelebt — ich gewann sie ihm im Spiele ab, feilte einmal den Geldschrank meines Papas damit an, und da sagte Papa gleich: Da hat entweder Tom Nicker mir einen Besuch abstatten wollen oder Du verflixtes Saumädel hast wieder einmal —«
»Ja«, unterbrach Atalanta das kleine Plappermaul, so interessant diese Offenbarungen auch waren, »wenn Sie oder einer Ihrer Freunde nun dabei erwischt worden wären?«
»Na, was wäre dabei?«
»Dann wären Sie doch bestraft worden?«
»Na, und was wäre da? Alle hätten sie uns doch nicht erwischt. Und dann hätten wir uns eben wieder gegenseitig befreit, bis wir alle zusammen im Loch gesessen hätten. Und das wäre doch erst recht herrlich gewesen.«
Atalanta bekam da nichts Erstaunliches zu hören. Sie kannte doch Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Extreme berühren sich eben. Total nüchtern, nur an den Geldsack denkend, und doch wieder des höchsten Idealismus fähig, zu jedem Abenteuer immer bereit, ganz von Aberglauben durchseucht. Und außerdem alles Reklame, für die eigene Person, wie fürs Geschäft. Oder Beides ist ja ein und dasselbe. Nur populär werden, die meisten Stimmen des Volkes bekommen, das ist die Hauptsache. Was hat denn da ein Jahr Gefängnis zu bedeuten? Selbst Zuchthaus wird in Kauf genommen und das ist dann nicht einmal entehrend. Solchen dummen Schnickschnack kennt man weder in Amerika noch in England. Wer seine Schuld durch Freiheitsstrafe gebüßt hat, der hat gesühnt, und damit basta! Wer der Ehre für verlustig erklärt wird, was ja auch vorkommen kann, der muss sofort aus dem Lande.
Nach und nach fanden sich unter der Eiche gegen zwei Dutzend Personen zusammen. Sie hatten ja das ganze Beamtenpersonal des Gefängnisses überwältigen wollen — lauter Mitglieder des Sportingklubs, mit dem betreffs des Reichtums und Namenklangs seiner Mitglieder nur der Athletikklub konkurrieren kann.
Personen sagten wir, nicht Herren und Männer, weil auch einige Damen dabei waren, allerdings meist in Männerkostümen. Die eine von ihnen, gerade die, welche sich beim tätlichen Angriff mit hatte beteiligen wollen, war nebenbei noch Vorstandsmitglied von der »Inneren Mission«.
Auch ein Automobil kam vorgefahren, wie eine ungeheure Granate aussehend, ein dreihundertpferdiges, mit dem der Friscoer Sportingklub das letzte Hundertmeilenrennen gewonnen hatte. Auf ihm hatten die nächtlichen Helden die Befreite und sich selbst in Sicherheit bringen wollen — oder aber, was wahrscheinlicher, mit ihr einen Triumphzug durch die Stadt veranstalten wollen.
Auch jetzt herrschte wie vorhin bei Miss Nofear jubelnde Freude, aber auch eine gewisse ärgerliche Enttäuschung, als man hörte und sah, wen man vor sich hatte. Sie hatte sich schon selbst befreit.
Sie hatten es ja alle gleich geahnt, als sie vorhin den Spektakel gehört, wonach jemand entflohen sein musste.
»Wie haben Sie denn Ihre Flucht bewerkstelligt?«
Atalanta berichtete mit kurzen Worten, wie sie das Gitter herausgerissen hatte und abgesprungen war, über die Mauer setzend, in die Gärten hinein.
Jetzt siegte schon die allgemeine Freude über die Enttäuschung, zu spät gekommen zu sein.
»Uns wundert nur, dass Sie nicht weiter verfolgt werden, dass man hier nicht die weitere Umgegend absucht.«
»O, dazu werden meine Verfolger wohl die Lust verloren haben.«
»Wie das?«
Nun erzählte die Indianerin auch noch, mit möglichst bescheidenen Worten, wie sie von den 26 Verfolgern elf Stück unschädlich gemacht hatte, immer in der Mitte der anderen.
Da brach der Jubel erst richtig los. Und er fand ein vieltausendstimmiges Echo dort, wo die Stadt lag.
»Hört Ihr? Jetzt weiß es die ganze Stadt, dass die unschuldig Verurteilte ausgebrochen ist! Hip, hip, hurra für die Atalanta — hurra, das soll einen Triumphzug geben!«
Alle fanden es ganz selbstverständlich, dass man mit der Ausbrecherin jetzt durch die Stadt fahren müsse. So bekamen diese Helden und Heldinnen doch wenigstens noch etwas von der erhofften Ehre ab. Schon wurden Eichenlaubzweige abgerissen, um das Automobil und die wahre Heldin damit zu schmücken.
Nur diese selbst war hiermit nicht einverstanden.
»Es wird meinetwegen zu Volksaufläufen kommen, zu Widersetzlichkeiten gegen die Polizei —«
»Was schadet das? Kann das überhaupt noch größer werden, als es jetzt schon ist?«
»Jawohl, es kann noch zu viel größeren Ausschreitungen kommen, und ich mag daran doch keine Schuld tragen.«
Sie erhob noch andere Einwendungen, aber diese Ritter der Nacht bestanden auf ihren Triumphzug. O, die Polizei sollte nur wagen, ihnen die Gefeierte abzunehmen!
»Nun denn, meine Herren und Damen, so muss ich Ihnen den Hauptgrund sagen, weswegen ich nicht gefeiert werden will. Dadurch werde ich doch unbedingt lange Zeit aufgehalten —«
»Na, wir haben doch Zeit genug!«
»Aber ich nicht. Ich habe mir doch nicht umsonst gleich ein richtiges Frauenkleid verschaffen wollen —«
»Ja, weshalb eigentlich wollten Sie das? Doch nicht etwa als richtige Dame auftreten unter einem Schleier? Sie müssen unbedingt die Indianerin bleiben, die Sie sind.«
»Weil mich meine ganze Sehnsucht nach dem Hause treibt, das auf Irvinghill steht —«
Da wurden sie alle gleich still und etwas verlegen.
»Ach so, Ihren unglücklichen Gatten wollten Sie erst sehen — ja, das ist freilich etwas anderes.«
»Ich wollte die Hausmauer erklimmen bis an das Fenster, hinter dem er mit einer Puppe spielt, die mich vorstellt, und es hätte nichts geschadet, wenn die Zelle auch schon dunkel ist — aber ein einfacher Vorhang schon hätte meine einzige Sehnsucht vereitelt, und so wollte ich mich zur Vorsicht doch gleich mit einem Damenkostüm versehen. Dann wäre ich vorn eingetreten, verschleiert, hätte mich für eine Schwester des Grafen ausgegeben, auf der flüchtigen Durchreise begriffen — man hätte mir den Anblick des Bruders wohl nicht versagt. Und wenn er auch schon geschlafen hätte, nur ein Blick auf ihn würde mir genügt haben.«
Sofort war der allgemeine Entschluss geändert.
»Gut, so fahren wir jetzt erst nach Irvinghill.«
»Ich bitte darum.«
»Der nächste Weg ist ja doch durch die ganze Stadt.«
»Ja, aber ich will unerkannt bleiben, damit ich nicht aufgehalten werde.«
»Selbstverständlich. Dann auf dem Rückweg.«
»Darüber können wir ja dann noch sprechen.«
»Gut. Dann vorwärts!«
Sie stiegen ein. Alle fanden in dem Rennautomobil ja nicht Platz, es waren überhaupt nur drei Sitzplätze vorhanden, wohl aber gingen alle drauf, indem sie sich rittlings auf die Riesengranate setzten, hinten und vorn.
So ging es in mäßiger Fahrt, damit die verwegenen Reiter und Reiterinnen nicht schon vom Luftzug abgestrichen wurden, der nahen Stadt zu. In der Mitte saß die Indianerin, zwischen Tom Nicker, dem ehemaligen Einbrecherkönig, der jetzt aber schon längst als Börsenjobber eine hochangesehene Persönlichkeit war, und Miss Ohnefurcht, welche die Indianerin mit ihrem Mantel und Automobilschleier eingehüllt hatte, und eine Erkennung war unmöglich. Alle hatten ihr Ehrenwort gegeben, sie nicht zu verraten, das heißt auch durch keinen Freudentaumel sich dazu verleiten zu lassen.
Wir wollen nicht zu schildern versuchen, wie es in der Stadt zuging.
»Hip, hip, hurra für die Gräfin Atalanta von Felsmark!! Hip, hip, hip, hurra für das Gentlewoman von Amerika!!«
Dieser unausgesetzt gebrüllte Ruf beherrschte alle die wogenden Straßen.
Polizisten und sonstige Beamte waren gar nicht zu sehen; denn wenn sie auch ebenfalls mit der allgemeinen Volksanschauung über Recht und Gesetz sympathisieren mochten, so hätten sie doch ihre Pflicht tun müssen.
Aber gerade wegen ihrer Unsichtbarkeit kam es zu gar keinen Ausschreitungen.
Und doch war es schon so weit, es fehlte eben nur an Gelegenheit, und nur solch ein Beispiel wollen wir schildern.
Die Behörden hatten von der Flucht der schon verurteilten Zuchthäuslerin und den näheren Einzelheiten natürlich eher erfahren als das große Publikum, der Polizeipräfekt hatte es für seine Pflicht gehalten, sofort Maßregeln für ihre Wiederergreifung zu treffen, durch öffentliche Verkündigung mit einer Prämie.
Es war noch keine halbe Stunde vergangen, und schon waren die großen Plakate gedruckt, sie wurden hier und da von Leuten schnell an Ecken, Häuserwänden und Säulen festgeklebt.
Die wegen Aufruhrs und Hochverrats zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilte Gräfin Atalanta von Felsmark, Indianerin, ist heute Nacht dem hiesigen Gefängnis entsprungen. Eine Belohnung von hunderttausend Dollars wird demjenigen
zugesichert, der sie tot oder lebendig ausliefert.
Der Polizeipräfekt von San Francisco
Ja, der Präfekt hatte seine Pflicht getan, aber es war doch eine große Torheit gewesen, in der Überstürzung geschehen.
Wer dieses Plakat zunächst mit nüchternen Augen betrachtete, warf gleich eine erstaunte Frage auf.
Hunderttausend Dollars? Hallo!! Seit wann werden denn für die Wiederergreifung eines flüchtigen Verbrechers gleich solche Summen ausgeworfen? Da sind schon zehntausend auch für Amerika eine recht hübsche Prämie. Die Behörden dürfen doch nicht mit dem Geld, welches das Volk erst durch Steuern zusammenbringt, so wüsten, und darauf pocht gerade der Nordamerikaner.
Oder wer war der Schuft, der diese Prämie aus seinen Privatmitteln gestiftet hatte? Wem war an der Wiederergreifung der eigentlich doch so harmlosen Indianerin so ungeheuer viel gelegen?
O nein, die Sache war ganz anders. Den Behörden stand doch das ganze Vermögen der wegen Hochverrats Verurteilten zur Verfügung, das wurde einfach abgezogen, die konnten auch gleich eine, einige Millionen als Prämie aussetzen.
Als dies zur Erkenntnis kam, da erfüllte schon ein einziger Wutschrei die ganzen Straßen.
Und nun der Ausdruck: »Tot oder lebendig«. So etwas gibt es heute nicht mehr. Diese Indianerin war keine Mörderin, die gehenkt werden sollte. Das war von dem Polizeipräfekten entweder eine grenzenlose Dummheit gewesen, in der Hast diktiert, oder aber — er hatte auf die große Gefährlichkeit der Flüchtigen aufmerksam machen wollen.
Schade, dass man keines einzigen von denen hatte habhaft werden können, welche diese Plakate angeklebt hatten. Es war eben schnell an unbelebten Plätzen geschehen, dann wurde es unterlassen. Diese wenigen Plakate aber wurden unter Wutgebrüll sofort wieder abgerissen oder noch lieber mit faulen Eiern und Kot beworfen, bis ein geistreicher Kopf auf einen anderen Einfall kam.
Schnell einen großen weißen Zettel hergenommen, unter die Worte »hunderttausend Dollars Belohnung« möglichst groß die Worte geschrieben: »Wer den Polizeipräfekten ersäuft! Die Bürgerschaft von San Franzisco«.
Das Volk, das sich immer mehr in Wut hineinarbeitete, jubelte Bravo, sofort wurden solche und ähnliche Plakate auch schon gedruckt und überall angeklebt.
Es war an sich harmlos, nur für die Betreffenden nicht. Dieser Indianerin scharfsinniger Geist erkannte mit Schrecken, wie weit es hier schon gekommen war und dass sie sich jetzt gar nicht mehr zeigen durfte, auch nicht, um Ruhe zu stiften, falls jemand ihretwegen in Gefahr kam, wollte sie selbst ihr Leben nicht in ganz leichtsinniger und zweckloser Weise aufs Spiel setzen.
Denn Geld ist eben Geld und behält seine Wunderkraft. Ein Schuss aus irgend einem Fenster, eine Kugel ins Herz — der Mörder flüchtete vor der Lynchjustiz des Volkes und bewies erst aus sicherer Ferne, dass er derjenige sei, der sich die hunderttausend Dollars verdient habe.
Die Stadt lag hinter ihnen, es ging auf Irvinghill zu.
»Sie werden doch natürlich die Wand hinaufklettern?«, nahm wieder Miss Nofear das Wort.
»Nein, die Verhältnisse sind, wie ich bemerke, doch ganz andere geworden. Ich werde hübsch wie jeder andere Mensch durch die Haustür hineingehen.«
»Schade. Ich hätte Sie gern die Hausmauer hinaufklettern sehen mögen. Na, dann machen Sie mir das ein andermal vor, das möchte ich auch lernen, Papa gibt mir manchmal nicht den Hausschlüssel. Aber dann treten Sie doch offen als Atalanta auf?«
»Auch nicht. Ich werde mich, wie ich beabsichtigt, als Schwester des Grafen ausgeben, die sich auf schneller Durchreise befindet, sodass der nächtliche Besuch entschuldbar ist.«
»Na, wie Sie wollen. Ach, das ist ja zu traurig mit Ihrem Gatten. Ich habe alles gelesen, alles; es hat ja alles in der Zeitung gestanden, ganz ausführlich. Wie er sich jetzt mit der —«
Das junge Mädchen war feinfühlig genug, nicht von der Ersatzpuppe zu sprechen, wenigstens hatte es sich noch schnell besonnen.
»Sie wollen ihn nur einmal sehen?«
»Nur einen einzigen Blick auf ihn werfen. Er wird um diese Zeit doch gewiss schon schlafen.«
»Ja warum nehmen Sie ihn da nicht gleich mit?«
Ein quälender Seufzer zitterte aus der Indianerin Brust, aber so leise, dass auch der Nächstsitzende nichts davon merkte.
Wusste denn die Fragerin nicht, dass der Irrsinnige auch die eigene Gattin nicht erkannte, nichts von ihr wissen wollte, sie jedenfalls hasste wie jeden anderen Menschen, weil es bei ihm eben die furchtbarste Menschenscheu, gepaart mit Verfolgungswahn, war?
Gewiss hatte sie auch hiervon gelesen, jener Kapitän hatte doch genug berichten können, wie es an Bord des Schiffes zugegangen war, das junge Mädchen hatte nur nicht gleich daran gedacht, als es diese Frage stellte.
»Nein«, entgegnete Atalanta jetzt ruhig, »ich halte es für das Beste, wenn er in der Irrenanstalt bleibt, wo er sich unter der sachgemäßesten Pflege befindet. Wenn er geheilt wird oder wenn sich sein Zustand bessert, so ist das ja etwas anderes, dann würde ich ihn zu mir nehmen, aber so — nein, ich lasse ihn in der Irrenanstalt, gleich in dieser.«
»Und wo wollen Sie sich dann hinbegeben?«
Eine kleine Pause erfolgte, ehe sich die melodische Stimme der Indianerin wieder vernehmen ließ.
»Ich weiß einen Ort auf der Erde, wo mich niemand mehr finden wird.«
Das Automobil fuhr in langsamer Fahrt auf der ausgezeichneten Landstraße so ruhig, dass auch alle anderen dieses Gespräch hören konnten.
Über diese Worte herrschte eine allgemeine Bestürzung.
»Wie, Sie wollen jeden Kampf aufgeben?!«, erklang es durcheinander.
»Was für einen Kampf?«
»Nun, mit Ihren Gegnern.«
»Ich habe keine Gegner — mehr.«
»Sie wollen der Miss Morgan auch einfach Ihren Besitz am Sklavensee überlassen?«
»Sicher. Da ist doch überhaupt gar nichts mehr zu überlassen. Sie hat den Sklavensee, soweit er noch mir gehörte, doch auf ganz rechtliche Weise erworben.«
Die Enttäuschung dieser Herren und Damen war grenzenlos. Die hatten doch erwartet, dass diese Indianerin jetzt mit aller Macht gegen den Richterspruch und seine Folgen vorgehen würde, dass sie einen regelrechten Krieg führen würde, und da hätten sie auf ihrer Seite mitgemacht.
»Sie wollen sich wohl ganz von der Welt zurückziehen?«
»Völlig.«
»Wohin denn?«
»Ich kenne, wie ich schon sagte, einen Ort, wo mich niemand finden wird, wie man mich auch suchen mag.«
Weiter war aus ihr nichts herauszubringen, und man gab sich auch gar nicht viel Mühe.
»In die Felsenwohnungen Ihres Sklavensees hatte doch niemand Zutritt?«, begann nur einer noch einmal.
»Nein.«
»Es sind doch dort japanische Matrosen, welche die Geheimnisse behüten?«
»Die Eingänge dazu — ja. Acht Mann unter einem japanischen Leutnant.«
»Und welche die goldenen Schätze durch Seehunde aus dem See holen lassen?«
»So ist es — so war es.«
»Und auch alles dieses Gold wollen Sie nun so ohne Weiteres dem Fiskus überlassen?«
»Wie es das Gesetz für recht befunden hat — ich füge mich.«
»Frau Gräfin, Sie sind — sind —«
»Eine Närrin, sprechen Sie es nur ruhig aus. Gut, mag ich als solche gelten. Ich aber will fernerhin endlich Frieden haben. Ich werde aus der Welt für immer verschwinden — wenn ich auch nicht etwa an Selbstmord denke.«
»Aber diese Japaner werden der neuen Besitzerin doch nicht einfach weichen, auch gegen Militär werden sie sich zur Wehr setzen, und sie sitzen in den Felsen ja wie in einer uneinnehmbaren Festung.«
»Sie haben recht — es ist gut, dass Sie mich darauf aufmerksam machen. Was sind das dort für Lichter? Eine Vorortstation. Da ist doch auch immer ein Telegrafenamt dabei. Ich werde meinen Leuten sofort telegrafieren, dass sie noch heute Nacht den Sklavensee verlassen.«
»Ist das wirklich Ihr fester Entschluss?«, wurde nur noch gefragt.
»Er ist es.«
Von keiner Seite noch eine Einwendung, sofort hielt der das Automobil steuernde Tom Nicker vor der einsamen Station.
Und da zeigte es sich überhaupt, was das für »Helden« und »Heldinnen« waren. Alles war nur Abenteuerlust und Sensationssucht gewesen. Jetzt hatte diese ganze Geschichte gar keinen Reiz mehr für sie.
Mit einem Male dachten sie alle daran, dass es jetzt in der aufrührerischen Stadt doch viel interessanter sein müsse als hier, und sie suchten ihre Verabschiedung dadurch zu bemänteln, dass sie sagten, hier seien sie doch ganz überflüssig, sie könnten die Sicherheit der Verfolgten nur gefährden, zu ihrer Entdeckung beitragen.
Natürlich boten sie auch ihre weitere Hilfe an, und da musste man ihnen nun wieder die Gerechtigkeit widerfahren lassen: Als Freunde in der Not waren sie ganz echt zu nehmen. Jeder einzelne von ihnen wäre bereit gewesen, die Verfolgte in sein Haus aufzunehmen, in allen Ehren, ihretwegen dem Gesetz zu trotzen, alle Folgen zu tragen, sie mit seinem Blut zu verteidigen, ihretwegen auch ein gutes Stück Geld zu opfern.
Aber mit einer, welche der Welt entsagen wollte, so harmlos herumzufahren — nein, das war nichts für diese Herrschaften. Da war es eben jetzt in der Stadt doch viel interessanter, dort gab es Radau und noch etwas zu erleben.
»Wissen Sie denn dann gleich einen sicheren Ort? Sollen wir Ihnen wegen des Telegramms noch behilflich sein? Können Sie es unerkannt aufgeben? Wir stehen Ihnen natürlich noch ganz zur Verfügung, Sie brauchen nur zu befehlen.«
So und ähnlich musste natürlich noch gesprochen werden.
»Ich danke Ihnen sehr, meine Herren und Damen, ich weiß mir allein weiter zu helfen, fühle mich in völliger Sicherheit. Dass Sie mich befreien wollten, werde ich Ihnen nie vergessen.«
»Dann brauchen Sie auch das Automobil nicht mehr? Dürfen wir es zur Rückfahrt nach der Stadt benutzen?«
»Halt, über das Automobil unseres Klubs habe heute nur ich zu bestimmen!«, mischte sich da Miss Nofear ein. »Bekanntlich ist nach den Klubstatuten heute mein Tag, ich habe die Steuerung Mister Nicker nur überlassen, weil ich in dieser Sache eben eine andere Beschäftigung übernommen hatte, das hat sich aber nun erledigt, bis morgen Mittag um zwölf gehört das Klubautomobil mir.«
»Nun ja, dann fahren Sie uns nach der Stadt zurück.«
»Mitnichten, ich fahre, wie beschlossen war, die — unsere Freundin erst nach Irvinghill.«
»Aber das sind ja nur noch zehn Minuten zu Fuß —«
»Und fahre sie wieder zurück und überall hin, wohin sie bestimmt.«
»Nein, Miss«, wehrte Atalanta selbst ab, »das ist doch gar nicht nötig —«
»Ich mache die Herren darauf aufmerksam, dass dort ein Zug kommt, der nach der Stadt fährt, und wenn Sie den nicht benutzen, so müssen Sie selbst zu Fuß gehen — das Automobil bekommen Sie bis morgen Mittag nicht.«
Die Gesellschaft hatte sich sofort entschlossen, diesen Zug zu benutzen, und man musste sich beeilen, auf den Perron zu kommen, denn solch ein Vorortzug hält immer nur wenige Sekunden.
Miss Nofear — die jetzt in einem Herrenkostüm dastand — ließ sich nur noch in aller Schnelligkeit von einer Freundin Hut und Mantel geben, noch einige Worte der Entschuldigung und Freundschaftsbeteuerungen, und die beiden standen allein neben dem Automobil.
»Nein, Frau Gräfin«, wandte sich Miss Nofear an diese, und man konnte ruhig einen Namen nennen, weit und breit war kein Mensch zu erblicken, »mögen alle anderen, mag die ganze Welt Sie im Stich lassen, ich tu's nicht, ich bleibe bei Ihnen und gehe mit Ihnen durch Wasser und Feuer bis ans Ende der Welt.«
Es waren die enthusiastischen Worte eines schwärmerischen Backfisches, und das trübe Lächeln, welches das bronzene Gesicht hatte beschleichen wollen, verwandelte sich schnell in ein glückliches, als die Indianerin jener die Hand reichte.
»Ich danke Ihnen, ich werde Sie nie vergessen. Aber wozu wollen Sie mich denn weiter begleiten —«
»Ich bleibe bei Ihnen, bis ich Sie in Sicherheit weiß.«
»Es kann doch noch gefährlich werden —«
»Na, wollte ich denn nicht das Gefängnis bis zur dritten Etage hinaufklettern und Ihr Fenster aufsägen? Aber nun sagen Sie erst mal: Wollen Sie sich denn wirklich wie eine Nonne verkriechen?«
»Ja, es ist mein unumstößlicher Entschluss. Aber nicht wie eine Nonne, die im Kloster doch immer in Gesellschaft ist, sondern als Einsiedlerin werde ich fernerhin leben.«
»Wissen Sie was, lassen Sie mich neben Ihnen ansiedeln, ich werde Ihre Einsamkeit durchaus nicht stören.«
Atalanta streichelte zärtlich die glühenden Backen des jungen Mädchens, sie brauchte keine Antwort zu geben, jene wartete gar keine ab.
»Also Sie wollen auch wirklich Ihren Sklavensee und das ganze Gold im Stich lassen?«
»Ja. Ich will endlich Ruhe und Frieden haben.«
»Na, das können Sie ja halten wie Sie wollen, und großartig ist das ja überhaupt, so eine Verachtung des schnöden Mammons. Und Sie wollen die japanischen Matrosen jetzt sofort abbeordern?«
»Jetzt sofort.«
»Wohin?«
»Wir haben für solch eine Eventualität schon einen bestimmten Ort ausgemacht. Nicht etwa, dass ich ihn Ihnen verschweigen wollte — Ihnen würde ich alles anvertrauen, alles — sondern er lässt sich überhaupt schwer beschreiben, er liegt in —«
»Nein, nein, das will ich ja gar nicht wissen — ich meine nur, dass Sie hier nicht etwa ertappt werden. Erkennen wird Sie ja niemand unter meinem Mantel und Schleier, obschon es mir überhaupt lieber wäre, wenn Sie ganz offen als die rote Atalanta aufträten, immer mit dem Revolver in der Hand, an der Brust die rote Desperadoschleife — aber es ist nur wegen der Aufgabe des Telegramms —«
»Es ist ein ausgemachtes Zahlentelegramm.«
»Aber an wen schicken Sie es? Kann das nicht Verdacht erregen?«
»Gar nicht. Ich schicke es an Mister Bernsdorf, den Vorstand der deutschen Kolonie, der erhält solche Telegramme genug, auch Kaufleute bedienen sich ja sehr häufig solcher ausgemachten Zahlen, die doch viel kürzer sind als Worte, jede einzelne Zahl bedeutet einen ganzen Satz.«
»Na gut, dann telegrafieren Sie, ich warte hier draußen. Sobald Sie einen Schuss abgeben, bin ich bei Ihnen, ich habe zwei Revolver bei mir, ich schieße alles über den Haufen.«
»Sie können zur Mörderin werden?«, fragte Atalanta ernst.
»Ach was, Mörderin! Ihretwegen ja, denn wer Sie angreift, gegen wen Sie sich verteidigen müssen, der ist es auch wert, über den Haufen geschossen zu werden. Ich habe noch keinen Menschen getötet, aber Ihretwegen knalle ich ohne Bedenken los, das ist doch selbstverständlich.«
»Und denken Sie auch an die Folgen?«
»Dass ich ins Zuchthaus kommen oder gar gehangen werden könnte? Da breche ich zuvor aus, dann würde auch ich eine Desperada werden. Hei, das sollte ein lustiges Leben werden! So eine Desperada, mit der roten Schleife an der Brust, in jeder Hand immer einen zölligen Revolver — das war immer mein idealster Traum von frühester Jugend an.«
Die Indianerin sagte nichts mehr, sie zog den Schleier fester vor das Gesicht, warf noch einen Blick an sich hinab, fand alles in Ordnung. und sie betrat den Telegrafenraum.
Nach wenigen Minuten kam sie wieder heraus.
»Es ist geschehen, ich habe nichts mehr in dieser Welt der Menschheit zu suchen — nur einen einzigen Menschen möchte ich noch einmal sehen.«
»Und dann?«
»Dann werde ich Sie bitten, mich zu verlassen.«
»Wo?«
»Sobald ich wieder aus dem Irrenhaus trete.«
»Kann ich Sie denn nicht wenigstens noch etwas weiter fahren, bis Sie in Sicherheit sind?«
»Den Weg dorthin vermag kein Automobil zu befahren.«
So dachte Atalanta, aber es sollte alles ganz anders kommen.

»Allmächtiger!«, ächzte Miss Morgan, »so gibt es also wirk-
lich Geister, die Seelen der Toten leben also wirklich fort?«
Mit dem Automobil, auch wenn es nur den vierten Teil seiner dreihundert Pferdekräfte entwickelte, waren es nur noch zwei Minuten. Dann fuhr es mit Leichtigkeit den ziemlich steilen Hügel hinauf, hielt vor dem Tore des großen Hauses, das seinen Zweck nicht erkennen ließ, das so ungemein freundlich aussah, dessen Bewohner ja meistenteils auch ganz glücklich sein mochten in ihrer geistigen Umnachtung.
Atalanta stieg aus und zog die Glocke. Der Pförtner öffnete.
»Was wünschen Sie?«
»Ich bin die Schwester des hier internierten Grafen Arno von Felsmark, bin auf der Durchreise begriffen — kann ich meinen armen Bruder nicht einmal sehen? Nur einmal sehen!«
»Der Graf ist gar nicht mehr hier.«
Auch diese Indianerin konnte erschrocken zusammenzucken.
»Nicht mehr hier?!«
»Der ist vor ungefähr zwei Stunden abgeholt worden.«
»Abgeholt?! Von wem?«
»Im Auftrage der Miss Marwood Morgan.«
Jetzt aber zuckte die Indianerin nicht mehr zusammen.
»Und man hat ihn ihr ausgeliefert?«, fragte sie ganz ruhig.
»Jawohl, weshalb nicht?«
»Weshalb nicht? Was geht denn diese Dame mein — Bruder an?«
»Da müssen Sie den Herrn Direktor fragen, hiervon weiß ich nichts.«
Die Sache war einfach die, dass man dieser Milliardärin überhaupt keinen Wunsch abschlug, der nur irgendwie zu erfüllen war.
»Wohin hat sie ihn gebracht? Ist Ihnen das bekannt?«
»Gewiss doch, unsere eigenen Leute haben ihn ja nach dem Bahnhof bringen müssen.«
»Nach dem Bahnhof? Wann?«
»Vor ungefähr zwei Stunden, wie ich sagte, so gegen neun.«
»Wohin ist die Dame mit ihm gefahren?«
»Nach Pittville, Miss Morgan hat doch den Sklavensee der indianischen Gräfin erworben.«
Und nun nahm sie auch noch den Gatten mit, hatte ihn wiederum entführt!!
Aber die Indianerin blieb ganz sachgemäß, sie fragte ganz sachgemäß.
»Ist mein Bruder denn willig gefolgt?«
»Er schlief sehr fest, wir mussten ihm erst einen Schlaftrunk geben, Miss Morgan selbst gab ein besonderes Pulver, das sie bei sich hatte.«
Natürlich, die wusste ja mit solchen Mittelchen Bescheid!
»Um neun ist sie abgefahren?«
»O nein. Nur nach dem Bahnhof. Der nächste Zug, ein Pacific, ging erst um elf.«
Durch die offene Tür blickte man gerade auf eine mächtige Wanduhr, eine elektrische, die sicher ganz richtig ging, und nach dieser war es gerade fünf Minuten über elf Uhr.
»Punkt elf ging der Pacific?!«, stieß die Verschleierte jetzt doch etwas hastig hervor.
»Punkt elf, vor fünf Minuten ist er abgegangen.«
»Wird dieser Zug von einem anderen —«
Unnötige Frage, der Pacificzug, quer durch ganz Amerika gehend, wird von keinem anderen Zuge überholt.
Die Verschleierte senkte den Kopf, legte die Hand vor die Stirn, durch die die Gedanken so furchtbar wild jagten und dennoch ganz geordnet.
Telegrafieren? An wen? Wie war der Pacific zum Halten zu bringen? Was sollte denn aber sie, die Vogelfreie, die jeder Mensch wie einen tollen Hund niederschießen durfte, tun?
Jäh wandte sie sich gegen ihre Begleiterin um, die alles gehört hatte.
»Der Pacific macht im Durchschnitt achtzig Kilometer — wie viel macht Ihr Automobil?«
»Bis zu hundertzwanzig. Und gerade wollte ich Ihnen den Vorschlag machen —«
»Der Pacific hält das erste Mal in Sacramento, das sind genau hundert Kilometer — er braucht dazu anderthalb Stunden, weil es bergauf geht — haben Sie genug Benzin?«
»Benzin genug, genug! Kommen Sie, kommen Sie! Und ich kenne den Weg, bin ihn schon oft genug gefahren! In einer halben Stunde haben wir den Pacific übererholt!«
Das freilich war nun Schlag auf Schlag gegangen, mit einem Satze saß die Indianerin im Automobil, herumgesteuert, und schon sauste es den Hügel hinab.
»Na endlich, na endlich!«, jauchzte das Dämchen. »Endlich wird doch noch etwas Ordentliches daraus! Und ich ganz allein, hip, hip, hurra! Wir überholen den Pacific, reißen die Schienen auf und bringen den Zug zum Entgleisen... ›Hände hoch!‹, brüllen wir, in jeder Hand zwei Revolver, wenn die Passagiere aussteigen —«
Und so phantasierte das tolle Mädchen weiter, während das Rennautomobil in rasender Fahrt dahinschoss. Denn der genügte es noch lange nicht, den Pacific zu überholen und in Sacramento zu erwarten, das musste viel abenteuerlicher arrangiert werden.
Übrigens dachte auch Atalanta sofort daran, dass es in Sacramento nicht so einfach gehen würde, dem verwegenen Weibe die lebende Beute wieder abzunehmen. Sacramento ist eine große Stadt, der Bahnhof mitten darin gelegen — und ach, auf was für Schwierigkeiten würde man da sonst noch stoßen!
Nein, da musste eine besondere List ausgegrübelt werden. Aber dazu war noch Zeit, erst einmal den Zug einholen, ihn wenigstens in Sicht bekommen.
Zunächst wäre das Automobil beim Nehmen einer scharfen Kurve beinahe umgekippt, so hatte es sich auf die Seite gelegt, und das hätte für die beiden jedenfalls den Tod bedeutet.
»Seien Sie vorsichtig!«, warnte Atalanta. »Wenn uns oder dem Automobil etwas passiert, nur die kleinste Havarie, so ist alles vorbei.«
»Ohne Sorge!«, lachte das junge Ding. »Weil ich einmal ein bisschen kippte? Ach, ich kippe noch ganz anders, nehme noch ganz andere Kurven, habe schon drei Schweine totgefahren, die Gänse und Hühner sind gar nicht zu zählen. Warten Sie nur, wenn wir erst richtig loslegen.«
».Sind wir denn noch nicht in voller Fahrt?«
»Das ist erst dreiviertel Kraft. Wenn wir erst dort die Buche hinter uns haben, da geht es erst los, dort fängt die Chaussee an, jetzt habe ich erst einen Feldweg genommen.«
Ja, man merkte es, ein fürchterlicher Weg — das Auto sprang und hüpfte wie ein junger Ziegenbock.
»Wir fahren nicht erst durch die Stadt?«
»I wo! Ja, ein anderer würde es allerdings tun, um die Chaussee aufzusuchen. Ich schneide aber alles ab, jetzt geht es quer über ein Maisfeld.«
Ja, das merkte man ebenfalls. Auf dem Felde hatte man die Stängel stehen lassen, es splitterte und krachte in unheimlicher Weise.
»Sie kennen wohl hier die Umgegend ganz genau?«
»Wie das Geheimfach von Papas Schreibtisch. Ich bin doch hier geboren, habe hier schon überall gewildert, wo Wild in Parks eingeschlossen ist.«
Die Landstraße war erreicht, das Automobil machte einen richtigen Sprung über einen Graben weg.
Schnurgerade zog sich die weiße Straße hin, hell vom Mond beschienen, und jetzt erst zeigte das Rennfahrzeug, was es leisten konnte. Aber auch das junge Mädchen bewies, wie es den Kraftwagen in der Gewalt hatte, und außerdem war sie dennoch vorsichtig, nahm spätere Krümmungen mit gemäßigter Fahrt.
So verging eine Viertelstunde.
»Da ist der Zug!«
Er kehrte in der Ferne der Straße jetzt etwas die Seite zu, man sah die erleuchteten Fenster, sah, wie die mächtige Lokomotive einen Berg hinaufkeuchte.
»Wetten, dass wir ihn in der nächsten Viertelstunde einhaben?«, rief Miss Nofear. »Das geht nämlich vorläufig immer so weiter bergan, und unser Auto ist ein Straßenrenner, ist ein spezieller Bergsteiger.«
Der Indianerin Augen funkelten beim Anblick des illuminierten Zuges auf. Wie in Gedanken streifte sie Hut und Schleier und Mantel ab, ordnete an ihrem Gürtel die beiden Revolver und das Bowiemesser, welche Waffen sie einem ihrer überwältigten Verfolger abgenommen hatte.
Der Zug verschwand.
»Wo ist er jetzt?«
»Er geht durch einen langen Tunnel. Und wir bekommen ihn für zehn Minuten überhaupt nicht mehr zu sehen, die Schienen nehmen einen anderen Weg. O, ich weiß hier Bescheid! Aber wenn wir ihn wiedersehen, dann sind wir entweder schon voraus oder gerade neben ihm.«
Die zehn Minuten vergingen, immer bergan, das Automobil knatterte furchtbar, und überhaupt eine halsbrecherische Fahrt hier im Gebirge, in der Sierra Nevada, obgleich sich die Straße doch immer die besten Stellen ausgesucht hat.
Da plötzlich, in langsamer Fahrt um eine schroff vorspringende Felsecke biegend, war man dicht neben dem Zuge, an einem der letzten Wagen.
»Habe ich es nicht gesagt? So, nun können Sie sich den Wagen aussuchen, in dem sie sitzen — wenn sie die Fenster nicht verhangen haben. Ja, könnten Sie nicht gleich hineinspringen, die Morgan tüchtig abdachteln und Ihren Mann gleich herausholen? Gleich so in voller Fahrt? Ach, das wäre ja herrlich! Und Sie Athletin bringen doch noch etwas ganz anderes fertig.«
Ja, wer die nötige Gewandtheit dazu besaß — so unausführbar war dieses Kunststück nicht.
Die Schienen liefen dicht neben der Straße, und zwar etwas tiefer als diese, sodass man in die Fenster hineinblicken, mit der Hand hineingreifen konnte, und wenn das schnellere Automobil gemäßigt wurde, so schien man ja neben dem Zuge zu halten, als stände dieser selbst still.
Zunächst ließ Miss Nofear das Auto noch etwas schneller fahren, sodass es langsam den ganzen Zug entlang ging. Und da sah Atalanta ihren Arno in der Ecke auf der anderen Seite sitzen!
Wahrscheinlich gefesselt, aber mit einem Mantel eingehüllt, die Augen geschlossen. Ja, das war das schöne, klassische Gesicht, jetzt noch immer von einem großen Vollbart umrahmt.
»Langsamer!«, hauchte die Indianerin, ihre Hand mit eisernem Griff auf das Steuerrad legend, und Miss Nofear wusste sofort, dass das Ziel gefunden war, sie ließ das Automobil mit dem Zuge gleiche Fahrt gehen.
Die Indianerin, deren Augen wie glühende Kohlen leuchteten, duckte sich zum Sprunge zusammen. Ja, es musste gehen. Das weite Fenster war offen, auf den Polsterbänken saßen vier Männer, alle schlafend zurückgelehnt. Sie brauchte ja nur hineinzugelangen, zum Wiederherauskommen bedurfte sie das Automobil gar nicht.
Plötzlich tauchte am Fenster eine weibliche Gestalt auf, eine Dame im Reisekostüm — und plötzlich nahm das schöne Gesicht einen furchtbar starren Aufdruck an.
Die beiden Rivalinnen und Todfeindinnen standen sich einander gegenüber, wie auf ebenem Boden, und nicht, als ob sie mit kolossaler Geschwindigkeit dahinsausten, blickten sie einander in die Augen.
»Atalanta — die entflohene Zuchthäuslerin!«, schrie da Miss Morgan, auch schon einen Revolver anschlagend.
»Du sollst mich nicht hindern!«
Aber die Indianerin kam nicht zum Sprung.
Mit einem Male war der betreffende Wagen schon ganz seitwärts, dann schoss der Zug weiter vorüber, denn das Automobil fuhr ganz langsam.
»Verflucht, das Benzin ist ausgegangen!«, rief Miss Nofear.
Es hatte sich in dem Zerstäuber bis zum letzten Tropfen verbraucht, und da es noch immer bergauf ging, so war das Automobil, als die Kraftquelle aufhörte, auch sofort mächtig gebremst worden.
Die Indianerin hatte keinen Vorwurf, dass dies gerade im unpassendsten Moment passiert war, was recht wohl hätte vermieden werden können — sie war behilflich, den Behälter aus einem der Reservekästen wieder zu füllen.
»Schadet nichts«, tröstete Miss Nofear, »wir holen den Zug wieder ein, jetzt noch viel schneller als vorhin, denn jetzt macht die Bahn einen großen Umweg, wir aber fahren direkt, schneiden den ganzen Bogen ab.«
»Kommen wir wieder so nahe heran?«
»Nein, das freilich nicht. Aber in Sacramento sind wir immer noch eine halbe Stunde früher.«
»In Sacramento möchte ich den Zug aber nicht erst erwarten.«
»Recht so, recht so!«, jubelte das Mädchen. »Bringen wir ihn schon früher zum Stehen!«
»Wie ist das zu machen?«
»Na, wir reißen einfach die Schienen auf.«
»Und bringen den Zug zum Entgleisen, morden einige hundert Menschen, vielleicht meinen Mann mit —«
»Ach ich dumme Gans, natürlich, da haben Sie recht, dann geht's freilich nicht!«
»Ist sonst nicht eine Stelle da, wo man den Zug zum Halten bringen kann?«
»Überall, wenn wir nur erst wieder an den Schienen sind.«
»Wie überall?«
»Na, wir legen uns einfach mit dem Auto quer über die Schienen und schwingen eine Lampe.«
Ja, das ginge.
»Oder da ist auch die Weiche von Quidly, noch zwanzig Minuten von der Stadt entfernt, in der aber der Pacific nicht hält.«
»Mit einem Wärterhaus?«
»Jawohl.«
»Einsam?«
»Ganz einsam. Nur das kleine Häuschen.«
»Kennen Sie es?«
»Sehr gut. Ich sprach erst neulich vor, um Benzin zu fassen, es ist auch eine Benzinstation.«
»Nur ein Wärter ist drin?«
»Nein, es müssen immer zwei sein.«
»Mit Familie?«
»Nein, die beiden sind allein.«
»Und dort kann der Zug zum Halten gebracht werden?«
»Natürlich, durch das rote Licht. Wir setzen den Männern den Revolver auf die Brust und zwingen sie, das Signal zu stellen — oder wir tun es selber — und wenn sie sich wehren, schießen wir sie sofort über den Haufen — oder Sie überwältigen sie. Ach, das wird ja herrlich, herrlich!«
Das exzentrische Dämchen war wieder einmal ganz in ihrem Fahrwasser — und das Automobil ebenfalls schon längst wieder in voller Fahrt.
Auch Atalanta hielt diesen Plan für den besten, um zum Ziele zu gelangen. Erst hatte sie daran gedacht, auf den Zug zu springen, das wäre der Akrobatin ja ein Leichtes gewesen, und den Mann herauszuholen.
Aber mit dieser Last wieder herabspringen? Ihren Gummigliedern sollte es wohl nichts schaden, mochte sie sich überschlagen, so oft sie wollte. Aber der Gefesselte, den sie wohl nicht gleich befreien konnte? Denn das musste doch alles in wenigen Augenblicken geschehen.
Nein, der Plan mit dem falschen Signal war der beste. Wie sie ihn ausführen wollte, das erzählte sie nicht erst, es war gar keine Zeit mehr dazu, schon tauchten in der Ferne Lichter auf — die Weichenstelle vor Quidly, gerade in der Hälfte zwischen Frisco und Sacramento gelegen. Die Ortschaft selbst war nicht zu sehen, die liegt tiefer in den Bergen.
»Lassen Sie mich machen, ich weiß schon, wie ich den Wärter veranlassen kann, dass er den Zug zum Stehen bringt!«, sagte Atalanta.
Schnell hüllte sich die Indianerin wieder in Mantel und Schleier.
Die Straße ging jetzt noch in beträchtlicher Entfernung von den Schienen entlang, diese lagen auf einem sehr hohen Damme, und Atalanta erkannte sofort, dass in dieser Gegend auch ihr ein Abspringen wohl den Tod gebracht hätte, denn längs des Bahndammes starrte alles von kleinen, spitzen Felsen.
Das Wärterhaus lag auf der anderen Seite, Miss Nofear erklärte, dass der Bahndamm hier untertunnelt sei. Von dem Zuge war hinter ihnen noch nichts zu erblicken.
»Er kann doch nicht schon vorüber sein?«, fragte die Indianerin mit wirklicher Angst.
»Unmöglich, unmöglich! Die Bahnlinie macht einen ganz gewaltigen Bogen, die Bewohner von Quidly haben ihre Straße für die Schienen nicht freigegeben, wir müssen reichlich fünf Minuten Vorsprung haben.«
Das Automobil sauste durch den Tunnel und hätte dabei bald einen Radfahrer umgerissen; es hielt mit einem fast plötzlichen Ruck vor dem Wärterhäuschen, von dem aus eine schmale Treppe auf den Bahndamm führte. Doch die Signalmasten konnten schon von hier unten aus bedient werden. Jetzt wurde für das linke Gleis — in Amerika wird wie in England links gefahren — das grüne Licht gestellt, der Pacificzug konnte frei passieren.
Die verschleierte Indianerin sprang aus dem Wagen. Neben der Treppe stand ein Mann mit der Dienstmütze, am Gürtel den Revolver im Futteral.
»Sind Sie der Bahnwärter?«
»Well, Miss!«
»Wann kommt der Pacific von San Francisco hier vorbei?«
In diesem Augenblick schlug drinnen im Häuschen eine Glocke.
»Das ist das Zeichen — in genau fünf Minuten — er hat aber eine Minute Verspätung. Was ist denn nur los?«
Diese Frage war berechtigt. Die fragende Dame gebärdete sich ganz außer sich, so hatte sie die Worte hervorgestoßen, hinter diesem Schleier hätte niemand die rote Athletin, überhaupt keine Indianerin vermutet, jetzt gab sie die Erklärung für diese Aufregung.
»Schnell, Mann, das Haltesignal! In dem Zuge ist ein gefährlicher Raubmörder, ich bin Detektivin, wir beide können uns die Prämie verdienen — —«
Also auf ganz friedlichem Wege oder doch durch eine ziemlich harmlose List wollte die Indianerin ihren beabsichtigten Zweck erreichen, ohne Anwendung jeder Gewalt.
Aber es sollte ganz anders kommen.
Der Mann war von vornherein misstrauisch, mehr noch als die verschleierte Dame musterte er das Rennautomobil mit recht merkwürdigen Blicken.
»He, Jack, komme doch mal heraus.«
Schon war sein Genosse zur Stelle.
»Das Ding dort sieht doch gerade so wie das Automobil vom Sportingklub aus, wie uns telegrafiert wurde, auf dem die ausgebrochene Indianerin geflüchtet ist —«
O weh! Es war schon bekannt geworden! Jemand aus jener Gesellschaft mochte doch geplaudert haben, oder vielleicht hatte man im Irrenhaus eine Ahnung bekommen. Und der Steckbrief wurde bereits durch ganz Amerika telegrafiert, bis an die Küste des Atlantischen Ozeans und bis nach dem Golf von Mexiko hinab, und diese beiden Wärter hatten die Depesche an ihrem Apparate mitgelesen.
Und gleichzeitig hatte der Mann der Dame mir einem schnellen Griff den Schleier vom Gesicht gerissen, bronzefarbene Züge mit indianischem Charakter starrten ihm entgegen.
»Die rote Atalanta!«
Gehört hatte dieser Mann sicher schon von der roten Athletin, er wusste, was sie leisten konnte, aber sonst unterschätzte er sie, sonst hätte er sich wenigstens erst gesichert, ehe er ihr den Schleier abriss.
Es war der einzige Griff gewesen, den er hatte ausführen können. In demselben Moment streckte ihn schon ein Faustschlag, gegen die Schläfe geführt, zu Boden.
Dem anderen gelang es, wenigstens noch nach dem Revolver zu greifen, aber nicht mehr, ihn aus dem Futteral zu ziehen. Da war die Indianerin schon bei ihm und hatte ihn gleichfalls zu Boden gestreckt.
»Binden Sie den Besinnungslosen!«
Ehe noch Miss Nofear, in so etwas doch gänzlich unbewandert, in ihren Taschen nachgesehen hatte, ob sie auch etwas zum Binden bei sich habe, war Atalanta schon mit ihrem Manne fertig, sie war mit Lederriemen versehen, und mit Zauberschnelle war auch der zweite von ihr abgefertigt.
»Dort kommt der Zug!«
Sie sprang nach dem Signalmast. Unten an den Griffen standen die Bezeichnungen, ein vorsichtiges Probieren, dann klappte der Arm mit dem grünen Licht herab, dafür ging der rote hoch.
Der Zug brauste heran, da aber ein furchtbares Zischen der Lokomotive, ein Rucken und Poltern den ganzen Zug entlang, und die Lokomotive stand, keine zehn Meter von dem Signal entfernt.
»Was ist denn nun schon wieder los?!«, schrie der Maschinenführer.
»Erwarten Sie mich hier!«, hatte Atalanta noch geflüstert und war schon unterwegs.
Sie hielt sich im Mondschatten des Bahndammes, sprang in großen Sätzen über die spitzen Steine, die wie Spieße dastanden, ohne sich auch nur den Fuß zu ritzen, konnte es dagegen nicht hindern, dass dabei der lange Mantel in Fetzen ging.
Wo das Abteil gewesen war, in dem sich die von Atalanta Gesuchten befanden, das wusste diese Indianerin ganz genau, da konnte die sich nicht irren, brauchte nicht erst zu suchen. Der sonstige Plan war ja ganz einfach. Es musste eben eine vollständige Überrumpelung sein. Mit dem herausgerissenen Arno kehrte sie dann ebenso schnell zu dem Automobil zurück, das sie für solch eine Flucht recht wohl zu würdigen wusste.
Wenn man dort die Miss Nofear wegen der gebundenen Bahnwärter vielleicht auch schon festgenommen hatte, die brachte sie wieder frei, das wurde ebenfalls eine Überrumpelung.
In diesem Wagen, in diesem Abteil hatte sie Arno und seine Begleiter erblickt. Rasch setzte sie den Bahndamm hinauf und schwang sich auf das Trittbrett. Auf dieser Seite aber waren innen die Gardinen vorgezogen, nicht die geringste Spalte war vorhanden.
Atalanta öffnete die Tür — das Einzelcoupé war leer!
Und doch gab es hier keinen Irrtum, das war es gewesen!
Auch schon der Geruch sagte es dieser Spürnase.
Oder hatten die Passagiere unterdessen ein anderes Coupé aufgesucht?
Atalanta trat vollends hinein.
»Zum Teufel, was hält denn der Zug nun schon wieder auf freier Strecke?!«, rief draußen eine Männerstimme.
Der scharfe Geist dieser unvergleichlichen Schachspielerin hatte sofort das Besondere herausgehört.
Sie drehte sich um, machte die Tür zu, riss die Gardine zurück und blickte zum Fenster hinaus.
Aus dem Nachbarcoupé lehnte sich ein Herr.
»Schon wieder?«, fragte sie. »Hat denn der schon einmal gehalten?«
»Wissen Sie denn das nicht?«
»Ich habe geschlafen.«
»Na, die Miss Morgan hat doch erst vor fünf Minuten die Notbremse gezogen, dieses verrückte Weibsbild!«
»Und hat den Zug verlassen?«
»Selbstverständlich, mit ihren Begleitern, mit dem wahnsinnigen Grafen, der aber noch lange nicht so verrückt ist wie sie selber.«
Da wusste die Indianerin alles. Sie hatte eines vergessen, ebenso wie ihre Begleiterin, nämlich dass man den Pacificzug und noch manchen anderen überall halten lassen kann, sowohl um ihn zu verlassen wie ihn zu besteigen. Es hängt mit den kolossalen Strecken zusammen, welche diese Züge in Amerika durchzumachen haben. Wenn ein Mensch mitten in der Prärie neben den Schienen steht, und er winkt, so hält der Zug und nimmt ihn als Passagier mit. Freilich kostet das Geld, schweres Geld. Der Aufenthalt wird nach Sekunden berechnet, und die erste halbe Minute kostet auf der Northern Pacific achtzig Dollars, jede weitere Sekunde sechs Dollars. Freilich wird zur Aufnahme von Passagieren nur gehalten, wenn sich innerhalb von zwanzig englischen Meilen nach vorn oder zurück keine Station befindet.
Hier hätte sich der Zug nicht durch Winken aufhalten lassen, da hatten die beiden also nichts vergessen gehabt.
Aber den Zug anhalten, um auszusteigen, das kann man auf dem Pacific überall, wenn man mindestens achtzig Dollars bezahlen will. Man zieht einfach die Notbremse.
Und Miss Morgan hatte sie gezogen, nachdem sie in dem Automobil ihre Todfeindin erkannt, da war der doch gleich eine Ahnung aufgegangen. Und da hatte sie es eben vorgezogen, den Zug mit ihrer Beute schleunigst zu verlassen, gerade auf der Strecke, wo das Automobil den Zug nicht mehr begleiten konnte.
Dies alles war der Indianerin blitzähnlich durch den Kopf gezuckt, ohne dass sich dabei ihre Gedanken verwirrten.
»Wo hat sie den Zug verlassen?«
»Vor fünf Minuten, in der Nähe von Kaskarafall.«
Es war ein berühmter Wasserfall mit Eisenbahnstation.
Da merkte die zum Fenster heraussehende Indianerin, wie hinter ihr auch die andere Tür geöffnet wurde, sie drehte sich um — vor ihr stand ein Schaffner.
Wie der sie anblickte, mit ihrem zerfetzten Kleide, in das bronzefarbene Gesicht stierte — sie wusste gleich alles.
»Die rote Atalanta — hunderttausend Dollars Prämie!«, schrie der Mann, als echter Yankee sofort an das Geld denkend, gleichzeitig aber auch seinen Dienstrevolver herausreißend.
Da aber hatte die Indianerin, ohne die Tür zu öffnen, schon einen Hechtsprung durch das Fenster gemacht, sie war schon wieder in einer finsteren Schlucht verschwunden.
Dort stand sie und lauschte.
An dem Wärterhaus war es lebendig geworden. Rufe ertönten. Der Zugführer war hingeeilt, andere Beamte waren gefolgt, sie hatten die Gebundenen gefunden, die Lage erkannt.
»Ein falsches Haltesignal ist gestellt worden! Die rote Atalanta hat es getan, die entsprungene Zuchthäuslerin! Sie hat die beiden Wärter niedergeschlagen! Der eine ist tot! Die rote Atalanta hat ihn ermordet!«
Die Indianerin hatte es geahnt. Den letzten Fausthieb gegen die Schläfe, noch im Sprunge gegeben, hatte sie zu stark ausgeführt. Jetzt war die Ahnung zur Gewissheit geworden.
Und da brach es bei der Indianerin einmal hervor.
Sie neigte den Oberkörper zurück und schüttelte drohend die geballten Fäuste gegen den gestirnten Himmel.
»Zur Mörderin geworden an einem Unschuldigen! Deinetwegen! O Du abscheuliches Weib, hätte ich Dich doch damals von der Abgottschlange verschlingen lassen!«
Dann wusste sie, was sie zu tun hatte. Der Miss Nofear konnte sie jetzt nicht mehr beistehen oder sie hätte über noch mehr Leichen gehen müssen. Übrigens war es ganz gleichgültig, ob das exzentrische Dämchen schon hier oder erst in San Francisco festgenommen wurde. Gegen Misshandlungen war sie jedenfalls geschützt. Denn in Amerika ist jede Frau selbst in der rohesten Männergesellschaft unantastbar, sie wird mit Hochachtung behandelt, wenn es nicht gemeinsam handelnde Bösewichter sind. Die Indianerin eilte weiter den Bahndamm entlang.
Miss Marwood Morgan war mit einer ganzen Reihe von Automobilen in Atalantatown, wie sich die neue deutsche Kolonie am Sklavensee genannt hatte, die gesetzlich mit allen Bürgerrechten anerkannt worden war, eingetroffen.
Wohl kam sie von Pittville her, aber dieses hatte sie mit der Bahn von Osten her erreicht, sie musste also einen kolossalen Umweg gemacht haben.
Sie hatte noch immer die vier Männer bei sich, welche den Irrsinnigen transportierten, darunter den ehemaligen Wald- und Prärieläufer Renald, der ja schon einmal bei der Entführung des Grafen die Hauptrolle gespielt hatte.
Außerdem hatte sie sich in Pittville, wo reguläres Militär liegt, zu ihrem Schutze bei Besitzergreifung ihres Eigentums eine Abteilung Soldaten unter einem Leutnant mitgeben lassen. Das ist in Amerika, wenn nur irgendwie ein Grund dazu vorhanden ist, immer möglich; natürlich muss man die requirierten Soldaten verpflegen und den größten Teil ihres sehr hohen Soldes tragen.
Zwar kampierte am Sklavensee schon eine Schwadron Kavallerie, aber die war nur dazu bestimmt, die Ausbeutung der unterseeischen Goldschätze durch Seehunde zu überwachen.
Ja, Miss Marwood Morgan war in dem Kampfe mit ihrer Gegnerin, die sie sich aus frevelhaftem Übermute selbst geschaffen hatte, Siegerin geblieben — aber es war ein teuer erkaufter Sieg, seit ihrem letzten Streiche zitterte das sonst wirklich couragierte Weib in ständiger Angst um ihr Leben.
Vier Tage waren vergangen, seitdem die Indianerin entsprungen war. Das Obergericht in Washington hatte die Maßnahmen des Polizeipräfekten von San Francisco gutgeheißen und bestätigt: Die Belohnung von hunderttausend Dollars aus dem eigenen Vermögen der Verräterin blieb bestehen, und ebenso der Ausdruck »tot oder lebendig«.
Der sonst so ausgezeichnete Beamte sollte von oben herab gerechtfertigt werden, gerade weil ihn das sinnlose Volk so angegriffen hatte.
Und außerdem handelte es sich jetzt um Wiederergreifung oder vielmehr Unschädlichmachung einer Mörderin — ja, noch mehr: um eine Verbrecherin, die Weichensteller überwältigt, einen Pacificzug auf freier Strecke durch falsche Signale zum Halten gebracht hatte und dadurch viele Hunderte von Menschen in Lebensgefahr hätte bringen können.
Da gibt es keine Schonung mehr.
»Tot oder lebendig!«
Der Indianerstamm, der sich nur die geringste Gefährdung der Schienenstränge oder Telegrafenlinien zuschulden kommen lässt, wird sofort nach dem entgegengesetztesten Teile des ungeheuren Landes verpflanzt, die nordischen Pelzjäger kommen nach dem heißen Texas hinab und umgekehrt, und fügen sie sich nicht dem ersten Befehle, so werden sie sofort bis auf den letzten Mann niedergemacht, die Weiber und Kinder kommen in Zwangserziehungsanstalten.
Jetzt war es eine einzelne Indianerin, um die es sich handelte. Stellte sie sich nicht freiwillig der Behörde, der sie sich am nächsten befand, oder ergab sie sich nicht dem ersten Polizei- oder Kriminalbeamten, der ihr begegnete, der sie unter seinen Schutz nehmen musste, so hatte jeder Mensch das Recht, sie wie ein wildes Tier niederzuschießen.
Und es war nicht bei der Belohnung von hunderttausend Dollars geblieben. Auf eine ganze Million war sie erhöht worden. In allen Zeitungen Amerikas war es zu lesen, als öffentliche Ankündigung und als redaktionelle Mitteilung.
Eine Million Dollars durch einen einzigen Schuss zu verdienen! O Ungeheuerlichkeit!
Nun, die Regierung hatte ja über das ganze Vermögen der entsprungenen Zuchthäuslerin zu verfügen, über sieben Millionen Dollars, durch den Verkauf des Sklavensees war noch eine hinzugekommen, es hätten also gleich acht Millionen als Prämie ausgesetzt werden können. Denn der Fiskus hatte von diesem Gelde so wie so nichts, nicht einmal die Zinsen, das war nicht angängig. Wurde also die Hochverräterin ergriffen und saß doch noch ihre Strafe ab — freilich kam jetzt noch der Mord und der Eisenbahnfrevel hinzu — so erhielt sie nach ihrer eventuellen Entlassung vielleicht gar nichts mehr ausgezahlt.
Also über diese Belohnung von einer Million brauchte man sich nicht so besonders zu wundern. Das zeigte nur, mit was für einem gefährlichen Wilde man es zu tun hatte, gegen das jedes Mittel erlaubt war, um es unschädlich zu machen, jede Art von Feuerwaffe, Selbstschuss, Falle oder Gift.
Aber bald wurde es bekannt, dass es die Regierung bei den hunderttausend Dollars hatte bewenden lassen.
Die anderen neunmalhunderttausend waren von einer Privatperson hinzugefügt worden. Von welcher? Man hatte es sofort erraten können. Von Miss Marwood Morgan.
Denn die hatte ja das größte Interesse daran, die entsprungene Zuchthäuslerin, deren Besitz sie übernommen, wieder hinter Schloss und Riegel zu wissen, und was machten denn eine Million Dollars für eine Marwood Morgan aus, der Milliardärin, die ganze Städte ihr eigen nannte, von ihren Aktien an dem größten Stahlwerk der Welt ganz abgesehen, die ein Einkommen von jährlich mindestens zehn Millionen Dollars versteuerte, die ein ganzes Heer von Beamten unterhielt, deren Aufgabe es nur war, dieses Einkommen wieder mit guten Zinsen anzulegen.
Aber die Milliardärin hatte sich gerade durch die Aussetzung dieser Prämie ihr eigenes Grab geschaufelt, wenn es auch noch nicht so weit war, dass sie sich hineinlegen musste.
Sie hatte es sich so schön ausgemalt, in dem Besitze ihrer Todfeindin am Sklavensee als Herrin zu hausen, während jene hinter Zuchthausmauern spann. Denn aus der Befürwortung des Rechtsanwalts Moore wäre nichts geworden. Da hatte die Marwood Morgan mit ihren Millionen doch etwas mehr zu kommandieren. Gut, ihre Feindin hätte im Steinbruch arbeiten können — aber nur, wenn ihr diese Beschäftigung das wenigste Vergnügen machte. Bat sie um Steinbruch, dann musste sie Tüten kleben, und bat sie um Büroarbeit, dann kam sie in den Steinbruch.
O, Miss Morgan hätte der schon das Leben im Zuchthause heiß zu machen gewusst. Zehn Jahre sind an sich schon eine kleine Ewigkeit, und die Indianerin hatte diese kleine Ewigkeit sicher nicht aushalten sollen! Und auch dafür hatte die Morgan gesorgt, dass Atalanta immer zu hören bekam, wie behaglich ihre Feindin dort am Sklavensee hauste, wie sie alles wieder vernichtete, was jene geschaffen hatte, die ganze deutsche Kolonie wieder zum Teufel jagte, trotz aller gesetzlichen Rechtmäßigkeit, denn das war der doch mit ihren Millionen ein Leichtes — —
Ja, das hatte sie sich alles so schön ausgemalt. Aber nun war die Indianerin noch nicht im Zuchthaus, erfreute sich vorläufig noch der unbeschränktesten Freiheit.
Da hatte Miss Morgan für ihre Wiederergreifung oder überhaupt Unschädlichmachung eine ganze Million ausgesetzt. Na, nun natürlich gab es keinen Enthusiasmus mehr für die Entflohene, die sich mit dem Eisenbahnfrevel und der Ermordung des Weichenstellers überhaupt schon alle Gunst des großen Publikums verscherzt hatte. Wo die jetzt auftauchte, knallten sofort von allen Seiten Schüsse. Die war geliefert!
Aber es war nicht anders, als ob Miss Morgan die Million auf ihren eigenen Kopf ausgesetzt habe. Das sonst so couragierte Weib, das bisher gar nicht gewusst hatte, was Nerven seien, wurde plötzlich ständig von einer nervösen Furcht gefoltert.
Überall, wohin sie blickte, sah sie die lederne Gestalt mit dem bronzefarbenen Indianergesicht, keinen Revolver oder Dolch in der Hand, wohl aber fühlte sie selbst immer schon einen glühenden Eisenstempel sich in ihre Stirn brennen, dass es qualmte und zischte — in dieselbe Stirn, aus der Professor Dodd schon einmal so ein Stempelzeichen mit wunderbarer Geschicklichkeit herausoperiert hatte — und nicht nur das, es war ihr immer, als ob sie schon an einem Marterpfahle stände, sie fühlte schon die brennenden Flammen an ihren Füßen emporzüngeln.
Es war nur Einbildung. Natürlich. Aber schrecklich war es doch. Und das eherne Indianergesicht stand nachts vor ihrem Bette, und wenn sie sich bei der Toilette umkehrte, so verschwand es schnell hinter dem Waschtisch, und es verschwand, wenn sie bei Tisch saß und sich umblickte, schnell hinter der Tür, und während der Automobilfahrt verschwand es hinter jedem Baum und Strauch. Ja, manchmal glaubte sie, dass es auf ihrer Stirn und an ihren Füßen wirklich so brenne, dass es gar keine Einbildung sei.
»Ich werde wahnsinnig — ich bin krank«, murmelte sie manchmal, an ihre Stirn tastend und nach ihren Füßen blickend, ob sie dort nicht Flammen züngeln sehe. Aber auf der schneeweißen Haut war nicht einmal ein rotes Fleckchen zu sehen.
Trotzdem nun war sie nach dem Sklavensee gegangen, um ihren neuen Besitz anzutreten. Das hatte doch gar zu großen Reiz gehabt, dem hatte sie nicht widerstehen können. Und vielleicht war sie, nach dem alten Rezept, gerade in der Höhle des Löwen am sichersten geborgen.
Und nun war sie hier eingetroffen, mit dreißig Mann Infanterie als persönliche Sicherheitswache. Sie hatte um mehr gebeten, sie beabsichtigte, die ganze Felsenwohnung in eine Festung umzuwandeln, aber jetzt im Kriege mit Mexiko waren die regulären Soldaten rar, mehr hatte das kleine Pittville nicht liefern können, sie hatte sich schriftlich nach der nächsten großen Garnison wenden müssen, von dort wollte man ihr eine Kompanie senden, die freilich erst später eintraf.
Mit der deutschen Kolonie, die unterdessen auf hundert Köpfe angewachsen, war sie gar nicht in Berührung gekommen, sie hatte einen großen Umweg darum gemacht. Wohl aber hatte sie den deutschen Grund und Boden durchqueren müssen, wollte sie nicht den ganzen See umgehen. Denn Pittville lag südlich davon, und das ganze Südufer war von der Gräfin der deutschen Kolonie geschenkt worden. Hierbei sei gleich bemerkt, dass Otto Bernsdorf von den Kolonisten zum Mayor erwählt worden und er als solcher von der Regierung des Staates Colorado bestätigt worden war, als Mayor von Atalantatown. Das ist einfach Bürgermeister, nicht zu verwechseln mit Major, welchen Offiziersrang Amerika und England ja ebenfalls haben.
Außer Proviant für die ersten Tage hatte Miss Morgan auch ein großes, transportables Boot mitgenommen, sodass sie bei der Übersiedlung nach den Felsenwohnungen von der deutschen Kolonie vollends unabhängig war.
Sie und alle Welt hatte erwartet, dass man diese Felsenwohnungen, für jeden Fremden verschlossen von acht japanischen Matrosen unter einem Seeoffizier bewacht, im Sturm nehmen müsse. Und da dies bei der ganzen Beschaffenheit dieser natürlichen Festung wohl nicht gelingen würde, so hatte sich Miss Morgan schon darauf gefasst gemacht, nur mit dem nördlichen Ufer und den Inseln fürlieb nehmen zu müssen.
Aber alles war ganz anders gekommen. Der Zwangsbefehl eines Regierungsbeamten war gar nicht nötig gewesen. Auf die telegrafische Order von Pittville aus an den Vertreter der bisherigen Besitzerin, an Mayor Bernsdorf, die Felsenwohnungen zu räumen, hatte dieser sofort geantwortet, dass die verkauften Wohnungen bereits geräumt seien. Schon in derselben Nacht hatten die acht japanischen Matrosen unter ihrem Offizier den hohlen Felsen und den ganzen See verlassen, waren spurlos verschwunden, wohin, das wusste niemand. Aber die Hauptsache war, dass sie jenen Wassereingang sperrangelweit offen gelassen hatten. Einen anderen gab es ja nicht, und sonst wäre die neue Besitzerin in die schwerste Verlegenheit gekommen, wie sie überhaupt in ihre steinerne Behausung gelangen sollte. Sie hätte erst Löcher sprengen müssen, und da war noch sehr die Frage, ob man auch wirklich an einer nur dünnen Wand das Sprengloch bohrte. So aber brauchte diese Frage gar nicht erst aufgeworfen zu werden.
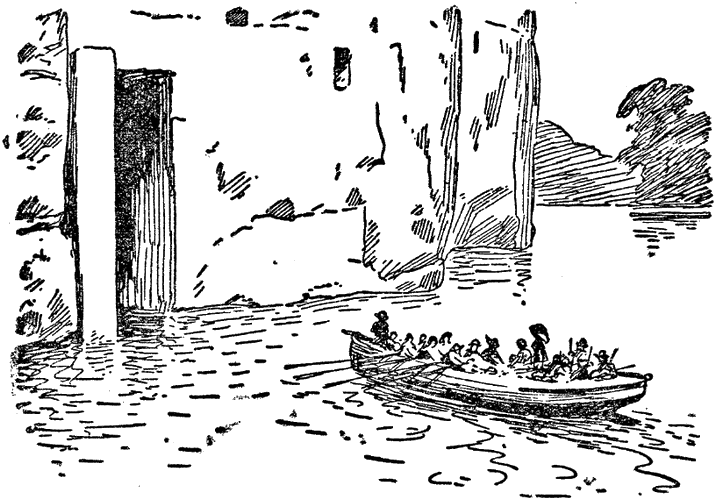
Diesem Wassereingange näherte sich jetzt das große Boot. Es wurde von acht Soldaten gerudert, acht andere gingen nur als Bedeckung mit, ihr Leutnant und Miss Morgan. Der Rest kampierte am Ufer, dort lag auch Graf von Felsmark, noch immer in tiefem Schlafe, bewacht von Renald und seinen Kumpanen.
Der Wassereingang wurde also dadurch gebildet, dass sich eine mächtige, sehr dicke Steinwand um Zapfen wie in Angeln als eine Tür herausdrehte, sodass sie jetzt in den See hinaus stand — ein ganz seltsamer Anblick.
Der neuen Besitzerin all dieser Geheimnisse war es gar nicht geheuerlich zumute, schon hier, noch in der freundlichen, warmen Herbstsonne überlief sie ein kaltes Grausen. Sie hätte lieber gleich wieder umkehren oder doch erst die anderen vorausschicken mögen, um auszukundschaften, aber da schämte sie sich doch zu sehr vor sich selbst, nun hatte sie den ersten Schritt einmal getan, nun kehrte sie auch nicht wieder um.
»Was meinen Sie, Leutnant Torres, wenn wir nun auf eine unterseeische Mine laufen und sie explodiert?«
»Dann fliegen wir einfach in die Luft!«, lautete die trockene Antwort.
Der Leutnant sah aus wie ein in eine Uniform gesteckter Hinterwäldler und war auch wirklich nichts anderes gewesen, bis er sich zum Militär gemeldet hatte und sofort Sergeant und dann gleich Leutnant geworden war. Jedenfalls aber ein tüchtiger Kerl. Tüchtige Kerls sind diese Soldaten der regulären Armee überhaupt alle, das muss man ihnen lassen. Sie werden sämtlich an Indianergrenzen ausgebildet — und in Nordamerika gibt es nicht etwa nur jenes eine große Indianerterritorium, sondern achtunddreißig, freilich viel kleiner als jenes allbekannte — es sind überhaupt »Marksmen«, d. h. Grenzleute, sie stellen ihren Mann in jeder Weise, wenn ihre Disziplin als Soldaten auch eine sehr lockere ist.
Wie alt dieser Leutnant hier war, konnte man unmöglich sagen, sein Gesicht war ganz von Hieben und Stichen zerfetzt, außerdem fehlte ihm das rechte Ohr, und wenn er seinen Filzhut mit der Kokarde abnahm, sah man, dass er keinen Skalp mehr zu verlieren hatte, der war ihm von einer Rothaut bereits abgezogen worden.
»Dann fliegen wir einfach in die Luft«, lautete also die Antwort, und dann biss sich der Herr Leutnant von einer Platte Kautabak ein mächtiges Stück ab.
»Ob uns diese Japaner nicht so eine Überraschung hinterlassen haben?«
»Weiß nicht, Miss.«
»Wir hätten erst jemanden vorausschicken sollen.«
»Well, Miss, gehen Sie erst allein voraus.«
Miss Morgan biss sich auf die Lippen. Sie hatte von diesem verwetterten und sogar verwilderten Leutnant während der Reise schon einige Lektionen bekommen. Aber dieser Mann imponierte ihr immer mehr, sie wusste nicht, warum — jedenfalls aber wusste sie, dass er absolut zuverlässig war.
»Ich meine, wir hätten von den deutschen Kolonisten, ihrem Mayor doch erst eine Garantie fordern sollen.«
»Was für eine Garantie?«
»Nun, weil eben diesen hinterlistigen Japanern alles zuzutrauen — — —«
Erschrocken brach Miss Morgan ab, so dicht war an ihrem Gesicht ein Flatsch brauner Sauce aus des Herrn Leutnants Munde vorbeigeschossen.
»Halt, Miss! Verunglimpfen Sie die Japaner nicht. Die Japaner sind nicht hinterlistig. Feine Burschen, die Japaner, lauter Gentlemen!«
»Sie kennen die Japaner?«
»Well, Miss!«
»Sie waren in Japan?«
»No, Miss!«
»Woher kennen Sie sie sonst?«
»Vom Bellay-College in Frisco. Waren da vier Japaner, studierten Mathematik, kleine, zierliche Bengelchen. Hatte den einen beleidigt, unwissentlich. Der forderte mich zum Boxgang. Ich wollte das Bürschchen schonen, musste es aber zusammennocken, ging nicht anders. Einer trat immer für den anderen ein, musste einen nach dem anderen verboxen. Dann bat ich um Entschuldigung. Very well, sagten sie, wischten sich das Blut aus dem Gesicht und schüttelten mir die Hand. Damals traute auch ich ihnen nicht so recht. Auf dem Heimweg wurde ich von Rowdys überfallen, 's wäre mir eklig gegangen, keinen Cent war mein Leben mehr wert. Die vier waren hinter mir. Denen habe ich's zu verdanken, dass ich hier noch meinen Tabak kauen kann. Sie hauten mich raus. Feine Bengels, die Japaner, verdammt fein!«
Mit immer größerem Interesse betrachtete Miss Morgan den Sprecher, der noch nie eine so lange Rede gehalten hatte.
»Sie selbst haben das Bellay-College besucht, die Universität?«
»Well, Miss!«
»Was haben Sie denn studiert?«
»Theologie. Sechs Semester.«
»Sie wollten — Pastor werden?«
»Sollte — Missionar — Indianermissionar. Bin's auch gewesen. Bis mir der weiße Adler von den Pawnees den Skalp abzog. Wenn ich zwei gehabt hätte, so hätte ich ihm auch den anderen gegeben. Denn ich predigte das neue Testament. Aber ich hatte nur einen Skalp. Deshalb ging ich zum alten Testament über. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und ich zog dem weißen Adler gleichfalls die Kopfhaut ab. Seitdem bin ich nicht mehr Missionar!«
»Das waren gebildete Japaner, die Sie kennen lernten, einer ganz anderen Kaste angehörend. Hier handelt es sich um japanische Matrosen.«
»Gilt ganz genau dasselbe von ihnen, vielleicht erst recht.«
»Sie halten solch einen Japaner nicht für fähig, dass er hier eine Höllenuhr oder so etwas Ähnliches angelegt hat?«
»Ausgeschlossen. Wenn der Japaner eine Mine legt, dann warnt er erst davor, wenn er dem Feinde natürlich auch nicht die Stelle bezeichnet, wo sie liegt.«
Plötzlich hatte Miss Morgan ihre Ruhe wieder. Hätte dieser Mann doch schon eher so gesprochen!
Das Boot fuhr durch den Eingang in das Bassin.
Alles nackt.
»Die Japaner haben hier doch mehrere Boote gehabt, auch Motorboote.«
»Sicher.«
»Wo sind die?«
»Die haben sie mitgenommen.«
»Sie können den See damit doch nicht verlassen haben.«
»Dann haben sie sie versteckt oder versenkt.«
An der Decke hing noch die elektrische Bogenlampe. Aber sie brannte nicht.
Wir wollen es kurz machen: Im Laufe der Zeit hatte die Indianerin gegen zwanzig der kleinen und großen Felsenkammern sehr hübsch einrichten lassen. Möbel in verschiedenem Geschmack hatte eine große Firma geliefert, einige schöne Schnitzereien stammten aus der Kolonie, von der sich mehrere Mitglieder mit diesem Kunsthandwerk beschäftigten, zur Ausfüllung der Wintermonate sollte hier eine Kunsttischlerei und Bildhauerei gegründet werden, das war sogar schon in vollem Gange.
Alle diese Möbel waren noch vorhanden, bis auf das letzte, kleinste Stück, auf dem Schreibtisch lag noch der Federhalter. Überall Bogenlampen und Glühbirnen, die Leitungsdrähte in tadelloser Ordnung — aber die Elektrizität fehlte. Deshalb gingen auch die Fahrstühle nicht. Dagegen funktionierten die Telefone, weil diese ihre eigene Batterie hatten.
Mit klopfendem Herzen durchschritt Miss Morgan all diese Räume, treppauf und treppab. Das alles gehörte nun ihr!
Nein, fürchten tat sie sich jetzt nicht mehr, dass etwas unter ihrem Tritt oder Griff explodieren könnte.
Nur jene eigentümliche Vision verließ sie nicht, die ihr nun schon zu sehr zur Gewohnheit geworden.
Sobald sie sich schnell umdrehte oder nur den Kopf schnell wendete, sah sie hinter der nächsten Ecke oder Tür, nach der sie gerade blickte, das Gesicht der Indianerin verschwinden, genau so, wie sie es damals gesehen hatte, aus dem Coupéfenster des Pacificzuges, mit den starren Zügen und den furchtbar glühenden Augen — oder sie sah auch die ganze Gestalt in dem ledernen Jagdhemd und dem kurzen Röckchen schnell hinter die nächste Ecke springen, so wie sie ja damals auch die ganze Gestalt in dem Automobil gesehen hatte.
Dabei war es gleichgültig, ob sie sich im Finstern befand oder ob von den Fensteröffnungen die Omnihilitplatten entfernt worden waren. Auch wenn der goldene Sonnenschein hereinflutete, immer wieder hatte sie dieselbe Vision, sie brauchte nur schnell den Blick nach einer Ecke, einem Vorsprung oder einer Tür zu werfen. Stets verschwand dahinter die Indianerin oder doch wenigstens ihr Kopf, mit dem sie hervorgelugt hatte.
Und dann hinterher hatte Miss Marwood Morgan jedes Mal das Gefühl, als ob ihr ein glühender Eisenstempel in die Stirn gepresst würde, sie fühlte jedes Mal wirklichen, heftigen Schmerz an der Stirn, hörte es sogar zischen, glaubte den unangenehmen Geruch nach verbranntem Fleisch zu bemerken. Das konnte eine Reflexion sein, das hatte sie ja schon einmal in Wirklichkeit durchgemacht — aber wie kam es, dass sie dann auch jedes Mal solche Schmerzen wie von Feuersglut an den Füßen verspürte?
»Ich werde krank«, flüsterte sie dann, mit der Hand die schmerzende Stirn reibend, auch nach den Füßen blickend, ja sogar hin und wieder einen Strumpf ausziehend, um sich zu überzeugen, dass an ihren weißen Füßen kein rotes Pünktchen zu sehen war.
Dann aber stampfte sie jedes Mal mit dem Fuße auf.
»Und ich will nicht krank werden! Es ist Einbildung! Ich will nicht krank werden, ich will nicht!!«
Energie besaß dieses Weib jedenfalls, eine kolossale Energie.
Ja, Energie besaß Miss Marwood Morgan.
So viel Energie, wenn nicht Klugheit, dass sie sich hütete, einen Arzt zu fordern, um ihn wegen ihres Zustandes zu befragen. Denn der hätte bei der Milliardärin doch natürlich sofort ganz gefährliche Symptome gefunden, um sie tüchtig schröpfen zu können — und wenn ein Arzt, dem man vertraut, erst einmal Einbildungen bestätigt, dann ist es vorbei. Dann kann man nur gleich in allen Bädern und Kuranstalten abonnieren.
So viel Energie besaß sie, dass sie nach zwei Tagen noch immer durch die zahllosen Räume des vierzigstöckigen Riesenbaues der Natur, den unbekannte Menschen früherer Jahrtausende nur ausgehöhlt hatten, ganz allein wanderte. Noch längst waren nicht alle die unzähligen Fenster geöffnet worden. Und dann schritt sie durch die stockfinsteren Räume, in denen auch der leiseste Tritt wie in einem mächtigen Steinsarge hallte, in der Hand eine Benzinlaterne, die ein schwaches, unsicheres Licht verbreitete, sie ganz allein.
Wenn sie sich zuerst immer von einigen bewaffneten Soldaten hatte begleiten lassen, so war dies nur deshalb geschehen, weil sich doch vielleicht noch jene Japaner oder andere Menschen hier versteckt halten konnten. Und gewiss, vor gewalttätigen Menschen kann man sich fürchten, da ist jede Vorsicht angebracht.
Aber es hielt sich niemand hier verborgen. Unterdessen waren doch schon sämtliche Räume abgegangen worden, und die allermeisten waren ja ganz nackt. Außerdem war am allernächsten Tage mit einem besonderen Automobil ein Polizeikommissar aus Pittville mit seinen berühmten vier Bluthunden hier angekommen. Am Tage ihrer eigenen Abreise war er nur gerade abwesend gewesen, aber arrangiert war die Sache schon, er stand für einige Zeit in den Privatdiensten der Milliardärin.
Die vier Hunde mussten Witterung nehmen von allen Menschen, die sich jetzt hier befanden und vorläufig blieben, dann wurden sie durch alle Etagen gejagt. Hätten die irgend einen anderen Menschen gefunden, so wäre der von zweien gestellt worden, die beiden anderen der ausgezeichnet dressierten Tiere hätten die Meldung zurückgebracht, und ähnlich hätten sie es gehalten, hätten sie die frische Spur eines fremden Menschen gewittert. Allerdings waren ja noch vor kurzem andere Menschen hier gewesen, aber das wussten die vorzüglichen Spürhunde recht wohl, da gab es bei denen keinen Irrtum.
Nein, vor Menschen brauchte sich Miss Morgan nicht mehr zu fürchten. Jetzt ließ sie durch die Soldaten die Aus- und Eingänge besetzen, von denen nur zwei vorhanden waren: unten das große Wassertor und oben der auf das Plateau mündende Aufzug, der aber auch durch eine breite Treppe zu erreichen war. Gleich daneben war die Sternwarte erbaut worden, in diese quartierte Miss Morgan noch eine besondere Wache ein, die das ganze Plateau überblicken konnte.
Was konnte sie noch für Vorsichtsmaßregeln treffen? Gab es hier vielleicht noch geheime Eingänge? Sie glaubte es nicht, wollte es nicht glauben.
Höchstens die verschiedenen Theatereinrichtungen gaben ihr noch zu denken. In den meisten wurden doch Lichtbilder an den Wänden hervorgebracht. Diese bestanden immer aus einer eigentümlichen Masse, wie aus Glas, aber undurchsichtig — eben aus jenem rätselhaften Omnihilit. Doch davon abgesehen — sollte man denn nicht auch hinter diese Wände kommen können? Da musste doch noch etwas dahinterstecken, jedenfalls immer das ganze Geheimnis.
Aber es gelang durch kein Instrument, mit keinem Diamantmeißel oder -Bohrer, auch nur den leisesten Ritz in diesen Platten hervorzubringen. Ebenso wenig konnten Türen gefunden werden. Die Registrierapparate waren wohl noch vorhanden, aber sie funktionierten nicht mehr. Also entstanden zum Beispiel auch nicht mehr die Öffnungen, durch welche früher in dem mechanischen Theater die Puppen herausgekommen waren.
Miss Morgan bezwang ihren Stolz, sie veranlasste Soldaten, dass sie sich in die deutsche Kolonie begaben, Verbindungen anknüpften, um die auszuhorchen, welche hier wenigstens zeitweilig hatten aus- und eingehen dürfen.
Da aber merkte sie, dass sie sich überhaupt vollständig geirrt hatte, wenn sie geglaubt, die deutsche Kolonie würde ihr jede mögliche Schwierigkeit in den Weg legen, um ihr hier den Aufenthalt recht ungemütlich zu machen. Nicht die geringste. Sie hatte geglaubt, keine Nahrungsmittel zu bekommen, deshalb hatte sie gleich für einige Tage Proviant mitgenommen, weiterer war bestellt.
Ganz im Gegenteil, die deutschen Farmer kamen von selbst, fragten, ob die neue Besitzerin ihnen nicht Produkte der Landwirtschaft abkaufen wolle, zum üblichen Marktpreise, und sie waren hocherfreut, als es geschah.
Wegen einer kleinen Grenzstreitigkeit, gar nicht von Belang, ließ Miss Morgan auch einmal den Mayor der Kolonie zu sich bitten, nur um zu prüfen, ob er wirklich käme. Bürgermeister Bernsdorf kam sofort, ließ sich auch gern über alles ausfragen, was er über die Verhältnisse berichten konnte.
Viel war das freilich nicht.
»Auf mein Ehrenwort als deutscher Offizier, der ich noch immer bin — ich weiß nicht, ob hinter diesen abschließenden Felswänden noch etwas steckt und wie man dahinter gelangen könnte.«
»Die Gräfin hat Sie darin nicht eingeweiht?«
»Miss, sonst würde ich Ihnen das doch nicht sagen, ich habe Ihnen doch mein Ehren...«
»Pardon, pardon! Nun, dann eine andere Frage: Die deutsche Kolonie Atalantatown ist Gemeingut?«
»Ja, Gemeingut aller ihrer jetzigen Bürger und aller derer, welche mit überwiegender Stimmenmehrheit als neue Mitglieder aufgenommen werden.«
»Könnten diese Bürger ihren ganzen Besitz an Grund und Boden und allem anderen verkaufen?«
»Gewiss. Durch Ratsbeschluss. Warum nicht?«
»Würden sie alles wieder verkaufen?«
»Das käme darauf an. Wenn uns ein genügender Preis geboten wird.«
Die Augen der Milliardärin funkelten auf.
»Wie viel fordern Sie?«
»Ich? Da komme ich gar nicht in Betracht. Das muss allgemein abgestimmt werden, und da habe auch ich als Mayor nur eine einzige Stimme.«
»Aus wie vielen Köpfen besteht die Kolonie?«
»Es fehlen genau zwei an vierhundert.«
»Es sind doch lauter wenig bemittelte deutsche Bauern.«
»Meistenteils sogar sehr arme. Wohl hatten viele ein Gütchen, dann aber regelmäßig mit Hypotheken überlastet. Ein freier, deutscher Bauersmann, der sich nur irgendwie anständig über Wasser halten kann, geht nicht nach Amerika.«
»Wenn ich nun eine Million Dollars dafür biete, dann kämen auf den Kopf 2500 Dollars.«
»Das stimmt ganz genau.«
»Das wären nach deutschem Gelde 10 000 Mark.«
»Sogar noch etwas mehr.«
»Nun sind es aber doch Familien, aus vielen Köpfen bestehend.«
»Einige sogar aus sehr, sehr vielen Köpfen bestehend.«
»Dann bekämen diese Familien also doch einige zehntausend Mark.«
»Natürlich. Bis zu hunderttausend Mark. Das heißt, das würde ja alles im Verhältnis verteilt.«
»Würden solche Familien und auch einzelne, die nur 10 000 Mark erhalten haben, nicht wieder nach Deutschland zurückkehren?«
»Na und ob, aber sofort!!«
»Nun gut — ich biete eine Million Dollars.«
Bernsdorf rückte etwas auf seinem Stuhle und räusperte sich.
»Ja, geehrte Miss, wenn Sie uns diesen großmütigen Vorschlag vorgestern gemacht hätten, die ganze Kolonie wäre sofort einstimmig darauf eingegangen.«
»Vorgestern?«
»Jawohl, vorgestern noch!«
»Heute nicht mehr?«
»Nein.«
»Warum denn nicht.«
»Wissen Sie denn nicht, was uns widerfahren ist?«
»Was denn?«
»Sie als neue Besitzerin, das heißt als unsere Nachbarin, haben uns mit Ihrer Ankunft ein kolossales Glück gebracht.«
»Ich — ein — Glück?!«
»Und was für eins! Es ist geradezu, als ob Sie wie ein Engel vom Himmel herabgestiegen wären, um uns mit einem Goldregen zu überschütten. Sie hatten gerade hier Ihren Einzug gehalten, da kommt der alte Wolfram gelaufen, der hinten an den Wolfshügeln seine Farm hat — er hat nach Wasser gebohrt, um nicht immer nach dem entfernten Bach laufen zu müssen — und aus dem Bohrloch spritzt auch etwas heraus — aber das ist doch kein Wasser, sondern —«
»Sondern?«, flüsterte die Amerikanerin, gleich ahnend.
»Das schönste Petroleum. Wo man dort an den Wolfshügeln auch bohrt, überall springt Petroleum empor. Es hat seit vierundzwanzig Stunden keinen Zentimeter abgenommen, also ist das Reservoir einfach unerschöpflich. Und es ist schon fast ganz reines Petroleum, es braucht nur ganz oberflächlich noch einmal raffiniert zu werden. Nein, geehrte Miss Morgan, mit Ihrer Million Dollars kommen Sie jetzt zu spät — ich bedauere. Jetzt kann sich hier jeder Bauer schon als Millionär fühlen. Wir machen Rockefellern Konkurrenz. Ja, wenn Sie eine ganze Milliarde böten — aber wohl auch dann nicht einmal. Nun, werte Miss, Sie gestatten wohl, dass ich mich entferne. Ich habe eine Besprechung mit dem Ingenieur, der schon die Rohrleitungen anlegt.«
Miss Morgan merkte gar nicht, wie sich jener enfernte.
Erst nach einigen Minuten sprang sie auf, mit einem Wutschrei, stampfte mit den Füßen, und dass sie spanisches Blut in den Adern hatte, von der Mutter her, zeigte sie dadurch, dass sie dann mit einem Dolch fortgesetzt in die Polster der Möbel stach, um ihrer Wut Luft zu machen, und das ist echt spanisch.
Nachdem sie sich so ausgetobt hatte, begab sie sich einige Räume weiter. Sie befand sich in der ersten Etage, die von der Indianerin durchlaufend wohnlich eingerichtet worden war.
In einem dieser Gemächer lag Graf Felsmark auf einem Bett. Er schlief noch immer, infolge des Schlaftrunkes, den man ihm vor nun sechs Tagen in der Irrenanstalt von San Francisco gegeben hatte, von Miss Morgan selbst gemischt.
Sie besaß auch ein Mittel, um ihn in wenigen Minuten wieder zum Erwachen zu bringen, aber sie wollte es nicht anwenden, wollte abwarten, welche Folgen ein natürliches Erwachen haben würde, was wohl noch einige Tage dauerte. Vielleicht, dass er dann wieder bei normalem Verstande war. Denn wie es jetzt mit ihm stand, das hatte sie selbst durch das Türfenster beobachtet, wie er die große Puppe geliebkost hatte und wie er dann wütend auf die eintretenden Männer losgestürzt war, die ihn alle zusammen trotz ihrer auserlesenen Kraft nicht hätten überwältigen können, wenn ihm nicht schnell eine Kappe mit einem Chloroformschwamm über den Kopf gezogen worden wäre. Erst nachträglich war ihm dann der lang andauernde Schlaftrunk eingeflößt worden.
Auch hier hatte man für sein Erwachen noch jede Vorsichtsmaßregel angewendet. Von seinen Händen und Füßen gingen schwere Ketten nach den Felswänden, wo sie einzementiert waren.
In dem Nebenraume befanden sich immer drei Wächter, die regelmäßig abgelöst wurden, in dem Gemach auf der anderen Seite schlief Miss Morgan selbst, und zwar allein.
Sie hätte sich doch leicht eine weibliche Gesellschaft besorgen können, aber sie tat es nicht, und dass sie in der auf alle Fälle unheimlichen Felsenkammer, mochte diese auch noch so luxuriös und behaglich eingerichtet sein, allein schlief, das bewies am überzeugendsten, dass sich dieses Weib nicht etwa vor den Gestalten ihrer Einbildung oder gar vor Gespenstern fürchtete.
Die Abenddämmerung brach an.
Miss Morgan blickte herab auf das bärtige, idealschöne Antlitz des Schläfers.
Liebte sie diesen Mann?
Ja, sie hatte ihn geliebt, wahnsinnig, jetzt hasste sie ihn ebenso glühend.
Oder auch nicht.
Sie liebte ihn noch immer — weil sie die hasste, die ihn liebte.
Denn durch diesen Mann hatte sie wieder das Mittel in die Hände bekommen, um die Todfeindin doch noch zu ihren Füßen zu zwingen, dass sie um Erbarmen flehte, oder sie konnte ihre Seele zermartern.
Ach, wäre diese rote Teufelin doch nur nicht entflohen, säße sie doch nur hinter den Zuchthausmauern.
Was für Mitteilungen wollte sie der zugehen lassen!
Wie wollte sie die quälen!
Wie schön hatte sie sich dies alles ausgemalt!
Und nun war sie entflohen, noch in Freiheit.
Ja, sie wusste, dass der Mann, den sie über alles liebte, in der Gewalt ihrer Todfeindin war, aber diese konnte sich nicht an ihren Qualen weiden, das war es!
Plötzlich stutzte Miss Morgan.
Hatten sich nicht seine Lippen bewegt?
Gewiss, jetzt wieder. Er flüsterte sogar etwas, es war nur nicht verständlich.
Danach musste er jetzt bald erwachen.
Jetzt wurden die Worte deutlicher.
Es war nur ein einziges.
»Atalanta!«, seufzte es von den bärtigen Lippen.
Das schöne Gesicht der Amerikanerin verzog sich wie im Krampfe.
Immer und immer wieder dieser verfluchte Name! Sobald er nur etwas wieder zur —
Ein Rascheln ließ sie schnell den Kopf wenden.
Sofort verschwand dort, wo sie hingeblickt hatte, das bronzene Gesicht der Indianerin mit den furchtbar starren Zügen und den glühenden Augen.
Hinter dem großen Schranke hatte sie hervorgesehen, aber schnell den Kopf wieder zurückgezogen.
Natürlich! Das ging ja jetzt gar nicht anders mehr. Und das Rascheln konnte Miss Morgan auch nicht mehr erschrecken. Sobald es dunkel wurde, raschelte es überall. Denn es wimmelte hier von Fledermäusen und Nachtvögeln, die sich während der früheren Besitzerin Abwesenheit schon wieder einquartiert hatten und die nach und nach wieder vertrieben werden mussten.
Wieder raschelte es, zufällig sah Miss Morgan, wie etwas Schwarzes zum Fenster hinaus huschte. Jetzt blickte sie schnell einmal nach dem Tisch — richtig, sofort verschwand darunter der Kopf der Indianerin, der darüber hervorgelugt hatte.
»Zu dumm, diese Einbild...«
Da schrak sie zusammen.
Dieses gellende Schreien, das näher kam, das war ein natürliches, das war etwas anderes, vor so etwas konnte sie wohl erschrecken.
»Das ist doch Hassans Stimme, was hat der Kerl?«
Ein herkulisch gebauter Neger stürzte herein, Hassan, ihr treuer Leibdiener, der um manche Geheimnisse seiner Herrin wusste, der ihr auch jetzt bei der Entführung des Grafen behilflich gewesen war.
Der Schwarze, der sich sonst vor Gott und dem Teufel nicht fürchtete, zitterte an allen Gliedern.
»Missus, Missus —«
»Was ist denn nur los?!«
»Ich habe sie gesehen, ich habe sie gesehen!!«
»Wen denn nur?!«
»Die rote Atalanta.«
Des Weibes erster Griff war nach ihrem Revolver, und dabei wurde es eisig ruhig.
Ja, warum sollte die Indianerin denn hier nicht eingedrungen sein?
Im Augenblick begriff sie nur eines nicht: dass ihr schwarzer Hassan deshalb so erschrocken war, weil er sie gesehen hatte. Fliehen konnte er wohl, wenn er sich mit dieser roten Athletin nicht in einen Kampf einlasset wollte — aber schreien und zittern und sich fürchten, das gab es bei dem doch sonst nicht.
»Wo hast Du sie gesehen?«
»Oben, oben — in der dritten Etage —«
»Du hast sie wirklich gesehen?«
»Überall, überall?!«, stieß der Neger mit klappernden Zähnen hervor.
»Was, überall?!«, fragte die Morgan, das Kommende noch nicht ahnend.
»Ja — überall — überall — wohin ich auch blickte — überall sah ich die Indianerin stehen — in dem ledernen Jagdhemd mit dem kurzen Rocke — stets sprang sie schnell hinter einen Vorsprung — oder sie blickte auch nur mit dem Kopfe hinter einer Ecke vor —«
Zunächst wusste Miss Morgan gar nicht, was sie hierüber denken sollte. Die Sache war nämlich die, dass sie noch keinem einzigen Menschen von ihren Halluzinationen erzählt hatte, kein einziges Wort. Niemand konnte auch nur etwas davon ahnen.
Wie kam dieser Neger, dessen völlige Phantasielosigkeit sie zur Genüge kannte, dazu, ebenfalls solche Visionen zu haben?
»Du hast geträumt, Hassan!«, sagte sie zunächst.
»Nein, nein — wo ich auch hinblickte, überall verschwand die Indianerin — huh, und wie die mich anstierte, wie die Augen glühten —«
»Bist Du denn nicht gleich hingesprungen, um sie zu packen, Du zweibeiniger Bullenbeißer?«
»Natürlich — natürlich — schießen wollte ich zuerst — aber da war sie ja schon immer verschwunden — und dann — und dann —«
»Na, und dann?«
»Dann bin ich auch hingeschlichen — hingesprungen — mit dem Revolver in der Faust — aber sie war niemals mehr da — und sie konnte sich doch gar nicht versteckt haben — es war doch immer ganz nackte Felswand — und da blickte sie auch schon wieder um eine andere Ecke — oder durch eine Tür — und sprang ich hin, aber es war wieder nichts da! —«
Der Neger begann jetzt erst recht wie Espenlaub zu zittern und mit den Zähnen zu klappern, dass er gar nichts mehr hervorbrachte.
Miss Morgan wurde in aller Ruhe nachdenklich. Irgend etwas musste dieser Neger doch erlebt haben. Das heißt innerlich, in seiner Einbildung. Bisher hatte er noch gar nicht solche eingebildete Visionen gehabt, das war bei ihm etwas ganz Neues, und davor entsetzte er sich nun.
Aber wie kam das überhaupt? Sollten denn solche Halluzinationen wirklich wie durch Ansteckung übertragbar sein, wie einige moderne Psychologen behaupten?
»Hast Du Dich denn sofort so vor diesen Erscheinungen gefürchtet?«, examinierte Miss Morgan zunächst sachgemäß weiter.
»Nein — nein — sonst wäre ich doch nicht hingeschlichen — hingesprungen, um sie zu packen oder niederzuschießen —«
Da hatte der Neger allerdings ganz recht.
»Nun, und warum hast Du denn plötzlich den furchtbaren Schreck bekommen?«
»Als ich — als ich — weil ich sie nicht finden konnte, weil sie doch immer spurlos verschwand — da erst fiel mir ein —«
»Was fiel Dir ein?«
»Das ist überhaupt gar nicht die rote Atalanta in Fleisch und Blut, das ist nur ihr Geist, oder ein anderes Gespenst —«
»Hassan, Du glaubst doch nicht etwa an Gespenster?!«
»Nein, ich habe bisher nicht an Gespenster geglaubt — aber wenn ich nun eins gesehen habe, soll ich da nicht daran glauben?«
Ja, das war eigentlich ganz logisch.
»Unsinn, Hassan, es gibt keine Gespenster und Geister, Dir hat einfach Deine Einbildung etwas —«
Da kam der alte Renald hereingestürzt, das sonst braunschwarze, verwetterte Gesicht mit einem Male aschgrau, der ganze Mann verstört.
»Miss, da oben spukt's!!«
»Was spukt?«, zwang sich das Weib zu eisiger Ruhe.
»Die Indianerin, die rote Atalanta!«
Jetzt fing der auch an!
»Ihr habt sie gesehen?«
»Auf dem Korridor der vierten oder fünften Etage.«
»Wie habt Ihr sie gesehen?«
»Wohin ich blickte, stand sie in ihrer ganzen Gestalt oder steckte ihren Kopf hervor, hinter einer Ecke oder einer Tür oder sonst wo. Dass sie's etwa leibhaftig wäre, davon brauchte ich mich gar nicht zu überzeugen, denn sie war an manchen Stellen gleichzeitig, oder doch sah sie einmal hinter dieser Ecke hervor, und im nächsten Augenblick sah sie schon wieder durch eine Tür, die fünfzig Schritte davon entfernt war. Die rote Atalanta spukt hier herum.«

Jetzt wusste aber die Miss Morgan nicht mehr, was sie dazu sagen sollte. Dass sich die beiden etwa verständigt hätten, um sie zu erschrecken, das war vollkommen ausgeschlossen.
Höchstens eine Möglichkeit gab es.
»Hat es Euch Hassan schon erzählt?«
»Was erzählt?«
»Da seht, der hat sie auch gesehen!«, brachte Hassan zähneklappernd hervor.
»Was, Du hast den Spuk auch schon gesehen?!«, rief Renald.
Nein, eine Verständigung zwischen den beiden lag nicht vor.
»Das lässt sich sehr einfach erklären«, ließ sich da eine dritte Stimme vernehmen.
Auch Leutnant Torres war eingetreten, gleich hinter Renald. Er war nur von Miss Morgan nicht sofort bemerkt worden.
»Sie wissen eine Erklärung hierfür?«
»Eine ganz einfache.«
»Nun?«
»Die Indianerin ist tot und spukt nun hier an diesem Orte herum, an dem sie bei Lebzeiten mit ihrem ganzen Herzen gehangen hat.«
Miss Morgan starrte dem Sprecher in das verwitterte, verwegene Gesicht, in dem jeder Zug die größte Energie ausdrückte.
Aber diese Amerikanerin dachte nicht etwa daran, dass jener sie verspotten wolle. Sie kannte doch den Yankee.
Und das war eben solch ein Yankee, einerseits der verwegenste Kerl, der sich vor Gott und Teufel nicht fürchtete, der aber anderseits von der Existenz von Geistern ganz fest überzeugt war.
»Sie glauben an Geister?«, fragte sie doch erst noch einmal.
»Geister, Geister — was heißt Geister. Um die Seele eines Verstorbenen handelt es sich hier, die noch mit ihrem Astralkörper bekleidet ist, sich davon noch nicht frei machen kann.«
»Sie meinen, die Gräfin ist tot?«
»Na ganz sicher doch! Sonst könnte sie doch nicht hier herumspuken. Wahrscheinlich hat sie schon vor drei Tagen ihren Tod gefunden. Denn so lange dauert es gewöhnlich, ehe sich der Astralkörper aus der Masse Fleisch und Blut herausgeschält hat, und so lange muss auch die Seele warten. Wie lange dann die Seele braucht, um wieder aus dem Astralkörper herauszukommen, das heißt bis auch dieser sich auflöst, das freilich ist ganz verschieden. Deshalb spukt der eine Tote nur ein paar Tage und der andere ein paar hundert Jahre. Das hängt vor allen Dingen auch mit seinen Gewohnheiten zusammen, die er im Leben gehabt hat. Ein Geizhalz kann sich natürlich nicht so leicht von seinem vergrabenen Schatze trennen, der schwabbelt immer darauf herum. Das weiß doch heutzutage jeder vernünftige Mensch. Und wer das nicht glaubt, der ist und bleibt eben ein Esel.«
Wir haben einen Spiritisten sprechen lassen.
Miss Morgan starrte den Leutnant nur immer an.
»Haben Sie denn schon so ein Gespenst gesehen?«
»Gespenst, Gespenst«, erklang es verächtlich, »Gespenster gibt es überhaupt nicht. Hier handelt es sich um einen ganz natürlichen Vorgang. Freilich habe ich schon solche abgeschiedene Seelen im Astralleib gesehen, massenhaft.«
»Wo?«
»In spiritistischen Zirkeln.«
»Ach so!«
»Na, was gibt's denn da zu achsooon? Wo soll ich sie denn sonst gesehen haben?«
»Irgendwo anders, allein in einem Zimmer, auf einem Friedhofe —«
»Ich bin kein solcher Geisterseher.«
»Ja, warum sehen Sie sie denn aber in spiritistischen Versammlungen?«
»Na, weil da einfach ein Medium dabei ist, das seine Nervenkraft, oder wie man das Zeug nun sonst nennen mag, der abgeschiedenen Seele leiht, dass sie sich materialisieren kann. Das ist doch alles ganz klar.«
»Aber warum haben denn diese beiden die spukende Indianerin gesehen?«
»Weil die eben zum Geistersehen disponiert sind Oder es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Die Indianerin ist jedenfalls —«
Ein Soldat trat ein.
»Der Mayor von Atalantatown schickt hier eine telegrafische Meldung aus Pittville. Sie stände schon in den Zeitungen, die wir aber doch erst morgen früh bekommen können.«
Miss Morgan nahm das dargereichte Blatt Papier und las die geschriebenen Zeilen, in Eile hingeworfen:
Soeben teilt mir der Redakteur der »Pittville News« eine Depesche aus Denver mit, die jetzt durch Extrablätter in ganz Amerika verbreitet wird: Erst jetzt berichtet eine in Denver eingetroffene Goldgräberexpedition, dass sie vor vier Tagen eine Indianerin erschossen hat, als sie versuchte, ihnen ein Pferd zu stehlen.
Es war in den Schluchten der Cascadaberge am Cascadafluss. In der Morgendämmerung glaubte man, es mit einem Manne zu tun zu haben. Er wollte durch den Cascada schwimmen, wurde aber hierbei vom Pferde geschossen. Die Leiche trieb bald auf einer Sandbank an, und da erst erkannte man, dass man ein Weib vor sich habe, eine Indianerin. Sie wurde begraben, ohne dass man wusste, wer es sei. Erst in Denver erfuhr die aus sechs Mann bestehende Expedition von der entsprungenen Gräfin Atalanta v. F. und von der ausgesetzten Belohnung. Die getötete Indianerin konnte nur diese gewesen sein. Kleidung und alles andere stimmte. Die Leiche ist von einer gerichtlichen Kommission schon wieder ausgegraben worden, alles stimmte, es war unsere Gräfin, die Prämie ist den sechs Männern bereits ausgezahlt worden. Dies teile ich Ihnen tieferschüttert mit. Gott lasse sie in Frieden schlummern.
Respektvollst,
Bernsdorf.
Auch Miss Morgan war furchtbar erschüttert, so sehr, dass ihre zitternde Hand das Blatt Papier nicht mehr halten konnte.
»Schon seit vier Tagen tot!«, hauchte sie.
»Wer? Doch nicht die Indianerin? Erlauben Sie, dass ich es lese?«
Der Leutnant hob das Papier auf und überflog die Zeilen.
»Seit vier Tagen. Na, sagte ich's nicht? Im Durchschnitt dauert es drei Tage, bis sich die Seele abgelöst hat. Gott lasse sie schlummern in Frieden. Hm. Nee, so einfach ist das nicht, wie sich das die meisten Menschen vorstellen. Die muss jetzt noch lange herumzappeln, ehe sie wirklich Ruhe findet, gerade diese Indianerin, die jedenfalls einen ungemein stark entwickelten Astralleib hat, von dem sie sich nicht so leicht befreien kann. Und das ist es eben, was ich vorhin noch sagen wollte. Diese beiden hier brauchen gar keine Geisterseher zu sein, sonst niemals eine abgeschiedene Seele zu erblicken — aber diese jedenfalls doch kolossal energische Indianerin hat einen so intensiv entwickelten Astralleib, dass er auch jedem anderen Menschen sichtbar wird. Nun, wir wollen doch gleich einmal sehen.«
Unterdessen war es vollkommen dunkel geworden, der Leutnant zog seine Taschenlampe hervor und setzte sie in Brand.
»Kommen Sie mit?«
Ja, Miss Morgan kam mit, auch sie bewaffnete sich mit einer Lampe, die einen noch stärkeren Blendstrahl aussendete. Aber die beiden Männer zogen es vor, in die Wachtstube zu ihren Kameraden zu gehen.
Sie traten auf den Korridor, der hier durch Lampen erleuchtet war.
»Hassan hat sie in der dritten Etage, Renald in der vierten oder fünften gesehen«, flüsterte Miss Morgan, und dass sie so flüsterte, das zeigte schon, wie es mit ihr beschaffen war, wenn sie äußerlich auch kaltblütig blieb.
»O, das hat gar nichts zu sagen, in welcher Etage, die ist überall und nirgends, die ist jetzt auch hier —«
»Hier?!«
Scheu blickte sich Miss Morgan um, und natürlich sah sie jetzt erst recht das Indianergesicht mit den glühenden Augen überall verschwinden.
»Jawohl, die ist überall, wo sie sein will, und das ist ja auch ganz einfach. Sie werden das schon selber erleben, wie das ist, wenn Sie erst einmal tot sind, obgleich Sie dann gar nichts davon wissen. Das ist alles nur wie ein Traum. Die weiß überhaupt noch gar nicht, dass sie tot ist, sie hat nur so eine unbestimmte Ahnung, dass sie sich in irgend einer ihr gänzlich unbekannten Welt befindet, und da sie das alles nicht begreifen kann, glaubt sie zu träumen, und da schwabbelt sie nun so in der Luft herum —«
Hastig und krampfhaft packte Miss Morgan des Geisterkundigen Arm, der sich wie Eisen anfühlte.
Ein schauerliches Geheul kam von oben herab durch den Korridor, in ein fürchterliches Gewinsel übergehend.
»Was haben Sie denn? Sie dachten wohl, das wäre die tote Indianerin? Nee, nee, so heulen und quieken die Seelen der Verstorbenen nicht. Wenn sie fähig sind, Töne von sich zu geben, dann geben sie andere Töne von sich. Aber immerhin, dieses Heulen und Winseln ist ganz interessant. Das waren nämlich die vier Bluthunde. Sehen Sie, die haben die tote Indianerin auch schon gesehen. Oder vielleicht auch gewittert. Denn solche tote Seelen im Astralleib riechen nämlich auch. Das heißt nicht für alle Menschen. Dass aber Hunde und auch Pferde Geister wittern können, nur mit der Nase, ohne dass sie sie sehen, das ist schon längst bewiesen!«
Unter solchen Belehrungen des Geisterkenners schritten sie den Korridor entlang, der nach oben führenden Treppe zu.
Noch einmal das schauerliche Heulen und Winseln, dazwischen gellende Pfiffe und menschliche Flüche, auch Peitschenknallen, und dann kam es von jener Treppe herab und durch den Korridor gestürzt, vier mächtige Köter, mit lang aus dem zähnestarrenden Rachen heraushängender Zunge.
Gleichzeitig erschien auf der Treppe ein Lichtchen.
»Halten Sie die Hunde auf!«, schrie eine Stimme, die des Polizeikommissars.
»Jawohl, halten Sie die Hunde auf«, wiederholte Leutnant Torres, wie Miss Morgan schnell zur Seite tretend, um wenigstens nicht umgerissen zu werden. »Da suche ich doch lieber einen Floh im Stroh. Ja, wenn Sie mir erlauben, dass ich die Tiere niederknalle, will ich sie wohl aufhalten.«
Der Polizeikommissar war herbeigekommen.
»Was haben nur die Luder? Mit einem Male fangen sie an zu heulen, wie ich es noch gar nicht gehört habe, machen kehrt und brennen einfach durch. Gerade wie ein junger Hund, der zum ersten Male eine menschliche Leiche wittert.«
»Haben Sie's gehört?«, wandte sich Torres, immer in seiner phlegmatischen Weise, an Miss Morgan. »Gerade als ob sie zum ersten Male eine menschliche Leiche witterten. Wegen der heulen und winseln die aber jetzt nicht mehr. — Na und Sie, Mister Spratt, haben denn gar nichts gemerkt?«
»Nein, was denn?«
»Haben Sie keinen Schatten zappeln sehen? — Die Indianerin, die rote Gräfin, ist tot und treibt sich jetzt als Astralleiche hier herum.«
»Als — als — Astrallampe? Tot?«
»Jawohl, tot. Was man so tot nennt. Die spukt jetzt hier, was das gewöhnliche Volk so spuken nennt. Haben Sie nichts davon gesehen?«
»Spuken? Ach gehen und hängen Sie sich!«
Und der Kommissar machte, dass er seinen Hunden nachkam.
»Der hat aber nichts gesehen«, sagte Miss Morgan immer noch flüsternd.
»Ach der — der«, entgegnete der ehemalige Missionar, spätere Hinterwäldler und jetzige Leutnant verächtlich, »der ist noch dümmer als seine Hunde — der kann nicht einmal einen Jungen von einem Mädchen unterscheiden. Faktisch, er hat's bewiesen, dass er's nicht kann. Er hat einmal die Fährte eines nackten Fußes für die eines Jungen erklärt und dabei war's ein Mädchen gewesen. Das ist doch gar kein gebildeter Mensch!«
Sie setzten ihren Weg fort, erstiegen die breite Steintreppe. Miss Morgan sah natürlich hinter jeder Ecke das Indianergesicht verschwinden.
»Jawohl, da war sie, jetzt habe ich sie auch gesehen«, sagte da Leutnant Torres, sich in aller Seelenruhe ein neues Stück Kautabak abbeißend.
»Was, Sie hätten sie wirklich gesehen?!«, stieß Miss Morgan in furchtbarem Schrecken hervor.
»Jawohl, dort hinten guckte sie um die Ecke herum, war aber gleich wieder weg.«
Miss Morgan suchte zu lachen, wenigstens innerlich. Jetzt wurde der auch schon von denselben Visionen befallen! Wie so etwas doch ansteckt!
Denn für den starken Freigeist dieses Weibes war dies alles immer noch nur Einbildung. Es konnte ja gar nicht anders sein. Der ganze Spiritismus ist Schwindel. Wenn der Mensch tot ist, ist er tot, und damit basta. Wer wusste, weshalb die Hunde so geheult hatten.
»Sehen Sie doch einmal nach, wo sie geblieben ist«, spottete sie.
»Machen Sie doch keine Witzchen. So eine Seele kann sich doch immer nur für einen einzigen Moment materialisieren, dann ist ihre Kraft schon wieder erschöpft. Oder sie muss die Nervenkraft eines Mediums zu Hilfe nehmen. Allerdings, bei sehr starkem Astralleib, kann sie es auch durch Übung so weit bringen, sich für längere Zeit sichtbar zu machen. Dann aber muss sie auch schon Töne hervorbringen, ebenfalls durch ihre Nervenkraft. Das Hervorbringen von Tönen ist viel leichter als das Sichtbarmachen. Das können wir ja überhaupt gleich einmal versuchen.«
Sie befanden sich gerade in jener weiten Halle, in der einst, bei Atalantas und Arnos erstem Besuche hier, die erstarrten Menschengruppen gestanden hatten. Ihre Lampen verbreiteten nur einen kleinen Lichtkreis um sie herum.
»A — ta — lan — taaa!!!«, rief der Leutnant mit lauter Stimme.
»— taaa — taaa — taaa«, scholl es zurück, immer schwächer werdend.
Der Leutnant nickte zufrieden mit dem Kopfe.
»Haben Sie's gehört? Sie antwortet schon.«
Jetzt musste Miss Morgan aber doch wirklich lachen.
»Das war doch nur das Echo von den Wänden!«
»Soooo? O Sie Superkluge! Sie sind gerade so klug wie alle die Anti-Spiritisten. Also das Echo! Warum hat es denn kein Echo gegeben, als Sie jetzt so gelacht haben?«
Miss Morgan hatte gar nicht darauf geachtet, ob ihr Lachen ein Echo gegeben habe oder nicht, wusste aber sofort eine Antwort.
»Dieses Echo hat der Geist wahrscheinlich verschluckt«, spottete sie.
»Auch möglich. Hm. Gar nicht so dumm geurteilt, so etwas bringen die Spiritisten schon fertig. Lachen Sie doch noch einmal.«
»Hahaha!!!«
»— hahahahaha —«, schallte es nach, immer schwächer werdend.
»Sehen Sie, diesmal hat sie das Echo nicht wieder verschluckt. Also muss doch auch ihre Seele hier sein.«
Nun war sich aber Miss Morgan nicht mehr sicher, ob dieser Leutnant sie nicht nur veralberte! Es war eben so ein echter Spiritist, der mit allen Hunden gehetzt ist, er hatte jetzt so eine jener spiritistischen Beweisführungen zum besten gegeben.
»Pst!!!«, stieß er jetzt scharf hervor.
»Pst — pst — pst«, tönte es zurück.
»Haben Sie's gehört? Sie antwortet immer besser. — Gegen so eine abgeschiedene Seele muss man nur immer recht energisch sein, denn sie befindet sich eben in einem traumähnlichen Zustande, ungefähr wie ein lebender Mensch in der Hypnose. Man muss ganz kräftig befehlen. Also: Atalanta, ich befehle Dir, mir mein Lachen nicht mehr nachzumachen!! Hahahaha!!!«
Kein Echo kam. Totenstille herrschte.
»Na? Was sagen Sie denn nun?«
Wenn nicht erschrocken, so war Miss Morgan mindestens verwirrt.
»Pst!!!«
Nichts kam.
»Atalanta, jetzt mache das letzte Wort nach!«
»Pst — pst — pst«, erklang es, immer schwächer werdend.
»Da haben Sie es! Und dass das immer schwächer wird, da ahmt sie nicht etwa das Echo nach. Sondern die Kraft verlässt sie nach und nach. Noch einmal dasselbe!«
»Pst — pst —«, kam es nur zweimal.
»Öfter!«
»— pst — pst — pst — pst —«
»Halt! Nun noch drei mal und dann lachen!«
»— pst — pst — pst — hahahaha —«
»Na, was sagen Sie nun, Miss?«
»Da hat sich jemand versteckt und narrt uns.«
»Ahah, ahaaaa!! Jetzt haben Sie's erfasst! Was sagen Sie denn nun aber zu dem da?«
Miss Morgan wusste erst gar nicht, was jener meinte, sie brauchte nur den Kopf zu wenden, und — in ihren Adern erstarrte das Blut!
Dort hinter jener Ecke blickte das Gesicht der Indianerin hervor, das der Gräfin von Felsmark.
Zu beschreiben war die ganze Erscheinung nicht. Jene Felsecke lag noch nicht im Bereiche des Lampenlichtes, also noch im Finstern, und dennoch war sie ganz deutlich zu sehen.
Das Gesicht mit den indianischen Zügen war schneeweiß und dennoch das echte einer Indianerin, man glaubte also auch die rotbraune Farbe zu sehen.
Das ist es ja eben, was jeder »Vision« anhaftet. Es ist alles nur scheinbar und dennoch ganz deutlich. So war es ja auch immer schon gewesen, wenn sich Miss Morgan einmal schnell umgeblickt und dieses Gesicht hatte verschwinden sehen.
Diesmal verharrte es, und es war dennoch genau dasselbe.
Allerdings höchstens drei Sekunden, dann war es wieder verschwunden. Aber drei Sekunden sind doch bei so etwas eine ziemliche Zeit, da kann man solch eine Erscheinung schon betrachten.
Also der Miss Morgan war das Blut in den Adern erstarrt. Aber nur für diese drei Sekunden.
»Da steckt jemand dahinter, der uns äfft!!«, schrie sie dann und — stürzte nach jener Ecke, die Lampe vorhaltend.
Ja, Courage besaß dieses Weib! Das hätte ihr nicht jeder Mann nachgemacht.
Leutnant Torres schlenderte gemütlich nach und sah, wie jene mit der Lampe herumleuchtete, ohne etwas zu erblicken.
»Geben Sie sich doch keine Mühe. Glauben Sie mir nur, dass es die Seele der toten Indianerin im Astralkörper ist, und so ein Spirit kann in ein und demselben Augenblick überall sein, wenn er nur will. Eben auf das Wollen kommt es nur an, so eine Seele muss durch Erfahrung und Übung nur erst wissen, was sie alles leisten kann. Sehen Sie, dort ist sie ja schon wieder.«
Auf der entgegengesetzten Seite blickte das Indianergesicht wiederum hinter einer Ecke hervor. Jeder Zug war deutlich erkennbar, die starren Augen glühten.
»Tritt weiter hervor, ich befehle es Dir!!!«, kommandierte Torres sofort.
Und richtig, der Kopf streckte sich weiter vor, die Schultern folgten nach, der ganze Oberkörper, schon sah man das kurze Lederröckchen, die Stickereien daran — aber der nachfolgende Körper ward immer undeutlicher, verschwamm immer mehr, bis alles wieder mit einem Schlage verschwunden war. Also nicht etwa, dass sich die Erscheinung wieder zurückgezogen hätte.
»Allmächtiger!«, ächzte Miss Morgan. »So gibt es also wirklich Geister?! Die Seelen der Toten leben wirklich fort?!«
»Jawohl, nun zweifeln Sie immer noch daran! Aber an eine Unsterblichkeit der Seele dürfen Sie nicht etwa glauben, das heißt, dass so eine Seele nun für alle Ewigkeit so in der Erdatmosphäre herumzappelt. Das wäre eine schöne Geschichte! Nein, so einfach ist es Gott sei Dank nicht. Wenn Sie sich darüber näher orientieren wollen, was es mit dem ganzen Spiritismus ist und was weiter aus der Seele nach dem Tode wird, wenn sie sich auch vom Astralleib befreit hat, so müssen Sie das Werk von Andrew Jackson Davis lesen.
Jedenfalls aber«, fuhr der hinterwäldlerische Geisterkenner fort, »gelingt dieser Atalanta das Materialisieren immer besser. Übung macht eben den Meister, auch im Geisterreich. Und nun immer feste draufdrücken, den Lehrling bei den Ohren nehmen. Das kann ich noch nicht, wohl aber ihr energisch kommandieren. Also passen Sie auf: Atalanta, ich befehle Dir, Dich hier im Freien vor unseren Augen zu materialisieren, und zwar auf der Stelle, wo ich hinspucke!«
Und da erschien in der Finsternis auf dem Boden auch schon ein heller Fleck. In beträchtlicher Entfernung von den beiden. Denn der Herr Leutnant konnte spucken wie ein alter Bootsmann, der bequem von vorn nach hinten über das ganze Schiff spuckt — wenn es nicht gar zu groß ist.
Der helle Fleck wurde immer größer und weißer — und er begann hin und her zu zittern — wuchs zu einer Säule empor, die auch keinen festen Halt hatte, auch so hin und her zitterte — und aus der zitternden Säule wuchsen zitternde Hände heraus, sie wurden länger, bekamen Arme — und dann bildete sich ein Kopf, erst recht schrecklich zitternd, Gesichtszüge wurden bemerkbar — mit einem Male stand die ganze Indianerin da, weiß und leuchtend und dennoch wie im Leben — sie stand ganz ruhig da ohne jedes Zittern — im nächsten Moment war alles wieder verschwunden.
»Futsch!«, sagte der Leutnant, nach jener Stelle auch noch einmal einen Tabakstrahl sendend. »Haben Sie's gesehen? Das war eine regelrechte Materialisation, so geht's in jeder spiritistischen Sitzung zu, wenn es einmal gelingt, einen Spirit zu zwingen, dass er sich ganz offen nach und nach materialisiert. Ganz genau so immer erst das Zittern, mit einem Ruck Stillstand, dann futsch. Es gelingt freilich selten. Diese indianische Seele muss eine verdammt starke Energie besitzen, dass sie das gleich am vierten Tage nach ihrem Tode kann — eine ganz verdammt starke, sage ich!«
»Mein Gott, mein Gott, so muss die Seele also nach dem Tode wirklich ruhelos umherirren!«, ächzte Miss Morgan mit gefalteten Händen, und sie hatte die Hände schon lange nicht mehr gefaltet.
»Ja, geehrte Miss, darauf müssen Sie sich gefasst machen, dass Sie auch einmal so in der Luft herumschwabbeln. Und wo schwabbelt man herum? Das steht schon in der Bibel. Wo Euer Schatz ist, da ist Euer Herz. Auch nach dem Tode, da erst recht. Und da ist das Herz, die Seele, noch mit dem Astralleibe bekleidet. Die Seele des Geizhalses schwabbelt bei seinem Geldschranke herum und die der Mutter bei ihrem Kinde und so weiter und so weiter. Ich will verdammt sein, wenn die Indianerin nicht jetzt schon wieder bei dem verrückten Grafen ist und ihn abschmatzt.«
Miss Morgan stierte den tabakkauenden Gentleman an.
»Bei dem Grafen — in jenem Zimmer?!«
»Natürlich. Es ist doch ihr Mann, den sie geliebt hat und den sie noch liebt. Wo der Schatz ist, da ist auch das Herz. Das ist überhaupt alles ganz einfach. Die Indianerin hat sich hierher gesehnt, hat sich überhaupt hierher begeben wollen. Nun ist sie auch nach dem Tode hier. Sie weiß auch, dass sich hier ihr Gatte befindet. Den muss sie aber erst suchen, obgleich sie es gar nicht nötig hätte. Sie brauchte nur zu wollen, und sie wäre sofort dort. Aber sie weiß nicht, dass sie das kann, und deshalb will sie es nicht. Können Sie durch eine verschlossene Türe gehen? Nein. Und nach dem Tode weiß man nicht, dass man tot ist, man glaubt nur zu träumen. Das ist die Ursache, weshalb Geister niemals durch verschlossene Türen gehen können. Wenigstens meistenteils nicht. Sie glauben, sie müssten die Tür erst öffnen. Also klinken sie die Tür auf. In ihrer Einbildung öffnen sie die Tür, jetzt können sie durch. In ihrer Einbildung gehen die toten Seelen überhaupt ganz ihren früheren Lebensgewohnheiten nach. So möchte ich jede Wette machen, dass diese tote Indianerin heute Nacht ganz regelrecht in ihr Bett steigt. Sie wird sich ausziehen, wird die Bettdecke zurückziehen, wird zuerst den linken Fuß heben, oder, wenn sie gewohnt war, mit dem rechten immer hineinzusteigen —«
»Um Gottes willen, in ihrem früheren Bette schlafe ich ja!!«, flüsterte Miss Morgan stöhnend.
»Macht nix, ist dem Spirit ganz egal. Die Indianerin wird sich neben Sie legen, auf Sie darauf, in Sie hinein — na, was laufen Sie denn?«
Ja, Miss Morgan begann zu laufen, sie wollte davonstürzen, kam aber gleich wieder zurück. Ganz allein durch die finsteren Räume zu flüchten, das wagte sie jetzt doch nicht mehr.
»O, Sie brauchen keine Angst zu haben«, suchte sie der Leutnant zu beruhigen, »das ist doch nur Einbildung von dieser toten Seele, sie tut dies alles nur im Traume, und wenn Sie sie auch sehen, fühlen werden Sie natürlich nichts. Ebenso wenig wie einen Schatten. Aber wir wollen doch einmal nach dem Grafen sehen, ich möchte wetten, dass sie schon dort ist. Denn die weiß nun schon, was sie alles leisten kann, sie braucht nur zu wollen, dann ist sie sofort an der gewünschten Stelle. So muss man auch im Geisterleben immer lernen.«
Sie begaben sich zusammen zurück, Miss Morgan, mit deren Energie es nun vorbei war, dicht an ihren Begleiter gedrückt.
Da kam es hinter ihnen wiederum die Treppe herabgestürmt. Diesmal aber waren es Menschen, die Lampen bei sich hatten — jene Soldaten, welche den oberen Eingang und von der Sternwarte aus auch das Plateau bewachen sollten.
»Hier spukt's, hier bleiben wir keine Minute länger!«, schrien sie mit entsetzten Gesichtern, als sie an den beiden vorüberstürzten.
»Auch in der Sternwarte?«, rief ihnen der Leutnant nach.
»Überall, sogar im Freien auf dem Plateau!«
»He, wartet mal noch — stillgestanden, ihr Kanaillen, stillgestanden befehle ich!!«
Jawohl! Sogar ihre Gewehre hatten sie oben liegen lassen. Wenn die Geister kommen, dann denkt man nicht mehr an die Gewehre und hört man nicht mehr auf das Kommando des Vorgesetzten — es müssen nur richtige Geister sein oder man muss an Geister glauben. Das hat schon Arthur Schopenhauer gesagt: Um sich nicht vor Geistern zu fürchten, muss man an Geister glauben.
Auch die untere Wachtstube war leer. Alles schon ausgeflogen. Als Leutnant Torres einmal zu einem Fenster hinausblickte, auf den See hinab, sah er den zweitem Teil seiner Truppe abrudern, in einem Boote, welches wie noch ein anderes die deutsche Kolonie den neuen Bewohnern auf eine Bitte sofort zur Verfügung gestellt hatte.
Da brauchten sich die beiden nicht zu wundern, wenn sie auch das Vorzimmer leer fanden, in dem speziell Miss Morgans Getreue unter Renalds Aufsicht den schlafenden Grafen bewachen mussten.
»Und der Graf?«, flüsterte Miss Morgan.
»Ich bezweifele, dass die feigen Burschen den mitgenommen haben. Feig? Na, ich will da lieber keinen Stab brechen. Werden ja gleich — sehen Sie, da kniet sie schon.«
Der Leutnant hatte den Vorhang, der den Wachtraum von dem Schlafzimmer trennte, zurückgeschlagen.
Es war vollständig finster in dem Raume, die Blendstrahlen der Lampen fielen auch noch nicht hinein.
So sah man nur die leuchtende Gestalt, welche dort kniete, wo sich das Lager des Grafen befand — farblos und dennoch die rote Indianerin in dem braungelben, buntgestickten Lederkostüm.
Sie bewegte sich, neigte sich, hob und senkte die Arme, beugte den Kopf noch tiefer — es war nicht anders, als ob sie den schlafenden Grafen liebkose, küsse und streichele.
Im nächsten Moment war sie verschwunden, vielleicht noch eher als Miss Morgan den Blendstrahl hatte auf sie fallen lassen. Aber deutlich genug war sie zu sehen gewesen, hier konnte es sich nicht etwa nur um eine Vision gehandelt haben.
Und nun geschah etwas Seltsames, Furchtbares.
Dieser Hinterwäldler-Offizier war entweder ein menschlicher Frosch oder absolut geisterfest, der betrachtete das alles mit einer Ruhe, wie wir etwa den Regenbogen betrachten.
Miss Morgan hingegen, die bisher alles Übernatürliche geleugnet hatte, von Geistern und dergleichen nicht erst zu sprechen, war vor Gespensterfurcht plötzlich ganz zusammengebrochen.
Da aber zeigte es sich wieder einmal, dass im Herzen des Menschen zwei Leidenschaften wohnen, die stärker sind als alle, alle anderen Symptome, Gefühlszustände, deren der Mensch überhaupt fähig ist: die Liebe und der Hass.
Bei diesem Weibe war es der Hass, der plötzlich hervorbrach, so furchtbar, dass alle Gespensterfurcht plötzlich zu einem Atom zusammenschmolz.
Mit einem Sprunge war sie in dem Raume, hatte die Lampe auf den Tisch gesetzt, aus dem Gürtel einen Dolch gerissen — so schaute sie mit wildrollenden Augen um sich, den Dolch in der erhobenen Faust — einer Furie gleich.
»Atalanta — Atalanta —«, stieß sie zähneknirschend und trotzdem hohnlachend zu gleicher Zeit in unbeschreiblicher Weise hervor, »Atalanta — rotes Teufelsweib — siehst Du mich? — siehst Du mich? — dann siehe hier, wie ich Dir hier auch noch im Tode das Liebste raube —«
Und mit einem zweiten Sprunge stand sie neben dem Lager des Grafen, wie ein blauer Strahl sauste der Dolch herab, nach dem Herzen des Schläfers —
Es war doch eigentlich eine große Inkonsequenz, dass sie ihn töten wollte. Dann schickte sie ihn doch nur der Geliebten ins Schattenreich nach.
Aber solche Gedanken machte die sich jetzt nicht.
Und sie sollte auch nicht ihre Absicht erreichen.
Die mit dem Dolche herabsausende Hand hielt mitten in der Bewegung mit einem Ruck ein, es sah nicht anders aus, als sei sie von einer unsichtbaren Kraft am Gelenk aufgefangen worden, und Leutnant Torres sah noch anderes, was ihm trotz aller seiner Geisterkundigkeit unerklärlich war.
Nicht nur dass Miss Morgans Arm so plötzlich erstarrte, was gar nicht mit rechten Dingen zugehen konnte, sondern sie selbst wurde wie von einer unsichtbaren Macht zurückgerissen, in demselben Moment auch schon zu Boden geschleudert, und gleich darauf sah Torres, wie sich um ihre Handgelenke, die sie ganz merkwürdig zusammenpresste, eine sichtbare Lederschnur legte, deren Enden sich in Knoten zusammenschnürten —
Mehr konnte Leutnant Torres bei der Miss Morgan nicht beobachten, er sollte ganz genau dasselbe selbst erleben und den Schluss an seinem eigenen Leibe fühlen.
Plötzlich wurde er von unsichtbaren Geisterhänden gepackt, die aber äußerst realistisch zugriffen, mit Riesenkraft niedergedrückt, ein knöchernes Knie legte sich auf seine Brust, auch seine Hände wurden zusammengepresst, auch um sie legte sich eine sichtbare Lederschlinge —
»I, so was können abgeschiedene Seelen auch bei der besten Materialisation ja nicht, so was gibt's ja überhaupt gar nicht im Geisterreich!!«, ächzte der Leutnant, als ihm auch schon seine Füße gebunden wurden.
Da erschien über ihm ein hageres Männergesicht, die ganze Gestalt eines baumlangen Mannes, nur aus Knochen und Sehnen bestehend, folgte nach — und dort, wo Miss Morgan am Boden lag, richtete sich ebenso nach und nach eine andere Gestalt empor — Atalanta, die rote Gräfin, aber das war jetzt keine Vision mehr, keine überirdische Erscheinung, sondern das war wirklich die Indianerin in Fleisch und Blut, darüber konnte nun Zweifel mehr sein.
»I so was gibt's ja gar nicht, so was ist im Geisterreiche ja gar nicht erlaubt!«, staunte Leutnant Torres.
In einer behaglich eingerichteten Felsenkammer, deren Wände mit Teppichen verhangen waren, saß an einem offenen Kamin, in dem große Holzscheite Funken sprühten, ein Mann mit mongolischen Gesichtszügen.
Es war ein junger Japaner, aber keine jener zwerghaften und dennoch kolossalen Matrosengestalten, sondern mittelgroß und schlank.
Leutnant Makuso, ein See-Offizier, der Führer der acht japanischen Matrosen, die zum Schutze der Felsenwohnung und der Sternwarte zurückgeblieben waren.
Diese Felsenkammer hier aber lag noch hinter den Wänden, welche Miss Morgan für die Grenzen ihres neuen Besitzes gehalten hatte, halten musste, weil sie nicht dahinter dringen konnte.
Einer der Wandteppiche schob sich etwas zur Seite, geräuschlos schlüpfte ein kleiner Junge herein, aber schon mit langen Hosen, aus einem dunklen Lodenstoff, aus dem der ganze Anzug bestand, in dem alles Knabenhafte und Kindliche vermieden war.
Es war überhaupt gar kein sechsjähriger Junge, für den man ihn nach einem oberflächlichen Blick halten mochte. Man brauchte nur das alte, faltige Gesicht mit den melancholischen Zügen zu sehen, dann wusste man, was hier vorlag.
Es war ein Zwerg, ein außergewöhnlich kleiner, ganz wenig über einen Meter hoch. Solch kleine Zwerge sind selten.
Zuerst blinzelte er mit seinen melancholischen Augen, über denen die Brauen schon weiß waren, in das elektrische Licht an der Decke, dann trat er an den Kamin, hielt die zierlichen Kinderhändchen dichter an das Feuer, wobei ein Schauer durch die feinen Glieder ging.
»Kalt heute, Mister Dollin«, sagte der Japaner, sich eine Pfeife stopfend, mit freundlicher Teilnahme.
»Ja, sehr kalt«, entgegnete ein dünnes, weinerliches Kinderstimmchen, »und nun hier zwischen den Felsmauern, in die nie ein Sonnenstrahl fällt.«
»Werden Sie denn längere Zeit hier bleiben?«
»Ich weiß nicht, Herr«, erklang es schroff, so weit das Kinderstimmchen solch eines Tones fähig war, und sofort drehte sich der Kleine um und ging wieder hinaus.
»O weh«, murmelte der Japaner bedauernd, »ich habe nicht daran gedacht, dass man ihn nach so etwas nicht fragen darf, und es war doch überhaupt nur Teilnahme mit dem armen kleinen Kerl, der vielleicht aus einer sonnigen Gegend von dem geheimnisvollen Manne, dem er unbedingt zu gehorchen hat, nach hier abkommandiert worden ist, um uns zur Verfügung zu stehen. Nun habe ich das arme Männchen durch meine Frage gleich wieder vom Feuer verscheucht!«
Der Japaner sollte nicht lange in der bedauernden Stimmung bleiben. Ein lustiges Trällern erscholl, ein anderer Mann trat ein, zwar ebenfalls nicht groß, aber noch lange kein Zwerg, außerdem über ein hübsches Bäuchlein verfügend.
Obgleich das runde Gesicht recht finstere oder doch verdrießliche Züge hatte, befand er sich jetzt in der besten Stimmung, fing gleich zu tanzen an, so einen Negertanz.
»Littleli, littlela, littlelu — hahahahaha — pst pst pst pst pst —«
Der Japaner begann zu lachen, dass ihm die Tränen aus den Schlitzaugen über die hervortretenden Backenknochen liefen.
»Ja, wie Sie dem das Lachen und das pst pst pst nachmachten, das war einfach göttlich!«
Littlelu hatte einen Stuhl ans Feuer gezogen, setzte sich, wieder ganz ernst, und stopfte sich ebenfalls eine Pfeife.
»Na, mein Echo war ja nun das wenigste dabei. Aber wie der Leutnant Torres immer alles zu erklären wusste, wie der mit seiner Geistertheorie auspackte, mit dem Astralleib der toten Indianerin und so weiter, wie die sogar das Echo fressen können sollte — ja, das war wirklich göttlich.«
»Wie kam es denn, dass sonst das Lachen kein Echo fand?«
»Einfach weil sie sich gerade in dem musikalischem Theatersaale befanden, in dem durch eine wunderbar berechnete Akustik jedes Echo vermieden worden ist. Hat ja überhaupt alles ganz wunderbar geklappt. Auch dass gerade der Tod der Indianerin gemeldet worden war. Schade nur, dass die Morgan dann den Grafen erstechen wollte. Da musste die Gräfin natürlich mit ihren natürlichen Händen eingreifen. Ein Glück übrigens, dass sie gerade dabei war. Sonst hätte das schlecht ablaufen können, Mister Dollin hätte im Augenblick die Katastrophe nicht abwenden können, über welche Hilfsmittel er sonst auch verfügt. Schade, jammerschade, dass es so gekommen ist. Ach, was hätten wir denen noch für einen Spuk vorgemacht! Was hätte dieser Leutnant noch alles aus dem Geisterreiche erklären können! Ich hatte schon einen Eimer Wasser bereit stehen, um ihn ihm im passenden Momente über den Kopf zu gießen.«
»Ja, wie bringt denn aber der Zwerg diese Erscheinungen zustande? Das ist mir immer noch ein Rätsel.«
»Mir auch. Und das werden uns wohl auch immer versiegelte Geheimnisse bleiben. Er hat einen kleinen Apparat, einen Kasten, mit dem er alles hervorbringen kann, an Lichtbildern, was er nur will. So sieht es wenigstens aus. Es scheint ihm gar nichts unmöglich zu sein. Ich denke höchstens, dass es sich um eine Spiegelung von der wirklichen Person handelt, die er erscheinen lässt. Ja, wie bringt er denn aber nun die Bewegungen hervor? Und vor allen Dingen, wie macht er — ach, es hat ja gar keinen Zweck, uns hierüber den Kopf zu zerbrechen, wir werden diese Rätsel niemals lösen. Jedenfalls ist dieser Apparat noch viel, viel wunderbarer als der, mit dem sie dort auf der türkischen Insel den Spuk erzeugten, wie ich Ihnen erzählte.«
»Und Sie wollten mir weiter erzählen!«
»Ja, wo war ich stehen geblieben?«
»Wie in Ihrer und auch Kapitän Hagens Tasche angesichts der kalifornischen Küste plötzlich die Telefonuhren klingelten.«
»Richtig. Was wir sonst auf der langen, langen Luftreise für Abenteuer erlebten, das erzähle ich Ihnen ein andermal.
Also angesichts der kalifornischen Küste, es war schon Abend, klingelten in unseren Taschen plötzlich die Telefonuhren. Beide waren noch auf das Wort ›Mohawk‹ eingestellt.
Nanu, denken wir, da hat die Atlanta ihre sämtlichen Telefonuhren also doch nicht über Bord geworfen? Recht so, freut uns.
›Hier Hagen und Littlelu, wer dort?‹
›Sirbhanga Brahma.‹
Aha! Der war es, der sich so eine Zauberuhr reserviert hatte!
›Sie wünschen?‹ Wir sollten uns sofort auf der Pliasplatte niederlassen. Ob wir die kennen? Ei gewiss! Das ist das Bergplateau östlich von San Francisco, sehr schwer ersteigbar, oben sind nur ein paar Quadratmeter Platz.
›Bitte‹, fährt das Telefon fort, ›dort begeben Sie sich also hin und lassen sich darauf nieder. Dort erwartet Sie ein Herr, Mister Dollin, dem vertrauen Sie sich an, er wird Sie weiter führen. Es ist ein Zwerg, ich bitte Sie, ihn nichts zu fragen oder es ihm nicht zu verübeln, wenn er auf gewisse Fragen Ihrerseits nicht antwortet. Schluss.‹
Alle war's. Der Brahmane hätte ruhig etwas mehr sagen können. Wir hätten doch gern gewusst, wo sich der ›Mohawk‹ jetzt befand, wie's dem Grafen ginge und so weiter und so weiter. Wir versuchten es noch einmal mit dem Anrufen, aber es kam keine Antwort.
Nun, wir überflogen das schon erleuchtete Frisco, und wir hätten nicht durchsichtig zu sein brauchen, man hätte uns nicht sehen können.
Wir ließen uns auf der Pliasplatte nieder, von der es ganz ausgeschlossen war, dass sich dort oben jetzt ein Mensch aufhielt. Nicht der verwegenste Bergkraxler macht am Abend eine Klettertour da hinauf und bleibt in der Nacht oben.
Aber da steht richtig ein Jüngelchen — ein Zwerg.
›Mister Dollin? Kapitän Hagen, Mister Maxim. Sehr angenehm. Ja, wie kommen Sie denn eigentlich hier herauf?‹
›Bitte, meine Herren, ich darf auf solche Fragen keine Antwort geben!‹
›Ah — wir bitten um Verzeihung!‹
Die Reise ging weiter. Der Zwerg saß auf Hagens Aeroplan, aber der hatte auch keinen Genuss von dieser Gesellschaft, Mister Dollin sprach kein Wort, und Neugierde kann man diesem deutschen Seebären ja nicht gerade nachsagen.
An einer günstigen Stelle wird wieder gelandet, wir schlafen die Nacht, am frühen Morgen geht's weiter.
›Wohin, Mister Dollin?‹ Der streckt nur sein Kinderhändchen nach Osten aus.
Am späten Nachmittage desselben Tages, als vor uns schon das Felsengebirge aufsteigt, sehen wir unter uns in der Prärie ein winziges Figürchen laufen. Mister Dollin hatte uns erst darauf aufmerksam gemacht, das heißt nur darauf gedeutet, und da er weiter deutet, lassen wir uns gehorsam nieder.
Wer kann das sein, der da unten im Hundetrab rennt? Herr Gott im Himmel, wie wird uns, wie wir unsere Gräfin erkennen!!
Aber wie wird uns erst zu Mute, als wir landen und die Gräfin zu erzählen anfängt!
Der ›Mohawk‹ bei den Cook-Riffen gescheitert, Mann und Maus untergegangen. Wenigstens weiß die Gräfin nicht anders, als dass nur sie und der Graf und zwei Japaner mit dem Leben davon gekommen sind, die aber noch nachträglich gestorben sind.
Also der Sirbhanga hat uns antelefoniert. Na, dann muss der wohl auch noch leben. Oder er hat aus dem Himmel telefoniert, oder aus seinem indischen Nirwana.
Aber was wir nun sonst weiter erfuhren! Aufruhr und Hochverrat, zehn Jahre Spinnspinn in Belltown, entsprungen —
Na, Sie wissen ja alles. Jetzt befand sich die Gräfin auf dem Wege nach dem Sklavensee, um die Miss bei den Schweinsohren zu nehmen. Sie hatte den Anschluss verpasst, hatte schon zwei Pferde gestohlen und kaputt geritten, gegenwärtig ritt sie auf Schusters Rappen.
Wir luden sie auf. Kapitän Hagen aber wollte nun einmal andere Gesellschaft haben als den Zwerg, den überließ er jetzt mir, er nahm dafür die Gräfin neben sich in den Sattel.
Ich erwähne diesen Wechsel besonders, weil er noch von großer Bedeutung werden sollte. Während der weiteren Fahrt hat Kapitän Hagen der Gräfin nämlich tüchtig den Kopf zurechtgesetzt.
Weshalb? Nun, Sie wissen doch ebenfalls, was die Gräfin vorhatte. Einfach auf alles verzichten wollte sie, sich geduldig in alles ergeben. Nur Ruhe, nur Frieden wollte sie endlich haben.
Nun ja, das kann man bei dem armen Weibe begreifen, aber — Kapitän Hagen wollte es nicht begreifen. Der taute aber plötzlich auf und fluchte ganz gewaltig.
Und ich nämlich mit. Denn da bin ich nun auch nicht so einer. Aufruhr und Hochverrat — verfluchter Unsinn ist das! Da kann höchstens Widerstand gegen die Staatsgewalt mit einigen tödlichen Ausgängen in Betracht kommen. Aber Aufruhr — und gar Hochverrat — i da lachen ja alle Teufel in der Hölle über so etwas!
Nein, das ist einfach Vergewaltigung aller Menschenrechte! Die ganze Sache ist ja so einfach. Da die Regierung der roten Gräfin nicht ihre Geheimnisse abknipsen konnte, will man ihr nun wenigstens aus Rache alles andere nehmen, was sie sonst noch hat. Vor allen Dingen die goldenen Schätze in dem See!
Also kurz und gut, Kapitän Hagen hat ihr tüchtig den Kopf gewaschen — eine solche Nachgiebigkeit ist hier geradezu ein Verbrechen — und wenn sich die Gräfin nicht zur Wehr setzen wollte, so ginge er, Kapitän Hagen, ganz allein vor —
Nein, nicht allein, ich ging mit — durch dick und dünn — durch Wasser und Feuer! Wissen Sie, Leutnant, ich bin kein Bundesstaatler, werde nur immer für einen Yankee gehalten. Ich bin englischer Kanadier, habe hier auch gar nicht die Bürgerrechte — aber wenn auch die Vereinigten Staaten meine Heimat und mein Vaterland wären, ich würde auf eigene Faust meinem Vaterlande den Krieg erklären — i zum Teufel noch einmal, solch eine Vergewaltigung aller Menschenrechte darf man sich doch nicht gefallen lassen, oder man ist kein Ehrenmann!!«
Schon längst hatte Littlelu seine Pfeife zwischen den Zähnen zerbissen, jetzt schleuderte er sie ins Feuer, sprang auf und trampelte hin und her.
»Nun ja, ich weiß schon«, sagte ruhig der japanische Offizier, »wir werden die Regierungsarbeiter und das Militär zwingen, das Goldfischen einzustellen und überhaupt den See wieder zu verlassen. Die Gräfin ist damit einverstanden.«
Auch Littlelu hatte sich schnell wieder beruhigt, er setzte sich wieder und fuhr in seiner Erzählung fort:
»Ja, die Gräfin war sehr bald damit einverstanden, Hagen hat eben zu sprechen verstanden. Ei verflucht! Aber man kann es der Gräfin nicht verdenken, wenn sie dabei jede Gewalttat vermeiden will, sonst reißt sie sich ja wirklich hinein. Wenigstens muss erst versucht werden, alles im Guten zu regeln — oder vielmehr durch eine List, durch Schlauheit, denn von einer Einigung im Guten kann jetzt doch keine Rede mehr sein.
Da, wie wir beim letzten Nachtquartier hierüber berieten, ergriff zum ersten Male der Zwerg das Wort. Er schlug vor, die neuen Bewohner der Felsenbehausungen durch einen Spuk hinauszugraulen. Und das haben wir heute Abend ausgeführt.
Es ist uns nur zur Hälfte geglückt. Dadurch, dass die Morgan den Grafen erdolchen wollte, hat die Sache eine ganz andere Wendung genommen. Das in seinem Hasse wahnsinnige Weib musste überwältigt werden, desgleichen der mitanwesende Leutnant Torres. Und das konnten keine Geisterhände sein, die so energisch zugriffen. Die Gräfin und Hagen hatten ganz recht, wenn sie nun gleich ihre Tarngewänder abstreiften.
Anderseits ist es ja dennoch vollkommen geglückt. Die geflohenen Soldaten und die von Miss Morgan mitgebrachten Männer können draußen nichts anderes erzählen, als dass hier drinnen die tote Indianerin spukt, und nun können wir die draußen auch noch mit weiterem Spuk schrecken. Nur müssen natürlich die Miss Morgan und Leutnant Torres unsere Gefangenen bleiben.
Weiter wüsste ich nichts zu berichten. Oder haben Sie sonst noch etwas zu fragen?«
Überlegend blickte der Japaner in das Feuer, bis er schnell den Kopf hob.
»Ja, was ist denn das nun eigentlich für eine Geschichte mit der Indianerin, die beim Durchschwimmen des Cascada als Pferdediebin erschossen worden ist? Also Sie haben dieses Märchen erst in die Welt gesetzt?«
»O nein, solche weitgehende Einleitungen haben wir gar nicht erst getroffen. Das ist nur ein merkwürdiger Zufall, der uns da zu Hilfe gekommen ist.«
»Ja, wer ist denn da erschossen worden?«
»Das weiß ich nicht. Die Gräfin Atalanta von Felsmark war es jedenfalls nicht, die sie sogar schon begraben haben. Wissen Sie, was ich mir denke?«
»Nun?«
»Jene sechs Männer von der Goldgräbergesellschaft sind ausgetragene Jungens, die haben eine Indianerin getötet, haben ihr eine entsprechende Tätowierung auf den Rücken gegeben, sie so gekleidet, wie die steckbrieflich verfolgte Zuchthäuslerin ja zur Genüge beschrieben wurde und haben sie begraben! Dann haben sie eines Tages, als von der Gräfin Felsmark und von ihrer Flucht die Rede war, verwundert gefragt: ›Was, eine Indianerin ist entsprungen, auf deren Wiederergreifung oder Tötung eine Million Dollars Prämie steht? Dann haben wir uns ja diese Million verdient, wir haben diese Indianerin getötet. Grabt sie nur aus, Ihr werdet sie schon erkennen.‹ — Die Leiche soll schon stark von Ameisen angefressen gewesen sein, die gerissenen Kerle haben sie eben gerade an solch einer Stelle vergraben. Die Tätowierung auf dem Rücken war nicht mehr deutlich zu erkennen, noch weniger das Gesicht, aber sonst stimmte alles, hauptsächlich die lederne Kleidung. Die sechs Burschen sollen tatsächlich die Million Dollars schon ausgezahlt bekommen haben. Na, die werden sich ja nicht schlecht ins Fäustchen lachen! Und wenn dann die tote Gräfin einmal wieder lebendig erscheint — der Fiskus oder die Staatsanwaltschaft werden dann weniger lachen. Denn diese Prämie kann man weder der Gräfin zur Last schreiben noch es sich von der Miss Morgan geben lassen, die hat der Fiskus aus seiner Tasche zu ersetzen.«
Der Japaner lachte.
»Wie sind Sie eigentlich hier herein gekommen?«, fragte er dann.
»Hinten durch einen geheimen Eingang im Cañon.«
»Durch den Cañon? Den haben auch wir benutzt, als wir uns von hier scheinbar oder auch wirklich entfernten. In der Nacht sind wir dann mit unseren Booten in den Cañon gefahren und dann weiter durch eine geheime Felsentür ins Innere dieses Heiligtums gelangt!«
»Aber immer auf dem Wasserwege?«
»Natürlich mit den Booten.«
»Dort, wo wir hinkamen, war kein Wasser, also muss das wieder ein anderer Eingang sein. Nun, das ist ja ganz gleichgültig. Sie sollten die Gräfin hier erwarten?«
»Ja, nein«, entgegnete der Japaner zögernd, »nur eine gewisse Zeit sollten wir hier warten — dann — bitte, meine Zunge ist da gebunden —«
»O, verzeihen Sie, ich will Sie doch nicht etwa ausforschen.«
»Was wird nun weiter geschehen?«
»Nun, zunächst haben Ihre Matrosen unten das Wassertor zugeklappt und sind jetzt dabei, die sämtlichen Fenster wieder mit Omnihilitplatten zu verschließen.«
»Dann können die draußen aber nicht mehr an Spuk glauben.«
»Warum nicht?«
»Nun, solche wesenlose Geister können doch nicht die Fenster zumachen!«, lachte der Japaner.
»O, die können noch viel mehr, und die Soldaten glauben jetzt noch etwas ganz anderes«, lachte auch Littlelu. »Aber dass die abgeschiedenen Seelen das elektrische Licht andrehen, um sehen zu können, das allerdings werden auch die Geistergläubigsten nicht glauben, und deshalb schließen wir lieber die Fenster.«
»Das elektrische Licht funktioniert wieder?«
»Allüberall, so wie hier hinten. Der Zwerg hat alles sofort wieder in Funktion gesetzt.«
»Was ist das eigentlich für ein Zwerg?«
»Da fragen Sie mich zu viel. Sie wissen doch, dass er auf so etwas einfach keine Antwort gibt.«
»Na, was meinen Sie denn, wer er ist?«
»Eben ein Diener jenes geheimnisvollen Mannes oder einer ganzen Gesellschaft von hochentwickelten Menschen, welche unserer Gräfin als der rechtmäßigen Besitzerin dieses Gebietes, in dem sich einst ein abtrünniges Mitglied ihrer Gesellschaft niedergelassen hat, sehr wohlgesinnt ist. Mehr kann ich nicht sagen. Aber das eine weiß ich bestimmt: Jener Señor Tenorio wird sich hier niemals wieder einmischen. Der ist jetzt für immer auf jene türkische Insel gebannt. Dort mag er seinen Hokuspokus nach Herzenslust treiben, hier wird er es niemals wieder tun.«
Ein elektrisches Klingeln erscholl in mehrfachen Wiederholungen.
»Das ist das Zeichen, welches mich zur Gräfin ruft«, sagte Littlelu, schnell aufstehend. »Auf Wiedersehen, Herr Leutnant.«

»Was wünschen die Herren?«, rief Atalanta von der
Felsöffnung herab den im Boote sitzenden Männern zu.
Jetzt war der Raum elektrisch erleuchtet, in dem Graf Arno schlafend lag.
Vor seinem Bette standen Atalanta und der Zwerg, sie beobachteten ihn. Er lag wieder ganz still, flüsterte nicht mehr den Namen der Geliebten.
»Er ist abermals in tiefen Schlaf gefallen«, sagte die Indianerin, die seinen Puls fühlte. »Es scheint ein ganz normaler Schlaf zu sein, sein Puls geht ganz regelmäßig. Aber wie wird sein Erwachen sein?«
»Ich kann es nicht sagen«, entgegnete des Zwerges Kinderstimmchen, das auch immer etwas Weinerliches an sich hatte.
»Ich fürchte, es ist noch ganz derselbe Zustand.«
»Ich auch.«
»Ach, Sie rätselhafter Mann, der auch Sie mir schon Proben von fabelhaften Fähigkeiten und Kenntnissen gegeben haben, können Sie mir denn nicht helfen, dass ich meinen Gatten wiederbekomme?!«, brach es bei der Indianerin wieder einmal jammernd hervor.
»Nein, das kann ich nicht«, erwiderte das weinerliche Kinderstimmchen. »Wenn der, dem ich zu gehorchen habe, hier irgendwie helfen könnte, so würde er mir sofort den Befehl dazu geben. Aber auch uns sind Grenzen gesetzt, denn wir sind nicht etwa übernatürliche Wesen, auch wir sind sterbliche Menschen, die sich in gewissen Sachen nur besondere Kenntnisse erworben haben — mühsam, ach gar mühsam!«
Die Indianerin hatte sich schnell wieder beherrscht.
»Ich möchte eigentlich, dass er sich beim Erwachen in ganz anderer Umgebung befindet.«
»Ja, das denke ich auch, das dürfte gut sein.«
»In einer anderen Umgebung wacht er ja überhaupt auf. Aber dieser Raum hat doch mit der Zelle in der Irrenanstalt eine verzweifelte Ähnlichkeit. Nicht viel anders war es an Bord des ›Mohawk‹. Am liebsten möchte ich ihn im Freien erwachen lassen, ungefesselt, auch sonst ganz frei. Ach, hätte ich ihn doch überhaupt dort in Afrika auf der Sumpfinsel gelassen, wo er sich als Einsiedler so glücklich fühlte!«
Aufmerksam blickte der Zwerg zu der schlanken Indianerin empor.
»Ihn im Freien erwachen lassen, auch sonst sich ganz selbst überlassen? Das können Sie hier haben.«
»Hier am Sklavensee? Nein, das würde ich nicht wagen, am wenigsten unter den jetzigen Verhältnissen.«
»Nein, nicht draußen. Hat Ihnen Señor Tenorio nicht das Felsental gezeigt?«
»Welches Felsental? Es gibt deren viele hier.«
»Ich meine nicht draußen, sondern hier innerhalb der Felsenwände, ein künstlich geschaffenes.«
»Davon ist mir nichts bekannt.«
»Ja, Frau Gräfin, das könnte versucht werden. Soll er ein Robinsonleben führen, mit nichts anfangend, sich nach und nach alles selbst schaffend?«
»Ein Robinsonleben hier innerhalb der Felswände, in einer künstlichen Schlucht? Ich verstehe nicht recht.«
»Das Einfachste ist, wir gehen gleich hin und nehmen ihn auch gleich mit. Einen Augenblick — oder doch nur eine Minute, dann bin ich wieder hier — bitte, wollen Sie unterdessen einige Matrosen beordern, welche den Schläfer tragen, wenigstens bis zu einem Automobil.«
Der Zwerg ging mit kleinen Schrittchen schnell hinaus, und die Indianerin gab sich keinen Grübeleien hin, sondern rief telefonisch drei japanische Matrosen, klingelte auch nach Littlelu und Kapitän Hagen.
Als die Gerufenen kamen, stellte sich auch der Zwerg wieder ein. Atalanta hatte den Schlüssel, den Miss Morgan in der Tasche getragen, der die Ketten aufschloss, doch blieb der Schläfer einstweilen noch gefesselt, falls er zu früh aufwachte, obgleich der Zwerg versicherte, dass sie in fünf Minuten an ihrem Ziele seien.
Nur von den Wänden wurden die Ketten gelöst, dann hoben zwei Matrosen den Schläfer auf ihre verschränkten Arme, so trugen sie ihn unter Führung des Zwerges davon.
Es ging in den Illusionsraum, der gleich in der Nähe war und dessen elektrische Beleuchtung schon funktionierte. Jetzt drehte sich vor dem Zwerge an der hinteren Wand, ohne dass er irgend etwas tat, noch ehe er sie erreicht hatte, eine Steinwand heraus.
Man blickte in einen Gang, elektrisch erleuchtet, gleich vorn stand ein Gefährt auf Rädern, wie ein Automobil aussehend und doch wieder ganz anders.
Der Schläfer wurde hineingehoben, sie nahmen Platz, der Zwerg steuerte. In rasender Fahrt ging es den Tunnel entlang, wie weißglühende Funken huschten die Bogenlampen vorüber, alle drei Sekunden eine. Wenn es hier Türen oder abzweigende Gänge gab, so konnte man sie doch nicht erkennen, dazu fuhr das Automobil viel zu rasch.
Kapitän Hagen machte aus seinem grenzenlosen Staunen kein Hehl.
»Wenn man auch annimmt, dass dies ein von der Natur geschaffener Tunnel ist, wahrscheinlich ein alter Wasserlauf — von wem stammen diese kolossalen Beleuchtungsanlagen?«
»Fragen Sie Mister Dollin, der wird es Ihnen erklären!«, entgegnete Littlelu.
Hagen aber wusste, dass er von diesem nichts erfahren würde. Sein Freund hatte ihm ja schon genug erzählt, was es hier alles zu schauen gäbe, aber er konnte sich gar kein Bild davon machen, und auch für die, welche schon mit allem vertraut zu sein glaubten, gab es hier immer wieder neue Überraschungen.
Als das Automobil hielt, konstatierte Littlelu, der bei der Abfahrt nach der Uhr gesehen hatte, dass man genau drei Minuten gefahren sei.
Wenn nun das Automobil mit einer Geschwindigkeit von 60 Kilometern in der Stunde gefahren war, mindestens, so war man also mindestens drei Kilometer tief in den Felsen gedrungen.
»Demnach gehört dieses Gebiet immer noch mir«, sagte die Indianerin mit einigem Nachdruck.
»So ist es«, bestätigte der Zwerg ohne Aufforderung, »die Waldschlucht liegt noch auf Ihrem Grund und Boden, ist Ihr Eigentum.«
Sie stiegen aus, durch unsichtbaren Mechanismus oder durch unsichtbare Hände wurde wieder eine Steintür aus der Wand gedreht, noch ein kurzer Gang, wieder entstand eine Öffnung.
Die Eintretenden glaubten ihren Sinnen nicht trauen zu dürfen.
Ein Urwald zeigte sich hier ihren erstaunten Blicken, wie es einen solchen in der Natur nicht gibt, in den die zum Teil riesenhaften Bäume von allen Erdteilen geliefert worden waren. Europa war hauptsächlich durch Eiche und Linde vertreten, aber auch die edle Kastanie fehlte nicht; Asien am meisten durch indische Spezialitäten, von denen der Teakbaum wohl der schönste ist; Afrika durch den Baobab; Nordamerika durch die Sykomore, der Süden durch den Campechebaum; Australien durch die verschiedenen Arten des Eukalyptus, des Gummibaumes.
Doch es war nur ein Urwald en miniature, oder man konnte sich vorstellen, man befände sich am Saume des Waldes. Gleich dahinter kam eine Wiese, eine Prärie mit frischem, kniehohem Grase, jenseits derselben erhob sich wieder ein Nadelwald, an diesen grenzte eine Sandfläche, die man als eine kleine Wüste bezeichnen konnte. Dann kam wieder eine hohe, wilde, zerrissene und zerklüftete Felsformation, an der ein Steinbock seine Freude gehabt hätte; ihr entsprang in dickem Strahle eine Quelle, die dann als Bächlein durch die Steppe rann, sich in ein viel breiteres Gewässer ergießend, das man schon einen Fluss nennen konnte, einmal verbreiterte er sich zu einem ansehnlichen Teich, hier schon See zu nennen —
Das sah man so auf den ersten Blick. Man musste erst dieses ganze Reich durchwandern, ehe man etwas beschreiben konnte.
»Ja, träume oder wache ich denn nur?«, flüsterte Hagen, sich die Stirn reibend.
Und Littlelu drückte sein Staunen dadurch aus, dass er mit weit geöffnetem Munde zum Himmel empor starrte.
Das größte, einfach unfassbare Wunder bestand nämlich darin, dass es jetzt doch Nacht war — hier aber stand am azurblauen Himmel, über den nur einige leichte Wölkchen zogen, die strahlende Mittagssonne.
»Ja, sind wir denn in den drei Minuten nach der anderen Hälfte der Erdkugel gekommen, etwa nach Indien oder Australien?!«, flüsterte Hagen wiederum.
»Wegen der Sonne, meinen Sie?«, sagte Mister Dollin. »Das ist eine künstliche Sonne.«
»Künstliche Sonne?!!«, schrien Hagen und Littlelu gleichzeitig.
»Gewiss. Das ist eine elektrisch leuchtende Kugel, die sich über eine durchsichtige Omnihilitplatte hinweg bewegt. Die weite Entfernung ist eine Illusion. Es ist hier überhaupt alles Illusion, verbunden mit natürlicher Wirklichkeit. Es ist einfach ein Treibhaus, als Wildnis eingerichtet, die alle Zonen repräsentiert, die kalte ausgenommen. Allerdings ein ganz kolossales Treibhaus. Es ist ein natürlicher Talkessel von etwa 120 Meter Durchmesser. Oder vielmehr eine ungeheuere Höhle, denn oben ist sie geschlossen. Der Himmel ist künstlich, die Wolken sind es selbstverständlich auch, ebenso wie die Sonne.«
Es war eine ganz nüchterne Erklärung, die der Zweg gab, aber sie vermehrte das Staunen der Besucher nur ins Ungeheuere.
»Wer hat denn dies alles geschaffen?!«
»Bitte, meine Herren, fragen Sie mich alles andere, nur dieses nicht.«
»Eine künstliche Sonne! Findet der Mensch Worte! Na ja, warum nicht. Sie bewegt sich an der Decke?«
»Gewiss, durch einen Mechanismus.«
»Wie hoch ist diese Decke?«
»Gegen 200 Meter über dem Erdboden.«
»Oho!«
»Nun ja, jener Gummibaum dort ist ja schon bestens 100 Meter hoch, die Konifere dort ist noch höher. Aber steigen Sie bis zum Gipfel empor, Sie werden dadurch dem vermeintlichen Himmel nicht näher gerückt.«
Atalanta hatte bisher keine Frage gehabt, sich nur immer aufmerksam umgeschaut, erst jetzt nahm sie das Wort.
»Also hier soll der Graf erwachen?«
»Ich denke, wir versuchen das Experiment.«
»Ja, ganz ausgezeichnet, nur fürchte ich — oder eigentlich hoffe ich es — wenn sein normaler Verstand zurückkehrt, so wird er bald merken, dass dies alles nur künstlich ist.«
»Das bezweifle ich.«
»Er kann sich schon diese Vermischung der verschiedenen Vegetationen nicht erklären.«
»Dann kennt er Neu-Guinea nicht. Dort finden sich solche Landschaften, Asien vermischt sich mit Australien, auch die amerikanische Flora ist hinzugekommen.«
»Nun gut, das ist auch Nebensache. Bewegt sich denn die Sonne ganz natürlich?«
»Ganz natürlich. Jetzt habe ich sie auf die Mittagszeit eingestellt. Beobachten Sie den Schatten, er bewegt sich ganz regelmäßig. Gegen fünf Uhr verschwindet sie hinter den Felswänden, dann dauert es noch anderthalb Stunden, bis die Nacht anbricht, welche ja die natürliche Länge haben kann, das haben wir doch ganz in unserer Gewalt.«
»Sind es immer dieselben Wolken, die am Himmel vorüberziehen?«
»Durchaus nicht. Es können Gewitterwolken kommen, mit Blitz und Donner.«
»Der Regen fehlt.«
»Im Gegenteil. Gewiss, die Vegetation muss künstlich bewässert werden, aber das Wasser kommt als Regen von der Decke, vom Himmel.«
»Es herrscht hier ständig dieselbe feuchtwarme Temperatur.«
Da plötzlich erzitterte das Laub unter einem kühlen Luftzuge.
»Das ist der Wind, welcher den baldigen Regen anmeldet. Bis zum Sturme darf es nicht kommen, schon ein stärkerer Wind wäre in diesem von hohen Felswänden eingeschlossenen Talkessel unnatürlich.«
Die beiden Freunde waren wiederum außer sich vor Staunen, nur ob dieses kühlen Windhauches. In einem Treibhause sollten sie sich befinden? Es war kaum begreiflich.
»Sind diese Wände unersteigbar?«
»Ja.«
»Und wenn es ihm doch gelänge, hinaufzukommen?«
»Dann freilich würde er gegen die Himmelsdecke stoßen. Aber ich halte ein Erklimmen für ausgeschlossen. Auch könnten wir ihn daran hindern, da gibt es immer Mittel, ohne dass er uns sieht.«
»Können wir ihn immer beobachten, ohne dass er uns bemerkt?«
»Von allen Seiten, auch von der Decke aus.«
Wieder blickte sich die Indianerin nach allen Seiten um.
»Sind jene Brotfrüchte dort natürliche?«
»Gewiss.«
»Und die roten Beeren dort?«
»Alles, alles ist hier gewachsen. Da ist nichts etwa drangehangen.«
»Aber das reicht noch nicht zu seiner Ernährung aus.«
»Befehlen Frau Gräfin, dass hier Wild eingesetzt wird? Darüber würde allerdings einige Zeit vergehen.«
»Nein, es ist nicht nötig. Er soll nur als Einsiedler leben, nicht als Jäger. Und dennoch, die Ernährungsfrage ist noch zu lösen.«
»Nun, lassen wir ihn doch alles, was er braucht, finden.«
»Was finden?«
»Zum Beispiel die verschiedensten Konservenbüchsen, Hülsenfrüchte —«
»Wie sollen denn die hierher kommen?«
»Hier ist schon einmal eine Expedition gewesen, sie hat ein Proviantmagazin angelegt.«
»Hm, das ist eine Idee. Das muss aber sofort gemacht werden.«
»Das ist nicht nötig. Man kann dieses Tal von sehr vielen Seiten betreten, durch geheime Eingänge, die jener aber niemals finden wird. Meist gehen diese Eingänge durch Höhlen, solch eine füllen wir mit dergleichen Proviant, und wir können es leicht arrangieren, dass er diese Höhle erst später entdeckt.«
»Ja, das ginge zu machen.«
»Und soll er auch Werkzeuge und andere Hilfsmittel finden?«
»Nein, er soll sich wie ein Robinson alles allein schaffen. Darüber kann übrigens ja noch gesprochen werden. Alles, was hier als Felsen erscheint, ist doch nicht etwa diamanthartes Omnihilit?«
»Nein, es ist natürlicher Stein.«
»Gut, so soll er sich erst Steinwerkzeuge fertigen. Jetzt müssen wir uns aber beeilen, er scheint zu erwachen!«
Der Schläfer bewegte sich unruhig. Die Fesseln wurden ihm abgenommen, sonst blieb er so liegen, wie er lag. Ehe sie sich wieder hinausbegaben, musterte die Indianerin noch einmal den Platz wegen ihrer hinterlassenen Spuren.
Sie hatten auf festem Boden gestanden, der mit Moos bewachsen war, waren nicht viel hin und her gegangen, der Graf war doch kein professioneller Fährtensucher — nein, er würde durch keine Spuren stutzig werden.
»Bei Gott, das ist wohl das interessanteste Experiment, das je gemacht worden ist«, sagte Littlelu, als sie draußen unter des Zwerges Führung eine Treppe erstiegen, »einen Menschen, der aus langem, langem Schlafe erwacht, keine Ahnung hat, wo er sich befindet, in eine Wildnis zu versetzen, aus der er nicht herauskommen kann, und nun seine Entwicklung als Robinson zu beobachten.«
»Und ich möchte an seiner Stelle sein«, setzte Hagen hinzu, »eine gute Zeit lang wenigstens würde ich es aushalten.«
»Hier ist die erste und beste Gelegenheit, um ihn beobachten zu können«, sagte Dollin.
Das, was man von dort drinnen für massiven Felsen halten musste, vielleicht meilendick, eben ein ganzes Felsengebirge, in dem die Natur hier nur ein schluchtenähnliches Tal geschaffen hatte, war im Grunde genommen nur eine dünne Wand, an der außen überall Galerien herumliefen, durch Treppen miteinander verbunden. Als wäre nun dieses ungeheuere Treibhaus schon für so ein Experiment bestimmt gewesen, waren überall kleine Öffnungen angebracht, durch die man hineinsehen konnte, von jeder Höhe aus. Natürlich musste dann hier draußen das elektrische Licht ausgedreht werden, sonst bekam der dort drin, wenigstens in der Nacht, das heißt, wenn es dort drin finster war, Lichtstrahlen zu sehen, die er sich natürlich nicht hätte erklären können.
Es war auch bereits hier draußen finster, die kleine Lampe, mit welcher der Zwerg leuchtete, schadete nichts, es war ja jetzt dort drin auch Tag, und bei Nacht brauchte die Lampe nur etwas tiefer gehalten zu werden, unterhalb der Gucklöcher, und kein durchgehender Strahl konnte sie verraten.
Sie blickten durch die Öffnungen. Etwa sechs Meter unter ihnen lag der Schläfer, bekleidet mit einem gelben Leinwandanzuge und Halbschuhen.
Jetzt gähnte er, hob die Arme und reckte sich, richtete sich halb auf und blickte um sich.
Mit furchtbarster Spannung wartete die Indianerin die nächste Sekunde ab. Sie würde entscheiden, ob ihr Gatte völlig zum Tiere herabgesunken war oder ob in seiner Brust noch der menschliche Prometheusfunke glühte.
Jetzt rieb er sich die Augen, stand vollends auf, schaute sich von Neuem um, und unverkennbar war Staunen in seinem bärtigen Gesicht.
Und dieses Staunen war ein gar günstiges Zeichen für seinen Geisteszustand!
Allerdings kein »Wo bin ich?«, kein anderes Wort, aber das war auch gar nicht nötig.
Dann begann er langsam zu wandern.
Es war also ein Gebiet von etwas über einem Hektar, das ihm zur Verfügung stand. Die Beobachter konnten, wenn sie wollten, mit ihm gehen. Entfernte er sich von ihnen nach der anderen Seite, so mussten sie eben schnell nach dieser gehen. Weiter aber als 60 Meter konnte er sich überhaupt nicht von ihnen entfernen, dann befand er sich gerade in der Mitte. Das ist ja keine beträchtliche Entfernung für das menschliche Auge, außerdem konnte man ja ein Fernglas zu Hilfe nehmen. Und es gab keinen Platz, wo man ihn nicht hätte sehen können. Es sei denn, er kroch in eine Höhle oder in einen hohlen Baumstamm.
So durchwanderte er das ganze Gebiet, sich meist an der Felswand haltend. Offenbar kam es ihm darauf an, eine Schlucht, eine breite Spalte, einen Ausweg zu finden. Er fand nichts dergleichen. Kroch er einmal in eine Höhle, so kam er immer sofort wieder heraus.
Unterwegs pflückte er einmal einige Apfelsinen, verspeiste sie, große, saftige Früchte, obgleich sie niemals Sonne gehabt hatten. Wohl aber intensives elektrisches Licht, und die Erfahrung ist schon längst gemacht worden, dass sich alle Pflanzen im elektrischen Lichte ganz vorzüglich entwickeln, sogar noch viel üppiger als im natürlichen Sonnenlichte, sie wachsen viel, viel schneller. So gänzlich lässt sich die Natur freilich nicht verspotten. Alle so künstlich gezogenen Pflanzen sind nicht fortpflanzungsfähig, entwickeln wohl die schönsten Früchte — wenn sie solche haben — aber keinen Samen oder dieser ist nicht keimfähig.
Die Apfelsinen waren für den Durst gewesen, obgleich Arno auch schon aus dem Bache getrunken hatte, daran niederkniend, dann kam eine Brotfrucht daran, der mehlige Brei stillte den Hunger, den er nach sechstägigem Schlafe wohl haben mochte, wenn auch der Stoffwechsel während dieser Zeit auf ein Minimum beschränkt gewesen war.
Während er aß, im Stehen, schüttelte er mehrmals den Kopf, untersuchte seine Taschen, schüttelte den Kopf noch stärker, blickte noch erstaunter um sich.
»Gelobt sei Gott, er ist bei voller Vernunft!«, flüsterte Atalanta.
Es war ein etwas voreiliges Urteil. Aber geändert hatte sich sein Zustand allerdings total, das stimmte, von Tierähnlichkeit war keine Rede mehr.
Hierauf legte er sich nieder, blieb wohl eine halbe Stunde lang regungslos liegen. Aber das hatte nichts mehr mit seinem früheren Verhalten zu tun. Er lag nicht auf dem Gesicht und stöhnte, sondern hatte sich hübsch den Schatten eines Baumes ausgesucht und sich behaglich ausgestreckt, den Kopf auf die Hand gestützt. Er dachte angestrengt nach.
Dann erhob er sich, und es war ganz folgerichtig, dass er nochmals die ganzen Felswände abging, um einen Ausgang zu finden.
Wiederholtes Achselzucken. Dann begann er, seine Aufmerksamkeit den Baum- und Strauchfrüchten zuzuwenden, er spähte auch lange Zeit in das Wasser des Flusses wie des kleinen Sees.
»Sind Fische drin?«, fragte die Indianerin den Zwerg flüsternd, dieses Spähen sofort richtig erfassend.
»Nein, aber wir können ja welche einsetzen.«
»Das will überlegt sein, ob das nachträglich noch angebracht ist. Dagegen können doch ab und zu Vögel über die Felswände in das Tal hinein fliegen.«
»Gewiss. Es müssen nur erst welche gefangen werden.«
»Das wollen wir tun. Die frische Fleischnahrung wollen wir ihm nicht gänzlich entziehen. Auch Kaninchen und andere kleinere Tiere könnten wir einsetzen. Nur für große bin ich nicht, für Hirsche, Rehe und dergleichen. Das Vorkommen solcher Tiere hier in dem weltabgeschlossenen Talkessel könnte ihn doch stutzig machen.«
»Und das Fehlen aller Insekten dürfte ihm auch einmal auffallen!«, meinte Hagen.
»O, ich werde ihm ein paar Fliegen haschen«, sagte Littlelu, »und wenn er große Sehnsucht nach anderen Insekten hat, zum Beispiel nach jenen, bei deren Fang man erst den Finger nass macht, ehe sie einem entspringen — die kann er von mir auch bekommen.«
Jetzt hob der künstlich geschaffene Robinson ein großes Stück abgeschälte Baumrinde auf, betrachtete es nachdenklich und probierte mit den Fingernägeln, die Rinde schien sehr trocken zu sein; dann schaute er sich suchend um, hob einen Ast auf, warf ihn wieder weg, suchte einen anderen, ganz gerade, brach einen grünen Zweig ab, riss eine Schlingpflanze in Stücke und machte sich etwas zu schaffen —
Und vor den Augen der Beobachter vollzog sich ein unergründlich Geheimnis der Natur, der Schöpfungskraft. —
Was ist es denn eigentlich, was den Menschen vom Tiere unterscheidet?
Man fange nur ja nicht mit »Vernunft« und dergleichen an, das sind Worte, nichts als leere Worte.
Es gibt sehr viele Tiere, welche das zeigen, was wir Vernunft nennen, und viel mehr davon haben als manche Menschen.
Es gibt sehr viele Tiere, welche für den nächsten Tag sorgen und noch viel weiter hinaus, während der Australneger nicht einmal ein Wort für »morgen« hat, obgleich er Tag für Tag schwer um seine Ernährung ringen muss, und er denkt nicht daran, von dem heutigen Überfluss auch nur eine geröstete Eidechse mit auf die Wanderung zu nehmen.
Es gibt Völkerschaften, die sich zu ihrer Bekleidung nicht einmal eines Feigenblattes bedienen.
Es gibt Völkerschaften, die kein einziges Handwerkszeug kennen, als Bewaffnung nur einen Knüppel haben — und eines Knüppels bedient sich auch der Gorilla.
Man hat den Elefanten in seinem Schmerze weinen sehen, und die klügeren Affen haben ganz offenbar ein schnatterndes Lachen, so wie es auch schon erwiesen ist, dass sie sich durch Laute verständigen.
Was unterscheidet nun den Menschen vom Tiere? Denn ein Unterschied besteht. Zwischen Bismarck und dem tierischsten Australneger, hat sich einmal einer unserer größten Naturforscher ausgedrückt, ist bei weitem kein so großer Unterschied als zwischen diesem Australneger und dem klügsten Affen, der sich, wenn er friert, in eine Decke wickelt.
Aber den charakteristischen Unterschied zwischen Mensch und Tier hat dieser Naturforscher, Professor Häckel, nicht anzugeben gewusst.
Nach Ansicht des Schreibers dieses ist es die Erzeugung und Benutzung des Feuers.
Das haben auch schon die alten Griechen und Römer gewusst, indem sie die Sage von dem Prometheus erdichteten, der den Göttern das Feuer stahl, wofür er ewige Pein erleiden musste, weil er die Menschen dadurch götterähnlich gemacht hatte.
Wenn im tropischen Afrika, wo es ganz empfindlich kalte Nächte gibt, die Reisenden ihr Lagerfeuer verlassen, so stellen sich bald Affen ein, kauern sich um das Feuer und wärmen sich. Das ist schon häufig beobachtet worden. Die Affen kennen die wohltätige Wirkung des Feuers, sie werden durch den Schein von weitem angelockt, obgleich sie in der Nacht sonst schlafen.
Aber keinem Affen fällt es ein, von dem Holzvorrat etwas nachzulegen, um das Feuer zu unterhalten.
Das ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier: die Erzeugung des Feuers mit der Absicht, es zu benutzen.
Und der Graf war dabei, sich einen Feuerbohrer zu verfertigen.
Er machte sich einen Bogen, die Sehne, das Stück Schlingpflanze, wickelte er um den geraden, kurzen Ast, stemmte dessen Ende gegen das Stück Baumrinde, das er gegen einen Baum legte, das andere Ende des Bohrers lief in einem hohlen Stein, den er vor sich auf der Brust hatte, so fing er an zu quirlen.
Bald sprühten die Funken. Er hatte Glück gehabt. Denn so einfach ist diese Geschichte sonst nicht. Wer es einmal probiert hat, der weiß, wie man da manchmal quirlen kann, den ganzen Tag, und es sprüht kein Funke. Es kommt ganz auf die Beschaffenheit des Holzes an, und große Erfahrung gehört dazu, das richtige auszuwählen.
Graf Felsmark aber hatte Glück gehabt. Aus einigen Funken wurde schnell ein ganzer Funkenregen, nun schnell das Rindenstück auf den Boden gelegt und so weiter gequirlt, das entstandene Bohrloch hatte sich mit Holzkohle umgeben, die glühte, trockene Blätter darauf gehäuft, immer weiter gequirlt und dazu geblasen, die Blätter begannen zu glimmen, trockene Ästchen darauf gelegt und geblasen — und Prometheus hatte den eifersüchtigen Göttern das Feuer gestohlen!

Die Beobachter wussten recht gut, was das zu bedeuten hatte. Er war wieder ein Mensch, ein wirklicher Mensch, mochte sonst in seinem Gehirn auch längst noch nicht alles in Ordnung sein.
Unverkennbar war die Freude, mit welcher er das lodernde Feuer betrachtete. Jetzt holte er aus dem nahen Bache einige große, flache Steine, die er jedenfalls schon vorher gesehen hatte, legte sie auf das immer größer werdende Feuer. Nun suchte er eine abgefallene, möglichst große Brotfrucht, deren Fleisch nicht mehr so dünnflüssig war, formte aus dem Teige Kuchen, und als die Steine heiß genug waren, wurden die flachen Kuchen dazwischen gebacken, er nahm eine zweite Mahlzeit ein, die ihm sichtbar besser mundete als die erste.
»Nein, wir wollen ihn keine Konserven finden lassen«, flüsterte Atalanta, »auch kein einziges Werkzeug, kein Messer, er soll sich alles, alles selbst fertigen, natürlich aus Stein, das wird ihn am besten beschäftigen.«
»Da kann er sich ja so in zehn Jährchen ganz hübsch eingerichtet haben«, meinte Littlelu.
»Ich kann warten. Ich werde diesen Heilungsprozess nicht wieder unterbrechen. Aber Vögel und Kaninchen soll er bekommen, es gibt doch auch noch andere kleinere Tiere, die in Höhlen leben und nur zeitweilig zum Vorschein kommen. Ich denke jetzt zum Beispiel gerade an Waschbären, von denen die Ufer des Sees wimmeln. Aber wie steht es mit Salz, ohne das der Mensch nicht auskommen kann, ohne dessen Genuss er sogar verkommt, auch geistig?«
»Salz ist dort drin allerdings nicht vorhanden«, entgegnete der Zwerg.
»Nu, wir können ja die Vögel und die Kaninchen und Waschbären immer gleich einsalzen«, konnte sich der ehemalige Zirkusclown nicht enthalten, seine Bemerkung zu machen.
»Salz muss er haben«, ignorierte die Indianerin den Witzbold. »Wir lassen ihn einfach einige Blöcke Steinsalz finden. Mag er darüber grübeln wie er will. Deren Vorkommen hier kann ihm schließlich nicht rätselhafter sein, als dass dort eine einzige Kokospalme steht, neben einer Kastanie. Diese Kokospalme mit großen Nüssen ist übrigens vortrefflich, er wird sich daraus die ersten Gefäße fertigen. Und nun wegen der Tiere? Es wäre recht hübsch, wenn hier bald Nacht würde, ich wollte wohl draußen in der wirklichen Nacht am Seeufer noch heute Kaninchen und Waschbären fangen.«
»Nun, das geht doch zu machen«, ließ sich Littlelu wieder vernehmen. »Sie, Herr lieber Gott«, wandte er sich an den Zwerg, »können Sie die Sonne nicht ein bisschen fixer schieben?«
»Das würde er am Schatten bemerken —«
»Na, dann befehlen Sie doch dem Herrn Petrus, er soll ein paar Wolken vorschieben, er kann es ja auch tüchtig regnen lassen, dass der Graf sich in eine Höhle verkriechen muss. Sprechen Sie doch einmal mit dem Herrn Petrus.«
Da sah man das alte, faltige, melancholische Kindergesichtchen zum ersten Male lächeln.
»Ich brauche nicht mit Petrus zu sprechen — ich bin selber Petrus — ich heiße Petrus — Petrus Dollin.«
Dort, wo Kapitän Hagen stand und durch eine Öffnung spähte, erklang ein grunzender Laut. Dem jungen Deutschen war die ganze Geschichte schon immer spaßhaft vorgekommen. Wie der sich dort drin für einen auf eine ummauerte Insel verschlagenen Robinson halten musste, wie er sich Feuer bohrte, und hier draußen wurde beobachtet, wurde beraten, was man ihm noch alles bewilligen dürfe, ob man es regnen lasse oder nicht.
Wahrhaftig, man spielte hier draußen die Rollen des lieben Gottes nebst seiner Gehilfen, die man früher Götter nannte.
Außerdem aber sagte sich Kapitän Hagen, ein echter Deutscher, der allen anderen Kulturvölkern als Phantast gilt, deshalb teils geachtet, teils verachtet wird — dass er da gleich selbst mitgemacht hätte. Gleichgültig, ob er von dem Hokuspokus wusste oder nicht. Oder er hätte beides zusammen verbunden — einmal draußen in aller Kultur leben, dann wieder hier den Robinson spielen mögen.
Ja, es wäre eine Spielerei gewesen. Eines ernsten Mannes nicht würdig? Oho!! Was sind denn alle die Kartenspiele und alle die anderen Unterhaltungen bis hinauf zum Schach? Ja, manche tiefernste Wissenschaft, wie zum Beispiel das Studium der Weltgeschichte, ist im Grunde genommen eine ganz zwecklose Beschäftigung, ist nur ein geistiger Sport. Wenigstens wenn man es von dieser Seite aus betrachten will.
»Also der Himmel soll sich mit Wolken überziehen?«, fragte der Zwerg nochmals.
»Ja, und geben Sie nur auch einen tüchtigen Regenguss. Ich möchte sehen, wie er sich eine Höhle sucht, ob er sich darin gleich wohnlich einrichtet. Geben Sie ihm einige Zeit, er soll erst merken, dass starker Regen zu erwarten ist.«
Dass der Zwerg seine Helfershelfer hatte, war ja zweifellos, und diesen gab er jetzt seine Befehle. Auf welche Weise? Er sagte es nicht, man fragte ihn deshalb nicht — man brauchte ihn bloß zu beobachten.
Wenn er die rechte Hand nicht immer in der Jackentasche hatte, so steckte er sie doch jedes Mal hinein, wenn sich dort drin in der »künstlichen Natur« etwas ändern sollte. Er hatte in der Tasche einfach einen drahtlosen Telegrafen. Auch die Telefonuhr konnte man ja als solchen verwenden. Man brauchte doch nur den Knopf kurz und lang zu drücken, so entstanden Punkte und Striche durch Klingelzeichen von verschiedener Länge. Hier freilich war wohl eine andere Vorrichtung getroffen.
Der die gebackenen Kuchenfladen Verzehrende hob den Kopf, blickte zum Himmel empor, und die Beobachter wussten sofort, weshalb er es tat. Wenn sie den leisen Wind nicht fühlten, so sahen sie doch, wie sich das Laub der Bäume bewegte, dann auch die dünnen Zweige, zuletzt das Gras am Boden.
»Er mustert auch die Felswände, er überlegt, wie das möglich sein kann in diesem Talkessel, er hat seine vollständige Geisteskraft wieder, für die es in der Natur kein Rätsel geben darf, ohne seine Lösung wenigstens zu versuchen.«
So flüsterte die Indianerin und bewies dadurch, dass man auch ihr hier nicht Unmöglichkeiten hätte vormachen dürfen, über die sich sonst andere Menschen, physikalisch weniger gebildet, gar nicht den Kopf zerbrochen hätten, die ihnen überhaupt gar nicht aufgefallen wären.
Ein starker Wind durfte in diesem von hohen Felswänden eingeschlossenen Talkessel natürlich niemals wehen. Und von schwächeren Winden auch nur ein besonderer — jener, welcher regelmäßig dem Gewitter oder doch einem plötzlichen starken Regen vorangeht, eben dem Gewitterregen, der ja nicht von elektrischen Entladungen begleitet zu sein braucht. Dieser stets kühle Wind konnte und musste in den Talkessel einfallen und an den warmen Felswänden wieder emporsteigen.
Der Himmel begann sich mit Wolken zu überziehen, die schnell immer schwärzer wurden.
»Auch ein Gewitter?«
»Ja, lassen Sie es blitzen und donnern.«
Zunächst murrte es in der Ferne.
Schon hatte der Robinson seine Vorkehrungen getroffen, die darin bestanden, dass er einen brennenden Ast nach einer nahen Höhle trug, die er schon vorhin sich ausgesucht haben mochte, und schnell trockenes Holz zusammentrug.
Immer finsterer war es in dem Talkessel geworden, jetzt zuckte der erste Blitzstrahl über den Himmel, ein furchtbarer Donnerschlag folgte, und nun brach das Unwetter los. Ein einziges Feuermeer, ein ununterbrochener Donner, und dazu prasselte der Regen in Strömen herab.
»Fabelhaft — fabelhaft prächtig!«, staunte besonders Hagen immer wieder.
Während sich die beiden Männer nicht satt sehen konnten an dieser Illusion, die aber doch nicht das Geringste an Realität vermissen ließ, wollte Atalanta diese künstliche Nacht hier drinnen und die natürliche draußen benutzen, um am See einige Kaninchen und Waschbären zu fangen, die gleich hier eingesetzt werden sollten.
Sie wurde von dem Zwerg zurückbegleitet, während Hagen und Littlelu noch hier blieben, obgleich ihnen gesagt wurde, dass sie dies alles auch vorn in der Camera obscura beobachten konnten, diese brauchte nur durch eine besondere Vorrichtung darauf eingestellt zu werden.
Wieder waren zwei Tage vergangen.
Mayor Bernsdorf stand an einem Fenster seiner Wohnung, in seinem eigenen Hause, aus Steinquadern errichtet, das er demnächst mit seiner jungen Frau, die jetzt noch als seine Braut in Deutschland weilte, teilen wollte.
Vor ihm lag der See im Morgensonnenschein. Aber heute sah er anders aus als noch vor zwei Tagen, er war nicht mehr von Booten belebt, von Menschen und Seehunden, die goldene Schätze ans Tageslicht beförderten.
Bis vor einer Woche waren es die japanischen Matrosen gewesen, welche diese Goldfischerei mit acht Seehunden betrieben hatten. Dass diese Japaner die während ihrer Herrin Abwesenheit geförderten Goldschätze bei ihrem heimlichen Abzuge mitgenommen oder doch gut versteckt hatten, war so selbstverständlich, dass die hierher geschickten Regierungsbeamten gar nicht groß danach gesucht hatten. Mayor Bernsdorf war ja deshalb einmal verhört worden, hatte aber auf sein Ehrenwort und noch mehr auf seinen Diensteid hin nicht das Geringste darüber mitteilen können.
Dann hatten Soldaten unter Aufsicht ihrer Offiziere und von Beamten das Fischen des Goldes fortgesetzt. Denn die acht Seehunde hatten sich ihren neuen Herren willig zur Verfügung gestellt, sie suchten von ganz allein den Grund ab, man brauchte ihnen nur die goldenen Teller, gegen welche andere Goldsachen gar nicht in Betracht kamen, aus dem Maule zu nehmen.
Merkwürdig nur war es, wo diese Tiere während der Nacht blieben. Nachdem sie den ganzen Tag unverdrossen gearbeitet hatten, sich nebenher spielend durch Fischfang sättigend, schwammen sie, sobald die Dämmerung anbrach, nach der Felswand, tauchten unter, verschwanden in einem Loche, das ungefähr sechs Meter unter der Wasseroberfläche lag. Am Morgen kamen sie dann aus diesem Loche wieder zum Vorschein.
Wohin nun dieser unterseeische Tunnel führte, das war nicht zu ermitteln. Die Seehunde brauchten doch natürlich Luft, sie schlafen ja überhaupt auf dem Trockenen. Aber innerhalb jener hohlen Felsenregion war kein Bassin und kein anderer Raum zu finden, den die Tiere während der Nacht benutzten. Man hatte zwei Taucher mit, diese hatten den unterseeischen Tunnel untersuchen müssen. Aber der Eingang war viel zu eng, als dass ein Mensch hätte hineinkriechen können, während selbst ein sehr großer und fetter Seehund noch mit Leichtigkeit durchschlüpfte.
Nun, die Hauptsache war ja auch, dass die Seehunde jeden Morgen wiederkamen und ihre Arbeit verrichteten.
Im Laufe der vier Tage hatten sie, obgleich man doch noch gar nicht so mit ihnen umzugehen wusste, rund 3000 solcher Teller heraufbefördert, von denen also jeder, immer zwei Pfund wiegend, einem Werte von 500 Dollars entsprach. Ein Transport von 50 Zentnern des reinsten Goldes war schon nach Pittville und weiter nach New York respektive Washington an das Schatzamt abgegangen. Da besaß ja die Regierung eine Goldquelle, von der sie sich auch nichts hatte träumen lassen. Und diese Goldquelle schien einfach unerschöpflich zu sein. Man musste nur noch mehr Seehunde anschaffen, und jeden Tag konnten Millionen heraufbefördert werden. Allerdings musste das ja einmal aufhören, aber man weiß ja, was für fabelhafte Schätze in jenen alten Tempeln angehäuft gewesen sind. Der Regierungssäckel der Vereinigten Staaten konnte sich dadurch um Milliarden bereichern.
Freilich würden deshalb die Bürger keinen Cent weniger Steuern zu zahlen haben. In den Haushaltungsplänen solch ungeheuerer Staaten wird ja noch mit ganz anderen Summen gerechnet. Die Vereinigten Staaten gewinnen aus Minen jedes Jahr ungefähr für 350 Millionen Mark Gold, und das schon seit 60 Jahren, von solchen Flutwellen wie bei der Goldentdeckung Kaliforniens ganz abgesehen, und dennoch sind die Vereinigten Staaten von Nordamerika nicht etwa sehr reich zu nennen. Bekanntlich kommen in Amerika häufig Geldkrisen vor, dann springt immer England seinem Vetter jenseits des Ozeans mit barem Gelde bei, um eine wirtschaftliche Gefahr zu beseitigen.
Immerhin, das Gold des Sklavensees wurde in Washington schmunzelnd eingestrichen, einige neue Panzerschiffe, die man vielleicht demnächst sehr gut gegen Japan brauchen konnte, würden dabei schon herausspringen.
Doch nur vier Tage währte diese Freude. Da kam jene Nacht.
»In den Felsenwohnungen spukt die tote Indianerin, die rote Atalanta!!«
Mit diesem Rufe waren die dreißig Soldaten und die anderen Männer angerudert gekommen, hatten erzählt, was sie Fürchterliches geschaut, alle dasselbe und jeder doch wieder anders.
Sie waren ausgelacht worden.
»Unsinn! Spuk!«
Man hatte wieder eindringen wollen. Da war das Wassertor geschlossen gewesen, und es gab vorläufig keine Möglichkeit, es zu öffnen, und nach dem Plateau kannte man noch keinen Aufstieg.
Es wurde bis zum Morgen gewartet. Jetzt erst wurde konstatiert, dass auch sämtliche Fenster geschlossen worden waren. Und dann fiel auf, dass sich die Seehunde nicht einstellten. Und da plötzlich begannen die vier Boote, die sich auf dem See befanden, zu sinken, eines nach dem anderen füllte sich mit Wasser, das mit Macht aus dem Boden heraufdrang. Nur drei von ihnen konnten mit Mühe, indem beständig geschöpft wurde, noch an Land gebracht werden, das vierte sank, die Besatzung rettete sich durch Schwimmen, und nur diese Leute konnten aussagen, dass es ihnen gewesen wäre, als ob von oben herab ein Projektil durch den Boden geschlagen sei, und solche Löcher, aber faustgroße, wiesen denn auch die anderen an Land gebrachten Boote auf.
Ein Boot, welches man noch einmal auf den See hinausschickte, erlitt dasselbe Schicksal, plötzlich war am Boden ein großes Loch, durch welches das Wasser mit Macht hereinströmte, und nur das konnte die Mannschaft behaupten, dass dieses Loch nicht von oben durchgeschlagen worden sei, also könne es sich auch nicht um eine Kugel oder irgend ein anderes Projektil handeln. —
Das war vorgestern Morgen geschehen.
Eben stand Paul von Bernsdorf am Fenster und blickte auf die einsame Wasserfläche, die so friedlich im goldenen Sonnenschein dalag.
Da kam hastig sein Freund herein, Dr. Sanden.
»Du, Paul, der Sheriff von Pittville stattet Dir in höchsteigener Person seinen Besuch ab, er ist mit einigen Reitern schon nach Deinem Hause unterwegs.«
»Sein Besuch soll mir sehr angenehm sein, Mister O'Perk ist ein prächtiger Mensch!«, lächelte Bernsdorf.
Der Mayor von Atalantatown war ja von den Offizieren und Beamten schon wiederholt verhört oder vielmehr in aller Höflichkeit um seine Meinung befragt worden. Denn Atalantatown war eine selbstständige Ortschaft, hatte mit der anderen Umgebung des Sklavensees so wenig zu tun wie dort mit den Felsenwohnungen, auch die Goldfischerei ging die Bürger gar nichts an, und ihr Bürgermeister war eben so ein Regierungsbeamter wie jene, die ihn ausfragen wollten, da hatte er nicht etwa einen Vorgesetzten.
Der Sheriff von Pittville war freilich etwas anderes, die neue deutsche Kolonie gehörte zu dessen Gerichtsbarkeit.
Vier Reiter näherten sich dem Hause. Der eine von ihnen, ein durch sein bartloses Gericht noch jugendlich aussehender Mann, der seine wasserdichte Jacke vor sich über den Sattel gelegt und die Hemdsärmel bis an die Achseln aufgekrempelt hatte, an dem Gürtel, der die langen Schäfte der Stiefel festhielt, zwei gewaltige Revolver und ein Bowiemesser, war Mister O'Perk, der Sheriff, der Richter von Pittville.
Über solche amerikanische Sheriffs ist ja schon genug erzählt worden, und die abenteuerlichste Erfindung reicht noch nicht an die Wirklichkeit heran. Wenn sich in Nordamerika drei Familien in drei Häusern oder Hütten zusammentun, so können sie sich als »town« registrieren lassen und einen Sheriff verlangen, den sie allerdings besolden müssen. Und dann ist auch eine gewisse Entfernung von der nächsten Sherifftown dazu nötig.
Es hängt eben mit der Rechtsunsicherheit und überhaupt mit den wilden Verhältnissen zusammen, die in dem gewaltigen Lande selbst in jenen Teilen noch herrschen, die wir schon für durchaus kultiviert halten, weil wir auf der Karte einige schwarze Linien durchgehen sehen, während man in Wirklichkeit oft noch tagelang zu reiten hat, ehe man die nächste Eisenbahnstation erreicht.
Es sind jüngere Rechtsgelehrte, etwa unseren Assessoren vergleichbar, im Notfalle werden aber auch Referendare dazu genommen, das heißt Anwärter, die in Washington unter Aufsicht des Sheriff-General-Inspektors dazu besonders ausgebildet werden. Es sind die tüchtigsten Kerls, müssen mit Revolver und Messer ebenso gut umzugehen wissen wie mit der Feder und müssen dabei einen tadellosen Ruf haben, an ihrem ehrenwerten Charakter darf nicht der geringste Zweifel haften. Denn so ein Sheriff hat Gewalt über Leben und Tod, er ernennt die Geschworenen und vollstreckt sofort das Todesurteil, und wer gegen ihn nur den Finger aufhebt, den schießt er nieder. Er muss sich deshalb freilich verantworten, kann aber nur entlassen, niemals bestraft werden. So hat er ganz die Machtstellung eines Kapitäns auf seinem Schiffe. Das geht ja auch nicht anders, und es handelt sich dabei hauptsächlich darum, um mit aller Macht der in Amerika so beliebten Lynchjustiz entgegenzutreten.
Die vier Reiter sprangen ab, übergaben ihre Pferde zwei hinzuspringenden Männern und betraten das Haus. Bernsdorf empfing sie in dem hierzu bestimmten Zimmer, das einen zwar bäuerischen und durch seine vielen Schnitzereien, die ersten Produkte der Hausindustrie dieser Kolonie, dennoch künstlerischen Eindruck machte.
»Morning, mein lieber Mayor«, rief der Sheriff, der bedeutend älter war, als sein glattrasiertes Gesicht mit den höchst energischen Zügen aussah, »ich bringe hier noch drei Kollegen mit —«
Er stellte die anderen vor, ebenfalls Kriminal- und Polizeibeamte. Mit dem Sheriff, der sein Dienstleben in den Wildnissen schon hinter sich hatte, als Richter von dem doch ansehnlichen Pittville eine gar hohe Stellung einnahm, hatte Bernsdorf schon oft genug zu tun gehabt, und er hatte in ihm den vortrefflichsten Menschen kennen gelernt.
»Ich komme nicht nur als Sheriff von Pittville, sondern als Ihr Sheriff, als Ihr richterlicher Vorgesetzter, der Sie in strenges Verhör zu nehmen hat«, sagte er, dem Bürgermeister noch die Hand schüttelnd. »Ja, Mayor, was ist das hier nun eigentlich für eine Geschichte? Erst aber einen Schluck — halt, Ihr braut doch schon Euer eigenes Bier. Das möchte ich einmal probieren. Und die Schinken, die ich neulich habe in Pittville verfrachten sehen, sahen delikat aus.«
Bei schäumenden Humpen und reichbesetzter Frühstückstafel berichtete der Mayor, ein Beamter nahm das Protokoll auf.
»Hm. Da war das aber viel interessanter, was mir gestern Abend die Soldaten erzählten, sogar was der Polizeikommissar berichtete, obgleich der gar keinen Spuk gesehen, ihn nur durch die Nase seiner Hunde gemerkt hat.«
»Ich bin ja auch gar nicht in den Felsenräumen gewesen!«, lächelte Bernsdorf.
»Und Sie haben sonst nichts von dem sogenannten Spuk gemerkt?«
»Rein gar nichts.«
»Glauben Sie, dass die tote Indianerin wirklich spukt?«
»Sheriff, das sind merkwürdige Fragen — ich glaube doch nicht etwa an Gespenster.«
»Nun, warum denn nicht? Es gibt in Amerika wirklich gebildete und sogar eigentlich ganz aufgeklärte Menschen genug, die von der Existenz von Geistern, spukenden Seelen und dergleichen völlig überzeugt sind.«
»Da haben Sie recht, das hatte ich vergessen — ich aber gehöre nicht zu diesen Geistergläubigen.«
»Ich auch nicht. Sind Sie überzeugt, dass jene Soldaten wirklich irgend etwas Merkwürdiges, was man so Spuk nennt, gesehen haben?«
»Ja, das muss ich wohl. Alle Aussagen der mehr als dreißig Männer lauten gar zu übereinstimmend.«
»Und was Polizeikommissar Spratt aussagt?«
»Der glaubt ebenfalls nicht an Geister.«
»Nein, aber das Verhalten seiner Hunde hat den Mann so konfus gemacht, dass ich ihn gar nicht erst mit hergebracht habe, denn der würde nur Verwirrung mit seinen Aussagen anstiften, und so habe ich überhaupt gar keinen anderen mitgebracht, wir vier stehen hier ganz vorurteilsfrei, wir wollen erst hier die Neuigkeit zu hören bekommen.«
»Ich habe Ihnen gesagt, was ich darüber weiß.«
Jetzt blickten die scharfen Augen des Sheriffs den Bürgermeister ganz durchdringend an.
»Sie wissen wirklich nichts anderes zu berichten?!«
»Sheriff, stellen Sie direkte Fragen, und ich werde der Wahrheit gemäß antworten, jede Antwort nehme ich auf meinen Diensteid.«
»Gut. In der Felswohnung müssen jetzt doch Menschen sein.«
»Das ist keine direkte Frage, auf die ich direkt antworten kann.«
»Glauben Sie, dass sich darin Menschen befinden?«
»Bei mir handelt es sich nicht darum, ob ich glaube oder nicht glaube.«
»Sie sind ein Fuchs, mein lieber Mayor!«
»Ich weiß, was ich auf meinen Diensteid zu antworten habe und worauf nicht.«
»Wissen Sie, ob sich darin Menschen befinden?«
»Ich weiß es nicht. Ich habe seither keinen Menschen hineingehen und herauskommen, keinen an einem Fenster stehen sehen.«
»Ist die Gräfin von Felsmark wirklich tot?«
»Woher soll ich das wissen, ob sie wirklich tot ist?«
»Aber Sie wissen doch von ihrem Tode.«
»Es hat in den Zeitungen gestanden, die hierher kommen, es ist mir aber auch schon vorher telefoniert worden.«
»Sie zweifeln nicht an dieser Meldung?«
Bernsdorf fuhr etwas empor.
»Sie wollen doch nicht etwa sagen, dass sie —«
»Es ist gut, ich glaube Ihnen, dass Sie an jener Meldung nicht gezweifelt haben, nichts von der Wirklichkeit wussten — die Indianerin lebt noch.«
Jetzt schnellte Bernsdorf von seinem Stuhle empor.
»Sie lebt noch, allmächtiger Gott, sie lebt noch — Otto, Otto, hast Du es gehört?!«
Doktor Sanden trat durch die Nebentür. Er war nicht minder freudig bestürzt über das Gehörte. Nein, hier in dieser Kolonie hatte man keinen Zweifel in die Richtigkeit jener Meldung gesetzt.
»Die sechs Goldgräber«, fuhr der Sheriff fort, »haben sich verplappert. Sie hatten von der Geschichte mit der entsprungenen indianischen Gräfin gehört, die Million Dollars stach ihnen in die Nase — sie haben ein vagabundierendes Indianermädchen getötet, ihr so einen Anzug gemacht und sie tätowiert, wie ja alles zur Genüge beschrieben worden ist, und haben die Leiche in der Nähe eines Ameisenhaufens vergraben. Die ausgezahlte Prämie ist ihnen wieder abgenommen worden, an der Million fehlten nur zwei Dollars, wofür sie sich zwei Flaschen Whisky gekauft hatten, die an ihnen in der Trunkenheit zu Verrätern wurden.
Nun ist deshalb ja noch nicht erwiesen, dass die indianische Gräfin nicht auf andere Weise ihren Tod gefunden hat, aber zu dieser Annahme liegt sonst gar kein Grund vor. Was ist nun hieraus zu schließen, Herr Mayor?«
»Dass die Gräfin persönlich zurückgekehrt ist und den ganzen Spuk arrangiert hat, um die neuen Bewohner aus ihrer Felsenbehausung hinauszugraulen«, entgegnete Bernsdorf offen.
»So ist es«, bestätigte der Sheriff, »sie selbst hat sich den Geisterhelden in Fleisch und Blut gezeigt. Freilich behaupten diese Geisterhelden ja, das wäre gar nicht möglich, der Indianerkopf und die ganze Gestalt hätte sich an den verschiedensten Stellen zu gleicher Zeit gezeigt, aber was haben die denn in ihrer Phantasie alles gesehen, und außerdem lässt sich das doch alles machen, die hat eben mit einer Laterna magica gearbeitet, die hat doch lauter Krimskrams darin, und ich vermute, dass sie auch noch Helfershelfer bei sich hat, jedenfalls sogar jene japanischen Matrosen.«
»Sehr leicht möglich.«
»Sie haben in den letzten zwei Tagen oder schon vorher nichts davon bemerkt?«
»Keine Spur, Herr Sheriff.«
»Gut, ich glaube Ihnen. Was sagen Sie aber nun dazu, dass sich dort drin noch die Miss Morgan und Leutnant Torres befinden?«
»Was soll ich dazu sagen? Dabei ist mir nur eines unerklärlich.«
»Und das wäre?«
»Dass die Offiziere mit ihren Soldaten ihren Kameraden einfach im Stich lassen.«
»Ja, was sollen sie denn tun? Sie haben versucht, mit Booten hinzurudern. Die Boote werden auf rätselhafte Weise angebohrt, dass sie sinken. Und anders als auf dem Wasser ist der verschlossene Eingang doch nicht zu stürmen.«
»Mich wundert, dass noch kein Geschütz hier ist, um die Felswohnung zu bombardieren, wenigstens einmal nach den Fenstern zu schießen!«
»Die Geschütze sind bereits unterwegs. Die Hauptsache aber ist, dass den Offizieren behördlicherseits ein weiteres Vorgehen gegen den Felsen untersagt worden ist. Denn dass jene tote Indianerin nicht unsere Gräfin ist, das ist schon seit vorgestern Abend bekannt, die Sache ist nur noch geheim gehalten worden. Haben Sie eine Erklärung dafür, wie die Boote durchlöchert werden?«
»Nein.«
»Hat die Gräfin das schon vorher gekonnt, oder Ihnen wenigstens eine Andeutung gemacht, dass sie so etwas gegebenen Falles könnte?«
»Nein, gar nichts.«
»Sie kennen keinen anderen Eingang in die Felswohnung?«
»Nein.«
»Sie können sich mit der Gräfin nicht telegrafisch oder telefonisch in Verbindung setzen?«
»Nein. Die Gräfin hat mit Absicht keine Leitung zwischen unserer Kolonie und ihrer Behausung herstellen lassen, um nicht von der Außenwelt und von Zeitungsreportern und anderen Neugierigen ständig gestört zu werden. Wollte sie oder jemand anderes von ihren Felsenmaulwürfen nach Pittville telegrafieren oder sprechen, so kam der Betreffende in unsere Kolonie auf das Telegrafenzimmer.«
»Gut. Nun also habe ich von meiner vorgesetzten höchsten Behörde den Befehl erhalten, diese Sache, die sich auf einem mir unterstellten Revier abspielt, weiter zu untersuchen und die entsprungene Zuchthäuslerin, wenn sie sich hier aufhält, wieder dingfest oder — unschädlich zu machen!«
»Sie zu töten!«, ergänzte oder verbesserte Bernsdorf.
»Sie kennen ja den Wortlaut jener Bekanntmachung. Und Sie werden mich unterstützen, Herr Mayor?«
»Ich stehe Ihnen ganz zu Diensten, Herr Sheriff, ich kenne meine Pflichten.«
»Was halten Sie nun für besser: Wollen wir zusammen einmal hinfahren oder Sie erst allein?«
»Um eine mündliche Anknüpfung zu versuchen? Fahren Sie lieber gleich mit.«
»Das denke ich auch. Ich müsste Ihnen sonst erst gar zu viele Instruktionen geben. Es könnte nur sein, dass auch unser Boot zum Sinken gebracht wird.«
»Daran glaube ich nicht, sobald man merkt, dass wir uns in ganz friedlicher Absicht nähern. Wir müssen die weiße Parlamentärflagge zeigen.«
»Tun wir das.«
»Und wenn uns eine Unterredung gewährt wird?«
»Herr Mayor, ich weiß, was Sie mit dieser Frage meinen. Glauben Sie nicht, ich werde die Gräfin, sobald sie sich zeigt, niederschießen. Die wird doch ihre Sicherheitsmaßregeln treffen, und abgesehen davon, dass ich Familienvater bin, kann ich auch das Leben meiner Gefährten nicht so aufs Spiel setzen — ich weiß schon, wann ich zu schießen habe und wann nicht. Darüber können Sie ohne Sorge sein. Außerdem wird die Gräfin doch daraufhin unser Ehrenwort abfordern, was unter allen Umständen gehalten wird, keiner dieser Herren ist ein Fanatiker.«
Das Frühstück war beendet und dann war auch nichts weiter zu besprechen.
Auch Dr. Sanden begab sich mit in das Boot, weitere Männer wurden nicht mitgenommen, die Herren ruderten selbst.
Nach kurzer Fahrt war die Stelle erreicht, an der sich das Felsentor befand, wovon äußerlich aber nicht das Geringste zu bemerken war, dem Sheriff und den anderen Herren musste es erst gesagt werden.
»So, dann sind wir ja da, wo der Maurer ein Loch gemacht und es wieder geschlossen hat, und unser Boot hat unterdessen auch kein Leck bekommen. Das ist schon ein friedliches Zeichen. Ja, was aber nun weiter? Wo ist hier eine Klingel oder ein Klopfer?«
»Wir sind sicher schon beobachtet worden.«
»Das glaube ich wohl, aber das ermöglicht uns noch keinen Eingang. Wollen Sie nicht einmal Ihre Stimme erheben, Herr Mayor?«
Bernsdorf stand auf.
»Frau Gräfin Atalanta von Felsmark, wir bitten Sie um eine Unterredung!!«, rief er mit schallender Stimme.
Sofort entstand in der Höhe der ersten Etage an einer Stelle, wo niemand ein Fenster vermutet hätte, eine viereckige Öffnung, daran zeigte sich die Indianerin, die Arme über der Brust verschränkt.
»Was wünschen die Herren?«
Auch der Sheriff war schnell aufgestanden.
»Ich bin der Sheriff von Pittville —«
»Ich weiß es«, wurde er unterbrochen, »und gut, dass Sie gekommen sind. Verkünden Sie Ihrer Behörde, oder Ihrer Regierung, was ich Ihnen jetzt sage:
Ich bin zu Unrecht des Aufruhrs und Hochverrates angeklagt und deshalb auch zu Unrecht zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt worden.
Ich verzichte auf eine Wiederaufnahme des Prozesses, da ich unterdessen zur Überzeugung gekommen bin, dass es in diesem Lande doch keine Gerechtigkeit für mich gibt.
Ich verzichte auf jede Gnade und Amnestie, die man doch immer wieder rückgängig machen kann.
Ich greife zur Selbsthilfe.
Wer mein Gebiet betritt, den betrachte ich als meinen Feind und gehe dementsprechend gegen ihn vor.
Zu diesem meinem Gebiete gehören nicht nur, wie selbstverständlich, alle Inseln, sondern auch der ganze See, das Wasser.
Das Boot, welches meinen See befährt, wird von mir versenkt — sofort versenkt, nicht nur leck gemacht.
Die deutschen Kolonisten gehen mich nichts an, diesen habe ich das Südufer abgetreten. Aber auch ihnen verbiete ich fernerhin den See zu befahren oder zu durchschwimmen. Anderen Falles haben sie gleichfalls meine Gegenwehr zu erwarten, die mit dem Tode des Betreffenden enden kann.
Auf das mir bisher gestohlene Gold und Geld verzichte ich, weitere Diebstähle werde ich aber unmöglich machen.
Miss Morgan und Leutnant Torres bleiben vorläufig in meiner Gefangenschaft.
Die Soldaten und alle sonstigen Menschen haben mein Gebiet innerhalb von zwei Stunden bis auf den letzten Mann zu verlassen, sonst ist ihr Leben nicht mehr geschützt, und ich fühle mich unverantwortlich für Blut, welches fließen wird, denn ich habe gewarnt.
Auch Ihr Boot hat in zehn Minuten am Ufer zu sein, sonst wird es versenkt.
Ich habe dem kein Wort hinzuzufügen und nehme keine Entgegnung an.«
Das Fenster wurde wieder geschlossen.
»Das war kurz und bündig«, sagte der Sheriff, »nun wissen wir, woran wir sind. Eigentlich müsste ich sie auffordern, sich der Staatsgewalt zu unterwerfen, es ist sogar meine Pflicht, aber ich geniere mich förmlich, hier noch weiter herumzubrüllen — nein, ich tu's nicht.«
»Es wäre auch ganz zwecklos«, entgegnete Bernsdorf, seine Taschenuhr ziehend. »Hingegen mache ich Sie darauf aufmerksam, dass es genau vierzehn Minuten nach neun ist und dass wir genau neun Uhr vierundzwanzig Minuten im Wasser liegen werden. Denn dass die genau nach zehn Minuten unser Boot versenken wird, daran zweifle ich nicht.«
»Ich auch nicht. Ich möchte sogar einmal sehen, wie das Leck im Boot entsteht.«
»Schön, dann aber schlage ich vor, dass wir erst etwas näher ans Ufer rudern, damit wir dann nicht gar so weit zu schwimmen haben.«
Diese Eventualität wurde also von den Herren ganz humoristisch aufgefasst, und sie waren auch wirklich entschlossen, die Katastrophe abzuwarten.
In zehn Minuten konnten sie die Bootsstation von Atalantatown bequem erreichen. In einer Entfernung von etwa hundert Metern davon aber stoppten sie, beobachteten das Wasser, die Felswand und die Uhr.
»Genau neun Uhr dreiundzwanzig Minuten«, sagte .Bernsdorf, »wenn sie pünktlich ist, muss das Loch in einer Minute da sein. Dass wir sie zu einem Schiffbruch herausfordern, das muss sie doch bemerken.«
»Auf welche Weise mag sie denn nur —«
Plötzlich war es nicht anders, als ob das Boot unten von vorn nach hinten aufgeschlitzt würde, oder es war vielmehr wirklich so, es spaltete sich einfach auseinander. Im Nu lagen die fünf Herren im Wasser, mussten schwimmen oder konnten sich auch an den beiden Bootshälften anklammern.
»Der ihre Uhr geht eine halbe Minute vor«, sagte der Sheriff immer noch mit Humor, als er schon im Wasser pustete.
Als sie aber das Ufer erreicht hatten, war es mit dem Humor denn doch vorbei.
In der Kolonie hatten sich unterdessen einige Offiziere jener Kompanie eingefunden, die vom Ostufer aus die Goldfischerei betreiben oder doch die Arbeiter bewachen sollten. Es waren schon wiederholt Diebstähle versucht worden.
Der plötzliche Untergang des Bootes, den sie beobachtet, hatte sie mit neuer Bestürzung erfüllt, wie jedes Mal, wenn eines ihrer Boote auf rätselhafte Weise ein Leck erhielt. Der Bericht des Sheriffs erzeugte einen Sturm der Entrüstung.
»Was, wir sollen vor dieser tollen Indianerin das Feld räumen?! Wir müssen vielmehr unseren Kameraden befreien, den Leutnant Torres!«
»Darüber habe ich Ihnen nichts zu befehlen, meine Herren«, entgegnete der Sheriff gleichmütig, »ich richte nur aus, was mir die Gräfin aufgetragen hat.«
»An Ihnen ist es, diese Verbrecherin unschädlich zu machen!«
»Ja, dazu muss ich sie aber erst haben, und dazu müsste ich Sie, meine Herren, erst auffordern, mit Ihren Soldaten diese Felsenfestung im Sturm zu nehmen. Wollen Sie meiner Aufforderung nachkommen? Aus strategischen Gründen brauchen Sie meiner Aufforderung nicht Folge zu leisten. Das müssen Sie besser wissen als ich, ob eine Erstürmung möglich ist oder nicht, ich bin gar kein Soldat gewesen.«
So gingen die Reden hin und her. Man wusste nicht, was da zu tun sei. Solch ein Fall war ja noch gar nicht dagewesen. Und dass man auf den Befehl dieses Weibes hin dieses Gebiet räumen solle, das war doch ganz ausgeschlossen, die Miliz der glorreichen Vereinigen Staaten hätte sich mit unauslöschlicher Schande bedeckt.
»Davon kann keine Rede sein«, sagte der mitanwesende Captain, der Hauptmann jener Kompanie, welche auch die anderen dreißig Soldaten, die damals geflohen waren, aufgenommen hatte. »Warten wir nur erst einmal ab, was daraus wird.«
Es war der beste Vorschlag. Dann wollten sie aber auch an Ort und Stelle sein, also dort, wo die Kompanie lag, am Ostufer des Sees.
Bis dahin war es ein scharfer Ritt von einer Stunde, so hatten sie noch eine dreiviertel Stunde Zeit, ehe die Frist abgelaufen war. Es wäre möglich gewesen, bis dahin noch über die Grenze zu gehen, was aber nicht ausgeführt wurde.
Desto mehr wurde darüber debattiert, auf welche Weise denn die Indianerin sie von hier vertreiben wolle. Bis nach jener Felswand hin, also über den ganzen langgestreckten See hin, waren es rund acht englische Meilen. Ja, fünfzehn Kilometer weit tragen moderne Geschütze, Küsten- und Schiffskanonen sogar 20 Kilometer weit. Und an Bord ihres »Mohawks« hatte diese Indianerin einmal in spielender Weise gezeigt, dass sie über noch ganz andere Geschütze verfügte, wenigstens hinsichtlich der Treffsicherheit. Von der Schussweite hatte sie keine Probe gegeben, und jenes Geschütz hatte zu denjenigen Geheimnissen des Sklavensees gehört, das nicht gezeigt wurde, niemand hatte das Instrument zu sehen bekommen, mit dem damals der Schuss, welcher auf dem Jefferson-Platze in San Francisco die Statue der Gerechtigkeit an den Füßen abgebrochen hatte, abgegeben worden war.
Es lässt sich denken, welche Aufregung in dem Zeltlager herrschte, welche Mittel alle erwogen wurden, deren sich die Indianerin bedienen könnte, um ihre Widersacher von hier zu vertreiben.
»Meine Herren«, sagte Bernsdorf, der mitgekommen war, »Sie wissen, dass ich mit der Gräfin von Felsmark nicht etwa im Bunde bin. Sie hat uns ein großes Stück ihres ehemaligen Gebietes geschenkt, wir haben unsere Kolonie ihr zu Ehren Atalantatown genannt, wir sind ihr äußerst dankbar, aber sonst haben wir gar nichts weiter mehr mit ihr zu tun. Und aus Dankbarkeit gegen sie würde ich ihr niemals auch nur ein Huhn verkaufen oder gar heimlich zustecken — ich nicht — obgleich ich sonst kein undankbarer Mensch bin. Aber jetzt bin ich kein freier Mensch, sondern bin der Mayor von Atalantatown, und jede Gefälligkeit, die ich dieser entflohenen Zuchthäuslerin erweise, könnte alle Kolonisten, die sich mir anvertraut haben, in die schwersten Unannehmlichkeiten bringen. Da müsste ich erst mein Amt niederlegen, dann könnte ich tun und lassen, was ich wollte.
Weshalb ich dies sage? Ich wollte nur sagen, dass ich trotz alledem den Charakter dieser indianischen Gräfin sehr gut kenne. Ich halte sie niemals für fähig, dass sie etwa hier zwischen die Soldaten mit gehacktem Blei schießt. Dazu ist die viel zu edel, viel zu gutmütig!«
Diese Worte verfehlten nicht ihre beruhigende Wirkung. So verging unter Warten auch die letzte Viertelstunde. Wieder war es Bernsdorf, der darauf aufmerksam machte, dass die Frist abgelaufen sei.
»Meine Herren, um neun Uhr vierzehn Minuten machte mir die Gräfin die Mitteilung von ihrem Vorhaben, und wenn sie wiederum so pünktlich ist wie vorhin, dann müsste jetzt —«
Erschrocken fuhr alles zusammen. Ein schwacher Knall war ertönt. Alles blickte nach oben, denn von dort musste es gekommen sein. Aber kein Rauchwölkchen war gegen den azurblauen Himmel in der völlig windstillen Luft zu unterscheiden. Und doch war dies ganz sicher die Einleitung zu dem Angriff einer unsichtbaren Macht gewesen.
Wohl waren die Soldaten schon immer bereit gewesen, niemand hatte sich aus dem Lager entfernen dürfen, aber erst jetzt erscholl das Kommando, welches die ganze Kompanie, zirka vierhundert Mann, unter die Gewehre rief. Auch die Arbeitsmannschaften und sonstigen Leute mussten sich in gefechtsbereiter Linie aufstellen.
Bernsdorf war der einzige, der in einiger Entfernung davon stand.
Da, es war kaum eine halbe Minute nach jener rätselhaften Detonation vergangen, sah er, wie die linken Flügelmänner zu taumeln begannen, sie ließen ihre Gewehre fallen, stürzten zu Boden, und es sah nicht anders aus, als ob ein Kind eine Reihe Bleisoldaten umwirft, so sank auch die doppelte Reihe dieser lebendigen Soldaten zu Boden, die Offiziere und alle, die auch vor der Front standen, blieben regungslos liegen.
Noch traute Bernsdorf seinen Augen nicht, er glaubte zu träumen, als ihn plötzlich, ohne dass er irgend einen auffälligen Geruch verspürte, eine Betäubung überkam, mit einem Male schwanden ihm die Sinne, auch er stürzte bewusstlos zu Boden.
Mehr als eine Stunde verging. Immer höher stieg die Herbstsonne und betrachtete neugierig die ganze Kompanie Soldaten, die samt ihren Offizieren und einigen Zivilisten da so friedlich im niedergestampften Grase schlummerten.
Oder war alles tot? Nein, ruhig ging bei jedem Manne der Atem. Jetzt machten einige auch Bewegungen, begannen sich behaglich zu räkeln.

Der Sheriff, der zufällig etwas hinter der Front gestanden hatte, als der allgemeine Sturz kam, war der erste, der die Augen aufschlug, sich halb emporrichtete, dann mit einem unterdrückten Schrei vollends aufsprang.
Mit beiden Händen fuhr er sich gegen den Kopf. Nicht dass ihm dieser geschmerzt hätte, nicht im Geringsten. Der war ihm so klar, als hätte er den gesündesten Schlaf hinter sich.
Aber sonst war ja freilich aller Grund vorhanden, dass er mit stieren Augen um sich blickte.
»Wir sind betäubt worden — sind umgefallen — haben geschlafen.«
Zunächst riss der Sheriff seine Uhr hervor.
»Gleich halb eins — länger als eine Stunde haben wir so dagelegen —«
Dann begann sein Auge erst recht wieder auf die nächsten Schläfer zu stieren.
Er sah etwas — auf jeder Stirn einen schwarzen Fleck —
Er beugte sich über den nächsten Mann, obgleich er es gar nicht nötig hatte, denn es war deutlich genug —
Jeder Mann trug auf der Stirn ein großes, schwarzes Signum, einen Fisch darstellend, der von einer Schlange umwunden war — das Totem der Mohawks!
Auch die Hand dieses eisernen Mannes zitterte, als sie die Stirn des nächsten Schläfers betastete.
Nein, das Totem war nicht eingebrannt, wie es sonst die nordamerikanischen Indianer tun, es war nur schwarze Farbe, noch etwas feucht, und ließ sich verwischen.
Da hatte der Sheriff an seiner eigenen Stirn ein so eigentümliches Gefühl — natürlich, auch er war doch nicht verschont geblieben, so wenig wie der Captain oder dort Bernsdorf —
Aber er fühlte an seiner Stirn noch etwas anderes als feuchte Farbe, ein Blättchen Papier, er löste es ab —
Auf dem Blättchen Papier stand etwas mit Bleistift geschrieben, und der Sheriff kannte schon die Schriftzüge der steckbrieflich Verfolgten:
Das nächste Mal brenne ich mein Totem ein.
Atalanta, die letzte Mohawk.
Und wieder eine Stunde später lag dieses östliche Ufer verlassen da, weit und breit war kein Mensch mehr zu erblicken.
Und in ganz Amerika würde sich kein Soldat mehr finden, der sich nach dem Sklavensee kommandieren ließ.
Gegen Menschen wollten sie kämpfen, und wenn es die leibhaftigen Teufel selbst gewesen wären — nicht aber gegen unsichtbare Mächte.
Leutnant Torres saß in einer behaglich eingerichteten Felsenkammer und schaute dem Rauche seiner Shagpfeife zu, wie er oben an der Decke durch ein kleines Loch abzog.
Er hatte noch zwei andere solche Räume zu seiner Verfügung, es fehlte ihm absolut nichts, nur kein Fenster gab es hier, also auch kein Tageslicht; dieses wurde durch elektrisches ersetzt.
Und nur hier in diesem Raume befand sich eine Tür, aus Eisen oder wahrscheinlicher aus Omnihilit. Sonst waren die Räume nur durch Öffnungen verbunden, die mit Portieren verhangen waren.
Ein Klingeln erscholl, so leise, dass es auch einen unruhigen Schläfer nicht geweckt hätte.
Torres stand auf und trat an das an der Wand hängende Telefon.
»Hier Torres.«
»Ihr bestellter Tabak ist da«, sagte eine Stimme, die unverkennbar einem Japaner angehörte.
»Aaaah! Schon?«
Er ließ durch einen Druck neben dem Telefon eine Klappe aufspringen, in der ziemlich großen Öffnung der Wand standen drei Blechbüchsen, die eine, wie schon immer die Aufschrift verriet, gefüllt mit gelbem »Honey Dew«, die zweite mit braunem »Seddle Leaf«, die dritte mit schwarzem »Navy Cut«, halbfein in lange Streifen geschnittene und wieder zusammengepresste Tabaksblätter, die beliebtesten Sorten in Nordamerika und England, am besten gemischt schmeckend, aber nicht jedem zugänglich.
»Wahrhaftig! Wo bekommen Sie denn das nur immer her?«
»Wir haben alles, Herr Leutnant.«
»Ja, mein lieber Toki —«
»Noki, Herr Leutnant.«
»Na, dann mein lieber Noki — ich möchte wirklich wissen, was man hier nicht bekommt?«
»Sie brauchen nur zu fordern.«
»Nun dann möchte ich heute Mittag einen ganzen Elefanten haben, durchgebraten, die Haut recht knusprig.«
Die quäkige Mongolenstimme lachte.
»Wird besorgt, Herr Leutnant. Befehlen Herr Leutnant sonst noch etwas Besonderes zum Mittagessen?«
»Ich hätte einmal Appetit nach Huhn und Reis mit Curry.«
»Wird besorgt, Herr Leutnant. Sonst noch ein Spezialgericht?«
»Und — und — ich war einmal mit einem Deutschen zusammen, der schwärmte immer von — von — na, wie hieß doch gleich das Teufelszeug, das man in ganz Amerika nicht bekäme — von — ja richtig, jetzt fällt's mir wieder ein — Frankfurter Wurst und Sauerkraut.«
»Was war das?«
Es dauerte lange, ehe der Amerikaner dem Japaner die deutsch gesprochenen Worte verständlich gemacht hatte, und das war umso schwieriger, weil er sie nach dem englischen Alphabet buchstabierte, wodurch eigentlich etwas ganz anderes herauskam, für Engländer aber immerhin verständlich.
»Frankfurter Wurst mit Sauerkraut. Also das ist etwas zu essen?«
»Jawohl, ich glaube gar, es ist das Nationalgericht von vielen Deutschen.«
»Einen Augenblick, Herr Leutnant.«
Es dauerte länger, aber doch nur eine halbe Minute, bis die Antwort kam.
»Frankfurter Wurst und Sauerkraut — jawohl, Herr Leutnant, das können Sie heute Mittag bekommen.«
Der Herr Leutnant machte aus seinem Staunen kein Hehl, dann aber auch ein ganz besonderes Gesicht.
»Aaaah, nun ist für mich das Rätsel gelöst, woher Ihr Felsenmaulwürfe alle die verschiedenen Gerichte bekommt, wie man sie auch fordern mag! Ihr habt hier ein reich assortiertes Lager von Konserven, von schon gekochten Gerichten aller Art, die man nur zu wärmen braucht. Nicht wahr, so ist's?«
»Herr Leutnant, Sie dürfen fordern, was Sie wollen, aber keine solche Fragen stellen!«
»Na gut. Und dass ich nicht vergesse — das Badewasser war heute früh so heiß, dass ich erst eine halbe Stunde blasen musste, ehe ich hineinsteigen konnte, und noch jetzt fühle ich mich wie ein rotgekochter Krebs.«
»Aber das ist doch des Herrn Leutnants eigene Schuld, Sie brauchten doch nur den kalten Wasserhahn aufzudrehen.«
»Gedreht habe ich wohl, aber herauslaufen tat nichts.«
»Nicht?! Funktionierte er denn gestern auch nicht?«
»Gestern brauchte ich kein kaltes Wasser nachlaufen zu lassen.«
»Es muss kaltes Wasser kommen, es ist alles in Ordnung. das ist dann Tulas Schuld, ich bitte für meinen Kameraden um Entschuldigung«, lautete die Antwort des Japaners, auch als Matrose von vollendeter Höflichkeit.
»Sonst noch etwas, Herr Leutnant?«
»Ich wüsste jetzt nichts.«
»Dann bitte Schluss — halt! Soeben fragt die Frau Gräfin an, ob sie den Herrn Leutnant besuchen darf.«
»Es ist mir sehr angenehm.«
Torres kehrte auf seinen Stuhl zurück, klopfte die Pfeife aus, riss aus jeder der drei Büchsen ein Büschelchen, verrieb den Tabak zwischen den Händen, stopfte sich die Pfeife, und als sich die Tür öffnete und die Indianerin eintrat, ließ er sich durchaus nicht stören, blieb sitzen, brannte die Pfeife an und paffte, ruhig den Damenbesuch anblickend.
Denn es war nicht das erste Mal, dass die Gräfin zu ihm kam, und er wusste, dass dieser Besuch genau so ausfallen würde wie die bisherigen.
Die Gräfin trug ein indianisches Kostüm und sie war und blieb auch eine ganz waschechte Indianerin. Und dieser Leutnant war ein Hinterwäldler, der den indianischen Charakter kannte.
Sie blieb in der offenen Tür stehen, die Arme über der Brust verschränkt, und blickte den Gefangenen unverwandt an, und der blickte sie ebenso an, ob er nun aß oder rauchte oder sonst etwas machte.
So hatte sie es einmal schon auf zehn Minuten gebracht, was für so etwas doch eine kleine Ewigkeit bedeutet, und dann war sie wieder gegangen. Ohne ein Wort zu sprechen. Sie wollte sich den Gefangenen nur einmal besehen. Und wenn er Wünsche hatte, so konnte er das telefonisch der Dienerschaft mitteilen. Sie selbst war für ihn nicht zu sprechen, gab einfach keine Antwort. Aber dieser Hinterwäldler gab sich auch gar keine Mühe erst, der ein Wort herauszulocken.
Diesmal aber währte es nur fünf Minuten, dass sie ihm unverwandt in die Augen blickte, und da brach sie das Schweigen.
»Herr Leutnant Torres!«
»Frau Gräfin?«
»Ich traue Ihrem Ehrenwort.«
»Können Sie.«
»Ich lese in Ihren Augen, dass man Ihrem Ehrenwort trauen kann.«
»Hm. Und?«
»Geben Sie mir Ihr Ehrenwort?«
»Worauf?«
»Dass Sie nichts verraten.«
»Was nicht verraten?«
»Dass wir hier das physikalische Problem gelöst haben, jeden Gegenstand durchsichtig zu machen.«
»Dass Sie sich selbst unsichtbar machen können, meinen Sie.«
»Ja — wie man sich so ausdrückt.«
»Und wenn ich daraufhin mein Ehrenwort gebe?«
»Dann sind Sie frei.«
»Kann ich nicht.«
»Weshalb nicht?«
»Weil ich von meinen Vorgesetzten verhört werde, da darf ich nichts verschweigen, am wenigsten, wie hier der Spuk zustande gekommen ist.«
»Davon wissen Sie gar nichts.«
»Aber ich muss doch aussagen, was ich weiß oder doch zu wissen glaube.«
»Sie geben daraufhin Ihr Ehrenwort auch unter keinen sonstigen Bedingungen?«
»Nein.«
»Ihr letztes Wort?«
»Ist es in dieser Beziehung.«
»Dann bleiben Sie mein Gefangener.«
Der Leutnant stopfte den Tabak nach, paffte und zuckte die Achseln.
»Mein Gefangener Zeit Ihres Lebens.«
»Well. Mir haben zwei ganz verschiedene Medien prophezeit, dass ich 83 Jahre 4 Monate und 17 Tage alt werde — morgen habe ich meinen 38. Geburtstag — well, so bleibe ich noch 45 Jahre 4 Monate und 18 Tage bei Ihnen — well. Hoffentlich bleibt das Essen immer so gut.«
»Geben Sie mir Ihr Ehrenwort, dass Sie nicht zu entfliehen versuchen.«
»Und dann?«
»Dann können Sie sich hier überall frei bewegen, durch jede Tür gehen, welche Sie zu öffnen imstande sind.«
»Auch unter Anwendung von Gewalt?«
»Ja.«
»Dann können Sie mir doch gleich diese Freiheit geben und brauchen mir nicht erst mein Ehrenwort abzunehmen.«
Die Indianerin wiegte den Kopf mehrmals hin und her, sie lächelte sogar, mochte es auch ein sehr düsteres und spöttisches Lächeln sein.
»Eigentlich haben Sie da recht — ja. Aber unter solchen Verhältnissen kommen Sie niemals auf das Plateau hinauf, das ich Ihnen sonst ebenfalls zur Verfügung stellen würde, dass Sie sich wirklich auch im Freien bewegen können.«
»Nein, Frau Gräfin, auf meine Flucht werde ich stets sinnen, das bin ich der Fahne schuldig, der ich Treue geschworen habe. Ich muss so bald wie möglich zu ihr zurückzukehren versuchen.«
»Aber können Sie dabei nicht wenigstens tätliche Angriffe unterlassen?«
»Auf meine Wärter und Wächter?«
»Auf alle Menschen, die Ihnen hier innerhalb dieser Felswände begegnen.«
Jetzt war es der Leutnant, der seinen Kopf hin und her wiegte.
»Ja, das kann ich versprechen. Das geht nicht gegen meine Dienstpflicht. Ich werde hier anständig behandelt und werde mich deshalb auch nicht von einer gewalttätigen Seite zeigen.«
»Geben Sie Ihr Ehrenwort.«
»Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass ich, um meine Freiheit zu gewinnen, niemals gegen einen Menschen handgreiflich vorgehen werde. Sollte ich meinen Entschluss ändern, so würde ich Sie hiervon zuerst benachrichtigen, und zwar so, dass Sie noch Zeit hätten, Gegenmaßregeln zu treffen.«
»Gut. Alle Türen, die Sie öffnen können, stehen Ihnen zur freien Benutzung — auch Felswände können Sie durchbrechen. Man wird Sie daran nicht einmal hindern. Gut.«
Und die Indianerin wandte sich und verließ den Raum, diesmal die Tür hinter sich offen lassend.
Der Leutnant stand auf und streckte sich behaglich.
»Wenn nur alle Menschen so wären wie diese Indianer und speziell wie diese Indianerin, dann ließe es sich besser leben auf Erden, dann würde es viel leichter sein, mit den Geistern in Verbindung zu kommen.«
Er trat in den nächsten Raum, der ganz nackt war, in den er nur bei seiner Durchführung hierher gekommen war — der Sicherheitsraum, den die Tierbändiger beim Betreten des Raubtierkäfigs benutzen. Jetzt stand auch die zweite Tür offen. Sie führte auf einen Korridor.
Soeben ging ein kleiner, dicker Mann vorüber.
»Morning, Leutnant.«
Torres hatte ihn gesehen, als er festgenommen und hierher transportiert worden war, hatte ihn schon früher im Zirkus auftreten sehen, schon als Kind mehrmals und später noch, hatte sich über ihn das Herz aus dem Leibe lachen wollen.
»Morning, Mister Littlelu.«
»Na, wie schmeckt die Freiheitsluft im zweiten Grade? Wir wissen schon alles. Ich gratuliere. Kommen Sie mit?«
»Wohin?«
»Ich will gerade etwas in Augenschein nehmen, Ihnen etwas vorzaubern.«
»Auf spiritistischem Wege?«
»Hören Sie mir bloß auf mit Ihrem Spiritismus! Sind Sie denn noch immer nicht kuriert von Ihren abgeschiedenen Seelen und Astrallampen?«
»Ja, wieso denn? Sie meinen, weil sich damals der Spuk auf eine physikalisch-wissenschaftliche Ursache zurückführen ließ? Nein, deshalb ist mein Glaube nicht im mindesten erschüttert. Das ist doch auch ganz einfach. Sobald der Mensch stirbt, löst sich seine Seele —«
Schnell hielt sich Littlelu beide Ohren zu.
»Hören Sie auf, hören Sie auf! Sie haben der Gräfin Ihr Ehrenwort gegeben, nicht gewaltsam gegen uns vorzugehen. Wenn Sie noch einmal von Ihren abgeschiedenen Seelen anfangen, zeihe ich Sie des Wortbruches. Ich mag von diesem Zeuge nichts hören.«
»Sie werden auch kein Wort mehr von mir darüber zu hören bekommen, einem Ungläubigen ist nun doch einmal nicht zu helfen, er wird nicht hören und sehen wollen, wenn auch die Toten wiederkommen.«
»Na, dann kann ich ja meine Ohren wieder aufmachen«, sagte Littlelu und tat es. »Also kommen Sie mit?«
»Ich habe nichts vor, weiß nicht, wo ich mich hier zuerst hinwenden soll.«
»Kommen Sie, ich werde Sie in die Geheimnisse des Sklavensees einweihen, welche Benennung ja schon ein populäres Schlagwort geworden ist.«
»Ach, das ist ja vortrefflich! Ich habe schon so viel von diesen Geheimnissen zu hören bekommen, und wenn ich sie nun gar sehen soll, dann bereue ich meine Gefangenschaft hier nicht, wenn ich sie überhaupt schon jemals bereut hätte!«
»Was soll man Ihnen denn hier von den Geheimnissen des Sklavensees erzählt haben?«
»Nun, es gibt doch genug Menschen, welche davon erzählen können —«
»Wer denn?«
»Nun, auf dem Zauberschiff in San Francisco wurden sie doch vorgeführt —«
»Ach, das ist doch gar nichts gewesen, was da vorgeführt wurde!«, erklang es verächtlich ans Littlelus Munde zurück, während sie den endlos langen Korridor durchschritten. »Hier, hier sitzen die eigentlichen Geheimnisse, deshalb eben heißen sie die des Sklavensees. Und die hat noch kein anderer Mensch zu sehen bekommen. Höchstens ein paar von den deutschen Kolonisten. Also Sie bleiben, wie ich gehört habe, 45 Jahre, 4 Monate und 18 Tage in unserer Gesellschaft? Na, dann werde ich Ihnen ja ein gut Teil von diesen Geheimnissen vorführen können, das heißt, wenn ich mich beeile, Ihnen jeden Tag einige Dutzend zeige, und dann vorausgesetzt, dass ich noch einige Tage älter als Sie werde.«
»Was, sind es denn gar so viele?«, lachte der Leutnant.
»Ich wage die Zahl nicht auszusprechen, es geht in die Illionen.«
»Und ich darf nun in alles eingeweiht werden, was sonst keinem Sterblichen zu schauen vergönnt ist?«
»Warum nicht? Sie kommen ja doch niemals wieder heraus, um es der anderen Welt ausplaudern zu können. Da, was meinen Sie zu diesen Fenstern? Sie brauchen doch nur hinauszuspringen, dann haben Sie Ihre Freiheit, welche zu gewinnen wir Sie nicht einmal hindern.«
Sie hatten einen Seitengang erreicht, der durch viele Fenster Tageslicht erhielt.
Leutnant Torres trat an eines, blickte hinab auf den Sklavensee, das Wasser war nur wenige Meter unter ihm, sie befanden sich in der ersten Etage oder eigentlich sogar parterre.
»Na, nun machen Sie das Fenster auf und springen Sie hinaus, dann sind Sie frei, auf eine kleine Schwimmtour kommt es Ihnen doch nicht an.«
Das Fenster war geschlossen, das heißt das Glasfenster, ein Handgriff war nicht zu sehen.
»Hauen Sie die Scheibe doch ein, treten Sie dagegen.«
Dazu genierte sich der Leutnant jetzt natürlich, er begnügte sich, mit dem Finger dagegen zu klopfen. Die Glasscheibe, das reinste Spiegelglas, schien gar nicht so dick zu sein.
»Hm, wenn dieses Fenster auch während der Nacht so ohne Läden bleibt, warum soll ich denn da nicht —«
»Was während der Nacht? Immer treten Sie doch dagegen — da — und da — und da —«
Und Littlelu trat immer fest mit seinen derben Stiefeln gegen die Scheibe.
Jetzt ging dem Leutnant freilich eine Ahnung auf.
»Die ist wohl unzerbrechlich?«
»Nehmen Sie einen Schmiedehammer und hauen Sie immer lustig drauf los.«
»Ah, das ist also jenes rätselhafte Omnihilit, das auch von keinem Diamanten geritzt wird!«
»Jetzt haben Sie's erfasst! Wenn Sie auf irgend eine Weise so eine Scheibe zertrümmern können, dann sind Sie frei. Die werden jetzt überall eingesetzt, unsere Matrosen sind schon tüchtig bei der Arbeit.«
Sie schritten weiter.
»Sind Sie damals auf dem ›Mohawk‹ gewesen?«
»Nein, da war ich ganz wo anders.«
»Ach, Sie haben überhaupt noch gar nichts von den Geheimnissen gesehen?«
»Noch gar nichts.«
»Nun, da könnten wir ja erst mit dem mechanischen Theater anfangen. Aber nein, mit solchen Kleinigkeiten wollen wir uns gar nicht erst einlassen. Gehen wir gleich hier hinein.
Sie betraten eine weite Halle, wieder amphitheatralisch eingerichtet, aber die Sitze gingen doch nicht gar so steil hinauf.
Gegeben hatte es diesen Raum natürlich schon immer, aber die Hauptsache hatte er damals noch nicht enthalten. Señor Tenorio hatte die Gräfin ja in alles einweihen, alles etwa Fortgeräumte wieder herstellen wollen, aber da war ja die lange Schiffsreise dazwischen gekommen. Jetzt hatte der Zwerg alles wieder in Ordnung gebracht.
Die beiden setzten sich auf die erste Bankreihe, welche eine Zirkusmanege umgab. Aber die eigentliche Manege, worunter man im speziellen die rotgepolsterte Umfassung versteht, auf welcher auch die Pferde manchmal laufen müssen, fehlte hier, statt dessen zog sich um den inneren Kreis ein eisernes Geländer, welches jedoch den Blick durchaus nicht hinderte, man konnte bequem darüber hinweg blicken, nur nicht gleich so in die Manege hineinspringen.
Nun sei dem geneigten Leser für das Folgende gleich eine Erklärung gegeben, wenigstens eine Andeutung dazu.
In Amerika wird jetzt unter Edisons Leitung, der auch schon oft darüber gesprochen hat, intensiv an einer neuen Art von Kinematografie gearbeitet, der man das Wörtchen »Radio-« vorsetzt, was aber nichts mit dem Element Radium, sondern mit Radius, Halbkreis, zu tun hat, was jedoch wiederum nicht ganz richtig ist.
Die lebenden Bilder sollen nicht mehr gegen eine Wandfläche, sondern entweder wie in einem Panorama gegen eine geschlossene Kreisfläche geworfen werden, oder auf deren Außenseite, sodass man dann die Bilder von allen Seiten wie in einem Zirkus betrachten kann.
Übrigens ist diese Erfindung schon einmal vor einigen Jahren im Zirkus Busch vorgeführt worden, aber in einfacher Fotografie, auch sonst sehr mangelhaft. Die Plastik war sehr gut, aber die Perspektive schwamm durcheinander.
Diese neue Art von Kreiskinematografie soll jetzt bald in höchster Vollendung herauskommen, Edison behauptet, dass sie tatsächlich alle Theater überflüssig mache, auch den Zirkus und sonstige Vorstellungen in geschlossenen Räumen, man könne die Illusion nicht mehr von der Wirklichkeit unterscheiden.
Hier nun war dieses Problem bis zum letzten Grade gelöst. Dazu kam noch das Omnihilit. Leutnant Torres ahnte nicht, dass er vor einer Glasscheibe saß, welche die ganze Manege bis hinauf zur kolossal hohen Decke kreisförmig umgab.
Und dazu mochte ja noch vieles andere kommen, was der sonstigen Welt noch ganz unbekannt war. Auch die Wunder der Illusionsbühne waren hiermit verbunden.
Die beiden hatten sich einem großen Zelte gegenüber niedergesetzt, das auf der anderen Seite der Manege stand.
Ob Littlelu einen geheimen Mechanismus auslöste oder was er sonst tat — der Zeltvorhang wurde zurückgeschlagen, Pfeifen und Trommeln ertönten, eine Bande von braunen, mehr ganz als halb nackten oder in Lumpen gehüllten Männern, Frauen und Kindern marschierte in die Manege, begleitet von einem hornlosen Ochsen, der einiges Gepäck trug, von mehreren Ziegen und schrecklich dürren Hunden.
»Indische Gaukler!«, rief der Leutnant erfreut.
»Hm«, brummte Littlelu, »hätte ich gewusst, dass die kämen, dann hätte ich auch eine indische Szenerie dazu gemacht. Na, lassen wir, die treten eben hier in einem Zirkus auf. Haben Sie schon solche indische Gaukler gesehen?«
»Nein, ich war noch nicht in Indien.«
»Die kann man doch auch in Amerika zu sehen bekommen.«
»Aber doch nicht solche echte, die einem die Illusionen ihrer Heimat vorgaukeln können!«
»Warum denn nicht? Weshalb sollen die denn das nicht hier fertig bringen, wenn sie nur dafür bezahlt werden?«
»Weil sie es eben hier nicht können, nicht außerhalb ihrer Heimat, da verlässt sie ihre hypnotische Kraft.«
Der Leutnant hatte recht. Es sei dies gleich am Anfange gesagt.
Überall in Vorderindien, wo sich eine öffentliche Vorstellung lohnt, wenn auch nur auf wenige Kupfermünzen reflektiert wird, treten wandernde Gaukler auf.
Sie als Derwische oder Fakire zu bezeichnen ist falsch, im Hindustanischen heißen sie Racenwaschamschas, wandernde Tempeldiener, denn sie stehen auch noch im Dienste ihrer Tempel und müssen den größten Teil ihres Einkommens an diese abgeben. Sie gehören zu der untersten Priesterkaste, können Brahmanen sein oder auch nicht.
Ihre Gaukeleien sind zum größten Teil Illusionen, welche sie bei den Zuschauern durch hypnotische Suggestion hervorbringen, soweit es sich dabei nicht um wirkliche Kraft, Gewandtheit und Taschenspielerkniffe handelt.
Die ganze Hypnotik ist bei uns Abendländern noch sehr jung, und von den Männern der Wissenschaft ist sie überhaupt erst in allerjüngster Zeit als Tatsache anerkannt worden.
Im Morgenland und speziell in Indien ist die Hypnotik schon seit uralten Zeiten betrieben worden, und zweifellos verstehen die Brahmanen noch eine ganz andere Art von Hypnotik, von der wir noch gar keine Ahnung haben.
Die Hauptsache ist immer, dass ein großer Kreis gezogen wird. Innerhalb dieses Kreises sieht das Publikum alles, was der Gaukler selbst zu sehen sich einbildet. Es ist Gedankenübertragung auf hypnotischem Wege. Freilich ist »Hypnotik« ja nur ein ganz leeres Wort. Zu fotografieren sind die Illusionen natürlich nicht. Es gibt auch hin und wieder Zuschauer, die nichts sehen; sie sind selten. Mit kräftiger Energie oder Ungläubigkeit scheint das dabei gar nichts zu tun zu haben. Manche zartbesaitete Dame, ganz von Aberglauben durchseucht, möchte gern etwas sehen, hilft mit ihrer eigenen Einbildung nach, und sie sieht nichts, nur den Gaukler mit den schrecklich verdrehten Augen und verzerrten Zügen. Denn er hat sich selbst hypnotisiert. Und das scheint diese andere Art von Hypnotik zu sein, die wir noch nicht kennen. Hier setzt sich der Hypnotiseur erst selbst in hypnotischen Schlaf und suggeriert, man sehe ihn herumspringen.
Sobald man aus dem Kreise heraustritt, verschwindet die Illusion. Merkwürdig ist dabei, dass man sie entweder von absoluter Deutlichkeit hat, auch gar nichts an Wirklichkeit vermissen lassend, oder überhaupt gar nicht. Undeutliche oder schwankende Bilder gibt es nicht. Sobald eben im Gehirn des Beobachters der Gedanke entsteht, dass hier doch etwas nicht in Ordnung sein kann, verschwindet die Illusion überhaupt ganz. Aber willkürlich kann man das nicht hervorrufen.
Nun liegt die Frage nahe: Warum kommen diese indischen Gaukler nicht zu uns nach Europa und verdienen durch ihre Illusionen goldene Berge?
Da kann eine Gegenfrage aufgestellt werden. Weshalb erzeugt der Mohn bei uns kein Opium, der Hanf kein betäubendes Haschisch? Wir können den Mohn bei uns ebenso kräftig zur Blüte und Frucht bringen wie in Indien, nicht nur im Treibhaus, auch im Freien. Wir gewinnen auch aus dem Samen die braune, klebrige Flüssigkeit, der chemischen Zusammensetzung nach ist es ganz echtes Opium — und es ist dennoch keines, die betäubende Kraft fehlt, man kann daraus kein Morphium herstellen.
Es ist ja etwas ganz anderes, und dennoch kann es eng damit zusammen hängen, dass die indischen Gaukler bei uns im Abendlande ihre Illusionen, auf hypnotischer Suggestion beruhend, nicht fertig bringen. Ihre Kraft verlässt sie hier. Oder nur ein einmaliges Versagen, dann zweifeln sie an sich selbst, und damit ist es vorbei, dann sinken sie zu gewöhnlichen Gauklern herab, zu Taschenspielern, oder werden gar als Betrüger »entlarvt«. Ein ganz ungerechter Ausdruck.
Übrigens dürfen diese echten Racenwaschamschas ihre Heimat, ihren engbegrenzten Bezirk, ja gar nicht verlassen. Sie stehen unter strengen Gesetzen ihres Tempels, ihre Kunst ist ein tiefes Geheimnis der Priesterkaste. —
Doch kehren wir nun wieder zurück zu der Vorstellung, zu der Littlelu den Leutnant Torres in den Felsensaal geführt hatte.
Die schauderhafte Musik der Pfeifen und Trommeln verstummte, schnell wurde der Ochse abgepackt, ein durchlöcherter Teppich ausgebreitet, ein alter, weißbärtiger Mann, ein gebrochenes Englisch kauderwelschend, stellte sich als Häuptling der Bande vor. Er lockte einen der verhungerten Hunde zu sich, ein eigentümlicher Griff ins Kreuz, der Hund schien plötzlich ganz starr zu werden, und es war wirklich so, der Gaukler konnte ihn an einem Hinterbein wie einen Holzblock aufheben. Und das ist keine Illusion, diesen Griff und Kniff hatte schon Moses von den ägyptischen Priestern gelernt — als er die Schlange in einen Stock verwandelte.
Der erstarrte Hund wurde auf den Teppich gesetzt, der Gaukler zeigte einen oben offenen Korb, deckte ihn über den Hund, hob ihn sofort wieder, und jetzt war das erst so knochendürre Tier kugelrund geworden, jetzt bewegte es sich auch, wenn es auch nicht davon lief, denn es konnte vor Fett überhaupt nicht laufen.
Wieder wurde der Korb darüber gestülpt, wieder wurde er hoch gehoben, und jetzt war aus dem Hund ein stattliches Schwein geworden.
Bei der dritten Verwandlung lag das Schwein auf der Seite und neben den Hinterfüßen sein Kopf, aus dem Halsstumpf ergoss sich ein Blutstrom.
Beim vierten Male hatte das Schwein seinen Kopf wieder und außerdem sieben kleine Ferkel bekommen, die lustig herumliefen und quiekten.
Ein grunzendes Locken der Alten, die Ferkel, die in der ganzen Manege herumgelaufen waren, versammelten sich wieder um sie, der Korb wurde darüber gestülpt und als der Korb abermals hochgehoben wurde, war der dürre Hund wieder darunter, gleich beweglich lief er davon.
Ein anderer Gaukler trat auf, wie sein Vorgänger immer sprechend, seine Experimente humoristisch erläuternd, dabei manchmal die schrecklichsten Zoten reißend, ohne die es bei diesen indischen Gauklern nicht geht, weil das eingeborene Publikum so etwas nun einmal liebt.
Er nahm einen kleinen Tonkrug, zeigte, dass er leer war, füllte aus ihm ein Dutzend Schalen voll Wasser, jede so groß, dass der Krug eigentlich nicht eine einzige Schale gefüllt hätte.
Hier kam auch noch die zweite Art von Illusion hinzu, indem er in dem Wasser mit der Hand plätscherte. Littlelu wie Leutnant Torres wurden vollgespritzt und wischten sich die nassen Gesichter mit dem Taschentuche ab.
Dann goss der Gaukler das Wasser aus dem Dutzend Schalen in den Krug zurück, zerbrach diesen sofort — es war kein Tropfen darin gewesen.
Dann kam ein junges Weib mit einem Taubündel, warf dieses in die Luft, dass es sich dabei aufrollte, es blieb frei in der Luft stehen, sie kletterte daran empor, immer höher und höher, das Bündel hinter sich aufrollend. Sie wurde immer kleiner, bis sie im Himmel zu verschwinden schien.
Dann kam sie schnell wieder herabgerutscht, jetzt aber den Kopf nach unten, dass das lange Haar herabhing, noch in einiger Entfernung vom Boden hielt sie an, ein Mann kletterte hinauf, schnitt mit einem Messer der Frau das Haar ab, das aber sofort wieder nachwuchs, er schnitt und schnitt, das Haar immer herabwerfend, ein Haufen bildete sich, mit dem man eine ganze Matratze hätte ausstopfen können, es wurde in einen kleinen Korb gepfropft, zuletzt schnitt der Mann, der über seine vergebliche Mühe immer schimpfte, der Frau den ganzen Kopf ab, das herausfließende Blut wurde in dem Korb aufgefangen, der Kopf wurde hineingetan, dann stürzte die kopflose Frau nach, das Seil kippte hinein, alles wurde in den Korb gepfropft, der Deckel zugemacht, zwei Männer stampften darauf herum, und wie der Deckel wieder geöffnet wurde, sprang die Frau unversehrt heraus, unter dem Arm das zusammengerollte Seil.
So folgten noch einige andere Gaukeleien, teils auf Illusion durch hypnotische Suggestion, teils auf wirklicher Kraft und Gewandtheit beruhend, und das ist es ja eben, dass diese Inder die Grenzen zwischen Illusion und Wirklichkeit zu verschmelzen verstehen.
Das heißt, dies hier war ja nur die kinematografische Wiedergabe einer wirklichen Vorstellung.
Aber wer sollte das unterscheiden können.
»Sind denn das nicht wirkliche Menschen?!«, fragte Leutnant Torres wiederholt.
»Überzeugen Sie sich doch selbst, gehen Sie einmal hinein in die Manege.«
Torres erhob sich und trat an das Geländer.
»Darf ich darüber steigen?«
»Immer steigen Sie!«
Torres tat es, aber nur noch ein weiterer Schritt, und er stieß gegen eine Glaswand.
»Ja, aber wie ist es denn möglich, dass die hier Wasser durchspritzen?«
»O, die können auch noch etwas anderes durchwerfen, Apfelsinen und dergleichen.«
»Ja, wie ist denn das nur möglich?«
Da konnte auch Littlelu keine Erklärung gehen. Er wusste nur, dass es ein Mittel gab, um dieses durchsichtige Omnihilit, also gefrorenes Wasser in einem besonderen Aggregatzustand, plötzlich für jeden Gegenstand durchdringlich und im nächsten Moment wieder diamanthart zu machen.
Ohne Beispiel ist dieses Phänomen keineswegs, da uns aber die Natur schon allzu bekannt, ja schon allzu gewöhnlich ist, so sehen wir gar keine Phänomene mehr. Man soll nur erzählen hören, wie in Kairo das erste künstliche Eis dargestellt wurde und wie sich die Araber vor diesen künstlichen Eistafeln entsetzt haben! Als dann eine Fabrik von künstlichem Eis entstand, hat man viele Jahre lang keine eingeborenen Arbeiter bekommen können.
Also diesem Beispiel ist ja in der offiziellen Natur, wie man sich ausdrücken könnte, schon vorhanden. Wasser ist für jeden Gegenstand durchdringbar. Man kann, einfach gesagt, den Finger hineinstecken — aber nicht mehr, wenn es gefroren ist.
Nun gibt es ein physikalisches Experiment: Wenn man in einem Gefäß Wasser bei absoluter Ruhe, die aber nur bei den größten Vorsichtsmaßregeln möglich ist, ganz, ganz langsam abkühlt, so kann man es bis auf mehrere Grad Kälte herabbringen, ohne dass es gefriert. Dann nur die geringste Erschütterung des Glases, nur das leiseste Blasen auf das Wasser, und in einem Moment verwandelt es sich in einen kompakten Eisklumpen.
Dasselbe Experiment lässt sich aber durch andere Mittel auch umgekehrt machen, ein kompakter Eisklumpen verwandelt sich durch Zurückhaltung der Krise in einem einzigen Moment in flüssiges Wasser.
Die Möglichkeit war also vorhanden. Hier hatte man nur noch eine ganz andere Erfindung schon gemacht. Hier waren Menschen an der Arbeit gewesen, welche zu der anderen Menschheit in demselben Verhältnis standen wie diese zu jenen Arabern.
Aber wer spritzte denn nun das Wasser durch? Diese Wand war sicher nur scheinbar so durchsichtig, dahinter befanden sich wirklich Menschen. Aber was für welche? Japanische Matrosen sicher nicht, auch der Zwerg nicht.
Nein, zwischen diesen Felswänden hielten sich überhaupt noch viele andere Menschen auf, welche die rechtmäßigen Bewohner aber niemals zu Gesicht bekamen, der Zwerg hatte noch unsichtbare Helfershelfer.
Im Übrigen sprachen die beiden gar nicht weiter über die Phänomene, sie nahmen mit Vergnügen das hin, was sie zu sehen bekamen, und da handelten sie auch am klügsten.

Als Littlelu und Leutnant Torres dem aufrecht daher-
kommenden Eisbären näher traten, brüllte dieser
laut auf und hob die mächtige Tatze zum Schlage.
Die Gauklerbande war unter Trommeln und Pfeifen wieder abgezogen und in dem Zelte verschwunden. »Wollen Sie noch mehr in diesem Illusions-Zirkus sehen?«, fragte Littlelu. »Soll ich noch mehr aus dem Zelte herauskommen lassen? Einmal zur Abwechslung Hottopferde mit famosen Reitkünstlerinnen? Oder eine Raubtiergruppe, in Freiheit vorgeführt? Übrigens kann ich die ganze Sache auch anders arrangieren, es braucht nicht immer das Zelt zu sein. Da muss ich nur, um die Wirklichkeit zu wahren, erst einmal den runden Vorhang fallen lassen.«
»Wissen Sie, da möchte ich mir erst einmal die Camera obscura ansehen. Habe schon so viel von dieser wunderbaren Vorrichtung gehört, kann mir gar keine Vorstellung davon machen. Danach brenne ich am meisten.«
»Das tut mir leid, die Camera obscura ist das einzige, was ich Ihnen nicht zeigen kann.«
»Warum nicht? Funktioniert sie nicht?«
»Doch. Aber die Gräfin hat sie verschlossen, sie darf nicht benutzt wer-den.«
»Weshalb nicht?«
»Weil die Gräfin in ihrer friedlichen Ruhe, die sie endlich hier für immer gefunden zu haben glaubt, nicht mehr gestört sein will. Deshalb wird sie auch keinen Brief mehr annehmen, keinen anderen Menschen mehr sehen wollen. Er könnte ihr irgend eine sie beunruhigende Mitteilung aus jener anderen Welt machen, für die sie gestorben sein will.«
»Aber ich verstehe nicht — was hat das mit der Camera obscura zu tun, in der sie jene andere Welt ohne alle Teilnahme beobachten kann?«
»Ohne alle Teilnahme? Hm. Gesetzt nun den Fall, die Gräfin sieht in der Camera obscura, wie hier in ihrer nächsten Nachbarschaft ein Mensch ein großes Unrecht begeht, er misshandelt etwa auf scheußliche Weise ein Kind. Da kann diese Indianerin natürlich nicht ruhig zusehen, sie eilt zu Hilfe — verlässt also schon ihre Einsamkeit, und daraus können nun weiter die größten Verwicklungen entstehen, die sie immer mehr um ihre eben erst gewonnene Ruhe bringen —«
»Das ist ja der höhere Egoismus!!«, rief Torres.
»Egoismus? Hm. Wenn ich ein sehr gefühlvoller Mensch wäre, so könnte ich mir kein Beefsteak mehr schmecken lassen, weil ich überall, wo ich hinblicke, hungrige Menschen sehe, die schon mit einem Stück Brot zufrieden sind. Um nun diesen Anblick nicht mehr zu haben, um nicht mehr an all das Elend erinnert zu werden, um mir mein Beefsteak schmecken zu lassen, ziehe ich mich in absolute Einsamkeit zurück. Ja, geehrter Herr Leutnant, wo fängt da der Egoismus an und wo hört er auf?«
Dieser akademisch gebildete Hinterwäldler war klug genug, um alles gleich zu verstehen, wohin jener zielte, sie sprachen gar nicht weiter darüber. Denn das ist ein Thema, mit dem man niemals fertig wird. Das aber ist auch der Grund, weshalb alle die großen Religions- und Ordens- und Sektenstifter freiwillig zum Bettelstab griffen.
Während sie wieder durch die Gänge wanderten, hielt Littlelu einen kleinen Vortrag über ein anderes Thema.
Für die zivilisierte Menschheit scheint eine ganz neue Ära anbrechen zu wollen.
Immer mehr versucht man die Natur durch Kunst zu ersetzen, das heißt sich durch Kunst in natürliche Wirklichkeit hineinzutäuschen.
Allerdings ist dieses Bestreben ja von jeher vorhanden gewesen.
Was hat denn das Theater für einen anderen Zweck, als durch fremde Phantasie seine eigene unterstützen zu lassen, sodass man sich in fremde Zeiten und Verhältnisse hineintäuschen lässt. Dasselbe gilt vom Lesen von Unterhaltungsbüchern und noch hundert anderen Mitteln, durch die man die Wirklichkeit für einige Zeit zu vergessen sucht.
Aber das wird immer weiter getrieben. Immer mehr will man die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Einbildung verwischen.
Früher war jeder Fürst oder reiche Mann nur darauf bedacht, sein Schloss oder Haus so behaglich wie möglich einzurichten, dabei auch mit so viel Luxus, wie es seine Mittel erlaubten. Wohl waren da auch Kunstgegenstände vertreten, aber die hatten wieder einen ganz anderen Zweck. In einem mittelalterlichen Patrizierhaus gab es kein Zimmer, das im Geschmack und Stil von früheren Jahrhunderten eingerichtet wurde, etwa gar das Innere einer Pfahlhütte darstellen sollte. Die Rittersäle und dergleichen waren wieder etwas ganz anderes.
Heute haben die reichen Leute, die an so etwas Geschmack finden, ein altdeutsches Zimmer, ein urgermanisches Zimmer, ein Biedermeierzimmer, ein Rokokozimmer, ein Renaissancezimmer, ein englisches, französisches, italienisches, orientalisches, indisches Zimmer, und so weiter und so weiter, so weit Raum, Geldmittel oder Kredit reichen. Am großartigsten findet man das in den »Residenzen« der reichen Engländer, und in den verschiedenen Zimmern werden nun auch die dazu gehörigen Lebensgewohnheiten mit historischer Treue nachgeahmt, sodass man auf der keltischen Diele als angelsächsischer Thane auf Bärenfellen liegt, selbst mit Fellen bekleidet, und von dem am Spieße gebratenen Ochsen mit dem Messer absäbelt, während man nebenan als Pascha mit untergeschlagenen Beinen auf Kissen kauert, den Tschibuk oder die Wasserpfeife raucht und sich von Odalisken etwas vortanzen lässt. — —
»Haben Sie von dem Zauberhause des Maharadscha von Nagpore gehört?«, fragte Littlelu.
Leutnant Torres verneinte.
»Hier ist eine Nachahmung davon.«
Sie betraten eine weite Halle von etwa fünfzig Metern Durchmesser, die kugelförmige Decke war in der Mitte 30 Meter hoch — eine natürliche Höhle. Das Felsengebirge ist ja so reich an Höhlen, und dies alles hier ließ sich nicht vergleichen mit der Mammuthöhle in Kentucky, von deren Gängen erst 430 Kilometer erforscht sind, es mögen aber noch viel mehr sein, viele Gänge sind verschüttet oder ihr Betreten ist wegen giftiger Gase nicht ratsam, wenn nicht unmöglich. In diesem Labyrinth gibt es Hallen von mehreren Hundert Metern Durchmesser.
Auch diese Halle hier wurde durch eine Bogenlampe elektrisch erleuchtet. An den nackten Felswänden war sonst nichts gemacht, der Höhlencharakter war gewahrt worden. Nur dass sich in der Mitte ein Haus erhob, ein Steinkasten, mit Türen und Fenstern, zwölf Meter im Quadrat und fünf Meter hoch. In dem ungeheuren Raume verschwand dieses Gebäude ganz.
»Gehen wir erst einmal ringsherum«, sagte Littlelu. »Bemerken Sie etwas Auffälliges?«
Nein, da war nichts zu bemerken. Vier Mauern, jede also zwölf Meter lang, auf jeder Seite zwei Türen und zwei Fenster.
Durch die Fenster war von außen nichts zu erblicken, so nahe man auch das Auge brachte. »Treten wir nun durch irgend eine beliebige Tür ein, hier gleich durch diese.«
Sie taten es und befanden sich im Wohnraum eines englischen Farmerhauses. Nicht der geringste Gegenstand fehlte, den man in diesem zu sehen gewohnt ist, nicht der Zinnhumpen auf dem Ofensims und an der Wand nicht ein schauderhafter Farbendruck, die Seeschlacht von Trafalgar darstellend.
Aber wie ward dem Leutnant, als er seinen Blick zum Fenster lenkte. Da sah er einen englischen Hühnerhof, belebt, und zwar ganz richtig belebt von Federvieh aller Art, soeben trat aus einem Seitengebäude eine junge Frau, streute den herbeieilenden Hühnern Futter, dann führte ein Knecht ein Pferd über den Hof — —
Torres wollte das Fenster öffnen, fand aber keinen Griff. So öffnete er noch einmal die Tür und — blickte in die öde Halle.
»Kinematografie«, sagte er.
»Natürlich, Kinematografie. Oder dachten Sie, dort draußen wäre wirklich plötzlich ein Hühnerhof? Gehen wir in das nächste Zimmer.«
Es waren immer drei Türen vorhanden. Eine führte also hinaus ins Freie, die beiden anderen verbanden mit den Nachbarräumen.
Beim Betreten des nächsten wusste man nicht gleich, was er vorstellen sollte. Ein Zimmer war es nicht zu nennen. Die schrägen Wände bestanden aus Schilf, an aufgestellten Stücken von Baumrinde hingen Fischereigeräte, aber nur von allerprimitivster Art, Bindfaden oder sonstige Schnüre gab es zum Beispiel nicht, sie wurden durch Baststreifen ersetzt, die Angelhaken bestanden entweder aus Dornen oder krummen Fischgräten; Messer, Äxte und dergleichen waren aus Stein.
Der Blick durch die dreieckige Hüttenöffnung fiel auf eine Wasserfläche, in der Ferne einige bewaldete Inseln, noch näher schob sich eine Landzunge in den See hinein, in einiger Entfernung davon stand im Wasser auf Pfählen eine schilfbedeckte Hütte.
»Wir sind in einer prähistorischen Pfahlbauhütte, noch in der Steinzeit!«
Die Landschaft wurde lebendig. Hinter der Halbinsel hervor kamen Boote, ausgehöhlte Baumstämme von plumpester Form, von in Felle gehüllten Männern gerudert. Auch die Landzunge belebte sich. Ein braunschwarzer Bär kam getrottet, noch viel größer als der ungeheuere Grizzlybär, der aber grau ist, und dann war dieser hier noch ganz unverhältnismäßig lang — —
»Ein Höhlenbär!!«
Er befand sich auf der Flucht vor Jägern. Das heißt, deren Steinäxte und elende Pfeile fürchtete er schwerlich, wohl aber die brennenden und glühenden Baumstämmchen, welche die Pfahlbaumenschen in den Händen hatten, vor dem Feuer ging er lieber ins Wasser. Hier wurde er von den Booten umringt, die doch etwas schneller waren als das schwimmende Tier, das jetzt von allen Seiten mit Pfeilen gespickt und mit Lanzen berannt wurde.
»Grandios, da möchte man gleich mitmachen!«, jubelte der ehemalige Hinterwäldler, vom Jagdfieber ergriffen.
Er musste sich überzeugen, dass er nicht direkt ins Freie blickte, sondern dass eine Glasfläche dazwischen war.
»Ja«, stiegen ihm dann immer noch Zweifel auf, »solche Szenen müssen aber doch erst fotografiert werden, und solch einen riesigen Bären gibt es heute doch gar nicht mehr!«
»Fragen Sie mich nicht, ich weiß nicht, wie das hier alles gemacht wird!«, erwiderte Littlelu. »Übrigens — der Kinematografie ist heutzutage doch kaum noch etwas unmöglich.«
»Aber es ist hier doch eine ganz andere Art von Kinematografie, das ist hier doch kein an die Wand geworfenes Lichtbild, hier scheint sich doch alles auf der kleinen Glasscheibe abzuspielen.«
»Hierüber dürfte ich Ihnen eine Erklärung geben können, wenigstens eine Mutmaßung, und ich habe sie erst von einem japanischen Ingenieur.
Sie wissen vielleicht, dass die Zeiten des Phonographen, wie man ihn bisher benutzt, bald vorüber sein dürften. Dieser Edinson'sche Phonograph beruht auf mechanischem Prinzip. Die Schallwellen erzeugen in einer Substanz Eindrücke, diese werden wieder in Schallwellen umgesetzt.
Der Däne Poulsen erreicht jetzt dasselbe auf elektromagnetischem Wege. Die Schallwellen werden magnetisch auf eine Stahlplatte oder ein Stahlband fixiert, und, elektrisch erregt, bringen sie die Stahlplatte wieder zum Tönen. Der bisherige Phonograph ist mit dieser neuesten Erfindung, Telegrafon, gar nicht mehr zu vergleichen. In so einen Apparat kann man stundenlang sprechen, und alles kommt vollkommen getreu wieder heraus.
Jener japanische Ingenieur meint nun, dass die hier eine ganz andere Art von Fotografie haben. Was man durch ein besonders präpariertes Glas erblickt, wird darauf elektromagnetisch fixiert, und lässt man einen Strom durchgehen, so sieht man alle die Bilder wieder vorbeiziehen. Sehr einfach, nicht wahr? Ja, wenn wir nur wüssten, wie's gemacht würde. — Nun, gehen wir in den nächsten Raum.«
Die Bärenjagd war noch lange nicht zu Ende, aber Leutnant Torres musste sich mitziehen lassen.
Abwechslung ergötzt das Leben! Ein kleiner, eleganter Salon, durch das Fenster ein Blick auf ein Straßenleben herab, wie es ein solches nur an einem einzigem Orte dieser Erde gibt: in der City von London, an der Bank von England, am Kreuzungspunkt von neun Hauptstraßen! Unbeschreiblich dieses Gewühl!
»Hier können Sie sich einmal hinsetzen und einige Stunden beobachten, bis zum Abend, wenn schließlich auch der letzte Konstabler ausstirbt — aber jetzt nicht — weiter mit Ihnen!«
Der vierte Raum, den sie betraten, war ein lauschiges, orientalisches Gemach mit schwellenden Kissen und Polstern. Das Fenster war verhangen, Littlelu lüftete nur ein klein wenig den Vorhang und spähte durch eine Spalte —
»Aaaaaaah — ooooooh!!!«, machte er dann und behielt den Mund offen.
Leutnant Torres wollte natürlich auch wissen, was es da zu sehen gab, aber Littlelu wehrte ihn ab.
»Nenenenee, das ist nichts für Sie, alter Freund, dazu sind Sie noch viel zu jung — das ist hier etwas anderes als das Straßenleben an der Londoner Bank!«
Natürlich erzwang sich der Leutnant den Durchblick, er brauchte gar keine große Gewalt anzuwenden.
Ja, man hatte da einen hübschen Anblick. Ein Bad, ein Schwimmbassin, gerade benutzt von Haremsdamen. die hier in ihrem eignen Bade keine Kostüme brauchten.
»Halt, halt, halt, halt!!«, schrie Littlelu, dem Leutnant nacheilend und ihn beim Rockzipfel festhaltend. »Hier geblieben! Das ist nichts für Sie! Oder Sie werden von den Eunuchen massakriert!«
Aber Torres hatte schon die Tür geöffnet, welche hinüberführen musste — er blickte in die öde Felsenhalle.
»Schade«, sagte er, die Tür wieder schließend.
»Na, lassen wir die Damen einstweilen, sie sind gerade beim Abtrocknen, gehen wir zunächst ins fünfte Zimmer«, tröstete Littlelu.
»Ins fünfte? Ins erste zurück. Da kommen wir also wieder in die englische Farmerwohnung.«
Gewiss, anders konnte es nicht sein. Jeder Raum war ungefähr sechs Meter im Quadrat, das ganze Haus zwölf Meter im Quadrat, also konnte es auch nur vier solche Räume enthalten. Man hatte sich immer im Kreise gedreht.
»Ach so, ja, da haben Sie recht«, bestätigte denn auch Littlelu. »Also gehen wir noch einmal zu dem Farmer, bewundern wir den Hühnerhof.«
Er öffnete die Tür. Aber von einer Bauernstube und einem Hühnerhof war nichts mehr zu sehen. Jetzt war das eine Schiffskajüte, und durch die runden Fensterchen erblickte man Eisberge, zwischen denen eine spielende Walfischherde Wasserstrahlen empor blies.
Verdutzt blickte sich der Leutnant um.
»Das ist doch alles ganz echt? Und sollte ich alter Pfadfinder denn plötzlich so allen Orientierungssinn verloren haben? Wir befinden uns doch unbedingt wieder im ersten Zimmer, wo vorhin die Bauernstube mit dem Hühnerhof war!«
Er öffnete wieder die Tür, durch die er soeben gekommen war.
Das orientalische Gemach mit dem Blick in den Baderaum war nicht mehr. Statt dessen das Innere einer Blockhütte, nach allen vorhandenen Utensilien dasjenige einer im australischen Busch befindlichen Familie, und soeben brauste denn auch eine wilde Jagd vorüber, Reiter mit Hunden hinter einem Rudel Kängurus her.
Immer verdutzter wurde das Gesicht des Leutnants, er zupfte sich an der Nasenspitze.
»Ja, bin ich denn nur behext? Nein, hypnotisiert bin ich nicht. Das ist alles die reellste Wirklichkeit. Ja, wie ist denn das nur möglich?«
Er öffnete die ins Freie führende Tür, trat in die weite Halle, ging um das Haus herum. Jede Wandseite war vierzehn Schritte lang, daran war nichts zu ändern. Er trat wieder durch eine Tür, seiner Berechnung nach musste sie in den Londoner Salon führen — nein, jetzt hatte der sich in die Schneehütte von Eskimos verwandelt, durch die winzige Luftöffnung erblickte man Seehunde und Eisbären.
Der nächste Raum, wenn er wieder zurück ging, hätte die Pfahlbauhütte sein müssen. Jetzt aber war daraus ein holländischer Prunksalon geworden, durch das Fenster blickte man auf das Hafenleben von Amerika.
»Mir bleibt der Verstand stehen!«, murmelte Torres.
1 Richtig muss es wohl ›Amsterdam‹ heißen.
»Lassen Sie ihn ruhig stehen bleiben und setzen Sie dafür Ihre Beine in Bewegung!«, sagte der eintretende Littlelu.
Der Leutnant befolgte den Rat, er ging aus einem Raum in den anderen, immer im Kreise oder vielmehr im Viereck herum, immer schneller und schneller, immer schneller kam er dadurch aus einer Situation in die andere.
Um es kurz zu sagen: Er machte alle Erdteile durch, immer bunt durcheinander, alle Völkerrassen, alle menschlichen Wohnungsverhältnisse, vom europäischen Palaste bis herab zur Rindenhütte des Australnegers. Und durch Fenster oder sonstige Öffnungen sah er immer eine entsprechende Szenerie in vollem Leben.
Da machte der herumrennende Leutnant eine Entdeckung.
Sobald er durch eine Tür ging, schloss sich diese hinter ihm von selbst. Als er eine solche nun einmal schnell wieder öffnen wollte, konnte er es nicht. Da wurde er schon stutzig. Er wartete einige Zeit, vielleicht eine Minute, dann konnte er die Tür wieder öffnen, und da hatte sich der Raum wieder verwandelt.
In diesem Augenblick, als ihm die Erkenntnis gekommen, trat Littlelu ein, der sich während dieser Rennjagd seines Begleiters draußen aufgehalten hatte.
»Ich hab's gefunden, wie das hier gemacht wird!«
»Schon? Das wäre bei Ihnen schnell gegangen.«
»Das Zimmer, welches man verlässt, wird durch einen Mechanismus versenkt, erhält unten eine andere Einrichtung oder wird gleich durch ein anderes ersetzt und wieder heraufbefördert.«
»So ist's! Meine Hochachtung! Ich habe länger dazu gebraucht, ehe ich zu dieser Lösung des Rätsels kam. Freilich habe ich auch nicht meine Beine so schnell in Bewegung gesetzt wie Sie. Und viele Menschen haben eben mehr Verstand in den Beinen als im Kopfe. Merkwürdig war bei mir nur, dass ich schon von dem sogenannten Hause mit den zehntausend Zimmern des Maharadschas von Nagpore gehört hatte und dass ich dennoch nicht gleich auf den Gedanken kam, dass hier dasselbe vorliege.«
Sie befanden sich gerade in einem italienischen Zimmer, nach antikem Muster, wie man es zum Beispiel bei den Ausgrabungen von Pompeji gefunden hat, prachtvoll mit Mosaik getäfelt.
Littlelu ließ sich auf einer Marmorbank nieder und legte sein linkes Bein über die Schulter einer Amorstatue.
»Es ist dies eine Nachahmung von etwas schon Vorhandenem. Der Wahrheit muss man immer die Ehre geben. Ungefähr im Jahre 1870 gab der damalige Maharadscha der Provinz Nagpore, ein indischer Nabob, dessen Kinder mit Edelsteinen spielen können, englischen Ingenieuren den Auftrag, nach seinen Plänen ein Haus zu bauen, eine amüsante Spielerei in der Baukunst. Das steht noch heute, ist noch in vollem Betriebe. Es ist ein wenig kleiner als dieses, hat aber auch vier Räume, steht auf einem großen Felsen, der ganz hohl ist, in dem ist nun die ganze, eigentliche Einrichtung vorhanden. Die Zimmer, sozusagen möblierte Fahrstühle, rutschen in Schienen auf und ab, unten werden sie schnell umgewechselt, die einstweilen unbenutzten werden schnell wieder anders eingerichtet, und so geht man immer aus einem Zimmer ins andere. So amüsieren sich noch heute der Sohn dieses Maharadschas und seine Gäste. Diese Spielerei soll ihm viele Millionen gekostet haben. Sie wird das ›Haus mit den zehntausend Zimmern‹ genannt. So viele Verwandlungen können nun freilich nicht gemacht werden. Die Inder lieben große, runde Zahlen — gerade so wie wir Amerikaner. Wie viele Verwandlungen ausgeführt werden können, das weiß ich nicht. Das ist nur eine Frage des Geldbeutels. Ich will nur konstatieren, dass so etwas wie hier schon anderswo existiert, eine Idee hat schon einmal ein anderer Mensch gehabt und sie ausführen lassen.«
»Und dort sieht man auch aus jedem Fenster solche kinematografische Szenerien?«, fragte Torres.
»Nein, das nun freilich nicht. Kinematografie gab's damals noch nicht, und hier handelt es sich doch überhaupt um eine ganz spezielle Erfindung. Aber dass man die hier verwendet hat, das kann mir auch nun nicht weiter imponieren. Dafür soll es dort prachtvolle Wasserkünste geben.«
»Wie viele Verwandlungen können hier ausgeführt werden?«
»Weiß ich nicht. Wie oft sind Sie herumgerannt?«
»Vielleicht fünfmal, wozu noch unser erster Rundgang kommt.«
»Das wären also vierundzwanzig verschiedene Zimmer. Ich habe im Lau-fe der Zeit vielleicht vierzig besichtigt, mit aller Muße.«
»Das muss doch konstatiert werden können, wann es ein Ende hat, bis sich die Zimmereinrichtungen wiederholen.«
»Gewiss, rennen Sie nur immer herum.«
»Na, erst will ich mich ein bisschen verschnaufen. Wer hat denn das nun hier alles eingerichtet?«
»Fragen Sie den, der's gemacht hat, ich weiß gar nichts«, lautete Littlelus Antwort, und er legte auch noch seinen rechten Fuß einer sitzenden Venus in den Schoß.
»Da müssen dort unten doch Menschen sein, die das alles machen.«
»Höchstwahrscheinlich. Oder dressierte Affen. Ich weiß es nicht.«
»Oder könnte es nicht auch automatisch gemacht werden?«
»Auch möglich! Elektromagnetisch-homöopathisch.«
»Kann man denn da nicht hinunter gelangen?«
»Probieren Sie's doch.«
»Haben Sie es noch nicht versucht?«
»Ich hab's versucht.«
»Es ist Ihnen nicht gelungen?« — »Nee.«
»Ich stelle mir die Sache ganz einfach vor. Man öffnet eine Tür, tut, als wollte man eintreten, tritt aber schnell zurück und rutscht nun mit in die Tiefe. «
»Na, da treten und rutschen Sie doch.«
»Mann, seien Sie doch nur nicht so furchtbar faul! Also das gelingt nicht, meinen Sie?«
»Nee, es gelingt nicht. Was meinen Sie wohl, was ich hier schon herausgehuppt bin! Wie ein vom Größenwahnsinn befallener Ziegenbock! Zusammen mit Kapitän Hagen. Kennen Sie den schon? Nein? Kennen Sie wenigstens seine Beine? Wenn der mit einem Fuße hier drin in dieser italienischen guten Stube steht, hat er seinen anderen schon drüben in der australischen Blockhütte. Was wir beide auch versucht haben, man rutscht nicht mit hinunter. Alle möglichen Listen haben wir angewendet. Es geht nicht. Sobald man nicht heraus ist und die Tür nicht geschlossen ist, geht das Zimmer nicht hinab, und die Tür lässt sich erst wieder öffnen, wenn alles in Ordnung ist. Und dazu braucht's immer nur eine halbe Minute Zeit.«
Der Leutnant trat ans Fenster. Das Straßenleben in einer altitalienischen Stadt, stark vermischt mit griechischem Charakter. Es konnte wirklich das alte Pompeji sein.
»Und es ist dennoch großartig!«, sagte Torres nach einiger Zeit.
Littlelu nahm sein linkes Bein von des Amors Schulter und seinen rechten Fuß von der Venus Schoß, erhob sich faul und trat ebenfalls ans Fenster.
»Ja, großartig ist es. Ich gebe es zu. Ich verstehe, dass ein Mensch hier die Wirklichkeit vollkommen vergessen, sich mit diesen Illusionen begnügen kann — sogar Zeit seines Lebens. Diese indianische Gräfin, ein geborenes Naturkind, mit Bärenmilch gesäugt, kann es. Kapitän Hagen, dieser alte Seebär, der sich den Wind aller Weltteile hat um die Nase pfeifen lassen, kann es ebenfalls. Ich bezweifle nicht, wie er versichert, dass er Zeit seines Lebens hier herumspazieren kann, ohne sich nach wirklicher Natur zu sehnen. Ich kann es nicht.«
»Sie würden auf die Dauer nicht durch diese Wiedergaben, die an Naturtreue absolut nichts vermissen lassen, befriedigt werden?«
»Nein. Ich kann mich überhaupt niemals richtig hineintäuschen — ich bin darin ein Schafskopf, ich habe entweder zu viel Phantasie oder zu wenig. Ich fühle mich immer zwischen den Wänden des Felsengebirges von Nordamerika eingekeilt. Ich sehe immer durch die Fenster, was mir da auch vorgegaukelt wird, die nackten Felswände der Höhle. Ich bedauere selber, dass es so ist. Aber ich kann mich nicht anders zwingen. Kommen Sie, ich will Ihnen immer noch etwas anderes zeigen, was absolut nichts an Wirklichkeit einbüßt — nur nicht für mich.«
Sie verließen das Haus und die Höhle, durchschritten einige kurze Gänge, Littlelu orientierte sich manchmal nach einem Kärtchen, dabei einen Taschenkompass benutzend.
»Hier kann man sich nämlich böse verlaufen. Ich glaube, das Labyrinth des Minotauros war nichts gegen dieses hier. Aber ein Verirren ist ungefährlich. Dafür gibt es hier wieder eine andere Camera obscura, in der alle diese Gänge beobachtet werden können. Ein Vermisster würde sehr schnell gefunden werden.«
»Sind Sie schon überall gewesen?«
»Ach, geehrter Herr — stellen Sie nicht solche Fragen. Ich weiß gar nichts. Heute glaube ich es, morgen gibt mir Mister Dollin wieder eine ganz andere Karte, die mich in eine ganz andere Region führt. Es ist rein zum Verrücktwerden.«
»Wer ist das, Mister Dollin?«
»Fragen Sie ihn selber, wer er ist!«
Lirtlelu sprach in einer Weise, dass Torres immer lachen musste.
Sie erstiegen eine Treppe, die auf eine Galerie führte. In Kopfeshöhe waren an der Wand kleine Löcher angebracht.
»Blicken Sie hindurch. Wie gefällt Ihnen dieses kinematografische Bild?«
Leutnant Torres hatte ja soeben viele solcher Bilder gesehen, auch genau von demselben Genre, und doch wurde der akademische Hinterwäldler, der eben Sinn so etwas hatte, ganz überwältigt.
Er sah eine Polarlandschaft, mächtig sich auftürmende Eismassen, beleuchtet von einer tiefstehenden, blutroten Sonne, von einem Nebelflor umgeben. Es brauchte ja nicht gerade die Mitternachtssonne zu sein, aber man konnte es annehmen. Belebt wurde diese furchtbar wilde Eiswüste von flatternden Polarvögeln und einigen Eisbären.
»Nun, wie finden Sie das, Herr Leutnant?«
»Herrlich! Ich möchte aber lieber, es wären keine Vögel und Eisbären da. Eine Todesruhe müsste noch mehr wirken.«
»Hm. Sie mögen recht haben. Kommen Sie mit. Wir wollen die Vögel und Eisbären ausradieren.«
Sie stiegen die Treppe wieder hinab, gingen nur wenige Schritte unten im Gange und vor Littlelu entstand in der Felswand eine kleine Öffnung.
Ehe Torres vor der eisigen Luft, die ihm entgegenwehte, zurückschrecken konnte, hatte ihn sein Begleiter schon vollends hineingezogen.
»Kommen Sie nur. Sie holen sich doch nicht so leicht einen Schnupfen. Nun, was meinen Sie zu dieser kinematografischen Illusion?«
Lange Zeit war der Leutnant sprachlos. Was er durch die mit einer Glasscheibe versehene Öffnung erblickt hatte, war eben kein kinematografisches Bild gewesen, es war alles Wirklichkeit!
Ein Chaos von wirklichen Eisblöcken und Eisschollen zu bizarren Bergen aufgetürmt! Dass die Unbegrenztheit des Raumes eine panoramatische Täuschung sein musste, so wie die Sonne nicht echt sein konnte, das war selbstverständlich. Aber was schadete das, wenn die Täuschung eine perfekte war.
Endlich brach der Leutnant das Schweigen, er fand Worte.
»Ja, wo sind aber die Vögel und Eisbären geblieben?«
Plötzlich brach Littlelu in ein schallendes Gelächter aus und sagte:
»Sehen Sie nun, dass Sie niemals zufriedengestellt werden können? Ich denke doch, Sie fallen vor Überraschung gleich um, hinter der Wand nun eine wirkliche Eiswildnis zu finden. Und derweil vermissen Sie gleich die Vögel und die Eisbären! Sie sind ein ganz echter Mensch wie alle anderen, die aus dem Geschlechte des Prometheus sind. Immer unzufrieden. Und das ist ja eben dasjenige, was mir am Menschen gefällt. Sonst hätten wir heute kaum das Insektenpulver erfunden.«
»Und ich versichere Ihnen, dass ich mich vollkommen in den Wahn hineintäuschen kann, mich hier am Nordpol zu befinden.«
»Na gut, das will ich Ihnen glauben. Ich kann's nicht. Ich bin eben nicht so zum glücklichen Wahnsinn veranlagt. Für mich ist das eine Eiskammer, in der man die Eisblöcke, nicht einmal natürlich, sondern künstlich gefrorene, absichtlich durcheinander geworfen hat. Ich sehe immer noch den Tapezierer und Dekorateur, wie der alles arrangiert, manchmal hinausgeht und einen Grog trinkt oder sich einen hereinbringen lässt. Und diese Sonne dort? Die hat in Wirklichkeit nur einen halben Meter Durchmesser, ist rot angemalt und wird auf Schienen an Drähten fortgezogen. Ich kann mir nicht helfen.«
»Ich bin da ein glücklicherer Charakter als Sie.«
»Ja, das sind Sie. Nun kommen Sie. Lange können wir uns hier nicht aufhalten, wir sind doch nicht danach angezogen. Eine Kälte von mindestens fünf Grad muss hier wohl herrschen. Nur die Eskimowohnung wollen wir noch besichtigen, die hier sein soll, wir müssen sie aber erst suchen. Wenn Sie Lust haben, können Sie sich ja mit einem Pelzkostüm versehen und hier ein bisschen spielen, Kapitän Hagen wird Ihnen dabei Gesellschaft leisten. Für mich ist das nichts.«
Man konnte keine drei Schritte auf ebenem Boden gehen. Sofort begann das Klettern über Eisblöcke und aufgetürmte Schollen hinweg. Dabei mussten oft genug die Hände benutzt werden, und Littlelu machte ein Gesicht und schlenkerte manchmal die Hände, dass man gleich merkte, wie wenig er Kälte liebte und wie ungern er Eis angriff.
»Sind Sie schon einmal hier gewesen?«, fragte Torres während dieser Klettertour.
»Ja, habe aber nur von außen hereingeblickt, durch die Löcher. Ich wusste schon, dass dahinter etwas mehr Wirklichkeit war, konnte aber damals die Tür nicht finden. Mister Dollin hat mir erst den Eingang beschrieben. Ah, da haben der Herr Eskimo und die Frau Eskimo ja schon ihre Flagge gehisst!«
Wenigstens waren es zwei kurze Mastbäume, die in einiger Entfernung voneinander in das Eis gerammt waren. Zwischen ihnen war eine Leine gespannt, an der dicke und dünne Streifen hingen. Man konnte zweierlei Formen an dem zusammengeschrumpelten Zeuge unterscheiden, die eine Form war auch ziemlich bekannt — das waren Stockfische. Aber die anderen Streifen waren zweifelhafter.
»Das ist gefrorener Seehundspeck«, erklärte Torres, der nur einmal daran gerochen hatte. »Ich bin zwar noch nicht am Nordpol gewesen, aber Seehundspeck kenne ich. Ich bin vom nördlichen Oregon her, dort kommt auf den Markt genug Seehundspeck, und es gibt sehr viele Leute, die den leidenschaftlich gern essen, und zu diesen gehöre auch ich. Auch Stockfisch esse ich ab und zu ganz gern. Aber Seehundspeck könnte es bei mir täglich geben. Was haben Sie denn?«
Während Torres sprach, hatte sich Littlelu mit einem unbeschreiblichen Gesicht immer geschüttelt und den ganzen Körper gewunden. Der Leutnant bemerkte dieses Gebaren seines Begleiters erst jetzt.
»Hören Sie auf — hören Sie auf«, stöhnte Littlelu, »Stockfisch — und nun gar erst Seehundspeck — hööööö — ich bin aus Kanada — da gibt's auf den Märkten auch überall Seehundspeck — hööööö — alles, alles kann ich essen — Schnecken, Regenwürmer, sogar Krebse, die ich direkt von Leichen wegnehme — aber Stockfisch — hööööö — und nun gar erst Seehundspeck — hööööhh —«
Er wischte sich die Augen. Er hatte wirklich gewürgt.
Leutnant Torres lachte und schickte sich an, in die Schneehütte zu kriechen, die sich neben den Masten in Gestalt eines sehr stumpfen Kegels oder mehr einer Halbkugel in Höhe von etwa zwei Metern erhob, ein echtes Iglu.
Die Eskimos, oder die Inuit, wie sie sich selbst nennen, was »Menschen« bedeutet — alle isolierten Völker nennen sich »Menschen«; Eskimo ist ein Wort der benachbarten Schwarzfußindianer und bedeutet »Rohfleischfresser« — fertigen diese Wohnungen auf die Art an, dass sie mit heißen Messern aus Eis handliche Blöcke schneiden, diese um ein ziemlich tiefes Loch im Boden herum zur Kuppel zusammenfügen, dann noch eine tüchtige Schneelage darauf häufen, die mit der Zeit vereist. Einige ganz kleine Fensterchen werden mit starken, aber durchsichtigen Eisscheiben geschlossen. Für den Eingang wird ein ebenfalls halbunterirdischer Tunnel angelegt von zwei bis zehn Metern Länge, je nach der geschützten oder windigen Lage des Iglus. Dieser hier war kaum zwei Meter lang.
»Kommen Sie mit?«, fragte Torres, schon auf Händen und Knien liegend.
»Gott soll mich bewahren!«, rief Littlelu, sich immer noch die Augen wischend. »Nicht für hunderttausend Dollars! Nicht für alle Schätze der Welt! Hier haben wirklich Eskimos gehaust, da drin mag's schön nach Stockfisch und mehr noch nach Tran stinken!«
Torres kroch in den Tunnel, nachdem er erst ein als Stöpsel eingepfropftes Rentierfell herausgezogen hatte; er musste wie ein Maulwurf kriechen, oder sogar wie eine Schlange, mehr auf dem Bauche als auf den Knien, kam aber mit Schnee und Eis gar nicht in Berührung, sogar die Wände waren kunstvoll mit Fellen tapeziert.
Dann ging es noch einen halben Meter hinab, und Torres befand sich im Innern des Kegels, etwas über zwei Meter im Durchmesser und in der Mitte gerade ein Aufstehen erlaubend.
Wunderbar war zunächst das Licht, welches hier herrschte, halb grün, halb rot, halb blau — irisierend — erzeugt eben durch die als Fenster eingesetzten Eisscheiben, durchsichtig wie Glas, und mochte draußen auch eine künstliche Sonne scheinen, so verbreitete sie doch normales Tageslicht.
Boden und Wände waren mit Fellen und Pelzen bekleidet, in der Mitte stand die Hauptsache jeder solcher Winterhütte: die ewige Lampe, ein flaches Tongefäß, Fischtran oder ausgelassenes Fett enthaltend, als Docht ein Geflecht aus einem besonderen Bast.
Nach Bericht aller Reisenden, die solch eine Schneehütte besucht haben, herrscht darin durch das enge Zusammenleben vieler Menschen und durch die sehr große Flamme immer eine wahre Backofentemperatur. Die Eskimos halten sich darin splitterfasernackt auf.
Nun ist aber doch alles aus Eis. Das müsste doch schmelzen. Aber das tut es nicht. Kein Tropfen sickert von den Wänden.
Wie kommt das? Weil in diesen Schneehütten das Thermometer niemals über den Gefrierpunkt steigt, es herrschen immer noch einige Grad Kälte. Diese Wärme ist nur eine Einbildung. Man muss nur bedenken, dass draußen Polarwinter ist, manchmal mit 40 und noch mehr Grad Kälte. Dann kommt die physiologische Erscheinung des vermehrten Stoffwechsels hinzu. Der menschliche Körper muss unbedingt große Mengen von Fett konsumieren, sonst kann er dort nicht existieren, und was die Eskimos für ungeheuere Mengen von Speck verschlingen, davon machen wir uns gar keine Vorstellung oder es klingt unglaublich. Auf einen Sitz vier Pfund Speck, dazu eine große Schüssel voll Lebertran, und das vier bis fünf Mal täglich, das ist für einen Eskimo eine Kleinigkeit. Und ehe ein europäischer Reisender fähig ist, so weit vorzudringen, dass er solch eine Schneehütte erreichen kann, hat er sich bereits an diese Lebensweise gewöhnt, die Natur fordert es. Wenn er sich früher vor einem Löffelchen Lebertran entsetzt hat, so trinkt er jetzt mit Behagen einen ganzen Kübel aus. Und dieser enorme Fettumsatz, wozu die Natur direkt kommandiert, sodass alles auch wirklich oxidiert, im Körper verbrannt wird, erzeugt eine Körperwärme, die einige Grad Kälte noch als hohe Temperatur empfindet. Eben weil sie diese Kälte benötigt.
Sonst waren noch einige Messer, eiserne Kochtöpfe, ein Feuergestell und drei zusammengerollte Pelzkostüme vorhanden, nichts weiter, und das war wiederum richtig. Alle sonstigen Gerätschaften, wie auch die Schlitten, werden während des Winters in einem einfacheren Loche aufbewahrt; in diesen kunstvollen Schneehütten wollen sich die Eskimos wie die Heringe zusammenschichten.
Ja, hier hatten Eskimos gehaust oder andere Menschen, die einmal hatten Eskimos spielen wollen. Während draußen gar nichts zu riechen gewesen war, roch es hier ganz entsetzlich nach Stockfisch und angebranntem Speck. Deshalb konnte es schon lange her sein, dass hier gebraten und gekocht worden war. Aber der Dunst war in die Felle und Pelze gegangen und würde wohl so lange darin haften wie noch ein Haar daran war.
Leutnant Torres kroch wieder heraus.
Littlelu war immer noch nicht fertig mit seinem Stockfisch und Seehundspeck. Jetzt lag er auf den Knien. hatte die Hände zum blauen, etwas nebligen Himmel erhoben. Und es brauchte kein Übermut zu sein, wenn er betete.
»Gnädiger Gott, ich danke Dir, dass Du mich hast keinen Eskimo werden lassen — und dass ich nie in die Verlegenheit gekommen bin, ein Eskimoleben führen zu müssen —«
»Was nicht ist, kann ja noch werden!«, ließ sich hinter ihm Torres vernehmen.
Littlelu blickte sich um und stand auf.
»Nie! Nie!!«, schrie er mit wahrer Wut.
»Wenn Sie einmal Gelegenheit haben, eine Polarexpedition mitzumachen —«
»Nicht für alle Schätze der Erde!! Nicht für sonst etwas!! In die Gegend, wo man nur Stockfisch und ähnliche Delikatessen kennt, bringt mich niemand, niemand! Mich nicht!!«
Es war immer etwas dabei, dass Leutnant Torres herzlich lachen musste. Littlelu war eben ein geborener Komiker.
»Gesetzt nun den Fall, Sie gerieten einmal in Gefangenschaft und man setzte Ihnen, Ihre Antipathie kennend, gerade nur Stockfisch und Seehundspeck vor. Was dann?«
»Was dann? Dann würde ich ganz einfach verhungern.«
»Wissen Sie, was richtiger Hunger ist? Haben Sie schon einmal vor dem Hungertode gestanden?«
»Nee. Habe ich bisher noch nicht nötig gehabt. Habe mich bisher noch immer redlich ernähren können. Ich will Ihnen eines sagen: Den Australnegern sind bekanntlich große Holzwürmer ein Leckerbissen, die sie aus der Rinde der Gummibäume hervorziehen und lebendig verschlucken. Da will ich mitmachen. Jawohl, wenn mich der Hunger foltert, glaube ich, dass ich auch solche Würmer lebendig verschlucken kann. Oder ich kann sie ja auch vorher totmachen, ihnen erst den Kopf abbeißen. Das getraue ich mir. Aber Stockfisch und Seehundspeck — ich ziehe den freiwilligen Hungertod vor!«
Littlelu stampfte mit den Füßen, schlug sich die Arme um den Körper und rieb sich dann sein stattliches Bäuchlein.
»Ob ich weiß, was richtiger Hunger ist? Ja, das weiß ich. Gerade jetzt habe ich welchen — Hunger wie ein Wolf. Ich habe mir zu heute Mittag Hammelsteaks bestellt — ah, Hammelsteaks, und vorher eine Schildkrötensuppe! Habe deshalb heute gar nicht gefrühstückt. Kommen Sie, mir knurrt der Magen fürchterlich, außerdem friere ich wie ein junger Hund. Oder wollen Sie hier bleiben und etwas Eskimo spielen, sich mit Stockfisch und Seehundspeck delektieren? Dann bleiben Sie.«
Aber der Leutnant ging mit. Auch er begann jetzt zu frieren.
»Wie wird nur hier diese Kälte erzeugt?«
»Jedenfalls sind die Wände hohl. Da ist irgend so ein Luderzeug drin. Mir überhaupt ganz egal. Wenn ich lieber wüsste, wo ich hier hereingekommen bin.«
An der betreffenden Stelle befanden sie sich, das konnte besonders der ehemalige Pfadfinder bestimmen. Aber an der vereisten Wand, eben eine richtige Gletscherwand, war nicht die geringste Fuge zu entdecken, und vergebens fingerte Littlelu daran herum.
»So 'ne Gemeinheit, so 'ne Hundsgemeinheit, so 'ne Seehundsgemeinheit!«, sagte er endlich, sich in die Hände blasend und sie dann in die Taschen steckend. »Leutnant, probieren Sie einmal. Hier ist irgendwo eine Stelle, wenn man darauf drückt, geht die Tür auf.«
Der Leutnant tastete und drückte und drückte, ohne dass etwas aufging.
»Na, haben Sie's denn noch nicht? Wie lange dauert denn das bei Ihnen? Wenn ich nicht so an die Pfoten fröre, hätte ich's gleich. Und meine Füße, meine Füße — o o o o o o!«
Er stampfte herum, während der Leutnant immer tastete und drückte. Dann fing auch Littlelu wieder an zu suchen, ohne den Mechanismus zu finden.
»Ich glaube wirklich, es wird immer kälter«, sagte jetzt auch der Leutnant. »Das sind nicht nur noch vier bis fünf Grad, das taxiere ich schon auf zehn Grad Celsius. Sollte das damit zusammenhängen, dass die Sonne sinkt?«
»Tut sie?«
»Die ist schon ganz bedeutend gesunken!«
»Halten Sie sie auf, das ist nur eine künstliche Sonne. Verflucht ja, wird das kalt!«
»O, das macht nichts, das ist ja nur eine künstliche Kälte!«, spottete der Leutnant.
»Herr, ich verbitte mir solche Witze! Verflucht noch einmal, wo ist denn hier nur der Knopf? Suchen Sie noch einmal. Ich glaube, ich habe mir schon die Fingerspitzen erfroren.«
Die Sonne sank schnell, es wurde immer kälter, und der befreiende Mechanismus ward nicht gefunden.
»Wenn wir hier eingeschlossen blieben und wir würden nicht vermisst oder dann nicht gefunden, dann könnten wir ja gleich einmal ein bisschen Eskimo spielen und Stockfisch und Seehundspeck —«
»Herr, ich verbitte mir solche Witze, ich hab's Ihnen schon einmal gesagt!!«, schrie Littlelu wütend, dabei aber immer der Komiker bleibend. »Ich habe fürchterlichen Hunger — meine Hammelsteaks will ich haben — meine Schildkrötensuppe und meine Hammelsteaks — Himmelbombenelement noch einmal, ist das eine Hundekälte!«
Die Türe wurde nicht gefunden, und die beiden fühlten, dass sie ihre Gliedmaßen demnächst erfrieren konnten, zuerst die Ohren.
»Ist kein anderer Ausgang vorhanden?«, fragte Torres.
»Mister Dollin hat mir nichts davon gesagt.«
»Wir werden in der Camera obscura beobachtet?«
»Das ist nicht gerade gesagt. Nein, weshalb denn? Erst wenn wir nach längerer Zeit vermisst werden, wird man uns darin suchen!«
»Dann müssen wir uns zuerst vor dieser hahnebüchenen Kälte schützen. Wir sind in unserer dünnen Kleidung des Todes! In der Schneehütte liegen einige Pelzkostüme, die müssen wir anziehen, kommen Sie mit.«
Littlelu war schon sehr, sehr kleinlaut geworden, er raffte sich noch einmal auf.
»Nein! Nein! Ich will mich nicht zum Eskimo herabwürdigen!!«
»Aber, Mensch, Sie sind dem Erfrierungstode ausgesetzt!«
»Ja, ich weiß es, aber ich krieche nicht in diese Eskimohundehütte! Holen Sie die Pelzkleider heraus!«
Es waren zwei echte Eskimokostüme, die Torres heraufbrachte. Erst kommt, von innen angefangen, ein doppelter Anzug aus dünngeschabtem Rentierfell, in dicker Lage mit Eiderdaunen gefüttert, auf der Innenseite, die der Eskimo auf der bloßen Haut trägt, noch mit den Bälgen junger Möwen benäht. Darüber kommt ein wasserdichter Überzug aus Seehundsfell, noch extra bezogen mit Fischblase. Dann erst kommt der eigentliche Pelz, gewöhnlich, wie auch hier, aus zusammengenähten Fuchsfellen. Dann weiter die Pelzkappe, die nur kleine Öffnungen für Augen und Mund hat, in den der Eskimo bei sehr großer Kälte einen Fuchsschwanz nimmt — hier ebenfalls vorhanden wie die unförmigen Pelzhandschuhe.
Das kann man aber nicht einzeln anziehen, das ist zusammengenäht, das heißt, die Hose für sich und die Jacke für sich, man steigt wie in einen Sack, an dem auch gleich die ebenso gefütterten Stiefel aus Seehundsfell sind, stülpt sich den zweiten Sack über den Kopf und kriecht mit den Armen hinein, die Verbindungsstelle wird mit einem Leibpelz wasser- und sogar luftdicht umschnürt, dergleichen der Hals mit einem Streifen aus Fischblase, um die Verbindung zwischen Kappe und Jacke wasserdicht zu machen.
»Es waren drei Kostüme vorhanden«, sagte Torres, »ich habe das weiteste ausgesucht, es wird Ihnen schon passen.«
Entsetzt war Littlelu vor den Pelzen zürückgefahren.
»Die stinken ja nach Stockfisch und verbranntem Speck!!«
»Daran, mein lieber Freund, werden Sie sich schon gewöhnen. Oder wollen Sie lieber Ihre Nase erfrieren, dass Sie überhaupt niemals wieder etwas riechen?«
Nein, da zog Littlelu vor, doch lieber hineinzukriechen. Er tat es, Torres war ihm behilflich. Sagen tat Littlelu nichts, er ergab sich in sein Schicksal.
Er hatte sich nicht erst seines Anzugs entledigt, dabei wäre er ja auch erfroren oder hätte sich doch den Tod holen können, er schlüpfte gleich mit den Stiefeln hinein, hatte auch ganz gut Platz darin.
Als aber nun Torres die letzten Riemen zugeschnürt hatte und einen Schritt zurücktrat, sein Werk musternd, da brach er in ein schallendes Gelächter aus.
Jetzt glich Mister Littlelu vollkommen einer Kugel, die auf kurzen, dicken Säulen ruhte, auf zwei Baumstümpfen, oben einen Knopf hatte und von deren Seiten zwei Bratwürste herabhingen.

»Ja, nun lachen Sie mich auch noch aus!«, erklang es dumpf grollend hinter der Pelzmaske. »Meine Hammelsteaks will ich haben! Und vorher meine Schildkrötensuppe! Und hinterher einen Eierkuchen aux confitures! O mein Magen, mein armer Magen, wie der knurrt!«
Auch Torres schlüpfte schnell in seine Pelzkleidung.
»Ich habe drin in der Schneehütte bereits die Lampe angebrannt und einen Topf mit Eis angesetzt, wir können uns gleich eine Portion Stockfisch kochen. Allerdings müsste er ja eigentlich erst acht Tage gewässert werden, aber —«
»Ungeheuer, geben Sie mir eine Harpune, damit ich Sie aufspießen kann!! Ja, zum Menschenfresser kann ich werden, ehe ich dieses Zeug anrühre! Und überhaupt, meine Hammelsteaks will ich haben! Will ich haben!!«
So schrie und weinte er und stampfte mit seinen kurzen, unförmlichen Beinchen herum, sich wie ein ungezogenes Kind gebärdend. Natürlich tat er das nur, um sich selbst durch Humor über die fatale Situation hinwegzusetzen und er nahm es nicht übel, dass sich der Leutnant vor Lachen ausschüttete.
Am fatalsten aber war, dass die Sonne, die einen großen Kreis beschrieben hatte, bereits unter dem Horizonte verschwunden war, nur ihr roter Widerschein verbreitete noch Licht — ein herrlicher Anblick, wie die Eismassen erglühten — doch in wenigen Minuten würde hier finstere Nacht herrschen.
»Eine Lampe haben Sie nicht bei sich?«
»Jawohl, eine elektrische, sogar eine ewige, aber ich habe vergessen, sie aus der Hosentasche zu nehmen, und ich kann mich doch nicht noch einmal ausschälen«, erlang es kläglich.
Torres kroch noch einmal in die Schneehütte, einen Stockfisch und einen Streifen Seehundspeck mitnehmend. Als er nach zehn Minuten wieder hervorkam, konnte er die Hand nicht mehr vor den Augen sehen.
Desto schöner nahmen sich in dieser Finsternis die beiden erleuchteten Eisfensterchen der Hütte aus.
»Ganz unnatürlich, alles ganz unnatürlich«, ließ sich Littlelus knurrende Stimme vernehmen, »in den Polargegenden tritt die Finsternis niemals so schnell ein, die Dämmerung nach Untergang der Sonne währt stundenlang.«
Da flammte es im Norden auf, weiße Strahlen zuckten am Horizont empor, eine weiße Scheibe stieg langsam auf, die man zuerst für die Sonne eines neuen Tages halten konnte, sie verbreiterte sich schnell, verlor den Kern — bis zuletzt ein mächtiger Bogen am Himmel stand, vom Umfange eines Regenbogens, aber viel, viel breiter, aus dem intensiv weiße Strahlen zuckten — ein weißes Nordlicht, die Helligkeit des Vollmondes verbreitend.
Nach einiger Zeit färbten sich die Strahlen gelb, dann kamen rote hinzu, dann grüne, blaue, violette — ein irisierendes Nordlicht, die ganze Eislandschaft in wunderbarer Farbenpracht erstrahlen lassend.
Leutnant Torres machte aus seiner staunenden Bewunderung kein Hehl.
»Herrlich, fabelhaft prächtig! In meiner Heimat sieht man oftmals Nordlichter, aber gegen dieses sind sie nur ein matter Abglanz. Alle Polarreisenden versichern, dass man so ein Nordlicht gar nicht beschreiben kann, und der Pinsel des Malers kann doch nur immer einen einzigen Moment dieses wunderbaren Farbenspieles festhalten — jetzt glaube ich es, dass niemand es wagen mag, so etwas zu schildern.«
»Ja, wenn es natürlich wäre«, knurrte Littlelu. »Das ist hier aber doch künstliche Mache, da werden hinter den Kulissen elektrische Strahlen durch Glasprismen geschickt.«
»Ist diese Kälte etwa auch unnatürlich?«
»Ganz gewiss, die ist ebenfalls künstlich erzeugt!«
»Aber mein Hunger ist jedenfalls ganz natürlich.«
»Ja, meiner auch«, bestätigte Littlelu kläglich. »O Gott, o Gott, wie soll denn das nur werden, wenn die uns hier nicht bald finden? So eine Hundsgemeinheit! Und dieser Pelz hält ja gar nicht warm, ich friere jetzt erst recht wie ein Schneemann.«
Ja, die Kälte wurde immer grimmiger, man konnte wirklich nicht mehr atmen und tat gut, den Fuchsschwanz zu Hilfe zu nehmen.
»Kommen Sie mit in die Schneehütte, dort drin ist's ganz traulich«, riet Torres.
Littlelu ließ sich nicht dazu bewegen.
»Wenn ich sterben, erfrieren und verhungern soll, dann wenigstens hier draußen, ehe ich mich vollends zu einem Eskimo herabwürdige.«
So kroch Torres allein zurück. Es war wirklich ganz traulich in dem mit Pelzen ausgekleideten Raume. Die Flamme hatte den Tran unterdessen völlig aufgetaut, schlug fast einen halben Meter hoch empor, verbreitete in der Nähe eine ganz behagliche Wärme. In einiger Entfernung davon war freilich nichts mehr zu spüren. Da siegte die Kraft der Eiswände. Der Atem quoll als weißer Rauch aus dem Munde.
Torres rührte mit einem Messer in dem über der Flamme brodelnden Kochtopfe und wollte die Speckseite in noch dünnere Streifen schneiden, was ihm aber nicht gelang, der Speck war zu hart gefroren, er musste erst aufgetaut werden.
Nicht lange dauerte es, als in dem Tunnel eine klägliche Stimme erscholl:
»Helfen Sie mir, ich bin stecken geblieben!«
Die menschliche Kugel hatte sich in der Mitte des Tunnels festgekeilt. Torres packte seinen Gefährten bei den Händen und zog ihn mit Mühe herein. Später aber zeigte es sich, dass Littlelu recht gut durchkonnte, wenn er nur wollte. Er versuchte sich eben immer noch durch Humor über die fatale Situation hinwegzuhelfen.
Er jammerte wieder über den Gestank, fing beim Anblick der Vorbereitungen, die Torres zu seinem Essen traf, wieder wirklich zu würgen an, da war gar kein Humor dabei, vergaß aber auch nicht, sich an der Flamme zu wärmen, was ihm jedoch nicht gelang. Die Wärme ging nicht durch die Pelzhandschuhe, und zog er sie aus, so erfror er bald die Hände, oder er musste sie direkt in die Flamme halten.
»Und da sagt man nun, in diesen Schneehütten herrsche immer eine Backofentemperatur!«, jammerte er.
»Das ist ja nur Einbildung, durch den Gegensatz der draußen herrschenden, fürchterlichen Kälte erzeugt.«
»Na, herrscht draußen etwa nicht eine fürchterliche Kälte?«
»Ja, da kommt aber auch noch jene physiologische Erscheinung hinzu, Sie müssen erst tüchtig Speck essen, immer tüchtig Speck essen —«
Torres vermochte die Speckseite nicht zu zerkleinern, nicht dicht neben der Flamme aufzutauen, und so machte er es zuletzt genau so wie die Eskimos, er mochte davon ja auch schon gehört haben.
Er brannte das eine Ende der Speckseite einfach an, die Flamme leckte nach oben, und als das ganze Stück ein einziges Feuer war, warf er es hin und erstickte die Flammen mit einem Fell.
Die Folge dieses Experimentes war, dass ein undurchdringlicher Qualm und ein wirklich schier unerträglicher, atemversetzender Gestank nach verbranntem Fett den engen Raum erfüllte, und die weitere Folge war, dass Littlelu schnell wie ein glatter Aal durch den Tunnel wieder ins Freie schlüpfte.
Draußen hörte ihn Torres stöhnen und ächzen und würgen.
Etwa eine Stunde mochte das Nordlicht gespielt haben, dann verlosch es nach und nach, für einige Minuten herrschte wieder absolute Finsternis, dann kam wieder ein grandioses Morgenrot und über dem Horizonte tauchte die Sonne eines neuen Tages auf, um wieder einen großen Kreis über den ganzen Himmel zu ziehen, ohne sich besonders hoch zu erheben.
Torres kam wieder aus dem Tunnel gekrochen, noch schmatzend.
»Der Stockfisch war noch sehr hart, schmeckte aber sonst sehr gut, und an dem Seehundspeck war überhaupt nichts auszusetzen. Einfach delikat. Man muss nur den Ruß abkratzen.«
Littlelu hatte sich zu einer richtigen Kugel zusammengekauert, jetzt erhob er sich.
»Wir müssen die Tür suchen.«
»O, ich habe es nicht so eilig, ich kann hier einige Zeit aushalten.«
»Ich krepiere vor Hunger.«
»Ich nicht, ich bin gesättigt, fühle mich äußerst behaglich. Auch die Kälte lässt jetzt wieder ganz bedeutend nach.«
Aber der Leutnant half doch mit suchen, zwecklos, die Türe wurde nicht gefunden.
»Wir müssen aber doch vermisst werden«, meinte Torres, »wir sind nun doch schon eine ganze Nacht hier.«
»Eine ganze Nacht? Sie sind verrückt! Diese Nacht hat nur eine Stunde gedauert. Ich habe mich vorhin einmal ausgeschält, um meine Lampe und meine Uhr herauszuholen, ich brauchte ja nur die Hosen aufzuschnüren, wäre dabei aber beinahe erfroren. Nein, wir sind noch nicht einmal zwei Stunden hier. Da vermisst man uns noch nicht, besonders nicht, wenn man hier auf neue Sehenswürdigkeiten ausgeht. In Bezug auf die Mahlzeiten gibt es hier auch keine festgesetzten Stunden.«
»Und wie lange dauert es, bis man uns vermisst?«
»Ja, wenn ich das wüsste. O Gott, o Gott, ich wage gar nicht daran zu denken! Mein Magen, mein armer Magen!«
Sie verließen diese Stelle, um einmal anderswo nach einer Tür zu suchen. Es konnte ja noch einen anderen Ausgang geben, leichter zu finden. Sie hatten sich überhaupt noch gar nicht aus der Umgebung dieser Schneehütte entfernt, und es war ein gar weiter Raum, in dem sie sich befanden. Wie groß er war, das konnte man mit den Augen nicht beurteilen, nur durch Tasten mit den Händen, denn die Täuschung des Panoramas, die Verschmelzung von Wirklichkeit mit gemalter Perspektive, war eine vollkommene.
Sie waren noch nicht weit gekommen, als sie eine große Überraschung erleben sollten.
Eisgrotten und Eisspalten gab es überall. Als Ausgang konnte nur eine solche in Betracht kommen, die nahe der Wand lag, obgleich sie noch gar nicht wussten, wo diese begann.
Als sie nun in eine breite Eisspalte, in die gerade die Sonne schien, eindringen wollten, scholl ihnen ein drohendes Brummen entgegen, und aus dem dunkleren Hintergrund trabte ein mächtiger Eisbär hervor.
Der Schreck der beiden lässt sich denken. Deshalb konnten sie sonst ganz furchtlose Männer sein, die sie auch wirklich waren. Aber mit solch einem Eisbären ist eben nicht zu spaßen.
Schnell retirierten sie nach der noch nahen Schneehütte zurück. Nur in dieser hätten sie Schutz vor dem grimmigen Raubtiere gefunden. Denn der Eisbär klettert doch überall hin, wohin sich ein Mensch flüchten könnte.
In den Tunnel krochen sie freilich noch nicht, sie blickten sich um und sahen, dass der Bär ihnen nicht gefolgt war.
Da brach Littlelu in ein Lachen aus.
»Ach, wir Narren! Das war doch nur ein künstlicher, ein Automat!«
»Teufel noch einmal, danach sah das Vieh aber gar nicht aus, ich habe es doch ganz deutlich gesehen!«, meinte Torres.
»Sie sind eben noch nicht in unserem mechanischen Theater gewesen, da bekommen sie etwas ganz anderes zu sehen. Und wie soll sich denn überhaupt hier ein Eisbär aufhalten können?«
»Nun, ein zahmer, der gefüttert wird. Solch einer Zahmheit ist nur nicht recht zu trauen.«
»Nein, nein, es war ein Automat. Kommen Sie nur ruhig mit.
Sie begaben sich wieder hin. In der Eisgrotte war kein Eisbär mehr zu sehen. Als sie aber näher kamen, die Höhle gerade betreten wollten, erscholl von Neuem das drohende Brummen, wieder kam der Eisbär aus dem Hintergründe vorgetrabt.
Etwas Bestürzung erweckte das Ungeheuer doch noch, die beiden retirierten wenigstens einige Schritte rückwärts, und da zog sich auch der Bär zurück.
»Sehen Sie? Ganz genau dasselbe wie vorhin«, erklärte Littlelu.
»Dass er wieder zurück geht, haben wir vorhin nicht gesehen.«
»Jetzt aber haben wir es gesehen, und das wird er immer so machen. Es ist eben ein Automat.«
»Wie soll denn die Bewegung zustande kommen?«
»Jedenfalls durch den Boden. Wir lösen durch unser eigenes Gewicht den Mechanismus. aus.«
»Ja, aber wie soll sich denn der Bär bewegen?«
»Eben ein Automat, mit Quecksilber gefüllt, durch Elektrizität getrieben. Wie das freilich gemacht wird, das müssen Sie einen anderen fragen, ich weiß es nicht, mir ist es auch ganz egal!«
Sie gingen wieder näher, wieder kam der Eisbär hervor, als sie sich nicht mehr entfernten, sondern noch einige Schritte taten, setzte sich der Bär auf das Hinterteil, richtete sich empor, riss den Rachen auf, brüllte furchtbar und hob die eine Tatze zum Schlage.
Es gehörte viel, viel Überzeugung dazu, um glauben zu können, dass es nur ein künstlicher Eisbär sei. Das Brüllen, die glühenden Augen, die erhobene Tatze, jede andere Bewegung — gar nichts ließ die Natürlichkeit vermissen.
Und doch, der Hinterwäldler konnte nicht getäuscht werden.
»Nur eines fehlt — aus seinem Rachen müsste Dampf quellen wie bei uns, und das tut es nicht.«
»Da sehen Sie, es ist eben alles nur Kunst, der Natur nicht einmal treulich nachgeahmt, ganz stümperhafte Kunst, die niemals täuschen kann, mich wenigstens nicht«, entgegnete Littlelu, obgleich gerade dem das Fehlen des dampfenden Atems gar nicht aufgefallen war. »Wenn Sie übrigens Ihren Kauapparat mit dem Ausdruck Rachen bezeichnen, so habe ich nichts dagegen — ich habe nur einen Mund, der sich noch nicht mit Stockfisch und Seehundspeck geschändet hat und es auch niemals tun wird. Und wenn das kein Automat wäre, sondern ein Eisbär, so wäre es mir tausendmal lieber. Dann würde ich ihm sofort zu Leibe gehen, ihn mit meinen Händen erwürgen und mir das beste Stück aus seinem Leibe herausschneiden. So kann man dieses Luder nicht einmal essen.«
Er ging hin — aber nicht sehr weit. Der Eisbär hob die Tatze mit den furchtbaren Pranken höher, ließ sie blitzschnell herabsausen, und erschrocken war Littlelu zurückgesprungen.
»Ei verflucht, das ist ja gefährlich!«, sagte er, in den Haaren kratzend — das heißt in den Haaren seiner Pelzkappe.
»Gehen Sie nur ruhig hin, es ist ja nur ein künstlicher Bär«, spottete Torres.
»Ja, die Guillotine ist auch nur ein Automat, ein künstlicher Scharfrichter, aber legen Sie einmal den Kopf unter das Fallbeil und drücken Sie den Knopf! — Haben Sie nicht eine Stange?«
Eine solche war nicht vorhanden. Littlelu ging vorsichtig näher, hob das eine Bein und gab dem Ungeheuer einen derben Tritt in den Leib.
Der Eisbär stand, wohl aber verlor Littlelu die Balance, rutschte aus, fiel auf den Rücken, konnte sich in der unförmlichen Umhüllung wohl wirklich nicht schnell wieder erheben, strampelte mit Beinen und Armen und schrie Zeter und Mordio.
Lachend half ihm Torres wieder auf und zog ihn einige Schritte zurück, der Eisbär ließ sich nieder, warf sich herum und trottete, als sich jene entfernten, wieder in seine Höhle.
Sie waren noch nicht weit gegangen, als aus einer kleineren Spalte ein weißer Eisfuchs herauskam, schnell über eine ebene Fläche hinhuschte und in einem Loche verschwand.
Vergeblich warteten sie, dass er zurückkäme. Als sie sich aber einige Schritte entfernt hatten, kam aus jener Spalte ein anderer heraus, der einen schwarzen Schwanz hatte und in ein anderes Loch huschte.
Und so wurde es überall lebendig. Doch waren es immer nur Füchse, die sich zeigten, und das war auch ganz richtig. Und vergebens versuchten sie, solch einem Tier den Weg zu verlegen. Es waren eben Automaten, deren Mechanismus sich nur auslöste, wenn sie auf bestimmte Stelle traten.
»Wenn ich einen Lasso hätte, wollte ich wohl einen fangen!«, meinte Torres.
»Wozu das, wenn man den mit Quecksilber gefüllten Balg nicht essen kann?«
»Diese Polarfüchse sind überhaupt ungenießbar, Eskimos verschmähen ihr Fleisch, und wenn sie noch so von Hunger geplagt werden.«
»Wenn ein Eskimo so hungrig wäre wie ich, würde er das Fleisch wohl mit bestem Appetit verspeisen. Himmel Donnerwetter noch einmal, meine Hammelsteaks! Ich fühle schon, wie ich in dem Pelze immer mehr zusammenklappere. Na, einmal müssen wir ja doch hier wieder herauskommen, dann will ich nicht schlecht einhauen!«
»Na, wenn Sie mich noch zu überleben gedenken, dann haben Sie ja noch 45 Jahre, 5 Monate und 17 Tage Zeit, bis dahin werden Ihre Hammelsteaks wohl durchgebraten sein.«
»Mensch, seien Sie still, ärgern Sie mich nicht!«, schrie Littlelu wütend. »Hier heraus will ich, sofort!«
Aber sie fanden keinen anderen Ausgang, wie sie auch die Grotten und Spalten untersuchten, in denen sie noch manche Überraschung erlebten.
Sie seien nicht aufgezählt, nicht geschildert. Nur eine einzige noch.
Auf einer ebenen Eisfläche, auf der sich eine große Schar Schlittschuhläufer hätte tummeln können, befand sich ein offenes Wasserloch, wie es solche ja auch in der wirklichen Polarregion gibt, auch bei der strengen Kälte niemals zufrierend, weil hier warme Wasserströme zusammentreffen.
Als die beiden näher kamen, tauchte der Kopf eines Seehundes auf, blies und schnaufte und nieste, schwang sich halb auf das Eis, und erst als die beiden noch näher kamen, verschwand er wieder im Wasser.
Erst als die beiden dies mehrmals wiederholt hatten, sich entfernend und wieder nähernd, und der Seehund immer wieder kam und wieder verschwand, waren sie überzeugt, dass es ein künstlicher war, ein Automat. Sonst war jede Bewegung und das Gebaren vollständig natürlich. Und es war auch gleich, von welcher Seite sie kamen, stets drehte ihnen der Seehund den Kopf zu. Kamen sie aber von zwei verschiedenen Seiten, so tauchte das Tier nicht auf, wahrscheinlich weil das Gegengewicht den Mechanismus nicht auslöste.
Es war unbegreiflich, wie dieses Kunstwerk funktionierte. Littlelu natürlich hatte nur darüber zu schimpfen, verächtlich von solcher stümperhaften Nachahmung der Natur zu sprechen.
Die Sonne hatte dreiviertel des Horizontes umkreist, wollte wieder untertauchen, drei Stunden hatte sie dazu gebraucht, und während die Temperatur bei ihrem Hochstand ganz erträglich gewesen war, setzte jetzt wieder eine grimmige Kälte ein.
Die Verzweiflung, die jetzt über Littlelu kam, hatte nichts Humoristisches mehr an sich. Aber schimpfen musste er doch noch.
»Da sehen Sie, was das alles für Pfuschwerk hier ist. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang müssen es unbedingt vierundzwanzig Stunden sein, wenige Minuten mehr oder weniger, und hier in diesem Eiskeller vollzieht sich das in vier Stunden. Und solchen Schwindel soll man nun glauben, für Natur hinnehmen!«
»Ich glaube, wenn Sie einmal nicht mehr schimpfen und alles schlecht machen, dann finden wir den Ausgang gleich!«, meinte Torres.
Aber Littlelu schimpfte weiter, jammerte, winselte.
Finsternis, Nordlicht, Finsternis und wieder Sonnenaufgang.
Wir wollen es kurz machen: Noch dreimal umkreiste die Sonne den Horizont und tauchte zum vierten Male unter. So waren die beiden schon sechzehn Stunden gefangen. Gestern gegen Mittag waren sie hereingekommen, jetzt war es nachts um vier Uhr. Und Littlelu hatte gestern früh um acht nur ein Brötchen gegessen, um für den Mittag rechten Appetit zu haben, den er nun schon sechzehn Stunden hinter sich hatte.
Jetzt kauerte er in der Schneehütte, hatte einige Stunden geschlafen, dabei von Hammelsteaks und anderen schönen Sachen träumend, die er verschlungen, von welchen platonisch eingenommenen Mahlzeiten er natürlich nicht satt geworden war.
Dazu kam nun auch die viele Bewegung in der grimmigen Kälte, denn immer und immer hatte er nach dem Ausgange gesucht — die Natur forderte ganz gebieterisch ihre Rechte. Es war leicht möglich, dass dieser dicke Mann, an regelmäßige und reichliche Mahlzeiten gewöhnt, bald des Hungertodes starb, das geht bei manchen Menschen schnell, und gerade bei solcher Kälte. Der Stoffwechsel geht da ungeheuer schnell vor sich.
Jetzt schaute er trübselig dem Leutnant zu, der mit Behagen seine dritte oder vierte Portion trotz allen Kochens steinharten Stockfisch verzehrte und dazwischen ab und zu einen Streifen schwarz angekohlten Seehundspeck verschlang.
Da ging durch die dicke Kugel, Littlelu genannt, ein sonderbares Rucken, und so ruckte er auch heran, wie es nur solch ein Clown fertig bringt.
»Leutnant, ich verhungere tatsächlich, ich halt's nicht mehr aus«, erklang es unsagbar kläglich.
»So essen Sie doch.«
»Meinen Sie?«
»Hier ist gerade ein recht weiches Stück Stockfisch.«
Und es geschah: Littlelu begann Stockfisch zu essen, dabei unbeschreibliche Grimassen schneidend, sodass Torres aus dem Lachen nicht herauskam.
»Das nennen Sie gekochten Fisch?«
»Jawohl, der hat mindestens zwei Stunden gekocht.«
»Worin haben Sie ihn denn gekocht?«
»Nun, in Wasser.«
»Wo haben Sie denn das Wasser her?«
»Nun hier ist doch Eis genug. Dieses hier stammt aus der Hüttenwand. Ich war vorhin zu faul, erst hinaus zu gehen, da habe ich mit dem heißen Messer dort ein großes Stück aus der Wand herausgeschnitten.«

Die Grimasse, die Littlelu jetzt schnitt, übertraf die vorigen.
»Stockfisch — in einem Stück Wand gekocht«, sagte er dann in einem Tone, dass sich Torres erst recht vor Lachen wälzte.
Littlelu aber begann wieder zu würgen.
»Ich kann nicht — ich kann's beim besten Willen nicht — geben Sie mir lieber so ein Stück Speck her.«
Und er versuchte es mit dem angebrannten Speck. Er musste angebrannt werden, sonst taute er nicht auf, denn er war glashart.
»Nein, den erst recht nicht — da lieber noch Stockfisch — nein, ich will's doch lieber noch einmal mit dem Speck versuchen —«
Und so ging das immer hin und her, und auf diese Weise brachte der verhungerte Littlelu doch zwei Pfund Stockfisch und ebenso viel Speck in den Magen.
Dann schlief er wieder eine Stunde, und dann begann er abermals zu essen, nun war der Bann gebrochen. Aber nicht etwa, dass es ihm schmeckte. Durchaus nicht! Dazwischen wurde er immer wieder einmal vor Ekel gewürgt, aber er aß weiter. Die Natur forderte eben ihre Rechte.
So waren wieder einige Stunden vergangen, als draußen ein lautes »Hallo!« erklang.
Wie ein Aal schlüpfte Littlelu in den Tunnel und wurde von diesem wie eine Bombe ausgespieen, er lag an Kapitän Hagens Brust — oder vielmehr an des Riesen Bauche.
»Hagen, mein Retter, mein Engel — o Sie verfluchter Kerl, konnten Sie denn nicht vier Stunden eher kommen?! Dann wäre ich jetzt noch ein Mensch!«
Die Erklärung war bald gegeben. Man hatte die beiden eben gestern den ganzen Nachmittag nicht vermisst, noch weniger in der Nacht, erst heute früh, als von ihnen kein Frühstück verlangt wurde. Da war das Labyrinth mit Hilfe jener besonderen Camera obscura abgesucht worden. Aber in der Schneehütte hatten sie nicht gesehen werden können. Die indianische Gräfin selbst war auf die Suche gegangen, ihre feine Nase — oder wie sie das nun sonst machte — hatte die Spur verfolgt.
Und dabei war es so einfach, die Tür auch von innen zu öffnen.
Zehn Minuten später saß Littlelu in einem frisch gewaschenen Anzug an einem gedeckten Tische. Sein Magen war zum Platzen mit Stockfisch und Seehundspeck angefüllt, aber das machte nichts, er war fähig, auch die längste Speisekarte noch abzuessen.
»Was wünschen Sie zu speisen?«, fragte der aufwartende Japaner.
»Ganz egal was — nur recht viel und recht gut und recht fix!«
»O, wir haben gestern eine große Delikatesse gehabt, es ist etwas ganz Neues hier in den Provianträumen gefunden worden, und es ist noch viel davon übrig geblieben!«, sagte der Japaner mit den Fingern schnalzend.
»Immer her damit, immer her damit, wenn's nur fix geht!«
Nach wenigen Minuten brachte der Japaner zwei dampfende Terrinen herein und setzte sie auf den Tisch.
»Was — ist — denn — das?!«, flüsterte Littlelu misstrauisch oder schon mit ganz entsetzten Augen, denn er roch gleich etwas.
»Stockfisch mit echt grönländischem Seehundspeck«, sagte der Japaner, der mit dem Eskimo im Gesichtsausdruck und Körperbau und noch in manchem anderen eine verzweifelte Ähnlichkeit hat.
Littlelu sagte nichts, nur ein Stöhnen kam aus seinem Munde, dann fiel er in den Lehnstuhl zurück und reckte die Beine in die Luft.
Atalanta saß vor ihrem Schreibtisch und übersetzte ein spanisches Werk, ohne noch ein Wörterbuch gebrauchen zu müssen.
Der Schreibtisch stand in der Mitte eines weiten Raumes, der sonst fast ganz in Dunkel gehüllt war, eine kleine Glühlampe, mit einem Schirm überdeckt, beleuchtete nur die Stelle, wo sie schrieb.
Dafür aber war die gegenüberliegende Wand hell erleuchtet, ohne dass man die Lichtquelle sah, sie zeigte ein Lichtbild — jene Wildnis zwischen den Felswänden, den Talkessel, in dem Graf Arno als Einsiedler, als Robinson hauste.
So hatte die Schreibende, sobald sie von ihrer Arbeit aufblickte, den Geliebten immer vor sich. Wohin er auch ging, durch einen kleinen Apparat auf dem Schreibtische konnte sie ihm überall hin folgen, es sei denn, er kroch in eine Höhle oder in einen hohlen Baumstamm, nur dann versagte diese Camera obscura. Und wenn sie wollte, so konnte sie seine Gestalt, nur sein Gesicht ins Riesenhafte vergrößern, sodass ihr kein Zug in demselben entging.
Der Einsiedler hatte sich in dieser isolierten Welt nach Möglichkeit eingerichtet. Obgleich er schon wissen musste, dass es hier keine Schlangen gab, hatte er als Behausung wiederum einen hohlen Baobab erwählt. Eben eine Liebhaberei, wahrscheinlich auch eine Erinnerung an jene afrikanische Sumpfinsel, auf der er sich doch offenbar so glücklich gefühlt hatte.
Von dem untersten Aste hing eine Strickleiter herab, aus Schlingpflanzen gedreht, schon hatte er oben wieder eine Plattform hergestellt, durch Zusammenbinden von abgeschnittenen Zweigen.
Unter dem Baume waren einige Kaninchen- und Waschbärenfelle zum Trocknen ausgespannt, andere hatte er schon mit einem Steinmesser, das er sich mit unendlicher Geduld geschaffen hatte, dünngeschabt und mit Fett gegerbt.
Da er viel Zeit darauf verwendete, eine besondere Art Schlingpflanze in die einzelnen Fasern aufzulösen, dachte er jedenfalls daran, seine schon schadhaft werdende Kleidung durch eine selbstgeschaffene aus Leder zu ersetzen.
Ein mit Salz ausgebrannter Tontopf und einige andere Gegenstände verrieten weiter, wie er sich immer zu helfen, sein Leben behaglich zu machen wusste. Langeweile hatte er niemals. Nur wenn die Sonne, bezüglich deren Wirklichkeit er nicht den geringsten Zweifel hegen konnte, am höchsten stand, legte er sich für eine Stunde oben auf die Plattform nieder und rauchte aus einem ausgehöhlten Holzklötzchen mit einer Federspule getrocknete Blätter eines besonderen Strauches, dabei genau so ein zufriedenes Gesicht machend wie damals auf jener Sumpfinsel. Nur dass er jetzt öfters spucken musste. Das mochte ein schönes Kraut sein. —
Eine Tür ging, ein Schritt näherte sich durch die umgebende Dunkelheit, Kapitän Hagens lange Gestalt tauchte auf.
»Sie haben mich befohlen. Frau Gräfin?«
»Ich habe Sie bitten lassen. Ich möchte mit Ihnen einmal sprechen. Bitte, nehmen Sie Platz. Haben Sie meinen Gatten manchmal beobachtet?«
»Mindestens zweimal am Tage gehe ich hin und beobachte ihn durch die Gucklöcher, kann stundenlang dort stehen und — ihn beneiden.«
»Sie möchten an seiner Stelle sein?«
»Ja.«
»Auf wie lange?«
»Das weiß ich nicht. Ich bedauere schon, so eine Andeutung gemacht zu haben.«
»Ich verstehe. Halten Sie ihn für glücklich?«
»Mindestens für ganz zufrieden. Vielleicht aber ist er wirklich glücklich. Er macht ganz den Eindruck.«
»Halten Sie ihn geistig für ganz normal?«
»Ich möchte es annehmen.«
»Sie antworten zögernd.«
»Er macht den Eindruck eines ganz normalen Menschen.«
»Halten Sie es für angebracht, dass ich ihn jetzt aufsuche?«
Da zögerte Hagen noch länger mit der Antwort.
»Nnnein«, sagte er dann, »davon würde ich ihnen abraten.«
»Weshalb?«
»Dass er niemals zu sich selbst spricht, keinen Ton von sich gibt, das kann ich begreifen. Solche Menschen gibt es genug, die keine Selbstgespräche führen, keinen Seufzer kennen. Aber — ich halte ihn für menschenscheu, was, offen gesagt, ebenfalls ein stiller Wahnsinn ist. Ich glaube, er fühlt sich nur deshalb glücklich, weil er sich an einem Orte weiß, von dem er hofft, niemals von einem anderen Menschen dort gefunden zu werden.«
»Sie haben recht, so habe auch ich schon gedacht«, erklang es mit einem leichten Seufzer. »Halten Sie es denn überhaupt für gerecht, einen Menschen so einzusperren, ihn in solch einem Wahne zu lassen?«
»Gerecht? Gewiss doch! Das ist doch ganz einfach eine Kur.«
»Ja, aber die Folgen dieser Kur muss man doch einmal prüfen.«
»Eigentlich ja. Ich weiß schon, was Sie meinen.«
»Einmal müssen wir ihn mit einem Menschen zusammenbringen, um zu beobachten, was es für einen Eindruck auf ihn macht.«
»Ja, daran habe ich auch schon gedacht und mir überlegt, wie man das fertig bringen könne.«
»Es geht zu machen. Durch einen Eingang von unten darf der Betreffende nicht hereinkommen, nicht durch eine zufällig entdeckte Felsspalte. Der Graf hat alles schon zu gut untersucht. Ich habe einen anderen Plan, oder vielmehr Mister Dollin hat ihn mir erst angegeben.
Es sind hier Ballonhüllen von verschiedener Größe vorhanden, Apparate, um Wasserstoffgas zu entwickeln, alles. Also es geht jemand mit einem Luftballon in den Talkessel nieder. Das ist alles möglich, und es kann ja bei Nacht geschehen. Auf diese Weise will ich dem Robinson auch Verschiedenes zukommen lassen, Messer, eine Axt und dergleichen, denn wie der Arme sich mit seinen Steinwerkzeugen plagt, das ist ja fürchterlich.«
»Und eine große Portion guten Tabak«, ergänzte Hagen, »denn wie dem seine Blätter stinken, mit Verlaub zu sagen, das ist noch viel fürchterlicher.«
»Ja, daran habe ich auch schon gedacht«, lächelte die Gräfin. »Was sagen Sie nun zu diesem Plane?«
»Gewiss, das geht. Und was soll nun aus dem Besucher werden?«
»Der steigt wieder mit seinem Ballon in die Höhe.«
»Ich denke, der Ballon ging nieder, was doch nur aus Gasverlust erfolgen konnte.«
»Ja, aber er hat eine Bombe mit komprimiertem Gase mit, er kann nachfüllen.«
»Und den Grafen nimmt er mit?«
»Wenn dieser will. Er verspricht wenigstens, wiederzukommen und ihn abzuholen. Jetzt trägt der Ballon gerade einen einzigen Menschen.«
»Und wenn der Graf nicht will?«
»So gibt der Fremde sein Ehrenwort, niemandem etwas von seiner Entdeckung zu sagen.«
»Und wenn der Graf nun...«
Hagen stockte, wagte es nicht auszusprechen.
»... davonstürzt und sich gar den Kopf am nächsten Felsen zerschellt?«, ergänzte Atalanta.
»Ja, das ist es, das muss überlegt werden.«
»Darüber möchte ich Ihren Rat hören.«
»Frau Gräfin, bitte, fordern Sie über solch eine Angelegenheit nicht meinen Rat!«
»Nun gut, das hat ja auch noch Zeit. Es handelt sich nur darum, wen wir ihm da zuschicken, falls ich es ausführe. Ich komme nicht in Betracht. Mister Maxim auch nicht. Ist es ein Japaner, so könnte in ihm auch sofort der Verdacht entstehen, dass es ein Abgesandter von mir ist, und das will ich durchaus vermeiden. Kennt er Sie?«
»Er hat doch damals auf der Sumpfinsel mit mir gesprochen.«
»Was meinen Sie zu Leutnant Torres?«
»Jawohl, den hätte ich auch vorgeschlagen.«
Sinnend blickte die Indianerin nach dem Lichtbild an der Wand.
Der Robinson hatte sich mit Pfeil und Bogen bewaffnet, war nach der Felswand gegangen und harte sich in den Hinterhalt gelegt.
Jetzt huschte ein Kaninchen über den Rasen, der Pfeil schwirrte von der Sehne, das Tier wurde durchbohrt, aber nicht tödlich; es eilte ins Gebüsch, das an der Felswand wucherte, und hatte dabei wahrscheinlich den dünnen Pfeil abgebrochen.
Der Jäger ging hin, bog die Büsche auseinander und verschwand gleichfalls darin.
»Das sieht ja gerade aus, als ob dort eine Höhle sei«, meinte Atalanta. »Von dieser habe ich noch nichts gewusst und Arno jedenfalls auch nicht.«
Einige Minuten vergingen, der Jäger kam nicht wieder zum Vorschein.
»Das ist auffallend. Was mag er darin so lange zu verweilen haben?«
»Nun, er sieht sich eben in der neu entdeckten Höhle um.«
»So lange?«
»Warum nicht? Vielleicht gräbt er einen Kaninchenbau aus.«
»Er hat gar kein Handwerkszeug bei sich.«
Wieder verstrichen einige Minuten, und der Graf tauchte nicht wieder auf.
»Das beunruhigt mich!«, flüsterte Atalanta.
Mit tiefstem Mitleid blickte Kapitän Hagen auf das rote, schöne Weib.
Das war nun eine Ehe, ein Leben, ein menschlicher Zustand!
Der herrlichste Mann, den je die Erde getragen, göttergleich in Jugendpracht und Jugendkraft — geisteskrank, nach Hagens fester Überzeugung für immer, wagte es natürlich nicht auszusprechen — und hier diese junge Indianerin, nach zweijähriger Ehe eine jungfräuliche Frau — die nichts weiter hatte auf Erden als diesen Mann — sonst von aller Welt verraten und verkauft, wie ein Stück Wild gehetzt — und sie saß hier zwischen den Felswänden und beobachtete Tag und Nacht das Schattenbild des Geliebten — das musste ihr genügen und genügte ihr auch, dass sie den geliebten Mann nur im Schattenbild vor sich hatte, damit war sie schon zufrieden.
Siedend heiß stieg es dem deutschen Kapitän plötzlich zum Herzen empor.
Und plötzlich klang ein Lied in seinen Ohren, er wusste nicht den Anfang und von wem, ein schwermütiger Männerchor — —
O Himmel der Heimat, wie bist du so hart
Zu deinen Kindern hienieden —
Da klingelte der auf dem Schreibtisch stehende Telefonapparat. Schnell griff die Gräfin danach.
»Hier Atalanta, wer dort?«
»Hier Noki. Ich habe die Wache am Felsental. Wie ich jetzt meinen Rundgang mache, sehe ich auf der Nordseite unten eine Tür aufstehen, von der ich gar nichts weiß, es ist eine Höhle —«
Die Gräfin warf das Telefon hin und jagte hinaus, mit einem Fahrstuhl hinabgesaust, durch Gänge und Säle gerannt, vor ihr öffnete sich eine Tür, ein endloser Tunnel erstreckte sich entlang, derselbe, den man damals mit dem schlafenden Grafen benutzt hatte.
»Das Automobil, wo ist das Automobil?«
Es war nicht zu sehen, niemand antwortete, und die Indianerin hielt sich nicht weiter auf, sie jagte den Gang entlang, flog, dass ihre Füße kaum den Boden zu berühren schienen.
Die Strecke, zu der das rasende Automobil drei Minuten gebraucht hätte, legte sie in zehn Minuten zurück, und kein anderer Mensch hätte ihr das nachgemacht, und wenn es Achilles selbst gewesen wäre.
Dann hatte sie die Felswand erreicht, welche das künstliche Waldtal umgab, rannte daran herum bis nach der Nordseite.
Da stand ein japanischer Matrose neben einer großen Steinplatte, die sich aus der Wand herausgedreht hatte.
»Ich glaube fast, der Graf ist hier durchgegangen — «
Atalanta brauchte ihn nicht weiter anzuhören. War es wirklich ihre Nase, oder sollte diese Indianerin nicht andere Augen besitzen, welche jede Spur auch auf dem nackten Steinboden erkannten?
Sie sah die Fährte des geliebten Mannes deutlich vor sich, mit ihren geistigen Augen, und sie folgte ihr mit fliegendem Schritt.
Einen Gang entlang, eine Treppe hinauf, von deren Existenz sie noch gar nichts wusste.
Denn, ach, was für Gänge und Treppen gab es hier! Besonders Hagen war es, der hier täglich wie ein Felsenmaulwurf herumkroch, und jeder Tag führte ihn wieder in ganz fremde Regionen.
Die Treppe hinaufgejagt, immer fünf, sechs Stufen auf einmal genommen. Auch hier war alles elektrisch erleuchtet, aber die Gestalt des Flüchtlings war nicht zu erblicken, wie oft sie auch um Ecken bog.
In welcher Etage befand sie sich, wie hoch war sie schon gekommen, wie lange schon jagte sie so hinauf? Sie wusste es nicht.
Da hatte die Treppe ein Ende — nein, sie endete in einer Öffnung, die ins Freie führte, eine Falltür war heruntergeklappt, und Atalanta stand hoch oben aus dem nackten Plateau.
Es war Nacht, kurz vor Mitternacht. Ein monotoner Regen plätscherte vom Himmel. Dennoch war es ziemlich hell, weil hinter den grauen, nicht allzu dicken Wolken der Vollmond stand.
In diesem schwachen Dämmerscheine war der Flüchtling nicht zu erblicken, auch nicht für die Augen dieser Indianerin.
Und wenn es geregnet hatte oder gar noch regnete, besonders wie hier auf solch nackten Felsen, da versagte auch der Spürsinn dieser Indianerin. Da stand sie ratlos wie jeder andere Mensch da, ratlos wie auch der beste Spürhund.
Wohin hatte er sich gewendet? Alle Himmelsrichtungen, alle zweiunddreißig Striche der Windrose hatten ihm frei zur Wahl gestanden.
Und wenn sie auch die zwanzig Minuten, die er Vorsprung gehabt, durch ihre Schnelligkeit bis auf fünf herabgedrückt hätte — wie weit kann ein fliehender Mensch in fünf Minuten nicht kommen?
Und wie das der Indianerin klar ward, da wurde sie wieder einmal von der hoffnungslosesten Verzweiflung gepackt.
Sie sank auf die Knie nieder und reckte die Arme zu dem sprühenden Himmel empor. Und ein verzweifelter Schrei jammerte zu diesem Himmel empor, gekleidet in die Worte eines Gedichtes.
Hatte Kapitän Hagen vorhin laut gesprochen? Sicher nicht. Oder war es Gedankenübertragung? Es war etwas, wovon wir Menschen nichts wissen.
O Himmel der Heimat, wie bist du so hart
Zu deinem Kinde hienieden!!
So erklang es in jammernder Verzweiflung aus dem Munde des hier eingeborenen Kindes, an dem die weißen rücksichtslosen Eroberer noch einmal eine Kraftprobe versuchten, um es zu enterben.
Der Himmel der Heimat antwortete seinem Kinde mit einem trostlosen Plätschern.
Da starrte die Indianerin die Gestalt an, die plötzlich vor ihr stand, in einen schwarzen Mantel gehüllt, starrte in das weißbärtige Gesicht mit den unendlich gütigen Zügen.
Und dann schnellte sie mit einem Jubelschrei empor.
»Sirbhanga Brahma!! Dich schickt der Himmel!!«
»Ja, ich komme noch einmal, um Dich endlich Deinem Glücke zuzuführen«, entgegnete die so überaus weiche Stimme des alten Inders, »aber in ganz anderer Weise, als Du es Dir denkst. Komm, folge mir in Dein Reich hinab.«

»Aha, Hendrick, Ihr bringt einen zweiten Deserteur le-
bendig! An dem werde ich ein Exempel statuieren!«, rief
Oberst Eisenfaust dem Hünen und dessen Begleiter zu.
Hört hört hört hört hört hört hört!!! Hip hip hip hurra für die glorreichen Vereinigten Staaten von Nordamerika!
Gott erhalte unseren Präsidenten!
Krieg Krieg Krieg Krieg mit der Republik von Mexiko, einer Republik von räudigen Hunden!!
Starke Männer dieses herrlichen Landes, kühne Männer, löwenherzige Männer!!
Hört hört hört hört hört hört hört!!!
Kommt, Ihr jungen Löwen, kommt, Ihr alten Adler, lasst Euch anwerben zum Kampfe gegen diese mexikanischen Hunde, dass Ihr sie auffresst!
Kommt, Ihr löwenstarken Adler, Ihr bekommt die schönsten Uniformen mit doppeltgefütterten Unterhosen!
Jedes Paar Stiefel kostet fünf Dollars fünfundzwanzig Cent, unter Garantie, dass die Sohlen wirklich genäht sind, nicht nur angeleimt wie im kubanischen Kriege!
Drei Paar dicke Strümpfe aus bester ungefärbter Wolle!
Hört hört hört, Ihr starken Löwen und kühnen Adler; jeder sofort drei Paar dicke Strümpfe und doppelt gefütterte Unterhosen!
Das Gewehr, Magazin System Bulling Snyder, ist persönliches Eigentum jedes Soldaten, das kann er dann mit nach Hause nehmen!
Desgleichen die Browning-Pistole mit allen Patronen, die er nicht verschossen hat!
Ebenso das Bajonettmesser Bowie-Hatchfield in nickelbelegter Lederscheide!
Dort sind Proben von Gewehr, Unterhosen, Pistole, Strümpfen, Messern und Stiefeln ausgestellt, prüft sie auf ihre tadellose Güte!
Und nun, Ihr löwenstarken Männer mit den Adlerherzen, obgleich ich weiß, dass Ihr gegen Euren Erbfeind umsonst zu Felde ziehen würdet, nur aus Liebe zu Eurem glorreichen Vaterlande — Ihr bekommt pro Tag einen Dollar Löhnung!
Auszahlbar jeden Sonnabend Nachmittag!
Bei Rückständigkeit wegen besonderer Verhältnisse zwölf Prozent Zinsen, unter Garantie der Regierung der Vereinigten Staaten!
Hört hört hört hört, Ihr tapferen Verteidiger des Vaterlandes: zwölf Prozent Zinsen!
Täglich pro Kopf anderthalb Pfund bestes Fleisch, möglichst frisches!
Dazu reichhaltige Zukost, immer neue Kartoffeln und frisches Brot!
Jeden Tag zum Dinner, wenn es irgend möglich ist, Pudding!!!
Wenn die Rationen einmal nicht voll geliefert werden. können, Vergütung in barem Gelde zu den höchsten Marktpreisen!
Täglich pro Kopf ein viertel Liter besten Whisky, irisch oder schottisch, ganz nach Wunsch!
Möglichst absolute Sonntagsruhe!
Kommt kommt kommt kommt, Ihr glorreichen Söhne der glorreichen Vereinigten Staaten von Nordamerika, lasst Euch anwerben zur Vernichtung dieser mexikanischen Banditen und Strauchdiebe, lasst sie Eure heldenkühnen — he, Sergeant, dort maust einer eine Unterhose!«
So erklang es in Denver vor dem Stadthause, dazu lauter Trommelwirbel und dann wieder einmal schmetternde Janitscharenmusik der freiwilligen Stadtkapelle.
Rekrutierung! Sie war sehr nötig. Die glorreichen Truppen der glorreichen Vereinigten Staaten von Nordamerika hatten von den mexikanischen Gebirgsbewohnern, die tatsächlich zu neunzig Prozent aus Paschern und Banditen bestehen, ganz glorreiche Haue bekommen.
Es war eine ganz besondere Rekrutierung. Wie überhaupt jede Rekrutierung in Amerika und in England eine ganz besondere ist.
Kastengeist, Kastenwesen. Wenn auf kaufmännische Commis reflektiert wird, so wird wieder ganz anders geworben, aber schließlich ist es doch dasselbe, und dann kommen nur diese, mit ihren Damen, und dann wird getanzt, deshalb kommen sie gleich in Ballschuhen. Und werden wieder die Handwerker für sich herangezogen, die Farmer. Und so weiter.
Hier hatte man es auf die »Tramps« abgesehen, auf die Landstreicher und sonstigen Stromer und Vagabunden, von denen es in Nordamerika nicht wenige gibt.
Nur zwei Tage hatten es Plakate in Denver und Umgebung verkündet, und fast tausend waren zusammengeströmt. Und was für Individuen! Nicht nur wegen der Lumpen, sondern auch wegen ihrer sonstigen Kör-perbeschaffenheit. Und sie alle, alle wurden genommen! Gleichgültig, ob sie schief oder lahm oder bucklig waren.
Solch eine Rekrutierung übernimmt ein Stabsoffizier im Auftrage des Kriegsministeriums, oder er fragt vielmehr darum an, übernimmt sie gewissermaßen in Kommission. Ganz geschäftlich. Er verdient an jedem Soldaten, den er in den Krieg führt, täglich einige Cents. Geschäft ist Geschäft, zumal in Amerika.
Auf dem Podium standen die Offiziere der neu zu bildenden Abteilung, immer Regiment genannt, wenn es auch nur aus einigen Dutzend Soldaten besteht. Dieses hier, aus Landstreichern gebildet, würde, wie üblich, den Namen »Guard of Tramps« führen. Nennen wir es Lumpengarde.
Prachtvolle Gestalten, diese Offiziere, prachtvoll uniformiert. Allerdings nicht mit Orden dekoriert, nicht mit goldenen Streifen und Litzen und dergleichen benäht und beklebt. Ganz einfache, ledergelbe Anzüge, die militärischen Abzeichen kaum bemerkbar, am schwarzen Gürtel der mächtige Pallasch in brünierter Scheide. die Schaftstiefel bis an den Leib reichend, daran die pfundschweren Sporen, ohne welche der Amerikaner nun einmal nicht reiten kann, als einzigen Schmuck wallende schwarze Federn auf dem hochgeklappten Schlapphut, und auch deren Agraffen aus geschwärztem Stahl. Und dennoch prachtvolle Gestalten.
Und die prächtigste Gestalt war die des Werbe-Offiziers, des zukünftigen Kommandeurs dieser Lumpengarde. Im kubanischen Kriege war er einfach Captain Kettelhorst gewesen, aus dem ein deutscher Witzbold das Wort Kesselwurst gemacht hatte, was von den anderen nachgesprochen wurde. Im Kriege auf den Philippinen war er Major Einhand gewesen, weil er gleich im ersten Gefecht seine rechte Hand verloren, den ganzen Feldzug nur mit der linken Hand mitgemacht hatte. Und jetzt war er Oberst Eisenfaust. Wenn er sein Schwert zog, musste er, ein amerikanischer Götz von Berlichingen, die Finger seiner eisernen Hand um den Griff klappen.
Aber nun diese ebenso kühnen wie klugen Augen in dem verwetterten, von vielen Narben durchzogenen Gesicht — wollte dieser Mann seinem Kriegsvorgesetzten wirklich eine Garde von halbverhungerten Landstreichern, zum Teil von Krüppeln, zuführen, mit denen er sich unsterblich blamierte?
Für den kubanischen Krieg hatte er die höchste Kaste aus dem Kaufmannsstande geworben, Bankbeamte und dergleichen, auch viele Sportsleute, vornehme Müßiggänger, die nach Kriegslorbeeren lüstern waren. Mit denen hatte er sich allerdings sehr blamiert. Schlapp vom Anfang bis zum Ende, allemal, wenn's darauf ankam, versagend, sogar die Sportsmänner. Bei denen war die Klippe, an der sie gewöhnlich scheiterten, der — Suff! Und da war gar nichts mit Entziehung von Branntwein zu machen gewesen. Wo es solchen gab, da wussten sie ihn sich auch zu verschaffen.
Nach den Philippinen hatte er dann Handlungsgehilfen geführt, Postbeamte und dergleichen, er war aber auch mit diesen Leuten nicht zufrieden gewesen. Alles hatten sie besser gewusst, sehr wenig Ausdauer und — wieder der Suff!
Jetzt probierte er es einmal mit einer Lumpengarde. Und wir werden gleich sehen, wie es dieser Mann zu machen verstand, um das beste Material zu bekommen. Amerikanisch! Aber nicht etwa, dass es alle Werbe-Offiziere so machten, das war des Obersten Eisenfaust ureigenstes Rezept, er wandte es zum ersten Male an.
Nur noch eines sei gleich im Voraus angedeutet: Es ist durchaus nicht gesagt, dass die Kriegstüchtigkeit und besonders die Marschfähigkeit von der Gestalt, vom Brustumfange und dergleichen abhängt! Seume, der den »Spaziergang nach Syrakus« mitgemacht hatte, hinkte.
Das Werbegeschäft ging außerordentlich schnell, weil sehr viele Tische vorhanden waren, hinter denen die schreibenden Wachtmeister saßen und dann, weil nur nach dem Namen gefragt wurde und ob der Betreffende reiten könne. Ob er des Reitens kundig, das war die Hauptsache. Das ist auch sehr wichtig. Marschieren, schießen und so weiter, das lernten diese Soldaten schon im Kriege. Aber wenn dem Feinde einmal ein Trupp Pferde abgenommen wurde und es galt, die ganze Bande möglichst schnell anderswohin zu werfen, dann handelte es sich darum, wer schon reiten konnte, denn das lässt sich nicht so schnell lernen, wie es sich mancher auch vorstellen mag.
Eine Verzögerung trat nur dadurch ein, dass jeder eine Nummer erhielt, die ihm immer gleich mit Bindfaden hinten auf den Rücken genäht wurde. Sonst hätten alle »Soldaten« gleich vorbeimarschieren können. Doch auch das Annähen des Leinwandlappens ging sehr schnell.
Übrigens waren es nicht etwa nur Krüppel. Die waren natürlich nur spärlich vertreten. Es waren sogar gar stramme Kerls dabei, Männer mit Bärenknochen und furchtbaren Fäusten, die aber eben die Arbeit nicht liebten. Und allerdings sahen auch diese Hünen und Kraftmenschen meistenteils etwas verhungert aus.
Das war aber nicht der Fall bei dem Hünen, der jetzt an den Tisch trat. Das war ein gut gefütterter Kraftmeier ersten Ranges. Aber verlottert! Sein Anzug bestand nur noch aus zusammenhängenden Löchern, so waren auch die Stiefel beschaffen, und seinen Vollbart musste er sich jüngst mit einem stumpfen Messer abgehackt haben.
»Name?«
»Fred Hendrick.«
»Können Sie reiten?«
»Ja.«
»Nummer 775. Der Nächste!«
Im Gegensatz zu dem herkulischen Riesen kam ein kleiner, zierlicher Wicht, nicht so sehr zerlumpt, nur die Jacke war ihm viel zu groß, die Ärmel gingen ihm weit über die Hände, und das brünette Gesicht, umrahmt von tiefschwarzen, etwas langen Haaren, verrieten gleich entweder den Italiener oder den Savoyardenknaben — der eben auch ein Italiener, wenn er auch zu Frankreich gehört.
»Name?«
»Giuseppe.«
»Das ist doch nur ein Vorname!«
»Hat sich nix anderes Namen, weiß sich nix anderes Namen.«
»Auch gut!«, meinte der gutgelaunte Wachtmeister. »Giuseppe? Na, da wollen wir gleich Pepi schreiben, nicht wahr?«
»Si si, Signore, Pepi.«
»Können Sie reiten?«
»Si si, Signore.«
»Nummer 776. Der Nächste!«
Jetzt kam ebenfalls ein sehr kleiner Kerl, der mit einem mächtigen Höcker versahen war.
»Name?«
»Schulze.«
»Vorname!«
»Na, wenn ich Schulze heiße, dann heiße ich natürlich auch Friedrich Wilhelm.«
»Also Wilhelm Schulze. Können Sie reiten?«
»Nee. Ich habe bei den Gardegrenadieren zu Fuß gestanden.«
»Nummer 777. Der Nächste!«
Die Abfuhr verzögerte sich etwas, weil der Soldat hinter ihm frisch einfädelte und dann nicht gleich wusste, auf welche Stelle des Buckels er den Flecken anheften solle.
Der auf dem Podium hin und her gehende Oberst war gerade in der Nähe gewesen, er blieb stehen.
»Sie sind Soldat gewesen?«, fragte er herab.
»Jawohl, Herr Oberst!«, rief die recht kräftige Bruststimme des Buckligen hinauf.
»In Deutschland? Bei den Gardegrenadieren?«
»Jawohl, Herr Oberst!«
»Mit dem — mit dem —«
»Mit meinem mächtigen Aste, meinen Sie? Den hatte ich damals noch nicht. Damals war ich noch zwei Meter lang und schlank wie eine Tanne.«
»Ist nicht möglich! Wie ist denn das gekommen?«
»Ich wurde nach meiner Entlassung erst Kammerdiener, dann Kammerherr, dann bekam ich gleich Ministerportefeuille. Da habe ich immer so viele Bücklinge gemacht, bis ich zuletzt den Buckel bekommen habe.«
Alles lachte, am meisten Oberst Eisenfaust. Es ging überhaupt sehr lustig zu.
»Na, da halten Sie sich dann stramm! Mir kommt's auf einen Buckel nicht an und dessen Fehlen macht den Mann nicht aus.«
»Der Nächste!«
Der vierte in dieser Reihe war ein klapperdürrer Greis von vielleicht siebzig bis achtzig Jahren.
»Name?«
»Hä?«, machte der Alte, einen großen Tropfen an der blauroten Nase und die Hand am Ohre.
»Ihr Name!«
»Hä?«
»Ihr Naaaaame!!!«, brüllte ihm der Wachtmeister ins Ohr. »Wie Sie heißen!!!«
»Wie ich heeßen tu? Das weeß'ch nee.«
»Können Sie reiten?«
»Hä?«
»Ob Sie reiten können. Reiten, reiten, reiten!!«
»Ob'ch was kann?«
»Nummer 778. Der Nächste!«
Die Aufgeschriebenen mussten sich sofort auf eine Bank setzen und Schuhe und Strümpfe ausziehen, um neue zu bekommen. Das heißt, nur selten war ein Kavalier darunter, der sich wenigstens bis zu Fußlappen aufgeschwungen hatte. Die Stiefel zu fünf Dollars fünfundzwanzig Cents mit wirklich angenähten Sohlen wurden übrigens sehr sorgfältig angepasst. Außerdem bekam jeder noch einen Strick, um die eigenen abgelegten Stiefel oder Schuhe über die Achseln hängen zu können. Den meisten war das ganz unbegreiflich. Denn ihre Schuhe waren doch gar keine Schuhe mehr, nicht einmal Sandalen. Aber sie mussten — Befehl! Und wer wirklich Strümpfe oder so etwas Ähnliches besessen, musste auch diese anknüpfen und mitnehmen — Befehl!
Diese vier Männer, deren Werbung wir beigewohnt, waren mit die letzten gewesen. Die allerersten hatten nur wenige Stunden zu warten brauchen, sie waren so hingehalten worden, hatten auch etwas zu frühstücken bekommen, allerdings höchst frugal, Tee und Butterbrot, nun aber ging es sofort zum gemeinsamen Mittagsmahl.
Im Freien waren lange Tafeln mit Bänken aufgestellt, ganze Ochsen, Hammel und Schweine waren am Spieße gebraten worden, das geröstete Fleisch wurde in mächtigen Bergen aufgetürmt, gleich auf der Tischplatte, daneben Weißbrot und Salz.
So, nun klappt Euer Messer auf oder zieht das Bowie unter den Lumpen hervor, und wer keine Klinge hat, greift mit den Händen zu.
Diese fast tausend verhungerten Landstreicher konnten etwas verschlingen — und wahre Vornehmheit lässt sich nicht nötigen. Aber diese ungeheueren Fleischberge vermochten sie nicht abzutragen, obgleich man ihnen eine ganze Stunde Zeit ließ. In den Tonkrügen war freilich nur Wasser, darüber wurde etwas geschimpft. Der kalifornische Landwein ist doch so billig und die heurige Ernte war so gut geraten, es fehlte an Fässern, um den Most zu fassen.
Da schmetterten die Trompeten.
»Antreten zum Abmarsch!!«
Die Krieger, die mit einem Male alle ein Bäuchlein bekommen hatten, stellten sich in Reihen auf, wie es kam, zu dritt oder zu zwölft, ganz egal. Dazwischen schoben sich immer einmal ein halbes Dutzend Trommeljungen ein. Das sind Waisenknaben, die zu Soldaten erzogen werden, schon uniformiert und ausgezeichnet trainiert! Mit Lesen und Schreiben sieht es ja faul aus, aber pfeifen und trommeln und marschieren können sie!
»Regiment — marsch!!!«
Das »Regiment« setzte sich in Bewegung. Die Kapelle der freiwilligen Feuerwehr gab den abziehenden Kriegern mit den löwenkühnen Adlerherzen das Ehrengeleit, natürlich unter den Klängen des Yankee-Doodles.
Wohin ging es? Natürlich nach dem Bahnhofe.
Nein, eben nicht.
Kurz vor dem Bahnhofe bogen die voranreitenden Offiziere in die Landstraße ein, welche mit zweiundzwanzig Kilometern nach dem Städtchen Idaska führt.
Gleich beim Abschwenken blieb die Kapelle zurück, jetzt setzten die Pfeifen- und Trommeljungen ein, wiederum mit dem Yankee-Doodle, weiter haben sie überhaupt nichts auf dem Repertoire, aber den pfeifen und trommeln sie sogar, wenn sie durch Ströme schwimmen.
Und sofort wurde Geschwindschritt angeschlagen.
Der erste, der zurückfiel, gleich mit der Kapelle, war der alte Strolch zwischen siebzig und achtzig Jahren.
»Na looft doch nur nich so; mir gomm noch zeit'g genug nach Zion!«
Das heißt, er sprach englisch. Aber einen entsprechenden Dialekt.
Er wurde weidlich belacht. Sehr viele kannten ihn, den alten Tramp, den Vater Zion, der seit vielen Jahrzehnten schon ständig zwischen New York und Frisco fechtend hin und her pilgerte. Er selbst aber war ständig auf dem Wege nach Zion, also ins Himmelreich, so eine Idee von ihm. Der Alte war sehr fromm, besonders wenn er den nötigen Spiritus im Leibe hatte. Es war eben der Vater Zion.
Und nun hatte man dem Alten weisgemacht, das wäre die Heilsarmee, die neue Truppen anwerbe, um nach Zion zu marschieren. Und das war nun aus dem Kopfe des halbtauben Alten nicht wieder herauszubekommen. Der wollte jetzt mit der Heilsarmee nach Zion marschieren.
»Na looft doch nur nich so, mir gomm noch zeit'g genug nach Zion!«
Das heißt, ganz zurück blieb er nicht, er blieb nicht stehen, er latschte immer feste weiter. Nur dass er auch die letzten sehr schnell aus den Augen bekam. Aber dann humpelte er immer noch weiter.
Neben dem Zuge ritten und marschierten sehr viele Wachtmeister und Korporale, hinter dem Zuge kamen einige mit Maultieren bespannte Planwagen, hinter diesen zu Fuß noch ein großer Trupp von Unteroffizieren — oder vielmehr von Korporalen, Sergeanten. Denn in Amerika gibt es keine gemeinen Soldaten, jeder fühlt sich als Unteroffizier und gilt auch wirklich als solcher. Der nächste Vorgesetzte ist der Korporal.
Diese letzten hier hatten, wie üblich, ihre Stöcke aus eisenfestem und dennoch elastischem Hickoryholz in den Händen, das Attribut ihrer Würde außer Dienst.
Als nun der alte Vater Zion zurückblieb, wollten sich zwei gleich an ihn heranmachen, andere aber wehrten ihnen.
»Ach lasst den nur, das ist der Vater Zion«, hieß es, »auf das eine Paar kommt es nicht an. Eine andere Ausnahme freilich gibt es nicht.«
Die Bedeutung dieser Worte sollte sehr bald klar werden.
Immer Geschwindschritt, den Kilometer in zehn Minuten! Und die Oktobersonne, die nach langer Regenzeit den sogenannten indianischen Sommer erzeugt, brannte gar heiß vom Zenit herab! Und die schlechte Landstraße war vom letzten Regenguss noch total aufgeweicht!
Nach einer Viertelstunde schon blieben die ersten zurück. Sie mochten sich verabredet haben und fanden schnell immer mehr Anhänger.
»He, Freunde, Ihr könnt wohl nicht mehr?«
»Nein, und wir machen überhaupt nicht mehr mit, wir haben ja auch noch gar nicht geschworen.«
»Recht so, dann zieht aber erst mal unsere Stiefel und Strümpfe wieder aus.«
Und wer sich nicht gleich hinsetzte, der wurde sofort von zwei Korporalen niedergedrückt, ihm die neuen Stiefel und Strümpfe abgezogen und in einen Planwagen geworfen, und wer sich etwa zur Wehr setzen wollte oder sonst irgend etwas einzuwenden hatte, der wurde erst in aller Schnelligkeit von den Hickoryknüppeln windelweich geprügelt.
O ja, sie sind praktisch, die Amerikaner, das muss man ihnen lassen.
Und immer mehr bekamen die Korporale zu tun. Stiefel aus, Strümpfe aus und unter Umständen noch tüchtig das Leder vollgehauen!
Nach einer Stunde war ein Drittel abgefallen, nach zwei Stunden die Hälfte von den tausend Mann. Immer wurden Stiefel und Strümpfe ausgezogen und beim geringsten Widerspruch wenigsten ein paar sausende Hiebe ausgeteilt.
Dann wurde eine kurze Rast gemacht, aus den Planwagen Brot und Fleisch verteilt, und außerdem erhielt jeder eine große, flache Flasche Branntwein.
Auch Vater Zion, denn der war beim Austeilen zur Stelle. Der kam mit einer Equipage, die ihn mitgenommen hatte.
»Regiment marsch!!«
Das bis zur Hälfte zusammengeschmolzene »Regiment« setzte sich wieder in Bewegung, wieder in Geschwindschritt, unter dem gepfiffenen und getrommelten Yankee-Doodle.
»Um Gottes willen trinkt keinen Schnaps!!«, sagte der bärtige Riese, Fred Hendrick, zu seinem rechten Nachbar, dem Buckligen, während links neben ihm der kleine Italiener marschierte.
Die drei zusammengehörenden Nummern waren bei dem Abmarsch zufällig an die Spitze gekommen und hatten diese bisher behauptet. Der Riese mit militärischen Grenadierschritten, links neben ihm der kleine Italiener mit kurzen, elastischen Doppelschritten, während der kleine Bucklige mit seinen hageren Beinen ganz ungewöhnlich lange Schritte machte, dabei immer den Oberkörper vorwerfend, dass er an ein Dromedar erinnerte. Der wurde nicht schlapp und vertrieb sich die Zeit mit Singen von deutschen Soldatenliedern.
Herr Hauptmann, mein Hintermann der Kerl ist gar zu dumm,
Der tritt mir egal uff'n Stiefelhacken rum —
Jetzt hatte er die Flasche entkorkt und an den Mund gesetzt.
»Um Gottes willen, trinkt keinen Schnaps!«, warnte der Hüne.
Das gesunde Gesicht des Buckligen grinste verschmitzt.
»Ohne Sorge, Kamerad. Nur mal lecken. Richtig, mindestens sechzigprozentiger. Nur keine Bange, da ist doch Friedrich Wilhelm Schulze viel zu schlau. Der lässt sich nicht besoffen machen. Denn das wollen die doch nur —«
Und dann fing er wieder zu grölen an.
Hat denn keener den Fähnrich mit der Fahne gesehn?
Ma weeß ja gar nich, wo der Wind tut her wehn.
Nicht alle dachten so, an dem kredenzten Branntwein nur einmal zu lecken. Wozu hatte man ihn denn bekommen. Die Folgen zeigten sich bald. Viele, viele von ihnen hätten den Geschwindmarsch noch stundenlang ausgehalten, aber der Schnaps ließ sie erschlaffen. Viele legten sich hin, einige waren sogar sinnlos betrunken, die Quantität langte dazu.
Das machte sich Vater Zion zunutze. Denn der war natürlich bald wieder weit hinten. Den Zurückbleibenden wurden wie immer nur die Stiefel und Strümpfe ausgezogen, die Flasche konnten sie behalten, leer oder noch halb gefüllt.
Und nun hatte es Vater Zion auf die am Wegrande und im Straßengraben Liegenden abgesehen. Denen visitierte er die Taschen nach den Flaschen. Natürlich waren diese leer. Aber ein ganz kleines Restchen war noch in jeder. Das nutschte der alte Sünder aus, dann humpelte er weiter.
»Na, da looft doch nur nich so, mir gomm schon noch zeit'g genug nach Zion!«
Und dann fing auch er einmal an zu singen, ebenfalls Soldatenlieder — Heilsarmeelieder.
Noch zwei Stunden Geschwindschritt, und Idaska war erreicht. Zweiundzwanzig Kilometer in vier Stunden mit einer Pause — eine äußerst tüchtige Leistung! Freilich waren von den tausend Mann auch kaum 300 vorhanden.
»Halt — Front!!«
Oberst Eisenfaust ritt die Front ab. Es hieß, dass er jeden Mann vom ersten Augenblicke an mit Namen kenne, wenn er diesen nur erst einmal gehört hatte.
Und während er so die Front abritt, hatte er seine Betrachtungen.
Wo waren sie geblieben, die großen, starken Männer, oftmals mit wahren Bärenknochen? Besiegt von ihrer eigenen Schwere, besiegt von ihrer Energielosigkeit, besiegt vor allen Dingen vom Schnaps lagen sie auf der Landstraße!
Und nun der zierliche Italienerknabe, wie wacker der sich gehalten hatte, was der jetzt noch für ein vergnügtes Gesicht machte, als wäre seine Herzallerliebste bei ihm.
Und dort der kleine Bucklige, wer hätte das dem zugetraut?!
Und nun gar erst dort hinten im zweiten Gliede der uralte Mann, Nummer 778! Von dem hätte ihm, dem Obersten, einmal jemand prophezeien sollen, dass der hier mit zur Stelle sei! Das hätte er niemals geglaubt. Freilich konnte sich der Alte kaum noch aufrecht halten, er taumelte vor Schwäche hin und her — aber die Hauptsache war, dass er hier mit zur Stelle war.
Ja, Vater Zion war wieder mit zur Stelle. Dass er diesmal mit einem schnellen Jagdwagen gekommen war, das konnte der Herr Oberst ja nicht wissen. Jetzt ritt dieser in die Mitte der Front, alles ward still. Man merkte, dass er eine Ansprache halten wollte.
»Kameraden — denn meine Kameraden seid Ihr jetzt — Ihr habt die Probe bestanden, jetzt erst seid Ihr angeworbene Soldaten der Bundesstaaten! Ich danke Euch, Kameraden! Ich danke Euch, weil Ihr mein Vertrauen nicht getäuscht habt! Ich hatte den Glauben gefasst, dass sich unter den Tramps, die Ihr meistenteils doch alle seid, weit tüchtigere Männer befinden als in jeder anderen Gesellschaftsklasse Amerikas. Denn ich habe meine Erfahrungen gemacht, böse Erfahrungen, was aber nicht hierher gehört. Kurz, Ihr habt mein Vertrauen gerechtfertigt, habt es sogar noch weit übertrumpft. Denn ich hatte nur mit zehn Prozent gerechnet, die ich in vierstündigem Geschwindschritt bis hierher bringen würde. Und es sind dreißig Prozent geworden. Ich danke Euch, Kameraden.«
Der Oberst machte eine kleine Pause.
»Kameraden«, fuhr er dann fort, »Ihr wisst, dass man Euch den Spottnamen Lumpengarde gibt, den Ihr auch behalten werdet. Und ich bin Euer Oberst, der Kommandeur einer Lumpengarde. Wohlan, wir wollen diesen Namen im Kriege gegen Mexiko zu Ehren bringen. Oberst Eisenfausts Lumpengarde soll eine Elitegarde, eine Heldenschar werden, von der man nur mit ehrfürchtigem Respekt spricht, und darauf hin, Kameraden — hip hip hurra für die Vereinigten Staaten von Nordamerika!! Hip hip hurra für ihren Präsidenten!!!«
Brausend wiederholten die dreihundert Männer die beiden Hurrarufe, ihre Hüte und Mützen schwingend, und dann setzten sie noch einen dritten hinzu:
»Hip hip hip hurra für Oberst Eisenfaust!!!«
Auch Vater Zion schwang seine fettige Kappe, auch er brüllte mit, aber etwas ganz anderes:
»Halleluja for Zion!! Halleluja for General Booth von der Heilsarmee!!«
In Idaska, der Station einer Zweigbahn, war aus besonderen Gründen ein großes Kriegsmagazin angelegt worden, Oberst Kettelhorst hatte freie Verfügung darüber. Die 300 Mann wurden sofort eingekleidet und bewaffnet. Es ging sehr schnell, die Zeugmeister hatten schon große Übung, ein Blick auf die Figur genügte, jedem wurde seine gelblederne Uniform und was sonst dazu gehörte, zugeworfen, und es passte.
»Herr Oberst, ich muss Sie auf einen Mann aufmerksam machen, der sich nur eingeschlichen hat«, sagte ein Offizier zu seinem Vorgesetzten, der die Einkleidungsszene beobachtete.
»Nur eingeschlichen hat?«
»Dort der Alte, der eben mit seinem Knochenbein in die Hose fährt.«
Und der Oberst erfuhr, wie Vater Zion zweimal mit einem Wagen nachgekommen war, außerdem so bezecht war, dass er kaum noch stehen konnte.
Erst biss sich Oberst Kettelhorst auf die Lippen, dann lachte er laut auf, und dann wurde er wieder ernst.
»Es bleibt dabei! Ich habe mir selbst mein Wort gegeben: Wer mit mir von Denver ausrückt und mit mir hier in Idaska gleichzeitig eintrifft, der soll angenommen sein, soll mein Kamerad sein, und wenn er ein schiefer, blinder, tauber Zuchthäusler ist! Es war eine Caprice von mir, dass ich diesen Vorsatz so präzis nahm, nun aber bleibt es auch bestehen! Weil er zweimal mit einem Wagen nachfuhr? Well, das war sehr schlau von dem alten Burschen. Jedenfalls ist er gleichzeitig mit mir hier eingetroffen. Schwer bezecht ist er? Na, er kann doch noch auf einem Beine balancieren? Und mag er dabei auch wanken wie er will, Hauptsache ist, dass er steht. Er bleibt!«
Nach einer halben Stunde marschierten die dreihundert Mann wieder ab, nach einer nahen Baracke, wo sie übernachten sollten. Jetzt waren es wirkliche Soldaten.
Aber was für welche! Wie die latschten, ohne Schritt und Tritt! Und wie die ihre Gewehre trugen!
Oberst Kettelhorst ließ sie an sich vorbei defilieren wie eine Herde Gänse. Aber dieser amerikanische Offizier fand nichts dabei. Warum sollte er auch?
Im letzten Bürgerkriege, Nord gegen Süd, haben Hunderttausende von amerikanischen Kriegern keine Ahnung vom Militärdienst gehabt. Während des Krieges wurden sie die tüchtigsten Soldaten, haben sich wie Helden geschlagen und erstaunliche Märsche gemacht. General Orlandas Marsch mit der vierten Division über das winterliche Allegheny-Gebirge steht in der ganzen Weltgeschichte fast ohne Beispiel da.
Und Oberst Kettelhorst hatte mit dieser Lumpengarde überhaupt etwas ganz Besonderes vor, er wollte gar keine regelrechten Soldaten aus ihnen machen. Er hätte auf dem Kriegsschauplatze ein Regiment regulärer Truppen übernehmen können, diese Tramps wären nur eingereiht worden. Er wollte nicht. Diese Lumpengarde sollte wirklich für sich bestehen bleiben, unter seiner eigenen Führung. Er wollte eine Spy-Truppe aus ihnen machen, eine besondere Abteilung von Spionen, von Kundschaftern, zum Aufklärungsdienst.
Es war gar keine schlechte Idee. So ein bettelnder Landstreicher ist doch auch ein halber Wilder — oder sogar ein ganzer. Mit tausend Listen muss er sein täglich Brot zusammenfechten, er verstellt sich, betrügt, stiehlt — immer auf der Flucht, dass er wenigstens nicht durchgepeitscht wird. Benutzt er einmal die Eisenbahn, so löst er sich kein Billett, schmuggelt sich in einen Wagen, womöglich in einen mit Korn beladenden, kaut tagelang Getreide, oder er springt in voller Fahrt auf eine Plattform oder auf die Puffer, er muss immer gewärtig sein, von einem Schaffner heruntergeschossen zu werden — es wird tatsächlich sofort geschossen — er ist jederzeit bereit, von dem sausenden Zuge wieder abzuspringen. Auch sein Nachtlager muss er erschleichen, denn die sonst so gerühmte amerikanische Gastfreundschaft gilt nicht mehr für diese Tramps. Jeder Einzelne hat sein besonderes Mittel, sein Geheimnis, um die Hunde zu beruhigen und von seiner Spur abzulenken. Und die meisten Nächte verbringt er doch im Freien, nach dem heißesten Tage zitternd in kalter Taunacht, sich in ein Schneeloch grabend, hungrig, ohne Decke — und dabei immer fidel!
Natürlich hat man auch schon versucht, solche Kundschaftertruppen aus professionellen Jägern, Waldläufern, Trappern und dergleichen Leuten, weißen wie roten, zu bilden. Einmal aber lassen sich solche Männer der Wildnis nicht leicht zum Kriegsdienst werben, und dann ist es auch ganz merkwürdig, wie der Spürsinn dieser Leute gänzlich versagt, wenn sie aus ihrem Revier, das doch immer seine Grenzen hat, in ein anderes versetzt werden. Eine Erscheinung, die sich aber auch im Tierreich findet, besonders bei den Raubtieren, was hier nur angedeutet sein mag. Außerdem wollen solche Männer nicht zusammen leben, können es nicht, keiner will dem anderen gehorchen.
Diese Tramps aber hier waren in der ganzen Welt zu Hause, so weit der Himmel blau ist, allüberall wissen sie sich durchzuhelfen, und dass sie sich organisieren ließen, das hatte schon der gemeinsame Marsch bis hierher bewiesen. Da hätte kein solcher Waldläufer mitgemacht. —
Nur als er den letzten »Soldaten« erblickte, verdüsterte sich des Obersten Gesicht etwas.
Ganz hinterher latschte oder taumelte sogar Vater Zion, in seiner funkelnagelneuen Uniform, den Schlapphut mit den wallenden Federn mehr im Gesicht als auf dem Kopfe: Er schleifte hinter sich am Riemen sein Gewehr durch den Dreck wie eine Mistgabel.
Doch gleich heiterte sich das Gesicht des Obersten wieder auf.
»Meinen Bankbeamten aus Kuba musste immer ein Ziegenbock vorausmarschieren, sonst ging es nicht«, murmelte er. »Meine Handlungsgehilfen auf den Philippinen mussten in ihrer Mitte immer einen Affen haben, der jemandem auf der Schulter saß — sonst hätten sie kein Glück, sagten sie. Na, nun wollen wir es in Mexiko einmal mit einem alten Manne versuchen, der hinterher humpelt. Vielleicht bringt der mehr Glück als der Ziegenbock und der Affe. Ja, er soll bleiben! Wir werden ihn schon immer mitschleppen. Sonst wird er schon eine Equipage finden, dass er uns immer nachfahren kann.«
Und so humpelte der alte Vater Zion hinterdrein, den Federhut im Gesicht und das Gewehr nachschleifend. Und dabei hatte er so seine Gedanken.
»Nee, nee, dass sich die Heilsarmee jetzt solche Federhüte angeschafft hat! Und sogar Flinten! Aber hibsch wird's, wenn wir so mit den Federhüten und mit den Flinten in Zion einziehen. Da werden sich aber die lieben Engelchen freun!«
Die Oktobernacht brach schon frühzeitig an, die neubackenen Soldaten, wirklich sehr erschöpft, sollten einige Stunden schlafen, um Mitternacht ging es weiter, wenn auch mit der Bahn. Vereidigt wurden sie erst in Sacramento mit noch anderen Rekruten zusammen.
In der Baracke war alles für ihre Bequemlichkeit vorhanden, auch eine schon gedeckte Tafel, nur an Matratzen mangelte es. Die meisten mussten zu zweit eine benutzen, und sie waren auch breit genug.
»He da«, rief ein Wachtmeister einem Manne zu, der sich schon zu entkleiden begann, »hier wird sich nicht ausgezogen! Wir sind im Kriege und nicht bei Muttern! Die Koppel könnt Ihr ablegen, nichts weiter, und als Herzliebste nehmt Ihr Euer Gewehr in den Arm!«
Es war auch kein echter Tramp gewesen, der sich zum Schlafen hatte ausziehen wollen. Alle anderen kannten ja so etwas gar nicht. Die zogen sich nur aus, wenn — wenn — die elementaren Naturgewalten sie auszogen, das heißt, wenn die letzten Lumpen vom Leibe fielen.
Auch der Oberst Eisenfaust nahm noch einmal das Wort, ehe er ging, in Bezug darauf, dass meist zwei eine Matratze benutzen mussten.
»Suche sich dazu jeder einen Kameraden aus, mit dem er auch fernerhin zusammenzuhalten gedenkt, wenn nicht schon Freundschaft geschlossen worden ist. Ich will zwischen Euch Kameradschaft haben im Ganzen und im Einzelnen. Deshalb werdet Ihr auch nicht der Größe nach eingereiht, Ihr bildet eine bunte Reihe, wie Ihr Euch zusammenfindet. Gute Kameradschaft ist halber Dienst, alles erträgt sich noch einmal so leicht. Gute Nacht, Kameraden. Morgen schlafe ich mitten unter Euch, wahrscheinlich schon am Lagerfeuer.«
»Ja, Kleiner, da könnten wohl nur wir beide uns in diese Matratze teilen«, meinte der riesenhafte Hendrick zu dem kleinen Italiener, »sind wir doch den ganzen Weg zusammen marschiert.«
Während dieses Marsches hatten die beiden kein Wort zusammen gewechselt. Die beiden waren in der Gestalt so grundverschieden und doch hatten sie einige Ähnlichkeit gezeigt.
Der Riese hatte immer seinen Schritt bändigen müssen, und je länger sie marschiert waren, desto elastischer war dieser Schritt geworden — tief hatte er dabei immer die Luft eingeatmet, so heiß und staubig sie auch sein mochte, wie mit Entzücken, und dieses Entzücken hatte sein ganzes Gesicht strahlen lassen. Es war fast seltsam gewesen, dass man ihn nicht manchmal laut hatte aufjauchzen hören.
Und nebenher war der gegen diesen Riesen fast zwerghaft kleine Italienerknabe getänzelt, aber taktmäßig, wenn auch in Doppeltakt, von unverwüstlicher Federkraft, und auch der hatte immer so ein sonderbares Gesicht gemacht, als wolle er immer hell aufjauchzen, obgleich sein Mund fest geschlossen geblieben war.
Schon war der Knabe, der vielleicht sechzehn Jahre alt sein konnte, niedergekniet, schlug auf der Matratze die Decke zurück, strich sie glatt und ordnete die Keilkissen. Mehrere Lampen erhellten den Raum. Jetzt hob er den Kopf und blickte den Sprechenden an.
»Junge, was machst Du denn für ein glückliches Gesicht?!«, fragte der Riese erstaunt, und es war auch ganz auffallend, wie die hübschen, etwas trotzigen Knabenzüge in seliger Freude strahlten.
»Es ist nur der Widerschein des Glückes in Deinem Gesicht, das sich in meinem spiegelt.«
Jetzt aber machte der blonde Riese erst recht ein erstauntes, wenn nicht bestürztes Gesicht.
»Junge, was führst Du da für eine gewählte Sprache?! Du kannst doch unmöglich so ein italienischer Affenbändiger oder Kastanienröster sein?!«
»Nein, der bin ich auch nicht, war ich auch nicht. Mir ist es nicht an der Wiege gesungen worden, dass ich mich einmal zur Lumpengarde melden werde.«
»So, hm«, brummte der Riese, an etwas anderes denkend. »Na, darüber können wir uns ein andermal unterhalten, wir haben ja noch Zeit genug dazu. Jetzt wollen wir erst ein bisschen schlummern.«
Er schnallte ab, streckte sich auf der Matratze aus und zog die Decke hoch.
»Das ist ja nur eine Decke!«
»Ja, aber eine sehr große«, entgegnete der kleine Italiener.
»Die anderen haben aber doch alle zwei Decken, jeder eine.«
»Nein, nicht alle. Dann sind das kleine Decken. Es gibt auch Matratzen mit nur einer Doppeldecke, wir haben gerade solch eine erwischt.«
»So. Na, auch gut. Wir werden uns noch oft genug nur mit dem Himmel zudecken können. Nun komm, Kleiner, krieche mit drunter, und dann zapple nicht so, ich bin müde. Na was gibt's denn da zu lachen?«
Der Junge war, wie er neben dem Riesen unter die Decke kroch, in ein silbernes Lachen ausgebrochen.
»Ich freue mich, dass ich noch lebe, hahahahaha!«, lachte er noch immer herzlich.
Es wurde überall noch gesprochen, niemand gebot Ruhe.
»Dass Du noch lebst? Hm, da hast Du eigentlich gar nicht so unrecht. Was sagte ich vorhin? Wir hätten noch genug Zeit, uns zu unterhalten? Vielleicht nur zwei Tage noch. Vielleicht übermorgen schon senden uns die mexikanischen Pascher und Banditen ihre todessicheren Kugeln entgegen, wenn nicht gehacktes Blei. Hast Du schon einmal die Kugeln pfeifen hören, Kleiner?«
»Nein, Du?«
»O ja — das heißt, ich will nicht renommieren — ich bin auch noch nicht im Kriege gewesen. Fürchtest Du Dich denn gar nicht, Kleiner?«
»Fürchten? Hätte ich mich denn sonst anwerben lassen?«
»Da hast Du wiederum recht. Es war überhaupt eine dumme Frage von mir. Als ob die Jahre etwas mit der Courage zu tun hätten. Aber dass Du den Marsch so ausgehalten hast, das wundert mich doch etwas. Es war wirklich keine Kleinigkeit. Und Du siehst doch eigentlich mehr noch schwächlich als zierlich aus.«
Jetzt kicherte der kleine Italiener unter der Decke.
»Hast Du von den Calzanen gehört?«
Der andere fuhr etwas empor.
»Was, Du willst doch nicht etwa sagen, dass Du ein Calzane bist oder warst?!«
Die Calza war früher ein Ritter- oder vielmehr Pagenorden, gestiftet im vierzehnten Jahrhundert zu Venedig, um Edelknaben durch besondere Erziehung zu besonders streitbaren Rittern auszubilden. Sie trugen besondere Stiefel, auf italienisch Calza. Dieser existiert noch heute, ist aber nach Neapel verlegt ein Kadettenkorps, in dem besonders taugliche Offiziere ausgebildet werden sollen. Die Söhne von Edelleuten, meist von verarmten, werden von zartesten Kindesbeinen an mit spartanischer Strenge erzogen, müssen nichts weiter machen als turnen, schwimmen, fechten und dergleichen, es ist eine Kinderschinderei. Akrobaten gehen daraus hervor, aber keine Offiziere. Es ist eben wie mit allem in Italien — alles Übertreibung. Die italienische Kavallerie hat die besten Reiter, nirgends wird die Reitkunst so gepflegt, das heißt so toll betrieben; aber die italienische Kavallerie selbst taugt gar nichts. Von den Bersaglieri, den Bergjägern und Scharfschützen, verlangt man die unglaublichsten Anstrengungen, jeder Soldat muss mit einem Manne auf dem Rücken eine Stange hinaufklettern und ähnliche Kunststückchen ausführen können — aber im Kampfe ausgezeichnet haben sich diese Bersaglieri noch niemals. Und bei dem großen Brande in Brindisi standen sie ratlos da, während deutsche Matrosen im Handumdrehen aus Apfelsinenkisten Leitern fertigten und die Leute aus den Fenstern herausholten.
»Ich war ein Calzane«, bestätigte der kleine Italiener.
»Dann bist Du doch der Sohn eines Edelmannes.«
»Der bin ich.«
»Du selbst bist ein Edelmann?«
»Das muss dann wohl sein.«
»Wie ist Dein Name?«
»Giuseppe.«
»Du willst Deinen Vatersnamen nicht nennen?«
»Nein.«
»Hm, das kann ich Dir nicht verdenken, nachdem Du nun einmal in die Lumpengarde eingetreten bist.«
»Und ich setze voraus, dass Du nicht darüber sprichst, was ich Dir anvertraut habe.«
»Sicher nicht.«
»Obgleich ich Dir nicht etwa Dein Wort abnehme. Wenn es sein müsste, könntest Du ruhig darüber sprechen. Sonst brauchte ich doch nicht erst zu sagen, dass ich in der Calza erzogen worden bin, und wer die kennt, weiß auch, dass darin nur Edelknaben aufgenommen werden.«
»Wie lange warst Du drin?«
»Von meinem vierten bis zum zwölften Jahre.«
»Und dann?«
»Dann entfloh ich dieser Strafanstalt. Denn weiter ist es doch nichts.«
»Wohin?«
»Ich versteckte mich auf einem Dampfer, der nach New York ging. Italienische Farmer nahmen mich mit nach Arizona, wo sie sich ansiedelten. Vier Jahre habe ich dort gearbeitet, bis wir abbrannten. Meine Pflegeeltern sagten, nun müsste ich für mich selber sorgen. Erst bin ich ein bisschen herumgebummelt, war auf dem besten Wege, ein regelrechter Tramp zu werden, bis ich mich heute früh in Denver anwerben ließ.«
»Wie alt bist Du?«
»Rechne es Dir doch aus.«
»Also sechzehn Jahre.«
»Und ein halbes dazu.«
»So alt hätte ich Dich noch gar nicht geschätzt. Du sprichst ein vortreffliches Englisch.«
»In Arizona hatten wir doch viele englische Nachbarn, aber auch viele spanische. Ich spreche auch Spanisch.«
»Ja, ich weiß, in Arizona gibt's viele Spanier. Da hast Du schon viel durchgemacht in Deinem jungen Leben.«
»Wieso?«
»Na ja, das weißt Du nicht, weil Du es eben nicht anders kennst. Aber Du sagtest doch selbst, dass die Calza eine Strafanstalt gewesen sei.«
»Ja, das allerdings merkte ich dann, als ich daraus geflohen war. Aber gefallen hat es mir darin dennoch.«
»Und trotzdem bist Du geflohen?«
»Aus Scham vor Schande.«
»Was hattest Du denn ausgefressen?«
»Ich war schon Pagenaufseher und sollte degradiert werden, ganz unschuldig, wegen eines Vergehens, das ich nicht begangen hatte. Aber ich wurde überführt. Totpeitschen hätte ich mich lassen, aber Degradation konnte ich nicht ertragen, da bin ich geflohen.«
»Ja, in der Calza soll es mörderliche Prügel geben.«
»Niemals, man wird von keiner strafenden Hand berührt.«
»Nicht?! Du sagtest doch eben selbst, da hättest Du Dich lieber totpeitschen lassen.«
»Das sagte ich nur so. In der Calza gibt es keine körperlichen Züchtigungen, sie wären doch entehrend.«
»Ich habe aber von glaubwürdiger Seite das Gegenteil erzählen hören. Es sollen schon viele Knaben unter den Misshandlungen gestorben sein. Oder hat man sie gezwungen, sich viele Stunden in eiskaltem Wasser aufzuhalten?«
»So ist es, und es ist dennoch nicht so. Das Ehrgefühl der Knaben wird bis zum höchsten Grade geweckt, man verlangt von ihnen, dass sie sich freiwillig den Strapazen und selbst Martern unterwerfen, wie sie sonst nur asketische Mönche ersinnen können. Tun sie das nicht, übertrifft nicht einer den anderen immer an solchen freiwilligen Martern, so wird er so verhöhnt und verachtet, dass er lieber Selbstmord begeht.«
»Schrecklich! Ja, das sind italienische Zustände, ich weiß es. Ich mag gar nichts mehr davon hören.«
»Nachdem ich mich Dir offenbart habe, möchte ich auch wissen, wer Du bist?«
Eine längere Pause erfolgte, ehe die Antwort kam.
»Wer ich bin? Knabe, ich müsste Dir ein Märchen erzählen, das Du doch niemals glauben würdest.«
»Ein Märchen?«
»Höre. Es war ein Ehepaar — die Frau liebte ihren Mann über alles in der Welt, und der Mann ebenso seine Gattin. Beiderseits die denkbar innigste Liebe. Und doch sperrt die Frau ihren Mann in ein großes Zimmer, in das sie einige Topfpflanzen gesetzt hat, und sagt: Das ist eine Wildnis, hier führe Du ein Leben als Jäger und Robinson. Adieu — und sie schließt die Türe zu.«
Der Italiener lachte.
»Was erzählst Du mir da?!«
Nur ganz im Anfange hatte Hendrick etwas schwermütig gesprochen, jetzt lachte er ebenfalls mit ungekünstelter Herzlichkeit.
»Nicht wahr, so ein Märchen glaubst Du nicht? Und dennoch ist es Tatsache. In dem Zimmer mit den Topfpflanzen sollst Du ein Jägerleben führen!«
»Ich? Natürlich sprichst Du doch nur von Dir.«
»Na gut, ich gebe es zu. Ich bin dieser glückliche Ehemann selber.«
»Ja, was solltest Du denn da drin jagen?«
»Nun, sie kann ja noch Mäuse hineingesetzt haben — vielleicht auch einige Kaninchen.«
»Ich verstehe Dich nicht«, lachte Giuseppe. Ist Deine Frau denn wahnsinnig?«
»Nein, aber ihren Mann, mich, hält sie für wahnsinnig.«
»Du bist doch nicht wahnsinnig.«
»I Gott bewahre«, lachte Hendrick ebenfalls. Aber glaubst Du nun, dass ich Dir nicht weiter erzählen kann?«
»Hm, da müsstest Du allerdings wohl sehr lange Erklärungen geben.«
»Ja, und ich bitte Dich überhaupt, mich gar nicht mehr darüber zu fragen. Gegenwärtig fühle ich mich glücklich, als Soldat, der nur seinem Vorgesetzten zu gehorchen hat, sonst sich den Teufel um morgen, die nächste Stunde zu kümmern braucht. Jetzt ist, wie es der Wachtmeister vorhin sehr hübsch wünschte, mein Gewehr hier im Arme meine Herzallerliebste. Willst Du mir durch Deine Fragen dieses mein Glück stören?«
»Nein, das will ich nicht. Aber weißt Du, was dann noch der Oberst sagte?«
»Wir sollten einige Stunden schlafen.«
»Wir sollten gute Kameradschaft halten, und wer noch keinen guten Kameraden hätte, der sollte sich einen suchen.«
»Richtig. Na, und wir beide liegen ja schon zusammen in einem Bette. Willst Du mein guter Kamerad sein, Kleiner?«
»Ich will Dein guter Kamerad sein, Großer«, erklang es lachend zurück, und lachend schüttelten sich die beiden im Liegen die Hände, so ernst sie es auch meinten.
»Denn mein Kleiner wirst Du wohl bleiben, oder mein Pepi.«
»Bin ganz damit einverstanden.«
»Fühlst Dich nicht beleidigt, weil Du doch ein Edelmann bist, wenn auch ein noch so kleiner?«
»Ach was, darauf pfeife ich, und ich will es doch gar nicht mehr sein.«
»So wenig wie ich ein — Du, nun wollen wir aber schlafen. Ziehe Deine Beine ein bisschen ein, Du stößt mich mit Deinen Knien ja immer in den Bauch.«
Hendrick hörte noch ein silbernes Lachen, dann war er gleich hinübergeschlummert, wie es jetzt im ganzen Saale still geworden war.
Noch vor der Reveille wurde Fred Hendrick wieder durch solch ein hellet Lachen geweckt, das direkt in sein Ohr hineinklang. Auch lag, was er aber erst jetzt merkte, ein Arm um seinen Hals.
Hendrick hob nur etwas den Kopf, betrachtete das hübsche Knabengesicht, das im Traume lächelte. Sogar laut gelacht hatte Pepi im Schlafe.
»Wie glücklich der arme Junge ist, dass er unter die Soldaten gekommen ist, genau so wie ich«, murmelte er, legte sich wieder hin, ohne den Arm zu entfernen, der ihn so zärtlich umschlang, und war bald wieder eingeschlafen.
Vier Wochen später.
Oberst Eisenfaust stand an der Brüstung des Festungshofes und beobachtete mit einem Feldstecher das tief unter ihm liegende Gelände.
Niemand konnte dem eisernen Manne ansehen, wie der Grimm in ihm nagte.
Es war alles ganz anders gekommen, als er geplant hatte.
Auf dem Kriegsschauplatze angekommen, hatte er von dem General, dem er unterstellt war, den Befehl erhalten, mit seiner Lumpengarde sofort hier diese Festung zu besetzen.
Fort Chilinque in der Sierra Blanca war eine uneinnehmbare Festung. Von Felswänden umgeben, die überall nach innen etwas überhingen, konnte sie von unten und von den nächsten Gebirgszügen aus mit Artillerie gar nicht beschossen werden. Nur von dem gegenüber liegenden Bergfelsen Barbelinos aus, der noch weit höher war als die Festung, wäre das möglich gewesen; aber der war unersteigbar. An eine Erstürmung war erst recht nicht zu denken. Einige wenige Magazingewehre genügten zur Verteidigung, sie putzten einfach alles weg, was auf dem schmalen Saumpfade dort hinter jener Felsenecke auftauchte.
Oberst Eisenfaust hatte gehorchen müssen, er war gar nicht dazu gekommen, dem Generalstabe seinen Plan darzulegen, den er mit seiner Lumpengarde vorhatte.
Nur zwanzig Mann unter einem Leutnant waren es gewesen, die er mit seinen dreihundert Soldaten abgelöst hatte. Diese zwanzig Mann hatten auch vollständig genügt. Dieses Fort hatte ja bei der jetzigen modernen Kriegsführung gar keinen Zweck mehr. Nur insofern war es noch sehr wichtig, als der Generalstab hier ein großes Proviantmagazin angelegt hatte. In den Felsenkellern waren ungeheuere Quantitäten von Hartbrot, Hülsenfrüchten und Salzfleisch aufgestapelt. Diesen Proviant wollte die Bundesarmee immer direkt hinter sich im Rücken haben.
Ja, im Rücken! So war es damals gewesen, als diese Vorratskammer angelegt worden war!
Die Bundesstaatler waren in den letzten Wochen siegreich gewesen. Aber die Mexikaner hatten sie in ihre Schluchten gelockt, um sie dann bataillonsweise gefangen zu nehmen oder, wenn sie sich nicht auf Gnade und Ungnade ergaben, sie durch herabrollende Steine und Stämme zu zermalmen, sie wie eingeschlossenes Wild niederzuknallen.
Jetzt waren die Truppen der Bundesstaaten schon wieder meilenweit nach Norden zurückgeworfen, schon seit zwei Wochen war dieses Fort vom Feinde umringt.
Genommen konnte es freilich nicht werden. Aber die Besatzung konnte auch absolut gar nichts gegen den Feind unternehmen, nicht einmal die unten vorbeiziehenden Truppen bombardieren. Wohl waren ein Dutzend brauchbare Geschütze da, einige der Tramps verstanden sie zu bedienen, oder sie hätten es eben gelernt — aber nicht einmal eine Pulverkartusche war vorhanden, um einen Schreckschuss abzugeben. Es hatte der Gebirgsartillerie einmal an Munition gefehlt, das Fort hatte alles hergeben müssen, was es daran besessen — eben weil man niemals daran gedacht hatte, dass diese mexikanischen Banditen bis hierher dringen könnten.
So war die Besatzung jetzt auch noch abgeschnitten. Und wenn sie auch keinen Proviant zu decken gehabt hätte, sodass wenigstens dieser nicht dem Feinde in die Hände fiel — sie hätten sich überhaupt gar nicht durchschlagen können, ein Ausfall wäre der reine Wahnsinn gewesen.
Denn hinter jener Felsenecke lag eine starke Abteilung. Die konnten nicht hervor, die Belagerten aber ebenso wenig heraus. Sie wären Mann für Mann auf dem schmalen Saumpfade abgeschossen worden.
Man saß hier rettungslos in einer Mausefalle!
Dazu kam nun noch, dass es in dem Fort gänzlich an Brennmaterial fehlte. Früher hatte man dort auf dem Bergabhang Holz geschlagen. Da waren über Nacht die Truppen der Bundesstaaten fluchtähnlich zurückgegangen, am anderen Morgen waren die Mexikaner da gewesen. Zwei der Tramps, welche Holz hatten holen wollen, waren unter zwei Schüssen zusammengebrochen, den Abhang hinabgekugelt und in der Tiefe verschwunden.
Jetzt konnte die Besatzung keine Mehlsuppe, keinen Tee kochen. Es gab nur Hartbrot und rohes Salzfleisch. Oder sie hätten rohe Hülsenfrüchte kauen müssen. Etwas anderes gab es nicht.
Das einzige Glück im Unglück war, dass es Tramps waren, Landstreicher, die hier als Festungsverteidiger lagen. Die machten sich nichts daraus, bloß kaltes Quellwasser zu trinken, Hartbrot zu kauen und rohes Salzfleisch zu essen. Wenn das andere Soldaten gewesen wären, aus einer besseren Gesellschaftsklasse — Oberst Eisenfaust mochte es sich gar nicht ausmalen! Wenn das Essen aufhört, hört auch das Soldatenspielen auf. Und Hartbrot und rohes Salzfleisch ist kein Essen. Der Amerikaner isst rohes Fleisch ebenso wenig wie der Engländer, es ist ihm ein Gräuel. Dass wir ein halb durchgebratenes Beefsteak »englisch« nennen, ist vollkommen ungerechtfertigt; das kennt der Engländer gar nicht. Er brät sogar den Salzhering und isst keinen geräucherten Aal, keinen ungekochten oder ungebratenen Schinken. —
»Alarm!!«, schrien da gleichzeitig einige Wachtposten, und ein Trompeter ließ sein Instrument schmettern.
Das Ganze zeigte, wie Oberst Eisenfaust seine Leute in Gefechtsbereitschaft hielt, und dabei war innerhalb der vierzehn Tage kein einziger Angriff erfolgt. Aber die Besatzung hatte sich eben nicht in träumende Ruhe hineintäuschen lassen.
Hinter jener Felsenecke, die etwa achtzig Meter entfernt war, war ein Mann hervorgetreten, sofort hatten ihn gleichzeitig alle Wachtposten gesehen, sofort erklang das Signal, und im Nu kamen aus den Felsenkammern Soldaten hervorgestürmt und eilten auf ihre Gefechtsstationen. Der eine hatte gerade seine Hose geflickt, und er erschien in Untersachen — ein anderer hatte sich gerade rasieren wollen, er stand mit eingeseiftem Gesicht an der Brüstung, das Gewehr schussfertig.
Der Mann an der Ecke schwenkte eine weiße Flagge.
»Parlamentär!«, schrie er.
»Angenommen!«, rief der Oberst zurück.
Nur vor vierzehn Tagen, an jenem Morgen, da man erkannte, dass die Bundestruppen in der Nacht zurückgewichen waren, war ein Parlamentär gekommen und hatte zur Übergabe der Festung aufgefordert, sonst nie wieder.
Der Mann erstieg den schmalen Saumpfad, eine förmliche Klettertour. Er trug das phantastische Kostüm der mexikanischen Gebirgsbewohner, sagen wir gleich: der Banditen.
Mit einem schrecklichen Rasseln und Quietschen ging die Zugbrücke nieder, legte sich über den breiten tiefen Spalt, der das Tor von dem Wege noch trennte. Aber dieses Rasseln und Quietschen war gewissermaßen nur künstlich. Bei einem nächtlichen Ausfall hätte die niedergehende Zugbrücke nicht den geringsten Laut von sich gegeben.
Der Parlamentär betrat den Festungshof. Ein blutjunges Kerlchen, das aber sicher seinen ganzen Mann stand.
»Leutnant Tajeda von der Brigade des Generals Lerdo de Perfiro.«
»Colonel Kettelhorst, Kommandant dieser Festung.«
»Im Namen des Generals Perfiro fordere ich Sie auf, sich zu ergeben.«
»Nein.«
»So werden wir die Festung im Sturme nehmen.«
»Nehmen Sie sie.«
»Wir hätten nicht nötig, wegen dieser Festung auch nur einen Mann zu opfern. Euch wird der Weg verlegt, Ihr seid einfach kalt gestellt. Dass hier sehr viel Proviant liegt, wissen wir, aber wir brauchen Eure Erbsen und Bohnen und Linsen nicht. Wir haben den Yankees so viele Rinder und Hammel abgenommen, die sie sich nachtreiben ließen, dass wir nicht wissen, wie wir die Tiere in dieser Jahreszeit füttern sollen, dass wir nur die besten Rückenstücke und die Lenden von ihnen essen.«
»Was soll's der vielen Worte?«
»Aber wir müssen diese Festung einnehmen, es handelt sich um den moralischen Effekt.«
»So tun Sie doch dieser Moral Genüge.«
»Deshalb haben wir in vierzehn Tagen die ungeheuere Leistung vollbracht, dort oben hinauf Geschütze zu schaffen.«
Der Offizier hatte dabei mit dem Daumen über die Achsel gedeutet, nach dem mächtigen Felsenberge, den die untergehende Sonne vergoldete.
Oberst Eisenfaust war ein wenig in die Höhe gezuckt.
»Auf den Barbelinos Geschütze?«
»Ja.«
»Das ist nicht wahr!«
»Herr Oberst, wie können Sie mich der Lüge zeihen, wenn ich Ihnen sofort den Beweis der Wahrheit geben kann?!«
»Ich meine — der Barbelinos ist unersteigbar!«
»Es gibt eben dennoch einen Aufstieg, er war nur bisher nicht bekannt, oder nur wenige Männer kannten ihn, sie haben uns geführt. Freilich, die ungeheuerlichsten Anstrengungen waren nötig, die Geschütze hinauf zu bringen. Jetzt sind sie oben. Gebirgskanonen vom schwersten Kaliber. Ihre Festung ist nicht mehr uneinnehmbar.«
Oberst Eisenfaust atmete schwer. Nur dass er noch hoffte, jener wolle ihn nur bange machen, um ihn zur freiwilligen Übergabe der Festung zu bewegen.
»Und ich kann es nicht glauben —«
»Ich werde einen blinden Schuss abfeuern lassen. Blicken Sie hin.«
Ohne sich umzudrehen, schwenkte der Mexikaner in besonderer Weise seine weiße Flagge, und in der nächsten Sekunde stieg auf dem waldigen Plateau des gegenüberliegenden Felsenkegels, kaum zwei Kilometer entfernt, eine weiße Rauchwolke empor, worauf dann ein donnernder Knall folgte.
»Sind Sie nun überzeugt? Sobald ich wieder hinter der Felsenecke verschwunden bin, werden zehn schwere Geschütze Bomben und Granaten gegen Ihre Festung speien — sie ist unhaltbar!«
Mit aller Kraft musste der Oberst seine maßlose Bestürzung niederkämpfen, denn der Mexikaner sprach die Wahrheit.
Sobald die Festung von dort oben aus beschossen werden konnte, war sie unhaltbar.
Es hing mit den ganzen Verhältnissen zusammen, unter denen sie angelegt worden war.
Wohl konnte nur der freie Hof beschossen werden, wohl konnte sich die ganze Besatzung in den Felsenkammern verbarrikadieren. aber zu halten vermochte sie sie darin auf die Dauer nicht, wenn der Feind nur energisch genug vorging.
Damit, dass auf den gegenüberliegenden Felsenberg Geschütze gebracht werden könnten, war eben absolut nicht gerechnet worden. Es fehlte hier in den Felsmauern an jeder Schießscharte, durch die man mit Gewehren den freien Hof hätte beherrschen können. Die Zugänge zu den Felsenkammern verschlossen ganz einfache hölzerne Türen, mit einem Tritt aufzusprengen. Und wenn eine einzige Granate in das Innere gelangte und explodierte, so machten die sich entwickelnden Pulvergase einen Aufenthalt in den Kammern unmöglich, alles würde ersticken, was sich nicht ins Freie flüchtete. Und nach einem vorangegangenen Bombardement musste es dem Feinde ein Leichtes sein, den Festungshof zu gewinnen, man konnte ihn von den Felsenkammern aus nicht auf dem sehr tief liegenden Wege beschießen. Und einmal auf dem Festungshofe, konnte der Feind auch in das Innere eindringen, dann handelte es sich nur noch um die numerische Überlegenheit des Gegners, und die Mexikaner würden wohl wie die Heuschrecken angeschwärmt kommen, und sie hatten schon oft bewiesen, dass sie gerade im Bajonettsturm und noch mehr im Kampfe mit dem Messer in der Faust ihren Mann standen. Denn dann schwand ihnen die Besinnung, dann wurden sie im Kampfesfieber toll wie die Stiere ihrer Heimat, während sie vor einem wohlgezielten Schnellfeuer selten Stand hielten.
Wenn der Kommandant die ihm anvertraute Festung rettungslos verloren sah, dann konnte er auch an Unterhandlungen denken, um vielleicht doch zu retten, was noch zu retten war, wenn es seine Ehre erlaubte.
»Zu welchen Bedingungen soll ich mich ergeben?«
»Auf Gnade oder Ungnade.«
»Was heißt das?«
»Die Besatzung kommt in Gefangenschaft.«
»Daran ist nicht zu denken. Ich verlange Abzug in allen Ehren unter Mitnahme unserer Waffen, Geschütze und des Proviantes.«
»Ha ha!!«, lachte der junge Leutnant. »Sollen wir Ihnen nicht auch noch Lastträger und Maultiere stellen, falls Ihre Leute nicht langen, um das alles mitzunehmen?«
»Darum würde ich allerdings bitten!«
Der Leutnant gab sein Lachen auf. »Sofortiges Strecken der Waffen, Übergabe auf Gnade und Ungnade!«
»Ich bitte um Bedenkzeit.«
»Auf wie lange?«
»Um zwölf Stunden.«
»Herr, das ist eine List!«, fuhr der Mexikaner empor.
»Wieso?«
»Sie wollen unterdessen Vorbereitungen treffen, um sich gegen das Bombardement noch möglichst zu schützen!«
»Selbstverständlich will ich das. Nennen Sie das eine List? Nun gut. Jedenfalls aber eine ganz erlaubte List.«
Der aufgebrachte Parlamentär beruhigte sich schnell wieder.
»Nein, indem Sie es gleich zugeben, verliert es den Schein jeder Hinterlist. Gut, ich gewähre Ihnen die zwölf Stunden Bedenkzeit — unter der Bedingung, dass Sie keine Vorbereitungen zur Sicherung gegen das Bombardement treffen.«
Jetzt machte der Oberst ein Gesicht, als wolle er hell auflachen. Er tat es aber nicht.
»Nein, das kann ich nicht versprechen.«
»So wird Ihnen keine Bedenkzeit gewährt. Sobald ich dort hinter der Felsenecke verschwunden bin, beginnt das Bombardement.«
»Tun Sie, was Sie nicht lassen können.«
»Ist das Ihr letztes Wort?«
»Es war mein letztes.«
»Bedenken Sie, dass Sie rettungslos —«
»Es war mein letztes Wort, sagte ich — wir werden bis zum letzten Mann kämpfen.«
»Gut.«
Aber der Parlamentär ging noch nicht. Er hielt noch eine andere Ansprache, an die unter Gewehr stehenden feindlichen Soldaten, und es war nicht schön, was er tat.
Die Mexikaner hatten sich in diesem Kriege bisher von der ritterlichsten Seite gezeigt. Es ist überhaupt ein ritterliches Volk, das mexikanische, das muss man ihm lassen. Zum Beispiel war bekannt, dass sie die vielen Kriegsgefangenen, die sie schon gemacht hatten, auf's Allerbeste behandelten, lieber selbst hungerten und ihnen ihre Ponchos gaben, ehe sie jene darben und frieren ließen, und dass sie Gefangene zum Ziehen von Kanonen und Holztragen verwendeten, war nur ein einziges Mal vorgekommen, es durfte sich auf Befehl der Kriegsleitung niemals wiederholen.
Das ist gewiss ritterlich zu nennen. Aber was dieser Mexikaner jetzt tat, das war nicht ritterlich.
»Leute! Soldaten, Korporale und Offiziere! Tretet zu uns über! Ihr werdet mit allen Rechten unserer Armee eingereiht, wir zahlen denselben Lohn wie die Vereinigten Staaten. Nach unserem Siege, der in kurzer Zeit erfolgen muss, erhält jeder Kombattant mindestens dreihundert Acker bestes Regierungsland, das er sich auswählen kann. Er kann es verkaufen oder wird, wenn er sich darauf ansiedeln will, von der Regierung der Republik mit barem Gelde tatkräftig unterstützt. Des Weiteren hat er Anwartschaft auf gut bezahlte Staatsämter. Leute, tretet über zu der siegreichen Armee der Republik Mexiko!«
So hatte der mexikanische Offizier mit schallender Stimme gerufen.
Nein, das war nicht ritterlich, so eine Verleitung zur Desertion, zur meineidigen Fahnenflucht, und am wenigsten von einem unantastbaren Parlamentär.
Aber es war begreiflich, in etwas sogar verzeihlich.
Desertionen oder vielmehr Übertritte zum Feinde waren in den Reihen der Bundesstaatler schon massenhaft vorgekommen und kamen noch täglich vor. Es war ja überhaupt so viel Gesindel darunter, das nur zu derjenigen Partei hielt, von der es sich die größeren Vorteile versprach. Und dann die vielen Spanier, die sich mit den Mexikanern viel mehr verwandt fühlten. Die meisten dieser Spanier hatten nur ein Gewehr, eine Browningpistole, Bajonettmesser, Patronen und gute Kleidung haben wollen, um dann sofort bei der ersten Gelegenheit zum Feinde überzugehen. Spanier wurden überhaupt nicht mehr angenommen, Italiener nur, wenn sie nachweisen konnten, dass sie in den Vereinigten Staaten mindestens nahe Verwandte mit eigenem Grundbesitz wohnen hatten. Den Franzosen kann man in der Geschichte nirgends nachweisen, dass sie aus Eigennutz oder aus sonstigen Gründen zum Feinde übergelaufen sind.
Den Mexikanern war das schon so geläufig geworden, dass hier dieser Offizier, sonst vielleicht ein tadelloser Charakter, einfach zur Desertion einlud, auf seinen Schutz als Parlamentär pochend.
Des Obersten an sich schon fast schwarzbraunes Gesicht färbte sich noch dunkler, mit sprühenden Augen machte er einen Schritt vorwärts.
»Herr, wenn Sie nicht die Parlamentärsflagge in der Hand hätten — das ist ja unerhört!!«
Er hätte seine Eisenhand nicht erst zur Faust zusammenzuklappen brauchen, um jenem einen Hieb zu versetzen, von dem er nicht wieder aufstand.
Aber wäre es wirklich seine Absicht gewesen, er wäre gar nicht dazu gekommen, ein anderer übernahm die Bestrafung für diese unerhörte Dreistigkeit.
Plötzlich kam aus einer der Felsentüren ein Soldat hervorgeschossen, ein uralter, Vater Zion, sprang über den Platz, den Kopf vorgestreckt, und rannte wie ein Ziegenbock mit seinem Kopfe dem mexikanischen Leutnant direkt in den Bauch hinein, mit einer Vehemenz, dass der Leutnant zurückgeschleudert wurde und rücklings über die nur niedrige Brüstung stürzte!
Dahinter war nur noch eine kurze Strecke sehr steile Böschung, dann ging es in die furchtbare Tiefe hinab. Und in diese wäre der Parlamentär gesaust, wäre er nicht von einem am Rande wachsenden Busche aufgehalten worden.
Aber das Entsetzliche kam erst jetzt.
Auch Vater Zion war über die Brüstung gestürzt, das heißt, er blieb mit dem Leibe wie ein Sack darauf hängen, und da kam ein unbeschreiblicher Ton aus seinen Munde, ein dicker Blutstrahl folgte nach. Der uralte Mann hatte einen Blutsturz. Und was für einen! Wie eine Fontäne schoss das rote, dicke Blut hervor, vermischt mit kleinen Klumpen, der Alte musste sich die ganze Lunge ausspucken, und dieser Bluterguss traf gerade auf den unten liegenden Offizier!
Dieser raffte sich empor, erkannte die furchtbare Gefahr, in der er sich befand, das geringste Rutschen und er verschwand in der Tiefe — so kroch er vorsichtig die Böschung entlang, bis er die Zugbrücke erreichte, schwang sich auf diese, und nun eilte er zurück.

Aber kurz hinter der Zugbrücke wandte er sich noch einmal. Der über und über mit Blut übergossene Mann bot einen schrecklichen Anblick. Drohend schüttelte er die Faust und in dieser die Flagge, die sich jetzt blutrot gefärbt hatte.
»Das sollt Ihr büßten!! Ihr habt einen heiligen Parlamentär tätlich angegriffen und besudelt!! Wehe, wer von Euch uns lebendig in die Hände fällt!!«
So rief er, eilte weiter und verschwand hinter der Felsecke.
Dies alles war weit schneller vor sich gegangen, als es sich hier schildern ließ.
Oberst Eisenfaust wäre nicht bestürzt gewesen, wenn man dicht vor ihm unvermutet eine Kanone losgebrannt hätte. Aber diesem Anblick hier war er nicht gewachsen, das war alles zu plötzlich gekommen, so etwas hatte er noch nicht erlebt, er vermochte das Ganze nicht gleich zu begreifen — das versetzte ihn in die größte Bestürzung.
Zunächst war es nur allgemein menschliche Teilnahme, die ihn erfasste.
»Um Gottes willen, der Alte hat einen Blutsturz bekommen!!«, schrie er. »Er stirbt!!«
»Nee, nee, Herr Oberst, der stirbt nich!«, ließ sich da eine Stimme vernehmen.
Sie gehörte dem Buckligen Nummer 777 an, Herrn Friedrich Wilhelm Schulze. Er war Proviantmeister geworden, hatte das Magazin unter sich bekommen und brauchte deshalb nicht beim ersten Alarm mit anzutreten. Als Gehilfe war ihm Vater Zion beigesellt worden.
Freundlich grinsend stand er jetzt da.
»Aber er spuckt doch Blut — spuckt seine ganze Lunge mit aus!«
Denn Vater Zion, noch wie ein Sack über der Brüstung hängend, spuckte immer weiter, wenn auch nicht mehr in solchen Strömen.
»Nee, nee, Herr Oberst, das sind nur Kirschen.«
»Kirschen?!«, wiederholte der Oberst, und sein verdutztes Gesicht war begreiflich.
»Ja, ich habe eine ganze Menge Konservenbüchsen gefunden, sie lagen unter den Linsensäcken und enthalten alle nur Früchte. Die eine habe ich geöffnet, um zu sehen, ob das Zeug noch gut ist, es waren Kirschen, eine Vierpfunddose, ich ließ sie stehen, hatte anderswo zu tun, und da hat Vater Zion die ganze Vierpfunddose ausgelöffelt. Davon ist es ihm schlecht geworden.«
Jetzt freilich begann der Oberst zu begreifen, und um seine Mundwinkel begann es schon zu zucken. Doch zunächst fesselte noch das weitere Benehmen des Alten seine Aufmerksamkeit.
Endlich war Vater Zion fertig mit Spucken, er richtete sich ächzend auf, taumelte in ganz bedenklicher Weise, immer über seine eigenen Füße stolpernd, da bemerkte auch der Oberst einen eigentümlichen, sehr bekannten Geruch. Von dem Alten ging eine ganz besondere Atmosphäre aus, die eng mit seinem Taumeln zusammenhing.
»Der Kerl ist ja ganz betrunken!!«
»Ja, der ist total besoffen«, bestätigte Schulze grinsend.
Ein neues Rätsel. Hier gab es keinen Alkohol.
»Wovon ist der denn so bezecht geworden?!«
»Nu, von den Kirschen.«
»Ja, aber von Kirschen wird man doch nicht besoffen?!«
»O ja, wenn sie danach sind — die sind in Rum eingemacht. Sonst hätte der doch auch nicht die Vierpfunddose ausgenascht.«
Da wandte sich der Oberst schnell um und biss sich auf die Lippen, um nicht mit einzustimmen in das schallende Gelächter, welches jetzt aus dem Forthofe aus fast dreihundert Kehlen losbrach.
Es war jetzt auch keine Zeit und Gelegenheit zum Lachen.
Plötzlich ein furchtbares Krachen über ihren Köpfen, dem ein Hagel von Eisenstücken folgte, und dann erst in der Ferne der Geschützdonner. Die Geschosse brauchten vier Sekunden, die Schallwellen zwei Sekunden mehr, um die zwei Kilometer zu durcheilen.
Die erste Granate war hoch oben gegen die Felswand geschlagen und dort krepiert. Die so einfach herabfallenden Eisentrümmer konnten nicht viel Schaden anrichten, höchstens durch scharfe Ecken und Kanten Fleischwunden erzeugen. Diesmal war es noch mit einigen geringfügigen Hautrissen abgegangen. Aber diese Warnung genügte, kein Kommando war nötig.
Alles eilte in die Felsenkammern und postierte sich in vorsichtiger Stellung und Lage hinter den Türen und Fenstern.
Die zweite Granate schlug mitten auf den Festungshof, sie hätte alles Lebendige davon fortgeräumt. Dann verirrten sich einige Geschosse, explodierten oben an der Felswand, aber immer besser schossen die sich drüben ein, und dann fand eine Bombe ihren Weg durch eine Tür, die nachfolgende gleich durch ein Fenster, in den Gängen einen furchtbaren Qualm entwickelnd, zum Glück gerade in den Gängen, in denen sich kein Mensch befand.
»Alle Öffnungen mit Säcken verstopfen!!«
Es geschah. Die Säcke mit Mehl und Hülsenfrüchten wurden herangeschleppt, alle Türen und Fenster damit verbarrikadiert, dazwischen nur kleine Schießscharten gelassen.
»Nein, so leicht wird es den Belagernden nicht, wie die sich das denken, diese Festung ist uneinnehmbarer denn zuvor«, konnte Oberst Eisenfaust mit Recht sagen, als er die vollendete Verbarrikadierung kontrollierte.
Ein Zehnzentimetergeschoss, und zwar eine Spitzkugel aus Hartguss, traf einen Mehlsack. Natürlich platzte der Sack. Aber sonst hatte das Geschoss den Sack nicht einmal umwerfen können, die Spitzkugel war nicht bis zur Hälfte eingedrungen, dann war sie ohnmächtig stecken geblieben und wieder herausgefallen, einen Mehlregen nach sich ziehend.
Denn das Mehl wie auch die Hülsenfrüchte besitzen dieselbe wunderbare Eigenschaft wie der Sand. Bekanntlich wird ein Sprengloch nur mit losem Sand verstopft. Das explodierende Pulver, Dynamit, zersprengt den ganzen Felsen, aber das bisschen Sand vermag es nicht aus dem Loche herauszuschleudern. Das hängt mit einem physikalischen Gesetze zusammen. Jedes lose Sandkörnchen bedeutet einen Widerstand für sich, jedes drückt gegen das nächstliegende, und der Widerstand wächst mit der Entfernung im Quadrat, also in ungeheurem Maße. Die Hülsenfrüchte und das Mehl vertraten hier die Stelle des Sandes. Die großen Bohnen boten den geringsten Widerstand, das feine Mehl den größten.
Um fünf Uhr brach die Novembernacht an, und die Kanonade, die nur eine Viertelstunde gewährt hatte, verstummte.
In den Felsenkammern hütete man sich, Licht zu zeigen. Dagegen schimmerte dort hinter der Felsenecke ein Lichtschein hervor. Die dort auf dem Saumpfade liegenden Mexikaner konnten ja das intensivste Licht erzeugen, das ihnen möglich war, danach hätten sich die Geschütze orientieren können. Aber es war doch ein sehr unsicheres Zielen, man konnte den Effekt nicht beobachten, es wäre nur unnütze Munitionsverschwendung gewesen.
Aber kurz vor Mitternacht würde der Mond mit halber Scheibe aufgehen, er beleuchtete die Festung für die Kanoniere auf dem Barbelinos gerade recht gut, und so war Oberst Eisenfaust überzeugt, dass dann das Bombardement mit aller Macht wieder aufgenommen würde und dass dann auch die Belagerer auf dem Saumpfade, die dann immer noch den Schutz der Dunkelheit genossen, zum Sturmangriff vorgehen würden.
»Die Freiwache geht schlafen!!«
Die Posten wurden verteilt. Sie gingen nach wie vor auch auf dem Festungshofe Wache.
Auch Oberst Eisenfaust hatte sich auf ein Schlafsofa gelegt. Kurz nach acht, nachdem die Wache abgelöst werden war, wurde er von dem Kapitän geweckt, auch ein Leutnant und zwei Korporale waren mit in das Kommandantenzimmer gekommen.
Dieser unangemeldete Massenbesuch musste den Oberst schon stutzig machen.
»Was ist passiert?!«, fuhr er empor.
»Vier Mann von der Wache fehlen, sie sind desertiert.«
Oberst Eisenfaust presste die Lippen zusammen, nichts weiter.
Es war nichts Neues, es waren von dieser Lumpengarde schon mehr als ein Dutzend zum Feinde übergelaufen, so nach und nach, während des Marsches bis hierher.
Von hier aus war noch keiner desertiert, Oberst Eisenfaust hatte geglaubt, nun sei seine Truppe rein von solchen Elementen.
Und nun waren doch wieder vier Mann verschwunden, sogar Wachtposten! Natürlich hatten sie ihre Waffen mitgenommen.
Also die Aufmunterung des Parlamentärs zur Desertion war doch nicht auf unfruchtbaren Boden gefallen.
Das schmerzte!
Manch anderer freilich hätte erst einmal seinem Zorn Luft gemacht, hätte geflucht und gewettert, womöglich der ganzen Mannschaft ganz ungerechtfertigt die schwersten Vorwürfe gemacht.
Oberst Eisenfaust fühlte nur einen heftigen Schmerz in der Brust, das sah man ihm an.
»Wer?«, stieß er dann kurz hervor.
Die Namen wurden genannt. Zwei davon wieder Italiener, die beiden anderen vaterlandsloses Gesindel, wenn sie sich auch stolz Bürger der Vereinigten Staaten genannt hatten.
»Wie konnte denn die Flucht geschehen?«
»Sie haben ein langes Brett über die Spalte gelegt.«
»Hat es denn niemand bemerkt, dass den Schuften noch eine Kugel nachgesandt —«
Da krachte draußen ein Schuss. Alle eilten hinaus. Es war eine stockfinstere Nacht.
»Wer hat da geschossen?«
»Ich — Fred Hendrick. Ich sah auf dem Saumpfad einen etwas helleren Schein — ich glaube, ich habe einen Menschen getroffen, wenn er auch nicht schrie, keinen Laut von sich gab — er muss sofort zusammengebrochen sein.«
»Auf dem Saumpfad?«
»Ungefähr in der Mitte zwischen hier und der Felsenecke.«
Lautlos ging die Fallbrücke herab, Oberst Eisenfaust selbst überschritt sie, allein.
Nach wenigen Minuten kehrte er zurück. In der einen Hand hielt er ein Gewehr, mit der anderen hatte er den Fuß eines Menschen gepackt, den er nach sich schleifte.
Wieder ein Deserteur, der auf frischer Tat ertappt worden war. Das erkannte man selbst in der Finsternis an der etwas lichtgelben Uniform, der Oberst fühlte es noch besser an der Konstruktion des Gewehres.
Oberst Eisenfaust ließ seine Benzinlaterne schnipsen, deckte vorsichtig das Licht mit dem Mantel, leuchtete dem Manne in das fahle Gesicht mit den starren Augen.
,Antonio Fretti! Also wieder ein Italiener! Kopfschuss durch die Schläfe. Fred Hendrick, ich ernenne Euch zum Korporal.«
Da aber, als des Erschossenen Gesicht sichtbar wurde, machten die Umstehenden noch eine andere Entdeckung.
»Der hat gar nicht Posten gestanden, das ist einer von der Freiwache!«
Es ging in den Schlafsaal, der erleuchtet sein konnte, weil hier die Fenster bis auf die letzte Ritze zugestopft waren.
Dass es nicht viel Zweck hat, die unter Decken oder ihren Mänteln liegenden Schläfer zu zählen, das weiß jeder, der gedient hat. Wenn man Gelegenheit hat, einmal unbemerkt durchs Kasernenfenster zu gehen, dann wird einfach die Decke ausgestopft, darunter hervor lugen zwei ausgestopfte Strümpfe, das Haar am Kopfende wird durch einen alten Besen ersetzt.
»Auf! Alles antreten!«
Die Unteroffiziere meldeten ihre Korporalschaften.
Und richtig, drei fehlten!
Und wieder war ein Italiener darunter.
»Das war aber wohl der letzte, nun sind diese Italiener alle ausgemerzt. Dass aber auch der Giuseppe fahnenflüchtig werden könnte, das hätte ich dem Jungen nicht zugetraut. Was wollen Sie?«
Der neue Korporal, der nun schon vor der Front stand, hatte stramme Stellung genommen.
»Nein, Herr Oberst, dass mein Kamerad fahnenflüchtig geworden, zum Feinde übergegangen ist, das halte ich nicht für möglich!«
»Ja, wo soll er denn sonst sein?«
»Der liegt ja noch dort!«, erklang der Ruf.
Ja, die Decke der Matratze, auf welcher der junge Italiener schlief, bauschte sich noch. Aber nur ein Griff, und er klärte alles auf. Der hatte wirklich jenes Mittel angewendet, hatte unter die Decke seine sonstigen Kleidungsstücke gepfropft, dass es aussah, als ob er darunter läge. Da auch sein Gewehr fehlte, konnte er nicht etwa bei einem Austreten verunglückt sein.
»Da seht Ihr, Korporal! Schafft Euch einen besseren Kameraden an. Ich freilich hätte mich ebenfalls von dem so treuherzig aussehenden Burschen täuschen lassen.«
Der neue Korporal wollte etwas entgegnen, er brachte aber nichts hervor, sondern schüttelte nur immer den Kopf.
Und er schüttelte ihn noch eine halbe Stunde später, als er draußen wieder Wache ging.
»Und ich kann's nicht glauben — kann's nicht glauben!«, murmelte er jetzt noch immer dazu.
»Was kannst Du nicht glauben?«, fragte in der Finsternis eine Stimme.
»Dass mein kleiner Pepi fahnenflüchtig sein sollte!«
»Da hast Du auch ganz recht, Kamerad«, sagte jetzt dieselbe Stimme, aber mit verändertem Klange.
»Pepi!!«, schrie Hendrick auf.
»Ich bin es.«
»Wo bist Du gewesen?!«
»Später. Erst muss ich zum Oberst.«
Da er nun aber einmal schon als Deserteur galt, musste ihn der Korporal, der ihn gefasst hatte, auch begleiten, ihn vorführen.
In finsterem Grübeln saß der Kommandant in seinem Zimmer.
»Aha, bringt Ihr einen zweiten Deserteur lebendig? An Dir werde ich ja ein Exempel statuieren, auch wenn Du freiwillig zurückgekommen bist.«
Erst jetzt im Lichte sah Hendrick zu seinem erschrockenen Staunen, dass der kleine Italiener nicht mehr seine ledergelbe Uniform, sondern ein mexikanisches Kostüm trug, nur mit militärischen Abzeichen, und zwar mit denen eines Leutnants.
»Weshalb bist Du zum Feinde übergelaufen? Weshalb bist Du wiedergekommen?«
»Ich bin nicht desertiert, ich war als Spion auf dem Barbelinos.«
Der Oberst erstarrte mitten in einer Bewegung.
»Auf dem Barbelinos?! Auf dem Berge dort drüben?! Als Spion?!«
»Ja. Ich habe einen Abstieg von der Festung gesucht und einen gefunden. Unten lief mir ein mexikanischer Leutnant in die Quere, den ich überwältigte. Viel verraten konnte er mir nicht, aber seine Uniform musste er mir überlassen. Nun ging ich nach dem Barbelinos. Ich fand sofort die Stelle, wo jetzt der Barbelinos zu ersteigen ist. Teils wusste ich mich durchzuschleichen, teils die Wachtposten zu täuschen, als mexikanischer Offizier. Ich war oben und zählte zehn Geschütze und sechzig Mann Besatzung. Weitere Leute sind damit beschäftigt, mit Winden Munition und Proviant hinaufzubringen. Sobald der Mond aufgeht, soll unsere Festung intensiv beschossen werden. Die hier schon liegenden Mexikaner sollen stürmen. — Herr Oberst, ich halte es für möglich, den Barbelinos zu nehmen. In einer Stunde kann die Batterie in unseren Händen sein. Geben Sie mir ein Dutzend Leute mit, die genügen, ich führe sie.«
Kurz und bündig hatte der kleine Bursche gesprochen.
Und dieser Oberst war kein Mann, der lange staunte und zweifelte. Für ihn gab es nur noch einige Fragen zu erledigen, um durch sich selbst ein klares Urteil zu gewinnen.
»Wo ist der Abstieg von hier?«
»Hinten an der Felsschlucht, wo wir die Abfälle hinabschütten.«
»Das ist einfach eine Schlucht von einigen Metern Tiefe mit ganz glatten Wänden.«
»Nein, in einer Tiefe von etwa zehn Metern zeigt sich ein schmaler Grat, freilich durch die schwarze Farbe des Gesteins kaum zu unterscheiden.«
»Und?«
»Wenn der Grat, sagte ich mir, weiter nach Westen läuft, bis er die Böschung erreicht, dann wäre es vielleicht möglich, ungesehen von den Belagernden hinabzukommen.«
»Wann hast Du Dir das gesagt?«
»Als der Parlamentär erklärte, dass wir hier unrettbar verloren seien — als er bewies, dass der Barbelinos schon mit Geschützen montiert sei.«
»Erst da ist in Dir diese Erkenntnis gekommen?«
»Ja.«
»Vorher hast Du gar nicht an so etwas gedacht?«
»Nein.«
»Aber Du hast doch diesen Grat in der Schlucht schon früher gesehen?«
»Ja.«
»Wann?«
»Gleich am ersten Tage unseres Hierseins, als ich einmal den Kehricht hinabschüttete.«
»Und da hast Du gar nicht daran gedacht, dass dort ein Abstieg möglich sein könnte?«
»Nein.«
»Mit keinem einzigen Gedanken?«
»Nein.«
»Erst in dem Augenblick, als der Parlamentär uns drohte, dachtest Du an diesen Grat, wolltest ihn weiter erforschen?«
»Ja.«
»Hm. Bist Du ein Defensive-Spieler?«
Es war eine merkwürdige Frage. Nur für einen Schachspieler verständlich. Es gibt eine besondere Art dieses Spieles. Man macht sich absolut keinen Angriffsplan, nicht bis zum Endspiel mit den letzten Figuren. Und — die Hauptsache — man versucht auch nicht den Angriffsplan des Gegners zu ergründen. Jeder einzelne Zug des Gegners wird einfach durch einen abwehrenden Zug erwidert.
Es ist dies eine außerordentlich schwere Spielart. Es gehört ein ganz besonderer Geistescharakter dazu, der wohl nur angeboren sein kann, sich gar nicht aneignen lässt. Niemals einen Angriffsplan schmieden, niemals auch nur mit dem kleinsten Gedanken an die Zukunft zu denken, sondern nur den gegenwärtigen Augenblick mit aller Kraft beim Schopfe zu fassen! Wer das kann, der dürfte auch im praktischen Alltagsleben der Meister des Schicksals sein.
Oberst Eisenfaust wartete keine Antwort auf seine Frage ab, er glaubte sich ja auch gar nicht verstanden. Jedenfalls aber hatte dieser Mann gleich das Richtige erkannt.
»Und dann hast Du versucht, diesen Grat zu benutzen?«
»Ja.«
»Wie?«
»Ich nahm ein Seil, band es fest, ließ mich hinab, erreichte richtig die Böschung und kletterte weiter hinunter.«
»Und so bist Du auch wieder heraufgekommen?«
»Ja.«
»Ist das Seil dort noch befestigt?«
»Ja. Auch mein Mantel und mein Gewehr liegen noch dort.«
»Du hattest zuerst auch Dein Gewehr mitgenommen?«
»Ja.«
»Weshalb?«
»Weil wir das Gewehr doch nicht aus den Händen lassen dürfen.«
»Korporal, überzeugt Euch, bringt Gewehr und Mantel mit, das Seil lasst hängen.«
Hendrick entfernte sich. Zwei Minuten blieb er aus, so lange blickte der Oberst den braunen Jüngling unverwandt an, direkt in die Augen, ohne ein einziges Wort zu sagen, und so lange hielt Giuseppe den durchbohrenden Blick aus.
Dann kehrte der Korporal zurück, brachte Mantel und Gewehr mit.
»Es stimmt alles. Das Seil ist um einen Felsblock geschlungen.«
»Gut. Eilt es sehr, dass wir zu dem Unternehmen aufbrechen?«
»Nein!«, entgegnete Giuseppe.
»Wie lange haben wir Zeit?«
»Es ist erst neun. In weniger als einer Stunde können wir oben sein, und die Kanonade beginnt erst um Mitternacht, wenn der Mond aufgeht.«
»Wann hast Du Dich von hier entfernt?«
»Gleich nach Anbruch der Nacht.«
»Du hattest also direkt vor, Dich auf den Barbelinos zu schleichen.«
»Ja.«
»Um zu spionieren.«
»Ja.«
»Du hast gleich an die Möglichkeit gedacht, dass wir uns dort der Batterie bemächtigen können?«
»Ja.«
»Und Du hast nicht für nötig befunden, mich, den Kommandanten dieser Festung, erst von Deinem Vorhaben in Kenntnis zu setzen?«
Nur ein kurzes Zögern.
»Nein«, erklang es dann offen.
»Weshalb nicht?«
»Solange ein Unternehmen ganz aussichtslos ist, darf man nicht davon sprechen, sonst gelingt es nicht — und ein Mann, ein wirklicher Mann tut so etwas überhaupt nicht.«
So sprach der kleine, braune Wicht mit tiefstem Ernst.
Unverwandt blickte ihn der Oberst an, aber der war nicht mehr so durchbohrend, ja, um die Mundwinkel des glattrasierten, verwetterten Gesichtes zuckte es ein ganz klein wenig.
›Weißt Du denn nicht, dass Du dennoch die denkbar schwerste Insubordination vor dem Feinde begangen hast, dass Du dennoch furchtbar streng bestraft werden musst, auch wenn Dein tollkühnes Unternehmen gelingt und man Dir dann vielleicht Denkmäler setzt?‹
So hätte der Oberst jetzt fragen müssen, er tat es aber nicht.
Abgesehen davon, dass Oberst Eisenfaust selbst ein Amerikaner, ein echter Yankee war — diese Szene spielte in Nordamerika, das war die Hauptsache.
In Deutschland wäre dieser ebenso naive wie praktische Jüngling ja schwer bestraft worden, mochte er auch einen noch so glänzenden Erfolg gehabt haben. In Frankreich wäre er verurteilt, das Urteil aber nicht vollstreckt worden. In Amerika aber liebt man wie sonst nirgends in der Welt tollkühne Bravourstückchen, da war jede Insubordination und alles andere sofort vergessen.
»Ein Dutzend Mann genügen?«
»Ja.«
»Um die fünfzig Mann dort oben zu überrumpeln?«
»Ja.«
»Weshalb soll ich Dir nicht mehr mitgeben?«
»O, je mehr, desto besser. Aber es müssen Bergkletterer sein.«
»Ist der Abstieg sehr schwer?«
»Ja, er ist sehr schwierig.«
»Bist Du in dieser Gegend schon einmal gewesen?«
»Nein.«
»Inwiefern ist der Abstieg sehr schwierig?«
»Nur hin und wieder ist ein fester Stein, auf dem der Fuß Halt findet, dicht muss man sich dabei an die Felswand schmiegen. Doch kommen dann noch einige Grate, welche den Abstieg erleichtern, ihn sogar beschleunigen.«
»Und das hast Du in der finsteren Nacht herausgefunden?«
»Ich kann im Finstern ziemlich gut sehen, vorausgesetzt, dass sich mein Auge tags zuvor mit Sonnenlicht gesättigt hat.«
Sofort drehte der Oberst die Lampe klein und blies sie aus. In dem Zimmer herrschte Stockfinsternis.
»Welche Hand hebe ich jetzt?«
Mit einem Male begannen die Augen des kleinen Italieners wie feurige Kohlen zu glühen, was vorher gar nicht der Fall gewesen war.
»Die linke.«
»Was mache ich jetzt?«
»Sie schlagen alle Finger ein bis auf den Daumen, bewegen diesen jetzt hin und her.«
Ohne ein Wort deswegen weiter zu verlieren, nahm der Oberst mit seiner eisernen Hand den heißen Zylinder ab und brannte die Lampe wieder an.
»Was gibst Du mir für eine Garantie, dass Du mir nicht nur ein Dutzend meiner Leute und wahrscheinlich noch viel mehr zum Feinde überführen willst?«, fragte er dann kalt.
Mit einem Rucke fuhr der junge Italiener empor, und jetzt begannen seine großen Augen auch im hellen Lichtschein ganz unheimlich zu glühen. Doch zum Worte kam er gar nicht.
»Ich erbiete mich als Garantie«, sagte Korporal Hendrick schnell.
»Ihr? Wie wollt Ihr diese Garantie geben?«
»Ich bleibe als Bürge für meinen Kameraden hier. Wenn er einen Verrat begeht, so will ich meinen Kopf verlieren — für ihn den Tod und vorher jede Schmach erleiden.«
»Gut. Oder vielmehr: nein! Ich brauche Garantie, keinen Bürgen. Ich traue Dir, Giuseppe. Wann willst Du aufbrechen?«
»Dann allerdings so bald wie möglich«, entgegnete der junge Italiener, nachdem er dem riesenhaften Korporal einen kurzen Blick zugeworfen hatte.
»Hast Du schon einen regelrechten Plan entworfen?«
»Nein.«
»Das musst Du aber doch.«
»Nein, das geht gar nicht, es ist ganz unmöglich.«
»Weshalb unmöglich?«
»Weil sich alle Berechnung jeden Augenblick als falsch erweisen kann, weil immer wieder neue Pläne entworfen werden müssten. Ich kann vorhaben, mir erst mexikanische Uniformen zu verschaffen. Aber ich begegne gar keinem Feinde — das macht schon die erste Kombination zunichte. Und wenn ich auf Mexikaner stoße und wenn ich Gelegenheit habe, sie unversehens zu überrumpeln, so könnte doch immer wieder ein anderer Plan entstehen —«
»Gut! Ich verstehe Sie. Sie sind — Du bist eben ein Defensive!«
Es war merkwürdig, dass der Oberst den gewöhnlichen Soldaten plötzlich mit »Sie« angeredet und dann sich verbessert hatte — und merkwürdig waren auch die Blicke, mit denen er den jungen Italiener manchmal betrachtete, wie es dabei immer um seine Mundwinkel zuckte, was aber nicht gerade bedeutete, dass er sich ein Lachen verbeißen musste. Diesem Manne war jetzt sicher durchaus nicht lächerlich zu Mute.
»Und wenn Du die Batterie genommen hast? Darüber muss ich doch etwas wissen.«
»Ja, das muss ich dem Herrn Oberst auch offenbaren. Sobald der Mond aufgeht, werde ich dennoch erst einige Zeit diese Festung beschießen. Danach wollen sich Herr Oberst einrichten.«
»Erst die Festung beschießen?«
»Ja.«
»Nicht gleich dort die Belagerer an der Felsenecke?«
»Das kommt natürlich auch, aber erst später. Ich habe noch etwas Besonders vor, habe etwas belauscht.«
»Belauscht? Höre Freund, das musst Du mir offenbaren, gar so auf Deine eigene Faust darfst Du nicht handeln. Was hast Du sonst noch vor? Was hast Du belauscht? Sprich! Ich befehle es Dir!«
»Die Mexikaner erwarten einen Konvoi; gegen Mitternacht, vermutet man, wird er durch dieses Tal ziehen.«
Hoch horchte der Oberst auf.
»Einen Konvoi?! Was führt er mit sich?!«
»Vor allen Dingen Patronen. Den vorgerückten Mexikanern soll schon sehr die Munition mangeln. Der Transport, direkt aus der Hauptstadt kommend, bringt eine Million Patronen mit.«
Der Oberst erhob sich jäh etwas vom Stuhl, mit halb geöffnetem Munde blickte er den jugendlichen Sprecher an.
»Frau — —«
Der Oberst gab seinem ganzen Körper einen förmlichen Ruck.
»Heilige Frau von Santa Fe!!«, rief er dann, obgleich er kein Katholik war, noch weniger ein Spanier. »Eine Million Patronen! Doch die Zahl dabei ist ganz gleichgültig, die Hauptsache ist, dass den Mexikanern Patronen mangeln, wenn Du richtig gehört hast. Und Du meinst, wir können den Transport abfangen?«
»Ich meine es.«
»Geht er unter starker Bedeckung?«
»Das weiß ich nicht. Jedenfalls aber wird die Begleitmannschaft ganz sorglos sein, wenn sie dieses Tal passiert, und deshalb eben muss ich erst die Festung bombardieren.«
»Weshalb das? Das verstehe ich noch nicht recht.«
»Nun, sobald der Mond aufgeht, muss die Festung unbedingt beschossen werden. Das ist mit dem Kapitän, der hier liegt, verabredet worden. Und das muss so lange geschehen, bis der Transport hier durchkommt. Dann natürlich richten wir sofort die Geschütze auf die Mexikaner dort hinter der Felsecke, das heißt sobald sich die Unserigen zum Angriff auf den Konvoi anschicken.«
»Richtig, sehr richtig! Junge, Du hast den Teufel im Leibe!«, rief der Oberst und fing plötzlich zu lachen an.
Und der »Junge« lachte mit. »Das hat man mir schon mehrmals gesagt!«
Schnell wurde der Oberst wieder ernst.
»Dazu reichen aber ein Dutzend Leute nicht aus.«
»Nein, wegen dieses zweiten Vorhabens hätte ich auch noch um viel mehr Leute gebeten.«
»Nimm mit, so viele Du brauchst. Wenn nur fünfzig hier bleiben, so genügt das vollständig. Und ich selbst muss hier bleiben. Du aber sollst alles Weitere auch weiter allein leiten, selbst einen Offizier werde ich unter Deinen Befehl stellen.«
»Das wäre auch unbedingt nötig, wenn —«
»Erledigt, erledigt! Wie viele Leute willst Du mitnehmen?«
»Nicht mehr als dreiundvierzig Mann.«
»Weshalb nicht mehr? Weshalb gerade dreiundvierzig?«, fragte der Oberst mit aufrichtiger Verwunderung.
»Weil nur die besten Kletterer mitkommen können.«
»Ja, aber weshalb da gerade dreiundvierzig?«
»Weil ich nur dreiundvierzig Mann für fähig halte, diese Klettertour mitzumachen.«
»Ja, kennst Du denn schon diese besten Kletterer?«
»Gewiss.«
»Woher denn?«
»Nun, wir sind doch bisher immer im Gebirge marschiert.«
Das stimmte allerdings. Aber richtige Klettertouren hatte man dabei nicht gemacht. Hatte das Auge des jungen Italieners dabei schon genug beobachtet, um aus Schritt und Tritt und Körperhaltung nur auf steilem Wege gleich den geübten Kletterer zu erkennen? Oberst Eisenfaust, obgleich er auch ein scharfes Auge und Erfahrung besaß, hatte solche Unterscheidungen bei seiner Truppe noch nicht gemacht.
»Wohlan, dann suche Dir diese Leute aus!«
Sie konnten gleich aufgerufen werden, der kleine Italiener hatte sogar schon ihre Namen im Kopfe.
Sie begaben sich in den Schlafsaal.
»Du nimmst mich doch auch mit, Kamerad?«, raunte unterwegs der neugebackene Korporal seinem kleinen Gefährten zu.
»Na sicher!«, lachte dieser. »Nun aber geh erst einmal in die Küche, und wenn deren Feuerherd schon lange nicht mehr geraucht hat, so wird in dem Kamin doch noch Ruß genug sein. Schaufle einen kleinen Sack voll ein.
»Wozu das?«
»Ich will mit dem Ruß Deinen neugierigen Mund stopfen — hast Du nicht gehört, dass ich jetzt Dein Vorgesetzter bin?!«, wollte sich der Kleine herrisch zeigen, aber es wurde nur ein Lachen oder doch Kichern daraus.
»Ah, ich weiß schon!«
»Na, dann weißt Du auch, dass Du dabei weder Deine Hände noch Dein schönes Antlitz noch Deine Uniform in Acht zu nehmen brauchst.«
Als Hendrick mit dem Sack voll Ruß kam, hatte Giuseppe seine zweiundvierzig Leute — denn Hendrick war schon mit zugezählt gewesen — aufgesucht, sie mit Namen gerufen, jetzt instruierte er sie, um was es sich handelte, und gab genaue Verhaltungsmaßregeln.
Wir brauchen sie hier nicht zu wiederholen, wir werden die Ausführung und den Erfolg sehen. Der Oberst aber staunte noch manches Mal. Dann ergriff er das Wort und stellte Giuseppe als bevollmächtigten Offizier über diese Expedition.
Hierauf wurden die Uniformen mit Ruß eingerieben. Ledergelb war sehr praktisch in Prärie und Wald, gerade in diesem Gebirge fiel es auf, weil der Boden meistenteils aus schwarzem Basalt bestand.
Die Hände und auch das Gesicht wurden bei dieser Manipulation ganz allein geschwärzt.
Dann wurden die Gewehre an den Riemen auf den Rücken gehangen und der Abstieg begann.
Eine Klettertour kann man eigentlich überhaupt nicht schildern, oder man müsste jeden Stein beschreiben, auf den der Fuß gesetzt wird.
Als Oberst Eisenfaust an dem Abgrund stand und in die pechschwarze Nacht unter sich hinabblickte, bezweifelte er, dass hier ein Abstieg von so vielen Männern möglich sei, wenn es richtig war, wie es ihm der Italiener geschildert hatte. Und hätte er selbst am Tage den Abstieg unternommen, so wäre ihm dieser bei seiner Körpergewandtheit wohl geglückt, aber er hätte erst recht bezweifelt, dass so etwas in stockfinsterer Nacht möglich gewesen sei. Und dennoch gelang es.
Als erster ließ sich Giuseppe hinab, ein leises Zischen unten, und Hendrick folgte nach, sofort, als er auf dem Grate stand, die eine Hand ausstreckend, die gleich von Giuseppe mit eisernem Griffe gefasst wurde, so nahm Hendrick den dritten in Empfang, dieser den vierten, und so ging das immer weiter, und dabei wurde die Menschenschlange von dem führenden Kopfe immer fortgezogen. Wenn drei oder nur zwei Männer nebeneinander einmal gestürzt wären, es hätte die schrecklichsten Folgen gehabt, die ganze Menschenreihe wäre hinabgesaust. Aber bei Einzelnen schadete es nicht, und oft genug schwebten mehr als zehn frei in der Luft — nur dass diese eben niemals hintereinander postiert sein durften.
Fast eine halbe Stunde ging dieses waghalsige Spiel um Tod und Leben fort, dann war die Talsohle erreicht. Hier war ebenfalls kaum die Hand dicht vor den Augen zu sehen. Nur die Augen des führenden Italieners sahen noch weiter. Immer noch Hand in Hand, wurde die ganze Kette durch Wald und Busch gezogen, durch einen Gebirgsbach und weiter durch Unterholz.
Hier und da flackerte ein Feuer auf, es wurde in weitem Bogen umgangen.
»Wir sind am Ziel, hier ist der Aufstieg zum Barbelinos«, hauchte Giuseppe seinem Kameraden zu.
Hendrick hatte keine Ahnung, dass er nur die Hand auszustrecken brauchte, um die nackte Felswand zu fühlen. Es war einfach alles schwarz um ihn herum. So sah er auch alles andere nicht, und wir wollen nur mit seinen Augen sehen.
»Wer da?«, erklang da eine Stimme auf Spanisch.
»Leutnant Lopez!«, erwiderte sein Kamerad mit tiefer Stimme.
»Parole!«
»Mexiko.«
Das wäre ein sehr einfaches Losungswort gewesen — so einfach, dass es wohl niemand erraten hätte. Aber es ging auch noch weiter.
»— triumphiert über —?«, fuhr der Wachtposten fort.
»seine Feinde«, hätte wohl ein jeder auf gut Glück geraten.
»— überhaupt«, ergänzte aber der falsche Leutnant.
»Passiert!«
Ja, der maskierte Feind durfte passieren. Aber auch der mexikanische Soldat passierte etwas — eine Grenze — nämlich die Grenze, welche zwischen Leben und Tod gezogen ist.
Ein Röcheln in der Finsternis, kaum vernehmbar — und doch wurde es eben noch von Hendricks Ohr gehört — und er wusste genug!
»He, Leutnant«, erklang da eine andere Stimme in der Nacht.
Und gleich darauf in dieser finsteren Nacht wieder so ein sonderbares Röcheln.
Den riesenhaften Mann überlief es eiskalt. Und er hatte doch schon einige Proben seiner Kaltblütigkeit in jeder Todesgefahr gegeben.
Dass der knabenhafte Italiener so sattelfest auf dem Kriegspfade war, auf dem Schleichgange sein Bowiemesser so zu gebrauchen wusste, darüber wunderte sich Hendrick übrigens nicht.
Giuseppe hatte ihm unterdessen noch mehr von seiner Vergangenheit erzählt, nicht nur, dass er ein spartanisch erzogener, in allen ritterlichen Künsten ausgebildeter Calzane war.
Auf der Farm seines Pflegevaters hatte er nicht viel gearbeitet. In Arizona hat ein großer Stamm der Apachen ein Reservat, ein Jagdasyl, in dem sie sich aber auch nach Herzenslust gegenseitig den Skalp abziehen können. Nur die Grenze dürfen sie nicht überschreiten und denjenigen mit keinem Finger berühren, der sich mit einer Bescheinigung der Regierung bei ihrem Häuptling vorstellt. Sonst können die Indianer in diesen Reservaten, von denen das größte und bekannteste das sogenannte Indianerterritorium ist, frei treiben, was ihnen beliebt, und das Bleichgesicht, das ohne Erlaubnisschein die Grenze überschreitet, ist nicht geschützt, sein Tod, seine Ermordung, wird nicht gesühnt.
Und bei diesen benachbarten Apachen hatte sich der Junge wohl immer aufgehalten, er war mit ihnen auf dem Kriegspfade gewesen. Da hatte er so etwas wohl lernen können. Alles Weitere war aufs Genaueste ausgemacht worden, die Folgenden brauchten keinen zögernden Schritt zu tun.
Giuseppe ging als mexikanischer Leutnant voraus, Hendrick folgte mit der Hälfte der Leute, der Rest blieb zurück.
Nur selten war es ein wirklicher, natürlicher Weg, meist mussten Leitern erklommen werden, von Absatz zu Absatz.
Auf diesen Absätzen stand hin und wieder eine Petroleumlampe, nur als Wegweiser dienend, und daneben lag oftmals — ein toter Mexikaner, nämlich tödlich getroffen von dem Bowiemesser des weit vorausgehenden Italieners. Wenn Hendrick hinkam, war die Sache immer schon längst abgetan, und kein Laut wurde zum Verräter.

Und immer wieder der riesenhafte Korporal von heimlichem Grauen geschüttelt. Nicht wegen dieser Leichen, wegen der Abfertigung dieser Schildwachen. Das war eben der Krieg!
Aber dass dieser knabenhafte Italiener — nein, das hatte er diesem Jünglinge nimmer zugetraut!
Zuletzt kam ein großer Aufzug, ein Seil ging über eine Winde, die aber oben stand.
Als Hendrick mit drei anderen in einem Korbe oben anlangte, waren die beiden Soldaten, welche die Winde zu bedienen hatten, ebenfalls schon abgetan. In aller Stille. Und eben diese Stille war das Fürchterliche dabei. Freilich, wenn man einmal bis hierher gelangt war, brauchte auch kein Losungswort mehr gegeben zu werden, der vermeintliche Offizier wurde auch sonst nicht von Soldaten und Unteroffizieren angesprochen.
Die anderen waren nachgefolgt, alle standen auf dem stark bewaldeten Plateau. Zwischen den Bäumen schimmerte ein größeres Feuer, darum saßen eine Menge Soldaten, essend, trinkend, rauchend. Daneben erblickte man auch einige Geschütze, also musste sich das Lagerfeuer ziemlich nahe am Rande des Plateaus befinden.
Ohne ein Wort zu sprechen, teilte Giuseppe die Heraufgekommenen noch einmal ab, sie nur mit der Hand berührend. Es war ja alles schon abgemacht.
Nur zu allerletzt erfolgte noch eine mündliche Instruktion, im leisesten Tone gehaucht.
»Und nun mir nach! Also nur mit dem Messer! Nur im allerhöchsten Notfalle einen Schuss! Ich hoffe aber, dass Ihr Euch lieber erwürgen lasst, ehe ihr nach der Pistole greift, wenn ihr mit dem Messer zu spät kommt! Los! Denkt, Ihr seid Panther! Vorwärts!«
Und wie die Panther schlichen die ehemaligen Tramps vorwärts. Ja, sie konnten schleichen, diese Tramps!
Es fiel kein einziger Schuss, und selten erklang mehr als ein Todesröcheln oder ein unterdrückter letzter Schrei.
An einem mit Säcken verbarrikadierten Fenster stand Oberst Eisenfaust und spähte mit dem Fernrohr durch einen kleinen Spalt nach dem gegenüberliegenden Berge.
Drei Stunden waren nun schon vergangen. Es lässt sich denken, was das für drei Stunden für den Obersten gewesen waren!
Kein Zeichen durfte ihm gegeben werden. Jeder Schuss, jeder Feuerschein hätte die unten liegenden Mexikaner stutzig machen können.
War der Überfall geglückt, oder hatten die vierundvierzig Mann schon hier beim Abstieg von dieser Festung ihren Tod gefunden?
Beides wurde dadurch ausgedrückt, dass es drüben so ruhig war.
Nur konnten sie nicht dort drüben mit dem Feinde handgemein und zurückgeschlagen worden sein, dieses Lärmen hätte man hier hören müssen.
Nun, die drei Stunden waren ja jetzt überstanden. Der Mond ging auf, die nächsten Minuten mussten die Entscheidung bringen.
Kaum war die Festung vom vollen Mondlicht übergossen, als dort oben die Kanonen zu donnern anfingen.
Wer feuerte sie ab?
Jedenfalls wurde herzlich schlecht gezielt. Hoch oben an der Felswand krepierten die Granaten.
Und das verriet deutlich, wer sie richtete — Oberst Eisenfaust konnte einen jauchzenden Freudenschrei nicht unterdrücken.
Nach einiger Zeit eine Pause in dem Bombardement, und dann flammte es dort drüben auf der Höhe blutigrot auf — ein Holzstapel war angebrannt worden, das verabredete Zeichen, dass es jetzt Zeit war, dort die Belagerer hinter der Felsenecke zu beschießen, weil sich dort unten im Tale der Transportzug näherte.
Und wieder begannen die Kanonen zu brüllen. Aber keine einzige Granate schlug mehr hier gegen die Felswand.
Dafür fing es dort hinter der Felsenecke an zu brüllen und zu prasseln — von Menschenstimmen und krepierenden Bomben und Schrapnells.
»Fertig zum Sturm!! Hip hip hip hurra!!«
Zweihundert Tramps waren es, die mit gefälltem Bajonett aus den Felsenkammern hervorstürmten, an der Spitze Oberst Eisenfaust.
Ehe sie die Felsenecke erreicht hatten, verstummte drüben der Kanonendonner. Die Kanonen konnten doch nicht ihre eigenen Kameraden bombardieren.
Aber es hatte genügt. Den Fliehenden konnten nur noch Gewehrsalven nachgesandt werden, einzuholen waren sie nicht mehr.
Hätte es nicht anders arrangiert werden sollen? Jetzt konnten sich die Fliehenden, mehrere hundert Mann, mit der Begleitmannschaft des Maultiertransportes vereinigen, der dort unten durch das enge Tal zog.
Da aber krachten auch von dort aus Gewehrsalven entgegen — der ganze Maultierzug, mit einer Million Patronen beladen, war bereits von Giuseppe und seinen Leuten genommen worden!

Miss Morgan hatte dem Japaner einen kräftigen Stoß in den
Rücken gegeben, sodass er kopfüber in die Tiefe stürzte.
Das Kriegsbild hatte sich total geändert. Die Kunde, dass hinter ihrem Rücken der unter unsäglichen Mühen befestigte Barbelinos in die Hände der Feinde gefallen war und der ganze Patronenvorrat dazu, hatte auf die siegreich vorgerückten Mexikaner wie ein lähmender Schlag gewirkt.
Sie fühlten sich eingeschlossen, und sie hätten auch gar keinen ernstlichen Widerstand leisten können, denn es fehlte ihnen eben an Patronen.
Nur dem Umstand, dass sie hier jeden Fußbreit des Geländes kannten, hatten sie es zu danken, dass sie durch Seitenschluchten und auf Schleichwegen wieder nach rückwärts entkommen konnten.
Aber allen Proviant, alle Gebirgsgeschütze und alles andere, was sie mit sich geführt, hatten sie im Stich lassen müssen, und jetzt waren ihnen die Bundestruppen so dicht auf den Fersen, dass sie nicht mehr Zeit fanden, dem Feinde wieder Fallen zu stellen.
Und wem hatte man diese Umwälzung zu verdanken? Das wusste man recht wohl. An allen Lagerfeuern wurde das Lied von dem kleinen Italiener gesungen, alle Zeitungen berichteten von ihm, flossen über von seinen Lobeserhebungen.
Aber für diesen kleinen Italiener selbst hatte das hier auf dem Kriegsschauplatze gar keine Folgen gehabt und ebenso wenig für Oberst Eisenfaust und seine ganze Lumpengarde, die jetzt wohl eher den Namen Elitegarde verdient hätte.
Oberst Eisenfaust hatte nur einen kleinen Teil seiner Leute zurückgelassen, um die beiden Festungen zu besetzen, mit den anderen war er dem Feinde in den Rücken gefallen. Dieser war also auf beiden Seiten entwichen, das war nicht zu vermeiden gewesen. In der Mitte der Strecke war Oberst Eisenfaust mit General Toler, dem Höchstkommandierenden auf dieser Operationsbasis, zusammengetroffen. Er hatte ihm Bericht abgestattet, ihm den knabenhaften Helden des Tages, wenn nicht des ganzen Krieges, vorgestellt.
Es war doch ganz selbstverständlich, dass die ehemalige Lumpen- und jetzige Elitegarde nun auch als erste den fliehenden Feind verfolgte, und da der Oberst den kleinen Helden nur zum Leutnant hatte ernennen können, so musste ihn der General jetzt sofort zum Kapitän befördern.
»Schön«, hatte General Toler gesagt, nachdem er den mit militärischer Kürze vorgetragenen Bericht teilnahmslos wie eine ganz gleichgültige Sache angehört, »so besetzen Sie mit Ihrer Lumpengarde nun wieder die Festung Chilinque.«
Und er hatte sich weggewandt, war nicht mehr zu sprechen gewesen.
Oberst Eisenfaust musste doch wie vom Donner gerührt sein. Wenn ihm auch davon nichts anzumerken gewesen war.
»Herr General, ich —«
»Was wollen Sie noch?«, hatte sich der Höchstkommandierende nur einmal noch umgewandt. »Haben Sie meinen Befehl nicht verstanden? Sie besetzen mit Ihrer Truppe wieder die Festung Chilinque.«
Es war sein letztes Wort gewesen. Es hätte auch nur noch gefehlt, dass der General dem Oberst vorwarf, er habe eine schwere Insubordination begangen, dass er die ihm anvertraute Festung verlassen und den befestigten Berg und den Munitionstransport genommen habe.
Oberst Kettelhorst war niemals mit General Toler in persönliche Differenzen gekommen, er wusste nicht, was dieser Mann gegen ihn haben könne. Anderseits war es ja klar genug. Eben Eifersucht, Neid. Oberst Kettelhorst hatte sich schon auf den Philippinen einen glänzenden Namen gemacht, wenigstens durch eigene Bravour in verschiedenen Gefechten, während General Toler schon dort immer im Hintergrund geblieben war — er hatte diesen Oberst von vornherein kalt stellen wollen, jetzt nach diesem riesigen Erfolge erst recht.
Vielleicht hoffte er auch, dass der Oberst jetzt nicht gehorchen, auf eigene Faust vorgehen würde. So etwas ist ja in Amerika sehr leicht möglich, ist schon oft passiert, und dann entscheidet immer der letzte Erfolg, der lässt dann alles vergessen. So weit hätte es aber General Toler nicht kommen lassen. Er hätte den meuterischen Oberst sofort festgenommen und ihn vor ein Kriegsgericht gestellt, hätte ihn einfach erschießen lassen. Dann hätte er die Trampgarde seinen eigenen Truppen eingereiht oder, wenn auch diese ungehorsam gewesen wäre, also gemeutert hätte, sie einfach zusammenkartätschen lassen.
Das hätte freilich der General selbst später schwer büßen müssen, er hätte doch die ganze Nation gegen sich gehabt, vorläufig aber wurde er vollkommen von maßlosester Eifersucht beherrscht, die nicht an Folgen denkt.
Aber diesen Gefallen tat ihm Oberst Eisenfaust nun nicht. Mochte es in ihm auch noch so kochen, äußerlich war ihm davon nichts anzumerken — er gehorchte.
So zog er also mit seiner siegreichen Lumpengarde wieder in die Festung ein. Alles war wieder so wie früher, jetzt konnten die Tramps auch wieder Feuerholz schlagen und sich eine Suppe kochen.
Aber einiges Neue im Festungsdienst kam doch noch hinzu. Nach dem Kriegsreglement stand der Offizier, der selbst eine Truppe geworben, nur unter dem direkten Befehl des Höchstkommandierenden, er konnte von diesem keinen anderen Vorgesetzten bekommen, kein anderer Offizier und kein Adjutant durfte ihm beigesellt werden. Aber zu kujonieren wusste ihn der General doch noch.
Gleich am ersten Tage hatte General Toler die Festung inspiziert. Bei dem Bombardement waren gar viele Proviantsäcke zerschossen worden, man hatte dann die herabgefallenen Linsen und Erbsen und Bohnen in andere Säcke geschaufelt, natürlich ohne sie erst wieder zu sortieren. Übrigens wimmelten alle diese Hülsenfrüchte von Unkrautsamen.
»Das ist ja eine heillose Wirtschaft hier«, hatte der General gesagt. »Nun, Sie haben ja Leute genug, und diese haben Zeit genug. Sie werden alle Hülsenfrüchte wieder sortieren und außerdem das Unkraut herauslesen lassen. Verstanden?«
»Zu Befehl, Herr General.«
Und so saßen nun die siegreichen Helden in den Felsenkammern und bei schönem Wetter auf dem Festungshofe und hatten vor sich große Haufen von bunt durcheinander gewürfelten Hülsenfrüchten, schoben die Bohnen vor sich und die Linsen nach links und die Erbsen nach rechts, während andere nur den Unkrautsamen herauslasen. Und wenn der Krieg ein Jahr lang währte, so würden die dreihundert Mann hiermit immer noch nicht fertig sein, so viele solcher Säcke waren hier aufgestapelt.
Ja, Oberst Eisenfaust gehorchte, wie es in ihm auch kochen mochte.
Aber fast erstaunlich war es zu nennen, dass die dreihundert Tramps nicht ihre Hülsenfrüchte im Stich ließen und auf eigene Faust in den Krieg marschierten.
Doch nein, es war nicht erstaunlich.
Denn nur von einem einzigen Manne hätte hierzu die Aufforderung ergehen können, von Leutnant Giuseppe.
Aber der kleine Italiener, der eigentliche Held, zeigte keine Neigung zur Meuterei, er stellte die Leute beim Sortieren an, ging selbst mit gutem Beispiele voran, und zwar wusste er dies in einer Weise zu tun, dass der ganzen Sache jeder üble Beigeschmack genommen wurde.
Kurz, gerade diese ehemaligen Vagabunden wussten in diese friedliche Beschäftigung mitten im Kriege Humor hineinzubringen. Wenn ein Tisch mit drei großen Haufen sortierten Bohnen, Erbsen und Linsen bedeckt war, so kam sicher jemand gestolpert, der »aus Versehen« den ganzen Tisch umwarf, und dann fing die Geschichte eben wieder von vorn an, und von früh bis spät hallten der Festungshof und die Felsenkammern wider von fröhlichem Lachen.
* Oberst Eisenfaust saß am Schreibtische, hatte den Federhalter zwischen die künstlichen Finger geklemmt und beendete soeben den achten großen Bogen Kanzleipapier, immer nur halbseitig beschrieben.
Es war eine Beschwerde an das Kriegsministerium in Washington, ein Bericht über seinen Vorgesetzten, den General Toler, wie ihn dieser behandelt hatte und noch täglich in jeder Weise zu kujonieren suchte.
Dieses »Kujonieren« bestand zum Beispiel auch darin, dass ihm der General keine Nachrichten vom Kriegsschauplatz zukommen ließ. Hierauf hatte der Kommandant dieser Festung wohl ein gutes Anrecht. Ja, der General enthielt ihm sogar Zeitungen vor. Briefsendungen musste er ihm natürlich ausliefern, und selbstverständlich hätte dies auch für an ihn adressierte Zeitungen gegolten. Aber als der Oberst einmal eine Ordonnanz hinabgeschickt hatte, um die letzten Zeitungen bittend, hatte der General zurücksagen lassen: es gäbe keine Zeitungen; der Oberst solle sich lieber um seinen ihm anvertrauten Proviant kümmern, dass er den nicht so versauen lasse, das sei besser als Zeitungslesen; und wenn der Oberst noch einmal wegen solch einer Lappalie eine Ordonnanz schicke, würde er ihn zur Meldung bringen.
So etwas nennt man doch wohl kujonieren. Und das Vorenthalten seiner Zeitung ist nun das letzte, was der Amerikaner vertragen kann. Das gehört mit zum täglichen Brot.
Dies alles war ganz ausführlich in der Beschwerde wiedergegeben.
Na, das konnte ja gut werden!
Denn diese Beschwerde musste doch ihren vorschriftsmäßigen Weg nehmen. Sie ging erst an den General selbst, wurde von diesem gelesen, er selbst musste sie weiter befördern!
Nachdem der Oberst das Schriftstück kuvertiert, adressiert und gesiegelt hatte, rief er die Ordonnanz.
Aus dem Nebenraume trat Korporal Hendrick ein, der heute Ordonnanzdienst hatte.
»Tragen Sie dies hinab. An die Geschäftsstelle des Generalstabes oder zu Händen des Herrn Generals selbst. Hier das ausgefüllte Quittungsformular.«
Der Korporal steckte das große Kuvert in die Ordonnanztasche, musste als amerikanischer Soldat, auch wenn er Gemeiner gewesen wäre, für den erhaltenen Befehl salutieren und marschierte ab.
Weit hatte er nicht. Nur den steilen Saumpfad hinab, eine Viertelstunde Weges. Dort unten war jetzt das Hauptquartier des Generalstabes.
General Toler saß in seinem komfortablen Zelte in Gesellschaft einer Dame.
Es trieben sich in diesem Lager Schlachtenbummler genug herum, nicht nur Zeitungsberichterstatter, und auch einige Damen. Meist wollten sie die Krankenpflegerin spielen, sie gaben wenigstens diesen Vorwand an.
Diese Dame hier war erst vor zwei Stunden eingetroffen, in Begleitung mehrerer Diener, nannte sich Miss Cecile Hobson, war unten sehr kurz geschürzt und im Gegensatz dazu oben ganz dicht verschleiert.
General Toler war noch gar nicht so alt und stand in dem Rufe, ein großer Frauenverehrer zu sein. Alle diese Schlachtenbummler mussten persönlich zu ihm kommen, wenigstens um den von ihm unterschriebenen Erlaubnisschein, sich hier im Lager und überhaupt auf dem Kriegsschauplatze aufhalten zu dürfen, selbst abzuholen. Für die anderen Damen hatte er immer nur einen flüchtigen Blick gehabt, dann war er fertig mit ihnen gewesen. Die waren eben alle danach beschaffen.
Nur mit der Miss Cecile Hobson hatte er eine Ausnahme gemacht. Vor zwei Stunden hatte sie sich ihm vorgestellt und war noch nicht wieder aus seinem Zelte herausgekommen, sie hatte ununterbrochen erzählen müssen, einen so langen, ermüdenden Ritt sie auch schon hinter sich hatte.
Das heißt, für den General war es nicht Miss Cecile Hobson. Und ausführlich musste sie ihm erzählen, wie sie ihre Freiheit wiedererlangt und was sie alles Wunderbares während ihrer Gefangenschaft erlebt hatte.
Um was für eine Gefangenschaft handelte es sich aber wohl, aus der sie geflohen oder befreit worden war?
Nun, das wusste jetzt schon längst die ganze Welt oder doch ganz Amerika.
Wir werden es später ausführlich erzählen.
Erwähnt sei jetzt nur, dass die dort oben auf Fort Chilinque von alledem keine Ahnung hatten, eben weil sie keine Zeitungen bekamen und auch sonst mit diesem Lager, mit allen anderen Soldaten, in absolut keine Berührung kamen.
»Ja, Herr General«, lachte jetzt die Dame, die auch während des Essens und Trinkens ihren Schleier nicht abgenommen hatte, »darf ich nun nicht auch endlich einmal zu Worte kommen?«
»Ich dächte, gerade Sie wären es gewesen, die bisher ununterbrochen geredet hat«, lachte der General zurück.
»Ich meine, dass ich endlich meine Bitte vorbringen kann.«
»Eine Bitte? Ich stehe ganz zu Ihren Befehlen, Miss.«
»Sie wissen doch, was mich hierher geführt hat.«
»Nein, wie soll ich das wissen?«
»Nun, um das Wunder der Welt persönlich kennen zu lernen.«
»Das Wunder der Welt?«, erheuchelte der General noch immer staunendes Unwissen, obgleich er schon längst alles wusste.
»Die neueste Sensation des Tages, den tollkühnen Leutnant, der nur einen Vornamen hat.«
Ja, General Toler hatte es schon immer gewusst, was diese Dame hier wollte, weshalb sie tagelang geritten war, und nun, da er es hörte, ärgerte er sich nur umso mehr, er durfte aber seinen heimlichen Grimm doch nicht merken lassen.
In demselben Augenblicke stieg aber in ihm auch eine Idee auf, wie er seinen Todfeind dort oben, den ihm der Neid gegeben, wieder einmal demütigen oder ihn zu einer Insubordination verleiten könnte.
»Hm, ja — gewiss, Miss — Sie wollen dem einen Besuch abstatten?«
»Das ist mein sehnlichster Wunsch, diesen Leutnant Giuseppe kennen zu lernen. Werden Sie mich nicht begleiten, Herr General.«
»Hm, ja — gewiss — ich fürchte nur, Sie werden oben auf dem Fort nicht angenommen —«
»Warum denn nicht? Haben Sie denn als Höchstkommandierender hierüber nicht zu bestimmen?«
»Sicherlich. Aber, Gnädigste — Sie wissen doch — wir befinden uns im Kriege — das Fort ist für Fremde unzugänglich — das Einfachste ist doch, ich lasse den Leutnant hierher kommen.«
Hiermit war auch die Dame sofort einverstanden, zumal sie hörte, dass es bis dort oben hinauf ein ganz böser Weg sei.
Also General Toler nahm einen Bogen Papier, er erschien ihm zu groß, riss ihn in der Mitte unregelmäßig durch, schrieb zwei Zeilen darauf: einen möglichst brüsken Befehl an Oberst Kettelhorst, er solle ihm sofort den Leutnant Giuseppe Dingsda herunterschicken.
General Toler war überzeugt, dass Oberst Eisenfaust diesen Befehl ignorieren würde. Desto besser, dann kam der Leutnant nicht, gegen den der noch jugendliche General schon wieder eine unbändige Eifersucht im Herzen fühlte, diesmal aber noch aus einem anderen Grunde.
Allerdings war es überhaupt sehr die Frage, ob der Oberst, der dem General gegenüber eine ganz besondere Stellung einnahm, diesem Befehl nachzukommen hatte. Darüber hätte erst eine spätere Untersuchung von vorgesetzter Seite aus entscheiden müssen. Mindestens musste die Aufforderung in ganz anderem Tone ergehen. Als Kommandant der Festung war der Oberst dem General ganz gleichberechtigt. Immerhin konnte ihm bei einer Weigerung in geschickter Weise noch ein Strick gedreht werden.
Kam aber der Leutnant wirklich, so hatte sich der Oberst unsäglich gedemütigt, dann konnte er auch weiter so behandelt werden, er hatte sich selbst degradiert.
Einige Fliegen auf einen Schlag wurden also auf jeden Fall geklappt.
Auch hier wurde kuvertiert, adressiert, gesiegelt und die Ordonnanz gerufen.
»Wie lange dauert es, bis der Leutnant hier sein kann?«
»O, höchstens zwanzig Minuten.«
Das war zu wenig, auf eine halbe Stunde musste man sich gefasst machen.
Inzwischen wurde die Unterhaltung fortgesetzt. Jetzt aber war es der General, der immer sprach, von der Dame durch Fragen dazu aufgefordert. Sie interessierte sich sehr für die Kriegslage, noch mehr für die zukünftigen Kriegspläne des Generals. Dieser musste sehr, sehr großes Vertrauen zu der Dame haben, dass er ihr so viel offenbarte.
So waren fünfundzwanzig Minuten vergangen, als sein diensttuender Adjutant eintrat.
»Eine Ordonnanz von Oberst Kettelhorst!«
Der General glaubte natürlich, es sei entweder der Leutnant selbst oder ein Bote, der ihm eine absagende Antwort auf seinen Befehl brachte.
»Von Oberst Kesselwurst? Herein mit ihm!«
Korporal Hendrick trat ein, zog das große Kuvert und den Quittungsschein aus der Tasche, hielt beides hin, ohne ein Wort zu sagen.
»Was soll das?«
Der General nahm misstrauisch den umfangreichen dicken Brief, erbrach ihn, schlug die Bogen auseinander, überflog sie. Ein flüchtiges Überfliegen genügte ja auch vollkommen, um den Inhalt der Hauptsache nach kennen zu lernen.
Und immer dunkler stieg ihm das Blut zu Kopfe.
»Un — er — hört!!«, stieß er immer wieder hervor, und dabei ballten seine zitternden Hände die Papierbogen zu einem unförmlichen Knäuel zusammen.
Eine halbe Minute hatte dieses Überfliegen gedauert, und so lange hatte die Dame hinter ihrem Schleier den stramm stehenden Korporal immer unverwandt angestarrt.
»Ich bitte um Quittung!«, sagte dieser jetzt.
Es waren also die ersten Worte, die er sprach, und sie wirkten auf die verschleierte Dame wie ein elektrischer Schlag.
»Graf Arno von Felsmark, fasst den Hochverräter!!«, schrie sie, gleichzeitig einen Revolver aus der Tasche reißend und ihn auf den Korporal anschlagend.
Er war es. Der geneigte Leser hat es natürlich schon längst gewusst. Und durch sein ganzes Gebaren gab er es auch gleich zu.
Ein plötzliches Zittern lief durch seinen athletischen Körper, wie er mit zum Tode erschrockenem, entsetztem Gesicht jetzt seinerseits die verschleierte Dame anstarrte.
»Miss — Marwood — Morgan!!«, hauchte er.
Sie, deren Augen gleichzeitig von Liebe und Hass geschärft waren — und wahrscheinlich auch von beständiger Todesangst — hatte den Korporal sofort erkannt, hatte es nur nicht gleich glauben wollen, den Mann, um den sich ihre ganze Gedankenwelt ausschließlich drehte, hier wiederzufinden, aber der Klang seiner Stimme hatte bei ihr den letzten Zweifel beseitigt — und an ihrer Stimme hatte auch er sie sofort erkannt, trotz des Schleiers. Diese Stimme konnte nur einer einzigen Person angehören.
»Fasst den Hochverräter!!!«
Es war gar kein Grund zu dieser furchtbaren Beschuldigung vorhanden. Wohl aber war es der Gatte einer Hochverräterin, der entsprungenen Zuchthäuslerin und jetzt auch noch wegen eines Mordes steckbrieflich Verfolgten, von allem anderen, was die rote Gräfin unterdessen sonst noch auf ihr Kerbholz bekommen hatte, nicht zu sprechen.
Offiziere stürzten herein, Soldaten, es standen ja vor dem Generalszelte genug Posten.

»Fasst den Hochverräter, es ist der Graf Arno von Felsmark, der Gatte der roten Atalanta!!!«
Besonders das letzte genügte vollkommen. Wer kannte die rote Atalanta nicht und hätte nicht gewusst, was ihr Mann für ein wertvolles Objekt war, ob nun Verräter oder nicht.
Die Offiziere und Soldaten stürzten sich auf den Korporal, Stricke waren vorhanden und einige der Männer verstanden sich aufs binden. Sie hatten auch sehr leichte Arbeit.
Arno dachte an gar keinen Widerstand, vollkommen fassungslos stand er da, an allen Gliedern zitternd, das verschleierte Weib immer noch wie ein Gespenst anstierend.
»Die — Miss — Marwood — Morgan!!«, ächzte er.
Er wurde hinausgeschleppt, zur Hintertür des Zeltes.
Noch stand der General da, die zusammengeknäulten Papierbogen in der Hand, das Ganze noch nicht richtig fassen könnend.
»Der Graf von Felsmark, der Gatte der roten Atalanta, sieh da, sieh da, wer hätte das gedacht!«, konnte er nur mit wenig geistreichem Gesichte zweimal sagen.
Und Miss Morgan keuchte hinter ihrem Schleier ganz entsetzlich, auch noch nicht wissend, ob sie folgen sollte oder nicht, in der Hand noch ihren Revolver.
Da ward der vordere Zeltvorhang zurückgeschlagen, wieder trat ein meldender Offizier ein, der von den Vorgängen, die sich soeben hier abgespielt hatten, wohl nichts wusste.
»Leutnant Giuseppe vom Fort Chilinque!«
Gleich hinter ihm trat der junge Italiener ein. Und nun spielte sich wiederum eine Szene ab, aber eine ganz andere.
Ein einziger Blick auf das braune, etwas rötliche Gesicht des jungen Italieners — dieses Weib hatte ihn sofort erkannt. Es hing ja so eng zusammen mit dem soeben fortgeführten Grafen.
Zunächst aber war sie so gelähmt, dass sie ihren Revolver fallen ließ.
Und dieser junge Italiener brauchte nicht erst ihren Schleier zu heben, nicht erst ihre Stimme zu hören. Bei dem lag es gleich in der Atmosphäre, die von ihr ausging.
Weit beugte er den Kopf vor, den ganzen Körper.
»Miss — Marwood — Morgan?!«, erklang es langsam mit etwas fragendem Tone.
Da kam Leben in die Erstarrte.
»Die rote Atalanta, Hilfe, rettet mich!!!«
So gellte es schrillend, und rasch drehte sie sich um und schoss zur hinteren Zelttür hinaus.
Zwischen ihr und dem Leutnant hatte ein Tisch gestanden — und im nächsten Augenblick setzte der Leutnant mit gleichen Füßen über diesen Tisch weg und ihr nach.
»Die rote Atalanta, rettet mich, schützt mich vor der Indianerin, sie mordet mich!!«, heulte draußen das Weib, über den freien Platz mehr fliegend als fliehend.
Atalanta, wie wir den Leutnant nun gleich nennen wollen, nahm die Verfolgung nicht sofort auf.
Sie sah, wie dort der Korporal fortgeführt wurde, ihr Gatte und ihr guter Kamerad.
Das ging auch nicht in den Kopf dieser Indianerin sofort hinein, ihr Fuß stockte.
Wohin zuerst? Den befreien oder die dort einholen?
»Arno, mein Arno!!«
Und sie stürmte dem Gatten nach, um ihn zu befreien.
Da aber änderte auch diese Indianerin einmal ihren schon gefassten Entschluss.
Schon nach wenigen Sprüngen blieb sie wieder stehen, blickte zurück nach der fliehenden Todfeindin, deren Hiersein sie sich so gar nicht erklären konnte.
»Die rote Atalanta, rettet mich vor der Indianerin, vor dieser roten Teufelin!!«, zeterte diese immer wieder.
Da drehte die Indianerin in Leutnantsuniform wieder um und setzte jener doch noch nach. Von der musste sie erst Aufklärung haben, wie sie aus ihrer Gefangenschaft am Sklavensee entkommen war, das dünkte ihr jetzt die Hauptsache, davon hing noch vieles andere ab.
Miss Morgan hätte sich recht gut vor der Indianerin schützen können. Denn da standen genug Soldaten herum, auch in größeren Gruppen, hinter die hätte sie sich doch nur zu flüchten brauchen, die hatten scharfe Patronen in der Tasche, und da gab es genug, welche die Indianerin sofort niedergeknallt hätten, von der sie wussten, dass auf ihren Tod noch immer eine Prämie von einer Million Dollars stand.
Aber das Weib war einfach sinnlos vor Todesangst. Sie jagte mit ihrem hochgeschürzten Kleide über den niedergestampften Rasen, dass ihre Füße kaum den Boden zu berühren schienen, und dabei hatte sie merkwürdigerweise immer die eine Hand auf ihre Stirn gelegt. Oder auch nicht so merkwürdig. Sie mochte dort schon wieder den glühenden Stempel brennen fühlen.
So jagte sie dahin, ihr frisiertes Haar hatte sich aufgelöst, flatterte lang nach, und nun die Hand auf der Stirn, immer gellend schreiend — ganz einer Wahnsinnigen gleichend.
Und wohin floh sie? Das war nun vollends Wahnsinn. Freilich konnte sie nicht wissen, wohin der Weg führte, den sie eingeschlagen hatte. Sie wollte wohl nur jene Felsenecke zwischen sich und ihre Verfolgerin bringen, um sich nur erst einmal unsichtbar zu machen, ungefähr so, wie der verfolgte Strauß, wenn er kein Entkommen mehr sieht, seinen Kopf im Sande verbirgt.
Und dort um die Felsenecke ging es gerade zu der Festung hinauf! Also sie floh direkt in die Höhle des Löwen. Das konnte sie aber nicht wissen und außerdem war sie eben sinnlos.
Durch das Zögern der Indianerin hatte sie ja einen ganz bedeutenden Vorsprung gewonnen. Aber mochte sie auch wie auf Flügeln fliehen, dieser schnellfüßigen Indianerin konnte sie nicht entgehen. Auf der Hälfte des Saumweges musste sie die Flüchtende eingeholt haben.
Aber es sollte noch ein Hindernis dazwischen kommen. Gerade als auch Atalanta um die Felsenecke bog, um welche Miss Morgan vor zehn Sekunden verschwunden war, kam hinter dieser ein Wachtmeister hervor, ein nicht sehr großer, aber ungemein dicker Mann.
Miss Morgan hatte ihn noch auf dem Wege passiert, war einfach an ihm vorbei gerannt, jetzt aber ging die Begegnung nicht so gut ab.
Die Indianerin in Leutnantsuniform rannte den Wachtmeister mit einer Wucht an, dass der dicke Mann gleich einen freien Salto mortale durch die Luft schlug, dann noch zwei Kegelpürze am Boden machte und darauf wimmernd liegen blieb, sich den Bauch haltend und reibend. Wir wollen gleich hinzufügen, dass ihm die Karambolage nichts weiter geschadet hatte, nur dass er sich noch einige Tage den Bauch rieb.
Aber auch die Indianerin war durch den wirklich furchtbaren Zusammenprall zu Boden geschleudert worden. Auch sie blieb einige Sekunden wie besinnungslos liegen, wahrscheinlich sogar wirklich besinnungslos.
Doch dann schnellte sie wie eine Feder wieder empor und setzte ihren Weg fort, als wenn nichts geschehen wäre.
Der Wachtmeister war nicht von dem Festungswege herab gekommen. Von dieser Felsenecke hier unten aus führten noch zwei andere Wege ab. Wohl aber hatte Miss Morgan den steilen Saumpfad benutzt, der am deutlichsten vor ihr lag, während es nach den anderen erst wieder um weitere Felsenecken ging.
Wieder hatte sie einige Sekunden Vorsprung bekommen, und der genügte, jetzt musste sie, auch wenn die Indianerin wie ein gehetzter Steinbock sprang, die Festung noch vor ihr erreichen.
Aber was machte das aus. Atalanta hatte einmal die Hand an den Griff der Browningpistole gelegt — zog sie aber nicht. Die rannte ja direkt in die Höhle des Löwen, dort oben konnte ihr die Todfeindin überhaupt nicht mehr entrinnen oder sie hätte sich den Felsen hinab stürzen müssen.
Oberst Eisenfaust trat gerade aus einer Felsentür, als er da über die herabgelassene Zugbrücke eine Dame angejagt kommen sah, so wild wie möglich, das schwarze Haar lang nachflatternd, ebenso den Schleier, der nicht mehr das schrecklich entstellte Gesicht verhüllte.
Und hinter ihr, aber noch auf dem steilen Wege, sein kleiner Leutnant.
»Die rote Atalanta — schützt mich vor der Indianerin, sie mordet mich!!!« So erklang es gellend, und die Fliehende rannte direkt auf den vor der Tür stehenden Obersten zu. Es gab noch andere Türen, aber diese war die nächste, der Zugbrücke direkt gegenüber, und vielleicht auch wollte die Fliehende jetzt Schutz hinter dem Rücken des Offiziers suchen.
Und da geschah etwas Merkwürdiges, wenigstens hätte es jeder aufmerksame Beobachter sehr merkwürdig gefunden.
Es sah nämlich nicht anders aus, als habe der Oberst nur auf die fliehende Dame gewartet, so trat er zur Seite, aber nur, um sie durchschlüpfen zu lassen, dann stellte er sich sofort wieder vor die Tür.
Und nun kam sein Leutnant angestürmt. Und dem streckte er seine eiserne Hand entgegen. Und ebenso eisern erklang es:
»Halt, Leutnant Giuseppe!! Stillgestanden!!«
Mit einem Ruck blieb der Angerufene denn auch dicht vor ihm stehen. Aber wie die Augen glühten!
»Vorbei, vorbei mit dem Leutnant Giuseppe. Ich bin die rote Atalanta, die indianische Gräfin von Felsmark, die Hochverräterin und entsprungene Zuchthäuslerin!!«
Wiederum merkwürdig, ganz merkwürdig, was die sich so Anschuldigende für eine Antwort bekam, und auch wieder so ganz ruhig und dennoch eisern gesprochen!
»A bah, Ihr seid der Leutnant Giuseppe!!«
»Nein, die Maskerade ist nun zu Ende, ich bin die rote Atalanta, die Ihr doch wohl kennt, und die dort drin ist meine Todfeindin —«
Mit diesen Worten wollte die Indianerin den Obersten beiseite schieben. Aber diesmal reichte ihre Kraft hierzu nicht ganz aus.
Der Oberst stand wie ein im Felsenboden wurzelnder Eichbaum. Und jetzt setzte er seine eiserne Hand gegen ihre Brust und drückte das starke Weib kraftvoll zurück.
»Stillgestanden, Leutnant, oder, bei Gottes Tod, ich nehme Euch sofort in Arrest!!!«
Und da mit einem Male ward auch die Indianerin oder der Leutnant ruhig, ganz ruhig, und nahm stramme Stellung an.
Ahnte sie schon etwas, was der Oberst vorhatte?
Wir werden es später sehen.
»Wer ist die Dame, die hier hereinschlüpfte?«
»Miss Marwood Morgan.«
»Die bekannte Milliardärin?«
»Jawohl, Herr Oberst«, erklang es ganz militärisch und sachgemäß.
»Warum flieht sie vor Euch, Leutnant?«
»Weil sie mich zu fürchten hat.«
»Weshalb?«
»Sie ist ihrer Gefangenschaft entflohen.«
»Ihrer Gefangenschaft? Hm, das verstehe ich nicht. Oder — ach richtig, war diese Miss Marwood Morgan nicht dort am Sklavensee im Coloradogebirge gefangen?«
»So ist es, Herr Oberst.«
»Von der Gräfin Atalanta von Felsmark wurde sie gefangen gehalten, nicht wahr?«
»Jawohl, Herr Oberst.«
»Und diese Indianerin mag wohl auch allen Grund gehabt haben, dieses Weib gefangen zu halten, wie?«
»Gewiss Herr Oberst.«
»Und Sie, Herr Leutnant Giuseppe, haben ebenfalls ein Wörtchen mit ihr zu sprechen — wie, Herr Leutnant Giuseppe?!«
In dem braunroten Gesicht des »Herrn Leutnant« hatte es schon mehrmals ganz merkwürdig gezuckt.
»Jawohl, Herr Oberst!«
»Also nur ein Wörtchen sprechen wollen Sie mit ihr, sie nicht gleich töten.«
»Ich denke nicht daran, Herr Oberst.«
»Na — warum brüllt sie denn da immer, sie würde ermordet?«
»Es ist ihr böses Gewissen.«
»Hm, mag sein. Aber Sie wollen ihr auch wirklich nichts anhaben?«
»Herr Oberst, ich habe hier doch meine Pistole, ich hätte sie doch niederschießen oder sie wenigstens lahmschießen können!«
»Richtig — da haben Sie wieder sehr recht, Herr Leutnant Giuseppe ohne Vatersnamen. Und ich denke, Herr Leutnant, nun haben Sie sich inzwischen wieder ganz beruhigt.«
»Ich bin ganz ruhig.«
»Vorhin, als Sie hier angejagt kamen und mich beiseite stoßen wollten, waren Sie es nicht.«
»Jetzt bin ich ganz ruhig, Herr Oberst.«
»Das menschliche Leben ist nämlich keine Hasenjagd — merken Sie sich das, Herr Leutnant!«
»Ich werde es mir merken, Herr Oberst«, musste jetzt der »Herr Leutnant« leise lächeln.
»Gut. Dann bleiben Sie mal hier stehen. Hier auf dieser Stelle! Bis ich zurückkomme. Entfernen Sie sich nur mit einem Schritte, dann fliegen Sie ins Loch, wenn ich Sie nicht Spießruten laufen lasse. Verstanden?!«
»Zu Befehl, Herr Oberst!«
»Sprechen sollen Sie die Dame, wenn Sie nun mal eine Unterredung mit ihr wünschen, erst aber will ich selbst sie einmal sprechen.«
Er begab sich ins Innere. Atalanta hörte ihn in weiter Entfernung rufen, Miss Morgan musste sich ganz nach hinten geflüchtet haben, wahrscheinlich in eine der Pulverkammern, die jetzt aber leer waren. Sie hatte sich jedenfalls eingeschlossen, denn es krachte, als ob eine Tür aufgesprengt würde, und nach weiteren fünf Minuten kam der Oberst zurück.
»So, Miss Morgan ist bereit, Sie zu empfangen. In meinem eigenen Wohnzimmer. Ich habe ihr mein Ehrenwort gegeben, dass sie hier nichts von Ihnen zu fürchten hat. Verstanden, Herr Leutnant Giuseppe?«
»Zu Befehl, Herr Oberst.«
»Hier auf der Festung Chilinque, zu der natürlich auch einige Umgebung gehört.«
»Ich habe verstanden, Herr Oberst, und Ihr Ehrenwort ist mir heilig.«
»So gehen Sie. Ihre Pistole will ich Ihnen nicht abnehmen, ich traue Ihrer Ruhe. Der Dame habe ich nur noch einen Dolch abgenommen, er scheint vergiftet zu sein. Gehen Sie, Herr Leutnant Giuseppe.«
Der »Leutnant« ging und betrat das Zimmer, in dem Miss Morgan ganz gebrochen auf einem Stuhle saß.
Aber es kam bald zwischen den beiden zu einer fließenden Aussprache.
Die Zeitungen hatten also von der verwegenen, sensationellen Flucht der Miss Marwood Morgan aus ihrer Gefangenschaft in den Steinkatakomben am Sklavensee berichtet.
Das hatte Miss Morgan den Zeitungsreportern selbst erzählt. Wie sie ihre Flucht eingefädelt, wie sie dabei über die Leichen einiger japanischer Matrosen gegangen war.
Wir brauchen diese Erzählung nicht wiederzugeben, weil das meiste davon oder eigentlich so ziemlich alles erlogen war. Miss Morgan hatte einen besonderen Grund, den Zeitungen ein Märchen aufzubinden. Oder sie wollte sich eben mit einem ganz besonders sensationellen Nimbus umkleiden.
Jetzt aber berichtete sie die Wahrheit. Und wir wollen es erzählen, als wenn wir alles selbst mit erlebt hätten.
Wie Leutnant Torres, so war auch Miss Morgan gleich nach ihrer Festnahme durch unsichtbare, aber sehr derb zupackende Geisterhände in ein recht komfortables Gefängnis gekommen.
»Die rote Atalanta lebt noch, diese Menschen hier verstehen sich unsichtbar zu machen!!«
Das war ihr erster Gedanke gewesen, nachdem sie wieder richtig denken konnte.
Die sehr belesene und auch sonst hochgebildete Amerikanerin sah in diesem »sich unsichtbar machen können« gar kein besonderes Wunder, mindestens nicht außer dem Bereiche der Möglichkeit liegend.
Denn gerade in Amerika wird von Physikern und verwandten Gelehrten hierüber jetzt eifrig debattiert, dass es eine Substanz geben könnte, welche nur gewisse Lichtstrahlen in derartiger Weise durchlässt, dass jeder zwischen dieser Substanz liegende Gegenstand scheinbar verschwindet, vielleicht wird im Laboratorium auch schon viel experimentiert. Jeden Tag ist in amerikanischen Zeitungen derartiges zu lesen. Seit der Entdeckung der sogenannten X-Strahlen durch Professor Röntgen hat man eben über das Wesen des Lichtes eine ganz andere Anschauung bekommen, ebenso wie man seit der neuesten Theorie, dass die sonst ganz unerklärliche Schwerkraft oder Anziehungskraft auf Energieschwingungen des Äthers beruht, es für möglich hält, noch einmal eine Substanz zu entdecken, welche Ätherschwingungen ohne Widerstand passieren lässt, wonach man aus dieser Substanz gewichtlose Gegenstände herstellen könnte. Diese Erfindungen werden eines Tages da sein, man wird sie anstaunen, von einer neuen Ära der Menschheit sprechen — und drei Jahre später benutzt jeder Bauer das Telefon, ohne zu ahnen, dass die genialsten Köpfe wegen solch einer selbstverständlichen Sache ihre Gehirne bis zum Wahnsinn angestrengt haben.
Also diese echte Amerikanerin sah in dem, was sie da soeben erlebt hatte, gar kein besonderes »Wunder«.
Nur zu wissen, dass ihre Todfeindin noch lebte, das war ihr jetzt viel wichtiger.
Merkwürdig war nur, dass sie plötzlich gar nicht mehr den brennenden Schmerz an der Stirn und an den Füßen fühlte.
Denn den hätte sie in der Einbildung jetzt erst recht fühlen können — in dem Glauben nämlich, dass sich dieser Schmerz nun bald realisieren würde.
Jeden Augenblick konnte die Indianerin doch eintreten, um solche Prozeduren nun wirklich an ihr vorzunehmen.
Oder hatte sie eine Ahnung, dass sie von ihrer Todfeindin in der Hinsicht nichts zu fürchten habe?
Wenn es eine Ahnung war, so wurde diese ihr zur Gewissheit, als bald darauf, schon in der ersten Viertelstunde, zwei Japaner erschienen, welche die Gefangene mit japanischer Höflichkeit in einen anderen Kerker brachten, der aber noch viel, viel komfortabler eingerichtet war als dieser hier, in dem ihr eine ganze Flucht von Zimmern mit allen nur erdenklichen Bequemlichkeiten zur Verfügung stand, sogar ein Klavier.
»Sie will sich nicht rächen, sondern mich nur unschädlich machen, mich hier für immer gefangen halten«, sagte sich das scharfsinnige Weib sofort und war sich ihrer Sache ganz sicher.
Denn dass diese Indianerin überhaupt gar nicht rachsüchtig war, das hatte sie schon immer gewusst. Nur beim ersten Grade ihres Zornes durfte man ihr nicht in die Hände laufen. Und schließlich ist, wie schon mehrmals gesagt, für gewisse Personen gänzliche Miss- oder nur Nichtachtung eine gar harte Strafe, vielleicht die allerhärteste.
Die Tage vergingen. Miss Morgan hatte über nichts zu klagen. Was sie verlangte, bekam sie. Natürlich musste das hier seine Grenzen haben. Aber zum Beispiel betreffs Speisen und Büchern sprach sie keinen Wunsch vergeblich aus, und sie glaubte, wenn sie die neueren Pariser Moden und Juwelen verlangt hätte, um sich zum Zeitvertreib zu schmücken, so hätte sie diese bekommen.
In ihrer Kalkulation hatte sie sich nicht getäuscht. Die indianische Gräfin ließ sich nicht ein einziges Mal blicken. Wenn sie vielleicht noch eine Rache ausüben oder die Gefangenschaft verschärfen wollte, so bestand diese nur darin, dass sie für ihre Feindin als Gefangenenwärter gerade den hässlichsten unter ihren japanischen Matrosen ausgesucht hatte, überhaupt den denkbar hässlichsten Menschen.
Kamuri war eine echte japanische Matrosengestalt, ziemlich so breit wie hoch, besonders der Oberkörper ein regelrechtes Quadrat, die Oberarme so dick wie die Schenkel seiner etwas krummen Beine.
Während man aber sonst gerade unter dieser Kaste recht hübsche oder doch wenigstens annehmbare Mongolengesichter findet, saß auf diesen mächtigen Schultern, begrenzt von Kanonenkugeln, ein ausgeprägter Affenkopf. Nicht das noch ziemlich manierliche Gesicht eines Gorillas oder eines Orang-Utans, sondern das eines Pavians oder gar eines Mandrills, mit großen, weitabstehenden Ohren, mit noch weiter abstehenden Backenknochen und gewaltig hervortretendem Unterkiefer, und aus dem furchtbaren Maule sahen unten sämtliche Zähne hervor, die einem Kamele anzugehören schienen, während oben zwei Reißzähne fletschten. Im Gegensatz dazu war die Nase kaum sichtbar.
Als Miss Morgan dieses Gesicht zum ersten Mal erblickte, entsetzte sie sich vor solcher unbeschreiblichen Hässlichkeit, sie fürchtete sich. Und das änderte sich im Laufe der Zeit nicht, sie konnte sich an solche Scheußlichkeit nicht gewöhnen, obgleich der Japaner von peinlichster Sauberkeit und gegen sie von vollendetster Höflichkeit war.
Und gerade in diesem Appartement fehlte die Vorrichtung, die Leutnant Torres in seinem kleineren Gefängnis gehabt hatte, der stumme Diener, die Öffnung in der Wand. Ihr Essen und alles andere, was sie wünschte, musste von diesem Japaner persönlich gebracht werden.
Nein, so starke Nerven diese Amerikanerin sonst auch besaß, in anderer Hinsicht war sie doch sehr empfindlich — und an solch menschliche Scheußlichkeit konnte sie sich niemals gewöhnen. Wäre es ein dressierter, wohlerzogener Pavian gewesen, dann hätte sie es fertig gebracht, aber vor solch einem pavianähnlichen Menschen wurde sie immer von Neuem mit unverändertem Abscheu erfüllt.
Eines Tages, als der Japaner das Mittagessen hereinbrachte, hatte sie es verpasst, sich vorher in ein anderes Zimmer zu flüchten, auf dem Gange dorthin hätte sie ihn passieren müssen, und so drehte sie sich wenigstens schnell um, nur um dieses Gesicht mit dem fürchterlichen Gebiss nicht zu sehen.
Unglücklicherweise blickte sie in den Wandspiegel, in dem sie das gelbe Affengesicht gerade so hübsch vor sich hatte. Und da sie es nun einmal anstarrte, musste sie diese Hässlichkeit auch weiter anstaunen, ihre Augen waren wie gebannt, sie konnten sich davon nicht abwenden, wie sie es auch versuchte und obgleich es ihr dabei übel wurde.
Da aber mit einem Male merkte sie etwas.
Der Japaner wusste nicht, dass er im Spiegel beobachtet würde, klapperte wohl mit den Tellern, sah aber dabei unverwandt nach der Dame.
Und wie nun die kleinen Affenaugen die schlanke und doch so üppige Gestalt verschlangen, diese sinnliche Gier darin!
Und diese Amerikanerin war ein echtes Weib, das sich seines weiblichen Wertes in den Augen der Männer bewusst war und mit diesen Werten wie ein Börsenjobber spekulierte. Hausse oder Baisse.
Und in diesem Augenblicke wusste dieses Weib, wie jetzt die Aktien standen.
Jetzt war für sie Hausse.
In diesem Augenblick sah sie sich schon wieder in Freiheit.
Aber nun nicht etwa, dass sie sich umdrehte und ungefähr sagte: »Mein lieber Freund, ich habe Sie bisher immer verkannt, Sie sind gar nicht so hässlich, vielmehr der reine Adonis — befreien Sie mich, und ich erfülle Ihnen alle Wünsche, die jetzt durch Ihren Kopf gehen!«
Dazu war dieses Weib viel zu schlau. Auch dazu, um jetzt nur irgendwelche Andeutung von so etwas zu machen. Sie kannte die japanische Treue. Dieser Pavian musste von ganz allein zu ihr kommen, der musste ihr zuerst solch einen Vorschlag machen oder es ging überhaupt nicht. Sie kannte eben die Japaner.
Als er das nächste Mal wiederkam, befand sie sich gar nicht in dem Raume, in dem er zu tun hatte. Aber dort hinter der Portiere im Nachbarzimmer erscholl leises Weinen.
Der Japaner stutzte, schnitt eine Grimasse. Dann schlich er nach der Portiere, spähte durch eine Spalte. Es war seine Pflicht, auch über das sonstige Wohlergehen seiner Schutzbefohlenen zu wachen.
Die Gefangene kauerte auf einem niedrigen Sessel, hatte das Gesicht in den Händen verborgen, schluchzte in herzzerreißender Weise, und zwischen ihren Fingern perlten große Tränen hervor.
Dabei sah sie dennoch, wie das gelbe Affengesicht an der Spalte nochmals eine entsetzliche Grimasse schnitt, aus der man gerade kein Mitleiden herauslesen konnte.
Dann trat er vollends ein.
»Ist Ihnen unwohl, Miss?«
Es war seine erste derartige Frage. Er hatte zu einer solchen noch gar keine Gelegenheit gehabt.
Keine Antwort. Das Weinen wurde leiser, das Schluchzen sollte unterdrückt werden, aber es gelang nicht und wurde dadurch nur umso ergreifender.
»Fehlt Ihnen etwas, Miss?«
»Ach, bin ich unglücklich!!«, erklang es da im jammerndsten Tone.
»Was wünschen Sie?«
Ja, in seiner Stimme lag die größte Teilnahme.
»Nichts, nichts!«
»Ich werde die Frau Gräfin davon benachrichtigen —«
Da schnellte sie auf. Wohl war sie ganz aufgelöst von Tränen, aber sie hatte dafür gesorgt, dass dadurch nicht ihr Gesicht entstellt würde. Und wie jetzt ihre Augen in dämonischer Wildheit aufflammten, sah es nur umso berückender aus.
»Wehe, wenn Sie das tun — wenn Sie diesem Weibe erzählen, dass Sie mich in Tränen gesehen haben!«
»Ich muss es berichten —«
»Sie werden es nicht tun, bitte, bitte nicht, nur diese Schmach tun Sie mir nicht an!!«
Bei diesen leidenschaftlich hervorgestoßenen Worten hatte sie ebenso leidenschaftlich seine Rechte mit ihren beiden Händen ergriffen, und das war jetzt alles ganz angebracht, und so flehend blickte sie ihn an.
Dem Japaner ging es wie ein elektrischer Schlag durch seine unförmlichen Glieder, mit einem Ruck riss er seine Hand los.
»Ich werde es ihr nicht berichten«, sagte er dann, verbeugte sich wie immer und ging.
Triumphierend blickte Miss Morgan ihm nach. Ja, sie konnte triumphieren. Es war ihr gelungen, diesen Japaner mit dem ersten Schritte vom Wege seiner Pflicht abzulenken, dadurch hatte sie ihn schon halb auf ihrer Seite — wie der Teufel, der bekanntlich nur den kleinen Finger braucht, um den ganzen Arm und den ganzen Leib samt der Seele zu nehmen.
Einige Tage vergingen. Die Gefangene weinte und schluchzte, ohne dass sich ihr Wärter um sie gekümmert hätte. Doch das schadete nichts, sie war ihrer Sache sicher. Und eben, dass er gar nicht mehr nach ihr blickte, mit Absicht immer nach einer anderen Richtung sah, ein verdrießliches Gesicht machte, nicht mehr so höflich war wie früher, sagte ihr mehr als alles andere.
Und eines Tages trat der Japaner vor sie hin, verschränkte die Arme über der Brust und blickte auf sie herab.
Aber diese Armverschränkung war nicht das Zeichen der Demut der Orientalen, es lag etwas Wildes und Trotziges darin — und mehr noch in seinen geschlitzten Augen.
Und dann ging es kurz.
»Soll ich Sie befreien?«
Die Weinende blickte auf, sie wollte ein freudig erstauntes Gesicht machen, zugleich den Ausdruck hineinlegen, als könnte sie nicht recht gehört haben — aber als sie dieses Gesicht sah, wusste sie, dass hier jede Schauspielerei überflüssig sei.
Und wie er dastand und gleich diese erste Frage mit ganz vernehmlicher Stimme gestellt hatte, danach musste er bestimmt wissen, dass er weder beobachtet noch belauscht wurde und werden konnte.
»Sie wollen mich befreien?«, fragte sie ganz geschäftsgemäß, wie es in ihrem Innern auch plötzlich aufjauchzte.
»Ja.«
»Zu welchen Bedingungen? Zu welchem Preise?«
Das gelbe Affengesicht grinste höhnisch.
»Sie wissen doch selbst ganz genau, was ich fordere.«
Ja, Miss Morgan wusste es natürlich, wollte aber doch noch etwas mehr hören.
»Sie wissen, dass ich sehr reich bin. Was für eine Summe fordern Sie?«
»A bah! Ich fordere Sie selbst mit allem, was Sie haben.«
»Dann wollen Sie — wollen Sie —«
»Mich wohl gar heiraten?«, ergänzte grinsend der Affenmensch. »Erraten! Sie sollen meine Frau werden.«
»Das geht aber doch nicht, Sie sind ein —«
»Dann bleiben Sie hier zwischen diesen Felsenmauern Zeit Ihres Lebens.«
Er wollte gehen.
»Kamuri!!«
Da blieb er.
»Wirklich heiraten?«
»Ja. Auf andere Weise bekomme ich nicht Ihr ganzes Geld.«
Miss Morgan witterte eine List, erkannte aber nicht deren Beschaffenheit.
»Können Sie mich denn so ohne Weiteres von hier fortbringen?«
»Ja.«
»Wie ist das möglich?«
»Man traut mir eben vollkommen, ich bringe Sie ungesehen von hier fort.«
»Indem Sie sich und mich unsichtbar machen?«
»Nein, die Tarngewänder sind mir unerreichbar, und ich habe sie auch nicht nötig.«
»Wo wollen Sie mich hinbringen?«
»Nach Japan, wo ich einen Schlupfwinkel weiß, in dem uns niemand findet, und wenn man auch die ganze Erde durchsiebt.«
»Und Sie verlangen eine regelrechte Heirat mit mir?«
»Jawohl, eine regelrechte Heirat, durch den Segen des Priesters.«
»In Japan?«
»Nein, schon hier in Amerika. Wir begeben uns zu einem Priester, der uns sofort auf gesetzmäßige Weise verbindet.«
»Wir werden verfolgt.«
»Nicht so bald. Ich weiß die Sache zu verzögern, ehe man Sie hier vermisst. Und dann sind wir schon auf einem Schiffe und in Sicherheit.«
»Und auch mein ganzes Vermögen wollen Sie haben?«
»Es wird Ihnen von Japan aus nicht schwer sein, hier nach und nach Ihr Vermögen flüssig zu machen.«
»O doch, das dürfte von Japan aus nicht so leicht sein.«
»Gut. Aber ich bin Ihr gesetzlich angetrauter Mann, Sie geben mir Vollmacht, und so gehe ich eben noch einmal nach Amerika und wickle die Geschäfte ab.«
»Sie sind der Rache dieser Indianerin ausgesetzt.«
»Das lassen Sie nur meine Sache sein, wie ich mich vor der schützen werde.«
Miss Morgan sann eine kleine Weile nach, sie tat wenigstens so. Ihr Entschluss war ja schon längst gefasst.
»Ich bin zu allem bereit, wenn ich nur aus diesen Felsenmauern wieder herauskomme!«, seufzte sie dann.
»Sie wollen mich so heiraten, wie ich Ihnen beschrieben habe?«
»Ja.«
»So beschwören Sie es.«
»Ich schwöre es bei allem, was mir heilig ist«, sagte sie mit möglichster Feierlichkeit, die Finger zum Schwure erhoben.
Aber das genügte dem Japaner noch nicht. Er sprach ihr die Eidesformel vor, als wäre er ein Christ und Staatsanwalt.
Miss Morgan hatte sie Satz für Satz nachgesprochen.
»So wahr mir Gott helfe, Amen.«
Wieder grinste das Affengesicht, diesmal aber lag auch etwas furchtbar Drohendes darin.
»So, jetzt weiß ich, was ich von Ihnen zu halten habe!«
»Was denn?!«
»Sie scheuen vor keinem Meineid zurück, nichts ist Ihnen heilig, Sie glauben ja überhaupt gar nicht an einen Gott und an eine ewige Seligkeit, die Sie zu verlieren hätten.«
»Wenn es wirklich so wäre — was haben Sie mich da erst schwören lassen?«
»Nur um Ihren Charakter zu prüfen. Sie denken ja gar nicht daran, mich hässlichen Affenmenschen zu heiraten.«
»Ich verstehe Sie nicht —«
»Hören Sie mich an! Ich begehe das denkbar niederträchtigste Verbrechen. Meine Herrin vertraut mir unbedingt, und ich entäusche ihr Vertrauen. Etwas Gemeineres gibt es kaum auf dieser Erde und auf keiner anderen, wo lebende Wesen existieren. Kein Hund handelt so. In zahllosen Wiedergeburten werde ich hierfür büßen müssen —«
»Verschonen Sie mich mit Ihrer Wiedergeburtstheorie, ich glaube nicht daran!«
»Aber ich. Gut, Sie brauchen auch nichts weiter davon zu hören, aber etwas anderes müssen Sie hören. Sie haben mich in wahnsinnige Leidenschaft versetzt. Wie leicht wäre es mir, diese zu befriedigen. Ich bin hier mit Ihnen allein, niemand beobachtet uns. Ich falle einfach über Sie her und dann, wenn ich meine Leidenschaft befriedigt, stoße ich mir einfach das Messer in den Leib — zittern Sie?«
Ja, Miss Morgan erzitterte. Sie sah sich auf Gnade und Ungnade diesem Menschen preisgegeben, der in seiner tierischen Leidenschaft an keine Folgen mehr dachte.
Und doch, er tat es — und das eben war ihr Glück.
»Dann müsste ich büßen. Denn der Tod beendet das Leben nicht, nur eine kurze Spanne aus demselben. Dann geht die Sonne wieder auf, und wie man sich gebettet hat, so erwacht man wieder.
Muss ich aber büßen, dann will ich vorher auch genießen. Und nicht nur einen kurzen Augenblick des Rausches. Ich nehme Dich mit mir. Ich heirate Dich wirklich. Denn so habe ich auch Gelegenheit, wenigstens in etwa die zürnenden Götter zu versöhnen. Auf diese Weise bekomme ich auch all Dein Geld, welches ich den Tempeln übergeben werde. Schwören ließ ich Dich deshalb, um Deinen Charakter kennen zu lernen. Dir gilt ein Meineid nichts, so weiß ich, was Dir auch ferner zuzutrauen ist. Aber vergebens wirst Du mich zu täuschen versuchen. Komm, folge mir.«
»Jetzt sofort?«
»Sofort. Ich habe alles schon vorbereitet, die Gelegenheit ist günstig. Nimm mit, was Du mitnehmen willst, wenn es nicht zu schwer ist.«
Miss Morgan hatte nichts mitzunehmen. Man hatte ihr nur Kleider gegeben, und das, welches sie gerade trug, war das haltbarste.
»Wohin bringst Du mich zuerst?«
»Schweige und folge mir, wenn Du bereit bist.«
Sie war es. Sie fürchtete nur noch, dass er das Betäubungsmittel, das man ihr abgenommen hatte, oder ein anderes benutzen würde. Aber auch das geschah nicht.
Sie traten auf den erleuchteten Korridor, bogen nach wenigen Schritten in einen finsteren Gang ein, der Japaner, dunkel gekleidet, fasste ihre Hand und ließ sie nicht wieder los, auch nicht, als ihr kühle Luft entgegen wehte.
Sie befanden sich bereits im Freien, in der stockfinsteren Nacht.
So weit hatte Miss Morgan erzählt, nicht ganz so ausführlich.
Jedenfalls aber hatte Atalanta alles erfahren, wie es sich zugetragen, sie hatte selten eine Frage nötig gehabt.
Und sie fand alles ganz glaubwürdig. Auch dass dieser Kamuri, auf dessen Treue sie Häuser gebaut, dem sie ihr eigenes Leben anvertraut hätte, aus eigenem Antrieb diesen Verrat begangen hatte, ohne große Verführungskünste der Gefangenen.
Wir haben immer das japanische Volk als ein Ideal von selbstaufopfernder Treue hingestellt. Gewiss, das ist es auch. Aber als ob es nicht überall Bösewichter und charakterlose Schwächlinge gebe! Und dieser Japaner brauchte im Grunde genommen gar kein solcher gewesen zu sein. Die sinnliche Leidenschaft hatte ihn eben überwältigt. Und die Liebe, und was damit zusammenhängt, ist eben unberechenbar, die kann mit einem Schlage alles über den Haufen werfen, einen feigen Schwächling zum kühnen Helden machen, also wohl auch einen kühnen Helden zum feigen Schwächling.
Dies hatte sich die Indianerin gleich gesagt, hiermit sich also auch gleich abgefunden.
»Nun, und wohin hat Sie Kamuri geführt?«
»Es war stockfinstere Nacht, man konnte die Hand nicht vor den Augen sehen. Wir gingen lange Zeit auf ebenem Wege, unter den Füßen war harter Steineboden —«
»War es oben auf dem Plateau des Berges?«
»Das weiß ich nicht. Es war ganz windstill. Aber wir konnten uns ja auch zwischen Felswänden befinden. Gefühlt habe ich allerdings niemals welche.«
»Sind Sie vorher Treppen gestiegen, ehe Sie bemerkten, dass Sie sich im Freien befanden?«
»Nur eine einzige, kurze Treppe.«
Dann wusste Atalanta auch, wo Kamuri das Freie gewonnen hatte.
»Wie lange sind Sie so gewandert?«
»Ich schätzte es auf eine Stunde.«
»Und dann?«
»Dann warteten wir vielleicht eine halbe Stunde, worauf sich im Osten der Horizont rötete. In der Morgendämmerung sah ich, dass wir auf einem kleinen Felsplateau standen, das hinter uns von einer Wand abgeschlossen wurde, und vor uns ging ein schmaler, offenbar ganz natürlicher Pfad jäh hinab. Den benutzten wir —«
»Ja, jetzt weiß ich bestimmt, wo Sie sich befunden haben. Sagte Ihnen Kamuri, wo Sie sich befanden, wohin der Pfad führte?«
»Erst hatte er mir jedes Sprechen verboten, dann stellte ich vergebens Fragen, er antwortete einfach nicht.«
»Und weiter?«
»Wir stiegen den Pfad hinab. Er war so schmal, dass wir selten nebeneinander gehen konnten. Und auch wenn das einmal möglich war, hielt sich der Japaner stets hinter mir. Hinter mir, verstehen Sie, Frau Gräfin?«
»Ich verstehe sehr wohl.«
»Nur einmal kam er vor mich zu stehen.«
»Wann?«
»Als wir uns beide einmal umdrehten.«
Die Erzählerin bereitete etwas vor, man hörte es gleich in ihrer Stimme und las es noch mehr in ihren Augen.
»Wie kam das?«
»Hinter uns erklang ein heiserer Schrei.«
»Wer hatte ihn ausgestoßen?«
»Ein Geier. Wir waren soeben um eine Ecke gebogen, als er dicht hinter uns vorbeischoss. Natürlich blickten wir uns um, der Japaner drehte sich so ziemlich ganz um. Und ich auch.«
»Und?«, fragte die Indianerin, als jene nicht von allein fortfuhr.
»Da stand er also einmal vor mir.«
»Ja.«
»Und rechts neben uns gähnte die Tiefe und ebenso vor ihm.«
»Ja.«
»Nur vor ihm, nicht vor mir.«
»Natürlich.«
»Und was hätten Sie da getan, Frau Gräfin?«
Die beiden blickten sich an. Nur ganz kurz war die Pause, aber auch inhaltsreich genug.
»Ich hätte dem Japaner einen Stoß gegeben«, erklang es dann aus dem Munde des weiblichen Leutnants.
Sie hatte der Wahrheit die Ehre gegeben!
»Und ich tat's auch — einen kräftigen Stoß in den Rücken. Da verschwand er in der Tiefe, in der Hand den Dolch, der mich immer bedroht hatte.«
Nun hatte es Miss Morgan auch ohne jedes Zögere sagen können, die Indianerin war ihr ja entgegengekommen.
»War es sehr tief?«, erklang es gleichmütig weiter.
»Tief genug, dass er unten zerschmetterte.«
»Sahen Sie es, wie er aufschlug?«
»Nein. Dort unten lag noch der Schatten der Nacht. Er überschlug sich zweimal, in einer Tiefe von vielleicht hundert Metern verlor ich ihn aus den Augen, und dann zählte ich sekundenweise noch immer bis fünf, ehe ich einen dumpfen Aufschlag hörte.«
»Da hat er auch seinen Tod gefunden.«
»Sicher.«
»Stiegen Sie nicht hinab, um sich von seinem Tode zu überzeugen?«
»Es gab gar keinen Abstieg.«
»Stimmt, Sie hätten auch niemals in jene Schlucht dringen können. Ich kenne sie. Und weiter?«
»Ich setzte meinen Weg fort, nach einer Wendung um die nächste Ecke sah ich eine Ortschaft unter mir liegen —«
»Adalare.«
»Ich erfuhr es, dass sie so hieß, als ich sie erreicht hatte.«
»Nach ungefähr einer halben Stunde gelangten Sie auf einen breiteren Passweg, der Sie in einer Stunde hinabführte.«
»So war es.«
»Alles Weitere, etwa was Sie den Leuten erzählt haben, kümmert mich nicht. Nur einige Fragen habe ich noch.«
»Ich werde sie der Wahrheit gemäß beantworten,«
»Wann ist das geschehen?«
»Genau heute vor vierzehn Tagen.«
»Wussten Sie, dass ich den Sklavensee verlassen hatte?«
»Nein!«
»Hatte Ihnen Kamuri nichts davon gesagt?«
»Dann hätte ich es doch gewusst.«
»Das ist nicht unbedingt gesagt. Sie hätten es doch nicht zu glauben brauchen.«
»Ich hatte keine Ahnung, dass Sie fort waren.«
»Auch nicht, dass sich der Graf entfernt hatte?«
»Auch nicht.«
»Weshalb sind Sie hierher gekommen?«
»Weil ich — weil ich — den Kriegsschauplatz besuchen —«
»Ich meine: Wussten Sie, dass Sie uns hier finden würden?«
»Ich war bis vor einer Viertelstunde überzeugt, dass Sie sich noch am Sklavensee befänden.«
»Dachten Sie nicht daran, dass ich Sie verfolgen würde?«
»Das wohl, aber wenn ich mich irgendwo sicher fühlen konnte, so musste es wohl hier auf diesem Kriegsschauplatze sein, den niemand ohne besondere Erlaubnis des kommandierenden Generals betreten darf.«
»Sie taten es unter Ihrem richtigen Namen?«
»Nein, ich nahm einen anderen an, Cecile Hobson, und hielt mich immer dicht verschleiert.«
»Aber dem General Toler haben Sie sich zu erkennen gegeben?«
»Ja, aber nur diesem.«
»Weshalb taten Sie das?«
»Weil ich meinen Schleier lüften musste, und der General kennt mich von früher.«
»Der General versprach Ihnen natürlich Diskretion.«
»Auf sein Ehrenwort.«
»Sind Sie nicht schon früher erkannt worden?«
»Ja.«
»Wo?«
»Gleich in Adalare.«
»Von wem?«
»Es war da eine ganze Gesellschaft Journalisten von verschiedenen Blättern, die mich erkannten.«
»Die befragten Sie doch.«
»Natürlich.«
»Und was erzählten Sie denen?«
»Was Sie hier lesen.«
Miss Morgan zog aus ihrem Busen eine Zeitung und gab sie dem Leutnant.
Da war es also etwas anders oder sogar ganz bedeutend anders geschildert, wie sie der Gefangenschaft entkommen war. Da hatte sie ihre wiedergewonnene Freiheit ganz bedeutend mehr ihrer eigenen Kraft und Kühnheit zu verdanken, ihr Weg war über mehrere japanische Wächter gegangen, die sie erdolcht hatte. Nur der eine war ihr »in treuer Liebe« gefolgt, und der arme Kerl war dann durch einen Fehltritt den Felsen hinabgestürzt.
»Weshalb haben Sie das so erzählt?«
»Weil — weil — ich hielt es so für besser —«
Die scharfsinnige Indianerin wusste den Grund noch besser. Es war eben eitle Renommage.
»Haben Sie nicht davon gesprochen, dass wir uns unsichtbar machen können?«
»Nein.«
»Weshalb nicht?«
»Weil — weil —«, erklang es wiederum zögernd, »weil ich dachte, das wäre Ihnen unangenehm.«
Einen Augenblick sah es aus, als wolle die Indianerin in Leutnantsuniform der Todfeindin ins Gesicht lachen.
»Weil man mir bei der Behauptung solch einer Unmöglichkeit auch alles andere, was ich erzählt habe, nicht glauben würde«, hätte die Antwort lauten müssen.
»Es ist gut, ich brauche es nicht zu wissen. Wir sind fertig miteinander. Wenigstens hier! Hier sind Sie geschützt — durch Oberst Eisenfausts Ehrenwort, das mich bindet.«
Atalanta sprach es und verließ ohne Weiteres das Zimmer.
Nur wenige Minuten noch hatte der Oberst gleich einer Schildwache vor der Felsentür gestanden, als er um die Ecke des Saumpfades General Toler biegen sah, in Begleitung einiger Offiziere, gefolgt von einer kleinen Abteilung Soldaten.
Ein Kommando des wachhabenden Festungsoffiziers, die Wache, und das war hier die halbe Garnison, trat unter's Gewehr, und als der General die Zugbrücke überschritt, wurde unter Trommelwirbel präsentiert, was ja nichts anderes bedeutet als ein ehrerbietiges Strecken der Waffen.
Oberst Kettelhorst ging dem General entgegen, machte ihm dienstliche Meldung über Stärke und guten Zustand des Forts.
Der General ließ ihn kaum aussprechen, dankte schon vorher.
»Wo ist die Indianerin?!«
Der Oberst beendete erst seine vorschriftsmäßige Meldung, schnarrte sie herunter, die Hand an der Mütze, dann aber machte er eine so legere Bewegung, knickte etwas mit den Knien zusammen, dann jedes Bein einzeln schlenkernd, was deutlich genug ausdrückte: Ich hatte die Pflicht, Dir diese Meldung zu machen, sonst aber bin ich hier genau so viel wie Du, Du hast mir hier nichts zu sagen.
»Was für eine Indianerin?«, fragte er dann allerdings, ohne Staunen zu heucheln.
Ein desto erstaunteres Gesicht machte der General.
»Sie wissen doch natürlich schon, dass Ihr Leutnant Giuseppe niemand anders ist als die indianische Atalanta von Felsmark!«
»Ja, Herr General, das weiß ich schon lange.«
»Sie ist doch hierher geflohen.«
»Nein.«
»Was, das wollen Sie leugnen?!«
»Herr General, leugnen ist so viel wie lügen — sie ist nicht hierher geflohen, sondern sie hat eine vor ihr fliehende Dame bis hierher verfolgt!«
»Das ist ja genau dasselbe —«
»Nicht für mich.«
»Wo ist sie jetzt?«
»Sie hat mit der Dame in einem meiner eigenen Zimmer eine Unterredung.«
»Liefern Sie sie mir aus!«
»Wollen Herr General, bitte, sich in das Kommandantenzimmer bemühen.«
»Wozu das?«
»Ich habe dem Herrn General etwas zu offenbaren.«
»Was gibt es da zu offenbaren? Die steckbrieflich verfolgte Zuchthäuslerin und Mörderin sollen Sie mir ausliefern — sofort!!«
»Herr General wollen meine Antwort gleich hier auf dem Festungshofe vor versammelter Mannschaft hören?«
»Ja.«
»Ich kann Ihnen die Frau Gräfin Atalanta von Felsmark nicht ausliefern.«
General Toler wusste sich noch einmal zu beherrschen.
»Weshalb können Sie nicht?«
»Weil es gegen meine Ehre geht. Ich will mich kurz fassen. Ich habe damals in Denver als bevollmächtigter Werbe-Offizier einen jungen Italiener namens Giuseppe als Soldat für meine Truppe angenommen. Wie er sich hier davonschlich, wie er zurückkam und sich erbot, den vom Feinde besetzten Barbelinos zu nehmen, ist dem Herrn General vollständig bekannt.
Bis zu diesem Zeitpunkte hatte ich nicht die geringste Ahnung, dass unter dem Soldatenrock ein Weib stecken könnte. Da erklärte mir der kleine Italiener seinen verwegenen Plan. Ich stellte einige Fragen, die er in ganz besonderer Weise beantwortete.«
»Wieso in ganz besonderer Weise?«
»Das kann ich hier nicht so ohne Weiteres erklären. Ich muss erwähnen, dass ich Schachspieler bin, und zwar früher ein so leidenschaftlicher, dass ich nichts anderes im Kopfe hatte, das ganze Leben nur als ein Schachspiel betrachtete. Das habe ich überwunden, nur etwas davon ist mir noch anhaften geblieben.
Als mir nun der kleine Italiener seinen Angriffsplan auf den feindlichen Berg klarlegte, wie er die Möglichkeiten erwog oder vielmehr nicht erwog, wie er meine Fragen beantwortete, da sah ich einen sogenannten Defensive-Spieler vor mir stehen — und in demselben Augenblick fühlte ich mich zwei Jahre zurück nach New York versetzt, ins Hippodrom, ich wohnte noch einmal der Vorstellung bei, die damals Atalanta, die rote Athletin gab — am meisten hatte mich ihr Schachspiel interessiert — und obgleich sie damals alles andere als auf Defensive gespielt hatte, so hatte ich in ihr doch gleich die geborene Defensive-Spielerin erkannt — und im Grunde genommen war ihr überaus opferreiches Angriffsspiel auch nichts weiter als eine geschickt versteckte Defensive — kurz und gut, plötzlich stand vor mir statt des italienischen Soldaten jene Indianerin — und da plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen — da plötzlich wusste ich ganz bestimmt, wen ich vor mir hatte: die indianische Gräfin Atalanta von Felsmark.
Also einen Zweifel gab es da nicht mehr bei mir, und ich wusste, was es mit dieser indianischen Gräfin für eine Bewandtnis hatte. Eine entsprungene Zuchthäuslerin, jetzt auch noch wegen eines Mordes verfolgt und so weiter und so weiter.
Meine Pflicht als Mensch, als Bürger und noch besonders als Offizier, als Beamter der Vereinigten Staaten, wäre es gewesen, dieses gefährliche Weib sofort dingfest zu machen.
Hiermit wäre mir natürlich nicht viel gedient gewesen. Nun ja, eine Million Dollars hätte ich mir dadurch verdient. Aber dort oben die feindliche Batterie in meine Hände zu bekommen, das war mir doch etwas mehr wert als eine Million Dollars.
Also ich — hypnotisierte mir gewissermaßen aus meinem Kopfe den Gedanken heraus, die indianische Gräfin vor mir zu haben — es war ganz einfach der Soldat Giuseppe, den ich angeworben hatte.
Der Soldat Giuseppe führte sein Bravourstückchen aus, ich ernannte ihn dafür zum Leutnant Giuseppe. Denn hätte ich ihn jetzt für die Frau Gräfin Atalanta von Felsmark genommen, so wäre es noch immer meine Pflicht gewesen, diese festzunehmen und bei der ersten Gelegenheit der Justiz zu übergeben. Davon aber, Herr General, konnte doch keine Rede sein. War mir diese Indianerin gut genug, als es sich darum handelte, das schon so gut wie verlorene Fort zu retten, nun, dann musste ich sie doch wohl auch fernerhin in Ehren halten. Oder ich wäre doch ein — Lump, ein Lump, wie solch ein zweiter nicht mehr auf der Erde herumläuft.
So stand auch fernerhin in meinen Diensten immer nur der Leutnant Giuseppe, der seinen Vatersnamen nicht weiß oder nicht nennen will, was man bei uns halten kann wie man will. Jetzt, Herr General, habe ich bekennen müssen, dass ich weiß, wer dieser Leutnant Giuseppe ist, dass ich es schon früher gewusst habe. Dadurch wird an der Sache natürlich nichts geändert. Jetzt sogar erst recht nichts. Sie fordern von mir, ich soll Ihnen die Gräfin Atalanta von Felsmark ausliefern. Es tut mir leid, Herr General, das kann ich nicht — es geht gegen meine Ehre.«
Mit ziemlicher Geduld hatte General Toler diese doch länger gewordenen Ausführungen angehört.
»Ich befehle Ihnen, mir die Gräfin Atalanta von Felsmark auszuliefern.«
»Ich tue es nicht.«
»Wissen Sie, dass ich als Höchstkommandierender hier zugleich die höchste Polizeigewalt ausübe?«
»Das weiß ich.«
»Sie widersetzen sich meinem polizeilichen Befehl?«
»Ja.«
»Dafür werden Sie sich später zu verantworten haben. Jetzt befehle ich Ihnen als Ihr vorgesetzter General, mir den Leutnant Giuseppe auszuliefern.«
»Es gibt keinen Leutnant Giuseppe mehr.«
»Sie weigern sich also ganz einfach, meinen Befehlen Folge zu leisten.«
»Ja.«
Der General streckte seine Hand aus.
»Geben Sie mir Ihren Degen!«
»Nein!«
Der General wandte sich halb um.
»Nehmt diesen Mann fest.«
Weder von seinen Offizieren noch von den mitgebrachten Soldaten rührte sich jemand. Der General sah diese Gesichter und er erblasste bis in die Lippen.
»Das ist Rebellion!!«, hauchte er.
Da trat Oberst Kettelhorst einen Schritt auf ihn zu.
»Herr General Toler, Sie haben doch schon meine Beschwerdeschrift gelesen und sofort weiterbefördert!«
Mit zitternder Hand griff der General zwischen seinen Waffenrock und brachte einige zusammengeballte Papierbogen zum Vorschein.
»Den Wisch, den Wisch —«, konnte er nur hervorstoßen.
Da begannen des Obersten stahlblaue Augen Feuer zu sprühen.
»Was?! So, nun ist's gut!! Ich habe Sie in dieser Beschwerdeschrift der totalen Unfähigkeit als Höchstkommandierender bezichtigt, da Sie aber die Beschwerde und Anklageschrift nicht befördern, sondern unterschlagen, so muss ich weiter vorgehen, das bin ich meinem Vaterlande schuldig: Ich bin nicht mehr Ihr Untergebener, ich bin Ihr Vorgesetzter — Sie sind nicht mehr General — Mister Edward Toler, geben Sie mir Ihren Degen!!«
Ja, der General riss sofort seinen Degen aus der Scheide — um jenen zu durchbohren.
Seine eigenen mitbrachten Offiziere waren es, die ihm rechtzeitig in den Arm fielen, ihn von hinten packten. Es war dies eine Szene, die nicht nur im Lande der unbegrenzten Möglichkeiten möglich war. Wenn etwa, was alles schon passiert ist, bei uns in Deutschland ein Offizier vor der Front von einem Soldaten beleidigt wird, so kann es sein, dass dieser Offizier, der plötzlich seine ganze Karriere vernichtet sieht, im ersten Affekt den Degen herausreißt, und hoffentlich werden ihm dann, wie es einmal passiert ist, Unteroffiziere und auch Soldaten, die eigentlich stramm stehen sollen, noch rechtzeitig in den Arm fallen. Und wenn ein Schiffskapitän sinnlose Kommandos gibt, sich überhaupt sinnlos benimmt, so wird er von seinen Offizieren, den Steuerleuten, einfach abgesetzt, unter Umständen eingesperrt. Und ein Schiffskapitän hat eigentlich noch eine ganz andere Machtstellung als ein kommandierender General.
Doch verlassen wir jetzt diese Szene.
Der erkannte und abgeführte Korporal saß in einer Holzbaracke. Die Fesseln oder Stricke hatte man ihm wieder abgenommen. Es war die improvisierte Arrestzelle des Lagers, vor der Tür und draußen herum standen Posten genug mit geladenem Gewehr. Er saß auf der Pritsche, die Arme auf die Knie und den Kopf in die Hände gestemmt.
Wir können nicht schildern, was für Gedanken durch Arnos Kopf jagten.
»Miss Marwood Morgan?«, murmelte er immer wieder. »Ja, die kann hier sein, warum nicht, das verstehe ich. Aber die rote Atalanta? Das wäre doch meine Frau! Und galt dieser Ruf nicht dem Leutnant Giuseppe, der erst mir und dann der Morgan nachrannte? So wäre also dieser Giuseppe meine Frau? Ja, natürlich ist das niemand anders als Atalanta! Jetzt weiß ich's. Dass ich Narr das nur nicht gleich erkannt habe! Hahahaha, haben wir beide immer auf ein und demselben Strohsack gelegen und — und — das ist ja überhaupt alles nur Unsinn, ist ja gar nicht wahr, ich träume ja nur.«
Und in diesem Kreise jagten seine Gedanken immer wieder herum, während er vor sich hin stierte, murmelnd und manchmal lachend.
Da hob er lauschend den Kopf. Himmel, diese Stimme!!
»Ja ja, nun weiß ich alles, das genügt mir schon, lassen Sie mich nur hinein, ich werde schon alles aus ihm herausbekommen —«
Wo hatte er diese metallische Stimme mit dem eigentümlich spöttischen Klange nur schon einmal gehört, wo hatte die so tief in sein Leben eingegriffen? Die Riegel wurden zurückgeschoben, eine hohe Gestalt im Reisepelz trat ein.
»Professor Dodd!!«, stöhnte Arno, noch ehe er das höhnische Mephistogesicht richtig gesehen hatte. Alles andere ging ungemein schnell.
»Geben Sie mir mal Ihre Hand.«
Der Professor hatte schon zugegriffen, und fast in demselben Moment, da er Arnos Hand berührte, sank dieser auch schon lang hin auf die Pritsche.
Nur einen prüfenden Blick, und Professor Dodd, ob es nun dieser oder jener war, ging schnell nach der Türe zurück, wollte sie öffnen, fand sie aber geschlossen und donnerte dagegen.
Sie wurde aufgemacht, der diensthabende Offizier stand davor.
»Der Kerl ist ja tot!«
»Was, tot?«, stieß der Offizier in ungläubigem Staunen hervor.
»Na freilich! Da liegt er doch!«
»Aber als ich soeben durch die Tür blickte, saß er doch noch —«
»Ganz zusammengekauert da. Als ich ihn anrührte, fiel er um. Der ist schon lange tot. Wahrscheinlich ein Herzschlag. Schnell, fassen Sie an, wir wollen ihn hinaustragen —«
Und schon hatte der Professor den Umgefallenen unter den Schultern gepackt.
»Na, da nehmen Sie ihn doch bei den Füßen!!«, fuhr er den Offizier an, dessen Verwirrung begreiflich war. »Ich will sehen, was noch mit ihm zu machen ist, der ist schon eine ganze Menge mal tot gewesen und wieder lebendig geworden, ich weiß, was ihm fehlt, aber schnell muss es gehen, schnell, schnell — na, da stehen Sie doch nicht so da —«
Der Offizier raffte sich auf, rief nicht erst Soldaten, griff gehorsam zu, nahm den Regungslosen bei den Beinen. »Wohin?«
»Na, hinaus, hinaus — erst einmal an die frische Luft —«
Da hatte man es nicht weit. Draußen stand ein großes Automobil, und ob der Offizier nun wollte oder nicht — der Professor dirigierte die Bürde in das Automobil hinein.
»Wohin wollen Sie denn —«
»Na ins Automobil, wohin denn sonst? Ich verstehe Ihre Teilnahmslosigkeit gar nicht. So — so —«
Die Tür zugeworfen, ein Druck auf den Gummiball, der dem draußen sitzenden Chauffeur das Zeichen zur Abfahrt gab, und das Automobil knatterte davon. Mit etwas geöffnetem Munde blickte der Offizier nach.
»Ja, wohin will denn der Professor den —«
Da kam wieder etwas anderes, was dem Offizier neue unlösbare Rätsel aufgab.
Unterdessen sauste das Automobil in nördlicher Richtung durch das Tal auf ziemlich guter Landstraße dahin. Professor Dodd hatte sich in die Polster zurückgelehnt, die Arme über die Brust gekreuzt und betrachtete mit teuflischem Lächeln den vor ihm regungslos liegenden Mann.
»So, das wäre die erste Fliege, die ich geklappt hätte, und nun erwarte ich die zweite. Ja aber —«
Er sah zum Fenster hinaus, wo die Felsen wie die Phantome vorüberhuschten, blickte auf den Apparat, der die Fahrtgeschwindigkeit anzeigte, und öffnete dann schnell das vordere Fensterchen.
»Zum Teufel, Mensch, was fahrt Ihr denn so schnell! Da kann uns doch kein sechsbeiniges Pferd einholen! Langsamer — viel langsamer — noch langsamer — so — so —«
Auch hinten war ein Fensterchen zu öffnen, und der Professor spähte dort hinaus.

»Dort hinten taucht ein Reiter auf. Eine Uniform. Ist sie's schon? Natürlich, so toll jagen kann nur so eine tolle Indianerin. Natürlich, sie ist's. Gut, wenn das mir auch bei der so schnell gelingt, dann will ich noch behaupten dürfen, zwei Fliegen mit einem einzigen Schlage geklappt zu haben. — Noch etwas langsamer, Chauffeur!!«
Der Reiter brauste heran.
»Steht, Ihr Räuber!!!«
Das Automobil hielt bereits, und aus dem Schlage stieg der Mann im Pelz. Gleichzeitig glitt die Indianerin in Leutnantsuniform von dem Pferde, es weiter jagen lassend.
»Señor Tenorio!!«
»Kenne ich nicht. Professor Dodd.«
Die Indianerin drängte sich zuerst an ihm vorbei und blickte in das Innere des Automobils hinein. Da lag der Korporal, ihr Gatte, wie schlafend da.
»Teufel, der Du bist, was hast Du nun wieder —«
Sie hatte es noch in den Wagen hineingesprochen. Da fühlte sie einen kleinen Stich am Halse, und Atalanta sank bewusstlos in das Automobil hinein.
»So, ich darf doch noch behaupten, zwei Fliegen mit einem Schlage geklappt zu haben«, grinste der Professor, die Regungslose weiter hinein schleifend, »jetzt, Chauffeur, könnt Ihr so schnell fahren wie Ihr wollt.«

»Ach, das ist herrlich, herrlich!«, jubelte Arno immer wieder, während
er mit Atalanta auf den edlen Pferden durch das Felsental galoppierte.
Als Atalanta wieder die Augen aufschlug, sah sie Rosen, nichts als Rosen, deren süßen Duft sie vorher wahrgenommen hatte, im Augenblicke des Erwachens, schon im Traume, wenn sie auch nicht wusste, was sie geträumt hatte.
Eine Rosenlaube. Sie lag auf einer mit rotem Samt gepolsterten Bank. Ihre Glieder waren umhüllt von einem weißen Gazegewebe.
Sie sagte sich, dass sie nicht nur träume, denn sie fühlte sich ganz frei im Kopfe.
Wie sie den Kopf wandte, fiel ihr Blick auf eine zweite Polsterbank, und da sprang sie empor und eilte hin.
Auf dieser Bank lag Arno, jetzt ohne Vollbart, in einer weißen Toga. Er schlief fest und lächelte recht glücklich dabei.
Erst blickte Atalanta noch einmal zum Ausgang der Laube hinaus.
Eine Szenerie mit gemäßigt-tropischer Vegetation. Der Mandelbaum blühte, ein Orangenbaum trug große Früchte, dort plätscherte ein Springbrunnen im Marmorbassin, auf einer großen Wasserblume gaukelte ein bunter Falter.
Nach diesem einzigen Blick wandte sie sich wieder dem Schläfer zu, etwas angstvoll.
»Arno, Arno, wach auf!«
Und er fing denn auch gleich zu blinzeln an, gähnte herzhaft, streckte die Arme aus und dehnte den ganzen Körper, dann blickte er mit klaren Augen die Indianerin an.
»Aaah, das war aber einmal herrlich geschlafen! Ach, Atalanta, was ich alles geträumt habe! Von Sandhosen und Wasserhosen, und dann habe ich Dich in Soldatenhosen gesehen, und dann warst Du Leutnant und ich Korporal, und ich hielt Dich immer für meinen —«
Plötzlich erstarrte sein Blick. Mit gleichen Füßen sprang er auf und sah verstört um sich.
»Ja, wo bin ich denn — wie ist mir —«
»Fasse Dich, Arno, sei ganz ruhig, ich bitte Dich!«, flehte die Indianerin, wie sie es sonst nie getan hatte, seine Hand ergreifend.
Sie fürchtete natürlich wieder für seinen Verstand, den er einmal unbedingt verloren hatte.
Mit einem Ruck richtete er sich empor.
»Sorge nichts, Atalanta, ich bin ganz vernünftig«, lächelte er, und man merkte ihm dabei gar keinen Zwang an. »Ja, wie kommen wir denn hierher?«
Die Indianerin bekam gleich ein ganz glückliches Gesicht.
»Du weißt es nicht?«
»Keine Ahnung. Du?«
»Ich auch nicht. Was weißt Du?«
»Dass Du Atalanta, meine Frau, bist und ich lange Zeit ein Narr gewesen bin. Erst ein wirklicher und dann lange Zeit einer in der Einbildung.«
»Wo warst Du zuletzt?«
»In Mexiko, im Fort Chilinque, erst als Soldat, dann als Korporal.«
»Und ich?«
»Erst warst Du mein guter Kamerad, dann wurde ich Korporal, und dann wurdest Du mein Leutnant.«
»Und Du erkanntest mich nicht?«
»Keine Ahnung habe ich gehabt!«
»Wann erkanntest Du mich?«
»Als ich selbst erkannt wurde —«
»Von wem?«
»Von der Miss Marwood Morgan.«
»Und wie kam es weiter?«
»Gleich hinter mir in das Zelt des Generals tratest Du — nein, trat der Leutnant Giuseppe ein — und da hörte ich die Morgan nochmals schrein — ›die rote Atalanta, sie mordet mich!!‹ — und ich hörte es immer wieder, wie ich, rückwärts blickend, sie fliehen sah, und Leutnant Giuseppe hinterdrein —«
»Und da?«, fragte Atalanta, als jener eine Pause machte.
»Ja, Atalanta, da freilich fiel es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen — mein guter Kamerad und meine Frau waren ja eines — und ich wollte es doch nicht glauben — da freilich begannen sich meine Gedanken wieder zu verwirren —«
»Gut gut gut gut!! In der Arrestzelle warst Du?«
»Jedenfalls, denn ich —«
»Gut gut. Das weiß ich auch jedenfalls besser als Du. Und wie war das mit Professor Dodd?«
»Er kam herein, sagte irgend etwas, ich weiß gar nicht mehr was, ergriff meine Hand, ich fühlte einen kleinen Stich, verlor das Bewusstsein —«
»Weißt Du, wie Du hierher gekommen bist, wo Du Dich befindest, wie lange Zeit unterdessen vergangen ist?«
»Von alledem habe ich nicht die geringste Ahnung, wie neugeboren fühle ich mich.«
»Und ich mich auch!«
Und plötzlich fiel sie ihm um den Hals, jubelnd und lachend und — vielleicht auch etwas weinend zugleich.
»Arno, mein Arno, endlich, endlich habe ich Dich wieder!!«
Er ließ sich herzen, war noch zu verwirrt, um die Liebkosungen gleich richtig zu erwidern.
»Na ja, Atalanta«, sagte er dann, »aber nun berichte nur, wie ich damals —«
Schnell verschloss sie ihm den Mund.
»Hierüber jetzt kein Wort weiter, nicht wahr?«
»Na ja, ich gehorche, aber darf ich nicht wenigstens erfahren, wo wir hier sind?«
»Irgendwo auf der Erde, wo die Sonne scheint«, lachte sie lustig, jubelte sie, »und auch in finsterer Nacht würde mir die Sonne scheinen, denn ich habe Dich wieder!«
»Du hast mich lange genug als guten Kameraden gehabt!«, lachte auch er.
»Ja, aber ich ziehe mir dieses Verhältnis vor. Nun wollen wir uns einmal umblicken, wo wir uns eigentlich befinden.«
Hand in Hand traten sie aus der Laube. Die beiden hatten Erfahrung, und man braucht nicht gerade an Ort und Stelle gewesen zu sein, um den Charakter einer Landschaft, einer Szenerie beurteilen zu können.
Also Mandel- und Orangenbäume, Granatapfelbüsche, Blütengewächse, dazwischen Springbrunnen und Kioske, also doch wohl ein Garten, aber doch alles das fehlend, was wir in unserem Garten zu sehen gewohnt sind, auch in einem italienischen, in einem indischen, der von Europäern angelegt worden ist, das Regelmäßige —
»Das sieht ganz aus wie ein maurischer Garten«, sagte Atalanta sofort.
»Jawohl, wie ich einen solchen in Spanien gesehen habe, in der alten Alhambra.«
»Du warst dort?«
»Ja, ich habe einmal als Offizier einen Urlaub in Spanien verbracht. Dort gibt es ja noch viele maurische Gebäude und Gärten, aber die haben schon längst ihren speziell maurischen Typus verloren. Nur in und bei der Alhambra sind noch einige in ihrem ursprünglichen Charakter erhalten worden.«
»Nun siehst Du! Das habe ja auch ich gleich gesagt! Ich habe nicht von einem arabischen oder türkischen Garten gesprochen, sondern von einem maurischen. Ich meinte damit das Altarabische aus der alten Sarazenenherrlichkeit, aus ›Tausend und einer Nacht‹, welches Buch doch manchmal von wirklichen Künstlern, die erst Land und Leute und Historie studiert haben, ganz vorzüglich illustriert ist. Ja, das alles macht ganz den Eindruck eines altmaurischen Gartens.«
Und dieser Garten war, wie wir gleich angeben wollen, ungefähr dreihundert Meter im Quadrat und von einer mindestens zwanzig Meter hohen Mauer eingeschlossen.
»Untersuchen wir diese Mauer«, sagte Arno.
»Halt, bleibe erst einmal hier stehen! Wir müssen doch hierher getragen worden sein, irgend ein anderer Mensch muss doch Spuren seiner Anwesenheit hier zurückgelassen haben.«
Sichtbare Spuren aber waren kaum möglich. Denn alle Gartenwege waren, auch wieder ganz maurisch, mit Steinplatten belegt, getäfelt, reich mit Mosaik durchzogen, auf schneeweißem Grunde in den buntesten Farben, in den phantastischsten Ornamentmustern, aber auch Blumen und Tiere, besonders bunte Vögel darstellend. Schon diese Steintäfelung der Wege war eine künstlerische Leistung ersten Ranges.
Nein, hier konnte kein Fuß einen Abdruck erzeugen. Aber Arno sah, dass die Indianerin sich trotzdem niederbeugte, zuletzt auch niederkniete, und so die Laube umschlich, auch in dieser selbst noch einmal Umschau hielt. Sie vertraute ihrer Witterung.
»Nein, ich kann nichts wahrnehmen, dass hier andere Menschen gewesen sind!«, lautete dann ihr Bescheid.
»Und ich glaube, dass Dich Dein Spürsinn noch nicht verlassen hat.«
»Sicher nicht.«
Am blauen Himmel lachte die Sonne. Ungeblendet blickte die Indianerin mit weit geöffneten Augen hinein.
»Und das ist keine künstliche Sonne, das ist die wirkliche Mutter der Erde, da kann man mich nicht täuschen.«
»Was sagst Du da?! Eine künstliche Sonne?!«, staunte Arno.
»Nun, weißt Du denn gar nicht, in welcher Felsenwildnis Du damals gewesen bist, als Du zuletzt die Kaninchen jagtest?«, lächelte Atalanta.
»In dem Felsengebirge am Sklavensee war ich, in einem künstlichen Treibhaus, ja, das weiß ich.«
»Das wusstest Du sofort?«
»Nein, erst als ich herauskam. Da freilich ward mir alles klar. Na, Atalanta, Du hast mich ja nicht schlecht gefoppt!«, lachte Arno.
»Und was war denn das für eine Sonne, die Dir immer leuchtete?«
»Nun, was soll denn das für eine Sonne gewesen sein? Das war eben die Sonne, die von oben herein schien, es war eine oben offene Felsschlucht.«
»Es war eine künstliche Sonne.«
»Eine künstliche Sonne?!«, wiederholte Arno in immer größerem Staunen.
Atalanta berichtete ihm mit kurzen Worten. Er konnte nur immer staunen und den Kopf schütteln, bis er es als einfache Tatsache nahm.
»Du glaubst doch nicht, dass wir uns hier wieder im Felsengebirge an Deinem Sklavensee befinden, wieder in solch einem künstlichen Wintergarten eingesperrt sind?!«
»Ich glaube gar nichts, ich gebe mich nicht mit Vermutungen ab. Jetzt zunächst weiß ich bestimmt, dass das dort oben die wirkliche Sonne ist. Da lassen sich meine Augen nicht täuschen. Und ich habe noch einen anderen Beweis dafür, dass es kein elektrisches Licht ist. Und auch Du hättest schnell darauf kommen können, dass das keine richtige Sonne war.«
»Wie denn?«
»Siehst Du dort den Wasserstaub, den die Fontäne erzeugt? Siehst Du den Regenbogen in allen Farben schillern? Das ist zerlegtes Sonnenlicht. Elektrisches Licht lässt sich nicht in diese sämtlichen Grundfarben zerlegen. Und Du hattest in Deiner Felsenwildnis ebenfalls einen stäubenden Wasserfall. Da hättest auch Du diese Beobachtung machen können. Das heißt, das Fehlen der Regenbogenfarben hätte Dich stutzig machen müssen.«
Arno kraulte sich hinter dem Ohre. Er hätte sich nicht zu schämen brauchen. Diese Indianerin verlangte etwas gar zu viel von seiner Beobachtungsgabe und seinen Kenntnissen in der Physik. Wer denkt denn an so etwas, wenn man nun einmal das leuchtende und wärmende Ding, das da oben sich bewegt, für die Sonne hält und gar keine andere Ahnung haben kann.
Jetzt begaben sie sich nach der Mauer, mussten aber unterwegs immer wieder diesen herrlichen Garten anstaunen, in dem die Fruchtbäume und kleine Palmen und die wunderbarsten Blumen, vor allen Dingen Rosen, so wild wucherten, obgleich es doch durchaus keine Wildnis war.
»Hoffentlich finden wir keinen Ausgang aus diesem Paradiese!«, meinte Arno einmal.
»Dann aber hoffentlich auch etwas zu leben, wenn wir uns nicht mit Feigen, Orangen und Rosenduft begnügen wollen«, ging Atalanta sofort auf den Scherz ein.
»O, dafür wird Professor Dodd schon gesorgt haben.«
»Du denkst ja mit einem Male recht gut von diesem Herrn.«
»Ja, wenn man sich so fröhlich gelaunt fühlt wie ich mich jetzt, überhaupt wie neugeboren, dann hält man optimistisch auch seinen ärgsten Feind für seinen besten Freund. Und ich kann überhaupt eigentlich gar nicht sagen, dass wir in diesem Professor einen so argen Feind gehabt hätten.«
Atalanta blieb die Antwort schuldig. Ihrem Begleiter hatte es eben diese paradiesische Umgebung und die schöne Sonne angetan.
Sie hatten die Mauer erreicht. Sie war aus mächtigen Granitquadern zusammengefügt. Solche Mauern, die sich als Überreste von Gebäuden hier und da in Europa finden, von einem verschwundenen Geschlechte stammend, schreibt man, wenigstens der Volkssage nach, riesenhaften Zyklopen zu, nennt sie also zyklopische Mauern. Weil es schwer zu verstehen ist, wie gewöhnliche Menschen, die sicher noch keine technischen Hilfsmittel besaßen, die schon eine hohe Ingenieurkunst voraussetzten, solche ungeheure Steine in die Höhe brachten. Aber auch die alten Araber haben solche zyklopische Mauern ausgeführt, schon die alten Ägypter, ohne Benutzung einer Winde — mit Hilfe der schiefen Ebene. Für jede Steinlage musste eine neue Erdböschung hergestellt werden, auf welcher die Quader heraufgewälzt wurden. Diese Erdböschung, die schiefe Ebene, vertrat unser heutiges Gerüst.
Hier auf der Sonnenseite standen an der Mauer Pfirsichbäumchen, auch Wein rankte sich an Spalieren hinauf, aber nicht höher als etwa fünf Meter, dann kam noch gegen fünfzehn Meter ganz nackte Mauerwand.
Bemerkenswert war, dass alle Früchte in den verschiedensten Zuständen vorhanden waren. Es gab hier ganz reife Weintrauben, halbreife, noch ganz unreife — und dann zeigten sich auch schon wieder Blüten in den verschiedensten Entwicklungen, an ein und demselben Rebenstock. Auch die Fruchtbäume, Orangen, Feigen, Mandeln und andere, trugen reife Früchte und setzten schon wieder Blüten an, ein und derselbe Baum, während ein anderer nur unreife Früchte hatte, dafür aber auch schon wieder kleine Knospen zeigte.
Es ist dies arabische Gartenkunst. Wir haben ja dasselbe auch bei einigen Pflanzen erreicht, mit deren Kultur man sich intensiv beschäftigt hat, zum Beispiel bei Apfelsorten, bei Rosen, dass man zu jeder warmen Jahreszeit reife Früchte und Blumen hat. Und wenn man in jedem Monat Feuerbohnen steckt, so kann man auch zu jeder Zeit Blüten und reife Bohnen haben.
Aber die arabische Gartenkunst ist uralt. Als ganz Mitteleuropa noch ein sumpfiger Urwald war, stand Griechenland wohl schon auf höchster Kulturstufe, doch von einer regelrecht betriebenen Obst- und Blumenzucht wusste man dort nichts. Während der arabische Orient diese Liebhaberei schon seit Jahrtausenden wissenschaftlich betrieb.
Es sind nicht sehr viele Obst- und Blumensorten, welche die Araber züchten, diese aber haben sie auf eine Kultur gebracht, von der wir Abendländer noch gar nichts wissen. Ja, sehr viele Obstsorten möchte man fast rein menschliche Produkte nennen, die Natur selbst kann sie gar nicht erzeugen. So zum Beispiel die Datteln, die bei uns auf dem Markte liegen, die kann die Natur nicht selbst hervorbringen. Die Dattelblüten befruchten sich nicht von allein. Ein Araber klettert auf einen Baum, bricht eine männliche Blüte ab und tupft in jede weibliche hinein. So müssen alle die Millionen von Dattelbäumen in Afrika und Asien künstlich befruchtet werden, alle die Milliarden von Blüten. Sonst gibt es keine Früchte.
Und die Feigen, die wir essen — die wilden sind fast ungenießbar — werden nur reif durch den Stich einer besonderen Wespe, welche aber nicht von selbst an die unreife Feige geht. Die Wespennester werden von anderen Fruchtbäumen geholt und an den Feigenbüschen befestigt, die ausschlüpfende Wespe begeht einen Irrtum, wenn sie die unreife Feige ansticht, sie tut es nicht zum zweiten Male. Aber dieser eine Stich hat genügt, um die grüne Frucht zu einer krankhaften Entwicklung zu bringen, durch die sie für uns erst schmackhaft wird.
Atalanta hatte mit dem Fingernagel an dem Stein gekratzt.
»Hast Du ein Messer bei Dir, Arno?«
Der Gefragte musste erst nach einer Tasche suchen, entdeckte erst jetzt, dass er überhaupt unter der römischen Toga auch eine weiße Hose trug. In deren Taschen hatte er nur ein weißes, sehr feines Tuch, nichts weiter.
»Ich bezweifle auch sehr, dass Adam und Eva im Paradies Taschenmesser gehabt haben, mit oder ohne Korkzieher. Und überhaupt Taschen? Die hätten sich solche doch höchstens in die Haut hineinschneiden können.«
Atalanta hatte noch immer an dem Steine gekratzt.
»Ja, Granit ist es. Aber große Quader brauchen es nicht gerade zu sein. Es können ja auch aufgelegte Granitplatten sein.«
»Auf was aufgelegt?«
»Nun, vielleicht auf eine Basaltwand.«
»Basalt? Der Felsen, in den Du mich eingesperrt hattest, war Basalt.«
»Jawohl.«
»Das ganze Felsengebirge dort besteht aus Basalt.«
»Ganz richtig.«
»Du denkst immer noch, wir könnten dort am Sklavensee sein?«
»Ich nehme es nicht an, aber ausgeschlossen ist es nicht.«
»Hat es denn dort solch einen maurischen Garten gegeben?«
»Wenn ich das wüsste, dann könnte ich schon eher einen Schluss ziehen.«
»Ist denn dieser Professor Dodd, nicht sein Doppelgänger, ebenfalls dort —«
»Bitte, Arno, frage mich nicht, ich weiß von dem, was Du erfahren möchtest, gar nichts, bin so klug oder unwissend wie Du. Sehen wir uns mit nüchternen Augen weiter um.«
Umgeblickt hatten sie sich ja schon genug, aber gerade von dieser Stelle aus sahen sie zwischen den Bäumen und Büschen auf der anderen Seite des Gartens ein größeres Haus stehen.
Das interessierte sie jetzt natürlich am meisten, sie begaben sich sofort hin, unterwegs sich noch immer über die Schönheit dieses Gartens freuend, denn immer Neues bekamen sie zu schauen, immer herrlichere Blumenbüsche, immer reizendere Springbrunnen mit Gold- und Silberfischen. Nur in die verschiedenen Kioske wollten sie noch nicht blicken, um sich nicht von ihrem Ziele ablenken zu lassen.
»Hast Du gesehen, was da drin war?!«, rief Arno einmal, als sie an solch einem kleinen Tempel vorüber gekommen waren. »Das sah ja gerade aus, als ob da —«
»Komm nur, komm, erst das Haus! Ach, sieh nur dort den roten Goldregen, das ist ja entzückend!«
Die Indianerin war wie umgewandelt, machte aus ihrer Freude gar kein Hehl. Dabei war es auch merkwürdig, wie die beiden immer Hand in Hand gingen. Das hatten sie früher nie gemacht.
Es war ein einstöckiges Haus, also über dem Parterre noch eine Etage, man würde es für zwei Bürgerfamilien berechnet haben, nach arabischer Bauart, besonders wegen des flachen Daches, auf dem man spazieren gehen kann. Aber hier einmal die unvergitterten Fenster nach vorn heraus. Eben weil dieses Wohnhaus ja schon in einem vollständig eingeschlossenen Garten lag. Da konnte ja kein Fremder in die Fenster hineinsehen. Denn sonst führen bei den arabischen Häusern die Fenster nur nach dem inneren Hofe, der zum Gärtchen eingerichtet ist, in der Mitte immer ein Springbrunnen.
Sie traten durch die Tür. Alles orientalisch eingerichtet, unten wie oben, alles aufs kostbarste. Wenigstens die Teppiche, Kissen und Decken waren von den kostbarsten Stoffen. Andere Luxusgegenstände waren gar nicht vorhanden. Sogar die im orientalischen Hause sonst unentbehrliche Wasserpfeife, deren Schmuck immer den Rang und Reichtum des Besitzers verrät, fehlte. Aber die Badeeinrichtung war natürlich vorhanden, und nicht etwa in einer entlegenen, womöglich fensterlosen Kammer untergebracht, sondern sie nahm den Ehrenplatz im Hause ein, war gewissermaßen der Salon und danach ausgestattet. Oder es wäre eben kein orientalisches Haus gewesen. Im richtigen Gegensatze dazu war die Küche nur ein enges Verlies, in dem man sich kaum umdrehen konnte. Der Herd hatte mehrere Feuerstellen, einfache Löcher, oben angebracht, zur Aufnahme der Holzkohlen, offen brennend, die Hitze ging oben zum weiten, überdachten Schornstein hinaus. Darüber sah man auf Stellagen sehr viele ganz kleine Kesselchen aus Kupfer, spiegelblank geputzt. Über dem Ausguss zwei Hähne. Aus dem einen kam kaltes, aus dem anderen fast kochend heißes Wasser.
»Das gibt zu denken«, meinte Arno. »Wo wird dieses Wasser heiß gemacht?«
»Jedenfalls außerhalb dieses Hauses. Denn es stößt mit der Hinterwand gegen diese Gartenmauer. Aber aus dem heißen Wasser ist noch gar nicht zu schließen, dass wir draußen Wächter haben müssen.«
»Wieso nicht? Das Wasser muss doch erst heiß gemacht werden.«
»Das ist nicht unbedingt nötig, es könnte auch eine heiße Quelle in der Nähe sein.«
Sie sahen sich weiter um, gingen aus einem Zimmer ins andere. Ein Bett oder so etwas Ähnliches gab es im ganzen Hause nicht. Ganz mit Recht nicht. Der echte Orientale streckt sich zum Schlafen unausgekleidet auf dem Polster oder Teppich aus, auf dem er tagsüber kauert.
Sie öffneten die in die Wand eingelassenen oder in Nischen angebrachten Schränke mit schöngeschnitzten Holztüren. Der eine, in dem Zimmer neben der Küche, enthielt feinste Porzellanservice für die verschiedensten Mahlzeiten, auch viele Silberteller, Essbestecke und dergleichen.
Also hatten die ursprünglichen Bewohner dieses Hauses doch nicht nur mit den Fingern gegessen. Oder es war schon mit den neuen Bewohnern gerechnet worden.
In anderen Schränken fanden sie Wäsche und Toiletten, aber nur orientalische, solche, wie sie schon trugen.
»Wenn wir nur auch Lebensmittel finden«, sagte Arno.
»Hast Du Hunger?«
»Eigentlich nicht. Mir ist, als hätte ich vor dem Schlafengehen sehr gut gespeist, obgleich mir nichts davon bewusst ist.«
Da kam einmal ein anderes Zimmer, das europäisch eingerichtet war. Wenigstens war ein moderner Schreibtisch vorhanden. Während der echte Orientale im Hocken freihändig schreibt, eine Fingerspitze der linken Hand immer dort unter dem Papiere fortgleiten lässt, wo die Feder die Buchstaben malt.
Und dort an der Wand befand sich ein Telefon.
Sofort ging Atalanta hin, nahm den Hörapparat ab und drehte die Kurbel.
»Wer ist dort?«, erklang es fast augenblicklich.
»Hier die Gräfin Atalanta von Felsmark.«
»Einen Augenblick, Frau Gräfin.«
Eine halbe Minute verging, und dann schnarrte es wieder in dem Apparat.
»Hier Professor Dodd. Haben Sie gut geschlafen, Frau Gräfin? Ist auch Ihr Herr Gemahl schon erwacht?«
»Sie sind der Professor Dodd aus New York, der Arzt, der Operateur?«
»Jawohl, gnädigste Frau Gräfin, der Professor Benjamin Dodd aus der Water Street in New York, den Sie für den schlechtesten Kerl halten und der in Wirklichkeit der denkbar beste Mensch ist, der immer nur Ihr Gutes will, wie das jedes anderen Menschen — hähähähä.«
Das hämische Lachen hinterher war gar nicht nötig. Jedes Wort schien aus Spott und Hohn zusammengesetzt zu sein.
»Wo befinden wir uns hier?«
»In einem Paradiese, soweit ein solches auf Erden möglich ist.«
»Und wo liegt dieses Paradies?«
»Das raten Sie einmal!«
»Sie wollen es uns nicht sagen?«
»Nein, das herauszubekommen soll Ihrem Scharfsinn überlassen bleiben. So haben Sie immer etwas zu tun, falls Ihnen doch einmal Langeweile ankommt, obgleich das nicht so bald der Fall sein wird, jetzt, da Sie Ihren geliebten Gatten immer bei sich haben, und nicht nur als einen guten Kameraden — hähähä.«
»Weshalb haben Sie uns bewusstlos gemacht?«
»Um Sie und Ihren Gatten hierher zu bringen.«
»Weshalb haben Sie uns hierher gebracht?«
»Hatten Sie, Frau Gräfin, nicht schon früher einmal den Entschluss gefasst, sich mit Ihrem Gatten an einen Ort zurückzuziehen, wo niemand Sie finden kann, wo Sie beide für die Welt so gut wie tot sind?«
»Ja, das wollte ich allerdings. Nur zufällige Verhältnisse ließen mich meinen Entschluss nicht ausführen.«
»Und wo lag und liegt dieser Ort?«
»Das werde ich natürlich nicht verraten.«
»Mir können Sie es ganz ruhig sagen.«
»Nein.«
»Sie haben solch einen Ort noch gar nicht gewusst, sondern sich erst einen suchen wollen.«
»Das ist Ihre Meinung.«
»Nein, das ist von mir Gewissheit. Sie selbst haben mir das erklärt.«
»Wann denn?«
»In der Hypnose.«
»Was, Sie hätten mich hypnotisiert?!«
»Jawohl, während Sie bewusstlos waren. Gerade in diesem Zustande ist es sehr leicht, jeden Menschen in Hypnose zu bringen, auch wenn er sonst gar nicht dafür empfänglich ist. Da haben Sie mir auch Ihre heimlichsten Gedanken offenbart.«
Die Indianerin war leise zusammengezuckt, furchtbar drohend flammten ihre Augen auf.
»Ungeheuer, das sollen Sie noch büßen!!«
»Bitte, ich bin kein Ungeheuer, da ist gar nichts Ungeheuerliches dabei gewesen. Ihre heimlichsten Gedanken waren so rein wie die eines Engels nicht keuscher sein können!«
»Immerhin, das ist ein schändlicher Missbrauch der Willenlosigkeit, in die Sie mich durch höllische Mittel versetzt haben!«
»Ich erkläre Ihnen aber auf mein Ehrenwort, dass bei dem hypnotischen Experiment jemand zugegen war, der als ein Schutzgeist über Sie wachte. Es ist nicht gerade schmeichelhaft für mich, dass ich das betone, muss der Wahrheit die Ehre geben, ich bin gezwungen dazu.«
»Wer war das?«
»Ein Mahatma.«
»Wer?!«
»Einer von jener geheimen Gesellschaft, die nach dem Glauben der Theosophen und verwandten Geister auf dem Gipfel des Himalaja haust, von dort aus die Geschicke der Menschheit lenkt oder doch ihre Entwicklung fördert.«
»Sie wollen doch nicht sagen, dass auch Sie dieser geheimen Gesellschaft angehören?!«
»Jawohl, auch ich bin ein Mitglied davon. Allerdings nur ein dienendes, ein ganz untergeordnetes. Ich habe mit den Kenntnissen, die man mir anvertraut hat, praktisch in der Welt tätig zu sein, um meinen Mitmenschen zu helfen, als Arzt und Chirurg. So, nun wissen Sie endlich, wer ich bin.«
Atalanta wusste nicht, was sie davon denken sollte.
Entweder es war wirklich so — oder dieser Professor Dodd wollte wieder einmal einen Schwindel in die Welt setzen, wie er es so liebte.
»Was ist das wieder für ein neuer Schwindel?«, fragte sie denn auch gleich direkt.
»Was für ein neuer Schwindel? Wann habe ich Sie denn schon einmal angeschwindelt?«
»Wenn nicht mich allein, dann die ganze Welt.«
»Wann habe ich schon einmal die ganze Welt beschwindelt?«
»Nun, zum Beispiel damals mit der imitierten Bundeslade haben Sie es doch versucht.«
»Ich weiß, was Sie meinen. Das ging nicht von mir, sondern von meinem Bruder aus, der dafür ja auch genügend bestraft worden ist.«
»Jener Señor Tenorio, wie er sich mir gegenüber zuletzt nannte, ist Ihr Bruder?«
»Habe ich Ihnen nicht einmal ganz offen gesagt, dass ich solch einen Bruder habe?«
In der Tat, das hatte er!
»Aber jener Señor Tenorio behauptete immer, dass er selbst der Professor Dodd aus New York sei, der überall sein könne, also auch im Felsengebirge an meinem Sklavensee.«
»Was kann ich dafür, wenn mein Bruder ein Schwindler ist? Wegen dieser seiner Flunkerei ist er ja bestraft worden, man hat ihn nach einer einsamen Insel verbannt.«
»Haben Sie immer gewusst, dass Ihr Bruder in dem hohlen Felsen an meinem Sklavensee haust?«
»Immer.«
»Sie haben aber doch getan, als ob Ihnen erst damals die Ahnung aufgegangen wäre, jener rätselhafte Mann, der sich für Sie ausgibt, könne Ihr Bruder sein.«
»Ja, gnädige Frau Gräfin«, lachte es in dem Telefon, »ich kann doch nicht jeden fremden Menschen in die Geheimnisse meines Hauptbuches blicken lassen. Welcher Geschäftsmann tut denn das, wenn er nicht ein ausgemachter Narr ist!«
Da hatte er wiederum recht!
»Haben Sie mir nicht mehrmals nach dem Leben getrachtet?«
»Nach Ihrem Leben? Wann denn?«
»Oder versuchten Sie nicht, mich in Ihren Besitz zu bringen, ebenso wie den Grafen von Felsmark, noch ehe er mein Gatte war.«
»Wann denn?«
»Nun, zum Beispiel, als ich in dem Wagen saß, in New York, und plötzlich füllte sich der Wagen mit einem betäubenden Duft. Und dann die vergiftete Torte, die uns in Scheintod versetzen sollte.«
»Mit beiden Fällen hatte ich nichts zu tun, das ging alles von der Miss Marwood Morgan aus.«
Atalanta war sofort geneigt, ihm das zu glauben, und ebenso der mithörende Graf. Denn dass es damals geglückt war, den Grafen scheintot unter die Erde zu bringen, das war ja direkt von jenem Weibe ausgegangen, darüber bestand ja gar kein Zweifel.
»Aber Sie müssen doch zugeben, dass Sie es versucht haben, mich auf Ihren Seziertisch zu bringen.«
»Gewiss. Das heißt, nicht gerade sezieren wollte ich Sie, sondern Ihren anatomischen Körperbau nur untersuchen. Habe ich denn aber da Ihrem Grafen nicht einen offenen Vorschlag gemacht, wie das zu machen sei?«
In der Tat, dieser Mann war ganz offen vorgegangen!
»Aber Ihr Bruder hat uns doch zu betäuben versucht.«
»Ja, gnädige Frau Gräfin, hier allerdings liegt eine Schuld von mir vor, das gebe ich ehrlich zu. Als ich hörte, dass Sie beide nach dem Sklavensee gingen, bat ich meinen Bruder, dass er Sie beide in meine Gewalt bringen solle, wenn auch nur einmal für einen Tag, für eine Stunde. Mein Bruder ist viel zu rigoros gegen Sie vorgegangen. So hatte ich das nicht gemeint. Mein Bruder ist denn auch dafür bestraft worden. Und ich will Ihnen gestehen, dass auch mir für meine Absicht eine gar harte Strafe zudiktiert worden ist, die ich bereits verbüßt habe.«
»Gut, ich glaube es Ihnen. Und weshalb haben Sie uns nun betäubt und hierher gebracht?«
»Auf Befehl jener Mächtigen, nach irdischen Begriffen sogar Allmächtigen, denen auch ich zu gehorchen habe. Ihr Gatte, den Sie gefangen hielten, war Ihnen entflohen, hatte sich zum Kriege gegen Mexiko anwerben lassen. Das offenbarte Ihnen Sirbhanga Brahma, Ihnen schon die Zukunft enthüllend, er riet Ihnen, sich ebenfalls den Soldaten einreihen zu lassen. Sie taten es.
Alles ging gut, Sie waren schon glücklich, an der Seite Ihres Gatten als treuer Kamerad weilen zu dürfen, ohne dass er Sie erkannte.
Da wurden er und Sie von anderer Seite erkannt. Das hatten jene Allmächtigen, die in die Zukunft wie in ein offenes Buch blicken, schon vorher gewusst, auch was Ihnen beiden sonst noch für schwere Verwicklungen drohten. Wiederum wären Sie beide getrennt worden, wiederum wäre Unglück über Unglück über Sie gekommen.
Das Schicksal ist jedem Menschen von vornherein bestimmt, obgleich er nicht etwa dessen Sklave ist. Lassen Sie mich nicht ausführen, wie das zu verstehen ist. Ich verstehe es übrigens selbst nicht. Kurz, hier lag einmal ein Fall vor, dass Ihr Schicksal von anderer Seite aus geändert, das Unglück von Ihnen abgewendet werden konnte. Durch freiwillige Entsagung ist so etwas nämlich möglich.
So erhielt ich als die Person, welche man für so etwas als die geeignetste hielt, von jener Gesellschaft den Befehl, Ihnen zu Hilfe zu kommen. Ich bekam ein Mittel, welches mir selbst bisher ganz unbekannt gewesen, um einen Menschen durch einen kleinen Nadelstich sofort in Bewusstlosigkeit, in Scheintod zu versetzen.
Ich habe es nach Gebrauch gleich wieder abliefern müssen.
Ich reiste sofort nach dem Kriegsschauplatze, hatte mir die nötigen Vollmachten besorgt, kam im rechten Augenblick, keine Sekunde zu früh, aber auch nicht zu spät. Wie das Weitere gekommen ist, wissen Sie ja selbst.«
»Gar nichts wissen wir, wir sind ja ohne Besinnung gewesen.«
»Ich meine: Sie wissen doch, wie ich Ihnen die Besinnung raubte.«
»Dann haben Sie uns hierher gebracht?«
»Ja.«
»Und wo befinden wir uns hier?«
»Frau Gräfin, ich stehe Ihnen zur Verfügung, ich muss es. Gern tue ich es nicht, das sage ich offen. Ich, der ich mit Leib und Seele einer Wissenschaft angehöre, täte lieber anderes als mich mit Ihnen zu unterhalten. Aber ich muss Ihnen jederzeit Zeit zu Diensten sein, es ist mir befohlen worden. Und wenn Sie durchaus wissen wollen, wo Sie sich befinden, so muss ich auch das sagen. Aber wozu wollen Sie das? Ist es nicht viel hübscher, wenn Sie es nicht wissen, wenn Sie Ihren eigenen Scharfsinn anstrengen müssen und praktische Versuche anstellen, um das herauszubekommen?«
»Sie haben nicht so unrecht. Nur eine Frage möchte ich stellen.«
»Bitte?«
»Befinde ich mich innerhalb der Felswände an meinem Sklavensee?«
»Frau Gräfin! Überlegen Sie es sich doch! Was für einen Monat haben wir?«
»November.«
»Nun bedenken Sie doch! Wenn Kalifornien, die Gegend um Frisco herum, auch keinen eigentlichen Winter kennt, so herrscht doch selbst dort im November kein solch herrliches Sommerwetter, wie Sie es hier haben. Und Ihr Sklavensee liegt durchaus nicht in so einer günstigen Gegend.«
»Hm, da haben Sie auch wieder recht, aber — nun gut, ich werde es selbst erforschen. Was hat man nun mit uns vor?«
»Sie werden jetzt hier genau so gefangen gehalten, wie Sie einst Ihren Gatten zwischen Mauern gefangen gehalten haben.«
»Und warum das?«
»Weil Sie von dem großen Unglück verschont bleiben sollen, das Ihnen droht.«
»Was ist das für ein Unglück?«
»Das weiß ich selbst nicht. Sie können es sich aber doch leicht selbst vorstellen.«
»Inwiefern?«
»Nun, Sie sind doch eine steckbrieflich Verfolgte, haben noch eine zehnjährige Strafe abzusitzen, und so weiter, und so weiter.«
»Deshalb also hält man mich hier gefangen.«
»Ja.«
Und das alles geht von jener geheimnisvollen Gesellschaft aus?«
»Ja.«
»Weshalb bekundet diese Gesellschaft solche Teilnahme an mir?«
»Weil Sie dadurch, dass Sie in die Geheimnisse dieser Gesellschaft eingedrungen sind, erst in solche fatale Lagen gekommen sind.«
»Das ist aber doch nicht die Schuld dieser Gesellschaft.«
»Ganz gewiss! Sie hätte ihre Geheimnisse besser wahren sollen, dass sich kein fremder Mensch ihnen auch nur nähern kann. Die Gesellschaft hat geduldet, dass ein Abtrünniger sein Laboratorium an einem Orte errichtete, der schon einem anderen Menschen — also Ihnen — gehörte. Dass Sie alles dransetzen, um diesen Ort als Ihr Eigentum zu behaupten und auch alles zu ergründen, was sich darauf befindet, kann man Ihnen nicht verdenken. Sie haben es fertig gebracht. Zuletzt hat mein ungehorsamer Bruder Ihnen selbst dabei geholfen, Ihnen vielerlei gezeigt. Dadurch aber sind Sie in solche fatale Lagen gekommen, dass Sie zuletzt wie ein Raubtier verfolgt wurden. So fühlt sich die Gesellschaft daran schuldig. Deshalb lässt sie Ihnen nun ihren Schutz angedeihen.«
»Hm, dieser Grund lässt sich hören. Es hat alles Hand und Fuß, wie Sie da sagen. Deshalb also werde ich hier gefangen gehalten.«
»Nennen Sie das eine Gefangenschaft in diesem Paradiese in Gesellschaft Ihres Gatten?«
»Auch in einem Paradiese kann man gefangen sein. Doch lassen wir das jetzt. Wie lange sollen wir hier drin bleiben?«
»Bis die Gefahr, die das Schicksal Ihnen bestimmt hat, vorüber ist.«
»Und wie lange währt das?«
»Das weiß ich nicht. Vielleicht für immer.«
»Zeit meines Lebens?«
»Ja. Vielleicht.«
,Dafür danke ich. Ich werde alles aufbieten, um von hier zu entkommen.«
»Das können Sie tun, wie Sie wollen.«
»Sie sagten vorhin doch, um meinem Geschick, dem Unglück zu entgehen, müsste ich freiwillig entsagen.«
»Das dürfen Sie nicht so wörtlich nehmen. Es steht Ihnen frei, alle Mittel anzuwenden, um durch oder über die Sie einschließenden Mauern hinwegzukommen. Niemand wird Sie daran hindern. Erst wenn Sie heraus sind, wird man Ihnen von anderer Seite Vorstellungen machen, dass Sie doch lieber in Ihrer Gefangenschaft bleiben, in Ihrem Paradiese.«
»Weshalb macht man mir diese Vorstellungen nicht gleich jetzt?«
»Es ist nicht nötig. Auch sollen Sie Zerstreuung haben, sollen sich bemühen, Ihrem goldenen Käfig zu entfliehen. Ich bin selbst höchst gespannt darauf, ob Sie das fertig bringen?«
»Gut, ich verstehe. Jetzt will ich auch gar nicht mehr wissen, wo ich mich befinde. Ich will es selbst herausbekommen. Wie ist es mit der Ernährung? Gibt es hier nur paradiesische Früchte?«
»Durchaus nicht. Rufen Sie nur immer per Telefon an, wenn Sie etwas wünschen. Sie können fertige Speisen bekommen oder auch rohes Fleisch und alles andere, was Sie sich selbst zubereiten.«
»Auch sonst kann ich verlangen?«
»Was Sie wollen. Was Ihnen zu liefern möglich ist.«
»Zum Beispiel — Bücher?«
»Jedes Buch, das auf der Erde existiert, wird Ihnen, wenn nicht sofort, in möglichst kürzester Zeit verschafft.«
»Wie wird uns das zugestellt?«
»Sie haben drei Klappen zu Ihrer Verfügung. Die eine ist über dem Schreibtisch, die andere in der Küche, die dritte in dem Nebenzimmer, in dem Sie wohl speisen werden. Sobald das Bestellte in der Mauernische bereit steht, ertönt ein Klingelzeichen —«
»Aha, solche Klappen — die kenne ich schon! Wer besorgt diese Klappen?«
»Die Diener, die Ihnen zur Verfügung stehen.«
Bekommen wir diese zu sehen?«
»Nein, niemals!«
»Weshalb nicht?«
»Weil — es ist besser so. Sie könnten einmal neugierige Fragen an sie stellen.«
»Eventuell unter Anwendung von Hilfsmitteln, nicht wahr? Sie sind sehr vorsichtig!«
»Nicht ich, sondern der Bevollmächtigte jener Gesellschaft, dem auch ich unterstehe.«
»Wer ist das?«
»Das werden Sie nicht erfahren, es ist auch gar nicht nötig.«
»Sirbhanga Brahma?«
»Nein, der ist es nicht, das kann ich Ihnen versichern.«
»Mister Dollin?«
»Wer ist das?«
»Den sollten Sie nicht kennen?«
»Nein, faktisch nicht.«
»Wo befinden Sie selbst sich eigentlich?«
»Sie denken wohl, ich stehe direkt hinter den Mauern?«
»Wo sonst?«
»Ich befinde mich bereits wieder in New York in meiner Klinik.«
»Auf Ehre?«
»Auf Ehre!«
»Da müssen wir aber doch gar lange geschlafen haben.«
»Haben Sie auch.«
»Wie lange?«
»Versuchen Sie das selbst zu ergründen.«
»Dann ist jetzt vielleicht also gar nicht mehr November?«
»Möglich. Strengen Sie nur selbst Ihren Scharfsinn an. Oder wollen Sie es durchaus wissen? Dann allerdings muss ich es Ihnen offenbaren.«
»Nein, nein, es ist schon gut so. Auch Sie können wir immer sprechen?«
»Immer.«
»Sie sind durch Telefon mit hier verbunden?«
»Ja, durch drahtlose Telefone. Haben Sie sonst noch einen Wunsch von mir persönlich? Sonst bitte ich Sie, mich zu entlassen. Ich habe gerade ein interessantes Experiment vor. Sind Sie mit der Hauseinrichtung zufrieden? Genügt Ihnen die orientalische? Oder wünschen Sie vielleicht Betten? Etwa ein zweischläfriges Himmelbett, hähähä?«
Erst nach längerer Zeit fiel der Professor in seinen hämisch-höhnischen Ton zurück.
»Ich danke, die Polster genügen schon.«
»Dann wünsche ich Ihnen viel Amüsement, hähähä. Wissen Sie, worüber ich mich so freue?«
»Nun?«
»Sie beide mussten nur deshalb so lange in todesähnlichem Schlafe liegen, weil während dieser Zeit an Ihrem Herrn Gemahl noch einmal eine Kur vollzogen wurde — eine Kur, die auch mir etwas ganz Neues war. Also recht viel Amüsement wünsche ich, hähähä, und Sie können ganz unbesorgt sein, Sie werden weder belauscht noch beobachtet, hähähä.«
Das Telefon klingelte ab.
Mit einem noch dunkleren Gesicht, als ihr die Natur gegeben, wandte sich die Indianerin ihrem Gatten zu.
»Was sagst Du zu alledem, Arno?«
»Ja, was soll ich dazu sagen?«, meinte dieser. »Da wollen wir vor allen Dingen einmal sehen, ob auch wirklich —«
Wohl nur, um seine Verlegenheit zu bemänteln, drehte auch er gleich noch einmal die Kurbel.
»Sie wünschen?«, fragte alsbald wieder jene erste Stimme, die dem Professor vorausgegangen war.
»Ich hoffe, hier ist das Rauchen erlaubt?«
»Gewiss doch.«
»Aber ich habe nichts zu rauchen.«
»So bestellen Sie doch.«
»Also ein paar gute Zigarren, gleich eine Kiste.«
»In fünf Minuten wird das Klingelzeichen ertönen. Dort im Schreibzimmer?«
»Gut, ich werde hier warten.«
»Haben Sie sonst gleich noch Wünsche?«
»Nun, dann noch eine gute Flasche Wein — Champagner — eine Flasche Mum.«
»Wird besorgt.«
»Halt!«, rief Atalanta ebenfalls ins Telefon.
»Sie wünschen?«
»Ich möchte doch noch einmal den Herrn Professor sprechen.«
»Ich werde ihn sofort benachrichtigen.«
Nach einer halben Minute meldete sich der Professor wieder.
»Sie wünschen, bitte? Ich muss bitten, wenn es mir auch durchaus nicht angenehm ist, dass Sie mich nochmals von meiner Arbeit abrufen. Da sehen Sie wieder, was im Grunde genommen ich doch für ein offener, ehrlicher Charakter bin.«
»Ja, ich sehe es immer mehr ein. Nur noch eine Frage habe ich an Sie.«
»Und?«
»Was wird unterdessen aus meinem Sklavensee?«
»Er steht unter dem Schutze Ihrer Leute, die Sie dort zurückgelassen haben. Es darf kein Quäntchen Gold von fremden Händen herausgefischt werden, sonst wird der Stellvertreter der Gesellschaft schon sorgen, dass die Boote wieder versinken. Ach, ja richtig, Mister Dollin heißt dieser Mann. Jetzt weiß ich, wen Sie vorhin meinten.«
»Wissen diese Leute, wo ich mich befinde?«
»Es ist ihnen wenigstens gesagt worden, dass Sie und Ihr Gatte im Schutze der Gesellschaft stehen und gut aufgehoben sind.«
»Was sagen sie dazu?«
»Was sollen sie dazu sagen? Die sind wohl zufrieden, dass alles so gekommen ist.«
»Was sagt Mister Littlelu, Kapitän Hagen dazu? Sind diese überhaupt noch dort?«
»Gewiss. Sonst hätte ich es wohl erfahren, Sie würden von so etwas wahrscheinlich auch benachrichtigt werden.«
»Ich meine, dass diese mich nicht etwa suchen.«
»Ausgeschlossen. Es ist alles so, wie ich ihnen sagte.«
»Das genügt mir. Weiter wollte ich nichts erfahren. Auch nicht, was sonst in der Welt passiert.«
»Nein, nein, das sollen Sie auch nicht, Sie sollen fernerhin in Ruhe und Frieden leben, wie Sie es sich immer gewünscht haben, was Sie aber durch eigene Kraft nicht einmal dort in den einsamen Felsenhöhlen am Sklavensee erreichen konnten. Und das ist auch der Grund, weshalb Sie mit keinem Ihrer Diener persönlich in Berührung kommen werden.«
»Hiermit bin ich sehr einverstanden. Ich danke Ihnen, Herr Professor. Bevor ich Sie nochmals anrufe, werde ich immer erst fragen, ob Sie auch Zeit für mich haben und gern kommen. Schluss.«
Es waren ja noch längst keine fünf Minuten vergangen, da erklang schon ein anderes Klingeln, und gleichzeitig sprang über dem Schreibtisch eine Wandklappe auf.
In der Nische standen drei Zigarrenkisten, ein Eiskübel mit einer Flasche Champagner, zwei geschliffene Gläser, auch ein Champagnerbrecher lag daneben.
»Aaaah!!«, frohlockte Arno, als er die Kisten näher untersucht hatte. »Siehst Du, Atalanta, in dem Gefängnisse, das Du mir gabst, hast Du mich nicht so gut versorgt. Du hast mich Kastanienblätter rauchen lassen! Ich bin eigentlich kein nachträglicher Mensch, aber das werde ich Dir nie vergessen! Und sogar Champagner! Was hast Du mir zu trinken gegeben? Warmes Wasserleitungswasser, und ich musste mir einbilden, es wäre Quellwasser, frisch aus dem Felsen herausgekommen. Wahrhaftig, eine Flasche Mum! Und ich hatte das nur im Scherz so hingesagt. Du, Atalanta, in diesem Paradiese bleiben wir! Daraus lassen wir uns nicht so leicht vertreiben. Übrigens ist uns ja auch gar kein Apfel verboten worden, sondern eher im Gegenteil — der Champagner aber ist noch recht warm, der muss noch länger im Eise stehen.«

Sie warteten nicht, bis er kalt geworden war. und merkwürdigerweise vergaß Arno sogar ganz, sich eine Zigarre anzustecken.
Sie wussten wohl selbst nicht, wie sie plötzlich wieder hinaus in den Garten gekommen waren, Hand in Hand nebeneinander herschreitend.
Sie sprachen nicht über die Vergangenheit, dachten nicht an die Zukunft — versenkten sich ganz in die Gegenwart, in das Glück der gegenseitigen Nähe.
Eine lauschige Bank, von hohen, blütenreichen Rosenbüschen überwuchert, lud zum Sitzen ein. Das schmelzende Locken einer Nachtigall forderte sie noch besonders dazu auf. Sie setzten sich, fuhren aber schon im nächsten Moment wieder empor. Und doch war es zu spät, sie waren beide schon pudelnass. Aus den Rosen über ihren Köpfen war eine tüchtige Wasserdusche auf sie herabgeregnet.
»Was war denn das?!«, lachte Arno.
Nun, das hatte man bald untersucht und erkannt. Wohl waren die Rosen und Zweige echt, außerdem aber gingen auch noch grüne Gummiröhren hinauf, die in kleinen Brausen endeten.
Eine Vexierbank mit Wasserspiel. Wie man so etwas früher besonders am französischen Hofe liebte, wie es noch heute in den Gärten von Versailles zu sehen ist. Aber auch in den orientalischen Haremsgärten gibt es dergleichen.
Es hatte nichts zu sagen. Die Sonne brannte tüchtig, bald waren ihre leichten Gewänder wieder getrocknet. Sie entdeckten noch andere Bänke, auf die man sich ebenfalls nicht setzen durfte, ohne von oben oder von unten nass zu werden, und jetzt lag der Reiz darin, dieser Dusche noch rechtzeitig zu entgehen. Aber da gab es noch andere Fallen, in die sie ahnungslos hineinliefen.
Am Wege stand eine Figur, ein Knabe, ein Cupido, präsentierte den Vorübergehenden eine Schale mit schönen Früchten, scheinbar natürlichen. Als man aber in Armweite des losen Knaben gekommen war, drehte sich die Figur auf dem Postament und wandte dem Betreffenden, der nach den Früchten greifen wollte, den Rücken.
Nun, zwei Personen konnten ihn doch leicht überlisten. Ja, er ließ sich auch eine der prächtigen Birnen von der Schale abnehmen, in demselben Augenblick aber spritzte es auch aus der Figur nach allen Seiten hin, wiederum waren die beiden ganz durchnässt.
Und solcher Überraschungen gab es noch gar viele.
Wieder ließ sich das süße Locken und schmelzende Flöten eines Vogels vernehmen. Wir haben vorhin gleich von einer Nachtigall gesprochen.
»Was ist das für ein Vogel?«, fragte Atalanta aufmerksam.
»Es klingt bald wie eine Nachtigall, aber doch wieder ganz anders.«
»Du meinst eine Nachtigall deiner Heimat?«
»Ja.«
»Und ich dachte erst an eine amerikanische, an eine indianische Whippoorwill, es ist aber doch wieder ein ganz anderer Schlag.«
Sie näherten sich dem Busche, ein unscheinbarer Vogel flatterte heraus, aber schon war er von Arno erkannt worden.
»Eine chinesische Nachtigall!«
»Wirklich? Du irrst Dich nicht?«
»Nein, wir hatten einige zu Hause, jetzt erkenne ich sie auch gleich am Lied.«
»Die kommt nur in China vor?«
»O nein, in ganz Asien, soweit es nicht zu kalt ist. Am häufigsten ist sie in Indien.«
Ein prachtvoller Schmetterling von Spannengröße gaukelte über den Blumen.
»Ich habe eine Schmetterlingssammlung gesehen, die sämtliche Exemplare von ganz Amerika enthielt, von Kanada an bis hinab nach dem Feuerland, und ich weiß bestimmt, dass diese Art nicht darunter war.«
Über den Weg lief ein riesenhafter, in allen Farben schillernder Käfer, der vorn am Kopfe eine Art Rüssel hatte, den er nach allen Richtungen bewegen konnte.
»Ein indischer Elefantenkäfer, den kenne ich!«, rief Atalanta sofort.
Die beiden sahen sich an.
»Sollten wir hier in Indien sein?«
»Möglich wäre es schon. Wenn die uns einen Monat haben schlafen lassen. In dieser Zeit kommt man von der Westküste Amerikas nach Indien.«
»Wahrhaftig, dort auf dem Wasser des kleinen Teiches schwimmen Lotosblumen!«
»Aber das dort ist wieder eine nördliche Pflanze.«
»Es gibt in Indien Regionen genug, wo sich die südliche Fauna und Flora mit der nördlichen vermischt. Denke nur an die südlichen Abhänge des Himalaja.«
»Kannst Du nicht nach der Sonne eine geografische Ortsbestimmung machen, auch ohne Uhr und sonstige Instrumente?«, fragte Arno. »Es ist so etwas doch wohl möglich, und Du hast Dich doch in so etwas ausgebildet.«
Die Indianerin blickte gegen die Sonne und beobachtete den Schatten von Bäumen.
»Ja, so etwas ist möglich, aber dazu gehören astronomische Kenntnisse und praktische Kniffe, die ich nicht besitze. Nein, ohne einen ganz genau gehenden Chronometer vermag ich keine Ortsbestimmung zu machen.«
»Du kannst nicht einmal bestimmen, auf welcher Hälfte der Erdkugel wir uns befinden? Auf der westlichen oder östlichen, auf der nördlichen oder südlichen?
»Nicht einmal das! Das ist alles gar nicht so einfach, sobald man nicht weiß, in welcher Zeit man lebt. Da nützt alle Beobachtung der Sonne und des Schattens nichts.«
»Aber mit der Zeit muss man das doch erkennen können.«
»Ja und nein. Wenn es hier jeden Nachmittag regnet, wenn es womöglich auch täglich ein Gewitter gibt, so können wir annehmen, uns in Ostindien zu befinden, in den Sommermonaten. Kommt ein halbes Jahr lang gar kein Gewitter, so kann man auf Mittelamerika schließen, etwa auf Ecuador, wo man noch nie einen Blitz gesehen hat. Aber das können auch alles Trugschlüsse sein.«
Die Indianerin pflückte eine Orange und schleuderte sie mit einer Kraft empor, dass die gelbe Kugel kaum noch zu sehen war.
»Hm, gegen ein Hindernis ist sie nicht gestoßen!«, sagte sie dann, als die Orange aus mindestens hundert Meter Höhe wieder herabgesaust kam.
»Gegen was für ein Hindernis?«
»Ich dachte immer noch an einen künstlichen Himmel.«
»An einen künstlichen Himmel?«
»Arno, ich will Dir später alles ausführlich erzählen, wenn Du noch nicht weißt, wie auch Deine Felsenwildnis begrenzt war.«
Sie pflückte eine andere Orange und warf sie über die Mauer.
»Die ist hinüber gekommen, so sieht es wenigstens aus.«
»Selbstverständlich hast Du sie hinübergeworfen.«
»Nun, das ist noch nicht so gewiss!«
»Wieso nicht?«
»Es kann auch etwas anderes gewesen sein. Warte nur, Du wirst schon sehen. Ob wir nicht da hinauf können?«
»Nichts leichter als das. Wir fertigen und einfach eine Leiter, oder schon eine Stange genügt, aus mehreren jungen Baumstämmen zusammengebunden, da klettern wir hinauf. Ich begreife überhaupt nicht, wie es so schwer sein soll, von hier zu entkommen.«
»Ja, eben das kommt mir verdächtig vor, diese scheinbare Einfachheit. Die werden schon ihre Vorsichtsmaßregeln getroffen haben. Aber es ist nicht nötig, dass wir erst eine Leiter oder auch nur eine Stange fertigen, dazu einige unschuldige Bäume knicken, ich weiß ein schnelleres Mittel. Warte hier wenige Minuten.«
Sie eilte davon, in der Richtung nach dem Hause.
Arno blickte unterdessen zu der Mauer empor, erwägend, was man dort oben wohl zu schauen bekäme, nach der anderen Seite hin.
Übrigens musste er sehr von seiner Turnkunst überzeugt sein. Von hundert Menschen wäre vielleicht kein einziger auf die Idee gekommen, dass es möglich sei, an der glatten Wand hinaufzugelangen, wenigstens nicht einfach an einer Stange, die man aus Bäumchen zusammenband, denn diese Mauer war mindestens zwanzig Meter hoch. Das ist fast die Höhe eines vierstöckigen Hauses. Da überlegt man doch sehr, ehe man an einer so primitiv gefertigten Stange hinaufklettert.
Da kam Atalanta schon wieder zurück, unter dem Arm ein großes Seilbündel, in der Hand einen starken Eisenhaken.
»Ich wollte erst eine starke seidene Decke in Streifen schneiden und zusammenbinden. Ehe ich diesen Vandalismus beging, fiel mir ein, einmal anzufragen, ob ich nicht ein geeignetes Seil bekommen könnte. Jawohl, sofort — in einer halben Minute lag in der Wandnische diese starke Waschleine, dazu der Haken, um den ich gleichzeitig gebeten hatte.«
»Wurde nicht gefragt, wozu Du das haben wolltest?«
»Nein, aber ich selbst sagte es gleich. Wegen des Hakens, so einen, dass er oben an der Mauerwand fassen könne, ich wolle hinaufklettern. Da wurde mir gesagt, ich könne auch eine Strickleiter bekommen, das dauere aber etwas länger.«
»Das finde ich alles sehr, sehr merkwürdig.«
»Ich nicht. Die sind sich ihrer Sache eben sicher, dass wir nicht über die Mauer kommen, auch wenn wir oben stehen.«
Unterdessen hatte Atalanta das Seil schon aufgewickelt, es sich in großen Schlingen über den Arm gelegt und am Ende den Haken befestigt. Sie schleuderte ihn. Der erste Wurf misslang, beim zweiten Male erreichte der Haken den Mauerrand und hatte auch gleich gefasst.
»Da willst Du hinaufklettern?«, wurde jetzt aber Arno doch nachdenklich. »Das ist doch eine sehr riskante Geschichte. Wenn sich der Haken nun doch loslösen sollte, und Du bist schon ziemlich oben?«
»Diese zwanzig Meter haben für mich gar nichts zu bedeuten, das weißt Du doch selbst!«, lachte die rote Athletin. »Ich muss nur immer daran denken, dass ich abstürzen könnte, und zum Absprung bereit sein. Über die Pfirsichbäume werde ich schon wegkommen. nur Du darfst nicht gerade unten stehen.«
Ohne an ihrer langen Kleidung etwas zu ändern, kletterte sie hinauf, nur mit den Händen, sich mit den Füßen von der Wand etwas abstemmend. Bald hatte sie den Mauerrand erreicht und war verschwunden.
Nach kurzer Zeit erschien sie wieder, dicht an dem Rande stehend.
»Das Rätsel ist gelöst und dadurch nur noch größer geworden!«, rief sie herab. »Erklären kann ich es Dir nicht. Vermagst Du heraufzuklettern? Der Haken sitzt ganz fest.«
Auch Arno klomm hinauf, musste freilich zuletzt seine ganze Kraft aufbieten, um das Ziel noch zu erreichen. Doch hätte er sich, wenn er gewollt, durch Umschlingen des Seiles mit den Beinen einmal ausruhen können.
Eine gelbe Sandwüste, nichts weiter war ringsherum zu erblicken.
»Dann wäre das hier also eine Oase, die man mit einer Mauer umgeben hat!«, meinte Arno.
Atalanta deutete auf die Orange, die in der Mitte der drei Meter breiten Mauer lag. »Das ist die Orange, die ich vorhin geworfen habe.«
»Nun ja, sie ist eben auf die Mauer gefallen. Du hattest zu kurz geworfen.«
»Sah das so aus?«
»Hm, eigentlich nicht.«
»Blicke doch einmal auf der anderen Seite der Mauer hinab.«
Arno trat hin, trat, ebenfalls ganz schwindelfrei, an den Rand und — stieß mit dem Kopf gegen einen unsichtbaren Widerstand.
»Alle Wetter, eine Glaswand!«, rief er, als er jetzt auch mit den Händen tastete.
»Es ist Omnihilit.«
»Omnihilit?«
Er wusste ja von alledem noch gar nichts, hatte damals in den Felsenräumen am Sklavensee wenig mehr gesehen als das kinematografische und das mechanische Theater.
Atalanta gab ihm eine ziemlich ausführliche Erklärung, was Omnihilit sei und was alles damit zu machen, soweit sie selbst es erklären konnte.
»Nun weißt Du es. Ein anderer, der hiervon nichts weiß und es gelingt ihm, hier heraufzukommen, würde glauben, das sei eine dicke Glaswand und dahinter Wüste. Ja, die kann sich auch wirklich dahinter befinden. Ebenso gut kann aber diese ganze Wüstenlandschaft nur auf die Omnihilitwand gemalt oder anderswie auf ihr erzeugt sein, dann ist das nur eine Illusion. Aber ob oder ob nicht, das können wir nicht beurteilen, und das ist es eben! Das Rätsel ist halb gelöst, wird aber nur noch größer.«
Arno schüttelte nur immer den Kopf, und dann blickte er in die Höhe.
»Und wie hoch mag die Wand sein?«
»Ist ebenfalls nicht zu bestimmen. Der Rand einer Omnihilitplatte ist gar nicht zu erblicken. Nun ja, ich kann es einmal mit einem Wurfe probieren.«
Sie nahm die Orange, trat an den anderen Rand der Mauer, beugte sich zurück und warf die Frucht empor. In einer Höhe von vielleicht fünfzig Metern beobachtete man, wie die Orange gegen einen Widerstand prallte. Dann fiel sie zurück.
»Also fünfzig Meter ist sie mindestens hoch. Vielleicht gelingt es mir, mit einem Pfeil darüber weg zu schießen. Aber dass wir selbst darüber kommen, das glaube ich nun nicht mehr; die haben für den, den sie hier gefangen halten wollen, unübersteigbare Schranken zu setzen gewusst.«
»Ja, wie ist das nur möglich, hier solch eine ungeheure Glasplatte zu errichten?«
»Frage mich nicht, Arno, ich weiß es nicht. Vielleicht kann sich die kühnste Phantasie nicht ausmalen, was diesen Menschen alles möglich ist. Es braucht ja auch gar keine freistehende Omnihilitplatte zu sein, vielleicht erhebt sich dahinter eine hohe Felswand, die nur mit solcher Masse angestrichen ist, wir glauben nur, vor einer durchsichtigen Glasmasse zu stehen.«
»Sollten wir uns da nicht doch in dem Felsengebirge befinden?«
»Möglich, aber auch nicht möglich. Diese Gesellschaft kann ja noch an anderen Orten der Erde solche Plätze mit wunderbaren Einrichtungen angelegt haben. Gehen wir einmal die Mauer entlang.«
Sie taten es. Als sie über ihrem Hause standen, sahen sie auf der anderen Seite unter sich immer noch die nackte Wüste. Man musste aber doch annehmen, dass sich hier die Wohnungen ihrer Wächter, der Diener befanden. Davon war aber eben nichts zu sehen. Allerdings konnte man ja auch den Kopf nicht über den Mauerrand vorstrecken, daran hinderte die Glaswand.
Es hatte eben gar keinen Zweck, über alles dies sich den Kopf zu zerbrechen.
Eine handgreifliche Tatsache hingegen war es, dass von hier aus eine steinerne Treppe, die sich an die Mauer schmiegte, hinabführte, bis auf das flache Dach des Hauses. Von dieser Treppe hatten sie vorhin wegen der Terrainverhältnisse nichts sehen können.
Sie begaben sich hinab auf das Dach, auf dem nichts weiter Bemerkenswertes war als eine Luke mit Tür; sie ließ sich aufheben, eine Wendeltreppe zeigte sich.
Diese hatten sie schon vorhin gesehen, sie führte in ein Zimmer, in das sie aber noch nicht gekommen waren. Wären sie schon dort gewesen, so hätten sie auch die auf die Mauer führende Treppe gefunden und hätten sich so die ganze Kletterei ersparen können.
»Und der Mann hat gewusst, was ich vorhatte!«, lachte Atalanta. »Er gibt mir ruhig das Seil und den Haken! Da sehen wir, wie unsere Willensfreiheit absolut nicht beschränkt werden soll! Wenn wir uns gern den Hals brechen wollen — gut, das steht uns ganz frei! Aber verraten wird nichts, was es hier sonst noch zu finden gibt.«
»Gut, so wollen wir selbst suchen. Hast Du gesehen, Atalanta, was sich in dem Kiosk befand, an dem wir vorhin vorbeigingen?«
Ja, auch sie hatte im Vorbeigehen durch ein Fenster geblickt, und es hatte viel Energie dazu gehört, um den Weg nach dem sich einmal vorgenommenen Ziele, dem Wohnhause, fortzusetzen.
Sie hatten in dem Kiosk eine Einrichtung und viele Gegenstände gesehen, die sehr an das alte Ägypten erinnerten, und in Nischen hatten einige zusammengetrocknete Mumien gehockt.
Das musste doch sehr interessant sein, diese Sache näher zu untersuchen.
So begaben sie sich jetzt hin.
Arno hatte das kleine, tempelartige Gebäude zuerst erreicht, zwei Schritte vor Atalanta, und er blickte nun durch das ihm zunächst liegende Fenster.
»Nein, das ist er nicht!«, sagte er sofort.
Davon musste sich im nächsten Augenblick auch Atalanta überzeugen. Da waren keine altägyptischen Sachen und Mumien mehr zu sehen, sondern in einer chinesischen Teestube hockte am Boden ein dicker Sohn des himmlischen Reiches, führte die Tasse zum Munde und ließ sich von einer schlitzäugigen Schönheit auf einer Laute etwas vorklimpern. Allerdings war alles bewegungslos.
Zunächst trat Atalanta einen Schritt zurück und blickte sich um.
»Doch, das ist derselbe Kiosk.«
»Es ist nicht möglich!«
»Ein Irrtum ist ausgeschlossen, es ist derselbe Kiosk, in dem vorhin die ägyptischen Mumien waren.«
»Ja, wo sollen denn die hingekommen sein?«
»Weiß ich nicht. Gehen wir hinein.«
Die Tür ließ sich öffnen, was ja noch die Frage gewesen war, und — auch der Chinese und das Mädchen waren ebenso wie die ganze chinesische Teestube verschwunden. Man blickte in einen ganz nackten Raum.
»Ja, wie ist denn das nur möglich?! Ach so, es sind einfach nur die Fenster bemalt! Aber diese wunderbare Perspektive, das sah doch alles wie natürlich aus, nur dass sich die Figuren nicht bewegten.«
So hatte Arno gerufen, noch ehe er eingetreten war, und er ging nochmals zurück, um durch das Fenster zu blicken.
Es war dasselbe, durch das er soeben gesehen hatte. Da war aber wiederum kein Chinese mehr zu erblicken, sondern jetzt sah man in eine Fischerhütte, wahrscheinlich sollte es eine ostfriesische sein, an der Decke hingen geräucherte Flundern, die gerühmten Leberkäse und solche merkwürdige Würste, an denen die Speckstücke wie die Haselnüsse hervortreten — und auf dem offenen Herde brannte ein Feuer, und zwar ein lebendiges Feuer, es flackerte — und jetzt ging die Hüttentür auf, eine Frau in friesischer Tracht trat ein und machte sich an dem Herde zu schaffen.
Arno blickte schnell einmal nebenan durch die Tür. Aber da war nur der nackte Raum.
»Wie ist das nur möglich?!«, staunte er immer wieder.
»Kinematografie, aber eine ganz andere Art, als die wir sonst kennen, auf einem ganz anderen Prinzip der Fixierung beruhend, wie ich Dir schon erklärte!«, entgegnete Atalanta.
Es lag hier etwas Ähnliches vor wie mit jenem Gebäude, das wir »das Haus mit den 10 000 Zimmern« genannt haben. Aber hier war es gewissermaßen umgekehrt. Hier waren nur von außen durch die Fenster die Illusionen zu erblicken.
Wie die Veränderungen zustande kamen — und die Szenerien wechselten noch gar oft, jetzt immer lebendig — das war nicht zu ermitteln. Jedenfalls lösten die Beobachter, wenn sie vor einem Fenster standen, durch ihr eigenes Gewicht einen Mechanismus aus, aber auch ein Öffnen und Schließen der Tür des Kioskes schien von Einfluss zu sein. Zum Beispiel hatte erst das Öffnen der Tür die Bilder lebendig gemacht.
»Wir wollen doch einmal eintreten und die Tür hinter uns schließen«, sagte Atalanta, »ob da nicht wieder etwas anderes kommt; denn ich glaube nicht, dass man das Innere des Kioskes umsonst so leer gelassen hat, da steckt wohl wieder etwas dahinter.«
Im Innern war nichts von gemalten Glasscheiben zu sehen. Da blickte man einfach durch klare Fensterscheiben in den maurischen Garten hinauf.
Kaum aber hatten sie die Tür hinter sich geschlossen, als sich der Boden zu senken begann. Es war ein Fahrstuhl. Hinab ging es in die Tiefe. Dann ein kleiner Ruck und der enge Raum, in dem sie sich befanden, bewegte sich seitwärts, was sie recht wohl fühlten. Merkwürdig dabei war nur, dass sie durch die Fenster noch den maurischen Garten sahen. Aber die Tür konnten sie nicht mehr öffnen.
Dann ging es wieder in die Höhe, die Fenster verdunkelten sich, es wurde ganz finster, dann wieder Dämmerlicht, und plötzlich, als der Fahrstuhl hielt, standen beide im Freien.
Oder doch in einer geräumigen Höhle. Und vor dieser breitete sich die gelbe Sandwüste aus. Und das war keine Illusion, die Höhle war nicht etwa von einer Omnihilitplatte geschlossen, auf welcher oder durch die man diese Wüstenlandschaft nur zu erblicken glaubte, sondern man konnte hinaustreten, und da befand man sich in einer wirklichen Wüste, auf deren gelben Sand die noch immer hochstehende Sonne mit furchtbarer Kraft brannte.
Freilich war sie begrenzt. Es war nur ein Wüstental, von bizarren Felsformationen eingeschlossen, bald niedrig, bald bis zum Himmel emporsteigend. Aber einmal war dieses Tal mindestens so groß wie der maurische Garten, also ein echter Beduine hätte sich schon ganz behaglich darin fühlen können, ein ganzer Stamm konnte darin zu Pferde eine Fantasia aufführen, und dann waren die Felsformationen an einigen Stellen unterbrochen, und durch Spalten und Schluchten blickte man in die endlose Wüste hinein.
»Das ist natürlich nur Illusion, dort sind Omnihilitplatten davor!«, sagte Atalanta.
Aber sie wollten sich doch einmal hinbegeben.
Vorher noch bemerkten sie, dass in dieser Wüste auch eine Tierwelt existierte.
Gleich beim Verlassen der Höhle sahen sie zwischen den Steinen eine Smaragdeidechse dahinhuschen und in einem Loche verschwinden.
Wovon ernährte sich dieses Reptil?
Nun, selbst im ewigen Gletschereis leben Insekten, und man wird auch wohl keine künstliche Wüste herstellen können, ohne dass sich Insekten mit einschmuggeln, und füllt man nur eine Kiste mit Sand, den man vorher gesiebt hat, so sind doch mindestens mikroskopische Tierchen noch darin, und das zu Millionen.
Aber es gab hier auch noch andere, größere Insekten.
»Eine mauernde Wüstenspinne!!«
Zu ihren Füßen arbeitete sie, nicht viel größer als eine gewöhnliche Kreuzspinne.
Wer einmal in der afrikanischen Wüste gewesen ist — die Wüsteneinsamkeit wirklich genossen hat, nicht nur so einmal unter der Flagge von Cook und Sohn mit dem roten Baedeker ein bisschen in Ägypten herumkutschiert ist, wobei man ja auch ab und zu durch eine Sandfläche geführt wird — der kennt auch die mauernde Spinne, und wo er sie hat arbeiten sehen, da wird er sich sicher hingelegt und ihr stundenlang zugeschaut haben, bis er durch die Verhältnisse gezwungen wurde, seinen Platz zu verlassen. Der Betreffende braucht kein Naturforscher zu sein, wenn er diesem Tiere interessiert zusieht.
Es ist staunenswert, fabelhaft, wie diese Spinne arbeitet! Wie sie die Sandkörnchen zusammenschleppt und um ihr unterirdisch angelegtes Nest Mauern aufbaut, wie sie die Steinchen mit einem Safte, den sie von sich gibt, zusammenkittet, wie sie aber erst sorgfältig die Steine auswählt, dass sie möglichst fugenlos zusammenpassen — und sie begnügt sich nicht mit einer einfachen Mauer, die ungefähr einen Zentimeter hoch wird, sie fügt Türmchen darauf, macht hier und da einen Eingang mit Bogengewölbe, macht längere Tunnel, dann klebt sie wieder einen Balkon daran — und ist diese eine Mauer fertig, dann zieht sie wieder eine andere darum, baut sie wieder ganz, ganz anders.
Man weiß nicht, weshalb die Spinne diese wahrhaft künstlerischen Mauern baut. Gegen ihre Feinde — Reptilien und Vögel — bieten sie doch absolut keinen Schutz. Und dann wozu diese Türmchen und Balkone und Veranden? Man muss annehmen, dass, nachdem die Spinne ihr ebenso kunstvolles unterirdisches Nest beendet hat, ihr künstlerischer Bautrieb noch nicht befriedig ist, jetzt betätigt sie sich außerhalb des Nestes, aus reiner Freude am Schaffen.
Endlich rissen sich die beiden von dem reizenden Anblick los. Die Indianerin versicherte, dass sie diese Stelle auch ohne hinterlassenes Zeichen wiederfinden könne, wenn sie dann weiter beobachten wollten, und wie damit Arno nicht zufällig das Werk der Spinne zertrete, legte er sein Taschentuch hin und beschwerte es mit Sand.
Ja, der Fernblick in die weitere Wüste war eine Illusion, die Ausgangsschluchten waren mit Omnihilitplatten verschlossen.
In was für Verlegenheiten hätte wohl ein anderer kommen können, der nicht an solche Glasplatten dachte? Nun, der Schöpfer dieses Zauberreiches hatte dafür gesorgt, dass jemand nicht etwa mit gesenktem Kopfe wuchtig gegen diese scheinbar oder wirklich durchsichtige, gar nicht zu bemerkende Scheibe rannte. Diese Schluchten waren mit brusthohen Dornenhecken verbarrikadiert, allerdings ebenfalls nur gemalt oder sonst wie auf die Scheibe projiziert, aber doch jedenfalls so natürlich, dass auch kein Hund, der sonst sein Spiegelbild nicht für voll nimmt, weil die Witterung fehlt, auf den Gedanken gekommen wäre, in diese Dornenhecke hineinzuspringen, weil die Stacheln ja doch nichts schaden könnten.
Dort aber war eine Schlucht ohne solche Hecke! Sie begaben sich hin — und siehe da, hier war auch keine Glaswand, sie konnten in die Schlucht hineingehen.
Diese war durchschnittlich acht Meter breit, der feine Sand am Boden wie geharkt oder vielmehr wie gesiebt, zu beiden Seiten erhoben sich die Felswände, teils bis in die Wolken hinein, die jetzt am Himmel auftauchten, teils viel niedriger — teils ganz glatt, teils erkletterbar — unten am Grunde viele Höhlen, aber auch mit Löchern und Spalten — eine ganz bizarre Felsformation.
Das hatten sie beobachtet, während sie schon weit in den sich schnurgerade hinziehenden Engpass eingedrungen waren, und jetzt zweigten sich auch links und rechts andere Schluchten ab.
»Wohin führen diese?«, fragte Arno.
»Ich weiß es nicht.«
Arno machte wenigstens im Vorbeigehen schnell einmal einige Schritte in solch eine Nebenschlucht, nachdem er vorher mit der Hand vorsichtig getastet hatte.
»Die sind nicht verschlossen, das sind wirkliche Schluchten.«
»Das glaube ich schon, wir kommen hier in eine ganz andere Region.«
»Wollen wir nicht einmal solch eine Querschlucht untersuchen?«
»Später. Dann wollen wir auch prüfen, wie hoch sich diese Felsen erklimmen lassen, obgleich ich schon ahne, dass wir dort, wo wir gegen ein unnatürliches Hindernis stoßen würden, gar nicht hinaufkommen. Erst wollen wir sehen, wohin diese gerade Hauptschlucht führt, wo sie endet.«
Sie wanderten und wanderten mit schnellem Schritt, und das Ende wollte nicht kommen.
»Wie ist das nur möglich?!« staunte Arno immer wieder. »Wo befinden wir uns hier nur?!«
Da blieb seine Begleiterin stehen.
»Tausend Doppelschritte — das sind bei mir, wie ich abgezirkelt habe, genau tausend Meter!«
Da aber war die Schlucht auch gleich zu Ende. Das heißt, vor ihnen lag eine Felswand, vor ihr beschrieb die Passage einen Bogen.
Ehe sie diesen mitmachten, blickte Atalanta noch einmal die schnurgerade Strecke entlang.
»O, Arno, das gäbe eine Reitbahn, wenn wir nur auch Pferde hätten!«
»Nun, wir brauchen sie doch nur telefonisch zu bestellen, dann liegen sie gesattelt und gezäumt hinter der Klappe in der Wandnische.«
Sie lachten wie die Kinder — nein, wie glückliche Menschen, und immer wieder fanden sich ihre Hände.
Richtig, diese Hauptschlucht beschrieb einen großen Bogen, einen ganz gewaltigen, sie hatten ungefähr dreihundert Doppelschritte zu machen, dann hatten sie wieder eine schnurgerade Linie vor sich.
»Die führt wieder in das große Tal hinein und mündet auf einer anderen Seite, was wir vorhin nur nicht bemerkt haben.«
Natürlich benutzten sie diese zweite Hauptschlucht zum Rückweg, jetzt aber bogen sie auch einmal in eine Seitenschlucht ein. Da aber kam wieder eine Querspalte, der sie nachgingen, und von dieser zweigte wieder eine andere ab.
Es war ein vollkommenes Labyrinth, und immer wieder wurden die Gänge von teils himmelhohen, bizarren Felsformationen gebildet.
»O Atalanta, Atalanta, wie kann man nur solch eine Wüste und so ein ganzes Felsenlabyrinth künstlich schaffen!«, staunte Arno immer wieder.
»Nun«, entgegnete die Indianerin, »dass dies künstliche Felsen sind, gemauert und geformt, das glaube ich ja nicht. Und doch, möglich wäre es. Und was ist dabei so unmöglich? Ich habe überhaupt soeben an etwas gedacht. Sieh, Arno, ein Funke der göttlichen Phantasie muss nur einmal in einen Menschen fallen, er muss Mittel haben oder einen Gönner finden, seine Idee praktisch auszuführen, und die Welt bekommt wieder einmal etwas zu sehen, wovon sie sich bisher nichts hat träumen lassen.
Mir ist zum Beispiel bekannt, dass es im Mittelalter in Europa noch keinen Wintergarten gab. Ein deutscher Kaiser, ich weiß nicht welcher, wohl im siebzehnten Jahrhundert, glaubte, als er in den ersten Wintergarten geführt wurde, den ein reicher Sonderling angelegt hatte, in eine Märchenwelt versetzt zu sein. Mitten im Winter reife Kirschen an den Bäumen, alle anderen Arten von ausländischen Blumen und Früchten — das konnte doch gar nicht mit rechten Dingen zugehen! Und das Volk hielt jenen Sonderling auch für einen Zauberer. Heute hat jedes reiche Haus seinen Wintergarten.
Oder nimm die geschlossenen, heizbaren Schwimmbäder an. Ich weiß zufällig bestimmt, dass es noch vor hundert Jahren in ganz Amerika und im christlichen Europa kein einziges Schwimmbassin gab, das im Winter zu benutzen war. Ja, es existierten wohl welche, im Orient und in Italien aus altrömischer Zeit, aber diese ließ man verfallen, weil es damals einfach ungesund war, im Winter kalt zu baden.
Und heute? Heute hat jedes kleine Städtchen seine im Winter geheizte Schwimmhalle, was also doch eine Überlistung der Natur bedeutet, und in den Städten bietet man alles auf, um den Menschen, die nun einmal im Häusermeer leben müssen, die freie Natur immer mehr vorzutäuschen, in den geschlossenen Badehallen sind richtige Sanddünen, an denen eine künstliche Ebbe und Flut spült, an den Strand grenzt ein Wäldchen, in dem man sich dann —«
»Halt, halt, halt, halt, Atalanta!«, fiel Arno der Sprecherin ins Wort. »Du kennst nur Dein Amerika! Hier ist es allerdings schon so. Aber wir in Europa haben als Schwimmbassin immer noch nichts anderes als ein größeres viereckiges Loch, eine große Badewanne, und darüber ein Dach.«
Trotzdem, die Indianerin hatte recht. Es ist ja schon an früherer Stelle ausführlich geschildert worden, wie sich der Mensch immer mehr die freie Natur vorzutäuschen sucht, fremde Länder und alles andere, wonach er sich in seinen engen Grenzen sehnt, jede Weltausstellung und die Hunderte von Vergnügungsveranstaltungen sind Zeuge davon — wie etwa »Venedig in Wien«, um nur ein einziges Beispiel herauszugreifen — und phantasiereichen Baumeistern und Unternehmern eröffnen sich da noch die weitesten Perspektiven.
Arno und Atalanta waren schon längere Zeit kreuz und quer durch die Schluchten dieses Felsenlabyrinthes gewandert, hatten auch schon wiederholt ihre eigenen Fährten in dem Sande gefunden.
»Wohin müssen wir, um nach dem Tale zu kommen?«, fragte Atalanta.
»Natürlich nach der Richtung.«
»Falsch, gerade nach der entgegengesetzten!«, lachte die Indianerin.
Ja, man konnte sich hier total verirren. Lebensgefährlich freilich konnte es nicht werden. Man brauchte ja nur beharrlich eine Richtung einzuhalten, dann musste man doch auch wieder auf eine der Hauptschluchten stoßen.
Sie hatten das Wüstental von einer anderen Seite aus wieder erreicht.
»Was ist das hier für eine Höhle? Sieht diese Öffnung nicht ganz türähnlich aus?«
Sie traten ein, kamen an eine steinerne Treppe, erstiegen sie. Auch hier war eine orientalisch eingerichtete Wohnung, ganz in den Felsen gehauen, burgähnlich, wenn auch nur klein. Ein Zimmer war ganz mit orientalischen Waffen ausgestattet, auch Beduinenkostüme waren vorhanden.
»Nun fehlten uns wirklich bloß noch —«
Da ein Pferdewiehern!
Beide sprangen an das Fenster und blickten in einen engen Hof, in dessen Mitte sich ein Ziehbrunnen befand, der Hof hatte noch andere Türen — und nur aus einer solchen konnte das Stampfen und fröhliche Wiehern kommen, welches den Menschen geradezu zu rufen schien.
Schnell war die in den Hof hinabführende Treppe gefunden. Und da standen in dem aus dem Felsen herausgehauenen Stall zwei prächtige, fahlgelbe Renner, echte Wüstenrosse! Freudig nickend wandten sie die feinen Köpfe nach den Eintretenden.
Das junge rote Weib hatte seinen indianischen Gleichmut ganz abgelegt.
»Das werde ich unseren Gefängniswärtern nicht vergessen, dass sie auch hieran gedacht haben!«, rief es jubelnd, als es zwischen die beiden Tiere trat und sie gleich zu liebkosen begann.
Es war Platz für noch mehr Pferde, aber nur für diese beiden hier hatte man auf den Steinboden Sand gestreut, nur vor ihnen lag in der steinernen Krippe etwas Gerste.
»Unbeschlagene Hufe und statt des Hafers Gerste — alles ganz echt arabisch!«, rief Arno.
»Es sind auch echte Wüstenrenner!«
»Wo bekommen sie die nur her?«
»Nun, vielleicht sind wir in Arabien! Zerbrechen wir uns doch überhaupt hierüber nicht den Kopf, nehmen wir dankbar, was man uns bietet!«
In einer Nebenkammer war Zaumzeug und alles zur Pferdewartung. Nur der Striegel fehlte. Der Beduine putzt sein Pferd nie, hat es auch nicht nötig. Das Zaumzeug war orientalisch, aber außer dem plumpen arabischen Sattel, in dem man wie in einem Kasten sitzt, war auch der englische vorhanden.
Mit freudigem Wiehern ließen sich die beiden Stuten schirren und satteln. Natürlich waren es Stuten. Der Araber reitet keinen Hengst.
Dann nahmen sich die beiden Eheleute nicht Zeit, erst Beduinengewänder anzulegen, auch Atalanta konnte in ihrem Kostüm recht gut nach Männerart im Sattel Platz nehmen, eine andere vom Hofe ausgehende Tür führte direkt in eine Nebenschlucht, diese in die Hauptlinie, und diese verwandelte sich, wie Atalanta vorhin gewünscht hatte, in eine Rennbahn.
»Die Tiere haben nicht zu lange gestanden, sie werden täglich ihre Zeit geritten!«, sagte die rote Kennerin sofort.
In fliegender Jagd ging es die mächtige Rennbahn herum.
»Ach, ist das herrlich, herrlich!!«, jubelte Arno immer wieder. »Atalanta, hier bleiben wir, aus diesem Paradiese lassen wir uns nicht so leicht vertreiben!«
»Nur wegen dieser Pferde nicht?«, lachte sie zurück.
»Jawohl, nur wegen dieser Pferde ist hier das Paradies; denn auf dem Rücken der Pferde liegt doch bekanntlich das Paradies der Erde.«
Es war der leidenschaftliche Reiter, der aus ihm sprach.
Dann lenkten sie in das Labyrinth ein, und bald war ein fröhliches Versteckspiel zu Pferde im Gange.
Erst nach mindestens zwei Stunden, nachdem sie die Rosse auch noch in dem weiten Tale tüchtig getummelt hatten, stiegen sie in dem Hofe wieder aus dem Sattel.
»So können wir sie aber nicht in den Stall stellen, wir müssen sie erst abkühlen, zudem sind es Beduinenrosse!«
Ja, der Beduine putzt sein Pferd nicht, reibt ihm nicht einmal den Schweiß ab. Aber wenn er es nur eine halbe Stunde sehr scharf geritten hat, so führt er es vielleicht eine ganze Stunde langsam auf und ab, welche sanitäre Maßregel auf die Leistungsfähigkeit des kostbaren Tieres von kolossalem Einfluss ist.
Ein eindringliches Klingeln erscholl.
»Das ist sicher ein Telefon!«
Ein solches hatten sie bisher hier noch nicht gesehen. Es befand sich neben dem Stall in einer zweiten Kammer, in der sie vorhin nicht gewesen waren.
»Wer ist dort?«
»Einer Ihrer Diener. Vor allen Dingen versichere ich auf Geheiß meines Herrn, dass Sie nicht etwa beobachtet werden. Es ist jetzt nur wegen der Pferde, die der Wartung bedürfen. Wir erfahren auf andere Weise, dass Sie die Tiere wieder einstellen wollen.«
»Wir glauben Ihnen. Und?«
»Bitte, lassen Sie die Pferde in den Stall, Sie brauchen sie nur frei zu geben. Dann wollen Sie die Tür schließen. Sobald Sie diese wieder öffnen können, stehen Ihnen zwei andere Pferde zur Verfügung, oder, wenn Sie wünschen, dieselben in zwei Stunden.«
»Nein, danke, vorläufig ist es genug. Aber können wir für das nächste Mal ein Polospiel bekommen?«
»Ein Polospiel? Einen Augenblick — ja, aber erst morgen — morgen früh wird sich ein Polospiel in der Zaumkammer befinden. Wünschen Sie jetzt zu speisen?«
»Auch hier können wir etwas bekommen?«
»Auch hier. Das Speisezimmer befindet sich ganz am linken Ende, dort ist über der Wandnische auch ein Telefon!«
Dann waren sie dort eben noch nicht gewesen. Das Pferdewiehern hatte sie ja von einer weiteren Untersuchung der Räumlichkeiten abgelenkt.
»Versorgen Sie erst die Pferde, geben Sie den Auftrag, ehe wir hierüber sprechen.«
»Die sind bereits versorgt.«
Arno hatte es getan, war ebenfalls in die Kammer getreten und hatte die Tür hinter sich geschlossen. Eine zweite führte von hier aus direkt in den Hof.
»Gut, so wollen wir gleich hier essen.«
»Arabisch oder europäisch, englisch?«
»Wir sind hier Araber, so wollen wir auch arabisch essen.«
»Das passt sehr gut, solch ein Hauptgericht ist zufällig gerade fertig. Aber doch wohl mit europäischem Besteck.«
»Nein, wir wollen hier ganz echte Araber sein!«, lachte Atalanta in das Telefon.
»In fünf Minuten wird ein Klingeln melden, dass das Essen serviert ist, soweit wir Ihnen servieren dürfen. Sie müssen sich hier allein bedienen....«
»Das wissen wir.«
».Haben Sie sonst noch Wünsche?«
»Jetzt nicht.«
»Dann bitte ich um Schluss.«
Als sich Atalanta umdrehte, stand hinter ihr Arno und schüttelte den Kopf.
»Sieh einmal — ich habe versucht, die Tür wieder zu öffnen — eine Minute, nachdem ich die Pferde hineingelassen, konnte ich es wieder — was meinst Du dazu?«
Atalanta blickte durch die offene Tür in einen ganz nackten Raum. Es war der Stall, aber die Pferde waren nicht mehr da, auch nicht mehr die Krippen, auf dem Steinboden fehlte der gestreute Sand.
»Sie haben auf einem Fahrstuhl gestanden, der ist ausgewechselt worden!«, rief die Indianerin sofort.
»Anders ist es wohl nicht. Aber was soll man hiervon denken?«
»Nun, was ist da so Seltsames dabei? O, Arno, Du weißt ja eben nicht, was in den Felsenbehausungen an meinem Sklavensee alles möglich ist! Man weiß nicht, ob man dort nicht überall auf einem Fahrstuhl steht, was jeden Augenblick aus dem Boden wachsen oder von der Decke herabkommen kann!«
»Du bist jetzt also überzeugt, dass wir uns am Sklavensee im Coloradogebirge befinden?«
»Durchaus nicht! Nur hat alles hier die größte Ähnlichkeit mit dort.«
»Hat es dort Pferde gegeben?«
»Ich habe niemals etwas davon gemerkt.«
»Gab es dort noch andere Menschen außer Deinen Japanern und Deinen sonstigen Gesellschaftern?«
»Man musste es wohl aus allem schließen, aber zu Gesicht bekommen habe ich keinen.«
»Hat Dich denn der Sirbhanga Brahma und dann sein Nachfolger, der Mister Dollin, von dem Du mir schon erzählt hast, in gar nichts eingeweiht?«
»Ja und nein. Durch jede Tür, die wir öffnen konnten, durften wir treten, und was wir dahinter fanden, konnten wir benutzen. Aber gezeigt wurde uns keine Tür, nichts Sehenswertes. Wir mussten alles selbst finden. Auch in dieser Hinsicht war alles genau so wie hier. Und ich habe dort weder Pferde noch andere Menschen gefunden.«
»Merkwürdig, höchst merkwürdig!«
»Ich finde das alles viel reizender als merkwürdig.«

»Ja, ich auch.«
»So bereiten wir uns zum Essen vor.«
Neben dem Brunnen befand sich eine Wascheinrichtung, sie benutzten sie.
Dann schrillte wieder eine Klingel, sie gingen hinauf und hatten bald das Speisezimmer gefunden, besonders durch den runden, ganz niedrigen Tisch charakterisiert.
»Hoffentlich dreht er sich nicht!«, lachte Arno, ließ sich aber sonst auf keine Reflexionen über jene Erlebnisse in Ägypten und Syrien ein. Es waren dies wunde Punkte in seinem Leben, die nicht zu berühren er alle Ursache hatte.
»Das hier muss die geheimnisvolle Klappe sein!«
Als sie geöffnet wurde, erfüllte sofort ein lieblicher Bratengeruch den ganzen Raum — weniger lieblich war der Anblick, der ihrer wartete.
In der sehr großen Nische lag ein großes Tier auf dem Rücken, reckte alle viere in die Luft und glotzte die beiden aus dem seitlich gewendeten Kopfe mit grünen Augen an.
Das helle Lachen, in das Atalanta ausbrach, galt dem Gesicht ihres Begleiters, denn der glotzte dieses Tier auch so an.
»Das ist doch — nicht etwa — ein — ein — gebratener Hund?!«
»Nein, aber ein gebratener Hammel!«, lachte die Indianerin jetzt erst recht, wie sie früher nie gelacht hatte.
»Wahrhaftig, ein ganzer Hammel! Ach richtig, ein ganzer gebratener Hammel ist ja die Festspeise der Araber! Auch der Kopf muss dran sein. Die grünen Augen sind eingesetzte Oliven. Hm, schön sieht das nicht gerade aus, auch nicht, dass man die Zähne im Maule gelassen hat —«
»Arno, bist Du ein Araber oder nicht?!«
»Wenn Du befiehlst, werde ich mich auch als Hottentotte fühlen und mit Behagen gebackene Ameisen verzehren. Nein wirklich, ich freue mich auf den Hammel. Ich werde, bescheiden wie ich immer bin, hinten beim Schwanze beginnen, fang Du vorn mit den Zähnen an.«
Sie hoben mit vereinten Kräften die große Holzplatte heraus, auf der das schwere Tier lag. Außerdem aber lag es noch auf einer Serviette, doch war diese aus Mehlteig gebacken und konnte ebenfalls gegessen werden.
»Nun gehört aber noch Reis dazu.«
Der war schon da, befand sich sachgemäß im Innern des Hammels.
Sie hockten an dem Tische nieder und aßen nach arabischer Sitte. Nur dass sie die Bissen auch mit der linken Hand, die des Teufels ist, zum Munde führten und diesen nicht gar so weit aufrissen, denn der Mohammedaner darf mit Fleisch nicht die Lippen verunreinigen, mit denen er dann zu Allah betet.
Es ging lustig genug dabei zu.
»Dass man das Tischtuch mit verspeisen kann, das führen wir später auch bei uns ein, das erspart die Wäsche, nicht wahr, Atalanta? Aber wenigstens einen Teelöffel verlange ich das nächste Mal doch.«
Nachdem sie ihren Hunger gestillt hatten, schoben sie den Braten, der ja nicht viel an Größe verloren, in die Wandnische zurück. Wenn es arabische Diener waren, so erwarteten diese ja auch nichts anderes.
Arabische Diener? Ja, war dieser ganze Hammel nicht schon gebraten gewesen? Gewiss, dann musste man auch auf echte Araber schließen.
»Wohin nun?«, fragte Arno, als sie sich im Hofe wieder wuschen. »Wollen wir jetzt einmal ein bisschen auf den Felsen herumklettern, ob wir gegen eine Himmelsdecke stoßen, und die Höhlen etwas näher untersuchen?«
»Nein, ich schlage vor, diese genauere Untersuchung jedes einzelnen Teiles später vorzunehmen, jetzt erst uns einen allgemeinen Überblick über alles zu verschaffen, was uns hier zur Verfügung steht.«
Arno war hiermit sehr einverstanden. Es war ja immer noch früher Nachmittag, sie konnten heute noch viel besichtigen.
Wollten sie so handeln, dann wurde auch nicht erst das Telefon befragt, ob es von hier aus noch einen anderen Rückweg nach dem maurischen Garten gab. War das der Fall, so mussten sie diesen später eben selbst finden.
Sie begaben sich wieder nach jener Höhle zurück, deren Boden ein Fahrstuhl war, wenn sich die Fugen auch kaum erkennen ließen. Ein Signalapparat war nicht vorhanden, jedenfalls gehörte ein gewisses Gewicht dazu, um den Mechanismus auszulösen.
Kaum standen beide auf der Platte, als erst ein einleitender Ruck kam, man hätte noch immer ohne Gefahr heruntergehen können, dann senkte sich die Platte ganz langsam hinab, dann, als es schneller ging, war sie durch Wände geschützt, dann ging es seitwärts und wieder hinauf, sie befanden sich wieder in dem Kiosk.
»Wenn ich das eingerichtet hätte, dann hätte uns der Fahrstuhl anderswo hinbringen müssen, wo wir vor Staunen gleich umgefallen wären!«, sagte Arno.
»Du bist ja der zweite Littlelu!«, lachte Atalanta. »Denn dem kann auch nichts recht gemacht werden, für den ist alles, alles nichts. Und wenn ihm auf Kommando eine gebratene Taube in den Mund fliegt, getrüffelt, wie er sie bestellt hat — dann schimpft er, dass er sie erst noch kauen muss.«
»Ach, Littlelu!«, lachte auch Arno. »Können wir den nicht hier in einer Wandnische erscheinen lassen?«
Schnell wurde Atalanta wieder ernst.
»Nein, lieber nicht. Ich zweifelte nicht, dass er uns beigesellt würde, aber diejenigen, die ein Interesse daran haben, uns hier zu isolieren, wollen uns allein haben, und dem wollen wir uns fügen — vorläufig.«
Erst als sie den Kiosk verließen und durch die Fenster blickten, sahen sie ein alchimistisches Laboratorium, in dem ein alter, weißbärtiger Mann im langen Talar mit Tiegeln und Retorten hantierte.
»Wunderbar! Das wird ja interessant! Passen wir gut auf, hier kann man offenbar lernen, wie man Gold macht!«, sagte Arno humorvoll.
»Nein, vorwärts!«, rief aber Atalanta. »Wir haben noch Zeit genug, solche kinematografische Bilder zu beobachten. Weißt Du, wie alt Adam geworden ist?«
»Adam? Den alten Adam meinst Du? Nein, das weiß ich nicht.«
»Neunhundert und zwölf Jahre.«
»Und Eva?«
»Davon meldet die Bibel nichts.«
»Na, ein paar hundert Jährchen wird die auch schon alt geworden sein. Also Du hast ganz recht, wir haben noch Zeit genug, uns diese kinematografischen Bilder zu betrachten. Untersuchen wir erst einmal einen anderen Pavillon.«
Sie begaben sich nach dem nächsten Kiosk. In diesem sahen sie durch die Fenster eine mächtige Löwin liegen, welche mit stolzem Mutterglück dem Spiele ihrer vier Jungen zuschaute.
»Reizend! Und wie natürlich!«
Ja, je länger man hinsah, desto mehr mochte man glauben, dass es sich hier um Lebewesen aus Fleisch und Blut handele.
»Ich hatte aber doch gehofft, hier etwas anderes zu sehen als wieder solche kinematografische Bilder, das ist einseitig!«, meinte Arno. »Nun, gehen wir hinein.«
Aber wie ward ihnen, als sie die Tür öffneten!
Da lag die Löwin mit den vier Jungen immer noch drin!
Aber jetzt richtete sie sich mit einem furchtbaren Gebrüll auf und duckte sich zum Sprunge.
Im Nu war die Tür wieder zugeschmettert!
»Sapperlot!«, atmete Arno tief auf. »Die Sache ist doch nicht so einseitig, wie ich erst glaubte! Ja, wie kann man uns der Gefahr aussetzen, dass wir hier von einem Löwen zerrissen werden?!«
»Es ist ein gezähmtes Tier.«
»Teufel noch einmal — dieses Zähnefletschen sah gar nicht so gezähmt aus — und dieses Brüllen!«
Atalanta hatte sich wieder dem Fenster zugewendet.
»Ja, jetzt ist aber schon wieder etwas anderes da!«
Jetzt glaubte man auf einem hohen Felsen zu stehen, unten in der Tiefe auf blauem Meere sah man die Schiffchen, Dampfer und Segler.
»Da denkt man an den Felsen von Gibraltar!«, rief Arno. »Ja, aber wie ist das möglich? Wo ist die Löwin geblieben?«
Ganz, ganz vorsichtig wurde die Tür etwas geöffnet und durch die Spalte gelugt. Die Löwin mit ihren Jungen war weg. Dafür erblickte man jetzt immer noch auch durch die Tür unter sich das Meeresbild, mit einer Klarheit, dass man kaum wagte, darauf zu treten, weil man eben glaubte, man würde durch die Luft hinabsausen.
»Es war doch nur ein kinematografisches Bild«, sagte Atalanta, »nur etwas anders arrangiert, auch in Verbindung mit einem Phonographen, der beim Öffnen der Tür das Löwengebrüll wiedergab.«
»Aber wir sahen alles doch auch noch durch die Tür!«
»Das lässt sich so erklären, dass sich dahinter immer noch eine Omnihilitplatte befand, welche nun fortgenommen ist, während dieses zweite lebende Bild jetzt im Glasboden erzeugt wird.«
Weiter suchten sie nicht nach Erklärungen. Und das Bodenbild verschwand plötzlich, sobald sie vollständig eingetreten waren, und als sie die Tür geschlossen hatten, verhandelte sich der Kiosk abermals in einen Fahrstuhl.
Wieder ging es hinab und seitwärts und hinauf, und als sie dann im Freien standen, wartete ihrer eine neue Überraschung.
Zur Schilderung des Ganzen sei erst etwas anderes erwähnt. Wiederum handelt es sich dabei um die Versuche der heutigen Menschen, die Natur durch Kunst zu ersetzen, sich in eine fremde Umgebung hineinzutäuschen.
In England werden Sports und Liebhabereien getrieben, von denen man auf dem Kontinent noch gar nichts weiß. Nur so zufällig erfährt man einmal davon, beobachtet sie selbst in England nur zufällig. Sie sind so mannigfaltig, dass man Bücher darüber schreiben könnte. Manche sind auch nicht zur Nachahmung zu empfehlen. So ist zum Beispiel jener »Sport«, dass man in eine große Kiste oder in eine leere Stube Ratten setzt und sie von Pinschern totbeißen lässt, einfach scheußlich, und doch wird das in England ganz regelrecht betrieben, es füllt die ganze Gedankenwelt einer großen Klasse von Menschen aus, da werden Wetten abgeschlossen und Rekorde aufgestellt, und die Besitzer der besten Rattentöter, die in kürzester Zeit die meisten Ratten abwürgen, verdienen Vermögen. Einen nützlichen Hintergrund hat die Sache nur insofern, als das Fangen von Ratten sehr viele Menschen lohnend beschäftigt, ohne welches in London, das ja unterirdisch durch und durch siebartig durchlöchert ist, jedenfalls ständig eine furchtbare Rattenplage herrschen würde.
Es gibt aber auch andere, sehr hübsche Arten von Sport in England, die man auf dem Kontinent so gut wie gar nicht kennt.
Wer London besucht, der versäume nicht, an einem schönen Sonntagmorgen einmal nach dem Victoria Park zu gehen, von Mile End Road aus. Die Fremden suchen immer nur den berühmten und allerdings auch viel schöneren Hyde Park auf.
Im Victoria Park, an dem großen Teiche, ist das Dorado all der Londoner, die für den Segelsport schwärmen, die sich aber keine Jacht leisten können, nicht einmal ein Segelboot, die an das Häusermeer gefesselt sind. So betreiben sie ihre Liebhaberei eben en miniature auf dem Ententeiche. Jeden Sonntagvormittag, von Sonnenaufgang an, sieht man hier Hunderte von Männern, meist ältere, bis zum zittrigen Greise, und jeder bringt sein Segelschiffchen mit, von Spannenlänge bis Metergröße, ganz verschieden getakelt, vom einmastigen Kutter an bis zum Fünfmaster, alles selbst gefertigt, und da wird beobachtet, wie der Hase mit dem Winde läuft.
Und es ist wirklich großartig, was man zu sehen bekommt — diese Schiffsmodelle, diese Präzisionsarbeiten! Und wie die ihre Schiffchen in der Gewalt haben! Es grenzt manchmal wirklich an Zauberei. Wie sich in der Mitte des großen Teiches die Rahen, wenn die Segel aus dem Wind kommen, von allein wieder einstellen, es scheint überhaupt alles von selbst zu gehen, oder als wären zur Bedienung winzige Zwerge darauf.
Denn da hat jeder sein Patent, wenn er es auch nicht anmeldet, und da wird die ganze Woche über Verbesserungen nachgetüftelt und am Abend gebastelt und am Sonntag Morgen das Schiffchen wieder geprüft.
Und nun findet natürlich ein Wettsegeln statt. Dass auch die Regierung dieser scheinbaren Spielerei großes Interesse entgegenbringt, beweist sie dadurch, dass sie für das große Wettsegeln zu Pfingsten hohe Prämien aussetzt, sogar einen königlichen Preis gibt es zu gewinnen und zu verteidigen.
Nein, es ist doch nicht nur so eine kindliche Spielerei! Die englische Regierung weiß immer, was sie tut. Britannien beherrscht die Wogen.
Aber das genügt immer noch nicht. Der Engländer will sogar im Zimmer dem geliebten Segelsport frönen. Nun freilich artet es zur richtigen Spielerei aus.
Im Crystal Palace bei Sydenham sind einige solche Kästen zur Benutzung aufgestellt. Es sind große Glaskästen, über einen Meter lang und einen halben breit, etwas Wasser darin, darauf schwimmt ein Segelschiffchen. Steckt man einen Penny, einen Groschen, in den Automat, so wird das Schiffchen frei, man kann eine Kurbel drehen, die ein Gebläse in Bewegung setzt, der erzeugte Wind geht in die Segel, man kann vor oder bei dem Winde segeln lassen, sogar dagegen kreuzen, je nachdem man steuert. Diese Steuerung geschieht auf magnetischem Wege, sie ist ebenso einfach wie sinnreich — durch ein außen angebrachtes Steuerrädchen wird unter dem Boden ein Magnet hin und her bewegt, so kann man das Schiffchen, das dadurch festgehalten wird, nach Belieben dirigieren. Weiter ist es nicht zu erklären.
Nun lässt man das Schiffchen zu dem Miniaturhafen hinaussegeln, der Weg ist vorgeschrieben, es muss um Inselchen herum, zwischen Sandbänke und Klippen und Riffe hindurch, und bringt man es glücklich in den Hafen zurück, so bekommt man seinen Penny zurück. Bleibt es hängen — wonach es magnetisch zurückgezogen wird — so hat man den Penny verloren.
In anderen Automaten können auch zwei Schiffchen auf diese Weise um die Wette segeln. —
Was dort im Kleinen, war hier im Großen ausgeführt worden — ein künstlicher Ersatz für die Natur.
Die beiden standen am Ufer eines Gewässers, das man schon recht gut einen See nennen konnte, denn er war mindestens so groß wie der maurische Garten, wie das Wüstental. Teils wurden die Ufer von hohen, steilen Felsen gebildet, teils waren sie flach, teils Sanddüne, teils mit Gras bewachsen, einzelne Bäume und ein ganzes Wäldchen, und dann ging es weit, weit in die offene See hinaus. Aber das war Illusion, da war wieder so eine Glaswand davor, die das vortäuschte, das wussten die beiden nun schon. Deshalb hatte man dort auch eine Klippenbank vorgelagert, damit man nicht etwa hineinfuhr und daran mit dem Boote zerschellte.
Über die beiden Inseln in dem See, die eine felsig, die andere buschig und mit Bäumen bestanden, die waren echt, so echt wie das voll ausgerüstete Segelboot, das dort lag, so echt wie der steife Wind, der die Gewänder flattern ließ.
»Ja, sind wir hier denn nicht wirklich im Freien?! Aber wo kommt denn hier zwischen den Felsen der Wind her?!«, staunte Arno.
Nun, das hatten sie bald herausgefunden. Dieser Wind kam aus den vielen Löchern der einen Felswand, und wenn die Kraft nicht genügte, um die ganze Wasserfläche zu überstreichen. so wurde die Luft auf der anderen Seite in Felslöcher wieder eingesogen. Auf diese Weise musste überall eine ziemlich gleichmäßige Windströmung herrschen.
Auch das kleine Rad war bald entdeckt, mit welchem man den Wind ganz abstellen oder ihn bis zum Sturme verstärken konnte, dass der See ganz ansehnliche Wellen warf, wozu später aber noch ein besonderer Mechanismus gefunden wurde.
Sie stellten einen mäßigen Wind ein, stiegen ins Boot, richteten den Mast auf und befestigten das große Segel. Es konnte auch noch ein Klüverbaum ausgeschoben werden, aber mit dem Klüversegel wollten sie es lieber noch nicht probieren.
Beide hatten eine Ahnung vom Segeln, wussten, worauf es ankam, hatten beide schon in einem Segelboot gesessen, selbst aber noch nicht gesteuert und den Segelbaum herumgeworfen, den Wind abgefangen.
Nun, das ist ja gar nicht so schwer, die Ausnutzung des Parallelogrammes zweier Kräfte, nämlich der treibenden Kraft des Windes und der widerstehenden des Steuerruders. Schnell hatten sie es heraus, worauf es immer ankommt, sie rannten einmal gegen die Felseninsel, blieben an einer Wand kleben und mussten sich mit dem Riemen freibringen, verfilzten sich mit dem Tauwerk in die Baumzweige der zweiten Insel — aber es dauert nicht lange, so konnten sie zwischen den beiden Inseln eine ganz schöne Acht beschreiben.
»Ach, ist das herrlich, herrlich!!«, jubelte Arno immer wieder, und die Indianerin jubelte mit.
Ja, es ist etwas Herrliches um das Bootssegeln. Wer es freilich nicht kennt, der weiß eben nichts davon, kann gar nicht verstehen, was da Herrliches dran sein soll. Das Bootssegeln ist eine regelrechte Kunst. Ja, man kann sogar von einer Wissenschaft sprechen. Es handelt sich eben um jenes Parallelogramm. Und außerdem ist ein tiefes psychologisches Geheimnis dabei.
Ganz gewiss ist es, dass der schulgerechte Reiter seinem edlen Pferde nach und nach immer mehr von seinem eigenen Geiste mitteilt. Von so etwas weiß aber eben nur der geborene, man möchte sagen gottbegnadete Reiter, für den das Tier zwischen seinen Schenkeln nicht nur ein lebendiges Stück Fleisch mit vier Beinen ist. Beim Bootssegeln geht das aber noch viel weiter. Hier haucht der verständnisvolle Mensch einem toten Stück Holz seine eigene Seele ein, er fühlt es, wie er immer mehr mit dem Boote verschmilzt.
Doch so etwas lässt sich eben nicht beschreiben. Einer, der kein Interesse für das Schachspiel hat, versteht auch nicht, wie zwei Menschen stundenlang auf das Brett starren können, immer eine Viertelstunde brauchen, ehe sie so ein Figürchen ein Feld weiter schieben — so wenig ein Wilder, der nichts von der Lesekunst weiß, begreift, weshalb ein Weißer stundenlang in ein Buch starrt, nur um alle fünf Minuten eine Seite herumzublättern.
Jedenfalls liegt der Hauptspaß bei diesem Sport nicht darin, mit vollen Segeln über eine endlose Wasserfläche dahinzurauschen, sondern je enger das Wasser, je mehr Hindernisse, desto besser, wenn nur noch Raum genug zum Kreuzen ist. Den Wind als feindliches Element betrachten, das man überlisten, besiegen muss, indem man ihm entgegensegelt, darin liegt der Hauptreiz! Das ist der Grund, warum so mancher, der an so etwas Interesse findet, tatsächlich von früh bis abends, wenn er nur Zeit dazu hat und ein Lüftchen weht, zu Hause auf seinem Ententeiche segelt, immer um ein Schilfblatt herum, ohne dass er Sehnsucht empfindet, seine Kunst auf einem größeren Wasser oder gar auf dem Meere zu probieren.
»Ach ist das herrlich, herrlich!!«, riefen Arno und Atalanta wiederholt aus.
Und die beiden fingen erst an mit dieser Kunst, glaubten schon viel erreicht zu haben, wenn sie glücklich einmal um die beiden Inseln herumkamen, zuletzt direkt gegen den Wind, ohne gestrandet oder hängen geblieben zu sein, sie ahnten ja noch nicht, was man mit einem guten Boote alles leisten kann, wenn man durch den Klüver das Parallelogramm der Kräfte nochmals teilt.
Dann landeten sie einmal mit Absicht an der bewaldeten Insel, freuten sich, dass das Manöver mit vollem Segel so gut gelang, und sie drangen ein in das Gewirr von Zweigen und Büschen.
»Ach, ist das herrlich hier!«
Ja, es war herrlich. Die ganze Erde hatte von ihrer Pflanzenwelt die schönsten Exemplare hergeben müssen, um diese kleine Insel zu schmücken, alles eine Farbenpracht und ein Duft.
Sie zerbrachen sich jetzt nicht den Kopf darüber, wie hier die indische Vanille neben dem deutschen Apfelbaum gedeihen konnte, beide reife Früchte tragend — gerade unter diesem Apfelbaum lud der grüne, weiche Rasen zum Ruhen ein, und sie lagerten sich.
Die Tage vergingen, ohne dass sie gezählt wurden. Die beiden jungen Eheleute lebten tatsächlich wie im Paradiese, in einem Paradiese, in dem es keine Schlange gab, in dem sie von jeder Frucht naschen durften — auch von jenem bekannten Apfel, ohne dass sie deswegen aus dem Paradiese vertrieben wurden.
»Wirst Du Dich hier immer glücklich fühlen können, Geliebter?«, fragte Atalanta liebevoll.
»An Deiner Seite gewiss!«, erwiderte Arno.
Und warum nicht? Langeweile gab es hier nicht.
Sie brauchten nur zu suchen, so fanden sie wohl stündlich eine neue Überraschung.
Es sei jetzt nicht weiter beschrieben, was sie noch alles entdeckten, erwähnt sei aber, dass Atalantas Behauptung, man könne nicht bestimmen, auf welcher Hälfte der Erdkugel man sich befände, eine voreilige gewesen war. Oder sie hatte eben gemeint, nur nach der Sonne könne man dies nicht beurteilen.
Die Sterne der ersten Nacht mussten ihnen das ja sagen. Es war der südliche Sternenhimmel, der sich in seiner ganzen Pracht über ihnen ausbreite.
»Ob das aber auch wirkliche Sterne sind?«, fragte Atalanta.
»Na nu, wie kannst Du daran zweifeln? Ist ihr Flimmern und ihr Farbenspiel nicht ganz echt?«
»Ja, so sieht es allerdings aus.«
»Und Du hattest doch selbst gesagt, in der Natürlichkeit der Sonne könntest Du Dich nicht täuschen.«
»So sagte ich damals.«
»Und jetzt?«
»Es könnte doch ein Mittel geben, um uns diese Sterne nur vorzutäuschen und am Tage eine Sonne, deren Licht durch ein Prisma in die Regenbogenfarben zerlegt wird, deren Strahlen man durch eine Glaslinse auch konzentrieren kann, und es ist dennoch nicht die richtige Sonne.«
»Wie wäre denn das möglich?«
»Durch eine Spiegelung.«
»Ich verstehe Dich nicht.«
»Bitte, erlass mir auch die weitere Erklärung. Du weißt ja nicht, was diese rätselhaften Menschen schon in meiner Behausung am Sklavensee für Illusionen hervorbringen konnten, so etwas kann man gar nicht beschreiben, und es ist ja auch nur eine Vermutung von mir, dass auch hier der Himmel nur eine Illusion sein könne. Nehmen wir nur alles als Tatsache an.«
So waren mindestens vierzehn Tage vergangen. Während dieser Zeit hatte sich der Himmel wohl schon wiederholt mit Wolken überzogen, aber geregnet hatte es noch keinen Tropfen. Dafür taute es jede Nacht stets sehr stark, was den Pflanzen wohl genügte.
Auch in der Wüste war am Morgen der Sand immer ganz nass, auf den Felsen hatten sich große Tropfen angesammelt.
Woher aber kam der Unterschied, dass hier im maurischen Garten die Nächte immer sehr warm waren, während gleichzeitig in der Wüste das Thermometer, das sie sich hatten geben lassen, ganz sachgemäß fast bis auf den Gefrierpunkt sank?
»So befinden wir uns dennoch immer in geschlossenen Räumen!«, war es diesmal Arno, der dies rief, als sie zum ersten Male diese Entdeckung machten.
»Weshalb?«
»Weil doch nur in geschlossenen Räumen eine solche Regulierung der Temperatur möglich ist.«
»Es könnte auch ein Mittel geben, um selbst im Freien die Temperatur nach Willkür zu regulieren, wenn die betreffende Gegend nur mit genügend hohen Mauern umgeben ist.«
»Was für ein Mittel wäre das?«
»Kohlensäure.«
»Kohlensäure?«, wiederholte Arno verwundert. »Wie meinst Du das?«
Atalanta sprach sich weiter darüber aus. Auch Arno wusste ja davon, was heute jeder Mensch kennt, der für so etwas Interesse hat, aber er hätte niemals gewagt, diese Theorie über die Erdtemperaturen der verschiedenen Zeiten hier mit diesen Rätseln in Verbindung zu bringen.
Bekanntlich hat unsere Erde im Laufe ihrer Geschichte, im Laufe von ungefähr Jahrtausenden, wiederholt die verschiedensten Temperaturschwankungen durchgemacht.
Einst war es sogar an den Polen so warm, dass dort eine tropische Vegetation gedeihen konnte, in Deutschland wuchsen Palmen, dazu entsprechende Tiere, die man heute nur noch im heißen Süden findet. Die sogenannte »Urwelt« mit ihren heute ausgestorbenen Tieren und Pflanzen sei dabei gar nicht erwähnt.
Dann kam eine Zeit, wo sich auch Deutschland mit Eisgletschern bedeckte, die alles Leben unmöglich machten.
Und diese Eisgletscher schmolzen wieder, die heutige Temperatur mit ihrer Pflanzen- und Tierwelt stellte sich ein.
Dass es so gewesen ist, das weiß heute wohl jedes Kind.
Nun aber ist mit ziemlicher Sicherheit nachgewiesen worden, dass es gar viele solche heiße Perioden und Eiszeiten gegeben haben muss, die immer miteinander abwechselten.
Es gibt nichts Konstantes in dieser Welt. Auch jetzt befinden wir uns wieder in solch einem Wechsel der Temperatur. Aber dieser Wechsel, ehe die Temperatur wieder ihr Extrem, die äußerste Grenze ereicht hat, vollzieht sich so langsam, dass wir heute noch nicht wissen, ob wir wieder einer kalten oder einer heißen Periode entgegengehen. Doch ist aller Grund zur Annahme vorhanden, dass sich die Erde wieder erwärmt, dass wir in hunderttausend Jahren wieder unter Palmen und Gummibäumen wandeln werden.
Ach, was sind schon für Theorien aufgestellt worden, um diesen Temperaturwechsel der ganzen Erde zu erklären! Am einfachsten ist ja die Annahme, dass sich die Erde abwechselnd der Sonne nähert und sich wieder entfernt. Diese Theorie aber hat man schon längst fallen lassen. Viel für sich hat auch, dass auf der Erde durch vulkanische Katastrophen mächtige Erhebungen stattgefunden haben, dort oben musste sich aller atmosphärischer Niederschlag in Eis verwandeln, die Gletscher rückten herab, ließen durch ihre ausstrahlende Kälte auch unten alles erstarren, bis die Erhebungen sich wieder senkten.
Und so gibt es noch Dutzende von Theorien. Wir führen sie nicht an, man hat sie auch alle wieder aufgegeben.
Unsere moderne Wissenschaft hat dieses Rätsel wohl definitiv gelöst, die Richtigkeit lässt sich durch Experimente nachweisen.
Es hängt mit dem Gehalt der atmosphärischen Luft an Kohlensäure zusammen.
Die Kohlensäure hat die Eigenschaft, die Sonnenstrahlen durch Reibung viel, viel stärker zu erwärmen, als dies die atmosphärische Luft, aus Sauerstoff und Stickstoff bestehend, vermag, und ferner ist sie ein viel schlechterer Wärmeleiter, sie bindet die einmal aufgenommene Wärme viel besser, lässt also die Erdwärme nicht so schnell wieder in das kalte Weltall ausstrahlen.
Jetzt enthält die Erdatmosphäre 0,03 Prozent Kohlensäure. Das hat sich in den hundert Jahren, seitdem man das zu messen versteht, noch nicht geändert. Wenigstens vermögen wir auch mit den feinsten Apparaten keine Schwankung zu konstatieren. Und dabei ist es gleich, ob man die Luft am toten Meere, 400 Meter unter dem Niveau der anderen Meere, oder zehntausend Meter hoch auf dem Himalaja untersucht. Wohl ist die Kohlensäure schwerer als die Luft, wohl ist auf der Erdoberfläche viel mehr Kohlensäure vorhanden als oben in den Wolken — aber dort oben ist doch auch die Luft viel dünner, Prozent bleibt immer Prozent.
Und nun hat man durch ein untrügliches Experiment konstatiert, dass sich dieser Gehalt an Kohlensäure nur um die Hälfte zu vermindern brauchte, auf 0,015 Prozent, und über Mitteleuropa würde eine neue Eiszeit hereinbrechen, die Äquatorgegenden würden die Jahrestemperatur Norddeutschlands annehmen.
Würde sich aber der Kohlensäuregehalt verdreifachen, so würde Deutschland das heutige äquatoriale Klima haben. Noch etwas mehr Kohlensäure, und Menschen könnten überhaupt nur noch an den Erdpolen existieren. Und das könnten sie, die dreifache Menge Kohlensäure hätte für sie noch nichts zu bedeuten, das merkt man beim Atmen gar nicht, aber eben die Hitze und ihre Begleiterscheinungen würden unerträglich werden.
Nun fragt sich bloß noch, wodurch diese Schwankungen an Kohlensäuregehalt entstanden sind.
Das lässt sich leicht erklären.
Als die doch einst feurigflüssig gewesene Erde so weit erkaltet war, dass sich auf ihr eine harte Kruste bilden konnte, als überhaupt die Vorbedingung für eine Existenz von Pflanzen gegeben war, hat die Erde doch sicher im Innern noch gewaltig rumort, jedes Gebirge war ein Sicherheitsventil für die komprimierten Gase, die Vulkane hauchten ungeheure Mengen von Kohlensäure aus.
Das musste für die Entwickelung der Vegetation erst recht günstig sein, denn die Pflanze lebt von Kohlensäure oder braucht sie, wie das Tier den Sauerstoff.
So bedeckte sich die ganze Erde mit einer fabelhaft üppigen Vegetation, bis zu den Polen hinauf. Die Vulkane lieferten die Kohlensäure immer spärlicher, und die vorhandene wurde von den Pflanzen aufgefressen.
Dadurch wurde immer weniger Sonnenwärme gebunden und festgehalten, dadurch musste es auf der Erde immer kälter werden, die Pflanzenwelt starb, die Eiszeit brach herein.
Zahllose Jahrtausende vergingen. Vulkane gab es noch immer, die Kohlensäure aushauchen, aber keine oder zu wenig Pflanzen, um sie zu absorbieren. So musste sich immer mehr Kohlensäure anhäufen. Also musste auch wieder mehr Sonnenwärme gebunden werden. Also entstand auch wieder eine neue Pflanzenwelt, selbst im höchsten Norden und tiefsten Süden von tropischer Üppigkeit. Und als diese im Laufe von zahllosen Jahrtausenden die Kohlensäure wieder aufgefressen hatte, musste auch wieder eine Eiszeit anbrechen.
Und so wird das fort und fort gehen, bis — — einmal ein Ende kommt, weil es auch einmal einen Anfang gehabt hat. Aber von diesem Ende wissen wir nichts, wir können davon kaum eine Ahnung haben. —
»Und Du meinst, sie könnten durch Entwickelung von Kohlensäuregas solche verschiedene Temperaturen erzeugen?«, fragte Arno.
»Das wäre die einzige plausible Erklärung, wenn wir nicht mit geschlossenen Räumen rechnen wollen.«
»Aber wir merken doch gar nichts von einem Überschuss von Kohlensäure.«
»Brauchen wir auch nicht. Ich sagte Dir doch schon, welche geringe Mengen genügen, um solche Temperaturunterschiede zu bewirken.«
»Die Kohlensäure ist viel schwerer als die atmosphärische Luft.«
»Aber sie verteilt sich dennoch prozentual, kann ja auch nach oben schnell wieder herausbefördert werden.«
»Wie sollte das gemacht werden?«
»Bitte, Arno, frage mich nicht so, ich weiß ja selbst gar nichts davon. Es sind doch alles nur Vermutungen.«
Heute begann es vom bedeckten Himmel zum ersten Male zu regnen. Es war ein sehr warmer Regen.
Die beiden befanden sich gerade im maurischen Garten.
»Nun wollen wir uns schnell einmal in die Wüste begeben, ob es dort auch regnet!«, sagte Atalanta.
Der Fahrstuhl des betreffenden Kioskes beförderte sie in die Wüstenregion.
Hier kein Tropfen! Am azurblauen Himmel strahlte die Sonne.
»Nun bin ich sprachlos!«, sagte Arno.
Atalanta konnte noch über den Widersinn dieser Bemerkung lachen.
»Also müssen wir über uns doch noch eine Decke haben — oder sonst etwas, was den Regen auffängt, uns den Himmel blau erscheinen lässt!«
Nun gingen sie zurück in den maurischen Garten, der Fahrstuhl eines anderen Kioskes führte sie in das Gebiet des Winters. In diesem Kiosk war auch für warme Kleidung gesorgt, die sie zuvor anlegten.
Eine Gebirgslandschaft im winterlichen Kleid! Auch in Wirklichkeit größer als alle anderen Gebiete, mit denen hier die Natur überlistet wurde. Wohl fünfhundert Meter lang war die schräge Fläche, die sie zwischen bizarren Felswänden täglich auf Rodelschlitten hinabsausten, die Fahrt wurde durch eine Anhöhe gebremst, von dieser ging es auf einer anderen Strecke wieder zurück, ein Fahrstuhl beförderte sie zum Anfangsziel hinauf.
Aber jetzt dachten sie nicht daran, den Schlitten zu benutzen.
Jetzt war die ganze Landschaft wie in einen weißen Schleier gehüllt — es schneite in großen Flocken.
»Allmächtiger, jetzt bleibt mir der Verstand stehen!«, ächzte Arno.
»Ja, jetzt wird auch mir das bald zu viel! Wollen wir uns einmal eine Erklärung geben lassen?«
Denn es war ihnen ja gesagt worden, man würde ihnen alles erklären, sobald sie es wünschten, es befahlen. Die Diener seien ihnen unbedingten Gehorsam schuldig.
Arno hatte oft genug solch eine Erklärung gewünscht, aber Atalanta hatte ihn immer wieder gebeten, wenigstens noch etwas zu warten. Sie hatte gehofft, aus eigener Kraft alle die Rätsel zu ergründen.
Jetzt trat Atalanta kurz entschlossen an das Telefon, das sich in dem warmen Sportzimmer befand, und drehte die Kurbel.
»Zu dienen?«, wurde fast augenblicklich gefragt.
»Wir möchten eine Erklärung haben.«
»Bitte worüber?«
»Wie kommt es, dass es hier schneit und im maurischen Garten so warm regnet?«
»Ah, Sie wünschen eine Erklärung dieser Phänomene?«
»Ja. Und wir wollen mit dem Anfang beginnen: Wo befinden wir uns hier?«
»Diese Erklärung darf ich nicht geben.«
»Ich denke, wir bekommen alles erklärt, wir brauchen nur zu fragen.«
»Gewiss — ich meine nur, dass ich selbst hierzu nicht ermächtigt bin.«
»Durch wen sollen wir die Erklärungen sonst bekommen?«
»Ich werde sofort den betreffenden Meister benachrichtigen. Bitte, gedulden Sie sich nur fünf Minuten.«
Die fünf Minuten konnten noch nicht vergangen sein, als das Telefon wieder klingelte.
Gleichzeitig aber ertönte auch ein donnernder Knall, dass alles erzitterte, und ein langanhaltendes Murren folgte.
»Ein Gewitter, es muss hier in der Nähe eingeschlagen haben!«, rief Arno.
Auch Atalanta glaubte wohl dasselbe, obwohl sie durch das Fenster in das Schneetreiben blickte. Es war eben alles Kunst, nur das wirkliche Gewitter mit Blitz und Donner ließ sich nicht unhörbar machen.
»Ja?«, fragte sie in das Telefon hinein.
Es hatte sich doch wieder jemand gemeldet, aber jetzt kam keine Antwort. Sie drehte die Kurbel, rief an, probierte alles — niemand antwortete.
»Der hier offenbar in dichter Nähe niedergegangene Blitz wird doch nicht etwa den Telefonbetrieb gestört haben?«
»Es ist merkwürdig, dass der Blitz oder vielmehr der Donnerschlag so plötzlich kam.«
»Nun, einmal muss das Gewitter doch seinen Anfang nehmen.«
»Aber sollte es denn bei dem einzigen Donnerschlag bleiben?«
»Kann auch vorkommen.«
»Oder sollte es eine Explosion gewesen sein, die wir gehört haben?«
»Auch möglich!«, entgegnete die Indianerin phlegmatisch.
Sie versuchte es nochmals, eine telefonische Verbindung zu bekommen, es gelang ihr aber nicht.
»Sieh, Atalanta, jetzt fängt es auch hier zu regnen an!«, rief da Arno.
Ja, plötzlich hatte sich das Schneetreiben in einen Regenfall verwandelt.
Sie traten ins Freie. Und die Fensterscheiben hatten nicht nur etwas vorgegaukelt, was hier ja alles möglich gewesen wäre, sondern es regnete wirklich in großen Tropfen.
Und wie warm dieser Regen war! Jeder Tropfen grub in den Schnee ein großes Loch, er schmolz zusehends zusammen.
»Da möchte man annehmen, dass es wirklich eine Explosion gewesen ist. Hier ist irgend etwas passiert, was die ganze Maschinerie in Unordnung gebracht hat, wodurch alle diese Gaukelspiele erzeugt werden!«
Noch einmal wurde das Telefon probiert. Es funktionierte nicht.
»Versuchen wir es mit einem anderen, begeben wir uns in die Wohnung.«
Sie fuhren nach dem maurischen Garten zurück. In dem Kiosk war es ganz auffallend warm, sogar heiß.
Als sie aber nun, ohne erst die pelzgefütterte Kleidung abgelegt zu haben, die Tür öffneten, da fuhren die beiden entsetzt zurück, schleunigst wieder die Tür zuschmetternd.
Ein solch heißer Brodem war ihnen entgegengeschlagen, wie aus einem glühenden Ofenloche kommend, ihnen fast die Gesichter verbrennend.
»Um Gottes willen, Atalanta, was ist das?!!«, schrie Arno bis zum Tode erschrocken.
Die Indianerin dagegen blieb ganz gleichgültig, obgleich gerade sie die Tür vor dem feurigen Ofenloche mit raschem Entschlusse wieder zugeworfen hatte.
»Hier ist eine Katastrophe passiert! Die Leute haben die Gewalt über die Wärmeregulierung verloren, die künstlich aufgespeicherte Wärme entladet sich plötzlich.«
Es war eine Erklärung, die etwas für sich hatte, wenn man nun einmal eine Erklärung haben wollte.
Durch die Fenster sahen sie, wie sich draußen die Pflanzen unter der Hitze krümmten. Und dabei regnete es noch immer in Strömen. Jetzt freilich stieg ein Nebel, ein Dampf auf, der ihnen alle Aussicht entzog.
Und sie konnten sich auch gar nicht länger solchem Beobachten hingeben. Hier in dem Kiosk konnten sie nicht bleiben. Das Öffnen der Tür hatte eine intensive Wärmemenge hereinströmen lassen, und außerdem fühlten sich die Wände schon heiß an. Es war hier drin wie in dem heißesten Raume eines Dampfbades, das Ausziehen der Pelzkleidung hätte gar nicht viel genützt. Vielleicht im Gegenteil. Ein Pelz kann ebenso gut vor dem Verbrennen wie vor dem Erfrieren schützen. Und sie fühlten die furchtbare Hitze am meisten im Gesicht und an den Händen.
»Atalanta, Atalanta, wir verbrennen!«, schrie Arno in gesteigertem Entsetzen, und dies war auch begreiflich genug.
»Zurück nach der Rodelbahn!«
Das war auch im Augenblick das Beste. Wenn es irgendwo noch kühl war, so musste es wohl dort sein, wo bisher Eis und Schnee gelegen hatte.
Sie hatten unterdessen herausgefunden, wie man in diesen Kiosken die Fahrstühle auch nach Belieben dirigieren konnte, und der Mechanismus gehorchte noch. Nur während der Fahrt konnten sie den Raum, in dem sie sich befanden, nicht aufhalten, sonst hätten sie das jetzt getan; denn nachdem sich der Fahrstuhl gesenkt hatte, wurde es wieder ganz kühl, und dabei blieb es, bis er sich wieder hob, da wurde es auch wieder immer wärmer.
Und wie ward ihnen, als sie hier vorsichtig ins Freie traten!
Ja, kühl war es auch hier, wenigstens im Vergleich zu der Hitze, die dort im maurischen Garten geherrscht hatte, aber doch schon so warm, dass bereits aller Schnee weggeschmolzen war.
Sie erkannten überhaupt die ganze Szenerie kaum wieder.
Von allen den Felsen stürzten Gießbäche herab, die sich auf der schiefen Fläche zu einem wilden Gebirgsbach vereinigten, der dort unten in einem wilden Strudel verschwand.
Nur ganz oben auf den Felsen lag noch etwas Schnee, hier unten war schon alles nackter, schwarzer Stein, und jetzt erst merkten sie, was dieser für eine intensive Hitze aushauchte, die nur durch den herabströmenden Regen noch etwas gemildert wurde.
»Hinauf auf die Felsen, hier unten verbrennen wir!«, schrie Atalanta.
Aber das rauchende Felsengestein war hier unten schon so heiß, dass man es gar nicht mehr anfassen konnte.
»Wir verbrennen, wir verbrennen!«, schrie Arno.
Ja, danach sah es auch ganz aus.
»Zurück in den Fahrstuhl!«
In diesem war es wieder ganz bedeutend kühler. Nur schade war es, furchtbar war es, dass er sich sofort in Bewegung setzte, sich nicht zum Stillstand bringen ließ.
Während der unterirdischen Fahrt war es ziemlich kühl, aber diese beförderte sie direkt in einen glühenden Backofen hinein!
»Lebe wohl, Atalanta, wir sind des Todes!«, ächzte Arno.
Ja, wenn er Grund gehabt hätte, gegen eine feuersspeiende Batterie zu stürmen, er hätte sich nicht gefürchtet, aber in einen glühenden Ofen befördert zu werden, diesem Gedanken war er nicht gewachsen.
Der Fahrstuhl ging nach oben und hielt. Sie befanden sich wieder in dem Kiosk, lebten noch und schienen am Leben bleiben zu sollen.
Gewiss, es war noch sehr warm, aber erträglich. Und draußen fiel der Schnee in dicken Flocken herab!
Freilich blieb er nicht liegen, er schmolz in dem Augenblick, da er den Boden berührte, aber dass es überhaupt schneite, war doch schon ein Zeichen, dass es draußen nicht mehr so heiß sein konnte.
Vorsichtig öffneten sie die Tür. Nein, es war ganz erträglich. Ein warmes Winterwetter. Ein ganz nasser Schnee, oder auch wieder ganz anders. Der Boden fühlte sich noch sehr, sehr warm an, während die emporgereckte Hand sich in einer ganz empfindlich kalten Region befand.
»Nun werde daraus der Teufel klug!«, machte Arno seinem Staunen endlich Luft.
»Da ist gar nichts so Staunenswertes dabei!«, entgegnete Atalanta. »Wir sind in einer Gegend, wo wirklicher, kalter Winter herrscht, aber der Boden wird hier unterirdisch geheizt, und die Hitze ist plötzlich zu groß geworden, und ebenso hat der Mechanismus, der auch die höheren Luftschichten bisher warm gehalten hat, plötzlich versagt, jetzt bricht die natürliche Winterkälte von oben herein, und der erhitzte Boden kühlt nach und nach wieder ab.«
»Und weshalb schneit es dann dort zwischen den Felsen nicht, wo zuerst Winter war?«
»Eben weil dort bis hoch oben hinauf Felsen sind, die sich plötzlich erhitzt haben, und die verwandeln nun den Schnee schon in höheren Luftschichten in Wasser.«
Arno konnte nur den Kopf schütteln, aber die Hauptsache war doch, dass es jetzt hier ganz erträglich war.
Aber ach, wie sah der ganze Garten aus, der noch vor einer Viertelstunde in üppigster Fruchtbarkeit geprangt hatte! Als wäre ein Todeshauch darüber gegangen. Und nichts anderes war es ja auch gewesen. Sämtliche Früchte und Blüten waren abgefallen, und die noch an Büschen und Bäumen haftenden Blätter hingen schlaff herab, würden sich wohl schwerlich wieder erholen. Außer dass in der Atmosphäre eine wahre Glut geherrscht haben musste, waren wahrscheinlich auch alle Wurzeln verbrannt worden; denn wie dünn hier das Erdreich war, davon hatten sich die beiden schon wiederholt übererzeugt. Und der darunter befindliche Stein war jedenfalls nur eine dünne Platte, eine Ofenplatte von gewaltiger Größe. Darunter zogen sich die Heizröhren oder elektrischen Drähte entlang, und die Wärmequelle hatte einmal in wenigen Minuten alle ihre aufgespeicherte Hitze ausgespien. Anders war es nicht zu erklären.
»Nein, Atalanta, da halte ich es doch lieber mit der richtigen Natur als mit solchen künstlichen Paradiesen!«, konnte Arno schon wieder in scherzhaftem Tone sagen, obgleich es ihm sonst höchst ernst zumute war.
»Es ist eben die alte Geschichte: Der liebe Gott sorgt schon dafür, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, und auch sonst lässt er sich nicht viel ins Handwerk pfuschen.«
Sie begaben sich in das Wohnhaus. Auch hier funktionierte das Telefon nicht, oder es antwortete doch niemand, wie zu erwarten gewesen war.
»Sollten die nicht wissen, was hier geschehen ist?«, fragte Atalanta.
»Ganz sicher wissen die das.«
»Sollten die nicht ein Mittel haben, sich mit uns anderswie als durch das Telefon in Verbindung zu setzen?«
»Natürlich, die Dienerschaft befindet sich doch hier in dichter Nähe. Denn was wir fordern, ist manchmal fast im Augenblick da, das kann auch nicht durch die schnellste Rohrpost etwa von weit her befördert werden.«
»Und warum suchen sich diese unsere unsichtbaren Diener nicht mit uns in Verbindung zu setzen?«
Arno blickte die Fragerin steif an.
»Du fragst recht merkwürdig, Atalanta!«
»Ja, antworte nur!«
»Du denkst doch nicht etwa, alle diese Leute könnten durch eine Explosion oder durch eine sonstige Katastrophe ihren Tod gefunden haben?«
»Wir müssen damit rechnen. Und weißt Du, was das auch für uns zu bedeuten hätte?«
Arno machte eine kleine Pause.
»In unserem Paradiese sind alle Früchte herunter gefallen«, sagte er dann, »alles ist dem Verderben preisgegeben — wir haben immer nur das bekommen, was wir forderten — von Mahlzeit zu Mahlzeit — haben gar keinen Proviant — das bedeutet für uns den Hungertod!«
»Ja. Innerhalb von acht Tagen müssen wir hier einen Ausgang gefunden haben. Länger getraue auch ich mir nicht ohne Nahrung auszukommen. Also vorwärts, suchen wir einen Ausgang! Darauf müssen wir jetzt alle unsere Kräfte konzentrieren.«
Da musste wohl das erste sein, dass sie einmal die Wandnischen näher untersuchten.
Alle drei Nischen in diesem Hause waren so groß, dass ein erwachsener Mensch bequem hineinkriechen konnte. Hinten war eine geschlossene Wand. Sie hatten die verschiedensten Werkzeuge zur Verfügung, auch eine schwere Eisenstange, aber vergebens versuchten sie alle Mittel, es gelang nicht, eine dieser Hintertüren zu erbrechen.

»Das ist tadellos schön gemalt und kann nicht
übertroffen werden!«, sagte der Italiener,
den Teller mit Kennerblicken betrachtend.
Wir fassen gleich die nächsten drei Tage zusammen. Niemand antwortete im Telefon, niemand meldete sich sonst wie — und die beiden sahen sich dem Hungertode ausgeliefert.
In der Natur waren rätselhafte Veränderungen vor sich gegangen.
Der ersten, furchtbaren Hitze war eine ganz grimmige Kälte gefolgt. Auch in der Wüste hatte es geschneit, auch dort hatte eine hartgefrorene Schneedecke gelegen.
Aber nur wenige Stunden, dann war es überall wieder warm geworden wie zuvor, mit Ausnahme der Rodelbahn, dort blieb es kalt. Zwar fehlte jetzt dort der Schnee, aber eine dünne Eiskruste hatte alles überzogen.
Es war zwecklos, über diese Rätsel nachzugrübeln. Es war hier eben gar keine richtige »Natur«. Mindestens war alles zur Hälfte Menschenkunst. Die Maschinerie, die dies alles besorgte, musste einmal aus der Ordnung gekommen sein und hatte sich wohl selbsttätig wieder eingestellt, alles funktionierte wieder in normaler Weise.
Aber die ersten Folgen der ersten Hitze und nachfolgenden Kälte waren nur zu deutlich zu erblicken. Es schien ja, als ob sich die meisten Bäume und Sträucher und Büsche in dem Garten wieder erholen wollten, aber für die beiden Gefangenen kamen sie nicht mehr in Betracht.
Am fatalsten für sie war, dass der Kälte noch einmal eine Wärme gefolgt. Die abgefallenen Früchte hätten sich in gefrorenem Zustand längere Zeit gehalten. So waren sie wieder aufgetaut — schon am nächsten Tage war alles verdorben gewesen, total ungenießbar.
In dem ganzen Garten gab es keine Beere mehr, kein genießbares Blatt, das sie hätten kauen können!
Es schien wieder neues Grün kommen zu wollen, aber ehe nur die ersten Spitzen des schnell wachsenden Rhabarbers eine Portion Gemüse gaben, da waren sie schon längst verhungert!
Sie hatten innerhalb dieser drei Tage alles probiert, was zu probieren gewesen war, um aus diesem Garten oder einer anderen Region herauszukommen, irgendwie ein Schlupfloch zu finden oder zu schaffen. Es war alles vergeblich.
Am ersten Tage hatten sie noch die abgefallenen Früchte essen können, am zweiten mussten sie schon lange suchen, ehe sie noch eine genießbare fanden, heute am dritten Tage gestand Arno offen, dass er von nagendem Hunger gepeinigt würde.
»Es ist zum Teufel holen!«, schimpfte er noch mit einigem Humor. »Adam und Eva wurden aus dem Paradies geschmissen — und wir wollen gern heraus und können nicht! Was machen diese Menschen solche Geschichten, wenn sie die ganze Sache nicht richtig kontrollieren können?! Na, wenn ich diese Mahatmas noch einmal erwische, die sollen ja von mir etwas zu hören bekommen!«
»Bist Du wirklich schon sehr hungrig?«, fragte Atalanta.
»Na, hörst Du nicht, wie mein Magen immer grimmiger knurrt? So eine Bande!«
»Wir sind noch lange nicht verloren, haben noch genug, um unseren Hunger zu stillen.«
»Was denn?«
»Nun, zuerst müssen wohl die Pelze daran kommen, das Leder.«
»Ich danke für Leder!«, lachte Arno grimmig. »Was die Natur mit Leder umgeben hat, das will ich haben! Ach, hätten diese Kerls nur ihre Finger von der Natur gelassen! Pfuschen die hier dem lieben Gott in seiner Schöpfung herum, und dann verlangen sie von uns, dass wir Leder kauen sollen! So 'ne Schwefelbande!«
Eine Nachtigall ließ ihre schmelzenden Töne vernehmen, zum ersten Male wieder. Während ihres Aufenthaltes hier hatten sie mit ziemlicher Sicherheit konstatiert, dass sich nur zwei Nachtigallenpärchen hier aufhielten, andere Vögel gab es überhaupt nicht.
»Atalanta, da singt ein Braten. Ja, es hilft alles nichts, wir müssen diese Nachtigallen wohl verspeisen. Zeig Deine indianische Kunst, fang sie. Gibt's auch gar keine Käfer mehr und — —«
Arno unterbrach sich, hob den Finger.
»Du, am See sind wir auch noch nicht gewesen!«
»Dort halte ich ein Suchen nach einem Ausgange nicht für angebracht. Hier im Wohnhaus an der Mauer oder vielleicht noch in der arabischen Felsenburg, wo die Pferde gefüttert wurden — das ist wohl unsere einzige Hoffnung.«
»Waren denn in dem See keine Fische?«
»Ich habe niemals etwas davon bemerkt, wir haben auch gar nicht an einen Angelsport gedacht.«
»Ein Paradies ohne Fische und sogar ohne Angelsport, so eine Lumperei! Und die wollen nun vom allerobersten Gipfel des Himalaja die Geschicke der Menschheit lenken! Na, ich danke! Schämen sollen sie sich was! Wenn diese Geistermenschen dort oben nur alle erfrören. Wenn sie nur schon vorher alle erfroren wären, ehe sie sich in unser Geschick mischten! — Fahren wir einmal an den See.«
Atalanta tat ihm den Willen. Die Fahrstühle funktionierten nach wie vor. Auch die kinematografischen Fensterbilder. Hier in diesem Kiosk machte sich soeben die friesische Fischersfrau wieder am Feuer zu schaffen, briet nach englischer Weise eine geräucherte Flunder, ein mächtiges Tier.
»So eine Gemeinheit!«, schimpfte Arno wieder mit halbem Humor. »Die isst Flundern und lässt uns zusehen! Und geht man hinein. dann ist sie verschwunden. Was diese Kinderei mit den lebenden Bildern nur überhaupt soll! Und nicht einmal einhauen kann man diese Fenster!«
Der Fahrstuhl beförderte sie an den See.
Hier eine große Überraschung.
Der ganze See war total ausgelaufen!
Es sah geradezu unheimlich aus, dieses riesige, tiefe, nackte Bassin. Man kannte die Szenerie eben ganz anders. Am unheimlichsten machten sich die beiden Inseln, wie die sich gegen acht Meter hoch in der Mitte emporreckten. Auch hier musste Hitze und Kälte geherrscht haben. Die ganze Vegetation war ebenfalls ruiniert.
Wie war das Wasser abgelaufen, wohin? Das sah man sofort. Auf der anderen Seite, ihnen gerade gegenüber. zeigte sich am Boden des Bassins, das heißt noch in der Uferwand, eine große Öffnung, der Anfang eines Tunnels, so hoch, dass man hätte hinein reiten können.
»Atalanta, sollten wir dort einen Ausgang finden, wo sich auch das Wasser befreit hat?!«
»Keine verfrühte Hoffnung, Arno! Untersuchen werden wir natürlich diese Schleuse.«
Sie begaben sich dort hinab, wo der sandige Strand sanft abfiel, und durchschritten das völlig trockene, ganz ebene Becken.
Und eine hoffnungsvolle Ahnung überkam sie, als sie den Tunnel erleuchtet sahen, von einem weißen Lichte erfüllt, das seine Quelle ganz dort hinten haben musste.
Sie wanderten den Tunnel entlang und hatten ungefähr vierzig Schritte zu machen, dann standen sie an einem ziemlich breiten Wasser, das träge zu ihren Füßen floss, zwischen glatten Felswänden, und an der Decke strahlte eine elektrische Bogenlampe.
An dem Flusse führte nach beiden Seiten hin eine Galerie entlang. Sie benutzten die rechter Hand, wo in einiger Entfernung wieder eine Bogenlampe strahlte, während sich nach links der Strom im Finstern verlor.
Bald erreichten sie eine offene Tür, blickten in eine weite Halle, an deren Wänden sich zahllose große Kisten auftürmten, durch Drähte miteinander verbunden.
»Eine elektrische Akkumulatoren-Batterie!«
»Und dort liegt ein Mensch!«
Er lag halb hingestreckt am Boden, halb auf solch einem Kasten. bekleidet mit einem schwarzen Trikotanzug, sehr mager, das glattrasierte Gesicht faltig und weiß wie eine Kalkwand, aber ohne Zeichen eines vorangegangenen Schmerzes — —
»Auch wieder so ein Opfer dieser Gesellschaft, das niemals wieder das Tageslicht erblickt hat!«, flüsterte die Indianerin.
Denn diesen schwarzen Trikotanzug, diese hagere Gestalt und dieses asketische Geistergesicht hatte sie schon einmal gesehen — bei jenem skelettartigen Menschen, der damals das kleine Unterseeboot gelenkt hatte, der einen Herzschlag bekommen oder sonstwie einen plötzlichen Tod erlitten hatte.
Das hier war freilich ein anderer, aber es war dieselbe Erscheinung, derselbe Gesichtsausdruck.
»Zeigt er Verletzungen?«, fragte Arno leise.
Nein, gar keine. Der Tod musste ihn mitten im vollsten Leben überrascht haben. War dieser vor drei Tagen erfolgt, so zeigte auch die Leiche noch keine Spur einer Verwesung. Es war sehr kühl hier.
Sie gingen weiter, sahen in diesem Raume noch eine andere Leiche im schwarzen Trikot, kamen in einen Raum, der angefüllt war mit Rädern und Kurbeln und Hebeln — eine systematische Maschinerie, aber wohl rätselhaft auch für jeden Ingenieur.
Hier lagen gleich vier Männer — tot, hingesunken ohne ein sichtbares Zeichen des Schmerzes. Wie friedlich schlummernd lagen sie da. Ja, der eine lächelte sogar noch glücklich, obgleich die Todesstarre schon längst vorbei war.
Dann ein engerer Raum, wohnlich als Schreibzimmer eingerichtet, und mit dem Oberkörper über dem Schreibtisch lag ein Mann, der einen schwarzen Kaftan trug, und da er mit dem Kopfe halb auf der Seite lag, konnte man auch sein Gesicht sehen — ebenfalls so faltig und geisterhaft bleich, aber mit einem kurzen, graumelierten Vollbart.
Er war nicht direkt über den Tisch gefallen, vor ihm war noch das Buch zu sehen, in das er bis zum letzten Augenblick geschrieben hatte.
Unverständliche Hieroglyphen — eine Geheimschrift.
Aber zu allerletzt, als er die kalte Todesfaust an seinem Herzen fühlte, war er doch noch in die Sprache gefallen, die er wahrscheinlich als Kind gelallt hatte, und er hatte diese letzten Worte englisch niedergeschrieben:
»Die Kohlensäure kommt, wir sind...«
»... rettungslos verloren«, hatte er sicher noch schreiben wollen.
Da hatte ihm der Tod die Feder aus der Hand genommen.
Die Pflicht dieses Mannes war es gewesen, über alles, was sich hier ereignete, Tagebuch zu führen, und er hatte seine Pflicht bis zum letzten Augenblick erfüllt.
»Kohlensäure, also wirklich!«
Daher auch die friedlichen und glücklichen Gesichter all der Toten! Wohl mochten sich alle diese Gesichter, als sie sich des unvermeidlichen Todes bewusst wurden, im ersten Schreck verzerrt haben — aber die Kohlensäure führt nicht nur den Erstickungstod herbei, weil atembare Luft, Sauerstoff fehlt, sondern die Kohlensäure ist ein direkt giftiges Gas, das sehr schnell betäubt, und in dieser Betäubung soll man immer angenehme Träume haben.
Jetzt war von diesem Gase keine Spur mehr zu merken.
Der nächste Raum, den sie betraten, enthielt wieder Kästen verschiedener Art. Bei einem war eine Tür geöffnet.
»Diese Einrichtung kenne ich von den Unterseebooten her«, sagte Atalanta, »das ist ein elektrischer Kochofen!«
Sie drehte an einem Rade, und bald begann eine Platte glühend zu werden.
»Ja, den kann ich bedienen.«
»Nun müssen wir auch etwas suchen, was wir hinein setzen können, der Kochofen allein tut es noch nicht«, meinte Arno.
Hierfür sorgte schon der nächste Raum. Er war ganz mit Konservendosen aller Art gefüllt. Und wieder der nächste verriet, wie man den Gefangenen im Paradies auf Wunsch auch immer frisches Fleisch hatte liefern können.
Es waren ganze Ställe, in denen Rinder, Kälber, Schweine und Schafe standen — oder jetzt vielmehr lagen. Alles tot. Und hinter Gittern Geflügel aller Art. Wieder nebenan waren die Räume für das Futter, ganze Felsenscheunen voll Heu und Körner und Kartoffeln und anderes. Außerdem noch in Eisschränken schon geschlachtete Tiere. Es war alles so sauber gehalten und die Ventilation durch einen ständigen Luftzug, der noch jetzt wirkte, so gut, dass von einem Stallgeruch nicht das Geringste zu merken war.
Erst wurden Konserven gewärmt, das ging am schnellsten, und die beiden aßen wie Menschen, die drei Tage gehungert haben.
»So, meine liebe Frau, nun zeige, dass Du auch einen Eierkuchen machen kannst — dort sind Eier — und während Du den Kleister anrührst, werde ich ein Beefsteak à la Chateaubriand für vier bis sechs Personen braten.«
»Eierkuchen?«
»Ja, Eierkuchen. Weißt Du nicht, wie man das macht? Ich gebe Dir das Rezept für zwei Personen: Nimm zwei Dutzend Eier, schlage jedes einzeln auf dem Rande einer Tasse oder eines Kohleneimers auf, stecke in jedes zuvor Deine Nase, ob es auch nicht — nein, es ist gotteslästerlich, in Gegenwart dieser Toten so zu sprechen. Aber die Eierkuchen kannst Du trotzdem machen.«
Nach Vollendung dieser ausgiebigen Mahlzeit wanderten sie weiter, kamen durch viele Räume und mächtige Hallen mit maschinellen Einrichtungen, von denen sie gar nichts verstanden, dann aber auch durch Felsensäle, immer elektrisch beleuchtet, die nichts weiter enthielten als riesige Spiegel, einer immer hinter dem anderen stehend, der Boden ein Spiegel und die Decke ein Spiegel, bald sah man sich darin und bald nicht, manchmal aber erblickten sie darin auch ganz wunderliche Bilder — sie hielten sich gar nicht damit auf, auch Atalanta gestand, dass ihr in diesem unverständlichen Zauberreiche, in dem hin und wieder eine Leiche lag, zu grauen begann.
Dann kam ein langer Gang, der an einer Tür endete. Sie ließ sich öffnen. Wieder ein endloser Gang, der viele Abzweigungen hatte. Überall brennende Bogen- und Glühlampen. Hier aber keine Leichen mehr.
Da blieb die Indianerin stehen und blickte sich um.
»Arno, ich merke etwas!«
Sie trat an ein kleines Loch, das sich in Kopfeshöhe in der Wand befand, winkte ihrem Gefährten, auch er musste durchblicken.
»Kennst Du das?«
»Himmel, meine Felsenwildnis mit den Karnickeln!«
»Wir sind im amerikanischen Felsengebirge an meinem Sklavensee!«
»Und über uns hat in der Nacht das südliche Kreuz geleuchtet!«
»Alles war nur Spiegelung!«
Sie hielten sich nicht weiter dabei auf, auch nicht an dieser Stelle, schritten weiter, und jetzt kannte Atalanta den Weg, sie konnte sich nicht mehr in dem Labyrinth, das hier erst richtig begann, verirren.
Und dort stand auch das Automobil, das sie so oft benutzt hatte, und sie tat es wieder.
Dann hatten sie die Region der eigentlichen Felsenwohnungen erreicht, wo die Fenster auf den See hinausführten, und sie blickten hinaus.
Es war Winter, der See zugefroren, am Ufer beugten sich die Bäume unter der Schneelast!
Und dort rauchte das Dampfsägewerk, dort rodelten die Kinder der Kolonie einen Hügel hinab!
Sie hörten in dem sonnigen Wintermorgen das Kreischen der Säge und die jubelnden Stimmen.
Und da ein vielstimmiger Gesang, ein deutscher Männerchor:
»Drei Könige zogen vom Morgenland, geleitet von einem Stern, zu suchen — —«
Der Gesang brach kurz ab, eine Pause, und dasselbe begann von vorn.
»Ich glaube, es ist bald Weihnachten, die üben sich ein Weihnachtslied ein!«, sagte Arno. »Denn die können doch nicht — —«
Auch er brach erschrocken ab.
Leidenschaftlich hatte sich die Indianerin plötzlich an seine Brust geworfen, sie umklammerte ihn weinend und schluchzend.
»Um Gottes willen, Atalanta, was ist Dir?«
»Du kannst noch fragen?! Ach, ich bin ja so glücklich, so glücklich, dass ich dies alles wiedersehen kann — dass ich Dich wiederhabe!«
Dann, als das seelische Gleichgewicht wieder hergestellt war, sahen sie sich weiter um in den Felsenräumen. Sie waren gerade in einer Etage herausgekommen, die ganz leer war. Aber auch schon hier konnte man viel daraus schließen, dass hier und da eine Fledermaus und manchmal auch ein Vogel tot am Boden lag. Und der eine Raum war die reine Leichenkammer von Fledermäusen.

Und dann sahen sie in einer unteren Etage auf einem Teppich eine kleine menschliche Gestalt liegen — Mister Dollin.
In seinen Kinderhändchen hielt er noch den Zettel, auf den er seine letzten Gedanken geschrieben hatte:
Vor ungefähr fünf Minuten erschütterte eine furchtbare Detonation den Felsen.
Ich fürchte, dass des Ingenieurs Goldeway technische Prophezeiung in Erfüllung
gegangen ist, der Kohlensäurekessel ist explodiert! Auf meine Warnung hin haben die Japaner und alle anderen die Felsengewölbe sofort verlassen. Sollte
ich — — —
Ja, er hatte gesollt!
Auch der Zwerg war als ein Held der Pflichttreue gestorben.
Wir verlassen nun das einsame Felsengebirge vorläufig und versetzen uns nach Berlin, in einen der dichtbevölkertsten Stadtteile.
Die Vorsaalklingel schellte.
Frau Baumer band die Küchenschürze ab.
Auf ihrem Wege durch den düsteren Korridor öffnete sich eine Zimmertür, durch die Spalte lugten die neugierigen Gesichter zweier halbwüchsiger Kinder, eines Knaben und eines Mädchens.
»Das ist der sechste, und der nimmt's wieder nicht!«, sagte der Junge, und man hörte unverkennbar etwas Schadenfreude heraus.
»Still, Paul!«, verwies die Mutter. »Geht an Eure Schularbeiten! Und überhaupt ist's die Gemüsefrau.«
Aber es war nicht die Gemüsefrau, sondern ein junger Mann, anständig, wenn auch nicht gerade sehr elegant gekleidet.
»Hier ist ein Garçonlogis zu vermieten?«
»Jawohl, bitte treten Sie näher.«
Die kleine, rundliche Frau wurde von einer gewissen Aufregung befallen. Es war auch ein gar wichtiges Ereignis. Zum ersten Male wollte sie in ihrer Wohnung einen Untermieter aufnehmen, irgend einen wildfremden Menschen!
Schon seit zehn Jahren war sie Witwe. Die Zinsen des vorhandenen Vermögens langten gerade, um ohne große Entbehrungen durchzukommen und den Kindern eine gute Erziehung zu geben. Nur als Richard, der älteste Sohn, das Technikum besuchte und dann beim Militär sein Jahr abdiente, hatte auch das Kapital etwas angegriffen werden müssen. Jetzt hatte Richard seine erste Stellung angetreten, in einer großen Maschinenfabrik, und er war gleich auf Montage nach Amerika geschickt worden. Freilich nur ein untergeordneter, spärlich bezahlter Posten. Viel abgeben konnte er der Mutter nicht. Eher Hannchen, die zwanzigjährige Tochter, die durch Porzellanmalerei einen hübschen Zuschuss zum Wirtschaftsgeld lieferte. Nur so konnte der dreizehnjährige Paul das Gymnasium besuchen, die um ein Jahr jüngere Grete eine höhere Mädchenschule, und es wäre auch wirklich schade gewesen, wenn den aufgeweckten, fleißigen, braven Kindern dieser teure Unterricht entzogen worden wäre.
Ein Glück war es, dass sie hier diese Wohnung hatten. Es war ja das billigste Stadtviertel, aber sonst war auch hier für sechshundert Mark keine Vierzimmerwohnung zu haben, gar nicht daran zu denken, und hätte sie auch noch viel mehr Mängel aufzuweisen gehabt als diese hier. Aber der Hausbesitzer war ein edler Philantrop — oder wahrscheinlicher ein kurioser Sonderling. Als er vor nun zwanzig Jahren dieses Haus erwarb, hatte er ausnahmsweise billige Mietpreise festgesetzt und seitdem niemals gesteigert. Freilich waren eben auch viele Mängel vorhanden. Aber immerhin, solch eine Wohnung für solch einen Preis gab es in ganz Berlin nicht wieder, und an die Mängel hatten sie sich im Laufe der langen Jahre gewöhnt.
Als nun Richard nach Amerika gegangen, war sein Zimmer frei geworden. Ein Familienrat hatte stattgefunden. Der Hauswirt erlaubte Untervermietung. Sollten sie? Wenn das Zimmer monatlich sechzehn Mark einbrachte, so waren das im Jahre fast zweihundert. Blieben nur noch vierhundert für Miete. Und sie hatten es sehr, sehr nötig, gerade jetzt, wo Richard von Kopf bis zu Füßen neu und reichlich hatte eingekleidet werden müssen.
Ja, sie wollten. Nur Paul war dagegen gewesen, indem er auf alle die diebischen Einlogierer aufmerksam machte, von denen die Zeitungen immer berichten.
»Aber sie mausen doch nicht alle«, sagte das jüngste Mitglied des Familienrats, Gretchen.
»Na — der bei Schrotmanns hat auch gemaust. Und das war ein ganz feiner. Eine silberne Schnupftabaksdose hat er gemaust, die aber von Zinn war, und von der Frau Schrotmann drei Hemden mit Spitzenbesatz. Mutter, ich an Deiner Stelle würde keinen nehmen.«
Paul(1) hatte nämlich auf ein eigenes Zimmer spekuliert. Jetzt sollte er sogar in dem Korridorverschlag schlafen. Aber er sah die Notwendigkeit ein, gab seine Opposition bald auf und gab zu, dass es auch hin und wieder einen nichtmausenden Zimmerherrn geben könnte. Und er hatte auch ganz recht, von solchen berichten die Zeitungen viel weniger als von mausenden.
(1) Im Original steht hier der Name ›Richard‹.
Freilich hatte der kleine Paul nur wehen Herzens seine Zustimmung gegeben, dann aber auch entschlossen wie ein ganzer Mann.
Doch mit dem Entschlusse allein war es noch nicht getan. Ach, was war das für ein Familienrat gewesen! Tagelang hatte er gewährt. Da musste erst Umfrage gehalten werden, wie es andere mit ihren »Möblierten« hielten, wegen des Preises, wegen des Kaffees, ob ein oder zwei Brötchen dazu. Und was gab es da sonst noch alles zu bedenken! Seife und Petroleum und Stiefelwichse! Und vielleicht auch in volle Pension nehmen? Sie aßen gute Hausmannskost, darauf hielt die Mutter, lieber machte sie auch das unschuldigste Vergnügen nicht mit.
Ja, eventuell volle Pension!
Vorgestern war die Annonce aufgegeben worden, gestern hatte sie im Abendblatt gestanden, heute früh um sieben hatte der erste Zimmerbedürftige geklingelt, und jetzt, drei Stunden später, meldete sich der sechste.
Also Frau Baumer hätte gar nicht mehr so aufgeregt zu sein brauchen, hätte nun schon daran gewöhnt sein können. Aber es war eben doch noch immer das große Ereignis.
»Hier ist das Zimmer.«
Ja, bloß die Tür brauchte geöffnet zu werden, dann wusste man, weshalb die vorigen fünf Zimmersucher sich hier nicht hatten einquartieren wollen.
Kein Zimmer, sondern nur eine heizbare Kammer. Allerdings recht hübsch und behaglich eingerichtet. Aber die Aussicht! Gar keine Aussicht. Einen Meter vom Fensterchen entfernt war die nackte Mauer des Nachbarhauses. Und aus dieser Schlucht stieg der Duft von faulenden Kartoffelschalen und anderen Abfällen selbst bis hier in die dritte Etage empor. Und außerdem noch ein Höllenspektakel von auf hohle Eisenplatten donnernden Schmiedehämmern.
»Was, das ist das Zimmer?! Hier soll ich drin wohnen?!«
»O, mein Sohn hat sich hier sehr wohl befunden, hat sehr gut studieren können, an das bisschen Klopfen gewöhnt man sich bald — —«
»Das nennen Sie ein bisschen Klopfen?! Das ist wohl eine Kesselschmiede. Wann fängt denn der Radau früh an?«
»Um drei — —«
»Was, schon früh um drei?!«
»Ja, es ist auch ein Hufbeschlag dabei, die fangen schon um drei — —«
»Und für dieses Nachtkonzert verlangen Sie sechzehn Mark?!«
»Ich würde auch fünfzehn — —«
»Nee, Madameken, nich in de Hand, nich geschenkt. Adieu.«
Ergebungsvoll schloss Frau Baumer hinter dem Sechsten die Vorsaaltür.
»Nein, Mama, wir haben uns vollständig geirrt.«
Auch Hannchen war auf den Korridor gekommen und hatte dieser Verabschiedung noch beigewohnt.
Die Dünste der Abfallgrube konnten nicht schädlich sein. Das hübsche, blonde Mädchen, das hier geboren und immer zu Hause war, strotzte vor Gesundheit. Aber die natürliche Röte der Wangen schien ihr nicht zu genügen, sie hatte auf jede Backe auch noch einen roten Pinselstrich gemacht. Die rechte Augenbraue hingegen hatte sie grün gefärbt, und die Stirn nun gar zeigte Kleckse und Striche in allen Regenbogenfarben, sie war die reine Palette.
Fräulein Johanna Baumer bemalte nämlich nicht nur Porzellantassen, sondern auch ihr Gesicht. Die Finger blieben bei der Arbeit ziemlich unbefleckt, aber durch eine gewisse Bewegung, wenn sie einen der doppelten Pinsel hinters Ohr steckte, bekam sie immer einmal einen Farbenstrich im Gesicht ab. Doch das gehörte schon vollkommen zur Hausordnung, die Familie kannte Hannchen gar nicht anders als mit buntscheckigem Gesicht, sie selbst öffnete so die Vorsaaltür, neulich erst war sie mit dieser Tätowierung sogar zum Bäcker gelaufen. Das freilich war nur eine Vergesslichkeit gewesen, sonst hielt sie sogar sehr auf sich.
»Da hat sich eene als Indianer anjemalt, die will uff'n Kriegspfad gehn!«, hatten ihr die Jungen nachgerufen.
Hannchen hatte sich furchtbar geschämt. Aber hier im Hause gehörte der Farbenschmuck mit zur Toilette.
»Nein, Mama, wir haben uns vollständig geirrt. Wir kennen diese Verhältnisse gar nicht. Was da verlangt wird. Wir sind daran gewöhnt, aber — —«
Wieder wurde die Klingel gezogen.
»Das ist der Siebente«, ließ sich Paulchen aus der vorsichtig geöffneten Türspalte wehmütig vernehmen. »Wenn der das Zimmer nicht nimmt, dann bekomme ich's doch, nicht wahr, Mutterchen? Ich will ja auch gern kein Fleisch mehr essen und keine Butterstullen.«
»Wir sagen, das Zimmer sei schon vermietet«, meinte Hannchen, sich nach der Eingangstür begebend.
»Meinetwegen«, seufzte die Mutter, sich selbst zum Troste noch hinzusetzend: »Aber das ist überhaupt die Gemüsefrau.«
Nein. es war wiederum überhaupt nicht die Gemüsefrau! Ganz im Gegenteil. Der Treppenflur war nicht viel heller als der Korridor, aber so viel konnte man doch erkennen, dass das etwas ganz anderes war, auch etwas ganz, ganz anderes als die vorhergehenden sechs Besucher.
Dieser siebente Zimmeranwärter hier fiel besonders durch den hohen Zylinder auf, und es war an sich schon eine sehr hohe Gestalt, und dieser Zylinder glänzte auch in dem Dämmerlichte in tadellosem Scheine. Außerdem nun noch ein so vornehmer Geruch nach Juchtenleder.
»Verzeihung — ist hier ein Zimmer zu vermieten?«
Diese prächtige, sonore Stimme, dieser blanke Zylinder, dieser vornehme Juchtengeruch — Fräulein Hannchen vergaß ganz, dass sie das Zimmer ja schon vermietet haben wollten.
»O gewiss, gewiss — bitte treten Sie ein.«
Der Herr nahm im Eintreten den Zylinder ab, folgte den mehr rückwärts als vorwärts gehenden beiden Frauen.
So erreichten sie die noch offene Tür des Unglückszimmers, und als nun hier der Herr im vollen Tageslichte stand, da erkannte besonders die Tochter mit Schrecken, was sie da angerichtet, solch einen Herrn bis hierher geführt zu haben, angesichts jener Häusermauer, an der die Kartoffelschalendünste unter den Klängen der Schmiedehämmer emporschwebten.
Mustern konnte sie ihn, dazu hatte sie noch die nötige Geistesfreiheit, sie wusste nur nicht recht, ob sie von unten oder von oben anfangen sollte. Sie begann unten.
Diese Schnürstiefel! Ganz merkwürdige Stiefel. Dieses Leder! Wo hatte sie solche Stiefel doch schon gesehen? Ach richtig, in der Leipziger Straße, in dem ganz, ganz feinen Schuhwarenladen, dessen Spiegeltür der Portier nur öffnet, wenn man aus einer Equipage oder aus einem Luxusautomobil steigt, andere Sterbliche müssen sie sich selber öffnen. Ja, dort in dem Schaufenster hatte sie solche Herrenstiefel stehen sehen. Fünfunddreißig Mark das Paar, vierzig, fünfzig Mark! Und nicht etwa mit Lack oder solchem Firlefanz. Leder! Aber nun was für Leder! Eben Luxus — Fancy, sagt der Engländer.
Von den Füßen wanderte der jungen Porzellanmalerin kritischer Blick zu den Händen. Hier wieder dasselbe. Diese braunen Glacéhandschuhe! Um zu wissen, was für ein Unterschied zwischen Handschuh und Handschuh ist, muss man natürlich Handschuhkenner sein. Und Fräulein Hannchen war Handschuhkennerin. Freilich betrieb sie dieses Studium nur theoretisch. Sie liebte elegante Glacés gewissermaßen platonisch. Denn solche Stiefel und Glacéhandschuhe hatte sie noch nicht einmal im größenwahnsinnigen Traume getragen — und wenn es der Fall gewesen wäre, so hätten die dieses Herrn gar nicht so sehr verkleinert zu werden brauchen.
Und dann der schwarze Gehrockanzug! Dieses Tuch, wie das glänzte! Und nicht etwa vor Alter! Das konnte nun gerade Frau Baumer sehr gut beurteilen. Denn ihr Mann war Tuchhändler gewesen, sie hatte immer die Musterkollektionen mit zusammengestellt. Aber solch ein schwarzes Tuch war darin nie vertreten gewesen.
Doch das vergaß man ja alles, wenn man dem Herrn ins Gesicht blickte. Dieses merkwürdige Gesicht! Zunächst tief brünett, dunkelbraun, aber dabei mit einem rötlichen Untergrund. Unbedingt ein Südländer, wahrscheinlich ein Italiener. Von ganz dort unten her. Da die Südländer doch wohl immer einen starken Bartwuchs haben, der nach dem Rasieren schon in der ersten Stunde wieder hervorbricht, musste der soeben vom Barbier kommen, das Gesicht war vollständig glatt. Das schwarze Kopfhaar links gescheitelt, sicher nicht pomadisiert, aber doch wie Seide glänzend. Und nun die Augen, wie die erst glänzten, aber immer mit ganz starrem Blick — und starr war auch das ganze Gesicht mit der Adlernase.
Ein Taxieren seines Alters war unmöglich. Jedenfalls sah er durch die Bartlosigkeit viel jünger aus, als er in Wirklichkeit war. Im Übrigen war es eine hohe, schlanke, aber breitschultrige und kraftvolle Gestalt.
»Ah, diese Wand ist schön!«
Mit freudiger Überraschung, die aber nur im Tone lag, denn dieses steinerne Gesicht schien gar keiner Bewegung fähig zu sein, hatte er es gesagt, und elastischen Schrittes ging er nach dem offenen Fenster, brauchte sich nur wenig hinauszubeugen, um mit ausgestreckter Hand die Nachbarwand zu erreichen, und er fühlte daran und stieß dagegen, als wolle er sich überzeugen, dass man diese Mauer nicht etwa wie eine spanische Wand beiseite schieben könne.
»Keine Aussicht, das Fenster so gut wie verhangen und dabei dennoch volles Tageslicht — solch ein Zimmer habe ich gar nicht zu finden gehofft!«
Mit diesen Worten hatte er sich wieder umgedreht.
Also nur in der Stimme hatte die freudige Überraschung gelegen, das bronzene Gesicht war ganz unbeweglich geblieben. Dafür waren es die Gesichter der beiden Frauen, welche ihre Überraschung mimisch ausdrückten — mehr ein ungläubiges Staunen als ein freudiges.
Ja, Richard hatte sich hier wirklich sehr wohl befunden, gut studieren können — aber dass diese nackte Wand gerade sehr schön sei, davon hatte er nie etwas gesagt, und das wäre auch eine Geschmacksverirrung gewesen.
Die so seltsam glänzenden Augen schweiften durch das Zimmer, zu den beiden Frauen hinüber, wohl zum ersten Male blickte er sie an — und plötzlich erstarrten diese Augen vollends, wie gebannt hingen sie an Hannchens Gesicht, sekundenlang, und das ist bei so einem Anblicken eine gar lange Zeit, da kann eine Viertelminute zu einer kleinen Ewigkeit werden.
Und auf Hannchens Wangen verschwanden die roten Pinselstriche, nämlich weil die Wangen selbst so purpurn erglühten. Ach, ihr bemaltes Gesicht! Wie sie sich schämte! Aber sie konnte doch nicht das Schürzchen vorhalten, nicht davonfliehen!
Die starren, glänzenden Augen rissen sich von ihr los, schweiften weiter durchs Zimmer, musterten den kleinen, abgenutzten Schreibtisch, das eingedrückte Sofa, den wurmstichigen Kleiderschrank, den dürftigen Waschtisch, das hochaufgetürmte Bett.
»Das ist ein sehr gutes Bett«, glaubte Frau Baumer, welche die Verlegenheit der Tochter gar nicht bemerkt hatte, einmal dieses Möbel loben zu müssen, mit der Hand über die schneeweiße Oberdecke streichend.
»Das ist mir gleichgültig. Was ist das für ein lautes Hämmern?«
O weh, nun kam es doch!
»Das ist eine Kesselschmiede!«, musste erklärt werden.
»Das geht den ganzen Tag?«
»Nun, mittags eine Stunde ist — —«
»Wann fängt es früh an?«
»Die Kesselschmiede früh um sechs, daneben ist aber auch noch ein Hufbeschlag, da geht's schon um drei los!«, musste die Mutter nun auch noch gestehen.
»Meistenteils sogar schon halb drei«, war Hannchen noch ehrlicher.
»Also früh zwischen zwei und drei? Da ist ja vortrefflich!«
»Vor—trefflich?«, echote es ungläubig zurück aus dem Munde der beiden Frauen.
Dieser Ausländer, der er doch unbedingt war, sprach ja ein ganz perfektes, dialektfreies Deutsch, aber die Ausdrücke musste er wohl noch verwechseln.
»Ja, ich stehe nämlich immer um zwei Uhr auf, spätestens halb drei: Und nichts ist mir lieber, als wenn ich immer lauten Fabrikbetrieb um mich habe, klingenden Hammerschlag höre. Das tätige Leben wirkt auf mich suggestiv ein, spannt meine Arbeitskraft an. Ich bin den ganzen Tag zu Hause, lese und schreibe.«
Die Tochter, die ihre Verlegenheit überwunden, wechselte mit der Mutter einen heimlichen Blick. Hatten sie wirklich richtig verstanden?
»Das Zimmer gefällt mir außerordentlich«, fuhr dieses siebente Weltwunder eines Zimmermieters fort. »Nur — der Preis! Sechzehn Mark?«
Von diesen Stiefeln und Glacés hätte man das eigentlich nicht erwartet. Aber so sind sie eben heutzutage, die jungen Herren.
»Ist das Ihnen zu viel?«, wurde zaghaft geflüstert, und die Tochter hatte auch noch ein »denn« dazwischen geschoben.
»Aufrichtig gestanden, ja. Ich wundere mich, bin erstaunt.«
Dieses »ich wundere mich« oder »bin erstaunt« oder gleich beides zusammen gebrauchte er sehr oft. Aber dabei staunte er niemals. Dieses Gesicht war ja gar keines staunenden Ausdrucks fähig. Dagegen suchte er es wohl in die Stimme, in den Tonfall zu legen, offenbar mit Absicht, was ihm aber nicht immer gelang, er vergaß es manchmal.
»Oder ist bei den sechzehn Mark auch die Beköstigung? Volle Pension, wie man hier sagt?«
Oho!! Für sechzehn Mark volle Pension! Hatte dieser Italiener oder was er sonst war — hatte der eine Ahnung von den hiesigen Verhältnissen! Mutter und Tochter fanden gar keine Worte.
»Ja, ich bin erstaunt. Ich habe bisher in einem der ersten Hotels unter den Linden gewohnt, zahlte allerdings zwanzig Mark — —«
»Mit voller Pension?!«, rief die Mutter. Sie genierte sich dann, dass ihr das in der Gedankenlosigkeit entschlüpft war.
»Nein, nur für das Zimmer, für zwei Zimmer, die aber auch ganz anders eingerichtet waren, und daneben hatte ich mein eigenes Badekabinett — —«
»Für zwanzig Mark unter den Linden in einem Hotel?!«, rief die Mutter, immer noch nicht merkend, was hier für ein Irrtum vorlag.
»Jawohl, zwanzig Mark — —«
»Ach, Sie meinen wohl pro Tag?!«, rief da Hannchen.
Ja, jetzt erkannte auch die Mutter ihren Irrtum. Denn die wusste auch recht gut, dass es in den Berliner Hotels solche Zimmerpreise gibt.
»Natürlich, pro Tag.«
»Nein, wir meinen sechzehn Mark für den ganzen Monat!«
»Dieses Zimmer sechzehn Mark für den ganzen Monat? Sie scherzen!«
Und jetzt wurde einmal versucht, die schmalen Lippen zu einem Lächeln zu verziehen. Der Versuch missglückte gänzlich.
Es sei zur Ehre von Mutter und Tochter gleich erwähnt, dass sie gar nicht daran dachten, diesen Fremdling, der trotz seiner braunen Haut ein echter weißer Rabe war, nun auszubeuten, einen höheren Preis zu fordern. Solch ein Gedanke lag ihnen ganz fern. Vielmehr erzählten sie mit unnötiger Offenherzigkeit, wie ja die ganze Wohnung nur sechshundert Mark koste, was für eine Hilfe ihnen da die monatlichen sechzehn Mark seien. Das letztere setzte wenigstens Frau Baumer noch hinzu. Der Tochter war es etwas fatal.

Und der weiße Rabe hinwieder besaß auch keinen solchen Charakter, dass er jenen nun gleich das Geld aufgedrängt hätte.
»Nun wohl, wenn Sie damit zufrieden sind, mir ist es recht.«
»Wünschen der gnädige Herr — —«
»Bitte, ich bin nicht gnädig.«
Au! Aber der Tochter imponierte es.
»Wünschen der Herr auch in Pension zu gehen?«
»Beköstigung? Nein, ich möchte mich selbst beköstigen.«
»Der Herr speisen in einem Restaurant?«
»Nein, das werde ich auch nicht mehr tun. Bisher aß ich in einem vegetarischen Speisehaus — sie bekommt mir nicht, die vegetarische Kost. Ich werde zu Hause essen.«
»Sie wollen hier kochen?«, wurde jetzt misstrauisch gefragt. Denn das gefällt natürlich keiner Hausfrau in ihrem möblierten Zimmer. Was dabei herauskommt, das kennt man doch.
»Kochen? O nein. Ich möchte Sie bitten, täglich zwei Liter frische Milch zu besorgen, früh und nachmittags je ein Liter. Gleichgültig woher. Die Milch ist ja hier überall gleich gut. Das Schwarzbrot wird mir von einer Bäckerei, von der ich es schon immer bezogen habe, morgens hierher geschickt. Um die Milch bitte ich Sie, sich kümmern zu wollen.«
»Sie leben wohl nur von Brot und Milch?«, konnte sich Hannchen jetzt zu fragen nicht enthalten.
»Ich möchte es wenigstens jetzt anfangen. Die Krautkost bekommt mir nicht.«
».Sie essen gar kein Fleisch?«
»Nein, gar nicht. Obgleich ich eigentlich kein ausgesprochener Vegetarier bin.«
»Und was wünschen der Herr früh zum Kaffee?«, fragte die Mutter.
»Gar nichts. Überhaupt keinen Kaffee, keinen Tee, keine Schokolade — es regt mich alles zu sehr auf.«
Oho, der war ja furchtbar empfindlich! Sogar Schokolade regte ihn auf! Und dabei sah der gar nicht so nervös aus!
»Da wollen Sie wohl die Milch dafür haben?«, fragte Frau Baumer und bekam dafür von der Tochter einen heimlichen Puff, und das mit Recht.
»Die werde ich Ihnen immer gleich bezahlen, ist wohl das Einfachste. Ist die Sache also abgemacht? Gut. Ich habe mich Ihnen noch gar nicht vorgestellt: Leonardo. Ich muss wohl einen polizeilichen Anmeldeschein ausfüllen.«
Auf dem Schreibtisch lag ein ganzes Pack solcher Scheine. Er setzte sich und füllte mit dicken Zügen die Rubriken aus.
Titus Leonardo — Neapel — Privat.
»Sind Legitimationspapiere nötig?«, fragte er, schon die Hand an der Brusttasche.
»Die müssen Sie auf der Polizei vorlegen, Sie werden hinbestellt, gerade mit den Italienern nehmen sie's sehr scharf, von wegen der Anarchisten — —«
Jetzt aber bekam die Mutter von der Tochter einen ganz mächtigen Puff.
»Na, ich meine doch nur so. Der Herr sieht doch nicht etwa wie ein Anarchist aus.«
Der Signore hatte mit keiner Wimper gezuckt.
»Doch Vorausbezahlung? Wie ist es mit der Kündigung? Ich habe gehört, dass so etwas beim Privatlogis hier üblich ist. Bitte, keine Kündigung. Ich zahle ein Jahr voraus, länger bleibe ich doch nicht hier. Ziehe ich eher, so ist das Geld eben verfallen. Ist das Ihnen recht?«
Ja, wenn dieser weiße Rabe eben wollte. Das heißt aber: Selbst unter den weißen Raben sind solche Exemplare selten! Solch einen Zimmerherrn gab in ganz Berlin nicht wieder!
»Das macht zusammen einhundertzweiundneunzig Mark, nicht wahr? Heute ist der zweite Juli. Ich habe so viel Geld nicht einstecken, schreibe Ihnen einen Scheck aus.«
Er zog ein Scheckbuch der Deutschen Bank hervor, Frau Baumer bekam in ihrem Leben den ersten Scheck, den sie natürlich etwas zweifelnd betrachtete.
»Die Deutsche Bank, ja, die kenne ich — bekommt man das gleich ausgezahlt?«
»Ohne Weiteres. Zu den angegebenen Geschäftsstunden. Abgestempelt ist er schon. Vielleicht, dass Sie Ihren Namen hinten drauf schreiben müssen. Es kann ihn aber jeder andere einlösen. Verlieren Sie ihn nicht, das ist so gut wie bares Geld. Mein Gepäck lasse ich gleich herbesorgen. Ist hier in der Nähe eine Badeanstalt?«
»Gleich hier an der Ecke, an dem Platze mit den Anlagen.«
»Ja, von dort komme ich. Aber keine Schwimmhalle, ich meine Wannenbäder.«
»Das ist alles da, das ist ein großartiges Bad.«
»Wann macht es früh auf?«
»Schon früh um sechs!«, konnte Hannchen mitteilen.
»So werde ich immer von sechs bis sieben fort sein. In dieser Zeit kann wohl mein Zimmer in Ordnung gebracht werden. Oder ist das zu früh?«
»Durchaus nicht!«
»Dann ist es ja gut. Ich empfehle mich den Damen. In einer Stunde bin ich wieder hier. Ah, dieses donnernde Hämmern ist ja köstlich! Darauf freue ich mich!«
Nun konnte über ihn gesprochen werden, und es wurde ausgiebig getan.
»So ein kurioser Mensch ist mir noch nicht vorgekommen!«
»Ein reicher Sonderling.«
»Lebt nur von Brot und Milch!«
»Na, warum denn nicht, wenn's ihm Spaß macht?«
»Und wie der mich anblickte!«
»Tat er das? Na, aber Du auch mit Deinem bemalten Gesicht!«
Auch die Kinder hatten ihn gesehen, hatten hinter der Tür gestanden.
»Weißt Du, Paul, wie der aussieht?«, sagte Grete. »Gerade wie der Schinkengooker in Deinem Lederstrumpf.«
»Wie Chingachgook die große Schlange? Grete, Du bist wohl — — — Stelle Dir mal diesen edlen Indianerhäuptling mit so 'n hohen Stehkragen und mit 'n Zylinder auf dem Kopfe vor! Nein, das ist ein alter Schnapsbruder.«
»Paul!«, riefen Mutter und Hannchen förmlich entsetzt. »Wie kommst Du denn auf so eine Idee?!«
»Na, wo hat denn der sein rotes Gesicht her?«
»Das ist ein Italiener — —«
»Die sehen nicht so rot aus.«
»Wo der nur Milch trinkt!«
»Gerade eben deswegen! Wenn die Schnapsbrüder fromm werden, dann trinken sie Milch. Bis sie's nicht mehr aushalten. Dann holen sie das Versäumte wieder nach.«
Der kleine Junge sprach da eine große Weisheit aus.
»Passt nur auf«, setzte er noch hinzu, »der fängt auch einmal wieder mit dem Schnapse an.«
»Paul, ich verbiete Dir, so etwas zu sagen!«, rief die Mutter. »Wo Du den Herrn gar nicht kennst!«
»Na, wenn er keinen Schnaps trinkt, dann hat er anderes auf dem Gewissen.«
»Paul, noch ein einziges Wort — —!«
Paul ging, um seine Ferienarbeiten schnellstens zu erledigen. Ach, wie hatte er sich darauf gefreut, sie in jenem Zimmer, in seinem eigenen, machen zu können! Dann wäre er die ganzen Ferien hindurch über seinen Büchern geblieben, wäre dann zu Michaelis ganz sicher noch vier Plätze heraufgerutscht und somit Klassenerster geworden. Nun hatte er gar keine Lust mehr. Wie Kinder eben sind — und manchmal noch mehr Erwachsene.
Die Mutter aber zog sich schnell an, wollte gleich den Scheck einlösen, nahm vorsichtshalber Geburts-, Tauf-, Konfirmations- und Trauschein mit.
Als sie nach einer Stunde mit dem Gelde zurückkam, hatte Signor Leonardo schon seinen Einzug gehalten
»Vorher hat ein Dienstmann seine Handtasche gebracht.«
»Sonst nichts weiter?«
»Nein.«
»Dann werden seine Koffer schon noch kommen.«
Aber diese kamen nicht. Und der Zimmerherr ließ von sich nichts sehen und hören, wie auch Gretchen mehrmals an der Tür lauschte — allerdings heimlich, die anderen durften von ihrer Neugier nichts merken.
Am Nachmittag brachte ihm Frau Baumer in einem Glaskrug einen Liter Milch hinein. Der Italiener saß am Schreibtisch, so wie er gekommen, nur den Zylinder hatte er auf die Stellage gehängt und die Handschuhe ausgezogen; er las in einem dicken Buche und machte sich auf einem Blatt Papier Notizen.
»Wünschen der Herr etwas dazu?«
»Nein, danke.«
»Sie müssen doch etwas essen.«
»Nein, danke. Eine kleine Hungerkur tut mir ganz gut. Morgen früh um sieben kommt mein Brot. Die Milch bezahle ich also immer gleich.«
Er hatte das Geld lose in der Hosentasche und gab ihr eine Mark.
»Ach, da kann ich nicht wechseln — —«
»Wechseln? Im Hotel kostet der Liter Milch eine Mark.«
»Ja, im Hotel! Unter den Linden! Nein, der Liter kostet nur zwanzig — —«
»Ach lassen Sie doch. Sie müssen doch auch jemanden schicken. Das andere ist also fürs Holen. Wann kommt die Milch früh?«
»Halb sieben. Aber ich kann doch nicht — —«
»Dann werde ich die Mark immer hier auf den Tisch legen.«
Frau Baumer musste die Mark mit hinausnehmen.
»Protzig!«, sagte Paul.
»Weshalb denn protzig?«, verteidigte Hannchen den neuen Zimmerherrn, um den sich jetzt alles drehte. »Das ist eben ein sehr reicher Mann, der den Wert des Geldes gar nicht kennt oder eben alles nach Hotelpreisen beurteilt.«
»Weshalb zieht er denn da zu uns in so eine Bude?«
»Das ist Geschmackssache. Der studiert die deutschen Verhältnisse, Land und Leute, jetzt will er die mittleren Klassen kennen lernen«, belehrte Hannchen den jüngeren Bruder, diese mittleren Volksklassen durch Gesten so genau bezeichnend und sich dabei drei dicke violette Pinselstriche über das Gesicht ziehend.
Dann wandte sich Hannchen an die Mutter.
»Aber, Mama — können wir denn die Mark auch immer behalten?«
»Na, der Milchfrau gebe ich sie nicht etwa!«
Auch Hannchens zartes Gewissen war schnell beruhigt. So freute sie sich.
»Mama, wo sollen wir denn nur hin mit dem vielen Gelde?! Das wären ja täglich eine Mark sechzig extra?!«
»Ja, Kinder, mir kommt das auch ganz märchenhaft vor. Hoffentlich bleibt er recht lange bei uns. Und dass Ihr nicht darüber sprecht!«
Die Nachmittagspost brachte einen Brief, der den Einlogierer einmal vergessen ließ.
Der erste Brief von Richard! Zunächst schilderte er die See- und Landreise, dann kam der junge Techniker ausführlich auf das Industrielle zu sprechen. Großartig! Fabelhaft!
Es handelte sich um die Baumwollspinnerei der Gebrüder Moor in Moorfield, Staat Colorado, mitten im Felsengebirge gelegen, südlich von Denver. Sie hatte aus Deutschland, aus der Fabrik des Kommerzienrats Heinrich Gehrling, wo Richard angestellt war, eine neue Art von Spinnmaschinen bezogen, er war also mit zur Montage hingeschickt worden.
Es war die einzige Baumwollspinnerei in ganz Amerika, die dem hierin herrschenden England Konkurrenz machte, besonders weil kolossale Wasserkräfte benutzt werden konnten, die alle Dampfmaschinen überflüssig machten. Achtzehntausend Spinner und Spinnerinnen in Tag- und Nachtarbeit! Diese Einrichtungen! Auch in sanitärer und anderer Hinsicht, zur Unterhaltung der Angestellten in ihrer Freizeit. Sportplätze in schwerer Menge, eigene Rad- und Pferderennbahnen, eigene Schwimmhallen, für die Clerks, die Kommis, ein eigener Marstall. Bibliotheken, eigenes Theater! Und was für eins! Sanatorien und Konservatorien! Für die aufgeweckten Kinder der Arbeiter das vortrefflichste Gymnasium. Alles frei! Legate zum Weiterstudieren an der Universität. Und nun diese Gehälter! Was so einer von dem Dutzend Direktoren bekam! Aber auch schon der gewöhnliche Arbeiter! Vom ersten Tage an pensionsberechtigt. Natürlich nicht gleich mit einer auskömmlichen Leibrente. Aber es wuchs von Woche zu Woche. Witwen- und Waisenversorgung und alles!
Dies alles, wollen wir nun den Brief selbst mitlesen, liegt in einem großen Tale, nach dem Besitzer wiederum Moor Valley genannt.
Nach Norden zu ist es offen, im Süden wird es von einem unübersteigbaren Gebirgszug begrenzt, von einer himmelhohen, steilen Felswand, die aber kilometerdick ist. Und hinter dieser Felswand nun liegt der rätselhafte Sklavensee mit seiner geheimnisvollen Besitzerin, wovon auch unsere Zeitungen einst so viel erzählt haben, was aber alles so märchenhaft klang, dass man bald lieber gar nicht mehr darüber gesprochen hat.
Es ist aber doch alles an dem. Hier wird fast über nichts weiter gesprochen.
Die rote Atalanta ist, nachdem sie lange verschwunden gewesen, wieder als ein Leutnant im mexikanischen Kriege aufgetaucht, dann verschwand sie abermals spurlos — —
Ich muss Euch dies ein andermal ausführlicher erzählen, sonst würde dieser Brief ein ganzes Buch werden, und jetzt will ich nur von mir selbst und meiner Umgebung berichten. Das interessiert Euch jetzt doch am meisten.
Und dennoch, zwischen diesem Moor Valley und der jenseitigen Gegend mit dem Sklavensee herrscht eine wunderbare Ähnlichkeit, wenigstens in gewisser Beziehung.
Wisst Ihr, wem dies alles hier, die ungeheuren Fabrikanlagen und die ganze Stadt mit den 35 000 Einwohnern gehört? Lasst Euch erzählen. Die Gründer und früheren Besitzer, die drei Gebrüder Moor, sind tot, sie sind alle unverheitatet gestorben. Der letzte von ihnen war Tobias Moor. Und der jetzige alleinige Besitzer? Das ist — hört und staunt — das ist ein Indianerhäuptling! Ein Sioux, ein Tolewane. Ratsch — tscham — tscham — pft pft pft — tarritarra oder so ähnlich heißt er. Soll der Kuckuck das aussprechen können. Auf deutsch: der blutleckende Jaguar. Dieser blutleckende Jaguar ist jetzt der alleinige Besitzer des Riesenetablissements, der ganzen Stadt und des ganzen Tales, der nicht nur ein Vermögen, sondern ein jährliches Einkommen von ich weiß nicht wie viel Millionen Dollars versteuert, und für das übrige Tal, das gar nicht benutzt wird, ist ihm schon wiederholt eine halbe Milliarde und noch mehr geboten worden, weil unter der Erde alles Eisen und Kohle ist, was er selbst aber noch nicht ausnutzt.
Wie ist dieser Indianerhäuptling dazu gekommen? Das ist nicht so einfach. Und hier liegt wieder ein anderes Verhältnis vor als bei dem benachbarten Sklavensee, der ja ebenfalls einer Indianerin gehört, die ihn von ihren roten Vätern geerbt hat. Aber der blutleckende Jaguar ist ja ein Sioux, stammt hoch oben aus dem Norden. Und doch handelt es sich um eine ganz ähnliche Sache. Denn Ihr wisst doch, dass die rote Atalanta, die jetzige Frau Gräfin von Felsmark, die letzte ihres Stammes ist, der Mohawks, die einst an diesem Sklavensee hausten. Sie wurden im Kampfe bis zum letzten Mitglied vernichtet, nur ein einziges Kind blieb zufällig verschont, eben jene Atalanta.
Bei diesem Siouxhäuptlingssohne nun liegt etwas ganz, ganz Ähnliches vor, und dennoch wieder etwas ganz anderes.
Also lasst es Euch erzählen. Und ich will mich nicht mehr mit Vergleichen der Ähnlichkeit aufhalten. Paul, das ist besonders etwas für Dich!
Vor ungefähr zwanzig Jahren sollten einige Stämme Sioux, die durchaus keine Ruhe halten wollten, aus dem Dakotagebiete, ihrer Heimat, mit Gewalt nach dem Indianerterritorium verpflanzt werden oder sie hatten völlige Ausrottung zu befürchten. Die letztere würde vor allen Dingen den Tolewanen gelten, einst der mächtigste Stamm der Sioux. Und man hatte sich nicht verrechnet. Die Tolewanen rüsteten sich zum Verzweiflungskampf im tollen Wahne. Es ist grauenvoll dabei zugegangen. Alle Weiber, Greise und Kinder, die noch keine Waffe zu führen wussten, haben sie zuvor abgeschlachtet. Dann gingen die Krieger in den Kampf. Die Ähnlichkeit mit dem Schicksale der Mohawks am Sklavensee ist auch gar nicht so merkwürdig, so etwas ist ja in Amerika schon zahllose Male vorgekommen.
Natürlich wurden die Tolewanen bis zum letzten Manne niedergemacht. Noch die Sterbenden schossen und stachen. Unter den Sterbenden, die das nicht mehr mochten, fand man einen etwa zwölfjährigen Knaben. Man hatte ihn auch schon im Kampfe sich hervortun sehn, er wagte sich am weitesten aus dem Hinterhalte hervor und schoss immer die Offiziere weg. Der halbwüchsige Junge, eigentlich ein Kind noch, hatte schon eine ganze Menge geräucherte Skalpe am Gürtel hängen, aber auch einige noch ganz frische, blutige, eben erst in aller Schnelligkeit abgezogene. Es war, wie sich dann herausstellte, der Sohn des Häuptlings, sein zukünftiger Nachfolger, der blutleckende Jaguar, der diesen »Ehrennamen« eben nicht umsonst bekommen hatte. Jetzt war er von Säbelhieben ganz zerfetzt, von Lanzenstichen durchbohrt, mit einem Schuss durch die Lunge. Aber er lebte noch.
Bei dem Gemetzel und dem ganzen Waffenzuge war auch Tobias Moor zugegen gewesen. Nicht als Soldat, sondern als Friedensapostel. Der alte Herr hat als Amateurmissionar viel unter den Indianern gewirkt, hat viel Gutes getan, hatte auch hier noch versöhnend vermitteln wollen. Der Junge hauchte doch nicht gleich sein Leben aus. Moor nahm sich seiner be sonders an und brachte ihn in Pflege. Fast ein ganzes Jahr hat der Indianerknabe zwischen Tod und Leben hingesiecht, bis er sich mit einem Male rasch erholte.
Der alte Moor hatte ihn zum Indianermissionar bestimmt. Aber der Junge wollte gern Arzt werden. Das Hantieren der Ärzte um ihn herum hatte ihm imponiert. Nun, das konnte ja später auch miteinander verbunden werden. Zuerst musste er doch Lesen und Schreiben lernen. Er kam in die Schule. Und was andere mühsam in Jahren erlernen, dazu brauchte der Indianerknabe immer nur eben so viele Monate. Dabei war nichts Außergewöhnliches. Alle die Neger und überhaupt alle Menschen, die damit spät anfangen, sollen so fabelhaft schnell lernen, fast ohne Ausnahme. Ihr Gehirn war eben bisher mit nichts weiter belastet, es saugt wie ein trockener Schwamm alles, was geboten wird, begierig auf.
Doch nur bis zu einer gewissen Grenze. Dann geht's im gewöhnlichen Bummelschritt weiter, wenn sie nicht plötzlich ganz versagten.
Aber mit dem kleinen Jakob, wie er getauft worden, war es doch nicht so.
Das war wirklich ein Genie. Nach vier Jahren schon konnte der Junge, der er mit seinen sechzehn Jahren doch noch immer war, die Universität beziehen, und nach drei weiteren Jahren schon nahm er an der Columbia-Universität in New York einen Professorenstuhl der Medizin ein.
Zu seinen Kenntnissen aber kam noch etwas anderes hinzu. Er hatte eine wunderbar sichere und leichte Hand. Vielleicht hing's mit seinem früheren Skalpieren zusammen. Warum nicht? Kurz: Viele Jahre lang ist Professor Doktor Jakob Moor neben dem Professor Dodd, von dem Ihr doch auch schon gehört habt, der berühmteste Operateur von ganz Amerika gewesen. Mit einem Male aber gab er diesen Beruf ganz auf, er wollte keinen einzigen Schnitt mehr tun, nicht einmal die kleinste Wunde mehr verbinden. Weshalb nicht, das weiß man nicht. Er sagt, er hätte seine ruhige Hand verloren. Aber das ist nur eine Ausrede. Er muss jemandem doch noch ein Heftpflaster auf eine Schnittwunde im Finger kleben können. Nein, er tut es prinzipiell nicht. Es muss ihm irgend etwas passiert sein. Man sagt, er könne kein Blut mehr sehen, er entsetzte sich vor jedem Messer.
Aber er ist auch nicht nur Mediziner. Schon früher hat er nebenbei noch Mathematik, Astronomie, Chemie, Philologie und alle anderen Wissenschaften studiert, hat in allen den Doktor- und zum Teil auch den Professorentitel. Es ist ein Universalgenie, wie ein solches die Welt wohl selten gesehen hat. Jetzt hält er sich in England auf, studiert oder hält Vorlesungen an der Universität Oxford.
Der nun hat Tobias Moor beerbt, ist alleiniger Besitzer der Riesenspinnerei und der ganzen Stadt. Darum kümmern tut er sich freilich nicht. Der hat seinen Generaldirektor, der wohl ein Gehalt von hunderttausend Dollars bezieht. Und dieser vier- oder fünffache Doktor und Professor, Ehrenmitglied aller Universitäten und wissenschaftlichen Gesellschaften, ist also dereinst ein skalpierender Indianer gewesen! Ein Indianer ist er ja heute noch, der letzte seines Stammes, der letzte Tolewane. Aber man sagt, dass er, sonst ein ganz harmloser Mensch, noch manchmal einen tollen Wahn bekommen soll. Der Indianer bricht manchmal bei ihm durch. Schon als Junge, als er noch Zögling des Instituts war, hat er sich manchmal auf ein Pferd geschwungen, oft genug auf ein gestohlenes, und ist fortgejagt, niemand wusste wohin, bis er nach mehreren Tagen ganz zerfetzt wiedergekommen ist. Dann war sein Wahn verraucht, dann hatte er für einige Monate Ruhe. Bis er sich wieder einmal austoben musste. Ja, hier wird etwas Grässliches von ihm geflüstert. Einmal, als er schon der berühmte Arzt und Gelehrte war, soll er hier in der Trunkenheit ins Leichenhaus gestiegen sein und alle aufgebahrten Leichen skalpiert haben, einige Dutzend. Sein Pflegevater, der ihn über alles liebte, soll Hunderttausende oder gar Millionen bezahlt haben, um diese Sache totzuschweigen, sie aus der Welt zu schaffen. Und man darf darüber auch gar nicht sprechen. Wenn's überhaupt wahr ist. Einer wurde deswegen einmal vor Gericht gezogen, konnte absolut nichts beweisen und ist wegen infamer Verleumdung schwer mit Gefängnis bestraft worden.
Nun, meine liebe Mutter, habe ich Dir zum Schluss noch etwas wenig Erfreuliches mitzuteilen — —
Eine kleine Jeremiade folgte. Der brave Sohn hatte gehofft, die Hälfte der großen Zulage, die er für Amerika bekam, der Mutter zuwenden zu können. Statt dessen kam er damit hinten und vorn nicht aus. Allen seinen Begleitern ging es ebenso. Daran war nur der amerikanische Direktor schuld, dem sie unterstellt waren. Der erlaubte nicht, dass die deutschen Ingenieure und Monteure in den Speiseanstalten der Fabrik aßen, nicht die Küchen der Arbeiter benutzten, und sonst war Verpflegung nur in dem einzigen, fabelhaft teuren Hotel von Moorfield zu haben. Eine Petition an den Generaldirektor war auch von diesem abschlägig beschieden worden, das war ebenfalls ein Deutschenhasser — —
»Sst!«, zischte Gretchen mit erhobenem Finger. »Der Möblierte ruft!«
Ja, er rief auf dem Korridor nach Frau Baumer. Diese eilte. Er konnte das offene Fenster nicht zubekommen. Die Mechanik wurde ihm erklärt, Frau Baumer kam zurück.
»Wo ist der Brief?«
»Ich habe ihn doch hierher gelegt.«
»Nein, ich glaube, Du hattest ihn in der Hand, als Du hinausgingst.«
»Nein, Mama Du hast ihn mitgenommen.«
»Dann muss ich ihn geradezu auf der Fensterbank bei dem Italiener liegen gelassen haben.«
Die Mutter getraute sich nicht, den vornehmen Mieter noch einmal zu stören, so verging einige Zeit, bis sich die energische Hanne auf den Weg machte. Sie klopfte an.
»Bitte.«
Er saß am Tisch und las wieder in dem dicken Buche, erhob sich aber bei Hannes Eintritt sofort.
»Meine Mama hat wohl vorhin einen Brief liegen lassen — ach, da liegt er ja richtig auf der Fensterbank! Verzeihen Sie nur, wenn ich gestört habe — —«
»Durchaus nicht, mich kann nichts stören. Aber eine Frage gestatten Sie mir wohl, geehrtes Fräulein.«
»Bitte sehr?«
»Sie sind wohl Malerin?«
Jetzt konnte das Mädchen wieder unbefangen lachen.
»Weil mein Gesicht so bemalt ist? Ja. Porzellanmalerin, und ich habe die üble Angewohnheit, immer einmal mit dem Pinsel ins Gesicht zu fahren. Weiß selbst nicht, wie ich das mache.«
»Porzellanmalerin? Ah, ich interessiere mich sehr für Porzellanmalerei. Darf ich bei Gelegenheit einmal etwas von Ihnen sehen?«
»Ach, es ist recht stümperhaft, was ich leiste.«
»Sie malen nur zum eigenen Vergnügen?«
»Nein, im Auftrage einer Fabrik, ich werde dafür bezahlt!«, war gleich die offene Erklärung.
»Da müssen Sie aber doch schon Gutes leisten.«
»Es ist nicht so schlimm, es wird auch danach bezahlt.«
»Darf ich nicht gelegentlich einmal Ihr Atelier besichtigen!«
»Meine Fensterecke, o ja, warum denn nicht«, lachte sie. »Wenn es Ihnen einmal passt.«
»Nein, wenn es Ihnen passt.«
»Na ja, es muss erst aufgeräumt werden. Denn da sieht es manchmal schrecklich aus. Bitte nochmals tausendmal um Verzeihung, Signore.«
»Gute Nacht, geehrtes Fräulein.«
Dabei aber war die Sonne noch nicht untergegangen.
Hannchen berichtete im Wohnzimmer.
»Ein äußerst höflicher, feiner, liebenswürdiger Mensch«, schloss sie, »aber — ich weiß nicht — ich fürchte mich vor ihm. Allein in der Wohnung möchte ich nicht mit ihm bleiben. Ich glaube, der kann gar nicht lachen — und auch nicht weinen.«
»Der hat eben was auf'm Gewissen«, musste sich Paul wieder hören lassen.
»Schäme Dich, Paul, einem fremden Menschen, von dem Du gar nichts weißt, so etwas nachzureden!«
Um acht hörte man den »Möblierten« zu Bett gehen.
»Und seine Koffer sind noch nicht gekommen! Jetzt hat der kein Nachthemd!«
»Wenn er nur überhaupt eins hat«, sagte Paul. »Mutter, denke an Schrotmanns — gib nur acht auf Deine Hemden — und Du auch, Hanne.«
Nein, er hatte wirklich kein Nachthemd, überhaupt gar nichts, was er nicht auf dem Leibe trug, auf den Waschtisch gelegt hatte und noch in der Handtasche barg, was aber doch nicht viel sein konnte.
Nachts Punkt zwei stand er auf, ohne einen Wecker nötig zu haben, ehe noch unten das Hämmern begann, brannte die Lampe an, zog die Stiefel an, machte leise einige Schritte — dann war Ruhe. Jetzt saß er vier Stunden am Schreibtisch. Punkt sechs ging er fort, ohne sich gewaschen zu haben. Na ja, er ging ja nebenan in die Badeanstalt.
Eine halbe Stunde später brachte ein livrierter Mann aus einer königlichen Hofbäckerei, deren Wagen die Stadt befuhren, ein kleines Schrotbrot, ein Pfund. Wenn es Frau Baumer hineinlegte, nahm sie vom Schreibtisch die Mark für die Milch, die zweite Mark erhielt sie am Nachmittag persönlich aus seiner Hand.
Das dicke Buch, in dem er immer las, war Taulers »Nachfolge des armen Lebens Christi«; es stammte aus der königlichen Bibliothek. Was er schrieb, schloss er immer im Schreibtisch ein und nahm den Schlüssel mit.
Punkt sieben kam er zurück, offenbar mit neuem Kragen und Manschettenhemd, saß den ganzen Tag am Schreibtisch, immer in Gala, sich nicht die geringste Bequemlichkeit gestattend, ging Punkt acht Uhr zu Bett.
Die zwei Liter Milch trank er, von dem Pfundbrote blieb meist etwas übrig.
Als er drei Tage so gelebt hatte, wusste man, dass sich daran auch nichts mehr ändern würde.
»Die Wäsche muss er sich unterwegs kaufen.«
»Um diese Zeit ist doch noch alles zu.«
»Er lässt sie sich ins Bad schicken. Und wo bleibt die alte?«
»Die lässt er im Bade liegen.«
»Das ist ja eine merkwürdige Lebensweise, und eine teure dazu.«
»Wenn er sich's leisten kann?«
Am Mittwoch war er gekommen, und am Sonnabend berichtete Hannchen, dass er heute früh unbedingt mit funkelnagelneuen Stiefeln zurückgekommen sei. Sie habe es ganz deutlich an den Sohlen gesehen, wenn diese auch schwarz gewesen seien.
»Dann irre ich mich auch nicht«, ergänzte die Mutter, »dann hat er heute auch einen neuen Anzug an, obgleich der alte auch noch ganz neu gewesen war. Und auf seinem Zylinder fehlt das weiße Tüpfelchen. Der ist ebenfalls neu.«
Die bestellte Waschfrau kam, und da kam die richtige. Ihre beste Freundin war die Frau jenes Bademeisters, der den Italiener bediente.
»Der wohnt bei Ihnen?! Hören Sie, was ist das nur für ein merkwürdiger Mensch? Der muss ja gar nicht wissen, wohin mit seinem Gelde. Er hat ein Wannenbad erster Klasse gleich ganz gemietet, da darf kein anderer mehr hinein, und dafür bezahlt er die Woche fünfzig Mark! Jeden Nachmittag bringt jemand aus Streckers Wäschegeschäft für ihn neue Wäsche hin, die er am anderen Morgen anzieht, Oberhemd und Unterwäsche und Strümpfe und Taschentücher und was er sonst braucht, immer nur das Allerfeinste, das trägt er nur einen einzigen Tag, das alte lässt er immer liegen, das kann der Badediener nehmen, der Löffler. Und gestern Abend ist ein neuer schwarzer Gehrockanzug gekommen, vom feinsten Hofschneider, und neue Stiefel und ein neuer Hut, und das trägt er nur eine Woche, jeden Sonnabend zieht er einen neuen Anzug an und nagelneue Stiefel und setzt einen neuen Zylinder auf, und die alten Sachen, die doch aber auch noch ganz nagelneu sind, soll nur der Löffler behalten, hat er gesagt. Er soll nicht noch einmal fragen, was damit werden soll. Und außerdem bekommt der Löffler noch für jedes Bad eine Mark Trinkgeld. Der weiß ja gar nicht mehr, was er mit dem vielen Gelde anfangen soll. Und dann kommt der Barbier, der muss ihn rasieren, wie viel der bekommt, weiß ich nicht, der darf aber kein Wort mit ihm sprechen, das hat er ihm streng verboten. Und dabei soll er gar kein Härchen im Gesicht zum Wegrasieren haben. Ja, was soll man denn von so einer Verschwendung denken? Und der wohnt bei Ihnen in der Hinterkammer?!«
Ja, Frau Baumer und Hannchen, die das hörten, wussten auch noch nicht, was sie davon denken sollten. Von solch einem verschwenderischen Luxus, der sich aber einzig und allein auf Anzug, Wäsche und Körperpflege erstreckte, hatten sie bisher auch noch nichts gehört. Und nun im Gegensatz dazu betreffs Wohnung und Essen die allergeringsten Ansprüche, fast gänzliche Bedürfnislosigkeit!
»Was macht der Badediener denn nun mit den Sachen?«, war Hannchens nächste Frage.
»Die verkauft er natürlich. Jetzt an einen Trödler, er wird aber schon noch Privatabnehmer finden, die es besser bezahlen. Und nun gerade der Lump! Wenn unsereins doch einmal solches Glück hätte! Oder wenn er das Geld oder lieber gleich die Sachen seiner Frau gäbe!«
»Was fängt er denn mit dem Gelde an?«, fragte Hannchen weiter, und plötzlich bekam das Mädchen einen ganz roten Kopf.
»Das verbringt er abends alles im Kartenspiel. Er ist und bleibt eben ein Lump. Die arme Frau ist zu bedauern. Miete und Wirtschaftsgeld — alles muss sie selber schaffen — durch Scheuern und Waschen. Der verbringt alles. Ein Glück nur, dass keine Kinder da sind.«
Die Mutter ging mit ins Waschhaus. Man sah, dass Hannchen mit einem großen Entschlusse rang, der ihr schon vorhin das Blut in die Wangen getrieben hatte.
»Ja, ich tu's, es ist meine Pflicht«, murmelte sie. Schon wollte sie an der Tür des Zimmerherrn klopfen, als es klingelte. Ein Bote der königlichen Bibliothek brachte für Herrn Titus Leonardo ein großes, schweres Bücherpaket. Mitzunehmen sei heute nichts wie sonst jeden Sonnabend.
»Warten Sie einen Augenblick, vielleicht will Herr Leonardo — —«
»Nein, nein, das hat der Herr schon alles abgemacht«, entgegnete der sich entfernende Bote, die Bemerkung nur auf die Trinkgeldfrage beziehend.
Sie trug ihm das Paket hinein. Er machte ihr bedauernde Vorwürfe, sich mit dem schweren Paket abzuschleppen. weshalb sie den Boten nicht habe hereinkommen lassen oder ihn selbst herausgerufen habe.
»Herr Leonardo, gestatten Sie mir ein freies Wort.«
»Aber ich bitte sehr.«
»Sie geben Ihre abgelegten Sachen dem Badediener, wie wir zufällig erfahren haben, und der ist es gar nicht wert.«
Das energische Mädchen schilderte es näher, erklärte offen, durch wen sie dies alles zufällig erfahren habe.
»Geben Sie das doch wirklich bedürftigen Leuten. Es gibt in Berlin so viele arme Schreiber und Kommis, die durch lange Stellenlosigkeit heruntergekommen sind, die sich gar nicht mehr vorstellen können, nur weil sie keinen ordentlichen Anzug haben. Denen ist damit geholfen. Sie brauchen sich nicht selbst darum zu kümmern, wir haben hier so viele wohltätige Anstalten und Vereine, die holen alles ab und verteilen es dann mit vorsichtiger Hand, dass es nicht an Unrechte kommt. Ich will Ihnen solche Adressen aufschreiben. Oder ich selbst will jemanden nach dem Bade schicken, Sie brauchen sich gar nicht darum zu kümmern. Nur dass es dieser Badediener nicht mehr bekommt.«
Die glänzenden Augen hatten die Sprechende unverwandt angeblickt.
»Sie haben recht, Fräulein. Ich habe bisher in dieser Beziehung ganz gedankenlos gehandelt, nur an meine eigene Bequemlichkeit denkend. Ich danke Ihnen sehr. Ja, bitte, arrangieren Sie das. Wollen Sie?«
»Aber mit dem größten Vergnügen! Sie wissen nicht, was Sie damit Gutes stiften können!«
»Nein, Sie gaben die Veranlassung dazu.«
»Ich werde ein paar Zeilchen aufsetzen, eine Vollmacht von Ihnen, wegen des Abholens, die Sie dann unterschreiben.«
»Bitte sehr. — Fräulein, Sie halten mich wohl für einen rechten Sonderling.«
»O, inwiefern denn?«
,Nun, wegen meiner Gewohnheiten.«
»Das kann doch jeder halten wie er will. Wenn Sie es sich leisten können? Überhaupt entsinne ich mich jetzt, dass auch Napoleon der Erste niemals gewaschene Sachen trug, jeden Tag ganz neue.«
Das bronzene Gesicht versuchte zu lächeln, was wiederum misslang.
»Nun, mit Napoleon möchte ich mich nicht vergleichen. Aber es gibt tatsächlich sehr viele Menschen, die es so halten, besonders in Amerika. Aber auch in Italien. Sicher auch hier. — Fräulein, Sie wollten mir doch einmal Ihr Atelier zeigen.«
Dazu war gerade jetzt die unpassendste Gelegenheit. Die Geschwister waren fort und die Mutter befand sich im Waschkeller. Aber warum denn unpassend? Man hatte nun einmal einen fremden Mann in die Wohnung genommen, der doch gleich gesagt, dass er immer zu Hause sei. Daran musste man sich gewöhnen.
Und was hatte man denn an diesem Zimmermieter auszusetzen? Ja, Hannchen fühlte sich immer ganz unheimlich in seiner Nähe. Aber sie schalt sich selbst deshalb.
Auf dem Paket standen die Autorennamen der darin enthaltenen Bücher. Meister Eckardt, Johannes Ruysbroek, Heinrich Suso, Hermann von Fritzlar. Die einstige »höhere Tochter« kannte diese Namen recht gut, wenn sie die Bücher auch nicht selbst gelesen hatte. Es waren christliche Mystiker, Theologen einer besonderen, beschaulichen Richtung — vom inneren Leben Gottes — zu denen auch Johannes Tauler gehört, dessen »Nachfolgung des armen Lebens Christi« dort schon auf dem Tische lag.
Und wenn es auch ein Privatgelehrter war, der diese religiösen Bücher nur zum Studium, nur aus wissenschaftlichem Interesse las — war es nicht immerhin eine Garantie für seinen Charakter?
So urteilte wenigstens dieses junge, unerfahrene Mädchen. Als ob nicht auch der Teufel Theologie studieren könnte!
»Bitte, dann kommen Sie gleich mit.«
Die Fensternische im Wohnzimmer war ihr Atelier. Auf einem großen Tische standen ungebrannte Porzellanteller, Tassen und Vasen, zum Teil schon bemalt oder damit angefangen, Farbkästen und andere Utensilien.
Der Italiener nahm einige fertige Vasen mit Raffael'schen Engelsköpfen, einen Teller mit Blumenmuster, betrachtete beide längere Zeit prüfend, die Entfernungen vom Auge verändernd.
»Das ist tadellos, ist schön, kann nicht übertroffen werden!«, sagte er dann.
»Ach, das ist doch nicht weiter — —«
»Fräulein, Sie dürfen Ihre Kunst nicht herabsetzen! Sonst wird auch einmal Ihre Muse verächtlich von Ihnen sprechen. Sie wissen selbst recht gut, dass Sie hierin Hervorragendes leisten. Malen Sie sonst? Aquarell? In Öl? Am liebsten freilich wären mir erst Bleistiftskizzen oder Kohle.«
»Sie sind selbst Künstler?«, flüsterte Hannchen, plötzlich ganz befangen werdend.
»Nicht ausübender, aber ich verstehe etwas davon — nein, nicht nur etwas, sondern sehr viel.«
Schüchtern gab sie ihm Skizzenbücher und Mappen, legte auch einige Aquarellstudien und kleine Ölmalereien vor ihn hin; er blätterte in den Zeichenbüchern und Mappen, betrachtete einige Blätter längere Zeit.
»Haben Sie schon einmal ein fachmännische Urteil über Ihre Skizzen gehört?«
»Ja.«
»Von wem?«
»Von dem maßgebenden Professor der Akademie der Künste, dem ich sie zur Prüfung vorlegte.«
»Und was sagte der?«
»Bitte, geben Sie doch erst Ihr Urteil ab, es interessiert mich.«
»Er hat Sie nicht ermutigt?«
»Nein.«
»Ich kann es auch nicht. Sie würden nur eine Malerin zweiten oder gar dritten Ranges werden und bei allem Fleiße auch bleiben. Es ist ein hartes Urteil, aber ein ehrliches, und eben deshalb dürfen Sie mir glauben, wenn ich Ihnen sage: In der Porzellanmalerei leisten Sie wirklich ganz Hervorragendes! Davon verstehe ich wirklich etwas. Ich kann Ihnen nicht nur alle bekannten Porzellanmaler herzählen, sondern kann auch auf den ersten Blick einen Trendel von einem Machaubriand unterscheiden, obgleich die beiden in ganz genau derselben Manier gemalt haben. In der Porzellanmalerei sind Sie echte Künstlerin, dürfen Sie sich schon eine Meisterin nennen. Die Feinheit dieser Engelsköpfe und die liebliche Zartheit dieses Blumenmusters hier kann nicht mehr übertroffen werden.«
Die junge Künstlerin wurde ganz rot vor Freude, vor Glück.
»Ach«, klagte sie dann, »wenn es nur einmal anerkannt würde! Aber das Publikum heutzutage versteht ja gar nichts mehr davon. Wenn es Meißner Porzellan mit dem Stempel der königlich-sächsischen Fabrik ist und bei einem Hoflieferanten gekauft wird — das genügt. Darauf kommt es an. Oder eine alte, zersprungene Tasse mit der Urkunde, von welchem alten Meister sie gemalt worden ist — das wird bezahlt. Aber neue Malerei — von wem die ist, danach wird gar nicht mehr gefragt. Ja, wenn Menzel so eine Tasse malte und seinen Namenszug darauf setzte, dann würde sie zehnfach, hundertfach mit Gold aufgewogen werden. Er könnte dabei mit Absicht, aus Ironie, irgend etwas draufgekleckst haben. Aber wir eigentlichen Porzellanmaler bleiben unbekannt. Der Unterschied zwischen einer Stümperei und wahrhaft künstlerischer Ausführung wird auch gar nicht mehr beachtet. Wenn auf dem echt Meißner Porzellan nur Veilchen und Vergissmeinnicht sind. Ich muss von früh morgens bis spät abends malen, wenn ich drei Mark verdienen will.«
»Ach, das ist ja schrecklich!«
»Ja, es ist so.«
»Es gibt aber doch auch wirkliche Kunstkenner, die auch Geld dafür ausgeben.«
»Die gibt es. Aber die gehen doch in Geschäfte, wo sie die Auswahl haben.«
»Solch ein Tässchen wie dieses hier habe ich im Schaufenster mit fünf Mark ausgezeichnet gesehen.«
»Ja, das kostet es auch. Bei mir würden Sie es für zwei Mark bekommen.«
»Ach was!«, versuchte der Italiener zu staunen, was ihm aber höchstens mit dem Tone gelang.
»Da würde ich noch sehr, sehr viel daran verdienen, das heißt, da würde meine Arbeit noch sehr gut bezahlt werden.«
»Wissen Sie, woher man solche ungebrannte Ware bezieht?«
»Direkt aus der Meißner königlichen Manufaktur.«
»Sie bekommen sie zu Engrospreisen?«
»Ich, ja. Mein Name als der einer billigen und zuverlässigen Malerin ist dort schon sehr gut bekannt, ich bekomme oftmals von dort direkte Aufträge.«
»Für wen malen Sie das hier?«
»Für ein Berliner Porzellangeschäft.«
»Haben Sie da festen Kontrakt, der Sie bindet?«
»Durchaus nicht. An diesem Auftrag hier habe ich höchstens noch eine Woche zu malen und muss mich unterdessen schon nach anderer Arbeit umsehen. Sonst wird's knapp in unserem Hausstande.«
Bei dieser offenen Erklärung warf der Italiener ihr nur einen Blick zu und griff gleich wieder nach dem Blumenteller.
»Hören Sie, Fräulein, Sie bringen mich auf eine Idee! Ich habe im nächsten Jahr um diese Zeit ein Hochzeitsgeschenk zu machen. Habe schon immer gegrübelt, was ich schenken könnte. Etwas ganz Besonderes. Jetzt weiß ich es. Ein gemaltes Meißner Tafelservice. Würden Sie mir das malen?«
»Ja, Herr Leonardo, wenn Sie mir den Auftrag zuweisen wollen«, sagte Hannchen mit ziemlicher Gleichgültigkeit. »Wie groß soll denn das Service sein?«
»Nun — ein Suppenteller, drei Speiseteller, zwei kleinere Teller, Kaffeetasse, Teetasse, die dazu gehörenden Untertassen — das wären zehn Stück — von jedem drei Dutzend — macht zusammen dreihundertsechzig Stück, wozu noch Suppenterrine, Bratenschüsseln und dergleichen kommt. Könnten Sie mir das in einem Jahre liefern?«
Jetzt freilich begann Hannchen zu staunen. Sie hatte nur an ein Kaffeeservice gedacht.
»Herr, wissen Sie auch, was das kostet?! Aus der Meißner Porzellanmanufaktur?«
»Nun, ungefähr kenne ich die Preise. Auf zwanzigtausend Mark habe ich mich gefasst gemacht.«
»Nein, so viel kostet es längst nicht, aber — —«
»Inklusive der Malerei! Es kommt doch ganz auf die Malerei an. Ich werde die Muster selbst entwerfen, und da werden Sie allerdings eine ganz — knifflige Arbeit, wie man hier sagt, bekommen. Wir machen die Sache so: Sie lassen sich aus Meißen ungebrannte Proben nach meinen Angaben schicken. Unterdessen entwerfe ich die Muster zur Malerei. Damit gehen wir — nehmen hier Porzellangeschäfte fremde, ungebrannte Sachen zur Ausführung der Malerei an?«
»Das tut jedes Porzellangeschäft. Größere Aufträge lassen sie aber in Meißen ausführen, schon wegen des Brennens.«
»So gehen wir in ein gutes Geschäft, in das beste, und fragen, was die Ausführung der Malerei nach meinen Mustern kostet. Und denselben Preis zahle ich Ihnen. Einverstanden?«
Die junge Künstlerin glaubte plötzlich den Himmel sich öffnen zu sehen. Nur eine kleine unangenehme Empfindung wollte sich ihr dabei aufdrängen.
»Herr, Sie wollen gegen mich großmütig — —«
»Bitte, Fräulein!«, wurde sie von der prächtigen Stimme unterbrochen. »Von einer großmütigen Unterstützung, was Sie wohl sagen wollten, ist da gar keine Rede. Sie werden das Porzellan zu Engrospreisen bekommen, dabei werde ich schon einige tausend Mark ersparen, das nehme ich dankbar an. Aber Sie können nicht von mir verlangen, dass ich Ihnen die künstlerische Arbeit zum kümmerlichsten Stundenlohne bezahle. Dazu müssen Sie mich doch nun schon kennen. Und mein Entschluss ist jetzt gefasst: Ich schenke jenem Brautpaar ein Meißner Tafelservice. Und dieses Paar speist nicht von gewöhnlichen Tellern. Die drei Dutzend Teller von jeder Sorte langen nicht einmal am Jour fixe für die Gäste. Ich kann Ihnen schon jetzt versichern, dass Sie dann Aufträge in Hülle und Fülle bekommen werden, besonders aus Italien, direkte Bestellungen von Familien. Können Sie die dreihundertsechzig Stück in einem Jahre liefern?«
»Ja, das kann ich«, flüsterte Hannchen, ganz erregt. »Das heißt, da muss ich natürlich erst das Muster sehen.«
»Nun, wenn auch nur ein einziges Dutzend fertig würde. Aber bei drei Dutzend bleibe ich, und vorher dürfen Sie keine anderen Aufträge annehmen. Wollen Sie?«
»Und ob ich will!«, jauchzte da die junge Künstlerin auf.
»Also abgemacht! Wie ist es nun mit den Porzellanproben?«
Hannchen hatte ein Musterbuch der königlich-sächsischen Porzellanmanufaktur zur Hand. Illustrationen und Angaben ließen keinen Zweifel aufkommen. Der Italiener wählte sofort, immer nur das beste, notierte die Preise und rechnete zusammen.
Rund fünftausend Mark, Grossistenpreis. Zweitausend Mark ersparte er mindestens dabei.
»Nun lassen Sie sich so ein Muster schicken, von jedem ein Stück. Das muss wohl gleich bezahlt werden.«
Nein, dafür war die dort bekannte Malerin gut.
»Und wie lange dauert die Anfertigung?«
»Das geht dann schnell. In acht Tagen haben wir es schon hier.«
»So schreiben Sie gleich heute noch, gleich jetzt. Wenn morgen auch Sonntag ist. Und ich fange morgen früh sofort mit den Entwürfen der Muster an. Ich habe eine gute Idee dazu. Geben Sie mir doch gleich einen Farbkasten mit.«
Als die Mutter aus der Waschküche kam, fand sie die Tochter ganz entgeistert auf dem Sofa sitzen.
»Um Gottes willen, Hannchen, was ist denn passiert?!«
Da jubelte die Tochter los:
»Mama, diesen Zimmermieter hat uns der liebe Gott geschickt — wir sind reich — endlich soll meine Knechtschaft ein Ende haben!«
Sie berichtete. Ja, wenn es auch nur ein ganz einfaches Muster war, auch das bescheidenste Geschäft würde für die Malerei nicht unter dreitausend Mark verlangen. Denn bei solch allerfeinstem Porzellan kam doch keine Stümperei in Betracht. Der ausführende Künstler hätte von dem Geschäft natürlich allerhöchstens tausend Mark erhalten.
Die Mutter verstand genug vom Berufe der Tochter, wenigstens nach der materiellen Seite hin, um das zu wissen, und sie glaubte, dass es nur einer einmaligen Einführung bedürfe, um dann mit direkten Aufträgen überhäuft zu werden. Es ist ja immer die alte Geschichte vom Künstlerelend und Künstlerglück.
Paul wurde ganz kleinlaut, als er es hörte. Auch gegen das nun erst kommende Kapitel mit der verschwenderischen Wäsche- und Kleidergeschichte hatte er gar nichts einzuwenden. Im Gegenteil, das alles imponierte ihm ganz mächtig.
Und Hannchen wollte ihn an ihrem Glücke teilnehmen lassen. Zur Wohnung der Flurnachbarn gehörte ein separates Zimmer, Eingang von der Treppe aus, es wurde unmöbliert besonders vermietet, jetzt war es gerade frei. Das sollte Paul bekommen.
Da kannte auch dessen Jubel keine Grenzen!

Links und rechts schmetterten die vier Angreifer des Italieners
gegen die Wände, ein Kleiderschrank krachte zusammen.
Im Laufe des nächsten Tages verlangte der Italiener wiederholt mehr Farben und andere Malutensilien. Einen Blick auf seinen Arbeitstisch bekam man nicht.
Zum Abendbrot stellte sich pünktlich wie jeden Sonntag Herr August Schulze ein. Er hatte mit Richard zusammen das Technikum besucht, war aber bedeutend älter als dieser, hatte schon vorher drei Jahre bei der Kavallerie gedient.
Es war ein äußerst strebsamer Mensch. Er war ein Schlossergeselle gewesen, hatte sich das nötige Geld zum zweijährigen Besuche des Technikums zusammengespart, sich gewissermaßen vom Munde abgedarbt. Das Technikum forderte das Einjährigenzeugnis oder die entsprechenden Kenntnisse, durch strenges Examen nachzuweisen, und der Schlossergeselle hatte sich diese durch Selbststudien angeeignet. Dann war er aber auch gleich als Werkmeister in jener großen Spinnmaschinenfabrik angekommen, er hatte eine ausgezeichnete Stellung. Durch ihn auch nur war Richard dort angestellt worden, wenn auch erst nur als Hilfszeichner.
Und auch noch jetzt war August rastlos auf seine Weiterbildung bedacht. Jeden Abend saß er bis in die späte Nacht über seinen Büchern, rechnete und zeichnete. Nur einmal in der Woche ging er in den Turnverein. Denn der kleine, untersetzte Mann mit den etwas geschweiften Kavalleriebeinen war ein gewaltiger Turner vor dem Herrn. Sonntags machte er Fußmärsche von fünfzig Kilometern und noch weiter, ob die Sonne glühte oder ob's schneite und hagelte. Am Sonntag Abend aber war er bei Baumers. Punkt halb acht klingelte er, unter dem linken Arm eine große Leberwurst als Zugabe für den Abendtisch, in der rechten Hand eine Rose für Fräulein Hannchen und in der linken eine Zuckertüte für die Kinder. Ging die Familie Sonntags abends einmal aus, nur im Sommer, in einen Konzertgarten, so bezahlte er das Bier für alle. Das hatte er von Anfang an so gemacht, als Richard ihn einmal, gleich in der ersten Studienzeit, für den Sonntag Abend eingeladen hatte, obgleich er sich damals das Geld dazu vom Munde abdarben musste, was man natürlich nicht gewusst hatte. Jetzt konnte er sich das ja leisten. Aber ändern tat sich daran nichts. Frau Baumer hatte damals am ersten Abend gesagt, dass seine mitgebrachte Leberwurst delikat sei, und da brachte er seit nun zwei und ein halb Jahren auch immer dieselbe Leberwurst mit, und immer dieselbe Zuckertüte und immer dieselbe Rose. Er war der Hausfreund, am Sonntag Abend gehörte er mit zur Familie, sie duzten sich mit Ausnahme der Frau Baumer, ohne ihn wäre es kein Sonntag Abend gewesen.
Eine ansehnliche Person war er aber nicht. Wie gesagt: eine kleine, untersetzte, breitschultrige Gestalt mit etwas geschweiften Kavalleriebeinen, dazu ein unförmlich großer, semmelblonder Kopf, in dem nichtssagenden Gesicht mit einigen unsichtbaren Barthaaren eine Mopsnase und wasserblaue Augen, die immer nicht wussten, wo sie vor Verlegenheit hinsehen sollten. Überhaupt linkisch! Auch hier, wo er doch ganz zu Hause war, wusste er im Stehen nicht, was er mit seinen großen Bärentatzen anfangen sollte, er lag immer im Kampfe mit dem ungewohnten Stehkragen, im Sitzen rieb er sich mit Vorliebe die Knie und die Waden, musste zu jedem Bissen genötigt werden, wagte nicht zu kauen, noch weniger sich eine Zigarre anzubrennen, steckte sie wiederholt verkehrt in den Mund, ohne zu spucken oder sonst das kleinste Zeichen von Schmerz von sich zu geben, wurde bei jedem Worte rot, wusste keine Antwort, konnte nur stammeln — ein unglücklicher Mensch in seiner Schüchternheit!
»Irrt Euch nur nicht«, hatte Richard schon mehrmals gesagt, als der arme, unbeholfene Mensch dann bedauert wurde. »Ihr solltet ihn nur einmal in der Fabrik sehen! Da ist er ein kleiner Teufel! Schimpfen tut er freilich nie, aber was der für ein Feuer hinter den Arbeitern macht, und wie bei dem alles klappt! Der bekommt doch nicht umsonst in der Woche sechzig Mark.«
Aber die anderen konnten ihn sich auch in der Fabrik nicht anders vorstellen.
Punkt halb acht klingelte es. Ein Chronometer konnte nicht pünktlicher gehen.
»Die Leberwurscht kommt!«, rief Paul, nach der Tür rennend, gefolgt von den beiden anderen. »Her mit der Leberwurscht, August! Was, das sind doch zweie?!«
»Ja, ich habe — habe — ich dachte — dachte — wie's manchmal so kommt — —«
»Mutter, Mama, der August hat heute auch noch eine Blutwurst mitgebracht, genau so groß!«
»Ja, ich dachte — dachte — weil — weil — —«
»Und ein ganzes Pfund vom feinsten Schokoladenkonfekt!«, jubelte Grete, die ihm schon den Papiersack aus der Seitentasche gezogen hatte.
»August, Du hast wohl das große Los gewonnen?«, scherzte Hannchen.
»Nein — a — a — a — ach nein — wo ich — wo ich doch gar nicht spiele — aber — aber — ich habe gestern — fünf Mark Zulage bekommen — und — und — da dachte ich — dachte ich — —«
»Mutter, Mutter, der August bekommt jetzt fünf Mark mehr, dafür bringt er uns nun jeden Sonntag zwei Würste mit!«, jubelten die Kinder.
Aber diese waren viel zu aufgeweckt und wohlerzogen, um hiermit Ernst zu meinen. Und die Hauptsache war: Dieser Hausfreund wollte ja gar nicht anders behandelt sein.
»Und wo ist denn meine Rose?«, examinierte Hannchen weiter.
»Die habe ich — habe ich — —«
»Was, Du hast einmal meine Rose vergessen?!«
»Ich dachte — dachte — —«
»Was ist denn hier in dem großen Paket?«
»Das — das — da drin — ist etwas für mich —«
Er wurde in die Wohnstube gezogen, geschleift. Von allein, ohne Anwendung von Gewalt, wäre er ja niemals hineingekommen.
»August, Du hast ja schon wieder Deinen Schlips vergessen!«
»Nein — a — a — ach nein — Ihr macht nur Spaß — —«
Jetzt wäre es angebracht gewesen, dass er sich an den Hals griff, aber nun wagte er es gerade nicht.
Er wurde vor den Spiegel geschleppt.
Ach Du großer Schreck! Ja wirklich! Es kam öfters bei ihm vor, und jedes Mal wollte er vor Scham in die Erde versinken.
»Nun hast Du aber schon alle Schlipse bekommen, die Richard hatte, und Du bringst ja keinen wieder zurück. Warte, ich male Dir einen an. Du trägst ja ein Papiervorhemdchen.«
Nun war seine Scham eine noch größere. Das wussten die auch schon, obwohl das doch von Leinwand gar nicht zu unterscheiden ist.
Es half ihm alles nichts, er wurde auf einen Stuhl niedergedrückt, geschäftige Hände knöpften Kragen und Vorhemdchen von dem blau und weiß gestreiften Wollhemd ab, ihn dabei möglichst kitzelnd, worauf er aber nicht reagierte, weil er sowieso schon halb tot war.
Er trug, sonst immer möglichst unauffällig gekleidet, mit Vorliebe einen langen, bunten Schlips.
»Nicht wahr, himmelblau mit roten Drachen?«, fragte Hannchen, auf ihrem Maltisch die Lampe anbrennend.
»Nu — nu — Drachen — —«
»Und einige grüne Teufelfratzen dazwischen.«
»Nu — nu — Fratzen — —«
Er zitterte vor Angst, was da kommen würde. Die junge Künstlerin war im Handumdrehen fertig, die Farben trockneten sofort. Er bekam es erst zu sehen, als er vor dem Spiegel stand. Ein rosenroter Langschlips, anscheinend selbstgebunden, mit blauen Vergissmeinnichten, dazwischen etwas zartes Gold. Wirklich reizend, wenn auch nicht gerade zu dieser Figur passend.
»Ach, das ist doch ein wirklicher Schlips!«
»Fass ihn nur an.«
Er tastete in einer Weise und machte ein Gesicht, wonach er wirklich an einen handgreiflichen Schlips geglaubt haben musste, und dann schob er seine hellblonden, fast unsichtbaren Augenbrauen vollends in die Höhe, er konnte mit einem Male fließend sprechen.
»Hannchen! Ich habe eine Idee!«
»Du eine Idee? Da bin ich doch gespannt!«, wurde gelacht.
»Wenn das eingeführt wird — so bemalte Vorhemdchen und Oberhemden — erst in England und Amerika — Handmalerei und für die billigen Sachen Buntdruck, der aber doch erst ein Muster haben muss — —«
»Na lass nur«, lachte Hannchen jetzt erst recht, »ich habe jetzt etwas anderes zu malen als Schlipse, wovon ich Dir dann erzählen werde.«
Ja, so lachte sie, und die anderen lachten mit.
Und es war diesen drei jungen Menschenkindern zu verzeihen, dass sie nicht begriffen, wer vor ihnen saß, über den sie sich so belustigten!
Und der Mann mit der genialen Idee, der soeben dabei gewesen war, mit einem einzigen Fußtritt eine unerschöpfliche Goldquelle aus der Erde zu stampfen, sank wieder in seine Hilflosigkeit zurück, schielte nach seinem Paket, das auf das Büfett gelegt worden war, was aber nicht bemerkt wurde.
»Und was bekomme ich denn nun für meine Kunst?!«, lachte Hannchen.
»Na — na — was — was kostet denn — —«
»Einen Kuss.«
»Nu — nu — meintswegen — —«
Das blühende Mädchen nahm seinen Kopf zwischen die Hände und knallte ihm einen Kuss auf die dicken Lippen. Es war nicht der erste. Beim Pfänderspiel wurde er immer mit Küssen bedacht, gerade weil es ihn so furchtbar verlegen machte.
Noch vor dem Abendessen bekam er als erste Hauptsache Richards Brief zu lesen, bei Tisch, wo er wie immer förmlich gefüttert werden musste, wurde darüber gesprochen.
»Na, was meinst Du denn nun dazu, August? So sprich doch einmal.«
August rieb sich krampfhaft die Knie und die Waden.
»Ja — jaaa — die Zulage — die reicht nicht — und — und — das geht doch nicht, dass die da drüben nicht zu fre..., dass die da drüben hungern sollen — das — das schändet doch die ganze deutsche Arbeiterschaft — die Amerikaner lachen uns doch nur aus — und — und — da bin ich gestern beim Direktor gewesen — jaaaa.«
Und nachdem er das glücklich herausgebracht hatte, starrte er tiefsinnig in seine Tasse.
»Soll ich Dir noch einmal einschenken, August?«
»Ach — a—a—a—ach nein — der Kaffee ist so stark — —«
»Das ist Tee, August.«
»A—a—ach — ach so — —«
»Was wollten Sie denn beim Direktor?«, fragte Frau Baumer.
»Nu — nu — von wegen der Zulage — weil's mir Richard doch auch geschrieben hat — —«
»Was, Richard hat Ihnen geschrieben?!«
»Nu ja — vorgestern Abend — das heißt — —«
»Und das sagen Sie erst jetzt?!«
»Nu — nu ja — ich sag's doch jetzt — —«
»Was hat er Ihnen denn geschrieben? Haben Sie den Brief mit?«
»N—nein — nein«, der arme Mensch würgte verzweifelt an seinem Kragen und wollte sich immer den angemalten Schlips zurechtschieben. »Nu — hauptsächlich wegen der Zulage — dass die nicht reicht — und — und — und da bin ich gestern früh gleich zum Direktor gegangen und — und — habe Radau gemacht — jaaa.«
»Du hast beim Herrn Direktor Radau gemach, August?«, wurde ungläubig gelächelt.
»Ja — das — das geht doch nicht — das schändet doch die ganze deutsche Arbeiterschaft — die — die brauchen doch auch gar nicht um die Erlaubnis zu betteln, in der amerikanischen Garküche zu fress... — zu essen — —«
»Sage mal, August, aber zu dem Direktor hast Du wohl fressen gesagt?«
»Nu aber wie!«
»Und was sagte der Direktor?«
»Nu — nu — was sollte der denn sagen — ich hatte doch recht — aber nachgeben wollte der auch nicht — das ginge mich doch gar nischt an, meinte der — und da wollte ich gehen — —«
»Gehen wolltest Du? Doch nicht etwa deshalb Deine schöne Stellung aufgeben?!«
»Ja—a—a — das wollte ich — in so 'ner Fabrik mag ich nicht mehr arbeiten, wo so die ganze deutsche Arbeiterschaft geschändet wird!«
»Du Trotzkopf Du! Deine schöne Arbeit gleich so hinwerfen zu wollen! So eine findest Du in Deinem ganzen Leben nicht wieder!«
»Nu — nu — ich soll doch schon immer in Magdeburg anfangen — da soll ich doch achtzig Mark bekommen —«
Mit großen Augen wurde der Stammelnde angeblickt, der errötend immer seine Knie und Waden rieb. Sie verstanden ihn gar nicht recht.
»Wie ist es denn nun aber geworden beim Direktor?«, fragte Frau Baumer.
»Na ja — und den Radau hat der Alte gehört — der ist jetzt wieder da — der mischte sich ein, nu natürlich, der hat überhaupt noch gar nichts gewusst, dass die schon immer telegrafiert hatten — na, der Direktor hat ja etwas zu hören bekommen — nur ein einziges Wort, aber das genügte — und nun hat jeder drüben einen Taler täglich Zulage bekommen — extra noch — und die Ingenieurs fünfe — na, das ließ ich mir gefallen.«
Also jeder pro Tag drei Mark mehr von jetzt ab, auch Richard. Na, da konnte der wohl jetzt auskommen Das war wieder eine fröhliche Botschaft, die August gebracht hatte. Die ganze Familie freute sich königlich.
Aber diesen stammelnden Mann da, der sich immer die Knie rieb und am Kragen würgte, den wollten sie noch immer nicht verstehen!
»Ich hab's mir ja gleich gedacht«, sagte Frau Baumer, »Herr Kommerzienrat Gehrling braucht es bloß zu erfahren, dass seine Leute in Amerika nicht auskommen, dann wurde das sofort geregelt, er war nur verreist. Und Sie haben bei dieser Gelegenheit gleich fünf Mark wöchentliche Zulage gefordert?«
»Nein — ach nein — der Alte gab sie mir freiwillig — —«
»Und Du hast wirklich aus Magdeburg ein Angebot von achtzig Mark?«
»Ja — ach ja — —«
»Warum nimmst Du denn das nicht an?«
»Nu — weil — weil — als ich vom Technikum kam, da war ich froh, bei Gehrling gleich als Werkmeister anzukommen — und — und — da habe ich erst etwas gelernt — und — nein, das könnt ich nicht —«
»August, Du bist doch ein kurioser Kauz!«
»Jaaa.«
»Weißt Du denn schon, dass wir einen Zimmerherrn haben?«
Während die Mutter und Gretchen abräumten, bekam August jetzt dieses Neueste von Hannchen erzählt, alles, nichts wurde vergessen.
Der auf dem Sofa sitzende August schielte verlegen nach seinem Paket und rieb sich die Knie.
»Ja — ach jaaa — —«
»In dem Jahre kann ich mir ein kleines Vermögen verdienen. Ein paar tausend Mark springen dabei sicher heraus. Es kommt ja ganz auf das Muster an. Ich bin doch gespannt, was er fertig bringt. Das ist nicht so leicht, so ein Muster zu entwerfen. Das wird bezahlt! Er malt heute schon den ganzen Tag. Vielleicht hat er morgen schon eins fertig. — August, denke Dir, wenn ich dann jedes Jahr so meine dreitausend Mark verdiene.«
»Ja — ach jaaa — —«
»August, Du bist doch ein Stockfisch!«
»Jaaa!«, schmunzelte August.
»Hat Dir Richard auch von dem kleinen Indianerhäuptling erzählt, der dann so ein berühmter Mann geworden ist?«
»Nein — das — das hat er nicht — —«
»Aber Du hast's doch vorhin in unserem Briefe gelesen.«
»Ja — natürlich — gewiss — jaa — —«
»Sst!«, zischte Gretchen mit erhobenem Zeigefinger. »Der Möblierte ruft! Fräulein Baumer! Bist Du das, Hanne, oder soll ich kommen?«
Hannchen eilte schon, blieb ziemlich lange, zehn Minuten waren schon vergangen und sie war noch immer bei dem Zimmerherrn drin.
»Der zeigt ihr das Muster«, sagten die Kinder und begannen wieder den armen August zu martern. Aber es sei nochmals betont: das wollte er ja! Deshalb war er ja hier. Wäre er nicht so malträtiert worden, dass ihm der Angstschweiß aus allen Poren lief, so hätte er sich unglücklich gefühlt. Denn dann wäre hier etwas nicht in Ordnung gewesen.
Das fühlten alle instinktiv heraus, und deshalb taten sie es.
Endlich kam Hannchen zurück, eine Mappe unterm Arm, die Faust vor der Stirn, sie tat, als ob sie taumele.
»Ich bin von Sinnen! Der Verstand bleibt mir stehen!«, ächzte sie, den Kobold im Nacken.
»Was ist denn geschehen, Hannchen!«, erklang es erschrocken.
»Hier seht selbst, ob so etwas möglich ist!«
Die Mappe enthielt zehn prachtvoll getuschte Muster, in natürlicher Größe. Die einfachsten deutschen Blumen, aber wunderbar arrangiert, jedes Muster anders, verschieden, wunderbar ausgeführt.
»In einem einzigen Tage hat er das gemacht! Ich muss es glauben, das sind meine Farben, sie sind noch ganz frisch! Dieser Geschmack! Hier dieses Lilienmuster. Und hier die Gänseblümchen! Diese Zartheit der Auffassung! Wie dieses hier die Blättchen entfaltet und sich an das große anschmiegt! Wie dieses hier sich biegt! Und diese zehn Muster in einem einzigen entworfen und fertig ausgeführt! Ja, der kann sich jeden Tag einen neuen Anzug kaufen — wenn er's sonst nicht hätte! Was meint ihr denn wohl, was so ein Musterzeichner für solch einen Entwurf bekommt? Denn das sind doch die echten Künstler, die Schöpfer, wir Porzellanmaler sind nur die Kopisten. Unter fünfzig Mark ist da nicht viel zu haben. Der hat heute mindestens seine fünfhundert Mark verdient — ach, tausend Mark! Um solche Entwürfe reißen sich die Porzellanfabriken. August, was sagst Du denn dazu?«
»Ja — jaaa — so'n Tollewahne — —«
»August, Du träumst wieder, wache auf!«, wurde er an der Schulter gerüttelt. »Wir sprechen nicht von dem Indianerhäuptling, das hier ist von unserem Zimmerherrn!«
»Ja — jaaa — so'n möblierter Italjäner — —«
Es war mit dem unverbesserlichen Träumer nichts anzufangen.
»Aber das wird eine teure Geschichte«, sagte Hannchen. »Dreihundertsechzig Stück? Unter fünf- bis sechstausend Mark nimmt das auch das bescheidenste Geschäft nicht in Auftrag. Herrgott, wenn ich die bekäme! In einem Jahre wollte ich's schon fertig bringen, ich richte mich ein, würde immer mit einer Farbe durchmalen. Das ist etwas ganz anderes, als wenn man nur einen einzigen Teller oder drei bearbeitet. Fünftausend Mark! August, dann heiraten wir uns! Nicht wahr?«
»Ja — jaaa — aber — aber — —«
»Du magst mich nicht?«
»Ja — ach jaaa — Gott warum denn nicht — aber — aber — ich muss jetzt gehen — —«
Es war auch seine gewöhnliche Zeit. Er wurde unter tausend Allotrias an die Vorsaaltür gebracht, der Hut musste ihm nachgebracht werden, sonst vergaß er den regelmäßig.
»Aber das nächste Mal vergisst Du meine Rose nicht wieder, August!«
»Nein — o o o nein — —«
»Ach, Dein Paket! Das hättest Du natürlich ebenfalls vergessen!«
Es wurde ihm gebracht.
»Was ist denn nur da drin?«
»Ach — ach — nichts weiter — —«
»Du willst es wohl gar nicht mitnehmen?«
»Nein — es — es ist — behalte es nur, Hannchen!«, würgte der arme Kerl hervor, noch eine »Gute Nacht!«, und er floh die Treppe hinab, immer vier Stufen überspringend, was im Abwärtssteigen doch eine ganz besondere Kunstleistung ist.
Das Paket wurde geöffnet. Es enthielt einen Pappkarton, in dem ein großes, prachtvolles Rosenbukett lag.
»Ach, das war überhaupt für mich bestimmt!«, rief Hannchen. »Aus Freude über seine Gehaltszulage, wie er ja heute auch zwei Würste und ein ganzes Pfund Konfekt mitgebracht hat! Und mir ein ganzes Rosenbukett. Und der liefert das nicht ab, sitzt den ganzen Abend da und denkt nicht dran, hätte es bald wieder mitgenommen! Nein, so ein kurioser Kauz, dieser August!«
Sie dachten nicht daran, dass er ja niemals etwas überreichte, dass sie ihm ja alles immer gleich abnahmen, sogar aus der Tasche zogen.
»Ja, es ist jammerschade um den armen Menschen«, bedauerte ihn auch Frau Baumer. »So ein bescheidener, fleißiger, solider, pünktlicher junger Mann. Seine pünktliche Gewissenhaftigkeit in allem und jedem, das ist es ja eben, weshalb er vom Schlosser gleich zum Aufseher befördert wurde, weshalb sein Prinzipal so viel auf ihn hält. Aber diese unglückliche Schüchternheit, die gar keine Grenzen kennt. Der bringt's mal nicht weiter, der soll Gott jeden Tag danken, dass er so eine Lebensstellung bekommen hat. Ob man ihm denn nicht eine passende Frau verschaffen könnte? Der ist doch zur Ehe wie geschaffen.«
»Ach, August und heiraten!«, lachte Hannchen. »Das wird einmal ein alter Junggeselle, der er ja überhaupt schon heute ist.«
Unten auf der anderen Seite der Straße stand der Besprochene und blickte nach den erleuchteten Fenstern der dritten Etage empor.
»Wieder einmal nichts!«, erklang es leise seufzend. »Und wenn's heute nicht ging — nun geht's nicht mehr. Hätten die mir nicht sagen können, dass sie Richards Zimmer vermieten wollten? Dann, wenn ich jeden Abend bei ihnen gewesen, wäre es schon einmal gegangen. Nun ist's vorbei! Nun hat's der reiche Italiener, um den sich jetzt dort oben alles dreht. Und wenn ich nächsten Sonntag wieder mit meiner Wurst und Zuckertüte und Rose komme, wird man mir Neues von ihm erzählen. Ach! Ich will noch die Differentialrechnung lösen — nein, erst werde ich das Patent bearbeiten — —«
Mit weiten, elastischen Turnerschritten ging der kleine Mann davon.
Da sah er in der einsamen Straße im trüben Scheine einer Laterne zwei Menschen, es war, als ob sie einmal für eine Sekunde miteinander rängen, er hörte Stimmen.
»Wenn Sie jetzt nicht sofort gehen, rufe ich die Polizei, Sie unverschämter Mensch!«, sagte eine Frauenstimme, nicht so laut, wie sie bei solch einer Gelegenheit hätte tun sollen.
»Hilfe!«, rief sie dann, aber auch noch unterdrückt.
Mit drei mächtigen Sätzen war August bei den beiden. Ein eleganter Herr, ein großer, starker Mann, wollte eine Dame umfassen, der es hauptsächlich darum zu tun war, dass sich ihr riesiger Hut dabei nicht verschob.
»Was ist denn hier los?!«
»Der Herr belästigt mich immer, ich bin eine anständige Frau — —«
»Na, dann lassen Se se doch zufrieden, wenn se nich will«, sagte August mit Entschiedenheit zu dem Herrn, zu dem er in die Höhe blicken musste.
»Was willst Du kleiner Junge?«, lachte der andere herab.
»Soll der Herr Sie begleiten?«, wandte sich der kleine Junge an die Dame.
»Nein, nein, ich bin eine anständige Frau, er belästigt mich immer!«
»Na, dann gehen Sie.«
»Was, Du Knirps willst hier befehlen?«, lachte der Riese. »Ich nehme Dich unter'n Arm und lasse Dich verhungern!«

»Jetzt gehen Sie Ihrer Wege! Verstanden?«
Dabei hatte der Zwerg dem Goliath die Hand auf die Brust gesetzt, oder mehr auf den Bauch, und drängte ihn zurück.
»Was, Du willst mich — —«
Und der Riese schlug zu. Aber die Faust wurde beim Handgelenk gefangen, gleichzeitig auch das andere gepackt.
»Männicken, ich will Sie nicht unglücklich machen, aber wenn Sie jetzt nicht ruhig gehen, dann — —«
Ganz ruhig hatte es der Zwerg gesagt, aber der Riese fühlte die furchtbare Kraft, mit der seine Handgelenke gepackt worden, beim nächsten Druck wären sie wie von eisernen Schraubstöcken zermalmt gewesen, und er sah im Laternenschein die blauen Augen, wie die ihn anblitzten, und, wieder freigegeben, machte er schleunigst, dass er weiterkam, ohne auch nur noch ein einziges Wort gesagt zu haben.
»Ach, mein Herr, wie soll ich Ihnen danken!«, fing die Dame jetzt an zu flöten, und sie flötete noch mehr.
Ihr rettender Engel aber begann wieder an seinem Kragen zu würgen.
»Ja — ach jaaa — —«
»Nicht wahr, Sie begleiten mich nun auch nach Hause.«
»Jaaa — das heißt — ich — ich — —«
»Wir nehmen eine Droschke.«
»Jaaa — —«
Da kam gerade eine gefahren, sie war frei, die rief sie an, nannte eine Adresse und stieg ein. August trat erst noch einmal zum Kutscher.
»Hier haben Sie zwei Mark, das wird wohl reichen, fahren Sie los!«
Sprach's, klappte den Schlag zu und rannte davon
Am Montag wurde Signor Titus Leonardo wegen der persönlichen Ausweisung auf die Polizei beordert; er blieb ziemlich lange aus, und am Dienstag früh kamen aus Meißen die bestellten Porzellanproben.
Sie wurden oberflächlich besichtigt und gleich in der sorgfältigen Verpackung gelassen.
»Wir nehmen sie mit, in einem Taxameter. Sie begleiten mich doch, Fräulein?«
Hannchen erklärte, in einer Viertelstunde fertig zu sein; sie zog ihr neues Sommerkleid an.
»Haben Sie schon ein Geschäft gewählt?«, fragte sie, als sie in den offenen Wagen stieg.
Der Italiener nannte den vornehmsten Porzellanladen der Residenz.
»Aber warum denn nur gerade dieses allerteuerste Geschäft?«
»Weil ich in diesem das Service sowieso gekauft hätte.«
Gegen diesen Grund war nichts einzuwenden.
»Sind Sie dort bekannt, Fräulein?«
»Aufträge habe ich schon von diesem Geschäft erhalten, mein Name und meine Adresse sind dort bekannt, aber persönlich bin ich noch nicht dort gewesen.«
»So wollen wir Ihr Inkognito wahren. Ich selbst gebe als Adresse mein früheres Hotel an, von wo mir alles sofort zugestellt wird. Nur noch eine Frage, Fräulein. Ich hätte sie eigentlich schon früher stellen müssen. Wir tun also in dem Geschäft, als hätten wir — hätte ich die Absicht, dort die Malerei in Auftrag zu geben. Ich bin aber doch von vornherein entschlossen, diese Arbeit Ihnen zu übertragen. Wir wollen nur einmal die Preise hören. Ist das auch ein ehrliches Vorgehen, das wir vor jedem Menschen und hauptsächlich vor unserem eigenen Gewissen verantworten können?«
»Ganz sicher!«, rief Hannchen verwundert. »Das ist eine ganz saubere Geschäftsmanipulation!«
»Gut. Es ist auch meine Überzeugung. Und ich werde diesem Geschäft als Dank dann auch noch etwas zuweisen.«
»O, das ist doch gar nicht nötig — —«
»Bitte!«
Sonst verlief die Fahrt schweigend. Der Kutscher trug die Kiste in den hocheleganten Laden, Signor Leonardo brachte sein Anliegen vor, breitete seine farbigen Blätter aus, ein maßgebender Herr erschien. Mit unverhohlenem Staunen betrachtete er die getuschten Muster.
»Darf ich fragen, von wem diese Muster entworfen und ausgeführt sind?«
»Von mir selbst. Was kostet nun die Übertragung der Malerei? Also von jedem drei Dutzend.«
»Das kann ich nicht so ohne Weiteres sagen. Da muss ich erst die Porzellanmaler anfragen. Bei diesem feinsten Porzellan kommt doch natürlich nur der beste Künstler in Betracht.«
»Selbstverständlich.«
»Sollen mehrere daran arbeiten?«
»Nein, das möchte ich eben vermeiden. Auch die verschiedenen Muster von ein und derselben Künstlerhand. Der Betreffende ist ein gar scharfer Kenner, würde die verschiedene Manier sofort unterscheiden.«
»Dann ist die Ausführung aber nicht unter einem Jahre möglich.«
»Darauf war ich schon gefasst. Was kostet das nun. Nur so ungefähr.«
»Ja, es kommt eben ganz auf den Künstler an, was der verlangt!«, wurde immer ausgewichen.
Der Italiener blickte sich um, nahm einen bemalten Teller. Hannchen zuckte etwas zusammen.
»Von wem ist der gemalt?«
»Der? Dieser Teller ist von — dem berühmten Paulack gemalt.«
»Ist nicht wahr, der ist von mir!«, flüsterte Hannchen, als der Herr sich einmal umwandte, ihrem Begleiter schnell zu.
»Oder wie wäre es mit — —«
»Bitte, bemühen Sie sich nicht weiter, ich werde bei diesem Paulack bleiben. Ist es ein noch lebender und arbeitender Künstler?«
»Ei gewiss. Das ist der bedeutendste deutsche Porzellanmaler!«
»Den möchte ich haben. Bis wann kann ich den Preis erfahren?«
»Morgen Abend haben Sie bestimmt die genaue Kalkulation.«
»Können Sie mir denn nicht ungefähr sagen, was das kosten dürfte?«
»Ja — unter acht-, — neuntausend Mark ist da nichts zu machen.«
»Das ist viel.«
»Ja — wenn ein Künstler persönlich ein ganzes Jahr daran arbeitet — und selbst zu so einer Untertasse hat er den ganzen Tag nötig — und unter zwanzig Mark pro Tag arbeitet so ein Künstler natürlich nicht. Es gibt ja auch viel billigere — —«
»Nein, nein, ich sehe es ein. Ich möchte es von diesem Paulack gemalt haben. Natürlich vorläufig ohne jede Verpflichtung.«
»Selbstverständlich. Es ist nur eine Frage. Morgen Abend spätestens haben der Herr Bescheid. Darf ich um die Adresse bitten.«
Er erhielt sie — jenes Hotel unter den Linden.
»Und Ihre Provision, da ich das Porzellan nicht von Ihnen beziehe?«
»Die ist dann bei der Kalkulation schon dabei. Eine ganz geringe Kleinigkeit.«
»Und das Brennen?«
»Kostet ebenfalls nur eine Kleinigkeit.«
»Und eventueller Bruch?«
»Beim Brennen kommt das bei unserer heutigen Technik kaum noch vor. Außerdem gibt es dafür eine Versicherung. Das tragen wir alles selbst.«
»Sie sind äußerst liebenswürdig. Danke verbindlichst. Wir empfehlen uns.«
In einiger Entfernung von dem Laden machte Hannchen auf der Straße eine Bewegung, als wolle sie die Hände über dem Kopfe zusammenschlagen.
»Acht- bis zehntausend Mark mindestens!«
»Es werden noch einige tausend Mark hinzukommen. Ich habe ja gleich gesagt, dass mich das ganze Service auf zwanzigtausend Mark zu stehen kommen wird, wovon nur das durch Ihren direkten Bezug Ersparte abgeht.«
»Und dieser berühmte Paulack, der natürlich nicht unter zwanzig Mark pro Tag arbeitet — das bin ich! Ach, ich armes Würmchen!«
»Ja, geehrtes Fräulein, das ist so im Reiche der Kunst und wird wohl auch immer so bleiben. Man wird Ihnen vielleicht nur den zehnten Teil bieten. Aber was wollen Sie? Wie viele berühmte Maler haben nicht ihr bestes Werk für hundert Mark verkauft, um einmal für einige Zeit dem nagenden Hunger zu entgehen, um die schuldige Miete zu bezahlen. Der erste Händler verkaufte es schon für tausend Mark und jammerte dann, dass der nächste Verkäufer fünftausend dafür bekam. Noch zu Lebzeiten des Künstlers war sein Bild zehntausend Mark wert. Das ist schon das Hundertfache. Später wurde es nach Amerika oder England für hunderttausend oder einige hunderttausend Mark verkauft. Soll ich Ihnen solche Beispiele anführen?«
»Es ist nicht nötig, ich kenne selbst genug! Ja, Sie haben recht. Und ich glaube sogar, das muss so sein, das ist eine weise Einrichtung der Natur. Dichter und Künstler! Etwas Hungern gehört dazu. Unser Kanarienvogel singt auch nicht, wenn sein Futternapf immer voll ist. — Wohin gehen wir jetzt?«
»Würden Sie einmal mit mir in die Gemäldegalerie gehen?«
»Herzlich gern.«
Hannchen wurde ganz stolz, neben diesem Manne zu gehen, der durch seine prächtige Erscheinung die Blicke aller auf sich zog. Mit heimlichem Lächeln erinnerte sie sich daran, wie sie als Schulmädchen, als »höhere Tochter«, wie es auch andere machten, manchmal neben einem Offizier hergelaufen war, damit die Leute glaubten, sie gehöre zu ihm. Unschuldige Jugendtorheiten.
Im Museum musste er schon gewesen sein, er bestätigte es, zeigte durch einige Bemerkungen das größte Kunstverständnis, sprach aber ungefragt gar nicht.
»Es ist halb eins, ich muss nach Hause, um eins essen wir!«, flüsterte sie.
»O, und ich hoffte, in Ihrer Gesellschaft in einem Restaurant speisen zu dürfen. Es wäre auch für mich einmal eine so große Ausnahme.«
»Nun, da brauche ich bloß zu telefonieren, nach unten in den Laden«, entgegnete sie mit gewöhnlicher Offenheit.
Er führte sie in eines der ersten Hotels und bestellte zwei Menüs.
»Ich glaubte, Sie seien Vegetarier.«
»Nur zeitweilig. Ich bin bereit, in jeder Sache einmal eine Ausnahme zu machen.«
»Aber doch nicht nach böser Seite hin«, begann sie zu scherzen.
»Da soll man immer nur sagen: Herr, führe uns nicht in Versuchung«, entgegnete er, aber ohne besondere Feierlichkeit! Dieses bronzene Gesicht war immer noch unbeweglich.
Wegen seiner religiösen Lektüre musste sie ihn dann einmal fragen. Heute würde sie doch überhaupt etwas mehr über ihn erfahren.
»Trinken Sie Weiß- oder Rotwein? Ich bemerke aber gleich, dass ich strenger Abstinenzler bin.«
»Darin machen Sie keine Ausnahme?«
»Nein, darin nicht. Aber bitte, nehmen Sie auf mich keine Rücksicht.«
»O, ich trinke ganz gern einmal ein Glas Wein. Weiß oder rot? Das ist mir ganz — nein, ich will ehrlich sein. Rheinwein ist mir das Liebste. Natürlich recht leicht.«
Er suchte in der Weinkarte und bestellte eine halbe Flasche.
»Und, Kellner, dann das Filet für mich möglichst durchgebraten!«
»Und meines englisch!«, ergänzte Hannchen.
In solch ein Lokal war sie noch nicht gekommen, aber wegen der »Aufmachung« konnte die junge Künstlerin nicht befangen werden. Mit freien, interessierten Blicken musterte sie die Dekoration.
»Unter den Italienern findet man doch selten Temperenzler.«
»Und ich stamme auch noch aus einer Weinbauernfamilie. Mein Vater ist oder war Weinbergsbesitzer. Das wird dort allerdings alles in Pacht gegeben. Ich selbst sollte Priester werden.«
»Ah! Und Sie sind es nicht geworden?«
»Bevor ich die Weihen empfing, trat ich aus dem Orden, aus der katholischen Kirche.«
Jetzt konnte sich das Mädchen dieses steinerne Gesicht schon eher erklären.
»Sie traten zum Protestantismus über?«
»Ja.«
»Hatten Sie nicht mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen?«
»Nein. Meine Eltern waren schon tot. Dann ging ich auf Reisen.«
Die Suppe kam, die Gänge wurden serviert. Er erzählte ihr dazwischen vom Leben in einem italienischen Kloster, so interessant, dass sie gar nicht wusste, was sie aß.
Einmal bemerkte sie, dass seine glänzenden Augen so seltsam starr auf ihren Teller blickten. Sie zerschnitt gerade ihr Filet, das allerdings sehr wenig angebraten war; das Blut floss noch heraus.
»So roh habe ich es nicht haben wollen, aber wenn es so zart ist, lässt man es sich gefallen. Waren Sie auch in England?«
»Nein, in England war ich noch nicht.«
»Es ist ein weitverbreiteter Irrtum, dass der Engländer das Fleisch halb-roh haben will. Der isst sogar gar nichts roh, keinen rohen Schinken, keinen geräucherten Fisch, er brät sogar den Salzhering. Nur weil die einzige Ausnahme die ist, dass er im großen Stück Roastbeef in der Mitte einen ganz kleinen roten Punkt haben will, deshalb nennt man das englisch gebraten. Aber vor blutigem Fleische würde sich der Engländer entsetzen.«
»Ja, ich habe davon gehört. Dasselbe gilt vom Amerikaner, vom Yankee.«
»Waren Sie in Amerika?«
»In Nordamerika habe ich mich einige Zeit aufgehalten.«
»Kennen Sie die große Spinnerei der Gebrüder Moor in Moorfield, Staat Colorado?«
»Nein, habe noch nichts davon gehört.«
»Dort ist mein Bruder Richard.«
»Ach was!«
Immer nur in der Stimme die Teilnahme, und ein feines Ohr hörte auch das Gezwungene heraus.
Sie erzählte etwas von ihrem Bruder, wie er dorthin gekommen war.
»Und denken Sie, der Prinzipal dieser Riesenspinnerei ist ein echter Indianer.«
»Was Sie nicht sagen!«
»Der schon als Kind Blassgesichter skalpiert hat und der es noch heute manchmal tut.«
»Noch heute? Als Prinzipal jener Spinnerei? Wie soll man das verstehen?«
Hannchen gab die Erzählung des Bruders wieder. Signor Leonardo staunte, so weit er des Staunens fähig war.
»Einer, der so etwas behauptet hat, dass er die Leichen geschändet haben soll, konnte es vor Gericht nicht beweisen und ist wegen Verleumdung schwer bestraft worden?«
»So schrieb mein Bruder.«
»Ja, dann ist es vielleicht gar nicht wahr?«
»Auch möglich.«
»Dann dürften auch wir, so weit wir auch davon entfernt sein mögen, gar nicht davon sprechen.«
Das Mädchen wurde sehr verlegen.
»Sie haben recht«, gab sie dann aber auch gleich zu. »Das werden alles nur Redereien sein. Sind Sie in Amerika mit Indianern zusammengekommen?«
»Nein, in diesen Gegenden, wo sie noch in ihrer Ursprünglichkeit hausen, war ich nicht. Und die zivilisierten Indianer, denen man hier und da begegnet, sind meist höchst zweifelhafte Objekte.«
Hannchen sah einen Mann im Arbeitsanzuge hereinkommen, mit einer großen Rohrzange; wohl ein Schlosser, der sofort eine unaufschiebbare Reparatur auszuführen hatte.
Aber etwas wie Schreck durchfuhr Hannchen, als sie in ihm August erkannte! Noch einmal wurde sie etwas irre, als sie sah, wie der Mann, ohne irgend ein Zeichen der Befangenheit, über den roten Teppich schritt, mit einem Oberkellner sprach, sogar ziemlich herablassend, als wäre er hier ein zahlender Gast, und dabei freien, scharfen Blickes das Lokal überschaute. Und doch, es war August!
Da sah er die Dame mit dem Herrn, und da war es plötzlich mit ihm vorbei, da kam der August hervor. Das Blut schoss ihm ins Gesicht, er begann an dem kragenlosen Hemd zu tasten, wollte nicht mehr nach jenem Tische sehen und musste es doch wie gezwungen tun, mit einem blöden Lächeln.
Und ebenso erging es Hannchen. Sie wusste nicht, ob sie hinsehen solle oder nicht, ob sie ihm wenigstens zunicken solle oder nicht, sie fühlte, wie sie purpurrot wurde.
August ging wieder, über den faltenlosen Teppich stolpernd. Leonardo, der ihm halb den Rücken zugekehrt, hatte von der ganzen Szene nichts bemerkt, er war gerade in seinen Teller vertieft gewesen. Erst nach einigen Minuten merkte er, wie seine Gesellschafterin plötzlich so schweigsam geworden und immer noch ganz rot war.
»Was ist Ihnen, Fräulein?«
»Ach, mir ist etwas Fatales passiert — ich ärgere mich wütend — —«
»Worüber denn?«
»Über mich selbst! Ich habe mich betragen wie ein — —«
Da kam August wieder mit der Rohrzange, ging auf sie zu, jetzt aber elastischen Schrittes, ohne irgend welche Befangenheit, wie zuvor, als er Hannchen noch nicht erblickt hatte.
Aber ihr Tisch war auch gar nicht sein Ziel. sondern der benachbarte, an den sich vor einer Minute ein alter, feiner, sehr beleibter Herr niedergelassen hatte. Vor den stellte er sich hin, die Zange auf der Schulter und die Mütze in der Hand, respektvoll, aber ohne jede Verlegenheit, und so sprach er auch.
»Da ist nichts mehr zu machen, Herr Kommerzienrat, das Rohr ist geplatzt, da muss ein neues rein.«
»Ist es denn nicht möglich, dass Sie ein neues hineinbringen? Sonst kann ich das Speisezimmer heute Abend gar nicht benutzen, das hält man ja vor Rauch nicht aus.«
»O ja, das will ich schon fertig bringen.«
»Bis um sieben?«
»Um sechs soll's fertig sein. Nur kann ich nicht in der Fabrik sein.«
»Natürlich, natürlich nicht. Ach, Schulze, Sie sind doch ein Prachtmensch, dass wenigstens Sie mit diesem vertrackten englischen Ventilator fertig werden! Wenn ich Sie nicht hätte! Ich danke Ihnen, Herr Schulze. Also beeilen Sie sich, lassen Sie in der Fabrik nur alles liegen. Hier haben Sie eine Zigarre. Aber roochen Se se nich in meiner Wohnung. Meine Frau könnte es riechen. Es ist nämlich ein Geburtstagsgeschenk von ihr.«
»Ich danke Ihnen, Herr Kommerzienrat.«
August steckte die lange Nudel mit der goldenen Bauchbinde in seine Mütze, wollte gehen, ohne für Hannchen, neben der er dicht gestanden hatte, noch einen Blick gehabt zu haben.
Da streckte ihm diese lächelnd die Hand entgegen.
»Guten Tag, mein lieber August. Entschuldige nur, dass ich Dich vorhin nicht gleich erkannt und begrüßt habe.«
Da war es mit dem armen Kerl wieder vorbei, er wollte die Hand nicht nehmen, wurde rot wie eine Klatschrose, würgte am Hemdenbund, dann, als die schlanke, weiße Hand nicht zurückgezogen wurde, legte er seine schwarze Bärentatze hinein und erschrak nun über diese Dreistigkeit erst recht.
»Ach — ach — Hann — Fräulein — ich — ich — Sie sind's — —«
»Nanu, seit wann nennen wir uns denn Sie?!«, lachte das Mädchen.
Aber sie wusste auch gleich, in was für eine schreckliche Situation sie den armen Menschen brachte. Er wäre wohl gar nicht wieder gegangen, er hatte nicht mehr die eigene Kraft dazu.
»Halte Dich nicht auf, August, wenn Du zu tun hast. Am Sonntag Abend auf Wiedersehen. Oder kannst Du uns denn nicht einmal Wochentags besuchen? Aber halte Dich nicht auf. Adieu, mein lieber August.«
Er stolperte davon, erst nahe der Tür seinen normalen Gang wiedergewinnend.
Die junge Malerin hob ihr Weinglas, mit ganz verklärtem Gesicht.
»Ach, jetzt ist mir wieder leicht zumute — so leicht und fröhlich!«
»Sie kannten den Mann?«, fragte Leonardo, der diese Szene aufmerksam, aber ohne jede Verwunderung beobachtet hatte.
»Der Freund meines Bruders, unser Freund, mein Freund. Ein Werkmeister. Der bravste Mensch, der auf Gottes Erdboden wandelt.«
»Fräulein — ich habe die Welt gesehen, jetzt bin ich in Deutschland — wissen Sie auch, dass Sie soeben etwas getan haben, was Ihrem Charakter zur höchsten Ehre gereicht?«
»Ich weiß, was Sie meinen — nein, ich habe ihn schon vorhin gesehen und habe ihn erst nicht erkennen wollen, weil er einen Arbeitskittel anhatte — —«
»Die letzte Tat gibt den Ausschlag.«
Er hob sein Glas mit Selterswasser.
»Ich möchte eigentlich — nein, ich tu's nicht —«
»Trinken Sie nur mir zu Ehren ein Glas Wein«, lachte Hannchen, seine Gedanken sofort erratend.
»Bitte, entschuldigen Sie mich. Ich bringe Ihnen meine Hochachtung auch ohne Wein und Champagner. Sie sehen ganz glücklich aus.«
»Ja, ich bin auch ganz glücklich!«
»Sie wären es nicht, wenn Sie nicht erst unzufrieden mit sich selbst gewesen wären und sich dann erst überwunden hätten. Jedes Glück muss erst erkauft werden — manchmal recht teuer.«
Also das dort war der Kommerzienrat Gehrling, der Prinzipal ihres Bruders! Sie hatte ihn persönlich noch gar nicht gesehen.
Übrigens stand er jetzt in einiger Entfernung am Zeitungsregal, er mochte sich gleich nach Augusts Entlassung dorthin begeben haben, war vielleicht gar nicht Zeuge geworden, wie sein Werkmeister auch von der Dame begrüßt worden war.
Jetzt begab er sich wieder nach seinem Tisch, dem sich ein anderer älterer Herr näherte.
»Sie, Kästner, es ist also Tatsache!«, rief ihm der alte, joviale, sehr lebhafte Kommerzienrat entgegen. »Die Moors in Moorfield wollen mit meiner Doppelmaschine auch Wolle spinnen! Haaah, das wird ein Bombengeschäft! Das ganze Nordufer des Sklavensees ist schon gekauft worden, ein paar Quadratmeilen — englische.«
»Wozu denn das?«, fragte der andere, sich setzend. »Die haben in ihrem Tale doch noch Platz genug.«
»Aber kein Wasser.«
»Was, kein Wasser hätten die?! Die treiben doch alles mit Wasser.«
»Ja, aber in Moor Valley ist das Wasser viel zu hart für die Wollwäscherei. Der dazwischen liegende Gebirgszug scheint eine Scheide von zwei ganz verschiedenen Wasserarten zu sein. In Moor Valley ist das Wasser ungemein kalkhaltig, das vom Sklavensee ist ganz weich. Natürlich könnten sie ihr Wasser entkalken. aber es ist auskalkuliert worden, dass die Anlage dazu teurer kommen würde, als wenn sie gleich drüben auf der anderen Seite ein neues Etablissement errichten. So haben sie einfach das ganze Nordufer gekauft. Und das Gebirge muss natürlich mit einem Tunnel durchbrochen werden. An der geeignetsten Stelle sind es noch mehr als drei Kilometer, die zu durchtunneln sind. Ja, ja, Freundchen, das sind dort drüben Unternehmungen!«
»Da haben sie das Land von der verrückten Indianerin gekauft, welcher der Sklavensee gehört?«
»Schon lange nicht mehr. Das alles hatte doch jene Miss Marwood Morgan im Auktionswege von der Regierung erstanden, das war doch der Indianerin wegen Hochverrats konfisziert worden.«
»Aber ich habe gehört, die Indianerin soll dort noch immer hausen und allen möglichen Spuk treiben, soll schon ganze Regimenter von Soldaten in die Flucht geschlagen haben.«
»Ja, Soldaten!«, lachte der Kommerzienrat. »Aber lassen Sie mal meine Spinnmaschinen kommen! Vor Fabriksgeklapper reißen alle Geister aus.«
»Der Besitzer der Moorfield-Werke soll doch auch ein Indianer sein.«
»Jawohl, das ist auch so ein roter Schwede. Und er soll ebenfalls, obgleich ein großer Gelehrter, ein ganz toller Kerl sein. Na, da findet er ja gleich die richtige Nachbarin. Die beiden werden sich schon vertragen — oder sie fechten eben die Sache mit Tomahawk und Skalpiermesser aus.«
Während die beiden Herren noch lachten, kam der Oberkellner an den anderen Tisch und meldete, die Dame, welche vorhin telefoniert habe, möchte noch einmal an den Apparat kommen.
»Ach, passen Sie auf, da ist schon eine Anfrage aus dem Porzellangeschäft da, ich bin doch der berühmte Paulack!«
So war es. Die Mutter telefonierte, dass ein Herr persönlich da sei, um ihr einen großen, großen Auftrag zu geben; er wolle noch warten, wenn sie gleich zurückkäme.
Sie fuhren mit einer Automobildroschke nach Hause, unterwegs ihre Verabredungen treffend.
Der Abgesandte des Geschäfts hatte sie nicht im Laden gesehen, er brachte die Tuschzeichnungen mit, bot ihr für die dreihundertsechzig Stück, spätestens in einem Jahre zu liefern, zweitausend Mark und ging schließlich bis zu dreitausend hinauf. Das war doch noch bedeutend besser, als sonst mit malenden Künstlern gefeilscht wird.
Die Porzellanmalerin dankte, sie könne den Auftrag nicht annehmen.
Am anderen Tage bekam Signor Leonardo durch sein früheres Hotel die Kalkulation übermittelt: elftausend Mark, unter dem sei nichts zu machen. Er ging selbst hin, um Proben und Muster wieder abzuholen, machte aber auch einen größeren Einkauf, welche Sachen er an eine Adresse nach Italien schicken ließ.
»Elftausend Mark, das kann ich ja gar nicht annehmen!«, zitterte die junge Künstlerin vor Aufregung.
»Weshalb nicht? Es bleibt dabei, wie es ausgemacht wurde.«
Sie musste nachgeben, tat es natürlich nur gar zu gern, hatte nur den ersten Widerstand überwinden müssen. Um nicht ins Schablonenhafte zu verfallen, malte sie doch lieber satzweise, immer an einem anderen Muster, sodass stets ein aus zehn Stück bestehendes Service fertig wurde, welches ihr der Auftraggeber bei der Ablieferung bezahlte, mit dem sechsunddreißigsten Teile jener Summe, wegen seiner sonstigen Unkosten etwas zu seinen Gunsten abrundend, mit dreihundert Mark, die sie sich immer in zehn Tagen verdient hatte.
In der Lebensweise des Italieners änderte sich infofern etwas, als er jetzt manchmal im Wohnzimmer saß und der Malerin zusah.
In den ersten Tagen war er von der Künstlerin mehrmals gerufen worden, sie hatte ihn etwas zu fragen, dann kam er von selbst, weil ihm wegen der Ausführung noch etwas eingefallen war, dann setzte er sich in die Fensternische und blieb immer länger. Es hatte ja auch nicht anders kommen können. Dass seinetwegen die Kinder oder gar Frau Baumer das Zimmer verließen, hatte er sich streng verbeten.
Länger als eine halbe Stunde blieb er ja niemals, er kam täglich drei- oder viermal, meist zu regelmäßigen Zeiten, wo er wusste, dass er das Familienleben nicht störe. Wenn dabei über etwas anderes als über die vorliegende Arbeit gesprochen wurde, so war dies nur über Kunst, über die Malerei im Allgemeinen. Meistens aber schaute er Hannchen schweigend zu, ganz in Gedanken versunken, bis er aus seinen Träumen erwachte und mit dem Bemerken, nun müsse auch er wieder an seine Arbeit, auf sein Zimmer ging.
Es kam ja manchmal vor, dass die beiden allein waren, ganz allein in der Wohnung, und dann sprach er sicher kein einziges Wort. Da wurde es dem jungen Mädchen immer ganz unheimlich zumute. Nicht, dass sie sich wegen des Alleinseins mit dem doch immer noch fremden Manne gefürchtet hätte — so etwas kannte sie gar nicht, wenn sie nicht gerade um einen bösen Charakter gewusst hätte — nein, dann fühlte sie seine Nähe, etwas sie Beängstigendes ging von diesem Manne aus, sie wusste nicht, was es war, was ihr plötzlich das Herz so vor Angst zusammenschnürte — und nun freilich auch diese Augen, wie die mit so starrem Ausdruck auf ihren vorsichtig malenden Pinsel gerichtet waren, und sie wusste doch, fühlte es, wie diese Augen eigentlich an ihrer Gestalt hingen — und nun dieses Schweigen dazu — —
»Fräulein!«, begann er, zum allerersten Male dieses Schweigen brechend, als sie wieder einmal so allein waren.
Nicht ganz allein im Hause. Die Mutter stäubte nebenan in der guten Stube ab. Aber es war doch ein Alleinsein, und das allererste Mal, dass er bei solch einer Gelegenheit nur ein einziges Wort an sie richtete.
Hannchen erschrak so, dass ihr fast der Pinsel ausgerutscht wäre, was zwar den Teller nicht verdorben, ihr aber eine langwierige Wischarbeit verursacht hätte.
»Bitte?«
»Sie halten mich wohl für einen rechten Sonderling.«
Jetzt, da es so weit war, konnte sie wieder mit ganz ruhiger Hand den Pinsel führen, ruhiger als zuvor, da er schweigend zugesehen hatte.
»Aber wieso denn nur?«
»Bitte, seien Sie doch ganz aufrichtig.«
»Ja.«
Das war ein offenes Geständnis gewesen, wozu sie ihn auch offen hatte anblicken müssen, und seine glänzenden Augen, die ja jetzt auch nicht starrten, beeinflussten sie nicht.
»Sie halten mich für einen Sonderling? Weshalb?«
»Ja, wenn Sie nun wieder so fragen — —«
Sie beugte sich wieder über ihren Teller.
»Weil ich von Brot und Milch lebe?«
»Das wäre das wenigste.«
»Weil ich beim stillsten Studium dröhnenden Hammerschlag um mich hören will?«
»Das schon eher — wenn ich auch das begreiflich finden kann.«
»Weil ich mich überhaupt hier eingemietet habe?«
»Weil Sie ein so einsamer Mensch sind.«
»Ich werde wohl einen Grund dazu haben.«
»Das glaube ich wohl.«
»Was mag das für ein Grund sein?«
»Sie sind melancholisch.«
»Das bin ich. Wissen Sie, was Melancholie ist?«
Eine sehr merkwürdige Frage! Das Mädchen aber blieb ihm die Antwort nicht schuldig.
»Melancholie soll ein furchtbares Leiden sein, wovon ein anderer, der nichts davon weiß, eben auch gar keine Ahnung hat.«
»Woher wissen Sie das?«
»So steht's im Konversationslexikon.«
»Haben Sie darüber nachgelesen?«
»Ja.«
»Meinetwegen?«
»Ja.«
»Steht darin auch ein Mittel dagegen?«
»Viel Bewegung im Freien und Zerstreuung, harmlose Vergnügungen.«
»Das habe ich alles getan, und es hat mir nicht geholfen.«
»Vor allen Dingen keine Einsamkeit.«
»Das — kann ich nicht.«
»Waren Sie einmal in einer entsprechenden Heilanstalt?«
»Ja.«
»Und?«
»Ich halte es darin nicht aus. Nur keine anderen Menschen! Und so ist es immer dasselbe.«
»Haben Sie keinen Freund, dem Sie sich innig anschließen könnten?«
»Ich habe keinen.«
»Sie müssen sich einen suchen.«
»Durch Zeitungsannonce?«
Er legte keinen Hohn in seine Stimme — es lag allein schon in den Worten.
»Nein, durch Zeitungsannonce kann man freilich keinen Freund finden.«
»Ich habe auch auf andere Weise genug gesucht und keinen gefunden.«
»Ja, das liegt allerdings in Gottes Ratschluss.«
»Ihr Gott hat mir noch keinen solchen Freund zugeführt.
»Warum betonen Sie das ›Ihr‹? Glauben Sie an Gott?«
»Ja. Gott ist ein persisches Wort und bedeutet unfassbar, das Unfassbare. Ja, ich glaube an jenes Unfassbare.«
»Glauben wir nicht alle an einen Gott?«, umging das Mädchen alle solche Definitionen.
»Nein. Jeder hat seinen eigenen Gott. So viele Menschen es gibt, so viele gibt es — nicht Götter, sondern so oft ist Gott.«
»Nun gut, ich verstehe, was Sie da meinen, und auf eine weitere Debatte hierüber lasse ich mich nicht ein. So müssen Sie eben Ihren Gott um solch einen Freund bitten.«
»Ich habe es getan, und er hat meine Bitte bereits erhört.«
»Ja?«
»Er hat mir solch einen Freund wenigstens schon in der Ferne gezeigt.«
Hannchen wunderte sich, dass sie noch so ruhig den Pinsel führen konnte, als sei es das gleichgültigste Gespräch, obwohl sein Ziel, auf das er zusteuerte, doch so durchsichtig war.
Als sie nicht gleich eine Antwort gab, weil sie wirklich nicht gleich eine wusste, nahm er wieder das Wort.«
»Fräulein, ich möchte meine Lebensweise ändern.«
»Inwiefern?«
»Wie andere Menschen leben.«
»Daran tun Sie recht.«
»Ich hätte eine große, große Bitte an Sie, an Ihre Frau Mama.«
»Nun?«
»O, wie gleichgültig dieses ›nun?‹ klingt!«
»Ja, was soll ich sonst sagen?«
»Ich bitte wie ein Kind.«
»Sprechen Sie wie ein Mann.«
»Lassen Sie mich mit an Ihrem Familientisch essen.«
Freudig überrascht blickte das Mädchen empor.
»Aber herzlich gern! Ja, warum denn nur nicht? Wir hatten Ihnen doch volle Pension angeboten, und der Einmieter isst doch nicht auf seinem Zimmerchen —«
»Bei mir ist es etwas anderes.«
»Ja, ich weiß, ich weiß. Ich rufe die Mama —«
»Nein, bitte noch nicht! Die Gelegenheit ist nun einmal da, das Eis ist gebrochen.«
»Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Wegen Familienanschluss? Wollen Sie jeden Abend bei uns verbringen? Aber herzlich gern!«
»Mein Wunsch geht noch viel weiter.«
»Noch viel — ja, so sprechen Sie doch!«
»Ich wage es nicht.«
»Weshalb denn nur nicht?«
»Oder ich muss mir einbilden, Sie seien ein Arzt, zu dem der Kranke spricht.«
»So bilden Sie sich das doch ein!«
»Ich — wenn mir die Bitte nicht gewährt würde —«
Ruhig legte Hannchen den Pinsel hin, ruhig blickte sie ihn an.
»Ich weiß, was Sie gern möchten.«
»Sie wüssten — —?«
»Hier in diesem Zimmer den ganzen Tag neben mir sitzen, arbeiten, lesen und schreiben — das möchten Sie. Nicht wahr?«
Dieses eherne Gesicht war durchaus keines Ausdrucks fähig.
»Sie haben es ausgesprochen.«
Es war etwas Hochfeierliches darin, wie das junge Mädchen jetzt aufstand und sich an ihn wandte.
»Herr Leonardo! Kein Mensch soll mich vergebens um etwas bitten, wenn ich ihm helfen kann, wenn es recht und gut ist. Manch anderer würde Ihr Wunsch überraschend, seltsam vorkommen — mir nicht! Ich glaube an einen Gott, und ich glaube, dass er Sie in unsere Familie geführt hat, damit wir Ihnen helfen. Mein Wille ist es, Ihren Wunsch zu erfüllen, aber mein Wille ist hier nicht maßgebend. Bitte, Herr Leonardo, begeben Sie sich auf Ihr Zimmer, ich werde mit Mama darüber sprechen, ob sie es erlaubt. In spätestens einer halben Stunde bringe ich Ihnen Bescheid.«
»Und wenn Ihre Frau Mama nun — —«
»Bitte, gehen Sie.«
Er ging. In seinem Zimmer stellte er sich vor den Spiegel und — schnitt Grimassen; er versuchte sein Gesicht in jene Falten zu legen, die ein Lächeln erzeugt.
»Ich will lächeln — ich will!«, murmelte er dabei fortgesetzt.
Es gelang ihm so weit, wie sich ein Lächeln auf diese Weise erzwingen lässt. In einiger Entfernung, hätte er auf der Bühne gestanden, musste es ganz gut aussehen, aber hier im Spiegel erblickte er nur eine Grimasse.
Schon nach zehn Minuten klopfte es, Hannchen kam, heiter wie immer, nur die Augen blickten sehr ernst.
»Mama hat es sofort erlaubt. Wir werden von jetzt an im guten Zimmer essen — nein, nein, Ihretwegen gar keine Umstände, es war schon längst beschlossen, die ganz unnütze gute Stube aufzugeben. Mama und Gretchen werden sich nur in unserem Zimmer aufhalten, wenn sie eine ruhige Beschäftigung haben. — Herr Leonardo, wir wollen unser gegenseitiges Verhältnis, wie weit Sie mit zur Familie gehören, gleich fest regeln. Die große Malerei, die Sie mir in Auftrag gegeben, hat damit gar nichts zu tun. Sie sind zu uns gekommen, bevor Sie uns kannten, Gott hat Sie zu uns geführt, und wären Sie ein armer Student und hätten sich uns mit derselben Bitte genähert, so hätten wir sie mit derselben Liebe erfüllt. Sie haben bisher immer eine Mark für den Liter Milch bezahlt, der nur zwanzig Pfennige kostet, wir haben das angenommen, weil — wir uns einfach dabei nichts weiter dachten — von jetzt an muss das aufhören. Ihr Auftrag hat, wie gesagt, mit alledem gar nichts zu tun. Die so äußerst lohnende Arbeit macht mich natürlich sehr glücklich, aber — näher bringt sie uns nicht. Es ist allein Ihre Bitte und unser von ganzem Herzen bereiter Wunsch. Ihnen zu helfen, von Ihnen trübe Gedanken fernzuhalten, dass Sie wieder heiter lächeln lernen, was uns näher zusammenführt. Sie werden doch nun auch manchmal mit uns Spaziergänge, kleine Ausflüge machen, sich unseren unschuldigen Vergnügungen anschließen, einmal mit uns ins Theater gehen? Ja? Gut. Aber dass Sie etwa für uns bezahlen, das ist völlig ausgeschlossen. Jedes Geschenk, das Sie uns machen, zerschneidet das Band zwischen uns. Wir selbst gehören zu denen, die lieber geben als nehmen. Dabei kann man immer eine Ausnahme machen. Wenn wir wie neulich unterwegs sind und Sie laden mich ein, mit Ihnen in einem Restaurant zu essen, so denke ich gar nichts weiter dabei, nehme es herzlich gern an, halte es für selbstverständlich, dass der Herr für die Dame bezahlt. Aber wenn ich glauben müsste, Sie dächten, ich hätte es nötig, ich spekulierte auf so etwas, dann — würde ich nie wieder mit Ihnen gehen und Sie fernerhin meiden. — So, das war offen und ehrlich gesprochen. Sind Sie mit diesem Kontrakte einverstanden?«
Mit lächelndem Munde und doch so ernst und energisch hatte es das frische Madchen gesagt, und er neigte bejahend, aber wortlos das Haupt.
»Dann kommen Sie«, fuhr sie lustig fort. »Nein, nicht erst morgen, sondern sofort! Nur immer sofort alles gleich beim Schopfe fassen! Kommen Sie, Sie müssen beim Umräumen feste mit Hand anlegen. Ach, Sie dachten wohl, wir holten dazu erst einige Packträger herauf? Nein, das gibt's bei uns nicht. Es ist auch nichts weiter, als dass ich aus meiner Fensternische ausziehe. Nein, nein, nicht Ihretwegen. Ich habe früher vor dem breiten Fenster gearbeitet, das war mir viel lieber, ich habe das Licht lieber nur von vorn, aber ich musste wegen der Kinder umziehen. Als nämlich Paul zu groß wurde, musste er im Wohnzimmer auf dem Schlafsofa schlafen. Das ist jetzt nicht mehr nötig, jetzt hat er sein eigenes Zimmer, was wir auch nur wieder Ihnen zu verdanken haben. Aber so etwas nehmen wir dankbar an, das kommt alles von Gott, der den Menschen nur als Werkzeug gebraucht. Es ist nicht viel umzuräumen, nur ein paar Tische und Stühle.«
So plaudernd, hatte sie ihn in das Wohnzimmer zurückgeführt. Nach Entfernung von Blumenständern und anderen Sachen, die jetzt in der Fensternische Platz fanden, wurde vor den anderen beiden Fenstern je ein größerer Tisch aufgestellt, von Frau Baumer, die ihm nur freundlich zunickte, mit zweckentsprechenden Decken belegt, die Farbenflecke und Tintenkleckse vertragen konnten.
»Wollen Sie zur Rechten, so gehe ich zur Linken, und wollen Sie zur — nein, das werde ich gleich bestimmen. Sie haben, wenn Sie mir bei der Arbeit zuschauten, immer links gesessen, so werden Sie auch hier links sitzen, damit Sie aus dem rechten Augenwinkel immer nach mir herüberschielen können.«
»Ach, Fräulein, Sie sind doch die liebenswürdige Aufmerksamkeit selbst, wie — —«
»Ja, Du lieber Gott«, lachte sie, »wenn man so einen kranken Jüngling hat, der selber nicht weiß, was ihm fehlt, da muss man doch als Arzt aufmerksam sein! So, der Umzug ist geschehen, das neue Leben kann beginnen. Nun, Herr Leonardo, seien Sie als mein Arbeitskollege herzlich willkommen — und wenn Sie einmal wieder Sehnsucht nach Ihrer stillen oder vielmehr lärmenden Klause haben, genieren Sie sich nicht, dann ziehen Sie sich wieder einmal für einige Zeit in Ihre mürrische Einsamkeit zurück. Aber ich hoffe doch, Sie werden es bei mir aushalten.«
Das neue Leben begann. Da er jetzt mit der Familie bis zehn und elf Uhr nachts zusammenblieb, stand er erst um sechs auf, ging in sein Bad und war zum gemeinsamen Kaffeetisch zurück. Während der Arbeitsstunden, mit Lesen und Schreiben ausgefüllt, sprach er nur, wenn er gefragt wurde. Es war ganz deutlich zu bemerken, wie ihm die Nähe eines anderen Menschen genügte, und er freute sich auch, wenn er angesprochen wurde.
Der kräftigen Hausmannskost sprach er mit Appetit zu, er wurde niemals gefragt, ob er dies oder jenes gern oder überhaupt esse, diese klugen Menschen wussten schon, wen sie vor sich hatten, wie der zu behandeln war — was macht sich denn so einer aus der Esserei, es ist ihm eine Pein, deswegen befragt zu werden. Gegen den bescheidenen Pensionspreis hatte er kein Wort eingewendet.
»Na, Frau Baumer, Sie haben ja ein Glück!«, sagte einmal die Nachbarsfrau. »Sie nehmen dem reichen Kauz nicht mehr ab? Na, dann wird sich der ja einmal tüchtig revanchieren. Und der hat es doch natürlich auf Fräulein Hannchen abgesehen. Darf man schon gratulieren?«
Jeder beurteilt den anderen nach seinem eigenen Charakter — wenigstens die meisten Menschen tun so. Nichtachtung ist das beste. Weitere Spitzfindigkeiten ließ der Ruf dieser Familie nicht aufkommen. Aber war es nicht schon genug?
Abends wurde meist Schach und Dame gespielt oder gelesen, illustrierte Zeitschriften. Ausgegangen wurde noch nicht.
Es kamen einige Fälle vor, welche den Einlogierer der Familie noch näher brachten.
Paul fühlte sich in seiner separierten Stube als Gelehrter, der nichts weiter als seine Bücher und seinen Schreibtisch kennt, er musste jetzt in den Ferien manchmal hinaus ins Freie gejagt werden. Er war ja überhaupt immer ein sehr fleißiger Schüler gewesen, ließ keine Schularbeit, die er heute erledigen konnte, bis morgen hängen, aber so ein Anlass wie der eines eigenen Zimmers, was im Leben eines Kindes genau so viel zu bedeuten hat wie beim erwachsenen Manne etwa der Wechsel von einer Knechtschaft zu einer sorgenfreien Existenz, hat tatsächlich schon aus manchem trägen Knaben einen strebsamen gemacht. Nur ein einziges Mal richtige Arbeitslust in ihm erweckt, diese für einige Zeit zu erhalten wissen, die Folgen kommen von selbst, er fühlt sich beglückt, sein Charakter ändert sich plötzlich total — die Folgen für sein ganzes späteres Leben lassen sich gar nicht absehen! Wenn man die Geschichte von Männern, die von mittelmäßigen und sogar beschränkten Köpfen plötzlich zu Genies umgeschlagen sind — Linné, Alexander von Humboldt, um nur die beiden größten Naturforscher zu nennen — ganz genau kennte, so würde man immer finden, dass so eine äußere Ursache daran schuld war.
Einmal kam Paul herüber und fragte die Schwester, wie ein französisches Wort auszusprechen sei. Er hatte sein Vokabularium mit.
»Hast Du diese Vokabeln schon auf?«
»Nein, 's ist aber doch besser, wenn ich's schon mache.«
»Paul lernt nämlich sehr schwer«, sagte Hannchen zu dem anderen Tische hinüber, »nur sitzt dann auch alles bei ihm.«
»Hat er Phantasie?«, fragte der Italiener.
»Phantasie mehr als genug«, lachte Hannchen zurück. »Aber was hat das mit dem Vokabelnlernen zu tun?«
»Zeig mir doch einmal Dein Buch, Paul.«
Er war gebeten worden, die noch nicht konfirmierten Kinder nicht mit Sie anzureden. wie er es früher getan hatte.
»Wie lange brauchst Du an so einer Reihe von — ungefähr dreißig Vokabeln?«
»Das kommt ganz darauf an — einen halben Tag, einen ganzen.«
»Kannst Du hier diese Reihe schon?«
»Nein, kein einziges Wort.« Höchstens dass hier und da ein Anklang an ein ihm schon bekanntes lateinisches Wort war.
»Willst Du diese dreißig Vokabeln in fünf Minuten gelernt haben?«
»In fünf Minuten?!«
»Pass auf. Ich werde Dir die deutschen und französischen Vokabeln mit Verbindungen sagen, Dir mehr eine kleine Geschichte erzählen. Stelle Dir alles recht lebhaft im Geiste vor. Hast Du eine Cousine? Ja. Deine Cousine ist in der Küche, la cuisine, steht am Herd, der fourniert ist, daher le forneau heißt. Die Feuerung wird von einem Chauffeur besorgt, also einem Manne, und da er auch die Asche zu entfernen hat, wird er le chauffage genannt. Also die Feuerung le chauffage. Die Asche selbst besteht aus Hunderten von einzelnen Stückchen und heißt deshalb les centres — vom lateinischen centrum. Glüht aber die Asche, so bäckt sie unter einem bräzelnden Geräusch zusammen und heißt dann la braise — —«
So fuhr der Italiener fort, die dreißig Vokabeln mit einander zu verbinden; er brauchte dazu kaum zwei Minuten, er sprach sehr schnell, und, abgefragt, konnte sie Paul zu seinem eigenen grenzenlosen Erstaunen sofort auswendig.
Ja, er wusste, was Mnemotechnik ist. Wer weiß es nicht? Aber wer wendet sie praktisch an?
»Nun versuche dieselbe Reihe Vokabeln selbst so mit einander zu verbinden.«
Paul tat es, es gelang ihm so ziemlich, er besaß Phantasie genug — und darauf kommt es allerdings an, auf die Phantasie, die für den Menschen überhaupt alles, alles ist. Mit Hilfe der Phantasie verwandelt er ein Stück trockenes Brot in ein Beefsteak und die Dachkammer in einen Palast. Aber auch gleich praktischen, direkten Erfolg kann man mit Hilfe der Einbildungskraft erzielen. Draußen ist so herrliches Wetter und Du musst in dumpfer Stube am Schreibtisch sitzen, an der Hobelbank stehen. Bilde Dir nur fest ein, Du müsstest jetzt eigentlich im Keller Kohlen schaufeln, oder Du kannst es ja auch wirklich einmal für eine Viertelstunde tun, bis der Zuchthauswärter kommt — natürlich bist Du unschuldig ins Zuchthaus gekommen, was jedem Menschen jeden Tag passieren kann — und Dir sagt, Du sollst heute oben arbeiten, im Büro, in der Werkstatt — und Du wirst mit größtem Genuss am offenen Fenster sitzen oder stehen und Dich manchmal durch einen Blick nach dem drüben an der Häuserwand liegenden Sonnenschein ergötzen, Du wirst dreimal so viel fertig bringen, als wenn Du misslaunig bei der Arbeit wärest.
Der Italiener führte Paul in diese Art Mnemotechnik immer mehr ein, und was dem Knaben früher eine Last war, wurde ihm jetzt zur Lust.
Gretchen hatte sich am Herd eine tüchtige Brandwunde am Armgelenk zugezogen. Der sofort geholte Arzt hatte ihr eine lindernde Salbe aufgestrichen und eine Bandage umgelegt.

In der Nacht begann das Kind vor Schmerzen zu schreien. Der Italiener trat aus seinem Zimmer, vollkommen angezogen, nur statt des Kragens ein weißes Halstuch umgeschlungen, traf auf dem Korridor Frau Baumer, zum Fortgehen bereit.
»Was ist mit Gretchen?«
»Sie hält es vor Schmerzen nicht aus, ich muss den Arzt holen.«
»Lösen Sie die Bandage, die dürfte die Ursache des Schmerzes sein.«
»Das glauben wir auch, aber der Arzt hat es ja strikte verboten, die Binde abzunehmen.«
»Vertrauen Sie mir das Kind an, ich verstehe etwas von Brandwunden. Das Salbenpflaster soll auch darauf bleiben, nur die Bandage möchte ich ändern.«
Gretchen musste ins Wohnzimmer kommen, im Beisein aller löste der Italiener die Binde und legte sie in ganz anderer Weise wieder an, sich ungemein geschickt benehmend. Sofort hörte der Schmerz auf, er kam nicht wieder.
»Sind Sie denn Arzt?!«, fragte Hannchen erstaunt.
»Nein. Das ist die italienische Wickelung, für manche Fälle, wie für diesen, viel besser als jede andere.«
Als er sich bei dieser Gelegenheit bückte, sah Hannchen unter dem verschobenen Schale an seinem Halse eine furchtbare Narbe, sicher einen Drüsenschnitt, aber das Messer musste schrecklich gearbeitet haben, zwei Finger konnte man in die Furche hineinlegen, Hannchen schauderte davor fast zurück, und eben deswegen sagte sie davon dann auch zu den anderen nichts, sie war nur froh, dass er das Halstuch gleich wieder zurecht schob.
Am anderen Tage kam der Arzt von selbst, machte beim ersten Blick auf die Bandage ein verdutztes Gesicht, wurde ganz unwirsch, als er sie abwickelte.
»Wer hat denn die angelegt?!«
Es wurde ihm alles mitgeteilt.
»Ist dieser Italiener ein Arzt oder Student der Medizin?«
»Nein. Ein ehemaliger Geistlicher, ein Mönch, jetzt Privatgelehrter.«
»So. Na, da lassen Sie das Kind von dem italienischen Pfaffen nur weiter behandeln, ich komme nicht wieder!«
Sprach es brüsk, ging und schickte die Rechnung.
Die Brandwunde heilte von allein fast ohne Narbe.
Solche Fälle mussten den Italiener der Familie natürlich immer näher führen. Aber ändern tat sich sein Wesen nicht. Es blieb das eherne, regungslose Gesicht, der ruhige, vornehme, schweigsame Charakter. Zufrieden und behaglich fühlte er sich, wenn nicht glücklich, das war deutlich zu merken, und das war die Hauptsache.
Am Sonntag war August nicht gekommen, wie es im Jahre wohl zwei- oder dreimal passieren konnte, er hatte eine Turnfahrt mitgemacht, hatte dies der Familie wie immer schon am Sonnabend mitgeteilt, in einem Briefe, dessen Schrift wie gestochen aussah, tadellos orthografisch, in einem abgefeilten Stile, mit etwas gar zu gewählten, blühenden Ausdrücken.
»Sehen Sie, das hat unser Freund geschrieben, den Sie damals in dem Hotel gesehen haben«, sagte Hannchen mit förmlichem Stolze zu ihrem Arbeitsnachbar. »Sollte man das diesem linkischen Menschen mit den schweren Arbeitshänden zutrauen? Richard hat mir einmal ein Kollegienheft von ihm gezeigt, zu Hause ausgearbeitet, mit Zeichnungen von physikalischen Apparaten darin — einfach prachtvoll! Richard war ein sehr peinlicher Schüler und kann gut zeichnen, aber gegen Augusts Heft war das seine Schmiererei.«
Leonardo betrachtete den Brief aufmerksamer als dass er ihn las.
»Einen Charakter drückt diese Handschrift nicht aus,« urteilte er dann.
»Was, August keinen Charakter?!«
»Weil nämlich der Schreiber einen so starken Charakter hat, dass er ihn verbergen kann. Dieser Mann weiß genau, was er will.«
Hannchen verstand ihn nicht, fragte aber auch nicht weiter.
Am nächsten Sonntag Abend Punkt halb acht stellte sich August wieder ein mit Leberwurst, Zuckertüte und Rose. Von der Begegnung in dem Hotel durfte Hannchen gar nicht sprechen, der arme Kerl wurde verlegener denn je.
Er wollte erzählen, wie er in der Wohnung des »Alten« einen Ventilator zu reparieren gehabt habe, die Meldung davon dem »Alten« in jenes Hotel bringen musste, brachte aber schon das Wort »Ventilator« gar nicht heraus.
Leonardo war gerade auf seinem Zimmer, so wurde August, der sich immer vergewisserte, dass er heute einen Schlips anhabe, schnell etwas über die neue Hausordnung orientiert. Dass nun ein Fremder mit am Tische saß, war ihm natürlich furchtbar fatal, wenn er auch das Gegenteil behauptete, es wenigstens versuchte.
»Ja — jaaa — Mel — Mela — Melancholerie — jaaa —«, rieb er sich aus seinen Knien heraus.
Dann, als er einmal im Wohnzimmer allein war, betrachtete er mit wehmütigen Blicken den zweiten, mit Büchern und Papier bedeckten Arbeitstisch.
»Warum kann an dem nicht ich sitzen?«, seufzte er lautlos.
Der Italiener kam und hatte sofort erfasst, wie er dem armen Menschen nur den größten Gefallen tat, wenn er sich gar nicht um ihn kümmerte. So schlimm hatte er es sich denn doch nicht vorgestellt. Augusts Verlegenheit und Ungeschicklichkeit fanden heute gar keine Grenzen. Die Kinder verschonten ihn heute mit ihren Scherzen, und nur umso schlimmer wurde es mit ihm. Er war einfach eine »abwechselnd erbleichende und errötende Leiche«, wie sich Paul dann ausdrückte. Hannchen beschloss, den Zimmerherrn am Sonntag vom Abendtisch fernzuhalten.
Augusts Zeit zum Gehen war gekommen, aber gerade heute machte er keine Anstalten, seine Todespein zu beenden, er war in seiner schrecklichen Verlegenheit eben gar nicht fähig dazu.
»Es ist um zehn, August.«
»Jaaa — ach jaaa — —«
Schließlich kam Hannchen auf die Vermutung, dass er noch etwas auf dem Herzen haben müsse, er würgte gar zu schrecklich am Kragen, wollte etwas herauswürgen, was ihm nicht gelang, und ehe Hannchen dem Italiener einen Wink zu geben brauchte, verließ dieser schon von selbst das Zimmer.
»Du willst uns wohl noch etwas sagen, August?«
»Ja — ach jaaa — heute — nee gestern — gestern musste ich auf's — Büro kommen — zum Direktor — auch der Alte war da — die — Ingenieure drüben werden nicht fertig mit der Geschichte — die — unsere Spinnmaschinen gehen nicht — ich — ich — hatte es ja gleich gesagt — Wasserturbinen und Dampfmaschinen — das — das ist doch ganz was anderes — die — die Turbinen ziehen zu langsam an — und — und da schließen sich die Sperrhaken nicht schnell genug — und — und da verlaufen sich die Fäden — aber — aber — ich weiß, wie das gleich wieder in Schuss gebracht werden kann — ich — ich hab's schon vor vier Wochen gesagt und ganz genau aufgezeichnet — aber — aber — was die Ingeniers sind, die Großfress... die — die — na ja — die haben mich ausgelacht — und nu — nu — gestern — hat der Alte gesagt: ›Schulze‹, hat er gesagt, ›da müssen Sie nüber und Dampf dahinter machen‹ —«
»Was, Du gehst nach Amerika?!«
»Ja — jawohl — die Sperrhaken — —«
»Wann denn?!«
»Mo — morgen früh — sechse zwanj.«
»Was, morgen früh schon?! Und das sagst Du erst jetzt?!«
»Nu — nu ja — ich sag's doch jetzt.«
»Wo Du schon gehen willst?! Wo Du den ganzen Abend hier bist?!«
»Nu — nu — Ihr habt mich doch egal nicht zu Worte kommen lassen.«
Eigentlich hatte er ja da ganz recht.
»Wie lange bleibst Du denn drüben?«
»Nu — nu — nu — —«
»Wann kommst Du denn wieder?«
»Ga — ga — gar nicht.«
»Was, Du bleibst für immer drüben in Amerika?!«
»Ja — ach jaa — wir — wir liefern doch zweihundert Spinnmaschinen hinüber — und — und später noch viel mehr — und — und — da wollen die einen Werkmeister von uns hinüber haben — für ständig — und — und — das soll ich sein — von wegen die Sperrhaken — —«
Die erste war Hannchen, die in Tränen ausbrach.
»August, nun gehst Du für immer fort — —«
Er glotzte mit seinen wasserblauen Augen regungslos in die Lampe.
»Jaa — ach jaa — —«
»Darf man erfahren, was Sie da für ein Gehalt bekommen?«, fragte die praktische Frau Baumer mit unsicherer Stimme.
»Fuff — fuff — fuffzig Dollarsch — —«
»Fünfzig Dollars? Im Monat?«
»Nee, in der Woche.«
»Fünfzig Dollars in der Woche?! Zweihundert Mark?! Das ist ja enorm!«
Das war es eigentlich nicht. Ein Werkmeister, der in Deutschland sechzig bis achtzig Mark bekommt, kann in Nordamerika schon fünfzig Dollars beanspruchen.
»Na ja, freilich«, wurde Frau Baumer jetzt etwas anderer Ansicht, »das teuere Leben drüben, besonders die Wohnung, und Sie wollen doch auch einmal ans Heiraten denken.«
»Nee — aaach nee — nich in de Hand — und — und — die Wohnung habe ich frei — jetzt muss ich aber gehen.«
Ja, wenn er morgen um sechs schon auf dem Bahnhof sein wollte, dann wurde es Zeit.
Jetzt war es ein allgemeines Weinen und Schluchzen, unter dem er nach der Tür begleitet wurde. Ein Weiterbegleiten oder gar »auf den Bahnhof bringen« verbot sich hier ganz von selbst.
»August, mein lieber, lieber August, dass Du uns für immer verlassen willst!«, schluchzte besonders Hannchen herzzerreißend. Er selbst hatte keine Tränen, nur dass er jetzt die Worte überhaupt nicht mehr hervorbrachte.
»Haben Sie denn schon eingepackt?!«, fing jetzt Frau Baumer zu schluchzen an.
»Nu — nu — frei — frei — freilich — un — und — die finf — finf — finf Schlipse von Ri — Richard — die kriegen Se mo — mo — morjen —«
»Dass Sie das aber nur erst jetzt sagen, Sie hätten doch für Richard so viel mitnehmen können!«
Ja, das hatte August sehr schlau gemacht!
Unter erneutem Weinen und Schluchzen die üblichen Abschiedsworte, dann voltigierte August die Treppe hinab, und unten auf der Straße ging's auch bei ihm los.
Am nächsten Tage herrschte Trauer in der sonst so fröhlichen Wohnung. Signor Leonardo hielt es für das beste, gar nicht sein Zimmer zu verlassen. Hannchen arbeitete auch nicht, hatte sich wieder zu Bett gelegt, um ungestört weinen zu können. So nahe ging ihr der Verlust des Hausfreundes, der nun nicht mehr jeden Sonntag Abend kommen würde, den sie vielleicht niemals im Leben wieder sah.
Gegen Mittag kam eine große Kiste und eine Nähmaschine. Letztere war für Frau Baumer bestimmt, ihre alte nähte nicht mehr gut, sie hatte sich schon immer eine andere anschaffen wollen.
Einige beigelegte Zeilen von Augusts Hand sagten, dass er sie selbst gemacht, dass er seit einem Jahre jeden Tag eine halbe Stunde daran gearbeitet habe, nach Feierabend oder in der Mittagszeit in der Fabrik, natürlich mit Erlaubnis seiner Vorgesetzten.
Ein Wunder von einer Nähmaschine! Nähte vorwärts und rückwärts und seitwärts, konnte als Schreibtisch und Waschtisch und Nachttisch benutzt werden, als Geldschrank und Wäscheschrank und Speiseschrank, hatte so viele Kästchen und Fächerchen, dass man sie gar nicht fand.
Und in der großen Kiste für Paul und Gretchen alles das, was die Kinder im Laufe der drei Jahre in seiner Gegenwart so nebenbei einmal als das Ziel ihrer Sehnsucht erwähnt hatten, das hatte er alles erlauscht und sich gemerkt und nun verwirklicht. Bücher und eine Druckerei und ein ausgezeichnetes Mikroskop und noch Dutzende von Kleinigkeiten für Paul, und dementsprechende Sachen für Gretchen. Nichts hatte er vergessen, auch nicht das Briefstoffpapier mit dem Monogramm, das vor zwei Jahren Gretchens heißesten Wunsch gebildet hatte.
»Nein, gibt es denn nur solch eine Aufmerksamkeit in der Welt?!«
Für Hannchen aber nichts weiter als eine einzige Rose. Und dennoch hatte er hiermit wiederum das Richtige getroffen.
Und außerdem noch Richards fünf abgelegte Schlipse, die er nach und nach mitgenommen hatte. Gereinigt, sie rochen noch nach Benzin. Und diesem Manne hatte man immer Vergesslichkeit vorgeworfen!
Doch alles dies konnte den Schmerz der Trennung nicht lindern. Er war so groß, dass er nicht einmal Bestürzung über diese wertvollen Geschenke aufkommen ließ. Selbst die Kinder konnten sich nicht richtig freuen.
»Ach, wäre er doch lieber hier geblieben!«, klagten sie.
Die Abendpost brachte einen Brief aus Amerika, aus Moorfield, und der schlug nun vollends den Boden aus diesem Kalendertage.
Mutter, erschrick nicht vor Freude. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, um Euch das Märchen zu erzählen, das dennoch Tatsache ist. Wir haben hier nichts zu tun. Unsere Maschinen gehen nicht. Sie machen rätselhafte Strümpfe und alles andere, was sich kein Mensch deuten kann, nur Fäden spinnen sie nicht.
Es muss jemand herüber kommen, der von der ganzen Geschichte mehr in den Händen hat als die Ingenieure im Kopfe, und mich soll's gar nicht wundern, wenn's unser August ist. Ich habe die Ingenieure schon munkeln hören, dass nur der uns aus der Patsche helfen könnte, und sie fluchen schon, dass sie diesen Allerweltskerl nicht gleich mitbekommen hätten. Unterdessen bummeln wirden ganzen Tag herum und leben herrlich und in Freuden. Denn wir haben doch noch mehr Zulage bekommen, wir Unterbeamten drei Mark mehr pro Tag, damit lässt sich's nun freilich auskommen, zumal für uns jetzt auch die Speiseanstalten offen sind. Da muss etwas von oben dazwischen gesaust sein.
Der Generaldirektor ist doch wohl gar kein solcher Deutschenhasser, er hat nur gar nichts davon gewusst, unsere Bittschrift hat ihn gar nicht erreicht. Jetzt mit einem Male sind die Herren, die da was zu sagen haben und uns grob abwiesen, wie die dressierten Hündchen gegen uns.
Nun aber kommt die Hauptsache. Nochmals: Mutter, erschrick nicht vor Freude, und glaube nicht, dass ich wahnsinnig bin und nur Märchen zusammenträume. Heute in aller Frühe schlendere ich durch einen Saal, da will eine große Spinnmaschine — aber keine von uns — nicht gehen, die Schlosser und Ingenieure suchen und suchen, ich sehe nur so hin und sehe zufällig ein Stiftchen zwischen den Zahnrädern liegen, das ich entferne.
Gleich darauf kommt jemand, ich möchte ihm zum Generaldirektor folgen.
Was, ich zum Generaldirektor?! Ihr müsst nämlich wissen, das ist hier ein Fürst, ein König, eine unnahbare Majestät. Weil ich das Stiftchen gefunden hatte? Na, wenn mich irgend ein Direktor in sein Büro hätte rufen lassen — aber gleich der General!
Ich folge und komme ins Allerheiligste. Und der Generaldirektor empfängt mich doch, als wäre ich seinesgleichen. Klopft mir auf die Schulter und bietet mir eine Zigarre an. Und der sieht nicht so aus, als ob er gegen jeden so wäre.
Das soll eine ganz selbstherrliche Majestät sein!
Ob ich Richard Baumer aus Berlin sei. Ja, der bin ich. Er erkundigt sich noch genauer. Ich sei ihm warm empfohlen worden. Ob ich Lust habe, hier angestellt zu werden. O gewiss! Hier hat ein Schlosser mindestens zwanzig Dollars, und ich arme Reißbrettzwecke! Kündigung habe ich ja wöchentlich, und das kann der doch überhaupt machen wie er will.
»Bitte, kommen Sie mit, Sir!«, sagt er, führt mich in ein kleines Büro, wie ein Damenboudoir eingerichtet, nur praktischer. »So, hier ist Ihr Privatoffice.«
Ja, Mutter, nun sitze ich hier in meinem Privatoffice und schaukele mich im amerikanischen Drehstuhle. Habe mich jeden Tag hier drei Stunden zu schaukeln, von früh zehn bis mittags ein Uhr. Dann ist Feierabend. So gegen zwölf kommt jemand mit einer Mappe, da liegen ein paar Listen und Rechnungen drin über das Fleisch und Gemüse, was hier täglich in die Küchen und Kantinen geliefert wird, diese Papiere habe ich abzustempeln und mit meiner Unterschrift zu versehen. Nichts weiter. Nicht etwa auf die Richtigkeit zu prüfen. Das geschieht an ganz anderer Stelle. Ich habe hier dem Kinde nur einen Namen zu geben, der ganzen Sache die letzte Weihe.
Und für diese Fünfminutenarbeit täglich erhalte ich jährlich — Mutter, Kinder, ich bin nicht etwa irrsinnig geworden — 8000 Dollars, sage und schreibe achttausend Dollars — —
»Ja, das klingt allerdings ganz märchenhaft!«, unterbrach sich die vorlesende Hannchen.
»Weiter, lies weiter!«, wurde gedrängt.
Ich bin das, was man in Deutschland einen Aufsichtsrat nennt. Hier einfach Inspektor. Aber so ein einfacher Inspektor oder Aufsichtsrat bin ich gar nicht.
Das habe ich schon längst hinter mir. Ich bin Generalinspektor für die Naturalienlieferungen, die in die Spinnerei und in die ganze Stadt kommen, für fünfunddreißigtausend Menschen. Soeben habe ich die Lieferung von einer Viertelmillion Flaschen Selters und Limonade erlaubt. Alkohol in jeder Form ist hie verboten.
Ja, es ist alles ganz richtig. Bereits ist unser eigener Notar, aber doch ein Staatsbeamter, hier gewesen, gegen ein Dutzend Direktoren und andere Bevollmächtigte haben meine Unterschrift mit der ihrigen beglaubigt. Vor mir liegt das Reglement. Das Anfangsgehalt des Generalinspektors ist achttausend Dollars und steigt jährlich um fünfhundert Dollars. Mein Vorgänger, der diesen Posten erst vor wenigen Wochen verlassen, hatte ihn zwanzig Jahre lang und ist mit einem Gehalte von achtzehntausend Dollars abgegangen. Er bezieht jetzt eine Pension von zweitausend Dollars. Wenn ich heute aufhörte, müsste auch ich schon achthundert Dollars Pension bekommen. Reglement!
Fragt mich nicht, wie ich zu diesem fürstlichen Faulenzerposten gekommen bin. Ich bin bereits beim Generaldirektor gewesen, habe ganz offen gefragt, ob hier denn nicht ein Irrtum vorliege. »No, Sir, all right.« Unser erster Ingenieur meint, ich müsse hier einen gewaltigen Protektor haben. Ich weiß von nichts.
Mein gefundenes Stiftchen kann doch unmöglich daran schuld sein.
Wisst Ihr, wie es mir vorkommt? Wie wenn ein königlicher Prinz mit seinem zwölften Jahre oder noch früher zum Leutnant ernannt wird, im nächsten Jahre ist er schon Oberst, dann wird er gleich General. Ist denn nur vielleicht unser seliger Vater hier in Amerika so ein heimlicher König gewesen? Nun, liebe Mutter —
Zunächst brach Frau Baumer in bittere Tränen aus.
»Ach, nun bleibt auch Richard in Amerika!«
»Warte nur, Mama, es kommt gleich etwas anderes, ich habe den Brief schon überflogen«, sagte Hannchen eilfertig und fuhr im Vorlesen fort.
Nun, liebe Mutter und Geschwister, mache ich Euch einen Vorschlag: Packt Eure Sachen und kommt mit herüber! Bei mir hat alles seine Richtigkeit. Auch freie Wohnung habe ich, und was für eine! Acht Zimmer, auf's Feinste möbliert, oben auf Moor Hill, wo nur die allerhöchsten Beamten wohnen. Ich kann natürlich auch Verwandte und irgend wen zu mir hereinnehmen, nur nicht gegen Geld. Das steht alles im Reglement. Paul hat freies Gymnasium; auch ein Mädchengymnasium ist vorhanden. Kommt herüber! Und wenn's auch nur ein einziges Jahr wäre, das lohnte sich doch schon. Ich könnte mir gleich für ein ganzes Jahr Vorschuss geben lassen. Stellt Eure Möbel ein. Wenn's länger dauert, wenn's Euch hier gefällt, lassen wir sie nachschicken. Ja, Hannchen kann hier mit ihrer Porzellanmalerei schrecklich viel verdienen, ich hab's gestern zufällig erfahren, will mich aber jetzt nicht weiter darauf einlassen. Es hängt mit einem vornehmen Frauenverein zusammen, der in sämtlichen größeren Städten Amerikas eigene Geschäfte hat, in denen die Heimarbeiten der Mitglieder verkauft werden. Ja, ich bitte Euch flehentlich, kommt herüber! Mir wird es hier ganz ängstlich mit dem vielen Gelde —
Es folgte ein kurzer Schluss. Wie viel Geld er hinüberschicken solle.
»Mama, wir gehen hinüber!«, sagte Hannchen.
»Wir gehen nach Amerika!«, jubelten die Kinder.
»Ja, es ist wohl das Beste, wenn wir uns hinüberbegeben«, pflichtete auch die Mutter bei. »Unter solchen Umständen möchte ich den etwas leichten Richard nicht allein lassen. Natürlich nicht gleich — —«
»Nein, nein, so schnell wird nicht geschossen!«, lachte Hannchen. »Die Sache muss sich erst klären, da muss er erst noch mehrmals schreiben. Denn das klingt ja alles ganz unglaublich. Freilich — es kann alles in der Welt passieren. Du kennst doch die Geschichte mit Vetter Artur. Der dient erst dreiviertel Jahr, muss vor die Front, der neue Feldwebel liest den Tagesbefehl vor — Einjährig-Freiwilliger Töpel zum Sergeanten ernannt — aber es ist nur Gefreiter gemeint, der Regimentsschreiber hat sich verschrieben. Das ist nicht bemerkt worden, der Oberst hat unterschrieben, und diese Beförderung geschieht im Namen des Königs, geht nicht mehr rückgängig zu machen. Wenigstens nicht so einfach. Der Oberst kann es nicht wieder aufheben. Vielleicht liegt dort drüben auch so ein Versehen vor. Jedenfalls hat Richard ein ganz kolossales Glück gehabt.«
»Ja, Hannchen, wie wird es denn da aber mit Deiner Malerei, an der Du ein ganzes Jahr zu arbeiten hast?«
»Das, liebe Mama, habe ich alles schon beim Lesen des Briefes überlegt. Erstens habe ich mich nicht verpflichtet, gerade hier zu malen, und Entfernungen spielen heute gar keine Rolle mehr. Zweitens steht mir mein Bruder näher als unser Zimmerherr. Und drittens und letztens: Wir nehmen Herrn Leonardo einfach mit! Wenn ihm so viel an unserer Gesellschaft gelegen ist — gut, so mag er uns doch begleiten. Seine Bücher bekommt er drüben auch. Wir sprechen einmal mit ihm darüber, es braucht ja — und doch, warum nicht gleich nachher beim Abendessen? Ach, der arme Mensch hat heute überhaupt noch gar nichts von uns gehabt!«
»Und dann sind wir wieder mit August zusammen!«, jubelten die Kinder.
Ganz verklärt blickte Hannchen zur Decke empor.
»Und dann sind wir wieder mit August zusammen!«, echote sie. »Ach, darauf freue ich mich am allermeisten, deshalb möchte ich gleich morgen abfahren! Und der weiß nun doch noch nichts davon! Weißt Du, Mama, wir telegrafieren an Richard, er soll nichts verraten, dass wir eventuell nachkommen, ob wir nun kommen oder nicht. Mag das kosten was es will! Diese Überraschung lasse ich mir nicht entgehen. Jetzt will ich aber erst mal nach unserem Italiener sehen. Der arme Mensch hat heute ganz allein essen müssen.«
Auf dem Wege zur Tür blieb Hannchen noch einmal stehen.
»Weißt Du, Mama, seitdem dieser Italiener bei uns ist, werden wir mit Segen doch geradezu überschüttet! Er mietet das Zimmer, nachdem wir schon alle Hoffnung aufgegeben haben, erweist uns hierdurch den größten Dienst. Er gibt mir den herrlichen Auftrag, einen Jahresverdienst von elftausend Mark, den ich ohne Erröten annehmen kann. Jetzt nun das mit Richard. August geht als wohlbestallter Mann hinüber, es ist für uns der bitterste Schmerz, und gleich verwandelt er sich in die fröhlichste Hoffnung eines Wiedersehens. Ist das nicht wunderbar?«
»Ja, es ist wunderbar!«, bestätigten alle.
»Diesen Fremdling hat wirklich Gott zu uns geführt.«
Hannchen ging auf den Korridor und brannte erst die Wandlampe an. Ehe sie an des Italieners Tür klopfte, klingelte es. Der Treppenflur war noch nicht erleuchtet, es herrschte Dämmerung, sie erkannte die dunklen Umrisse zweier Männer.
»Was wünschen Sie?«
»Wohnt hier Herr Titus Leonardo?«, fragte eine tiefe Stimme.
»Ja, der wohnt hier.«
»Ist er zu Hause?«
»Ja, er ist zu Hause.«
»Bitte, wollen Sie mich zu ihm führen.«
Der erste Besuch!
»Wen soll ich denn melden?«
»Er weiß schon, wir sind gute Freunde.«
»Aber bitte einen Namen.«
»Nein, nein, das ist nicht nötig, wir — —«
Da trat der Italiener aus seinem Zimmer.
»Entfernen Sie sich, Fräulein, freie Bahn!«
Mit diesen Worten wurde Hannchen von den beiden Fremden unsanft zurückgestoßen, und zu ihrem Entsetzen sah sie noch zwei weitere Männer eindringen, zusammen vier.
Der erste trat schnell auf den Italiener zu.
»Im Namen des Gesetzes, Sie sind verhaftet! Keinen Widerstand!«
Eisen klirrte, ein weiterer Mann suchte ihm schnell Handfesseln anzulegen. Es gelang nicht.
Da sah das entsetzte Mädchen, wie sich das rotbraune, stolze Gesicht plötzlich zu einem Lachen verzerrte — sein erstes Lachen — zu einem grimmigen Hohngelächter — die hohe, kraftvolle Gestalt richtete sich mit einem Ruck noch höher empor.
»Mich, mich fesseln?! Ha, ihr blassen Pygmäen —«
Links und rechts schmetterten die vier Männer gegen die Wände, ein Kleiderschrank krachte zusammen.
Ein Mann raffte sich sofort empor, schlug die Browningpistole auf ihn an.
»Ergebt Euch, oder — —«
Ein furchtbarer Schlag wie ein Blitz, mit einem Schmerzensschrei ließ der Getroffene die Pistole fallen, plötzlich war diese in des Italieners Hand.
Da aber ließ er selbst, der scheinbar immer ganz ruhig da stand, so blitzähnlich waren seine Bewegungen, die Pistole fallen, er streckte seine beiden Hände hin.
»Da habt Ihr mich. Es war ein Irrtum von mir und es ist ein Irrtum von Euch.«
Die Zurückgeschleuderten stürzten sich wieder auf ihn.
»Hund von einem Anarchisten, blutverfluchter Raubmörder — —«
Jetzt waren die ruhig hingehaltenen Hände sofort gefesselt, die Beamten schleppten ihn hinaus, die Treppe hinab, ohne Hut.
Immer noch zwei andere Männer drangen ein.
»Ich bin Kriminalbeamter, hier meine Legitimation, muss sofort Haussuchung halten.«
Ob ihm Hannchen dabei geholfen hatte oder nicht, wusste sie später nicht mehr.
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.