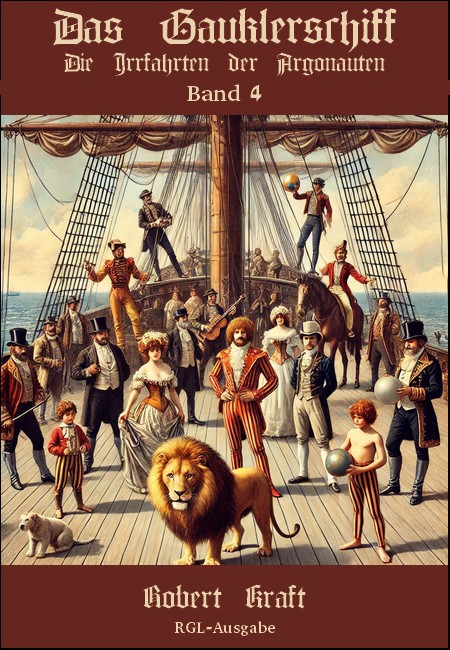
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.
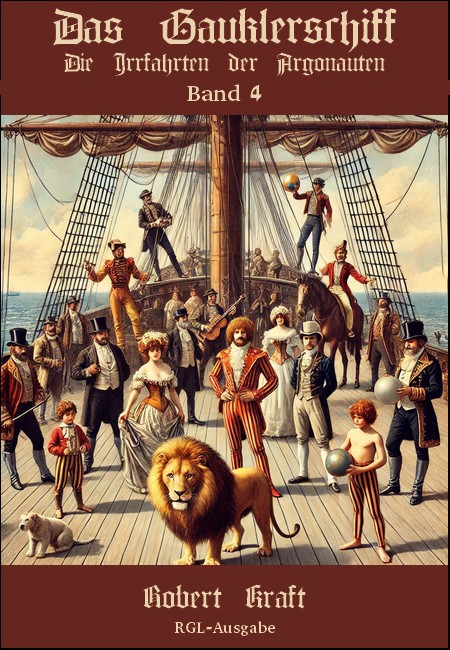
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
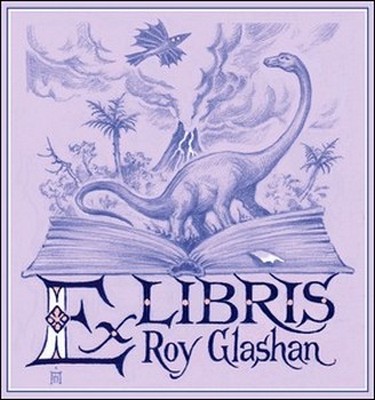
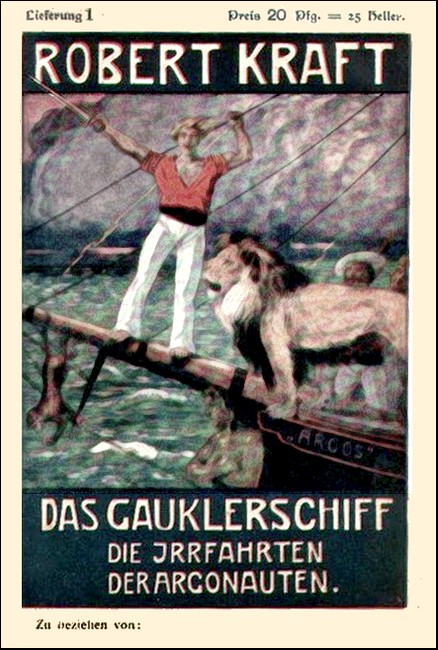
Das Gauklershiff, Cover von Lieferung 1

Das Gauklershiff, Titelblatt von Lieferung 1

Das Gauklerschiff, Band 4
Verlag Dieter von Reeken, 2022
Vor seinem Löwengarten,
Das Kampfspiel zu erwarten
Saß König Franz.
Und um ihn die Großen der Krone,
Und rings auf hohem Balkone
Die Damen in schönem Kranz.
Wer kennt sie nicht, diese Strophen, welche Schillers Gedicht »Der Handschuh« einleiten. Es war eine ganz andere Szenerie hier in diesem sibirischen Tal als jene, die der Dichter mit so wenigen Worten so scharf mit so wunderbarer Plastik zu schildern weiß, und doch wurde wohl jeder, der sie kannte an diese Strophen lebhaft erinnert, es konnte gar nicht anders sein.
Dort, wo einst die Amazonen gehaust hatten, zog sich in ziemlicher Höhe an der Felswand ein natürlicher Vorsprung hin, der von Menschenhänden zu einem Altan, zu einem Balkon umgebildet worden war, und auf diesem saßen alle die Personen der »Argos«, die nicht zur eigentlichen Schiffsbesatzung gehörten, alle die männlichen und weiblichen Gäste, hatten vor und unter sich den See, in dem sich die Vormittagssonne spiegelte, und harrten der neuen Überraschungen, mit denen ihnen jetzt Tag für Tag aufgewartet wurde, oftmals vom frühester Morgen an bis in die späte Nacht hinein, und niemand bekam diese Art von Spielen überdrüssig, sodass noch niemand an eine Abreise dachte.
Und da es meist ritterliche Kampfspiele waren, die ihnen vorgeführt wurden, so war auch in alle diese Zuschauer ein ritterlicher Geist gefahren, den sie auch in ihrem Äußeren kund taten, ohne dass sie sich dessen eigentlich bewusst wurden, mindestens ohne dass sie deshalb eine Verabredung getroffen hätten.
Es war ein ungemein buntes, schillerndes, reizvolles Bild, das der Balkon bot. Alle die Damen in prächtiger Toilette, nicht aber etwa in modernen Ball- oder Gesellschaftskleidern, sondern in Kostümen, die allen Jahrhunderten angehörten, eines immer bunter und phantastischer als das andere, und dasselbe galt auch von den Herren.
Es kann mit ganz einfachen Worten gesagt werden, was hier vorlag: sie spielten Karneval, Maskerade! Und jedes hatte sich nach seinem Geschmack kostümiert.
Merkwürdig war nur, dass hier durchaus keine Verabredung vorgelegen hatte. Das war im Laufe von ungefähr acht Tagen alles so nach und nach von ganz allein gekommen. Sie hatten sich immer mehr den Schauspielen angepasst, die ihnen vorgeführt wurden. So war es gekommen. Und da lässt sich ja gerade mit den einzelnen Stücken von Damenkleidern, die man gegeneinander austauscht, viel machen. Zumal auf solch einem Schiff, das seit vielen Jahren die ganze Welt bereist und überall werden Nationalkostüme und Volkstrachten gesammelt, zum Andenken mitgenommen. Sonst war das ja auch bald zurechtgeschneidert. Und da machten auch die beiden Töchter des Vaters Abdallah mit, ebenso ihre Dienerinnen, und diese mohammedanischen Araberinnen trugen schon längst keinen Schleier mehr, wozu auch, sie bildeten hier ja alle zusammen eine vertraute Familie — und wozu sollte der kostbare Juwelen- und Perlenschmuck, den sie mitgenommen, immer unbenutzt im Kasten liegen, sie hatten ihn angelegt, und dasselbe galt von allen den anderen Damen, und wenn das Geschmeide nicht ihnen selbst gehörte, so eben einer anderen, und das flimmerte und glitzerte alles im goldenen Sonnenschein.
Und auch die Herren machten also mit. Es kann unmöglich jedes Kostüm beschrieben werden. Es sei nichts weiter erwähnt, als dass Doktor Isidor mit Vorliebe als spanischer Grande paradierte, statt des Zylinders ein gewaltiges Samtbarett mit wallender Straußenfeder auf dem Affenschädel, an der Seite einen prachtvollen Galanteriedegen, der Griff strotzend von Diamanten, die zwar nur aus Glasscherben bestanden, nicht einmal aus geschliffenen Glasstücken, aber das tat ja nichts zur Sache, jedenfalls von dem ersten Maschinisten, diesem Hexenkünstler, in aller Schnelligkeit wunderbar gefasst, und dass Doktor Isidor seit einiger Zeit statt seines gewöhnlichen Klemmers eine große Brille trug, mit Horneinfassung, das sah zwar bei diesem spanischen mittelalterlichen Kostüm seltsam aus, war aber eigentlich ganz kostümgetreu, historisch treu, indem im 16. Jahrhundert in Spanien jeder, der den Kavalier und Stutzer markierte, eine große Hornbrille trug, so ungefähr wie heutzutage fast jedes Herrchen einen Klemmer auf der Nase balanciert, wenn es auch Augen wie ein Luchs hat.
Karneval von Sibirien!
Es war bereits zum Schlagwort geworden.
Den spielten sie.
Spielten ihn nun schon seit acht Tagen, und die Zeit war noch gar nicht abzusehen, da sie dieses Spieles überdrüssig wurden.
»Lassen Sie mal erst den Winter mit Schnee und Eis kommen, was ich da arrangieren werde! Etwas, was in unserer Eisgrotte auszuführen gar nicht möglich ist.«
So hieß es — jetzt, anfangs Juli, da der Sommer noch gar nicht richtig begonnen hatte!
Und das sagte jeder einzelne. Nämlich weil jeder einzelne immer neue Überraschungen ausheckte, einer wollte immer den anderen darin übertreffen, und sogar die Damen beteiligten sich an diesem Wetteifer in neuen Erfindungen.
So waren sie wieder einmal in aller Frühe, obgleich gestern die Vorstellung im Zirkus bis tief in die Nacht hinein gewährt hatte, hier zusammengekommen, um einem Wasserspiele beizuwohnen. Die Gäste und die sonstigen hohen Herrschaften hier auf dem Balkone, die anderen, so weit sie nicht dabei beteiligt waren, nicht mitwirken mussten, wussten schon einen anderen guten Zuschauerplatz zu finden, man brauchte sich ja nur an eines der Felsenfenster zu stellen. Was für ein Spiel oder Kampf oder sonstige Vorstellung stattfand, das wusste man niemals im voraus, das musste stets eine Überraschung ergeben.
Nur kurz vorher wurde stets der Name der Person, welche die neue Schaubelustigung erfunden hatte und derjenigen, die das Ganze nach den Angaben des Erfinders arrangiert hatte, genannt, sonst nichts weiter.
Jedenfalls aber musste es doch ein Spiel oder Kampf zu Wasser sein, sonst wäre man doch nicht eingeladen worden, hier auf diesem Seebalkon Platz zu nehmen.
Der Waffenmeister, der sonst am meisten arrangierte oder sich an den Spielen direkt beteiligte, schien diesmal nicht mit dabei zu sein, oder sogar ganz bestimmt nicht, denn er befand sich mit auf dem Balkon, in eine silberne Schuppenrüstung gehüllt, wie noch einige andere der Herren, und das war nicht nur ein Kostüm, mit dem man sich schmücken wollte, sondern zu sehr vielen der Schaustellungen war solch eine den Körper schützende Panzerung auch sehr nötig.
Da fiel in einiger Entfernung ein Kanonenschuss, und Stevenbrock erhob sich.
»Ein Wasserspiel, erfunden von der Frau Gräfin von Mohakare, arrangiert von Mister Juba Riata!«, verkündete er und hob seinen Revolver, um zwei Platzpatronen abzufeuern, als Bejahung, dass das angekündigte Spiel beginnen könne. Doch da, noch ehe er den ersten Schuss abgefeuert hatte, erscholl im Hintergrunde des weiten Balkons eine Stimme, der jederzeit dienstbereite Siddy war es, der aus dem Ausgange geeilt kam.
»Herr Waffenmeister, Mister Merlin wünscht Sie zu sprechen.«
Georg feuerte dennoch seinen Revolver ab, aber nur einen einzigen Schuss. Und dieser einzige Gegenschuss bedeutete, die Vorstellung möchte noch nicht beginnen.
Zum ersten Male wieder, nachdem Merlin den befreiten Waffenmeister schlafend zurückgebracht hatte, zeigte sich der geheimnisvolle Mann wieder. Das musste gewürdigt werden, da wurde die Vorstellung aufgeschoben.
Georg verließ den Altan, begab sich hinein in den Felsen, in dem einst die indischen Amazonen gehaust hatten, wo noch jetzt alles mit orientalischer Pracht eingerichtet war.
Aber diese Räume, in denen diese menschlichen Bestien gehaust, wurden von den Argonauten nicht benutzt. Sie bildeten nur den Durchgang nach diesem im Freien liegenden Balkon.
In der Mitte des ersten Raumes, auch schon mit kostbaren Teppichen und Polstern und Kissen ausstaffiert, stand Merlin, wie immer in sein gelbes Lederkostüm gehüllt.
»Ich störe doch nicht?«
»Niemals.«
»Du hast meinetwegen die Vorstellung unterbrochen — sie nicht beginnen lassen.«
»Wir haben Zeit.«
»Ich komme mit einer Bitte. Ich habe Gäste bekommen. Sie möchten gern Euren Vorstellungen beiwohnen. Es wäre dies möglich, ohne dass Ihr sie zu Gesicht bekommt. Aber das möchte ich nicht, es widerspricht meinen Gefühlen, ebenso denen meiner Gäste. So bitten sie Dich, dass sie Euren Vorstellungen offen beiwohnen dürfen...«
»Herzlich gern, sie sollen auch unsere Gäste sein!«
»Nein, bitte nicht! Sie möchten ganz für sich bleiben, nicht angesprochen werden... verzeihe, dass ich solch eine Bedingung stelle.«
»Ich verstehe. Trotzdem sind sie mir und uns allen herzlich willkommen.«
»Nicht nur dieser Vorstellung, sondern auch allen anderen möchten sie beiwohnen. Sie bitten darum, dass sie auch jederzeit den Zirkus betreten können, wenn Ihr Euch darin belustigt.«
»Sie sind jederzeit unsere Gäste, obgleich wir uns niemals im Geringsten um sie kümmern werden.«
»Ich danke Dir. Also es findet keine Vorstellung statt. Ich meine: ich nenne Dir nicht ihre Namen, nicht woher sie sind und wohin sie wieder gehen werden. Übrigens kennst Du sie schon.«
»Ich kenne sie schon?!«
»Du hast sie schon einmal gesehen.«
»Wo denn?«
»Es wird Dir schon einfallen, wenn Du die ganze Gesellschaft siehst, wenn vielleicht auch nicht sofort.«
So hatte der jugendliche Greis zuletzt gelächelt, schlug einmal die Hände zusammen, sofort rollte einer der Wandteppiche zurück, und...
Und Georg begann zu starren!
Die angemeldeten Gäste traten ein.
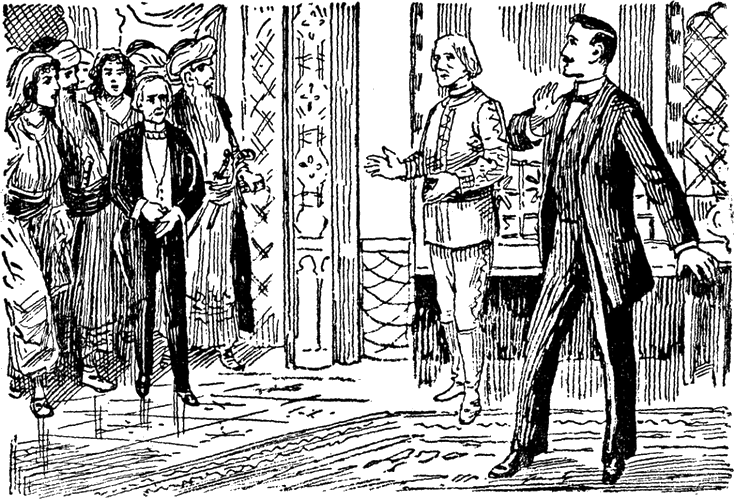
Meist langbärtige, würdevolle Männer, alle in orientalischen Kostümen, halb indisch, halb türkisch, jedenfalls immer aufs Prächtigste gekleidet, mit Schwertern gegürtet, deren Griffe von Edelsteinen funkelten, dasselbe galt von den Dolchen und Pistolen — und dazwischen ebensolche orientalische Weiber, halb indisch, halb türkisch kostümiert, nämlich insofern, als viele von ihnen auch nie an die Knöchel reichende Pumphosen trugen, kein Obergewand darüber, was man in Indien nicht findet, alles schillernd von bunter Seide mit goldenen Stickereien, lauter junge, durchweg bildhübsche Weiber, das Antlitz unverhüllt, herrlich geschmückt, mit Juwelen und Perlen schier überladen...
Und Georg starrte und starrte.
Nicht allein über diesen Anblick wie aus einem Märchen aus Tausendundeiner Nacht.
Nein, noch etwas anderes war dabei, was ihn plötzlich ganz kopfscheu machte, was ihn sein Gehirn martern ließ.
Himmel noch einmal, wo hatte er denn nur diese ganze Gesellschaft schon einmal gesehen?!
Und zwar ganz genau ebenso eintretend, auch in solch einem orientalischen Prunkraum. Die Erinnerung wäre ihm vielleicht nicht gleich gekommen, denn es war ein gar zu seltsames Zusammentreffen zwischen dem Jetzt und längst vergangenen Zeiten.
Aber eine einzige Gestalt brachte ihm sofort die Erinnerung zurück.
Ein Mann war darunter, der sich von den anderen ganz auffallend unterschied.
Ein Herr, ein kleines, zierliches, patentes Herrchen, schon sehr alt, das bartlose Gesicht ganz durchrunzelt, im schwarzen Frackanzug mit schneeweißem Oberhemd, Stehkragen und weißem Schlips, zierlich trippelte es auf Lackschuhen einher, die weißen Glacehandschuhe noch zuknöpfend, den chapeau claque unterm Arme...
»Himmel noch einmal, der Professor Beireis aus dem Seelandsfelsen bei Australien!«
Kein anderer war es.
Und da also erkannte Georg auch die ganze orientalische Gesellschaft gleich wieder!
Dieselbe, welche damals den orientalischen Saal betreten hatte, das heißt nur als Spiegelbild, Georg hatte dies alles nur im Spiegel gesehen!
Ebenso wie auch das Männchen, das sich in seiner Einbildung wie ihm später gesagt worden war, für den wiedergeborenen Professor Gottfried Beireis aus Helmstedt hielt.
Auch der hatte ja gar nicht in Wirklichkeit neben dem Speisenden auf dem Sofa gesessen, sondern nur als ein wesenloses Spiegelbild. Dann ein Klingeln, und plötzlich war dies alles verschwunden gewesen. Und Schwester Anna hatte telefonisch um Entschuldigung gebeten, dass man den Gast sofort mit solchen Illusionen belästige. Aber Georg hatte erwidert, man möge nur mit den Illusionen ruhig fortfahren. Da jedoch war die Walfischjagd mit dem unglücklichen Ausgange dazwischen gekommen.
Jetzt trat diese ganze orientalische Gesellschaft in vollem Leben hier ein, und der Professor Beireis mitten dazwischen!
Er war auch der einzige, der nach dem Waffenmeister den zusammengeklappten Zylinder graziös schwenkte, ihn so begrüßte, die anderen Männer, die Inder und Türken und Araber, blickten würdevoll gerade aus, strichen sich höchstens die stattlichen Vollbärte, hatten für Georg sonst gar keinen Blick. Während die weiblichen Mitglieder schon etwas neugieriger zu sein schienen, mit den mandelförmigen Augen bereits herumfunkelten. Doch Georg hatte ja gar keine Zeit, nähere Betrachtungen anzustellen.
»Jetzt erinnerst Du Dich, diese Herrschaften schon einmal gesehen zu haben, nicht wahr?«, redete ihn Merlin, der sich überhaupt gar nicht von ihm abgewandt hatte, lächelnd wieder an. »Bitte, nun teile Deinen Freunden mit, um was es sich handelt, Deine Erlaubnis haben wir ja, dann sorgst Du wohl dafür, dass diese Gesellschaft für sich sitzen kann, und sie wird auf den Balkon kommen.«
Georg begab sich wieder hinaus, brauchte nur eine einzige Minute, um alles zu erklären, das Staunen war ja groß, aber da galt es vor allen Dingen zu handeln, der Balkon war groß genug, um noch eine ganz andere Menschenmenge zu fassen, man brauchte nur etwas zusammenzurücken oder überhaupt die eine Hälfte des Altans zu wählen, Georg rief zurück, dass alles in Ordnung sei, und die exotischen Gäste traten heraus.
Man brauchte nicht neugierig die Köpfe zu wenden, man konnte sie auch so beobachten, als sie die Plätze einnahmen.
Sechsundzwanzig Personen wurden gezählt, und die Hälfte davon schienen dienstbare Geister zu sein, nur männliche, darunter auch einige pechschwarze Neger. Die tiefschwarze Ebenholzfarbe schien wirklich eine ausgesuchte zu sein. Diese brachten schon wundervolle Kissen für die Steinplätze mit und außerdem riesige Wasserpfeifen und Tschibuks, alles überaus kostbar, mit Gold und Elfenbein ausgelegt und von farbigen Juwelen funkelnd, dazu Becken mit glühenden Holzkohlen, die vornehmen Inder und Türken, die sie bedienten, begannen sofort zu rauchen, während zwischen den Weibern, die offenbar keine besondere weibliche Bedienung hatten, die unvermeidlichen Schalen mit allerhand Naschwerk, wobei überzuckerte Blumenblätter immer die Hauptrolle spielen, aufgestellt wurden, und so konnte man die ganze Gesellschaft leicht voneinander unterscheiden.
Es waren nur vier vornehme Männer, durchweg schon vorgerückten Alters und mit langen, bis auf den Gürtel wallenden Bärten geschmückt; neun vornehme Weiber, alle jung und von auffallender Schönheit; dazu elf Diener, ebenfalls sehr kostbar gekleidet, aber ohne Schmuck und Waffen; und schließlich, um die 26 Personen voll zu machen, noch zwei andere.
Die eine von diesen war ja den Argonauten schon allgemein bekannt: der Professor Beireis. Man hatte ja im Seelandsfelsen während Georgs Abwesenheit längere Zeit ganz freundschaftlich mit ihm verkehrt.
Doch hatte er jetzt für die ehemaligen Freunde keine Begrüßung, keinen Wink mehr. Nur dem Waffenmeister hatte er vorhin zugewinkt. Jetzt auf dem Balkon kümmerte er sich um die anderen gar nicht mehr. Das war ja auch ganz richtig so, nachdem nun einmal ausgemacht worden war, dass die beiden Parteien völlig getrennt von einander bleiben sollten.
Fast noch auffallender als dieser kleine Salonmensch im schwarzen Frackanzug war die zweite fremde Gestalt, die ebenso wenig in diese exotische Gesellschaft, die ganz an Tausendundeine Nacht erinnerte, passen wollte.
Es war ein äußerst großer Mensch, ein Riese, dem »Bandlwurm« wenig an Länge nachgebend, aber mit mächtigen Schultern massiv, geradezu herkulisch gebaut. Auch er war ganz schwarz gekleidet, aber nicht etwa mit so einem modernen Frackanzug, sondern es war ein eng anliegendes Samtkostüm, mit Kniehosen und Wams, einen recht altertümlichen Eindruck machend, man wurde lebhaft an die holländische Hoftracht des 17. Jahrhunderts erinnert, nämlich deshalb, weil diese von Rembrandt so oft dargestellt worden ist, und wirklich trug der Riese auch die dazu gehörigen, auffallenden Schnallenschuhe und ebenso an Handgelenken und als Kragen die weißen, kostbaren Spitzen, wodurch der riesenhafte Mann etwas Kindliches bekam. Das heißt mit unseren modernen Augen betrachtet!
Und unter dem schwarzen Samtbarett quollen lange, flachsblonde Locken hervor. Das war aber auch das Einzige, woraus man sonst auf das persönliche Aussehen dieses Riesen etwas schließen konnte. Auch seine Hände waren schwarz bekleidet, und ebenso trug er vor dem Gesicht eine schwarze Maske.
Georg sah nur noch, dass die orientalischen Diener diesen holländischen Riesen mit ganz besonderer Aufmerksamkeit behandelten, jeder wollte ihm ein Kissen unterschieben, was aber von dem Schwarzen gar nicht gewürdigt wurde, oder nur insofern, als er mit einer zweifellos verächtlichen Bewegung die Kissen fortschleuderte und sich nun gerade auf die nackte Steinstufe niedersetzte, dann kümmerte sich Georg nicht weiter um die ganze Gesellschaft, hob seinen Revolver und feuerte die zwei Signalschüsse ab.
Hinter jener Felsenecke, die schon mehrmals eine Rolle gespielt hat, kamen die zwei Jollen der »Argos« hervor, von Matrosen gerudert, die sich durch nichts auszeichneten.
Sie hatten auch nur erst eine vorbereitende Arbeit auszuführen, verankerten im Wasser, etwa 50 Meter von einander entfernt, zwei »Tore«. Man wurde nämlich sofort an jene Tore erinnert, wie sie beim Fußballspiel gebraucht werden, und das sagt wohl genug.
Das Aufstellen dieser schwimmenden und verankerten Tore war schnell geschehen, und da kamen schon hinter der Felsenecke eine ganze Menge andere Fahrzeuge hervor, kleine, leichte Kanus, aus gespannten Fellen hergestellt, vierzig Stück, davon die eine Hälfte schwarz, die andere Hälfte gelb, in jedem ein Indianer mit Schaufelruder. Die Kanus fuhren auf, die Farben teilten sieht, und das indianische Wasserpolospiel begann.
Der Begründer der ganzen Indianerliteratur, die doch auch ihre weltgeschichtliche und volkswirtschaftliche Bedeutung hat, man bedenke nur, was für Unsummen dadurch ins Rollen kamen und noch kommen, ist Fenimore Cooper durch seine Lederstrumpf-Geschichten. Es gibt gar keine Indianererzählung, aus der man nicht immer Coopers Gesicht hervorschauen sieht. Sitten, Gebräuche, Redeweise usw. — alles ist Cooper. Was der von den Indianern nicht gewusst hat, das vermögen auch seine zahllosen Nachahmer nicht zu schildern, mögen sie sonst auch noch so selbständig sein.
Nun ist ja Cooper zweifellos ein tüchtiger Kenner der nordamerikanischen Indianer gewesen. Aber von ihren Ballspielen hat er entweder nichts gewusst, oder er hatte eben keine Gelegenheit, davon zu sprechen, und daher wissen auch alle seine Nachahmer wirklich nichts von dieser indianischen Leidenschaft. Nun aber gibt es doch auch noch andere Kenner des indianischen Lebens, mehr wissenschaftliche Forscher, so vor allen Dingen der gelehrte Amerikaner Daniel Sticker, der alles zusammengetragen hat, was über den indianischen Charakter bekannt geworden ist, von den historischen Anfängen an bis ums Jahr 1880.
Da liest man auch von der geradezu leidenschaftlichen Manie, welche die nordamerikanischen Indianer noch heute für alle Art Ballspiele haben, die Umwohner der großen kanadischen Seen speziell für die Wasserballspiele.
Die Lady Ethel Bristol, jetzige Gräfin von Mohakare, war eine geborene Amerikanerin. Sie mochte davon gelesen oder vielleicht auch selbst solche Wasserspiele beobachtet haben. Jedenfalls war sie es gewesen, die auf den Gedanken gekommen war. Was auch diese Apachen und Komantschen für leidenschaftliche Ballspieler waren, ist schon gesagt worden. Wasserspiele kannten sie nicht, dazu hatten sie auf den wenigen Bächen, die ihr Heimatland durchfließen, ja gar keine Gelegenheit gehabt. Aber es brauchte ihnen nur davon gesagt zu werden, Juba Riata brauchte es nur einmal zu arrangieren, und sie waren sofort mit Feuer und Flamme dabei. Rudern konnten sie ja alle und solche Kanus aus Fellen waren leicht im Handumdrehen gefertigt.
Und das Wasserpolo begann. Es handelte sich also darum, welche Partei den Ball durch das feindliche Tor trieb. Dieser Ball bestand aus einer großen, weißen Fischblase, durfte nicht mit den Händen angefasst, nur mit dem Boote selbst getrieben oder mit dem Ruder geschlagen werden.
Solch ein Kampf lässt sich ja gar nicht schildern, keine einzige Phase davon. Es kann nur gesagt werden, dass die Zuschauer dort oben auf dem Balkon, besonders indem jeder bald für eine Farbe Partei nahm, nach und nach förmlich zu rasen begannen. Und auch der ernsteste der exotischen, würdevollen Gäste lachte schließlich aus vollem Halse, während die neun Weiber schon immer jubelnd in die Hände geklatscht hatten und von den Dienern besonders die Neger manchmal richtige Freudentänze aufführten.
Wie soll man da nun beschreiben, weshalb dieser lachende Jubel und begeisterte Enthusiasmus. Der Hauptwitz lag darin, dass die meisten der vierzig Indianer zwar schon so ziemlich wieder ihre normalen Figuren bekommen hatten, dass sich darunter aber noch immer einige unförmliche Fettwänste befanden, die sich aber trotzdem mit Feuereifer der wilden Jagd um den Ball hingaben, und dass die leichten Boote fortwährend umschlugen. Sie waren seitwärts mit Luftkissen versehen, schwammen daher auch in gekenterten Zustande, konnten mit leichter Mühe wieder umgekehrt werden, man musste sie nur wieder leer schöpfen, da musste der Schwimmer aber erst wieder hineingeklettert sein, was gar nicht so einfach war, und so war dieses ganze Spiel ein einziges Umschlagen in ganzen Reihen und Wiederaufrichten und Leerschöpfen — und dabei ging es immer in tollem Kampfe um den großen, weißen Ball, der ständig hin und her sauste, und die sonst so ernsten, würdevollen Indianer gaben sich diesem Kampfe mit einer Leidenschaft hin, machten einen Spektakel dabei, brüllten und heulten, als ob zwei ganze indianische Kriegsheere im Kampfe auf Tod und Leben lägen.
So verging fast eine Viertelstunde mit diesem tollen, brüllenden, plätschernden und spritzenden Durcheinander, als der Ball von der gelben Partei durch das feindliche Tor getrieben wurde, und es war die höchste Zeit, denn fast hatte es schon ausgesehen, als ob sich auch dort oben die Zuschauer in die Haare fahren würden. So wie in England bei den Fußballspielen, wobei sich das vieltausendköpfige Publikum, für die Farben Partei ergreifend, manchmal förmliche Schlachten liefert.
»Gesiegt, gesiegt, Gelb hat gesiegt!«, jubelten die einen.
»Den nächsten Ball aber schießt Schwarz, tausend Pfund wer setzt dagegen!«, schrie Lord Harlin, ein sonst ganz phlegmatischer Mensch, der aber plötzlich ganz aus dem Häuschen war.
Aber es wurde nichts daraus, die 40 Kanus fuhren schon wieder ab, es konnte gar nicht weiter gespielt werden, denn die beiden Jollen entfernten schon wieder die beiden Tore.
Alles nur einmal! Dieses Spiel konnte ja später wiederholt werden, aber zur Zeit immer eine Vorstellung schnell hinter der anderen. Und da kam schon hinter jener Felsenecke eine zwanzigriemige Galeere hervor, golden im Sonnenschein glänzend, am Heck eine grüne Flagge führend, und gleichzeitig aus einem Wassertore, das sich unterhalb des Balkons geöffnet hatte, eine zweite mit roter Flagge, ebenso wie jene zur Hälfte von Matrosen, zur Hälfte von Schiffsjungen gerudert, was sich ja leicht verteilen ließ, und jetzt ging es anders im Rudertakt, die waren unterdessen eingepullt worden!
Die rote wurde von Georg gesteuert, der sich unterdessen vom Balkon entfernt hatte, die grüne von Ernst, dem zweiten Steuermanne, und dann befanden sich an Deck noch andere Ritter. Denn gepanzert war alles.
Was jetzt vorgeführt werden sollte, das war ja sofort klar, auch ohne Ankündigung. Ein Kampf zwischen diesen beiden Galeeren. Wie der stattfinden sollte, das war ja allerdings noch die Frage.
Die beiden Galeeren näherten sich schnell, stoppten erst in kurzer Entfernung voneinander, und dann fand doch eine Ankündigung statt, oder vielmehr eine Herausforderung zum Zweikampfe, und zwar besorgte dies auf Georgs rotbeflaggter Galeere, deren Mannschaft goldgepanzert war, während drüben die silbernen Schuppenpanzer glänzten, Oskar. Denn der Steuernde konnte nicht gut zugleich der Hauptmann des Kriegsschiffes sein.
Also Oskar, ganz vorn auf dem hohen Vorderdeck stehend, schwang eine mächtige Lanze, mit der anderen Hand einen Schild, schlug mit dieser Lanze dröhnend gegen den Schild, und dann erhob er ebenso dröhnend also seine Stimme: »Ihr elenden Grünfinken! Ihr Himmelhunde! Ihr Karnickel! Ihr Rübenschweine...«
»Um Gotteswillen, Oskar, bist Du denn toll geworden?!«, ließ sich da hinten der steuernde Waffenmeister ganz entsetzt vernehmen. »Was soll denn das Publikum dort oben denken! Das sind doch edle Ritter, die Du in ritterlicher Weise zum Zweikampfe herausfordern sollst!«
Ja, es war ein Fehlgriff gewesen, dass man gerade Oskar für diesen Posten gewählt hatte, oder man hätte ihn wenigstens zuvor instruieren, ihm den Wortlaut der Herausforderung genau vorschreiben sollen, nicht seiner eigenen Schauspielerfähigkeit überlassen dürfen.
In anderer Hinsicht freilich... Oskar befleißigte sich vielleicht der möglichsten historischen Treue!
Denn wie es uns so viele Romanschriftsteller schildern wollen — so ist es in den alten Ritterzeiten sicher nicht zugegangen! Alle Hochachtung vor einem Gustav Freytag und Felix Dahn, aber gesprochen ist so edel und erhaben damals nicht worden! Ganz abgesehen davon, dass da jede Kuhmagd genau so edel und erhaben spricht wie die Königin. Wir haben aber historische Berichte und Dokumente von Zeitgenossen, dass es unter jenen herrlichen Rittern ganz anders zuging, dass sie sich ganz anderer Ausdrücke bedienten. Was die sich beim Herausfordern zum Zweikampf für Injurien an den Kopf warfen! Wie die sich titulierten! Nämlich auch in Briefen, die urkundlich noch erhalten sind! Den Damen gegenüber wohl, wenn es um die Minne ging, süß und aalglatt — aber die Ritter untereinander die reinen Rülpse. Nun, wenn auch Oskar die Sache kannte und historisch treu sein wollte, so sah er doch ein, dass sich das hier nicht paßte. Er brach sofort ab, schwang noch einmal seine Lanze, schlug noch einmal an seinen Schild und hub nochmals also an:
»Meine edlen Herrn Grünfinken! Ihr Herren Karnickel! Edle Rübenritter...«
Auch diese Verbesserung seiner Ansprache wurde dadurch unterbrochen, dass die feindliche Galeere eine dritte verbesserte Auflage nicht abwarten wollte, sondern plötzlich mit voller Fahrt losging!
Allerdings nur mit Hilfe der Ruder, jene geheimnisvolle Kraft wurde hierbei nicht angewendet. Immerhin, diese Matrosen und Schiffsjungen verstanden jetzt zu pullen.
Und beinahe wäre der schnelle, unvermutete Angriff gelungen! Wenn nicht Georg ein noch schnelleres Kommando gegeben hätte, das ebenso schnell und exakt ausgeführt wurde, und wenn er nicht noch rechtzeitig das Steuer herumgeworfen hätte. Sonst hätte ihm die vorbeistreichende Galeere sämtliche Riemen auf Backbordseite abgeknackt, und darauf kam es an, hiermit wäre der Kampf sofort zugunsten der grünen Partei entschieden gewesen.
So fuhr die grüne Galeere der roten nur hinten zwischen die Rippen, brach ihr nur zwei Riemen ab, und diese durften sofort wieder ersetzt werden. Nur um eine ganze Reihe handelte es sich, erst dadurch sollte eine Galeere manövrierunfähig gemacht, besiegt sein. Und der Kampf ging weiter. Fast eine halbe Stunde währte er, und er musste wohl sehr, sehr interessant sein, sonst hätte das Publikum dort oben nicht wiederum so gejubelt und manchmal fast gerast. Aber solch ein Kampf lässt sich eben nicht beschreiben.
Es mag nur gesagt sein, dass die rote Galeere entweder vom Waffenmeister der Argonauten schlecht gesteuert oder von der Mannschaft gerudert oder von Unglück verfolgt wurde. Sie verlor einen Riemen nach dem anderen, einmal gleich acht gleichzeitig, sodass nur noch zwei auf der einen Seite hervorragten. Freilich konnten, so lange auch nur noch ein einziger auf einer Seite vorhanden war, die abgebrochenen immer wieder ersetzt werden. So war ausgemacht worden.
Immerhin, die grüne Galeere war der roten doch weit überlegen, das war ganz deutlich zu bemerken. Und außerdem war die Anzahl der Reserveriemen auch beschränkt. Die rote Galeere hatte gar nicht mehr viel Riemen zuzusetzen, vielleicht nur noch drei oder vier, wenn sie dann nur noch einen einzigen Riemen verlor, so war sie ebenfalls besiegt.
Da, als also fast schon eine halbe Stunde lang der Kampf hin und her gewogt hatte, ging die bisher sich fast immer nur auf die Defensive beschränkt habende rote Galeere, die eben von der grünen förmlich gejagt worden war, zum ersten Male zum ernsten Angriff über.
Und es war ein so kühner und unerwartet schneller Angriff, dass es schon geschehen war, ehe das Publikum noch richtig zum Bewusstsein des Manövers gekommen. Die rote Galeere war plötzlich mit eingelegten Riemen an der grünen vorbeigeschossen und hatte dieser die ganze Ruderreihe auf Steuerbordseite abgeknackt!
Bei diesem Ruderabbrechen ging es niemals ohne Konfusion auf dem betroffenen Schiffe ab. Die betreffenden Ruderer wurden dabei natürlich immer von den Sitzen geschleudert. Es war auch ganz angebracht, dass sie gepanzert waren, es hätte doch leicht einmal Verletzungen geben können.
Bei diesem furchtbaren Vorüberstreifen war auf der grünen Galeere natürlich die ganze Steuerbordseite durcheinander geworfen worden, alles lag und purzelte noch übereinander weg.
Und da, noch ehe sie sich wieder aufraffen konnten, erscholl drüben schon ein neues Kommando, nochmals kam die rote Galeere zurückgebraust und hatte im nächsten Augenblick auch die ganze Riemenreihe auf Backbordseite abgemäht.
Der Waffenmeister der Argonauten hatte zum Schluss doch noch seiner Farbe zum Siege verholfen, noch viel mehr, als es nötig gewesen wäre.
»Der Kampf Mann gegen Mann beginnt!«, wurde oben verkündet, nachdem sich der allgemeine Jubel etwas gelegt hatte. »Dieses neue Kampfspiel ist in Szene gesetzt und arrangiert vom Heizer Felix Brunner!«
Ehre, wem Ehre gebühret. Wer etwas Gutes ausgediftelt hatte, wobei es sich um ein gemeinsames Spiel handelte, der unterbreitete seine Idee dem Waffenmeister als der letzten Instanz. Ging der auf den Vorschlag ein, dann wurde die Sache auch arrangiert, und wenn auch sämtliche mitwirken mussten, die Szene wurde erst mehrmals geprobt und dann den Gästen vorgeführt, und dann wurde auch stets der Name des genialen Erfinders verkündet, und wenn's auch der kleinste Knirps von Schiffsjunge war.
Wie sollte der Kampf zwischen den beiden Galeeren Mann gegen Mann stattfinden?
Natürlich wurde jetzt geentert.
Wie aber dann weiter?
Sollte wirklich mit Waffen gefochten werden? Die man vorher eingerußt hatte, um jeden sitzenden Hieb zu markieren?
Das wäre für die Zuschauer schwer zu erkennen gewesen, selbst durch ein gutes Fernglas. Außerdem hätte fortwährend ein Schiedsrichter einschreiten müssen.
Oder sich gegenseitig mit dem Lasso wegfangen? Oder sich einander bei den Händen hinüber ziehen? So wurde jetzt schon dort oben debattiert, und man sieht, es war gar kein leichtes Problem gewesen, welches der Heizer Felix da gelöst, hatte. Denn dass der nun irgendwie etwas Geniales ausgeheckt, das war ja nun gar kein Zweifel, und da war ich doch wirklich gespannt.
Zuvor noch sei der Leser daran erinnert, dass der Heizer Felix der gelernte Buchdrucker war, der damals auf der Fahrt von Para nach Bordeaux, als man die Passagiere des französischen Dampfers aufgenommen, den ausgezeichneten Witz gemacht hatte. Wie der französische Journalist, der die Patronin der Argonauten in seiner Broschüre so verunglimpft, über der Winde hängend seinen Magen umgekrempelt hatte.
»Du sieh mal, Garl«, hatte er zu seinem Kollegen gesagt, »der schbuckt Lettern, setzt se glei zusamm...«
Es ist nicht umsonst, dass hieran noch einmal erinnert wird, der Leser wird es gleich merken.
Die beiden Galeeren hatten sich etwas von einander entfernt, und da sah man, dass die Mannschaften unterdessen auch schon die Kostüme gewechselt hatten. Statt der Schuppenrüstungen trugen sie alle jetzt weiße Hosen und farbige Trikothemden, wiederum durch Rot und Grün von einander unterschieden.
Und jetzt ließ jede Galeere zehn Boote über Bord zu Wasser.
Oder vielmehr keine Boote, sondern es waren Kähne, ganz einfach zusammengefügte Bretter, wasserdicht gemacht, jeder Kahn konnte gerade zwei Mann bequem tragen, obwohl sie sonst ziemlich lang waren.
In jedem Kahn setzte sich ungefähr in die Mitte ein Mann mit einem Schaufelruder, ein zweiter von der gleichen Farbe stellte sich aufrecht ganz hinten auf, bewaffnet mit einer langen Stange, an der sich vorn ein Brettchen befand.
Und das bekannte Spiel begann.
Was für ein bekanntes Spiel?
Wie kam gerade Felix, der Heizer und ehemalige Buchdrucker, dazu, dieses Kampfspiel zu Wasser zu erfinden? Es war gar nicht seine eigene Erfindung Aber gerade ihm war es ein sehr bekanntes Kampfspiel, nur er hatte diese Idee gehabt.
Nämlich weil Felix ein geborener Leipziger war!
In Leipzig findet alljährlich im Sommer an einem gewissen Tage ein besonderes Fest statt: das Fischerstechen. Ein Volksfest darf man es nicht nennen, wenn auch alles daran teilnimmt, besonders alle Kinder — es ist aber doch nur das Fest einer Zunft, die es seit alten, alten Zeiten feiert und so auch noch heute genau in derselben uralten Weise.
An diesem Tage hält die Fischerinnung ihren Umzug durch die Stadt, die Fischer schicken eine Deputation ins Rathaus, werden dort auch bewirtet, und dann geht es auf einen Teich hinaus. Früher war es Schimmels Teich, heute wird das Kampfspiel auf dem Gewässer von Freges Waldgrundstück abgehalten.
Es ist ein ritterliches Turnier, übersetzt in die Fischerzunft. In jedem Kahne immer zwei Männer, der eine rudert, der andere ist der Kämpe, bewaffnet mit einer langen Stange. Irgend zwei Kähne nähern sich, legen nebeneinander an, werden festgehalten, die hinten stehenden Kämpen setzen ihre Stangen vorn mit dem Brettchen einander gegen die Brust, drücken und drücken, bis einer das Gleichgewicht verliert und hintenüber ins Wasser purzelt. Der scheidet aus. So werden der Kämpfenden immer weniger, bis zuletzt doch nur einer übrig bleiben muss. Das ist der Sieger, bekommt seine Trophäe und wird in die Weltgeschichte der Leipziger Fischer eingetragen. Das nachfolgende »Aalklettern« und eine lustige Wasserpantomime ist Nebensache. Hauptsache ist das eigentliche Stechen.
Man darf dieses Leipziger Fischerstechen nicht so leicht nehmen. Es ist eine uralte, heilige Tradition, die irgend einen historischen Hintergrund hat. Der Stadtkommandant von Leipzig wohnt diesem Turniere stets bei, und zwar nicht nur als eingeladener Gast, sondern als Vertreter des Königs! Ein »bekanntes« Kampfspiel hatten wir gesagt.
Wer kennt es?
Nun eben wer Leipzig kennt. Es gehört zu Leipzig wie die Messe.
Es sollte aber wirklich bekannter werden, nachgeahmt. Es ist wirklich ein ganz eigenartiges, amüsantes, ritterliches und dabei ganz harmloses Kampfspiel, obgleich es alle Kraft und Gewandtheit erfordert.
Der Heizer Felix hatte es als Leipziger gekannt, hatte seinen Vorschlag gemacht, und mit Jubel war die Idee aufgenommen und verwirklicht worden. Solche 20 Bretterkähne zu fertigen, das war ja für diese Mannschaft, die über hundert Paar geschickte Hände verfügte, eine Kleinigkeit gewesen.
Und das Wasserturnier begann, Boot gegen Boot, Mann gegen Mann, immer wieder Rot gegen Grün.
Wer purzelte, der schied aus, übernahm aber zuerst die Führung des Bootes, jetzt kam der bisherige Ruderer daran, und wurde auch der besiegt, dann schied das ganze Boot aus, die beiden begaben sich auf ihre Galeere oder an Land zurück, wo beiderseits schon wieder Vorbereitungen zu neuen Spielen getroffen wurden.
Übrigens nahmen nicht alle Teil an diesem Stechen. Es waren ja auch mehr als 40 Mann auf beiden Galeeren gewesen. So auch Georg nicht. Er hatte gerade als Waffenmeister seine besonderen Gründe, sich nicht an solchen Einzelkämpfen zu beteiligen.
Also es ging los. Die Kämpfer purzelten ins Wasser. Manchmal aber stemmten und drückten zwei eine ganze Viertelstunde lang, ehe einer den anderen zum Wanken brachte. Gerade deshalb ist es vorteilhaft, wenn gleich viele Boote gleichzeitig um die Palme ringen, das Auge hat mehr Abwechslung. Und an Abwechslung fehlte es denn auch nicht, nicht an humoristischen Szenen, dass oben auf dem Altan manchmal alles brüllte vor Lachen. Und außerdem nun, je mehr sich das Spiel seinem Ende näherte, sich die Boote lichteten, ging es wieder los mit dem Für und Gegen, jeder hatte natürlich seine Partei.
Zuletzt waren nur noch drei Boote übrig. Oder vielmehr nur noch drei Kämpen, die bisher noch nicht besiegt worden waren.
Das Schicksal war ziemlich gerecht gewesen. Es kam ja manches Unglück vor, das heißt mancher war nur ausgerutscht, sogar direkt vornüber ins Wasser gefallen, was aber doch unbedingt mitzählen muss — im allgemeinen aber war es immer so gekommen, wie man ungefähr erwartet hatte.
Körperkraft und Gewandtheit siegten. Allerdings spielt hierbei auch das Körpergewicht eine große Rolle. Der ganz von Eisen und Stahl gebaute Kretschmar war doch für diesen Kampf etwas gar zu leicht, er war vom langen Heinrich spielend geworfen worden. Hingegen hatte dieser, der höchstens anderthalb Zentner wog, freilich auch nur aus Knochen bestand, den dreizentrigen August besiegt, wenn auch erst nach langem, langem Ringen.
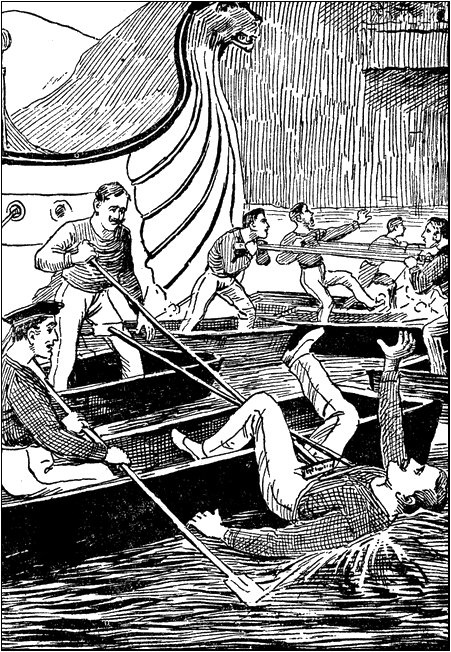
Der Kampf begann und hier und da
purzelte einer der Kämpen ins Wasser.
Und so waren zuletzt — oder zu vorletzt — nur noch drei übrig: von der grünen Partei Häckel, von der roten Partei der lange Heinrich und Albert der Sänger.
Dieser letztere aber zählte bei diesem Endgefecht nicht richtig mit. Allerdings war Albert, wie schon mehrmals erwähnt, ein bärenstarker Kerl. Er war ja auch derjenige gewesen, den damals Georg von allen Argonauten als einzigen auswählte, der ihm helfen sollte, die vierzentrige Mama Bombe über die schwankende Riffbrücke zu tragen. Diese seine Kraft sah man ihm gar nicht an. Er war zwar kräftig gebaut — natürlich — aber nicht von auffallender Muskulatur, hatte auch keinen besonders starken Knochenbau. Aber Mark hatte dieser Ostfriese in den Knochen, das war es! Und nun kam noch dazu seine ungemeine Bedächtigkeit, die manchmal bis zum impotenten Phlegma ausarten konnte.
Ja, und dennoch...
Dieser gottbegnadete Sänger war ein ganz echter Ostfriese, dort oben von der Waterkant her, aus Butjadingen
— »jau jau.«
Wer so wie der Schreiber dieses ostfriesische Seeleute, Fischer und Bauern kennen gelernt hat, der weiß, was das für ein merkwürdiger Menschenschlag ist. Ein ganz, ganz merkwürdiger Menschenschlag und ein ganz gefährlicher dazu!
Nur dass man diesen Kerls nicht böse werden kann. So plump, so schwerfällig, so langsam, eh die nur ein Wort herausbekommen — und dann wieder bei Gelegenheit, wenn's einmal sein muss, mit der Faust fix wie's Donnerwetter!
So bieder, so ehrlich, so treu — und dabei listig wie die Schlangen, faustdick hinterm Ohre, mit allen Hunden gehetzt!
Gastfreundschaftlich bis zum äußersten, der Ärmste gibt sein Letztes hin — aber dabei weiß er's immer nur vom Lebendigen zu nehmen, tut nichts umsonst!
Ein ganz merkwürdiger Menschenschlag, diese Ostfriesen!
Aber haben wir denn das nicht auch im Großen als ganzes Volk, als Nation?
Diese Ostfriesen sind der letzte Rest der alten Angelsachsen in Deutschland, die heute in England dominieren und regieren! Das ist es! Drüben in England offenbart sich dieser Charakter der alten Angelsachsen, die einzigen Gegner, deren Karl der Große nicht allein durch Waffengewalt Herr werden konnte, ganz und gar, in der Politik sowohl wie in der Person. —
Auch bei diesem Wasserkampfe hatte sich Albert als echter Ostfriese bewiesen.
Zuerst hatte er gerudert, war aber gleich so vorsichtig gewesen, sich als Partner August den Starken zu wählen, den er immer nur mit den stärksten Gegnern zusammengebracht hatte.
Als dieser gefallen war, hatte natürlich Albert die Lanze nehmen müssen. Ehrlich und offen hatte er sich immer dem ersten besten Gegner genähert — nur merkwürdig, dass das immer gerade einer gewesen war, der ihm bei weitem nicht das Wasser reichen konnte. Die hatte dieser baumstarke Kerl, der er war, ja nun allerdings mit leichter Mühe abgefertigt.
Da war Häckel herbeigeeilt gekommen, um diesen männermordenden Roten unschädlich zu machen.
Gewiss, unverzagt stellte sich Albert diesem furchtbaren Gegner, denn bei so einem Ostfriesen gibt es doch nicht etwa so etwas wie Feigheit!
Da aber, wie die beiden die Lanzen schon eingestemmt, hatte Albert einen Hustenanfall bekommen.
Den musste der edle Häckel natürlich erst vorüber lassen.
Aber er hatte gar lange zu warten. Albert hustete egal weiter.
Bis endlich Häckel die Geduld verlor.
»Na, hast Du Dich nun endlich ausgehustet?«
Albert jiebste tief auf und blickte den Frager vorwurfsvoll an.
»Na wat denn, ick mött doch mien Keeehl skoooohhn?!«, Ja natürlich, wenn dieser gottbegnadete Sänger, wohl mit der größte Stolz der »Argos«, einen Hustenanfall bekam, da war nichts zu machen. Der musste doch seine Kehle schonen.
Und als er nun immer wieder zu husten anfing, da hatte Häckel endlich aufgegeben.
Und da war der Hustenanfall sofort vorbei gewesen, Albert hatte kurz hintereinander den Peter und dann den Otto ins Wasser geworfen, geschleudert, dass es nur so knallte und spritzte!
Dann aber hatte ihn, der nun bald zu den letzten gehörte, Kaul erspäht und auserkoren. Kaul, der ehemalige Maler und Tapezierer, der sich die Haare an den Zimmerdecken abgestoßen hatte, ebenfalls ein ganz phänomenaler Pflaumenschmeißer.
Und diesmal hatte Albert nicht wieder ausweichen können. Doch was denn überhaupt? So ein Ostfriese weicht keinem aus, am wenigsten tat es Albert. Natürlich konnte er jetzt auch nicht wieder einen Hustenanfall bekommen. Was hatte er überhaupt für diesen gekonnt?
Also Albert stemmte unverzagt die Lanze ein; er tat es freilich in ganz besonderer Weise. Setzte seinen Fuß zuerst etwas seitwärts und setzte auch seine Lanze dem Gegner etwas seitwärts auf die Brust, und als er dann seine Fußstellung verbesserte, hatte er den Gegner mehr von der Seite bekommen, und ehe der etwas von dieser niederträchtigen List merkte, war er schon sanft zur Seite gedrückt und purzelte ins Wasser, und da hatte alle Riesenkraft und Schlangengewandtheit nichts genützt. Aber er konnte sich auch nicht beschweren, den Kampf ungültig machen. Hier war jede List erlaubt, man durfte sich eben nicht überlisten lassen. Wer purzelte, der purzelte.
So war es gekommen, dass Albert mit in die letzten Endkämpfe trat, welche die eigentliche Entscheidung herbeiführen sollten.
Doch in Betracht kam er hierbei nicht. Es handelte sich nur darum, ob der furchtbare Häckel für Grün oder der gewaltige Heinrich für Rot siegen würde.
Und jetzt traten diese beiden sich gegenüber, stemmten ihre Lanzen ein.
Atemlose Stille herrschte unter den Zuschauern dort oben wie hier unten. Jetzt ging es um die Ehre der Farbe, der ganzen Partei.
Man sollte nicht lange gefoltert werden. Wer vielleicht doch noch auf den langen Heinrichs gehofft hatte, der hatte sich eben getäuscht. Höchstens eine Minute des furchtbaren Stemmens und Drückens, dann war schon deutlich erkennbar, dass der ehemalige Advokatenschreiber diesem Matrosen weit überlegen war, und da schlug der letztere auch schon rücklings ins Wasser. Gegen jenen germanischen Herkules war einfach nichts zu machen.
Auf dem Balkon wurde Bravo geklatscht, und auch hier unten jubelten die Grünen dem Sieger zu, der ihre Farbe trug.
Aber — das Richtige war es längst nicht! Schon immer hatte während der letzten Kämpfe, als es immer deutlicher wurde, dass Häckel Sieger bleiben würde, etwas wie eine peinliche Stille über alle Zuschauer gelegen, dort oben wie hier unten.
»Mir scheint, jetzt würgt jeder einen Wurm hinter!«, hatte Klothilde einmal zu ihrem Nachbar, dem Doktor Isidor gesagt.
Und sie hatte recht!
Häckel war ja ein ganz guter Kerl, der beste Kamerad, er gehörte vollkommen mit zu den Argonauten. Aber — so ein ganz echter Argonaut war er doch nicht!
Er war nicht mit vom alten Stamme.
Und er war ein Advokatenschreiber gewesen, ein Schreiberlein.
Musste der gerade der Sieger im Entscheidungskampfe, der unüberwindliche Held sein?
Kurz, wenn der lange Heinrich, dieser echte Seemann von der Waterkant, Sieger geblieben wäre, dann wären nicht nur die siegreichen Roten in einen ganz, ganz anderen Jubel ausgebrochen, sondern sogar die Grünen hätten mit eingestimmt. Obgleich ihre Partei doch verloren hätte. Dann aber wäre es eben ein ganz echter Argonaute gewesen, einer vom alten Stamme, der den Sieg davon getragen, nicht so ein hergelaufener oder gar von der Straße aufgelesener...
Na, never mind, es war geschehen. Häckel hatte gesiegt, die ihm gebührenden Ovationen wurden ihm auch gezollt. Doch halt, erst hatte er ja noch einen anderen Gegner abzufertigen, den Albert. Na, das wurde eben noch schnellstens besorgt. Schade, dass man da auch noch zusehen musste.
»Komm her, Albert. Dass Du aber nicht etwa wieder den Husten bekommst!«
»Wat Husten? Ick häww keen Husten.«
Und schon lagen die beiden Kähne nebeneinander. Erst aber musste sich Albert noch einmal die Nase putzen.
Also er klemmte seine Lanze zwischen die Beine, zog bedächtig sein rotes Taschentuch hervor, faltete es bedächtig auseinander, suchte sich in dem schönen Muster, drei reifenspielende Jungfrauen darstellend, bedächtig die schönste Jungfrau aus, in die er seine Nase steckte, reinigte bedächtig sein linkes Nasenloch, dann reinigte er bedächtig sein rechtes Nasenloch, dann besah er sich bedächtig die so behandelte Jungfrau, dann wickelte er das Taschentuch bedächtig zusammen, steckte es bedächtig in die Hosentasche, wischte sich erst noch einmal die Finger bedächtig am Hosenhintern ab — so, nun war er fertig, nun nahm er bedächtig wieder die Lanze zur Hand.
»Himmel, ist dieser Albert ein langweiliger Mensch!«, stieß oben die Patronin unmutig zwischen den Zähnen hervor.
»Well!«, stimmte der neben ihr sitzende Kapitän Martin verdrießlich bei. Der war übrigens der einzige, der die Maskerade nicht mitmachte, denn der trennte sich doch nicht von seinem blauen Bratenrock. Nun, dafür würde es jetzt ja um so schneller gehen. Die beiden setzten die Lanzen ein.
Häckel wusste, welchem Trick sein Kollege Kaul zum Opfer gefallen war, und er achtete darauf, dass ihm nicht so etwas passieren könnte, ergriff die feindliche Lanze und setzte sich das Brettchen selber auf die Brust, an der ihm passendsten Stelle.
Dann drückte er los, der gewaltige Herkules, gegen den der andere, so groß und stark er auch gebaut sein mochte, doch ganz verschwand.
Häckel schien sich Zeit zu nehmen, wandte vielleicht erst die halbe Kraft an, denn noch sah man seinen Gegner nicht wanken.
Und so vergingen vielleicht zwei Minuten — zwei unbeschreibliche Minuten!
Und dann vollzog sich ein Wunder.
Da sah man ganz deutlich wie Alberts rechtes in Kniebeuge vorgesetztes Bein langsam vorging, wie er also immer eine tiefere Kniebeuge machte, wonach auch sein Körper sich vorneigen musste, und ganz ebenso ging Häckel nach rückwärts!
Und das ging Zoll für Zoll so weiter, oder vielmehr Linie für Linie, nur aller zehn Sekunden konnte man den Unterschied konstatieren, aber dieser Unterschied in den Körperstellungen vollzog sich auch unaufhaltsam!
Bis zuletzt Häckel das Ende seines Körpergleichgewichts erreicht hatte, die Stange fallen ließ und rückwärts ins Wasser schlug. Während Albert bedächtig seine Stange zwischen die Beine klemmte, bedächtig sein rotes Taschentuch aus der Hose zog, um seine Nase zu putzen.
»Du, Jochen, ich gläuw, ick häww dn Snuppen krägen.«
Jochen, sein Rudersmann, hörte es leider nicht mehr konnte ihn daher nicht bedauern.
Denn da war der Tumult schon losgebrochen. Denn das war kein Jubel mehr, das war schon mehr Tumult und Aufruhr.
»Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst!«, heulte Georg auf seiner Galeere. »Bei Gott, ich hab gewusst, dass sich unser Albert nicht werfen lässt! Von Hexenkünsten kann der besiegt werden, aber nimmermehr von einem Menschen, so bald der einmal ordentlich Ernst macht! Bei Gott, ich hab's gewusst... obgleich ich selber nicht dran geglaubt habe.«
Und das, was hier Georg sagte oder vielmehr heulte, nicht nur schrie, das wussten jetzt plötzlich alle, alle.
Sie alle, alle hatten ganz bestimmt gewusst, dass Albert als letzter Sieger aus dem Kampfe hervorgehen würde.
Weil es eine Kraft gibt, die überhaupt unbesiegbar ist. Eine Kraft, die man dem, der sie besitzt, gewöhnlich oder sogar immer nicht ansieht, weil sie nicht in den Muskeln und nicht in den Knochen steckt, sondern ganz wo anders.
In den Knochen drin, könnte man höchstens sagen. »Der hat Mark in den Knochen.« Asenkraft, nannten die alten Germanen diese Art von Kraft, die den unüberwindlichen Helden ausmacht, der selbst den Kampf mit Göttern erfolgreich aufnimmt.
Heute haben wir, die Nachkommen dieser Germanen, das romanische Wort »Genie« dafür. Freilich nur für eine geistige Kraft gebraucht, die sich in ihrer Wirkungsweise nicht weiter definieren lässt.
Unsere Vorfahren, die noch den Bären und dem Auerochsen mit der Lanze zu Leibe gingen, haben sich freilich um diese geistige Kraft verdammt wenig gekümmert.
Aber eine Asenkraft und ein Asentum kannten sie. Und als ob sich das, was wir heute Genie nennen, nicht auch auf körperliche Kraft anwenden ließe!
Wir heute wissen freilich nichts mehr davon, das haben wir über unseren Millionen von Büchern total vergessen!
Diese Asenkraft besaß Albert eben — Mumm in den Knochen! — Und außerdem war er, was doch auch für seine geistigen Fähigkeiten sprach, so schlau, so klug, so genial gewesen, ein echter Ostfriese, diese seine ganze Kraft bis zum letzten Kampfe aufzusparen, während sich der Gegner schon sehr erschöpft hatte! —
»Um Gottes willen, wo wollen Sie denn hin?!«, schrie oben auf dem Balkon Klothilde und packte die Patronin beim Gürtel.
Denn es sah nicht anders aus, als wolle diese auf die Brüstung klettern, um die drei Etagen hinunter zu jumpen, in den See hinein. Natürlich nur, um den Sieger in ihre Arme zu schließen. Mag das genügen, um die allgemeine Stimmung zu schildern.
Oder höchstens noch, dass Kapitän Martin seine Hände aus den Hosentaschen genommen hatte und sich immer auf die Knie klatschte, nicht nur so gemächlich, sondern wie ein Wilder.
Mehr lässt sich aber wirklich nicht sagen.
»Die siegreiche Galeere bombardiert eine feindliche Festung mit Katapulten und Ballisten!«, wurde verkündet. »In Szene gesetzt vom Segelmacher Oskar L... aus Köln!«
Wir können seinen Namen nicht ausschreiben, denn dieser Segelmacher Oskar ist nicht etwa eine aus der Luft gegriffene Persönlichkeit, sondern sein Vater ist heute noch in oder bei Köln ein Großindustrieller, der mit seinen Katalogen zeitweise ganz Deutschland überschwemmt.
Weshalb aber überhaupt hatte der Herold diesmal die Vaterstadt des Betreffenden hinzugefügt? Sonst geschah das doch niemals.
Und diesmal war doch auch gleich verkündet worden, welche neue Überraschung kommen würde, wenigstens mit starker Andeutung.
Nun, es würde schon seinen Zweck haben. Hier wurde wenig oder gar nichts zwecklos getan und gesprochen. Unterdessen war auf der Galeere mit der grünen Flagge ein Apparat aufgebaut werden. Eine Wurfmaschine, wollen wir gleich sagen.
Man unterscheidet zwischen Katapult und Ballist. Jeder Bogen, der durch seine Elastizität den Pfeil absendet, wirkt als Ballist. Denkt man sich aber den Bogen fest, starr, unelastisch statt der undehnbaren Sehne ist eine Gummischnur vorhanden, diese wird durch Zurückziehen gespannt, durch das Vorschnellen oder eigentlich Wiederzusammenziehen der Gummischnur wird der Pfeil vorwärts geschleudert, dann wirkt der Bogen als Katapult. Das ist der Unterschied dieser beiden Arten von Wurfmaschinen. Im Prinzip.
Eine Vereinigung beider Systeme war der sogenannte Onager, der zuletzt aber einfach Ballist genannt wurde.
Bei diesem stak ein Brett zwischen zwei Tauen, diese wurden durch Maschinerie zusammengedreht, das elastische Brett noch extra mit einer Winde zurückgebogen, es hatte hinten eine löffelartige Vertiefung, in diese kam das Geschoss, und wurde nun die Arretierung gelöst, so schnellte das Brett hoch und vor, teils durch seine eigene Elastizität, teils durch das Bestreben der beiden Taue, sich wieder aufzudrehen.
Bei der Erstürmung von Konstantinopel durch Mohammed II. wurde solch ein Onager verwendet, der, wie wir genau wissen, Steine oder Eisenkugeln im Gewichte von sechs Zentnern 800 Meter weit schleuderte. Alle Hochachtung! Da brauchst man sich nicht zu wundern, dass solche Wurfmaschinen noch benutzt wurden, als die Pulverkanonen schon ziemlich weit vorgeschritten waren. Freilich war jenes Ballist auch ein ganzes Gebäude, seine Bedienung erforderte 200 Mann.
So großartig war dieses Ballist ja nun nicht, welches hier an Bord der Galeere einige Mann innerhalb von zehn Minuten aufbauten.
Aber immerhin, was diese Argonauten taten, das würde auch schon seinen Zweck erfüllen.
Also eine Festung wollten sie beschießen?
Wo war denn diese Festung?
»Augen zu, Maul auf, damit die Trommelfelle nicht platzen, wenns knallt!«, hörte man dort unten Oskars wohlbekannte Stimme brüllen. » Achtung — feeerrtick — Feuer!«
Natürlich war kein Knall zu hören.
Aber sehen tat man etwas.
»Himmel, die beschießen uns!«
Jawohl, da kam der Todesbote schon angeflogen
Dort oben der Balkon, das war die schwache Stelle der Festung, die wurde beschossen, und der Feind war auch so unvorsichtig, sich dort zu zeigen.
Und da kam sie schon durch die Luft gesaust, eine ganz stattliche Kugel, von mindestens einem Viertelmeter Durchmesser, und sie sauste direkt auf den Balkon zu.
Klatsch, bruch, kladderadatsch!
Die Kugel war noch acht bis zehn Meter hoch über dem Balkon gegen die Felswand geschlagen. Und es war eine Bombe!
Sie explodierte!
Sie explodierte so fürchterlich, dass sie sich gleich ganz und gar in einen braunen Staub auflöste der harmlos herabrieselte.
Dieser braune Staub war Nebensache.
Hauptsache war der auf den Feind herabsausende Regen und Hagel von Konfetti. —
Konfetti!
Wir leben doch in einer ganz tristen Zeit! Man geniert sich förmlich, da mitleben zu müssen. Eine ganz und gar knausrige Zeit!
Fast alle Erfindungen streben nur danach hin, um irgend etwas billiger zu machen.
Und so ist es auch mit allem und jedem.
Nur immer sparen, nur immer knausern! Und dabei doch den Schein der Großartigkeit wahren!
Alles Lüge und Heuchelei!
Da sitzt man in einem Theater, sieht ein effektvolles Stück, sehr schön aufgeführt, man wundert sich nur, dass die Menschen egal mit den Kinnladen klappern und dennoch keinen Ton hervorbringen, und mit einem Male zuckt es und alles auf der Bühne ist verschwunden — und dann flammt es wieder auf und alles ist wieder da, die Menschen schlenkern wieder die Gliedmaßen, reißen den Mund auf und klappern lautlos mit den Kinnladen — und dann ist wieder alles weg — und dann ist wieder alles da — na, und so erfährt man nach und nach, dass das überhaupt gar keine richtigen Menschen sind! Kintopp!
Und so ist es mit allem und jedem heutzutage.
Alles Vorspiegelung falscher Tatsachen!
So ist es auch mit dem Konfetti, das in den Karnevalstagen geworfen wird.
Konfetti ist nichts anderes als das uns bekanntere Konfekt. Zuckerzeug, Süßigkeiten, Naschwerk.
Mit solchem echten Konfekt bewarf man sich in früheren Zeiten beim Karneval. Damit die Bonbons nicht am Boden schmutzig wurden, wickelte man sie in Papier, in schöne, bunte Papiertüten. Und so war es noch zu unserer Kinderzeit in den siebziger Jahren, als in noch gar vielen deutschen Städtchen öffentlich echter Karneval gefeiert wurde, da wurde noch mit echtem Konfetti geworfen, mit Bonbons und anderen Süßigkeiten, da führte Prinz Karneval und seine Begleitung solche eingewickelte Bonbons wagenweise mit sich und streute sie aus, da fuhren Hunderte von Droschken herum und aus allen wurde mit einpapierten Bonbons geworfen, und dann hinterher wurden alle eingeworfenen Fenster vom Prinzen Karneval bezahlt — von der Gesellschaft, die dies alles arrangierte.
Oder ist es etwa nicht so gewesen? Ist es nicht so gewesen zum Beispiel im Jahre 1876 in Leipzig, als Georg Kuchs Prinz Karneval war?
Ja, es war so! Damals gab es freilich noch keinen Kintopp. Und heute? Heute wirft man sich in den Karnevalstagen auch noch mit Konfetti, mit Konfekt. Aber die eingewickelten Bonbons das eigentliche Konfekt, hat man dabei weggelassen. Man wirft sich nur noch mit der bunten Papierumhüllung. Und die auch noch so klein als möglich geschnitten, in winzigen Schnipselchen ausgestanzt aus alter Makulatur, aus alten Abfällen, die man in der Fabrik nicht einmal mehr als Klosettpapier gebrauchen kann, dieses Zeug, die Tüte einen Fünfer, der ganze halbe Liter einen Groschen, schmeißt man sich gegenseitig ins Gesicht und nennt es stolz Konfetti, nennt es Konfekt...
Himmel, hast Du keine Flinte!
Es ist zum totschießen!
Nein, es ist zum Weinen!
Wir leben in einer ganz traurigen Zeit...
Aber solche traurigen Burschen waren diese modernen Argonauten nicht!
Die hatten einen ganzen Tag und eine ganze Nacht gewürgt, um unter August des Starken Anleitung echtes Konfetti herzustellen. Zucker und Schokolade und ähnliches Zeug war ja an Bord massenhaft vorhanden, und August der Starke selbst hatte geschwitzt, dass ihm immer der Schweiß von der Nasenspitze in den Marzipanteig getropft war, aus dem er dann Kartöffelchen und Brezelchen und andere schöne Sächelchen formte und buk. Und dieses echte Konfetti nun, auch alles schön in buntes Papier eingewickelt, kam jetzt aus der Luft herabgeprasselt, nachdem die irdene Bombe in Atome zersplittert war.
Ach, war das ein Gejubel und ein Gequieke, als der bunte Regen auf das Publikum dort oben herabgeprasselt kam! Als man den Inhalt der bunten Papierchen erkannte! Die neun fremden Weiber jubelten und quiekten am allerlautesten mit und begannen zu lutschen und zu nutschen und zu tschutschen.
»Karneval — Karneval in Sibirien!«, jauchzte die Patronin, in die Hände klatschend; dabei aber klang es fast und sah es fast aus, als ob sie zu weinen anfangen wolle.
Jaaaa, das war auch Oskar gewesen, der Kölner Jong, der diese Idee mit der Schießerei und dem Konfetti ausgeheckt hatte, und der ließ sich nicht lumpen, wenn es sich um den Karneval handelte, auch in Sibirien nicht!
»Well, das Zeug schmeckt ganz gut!«, sagte Kapitän Martin, den letzten Rest einer Marzipankartoffel verzehrend.

Jaaaa, sollte die wohl auch nicht gut schmecken! Da steckte mancher Schweißtropfen drin, von August des Starken Nasenspitze hineingeträufelt!
Und Kapitän Martin hob eine zweite Marzipankartoffel auf, biss hinein, schmeckte — und machte ein recht merkwürdiges Gesicht.
»Das — das — schmeckt doch grade wie — wie — wie Seeeefee?«
Jawohl, er hatte es sofort herausgeschmeckt. Dieses Kartöffelchen hier war von Seefe. Von guter, deutscher, solider Kernseife.
Müssen denn auch alle Kartoffeln gerade von Marzipan sein?
Jetzt war es die kleine Ilse, die misstrauisch eine längliche, bräunliche Kugel betrachtete, die sie aus Silberpapier gewickelt und in die sie schon gebissen hatte. Das heißt, da hatte sie schon viele Bonbons und Pralinees gegessen.
»Du, Tante, was ist denn das hier? Wie schmeckt denn das so komisch? Eigentlich ganz gut, so — so... würzig, aber — aber —«
Noch ehe die Patronin den fraglichen Bonbon untersuchen konnte, hatte ihn schon Klothilde in den Fingern.
»Das? Das ist eine Karnickelnorbel.«
Jaaaa, so etwas muss man beim echten Karneval mit in Kauf nehmen. Beim echten Konfetti. Zumal beim Karneval in Sibirien. Arrangiert von dem Segelmacher Oskar L... aus Köln.
Die Freifrau von der See fiel vor Lachen von ihrer Steinbank herunter.
Bruch, kladderadatsch!
Eine zweite Bombe, mit wunderbarer Genauigkeit geschleudert, war an der Felswand krepiert, ergoss ihren Inhalt über den Feind.
»Ach wie reizend!«
Lauter kleine weiße Mäuse, aus Zucker, mit Schwänzchen und allem, was dazu gehört.
Bruch, kladderadatsch! Eine dritte Bombe war explodiert.
»Ach wie — — huuiiiiiiihhhh!«
Wiederum lauter kleine weiße Mäuschen. Diesmal aber lebendige!
Vater Abdallahs Mäusepalast, von ihm noch immer eifrigst gepflegt, hatte herhalten müssen!
Bruch kladderadatsch!
Man brauchte nicht so ängstlich nach oben zu sehen und schon im voraus zu quieken.
Wieder regnete es Konfekt herab, diesmal aber nur das allerfeinste.
Bruch, kladderadatsch!
Jetzt freilich konnte man mit Recht quieken und johlen.
Die krepierende Bombe entsendete eine ungeheure Wolke von Mehlstaub, der sich auf den Feind herabsenkte, Männlein und Weiblein einpudernd.
Und dann kamen wieder Marzipankartoffeln.
Und dann kam eine Bombe mit parfümiertem Wasser. Und dann kam eine unparfümierte tote Katze.
Und hiermit wollen wir die Beschreibung dieses Bombardements schließen, obgleich es noch längst nicht zu Ende war.
Karneval in Sibirien!
*) Das Recht der dramatischen Aufführung und kinematografischen Wiedergabe dieser Pantomime behält sich der Verfasser vor.
Ein dröhnendes Signal, geradezu furchtbar dröhnend, dass die Luft erzitterte, nämlich auf den größten Basspfeifen der Orgel hervorgebracht, rief die Herrschaften zum Frühstück.
Es wurde wie alle Mahlzeiten immer an Bord des Schiffes eingenommen, das jetzt in einer bequem zu erreichenden Seitenschlucht lag.
Die letzte Bombe hatte ein Paket gebracht, mit der Aufschrift: Für Frau Rosamunde Wenzel-Attila.
Aus sorgsamster Watteverpackung kam ein stattlicher Nacktfrosch zum Vorschein — stattlich als Porzellanpuppe, sonst für menschliche normale Verhältnisse ja viel zu klein. Natürlich wieder unbändiges Gelächter, als der kleinen Dame der Nacktfrosch in den Arm gelegt wurde.
»Nun möchte ich bloß wissen, wo die Kerls diese Puppe herhaben?«, hieß es auf anderer Seite.
Ja, was gibt es nicht alles an Bord eines Schiffes. Das jahrelang unterwegs ist! Was sich da alles anhäuft!
Ein neues Orgeldröhnen ermahnte, dass das Frühstück bereit stehe.
»Ach, dieser Meister Kännchen, dass der mit seinem Frühstück alles unterbrechen muss!«, wurde unwillig gesagt.
»Hören Sie mal, die dort unten sind über diese Störung nicht so unwillig!«
Nein, was sich dort unten noch bewegte, das machte schleunigst, um an Bord des Schiffes zum Frühstück zu kommen. Sie hatten es sich auch redlich verdient.
Die Herrschaften verließen den Balkon, mehlgepudert und auch sonst total derangiert.
Nur die exotischen Gäste blieben noch zurück. Um diese durfte man sich ja nicht kümmern.
Allerdings wäre beinahe eine völlige Vermischung der beiden getrennten Gesellschaften eingetreten. Es hatte ja kaum anders sein können. Auch die würdevollen Männer waren von den geschauten Kampfszenen ganz hingerissen worden, von den Weibern und Dienern gar nicht zu sprechen, und nun gar bei dem letzten Bombardement war alles durcheinander gekommen, die orientalischen Damen waren vor den lebendigen Mäusen quiekend hinübergeflüchtet, nachdem sie sich kurz vorher um die weißen Zuckermäuse förmlich gebalgt hatten, und die Diener hatten auch treiben dürfen, was sie wollten, hatten sich keinen Zwang anzulegen brauchen. Die vier älteren Männer, die so stolz und würdevoll einmarschiert waren, hatten sich zuletzt gar keine Mühe mehr gegeben, durch Streichen der Bärte und andere Manipulationen ihr schallendes Gelächter im Keime zu ersticken.
Nur einer hatte eine Ausnahme gemacht. Der Professor Beireis war einfach ganz zapplig gewesen, der schwarze Riese hingegen hatte als einziger immer ruhig dagesessen. Nicht gerade bewegungslos, nicht steif, er hatte hinter seiner Maske alle Vorgänge dort unten immer aufmerksam verfolgt, aber jedenfalls hatte er nie gelacht, war auch bei der aufregendsten Kampfesszene niemals so aufgesprungen, anfeuernde Zurufe ausstoßend, wie es die vier Radschahs — so wollen wir sie nennen — oft genug getan hatten.
Das war jenseits der Grenze doch von einigen Augen beobachtet worden, es wurde dann beim Frühstück darüber gesprochen.
Jetzt, da es zum Aufbruch ging, saß diese exotische Gesellschaft wieder in sich abgeschlossen da, so wie sie Platz genommen, zwar ebenfalls mehlbestäubt und etwas derangiert, am meisten die neun Damen, aber doch immer wieder exklusiv, unnahbar.
»Wo und wann findet denn nun die nächste Vorstellung statt?«, fragte noch einmal die Patronin mit vernehmlicher Stimme, ehe sie den Balkon durch Eintritt in den Felsen wirklich verließ.
Sie tat es mit Rücksicht auf diese fremden Gäste, denen sich Merlin nicht beigesellt hatte.
Diese Rücksicht war eigentlich gar nicht angebracht. Wenn man sich um diese Gesellschaft, wie aufs dringendste gebeten worden war, nun einmal gar nicht kümmern sollte. Die Patronin war dennoch zu dieser Frage gedrängt worden, dass jene es noch hören konnten, womöglich auch die Antwort. Wegen der Mehlpuderung mit nachfolgendem Wasserregen, wodurch vielleicht manches kostbare Gewand für immer vernichtet worden war, verlor sie kein Wort, machte sich darüber überhaupt gar keine Gedanken, wie auch niemand anders hier, das war hier solch eine Kleinigkeit, das man überhaupt gar nicht daran dachte — aber jene Frage hatte die Patronin doch stellen müssen.
Es war niemand da, der sie beantworten konnte. Doch, einer, Doktor Isidor, der wusste, wo und wann die nächste Vorstellung stattfand.
»Jetzt sofort — an Bord des Schiffes im Speisesalon. Meister Kännchen wird seine Künste auf der Frühstückstafel vorführen.«
Das Lachen über diese treffende Antwort erklang schon nicht mehr auf dem Balkon. »Punkt zwölf Uhr beginnt eine neue Vorstellung im kleinen Zirkus.«
So war noch während der Frühstückstafel, für die man sich natürlich schon umgekleidet hatte, verkündet worden, und zur bestimmten Zeit saßen dieselben Personen auf den steinernen Bänken oder vielmehr Stufen des betreffenden Raumes.
Auch auf dieser Seite, auf der die Amazonen gehaust hatten, befand sich ein großer Felsenzirkus von denselben Dimensionen, wie man drüben ihn gefunden und benutzt hatte, außerdem aber noch ein kleinerer, bei dem der Durchmesser der tiefgelegten Manege nur etwa 22 Meter betrug, also den heutigen internationalen Manegedurchmesser immer noch um neun Meter übertreffend. Auch diese Manege hier konnte unter Wasser gesetzt werden, es war bereits geschehen, und auch sonst waren schon Vorbereitungen getroffen worden.
In der Mitte des Wassers erhob sich eine Insel — eine Badeinsel, wollen wir gleich sagen. Daran zwei Bretterhäuschen, ein größeres als Unterkunft des Bademeisters mit seinen nötigen Utensilien, ein kleineres als Aus- und Ankleidezelle. Dann eine ins Wasser führende Treppe, ein Sprungbrett, eine Barriere, ein paar eingerammte Stangen, zwischen denen Leinen gespannt waren, an denen Badehosen und Handtücher trockneten, und noch einiges mehr, was sonst noch zur Szenerie solch einer Badeinsel gehört.
Mit dem Lande verbunden war sie durch eine schmale, hochaufgelegte Brücke, welche in eine Öffnung der Felsenwand mündete. Das heißt, wenn man dabei an den Zirkus denkt. Denn auch dieser hatte auf der einen Seite so eine glatte Wand, die dicht bis an die Manege heranging. Jetzt war dieser Aus- und Eingang für die auftretenden Artisten hübsch mit Schilf dekoriert, sodass es aussah, als ob die Brücke von der Badeinsel eben an ein felsiges, aber grünes Ufer führe.
Die kommenden Herrschaften wurden angewiesen, sich so zu setzen, dass sie gerade in die Badezelle, wenn deren Tür offen war, hineinblicken konnten. Dies muss erwähnt werden, sonst nichts weiter. So hatten sich auch alle anderen gesetzt, alle die Matrosen und Heizer und Schiffsjungen, nur mehr oben auf die Stufen des Amphitheaters. So hatte man auch die Treppe und das Sprungbrett vor sich, die Brücke führte seitwärts nach dem Lande, man konnte unter ihr wegsehen.
Übrigens konnte, muss doch noch bemerkt werden, jeder auch um die ganze Manege herumgehen, sich die Badeinsel von hinten betrachten, von allen Seiten. Wenn ihm nicht sein eigener Scharfsinn die Erklärung für die rätselhaften Vorgänge der nachfolgenden Pantomime gab, auf diese Weise, indem er um die Manege herumging, fand der Wahrheitssucher sie sicher nicht. Dann aber entgingen ihm die haarsträubenden Szenen, die sich vor den beiden Häuschen zu Wasser und zu Lande abspielten.
Es war nicht die erste Wasserpantomime, die hier in diesem kleinen Zirkus aufgeführt wurde.
»Weshalb ist denn heute das Wasser so dunkel, ganz undurchsichtig?«, wurde denn auch sofort von verschiedenen Seiten gefragt.
Denn das hereinfließende Wasser, aus einem Felsenreservoir kommend, zeichnete sich durch außerordentliche Klarheit aus. Dazu kam nun der hellgelbe Grund von jenem Bernsteingummi, der auch hier gelegt war, so konnte man immer, wenn das Wasser nicht gar zu sehr aufgeregt war, bis auf den Boden des bei mittlerer Höhe zwei Meter tiefen Bassins blicken.
Man hatte auf diese durchsichtige Klarheit des Wassers noch gar nicht weiter geachtet, hielt sie eben für ganz selbstverständlich, und so fiel es nur umso mehr auf, dass diesmal das Wasser ganz undurchsichtig, direkt schwarz war.
Nun, man hatte diesmal eben das Wasser mit Absicht undurchsichtig gemacht, was mit einer Sepia ähnlichen Flüssigkeit, nur in geringer Menge zugesetzt, leicht zu erreichen war, und das würde schon seinen später erkennbaren Zweck haben.
Da, wie sich das »Publikum« schon geordnet hatte, was bei diesen Bordgästen natürlich mit militärischer Raschheit vor sich ging, erschien seitwärts auf einer der oberen Stufen wieder Merlin, und hinter ihm in einem größeren Eingange tauchten auch schon wieder die orientalischen schimmernden und funkelnden Kostüme auf.
Schnell ging Georg dem gelben Ledermanne entgegen.
»Als verantwortlicher Leiter all dieser Spiele bitte ich um Entschuldigung, dass vorhin den Kleidern Deiner Gäste übel mitgespielt wurde, besonders durch die Mehlbombe. Ich war über den Inhalt der einzelnen Bomben nicht weiter orientiert, konnte es dann nicht mehr verhindern... so etwas wird in Zukunft nicht wieder vorkommen.«
Ja, jetzt war diese Entschuldigung allerdings angebracht, wenigstens eben vom verantwortlichen Leiter all dieser Vorstellungen.
Aber der jugendfrische Greis gab ebenfalls die hier einzig angebrachte Antwort, zunächst in Form einer Gegenfrage.
»Haben sich Deine Freunde und Freundinnen über den Mehlstaub beschwert?«
»O nein, die nicht«, lachte Georg, »die hätten auch noch etwas ganz anderes vertragen...«
»Dann bitte ich Dich, auf meine Gäste keine Rücksicht zu nehmen, oder es ist ihnen nicht möglich, Euren Vorstellungen fernerhin beizuwohnen, denn sie würden ihre Gegenwart als störend empfinden.«
»Na gut, also es wird auch fernerhin durchaus keine Rücksicht auf sie genommen werden. Übrigens kommt so etwas auch nur selten vor, bei dieser Pantomime hier braucht das Publikum auch gar nicht mitzuspielen. Dagegen muss ich Dich vorher auf eines aufmerksam machen. Bei dieser Pantomime jetzt spielt die Hauptrolle eine Entkleidungsszene. Die ganze Pantomime ist überhaupt nur eine einzige Aus und Ankleideszene. Und unter Deinen Gästen sind viele Damen...«
»Und unter Euch doch ebenfalls. Ich verstehe, weshalb Du mich darauf aufmerksam machst. Nein, auch hierauf brauchst Du keine Rücksicht zu nehmen, und es sind überhaupt Orientalinnen, Inderinnen.«
Georg wusste, was hiermit gemeint war. Weil er ein Seemann war.
Wer den Menschen nicht sehen kann, wie ihn der liebe Gott geschaffen hat, der darf keine größere Reise nach dem Süden machen, noch weniger eine Reise um die Erde, oder er mag sich nur immer in seine Kabine einschließen, die Bullaugen gedichtet. Dann freilich wird er ja von seiner Reise nicht viel erzählen können. Schon in Madeira, ja schon in Lissabon fängt es an, wenn die portugiesischen Fischerjünglinge das Passagierschiff umschwimmen, darauf wartend, dass kleine Münzen ins Meer geworfen werden, nach denen sie tauchen, wobei sie auch jede Badehose als hinderlich betrachten, und je weiter südlich nach Osten oder Westen, desto loser wird das Gewand des Menschen, desto öfter wirft er es bei jeder Gelegenheit ab. Wer sich also hieran stößt, der soll lieber zu Hause bleiben. Freilich gesteht er hiermit auch ein, wie faul es mit seiner eigenen Moral und Sittlichkeit beschaffen ist.
Auch die exotischen Geister waren platziert worden, zwischen den Exklusiven und der Mannschaft der »Argos«. Es waren wieder dieselben, diesmal aber war noch Viviana hinzugekommen, ebenfalls in einem orientalischen Prachtgewand, und auch Merlin ließ sich auf einer Steinstufe nieder.
Ein Glockenzeichen erscholl, und der Waffenmeister, zwischen den anderen sitzend, erhob seine Stimme:
»Der rätselhafte geheimnisvolle und unheimliche Badegast. Oder: wie sich der Teufel einmal baden will. Eine stumme Pantomime, in Szene gesetzt und ausgeführt vom Matrosen Hahn.«
Ahaaaa! Durch die Reihen all der Matrosen und Heizer ging gleich eine lebhafte Bewegung. Einesteils wegen des vielversprechenden Titels, und dann wohl vor allen Dingen, weil »unser« Hahn derjenige war, welcher. Was man vorher eben absolut nicht wusste. Der Leser erinnert sich seiner noch, des in der kaiserlichen Marine wegen verschiedener Bravourstückchen mehrfach dekorierten Matrosen, der aber alle seine Orden irgendwo in der Welt versetzt hatte — oder versoffen, wollen wir lieber gleich sagen, dieses Matrosen, der ganz ausnahmsweise bei seinem Vatersnamen gerufen wurde, weils eben ein Hahn war. Aber nicht nur ein einfacher Hahn, irgend ein Hahn, sondern es war »unser Hahn«.
Er schien mit dem Segelmacher große Charakterähnlichkeit zu besitzen. Nämlich insofern, als auch der Kopf dieses Matrosen voll lauter Dummheiten steckte. Aber diese Ähnlichkeit war eine nur scheinbare, sonst waren es zwei total verschiedene Charaktere. Die beiden waren auch keine besonderen Freunde. Das heißt, Kameraden wohl, etwas anderes gab es auf diesem Schiffe nicht, aber keine speziellen Freunde, was sonst doch wohl der Fall gewesen wäre, wenn sie sich im Charakter so geglichen hätten. Hahn war ein total verlumpter Mensch, den man nicht mit fünf Groschen nach der Post schicken durfte. Nicht etwa ein schlechter Mensch — dann hinterher weinte er wie ein Kind — eben ein für diese Welt verlorener Mensch, wie es unter den Seeleuten so viele, ach so viele gibt! Ein Glück, dass es ein Meer und Schiffe gibt.
Da war Oskar der Segelmacher ja nun freilich ein ganz anderer Kerl, der brauchte keine ständige Aufsicht, der wusste Recht und Unrecht zu unterscheiden, dem konnte man alles anvertrauen, ein so genialer Liedrian er auch sonst sein mochte. Die größte Ähnlichkeit zwischen den beiden bestand darin, dass auch Hahn ein verlorener Sohn war, und zwar aus einer Familie stammend, die sich ebenfalls niemals hätte träumen lassen, dass eines ihrer Mitglieder dereinst als Seemann in aller Welt Ruhm und Ehren und — Verachtung ernten würde. Er war der Sohn eines Strumpfwarenfabrikanten tief drin im Binnenlande. Und dann vor allen Dingen war Hahn ein ganz ausgezeichneter Schwimmer. Wenn er sich auch nicht gerade mit Oskar messen konnte. Dafür aber war er an Bord der »Argos« der beste Taucher. Er musste eine ganz besonders beschaffene Lunge haben, konnte fast zwei Minuten unter Wasser aushalten und dabei auch noch die verschiedensten Kunststückchen ausführen. —
Die Vorstellung begann, ohne ein weiteres Zeichen. Die Tür des größeren Bretterhäuschens öffnete sich, ein Mann in weißer Hose und Hemd trat heraus. Das war aber nicht Hahn, sondern diese kolossale Gestalt konnte nur August dem Starken angehören, er hatte sich auch gar nicht weiter zu verändern gesucht.
Er spielte den Bademeister. Hatte wohl geschlafen, gähnte und dehnte sich, begann Wäsche aufzuhängen und abzunehmen, nahm dazwischen immer einmal einen Schluck aus der Pulle.
Eine an dem Hause angebrachte Klingel schellte. Ehe die Brücke das Schilfland erreichte, war noch eine kleine Gittertür angebracht, von ihr führte ein Draht nach dieser Klingel, wenn das Türchen geöffnet wurde, läutete die Klingel. Das war nun der Hahn, der dieses Türchen geöffnet hatte und jetzt über die Brücke schritt! Das erkannten die Kameraden doch gleich an seinem Gange, an seinen ganzen Bewegungen. Wenn er sich auch sonst unkenntlich gemacht hatte.
Sonst bartlos, trug er jetzt einen schwarzen Knebelbart, mit ganz steif ausgedrehten Spitzen — und das veränderte sich auch im Wasser nicht — außerdem über dem linken Auge eine schwarze Binde. Ein höchst eleganter, wenn auch sehr auffallender Sommeranzug. Schwarz und weiß gestreifte Beinkleider, rote Seidenjacke, gelbes Seidenhemd mit blauen Blümchen, grüner Schlips, schwarze Schärpe, Panamahut mit grünem Band, ausgeschnittene Lackschuhe mit bunten, durchbrochenen Seidenstrümpfen.
Unverkennbar ein Dandy, ein nordamerikanischer Stutzer! Das sah dieses weltgereiste Publikum doch sofort.
Der Bademeister bekomplimentiert den vornehmen Herrn, der die Insel betreten hat.
Wünschen Sie zu baden?
Ja.
Bitte sehr. Es muss aber im voraus bezahlt werden. Das heißt, es wurde nicht gesprochen, es war ja eine Pantomime, wobei das Eigenschaftswort »stumme« ganz überflüssig ist.
Die beiden hätten recht gut sprechen können, auch als Schauspieler. Aber die Pantomime hat ihre Vorteile, es muss alles durch lebhafte Gesten ausgedrückt werden, alles ist in ständiger, lebhafter Bewegung. Der dicke Bademeister komplimentiert noch mehr, wie er ein Silberstück bekommt, wie es eine solche ungeheure Silbermünze überhaupt in der ganzen Welt nicht gibt! Theatralischer Effekt. Da verschwindet ein Taler oder Dollar doch ganz.
Bitte, hier ist die Auskleidezelle.
Der Badegast betritt sie, entkleidet sich ungeniert bei offener Tür. Jacke aus, Hose aus, Hemd ab, alles mit jener Fixigkeit, die man bei Artisten findet — und bei Seeleuten — alles wird aufgehängt, und der Mann steht in einem ballroten Trikot-Badekostüm da, die Brust mit einem großen, schwarzen Teufelskopf geschmückt, gehörnt, zum Munde hängt die rote Zunge heraus.
Außerdem trägt der Entkleidete am linken Handgelenk noch ein auffallendes Armband und am rechten Fußgelenk ebenfalls einen großen, goldenen, mit blitzenden Steinen besetzten Ring, den man schon vorher über dem Lackschuh auf dem Seidenstrumpfe gesehen hat.
Nun ist ja erst recht erwiesen, dass es ein nordamerikanischer Dandy ist. Das Tragen von kostbaren Fußringen war damals bei diesen Fatzken allgemein üblich, zum Teil auch heute noch. Heute sind es vor allen Dingen die Damen, welche ihre Verlobungsringe am Fußgelenk tragen, mit Sicherheitsschloss versehen, den Schlüssel dazu hat der Bräutigam in der Westentasche. Mag sehr nötig sein.
Der Herr ist fertig, tritt heraus, schließt hinter sich die Tür der Zelle (!), kühlt sich ab, greift sich unter die Arme.
Unterdessen hat sich auch der Bademeister zu beschäftigen gewusst, dabei immer einmal einen Schluck aus der Buttel nehmend. Nicht zwecklos für die Pantomime! Bei solch einer Pantomime darf es überhaupt keine einzige unnötige Bewegung geben. Dieses Schnapstrinken geschieht immer heimlich, mit einem scheuen Blick nach einem etwaigen Beobachter.
Jetzt bewundert der Bademeister zunächst das Kostüm des Herrn.
Was ist denn das für ein Teufelskopf drauf?
Nun, das ist eben ein modernes Badekostüm, nach meinem Geschmack gefertigt. Jetzt werde ich ins Wasser gehen.
Können Sie schwimmen?
Ei gewiss doch!
Sonst ist diese Seite für Nichtschwimmer.
Ohne Sorge, ich kann schwimmen
Und der rote Teufel nimmt einen Anlauf, geht mit einem eleganten Kopfsturz — einem »Aufsatz« — vom Sprungbrett ab.
Diesen Augenblick, den der Mann unter Wasser verbringt, benutzt der Bademeister zu einem noch recht tüchtigen Zug aus der Buttel.
Immer noch nicht oben? Na dann schnell noch einen. Das heißt, jetzt fängt der Bademeister zu stutzen an.
Der Kerl taucht nicht wieder auf.
Die Zeit vergeht unter dem Spähen des Bademeisters nach allen Seiten, der Kerl kommt nicht wieder zum Vorschein, und der Bademeister kriegt es mit der Angst zu tun. Er nimmt eine Stange und stochert im Wasser herum. Aber wie er auch stochert, er bringt den Verschwundenen nicht wieder zum Vorschein, und es nützt nichts, dass er den Haken durch seine mächtige Harpune ersetzt, er kann den auf dem Grunde Liegenden nicht anspießen.
Es ist ein guter Mensch, der Bademeister, nimmt es sich furchtbar zu Herzen, oder vielleicht kann er auch seine Stellung verlieren — er ergibt sich dem stillen Suff.
Da, wie er verzweiflungsvoll dasitzt und aus der Buttel lutscht, schellt wieder die Klingel.
Also es kommt jemand.
Der Bademeister steht auf, um nachzusehen.
Und da wird der Bademeister von der Starrsucht befallen, er reißt die Augen auf.
Ach, und wie nun der in seinem Kürbisgesicht die Augen aufzureißen verstand! Und wie er dazu das Maul aufsperrte!
Es hatte schon vorher unter dem Publikum manchmal gewiehert, jetzt fingen aber auch die exotischer Gäste, sogar die vier würdevollen Radschas zu wiehern und zu grunzen an. Weil sie noch nicht richtig lachen wollten.
Der Bademeister hatte ja auch allen Grund, Augen und Maul so aufzureißen.
Denn da kommt über die Brücke ein Dandy geschritten, in schwarz und weißgestreifter Hose und roter Seidenjacke, mit schwarzem Knebelbart und schwarzer Binde über dem linken Auge... na, kurz und gut, derselbe!
Kann ich hier ein Bad nehmen?
Ach, dieser Bademeister! Er spielte eigentlich die Hauptrolle. Was dieser ehemalige Bäckergeselle für ein gottbegnadeter Schauspieler war, das ist ja schon früher gesagt worden. Er musste ja auch in jenem großen »Argonautenschauspiele« eine der Hauptrollen spielen, da mimte er die Kaiserin-Mutter von China!
Und nun jetzt als Bademeister!
Dass dieser riesenstarke Fleischkoloss wie aus Gummi zusammengesetzt war, wurde ja ebenfalls schon wiederholt gesagt.
Und wie der nun jetzt dastand, vorgebeugt, den Hals wie eine Schildkröte vorreckend, das Maul sperrangelweit aufgerissen...
Die exotischen Gäste waren auch für solche theatralische Komik empfänglich. Das leise Wiehern und Grunzen der vier würdevollen Radschas verwandelte sich plötzlich in ein lautes Brüllen.
Doch weiter!
Kann ich hier ein Bad nehmen?
Da der Bademeister keine Antwort gibt, den Doppelgänger immer nur anstarrt, steckt ihm dieser das große Silberstück in den aufgerissenen Rachen.
Da rafft sich der Bademeister auf, zuckt die Achseln, führt den Herrn nach der Zelle.
Wie er deren Tür geöffnet hat, prallt er zurück, blickt wieder und wieder hinein und ist wieder ganz Starren.
Denn in der Zelle sind — wie auch das Publikum deutlich sieht — keine Sachen mehr. Die Kleider des ersten Badegastes sind daraus verschwunden. Na, der neue weiß nichts davon, weiß nicht, weshalb der Bademeister so starrt und staunt, er zieht sich aus. Und steht wieder in einem roten Trikotkostüm mit schwarzem Teufelskopfe da, mit Armband und Fußreif.
Während dieser Entkleidungsszene hat der Bademeister immer regungslos dagestanden, in einiger Entfernung von der Zelle, immer nach dieser schielend.
Ach, und wie nun August der Starke dastand und schielen konnte!
Also der rote Teufel tritt heraus, kühlt sich ab, immer mit ganz genau denselben Bewegungen wie vorhin, so hat er auch jedes einzelne Kleidungsstück ausgezogen und hingehängt, nur dass jetzt keine weitere Unterredung mit dem Bademeister stattfindet, sondern der rote Teufel geht gleich mit einem eleganten Kopfsturz vom Sprungbrette ab.
Der Bademeister hat ihm nachgeschielt, jetzt schleicht er hin an die Barriere, blickt scheu und schielend ins Wasser.
Der Hineingesprungene taucht nicht wieder auf. Scheu nimmt der Bademeister wieder die Stange und stochert in dem Wasser herum, aber ganz anders als vorhin, so scheu.
Ebenso scheu schleicht er dann nach der Zelle, öffnet sie. Da hängen keine Kleider mehr drin.
Der Bademeister betastet seinen Kopf und... greift ganz folgerichtig zur Buttel.
Wie er noch so tiefsinnig dasteht und trant und trinkt, läutet die Glocke.
Langsam und scheu wendet der Bademeister den Kopf und... scheint sich gar nicht so sehr zu wundern, wie da der dritte Dandy mit schwarz und weiß karierter Hose und roter Jacke und schwarzer Augenbinde über die Brücke kommt.
Kann ich hier ein Bad nehmen?
Der Bademeister antwortet nicht, hält einfach die Hand hin, nimmt die große Silbermünze, lässt sie auch wieder in seiner Tasche verschwinden.
Aber nun dieses Gesicht dabei! Doch das lässt sich ja nicht beschreiben, schon eher, wie der Bademeister diesmal dem Dandy beim Auskleiden behilflich ist.
Oder nicht eigentlich behilflich. Sondern auf jedes Kleidungsstück, das der Dandy ablegt, stürzt er sich, hascht es wie eine Fliege weg, hängt es nicht auf, sondern klemmt es sich unter die Arme.
Der Dandy blickt ihn groß an.
Sind Sie verrückt?!
Dem Bademeister ist es ganz egal, was jener von ihm denkt, der hascht weiter nach den abgelegten Kleidungsstücken, reißt sie dem Dandy schnell aus den Fingern, jeden Schuh und jeden Strumpf, klemmt ihn sich unter die Arme, alles fest an den Leib pressend.
Wieder das rote Trikot mit Teufelskopf, Armband und Fußring.
Wieder das Abkühlen.
Diesmal aber kommt der rote Teufel nicht zum Sprung, nur zum Anlauf. Der Bademeister hat neben Barriere und Sprungbrett die Kleidersachen zu Boden fallen lassen, stemmt fürsorglich seinen Fuß darauf, so nimmt er von der Barriere eine Leine, oder gleich zwei, und wie der rote Teufel an ihm vorbei läuft, um den Kopfsprung zu machen, fängt er ihn weg.
Was haben Sie denn?! Was ist denn los?
Der Bademeister gibt keine Antwort, auch nicht pantomimisch sondern er schnallt ihm einfach den Gürtel um, nimmt ihn an die Leine, und nicht nur um den Leib, sondern legt ihm eine zweite Schlinge auch nach um den Hals.
Mensch, sind Sie denn verrückt?!
Du darfst nur mit der Leine ins Wasser, weiß der Bademeister sich jetzt auszudrücken, auch springen darfst Du nicht, musst auf der Treppe hinabsteigen, Dein Kopf darf nicht unter Wasser kommen, deshalb noch diese zweite Leine.
Aber ich kann doch schwimmen!
Ist mir ganz egal — Du kommst nur an dieser doppelten Leine und nur auf der Treppe ins Wasser!
Der Badegast fügt sich endlich achselzuckend, steigt hinein, schwimmt etwas herum, will einmal tauchen, aber der Bademeister erlaubt es ihm nicht, hält ihn mit der um den Hals gelegten Schlinge hoch, und dabei achtet er sorgsam immer auch darauf, dass sein Fuß noch auf den sämtlichen Kleidersachen steht.
Der Rote kommt wieder heraus, der Bademeister nimmt ihn in Empfang, hüllt ihn sofort in ein Badelaken, reibt ihn ab, ihn immer festhaltend, dann gibt er ihm sein Hemd, will nichts davon wissen, dass sich jener erst des nassen Badekostüms entledigen will — vorwärts, anziehen! — so reicht er ihm ein Stück nach dem anderen, ihn dabei auch immer noch festhaltend, und wie der Dandy den letzten Lackschuh zubindet, stülpt er ihm den Panamahut auf den Kopf, schiebt ihn nach der Brücke, macht ein höfliches Kompliment, und wie der Dandy kopfschüttelnd und gegen seine Stirn klopfend über die Brücke schreitet und jenseits zwischen dem Schilfe verschwindet, kehrt der Bademeister tiefatmend und hoch befriedigt zurück.
So richtig ist ihm freilich noch nicht zumute.
Erst, sucht er einmal ausgiebige Beruhigung in dem Inhalt seiner Buttel.
Dann fängt er über den Fall nachzusinnen an, immer einmal einen Schluck nehmend.
Er sieht auch noch einmal in die Zelle hinein, in der natürlich keine Kleider hängen, überzeugt sich noch einmal von ihrem Nichtvorhandensein durch komisches Hineintasten.
Dadurch kommt er auf die Idee, auch einmal in die Tasche zu greifen, in die er immer die Silbermünzen gesteckt hat.
Aber wie er auch sucht, er bringt nur eine zum Vorschein. Und es müssen doch, er braucht dazu gar nicht lange an den Fingern zu zählen, eigentlich drei sein.
Und da endlich kommt ihm die Erkenntnis! Er hat das von den drei Doppelgängern, also eigentlich Triplegängern, muss man da wohl sagen — hast das alles nur geträumt!
Nur der letzte Badegast war eine reelle Figur gewesen! Die Erscheinungen der beiden ganz ähnlichen Vorgänger hat er nur geträumt.
Allerdings sehr merkwürdig, denn das hätte er dann doch im voraus träumen müssen, es wären also sogenannte Wahrträume gewesen, aber das ist doch solch einem Bademeister wie diesem ganz egal, zumal wenn er die Buttel so liebt.
Jedenfalls hat er nun eine Erklärung für den ganzen Vorgang gefunden, das sieht man ihm gleich an, besonders wie hochbefriedigt er hierüber ist.
Nun weiß er aber auch, woher ihm diese unheimlichen Visionen gekommen sind.
Der Schnaps ist daran schuld.

Er hat einfach schon ein bisschen das Delirium.
Und da ergreift ihn ein Abscheu gegen sich selbst und eine furchtbare Wut gegen die Schnapsflasche, er nimmt sie hier, eine ganz tüchtige Kruke, hebt sie, um sie ins Wasser zu schleudern, holt noch weiter aus und trinkt erst noch einmal aus ihr — eigentlich schade, schade, dass noch so viel drin ist — aber das hilft nun alles nichts — er setzt seinen Entschluss mit eiserner Energie durch, holt aus zum Wurfe und... besinnt sich doch noch einmal, nimmt erst noch einen tüchtigen, tüchtigen Zug — so, nun aber fliegt die Buttel über die Barriere ins Wasser hinein! Und da, wie die Flasche versinkt — da plötzlich taucht an dieser selben Stelle pustend ein Menschenkopf auf, geschmückt mit schwarzem Knebelbart, um das linke Auge eine schwarze Binde, der obere Teil eines roten Trikots folgt nach, mit kräftigen Stößen schwimmt der Mann nach der Treppe, und an seinem linken Handgelenk sieht man ein kostbares Armband funkeln!
Ach, und nun dieser Bademeister, dieser August der Starke!
Wie der langsam seinen Gummihals vorreckt, immer weiter und weiter, mit diesem Gesicht, mit diesen Augen, wie er dabei langsam in die Kniebeuge geht und immer mehr mit den Knien zu schlottern anfängt!
Und so beobachtet er auch den roten Mann weiter. Der hat die Treppe erstiegen, nimmt, ohne sich um den Bademeister zu kümmern, ein bereithängendes Badelaken, hüllt sich darin ein, betritt die Zelle, deren Tür immer offen gestanden hat, jetzt schließt er sie hinter sich.
Einige Minuten weiß der Bademeister vollkommen auszufüllen. Wenn er auch nichts weiter tut, als dass er ruhig dasteht, etwas gebückt, sein Hinterteil dem Publikum halb zugekehrt — und nun was für ein Hinterteil — und nach der Badezelle blickt, ohne noch mit den Knien zu zittern. Dafür wendet er jetzt manchmal das Gesicht nach dem Publikum, und nun was für ein Gesicht! Dieses Mienenspiel, diese Augen, dieses offene Maul!
»Ach, das ist ja zum Brüllen!«, stöhnte Kapitän Martin, sich immer die Tränen aus den Augen wischend. Und da plötzlich macht der dicke Bademeister einen Satz wie ein Frosch aber nach rückwärts. Denn da öffnet sich die Zellentür, der Dandy tritt heraus, vollkommen angezogen, er lüftet vor dem entsetzten Bademeister, der immer noch in der Kniebeuge steht, jetzt aber auch wieder mit den Beinen zu schlottern anfängt den Panama, schreitet über die Brücke, verschwindet am schilfigen Ufer.
Der Bademeister richtet sich langsam auf.
Jetzt gibt es nur eins für ihn.
Er geht ziemlich gefasst in sein Häuschen, kommt mit einer Geneverkruke zurück, entkorkt sie und ergibt sich wieder dem Suff.
Da, wie er die Buttel zum dritten Male an den Mund führt, nahe der Barriere stehend, hält er in der Bewegung plötzlich inne, erstarrt, reckt wieder den Gummihals vor und geht wieder in die Kniebeuge.
Denn da taucht genau an der vorigen Stelle, in gerader Linie mit dem Sprungsbrett, im Wasser wieder ein pustender Kopf mit schwarzem Knebelbart und schwarzer Augenbinde auf, natürlich fehlt auch das Armband nicht, so schwimmt der Mann nach der Treppe, ersteigt sie, nimmt ein Badelaken, geht nach der Zelle, deren Tür offen steht, wirft das von seinem Vorgänger zurückgelassene Badetuch heraus, schließt hinter sich die Tür.
Der erste Teil dieser dritten gleichartigen Szene ist genau so wie der erste Teil der vorhergehenden Szene. Nur dass der Bademeister gleich mit einem Ruck in die Kniebeuge gegangen ist und nicht so mit den Beinen geschlottert hat.
Und jetzt, wie sich die Zellentür geschlossen hat, bleibt er auch nicht mehr ruhig stehen, sondern er schleicht hin, hebt das herausgeworfene Badelaken auf, betastet es, ebenso auch dasjenige, welches der erste gebraucht hat, und da scheint dem Bademeister nach und nach das Verständnis aufzudämmern, er greift in die Tasche und bringt daraus richtig drei Dollars zum Vorschein.
Na, nun ist ihm vollends alles klar! Er hat vorhin doch nicht nur geträumt. Drei Badegäste sind ins Wasser gegangen, drei sind wieder herausgekommen. Denn er hat doch auch die drei Dollars in der Tasche.
Dass sich diese drei Herren so ähnlich sehen, und wo die ersten beiden unterdessen so lange im Wasser geblieben sind, das ist diesem Bademeister ja ganz egal, darüber macht er sich weiter keine Kopfschmerzen. Die Hauptsache ist, dass er in der Hand die drei Dollars hat, die er immer wieder zählen kann, das ist ihm ein vollgültiger Beweis, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist.
Also wie nun die Zellentür zum dritten Male aufgeht und der dritte Dandy in schwarz und weiß karierter Hose und roter Seidenjacke heraustritt und beim Weggehen vor dem Bademeister den Panama lüftet, da macht dieser ebenfalls eine höfliche Verbeugung und komplimentiert jenen weiter bis zur Brücke. So, nun ist die Sache in Ordnung. Drei sind gekommen, drei sind gegangen. Ganz gefasst kehrt der Bademeister zurück, hängt die nassen Laken auf.
Da, wie er wieder einmal an der Barriere steht, wird er abermals von starrem Entsetzen befallen.
Denn da taucht an jener selben Stelle pustend der vierte Kopf auf mit schwarzem Knebelbart und schwarzer Augenbinde.
Diesmal aber wartet der Bademeister nicht ab, bis jener schwimmend die Treppe erreicht hat.
Nur einmal noch zählt er an den Fingern schnell oder auch bedachtsam bis vier, und dann macht er einen Satz und liegt hinter seinem Häuschen platt auf dem Bauche.
Und so versteckt beobachtet er, wie der vierte rote Mann aus dem Wasser steigt, ein Badelaken nimmt, sich darin einhüllt und die völlig leere Zelle betritt, die Türe hinter sich schließend.
Es genügt vollkommen, dass der Bademeister hinter dem Häuschen auf dem Bauche liegt und so darauf wartet, ob auch dieser vierte Kerl wieder angezogen aus der Zelle kommt.
Denn diese Gesichter, diese Augen, diese Halsverrenkungen! Und schließlich wie er manchmal auch an den Fingern bis vier zählt!
Das Publikum wälzte sich vor Lachen, in fast buchstäblichem Sinne dieses Wortes. Und richtig, auch der vierte Teufel hat in der leeren Zelle Kleider zu finden gewusst, er tritt angezogen heraus, lüftet, ohne jemanden zu sehen, den Panama und verlässt die Insel.
Der Bademeister ist auf dem Bauche etwas nachgerutscht, um ihn auch noch über die Brücke schreiten zu sehen.
Dann erhebt er sich.
Ganz gelassen.
Er will sich nur erst überzeugen, ob er sich nicht geirrt, nicht verrechnet hat.
Also er zählt erst seine drei Dollars, dann zählt er die nassen Badetücher und bringt es da bis auf vier. Nun fängt er auch noch an den Fingern zu zählen an, das liegt ihm besser.
Und wie er da, wieder an der Barriere stehend, bis zum vierten Finger gekommen ist, während die drei Dollars vor ihm auf dem breiten Barrierenrand liegen — da taucht plötzlich an jener Stelle abermals pustend ein Kopf auf mit schwarzem Knebelbart und schwarzer Augenbinde, am linken Handgelenk das Armband, wie die anderen auch immer am rechten Fuß den Ring trugen.
Diesmal aber ist das Verhalten des Bademeisters ein ganz, ganz anderes.
Weit ausholend, konstatiert er an seinem fünften Finger, dass dies der fünfte ist, der da auftaucht, während vor ihm nur drei Dollars liegen. Zu dieser Berechnung hat er auch Zeit, denn diesmal schwimmt und plätschert der rote Teufel erst etwas herum.
Und dann, wie der Bademeister seiner Rechnung sicher ist, verschränkt er die Arme über der Brust und schaut dem Schwimmer zu, mit ganz ruhigem Gesicht, das nur ein klein wenig finster ist — es malt sich darin ein fester Entschluss aus, wollen wir sagen, der mit aller Energie auch ausgeführt werden soll.
Doch gar nicht lange, so ersteigt der rote Mann die Treppe.
Ruhig, die Arme verschränkt, den Bauch hervorgereckt, betrachtet ihn der gewaltige Bademeister mit seinen zum Tode entschlossenen Augen.
In dem Augenblick aber, da der rote Teufel an ihm vorüberschreiten will, macht der Bademeister plötzlich einen Satz, packt den Kerl um den Leib und schmeißt ihn über die Barriere wieder ins Wasser hinein.
Der so Behandelte taucht wieder auf.
Mensch, bist Du denn verrückt?! Was fällt Dir denn ein?!
So weiß er durch Gesten zu fragen.
Der Bademeister aber gibt keine Antwort, ruhig steht er an seiner alten Stelle, die Arme verschränkt, den Bauch hervorgereckt, betrachtet mit finster entschlossenem Gesicht den Schwimmenden und Fragenden.
Na, der ersteigt zum zweiten Male die Treppe, will nach seiner Zelle gehen, kommt aber nicht weiter, als bis er den Bademeister passieren muss — da stürzt dieser abermals blitzschnell auf ihn zu, packt ihn um den Leib, schmeißt ihn zum zweiten Male über die Barriere ins Wasser, dass alles nur so knallt!
Mensch, bist Du denn wahnsinnig geworden?! Was soll denn das heißen?!
Diesmal gibt der Bademeister eine Antwort.
Is nich, is nich, Du kommst nicht wieder herauf, an bleibst im Wasser!
So hört man ihn ganz deutlich sprechen, wenn er dies auch nur durch Handbewegungen, durch abwehrendes Schütteln der Hand ausdrückt.
Und dann kümmert er sich nicht weiter um den Schwimmenden, dreht sich um, hängt die nassen Bademäntel auf.
Na, der Dandy muss es zum dritten Male versuchen, das Trockene zu erreichen, auf der Treppe. Eine andere Gelegenheit, die ziemlich hohe Insel zu erklettern, gibt es nicht.
Also er tut es, ist sehr vorsichtig dabei, klimmt auf allen Vieren die Treppe empor, immer spähend, ob ihn der Bademeister beobachtet.
Nein, das tut der nicht. Er dreht jenem den Rücken zu. Aber dieser Bademeister muss wohl auch hinten am Kopfe Augen haben.
Denn in dem Augenblick, wie der rote Teufel richtig oben steht, sich eben aufrichtet, um mit einem Sprunge die Zelle zu erreichen, dreht sich der Bademeister blitzschnell um, hat den Kerl wiederum um den Leib gepackt und schmeißt ihn zum dritten Male über die Barriere ins Wasser!
Und diesmal lässt er es nicht hierbei bewenden, sondern er nimmt schnell eine andere Stange, eine, die vorn eine große Gabel mit runder Ausbuchtung hat, und wie der Schwimmer wieder auftaucht, setzt er ihm schnell diese Gabel in den Nacken, die passt gerade so hübsch über den Hals, drückt den Kopf tief unters Wasser, sehr tief.
So, der Herr Bademeister hat Zeit. Die Stange in beiden Händen, sieht er gelassen zu, wie dort immer Luftblasen emporquellen. Der Mann muss so tief hinabgedrückt worden sein, dass er mit den Händen schon nicht mehr die Oberfläche erreichen kann.
Doch, oder er hat die Gabel etwas gehoben — da taucht aus dem Wasser eine Hand auf, greift mit den Fingern wild um sich. Es ist die linke Hand, denn man sieht das Armband.
Das hätte ja nichts zu sagen, dadurch würde der Mann unter Wasser auch nicht vom Tode errettet werden, aber das passt dem Bademeister nicht, er mag von dem teuflischen Kerl, der ihn so veralbert hat, überhaupt gar nichts mehr sehen, und er weiß sich zu helfen, nimmt schnell, natürlich ohne die erste loszulassen, eine zweite Stange mit ebensolcher Gabel, nur etwas kleiner, titscht mit ihr auch diese Hand unters Wasser. Da taucht etwas mehr nach vorn ein Bein auf, oder doch ein Fuß, aber auch das Unterbein kommt mit heraus, es ist der rechte Fuß, man sieht den Fußring, strampelt — da lässt der Bademeister mit der zweiten Stange die Hand los und titscht dafür diesen Fuß unter.
Da kommt wieder die rechte Hand zum Vorschein — der Bademeister lässt den Fuß los und titscht die Hand unter.
Der rechte Fuß taucht wieder auf — wird untergetitscht.
Und so geht das noch mehrmals. Es ist immer nur der linke Arm oder der rechte Fuß, die abwechselnd auftaucht und vom Bademeister mit der kleineren Stange immer prompt untergetitscht wird.
Bis zuletzt nichts mehr erscheint, und der Bademeister merkt wohl, dass auch nichts mehr in der großen Gabel hängt, er zieht sie zurück, wartet noch einige Zeit lauernd, immer mit der Stange bereit, wieder unterzutitschen — bis er sich endlich seiner Sache sicher ist.
Gott sei Dank, der Kerl ist ersoffen, ist mausetot!
Dass dieser Teufel schon früher so lange unter Wasser geblieben ist, ohne seinen Tod gefunden zu haben, daran denkt dieser versoffene Bademeister natürlich nicht.
Wenn aber nun das Publikum etwa glaubte, der rote Teufel würde nun doch wieder auftauchen, um den Bademeister zu foppen, so irrte sich das Publikum. Dann hätte der Matrose Hahn die ganze Sache schlecht arrangiert. Denn dann wäre das eine Wiederholung gewesen, die wohl manchmal erlaubt ist und sogar sein muss, aber in diesem Falle durfte eine solche Wiederholung nicht stattfinden. Jetzt musste wieder etwas ganz anderes kommen.
Tief befriedigt legt der Bademeister seine beiden Mordinstrumente hin.
Nun natürlich erst mal die Pulle her!
Dann aber kommt ihm doch das Bewusstsein, man merkt es ihm deutlich an, dass hier doch noch irgend was anderes geschehen müsse. Er hat doch einen Menschen quasi ermordet. Erst muss einmal die Leiche ans Tageslicht.
Also der Bademeister nimmt die gewöhnliche Hakenstange, stochert mit ihr im Wasser herum, bis auf den Grund.
Es bleibt nichts an dem gewöhnlichen Haken hängen. Da greift der Bademeister, wie schon einmal, nach der Stange mit der gewaltigen Harpune.
Und es dauert auch gar nicht lange, so verrät schon sein Gesicht, dass er auf dem Grunde etwas angespießt hat, eine Hand taucht auf, es ist die linke, mit dem Armband, natürlich folgt der ganze Arm nach und...
Der Bademeister reißt vor Staunen sein Maul auf! Denn er hat mit seiner Harpune nichts weiter als diesen Arm angespießt. Der Kerl muss dort unten im Wasser einfach aus dem Leime gegangen sein. Da ist wohl eine außerordentlich schnelle Verwesung oder sonst etwas eingetreten — kurz und gut, der linke Arm hat sich vom Rumpfe abgelöst. Und gottvoll sah es nun aus, wie dieser Bademeister dastand, die Stange weit von sich abhielt, die Spitze in die Höhe gerichtet, und staunend den auf die Harpune gespießten Arm betrachtete.
Was dieser ehemalige Bäckergeselle und jetzige Bootsmann dabei für ein Gesicht machen konnte! Wie der den einzelnen Arm anguckte!
Georg wurde lebhaft an jene Szene erinnert, wie Mister Tabak in dem Speisehaus zu Marseille die elende Sardine mit seinem Riesenmesser angespießt hatte und sie tiefsinnig betrachtete.
Ja, erinnert wurde man lebhaft an diese Szene, sie hatte die größte Ähnlichkeit mit der hier.
Nur dass dieser Bademeister eine ganz andere Gestalt hatte, überhaupt, es war ja etwas ganz anderes und dann nun vor allen Dingen, was der für ein Gesicht dabei machte, wie der sein Maul aufriss, während er den angespießten Arm betrachtete.
»Ach, da platzt einem ja bald der Schädel!«, schüttelte sich Kapitän Martin vor Lachen, auch wirklich seinen Kopf mit beiden Händen haltend, und wenn das dieser Mann sagte, und tat, zumal er hierzu doch auch erst die Hände aus den Hosentaschen nehmen musste, so hatte das doch sicher etwas zu bedeuten.
Wie sich das andere Publikum benahm, jetzt und während der ganzen Vorstellung, davon wollen wir lieber gar nicht erst anfangen. Na, der Bademeister muss endlich dran glauben, er legt den einzelnen Arm hin, stochert weiter mit der Stange im Wasser nach dem Rumpfe.
Er bringt ein Bein zum Vorschein, das rechte mit der Fußspange — man muss annehmen, dass der andere Körper nachfolgt, denn solch eine im Wasser untergesunkene Leiche kommt doch nach und nach zum Vorschein — aber wiederum bleibt es bei diesem einen Beine, das der Bademeister an seiner Harpunenstange aufgespießt hält.
Natürlich wieder große Verwunderung. Aber doch nicht ein solches Staunen wie vorhin. Das wäre auch ganz verfehlt gewesen. Der Kerl ist eben aus dem Leime gegangen, hiermit muss sich der Bademeister nun auch abfinden.
Er stochert weiter nach dem Rumpfe oder nach den anderen Gliedmaßen und bringt wieder einen Arm angespießt herauf.
Aber auch der trägt ein Armband, und ist überhaupt ein linker Arm mit einer linken Hand.
Was, hat denn der Kerl zwei linke Arme gehabt?! Jetzt freilich wird der Bademeister wieder vom größten Staunen befallen, besonders wie er sich durch Vergleichen mit dem anderen Arm und mit seinen eigenen Händen überzeugt, dass es wirklich wiederum ein linker Arm ist.
Und wie er das nun tut, und dieses misstrauische Staunen, das sich in dem Kürbisgesicht dabei ausmalt, das ist nun wieder einfach köstlich, dass sich das Publikum fast wälzen will! Jetzt will ich erst mal den anderen Arm haben, den rechten!
Ganz deutlich hört man es ihn durch seine Gesten sagen!
Und er stochert weiter, spießt aber wieder ein Bein an. Ein Bein, das um das Fußgelenk den bekannten Ring trägt, und es ist überhaupt wiederum ein rechtes Bein »Was, hat denn der Kerl zwei linke Arme und zwei rechte Beine gehabt?! Mir ganz egal, ich will den rechten Arm haben!«
Der Arm kommt denn auch zum Vorschein, aber es ist wiederum ein linker mit dem Ringe!
Und dann spießt die Harpune wieder ein rechtes Bein an.
Und dann wieder einen linken Arm.
Und dann wieder ein rechtes Bein.
Und dann wieder einen linken Arm.
Und dann wieder ein rechtes Bein.
Dieses letzte aber bringt der Bademeister nicht ganz herauf, sondern er wirft es ins Wasser zurück, mit einer Bewegung, die ganz deutlich sagt:
»Ich bin fertig! Diese Welt ist voller Teufel, und von denen lasse ich mich nicht mehr veralbern. Ich nicht! Jetzt weiß ich, was ich zu tun habe!«
Dies alles sagte eine einzige Handbewegung in Verbindung mit einem entsprechenden Gesicht. Ganz deutlich glaubte man es sagen zu hören. Daher eben das Wort »Pantomime«. Und dieser ehemalige Bäckergeselle war eben ein ganz phänomenaler Pantomimiker. Welche schon ziemlich wieder vergessene Kunst erst durch die kinematografische Dramatik, die freilich noch in den Windeln liegt, wieder zu Ehren kommt.
Es kam ein amerikanischer Schluss. Ein Wort, das sich in der Dramaturgie bereits eingebürgert hat.
Und ein anderer Schluss war hier auch wirklich sehr schwer zu schaffen. Es konnte nur ein sogenannter amerikanischer Schluss sein. Noch ein blutiger Witz, und dann ist es ohne Erklärung aus.
Der Bademeister schleuderte das fünfte rechte Bein mit jener Gebärde der resignierten Entsagung ins Wasser zurück, wandte sich, ging nach dem Häuschen, bückte sich und hing an seinen Gürtel, was da am Boden lag: mit Haken versehene Steine und Eisengewichte.
Und wie er sich so genügend beschwert hatte, nahm er noch einen tüchtigen Schluck aus der Buttel, und dann ging er nach der Treppe, stieg sie hinab — und wie sein Fuß das Wasser berührte, besann er sich, drehte sich um, ging zurück, nahm erst noch einmal einen tüchtigen Schluck aus der Buttel — so, nun war er bereit, seinen Vorsatz auszuführen, aus dieser schnöden Welt, in der man dermaßen veralbert wird, zu scheiden — aber wie er schon bis zu den Knien im Wasser stand, besann er sich drehte sich um, stieg hinauf, um die Buttel zu holen, mit dieser stieg er hinein ins Wasser unterwegs noch einmal trinkend — und wie ihm das Wasser schon bis an den Leib ging, besann er sich, drehte noch einmal um, holte noch eine zweite Geneverkruke, entkorkte sie, nahm sie in den anderen Arm, und nun war er definitiv vorbereitet, um den nassen Weg ins Jenseits anzutreten, und nun hätte eine nochmalige Wiederholung auch nicht mehr gewirkt, während noch die letzte wahre Lachsalven ausgelöst hatte — jetzt führt er seinen Vorsatz unaufhaltsam aus, nur dass er unterwegs noch einige Male aus der Flasche trinkt — dann taucht er unter, zur Vorsicht aber die Buttel mit der Hand noch über Wasser haltend — und unter Wasser besinnt er sich doch noch eines anderen, er taucht noch einmal mit dem Kopfe auf, um noch einmal zu trinken, und so taucht er mit dem Kopfe für immer unter, die Flasche noch am Munde, so ist er verschwunden für immer — da aber kommt noch einmal seine Hand zum Vorschein, sie hält die Flasche, die Öffnung nach unten, es fließt kein Tropfen mehr heraus — die Hand lässt die Flasche fahren, sie bleibt oben schwimmen, den armen Bademeister sieht man niemals wieder.
Nur noch einige aufsteigende Luftblasen bezeichnen die Stelle, wo er mit diesen letzten Luftblasen jetzt seinen Atem aushaucht.
Und dann wird es stille.
Ganz bänglich stille.
Das Publikum spannt, wird förmlich verlegen.
Denn was soll denn nun noch kommen?
Nun, da steigt ein großer Kork empor und bleibt neben der ersten Kruke schwimmen.
Und nicht lange dauert es, während aber das Publikum schon zu grunzen beginnt, da steigt auch noch eine zweite Geneverkruke empor, und bleibt neben der ersten schwimmen. Der Bademeister hat die zweite Flasche, die er mitgenommen, noch unter Wasser geleert.
»Schluss der Vorstellung!«, rief Georg konnte es aber vor Lachen kaum herausbringen.
Obgleich der schon zwei Proben dieser Pantomime beigewohnt hatte.
Dann kann man wohl begreifen, wie sich das eigentliche Publikum benahm, das keine Proben gesehen hatte.
Aber man muss diese Pantomime wohl selbst gesehen haben, diese Szenen, auch diesen Schluss, um begreifen zu können, weshalb das Publikum sich so benahm. Eine Beschreibung tut es da nicht, das ist immer etwas Totes.
Aber wir wollen noch einen anderen Schluss hinzufügen. Dass heißt nämlich diesem Kapitel.
Der Verfasser möchte noch ein persönliches Erlebnis erzählen. Weshalb, das wird der geneigte Leser bald erkennen.
»Bitte, mein Freund, meine Tochter Viviana möchte Dich gern einmal sprechen.«
So hatte Merlin den Waffenmeister alsbald angeredet. Georg begab sich eiligst hin zu der exotischen Gesellschaft, die also einige Stufen höher saß.
Sie hatten weidlich gelacht, alle die orientalischen Damen und Diener und auch die würdevollen Radschas. Sie hatten sich manchmal... gekugelt, wie man so sagt. Nicht minder aber hatten sie oftmals gestaunt. Hatten gestaunt, wie es bei dem anderen Publikum gar nicht vorgekommen war.
Außerdem sei noch nachträglich bemerkt, dass diese orientalischen Damen und Herren während der Vorstellung immer eifrigst Augengläser benutzt hatten, eine besondere Art, halb Lorgnette, halb »Operngucker«. Sie hatten sie in der Tasche oder in am Gürtel hängenden Beutel gehabt, sie also häufig benutzend und dabei unter einander Bemerkungen austauschend.
»Das war ja wunder-wunder-wunderschön, so habe ich noch niemals gelacht!«, wurde Georg von Merlins Tochter lachend wie ein Bruder empfangen, obgleich er sie doch kaum kannte. »Aber nun sage bloß, wie ist denn dies alles nur möglich gewesen?! Meine Freunde und Freundinnen hier bestürmen mich, ich soll eine Erklärung geben, aber wie kann ich denn das, ich war und bin immer noch selbst ganz starr vor Staunen, ich hoffe, diese Erklärung jetzt erst von Dir zu bekommen!«
»Was denn für eine Erklärung?«, lächelte Georg, dabei aber selbst schon etwas zu staunen beginnend.
»Nun, wie das alles nur möglich sein kann! Denn das sind keine Illusionen gewesen!«
»Illusionen?!«
»Du weißt doch, was ich meine — Gedankenübertragung, der Zuschauer muss sehen, was sich der Gaukler in seiner Einbildung lebhaft vorstellt. Wir alle waren erst fest überzeugt, dass dies alles nur Illusionsgaukelei sei. Denn wie konnte der Teufel denn immer unter Wasser verschwinden und wieder von der Brücke her zum Vorschein kommen, und dann wieder umgekehrt, und das war doch immer derselbe Mann. Und was nun sonst noch alles passierte! So lange kann doch kein Mensch unter Wasser bleiben, und wenns auch der geschickteste Perlentaucher ist! Also musste es unbedingt doch Illusion sein, das Vorgaukeln von nur gedachter Einbildung. Nun hatten wir aber unsere Illusionsgläser bei uns. Hier diese Dinger, wenn man nämlich durch diese blickt, kann man sofort unterscheiden, ob etwas Illusion oder Wirklichkeit ist. Woher diese Wirksamkeit, das kann ich Dir jetzt nicht erklären, ich weiß es eigentlich selbst nicht. Kurz, dieses Instrument wirkt genau so wie ein Fotografenapparat, aber direkt für das menschliche Auge. Die Wirklichkeit bleibt natürlich bestehen, wenn man durch diese Gläser blickt, jede Illusion dagegen verschwindet, man sieht einfach nichts. Nun aber war alles, was uns da vorgeführt wurde, auch durch diese Gläser zu sehen. Also konnte es sich doch auch nicht um Illusionen handeln. Und da ist bei diesen Apparaten jeder Irrtum ausgeschlossen. Ja, wie ist denn da dies alles nur möglich gewesen?! Wie habt Ihr diese Zauberei denn nur fertig gebracht?! Was für eine ganz besondere Art von Zauberei und Magie und Yoga ist denn das nur?!«
So hatte das junge Mädchen gesprochen, und einige Dutzend exotischer Augenpaare hingen mit spannender Erwartung an dem Mann, der die Erklärung dieser »Wunder« hoffentlich auch geben würde. Und nun allerdings brach bei Georg vollends das offene Staunen hervor.
Wie, alle diese orientalischen Gäste fanden keine Erklärung für die Vorgänge dieser Zeremonie?!
Sie erhielten die Erklärung.
Der deutsche Leser braucht sie selbstverständlich nicht.
Die ziemlich hohe Insel war hohl, war nur ein Aufbau, unter ihrem Boden konnte man noch über Wasser atmen.
Zwischen diesem unsichtbaren Hohlraum und der Badezelle befand sich eine Kommunikation, also einfach eine Verbindung, diese benutzte der rote Teufel, in dem Hohlraum mochte er auch noch Gehilfen stecken haben, ferner waren in dem Hohlraum noch die sonstigen Requisiten untergebracht.
Ferner führte aus der Manege unter Wasser nach ein Tunnel hinaus ins Freie, das heißt hinter die Kulissen.
Der Matrose Hahn, dieser ausgezeichnete Taucher, schwamm einfach aus jenem Inselhohlraum durch diesen Tunnel in dem undurchsichtigen Wasser hinter die Kulissen, wenn er dann wieder über die Brücke kam, und umgekehrt.
Dass die Beine und Arme nur ausgestopfte Trikotgliedmaßen waren, braucht nicht erst gesagt zu werden.
Wie überhaupt, sei nochmals betont, der Leser gar keine Erklärung nötig hätte. So wenig wie das andere Publikum. Die von Bord der »Argos« hatten da doch niemals eine staunende Frage aufgeworfen, auch die kleine Ilse nicht. Aber diese exotischen Gäste hatten eine Erklärung nötig gehabt.
Diese selben Personen, die, wie Viviana, die Tochter Merlins des Zauberers, mit Illusions- und Taschenspielerkünsten sozusagen ganz geschwängert waren!
Die hatten sich den ganz einfachen Vorgang nicht erklären können, die hatten schon an Zauberei, an übernatürliche Wunder geglaubt! —
Das ist es, worüber der Verfasser noch einmal sprechen, wozu er außerhalb des Romans ein persönliches Erlebnis erzählen möchte.
Im Jahre 1889 lag ich in Bombay, hatte einmal Gelegenheit, obwohl zum Schiffsvolke vor dem Mast gehörend, also einfach Matrose, in eine bessere Gesellschaft eingeladen zu werden.
Der Gastgeber, ein Deutscher — wie überhaupt fast alles deutsch war — hatte dazu in seinen Bungalow, seine Villa, auch einen Fakir bestellt, einen berühmten Illusionsgaukler. Also einen Yogi. Fakir und Derwisch ist ja eigentlich etwas ganz anderes.
Der Kerl kam, ein braunschwarzes, lebendiges Skelett, machte innerhalb seines Zauberkreises, in dem sich auch die Zuschauer befinden mussten, die wunderbarsten Sachen.
Viel Neues war es allerdings nicht, was wir zu sehen bekamen. Nicht viel anderes, als was man überall in den indischen Städten auf der Straße und in den Kneipen zu sehen bekommt. Alle diese Verwandlungsillusionen und Taschenspielerkünste und sonstigen Gaukeleien sind, wie schon einmal erwähnt, äußerst einseitig. Dadurch eben bilden sich diese Gaukler aber auch zu solcher Vollkommenheit aus. Es ist eine einzige Schule, die seit Jahrtausenden besteht, jeder Lehrer lehrt seinem Schüler nur das, was er selbst kann, und so kommt immer dasselbe heraus, nun aber auch in der höchsten Vollkommenheit.
Dieser berühmte Yogi hier, selbst ein Guru, ein Lehrer in der Yoga-Wissenschaft, wusste aber nun in ganz wunderbarer Weise Illusionen mit wirklichen Taschenspielerkniffen zu verschmelzen, das war es, was ihn berühmt machte, worin er unvergleichlich war.
Es wurde viel fotografiert, aber es war gar nicht möglich, dem Kerl mit dem Knipsapparat beizukommen, Illusionen von Wirklichkeit zu unterscheiden. Indem er das Publikum darin selbst ständig irre führte. Wenn man dachte, man fotografiere eine Illusion, wobei also doch nichts auf die Platte kommt, dann fotografierte man eine Wirklichkeit, durch Taschenspielerkniff hervorgebracht, und dann erzeugte er wieder durch Gedankenübertragung einen ganz einfachen Vorgang, so einfach, dass niemand daran dachte, diesen zu fotografieren, der aber doch eine Hauptrolle insofern spielte, als er dazu diente, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer von einem anderen Punkte abzulenken.
Immerhin, auch seine suggestive Illusionskraft war ganz erstaunlich.
Die Vorstellung war beendet.
Nun war unter uns auch ein Herr, der für eine deutsche Champagnerfirma Indien bereiste. So ein richtiger oller Reese-Onkel, mit allen Hunden gehetzt, ganz vollgepfropft mit Witzen und Anekdoten, auch sonst ein Tausendkünstler, spielte großartig Klavier und balancierte dabei einen Stuhl auf der blauroten Gesichtsgurke, setzte vorher auf das Klavier einen Topf mit frischer Milch, imitierte auf den Tasten ein Gewitter mit Blitz und Donner, und dann hinterher war die Milch sauer geworden. Und lauter solchen Unsinn.
»Nun werde ich diesem Hexenmeister einmal etwas vormachen!«
So sprach der Champagneronkel, und der Yogi war bereit, sich von diesem Abendländer eine Vorstellung geben zu lassen. Der Champagneronkel machte ihm nichts weiter als Kartenkunststückchen vor. Allerdings nun großartig! Wie der, abgesehen von anderen Kartentricks das Kümmelblättchen schlagen konnte! Nicht nur mit drei, sondern mit vier und sogar fünf Karten! Es war gar nicht möglich, die richtige herauszufinden. Wie sich der Yogi auch bückte und mit seinen doch gewiss äußerst scharfen Taschenspieleraugen auch lugte.
Doch von solchen schwierigeren Sachen und komplizierteren Kartenkunststückchen ganz abgesehen.
Der deutsche Hexenmeister machte mit Absicht immer einfachere Sachen. Nämlich weil er sich selbst immer mehr zu wundern begann und zwar über das Verhalten dieses Yogis.
Ja, hier fand auch eine rätselhafte Umwandlung statt. Der Weinreisende nahm eine französische Spielkarte, zeigte sie ausgebreitet dem Yogi, die Farben nach oben, drehte sie um, mischte die Blätter.
»Nun ziehe Dir eine beliebige Karte, mein Junge.«
Es geschah.
»Was hast Du gezogen? Piquedame. Die erkennst Du doch wieder. So, nun stecke die Karte wieder zurück — ich mische das Spiel vor Deinen Augen — nun ziehe wieder eine Karte... was hast Du gezogen? Wieder Piquedame! Merkwürdig. Stecke die Karte zurück — ich mische — ziehe — wieder Piquedame...«
Und so fort.
Na, der Leser weiß doch wohl, wie das gemacht wird! Es ist so ziemlich das allereinfachste Kartenkunststückchen, wenn man die nötige Fingergewandtheit dazu besitzt. Der Herr vertauschte das richtige Kartenspiel einfach mit einem anderen, das überhaupt nur Piquedamen enthielt.
Das ist die ganze Sache, zu dumm! Dieses Vertauschen will natürlich gelernt werden, dieser Champagneronkel hier brachte es großartig fertig.
Ach, und diesen Eindruck nun, den dieses allereinfachste Kartenkunststückchen schon — von den anderen, komplizierteren gar nicht zu sprechen — auf den braunen Hexenmeister hervorbrachte!
Wie der staunte, wie der sich förmlich entsetzte! Wie der seine Götter anrief! »O Shiva und Vhishnu, das ist Zauberei! Sahib, o Sahib, wie bringst Du diese Zauberei fertig! Was für ein Yoga ist das nur!«
Zuletzt wollte er den Champagneronkel sogar anbeten. —
Also da hat man es!
Es ist ein sehr, sehr lehrreiches Gleichnis!
Dieser indische Yogi war das, was man einen Adepten nennt, einen Magier, einen Zauberer.
Und er war tatsächlich ein Zauberer, ein mit übernatürlichen Kräften begabter Mensch.
Denn wenn jemand sagt: »Es wachse hier aus diesem Teppich heraus ein Mangobaum!«, — und dieser Baum beginnt wirklich zu wachsen, bis er in voller Größe dasteht, die Zuschauer sehen ihn ganz deutlich, sie können sogar die Nüsse abpflücken und essen, so muss man das doch Zauberei nennen, der Betreffende ist ein ganz echter Zauberer.
Auch wenn alles nur Illusion durch Gedankenübertragung ist, verbunden mit Taschenspielergeschicklichkeit, man darf es dennoch echte Zauberei nennen. Oder es müsste erst näher definiert werden, was man denn überhaupt unter Magie und Zauberei verstanden haben will.
Dieser Inder besaß zweifellos magische Fähigkeiten, von deren reellem Vorhandensein, wenn man von Ammenmärchen und einzelnen Sekten absieht, wir Abendländer jetzt erst etwas zu ahnen beginnen. Er hatte sie durch ein besonderes körperliches und geistiges Training erworben, hatte wahrscheinlich jahrelang in einem düsteren oder gar stockfinsteren Raume eingemauert gesessen, regungslos in einer unnatürlichen Stellung verharrend, ständig nach der Nasenspitze schielend und das heilige Wort »Aum« aussprechend. Dabei musste er hungern und dursten, bis sein Leben fast erloschen, täglich waren ihm nie mehr als drei Stunden Schlaf vergönnt. So berichten fast alle, besonders Engländer, die unter der Leitung von Gurus die indische Geheimwissenschaft Yoga betreiben wollten. Dies wird zuerst von ihnen gefordert, für viele Jahre lang. Und das ist erst der Anfang! Immer entsetzlicher werden die asketischen Übungen, welche den Zweck haben, die Seele vom Körper frei zu machen, sodass der Geist den Körper vollkommen beherrscht, und wenn man sich selbst besiegt hat, so besiegt man die ganze Welt — dann also kann der Betreffende seine eigenen Phantasiegebilde auf andere übertragen. Und dass hierdurch im Menschen schlummernde Fähigkeiten frei werden, die er dann nach Willkür zur Erzeugung von Phänomenen verwenden kann, das ist nunmehr einwandfrei nachgewiesen worden, mag es auch noch genug geben, die daran nicht glauben wollen.
Dieser Inder hier hatte es so weit gebracht. Er hatte sein Fleisch in fast buchstäblichem Sinne des Wortes abgetötet, denn er hatte überhaupt gar kein Fleisch mehr an den Knochen. Er war ein echter Magier geworden, ein Zauberer, der bis zu einer Grenze den Naturkräften befehlen konnte, sie gehorchten ihm. Und da wird diesem selben Manne ein ganz einfaches Kartenkunststückchen vorgemacht, und da bricht er körperlich und geistig zusammen, betet es als ein »Wunder« an! —
Das ist es, worauf es hierbei ankommt!
Es war gar kein so alberner Spaßvogel, der zuerst auf die Idee kam, den zehn Geboten noch ein elftes hinzuzufügen:
Mensch lass Dich nicht verblüffen!
Und das gilt auch umgekehrt für alle die Erscheinungen und Fähigkeiten, welche wir heute magische, also übernatürliche nennen. Wenn jemand etwa eine glühende Kohle in die Hand nehmen kann, ohne sich zu verbrennen; wenn jemand seinen Körper durchsticht, sich die schrecklichsten Wunden beibringt — ein Streichen darüber, und es ist nichts mehr davon zu sehen; es gilt für den ganzen Spiritismus mit all seinen unleugbaren Phänomenen.
Es dürfte die Zeit kommen — und sie kommt ganz gewiss — da man alles das, was wir jetzt magisch oder übersinnlich nennen, was von anderen einfach geleugnet wird, auf ganz natürliche Weise wird erzeugen können. Dazu aber muss man erst einmal der Wahrheit die Ehre geben, nämlich anerkennen, dass es noch andere Naturkräfte gibt, die in jedem Menschen schlummern und nur geweckt zu werden brauchen, was dann aber, wenn der Materialismus besiegt worden ist, nicht mehr durch körperliche, asketische Übungen geschieht, sondern wozu nur die Ausbildung der höchsten geistigen Kraft nötig ist, über welche der Mensch verfügt, und das ist die Liebe! In diesem Falle besser Mitleid genannt.
Während Georg dem Mädchen die Erklärung gegeben, dieses den anderen exotischen Gästen berichtet hatte, war das Wasser abgelassen und der feuchte Grund schnell aufgetrocknet worden.
Die nächste Vorstellung sollte also wiederum hier stattfinden.
»Es ist noch eine Pause von einer Viertelstunde nötig«, musste dann Georg, der hinter den Kulissen gewesen war, verkünden, »es sind noch einige Vorbereitungen zu treffen.«
»Kann ich Dich sprechen?«, wurde er wiederum von Merlin angeredet.
»Bitte.«
»Diese Viertelstunde wird durch nichts anderes ausgefüllt?«
»Nein, es ist nicht gut angängig, oder wir müssten diesen kleinen Zirkus erst verlassen. Die Vorbereitungen zur nächsten Nummer schieben sich nur etwas länger hinaus, als erst angenommen worden war.«
»Bis dahin bleibt die Manege frei?«
»Die Vorbereitungen geschehen in den Stallgängen.«
»Der Maharadscha, den ich meinen Gast nenne — verzeihe, wenn er seinen weiteren Namen verschweigt — möchte gern Euch einmal eine Vorstellung geben. Willst Du ihm für diese Viertelstunde die Manege zur Verfügung stellen?«
»Gewiss doch! So lange er will, nicht nur eine Viertelstunde!«
»Gut. Dann lasse Deine Leute sich mehr nach unten setzen, um die ganze Manege herum, oder auch noch innerhalb derselben im Kreise.«
Eine Verkündigung, und es geschah. Alles verteilte sich auf der untersten Stufe im Kreise, die Manege selbst zunächst noch freilassend. Auch die exotischen Gäste hatten ganz unten Platz genommen.
Und da kamen schon aus einem Seitengange, der von den Argonauten nicht benutzt wurde, von dem man nur wusste, dass er in leere Felsenkammern führe, einige Chinesen heraus, ganz einfach gekleidet, Arbeiter, Kulis, die einen langen Pack trugen, legten ihn in der Mitte der Manege hin, breiteten ihn aus. Es war ein schwarzer, glatter, kreisrunder Teppich von etwa zehn Meter Durchmesser.
»Wollen sich Deine Freunde und Leute um diesen Teppich aufbauen!«, sagte Merlin. »Die Gaukeleien, mit denen Euch der Maharadscha aufwarten will, müssen in möglichster Nähe beobachtet werden. Nur ein Gang nach jenem Tor möchte freigelassen werden.«
Es geschah, wie der vielgeplagte und unermüdliche Waffenmeister anordnete. Man gruppierte sich um den Teppich. Die exotischen Gäste hatten ja schon ihre eigenen Kissen mitgebracht, sie ließen sich gleich darauf nieder, dicht vor dem Teppich, hinter ihnen stellten sich die Diener auf, und so hielten es auch die anderen Herrschaften, für die schnell Kissen und Polster besorgt waren, das »Volk« baute sich dahinter im Kreise auf, der ja groß genug war, um in einigen Reihen alle zu fassen, es musste nur der Leibesgröße nach angetreten werden.
Ein Gongzeichen, und herein marschierten mit anmutigen Bewegungen eine Reihe chinesischer Gestalten, neun Stück: zwei Männer, drei junge Weiber und vier halbwüchsige und auch noch etwas kleinere Kinder.
Alle echt chinesisch gekleidet, mit langen, bunten Seidengewändern, nur dass bei diesen die langen, weiten Ärmel fortfielen, diese gingen, allerdings auch sehr weit, nur bis an die Ellbogen, um den Hüften prachtvolle Schärpen, die schwarzen Haare zierlich frisiert, mit Blumen und seltsamen Spangen geschmückt, lauter zierliche Gestalten, die hübschen Gesichter mit den listigen Schlitzaugen wie aus gelbem Elfenbein geschnitzt.
So marschierten sie anmutig in den Kreis, nach allen Seiten hin lächelnd, und lächeln taten sie überhaupt immer, verteilten sich nach allen Richtungen, zogen aus dem Gürtel, in dem sie die verschiedensten Gegenstände trugen, bunte Papierbogen, verteilten sie unter dem Publikum, dazu mit dünnen Stimmchen Bemerkungen machend, denen man das Scherzhafte gleich anhörte.
»Es ist farbiges, ganz gewöhnliches, wenn auch echt chinesisches Seidenpapier, das die Gaukler verteilen!«, ließ sich Georg, der von Merlin wieder instruiert worden war, vernehmen. »Die Herrschaften, oder auch die dahinter stehenden Leute, sollen die Papierbogen nehmen und sie in Stückchen zerreißen. Ungefähr von der Größe der Oberfläche einer Streichholzschachtel. Doch kommt es gar nicht so darauf an. Auch auf die Form nicht. Immer lustig in Stückchen zerreißen, wie es kommt. Jedes Fetzchen Papier möchte einzeln dem betreffenden Gaukler zurückgegeben werden.«
Es geschah. Also es waren neun Personen, und jede hatte ein anders farbiges Blatt Seidenpapier zum Zerreißen unter das Publikum gegeben, welche Farben namentlich aufgeführt werden müssen, da es hierauf hauptsächlich ankommt: weiß, hellblau und dunkelblau, hell- und dunkelgrün, hell- und dunkelrot, hell- und dunkelgelb. Jede Farbe war von der anderen durchaus verschieden.
Der betreffende Gaukler, Mann, Weib oder Kind, ließ sich die zerrissenen Stückchen immer einzeln zurückreichen, faltete jedes noch einmal zusammen, machte einen eigentümlichen Knick hinein und warf es dann achtlos auf den schwarzen Teppich.
Dies erforderte ja einige Zeit, die aber durchaus nicht langweilig wurde. Erstens konnte man sich wirklich gar nicht satt sehen an diesen chinesischen Gestalten, es waren so überaus zierliche Persönchen, die reinen Nippfiguren, was sogar von den erwachsenen Männern galt, und wie viel mehr nun noch von den jungen Weibern und den Kindern. Diese Gesichtchen mit den Schlitzaugen! Diese Händchen! Diese Figürchen! Alles eben wie aus gelbem Elfenbein geschnitzt. Und wenn man diesen Ausdruck wählt, so kann man dabei doch nicht an schlaffes Fleisch denken. Nein, besonders die von Muskeln und Sehnen starrenden Unterarme zeigten, obgleich immer noch wie von Künstlerhand geschnitzt, vom vollendetsten Ebenmaße, was auch diesen zierlichen Weibern und Kindern für eine Kraft innewohnen musste.
Dann zweitens verstand fast ein jeder dieser Matrosen doch wenigstens einige Brocken Chinesisch, die wurden angebracht, und die Gaukler blieben auf neckische Fragen die schelmischen Antworten nicht schuldig, und die verstanden wieder einige Brocken Englisch was aber um so possierlicher klang, weil die Chinesen das R nicht aussprechen können, dafür meist ein L einschieben, und nun überhaupt ein heiteres Wesen, das Lächeln war nicht gekünstelt — und so kam es, dass im Handumdrehen eine allgemeine Plauderei mit Lachen und Kichern im Gange war.
Übrigens gehört dies mit zu einer echten orientalischen Vorstellung. Die Gaukler schwatzen unaufhörlich, unterhalten sich mit dem Publikum, dieses muss selbst mitspielen.
Der letzte Papierbogen war zerrissen, das letzte Fetzchen noch von Gauklerhand zusammengefaltet und in eigentümlicher Weise noch einmal geknickt und dann achtlos zu Boden geworfen worden.
Jetzt zog jeder aus dem Gürtel einen kleinen Handbesen, sie fegten die Papierstückchen nach der Mitte zusammen, dass sie dort einen bunten Haufen bildeten.
Der Besen wurde zurückgesteckt, dafür nahm jeder aus seinem Gürtel zwei Fächer, feststehend, aus Stroh geflochten, die bekannten chinesischen Fächer, in jede Hand einen. So stellten sie sich um den bunten Papierhaufen herum, aber weit genug auseinander, dass man bequem zwischen ihnen durchschauen konnte, und begannen zu fächeln.
Hierzu möchte erst noch etwas bemerkt werden. Auch die Artistik hat ihre Kunstströmungen. Was einst beliebt gewesen ist, wird vergessen. Das Publikum ist mit gewissen Produktionen übersättigt worden. So konnte man sich früher einen größeren, echten Jahrmarkt ohne gespanntes Turmseil gar nicht vorstellen, was es heute gar nicht mehr gibt, und man hat sich überhaupt von der ganzen Seiltänzerei abgewendet.
So ist es auch mit den chinesischen, indischen und arabischen Gauklern, die zu uns nach Europa kommen.
Heute produzieren sich diese, wenn man sie richtig beobachtet, hauptsächlich in Kunststückchen, welche auf den Gesetzen der Zentrifugalkraft und des Beharrungsvermögens beruhen.
Früher, noch zu unserer Kinderzeit, war das anders. Da hatten sich diese orientalischen Gaukler hauptsächlich auf die Beherrschung der Luftbewegung und des Luftwiderstandes geworfen.
Wer entsinnt sich noch des Schmetterlingsspieles, mit welchem die chinesischen und indischen Tausendkünstler uns als Kinder belustigten? Jetzt aber sieht man dieses Schmetterlingsspiel gar nicht mehr.
Das heißt nicht mehr bei uns in Europa. Wir Abendländer sind damit übersättigt worden, und die exotischen Artisten haben sich unserem Geschmacke angepasst. In ihrer Heimat aber steht dieses Schmetterlingsspiel noch in vollster Blüte.
Und das Schmetterlingsspiel war es, das diese neun chinesischen Künstler jetzt vorführten. Wie das Seidenpapier dabei in Stückchen gerissen wird, scheint ganz gleichgültig zu sein. Es kommt immer nur auf ein letztes Zusammenfalten und dann hauptsächlich wohl auf ein ganz besonderes Knicken an. Ach, was haben wir als Kinder uns abgemüht, nur zwei solche papierne Schmetterlinge oder auch nur einen einzigen durch Wedeln mit dem Fächer schwebend in der Luft zu erhalten!
Es kam über ein klägliches Resultat nie hinaus. Das Geheimnis muss eben in dem eigentümlichen Falten und dem letzten Knick liegen, und dann natürlich eine kolossale Übung, von zarten Kindesbeinen an, tagaus, tagein, von früh bis abends, und schließlich kommt wohl auch die Vererbung in Betracht, innerhalb einer Kaste, die diese Kunst vielleicht schon seit vielen Jahrtausenden betreibt.
Die achtzehn wedelnden Fächer brachten den bunten Papierhaufen zum Aufwirbeln. Erst ein allgemeines Durcheinander, dann hatte jeder eine Gruppe Schmetterlinge über sich und um sich vereinigt, immer ein bis zwei Dutzend von allen Farben.
So trennten sie sich, jeder ging seinen eigenen Weg, seinen Schmetterlingstrupp um sich spielend lassend.
Es war ja schon erstaunlich genug, wie sie diese Papierschnitzelchen in der Luft zu beherrschen wussten, nur mit den beiden Fächern, in jeder Hand einen. Das hier war erst der allereinfachste Anfang, und schon konnte man Verschiedenes gar nicht begreifen, hielt es einfach für unmöglich, also hätte man doch eigentlich an übernatürliche Zauberei glauben müssen.
Es hatte sich zum Beispiel jemand isoliert, ließ ein Dutzend Schmetterlinge direkt vor seiner Brust gaukeln, da sonderten sich drei ab, flogen ihm über den Kopf weg oder auch seitwärts um den Körper herum, gaukelten nun hinter seinem Rücken, während sich die Fächer nur vorn mit den Schmetterlingen beschäftigten. Dann kamen, offenbar so bald es gewünscht wurde, die drei Außenseiter wieder zurückgeflogen und vereinigten sich wieder mit dem Trupp.
Wie war denn das möglich? Dass die Fächer auch die Papierschnitzel hinten im Rücken beherrschen konnten, das war vollständig ausgeschlossen.
Man musste gar scharfe Augen besitzen und in Beobachtung geschult sein, um dieses Rätsel lösen zu können.
Sie arbeiteten miteinander, verständigen sich durch geheime Zeichen, kamen sich gegenseitig zu Hilfe.
Diese junge Frau zum Beispiel, die jenes Experiment ausführte, hatte den Oberkörper etwas vorgebeugt um lächelnd den Haupttrupp Schmetterlinge vor sich in Schach zu halten, und dabei ihr linkes Bein graziös nach hinten frei ausgestreckt. Das war aber nicht nur eine elegante Attitüde, sondern mit dem ausgestreckten Fuße gab sie geheime Zeichen, konnte sie richtig wie mit Worten sprechen, und sofort, aber ganz unauffällig, näherte sich ihr von hinten einer der Männer, er schien nur mit seinen eigenen Schmetterlingen beschäftigt zu sein, regierte diese jedoch nur — und warum nicht! — nur mit dem linken Fächer, den rechten hatte er in der herabhängenden Hand und ließ ihn kaum merklich erzittern, und dennoch genügte diese Luftbewegung, um der Frau die drei Schmetterlinge abzunehmen, die sie hinter sich schickte, die nun er seinerseits hinter ihrem Rücken spielen ließ, und dies geschah so unauffällig und außerdem immer noch in solch beträchtlicher Entfernung, dass niemand von dieser gegenseitigen Hilfe merken konnte.
Georg, der diese Frau gerade beobachtete, hatte gewiss scharfe Augen und verstand zu beobachten, aber er musste hierüber erst Aufklärung von seiner Nachbarin Viviana erhalten, nun erst war er imstande, mit seinen eigenen Augen die Hilfsleistung zu erkennen.
Und dies, schon erstaunlich genug, war erst der allereinfachste Anfang des ganzen Schmetterlingsspieles.
Ein quäkendes Kommandowort des einen Mannes, und alle nahmen die beiden Fächer nur in die rechte Hand.
So leitete jetzt jeder seine Schmetterlingsgruppe und dabei war deutlich zu sehen, wie die beiden Fächer in der einen Hand ganz selbständig von einander bewegt wurden, jeder für sich. Bald arbeiteten beide Fächer nach einer Richtung, bald gingen sie seitwärts auseinander, einmal stand der eine nach oben, der andere fast nach unten, und dabei bewegte sich der eine ganz langsam, der andere zitterte mit fabelhafter Schnelligkeit, usw. usw. in den denkbar verschiedensten Variationen, wie es eben das Zusammenhalten der Schmetterlinge erforderte. Und dabei blieb die freigewordene linke Hand nicht unbeschäftigt. Jetzt kam auch noch die Taschenspielerei hinzu. Wenigstens so genannt, obgleich diese Gaukler unmöglich Kleidertaschen und ihre nur halblangen Ärmel benutzen konnten.
Sie zauberten, die linke Hand immer weit ausstreckend allerhand Sachen hervor und ließen sie wieder verschwinden, dicht vor den Augen der Zuschauer. Dabei immer schwatzend in ihrer possierlichen Weise.
»Eine Bohne, nichtwahl? Hui, zwei Bohnen, nichtwahl? One — two — thlee — nuiii dlei Bohnen — nuuiii, oheio, hundeltmal hundelt Bohnen!!«
Es waren Kaffeebohnen, mit denen der betreffende Gaukler gerade experimentierte. Er schien sie geradezu aus der Luft hervorgezaubert zu haben. Zuletzt zeigte er, dass er eine ganze Masse Bohnen in der Hand hatte, er ließ sie auch befühlen, welche nehmen, um von der Wirklichkeit zu überzeugen — dann schloss er wieder die wunderbaren Elfenbeinfingerchen darüber, ein Reiben, und wie er die Hand, die er immer weit ausgestreckt gehalten hatte, wieder öffnete, waren alle Bohnen verschwunden.
Jeder führte etwas anderes aus. So zum Beispiel griff eines der halbwüchsigen Kinder, ein Mädchen, in seinen Mund, zog ein langes, weißes Band hervor. Dieses ließ es in der Luft flattern, dann griff die linke Hand nach, zog das Band mit jedem Griffe ein, bis es sich ganz in der Hand befand, und wie das Mädchen die Hand öffnete, war das Band daraus verschwunden. Dies geschah dicht vor den Zuschauern, und diese selbst mussten mitwirken. Sie mussten das wiedererschienene Band nehmen, von ganz dünner Seide, das Mädchen zog es innen aus den Händen heraus, bis es in seiner eigenen Hand überhaupt gänzlich verschwunden war.
Und die Sache ging noch weiter.
»Zelleiß es, zelleiß es in lautel kleine Stückchen!«
Gut, das lange Band wurde in lauter kleine Stückchen zerrissen, was mit leichter Mühe geschah, es war ein äußerst dünnes Gewebe, die kleine Gauklerin ließ sich die einzelnen Stücken als ein Päckchen in die linke Hand geben, die wunderzierlichen Fingerchen kneteten darauf herum, und dann plötzlich flatterte aus der Hand wieder das lange Band, von dessen Unverletztheit sich jeder überzeugen konnte.
Und während überall solche Kunststückchen ausgeführt wurden, immer verschieden, immer nur mit der linken Hand, wurden mit der rechten Hand die Schmetterlinge gaukelnd in der Luft erhalten, denen musste auch die ganze Aufmerksamkeit gelten, zumal sie jetzt noch anders dirigiert wurden.
Die Chinesen begannen immer mehr, die Zuschauer mit den Schmetterlingen zu necken, sie flogen auch um deren Köpfe herum, ließen sich auf ihnen nieder, auf der Nase, flogen ihnen beharrlich ins Gesicht, einer hatte es einmal besonders auf Klothildes Haarbüschel abgesehen, glaubte wohl, dieses Gewächs sei eine Blume, aus der er nippen wollte, ließ sich nicht verscheuchen, aber ebenso wenig fangen, wie Klothilde auch haschte und schlug. Das Gelächter war groß. Ebenso aber auch das Staunen über diese unbeschreibliche Kunstfertigkeit, mit der diese beiden von einer einzigen Hand gelenkten Fächer die Papierschnitzelchen beherrschten.
»Ist das nur Illusion gewesen?«, fragte Georg, der gerade das Kunststück des Kindes mit dem Seidenband beobachtet hatte, seine kindische Nachbarin, Merlins Tochter.
Er hatte sich nicht neben Viviana, sondern diese sich neben ihn gesetzt.
»Es ist alles Wirklichkeit. Nimm hier mein Illusionsglas, überzeuge Dich selbst!«
Georg nahm das dargereichte Augenglas, er sah überall dasselbe und wunderte sich hierüber nicht besonders. Erstens musste zunächst erwiesen werden, dass man durch diese Gläser wirklich Illusion von Wirklichkeit unterscheiden konnte, und dann war das vorhin von ihm gar nicht so gemeint gewesen. Er hatte nicht an eine eigentliche Illusion gedacht, dieses Zerreißen von Geweben und ein sofortiges Wiederzusammenfügen der einzelnen Stückchen war ihm von chinesischen und indischen Gauklern gar nichts Neues, als Neues kam hier nur das Schmetterlingsspiel hinzu, sondern er hatte nur gemeint, ob das Kind das Seidenband etwa vertauscht habe.
So äußerte er sich jetzt auch, als er das Glas zurückgab.
»Wie diese Kunststückchen ausgeführt werden, weiß ich nicht«, entgegnete Viviana. »Jedenfalls würde man über ihre Einfachheit, wenn man die Erklärung bekäme, dann lachen. Aber auch der Maharadscha könnte es Dir nicht erklären.«
»Kann denn der nicht die Erklärung bekommen, wenn er sie haben will?«
»Nein. Es handelt sich um das Geheimnis einer Kaste, und zwar hängt es mit der Religion zusammen, deshalb werden diese Geheimnisse um keinen Preis verraten, und wenn ein Gaukler dazu gezwungen werden sollte, so würde er eher Selbstmord begehen, ehe er sich das Geheimnis durch Schmerzen erpressen lässt.«
Das ist es, weshalb es ganz unmöglich ist, hinter die Schliche dieser Gaukler zu kommen! Es hat alles einen religiösen Hintergrund. Mindestens insofern, als alle diese mohammedanischen oder buddhistischen Gaukler einem Tempelorden angehören, dem sie auch fast ihren ganzen Verdienst zu überweisen haben.
Viviana winkte einer der jungen Frauen, die sich ganz besonders durch ihre Grazie wie auch durch die Geschicklichkeit ihres Schmetterlingsspiels auszeichnete.
Sie kam heran. Viviana sprach mit ihr.
»Du möchtest ihr einen oder mehrere Gegenstände geben, die sie bequem in ihrer Hand verbergen kann und die Du immer als Dein Eigentum wiedererkennst.«
Georg wühlte in seinen Hosentaschen, brachte einen Hosenknopf, ein kurzes Stückchen Bleistift und einen blauen Stein zum Vorschein, was ja nicht gerade für besonderen Reichtum sprach, aber was brauchte man denn hier in Sibirien Reichtümer eingesteckt zu haben. Während dieses Suchens schon hatte die Gauklerin nebenbei ein Kunststück ausgeführt, das der Beschreibung wert ist.
Mit der rechten Hand immer die Schmetterlinge spielen lassend, nach diesen blickend, hatte sie mit der anderen Hand den linken Ärmel hochgeschlagen, ihn regelrecht aufgekrempelt bis über die Schulter hinauf.
Das ist einfacher gesagt als getan. Man probiere es einmal, den halblangen, bis zum Ellbogen gehenden Ärmel mit der Hand desselben Armes zu fassen und ihn noch zu krempeln. Hierbei ging überhaupt etwas schier Übernatürliches vor sich. Nicht nur, dass es schon ganz rätselhaft war, wie sie die Hand und die Finger so weit zurückbiegen konnte, bis sie den Saum des Ärmels fasste, sondern Georg sah auch ganz deutlich, wie sich ihr Unterarm dabei bog, es war auch gar nicht anders möglich, sonst hätte sie den Ärmel gar nicht fassen können, also hatte diese Gauklerin tatsächlich biegsame Knochen, die sie nach Willkür biegen konnte.
»Du sollst ihren Arm festhalten. Wo Du willst. Am besten ist es wohl am Handgelenk, das kannst Du ganz umspannen. Da ist ausgeschlossen, dass sie etwa die Sachen zurückschnellt, sie in der Achselhöhle verschwinden lässt.«
Georg tat es, fasste diesen wunderbaren Arm, wie aus Elfenbein gedrechselt und geschnitzt, es gibt keinen anderen Vergleich, so wunderbar zierlich und doch so hart wie Stein, das Handgelenk dünn wie das eines vierjährigen Kindes — das sich nicht durch besondere Dicke auszeichnet — und der Oberarm dabei schwellend von Muskeln.
Zuerst fasste Georg nur mit der einen Hand das Gelenk, dann später auch mit der anderen Hand noch weiter oben den Arm, hinter dem Ellbogengelenk, dort noch immer den ganzen Arm mit seinen Fingern umspannen könnend.
Anfangs machte Viviana den Dolmetscher, bald war das nicht mehr nötig, die Chinesin konnte die einzelnen Gegenstände bei Namen nennen.
»Lege alles in meine Hand!«
Die Fingerchen wurden darüber geschlossen, machten reibende Bewegungen
»Was soll ich noch in meiner Hand haben?«
»Gar nichts mehr.«
Noch ein Reiben, die Fingerchen wurden aufgeschlagen — die Hand war leer.
Georg wendete sich hin und her, strich den Arm hinauf — es war unbegreiflich, wo die Gegenstände geblieben waren.
»Nun zaubere den Knopf zurück.«
Die Fingerchen wurden geschlossen, ein Reiben — in der Hand lag nur der Knopf.
Und so ging es weiter, ganz wie gewünscht wurde. Dann aber gab die Gauklerin, immer lächelnd nur nach ihren spielenden Schmetterlingen blickend, auch ungewünschte Kunststückchen zum besten. Plötzlich, wie Georg nur an seinen Hosenknopf und an das Bleistift-Endchen dachte, kam aus der geschlossenen Elfenbeinhand, aus einer seitlichen Öffnung zwischen dem gebogenen Zeigefinger und dem Daumen, der buntschillernde, züngelnde Kopf einer Schlange zum Vorschein.

Es war begreiflich, dass Georg etwas zurückprallte. Eine Schlange ist immer eine Schlange.
»Gut Slankeee«, lächelte beruhigend die reizende junge, Frau, »gut Tielchen, tut niemand nix. Hast Du Vogelchen liebel?«
Das Schlangenköpfchen, immer mit funkelnden Augen lebhaft züngelnd, zog sich zurück, die Hand wurde geöffnet, in ihr lagen, wie Georg gewünscht hatte, der Knopf und der Bleistift.
Die Fingerchen wurden wieder geschlossen, wieder jenes Reiben, und aus der seitlichen Öffnung kam jetzt ein buntschillernder Vogelkopf zum Vorschein, den Schnabel weit aufsperrend, wie es in der Hand gehaltene kleine Vögel gewöhnlich tun, auch einmal in die Hand zu beißen versuchend.
Es dürfte Leser genug geben, die dieses Experiment schon gesehen haben, ganz genau so, wie es hier beschrieben wird, von indischen Gauklern, die sich immer mehr in Europa einfinden, sich auf Weltausstellungen und bei ähnlichen Gelegenheiten produzierend. Wenn man es sich etwas mehr kosten lässt, kann man dabei auch den Arm und die Hand am Gelenk halten, sodass der Gaukler die Sachen also nicht aus dem Ärmel herausholen kann, ganz abgesehen davon, dass der Mann meist mit nackter Oberkörper geht.
Georg hatte gerade dieses Kunststückchen — stereotyp wie die meisten — noch nicht gesehen, und daher war sein Staunen begreiflich, wobei er nicht zu denen zu gehören brauchte die sich so leicht verblüffen lassen. Es ist, doch immerhin etwas ganz Außerordentliches, worüber man mit Recht staunen muss.
»Wunderbar! Fabelhaft! Wo bringt die nur diese Tiere her?«
»Ich weiß es auch nicht«, entgegnete Viviana. »Aber sei versichert, dass es keine Illusion durch Gedankenübertragung ist.«
»Das glaube ich schon. Also kann sie auch nicht alles aus der Hand kriechen lassen, was ich von ihr verlange.«
»Nein, das kann sie nicht. Eben weil es Wirklichkeit ist. Sie ist nur für gewisse Kunststücke eingerichtet.«
Die Gauklerin sollte diese Erklärung aber gleich Lügen strafen, obgleich sie in anderer Hinsicht doch richtig blieb.
Zunächst ließ sie den Vogelkopf wieder verschwinden, zeigte, dass sie in der Hand die drei Gegenstände hatte, schloss die Fingerchen, und aus jener seitlichen Handöffnung kam wieder der Schlangenkopf zum Vorschein.
Aber auch bei diesem Kopfe blieb es diesmal nicht, sondern der ganze Leib folgte nach, zunächst langsam bis zur Hälfte, dann ließ die Gauklerin schnell die ganze Schlange nach unten herausgleiten, reichlich einen Viertelmeter lang, fasste sie am äußersten Schwanzende, hob das sich windende Tier hoch, Kopf zurück und Mund auf, und so ließ sie die Schlange in ihren Hals gleiten, verschluckte sie.
Nicht gerade sehr appetitlich, besonders bei diesem liebreizenden Dämchen sah es hässlich aus, aber man musste nun eben mit chinesischen Verhältnissen rechnen.
»Gut, gut, sell gut«, lächelte die Gauklerin und rieb sich vergnügt die Magengegend.
Aber hierbei blieb es nicht, sondern sie zog mit der Fingerspitze eine Linie, vom Magen an hinauf über den linken Oberkörper, dann über die Schulter und den Oberarm bis zum Ellbogen, weiter konnte sie mit dem linken Finger natürlich nicht reichen, es war schon erstaunlich genug, dass sie die Linie so weit ziehen konnte, dann schloss sie die Hand wieder, ein Reiben der Fingerchen, und zwischen ihnen erschien eine zweite Schlange, eben so schillernd und von derselben Größe, die gleichfalls verschluckt wurde, genau so, wie ein Italiener eine lange Makkaroninudel in den Magen hinabbringt, ohne sie zu kauen.
»Was, die will doch nicht etwa behaupten, dass es dieselbe Schlange ist, die den Weg aus dem Magen durch den Leib nach oben nimmt, durch ihren Arm wieder in ihre Hand zurückkriecht?!«
»So sagt sie wenigstens«, lachte Viviana.
Noch zwei weitere Schlangen erschienen auf dieselbe Weise und wurden verschluckt.
»Ja, wo bekommt die denn nur alle diese Schlangen her?«
»Wenn man ihr glauben darf, so ist es immer ein und dieselbe Schlange!«, lachte Viviana wieder.
»Ein sehr billiges Mittel, um seinen Hunger zu stillen, wenn der Magen dabei auch betrogen wird«, bemerkte nebenan Doktor Isidor.
Die Gauklerin sagte etwas Längeres auf Chinesisch.
»Du möchtest Deine Rocktasche etwas öffnen«, verdolmetschte Merlins Tochter, »sie will ihre Schmetterlinge hineinspazieren lassen.«
Diese junge Frau war auf die Kunst ihres Schmetterlingsspiels offenbar stolzer als auf ihre anderen Gaukeleien, und da hatte sie auch recht, sie verstand jedenfalls von allen die papiernen Schmetterlinge am besten zu beherrschen, auch hier während ihrer Produktionen mit der linken Hand hatte sie es bewiesen, die umsitzenden Zuschauer und besonders Georg fortwährend mit den bunten Papierschnitzelchen neckend, was aber nicht weiter beschrieben werden kann.
Also Georg setzte sich zurecht, öffnete die rechte Seitentasche seines Jacketts und sorgte dafür, dass sie gut offen blieb.
Zunächst ließ die Chinesin die Schmetterlinge in buntem Durcheinander um ihren Kopf gaukeln, dann streckte sie den linken Arm aus, die Schmetterlinge ordneten sich in der Luft zu einer Reihe, dicht nebeneinander, und plötzlich ließen sie sich alle gleichzeitig auf diesem Arme nieder, einer neben dem andern. Es war ein unbegreifliches Kunststück gewesen, dessen Effekt sich gar nicht schildern lässt. Wie die Schmetterlinge — es waren vierzehn Stück — in der Luft plötzlich eine Reihe gebildet hatten, wie die einexerzierten Soldaten, und sich mit einem Schlage auf dem ausgestreckten Arme niedergelassen hatten!
Nun lagen sie da, nun konnte man sehen, dass es nichts weiter als zusammengefaltete und eingeknickte Seidenpapierschnitzelchen waren.
»Fabelhaft, fabelhaft!«, staunte Georg wie alle die anderen.
Das war aber erst der Anfang gewesen.
Zunächst zählte die Gauklerin die auf ihrem Arme sitzenden Schmetterlinge, und das reizende, schlangenfressende Scheusal schien äußerst stolz darauf zu sein, dass es englisch bis vierzehn zählen konnte, freilich ohne das R aussprechen zu können.
»Welchel, welchel?«
»Du sollst den Schmetterling bezeichnen, der in Deine Tasche schlüpfen soll«, verdolmetschte Viviana die weiteren chinesischen Worte.
Georg bezeichnete einen in der Mitte, die Fächer in der rechten Hand klapperten, und sofort erhob sich der betreffende Schmetterling unter seinen ruhig sitzen bleibenden Kameraden, gaukelte auf Georg zu und schlüpfte in dessen Rocktasche.
Und so folgte einer nach dem anderen, wie Georg immer bezeichnete. Dann, als alle vierzehn Schmetterlinge in seiner Tasche verschwunden waren, klapperten die beiden Fächer direkt vor dieser, und sofort schlüpften sämtliche Schmetterlinge aus der Tasche heraus, alle in einem Haufen, gaukelten einige Zeit in der Luft herum, bis sich einer nach dem anderen vom Schwarm ablöste und wieder in die Rocktasche schlüpfte.
Jetzt wiederholte sich das Herauskommen in anderer Weise, indem jeder einzeln zum Vorschein kam. Dabei konnte Georg einmal ganz deutlich beobachten, wie die Fächer auch nach rückwärts gehende Luftströmungen erzeugten, sodass also gewissermaßen oder auch tatsächlich ein luftverdünnter Raum entstand, in welchen der Schmetterling hineingezogen wurde. Sonst war es ja überhaupt auch gar nicht zu begreifen, wie sie die Papierschnitzel aus der Tasche herausbrachte.
Ganz, ganz wunderbar war es, wie sie jeden einzeln hervorlockte! Wohl kam es vor, dass manchmal gleich zwei durch den Wirbelwind hervorgezogen wurden, aber immer durfte nur einer abfliegen, der zweite musste vorher zurück, bis auch er daran kam.
Und am unbegreiflichsten war für Georg dabei, wie die nur mit den beiden Fächern in einer Hand auch den ganzen Schwarm in der Luft spielen lassen konnte, während sie sich doch so intensiv mit der Tasche beschäftigte! Und hier gab es keine fremde Hilfe, niemand anders befand sich in der Nähe!
Sie hatte jeden einzelnen gewissenhaft gezählt. Bis auf dreizehn war sie gekommen, der letzte fehlte noch, und der wollte nicht aus der Tasche. Oder hatte sie sich im Zählen geirrt?
Alle Schmetterlinge mussten sich auf ihren Arm niederlassen.
Nein, es waren nur dreizehn.
»Wo ist del vielzehnte?«
Sie gab sich die größte Mühe, ihn aus der Tasche zu bringen, aber der musste sich in einer Falte verfangen haben.
Endlich wurde Georg aufgefordert, ihn selbst hervorzuholen.
Er fand in der leeren Rocktasche keinen vierzehnten Schmetterling.
Da öffnete die Gauklerin lächelnd ihre linke Hand, da lag der vierzehnte drin, erhob sich und gesellte sich dem ganzen Schwarme bei.
Es war ein Kunststückchen gewesen, dessen Effekt man nur nicht richtig zu würdigen wusste. Jeder hatte nur dreizehn Schmetterlinge gezählt, die aus der Tasche herausgekommen waren. Wie hatte sie den vierzehnten in ihre Hand bekommen? Nun, eben eine Täuschung. Sie hatte einmal zwei zusammen herauspraktiziert. Ja, das war leicht gesagt, aber zu begreifen war es eigentlich nicht, wie sie das fertig gebracht hatte.
Und es sollte sich gleich zeigen, dass diese Gauklerin noch etwas ganz anderes mit ihren Schmetterlingen fertig gebracht hätte, wenn sie nur gedurft hätte! Es sollte sich gleich zeigen, was unter dieser Bande für eine militärische Zucht herrschte!
Wieder ein quäkendes Kommando jenes männlichen Chinesen.
Es war ja keinem Zuschauer weiter aufgefallen, dass jeder Gaukler die beiden Fächer immer nur mit der rechten Hand geführt hatte, dass niemand einmal den einen Fächer in die linke Hand genommen hatte oder einen dritten hinzu, denn jeder hatte in seinem Gürtel noch andere Fächer stecken.
Jetzt aber, kaum war das Kommando erschollen, zog jeder aus dem Gürtel noch zwei andere Fächer, diese in die linke Hand nehmend. Also jetzt wurde mit vier Fächer gewedelt, jede Hand dirigierte zwei.
Zunächst begannen sie sich zu entkleiden, was ja auch freilich seine Schwierigkeiten hatte, indem sie doch mit beiden Händen die Fächer klappern ließen, so die Schmetterlinge spielen lassend, und diese langen Gewänder waren gar nicht so einfach abzustreifen.
Sie taten es mit den Füßen, traten aus den Strohsandalen, hoben die mit weißen Strümpfen bekleideten Füße, deren große Zehe isoliert war, lösten die Schärpen, zogen sich aus, bis sie alle in braunen Trikots dastanden.
Herrliche Gestalten, wenn auch alle etwas kurzbeinig geraten. Aber das vergaß man ganz über dem sonstigen Körperbau vom schönsten Ebenmaß.
Der eine Mann stellte sich in die Mitte der Manege, der zweite kletterte an ihm hinauf, ohne Benutzung der Hände, mit denen er ja die Fächer und Schmetterlinge dirigieren musste, stellte sich jenem auf die Schultern, dann kletterte seine Frau hinauf, eine zweite, die dritte, dann kamen die vier Kinder daran, bis alle neun Personen übereinander standen. Im Bauen solcher Pyramiden haben diese orientalischen Gaukler ja überhaupt etwas los.
Sie ließen ihre Schmetterlinge spielen, ein jeder einen Schwarm.
Da ein quäkendes Kommando, und die Sache änderte sich. Inwiefern, das war noch nicht gleich richtig zu erkennen. Man sah nur, dass die einen Schmetterlinge mehr in die Höhe flatterten, andere sich herabsenkten, bis das Resultat geschehen war. Jetzt hatte jeder einen Schwarm von nur einer einzigen Farbe.
Dies lässt sich nun freilich leichter sagen als ausführen. Es war ganz unbegreiflich, wie die diese Papierschnitzel von neun verschiedenen Farben von einander geschieden hatten, nur durch solches Fächerwedeln.
Und so ging das Spiel weiter. Die gleichfarbigen Schwärme senkten sich herab und stiegen in die Höhe, gingen durcheinander hindurch und waren doch immer wieder zusammen. Jetzt waren die weißen Schmetterlinge oben in der neunten Etage, die dunkelroten in der untersten, und alle Schwärme durchkreuzten sich, bis das Ganze umgekehrt war.
Es lässt sich weiter nicht beschreiben. Jedenfalls konnten sich die Zuschauer nicht sattsehen an diesem wunderbaren Spiele. Die Pyramide wurde abgetakelt. Es kam die Schlussnummer dieses Schmetterlingsspiels, an sich wohl ziemlich unscheinbar, aber das Schwierigste hatten die Gaukler doch sicher bis zuletzt aufgespart, und das musste auch jeder Einsichtsvolle wohl erkennen, wenn es dabei auch ohne Bravourstückchen abging.
Jeder trieb seinen Schmetterlingsschwarm, wieder alle Farben durcheinander, nach der Mitte der Manege, dort sank alles zu Boden. Der eine Mann zeigte noch einmal, wie er alle die neun Farben durcheinander mengte. Dann traten die neun Personen um den Papierhaufen herum und begannen mit den vier Fächern zu wedeln, in ganz eigentümlicher Weise, wie man es bisher noch nie beobachtet hatte, es war eine ganz andere Bewegung dabei.
Die Folge war, dass der Papierhaufen aufwirbelte. Zuerst alle Farben bunt durcheinander. Aber es dauerte gar nicht lange, so merkte man immer mehr, wie sich die neun Farben von einander trennten, obwohl immer noch in einem Wirbel zusammen — da, ein Kommando, jeder ging zurück, einen gleichfarbigen Schwarm Schmetterlinge nach sich ziehend!
Es kam manchmal ein kleiner Irrtum vor, dass sich ein Schmetterling zu einem andersfarbigen Schwarm hielt, aber es war nicht anders, als ob dieser Papierschmetterling selbst seinen Irrtum einsehe, er verließ den fremden Schwarm und gesellte sich noch nachträglich zu seiner Farbe, und so kam man fast auf die Vermutung dass dieser Fehler absichtlich herbeigeführt worden war, um eben die Unfehlbarkeit in dieser Direktion zu beweisen. Ganz erstaunlich war es ja auch schon, wie die Gaukler die Schmetterlinge jetzt nicht mehr vor sich her trieben, sondern hinter sich nachzogen!
»Das ist die schwerste Leistung, die es bei diesem Schmetterlingsspiel gibt«, erklärte Viviana. »Das bekommt vielleicht selbst der Kaiser von China selten zu sehen.«
Noch mehrere Male gingen die verschiedenen Farben bunt durcheinander jetzt aber immer in der Luft schweben bleibend, immer wirbelnd, wurden einzeln wieder zurückgezogen, dann ein Kommando, die Papierschnitzel fielen zu Boden, die neun Gaukler verbeugten sich flüchtig, hauptsächlich vor dem Maharadscha, rafften schnell ihre Gewänder auf und sprangen hinaus.
Den ihnen nachfolgenden tosenden Beifall, den ihnen aber nur die Argonauten spendeten, hatten sie reichlich verdient.
Es war die Revanche des Maharadscha gewesen, nun wollte er sich wieder etwas vormachen lassen.
Wir wollen und können nicht alle die weiteren Vorstellungen beschreiben. Der sibirische Wisent und der amerikanische Bison lieferten sich gerade einen fürchterlichen Zweikampf, wenn auch ihre Hörner mit Kugeln geschützt waren, wobei letzterer Sieger bleiben sollte, als Georgs Schulter berührt wurde.
Es war wieder Merlin, der hinter ihm stand.
»Ein Mensch braucht Deine Hilfe, und Du wirst sie ihm nicht verweigern, auch wenn es Dein Feind gewesen ist.«
»Mein Feind?«
»Kapitän Satin.«
»Was ist mit ihm?«
»Das rächende Schicksal hat ihn endlich erreicht, er ist tödlich verunglückt, furchtbar verunglückt, er liegt im Sterben, kann unmöglich gerettet werden — aber es muss doch getan werden, was noch irgendwie zu tun ist, und da kann nur Dein Schiffsarzt in Betracht kommen.«
Schon war Georg aufgesprungen, um nach Doktor Isidor zu gehen, der einige Plätze entfernt saß.
»Und nimm doch einige Deiner Leute mit«, sagte Merlin noch, »vier Mann, der Verunglückte muss getragen werden.«
Georg wählte die vier Mann schnell aus, sie entfernten sich, von Merlin geführt. Es war gerade eine so aufregende Kampfesszene in der Arena, dass dieses Entfernen von den anderen gar nicht bemerkt wurde.
»Was ist ihm denn passiert?«, fragte Doktor Isidor unterwegs, der glücklicherweise einmal ganz nüchtern war, als sie durch die Felsenkorridore schritten.
»Er ist in eine Maschinerie gekommen, ist total zermalmt worden. Seine Leute wussten nichts mit ihm anzufangen, sie brachten ihn mir, oder Kapitän Satin selbst hat es wohl verlangt. Ich weiß nichts anderes, als dass ich ihn Dir übergebe. Denn hier ist meine Macht zu Ende, hier bist Du als geschulter Arzt der Mächtigere.«
»Wo befindet er sich? Ich habe nichts weiter bei mir als ein kleines Taschenbesteck —«
»Ich dachte, Ihr nehmt ihn mit an Bord, oder doch in die Nähe Eueres Schiffes, wenn dieses nicht durch seine Gegenwart verunreinigt werden soll —«
»Davon ist gar keine Rede«, unterbrach diesmal Georg, »wenn er am besten in unserem Lazarett aufgehoben ist, dann kommt er hinein, und wenn es auch der leibhaftige Teufel selbst wäret.«
»Ich danke Dir. Hier liegt er schon.«
Sie hatten eine Felsenkammer betreten. In der Mitte derselben stand eine Bahre, bedeckt mit einem Tuche, unter dem man eine menschliche Gestalt erkannte.
Doktor Cohn hob das Tuch, warf nur einen Blick darunter, ließ es gleich wieder fallen.
»Ach Du lieber Gott! Lebt der denn wirklich noch?«
Die Antwort gab der vermeintliche Tote selbst.
»Hähähähähä!«, erklang es meckernd unter dem Tuche.
Es war gewiss keine lächerliche Situation, zumal nach dem, was auch die anderen soeben Furchtbares unter dem Tuche zu sehen bekommen hatten, aber dieses meckernde Lachen auf jenen Ausruf hin wirkte wirklich humoristisch. Wenn es bei den Umstehenden auch nicht zu einem Lachen kam.
»Na, da fort mit ihm an Bord!«, kommandierte Georg.
Das Schiff wurde durch Felsengänge, wobei Merlin wieder den nächsten Weg führte, erreicht, die Bahre wurde im Lazarett auf dem großen Operationstische niedergelassen, jetzt das Tuch entfernt. Es war ein Wachstuch, das Blut konnte nicht durchdringen, so war der Verunglückte auch sonst gelagert worden, dass er beim Transport keine blutige Spur hinterließ.
Denn sonst lag er in einer Blutlache, es war überhaupt nur ein blutiger Fleisch- und Knochenbrei, was man erblickte, wenigstens die unteren Extremitäten waren vollständig zermalmt, dasselbe galt von den Armen und Händen, auch der Brustkasten schien eingedrückt zu sein, und außerdem war der Mann skalpiert, die Kopfhaut ihm gänzlich abgerissen worden.
Mit Grausen blickte Georg auf das entsetzliche Bild herab.
Er hatte immer gehofft, diesem Manne noch einmal persönlich zu begegnen, seiner habhaft zu werden, um ihn im Guten oder im Bösen zu veranlassen, dass er vor Zeugen ein Geständnis ablege, wie er es gewesen sei, der damals in dem New Yorker Hotel den Mord begangen habe, wofür der Bruder der Patronin als vermeintlicher Täter ins Zuchthaus gekommen und darin gestorben war.
Kapitän Satin hatte es ihm ja schon selbst gestanden, hatte damit renommiert, damals an Bord seines »Seeteufels«, aber das hatte doch wohl schwerlich genügt, um den Prozess wieder aufzunehmen, um die Ehre des unschuldig im Zuchthaus Verstorbenen wieder herzustellen.
Und nun war dieses persönliche Wiedersehen so erfolgt! Von dem war kein Geständnis vor Zeugen mehr zu erwarten, das wusste Georg gleich. An die entwendeten Flibustierschätze dachte er jetzt überhaupt nicht, da schon eher an den Ingenieur Breithaupt, den dieser Mann ja ebenfalls auf dem Gewissen hatte. Aber davon jetzt mit Fragen anzufangen, das hatte ja alles gar keinen Zweck mehr.
»Tja, da ist nichts mehr zu wollen«, sagte Doktor Isidor achselzuckend, ohne an eine Untersuchung zu gehen, ohne die blutige Masse nur zu berühren. »Der ist von einer Maschinerie so kunstgerecht in lauter kleine Stückchen tranchiert und frikassiert worden, dass ich ihn auch nach seinem Tode nicht wieder zusammenflicken könnte. Was haben ihn denn nur seine Leute noch zu uns geschickt?«
»Ich glaube, es war sein eigener Wunsch«, flüsterte Merlin, der selbst furchtbar erschüttert war.
»Tja«, machte der jüdische Schiffsarzt nochmals, »ich kann ihm nicht helfen. Höchstens — wenn die Anwesenden damit einverstanden sind, d. h. dass sie mich später nicht anzeigen, denn es ist etwas strikte Verbotenes, gerade einem Arzt aufs Strengste verboten, was ich vorhabe — höchstens, dass ich ihm ein Pulverchen eingebe, das ihn von allen Qualen befreit — nein, es ist gar nicht mehr nötig, der ist schon tot.«
Da aber, wie Doktor Isidor dies eben gesagt hatte, bewegten sich in dem entstellten Gesicht die blutigen Lippen.
»Hähähähähä!«, erklang es noch einmal meckernd.
Das war aber der letzte höhnische Laut gewesen, den dieser Teufel im Leben von sich gab, durch den blutigen Brei ging ein Zittern, es streckte sich, was nur irgendwie noch zu strecken ging, der Kopf hob sich etwas und schlug wieder zurück, und — alle war es!
»So, der lacht nicht mehr«, sagte Doktor Isidor.
Sie blickten einige Sekunden schweigend auf den Toten herab, dann nahm Georg seine Kopfbedeckung ab, alle folgten seinem Beispiele.
»Was dieser Mann auch getan haben mag«, sagte er feierlich, »wir haben nicht mehr über ihn zu richten. Jetzt steht er vor einem höheren Richter. Ich lege nichts in die Wagschale seiner Sünden, ich verzeihe ihm, was er mir getan hat. Der Herr sei seiner Seele gnädig. Amen.«
Feierlichst hatte es Georg gesagt, wollte seine Mütze wieder aufsetzen, stockte erschrocken mitten in der Bewegung. Denn —
»Hähähähähähä!«, erklang es da wieder aus dem blutigen Munde.
Alle standen ganz erstarrt da, und es war begreiflich. Nur Doktor Isidor war einer Bewegung und einer Bemerkung fähig, und was der nun für ein Gesicht dazu machte, als er es sagte:
»Na gottverpippich noch einmal! So etwas ist mir in meiner Praxis doch noch nicht passiert! Meckert der Kerl sogar noch nach seinem Tode!«
Wie er das gesagt hatte, und nun dieses Gesicht dazu mit den wackelnden Elefantenohren — die Folge davon war, dass wenigstens die vier Matrosen ein grunzendes Lachen von sich gaben, indem sie es unterdrücken wollten, was ihnen aber nicht gelang.
»Doktor, ist dieser Mann tot oder nicht?«, fragte Georg ernst. »Das müssen Sie als Arzt doch beurteilen können.«
»Ich kann Ihnen nur sagen, dass ein toter Mensch eigentlich nicht mehr meckert, das ist mir etwas ganz Neues.«
Doktor Cohn ging doch noch an eine Untersuchung, so weit es da überhaupt eine Untersuchung gibt. Sämtliche Kennzeichen, um Tod von Scheintod zu unterscheiden, um überhaupt zu konstatieren, dass der Tod definitiv eingetreten ist, haben sich bisher als trügerisch erwiesen. Nur die beginnende Verwesung lässt keinen Zweifel mehr, was aber doch erst später eintritt und schließlich doch durch künstliche Mittel ganz aufgehoben werden kann.
Der Schiffsarzt hielt den Hauchspiegel vor die Lippen, prüfte den Puls, wo der noch zu prüfen war, lauschte durch das auf den Brustkorb gesetzte Stethoskop nach einem eventuellen Herzschlag, ließ dazu auch noch durch den Körper einen galvanischen Strom gehen —
»Meiner gewissenhaften Überzeugung nach ist dieser Mann tot, ist sozusagen mausetot, ist sogar eine tote Leiche —«
»Hähähähähä!«, fing es da wiederum zu meckern an, wobei auch der eingedrückte Brustkasten erschüttert wurde.
Doktor Isidor hatte einen affenartigen Satz nach rückwärts gemacht.
»Die Wissenschaft kann sich irren«, sagte er dann einfach, »diese tote Leiche lebt noch.«
»Lassen wir ihn hier liegen, unter Beobachtung, entschied Georg, dann sein Taschentuch benutzend. »Wollen Sie selbst hier bleiben, Doktor?«
Ja, natürlich übernahm Doktor Isidor diese Beobachtung selbst, und den vier Matrosen schien es sehr recht zu sein, dass keiner von ihnen zum Dableiben aufgefordert wurde.
Denn geheuerlich war es niemandem zumute. Das hier war doch noch ein ganz anderer Fall, als der mit der jungen Inderin, die sich nun als Merlins Tochter entpuppt hatte. Bei der hatte man ja auch nicht gewusst, ob tot oder lebendig, aber bei der hätte sich niemand einer einsamen Wache zu entziehen gesucht. Das hier war eben etwas ganz anderes, etwas gar zu Grausiges, gerade dadurch, dass die ganze Sache durch das meckernde Lachen etwas Humoristisches bekam.
Tatsächlich, keiner der Matrosen hätte mit diesem lachenden Toten allein bleiben mögen, und erst recht nicht, wenn ihm der schreckliche Anblick des zermalmten Körpers durch ein verhüllendes Tuch entzogen würde. Man hätte fortwährend auf das meckernde Lachen gewartet. Der Waffenmeister sagte dann ganz offen, dass es ihm ebenso ginge. Er hätte nicht allein in der Kammer bleiben mögen, auch nicht am hellen Tage, von einer Nacht gar nicht zu sprechen.
Doktor Isidor machte sich nichts daraus, hielt auch ganz allein die Nachtwache, wollte von keiner Gesellschaft etwas wissen. So war dieser Tag, die Nacht und der nächste Morgen vergangen. Ab und zu hatte ja eine der Hauptpersonen — oder auch den Leuten wurde es gestattet, wenn sie den entsetzlichen Anblick einmal haben wollten — das Lazarett betreten.
»Hat er noch kein Lebenszeichen von sich gegeben?«
»Hädd he all wedder meckert?«
So und ähnlich wurde dann gefragt.
Doktor Isidor, der sich die Zeit mit Lesen, Kognak und Selterswasser vertrieb, konnte immer verneinen.
Am Mittag des zweiten Tages kam auch der Waffenmeister wieder einmal ins Lazarett, Doktor Isidor speiste gerade, hatte sich sein Mittagsessen auf dem Operationstisch servieren lassen, direkt neben der Leiche, speiste mit bestem Appetit.
»Hören Sie, Herr Waffenmeister — also diese Leiche ist wirklich tot. Nun gilt's gar keinen Zweifel mehr. Merken Sie nichts?«
»Ich dächte, hier — hier — röche es recht unangenehm.«
»Wenn Sie das ein unangenehmes Riechen nennen, dann sind Sie ein unverbesserlicher Optimist. Die Zersetzung hat bereits heute Nacht begonnen, der Kerl stinkt schon wie ein bereits vor acht Tagen an der jauchigen Wassersucht verreckter Ziegenbock —«
»Und da speisen Sie hier Schweinslendchen à la Jardiniere in Madeirasauce mit Blumenkohl und lecken sich die Finger ab? Na da guten Appetit!«
»Danke. Ich will Ihnen auch sagen, weshalb die Leiche jetzt unbedingt tot sein muss und warum der Kerl so schnell in Verwesung übergegangen ist. Ihnen will ich anvertrauen, den anderen brauchen Sies nicht zu sagen. Ich habe ihm schon gestern Nachmittag eine Blausäureeinspritzung gegeben, eine ganz konzentrierte Lösung, die auch kein echt höllischer Teufel nur eine Viertelminute überlebt. Was sollte denn auch anders geschehen. Zu retten war er doch nicht mehr, und wir werden uns von so einem meckernden Satan doch nicht auch noch im Tode veralbern lassen. Nun aber muss er schleunigst unter die Erde gebracht werden. Das ist, was ich Ihnen sagen wollte, weswegen ich Sie auch gleich aufgesucht hätte. Nur noch das Kompott hier und den Selleriesalat wollte ich mir zu Gemüte ziehen.«
Es geschah. Ein Aufruf, und einige Matrosen meldeten sich freiwillig, um behilflich zu sein, den Toten einzusargen. Auch Georg wollte dabei sein, um eben diesen Matrosen nicht an Heroismus nachzustehen.
Ein Sarg war im Handumdrehen gefertigt, die Leute hatten schon durch das Begraben der vielen Amazonen darin die größte Übung bekommen. An ein Entkleiden der Leiche war bei ihrer Verfassung gar nicht zu denken.
Dagegen wurde jetzt gemerkt, dass dem Toten das linke Unterbein vom Knie an fehlte.
»Ich habe es ihm schon heute Nacht abgelöst«, erklärte Doktor Isidor auf Georgs Frage, »mir fehlte unter meinen anatomischen Präparaten noch eine linke Achillessehne, die habe ich ihm abgenommen, musste ihm dazu natürlich den ganzen Unterschenkel abschneiden.«
»Hädd he dabie gemeckert?«, musste ein Matrose fragen.
Der Fürwitzige bekam für seine Albernheit vom Waffenmeister einen Verweis, sonst wurde dieser ganzen Sache keine Beachtung geschenkt.
In eine Decke gewickelt, eingesargt und zugenagelt, der Kasten wurde nach dem Begräbnisplatze getragen, wo alle die Amazonen unter schlichten Erdhügeln ruhten, immer gleich dutzendweise.
Ein neues Einzelgrab wurde schnell ausgeworfen. Die Patronin hatte sich nicht eingefunden, keiner von ihren Gästen. Dagegen waren noch einige Matrosen und Heizer herbeigekommen.
Es ging ohne jede weitere Zeremonie vor sich.
Da, wie eben zwei Seile um den Sarg geschlungen wurden, prallten die hiermit beschäftigten Matrosen entsetzt zurück.
»Hähähähähähä!«, hatte es ganz vernehmlich in dem Sarge geklungen.
Es lässt sich denken, wie auch alle anderen ganz erstarrt dastanden.
Im Augenblick zuckte durch Georgs Kopf nur ein einziger erklärender Gedanke.
Bauchrednerei!
Unter den Umstehenden war einer, der die Kunst des Bauchredens verstand, er hatte, gottlos, wie die Matrosen und ähnliche Geister nun einmal sind, das meckernde Lachen scheinbar in dem Sarg ertönen lassen. Im nächsten Moment musste Georg diesen erklärenden Gedanken wieder verwerfen.
An Bord des Gauklerschiffes, was für Genies und Kapazitäten es auch sonst barg, befand sich niemand, der diese Kunst verstand. Im Laufe der Jahre hätte dies unmöglich verborgen bleiben können. Und ein Fremder war nicht zugegen, auch Merlin nicht.
Nein, das meckernde Lachen war wirklich in dem Sarge erschollen.
Oskar war es, der zuerst ein Wort fand und so ziemlich das ausdrückte, was jetzt alle dachten.
»Nun schlage Gott den Deibel tot und diesen Kapitän Satin noch extra! Muss denn dieses stinkige Aas auch noch im Sarge feixen und meckern?«
»Öffnet den Sarg!«, befahl Oskar.
Es geschah. Der Tote lag, wie er drin gelegen hatte.
Vorausgesetzt, dass da überhaupt etwas zu unterscheiden gewesen wäre.
Da plötzlich stand unter den anderen auch Merlin, hinter ihm vier fremde Neger in grober Drillichkleidung. Niemand hatte ihr Kommen bemerkt.
»Was hat es mit dieser Leiche für eine rätselhafte Bewandtnis?«, flüsterte Georg geradezu entgeistert.
»Ich weiß es nicht«, entgegnete Merlin ganz ruhig.
»Wir können diesen Mann, der noch Laute von sich gibt, doch nicht begraben —«
»Das sollt Ihr auch nicht. Soeben kamen diese vier Männer zu mir, zu seinen Leuten gehörend. Sie bitten sich die Leiche ihres Kapitäns aus.«
Die konnten sie mit dem größten Vergnügen bekommen, gleich mit dem Sarge.
Und die vier Neger klappten den Deckel wieder zu, hoben den Kasten an den beiden Tragstangen auf und gingen mit ihm davon, verschwanden hinter einer Felsenecke, und mit ihnen auch wieder Merlin.
Die Zurückgebliebenen umstanden das Erdloch und wussten nicht recht, was sie nun anfangen sollten.
Bis ihr Waffenmeister das Wort ergriff.
»Wir wollen den anderen sagen, dass der tote Kapitän im letzten Augenblick von seinen Leuten abgeholt worden ist. Aber davon, wie er hier im Sarge noch einmal gemeckert hat, wollen wir niemandem etwas sagen. Es wird überhaupt mit keinem Worte mehr von ihm gesprochen. Verstanden? Das ist das beste Mittel, um diese alberne Geschichte so schnell wie möglich zu vergessen. Denn sonst, wenn wir weiter über dieses Rätsel grübeln und schwatzen und plappern, dann veralbert uns dieser Teufelskapitän wirklich noch nach seinem Tode.«
So sprach Georg, und so geschah es.
Kommen Sie mit, Waffenmeister?« So wurde dieser am Nachmittage des folgenden Sonntags von Juba Riata gefragt. Dieser Sonntag wurde wie immer in heiliger Stille begangen. In aller Frühe das gewöhnliche Deckwaschen, dann war Schluss aller Arbeit. Sonst gehen die Matrosen am Sonntag, wenn es die Verhältnisse erlauben, ihren Belustigungen nach, aber das musste hier, wo man die ganze Woche hindurch lärmenden Karneval feierte, ausgeschlossen sein.
Dagegen gehört zur seemännischen Heiligkeit des Feiertags unbedingt, dass man sich mit seiner Wäsche und sonstigen Kleidungsstücken beschäftigt. Nicht Zeugwaschen, sondern Ausbessern. Flickstunde.
Und dass der Seemann diese sonntägliche Flickstunde mit so tiefer Inbrunst auffasst, hat auch seinen tiefen Grund. Was soll denn sonst an Bord eines Schiffes daraus werden, wenn man sein Zeug nicht in tadelloser Ordnung zu halten sucht. Der Soldat in der Kaserne kann sich neue Strümpfe kaufen. Aber auf hoher See gibt es die nicht um alles Geld der Welt.
Der Herr Waffenmeister und Kapitän Georg Stevenbrock, in der Batterie auf einer Revolverkanone sitzend, zog eine kleine, glattpolierte Kokosnuss aus dem grauen, plumpen Wollstrumpfe, der aber mehr kostete als manches Paar durchbrochener Seidenstrümpfe und dem jetzt kaum noch das schärfste Auge anmerkte, dass auch dieser Strumpf noch vorhin durchbrochen gewesen war, hinten an der Hacke mit einem tüchtigen Loch, steckte die Stopfnadel sorgfältig vorn ins Hemd und nahm von der Nase die große Stahlbrille, die er, schon etwas weitsichtig, bei solchen feinen Arbeiten trug — eine Arbeit, die er auch als Großadmiral keinem anderen überlassen, anvertraut hätte, so wie tatsächlich Admiral Schröder in den neunziger Jahren als Chef des Nordseegeschwaders noch mit eigener Hand sein Zeug in Ordnung hielt, so wie er auch einmal der versammelten Mannschaft seines Flaggschiffes mit eigener Hand demonstrierte, wie man die Seestiefel »insmürt«, nicht etwa mit der Bürste — »dat taun de Wiewer« — sondern das Fett muss immer fix mit dem Handballen eingerieben werden.
Köstliche Erinnerungen! Wie dieser alte Haudegen in Admiralsuniform vor den Augen von 400 strammstehenden Matrosen einen Seestiefel unter erklärenden Worten mit Fischtran bearbeitete, und wie nun alle die anderen Offiziere vom jüngsten Leutnant an bis zum ältesten Kapitän zur See — Oberst — aufmerksam spannen müssen, zumal es dem alten Admiral Schröder gar nicht darauf ankam, sich dieses Experiment vom nächsten besten Offizier nachmachen zu lassen! — —
»Wohin, mein lieber Juba?«
»Eine halbe Stunde Kanufahrt von hier. Ich habe etwas Merkwürdiges gefunden.«
Dann, wenn Peitschenmüller nicht selbst mehr davon erzählte, fragte Georg auch nicht weiter.
»Ich bin bereit, ich komme mit.«
Er trug sein Zeug weg und erschien bald am Strand in voller Ausrüstung, die aber nur darin bestand, dass er seinem aus Stiefeln, Hose und Hemd bestehenden Anzuge noch einen breitkrempigen Strohhut hinzugefügt, über die eine Schulter eine Decke, über die andere eine Doppelbüchse mit Patronentasche gehängt hatte.
Juba Riata erwartete ihn schon, saß in einem der ledernen Kanus, das allen Anforderungen entsprach und das außer einem zweiten Mann auch noch Pluto aufnehmen konnte, den Bluthund, der freilich still sitzen musste, was das kluge Tier auch von ganz allein tat.
Sie griffen zu den Schaufelrudern und fuhren ab. Peitschenmüller lenkte quer über den See, der hier noch nicht seine ganze Breite hatte.
Gesprochen wurde nicht. Juba Riata war nicht sehr für Unterhaltung. Der konnte einen ganzen Tag lang mit jemandem zusammen sein, ohne einmal den Mund zu öffnen. Wenn er es jetzt doch tat, so musste es auch nötig sein.
»Ich hätte gern auch Doktor Cohn mitgenommen, aber der schlief, und Siddy sagte mir gleich, dass er jetzt nicht wach zu bekommen sei.«
»Haben Sie etwas gefunden, was den Schiffsarzt besonders interessieren dürfte?«
»Ja, in Felsen gehauene Figuren. Doktor Cohn ist doch wohl am besten in der alten Geschichte beschlagen. Verzeihen Sie, wenn ich das annehme. Oder haben Sie inzwischen mehr über das Urvolk erfahren, das einst hier gehaust hat?«
»Nicht mehr, als mir Merlin damals gesagt hat, und das war wenig genug, mehr weiß er wahrscheinlich selbst nicht, und das habe ich ja den anderen berichtet.«
»Nun, ich hielt es für meine Pflicht, Ihnen die merkwürdigen Figuren zu zeigen. Sie können ja dann entschließen, ob alle anderen sie besichtigen sollen. Meine Sache ist es nicht, da zu einem Massenbesuch aufzufordern.«
So sprach Juba Riata, der seinem Charakter eben immer treu blieb, und fiel in sein bisheriges Schweigen zurück. Was hatte es auch für einen Zweck, dass er die entdeckten Figuren näher beschrieb, wenn Georg sie gleich mit eigenen Augen schauen sollte.
Es ging in seinen Seitenarm hinein, ein kleiner See wurde passiert, wieder in einen schmalen Seitenarm, der sich erweiterte, wieder in eine Wasserstraße und so immer kreuz und quer durch weite und enge Geheimschluchten, die immer eine Kanufahrt erlaubten, in ein Labyrinth hinein, aus dem sich Georg allein nicht so leicht wieder herauszufinden getraut hätte, wie man überhaupt bei jedem Eindringen in diese Gebirgsschluchten zur Überzeugung kam, dass hier eine hundertköpfige Schiffsmannschaft ein ganzes Menschenalter forschen konnte, jeder immer auf eigene Faust, und die meisten Schluchten wurden dennoch von keines Menschen Fuß berührt.
»Wir sind am Ziel«, sagte da Juba Riata.
Eine scharfe Biegung des träge fließenden Baches, eine breitete Schlucht eröffnete sich vor ihnen, und der merkwürdige Anblick war vorhanden.
In die glatte, himmelhohe Felswand waren in halber Plastik zwei kolossale, wohl 20 Meter hohe menschliche Gestalten eingemeißelt, Krieger mit Brustharnisch und Beinschienen, auf dem Kopfe einen einfachen Helm, in der rechten Hand ein Schwert, das im Verhältnis des ganzen Riesen etwas klein war, sich mit der linken Hand auf einen Schild stützend.
So schienen die beiden links und rechts stehenden Riesen eine nur schmale Steintreppe zu bewachen, die zwischen ihnen im Felsen hinauf und natürlich auch hineinführte, dadurch einen seltsamen Eindruck machend, dass diese Treppe durch die perspektivische Täuschung immer schmäler zu werden schien, bis sie sich ganz im Finstern verlor.
Das war das erste. Nun weiter befanden sich vor diesen beiden menschlichen Figuren am Boden zwölf Postamente, immer etwa zwei Meter voneinander entfernt, und auf dem einen Postament, auf dem vierten von links, stand eine schlanke Steinsäule, noch etwas höher als die beiden Riesen, dabei kaum einen viertel Meter im Durchmesser haltend, ganz frei auf dem Sockel, indem die schlanke, dünne Säule unten kegel- oder trichterförmig auseinander ging, einen solchen trichterförmigen Ansatz, aber einen bedeutend kleineren, hatte sie auch oben, sodass die ganze Säule einer kolossalen Posaune glich. Und die vielen umherliegenden zylindrischen Bruchstücke verrieten, dass auch auf den elf anderen Postamenten einst solche steinerne Riesenposaunen gestanden hatten. Sie mussten umgestürzt worden sein, sicher von Menschenhänden, denn sonst war schwer zu begreifen, wie auch das breite Kegelstück von dem Postament herabgekommen war.
Nur diese letzte Riesenposaune war stehen gelassen worden.
»Alle Wetter!«, rief da Georg in hellem Staunen. »Am Ende haben wir da gar den Gog und Magog entdeckt!«
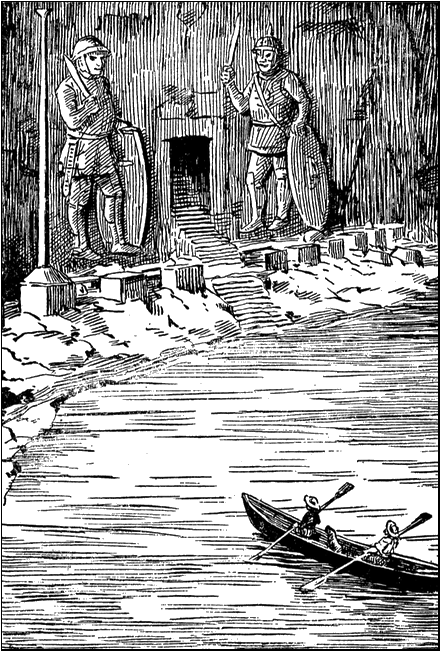
»Alle Wetter!«, rief Georg in hellem Staunen. »Am
Ende haben wir da gar den Gog und Magog entdeckt!«
»Wen?«, wunderte sich Juba Riata. »Was nannten Sie da für Namen?«
Georg berichtete.
Es war sein Zufall, dass er so ausführliche Auskunft geben konnte.
In Guild Hall, dem Rathause von London, stehen vor einer Saaltür zwei Kolossalstatuen aus Holz, gepanzerte und mit dem Schwerte umgürtete Krieger. Der den Fremden führende Portier oder Diener erklärt, dass dies »Gog und Magog« seien, welche Figuren anno dazumal in einem Schutthaufen bei Cornwallis gefunden worden wären. Wahrscheinlich stammten sie aus der Römerzeit.
Mehr sagt der führende Nestor nicht. Mehr weiß er wahrscheinlich auch nicht über diese beiden Figuren. Trotz seiner vielen Ordenssterne und seiner schönen Pumphosen mit Schnallenschuhen. Diese beiden Kerls heißen eben Gog und Magog, und damit basta!
So war es damals, als unser Held das Londoner Rathaus mit seinem Besuche beehrte — und der Schreiber dieses, sei gleich hinzugefügt — und so wird es wohl auch heute noch sein.
Nun braucht man sonst gar nicht so wissbegierig zu sein, kein Gelehrter, um von diesem Gog und Magog noch etwas mehr erfahren zu wollen. Zum Teufel, die beiden Holzfiguren können doch nicht so einfach die sonderbaren Namen Gog und Magog bekommen haben! Es muss doch irgend ein Grund dahinterstecken!
Übrigens, wenn man etwas frömmer wäre, d. h. wenigstens etwas mehr in der Bibel lese, dann würden einem diese beiden Namen gar nicht so unbekannt sein.
Da man sich aber nun leider um diese unerschöpfliche Fundgrube für die ganze Weltliteratur so wenig kümmert, so weiß man gar nichts davon, also schreibt man sich diese beiden Namen einstweilen hinter die Ohren, besser ins Notizbuch und schlägt dann bei Gelegenheit einmal in einem großen Konversationslexikon nach.
Es muss aber, will man mehr darüber erfahren, besonders auch die Quellenangabe, wo man Näheres nachzulesen hat, eine ältere Ausgabe sein. Die neueren Lexika haben sich zu viel mit Erfindungen zu beschäftigen, da werden solche Sachen immer nur mit wenigen Worten abgefertigt.
Die beiden Namen Gog und Magog werden in der Bibel dreimal unabhängig von einander erwähnt.
Das erste Mal im 1. Buch Mosis, 10, 2:
Die Kinder Japhets sind diese: Gomer, Magog, Madai usw.
Also wenigstens der Name Magog kommt vor.
Dann beschäftigt sich das ganze 38. und 39. Kapitel Hesekiel mit Gog und Magog.
Hier ist aber der Gog ein Fürst, ein König, der im Lande Magog herrscht. In diesen beiden Kapiteln weissagt der Prophet, dass nach der Wiederherstellung des Reiches Israels — was also bis heute noch nicht geschehen ist, denn da müssten nach allen Propheten die Juden erst ihren Messias gefunden, nach unseren Begriffen also Christum anerkannt haben — dass dann noch ein letzter, furchtbarer Ansturm der ganzen Heidenmacht unter jenem Gog stattfände, bis er vom Volke Gottes endgültig besiegt würde.
Und zum dritten und letzten in der Offenbarung Johannis Kap. 20, 8.
Und der Satan wird ausgehen zu verführen die Heiden an den vier Örtern der Erde, den Gog und Magog, sie zu versammeln in einen Streit, welcher Zahl ist wie der Sand am Meer.
Hier sind mit diesen beiden Namen also schon zwei Personen gemeint. — —
So weit die Bibel.
Nun gibt es noch heute eine Gegend, eine Stadt, in der noch heute ganz lehhaft von Gog und Magog erzählt wird.
Das ist die Gegend von Astrachan!
Unter der dortigen Bevölkerung zirkulieren noch heute ganz lebhaft die verschiedensten Sagen und historischen Berichte über die Hunnen.
Weshalb? Weil die Hunnen ihre Einfälle aus Asien nach Europa regelmäßig durch die astrachanische Tiefebene genommen haben! Und die sind ja viel öfter eingebrochen, als wir in Mitteleuropa davon wissen. Uns ist historisch beglaubigt nur ihr letzter Zug, der sie so weit nach Westen führte, wonach dieses rätselhafte Volk für immer aus der Weltgeschichte verschwand.
Und die Astrachaner bezeichnen noch heute mit Gog sind Magog zwei hunnische Könige. Das sind aber keine Personennamen, sondern das sind Titel! Die Hunnen sollen stets zwei Könige gehabt haben, von denen der eine den Titel Gog, der andere den des Magog führte.
Und je weiter man nun diese Sache verfolgt, desto interessanter wird sie.
Wir wissen ja von den Verfassungsverhältnissen dieses rätselhaften Nomaden- oder vielmehr Räubervolkes, das einst wie eine Gewitterwolke vernichtend über Europa hereinbrach, herzlich wenig — aber das wissen wir bestimmt, dass die Hunnenhorden, wenn sie im Kriege vereint waren, stets unter zwei Königen standen.
So hat auch Attila ursprünglich einen Mitregenten gehabt: seinen Bruder Bleda.
Attila, diesem ganz gewaltigen Herrschergeist, war dieser Mitregent hinderlich, er ließ ihn ermorden, schwang sich zum Alleinherrscher auf, was, wie wir jetzt genau wissen, bei den Hunnen die größte Ausnahme war. Sonst kannten sie immer nur zwei Könige. Und Attila selbst trug dieser politischen Verfassung seines Volkes Rechnung, indem er als seine Nachfolger doch wiederum gleich zwei Könige bestimmte: den Ellak und den Dengesich.
Nun, und kennen wir nicht noch andere Völker, die stets zwei Herrscher neben einander gehabt haben? Gewiss. Zum Beispiel Japan. Die ursprüngliche Verfassung Japans schreibt immer zwei Regenten vor. Der eine heißt Mikado, was so viel wie »Volksbesitzer« bedeutet, der andere Shogun gleich Landeigentümer.
Erst der jüngst verstorbene Mikado hat die Mitregentschaft des Shoguns beseitigt.
Und dasselbe gilt auch für China. Auch China hat eigentlich immer zwei Regenten gehabt. Das ist uns nur niemals so zum Bewusstsein gekommen. War denn aber nicht zu unserer Zeit immer die Kaiserin-Mutter die eigentliche Herrscherin im Lande? Und den Chinesen war das ganz selbstverständlich. Ihr Sohn war nur Mitregent. Nach ihrem Tode ging die Revolution auch gleich los.
Und was bedeuten denn nun die Namen Gog und Magog?
Man braucht nur hinten das g wegzulassen, dann sind es ganz bekannte Worte. Das ist Chinesisch! Go heißt Mann, der Krieger, und Ma heißt Land. Mago würde also Männerland oder Kriegsvolk heißen.
Und wie haben sich die Hunnen selbst genannt? Sie zerfielen in die beiden großen Nationen der Kutrigoren und der Utigoren, diese wieder in die Horden der Onigoren und Sanigoren.
Man sieht, überall kommt wieder das Go zum Vorschein!
Ebenso wie beim japanischen Siogon, das wäre der Gog, und wird man denn nicht beim Worte Mikado sehr an Magog erinnert? Und nun wollen wir es kurz machen, wollen chinesische Geschichtsforscher sprechen lassen.
Im 2. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung rückte vom Norden her gegen China los mit ungeheurer Kriegsmacht ein rätselhaftes Reitervolk, das man noch nie gesehen hatte. Die Chiungnus, wie sie damals genannt wurden, kleine, untersetzte, überaus hässliche Menschen. Sie wurden nach langwierigen Kämpfen von den Chinesen besiegt. Der eine Teil floh nach Westen, ein anderer blieb im Lande, verschmolz mit den Chinesen, ein dritter Teil schlug sich nach Süden durch, schiffte sich nach den Inseln über, nach dem jetzigen Malaiischen Archipel, kehrte zurück und eroberte für immer die China direkt vorgelagerten Inseln, das heutige Japan.
So berichten chinesische Schriftsteller.
Und so ist es gar kein Zweifel: die heutigen Japaner sind die Nachkommen der ehemaligen Hunnen, vermischt mit chinesischem und malaiischem Blute! Das sieht man diesen Affenmenschen doch überhaupt gleich an, wenn man weiß, wie das Aussehen der Hunnen geschildert wird.
Und nun erinnere man sich der Prophezeiung des alten Hesekiel!
Und dann denke man an die heutige sogenannte gelbe Gefahr. Und dass die Japaner und Chinesen noch einmal über uns herfallen werden, als Buddhisten, also als Heiden, dass es auf der Erde noch einmal zu einem verzweifelten Rassenkampf kommen wird, das ist ja ganz zweifellos! O es ist wunderbar, wunderbar!
Schließlich aber nicht wunderbarer als jene uralte Prophezeiung, wonach das israelitische Volk heimatlos in der Welt umherirren soll, verachtet und verfolgt, und dennoch immer das auserwählte Volk Gottes bleibend, alle Macht in Händen habend. Das Geld!
Und vor 2500 Jahren schon weissagte der Prophet Hesekiel oder Ezechiel von einem furchtbaren Verzweiflungskampfe zwischen dem gesamten Christentum und der gelben Rasse, welcher Kampf jetzt auf wirtschaftlichem Gebiete bereits begonnen hat!
Es ist wunderbar, wunderbar!
So hatte Georg seinem Freunde berichtet. Wenn auch nicht so weitläufig.
Dann aber hatte er noch etwas anderes hinzuzufügen. Unter der Astrachaner Bevölkerung geht noch heute eine spezielle Sage über diesen Gog und Magog.
Die Hunnenfürsten und ihr Volk sind noch nicht ganz von der Erde verschwunden, sie sind noch nicht tot. Hoch oben im asiatischen Norden, irgendwo in einem unbekannten Gebirge, schlafen die beiden, Gog und Magog. Sie lehnen im
Schlaf aufrechtstehend gegen die Felswand, riesige Kriegergestalten, und vor ihnen
stehen zwölf riesige Posaunen. Und im Laufe der Jahrhunderte wird eine dieser
Posaunen nach der anderen umstürzen, und wenn die letzte fällt, dann wird die
Welt von einem furchtbaren Posaunenton erschüttert werden, und dann werden
Gog und Magog erwachen, und die toten Hunnenkrieger werden aus ihren Gräbern steigen, und sie werden die Welt wiederum mit ihrem wilden Kriegsgeheul
erfüllen, alle Kultur vernichtend.
So kann man in älteren Konversationslexika lesen. Im großen Meyer z. B. in der Ausgabe von 1870.
Wie diese Sage entstanden ist, was die zwölf Posaunen bedeuten sollen, weiß man nicht.
Ebenso wenig, wie man weiß, wo der Anfang der Sage mit dem Kaiser Barbarossa herstammt, der im Kyffhäuser schläft, um den die Raben kreisen.
Dagegen ist leicht erklärlich, weshalb diese Sage so lebhaft gerade in der Astrachaner Umgegend zirkuliert. Weil es dort eben noch heute viel hunnisches Blut gibt, man soll es den Leuten gleich ansehen. Da mögen sie dort noch heute von der alten Hunnenherrlichkeit träumen, die selbst einmal das mächtige Rom tributpflichtig machen konnte, mögen diese Zeiten zurückerhoffen. —
»Peitschenmüller, wir haben hier den Gog und Magog mit ihren zwölf Posaunen entdeckt!«
»So sollte an dieser Sage also wirklich etwas Wahres sein?«
»Irgend etwas Wahres ist ja an jeder Sage. Deshalb aber bleibt es doch immer eine Sage. Na, lassen wir das. Jedenfalls haben wir hier den reellen Hintergrund gefunden, auf dem die Astrachaner Fabeln beruhen. Das sind doch zweifellos mongolische Gesichter und hunnische Gestalten, nur ins Riesenhafte übersetzt.«
Ja, das waren sie. Die noch ganz wohlerhaltenen Figuren hatten echte Mongolengesichter, hervorstehende Backenknochen und Schlitzaugen, die Nasen waren nicht abgeschlagen, wie man erst meinen mochte, sondern nur so außerordentlich eingedrückt, und erst jetzt sei erwähnt, dass die Gestalten auch noch für ihre Riesengröße ungemein untersetzte Leiber mit ganz gewaltigen Schultern hatten. Und so werden uns die Hunnen geschildert, nur dass diese sehr klein waren, aber sonst sollen auch sie ganz unförmliche, fast rechteckige Leiber besessen haben, mit gewaltigen Schultern, das Urbild eines Hunnen, dessen Beschreibung am treuesten auf uns überkommen ist, war Attila — und diesen selben Körperbau finden wir auch bei den Japanern! Zumal bei den unteren Kasten, bei den Bauern, Fischern und Schiffern, die ihre hunnische Rasse eben wohl am reinsten erhalten haben.
»Besteht nicht wirklich eine große Ähnlichkeit zwischen unserem Wenzel-Attila und diesen Hunnengestalten?«, meinte Juba Riata.
O ja, sie bestand.
»Schade, dass wir den nicht gleich mitgenommen haben«, setzte Peitschenmüller noch hinzu.
»Na, er wird es ja doch noch zu sehen bekommen.«
»Lieber nicht«, entgegnete Georg scherzhaft. »Der ist imstande und schmeißt diese letzte Posaune gleich um, damit die Hunnen als neue Welteroberer dann wirklich kommen.«
»Und Sie meinen, sie kämen dann auch wirklich wieder?«
Georg warf dem ganz ernsthaften Frager einen Blick zu. Nicht gerade einen erstaunten. Er kannte doch schon seinen Freund.
Es war ein ehemaliger Hinterwäldler und Cowboy, solche Naturmenschen huldigen doch allerhand Aberglauben, und das kam auch bei diesem sonst durchaus gebildeten Manne immer noch einmal zum Durchbruch.
»Na, aus ihren Gräbern auferstehen werden die alten Hunnen wohl nicht wieder«, war dann Georgs Antwort. »Von wem aber mögen wohl diese steinernen Posaunen umgestürzt worden sein?«
Aufmerksam betrachtete Juba Riata die Umgebung. »Von Menschenhänden sind sie nicht umgeworfen worden«, lautete dann sein Urteil.
»Nanu! Wie denn sonst? Wie sollen denn sonst die unteren steinernen Kegel, von denen jeder doch sicher einige Zentner wiegt, von den Postamenten herabgebracht worden sein?«
»Durch Wasserkraft. Dieser Bach muss manchmal übertreten und dann in dieser Schlucht schrecklich hausen.«
Juba Riata erläuterte näher, warum er dies aus gewissen Merkmalen schloss, und Georg musste ihm recht geben.
»Und wohin führt diese Treppe?«, fragte letzterer dann.
»Bis zum Gebirgskamm hinauf, auf ein Plateau.«
»Sie waren schon oben?«
»Ja, heute früh. Man hat eine Stunde tüchtig zu steigen.«
»Und was sieht man oben?«
»Nach der einen Seite überblickt man unser Tal, nach der anderen sieht man in die freie Steppe hinab.«
»Sonst nichts weiter Interessantes?«
»Nach ungefähr zehn Minuten Steigens kommt man in eine Region, wo links und rechts von der Treppe Höhlengänge abzweigen. Da zeigte mir Pluto an, dass in solch einen Gang eines menschliche Spur führe.«
»Sie haben sie verfolgt?«
»Nicht sehr weit.«
»Weshalb nicht?«
»Es war ein ganzes Labyrinth von Gängen, ich hatte keine Lampe bei mir und alles Holz im Walde war heute früh noch zu feucht, um es als Fackel zu benutzen. Da habe ich mir erst eine Laterne besorgt.«
»Dann wollen wir die Spur einmal verfolgen!«
»Ich wollte Sie dazu auffordern.«
Sie erstiegen die etwa vier Meter breite Steintreppe. Auf den Stufen stand hier und da noch Wasser, indem es heute Nacht geregnet hatte, in diesem schattigen Gange, der sich immer tiefer in die Felsen hineinzog, trocknete es nicht so schnell ab, und daher war es auch erklärlich, dass der sonst so vorzügliche Spürhund nicht schon auf dieser Treppe die menschliche Fährte gewittert hatte, sie war vom Regen verwaschen worden.
Nach etwa zehn Minuten Steigens kamen zu beiden Seiten die Höhlengänge und in einem solchen zur rechten Hand zeigte Pluto alsbald auch wieder eine Spur an, gleich durch sein Benehmen verratend, dass sie von einem Menschen herrühre.
»Wie ich aber meinen Pluto verstehe«, meinte Juba Riata, »so ist es ihm kein ganz fremder Mensch. Mindestens weiß er schon im voraus, dass wir ihn nicht zu fürchten brauchen.«
»Es wird einer von der indischen Gesellschaft sein.«
»Das denke ich auch. Und auch wenn Pluto diesen Menschen selbst noch nicht gewittert hat, so wird es doch dieselbe Witterung sein, die dieser ganzen Gesellschaft wie jeder, die sich für sich hält, nun einmal anhaftet. Aber wird es einer solchen Person auch angenehm sein, wenn wir ihr nachspüren, da wir diesen Leuten doch Rücksicht schuldig sind?«
»Nun, wenn wir stören, so können wir uns ja sofort wieder zurückziehen. Sonst aber können wir doch nicht wissen, auf wessen Fährte wir uns befinden.«
Sie entzündeten ihre Taschenlampen und drangen ein, der Hund voran.
Er führte sie kreuz und quer durch Gänge, die leicht zu begehen waren, aber auch ein wahres Labyrinth bildeten, bis sie an eine hinaufführende Treppe kamen, die Juba Riata heute früh noch nicht erreicht hatte. Pluto führte sie hinauf, höher und immer höher, drei normale Etagen hoch sicher, ehe wieder ein horizontaler Gang kam, da zeigte der Hund Unruhe, und da sahen sie auch schon deren Ursache.
In der Ferne schimmerte ein Lichtchen. Mit verdeckten Lampen schlichen sie vorwärts, und ganz besonders Georg leuchtete sich dabei vor die Füße, denn er dachte lebhaft an jene Rutschpartie, die ihn damals auch in solch einem finsteren Gange, als er in Begleitung Juba Riatas ebenfalls solch einem viereckigen Scheine zugestrebt war, plötzlich in die fatale Gefangenschaft der Amazonen befördert hatte.
Und wie ward ihm nun, als er den viereckigen Lichtschein, also einfach ein erleuchtetes Fenster, erreichet hatte und hindurchblickte.
Er sah nämlich so ziemlich genau dasselbe wie damals! Es war eine Felsenklause mit derselben Einrichtung, dasselbe Lagerbett mit allen anderen Hausgerätschaften, an der Wand dieselben schwarzen Rüstungen und mächtigen Schwerter, für einen Riesen bestimmt, derselbe Tisch mit derselben brennenden Lampe darauf, mit derselben aufgeschlagenen Bibel in deutscher Sprache, und schließlich auch derselbe Humpen.
Aber nicht, dass es dieselbe Felsenkammer gewesen wäre. Jene, nach der sie aus der Eisgrotte gelangt waren, befand sich ja ganz, ganz anderswo, lag jenseits des Sees. Es war überhaupt eine andere Kammer, das sahen die scharfen Augen dieser beiden Männer gleich, sie war größer als jene erste, hatte viel mehr aus dem Stein gehauene Vorsprünge und Konsole, dagegen war die Fensteröffnung kleiner, aber hier nicht durch eine Glasscheibe verschlossen.
Aber sonst war die Einrichtung der Klause dieselbe, und sie musste auch denselben Bewohner haben.
Nun, jener Klausner war einfach umgezogen, von dort hierher, vielleicht war jenes Erlebnis der beiden daran Schuld, weil sie ihn in seiner Einsamkeit aufgespürt hatten, und nun mussten sie ihn hier zufällig zum zweiten Male finden.
Da bewegte sich an der Wand ein Vorhang aus Sackleinen, schnell wichen die beiden zurück, ohne den Blick durchs Fenster zu verlieren.
Ein Mann trat herein, ein Hüne, ein Riese, herkulisch gebaut, ganz schwarz gekleidet, in einem altertümlichen, holländischen Kostüm.
Der riesenhafte, schwarzgekleidete Mann mit der schwarzen Maske!
Es kam den beiden gar nicht so überraschend.
Sie hatten sich schon einmal darüber unterhalten, ob dieser Schwarzmaskierte unter den exotischen Gästen nicht vielleicht jener Klausner sei.
Wenn sie den damals auch gar nicht zu sehen bekommen hatten.
Aber es lag gar zu sehr auf der Hand. Diese kolossalen Ritterrüstungen passten nur für solch eine kolossale Gestalt.
Und dann hatte man, so gut die schwarze Maske auch das Gesicht bedeckte, doch noch etwas Haut zu sehen bekommen, und die war schneeweiß gewesen, danach konnte sich dieser Mann nie Sonne und Wetter aussetzen, musste sich immer in geschlossenen Räumen aufhalten.
Auch aus seinem Verhalten während der Vorstellungen konnte ein scharfer Beobachter mancherlei schließen.
Wohl verfolgte er alles mit größter Aufmerksamkeit, aber nie äußerte er eine Teilnahme, mochten sich seine sonst so ernsten, würdevollen Begleiter, die bärtigen Inder, auch noch so von der Begeisterung hinreißen lassen, niemals lachte er — und dennoch sah man deutlich, wie es in ihm zuckte. Er wusste sich eben mit aller Gewalt zu beherrschen.
»Zweifellos gehört er mit zu jener geheimen Gesellschaft, in der Schwester Anna eine Hauptperson ist, noch weit über Merlin und dem Fürsten des Feuers stehend, und jedenfalls ist auch er einmal ein Abtrünniger gewesen wie der Kapitän Satin, oder er hat sich sonst etwas zuschulden kommen lassen, wofür er nun büßen muss, in der Einsamkeit, und wenn er hier zu unseren Vorstellungen mitgenommen wird, so ist auch das ihm nur eine Strafe, eine Qual, indem er sich vollkommen teilnahmslos zeigen muss, wie es in ihm auch kochen mag.«
So hatte Georg damals gesprochen, als er mit Juba Riata die Vermutung ausgetauscht, dass sie in der schwarzen Maske jenen ihnen unsichtbar gebliebenen Klausner vor sich haben könnten.
Übrigens hatte die schwarze Maske nur an jenem ersten Tage den Vorstellungen beigewohnt, dann war sie nie wieder unter der indischen Gesellschaft gesehen worden, die tagtäglich den Spielen der Argonauten beiwohnte, allerdings ohne sich diesen sonst irgendwie zu nähern.
Und nun zeigte es sich, wie die beiden mit ihrer Vermutung recht gehabt hatten.
Der Eintretende war die sogenannte schwarze Maske. Aber die hatte er jetzt nicht vors Gesicht gebunden. Und es war ein ungemein gutmütiges Gesicht, das die beiden erblickten, geschmückt mit einem blonden Knebelbart, mit großen, blauen Augen, wozu man sich nun noch einen wahren Löwenkopf vorstellen muss, umwallt von einer blonden Löwenmähne.
Mit einem tiefen Seufzer ließ sich der Hüne auf dem schweren Stuhle nieder, dass dieser krachte, und begann in der alten Bibel zu lesen.
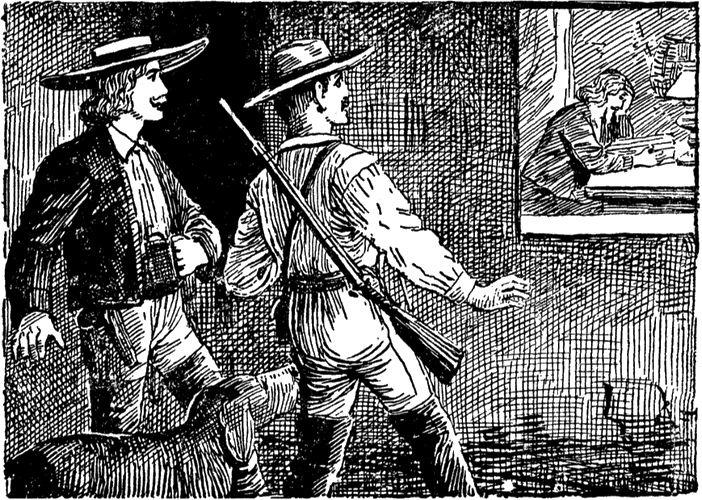
Nun konnten die heimlichen Beobachter sein Gesicht erst recht richtig im Lampenschein betrachten.
Ja, das Gesicht war weiß wie frischgefallener Schnee, aber von einem kränklichen Aussehen gar keine Spur, es war nicht nur dick, nicht nur pausbäckig, sondern es strotzte von runden Muskeln — und solche muskulöse Gesichter gibt es, man betrachte Tizians Simson! — es strotzte von Muskeln, wie die schneeweißen Hände und Finger, wie die ganze Hünengestalt, und die kerngesunde Lebenskraft leuchtete vollends aus den blauen, geradezu mächtigen Augen.
Ja, etwas melancholisch war dieses von der flachsblonden Löwenmähne umrahmte Germanengesicht. Aber vor allen Dingen war darin eine so außerordentliche Gutmütigkeit ausgedrückt, dass man alles andere darüber vergaß.
Ein naives, ewig heiteres Riesenkind, das mit seinen sonnigen Augen vertrauensvoll auch in die schwärzeste Zukunft blickt, nur gegenwärtig, weil es sich einsam fühlte, etwas niedergeschlagen — das war der Eindruck, den man von diesem riesenhaften Manne bekam, immer deutlicher, je länger man ihn betrachtete, und der gewaltige Knebelbart konnte diesen kindlichen Eindruck nicht stören,
Übrigens las er nicht lange in der Bibel.
Plötzlich stutzte er, seine leuchtenden Augen flammten noch mächtiger auf. Was war es für eine Bibelstelle, die ihn plötzlich so fesselte?
Nein, keine göttliche Offenbarung war es, die ihn inspirierte.
Oder vielleicht doch.
Über das Bibelblatt kroch etwas.
So gut war die Beleuchtung und so nahe standen die beiden Späher, dass sie deutlich sehen konnten, dass es eine kleine Spinne war. Ein Holzspänchen genommen und die Spinne vorsichtig vom Blatt gehoben und auf den Tisch gesetzt, die Bibel als vorläufig überflüssig zurückgeschoben.
Die Spinne wollte das Weite suchen.
Schnell den Humpen hergenommen, etwas von der Flüssigkeit — und es schien nichts weiter als Wasser zu sein — auf den Tisch gegossen und um die Spinne einen nassen Kreis gezogen.
So, die war vorläufig gefangen, innerhalb eines mit Wasser gefüllten Burggrabens.
Aber sie sollte nicht gefangen bleiben, oder als Arrestant doch etwas mehr Bewegungsfreiheit genießen.
Auf dem Tische lag ein Stück Holz, mit einem Federmesser winzige Spänchen abgeschnitzelt, und der Riese begann mit seinen muskulösen Fingern ein winziges Brückchen über den Burggraben zu bauen, nachdem er noch eine zweite Wasserbarriere herumgezogen hatte.
Wir wollen einmal mit Georgs Kopfe denken.
Na, das kann ja noch gut werden! dachte der. Nämlich wenn wir hier bleiben und weiter beobachten wollen, was der mit der Spinne noch alles anfängt.
Denn man weiß doch, auf was für Gedanken und Beschäftigungen ein intelligenter Mensch kommen kann, wenn er eingesponnen ist. Deshalb braucht man ja nicht gerade selbst schon hinter schwedischen Gardinen gesessen zu haben. Schaden tut es übrigens nichts. Kein braver Journalist, der nicht einmal gebrummt hat, sagte Bismarck. Oder wenn es wenigstens einmal der Karzer gewesen ist. Dann kann man mitsprechen. Es gehört wie mit zur allgemeinen Bildung, wenn man anfängt, eine Wanze zu dressieren.
Doch hier sollte das Spielchen bald beendet sein.
Mit einem Male war das Spinnchen aus seiner Wasserfestung verschwunden. Musste wohl in den weiten Ärmel gekrochen sein.
Der Riese hielt sich nicht lange mit einer Verfolgung des Flüchtlings auf.
Seinen gewaltigen Büffelschädel mochten dabei doch auch andern Gedanken durchkreuzt haben.
Plötzlich, wie er zur Decke emporblickte, nahm sein gutmütiges Gesicht doch einen recht, recht melancholischen Ausdruck an, und mit einem tiefen, tiefen Seufzer kam es über die bärtigen Lippen, in unverfälscht deutscher Sprache:
»O Gog und Magog, wann endlich werdet Ihr erwachen, wann endlich wird die letzte Posaune tönend stürzen, damit ich mit Euch kämpfen kann?«
Draußen die beiden blickten sich an.
Dann winkte Georg, schritt unhörbar davon, von wo er gekommen, und Juba Riata folgte ihm.
»Es widerstrebt mir«, sagte Georg dann, als sie außer Hörweite waren, »diesen Einsiedler heimlich zu beobachten und zu belauschen. Ebenso auch, mich ihm zu zeigen. Seine Einsamkeit muss doch eine freiwillige sein, denn er hätte doch wohl Gelegenheit, zu entfliehen. Also wollen wir ihn nicht stören. Ich werde Merlin über ihn einmal fragen, und erhalte ich nur einen abweisenden Wink, so soll er mir genügen. Ich habe keine Ursache, mich in das Treiben dieser Menschen zu mischen, die ich als ganz vortreffliche erkannt habe.«
So sprach Georg, und einem Juba Riata genügte das. Nur noch eine Frage hatte letzterer.
»Er wartet darauf, bis die letzte Posaune ertönt und umstürzt, um dann mit Gog und Magog kämpfen zu können?«
»So sagte er. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Vielleicht auch geistig umnachtet. Ich weiß es nicht.«
Hiermit war diese Sache erledigt für die beiden Männer.
Sie setzten das Ersteigen der Treppe fort. Bald war die Anfangsspalte, obgleich die Treppe schnurgerade emporstieg, hinter ihnen kaum noch zu sehen, ebenso sah man über sich nur einen ganz schmalen Streifen des Himmels, infolgedessen wurde es immer dunkler, wenn auch nicht so, dass man die Laternen hätte benutzen müssen.
Und eine Hitze!
»Das ist ja der wahre Backofen, der unterm Äquator geheizt wird«, meinte Georg, sich den perlenden Schweiß von der Stirn wischend.
»Ja, es herrscht eine drückende Schwüle«, entgegnete Juba Riata, »es gibt sicher ein Unwetter.«
»Ein Unwetter? Wir hatten doch vorhin das herrlichste Wetter?«
»Das muss sich unterdessen geändert haben, wir konnten die aufsteigenden Wolken in der engen Schlucht nur nicht beobachten, von hier aus können wir es noch weniger. Aber das ist nicht nur eine gewöhnliche Hitze, die in diesem Kamin liegt. In der Atmosphäre bereitet sich etwas vor, ich fühle es ganz deutlich. Wir wollen uns beeilen, in diesem Kamin dürfen wir uns keinesfalls von einem Unwetter überraschen lassen.«
»Weshalb nicht? Was soll da für eine besondere Gefahr vorhanden sein?«
»Denken Sie nur, wenn jetzt ein heftiger Regenguss kommt, ein Wolkenbruch, nur ein kleiner braucht es zu sein. Wie ich das Plateau dort oben heute früh gesehen habe, so muss alles Wasser hier herabfließen. Wir geraten in einen Sturzbach, werden einfach fortgespült, können uns nur gleich verloren geben.«
»Au weh!«, machte Georg erschrocken. »An solch eine Möglichkeit habe ich noch gar nicht gedacht. Da wollen wir uns beeilen, wenn Sie so stark ein Unwetter vermuten. Oder wollen wir lieber umkehren?«
»Nein, lieber hinauf. Denn mehr als dreiviertel der Strecke haben wir schon hinter uns, und wenn es hinab auch schneller geht, das letzte Viertel aufwärts geht doch noch schneller.«
»Dann mal los!«
Sie nahmen immer gleich zwei Stufen auf einmal, was bei deren Beschaffenheit nur mit sehr großen Schritten möglich war. So ging es noch eine Viertelstunde lang hinauf, und nur solche ausgebildete Sportleute und Athleten, wie die beiden es waren, konnten dabei nicht außer Atem kommen, vermochten dies überhaupt auszuhalten.
Aber wie aus dem Wasser gezogen waren sie doch, als sie oben ankamen, einfach von der letzten Stufe hinaus und hinauf auf das freie Plateau tretend.
Weitere Umschau über das Plateau hielt Georg jetzt nicht, er hatte zunächst etwas anderes zu betrachten — den Himmel!
Es hatte seinen guten Grund gehabt, dass es in dem Treppenkamine so dunkel gewesen er und dass der auch dann, als oben die Spalte sich für das Auge wieder verbreiterte, nicht heller werden wollte. Die beiden hatten über sich immer einen tiefblauen Himmel zu sehen gemeint, einfach deshalb, weil dieser Himmel so beschaffen gewesen war, von keinem Wölkchen getrübt, als sie sich noch unten in der Schlucht befunden hatten.
Jetzt aber sahen sie, dass dieser Himmel nicht tiefblau sondern pechschwarz war! Nur im Westen hatte er eine schwefelgelbe Färbung. Und auch hier oben herrschte jetzt in der fünften Nachmittagsstunde des Junitages eine Dunkelheit, dass man kaum noch zehn Schritte weit deutlich etwas sehen konnte.
Sonst war es jetzt bei drückender Schwüle noch völlig windstill, soeben kamen die ersten großen Tropfen herab, die auf dem heißen Steinboden sofort wieder verdunsteten.
»Alle Wetter, Juba — Sie haben recht gehabt — das gibt etwas, wie wir es hier in Sibirien noch nicht erlebt haben dürften!«
Kaum hatte Georg dies gesagt, als durch die Atmosphäre ein eigentümliches Sausen ging, eine Windsbraut kam angefegt, die gegen die bisherige Wärme geradezu eiskalt zu nennen war, und sie war es, die das ganze elektrische Spielwerk mit allen Nebenerscheinungen in Gang brachte.
Die erste Vereinigung der gespaltenen Elektrizität vollzog sich hier in dieser Gegend, vom Himmel lief zur Erde herab ein Blitz, der schon mehr eine gezackte Feuersäule zu nennen war, das fast gleichzeitige schmetternde Krachen war für das menschliche Trommelfell kaum noch zu ertragen, dann plötzlich stand der ganze Himmel unter einem Mordsspektakel in Flammen, und gleichzeitig begann das herabzuprasseln, was der Engländer beim Regnen »Bindfaden und Stricke« nennt.
»Wir müssen einen Schutz suchen.«
Das sagten aber die beiden nicht, sondern wie auf Kommando, als hätten sie es sich erst sorgfältig einstudiert, fassten sich die beiden plötzlich bei den Händen und rannten, was sie rennen konnten, der nächsten Felsformation zu, die sich auf dem Plateau erhob, und fanden auch wirklich gleich einen überhängenden Felsen, der sie vor dem Wassergusse vollkommen schützte.
Kaum hatten sie diesen Zufluchtsort erreicht, wohl schon tüchtig nass, aber doch noch nicht bis auf die Knochen, als Georg den dröhnenden Donner mit seinem schallenden Gelächter vermischte.
»Nun hört aber doch wirklich alle Gemütlichkeit auf! Solch einen plötzlichen Ausbruch eines Gewitters habe ich in der besten, gewitterverseuchtesten Tropenregion nicht erlebt — so deutlich habe ich noch nie mein Herz in die Hosen rutschen gefühlt!«
So lachte Georg aus vollem Halse, und merkwürdiger Weise stimmte auch der sonst so ernste Juba Riata ebenso herzlich mit ein. Eben weil er selbst ganz das gleiche Gefühl gehabt hatte.
Diese beiden Männer hatten sich einmal ins Bockshorn jagen lassen. Sonst machten sie sich ja nichts weiter daraus. Es war ein tüchtiges Gewitter mit einem tüchtigen Regenguss, nichts weiter. An eine Gefahr für ihre Gefährten dachten sie gar nicht, ebenso wenig an eine eigene hier oben. Wo sollte denn eine Gefahr liegen?
Anders war es, wenn sie daran dachten, wenn sie jetzt noch auf halbem Wege in dem Treppenkamin gesteckt hatten.
Diese Treppe war in Bezug auf solche Witterungsverhältnisse so unglücklich als möglich angelegt worden.
Aber es war ja überhaupt eine natürliche Felsenspalte, deren Boden ganz schräg hinaufging, bis er auf dem Plateau endete, und das, was die Natur geboten, hatte man eben zu einer Treppe benutzt, Stufen herausgemeißelt.
Diese Spalte, einige hundert Meter lang, lag an der tiefsten Stelle des Plateaus, das, sonst ganz eben, sich von allen Seiten hin darauf zu senkte, also musste auch alles Regenwasser nach dort abfließen, sich in die Spalte ergießen, die jedenfalls überhaupt hierdurch erst entstanden war, durch Auswaschung im Laufe der Jahrtausende. Also das, was man in Amerika einen Cañon nennt. Die Ureinwohner mochten sie deshalb, ehe sie die Treppe anlegten, mit einer Mauer umgeben haben, eben um das Regenwasser abzuhalten, es waren noch, wie spätere Untersuchungen ergaben, einige Spuren davon erhalten, jetzt aber floss alles Wasser von allen Seiten dort hinein.
Die unter dem Felsen Weilenden konnten es deutlich beobachten. Sie waren nur 20 Schritte von der Spalte entfernt, die unaufhörlichen Blitze sorgten für die nötige Beleuchtung. Von allen Seiten floss das Regenwasser gerade auf diese Spalte zu, ergoss sich hinein. Dazu brauchten ja nicht etwa große Fluten anzukommen, das Wasser berührte nicht den Fußrücken, aber bei einer Länge von einigen hundert Metern — und die Größe des ganzen Plateaus kannten sie noch gar nicht — genügte das schon, um dort in dem Kamin einen wütenden Gießbach zu erzeugen. Später sollten sie es auch mit eigenen Augen erblicken.
Jetzt wollten sie sich lieber im Trocknen halten, sich nicht unnötig noch nässer machen. Und diese Vorsicht war sehr gut. Das Gewitter verzog sich schnell, aber der Regen währte fort. Stundenlang goss es in Strömen vom Himmel herab, und als er endlich nachließ, es nur noch leise rieselte, da war schon längst die Nacht angebrochen, eine stockfinstere Nacht. Die Treppe mochte wieder begehbar sein, aber sie dachten nicht daran, jetzt hinabzusteigen, dazu hatten die beiden zu große Erfahrung, brauchten sich gar nicht erst zu beraten. Dass dort unten noch ihr Boot lag, darauf durften sie nicht hoffen. So gut sie es auch befestigt hatten, der stundenlange Regenguss musste dort unten in der engen Schlucht den sonst so friedlichen Bach ganz sicher in einen reißenden Strom verwandelt haben, der hatte das Kanu losgerissen, das war mit den beiden wasserdichten Decken und einigem Proviant auf und davon gegangen, daran war ja nun gar kein Zweifel.
Und was sollten sie dort unten in der Stockfinsternis herumtappen, da nützten ihre Taschenlämpchen nicht viel. Nein, sie mussten hier oben die Nacht verbringen, den Morgen erwarten.
Also sie machten es sich so bequem als möglich, jeder suchte sich — ironisch gesprochen — auf dem harten Stein die weichste Stelle aus, für den Kopf ein steinernes Kissen, und bald war Georg sanft entschlummert.
Wenn er sich dann recht erinnerte, so musste er etwas von einem jüngsten Gericht geträumt haben, als er erwachte.
Wieder goss es in Strömen vom Himmel herab.
Aber das war es nicht, weshalb er plötzlich in Todentsetzen auf seine Füße sprang.
Ein Ton erschütterte die Luft, der sich unmöglich beschreiben lässt.
Es war nicht anders, als ob hunderttausend Posaunen gleichzeitig mit seinem einzigen Tone schmetterten. Die Schwingungen der Luft waren so furchtbar, dass sie das Trommelfell zu zerreißen drohten. Unwillkürlich hielt sich denn Georg auch gleich die Ohren zu, er konnte den schrecklichen Ton aber dennoch kaum ertragen.
Glücklicherweise nur wenige Sekunden, dann nahm die Stärke schnell ab, wie in weiter Ferne verlor sich der schreckliche Ton.
»Um Gotteswillen, Juba, was war das?«
Neben ihm stand Peitschenmüller, er war nicht minder entsetzt, man hörte es gleich seiner Stimme an.
»Das war die Posaune des jüngsten Gerichts, anders weiß ich es nicht —«
Wieder geschah etwas, dass sich die beiden erschrocken packten, um nur ihre gegenseitige Nähe zu fühlen.
Ein furchtbares Krachen erscholl, das diesmal aber weniger die Luft, als vielmehr den ganzen Felsen in Schwingungen versetzte, das ganze Plateau erzittern ließ.
Noch ein nachfolgendes Poltern, es verklang und wieder herrschte Stille, bis auf den heftig plätschernden Regen.
»Um Gott, Juba, was war das nun wieder?«
»Da ist eine unterwaschene Felswand eingestürzt«, konnte der Gefragte jetzt mit Ruhe antworten.
»Und was war das für ein furchtbarer Posaunenton?«
Auch hierfür wusste Juba jetzt eine Erklärung.
»Es ist nicht nötig, dass wir glauben, Gog und Magogs letzte Riesenposaune habe diesen Ton von sich gegeben. Ich habe solch einen fürchterlichen Posaunenton schon einmal gehört, in Amerika, im Felsengebirge, und konnte seine Entstehung sogar mit den Augen beobachten. Ein unterirdischer Wasserlauf, bisher eingeschlossen, gewann plötzlich die Freiheit, und wie das Wasser aus der Felsenröhre hervorbrach, da erscholl auch solch ein merkwürdiger Ton von furchtbarer Heftigkeit.«
Ja, da kam dem Waffenmeister plötzlich die Erkenntnis. Auch er hatte solch einen Posaunenton schon einmal gehört. Wohl auch jeder Leser zu Hause. Nur nicht mit solcher Heftigkeit.
In der Wasserleitung erschallen manchmal solche Töne. Das Wasser staut sich durch irgend ein Hemmnis, wahrscheinlich auch mit Luft vermengt, dadurch kommt die ganze Röhrenleitung oder ein Teil davon in Schwingungen, diese teilen sich der Luft mit, und in dem Hause vibriert ein eigentümlicher, machtvoller Ton, an eine Posaune erinnernd.
Und was hier in einer künstlichen Röhrenleitung geschieht, das wird die Natur wohl auch im großen ausführen können. Tatsächlich im amerikanischen Felsengebirge, wie aber auch besonders im Sinaigebirge, das ebenfalls mit engen Wassertunnels durchzogen ist, sind solche vibrierenden Posaunentöne öfters zu hören. Hier ist es der Stein, der ganze Felsen, der die Schwingungen aufnimmt und fortpflanzt und sie an die Luft abgibt, welche die Schwingungen in Töne umsetzt, wodurch aber natürlich auch ganz andere Töne entstehen als in den dünnen Eisenröhren einer Wasserleitung.
Es war gerade Mitternacht gewesen, als dies passiert war. Noch zwei Stunden lang goss es in Strömen vom schwarzen Himmel herab, dann hellte sich dieser plötzlich auf, und da setzte in dieser hohen nordischen Breite auch schon die sommerliche Morgendämmerung ein.
Regnen tat es nicht mehr, aber noch immer floss reichlich Wasser ab, die beiden begaben sich hin nach der Spalte und sahen nun erst recht, wie das sich hinab ergießende Wasser dort unten einen Sturzbach bildete, der natürlich an Fürchterlichkeit immer zunahm, je weiter er sich von dem Ausgange der Spalte entfernte. Denn da kam doch immer mehr Wasser hinzu. Da hätte sich kein Mensch und auch kein Elefant halten können, er wäre wie ein Stäubchen fortgespült worden.
Unterdessen, bis das letzte Regenwasser vollständig abgeflossen war, schritten die beiden an der Spalte entlang, um an den Rand des Plateaus zu kommen, von wo man, wenn das Terrain günstig war, in die Talschlucht hinabblicken können musste.
Sie sollten eine schauerliche Entdeckung machen. Wohl legten sie ungefähr 300 Meter zurück, wohl erreichten sie den Rand des Plateaus, aber die ursprüngliche Grenze, die das Plateau noch gestern gehabt, war das nicht mehr!
Der Felssturz war in ihrer dichten Nähe erfolgt, die Felswand zu beiden Seiten des Treppenkamins war abgebrochen, in sich zusammen in die Tiefe gestürzt! Das konnten sie aus den frischen Bruchstellen ganz deutlich erkennen. Ja, es war seine ganz schauerliche Entdeckung die sie da machten. Wohl waren sie noch 500 Meter von dieser Bruchstelle entfernt gewesen, wieviel abgestürzt war, konnten sie nicht beurteilen, jedenfalls aber hätten noch ganz andere Felsenmassen zusammenbrechen können, auch noch die Stelle, auf der sie gelegen, zumal man annehmen musste, dass der ganze Felsen unterwaschen war, und dann wären auch sie unter Trümmern begraben gewesen.
Und fürchterlich sah es dort unten aus, in einer Tiefe von 900 bis 1000 Metern. Georg konnte es deutlich mit bloßen Augen erkennen.
Die ganze Talschlucht, durch die gestern noch ein harmloses Bächlein geflossen war, hatte sich in einen tobenden Strom verwandelt, und dort, wo sich die Trümmer der abgestürzten Felswand auftürmten, kochte es erst recht in fürchterlicher Weise.
»Da steht auch die letzte Posaune nicht mehr«, meinte Juba Riata.
»Und die beiden steinernen Riesen sind lebendig geworden«, fügte Georg hinzu.
»Lebendig geworden?«
»Na, sie haben doch wenigstens ihren alten Platz verlassen.«
Ja natürlich, die standen nicht mehr dort unten als Wächter neben der Treppe, dieser ganze Teil war ja zusammengebrochen.
»Merkwürdig«, sagte Juba Riata kopfschüttelnd, »so haben sich Gog und Magog in dieser Nacht wirklich bewegt, und dies geschah unter einem schmetternden Posaunentone und gleich darauf brach diese Posaune selbst zusammen. Merkwürdig! Da möchte man wirklich an Prophezeiungen glauben.«
»Hören Sie, Juba, wir wollen lieber nicht über diese alte Fabel nachgrübeln, wir wollen lieber Gott danken, dass wir gestern Nachmittag hier heraufgeklettert sind. Denn wenn wir unten geblieben wären, dort unten einen Schutz vor dem Regen gesucht hätten in einer Höhle oder unter einem Baume, dann lägen wir jetzt ganz sicher dort unter den Felsmassen begraben. So haben wir nichts weiter als den Verlust unseres Kanus zu beklagen. Und dann freilich dürfen wir nicht mehr daran denken, dass wir noch die Treppe benutzen können. Die Schlucht erreichen wir auf ihr wenigstens nicht mehr, auch später nicht, wenn sich das Wasser verlaufen hat. Oder wir müssen uns auf eine halsbrecherische Kletterpartie gefasst machen.«
Natürlich, die Felswand war ja auf beiden Seiten der Treppe niedergebrochen. Wenn die Trümmer auch den Kamin nicht gefüllt hatten, so lagerten die Schuttmassen doch dicht davor, wie man es auch von hier oben aus erkennen konnte. Und das waren Schuttmassen, die sich nicht so leicht überklettern ließen, zumal doch alles nur lose zusammenhing, jeder Tritt konnte die ganze Masse wieder in Bewegung bringen, eine neue Zusammenbruchskatastrophe herbeiführen. Sie begaben sich zurück ans Ende der Treppe und stiegen dennoch hinab. Untersucht musste die Sache ja doch werden.
Nachdem sie die Höhlenregion passiert hatten, sahen sie schon, dass sie nicht viel weiter kommen würden. Vor ihnen war der Kamin mit Wasser gefüllt, das zwar seitwärts in dem engen Schachte still sein musste, aber dort türmten sich die Trümmermassen auf, zwischen denen es fürchterlich kochte.
»Juba, das sieht gar nicht danach aus, als ob wir jemals diese Treppe wieder benutzen könnten, um das Freie zu gewinnen.«
»Und außerdem steigt das Wasser noch«, setzte jener hinzu.
Nur eine kurze Beobachtung und Georg musste es bestätigen.
Schon nach fünf Minuten war das Wasser an der Treppe um mindestens einen Zentimeter höher gestiegen.
»Da wollen wir doch lieber gleich einmal sehen, was aus unserem Einsiedler geworden ist, jetzt ist Grund vorhanden, ihn anzusprechen. Wenn das Wasser noch länger so steigt, dürfte es uns zuletzt den Tunnel verschließen.«
Sie stiegen wieder empor. Plato nahm in dem betreffenden Höhlengange wiederum die Spur auf.
Beim weiteren Vordringen aber machten sie eine seltsame Entdeckung. Der Hund führte die unterirdische Treppe hinauf, den gestrigen Gang entlang, blieb stehen — zweifellos befanden sie sich an der Stelle, wo gestern das Fenster gewesen war, doch von diesem war jetzt keine Spur mehr zu bemerken.
Pluto führte sie auch noch weiter, offenbar der Fährte des Einsiedlers folgend, blieb aber wiederum an einer nackten Felsenwand stehen. Hier musste der Klausner seine Tür benutzt haben, von der aber nichts zu bemerken war, die nicht geöffnet werden konnte, wie man auch nach einem geheimen Mechanismus suchte, der ein Stück Felswand herausgedreht hätte.
Unverrichteter Sache mussten die beiden umkehren.
»Ich hatte gehofft«, sagte Georg, »der Klausner würde uns ein Frühstück vorsetzen können, ich werde immer lebhafter daran erinnert, dass wir gestern auch kein Abendbrot gehabt haben. Na, hoffentlich gibt es von dem Plateau noch einen Abstieg nach einer anderen Seite, den wir schleunigst benützen wollen, denn auf dem nackten Plateau selbst werden wir schwerlich eine gedeckte Tafel finden.«
Also sie erstiegen zum zweiten Male die Treppe, was wiederum fast eine ganze Stunde erforderte.
Als sie das Plateau erreichten, war es gegen fünf Uhr, die Sonne war unterdessen hochgekommen.
Es war ein ganz nacktes Felsenplateau, völlig eben bis auf einige Felsformationen, die man als Miniaturgebirge betrachten konnte. Nirgends hatte auch nur ein Grashälmchen Fuß fassen können. Eben weil jeder tüchtige Regenguss allen sich bildenden Humus von hier oben wegspülen musste.
»Von dort aus blickt man in die Steppe hinab, dort bin ich schon gestern früh gewesen, weiter bin auch ich nicht gekommen«, sagte Juba Riata.
Sie begaben sich hin, hatten noch etwa 250 Meter zu marschieren.
Wieder fiel hier die himmelhohe Felsenmauer ganz jäh hinab, und ein Anblick erwartete sie, den sie sich nimmer hätten träumen lassen.
Unter ihnen lag die Steppe sich unübersehbar nach Osten hinziehend, wie Silberfäden schlängelten sich sehr viele Bäche durch das im ersten Sommerschmuck stehende Gras, ein herrlicher Anblick — aber sie dachten jetzt nicht daran, diese Naturschönheit zu bewundern — sie sahen überhaupt nur die riesenhafte Schlange, die sich durch diese Steppe bewegte, und diese riesenhafte Schlange bestand aus Menschlein, auf winzigen Pferdchen sitzend und dazwischen immer einmal ein Wägelchen von vier oder noch mehr Ochsen gezogen, wie auch solche Ochsen oder Rinder noch in ungeheuren Herden von Reitern getrieben wurden.
»Juba, Juba, was ist denn das für eine Völkerwanderung, die dort unten im Gange ist?«, stieß Georg in grenzenlosem Erstaunen hervor.
»Das sind die Hunnen, welche durch Gogs und Magogs letzte Posaune wieder ins Leben gerufen worden sind«, entgegnete der Gefragte. Und er hatte recht. Seine Adleraugen waren doch noch schärfer als die des Seemanns. Dieser musste erst sein Taschenfernrohr zu Hilfe nehmen, dann fand er seines Begleiters Ansicht bestätigt.
Das ausgezeichnete Taschenfernrohr zog 2-mal heran, dadurch wurde jeder Gegenstand bei dieser Entfernung ungefähr aus 40 Meter dem Auge nahe gerückt, und da lässt sich ein Mensch schon deutlich unterscheiden.
Ja, das waren Hunnen, wie sie uns am besten, wenn man von zeitgenössischen, aber sehr unklaren Schilderungen absieht, wohl Viktor von Scheffel in seinem Roman »Ekkehard« beschrieben hat, weil er eben erst gewissenhafte Quellenstudien gemacht hatte, dabei Fabel von Tatsachen unterscheidend.
Kleine, wilde, struppige Gestalten, in rohgegerbte Felle gekleidet, mit gelben Gesichtern von entsetzlicher Hässlichkeit, auf ebenso kleinen, wilden, struppigen Pferden sitzend, in einem roh aus Holz geschnitzten und gezimmerten Sattel, bewaffnet mit Pfeil und Bogen, Lanze und Schlingen, mit denen sie die ausbrechenden Rinder zurückbrachten die mit Fellen überspannten Planwagen mit vollen Rädern ausgestattet, auf ihnen hässliche Weiber und nackte Kinder massenhaft — so sind einst die Hunnen gewandert.
Und so weit das Auge reichte, bewegte sich diese mehrreihige Menschenschlange von Osten her durch die Steppe. Obgleich diese völlig eben war, für das Auge von keinem Gebirge begrenzt, konnte doch Georg mit seinem ausgezeichneten Fernrohr ihr Ende nicht erkennen, dann schmolzen die Figürchen zusammen, nur noch die dunkle Schlange ohne Schwanz war in dem grünen und blumigen Gras zu unterscheiden.
Die schlangengleiche Bewegung des Zuges kam daher, weil einige Vorreiter immer nach dem bequemsten Übergang über die angeschwollenen Bäche suchten, dorthin lenkte dann der Kopf der Schlange, dort wurden dann die Wagen durchs Wasser gezogen, wobei die nächsten Begleiter aus den Sätteln sprangen und mit in die vollen Räder griffen.
Woher kamen nun in solch ungeheurer Anzahl diese fremdartigen Menschen, die den ehemaligen Hunnen so ungemein ähnlich waren, sich mindestens in keine der bekannten Völkerrassen einreihen lassen wollten?
Denn dass man hier eine noch ganz unbekannte Völkerrasse vor sich hatte, das war den beiden sofort klar.
Nun, die beiden wussten ja, wo sie sich befanden: in einem asiatischen Waldgebiete, das sich vom Ob bis zur Jana erstreckt, 500 geografische Meilen lang und 1800 breit, das ist also ein Gebiet fünfzehnmal so groß als ganz Deutschland und das — aus Gründen die im 33. und 34. Hefte(1) erläutert worden sind — noch viel unbekannter ist als der brasilianische Urwald.
(1) In den Kapiteln 82—84 des 3. Bandes dieser Ausgabe.
Nun nehme man einmal Afrika an. Es vergeht doch fast kein Jahr, in dem nicht europäische Forschungsreisende ein neues, noch unbekanntes Volk finden, das noch nie mit Europäern in Berührung gekommen ist, oftmals von ganz gewaltiger Ausdehnung. Und dabei ist doch Afrika schon so ziemlich erforscht. Wenn nicht Europäer, so kommen doch allüberall arabische Händler mit ihren Karawanen hin. Diese wollen den Europäern entweder nichts von diesen der anderen Welt noch unbekannten Völkern sagen, aus geschäftlichem Interesse, oder sie wissen wirklich noch nichts von ihnen.
Immerhin, es vergeht also fast kein Jahr, in dem von europäischen Forschungsreisenden nicht noch ganz unbekannte Völkerschaften entdeckt würden. Dies gilt von Afrika. Wie mag es nun aber erst in dem ungeheuren Asien sein?
Man braucht nur an Tibet zu denken. Was hat es nicht für ungeheure Mühe einem Manne wie Sven Hedin gekostet, um mit diesem mächtigen Volke bekannt zu werden, das schon seit uralten Zeiten auf einer ganz bedeutenden Stufe der Kultur steht — wenn auch nicht mit unserer zu vergleichen — um uns auch nur die primitivsten Sitten der Tibetaner erzählen zu können! Von ihrem religiösen Kultus gar nicht zu sprechen.
Und nun dieses nordasiatische Waldgebiet von mehr als 150 000 geografischen Quadratmeilen, wobei diese Steppe, so unübersehbar sie auch selbst von hier oben aus sein mochte, gar nicht in Betracht zu kommen braucht, von welchem ungeheuren Gebiete man annimmt, dass nur einige tausend eingeborene Jäger es durchstreifen — sollte denn solch ein Terrain nicht wirklich mehr Menschen beherbergen? Deutschland hat jetzt rund 65 Millionen Einwohner. Nun bedenke man, was für große Strecken man in gewissen Gegenden Deutschlands, in Ost- und Westpreußen aber auch anderswo, mit der Eisenbahn durchsausen kann, stundenlang am hellen Tage, ohne dass man einen einzigen Menschen, eine einzige Hütte erblickt!
Und dieses asiatische Waldgebiet ist fünfzehnmal so groß wie ganz Deutschland. Und da sollen sich nicht eine Million Menschen drin »verkrümeln« können in einer Weise, dass die andere Welt nicht das Geringste von ihnen merkt?
Hierüber hatten sich die beiden unterhalten, mit eben solchen Argumenten.
»Spaß!«, sagte Georg zuletzt, nachdem diese Erörterungen abgeschlossen waren. »Und wenn das wirklich eine Million Männer, Frauen und Kinder wären, zu welcher Zahl aber schon etwas gehört, und wenn es zehn Millionen Menschenköpfe wären — ich halte es für möglich, dass die sich in diesem ungeheuren Gebiete verborgen gehalten haben, wenn auch gar nicht mit Absicht. Die arrangieren jetzt eben eine Völkerwanderung, wollen sich einmal das weitere Land ansehen, natürlich mit der Absicht, jedes bessere Gebiet zu erobern.«
»Da könnte also noch einmal eine neue Welteroberung durch Hunnen entstehen«, meinte Juba Riata.
»Na, das nun weniger«, entgegnete Georg. »Wenn die weiter keine Waffen haben als Pfeile und Lanzen, dann sieht es traurig für sie aus, dann werden sie auf ihrem Eroberungszuge nicht weit kommen. Nicht einmal bis ins europäische Russland hinein. Die Zeiten haben sich unterdessen nun doch etwas geändert. Da werden die russischen Regimenter höllisch schnell zur Stelle sein, zunächst die Kosaken, die mit ihren Karabinern umzugehen wissen, und dann kommen die Maschinengewehre angerückt, die alles zusammenknattern. Nein, ein Weltumsturz durch solche primitive Hunnen ist heutzutage nicht mehr möglich. Die gelbe Gefahr, die von den Chinesen und Japanern ausgeht, die unsere europäische Macht und Kultur vielleicht einmal langsam erdrückt, bis es dann auch noch zu offenen Feldschlachten kommt, das ist wieder etwas ganz anderes. Aber solche mongolische Nomadenhorden haben wir heutzutage nicht mehr zu fürchten, mit denen werden wir schon fertig, und wenn sie auch in Myriaden angeschwärmt kommen. Da kann ein einziger tollgewordener Bienenschwarm in einer Kavallerieschwadron schon mehr Unheil anrichten.«
»Auf wie viele Menschen schätzen Sie den Zug?«, fragte Juba Riata.
»Auf 100 000 bis auf eine Million. Ich will hiermit sagen: das lässt sich überhaupt noch gar nicht schätzen. Ich kann ja noch nicht einmal mit dem Fernrohr das Ende des Zuges erkennen.«
»Wovon mögen sie sich auf einer längeren Zeit ernähren? Mit Jagd ist da nichts zu machen.«
»Sie führen doch genug Rinder mit, nicht nur solche, welche die Wagen ziehen müssen.«
»Ja, aber solche Menschenmengen essen, wenn sie nichts weiter haben, ganze Rinderherden schnell genug auf, das weiß ich aus bester Erfahrung — ah, sie treiben ja auch Schweine mit! Das ist schon etwas anderes!«
»Schweine? Wo?«
»Dort überall neben den Wagen werden sie ja getrieben.«
Georg hatte wohl schon Hunde zu sehen geglaubt, brauchte aber nur sein Fernrohr zu richten, so erkannte er, dass die vermeintlichen Hunde, die frei umherschwärmten, Schweine waren. Und in weiter Ferne wurden dann noch unermessliche Herden von solchen großen Borstentieren gesichtet.
Wenn diese neuen Hunnen Schweinefleischesser waren, wenn sie genügend Herden lebendiger Schweine mit sich trieben, dann allerdings konnte die Ernährungsfrage bei dieser Völkerwanderung für immer gelöst sein.
Kein anderes nutzbringendes Tier lässt sich so leicht ernähren und liefert in seinen Nachkommen so viel frisches Fleisch als das Schwein. Ein gewöhnliches Hausschwein bringt es im Jahre bis auf 20 Junge, ein Wildschwein — womit hier wohl gerechnet werden musste, wenn es auch unter dem Schutze des Menschen stand — wirft jährlich sechs bis zwölf Junge, und das reicht wohl aus, um eine ganze Familie zu ernähren.
Gesetzt den Fall, in Deutschland würde einmal acht Jahre lang kein inländisch erzeugtes Schweinefleisch mehr gegessen, während dieser Zeit aber immer intensiv die Schweinezucht betrieben, man würde die Schweine sich selbst überlassen, wodurch sie sich schnell wieder in echte Wildschweine verwandelten — nach acht Jahren brauchte in Deutschlands niemand mehr zu arbeiten, um sich zu ernähren, man brauchte nur noch Wildschweine zu erlegen und zu braten.
Es ist dies eine leere Phantasie, immerhin ist diese Berechnung von geeigneten Köpfen auch wirklich schon ausgeführt, ganz interessant.
Natürlich würde es dann auch kein Brot mehr geben, kein Korn und keine andere Frucht. Diese Wildschweine würden alles zerwühlen, dadurch den Boden wohl sehr fruchtbar machend, aber nur für Unkraut und den zukünftigen Urwald, der auf sumpfigem Boden nach ungefähr 50 Jahren ganz Deutschland wieder bedecken würde.
Doch wir wollen auf diese Phantasie nicht weiter eingehen. Jedenfalls waren diese Hunnen, wenn sie genug Borstenvieh mit sich führten, für immer auf ihren Wanderungen der Nahrungssorge enthoben. Das Wildschwein ist, so weit uns bekannt, gar keinen Krankheiten ausgesetzt und weiß auch im Winter immer Nahrung zu finden, wühlt sich durch den dicksten Schnee, wo kein Hirsch mehr durchkommt, und mästet sich außer an gefrorenen Wurzeln auch noch an Insektenlarven aller Art.
Jetzt gingen die nach Furten suchenden Vorreiter zurück, der Kopf der Schlange bewegte sich der Felsenwand zu, auf der die beiden standen oder vielmehr schon lagen, um selbst nicht gesehen zu werden. Die Wagen fuhren im Halbkreis auf, immer mehr gesellten sich hinzu, es wurde also eine Wagenburg gebildet, wie es die wandernden Germanen und auch die Hunnen handhabten, wenn sie für längere Zeit lagern wollten.

Wohl noch zwei Stunden beobachteten die beiden Freunde das Treiben dort unten. In der Nähe der Felsenwand war die Gegend dicht bewaldet, es wurde Holz gefällt, überall flackerten Feuer auf, an denen schon abgekocht oder wohl richtiger abgebraten wurde, noch ehe getötete Rinder und Schweine ausgeschlachtet worden waren. Man sah sogar deutlich, wie die Männer unter ihren Pferdesätteln schon vorhandene Fleischstücke hervorholten, die sie eben nach guter, alter Hunnensitte erst unter den Sätteln mürbe geritten hatten. Dabei rückten immer neue Scharen mit neuen Wagen und Viehherden an, dieses Lager immer mehr vergrößernd.
»Ja, mein lieber Juba, das ist alles höchst interessant — aber ich muss gestehen, dass ich zunächst an mich denken möchte. Ich habe fürchterlichen Hunger. Und ich brauche gar nicht so egoistisch zu sein — wir müssen auch unsere Gefährten davon benachrichtigen, was wir für eine Nachbarschaft bekommen haben, auf deren näheren Besuch wir doch gefasst sein müssen.«
Sie erhoben sich und suchten das Plateau ab.
Wieder vergingen fast zwei Stunden, bis sie konstatiert hatten, dass dieses Plateau ungefähr einen halben Kilometer breit und drei Kilometer lang war, dass die Felswände nach allen Seiten glatt wie die Mauern abfielen und dass es nur noch einen zweiten Abstieg gab, wiederum eine künstliche Treppe, die nach der anderen Seite hinabführte, nach der Steppe zu, und offenbar führte sie gerade in die Wagenburg hinein.
Während dieser ganzen Zeit, während der letzten vier Stunden, schien das Wasser in der Talschlucht um nichts gefallen zu sein. Dort unten rauschte und schäumte es nach wie vor.
In dem Lager der Hunnen herrschte ziemliche Ruhe. Sie mochten trotz des fürchterlichen Regens die ganze Nacht gewandert sein, sodass sie sich jetzt der Ruhe hingaben. Aber für zahlreiche Wachtposten, weit in die Steppe vorgeschoben, war gesorgt.
»Ja, wenn wir hier oben nicht verhungern wollen, müssen wir dort zu den Hunnen hinab?«, sagte Georg, seinen Gurt enger schnallend.
»Werden Sie wirklich so vom Hunger geplagt?«
»Ich habe faktisch seit gestern Mittag nichts gegessen, und ich habe keine solche indianische Natur, um tagelang hungern zu können. Wenn ich etwas leisten soll, muss ich mich bei Kräften fühlen.«
»Was leisten?«
»Wir werden diese mongolischen Nomaden wohl nicht als Freunde ansprechen dürfen.«
»Hm. Mich wundert, dass sie noch nicht hier oben erschienen sind. Sollten sie die Treppe nicht von unten bemerken?«
»Wir müssen untersuchen, weshalb sie das nicht tun. Vielleicht geht sie auch im Zickzack, nimmt einen ganz anderen Weg, mündet ganz anderswo in der Steppe, sodass wir ungesehen an ihnen vorbeikommen. In unser Tal wollen wir dann schon wieder gelangen. Aber so lange warten, bis sie doch vielleicht die Treppe finden und sie ersteigen, wollen wir nicht. Begegnen wir ihnen als Feinde, so ist es schon besser, wir treffen mit ihnen auf der schmalen Treppe zusammen, wo wir sie hinter einem Vorsprung so lange in Schach halten können, bis sich dort drüben das Wasser verlaufen hat. Oder haben Sie einen anderen Vorschlag zu machen?«
Juba Riata wusste keinen. Sie stiegen hinab. Der Bluthund, von seinem Herrn mehr durch Gebärden und Streicheln als durch Worte instruiert, immer eine gute Strecke voraus, um rechtzeitig vor einer Gefahr zu warnen.
Diese Treppe führte richtig im Zickzack hinab. An jeder Ecke blickte Plato zurück und wusste durch Zeichen auszudrücken, dass die Luft rein sei.
So dauerte es wieder fast eine Stunde, bis sie das Ende der Treppe erreicht hatten. War es in dem Kamin schon immer dunkler geworden, so hätte es jetzt zuletzt ganz finster sein müssen, denn die Stufen mündeten in einer geschlossenen Höhle.
Aber ein eigentümliches Lichtspiel sorgte doch für hellere Beleuchtung. An der Wand vor ihnen zuckten Lichtstrahlen wie Blitze hin und her, und diese beiden erfahrenen Männer erkannten schnell, was hier vorlag.
Der Ausgang der geräumigen Höhle war mit Gebüsch bestanden, wohl dicht, aber nicht dicht genug, um nicht noch Sonnenstrahlen durchzulassen, diese fielen von Südosten her gerade darauf, und jedes sich bewegende Blatt half mit, dieses Spiel der Sonnenstrahlen zu erzeugen.
Sie schlichen näher an die grüne Mauer heran. Mussten sehr vorsichtig sein, denn sie hatten bereits menschliche Stimmen gehört, dazwischen das Brüllen von Rindern und Wiehern von Pferden.
Bald hatten sie geeignete Spalten gefunden, durch die sie blicken konnten. Die grüne Hecke zog sich jedenfalls an der ganzen Felswand entlang, die davorsitzenden Männer hatten keine Ahnung, dass sie hier eine Höhle verdeckte, in die eine nach oben führende Treppe mündete. Die Hecke, besonders aus Himbeersträuchern bestehend — und demnächst würde diese ganze Gegend, zumal das waldige Tal, Beeren aller Art in unermesslicher Fülle liefern, wie ja auch gerade das kalte Norwegen die Heimat der köstlichsten Waldbeeren ist — war kaum anderthalb Meter dick, und dicht davor brannte ein Feuer, um das vier Männer saßen.
Das war jetzt für die beiden die Hauptgruppe in der ganzen Lagerszenerie, die sie sonst hier zwischen den hochstämmigen Nadelbäumen ohne Unterholz vor Augen hatten.
Ja, das waren echte Hunnen, wie man sie beschrieben findet, wie man sie sich vorstellt.
Denn was Georg durch sein Fernrohr gesehen, ist nur wenig noch hinzuzufügen. Durchweg sehr kleine, untersetzte Gestalten, manchmal durch die äußerst breiten Schultern richtig viereckig, mit gelben Mongolengesichtern, hervortretenden Backenknochen, Schlitzaugen und — was sonst nicht für alle Mongolen gilt — ein ungeheuer breiter Mund, gekleidet ausschließlich in Rehfelle, nur ganz roh gegerbt, die haarige Seite nach außen, aber meist kaum noch erkenntlich, denn alles an ihnen starrte von Schmutz und Fett. Um die Füße und Waden trugen sie aufgewickelte Riemen aus stärkerem Leder, auf dem Kopfe Pelzmützen der verschiedensten Art, wenn diese noch als solche zu erkennen waren. Eine Ausnahme schien nur zu bilden, dass sie nicht, wie wir von den ehemaligen Hunnen wissen, ihr schwarzes, straffes Haar kurz scherten, sondern es bis auf die Schultern herabhängen hatten, wodurch sie wieder den Samojeden glichen, oder auch den Eskimos. Das ist ja überhaupt alles ein Schlag.
Bemerkenswert war, dass die Lanzen- und Pfeilspitzen durchweg aus Stein, Knochensplittern oder starken Fischgräten bestanden. Sie kannten kein Eisen. Wohl auch kein Kupfer, Zinn und Zink. Sonst hätten sie doch wohl Messing oder härtere Bronze herzustellen gewusst. Es war nichts davon zu sehen. Auch die Messer waren von feiner dunklen Steinart. Dagegen waren die hölzernen Messergriffe, wenigstens die dieser vier Hauptpersonen, reich mit Silber und Gold ausgelegt, und das galt besonders von einem hölzernen Schilde, einen halben Meter hoch und etwas schmäler, der an einem Baume hing. Auch dieser war reich mit Silber und Gold ausgelegt, in Arabesken, die freilich jeden künstlerischen Geschmackes entbehrten, auch sonst nur eine ganz rohe Arbeit.
Das war Silber und Gold, nicht etwa Zink oder Zinn und Kupfer, das konnte man gleich unterscheiden. Es war auffallend, wie dieses Edelmetall an den Waffen sehr reichlich verschwendet worden war, während diese vier Männer, offenbar hohe Anführer, sonst nicht den geringsten Schmuck trugen.
Bis auf diese reich verzierten Waffen glichen die vier am Feuer Sitzenden ganz den anderen. Sie starrten genau so von Schmutz und Fett und getrocknetem Blut. Nur der eine zeichnete sich noch besonders durch seine Gestalt aus. Das war ein echter Attila, wie er uns von Zeitgenossen beschrieben wird. Viel größer mochte er nicht sein als die anderen, bildete aber noch ein ganz anderes Viereck. Zwischen den gewaltigen Schultern saß ohne Hals ein wahrer Büffelkopf, die Nase war so eingedrückt oder abgeplattet, dass sie kaum zu sehen war, und obgleich auch er nur Schlitzaugen hatte, so sprühte aus diesen doch ständig ein stolzes, verzehrendes Feuer, und so war auch in jeder Bewegung alles unbezähmbarer Stolz, so viehisch sich dieser Mensch auch sonst betragen mochte.
Die vier zankten sich heftig. Das war aber nur scheinbar. Sie unterhielten sich nur in jener heftigen, schnatternden Weise, wie es alle Mongolen tun, auch die stolzen Japaner, wobei man immer glaubt, sie müssten sich im nächsten Augenblick in den Haaren liegen, während sie sich doch nur ganz gemütlich unterhalten. Auch hier waren kai und quai und tschai die Hauptlaute, die man zu hören bekam.
Man brauchte nur länger zu beobachten, so fand man doch heraus, mit welcher Ehrfurcht die anderen drei dem Breitschultrigen entgegenkamen. Hinwiederum dauerte es gar nicht lange, so holte der Breitschultrige mit der Hand aus und schlug mit dem flachen Handrücken einem anderen, doch sicher einem Häuptling ins Gesicht, dass gleich das Blut in dickem Strahle aus der Nase sprang und er hinten über schlug.
Aber das hatte in dieser gemütlichen Gesellschaft gar nichts zu sagen. Die beiden anderen lachten wiehernd auf, alle die anderen Hunnen, die es gesehen, lachten mit und ebenso auch der Geschlagene, der sich gleich wieder aufrichtete, immer ruhig das Blut aus der Nase fließen lassend.
»Schakai Gog, schakai Gog!«, erklang es jubelnd und lachend im Chor.
Die beiden Beobachter wechselten Blicke.
»Da hätten wir also den oder einen Gog vor uns«, flüsterte Georg. »Übrigens eine feine Gesellschaft das, die müssen Knigges ›Umgang mit Menschen‹ gründlich studiert haben.«
Der Gog, wie wir ihn nun gleich nennen wollen, also soviel wie König oder Kaiser, klatschte in seine ungeheuren Tatzen, die aber nur ganz kurze Finger hatten, und alsbald wurde von einigen Dutzend Hunnen ein widerspenstiger Bulle herangezerrt, ein wunderschönes Tier, wie man es sonst in den Alpen zu sehen bekommt, mit mächtigen Hörnern. Unter der dem Feuer am nächsten Kiefer wurde er an den Füßen gefesselt, der Hauptstrick über einen hohen, starken Ast geworfen, so wurde das Tier mit vereinten Kräften in die Höhe gezogen, also an den Füßen, aber in einer Weise, dass der Kopf noch tiefer herabhing, dann näherte sich ein Mann, ein gewaltiges, schwertähnliches Steinmesser in der Hand, wartete eine Gelegenheit ab, bis das geängstigte, furchtbar brüllende Tier einmal den Kopf still hielt, dann ein Schnitt über den Hals, und aus diesem schoss ein Strom rauchenden Blutes hervor.
Unterdessen hatte ein wohl noch junges, aber entsetzlich hässliches und ebenso schmutziges Weib vier große Schalen aus schwerem Golde gebracht, jeder der vier Häuptlinge nahm eine und hielt sie unter den Blutstrom, nicht anders, als ob sie die Schale unter eine Wasserquelle hielten, dabei war es ihnen ganz gleichgültig, dass sie selbst über und über mit Blut besudelt werden, und mit dem größten Behagen schlürften sie das dampfende Blut, während der Ochse noch zuckte, noch völlig lebte.

Das aus dem mit einem raschen Schnitt geöffneten
Halse des aufgehängten Tieres fließende Blut
fingen die vier Häuptlinge in goldenen Schalen
auf, um es dann mit größtem Behagen zu schlürfen.
Noch einmal füllten sie ihre Schalen, dann erst kamen andere Hunnen mit hölzernen und steinernen Näpfen, um sich an dem Reste des Blutstroms zu delektieren.
Denn die größte Masse des Blutes war zwecklos auf die Erde gelaufen. Ein Zeichen, wie gering hier ein Rind im Werte stand. Wobei freilich auch zu bedenken war, dass es Fürsten waren, die sich einmal einen warmen Bluttrank zu Gemüte ziehen wollten.
»Na da guten Appetit«, konnte auch Juba Riata etwas humoristisch werden. »Die amerikanischen Rothäute trinken zwar ebenfalls das Blut von frisch geschlachteten Pferden und Rindern, die benehmen sich aber doch bedeutend manierlicher dabei.«
»Und ich«, fügte Georg hinzu, natürlich in ebenso leisem Tone, »möchte ganz gern an dem Gelage teilnehmen. Wenn ich auch nicht gerade Appetit nach dem heißen Blute habe, so möchte ich doch ein saftiges Beefsteak von diesem Ochsen haben, möchte gleich hineinbeißen, und ein kühler Trunk dazu wäre mir auch recht angenehm.«
»Werden Sie auch schon von Durst geplagt?«
»Ja, Juba, was soll daraus werden? Hier können wir nicht für immer stehen bleiben und beobachten. Wollen wir noch einmal nach der anderen Treppe, ob sich das Wasser verlaufen hat? Ich bezweifele es. Oder wollen wir hier männlich hervortreten?«
Sie sollten sich nicht lange zu beraten brauchen. Plötzlich wurde die Höhle von einem roten, flackernden Lichte erfüllt, durch eine Seitenspalte, die sie vorhin in der Dämmerung gar nicht gesehen hatten, waren Hunnen eingedrungen, Fackeln in den Händen, immer mehr folgten nach.
Sofort hatten sie die beiden entdeckt, es konnte ja gar nicht anders sein, und die sahen auch gleich ein, dass hier jeder Widerstand nutzlos war. Das waren viel, viel mehr, als wie sie über Schüsse verfügten, und auch mit dem Messer wären sie nicht durchgekommen, die ganze Höhle wimmelte plötzlich von solchen Hunnengestalten.
»Gut Freund!«, konnte Georg noch rufen, in welcher Sprache er es getan, wusste er dann später selbst nicht, und da hatte sich auch schon der ganze Schwarm heulend auf sie geworfen, die beiden waren einfach zugedeckt, noch ehe sie wussten, wie ihnen geschah, wenn sie nun einmal nicht an Benutzung der Waffen gedacht hatten. Und ebenso schnell war der Bluthund trotz seines wütenden Beißens durch Schlingen unschädlich gemacht worden.
Unter Schnattern wurden ihnen die Hände auf dem Rücken gebunden, man riss sie empor, da hatten die Steinmesser auch schon eine Öffnung in die Himbeerhecke gehauen, sie wurden hindurch ins Freie gestoßen.
Das ganze Hunnenlager, so weit es sich zwischen den Bäumen überblicken ließ, kam in größte Aufregung, noch größer war das allgemeine Geschnatter.
Auch die vier Häuptlinge waren aufgesprungen, der Gog kam trotz seiner kleinen Figur mit ganz gewaltigen Schritten den beiden entgegen, ein Wink, und das Geschnatter verstummte.
Er fragte etwas, was natürlich nicht verstanden wurde. Einmal war Georg überzeugt, dass er auch Russisch sprach, aber Georg hatte die Zeit in Petersburg nicht weiter benützt, um vom Russischen mehr als die landläufigen Redensarten zu lernen, die man besonders in Restaurationen nötig hat, sonst hätte ein Seemann ja auch viel zu lernen.
»Sprechen Du Deitsch?«, erklang es da zu seinem höchsten Staunen aus dem breiten Maule des abgebrochenen Riesen, der aber trotz aller Schmierigkeit immer einen wahrhaft majestätischen Eindruck machte, besonders das Blitzen der Schlitzaugen war wirklich achtunggebietend.
Nun, weshalb sollte er nicht etwas Deutsch können? Ganz Russland und auch Sibirien ist ja mit Deutschen oder doch Deutschsprechenden durchsetzt.
»Ja, ich spreche Deutsch, ich bin ein Deutscher.«
Und der Gog konnte nicht nur diese Frage ausdrücken, er sprach vollkommen Deutsch, wenn auch noch so holprig und ungrammatikalisch und sonst in merkwürdiger Weise, das wir aber nicht weiter wiedergeben wollen.
»Wer seid Ihr?«
Georg hielt es für das Klügste, ganz bei der Wahrheit zu bleiben. Mit einem Schiffe vom nördlichen Eismeere auf Flüssen ins Innere von Sibirien gefahren, ein von Felswänden eingeschlossenes Haus gefunden, wo man schon drei Monate zugebracht hatte, gestern Nachmittag in einer Schlucht eine Treppe erstiegen, Wolkenbruch, die Treppe verschüttet, eine zweite Treppe hinab, die hier in diese Höhle führte, wo man das Lager der fremden Männer beobachtet hatte. So hatte Georg kurz und bündig berichtet. Natürlich nichts von den steinernen Figuren und Posaunen und dem Einsiedler, das war jetzt ja auch gar nicht nötig.
Schweigend, ohne ihn zu unterbrechen, hatte der Gog zugehört. Dabei aber hatte er immer aufmerksam die den beiden abgenommenen Gewehre und besonders die Jagdmesser untersucht, sich von deren Schärfe überzeugend.
»Ein Schiff, gut, ich weiß«, sagte er jetzt, als Georg seinen Bericht beendet hatte. »Und das hier nennt Ihr Gewehr oder Büchse?«
»Ja.«
»Damit schießt Ihr.«
»Ja.«
»Dabei knallt es.«
»Ja.«
»Zingo!«
Ein Mann trat vor, der den beiden schon aufgefallen war. Er war bedeutend größer und schlanker als die anderen Hunnen, hatte ganz andere Gesichtszüge — Georg hatte überhaupt in dem schon älteren Manne gleich einen Zigeuner vermutet, der Name, mit dem er gerufen worden, hatte es ihm bestätigt.
Unsere Zigeuner werden in Italien Zingari genannt, Einzahl Zingaro, oder auch nur Zingo, in Russland heißen sie Romanischaves, wörtlich Menschenkinder, aber merkwürdigerweise führen gerade hier die Hälfte aller männlichen Zigeuner den Vornamen Zingo. Der Gog redete ihn in seiner mongolischen Sprache an, der Zigeuner nahm das eine Gewehr, wendete es hin und her, untersuchte die Patronentasche, lud die Gewehrkammer, kannte die Konstruktion des Schlosses offenbar nicht, hatte sich aber schnell hineingefunden, legte an, zielte nach einem nahen Baume, der Schuss krachte.
Die Wirkung des Knalles, des Feuerstromes war eine ganz kolossale. Sofort aber ward auch offenbar, wie sich diese schnatternden, bei ihren Gesprächen sonst immer so aufgeregten Männer zu beherrschen wussten, wenn es einmal darauf ankam.
Sie alle waren erschrocken zusammengezuckt. Schreck und sogar Entsetzen malte sich in den hässlichen Zügen wider, dann aber war es sofort vorbei, es wurde Gleichgültigkeit geheuchelt, und allen gelang dies auch vollkommen.
Der Gog begab sich hin nach dem Baume, untersuchte die Stelle, wo die Kugel eingeschlagen war, wollte sie mit seinem Steinmesser herausholen, als ihm das nicht so leicht gelang, überließ er dies anderen, nahm das Gewehr, lud es selbst, sich ebenso unkundig aber doch geschickt beweisend, ließ sich von dem Zigeuner noch einmal über das Visieren belehren, zielt nach einem anderen Baume, feuerte, ging hin, untersuchte den Schuss wieder und kam zurück. Sein Gesicht drückte die spannendste Erregung aus, er wusste sich aber zu beherrschen.
»Gut, Zingo hat nicht gelogen. Du bist ein Mann aus dem Lande, wo es Eisen gibt. Ist's nicht so?«
»Ja, Eisen gibt es bei uns.«
»Aber Du bist kein Russe.«
»Ein Deutscher.«
»Die Russen wohnen in Russland, die Deutschen in Deutschland.«
»So ist es.«
»Die Russen wollen Herrscher in diesem ganzen Lande sein, wo wir jetzt sind.«
»Ja.«
»Und dann kommt Deutschland, es grenzt an Russland.«
»Ja.«
»Das ist noch weit von hier.«
»Noch sehr weit.«
»Wie weit? Wie lange braucht ein Mann, wenn er von früh bis abends geht?«
»Ungefähr hundert Tage«, sagte Georg aufs Geratewohl.
»Hundert, gut, ich weiß, hundert«, nickte der Gog gravitätisch. »Wie viele seid Ihr auf dem Schiffe gewesen?«
»Zweihundert«, entgegnete Georg kurzerhand, dabei die Indianer und englischen Seeleute mit einrechnend, wenn das ja auch eigentlich nicht stimmte.
»Nur zweihundert? Dann ist das kein sehr großes Schiff.«
Oho! Das klang verwunderlich!
»Doch, es ist ein sehr großes Schiff.«
»Es gibt Schiffe, auf denen tausend und noch mehr Menschen sind.«
Jetzt wusste Georg, was hier vorlag. Dieser Hunne war noch nicht mit anderen Menschen in Berührung gekommen, die Feuerwaffen besessen hatten, das war ja zweifellos. Aber dieser Zigeuner kannte die andere Welt, der hatte ihm auch schon von Kriegsschiffen und großen Passagierdampfern erzählt.
»Es ist ein Schiff von 50 000 Tonnen, mehr als hundert Meter lang.«
»Tonnen? Meter? Gut, ich weiß. Bist Du ein Häuptling von diesem Schiffe? Ein — Offizier, sagt Ihr doch wohl? Bist Du?«
»Ich bin der zweite Kapitän dieses Schiffes.«
»Kapitän. Gut, ich weiß. Alle die zweihundert Männer gehorchen Dir?«
»Sie gehorchen mir. Es sind aber auch Frauen und Kinder dabei.«
»Gut. Also, Du bist der zweite Kapitän, so viel wie der Magog.«
»Ich glaube wohl, dass meine Stellung so viel wie die eines Magogs ist.«
»Gut. Und Du stehst vor dem Gog der Kuturgoren. Weißt Du, was das ist? Hast Du diesen Namen schon gehört?«
»So nannten sich selbst jene Menschen, die wir Hunnen nannten.«
»Hunnen, gut, ich weiß«, erklang es immer wieder. »Was taten diese Hunnen?«
»Sie fielen einmal erobernd in Europa ein, kamen bis nach Deutschland und Italien.«
»Italien — gut, ich weiß — Rom. Wann war das?«
»Vor ungefähr 1500 Jahren.«
»Im fünften Jahrhundert nach —«
Erwartungsvoll blickte das feuersprühende Auge bald nach dem Gefragten, bald nach dem Zigeuner, der ebenso erwartungsvoll daneben stand.
»Nach Christi Geburt«, ergänzte Georg und musste sich doch immer wieder wundern, hier so examiniert zu werden.
»Christus — gut. Und wie hieß der Gog, welcher die Hunnen damals führte?«
»Attila.«
»Und der Magog?«
»Es war Attilas Bruder Bleda«, glaubte Georg wohl richtig zu antworten, und jener bestätigte es durch Kopfnicken.
»Gut. Und ich bin der Gog Rugila.«
Dann hieß der gerade so, wie der Vorgänger und Oheim Attilas geheißen hatte.
»Wo liegt Dein Schiff?«, fuhr jener dann fort.
»Auf dem See eines Tales, das sich hinter dieser Felswand befindet.«
»Du kannst nicht den Weg zurück, den Du gekommen bist?«
»Ich bezweifle es. Wie ich Dir geschildert habe, ist die andere Treppe infolge des gestrigen Wolkenbruches zusammengestürzt.«
»Gibt es nicht einen anderen Weg in das Tal?«
»Ich muss ihn erst suchen.«
»Du kennst noch keinen?«
»Wir sind auf dieser Seite des Tales noch niemals gewesen.«
Die Augen des Hunnenherrschers schienen Georg durchbohren zu wollen, aber er musste wohl mit den Antworten zufrieden sein, er glaubte jenem, das sah man ihm gleich an.
»Ist dieses das Tal des Obi?«, erklang es dann wieder ganz unvermutet.
»Ja.«
»Wer wohnt darin?«
»Wir haben darin zuerst keine Bewohner gefunden —«
»Du lügst!«, fuhr da der Gog mit drohenden Brauen etwas empor.
»Zuerst nur einen einzigen Mann —«
»Wie hieß dieser?«
»Er nannte sich Merlin.«
»Gut«, erklang es immer wieder, wohl etwas düster, sonst aber befriedigt.
Dann fiel der Gog in tiefes Sinnen. Minuten vergingen, und er schien daraus nicht wieder erwachen zu wollen. Regungslos und schweigend standen auch alle anderen da, auf ihren Führer blickend.
»Erlaube mir, Gog, dass ich unaufgefordert spreche«, brach da endlich Georg das drückende Schweigen.
»Du wagst viel, Fremder. Doch ich verzeihe Dir. Weil Du eben ein Fremder bist, der unsere Sitten nicht kennt. Sonst wärst Du jetzt ein toter Mann. Nun? Sprich!«
»Wir haben Euch zufällig gesehen, wir haben Euch beobachtet, und ehe wir vortreten konnten, wurden wir von Deinen Leuten entdeckt und überwältigt —«
»Was willst Du? Sprich!«
»Wir haben nicht daran gedacht, Euch als Feinde zu betrachten —«
»Doch nicht etwa als Freunde die Ihr erwartet habt?«, erklang es spöttisch.
»Nein, das auch nicht. Aber — wir sind gebunden worden. Wir sind noch gebunden. Wir haben seit gestern Mittag nichts gegessen —«
Ein Wink, einige fremde Worte, und den Gefangenen wurden sofort die Hände auf dem Rücken befreit.
»Ist dieser Mann auch ein Häuptling? Ein Offizier?«
»Ja, er nimmt den Rang eines hohen Offiziers ein.«
»Seht Ihr den Wagen dort?«
Der Gog deutete auf einen in der Nähe stehenden Planwagen, der sich außer durch seine Größe dadurch auszeichnete, dass die ihn überdeckenden Felle rot gefärbt waren.
»Wir sehen ihn.«
»Ihr könnt doch bis hundert zählen.«
»Das können wir.«
»Ihr dürft Euch frei bewegen, dürft nehmen, was Ihr wollt. Aber zählt Eure Schritte. Entfernt Ihr Euch mehr als hundert Schritte von diesem roten Wagen, so seid Ihr des Todes! Und keinem Pferde dürft Ihr Euch auf mehr als zehn Schritte nähern! Oder Ihr seid des Todes! Sofort seid Ihr von Pfeilen durchbohrt! Und tretet Ihr so weit an einen Mann heran, dass er Euch mit seinem Messer erreichen kann, so habt Ihr dieses Messer sofort in Eurem Herzen! Verstanden?«
»Wir haben Dich verstanden.«
»Habt Ihr noch andere Waffen bei Euch?«
»Einen Taschenrevolver —«
»Legt sie ab.«
Die beiden entleerten ihre Taschen, legten einen kleineren Revolver, eine Browningpistole, einen Nickfänger und ein Taschenmesser ab.
»Nichts weiter?«
»Nein.«
»Wenn ich Euch jetzt untersuchen lasse, und ich finde noch irgend eine Waffe, so seid Ihr des Todes!«
»Wir haben keine Waffe mehr bei uns.«
»Gut. Ihr seid frei. So weit ich Euch gesagt habe. Wie weit?«
Georg wiederholte die Bestimmungen.
»Gut. Esst und trinkt und nehmt, was Ihr findet. Es gehört Euch. Geht. Oder bleibt. Wie Ihr wollt. Bis ich Euch wieder rufe.«
Der Gog wandte sich ab. Georg ging schnurstracks, von Juba Riata etwas langsamer gefolgt, nach einem kleineren Feuer, an dem niemand saß, aber neben dem mehrere große Fleischstücke lagen, löschte erst seinen Durst im Wasser des vorbeifließenden Baches, dann nahm er von den umherliegenden Gerätschaften ein Steinmesser und begann von den Ochsen- und Schweinevierteln zum Braten geeignete Stücke abzuschneiden, sie auf die glühenden Holzkohlen legend.
»Nette Geschichte, das«, brummte Juba Riata, sich ebenfalls am Feuer niederlassend, ohne vorher getrunken zu haben. »Was meinen Sie nun zu alledem?«
»Ich meine, dass es gut ist, solches Röstfleisch schon vorher etwas mit Salz einzureiben. Haben Sie welches bei sich? Nein? Im Boote gelassen? Und hier ist auch keins zu sehen. He, Freund sprichst Du auch Deutsch? Hast Du nicht eine Handvoll Salz? Verstehst Du mich nicht? Zum Teufel, was heißt denn Salz auf Russisch? Ich habe doch in Petersburg in den Restaurants — ach so, da verlangt man einfach die internationale Menage. Na, da bringe mal eine Menage her, mit Salz, Pfeffer und Senf. Essig und Öl brauche ich nicht, dagegen ist mir etwas Worcestersauce immer angenehm. Aber bitte — immer einen Schritt vom Leibe bleiben — von wegen Deines Steinmessers —«
So sprach Georg, sich mit seinen Fleischstücken beschäftigend.
Und schon hatten sich zahlreiche Hunnen eingefunden, die um die beiden einen Kreis bildeten, sie beobachtend, schon wieder schnatternd und dabei auch viel lachend.
Und wie sie jetzt lachten, da bekamen diese hässlichen, schmutzigen, sonst so wilden Gesichter einen überaus gutmütigen Ausdruck. Und von überaus gutmütigem Charakter werden uns die ehemaligen Hunnen auch von zeitgenössischen Berichterstattern geschildert. Den fremden Frauen gegenüber von einer täppischen Galanterie, und besonders waren es die größten Kinderfreunde, spielten gern mit Kindern, wurden dabei selbst zu Kindern.
Das heißt: dies alles nur so lange, bis sie sich eben in echte Hunnen verwandelten. Wenn sie keine Gäste mehr, sondern Hunnenkrieger waren, dann hörte die ritterliche Galanterie gegen die Damen natürlich auf, und dann spielten sie nicht mehr mit den fremden Kindern, sondern zerschmetterten sie an Mauern und Bäumen oder warfen sie ins Feuer
Genau wie bei den Kosaken! Wir haben ja noch ganz frische Berichte, wie anno 1813 die Kosaken in deutschen Quartieren lagen, wie da die bärtigen Kerle, immer nach Branntwein und Knoblauch duftend, die Kinder abküssten, wie sie sich immer als Kinderwärterinnen anboten und ihre Sache auch vorzüglich machten, da war jeder Frevel ganz ausgeschlossen — aber sonst waren es, wenn sie sich in Soldaten verwandelten, eben Kosaken, welche ein Kind ebenso gern aufspießten wie einen Mann.
Aber sie schienen zu verstehen. Lachend machten sie unter Nicken Bewegungen, als ob sie Salz streuten. Und da kamen auch schon einige Weiber, die in einem Lederbeutel das unersetzbare Salz brachten, ferner trugen sie in großen Holzschalen, roh geschnitzt oder auch ausgebrannt, Milch herbei, teils frische, teils solche von mehr gelblicher Farbe, die etwas schäumte — unverkennbar Kumys, gegorene Pferdemilch.
»Immer einen Schritt vom Leibe bleiben!«, wehrte Georg zunächst mit affektiertem Schreck ab, als sich das eine Weib ihm zu sehr genähert hatte.
»Ohne Sorge«, beruhigte ihn gleich Juba Riata, »ich habe vorhin ganz deutlich bemerkt, wie der Gog betonte, dass es sich nur um Männer handelt, die uns niederstoßen, wenn wir uns ihnen in Armweite nähern, nicht hingegen bei —«
Juba Riata brauchte nicht weiter zu erklären, die weitere Ausführung übernahm das Weib gleich selbst.
Plötzlich hatte die junge Frau, die sie sein mochte, die dem Waffenmeister gerade das Salz gereicht, diesen beim Kopfe gepackt und ihm einen Kuss auf die Lippen gebrannt, dass es nur so geknallt hatte.
Georg saß da, in der einen Hand den Salzbeutel, die andere noch ausgestreckt, während der sonst so ernste Peitschenmüller schon in ein schallendes Gelächter ausbrach, in das die umstehenden Hunnen brüllend einstimmten.
»Himmeldonnerwetter noch einmal!«, brachte Georg dann hervor. »Na, was gibt's denn da zu lachen?«
»Ach, dieses Gesicht, wie Sie jetzt mit halb offenem Munde dasaßen!«
»Ja, soll man da nicht das Maul aufsperren? Himmeldonnerwetter noch einmal! So was ist mir lange nicht passiert! Küsst mich da solch eine holdselige Jungfrau, der ich mich noch gar nicht vorgestellt habe, frisch vom Flecke weg! Brrrrr. Die roch gerade wie eine angebrannte Knackwurst, bei der der Fleischer das n vergessen hat. Warten Sie — da haben Sie auch das Ihre weg! Na, hatte ich nicht recht? Riecht die nicht gerade so?«
Auch Juba Riata war von demselben Weibe beim Kopfe gepackt worden und hatte seinen Kuss aufgeknallt bekommen, mit einer Schnelligkeit, dass einfach gar nichts dagegen zu machen gewesen war. Und nun machte Juba Riata auch ein ganz ähnliches Gesicht.
»Hoffentlich geht das nun nicht so weiter!«, sagte Georg noch. »Dass uns nicht etwa alle die Hunnendamen so der Reihe nach abküssen!«
Nein, es blieb nur bei diesem einen Begrüßungskusse, diese eine Frau hatte ihn wohl für alle gegeben.
»Ja, das ist Kumys«, sagte Georg dann, an eine der Schalen riechend und dann trinkend, einen tüchtigen Zug nehmend.
»Das Luderzeug schmeckt ganz gut, aber, aber —«
Er kaute etwas, griff an die Lippen, brachte etwas zum Vorschein.
»Was ist denn das? Ein Frosch! Ein kleines Fröschlein. Tot! Eine sogenannte Leiche. Ganz vertrocknet. Eine Mumie. Armes Tier. Warum musstest Du so jung Dein Leben lassen? In der schönsten Blüte Deiner Jahre bist Du vom blassen Tod —«
»Hier sind auch Frösche drin«, wurde diese nachträgliche Grabesrede von Juba Riata unterbrochen. Er hatte eine kleinere Schale mit frischer Milch ziemlich geleert, dabei aber vorsichtig die Lippen etwas zusammenhaltend, und das war auch sehr gut gewesen.
»Frösche?«, machte Georg, der noch nicht in die Schale sehen konnte.
»Gleich drei.«
»Lebendige?«
»Ebenfalls getrocknet. Hier in der frischen Kuhmilch.«
»Dann sind sie mit Absicht hineingetan worden. Kühe, die aus ihren Eutern Milch mit Froschmumien von sich geben, gibt es nicht in der Naturgeschichte. Aaaah!«
Er hatte mit dem Steinmesser in dem Kumys herumgekrebst, auch die Finger zu Hilfe nehmend und noch zwei weitere getrocknete Froschleichen zum Vorschein gebracht, und als dann die anderen Schalen mit Milch oder Kumys untersucht wurden, ergab es sich, dass eine jede drei solcher sehr kleinen, getrockneten Frösche enthielt.
»Das ist offenbar eine heilige Zeremonie, dass man hier in jedes Getränk drei einbalsamierte Froschkinder tut«, entschied Georg dann. »Hoffentlich gehört nicht dazu, dass man sie auch noch verschlingt, und diese Herren verübeln uns wohl nicht, wenn wir derartige Gratiszugaben sanft beseitigen.«
Nein, die umstehenden Hunnen verübelten es durchaus nicht. Sie wieherten vor Lachen. Aber sonst mochte Georg recht haben, um einen Schabernack konnte es sich doch nicht handeln, sonst hätten diese Schäker nicht ausschließlich getrocknete Frösche in die Getränke getan, immer gerade drei, da hat die Erfindungsgabe doch weiten Spielraum.
Georg vertiefte sich in das erste, ganz leicht angebratene Beefsteak, länger konnte er nicht warten, als der Zigeuner ans Feuer trat.
»Haben Du Tabak?«, war seine erste Frage.
Er sprach ganz ganz genau dasselbe Deutsch wie der Gog. Er kannte alle Worte, konnte sie anwenden, nur dass er nichts von Konjugation und Deklination wusste.
Später von äußerster Höflichkeit, hatte er diese erste Frage mit wahrer Gier gestellt.
Ja freilich! Armer Kerl!
Was ist denn ein Zigeuner ohne Tabak! Alles kann der Zigeuner vertragen, sogar dass sein Silberbecher, den auch der ärmste Schlucker hat, für lange Zeit nicht mit Branntwein gefüllt wird, nur keine Tabaklosigkeit — und keinen Wind. Sobald es etwas bläst, dann verkriecht er sich irgendwo und kommt nicht eher zum Vorschein, als bis die Luft wieder ruhiger geworden ist. Das ist etwas ganz Merkwürdiges.
Ja, Tabak hatten die beiden, auch ihre Pfeifen hatten sie nicht als Waffen abgegeben. Georg zog seine gefüllte Fischblase hervor, seine Pfeife war nicht nötig. Zingo hatte seine eigene, aus einem Knieast geschnitzt, stark gebraucht, wie überhaupt der ganze Kerl nach verbrannten Blättern roch, die freilich nichts mit Tabak zu tun gehabt hatten.
»Ich sein kein Hunne, ich sein Zigeuner, ich Dich nix töten«, sagte er dabei, als er nach dem Tabaksbeutel griff.
Dann, mächtig dampfend, berichtete er, ganz von allein, zunächst über sich selbst.
Wir geben es in etwas anderer Weise wieder.
Zingo hatte wohl in seinen jüngeren Jahren einer Bande angehört, später nicht mehr, hatte sich mehr als ein halbes Menschenalter lang in aller Welt herumgetrieben, sogar in Nord- und Südamerika, die Fiedel spielend, Kessel flickend, mit Pferden handelnd.
Als Pferdehändler war er zuletzt auch in Russland gewesen. Mehr noch aber als Spion einer anderen Macht, wenn er auch nicht in deren direkten Diensten stand. Erwischt worden, geknutet, gebrandmarkt und lebenslänglich nach Sibirien.
Aus den Bergwerken von Sllobodz geflohen. Umstände hatten ihn gezwungen, seinen Weg nach Osten zu nehmen, immer weiter. Nachdem er die letzten Menschen getroffen hatten, eingeborene Jäger, war er noch ein halbes Jahr lang gewandert, immer nach Osten, ohne noch einem Menschen zu begegnen.
Da, ehe die strenge Winterkälte einsetzte, wurde der halbnackte Mann schier verhungert in dem Walde, aus dem es keinen Ausgang zu geben schien, von fremden Menschen gefunden, deren Sprache er ausnahmsweise nicht kannte. Denn sonst gehörte Zingo zu jenen Zigeunern, die nur acht Tage mit Fremden zu verkehren brauchen, um sich fließend mit ihnen unterhalten zu können, ohne diese Sprache jemals richtig zu lernen. Es waren Kuturgoren, wie sie sich selbst nannten, was soviel wie Pferdemenschen bedeutet, Zentauren.
Acht Jahre schon lebte Zingo unter ihnen, und hatte sie nun also zur Genüge kennen gelernt.
Auf 120 000 Mann schätzte Zingo sie, dazu noch Weiber und Kinder, zusammen vielleicht eine halbe Million. Sie bildeten Horden, die unter Häuptlingen standen, diese wieder unter zwei nebeneinander regierenden Königen, welche die Titel Gog und Magog führten. Sie lebten in den unermesslichen Wäldern und Steppen von Pferde-, Rinder- und Schweinezucht, von Wurzeln, Zwiebeln und Beeren, und was der Wald sonst noch bietet, was aber nicht gezogen werden durfte. Jeder Anbau von derartigem Gemüse war durch Regierungsgesetz oder durch Tradition, wollen wir sagen, direkt verboten. Zwischen den einzelnen Horden kam es manchmal zu Kämpfen, die regelmäßig mit der vollständigen Ausrottung der besiegten Horde endeten. Wohl Aberglauben aller Art aber keine eigentlichen Zauberer, keine Priester, keine Spur von einer Religion.
So hatten die Kuturgoren immer gelebt, seit uralten Zeiten. Sie wussten nicht, dass es außer ihren Wäldern und Steppen noch andere Gegenden mit wilden Menschen gebe, sie hatten auch niemals daran gedacht, sich auszubreiten. Hatten es nicht nötig.
Und doch, eine Sage hatte sich erhalten, dass es im Süden und Westen noch andere Menschen gebe, mächtige Völker, und dass die Kuturgoren schon einmal ihre Wälder und Steppen verlassen hätten. Dabei hatten sie sich geteilt. Die eine Hälfte wäre nach Süden, die andere nach Westen gewandert. Überall waren sie siegreich gewesen. Aber die nach Süden gezogenen Kuturgoren verschwanden für immer, die nach Westen vorgedrungenen wurden zuletzt doch wieder zurückgeworfen, kehrten nach langen Irrfahrten in ihre alte Heimat zurück, zu einem kleinen Reste zusammengeschmolzen der sich langsam wieder erholte, bis zur jetzigen Volkszahl.
Doch das war nur eine Sage, eine Fabel, nichts weiter. Es glaubte niemand daran.
Da war der Zigeuner zu ihnen gekommen. Zingo hatte keine Schule besucht, aber er hatte einen Kopf, der nichts vergaß was er einmal gehört, und er war lange Jahre in Ungarn gewesen, wo man sich noch so lebhaft von den Hunnen erzählt. Und er hatte sofort erkannt, dass er echte Hunnen vor sich habe, ganz abgesehen davon, dass noch die alten Hunnennamen unter ihnen üblich waren, wie sie sich ja selbst Kuturgoren nannten, welches Wort ihm ebenfalls bekannt war.
Und nun, nachdem er ihre Sprache erlernt, hatte er von ihren Vorfahren erzählt. So beruhte die alte Sage also auf Wirklichkeit, und die mächtigen Völker im Süden und Westen existierten wirklich.
Am meisten Staunen aber erregte das Messer, das der Flüchtling noch bei sich gehabt hatte. Was war das für ein wunderbares Metall, das besser schnitt als der schärfste Feuerstein, das sich biegen ließ, und doch immer wieder in seine ursprüngliche Lage zurückkehrte? Da hatte Zingo erzählt von jenen Ländern, in denen man für solch einen Ochsen 30 Stück dieser Messer erhielt, weiter nach Westen aber auch 500 bis zu 1000, immer billiger wurden sie.
Dieses Messer fast allein war es gewesen, das die Eroberungslust der Kuturgoren geweckt hatte. Sie wollten nach Westen ziehen und sich solche Messer holen, von vornherein nicht an friedlichen Handel, sondern nur an Beute denkend. Das alte Hunnenblut war wieder erwacht.
Aber so schnell ging das nicht. Zunächst hatte gerade eine furchtbare Viehseuche mehr als die Hälfte aller Männer pferdelos gemacht, und was war denn ein Kuturgore ohne Pferde! Jahre konnten vergehen, ehe der alte Pferdebestand wieder hergestellt war, und Gog Rugila konnte warten. Inzwischen wurden Späher nach Westen geschickt. Der chinesische Süden kam nach des Zigeuners Erzählungen für einen Raubzug nicht in Betracht. Immer neue Abteilungen gingen ab, aber keine einzige kehrte zurück. Wo sie geblieben waren, wusste man nicht. Sie hatten sich eben in den unendlichen Wäldern und Steppen verloren. Dazu kamen auch noch innere Zwistigkeiten.
Kurz, acht ganze Jahre vergingen. Da endlich begann die allgemeine Völkerwanderung. Sie brachen auf, alle Frauen und Kinder und alles Vieh mitnehmend, sie verließen ihre Heimat, um jene fabelhaften Länder aufzusuchen.
»Seit nun bald vier Wochen sind wir unterwegs.«
So hatte der Zigeuner seinen Bericht geschlossen, sich immer so kurz wie möglich fassend.
»Woher hat der Gog Deutsch gelernt?«, war Georgs erste Frage.
»Von mir. O, was der alles von mir gelernt hat! Die ganzen Jahre habe ich ihn Tag und Nacht unterrichten müssen, ihm immer nur von jenen Ländern erzählen, und dabei hat er ganz regelrecht Russisch und Deutsch und Französisch und Englisch gelernt. Denn, sagte er, er muss die Sprachen der Länder, die er erobern will, auch selbst beherrschen. O, was dieser Gog Rugila für ein gewaltiger Mensch und für ein Kopf ist! Wenn Du ihn nur erst näher kennen lernst!«
Georg glaubte es, bekam schon allen Respekt vor diesem Manne, der sich erst so präpariert hatte, ehe er seinen Eroberungszug antrat.
»Wer ist der Magog, der zweite König?«
»Magog Enak war schon ein sehr alter Mann, sehr vorsichtig dazu. Auch seinetwegen ist der Aufbruch so lange hinausgeschoben worden, denn er wollte niemals etwas von diesem Eroberungszuge wissen. Er war der Prophet des Volkes, warnte immer davor, sämtliche Kuturgoren würden dabei zugrunde geben. Da starb er, und nun konnte Gog Rugila seinen Willen, der auch der des ganzen Volkes war, durchsetzen. Bisher hatte man nur zu großen Respekt vor dem alten Magog gehabt.«
»Wird nicht immer gleich ein zweiter neuer König gewählt?«
»Nein, es ist nicht unbedingt nötig. Nur wenn es das Volk verlangt, muss der eine König einen zweiten Mitregenten wählen. Dieses Verlangen ist noch nicht gestellt worden.«
»Woher wisst Ihr, dass dies das Tal des Obi ist, in dem ein Mann namens Merlin haust?«
Der Zigeuner warf erst einen scheuen Blick nach den umstehenden Hunnen, sprach dann aber ganz offen.
»Magog Enak war ein Prophet. Ich muss glauben, dass er wirklich die Gabe der Weissagung besaß, ich habe Proben davon bekommen. Außerdem aber war er selbst kein Kuturgore. Auch er verirrte sich vor langen, langen Jahren, noch ein junger Mann, als Fremder unter dieses Volk. Er lebte ganz einsam, ich habe ihn nur einmal zu sehen bekommen, und danach hätte ich ihn für einen Deiner Landsleute gehalten.«
»Für einen Deutschen?«
»Seine Heimat muss im fernen Westen gewesen sein.
Er hatte früher blonde Haare. Und ein Russe war er jedenfalls nicht.«
»Und der hat von diesem Obitale und einem Manne namens Merlin erzählt?«
»Ich — weiß es nicht«, erklang es zögernd. »Ich kann nur sagen, dass Magog Enak immer vor einer Auswanderung gewarnt hat. Die Kuturgoren, prophezeite er immer, würden nur bis an ein von hohen Felswänden eingeschlossenes Tal kommen, in welchem ein schrecklicher Gott Obi herrsche und ein rätselhafter Mann namens Merlin hause. Die Kuturgoren würden dieses Tal betreten und dabei ihren völligen Untergang finden. Er hat dieses Tal auch beschrieben, das heißt die es einschließenden Felsen, und schon gestern haben wir erkannt, dass wir jetzt dieses Obital erreicht haben. Mehr weiß ich nicht. Ich gehöre nicht mit zu den Häuptlingen, die in alles eingeweiht sind.«
»Die Kuturgoren glaubten dieser Prophezeiung des Magogs?«
»Ja, sie glauben daran.«
»Und trotzdem wollen sie in das Tal eindringen?«
»Nein, das wollen sie eben nicht!«
»Sondern?«
»Es einfach umgehen. Dann können sie in dem Tale doch auch nicht ihren Untergang finden.«
»Aha! Stammte der Magog vielleicht aus diesem Tale? War er selbst drin gewesen?«
»Das weiß ich nicht. Bitte, frage auch nicht so. Ich habe Dir berichtet, was ich Dir berichten sollte.«
»Das solltest Du tun?«
»Ja, der Gog befahl es mir.«
»Weshalb?«
»Damit Du über alles unterrichtet bist, was Du wissen musst, wenn Du dann wieder vor den Gog kommst. Denn Du selbst bist ein Häuptling, er will Dich als seinesgleichen betrachten und Dich danach behandeln. Da sollst Du auch wissen, mit wem Du es zu tun hast. So hat er mir befohlen.«
»Was ist aus meinem Hund geworden?«, fragte jetzt Juba Riata, und er mochte diese Frage schon längst zurückgehalten haben, hatte nur nicht unterbrechen wollen.
»So viel ich weiß, hat man ihn vorhin mit Riemen umschnürt wie er war, unter einen Wagen geworfen.«
»Ist er verwundet worden?«
»Ich habe vorhin nichts davon bemerkt.«
»Kann er sich nicht wieder mir beigesellen?«
»Wird er nicht bösartig sein?«
»Nein, sobald ich ihm befehle, diese fremden Menschen als seine Freunde zu betrachten, mögen sie ihm vorher auch getan haben, was sie wollen.«
»Folge mir, ich werde versuchen, dass man ihn freilässt.«
Die beiden erhoben sich, die umstehenden Hunnen öffneten den Kreis weit, um den Fremden durchzulassen, den sie töten mussten, wenn er sich einem Manne bis auf Armlänge näherte.
Georg brauchte nicht lange seinen Gedanken nachzuhängen, so kehrte Peitschenmüller zurück neben ihm Pluto, der sich alsbald hungrig über die ihm abgetretenen Fleischstücke hermachte, auch er hatte ja lange genug gefastet, dabei aber noch immer seine ruhevolle Würde wahrend, was so gar nicht einem Bluthunde entsprach, wie man sich einen solchen immer vorstellt.
»Sie haben keine Hunde«, erklärte Juba Riata zunächst, sich wieder niederlassend, »kennen gar keine Hunde, staunen dieses ihnen ganz fremde Tier an, halten es für eine besondere Art des Wolfes — da ihnen aber nun dieser eine ganz vertraute Erscheinung ist, mit dem sie ständig in Fehde leben, so haben sie sich auch nicht etwa vor meinem Pluto gefürchtet.«
»Ja, Juba, was sagen Sie nun zu alledem, was wir da erfahren haben?«
»Das ist höchst interessant. Also die alten Hunnen existieren noch, und als die Steinfiguren die Felsenwand verließen, und als der furchtbare Posaunenton erscholl, da sind sie richtig wieder aufgetaucht.«
Peitschenmüller hatte wohl recht, aber Georg wollte sich hierauf nicht weiter einlassen.
»Also sie wissen, dass in diesem Tale ein Gott Obi herrscht und ein Mann namens Merlin haust, und dass sie dieses Tal nicht ungestraft betreten dürfen.«
»Ja, auch das ist sehr merkwürdig, aber dazu kann ich gar nichts sagen«, wollte sich nun Peitschenmüller wieder auf dieses Thema nicht weiter einlassen.
»Wo ist der Zigeuner geblieben?«
»Er sagte, ich solle allein zu Ihnen zurückkehren, jetzt müsse er zum Gog.«
»Wo ist der?«
»Ich habe ihn nicht gesehen.«
Und sie sollten ihn auch sobald nicht wieder zu sehen bekommen, so wenig wie den Zigeuner. Zwei Tage waren vergangen, und jene beiden schienen verschwunden zu sein. Unterdessen hatte sich nichts geändert. Die Hunnen schienen einen gewaltigen Marsch hinter sich zu haben, der Mensch und Tier erschöpft hatte, jetzt wollten sie für längere Zeit der Ruhe pflegen.
Die beiden Gefangenen waren sich selbst überlassen, konnten tun, was sie wollten, aber jede Flucht war ihnen unmöglich gemacht worden. Denn es war nicht nur bei dem Verbot und der Drohung geblieben, sich nicht weiter als hundert Schritte von dem roten Wagen zu entfernen, sondern um diesen herum war auch auf die angegebene Entfernung eine doppelte Kette von Posten gezogen worden, ein Hunne stand oder lag dicht neben dem anderen, sie wurden regelmäßig abgelöst in der Nacht brannten lodernde Feuer, und wenn sich die beiden der Wachtkette näherten, dann sprangen auch die Liegenden auf und hielten ihnen drohend die Lanzen entgegen. Ebenso war auch der Eingang zu der Höhle, welche die Treppe enthielt, stark besetzt, obgleich diese kaum 30 Schritte von dem roten Wagen entfernt war, sodass mehr ein Halbkreis gebildet wurde, dessen Hälfte von der glatten Felswand begrenzt war.
Diese Wachen ließen sich auch nicht anreden, immer nur drohende Bewegungen. Hier hörte eben jede Gemütlichkeit auf, während man in dem Halbkreise selbst den Gefangenen mit der größten Freundlichkeit begegnete.
Aber es hatte keinen Zweck, die Leute anzusprechen. Keine der ihnen bekannten Sprachen wurde verstanden, und jedenfalls nicht, dass man sie nur nicht verstehen wollte. Sonst also die denkbar größte Zuvorkommenheit. Männer, Frauen und Kinder, alle wetteiferten miteinander, die beiden unfreiwilligen Gäste mit Leckerbissen zu versehen und sie sonst zu ergötzen. Aber die »Leckerbissen« wurden lieber nicht angenommen. Das mit den drei getrockneten Fröschen in jeder Milchschale war, wie nun schon erkannt worden, nicht nur eine religiöse Zeremonie, sondern Frösche galten hier eben als Leckerei, in Zeiten der Fülle wurden sie gesammelt und getrocknet, dann zum Genießen ließ man sie schnell etwas aufquellen, aber um mit diesem kostbaren Luxus nicht gar zu sehr zu wüsten, war strenges Gesetz, dass auch kein Häuptling in seine Trinkschale, die mindestens einen halben Liter fassen musste, gefüllt mit Wasser, Milch oder Kumys oder Blut, mehr als drei solcher getrockneten Frösche bekam, und da mussten sie schon sehr klein sein, und sie durften nicht eher verschluckt werden, als bis die Schale ausgetrunken war.
Jetzt brachte man den Gästen auch am Feuer geröstete Frösche und Eidechsen und Blindschleichen und Ringelnattern dar, die man in der Umgegend lebendig gefangen hatte, und dass sie zurückgetrieben wurden, konnte dem Überbringer nur sehr angenehm sein, denn dann brauchte der, der dieses Viehzeug selbst gehascht und zubereitet hatte, diese Leckerbissen nicht abzuliefern, etwa an die Häuptlinge, sondern konnte sie gleich selbst verschlingen. Der größte Jubel herrschte im Lager, als am Abend des zweiten Tages ein starker Ostwind Myriaden von Maikäfern gebracht hatte. Diese Insekten krochen hier viel später aus, sie mochten von weit her aus Eichenwäldern gekommen sein.
Alles war emsig beschäftigt, die schwärmenden Maikäfer niederzuschlagen und aufzusammeln. Sie wurden in Ledersäcke gesteckt, auf diesen trampelte man mit den Füßen herum, bis alles ein Brei war, dieser wurde in Steinschalen gekocht oder auf heißen Steinplatten geröstet und dann mit flüssiger Butter serviert. Dabei aber wurden schon immer ganze Maikäfer gekaut, gleich lebendig in die breiten Mäuler gesteckt und mit wonnigem Behagen geschmatzt.
Es gibt übrigens auch bei uns in Deutschland Leute genug, welche Maikäfer als ein vorzügliches Gericht rühmen. Und selbst Brehm empfiehlt in seinem »Tierleben« eine Bouillon von gerösteten Maikäfern als eine kräftige, ausgezeichnet schmeckende Suppe, besonders für Rekonvaleszenten geeignet. Und es ist eigentlich nicht einzusehen, weshalb sich nur von Laubblättern nährende Maikäfer unappetitlicher wären als zum Beispiel der ekelhafte Krebs. Und wenn die Maikäfersuppe eingeführt werden könnte, dann wäre sicherlich auch die Maikäferplage, die ja furchtbare Dimensionen annehmen kann, ganze Wälder vernichtet, durch die Engerlinge über große Gegenden Hungersnot bringt, schnellstens beendet. Immerhin, es war den beiden nicht zu verdenken, dass sie von dieser Leckerei nichts wissen wollten, so lange sie andere Nahrungsmittel noch in Hülle und Fülle hatten.
Noch ehe diese Maikäferschmauserei bei Feuerschein beendet war, zogen sich unsere beiden Freunde in ihr Zelt zurück, dass sie sich aus Häuten gefertigt hatten.
»Juba, was soll daraus werden?«
So hatte Georg während dieser zwei Tage schon mehrmals gefragt.
Er war überzeugt, dass man in dem Tale von den Hunnen, von ihrer Gefangenschaft und von ihrer Sicherheit wusste. Dafür würde der schier allwissende Merlin gesorgt haben, und der würde die beiden auch nicht im Stiche lassen.
Aber sie hätten sich doch lieber durch eigene Kraft befreit. Dazu war vorläufig nur so gar keine Aussicht vorhanden. Die Wachtpostenkette war einfach undurchdringbar, und dazu kam noch, dass sie so gar nicht wussten, wie es außerhalb derselben aussah. Denn diese Wagenburg hier befand sich ja doch in dem Kiefernwald, der sich längs der Felsenwand hinzog ehe die eigentliche Steppe begann, und so weit auch die Bäume auseinander standen und wenn auch alles Unterholz fehlte, man konnte nicht in diese Steppe hineinsehen, wo es doch jedenfalls auch von Hunnen wimmelte.
Bisher hatte Peitschenmüller noch niemals eine Antwort auf diese Frage gewusst, heute Abend war es der Fall.
»Wir müssen eine finstere Nacht mit tüchtigem Regen abwarten, der jedes Holzfeuer unmöglich macht, dann müssen wir versuchen, uns durchzuschleichen, einen anderen Rat weiß ich nicht.«
Sprach es, streckte sich auf den Fellen aus, und schon in der nächsten Minute verrieten seine regelmäßigen Atemzüge, dass er sanft entschlummert war.
Bald war auch Georg eingeschlafen. Wie lange er geschlafen hatte, wusste er nicht, als ihn gleichzeitig Plutos drohendes Knurren und ein heller Lichtschein weckte.
Die Augen aufschlagend, erblickte er zwei Hunnen, brennende Fackeln in den Händen, und zwischen ihnen stand der Gog, gleich an seiner vierschrötigen, trotz aller Kleinheit so kolossalen Gestalt erkennbar, wenn er auch in seinen Mantel von Eichhörnchenfellen, denen die Haare abgeschabt worden, eingehüllt war und die herabgezogene Pelzmütze fast das ganze Gesicht bedeckte.

»Sorgt für Euren Hund, dass ich ihn nicht töten muss«, war sein erstes herrisches Wort.
Da Pluto nicht gehetzt wurde, ging er überhaupt nicht zum Angriff über.
»Steht auf, nehmt alle Eure Sachen und folgt mir!«
Was sie noch besaßen, hatten sie alles bei sich. Wenn Georg einmal nach seiner Taschenuhr gesehen oder das Fernrohr benutzt hatte, so hatte das bei den Hunnen wohl Staunen und Neugier erregt, aber niemand hatte auch nur gefragt, was das denn für Instrumente seien, auch sein Häuptling, da musste wohl ein strenger Befehl des abwesenden Gogs vorgelegen haben. Und jetzt trat aus dem dunklen Hintergrund, den der Zelteingang bildete, noch ein vierter Hunne in den Lichtschein, und zu ihrem Staunen bekamen die beiden Gefangenen auch ihre Waffen ausgeliefert, die Gewehre und Patronentaschen und Messer.
»Nehmt und folgt mir!«
Sie ließen es sich nicht nochmals sagen und folgten dem Gog hinaus ins Freie.
Es war eine warme, stille, finstere Nacht. Hier und da ein verglimmendes Feuer, um das Hunnenkrieger schlafend lagen, oder wenn sie wachten, so nahmen sie doch gar keine Notiz von den Fackelträgern, von ihren obersten Fürsten, durften es wahrscheinlich nicht tun. In weitem Umkreise aber brannte eine einzige Feuerkette.
Sie schritten nach dem Eingange der Höhle, wo ebenfalls ein helles Feuer brannte, hier standen die Wächter, die etwa noch gelegen hatten, schnell auf.
Ein gebieterisches Wort, und die Hunnen traten vor dem Gog ehrerbietig zurück.
Sie schritten durch die Höhle, es ging die Treppe hinauf, voran die beiden Fackelträger, dann der Gog, dann die beiden, die sich jetzt wohl nicht mehr als Gefangene betrachten durften, dann noch einige Hunnen, die nichts weiter als zugestutzte Kiefernäste als Reservefackeln trugen.
Georg blickte einmal nach der Uhr — gleich um eins. Als sie nach einer Stunde oben auf dem Plateau waren, begann der junge Tag zu grauen. Der Gog machte nur eine gebieterische Handbewegung und sofort drehten die Fackelträger und die anderen hunnischen Begleiter um und verschwanden wieder in dem Treppenkamin.
Noch einige nachgerufene Worte, und Georg bemerkte ganz deutlich, wie sie ihren Abstieg ganz außerordentlich beschleunigten.
Jetzt wandte sich der Gog den beiden zu.
»Ich bin mit Euch hier oben allein«, sagte er in seinem mangelhaften Deutsch in dem er sich aber doch vollkommen auszudrücken wusste. »Ihr habt mich nicht mehr als Feind zu betrachten, so wenig wie ich Euch fürchte. Ihr seid frei und sollt zu den Euren zurückkehren. Wisst Ihr, wo ich während der zwei Tage und Nächte gewesen bin?«
Georg wusste es sofort.
Wohl nur von allein war dem Gog vorn der Mantel auseinander gegangen, und mit Staunen sah Georg an dem Gürtel, der den mächtigen Leib umspannte, zwei große Revolver im Futteral hängen, einen Säbel, und ferner hatte der Gog ein Fernrohr in der Hand — und Georgs Staunen war besonders deshalb berechtigt, weil er sofort erkannte, dass alles dies von Bord der »Argos« stammte.
»Du warst im Tal, Du warst an Bord unseres Schiffes!«
»Du sagst es. Ich habe mit Merlin gesprochen und war auch bei Deinen Gefährten, sie haben mich zwei Tage lang als Gast bewirtet, und was ich als Andenken auswählte, gaben sie mir freundlich als Geschenk mit. Sind da nicht auch wir Freunde? Nun kommt!«
Er wandte sich um und ging wieder voraus, führte sie dorthin, wo die beiden vor drei Tagen auf dem Plateau gestanden hatten, den Heranzug der Hunnen und das Auffahren der Wagenburgen beobachtend.
Obgleich der Tag schon dämmerte, galt das doch nur von hier oben, dort unten herrschte noch die finstere Nacht, man sah die Wachtfeuer leuchten.
Schweigend blickte der Gog einige Zeit hinab, dann wandte er seine geschlitzten Feueraugen wieder den beiden zu, speziell auf Georg.
»Zingo hat mir berichtet, so weit er selbst davon wusste. Ich habe den Prophezeiungen des Magog Enak nie geglaubt, habe ihn verlacht, und ich habe auch Merlins Behauptungen und Warnungen und Drohungen nie geglaubt. Denn ich kenne diesen Mann schon längst. Wovon aber Zingo nichts weiß, niemand anders. Dieser Merlin war schon öfters bei mir, in unseren fernen Wäldern, und ich war auch schon wiederholt bei ihm in diesem Tale. Wenn auch niemand von den Meinen etwas davon erfuhr. Ich habe ihm niemals geglaubt, dass es meinen Kuturgoren nicht möglich sei, die Welt zu erobern. Was er mir auch für Waffen zeigte, was er mir auch für Zauberei vormachte — ich lachte darüber. Solche Waffen wollten wir uns bald verschaffen, diese Zaubereien würde auch ich lernen, andere ebenfalls. Aber Männer konnte er mir nicht zeigen, Krieger, mit denen wir dereinst kämpfen würden, das war es! »Jetzt hat er mir solche gezeigt. Zwei ganze Tage und Nächte war ich bei den Deinen. Und sie haben mir gezeigt, was sie können. Jetzt glaube ich es. Die Kuturgoren werden in ihre Heimat zurückkehren, ohne gekämpft zu haben. Genug.«
Wieder wandte der Gog seine Blicke hinab.
Es war inhaltsvoll genug gewesen, was er da gesagt hatte, und es braucht wohl keiner näheren Erläuterung. Er hatte die Argonauten kennen gelernt, hielt alle anderen Menschen, die westlich von hier wohnten, für solche unbesiegbare Helden — da gab er die Hoffnung auf, ging mit seinen Hunnen lieber gleich in seine Wälder zurück.
Jetzt begann es auch dort unten sich zu lichten, schon konnte man die Planwagen unterscheiden, welche die ganze Steppe bedeckten, schon wurde es im Lager lebendig, Reiterchen huschten hin und her.
»Wie heißt der Mann, der auf einem Schiffe alle Wunden und Krankheiten heilen kann?«, wandte sich der Gog dann wieder an Georg.
»Doktor Cohn?«
»Nein, es war ein anderer Name, der zweite, Doktor I — si — dor?«
Mit etwas schwerer Zunge hatte es der Hunne hervorgebracht, der diesen Namen des Schiffsarztes eben allein gehört hatte.
»Ja, unser Doktor Isidor!«
»Ich habe mit ihm lange Zeit gesprochen. Er weiß noch viel, viel mehr als Zingo, er weiß alles. Wie wir darauf kamen, weiß ich nicht. Ja, ich fragte ihn über Rom, das einst Gog Attila belagerte. Kennst Du den Kaiser Nero?«
»Ich kenne ihn.«
»Was tat er? Wodurch hat er sich hauptsächlich berühmt gemacht?«
»Berüchtigt meinst Du wohl. Nun, Du meinst sicherlich, dass er selbst Rom an allen Ecken anzündete.«
»Er tat es nicht mit eigener Hand.«
»Es geschah es eben auf seinen Befehl!«
»Und was tat er dann, als die ganze Stadt brannte?«
»Er schaute zu und hatte seine Freude dran«, erriet Georg sicher das Richtige.
»Du sagst es«, bestätigte denn auch jener kopfnickend, »er zündete seine Stadt an und hatte seine Freude darüber, wie alles in Flammen stand, wie die Menschen durch die Straßen flohen, wie sie verbrannten.«
Wieder blickte der Gog in die Steppe hinab.
Soeben erhob sich die Sonne als ein feuriger Ball über dem östlichen Horizont, wie mit einem Schlage war plötzlich die ganze Steppe mit goldenem Lichte übergossen.
Da ließ der Gog seinen Mantel fallen und streckte seine herkulischen Arme vor.
»Ich bin der Kaiser Nero!«, rief er mit schallender Stimme. »Ich zünde Rom an, lass alles in Flammen aufgehen — o, es muss herrlich sein!«
Wahrhaft entsetzt wich Georg zurück.
Lag es in der Gebärde oder lag es in der Stimme dieses Mannes, dass er sich plötzlich so entsetzte?
»Gog, was willst Du tun? Doch nicht das dürre Gras der Steppe in Flammen setzen?«
»Nein. Nicht das, was Kaiser Nero von Rom getan hat. Der Gog Rugila der Kuturgoren ahmt niemals etwas nach. Wohlan denn, Merlin, die Zeit ist gekommen, die Sonne hat diese Felswand erreicht — nun zeige, dass Du die Macht hast, meine Krieger ohne Waffengewalt von hier zu entfernen, und ich will Dir dankbar zuschauen, auch wenn es die Vernichtung meines ganzen Volkes bedeutete!«
Kaum hatte der Gog dies gerufen, als die Luft von einem dumpfen Knalle erschüttert wurde.
Gar nicht so laut, aber doch von furchtbarer Wirkung in dieser feierlichen Stille.
Eine Wirkung war zunächst nicht zu bemerken.
Dort unten ging alles den gewöhnlichen Morgenbeschäftigungen nach, die Männer, die keinen unnötigen Schritt zu Fuß machten, trieben zu Pferde die Kühe und die milchgebenden Stuten zusammen, die Weiber schickten sich zum Melken an.
Mit einem Male aber fing alles zu laufen an, das ganze Lager wurde wie von einem furchtbaren Schreck erfasst, und da hörte man auch schon ihr Schreien bis hier oben.
Und da sah man auch schon die Ursache.
Plötzlich schob sich von der Felswand her in das Lager hinein ein breiter, silberglänzender Streifen — Wasser! Und ehe man etwas richtig beobachten konnte, war schon das ganze Lager unter Wasser gesetzt, es riss alles mit sich fort, Tiere und Menschen, und schon begannen die Planwagen zu schwimmen, wurden nach Osten in die Steppe hineingetrieben und wenn sie auch hier und da an Baumstämmen hängen blieben, so wurden sie von der gewaltigen Strömung doch gleich wieder losgerissen.
Im Nu hatte sich die ganze Steppe in einen reißenden Strom verwandelt in der es von Menschen und Pferden und Rindern und Schweinen wimmelte, alle verzweifelt um ihr Leben kämpfend.
»Um Gotteswillen!«, schrie Georg. »Unhold, Du hast diese Katastrophe mit Absicht herbeigeführt!«
»Nein, diese Katastrophe war unvermeidlich.«
Das hatte aber nicht der Gog gesagt.
Jäh fuhr Georg bei dem Klange der fremden und ihm doch so bekannten Stimme herum — hinter oder jetzt vor ihm stand Merlin.
»Die Wasserreservoirs in den hohlen Felsen«, fuhr dieser fort, »haben sich durch den letzten Wolkenbruch bis zum Überlaufen gefüllt, sie müssen unbedingt entleert werden, oder sie tun es von selbst, ich könnte es nicht hindern, und gebe ich dem Wasser keinen Ausfluss nach der östlichen Steppe, so würden sich die ungeheuren Wassermassen in das Tal ergießen und alles Lebendige töten, das sich nicht auf hohe Felsen zu retten vermag.«
»Aber hier diese zahllosen Menschen kommen um! Sie hätten doch vorher gewarnt werden können, dass sie sich rechtzeitig zurückzogen!«
»Sie hätten Schutz vor dem Wasser nur in meinem Tale gefunden, und das dürfen die Kuturgoren unter keinen Umständen betreten. Frage nicht nach dem Warum. Sie dürfen nicht! Und hätten sie sich anderswo in die Steppe begeben, dann allerdings hätten ihnen die Wasserfluten verderblich werden können. Glaube mir, dass hier der geeignetste Ort ist, wo sie den Kampf mit dem Wasser aufnehmen können, obgleich es gerade hier aus den Felsen hervorbricht. Es ist auch sonst nicht so schlimm, wie es aussieht. Das Gebiet der Kuturgoren ist reichlich mit Strömen und Flüssen durchzogen, es sind halbe Wassermenschen, die fortwährend mit Überflutungen zu kämpfen haben, und dasselbe gilt von allen ihren Tieren. Sobald ein jeder, Mann oder Weib oder Kind, ein Pferd oder seinen Wagen erreicht hat, dann fühlt er sich gesichert und lässt sich ruhig treiben, bis sie ein erhöhtes Terrain erreicht haben, und das ist gar nicht so weit von hier, wenn Du es auch nicht durch Dein Fernrohr erspähen kannst.«
»Aber warum sind sie dann nicht gewarnt worden, dass sie sich wenigstens vorbereiten konnten?«, hatte Georg dann nur noch zu fragen.
»Ich habe den Gog gewarnt. Er wollte es nicht glauben, oder er wollte es doch mit eigenen Augen sehen, wie ich alle seine Scharen wegspülen kann, jetzt und jederzeit. Denn die Macht dazu habe ich immer, und ich will nicht, dass diese wilden Volksmassen die ihnen gezogene Grenze überschreiten. Ihre Zeit dazu ist noch nicht gekommen. Und auch ich handele dabei nur auf Befehl eines Höheren. Der Gog hat seinen Willen gehabt, er hat es mit eigenen Augen geschaut.«
Nicht lange dauerte es, so war das ganze Gewimmele von Menschen und Tieren verschwunden, erst für das Auge, dann auch für das beste Fernrohr, und unter ihnen glänzte nur noch ein ruhiger Wasserspiegel.
»Noch einen Tag dauert es, bis sich das Wasser völlig wieder verlaufen hat«, sagte Merlin noch, »kommt, folgt mir, ich bringe Euch zu den Euren zurück, die von einer anderen Stelle aus dieses Schauspiel beobachtet haben. Und vorher möchte ich noch einmal mit Dir allein sprechen.«
Sie folgten dem gelben Manne, den Gog allein lassend. Merlin führte sie über das Plateau und jene erste, verschüttete Treppe hinab und in eine der ersten Höhlen hinein, von denen sie ja nur eine einzige untersucht hatten.
Georg wunderte sich nicht, nach kurzem Gange eine Felsenkammer zu betreten, die ganz komfortabel eingerichtet war, auch von jenem rätselhaften Lichte erfüllt.
»Setzt Euch, meine Freunde. Ihr habt vor drei Tagen hier in diesem Felsen den Mann ohne schwarze Maske gesehen, der Euch ja von der Gesellschaft der Inder schon bekannt gewesen ist. Ich weiß, dass Ihr ihn hier ohne Maske gesehen habt. Er heißt Raimund, ist ein Deutscher, gehört mit zu unserer geheimen Gesellschaft, war einmal abtrünnig geworden, musste dafür büßen. Keine Bestrafung, die wir nicht kennen, sondern nur eine Läuterung. Das hat sich jetzt vollendet. Genügen Euch diese Angaben über den Mann?«
»Wir haben gar keinen Grund, weitere Aufklärungen über ihn zu verlangen«, entgegnete Georg.
»Doch. Nämlich weil ich Euch bitten möchte, diesen Mann unter Euch aufnehmen zu wollen. Als Freund, als Argonauten, der sich an allen Euren Spielen und sonstigen Beschäftigungen beteiligt. Wollt Ihr?«
»Herzlich gern!«
»Dieser Raimund passt nicht zu uns, fühlt sich unglücklich bei uns, seine ganze Natur fordert eine tatkräftige Beschäftigung, und die können wir ihm nicht geben. Er hatte gehofft, mit den Hunnen kämpfen zu können, aber ich durfte es nicht zulassen, und als er diese Männer und ihre erbärmlichen Waffen gesehen, verzichtete er selbst verächtlich darauf. Bei Euch könnte er sich eher seinen Kräften entsprechend betätigen. Wollt Ihr ihn unter Euch aufnehmen, als Euren Kameraden?«
»Herzlich soll er uns willkommen sein, kann ich nur wiederholen!«
»Aber Ihr sollt nicht über ihn forschen, nicht ihn über seine Vergangenheit fragen. Was ich Euch von ihm gesagt habe, muss Euch genügen.«
»Nicht die geringste Frage wird an ihn gestellt werden.«
»Ich danke Euch. Raimund wird sich bei Euch einfinden. Nun noch etwas anderes. Wollt Ihr dieses Tal verlassen?«
»Wenn Du es wünschest —«
»Nein, ganz wie Ihr, wie Du bestimmst! Ich habe Euch in diesem meinem Reiche für alle Zeiten Gastfreundschaft zu gewähren, Euch immer zu Diensten zu stehen, und ich versichere Dir, dass ich es von Herzen gern tue.«
Die blauen Augen in dem faltigen und doch so jugendfrischen Antlitz blickten so ehrlich, dass man unmöglich an der Aufrichtigkeit dieser Worte zweifeln konnte.
»Ich selbst habe noch keine Neigung, dieses Tal zu verlassen, dessen Geheimnisse wir wohl noch längst nicht gänzlich erforscht haben. Doch hat hierüber in letzter Instanz unsere Patronin oder aber der gemeinsame Entschluss der ganzen Mannschaft zu entscheiden.«
»Nein, ich meine eigentlich, ob Ihr es einmal vorübergehend verlassen wollt?«
»Mit unserem Schiffe?«
»Nein. Das kann hier liegen bleiben.«
»Zu Fuß in die weitere Umgebung?«
»Auch nicht zu Fuß. Auf einem anderen Fahrzeug.«
»Auf was für einem?«
»Professor Beireis wird Euch weitere Erklärungen geben. Setzen wir unseren Weg fort. Diese Felsenräume hier hätten wir sowieso passieren müssen.«
Sie waren wieder vereint, hatten sich gegenseitig erzählt, die beiden Freunde, was sie unter den Hunnen erlebt oder doch beobachtet hatten, die Zurückgebliebenen, wie die Argonauten dem von Merlin eingeführten Gog eine Vorstellung gegeben hatten, fast zwei Tage während, wie sie ihn sonst unterhalten hatten, was dies alles für einen mächtigen Eindruck auf den Hunnenfürsten gemacht hatte.
Am anderen Tage stellte sich gleichfalls von Merlin geführt, Herr oder Mister Raimunds ein, wie er fernerhin genannt wurde, einige jener fremden Neger trugen ihm etwas Gepäck nach, der jetzt Unmaskierte wurde mit der größten Freundlichkeit empfangen, doch wollte man sich jetzt um ihn lieber noch nicht viel kümmern, er bekam zwei Kabinen angewiesen, da mochte er sich nach und nach einrichten.
Dann kam eine Einladung für die Indianer und die englische Mannschaft, der Maharadscha wolle ihnen eine spezielle Vorstellung geben, sie verließen das Schiff und verschwanden in einem Felsengange, bald darauf stellte sich der schon angemeldete Professor Beireis ein, wie er sich nun einmal nannte und der er sein wollte, wie immer patent im schwarzen Frackanzug.
Wieder waren es einige Neger, die ihm verschiedenes nachtrugen, darunter als Hauptsache einen schweren Zylinder von ungefähr einem Meter Höhe und einem viertel Meter Durchmesser, überall mit Messingschrauben versehen. Er wurde wie die anderen Sachen, Kisten und Blechkoffer und dergleichen, einstweilen an Deck gesetzt.
Wie gesagt, des Professors Besuch war angekündigt worden, man wusste, dass er einen Experimentalvortrag halten wollte, alles hatte sich dazu schon an Deck versammelt, niemand fehlte. Nur eben die Indianer und die englischen Schiffsleute waren vorher entfernt worden, natürlich mit guter Absicht.
Eine Vorstellung war auch nicht nötig, man kannte diesen Professor Beireis ja schon zur Genüge, von jenem australischen Seefelsen aus, wo man ganz intim mit ihm verkehrt hatte.
Das kleine, zierliche Männchen blickte sich würdevoll im Kreise um und zog gravitätisch seine weißen Glacehandschuhe aus.
»Meine Herrschaften«, begann er dann. »Ich habe die Ehre, beauftragt worden zu sein, Ihnen einen Experimentalvortrag zu halten. Es ist dazu nötig, dass ich ab und zu Fragen stelle, auch zum Teil solche, welche das Kommando dieses Schiffes betreffen. Soll ich mich dazu an Sie wenden, Herr Kapitän Martin, oder an den Herrn Waffenmeister?«
Kapitän Martin machte ein misstrauisches Gesicht und schlenkerte das rechte Bein nach dem Waffenmeister.
»Na da nehmen Sie nur mich«, begann dieser bereits zu lachen, denn das Männchen benahm sich von vornherein gar zu possierlich, was aber nicht weiter geschildert werden kann.
»Danke. Also, Herr Waffenmeister, Sie sind mein Partner. Sind alle Mann hier oben? Ist niemands mehr unter Deck?«
Schnell konnte konstatiert werden, ohne erst abzuzählen oder aufzurufen, dass sämtliche hier versammelt waren.
»Sind Ihre Kessel geheizt?«, war die nächste Frage.
Nein, unter den Kesseln war schon seit langer Zeit kein Feuer mehr, jetzt hatte man es nicht mehr nötig, immer auf Dampf zu halten. Außerdem war ein Hauptteil der Maschine gerade abmontiert worden, um eine allgemeine Schmierung vorzunehmen
»Dann bitte, wollen Sie die Trossen loswerfen lassen.«
Es geschah, wie das kleine Männchen sich ganz seemännisch ausgedrückt hatte.
Die »Argos« lag wieder an ihrer alten Stelle in der seitlichen Wasserschlucht, war mit einigen Tauen, welche durchs die Felsenfenster gingen, festgemacht, diese wurden losgeworfen und eingeholt.
»Danke. Sie erlauben doch, dass ich einmal die Führung des Schiffes übernehme? Ich hätte es eigentlich zuvor fragen müssen. Sie gestatten es mir? Danke. Haben Sie keine Sorge, weil das Schiff etwas stromab in die Schlucht hineingetrieben wird. In einer einzigen Minute habe ich es in meiner Gewalt.«
Und schnell hatte der Professor aus einem Kasten zwei dünne, blanke Kupferdrähte genommen, sie im Nu an zwei Klemmen des großen Zylinders, der mittschiffs an Deck stand, geschraubt, sofort nahmen zwei seiner schwarzen Gehilfen das Ende je eines Drahtes, gingen hinüber nach der Bordwand, nach beiden Seiten, befestigten es dort, ganz oberflächlich und es schien auch gar nicht darauf anzukommen, wo sie es befestigten, denn der eine hatte den Draht um einen Cofenagel geschlungen, der andere ihn flüchtig um die Wante des Mittelmastes gewickelt. Unterdessen hatte der Professor dem Kasten auch schon zwei andere, kürzere Drähte entnommen, sie ebenfalls an den Zylinder geklemmt, das andere Ende an ein schwarzes Brettchen befestigt, das mit vielen weißen Knöpfen besetzt war und das er immer in der Hand behielt.
»So, jetzt wollen wir eine kleine Spazierfahrt auf den See hinaus machen.«
Hatte man sich schon gewundert, was das Männchen da machte, wozu er das manövrierunfähige Schiff hatte abtauen lassen, so geriet doch jetzt alles vor Staunen schier außer sich, als sich das mächtige Schiff plötzlich in Bewegung setzte, langsam zur Wasserschlucht hinausfuhr, draußen immer schnellere und schnellere Fahrt annahm, dabei einen großen Bogen beschrieb, plötzlich sich vorn aufbäumte und im nächsten Augenblick ganz still dalag, nur von dem erregten Wasser noch etwas geschaukelt.
Niemand war während dieses Manövers, das allerdings kaum eine Minute gewährt hatte, eines Wortes fähig gewesen.
»Ja, ist denn das nur eine Illusion?«, erklang es dann. »Glauben die Herren, dass dies nicht Wirklichkeit ist, dass Sie dies zu erleben sich nur einbilden, dies alles nur träumen?«, lächelte der Professor, der sich immer mit dem Brettchen beschäftigt hatte, ab und zu einen Knopf drückend.
Nein, davon konnte keine Rede sein, das war nur so eine Redensart gewiesen.
»Wie ist denn das nur möglich?«, erklang es dann. »Nun, Herr Waffenmeister, wie erklären Sie sich die Sache?«
»Die wirkende Kraft kommt aus diesem Zylinder«, entgegnete dieser, wozu freilich nicht viel Scharfsinn gehörte.
»Sehr richtig. Was für eine Kraft?«
»Elektrizität.«
»Wiederum sehr richtig. Und wie treibt diese Elektrizität das Schiff vorwärts?«
»Das — ist mir unerklärlich. Denn Schraube und Ruder kann sie doch nicht bewegen.«
»Weshalb nicht?«
»Weil hinten gar keine Schraube ist, sie ist abgenommen worden, die Stopfbüchse ist gedichtet, und auch das Ruder ist abmontiert.«
»Kommt sonst eine der Damen oder einer der Herren auf die Idee, wie ich dann das Schiff durch Elektrizität fortbewegen kann? Oder durch Magnetismus, will ich gleich hinzufügen.«
Nein, auch dieser Hinweis auf die Wirkung von Magnetismus brachte niemand auf einen auch nur ahnenden Gedanken.
»Dann gestatten Sie mir, Ihnen zur Erklärung erst ein Experiment im Kleinen vorzuführen. Darf ich um eine größere Balje bitten, gefüllt mit Frischwasser.«
Er hatte Balje gesagt, nicht Wanne. Aber eine solche war es, groß genug, dass darin jemand ein Wannenbad nehmen konnte, schnell wurde sie durch die Handpumpe mit Frischwasser gefüllt, bis ziemlich an den Rand, wie der Professor angab.
Der hatte unterdessen einem Kästchen zwei andere Drähte entnommen, weiß und so dünn wie Rosshaar, man konnte sie kaum erkennen, hatte sie gleichfalls an den Zylinder befestigt, und jetzt bemerkte man, dass diese vielen Klemmschrauben verschieden gefärbt waren, weiß und gelb, und je zwei Drähte wurden immer an verschiedenfarbigen befestigt.
»So. Danke Für dieses erklärende Experiment möchte ich aber aus gewissen Gründen kein Modelschiffchen, sondern lieber einen kleinen Schlitten verwenden. Der demonstriert noch viel deutlicher als ein Schiffchen, das auf dem Wasser schwimmt. Einen Schlitten benützt man bekanntlich nur auf Schnee oder Eis. Also werde ich dieses Wasser zunächst gefrieren lassen.«
Der Professor nahm unter seinen Sachen einen Stab, ungefähr zwei Meter lang, der mit Strichen und Zahlen markiert war, in der Mitte befand sich eine Null, und auf dieser Null war jetzt der bewegliche Schieber angebracht.
Er steckte den Stab dicht an der hölzernen Wand der Balje ins Wasser und bewegte den Schieber ein wenig hinab.
»So. Ich lasse jetzt das Wasser gefrieren, indem ich ihm seine Wärme entziehe. Das besorgt dieser Stab. Allerdings ist es kein gewöhnlicher Stab, aber auch kein Zauberstab, sondern es ist ein Instrument, welches dereinst auch die andere Menschheit, wenn die Wissenschaft so weit ist, erfinden und benützen wird, um sowohl jede beliebige Hitze, wie jede beliebige Kälte zu erzeugen. Dadurch nämlich, dass das eine Ende des Stabes die Wärme eines Körpers, wozu man am bequemsten Wasser nimmt, aufsaugt und sie am anderen Ende wieder ausstrahlt. So gefriert das Wasser, am anderen Ende entsteht eine intensive Wärmequelle. Wenn man will. Ich habe den Stab jetzt anders eingestellt, Sie könnten das obere Ende ruhig anfassen, würden gar nichts von Wärme verspüren. Denn diese puste ich jetzt in das endlose Weltall hinaus. So, es ist geschehen.«
Schon vor den letzten Worten hatte sich auf dem Wasser eine dünne Eisschicht gebildet, und mit einem Male war alles zu einer festen Eismasse erstarrt, die sicher bis auf den Boden der Wanne ging. Da sich das Wasser beim Gefrieren ausdehnt, hatte sich die Oberfläche des Eises auch etwas gehoben. Der Stab blieb drin stecken.
»Nun habe ich hier das kleine Modell eines Schlittens.« Er zeigte, was er dem Kasten entnommen hatte. Nichts weiter als ein kleines Kinderspielzeug, nur wenig größer als eine Streichholzschachtel, die Kufen aus Holz, auf dem Sitz waren zwei kleine Klemmschrauben angebracht.
- Die »Käsehitsche« — wie der technische Kinderausdruck für diese Art Schlitten lautet — wurde auf die Mitte dies Eises gesetzt.
»Nun, meine Herrschaften, stelle ich Ihnen ein Problem. Wie ist es möglich, einen Schlitten durch Motorkraft fortzubewegen ohne Hilfe von Rädern? Denn sonst ist es doch kein Schlitten mehr, der nur auf Kufen über Schnee und Eis gleiten soll.«
Ja, das ist allerdings ein Problem!
Hierüber haben schon viele erfinderische Köpfe nachgegrübelt und tun es heute noch. Einen Schlitten durch Motorkraft fortzubewegen.
Es gibt ja schon solche Motorschlitten.
Aber immer müssen dabei Räder zu Hilfe genommen werden, an den Seiten angebracht, mit Stacheln versehen, die beim Umdrehen in das Eis eingreifen den Schlitten auf den Kufen so fortschieben.
Eine andere Art von Fortbewegung eines Schlittens durch Motorkraft kennt man noch nicht. Bei Schnee, der nur etwas lose zu sein braucht, versagt diese Vorrichtung natürlich.
Ja, wie soll man denn einen Schlitten überhaupt anders fortbewegen als durch solche Stachelräder, die sich drehen?
Man kann sich überhaupt gar nicht vorstellen, dass es eine andere Art von Fortbewegung eines Gleitschlittens gibt, abgesehen von menschlicher oder tierischer Zug- oder Druckkraft oder durch Stoßen oder durch Segel oder durch Gleiten auf einer schiefen Fläche.
Wie soll man denn sonst nur einen Schlitten fortbewegen?
Und doch, es schlummert in manchen Köpfen etwas wie eine Ahnung, dass sich eine motorische Kraft noch anders übertragen lässt als nur auf Räder, die sich dann drehen. Man muss nur einmal einen Ingenieur sprechen, der sich mit so etwas beschäftigt.
Merkwürdig ist nur, dass sich niemand auszudrücken vermag.
Die Ahnung besteht, aber man kann sie nicht in Worte kleiden.
Das ist ungefähr so wie mit der vierten Dimension. Wohl jeder selbstdenkende Mensch hat manchmal Augenblicke, da ihm die Ahnung überkommt, dass es vielleicht noch etwas anderes geben könnte als Länge, Breite und Höhe.
Dies wird wohl immer nur eine Ahnung bleiben, deren Richtigkeit höchstens durch magische Experimente nachgewiesen werden kann.
Hingegen dieses Problem, einen Schlitten durch Motorkraft anders zu bewegen, als indem via Stachelräder benützt oder etwa eine Propellerschraube, welche wie bei einem Luftschiff wirkt, das dürfte eines schönen Tages gelöst worden sein, und einige Jahre später werden wir die Geschichte so einfach finden wie — wie heute etwa den Flaschenzug.
Denn der Flaschenzug ist eine ganz gewaltige Erfindung gewesen! Wer ihn erfunden hat, wissen wir nicht. Jedenfalls aber kannten die alten Ägypter ihn noch nicht, obgleich sie sich so viel mit dem Fortbewegen und Heben schwerer Lasten beschäftigten. Die mussten beim Bau ihrer Pyramiden noch schiefe Ebenen aus Erde anlegen, auf denen sie die kolossalen Steine und Platten hinaufbeförderten. Der Flaschenzug war ihnen unbekannt. Nein, auch hier wusste niemand, wie man einen Schlitten anders als in den bekannten Weisen vorwärts bewegen sollte, und der Waffenmeister sprach es für alle aus.
»Danke«, dienerte das höfliche Männlein für diesen Bescheid. »Und dennoch ist es ganz einfach. Denken Sie sich — ich will das Experiment nicht erst ausführen, Sie können es sich doch lebhaft vorstellen — dieser Schlitten wäre von Eisen. Oder vorn und hinten wäre je ein Stück Eisen befestigt. Nun nehme ich einen Magneten. Halte ich diesen vor das vordere Eisenstück sorge dafür, dass er nicht mit ihm in direkte Berührung kommt, so wird der Schlitten doch immer dem Magneten nachfolgen. Habe ich dabei den positiven Pol gewählt, so wird dieses Eisenstück negativ. Nähere ich dann diesen positiven Pol hinten dem Eisenstück, das vielleicht schon vorher positiv bestrichen worden ist, so wird der Schlitten doch vorwärts gestoßen. Ist dem nicht so, meine Herrschaften?«
Ja, freilich, das geht! Aber wer hält den Magneten, das ist die Frage!
Dann ist viel einfacher, man bindet den Schlitten an einen Strick und zieht ihn.
Allerdings trifft man ab und zu auf einen erfinderischen Kopf, der so eine geistreiche Idee hat. Man befestigt vorn an den Schlitten oder an einen Wagen oder an ein Wasserfahrzeug einen Magneten, der auf Eisenteile anziehend wirkt. Dann muss der Magnet das Fahrzeug nach sich ziehen.
Das ist natürlich Unsinn. Das ist nur etwas für Witzblätter. Dann wäre ja das Perpetuum mobile erfunden und noch viel mehr. Aber wenn das Fahrzeug mit dem Magneten fest verbunden ist, dann zieht sich das Eisen doch gegenseitig an, die Karre bleibt natürlich stehen, setzt sich doch gar nicht in Bewegung. Wie sollte denn das möglich sein.
So hatte auch der Waffenmeister für alle gesprochen.
»Sie haben recht. Und doch, es ist möglich, ein Fahrzeug auf diese Weise durch Magnetismus fortzubewegen. Nur muss es ein anderer Magnetismus sein als der bisher der Menschheit bekannte, welchen nur Eisen besitzt und der nur wiederum Eisen oder ganz reines Nickel anzieht. Und dass es noch die verschiedensten Arten von Elektrizität und Magnetismus gibt, ist Ihnen wohl schon im Schlosse der Entsagung, wie Sie es nennen, gesagt worden.
Der Magnetismus, den ich nun hierbei anwende, ist, wie wir ihn nennen, diametraler. Das ist wieder ein anderer als diagonaler, durch den jener Metallstaub mit elektrischen Lichtstrahlen dirigiert wird. Was man unter diametral versteht, wissen Sie wohl. Entgegengesetzt. Genau vom Mittelpunkt an gleichmäßig direkt entgegengesetzt. Weiter kann ich Ihnen jetzt nichts von diesem diametralen Elektromagnetismus berichten, nicht wie er erzeugt wird, das Recht steht mir nicht zu.
Eine der Haupteigenschaften des diametralen Magnetismus ist, dass er die verschiedensten Materien anzieht, respektive abstößt, je nachdem dazu der diesen Magnetismus erzeugende diametral-elektrische Strom angestellt ist. Ich bitte um eine Schale mit Wasser, etwa ein Waschbecken, es kann auch Seewasser sein.«
Während dieses gebracht wurde, entnahm der Professor seinem Zauberkasten einen Stab, etwa 30 Zentimeter lang, zur Hälfte schwarz, zur anderen Hälfte rot gefärbt und befestigte an zwei Klemmschrauben die beiden haardünnen, weißen Drähte.
Die Schale war nach seiner Anweisung auf einen höheren Kasten gestellt worden, der nur die Stelle eines Tisches vertrat.
»Danke verbindlichst«, dienerte das Männchen gegen den Matrosen, der die Schale gebracht hatte. »Sie sehen hier einen Stab. Es ist ein ganz gewöhnlicher Holzstab, voll, was für eine Sorte Holz weiß ich nicht einmal. Und Sie können sich auf meine Worte verlassen, ich will Ihnen doch hier nicht etwa mit einem hohlen Zauberstabe etwas vorgaukeln. Sie können ihn dann auch, wenn Sie wünschen, zerbrechen.
Ich habe diesen Stab mit der magnetischen Batterie verbunden. Dadurch wird er mit diametralem Magnetismus geladen, wird selbst ein diametraler Magnet. Und zwar ist dieser Magnetismus jetzt für Wasser eingestellt. Wie dies geschieht, kann oder darf ich Ihnen nicht erklären. Das schwarze Ende ist positiv, das rote negativ. Nun nähere ich den positiven Pol dem Wasser — Sie sehen, er zieht das Wasser an.«
Das schwarze Ende des Stabes hatte die Wasserfläche noch nicht berührt, als das Wasser in einem dicken Faden hochsprang und sich von dem hochgehobenen Stabe auch noch höher ziehen ließ, bis der Strahl erst etwa in der Höhe eines halben Meters wieder zurückfiel, weil die Wasserlast eben für den Magneten zu groß wurde.
Das Staunen der Umstehenden war nicht ganz gerechtfertigt.
Ebenso hatte der Experimenteur nicht ganz Recht gehabt, als er vorhin behauptet, der uns bekannte Magnetismus zöge nur Eisen und reines Nickel an.
Dies gilt nur für Eisenmagneten.
Wenn man eine Stange aus Gummi oder Siegellack reibt, so wird diese bekanntlich elektrisch und zieht dann auch kleine Papierschnitzelchen, Korkstückchen, Holzspäne und dergleichen an, worauf schon früher einmal aufmerksam gemacht worden ist.
So einfach und bekannt diese Erscheinung auch ist, so hat sich die Wissenschaft doch noch gar nicht hiermit beschäftigt, das heißt insofern nicht, als sie die verschiedenen Substanzen in Betracht zieht, die hier dem Elektromagnetismus unterliegen.
Und es schadet gar nichts, wenn hierauf an dieser Stelle noch einmal aufmerksam gemacht wird.
Kein anderer als Arthur Schopenhauer, dieser exakte Wissenschaftler, behauptet, dass alle großen Erfindungen nicht von wissenschaftlichen Fachmännern, sondern von Dilettanten und Laien gemacht worden sind, im Grunde genommen! Die Gelehrten haben dann immer nur das einmal gelegte Ei ausgebrütet. Und so ist es nämlich auch, man braucht nur näher nachzuforschen! Beireis zog den an dem Holzmagneten kleben bleibenden Wasserstrahl noch mehrmals hoch.
»Ich könnte ihn noch viel höher ziehen, ehe er wieder abfällt, der Theorie nach sogar bis ins Endlose hoch, denn man kann diesen Magnetismus bis ins Endlose verstärken, aber mein Arm reicht nicht weiter. Das war die positive Seite. Nun nehme ich das rote, das negative Ende, das muss das Wasser natürlich abstoßen — da sehen Sie!«
Vor dem negativen Pol wich das Wasser zurück, es entstand in dem Wasser ein Loch, das überall hinging, wie sich der Holzstab bewegte, es war gar nicht möglich, den Magnet zu benetzen.
»Hier will ich den Magnetismus einmal tüchtig verstärken —«
Das schwarze Brett in der linken Hand, drückte er auf seinen weißen Knopf, dabei den Stab in die Schale tauchend, immer größer ward das Wasser. Doch das verdrängte Wasser hatte in der Schale keinen Platz mehr, floss über, und schließlich spritzte es nach allen Seiten bis zum letzten Tropfen heraus.
»So, dies war das einleitende, erklärende Experiment. Nun verbinde ich die beiden Drähte mit dem kleinen Schlitten. Und nun wissen die geehrten, scharfsinnigen Damen und Herren auch schon, wodurch sich jetzt der Schlitten wie von allein bewegt, zumal wenn ich noch hinzufüge, dass dieser Magnetismus sich gegen gefrorenes Wasser genau so verhält wie gegen flüssiges.«
Der kleine Schlitten setzte sich auf dem Eise in Bewegung, fuhr vorwärts und rückwärts, langsam und schnell und immer schneller, beschrieb Bogen und Achten, jagte im Kreise herum und blieb mit einem Ruck stehen, ganz wie der auf dem Knopfbrett herumfingernde Professor ihn dirigieren wollte, wie auch die Umstehenden manchmal wünschten.
Ja, die Erklärung war gegeben worden, aber das Staunen war doch grenzenlos, und Georg hatte noch Fragen zu stellen für alle anderen.
»Also der hölzerne Schlitten ist magnetisch, zieht vorn das Eis an und stößt es hinten von sich?«
»So ist es. Der diametrale Magnetismus bemächtigt sich des Gewichtsmittelpunktes eines jeden Körpers — noch etwas anderes als der Schwerpunkt, was ich Ihnen jetzt aber nicht erläutern kann — teilt sich sofort. Vorn ist der Schlitten positiv magnetisch, hinten negativ. Wo aber nun vorn und hinten ist, das kann auch bestimmt werden. So habe ich es in der Hand, den Schlitten auch rückwärts fahren zu lassen. Zum besseren Verständnis möchte man lieber sagen, dass auch das Wasser oder das Eis den Schlitten als Magneten anzieht. Vorn zieht es, hinten schiebt es. Natürlich gilt das auch für ein im Wasser schwimmendes Schiff. Dies, meine Herrschaften, ist das Fortbewegungsprinzip der Zukunft. Nur muss sich die Wissenschaft oder die ganze Menschheit erst einmal von dem wahnwitzigen Aberglauben befreit haben, dass es nur eine einzige Art von Magnetismus gebe. Denn diesem Irrglauben huldigt sie noch, obgleich sie doch schon von jeher zwei Arten von Elektrizität unterschieden hat, die der Reibung und die der Berührung, mit ganz verschiedenen Erscheinungen, und es gibt auch schon andere Arten von Elektrizitäten, und man wird noch erkennen, dass dieser verschiedenen Arten zahllose sind, und dann wird man auch noch die dazu gehörigen Arten von Magnetismus finden, und dann ist dieses Bewegungsprinzip gelöst, das allen Maschinen und Motoren ein Ende bereiten wird.«
»Wie lenken Sie denn aber nun den Schlitten?«, fragte Georg.
»Einfach indem ich in die eine Kufe mehr Magnetismus leite als in die andere. Dann wird die eine Kufe doch auch von dem Eise vorn stärker angezogen und hinten stärker abgestoßen als die andere, der Schlitten muss sich drehen. Das kann ich alles hier von dem Tastenbrette aus dirigieren. Doch ist es eigentlich falsch, wenn ich von Kufen spreche. Es handelt sich immer um den ganzen Gegenstand, der mit diametralem Magnetismus erfüllt wird. Nun gibt es von diesem Magnetismus wieder verschiedene Arten. Lasse ich den Schlitten vorwärts oder rückwärts fahren, so wirkt der Magnetismus in der Längsrichtung. Ich kann ihn aber auch nach der Breite hin wirken lassen. Dann wird die eine Breitseite positiv, die andere negativ. Dann muss der Schlitten natürlich nach der Seite hin rutschen.«
Und es geschah. Der kleine Schlitten schusselte auf seinen Kufen erst etwas nach der linken Seite hin, dann nach der rechten, was natürlich nicht so gut gehen konnte als wenn er in der Längsrichtung fuhr. Immerhin, es ging.
»Bei einem im Wasser schwimmenden Fahrzeug geht das natürlich viel besser, es direkt nach einer Seite hin schwimmen zu lassen.«
»Dann könnten Sie also auch unser ganzes Schiff direkt nach einer Seite hin fahren lassen?«
»Gewiss. Was ich Ihnen hier im kleinen zeige, gilt alles auch für die größten Verhältnisse, und Ihr ganzes Schiff ist durch jene beiden starken Drähte diametral magnetisch gemacht worden. Ich dirigiere es durch dieses Tastenbrett ebenso wie den kleinen Schlitten. Bevor ich Ihnen jedoch zeige, was ich noch alles mit Ihrem Schiffe machen kann, will ich Ihnen das nächste Experiment wieder im kleinen vorführen, oder doch in ganz anderer Weise, und zur Abwechslung wieder etwas ganz anderes. O, wenn Sie ahnten, in welchem Zustande sich jetzt Ihr Schiff befindet! Bitte, Herr Waffenmeister, wollen Sie einmal in die Höhe springen und dabei die Augen offen behalten.«
Georg sprang in die Höhe. Dabei die Augen zu schließen, daran hatte er gar nicht gedacht.
Mit ganz verdutztem Gesicht stand er nach diesem Sprunge da, sprang immer wieder, und immer verdutzter ward sein Gesicht
»Ja, was ist denn das?«
Die Folge war natürlich, dass auch alle die anderen Luftsprünge machten, die Damen nicht ausgeschlossen, bis das ganze Schiff nur mit Irrsinnigen besetzt zu sein schien, die sich in Bocksprüngen gefielen und dazu ununterbrochen Ausrufe des grenzenlosesten Staunens taten.
Die Sache war nämlich die, dass jeder, der in die Höhe sprang, während der Zeit, da er in der Luft schwebte, nichts mehr von dem ganzen Schiffe sah. Auch nichts von den anderen Menschen. Er sah nur unter sich Wasser, dort den Strand, dort die Berge — das Schiff und die Menschen waren verschwunden! Bis seine Füße wieder das Deck berührten. Dann war alles wieder da.
»Ja, wie ist denn das nur möglich?«
»Bitte, treten Sie einmal hier auf diese Unterlage«, lächelte das Männchen.
Schon hatte ein Neger einen kleinen, roten Teppich an Deck ausgebreitet, Georg trat darauf und —
Verschwunden war das Schiff und alles, was dazu gehörte und sich darauf behand, Georg stand auf dem roten Teppich, der frei in der Luft zu schweben schien. Unter sich sah er Wasser, den See, der aber hier ein langes, tiefes Loch bildete, einen Graben, den Dimensionen des Schiffes entsprechend, aber noch etwas länger und breiter, als wie das Schiff ins Wasser tauchte. Auch die Umgebung des Sees war deutlich zu sehen, genau wie sonst auch der See, nur eben das ganze Schiff fehlte mit noch einiger Wasserumgebung.
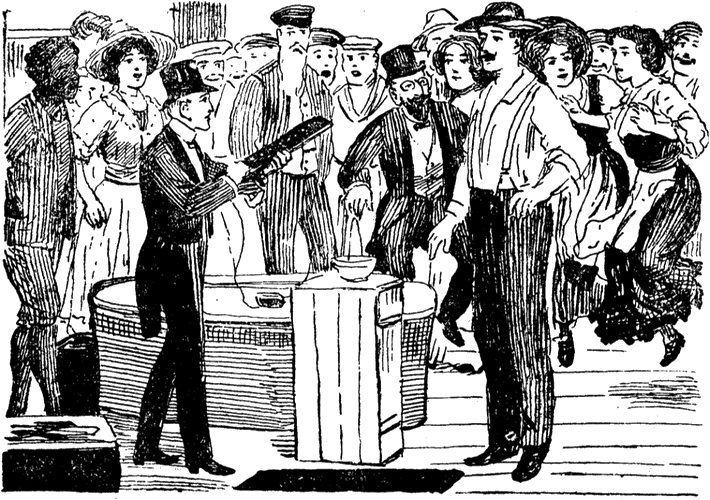
Als Georg von dem Teppich trat, nur mit der Fußspitze das Deck berührte, war das Schiff und alles wieder da.
Während einer nach dem anderen auf den Teppich trat und dieses Wunder über sich ergehen ließ, es konnten auch mehrere gleichzeitig darauftreten, nur durften sie nichts außerhalb des Teppichs berühren, sonst gelang das Phänomen nicht, gab der Professor eine Erklärung.
»Wir haben schon einmal darüber gesprochen. Es gibt Substanzen, welche die Lichtstrahlen durchlassen, Wasser und noch viele andere Flüssigkeiten, von festen Substanzen zum Beispiel natürlicher Glimmer in dünnen Scheiben und künstliches Glas.
Das Glas ist durchsichtig. So sagen wir. Weshalb ist es durchsichtig? Weil es die Lichtstrahlen durchlässt. Weshalb lässt es die Lichtstrahlen durch? Das wissen wir nicht. Wir wissen also nicht, weshalb farbloses Glas durchsichtig ist. Da ist unsere Weisheit zu Ende. Genau so wenig kennen wir den letzten Grund, weshalb der Stein zur Erde fällt. Dieser letzte Grund ist Gott. Gott ist ein persisches Wort und bedeutet so viel wie unfassbar, das Unfassbare. Wer also daran zweifelt oder sich darum streitet, ob es einen Gott gibt oder nicht, der hat die ganze Sache überhaupt noch nicht erfasst.
Nun ist aber gefunden worden, dass es noch andere Lichtstrahlen gibt als die für unsere Augen erkenntlichen, Lichtstrahlen, welche auch sonst undurchsichtige Substanzen durchdringen, sie daher für unsere Augen durchsichtig machen.
Die Konsequenz aus dieser zuerst von Professor Röntgen gemachten Entdeckung lässt sich noch gar nicht ziehen.
So hatte auch Professor Beireis zuerst gesprochen.
»Wieder ist es eine andere, besondere Art von Elektrizität«, fuhr er dann fort, »durch welche ich die gewöhnlichen Lichtstrahlen so umwandle, dass sie überhaupt jede uns bekannte Substanz durchdringen, sie also für unser Auge durchsichtig machen, und zwar in einer Weise, dass Form und Umrisse ganz verschwinden, dass der Gegenstand einfach unsichtbar wird. So wie etwa ganz reines Glas in ganz reinem Wasser vollkommen unsichtbar wird.
Ich leite durch dieses ganze Schiff einen Strom von solcher Elektrizität. Dadurch wird das ganze Schiff vollkommen durchlässig für die gewöhnlichen Lichtstrahlen, es scheint dem menschlichen Auge vollkommen zu verschwinden.
Dies ist aber nicht für Sie bemerkbar, weil Sie selbst mit dem Schiffe in Kontakt stehen, weil Sie selbst von dieser Elektrizität durchdrungen werden. Das hebt die Wirkung auf.
Indem Sie in die Höhe springen, lösen Sie den Kontakt, die Verbindung, dann erblicken Sie das Schiff nicht mehr. Dasselbe erzielt dieser Teppich. Es ist eine besondere Substanz, welche gegen diese Elektrizität isoliert. Das ist die Erklärung.«
Ja, man musste es wohl glauben, man hatte die Tatsachen vor Augen.
»Wie kommt es«, fragte Georg, wieder auf dem Teppich stehend und hinabblickend, »dass das Loch in dem Wasser bedeutend größer ist als das Schiff selbst, so weit es ins Wasser taucht?«
»Finden Sie dafür nicht selbst eine Erklärung?«, konnte das Männlein auch einmal schulmeisterhaft examinieren, und etwas Schulmeisterhaftes hatte es überhaupt immer an sich.
Aufmerksam blickte Georg über den Rand des Teppichs hinab.
Die Grenzen des Wassergrabens waren nicht scharf begrenzt. Das richtige, grünliche Wasser ging erst wie in einen Nebel über, der sich nach und nach auflöste, bis der scheinbar freie Raum kam.
Da sah Georg auch gerade, wie ein großer Fisch geschwommen kam, im Wasser erst noch ganz deutlich zu sehen, dann verlor er sich wie in einem Nebel, bis er ganz verschwunden war. Durch die Schiffplanken hindurch konnte er natürlich nicht schwimmen. Er tauchte dann wieder auf, erst undeutlich im Nebel, dann deutlich im Wasser, war also vor den Schiffplanken umgekehrt.
»Diese durchsichtig und unsichtbar machende Elektrizität pflanzt sich im Wasser nur auf eine gewisse Strecke fort«, sagte er dann, »wird immer schwächer, bis sie ganz versagt.«
»Bravo, Herr Waffenmeister, bravo!«, konnte das gelehrte Schulmeisterlein auch loben, obgleich zu dieser Antwort sehr wenig Scharfsinn gehört hatte. »So ist es. Mehr habe ich dem nicht hinzuzufügen.«
Georg blickte empor.
»Aber sie ist doch noch bis in die Mastspitzen wirksam, die fast 30 Meter über Deck liegen, und das ganze Schiff ist mehr als 100 Meter lang.«
»Aber das ist seine kompakte, innig zusammenhängende Masse, sie leitet diese Elektrizität viel besser als das Wasser. Bitte, lassen Sie sich diese Erklärung genügen. Höchstens kann ich noch sagen, dass der Wirksamkeit dieser Elektrizität überhaupt Grenzen gesetzt sind. Natürlich, sonst brauchte ich den Strom ja nur direkt in die Erde zu leiten, und die ganze Erde müsste unsichtbar sein. Bisher ist es uns nur gelungen, die völlige Wirkung bis zu einer Entfernung von 62 Metern zu erzielen. Wenn ich also den Strom etwa in einen Felsen hineinleite, und Sie stehen isoliert, so würden Sie in der Felsenwand ein Loch, eine runde Höhle von genau 124 Meter Durchmesser erblicken, aber nur 62 Meter tief. Denn der Strom pflanzt sich ja nach allen Seiten hin fort, und die eine Seite bleibt dabei frei. Verstehen Sie? Da hier der Apparat in der Mitte des Schiffes steht, dieses noch keine 124 Meter lang ist, so unterliegt es auch noch vollkommen der Wirkung, ist für den isoliert oder außerhalb des Schiffes Stehenden vollkommen unsichtbar. Verstehen Sie?«
Ja, man verstand. So schwer es auch einigen Köpfen fallen mochte.
»Da muss man sich doch auch selbst unsichtbar machen können«, sagte Georg, wieder den Gedanken von anderen aussprechend.
»Gewiss. Sie alle sind überhaupt unsichtbar. Aber nur für diejenigen, welche sich außerhalb dieses Radius befinden.«
»Kann man sich nicht auch innerhalb dieses Radius unsichtbar machen?«
»Dazu brauchen Sie nur auf diesen Isolierteppich zu treten. So, danke. Wenn ich Sie nun durch zwei Drähte mit der Batterie verbinde, noch besonders solch einen Strom durch Sie leite, dann sind Sie auch auf diesem Schiffe unsichtbar. Aber das ist nicht nötig. Ich habe hier eine kleine Batterie, die nehmen Sie einfach in die Hand, der Strom, so schwach er auch ist, durchläuft Ihren Körper, und Sie sind für die normalen Lichtstrahlen durchlässig, desgleichen alles, was mit Ihnen in Berührung steht, also auch Ihre Kleider — Sie scheinen für die Augen der anderen zu verschwinden.«
Der Professor hatte aus seiner Fracktasche eine kleine, weiße Büchse gezogen, von der Größe einer Zigarettenschachtel, fingerte daran etwas herum, obgleich man keine Knöpfe oder etwas Ähnliches sah und reichte sie dem Waffenmeister.
Sobald der Geber die Büchse freiließ, nur Georg sie in der Hand hatte, war er mit einem Schlage spurlos verschwunden, ebenso die weiße Büchse. Zu fühlen war er natürlich noch, aber keine Spur mehr von ihm zu sehen. Das heißt, das galt nur für die anderen. Mit seinen eigenen Augen sah er sich.
Einer nach dem anderen trat mit der Büchse auf den Isolierteppich und verschwand. Das Staunen lässt sich denken.
Professor Beireis lächelte verächtlich.
»Es werden keine hundert Jahre vergehen«, sagte er, »so wird dies die Menschheit so einfach finden wie die völlige Durchsichtigkeit einer Masse, hergestellt aus Sand, Soda und Metalloxyd, Glas genannt.«
Er mochte recht haben — aber vorläufig wurde diese Unsichtbarkeit doch als ein phänomenales Wunder angestaunt.
»Ist es nun nicht möglich?«, fragte Georg dann, »sich auch anderswo unsichtbar machen zu können als auf diesem Schiffe oder einem anderen Terrain, das nicht schon mit solcher Elektrizität durchdrungen ist?«
»Natürlich ist das möglich. Ob das Schiff oder ein anderes Terrain mit solcher Elektrizität durchdrungen ist oder nicht, darauf kommt es überhaupt gar nicht an. Sie drückten sich überhaupt wohl nur falsch aus. Sie meinen jedenfalls, ob man sich in solchem unsichtbaren Zustande nicht auch frei bewegen kann. Natürlich kann man das. Dazu ist doch nur nötig, dass Sie jeden einzelnen Fuß isolieren, Strümpfe aus solcher Masse überziehen.«
Und das Männchen griff in die andere Schößentasche seines Frackes und brachte ein Paar rote Socken zum Vorschein. Sie waren groß genug, dass Georg sie bequem über seine Stiefel ziehen konnte, nahm die weiße Büchse, und er war samt dieser und den roten Strümpfen für die Augen der anderen verschwunden. Setzen durfte er sich freilich nicht, auch nicht mit der Hand oder einem anderen Körperteil irgend einen anderen Gegenstand berühren, dann wurde er sofort in ganzer Gestalt wieder sichtbar, denn dann war ja der Kontakt mit dem Schiffe, mit dem Wasser, mit der ganzen Erde hergestellt, jene unsichtbar machende Elektrizität floss wirkungslos ab. Hob er aber etwas in die Höhe, einen Eimer oder sonst etwas, dann wurde ja auch dieser Gegenstand isoliert, verschwand gleichfalls vor den Augen anderer Beobachter, nur vor den eigenen nicht.
»Wunderbar, wunderbar!«
So viele wie möglich wollten die roten Strümpfe anziehen. Einer der ersten, der sich dazu vordrängte, war der Segelmacher, weil der eben Oskar hieß. Hinter ihm machte sich gleich Mister Tabak bemerkbar, der aber beim besten Willen die Strümpfe nicht anziehen konnte, weil dessen quadratische Füße an Größenwahnsinn litten.
»Nun zum nächsten Experiment«, nahm Professor Beireis wieder das Wort, als sich die Sucht nach den roten Socken und der weißen Büchse endlich gelegt hatte.
»Ich greife zu dem einfachen, diametralen Magnetismus zurück, stelle ihn aber jetzt auf etwas anderes als auf Wasser ein. Trotzdem möchte ich dazu Wasser gebrauchen, das heißt kein Eis, ich möchte diesmal ein Schiffchen schwimmen lassen. Dazu muss ich dieses Eis erst wieder in Wasser zurückverwandeln.«
Das war schnell geschehen. An dem im Eise noch steckenden Stabe brauchte nur der Schieber etwas nach oben geschoben zu werden, über die Null hinaus, und es dauerte gar nicht lange, so war das Eis wieder geschmolzen.
Unterdessen hatte der Experimenteur den kleinen Schlitten von den beiden Haardrähten abgemacht, und dafür ein quadratisches, dünnes Holzbrettchen, das zwei Klemmschrauben trug, daran befestigt. Das Brettchen wurde auf das Wasser gelegt, wo es sich alsbald zu bewegen begann.
»Sie sehen, das Brettchen schwimmt vorwärts oder rückwärts oder seitwärts, ganz wie ich will. Woher das kommt, wissen Sie ja nun. Könnte ich aber nun nicht noch eine andere Bewegung einleiten?«
»Jawohl.«
»Und die wäre?«
»Nach oben und nach unten.«
»Richtig! Ich verteile die beiden verschiedenen Elektrizitäten auf die beiden Flachseiten des Brettchens, das hier ein Schiff vorstellen soll. Für die obere Seite schalte ich negativen Strom, für die untere Seite positiven Strom ein. Was wäre dann die Folge?«
»Wenn dann die untere Seite das Wasser anzieht, die obere Seite es abstößt, so muss das Brett untersinken.«
Plötzlich sank das leichte Brettchen wie eine Steinplatte unter, blieb auf dem Boden der Balje liegen.
»Um es nun wieder emporsteigen zu lassen, brauchte ich ja nur den elektrischen Strom auszuschalten. Denn es ist eben Holz leichter als Wasser. Nun will ich aber den Doppelstrom wechseln lassen, sodass die obere Seite positiv wird, also das Wasser anzieht, die untere Seite negativ, das Wasser also abstößt oder das Wasser das Brettchen, was ja immer ganz dasselbe ist. Was ist die Folge davon?«
Mit Vehemenz schnellte das Brettchen vom Boden der Balje empor, sprang über das Wasser, wohl zehn Zentimeter hoch, fiel zurück, sprang bei Berührung der Wasseroberfläche wieder empor, und so ging das Spiel immer weiter, bis der Professor den Strom abstellte.
»Sie haben gesehen, der Theorie nach müsste das Brettchen ja frei in der Luft über der Wasseroberfläche schweben bleiben, weil der negative Magnetismus ja abstößt. Aber Sie wissen wohl alle, dass dies in der Praxis nicht möglich ist. Da kommen noch ganz andere Naturgesetze in Betracht. Es ist gerade wie beim Spiel der Papierschnitzelchen oder der Korkkügelchen unter der elektrisch gemachten Glasscheibe. Kurz und gut, auf diese Weise kann man keinen magnetisch gemachten Gegenstand in der Luft frei schweben lassen. Es ist ein ewiges Hin- und Herpendeln. Und doch lässt es sich ermöglichen. Nur in anderer Weise. Also will ich Ihnen erst einmal etwas anderes zeigen.«
Einer seiner schwarzen Diener hatte unterdessen an die große Zylinderbatterie zwei andere Haardrähte befestigt, der Professor nahm aus einem großen Kasten ein etwa meterlanges Rohr, scheinbar nichts weiter als ein einzölliges Gasrohr, und schlang die Enden der beiden Haardrähte einfach darum.
»So. Dies ist tatsächlich nichts anderes als ein einfaches Gasrohr. Es ist nicht nötig, dass die Zuführungsdrähte angeschraubt werden. Bei dem Schlitten und dem Brettchen habe ich das nur der Bequemlichkeit halber getan, damit sie bei der Herumfahrerei nicht im Wege sind. Es ist auch keine metallische Berührung nötig. Sie sehen ja auch, wie oberflächlich ich die Leitungsdrähte befestigt habe, mit denen ich das ganze große Schiff dirigierte.
Ich mache diese Gasröhre wieder diametral-magnetisch. Diese vordere Seite ist positiv, die hintere negativ. Jetzt aber habe ich den Magnetismus auf atmosphärische Luft eingestellt, was allerdings nicht so einfach ist, denn es kommt dabei ein Gemenge von 21 Volumteilen Sauerstoff und 78 Volumteilen Stickstoff in Betracht. Das fehlende Teil besteht aus Argon und anderen Gasen. Doch schließlich brauchte ich auch nur auf Stickstoff einzustellen, der Sauerstoff würde mitgerissen.
Aber der Apparat ist nun einmal für atmosphärische Luft eingestellt, die in allen Höhenlagen eine ganz gleiche Mischung zeigt. Jetzt geht der elektrische Strom durch die Röhre. Was ist die Folge? Vorn der positive Pol zieht die Luft an, sie geht durch die Röhre, wird hinten vom negativen Teile wieder mit Vehemenz ausgestoßen. Bitte, überzeugen Sie sich.«
Ja, die vordere Öffnung des Rohres saugte ganz mächtig die Luft ein. Aus Fräulein Gerlachs Frisur wurde eine Haarnadel, obgleich sie ziemlich fest stak, sofort herausgerissen und sauste hinten mit Vehemenz wieder heraus, es war ein ganz gewaltiges Sauggebläse.
»Und diese Kraft kann ich theoretisch bis ins Endlose steigern. Praktisch nicht weiter, als bis das Rohr durch die Kraft der durchstreichenden Luft auseinandergerissen würde. Schon längst vorher aber würde es mir aus den Händen gerissen werden, und auch ein Herkules könnte es dann nicht mehr halten. Stecke ich das positive Ende ins Wasser, dann hört das Saugen natürlich auf. Das Rohr ist ja nur für Luft eingestellt. Stelle ich den Magnetismus für Wasser ein, dann würde das Rohr natürlich als Pumpe und als Spritze wirken. Dieses Experiment brauche ich Ihnen nicht erst vorzuführen. Wir bleiben hier bei der Luft. Was lässt sich hieraus nun für eine besondere Wirkung erzielen?«
»Das ließe sich vortrefflich zur Fortbewegung eines Luftschiffes verwenden!«, rief Georg.
»Richtig, danke. Verwandeln wir also dieses Wasserschiff, durch ein einfaches Brettchen markiert, das sich aber auch schon als Unterseeboot erwiesen hat, in ein Luftschiff.
Der Professor legte das Gasrohr weg und wandte sich, in der einen Hand immer das Tastenbrett, wieder der Wasserbalje zu, auf der noch das Brettchen schwamm.
»Zunächst muss ich noch etwas erwähnen. Wir sind doch auch Menschen, denen Grenzen gezogen sind. Es ist mir nicht möglich, dieses Brettchen, so leicht es auch sein mag, kaum zehn Gramm wiegend, nur allein durch magnetische Luft vom Wasser zu heben. Denn ich kann ja nur den positiven Magnetismus der oberen Seite dabei wirken lassen, der die Luft ansaugt, oder, anschaulicher ausgedrückt, dass das Brettchen oben von der Luft in die Höhe gezogen wird. Wohl ist die untere Seite negativ, abstoßend, aber unter dem Brettchen ist ja keine Luft, die abgestoßen werden kann. Und die Kohäsion des Brettchens mit dem Wasser ist so stark, dass die Anziehungskraft der Luft nicht ausreicht, um diese Kohäsion zu überwinden. Ich könnte das Brett einfach aus dem Wasser nehmen, dann würde es sofort gehen. Aber ich will nun einmal das Brett aus dem Wasser heben, ohne es zu berühren, nur durch Magnetismus.
Und dass ich gleichzeitig zweierlei Magnetismus einleite, einen für Wasser, einen für Luft, dieses Problem haben unsere Physiker — das heißt die unserer Gesellschaft — noch nicht lösen können. Auch wir müssen eben jede Schranke mühsam überwinden.
Aber das lässt sich nun auch noch anders machen. Ich schalte zuerst Magnetismus für Wasser ein, unten negativ. Dadurch wird das Brettchen nach oben abgestoßen. In demselben Augenblicke nun, da es in der Luft schwebt, schalte ich für Luft um. Da ist das Brettchen gefangen! Unten stößt die Luft, oben zieht sie. Es fliegt immer weiter in die Höhe, bis ich den Strom so geregelt habe, dass die beiden magnetischen Kräfte genau der Schwere des Brettchens entsprechen, dann muss es in der Luft schweben bleiben. Passen Sie auf.«
Plötzlich schnellte das Brettchen von dem Wasser empor, wollte zurückfallen, besann sich, man sah, wie die Wasseroberfläche heftig bewegt wurde, es stieg immer ganz waagerecht bleibend, höher, senkte sich wieder, so ging es noch einige Male auf und ab, immer kürzere Pendelbewegungen machend, bis es regungslos in der windstillen Luft schwebte.
»So, die Schwerkraft ist ausbalanciert. Das ehemalige Unterseeboot hat sich in ein Luftschiff verwandelt. Ein solches muss aber doch auch manövrieren können. Und das habe ich in der Hand. Ich lasse einigen überschüssigen Magnetismus, natürlich immer diametralen, vorn und hinten wirken, auch seitwärts, so kann ich das Luftschiff vorwärts oder rückwärts fahren lassen, kann es lenken, wie ich will, es natürlich auch steigen oder sich senken lassen.«
Und es geschah. Das Brettchen, immer hübsch in horizontaler Schwebe bleibend, fuhr hin und her, hob und senkte sich, führte die verschiedensten Manöver aus. Nur die Länge der beiden Haardrähte bedeuteten eine Grenze.
»Wunderbar, wunderbar!«
Mehr konnte man wirklich nicht sagen.
»In hundert Jahren wird es nicht mehr wunderbar sein. Ja, ich möchte fast garantieren, dass keine hundert Jahre vergehen werden und auch die andere Menschheit hat diesen diametralen Magnetismus entdeckt. Und damit ist auch das Luftschiff in seiner höchsten Vollendung erfunden. Denn eine größere Vollkommenheit können wir mit unseren Menschengehirnen vorläufig nicht ausdenken.«
»Sie meinen, durch diesen Luftmagnetismus kann man auch einen großen, schweren Körper, wie ein solcher ein Luftschiff doch ist, auch ohne Gasballon heben und treiben?«, fragte Georg zweifelnd.
»Gewiss kann man das. Aber Sie haben ganz recht, wenn Sie daran zweifeln. Ja, da muss allerdings noch etwas anderes hinzukommen. Also schreiten wir zum nächsten Experiment. Ich bitte um eine Waage. Etwa um eine Tafelfederwaage, sie ist dazu am praktischsten. Haben Sie eine solche vielleicht an Bord?«
Sie brauchte nur aus der Kombüse geholt zu werden, so eine gewöhnliche Küchenwaage, bei der eine Feder niedergedrückt wird.
Unterdessen hatte der Professor das Brettchen, das bereits an Deck lag, von den Drähten gelöst, nahm eine ihm von einem Neger aus einem Kasten gereichte schwarze Platte, die ziemliches Gewicht zu haben schien.
»Meine hochgeehrten Herrschaften! Sie sehen hier eine volle gusseiserne Platte von genau 20 Zentimeter im Quadrat und zwei Zentimeter Dicke. Da das spezifische Gewicht dieses Gusseisens 7,84 ist, beträgt das Gewicht der Platte 6272 Gramm. Sie ist mit einem Lack überzogen, dessen Gewicht ja auch noch hinzukäme, dafür aber hat man hier zwei kleine Löchelchen gebohrt, gleichzeitig dazu bestimmt, die Kontaktstifte aufzunehmen. Diese wiegen 8 Gramm. Es ist eine Experimentalplatte, daher die genauen Berechnungen, bei uns muss auch noch das Gewicht der Haardrähte in Betracht gezogen werden, aber solche Genauigkeit ist ja hier nicht nötig.
Die beiden Drähte sind unterdessen mit solchen Kontaktstiften versehen worden, ich stecke sie in die Löcher, lege die Platte auf die Tafelwaage. Was gibt der Zeiger an? 13 Pfund. Die Waage geht falsch. Sie zeigt rund 280 Gramm zu viel an. Die Feder ist zu stark abgenützt, kann solche ziemlich große Gewichte nicht mehr tragen. Doch das hat ja hier bei uns gar nichts zu sagen. Also nehmen wir nur ruhig an, die Platte wiege dreizehn Pfund.
Jetzt leite ich durch diese Eisenplatte einen negativen Strom von diametraler Elektrizität, ohne sie aber dadurch magnetisch zu machen. Was bemerken die Herrschaften?«
Man bemerkte, dass die schwarze Farbe nach und nach in ein Grau überging.
»Und was bemerken Sie an dem Zeiger der Waage?«
Ja, da staunte man allerdings.
Der Zeiger ging immer mehr zurück, die Platte schien also immer leichter zu werden, und das um so mehr, je heller sie wurde.
Fast hatte sich die graue Farbe schon dem Weiß genähert, als die Nadel nur noch ein viertel Pfund anzeigte.
»So, hören wir vorläufig auf. Sie glauben doch nicht etwa, dass die Waage Sie betrügt? Nach meinem Strommesser, den ich hier an der Registertafel habe, wiegt die Platte jetzt ganz genau 117 Gramm. Bitte, wollen Sie sich durch Aufheben überzeugen, dass die Platte wirklich so leicht geworden ist. Fassen Sie sie ruhig an. Nur reißen Sie die Drähte nicht ab, die Kontaktstifte nicht heraus. Obgleich das keine andere Wirkung hätte, da der Strom unterbrochen wird, dass die Platte plötzlich wieder 13 Pfund schwer ist. Dann dürfen Sie sie sich vor Schreck nicht auf die Füße fallen lassen.«
Verschiedene nahmen die Platte in die Hände. Ja, die wog höchstens noch ein viertel Pfund. Und in einigen Händen ließ der Experimenteur sie auch nochmals ihr volles Gewicht annehmen, aber es langsam bis auf dreizehn Pfund bringend, dann das Gewicht wieder abnehmen lassend.
»Mann, Sie können wohl auch die Schwerkraft aufheben?«, rief Georg außer sich vor Staunen.
»Können wir«, war die selbstgefällige Bestätigung, obgleich dann hinterher ein bescheidenes Geständnis kam. »Was ist Schwerkraft? Das wissen auch wir Physiker in jener geheimen Gesellschaft nicht. Wir vermuten nur, dass diese Erscheinung, die wir Schwer- oder Anziehungskraft nennen, auf besonderen Ätherschwingungen beruht, die jeden Körper durchdringen. Jedenfalls aber haben wir ein Mittel entdeckt, um diese Schwerkraft in jedem Körper nach Belieben zu verstärken oder zu verringern. So, bitte, legen Sie die Eisenplatte auf die Waage zurück. Ich mache sie noch leichter, vermindere ihr Gewicht bis auf 20 Gramm. Sie sehen, die Platte ist fast schneeweiß. So, das genügt. Jetzt schicke ich durch die Platte auch noch einen doppelten diametralen Strom, der sie magnetisch macht, und zwar für Luft. Unten negativ, oben positiv, der Doppelstrom tritt als Elektromagnetismus in Aktion — da liegt die Eisenplatte.«
Ja, da flog sie in der Luft herum. Genau wie vorhin das hölzerne Brettchen. Vorwärts, rückwärts stieg, senkte sich, beschrieb die verschiedensten Figuren, ganz wie der Dirigent wollte, wie Wünsche geäußert wurden.
Die weiße Platte senkte sich auf einen Kasten herab und färbte sich mit einem Schlage tiefschwarz.
»Bitte — ziemlich 13 Pfund schwer. Bitte nehmen Sie die Platte, schlagen Sie sie auseinander, heben Sie sich die Stücke als Andenken auf. Wir haben noch genug solcher Dinger. Oder geben Sie mir irgend ein anderes Eisenstück, irgend einen anderen Gegenstand, Ihr Taschenmesser oder sonst etwas. Ich mache alles gewichtslos und lasse es in der Luft herumfliegen, auf mein oder Ihr Kommando. Die Sachen brauchen auch nicht gefirnisst zu werden. Nur dürfen sie dann nicht mit erdleitendenden Gegenständen in Berührung kommen. Dann geht natürlich die ganze Elektrizität flöten.«
So hatte das Männchen gesprochen.
Die Zuhörer brachten lange kein Wort hervor, bis diesmal Kapitän Martin es war, der es zuerst fand, natürlich ohne dabei seine Hände aus den Hosentaschen zu nehmen.
»Ei die tausend Sapperlot! Da können Sie wohl hier unser ganzes Schiff hochheben?«
»Kann ich.«
»Bis in die Wolken hinein?«, fing Klapitän Martin jetzt doch zu stutzen an.
»Kann ich.«
»Und mit diesem unserem Schiffe in der Luft herumgondeln?«
»Kann ich.«
Und als das Männchen in Frack und weißer Halsbinde diese dritte Bestätigung gegeben hatte, da geschah etwas Großes in der Weltgeschichte. Da nahm Kapitän Martin seine beiden Hände aus den Hosentaschen, zwecklos, nicht einmal um sich ein Stück Kautabak abzubeißen.
»Well, dann mal los«, erklang es dann von seinen bärtigen Lippen. »Aber ich komme nicht mit. Ich will erst an Land gesetzt sein. Und ich betrete dieses Schiff auch nicht wieder. Dann lege ich das Kommando nieder. Ein Seeschiff von 50 000 Tonnen, mit dem jeder Schneidergeselle auch in den Wolken herumgondeln kann, das mag ich nicht mehr kommandieren. Das geht gegen meine seemännische Ehre«
Da brach das würdevolle Männchen in ein herzliches Lachen aus.
»Nein, nein, Herr Kapitän, beruhigen Sie sich, ich kann es nicht, da verlangen Sie zu viel von mir —«
Doch schnell wurde der Professor wieder ernst.
»Und doch, ich könnte es, dieses Schiff hier bis in die Wolken heben, es in ein perfektes Luftschiff verwandeln. Aber so schnell geht das nicht. Dazu bedarf es Vorbereitungen. Wohl reicht diese Batterie hier zehnmal aus, um es zu heben, denn Sie ahnen nicht, wie viele Millionen Volt dieser Zylinder entwickeln kann, aber dazu müsste doch erst das ganze Schiff vom obersten Flaggenknopf bis zum Kiel aufs Sorgfältigste gefirnisst werden. Denn sonst wird ja alle Elektrizität ins Wasser geleitet. Ich muss es doch zuerst gewichtslos machen. Und auch dann noch würde hier oben durch das Ansaugen der Luft ein Wirbelstrom entstehen, der alle Masten aus den Fugen reißen wurde. Gar nicht davon zu sprechen, dass sich Menschen an Deck halten könnten. Nein, wenn die Herrschaften gestatten, so lade ich Sie zu einer Spazierfahrt auf einem Schiffe ein, welches extra für diesen Zweck erbaut worden ist.«
»Sie haben ein solches hier?«, fragte Georg ganz erregt. »Ja. Es ist hier in diesem Tale schon früher von unseren Leuten erbaut worden.«
»Sowohl als Wasserfahrzeug wie als Luftschiff zu benutzen?«
»Sie sagen es. Und als Unterseeboot dazu!«
»Ah! So hat es also damals Kapitän Satan benutzt, um die Amazonen hierher zu bringen?«
»Nein. Wohl hatte sich der abtrünnige Kapitän Satin dieses Fahrzeugs bemächtigt, konnte sich aber seiner nicht bedienen, verstand es nicht in Betrieb zu setzen. Bei der Herbeischaffung der Amazonen benutzte er ein Unterseeboot, das er uns allerdings ebenfalls geraubt hatte, aber die Verwendungen jener Elektrizitäten, durch die er es in ein Luftschiff hätte verwandeln können, waren ihm fremd, so weit gingen dessen Kenntnisse gar nicht. Also darf ich das Universalfahrzeug herbeibeordern? Wollen Sie eine Spazierfahrt mit mir machen?«
»Sehr gern!«
Professor Beireis zog seine goldene Taschenuhr an langer goldener Kette, ließ den Deckel aufspringen, der nahestehende Georg sah ein regelrechtes Zifferblatt mit Zeigern, der Professor blickte auch darauf, dann aber führte er gleich die Uhr an seinen Mund, sprach mit fremden, den anderen unverständlichen Worten gegen das Glas, dann hielt er die Rückseite der Uhr an sein Ohr.
Obgleich nichts zu hören war, musste er wohl eine Antwort bekommen haben, eine ihm nicht gefallende, denn er machte ein etwas verdrießliches Gesicht.
»Ich bitte um Entschuldigung es vergeht noch einige Zeit, ehe das Fahrzeug hier erscheinen kann«, sagte er dann, die Uhr zurücksteckend
»Das war wohl ein drahtloses Telefon?«, fragte Kapitän Martin, der seine Hände wieder in den Hosentaschen untergebracht hatte.
»Ja.«
»Well, was kostet so ein Ding?«
Es ist nicht so leicht zu erklären, weshalb sehr viele der Umstehenden, alle die, die Sinn für Humor hatten, plötzlich in ein heiteres Lachen ausbrachen. Es lag auch mit in dem eigentümlichen Blicke, den das kleine Männlein dem riesenhaften Kapitän zuwarf.
»Diese Erfindung ist uns nicht feil, keine — die anderen Menschen mögen sie nur selbst machen. Ja, es wird noch einige Zeit vergehen, bis der »Elektron« betriebsfähig ist, es wird gerade etwas montiert.«
»»Elektron« heißt das wunderbare Fahrzeug?«, fragte Georg.
»Elektron. Das hat aber eigentlich nichts mit Elektrizität zu tun. Elektron ist — verzeihen Sie, wenn ich Sie unnötig belehre — ein griechisches Wort und bedeutet so viel wie ›auserwählt‹. So wurde von den Griechen der Bernstein genannt, den die Seefahrer, wohl erst Phönizier, aus dem hohen Norden nach ihrer Heimat brachten. Weil es eben etwas ganz Kostbares, Seltsames, Auserwähltes war, wurde diese gelbe Substanz Elektron genannt. Und weil an diesem gelben Harze durch Reiben zuerst jene rätselhafte Naturkraft erkannt wurde, leitete man dann deren Namen von dieser Substanz ab, so entstand unser Wort Elektrizität. Bei unserem Fahrzeug trifft alles dreies zusammen: es ist etwas ganz Auserwähltes, die Hauptrolle spielt die Elektrizität, und zur Isolierung aller Teile wird Bernstein verwandt — so führt es seinen Namen ›Elektron‹ wohl mit Recht.
Nun, meine geehrten Herrschaften, möchte ich Ihnen die Zeit vertreiben, bis der ›Elektron‹ kommt. Darf ich Ihnen noch einige andere interessante Experimente vormachen? Oder haben Sie zu den bisher geschehenen noch Fragen zu stellen?«
»Ja, das hätte ich!«, rief Georg schnell.
»Bitte. Ich bin zu jeder näheren Erklärung gern bereit, so weit ich darf.«
»Sie haben gezeigt, wie Sie die Eisenplatte leichter machen konnten. Können Sie sie auch schwerer machen als Eisen?«
»Kann ich.«
Die Platte, noch mit der Batterie verbunden, wurde wieder auf die Waage gelegt, der Professor drückte auf die Knöpfe seines Brettes, wieder begann sich das schwarze Eisen heller zu färben Jetzt aber ging der Zeiger der Waage herab, immer tiefer, stieg an der anderen Seite wieder herauf. Die große, starke Waage gab bis zu 40 Pfund an.
»32 Pfund! Demnach hätte dieses Eisen jetzt das spezifische Gewicht 20, das ist aber das spezifische Gewicht des gediegenen Goldes. Ich gebe immer noch sechs Pfund zu. So, 38 Pfund. Es gibt ja einige seltene Metalle, die noch schwerer als Gold sind, aber ein so schweres kennen wir nicht. Und die Platte hat sich immer erst grau gefärbt. Aber weiter gehen darf ich aus verschiedenen Gründen nicht, kann es jetzt auch nicht. Und Sie würden auch schon erschrecken, wenn Sie erführen, was für eine furchtbare Spannung jetzt die elektrische Batterie hat, in der sich also auch diese Platte befindet. Das geht nach Ihrer Rechnung in die vielen Millionen Volt! Doch brauchen Sie keine Sorge zu haben, es kann nichts passieren, Sie können die Platte auch heben. Nur bedenken Sie, dass es 38 Pfund sind, die Sie sich eventuell auf die Zehen fallen lassen.«
Sie wurde von verschiedenen Händen gehoben. Ja, das waren 38 Pfund, welche diese Platte wog, nur zwanzig Zentimeter im Quadrat haltend und zwei Zentimeter dick! Noch viel, viel schwerer, als wenn sie aus gediegenem Gold bestanden hätte!
Ein Mann benahm sich ungeschickt, hatte solch eine Last nicht erwartet, ein Kontakt fiel heraus, und da erschrak er noch mehr, hätte die Platte beinahe hochgeschleudert. Denn plötzlich hatte die Platte ihr ursprüngliches Gewicht von 13 Pfund angenommen, war also dreimal leichter geworden als soeben.
»Es ist fabelhaft!«, staunte Georg für alle. »Ja, wenn die Platte das spezifische Gewicht des Goldes angenommen hat, besteht sie denn dann aus Gold?«
»Nein. Ebenso wenig, wie sie sich beim Leichterwerden verwandelt. Dann wird sie auch nicht zu Holz und zu Watte.«
»Es bleibt immer Eisen?«
»Ja.«
»Wie ist das möglich?«
»Das kann ich Ihnen nicht erklären.«
»Verdichtet sich die ganze Masse, rücken die Moleküle näher zusammen?«
»Nein. Dann müsste doch die ganze Platte zusammenschrumpfen.«
»Kommt das Eisen in einen anderen Aggregatzustand?«
»So ungefähr.«
»Sie dürfen es uns nicht erklären?«
»Nein. Und Sie würden mich auch nicht verstehen keiner von Ihnen.«
»Aber ich darf doch weiter fragen?«
»Bitte sehr. Ob ich Ihnen antworten darf, das freilich ist eine andere Sache.«
»Wenn die Eisenplatte das spezifische Gewicht des Goldes erreicht hat, kann man das Eisen dann auch in Gold überführen?«
»Ja.«
»Aber es gehört noch etwas anderes dazu?«
»Ja.«
»Wollen Sie uns das einmal vormachen?«
»Hierzu habe ich nicht die Erlaubnis bekommen.«
»Wird diese Erfindung einst auch die ganze Menschheit machen?«
»Ja. Sobald die diametrale Elektrizität entdeckt worden ist.«
»Wird dann als vorhandene Gold entwertet?«
»Nein.«
»Weshalb nicht?«
»Die künstliche Herstellung wird stets viel, viel teurer sein als die Gewinnung des Goldes, wie es uns die Natur liefert.«
Das ist die Antwort, die man auf solch eine Frage regelmäßig von allen vernünftigen Sachverständigen und — Geistern bekommt! Es ist dies schon einmal gesagt worden.
»Nun gut. Also nach unten, bei der Gewichtszunahme, ist Ihnen eine Grenze gezogen, wenigstens jetzt und hier. Und wie ist es nun nach oben?«
»Wie meinen Sie?«
»Wie leicht hatten Sie die Eisenplatte vorhin gemacht, als Sie sie als Luftschiff fungieren ließen?«
»Zehn Gramm.«
»Können Sie nun auch noch diese zehn Gramm wegnehmen, sodass die Platte völlig gewichtslos wird?«
Der Professor blieb die Antwort schuldig und benahm sich höchst seltsam.
Ein zappliges Männchen war es überhaupt immer, und plötzlich wurde es noch viel zappliger, trippelte hin und her und schlenkerte die Finger, dabei mit einem ganz merkwürdigen Gesicht.
»Ja — ich kann es«, fing es dann an, »ja — ich will es Ihnen vormachen — weil Sie es wünschen — und weil es mir nicht verboten worden ist, es Ihnen vorzumachen — aber gern tue ich es nicht — weil, weil, weil, weil, weil — es mir höchst unangenehm ist. Mir ist bei so einem Experiment etwas passiert. Wissen Sie denn, ja, wissen Sie denn —«
Und er blieb stehen, zog die Brauen hoch, das bartlose, faltige Gesicht bekam noch viel sorgenvollere Falten.
»Ja, geehrter Herr, wissen Sie denn eigentlich, was Sie da von mir verlangen? Wissen Sie denn, was das bedeutet: Gewichtslosigkeit? Kennen Sie denn irgend etwas, was absolut gewichtslos ist? Die Flaumfeder ist es doch nicht etwa. Nicht einmal ein Atom Wasserstoff. Und Sie verlangen von mir, ich soll diese dicke Eisenplatte dort absolut gewichtslos machen?«
»Nun, wenn Sie's können, dann machen Sie's nur einmal«, lächelte der Waffenmeister ob des erregten kleinen Herrn, der sich gar so possierlich benahm. Oder ist das Experiment gefährlich?«
»Nein, gefährlich ist es nicht. Nur ich, weil ich das Registrierbrett unbedingt halten muss, bekomme einen elektrischen Schlag, gegen den ich mich durch nichts schützen kann. Auch dieser Schlag ist mir nicht gefährlich, schädlich, aber aber, aber, aber — mir höchst unangenehm. Es ist ein ganz besonderer elektrischer Schlag. Es ist ein ganz verteufelter Schlag. Er geht einem durch alle Kaldaunen — pardon —«
Das Männchen hob mit noch höher gezogenen Augenbrauen wie warnend den Zeigefinger seiner niedlichen Hand.
»Meine Damen und Herren! Sie werden etwas zu sehen bekommen, was über jeden menschlichen Begriff geht! Sie werden einen Blick in die tiefsten Geheimnisse der Natur tun, hinter die Kulissen der Schöpfungskraft. Sie werden etwas zu sehen bekommen, etwas erleben, was jedenfalls — meiner festen Überzeugung nach — sogar über die Hutschnur der Götter geht. Mehr kann ich nicht sagen.«
Und er ging an die Vorbereitungen, die nur darin bestanden, dass er den abgelösten Draht mit dem Kontaktstift wieder in die Platte steckte und diese wieder auf die Waage legte. Die Zuschauer bauten sich in spannendster Erwartung im Kreise herum auf. Sollte man da auch nicht spannen! Wenn das, was man jetzt zu sehen bekam, sogar über die Hutschnüre der Götter ging!
»So. Die Geschichte geht los. Sie werden zuletzt auf dieser alten Waage nicht mehr mitlesen können. Ich habe hier auf meinem Registerbrett den allerfeinsten Messer, davon lese ich ab. Also jetzt sind es schon nur noch 12 Pfund — 10 Pfund — 5 Pfund —«
Die schwarze Farbe der Platte begann zu erblassen, bis sie zuletzt schneeweiß wurde oder noch weißer, wenn es etwas Weißeres als Schnee gibt — ein Pfund — ein halbes Pfund — ein viertel Pfund — 100 Gramm — 50 Gramm — 20 Gramm — 10 Gramm, jetzt haben wir schon die vorige Leichtigkeit erreicht, nun passen Sie auf, es geht gleich los — 5 Gramm — 1 Gramm — ein halbes Gramm — ein hunderstel Gramm — ein Milligramm — ein halbes Milligramm — ein zehntel Milligramm — ein dreißigstel Milligramm — ein aaaaauuutsch!!!«
Und mit schmerzhaft verzogenem Gesicht krümmte sich das Männchen, ließ das Registerbrett fallen und rieb sich die weiße Weste in der Magengegend.
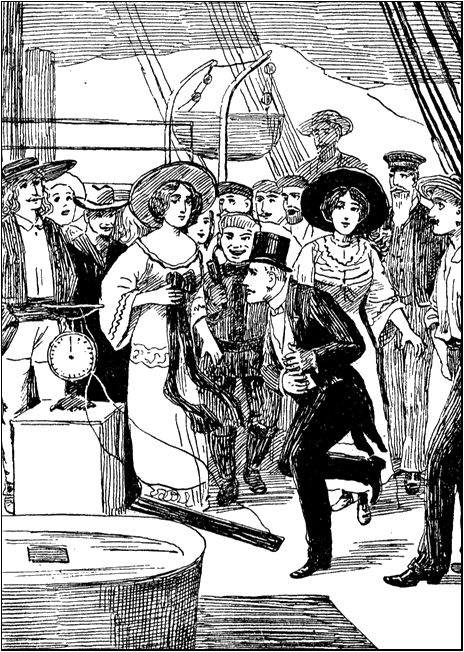
Und mit schmerzhaft verzogenem Gesicht krümmte sich das
Männchen und rieb sich die weiße Weste in der Magengegend.
Doch schien es schnell vorüber zu sein, er richtete sich gleich wieder auf.
»Wieder eine bittere Pille verschluckt! Nun, und wo ist die Platte geblieben?«
Ja, wo war die weißgewordene Eisenplatte geblieben? Als der Professor sein »Autsch« gejammert hatte, war sie plötzlich mit einem Ruck verschwunden gewesen. Die beiden Drähte mit den Kontaktstiften waren herabgefallen.
Unsichtbar geworden, d. h. durchlässig für die Lichtstrahlen? Nein. Sie war auf der Tafelwaage auch nicht mehr zu fühlen.
»Ah, ich weiß!«, sagte da Georg. »Ist die Eisenplatte völlig gewichtslos geworden, so wird sie ja auch von der Erde nicht mehr angezogen, sie macht also die Umdrehung der Erde um sich selbst nicht mehr mit, vielleicht auch nicht einmal mehr die Erdbewegung um die Sonne, das Beharrungsvermögen ist aufgehoben — während die Erde weitersaust, ist diese Platte im raumlosen Weltall stehen geblieben!«
»Diese Vermutung ist sehr scharfsinnig ausgedacht und logisch begründet«, lobte der kleine Mann wieder, »allein sie ist falsch! Meine Herrschaften, wir haben dieses Experiment in unseren Laboratorien zahllose Male gemacht, unter den verschiedensten Verhältnissen. Wir haben die betreffende Masse, die wir absolut gewichtslos machen wollten, in eine luftleere Bombe eingeschossen, haben diese einfach mit Quecksilber ausgefüllt. Die Bombe, viele tausend Atmosphären Druck aushalten könnend, war nach menschlichen Begriffen absolut undurchlässig für jedes bekannte Gas. Zwei hermetisch eingeschmolzene Drähte gingen durch, so wurde das Quecksilber mit diametraler Elektrizität gewichtslos gemacht, die Bombe selbst war nichtleitend. Nachdem wir unsere Pille geschluckt hatten, das heißt den Schlag bekommen, der am besten den gewünschten Zeitpunkt markiert, wurde die Bombe geöffnet. Sie war absolut luftleer. Das zu konstatieren, dazu sind wir in unserem Laboratorium in der Lage. Das Quecksilber also verschwunden. Und das haben wir zahllose Male gemacht, nicht nur mit Quecksilber. Wir wollen aber bei diesem bleiben.«
»Wo ist nun das Quecksilber hingekommen?«
»Meine Herrschaften! Wir stehen hier staunend vor einem der tiefsten Geheimnisse der Natur und Schöpfungskraft!
Es ist nicht anders anzunehmen, als dass sich dieses Quecksilber wie dort das Eisen wie jede andere Substanz, wenn sie absolut gewichtslos gemacht wird, in die Urmaterie aufgelöst hat.
Nur schade, dass wir uns unter diesem Wort ›Urmaterie‹ gar nichts vorstellen können.
Ebenso wenig, wenn wir dafür Äther sagen.
Da gibt es nur eines: da kann man nur niederknien und die Gottheit anbeten!
Und wenn man dieses Gebet in Worte kleiden will, so betet unsereins vielleicht: Herr, lass mich nicht wissen, sondern lass mich forschen!«
Und das Männchen zog ein Seidentüchlein hervor und trocknete den plötzlich perlenden Schweiß von der Stirn. Es war übrigens ein schönes Wort gewesen, das er da zuletzt gesagt hatte, es konnte mit seiner sonstigen Selbstüberhebung aussöhnen. Doch man musste wohl selbst ein Physiker sein, um zu begreifen, was ihn hierbei so mächtig erregte, und das sprach er selbst auch gleich aus.
»Meine Herrschaften! Ich bitte um Verzeihung dass Sie mich so schwach gesehen haben. Verzeihen Sie aber auch, wenn ich glaubte, dass Sie den Grund hierzu nicht richtig erkennen. Ich werde Ihnen ein anderes Experiment vorführen, welches scheinbar diesem ganz ähnlich ist, Sie wohl noch ganz anders in Staunen setzen wird. Obgleich es eigentlich nur eine kindliche Spielerei ist, eine Gaukelei, nichts weiter. Das heißt nicht etwa eine Illusion, auch nicht durch Taschenspielertricks ausgeführt, sondern mit Hilfe von physikalischen und chemischen Kräften, also in das Gebiet der sogenannten höheren Salonmagie fallend. Ich gebe das Resultat zum Besten, um Sie zu überraschen und füge erst später die ganz einfache Erklärung hinzu.«
Er nahm aus seinem Koffer ein Dutzend Kästchen und verteilte sie zur Untersuchung.
Die Kästchen waren aus schwarzem Holze, sehr dünnwandig, ungefähr sechs Zentimeter im Kubik, innen wohl mit Zinnfolie belegt, hatten einen Klappdeckel, nicht weiter verschließbar.
»Finden die Damen und Herren an diesem Kästchen irgend etwas Besonderes?«
»Nein.«
»Sind Sie überzeugt, dass die Kästchen leer sind?«
»Selbstverständlich.«
»Ist es möglich, dass in den Kästchen etwas verborgen ist, in einem Doppelboden?«
»Etwas Großes und Dickes kann es jedenfalls nicht sein.«
»Etwa so eine Figur hier?«
Er zeigte sie. Georg nahm sie als erster in die Hand.
Es war eine sitzende Buddhafigur, durch die gekreuzten Beine ebenso breit wie hoch, wieder ungefähr sechs Zentimeter, aus feinem grauen, porösen, ungemein leichten Steine.
»Was ist das für eine Steinart?«, fragte Georg.
»Was meinen Sie?«
»Bimsstein?«
»Erraten. Und außerdem ist die Figur hohl. Deshalb ist sie so leicht. Kann solch eine Figur etwa in einem Kästchen verborgen sein?«
»Ausgeschlossen.«
»Wollen Sie nun die Figur in solch ein Kästchen stecken und den Deckel zumachen.«
Es geschah. Die Figur ging ganz genau hinein, mit etwas Reibung, aber sonst ohne Schwierigkeit.
»Sie haben das Kästchen mit der Figur in der linken Hand. Nun nehmen Sie in die rechte Hand ein zweites Kästchen, wählen Sie ein beliebiges. So. Halten Sie die beiden Kästchen ausgestreckt oder am Körper oder ganz wie Sie wollen. Sind Sie überzeugt, dass sich die Figur in dem linken Kästchen befindet, das rechte leer ist?«
»Ich muss wohl davon überzeugt sein.«
»Sehen Sie noch einmal nach.«
Man brauchte mit den Händen nur einen Ruck zu machen, so klappten die leichten Deckelchen in den Scharnieren sofort auf, konnten dann ebenso leicht wieder umgelegt werden.
Natürlich, in dem linken Kästchen befand sich die Figur, das rechte war leer.
»Klappen Sie die Deckel wieder zurück. So. Bitte, nun wollen Sie die Deckel wieder öffnen.«
Georg starrte und starrte. Plötzlich befand sich die Buddhafigur in dem rechten Kästchen, das linke war leer. Er wurde auch aufgefordert, sie herauszunehmen.
»Wie ist denn das möglich?«
»Die Erklärung erfolgt später. Jedenfalls geht es mit ganz rechten Dingen zu. Soll dieser Umtausch wiederholt werden? Dann in anderer Weise.«
Georg musste die Figur in ein Kästchen zurücktun, behielt nur dieses in der Hand, die anderen elf Kästchen wurden an elf verschiedene Personen verteilt. Es wurde nur verlangt, dass sie den Deckel geschlossen hielten, nachdem sie sich überzeugt hatten, dass das Kästchen leer sei.
»In welches Kästchen soll die Figur wandern?«
»In das der Frau Patronin.«
Diese stand reichlich zehn Schritt von Georg entfernt.
»Ist die Figur noch in Ihrem Kästchen? Bitte, überzeugen Sie sich erst noch einmal.«
Ja, sie befand sich noch drin. Ebenso musste die Patronin noch einmal in ihr Kästchen blicken, auch hineinfühlen, es war leer!
»Schließen Sie die Deckel wieder. Eins, zwei, drei! Öffnen Sie die Deckel wieder.«
Georgs Kästchen war leer, die Figur befand sich im Kästchen der Patronin.
»Fabelhaft, fabelhaft! Entweder wir sind alle hypnotisiert oder das ist ganz echte Zauberei!«
»O nein. Das ist ein ganz einfacher, mechanischer Vorgang. Sie werden später, wenn ich die Erklärung gebe, einsehen, dass Sie etwas ganz Ähnliches schon längst kennen, dass es sich hierbei um etwas Ihnen ganz Geläufiges handelt. Sie lassen sich nur düpieren. In welches Kästchen soll Ihre Figur wandern, gnädige Mylady?«
»In das des Herrn Kapitän Martin.«
Sofort war die Figur dort.
»Bitte wollen Sie die Figur mit dem Messer durchschlagen«, wandte sich der Professor wieder an Georg.
Der brauchte nur sein Messer anzusetzen und leicht mit der Hand darauf zu schlagen, so war die Figur halbiert, innen dasselbe graue, sehr poröse Gefüge zeigend.
»Die ist ja gar nicht hohl, die ist ja voll!«
»Ja. Verzeihen Sie, dass ich vorhin sagte, die Figur wäre hohl. Ich kam Ihnen nur entgegen, um Ihnen die große Leichtigkeit plausibel zu machen. Es ist nämlich gar nicht Bimsstein. Denn so leicht dieser wiegen seiner Porösität auch ist, dass er auf dem Wasser schwimmt, nur fünf Gramm könnte die Figur dann doch nicht wiegen. Es ist eine künstliche Masse, die wir Menonith nennen. Nehmen Sie an, es sei versteinerte Schwammsubstanz, dann kommen Sie der Wahrheit auch ziemlich nahe. Nun wollen Sie die Figur noch vollständig zerpulvern, wozu Sie am besten wohl, damit nichts verloren geht, hier diesen Mörser nehmen.«
Es geschah. Das Zeug, so hart es auch war, ließ sich wegen seiner Sprödigkeit ungemein leicht zum feinsten Staube zerpulvern.
Der Professor schüttete das Pulver in ein Kästchen, die letzten Stäubchen mit einem Haarpinsel auswischend, Georg musste es wieder mit geschlossenem Deckel halten.
»Zu wem soll der Staub wandern?«
»Zum zweiten Steuermann.«
»Öffnen Sie die Deckel.«
Das Kästchen von Georg war leer, in dem von Ernst aber befand sich kein Staub, sondern wieder die unversehrte Buddhafigur.
Das Staunen lässt sich denken.
»Und das wollen Sie dann auf ganz einfache Weise erklären?«
»Ich werde es tun. Jetzt nehme ich hier ein großes Blatt Stanniolpapier, wickele darin die Figur gut ein — so — nun wollen Sie die Figur frei in die Hand nehmen, aber noch die Finger darum schließen, recht fest. So. In welches Kästchen soll die Figur wandern?«
Georg stand da mit ausgestrecktem Arm, in der Hand die eingewickelte Figur, die Finger darüber halb geschlossen.
»In das des Grafen Mohakare.«
Kaum hatte er dies gesagt, als seine Finger zusammenklappten, das leere Stanniolpapier zusammendrückten. Die Figur befand sich in dem Kästchen des Grafen.
Dieses erstaunliche Experiment musste noch mehrmals wiederholt werden. Wenigstens die Hauptpersonen wollten alle fühlen, wie die Figur in ihrer Hand plötzlich zu einem Nichts zerrann.
»Nun werde ich selbst einmal kommandieren«, sagte der Hexenmeister, als gerade Tönnchen die eingewickelte Figur in der Hand hatte. »Sind die zwölf Kästchen verteilt? Nur elf. Das Zwölfte steht hier. Bitte, nehmen Sie es. Hokuspokus, eins, zwei, drei! Öffnen Sie die Deckel.«
Tönnchen konnte die leere Stanniolfolie zusammendrücken, in jedem der zwölf Kästchen befand sich eine Buddhafigur, sie konnten herausgenommen werden, wurden nebeneinander hingestellt, eine war genau wie die andere. Zum Beispiel fehlte an sämtlichen das linke Ohrläppchen, das erst neuerdings bei der Versuchsfigur abgebrochen war.
»Dieses Experiment, wie ich die Figuren bis zu jeder Zahl vervielfältigen kann, gehört schon nicht mehr hierher, ich will Sie auch nicht weiter düpieren, sondern Ihnen nun gleich die Erklärung geben.
Nehmen Sie an — praktisch brauche ich das gar nicht erst vorzuführen — ich hätte hier eine gewisse Quantität Wasser. Einen Liter will ich sagen. In was für einem Gefäß sich dieses Wasser befindet, das ist zunächst ganz gleichgültig. Mir wird diese Aufgabe gestellt, dieses Wasser in ein anderes, leeres Gefäß zu übertragen, das zehn Meter von mir entfernt steht.
Wie löse ich diese Aufgabe?
Nun, ich nehme einfach das volle Gefäß, gehe hin und gieße das Wasser in das leere Gefäß. Da habe ich die mir gestellte Aufgabe gelöst.
Bitte, wollen Sie das nicht als eine Naivität auffassen. So einfach muss man anfangen, um durch logische Schlussfolgerungen zum Kompliziertesten zu kommen.
Ich habe aber gar nicht nötig, erst hinzugehen.
Ich nehme das Gefäß und schleudere das Wasser in das andere hinein, und ist dieses groß genug, so braucht dabei nichts verloren zu gehen, das hängt dann nur von meiner Geschicklichkeit ab.
Oder ich fülle das Wasser in eine größere Flasche, verstöpsele diese, durch den Kork gehen zwei Glasröhren, die eine bis auf den Grund, die andere erreicht das Wasser nicht, in diese blase ich kräftig, die Luft wird komprimiert, durch den Druck wird das Wasser zu der anderen herausgespritzt, ich lenke den Strahl in das andere Gefäß hinüber.
Das ist schon wieder eine ganz andere Methode, um das Wasser hinüber zu befördern.
Oder auf diese Weise kann ich das Wasser auch durch eine Glasröhre direkt hinüberleiten.
Und solcher Methoden lassen sich noch viele andere ausklügeln. Bisher ist das Wasser immer im flüssigen Aggregatzustand gewesen.
Nun aber kann ich dieses Wasser auch erst gefrieren lassen.
Dann kann ich den Eisklumpen hinübertragen, oder werfen, oder mit einer kleinen Schleudermaschine hinüberschleudern. Drüben taut der Eisklumpen wieder auf.
Dann kann ich das Wasser auch als Dampf hinüberdestillieren, der drüben wieder kondensiert wird.
So, das waren die drei Aggregatzustände, in denen das Wasser hinüber befördert werden kann, als flüssiges Wasser, als festes Eis und als gasförmiger Dampf.
Kann ich das Wasser nun noch in einer anderen Weise, in einem anderen Zustande hinüberbringen?«
»In einem vierten Aggregatzustande?«, fragte Georg sofort.
»Nein, ein vierter Aggregatzustand kommt dabei nicht in Betracht.«
Da konnte Georg diese Frage nicht beantworten, und auch kein anderer, Übrigens weiß man gar nicht, wie man sich einen vierten Aggregatzustand vorstellen soll.
Doch, einer wusste es: Doktor Cohn.
»Ich zerlege das Wasser durch Elektrolyse in seine Urbestandteile, in Wasserstoff und Sauerstoff, leite das Knallgas durch eine Röhre hinüber, vereinige die beiden Gase durch einen elektrischen Funken wieder zu Wasser.«
»Sehr richtig«, nickte der Professor zufrieden, und nun wussten es alle, die nur eine kleine Ahnung von Chemie hatten, und das nahm der Vortragende auch an, er gab dazu weiter keine Erklärungen. »Also auch auf diese Weise kann das Wasser hinübergeschickt werden.
Doch wollen wir dies erst einmal sein lassen. Ich komme noch einmal auf das gefrorene Wasser zurück.
Nehmen Sie an, ich hätte hier eine Flasche, welche die Form einer Buddhafigur hat. Es gibt übrigens solche Flaschen — Schnapsflaschen, wenn dabei auch nicht gerade der heilige Buddha verwendet wird.
Die inneren Wandungen machen die Linien der äußeren Seite mit. Fülle ich diese Flasche mit Wasser, lasse es gefrieren, zerbreche die Flasche, so habe ich also eine Buddhafigur aus Eis.
Jetzt destilliere ich dieses Wasser, gefroren oder nicht, nach einer anderen, leeren Flasche hinüber, die diese Gestalt einer Buddhafigur hat, kondensiere es durch genügende Kühlvorlage, lasse das Wasser gefrieren, zerbreche die Flasche, oder wenn sie eine enge Mündung hat, so zerbricht sie durch die Ausdehnung des gefrierenden Wassers von ganz allein — ich habe in der Hand eine Buddhafigur, die sich in einem Raume, in dem eine Temperatur unter Null Grad herrscht, auch für immer erhält. Nicht wahr, meine geehrten Damen und Herren?«
Ja, man sah ein, wie der Hexenmeister durch solch logische Folgerung der natürlichen Erklärung des scheinbaren Wunders immer näher rückte.
»Außerdem braucht es ja gar kein Wasser zu sein«, fuhr er fort. »Es gibt gar kein Metall, welches sich bei nötiger Vorsicht nicht unverändert destillieren ließe. Also könnten wir ja etwa auch Blei dazu nehmen. Nun komme ich wieder auf die Elektrizität zurück. Ich habe gesagt, dass Ihnen das, was Ihnen da so wunderbar erscheint, eigentlich eine schon ganz bekannte Erscheinung ist. Und das ist Tatsache. Nur dass es sich dabei um eine zweidimensionale Wirkung der Elektrizität oder um ein zweidimensionales Resultat handelt.
Meine Damen und Herren, Sie alle haben doch schon von der sogenannten Fernfotografie gehört. Es ist dies ein falsch gewählter Ausdruck, denn es handelt sich dabei nur darum, ein schon vorhandenes Bild auf elektrischem Wege zu vervielfältigen, wobei die Entfernung keine Rolle spielt.
Worauf es bei dieser sogenannten Fernfotografie ankommt, darauf will ich mich hier nicht einlassen. Dass können Sie in jedem neueren Konversationslexikon nachlesen.
»Und was nun der anderen Menschheit bisher mit Hilfe der Elektrizität nach zwei Dimensionen hin gelungen ist, in Form von Bildern, das haben wir bereits auf alle drei Dimensionen übertragen, sodass es uns möglich ist, einen Körper auf elektrischem Wege anderswo zu kopieren.
Übrigens ist auch dies Ihnen schon längst bekannt; einfach die Galvanoplastik. Nur darf ich die hierbei nicht zum Vergleich heranziehen, da es sich bei der Galvanoplastik um einen chemischen Vorgang handelt, während dieser hier ein rein physikalischer, ein ektrolytisch-mechanischer ist. Aber sonst ist das Resultat dasselbe. Und somit komme ich nun zur letzten Erklärung.«
Der Professor nahm eine der zwölf Buddhafiguren zwischen Daumen und Zeigefinger und zeigte sie der Zuhörerschaft, als wenn er vom Katheder aus doziere.
»Diese Substanz ist eine von uns künstlich hergestellte Kohlenwasserstoffgasverbindung, die wir Menonith nennen.
Sie wissen, dass alle reinen Kohlenwasserstoffverbindungen Gase sind.
Trotzdem wird es Sie nicht Wunder nehmen, dass es uns einmal gelungen ist, eine feste Kohlenwasserstoffverbindung herzustellen. Es ist dies nicht wunderbarer, als wenn Sauerstoff und Wasserstoff zusammen Wasser ergibt, das doch auch zu festem Eis gefriert.
Übrigens ist es ja gar nicht richtig, dass sämtliche Kohlenwasserstoffgase auch wirkliche Gase sind. Die kohlenstoffreichen kennen wir auch als Öle und Fette und selbst als harte, kristallisationsfähige Substanzen.
Kurz, es ist uns gelungen, eine Kohlenwasserstoffverbindung auf syntheti-schem Wege herzustellen, die einem Steine gleicht, hier dieses Menoniths, das sich unverändert erhält.
Wir werden sicher auch noch einmal dahin kommen, dass wir auch jede andere Substanz auf jede beliebige Entfernung hin plastisch übertragen können, vorläufig aber ist uns dies nur mit diesem Menonit gelungen. Und nun komme ich zum demonstrativen Experiment.«
Schon hatten seine schwarzen Assistenten zwei Stative in einiger Entfernung von einander aufgebaut, der Professor spannte zwischen ihnen einen Draht, verband diesen mit der Batterie, zeigte eine graue Kugel von der Größe eines Billardballes, sie war bis zur Mitte fein angebohrt, steckte sie an das eine Ende dies gespannten Drahtes.
»So. Jetzt lasse ich einen elektrischen Strom durch gehen Diese Kugel besteht also ebenfalls aus Menonith. Was ist die Folge?«
Man sah es. An dem anderen, leeren Ende des Drahtes entstand ein Pünktchen, es schwoll zum Kugelchen an, und wie die ursprüngliche Kugel am anderen Ende abnahm, so schwoll diese hier an, bis die Kugel eben nach dem anderen Ende des Drahtes gewandert war, wozu es ungefähr einer Minute bedurft hatte.
»Wie ist das möglich? Der feste Kohlenwasserstoff wird durch die Elektrizität in seinen gasförmigen Zustand verwandelt, der elektrische Strom reißt die Gasmoleküle mit sich fort, sie gleiten also an dem leitenden Drahte entlang, können aber nicht weiter als bis an sein äußerstes Ende, hier müssen sie sich wieder verdichten, nehmen die regelmäßigste Figur an, die wir kennen: die der Kugel, wie doch auch jeder Wassertropfen eine Kugel zu bilden sucht, jeder Weltkörper kugelförmig ist.
Große Schwierigkeiten hat es uns bereitet, diesen Vorgang so langsam vor sich gehen zu lassen, wie ich es hier gezeigt habe. Der elektrische Strom muss gewissermaßen gebremst werden. Wir brauchten diese Langsamkeit, um dabei nähere Untersuchungen anstellen zu können. Viel einfacher ist es, dem elektrischen Strome freien Lauf zu lassen, wodurch sich dieser Vorgang in dem Bruchteil einer millionstel Sekunde vollzieht. Nur für das menschliche Auge wird es dann wunderbarer, in Wirklichkeit ist es doch viel natürlicher. Also ich lasse den Strom zurückwandern, ohne ihn zu bremsen.«
Mit seinem Ruck war die Kugel an dem anderen Ende des Drahtes, und so ließ, der Professor sie noch mehrmals blitzschnell hin und her wandern.
»Nun komme ich dazu, wie man statt der Kugeln jede beliebige Figur übertragen kann.«
Statt der beiden Stative wurden zwei Glaskästen aufgestellt, bedeutend größer als jene schwarzen Holzkästen, innen mit Zinnfolie belegt, in die Wände waren an einigen Stellen Drähte eingeschmolzen, durch diese wurden die beiden Kästen sowohl mit der Batterie wie unter sich verbunden.
»Sie sehen hier eine gleiche Buddhafigur aus Menonith, nur im vergrößerten Maßstabe. Sie geht gerade in den Glaskasten hinein, berührt an sehr vielen Stellen die Zinnfolie. Das ist nötig, um möglichst viel leitende Kontakte herzustellen. Denn jetzt erfolgt nicht wie bei der Kugel die Übertragung von innen heraus, sondern von außen. Deshalb, und auch den Kopf der Elektrizität direkt zugänglich zu machen, bedecke ich den Kasten noch mit einer Glastafel, ebenfalls mit Stanniol überzogen. Wenigstens will ich Sitanniol sagen, in Wirklichkeit ist es etwas ganz anderes.
Dadurch ist Ihnen die Figur unsichtbar geworden, Sie sollen aber den Vorgang beobachten. Nun, da mache ich das Stanniol einfach auf die früher beschriebene Weise für die Lichtstrahlen durchlässig, also für Ihre Augen durchsichtig.«
Der Professor drückte auf einen Knopf seines Registerbrettes, und beide Glaskästen waren durchsichtig in dem einen sah man die graue Buddhafigur.
»Die Transformation geht vor sich, zuerst langsam.«
Man sah, wie in dem leeren Glaskasten hier und da an den Wänden graue Knoten entstanden, welche schnell wuchsen, und wenn man genau beobachtete, so konnte man konstatieren, dass diese ersten Knötchen in dem leeren Glastasten genau an denjenigen Stellen der Wände entstanden, welche denen entsprachen, wo im anderen Kasten die Figur die Wände berührte.
Hier nahm aber die Substanz nicht etwa ab. Diese Berührung blieb. Die Sache war eben die, wie der Experimenteur auch erklärte, dass die Transformation von innen heraus erfolgte, wenigstens von der einen Seite aus, auf der anderen Seite aber geschah das Wachsen von außen nach innen.
Zuletzt zerbrach die ursprüngliche Figur auch, man sah, dass sie ganz hohl geworden war, nur noch dünne Häutchen klebten an den Wänden, sie schmolzen immer mehr zusammen, um auf der anderen Seite die noch nicht ganz volle Figur auszufüllen.
»So, die Umwandlung ist geschehen. Nun hebe ich die Bremswirkung auf, lasse dem elektrischen Strome freien Lauf, der auch durch die Glaswände hindurch wie durch jede andere Masse die Kohlenwasserstoffmoleküle mit sich fortreißt. Zuck — zuck — zuck —«
Die Figur wanderte blitzschnell hin und her.
»Jetzt löse ich die Drahtverbindungen der beiden Kästen, sie sind ganz unabhängig von einander. Dass ich dasselbe auch ohne leitende Drahtverbindung erzielen kann, ist Ihnen doch ganz selbstverständlich. Es ist doch auch nur eine Frage der Zeit, dass auch die andere Menschheit den elektrischen Vorgang der zweidimensionalen Fernfotografie wie der dreidimensionalen Galvanoplastik auf drahtlosem Wege erzielen kann. Ich habe hier einen kleinen Apparat —«
Er zeigte ihn. Zwei Metallröhren vereinigten sich in einer größeren Kugel, an der sie nach allen Richtungen hin verschiebbar waren.
»In dieser Kugel befindet sich die elektrische Batterie, die ich dazu nötig habe. Ich visiere mit dem einen Rohre nach diesem Glaskasten, mit dem anderen nach jenem. Jetzt schalte ich ein. Die elektrischen Wellen verbinden die beiden Kästen, aber nicht direkt unter sich, sondern nehmen ihren Weg eben durch diese Kugel. Also wenn ich den magnetelektrischen Strom in volle Wirksamkeit treten lasse, so nehmen diesmal die Menolithmoleküle ihren Weg durch diesen Apparat. Eine langsame Wiederholung ist wohl nicht möglich. Zuck — zuck — zuck —«
Wieder wanderte die Buddhafigur blitzschnell aus einem Kasten in den anderen. Der Professor legte den Apparat weg. »Sie haben mich dieses Instrument nicht benutzen sehen, keinen meiner Assistenten. Aber ich habe noch andere Helfershelfer. Unsichtbare. Alle diese Vorgänge werden in einem weit, weit entfernten Laboratorium beobachtet. Wie dies geschieht kann ich Ihnen unmöglich erklären, oder ich müsste tagelang sprechen, und Sie würden mich wahrscheinlich auch noch nicht verstehen. Da muss von Grund auf eine ganz besondere Schule besucht werden, die auch ich durchgemacht habe, und ich stehe erst am Anfange meiner Universitätszeit. Ich bin erst ein Stümper gegen jene, welche in unserer Gesellschaft und Verbrüderung den Rang von Lehrern einnehmen.
Kurz, es handelt sich um eine Spiegelung, sowohl optisch wie akustisch wie elektrisch wie noch in anderen Weisen wirksam, für welche Ihre Gelehrten noch gar keine Ausdrücke haben.
Also dort wird in einer Art von Spiegel alles beobachtet und auch gehört, was hier gesprochen wird. Denn ausgesprochen muss es werden. Ein Gedankenlesen gibt es bei uns nicht, wenigstens nicht in diesem Laboratorium, wo exakt wissenschaftlich gearbeitet wird.
Wie oft, Herr Waffenmeister, soll die Figur hin und her wandern?«
»Viermal«, flüsterte der Gefragte.
Er flüsterte es, denn so klar dieser Vortrag auch gewesen war, dass das anfängliche Wunder auf ganz natürliche Weise erklärt worden, so wurde es ihm wie vielleicht allen anderen jetzt erst recht ganz unheimlich zumute. Kaum hatte er es ausgesprochen, nur geflüstert, als die Buddhafigur viermal aus einem Glaskasten in den anderen wanderte.
Und der Professor fuhr fort:
»Einer weiteren Erklärung bedarf es wohl nicht. Das wird jetzt eben dort in dem Laboratorium reguliert, von einem ganz gleichen Apparat aus, wie ich ihn hier zeige. Die Entfernung spielt dabei keine Rolle, auch in bezug auf die Schnelligkeit des Resultats nicht. Sie haben doch wohl schon von der sogenannten Molekularbewegung gehört. In jeder Substanz ist jedes Molekül in ständiger Bewegung. Ihr Professor Clausius hat ja darüber die genauesten Messungen angestellt. So bewegt sich ein Sauerstoffmolekül 400 Meter in der Sekunde, wenn man diese Notation in die Länge übertragen wollte, ein Wasserstoffatom gar fast 3000 Meter in der Sekunde. Hierbei kommt aber nicht nur diese Molekularbewegung in Betracht, sondern auch noch, dass diese Moleküle von dem elektrischen Strome mitgerissen werden. Also spielt der Theorie nach die Entfernung überhaupt gar keine Rolle, um in einem Moment überall hin die Figur zu transformieren, in der Praxis nur so weit, als wir spiegeln können, wobei uns allerdings Grenzen gezogen sind.
Alles andere können Sie sich nun wohl selbst erklären. Dass die Figur zerpulvert wurde, hatte nichts zu sagen. Oder da wurden Sie eben getäuscht. Dieser Staub wanderte aus dem Kästchen nach unserem Laboratorium zurück, wo das Original der Figur steht. Also ist es doch ein leichtes, von dort aus auch in jedem Kästchen eine Kopie entstehen zu lassen, es braucht nur unter einen elektrischen Wellenstrom genommen zu werden, wobei Sie es auch in der Hand schnell hin und her bewegen können. Vom Laboratorium aus weiß man es schon zu treffen. Sie könnten es sogar in die Tasche stecken oder anderswie verbergen, es in einem Panzerschrank unter Schloss und Riegel nehmen. Diese elektrischen Wellen durchdringen jede Substanz, jede, und man weiß das Kästchen auch immer zu finden, da wir auch jede Substanz durchsichtig machen können. Sonst habe ich dem nichts weiter hinzuzufügen.«
Das Männchen machte zum Zeichen, dass sein Vortrag beendet sei, nach allen Seiten hin eine zierliche Verbeugung.
Kein Bravo wurde ihm gezollt.
Das tiefste Schweigen herrschte ringsherum im Kreise. Sie alle standen unter dem gewaltigen Eindruck der Erkenntnis, dass es auf dieser Erde eine Vereinigung von Menschen gab, welche an Wissen und Können weit, weit über der anderen Menschheit stand, denen gegenüber unsere Gelehrten und Forscher Kinder zu nennen waren. Wenn einer unserer akademischen Physiker und Chemiker mit all seinen Apparaten und Instrumenten und sonstigen Hilfsmitteln nach einem wilden Volke Zentralafrikas kommt und diesen Leuten dort die modernsten Erfindungen vorführt — es wäre nichts anderes, als was soeben hier geschehen war, und es hätten die bedeutendsten Physiker und Chemiker zugegen sein können. Ein solcher war ja übrigens auch zur Stelle: Doktor Isidor Cohn. Aber der konnte nichts weiter als immer nur den Kopf schütteln und mit seinen Ohren wackeln.
»Sehr schön, sehr schön«, ließ sich da endlich eine Stimme vernehmen. »Sagen Sie mal, geehrter Herr Professor, können Sie auch hier diesen Stein so leicht machen, dass er auf dem Wasser schwimmt?«
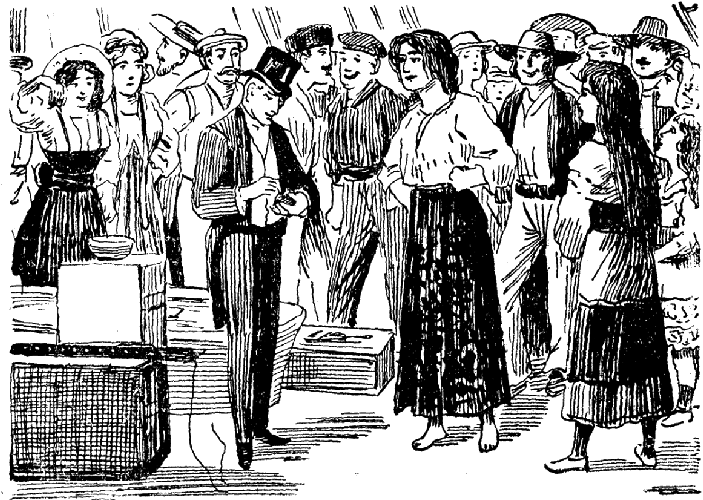
Klothilde war es, die mit diesen Worten vortrat.
Sie hatte sich schon während des letzten Teils des Vortrags zurückgezogen, auch einmal mit dem Segelmacher längere Zeit geflüstert, was aber niemand bemerkt hatte.
Ferner ist ein Grund vorhanden, dass wir gleich im voraus ihre Toilette beschreiben: Diese bestand, bequem und zigeunerhaft, wie man an Bord dieses Gauklerschiffes nun einmal ging, dem Äußeren nach aus nichts weiter als aus einem buntgestreiften Rocke, auf dem Oberkörper hatte sie wohl nichts weiter als ein geschlossenes Hemd. Fußbekleidung trug sie gar nicht, ging barfuß, konnte ihre zierlichen Füßchen auch wirklich sehen lassen.
Bei jenen Worten zeigte sie eine braune Figur, die ungefähr einer Ente glich, etwa, um ein Maß anzugeben, die Größe einer Streichholzschachtel hatte. Ja, es war eine Ente, aber ganz plump ausgeführt.
Der Professor nahm sie, betrachtete sie von allen Seiten, wog sie in der Hand.
»Was ist das für eine Gesteinsart?«
»Ich weiß es nicht. Ich habe den Stein am Seeufer gefunden, er gefiel mir, weil er gerade wie eine Ente aussah.«
»Der Stein ist voll?«
»Ja, natürlich ist er voll, nicht hohl. Können Sie den Stein gewichtslos machen, oder doch so leicht, dass er auf dem Wasser schwimmt?«
Der Professor kratzte zunächst mit dem Fingernagel darauf herum.
»Ist er mit einer Isolierschicht überzogen?«
»Mit was denn für einer Isolierschicht? Er ist so wie ich ihn am Seeufer fand.«
Der Professor hielt den Stein zwischen zwei von der Batterie ausgehende Drähte und fingerte auf seinem Tastenbrett herum.
»Nein«, sagte er dann, »dieser Stein muss erst mit Firnis oder einer anderen Isolierschicht überzogen werden, dann kann ich sein Gewicht nach Belieben verändern. So ist das nicht möglich, dieses Problem haben wir noch nicht gelöst. Ohne Isolierschicht wird die bidiametrale Elektrizität, welche die Wirkung der anziehenden Ätherschwingungen aufhebt, abgeleitet, selbst von der Luft. Und noch nicht einmal im luftleeren Raume ist uns dieses Problem zu lösen gelungen.«
»Ich aber kann diesen Stein gewichtslos machen.«
Überrascht blickte der Professor auf die Sprecherin.
»Ohne Firnisüberzug?«
»Ohne jede Firnisserei.«
»Ja, was wissen Sie denn überhaupt von diesem ganz besonderen Firnis, der unser ureigenstes Geheimnis ist?«
»Ich weiß gar nichts von diesem Firnis, sagte ich ja schon. Ich kann diesen Stein gewichtslos machen oder doch mindestens so leicht, dass er auf dem Wasser schwimmt.«
Zunächst legte der Professor den Stein auf das Wasser der Balje. Die Figur sank sofort unter, wie eben eine steinerne Ernte, die nicht hohl ist, untersinkt.
»Wie wollen Sie denn das machen?«, fragte er dann mit geringschätzenden aber doch schon etwas unsicherem Lächeln.
»Das ist nun wieder mein ureigenstes Geheimnis. Aber ich will es Ihnen verraten. Das mache ich mit parambolidynamischer Elektrizität.«
Der Professor machte zunächst ein unbeschreibliches Gesicht.
»Mit pa — pa — pa —«
»Es papat sich dabei nichts, sondern es ist ganz einfach parambolidynamische Elektrizität, die sich natürlich auch in parambolidynamischen Magnetismus umwandeln lässt.«
»Was ist denn das, parambolidynamische Elektrizität?«
»Das ist eine Elektrizität, die ich erfunden habe, oder doch entdeckt. Sie befindet sich als Naturkraft überall in der Luft, aus dieser kann ich sie nach Belieben herauspumpen.«
Es sei gleich bemerkt, dass den anderen Zuhörern nicht ganz geheuer zumute war. Es war doch Klothilde, die so etwas behauptete, und deren tiefernstes Gesicht kannte man doch schon. Und gerade weil sie einmal keine Grimassen schnitt — das war gerade das Gefährliche dabei! Aber dieses Männchen, das sich Professor Beireis nannte, mochte es die Klothilde nun schon kennen oder nicht — das war nur der wissenschaftliche Forscher, der die Wahrheit ergründen will.
»Sind Sie imstande, mir das vorzumachen, dass der Stein auf dem Wasser schwimmt?«
»Jawohl, bin ich.«
»Wann wollen Sie das Experiment ausführen?«
»Jetzt sofort.«
»Bitte sehr.«
»Folgen Sie mir.«
Man brauchte nur nach dem Vorderdeck zu gehen, dort hatte Klothilde bereits ihre Vorbereitungen getroffen.
Und wiederum wurden alle anderen ganz kopfscheu, oder bekamen sogar schon so eine kleine Ahnung, als sie merkten, dass derjenige, der diese Vorbereitungen getroffen hatte, der Klothilde dabei unterstützen wollte, kein anderer als der Segelmacher war.
Klothilde und Oskar — na, wenn die beiden zusammen arbeiteten, unter einer Decke steckten, da musste ja etwas Schönes dabei herauskommen!
Nur der Professor merkte nichts, ahnte nichts. Der wurde nur immer zappliger.
An Deck war ein dunkelgemusterter Teppich ausgebreitet, fast schwarz, zwei Meter im Quadrat. In der Mitte desselben stand auf drei kleinen Bieruntersetzern aus Porzellan eine größere Kokosnussschale, bis ziemlich an den Rand mit Wasser gefüllt, das sehr schmutzig aussah, jedenfalls ganz undurchsichtig war.
»Bitte, meine Herrschaften«, nahm Klothilde das Wort, »wollen Sie sich um diesen Teppich herum aufstellen. Das Betreten des Teppichs ist nicht erlaubt, keine Berührung mit der Fußspitze. Sonst wird die parambolidynamische Elektrizität abgeleitet. Denn, Herr Professor, eine Isolierung habe ich dennoch nötig. Nur keinen Firnis. Wohl aber besteht dieser Teppich aus einem besonderen Stoffe, der isoliert. Wenn die Herren Matrosen behaupten, das wäre ja die Klaviervorlage aus ihrem Klubsalon, so haben sie ja allerdings ganz recht, aber ich habe den Teppich erst imprägniert. Womit, das ist mein Geheimnis. Desgleichen muss die Wasserschale isoliert werden, mit porzellanenen Tellerchen, die man gewöhnlich kurzweg Bieruntersetzer nennt. Die Schale ist die Hälfte einer Kokosnuss, gefüllt mit einfachem Frischwasser, das ich mit etwas Sepiafarbe undurchsichtig gemacht habe. Dass dies alles so ist, dass sonst kein Hokuspokus in Betracht kommt, davon können sich Herr Professor dann hinterher überzeugen. Das Wasser muss undurchsichtig sein, weil im durchsichtigen Wasser die Wirkung der parambolidynamischen Elektrizität aufgehoben wird, ich den untergesunkenen Stein also nicht mehr erleichtern und ihn so heben könnte. Eine ausführlichere Erklärung folgt später. Und hier ist der Apparat, mit dem ich die parambolidynamische Elektrizität erzeuge.«
Klothilde, schon auf dem Teppich stehend, entnahm den Händen des Segelmachers ein meterlanges Rohr. Es war nicht nötig, dass sie einmal mit ihren schwarzen Karfunkelaugen im Kreise herumblitzte. Sie kannte ihre Argonauten und die dazu Gehörenden doch schon, die verrieten mit keiner Miene, falls sie schon etwas ahnten.
Und der Professor war und blieb ahnungslos, und dasselbe galt von seinen schwarzen Gehilfen.
Es war ebenfalls ein ganz gewöhnliches Gasrohr, welches der Herr Professor mit eigenen Händen untersuchen durfte, nur dass es herrlich angemalt worden war, mit Ringen von allen möglichen Farben. Sonst war absolut nichts weiter daran.
»Hiermit erzeugen Sie die pa — pa — parambolidynamische Elektrizität?«
»Nicht papaparambolidynamische, sondern ganz einfach parambolidynamische Elektrizität. Jawohl, mit diesem Instrumente, das ich Ihnen später erklären werde, wird sie aus der Luft gepumpt und dorthin geschickt, wo man sie haben will, und ihre Wirkung werden Sie gleich sehen. Nur ist dann nötig, dass die elektrischen Wellen von oben her auf das Wasser fallen. Bitte, Oskar, klettern Sie hinauf.«
Oskar nahm das Rohr, erstieg die Wante, die hier über Deck zum Kreuzmast empor ging, hing sich in einiger Höhe in die Stricke, visierte mit dem Rohre nach der Wasserschale.
»All right, die carambokonstantinopolitanische Elektrizität ist fertick!«, erklang es von oben.
»Nicht carambokonstantinopolitanische Elektrizität, sondern parambolidynamische«, verbesserte Klothilde mit unerschütterlichem Ernste. »Halt, noch nicht! Herr Professor, hier haben Sie wieder den Stein. Sie sollen ihn selbst in das Wasser werfen. Ist es noch derselbe?«
»Gewiss, es ist derselbe«, musste der nach kurzer Prüfung erklären.
»So erlaube ich Ihnen, dass Sie noch einmal den Teppich betreten, um den Stein selbst ins Wasser zu werfen. Dann müssen Sie ihn aber gleich verlassen. Bitte.«
Unterdessen hatte sich Klothilde mit untergeschlagenen Beinen auf dem Teppich niedergekauert, einen Meter von der Schale entfernt.
Der Professor betrat den Teppich, ging hin, ließ den Stein aus geringer Höhe in das Wasser fallen, zog sich, rückwärts gehend, die Schale immer im Auge behaltend, wieder zurück.
Die steinerne Figur war natürlich untergesunken.
»All right, Oskar!«
Oben ertönte jetzt ein eigentümliches, summendes Schnarren.
»Hören Sie? Jetzt saugt das Rohr die parambolidynamische Elektrizität aus der Luft auf und strahlt sie am anderen Ende wieder aus. Mein Assistent richtet sie direkt auf das Wasser und fingert auf dem Rohre herum, als ob er Flöte spiele. Die farbigen Ringe sind nämlich Kontakte, die ein- und ausgeschaltet werden können, so hat er den Stein ganz in seiner Gewalt, führt meine Kommandos aus. Also passen Sie auf: Hoch!«
Sofort tauchte die steinerne Ente auf, schwamm oben auf dem Wasser. Der kleine Professor vergaß seine Zappelei, er war nur noch Auge.
»Unter!«
Sofort verschwand die Ente unter Wasser.
»Hoch!«
Oben war sie wieder.
Und so ging das noch einige Male. Oben in den Wanten fingerte Oskar auf dem schnarrenden Rohre herum, immer nach dem Wasser visierend.
»Es sind auch noch andere Bewegungen möglich. Guten Morgen, Frau Ente!«
Die auf dem Wasser schwimmende Ente nickte ganz energisch.
»Wie ist Ihr Befinden? Gut?«
Die steinerne Ente zappelte noch energischer.
»Fort, verschwinden Sie!«
Weg war sie, untergetaucht.
Jetzt griff Klothilde in das trübe Wasser und brachte die Ente wieder zum Vorschein.
»Ist es derselbe Stein?«
Sie hatte ihn, sich im Liegen vorstreckend, dem Professor gegeben.
Es war ganz umsonst, dass der die nasse Ente so genau untersuchte. Es war dieselbe steinerne Ente.
Klothilde nahm sie wieder, warf sie ins Wasser, der Stein sank unter.
»Hoch!«
Da schwamm sie wieder oben.
»Gefällt es Ihnen im Wasser?«
Bejahung durch Zappeln.
»Können Sie auch tanzen? Soll ich Ihnen einmal etwas vorspielen?«
Ein noch energischeres Zappeln als Bejahung. Klothilde griff vorn zwischen Hemd und Hals, zog eine kleine Flöte heraus, fing an zu blasen, eine quäkende Melodie, bald langsam, bald schnell, und so tanzte auch die Ente auf dem Wasser, bald langsam, bald schnell, genau den Takt einhaltend.
Oben fingerte Oskar auf dem schnarrenden Rohre herum.
Während dieses Tanzes hatte der Professor einem seiner schwarzen Diener einige fremde Worte zugerufen, der Neger lief davon, kam mit einer Art Opernglas zurück, das der Professor vors Auge nahm. Es war jenes Instrument, durch das man Illusion von Wirklichkeit unterscheiden konnte.
»O Wunder über Wunder, es ist Tatsache!«
»Fort!«
Die Ente verschwand unter Wasser.
Da kniete der Professor einfach an Deck hin und hob gegen Klothilde die gefalteten Hände.
»Was soll das?«
»Ich bete Sie an!«, erklang es in furchtbarer Erregung.
»Ach, machen Sie doch keinen Sums. Das ist ganz einfach parambolidynamische Ektrizität. Mann, stehen Sie doch auf!«
Wohl gehorchte der kleine Professor, aber die gewaltige Erschütterung blieb, und er sprach es aus: »Miss! Sie haben da eine Erfindung gemacht, mit welcher sich die tiefsinnigsten Geister unserer gelehrten Gesellschaft schon seit langen, bangen Jahren vergebens beschäftigen, ohne das Problem lösen zu können. Jede Substanz noch auf eine andere Weise als die uns bekannte Weise schwerer oder leichter machten zu können, ohne sie erst isolieren zu müssen. Sie haben dieses Problem gelöst! Sie haben eine Art von Elektrizität entdeckt! Und wir suchen solche ingeniöse Köpfe in aller Welt, um sie unserer geheimen Gesellschaft einzuverleiben! Fräulein, Fräulein, ich beschwöre Sie, geben Sie mir eine nähere Erklärung über diese rätselhafte Naturkraft, die Sie aus der Luft saugen, die Sie beherrschen, oder ich werde auf der Stelle wahnsinnig, wenn ich's nicht schon bin. Bitte, bitte, geben Sie mir eine Erklärung! Und ich gratuliere Ihnen, dass Sie in unserer geheimen Gesellschaft gleich eine Lehrstelle, eine Professur einnehmen sollen!«
Mit ihrem tiefernstem Gesicht, ohne einmal Grimassen zu ziehen, hatte Klothilde das Männlein angehört.
»Nein, mein lieber Professor, wenn Sie nicht schon wahnsinnig sind — meinetwegen sollen Sie's nicht werden. Ich gebe Ihnen die ausführliche Erklärung Hier ist, die steinerne Ente —«
Sie griff in das Wasser, holte den nassen Stein hieraus, zeigte ihn.
»Und hier —«
Da tauchte an dem Wasser noch eine zweite Ente auf, ganz genau so aussehend.
»Und hier ist noch eine zweite Ente, die aber aus einem leichten Holze geschnitzt ist. Sie ist an einem schwarzen Rosshaar befestigt. Die Kokosnussschale hat am Boden ein ganz feines Löchelchen, durch dieses geht das Rosshaar. Das andere Ende des Haares habe ich hier an meiner großen Zehe befestigt, die ich unter dem Rocke verborgen hatte. So habe ich die hölzerne Ente in meiner Gewalt. Die steinerne sinkt natürlich zu Boden, ein kleines Nachgeben meiner Zehe und die hölzerne Ente steigt empor, ich kann sie tanzen lassen und wieder herabziehen. Die Schale hat einen doppelten Boden, der Hohlraum ist mit Sägespänen gefüllt, die sich erst mit Wasser vollsaugen müssen, ehe es durch das Löchelchen tropfen kann. Das Rohr dort oben ist ein angemaltes Gasrohr. Der Segelmacher hat im Maule eine Mundtrommel, oder im Munde eine Maultrommel, wollte ich sagen. Was parambolidynamische Elektrizität ist, weiß ich nicht. So, das ist die ganze Erklärung. Die Professur in Ihrer geheimen Gelehrtengesellschaft nehme ich an. Wie hoch wird die Stelle bezahlt?«
So hatte Klothilde gesprochen.
Ach, diese verdutzten Gesichter ringsherum!
Bis dann das schallende, das brüllende Gelächter losbrach.
Und es galt nicht zum mindesten dem kleinen Professor. Wie der dastand, etwas in die Kniebeuge gehend, mit was für einem Gesicht, dann mit geknickten Knien etwas herumschleichend und sich dabei hinterm Ohre kratzend.
»Au!«
Wir wollen gleich erwähnen, was die anderen erst später erfahren, wie Klothilde auf diese Idee gekommen war.
Sie hatte eben am Strande einmal diesen Stein gefunden, der wie eine Ente aussah, und da war ihr die geniale Idee so gekommen, wie eben jede geniale Idee entsteht.
Sie hatte nur ihre Gefährten veralbern wollen. Hatte sich solch eine Wasserschale gefertigt, auch das Rohr, das aber nur als Zauberstab dienen sollte, oder zu sonst einem Zwecke. An Elektrizität hatte sie dabei noch gar nicht gedacht.
Da war nun der Professor gekommen mit seinen elektrischen Zaubereiexperimenten die Gelegenheit war gerade so günstig — well, nun wollte auch Klothilde einmal etwas mit ihrer eigenen Elektrizität zum besten geben, hatte dazu den Segelmacher schnell eingeweiht.
So war es gekommen.
»Teufelsweib, Teufelsweib!«
Nur Kapitän Martin konnte das sagen, die anderen waren vor Lachen noch keines Wortes fähig.
Da sah man, wie der Professor schnell seine Uhr zog und sie ans Ohr hielt, nach einiger Zeit machte er eine Handbewegung, und es wurde still, weil man wusste, dass jetzt wieder etwas Besonderes kommen müsste. »Meine Herrschaften! Ich soll Ihnen mitteilen, dass dieser ganze Vorgang dort in unserem Laboratorium beobachtet worden ist. Gleichzeitig soll ich Ihnen aber auch auf Ehrenwort erklären, dass Sie sonst nicht etwa dort beobachtet werden, wozu man etwa noch gar Ihre Kabinenwände durchsichtig macht.
Solche Beobachtungen sind bei uns vollkommen ausgeschlossen. Die Erfindungen befinden sich in besten Händen, und das ist eben der Grund, weshalb wir sie nicht gleich der anderen Menschheit preisgeben, damit nicht — doch davon jetzt abgesehen.
Also dieser Vorgang ist dort beobachtet worden, weil das Schiffsdeck nun einmal wegen jener Experimente bespiegelt werden musste.
Meine hochgeehrte Dame«, wandte sich der kleine Professor jetzt mit einer tiefen Verbeugung speziell an Klothilde. »Miss Gracco, nicht wahr? Dort auf der Station befindet sich gerade einer unserer höchsten Meister. Auch er hat den Vorgang beobachtet, und er amüsiert sich köstlich über den Streich, den Sie mir soeben gespielt haben. Mir ist es ja nicht gerade angenehm, dass ich dies Ihnen mitteilen muss, aber ich entledige mich hiermit meines Auftrags. Dort in unserem Laboratorium ist jetzt nicht minder herzlich gelacht worden als wie hier, und bei uns wird selten gelacht. Dieser Meister möchte sich revanchieren für die ergötzlichen Minuten, die Sie ihm bereitet haben. Er möchte Ihnen etwas verehren, ein Andenken an diese Stunde. Ob Sie nicht irgend etwas haben, eine kleine Porzellanfigur oder etwas Ähnliches —«
»Eine kleine Porzellanfigur? Nee, die habe ich nicht. Ich habe überhaupt niemals nischt.«
Da hatte Klothilde allerdings ein großes Wort gelassen ausgesprochen.
Mit nichts war sie damals in Rio de Janeiro an Bord gekommen, und heute hatte sie noch immer nichts. Sie gehörte zur besitzlosen Klasse, und auf diesen respektablen Stand hielt sie mit stolzer Energie. Wenn das Schiff in einen Hafen lief, ging sie in Lumpen gehüllt an Land, kaufte sich ein pompöses Kleid, Strümpfe und Stiefelchen und Hut und was sonst noch dazu gehört, und wenn sie es dann wieder einmal anziehen sollte, dann hatte sie immer wieder »niemals nischt«. Wo das Zeug blieb, das war ein Rätsel. Na, mit übernatürlichen Dingen ging das ja nicht zu. Wenn etwa einmal das Wasser durch das Bullauge in ihre Kabine geschlagen war, dann nahm sie einfach ihr neues Kostüm her und schwabberte damit das Wasser am Boden aus, und dann war das doch kein Kostüm mehr, sondern nur noch ein Lappen. Sie war noch viel mehr als eine Zigeunerin. Wie gesagt, sie war stolz darauf, zur besitzlosen Klasse zu gehören, die »niemals nischt« hat.
»So geben Sie die steinerne Ente, die passt gerade recht gut für den beabsichtigten Zweck —«
»Ja, den Stein können Sie bekommen, Steine habe ich eine ganze Menge, die ganze Erde voll — oder halt, da fällt mir etwas anderes ein, ich habe doch noch etwas Besonderes —«
Flink wie ein Wiesel rannte sie davon, kam gleich wieder zurück, ein Stück Segeltuch in der Hand.
»Können Sie vielleicht das brauchen?«
Es war ein gewaltiger Hirschkäfer mit mächtigen Scheren, den sie in dem Lappen präsentierte. In diesen Buchenwäldern kamen viele Hirschkäfer vor, aber solche stattliche Exemplare waren doch selten.
»Ich habe ihn gestern gefangen, wollte ihn unserem Doktor Isidor in die Koje setzen, aber das Luder ist krepiert. Geht der nicht für eine Nippfigur durch?«
Der kleine Professor zog die Stirne kraus, als er das Ungeheuer betrachtete.
»Der ist freilich nicht von Porzellan, wie der Meister sagte, das ist organische Substanz — aber warten Sie —«
Er benutzte wieder seine Uhr als drahtloses Telefon.
»Meine Herrschaften, jetzt werden Sie Zeuge eines großartigen Vorganges, den auch ich nicht begreife.
Übrigens haben Sie mich vorhin schon gefragt, ob ich dieses Experiment ausführen könnte, ich bejahte, habe auch alles da, was dazu gehört, dennoch weigerte ich mich, weil ich keine Erlaubnis zur Vorführung dieses Experiments hatte — nun ist es der zweite Meister selbst, der es ausführen wird, ich bin dabei nur sein Assistent, nur sein Handlanger.«
Der Professor baute einen Apparat auf, die Hauptsache daran war eine Art Brennglas, das er nach der Sonne richtete, auf eine Platte darunter legte er den Hirschkäfer. Nicht lange dauerte es, so begann der braune Käfer zu erblassen, bis er sich ganz weiß gefärbt hatte.
»Jetzt ist die organische Substanz zerstört. Oder sie ist vielmehr in eine anorganische überführt worden, und das gilt auch von allen inneren Teilen. Und jetzt — da ist es schon geschehen.«
Mit einem Schlage hatte der weiße Käfer eine goldgelbe Farbe angenommen. Der Professor nahm ihn von der Platte.
»Meine Herrschaften — eine Transmutation, wie die alten Alchimisten die Umwandlung einer anderen Substanz in Gold nannten! Wenn sie dabei auch immer von einem schweren Metalle ausgingen. Das ist bei uns nicht nötig. Wir können auch Wasser in Gold verwandeln, müssen dazu freilich erst andere Elemente hinzufügen und das kommt uns selbst teuerer zu stehen, als wenn wir natürliches Gold kaufen. Hier handelt es sich ja aber um etwas ganz anderes. Dieser Hirschkäfer ist durch und durch in Gold verwandelt worden. Wenn Sie ihn durchschneiden so würden Sie unter dem Mikroskop noch die winzigen Zellen erkennen — aber alles Gold. Fräulein Klothilde, ein Meister verehrt Ihnen dies zum Andenken für die köstliche Viertelstunde die Sie ihm bereitet haben. Tragen Sie diesen goldenen Hirschkäfer als Brosche.«
Mit diesen Worten überreichte der Professor ihr den goldenen Käfer, der ungefähr zwanzigmal schwerer geworden war.
»Danke«, sagte Klothilde einfach. »Als Brosche soll ich das Ding tragen? Da hätte Ihr Meister aber auch gleich eine Nadel dranmachen sollen.«
»Meine Herrschaften der ›Elektron‹ ist zur Stelle!« Neben dem Schiffe tauchte eine schwarze Masse auf, zunächst nur eine Plattform, nicht ganz so lang wie die »Argos« — oder, um gleich die richtigen Maße anzugeben — genau 106 Meter lang und 14 Meter breit, vorn und hinten etwas spitz zulaufend.
»Wollen sich die Herrschaften an Bord des ›Elektron‹ für eine längere Reise einrichten? So nehmen Sie alles mit. Auch Ihre ganze Menagerie. Es ist alles, alles dafür eingerichtet worden. Das hat eben die Ankunft des ›Elektron‹ etwas verzögert.«
»Für eine längere Reise?«
»Ja. Die ganze Welt steht uns ja offen. So weit man darunter diese Erde mit einer Luftschicht von 10 000 Meter Höhe versteht. Wir können ja eine kleine Reise um die Erde machen. Sie können alles mitnehmen. Was nicht nötig ist, werde ich immer sagen. Zum Beispiel Klaviere sind nicht nötig. Die haben wir selbst an Bord.«
Zwischen der Patronin, Kapitän Martin und dem Waffenmeister fand eine kurze Beratung statt, wobei der Professor nur noch nähere Auskunft geben musste. Die »Argos« konnte ganz verlassen werden. Sie kam einstweilen in das Wasserbassin des Schlosses der Entsagung hinein. Die Indianer und englischen Matrosen blieben allein hier, standen aber unter genügender Aufsicht.
»Ja wenn es so ist, dann sind wir bereit, auf den »Elektron« überzusiedeln«, lautete dann der Entschluss.
Und der Umzug begann sofort. In einer Stunde war es geschehen.
Das Unterseeboot hob sich, bis die Plattform mit dem Deck der »Argos« bei umgelegter Bordwand in einer Linie lag, man hatte mehr als hundert Händepaare zur Verfügung und dann halfen wenigstens noch ebenso viele Männer von der Besatzung des »Elektron« mit, aus einer Musterkarte aller Völkerrassen bestehend, wenn auch die Japaner vorherrschten.
Und da hatte man gleich eine große Überraschung.
»Was, das sind doch die japanischen Matrosen von der ›Schwester Anna‹?«
Der kleine Professor konnte es nur bestätigen.
Aber eine alte Bekanntschaft brauchte nicht erneuert zu werden. Man war mit diesen japanischen Matrosen, die nur unter sich so geschwätzig gewesen, niemals bekannt geworden.
»Aber den Kapitän des ›Elektron‹ werden Sie sehr gut kennen und sich freuen, ihn wiederzusehen, wie auch er sich freut«, setzte Beireis noch hinzu.
»Kapitän Price O'Fire, der Fürst des Feuers?«
»So ist es. Er wird Sie dann begrüßen. Jetzt ist er noch beschäftigt. Ich habe Ihnen noch mitzuteilen, Herr Waffenmeister, dass der ›Elektron‹ aus fünf übereinanderliegenden Etagen besteht. Die beiden obersten und die unterste Etage stehen nur Ihnen und Ihren Freunden und Leuten zur Verfügung, ebenso können Sie sich jederzeit, wenn es möglich ist, oben an Deck aufhalten. Die Vorrichtungen, die Sie handhaben müssen, werden Ihnen erklärt, soweit es Ihnen nicht Freude macht, sie selbst auszukundschaften.
Die beiden mittleren Etagen sind nur für die Mannschaften des ›Elektron‹ bestimmt, den Kapitän nicht ausgeschlossen, auch ich werde nur kommen, wenn Sie mich rufen. Die beiden verschiedenen Mannschaften kommen gar nicht in Berührung, jede lebt wie in einer Welt für sich. So ist es bestimmt worden, ich muss es Ihnen mitteilen, es ist meine Pflicht. Nur jetzt halten sich die Ihnen schon bekannten Japaner und auch noch andere unserer Matrosen in Ihren Etagen auf, wegen des Umräumens, um erst einmal die Sachen aufzustapeln, um Ihren Leuten behilflich zu sein, damit der Umzug schnell vor sich geht, womit Sie doch einverstanden sind. Dann werden diese Leute Ihren Augen für immer verschwinden.«
So wurde es denn auch gehandhabt. Die Leute der »Argos« trugen die Sachen immer nur bis an die offenen Luken, wo sie von fremden Händen in Empfang genommen wurden. Erst als die ganze Menagerie an die Reihe kam, wobei selbst Vater Abdallahs weiße Mäuse nicht vergessen wurden, begaben sich auch die Argonauten unter Deck, fanden für die Tiere schon leere Räume mit geeigneten Vorrichtungen.
Unterdessen wanderte Georg durch das ganze Schiff, wenigstens durch die unterste, vierte und fünfte Etage, zu den anderen beiden, der zweiten und dritten, fand er gar keinen Eingang.
Durch jede Etage ging ein breiter Korridor, hüben und drüben reihte sich ein Raum an den anderen, teils durch Schiebetüren mit einander verbunden, teils isoliert, Schlafkabinen, Wohnräume, Salons, alles aufs Komfortabelste eingerichtet, aber nicht fremdartig, nach europäischem Geschmack, praktisch und bequem und künstlerisch zugleich. Fremdartig war nur, dass kein einziger Fenster vorhanden und dass dennoch alles von hellem Tageslicht erfüllt war. Doch auch das war ja den Argonauten nichts Neues mehr.
Auch Treppen gab es nicht. Dafür überall Aufzüge deren Betrieb sofort erkenntlich war. Hier und da auch ein Liftzug dessen Zweck durch eine besonders Aufschrift charakterisiert wurde. Er führte aus der dritten Etage direkt in die unterste hinab, oder umgekehrt, ohne in der zweiten und dritten Etage Halt zu machen.
Dann auch viele leere Räume, besonders in der obersten Etage, in denen jetzt die Tiere untergebracht wurden, die auch mit einem Liftzug an Deck befördert werden konnten.
In der Etage darunter war der Korridor kürzer, weil er in einen großen Saal mündete, der nach beiden Seiten durchging und außerdem doppelte Höhe hatte.
»Was für eine Bestimmung hat dieser Raum?«, fragte Georg einen Japaner, der damit beschäftigt war, einen großen Wandschrank anzubringen.
»Der Turnsaal.«
Und schon wurden alle die Turngeräte angeschleppt gebracht, Japaner in blauem Monteuranzug arbeiteten wie die Ameisen, um alles aufzustellen und festzuschrauben, wobei erst Löcher gebohrt werden mussten, wie die Argonauten angaben.
Auf seinem weiteren Gange durch das jetzt noch herrschende Durcheinander kam Georg an einer geräumigen Kabine vorüber, in der Hammid bereits seine Zimmermannswerkstätte einrichtete, an einer anderen, in der sich der erste Maschinist als Goldschmied etablierte, und dann kam ein größerer Raum mit vielen Kästen, zwischen denen Meister Kännchen stand, und der Chinese wollte dem erklärenden Japaner nicht glauben, dass dies die Küche sei.
Er wurde belehrt, auch über die Handgriffe welche die elektrischen Koch- und Backöfen in Funktion setzten, und die Töpfe und Pfannen waren nur nicht öffentlich ausgestellt.
»Und wie steht es mit dem Proviant?«
»Hier ist alles drin«, sagte der Japaner, die Tür eines in die Wand eingelassenen Schrankes öffnend.
»Da ist ja gar nichts drin!«
»Hier daneben ist das Telefon. Da rufen Sie hinein, was Sie brauchen. Dazu muss erst die Schranktür geschlossen sein. Wenn hier die weiße Platte sich in eine rote verwandelt, wobei ein Klingelzeichen ertönt, was spätestens nach fünf Minuten geschieht, öffnen Sie die Tür — vorher ist es auch nicht möglich — und in dem Schranke wird das Gewünschte sein.«
»Schon zubereitet?«
»Wie gewünscht wird. Dann allerdings dauert es etwas länger. Ich dachte jetzt nur an Proviant, den Sie selbst zubereiten.«
Meister Kännchen wusste sich sofort hineinzufinden, die Mittagszeit nahte überhaupt heran — und was ein Schiffskoch zu bedeuten hat, was man von ihm verlangt und was er können muss, was einen Schiffskoch überhaupt erst ausmacht, davon haben wir schon einmal gesprochen: und wenn er ganz bestimmt weiß, dass in den nächsten fünf Minuten das Schiff in die Luft fliegen wird, so hat er doch erst sein Essen fertig zu machen, dann kann er mitfliegen, oder er eignet sich eben nicht zum Schiffskoch — also Meister Kännchen klappte den Schrankdeckel zu und trat ans Telefon.
»Zwanzig Pfund bestes Ochsenfleisch, Hinterteil, für Rouladen für die Offiziersmesse!«, schrie er hinein.
Um die Ausführung kümmerte er sich nicht, sondern ließ in einen großen Kessel Wasser laufen, schon fast kochend. Er hatte aber den Hahn kaum angedreht, als ein Glockenton erscholl, die weiße Platte am Telefon hatte sich rot gefärbt, und wie der Koch den Schrank aufmachte, da lag jetzt ein mächtiges Stück frisches, delikat aussehendes Ochsenfleisch darin.
Woher das kam, das war diesem Schiffskoch ganz egal, wenn er's nur hatte, und er legte es auf den Hacketisch, unter dem Beile und Messer geordnet lagen.
»Einen Kalbskopf für die Patronatskajüte!«, kommandierte der Chinese jetzt in das Telefon hinein.
»Na da verlangen Sie aber ein bisschen viel«, meinte Georg.
Es hatte einmal in der Eiskammer der »Argos« einige Kalbsköpfe gegeben, aus Petersburg mitgenommen, aber die waren schon längst verspeist.
Doch wiederum nur eine halbe Minute, so kam das Zeichen, und in dem Schranke lag ein abgehäuteter Kalbskopf.
»Wo haben Sie denn den her?«, rief Georg erstaunt
Die Antwort gab nicht der Japaner, sondern Professor Beireis, der eben hinzugetreten war, da er den Waffenmeister schon gesucht hatte.
Wir geben eine etwas andere Erklärung.
In großen Städten sieht man heutzutage in den betreffenden Schaufenstern Konserven ausgestellt, an die man vor 20 Jahren noch gar nicht gedacht hat, und die Auswahl nimmt fast täglich zu. Beefsteak mit Schoten und Spargel, Rebhühnchen, Hirschrücken, alles schon fix und fertig gekocht und gebraten, in Büchsen oder Gläsern eingemacht — alles ist vorhanden. Für Jäger, für Touristen, für Picknicks, auch für einsame Gastwirtschaften ist das sehr geeignet. Besonders auch kann dadurch das große Risiko sehr vermindert werden, ob an Festtagen ein Massenbesuch wird oder nicht.
Das ist aber noch gar nichts gegen das, was man in dieser Hinsicht in großen Seestädten zu sehen bekommt. Wenn nicht in Schaufenstern, dann in Lagermagazinen, wo Schiffe und Expeditionen ausgerüstet werden. Da liebt man Präserven, die im Binnenlande nicht zu haben sind. Denn wenn auch heute Entfernungen die durch Eisenbahn verbunden sind, gar keine Rolle mehr spielen, so handelt es sich doch immer um den Bedarf, um die Nachfrage. Wer denkt denn zum Beispiel im Binnenlande an konserviertes Frischbrot. Und eingemachte Semmeln, oder etwa an saure Flecke in Büchsen. Und doch gibt es das. Es gibt heutzutage überhaupt alles, alles eingemacht.
Doch es ist gar nicht so leicht zu haben. Da hat etwa ein ehemaliger Seemann, der sich im Binnenlande niedergelassen hat, wieder einmal Appetit nach Schiffszwieback, von dem es hunderterlei Sorten gibt, vom gröbsten an bis zum allerfeinsten, dabei doch immer Hartbrot bleibend, kein Biskuit werdend, von den verschiedensten Firmen hergestellt. Solch ein Schiffszwieback ist gar nicht so leicht zu haben. Auch nicht in Hamburg. Da muss man genau seine Quelle wissen. Weil eben sonst gar kein Bedarf vorhanden ist, er wird nirgends angeboten.
»Wir sind mit allem, allem verproviantiert, was sich nur denken lässt«, lassen wir den kleinen Professor Beireis jetzt selbst sprechen, »und das in Hülle und Fülle. Und dies alles ist ganz frisch. Wenigstens scheinbar. Wir verstehen Fleisch und alles so zu präservieren, dass es seinen vollkommen frischen Zustand für alle Ewigkeit behält. Und dabei tritt auch nicht der Nachteil ein, der allen gekochten Präserven anhaftet. Man bekommt keinen Skorbut danach, das ist hierbei ganz ausgeschlossen.«
Ja, man nährt sich nicht ungestraft nur von Konserven. Die Natur lässt ihrer nicht ungestraft spotten. Der dauernde Genuss von gekochten Konserven zieht regelmäßig Skorbut nach sich. Nicht dagegen der dauernde Genuss von getrocknetem und geräuchertem Fleisch, von getrocknetem und wieder aufgeweichtem Obst und Gemüse. Denn das Trocknen ist ein natürlicher Vorgang. Die ganze Kocherei und Braterei aber ist unnatürlich, zumal wenn diese Konserven längere Zeit aufbewahrt werden. Das duldet die Natur nicht, da weiß sie sich zu rächen. Sie warnt zuerst dadurch, dass sie die Zähne locker macht und zuletzt ganz ausfallen lässt, ehe der richtige Skorbut einsetzt.
»Sie sind mit allem verproviantiert?«
»Mit allem, allem! Sie können verlangen, was Sie wollen.«
Kurz entschlossen trat Georg ans Telefon. Der Schalk, den er in diesem Augenblicke hinterm Ohre sitzen hatte, sah man ja nicht.
»Ich bitte um einen Elefantenrüssel! Um einen recht großen! Abgezogen braucht er noch nicht zu sein!«
»Au!«, machte der kleine Professor wie schon einmal, sich auch wieder hinterm Ohre kratzend. »Ja, wenn Sie freilich so etwas verlangen —«
»Da müssen Sie eben vorsichtiger in Ihren Behauptungen sein«, lachte Georg.
»Bim«, ging es da in dem Schranke, und die weiße Platte färbte sich rot.
Georg öffnete den Schrank.
Und der kleine Professor starrte genau so hinein wie der Waffenmeister.
In dem Schranke lag zusammengerollt ein grauer Riesenarm.
Was konnte das sein?
Nun eben der gewünschte Elefantenrüssel, unabgezogen!
Noch eine kleine Pause, dann griff Georg mit kühner Hand zu.
Zwei Meter lang und fast einen Fuß dick war der Riesenwurm.
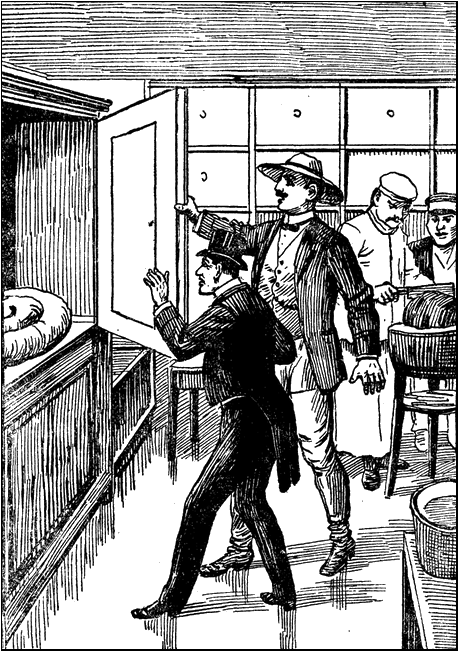
In dem Schranke lag zusammengerollt ein grauer Riesenwurm, auf
den der kleine Professor wie der Waffenmeister ganz entsetzt starrten.
Jetzt aber erkannte man den Irrtum.
Kein Elefantenrüssel, sondern eine Leberwurst.
Es war nichts so Ungewohntes für einen Seemann. Solche Riesenwürste sieht man überall in Hamburg und Bremen und in anderen deutschen Seestädten in den betreffenden Schaufenstern ausgehängt, noch länger als zwei Meter, drei Meter lang, noch dicker als ein Fuß! Solche ungeheuere Riesenwürste und nicht etwa nur zur Schau ausgestellt, sind nämlich der Stolz der verfressenen Nordgermanen. Ja, man muss sagen: verfressen. Denn bei denen fängt der Mensch doch überhaupt erst mit dem »Frühstück« an. Was aber nur sie so schön aussprechen können, dass man dabei schon Appetit bekommt.
Am herrlichsten sind die Holsteiner Fleischwürste, ein Mittelding zwischen Zervelat und Salami, aber von Dimensionen, dass man sie als Balken beim Bau von Häusern verwenden könnte. Sie haben überhaupt schöne Sachen, dort oben.
»Na, wenn dort in der uns verschlossenen Unterwelt auch der Humor so blüht, dann werden wir uns hier schon wohlfühlen!«, lachte Georg aus vollem Halse.
»Herr Waffenmeister, ich habe Sie aufgesucht, um Ihnen die besten Räume als die Ihren zu zeigen«, sagte der Professor, »denn vorhin wurde schon Ihr abgeschraubter Schreibtisch gebracht.«
»Die besten Kabinen gehören der Patronin.«
»Die hat bereits gewählt. Es sind auch nicht die schönsten Räume, aber doch die für Sie geeignetsten, wo Sie als Waffenmeister alles in der Nähe haben, was nun einmal zu Ihrem Posten gehört.«
»So zeigen Sie mir dieselben, dann bin ich einverstanden.«
Sie lagen ganz vorn im Schiffe, verteilten sich auf alle drei den Argonauten zur Verfügung stehende Etagen, waren durch besonderen Fahrstuhl miteinander verbunden, außerdem immer zwei Räume nebeneinander.
Einer davon war mit Rädern und Hebelwerk aller Art angefüllt.
»Von hier aus können Sie das Schiff steuern, beherrschen sämtliche Vorrichtungen. Es wird Ihnen alles noch genau erklärt werden. Irrtümer sind dabei ganz ausgeschlossen.«
Georg blickte sich um, auch nach dem Zimmer zurück, in dem soeben sein Schreibtisch der ja viele Schriftsachen barg, aufgestellt wurde.
»Hm. Das sieht ja bald aus, als sollte ich hier als Hauptperson gelten.«
»Die sind Sie doch auch.«
»Hm, eigentlich — na lassen wir das. Ich soll wohl gar auch das Kommando übernehmen?«
»Darf ich Ihnen jetzt den Kapitän des ›Elektron‹ zuführen?«, wich der Professor dieser Frage aus. »Ist es Ihnen angenehm?«
»Ich bitte sehr.«
Professor Beireis verabschiedete sich mit einer Verbeugung, verließ das Zimmer, und statt seiner trat durch die Tür ein hünenhafter Mann mit langem blondem Vollbart ein.
»Ah, Kapitän Price O'Fire, der Fürst des Feuers!«
Mit ausgestreckter Hand ging Georg freudig auf ihn zu. Der aber nahm die Hand nicht, sondern legte die seine in militärischer Haltung an die Mütze, salutierte also.
»Melde mich zur Stelle, Herr Patron!«
»Wat?«, brachte Georg verblüfft hervor.
»Ich bin nur der Kapitän des ›Elektron‹, Sie sind sein Eigentümer, ich stehe unter Ihren Befehlen.«
Georg fragte nicht lange, achselzuckend fügte er sich in das Unvermeidliche. Es war ja nicht das erste Mal, dass er von den Leitern dieser geheimen Gesellschaft solch eine ungemeine Gunstbezeigung bekam.
»Well, wenn es so ist — meinetwegen kann man mir die ganze Erde nebst den umliegenden Himmelskörpern schenken — ich nehme alles an, wenn ich mich dafür nicht groß zu bedanken brauche.«
Wir lassen die beiden allein und versetzen uns in eine deutsche Universitätsstadt. In einer elenden Zwischengasse, die zwei glänzende Geschäftsstraßen miteinander verband, prangte am Torweg eines baufälligen Hauses ein blitzendes Messingschild.
Gustav Richter, Holz und Kohlen.
Dieser Gustav Richter gehörte zu denjenigen Menschen, von denen es nur eine Frage ist, ob sie auch wirklich wissen, wie glücklich sie sind. Besser freilich ist es, sie wissen es nicht. Sonst könnten die Götter neidisch werden.
Vor nunmehr vierzig Jahren hatte Gustav Richter, nachdem er als aktiver Soldat den deutsch-französischen Krieg mitgemacht hatte, wobei ihm in seinem halben Dutzend glorreich mitgefochtenen Schlachten nur einmal eine Kugel den Helm vom Kopf gerissen, hier eine Stelle als Arbeiter gefunden, beim alten Grohmüller, der dieses Kohlengeschäft schon vom Vater geerbt hatte, und das ganze Haus dazu.
Fünf Jahre lang hatte Gustav von früh bis abends in dem düsteren Schuppen große Kohlen klein geklopft, eingeschaufelt, Holz gehackt und die Bestellungen mit dem Handwagen ausgeführt, gegen volle Kost, monatlich vier Taler und zu Weihnachten einen neuen Anzug, drei Hemden und sechs Schürzen.
»Ich habe genug, ich werde mich zur Ruhe setzen«, hatte da eines Tages der alte Grohmüller gesagt. »Weißt Du niemanden, Gustav, der mir mein Geschäft abkauft?«
»Ich? Nee, ich weeß niemanden.«
»Na, da kauf Du es mir doch ab.«
»Ich? Ich habe nur 182 Taler auf der Sparkasse.«
»Na, da heirate doch meine Luise.«
»Ich? Ja, wenn sie mich will.«
»Hast Du denn noch gar nicht gemerkt, wie gut Dir die Luise ist?«
»Ich? Nee.«
Die Luise, das einzige Kind, schaufelte ebenfalls von zarten Kindesbeinen an in dem finsteren Schuppen Kohlen und hackte Holz. Hübsch war die nun zweiundzwanzigjährige Jungfrau dadurch eben nicht geworden, aber vierschrötig, stellte einen ganzen Mann, sogar zwei Männer.
Nein, Gustav konnte gar nicht bemerkt haben, dass die Luise ihm gut war, denn nie hatte sie ihm so etwas merken lassen, dazu war sie viel zu — sittsam. Dumm kann man nicht sagen. Denn die Luise führte die Geschäftsbücher, aber ohne etwas zu schreiben, die hatte alles im Kopfe, und die vergaß nichts, am wenigsten eine noch nicht bezahlte Lieferung.
Nun, wenn es so stand — Gustav war kein Feigling, er fragte an und wurde erhört.
Hätte denn der alte Grohmüller, ein wirklich vermögender Mann, Besitzer eines schuldenfreien Hauses, das über kurz oder lang noch einmal ein hochwertvolles Spekulationsobjekt werden musste, keinen anderen Schwiegersohn finden können als solch einen armen Schlucker?
Der alte Grohmüller dachte eben anders, der hatte die Wahrheit erkannt.
Wenn jemand monatlich vier Taler bekommt, und erspart sich davon drei, in fünf Jahren 182 Taler, der ist, wenn sonst alles klappt, in der Finanzwelt dereinst ganz sicher noch zu etwas Hohem berufen!
Sechzehn Jahre lang schaufelte das Ehepaar zusammen in dem finsteren Schuppen Kohlen und hackte Holz, ein Knecht führte die Bestellungen aus, immer noch mit dem Handwagen.
Bis sich eines Tages Frau Luise ins Knie hackte, woran sie starb.
Der Witwer war allein in der Wohnung in der vierten Etage. In der Nacht — tagsüber war er ja in seinem Schuppen, und abends saß er jetzt regelmäßig in der Winkelkneipe nebenan, wenn auch nie mehr als vier Glas Bier trinkend, und dann zum Schluss einen Korn.
Der Schwiegervater hatte schon längst das Zeitliche gesegnet, noch früher die Schwiegermutter, Kinder waren dieser Holz- und Kohlenehe nicht entsprungen.
In solch einer einsamen Nacht entstand in Gustavs Kopf der Entschluss, wieder zu heiraten. Nicht dass er in seinem Schuppen eine billige Arbeitskraft gebraucht hätte. Seitdem sich in den beiden Hauptstraßen glänzende Läden etabliert hatten, ging das Kohlengeschäft immer mehr zurück. Es wurde nur noch ein Mann gebraucht, der die Bestellungen ausführte, der Herr Prinzipal konnte allein einsacken. Aber diese einsamen Nächte in der leeren Wohnung ertrug er nicht. Und dann vor allen Dingen die Esserei! In der Kneipe nebenan schmeckte es ihm nicht. Und eine andere Kneipe kannte er nicht. Und Luise hatte ganz ausgezeichnet kochen können. Besonders saure Flecke. Zweimal in der Woche oder, wenn sie beim Fleischer zu haben waren, auch dreimal. Und er war überhaupt gewöhnt, zu Hause zu essen. Ja, er wollte wieder heiraten. Aber erst versuchsweise. Das heißt: sich erst eine Wirtschafterin nehmen. Natürlich in allen Ehren. Immer erst prüfen, ob sich die Wirtschafterin als Gattin eignete, und wenn nicht, dann wurde sie eben wieder fortgeschickt, und das so lange, bis er die richtige mit den sauren Flecken und so weiter gefunden hatte.
Und Gustav war und blieb der Liebling der Götter.
Er brauchte gar nicht zu annoncieren.
Nur eine Äußerung seines Wunsches am abendlichen Stammtisch, und sie wurde ihm gleich ins Haus gebracht.
Freilich schien sie zu ihm zu passen wie ein weißer Zitronenfalter in den finsteren Kohlenschuppen.
Ein ältliches Mädchen mit einem schüchternen, durchgeistigten Madonnenantlitz. Die Tochter eines pensionierten Briefträgers. Oder vielmehr einer Briefträgersehegattin mit Witwenpension. Sie war froh, nach dem Tode der Mutter irgend einen anständigen Unterschlupf zu finden. Bisher hatte sie Klavierunterricht erteilt, die Stunde fünf Groschen, oder auch noch billiger.
»Können Sie saure Flecke kochen?«, war Gustavs erste Frage.
»Ja, die aß mein seliger Vater so sehr gern, und ich musste sie ihm immer kochen«, flüsterte die durchgeistigte Madonna.
Da war sie angenommen — versuchsweise.
Aber als Gustav zum ersten Male von ihrer Hand mit sauren Flecken geätzt worden war — gleich am zweiten Tage, am Dienstag, Montag haben die Fleischer noch keine Flecke — da stand es bei ihm schon felsenfest, dass die und keine andere seine zweite Frau werden müsse. Allerdings nicht nur wegen dieser sauren Flecke. Er hatte unterdessen doch auch beobachtet, wie Fräulein Hedwig in den zwei Tagen die völlig versaute Wohnung gesäubert hatte. Sogar am Sonntag, wo er zu Hause gewesen, und er hatte doch gar nichts davon gemerkt, wenn er nichts davon merken wollte, und doch hatte sie sich ihm nur sauber und adrett gezeigt.
Es kam zur Aussprache, und ein Vierteljahr später wurde Hochzeit gefeiert. Wenn der Kohlenmann wusste, was er an der Briefträgerstochter hatte, so die Briefträgerstochter auch, was sie an diesem Kohlenmanne besaß. Es waren wahrscheinlich alle beide Lieblinge der Götter.
Und genau an demselben Tage nach Jahresfrist an dem Frau Hedwig ihm die ersten sauren Flecke gekocht hatte, wurde dort oben in der vierten Etage ein Knäblein geboren, das in der heiligen Taufe den Rufnamen Otto erhielt.
Es ist über den Knaben vorläufig nichts weiter zu sagen, als dass er seiner Mutter wie aus den Augen geschnitten war, nur dass er anstatt eines Mundes einen Gedankenstrich hatte. Immer die Lippen fest zusammengekniffen. Dabei lässt sich nicht gut schreien.
Und als acht Jahre ins Land gegangen waren, ohne dass noch andere Kinder hinzugekommen, da erhielt der Kohlenhändler eines Tages vom Herrn Direktor der Bürgerschule, die Otto besuchte, ein Briefchen, eine höfliche Aufforderung, Herr Richter möge ihn doch einmal in der Sprechstunde besuchen, wegen Rücksprache betreffs seines Sohnes.
Der Kohlenhändler warf sich in seinen Sonntagsanzug und begab sich hin.
»Wissen Sie, was Sie an Ihrem Otto für einen Sohn haben?«
Na und ob dass der Vater wusste!
»Ich hätte ihn schon die vorige Klasse überspringen lassen können, aber ich bin prinzipiell gegen solche Überspringerei. Das rächt sich immer. Sind Sie in der Lage, Ihren Sohn studieren zu lassen?«
»Na und ob!«
»Bringen Sie ihn aber nicht vor dem zehnten Jahre aufs Gymnasium und lassen Sie ihn auch dort niemals eine Klasse überspringen. Ich habe Erfahrung, ich rate Ihnen nur das Beste.«
Mit seinem neunzehnten Jahre verließ der Sohn des Kohlenmannes und der Briefträgerstochter das Gymnasium als Primus omnium, als Erster von allen.
Er war genau derjenige geworden, der zu werden er schon als kleines Kind versprochen hatte.
Ein stiller, blasser, hochaufgeschossener Jüngling mit schlechter Haltung, in dem durchgeistigten Gesicht unter der scharfen Nase immer einen ausgeprägten Gedankenstrich. Keinen Freund, keinen Umgang. Auch den Eltern gegenüber niemals vertraulich werdend. Aber die fanden nicht etwa was dabei. Das war ihnen ganz selbstverständlich. Und als die Mutter einmal sehr krank geworden, während seiner Ferien, da hatte er zwei Wochen lang Tag und Nacht neben ihrem Bett gesessen, um der Fiebernden immer das kühle Getränk reichen zu können. Aber immer die Lippen fest geschlossen, nur auf die notwendigsten Fragen die notwendigsten Antworten zu geben. Und die Eltern kannten es nicht anders, als dass er nur das Allernotwendigste sprach, dass er nur für seine Bücher und für sein Laboratorium lebte. Dass er aber auch, wenn es nicht anders sein konnte, sofort bereit gewesen wäre, für seine Eltern Kohlen einzuschaufeln, Holz zu hacken und in Säcken auf dem Rücken fortzutragen.
Er hatte zum Studium die Chemie gewählt. Aber nicht erst, nachdem er das Gymnasium absolviert hatte. Als in der Untersekunda die ersten Chemiestunden begonnen, hatte er sich sofort zu Hause in einer Bodenkammer ein Laboratorium eingerichtet, und aus den primitivsten Anfängen entwickelte es sich zu einer Werkstatt der Wissenschaft, um die ihn mancher Privatchemiker beneidet hätte. Was er brauchte, bekam er ja also.
Dann studierte er zwei Jahre lang in den Hörsälen und Laboratorien der Universität Chemie und Physik.
»Hätten Sie Lust, Herr Richter, nach Ihrem bestandenen Staatsexamen mein Assistent zu werden?«
So hatte ihn sowohl ein Professor der Chemie wie einer der Physik gefragt, unter deren Anleitung er praktisch arbeitete.
Da starb der Vater an einem Herzschlage, wenige Wochen darauf folgte die schon einige Zeit bettlägerig gewesene Mutter nach.
Tränenlos hatte der Sohn am Grabe beider gestanden. Dann war sein erstes, dass er das Höchstgebot eines jener Häuserspekulanten annahm, die den alten Richter schon längst bestürmt hatten, immer vergebens.
Und das zweite war, dass der begüterte Jüngling in einem Vorort, zwanzig Minuten Eisenbahnfahrt von der Stadt entfernt, dann noch eine halbe Stunde zu Fuß, ein Gartengrundstück mit einem Häuschen kaufte, in das er mit allen Möbeln und seinem Laboratorium übersiedelte.
Dieser Kauf war nicht so von ungefähr und muss nun nachträglich etwas erwähnt werden.
Gustav Richter hatte als guter Christ immer den Sonntag geheiligt. Insofern, als er jeden Sonn- und Feiertag viel später aufgestanden war, dann nebenan einen solennen Frühschoppen gehalten, hatte, dann nach dem Essen ein Sonntagnachmittagschläfchen und hierauf mit Frau und später mit Kind einen Ausflug in die schöne Umgegend machte.
Das hatte er schon mit seiner ersten Frau so gehalten. Da, als Otto zwölf Jahre gewesen, war die Familie auch einmal nach diesem Vorort gekommen, hatte dieses Grundstück passiert, von einer hohen Mauer umringt, die aber an einer Stelle halb eingefallen gewesen. Man hatte in den Garten sehen können. Ein sehr schöner Garten mit alten Bäumen, ein hübsches Landhäuschen.
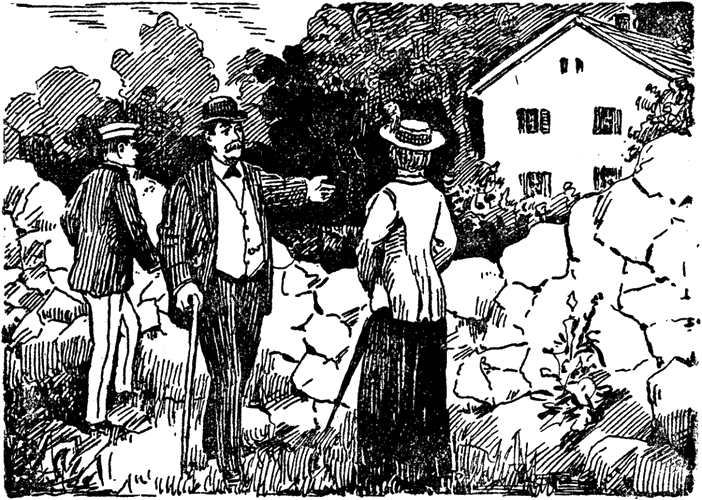
»Wenn ich mich einmal zur Ruhe setze, das möchte ich kaufen.«
So hatte Gustav Richter gesagt. Wie man eben einmal auf solch einen Gedanken kommt. Der dachte ja gar nicht dran, sein Kohlengeschäft aufzugeben, so lange er nur irgendwie noch kriechen konnte.
Und dennoch, es sollte sein letzter Spaziergang gewesen sein. Am anderen Tage hatte er das Podagra in den Beinen. Und das wurde niemals wieder. Kriechen konnte er wohl noch, auch nach wie vor seiner Arbeit nachgehen, aber aus den Sonntagnachmittagspartien wurde nichts mehr.
Der arme Junge! Und dass der sich einer anderen Familie anschloss oder Freunden, daran war gar nicht zu denken.
»Otto, das geht nicht, wenigstens am Sonntag musst Du einen Spaziergang machen, wenigstens am Nachmittag.«
Schweigend hatte Otto seine Bücher zugeklappt, schweigend war er gegangen. Geld hatte er immer bei sich, weil er es nicht verbrauchte. Er war wieder nach jenem Vorort gefahren, hatte sich wieder an die verfallene Mauer gestellt, um wieder einige Zeit mit zusammengekniffenen Lippen in den Garten zu blicken, so wie er es vorigen Sonntag getan hatte.
Dann aber war er nicht wieder nach der Station gegangen, sondern war zu Fuß nach Hause marschiert, ein tüchtiger Marsch von drei Stunden, hatte ohne zu fragen den manchmal ganz verschlungenen Weg, ehe er die Landstraße erreichte, zu finden gewusst.
Und von nun an war er jeden Sonntagnachmittag nach diesem Vorort marschiert, jetzt auch hin, immer drei Stunden hin und drei Stunden zurück, gleichgültig ob glühender Sonnenbrand oder Schneesturm, um einige Minuten über die verfallene Mauer, die sich nicht erneuern wollte, in den Garten und auf das Häuschen zu blicken.
Elf ganze Jahre hatte er das so getrieben! Sonntag für Sonntag!
Die Eltern wunderten sich nicht. Für diese war der Sohn kein geheimnisvolles Rätsel. Weil sie ihn eben von zartester Kindheit an nicht anders kannten. Und andere Leute gab es nicht, die sich über diesen Knaben und Jüngling als ein menschliches Charakterrätsel hätten den Kopf zerbrechen können.
Wem fiel es denn auch auf, dass der Junge und Jüngling jeden Sonntag die drei Meilen hin und her im Geschwindschritt zurücklegte, auch im glühendsten Sonnenbrande, ohne unterwegs einmal einzukehren, ohne einmal aus dem klaren Bache zu schöpfen, der die Landstraße begleitete?
Wer beobachtete ihn dabei, wie er dann, zu Hause angekommen, verstaubt und durchglüht, sich in seinem Laboratorium, das mit Wasserleitung versehen worden war, seinen Kochbecher voll frisches Wasser laufen ließ, das Glas wiederholt ausgießend und wieder füllend, um eben erst das alte, abgestandene laue Wasser aus der Leitung zu lassen, dann aber dieses Wasser in dem Kochbecher über Gas erst langsam zum Sieden brachte, ehe er es dann mit einem Löffelchen in kleinen Schlückchen nippte?
War er etwa so vorsichtig, dass er in seinem erhitzten Zustande kein kaltes Wasser trinken wollte? Das wäre allerdings eine ganz einfache Erklärung gewesen. Aber wozu sorgte er denn dann regelmäßig erst für möglichst frisches, kaltes Wasser, das er zum Kochen brachte, ehe er es genoss?
Und es kann nur gesagt werden, dass dieser blasse Jüngling nur als Kind die obligatorischen Masern gehabt hatte, vorher und hinterher niemals krank gewesen war, und dass er absolut nicht um seine Gesundheit besorgt war, so wenig wie seine Eltern, da sie es eben nicht anders kannten, als dass in diesem nur scheinbar so schwächlichen Körper ein eiserner Kern steckte.
Nein, in dieser Handlung war ein Rätsel verborgen. Wer in die alte Philosophie gut eingeweiht ist, der konnte es vielleicht ergründen.
Wenn er entdeckte, dass auf dem Nachttisch neben dem Bett dieses Jüngling ein stark abgegriffenes Büchlein lag, welches er am Tage meist in der Tasche trug, bei jeder Gelegenheit darin lesend.
Sein Titel lautete: Epiktet, »Handbüchlein der Moral«.
Epiktet, um 50 nach Christi geboren, war der griechische Sklave eines vornehmen Römers, der ihn einmal so misshandelte, dass Epiktet dann Zeit seines Lebens hinkte. Später freigelassen, lehrte er öffentlich als stoischer Philosoph. Seine ganze Hinterlassenschaft bestand in einer Holzbank, einem Kopfkissen und einer irdenen Lampe. Viel mehr wissen wir nicht von seinem sonstigen Leben. Aber wie berühmt er gewesen, das wird am besten dadurch bewiesen, dass bald nach seinem Tode ein reicher Mann diese irdene Lampe für 8000 Drachmen erstand, was ungefähr 2500 Mark sind, damals aber etwa 30 000 Mark entsprochen haben würde.
Epiktet selbst hat nichts geschrieben. So wenig wie Buddha oder Christus oder Sokrates oder Diogenes und andere, die man dennoch nicht vergessen hat. Seine Aussprüche sind von dem griechischen Schriftsteller Flavian Arrian gesammelt worden. Sie bilden den Inhalt des »Handbüchleins der Moral«.
Es ist nicht etwa ein seltenes Werk. Es ist für 20 Pfennige in jeder Buchhandlung zu haben.
Und nicht etwa der Schreiber dieses sagt es, sondern einer unserer größten modernen Religionslehrer hat es gesagt, dabei ein Mann von aufrichtiger Frömmigkeit, der es mit seinem christlichen Glauben ehrlich wie selten einer meint, der Schweizer Professor Dr. Hilty nämlich, dass man den Kindern lieber nicht so viel Religion beibringen soll, Bibelsprüche und Gesangbuchverse und dergleichen, sondern ihnen lieber das Büchlein dieses griechischen Heiden in die Hand geben soll. Denn Religion kann überhaupt nicht gelehrt werden, das ist nur eine Sache der Erfahrung. Durch dieses Büchlein aber kann man sich den Charakter systematisch aneignen, der später die Grundlage eines christlichen Lebens bildet.
Und was hat Epiktet gelehrt?
Von dem, was in des Menschen Macht steht, und von dem, was nicht in seiner Macht steht. Nur das erstere kann vernünftigerweise erstrebt werden, das letztere muss man lassen, ganz aus seinem Leben streichen.
Und dann eine Menge Lebensregeln. Da heißt es zum Beispiel im 47. Abschnitt: »Umklammere keine Bildsäulen.«
Und das ist nicht etwa symbolisch aufzufassen.
Als die stoische Philosophie zu entarten begann, stellten sich ihre ruhmsüchtigen Mitglieder im kalten Winter vor die öffentlichen Bildsäulen hin und umklammerten sie, um den anderen zu zeigen, wie unempfindlich sie gegen Kälte seien, um dafür bewundert zu werden.
Man muss sich nur in jene alten Zeiten zurückversetzen können, um dies zu verstehen.
Dies soll man also nicht tun.
»Sondern«, heißt es dann weiter, »wenn Dich heftig dürstet, so nimm den Mund voll kaltes Wasser, speie es wieder aus und — sage niemandem davon!«
Es ist die Philosophie der Verachtung! Nicht etwa Verachtung gegen andere — im Gegenteil, andere soll man nur lieben, ihnen nur Gutes tun, mindestens ihnen gegenüber in Taten, Worten und Gedanken jede mögliche Rücksicht ausüben — aber sich selbst soll man verachten, das heißt seine eigenen Schwächen.
Und diese Lebensregeln des griechischen Philosophen befolgte dieser Jüngling buchstäblich, hatte sie für eigenen Bedarf noch weiter ausgearbeitet.
Er löschte seinen furchtbaren Durst nur mit kochend heißem Wasser, das er nur in kleinen Schlückchen genießen konnte. Und wenn er nicht direkt auf einem nackten Brette schlief, sondern auf seiner Lagerstätte eine Matratze hatte, wenn auch so hart als möglich, und darüber noch eine Decke, so tat er das nur, um nicht Anstoß zu erregen, auch nicht seinen Eltern gegenüber.
»Ich schlafe besser hart als weich«, hatte er damals gesagt, als in dem Knaben diese Philosophie erwacht war, als er seine ganze Lebensweise danach einzurichten begann, und damit war die Sache erledigt, da konnte er sein System durchsetzen, ohne als ein Narr zu gelten — und ohne darüber sprechen zu müssen.
Der wusste schon, was er tat! —
Und noch etwas anderes sei nachträglich erwähnt. Otto hatte sich wegen der zukünftigen Militärpflicht zur ärztlichen Untersuchung stellen müssen.
Fast mitleidig betrachtete der alte Stabsarzt den blassen, langaufgeschossenen, dürren Jüngling mit den herabhängenden Schultern, ehe er ihm das Messband über die Brust spannte.
Untauglich wegen hoffnungsloser Engbrüstigkeit. Nicht zurückgestellt, sondern gleich hoffnungslos für den Militärdienst aufgegeben!
Und da als Otto wieder gegangen, hatte es auch einmal um die Winkel seines zum Gedankenstrich geschlossenen Mundes mitleidig gezuckt.
Nur mitleidig, nicht verächtlich.
Ha, wenn diese Menschlein wüssten, geahnt hätten! Jetzt also hatte er jenes Gartenhaus käuflich erworben, nach dem er elf ganze Jahre lang jeden Sonntagnachmittag ohne Ausnahme gewandert war, um es für einige Minuten zu betrachten.
Der begüterte Jüngling hatte einfach den geforderten Preis bezahlt.
Während die elterlichen Möbel und sein Laboratorium hingebracht wurden, was zwei Tage in Anspruch nahm, musste das Stück eingefallene Mauer erneuert werden.
Dann hatte er sich eingerichtet. Auf der Universität hatte er sich als Hörer und Praktikant im Laboratorium streichen lassen. Ohne seinen Grund hierfür anzugeben. Er war ja niemandem Rechenschaft schuldig. Und wer sollte ihn auch fragen. Er hatte nicht den geringsten Verkehr. Die Professoren, die einmal Hoffnung auf ihn gesetzt, hatten den so überaus verschlossenen Menschen schon längst aufgegeben.
Nur seinen Laboratoriumsdiener nahm er mit, einen Mann von 50 Jahren, der versuchsweise angestellt worden war und den Erwartungen nicht entsprochen hatte. Insofern nicht, als er sich von einem Assistenten nicht hatte kujonieren lassen. Da war ihm für den nächsten Monat gekündigt worden.
»Wie heißen Sie? Bertram Wehner? Wollen Sie einen Posten in meinem Privatlaboratorium übernehmen? Auch meinen Hausstand müssten Sie führen. Etwas kochen können Sie doch? Auch den Garten etwas in Ordnung halten.«
So hatte der junge Student zu dem Manne gesagt, dem er bisher noch gar kein Wort, keinen Blick gegönnt hatte, dessen Namen er noch gar nicht gekannt, weil dieser Mann während der wenigen Tage in einem anderen Revier beschäftigt gewesen, nur ab und zu an ihm vorübergegangen war.
Und dieser Bertram schien auch so einer zu sein, der die Menschen anders beurteilte als nur so oberflächlich dem Äußeren nach. Dass er sofort bereit dazu war. Obgleich die Missstimmung doch dadurch gekommen war, weil sich der Laboratoriumsdiener von dem im selben Flügel wohnenden Assistenten nicht als Botengänger und Mädchen für alles hatte brauchen lassen wollen. Und obgleich er schon in einem anderen Laboratorium eine sehr gut bezahlte und höchst bequeme Stellung mit sofortiger Pensionsberechtigung in sicherer Aussicht hatte. Er ließ sie sofort in Stich, um dieses Angebot des jungen Studenten anzunehmen, den er ganz und gar nicht kannte, und er hatte nicht einmal nach den Lohnverhältnissen gefragt, nach gar nichts weiter. Nur dass der ruhige, besonnene Mann mit dem intelligenten Gesicht dem Frager einige Zeit fest in die Augen geblickt hatte.
»Ja, zu Ihnen gehe ich gern«, lautete dann die Antwort. »Sie sind doch natürlich unverheiratet, haben auch sonst gar keinen Anhang.«
Das war eine sehr, sehr merkwürdige Frage, die erst jetzt hinterher gestellt wurde. Sehr, sehr merkwürdig wenigstens für den, der die Menschen mit anderen Augen als den gewöhnlichen beobachtet. Besonders wenn er wusste, dass der junge Student tatsächlich gar keine Ahnung von den Verhältnissen dieses Mannes hatte. Und es war ja eigentlich gar keine Frage gewesen, sondern eine ganz direkte Behauptung.
» Ich bin unverheiratet und stehe auch sonst ganz allein.«
Also richtig taxiert! Wie aber hatte das Otto so bestimmt wissen können?
Diesem Manne war seine Weltverlassenheit absolut nicht anzusehen. Am allerwenigsten etwas wie Vergrämtheit. Das bärtige, männliche Gesicht drückte nichts anderes als ruhige Freundlichkeit aus, stille Zufriedenheit.
Und es hatten sich denn auch zwei Menschen zusammengefunden, die für einander wie geschaffen waren. Als Herr und Diener!
»Hier haben Sie hundert Mark als Wirtschaftsgeld. Wenn die alle sind, sagen Sie es, Rechnung darüber brauchen Sie mir nicht abzulegen.«
»Was wünschen Herr Richter heute Mittag zu essen?«
»Das, was Sie mir vorsetzen werden. Also —?«
»Das, was mir am besten schmeckt«, entgegnete der Diener.
»Richtig. Und das immer so.«
Es war das erste und das letzte Mal gewesen, an diesem Tage des Einzugs, dass über so etwas gesprochen wurde. So lebten die beiden nun schon seit einem Jahre in dem Gartengrundstück. Als Herr und Diener. Aufs Engste miteinander verknüpft — durch eine unüberwindliche Schranke von einander getrennt.
Der junge Gelehrte setzte keinen einzigen Schritt außerhalb der Gartenmauer. Was man im Haushalte brauchte, wurde aus dem Orte geliefert, und was Otto im Laboratorium bedurfte, besorgte Bertram ab und zu aus der Stadt, hauptsächlich Chemikalien und Glassachen.
Der Einzug war im Frühjahr erfolgt. Bis zum Spätherbste hatte Otto täglich zwei Stunden, von nachmittags punkt zwei bis punkt vier Uhr, im Garten gearbeitet. Sicher nicht nur aus Liebe zur edlen Gartenbaukunst. Unkrautausjäten und dergleichen, und das ausgerechnet gerade in den heißesten Stunden, wenn es ihm auch ganz gleichgültig war, ob es dabei vom Himmel goss oder der Blitz dicht neben ihm einschlug. Er tat es nur zur geistigen Erholung, oder vielmehr, um auch dem Körper etwas zu tun zu geben, tat es für seine Gesundheit. Und er war eben ein Pedant. Ein geradezu lächerlicher Pedant. Dass er gerade so diese zwei Nachmittagsstunden einhalten musste, in denen anderer Menschen, die es sich leisten können, der Ruhe pflegen. Ein Pedant von jenem Holze, wollen wir aber auch noch hinzusetzen, aus dem die Welteroberer geschnitzt sind.
Als dann der Winter kam, im Garten beim besten Willen nichts mehr zu tun war, marschierte er während dieser beiden Stunden immer an der Gartenmauer entlang. Natürlich immer nur an der inneren Seite! Aber gegen Ende des Winters setzte er mit diesen abgezirkelten Spaziergängen plötzlich aus, und als der Frühling nahte, Bertram umzugraben begann und von den Rosenbüschen die Strohumhüllungen entfernte, beteiligte sich der junge Gelehrte auch nicht mehr an diesen Arbeiten. Er kam gar nicht mehr aus seinem Laboratorium heraus. Oder höchstens auf das Dach hinauf. Was trieb er nun eigentlich in seinem Laboratorium und jetzt so oft auf dem Dache seines Häuschens?
Die Leutchen im Orte hatten sich ja weidlich über den menschenscheuen Einsiedler den Kopf zerbrochen, über den »Goldmacher«, über den »Doktor Faust«, oder was sie ihm nun sonst für Namen gegeben hatten. Doch das war nur anfangs gewesen. Wenn man die Leute lassen kann, so wird man ja bald auch von ihnen gelassen. Nach Goethe.
Wer sich der Einsamkeit ergibt,
Ach, der ist bald allein!
Ein jeder hasst, ein jeder liebt
Und kümmert sich nicht dein.
So kümmerten sich auch diese Leutchen bald nicht mehr um den Einsiedler. Zumal nachdem er die erste Einladung zum Ortsvereinsfeste abgeschlagen hatte. Ganz fremd war er ihnen ja nicht. Es gab welche, die den alten Kohlenhändler Gustav Richter in der nahen Stadt gekannt hatten, und die konnten auch erzählen, dass »Richters Otto« schon als Kind so gewesen war. Da ließ man ihn. Wenn man ihn auch nicht gerade vergaß. Man sprach nur mit größter Hochachtung von ihm. Denn erstens war er sehr, sehr vermögend, die Schätzung schwankte zwischen einer viertel und einer halben Million; zweitens bezog er alle Lebensbedürfnisse aus dem Orte; und drittens hatte er, als die Liste für das seit Jahrzehnten projektierte Brausebad — »um die Reinlichkeit zu fördern« — endlich herumgegangen war, eine ganz beträchtliche Summe gezeichnet.
Schade nur, dass bei diesem jungen, reichen Sonderlinge an eine Verehelichung gar nicht zu denken war. Da ließen ihn alle die Frauen- und Jungfrauenvereine links liegen. Und das gab in diesem Orte den Ausschlag.
Aber selbst ein alter, erfahrener Praktikant wie Bertram wusste nicht, welchen Forschungen aus dem Gebiete der Chemie sein Herr eigentlich nachging. Obgleich Bertram zu jenen professionellen Laboratoriumsdienern gehörte, die manchmal mehr in der Fingerspitze haben als mancher Dozent mit dem Doktor- oder gar Professortitel im Kopfe. Bertram brauchte den neugelieferten Schwefel nur anzuriechen und etwas auf die Zunge zu nehmen, und er konnte sofort sagen, dass der Schwefel wieder einmal nicht chemisch rein war, dass er mit billiger Schwefelblüte vermischt worden, an die stets etwas freie, schweflige Säure gebunden ist. Ein anderer muss dazu erst eine langwierige Analyse vornehmen. Und auch dieser erfahrene Praktikant wusste nicht, welchem Geheimnisse im Labyrinth der chemischen Wissenschaft sein Herr eigentlich nachging, obgleich ihm das Laboratorium jederzeit offen stand.
Ja, auf das Quecksilber hatte er sich hauptsächlich gelegt. Sowohl nach chemischer wie nach physikalischer Richtung hin.
Die Hauptsache, mit der sich der junge Gelehrte ständig herumquälte, war ein Glaskasten mit sehr starken Wänden, 40 Zentimeter im Quadrat und nur 2 Zentimeter hoch, der auch mit einem Glasdeckel verschlossen werden konnte.
Dieser flache Glaskasten war mit Quecksilber gefüllt, das ständig den Strahlen der Sonne ausgesetzt wurde, ob sich diese nun hinter Wolken verbarg oder nicht. Aber das war nicht so einfach, sondern die Strahlen mussten immer ganz direkt im rechten Winkel auf das Quecksilber fallen. Dazu wurde der Kasten auf einem Apparat befestigt, dessen Plattform ganz genau die Bewegungen der Sonne mitmachte, was durch ein kompliziertes Uhrwerk erzeugt wird, wie solche Apparate heute schon in höchster Vollendung hergestellt werden, Heliostaten werden sie genannt, für physikalische und astronomische Zwecke, einstellbar für jeden Tag bis zur Sekunde, sodass man also zum Beispiel, solange die Sonne sichtbar ist, einen Strahl immer auf ein und denselben Punkt fallen lassen kann, durch ein Loch im Fensterladen oder in der Wand ununterbrochen in ein finsteres Zimmer hinein. Wenn also die Sonne im Osten auf- oder im Westen unterging, dann stand die Platte des Heliostaten mit dem Quecksilberkasten ganz senkrecht.
Erst war dieser Apparat im Garten aufgestellt gewesen, dann später war er auf dem nur wenig schrägen Dache des Hauses angebracht worden, aus dem Laboratorium führte eine kleine Wendeltreppe direkt hinauf.
Und diesem Quecksilber nun entnahm der junge Gelehrte ab und zu eine kleine Dosis, um sie in seinem Laboratorium in Retorten und Tiegeln den verschiedensten chemischen Prozessen auszusetzen, was, da Quecksilberdämpfe sehr giftig sind, meist im Abzugs- oder sogenannten Gasraume geschah. Das ist einfach ein großer Glasschrank, in dem sich oben in der Wand eine Öffnung befindet, die nach dem Schornstein geht, in dem Kanal brennt eine Gasflamme, diese saugt die Luft in den Schornstein hinein. Natürlich muss dieser auch ziehen. Aber tut er das nicht, so erkennt man dies ja gleich an der Gasflamme, sie schlägt nicht nach hinten.
Der schöne Maientag war zur Rüste gegangen, die Nacht war angebrochen.
Der junge Gelehrte befand sich in seinem Laboratorium. In dem Giftschranke brodelte über dem Bunsenbrenner ein Glaskolben, das Destillat ging durch mehrere komplizierte Vorlagen. Doch darum kümmerte sich der Chemiker nicht. Er saß an dem einfachen Schreibtische, an dem er immer seine Berechnungen und Notizen machte, an dem er aber auch regelmäßig seine Mahlzeiten einnahm. Auch jetzt stand neben ihm das Abendbrot, das ihm Bertram schon vor einer Stunde gebracht hatte, belegte Brotschnitten, und es war noch unberührt.
Die Ellbogen auf den Tisch und den Kopf in die Hände gestützt, so starrte Otto regungslos in den vor ihm aufgebauten Spiegel.
Es war der Quecksilberkasten, der jeden Abend vom Heliostaten abgenommen und hier auf diesem Tische an der Wand sorgfältig befestigt wurde. Wohl aus keinem anderen Grunde, als dass er eben hier für die Nacht seinen bestimmten Platz hatte.
Dieser flache vollständig mit Quecksilber gefüllte Glaskasten, so, dass sich auch kein einziges Luftbläschen dazwischen befand, war ja nichts anderes als der denkbar klarste Spiegel. So werden ja noch heute die besten Spiegel gefertigt, indem man eine Glasscheibe hinten mit einem Quecksilberamalgam belegt. Noch besser spiegelt ganz reines Quecksilber, nur müsste es dann eben wie hier zwischen zwei Flächen gespannt werden.
Aber mit diesem Quecksilber war im Laufe des Jahres eine Veränderung vor sich gegangen.
Wohl war es noch flüssiges, silberglänzendes Quecksilber, aber es irisierte. Das heißt, es schillerte in allen Regenbogenfarben, je nachdem das Licht darauf fiel oder von welcher Seite aus man es betrachtete. Jetzt, wie Otto gerade davor saß und hineinblickte, zeigte der Spiegel eine intensiv feuerrote Färbung. Er brauchte den Kopf nur ein klein wenig nach rechts zu neigen, so ging das Rot in ein prachtvolles Grün über. Etwas nach links, und er sah eine blaue Oberfläche. Dabei aber war und blieb es immer ein vollkommen klarer Spiegel.
Ja, verändert musste sich dieses Quecksilber unbedingt haben. Etwa dadurch, weil es länger als ein ganzes Jahr bei jeder Gelegenheit den Sonnenstrahlen direkt ausgesetzt worden war?
Das war nicht nötig. Man durfte überhaupt gar nicht von »diesem« Quecksilber sprechen. Es brauchte gar nicht mehr das ursprüngliche zu sein. Otto nahm ja ab und zu etwas heraus, täglich auch mehrmals, und das fehlende ersetzte er sofort wieder, sodass der Kasten immer ganz gefüllt blieb, und es war sehr die Frage, ob es auch wirklich reines Quecksilber war, was er wieder zusetzte. Bertram war nie dabei gewesen, wenn er dies tat, obgleich es dann nicht direkt entfernt wurde, aber er glaubte aus gewissen Kennzeichen, dass es etwas anderes war, was sein Herr immer nachfüllte.
Dem Anscheine nach war es allerdings noch einfaches Quecksilber, flüssig, silberweiß und spiegelnd, was dort den Kasten erfüllte. Nur dass es immer mehr zu irisieren begonnen hatte. Ohne anzuklopfen trat Bertram ein, wie immer zu dieser selben Stunde und Minute, um das Abendbrot abzuräumen. Das heißt das, was sein Herr davon übrig gelassen hatte oder übrig gelassen haben sollte.
Etwas ganz Außergewöhnliches aber war es, dass Bertram heute einige Zeit erst seitwärts hinter dem Stuhle seines Herrn stehen blieb, wobei doch schon einige Sekunden etwas zu bedeuten haben.
Betrachtete er das Gesicht seines Herrn einmal im Spiegel, so wie dieser selbst tat?
Ach, wie hatte sich dieses Gesicht in letzter Zeit verändert!
Es waren ja von jeher hagere, durchgeistigte Züge gewesen, und die täglichen zwei Stunden im Freien hatten sie nie viel bräunen können. Denn dazwischen waren ja immer 22 sonnenlose Stunden im Zimmer gewesen.
Aber jetzt war dieses Antlitz geradezu eingefallen! Tiefliegende Augen mit großen Ringen darum! Und diese blauen Augen, die früher immer nur eigentlich gestrahlt hatten, glänzten jetzt in einem wahrhaft verzehrenden Feuer!
Vor einem Vierteljahre, seitdem der junge Gelehrte plötzlich seine winterlichen Spaziergänge längs der Mauer aufgegeben und dann auch die Gartenarbeit nicht wieder aufgenommen, hatte diese Umwandlung mit ihm begonnen, und es war immer schlimmer geworden, jetzt hatte er kaum noch ein Lot Fleisch auf den Knochen. Man konnte ihm förmlich durch die Backen sehen, ebenso wie durch seine schlanken, schmalen Hände. Dazu kam nun noch, dass Bertram gerade so stand, dass er das Gesicht seines Herrn im Spiegel jetzt in einem grüngelben Lichte sah. Da war es nun vollends der reine Totenschädel, in dem nur noch die Augen lebendig waren. Und wie die flammten!
»Herr Richter!«, erklang es da leise.
»Ja?«
Bertram hatte ihm ja immer einmal etwas zu melden.
Der eigentümliche Ton dabei schien jenem nicht aufgefallen zu sein.
»Sie haben Ihr Abendbrot wieder nicht gegessen.«
Das freilich war etwas, was zwischen den beiden noch nicht passiert war!
Es war nichts anderes, als wenn etwa der persönliche Kammerdiener Seine Majestät gelegentlich fragt, weshalb sie ihre Barttracht verändert hat.
Es war einfach etwas ganz Unerhörtes, etwas ganz Unglaubliches, diese Frage Bertrams, weshalb sein Herr sein Abendbrot nicht gegessen habe. Man musste die beiden nur kennen, wie die zusammen und nebeneinander lebten.
Die Folge war, dass Otto das Stützen seines Kopfes aufgab, und sich halb im Stuhle dem Diener zukehrte. Sagen tat er nichts. Er öffnete den immer schärfer gewordenen Gedankenstrich unter der Nase nicht so leicht. Bertram würde schon von allein fortfahren, und das tat der denn auch.
»Sie haben heute auch das Mittagsessen gänzlich unberührt gelassen. Sind Sie krank, Herr Richter?«
»Nein.«
»Nicht magenkrank?«
»Nein.«
»Haben sich keine Quecksilbervergiftung zugezogen?«
Der junge Gelehrte warf einen Blick hinüber nach dem Giftschrank, wo es in dem Destillierkolben noch immer brodelte, und oben schlug die Gasflamme weit in den Schornstein hinein.
»Nein.«
»Wirklich nicht, Herr Richter?«
»Nein. Ich würde die Erscheinungen einer Quecksilbervergiftung sofort erkennen, ich prüfe mich daraufhin auch regelmäßig.«
»Dann weiß ich, was Sie vorhaben.«
»Was denn?«
»Sie wollen Selbstmord begehen. Durch langsames Verhungern.«
Es war ausgesprochen, das Ungeheuerliche.
Es brachte in den durchgeistigten Zügen, in denen nur ein scharfer Menschenbeobachter die ungeheure Energie erkannte, die diesem zarten Körper innewohnte, nicht den geringsten Eindruck hervor.
»Woraus schließt Du das, Bertram?«, erklang es ganz gleichgültig.
»Der erwachsene Mensch, auch wenn er nicht körperlich arbeitet, braucht zu seiner Ernährung täglich mindestens 80 Gramm Eiweiß, ungefähr 50 Gramm Fett und 400 Gramm Kohlehydrate. Das erfordert der Stoffwechsel. So etwas weiß doch auch unsereins, auch wenn man nicht studiert hat. Diesen Bedingungen haben Sie früher entsprochen. Sie haben früher ganz gut gegessen. Bis vor einem Vierteljahr. Bis zum 6. Februar. Wo Sie plötzlich Ihre Spaziergänge aufgaben. Von da an aßen Sie immer weniger. Und das wurde immer weniger und immer weniger. Jetzt rühren Sie Frühstück oder Mittagessen oder Abendbrot manchmal gar nicht mehr an. Heute bereits die beiden Mahlzeiten nicht mehr. Wie ich mir ausgerechnet habe, haben Sie in den letzten zwei Monaten täglich nicht mehr als 20 Gramm Eiweiß und 10 Gramm Fett und 150 Gramm Kohlehydrate zu sich genommen. Dabei muss der Mensch bei lebendigem Leibe verhungern. Ganz, ganz langsam, meine ich.«
»Woraus aber schließt Du, dass ich mich zu Tode hungern will? Ich kann doch einmal eine Hungerkur durchmachen. Ohne krank zu sein. Aus wissenschaftlichen Gründen. Ich kontrolliere mich dabei. Studiere die Erscheinungen. Dann, wenn es mir zu viel wird, fange ich wieder zu essen an.«
»Mein lieber Herr!«
Mit ganz wehmütiger Stimme hatte es Bertram hervorgebracht, dabei die Hände faltend.
»Und?«
»Nein, Sie wollen sich zu Tode hungern.«
»Woraus willst Du denn das nur mit solcher Sicherheit schließen?«
»Vorgestern musste ich einen Brief zur Post bringen.«
»Das kommt doch wohl öfter vor.«
»Einen eingeschriebenen.«
»Auch das ist nichts Neues.«
»An Herrn Doktor Malwen, Rechtsanwalt und Notar.«
»Und?«
»Und gestern Nachmittag, als Sie mich in die Stadt geschickt hatten, war der Notar hier bei Ihnen.«
»Und?«
»Sie haben Ihr Testament gemacht.«
»Woher weißt Du denn das?«
»Die Fleischersfrau sagte es mir vorhin, wollte mich aushorchen.«
»Woher will denn die Fleischersfrau das wissen?«
»Der Notar ist gestern noch einmal im Gasthofe eingekehrt und hat erzählt, dass Sie Ihr Testament gemacht hätten.«
Ein ganz klein wenig zogen sich die Augenbrauen über der kühnen Nase zusammen. Es war ja auch ein starkes Stückchen, was der Besitzer dieser Brauen und Nase da zu hören bekam.
»Herr Doktor Malwen traf in dem Gasthof einen Freund«, suchte Bertram diesen selbst zu entschuldigen, »er erzählte es ihm im Vertrauen, wie das manchmal so geht, glaubte sich mit ihm allein in der Gaststube und wusste nicht, dass die Kellnerin das Gespräch belauschen konnte! Nun weiß es natürlich das ganze Dorf.«
»Auch was ich testamentiert habe?«
»Nein, so weit ging die Vertraulichkeit nicht. Doktor Malwen sagte nur, dass Sie soeben Ihr früheres Testament umgeändert hätten. Nichts weiter.«
Schon hatten die Augenbrauen wieder ihre normale Stellung eingenommen. Es hatten auch scharfe Augen dazu gehört, um dieses Zeichen nur einer Verstimmung zu bemerken. In den Augen selbst war nicht das Geringste davon aufgeflackert.
»Nun, und weshalb soll ich nicht mein Testament umändern? Da siehst Du doch, ich hatte es schon einmal gemacht, gleich nachdem ich die Erbschaft angetreten. Unterdessen habe ich es mir eben anders überlegt.«
»Und auf diesem Tische hier lag neulich ein Buch, und es hatte schon öfters hier gelegen.«
»Was für ein Buch?«
»Es handelte über die Religion der Dschainisten.«
»Du hast darin gelesen?«
»Nein, aber ich kenne die Dschaina ganz genau.«
»Woher denn?«
»Ich war einmal in einem Laboratorium angestellt, in dem sich einige Herren ständig über diese Religion unterhielten.«
»Inwiefern? Was weißt Du davon?«
»Diese Sekte entstand in Indien fast gleichzeitig mit dem Buddhismus. Auch ihren Mitgliedern ist Nirwana das höchste Ziel, und um es schnellstens zu erreichen, um womöglich alle Wiedergeburten zu vermeiden, soll der Mensch Selbstmord begehen. Aber nur eine einzige Art ist erlaubt, führt überhaupt zum Ziel. Langsames Auflösen des Körpers, was durch Verhungern erreicht wird. Und zwar womöglich ein ganz langsames Verhungern. Nicht sofortige Nahrungsverweigerung, sondern sie muss nach und nach reduziert werden. Bis die Seele endlich den erschöpften Körper verlässt. Dann geht sie ganz bestimmt in Nirwana in das Reich des seligen Unbewusstseins ein. Und jene Herren, die sich darüber so häufig unterhielten, waren hochgebildete Menschen, und sie alle waren sich darüber einig, dass der Dschainismus die idealste Religion sei, die es auf Erden gebe und dass ihr Gründer auch dieses langsame Verhungern ganz plausibel zu machen gewusst habe. Herr Richter, ich bin fest überzeugt, dass auch Sie dies durchführen wollen!«
Ruhig hatte der junge Gelehrte zugehört, den Sprecher immer fest anblickend.
»Du sagst es. Dass Du nicht darüber sprichst, was Du erraten hast, das weiß ich. An meinem Entschluss kannst Du natürlich nichts ändern. Nur das erfahre noch, dass ich auch Dich in meinem Testament reichlich bedacht habe. Du sollst fernerhin unabhängig leben können. Außerdem habe ich Dir dieses Gartengrundstück vermacht, da ich weiß, wie sehr Dein Herz schon daran hängt. Geh, mein lieber Bertram! Heute nimm das Abendbrot wieder mit. Morgen aber bringst Du mir wieder Frühstück, und kümmere Dich nicht darum, oh ich es anrühre oder nicht. Geh!«
Es war in einer Weise gesprochen worden, wenn auch ohne jede Betonung, dass der Diener sofort den Teller nahm und nach der Tür ging.
Dort aber drehte er sich noch einmal um, er musste doch noch etwas sagen, und im flehendsten, kläglichsten Tone erklang es: »Mein lieber, lieber Herr Richter —«
»Geh!«
Da ging er.
Der freiwillige Hungertodeskandidat stand auf, ging nach dem Giftschrank, beobachtete einige Zeit den chemischen Prozess, blickte nach der Wanduhr.
»Um neun. Vor Mitternacht kann ich das Resultat nicht erwarten.«
Er ging hin nach der Uhr, die mit einem Wecker versehen war, stellte diesen auf zwölf ein, dann begab er sich in den Nebenraum, der seine Bibliothek enthielt, eine sehr stattliche, wählte nach kurzer Überlegung ein Buch, mit dem er sich bis dahin die Zeit vertreiben wollte.
Dabei zeigte es sich, dass dieser junge Gelehrte auch noch für anderes Sinn als nur für seine Wissenschaft hatte. Es waren Schillers Gedichte, die er gewählt hatte, und wer sie vielleicht auch alle auswendig kann, der wird sie doch immer wieder lesen — wenn er eben Sinn für so etwas hat.
Er begab sich mit dem Buche zurück ins Laboratorium, setzte sich wieder an den Tisch vor den Spiegel, begann zu lesen, wie er die Seiten gerade aufschlug.
Die Stunden vergingen. Er blätterte und las und blätterte.
Der große Zeiger der Wanduhr war noch fünf Minuten von der Zwölf entfernt, der kleine schien diese Zahl schon erreicht zu haben.
An die Freude.
Wer kennt dieses Gedicht nicht.
Freude schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten freudetrunken,
Himmlische, dein Heiligtum.
Wo ist dieses Gedicht entstanden?
Ausgerechnet in einer elenden Dachkammer zu Gohlis bei Leipzig, wo Schiller vom Gnadenbrot eines Gönners lebte.
In einem schiefen Dachkämmerchen, in dem man nur ganz vorn aufrecht stehen kann, ausgestattet mit einer armseligen Bettstelle, einem ebensolchen Tische und zwei Stühlen, auf dem einen steht das Waschbecken.
Seid umschlungen, Millionen,
Diesen Kuss der ganzen Welt!
Ob das auch in einem Prunksalon gesungen worden wäre?
O, Welt, da versinken alle deine Prunksalons in Staub und Moder!
Und der junge, blasse Gelehrte, dem schon der Tod den Stempel aufgedrückt hatte, las weiter:
Freude heißt die starke Feder
In der ewigen Natur.
Freude, Freude treibt die Räder
In der großen Weltenuhr.
Blumen lockt sie aus den Keimen,
Sonnen aus dem Firmament,
Sphären rollt sie in den Räumen,
Die des Sehers Rohr nicht kennt.
Froh wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prächt'gen Plan,
Wandelt, Brüder, eure Bahn,
Freudig wie ein Held zum Siegen.
Aus der Wahrheit Feuerspiegel
Lächelt sie den Forscher an —
Da schnarrte leise der Wecker.
Mitternacht!
Der Leser blickte auf.
Blickte gerade in den Spiegel, der ihm feuerrot entgegenleuchtete.
Und da plötzlich ging mit dem jungen Gelehrten etwas vor sich.
Plötzlich öffneten sich seine festgeschlossenen Lippen, noch weiter öffneten sich seine Augen, sie nahmen einen ganz starren Ausdruck an, und er streckte die Hände aus, ungläubiges Staunen malte sich in seinen sonst so unbeweglichen Zügen wider, und so erhob er sich, der Stuhl fiel um, so schlich er rückwärts, gebückt, die Hände noch immer gegen den Feuerspiegel vorgestreckt, dann fiel er auf die Knie nieder —
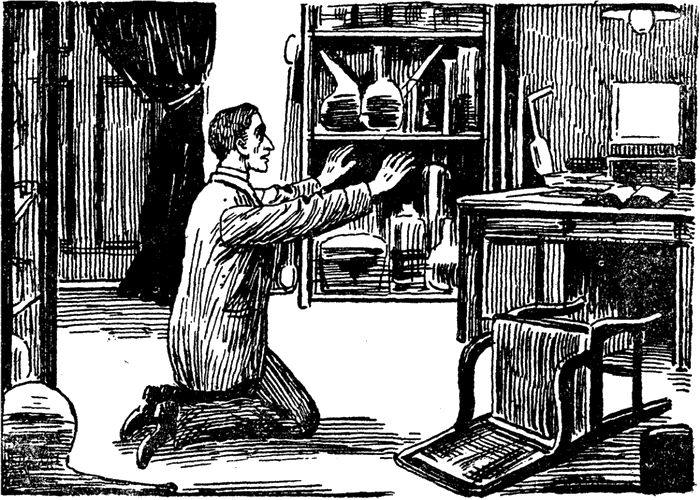
»Feruda! Feruda!«
In seinem traulichen Parterrestübchen schlief Bertram in seinem Bett. Das Weckerschnarren und das Stuhlumfallen hatte er nicht gehört. Erst ein lautes Klingeln in seinem eigenen Zimmer weckte ihn. Neben dem Bett lief an der Wand ein Gasrohr hinauf, eine Drehung des Hahnes, und die Gasflamme, bisher nur ein winziges Flämmchen, verbreitete helles Licht.
Welche Zeit? Halb eins. Sein Herr begehrte ihn.
Das war nichts Außergewöhnliches, kam häufig vor, dass er ihn mitten in der Nacht aus dem Bette holte. Dafür ist man Diener bei einem Gelehrten, der einen einmal geleiteten chemischen Prozess manchmal Tag und Nacht beobachten muss. Bertram hatte ja sonst Zeit genug, konnte schlafen, wann er wollte.
Aus dem Bett gesprungen, in dem er in Unterkleidern gelegen, in Hose und Jacke und Pantoffeln geschlüpft und hinauf.
Der Prozess im Giftschrank war beendet, die Vorlage schon weggenommen. Otto saß wieder an dem Tische, hatte geschrieben.
Aber kaum hätte ihn Bertram wiedererkannt. Obgleich sich an ihm absolut nichts weiter verändert hatte, als dass er seine Lippen nicht mehr so fest geschlossen hielt. Sonst waren es noch genau dieselben Züge, dieselben Au-gen. Aber diese etwas geöffneten Lippen genügten, um seinem Gesicht einen total anderen Ausdruck zu geben.
»Setze Dich, mein lieber Bertram. Hierher zu mir, ich habe mit Dir zu sprechen.«
Dass er den Diener »mein lieber Bertram« anredete, das kam ja öfter vor. Aber noch nie, nie hatte er ihn aufgefordert, sich hier zu setzen.
Der Diener gehorchte, Otto wandte sich ihm zu.
»Heute Nacht ist es mir endlich gelungen, das Problem zu lösen, dem ich schon seit vielen, vielen Jahren nachforsche, eigentlich schon von Kindheit an. Es war schon als kleines Kind immer mein Traum gewesen!«
»Eine wichtige Erfindung?«, fragte Bertram leise, ebenfalls zum allerersten Male solch eine Frage stellend.
»Ja. Eine höchst wichtige Erfindung. Eine epochemachende. Sie würde die ganze Welt umstürzen. Die sozialen Verhältnisse dieser Erde, meine ich. Aber auch namenlosen Jammer über die Menschheit bringen. Und das ist der Grund, weshalb ich meine Erfindung mit mir ins Grab nehmen werde. Diese Erfindung wird dereinst noch von anderen gemacht werden, wenn man nur erst zu der Erkenntnis gekommen ist, dass die alchimistische Lehre von der umwandelnden Kraft der Sonnenstrahlen doch nicht nur so ein leerer Wahn gewesen ist — recht so, mögen andere diese Erfindung machen und sie der Öffentlichkeit übergeben — ich will an diesem anfänglichen Jammer der Menschheit nicht schuld sein. Ich will Dir kurz andeuten, worum es sich handelt, wie ich überhaupt an das ganze Problem gekommen bin.
Du weißt, dass mein Vater Kohlenhändler war. Wahrscheinlich aber nicht, dass er der Sohn eines Bergmanns gewesen. Im Kohlenbergwerk beschäftigt. Auch schon mein Vater hatte von seinem dreizehnten Jahre an im Kohlenschacht arbeiten müssen. Bis er zum Militär kam. Dass er dann auch wieder zu den Kohlen überging, war jedoch nur ein Zufall.
Jedenfalls aber konnte er viel von den Bergleuten erzählen, von dem Leben tief unter der Erde im Kohlenschachte, von einem schrecklichen Unglück durch schlagende Wetter, dem auch mein Großvater zum Opfer fiel, dem mein Vater, ein Kind noch, nur mit knapper Not entrann.
Gern erzählte mein Vater von dieser seiner Bergmannszeit. Und ich hörte immer mit atemloser Spannung zu.
Und der Menschheit ganzer Jammer packte mich. Immer und immer wieder.
Du weißt, warum, Bertram.
Du bist auch einer von jenen wenigen, die nicht zu den Herdenmenschen gehören.
Diese Hunderttausende von Menschen, Kinder der Sonne — sie müssen um ein kärgliches Brot fast ihr ganzes Leben tief unter der Erde verbringen, damit die anderen Menschen nicht frieren, damit sie kochen können, um Lokomotiven und Schiffe zu heizen, um Kriege führen zu können, um zahllose Maschinen zu bewegen, die meistens ganz unnötiges Zeug fertigen.
Deshalb müssen viele Hunderttausende von armen Menschen, Kinder des Lichtes und der Sonne, in finsteren Schächten schwer arbeiten, ständig umringt von tausend Gefahren —
Ließe sich das nicht ändern?
Ließe sich diese schwarze Kohle nicht durch irgend etwas anderes ersetzen?
War diese schwarze Kohle nicht auch erst ein Produkt der heiteren Sonne?
Das war es, was mich schon als Kind Tag und Nacht beschäftigte.
Ich wollte diese armen Sklaven der schwarzen Kohle befreien, sie wieder ans Licht der Sonne ziehen.
Deshalb bin ich Chemiker geworden.
Schon als Kind.
Und heute Nacht habe ich dieses Problem gelöst! Bertram, ich habe eine Substanz erfunden, welche alle Kohle überflüssig macht!
Eine Quecksilberverbindung, welche Wasser in seine Elemente zerlegt, nur durch einfache Berührung.
Also die Substanz selbst zersetzt sich nicht, nützt sich nicht ab.
Mit einem erbsengroßen Stücke könnte man alle Weltmeere in Knallgas verwandeln.
Aber die beiden Gase sind bei der Entwickelung auch getrennt aufzufangen. Du weißt, Bertram, was das zu bedeuten hat. Alle Kohle, alles Petroleum, alle anderen jetzt zu Heiz- und Beleuchtungszwecken dienenden Produkte sind überflüssig geworden.
Aber unterdessen ist aus dem träumenden Kinde ein nüchterner Mann geworden, der zu rechnen versteht.
Und ich habe eine Rechnung aufgestellt, schon früher. Und da bin ich zu Zahlen gekommen, die mich mit Entsetzen erfüllt haben.
Nämlich die Zahlen, welche das Elend schildern, das meine Erfindung erzeugen würde, wenn ich sie der Öffentlichkeit preisgebe.
Alle die Hunderttausende, ja Millionen von Menschen, die in Kohlenbergwerken arbeiten, die sonst mit der Kohle zu tun haben, mit Petroleum und ähnlichen Materialien, alle würden sie brotlos, alle diese Arbeiter samt Frauen und Kindern!
Und die Banken, welche zusammenkrachen würden! Diese Revolution auf dem ganzen Weltmarkte!
Die hierdurch herbeigeführte Katastrophe lässt sich nicht schildern, nicht ausdenken.
Nein, ich nehme meine Entdeckung mit ins Grab. Mögen sie nur andere machen.
Genug hiervon! Etwas anderes ist es auch, worüber ich Dich jetzt sprechen wollte, Bertram.
Was sagen die Leute hier im Orte über mich?«
Mit gespanntester Aufmerksamkeit hatte der in Chemie wohlbewanderte Diener den Ausführungen gelauscht. Diese letzte Frage musste ihm ja höchst überraschend kommen, und es braucht wohl nicht erst betont zu werden, dass sein Herr eine solche noch niemals gestellt hatte; was andere über ihm sprächen. Sie würde aber schon ihren Grund haben.
»Dass Sie ein sehr guter Mensch seien, aber ein großer Sonderling«, fasste Bertram es kurz und bündig zusammen.
»Sonst nichts weiter?«
»Hm, nein, eigentlich nicht.«
»Nicht, dass ich zu bedauern wäre —?«
»Ach so — ja — natürlich — Sie müssten — müssten wohl — ich weiß nicht —«
»Sprich es nur aus! Ich weiß schon, was jetzt kommen wird!«
»Sie müssten wohl eine unglückliche Liebe im Herzen haben.«
»Richtig«, nickte der junge Gelehrte beistimmend. Eines Lächelns war er wohl nicht fähig, sonst würde er sicher dazu gelächelt haben.
»Ja natürlich«, setzte Bertram noch hinzu, »anders geht es bei diesen Leutchen hier doch nicht, bei denen die Frauenzimmer die Herrschaft führen. Wer so zurückgezogen lebt, wie Sie, der muss unbedingt einen geheimen Liebesgram haben.«
»Sehr richtig«, nickte Otto wiederum. »Und was denkst Du über mich, Bertram?«
Zunächst faltete der alte Diener die Hände. »Dass Sie der allerbeste Mensch sind, den es auf Gottes Erdboden gibt! Wenn Sie es auch nicht so von sich geben können.«
»Hier meine Hand, Bertram!«
Das allererste Mal, dass der Herr seinem Diener die Hand gab. Und dessen Hand bekam einen Druck, dass er fast schmerzhaft das Gesicht verzog, welche Kraft man dieser zarten, schmächtigen, gedrückten, jetzt auch noch so ausgedörrten Gestalt nimmermehr zugetraut hätte!
»Glaubst Du, dass ich glücklich bin, Bertram.«
»Ja, das glaube ich«, wurde im Brustton der tiefsten Überzeugung versichert.
»Weshalb glaubst Du das so bestimmt?«
»Weil — weil — weil Sie für nichts weiter als wie für Ihre Wissenschaft Interesse haben, ganz darin aufgehen. Solche Gelehrte sind immer glücklich.«
»Wenn ich Dir aber nun sage, dass ich tief, tief unglücklich bin!«
»Ja?!«, brachte der biedere Bertram mit ungläubigem Staunen hervor.
»Wäre es nicht möglich, dass ich eine tiefe Sehnsucht im Herzen habe?«
»Was denn für eine?«
»Ich will es Dir sagen. Auch ich habe als Kind Indianer- und Abenteuergeschichten gelesen. Dann später wissenschaftliche Reiseberichte. Habe auch Vorlesungen über Erdkunde gehört. Forschungsreisender hätte ich werden mögen.«
»Warum sind Sie es nicht geworden?«, war die ganz richtige Frage.
»Weil das mit den Kohlen dazwischen kam. Und Dieser Gedanke behielt die Oberhand. Mein Ideal. Aber die Sehnsucht, fremde Länder zu sehen, die ganze Erde, sie blieb.«
»So folgen Sie doch jetzt Ihrer Neigung.«
»Ja, Bertram, wenn ich nicht der wäre, der ich bin. Ich bin ein Sonderling. Stimmt. Ich bin ein Phantast. Wenn man mir vielleicht auch nichts davon anmerkt. Nein, ich bin noch viel mehr. Ich bin ein unverbesserlicher Träumer. Ich greife nach Sonne, Mond und allen Sternen.
Was ich hiermit sagen will?
Mich auf die Eisenbahn setzen, Schiffe benutzen?
Es genügt mir nicht. So wie die anderen Menschen zu reisen.
Gib mir die Möglichkeit, mich auf einen Telegrafendraht zu setzen und mich im Nu dorthin befördern zu lassen, wo ich sein will, im fernsten Weltteil — und ich will auf der Erde bleiben und dieses Laboratorium, meine ganze Wissenschaft verlassen. Glaubst Du, dass solch eine Art von menschlicher Beförderung möglich ist, per Telegrafendraht?«
»Hm«, brummte Bertram. »Möglich wäre es schon, wenn wir uns jetzt auch gar nicht vorstellen können, wie das zu machen wäre. Aber vor hundert Jahren konnte man sich auch nicht vorstellen, wie man sich telegrafisch verständigen könnte, hatte auch noch keine Ahnung von einer Lokomotive und Eisenbahn. Es wäre ganz unmöglich gewesen, jemandem das prophetisch beschreiben zu wollen. Man hätte denjenigen, der dies versucht, doch gleich ins Irrenhaus gesperrt.«
»Richtig. Und ich bin so unbescheiden, dass ich mich noch nicht einmal mit der telegrafischen Beförderung zufrieden geben würde. Denn da bin ich immer wieder an Draht und Stationen gebunden. Und auch drahtlose Beförderung genügte mir noch nicht. Immer wieder Stationen! Nicht Luftschiff, nicht Vogelschwingen! Ich möchte sein, wo ich im Moment sein will, mit Körper und Geist. Ein Wunsch — und über mir steht die Sonne des Äquators. Eine Mücke sticht mich — ein Wunsch — eisige Polarstürme umtoben mich. Sage, Bertram, wäre das nichts?«
»Herr, das ist nicht möglich!«
»Ich weiß es. Und die Okkultisten, die so etwas für möglich halten, sogar das Rezept dazu geben, wie man die Seele bei Lebzeiten vom Körper lösen und sie nach Belieben auf Reisen schicken kann, sogar nach fernen Planeten — ich glaube nicht daran. Aber diese geheime Sehnsucht ist es auch nicht, die mich so tief, tief unglücklich macht.«
»Noch eine andere?«
»Bertram, hältst Du mich der Liebe für fähig?«
»Nein!«, erklang es ganze ruhig und bestimmt.
»Weshalb nicht?«
»Weil — weil — ich habe es schon vorhin gesagt. Ihre Geliebte ist die Wissenschaft.«
»Bertram, hast Du einmal geliebt?« — »Ja.«
»Und bist dadurch unglücklich geworden? Bist der geworden, der Du jetzt bist?« — »Ja.«
»Ich habe es mir gedacht, habe es gewusst, weshalb Du Dich von der großen Herde abgesondert hast. Willst Du es mir erzählen?« — »Ja.«
Und der alte Mann erzählte. Ganz kurz.
Die alte, uralte Geschichte
Doch bleibt sie ewig neu,
Und wem sie just passieret,
Dem bricht das Herz entzwei.
Und dabei braucht man kein hochgebildeter Mensch zu sein, kein idealer Jüngling oder sentimentales Mädchen.
Das kann auch dem gewöhnlichsten Arbeiter einmal passieren.
Eine glückliche Ehe. Mit der Jugendgeliebten. Ein herziges Kind. Da war der Teufel gekommen. Sie war mit einem anderen davongelaufen. Er hatte nur noch das Kind, den Sohn. Und dann die Diphtheritis —
Da am Sterbebette des erstickenden Kindes war der verlassene Mann der geworden, der er nach zwanzig Jahren noch heute war. Der zufrieden war, wenn er in seinem ihm liebgewordenen Berufe seinen Unterschlupf gefunden hatte, als Laboratoriumsdiener solch einen Herrn.
So hatte Bertram erzählt. Ganz kurz.
»Und was ist aus ihr geworden?«
»Ich — weiß es nicht.«
»Sie ist gestorben?«
»Nein — ja — nein —«
»Du liebst die Treulose noch immer?«
»Ja«, erklang es hauchend in dem Raume.
»Gut. Ich habe mir so etwas Ähnliches gedacht, und nun weiß ich, dass ich zu Dir sprechen kann. Denn wie kann man sonst zu jemandem über so etwas sprechen, der niemals über eine alltägliche Liebelei hinausgekommen ist, und hat sie auch im Grabe geendet. Glaubst Du, Bertram, dass auch ich solch eine unglückliche Liebe im Herzen trage?«
»Sie?«
Mit ungläubigem Staunen hatte es der alte Mann hervorgebracht.
Und da streckte sein Herr mit plötzlich ganz verändertem Gesicht beide Arme aus, als wolle er ein Phantom umfangen, und dann legte er die linke Hand aufs Herz, die rechte auf seine Stirn, und in namenlosem Jammer kam es langsam über seine Lippen:
»Mein Herz ist Feuer — und mein Hirn ist Glut — und mein Leib verzehrt sich in Sehnsucht!«
Mit namenlosem Staunen, dem sich aber auch Schreck, fast Entsetzen beimischte, blickte der alte Diener auf seinen jungen Herrn.
Ganz abgesehen davon, dass er diesen Gelehrten gar keiner Liebe für fähig gehalten hätte — nein, dieser furchtbare Verzweiflungsausbruch war es, der ihn völlig überrumpelte! Denn wie, wie der das hervorgebracht hatte! Dieser Jammer, diese Verzweiflung!
Doch schnell hatte er sich wieder gefasst, war wieder derselbe.
»Lass Dir erzählen, Bertram.
Du bist der einzige, dem ich mich einmal offenbare. Es drängt mich etwas Unwiderstehliches, dass ich einmal mein Herz ausschütte, und ob Du ein Fürst oder ein Bischof oder ein Arbeiter bist, ist mir gleichgültig.
Du bist mein lieber Bertram, den ich während dieses Jahres, da wir zusammenleben, ins Herz geschlossen habe, und für den ich bereit bin, durchs Feuer zu gehen und die Folterqualen der ewigen Hölle zu ertragen, wie Du dasselbe auch für mich tun würdest.
Das wissen wir beide.
Auch wenn wir beide noch kein einziges Wörtchen deswegen verloren haben.
Höre mich an, Bertram.
Eine ganz, ganz seltsame Geschichte.
Ein Märchen.
In unsere Familie hat sich ein rätselhaftes Traumbild eingedrängt.
Mein guter Vater — der Herr aller Welten segne ihn — war der denkbar nüchternste, prosaischste Mensch, hatte nichts weiter als sein Kohlengeschäft im Kopfe und im Herzen. Und dann vielleicht noch seine Stammkneipe nebenan.
Und dann natürlich seine Familie. Doch das ist bei einem Menschen, der kein Bösewicht, selbstverständlich.
Auch der Wolf sorgt für seine Brut. Wenn er nicht anormal veranlagt ist, dass er sie lieber auffrisst.
So prosaisch war mein Vater, dass er nicht einmal träumte. Niemals.
Nur von einem einzigen Traume konnte er erzählen. Und er tat es gern, lachend, und unter Tränen zugleich.
Wie mein Großvater das Opfer einer Katastrophe im Bergwerk wurde, habe ich schon gesagt. Und auch mein Vater war dabei, sein Sohn, als sechzehnjähriger Junge.
Er befand sich ganz allein in einem abgelegenen Schachte. Da, eine einzige Flamme, ein Krachen — und die Wände stürzten auf ihn herab.
Gegen 18 Stunden hat er da verschüttet gelegen.
Das erfuhr er aber erst hinterher.
Er war immer besinnungslos.
Nach seiner damaligen Vorstellung verlor er das Bewusstsein, im nächsten Augenblick schon hatte er es wieder, und da holten sie ihn unter den Schuttmassen hervor.
Und wähnend dieses scheinbaren Augenblicks also hatte er einen Traum, den einzigen seines Lebens.
Plötzlich stand vor ihm in hellem Lichtscheine ein strahlendes Weib, antik gekleidet, so wie es der einfache Mann beschreiben konnte. Also feenhaft, wollen wir sagen. Am besten konnte er beschreiben, dass sie um die Stirn ein goldenes Band trug, das die Haare zurückhielt, vorn mit einem großen Diadem. Und dann konnte er nicht genug ihre bezaubernde Schönheit, ihr holdseliges Lächeln schildern. Eben eine Fee.
Und sie sprach zu ihm:
Ich bin die Freude. Sei getrost, Du wirst gerettet werden.
Nichts weiter. Verschwunden war sie wieder.
Also 18 Stunden nach der Katastrophe wurde der Junge ausgegraben.
Allerdings war es merkwürdig, dass man in dem toten Gange, in dem niemand mehr etwas zu suchen hatte, noch nachgegraben und dadurch ihn gefunden hatte. Aber nicht etwa, dass die Retter von einem Lichtschein geführt worden waren oder sonst etwas Seltsames erlebt hatten. Gar nichts. Einfach ein Zufall, dass man auch dort nachgeforscht hatte. Der Junge, mein späterer Vater, war nur dadurch dem gewissen Tode entgangen, dass sich ein stürzender Balken quer über ihn gelegt hatte, ohne ihn zu erdrücken.
Dies ist das Geschichtchen, das mein Vater gern erzählte. Nur aus dem Grunde, weil es der einzige Traum seines Lebens gewesen war. Worauf er nämlich sehr stolz war, dass auch er einmal so etwas wie einen Traum gehabt hatte. Sonst gab er gar nichts weiter darauf.
Mein Vater wurde Witwer, heiratete zum zweiten Mal. Ich erblickte das Licht der Welt. Meine Mutter, ein äußerst zartes Persönchen, hatte eine sehr, sehr schwere Niederkunft, obgleich es auch nur so etwas Nixiges war, was da zur Welt kam. Ganz merkwürdig war nur, dass sie hinterher gar nichts davon wissen wollte, was sie für Schmerzen ausgestanden, wie sie gejammert und geschrien hatte.
Sie wisse nichts davon. Sie habe geschlafen.
Und einen Traum habe sie dabei gehabt.
Plötzlich habe an ihrem Schmerzenslager eine Fee gestanden, um die Stirn ein goldenes Band, in der Mitte ein Diadem. Ein holdseliges Weib mit holdseligem Lächeln.
Ich bin die Freude. Sei getrost, ich bleibe bei Dir und helfe Dir.
So hatte die Fee gesprochen und hatte die Wehmutter gespielt. Und als sie verschwand, da erwachte meine Mutter, und ich war zur Stelle, alles gut abgelaufen. Und dass sie in ihren Schmerzen so geschrien, davon wollte meine Mutter nichts wissen. Sie hatte nicht die geringsten Schmerzen empfunden.
Nun, was war weiter dabei? Eben eine Ideenverbindung. Mein Vater hatte so viel von seinem Traum in höchster Not erzählt, da hatte auch meine Mutter in ihrer Leidensstunde denselben Traum gehabt. Nichts weiter. Leicht erklärlich. Und dass eine Niederkunft in unempfindlichem Zustande erfolgt, ohne dass der Wöchnerin ihre Bewusstlosigkeit anzumerken ist, das kommt öfters vor. So sagten die Ärzte.
Ich war zwölf Jahre alt, als ich einmal zufällig mit anhörte, wie meine Mutter dies einem Besuch erzählte. Sonst sprach sie nie davon, am wenigsten doch einem Kinde gegenüber. Ich muss betonen — es ist von Wichtigkeit — dass diese erlauschte Geschichte auf mich gar keinen Eindruck machte, oder höchstens, dass ich im Inneren darüber lachte und spottete; denn ich befand mich damals in jenem kritischen Stadium des Knabenalters, da jeder intelligente Junge an die Erzählungen des Religionslehrers zu zweifeln beginnt, und außerdem hatte ich Büchners »Kraft und Stoff« gelesen. Ich war bereits ein ganz perfekter Materialist, der nur an das glaubt, was er mit Fäusten packen oder doch wenigstens in mathematische Formeln zwingen kann.
Drei Jahre vergingen. Wieder kam ich in ein kritisches Stadium, zu dessen Charakterisierung ich am besten sagen möchte:
Ein unbegreiflich holdes Sehnen
Trieb mich durch Wald und Wiesen hinzugehn,
Und unter tausend heißen Tränen
Fühlt ich mir eine Welt entstehn.
Du verstehst, Bertram. Wenn dies Goethe seinen Faust auch bei einer ganz anderen Gelegenheit sprechen lässt.
Es trifft doch ganz für einen Knaben zu, der in diese Periode tritt.
Allerdings irrte ich nicht in Wäldern und Wiesen umher. Dazu hatte ich keine Zeit. Mein Stundenplan war bis zur Minute festgelegt. Und auch sonst entging ich allen Versuchungen, oder wusste sie doch mit zusammengepressten Zähnen zu überwinden; denn ich hatte schon meinen Epiktet gelesen, den ich ja auch Dir in die Hände gegeben habe. Ich betrieb schon eifrig die Philosophie der Verachtung, und das ganz besonders dem anderen Geschlecht gegenüber.
Ich ging damals in die Obertertia. Wir nahmen gerade die altfranzösische Literaturgeschichte durch.
Nun erst eine Frage, Bertram: Hast Du das altfranzösische Epos ›Feruda‹ gelesen oder doch davon gehört?«
Der alte Diener verneinte.
»Es wäre auch wunderlich, wenn Du es kenntest. Es ist ein fast vollständig vergessenes Denkmal der alten französischen Literatur, und es ist dem Inhalt, wie der Ausführung nach auch gar nicht wert, dass man es in der Erinnerung behält. Unser Literaturlehrer war nur so pedantisch, nichts zu übergehen.
Dieses Epos stammt wahrscheinlich aus dem 14. Jahrhundert, seinen Verfasser kennt man nicht, zum ersten Male gedruckt wurde dieses Epos in Genf 1519, ich glaube kaum, dass es noch andere Ausgaben gibt.
Es ist ein phantastisches Epos, ein Märchen in Gedichtform. Feruda ist eine Zauberin. Sie versteht die Kunst, sich unsichtbar zu machen, außerdem kann sie im Moment sein, wo sie will. Sich sogar mit Gedankenschnelle auf fremde Himmelskörper versetzen. Es ist eine gute Zauberin, sie greift helfend in die Geschicke der Menschheit ein. Im übrigen ein ganz verschrobenes Machwerk. Der Verfasser, wahrscheinlich ein Mönch, strotzt vor Unkenntnis und falschen Vorstellungen. Am Südpol ist es glühend heiß, in Skandinavien lässt er die Menschen arabisch sprechen, und die anderen Planeten besetzt er mit Schulen, in denen ausschließlich Mönche die seligen und unseligen Menschen unterrichten.
Dann muss ich noch bemerken, dass unser Literaturlehrer irrtümlicherweise — oder es mochte so auch in seinem Handbuche stehen — immer ›Ferude‹ sagte, es französisch aussprechend, also Ferüd.
Merkwürdig! Wie ich das hörte, zuckte mir gleich etwas durch den Kopf. Ferude — ist das nicht das Anagramm von dem deutschen Wort Freude? Natürlich, es sind dieselben Buchstaben. Da musste ich natürlich lebhaft an die Fee denken, die meinem Vater und meiner Mutter im Traum erschienen war. Die hatte sich ja immer ›Freude‹ genannt.
Als es mir mein Stundenplan erlaubte und sogar vorschrieb, ging ich hin nach der königlichen Bibliothek, fragte den Bibliothekar, der mich begönnerte, nach dem altfranzösischen Epos ›Ferüd‹.
Doch nicht etwa, weil dieser Name mich an die Träume meiner Eltern erinnert hatte. Dass ich nun da etwa weiter nachforschen wollte. Gott bewahre! Da hätte ich mich doch selbst verachtet! Nein, sondern ich las überhaupt alles, was in der Literaturstunde auch noch so flüchtig erwähnt wurde, regelmäßig im Urtext. So gewissenhaft war ich. Und nun dazu noch eine ausgeprägte Neigung für Literatur. Ich mag wohl der einzige vom ganzen Gymnasium gewesen sein, der das so hielt. Ich war schon seit Jahren Stammgast in der königlichen Bibliothek. Die Bibliothekare unterhielten sich gern mit mir, staunten mich Knirps als ein kleines Literaturwunder an. Ferüd? Ferude? Nein, gibt es nicht. Altfranzösisches Epos, wahrscheinlich aus dem 14. Jahrhundert? Ah, Du meinst Feruda!! Ja, das haben wir. Genf 1519.
Ich nahm den uralten Schmöker und zog mich auf mein Lieblingsplätzchen zurück, in ein Zimmerchen, das nicht so leicht von anderen Besuchern gefunden wurde, angefüllt mit ausrangierten Wörterbüchern aller Sprachen, also wie geschaffen für meine fremdliterarischen Studien.
Ich begann meine Lektüre. Nun, sie war gar nicht so uninteressant. Dieser Mönch war gar nicht so ungebildet und borniert, wie ihn unser Literaturlehrer hingestellt hatte. Er war eben ein Kind seiner Zeit gewesen. Dass er den Südpol von der Sonne verbrannt hinstellte und die Skandinavier arabisch sprechen ließ, das zeigte doch nur, wie es in den Köpfen der damaligen Menschen ausgesehen hat.
Anderseits herrliche Naturgemälde! Und dann imponierte mir mächtig, wie sich diese Zauberin Feruda so mit Gedankenschnelle überallhin versetzen konnte, wohin sie wollte. Das war es ja, was ich im geheimen immer ersehnt hatte.
Und ferner konstatierte ich, dass diese Zauberin tatsächlich den Namen ›Freude‹ führen sollte. Wenn sie Franzosen erschien, so wurde sie nämlich auch Lajoie genannt, nannte sich selbst so. Und das ist doch eben »die Freude«. Sie war eine Skandinavierin, der Mönch hatte wohl etwas von dem deutschen Worte ›Freude‹ gehört, hatte es latinisiert, das heißt in seinem Küchenlatein ›Feruda‹ daraus gemacht.
So versenkte ich mich in die wundersamen Reisebeschreibungen auf dieser Erde und auf fremden Weltkörpern, bis ich mit den Augen zu blinzeln begann und plötzlich, ehe ich es verhindern konnte, eingeschlafen war. Ich war übermüdet gewesen.
Was Wunder nun, wenn sich jetzt bei mir der Traum meiner Eltern wiederholte.
Plötzlich ein Lichtmeer und in demselben die noch blendendere Erscheinung eines Weibes.
Eine Fee in Feenkostüm. Um die Stirn ein goldenes Band mit Diadem. Ein junges Weib von überirdischer Schönheit, mit dem holdseligsten Lächeln, das sich denken lässt.
Und sie begann zu sprechen.
Ich bin Feruda.
Ich bin die Freude, die schon Deinem Vater und Deiner Mutter in ihren Nöten beigestanden hat, auf dass Du für dieses Leben nicht verloren gingest.
Denn in diesem Leben sollst Du Dein irdisches Ziel beenden, um dann in anderer Weise wirken zu können.
Denn Christus hat gesagt: Ich hätte Euch noch viel zu sagen, aber Ihr würdet mich nicht verstehen.
Du wirst bald reif dazu sein, um es verstehen zu können.
Doch bedarfst Du einer Führung.
Ich bin zu Deiner Führerin bestimmt. Und wir kannten uns schon immer, wovon Du jetzt aber nichts weißt.
Und immer wieder handelt es sich um einen freien Entschluss.
Ich bin Dein und Du bist mein. Willst Du mein Geliebter sein?
So hatte sie gesprochen.
Wort für Wort, wie ich es hier wiedergebe.
Und mir kam das alles so ganz selbstverständlich vor.
Es war ja nur ein Traum.
›Ja, ich will Dein Geliebter sein!‹, entgegnete ich ganz einfach.
›Wirst Du mir auch treu sein?‹, fuhr sie fort.
›Ich werde Dir immer treu sein.‹
›So höre, mein lieber Fortunat.
Denn für mich heißt Du Fortunat, wie für alle die, zu denen ich zähle. Strebe Deinem Lebensziele, das Du Dir gesteckt, weiter nach.
Du wirst es erreichen.
Und wenn Du es erreicht hast, dann werde ich Dir wieder erscheinen.
Nicht früher.
Und wenn Dir Feruda als Freude erscheint, nicht nur im Traume, dann richte unser Hochzeitsmahl an.
Dann lasse das Beste auftragen, was Du in Deinem Hause hast. Nichts mehr und nichts weniger.
Versprichst Du mir das?‹
›Ich verspreche es Dir!‹, entgegnete ich.
›So lebe wohl und warte, bis ich Dir wieder erscheine, um mit Dir das Abendmahl einzunehmen, das unsere Verbindung auf ewig bestätigt. Und hier, Geliebter, nimm meinen Verlobungskuss.‹
Und sie beugte sich herab und küsste mich auf die Stirn und küsste mich auf die Lippen.
Und da erwachte ich und saß in dem Lesezimmer!«
Der Erzähler machte eine Pause, legte die Hand vor die Augen und atmete schwer.
»Bertram, o Bertram!«, fuhr er dann fort.
»Lass es mich nicht schildern. Wie könnte ich es auch!
Dieser Kuss, dieser Kuss!
Wie der mir damals nach dem Erwachen auf Stirn und Lippen brannte; wie er mir die ganzen sieben Jahre lang gebrannt hat und heute noch brennt.
Doch nicht mit verzehrender Glut!
Von keuscher Reinheit!
Wie kühles Feuer, das von einem klaren Kristalle ausgeht.
Bertram, ich bin ihr treu geblieben, dieser Traumgestalt.
Nie habe ich ein Weib angesehen. Nur meine Mutter. Ich fühlte mich verlobt.
Und wenn ich darüber verächtlich spotten wollte, so erstarrte plötzlich dieser Spott vor Scham in meinem Herzen.
Und durch diesen Kuss bin ich der geworden, der ich bin. Ich habe meiner Verlobten gegenüber mein Wort gehalten.
Fest und stark habe ich mein Lebensziel verfolgt! Wohl glühte in meinem Busen ständig eine verzehrende Sehnsucht, aber dieser Vulkan gab mir doch nur die treibende Kraft.
Und auch sonst hielt sie mich aufrecht.
Fast möchte ich das vermessene Wort aussprechen: Wer kann mich einer Sünde zeihen?
Nein, ich bin mir während dieser sieben Jahre keiner Sünde bewusst.
Genug!
Ich war verlobt. Von namenloser Sehnsucht erfüllt, harrte und harrte ich ihrer Wiedererscheinung.
Merkwürdigerweise träumte ich trotz meiner grenzenlosen Sehnsucht niemals wieder von ihr. Ich träumte viel, aber alles andere, nur nicht von ihr, von ihr!
Doch wollte sie mir nicht anders erscheinen als im Traume?
Und sollte ich nicht erst mein Lebensziel erreichen? Ich arbeitete.«
Wieder eine längere Pause.
»Vor einem Vierteljahre fasste ich den Entschluss!«, erklang es dann weiter mit ruhiger Stimme.
»Durch eine Erkenntnis, durch einen Blick in die Geheimnisse der Natur, war mir mein Ziel weiter denn je entrückt worden.
Und in meinem Herzen die brennende Sehnsucht! Da beschloss ich, diesem Spiele ein Ende zu machen. Auf welche Weise, weißt Du, Bertram, Du hast es erraten.
Den Lebensfaden einfach durchzuschneiden, das widerstrebte mir.
Ja, ich bin für die Dschaina eingenommen.
Also verhungern, möglichst langsam.
Dabei bleibt man auch arbeitsfähig bis zum letzten Atemzuge. Denn Gehirn und Rückenmark nimmt nicht ab durch Fasten, und wenn sich auch sonst der physische Körper bis zur letzten Eiweißzelle verzehrt hat. Zusammensetzung und Gewicht dieser Nervensubstanzen bleiben immer die gleiche, bis zum Eintritt des Todes.
Hoffte ich etwa, im Tode mit meiner Braut vereinigt zu werden?
Ich will hierüber nicht weiter sprechen. Ich komme jetzt zum Schlusse.
Heute Nachmittag leitete ich einen neuen chemischen Prozess ein. Dort im Abzugsraum.
Ungefähr sechs Stunden würde es währen, ehe ich ein Resultat erwarten konnte.
Ein befriedigendes erwartete ich durchaus nicht; denn wie gesagt, die Erkenntnis einer Wahrheit und eines Irrtums zugleich, hatte mir mein Ziel ferner denn je gerückt.
Gegen neun Uhr war es, als ich mich nach langem Rechnen etwas erholen wollte. Ich stellte den Wecker auf zwölf ein und nahm Schillers Gedichte zur Hand.
Ich las und las, hier an diesem Tische; der Quecksilberkasten stand so wie jetzt, wie jede Nacht. Wie die Zeit verging, wusste ich nicht. Ich kam zu dem Gedichte »An die Freude«. Du kennst es? Wenigstens einigermaßen? Gut.
Da kommt doch auch die Stelle vor: Aus der Wahrheit Feuerspiegel lächelt sie den Forscher an.
Wer? Nun eben die Freude, welche hier als das mächtigste Prinzip im ganzen Weltgetriebe aufgefasst wird. Gar nicht so mit Unrecht. Es ist richtiger, als dabei an die Liebe zu denken; denn es gibt auch eine Liebe ohne Freude. Es ist ja überhaupt nur symbolisch gedacht. Die einzelnen Phasen dieses Gedichtes sind schon vielfach von Künstlern in Bildern festgehalten worden bei diesen Zeilen: aus der Wahrheit Feuerspiegel lächelt sie den Forscher an — haben sich alle Künstler immer dasselbe gedacht. Immer ein chemisches oder physikalisches Laboratorium, mit freudigem Staunen betrachtet der Gelehrte das gezeitigte Resultat seiner letzten Experimente.
Gerade bin ich an diese Zeilen gekommen, habe sie schon gelesen, da schnarrt der Wecker.
Ich blicke auf, muss unwillkürlich auf diesen Quecksilberkasten sehen, und da, Bertram, da sieht mir aus diesem Quecksilberspiegel, der in purpurnem Feuer glüht, ein menschlicher Kopf entgegen — um die Stirn ein goldenes Band mit Diadem — Feruda — meine Geliebte — meine Braut — lächelt mich holdselig an — nickt mir zu — bewegt die Lippen.
Wie ich mich benommen habe, weiß ich nicht. Ich musste dann den Stuhl aufheben.
Feruda! Da ein Knistern und leises Krachen und ich bin wieder nur noch der Gelehrte, der forschende Chemiker.
Ich springe hin nach dem Abzugschrank.
Richtig, der Destillierkolben ist gesprungen.
Und in der Vorlage liegt eine Substanz, die ich nicht kenne, die ich aber schon seit Jahren dort einmal zu finden gehofft habe!
In der Vorlage befindet sich etwas Wasser, das zischend verpufft.
Knallgas! Was kann's denn anderes sein!
Schnell die Gasflamme ausgedreht, die Entwicklung unterbrochen, ehe das ganze Haus in die Luft fliegt!
Ja, die schwarze Masse behält ihre Eigenschaft, das Problem ist gelöst, mein Lebensziel ist erreicht!
Als sie mir wieder erschienen, da hatte ich es erreicht! Und nicht im Traume war sie mir wieder erschienen, sondern dort im Spiegel — im Feuerspiegel, als Freude, als Wahrheit.
Jetzt freilich war sie nicht mehr darin.
Hatte ich eine Vision gehabt? Bah, was heißt Vision!
Jetzt war ich der Chemiker, der zu untersuchen hatte, ob das in der Retorte erzielte Resultat eine Vision war oder nicht.
Es war und blieb eine Tatsache. Da rief ich Dich, Bertram.
Und nun kommt der zweite Teil daran.«
Der junge Gelehrte war aufgestanden.
»Bertram, hältst Du mich für irrsinnig?«
»O nein. Es mag ja nur eine Vision gewesen sein, aber —«
»Davon spreche ich nicht, darnach frage ich Dich nicht. Ich möchte wissen, ob Du mich für irrsinnig hältst, wenn ich Dich jetzt bitte, hier den Tisch für zwei Personen zu decken und schnell das Beste aufzutragen, was Du in Küche und Keller hast. Und ich erkläre gleich, dass ich nicht etwa mit Dir speisen will. Erblickst Du in dieser meiner Forderung ein Anzeichen von Irrsinn?«
Stumm blickte der alte Diener seinen jungen Herrn einige Zeit an.
»Nein«, erklang es dann leise, »ich würde dasselbe tun.«
»So bitte. Ich selbst werde den Tisch für zwei Personen decken, bringe, was dazu nötig ist, dann richte das Essen für zwei Personen her.«
»Warum?«
»Wie Du willst. Das überlasse ich ganz Dir. Wir müssen doch auch noch Wein im Keller haben.«
Bertram ging, brachte alles, was zum Decken des Tisches für zwei Personen gehörte und entfernte sich wieder.
Otto deckte einen in die Mitte des Laboratoriums gerückten Tisch. Eine Viertelstunde später trug Bertram zwei warme und mehrere kalte Schüsseln auf, setzte eine Flasche Weißwein und eine Flasche Rotwein hin, aufgezogen, vor jeden Teller zwei Gläser.
»Ist es recht so, Herr Richter?«
»Hast Du nichts vergessen?«
»Ich wüsste nicht.«
»Dann bitte, lass uns — mich allein, bis ich Dich wieder rufe. Ich danke Dir, Bertram.«
Der Diener sah noch, wie sein junger Herr den zweiten Stuhl zurecht rückte.
Dann saß Bertram in seinem Stübchen. Bis ihn ein dumpfer Fall aus seinen Träumen weckte Er eilte hinaus, öffnete die Tür.
»Allmächtiger Gott!!«
Der junge Gelehrte lag neben seinem Stuhle am Boden.
Am anderen Morgen, oder eigentlich an demselben, klingelte der Briefträger vergebens an dem Gartentore.
Es kam ihm schon verdächtig vor, dass die Milchkanne und der Beutel mit dem Frühstücksbrot, die unter einer kleinen Verdachung ihren Platz hatten, heute nicht weggenommen worden waren. Als der Briefträger dann zum Gemeindevorstand kam, benachrichtigte er diesen davon. Der schickte den Gemeindediener, der holte alsbald telefonisch den Gendarm herbei.
Über die Mauer wurde gestiegen, dann ein Parterrefenster zertrümmert, als alles Klingeln und Klopfen vergebens gewesen war.
Man drang ein, kam ins Laboratorium. Da hatte man die Bescherung! Ein gedeckter Tisch mit Speisen und Weinflaschen besetzt, neben dem einen Stuhle am Boden lag der junge Gelehrte, neben dem anderen sein Diener.
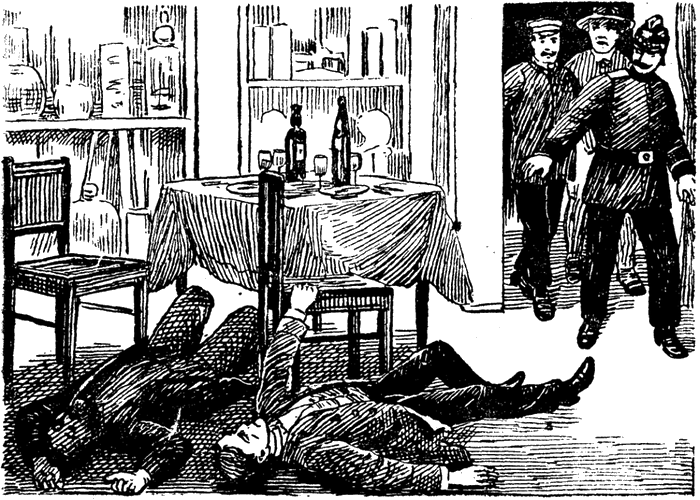
Die Weingläser waren vollgeschenkt, auch die Speisen auf beiden Tellern schon vorgelegt, angerührt hatten sie sie noch nicht gehabt.
Da war das eingetreten, was ihrer beider Tod herbeigeführt hatte.
Tatbestand aufgenommen, die Leichen wurden aufgehoben, dann gerichtlich untersucht, seziert.
»Tödliche Vergiftung durch Quecksilber, wahrscheinlich als Dampf eingeatmet.«
Das Testament des Herrn Otto Richter wurde erbrochen.
Er kannte keine Verwandte. Alles für wohltätige Anstalten, nur seinem Diener hatte er eine Summe ausgesetzt, von dessen Zinsen jener recht gut hätte leben können, wenn er jetzt nicht schon tot gewesen wäre. Und dieses ganze Grundstück dazu.
Nun, bei dem hatten sich schnell lachende Erben gefunden.
Sie wurden begraben. Der Diener auf dem Gemeindefriedhof, der junge Gelehrte kam zwischen Vater und Mutter.
»Hier Waffenmeister. Wer dort?«
»Hier Beireis. Darf ich Sie einmal sprechen, Herr Waffenmeister.«
»Sie sprechen ja schon mit mir, Herr Professor!«
»Bitte, nur Beireis. Also, Herr Waffenmeister, darf ich Sie einmal sprechen?«
»Aber mein geehrter Herr Beireis —«
»Bitte, auch das Herr wollen Sie weglassen — ganz, einfach Beireis. Oder meinetwegen auch Reisbrei, weil mich Ihre Leute unter sich nennen, was ich sehr wohl weiß.«
»Nanu, was ist denn heute mit Ihnen los?!«, staunte Georg am Telefon, und das mit Recht.
Denn das kleine Männchen war überaus stolz auf seinen Professorentitel, obgleich er ihn doch jedenfalls gar nicht hatte, wie er sich doch auch nur einbildete, jener Helmstedter Sonderling zu sein.
Da er sich aber nun einmal in diesem Wahne befand, so wollte er auch nur Herr Professor Beireis angeredet sein, oder doch Herr Professor, das Männchen war ja überaus eitel, allerdings auch genau so wie jener echte Helmstedter Gelehrte, und als er einmal gehört hatte, wie Matrosen über ihn als über den »Professor Reisbrei« gesprochen hatten, da war das Männel wie eine Rakete in die Höhe gegangen, hatte sich vor lauter Zappelei gar nicht wieder beruhigen können, bis ihm in aller Formalität Abbitte geleistet worden war.
Und nun sprach er plötzlich so! Forderte selbst dazu auf, dass man ihn nur ruhig »Reisbrei« nennen solle, ohne jede weitere Titulatur.
»Nanu, was ist denn heute mit Ihnen los?!«
»Ja, geehrter Waffenmeister, der Mensch kann sich manchmal plötzlich sehr ändern; mir ist eben etwas dazwischen gekommen.«
»Was denn?«
»Das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber sagen Sie mir, mein lieber Waffenmeister: Sind Sie ganz sündenrein?«
Zunächst machte der Herr Waffenmeister am Telefon ein recht dummes Gesicht.
»Ick? Als wie ich? Ob ich ganz sündenrein wäre, meinen Sie?«
»Ja, das meine ich.«
»Was verstehen Sie denn eigentlich unter sündenrein, Herr Professor?«
»Nur Beireis, nur Beireis. Oder meinetwegen auch Reisbrei, das zu hören ist mir sogar noch viel lieber. Nun, ob Sie manchmal ein Gebot übertreten.«
»Ick? Als wie ich? Manchmal? Ich übertrete jeden Tag alle sieben Gebote.«
»Sieben?«
»Ja, alle, alle.«
»Da fehlen aber doch noch drei.«
»Was fehlen drei? Ich übertrete jeden Tag, den Gott werden lässt, alle sieben Gebote, sage ich.«
»Es sind aber doch zehn Gebote.«
»Nee, sieben. Das weiß doch jedes Kind. Und machen Sie ja nicht etwa noch drei hinzu, mein lieber Beireis oder Reisbrei, ich habe an diesen sieben Geboten gerade genug.«
»Sie denken wohl immer an die sieben Bitten? Der Gebote aber sind es zehn.«
»Himmel Dunnerwetter ja! Sie haben recht, Beireis! Da sehen Sie, auf was für schwachen Religionsbeinen ich stehe. Also da übertrete ich die anderen Gebote täglich auch noch. Alle zehn zusammen. Und die sieben Bitten noch extra dazu.«
»Ooooo, Herr Waffenmeister, wie sind Sie mir doch über!«, erklang es seufzend aus dem Telefon.
»Sie wissen wohl noch mehr Gebote, die Sie übertreten können?«
»Das nicht. Aber in der wahren Demut, da sind Sie mir über.«
»In Demut?«
»Ja, indem Sie sich offen als einen großen Sünder bekennen, während ich vor Eitelkeit manchmal bald platze.«
»Na, mein lieber Beireis, was wollen Sie denn nun eigentlich von mir?«
»Ich wollte nur höflichst anfragen, ob ich Sie einmal sprechen darf.«
»Na zum Deiwel noch einmal, jetzt quattern Sie schon eine halbe Stunde —«
»Bitte, ganz genau sechs Minuten erst, oder die sechste ist noch nicht einmal ganz voll.«
»Also dann sprechen Sie weiter. Nur mache ich Sie darauf aufmerksam, dass ich nur noch vier Stunden Zeit habe.«
»O, ich wollte Sie höchstens eine Viertelstunde in Anspruch nehmen.«
»Also?«
»Ob Sie gestatten, dass ich Sie einmal spreche. Ich meine, ob ich Sie einmal in Ihren Räumlichkeiten aufsuchen darf?«
»Ja gewiss, immer, mein lieber Professor — Reisbrei ohne den Professorentitel.«
»Und ob ich Ihnen jemanden vorstellen darf?« — »Wen?«
»Die Vorstellung darf aus gewissen Gründen eben erst persönlich erfolgen.«
»Bringen Sie ihn. Nur dass es nicht etwa so ein Hokuspokusmacher ist. Ich habe vorläufig genug, das muss ich erst verdauen, sonst werde ich doch noch wahnsinnig.«
»Nur auf etwas möchte ich Sie erst noch aufmerksam machen.«
»Und?«
»Ich habe über den jungen Mann zu sprechen und er muss immer dabei sein.«
»Kann er.«
»Das dürfte Ihnen aber vielleicht unangenehm sein.«
»Weshalb denn?«
»Weil Sie so zartfühlend sind.« — »Ich?«
»Das sind Sie. Und der junge Mann muss alles anhören, was man sonst nur unter vier Augen zu —«
»Kommen Sie nur, bringen Sie ihn mit. Schluss!«
Kopfschüttelnd hing Georg den Hörtrichter an den Haken.
Er befand sich in dem »Elektron«, dem man nicht anmerkte, dass er jetzt als Luftschiff hoch über den Wolken dahinsauste, aber dieses Telefon in der Kajüte des Waffenmeisters war sein gewöhnliches.
Übrigens kam ihm dieses Verhalten des Professors Beireis nicht so ganz rätselhaft vor, er fand schon eine Erklärung dafür.
Wenn er jener geheimen Gesellschaft auch noch um keinen Schritt nähergerückt war, nur mit einigen Mitgliedern wie mit anderen Menschen verkehrte, so hatte er doch schon gemerkt, dass in dieser gelehrten Verbrüderung eine ganz stramme Disziplin herrschen musste.
Ungefähr so wie in der katholischen Kirche unter den Geistlichen, auch wie zwischen Beichtvater und Beichtkind.
Nur dass man hier wegen gewisser Vergehen nicht gerade Gebete am Rosenkranz hersagen musste.
Weshalb hatte denn der blonde Hüne, der erst eine schwarze Maske getragen, nicht lachen, kein anderes Zeichen irgend welcher Gemütsbeugung geben dürfen?! Weshalb hatte er zwischen Ritterrüstungen in einer einsamen Zelle sitzen und in der Bibel lesen müssen?
Nun, der hatte ganz einfach irgend etwas begangen, wofür er büßen musste. Das hatte ja übrigens Merlin selbst gesagt.
Und zweifellos war dieser Professor Beireis jetzt einmal wegen seiner Eitelkeit hochgenommen worden. Er musste sich demütigen, sich vor anderen selbst erniedrigen, was das Männchen nun in seiner Weise tat.
Wahrscheinlich war auch Merlin nicht umsonst in jenes Tal gebannt. Auch der hatte irgend etwas auf dem Kerbholze. Jetzt allerdings befand er sich mit an Bord des »Elektron«. Aber meist unsichtbar. Das heißt in den mittleren Etagen. Jedenfalls aber hatte er zu irgend einer Buße fremden Menschen Dienste zu leisten.
Die Tür öffnete sich nach einem Klingelzeichen, herein trat Professor Beireis, ihm nach folgte eine andere Gestalt, und ein größerer Gegensatz zu dem kleinen, ausgetrockneten Professor im schwarzen Frack mit weißer Halsbinde war kaum denkbar.
Ein ideal schöner Jüngling. Ein Apollo oder ein freundlich lächelnder Adonis, gehüllt in ein langes Gewand von einem grünen Gewebe, welches den zarten Gliederbau durchschimmern ließ.
Ein freundlich lächelnder Adonis, das weiße, klassische Antlitz von blonden Locken eingerahmt — diese Beschreibung genügt. Und dann noch um die Stirn ein goldenes Band, auf dem in der Mitte ein wundervolles Diadem glänzte.
Das Professorchen hatte seine übliche tiefe Verbeugung gemacht.
»Herr Waffenmeister, Sie haben die Ehre — nein, ich habe die Ehre, wollte ich sagen, Ihnen vorstellen zu dürfen — Fortunatus, einen unserer Meister.«
Mit unverhohlenem Staunen betrachtete Georg den Jüngling. So etwas von Schönheit hatte er noch nicht gesehen! Und zwar war ganz merkwürdig dabei, dass sich nicht etwa was Weibliches dazwischen mischte. Das ist nämlich auch die wunderbare Kunst, welche die alten Künstler in ihre Knaben- und Jünglingsgestalten zu legen wussten. Das gelingt heutzutage kaum noch. Aus derartigen Gestalten wird immer etwas Mädchenhaftes.
»Bitte, Herr Waffenmeister, genieren Sie sich nicht. Ich habe schon angedeutet, dass Fortunatus zwar unbedingt dabei sein muss, wenn ich jetzt zu Ihnen über ihn spreche, dass er sonst aber gar nicht für uns existieren darf. Bitte, sprechen Sie ruhig, was Sie auch sonst sprechen würden.«
O, der Waffenmeister Georg Stevenbrock war auch nicht gewohnt, sich ein Blatt vor den Mund zu nehmen.
»Dunnerlitzchen noch einmal! Gerade wie ein gemalter Engel!«
»Wie ein gemalter?«, fragte der Professor.
»Ja. Einen anderen habe ich noch nicht gesehen. Sie?
Ich nicht; oder nur welche aus Stein oder Gips. Dann aber hatten sie immer Risse und Sprünge. Und manchmal fehlte auch ein Arm oder Bein. Nee, faktisch, gerade wie ein gemalter Engel!«
Ruhig und in zwangloser Haltung stand der gemalte Engel dabei. Das Lächeln war stereotyp, lag im Gesichtsausdruck. Es lag schon in den großen, blauen Augen.
»Fortunatus heißt er?«
»Fortunatus. Oder einfach Fortunat. Das Herr wollen Sie fortlassen. Ihn auch mit Du anreden.«
»Deutsch?«
»Wie Sie belieben. Ja, deutsch. Erst aber reden Sie mit mir. Meister Fortunatus hat sich vorläufig ganz passiv zu verhalten.«
»Er ist in Ihrer Vereinigung ein Meister?«
»Ja, ein Meister.«
»Er steht noch über Ihnen?«
»Über mir?! Herr, was meinen Sie?! Hoch — hoch — hoch — hoch — hoch — hoch —«
Und das kleine Männchen, zuerst die Hand in Kopfeshöhe erhebend, hob diese zollweise immer höher, immer höher, bis es auf den Zehenspitzen räkelte.
»Halt, halt, halt, halt!«, fiel ihm Georg in den Arm. »Bleiben Sie mal hübsch hier unten, sonst fahren Sie mir noch oben zur Decke hinaus. Sie meinen, so hoch steht dieser Jüngling über Ihnen?«
»Und immer noch viel, viel, viel, viel, viel —«
»Höher!«, ergänzte Georg. »Aber ich denke, Sie sind selbst ein Meister?«
»Ich? Wer hat denn das gesagt?«
»Sie selbst und das oft genug.«
»Dann habe ich gelogen, geflunkert, ich stinke überhaupt immer vor Lügen, ich bin nichts weiter als ein Lehrling in dieser geheimen Verbrüderung, ein saudummer Junge —«
Das sonst so eitle Männchen, das sich plötzlich so umgewandelt hatte, schimpfte noch weiter über sich selbst.
»Und weshalb nun stellen Sie mir diesen Meister Fortunatus vor?«
»Ich tue es im Namen unserer Verbrüderung mit der Bitte, dass Sie ihn in Ihre Lehre nehmen möchten.«
»In meine Lehre?« — »Ja.«
»Was soll ich denn solch einem geistig so himmelhoch stehenden Meister noch lehren?«
»Nicht geistig, sondern ihn körperlich ausbilden, so wie Sie Ihre Schiffsjungen, alle Ihre Leute körperlich ausgebildet haben.«
Georg machte ein ganz besonderes Gesicht.
»Aha! Ahaaa! Das können Sie nicht?«
»Nein.«
»Sie können ihn doch turnen lassen, erst Freiübungen, die Kniebeuge und so weiter, dann geht's zu Geräten über —«
»Herr Waffenmeister! Spotten Sie doch nicht! Sie wissen doch ganz genau, was hier vorliegt, um was es sich handelt. Sie sind von uns schon seit langer Zeit beobachtet worden; seitdem Sie das sogenannte Gauklerschiff, die Argonauten, übernahmen. Ja, wir sind den anderen Menschen über. Himmelhoch über. Aber nur in geistiger Hinsicht. In körperlicher Hinsicht haben Sie etwas geleistet, wobei man bei uns — mit Respekt zu sagen — Maul und Nase aufgesperrt hat. Sie haben uns etwas vorgemacht, wovon auch unser Großmeister sich nichts hat träumen lassen, dass so etwas in so kurzer Zeit zu erreichen sei. Und wenn ich Sie schließlich noch daran erinnere, dass eine Schwester Anna Sie einmal innig gebeten hat, ihr von Ihrem Meister Hämmerlein etwas vorspielen zu lassen, so wissen Sie doch nun ganz genau, um was es sich handelt. Ersparen Sie mir also bitte alle weiteren Worte.«
Ja, Georg hatte verstanden. Übrigens etwas, was sich gar nicht so leicht mit Worten ausdrücken lässt.
Vielleicht aber wird man noch einmal dahinkommen, dass man den Kindern nicht mehr mit wöchentlich sechsunddreißig Stunden die Köpfe vollpfropft und nur zwei Stunden fürs Turnen übrig hat, sondern dass man sie sechsunddreißig Stunden im Turnen und in Handfertigkeiten aller Art unterrichtet, das »Geistige« hingegen wöchentlich auf zwei Stunden beschränkt. Denn um das zu erlangen, was man »allgemeine Schulbildung« nennt, Lesen und Schreiben und Rechnen und dergleichen, alles so falsch wie möglich, dazu gehört verflucht wenig! In Amerika ist die Bewegung dazu schon stark im Gange.
»Dieser junge Meister«, fuhr der Professor fort, »hat bisher nur die Ausbildung seines Geistes gepflegt, die seines Körpers total vernachlässigt, und ist verpflichtet worden, dies nun nachzuholen. Aber auch hierzu braucht man sachgemäße Anleitung, will man da schnell vorwärts kommen oder überhaupt etwas erreichen. Wollen Sie ihn in Ihre Dressur nehmen?«
»Dressur ist gut. Ja, ich will ihn in meine Dressur nehmen. Soll er nur körperlich kräftig werden, nur durch Freiübungen, meine ich, oder soll er auch an Geräten turnen lernen?«
»Turnen, jawohl, richtig turnen lernen soll er!«, bestätigte eifrig das kleine Männchen. »Die Kniewelle — und die Armwelle — und die Bauchwelle — und und und —«
Mehr schien der Herr Professor von der edlen Turnerei nicht zu wissen.
Und Georg rieb sich nachdenklich das etwas stachlige Kinn, während er den neuen Schüler betrachtete.
»Hm. Dass der aber, wenn er die Bauchwelle macht, sich nur nicht etwa in Dunst auflöst.«
»Wie meinen Sie?«
»Nu, dass der durch die Zentrifugalkraft, die doch auch bei solchen Wellen in Aktion tritt, wenn man am Reck herumwirbelt, nicht etwa aus dem Leime geht, sich in seine einzelnen Atome auflöst; denn der sieht gar so ätherisch aus.«
»O nein, da brauchen Sie keine Sorge zu haben, das hält bei dem alles ganz fest zusammen!«, beruhigte der Professor.
»So, na das ist ja hübsch!«, lachte Georg. »Aber in diesem antiken Kostüm kann er beim Turnen nicht bleiben, da kann er nicht die Kniewelle und die Grätsche machen, da bleibt er hängen.«
»So stecken Sie ihn nur in einen richtigen Turneranzug, oder er kann sich ja auch gleich selbst umziehen. Willst Du, Fortunat, ein Dir passendes Kostüm wählen?«
Kaum war dies gesagt, als das grüne Gewebe wie in Luft zerrann, und gleichzeitig legte sich um die zarten Glieder, die man, wenn auch undeutlich, in Fleischfarbe hatte durchschimmern sehen, etwas Dunkles, und der Jüngling stand in einem braunen Trikotanzug da. Und nicht nur das, sondern ebenso war auch plötzlich das goldene Band auf der Stirn mit dem Diadem verschwunden, in nichts zerflossen, und die blonden Locken waren ganz bedeutend kürzer geworden.
»Was ist denn das?!«, staunte Georg.
Es war ihm ja hier schon viel vorgegaukelt worden, aber so etwas, dass ein Mensch plötzlich sich so veränderte, denn doch noch nicht!
»Nun, Fortunatus hat sich eben in seinem Äußeren mehr seiner zukünftigen Tätigkeit angepasst.«
»Ist das Illusion?!«
»Das ist vollkommene Wirklichkeit.«
»Ja wie ist denn das möglich?!«
»Ich sagte Ihnen doch, dass dieser Jüngling einer unserer Meister ist. Das ist ein Adept. Der ist Herr des Stoffes.«
»Herr des Stoffes? Was soll das heißen?«
»Ich will Ihnen mit einem Worte der Bibel antworten, von Christus selbst ausgesprochen: So Ihr Glauben habt nur wie ein Senfkorn und Ihr sprecht zum Berge: hebe Dich auf — so wird es geschehen«
»Dieser junge Mensch könnte Berge versetzen?!«
»Und den Elementen gebieten — ja — und sie werden ihm gehorchen.«
Georg, der fast außer sich hatte werden wollen, beruhigte sich schnell wieder. Er nahm es auf seine Weise hin, wie es eben war.
»Ich wollte mir keinen Hokuspokus mehr vormachen lassen, jetzt wird aber meine Neugier doch rege. Dieser Adept beherrscht die Elemente, die Naturkräfte?« — »Ja.«
»Er kann dem Sturm gebieten, er kann es vom blauen Himmel regnen lassen, wenn er will?«
»Er kann es, aber er wird es nicht tun.«
»Weshalb nicht?«
»Weil er nicht gegen die göttliche Ordnung handelt.«
»Aha! Die alte Geschichte!«
»Zweifeln Sie nicht, dass er es nicht wirklich könnte.
Hier im geschlossenen Raume oder überhaupt im Kleinem, wenn dadurch nicht die Ordnung im Makrokosmos gestört wird, kann er Ihnen die verschiedensten Proben seiner Kraft geben. Und er ist bereit dazu. Sie brauchen nur zu fordern.«
Georg blickte sich suchend um, griff in die Tasche und zog einen Nickfänger hervor.
»Kann er dieses Messer aus meiner Hand verschwinden lassen?«
Da geschah es schon. Das große Messer in Georgs Faust zerrann wie in einen Nebel, zerrann in nichts.
»Ist das keine Illusion?«
»Nehmen Sie doch das Illusionsglas, das man Ihnen gegeben hat, wodurch Sie Illusion von Wirklichkeit unterscheiden können.«
»Ich kann hypnotisiert sein, da nützt dies alles nichts.«
»Ich versichere es Ihnen auf mein Ehrenwort, dass Sie nicht hypnotisiert sind, sich in keinem anderen ähnlichen Zustande befinden — ich versichere Ihnen auf Ehrenwort, dass dies alles vollkommene Wirklichkeit ist!«, erwiderte der kleine Mann gravitätisch und Georg glaubte es ihm sofort.
»Wo ist das Messer geblieben?«
»Es ist auf magische Weise verschwunden. Eine andere Erklärung kann ich Ihnen nicht geben, ich verstehe es selbst nicht.«
»Es soll in meine Hand zurückkehren.«
Es geschah sofort. Nur wusste Georg selbst nicht, wie ihm die Finger sanft auseinandergepresst wurden, bis er das Messer wieder in seiner Hand hatte. Teils geschah es nach und nach, teils mit einem einzigen Ruck — er hätte es unmöglich beschreiben können.
»Kann ich auch verlangen, dass das Messer anderswohin versetzt wird?«
»Sicher. Nur wollen Sie nicht gar zu große Forderungen stellen, nicht das ganze Universum dabei in Betracht ziehen: Es darf dabei niemand erschreckt werden.«
»Es soll dort in dem Polster stecken.«
Fast in demselben Augenblick war es so ausgeführt worden, wie es sich Georg im Geiste vorgestellt hatte. Denn wenn man so etwas ausspricht, muss man es sich noch bestimmter in Gedanken vorstellen.
Er hatte, ohne hinzusehen, an das in dieser Kajüte stehende Sofa gedacht, mit grünem Plüsch überzogen, und im Nu war das zugeklappte Messer aus seiner Hand verschwunden und stak mit geöffneter Klinge bis zum Heft in diesem Polster, an derselben Stelle, an die er gedacht hatte.
Er ging hin, zog es heraus, untersuchte den Stich im Polster, der bestehen blieb.
»Das ist einfach Zauberei!«
»Eine Zauberei, die jedem Menschen möglich ist!«, entgegnete der Professor.
»Wie erlangt man diese Fähigkeit?«
»Dadurch, dass Sie mindestens sieben Jahre lang ohne jede Sünde leben.«
»Weshalb gerade sieben Jahre lang?«
»Wissen Sie nicht, dass sich der menschliche Körper innerhalb von sieben Jahren vollständig neu aufbaut?«
Ja, das wusste Georg.
Dass sich der Körper beständig abnützt und erneuert, ist ja bekannt genug. Wir sehen immer, wie sich die Haut abreibt, wie Haare und Nägel wachsen. Nun aber haben unsere Gelehrten mit absoluter Gewissheit konstatiert, dass sich nach spätestens sieben Jahren der normale menschliche Körper überhaupt vollständig neu ersetzt hat! Auch in den Knochen ist kein phosphor- oder kohlensaures Kalkmolekül mehr dasselbe wie vor sieben Jahren! Alles hat sich durch den Stoffwechsel neu gebildet; denn auch alle Knochen sind ja mit zahllosen Äderchen durchzogen, in denen ständig das Blut zirkuliert, alte Bestandteile abspülend, neue Zellen aufbauend.
Was daher die Nahrung für einen kolossalen Einfluss auf den Körperbau auch noch in späteren Jahren haben muss, das muss aber erst noch durch langjähriges Studium geprüft werden, so weit sind wir noch nicht, und an die psychologische Einwirkung denkt unser materielles Zeitalter noch gar nicht.
»Wenn man sieben Jahre lang ganz sündenrein gelebt hat, dann soll man solche Zaubereien ausführen können?«
»Noch nicht sogleich. Dann aber werden Sie schon Ihren Führer bekommen, der Sie auf Ihrem einmal eingeschlagenen Weg auch weiter leitet.«
Georg warf dem Sprecher einen langen Blick zu — und zuckte skeptisch die Achseln.
»Dieser Adept kann überhaupt jeden Gegenstand verschwinden lassen und ihn irgend anderswo hin versetzen?«
»Jeden. Soweit es nicht gegen sein — Gewissen geht, wollen wir sagen.«
»Gut, ich verstehe. Sie sagten aber doch, die Physiker Ihrer geheimen, wissenschaftlichen Gesellschaft seien vorläufig nur imstande, nur eine einzige Substanz, die Sie Menonith nennen, aufzulösen und anderswo wieder zu materialisieren, so wie Sie es uns an der Buddhafigur demonstrierten. Man hoffe zwar, dies auch noch bei jeder anderen Substanz fertig zu bringen, vorläufig sei das aber ein noch ungelöstes Problem.«
»Das ist ja wieder etwas ganz anderes!«
»Inwiefern?«
»In jenem Laboratorium wird nur physikalisch, nur exakt-wissenschaftlich gearbeitet. Da handelt es sich also im Grunde genommen doch nur um mechanische Effekte; hier aber wird dasselbe durch geistige Kraft erzielt. Das ist doch etwas ganz anderes.«
»Ich verstehe diesen Unterschied nicht recht.«
»Nun, können Sie Ihren Gegner im Schachspiel nicht auch auf zweierlei Weise besiegen?«
»Auf zweierlei Weise?«
»Durch geistige und mechanische Kraft.«
»Durch geistige, ja. Aber wie denn durch mechanische Kraft?«
»Worauf kommt es beim Schachspiel an?«
»Dass man den feindlichen König mattsetzt.«
»Mattsetzt, was heißt das? Indem man ihm den König zuletzt wegnimmt, nicht wahr?«
»Im Grunde genommen ja.«
»Und das geschieht durch geistige Kraft. Aber Sie können Ihrem Gegner doch den König einfach vom Brett nehmen, dann hat er auch keinen König mehr, und wenn Sie der Stärkere sind, so vermag er es nicht zu hindern, oder Sie schlagen ihn tot. Dann haben Sie das Schachspiel durch mechanische Kraft entschieden.«
Lachend musste Georg die Richtigkeit dieser eigentümlichen Beweisführung anerkennen.
»Kann dieser Adept auch mich selbst an einen anderen Ort versetzen?«, fragte er dann weiter.
»Das kann er, aber das wird er nicht tun.«
»Weshalb nicht?«
»Sie sind keine tote Materie. Ein Gefühl würde Sie dabei überlaufen, ein Grausen, das mit Wahnsinn enden könnte.«
»Dann lieber nicht. Kann er sich selbst an einen anderen Ort versetzen?«
»Das kann er. Wohin soll er sich versetzen?«
»Er soll plötzlich dort auf dem Stuhle sitzen.«
Ruhig und lächelnd wie immer, jetzt nur im braunen Trikotkostüm, hatte der Jüngling dagestanden.
Kaum hatte Georg den Wunsch ausgesprochen, als die braune Figur in nichts zerrann und gleich darauf auf dem angedeuteten Stuhle saß, der sich mindestens vier Schritt von jener Stelle entfernt befand.
»Wunderbar, wunderbar!«
Hierzu sei etwas bemerkt.
Will der Leser glauben, dass es Anleitungen gibt, wie so etwas zu erreichen ist? Ganz moderne Anleitungen?
Es ist schon einmal von einer »Psychic Research Company« gesprochen worden. Das ist eine Gesellschaft von theosophischen Okkultisten, die volle Wissenschaftlichkeit für sich in Anspruch nimmt. Es sind auch berühmte Wissenschaftler dabei. Auch Edison gehört dazu. Ihren Hauptsitz hat sie in Chikago, hat dort einen großartigen Palast.
Diese Gesellschaft gibt Bücher heraus. In einem derselben wird das Rezept gegeben, wie man alles das ausführen kann, was hier beschrieben wurde, und noch ganz anderes dazu; wie man einfach Gottähnlichkeit erlangt. Wer dieses Rezept ausführen, alle die Regeln befolgen kann, der tue es.
Nur eines sei erwähnt:
Ein einziger unkeuscher Gedanke vernichtet alle die jahrelangen Bemühungen!
Also es ist einfach unausführbar!
Aber das kann versichert werden: Was sonst in diesem Buche steht, das hat alles Hand und Fuß, in Hinsicht der theoretischen Möglichkeit ist nicht der kleinste logische Fehler! —
»Können Sie auch Ihre Gestalt verändern?«, wandte sich Georg jetzt direkt an den Jüngling, der sich vom Stuhle erhoben hatte und in seiner bescheidenen Weise und doch so majestätisch wieder dastand.
»Ich kann es.«
»Irgend eine beliebige Gestalt annehmen?«
»Ich kann es. Nur verlange nichts von mir, was mir widerstrebt.«
»Was widerstrebt Ihnen in dieser Beziehung?«
»Etwa die Gestalt eines Tieres anzunehmen.«
»Gut, ich verstehe. Und ich kalkuliere, dass Sie auch meine Gedanken lesen können.«
»Ja.«
»So präsentieren Sie sich mir so, wie ich Sie jetzt zu sehen wünsche.«
Ein unbeschreibliches Schwellen der Gliedmaßen, der ganzen Gestalt begann, und vor Georg stand ein Mann, der die größte Ähnlichkeit mit der Figur Häckels hatte, an den Georg gedacht, also ein Herkules mit schwellenden Muskeln.
»Ist das Illusion?«, wandte sich Georg erst an den Professor.
»Nein, das ist Wirklichkeit, auf Ehrenwort!«
»Darf ich ihn befühlen?«
»Ja weshalb denn nicht?«
Georg trat ein und tat es. Es waren eiserne Muskeln, die er befühlte.
»Ja, Mann, was soll ich Sie denn noch in die Lehre nehmen?! Sie sind doch schon der reine Herkules, sind es immer, sobald Sie wollen, können sich dann doch auch jederzeit die nötige Gewandtheit wünschen.«
»Mitnichten.«
Es war aber der Professor, der diese Einwendung gemacht hatte.
»Was mitnichten?«
»Er ist nur scheinbar ein Herkules. In Wirklichkeit kann er kaum fünfzig Pfund heben.«
»Nicht?! Wie kommt das?!«
»Weil kein Mensch mehr kann, als was er gelernt hat.
Über seine Fähigkeiten hinaus kann sich auch kein Adept erheben. Oder glauben Sie etwa, wenn dieser Jüngling niemals Klavier oder Violine gespielt hat, und er wünschte es zu können, er wäre plötzlich ein unübertrefflicher Virtuos auf Klavier oder Violine? O nein, er kann nur so darauf stümpern wie jedes Kind. Hier hört alle Magie auf. Das muss alles, alles mühsam erlernt werden, so wie jede andere geistige und körperliche Fähigkeit.«
Mit sehr, sehr ernsten Augen betrachtete der Waffenmeister seinen neuen Schüler, der bereits wieder seine ursprüngliche Gestalt angenommen hatte.
»Ah, was ich da zu hören bekommen habe, das freut mich! Nun bin ich wieder auf irdischen Boden entrückt worden, mag ich auch noch so hoch in den Wolken schweben, meinetwegen meinen Flug nach einem fernen, noch unbekannten Planeten nehmen. Gut! Sind Sie bereit, mir in den Turnsaal zu folgen, wo jetzt gerade unsere Übungen in vollem Gange sind?«
»Ich bin bereit dazu.«
»So folgen Sie mir.«
Nach einer Viertelstunde verließ Georg den großen Turnsaal wieder, der sich also der Höhe nach durch die vierte und fünfte Etage des Elektron zog.
Auf dem Korridor begegnete ihm Juba Riata.
»Herr Waffenmeister, ein Wort — ich habe eine Entdeckung gemacht.«
»Welche?«
»Ist es direkt verboten, die zweite und dritte Etage zu betreten?«
»Nicht direkt. Diese beiden Etagen, die als Aufenthalt der eigentlichen Mannschaft dieses Schiffes dienen, sind uns nur verschlossen. Haben Sie einen Eingang gefunden?«
»Ja. In meiner Kabine, die sich, wie Sie wohl wissen, in der vierten Etage befindet, stand mir der Waschtisch recht unbequem. Ich konnte mich beim Eintritt durch die Tür kaum zwischen ihm und dem Bett vorbeidrücken. Vorhin kam ich auf die Idee, ihn lieber an die andere Wand zu stellen. Er war am Boden festgeschraubt, die Schrauben ließen sich aber ganz leicht lockern. Da, wie ich den Waschtisch abgerückt hatte, zeigte es sich, dass der Boden darunter offen ist, man erblickt eine Leiter, die also in die dritte Etage hinabführt.«
»Sie sind hinabgestiegen?«
»Nein.«
»Weshalb nicht?«
»Ich wollte es Ihnen erst mitteilen, ob es erlaubt ist. In fremde Geheimnisse möchte ich nicht dringen.«
»Sie sind gar zu rücksichtsvoll, Juba! Das müssen wir natürlich einmal untersuchen, wo die Leiter hinführt.«
Nach kurzem Gange betraten sie die Kabine, die also in derselben Etage lag, in der sie sich schon befanden.
Richtig, dort, wo ursprünglich der komfortable Waschtisch gestanden hatte, zeigte sich am Boden ein viereckiges Loch, man erblickte den Anfang einer metallenen Leiter. Erleuchtet war der Raum, doch konnte man nichts weiter sehen, oder man hätte mindestens erst niederknien müssen.
Das tat Georg nicht, ohne Zögern stieg er hinab, Juba folgte ihm.
Sie kamen in einen Raum von normaler Höhe und Breite, wie letztere überall durch Außenwand und Korridor bedingt wurde, etwa fünf Meter lang. Er enthielt nichts weiter als eine Art Steuerrad und dann noch verschiedene auf Stangen ruhende Hebel und kleinere Räder.
»Das ist ein Steuerraum, da wollen wir uns lieber nicht einmischen, hier bin ich noch nicht eingeweiht worden!«, sagte Georg.
»Und jetzt hat sich dort oben eine Tür vorgeschoben!«, setzte Juba hinzu.
Georg blickte zurück und nach oben.
Richtig, die Öffnung hatte sich geschlossen; ohne das geringste Geräusch war es geschehen.
Georg stieg wieder die Leiter hinauf, aber vergebens tastete er und probierte seine Kraft nach allen Richtungen, die Platte ließ sich nicht hinauf und hinab schlagen, noch sonst verschieben, und vergebens probierte auch Juba Riata.
Eine andere Tür war nicht zu erblicken.
»Fatal«, lachte Georg ärgerlich, »wir sind in eine Menschenfalle geraten und es bleibt uns nichts anderes übrig, als dies offen einzugestehen. Wir müssen rufen und klopfen, dass ein Sachverständiger kommt, der uns hier wieder herauslässt.«
Sie riefen und klopften und donnerten gegen die Wände. Ganz vergebens. Niemand kam. Kein Gegenzeichen erscholl.
»Ja, wir müssen eben immer weiter klopfen, bis wir gehört werden.«
Wohl eine halbe Stunde lang suchten sie sich bemerkbar zu machen, ohne dass dies ihnen gelang. Da plötzlich ein ziemlich heftiger Ruck von unten, und gleichzeitig erlosch das Licht, Stockfinsternis umgab die beiden.
»Juba, was war das?!«, flüsterte Georg.
»Das Luftschiff ist gelandet.«
»Es sind aber von den vierundzwanzig Stunden, welche diese Fahrt währen sollte, noch keine achtzehn vergangen.«
Nachdem die Argonauten mit allem, was sie mitnehmen wollten, an Bord gegangen waren, hatte der Elektron unter Kapitän O'Fires Führung einige Rundfahrten über das Tal gemacht, nur damit Georg Stevenbrock selbst in die Führung eingeweiht wurde.
»Wohin wünschen Sie jetzt zu fahren?«, hatte Priee O'Fire dann gefragt.
»Mir ganz egal!«, hatte Georg in seiner Weise geantwortet.
»Darf ich Ihnen das Interessanteste zeigen, was es wohl in der Welt, auf dieser Erde gibt?«
»Mir recht.«
»Es bedarf dazu aber einer Fahrt von ungefähr vierundzwanzig Stunden.«
»Meinetwegen.«
Und fort war es gegangen. Das war gegen Mittag gewesen.
Wenn es sich nun einmal um eine große Überraschung handelte, so wollte Georg auch gar nicht erfahren, nach welcher Richtung die Fahrt ging, wozu nur die paar Kompasse abgestellt zu werden brauchten. Ebenso wenig wusste man etwas über die Schnelligkeit der Fähre.
Wohl konnte der untere Boden durchsichtig gemacht werden, sodass er ein einziges Fenster bildete, wie schließlich alle Seitenplanken auch, aber das Luftschiff befand sich hoch über den Wolken, da war nichts zu sehen.
So waren vierzehn Stunden vergangen. Die Argonauten hatten sich vollends eingerichtet, hatten geschlafen, und dann, als dem Waffenmeister ein neuer Mann vorgestellt wurde, den er als Schüler aufnehmen sollte, hatten sie im Turnsaal schon wieder ihren gemeinschaftlichen Übungen obgelegen.
Jetzt war es nachts zwei Uhr. Aber einen Unterschied zwischen Tag und Nacht gab es hier ja ebenso wenig, wie an Bord eines Seeschiffes, wenn man nicht gerade an einen Passagierdampfer denkt.
»Dann haben wir unser Ziel eben schon in vierzehn Stunden erreicht!«, meinte Juba Riata. »Jedenfalls sind wir gelandet.«
»Woraus schließen Sie das?«
»Wir sind doch ziemlich heftig aufgestoßen.«
»Deshalb aber brauchen wir noch nicht gelandet zu sein. Doch ist dies der Fall, dann wird man uns auch bald vermissen; trotzdem können wir noch etwas weiter pochen.«
»Halt!«
»Was haben Sie?«
»Es ist nicht nötig, dass wir uns weiter bemerkbar machen.«
»Weshalb nicht?«
»Da — fühlen Sie nichts?«
»Nein. Was denn?«
»Die Tür oben muss wieder offen sein; ich fühle einen frischen Luftzug.«
In der Tat, jetzt merkte das auch Georg. Keiner hatte eine Taschenlampe mit, sonst hätten sie diese schon längst entzündet. Juba war der erste, der die Leiter hinaufstieg.
»Waffenmeister, das ist etwas ganz, ganz Merkwürdiges!«
»Was denn?«
»Wir müssen doch wieder in die vierte Etage des Schiffes kommen, in meine Schlafkabine.«
»Ja natürlich. Aber sagen Sie mal, Juba, hat es denn da drin schon vorhin so nach Zimt und Vanille gerochen?«
Denn ein solcher Duft durchzog jetzt plötzlich hier diesen Raum.
»Ja, Zimt und Vanille — Waffenmeister, wir befinden uns in einer tropischen Gegend, und zwar ganz direkt, wir befinden uns nicht mehr im Elektron, wir sind im Freien.«
»Ist nicht möglich!«
»Überzeugen Sie sich selbst.«
Jubas Stimme hatte schon nicht mehr in dem Raume erklungen, eiligst kletterte Georg hinauf. Stockfinsternis! Nicht die Hand war vor den Augen zu erblicken. Ein starker Duft nach exotischen Blüten und Gewürzen. Nichts regte sich.
»Vorsicht, ich stehe hier an einem Abgrund!«, warnte da Juba Riata.
»Was, an einem Abgrunde?!«
Georg brauchte nur einen Fuß vorsichtig vorzusetzen, so merkte er es selbst. Er fühlte keinen Boden mehr, wäre ins Leere getreten. Und so war das nach allen Seiten hin.
»Haben Sie Ihr Feuerzeug bei sich?«
Wer diese Frage stellte, ist gleichgültig.
Sie hatten alle beide keines. Georg hielt überhaupt nicht immer darauf, und Juba Riata hatte gerade seinen Gürtel abgeschnallt gehabt, an dem solche Utensilien hielten.
»Ja, was liegt denn hier nur vor?!«
»Mir ahnt es.«
»Nun?«
»Der Raum, den wir betreten haben, war ein kleines Beiboot, vollständig in das Schiff eingebaut, wir haben aus Versehen irgend einen Hebel gedreht, haben das Boot in Betrieb gesetzt, es hat das Schiff verlassen und ist gelandet, ohne dass wir zuerst etwas davon gemerkt haben, und die Schiffsmannschaft hat ebenfalls nichts davon gemerkt.«
Nach kurzer Überlegung musste Georg dieser Vermutung seines Freundes beistimmen.
Sie überzeugten sich, dass sie sich auf einer Plattform von vier Meter Breite und fünf Meter Länge befanden, das waren also auch die Dimensionen jenes Raumes gewesen, überzeugten sich hiervon aber nicht durch Abschreiten, sondern nur durch vorsichtiges Kriechen, denn bei einem unvorsichtigen Schritte konnten sie in eine Tiefe stürzen, die mindestens dreieinhalb Meter betragen musste.
»Haben wir denn nur gar kein Mittel, uns Licht zu verschaffen?«
Nein, es war keine Möglichkeit vorhanden.
Auch hinab konnten sie nicht so leicht gelangen, oder mindestens dann nicht wieder herauf; denn eine Höhe von dreieinhalb Metern will von zwei Menschen überwunden sein, die über nichts weiter als über die Länge ihrer Leiber und die ihrer Arme zu verfügen haben.
Oder ob die Leiter abzumachen ging?
Gerade fingen sie an, daran herumzustellen, als ganz in der Nähe ein unheimliches Brüllen ertönte.
»Das ist das Brüllen eines hungrigen Sundapanthers!«, konnte der tierkundige Juba Riata, dieser professionelle Tierbändiger, sofort erklären.
»Sie haben doch Waffen bei sich, Juba?«
»Gar keine. Ich hatte mich gerade gewaschen und dazu meinen Gürtel abgelegt.«
»Auch keinen Sackpuffer in der Tasche?«
»Auch nicht.«
»Kein Messer?«
»Gar nichts.«
»Und ich — auch nicht!«
Georg hatte in die Hosentasche gegriffen und darin sogar seinen Nickfänger vermisst. Er musste ihn nach dem Experiment mit dem Adepten in seiner Kajüte liegen gelassen haben.
Die beiden befanden sich, wie sie gewöhnlich gingen, nur in Hemd und Hose, alles so bequem wie möglich, der eine hohe Stiefel, der andere leichte Turnschuhe an den Füßen, und ihre Hosentaschen enthielten absolut gar nichts.
Und jetzt erscholl das Brüllen des hungrigen Panthers noch näher.
»Nette Geschichte das!«
Nach kurzer Beratung zogen sie sich in das Innere des Raumes zurück, wollten aber dafür sorgen, dass die Öffnung nicht etwa zum zweiten Male zuging, um sie vielleicht niemals wieder herauszulassen.
Juba erbot sich, die Wache zu übernehmen, blieb auf der Leiter stehen, mit halbem Körper oben heraussehend, während sich Georg unten auf die nackten Metallplatten niederlegte, um womöglich bis zum Tagesanbruch zu schlafen. Was sollte man auch anderes tun? Vor einem Angriff von Raubtieren war man wohl sicher, die wagten sich nicht so leicht an diesen ihnen fremden Gegenstand, in dem sie nur eine Falle vermuten konnten.
Georg schlief richtig bald ein.
»Auf, Waffenmeister!«
Durch die Luke drang helles Tageslicht herein, oben dröhnten Jubas schwere Stiefel. Georg sprang auf und kletterte die Leiter empor. Der Metallkasten lag im gelben Sande einer Wüste. Aber nur eine Wüste en miniature.
Eine ebene, ziemlich kreisrunde Sandfläche von etwa einem Kilometer Durchmesser, von Hügeln eingeschlossen, und diese waren dicht bewaldet. Der Kasten lag fast genau in der Mitte dieser Sandfläche.
»Juba, wir sind noch nicht verloren, und wir brauchen alle unsere Hoffnung auf Rettung nicht nur darauf zu setzen, dass das Luftschiff unser Fehlen bald merkt, auf die Suche geht und uns schnellstens findet, so lange wir noch nicht verhungert und noch eher verdurstet sind. Wo solcher Wald ist, da muss es auch Wild geben und Wasser dazu.«
»Das hat uns überhaupt heute Nacht schon der Panther erzählt!«, ergänzte Juba.
»Ja, der Panther! Wenn der uns nur nicht etwa als Konkurrenten betrachtet; der ist uns jetzt mit seinen Klauen und Zähnen ganz bedeutend über.«
»Wir wollen uns wenigstens mit Metallteilen bewaffnen, die wir abschrauben, ehe wir die erste Expedition antreten.«
Sie krochen noch einmal in den Raum hinab, dabei wieder an die Klappe denkend, die sie zu Gefangenen machen konnte. Wie diese Schiebetür zu öffnen und zu schließen war, das hatten sie jetzt im hellen Sonnenlichte bald herausgefunden, aber vergebens bemühten sie sich, eine der Metallstangen, auf denen Hebel und Ventilräder angebracht waren, abzulösen. Zu schrauben war gar nichts, trotz aller Kraftanstrengung vermochten sie auch die schwächste solcher Stangen nicht einmal zu verbiegen. Es musste ein ganz besonderes Metall sein.
»Na, da marschieren wir erst einmal dort nach dem Wald und brechen uns dort einen tüchtigen Knüppel ab, um mit diesem als Urmensch wieder von vorn zu beginnen, oder meinetwegen auch als Robinson.«
»Als Robinson?«, wiederholte Juba.
»Ich kalkuliere doch, Sie haben den unsterblichen Robinson Crusoe gelesen.«
»Gewiss; aber Sie meinen, wir wären hier verurteilt, ein Robinsonleben zu führen?«
»Ich meine gar nichts. Wie soll ich jetzt irgend etwas wissen. Vielleicht sind wir in dichter Nähe einer großen Stadt, oder vielleicht ist in den nächsten zehn Minuten schon das Luftschiff wieder zur Stelle. Ich hatte nur so einen kleinen Wunsch ausgesprochen. Mir wäre es ganz lieb, wenn ich einmal einige Zeit von der ganzen Bande getrennt würde, hier so den Robinson spielen könnte, zumal mit Ihnen — na, lassen wir das, es ist ein nicht ganz kameradschaftlicher Wunsch.«
Da unser Held so sprach, oder vielmehr nicht weiter sprechen wollte, wollen auch wir es nicht tun. Nicht ergründen, weshalb er wünschte, einmal einige Zeit allein leben zu können, ganz auf sich selbst angewiesen, oder doch nur in Gesellschaft solch eines Freundes.
Sie verließen den Raum wieder, sprangen die dreieinhalb Meter hinab in den weichen Sand und schritten ostwärts, der über den Bäumen aufgehenden Sonne entgegen, der Hügelkette zu. Wenn man von Hose und Hemd absah, aus Baumwolle oder Lodenstoff, von leichten Strümpfen, Fußbekleidung und Kopfbedeckung, so waren die beiden so, wie der liebe Gott sie erschaffen hatte.
Sie hatten noch keine hundert Schritte getan, als sie in dem weichen Sande eine Fährte bemerkten, die sich im Kreise herumzog.
»Das ist die Fährte des Panthers, der uns heute Nacht umschlichen hat!«, erklärte Juba.
»Dass er dies getan hat, ist dies ein Zeichen, dass er den Menschen schon kennt oder nicht?«, fragte Georg.
»Das vermag ich nicht zu beurteilen. Das kommt ganz darauf an. Er kann Menschen schon kennen, aber solche ohne Feuerwaffen, oder die ihn überhaupt mehr fürchten als er sie, oder er kann auch sehr von Hunger geplagt worden sein. Dem fremden Gegenstande aber wagte er sich nicht weiter zu nähern.«
»Bemerkt Ihr kundiges Jägerauge sonst noch Spuren, was das meinige nicht tut?«
»Nein. Doch ich erkenne aus gewissen Anzeichen, dass dieses sandige Tal nicht so ganz vor Wind geschützt ist, er muss manchmal über die niedrige Hügelkette hier einfallen, und dann verwischt er in dem überaus feinen Sande jede Spur.«
Juba bückte sich und nahm etwas Sand auf die Zunge.
»Schmeckt sehr salzig. Das ist der Boden eines ehemaligen Salzsees. Hier sind auch winzige Muschelchen zu erkennen. Der ganze Sand scheint aus zersplitterten Muschelschalen zu bestehen.«
Sie schritten weiter.
Da hatten sie einen wundersamen Anblick.
Es war keine zusammenhängende Hügelkette, welche die kleine Wüste umgab, sondern ein isolierter Hügel lag dicht neben dem anderen, die obere Laubgrenze des Waldes beschrieb also immer Wellenlinien, und aus solch einem tiefen Zwischenraum, von dem sie sich keine hundert Schritt mehr entfernt befanden, trat jetzt ein riesenhafter Elefant mit mächtigen Stoßzähnen hervor, witterte einen Augenblick mit erhobenem Rüssel, dann schwenkte er diesen und setzte seinen Weg in die Wüste hinein fort, und alsbald folgte ein zweiter, und da erschien schon zwischen den dichten Büschen der Kopf eines dritten.
»Achtung, Juba, jetzt fragt es sich, ob wir uns feig zur Seite drücken oder mutig nach unserer Mausefalle retirieren wollen!«
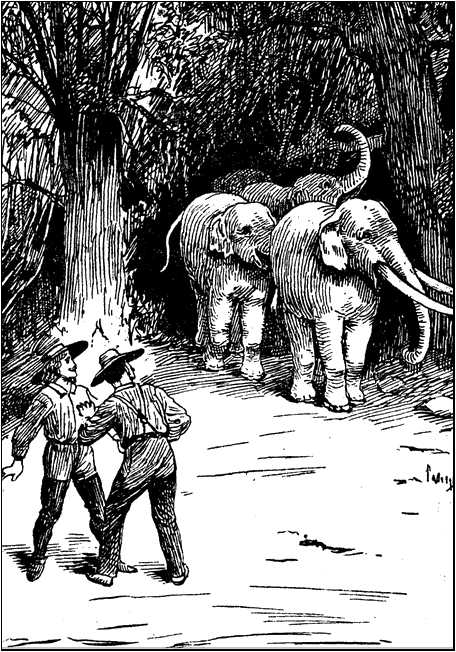
»Achtung, Juba!«, rief der Waffenmeister beim Anblick der
Elefanten. »Jetzt fragt es sich, ob wir uns feig zur Seite drück-
en wollen oder mutig nach unserer Mausefalle retirieren!«
»Es ist nichts zu fürchten, bemerkt haben uns die Tiere natürlich schon, aber sie beachten uns gar nicht, ich kenne den indischen Elefanten genau.«
So gingen sie den Dickhäutern nur etwas aus dem Wege.
Und es blieb nicht nur bei diesen dreien, sondern nicht weniger als sechsundsiebzig Elefanten wurden gezählt, die hintereinander aus dem Walde in die Wüste traten! Junge Männchen, die der alte Führer noch in seiner Herde duldete, und dann viele Weibchen mit Jungen.
Nur beim Heraustreten waren sie so vorsichtig gewesen, dann bildeten sie im langsamen Vorwärtsgehen schnell einen geschlossenen Trupp, alsbald begann auch ein allgemeines Spielen, hier und da blieb ein Elefant stehen und wiegte den Oberkörper hin und her, ohne die Vorderbeine vom Boden zu entfernen, desto mehr den Rüssel schwingend, dabei mit anderen Rüsseln zusammenklatschend, was die indischen Elefanten sowohl, wie die afrikanischen manchmal stundenlang tun, eben eine Spielerei, ein Zeichen des Wohlbehagens, verbunden mit gegenseitiger Liebkosung, noch mehr wurden die kleinen Elefantenkinder, die sich zwischen den Beinen der Mütter herumtrieben, ab und zu an den Eutern saugend, mit den Rüsseln geliebkost, richtig geküsst, und besonders auffallend war es, dass keine Mutter ihr Junges bevorzugte, so wie dieses auch bald an diesem, bald an jenem Euter laut schmatzend saugte, und überall fand es die gleiche Liebe.
»Gott segne meine Augen!«, flüsterte da Juba Riata ganz erregt. »Gott, ich danke Dir, dass Du mir einmal solch einen Anblick gewährst! Ich habe mehr als zwanzig Elefanten zusammen beobachtet, in einem Distrikt, wo sie so gut wie frei waren, aber gefangene waren es doch, und was war das gegen diese wilde Herde hier!«
»Und ich danke Dir, Gott«, ergänzte Georg, »dass Du mir meine Donnerbüchse abgenommen hast!«
»Könnten Sie darauf schießen?«
»Na, wenn nicht jetzt sogleich — über kurz oder lang könnte ich meine Jagdlust doch nicht bezähmen; oder Sie etwa nicht?«
»Gott verzeihe mir — Sie haben recht!«, gestand der ehrliche Juba Riata. Aber diese beiden Männer gehörten wenigstens nicht zu denjenigen »Menschen«, die es geradezu für ihre Pflicht halten, solch ein Tier sofort niederzuknallen oder doch anzuschießen, wenn es die Polizei nur irgendwie erlaubt oder die Jagderlaubnis nicht gar zu hoch für ihren Geldbeutel ist. Sonst nur immer totgeschossen und dann sich auf den Kadaver siegesbewusst gesetzt und sich fotografieren lassen!
Der alte Bulle gestattete eine Weile dieses Spielen, dann führte er seine große Familie weiter über die Wüste; sie verschwanden jenseits wieder in einem waldigen Hügeleinschnitt.
»Wir sind auf Borneo!«, sagte Peitschenmüller.
»Woher wissen Sie das?«
»Von diesen Elefanten. Ihre Ohren sind unten so ausgezackt, das ist das charakteristische Merkmal des Elefanten von Borneo!«
Georg glaubte es ihm.
Also auf Borneo!
Diese Insel ist zweimal so groß wie Deutschland, allerdings die umliegenden Inseln mit inbegriffen, sonst als kompakte Masse noch anderthalbmal so groß wie Deutschland.
Von den politischen und Ansiedlungs-Verhältnissen wollen wir hier nicht sprechen, da sie für uns nicht in Betracht kommen.
Das würde auch nur für die Küstengegenden gelten, manchmal nur ganz schmale Ränder. Das Innere dieser mächtigen Insel, nach Neuguinea die größte der Erde, ist uns noch gänzlich unbekannt.
Weshalb?
Weil in den Wäldern der Rotang wuchert, aus dem wir unser spanisches Rohr machen, das im natürlichen Zustande über und über mit großen, furchtbaren Stacheln besetzt ist.
Kann man sich denn da nicht mit einem Messer einen Weg hauen?
Nun, man kennt doch das spanische Rohr, wie schwer sich dessen glasharte Rinde mit dem Messer bearbeiten lässt.
»Es ist leichter, sich durch eine meilendicke Mauer von holländischem Käse zu essen, als mit Messer und Axt einen Weg von nur hundert Ellen durch diesen Rotangwald zu hauen.«
So drückt sich sehr drastisch, aber wohl ganz richtig der Engländer Mac Wallace aus, der es am Anfang dieses Jahrhunderts versuchte, an der Grenze der bebauten Gegenden ins Innere vorzudringen, mit allem ausgerüstet, was er dazu zu gebrauchen gedachte.
Innerhalb von wenigen Stunden waren mehr als zweihundert der besten Messer und Äxte vollständig unbrauchbar gemacht worden. Und nun diese schrecklichen Dornen! Die Hälfte seiner großen Karawane musste die Arbeit wegen Fleischwunden, wegen Blutverlust aufgeben.
Nur in ganz trockenen Jahren kann ab und zu ein Stückchen Urwald niedergebrannt werden. Dann kommt ein Sumpf und das Feuer verliert seine Macht; und das kann doch immer nur von den Küsten aus geschehen.
Das Innere von Borneo, ein Gebiet fast so groß wie Deutschland, ist uns noch gänzlich unbekannt. Es wird behauptet, dass darin in ausgebrannten Waldinseln gegen eine Million Dajaks leben, Eingeborene, ganz verschieden von den Malaien, die sich auch nicht vermehren, weil die in kleinen Horden lebenden Dajaks ihren ganzen Ehrgeiz darein setzen, sich gegenseitig die Köpfe abzuschneiden, um den getöteten Feind als Sklaven mit in die Ewigkeit hinüberzunehmen, wozu man ihm aber unbedingt den Kopf abgeschnitten haben muss.
Doch woher will man das wissen? Weil solche Dajaks einst auch an den Küsten gehaust haben, zum Teil auch heute noch, sonst aber verschwunden sind. Diese eingeborenen Kinder der Insel mögen ja allerdings einen Weg ins Innere gefunden haben — vielleicht auch nicht — und ihre Anzahl ist völlig aus der Luft gegriffen.
So hatte Georg, der die Verhältnisse von Borneo ungefähr kannte, gesprochen, während die beiden vollends dem Waldsaume zugeschritten waren.
Hier die Wüste, hier der Wald. Der Salzgehalt des ehemaligen Wasserbeckens verursachte diese scharfgezogene Grenze. Wohl rankten sich überall an den Urwaldbäumen Schlingpflanzen empor, aber von dem schrecklichen Rotang gar keine Spur, und auch sonst fehlten die Dornengewächse.
Wo sich die Elefantenherde durch den Wald bewegt hatte, das war auf dem sonst kurzbegrasten Boden nur für ein Jägerauge erkenntlich. Es ist ja ganz wunderbar, mit welcher Gewandtheit die Elefanten durch den dichtesten Wald zu schleichen wissen, ohne auch nur das geringste Geräusch von sich zu geben. Das heißt sobald sie sich nicht bemerkbar machen wollen! Das Leittier geht voran, untersucht mit der Rüsselspitze erst jede einzelne Stelle, auf die es seinen Fuß setzen will, schiebt jedes dürre Ästchen zur Seite, und jeder nachfolgende Elefant setzt den betreffenden Fuß genau auf dieselbe Stelle, und dennoch wandert der lange Zug mit einer Schnelligkeit, dass ein Pferd nur in flottem Trabe mitkommen kann, und so schmiegsam sind die Sohlen trotz aller Härte, dass unter den Tritten der mächtigen Tiere auch kein trockenes Blatt raschelt!
Mancher Jäger kann nicht genug davon erzählen, wie erstaunt er gewesen ist, plötzlich — wie er etwa unter einem Baume gelegen hat — in seiner dichtesten Nähe einen großen Trupp Elefanten an sich vorüberziehen gesehen zu haben, ohne dass er das geringste Geräusch hörte.
Überdies kann man diese ungemeine Gewandtheit dieses scheinbar so plumpen Dickhäuters ja schon in jedem Käfig beobachten, mit welcher wahren Eleganz er sich nach den wenigen Schritten immer auf den Hinterfüßen herumwirft, und wie graziös er überhaupt die Füße setzt. Das ist nur ein leichtes Tänzeln! Anders natürlich, wenn sich solch eine Herde sorglos der Äsung hingibt. Dann kracht der ganze Wald vom Abbrechen der jungen Zweige, vom Malmen der Backenzähne, und von dem eigentümlichen Geräusch, mit dem die aus dem Boden gerissenen Stämmchen gegen größere Bäume geklopft werden, um die Wurzeln von der anhängenden Erde zu befreien.
Auf solch eine Strecke kamen die beiden bald, wo alle erreichbaren Zweige abgebrochen und jüngere Stämmchen herausgerissen waren. Aber ein für Menschen bequem begehbarer Weg durch den Wald entsteht dadurch niemals; denn der Elefant wählt niemals wieder denselben Weg, auch nicht um von einem Tränkplatz zum anderen zu kommen, stets sucht er sich einen neuen Weg, es sei denn, dass der alte schon wieder vollkommen zugewachsen ist.
Da aber wurde dieser schmale, so wüst aussehende Elefantenpfad von einer breiten Chaussee gekreuzt! Ja, es war eine ganz regelrechte Chaussee, wenn man auch nicht gerade an eine der unsrigen denken darf.
Mitten durch den Ward ein breiter, fester Weg, der sich wohl um größere Bäume herumschlängelte, aber alle kleineren waren samt Wurzeln ausgehoben und seitwärts an den Rand geschafft, wo solche ziemlich ansehnliche Stämme manchmal förmliche Barrieren bildeten.
»Ein Rhinozerospfad!«, konnte Juba Riata sofort bestimmen, obwohl er einen solchen in der Wildnis noch gar nicht gesehen hatte. Aber so war es! Im Gegensatz zum Elefanten nimmt das Nashorn, auch in Monomanie lebend und höchstens von zwei Jungen begleitet, immer ein und denselben Weg. Diesen Weg hält es auch in peinlichster Ordnung, entfernt alle aufkeimenden Baumschösslinge daraus, schleudert sogar herabgefallene Zweige zur Seite. Allerdings tut es dies nicht aus Ordnungsliebe, sondern das Rhinozeros, ob es nur zwei Hörner auf der Nase hat oder nur eines, frisst mit Vorliebe Baumwurzeln, deshalb gräbt es mit seinem Horne Bäume aus, unterwühlt sie, bis sie umstürzen. So schafft es sich zunächst einen Weg durch den Wald, den es nun allerdings auch fernerhin immer benutzt, einfach aus Bequemlichkeit. Und ferner frisst das Rhinozeros im Gegensatz zum Elefanten nur ganz trockene Zweige, die frisch herabgefallenen schiebt oder schleudert es einstweilen zur Seite, wahrscheinlich einfach weil sie ihm noch nicht behagen, verzehrt sie erst später auf dem Rückmarsche, wenn sie den Saft verloren haben.
So entstehen nach und nach durch den Wald Wege, welche auf Java ganz direkt als Landstraßen benutzt werden. Die gestürzten Baumstämme schafft das Nashorn selbst beiseite. Freilich duldet es auf diesem seinen Wege kein anderes lebendes Wesen. Dann geht es gleich wütend darauf los. Aber man braucht nur zur Seite zu treten, in den Wald hinein, dann zieht das Rhinozeros wieder ruhig seines Weges dahin, vorausgesetzt, dass es nicht sonst gereizt oder gar angeschossen worden ist. Ja, man hat sogar mit Bestimmtheit konstatiert, dass auch die Schlangen diese Rhinozerospfade meiden; als ob sie wüssten, dass das gewaltige Tier sich bei ihrem Blick sofort auf sie stürzt und sie unter seinen Füßen zermalmt. Das mag von den Schlangen und anderen Kriechtieren ja Instinkt sein, aber — wenn wir nur erst wüssten, was Instinkt eigentlich ist! Vorläufig nichts weiter als ein leeres Wort.
Zunächst jedoch wandten sich die beiden Freunde seitwärts dorthin, wo sie aus einer Felsenformation eine klare Quelle als kleinen Wasserfall hervorspringen sahen und auch hörten.
Die Wasserfrage war schon gelöst, denn aus dem Vorhandensein von vielen Tieren allein hatte man nicht darauf schließen können, reines Quellwasser zu finden; die begnügen sich ja oft genug mit Sumpfwasser, das für den Menschen direktes Gift ist, zumal in tropischen Gegenden.
»Und hier sind schon unsere ersten Hausgerätschaften, die wir später auch als Wasserflaschen an den Gürtel hängen können!«, sagte Juba, von einer starken Liane einige Flaschenkürbisse abbrechend.
»Die sind doch gefüllt, haben Fleisch in sich!«, meinte Georg.
»Das wohl, aber das Fleisch ist gekocht kaum genießbar.«
»Darauf kommt es mir gar nicht an, sondern ich meine, wie man nun das Fleisch aus dem Kürbis herausbekommt, ohne die Flaschenform zu zerstören.«
»Man legt die Kürbisse in die Sonne, wie ich es jetzt schon tue, nach einigen Tagen ist das Fleisch innen ganz vertrocknet, außerdem löst es sich dabei von der Schale, nun muss man das Zeug von oben mit einem spitzen Stocke herausbäbeln, dann ist die schönste Kalebasse fertig, absolut wasserdicht.«
»Ausbäbeln?«, lachte Georg. »Sie haben Ihr Deutsch wohl in Sachsen gelernt? Bei uns zu Hause heißt das ausbuchsen. Zwar ebenfalls kein schönes Wort, aber es hängt doch jedenfalls mit Büchse zusammen. Und sagen Sie mal, Sie sind wohl schon einmal in Borneo gewesen?«
»Nein. Weshalb?«
»Erst halten Sie mir einen langen Vortrag über den Elefanten, dann über das Rhinozeros — nun, das schlägt ja in Ihr Metier — aber woher wissen Sie, wie man aus solch einem langhalsigen Kürbis eine richtige Flasche macht?«
»Weil wir solche Flaschenkürbisse auch in Texas haben!«, lautete die einfache Erklärung.
Dann brachen sie sich tüchtige Knüppel ab, was gar nicht so einfach war, und begannen den Hügel zu ersteigen, um oben Umschau zu halten.
Georg befand sich in der denkbar besten Stimmung. »Ich fühle mich zehn- bis dreißigtausend Jahre zurückversetzt. Ich fühle mich in der Wiege der Menschheit liegen. Ich fühle mich als Urmensch. Ja, schon fühle ich mein Gehirn kleiner werden und dafür meine Unterkiefer mächtig hervortreten. Dieser Knüppel ist meine erste geistige Errungenschaft. Dieser Knüppel wird sich in meiner Hand in zehn- bis dreißigtausend Jahren in ein elektrisch betriebenes Feuergewehr verwandeln; schon fühle ich ahnungsvoll auf meinem Leibe einen Pelz wachsen —«
Er brach ab und schaute wie Juba Riata nach oben. Dort saß auf einem Aste ein großer Affe, sofort als Orang-Utan erkennbar, kratzte sich und fletschte nach den beiden Menschen die Zähne, aber durchaus nicht unfreundlich, eher lachend, er schnatterte dabei. Lebhaft winkte Georg hinauf.

»Sei mir gegrüßt, Du trauter Kamerad! Ach, wenn Du wüsstest, wie geistig verwandt ich mich mit Dir fühle! Warte nur, warte nur, balde — wenn mir erst die Fetzen vom Leibe gefallen sind, dann klettere auch ich auf den Bäumen herum, dieser mein Freund hier wird mir die Flöhe aus dem Pelze absuchen —«
Georg machte einen Satz, schlug mit seinem Knüppel zu und hatte eine meterlange, grünschillernde Schlange tödlich getroffen.
»Das war nicht nötig, sie ist nicht giftig!«, sagte Juba Riata gelassen.
»Was ist das für eine Spezies?«
»Ich weiß nicht. Mir unbekannt.«
»Woher wollen Sie denn da das wissen? Sie haben doch noch gar nicht untersucht, ob sie Giftzähne hat oder nicht?«
»Auf Borneo gibt es keine einzige Giftschlange.«
Das ist eine Tatsache! Auf Java und Sumatra und Celebes und den anderen Sunda-Inseln gibt es Giftschlangen genug — auf Borneo ist keine einzige bekannt.
Man muss immer daran denken, dass das ja ganz gewaltige Gebiete sind, die immer ihre eigene Fauna und Flora haben, und in ihre letzten Geheimnisse lässt sich die Natur eben nicht blicken.
Weshalb gibt es denn in Irland keine Frösche? In England und Schottland massenhaft, in Irland keinen einzigen. Künstlich ausgesetzte halten sich auch nicht, obgleich ihnen das gemäßigte, feuchte Klima doch sehr zusagen müsste. Besonders die so nützliche Kröte hat man einzuführen versucht. Bald sind alle spurlos verschwunden. Man steht vor einem Rätsel.
»Ich weiß es ganz bestimmt«, versicherte Juba nochmals auf Georgs Zweifel, »dass es auf Borneo keine einzige Giftschlange gibt, wenigstens bekannt ist keine.«
»Gut, ich glaube Ihnen, und das freut mich sehr zu hören, denn sonst wäre es mein erstes gewesen, mir lange Schaftstiefel zu fertigen, die ich dann auch als menschenähnlicher Affe nicht abgelegt hätte. Aber sagen Sie mal, mein lieber Peitschenmüller, Sie wussten wohl schon, dass wir den Elektron versehentlich in einem Luftboot verlassen und auf Borneo landen würden, haben sich da vorher noch schnell über die Verhältnisse dieser Insel orientiert, weil Sie alles so genau kennen?«
»Ich habe überhaupt niemals etwas über Borneo gelesen.«
»Woher ist Ihnen denn da alles so genau bekannt?«
»Ich war in einem Zirkus lange Zeit mit einem Malaien zusammen, der stammte von Borneo, und da allerdings habe ich keine Gelegenheit versäumt, mich belehren zu lassen.«
»Dann freilich! Und nur gut ist's, dass ich gerade Sie als Begleiter erwischt habe, Giftschlangen sind mein Fall nicht; Sie haben mich beruhigt.«
»Und wissen Sie, wem man es zu verdanken hat, dass es gerade auf dieser Insel keine einzige Giftschlange gibt?« — »Nun?«
»Dem dort oben.«
Und Juba deutete nach dem Aste, auf dem der große Affe noch immer saß.
»Dem Orang-Utan dort?«
»Jawohl. Ein Waldmensch — nichts anderes bedeutet ja das malaiische Wort Orang-Utan — ist einmal von einer Giftschlange gebissen worden und daran gestorben, oder jedenfalls ist das sehr häufig passiert, als es hier noch Giftschlangen massenhaft gab. Da haben sich alle Waldmenschen zusammengetan und nicht eher geruht, als bis der letzten Giftschlange samt ihrer Brut der Garaus gemacht worden war. So meldet die Sage, so erzählte mir jener Malaie.«
»Danke Dir, mein lieber Kamerad!«, winkte Georg hinauf. »Nun wollen wir den Aufstieg fortsetzen. Nehmen wir die tote Schlange mit?«
»Wozu?«
»Um sie zu braten. Schlangenfleisch soll delikat schmecken. Chinesinnen lassen sie zwar gleich ungekocht und sogar lebendig in den Hals hinabgleiten, als wär's eine Makkaroninudel, wie ich selbst gesehen habe, aber dafür bin ich nicht. Na, lassen wir sie nur liegen, ich werde mit meinem Knüppel schon noch was Besseres schießen. Aber sagen Sie, Juba, können Sie sich Feuer aus den Augen schlagen oder sonstwie erzeugen? Der Mensch fängt erst mit dem Feuer an, auch der Unmensch. Das Feuer ist überhaupt das einzige, was den Menschen vom Affen unterscheidet — manchen Menschen wenigstens.«
»Man reibt einfach zwei Hölzer zusammen —«
»Gehen Sie weg mit Ihrer Reiberei!«, wehrte Georg im Weitergehen mit erkünsteltem Entsetzen ab. »Das habe ich mehrmals als Junge versucht, auch noch zweimal als Mann, habe mir selber die Hände durchgerieben, aber keinen Funken Feuer hervorgebracht!«
»Man muss einen Holzstab quirlen —«
»Gehen Sie mir weg mit Ihrer Quirlerei! Habe ich auch versuchst! Ich habe gequirlt, bis aus meinem Schweiße Buttermilch wurde — nischt is es!«
»Es geht schon«, lächelte Juba Riata, »man muss nur die richtigen Holzarten wählen, und einige Übung und ein gewisser Kniff gehört natürlich auch dazu. Ich werde es Ihnen vormachen, sobald wir Feuer bedürfen.«
Sie setzten ihren bequemen Aufstieg fort, währenddessen Juba noch einen anderen, fingerdicken Ast abbrach, von einer Art Weide ein Stück Bast abschälte, einige Vogelfedern aufhob und sich andere kleine Gegenstände nicht entgehen ließ, sich mit ihnen beschäftigte, mit Hilfe der Fingernägel und der Zähne.
Georg wusste, was er vorhatte, wollte ihn aber nicht durch seine Bemerkungen stören.
»Ist Ihnen hiermit gedient?«, sagte er nur einmal, ein Stück spitzen Feuerstein aufhebend.
»Vortrefflich!«, rief Juba erfreut. »Nach so etwas habe ich mich schon immer umgeschaut! Das erste Messer! Ich bin schon verschiedene Male in meinem Leben ohne Messer gewesen, und doch immer wieder empfindet man dann erst, was ein Messer oder nur etwas Messerähnliches zu bedeuten hat. Ich fertige nämlich Pfeil und Bogen.«
»Das habe ich mir gleich gedacht. Dass Sie mit Ihrem ersten Fitschepfeil nur nicht gleich einen Elefanten über den Haufen schießen!«
Sie hatten den Gipfel des ebenmäßigen Hügels erreicht. Umschau konnten sie wegen der Bäume nicht halten, und das würde sich auch nirgends ändern. Nach einiger Auswahl erklommen sie mühelos einen Affenbrotbaum, von dort oben hatten sie richtig freien Ausblick nach allen Seiten.
Im Westen unter ihnen das sandige Tal. Jenseits der Hügel, die sie zum Teil noch überblicken konnten, flaches Grasland, ebenso wie im Osten und in allen anderen Himmelsrichtungen, nur dass sich ab und zu aus der Ebene ganz plötzlich ein bewaldeter Hügel, in der Ferne auch recht ansehnliche Berge erhoben, aber niemals zusammenhängend, immer isoliert. Es ist eine Spezialität von Borneo, dass es keine eigentlichen, keine zusammenhängenden Gebirge hat. Alle Berge erheben sich isoliert wie die Inseln.
Dort hinten glänzte auch der Spiegel eines Sees, ein breiter Fluss mündete hinein. Und auf diesen Prärien überall verstreut große Herden von Antilopen und Hirschen aller Art, dazwischen auch Rinder und Pferde, die ihrer Morgenäsung nachgingen.
»Wie, auch Pferde?«, meinte Juba kopfschüttelnd. »Die gibt es auf Borneo nicht.«
»Aber genug!«, entgegnete Georg. »Das weiß ich nun wieder besser. Ich hatte einmal einen Passagier an Bord, der hatte auf Borneo eine große Pferdezucht.«
»Ja, Sie denken an gezähmte. Das sind aber doch sicher wilde.«
»Vielleicht entflohene und verwilderte.«
»Sie mögen recht haben.«
»Hoffentlich habe ich es; dass wir hier nicht etwa ganz in der Nähe einer Ansiedlung sind.«
»Dieser Wildreichtum schließt das wohl aus. Ja, aber was ist denn das?«
Juba machte seinen Freund auf einen Rudel Vierfüßler aufmerksam, die sich jetzt in der Wüste bewegten. Da sie fast genau die gleiche gelbe Farbe hatten wie der Sand, waren sie kaum zu unterscheiden, das Auge musste sich erst daran gewöhnen.
»Nun, was soll das sein? Das sind eben Antilopen.«
»Nein, das sind Gazellen.«
»Na dann eben Gazellen.«
»Sie machen wohl gar keinen Unterschied zwischen Antilopen und Gazellen?«
»Ich wüsste ihn nicht zu definieren.«
»Ich — eigentlich auch nicht!«, gestand Juba Riata. »Ja, die Gazelle mag nur eine Art von Antilope sein, zu diesen gehörend; aber das weiß ich, dass dies echte Gazellen sind, die nicht in Indien vorkommen, sondern ausschließlich in Nordostafrika und Arabien; wenn meine Wissenschaft auch nur aus zoologischen Gärten und mehr noch aus Zirkusmenagerien stammt. Wie kommen diese Gazellen hierher?!«
Georg verstand nicht, weswegen sein Freund sich darüber so aufregen konnte.
Aber der ehemalige Dompteur hatte ganz recht, vermochte sich nur nicht richtig auszudrücken. Wohl gehört auch die Gazelle zu den Antilopen, aber sie ist eine ganz besondere Spezialität, zwischen einer Gazelle und einer anderen Antilope ist ein Unterschied wie zwischen einem Pferd und einem Esel, und wer die Gazellen nun einmal kennt, für den ist eine Gazelle in Indien ein Ding der Unmöglichkeit, oder sie ist künstlich eingesetzt worden oder einem Wildpark entflohen.
Doch da Georg dieser Angelegenheit weiter keine Beachtung schenkte, fing auch Juba nicht wieder davon an.
»Und was sind das für Rinder mit den hakenförmigen Hörnern?«
»Das sind Tiere, bei deren Anblick mir wiederum der Verstand stehen bleiben möchte.«
»Was? Warum denn das?«, »Weil das Kaffernbüffel sind.«
»Kaffernbüffel? Kommen die denn nicht nur in Afrika vor?«
»Ja freilich, und das ist es eben! Wie kommen die denn hierher nach Borneo?!«
»Sie irren sich nicht? Sie kennen diese Tiere genau?«
»Irrtum ausgeschlossen. Das sind afrikanische Kaffernbüffel.«
»Ja, mein lieber Freund«, sagte Georg leichthin, »dann sind wir eben nicht auf Borneo, sondern in Afrika.«
»Aber wir haben doch schon einen Orang-Utan gesehen, der nicht in Afrika vorkommt, überhaupt nur auf Borneo und Sumatra.«
»Der Orang-Utan? Na, der hat einfach einmal eine Reise nach Afrika gemacht!«
»Und das dort sind lauter Antilopen, die nur in Indien vorkommen, niemals in Afrika!«
»Na, die sind einfach mitgereist.«
»Sie scherzen, Waffenmeister.«
»Natürlich scherze ich nur. Aber merken Sie nun endlich, was ich mit diesen Scherzen sagen will? Dass es mir verdammt schnuppe ist, ob ich in Indien oder in Afrika bin. Ich habe Hunger. Ist Ihr Fitschepfeil endlich fertig? Dann, bitte, schießen Sie mir dort so einen Büffel, gleichgültig, ob es ein indischer oder afrikanischer ist, damit ich mir ein Beefsteak herausschneiden kann. Ein Messer haben wir ja schon und Feuer haben Sie moderner Prometheus mir versprochen.« Ja, auch hier oben im Baumgipfel war Juba, nachdem er den Bogen schon fertig gehabt, unablässig mit Herstellung des Pfeiles beschäftigt gewesen. Er hatte dazu möglichst hartes Holz gewählt, dann war auch eine besondere Spitze nicht nötig, das Holz selbst brauchte vorn nur spitz geschabt zu werden, dann durchdringt es schon Fleisch und auch ein nicht allzu dickes Fell. Mehr Schwierigkeiten hatte es ihm mit seinen primitiven Hilfsmitteln bereitet, hinten im Schaft einen Schlitz und in diesem eine Feder der Länge nach anzubringen, und diese Feder ist unbedingt nötig, um den Pfeil bei seinem Fluge im Gleichgewicht zu halten, sonst wird er abgelenkt, er flattert. Bei der Konstruktion der modernen Luftschiffe kommt diese Erkenntnis, die alle wilden Völker gemacht haben, wieder zum Vorschein.
Und da entschwirrte schon der erste Pfeil dem primitiven Bogen. Ein großer, truthahnähnlicher Vogel, der zwischen den Zweigen zu erblicken war, auf dem Aste eines anderen Baumes sitzend, war das Ziel gewesen, und durchbohrt flatterte das Tier mit eigentümlichem Schreien zu Boden nieder, hatte sich bald für immer beruhigt. Sie stiegen hinab.
»Es war das Schreien eines Truthahnes im Todeskampfe, und es ist auch nichts anderes als ein amerikanischer Truthahn!«, sagte Juba, als er das stattliche Tier an den Flügeln aufhob.
»Heißt aber in England türkisches und in Frankreich indisches Huhn!«, versetzte Georg.
»Kommt aber wild nur in Amerika vor«, konnte Juba versichern, »seine Heimat ist Mittelamerika.«
Sie begaben sich wieder zu der Quelle hinab. Georg machte sich mit dem Feuerstein, der glücklicherweise eine sehr scharfe Bruchkante hatte, über den Vogel hier, während sich Juba nach einem zweiten Stück Holze umsah, um durch Reibung Feuer zu erzeugen. Als erstes sollte dieser selbe Pfeil dienen, und so hatte er auch schon vorher bei einem gestürzten Baumstamm, der von Insekten in Pulver verwandelt wurde, etwas trockenes Holzmehl aufgesammelt, es einstweilen in die Hosentasche gesteckt.
Das geeignete Stück trockene Baumrinde war bald gefunden, Juba schlang um den Pfeil die Bastsehne des Bogens, legte das Stück Rinde gegen einen Baumstamm, setzte die Pfeilspitze dagegen, den Schaft stemmte er gegen seine Brust, aber auch erst noch in ein Stück weichere Rinde, die eine kleine Höhlung bekommen hatte, so quirlte er den Pfeil mit dem Bogen schnell hin und her, dann streute er auf die Spitze Holzmehl, fing das herabfallende mit einem dritten Stückchen Rinde auf, immer wieder nachschüttend, und gar nicht lange dauerte es, so fing er glimmende Holzpartikelchen auf, die mit dürren Laubblättern durch Blasen schnell helles Feuer ergaben.
Das ist sehr einfach, will aber gelernt sein, und schon das letzte Anblasen lernt mancher niemals. Wirklich leicht aber, sich durch Reiben Feuer zu verschaffen, hat man es dort in Indien, wo es Bambusrohr gibt oder wenn man immer ein Stück davon bei sich hat. Man braucht nur einen Span abzuspalten und mit dessen scharfer Kante auf dem noch vollen Rohre herumzufitscheln. Wenn man durchgefitschelt ist, bläst man in das Rohr und es kommt ein Feuerstrom heraus, der nur noch aufzufangen und in helles Feuer zu verwandeln ist, was dann sehr leicht gelingt. Die Rinde des Bambusrohres enthält viel Kieselsäure, ist daher äußerst hart, beim gegenseitigen schnellen Reiben spritzen fortwährend Funken, allerdings so klein, dass man sie gar nicht sieht, aber wenn die Rinde durchgesägt ist, genügen sie doch, um die sich im Innern angehäuften Holzpartikelchen, an sich schon sehr heiß, in Brand zu setzen, und dann kann man dieses Feuer eben herausschütten oder herausblasen. Solche Stückchen Bambusrohr werden denn auch in Indien ganz allgemein als Taschenfeuerzeuge getragen.
Das Feuer brannte und Georg hatte den Truthahn ausgenommen, gerupft und ausgewaschen. »Die Braterei kann beginnen. Nun fehlt uns aber noch eine der wichtigsten Substanzen, ohne die der Mensch auf die Dauer gar nicht auskommen kann. Wissen Sie, Juba, was das ist?«
Der Gefragte griff in die linke Hosentasche — in der rechten hatte er das Holzmehl gehabt — und präsentierte eine Handvoll schneeweißes Salz.
»Oho!! Haben Sie immer Salz in Ihren Hosentaschen?!«
»Nein, aber wir haben doch vorhin neben einer Salzsaline gestanden.«
»Wann denn?!«
»Vorhin, als die Elefanten an uns vorbei marschierten, da war neben uns in einer Vertiefung des gelben Sandes eine weiße Kruste, ganz vortreffliches Salz. Während Sie in die Betrachtung der Elefanten vertieft waren, habe ich mich verproviantiert.«
»Und ich habe nichts davon bemerkt? Na meinetwegen. Juba, Sie sind ein Allerweltskerl! Fahren Sie so fort. Haben Sie immer in den Hosentaschen, was ich begehre, ich brauche gar nicht gemerkt zu haben, wie Sie es hineinpraktiziert haben.«
Der mit Salz eingeriebene Truthahn schmorte an einem grünen Zweige über der flammenlosen Glut, als ein Schnauben und Grunzen erscholl.
Auf der Chaussee, die von hier aus noch zu erblicken war, sie befanden sich keine fünfzig Schritt davon entfernt, wälzte sich auf vier unförmlichen Beinen etwas Gewaltiges von dunkler Farbe heran.
»Achtung, da kommt der Herr Wegebaumeister!«, flüsterte Georg. »Also, Juba, Sie garantieren, dass das Rhinozeros seinen Pfad niemals verlässt, um seitwärts zwei truthahnessende Menschen auf sein einfaches oder doppeltes Horn zu nehmen und dann unter seinen Füßen Gewiegtes zu machen?«
»Für ein Rhinozeros kann ich garantieren, nicht aber für ein Nilpferd, dessen Gewohnheiten kenne ich nicht so genau.«
»Was? Nilpferd? Was wollen Sie denn mit einem Nilpferd? Hier auf Borneo gibt's doch gar keinen Nil!«
»Möglich, aber was dort ankommt, das ist kein Nashorn, sondern ein afrikanisches Flusspferd.«
Georg war aufgestanden, machte den Mund halb auf.
»Na weiß Gott!«, brachte er dann hervor. »Das ist kein Rhinozeros! Erstens hat es keine Hörner auf der Nase, zweitens hat das Luder so ein breites Maul, und drittens ist's überhaupt ein Flusspferd! Wie kommt denn das hierher nach Borneo?! Jetzt blickt's hierher und nickt mir zu. Und Sie können nicht garantieren, dass auch ein Nilpferd niemals von dem schmalen Pfade der Tugend abweicht und den breiten Weg der Sünde betritt? Wissen Sie was, Juba, ich werde einen kleinen Ausflug machen. Ich habe so einen inneren Drang nach etwas Höherem. Ich werde einmal ein bisschen auf diesen schönen Baum klettern. Kommen Sie mit?«
Aber der Rückzug war nicht nötig, die Gefahr in Gestalt des gewaltigen Flusspferdes ging vorüber, verschwand zwischen den Bäumen.
Georg hob seinen Knüppel auf und schwang ihn drohend nach jener Richtung.
»Na, danke Deinem Schöpfer, Biest, dass Du nicht hierher gekommen bist! Dir hätte ich ja einen schönen Empfang bereitet! Na was gibt's denn da zu lachen?«
Ja, der sonst so ernste Juba Riata lachte aus vollem Halse.
»Sie befinden sich ja in ganz vorzüglicher Laune, Waffenmeister!«
»Ja, mein lieber Juba, mir ist, als wäre ein schöner Traum in Erfüllung gegangen, den ich als Kind geträumt habe. Und mir ist nicht nur so, sondern das ist eine Tatsache. Juba, ich glaube, ich bin ein Glückspilz. Mir ist ja schon mancher phantastische Kindestraum in Erfüllung gegangen. Ich habe das Schiff und die Mannschaft gefunden, von der ich einst geträumt. Aber auch noch von anderem habe ich als Kind geträumt. So hier in Hemd und Hosen am Feuer zu sitzen, das man sich nicht durch Streichhölzer verschafft — absolut nichts in den Taschen — wenn man auf einen Baum steigt, dann hat man auf der Erde nichts mehr zu suchen — und nun noch solch einen Freund dazu — ach, Juba, das ist ja einfach himmlisch! Sehen Sie, und nun bekommen wir ja auch Besuch aus Australien.«
Über den Weg hüpfte ein Rudel großer Kängurus, war gleich wieder zwischen den Bäumen verschwunden.
»Kängurus, wahrhaftig!«, rief Juba. »Und da wundern Sie sich nicht?!«
»Ich? Nee. Wie gesagt, wenn ich auf einen Baum steige, habe ich auf der Erde nichts mehr zu suchen, und da ist es mir doch ganz egal, ob dieser Baum in Indien oder in Afrika oder in Australien steht. Wenn ich mich übers etwas wundere, so ist es nur darüber, dass Sie sich wundern. Ich glaube dieses Rätsel bereits gelöst zu haben.«
»Ja?!«
»Wir befinden uns hier ganz einfach in einem Wildpark, der mit allen möglichen Tieren besetzt worden ist, angelegt von —«
Georg stockte.
»Himmeldunnerwetter noch einmal! Sehen Sie, mit der Kraft des gesprochenen Wortes hat es doch etwas auf sich. An solch einen Wildpark habe ich schon gedacht, kaum aber spreche ich den Gedanken laut aus, so komme ich noch viel mehr auf den Trichter! Da war vor zehn bis fünfzehn Jahren ein Amerikaner namens Osborne, ich entsinne mich seines Namens noch ganz genau —«
»Elias Osborne!!«
»Nanu! Jetzt kennen Sie wohl auch diesen Mann? Ja freilich, Sie stammen ja auch von daher, es schlägt ja überhaupt ganz in Ihr Fach. Was wissen Sie von dem?!«
»Es ist genau dreizehn Jahre her. Ein schwerreicher Mann, ein vielfacher Millionär. Er kaufte in St. Louis die großartige Menagerie des Metropolitan-Zirkus, der durch die Spielwut seines Besitzers, des Mister Ritchie, in Konkurs kam. Da bin ich doch zum ersten Male als Dompteur aufgetreten.«
»Ach nee! Na und was machte nun dieser Elias Osborne?«
»Er brachte die ganze Menagerie auf ein Schiff, sein eigenes, um mit ihr eine Tournee durch Europa anzutreten. Das Schiff ist verschollen, ist untergegangen mit Mann und Maus.«
»Richtig, aber nach Europa ist er nicht gefahren, wollte keinen Zirkus aufmachen, sondern dieser reiche Sonderling, ein großer Tierfreund, beabsichtigte in geeigneter Gegend einen großartigen Tierpark anzulegen, hatte dazu schon im Innern Javas ein mächtiges Areal gekauft. Auf der Fahrt nach Java ist sein Schiff mit Mann und Maus untergegangen.«
»Wissen Sie das bestimmt?«
»Das mit dem Tierpark auf Java? Ganz, ganz genau. Es hat damals in allen Zeitungen gestanden. Auf Java war das Areal schon gekauft.
»Hm!«, brummte Juba. »Das mit der Europareise war auch nur so eine Vermutung von uns und Zeitungen habe ich dann nicht mehr gelesen. Es war damals gerade die Zeit, wo ich mich von der Welt absonderte.«
»Na, Juba, nun wollen wir annehmen, das Schiff ist nicht untergegangen, sondern an der Küste von Borneo gescheitert, gestrandet, dieser Mister Osborne hat sich mit seiner ganzen Menagerie ins Innere von Borneo zu schlagen gewusst. Ist das nicht eine Erklärung?«
»Allerdings. Oder wir befinden uns hier auf Java.«
»Nein, das bezweifele ich. Erstens hat Osborne sein Ziel auf Java nicht erreicht, das weiß ich bestimmt, und zweitens trägt diese Gegend vielmehr den Charakter von Borneo, als von Java. Besonders durch die Inselberge, die sich jäh aus der Ebene erheben. Soviel geografische Kenntnisse habe ich vom Sunda-Archipel.«
»Na gut, dann ist ja alles erklärt. Wir befinden uns auf Borneo, wo Osborne seinen Tierpark doch noch gegründet hat, ohne dass die andere Welt etwas davon erfuhr.«
»Wenigstens ist es eine Theorie, die viel Möglichkeit für sich hat. Aus was bestand denn diese Menagerie?«
»Aus allem, allem möglichen. Es war eine höchst stattliche und auserlesene Menagerie.«
»Na, da wollen wir dann mal sehen, was wir noch weiter finden. Hoffentlich hat der gute Mann nicht auch Giftschlangen losgelassen. Aus Löwen und Tiger mache ich mir viel weniger; auch aus Menschen, die wir dann wohl auch erwarten müssen. Jetzt werde ich erst einmal dieses eine Truthahnherz essen. Es ist schon gar, Delikat! Das andere Herz können Sie essen, Juba.«
Bald war auch der ganze Truthahn gar, den teilte Georg mit seinem Freunde redlicher als das Herz.
Der letzte Knochen war abgenagt. Es waren zwei gesunde und sehr hungrige Männer gewesen, die den großen Vogel bewältigt hatten.
»So, nun wollen wir vertrauensvoll in die Zukunft blicken und erst einmal weiter nachforschen, was Mister Osborne von seiner Menagerie alles hierher geschafft hat und wie sich die lieben Tierchen unterdessen vermehrt haben.«
Sie verfolgten den Rhinozerospfad nach Osten weiter. Georg die Hände in den Hosentaschen, die Mütze in den Nacken gerückt, den Knüppel unterm Arme.
»Studio auf seiner Reis', jubheidi, jubheida, ganz famos zu leben weiß, jubheidi heida. Immer fort durch Dick und Dünn, schlendert er sein Dasein — —. Juba, da fällt mir gerade ein — blicken Sie auch manchmal hinter sich? Wenn hinter uns ein Nashorn oder so etwas Ähnliches kommt, sagen Sie es mir rechtzeitig, damit ich rechtzeitig zur Seite treten kann, damit ich nicht genötigt bin, das arme Tier totzuschlagen — aaahhh!!«
Auf einer sonnigen Lichtung wucherte üppig ein Kraut.
»Wissen Sie, was das ist?«
»Tabak.«
»Ja, Tabak. Der Samen ist von Vögeln hierher getragen worden, oder vielleicht hat dies alles hier schon einmal unter Kultur gestanden. Mir ganz egal. Jedenfalls ist das zweite unentbehrliche Lebensbedürfnis nach Salz gesichert. Aus Brot mache ich mir nicht viel, wenn ich nur jeden Tag meine drei Pfund Fleisch habe.«
Er pflückte einige schöne große Blätter, die schon etwas verwelkt waren, ab.
»Die können Sie aber noch nicht rauchen, die Blätter müssen erst eine Gärung durchmachen.«
»Weiß ich, sonst könnte man auch Kastanienblätter oder gezupftes Hemd rauchen. Aber Sie werden staunen, wie schnell ich diese Tabaksblätter die nötige Gärung durchmachen lasse. Ich habe dafür mein eigenes Patent.«
Er schob die Blätter vorn auf der Brust zwischen Haut und Hemd, sie pilgerten weiter.
Jäh machte der Urwald der Kalira Platz, der malaiischen Savanne, der Prärie. Ein herrlicher Graswuchs! Er erreicht nur Kniehöhe, bleibt auch im heißesten Sonnenbrande immer von saftigem Grün, und verdorrt er doch zuletzt, so zerfallen die zarten, überaus dicht stehenden Halme sofort in Staub, den Boden düngend, da aber ist auch schon wieder neues Grün vorhanden, das in zwei Tagen die normale Höhe erreicht.
Ein überraschender Anblick wartete ihrer. Unvermutet waren sie hinter den letzten Bäumen hervorgetreten, und in dichter Nähe vor ihnen weidete eine große Herde Zebras, zwischen ihnen die schier unvermeidlichen Strauße; denn diese beiden Tierarten halten in Afrika fast regelmäßig zusammen. Das Zebra benutzt den langhalsigen Vogel als scharfsichtigen Wächter, der Strauß wiederum fühlt sich zwischen den starken, mutigen Zebras vor manchem Raubtier sicher.
Beim Hervortreten der Menschen freilich stob die ganze Herde, wohl aus hundert Köpfen bestehend, in wilder Flucht davon.
»Da haben wir es!«, rief Juba. »Der Zirkus hatte auch eine stattliche Anzahl Zebras und Strauße, die Osborne mit erwarb!«
»Da haschen Sie sich ein Zebra und zeigen Sie, dass Sie es zureiten können. Ich bitte um einen gut eingerittenen Strauß!«
»Nun, glauben Sie, dass man Strauße reiten kann?«, »Ich habe es gehört, dass in einigen Gegenden Afrikas Strauße geritten werden. Besorgen Sie mir nur einen kräftigen Vogel, über den ich meine Beine hängen kann. Meinetwegen kann er auch — nanu!«
Etwas erschrocken hatte es Georg hervorgestoßen. Wenn einem in solch einer weltverlassenen Gegend plötzlich von hinten der Hut vom Kopfe genommen wird, soll man wohl auch erschrecken.
Und wie sich Georg schnell umkehrte, hätte er eigentlich noch mehr erschrocken, bis zum Tode entsetzt sein sollen. Hinter oder jetzt vor ihm stand ein mächtiger Elefant, sogar ein Riese unter diesen mächtigen Dickhäutern, von fast weißer Farbe, den Kopf etwas zurückgeneigt, soweit das einem Elefanten möglich ist, das Maul mit den gewaltigen Stoßzähnen halb geöffnet, und in dem Greifapparat des ganz in die Höhe gehaltenen Rüssels Georgs Hut!
Ja, da kann man wohl erschrecken.
Nun aber tat das Georg gerade nicht!
»Moiiin!«, sagte er ganz trocken und unverfroren. Eigentlich hatte er ja auch ganz recht. Ausreißen konnte hier nicht viel helfen.
Freilich hatte er dieses abgekürzte »Guten Morgen« wohl nicht so recht mit voller Besinnung gesagt.
Oder doch?
Mindestens kam es ihm jetzt zum Bewusstsein, dass diese Sachlage nun einmal nicht zu ändern war, und da konnte er nun auch gleich fortfahren.
»Moiiin! Du alter Schneesieber, gib mir mal meinen Hut wieder her.«
Richtig, gehorsam senkte der Elefant den Rüssel, Georg konnte ihm den Hut abnehmen und ihn sich wieder aufsetzen
»I Du kleiner Schäker, Du hast wohl ein Späßchen mit mir machen wollen?«
Das Ungeheuer hob den rechten Vorderfuß. Georg griff einfach zu.
»Moiiin, moiiin!«, sagte er, den ungeheuren Fuß kräftig schüttelnd, soweit Menschenkraft solch einen mächtigen Elefantenfuß schütteln kann. »Freut mich sehr, Sie wiederzusehen.«
Dann aber, während der Elefant mit ausgestrecktem Vorderfuß stehen blieb, blickte Georg erst einmal nach seinem Freunde, wortlos, nur in den Augen mit der Frage: »Was sagen Sie denn dazu?«
Juba stand wie eine Bronzefigur da.
»Ein gezähmter Elefant!«, sagte er jetzt.
»Ja natürlich. Von jener Menagerie stammend.«
»Ausgeschlossen!«
»Was ist ausgeschlossen?«
»Noch kein weißer Elefant ist nach Europa oder Amerika gekommen. Es ist ein indischer, und die Inder geben doch nicht etwa solch ein heiliges Tier her, am wenigsten eines von solch heller Farbe. Der ist ja wirklich ganz weiß zu nennen! Was hat der übrigens an seinen Zähnen?«
Er trat näher, Georg brauchte es nicht erst zu tun, bemerkte es aber doch erst jetzt.
Die beiden gewaltigen Stoßzähne waren über und über mit ziemlich tief eingeschnittenen Hieroglyphen bedeckt.
»Das sind Buchstaben des Sanskrit!«, sagte Juba. »Ich kann zwar kein Sanskrit, aber ich weiß, dass solche weiße Elefanten in ihre Stoßzähne Sprüche aus den heiligen Büchern der Inder eingeschnitten bekommen. Inder, mit denen ich verkehrt, haben mir genug davon erzählt. Dieser weiße Elefant stammt aus einem indischen Tempel.«
»Wie kommt der hierher?«
»Was weiß ich?«
»Richtig, es war eine dumme Frage von mir. Weshalb aber hebt er immer den Vorderfuß? Will er Pfötchen geben?«
»Er ladet uns ein, seinen Rücken zu besteigen.«
»Ach so! Richtig, so werden ja alle Reitelefanten dressiert.«
»Aber das wundert mich sehr.«
»Weshalb?«
»Heilige weiße Elefanten werden sonst niemals zum Reiten benutzt.«
»Daraus ersehen Sie, dass er schon in anderer Dressur gewesen ist.«
»Oder er gehört zu einem indischen Tempel, zu einer Sekte, die über das Reiten eben anders denkt.«
»Na, da wollen wir einmal aufsteigen.«
Und Georg schwang sich auf den ausgestreckten Fuß, schwang sich höher bis zum Rücken hinauf, setzte sich rittlings dicht hinter die Ohren.
Es gehörte aber ein tüchtiger Turner dazu, um das fertig zu bringen! Selbst die indischen, professionellen Elefantenreiter brauchen einen Haken dazu, sonst kommen sie nicht hinauf; für die anderen wird eine Leiter angelegt.
»Waffenmeister, was wollen Sie tun?«
»Auf diesem Elefanten reiten.«
»Können Sie einen Elefanten lenken?«
»Ich? Nee. Ich will mal sehen, wohin dieser Elefant mich lenkt.«
»Wir müssen vorsichtig sein!«
»Weshalb?«
»Es könnte hier doch noch ein bevölkerter Tempel existieren, mit fanatischen Priestern, das Tier könnte uns hinbringen.«
Georg machte es kurz.
»Juba, entweder kommen Sie mit oder Sie bleiben unten; dann reite ich allein davon.«
Da schwang sich auch Juba hinauf, setzte sich hinter seinen Freund.
»Hotte hüh, Schimmel!«, kommandierte dieser.
Sofort setzte sich der Elefant in Gang, nahm seinen Weg durch die Prärie.
Georg ließ ihm freien Lauf, hätte auch gar nicht gewusst, wie er ihn lenken sollte. Er hatte wieder die Hände in die Hosentaschen gesteckt, den Hut im Nacken und den Knüppel unterm Arm. So saß er seelenvergnügt hinter den Ohren auf dem Halse des Ungetüms.
»Bin doch gespannt, wo der uns hinbringen wird.«
Der Elefant, immer im Tritt gehend, strebte über die Savanne einem der isolierten Berge zu, hatte ihn nach einer Viertelstunde erreicht, umging ihn, und da sahen die beiden schon das offenbare Ziel.
Der Eingang zu einem buddhistischen Höhlentempel! Man braucht einen solchen nur einmal bildlich gesehen zu haben, um ihn immer wieder zu erkennen, und in der Bibliothek der »Argos« befand sich das Prachtwerk von Frederic Algot, der sechsundvierzig indische Höhlentempel beschreibt und bildlich wiedergibt, und Georg war in Bombay gewesen und hatte den Höhlentempel auf der Insel Elephantine besucht.
Er ist bei weitem nicht der größte, aber schon da steht man staunend und fragt sich, wie Menschenhände so etwas geschaffen haben können, alles aus dem Felsen herausgehauen, nur mit Hammer und Meißel! Gegen einen einzigen solcher indischen Höhlentempel, wenn man die herausgeschaffte Kubikmasse berechnet, verschwinden alle unsere modernen Tunnelbauten! Und nun diese Kunst dabei, diese Säulen, diese zahllosen Figuren, die man dabei hat stehen lassen! Also nicht draußen gefertigt und dann hineingetragen, sondern das ist noch derselbe ursprüngliche Felsen, an dem der Meißel vorübergeglitten ist.
Alle diese Höhlentempel haben drei Eingänge. Das heißt, der einzige Haupteingang hat immer drei Portikusse, er ist durch zwei Säulenreihen in drei Teile geteilt, und stets steht davor linkerhand noch eine einzige schlichte Säule.
Was diese Säulenanordnung in bezug auf Gottheiten bedeuten soll, das sei hier nicht weiter erklärt, das würde zu weit führen, es mag nur angedeutet werden, dass diese einzige linke Säule bei jedem indischen Hause und jeder Hütte, in der ein Shiva-Verehrer wohnt, durch einen einfachen Pfahl vertreten ist, der täglich mit heiligem Kuhmist eingesalbt wird.
So war es auch hier. Zwei Säulenreihen in dem mächtigen Tore, links davor eine einzige Säule. Der Tempel war verlassen, sonst wäre diese einzige Säule und die vorderen der anderen nicht mit Schlingpflanzen überwuchert gewesen. Erst wo das Sonnenlicht nicht mehr hindrang, hörte die Vegetation auf.
»Oder doch nicht mehr von Priestern bewohnt, die ihn in Ordnung halten, wollen wir lieber sagen!«, meinte Georg.
Der Elefant war vor dem Portale stehen geblieben, etwas rechts davon, vor einem kleinen Bassin, mit klarstem Wasser gefüllt, ziemlich tief, uneingefasst, wie man etwa solche Wasserlachen oftmals in Steinbrüchen findet. Auch dieses Wasserbassin gehört mit zum indischen Höhlentempel, es ist gewissermaßen das Weihbecken, wenn auch nicht überall vorhanden.
Also vor diesem Bassin war der Elefant stehen geblieben und hob den linken Vorderfuß.
»Absteigen? Hm. Sage mal, mein liebes Tierchen, kannst Du denn nicht —«
In diesem Augenblick dachte Georg an etwas.
Man saß doch in einer ganz beträchtlichen Höhe, auch für einen gewandten Turner sah es gar nicht so einfach aus, beim Abgleiten gerade auf den ausgestreckten Elefantenfuß zu kommen, man kann sich dabei leicht eine Beinverstauchung holen.
Und Georg hatte abgerichtete Elefanten gesehen, in Indien, nicht zu Kunststückchen dressiert. Der Elefant lässt sich auch noch anders besteigen und wieder verlassen. Er kniet auch auf Kommando nieder. Mit welcher Leichtigkeit das dieser nur scheinbar so plumpe Dickhäuter tut, ist ja bekannt. Und Georg hatte mehrmals gesehen, wie der betreffende Elefant dazu nur einen kräftigen Schlag auf den Kopf bekommen hatte, dann war das Tier sofort in die Knie gegangen, erst in die vorderen, dann in die hinteren.
Daran also hatte Georg gedacht, und da hatte er dem Elefanten auch schon eins mit der Faust auf den Kopf gegeben; sehr rücksichtsvoll braucht man dabei ja nicht zu sein.
Richtig, sofort knickte auch dieser weiße Elefant gehorsam vorn zusammen.
Und in demselben Moment schoss Georg über den Kopf des Tieres hinweg, machte einen eleganten Hechtsprung — also kopfüber — in das Wasserbassin hinein.
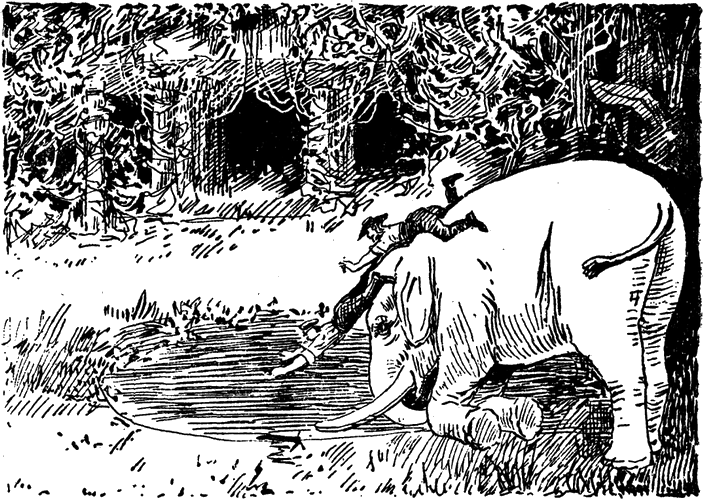
Und wie er wieder auftauchte, da plätscherte auch schon sein treuer Begleiter neben ihm.
»I, Peitschenmüller, was machen Sie denn hier in dem Wasserbassin?! Oder ziehen Sie sich denn nicht wenigstens vorher aus, wenn Sie ein Bad nehmen wollen?!«
»Zum Henker noch einmal«, pustete Juba, »mit solchen Überraschungen verschonen Sie mich! Sagen Sie es wenigstens vorher, wenn Sie einen Elefanten niederknien lassen wollen!«
Lachend kletterten die beiden wieder aufs trockene. Ihr Reittier war schon damit beschäftigt, seitwärts aus den Felsenspalten würzige Kräuter zu rupfen und zu verspeisen.
»Na, da wollen wir einmal diesen alten Höhlentempel besichtigen.«
Wer ihn angelegt, darüber sprachen die beiden jetzt nicht.
Es hätte auch wirklich keinen Zweck gehabt, und die Hauptsache wussten beide, nämlich dass alle diese Sunda-Inseln, die großen wie die allerkleinsten, ganz mit riesenhaften Bauten übersät sind, die man, in Ruinen liegend oder noch wohlerhalten, nur unter den Schlingpflanzen zu finden wissen muss. Da kann es einem aber so gehen wie einem holländischen Kaufmann, der seine Villa in der dichten Nähe von Batavia hatte, etwas hoch gelegen, inmitten von Obstkulturen, schon sein Großvater hatte hier ständig gewohnt, und vor kurzem entdeckte dieser Mann, dass sich unter seinem Kartoffelkeller ein mächtiger Höhlentempel erstreckt, der gegen zweitausend Steinfiguren enthält, in Überlebensgröße.
Und eben jetzt wieder hat man auf einigen kleinen Karolinen-Inseln — deutsches Gebiet — ungeheure Bauten entdeckt, ganz offen zu Tage liegend, wohlerhalten.
Mit unserer Menschheitsgeschichte, die wir uns zurechtgezimmert haben, ist es eben nichts! Widerwillig muss die exakte Wissenschaft endlich anerkennen, dass die phantastischen Okkultisten, die mit prophetischem Blick in die Vergangenheit schauen, doch recht behalten; nämlich dass es schon vor jener Zeit, da wir den Urmenschen auftreten lassen wollen, ganz gewaltige Völker mit der höchsten Kultur gegeben hat. Die alten Ägypter, sechstausend vor Christi, mögen die letzten Reste dieser dem Untergang geweihten Menschenrasse gewesen sein, und hier in Indien haben sicherlich buddhistische Sekten erst wieder aus den Ruinen dieses verschwundenen Geschlechtes gebaut oder noch Vorhandenes benutzt, das ist aber für unsere Kultur nun auch schon wieder verschwunden!
Und wenn die modernen Propheten recht behalten, dann ist in zwei- bis dreitausend Jahren ganz Europa wieder mit Urwäldern bedeckt, in denen Mongolen der Jagd auf Pelztiere obliegen. Erst aber musste Juba Riata noch einmal Feuer schaffen, unterdessen suchte Georg nach trockenen Ästen, die als Fackeln geeignet waren; denn aus dem Hintergrunde des Portals gähnte es ihnen schwarz entgegen.
Mit einer brennenden Fackel und noch einem genügenden Vorrat, drangen sie ein.
Der Feuerschein jagte Fledermäuse und andere fliegende Säugetiere, an denen gerade die Sunda-Inseln so reich sind, bis zur Größe eines Fuchses, ins Freie; doch war die Anzahl von Nachttieren, die hier hausten, nur mäßig, sie mochten anderswo noch bessere Schlupfwinkel in Masse finden.
Eine weite Halle, rechteckig gehalten, die ungewölbte Decke von stehen gelassenen Säulen abgestützt, auch überall an den Wänden eine Säule dicht neben der anderen, aber nur von halber Höhe, auf ihnen menschliche Figuren in Lebensgröße, Männlein und Weiblein, in möglichst obszönen Stellungen, so wie immer in diesen indischer Tempeln. Es gehört mit zur Religion. Es verherrlicht die Schöpfungskraft. Dann weiter hinten in der Mitte der stets vorhandene runde Kuppelbau, eine Art Kiosk, in dem man sich die Gottheit, welcher der betreffende Tempel speziell geheiligt ist, wohnend dachte, es heute noch tut. Er hat niemals einen Eingang, braucht ihn auch gar nicht zu haben, denn er enthält überhaupt keinen Raum, es ist voller Felsen, in dem die Gottheit wohnt, die doch natürlich den Stein durchdringen kann.
Zwischen den Wandsäulen führte hier und da ein Gang ab, in den Felsen hinein.
»Wohin mögen diese Gänge führen?«, fragte Juha Riata.
»Nun nach den Nebenräumen, nach den Priesterwohnungen und dergleichen!«, entgegnete Georg. »Mit solch einem Tempel war und ist ja immer noch vielerlei verbunden, meist auch ein Tierasyl, in welchem die brahmanischen und buddhistischen Priester — eine sehr lobenswerte Sitte — alle kranken Tiere, die ihnen gebracht werden, aufnehmen, um sie zu kurieren, aber die sie dem Besitzer niemals wieder ausliefern! Diese Tiere, ob nun Kanarienvogel oder Hund oder Pferd, werden dann bis an ihr Lebensende verpflegt. Wollen wir einmal hier in diesen ersten besten Gang eindringen?«
»Aber nicht weiter, als bis höchstens die Hälfte unserer Fackeln verbraucht worden ist!«, sagte der besonnene Juba.
»Selbstverständlich nicht.«
»Na — das ist bei Ihnen gar nicht so selbstverständlich!
Gesetzt den Fall, die Hälfte der Fackeln ist verbraucht und Sie sehen vor sich gerade etwas recht Interessantes — Sie würden doch nicht gleich den Rückweg antreten, sondern erst noch ein bisschen herumfackeln. Da kenne ich Ihren Charakter schon gut genug, aber das gibt's nicht bei mir!«
»Nein, Juba, ich werde mich ganz Ihren Anordnungen fügen, obgleich ich weiß, dass Sie auch im Finstern den Weg zurückfinden würden.«
»Da irren Sie sich! Da trauen Sie meinen Sinnen zu viel zu. Ja, so lange geschlossene Räume erleuchtet sind, kann ich mich niemals in der Richtung täuschen, auch im verwickeltsten Labyrinth würde ich den einmal begangenen Weg zurückfinden, dasselbe gilt im Freien für die schwärzeste Nacht — aber in finsteren geschlossenen Räumen verlässt mich mein Orientierungssinn vollkommen.«
Eine Erscheinung, die man bei allen mit den schärfsten Sinnen ausgestatteten Naturmenschen konstatiert hat. Solche wilde und halbwilde Jäger können auch im geschlossenen Raume jederzeit die Himmelsrichtungen angeben, man mag sie noch so kreuz und quer und in Windungen geführt haben. Das ist ganz erstaunlich! Das hört aber sofort auf, wenn man ihnen während des Ganges die Augen verbunden hat oder wenn sie also durch finstere Räume gekommen sind. Hierüber sind schon die genauesten Untersuchungen angestellt worden.
»Na, wir werden uns schon wieder herausfinden, vorausgesetzt, dass wir wirklich in ein Labyrinth kommen.«
Ja, ein solches war es, in das sie drangen. Insofern, als immer einmal rechts und links ein Gang abzweigte, der Haupttunnel sich spaltete, und dass es keine Merkmale gab, nur nackte Felswände, und das nennt man doch wohl ein Labyrinth.
Juba Riata schlug möglichst immer eine östliche Richtung ein, die ursprünglich begonnene. Dann kam eine Treppe, ein Absatz, immer wieder hinaufführende Treppen, bis ihnen das Tageslicht entgegenschimmerte, dann die goldene Sonne.
Durch eine unverschließbare Felsentüre traten sie auf eine Art von Altan, mit gemauerter Brüstung versehen, und hatten einen herrlichen Anblick.
Auf dieser Seite, die sie vorhin bei dem Elefantenritt nicht umgangen waren, fiel der Berg ganz steil ab, also eine fast glatte Felswand, und unter ihnen in einer Tiefe von wenigstens hundert Metern, lag weit ausgebreitet eine Ruinenstadt.
Alles mit Vegetation bedeckt, überwuchert, selbst auf den Dächern wuchsen stattliche Bäume, trotzdem aber konnte man doch immer noch die ehemalige Stadt ganz deutlich erkennen, auch wie die zum Teil mächtigen Bauwerke gar nicht so sehr zerfallen sein konnten. Nur die Wurzeln der größeren Pflanzen hatten viel auseinandergesprengt, sonst aber durfte man nicht eigentlich von Ruinen sprechen.
»Sapristi, was ist das?!«, Juba Riata hatte es gerufen, und auch Georg drehte sich gegen die Felswand um, gegen die Tür, aus der sie getreten.
Ja, das war allerdings etwas ganz Überraschendes, was sie da erblickten.
Der Balkon, ursprünglich sicher eine natürliche Schöpfung, ein Vorsprung, war ungefähr sechs Meter lang und vier breit. Die Tür befand sich an der einen Ecke, und in der anderen Ecke nun war in der Felswand eine kleine Grotte, wie eine hohle Halbkugel, ungefähr einen Meter hoch und also ebenso tief, und in dieser kleinen Grotte nun zeigte sich das Rätsel.
Der Boden der Grotte, in welche die Morgensonne schien, war mit feiner Erde belegt, bunte Steinchen bildeten Figuren, man erkannte gleich, dass das Ganze einen Garten vorstellen sollte, die Blumenbeete waren eben durch Steinchen von allen Farben imitiert, ganz echt dagegen waren die Pfirsich- und Orangebäumchen, welche die Wege einfassten, mit Blüten, halbreifen und ganz reifen Früchten, nur dass solche Bäumchen sonst gar nicht in der Natur vorkommen, denn sie waren höchstens anderthalb Spannen hoch; und dennoch waren es ganz echte, natürliche Pfirsich- und Orangenbäume
»Ein chinesischer Miniaturgarten!«, riefen die beiden wie aus einem Munde.
Dies bedarf einer Erläuterung. Die Chinesen haben im Gartenbau und in der Pflanzenkultur etwas los durch ihre vieltausendjährige Erfahrung, durch ihre ganze Tüftelei, verbunden mit unsäglicher Geduld, worin ja jeder Chinese groß ist. Aber wie in allen Künsten, so fallen sie auch hierbei ins Bizarre, ins Extreme. Aus einem gewöhnlichen Rettich ziehen sie — durch jahrhundertlange Überkultur — einen zentnerschweren Riesenkopf, und große Bäume lassen sie zwerghaft verkrüppeln.
Am besten scheint sich hierzu der Pflaumenbaum zu eignen, den sieht man wenigstens am häufigsten in solchen Miniaturexemplaren.
Der Theorie nach ist die Sache ganz einfach.
Von einem alten, möglichst kleinen Pflaumenbaum wird die kleinste, aber tadellose Frucht ausgesucht; der Kern muss sich im Topfe zu einem fruchttragenden Baume entwickeln, bei sorgfältigster Pflege, nur dass immer die Entwicklung der Wurzeln verhindert wird. Dadurch und bei fortwährendem Topfwechsel entsteht ein viel kleinerer Baum, und die Hauptkunst liegt darin, ihn gesund zu erhalten und Früchte bringen zu lassen.
Von diesem kleinen Baume, der aber schon alt sein muss, wird die kleinste, kerngesunde Frucht gewählt, der Kern wird in noch kleineren Töpfen zu einem noch kleineren Bäumchen gezogen.
Und so geht es weiter, bis man ein spannenhohes Bäumchen gezogen hat, das erbsengroße Pflaumen hervorbringt. Und das ist nicht etwa mit so einem Schössling zu vergleichen, der unter günstigen Umständen auch einmal Früchte tragen kann, sondern es ist ein richtiger Pflaumenbaum, mit sich weit ausbreitenden Zweigen, nur eben in Miniaturausgabe, nur von Spannenhöhe. Übrigens gibt es auch eine besondere Behandlungsweise, wodurch nur der Baum selbst so zwerghaft wird, die Früchte aber behalten die ursprüngliche Größe.
Das ist aber nun leichter gesagt als getan. An der Erzeugung solch eines Zwergbäumchens arbeiten viele Generationen! Es soll einige hundert Jahre dauern! Natürlich wird nicht immer nur ein einziger Kern genommen, sondern man experimentiert im Anfange mit Hunderten, die Hälfte missglückt gleich im Beginn, immer mehr Bäumchen gehen ein oder tragen keine Früchte mehr, bis der Ururururenkel froh ist, wenn er nur ein einziges spannenhohes Bäumchen mit jährlich reifen Früchten hervorgebracht hat. Es gehört chinesische Geduld dazu, dann ist auch ein Geheimnis dabei, wenn dieses auch nur in Erfahrung bestehen mag.
Solch ein tadelloses Zwergbäumchen wird dann von einem reichen Chinesen zu einem horrenden Preise gekauft, die letzte armselige Schluckerfamilie, die es Tag und Nacht behütet hat, wird für die Bemühungen einer ganzen Ahnenreihe bezahlt. Ist der Käufer ein Fürst oder hat er sonst die Macht dazu, so erhebt er den Mann auch gewöhnlich in den Adelsstand oder gibt ihm eine auskömmliche Beamtenstelle.
Aber nicht genug, dass der Liebhaber nun das Töpfchen mit dem Bäumchen hinsetzt und sich ab und zu an seinem Anblick weidet. Wenn er es sich leisten kann, so legt er sich eine ganze Sammlung von solchen Zwergbäumchen an, ordnet sie, und so entsteht daraus der chinesische Minaturgarten, der seinen Platz im sonnigen Zimmer auf einem Tische findet. Das heißt auf einem Gestelle von Gold und Elfenbein; denn wer sich solch einen Garten zulegen kann, dem kommt es dann auch auf den Rahmen, auf die Stellage nicht an. Solch ein winziger Garten kostet Hunderttausende, wenn nicht Millionen. Und was ist weiter dabei? Bei uns in Europa, besonders in England, werden doch für Rosen und mehr noch für Orchideen fabelhafte Preise bezahlt. Richtiger aber vergleicht man diese Liebhaberei mit unseren Gemäldesammlungen. Und zahlt ein schwerreicher Kunstfreund für einen Rembrandt oder sonst einen alten Meister nicht auch gleich einige hunderttausend Mark bar auf den Tisch? Von Gemälden weiß der Chinese nichts, der liebt wieder solche winzige Gärtchen.
Im britischen Museum sind einige solcher chinesischen Miniaturgärtchen ausgestellt. Reizend! Sie haben auf einem gewöhnlichen Ausziehtische Platz. Die Blumenbeete sind durch farbige Gläser markiert, die Wege mit Goldsand bestreut, kleine Teiche und Flüsschen mit richtigem Wasser, winzige Brückchen führen hinüber, winzige Pavillons und dergleichen mehr, was zu einem Garten gehört. Auch die Büsche und Sträucher sind imitiert, aber die winzigen Bäume sind echt! Nur sind sie sämtlich eingegangen. In den achtziger Jahren war einmal ein Gärtchen mit grünenden und sogar blühenden Pflaumenbäumchen zu sehen, frisch aus China importiert, aber auch sie verloren bald die Blätter, gingen ein. Es muss doch wohl noch ein besonderes Geheimnis dazu gehören, um diese Bäumchen auch zu erhalten, und das verraten diese Züchter, eine Kaste bildend, nicht.
Solch ein chinesisches Miniaturgärtchen lag also auch hier vor.
Das hatten die beiden weltbewanderten Freunde sofort erkannt und es gleichzeitig ausgesprochen, als sie nur den ersten Blick darauf geworfen.
Nun muss es aber noch näher beschrieben werden, denn mit den Bäumchen und den bunten Steinchen allein war es noch nicht getan.
Also hier waren es einmal zwerghafte Pfirsich- und Orangenbäume, welche den Baumbestand bildeten, höchstens anderthalb Spannen hoch, erstere mit erbsengroßen, letztere mit haselnussgroßen Früchten, teils ganz reif, teils halbreif, und derselbe Baum trug dann auch schon wieder Blüten, wie es solche Obstbäume in tropischen Breiten, wenn ihre Akklimatisation einmal gelungen ist, immer tun.
Die zwischen den mit farbigen Steinen markierten Blumenbeeten hinführenden Wege waren ebenfalls mit Goldsand bestreut.
Auch das Wasser durfte bei einem chinesischen Garten natürlich nicht fehlen.
Aus einem Löchelchen in der Felswand stürzte ein kleiner Wasserfall herab, der dann als Bach durch den Garten floss, in der Mitte einen Teich bildend, in dem wieder auf einem Inselchen das unvermeidliche Entenhäuschen lag, alles wunderhübsch ausgeführt. Über den Bach führten an zwei Stellen Brückchen. Dann ein Pavillon. Und um nun den Eindruck zu verstärken, als ob hier wirklich Menschen hausten, den Dimensionen dieses Gärtchens entsprechend, war vor dem Pavillon ein Tischchen mit zwei Stühlen aufgestellt, aber alles im chinesischen Genre, darauf stand ein Teeservice mit winzigen Tässchen und was sonst noch dazu gehört. Nicht einmal die Tabakspfeifen fehlten, die ja schon in Wirklichkeit bei den Chinesen klein genug sind, der Kopf nur von der Größe eines Fingerhutes. Diese Pfeifen hier brachte man am besten unter das Vergrößerungsglas.
Wir haben ganz ähnliche Spielereien — wobei auch alles ganz getreulich ins Zwerghafte übertragen wird übrigens auch bei uns einfach Puppenstuben oder ganze Puppenhäuser mit voller Einrichtung. Solche Puppenstuben kennt der Chinese nicht, er überträgt aber dasselbe auf den Garten, macht also einen Puppengarten daraus, jedoch nicht als Spielzeug für Kinder, sondern auch der würdevollste Mandarin hat an so etwas seine Freude.
Noch sei erwähnt, dass durch ein zweites Löchelchen in der Felswand der Bach den Garten wieder verließ, und in der Mitte zwischen diesen beiden Wasserlöchern befand sich eine größere Öffnung, auch etwa anderthalb Spannen, also dreißig Zentimeter hoch und zehn Zentimeter breit, mit Säulchen eingefasst, an denen sich zierliche Schlingpflanzen hinaufrankten, also den Zugang zu diesem Garten bildend, der auf seiner freien Seite mit einer hohen Mauer umgeben war, das heißt auch nur wieder anderthalb Spannen hoch. Für solch einen Luxusgarten natürlich keine einfache Mauer, sondern wiederum aus farbigen Steinen ausgeführt, die Mosaikmuster bildeten.
»Ein chinesischer Miniaturgarten!«, hatten die beiden wie aus einem Munde gerufen.
Juba Riata, der ja schon früher die Frau Helene Neubert auf ihren Weltreisen begleitet, hatte solche bei vornehmen Chinesen zu sehen bekommen. Georg war noch viel weiter in der Welt herumgekommen, aber der einfache Seemann hatte niemals Zutritt in solche reiche Häuser gehabt, er hatte nur die Muster im britischen Museum gesehen.
»Sind diese Bäumchen aber auch echt?«, war Jubas nächste Frage.
Ja freilich, da gibt es auch Imitationen, aus Wachs oder einer sonstigen Masse, für solche Liebhaber, die keine Hunderttausende für derartige Zwergbäumchen bezahlen können. Und auch bei diesen Imitationen liegen so wie hier abgefallene Früchte und weiße und rote Blüten am Boden.
Juba pflückte von den Bäumchen Blätter ab, Früchte, kostete sie.
»Wahrhaftig, das sind echte Zwergbäumchen!«
»Und dieser Garten wird doch zweifellos in Ordnung gehalten«, setzte Georg hinzu, »die Wege sind doch geharkt!« Die beiden blickten sich an, sahen sich scheu um und blickten sich wieder an.
»Hier sind Menschen, welche diesen Garten pflegen!«
»Wenigstens mit einem haben wir zu rechnen.«
»Oder sollten etwa gar — ach, das ist ja Unsinn.«
»Was wollen Sie sagen?«, fragte Juba. »Sprechen Sie es nur ruhig aus.«
»Mir stieg der wahnwitzige Gedanke auf, in diesem Gärtchen könnten Liliputaner hausen.«
»Was sind das, Liliputaner?«
So gebildet er auch sonst sein mochte, es war diesem ehemaligen Cowboy nicht zu verargen, dass er »Gullivers Reisen« nicht gelesen, noch nichts davon gehört hatte.
Es dürfte überhaupt gar nicht so viel geben, die Swifts Originalwerk gelesen haben. Immer nur Auszüge für Kinder.
Georg erklärte es ihm kurz, spannenhohe Menschlein, Däumlinge.
»Nun«, meinte Juba, »an solche winzige Menschlein möchte ich ja allerdings zweifeln, aber ich selbst habe in Singapore gesehen, wie in solch einem Gärtchen — da kommen sie ja schon!«
Aus dem Felsenlöchelchen, in dem der Bach wieder verschwand, kam eine Schar Entchen herausgeschwommen, den Dimensionen dieses Gärtchens entsprechend, ungefähr so groß wie Zaunkönige, aber sonst ganz richtige Enten, entweder ganz weiß oder in allen Farben schillernd.
Georg war ja erst außer sich vor Staunen, aber er beruhigte sich bald, und wir wollen gleich erledigen, worüber sich dann die beiden ausführlich unterhielten. Wir tun unrecht, die Chinesen ob ihrer Verkrüppelungskunst zu bewundern. Wir Europäer haben in Sachen der Zucht ins Riesenhafte und ins Zwerghafte doch noch viel, viel Erstaunlicheres geleistet. Man denkt nur nicht immer daran, weil es uns eben etwas ganz Geläufiges ist.
Abgesehen von der Pflanzenkultur. Wir wollen gleich mit der Tierzucht beginnen.
Die natürlichen Hundearten, die sich als konstant erwiesen haben, auch bei den verschiedensten Kreuzungen immer wieder als »echt« zum Vorschein kommen, sind in ihrer Anzahl gar nicht so groß. Die kleinste Art ist der Dachshund, die größte der Schäferhund.
Nun bedenke man, was wir alles aus den Hunden gemacht haben, wie wir deren Umwandlung in unsere Macht bekommen haben! Man nehme den riesenhaften Neufundländer und den zwerghaften Seidenhund an. Beide sind ein und dieselbe Art! Beide sind die gleiche Kreuzung vom Pudel und dem jetzt nicht mehr existierenden Pariser Fleischerhund. Die Umwandlung ins Zwerghafte wird durch Innenzucht erzielt, durch ständige Kreuzung enger Blutsverwandtschaft, wobei aber das Kunststück darin besteht, die sonst schädlichen Folgen solcher Innenzucht zu vermeiden, die Bastards gesund und fortpflanzungsfähig zu erhalten.
Fürwahr, wir haben aus den uns von der Natur gegebenen Hunderassen — und der Ursprung ist eigentlich ja nur der Wolf — etwas gemacht, worüber unsere Urahnen wie über Zauberei staunen würden. Und ist es nicht auch schon erstaunlich, wie unsere Spezialzüchter Pferde, Rinder, Schafe, Tauben, Hühner, Enten, Kaninchen usw. nach und nach verändern, sie teils immer größer, teils immer kleiner werden lassend, oder wie sonst Sport oder praktische Ausnutzung es wünscht?
Aber alle diese Zuchtversuche sind noch ganz neuen Datums, vor hundert Jahren hat sich noch niemand darum gekümmert, mit Ausnahme in bezug auf den Hund, dessen Zucht wird auch in Europa schon seit Jahrtausenden kultiviert, und das ist es eben, deshalb gerade beim Hunde solche großartigen Erfolge.
Und dabei beginnen wir erst jetzt richtig zu erkennen, was sich da noch für unbegrenzte Möglichkeiten eröffnen! Gibt uns denn die Natur nicht selbst Fingerzeige, was alles noch möglich ist? Noch ums Jahr 1870 hat Doktor Alfred Brehm bezweifelt, dass Maultiere fortpflanzungsfähig sind, hält Erzählungen von solchen Geburten für Fabeln. Noch vor zehn Jahren hielt man es für ganz ausgeschlossen, dass Löwe mit Tiger Blendlinge erzeugen können. Heute ist beides eine ganz alltägliche Geschichte.
Hat denn aber die Natur nicht selbst einen echten Blendling zwischen Hund und Katze geschaffen, den Leoparden? Hat nicht das australische Schnabeltier einen ganz richtigen Entenschnabel? Ja, dieses rätselhafte Säugetier legt sogar Eier, aus denen seine Jungen hervorgehen! Diese ehemalige Fabel ist jetzt als Tatsache konstatiert worden! O, niemand von uns ahnt, was in hundert Jahren solche Zuchtversuche gezeitigt haben können, wenn wir die Winke der Natur befolgen werden!
Und wie wir uns seit alten Zeiten her speziell auf die Zucht des Hundes geworfen haben, so die Chinesen sich auf die der Enten. Es ist ihre größte Liebhaberei. Aber wiederum besteht ihr ganzer Ehrgeiz hierin, möglichst kleine Enten zu erzielen, deren allerkleinstes die reichen Leute auf den Teichen ihrer Miniaturgärten schwimmen lassen.
Dass wir solche Zwergentchen von der Größe eines Sperlings oder gar eines Zaunkönigs nicht bei uns zu sehen bekommen, darüber dürfen wir uns nicht wundern. Das sind doch Kostbarkeiten, welche die reichen Leute wie Juwelen für sich behalten, solche lebende Raritäten lassen sich auch nicht so leicht wie Juwelen oder Gemälde in Museen oder anderswo ausstellen, und wahrscheinlich würden die äußerst empfindlich gewordenen Tierchen den Transport gar nicht vertragen, so wenig man in Europa die hummelgroßen Kolibris sieht, obgleich manche Gegenden von Amerika doch davon wimmeln.
Na, und wenn sich diese walnussgroßen Entchen nun auch bei uns einbürgerten, würden wir noch etwas Staunenswertes daran finden?
Die chinesische Zuchtkunst hat uns ja schon so etwas geliefert, man findet die Tiere in den ärmsten Familien und niemand denkt sich noch etwas Außergewöhnliches dabei.
Unsere Goldfische! Der Goldfisch ist ursprünglich ein Goldkarpfen gewesen oder eine Goldkarausche, ist es ja eigentlich heute noch. Jedenfalls ein großer Fisch von mindestens ein Pfund Schwere. Durch vieltausendjährige Zucht hat der Chinese aus diesem den heutigen Goldfisch gemacht, sein Gewicht auf das hundertfache herabgebracht und dementsprechend auch seine Größe.
Die Goldfische pflanzen sich auch nicht von allein fort. Allerdings ist keine künstliche Befruchtung nötig, wie dies etwa bei den Forellen geschehen kann, sie ist bei den Goldfischen überhaupt nicht möglich, sie müssen zur Selbstbefruchtung veranlasst werden, was aber höchst umständlich ist, es ist ein Geheimnis dabei, das jetzt meist von französischen Züchtern gehütet wird, und immer wieder einmal müssen neue Goldfische aus China bezogen werden.
Also wer staunt denn den Goldfisch im Wasserglase heute noch als ein Wunder der Zuchtkunst ins Zwerghafte an? Niemand. Weil es etwas Alltägliches ist. So ist eben der Mensch. So sieht er auch, wie die Raupe sich einspinnt, wie aus der Puppe ein Schmetterling hervorkriecht, ohne noch ein rätselhaftes Wunder darin zu schauen. Als Kuriosität sei noch erwähnt, dass ums Jahr 1750 ein englischer Seekapitän die ersten weißen Mäuse aus China mit nach Europa brachte, fünf Stück, sie dem englischen König Georg verehrte, und der war über diese wunderbaren, noch nie gesehenen Mäuse so entzückt, dass er den Kapitän durch Ritterschlag in den Adelsstand erhob. Nun wolle man einmal heute nach hundertfünfzig Jahren einem König fünf weiße Mäuse zum Präsent machen! Da käme man wahrscheinlich ins Irrenhaus. —
So hatten die beiden Freunde gesprochen, während sie die winzigen Entchen beobachteten.
Diese benahmen sich ganz wie ihre normalen Vettern, schwammen langsam stromaufwärts, putzten sich, schnatterten mit dünnen Stimmchen, schienen im Wasser etwas für menschliche Augen Unsichtbares zu fressen.
»Die müssen doch gefüttert werden!«, flüsterte Georg.
»Ja natürlich. Dass hier Menschen vorhanden sind, mindestens einer, darüber sind wir uns doch schon vorhin einig geworden.«
Georg wollte eben daran gehen, eines der Tierchen zu greifen, als er wie erschrocken die Hand zurückzog und dafür seines Freundes Arm packte.
Der hatte es auch schon gesehen.
Aus dem kleinen Felsentore war ein Figürchen getreten.
Ein winziger Mensch, wollen wir gleich sagen, kaum eine Spanne hoch.
Nur drei Sekunden war er zu sehen gewesen, dann war er wieder verschwunden.
Er hatte offenbar die beiden für ihn riesenhaften Menschen erblickt, war erschrocken, hatte sich blitzschnell umgewandt und sich mit einem Sprunge wieder in Sicherheit gebracht.
»Nun hört aber die Gemütlichkeit auf!«, flüsterte Georg ganz atemlos. »Juba, haben Sie's gesehen?!«
»Ich habe die Gestalt gesehen.«
»Das war ein Mensch!«
»Dem Anschein nach, ja.«
»Er hatte ein blaues Pumphöschen und ein rotes Jäckchen an.«
»Und auf dem Kopfe eine weiße Mütze mit gelber Troddel.«
»Ein richtiges Menschengesichtchen von gelber Farbe.«
»Ein echt chinesisches Gesicht.«
»Und in dem Händchen hatte er etwas wie eine Sichel.«
»Die habe auch ich bemerkt.«
So deutlich hatten die beiden das Figürchen gesehen, wenn auch nur für drei Sekunden.
»Na, nun könnte man aber doch gleich lang hinschlagen!«, fuhr dann Georg in seiner Weise fort. »Juba, halten Sie denn so etwas nur für möglich? Wir träumen doch nicht!«
»Nein, das tun wir nicht, und ich begreife nur nicht recht, worüber Sie denn so außer sich geraten.«
»Na, Juba, nun hören Sie aber auf! Ein Mensch, der nicht größer ist als ein normaler Bleistift!«
»Und schon zehn übereinandergesetzte Bleistifte dürften wohl die Länge eines normalen Menschen ergeben. Wenn wir Hunde züchten können, die nur den zwanzigsten Teil eines großen Köters wiegen, die Chinesen ebenso Enten und Fische, welche letztere sogar nur noch den hundertsten Teil des Gewichtes ihres Ahnherrn haben, weshalb soll es denn nicht auch einmal chinesischer Geduld gelingen, solche winzige Menschlein zu züchten?«
Ja, eigentlich hatte Juba Riata ganz recht. Es will einem nur so schwer in den Kopf hinein, bis man es einmal gesehen hat. Und dann will man's immer noch nicht recht glauben.
So wie es jetzt Georg erging.
Er hatte das winzige Menschlein mit eigenen Augen ganz deutlich gesehen und doch mochte er es nicht glauben.
So hat man auch Jahrhunderte lang an den Zwergvölkern Zentralafrikas gezweifelt, oder an dem Gorilla, hat alle Berichte von eigentlich sonst durchaus glaubwürdigen Augenzeugen als Fabeln verspottet — bis man solche metergroße Zwergmenschen und den ersten Gorilla nach Europa gebracht hat.
Das Menschlein ließ sich nicht wieder blicken. »Er hat uns erblickt, ist erschrocken, hat vor uns die Flucht ergriffen!«, sagte Georg, nun einfach mit der geschauten Tatsache rechnend. »Das verrät doch schon einen gewissen Grad von Intelligenz.«
»Nun, jede Fliege flieht auch, wenn man ihr mit dem Finger nahe kommt, deshalb braucht sie nicht gerade sehr intelligent zu sein!«, meinte Juba. »Da spricht für seine geistige Fähigkeit schon eher, dass er bekleidet gewesen ist.«
»Wenn Sie mich so korrigieren wollen, dann mache ich Sie darauf aufmerksam, dass man auch Äffchen kostümieren kann.«
»Er hatte eine Nadel in der Hand.«
»Die kann man einem Affen auch in die Hand gehen.«
»Worüber streiten wir uns eigentlich, Waffenmeister?
Verstecken wir uns und beobachten wir weiter, vielleicht kommt er wieder.«
Sie legten sich auf beiden Seiten der Grotte hin, sodass sie, wenn es nötig war, auch schnell den Kopf zurückziehen konnten, spähten über die kleine Mauer in den Garten hinein, nur noch ganz leise flüsternd, dabei aber auch den großen Haupteingang nach dem Balkon im Auge behaltend, um nicht etwa unangenehm überrascht zu werden.
Die Entchen ergingen sich nach wie vor im Wasser, die hatten sich nicht vor den großen Menschen gefürchtet.
Nicht lange währte es, so fiel den beiden auf, wie sich das bisher ganz klar gewesene Bächlein plötzlich zu trüben begann, eine milchige Farbe annahm, doch währte das nicht lange, so klärte sich das Wasser wieder.
Aber für die Entchen hatte das genügt. Mit Gier verschlangen sie das Wasser, oder das, wodurch dieses getrübt worden war, und folgten der letzten weißen Trübung auch hinaus, verschwanden also wieder durch das Felsenlöchelchen, durch das der Bach abfloss.
»Man hat etwas in das Wasser geschüttet, was den Tierchen sehr gut schmeckt«, sagte Juba, »so hat man sie wieder hinausgelockt.«
Wenn das so war, dann musste man aber auch die Hoffnung aufgeben, noch einmal den Liliputaner im Garten erscheinen zu sehen.
Jetzt erst wurden sie in dem Gärtchen etwas handgreiflich, überzeugten sich, dass die Porzellantässchen von dem Tische abzuheben waren, dass die Kanne zur Hälfte auch noch mit einer gelben Flüssigkeit gefüllt war.
»Das scheint richtiger Tee zu sein!«, meinte Georg. »Und diese farbigen Steine, welche die Blumenbeete markieren, sind echte Edelsteine, Rubine und Saphire und Smaragde und dergleichen!«, fügte Juba hinzu, sich mit diesen beschäftigend.
»Es stehen zwei Tässchen da; demnach hätten wir schon mit zwei solcher Liliputaner zu rechnen.«
»Und das ist auch echter Goldstaub, mit denen die Wege bestreut sind. Natürlich, bei solchen Miniaturgärtchen wird nicht gegeizt. Aber hier hinter dem Pavillon lehnt sogar die winzige Harke, mit der die Wege geharkt worden sind.«
»Und durch das Türchen des Pavillons sehe ich eine Art von Sofa — ach, wie niedlich!«
So tauschten sie gegenseitig die Resultate ihrer Untersuchungen aus.
»Ob wir nicht hinter diese Felswand in die Innenräume gelangen können?«, lautete dann die Frage.
Sie erhoben sich und verließen den Balkon, die Mitnahme ihrer Fackeln nicht vergessend. Noch ehe die Treppe wieder begann, führte ein Gang nach rechts ab, in dem aber schon wieder Finsternis herrschte
Die letzte brennende Fackel war natürlich schon längst erloschen. Doch jetzt war der erfahrene Hinterwäldler jederzeit imstande, sich Feuer zu verschaffen, er hatte die dazu geeigneten Holzstücke immer bei sich.
Nach drei Minuten brannte wieder ein kieniger Ast, sie drangen in den Felsentunnel ein, der nach jener Richtung führte, in der sich der Balkon mit dem Gärtchen befand, nur eben dass sie davon schon durch eine dicke Felswand getrennt waren.
Nicht lange währte es, so wurde der Tunnel immer niedriger und schmäler, sodass sie schon gebückt gehen mussten, ehe sie aber auf Händen und Füßen kriechen mussten, was dann auch notwendig war, wobei sie nur schlecht die Fackel brennen lassen konnten — der Qualm hätte sie ja erstickt — schimmerte ihnen Tageslicht entgegen.
Der vorankriechende Juba löschte die Fackel, jetzt musste der Weg wirklich auf Händen und Füßen fortgesetzt werden.
Da aber konnte er sich schon wieder aufrichten, gleich darauf auch Georg.
Die Überraschung war eine große.
Nach allem, was sie dort draußen Zwerghaftes gesehen, hatten sie doch auch hier mit ganz kleinen Dimensionen gerechnet, das letzte Kriechen auf Händen und Füßen hatte sie auch schon darauf vorbereitet. Statt dessen standen sie jetzt in einer ungeheuren Halle, die ihr Licht teils aus seitlichen Felsenspalten erhielt, teils von einer großen Öffnung an der Kuppeldecke, die mit einem Fenster von Milchglas geschlossen zu sein schien.
Die weite Halle, deren Durchmesser sich nicht so leicht abschätzen ließ, war eingerichtet, möbliert. Aber es dauerte einige Zeit, ehe sich die beiden zurecht gefunden, ehe sie diese Möblierung erkannt hatten.
Und dann fühlten sie sich förmlich ganz zusammenschrumpfen.
Das in der Mitte stehende Gerüst konnte nur ein Tisch mit vier Beinen sein, ins Riesenhafte übertragen. Vier Meter hoch, oben die Plattform dreimal so breit und lang, die Beine vierkantige Balken von einem Viertelmeter Durchmesser.
Dass es ein Tisch war, konnte man am deutlichsten auf dem daneben stehenden Stuhle erkennen, der ganz diesen Dimensionen entsprach.
An dem einen Tischbein lag am Boden ein Schwert, nicht spitz, sondern vorn abgerundet, dessen Klinge mindestens dreiviertel Meter lang war, fast ebenso lang aber auch der hölzerne Griff. Man wurde an ein gewöhnliches Tischmesser erinnert, nur ins Riesenhafte übersetzt.
Das war das erste, was die beiden erblickten, den Stuhl, den Tisch und dieses Messer, um alles andere kümmerten sie sich vorläufig nicht.
»Juba, wir haben uns in der Hausnummer geirrt!«, flüsterte Georg. »Wir wollten zu den Liliputanern und sind aus Versehen zu den Brobdingnags gekommen.«
»Brobdingnags? Was ist das?«
»So nannten sich die Riesen, zu denen Gulliver verschlagen wurde, nachdem er das Land der Liliputaner hinter sich hatte. Riesen so groß wie die Kirchtürme, an die hundert Ellen hoch, und Gulliver war immer noch eine winzige Maus dagegen.«
»Solche Dimensionen können hier nicht in Betracht kommen!«, entgegnete Juba gelassen. »Nehmen wir an — und ich werde mich nicht irren — jener Tisch sei vier Meter hoch. Die Höhe eines normalen Tisches beträgt fünfundsiebzig bis achtzig Zentimeter, die eines normalen Menschen hundertachtzig. Das ist also zweieinhalb Mal so viel. Demnach könnte der Mensch, der hier haust, nur zehn Meter hoch sein.«
»Nur zehn Meter?! Hören Sie, Juba — wir wollen lieber machen, dass wir wieder zu den Panthern und Nilpferden hinauskommen, die sind doch gegen solch ein menschliches Ungeheuer noch unschuldige —«
Hinter ihnen knallte es. Sie brauchten sich nur umzudrehen, so sahen sie die Ursache. In dem Loch, aus dem sie hervorkrochen, war eine Verschlussplatte heruntergefallen, nicht von hier draußen wieder aufzuziehen, sie kam von oben aus einem Schlitz.
Einige Bemühungen, sie wieder hochzuschieben, zeigten sich erfolglos.
»So, jetzt ist uns das Mauseloch versperrt, zum zweiten Male so niederträchtig gefangen — was ist das?!«
Ein Bollern ertönte, oder richtiger gesagt erdröhnte. Ja, dieses Geräusch war nur ein Bollern zu nennen. Sie erkannten es gleich, wenn sie so etwas auch noch niemals gehört hatten. Es war das Husten eines Menschen. Das hatten sie wohl schon oft genug gehört, aber noch niemals von solch furchtbar dröhnender Stärke.
Und jetzt ein anderes Geräusch, ein gewaltiges Klappen — es konnte nur von Schritten herrühren, ins Ungeheure übersetzt.
»Juba, hier können wir nicht bleiben — alle guten Geister — fix dort untern Schrank!«
Sie eilten dorthin, wo das Ding an der Wand stand — ein ungeheurer Kasten, aus Brettern gefertigt — mindestens zwei Wohnetagen hoch und dementsprechend breit und dick — nämlich wenn man überzeugt war, dass das Ding einen Kleiderschrank vorstellen sollte der untere Boden, auf gewaltigen Klotzfüßen ruhend, noch einen halben Meter über den Steinfliesen erhaben.
Dorthin rannten sie und krochen darunter; aber ganz einen halben Meter betrug die Höhe nicht, und da kann man nicht mehr auf Händen und Füßen kriechen, wenn sie auch nicht direkt auf dem Bauche zu rutschen brauchten.
Dagegen konnten sie sich dann, nachdem sie sich umgedreht hatten, vollkommen ausstrecken und waren immer noch geborgen, konnten den Arm ausstrecken, ohne mit der Hand hervorzugreifen. Und da kam es herein, dort, wo der Steinmetz in der Felswand ein großes Loch gelassen hatte, ein hohes, weites Portal.
Ein Mensch!
Aber nun was für einer!
Juba hatte sich vorhin nicht verrechnet, höchstens ein klein wenig zu niedrig taxiert.
Zehn Meter hoch war dieser Kerl sicherlich, dabei breitschultrig und sehr fleischig. Wenn dieses menschliche Ungetüm fünf bis sechsmal so groß war als ein anderer, normaler Mensch, so braucht man nur alles mit fünf bis sechs zu multiplizieren, um auch alle anderen Dimensionen zu haben. Also Finger von einem halben Meter Länge — ohne Berechnung der ganzen Hand — und dabei sehr fleischige, dicke, kulpige Finger, und der kugelrunde Kopf von einem ganzen Meter Durchmesser.
»Alle himmlischen Heerscharen!«, hauchte Georg. »Juba, das ist noch ein Junge, noch nicht einmal ein Jüngling, der hat noch nicht die Kinderschuhe ausgezogen, der kann noch wachsen!«
Das Kindische lag wenigstens im Anzuge, der auch hier aus blauen Pumphosen und einer roten Jacke bestand. Dazu Strümpfe aus einem grauen, groben Zeuge, an den vier Fuß langen und dementsprechend breiten Sohlen hölzerne Sandalen, aus den dicksten Brettern, mit Stricken befestigt. Kindlich war sogar das gelbe Gesicht zu nennen, wenn man sich nur erst einmal an die ungeheuren Dimensionen gewöhnt hatte. Bartlos und sehr gutmütig. Die blauen Augen, so groß und rund wie Untertassen, glotzten ganz freundlich, sonst freilich alles andere erschrecklich, besonders dadurch, weil der Unterkiefer etwas weit vorsprang und das Maul überhaupt sehr groß war, immer etwas offen stand, sodass man die ungeheuren Schneidezähne sah. Und außerdem machte das hässliche und doch so gutmütige Gesicht doch den Eindruck von unsäglicher Dummheit.
Jetzt blieb er stehen, nahm die Zipfelmütze ab, kratzte sich nachdenklich, wobei das dumme Gesicht noch dümmer wurde, den Riesenschädel, der vollständig nackt war.
»Bei dieser Zucht ins Große sind die Haare verloren gegangen!«, meinte Juba.
»Neenee, das ist noch ein Baby, das bekommt erst noch Haare!«, erwiderte der Waffenmeister, natürlich immer im leisesten Flüstertone, nur hauchend. »Aber sein Gehirn haben die Züchter nicht größer machen können, das stimmt. Wenn es noch kein Pulver gebe, der würde es sicher nicht erfinden — nicht einmal das rauchlose Insektenpulver.«
Die Folge dieses nachdenklichen Kopfkratzens war, dass das Ungeheuer den Raum wieder verließ, durch dasselbe Tor, durch das gekommen war.
»Ja, Juba«, begann jetzt Georg in ganz anderem Tone, wenn auch noch immer im flüsterndsten, »was sagen Sie nun hierzu?«
»Hier haben die Chinesen einfach einmal die Zucht nicht ins Kleine, sondern ins Große getrieben!«, lautete die Antwort. »Denn chinesisch ist diese ganze Sache, einen chinesischen Typus hatte dieser Mensch, trotz seiner runden Augen, besonders durch die hervortretenden Backenknochen.«
»Ganz einfach, sagten Sie? Wissen Sie, Juba, ich bin ja unter Umständen auch so ein Nevermindman wie Sie, aber ganz einfach finde ich diese Sache denn doch nicht. Ein Mensch von zehn Meter Höhe — der geht ja auf gar keine Kuhhaut.«
»Wir müssen uns aber damit abfinden, dass so etwas doch möglich ist. Und ich garantiere Ihnen, dass ein stattlicher Bernhardiner fünf bis sechsmal so groß ist als ein normaler Dachshund, der keine künstliche Zwergzucht ist, sondern zu einer konstanten Rasse gehört.«
Juba hatte recht. Es ist gar nicht einzusehen, weshalb nicht auch einmal solch große Menschen gezüchtet werden sollen, denn von einer Züchtung muss man dabei natürlich sprechen. Aber wer hat sich denn schon einmal mit solchen Menschenzuchtversuchen abgegeben?
Gewiss, es ist schon einmal geschehen. Es scheint tatsächlich nichts Neues unter der Sonne zu geben, man mag ersinnen, was man will, immer ein Anklang wenigstens ist immer schon einmal da gewesen. Friedrich Wilhelm I. der Vater des alten Fritzen, der hat diesen Versuch, möglichst große Menschen zu züchten gemacht, indem er, um für seine Garde recht viele »lange Kerls« zu bekommen, diese mit riesenhaften Jungfrauen kopulierte, ob sie wollten oder nicht. Das darf man doch wohl einen ganz regelrechten Züchtungsversuch nennen.
Dass dies aber ein falscher Weg ist, um sehr große Menschen zu erzeugen, das ist nun schon längst erwiesen. Unsere Tierzüchter sind ganz davon abgekommen, Eltern mit gleichen charakteristischen Merkmalen zu paaren, in der Hoffnung, dass in den Nachkommen diese charakteristische Körperbeschaffenheit sich vermehrt zeigen wird. Worauf es nach der neuesten Theorie bei der Zucht ins Große und Schwere ankommt, das kann hier nicht erläutert werden. Nur das sei hier noch angedeutet, dass man jetzt durch Einspritzen eines Präparates der Schilddrüse ins Blut ein Mittel gefunden hat, um das Wachstum ungeheuer zu fördern. Doch haben diese Versuche erst begonnen, vorläufig gehen die Versuchstiere auch noch regelmäßig ein; immerhin, die Möglichkeit ist bereits erwiesen.
Für Georg hatte schon der Bernhardiner und der Dackel genügt, er hatte gegen die Möglichkeit solch eines menschlichen Ungetüms nichts mehr einzuwenden.
»Gut. Also behandeln wir die zweite Frage: Wie kommen wir hier wieder — — pst, hier riecht's nach Schweinsknochen mit Sauerkraut!«
Vor allen Dingen aber krachten wieder die Holzsandalen, der Brobdingnag, wie wir das menschliche Ungeheuer nach klassischem Muster gleich nennen wollen, kehrte zurück.
Zwischen seinen Händen trug er vor sich eine runde Badewanne, aus der weiße Kugeln hervorsahen, so ungefähr von der Größe, wie auf solchen Kugeln Zirkuskünstler mit den Füßen laufen, und sie dampften.
»Das sind Klöße, Mehlklöße!«, entschied Juba.
»Nein, das sind Schweinsknochen mit Sauerkraut. Na ja, die Dinger da oben sind ja Klöße, das stimmt, aber die gehören doch ganz selbstverständlich zu den Schweinsknochen. Und die rieche ich aufs allerbestimmteste, auf das Sauerkraut will ich weniger schwören.«
Der Brobdingnag setzte die Badewanne auf den Tisch, sich selbst auf den Stuhl, bückte sich, hob das Schwertmesser auf und begann zu speisen.
Wenn man das speisen nennen konnte. Wie der sein Maul dabei aufriss! Und dieses Schmatzen!
»Mahlzeit«, sagte Georg, freilich vorsichtig genug, »gesegneten Appetit will ich ihm weiter nicht wünschen, das hat der nicht nötig. Herrgott, frisst der Kerl da Schweinsknochen mit Klößen und lässt mich ruhig zusehen! Und der verschluckt sogar gleich die Knochen mit. Haben Sie's gesehen?«
Ja, Juba hatte es gesehen.
»Dieses Pökelfleisch hat einem normalen Schweine angehört, da braucht der die Knochen nicht erst lange abzunagen, die bedeuten für den nichts anderes als für uns Sperlingsknöchelchen, oder von Krammetsvögeln, will ich sagen, die man recht gut mit verknuspern kann.«
»Wie viele solcher normalen Schweine mag der fressen — pardon, verspeisen können?«
»Ein ganzes ist sicher in der Schüssel. Sehen Sie, jetzt zermalmt er zwischen den Zähnen einen ganzen Schinkenknochen, als wär's ein Froschkeulchen.«
»Ja, es sind nicht nur Schweinsknochen, ich habe mich geirrt, aber jedenfalls ist es Pökelfleisch, das roch ich gleich.«
Der Essende ließ ein mächtiges Stück Fleisch auf dem Wege zum Munde vom Messer rutschen, klatschend schlug es auf den Steinboden auf.
»Dieser kleine Bissen hätte mich totgeschlagen, wenn ich gerade darunter gestanden!«, musste Georg wieder bemerken.
Der Bissen wurde einfach aufgehoben und in den Mund gesteckt.
»Der Kerl frisst — pardon, speist gerade wie ein Schwein!«, setzte Georg seine Bemerkung fort, und das mit Recht, denn es kam fortwährend vor, dass der Riese etwas fallen ließ, auf den Tisch, auf die Knie oder gar auf den Boden, es wurde einfach aufgenommen und in den Rachen gesteckt.
Jetzt rutschte von dem Messer ein angespießter Kloß ab und fiel zur Erde.
Das konnte doch kein gewöhnlicher Mehlkloß sein, so wie ein Gummiball springt und rollt kein gewöhnlicher Mehlkloß. Der ungeheure Ball rollte gerade auf den Schrank zu und der Riese war schon aufgesprungen, um dem Flüchtling nachzusetzen!
»Juba, dort kommt unser Schicksal angerollt! Und auf dieser Kugel steht für uns keine Göttin Fortuna! Wenn das Luder nicht noch rechtzeitig seinen Lauf bremst! Jetzt heißt's schnellstens zu überlegen, was besser ist: Zu beten oder auszukneifen!«
Es war unserem Helden durchaus nicht humoristisch zumute. Es war nur seine Ausdrucksweise.
Und richtig, der Riesenkloß rollte unter den Schrank! Und schon war das Ungeheuer, das Messer in der Faust, niedergekniet, bückte den Oberkörper noch tiefer, die beiden sahen den Kopf erscheinen, wie die Augen unter den Schrank glotzten.
Sah er die Menschlein?
Jetzt griff die Hand unter den Schrank. In Höhenstellung wäre sie nicht darunter gegangen. Die beiden hatten sich geräuschlos möglichst gegen die Wand geschmiegt. Zuvorderst lag Georg, und er brachte es fertig, den Riesenkloß gerade gegen diese Hand zu dirigieren.
Er wurde gefühlt und vorgeschleudert.
Die Hand zog sich zurück, schon glaubten die beiden erleichtert aufatmen zu dürfen.
Da aber glotzten die tellergroßen Augen noch einmal unter den Schrank, noch einmal tastete die Riesenfaust.
Und da wurde Georg von ihr am Fuße gepackt und vorgezogen. Der Brobdingnag saß am Boden und hatte das winzige Menschlein in seiner Faust; denn ein Püppchen bedeutete dieser Mensch nur für ihn.
Ist ein Mensch hundertfünfundsiebzig bis hundertachtzig Zentimeter groß, so war es nur eine Puppe von dreißig Zentimeter Länge, nichts weiter.
Den ungeheuren Mund weit geöffnet, so saß der Brobdingnag da und betrachtete die lebendige Figur.
»Ja, da staunst De wohl, was?«, sagte Georg.
Nein, es war unserem Helden durchaus nicht humoristisch zumute.
Jetzt hatte er dieses Riesengesicht in Meterweite vor sich, jetzt erst erkannte er den blödsinnigen Ausdruck desselben, und er erkannte weiter, dass er von diesem menschlichen Ungeheuer nichts Gutes zu erwarten hatte.
Ein blödsinniges Kind, das einen Menschenkäfer erwischt hat, mit ihm spielen will — das unglückliche Tier hat sicher nichts Gutes von diesem Kinde zu erwarten, und ist es noch nicht weit über die Bewusstseinsgrenze hinaus, so braucht es vielleicht nicht einmal blödsinnig oder grausam veranlagt zu sein. Wahrscheinlich wird das »Spiel« mit dem Ausreißen der Beine beginnen.
Georg war sich über sein Schicksal in dieser Faust, deren Finger seinen Leib schmerzhaft umspannten, nicht im unklaren.
Aber er konnte nicht anders sprechen, als nun einmal seine Ausdrucksweise war — die Ausdrucksweise von einigen zehntausend Seeleuten, deutschen Seeleuten. Noch niemand hat einen Schiffsuntergang so geschildert, wie er in Wirklichkeit geschieht.
Niemand würde es auch glauben.
Es ist überhaupt zu schildern gar nicht möglich.
»Die einen lagen betend auf den Knien, die anderen fluchten gotteslästerlich.«
So heißt es dann wohl.
Ach Du lieber Gott!
Nichts als blutige Witze und Spott und Hohn — bis das feuchte Grab allen Qualen ein Ende gemacht hat.
Zwei große Reisen als Schiffsjunge zwischen echten deutschen Matrosen genügen, um diesen Charakter fürs ganze Leben einzuprägen. Je härter einem das Schicksal anpackt, desto blutiger wird es verhöhnt, verlacht.
Prometheustrotz!
»Ja, da staunst De wohl, wat?«
Der Brobdingnag richtete sich schwerfällig auf, das Messer ließ er neben dem Schranke am Boden liegen, ging zurück, legte die in seinen Händen wie eine Puppe erscheinende Person Georgs auf den Tisch und setzte sich davor.
Das Maul blieb weit geöffnet, die Augen glotzten. Schweigend, nur mit rasselndem Atem, begannen die Riesenfinger der anderen Hand das lebende Püppchen zu betasten, zu untersuchen. Die Fingerchen, die Ärmchen, besonders die Haare; nicht minder aber auch die Bekleidung.
Dabei kamen als Zeichen des Staunens nur grunzende Laute aus dem zähnestarrenden Rachen. Die erste Besichtigung von vorn und hinten war beendet.
Jetzt wurde das Püppchen zur weiteren Untersuchung kopfüber gedreht.
Wie soll sich ein dreißig Zentimeter hohes Püppchen, wenn es lebendig wäre, gegen die Kraft eines erwachsenen Mannes wehren können?
Georg hatte bei alledem, auch als er so mit dem Kopfe nach unten hing, nur einen einzigen Gegenstand im Auge, der auf dem Tische lag.
Das Püppchen wurde wieder umgekehrt und so auf den Tisch gesetzt, wie eben ein kleines Kind eine Puppe hinsetzt. Erst ein Schlenkern, dass die Beine nach vorn fliegen und dann ein schnelles Stauchen.
»Bist Du ein Mensch? Kannst Du mich verstehen?!«, schrie Georg in höchster Todesnot.
Noch grenzenloseres Staunen in dem blödsinnigen Gesicht.
»Häoo, häoo!«, kam es unartikuliert aus dem geöffneten Maule hervor.
Jetzt wurde das Püppchen freigegeben, aber vorsichtig legten sich die Riesenfinger als geschlossener Wall herum, und um sich keine Bewegung entgehen zu lassen, hatte das Ungetüm seinen Kopf mit dem Kinn auf die Tischplatte gelegt.
Georg sprang empor. Noch fühlte er sich unverletzt Zunächst kreuzte er die Arme über der Brust, und in ganz besonderem Tone erklang es:
»Ich oder Du! Jetzt wird es sich entscheiden, ob der normale Mensch, wie ihn Gott geschaffen hat, mit der Behauptung, es sei sein Ebenbild, Herr aller Kreaturen ist, oder ob Du ungeheuerliche Missgeburt es sein sollst! Wohlan, riesenhafter Brobdingnag, wehre Dich gegen den Waffenmeister der Argonauten —«
Mit diesen letzten Worten, in furchtbarer Weise hervorgestoßen, war Georg mit gleichen Füßen über den Fingerwall gesprungen, hatte sich auf das zweite Messer gestürzt, das auf dem Tische lag, packte den Griff mit beiden Händen, die meterlange Klinge sauste durch die Luft — tief grub sie sich in die rechte Seite des ungeheuren Halses, sofort sprang eine dicke Blutfontäne aus der furchtbaren Wunde.
In Fechterstellung sprang Georg zurück, um nach ihm greifende Hände oder doch die Finger abzuschlagen.
Es war nicht nötig.
Wohl gar nicht wissend, wie ihm geschehen, die Wunde noch gar nicht fühlend, wie es stets im ersten Schmerze ist, erhob sich der Brobdingnag schwerfällig, taumelnd.
Da kam dort unten Juba Riata angestürmt, jenes andere riesenhafte Schwertmesser in beiden Händen; noch im Laufe holte er zum Schlage aus, er hieb nach dem rechten Fuße des Ungeheuers, und dieses brach dröhnend zusammen.

Während Stevenbrock zum zweiten Schlag auf den Riesen
ausholte, kam unten Juba Riata angestürmt, das andere
riesenhafte Schwertmesser in beiden Händen schwingend.
Juba hatte die Vorgänge dort oben auf dem Tische beobachtet, und er hatte seinen Freund nicht im Stiche gelassen — höchstens fünf Sekunden später, da sich Georg selbst zu schützen verstanden, hatte Juba dem Ungetüm die Achillessehne durchhauen, natürlich auch eine Schlagader öffnend.
Jetzt fand der auf der Seite am Boden liegende Brobdingnag noch andere Töne, er brüllte wie zehn Ochsen zusammen.
Und sein Gebrüll rief Hilfe oder doch Rache herbei. Durch jenes Portal stürmte eine Schar Chinesen herein, kräftige, wild aussehende Männer, krumme Schwerter in den Händen.
Der unten stehende Juba Riata war bereit, sie zu empfangen, mit den krummen Schwertern sein Riesenmesser zu kreuzen, und er blieb nicht allein.
Im Nu hatte Georg sein Messer hinabgeworfen, war hinabgesprungen, und die Höhe von vier Metern hatte für ihn nicht viel zu sagen, sein Messer wieder aufgerafft, und er stand neben dem Freunde.
Die chinesische Schar hatte Halt gemacht.
»Unglückliche, was habt Ihr getan?«, erklang es auf englisch aus ihrer Mitte.
»Come on, my boys!«, ermunterte Georg.
»Ihr irrt, wir kommen doch nicht als Feinde — erkennen Sie mich denn nicht?«
Und aus der Mitte drängte sich ein Mann hervor, nicht chinesisch gekleidet, mit langem, blondem Vollbarte — Price O'Fire!
Da schleuderte Georg mit einem fürchterlichen Fluche das Messer von sich. »Zur Hölle mit Euch und Eurem blutig verdammten Gaukelspiele!!«
Aber es war noch ein ganz anderer Fluch gewesen.
Über die indische Prärie schritten zwei Männer. Georg Stevenbrock und Price O'Fire. Sie unterhielten sich. Am meisten jedoch sprach der letztere, Georg stellte nur selten eine Frage.
Und dann tat er das im kürzesten Tone, sogar herrisch und gebieterisch, und so war auch der Ausdruck seines Gesichtes beschaffen — herrisch und finster.
Und der sonst so hoheitsvolle Price O'Fire schien recht kleinlaut zu sein.
So erreichten sie ihr Ziel, das Juba Riata unter anderer Führung schon vor ihnen aufgesucht hatte.
Den Elektron.
Das lange Luft- und Wasserschiff lag zwischen zwei Hügeln gebettet.
Einige der Argonauten trieben sich davor herum, und ganz merkwürdig war es, dass sich niemand von ihnen um den Kommenden, um den Waffenmeister bekümmerte.
Hier musste irgend etwas Besonderes vorangegangen sein.
Es war, als ob die drückende Schwüle des Nachmittags, die in der Atmosphäre brütete, ein nahes Gewitter verkündend, sich auch über all diese Menschen ausgebreitet hätte. Und Georg schien den Elektron und seine treuen Gefährten gar nicht zu sehen.
Unter einem Mangobaume, der noch in beträchtlicher Entfernung von jenen beiden Hügeln einsam auf dem Graslande stand, blieb er stehen.
»So. Ich bleibe hier. Also gehen Sie, richten Sie es aus. An meinem Entschlusse wird nichts geändert.«
Kapitän Price O'Fire machte ganz ausnahmsweise eine Verbeugung, die ihm auch gar nicht stand und schritt dem Elektron zu.
»Halt!«, erklang es, als er erst einige Schritte getan hatte. »Haben Sie nicht Pfeife und Tabak oder eine Zigarre bei sich, damit ich mir unterdessen die Zeit vertreiben kann? Ich lechze überhaupt danach!«
Der zurückgekommene Kapitän präsentierte ihm sein Zigarrenetui, Georg nahm eine, der Fürst des Feuers holte aus der Westentasche die bekannte schwarze Kugel hervor.
Da, als diese zwischen seinen Fingern zu erglühen begann, stutzte Georg plötzlich.
»Nein! Danke! Verzeihen Sie! Es war ein Irrtum. Bitte, nehmen Sie die Zigarre zurück.«
»Aber Herr Waffenmeister«, fing der sonst so energische Mann vor Bestürzung fast zu stammeln an, »weshalb wollen Sie denn nicht —«
»Wollen Sie die Zigarre zurücknehmen?!«, wurde er herrisch unterbrochen.
»Ich weiß gar nicht — ich kann doch nicht —«
Zerbrochen und zersplittert flog die Zigarre ins Gras. Ein starrer und auch etwas trübseliger Blick darauf; mit leisem Achselzucken wandte sich Price O'Fire, das Feuerzeug in die Westentasche zurücksteckend, um und setzte seinen unterbrochenen Weg nach dem Elektron fort.
Georg schritt im Schatten des Mangobaumes auf und ab und kam dabei immer an der zerbrochenen Zigarre vorbei. Sie schien seine Aufmerksamkeit zu fesseln, immer mehr und mehr, es ging etwas vor sich mit ihm, es schien ihm in allen Fingern zu zucken — bis er sich bückte und einige Bruchstücke aufhob.
Offenbar wollte er sie als Kautabak verwenden.
Da wieder ein Besinnen, mit Heftigkeit zermürbelte er die Bruchstücke vollends, verstreute sie, griff auf die Brust unters Hemd, zog die noch frischen, nur etwas verwelkten Tabaksblätter hervor, die er erst heute früh gepflückt hatte, fing die zu kauen an — ein sehr zweifelhafter Genuss.
Price O'Fire war im Innern des Elektron verschwunden. Nicht lange dauerte es, so kam von dort ein Männlein im Frackanzug getrippelt — Herr Professor Beireis.
Georg schien ihn nicht zu sehen, auch als er dicht neben ihm stand; denn Georg wandte sich ihm gar nicht zu, setzte seinen Spaziergang unter dem Baume fort.
»Hoch geehrter Herr Kapitän und Waffenmeister. Ich habe das Vergnügen —«
»Was wollen Sie?!«, wurde er angeschnauzt; denn das war kein Anfahren mehr. Mit höchst ängstlichem Gesicht war das Männlein gekommen, und dass es jetzt noch ängstlicher wurde, begreiflich.
»Ich komme im Auftrage des —«
»Sind Sie Merlin?!«
»Nein, Sie wissen doch, dass ich —«
»Sind Sie der Höchste an Bord des — von jenem Dinge da?«
»O nein, ich bin nur —«
»Wer ist der Höchste auf dem Dinge da?«
»Das ist dem Range nach Meister Fortunatus —«
»Ach papperlapapp! Was soll ich denn mit dem ätherischen Knaben, der egal aus dem Leime geht! Der nicht einmal für sich selbst sprechen kann! Ist nicht der Mann, der sich Merlin nennt, die höchste, maßgebendste Person dort auf dem Dinge da?!«
»Ja!«, gab das Professorlein jetzt mit immer kläglich werdender Stimme zu.
»Ist Merlin an Bord?«
»Ja.«
»Hat ihm Price O'Fire meine Bestellung ausgerichtet?«
»Ja.«
»Na und?«
»Er hat mich geschickt, ich soll —«
»Ach was! Merlin soll selbst kommen!!«
»Aber Ihre Frau Gemahlin selbst sagte —«
»Frau Gemahlin, Frau Gemahlin? Was denn für enne Frau Gemahlin? Ich habe keene Frau Gemahlin. Ich bin glücklicherweise noch ledig.«
»Die allergnädigste Freifrau von der See sagte —«
»Ach was! Mit der Patronin und mit meinen Leuten spreche ich später! Jetzt will ich erst einmal mit diesem Merlin sprechen! Er soll herkommen!«
»Er will aber nicht kommen!«, fing das Männchen jetzt fast zu weinen an.
»Dann bleibt er eben. Und ich bleibe hier!«
»Ich soll mit Ihnen verhandeln —«
»Sie?! Was habe ich denn mit Ihnen zu tun?! Scheren Sie sich doch zum Deiwel oder meinetwegen hängen Sie sich hier an diesem Ast auf, hier haben Sie gleich eine schöne Liane, mit Blüten dran, die können Sie als Strick benutzen — ich schneide Sie nicht ab. Ich will hier an dieser Stelle Merlin sprechen, er soll mir Rede und Antwort stehen —«
Da kam er schon über die Prärie geschritten, wie immer in seinem gelbledernen Anzuge.
Kaum erblickte ihn der kleine Professor, als er mit ganz erleichtertem Gesicht machte, dass er fortkam.
Georg hatte die Arme über der Brust verschränkt, so erwartete er den Kommenden, und der blieb in ruhiger Haltung vor ihm stehen.
Eine halbe Minute lang standen die beiden Männer sich so gegenüber, schweigend sich anblickend; dann ging es los, nun aber auch ohne jede Einleitung.
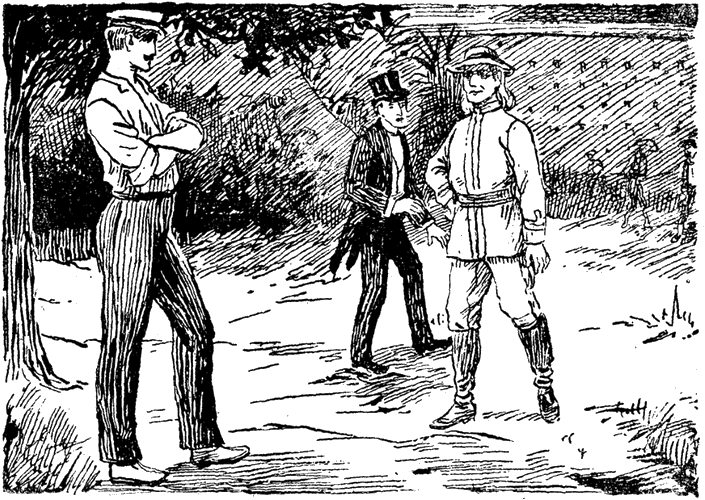
»Mister Price O'Fire hat mir alles berichtet!«, begann Georg.
»Ich weiß es.«
»Wir befinden uns hier im Herzen von Borneo?« — »Ja.
»Wohin vor ungefähr zwölf Jahren der verschollene Amerikaner Elias Osborne seine ganze Menagerie glücklich gebracht hat.« — »Ja.«
»Die Tiere blieben am Leben, haben sich vermehrt aber — Mister Osborne hat mit allen seinen Gefährten hier den Tod gefunden?« — »Ja.«
»Sie wurden von Chinesen, die hier hausen, ermordet?«
»Die Amerikaner drangen in die Geheimnisse dieser Chinesen und —«
»Wurden ermordet!«
»Getötet.«
»Meinetwegen getötet. Diese Chinesen, die in jenem alten Buddhatempel hausen, gehören mit zu Ihrer geheimen Gesellschaft?«
»Sie sind erst vor kurzem hier aufgenommen worden.«
»Gut. Das Ziel des Elektron war hier diese Stelle?« — »Ja.«
»Weshalb?«
»Um Dir und Deinen Leuten einige Überraschungen zu bereiten, um Dir die größten Sehenswürdigkeiten dieser Erde zu zeigen.«
»Von diesen chinesischen Mördern?«
»Es sind ganz friedsame Menschen geworden.«
»Gut. Das Luftschiff war nicht mehr weit von diesem Ziele entfernt, als wir, Mister Juba Riata und ich in der Nacht durch eine zufällig entdeckte Luke in die dritte Etage drangen. Ist das Ihnen bekannt?« — »Ja.«
»Sie wussten sofort darum?« — »Ja.«
»Wurde die Klappe mit Absicht geschlossen?« — »Ja.«
»Weshalb?«
»Beireis war es, der sich diesen Spaß erlaubte.«
»So! Spaß! Weshalb tat er das?«
»Um Euch eine besondere Überraschung zu bereiten.
Er benachrichtigte zunächst die Freifrau von der See, ob er sich diesen Scherz auch erlauben dürfe. Allerdings hatte er da die Klappe schon geschlossen, aber er hätte sie ja sofort wieder öffnen können. Die Mylady gab jedoch die Erlaubnis dazu.«
»So. Und um was für einen Scherz handelte es sich nun?«
»Du befandest Dich mit Deinem Freunde in einem Boote. Es wurde ausgesetzt und durch Fernleitung hierher dirigiert. Auch wir landeten, aber an anderer Stelle als Ihr. Wir wollten Euch beobachten.«
»Was beobachten?«
»Wie Ihr Euch in Eurem ganz hilflosen Zustande in dieser Wildnis benehmen würdet. Gefahr war dabei nicht vorhanden, immer wäre sofort Hilfe zur Stelle gewesen. Die Freifrau von der See war mit alledem ganz einverstanden.«
»So. Glauben Sie nicht etwa, dass ich der Patronin das übel nehme. Nicht im Geringsten! Bei mir handelt es sich jetzt um etwas ganz anderes. Da kam der weiße Elefant, der wahrscheinlich — na lassen wir das, darum kümmere ich mich ebenfalls gar nicht, ebenso wenig wie ich wegen der Zwerge und Riesen auch nur eine einzige Frage stellen werde, soweit sie nicht hier diesen einzigen Fall anbetrifft. Wir befanden uns in dem Raume des Riesen doch in einer äußerst gefährlichen Lage?«
»Ja.«
»Denn der hatte doch kein normales menschliches Gehirn, das war mehr ein Tier, der hätte mir aus Spielerei doch auch den Kopf abgebissen?«
»Ja, es war alles von ihm zu erwarten.«
»Bin ich mit Absicht in diese gefährliche Lage gebracht worden?«
»Nein.«
»Sondern?«
»Ihr begabt Euch von selbst hinein, wir erfuhren erst davon, als es zu spät war. Dann taten wir, was wir konnten, benachrichtigten sofort die hier hausenden Chinesen, dass sie Dich aus den Händen des Riesen befreiten, auch Price O'Fire war als erster unterwegs.«
»So. Nun hören Sie, Mister Merlin, was ich Ihnen zu sagen habe.
Ich fasse mich ganz kurz, bleibe nur bei der Hauptsache. Als ich vorhin unter den Chinesen Price O'Fire auftauchen sah, da war mir eigentlich alles sofort ganz klar, alles!
Und in demselben Augenblick, da mich diese Erkenntnis blitzschnell überkam, und als der Riese, von meinem Schwerthieb tödlich getroffen, sich verblutend und brüllend am Boden lag, da tat ich einen Schwur!
Vorher mögen Sie aber doch erst noch etwas anderes erfahren.
Ich habe diese ganze Gaukelei, mit der mir immer aufgewartet wird, schon längst satt!
Bis an die Halsbinde stand sie mir manchmal.
Immer habe ich nachgegeben, mir neue Sachen vorgaukeln lassen.
Aus Rücksicht gegen die anderen.
Es war eine Schwäche von mir; wenigstens ich hätte endlich ausscheiden sollen, da ich nun einmal den Entschluss gefasst hatte.
Jetzt aber ist diese Schwäche überwunden.
Nun ist's genug!
Ich habe mit jener geheimen Gesellschaft, der Sie angehören, nichts mehr zu tun!
Und ich verbitte mir jede weitere Einmischung!!
Also gehe ich natürlich auch nicht mehr an Bord des Elektron!
Ich rühre nichts mehr an, was von Ihnen stammt!
Ich verhungere lieber, ehe ich einen Bissen in den Mund nehme, der von Ihnen stammt oder der nur von Ihnen und Ihresgleichen berührt worden ist! So wahr mir Gott helfe!
Wir sind fertig miteinander!«
Mit der größten Betonung und dennoch mit der größten Ruhe hatte Georg gesprochen.
Traurig blickten ihn die blauen Augen des jugendfrischen Greises an.
»Was habe ich Dir getan?«
»Gar nichts haben Sie mir getan! Aber fragen Sie nicht so, dazu sind Sie überhaupt viel zu gescheit.«
»Ja, ich kann Dich verstehen.«
»Dann ist's ja gut. Ich habe meinen vorigen Worten nichts mehr hinzuzufügen.«
»Was willst Du tun?«
»Hier bleiben.«
»Was willst Du denn hier?«
»Na, nicht für immer hier bleiben. Ich schlage mich nach der Küste durch.«
»Das ist unmöglich.«
»Weshalb denn?«
»Es gibt keinen Weg durch den Rotangwald, es gibt kein Durchkommen.«
»Der Mister Osborne ist doch auch mit seiner ganzen Menagerie und all seinen Leuten durchgekommen.«
»Das war damals, jetzt ist es nicht möglich.«
»Weshalb denn nur nicht?«
»In dem ungeheuren Rotangwald, der diese freie Gegend hier umgibt, hausen viele Dajakstämme in kleinen Dörfern, die untereinander durch Wege verbunden sind, die nur als Kriegspfade dienen, damit ein Stamm dem anderen die Köpfe abschneiden kann. Diese Sitte der Dajaks kennst Du ja wohl.
Wie diese Wege durch den furchtbaren Dornenwald einst geschaffen worden sind, das weiß man heute gar nicht mehr, ist ganz unerklärlich. Auch wir mit allen unseren technischen Hilfsmitteln könnten einen solchen Pfad nicht herstellen. Da die Wege aber nun einmal existieren, können sie von den Dorfbewohnern mit leichter Mühe offen gehalten werden. Wird dies freilich während eines Jahres versäumt oder nur vernachlässigt, dann wächst der Pfad mit Rotang zu, er kann nicht wieder freigemacht werden, solch ein Dorf ist dem Hungertode verfallen.
Bis vor etwa zwölf Jahren führten solche Wege aus den benachbarten Dörfern auch bis hierher in diese rotangfreie Gegend, die einige Quadratmeilen umfasst. Aber hausen taten hier keine Dajaks, es war ein neutrales, geheiligtes Gebiet für die umwohnenden Stämme, man hielt es für den Sitz von Geistern. Lass Dir diese Erklärung genügen, es ist Dir doch nur recht, wenn ich mich so kurz wie möglich fasse.
Jener Mister Elias Osborne scheiterte mit seinem Schiffe an der Südküste Borneos, wo nur Dajaks wohnten. Er hatte Kämpfe mit ihnen zu bestehen, bis er die Freundschaft eines Priesters und Zauberers machte, den er sich auch tief verpflichtete.
Es war ein Wanderpriester, wie es hier solche gibt, die ständig von Dorf zu Dorf ziehen. Dieser versprach dem Osborne, ihm eine Gegend zu zeigen, wie er sie für seine Zwecke wünsche, und er führte ihn mit seiner ganzen Karawane von Dorf zu Dorf auf den geheimen Wegen, die noch kein Weißer, kein Fremder betreten hat bis hierher.
Gerade um jene Zeit wurden chinesische Mitglieder von unserer geheimen Gesellschaft abtrünnig und flüchtig. Sie begaben sich hierher — freilich auf andere Weise, wie, das kannst Du Dir wohl denken — fanden die Amerikaner hier schon vor, haben sie getötet, wie ich Dir ja bereits sagte.
Dann haben sie auch unter den umwohnenden Dajaks Angst und Schrecken zu verbreiten gewusst, diese wagten die nun wirklich verzauberte Gegend nicht mehr zu betreten, so sind die hierher führenden Wege im Laufe der Jahre wieder total verwachsen.
Jene Chinesen haben sich wieder uns unterworfen, sie sind zwar hier geblieben, müssen es, aber kein Mensch hat sie noch zu fürchten, wenn Menschen noch hierher gelangen könnten, es ist nicht mehr möglich.
Mehr habe ich Dir nicht zu sagen. Du kannst nicht wieder von hier fort, es sei denn, dass Du das Luftschiff benutzest!«
Aufmerksam hatte ihm Georg zugehört, ohne ihn einmal zu unterbrechen.
»Das ist sehr fatal, was ich da zu hören bekommen habe«, sagte er dann ruhig, »aber an meinem Entschlusse lässt sich nichts mehr ändern. Mich bindet ein Schwur, und wenn Sie wüssten, wie feierlich ich ihn in jenem Augenblick geleistet habe, bei was ich geschworen habe, dann würden Sie sich keine Mühe mehr geben, mich von hier fortzulocken. Tun Sie es also nicht, ersparen Sie sich jedes weitere Wort, es hat gar keinen Zweck! Ich betrete Euer Luftschiff nicht wieder! Dieses nicht und kein anderes! Ich nehme auch nicht das geringste mehr an, was irgendwie von Euch stammt; nicht einmal einen Ratschlag!
Weise die hier hausenden Chinesen nicht etwa an, dass sie mir beistehen sollen!
Ja, Mister Merlin, ich fordere jetzt Ihr Ehrenwort, dass Sie sich niemals wieder irgendwie in meine Angelegenheiten mischen!
Und, wenn ich mich auch in höchster Todesnot befände und Sie hätten die Macht, mir helfend beizuspringen — Sie werden es nicht tun! Bitte, geben Sie mir hierauf Ihr Ehrenwort. Das ist die allerletzte Gefälligkeit, um die ich Sie bitte.«
Noch trauriger denn zuvor blickten die schönen Augen des Greises den Sprecher an.
»Ist es denn gar nicht möglich —«
»Geben Sie sich doch nur keine Mühe mehr! Ihr Ehrenwort will ich haben!«
»So muss ich mich Dir fügen. Du hast mein Ehrenwort.«
»Dass Sie sich nicht im geringsten mehr in mein Schicksal und in meine Verhältnisse mischen?«
»Ich gebe Dir daraufhin mein Ehrenwort.«
»Und natürlich geben Sie Ihr Ehrenwort auch für Ihre Leute und für alle anderen, die zu jener geheimen Gesellschaft gehören?«
»Ja.«
»Auch von jener Schwester Anna werde ich nie wieder etwas hören, nie wieder ein Zeichen erhalten?«
»Nein.«
»Sie sind berechtigt, daraufhin ein bindendes Ehrenwort zu geben?«
»Ich bin es.«
»Dann nur noch eines. Damit wir ja nichts vergessen.
Meine Gefährten bringen Sie doch natürlich nach Sibirien zurück, an Bord der ›Argos‹ oder wohin sie sonst wollen —«
»Selbstverständlich.«
»Gut. Das geht mich nichts mehr an. Die mögen machen, was sie wollen. Vorläufig scheide nur ich aus. Es gibt Verhältnisse, welche jeden Heuerkontrakt lösen, jeden. Nun könnte es aber doch sein, dass einige mich nicht verlassen, hier bei mir bleiben und mein Schicksal teilen wollen. Auch für diese gilt Ihr Ehrenwort, dass Sie auch diesen nicht mehr helfen; denn das wäre doch nur eine indirekte Hilfe für mich. Nicht wahr?«
»Ja, auch für diese gilt alles das, worauf ich mein Ehrenwort geleistet habe.«
»Gut. Dann sind wir fertig miteinander. Mister Merlin, ich danke Ihnen für alle Freundlichkeit, die Sie mir erwiesen haben. Leben Sie wohl. Grüßen Sie herzlichst Ihre Tochter Viviana von mir, aber sehen möchte ich sie nicht mehr. Leben Sie wohl.«
Er hielt ihm die Hand hin, sie wurde genommen, gedrückt, dann wandte sich Merlin schnell und ging davon.
Hochaufatmend blickte ihm Georg nach. Es war doch etwas dabei, was ihn gewaltig packte, man sah es ihm an, und er breitete beide Arme aus und blickte zum Himmel empor.
»Gelobt sei Gott!«, kam es leise aus tiefstem Herzen hervor. »Der Spuk ist zu Ende! Und mag es nun ein Teufelsspuk oder ein Himmelswunder gewesen sein — ich habe ihm ein Ende bereitet, und ich weiß, dass es mit Deinem Willen geschah. Herr aller Welten, an den ich glaube, jetzt habe ich es nur noch mit Dir zu tun, jetzt bin ich nur noch auf die Kraft und Fähigkeiten angewiesen, die ich allein Dir zu verdanken habe — Dich allein will ich fürchten und bewundern und sonst nichts auf der Welt — und wenn es Dir gefällt, so führst Du mich dennoch durch diese Dornenmauer hindurch, trotz allen menschlichen Prophetengeistes. Amen.«
Dann steckte er zwei Finger in den Mund, ein trillernder Bootsmannspfiff gellte.
Die vor dem Luftschiffe sich aufhaltenden Matrosen blickten nach ihrem Waffenmeister, wenn sie es nicht schon immer getan hatten, und der semaphorierte mit den Armen:
»Möchte Kapitän Martin und Patronin hier sprechen.« Das Verstandenzeichen wurde gegeben und bald kamen die beiden.
Eine halbstündige Unterredung, dann ging Kapitän Martin zurück. Die Patronin blieb, weinte erst und dann lag sie jubelnd und lachend an des Geliebten Brust.
Und dann kam eine Deputation, bestehend aus einem Offizier, einem Unteroffizier und einem Matrosen. Wer diese waren, ist gleichgültig. Hauptsache ist, dass diese drei im Namen aller ein und dieselbe Erklärung brachten: »Wir bleiben hier bei Ihnen.«
»Wisst Ihr auch, was das zu bedeuten hat?«
Eine weitere Erklärung war nicht nötig. Sie wussten es, es gab an dem gemeinsamen Entschlusse nichts mehr zu ändern.
Trotzdem versuchte es Georg noch einmal.
»Ihr habt aber Angehörige zu Hause —«
»Das geht Euch gar nischt an, Waffenmeister!«, wurde er sofort unterbrochen. »Der Kapitän hat entschieden, dass wir unter solchen Verhältnissen unseres Heuerkontraktes entbunden sind, und nun können wir machen, was wir wollen. Wir bleiben bei Euch, Waffenmeister.«
Auch diese drei gingen wieder zurück.
»Helene, nun möchte ich ein bisschen zu heulen anfangen!«, meinte Georg, in seinen Hosentaschen vergebens nach einem Taschentuche suchend.
Und dann, als schon ausgeladen wurde, alles was den Argonauten gehörte, sonst aber auch nicht ein Bündel Kabelgarn, fand eine Versammlung der Gäste der »Argos« statt, immer wieder hier unter diesem Mangobaum, weiter näherte sich Georg dem Luftschiff nicht.
Und wieder eine Stunde später stieg der riesenhafte Elektron federleicht in die Lüfte empor, um in einiger Höhe urplötzlich spurlos zu verschwinden.
Zurückgeblieben war alles, was zur »Argos« im eigentlichen Sinne gehört hatte. Auch die einunddreißig Schiffsjungen mit ihrem »Fabs«, sogar die Madame Pompadour.
»Die hängen wir, wenn wir den Weg nach der Küste antreten, zwischen zwei der stärksten Elefanten, und haben wir keine Elefanten, dann tragen wir sie selber.«
An Bord des Luftschiffes befanden sich nur die eigentlichen Gäste, die sich so nach und nach angesammelt hatten. Man hatte von ihnen gleich Abschied für immer genommen.
Solche Sachen wie des Waffenmeisters Schreibtisch konnten natürlich auch zurückgehen.
Und ferner war noch Kapitän Martin mitgegangen, mit ihm auch die beiden Samojeden.
Er wollte mit der englischen Mannschaft die »Argos« aus Sibirien herausbringen und dann nach Pontiniak dampfen, dem Haupthafen von Borneo. Und wenn man dort noch nichts gehört hatte von einigen hundert Menschen, die ganz verwildert aus dem Innern der Insel gekommen waren, und wenn Kapitän Martin und seine Agenten auch beim Absuchen der ganzen Küste nichts von ihnen erfahren konnten — — nun, der Geist und Witz auch der anderen, ganz ordinären Menschheit, hat Flugmaschinen und Luftschiffe erfunden, mit denen man bereits hundert Meilen weit ohne Zwischenlandung fliegen kann, auch über undurchdringliche Rotangwälder hinweg — — mit denen wollte man dann weiter schauen.
Fast ein Vierteljahr war verstrichen. »Was soll aus uns werden?« Noch niemand hatte diese Frage gestellt, sie würde auch sicher niemals gestellt werden, vielleicht nicht einmal in Gedanken.
Sie hatten sich in den natürlichen Höhlen einer Felsformation und in der luftigen Höhe von benachbarten Bäumen wohnlich eingerichtet, gingen der Jagd und der weiteren Ausarbeitung eines möglichst komfortablen Lebens nach. Die Munition, von der jeder für sein Jagdgewehr zwei Patronentaschen voll mitgenommen hatte, die Schiffsjungen und selbst Ilse nicht ausgeschlossen, wurde möglichst geschont, auf der Jagd nur im Falle der Notwehr gebraucht, sonst wurde diese nur mit selbstgefertigten Bogen und Pfeilen, Lanzen und dergleichen Waffen betrieben, was überhaupt viel ritterlicher ist, und dasselbe, betreffs der Schonung, galt für die Kleider, die schon längst durch geeignete Felle ersetzt worden waren.
Die Ruinenstadt hatte man untersucht, nichts Bemerkenswertes darin gefunden, und sie hätte ihnen betreffs der Wohnungsfrage auch keine Vorteile gewährt. Das Betreten des Buddhatempels war strikte verboten. Sie hatten weder Riesen, noch Zwerge, noch normale Chinesen zu sehen bekommen, absolut nichts, was von Anwesenheit anderer Menschen gezeugt hätte. Einige Elefanten hatten sie gefangen und gezähmt, aber jener weiße mit den geschnitzten Stoßzähnen war spurlos verschwunden.
Auf den Jagden hatte es ja einige unausbleibliche Unglücksfälle gegeben, aber keinen tödlichen, und jede Fleischwunde und jeder Knochenbruch war schon wieder glücklich geheilt oder würde es noch tun. Einige Tauben fehlten, sie hatten das Weite gesucht — sonst fehlte an der ganzen Menagerie nicht einmal Huckebein, hatte noch nicht das Zeitliche gesegnet. Obgleich der nach Ansicht aller Rabensachverständigen schon seine hundert Jahre hinter sich haben musste.
Doch mit Jagd und Fang und Dressur und häuslichen Arbeiten und Sportbelustigungen aller Art war es noch nicht abgetan.
Es galt das Hauptproblem zu lösen. Wie von hier wieder fortkommen?!
Einen Weg durch den umgrenzenden Wald finden, und dieser Aufgabe musste ständig die Hälfte der ganzen Mannschaft nachgehen, wenn auch vielleicht noch gar niemand wünschte, diese idyllische Gegend so bald wieder zu verlassen. Der Pflicht wurde deshalb dennoch aufs gewissenhafteste nachgekommen. Man brauchte den gefundenen Weg ja vorläufig auch noch gar nicht zu benutzen.
Aber im Laufe des Vierteljahres war dieser Weg noch nicht gefunden worden, keine andere Möglichkeit, die Waldgrenzen passieren zu können.
Dieses Prärieterrain hier mochte vier geografische Quadratmeilen umfassen. Die kleinen Wälder innerhalb desselben waren völlig rotangfrei. Eingeschlossen wurde es rings von dichtem Urwald. Einige hundert Meter konnte man in diesen noch dringen, dann machte sich hier und da der stachelbewehrte Rotang bemerkbar, bis der so dicht zusammenstand, dass es kein Durchkommen mehr gab. Und da hätten auch zehnmal soviel Messer, als zur Verfügung standen, nichts genützt, in Bälde wären sie sämtlich unbrauchbar geworden.
Weshalb der Rotang gerade hier gedieh, nicht dort in den Wäldern der Prärie? Nun, eine Grenze ist überhaupt jeder Pflanzenart gezogen. Und der schreckliche Rotang, als spanisches Rohr auch manchmal für uns in der Kinderzeit schrecklich gewesen, gedeiht überhaupt nur auf sumpfigem Boden. Allerdings nicht direkt im Sumpfe. Der Boden muss nur ständig feucht sein. Und dies ist auch der Grund, weshalb sich der Urwald, in dem diese zu den Palmen gehörende Lianenart — nur die gefiederten Blätter sind mit so furchtbaren Stacheln bewehrt — wuchert, nicht ausbrennen lässt.
Und zweitens war dies der Grund, weshalb sich auch die Wasserwege nicht benutzen ließen, denn solche gab es zur Genüge. Von Norden her kamen mehrere ganz stattliche Flüsse in die Prärie herein und verschwanden südwärts wieder im Urwald, nach beiden Richtungen hätten sie ganz ansehnliche Fahrzeuge getragen, aber immer nur auf eine kurze Strecke, wie schon untersucht worden war, dann verloren sie sich regelmäßig in einen unpassierbaren Sumpf. So war die Sachlage nach einem Vierteljahre, als eines Mittags Georg in den luftigen Zweigen eines Affenbrotbaumes auf einer gezimmerten Plattform seine Siesta hielt, nicht schlafend, sondern behaglich blinzelnd den blauen Wölkchen seiner Pfeife nachblickend, gestopft mit selbstgezogenen Tabaksblättern.
So gab sich das ganze Lager dem süßen Nichtstun hin, als eine Bewegung entstand.
Es war der Matrose Hans — noch immer Hans Leichtfuß — der angesprengt kam, auf einem ganz absonderlichen Reittiere, auf einem Strauße, der vierte von vielen Gefangenen, den Juba Riata zum Reiten zugerichtet hatte. Solch eine Figur wie Hans Leichtfuß trug der starke Vogel im schnellsten Laufe mit Leichtigkeit, bei einem Manne wie August dem Starken hörte es natürlich auf.
Der rasende Ritt bis ins Lager hinein und das ganze Aussehen des Reiters musste gleich alles stutzig machen.
»Wo ist der Waffenmeister?!«
»Der liegt auf seinem Baume! Was ist passiert?«
Hans, nur wenig zügelnd, war abgesprungen, hatte fast einen Salto mortale geschlagen.
»Waffenmeister, der Weg ist gefunden!«
»Wo?«, fragte der ganz gemächlich, auch den Kopf hebend.
»Dort im Südosten! Seine Entdeckung hat vorher dem Sam das Leben gekostet!«
»Was?!«, schnellte jetzt freilich Georg empor.
»Sam ist mit abgeschnittenem Kopfe gefunden worden! Das kann nur ein Dajak gewesen sein. Die Spur ist schon mit Hunden verfolgt worden, sie geht durch einen hohlen Drachenbaum in den Wald hinein. Es ist ein rotangfreier Weg.«
Nun war es vorbei mit der Siesta!
Doch mit kaltblütiger Ruhe gab der Waffenmeister erst seine Anordnungen.
Einige Leute abgeteilt, die ihn auf schnellen Reittieren begleiteten, die anderen sollten alles nur gleich einpacken, was man mitzunehmen gedachte, selbst wenn noch nicht gleich aufgebrochen wurde.
Die Kavalkade brauste davon, auf Pferden, Kulans und Tarpans, die man aus Sibirien mitgenommen hatte, während hier noch einige Pferde und Zebras hinzugekommen waren. An der Spitze jagte wieder Hans auf seinem Strauße als Führer. Dass er sonst nichts weiter zu berichten habe, hatte er schon vorher gesagt.
Eine Meile wurde in einer Viertelstunde durchjagt. Nicht weit entfernt von der Grenze des Urwaldes umstanden einige Argonauten den Kameraden, der einem Mörder zum Opfer gefallen.
Es war der englische Matrose Sam, der Keulenschwinger. Er hatte von hinten durch den Rücken einen Stich ins Herz erhalten, von einer breiten Klinge herrührend, dann hatte ihm der Mörder glatt den Kopf abgeschnitten. Bemerkenswert war, dass der Dajak, um den es sich nur handeln konnte, ihm nur das Messer und einige Kleinigkeiten abgenommen hatte, nicht das Gewehr und die Patronen, nicht den Revolver. Der Mann hatte mit diesen Feuerwaffen nichts anzufangen gewusst, er kannte sie nicht.
Sam hatte mit einigen Kameraden das Lager noch vor Tagesanbruch verlassen, sie hatten jagen wollen, zugleich wie gewöhnlich die Waldgrenze nach einem Wege untersuchend, früh um acht war er noch gesehen worden, dann wurde er vermisst, gegen Mittag hatte man seine Leiche gefunden.
Der Waffenmeister sprach nicht viel vom guten Kameraden und von Rache.
»Begrabt ihn hier auf der Stelle. Wo ist nun der hohle Drachenbaum?«
Keine hundert Schritt von hier, ganz dicht am Rande des Urwaldes.
Dieser war hier im Süden und speziell gerade in dieser Gegend anders beschaffen als sonst, wie wir es schon beschrieben hatten; nämlich insofern, als nicht erst ein rotangfreier Waldgürtel kam, sondern die lianenartigen Stechpalmen schlangen sich sofort an den ersten Bäumen empor, welche die Prärie scharf begrenzten, also gleich im Anfange gar kein Betreten der Waldregion zulassend.
Das kam daher, weil der Waldboden bis dicht an das Präriegebiet sumpfig oder doch sehr feucht war, dann aber gleich ein felsiges Gebiet begann. Noch dicht an der Urwaldsgrenze erhoben sich aus dem ebenen Graslande ganz stattliche Felsformationen.
In einer solchen hatte ein gewaltiger Drachenbaum festen Fuß gefasst. Die Drachenbäume, welche das höchste Alter erreichen, das bei Pflanzen vorkommt, sind ja regelmäßig hohl.
Bis hierher hatten die herbeigeholten Hunde die Spur des Mörders verfolgt, hatten dann zu diesem Baume hinaufgebellt.
Auch Juba Riata war zur Stelle gewesen, er hatte als erster entdeckt, dass dieser hohle Baumstamm den Eingang zu einem unterirdischen Tunnel bildete, der nach dem Walde führte, eine gute Strecke darunter hinwegführte und dann auf einem rotangfreien Wege wieder zum Vorschein kam.
Juba Riata hatte sich mit einigen anderen sofort zur weiteren Verfolgung des Mörders aufgemacht. Wo diese jetzt waren, das wusste man hier nicht.
Georg schnallte den Gürtel enger, an dem der Degenstock befestigt war, dessen Scheide aus der schotenähnlichen Wurzel solch eines Drachenbaumes gefertigt, im übrigen ja mehr ein Schwert zu nennen als ein Degen, das Schwert des Cid — er griff in die tief herabhängenden Zweige des Baumes und schwang sich empor.
Der Weg war, wie er wusste, sehr finster, und die Argonauten besaßen wohl noch ihre Taschenlampen, aber kein Benzin und kein Petroleum mehr; dagegen hatten sie sich bereits Talgkerzen angefertigt, Hans hatte einige mit aus dem Lager gebracht.
Georg hatte den Gipfel des zwanzig Meter hohen Baumes erreicht, das heißt das Ende des Stammes. Wären die Drachenbäume nicht regelmäßig hohl, so würde der Stamm immer in einer Plattform enden; die Äste wachsen nur seitwärts heraus.
Eine finstere Öffnung gähnte ihm entgegen, ungefähr von einem Meter Durchmesser. Er wusste ja schon, was hier vorlag, wohin man durch diesen natürlichen Schacht gelangte, und er selbst sah oben am Anfange die tiefen Einschnitte, die im Innern der Höhlung an dem Holze in regelmäßigen Abständen angebracht waren.
Kurz entschlossen stieg Georg hinab, nach Art der Schornsteinfeger, wenigstens in früheren Zeiten, sich auf beiden Seiten mit Knien und Händen feststemmend, und durch die Einschnitte fanden ja die Füße selbst Stützpunkte.
»O Jammer, o Jammer, o Jammer!«, hörte man nach einiger Zeit unten in der Tiefe dumpf erklingen.
Auch Doktor Isidor war anwesend, saß bereits in den Zweigen, er sah dort unten das Lichtchen flackern.
»Was gibt's da zu jammern, Waffenmeister?!«, rief der hinab.
»Diesen Weg können wir unmöglich benutzen, um von hier fortzukommen!«, erklang es zurück.
»Weshalb denn nicht?«
»Na, hier geht doch nicht einmal unser Lulu durch, unser Elefantenbaby, noch viel weniger unsere Mama Bombe!«
Ja, es war ein höchst enger Weg. Dort, wo der Baumstamm im Boden wurzeln musste, war von solchen Wurzeln gar nichts zu bemerken. Die natürliche Höhlung setzte sich noch ein gutes Stück in einem senkrechten Schachte fort, der durch Felsen ging, dann kam rechtwinklig daran ein horizontaler Tunnel, der noch etwas abwärts führte, so niedrig, dass man nur auf Händen und Füßen kriechen konnte, manchmal sogar fast auf dem Bauche rutschen musste.
Jedenfalls war es ein von der Natur geschaffener Gang, eine Auswaschung des Regenwassers durch Jahrtausende, wenn auch schon vorher eine Felsenspalte vorhanden gewesen sein mochte, über deren Ausgang der Drachenbaum gerade Wurzel gefasst hatte. Dann mochten auch noch Menschenhände nachgeholfen, mindestens Hindernisse beseitigt haben.
Das brennende Talglicht vor sich haltend, kroch Georg vorwärts. Wie weit, das konnte er nicht taxieren; später wurde die Länge dieses Ganges auf hundertachtzig Meter konstatiert.
Da aber kamen regelrechte Stufen, Georg zählte zweiundvierzig, was ungefähr zwölf Meter Höhe bedeutete, und dann, nachdem ihm schon vorher das Tageslicht entgegengeschimmert war, befand er sich im Freien.
Auch auf dieser Seite endete der Gang in einer bizarren Felsformation, aber gleich direkt, nicht erst in einem hohlen Baumstamme, sie lag ebenfalls dicht am Rande des scharfbegrenzten Urwaldes, dessen Bäume mit stachelbewehrtem Rotang umschlungen waren, und nach der anderen Seite hin blickte Georg, der einen Felsen erklettert hatte, in ein grünes Prärieland, in dem sich nur hier und da wie Inseln kleine Hügel und in der Ferne auch größere Berge erhoben. Es gab hier im Süden also noch ein zweites solches offenes Prärieland, es wurde von jenem nur durch einen Waldgürtel von etwa hundertfünfzig Meter Breite getrennt, der einmal gleich an den Rändern mit Rotang überwuchert, also unpassierbar war. So hatte man wenigstens glauben müssen. Durch solch einen Waldgürtel aber konnte man sich natürlich einen Weg hauen, wenn auch einige Messer dabei draufgingen.
Vor allen Dingen aber sah Georg dort, von stöbernden Hunden umringt, Juba Riata und den Eskimo mit einem halben Dutzend Matrosen durch die Prärie angerückt kommen, und sie führten zwischen sich einen gefesselten Mann von brauner Hautfarbe, nackt bis auf den Schurz, dem sie die Waffen abgenommen hatten, die später beschrieben werden sollen. Erwähnt sei nur gleich, dass ein Matrose eine Lanze von reichlich vier Meter Länge trug, die sich dann aber als etwas ganz anderes als eine gewöhnliche Lanze erweisen sollte.
Georg war ihnen nicht entgegen gegangen, hatte sie hier erwartet.
»Waffenmeister«, begann Juba Riata, »unser Fortkommen von der eingeschlossenen Waldinsel ist gesichert. Hier schließt sich daran eine zweite solche Waldinsel, fast ganz der unsrigen gleichend, die aber von Dajaks bewohnt ist, und die werden doch wohl Verbindung wieder mit der Nachbarschaft haben, wenn auch nur zu dem Zwecke, um sich gegenseitig die Köpfe abzuschneiden.
Wir haben hier einen Mann gefangen; ob er der Mörder von unserem Sam ist, weiß ich nicht, wir können uns nicht mit ihm verständigen, aber ich bezweifle es, sonst müsste er doch wohl den Kopf bei sich haben. Ich bezweifle es auch aus anderen Gründen. Der braune Bursche saß ganz gemütlich unter einem Baume und verzierte ein Stück Holz kunstvoll mit einer Schnitzerei. Wir haben ihn gefangen genommen und wollten ihn erst einmal zurückbringen, vielleicht kann sich Doktor Cohn mit ihm verständigen. Auch sonst wollte ich nicht eigenmächtig vorgehen, sondern erst Ihre Instruktionen abwarten, denn auf Kämpfe mit Dajaks müssen wir uns hier gefasst machen. Köpfe stehen bei ihnen gar zu hoch im Werte. Wir haben schon einen großen Trupp gesehen, sie aber nicht uns.«
So hatte Juba Riata in Kürze berichtet.
Georg wandte seine Aufmerksamkeit dem Gefangenen zu, der seine Rasse repräsentierte, und es sei hier gleich erledigt, was über die Dajaks zu sagen ist.
Diese Ureinwohner Borneos, welche jeder Kultur bis heute gänzlich unzugänglich geblieben sind, mit keinem Fremden etwas zu tun haben wollen, sind ein mittelgroßer, schlanker, sehr kräftiger Menschenschlag von gelber bis dunkelbrauner Hautfarbe, großen, schönen, schwarzen Augen, mit langen, seidenweichen Haaren. Unter den Frauen, welche nur einen Hüftenrock tragen, findet man viele Schönheiten. Von allen Reisenden, denen es gelungen ist, mit ihnen in nähere Berührung zu kommen, werden die Dajaks als durchaus ehrlich, treu und zuverlässig geschildert, ihr einmal gegebenes Wort wird unverbrüchlich gehalten, überhaupt vom ritterlichsten Charakter. Dass sie ausgesprochene Jäger sind, ist selbstverständlich.
Der beste Kenner der Dajaks ist der Engländer Georges Richardson, der aber auch die nordamerikanischen Indianer studiert, jahrelang in den wildesten Indianerterritorien gelebt hat, und der sagt, dass man die ritterliche Romantik, mit der man nun einmal die amerikanischen Rothäute umgibt, viel lieber auf diese Dajaks übertragen sollte. Die seien es viel mehr und überhaupt wirklich wert, dass sie als solche Helden der Wildnis verherrlicht werden! Die müssten ihren Fenimore Cooper bekommen! Es sind aber nun einmal nach unseren Begriffen die jämmerlichen Menschen, die wie die wilden Tiere verborgen in ihren undurchdringlichen Urwäldern leben.
Diese »wilden Tiere« sollen die höchste Intelligenz besitzen und Künste ausüben, die einen Vergleich mit den unsrigen gar nicht zu scheuen brauchen. Die meisten Berge Borneos enthalten Eisenerz, aus diesem wissen sie das Eisen zu gewinnen, es in Stahl zu verwandeln, sie fertigen ihre ausgezeichneten Schwerter und Dolche selbst, deren hölzerne Griffe sie ebenso wie hölzernes Hausgerät mit Ornamenten beschnitzen, auch wissen sie Tonwaren zu brennen, die sie gleichfalls mit Ornamenten schmücken, auch färben, und diese verschiedenen Ornamente muss man gesehen haben, wenigstens in bildlicher Wiedergabe, um von dem hohen Kunstgeschmack dieser »wilden Tiere« überzeugt zu sein.
Man nimmt an — oder es ist jetzt auch zweifellos nachgewiesen — dass diese Dajaks einst auf hoher Kulturstufe gestanden haben. Die alten, kolossalen, architektonisch herrlichen Bauwerke, die nicht von den Mohammedanern und noch vorher von buddhistischen Indern stammen, die sind von den Dajaks aufgeführt worden! Das ist jetzt durch verschiedene Figuren erwiesen worden. Außerdem besitzen die Dajaks eine ganz ausgebildete Literatur, wenn diese auch nur von Mund zu Mund geht, sie haben eine Poesie, deren Schönheit jetzt erst erkannt wird, und in solchen Gesängen werden jener Zeiten der Macht und des Glanzes gedacht, da auf dieser Insel, jetzt mit Urwald bedeckt, eine prächtige Stadt durch Landstraßen mit der anderen verbunden war.
Diese Dajaks sind einfach wieder in den Urzustand zurückgesunken, wie es schließlich jeder Rasse und jedem Volke einmal gehen wird. Es hat eben alles seine Zeit, sagt Salomo der Weise. Von ihrer ehemaligen Kultur ist ihnen nur die Kenntnis übrig geblieben, wie man Eisen und Stahl gewinnt, Ton brennt und lasiert, ein großer Kunstgeschmack für zierliche Ornamente, eine gewisse poetische Gabe — und schließlich möchte man auch noch an chemische Kenntnisse denken, indem sie ein Pfeilgift und ein Gegenmittel dafür zu brauen wissen, welche beide noch allen Analysen unserer Chemiker gespottet haben. Wer die Zusammensetzung dieses Gegenmittels ausfindig macht, kann sich von der niederländischen Regierung eine Prämie von einer Million Gulden abholen, denn dieses innerlich einzunehmende Mittel hebt auch die Wirkung des Pfeilgiftes der Atschinesen auf, mit denen die Holländer auf Sumatra unaufhörlich zu kämpfen haben, obgleich deren Pfeilgift ein ganz anderes ist als das der Dajaks und die Atschinesen selbst gar kein Gegenmittel kennen.
»Der Bursche hier hat auch vergiftete Pfeile bei sich!«, sagte Juba Riata. »Ich habe mit einem einen großen Vogel geschossen, ihn nur leicht verletzt, aber innerhalb einer halben Minute war das Tier verendet!«
Georg hatte den bezeichneten Lederköcher genommen, zog vorsichtig einen der Pfeile heraus. Sie waren auffallend kurz, kaum zwanzig Zentimeter lang, hinten auch nicht mit Federn besetzt, sondern trugen einen Büschel Haare.
»Wie kann man denn mit solch kurzen Pfeilen schießen? Was hat der denn für einen Bogen dazu?«
»Sie werden auch gar nicht mit einem Bogen abgeschossen. Es sind mehr Stechbolzen, hier ist das Blaserohr dazu.«
Die vier Meter lange vermeintliche Lanze erwies sich als ein Blaserohr. Sie bestand aus einer besonderen Art von Bambusrohr — Hatjang genannt — das wohl äußerlich Knoten hat, innen aber ganz glatt ist. Dieses lange Blaserohr, Sipet genannt, haben die Dajaks mit einigen südamerikanischen Indianerstämmen gemeinsam, nur dass sie es auch noch als Lanze verwenden, indem sie vorn eine Stahlspitze befestigen, aber so, dass sie den Flug des Pfeiles nicht aufhalten kann. Also gewissermaßen ein Bajonett. Die kurzen Pfeile werden bis auf hundertfünfzig Schritt mit außerordentlicher Treffsicherheit gepustet.
Sonst bestand die dem Gefangenen abgenommene Bewaffnung aus dem Kris und dem Mandau. Ersterer ist ein Messer, ein Dolch, die lange Klinge aber mehrmals gewunden — man sprichst von Flammendolchen — letzteres ist ein Schwert von ganz eigentümlicher Form, nur bei den Dajaks zu finden. Die Klinge ist am Griffe viel schmäler als vorn, und dann steht der Holz- oder Horngriff zu der Klinge in einem Winkel von ungefähr dreißig Grad. Beide Griffe waren schön geschnitzt und mit Büscheln von langen Menschenhaaren verziert.
Es war ein noch junger Mann, ein Jüngling, herrlich gewachsen, schlank und vom vollendetsten Ebenmaß und dennoch muskulös. Ein hübsches Gesicht, sogar sanfte Züge. Von Furcht gar keine Spur. Mit fast heiterer Neugier betrachtete er die fremden Männer, nur etwas staunend die ihm jedenfalls noch fremderen Hunde. Als Georg gar so vorsichtig den vergifteten Pfeil aus dem Köcher gezogen und ihn misstrauisch betrachtete, hatte er sogar laut gelacht, jetzt freilich auch etwas spöttisch, dazu sagte er etwas mit wohltönender Stimme.
»Als wir ihn überraschten, ich ihn plötzlich beim Genick hatte, war er wohl sehr erschrocken, aber nur im Augenblick, dann tat er, als mache er sich gar nichts daraus, als seien wir schon gute Bekannte.«
»Sie können sich nicht mit ihm verständigen?«
»Nein. Wie soll ich? Englisch und Französisch kann er nicht. Auch nicht Holländisch. Das käme hier doch auch nur in Betracht. Mit Indianerdialekten will ich doch nicht erst anfangen. Der Bursche selbst wollte schon immer gern eine Unterhaltung anfangen. Wir verstehen ihn nicht.«
Da kam der Schiffsarzt an, der dem Waffenmeister gefolgt war.
»Hier, Doktor Isidor, ist etwas für Sie. Unterhalten Sie sich mal mit dem hier auf Dajakisch.«
»Auf Dajakisch? Hat sich was! Wir wissen von diesen Eingeborenen nichts weiter, als dass es unter ihnen eine ganze Masse Sprachen gibt — besonders Sprachen, nicht nur Dialekte, manchmal versteht ein Dorf schon das benachbarte nicht, und nur von dem Stamme der Olo Ngadju, die an der Ostküste hausen, hat A. Hardeland ein ganz dürftiges Wörterbuch verfasst.«
Immerhin, auch jetzt wieder hatte dieser jüdische Universalgelehrte seine erstaunlichen Kenntnisse bewiesen — und außerdem sprach er jetzt auch noch den Dajak an, und dieser antwortete sofort.
»Na, dann ist es ja gut! Er spricht Malaiisch. Dann werden wir auch fertig miteinander.«
Wieder einmal staunten die Umstehenden dieses versoffene Krummbein an! Trifft im Herzen Borneos einen Dajak an und kann sich gleich mit ihm unterhalten!
Das Malaiische ist es aber auch wert, studiert zu werden. Es ist eine der ausgebildetsten Sprachen, die wir kennen. Das geht eben alles bis auf das Sanskrit zurück. Dabei kennt es nur wenige, voneinander kaum abweichende Dialekte. Während bei uns ein richtiger Oberbayer einen Plattdeutschen doch gar nicht mehr versteht.
Doktor Cohn verdolmetschte alles Wichtige, was wir nicht wiederzugeben brauchen.
»Wer bist Du?«
Die gutmütigen, heiteren Züge veränderten sich einmal, stolz richtete sich der gefesselte Jüngling empor.
»Ich bin Oglondu, der Sohn des Häuptlings der Njamanas.«
»Die Njamanas hausen hier?« — »Ja.«
»Wie stark seid Ihr?«
»Wir stellen zweihundert Krieger ins Feld«, lautete die stolze Antwort, und noch stolzer wurde hinzugesetzt: »und in unseren Triumphhütten sind mehr als zehntausend Menschenköpfe aufgebaut!«,
Er hatte Ajaubinos gesagt. Das lässt sich nicht anders als mit »Triumphhütten« übersetzen. Die Sitte des Kopfabschneidens, die ganze Kopfjägerei, worin der Lebenszweck der Dajaks ausschließlich besteht, heißt »ajau«, und das ist »Triumph«. Ihre eigentümlichen Hütten, die später beschrieben werden sollen, heißen »binos«. Sie selbst nennen sich darnach »Ajaunas«, und dieses Wort »ajau« haben auch sämtliche Dajaks, womit sie eben die Kopfjagd bezeichnen, das Kopfabschneiden, ihr höchster Triumph. Übrigens hatten die Umstehenden nun schon gemerkt, dass man sich mit diesem Jünglinge, der noch niemals einen fremden Menschen gesehen, gar nichts von einer anderen Welt wusste, nicht aus diesem Walde herausgekommen war, wie mit einem gebildeten Europäer unterhalten konnte, wenn man ihn nur nicht gerade das fragte, was er unmöglich wissen konnte.
»Kennst Du uns denn?«
»Ich habe Euch noch nie gesehen.«
»Mich wundert, dass Du so wenig Aufhebens von uns machst.«
»Ich weiß, wo Ihr wohnt.«
»Wo denn?«
»Im Reiche der Hantus.«
»Hantus, Hantus? Das sind doch Geister!«
»Du sagst es. Dort kommt Ihr her.«
Des weiteren stellte es sich heraus, dass dieser Jüngling den Mister Elias Osborne kannte. Dabei war nichts Wunderbares. Die Karawane mit der großen Menagerie war damals, von jenem Zauberer geführt, hier durchgekommen.
Oglondu hatte sie zwar nicht selbst zu sehen bekommen, denn obgleich damals ein achtjähriger Knabe noch, war er schon auf einem Kriegszuge gewesen; aber erfahren hatte er natürlich alles.
Und nun war die Sache die, wie sich Doktor Cohn schnell vergewisserte, dass dieser Jüngling glaubte, er habe Leute von dieser amerikanischen Expedition vor sich! Dass die schon längst, gleich nach ihrer Ankunft, dort drüben von den Chinesen ermordet worden waren, davon wusste man hier gar nichts!
Gut, mochte der das nur glauben.
Durch geschickte Fragen, ohne sich eine Blöße zu geben, brachte Doktor Isidor dann weiter aus ihm heraus, dass damals durch den Dornengürtel ein Weg gehauen worden war; denn durch den Tunnel hätte Osborne seine zum Teil sehr großen Tiere natürlich nicht bringen können.
»Dieser Weg ist, im Laufe der Zeit wieder verwachsen?«
»Selbstverständlich.«
»Weshalb hat ihn Mister Osborne nicht offen gehalten?«
»Weil er nie wieder von hier fort wollte. Das musst Du doch aber alles selbst wissen!«, wurde der Jüngling jetzt doch etwas misstrauisch.
»Mister Osborne ist schon längst tot und er hat uns nie in seine Geheimnisse eingeweiht. Du bist in unser Reich eingedrungen und hast einen unserer Männer getötet.«
Es war eine geschickte Ablenkung. Darüber musste der Jüngling doch gleich alles andere vergessen.
Aber in seinen offenen Zügen malte sich jetzt solch ein Staunen aus, dass man sofort bestimmt erkannte, wie er unschuldig daran sei, noch gar nichts davon wusste.
»Du bist doch vor kurzem drüben in unserem Gebiete gewesen.«
»Im Reiche der Hantus? Wie soll ich das?«
»Kennst Du denn diesen unterirdischen Weg nicht, der hier mündet?«
»Ich kenne ihn.«
»Du hast ihn benutzt.«
»Wie soll ich das wagen können?«, erklang es wiederum.
»Warum kannst Du das nicht wagen?«
»Die Hantus würden mich doch sofort erwürgen.«
»Und auch jeden anderen von Euch?«
»Jeden!«
»Wie ist denn Osborne mit seiner Gesellschaft hineingelangt?«
»Er wurde von Konjamu geführt, dem mächtigsten Zauberer, und der Mond war ihm damals besonders günstig, er verbarg dazu vollkommen sein Gesicht.«
Doktor Isidor wusste es: die Dajaks verehren hauptsächlich den Mond als gute Gottheit, mehr als die glühende Sonne, und eine vollkommene Mondfinsternis hat ja bei solchen Naturvölkern immer etwas ganz Gewaltiges zu bedeuten.
»Einer unserer Männer ist vorhin drüben ermordet aufgefunden worden, der Kopf war ihm abgeschnitten, und der Mörder hat den Weg hier durch diesen Tunnel genommen. Kann das ein fremder Dajak gewesen sein, ein fremder Ajauna, der nicht zu Euch gehört?«
»Ein fremder Ajauna, hier auf unserem Gebiet, der nicht zu uns gehört?«, wiederholte er sinnend.
Dann zuckte er empor, die Erklärung für eine Möglichkeit war ihm bereits gekommen. »Ha, wenn Du die Wahrheit sprichst — — dann kann das nur Letanje gewesen sein!«
»Wer ist das, Letanje?«
»Er rühmt sich, obgleich er kein Zauberer ist, mit den Hantunaks in Verbindung zu stehen.«
»Mit weiblichen Geistern?«
»Ja, und er hat uns schon immer aufgefordert, wir sollen hinüberdringen und den weißen Fremden die Köpfe nehmen, die Hantunaks wären stärker als die Hantus selbst, er hat uns verhöhnt, dass wir es nicht glaubten.«
Also ein Freigeist unter den Dajaks, wenn er dabei auch selbst Geister zu Hilfe nahm, um die anderen zu einer großen Tat zu verleiten.
»Fragen Sie ihn«, sagte jetzt Georg, »wie seine Stammesbrüder uns aufnehmen werden, wenn wir jetzt ihr Gebiet durchziehen. Wir wollten auswandern, nach der Wüste zurück.«
Doktor Cohn verdolmetschte es.
Die Augen des Jünglings leuchteten auf.
»Die Njamanas freuen sich darauf, sie werden Euch allen die Köpfe abschneiden!«, lautete dann sein ungeschminkter Bescheid.
»Weshalb habt Ihr denn das nicht gleich bei unserem ersten Durchzug getan?«
»Ihr standet unter dem Schutze des mächtigen Konjamu.«
»Der ist tot?«
»Schon längst. Wir hatten ihm nur für einen Mondwechsel versprochen, Euch zu schonen, und dann habt Ihr Euch ja hinter der Hecke der Hantus verkrochen.«
Doktor Cohn, der über die Dajaks mehr wusste als alle anderen, konnte gleich eine Erklärung einschalten.
Bei den Dajaks gilt jedes Versprechen nur von einem Mondwechsel zum anderen, also immer höchstens vier Wochen, ein anderes gehen sie gar nicht ein, und wenn sie das einem Fremden gegenüber nicht betonen, dieser davon nichts weiß, so können sie doch nichts dafür. Nach dem übernächsten Mondwechsel erlischt jedes Versprechen und jede Abmachung.
Darin sind die Dajaks vielleicht ehrlicher als zum Beispiel die Engländer, die bekanntlich jeden Frieden und jedes Bündnis und alles andere immer »für ewige Zeiten« abschließen — bis eben etwas dazwischen kommt.
»Wie heißt Dein Vater?«, musste Doktor Cohn auf des Waffenmeisters Wunsch fragen.
»Er ist der Häuptling der Njamanas.«
»Als Häuptling führt er keinen besonderen Namen?«
»Nein.«
»Gut, ich wusste es. Was weiter, Waffenmeister? Können wir uns mit dem Häuptling in Verbindung setzen?«
»Ja.«
»Wir werden freundlich aufgenommen?«
»Nein.«
»Sondern?«
»Unsere Krieger schneiden Euch die Köpfe ab!«, lautete wiederum die bündige Erklärung.
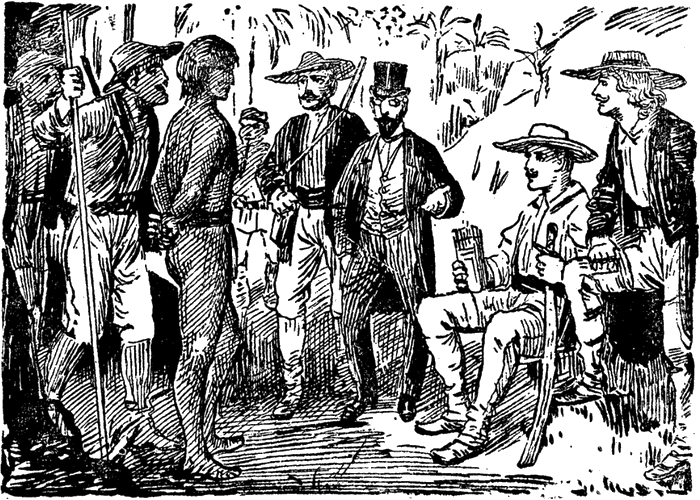
»Ihr wartet wohl schon immer darauf, dass wir einmal hinter der Dornenhecke hervorkommen?«
»Ja, gewünscht haben wir es immer, wenn auch nicht daran geglaubt.«
Dieses Glück wäre gar zu groß gewesen, um daran glauben zu können.
»Ihr schießt mit vergifteten Pfeilen?«
»Natürlich.«
»Ihr werdet auch uns mit vergifteten Pfeilen beschießen?«
»Euch? Weshalb denn? Was hätte denn das für einen Zweck?«
Wenn es die anderen nicht verstanden, was hier vorlag, so erfasste es doch sofort dieser geniale Schachspieler.
Die an der Küste und in der Nähe der Ansiedlungen Lebenden Dajaks mochten wissen, was für eine furchtbare Waffe sie in ihren vergifteten Pfeilen besaßen, gegen welche sich die Weißen sich nicht schützen konnten.
Diese Dajaks hier aber, nie mit Weißen in Berührung gekommen, hielten es für ganz selbstverständlich, dass dieses Gegenmittel jeder Mensch besaß. Sie benützten ihre Giftpfeile nur zur Jagd auf große Raubtiere, überhaupt zur Jagd, nicht zum Töten anderer Dajaks, die eben durch das Gegenmittel geschützt waren.
Es war von Wichtigkeit, dies zu wissen — nun musste man aber auch sehr, sehr vorsichtig sein, um sich ja keine Blöße zu geben.
»Wenn die Sache so steht«, entschied Georg jetzt, »wir gar nicht hoffen dürfen, mit dem Häuptling in friedliche Unterhandlung treten zu können, dann hat es auch gar keinen Zweck, uns hier länger aufzuhalten. Also wieder zurück! Drüben beraten wir uns weiter; den Burschen nehmen wir natürlich mit.«
Der Rückweg wurde angetreten. Der Gefangene folgte ganz willig, es blieb ihm auch nichts anderes übrig, sonst wäre er einfach durch den Tunnel am Boden geschleift worden.
Auf dem feindlichen Gebiete wurde keine Wache gelassen, das mit den vergifteten Pfeilen war doch eine gar zu kitzlige Sache, aber natürlich jenseits der Eingang durch den Drachenbaum nicht mehr ohne Aufsicht gelassen, und überhaupt sollte das Hauptquartier gleich hierher verlegt werden, von wo aus man den stachelgepanzerten Waldgürtel in Angriff nehmen wollte.
Seit einigen Tagen schon arbeiteten unablässig alle vorhandenen Messer und Entersäbel, um durch den Rotangwald einen Weg zu bahnen. Eine Axt gab es nicht. Auch der Schiffszimmermann hatte seine nicht mitzunehmen brauchen, an Bord des »Elektron« war ja alles Handwerkszeug vorhanden gewesen. Aber man hatte ja keinen einzigen fremden Gegenstand an Land bringen, hier zurückbehalten dürfen? Der in dieser Hinsicht so halsstarrige Waffenmeister hätte es niemals geduldet, hätte den Sünder aus der Gemeinschaft der Argonauten ausgestoßen — oder aber er selbst wäre gegangen, hätte sich fernerhin abseits gehalten. Soweit war es gegangen, dass die Patronin ein prächtiges Umschlagetuch wahrscheinlich eine Art Glasgespinst, das sie von Viviana geschenkt erhalten und beim Verlassen des »Elektron« getragen hatte, auf Georgs Wunsch in einen Fluss geworfen hatte, mindestens hatte er es nicht mehr an ihr sehen wollen. Dass Klothilde ihren goldenen Hirschkäfer vergessen hatte, das war ja nun wieder ganz selbstverständlich gewesen.
Aber ihre Entersäbel hatten diese wehrhaften Fechtbrüder bei der Übersiedlung von der »Argos« auf das im Wasser liegende Luftschiff nicht vergessen, und die hatten sie dann natürlich auch nicht zurückgelassen, und das war gut. Diese gewichtigen Klingen schafften doch ganz anders als die Schiffs und Jagdmesser.
Das allergrößte Glück aber war wohl, dass der erste Ingenieur, der, ein ehemaliger Grobschmied, jetzt die feinste Goldschmiedekunst aus Passion betrieb, seinen Handwerkskasten mitgenommen hatte. In diesem befand sich außer anderen Präzisionswerkzeugen auch ein Diamantfeilchen. Ein winziges Dingelchen. Ein Stückchen Uhrfederband, in das einige Diamantsplitterchen unverrückbar eingelassen waren. Nichts weiter, aber das genügte. Mit diesem winzigen Feilchen war eine geschickte Hand, von einem ingeniösen Kopfe gelenkt, imstande, eine mächtige Dampfmaschine aus gewöhnlichen Eisenklumpen zu fertigen. Nämlich wenn man aus einem Werkzeuge immer das nächste, das gebraucht wird, hervorgehen lässt.
Zuerst eine größere Feile! Dazu wurde das Stück eines Entersäbels genommen, der schon vorher in die Brüche gegangen war. Eine Feile wird gehauen. Aber das ist nicht so einfach getan, wie gesagt, besonders nicht, wenn man nichts zum Hauen hat, und dann ist das doch auch nicht so, dass man mit dem Meißel Einschnitte und so Zähne hervorbringt, sondern diese Zähne müssen auch wirklich scharf werden.
Aber mit diesem Diamantfeilchen war es wirklich eine Leichtigkeit, aus einem Stück ausgeglühtem Stahl eine große, wunderbar scharfe Feile herzustellen, die nur noch gehärtet zu werden brauchte.
Solcher Feilen wurden mehrere gefertigt, und dann konnte die Arbeit erst richtig beginnen; denn jetzt merkten die Argonauten erst, was es heißt, sich durch einen Rotangwald einen Weg bahnen zu wollen. Nach zehn Minuten war jedes Messer und jeder Entersäbel vollständig stumpf und, wenn der Stahl zu hart angelassen, auch noch schartig, ganz gezackt. Nur Georgs Damaszenerklinge vermochte die glasharte Rinde ohne Beschädigung zu durchschlagen, er wollte es aber lieber nicht zu sehr riskieren.
An ein Schleifen der unbrauchbar gewordenen Klingen wäre gar nicht zu denken gewesen, vorausgesetzt, dass sie überhaupt einen drehbaren Schleifstein besessen hätten, dann wäre bald am Griffe kein Stahl mehr vorhanden gewesen; sondern er wurde geglüht, ausgehämmert, gedengelt, scharf gefeilt und wieder gehärtet.
Auf diese Weise gelang es mehr als hundert Paar starken, geschickten und emsigen Menschenarmen die hundertfünfzig Meter Rotangwald in zwei Wochen zu durchbrechen.
Es ist dies so ausführlich behandelt worden, um eben einmal zu zeigen, was es heißt, ins Innere Borneos eindringen zu wollen.
Fürwahr, jener Engländer hat ganz recht, wenn er so schön sagt, dass es viel einfacher ist, sich durch eine kilometerdicke Käsemauer durchzufressen, als sich mit Messer und Axt einen Kilometer weit durch einen Rotangwald zu hauen.
Und da sieht man auch, was man von solchen »paradiesischen Eilanden« als Kolonien meist zu halten hat.
Ein einziger Maler wie Rembrandt hat durch späteren Verkauf seiner Bilder ins Ausland mehr Geld in sein Vaterland gebracht, als alle holländischen Kolonien zusammengenommen! Das ist genau berechnet worden. —
Unterdessen beschäftigten sich die Hauptpersonen und am meisten Doktor Isidor mit dem Gefangenen.
Man hatte ihm einen von Bäumen begrenzten Platz angewiesen, auf dem er sich frei bewegen durfte. Er wurde von einigen scharfen Hunden bewacht, das war sicherer als jede Kette. Sobald er die nur gedachten Grenzlinien mit einem Fuße überschritt, hatte er die scharfen Zähne im Beine und an der Kehle.
Oglondu hatte die gezähmten Tiere angestaunt, besonders den Löwen und den Königstiger und den Bison, die er ja noch nie gesehen, aber fürchten tat er sich nicht. Er erschrak gewaltig, als ein Gewehr abgefeuert wurde, aber Furcht hatte er nicht hinterher.
Ja, wie er dann das Gewehr untersuchte, wobei er auch wiederholt auf die Eisenteile biss — so wie der Engländer Gold- und Silbermünzen, denen er nicht recht traut, zwischen die Zähne nimmt, weil man dadurch bei einiger Übung echtes Gold und Silber sehr wohl von falschem unterscheiden kann, die Zähne sind im Gefühl überaus empfindlich — da erklärte er diesen besten englischen Stahl verächtlich als einen ganz schlechten Stoff, so wie er auch schon über die Messer und Entersäbel gespottet hatte. Und tatsächlich konnte deren Stahl auch keinen Vergleiche mit seinem Dolche und Schwert aushalten, wenn diese auch wieder nicht an Georgs wunderbare Damaszenerklinge heranreichte.
Ebenso staunte er wohl auch, als man ihm die Wirkung des Schusses zeigte, wie die Kugel ein Baumstämmchen glatt durchschlagen und ein zweites noch zersplittert hatte, aber über die Frage der Weißen, wie seine Landsleute sich denn gegen solche Feuerwaffen schützen wollten, lachte er wiederum verächtlich oder sogar wirklich belustigt.
»Was wollt Ihr denn mit diesen Dingern im Walde? Oder könnt Ihr etwa durch zehn dicke Bäume schießen?«
Er hatte recht. Auf diesem rotangfreien Gebiete gab es Wälder auch ohne Unterholz, parkähnlich, aber nirgends konnte man weiter als zehn Schritte schießen, dann blieb die Kugel in einem Baume stecken.
Und dann machte der braune Bursche stolz noch eine andere Bemerkung.
»Wenn wir solche Dinger gebrauchen könnten, dann hätten wir sie uns schon längst selbst gefertigt, viel bessere als Eure.«
Eine ganz gefährliche Bemerkung! Ein ganz, ganz gefährlicher Charakter!
Wenn solche Wilde alle »Segnungen der Kultur« stolz verschmähen, sogar den edlen Schnaps, wie es die Dajaks tun, dann freilich sind sie nicht so leicht unterzukriegen und auszurotten, wie es mit den armen nordamerikanischen Rothäuten geschehen ist. Das »Unterkriegen« in doppeltem Sinne gemeint.
Die Hauptsache aber, um die es sich handelte, war die Frage des Gegengiftes.
Dieses Gegenmittel wird von den Dajaks täglich eingenommen, es gehört bei ihnen zum täglichen Brot, damit sie, da es erst nach einigen Stunden wirkt, nachdem es durch die Verdauung ins Blut übergegangen ist, immer geschützt sind gegen die tödliche Vergiftung durch einen Pfeilschuss. Dies weiß man.
Also musste der Jüngling dieses Gegenmittel auch bei sich führen. Aber wo? Er war nackt bis auf den Schurz gewesen, an dem Lianengürtel hing kein Beutelchen und kein Büchschen.
Nun, er zeigte den Fremden selbst, wo er seinen Schatz, sein Lebenselixier, berge. Noch an demselben Tage, da er gefangen worden, hatte er »Momasse« begehrt.
Der Schiffsarzt war zur Stelle, er hatte genug über die Dajaks gelesen, und was der einmal gelesen hatte, behielt er auch für immer im Kopfe.
»Wozu brauchst Du Momasse? Du bist hier vor jeder Vergiftung geschützt.«
»Aber ich kann das Ugli bekommen.«
»Das Fieber? Diese Gegend ist völlig fieberfrei.«
»Gib mir meine Momasse.«
Doktor Cohn wusste es: Diese rätselhafte »Momasse« ist auch das trefflichste Mittel gegen Fieber.
»Wo hast Du Deine Momasse?«
Der Jüngling ahnte nicht, welches Geheimnis ihm abgelockt wurde. Dieser Dajak hielt es für ganz selbstverständlich, dass jeder Mensch in der Welt, die für ihn freilich nur im borneoschen Urwald bestand, seine »Momasse« einnehme.
»Wo soll ich sie haben? Natürlich im Griffe meines Mandaus.«
Erst jetzt dachte man daran, diesen Schwertgriff aus Horn näher zu untersuchen, und da entdeckte man, dass der Stift hinten nicht nur ein Zierrat war, er konnte herausgeschraubt werden, hatte ein ganz regelrechtes Schraubengewinde, wenn auch nur mit dem Messer geschnitzt — der Griff war hohl, zur Hälfte mit linsenartigen, weißen Körnern gefüllt, die deshalb nicht geklappert hatten, weil die leere Höhlung mit Baumwolle ausgestopft war.
Diese weißen Linsen sind bekannt genug. Sie sind auf ganz Borneo bei allen Dajaks genau dieselben, sodass man fast an die Samenkörner einer Pflanze glauben könnte. Aber das ist nicht der Fall. Sie bestehen hauptsächlich aus Stärkemehl und Milchzucker, jedes Eiweiß fehlt, wie überhaupt alle Samenstruktur. Es ist ein künstliches Präparat.
Worauf es ankommt, das haben unsere gelehrten Forscher, die sich hiermit beschäftigen, allerdings ergründet, und Doktor Isidor bewies durch seine Experimente, wie bewandert er in dieser Sache war.
Er ließ eines der kleinen Wildschweine, die es hier massenhaft gab und von denen man einige gezähmt hatte, eine Linse verschlucken, ritzte es nach einigen Stunden mit einem vergifteten Pfeil — dem Tiere war gar nichts anzumerken.
Und vergiftet war der Pfeil gewesen! Denn mit demselben Pfeile wurde ein zweites Wildschwein blutig geritzt, fast sofort bekam es Krämpfe und schon nach einer Minute war es tot. Diesem verendeten Tiere öffnete Doktor Cohn den Schädel, nahm das Gehirn heraus, ließ es einem andern Wildschwein fressen. Nun wurde dieses nach einigen Stunden mit einem Giftpfeil geritzt und es blieb gesund!
Wie war das möglich? Das Tier hatte ja gar nicht das Gegenmittel einbekommen!
Nun, das Pfeilgift lieferte eben erst dieses Gegenmittel, durch Umwandlung im tierischen Körper. So werden ja auch alle unsere sogenannten Lymphen und Heilserums dargestellt. Eine gesunde Kuh wird künstlich pockenkrank gemacht, ihre Lymphe, das eigentliche Pockengift, wird einem gesunden Menschen eingeimpft, dadurch wird er immun, unempfindlich gegen die Pocken. Professor Pasteur impft den tollwutkranken Menschen mit einem Serum, das er aus dem Rückenmark eines an Tollwut verendeten Hundes herstellt.
Woher diese Aufhebung des Giftes durch sich selbst, nur aus einem Körper in den anderen übertragen, da stehen wir ja nun freilich vor einem wohl niemals zu ergründenden Rätsel. Wir kennen nur die Tatsache, den Erfolg. Und so war es auch hier. Dieses Pfeilgift der Dajaks lähmt sofort das Gehirn und führt innerhalb einer Minute den Tod herbei. Über diese Schnelligkeit braucht man sich nicht zu wundern. Wer nicht ein gewohnheitsmäßiger Zigarettenraucher ist, braucht nur einen tiefen Zug aus einer Zigarette zu inhalieren, und schon fünf Sekunden später fühlt er die Betäubung im Kopfe. Das gasige Nikotin wird von der Lunge absorbiert, geht ins Blut über, und innerhalb zweier Minuten pumpt das Herz das Blut bis in die entferntesten Äderchen, zu allererst aber nach dem Gehirn.
Solch ein von dem Pfeilgift der Dajaks infiziertes Gehirn, in das Blut eines anderen Tieres oder eines Menschen überführt, hebt die Wirkung dieses selben Giftes wieder auf, entweder sofort, indem ein alkoholischer Extrakt dieses Gehirns direkt ins Blut gespritzt wird, oder nachdem dieses Gehirn selbst verdaut worden ist.
Das ist unseren Forschern und allen Holländern, die damit zu tun haben, sehr wohl bekannt.
Aber wer hat denn immer gleich so ein Gehirn bei der Hand. Dann muss man auch erst solches Pfeilgift haben. Und außerdem muss das betreffende Gehirn ganz frisch infiziert sein, sonst wirkt es nicht mehr.
Den wirksamen Bestandteil solch eines infizierten Gehirns nun fest an eine Substanz zu binden, die sich hält, vielleicht sogar für immer, das eben ist das Geheimnis der Dajaks, für dessen Ergründung die niederländische Regierung eine Prämie von einer Million Gulden ausgesetzt hat.
Auch das Pfeilgift wurde gefunden, das der edle Jüngling zur Reserve bei sich führte. Es war in dem hohlen Griffe seines Dolches enthalten. Eine braune, sirupähnliche Masse. Doch hier handelte es sich hauptsächlich um das Gegenmittel, um die Linsentabletten.
»Wie stellt Ihr die her?«
Jetzt allerdings wurde Oglondu doch etwas misstrauisch. Der Gedanke mochte in ihm aufdämmern, dass doch vielleicht nicht alle Menschen dieses Gegenmittel kannten.
Aber dieser jüdische Schiffsarzt war nicht so unvorsichtig gewesen, sich eine Blöße zugeben, er war von vornherein gewappnet gewesen.
»Wir haben nämlich unser eigenes Verfahren zur Herstellung dieser Momasse«, setzte er also schnell hinzu, »und mir scheint, unsere ist bedeutend wirksamer als das Eure. Wie also stellt Ihr die Momasse her?«
»Wie kannst Du mich fragen!«, lautete jetzt die merkwürdige Antwort. »Würdest Du mir etwa sagen, wie Du die Momasse machst?«
»Gewiss, wenn Du mir Dein Rezept gibst!«, log Doktor Isidor mit dreistem Munde, und es war verzeihlich, im Kriege ist alles erlaubt.
»Du lügst!«, wurde ihm jetzt aber gleich ins Gesicht geschleudert.
»Weshalb soll ich Dich denn belügen? Mir scheint aber, Du kennst das Rezept selbst nicht, die Momasse wird nur von Euren Zauberern bereitet.«
»Jeder kann sie selbst herstellen.«
»So tauschen wir unsere Rezepte.«
»Ich verstehe Dich nicht, Fremder. Sobald man das Geheimnis verrät, nur darüber spricht, verliert die Momasse doch ihre Kraft, jeder andere Ajauna könnte mich mit einem Pfeilschuss töten, alle Momasse würde mir nichts mehr nützen, und außerdem hätte ich alle Köpfe umsonst erbeutet!«
O weh! Da lag der Hase im Pfeffer!
Wie soll man solch einen tief in der Seele des Volkes eingewurzelten Aberglauben plötzlich ausrotten?!
Eine Beratung fand statt, aber niemand wusste ein Mittel, wie man diesem Dajak sein Geheimnis entlocken könnte. Mit dem Vorschlage, den Jüngling martern zu wollen, brauchte sich niemand erst zu beschmutzen. Wie viele Dajaks mögen deshalb schon Folterqualen ausgesetzt worden sein, um ihnen das Geheimnis zu erpressen. Doktor Cohn wollte es einmal mit Hypnose versuchen, versicherte aber gleich, dass es keinen Zweck haben würde. Die Macht der Hypnotik wird ja gewöhnlich weit überschätzt. Die Kraft des festen Vorsatzes und der Verweigerung wird in diesem künstlichen Schlafe nie gebrochen, niemals! Sonst brauchten wir ja gar keine Untersuchungsrichter mehr.
Aber man sollte auch nicht lange der Sorge wegen dieses Pfeilgiftes und der Erlangung des Gegenmittels nachhängen.
Am andern Morgen schon kläffte wütend der Spitz, der oben in den Zweigen des Drachenbaumes zwei Matrosen in der Bewachung des Zuganges unterstützte. Unten in der Tiefe war jemand, machte sich auch schon durch Worte bemerkbar. Doktor Isidor wurde geholt.
»Wer ist dort unten?«, rief er auf Malaiisch hinab, nachdem er das erste nicht verstanden hatte.
»Ich komme im Frieden der Njamanas«, erklang es zurück.
»Was willst Du?«
»Ich will die Leiche des Sohnes unseres Häuptlings holen, wenn die Hantus sie noch nicht verschlungen haben.«
»Oglondu lebt.«
»Das ist nicht wahr!«
»Kein Njamana und kein anderer Ajauna kann das Reich der Hantus lebendig betreten.«
Das war den Menschen dort unten nicht auszureden, und man wollte doch lieber nicht so per Distanz mit ihm verhandeln, wenigstens erst alles versuchen, ihn heraufzulocken.
Oglondu wurde vorgenommen.
»Schwöre mir, dass Du mit dem Abgesandten nur Malaiisch sprichst.«
Der Jüngling leistete einen zeremoniellen Eid, dessen Inhalt Doktor Cohn zwar nicht verstand, aber er glaubte ihm, und schließlich war es auch nicht von so großer Bedeutung.
Oglondu musste den Baum ersteigen, unter den nötigen Vorsichtsmaßregeln, dass er nicht etwa plötzlich nach unten entwischen konnte.
»Bist Du es, Balia Sadja? Antworte in der Sprache der Malajas.«
»Ich sehe Deinen Kopf, Oglondu, aber ich kann nicht glauben, dass Du im Reiche der Hantus noch lebst«, erklang es dort unten schon recht freudig.
»Ich lebe noch, und auch Du wirst leben bleiben. Diese Fremden wissen uns vor den Hantus zu schützen. Komme herauf, Balia Sadja, und Du kannst sofort, wenn Du willst, zurückkehren.«
Der Widerstand war gebrochen, und zur Überraschung aller tauchte aus der Stammöffnung statt des erwarteten Dajakkriegers ein junges Weib auf, ein Mädchen, sogar eine ganz auffallende Schönheit.

Zur Überraschung aller Umstehenden tauchte aus
der Stammöffnung statt des erwarteten Dajakkriegers
ein junges Weib auf, gefolgt von zwei Männern.
Die weiche, für einen Mann etwas hohe Stimme hatte man ja schon gehört, aber sie war nicht aufgefallen, weil auch Oglondu eine solche hatte.
Dann allerdings folgten noch zwei Männer, aber dieses junge Weib, durch besonderen Schmuck ausgezeichnet, war doch die Hauptperson.
Doktor Cohn hatte schon einen besonderen Namen gehört und konnte gleich eine Erklärung geben.
Es war eine Balia, eine »Geleiterin«, eine Zauberpriesterin.
Wohl kein anderes Volk auf der Erde hat einen so ausgebildeten Seelenkultus für ein Jenseits als wie die Dajaks, diese »wilden Tiere«.
Man bedenke doch: Die Dajaks schneiden sich nur deshalb gegenseitig die Köpfe ab, um im »Seelenlande« möglichst viele Sklaven zu haben. Zuletzt wird aber auch diesem Dajak einmal der Kopf abgeschnitten, nun wird er selbst wieder samt seinem ganzen Totengefolge der Sklave, der Untertan dessen, der ihm den »Triumph« genommen hat, und seine Sklaven haben doch auch wieder Köpfe abgeschnitten, sich Seelen dienstbar gemacht.
Und da gibt es nun im Seelenlande der Dajaks kein wildes Durcheinander, sondern dort ist nach Rangstufen alles ganz genau geordnet. Es ist gerade umgekehrt wie bei uns. Wir haben bei Lebzeiten eine Hofordnung und Beamtenordnung und andere Rangordnungen oben und unten und links und rechts und kreuz und quer — erst im Himmel werden wir alle gleich. Bei den Dajaks ist es gerade umgekehrt. Die sind im Leben alle gleich, erst nach dem Tode fangen die Rangordnungen an.
Das ist bei den Dajaks nun eine förmliche Wissenschaft geworden, die von den Balias gepflegt wird. Also »Geleiterinnen«. Sie geleiten die Seelen der Toten ins Jenseits hinüber, reihen sie dort ein. Ganz den altgermanischen Walküren entsprechend. Nur dass die Balias bei dem Geleiten noch leben und auf der Erde bleiben. Oder doch nicht so ganz: Sie versetzen sich durch Tanz in Verzückung, ihre Seele geht mit. Dann nach dem Erwachen berichten sie von den Zuständen, die im Jenseits herrschen.
Sie dürfen nicht heiraten, werden aber für diese Entsagung reichlich entschädigt. Die Balias werden heilig gehalten, sind aber trotzdem prostituierte Tänzerinnen. Ganz genau wie die bramanischen Bajaderen.
»Mit wem habe ich zu verhandeln?«, fragte der Schiffsarzt, nachdem er zur Vorsicht den Oglondu hatte entfernen lassen, da er nun unterdessen einen ganz anderen Plan gefasst hatte, um die hier vorliegende Schwäche zu verdecken.
»Mit mir, der Balia Sadim«, entgegnete diese.
»Wir haben Oglondu gefangen, Was gebt Ihr uns, wenn wir ihn Euch wieder ausliefern?«
»Weshalb seid Ihr in unser Gebiet eingebrochen und habt ihn gefangen?«
»Einer der Eurigen ist gestern hier zuerst eingedrungen und hat einen Mann von uns ermordet, ihm den Kopf abgeschnitten.«
»Hier in das Reich der Hantus eingedrungen? Das ist nicht wahr!«, erklang es auch hier sofort im Chor.
»Oglondu bezweifelt es nicht. Er meint, dass es wahrscheinlich Letanja gewesen ist.«
Gleich beim Hören dieses Namens wurden die drei unsicher.
»Ja, bei dem wäre es möglich. Dann aber ist Letanja nach unseren Gesetzen des Todes! Er hat ein strenges Verbot übertreten. Wir liefern ihn Euch auch zur Bestrafung aus.«
»Gut, angenommen. Das ist aber eigentlich ganz selbstverständlich, dadurch bekommt Ihr den Sohn Eures Häuptlings noch nicht frei.«
»Was forderst Du sonst noch?«
»Höre mich an, edle Balia! Wir wollen dieses Reich der mächtigen Hantus, unter deren Schutze wir stehen, endlich wieder verlassen, unsere Heimat wieder aufsuchen. Der Weg nach der Küste führt durch viele Dajakdörfer, mit denen wir nicht immer im Guten auskommen werden, sie werden uns mit vergifteten Pfeilen beschießen. Nun können wir uns ja Momasse in beliebiger Menge bereiten, haben auch massenhaft in Vorrat. Aber die Hantus haben uns verboten, auch nur ein einziges Korn mitzunehmen, dürfen uns auch unterwegs keine andere Momasse herstellen. Weshalb nicht, das sagen die Hantus nicht. Wir kommen nicht eher von hier fort, als bis wir das letzte Korn Momasse, das wir hier bereitet, vernichtet haben. Liefert uns Momasse.«
Einen klügeren Zug hätte dieser Schachspieler nicht tun können. Er hatte seinen Plan den anderen schon vorher klargelegt, so brauchte er jetzt nicht viel zu verdolmetschen.
Den drei Dajaks schien es ganz selbstverständlich zu sein, was sie da zu hören bekamen.
»Wieviel Momasse brauchst Du?«, fragte die Balia ganz einfach.
Ehe jener zu rechnen begann, fuhr sie selbst schon fort:
»Wir können Dir nicht mehr als einen Bodu liefern, denn wir müssen doch für uns selbst behalten, und wir müssen noch vier Monde vergehen lassen, ehe wir wieder Momasse machen dürfen.«
Religiöser Aberglaube — dagegen war nichts zu machen.
»Wie viel ist das, ein Bodu?«
»So viel.«
Sie machte mit beiden Händen eine Bewegung, wonach es ein recht ansehnlicher Haufen sein musste.
»Eine ganze Hirschhaut voll«, erklärte sie noch näher, »genug für hundertmal hundert Menschen, dass sie hundertmal hundert Tage gegen jeden giftigen Pfeilschuss gesichert sind.«
Na, dann war es ja gut. Dieses rätselhafte Zeug schien hier äußerst wohlfeil zu sein.
»Ist diese Momasse aber auch gut. Ihr bekommt den Gefangenen nicht eher frei, als bis ich mich durch verschiedene Proben überzeugt habe, dass die Momasse auch wirklich gegen Gift schützt.«
»Weshalb soll sie nicht gut und wirksam sein? Ich verstehe Dich nicht. Wie soll ich denn täuschen können? Ja, Du kannst Dich davon erst überzeugen, ehe Du Oglondu freigibst.«
»Schön. Aber hiermit ist es noch nicht abgetan. Dieses Zeug hat für Euch ja gar keinen Wert.«
»Was forderst Du sonst noch?«
»Schwerter.«
»Wozu? Ich sehe doch, dass Ihr selbst welche habt.«
»Um uns durch den Rotangwald zu hauen, und Eure Schwerter sind besser, wir erkennen es an.«
»Um Euch durch den Rotangwald zu hauen? Dazu dürfen wir Euch keine Schwerter und nichts anderes liefern. Dieser Wald, der das Reich der Hantus umgibt, ist uns heilig. Bitte, stelle nicht diese Forderung, bitte nicht!«
Es war so flehentlich gesprochen, dass Georg aufmerksam wurde und es sich verdolmetschen ließ.
»Da wollen wir auf die Schwerter verzichten!«, entschied er dann. »Diese Leute gefallen mir, sie scheinen grundehrlich zu sein, und die Menschenköpfe sammeln die eben wie wir die Briefmarken. Kommen Sie zu den Freundschaftsbedingungen, wegen der Führung und so weiter. Aber feilschen Sie nicht so wie ein polnischer Jude. Sie essen doch Schinken und schmieren auch noch Schweineschmalz darauf.«
Auch der Freundschaftsvertrag wurde abgeschlossen. Man wollte einander hüben wie drüben als Gäste willkommen heißen.
»Bis wie lange gilt dieser Vertrag?«
»Nun, bis zum übernächsten Mondwechsel.«
Länger war er nicht auszudehnen. Auf längere Zeit verpflichten sich die Dajaks, wie schon gesagt, eben zu nichts. Dagegen war nichts zu machen.
»Dann werden wir diesen Freundschaftsvertrag erneuern.«
»Das kann ich jetzt nicht versprechen, darf es nicht.«
»Bis dahin bleibt aber Oglondu unser Gefangener.«
»Wenn es sein muss!«, war die tiefbetrübte Antwort des jungen Weibes.
»Was war nun wieder das?!«, mischte sich da Georg ein, und es musste ihm verdolmetscht werden.
»Nein!«, entschied er dann. »Sobald uns die versprochene Momasse geliefert worden ist, soll Oglondu frei sein! Mensch, feilschen Sie doch nur nicht so! Nun fragen Sie bloß noch wegen der Führung.«
Die konnten ihnen die Njamanas nicht geben. Sie selbst kannten durch den Rotangwald ja keinen anderen Weg als den, der zum nächsten benachbarten Dorfe führte, einem anderen Dajakstamme mit dem sie in ständiger Fehde lagen. Es ging immer um die Köpfe.
Diesen Weg wollten sie zeigen, mehr konnten sie nicht tun. Wann wieder einmal solch ein Wanderpriester kam, dem sämtliche Schleichwege bekannt waren, das wusste niemand zu sagen.
Es genügte. Die Gesandtschaft wurde entlassen. Schon eine Stunde später kamen einige Dajaks wieder, die einen Sack aus der ganzen Haut eines stattlichen Hirsches trugen, gefüllt mit jenen weißen Linsenkörnern, und zwischen sich führten sie einen Gefangenen.
Es war Letanje, der auf seinem Rücken auch noch Sams Kopf hängen hatte.
Die Momasse erwies sich als wirksam, Oglondu wurde freigegeben, nachdem er zuvor noch gesehen hatte, wie der Mörder eines dieser weißen Männer einfach am nächsten Baume aufgeknüpft worden war.
In der Straße von Makassar, welche Borneo von Celebes trennt, segelte eine Brigg, die zwei vorhandenen Masten voll mit Rahen getakelt. Noch vor fünfzig Jahren hätte die »Seenixe« aus Bremerhaven als ein sehr stattliches Schiff gegolten, heute war sie mit ihren vierhundert Tonnen unter den Überseeschiffen ein verschwindendes Fahrzeug, werden jetzt doch Segelschiffe von zehntausend Tonnen gebaut, und besonders Nordamerika will sich hiermit immer noch nicht zufrieden geben. Der Vorteil von solchen riesenhaften Segelschiffen gegenüber den Frachtdampfern, die mit ihren Kohlen dreiviertel vom ganzen Verdienst auffressen, ist gar zu groß. Das schon einmal zu Grabe getragene Segelschiffswesen blüht gerade jetzt mächtig wieder auf, zumal die berühmten Werften von Baltimore bauen jetzt mehr Segler als Dampfer, und der Yankee weiß schon, was er tut.
Die »Seenixe« hatte ihren eisernen Bauch bis zum Platzen mit Kopra gefüllt. Das ist das von den Eingeborenen in Streifen geschnittene Fleisch der Kokosnuss, an der Sonne getrocknet, wohl auch über Feuer gedörrt, woraus man in den europäischen Raffinerien das Öl presst, aus dem man hauptsächlich Seife macht, jetzt auch Margarine.
Es muss sich wohl lohnen, wegen solchen Zeuges innerhalb eines bis zwei Jahren eine Segelfahrt um die ganze Erde zu machen. Freilich dazwischen auch andere Frachten. Um Kap Hoorn nach Valparaiso, dort die mitgebrachte Kohle zum vierfachen Preise verkauft, mit Mais nach Sydney, mit Stückgut aller Art die kleinen gesammelt — nun aber ging es um das Südkap Afrikas herum direkt nach Bremerhaven, in zwei bis sechs Monaten zu erreichen. Da ist bei einem Segelschiffe natürlich gar nichts zu sagen. Eine glänzende »Reise« war es gewesen bisher! Jeder Mann der aus elf Köpfen bestehenden Besatzung hatte schon mindestens tausend Mark Guthaben und das war die Hauptsache! Dagegen hatte es gar nichts zu bedeuten, dass niemand mehr Hände besaß, sondern nur noch dickes, verbeultes Sohlenleder mit fünf Zinken — dass hier und da solch ein Zinken, auch Finger genannt, abgequetscht worden war — dass Kapitän Biester dem einen Matrosen das ganze Bein mit der Säge des Schiffszimmermanns abgenommen hatte — nein, das hatte alles nichts zu sagen, auch der nunmehr einbeinige Matrose, der nicht etwa von Bord gekommen war, als das Schiff den nächsten Hafen anlief, hopste er schon lustig wieder an Deck herum, der Stumpf war ja auch fein in siedenden Teer getaucht worden — auch der schwamm in Seligkeit, wenn er sich ausmalte, wie er etliche Monate später im »Freudensaal« zu »Bremerhooven« den geschminkten Frauenzimmern für seine tausend Mark Champagner in den Rachen gießen würde.
Und Kapitän Biester hatte sich erst gestern berechnet, dass seine Dividende nunmehr fast achtzehntausend Mark betrug. Abgesehen von den jährlich dreitausend Mark festen Gehalt. Und daran konnte sich nun nichts mehr ändern, auch wenn heute Schiff und Ladung verloren ging. Das war ja alles versichert. Diese Dividende hatte er sich bereits durch die bisherige schnelle Fahrt verdient, für jeden ersparten Tag von Hafen zu Hafen so und so viel. Da kann ein Dampferkapitän ja nun freilich nicht mit, wenn er auch zehntausend Tonnen fährt; der bekommt nichts weiter als seinen fixen Gehalt.
Jetzt also segelte die schmucke Brigg, auch bei allen Strapazen, die sie auszustehen hatte, immer schmuck gehalten, mit günstigstem Nordwind durch die Straße von Makassar.
Ja, es ist nur eine Wasserstraße. Aber auch an der schmalsten Stelle noch fünfundzwanzig geografische Meilen breit! Da war von den Ufern der beiden großen Inseln, Borneo und Celebes, natürlich nichts zu sehen.
Der Bootsmann nahm seinen Nachmittagskaffee mit im Matrosenlogis ein; denn er war so gut wie allwissend und fühlte sich verpflichtet, andere beständig zu belehren.
»Die Straße von Makassar«, erklärte er jetzt, indem er aus seinem Schiffszwieback die Würmer herausklopfte und dann ein Stück blau angelaufenen Salzspeck darauf legte, »hat ihren Namen daher, weil die Mannschaft von jedem Schiffe, das hier strandet, makasseriert wird. Drüben auf Celebes von den Malaien, hüben auf Borneo von den Dajaks. Jede gestrandete Mannschaft ist rettungslos verloren, wird makasseriert. Daher der Name Straße von Makassar.«
»Wat, makasseriert?«, wurde gelacht. »Ihr meint wohl massakriert, Bootsen?«
»Makasseriert heißt es. Das hängt wieder mit Kasserol zusammen, worunter man einen Topf versteht, in dem die Ungarn ihren Goulasch kochen, und wenn nun dieser Goulasch frisiert wird, das heißt ganz fein gehackt und gewiegt, so entsteht daraus das sogenannte Frissikassee —«
Das Kochrezept wurde unterbrochen.
»Reeeehhh!!«, leitete der Kapitän das Kommando zu einem Segelmanöver ein.
Was dieses internationale »reeehhh« zu bedeuten hat, woher es stammt, das wusste nicht einmal dieser gelehrte Bootsmann, jedenfalls aber muss man dann rennen, und wer sich gerade umzieht, kann nicht erst seine Toilette beenden, und wenn der Matrose auch nur mit Schlips und Stehkragen bekleidet ist — er muss rennen.
Der Wind begann sich nach Westen zu drehen, die Rahen wurden herumgeholt.
Dann flaute der Ostwind immer mehr ab, am Abend wurden alle Segel festgemacht, es herrschte völlige Windstille.
Die Nacht brach an, eine stockfinstere Nacht. Und dann begann es in der Takelage zu pfeifen. Und dann kam eine Böe nach der anderen angesaust, aus allen Himmelsrichtungen zugleich, bis die aus Osten die Oberhand behielten, sich zu einem Sturme zusammentaten.
Wohl flog die »Seenixe« mit gerefften Sturmsegeln noch nach Süden, aber ein gewaltiges Abtreiben nach Westen war bei solch einer furchtbaren Blaserei doch nicht zu vermeiden.
Und gegen Mitternacht ein schrecklicher Ruck, ein Krachen, Splittern und Bersten, und die Brigg saß fest.
»Meine Seenixe — meine Seenixe wrack für immer!«, heulte der alte Kapitän jammernd auf. Wir wollen es auch sonst nicht weiter beschreiben. Die deutschen Matrosen taten, was sie tun konnten und tun mussten. Dazu gehört nicht ein Abschiednehmen von diesem Leben. Dafür bezahlt die Reederei nicht. Beten ist erlaubt, aber nur, wenn man dabei nicht die Hände faltet, sondern mit diesen immer tüchtig zupackt.
Der Sturm ließ schnell, wie er gekommen, wieder nach, das Schiff saß in normaler Lage wie angenagelt fest, zu sehen war in der Finsternis absolut nichts, die Brandung war eine mäßige.
»Steigt das Lenzwasser nicht mehr? Gut. Vorläufig sind wir gesichert. Nun, Kinners, füllt mal alle Töpfe mit Salzwater und macht es heiß, desgleichen haltet auf siedenden Teer. Ihr, Bootsmann, holt die Gewehre hervor. Wer von Euch hat in der Marine gedient? Instruiert die anderen. Modell 71/84. Also acht Patronen ins Magazin, die neunte auf den Löffel; aber wer vorher knallt, den soll der Dunnersslag rühren! Und keine Lichter zeigen! Nicht das Feuer in der Kombüse! Backbord geht zur Koje!«
So sprach Kapitän Biester, legte sich aufs Sofa und schlief sanft den Schlaf des Gerechten.
Die letzten Nachtstunden vergingen. Als es nach Ortszeit, wie die spätere Berechnung ergab, fast genau sechs Uhr war, flammte es urplötzlich im Osten auf, mit einem Male war der helle Tag angebrochen.
Die Brigg lag zwischen Riffen eingebettet. Es war nur ein schmaler Klippensaum, der das freie Wasser begrenzte, das sich überraschend schnell beruhigt hatte, dann kam eine Strecke Sand, der in das eigentliche Ufer überging.
Die emporrollende Sonne vergoldete eine herrliche Szenerie! Bis dicht an diese Sandbank standen die Kokospalmen, dahinter begann eigentlicher Urwald.
Ja, herrlich war diese tropische Uferlandschaft! Aber weniger herrlich war, was man sonst erblickte.
Gerade dem Wrack gegenüber trat der Palmenwald im Halbkreis zurück, und auf dieser Lichtung standen Hütten von eigentümlicher Form; sämtlich auf drei bis vier Meter hohen Pfählen errichtet, zu denen abnehmbare Leitern hinaufführten.
Das sind die »Binos«, die Pfahlhütten der Dajaks, wie sie solche ausschließlich benutzen, obgleich sie sich gar nicht wie andere Tropenbewohner so vor Raubtieren und Giftschlangen zu schützen haben. Sie kennen aber nun einmal keine andere Bauart als solche hohe Pfahlhütten.
Und vor diesen Hütten nun, die kaum einen Kilometer weit von dem Wrack entfernt standen, sodass man alles auch mit bloßem Auge schon deutlich erkennen konnte, waren alle Einwohner versammelt, Männer und Frauen und Kinder, und in dem Augenblicke, als plötzlich der neue Tag wie durch Zauberei aufflammte, stießen sie ein jauchzendes Triumphgeschrei aus.
Sie hatten die Beute erblickt, die ihnen nicht entgehen konnte.
Schon nach wenigen Minuten des Beobachtung aber mussten die Schiffbrüchigen anders urteilen. Es war gar zu eigentümlich, dass die Bande dort plötzlich so gebrüllt hatte, sonst aber nichts weiter tat.
Die Männer, alle bewaffnet und mit bunten Federn geschmückt, wie auch die Frauen und Kinder, hätten jetzt doch gleich nach den Kanus und Prauen laufen müssen, die dort an der Sandbank lagen, hätten doch überhaupt etwas anderes tun müssen, als nur so dastehen und nach dem Wrack winken.
Der alte Kapitän Biester war schon einmal mit Dajaks in Berührung gekommen, er konnte alsbald eine Erklärung geben.
»Natürlich freuen die sich, dass sie uns hier zwischen den Riffen festsitzen sehen. Aber erwartet haben sie diesen Anblick nicht. Die stehen schon die halbe Nacht hier so festlich geschmückt, ohne etwas von dem Wrack gewusst zu haben. Die feiern heute ihr heiliges Sonnenfest, wobei alle anderen Beschäftigungen ruhen müssen.«
Und so war es auch, wie man bald beobachten konnte. Schon wurden gefesselte Männer, Frauen und Kinder herbeigeführt, der eine Gefangene musste eine Art Plattform besteigen, ein Priester und Zauberer trieb seinen Hokuspokus, phantastisch geschmückte Balias tanzten singend um die Plattform herum, und dann, als es so weit war, wurde dem Gefangenen der Kopf abgeschlagen, dieser an einer Lanze im Kreise herumgetragen, begleitet von tanzenden und singenden Dajaks, und der Körper des Toten an anderer Stelle ebenso feierlich verbrannt.
Der Stamm dieser hier an der Küste hausenden Dajaks war im benachbarten Dorfe eingebrochen und hatte gute Beute an Gefangenen gemacht. Diesen wurden nicht einmal sofort die Köpfe abgeschnitten sondern man brachte sie lebendig ins Heimatdorf, damit man sie hier der Sonne opferte.
Zwar ist der Mond den Dajaks heiliger, aber die Sonne will doch auch ab und zu ihr Opfer haben. Und dann hat man hiervon noch den Vorteil, dass die Seelen derer, denen man zu Ehren der Sonne nachträglich den Kopf abschneidet und den Körper verbrennt, die Sklaven des ganzen Dorfes, seine Schutzgeister werden. Andere Beschäftigungen dürfen bei dieser Zeremonie nicht vorgenommen werden, sonst hat man den Gefangenen die Köpfe vergebens abgeschnitten.
Es konnte eine gute Zeit dauern, ehe man hiermit fertig wurde, denn jede Hinrichtung wurde mit allen umständlichen Zeremonien einzeln vorgenommen, jede dauerte wohl eine halbe Stunde, und drei Dutzend Gefangene hatten die Dajaks mindestens vorrätig.
So konnten die Schiffbrüchigen in Ruhe beraten, was nun zu machen sei.
Sehr trostreich sah ihre Lage nicht aus.
Die Brigg würde hier festsitzen für immer, bis einmal ein Sturm sie in ihre einzelnen Eisenplanken zerlegte, oder der Zahn der Zeit sie zernagt hatte.
Die kleine Jolle war bei dem Aufschlagen über Bord geschleudert worden und unten in Trümmer gegangen, und den großen Kutter, das letzte Boot, über die noch breiten Riffe ins freie Wasser bringen zu können, daran durften die elf oder zwölf Mann gar nicht denken. Wohl aber wäre ihnen das nach der anderen Seite gelungen, über die Sandbank weg, die auf der einen Seite von freiem Wasser begrenzt wurde, und die Dünung war dort gar nicht so stark.
»Das ist ebenfalls ganz ausgeschlossen!«, sagte aber der erfahrene Kapitän Biester gleich. »Die Dajaks lassen uns natürlich nicht aus den Augen, und wenn sie unsere Absicht merken, dass wir das Schiff im Boote verlassen wollen, dann geben sie natürlich gleich ihre Gefangenen auf, um lieber uns tot oder lebendig zu bekommen, pusten uns mit ihren vergifteten Pfeilen an. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als hier auf dem Wrack auszuhalten, was wir ja auch recht gut können, jeden Angriff werden wir schon abschlagen können, und auf ein größeres Schiff zu warten, das wir um Hilfe rufen und dessen Boot uns über die Klippen abholt. Ihr wisst, Kinners, der Kapitän Biester ist kein Bangbüchs, aber hier gibt es kein anderes Mittel.«
Es war bald Mittag geworden, und die Dajaks setzten ihre blutige Feierlichkeit ununterbrochen fort. »Ein Schiff!«, erklang da der Ruf.
Im Süden waren drei Mastspitzen aufgetaucht, schnell wuchsen sie empor, bis sich der ganze Rumpf über den Horizont erhob.
»Gelobt sei Gott, wir sind gerettet!«, sagte Kapitän Biester aus tiefstem Herzen.
Denn in einer ganz gefährlichen Lage hatten sich die Schiffbrüchigen hier ja doch befunden. Durch eigene Kraft hätten sie sich nicht von hier forthelfen können, und diesen noch nicht nivellierten Küsten, von denen man nur die groben Umrisse kennt, nähert sich nicht so leicht freiwillig ein Schiff.
Jetzt waren sie schon so gut wie gerettet. Das Schiff dort musterte doch natürlich sorgfältig durch mehrere Fernrohre diese Küste, hatte unter allen Umständen auch bereits die wracke Brigg entdeckt, und die lebenden Menschen wollten sich schon bemerkbar machen. Geborgen wurde die Koprafracht ja nicht etwa, aber auf jeden Fall mussten die Schiffbrüchigen abgeholt werden.
Hierzu sind noch einige Erwägungen zu machen, die später für uns wichtig werden.
Gesetzt nun den Fall, jenes Schiff war ein Kriegsschiff, welches die strikte Order hatte, schnellstens nach einem bestimmten Ziele zu fahren? Von seiner Schnelligkeit hing vielleicht Krieg und Frieden zweier Nationen ab, oder das Leben von vielen hundert Menschen, das alles war verloren, wenn sich das Kriegsschiff hier nur eine Viertelstunde aufhielt. Was dann?
Dann hatte der Kommandant die Pflicht, wenigstens ein Beiboot, etwa die Dampfpinasse, auszusetzen und den Schiffbrüchigen zu Hilfe zu schicken. Allerdings war das nur eine moralische Pflicht; sonst wäre es mindestens die öffentliche Meinung gewesen, die über ihn gerichtet hätte, und damit muss gerade der Schiffskapitän sehr wohl rechnen.
Kurzum, die Schiffbrüchigen durften sich als gerettet betrachten. Gingen die Dajaks unterdessen zum Angriff über, so wollte man sie mit den zwölf Magazingewehren schon in Schach halten, die Bullaugen geben hinter den eisernen Planken die vorzüglichsten Schießscharten ab, und die Rettungsmannschaft würde ebenfalls bewaffnet kommen, dafür wollte man schon durch Signale sorgen.
Das Schiff war höher gekommen, wenn auch noch nicht in Signalnähe.
Zunächst wurde es von kundigen Seemannsaugen beurteilt.
»Das ist ein Vollrigger mit einer Hilfsmaschine.«
»Sieht bald aus wie ein Man of War, wie eine Kreuzerfregatte.«
»Zeigt er keine Flagge?«
»Noch nichts davon zu sehen.«
Da war es wieder der alte Kapitän, der einen jubelnden Ruf der Überraschung ausstieß.
»Bei allem was lebt — ich will nicht Kapitän Franz Biester aus Geestemünde sein, wenn das nicht die Hamburger ›Argos‹ ist! Natürlich, das ist das Gauklerschiff! Mit meinem alten Freunde Kapitän Martin, der unter mir als erster Steuermann auf der ›Thekla‹ gefahren ist.«
Jetzt war das Schiff soweit gekommen, ganz erregt knüpfte Kapitän Biester selbst die ersten Flaggen zur Vorstellung an die Leine und hisste sie hoch.
»Seenixe, Bremerhaven, Kapitän Biester.«
Alsbald kletterten auch dort drüben die bunten Fähnchen in die Höhe, das Schiffsregister und das internationale Signalbuch war zur Stelle.
»Argos, Hamburg, Kapitän Martin.«
Jetzt jubelte jeder, der vielleicht noch gezweifelt hatte, hier wirklich von diesem berühmten Schiffe gerettet zu werden.
Kennen taten sie es ja alle, hatten sich im Mannschaftslogis und an einsamer Wache oft genug über das Gauklerschiff unterhalten.
Wie man bestimmt wusste, war es zuletzt den Jenissei hinaufgefahren, ins Innere von Sibirien gedrungen. Jetzt also kreuzte es schon wieder hier zwischen den Sundainseln.
Es wurde weiter signalisiert.
»Heute Nacht auf Klippen gerannt. Schiff verloren. Elf Mann Besatzung wohl. Bitte abholen.«
Einige Zeit verging, ehe die Antwort kam, und dann war es erst eine Frage.
»Was für Fracht?«
Ja, bei diesem unversicherten Gauklerschiff war das etwas ganz anderes, das konnte eine Fracht bergen, wenn es sich lohnte. Das war diesen Seeleuten ja wohlbekannt.
»350 Tonnen Kopra.«
»Sonst nichts weiter?«
»Nein.«
»Bedauern.«
Die Schiffbrüchigen trauten doch ihren Augen nicht, als sie diese beiden bekannten Flaggen sahen, welche das sich entschuldigende »Nein!« ausdrücken. Dann wussten die nicht, in was für einer gefährlichen Lage sich die Schiffbrüchigen befanden, man musste eine nähere Erklärung geben.
»Können großes Boot nicht über Klippen bringen, an Land feindliche Dajaks.«
Die beiden Flaggen wurden etwas gesenkt und wieder gehisst.
»Bedauern!«, hieß es also zum zweiten Male.
»Wir sind verloren!«
»Bedauern.«
In staunender Ratlosigkeit blickten sich die zwölf Männer an.
Das Schiff dort setzte unbekümmert seinen Weg nach Norden fort, hatte seitlich die Stelle schon passiert, allerdings in noch weiter Entfernung.
Durch das beste Fernrohr konnte man eben noch die Flaggen deutlich voneinander unterscheiden, also sah man auch nichts weiter als Menschen an Deck und auf der Kommandobrücke stehen, die Gesichter waren nicht weiter zu erkennen.
»Unerhört!«, stieß der alte Kapitän fast keuchend hervor. »Dann ist das entweder Kapitän Martin nicht oder —«
Er hisste nochmals Flaggen.
»Kapitän Franz Biester aus Geestemünde, früher Viermastschoner Thekla.«
»Kapitän Gustav Martin.«
»Kennen Sie mich nicht?«
»Ja.«
»In höchster Not!«
»Bedaure.«
»Wir fallen den Dajaks rettungslos zum Opfer! Vergiftete Pfeile.«
»Bedaure.«
Und unaufhaltsam rauschte das majestätische Schiff weiter dem Norden zu.
Und der alte Kapitän fragte nicht weiter nach dem Grunde dieser Weigerung, er brach fast zusammen.
Da aber trat etwas anderes ein, und diese rätselhafte, unerhörte Hilfsverweigerung sollte auch bald ihre Erklärung finden.
Die Dajaks waren unterdessen nach wie vor ihren blutigen Zeremonien nachgegangen. Ein Gefangener nach dem anderen wurde enthauptet, Mann oder Weib oder Kind, die Köpfe wurden an Lanzen gespießt und herumgetragen, die Körper wurden verbrannt, immer jeder einzeln umständlich für sich, immer unter Tanz und Gesang und Brüllen.
Sie wussten, dass sie dort das Wrack nicht ohne kolossale Verluste an Menschenleben angreifen konnten. Als das große Schiff aufgetaucht war, wussten sie zwar auch, dass ihnen jetzt diese Schiffbrüchigen entgehen würden, aber daran war nun nichts mehr zu ändern. Und eine große Beute würde diesen Strandräubern ja doch noch bleiben.
Plötzlich knatterten Gewehrschüsse, krachte eine ganze Salve. Es mochten mehr als fünfzig männliche Dajaks sein, und mehr als die Hälfte davon stürzte zu Boden, anscheinend von tödlichen Kugeln getroffen. Nur wenige wälzten sich noch in Zuckungen.
Die anderen starrten fassungslos einige Augenblicke, dann flohen sie dem Walde zu, mit ihnen die Weiber und Kinder, an den Gebrauch ihrer Waffen gegen den noch unsichtbaren Feind, wenigstens den Schiffbrüchigen noch unsichtbar, nicht denkend, natürlich auch nicht an die Mitnahme der noch lebenden Gefangenen.
Aber sie flohen nicht dem nächsten Waldessaum zu; denn gerade dort brachen jetzt die fremden Männer hervor, die auf sie geschossen, die meisten zu Fuß; schon aber zeigten sich auch einige Reiter, und zwar meist ganz merkwürdig beritten, auf Tieren, die es hier gar nicht gab, auf Zebras und Kulans und Tarpans, und der eine saß gar auf einem mächtigen amerikanischen Büffel.
Teils schossen sie noch auf die Fliehenden, aber immer nur auf die erwachsenen Männer, teils machten sie sich sofort daran, die Gefangenen zu befreien oder doch in ihre Obhut zu nehmen, vor allen Dingen die Frauen und Kinder, die ja schwer in ihren Fesseln leiden mochten.
Einige stürmten aber auch gleich über die Sandbank, allen voran ein Mann auf einem starken Zebra, auf das Wrack zu. Abgesprungen, den Zügel einem anderen zugeworfen, und der in Felle gehüllte Jäger setzte leichtfüßig, mit der Sicherheit eines akrobatischen Seiltänzers, über die Klippen hinweg, welche die Sandbank noch von dem Wrack trennten.
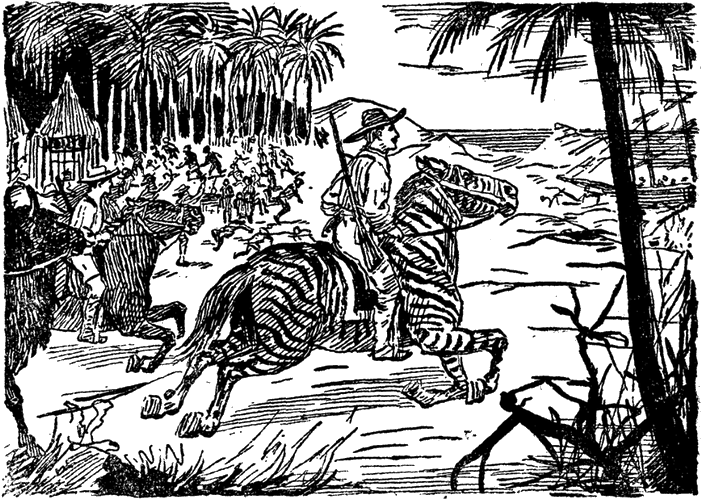
So schwang er sich über die Bordwand, und von den Schiffbrüchigen dachte natürlich niemand daran, den weißen Jäger, so rotbraun er auch verbrannt sein mochte, als Feind zu empfangen.
»Georg Stevenbrock, Waffenmeister der Argos — Himmel und Hölle, weshalb verweigert dort unsere Argos diesem Wrack die Hilfe?!«
Das Staunen der Schiffbrüchigen lässt sich denken. Zumal sie jetzt dort aus dem Walde einen ganzen Zug von Menschen und Tieren der seltsamsten Art hervorkommen sahen, mehrere Elefanten, schwer bepackt, desgleichen Kamele, Strauße — eine ganze Menagerie, geleitet von mehr als hundert Menschen.
Einfach die Argonauten!
Aber nicht dort an Bord ihres Schiffes, sondern hier auf Borneo.
Doch jetzt war keine Zeit zur Erklärung, oder der Waffenmeister der Argonauten verlangte doch eine ganz andere. Er hatte den Flaggenwechsel des Wracks mit dem Schiffe mitgelesen; aber Kapitän Biester konnte ja selbst keine Erklärung geben.
»Das ist unsere Argos, das wissen wir doch, auch wenn jetzt nicht ihr Name und Heimathafen am Heck zu lesen wäre, aber das kann doch unmöglich unser Kapitän Martin sein?! Was in aller Welt ist denn dort nur passiert?!«
Die Erklärung sollte alsbald kommen, von der Argos selbst.
Auch dort musste diese ganze Szene beobachtet worden sein, und die Folge war, dass das Schiff seine schnelle Fahrt stoppte, auch wieder etwas rückwärts ging.
Und da ward auch schon ein Boot ausgesetzt, das kleinste, das Dingi, ein einzelner Mann saß darin, ergriff die Riemen, hielt, vorwärts rudernd, auf die Küste zu. Er war auch ohne Fernrohr schon zu erkennen, da sich unterdessen das Schiff dem Lande bedeutend genähert hatte, und vor allen Dingen fiel sein langer Vollbart auf.
»Kapitän Martin — kein anderer als Kapitän Martin!«
Er war es. Nach einer Viertelstunde hatte er die Sandbank erreicht, landete dort, wo sie frei von Riffen war.
»Die fremde Mannschaft hat gemeutert, die Argos ist in ihren Händen!«
So hatte Georg schon vorher gesagt, und Kapitän Martin konnte es nur bestätigen, wenn es auch etwas anders war, als man hier zuerst geglaubt hatte.
Er berichtete.
Wir machen es so kurz wie möglich, wie es auch der Erzähler tat. Das Luftschiff war nach jenem sibirischen Tale zurückgekehrt.
Die Argos wurde mit den siebenundzwanzig Matrosen und Heizern bemannt, die von jenem englischen Dampfer stammten, sollte sofort aufbrechen, um wieder den Jenissei hinaufzugehen, die Gäste der Argos wurden natürlich mitgenommen, ebenso die sechsundneunzig Indianer.
Vorher aber hatte Kapitän Martin mit Merlin noch eine Unterredung.
»Wie steht es denn nun mit dem Flibustierschatz, den uns der Kapitän Satan doch ganz einfach gestohlen hat?
»Er gehört Euch, er steht zu Eurer Verfügung.«
»Well, dann mal her damit.«
Georg hätte diese Frage niemals gestellt, hätte den Schatz nicht angenommen, niemand hätte ihm widersprochen — aber Kapitän Martin war da nicht so.
»Well, wenn Sie und die Patronin ihn nicht haben wollen, dann nehme ich ihn!«, flocht er jetzt einmal ein, als Georg ein gar finsteres Gesicht machte.
»Weiter!«, gebot dieser.
Der Schatz wurde gebracht. Zuerst Goldbarren. Die Patronin hatte einst von zwanzig Tonnen gesprochen — es waren zweiundzwanzig Tonnen, welche der Flibustierkapitän auf seiner letzten Raubfahrt zusammengebracht hatte. 440 Zentner — die wollen durch Menschenhände geschleppt sein!
Und dann noch viele große Blechkisten voll Geschmeide und Juwelen, zusammengebeulte Kirchengefäße und dergleichen mehr.
Alles wurde an Bord genommen, die Argos ward von dem Samojeden, der sie schon hierher geführt, nach Krestowsk zurückgebracht. Es war Mitte August, hier Hochsaison für die Fischerei, der lebhafteste Betrieb herrschte, in dem sonst so einsamen Hafen lagen große Dampfer aller Nationen.
Die sechsundneunzig Indianer wurden auf einen amerikanischen Dampfer gebracht, der nach New York zurück fuhr. Kapitän Martin bezahlte das Passagiergeld aus seiner Tasche, gab ihnen sonst noch Geld, damit sie nach ihrer Heimat zurück konnten, oder wohin sie sonst wollten — nur fort mit dieser roten Bande!
Desgleichen wusste Kapitän Martin den anderen Gästen plausibel zu machen, dass es das Beste sei, wenn sie die Argos jetzt verließen. Er wolle mit seinem Schiffe durch die Beringstraße zu kommen suchen, das könne sehr, sehr gefährlich werden — aber ob dies nun wirklich der Fall war oder nicht, kurz und gut, er wusste sich der sämtlichen Gäste zu entledigen.
Denn dem Kapitän hatte diese gewährte Gastfreundschaft niemals gefallen, er hatte sich niemals diesen Gästen angeschlossen. Weshalb nicht? Er war eben ein Sonderling. Er hätte auch niemals einen Passagierdampfer gefahren, nicht für alles Geld der Welt — so gern der doch auch sonst Geld verdiente.
Die Gäste hatten gefühlt, wie unliebsam sie diesem Manne waren — sie waren von Bord gegangen, sämtlich, um eine andere Gelegenheit zur Rückreise in ihre Heimat zu finden.
»Well, jetzt hatte ich endlich einmal klar Schiff gemacht, unsere Argos war wieder gereinigt!«, musste er jetzt einmal einfügen.
»Weiter!«
Also nach Pontianak sollte es gehen, dem Haupthafen Borneos, um zu sehen, was unterdessen aus den Argonauten geworden war.
Da war es ja nun freilich durch die Beringstraße ganz bedeutend näher. Dieser Weg war im Gegensatz zu jenem um ganz Asien und Europa und womöglich noch Afrika herum, nur ein Katzensprung zu nennen. Und die Fahrt durch die Beringstraße ist heute, wo man die Verhältnisse so ganz genau kennt, kein Kunststück mehr. Die zweite russische Kriegsflotte, die nach Japan geschickt wurde, hat es schwer bereut, nicht ihren Weg durch das Eismeer genommen zu haben. Natürlich muss die Jahreszeit danach sein. Vom Herbst bis Frühling ist Schluss der Vorstellung, aber jetzt war Mitte August, das war die denkbar günstigste Zeit.
Die siebenundzwanzig Matrosen und Heizer, darunter aber auch zwei Steuerleute — Kapitän Arnold war der achtundzwanzigste — genügten zur Bedienung vollkommen, sie hatten sich in dieses Schiff bereits eingearbeitet, und vor allen Dingen waren sie auch bereit, die Fahrt mitzumachen — noch einmal Kohlen, Petroleum und Proviant eingenommen — es ging rechts herum um Asien durch die Beringstraße.
Da, als man diese schon hinter sich hatte, ein Maschinendefekt, dessen Beseitigung fast zwei Wochen aufhielt, und das genügte, um die Argos doch noch in fürchterliches Treibeis kommen zu lassen. Man kam wieder heraus, aber es hatte durch Eisrammen eine enorme Menge von Kohlen und Petroleum gekostet, oder man hätte überwintern müssen.
Außerdem ging das Trinkwasser zur Neige. Das in den Ballasttanks mitgenommene erwies sich als total verdorben.
Nun, nach Pontianak würde man schon ohne Aufenthalt noch kommen. Ein Mangel an Trinkwasser konnte überhaupt nicht eintreten, so lange die Kessel noch mit Kohlen oder Petroleum geheizt werden konnten, dafür sorgte der Destillierapparat.
Da wurde auf der Höhe der Haddak-Inseln, aber von diesen noch weit entfernt, ein großer Dampfer gesichtet, die »Orleans« von Marseille, die das Notsignal zeigte. Sogar höchste Seenot!
Leck und sinkend! Eine Zylinderexplosion hatte die Planken des Kielraums durchschlagen, die Dampfpumpen konnten das einströmende Wasser nicht mehr bewältigen.
Ein Passagierdampfer, fünfzig Mann Besatzung, vierhundert Passagiere nur Männer, Auswanderer nach Australien.
Ja, da war nichts zu machen; die musste man mitnehmen.
Sie kamen in ihren Booten angerudert, wie sie eben pullen konnten. Recht verwegene Gestalten, recht wilde Gesichter. Na, was soll man denn von solchen abenteuerlustigen Auswanderern, die in die australische Wildnis gehen wollen, auch anderes verlangen. Sie kamen an Bord. Und wie sie alle hübsch beisammen waren, da Revolver und Messer heraus auf die ahnungslose Mannschaft der Argos losgeschossen und losgestochen! Vierhundert französische Verbrecher, zur Deportation nach Neukaledonien bestimmt!
Oder es waren schon Sträflinge gewesen, man hatte die französischen Zuchthäuser mal ein bisschen leer machen wollen.
Hatten sich auf dem Transportdampfer zu befreien gewusst, schon dort Mannschaft und Wache überwältigt, einfach alles niedergemacht.
Unter den Sträflingen befanden sich auch viele Marinesoldaten, Matrosen und Heizer, auch drei, welche die nautische Führung übernehmen konnten, also ehemalige Offiziere, sogar gleich zwei Kapitäne mit verbrecherischem Charakter.
Sie waren weiter gedampft. Um die Zukunft kümmern sich ja solche Individuen nicht viel. Eben an irgend einer unbekannten Küste landen und dort ein freies Leben führen, das war ihr Ziel.
Da explodierte der eine Zylinder der unvorschriftsmäßig behandelten Maschine. Und dort kam gerade ein stattliches Kriegsschiff. Das musste genommen werden. Und die Verbrecher verließen den Passagierdampfer um so lieber, als es darauf nur ein ganz miserables Futter gab. Außerdem winkten ihnen auf dem Kriegsschiffe ganz andere Waffen, die man sich nur erst einmal aneignen musste. Es war zwar kein eigentliches Kriegsschiff, sondern die »Argos«, das berühmte Gauklerschiff, von dem alle die berichten konnten, welche der Freiheit nicht schon zu lange entbehrt hatten. Na, das war vielleicht erst recht gut, dieses Schiff war doch sicher tüchtig verproviantiert, auch mit Waffen wahrscheinlich auch mit Geschützen versehen.
»Werden wir aber mit diesen Argonauten, von denen man so Wunderbares erzählt, auch fertig werden?«
Na, solche Menschen riskieren doch alles. Man musste die dort drüben nur ganz ahnungslos halten.
Der Handstreich war gelungen.
»Ich will ja nicht gerade behaupten«, sagte Kapitän Martin, »dass er auch gelungen wäre, wenn die ›Argos‹ ihre eigentliche Besatzung an Bord gehabt hätte, unsere Argonauten — aber wir konnten jedenfalls gar nichts machen. Im Handumdrehen war alles totgeschossen und totgestochen.«
»Alle?!«
»Alle Sie haben keinen einzigen verschont. Auch in die Heizräume sind sie gleich gedrungen, noch ehe die unten eine Ahnung davon hatten. Es sind ja viele Seeleute dabei, ehemalige Heizer, die wissen doch Bescheid.«
»Haben sie nicht zum Übertritt aufgefordert?«, fragte der Waffenmeister.
»Damit haben sie sich nicht erst aufgehalten. Alles wurde gleich abgemurkst.«
»Aber Sie sind doch diesem Schicksal entgangen.«
»Well, ich habe aber auch gleich die Hände aus den Hosentaschen genommen, nämlich nur, um zu zeigen, dass ich keine Waffen drin habe; um mir die Hände fesseln zu lassen.«
Das sah dem Kapitän Martin ja nun auch ganz ähnlich! Aber was hätte er denn auch anderes tun sollen? Sich etwa allein mit den vierhundert Verbrechern herumprügeln?
»Und auch ich wäre gleich ins Jenseits befördert worden, wenn der Rädelsführer der Bande nicht mein guter Freund gewesen wäre, der schützte mich gleich.«
»Was, Ihr guter Freund?«
Kapitän Martin nahm erst ein neues Stück Kautabak, mit dem er reichlich versehen war.
»Well, Kapitän Baslare. Hat mir einmal in New Orleans einen großen Dienst erwiesen, hat für mich gebürgt. Ich habe mich zu revanchieren gewusst; eigentlich ein ganz famoser Kerl. Ist aber auf Abwege gekommen. Wollte gar zu fix reich werden, hat ein altes Schiff gekauft, es mit falscher Ladung zu hoch versichert und es auf den Grund gesenkt. Ein Dutzend Menschenleben gingen dabei flöten. 's kam heraus. Lebenslängliches Zuchthaus, dann begnadigt zur Deportation nach Neukaledonien, wo er doch die Möglichkeit hat, sich noch einmal als so halbfreier Kolonist zu etablieren. Der nahm gleich Partei für mich, sonst stände ich nicht mehr hier. Immer noch ein famoser Bursche. Ich bin wohl eingesperrt worden, hab's aber ganz fein gehabt.«
Man musste diesen alten Seebären sprechen hören, wie der dies alles hervorbrachte, natürlich die Hände in den Hosentaschen und manchmal mit den Beinen schlenkernd.
»Und was nun weiter?«
»Well, wir sind ungefähr eine Woche herumgegondelt.
Um die Philippinen und um Borneo herum. Diese Piraten waren nicht schlecht enttäuscht; nämlich so wenig Kohlen und Petroleum und besonders Trinkwasser vorzufinden. Die suchen schon seit diesen acht Tagen nach Trinkwasser. Aber wo so eine stattliche Flussmündung ist, in die sie einlaufen können, da ist auch immer sicher ein stattliches Fort. Und aus einem kleinen Bächlein genügend Trinkwasser für vierhundert Menschen zu schöpfen, für lange Fahrt, das ist in Märchenbüchern leichter erzählt als ausgeführt. Übrigens bin ich da nicht eingeweiht worden, soweit geht Kapitän Baslares Vertraulichkeit mit mir denn doch nicht. Also ich weiß nicht, was die Piraten eigentlich wollen. Jedenfalls aber weiß ich, dass jetzt auch noch der Destillierapparat nicht mehr funktioniert, es muss etwas gebrochen sein, was sie nicht reparieren können. Da wurde ich einmal geholt. Ich kann's auch nicht, sonst hätte ich's getan. Und überhaupt, sie haben ja kaum noch so viel Kohlen und Petroleum, um noch gegen den Wind zu kommen. Da können sie doch auch nicht mehr viel destillieren. Kurzum, jetzt sind sie mit ihren letzten Kohlen hauptsächlich auf der Suche nach Trinkwasser.«
»Und man hat Sie nun in Freiheit gesetzt?«
»Well, ich komme als Parlamentär. Natürlich gehe ich nicht wieder zurück. Ich bin freigelassen worden.«
»Was sollen Sie ausrichten?«
»Die Piraten sehen ein, dass sie einen großen Fehler begangen haben, was ich Ihnen freilich nicht sagen soll. Sie sahen hier das Wrack liegen, erfuhren, dass es mit Kopra befrachtet sei. Da dachten sie sich noch nichts dabei, fuhren ruhig weiter. Was sollten die mit diesem wertlosen Zeuge! Gleich hinterher aber fiel ihnen ein, dass Kopra in ihrer Lage doch nicht so ein wertloses Zeug sei; solch ausgedörrtes Koskosnussfleisch, fast fünfzig Prozent Öl enthaltend, brennt ganz famos. Und mit 350 Tonnen kann man lange heizen und auch viel Wasser destillieren.
Gerade aber nun, wie sie diese geniale Idee gefasst hatten, krachten die Schüsse. Die Dajaks wurden angegriffen. Sapristi, das waren ja keine anderen als die eigentlichen Argonauten, die dort aus dem Walde herauskamen! Ein wundersamer Zufall, dieses Zusammentreffen hier! Nun aber stand es freilich auch faul mit dem Abholen der Kopra. Well, und nun begingen diese Dummköpfe den zweiten Fehler, den allergrößten, den sie wohl je in ihrem Leben begangen haben und begehen werden.«
»Inwiefern?«
»Na, dass sie gerade mich als Parlamentär abschickten.«
»Was ist da für ein Fehler dabei?«
»Die hätten mich als Geisel behalten sollen. Oder hätten Sie nicht das Abholen der Kopra und noch viel mehr erlaubt, wenn die mit meinem Tode gedroht hätten?«
Natürlich, jetzt sah das Georg ein.
»Ich kann nicht begreifen, wie sogar dieser sonst so gerissene Kapitän Baslare plötzlich so borniert sein konnte, mich laufen zu lassen. Na, die ganze Gesellschaft hat eben völlig den Kopf verloren. Und nun soll ich fragen, zu welchen Bedingungen Sie gestatten, dass jene das Wrack ausnehmen, ohne dass Sie ihnen irgendwie ein Hindernis in den Weg legen.«
»Ich glaube, jede Antwort meinerseits ist überflüssig!«, entgegnete Georg.
»Ich muss mich erst meiner Pflicht entledigen, die ich nun einmal übernommen. Die haben doch den Flibustierschatz natürlich gefunden. Na, die mögen ja nicht schlecht gejubelt haben. Aber gleichzeitig mag ihnen wohl auch das Bewusstsein gekommen sein, wie wenig sie jetzt damit anfangen können. Kurz, und gut: Diese neuen Flibustier sind nobel, sie bieten Ihnen gleich die ganze Hälfte dieses Schatzes an, wenn Sie ihnen erlauben, dass sie hier ungestört die 350 Tonnen Kopra ausnehmen können. Und dann gestatten Sie wohl, dass sie auch gleich ein bisschen Wasser an Bord nehmen. Denn wo hier Dajaks wohnen, muss es doch auch Trinkwasser geben. Und dort an Bord scheint das Wasser jetzt schon höllisch knapp zu sein. Also wie steht's? Die Hälfte des Schatzes?!«
Georg musste herzlich lachen, es war auch nichts Gekünsteltes dabei, und die umstehenden Argonauten stimmten mit ein.
»Unser Schiff wollen wir wieder haben!«
»Well, sagen Sie ihnen das selbst. Ich habe mich meines Auftrags entledigt, aber die Antwort bringe ich natürlich nicht persönlich hinüber. Ich bleibe jetzt lieber hier.«
Es wurde denn auch sofort signalisiert, an Bord des Wracks wurde dazu das Einleitungszeichen gegeben.
»Bescheid erhalten?«, wurde drüben zunächst angefragt.
»Ja. Unser Schiff wollen wir haben.«
»Wer spricht?«
»Stevenbrock, zweiter Kapitän der Argos.«
»Wie viel fordern Sie für Kopra?«
»Unser Schiff.«
»Unmöglich. Die Hälfte des Schatzes.«
»Gehört uns.«
»Nicht mehr. Überlegen Sie! Wir gehen und kommen nicht zurück. Beraten Sie.«
Da gab es gar nichts zu beraten.
»Unser Schiff zurück!«
Die Argos machte Dampf auf und fuhr nach Norden davon.
Die Piraten glaubten wohl eine andere Gelegenheit zu wissen, um Heizmaterial und Trinkwasser baldigst zu finden.
Die »Argos« war verschwunden, man hatte sie nicht zurückgerufen. Was hätte man solchen Verbrechern und Mordbuben gegenüber auch für Bedingungen stellen sollen? Da gab es gar kein Entweder — Oder.
Bedingungslose Unterwerfung!
Man hätte sich doch Zeit seines Lebens vor aller Welt und vor sich selbst geschämt, da irgend welche Zubilligungen gemacht zu haben.
Diese Burschen mussten hängen — da gab es nun gar nichts weiter!
Welche niedergeschlagene Stimmung unter den Argonauten herrschte, lässt sich natürlich denken.
Aber jetzt vor allen Dingen musste erst einmal Rast gehalten werden, um sich von den Strapazen der letzten Wochen zu erholen; denn Strapazen hatte der Marsch von mehr als sechzig geografischen Meilen durch den Urwald ja gekostet, wenn man mit feindselig gesinnten Dajaks auch immer leicht fertig geworden war.
Dann später konnte beraten werden, was nun weiter werden sollte, wie man von hier fortkommen konnte, wie man auch womöglich das Schiff wieder erlangte.
So verging der Nachmittag in stiller Ruhe. Einige, auch Georg, wie überhaupt die Hauptpersonen, hatten sich auf dem Wrack einquartiert, das ganz sicher zwischen den Riffen gebettet lag, die meisten lagerten an dem Bache, der sich an dem Urwaldsaum entlang schlängelte.
So verging auch die mond- und sternenlose Nacht in stillster Ruhe. Die befreiten Dajaks hatte man laufen lassen, wohin sie wollten, die anderen brauchte man nicht zu fürchten. Die Hunde waren ja die besten Wächter. Zwei Stunden vor Tagesanbruch umhüllte sich alles mit dichtem Nebel. Es war nicht anders, als ob geradezu die Wolken vom Himmel herabkämen. Solche Nebel sind selten in diesen Breiten, wenn sie sich aber einmal einstellen, gewöhnlich am Morgen, dann spotten sie jeder Beschreibung. Nur die Londoner Nebel können sich mit ihnen messen.
Kurz nach sechs Uhr betrat Georg, der unter Deck geschlafen hatte, das Oberdeck, musste sich hinauftasten. Wohl war es hell, aber nicht die Hand vor den Augen zu erkennen. Alles war wie in Milch getaucht.
So verging eine halbe Stunde, während der man sich nur immer forttasten konnte, wenn man nur einige Schritte tun wollte, und dabei wurde auch das Gehör vollkommen getäuscht. Man glaubte einen Menschen weit, weit entfernt reden zu hören, und plötzlich prallte man mit ihm zusammen.
Mit einem Male aber ward dieser Nebel von der Kraft der hochgekommenen Sonne in die Höhe gezogen, nicht anders, als wie man einen Theatervorhang in die Höhe zieht.
Urplötzlich hatte man den weitesten Fernblick, die weiße Suppe hing oben am Himmel als Wolke.
Und was für einen Blick hatte Georg da!
Er traute seinen Augen nicht, er rieb sie erst ein paarmal, ehe er es glauben konnte.
Da liegt keine fünfhundert Meter von ihm entfernt dort auf dem sandigen Ufer, wo dieses klippenfrei ist, die Argos! Sie liegt mitten drin im Sande gebettet, hat auch hinten die Schraube noch aus dem Wasser herausgereckt, auch noch über dem Sande!
Liegt genau so das, wie sie schon einmal auf einer Sandbank gelegen hat, damals im Urwald von Brasilien!
Wie die hier so auf dem Sand gelaufen war?
Nun, das Schiff war eben immer noch einmal umgedreht. Unschlüssig, wie solch eine Verbrecherbande, die sich schnell zusammengefunden hat, noch kein richtiges Oberhaupt hat, eben immer ist.
Ob sie nun noch einmal das Wrack hatten aufsuchen wollen, oder zu welchem Zwecke sie sonst umgekehrt waren, das war ja ganz gleichgültig dabei.
Sie waren Volldampf gefahren, glaubten auch im dichtesten Nebel ihres Weges ganz sicher zu sein, waren es eben nicht gewesen, waren mit voller Kraft hier auf diese Sandbank gelaufen.
Oder auch schon die halbe Kraft hatte genügt, um das Schiff dermaßen in den Sand hineinschusseln zu lassen!
Doch solche Erwägungen stellte Georg jetzt nicht an. Der erkannte in diesem Augenblick nur ein Einziges. Die konnten nicht wieder von hier fort! Die brachten das Schiff nicht wieder frei!
Wenigstens nicht so ohne weiteres, nicht durch Dampfkraft, und hätten sie auch noch so viel Heizmaterial gehabt.
Es hatte ja gar keinen Zweck, die Schraube sich drehen zu lassen, die lag ja frei in der Luft.
Und das Wasser stieg auch nicht weiter, gerade jetzt war höchste Flut. Nur ein einziges Mittel gab es, um das Schiff wieder ins Wasser zu bringen: es auszugraben!
Ringsum den Sand wegschaufeln, so tief als möglich, natürlich so, dass dabei nicht von der See her das Wasser eindrang, das Schiff wurde dabei abgestützt, und wenn es soweit war, wurde der Schutzdamm durchbrochen, dann konnte die Schraube wieder arbeiten, das Schiff kam wieder in die freie See hinaus.
Aber das bedurfte ziemlicher Zeit!
Und an diesen Arbeiten konnte man sie mit Büchsenkugeln hindern.
Und dann vor allen Dingen: der Mensch bedarf doch seiner täglichen Ration Trinkwasser.
Und das Trinkwasser sollte bei ihnen schon äußerst knapp sein!
Und wie Georg alle diese Gedanken blitzschnell zusammengefasst hatte, da sprang er auch schon die Kajütentreppe hinab, hatte seine Büchse und sein Stockschwert ergriffen, stand mit einem Satze wieder auf Deck und da jagte er schon wie ein geflügelter Achill über die Sandbank dahin, dem Walde zu, an dessen Saume neben dem Bache die meisten Argonauten lagerten.
»Jungens, Jungens, wir haben sie, wir haben sie!«, jauchzte er während dieses rasenden Laufens. »Wir haben unser Schiff wieder, nur den Bach müssen wir halten, dass sie kein Trinkwasser bekommen!«
Nun, wer nicht gerade noch schlief, der hatte es ja schon selbst gesehen, das Wunder, ihr im Sand so hübsch eingebettetes Schiff, und die Schläfer wurden natürlich schnellstens geweckt, und dann konnte ihnen Georg weiter erklären, wie sie jetzt ihr Schiff unbedingt wieder in die Gewalt bekommen müssten.
Es ist nur noch eine Erklärung hinzuzufügen.
Die Entfernung der Argos von dem Wrack betrug also ungefähr fünfhundert Meter, die nach jenem Waldsaume fast das Doppelte.
Die fünfhundert Meter genügten schon, um von der Katastrophe gar nichts hören zu lassen. Es war ja auch ohne alles Lärmen abgegangen, das Schiff war ganz sanft auf den weichen Sand hinaufgeschusselt. Kanonen- und andere Schüsse hatten die Piraten nicht gelöst, wozu auch, und sich überhaupt gehütet, unnötigen Lärm zu machen. Und nun außerdem die Kampfkraft dieses Milchnebels, der jeden Laut förmlich erstickte!
Und dann sei noch nachträglich etwas bemerkt. Es geschieht erst jetzt, weil es eben erst jetzt von ganz besonderer Bedeutung war.
»Die haben ja jetzt nur noch ein einziges Boot, nur noch die zweite Jolle!«
Das Fehlen von vier oder doch drei Booten war schon gestern bemerkt worden, aber man hatte sich doch nichts weiter dabei gedacht.
Die »Argos« besaß sechs Boote: die große Barkasse mit Motor, zwei Kutter, zwei Jollen und das kleine Dingi.
Kapitän Martin hatte bereits berichtet — obschon dies ebenfalls erst jetzt erwähnt wird — wie er bei seinem Kampfe mit dem Treibeis in der Beringstraße die Barkasse und eine Jolle verloren hatte. Während der achttägigen Fahrt der Piraten hatten diese einen Kutter verloren, wahrscheinlich als sie einmal an der Küste nach Trinkwasser gesucht hatten, solch ein hölzernes Boot ist ja schnell futsch.
Als die Argonauten ihr Schiff wieder erblickten, hatte dieses also nur noch drei Boote in den Davits hängen gehabt. Von diesen war Kapitän Martin mit dem Dinghy abgegangen.
Also die »Argos« hatte sich nur noch mit zwei Booten entfernt, einem Kutter und einer Jolle. Und jetzt waren auch noch diejenigen Davits leer, in denen der zweite Kutter gehangen hatte.
Wo der über Nacht geblieben war, wusste man nicht, erfuhren die Argonauten auch nicht so bald, und das war ja auch ganz Nebensache.
Jedenfalls verfügten die Piraten jetzt nur noch über eine einzige Jolle, und in die gingen höchstens zwanzig Menschen hinein!
Und was nun?
Der Waffenmeister der Argonauten hatte sofort seinen Kriegsplan entworfen.
Die »Argos« lag also auf einer Sandbank, die nach der Seeseite völlig klippenfrei war.
Auf der Südseite, also nach der Richtung hin, wo die wracke Brigg lag, näherte sich die Klippenformation jener Sandbank bis auf höchstens hundert Meter, von der Nordseite her die Fortsetzung dieser Klippenformation vielleicht bis auf hundertzwanzig Meter. Es war, als ob es so hätte sein müssen, dass die »Argos« im dichten Nebel gerade zwischen diesen Riffen hindurchgelaufen war, um so weich wie möglich im Sande gebettet zu werden.
Denn zwischen den Riffen selbst wäre sie ein hoffnungsloses Wrack geworden, genau so wie die Brigg.
Und diese beiden Rifformationen bildeten den herrlichsten Schleichweg, den man sich denken konnte, um sich in sicherer Deckung dem festgenagelten Schiffe nähern zu können, um es zu beschießen.
Und schon rückten die beiden Trupps ab, welche Georg für diese Aufgabe abgeteilt hatte. Und dass er hierfür die geeignetsten Leute zusammenstellte, das war eben die Sache des Waffenmeisters.
Denn ganz so einfach war die Sache nicht, es gehörten die geübtesten Jäger sowohl, wie die gewandtesten Akrobaten dazu, um diese Schleichwege auch benutzen zu können, ohne von einer feindlichen Kugel getroffen zu werden. Man musste manchmal weite Sprünge von Klippe zu Klippe ausführen, wenn ein Waten oder Schwimmen ganz ausgeschlossen war, es war ein ganz halsbrecherischer Weg!
Aber die abgeschickten Leute würden ihre Ausgabe schon lösen, der Waffenmeister der Argonauten, der sie erst zu Akrobaten und Athleten ausgebildet, hatte sie ausgesucht.
Und dann natürlich blieb noch eine starke Schützenkette längs des Waldsaumes liegen, durch Büsche und Kokospalmen geschützt, um den Bach für die Piraten unantastbar zu machen.
An Patronen fehlte es nicht.
Es waren fast hundert Männer, die Schiffsjungen mit eingeschlossen, jeder mit einer Doppelbüchse bewaffnet, und zusammen verfügten sie über mehr als dreitausend Patronen.
Ein Glück, dass sie während des Jagdlebens in dem Prärielande so sparsam mit der Munition gewesen waren, und auf dem Durchmarsch durch den Urwald hatten sie noch viel weniger verbraucht.
Die Piraten mochten sich auch nicht schlecht die Augen reiben, wie der Nebel so plötzlich in die Höhe gerollt war.
Nicht, weil sie sich hier auf einer Sandbank sitzen sahen; das hatten sie natürlich auch im dichtesten Nebel gemerkt, mit verbundenen Augen, was ihnen da passiert war.
Aber dass sie da fünfhundert Meter von sich entfernt wieder die Koprabrigg liegen sahen, das hatten sie sicher nicht erwartet!
Durch die Fernrohre, teils eigene, teils von der Brigg stammend, sah man, was für verdutzte Gesichter die an Deck stehenden Verbrecher machten, wie sich viele tatsächlich die Augen rieben, und nicht nur vor Schlaftrunkenheit. Dann mussten sie es wohl glauben. Gleich darauf sahen sie den Waffenmeister der Argonauten über die Sandbank rennen, aber was er rief, hörten sie nicht, dazu war die Entfernung denn doch zu groß.
Und dann sahen sie auch nicht etwa, wie die abgeteilten Trupps nach den Klippenformationen rückten! Das geschah auf großen Umwegen, auch hinter Sandwellen gedeckt, und ebenso verließen diejenigen, welche die Nacht auf dem Wrack kampiert hatten, dieses, wie die Patronin, Ilse und Klothilde, die zogen sich ungesehen über die Klippen und dann auf jenen Schleichwegen über die Sandbank nach dem Waldessaum zurück.
Denn an Bord der Argos befanden sich ja Revolverkanonen und Schnellfeuergeschütze, das Wrack konnte leicht in Trümmer geschossen werden, dort in dem Urwald dagegen, der wie gewöhnlich am Rande ganz rotangfrei, war man gegen jedes Bombardement gesichert.
Es war gerade ein Sonntag, und in sonntäglicher Morgenstille lag alles da. Ein herrlicher Sonntagsmorgen! Auch der Himmel leuchtete wieder in wunderbarem Blau.
Von den Argonauten war absolut nichts mehr zu sehen. Nur einmal war beobachtet worden, wie dort am fernen Waldessaum ein Mann mit affenartiger Behändigkeit eine hohe Koskospalme erklettert und sich oben in den Ästen etwas zu schaffen gemacht hatte; dann war er wieder herabgeglitten und verschwunden. Kapitän Baslare selbst erstieg, wie es schon andere getan hatten, die Wanten bis zur Royalrahe hinauf, um Umschau zu halten — kein Mensch war zu sehen, auch keines jener Tiere, deren Einzug auf die Sandbank sie gestern mit beobachtet hatten.
Nun, die Piraten, ob nun Seeleute oder nicht, wussten, was sie zu tun hatten, was möglich war und was nicht.
Dort, wo sich die Pfahlhütten der Dajaks erhoben, gab es ja unbedingt Trinkwasser, welches die Piraten so sehr, sehr nötig hatten. Aber es von dort in Eimern zu holen, daran durfte man gar nicht denken; beim Wege über die Sandbank wurde doch jeder aus dem Hinterhalte weggeschossen.
Also nur so schnell als möglich wieder von hier wegkommen! Das Schiff musste einfach ausgegraben werden, genau so, wie es sich Georg sofort vorgestellt hatte.
Zunächst holten sie Schaufeln hervor, an Bord der »Argos« im Überflusse vorhanden, vor allen Dingen aber Balken und Bretter; denn ehe man an ein Ausschaufeln ringsum denken konnte, musste das ganze Schiff abgestützt werden. Das sind Arbeiten, deren Plan der Seemann, wenn nicht im Kopfe, dann in den Händen haben muss, sonst eignet er sich eben nicht zum Seemanne, mindestens kann er niemals als Seemann fahren; denn ein solcher muss sich in jeder Lage zu helfen wissen, in jeder! Auf der Steuermannsschule wird solch eine Möglichkeit, dass ein Schiff auf eine Sandbank läuft, vollständig aufs trockene hinauf, sehr wohl erwogen, und noch ganz andere Möglichkeiten dazu, und der Steuermannsschüler, der solch ein vom Lehrer theoretisch aufgestelltes Problem nicht geschickt zu lösen weiß auf dem Papiere, der kann seine Bücher nur gleich wieder einpacken, der wird nicht zum Examen zugelassen. Die Reedereien wollen ihre befrachteten Schiffe, Millionenwerte repräsentierend, doch keinem unpraktischen Menschen anvertrauen! Und hier kann Mutterwitz und praktische Hand durch keine Universitätsbildung ersetzt werden. Dafür aber gibt es im Seemannswesen auch noch die einzige Möglichkeit, als ganz ordinärer Mensch Offizier zu werden, Offizier in der kaiserlichen Marine! Noch heute! Wer sein Steuermannsexamen besteht, der dient in der Marine überhaupt als Einjähriger, er braucht vorher gar keine Schule besucht zu haben, und in der Marine gibt es überhaupt gar keine Selbstverpflegung, und jeder Einjährige kann Offiziersaspirant werden; dann, wenn er zugelassen wird, werden die weiteren Kosten für diese Laufbahn von einer Reedereigenossenschaft getragen, denn das sind dann natürlich Kerls, die später wie Gold gesucht werden, und dann freilich fängt es mit höherer Mathematik und höherer Astronomie an.
Es schadet wohl gar nichts, wenn dies hier einmal erklärt wird. Nur noch im Seemannswesen gilt das Wort wirklich, dass jeder Matrose den Admiralsstab im Zeugsack hat. Nur hier noch geht Mutterwitz und praktische Hand über jede andere Bildung, kann durch nichts ersetzt werden; denn das mit dem Generalfeldmarschallsstab, den jeder Soldat im Tornister tragen soll, das ist doch ein Märchen geworden, das endlich einmal ausgemerzt werden sollte. Nur in der Marine ist es noch heute kein Märchen. Wir haben noch heute zwei Admirale, die gewöhnliche Handelsmatrosen gewesen sind.
Wohl die Hälfte aller Piraten war auf beiden Seiten des Schiffes auf die Sandbank gesprungen, bereit, die Balken und Bretter zu empfangen, die aber erst unten aus dem Holzraum an Deck gewunden werden mussten.
Da fiel ein Schuss.
Der Schall kam aus der Richtung des Waldsaumes her.
Wollten die dort natürlich versteckt Liegenden etwa die hier Arbeitenden beschießen?
Die Entfernung betrug noch etwas mehr als einen Kilometer.
Ja, die modernen Infanteriegewehre schießen noch viel, viel weiter als tausend Meter. Das Schiebevisier der alten Marinebüchse, Model 71/84, ist auf 1600 einzustellen.
Aber Schießen und Treffen ist zweierlei. Bei solch großen Entfernungen ist an ein treffsicheres Zielen ja gar nicht zu denken.
Es konnte überhaupt nur ein Signalschuss gewesen sein, um aufmerksam zu machen.
Denn jetzt kletterten an jener Palme, die vorhin von einem Manne erstiegen worden war, bunte Lappen in die Höhe und bildeten eine Reihe. Kapitän Baslare hatte das internationale Signalbuch schon zur Hand.
»Alles zurück an Bord! Unter Deck!«, übersetzte er.
Es kam zu keinem Hohngelächter. Dieser Befehl war für die Piraten ganz unverständlich.
»Warum?!«, ließ Baslare durch zwei Flaggen zurückfragen, nur aus Neugier.
Durch zwei nacheinander gehisste Flaggenreihen wurde ausführlich geantwortet.
»In einer Minute werdet Ihr beschossen. Unter Deck!«
Noch immer verständnislos blickten die Piraten nach dem Waldessaum.
Von dort aus beschießen? Hatten die Argonauten etwa Geschütze bekommen?
Was die ursprünglich bei sich gehabt, wussten die Piraten ja; Kapitän Martin war befragt worden und er hatte berichtet. Warum sollte er nicht?
Nur Jagdbüchsen, die auf dreihundert Meter mit Sicherheit schossen, aber schon bei fünfhundert Metern hörte es auf. Eine Jagdbüchse mit großem Kaliber ist doch kein Infanteriegewehr, dessen kleine Stahlspitzkugel einen Knochen nur glatt durchschneiden soll, um den Gegner unschädlich zu machen. Von solch einem kleinen Stahlgeschoss stürzt aber noch nicht einmal ein Reh, wenn es nicht absolut tödlich getroffen wird. Solch ein Infanteriegewehr ist für Hochwildjagd gar nicht zu gebrauchen, von Büffeln und dergleichen erst gar nicht zu sprechen. Die Piraten plapperten noch zusammen, was die dort denn eigentlich gegen sie unternehmen wollten, als dort wieder eine Flaggenreihe aufstieg.
»Die Minute ist vergangen!«
Ja, und was nun? Na, da schießt doch einmal. Zeigt, was Ihr könnt, was Ihr eigentlich vorhabt.«
Ein Matrose erkletterte die Großwante, um noch einmal Umschau zu halten.
Er war erst bis zur Großrahe gekommen, der untersten des Mittelmastes, als wieder ein Schuss fiel, diesmal wirklich krachte, nämlich in viel größerer Nähe, nicht dort am fernen Waldessaume.
Und da warf der Matrose dort oben beide Arme hoch, sauste herab und schmetterte an Deck.
Und da krachten noch sechs andere Schüsse, zusammen oder kurz hintereinander, und noch sechs andere Menschen brachen zusammen, immer durch den Kopf geschossen, die auf dem Sande neben dem Schiffe gestanden hatten, aber nicht alle sechs auf derselben Seite, sondern drei auf Backbord und drei auf Steuerbord.
Hei, da freilich hörte das untätige Herumstehen auf und aus dem französischen Plappern wurden wilde Schreie.
»Sie liegen ganz nahe hinter den Riffen!! Sauve qui peut — es rette sich, wer kann!!«
In verzweifelter Hast ging es wieder auf Deck hinauf. Das hatte aber seine Schwierigkeiten. Wohl war hüben und drüben die Falltreppe herabgelassen worden, auch ein Fallreep, aber das hatten die wenigsten zum Abstieg benutzt, das war ihnen zu langsam gegangen, sie waren einfach die wenigen Meter in den feinen, weichen Sand hinabgesprungen. Die meisten dieser Verbrecher waren aus ihrer ehemaliger Praxis ja noch ganz andere Sprünge gewöhnt.
Ja, herabspringen hatten sie können, aber nicht wieder hinauf.
Um die beiden Falltreppen hüben und drüben und um die vorn herabhängende Strickleiter entstand ein wilder Kampf, sogar Messer wurden gezogen, es floss schon Blut. Und wer niedergetreten wurde, auf den wurde weiter herumgetrampelt
Ein förmliches Wunder war es, dass niemand liegen blieb. Jeder konnte sich noch hinaufschleppen, mit Stichwunden oder mit einem gebrochenen Knochen oder mit einem Unterleibsbruch.
Die Argonauten waren edel. Auf ihres Waffenmeisters Befehl! Sie hätten ja zwischen die Fliehenden schießen können, vielleicht alle wegputzen können, aber sie taten es nicht. Sie hatten auf die unten stehenden Piraten nur sechs Schüsse abgeben dürfen, auf jeder Seite sollten drei Tote sein. Und dann freilich durfte auch niemand mehr die Wante erklettern, sich überhaupt nicht mehr an Deck zeigen.
»Wir wollen der Hand der irdischen Gerechtigkeit nicht vorgreifen, wollen sie also möglichst lebendig haben.«
So hatte der Waffenmeister gesagt. Aber er hatte den abrückenden Riffschützen auch noch andere Instruktionen gegeben.
Die meisten Piraten waren ja auch gleich unter Deck gestürzt, aber einige hielten sich doch noch oben auf, um erst einmal näher zu sehen, woher die tödlichen Geschosse kamen, ob man sich nicht revanchieren könne.
»Jetzt darfst Du mal schießen, Kuno!«, sagte auf den Nordriffen der Segelmacher Oskar, der Führer dieser nördlichen Schützenkompanie. »Nimm den mit der roten Kappe aufs Korn, der blickt am frechsten hierher, hat auch schon ein Gewehr in der Hand; aber ein bisschen fix, Kuno, wenn ich bitten darf!«
Der Matrose Kuno, wie alle anderen auf dem Bauche hinter einer Felsenklippe liegend, nicht gerade sehr bequem, aber in sicherer Deckung, lugte, richtete sein Gewehr, zielte und schoss.
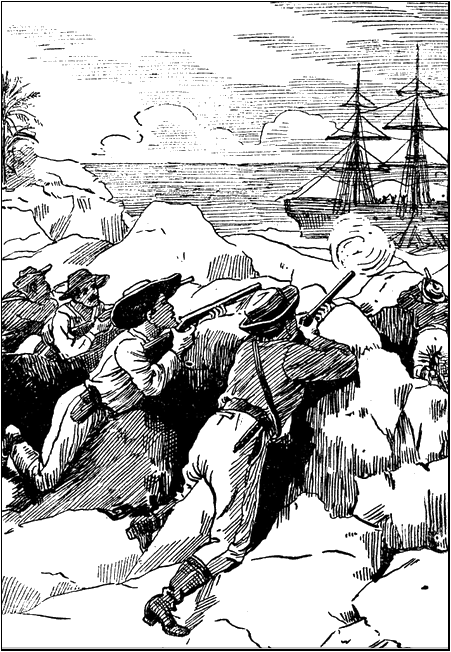
Der Matrose Kuno, wie alle anderen hinter einer Felsenklippe
auf dem Bauche liegend, richtete sein Gewehr, zielte und schoss.
Der Mann mit der roten Kappe ließ das Gewehr fallen, griff mit beiden Händen nach dem Kopfe und sackte zusammen.
Aber ganz merkwürdig war es, was Kuno jetzt für scheue Blicke um sich warf. War es vielleicht das erste Menschenleben, das er vernichtet hatte?
Nein, seine scheuen Blicke hatten einen ganz anderen Grund, und er sprach es aus.
»Verflucht noch einmal! Wenn das der Waffenmeister erfährt! Ich bin zu tief abgekommen, habe den Kerl nur durch die Backen geschossen, oder vielleicht auch ins Maul nein. Wenn das der Waffenmeister erfährt!«
Also das war des Matrosen einziger Kummer gewesen. Es schildert die Stimmung, die hier überhaupt herrschte; wie sie den Feind belagerten. Es fehlte nur noch, dass sie wie die Buren im Kriege auch Sonnenschirme aufspannten.
Fast gleichzeitig war auch auf den Südriffen ein Schuss gefallen, ein zweiter Pirat, der ganz frei an Deck stand, machte gleich einen Bocksprung, und da freilich zeigte sich über der Bordwand auch keine Mütze mehr.
Doch jetzt fiel auch ein Schuss auf Steuerbordseite aus einem Bullauge heraus, und wieder war der Matrose Kuno der Unglückswurm, auf den die Kugel nicht ganz umsonst abgefeuert worden war.
Die Spitzkugel des englischen Infanteriegewehres — diese hatten die Argonauten damals nicht auf den Elektron mitgenommen — hatte ihm das linke seiner ziemlich weit abstehenden Ohren durchlöchert.
Ja durchaus keine gefährliche Verwundung gar nichts von Bedeutung, aber —
»Kuno, Du bist und bleibst ein ausgemachter Döskopp!«, schimpfte der Segelmacher, als er das durchlöcherte und blutende Ohr des neben ihm liegenden Matrosen sah. »Wenn Du die Kugel durchs Auge bekommen hättest, ich würde Dir das andere nicht zudrücken. Was zum Henker hast Du Deinen Elefantenohrlappen da hinter der Klippe herauszuhängen? Na, das Loch zum Ohrring hast Du bekommen, nun nimm Dein Eselshirn aus dem Kopfe und hänge es dran. Aber das sage ich Euch, Jungens, das geht nicht so weiter, sonst lege ich sofort meine Führerstelle nieder! Ihr schimpfiert ja die ganze deutsche Seemannschaft. Der Kerl dort drüben hat geschossen, hat seine Fratze am Bullauge ganz deutlich gezeigt, und niemand hat ihm ein Stück Blei in die Visage gesetzt! Ich selbst konnte es nicht, ich visierte gerade nach achtern. Aber das kommt mir nicht wieder vor! Verteilt Euch hübsch, macht es untereinander aus, welches Bullauge jeder beobachtet! Und dass mir nicht etwa auf einen Kerl gleich doppelt und dreifach geschossen wird! Ich kann die Patronen doch nicht —«
Das letzte Wort, das Oskar gebrauchte, wollen wir lieber nicht wiedergeben.
Aber Erfolg hatte seine Standrede, und das war die Hauptsache.
Gleich darauf zeigten sich an zwei nebeneinander liegenden Bullaugen Gesichter, an jedem eines, es sollten Gewehrläufe herausgeschoben werden, aber weit kamen die Betreffenden damit nicht, gleichzeitig krachten zwischen den Riffen zwei Schüsse, und gleichzeitig verschwanden die beiden Köpfe.
Und es war auch ganz, ganz deutlich zu bemerken gewesen, wie alle beide Schüsse gesessen hatten, bei jedem Kopfe einer, das lässt sich auf solch eine Entfernung von hundert Metern, zumal wenn man so auf dem Bauche auf der Lauer liegt, der ganze Körper nur noch ein einziges Auge ist, ganz genau kontrollieren.
»Zentrum«, sagte der eine Matrose, der geschossen hatte, »ich garantiere für Zentrum«
»Nasenspitze abgekommen!«, meldete der andere, »Schuss zwischen die Augen.«
Am besten konnten diese Behauptungen als Tatsache die Piraten konstatieren, und da freilich verzichteten sie lieber darauf, ihren Kopf noch an einem Bullauge oder über der Bordwand oder sonst wo zu zeigen, zumal von der anderen Seite ebenso akkurat geschossen wurde, und es hat doch gar keinen Zweck, einen Gewehrlauf durch ein Guckloch zu schieben, wenn man durch dieses Loch nicht auch gucken darf.
Beobachtet wurde natürlich doch, und jetzt sah man vor allen Dingen, dass dort an der Palme wieder Flaggenreihen in die Höhe kletterten.
Kapitän Baslare, der hinter der Bordwand kauerte, hatte das Signalbuch noch bei sich.
»Zwei Mann an Deck, um mit uns zu signalisieren!«, lautete der Bescheid.
Der Kapitän richtete sich auf, fand auch sofort einen Genossen, der ihm beim Signalisieren behilflich sein wollte. Sie glaubten auch ohne weitere Versicherung, dass sie nicht beschossen würden; ihr Risiko bestand höchstens darin, dass die Riffschützen von dieser Schonung nichts wussten. Aber die waren bereits durch andere Zeichen darüber verständigt worden. Wenn noch ab und zu ein Schuss zwischen den Riffen hervor fiel, immer mit tödlicher Sicherheit abgegeben, so galt er doch niemals diesen beiden Männern.
»Lebt Kapitän Baslare noch?«, wurde drüben angefragt.
»Ja.«
»Unverwundet?«
»Ja. Signalisiert selbst.«
»Kommen Sie hierher zur Verhandlung. Allein. Sicherheit auf Ehrenwort.«
Wir versetzen uns nach der Signalstation der Argonauten. Die Flaggen stammten natürlich von der Brigg.
Dass man jetzt nicht gleich eine Antwort bekam, war begreiflich. Die Piraten berieten sich erst.
»Können auch einige andere mitkommen?«, wurde dann gefragt.
»Zwecklos. Kapitän Baslare allein.«
Wieder verging einige Zeit.
»Ihr Ehrenwort auch daraufhin, dass Sie Baslare wieder zurückliefern?«
»Aha, ahaaa!«, lachte Georg.
Weshalb diese Forderung, das war ja leicht begreiflich. Die Piraten hatten doch gemerkt, dass ihr Anführer, ein ehemaliger Kapitän, mit Kapitän Martin früher einmal befreundet gewesen war. Nun hegte man Misstrauen, die Argonauten könnten nur mit diesem Anführer Nachsicht üben, ihn durchschlüpfen lassen.
»Auf Ehrenwort! Kapitän Baslare geht zurück, eventuell schicken wir ihn gefesselt.«
Jetzt dauerte es nicht mehr lange, so kam der gewünschte Parlamentär über die Sandbank geschritten. Es war gar kein unsympathischer Mann, dieser Kapitän Baslare. Jedenfalls sah man ihm seinen verbrecherischen Charakter nicht an.
So erreichte er die Signalstation, wurde vom Waffenmeister der Argonauten empfangen, alle Hauptpersonen waren zur Stelle, wenn auch niemand einsprach.
»Ergeben Sie sich mit Ihren Leuten!«, begann Georg ohne Weiteres.
»Auf Gnade oder Ungnade?«
»Gnade oder Ungnade kann für uns gar nicht in Frage kommen. Ihr alle seid schon verurteilte Sträflinge, die sich befreit haben. Es ist ganz einfach unsere Pflicht, Euch dingfest zu machen und Euch im nächsten Hafen den Behörden auszuliefern.«
»Wenn Sie so sprechen, dann ist es ja auch ganz zwecklos gewesen, dass Sie mich persönlich hierher bestellt haben. Und was wollen Sie überhaupt eigentlich, schon morgen früh sind wir wieder frei.«
»Wie wollen Sie denn das anfangen?«
»Wir schaufeln uns aus.«
»Wie wir Sie daran hindern werden, haben Sie doch wohl schon gemerkt.«
»Sie werden aber morgen früh gemerkt haben, dass Sie uns nicht daran hindern konnten.«
»Sie haben keine Kohlen und kein Petroleum mehr.«
»Kohlen massenhaft.«
»Woher denn plötzlich?«
»Wir haben gestern Nachmittag ein Kohlenschiff angehalten und fast tausend Tonnen Kohlen übergenommen; mit vierhundert Menschen ging das fix, haben sie bar bezahlt oder doch in Goldbarren, auch viel Trinkwasser, und außerdem ist der Destillierapparat jetzt repariert worden, er funktioniert wieder.«
Georg, den Franzosen immer fest in die Augen blickend, lächelte.
»Weshalb haben Sie denn nicht schon früher ein Schiff angehalten und sich auf diese Weise mit Kohlen und Wasser versehen, entweder gegen Bezahlung oder durch Waffengewalt?«
Kapitän Baslare gab eine ganz glaubhaft klingende Erklärung hierfür, welche die Argonauten aber schon selbst gewusst hatten.
Es waren ja gar keine eigentlichen Piraten. Wir nennen sie nur so, weil sie nach den Seegesetzen jetzt unter Piraterie standen, wie schon einmal ausführlich erklärt wurde.
Wohl hatten viele diesen Vorschlag gemacht, richtige Seeräuber zu werden, ein fremdes Schiff anzuhalten und ihm das zu nehmen, was sie brauchten, aber die meisten, mindestens dreihundert von den vierhundert, hatten hiervon nichts wissen wollen.
Sie hatten an Bord den Flibustierschatz gefunden, den sie auf mindestens sechzig Millionen Franken taxierten, sich dabei ganz bedeutend zu ihrem Nachteil irrend. Dann kam auf jeden 150 000 Franken — nun fühlte sich ein jeder gleich als wohlbestallter Rentier, der in glücklicher Ruhe sein ferneres Leben bis ans sanfte Ende genießen konnte.
Es handelte sich nur darum, wie den Anfang dieses behaglichen Lebens finden.
Irgendwo an Land gehen, an eine einsame Küste und sich von dort aus unter die anderen Menschen zu versickern, das ist gar nicht so einfach, zumal nicht bei vierhundert Personen.
Das beste war, wenn sie erst einmal für einige Jahre in einer einsamen Gegend verschwanden, etwa in Australien, dort die Kolonisten spielten. Dann, wenn ihr samt und sonders ganz kurz geschorenes Haar — was doch alles zu bedenken ist — wieder gewachsen war und überhaupt Gras über diese ganze Geschichte mit der blutigen Befreiung, dann konnten sie sich so nach und nach wieder in die zivilisierte Welt hinauswagen.
So war beschlossen worden, und es war auch wirklich das Klügste gewesen.
Nun aber trat der Mangel an Heizmaterial und Trinkwasser ein. Doch deshalb hatten sie noch nicht Seeraub treiben wollen, eine große Majorität war immer dagegen gewesen.
Sie hatten immer gehofft, doch noch hier im Sunda-Archipel eine günstige Landungsstelle zu finden, wo sie sich mit Trinkwasser versehen konnten. Kohlen kamen erst in zweiter Linie in Betracht. Dann ging es mit Segeln weiter nach Australien, wenn man nicht gleich hier blieb. Allerdings war auch hierin die Uneinigkeit sehr groß, daher kam es, dass das Schiff so oft hin und her gefahren war; denn Kapitän Baslare war ja nur der nautische Leiter des Schiffes, nichts weiter.
So hatte der Franzose ganz offen berichtet.
Georg hatte ihm dabei immer fest in dise Augen gesehen.
»Und nun also haben Sie wieder Kohlen?«
»Ja, fast tausend Tonnen.«
»Was war denn das für ein Dampfer?«
»Ein japanischen. Die fragen den Teufel danach, wem sie ihre Kohlen verkaufen.«
»Und auch Trinkwasser hat Ihnen dieser japanische Dampfer abgegeben?«
»Ja, zehn große Fässer.«
»Und außerdem funktioniert der Destillierapparat jetzt wieder?«
»Tadellos.«
»Sie lügen.«
»Herr —!!«, wollte dieser Verbrecher aufbrausen.
»Nananananana!«, beschwichtigte Georg. »Jawohl, Sie lügen. Und nun will ich Ihnen sagen, weshalb ich persönlich mit Ihnen sprechen wollte. Um Ihnen in die Augen sehen zu können. Ich kann nämlich jedem Menschen in den Augen lesen, ob er lügt oder die Wahrheit spricht. Sie haben keine Kohlen übergenommen, auch kein Trinkwasser, auch Ihr Destillierapparat funktioniert nicht — nicht wahr, so ist es?!«
»Herr, wenn ich Ihnen versichere —«
»Da da da — sehen Sie? Jetzt habe ich wieder in Ihren Augen gelesen, dass ich ganz genau das Richtige getroffen habe. Sie haben weder Kohlen, noch Petroleum mehr, um die Kessel zu heizen; Ihr Destillierapparat ist hoffnungslos beschädigt, und auch sonst könnten Sie ihn ja überhaupt gar nicht mehr benutzen, Sie können ihn ja nicht heizen. So, das habe ich nur wissen wollen, aus Ihren Augen lesen. Ich danke Ihnen. Nun können Sie wieder zurückgehen.«
Der Franzose kniff die Lippen zusammen.
»Sie werden sehen, dass wir morgen früh nicht mehr hier —«
»Gut, dann werde ich es ja sehen. Jetzt keine Unterhandlung mehr! Oder wollen Sie sich mit allen Ihren Leuten bedingungslos ergeben?«
Statt aller Antwort hohnlachte der Franzose nur grimmig auf.
»Dann also begeben Sie sich an Bord zurück. Marsch! Nach fünf Minuten sind Sie vogelfrei, werden beschossen. Und das gilt sofort, falls Sie einen anderen Weg einschlagen, als nach dem Schiffe zurück.«
Der Kapitän wandte sich und ging zurück.
Der Tag verstrich.
Ab und zu knallte zwischen den Riffen ein Schuss, immer mit tödlicher Sicherheit ein Opfer fordernd. Sobald sich ein Kopf über der Bordwand oder an einem Bullauge oder sonst wo zeigte, kam der Todesbote geflogen. Dann auch einmal ein Salvenfeuer. Nämlich als die Piraten eine große Seitenluke geöffnet hatten und durch diese Balken und Bretter herauswerfen wollten. Schnell gaben sie diesen Versuch wieder auf, draußen eine Barrikade zu bauen, einfach aufzuhäufen, er kostete gar zu viele Opfer.
Die Nacht brach an, stockfinster. Das erste Viertel des Mondes war schon längst wieder untergegangen, der Himmel bedeckt, obgleich es sicher keinen Regen erwarten ließ. Hier regnet es zu ganz bestimmten Zeiten, jetzt war diese Zeit nicht.
Nun freilich hatten die Piraten eine Chance, die sie sich natürlich auch nicht entgehen ließen.
Kaum war diese stockfinstere Nacht angebrochen, als die Argonauten hörten, wie dort jetzt krampfhaft gearbeitet wurde. Balken krachten, Bretter klappten zusammen.
Vierhundert Menschen — oder sollten es jetzt noch dreihundertfünfzig sein — die können ja etwas schaffen, zumal wenn solche Verzweiflung dahinter sitzt. Bis morgen früh konnten sie das Schiff recht gut ausgeschaufelt haben, mit ihrem letzten Kohlen- oder Petroleumvorrat wieder unter Dampf in die freie See gegangen sein.
Und was wollten denn die Argonauten dagegen tun? Ja, sie konnten sie beschießen, Salvenfeuer abgeben. Die Richtung wussten sie ja. Aber es hat sich doch etwas, so in die finstere Nacht hineinzuschießen. Schießen kann man wohl, aber mit dem Treffen hat es dann seine Schwierigkeit. Wenn jeder vielleicht noch über dreißig Patronen verfügte, die waren dann gar bald verplatzt, und der Erfolg war ein ganz minimaler; denn dass die Piraten auch nicht das geringste Licht zeigten, das braucht wohl nicht erst betont zu werden.
Oder im Sturme angreifen!
»Wegen dieser Verbrecher setze ich auch nicht das Leben unseres Telleraufwäschers aufs Spiel!«, hatte der Waffenmeister gesagt.
Doch dieses Klappern von Balken und Brettern hatte überhaupt erst angefangen eine Viertelstunde nach Anbruch der Nacht, jetzt wurde dieses Material erst an Deck geschafft, als es sich schon zeigte, wie die Argonauten die Sache zu handhaben gedachten.
Da kam von den Südriffen her etwas Weißes, intensiv Leuchtendes, mit einem schwachen Knalle durch die Luft gesaust. Die Seeleute unter den Piraten wussten sofort, was es war.
Eine der Magnesiumraketen, von denen die Brigg bei Abfahrt von jedem Hafen ein voll Dutzend vorschriftsmäßig an Bord gehabt haben musste.
Wie hatte Kapitän Baslare nur an diese Magnesiumraketen nicht denken können? Nun, man vergisst manches so leicht.
Und der Waffenmeister der Argonauten hatte es nicht für nötig befunden, ihn darauf aufmerksam zu machen, wie auch die nächtliche Arbeit gestört werden konnte. Solch eine Magnesiumrakete brennt dort, wo sie aufschlägt, etwa fünf Minuten lang, auch auf dem Wasser, einen Umkreis von wenigstens hundert Metern intensiv beleuchtend. Schlägt sie auf einen festen Gegenstand zu heftig auf, so zerplatzt die eigentliche Leuchtkugel, der Feuerwerkssatz spritzt umher, macht dadurch den Beleuchtungseffekt nur noch wirksamer.
So war es auch hier. Der Glühstoff war gerade gegen den Schiffsrumpf geschlagen, ein Funkenregen, dann brannten die einzelnen Teile im Sande weiter, Tageshelligkeit verbreitend.
Und dort an dem Schiffsrumpfe wimmelte es von Menschen, die erst einmal die Schaufeln in Bereitschaft setzten, die Balken und Bretter waren noch nicht herabgeworfen worden, befanden sich noch an Deck.
»Schnellfeuer!«
Die Salven krachten.
Und dasselbe geschah auch auf die Steuerbordseite, von den Nordriffen her; nur dass sich hier die Rakete noch vor dem Schiffe im Sande gebettet hatte, aber ebenfalls ihren Zweck vollkommen erfüllend.
Heulend suchten die Piraten wieder das Deck zu gewinnen. Nur wenige besaßen die Geistesgegenwart und Klugheit, sich lieber flach in den Sand zu werfen.
Die verzweifelte Hast der einen und die Klugheit der anderen war ganz unnötig gewesen. Wieder hatten sich die Argonauten mit dieser einen Lektion begnügt, mit einer einzigen Salve. Sie hatten ja gar nichts davon, diese Verbrecher hier wegzuschießen, lebendig wollten sie sie haben, um sie dort auszuliefern, wohin sie gehörten.
Jedenfalls aber hatte diese Lektion genügt. Die Piraten machten während der ganzen Nacht keinen Versuch mehr, das Schiff ausgraben zu wollen. Zumal sie bald merkten, dass die Feinde nicht nur über das eine Dutzend Magnesiumraketen verfügten, das die Brigg laut Vorschrift an Bord haben musste und noch nicht angerissen hatte.
In ganz unregelmäßigen Pausen, sodass man die Zeit nie bestimmen konnte, jedenfalls aber mindestens aller zehn Minuten kam von hüben, wie von drüben solch eine Leuchtkugel geflogen, Tageshelligkeit verbreitend.
Woher die Brigg über so viel Leuchtraketen verfügte? Nun, sie war doch für ihre Fahrt nach dem Sunda-Archipel mit sogenanntem Stückgut befrachtet gewesen, das man aber in diesem Falle lieber Tauschgut nennen sollte. Sie war von einer kleinen Koralleninsel zur anderen gefahren, um von den Eingeborenen die während des ganzen Jahres aufgehäufte Kopra aufzukaufen, das heißt einzutauschen, gegen als das, was diese Insulaner bedürfen und was ihr Herz sonst erfreut. Dazu gehört auch Feuerwerk aller Art. Aber auch bei solchen Eingeborenen kann sich der Geschmack einmal schnell ändern. Die diesmalige Nachfrage nach Raketen, Fröschen, bengalischen Zündhölzern und dergleichen war nur gering gewesen, am stärksten waren kleine automatische Figuren begehrt worden, mit denen Kapitän Biester zwar ebenfalls hatte dienen können, aber mit zehn Kisten Magnesiumraketen, jede zu zwölf Dutzend, war er doch hängen geblieben. Also da brauchte man jetzt nicht mit solchen Leuchtraketen zu sparen, man würde auch noch für die nächsten Nächte genug haben.
Es war nachts gegen zwei Uhr.
Auf der Hauptstation am Waldesrand brannten einige Feuer, natürlich so geschützt, dass ihr Lichtschein den Piraten nicht etwa als Zielobjekt dienen konnte. Zwar hatten sie noch keine Revolverkanone und kein Schnellfeuergeschütz abgeschossen, aber das konnte doch noch geschehn. Da schlugen draußen in der Finsternis wütend einige Hunde an.
»Das war Pollux, er hat jemanden gefasst und gestellt«, konnte Juba Riata sofort erklären, »und auch Pluto hat in solcher Weise angeschlagen.«
Die dazu abgeteilten Leute waren schon draußen auf der Sandbank, bald kehrten sie zurück, zwei Männer zwischen sich führend.
Verwilderte Gestalten, beide wohl noch ziemlich jung, ihre braunschwarz verbrannten Gesichter aber ganz ausgemergelt, von zahllosen Falten durchzogen.
»Hallo, das sind doch Deutsche!«, rief der Waffenmeister sofort, als er die beiden im Scheine des Feuers sah.
»Landsleute, rettet uns, wir sind unschuldig!«, erklang es zurück.
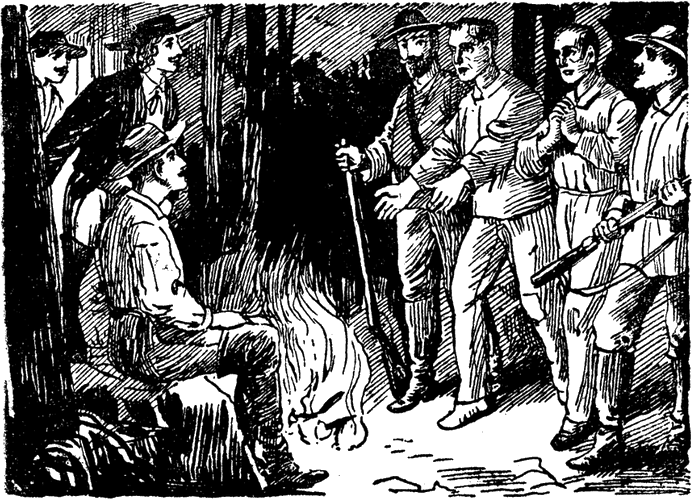
Diese Beteuerung kam nicht unerwartet.
Ja, es war schon über solch eine Möglichkeit ausführlich beraten worden.
Konnten sich unter den vierhundert Sträflingen nicht welche befinden, die ganz unschuldig verurteilt worden waren? Bei denen es angebracht war, sie in Schutz zu nehmen, sie in Freiheit zu setzen? Auch wenn man dadurch mit der französischen Regierung in Konflikt kam?
Mit dieser letzteren Möglichkeit hätten sich die Argonauten schon abzufinden gewusst.
Aber die Sache hatte einen anderen bösen Haken. Wenn man gefragt hätte: »Ist einer von Euch unschuldig zur Deportation nach Neukaledonien verurteilt worden?« — Na, sie wären natürlich alle unschuldig gewesen! Und wie sollte man denn ihre Behauptungen widerlegen, sie ihrer Schuld überführen?!
Nein, auf diese Weise ging die Sache nicht.
Man musste abwarten, ob vielleicht Überläufer kamen, die von selbst ihre Unschuld behaupteten. Die Möglichkeit in solch einer finsteren Nacht war zum heimlichen Überlaufen vorhanden; dann wollte man weiter sehen. Anders war es nicht zu machen.
Und nun also waren die ersten beiden Überläufer gekommen, um ihre Unschuld zu beteuern; zwei Deutsche.
»Wir sind zwei —«
»Still!«, gebot Georg sofort. »Ihr habt kein einziges Wort zu sagen, nur zu antworten, wenn Ihr gefragt werdet!«
Er musterte die beiden eingehender.
Einen sympathischen Eindruck konnten diese verwilderten Gestalten mit den ausgemergelten, verlebten Gesichtern unmöglich machen.
Wenn sie etwa glaubten, sofort Entgegenkommen zu finden, weil sie deutsche Landsleute waren, so sollten sie sich geirrt haben. Ein Verbrecher ist ein Verbrecher.
Ob das scharfe Auge des Waffenmeisters, der ja in der Seele lesen können wollte, sonst etwas an ihnen entdeckte, das sei dahingestellt
»Wie heißt Du?«, wandte er sich dann an den einen. »Nichts weiter als den Namen!«
»Sörop — Chrischen Sörop.«
Schon seine Aussprache verriet den Norddeutschen, auch der Familienname Christian Sörop — also Christian Sirup. Dass ganz oben in Norddeutschland Familiennamen sehr häufig sind, die sich aufs Essen und Trinken beziehen, ist ja schon einmal erklärt worden, für diejenigen, die es nicht selbst kennen. Auch Sörop ist gar kein seltener Name, dort oben gar nicht auffallend. Ein Professor Doktor Sörop hat in Deutschland zuerst die Zahnpraxis in das Gebiet der wissenschaftlichen Ärzte aufgenommen.
»Wohl aus Rostock?«, fragte Georg, diese norddeutsche Aussprache des Namens gleich noch besser heraushörend.
»Jawohl, Herr.«
»Was von Beruf?«
»Gärtner.«
»Und wie heißt Du?«, wandte sich Georg jetzt erst an den anderen.
»Bowiedel — Nepomuk Bowiedel.«
»Bowiedel?!«, wiederholte Georg mit ganz besonderem Gesicht.
Und dann brach er erst einmal in ein herzliches Lachen aus, für die anderen ganz unverständlich.
»Du bist wohl ein Böhmake?«
»Jawohl, Herr, Deutsch-Böhme. Aus Bodenbach.«
»Dacht ich mir's doch!«, lachte Georg noch immer.
»Dass der da Sirup heißt, das kann mich ja wenig irritieren — aber nun der andere Bowiedel — Sirup und Pflaumenmus — nee, das ist doch ein starkes Stückchen!«
Er gab den anderen eine Erklärung. Es war ein Zufall, dass er es konnte. Weil er einmal mit einem Deutschböhmen zusammen gefahren war, der sich bei Gelegenheit dieses Wortes bedient hatte; denn mancher Sachse wohnt dicht an der böhmischen Grenze und weiß nicht, dass dort drüben unser Pflaumenmus Bowiedel genannt wird. Das ist also nicht etwa tschechisch, sondern gut deutsch. Woher dieses Wort Bowiedel kommt — ja, weshalb nennen wir denn die bei der Zuckerfabrikation übrig bleibende Masse Sirup?
»Also Sirup und Pflaumenmus? Na da erzählt mal. Zuerst Du, Chrischen Sörop. Weshalb bist Du von Frankreich aus nach Neukaledonien geschickt worden?«
»Wir haben alle beide unseren Korporal totgeschlagen.«
»Was?!«, stutzte Georg. »Den Korporal totgeschlagen? Alle beide?«
»Ja, Herr. Bowiedel hat ihm mit dem Gewehrkolben den Schädel eingeschlagen und ich habe in demselben Augenblick dem Hund das Bajonett zwischen die Kaldaunen gerannt.«
»Wo denn?!«
»Bei der Oase Sirping.«
»Wohl in der Fremdenlegion?«
»Ja, Herr.«
»Aha! Wohl beim Strafexerzieren?«
»Ja, Herr.«
»Aha! Hab ich mir nun doch gleich denken können. Ja, Kinder, da seid Ihr aber doch nicht unschuldig verurteilt worden.«
»Wir sind unschuldig.«
»Na wie denn nur?«
»Herr, haben Sie einmal drei Stunden Strafexerzieren in der französischen Fremdenlegion, oder auch nur eine einzige, unter dem Korporal Lablanc vom zweiten Bataillon, und die Gelegenheit ist gerade günstig, Sie sind allein mit ihm, niemand sieht's — ob Sie den Hund nicht auch totschlagen und sich dann ganz unschuldig fühlen!«
Es war ein großes Wort gewesen, was da ausgesprochen worden war.
Die meisten der Umstehenden wussten es zu würdigen. Denn gerade Seeleute kommen ja so oft mit französischen Fremdenlegionären zusammen, mit entlassenen, aktiven oder desertierten, bekommen zu hören, was es heißt, in der französischen Fremdenlegion zu dienen, und so etwas muss man sich eben persönlich erzählen lassen. Das geschriebene Wort ist ja tot.
»Was habt Ihr ausgefressen, dass Ihr erst in die Fremdenlegion eingetreten seid?«
»Wir haben gar nichts ausgefressen.«
»Weshalb seid Ihr denn eingetreten? Erzähle erst Du einmal, Sörop.«
Der konnte auch gleich für den anderen sprechen; denn die beiden waren immer zusammen gewesen.
Vor ungefähr zwei Jahren hatten sie sich kennen gelernt, in Straßburg, auf der Walze, also als reisende Handwerksburschen, der Gärtner Christian Sörop aus Rostock und der Tischlergeselle Nepomuk Bowiedel aus Bodenbach waren weiter zusammen durch Elsass gewandert, der Arbeit vorläufig noch aus dem Wege gehend, weil sie eben noch Geld bei sich hatten, trotz alledem natürlich fechtend, Klinken putzend.
Eines Abends waren sie in ein Grenzstädtchen gekommen, noch auf deutscher Seite liegend, und da war es ihnen gegangen, wie es schon manchem Deutschen ergangen ist und noch manchem Deutschen ergehen wird.
Ein jovialer Herr, der den deutschen Patrioten markierte, dem auch nicht der geringste französische Dialekt anzumerken war, hatte sie in einer Wirtschaft traktiert, hatte ihnen die Spirituosen, vor allen Dingen den Absinth, immer nur so eingepumpt — und wie sie am anderen Tage erwachten, aber noch immer halb betäubt, da waren die beiden mit noch einigen anderen schon auf französischem Boden gewesen, die Papiere wurden ihnen vorgelegt, laut deren sie sich durch eigenhändige Unterschrift zum fünfjährigen Dienst für die Fremdenlegion in Algerien verpflichtet hatten.
Keine Ahnung von dieser Unterschrift! Nee, da machen wir nicht mit.
Nicht? Schon war Gendarmerie zur Stelle. Mit Gewalt nach Nancy abgeführt, weiter nach Marseille, per Schiff nach Algier hinüber.
Eingekleidet, und nun ging es los. Die beiden Freunde waren in ein und dasselbe Bataillon, in ein und dieselbe Korporalschaft gekommen.
Sie konnten erzählen von den fürchterlichen Strapazen der Rekruten, wie sie bis aufs Blut kujoniert und malträtiert würden, von dem Strafexerzieren, von stundenlangem Laufschritt im glühendsten Sonnenbrande, von den Arrestzellen unter der Erde, und all diese Strafen für Vergehen, die absolut nicht zu vermeiden sind, für die man gar nichts kann.
Ein ganzes Jahr hatten es die beiden ertragen, hatten es ertragen müssen. Da hatten sie einen neuen Korporal bekommen, der es besonders auf die Deutschen noch ganz anders abgesehen hatte.
Weil dem Bowiedel die Halsbinde gestohlen worden war, hatte er drei Stunden Strafexerzieren erhalten, und Sörop erhielt dieselbe Strafe, weil er für seinen Freund ein entschuldigendes Wort eingelegt hatte.
»Wartet, Ihr deutschen Kanaillen, ich will Euch zeigen, was es heißt, in der französischen Armee zu dienen!«
Und der Korporal hatte es ihnen gezeigt, dort in der einsamen Wüste neben der Oase, in der größten Mittagshitze.
Eine halbe Stunde lang hatte er es ihnen gezeigt. Dann war er von den beiden vom Leben zum Tode befördert worden.
»Und wir hatten uns nicht etwa verabredet, mit keinem Wörtchen! In demselben Augenblick, da Bowiedel ihm mit dem Gewehrkolben den Hirnkasten einschlug, rannte ich ihm das Bajonett in den Leib. Ich wusste gar nicht, dass Bowiedel schon das Gewehr herumgedreht hatte.«
»Nun und was weiter?«
Niemand hatte es gesehen. Sie verscharrten die Leiche im Sande und machten sich auf und davon. Über die nicht weit entfernte marokkanische Grenze wollten sie kommen. Was sie während zweier Tage ohne Wasser und Proviant in der Wüste durchgemacht hatten, dabei hielt sich der Erzähler jetzt nicht auf. Sie kamen denn auch über die Grenze, die Halbverschmachteten wurden von marokkanischen Arabern gefunden. Die verpflegten sie gut und lieferten sie der nächsten französischen Garnison aus, um sich die hundert Franken zu verdienen; denn auf jeden kurzgeschorenen Kopf eines desertierten Fremdenlegionärs ist eine Prämie von fünfzig Franken ausgesetzt. In Algier und Umgegend wird kein Europäer kurzgeschorenes Haar tragen; man kommt zu leicht in den Verdacht, ein desertierter Soldat zu sein.
Natürlich kriegsgerichtlich zum Tode verurteilt! Die Leiche des Korporals war doch bald gefunden worden.
Da wechselten in Frankreichs gerade die Präsidenten, und wie immer begnadigte der Neugewählte alle Todeskandidaten, an denen das Urteil noch nicht vollstreckt worden.
Deportation nach Guinea, nach der Teufelsinsel, für Lebenszeit.
Die Teufelsinsel aber war schon überfüllt, ausnahmsweise wurden auch vom Kriegsgericht Verurteilte einmal nach dem australischen Neukaledonien geschickt.
»Erst nachdem das Urteil rechtskräftig geworden war, hörte unsere Leidenszeit auf!«, schloss Sörop seinen Bericht. »Denn was wir während der langen, langen Untersuchung durchgemacht haben, wie wir malträtiert worden sind, das kann ich Ihnen gar nicht erzählen. Sie würden's gar nicht glauben. Gottlob, nun sind wir gerettet!«
»So, inwiefern denn?«, fragte der Waffenmeister kaltblütig zurück. »Habt Ihr Euren Korporal nicht tatsächlich ermordet? Ihr seid nach Gesetz und Recht zum Tode verurteilt worden, was auf dem Wege der Gnade in lebenslängliche Deportation umgewandelt worden ist. Unsere Pflicht ist es, Euch wieder den französischen Behörden auszuliefern.«
So sprach Georg. Es war ja auch tatsächlich ein ganz merkwürdiger Fall, der hier vorlag.
Ja, die Argonauten hatten schon mit der Möglichkeit gerechnet, dass unter jenen Sträflingen auch ganz Unschuldige sein könnten, darüber war bereits beraten worden. Nun aber stellten sich hier zwei Mann, welche ganz offen zugaben, einen Mord begangen zu haben, wofür sie doch wirklich den Tod oder eine entsprechende Strafe verdient hatten.
Aber nun freilich — was jetzt diese letzten Worte des Waffenmeisters auf die beiden für einen Eindruck machten! Dieses ungläubige Starren, diese plötzlich ganz verzweifelten Gesichter!
Und ganz ähnliche Gesichter machten auch die umstehenden Argonauten, die starrten ebenso ihren Waffenmeister an.
Unter den Umstehenden, die den Bericht mit angehört, befand sich auch der Segelmacher, der als Führer der einen Schützenkette einmal abgelöst worden war, und der war wie gewöhnlich der erste, der seiner Meinung Luft machen musste.
»Bei Gottes Tod, Waffenmeister«, rief er, »wenn Ihr diese beiden wieder ausliefern wolltet —«
Er kam nicht weiter.
»Ruhe da!«, donnerte ihn der Waffenmeister an, auch die anderen mit seinen blauen Augen anblitzend. »Du wärst der letzte, der hier zu entscheiden hätte!«
Ganz gelassen wandte er sich gleich wieder an die beiden.
»Weil Ihr den Korporal totgeschlagen habt, deshalb liefern wir Euch natürlich nicht wieder aus. Das hätte ich an Eurer Stelle wahrscheinlich ebenfalls getan, jeder von uns, da hattet Ihr ganz recht, als Ihr dies sagtet. Aber es kommt nur darauf an, ob Ihr uns auch die Wahrheit erzählt habt —«
»Herr, wir schwören es —«
»Das mit dem Korporal glaube ich schon; aber Ihr könnt ja auch noch etwas ganz anderes ausgefressen haben.«
»Gar nichts, gar nichts!!«
»Na, so ganz unschuldige Engel werdet Ihr doch nicht sein, schon vorher nicht, ehe Ihr in die Fremdenlegion kamt. Seid Ihr in Eurer Heimat schon einmal bestraft worden?«
»Nein.«
»Noch gar nicht?«
»Nein.«
»Besinnt Euch! Strengt Euer Gedächtnis an, darauf wird später alles ankommen!«
Da gab Bowiedel zu, schon einmal mit drei Tagen Haft wegen Bettelns bestraft worden zu sein, und das konnte er in diesem Falle allerdings wirklich vergessen haben.
»Das ist nichts weiter!«, entschied Georg denn auch gleich. »Und wie ist es denn mit Eurer Dienstpflicht in Deutschland, respektive in Österreich? Ihr müsst damals doch schon dienstpflichtig gewesen sein!«
»Wir haben ja auch alle beide gedient!«
»Sooo? Wo denn?«
Nun, sie hatten eben alle beide ihre drei Jahre schon abgerissen, der eine in Deutschland, der andere in Österreich, und Sörop war als Unteroffizier der Reserve entlassen worden.
»Sooo!! Das ändert nun freilich die ganze Sache! Das hättet Ihr gleich sagen sollen. Denn jeden desertierten Fremdenlegionär drückte ich nicht etwa an mein Herz, weil es ein Landsmann von mir ist, und wenn es auch an ein eigener Bruder wäre. Etwas faul im Staate Dänemark ist's doch gewöhnlich. Aber wenn Ihr erst Eurer Dienstpflicht in der Heimat genügt habt — das ist schon etwas ganz anderes, dann glaube ich auch, dass Ihr so ganz unfreiwillig zur Fremdenlegion gepresst worden seid. Na, wir werden die Sache näher untersuchen, ob Eure Angaben stimmen. Zu den Piraten zurückschicken tun wir Euch natürlich nicht. Ihr bleibt vorläufig hier und werdet bewacht. Fehlt Euch etwas?«
»Wasser! Wir haben Durst.«
Sie bekamen zu trinken, konnten gleich am Bache niederknien.
»Ist das Wasser auf dem Schiffe schon so knapp?
Sie berichteten.
Gestern Abend hatte jeder die letzte Wasserration erhalten, auch schon keine volle mehr.
Kein Tropfen trinkbares Wasser war mehr vorhanden, auch kein Wein und dergleichen, woran man den Durst hätte löschen können. Der Weinvorrat der »Argos« war während des langen Aufenthalts in dem sibirischen Tale doch stark angegriffen worden, und mit den letzten Flaschen hatten die vierhundert Sträflinge zuerst natürlich nicht gespart.
Spirituosen aller Art hingegen waren noch in Menge vorhanden gewesen, aber mit Rum und dergleichen kann man einmal doch nicht den Durst löschen, und dann war gleich in den ersten Tagen, als einmal eine große Ausschreitung vorgekommen, dieser ganze Vorrat von Spirituosen mit so ziemlich allgemeiner Übereinstimmung vernichtet worden.
An Kohlen und Petroleum mochte noch so viel vorhanden sein, dass man vielleicht zweihundert Seemeilen dampfen konnte. Der Destillierapparat war unheilbar kaputt. Und sich einen anderen zu konstruieren, auf irgend welche Weise Seewasser zu destillieren, das ist leichter gesagt als getan. Wäre das so einfach, dann würden doch nicht auch heute noch die Mannschaft von Segelschiffen in die Gefahr des Verschmachtens kommen. Sind auch die Kohlen für die Kombüse verbraucht, Holz wird es doch noch immer an Bord geben, man könnte die letzte Bank verfeuern, den letzten Holzeimer, mit Beilage von Holzspeck — aber es ist eben nicht so einfach, Wasser zu kochen und den Dampf wieder zu kondensieren.
So hatten die beiden berichtet, von dem Waffenmeister befragt.
Morgen oder vielmehr heute schon musste sich das Schicksal der Piraten entscheiden.
»Was wollen sie nun anfangen? Schmieden sie nicht irgendwelche Pläne?«
Nein, bis vorhin hatte noch keine Beratung stattgefunden.
»Wo ist der letzte Kutter geblieben?«
In der vorigen Nacht hatten sich mit ihm ein Dutzend Sträflinge heimlich entfernt. Dass jetzt so etwas auch noch mit der letzten Jolle geschah, überhaupt mit dem letzten Boote, das war völlig ausgeschlossen.
»Gibt es unter den Sträflingen welche, die Ihr für unschuldig haltet, die beteuern, dass sie unschuldig verurteilt worden wären?«
Die beiden wussten nichts davon. —
Die Nacht verging.
Immer ab und zu eine Magnesiumrakete, welche das Schiff und die ganze Umgebung mit blendendem Lichte übergoss und immer einmal wurden die Piraten mit tödlichen Schüssen belehrt, dass es von hier kein Entrinnen gab.
Der Tag brach an, und noch war die Sonne nicht hoch gestiegen, als die Piraten eine weiße Flagge hissten. Sie wollten nicht die Qualen des langsamen Verschmachtungstodes erst kosten, sie ergaben sich auf Gnade und Ungnade.
Einiges Parlamentieren hin und her, dann schritten immer zehn Mann über die Sandbank dem Waldessaume zu, wurden in Empfang genommen und gebunden.
Aber die Argonauten sollten auch von dieser langwierigen Arbeit verschont bleiben. Erst der dritte Trupp war unschädlich gemacht worden, als ein Dampfer gesichtet wurde, den man bald als ein großes Kriegsschiff erkannte, und als man sich durch Flaggensignale verständlich machen konnte, stellte er sich als eine französische Panzerkorvette vor.
Dieses Kriegsschiff kam wie gerufen. Es wurde kurz benachrichtigt, eine genügende Anzahl Matrosen landete in Booten und nahm den Argonauten die letzte Arbeit ab.
Sörop und Bowiedel wurden natürlich nicht ausgeliefert. Sie brauchten auch nur unsichtbar zu bleiben, dann wurden sie nicht einmal vermisst. Sie konnten sich ja unter den siebenundsechzig Toten befinden, welche diese einzige Nacht gekostet hatte, und diese Leichen waren nicht so leicht mehr zu rekognoszieren.
Das französische Kriegsschiff fuhr mit den dingfest gemachten Sträflingen wieder ab, es hatte genügend Kohlenvorrat abgegeben, und am nächsten Tage konnte auch die »Argos« die Sandbank wieder verlassen.
Es ging nach Pontiniak, wo man sich neu ausrüstete und die Schiffbrüchigen, wie auch die beiden Deserteure an Land setzte, und auch letztere beide durften, mit genügend Mitteln versehen, sich in Sicherheit fühlen.
Seit Wochen schon kreuzte die »Argos« im Indischen Ozean, ohne ein Ziel zu haben. Die Argonauten gaben sich ganz dem Genusse hin, ihr Schiff wieder zu haben, sie turnten und spielten, lebten ganz wie in ihrer ersten, schönsten Zeit, dieses köstliche Leben zur See war vollkommener Selbstzweck, niemand dachte daran, dass sie hieran einmal die Lust verlieren könnten.
Eine Sturmnacht stand bevor.
Das war nach ständig schönem Wetter ja nun allerdings einmal eine angenehme Abwechslung, weil so etwas nun einmal zum Seeleben gehört, wenn es einen ganzen Mann erfordern soll.
Und dieses Vergnügen sollten sie denn auch haben. Der Sturm pfiff aus Osten, wie man es sich besser gar nicht wünschen konnte. Mit gerefften Sturmsegeln flog die »Argos« in dem inselfreien Wasser dahin, und wenn das so bis morgen Mittag anhielt, konnte sie dann schon das Kap der guten Hoffnung passiert haben, sich zur Abwechslung im Atlantischen Ozean befinden.
Und um das »Vergnügen« voll zu machen, kam man jetzt auch noch in ein Gewitter. Ohne dass es einen Regenguss gab, wurden die schwarzen Wolken unaufhörlich von Blitzen zerrissen, manchmal stand das ganze Firmament in Flammen, unaufhörlich krachte der Donner.
In seinen Ölmantel gehüllt, stand Georg neben Kapitän Martin auf der Kommandobrücke, gab sich ganz diesem elementaren Genusse und dem seiner kurzen Pfeife hin.
Doch jetzt war diese gerade erloschen, gab keinen Rauch mehr. Feuer oder Tabak waren ausgegangen.
Georg trat in das Kartenhaus und stopfte frisch. »Schiff voraus zwei Strich steuerbord!!«, sang da langgedehnt der Mann auf dem Ausguck, dessen Stimme man in einer Donnerpause eben noch vernehmen konnte. Schnell sprang Georg wieder hinaus, blickte in die bezeichnete Richtung.
Nichts als pechfinstere Nacht, und gerade jetzt wollte sie kein Blitz mehr erhellen.
»Was war's?«
»Haben Sie es nicht gesehen?«, fragte Kapitän Martin. »Nein. Ich war gerade im Kartenhaus.«
»Schade. 's war ein bannig feiner Anblick. Ein vollgetakelter Fünfmaster, der sich uns da plötzlich präsentierte.«
Aller Augen, die es selbst nicht gesehen, wandten sich der bezeichneten Richtung zu, um im Blitzschein den Anblick des vollgetakelten Fünfmasters, sicher ein amerikanischer Chinafahrer, zu bekommen.

Aber es blieb dabei: es war, als ob es der letzte Blitz gewesen, kein zweiter wollte die Nacht erhellen.
Nur am südlichen Horizont, jener Richtung gerade entgegengesetzt, wetterleuchtete es noch manchmal. Doch die dortige Erleuchtung kam für die Steuerbordseite nicht mehr in Betracht. Auch die Feuer des gesichteten Seglers waren nicht zu sehen, das war bei diesem Seegange nicht zu verlangen, und wer wusste, wie weit der Fünfmaster entfernt gewesen. In solch einem Blitzlicht, so deutlich es auch alles erscheinen lässt, dass ein einziger Moment wie mehrere Sekunden wirkt, ist ja gar keine Entfernung zu taxieren.
»Ja, diese Yankees«, nahm Kapitän Martin wieder das Wort, »vor fünfzig Jahren wurde in der Phantasie dem letzten Segler schon die Totenglocke geläutet, heute bauen die Yankees bereits Siebenmaster — was ist denn los?!«
Er war plötzlich von dem Waffenmeister mit eisernem Griff am Arme gepackt worden.
»Da — da — haben Sie ihn gesehen?!«, stieß Georg in größter Erregung hervor, dabei nach Süden deutend.
»Wen denn?«
»Den fliegenden Holländer!«
»Ach machen Sie keinen Schnack!«
»Bei allem, was lebt — es war eine alte holländische Kogge, die ich dort ganz deutlich stehen sah, im Scheine zweier dicht aufeinander folgender Wetterblitze.«
»Einen alten holländischen Segelkasten? Das kann schon möglich sein.«
»Eine holländische Kogge aus dem 17. Jahrhundert, mit ungeheuer hohem Vorder- und Hinterkastell, wie es solch einen Schiffstyp heute im entferntesten nicht mehr gibt.«
»Ach, machen Sie keinen Schnack!«, wiederholte Kapitän Martin. »Sie haben nur eine Vision gehabt. Weil wir hier in den Gewässern sind, wo der fliegende Holländer spuken soll; daran haben Sie im Moment gedacht und da haben Sie die Erscheinung vor Ihren geistigen Augen gehabt.«
»Es tut mir leid, dass ich vom fliegenden Holländer gesprochen habe!«, entgegnete Georg ruhig, wieder ganz gefasst. »An diesen glaube ich nicht, aber dass ich eine holländische Kogge vom Typ des 17. Jahrhunderts dort im Süden ganz deutlich erblickt habe, das ist eine Tatsache, die ich mir nicht ausreden lasse.«
Mit diesen Worten verließ Georg die Kommandodrücke, gerade als die Schiffsglocke acht Glasen schlug. Mitternacht.
»He, Jungens«, wandte er sich unten an die abziehende Wache, »hat jemand auf Backbordseite, genau im Süden, noch ein anderes Schiff erblickt?«
Nein, niemand. Sie alle hatten ja nach Norden gesehen, um noch einmal den Fünfmaster zu erblicken.
Die abgelöste Wache begab sich ins Logis, bald gesellte sich auch der Mann vom Ruder bei, der also auf der Kommandobrücke gestanden.
»Hört, Jungens«, war dessen erstes Wort, »der Waffenmeister hat den fliegenden Holländer gesehen!«
Ja, man befand sich gerade in den Gewässern, in denen der fliegende Holländer kreuzen sollte.
Die gangbarste Sage über dieses Seegespenst, die aber nichts mit der Behandlung durch Richard Wagner zu tun hat, ist folgende:
In der Mitte des 17. Jahrhunderts lebte ein holländischer Kapitän Peter van Straten, ein tüchtiger Seebär, ein ganz guter Mensch, der aber an nichts glaubte, ein Freigeist, was er auch dadurch bewies, dass er seinem Dreimaster den ganz unchristlichen Namen »Hekuba« gegeben hatte — das war die Gattin des trojanischen Königs Priamus — und dass er mit Vorliebe an einem Freitag den Hafen verließ.
Jahrelang war alles gut gegangen. Da, bei seiner letzten Fahrt ließ sich van Straten verleiten, sogar an einem Karfreitag von Amsterdam abzusegeln. Die Fahrt sollte nach Ostindien gehen.
Wieder wurde er bis zum Kap der guten Hoffnung vom besten Wetter begünstigt. Da aber setzten widrige Ostwinde ein, die »Hekuba« kam nicht um das Kap herum.
Alle anderen Schiffe suchten den nächsten Hafen auf, nur van Straten wollte von so etwas nichts wissen, seinen starrköpfigen Willen durchsetzen.
Wohl zwei Wochen vergingen und Kapitän van Straten kreuzte noch immer vergebens gegen den Wind an. Bis er einen furchtbaren Schwur tat, seine Seele dem Teufel verschrieb, obgleich er doch gar nicht an ihn glaubte, oder er brauchte den Teufel ja auch gar nicht anzurufen.
»Und wenn ich auch bis in alle Ewigkeit hier kreuzen sollte, ich gebe nicht nach, als bis ich das Kap umsegelt habe!«
So rief er — da rutschte er sofort glatt um das Kap herum in den Indischen Ozean hinein; nun aber kam er erst recht nicht weiter — nun muss er hier für alle Ewigkeit kreuzen.
Das Schiff, das den fliegenden Holländer erblickt, immer in der Nacht, besonders in einer stürmischen Gewitternacht, ist rettungslos verloren. Es braucht zwar nicht mit Mann und Maus unterzugehen, aber das Schiff selbst erreicht niemals wieder seinen Heimathafen. Das ist die gangbarste Lesart dieser Sage, wie sie noch heute unter den Seeleuten zirkuliert, die auch den Namen des Bootsmannes und jedes einzelnen Matrosen kennen.
Ob man noch heutzutage an so etwas wirklich glaubt? Ja und nein.
Die Sache ist nämlich gar nicht so einfach.
Diese ganze Sage ist von Richard Wagner zwar viel romantischer behandelt worden, aber den tiefen Sinn, der dieser Sage zugrunde liegt, hat er nicht gekannt.
Denn ein wirklich tiefer, symbolischer Sinn liegt ihr zugrunde.
Es kommt dabei das in Betracht, worüber schon einmal gesprochen worden ist, und was man am besten in die guten, deutschen Worte kleiden möchte: Halt's Maul! Wenn Du ein Geheimnis weißt — sprich nicht darüber!
Nach der allgemeinen Ansicht aller sachverständigen Seeleute wird dieses Gespensterschiff nämlich niemals von allen oder von mehreren oder nur von zweien, sondern immer nur von einem einzigen Manne gesehen.
Kann dieser seinen Mund halten, dann hat die Begegnung, der gehabte Anblick gar nichts auf sich.
Sobald er aber anfängt zu »babeln« — ich habe den fliegenden Holländer gesehen! Habt Ihr ihn nicht gesehen? Dann ist das Schicksal seines Schiffes besiegelt.
Der fliegende Holländer spukt noch immer dort unten. Die heutigen Seeleute wissen noch nichts von seiner Erlösung durch eine Senta oder durch sonst etwas. Seine Erlösung soll noch einmal kommen, aber bisher ist es noch nicht geschehen.
Denn noch jeder, der ihn erblickt, hat »gebabelt«.
Es ist die Kraft der Wahrung eines Geheimnisses in innerster Brust, welche die Erlösung bewirken soll. Ein Gegenstück vom ersten Sündenfall im Paradiese.
Ja, sie glauben noch heute daran, die Seeleute; wenn auch nur in dem Sinne, wie hier geschildert, auch wenn sie es nicht weiter mit Worten definieren können. Es ist nur etwas Imaginäres, das dort unten sein Wesen treibt, der Betreffende hat nur eine Vision gehabt — aber auch hierüber muss er sein Maul halten können!
So wird noch heute jeder Schiffsjunge und jeder Mann, der seine erste Reise um das afrikanische Kap macht, von Erfahreneren belehrt. Passagiere können das Seegespenst überhaupt nicht sehen. —
»Hört, Jungens, der Waffenmeister hat den fliegenden Holländer gesehen!«
Das war das erste Wort gewesen, das Paul, der Matrose, der vom Ruder abgelöst worden, gerufen hatte, als er ins Mannschaftslogis gekommen war.
Georg saß in seiner Kabine.
Er wusste nicht, was er von alledem denken sollte. Er kannte doch die ganze Sage und alles, was damit zusammenhängt.
Und er hatte dieses alte holländische Schiff, als er zufällig einmal nach Süden geblickt, wirklich gesehen!
Ganz deutlich!
Daran war gar kein Zweifel. Zwei Blitze hatten kurz hintereinander am fernen Horizonte gezuckt, und ganz, ganz deutlich hatte er das merkwürdige Schiff mit dem holländischen Typ des 17. Jahrhunderts erblickt, mit drei rahenlosen Masten, mit außerordentlich hohem Vorder- und Hinterkastell, mit Stückpforten — eben das ganze Schiff der echte holländische Typ aus dem 17. Jahrhundert.
Man braucht gar nicht viel solche Bilder gesehen zu haben, um das doch gleich erkennen zu können; wenigstens gilt das für den Seemann. Was der in den alten Hafenstädten für Schiffsmodelle zu sehen bekommt, als Wappen überall an Haustüren und über Geschäftsläden!
Eine Vision? Ganz ausgeschlossen!
Georg konnte darauf schwören, dieses Schiff wirklich gesehen zu haben.
Oder man müsste erst einmal erklären, was das überhaupt ist, eine Vision.
Und natürlich hatte er sofort an die Sage vom fliegenden Holländer gedacht.
Und er hatte es gegen Kapitän Martin ausgesprochen.
»Ich habe den fliegenden Holländer gesehen!«
Und der Matrose Paul hatte am Ruder gestanden. Und der hatte es gehört, und dass der es nun gleich im Mannschaftslogis erzählte, das war ja ganz selbstverständlich.
Er, der Waffenmeister der Argonauten, hatte »gebabelt«. Natürlich war ja gar nichts dran an der ganzen Geschichte, aber... es war zu ärgerlich!
Ja, hatte er denn aber dieses alte holländische Schiff nicht wirklich gesehen?
Georg wusste gar nicht mehr, was er davon denken sollte, und da machte er es kurz, legte sich zur Koje und zog die Decke über die Ohren.
Seine glückliche Natur sorgte denn auch dafür, dass er schnell in tiefen Schlaf fiel, ohne dass ihm der fliegende Holländer im Traume erschienen wäre.
Als er erwachte, war seine Kabine schon von dem durch das Bullauge dringende Tageslicht erfüllt. Allerdings ein recht trübes Licht. Der Sturm hatte sich ausgetobt, es herrschte Windstille, dafür lagerte ein dicker Nebel über der nur mäßig rollenden See.
»Was war das nun heute Nacht mit der holländischen Kogge?«, war natürlich des Erwachten erster Gedanke. »Ach zum Teufel — meinetwegen kann's wirklich der fliegende Holländer gewesen sein — ich will nicht mehr daran denken.«
Mit diesem Vorsatze begab sich unser Held, dessen glücklichen Charakter wir ja schon zur Genüge kennen gelernt haben, an Deck.
So neblig war es nicht gerade, dass man wie damals nicht die Hand vor den Augen sehen konnte, jedenfalls aber doch ein ganz tüchtiger Nebel. Man befand sich im September, das hatte hier auf der südlichen Hälfte der Erdkugel Ende Winter zu bedeuten, da kommen in dieser Gegend solche Nebel häufig vor. Aus dem weißen Dunste tauchten ein Paar krumme Beine auf, erst dann, als die Säbelbeine näher marschierten, war auch der mit einem Zylinder gekrönte Oberleib zu unterscheiden. Hieraus erkannte der Sachverständige, dass der Nebel durch die Kraft der höher kommenden Sonne schon zu steigen begann.
»Ausgeschlafen, Herr Waffenmeister?«, erklang es aus der Wolke.
»Das geht Sie gar nichts an, Doktor, mindestens wäre als erste Frage viel angebrachter, ob ich schon gefrühstückt habe.«
»Sagen Sie mal, Waffenmeister — Sie wollen heute Nacht den fliegenden Holländer gesehen haben?«
»Wer hat denn das gesagt?«
»Das ganze Schiff spricht davon.«
»Das ganze Schiff soll der Teufel holen!«, rief Georg, ärgerlich, dass er sich jetzt von Doktor Isidor aufziehen lassen musste, und der hörte auch nicht so bald auf.
»Ja, da haben Sie recht, jetzt werden wir auch vom Teufel geholt. Es ist ja möglich, dass Sie den fliegenden Holländer gesehen haben, an Ihrer Glaubwürdigkeit zweifle ich ja gar nicht, aber Sie hätten Ihre Entdeckung für sich behalten sollen...«
»Da steht er!«, rief da der Verspottete mit ausgestreckter Hand.
Ja, da stand er!
Auf Backbordseite der »Argos« tauchten in dem Nebel die Umrisse eines unförmlichen Schiffes mit drei Masten auf — unförmlich nach unseren heutigen Begriffen — mit außerordentlich hohem Vorder- und Hinterteil, überhaupt von ganz plumpen Formen.
Und mit einem Male wurde der Nebel von einem frischen Winde weggefegt, und plötzlich lag es da in goldenem Sonnenlichte, was man soeben erst nur in verschleierten Umrissen gesehen hatte.
Eine alte holländische Kogge, wie der Ausdrucks nun einmal lautet, vom Typ des 17. Jahrhunderts! Er ist zu charakteristisch, als dass er verkannt werden könnte.
Dass Staunen der an Deck befindlichen Argonauten und aller derer, die jetzt hervorgestürzt kamen, lässt sich denken.
Also ihr Waffenmeister hatte nicht nur eine Vision gehabt oder hatte die anderen nicht nur »veralbern« wollen, mit seiner Behauptung heute Nacht, er habe den fliegenden Holländer oder doch ein entsprechendes Schiff aus alter Zeit gesehen.
Da lag es in Wirklichkeit vor den Augen aller!
Im Scheine der fernen Blitze wollte er es am südlichen Horizonte gesehen haben, die »Argos« hatte bei dem eintretenden Nebel einen mehr südlichen Kurs eingehalten, der Sturm hatte schnell nachgelassen, man hatte aber keine Segel gesetzt, war nicht gedampft — so lag man jetzt der vermeintlichen Vision des Waffenmeisters als einer Tatsache gegenüber, kaum eine viertel Seemeile, einen Kilometer von ihr entfernt. Ja, was sollte man nun von diesem rätselhaften Schiffe denken?
Vor allen Dingen muss betont werden, dass niemand vom fliegenden Holländer sprach. An diesen denken mochte ja wohl jeder, aber aussprechen tat es niemand, jeder hätte sich geschämt, und das war dann auch nur so eine Ideenverbindung, im Grunde seines Herzens glaubte doch niemand an solch einen Teufelsspuk, der hier auch noch den goldenen Strahlen der Morgensonne stand halten sollte.
»Well«, nahm Kapitän Martin als erster das Wort, »das ist so ein alter Kasten, der nach einem anderen Hafen überführt werden sollte, der Bugsierdampfer hat ihn heute Nacht aus dem Schlepptau verloren.«
Er sprach die Meinung aller aus, wenn auch niemand gleich daran gedacht hatte, dass hier so etwas vorliegen könnte. Auch Georg hatte nicht sofort diese Erklärung gefunden, eben weil er gar nicht nach einer solchen gesucht hatte.
Es sind ja noch einige Schiffe aus früheren Jahrhunderten erhalten geblieben, besonders auch Hansekoggen. Leider haben wir Deutschen diese historischen Andenken nicht zu würdigen gewusst. Ehe wir ihren schier unschätzbaren Wert erkannten, sind sie schon von anderer Seite aufgekauft worden, zumal von sammeleifrigen Engländern. Diese Hansekoggen liegen jetzt zum Teil im Londoner St.-Katherinen-Dock, in einem kleinen, ummauerten Bassin, einem Wassermuseum, teils sind sie in englischem Privatbesitz, bedürfen ja ab und zu einer Reparatur, aber im allgemeinen hat doch das ausgezeichnete Holz allen Jahrhunderten getrotzt.
Ja, sogar die »Pinta« existiert noch heute, eine der drei Karavellen, mit denen Kolumbus seine erste Fahrt nach dem unbekannten Westen antrat. Bis zum Jahre 1892 lag sie als spanisches Nationalheiligtum im Hafen von Valencia. Als aber nun die Amerikaner das fünfhundertjährige Jubiläum der Entdeckung ihres Landes feiern wollten, da machten die Yankees ein Angebot, dem die armen Spanier nicht widerstehen konnten, und so wanderte diese einzige Rarität nach New York hinüber.
Und bei der Fahrt über den Atlantik geschah es ebenfalls, dass der Bugsierdampfer die »Pinta« in einer stürmischen Nacht vom Schlepptau verlor.
Sie wurde am anderen Morgen gleich wieder gefunden, hatte außerdem eine starke Besatzung an Bord.
Wenn dies aber nun nicht der Fall gewesen wäre? Irgend ein Dampfer, auf dem nichts von diesem Vorgange bekannt war, sah da auf dem Meere ein uraltes Schiff treiben? Was hätte man denn da denken sollen? Und nun vielleicht konnte sich der Dampfer ihm nicht nähern, musste seine Fahrt fortsetzen, oder man hatte das rätselhafte Schiff nur im Nebel erblickt, verlor es bald wieder aus den Augen.
Fürwahr, durch solche Fälle können Sagen wie vom fliegenden Holländer und ähnliche Seegespenstergeschichten immer neue Nahrung finden.
Dies als war an Bord der »Argos« bekannt oder wurde doch, von denen, die darum wussten, erörtert, während man den alten Segelkasten betrachtete.
»Da ist keine Mannschaft drauf!«, hieß es dann zunächst.
Nein, das konnte nicht der Fall sein. Abgesehen davon, dass sich ja niemand blicken ließ. Vor allen Dingen aber rollte das Schiff ganz mächtig und auch ganz planlos, man sah, wenn es sich hinten hob, wie die Steuerpinne herumschlug. Also das Steuer wurde nicht gehalten und war nicht befestigt.
Wie kam das? Wenn solch ein als historische Rarität überaus kostbares Schiff geschleppt wird, so sind doch auch immer einige Seeleute darauf.
Nun, diese hatten den alten Kasten eben im Boote verlassen. Denn wer wusste denn, wie lange der, doch nichts anderes als ein hilfloses Wrack, schon auf hoher See trieb.
»Hei, das gibt einen Bergelohn!«, erklang es dann jauchzend als zweiter Ruf.
Denn wenn die Argonauten jetzt auch den großen Flibustierschatz an Bord hatten, es also gar nicht mehr nötig hatten — solch ein einträgliches Abenteuer war doch einmal nach ihrem Geschmack!
»Ja, wenn es keine Imitation ist!«, meinte Kapitän Martin.
Freilich, damit musste man auch rechnen. Solch alte Schiffe sind ja schon oft imitiert worden, nicht um Liebhaber solcher Raritäten zu täuschen — das ist ja gar nicht möglich, das ergibt doch sofort die Untersuchung des Holzes — sondern um ein derartiges Schiff, anscheinend aus früheren Jahrhunderten stammend, in Hafenstädten gegen Geld als Schauobjekt zu zeigen.
So wurde anfangs der neunziger Jahre ein sogenanntes Convict-Schiff gezeigt, auch in deutschen Hafenstädten, es fuhr sogar ein gutes Stück den Rhein und die Elbe hinauf. Vielleicht hat es einer oder der andere Leser besichtigt.
Ein Convict-Schiff wäre also ein Verbrecherschiff. Im Speziellen aber nannten die Engländer diejenigen Schiffe so, auf denen im 18. und auch noch im Beginne des 19. Jahrhunderts Sträflinge von England aus nach Australien deportiert wurden.
Jenes Schiff war also nur eine künstliche Nachahmung, seine Anziehungskraft auf das schaulustige Publikum bestand hauptsächlich darin, dass man in den verschiedenen Räumen Wachsfiguren aufgestellt hatte, welche die Szenen wiedergaben, die sich auf solch einem Verbrecherschiff einst abgespielt haben mögen, vor allen Dingen auch, wie die Deportierten während der Seefahrt für Vergehen bestraft wurden, wie man sie durchpeitschte, Folterszenen und dergleichen mehr. Höchst grausig anzusehen, aber trotzdem sehr interessant.
Es muss dies alles erwähnt werden, weil dieses Convict-Schiff damals gerade in Liverpool gelegen hatte, als die »Argos« dort selbst angemustert hatte, und auch diese Sehenswürdigkeit hatte die Patronin mit ihrem Volke, ihren Argonauten, besichtigt.
Daher eben kam es, dass jetzt die ganze Mannschaft über solche alte Schiffe und ihre Imitationen orientiert war, und es wird auch noch in anderer Hinsicht von größter Bedeutung werden.
Vorläufig war auch mit dem besten Fernrohr nicht zu unterscheiden, ob eine Imitation vorlag oder nicht. Einen sehr, sehr alten Eindruck machte der hölzerne Kasten ja, aber den macht auch das modernste Segelschiff, wenn es nur ein Vierteljahr unterwegs ist, ohne dass beständig seine schmucke Farbe erneuert wird. Auch dass sich die Takelage in Ordnung befand, war ganz selbstverständlich.
Die »Argos« hatte Dampf aufgemacht, hielt darauf zu. Erst wurde das Wrack einmal umfahren, vorsichtig in weitem Bogen, falls das Schlepptau noch nachschleifte. Wenn sich dieses in die Schraube des Dampfers verwickelte, konnte der sich nur selbst gleich als ein Wrack betrachten, bis ihn Taucher nach stundenlanger Arbeit wieder befreit hatten.
Hinten am Heck stand kein Name, auch nicht anderswo. Natürlich nicht. Dann ging man von Süden her mit dem Seegange noch mehr heran.
Dass der Dampfer direkt beilegte, das war bei diesem Seegange vollkommen ausgeschlossen, zumal es sich um ein steuerloses Wrack handelte, dessen Drehungen ganz unberechenbar waren. Nur in Booten konnte man sich an Bord begeben. Die fehlenden Boote waren in Pontianak, das wegen seiner vorzüglichen Teakholzboote sogar einen berühmten Namen hat, natürlich sofort ersetzt worden.
Eine Jolle wurde ausgesetzt. Georg teilte die sechs Matrosen als Rudermannschaft ab, zur Begleitung gingen Doktor Cohn, Juba Riata und Mister Tabak mit, und nicht etwa nur als Neugierige.
Denn da wäre ja gern noch manch anderer mitgegangen, vor allen Dingen auch die Patronin und Ilse, die doch auch danach brannten, dieses merkwürdige Schiff zu betreten.
Aber mit solch einem Wrack, auf dem sich kein Mensch mehr bemerkbar macht, ist es doch immer eine eigentümliche Sache. Sein Betreten kann sogar höchst gefährlich werden. Wenn man nun auf solch einem Wrack lauter Leichen findet? Etwa mit Pestbeulen bedeckt? Was dann? Dann müssen sich diejenigen, die an Bord gewesen sind, der umständlichsten Desinfektion unterwerfen. Sie dürfen aber auch gar nicht so einfach zurückkehren, das geschieht auf ganz umständliche Weise, sie werden sofort in Isolierhaft genommen. Es ist ganz grauenhaft, wenn solch ein Fall einmal eintritt, was die internationalen Seegesetze da alles vorschreiben, um die andere Welt vor einer Ansteckungsgefahr zu schützen.
Auch hierüber war zuletzt noch gesprochen worden. Natürlich ohne jede Besorgnis, ohne an solch eine Möglichkeit in Wirklichkeit zu denken. Nur weil der Schiffsarzt schon seine Anordnung wegen einer eventuellen Desinfektion der Zurückkehrenden getroffen hatte, wie es seine ihm vorgeschriebene Pflicht war, was auch vom Kapitän ins Logbuch eingetragen werden musste. Das geschieht aber in jedem Falle, wenn auf hoher See eine Mannschaft von Bord zu Bord geht, das ist eben Vorschrift.
»Georg, bleibe da, gehe nicht hinüber!«, hörte es dieser flüstern.
Erstaunt blickte er in das bleiche Antlitz der Patronin, welche die günstigste Gelegenheit, als es niemand anderes hören konnte, wahrgenommen hatte, um ihm dies zuzuflüstern.
»Weshalb denn nicht?«
Das junge Weib war plötzlich ganz fassungslos.
»Weil — weil... ich habe so eine Ahnung, als lauere dort drüben der Tod auf Dich — auf uns alle — es ist der fliegende Holländer...«
»Der fliegende Holländer? Lass Dich doch nicht auslachen!«, lachte Georg denn auch wirklich belustigt. »Und wenn er's wäre — nun gut, so werden wir ihn jetzt von seiner ewigen Verdammnis erlösen.«
»Nein, — nein — ich denke nur an eine Seuche, die dort drüben ausgebrochen sein kann...«
Schnell wurde Georg wieder ernst.
»Dich haben wohl die Vorkehrungen beunruhigt, die Doktor Cohn getroffen hat. Das geschieht aber in solch einem Falle stets, das weißt Du doch selbst, Dir fällt es nur besonders auf, weil Du durch dieses alte Schiff in besondere Gemütsstimmung gekommen bist. Nun gut, Dir als Patronin steht es ja frei, uns direkt zu verbieten, das Wrack dort zu betreten...«
»Daran denke ich nicht.«
»Dann darfst Du aber auch nicht daran denken, mich zurückhalten zu wollen. Der erste Kapitän hat die Pflicht, an Bord seines Schiffes zu bleiben, aber als zweiter Kapitän ist es ebenso meine unbedingte Pflicht, mich als erster hinüberzubegeben. Oder glaubst Du etwa, ich werde meine Jungen in irgend eine Gefahr schicken, ohne mich selbst an die Spitze zu stellen? Na, Helene, da musst Du mich unterdessen doch besser kennen gelernt haben.«
Die Patronin raffte sich auf, ihre Farbe kehrte zurück.
»Du hast recht«, lächelte sie jetzt selbst, »ich weiß selbst nicht, wie ich dazu gekommen bin, es war eine Schwäche von mir.«
Die Jolle ging ab, Georg am Steuer. In gehöriger Entfernung wurde abgestoppt. Furchtbar rollte der steuerlose, backtrogähnliche Kasten auf der hohlgehenden See. Der Eskimo schleuderte den am Seil befestigten Enterhaken, er saß sofort fest.
Georg übergab das Steuer einem Matrosen, arbeitete sich als erster an dem Seile durchs Wasser hinüber, kletterte hinüber, was einem gewandten Manne keine Gefahr bietet, während das Boot natürlich sofort zerschellt wäre. Als zweiter folgte der Eskimo, dann Juba Riata, dann wurde Doktor Isidor in der Schlinge hinübergeholt.
Ein nacktes Deck zeigte sich. Alles, was vorhanden gewesen, war abgewaschen worden. Die Bordwand sehr verschrammt, desgleichen wohl auch das Deck, aber dessen Bretter, wie beim Parkett kreuzweise zusammengelegt, zeigten doch noch die außerordentlich sorgfältige Fügung.
Georg schnipselte hier und da mit einem Messer.
»Keine Imitation! Das ist uraltes Teakholz, das im Salzwasser nur immer fester wird. Das kann ich schon jetzt erklären, noch ehe eine gelehrte Kommission mit Mikroskopen und anderen Instrumenten kommt. Das sehe ich sogar schon an dem Deck. So können wir die Decksplanken heute gar nicht mehr fügen, das haben wir über unsere Fabrikarbeit verlernt.«
»Und das Tauwerk?«
Auch dieses untersuchte Georg an einzelnen Stellen mit kundigem Blick und tastender Hand.
»Das ist freilich neu. Natürlich. Der alte Kasten ist neu aufgetakelt worden. Aber die Masten sind noch aus demselben alten Holze. Und ganz neu ist das Tauwerk auch nicht mehr. Ich kann es schon auf etliche Jahre schätzen. Nach ganz neuer Takelung müssen wir erst noch suchen, um ein Urteil zu gewinnen, wann die letzte Mannschaft das Schiff verlassen hat. Wenn wir unten nichts Schriftliches finden.«
Sie begaben sich nach dem Kajüteneingang, der sich nur an dem hohen Achterkastell befinden konnte. Die erhöhte Back diente schon damals wie noch heute der Mannschaft als Aufenthalt.
Die schwere Tür, mit schönen Schnitzereien verziert, war verschlossen. Das heißt, die merkwürdige Klinke ließ sich nicht bewegen.
Schon beriet man, wie man die Tür aufsprengen könnte, sah sich nach einem dazu passenden Instrument um, als es Juba Riata einfiel, noch einmal kräftig an der Klinke zu rütteln. Da zeigte es sich, dass es eine Art von Vexierschloss war, die Klinke konnte bedeutend gehoben werden, dann ließ sie sich niederdrücken, und durch einen kräftigen Druck wich die Tür zurück.
Erst kam ein kleiner, ganz nackter Vorraum. Wenn noch irgend etwas vorhanden gewesen wäre, nur ein Lappen an der Wand gehangen hätte, so hätte man höchstens von »leer« sprechen können. Aber er war ganz nackt. Das war geradezu auffallend.
Die nächste Tür, die sich leicht öffnen ließ, führte in einen größeren Raum, in dem es schon ganz anders aussah.
Auch er war leer, doch noch genug vorhanden, um erkennen zu lassen, was darin einst alles vorhanden gewesen, ohne dass es fortgeräumt worden war.
Alles, was hier einst drin gewesen, war einfach dem Zahne der Zeit und vielleicht auch denen der Motten und anderer Insekten zum Opfer gefallen. Der Boden war mit einer Schicht Staub bedeckt, noch waren Holzteile von Möbeln zu unterscheiden, die man freilich nicht derb anfassen durfte, sonst zerfielen sie in Holzmehl, und dann auch noch hier und da bunte Stoffetzen, besonders solche, welche einst mit echten Gold- und Silberfäden durchwirkt gewesen waren, welches Edelmetall eben unverwüstlich ist. Dies alles ließ sich noch in dem Tageslichte erkennen, das durch die beiden offenen Türen fiel; denn die Fenster und zwar hier in diesem altertümlichen Schiffe richtige, rechteckige Fenster, wenn auch nur sehr klein — waren mit Metallplatten verschlossen — natürlich, sonst wäre ja die See hereingedammt.
»Das finde ich sehr, sehr merkwürdig!«, meinte Georg.
»Was finden Sie so merkwürdig?!«, fragte Doktor Isidor.
»Dass hier alles noch so unangetastet ist.«
»Nun, man hat eben alles so gelassen, wie man das Schiff gefunden hat.«
»Wo denn gefunden?«
»Ja, das fragen Sie mich einmal!«
»Nun gut, davon abgesehen — sonst fällt hier wirklich nichts auf?«
»Nein, was denn nur?«
»Da sieht man, dass das Schachspiel doch nicht den Scharfsinn erzeugt, der für jeden einzelnen Fall nötig ist. Fragen Sie mal Juba Riata und den Eskimo, ob denen nichts auffällt. Von mir selbst will ich gar nicht sprechen.«
In der Tat, diese beiden blickten mit ganz besonderen Augen um sich, und vor allen Dingen musterten sie misstrauisch den staubbedeckten Boden.
»Wo sind denn hier die Fußspuren?«, kam es dann gleichzeitig aus ihrem Munde.
»Dieser Raum ist eben von der Besatzung nicht betreten worden!«, hatte der Arzt gleich eine Erklärung.
»Nicht betreten worden? Niemals?«, fragte Georg spöttisch.
»Später nicht mehr; wer hier zu befehlen hatte, der wollte möglichst die Ursprünglichkeit wahren, er hat die Fußspuren wieder verharkt.«
»Verharkt? Hier ist doch nicht geharkt worden.«
»Na, dann sind die erzeugten Fußspuren sonst wie wieder verwischt worden.«
»Nein, meiner Ansicht nach liegt dieser Staub so da, wie er sich im Laufe der Zeit hier angehäuft hat. Habt Ihr nicht dasselbe Gefühl?«
Ja, die beiden Naturmenschen, als welche der ehemalige Cowboy und der Eskimo doch zu bezeichnen waren, hatten ganz genau dieses selbe Gefühl; denn um ein Gefühl konnte es sich dabei doch nur handeln.
Sie hatten das Gefühl, dass hier alles, alles ganz unberührt war, wie es einst gewesen, dass noch niemand vor ihnen wieder diesen Raum betreten hatte.
Woher dieses ganz bestimmte Gefühl, das freilich konnte niemand definieren. Daher eben das Wort »Gefühl«, wobei man doch gar nichts mit dem Tastsinn fühlt. Es lag schon gewissermaßen in der Luft, die ja auch stickig genug war.
»Na, wollen wir erst mal weiter sehen, was uns der nächste Raum zeigt.«
Man hatte die Taschenlampen mitgenommen, sie wurden angezündet.
Wie aber ward den Vieren zumute, als sie die nächste Tür geöffnet hatten und ihre Lampen helles Licht verbreiteten!
Es war eine altertümliche Kajüteneinrichtung, höchst kostbar, an goldenen und silbernen Gerätschaften war kein Mangel, und man erkannte gleich, dass all diese Sachen von überall her zusammengetragen worden waren, aus aller Herren Ländern, nicht zum mindesten hatten sowohl indische Tempel, wie christliche Klöster oder Kirchen ihre Heiligtümer lassen müssen, also offenbar Piratenraub, der hier zur Ausschmückung dieser Kajüte hatte dienen müssen, und nun diese Einrichtung hier vollkommen erhalten, der persische Teppich sowohl, wie auch das zarteste Spitzengewebe.
Doch dies alles sahen die vier jetzt gar nicht. Sie sahen nur die menschliche Gestalt, die dort auf dem Diwan lag.
Ein grauenvoller Anblick!
Doch zunächst muss das Allgemeine beschrieben werden.
Es war ein Mann, gekleidet in mittelalterlicher, phantastischer Tracht, mit weiten Pumphosen vom feinsten, blauen Tuche, das spitzenbesetzte Wams von gelber Farbe, die halblangen Stiefel von rotem Leder. Um den Leib eine schwarze, gold- und silberdurchwirkte Schärpe, in der mehrere Dolche und Pistolen steckten.
Ein ungemein kräftiger, herkulisch gebauter Mann mittleren Alters, das schöne, tiefgebräunte Gesicht von blonden, halblangen Locken umrahmt, dieses schöne Gesicht aber entstellt ebenso wohl von wilden Leidenschaften, wie von Todesschmerz, wozu er auch allen Grund hatte, denn — sein Kopf war bis zur Stirn in zwei Hälften gespalten!
Und aus dieser fürchterlichen Todeswunde floss noch das rote, frische Blut herab, auf dem Diwan und auf dem Teppich große Lachen bildend.
Und daneben am Boden lag noch die mächtige Axt, ein Kriegsbeil, mit dem ihm diese Todeswunde beigebracht worden war. So lag der Mann da, halb auf der Seite, die Fäuste im letzten Todeskrampfe geballt, das schöne Gesicht verzerrt, der Mund mit den blendenden Zähnen halb geöffnet, mit furchtbarem Blicke der weit aufgerissenen Augen zur Decke empor stierend.
Ein schrecklicher Anblick! Ein Sterbender, noch nicht tot, sondern eben im letzten Todeskampfe für immer erstarrend.
Entsetzt standen die vier Männer da.
Oder vielleicht nur Doktor Cohn nicht. Oder der war doch derjenige, der zuerst Worte und auch gleich eine natürliche Erklärung fand.
»Ein Pendant zu dem Convikt-Schiff, das wir damals in Liverpool gesehen haben!
Da hat jemand so eine alte holländische Kogge irgendwo aufgetrieben, hat sie mit Wachsfiguren ausgestattet, um mit ihr als Schauobjekt von Hafen zu Hafen zu fahren, hat sie im Sturme vom Schlepptau verloren.
Offenbar wollte der geniale Unternehmer die Szene einer Meuterei darstellen. Das hier ist der Kapitän, selbst ein Pirat, wie die ganze Einrichtung erkennen lässt, dem hier in seiner Kajüte von den Matrosen im Schlafe der Kopf gespalten worden ist. Voraussichtlich werden wir noch viele andere solcher Wachsfiguren in den verschiedensten Stellungen finden; hoffen wir es wenigstens, damit unser Fund noch wertvoller wird.«
So erklärte Doktor Isidor, als wenn er dozierend an dem Katheder stände, und seine Hörer hatten nichts mehr hinzuzusetzen. Natürlich, so war es! Georg hatte zwar jenes Convikt-Schiff nicht gesehen, nichts Ähnliches, aber es war ihm genug davon erzählt worden.
So ging man jetzt an eine nähere Untersuchung dieser Wachsfigur. Die Imitation war eine überaus naturgetreue. Das Blut konnte selbstverständlich kein frisches sein, wie man zuerst geglaubt hatte. Offenbar war dabei roter Siegellack verwendet worden, den man in heißflüssigem Zustande aufgetragen hatte, daher die Bildung der Tropfen, daher klebte auch die rote Masse ganz fest auf dem Diwan, wie auf dem Teppich, wie in den Haaren, dass sie sich ohne Verletzung des Untergrundes nicht ablösen ließen.
Diese Haare des Mannes selbst waren echt, wunderbar in die Kopfhaut eingelassen, wie es wohl nur chinesische Geduld und Geschicklichkeit fertig bringt, denn die Chinesen statten ja auch ihre kostbaren Porzellangötter mit echten Menschenhaaren aus, wissen jedes einzelne Haar für sich in das Porzellan einzulassen, ebenso den Bart und die Augenwimpern, und dasselbe war auch hier der Fall. Also nicht etwa, dass man die Haare nur so an das Wachs drangeklebt hätte.
An das Wachs?
Die vier Männer, die schon eine ganz natürliche Erklärung gefunden zu haben meinten, indem sie einfach vor einer Wachsfigur standen, daher ihr erstes Grausen schon überwunden hatten, begannen von neuem ganz scheu auf die Gestalt zu blicken.
»Ist denn das wirklich nur eine Wachsfigur?«
»Der hat doch eine ganz richtige Haut!«
»Und das ist überhaupt kein Wachs!«
»Das ist ein richtiger Mensch, der sich nur im Starrkrampf befindet!«
So und ähnlich klang es flüsternd durcheinander, und diesmal schloss sich Doktor Isidor nicht aus, auch er war ganz bestürzt.
Nun sei gleich etwas erwähnt.
Die Argonauten hatten ja schon einmal einen Menschen gefunden, von dem sie lange, lange Zeit nicht gewusst hatten, ob er tot oder lebendig sei, nur im Scheintode liege.
Damals die junge Inderin in dem chinesischen Piratenneste, in der Kiste verpackt, die sich dann später als Merlins Tochter Viviana entpuppt hatte.
Nein, da hatten sie auch nicht gewusst, ob wirklich tot oder nur scheintot, sich in einem Starrkrampfe befindend.
Aber das war doch etwas ganz, ganz anderes gewesen als der hier vorliegende Fall!
Bei jener Inderin hatte man gar nicht an eine künstliche Figur gedacht, niemand war auf solch einen seltsamen Gedanken gekommen. Die Glieder waren ja auch noch beweglich gewesen, nur dass jeder Finger immer wieder in seine ursprüngliche Lage zurückschnellte. Man hatte in das Fleisch schneiden können, Doktor Isidor hatte eine Ader am Arm geöffnet, es war zwar kein Blut geflossen, wohl aber hatte sich solches herausdrücken lassen, dunkel und sehr dick, wie geronnen. Also das war ein richtiger Mensch gewesen, von dem nur der Instinkt der Hunde behauptet hatte, dass er nicht tot, dass noch erstarrtes Leben in ihm sei.
Ganz, ganz anders hier!
Dieser Mann hier war vollkommen starr. Kein Finger konnte bewegt werden, nicht das Ohrläppchen. Die steinharte Masse konnte aber auch nicht, wie Doktor Isidor bereits probierte, mit dem Messer geritzt werden.
Nun, dann war die Figur eben aus einem harten Stein oder Erz!
Nein, das war sie nicht.
Weshalb nicht, weshalb es richtiges Fleisch sein musste, das so hart präpariert worden, das freilich war schwer zu sagen.
Zunächst waren alle die Hautporen deutlich zu sehen, schon mit bloßen Augen, noch deutlicher unter dem Vergrößerungsglas, das Doktor Isidor aus der Westentasche gezogen, und er erklärte, dass es eine vollständig natürliche Hautkonstruktion sei.
Aber das war es nicht, weshalb man den so ganz bestimmten Eindruck bekam, dass es ein wirklicher Mensch sei, der hier lag, nur durch irgend ein Mittel wunderbar gehärtet. Auch diese Hautporen, die ganze Hautstruktur hätte man doch schließlich nachahmen können, auch unter der Kleidung. Ebenso wie man jedes einzelne Haar mit chinesischer Geduld einsetzen konnte, nicht nur auf dem Kopfe, als Schnurrbart und Augenwimpern, sondern überall waren die üblichen Härchen auf der Haut sichtbar. Nein, dies alles war künstlich nicht zu erreichen.
Vor allen Dingen lag es in den Augen! So starr diese auch gegen die Decke stierten — so kann nur ein lebendiger Mensch im letzten Todeskampfe blicken!
»Bei Gott, Jungens — das ist ein lebendiger Mensch!«, flüsterte Georg scheuer denn zuvor.
»Nee Waffenmeister«, entgegnete Doktor Isidor, wohl ebenfalls noch recht fassungslos, aber doch nicht mehr entsetzt, noch sein Taschenmesser probierend, »wer solch einen furchtbaren Beilhieb über den Kopf bekommen hat, der ist mausetot.«
»Aber das ist doch ein wirklicher Mensch, der einst gelebt hat!«
»Ja, das ist etwas anderes, das muss man allerdings als Tatsache annehmen. Nur jetzt tut er nicht mehr leben. Der ist gleich nach seinem Tode irgendwie einbalsamiert oder sonst wie imprägniert worden, dass sein Fleisch und alles an ihm steinhart geworden ist. Lässt sich denn nur gar nichts schneiden?«
Die Untersuchung ging weiter, die wir hier kürzer zusammenfassen.
Gewiss, es ließ sich an der Figur verschiedenes schneiden. So die Haare, auch die Fingernägel. Der Schiffsarzt, ganz gewissenhaft in seinen Untersuchungen vorgehend, verbrannte einige abgeschnittene Haare und Nägelschnipsel, beide entwickelten den spezifischen Horngeruch. Unmöglich dagegen war es, diejenige Masse zu verbrennen, durch Hitze zu zerstören, welche das eigentliche Fleisch darstellte. Sie wurde wohl angeräuchert, aber durch die Flamme sonst nicht im geringsten angegriffen.
Von dem Versuche, die Flamme der Taschenlampe auch gegen das Auge zu richten, wurde der Schiffsarzt von dem Waffenmeister in begreiflicher Scheu abgehalten.
Dass man von dem Kleiderstoffe nach Belieben abschneiden konnte, das fand man ja ganz selbstverständlich.
Eine ganz merkwürdige oder sogar unheimliche, mindestens unerklärliche Entdeckung machte man hingegen, als man den Körper umwenden wollte, um einmal mehr den Rücken zu besichtigen.
War es nicht schon sehr merkwürdig, dass dieser Körper so fest auf dem Diwan lag, obwohl das Schiff so mächtig von einer Seite auf die andere rollte? Der Mann hätte doch von dem Diwan herabfallen müssen.
Da, wie man Hand anlegte, bemerkte man, dass dieser Körper überhaupt gar nicht zu bewegen war! Er war auf dem Diwan wie angenagelt, wie festgeleimt.
Nein, er wurde wie von einer gewaltigen magnetischen Kraft festgehalten!
Das war es!
Es gelang den vier starken Männern wohl, ihn mit vereinten Kräften in die Höhe zu heben, aber dabei riss der Bezug von dem Diwan, der selbst mit den Füßen am Boden festgeschraubt war, in Fetzen ab. Und wie man nun den Körper wieder senkte, um ihm eine andere Lage zu geben, rollte er sofort wieder in seine ursprüngliche Lage zurück, klebte von neuem an, sodass man ihn auch von neuem wieder unter größter Kraftanstrengung hätte hochheben müssen.
Man ließ es bei diesem einen Versuche bewenden, den Körper herabheben oder auch nur eine andere Lage geben zu wollen; denn ein neues Grausen erfasste die vier Männer, zumal sie dabei noch andere Beobachtungen machten.
Also von dem Diwan hatte sich der kostbare Samtbezug stückweise abgelöst, die Fetzen waren an dem menschlichen Körper kleben geblieben, obgleich man diesen doch eigentlich entkleiden konnte. Der Magnetismus schien eben nur dort zu bestehen, wo der Körper auf der Unterlage ruhte oder geruht hatte. Und als der Körper nun wieder in seine alte Lage zurückrollte, zurückgezogen wurde, da wurden von derselben geheimnisvollen Kraft auch die Diwanfetzen angezogen, sie legten sich wieder an ihre alte Stelle, pressten sich fest, in einer Weise, dass dann auch nicht der geringste Riss mehr zu erkennen war.
Und dieser rätselhafte Magnetismus machte sich überall bemerkbar.
So war es kaum möglich, aus der Tuchschärpe einen Dolch oder eine Pistole zu ziehen. Die Waffe wurde von einer geheimnisvollen Kraft festgehalten. Erst durch eine größere Kraftanstrengung gelang es, dabei konnte die Schärpe auch zerreißen, aber kaum hatte man die Waffe, die sich sonst als ganz normal erwies, wieder der Schärpe genähert, als sie auch gleich von selbst an ihre alte Stelle zurückfuhr und auch die Schärpe selbst ordnete sich wieder, keiner der Risse war mehr zu erkennen.
Und ganz ebenso war es mit allen anderen Dingen in dieser Kajüte.
Die Blutlachen, also starre Massen, klebten ganz fest auf dem Diwan, wie auf dem Teppich. Sie konnten nur unter Kraftanstrengung abgenommen werden, indem auch der Diwanüberzug oder der Teppich in Stücke riss. Dasselbe galt auch von dem blutigen Beil. Nur mit der größten Kraftanstrengung konnte es aufgehoben werden, bis es dann in gewisser Höhe plötzlich seine normale Schwere annahm. Das heißt, der Zug nach unten hörte auf. Kaum aber wurde es der Stelle, wo es ursprünglich gelegen, genähert, so wurde es plötzlich förmlich zu Boden gerissen und nahm ganz genau seine alte Lage wieder an, aus der es so ohne weiteres auch nicht verrückt werden konnte.
»Hier ist Magnetismus im Spiele.«
So sprachen Georg und der Schiffsarzt. Aber wohl nur, um sich selbst zu beruhigen, um eine natürliche Erklärung zu haben, um nicht an etwas Übernatürliches, an Zauberei glauben zu müssen.
Die beiden anderen, Juba Riata und der Eskimo, waren als Naturmenschen viel scheuer, suchten nach gar keiner Erklärung und handelten hierdurch viel korrekter.
Denn eine Erklärung durch Magnetismus für diese seltsame Anziehungskraft genügte hier durchaus nicht. Im Übrigen sollten die vier Männer nicht lange solche Untersuchungen anstellen können.
Das Schiff sinkt, Waffenmeister, das Schiff sinkt!« Noch waren die vier Männer keine zehn Minuten in der Kajüte oder überhaupt an Bord gewesen, als dieser Ruf der Matrosen gedämpft an ihr Ohr drang.
Sie stürzten hinaus. Und was die Matrosen im Boot erst so spät bemerkten, weil sie das rollende Schiff immer vor Augen gehabt hatten, daher das langsame Sinken, wie sich die neigende Bordwand immer mehr den Wellenbergen näherte, nicht so konstatieren konnten, das erkannten die vier jetzt sofort.
Ja, das Schiff musste schon wenigstens einen Meter tiefer tauchen, für sie, welche den Unterschied mit einem Male erkannten, sah die Sache schon ganz gefährlich aus, und jetzt wurde diese Gefahr auch an Bord der »Argos« erkannt. Ein Kanonenschuss fiel, das Notzeichen wurde gehisst, alles schrie und winkte und semaphorierte.
Da gab es kein Zögern mehr. Das Sinken ging natürlich immer schneller und schneller, und wenn das Schiff vollends wegsackt, dann kommt das Allergefährlichste von der ganzen Sache: Der letzte Strudel, dem kein Schwimmer widerstehen kann, der auch jedes in der Nähe befindliche Boot mit in die Tiefe reißt.
Also schleunigst wieder an der Verbindungslinie durchs Wasser ins Boot geentert und mit vollen Riemen zurückgegangen! Und es war auch tatsächlich die höchste Zeit gewesen. Sie hatten kaum ein Dutzend Ruderschläge gemacht, als die Kogge abging, als verschwände sie in einer Theaterversenkung, nur dass man im Theater die wütenden Wasserberge nicht so nachmachen kann — ein tiefes Tal, in dem auch die Masten verschwanden, das Boot hatte Lust, ihnen zu folgen — —.
»Jungens, pullt für unser Leben!!«, heulte der Waffenmeister — — da kam das Wasser wieder angerollt, nicht von den Seiten, sondern von unten, wie von einer ungeheuren Quelle ausgespien, die Nussschale von Jolle wurde weit abgeschleudert — und war in Sicherheit.
Sie tanzte nach der »Argos« zurück, die zehn Insassen gingen noch einmal durchs Wasser, dann gelang es, das Boot unversehrt wieder an Bord zu bringen.
Die Zurückgekehrten berichteten.
»Das ist ja kaum glaublich!«
Eine gebräuchliche Redensart.
»Was soll man davon denken?«
»Ich wüsste eine Erklärung!«, meinte Georg.
»Nun?«
»Jene geheime Bande hat uns noch einmal eine Überraschung bereiten wollen und hat sich noch rechtzeitig überlegt, dass sie das ja nicht mehr dürfe, oder so ähnlich, da hat man die Kogge wieder verschwinden lassen. Es wäre wenigstens eine Erklärung.«
Gut, sie wurde als richtig angenommen — und man sprach nicht mehr darüber, mit keinem Wort, ohne vorherige Ausmachung. Der zurückgekehrte Schiffsarzt bekam gleicht etwas zu tun. Nachdem der Matrose Franz vorhin noch beim Aussetzen des Bootes geholfen, hatte er seinem besten Freunde endlich gestanden, dass er sich seit gestern Abend recht »mies« fühle, er habe schon die ganze Nacht nicht geschlafen, und jetzt könne er sich vor Schwäche kaum noch auf den Beinen halten.
Und als er dies gesagt, gestanden, da war er ohnmächtig zusammengebrochen. Jetzt lag er in seiner Koje, war schon wieder zu sich gekommen, erklärte, sich wieder ganz wohl zu fühlen, nur sehr schwach.
Doktor Isidor konstatierte etwas Fieber, nichts weiter. Na, so ein Krankheitsfall kann bei hundert Menschen doch einmal vorkommen. Franz würde schon bald wieder hergestellt sein.
Wohin nun?
Das war schon längst beschlossen gewesen.
Nach Kapstadt.
Wo die Argonauten ihre ersten Triumphe gefeiert hatten.
Ach, wie sie sich freuten, wieder nach Kapstadt zu kommen!
Ach, was jetzt überhaupt wieder für ein Leben an Bord herrschte.
Was sie unterdessen alles ausgeheckt und sich eingeübt hatten!
Was sie den staunenden Kapstädtern alles vormachen wollten! Und nun unabhängiger denn je zuvor, mit dem Flibustierschatz an Bord, wenn man den nun auch in bessere Sicherheit bringen würde.
Jedenfalls aber konnten sich die verschiedenen Armenkassen freuen. Und was ist es doch für ein Unterschied, ob man seine Kräfte und sein Können zum Ringen um die eigene Existenz verwendet oder sie in die Dienste der Wohltätigkeit stellt.
Ja, noch nie hatte den Argonauten der Himmel so voller Geigen gehangen, wie während dieser Fahrt nach Kapstadt.
In zwei Tagen konnte man es erreicht haben.
Wenn es nur mit dem Matrosen Franz nicht immer schlimmer geworden wäre. Es war doch nicht nur ein vorübergehendes Unwohlsein gewesen.
»Jungens«, hatte schon am Abend desselben Tages der Segelmacher im Vertrauen zu einigen anderen gesagt, »ich glaube fast, der alberne Kerl spielt uns einen bösen Streich und macht ein Sterbchen. Der bekommt eine so lange Nase, das ist immer ein böses Zeichen, da habe ich meine Erfahrungen.«
Franz bekam immer heftigere Fieberanfälle und klagte, abgesehen von größter Schwäche, über Schmerzen in den Leistengegenden. Doktor Isidor hielt es entweder für einen inneren Bruch, der noch nicht nach außen trat oder für eine Darmverschlingung, behandelte ihn darnach, wenn es da überhaupt eine besondere Behandlung gibt. Klistiere neben warmen Umschlägen. Von der trüben Sorge des Segelmachers erfuhr der Schiffsarzt nichts.
Dann aber bekam dieser noch etwas anderes zu tun.
»Was fehlt nur meinem Hörnchen?«, klagte die Patronin.
Sie hatte aus Sibirien ein Eichhörnchen mitgenommen und es gezähmt. Das reizende Tierchen wollte nichts mehr fressen, sperrte auch manchmal so lange das Maul auf.
Es kamen ja manchmal Krankheiten in der großen Menagerie vor, und Doktor Isidor hatte sich immer auch als ein ausgezeichneter Tierarzt bewiesen, freilich wohl viel mehr noch Juba Riata. Eine Seuche war noch nie ausgebrochen.
»Es wird eine bittere Mandel gefressen haben!«, meinte Doktor Isidor jetzt, nachdem er das Tierchen untersucht hatte. »Da müssen Sie überhaupt vorsichtig sein, schon drei bittere Mandeln genügen, um jedes Eichhörnchen unfehlbar sterben zu lassen, obgleich es sie gern frisst. Aber dort, wo die Mandeln reifen, gibt es auch keine Eichhörnchen.«
Am zweiten Tage in früher Morgenstunde wurde der Tafelberg gesichtet, gegen Mittag steuerte man dem Hafen von Kapstadt zu, passierte schon die Reede.
Der Waffenmeister suchte in seinem Schreibtische nach dem Polizeischein, der damals die öffentliche Vorstellung der Argonauten im Theater erlaubt hatte, als Meister Kännchen eintrat, der chinesische Koch, ganz verstört.
»Ich habe zwei Latten gefunden!«
»Zwei Latten? Was denn für Latten?«
»Zwei tote Latten.«
»Tote Latten? Was sind denn das für Dinger?«, lachte Georg, ganz in sein Suchen vertieft und daher das verstörte Gesicht des Chinesen nicht bemerkend.
Da trat auch Doktor Isidor hastig ein.
»Waffenmeister, ich habe Ihnen etwas Schreckliches mitzuteilen!«
»Was ist los?!«
»Ohne Umschweife — Franz hat die Bubonenpest!«, Ein Blick und der starke Mann stützte sich schwer auf den Schreibtisch.
»Allmächtiger Gott!«, stöhnte er.
Er brauchte nicht erst zu fragen, ob da kein Irrtum vorliegen könne, ob der Arzt seiner Sache ganz sicher sei.
Jetzt wusste er, was der Koch vorhin hatte sagen wollen. Als Chinese konnte er das R nicht aussprechen, schob dafür immer ein L ein.
Zwei tote Ratten hatte er gefunden!
Und das Eichhörnchen lag im Sterben, hatte die chronische Maulsperre!
Die tierischen Träger des Pestbazillus sind die Nagetiere, vor allen Dingen die Ratten.
Wenn unter den Ratten ein großes Sterben beginnt, dann bricht ganz sicher die Pest aus!
Bei den Nagetieren, die einzigen, bei denen diese Seuche auftritt, zeigt sich die Krankheit zuerst durch Anschwellen der Lymphdrüsen der Kiefer, was aber nicht immer mit Maulsperre verbunden zu sein braucht. Von anderen Lebewesen wird nur noch der Mensch angesteckt; denn die sogenannte Rinderpest ist wieder etwas ganz anderes. Beim Menschen schwellen zuerst die Lymphdrüsen der Leistengegend an, also am Unterleib.
»Sie sind über Nacht plötzlich faustgroß geworden, und schon zeigen sich auch Beulen hinter den Ohren und im Nacken — es ist die echte Pest!«
»Allmächtiger Gott!«, stöhnte Georg nochmals. »Weiß es schon der Kapitän?«
»Sie sind der erste, dem ich es mitteile, weil ich gerade an Ihrer Kabine vorbeikam und Sie darin wusste.«
Sie erfuhren es sofort alle, und zwischen den Hauptpersonen fand augenblicklich eine Beratung statt, während das Schiff schon seine Fahrt stoppte.
Ob Kapstadt anlaufen oder nicht, das heißt, ob sich in Quarantäne begeben oder nicht.
Für die Pest, wie für jede andere ansteckende Krankheit, die epidemisch als Seuche um sich greifen kann, Cholera, Pocken, Aussatz, Genickstarre und dergleichen, hat jeder Hafen seine eigene Quarantänezeit.
Bei der echten Bubonenpest, wie sie hier vorlag, ist sie nach internationalen Bestimmungen nirgends unter zwei Wochen, in den englisch-indischen und chinesischen Häfen wird sie auf vier Wochen ausgedehnt, in Kapstadt beträgt sie drei Wochen.
Das Schiff, auf dem ein einziger Pestfall vorgekommen ist, wird an einer einsamen Küstenstelle isoliert, hier steht es unter ständiger Aufsicht der Sanitätsbehörde, bis der erkrankte Mann entweder gestorben ist oder für geheilt erklärt wird. Dann wird das ganze Schiff gründlich desinfiziert, und dann erst beginnt die eigentliche Quarantäne, die für die englische Kolonie also drei Wochen währt. Erkrankt während dieser Zeit kein Mann an der Pest, dann ist die Sache eben all right, nach nochmaliger Desinfektion ist das Schiff wieder koscher und kann fahren, wohin es will. Erkrankt aber während dieser Zeit wieder ein Mann an der Pest, dann fängt die Geschichte eben wieder von vorne an, entweder wieder Tod oder Heilung, und dann immer wieder drei Wochen Quarantäne, jedenfalls nicht unter zwei Wochen.
Das ist die Pest!
Das ist Quarantäne!
Was daraus unter Umständen werden kann, vermag sich wohl jeder selbst vorzustellen.
Unter solchen Umständen kann es passieren, dass ein Schiff gar nicht wieder den Quarantäneplatz verlassen darf, natürlich auch niemand von der Mannschaft oder den Passagieren, bis der letzte Mensch alt wie Methusalem an der Pest gestorben ist, das Schiff verbrannt oder versenkt worden ist.
Solche Fälle sind tatsächlich schon vorgekommen, wenn auch hierbei der liebe Gott dafür sorgt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Einmal erlischt die Seuche ja doch, die Menschen in ihrer Atmosphäre sind ganz immun gegen jede Ansteckungsgefahr geworden. Aber Jahre dauert so etwas oft. Aber nun braucht sich ein Schiff ja überhaupt gar nicht in Quarantäne zu begeben, das heißt, es braucht ja keinen Hafen anzulaufen. Das Erlöschen der Pest kann auf hoher See abgewartet werden. Wann dies geschehen ist, kann jeder darin erfahrene Mensch beurteilen. Die erfolgte Ansteckung äußert sich innerhalb von zwei bis spätestens sieben Tagen durch Schwäche und Fieber, und hat dann niemand mehr Schmerzen in der Leistengegend, so darf die Pest als erloschen betrachtet werden. Dann freilich hat das Schiff in irgend einem Hafen immer noch eine zwei- bis vierwöchentliche Quarantäne durchzumachen, eben eine Garantie zu bieten, dass kein Pestfall mehr vorkommt, aber hiermit ist dann die Sache doch auch abgetan.
Und den Hafenbehörden ist es natürlich äußerst angenehm, wenn ein Pestschiff lieber draußen auf hoher See bleibt; denn diese Quarantänebeamten, die dazu kommandiert sind oder wohl immer freiwillig sich gemeldet haben, haben doch nichts zu lachen, die stehen doch natürlich selbst unter Quarantäne, im Pestverdachte, wenn sie nicht selbst mit Beulen bedeckt elend sterben. Die kommen doch mit der anderen Welt gar nicht mehr in Berührung. Und auf welche komplizierte Weise nun die Nahrungsmittel und alle anderen Sachen herbeigeschafft werden müssen — ach, es ist ein Elend, diese ganze Pestgeschichte, ihre Handhabung so verwickelt, dass es unmöglich auch nur einigermaßen hier wiedergegeben werden kann! Dieses Erlöschen der Pest auf hoher See abzuwarten, wenn es der Proviant und alles andere gestattet, das kann natürlich nur ein freies Schiff, mit dem Eigentümer an Bord. Eine Reederei will doch ihr Schiff nicht so planlos draußen herumgondeln lassen.
Die »Argos« war solch ein freies Schiff.
Es war keine Beratung, die stattfand, sondern nur eine Beschlussfassung; denn jeder einzelne Matrose musste befragt werden, ob er nicht lieber an Land in Quarantäne gehen wolle.
Nein, dazu hatte niemand Lust.
So wendete die »Argos«, um wieder in offene See zu gehen.
Gleichzeitig aber musste eine Pflicht erfüllt werden — eine schwarze Flagge mit rotem Kreuze wurde gehisst, die Pestflagge — »hütet Euch vor uns, wir haben den schwarzen Tod an Bord!« —
Wir kennen noch kein Mittel gegen die Pest.
Es ist gelungen, Pferde, sonst gegen Pest ganz unempfindlich, künstlich an der Pest erkranken zu lassen, wieder immun zu machen — aber das aus der Lymphe dieser Tiere hergestellte Serum hat sich als wirkungslos erwiesen, und so sind alle anderen Versuche bisher gescheitert.
Der Kampf gegen die Pest besteht nur darin, dass man die Erkrankten und alle, die mit ihnen in Berührung gekommen sind oder sein können, möglichst isoliert, dass auf peinlichste Sauberkeit gehalten wird.
Aber eine ganz, ganz merkwürdige Beobachtung hat man gemacht; nämlich dass alle Leute, die viel mit Öl und Fett zu tun haben, gegen die Pest vollständig gefeit zu sein scheinen: Arbeiter in Ölpressereien, in Schweineschlächtereien, in Talgsiedereien, besonders auch die Besatzungen von Walfischjägern, welche den Tran gleich an Bord oder Land auskochen.
Wohl kommen unter solchen Leuten bei Epidemien auch Pesterkrankungen vor, aber es bleibt immer nur beim ersten Stadium, nur die Drüsen der Leistengegend schwellen an, brechen auf und heilen wieder — der Pestfall ist überwunden.
Da glaubte man ein Mittel gegen die Pest gefunden zu haben. Man setzte die Erkrankten oder Pestverdächtigen in Öl- und Fettbäder, auch alle anderen, die es sich leisten konnten, nahmen täglich solche, rieben sich ständig mit Fett oder Öl ein.
Es hat alles nichts genützt. Und wer auch wochenlang bis an den Hals in Öl oder Fett saß, bei dem konnte doch plötzlich die Pest ausbrechen, er starb daran.
Da glaubte man, dass es ganz frisch ausgepresstes Öl, respektive ausgekochtes Fett sein müsse, welches diese Eigenschaft besitze.
Es war wieder eine falsche Kalkulation. Die Menschen starben auch in den frischen Ölbädern nach wie vor. Dies alles ist schon im 14. Jahrhundert erkannt und erprobt worden, als zum Beispiel in den Jahren 1348 bis 1350, also innerhalb von drei Jahren, allein in Europa, wie genau berechnet werden kann, mindestens 25 Millionen Menschen von der Pest dahingerafft worden sind, ums Jahr 1860 wurden diese Versuche noch einmal ganz intensiv wiederholt, man fängt auch jetzt immer noch einmal damit an und muss doch immer wieder zu der Überzeugung kommen, dass Öle und Fette, äußerlich oder innerlich verwendet, keine Heilkraft gegen die Bubonenpest besitzen.
Dabei aber bleibt die Tatsache bestehen, dass alle Menschen, die viel mit Öl und Fett zu tun haben, gegen die Pest geschützt sind. Die Krankheit kann bei ihnen wohl auch ausbrechen, aber sie sterben niemals daran.
Wie kommt das? Was liegt hier für ein Rätsel vor?! Nun, es lässt sich schon erklären.
Es genügt eben nicht, sich zu Zeiten der Gefahr in ein Öl- oder Fettbad zu setzen. Es handelt sich dabei um eine ganze Fettatmosphäre, denen sich der Mensch schon vorher lange, lange Zeit ausgesetzt hat, sie ständig eingeatmet hat. Solch ein Arbeiter stinkt doch schon einige Knoten weit nach Öl und Fett, er kann sich waschen wie er will, er wird diesen Duft nicht los, er ist eben durch und durch von Fett imprägniert.
Und darauf kommt es zweifellos an. Und außerdem muss es ganz frisches Öl und Fett sein, aus Pflanzen und Tieren direkt hergestellt, mit dem man seinen Körper vollsaugen lässt, sonst hat es auch keinen Zweck; denn es gibt ja viele wilde Völkerschaften, die ihren Körper ständig mit Fett einsalben. Es bildet kein Schutzmittel gegen die Pest. Nur Menschen, die ständig in Ölpressereien und Fettsiedereien arbeiten, die Fettatmosphäre gleich einatmen, sind gefeit. Also ein Mittel gibt es doch, um sich gegen den schwarzen Tod zu schützen. Befindet man sich in solch einem reizenden Lande und die Pest meldet sich an, so etabliert man schnellstens eine Ölpresserei oder Talgsiederei, im Großen oder im Kleinen; oder man geht als Arbeiter in solch eine Fabrik.
Ironisch gesprochen!
Das ist doch gar nicht durchführbar.
Abgesehen davon, dass es erst längere Zeit bedarf, um seinen ganzen Körper durch Lungeninhalation so voll Fett zu pumpen.
Also es gibt noch kein Heilmittel und kein Schutzmittel gegen die Rattenpest. —
»Wir gehen auf die Walfischjagd, werden Trankocher!«
Nicht nur einer hatte diesen Vorschlag gemacht.
Die anderen aber, die nicht selbst gleich daran gedacht, wussten doch, weshalb dieser Vorschlag gemacht worden, sie alle waren welterfahrene Seeleute, und er wurde einstimmig angenommen.
Es ging nach Südosten, nach den Kergueleninseln zu. Dort gibt es noch Walfische genug, Potwale; weil diese so wenig gejagt werden, weil ihre Jagd so außerordentlich gefährlich ist, wie schon früher einmal ausführlich geschildert wurde.
Diese Gefahr fürchteten die Argonauten nicht. In jenem sibirischen Tale waren zwei vortreffliche Walfischboote gebaut worden, Proviant war noch für ein halbes Jahr vorhanden, das Heizmaterial wurde möglichst gespart.
Vierzehn Tage später. Wieder saß der Waffenmeister der Argonauten in seiner Kabine am Schreibtisch, diesmal aber untätig, hatte den Kopf in die Hände gestützt und brütete vor sich hin.
Durch das runde Fensterchen hätte er einen herrlichen Anblick gehabt.
Es war eine mondlose Nacht, aber fast taghell erleuchtet durch ein prachtvolles Polarlicht, das in allen Farben im mächtigen Bogen am südlichen Horizonte zuckte.
Es beleuchtete zwei gewaltige Eisberge von den bizarrsten Formen, und zwischen diesen tummelte sich eine große Herde Walfische, überall spritzten die Wasserstrahlen wie Fontänen empor.
Es waren die ersten Wale, die man erblickte. Aber die »Argos« setzte kein Boot zur Jagd aus.
Viel, viel hatte sich in diesen vierzehn Tagen an Bord geändert!
Der Matrose Franz war gestorben.
Dann war der schwarze Simson darangekommen. Dann die Mama Bombe. Und heute hatte man die irdischen Reste des Kapitän Martin dem Meere überliefert!
Der Waffenmeister der Argonauten war jetzt erster Kapitän des Schiffes.
Aber er verfügte kaum noch über ein Drittel der vorhandenen Hände. Die beiden anderen Drittel rangen mit dem schwarzen Tode.
Nein, es hatte keinen Zweck mehr, Walfische zu jagen, um an Bord des Schiffes eine Tranatmosphäre zu verbreiten. Der schwarze Tod war schneller gewesen.
Georg beobachtete gar nicht die wunderbare Szenerie dort draußen.
»Mein Gott, mein Gott, was soll daraus noch werden?!«, stöhnte er jetzt. »Herr, mach ein Ende mit diesem Jammer.«
Das Tischtelefon klingelte. Mechanisch griff er danach.
»Hier Waffenmeister. Wer dort?«
»Hier Doktor Cohn. Herr Kapitän, ich habe Ihnen eine böse Meldung zu machen.«
»Wer ist wieder gestorben?«
»Niemand. Ilse ist ergriffen worden.«
Georg ließ das Telefon einfach fallen.
Auch das noch!
Er ging nicht hin, wollte nicht Zeuge des Jammerns von Helene werden.
Ja, wenn er das Kind durch sein Herzblut hätte retten können!
Er hätte es auch tropfenweise für jeden der Schiffsjungen hingegeben, die jetzt mit dem schwarzen Tode rangen, für jeden anderen.
»Ilse, meine kleine Ilse!«, weinte der starke Mann leise in seine Hände hinein.
Wieder schrillte das Telefon, diesmal aber das an der Wand hängende.
Sofort erhob sich Georg. Er war der Kapitän des Schiffes, der nur weinen durfte, wenn er Zeit dazu hatte.
Da, wie er aufstand, bekam er plötzlich wie einen Schlag in die Kniekehlen, dass er wieder auf den Stuhl sank, eine furchtbare Schwäche bemächtigte sich seiner.
»Das ist die Pest, auch ich bin infiziert!«, flüsterte er. »Wohl mir, so werde ich nicht der letzte sein, der diese Tragödie überleben muss.«
Er überwand diese erste Schwäche, stand auf und ging festen Schrittes nach dem Telefon.
»Hier Waffenmeister. Wer dort?«
»Schwester Anna.«
Jäh zuckte Georg zusammen. Er dachte an seinen Schwur — und dachte auch nicht daran. Jetzt hätte er sofort den Hörer anhängen und zurücktreten sollen — und tat es nicht.
»Was willst Du?«
»Euch von der Pest befreien.«
»Tue es.«
»Wir dürfen uns nicht in das Schicksal der Menschen einmischen, sonst gebe es ja keine Pest und manch anderes auf dieser Erde nicht mehr.«
»Uns aber kannst Du erretten?«
»Ja, durch Dich.«
»Tue es.«
»Du brichst Deinen Schwur.«
»Wie Du Dein mir durch Merlin gegebenes Ehrenwort.«
»Es gibt noch Heiligeres als ein Ehrenwort.«
»Und als einen Schwur. Ich weiß es. In den letzten Tagen ist es mir zum Bewusstsein gekommen.«
»Ich kann Euch retten. Keiner der Erkrankten soll sterben, sie alle sollen wieder gesunden.«
»Ich glaube es.«
»Hältst Du uns für fähig, dass wir Euch die Pest erst geschickt haben, um Dich uns gefügig zu machen?«
»Nein, dazu halte ich Euch nicht für fähig.«
»Trotzdem stellen wir jetzt Bedingungen.«
»Nenne sie.«
»Wir fordern Dein Herzblut von Dir!«
»Nimm es.«
»Du bist jetzt Kapitän dieses Schiffes?«
»Ja.«
»Nur allein Dein Befehl gilt?«
»Nur er allein.«
»Auch die Patronin ordnet sich Deinem Willen unter?«
»Bedingungslos.«
»Und Du sollst Deinen Willen fernerhin dem unseren unterordnen.«
Wieder zuckte Georg zusammen.
»Das ist die Bedingung, zu welcher Du uns von der Pest befreien willst?«
»Ja. Du bist dazu bestimmt, einer der unserigen zu werden, und jetzt ist die Zeit gekommen, da sich Dein Schicksal erfüllt. Glaube es mir und zögere nicht.«
»Ich zögere nicht.«
»Wir fordern von Dir bedingungslosen Gehorsam.«
»Auf wie lange Zeit?«
»Für immer.«
»Ich gelobe ihn.«
»Unser Kommando ist sanft und unsere Befehle sind leicht —«
»Ich gelobe unbedingten Gehorsam für alle Zeit!«
»Gut. So bekräftige das Versprechen Deines unbedingten Gehorsams durch Dein Herzblut. Nimm ein Stück Papier und eine neue Feder, ritze Deinen Arm blutig und schreibe mit dem Blute Deinen Namen auf das Papier. Nichts weiter. Dann wirf das Papier durch das Bullauge ins Meer. Es ist nur eine Formalität, aber sie muss sein, ist uns vorgeschrieben. Tue das, das Weitere wirst Du dann erfahren.«
In der Kajüte saß die Patronin mit gefalteten Händen und sah mit starren Augen zu, wie sich Doktor Isidor mit der kleinen Ilse beschäftigte, die vor zehn Minuten plötzlich kraftlos zusammengebrochen war.
Zu jammern und die Hände zu ringen, dazu war Helene nicht mehr fähig.
Da trat Georg ein, festen Schrittes, und so aschfarben auch sein sonst so gesundes, gebräuntes Gesicht war, leuchtete darin wie auch in den Augen doch etwas Wunderbares.
Den linken Ärmel hatte er samt Hemd hochgestreifelt und die rechte Hand auf den Arm gepresst, etwas oberhalb der Pulsader, und unter dieser Hand rieselte es rot hervor, sein ganzer Weg war mit Blutstropfen gezeichnet.
Kaum sah die Patronin ihn und das Blut, als sie emporsprang, einen gellenden Schrei ausstieß und schwer zu Boden schlug.

Kaum sah die Patronin den Waffenmeister, von dessen Arm
das Blut wie ein Bächlein herabrann, als sie emporsprang,
einen gellenden Schrei ausstieß und schwer zu Boden schlug.
Doktor Isidor, sich über die bewusstlos auf dem Sofa liegende Ilse beugend, wusste wohl, dass der Waffenmeister eingetreten war, hatte aber nochnicht nach ihm gesehen, warf jetzt nur einen Blick nach der zu Boden Gestürzten.
»Bums — wieder eine — jetzt fängt die auch noch an. Waffenmeister und Kapitän, stellen Sie mich lieber vor den Feuern an — was ich hier als Arzt zu leisten habe, das geht über meine Kraft.«
Jetzt erst blickte er ihn an.
»Mensch, wie sehen Sie denn aus?! Jetzt sind Sie auch schon — —. Sie bluten ja? Was haben Sie gemacht?«
Georg nahm die rechte Hand vom Arm, aus dem ziemlich tiefen Schnitt sprang das helle Arterienblut im Takte des Pulsschlags ziemlich hoch empor.
»Schnell ein Glas her — oder irgend ein anderes reines Gefäß — fangen Sie mein Blut auf!«
Verständnislos blickte der Arzt den Sprecher an, der wieder die Blutung durch Aufpressen der Hand zu hemmen suchte, bis er sich aufraffte.
»Sie haben sich eine Arterie verletzt! Schnell Ihren Arm unterbinden — —«
»Nein, nichts wird unterbunden! Ein Glas her, fangen Sie mein Blut auf! Und dann nehmen Sie eine kleine Spritze, so eine Morphiumspritze, Sie spritzen mein Blut jedem Erkrankten in die Adern — irgend wohin — und er ist gerettet, wird gesunden —«
Wieder blickte der Arzt den hastig Sprechenden ganz unsicher an.
»Weshalb denn das? Sie denken doch nicht etwa, Sie wären immun gegen die Pest, Ihr Blut wirke als Heilserum —?«
»Jawohl, das ist es, das ist es, jetzt haben Sie's erfasst!«, jubelte da plötzlich Georg mit lachendem Munde auf. »Mein Herzblut, das ist das Allheilmittel für meine Jungen, für die Argonauten! Aber nun schnell doch — Mensch, wollen Sie gleich gehorchen?! Soll ich mich hier umsonst verbluten?! Oder denken Sie etwa, ich bin wahnsinnig, dass Sie auch gegen mich als Kapitän die Leute hetzen können? Soll ich Ihnen beweisen, dass ich nicht wahnsinnig bin? Soll ich Sie beim Kragen nehmen und mit Ihrem Kopfe dort durch die Wand fahren? Schnell, mein Blut aufgefangen und dann losgespritzt, immer wieder mit frischem Blute!«
Ja, Doktor Isidor war vollkommen davon überzeugt, dass der Waffenmeister plötzlich übergeschnappt war. Aber auf jene eigentümliche Beweisführung für ganz gesunde Vernunft wollte er es doch lieber nicht ankommen lassen. Er gehorchte. Das sonst so dreiste Männlein war plötzlich ganz eingeschüchtert. Denn so hatte er den Waffenmeister noch nie gesehen. Das Furchtbare, das in ihm lag, war gar nicht zu definieren, zumal er ja dabei doch so jubelnd lachte.
Also Doktor Isidor nahm gehorsam das Weinglas, das auf dem Tische stand.
»Ist das auch rein?«
»Ganz rein.«
»Das riecht doch nach Schnaps — genau so wie Sie selber!«
»Da war ganz reiner französischer Kognak drin.«
»Ein reines Glas, ein wirklich reines Glas!«, lachte Georg noch immer. »Das Blut darf nicht direkt entnommen werden, es muss erst in einem reinen Gefäße aufgefangen werden, so lautete der Befehl.«
»Was für ein Befehl? Wer hat ihn gegeben?«
»Mensch, wollen Sie nun gleich gehorchen?!«, donnerte ihn der Waffenmeister jetzt noch in ganz anderer Weise an. »Noch solch eine Frage und meine Faust schmettert Sie zu Boden!«
Zum zweiten oder gar dritten Male ließ sich Doktor Isidor nicht ermahnen. Ein Wandschrank enthielt Gläser genug, es wurde ausgewischt, Georg ließ es aus dem roten Lebensquell halb voll laufen, dann wieder die Hand auf den Schnitt pressend.
»So, nun wollen wir sehen, wie weit wir damit kommen, sonst gibt's neues. Wenn es auch etwas gerinnt, das schadet nichts, wenn es sich nur eben noch spritzen lässt. Nur unterbinden darf ich die Quelle nicht, sie muss fließen, immer fließen. Na, wo haben Sie nun Ihre Klistierspritze?!«
Der Schiffsarzt rannte nach seiner Kabine, Georg ihm gleich nach, betrachtete misstrauisch die gewaltige Spritze, die Doktor Isidor von der Wand genommen hatte und ihm präsentierte.
»Was ist denn das?«
»Eine Klysopompe.«
»Bombe?«
»Auch Klistierspritze genannt.«
»Kann man denn mit der eine Flüssigkeit unter die Haut spritzen?«
»Nee, unter de Haut nich —«
»Mensch, verstehen Sie mich denn nur gar nicht? So eine kleine Morphiumspritze meine ich!«
Doktor Isidor brachte ein Spritzchen zum Vorschein, mit dem sich Georg zufrieden erklärte.
»Wer von den Erkrankten hat es nun am nötigsten?«
»Auch die Patronin ist infiziert —«
»Ach, die ist ja eben erst umgefallen! Auch Ilse nicht! Wer ist dem Tode am nächsten? Wo ist er untergebracht —?«
»Jimmy lag vorhin schon im Sterben, als mich die Patronin rief —«
»Zu ihm, zu ihm!!«
Sie eilten nach dem Lazarett, Georg den Arzt immer vor sich lassend, ihm auf die Hacken tretend, damit er ihm nicht etwa entwischte.
Und da hatte er auch ganz recht, Doktor Isidor wäre dem irrsinnig gewordenen Waffenmeister und Kapitän nur gar zu gern entwischt. In dem kleinen Lazarett war nur ein Sechstel der definitiv Erkrankten, bei denen die Pest schon vollkommen ausgebrochen, untergebracht, darunter auch Jimmy, der schwarze Küchenjunge, wenn auch nunmehr schon ein Jüngling.
Wir wollen das Aussehen solch eines Menschen, bei dem sich die Bubonenpest voll und ganz bemerkbar macht, nicht beschreiben. Und nun diese Atmosphäre! Und da hilft keine Saugluft und keine Desinfektion, kein Parfüm.
»Nun los, spritzen Sie, irgend wohin, nur eine gute Dosis! Nehmen Sie die Spritze ganz voll. Ich habe noch Blut genug im Leibe.«
»Der ist schon tot.«
»Spritzen Sie!«
»Bei dem hilft nichts mehr, der ist tot wie eine gebratene Ratte.«
»Spritzen Sie, Mensch, spritzen Sie!«
Doktor Isidor spritzte gehorsam.
»Da, haben Sie gesehen, wie er zuckte, als Sie die Spitze einschoben?!«, frohlockte Georg. »Und wenn auch seine Seele schon entflohen wäre, sie müsste zurückkehren, kraft meines Herzblutes, das ich ihm zum Opfer bringe!«
Von einem Zusammenzucken hatte Doktor Isidor absolut nichts gemerkt, wohl aber, dass der Waffenmeister wirklich übergeschnappt war. Wie hätte er sonst so sprechen können.
Im Laufe von ungefähr zwei Stunden bekamen sämtliche Erkrankte ihre Einspritzung. Wenn das Glas mit Blut leer war oder dieses zu dick wurde, ließ Georg aus seiner Wunde frisches hineinlaufen, diese dann immer nur durch einfaches Aufpressen der Hand verschließend, so weit es möglich war. Etwas sickerte ja immer hervor.
Erst ganz zuletzt waren Ilse und dann die Patronin daran gekommen.
»Sind alle Erkrankten geimpft? Dann die anderen zusammentreten!«
Napoleon, der erste Bootsmann, ließ seine Pfeife trillern.
Eigentlich hätte jetzt August der Starke Wache haben müssen, aber der konnte nicht mehr pfeifen, oder es war doch das letzte Loch, auf dem er pfiff. Der arme Kerl gehörte mit zu den bevorzugtesten Todeskandidaten.
Die Wache trat an, so weit sie noch wachfähig war. Kaum noch dreißig Mann und Jungen.
Jeder bekam seine Einspritzung mit dem Herzblute seines Waffenmeisters.
Es wurden dabei recht eigentümliche Gesichter gemacht, sie blinzelten hinter Georgs Rücken einander zu, besonders Oskar tat sich hierin hervor, tippte sich vor die Stirn und machte dann wieder beruhigende Bewegungen, und dann fehlte es natürlich auch nicht an humoristischen Bemerkungen, an blutigen Witzen.
Denn ohne das — es muss immer wieder bemerkt werden — geht es bei Seeleuten, bei deutschen Seeleuten nun einmal nicht ab, und wenn auch das ganze Schiff voll Pulver gefüllt ist und der plötzlich irrsinnig gewordene Kapitän steht im Begriff, mit der Pistole hineinzuschießen — well, dann fliegt man noch mit Hohn und Spott in die Luft.
»Mir bitte eine doppelte Portion, vorausgesetzt, dass sie nischt kostet!«, war die letzte solcher Bemerkungen, die Klothilde machte, als sie ihren vollen, kräftigen Schokoladenarm hinstreckte. »Von der Pest merke ich zwar nichts, aber eine kleine Blutauffrischung kann mir nichts schaden, sonst degeneriere ich immer mehr.«
»Sind alle Gesunden angetreten? Fehlt noch jemand?«
Nach einem gewissen System konnte das leicht konstatiert werden, ohne dass jeder einzelne ausgerufen wurde.
»Mister Tabak fehlt.«
»Wo ist er?«
»In seiner Kabine, wird schlafen.«
Georg ließ ihn nicht holen, sondern begab sich gleich selbst hin, den Arzt mitnehmend.
Ja, in seiner Kabine befand sich der Eskimo, aber nicht schlafend, sondern er saß unter der elektrischen Lampe am Tischchen und säbelte von einer mächtigen Speckseite lange Streifen ab, sie verschlingend, früh um zwei zum ersten Frühstück.
»Lassen Sie sich impfen.«
»Wat?«
»Sie sollen eine Einspritzung mit einem Heilserum bekommen.«
»Wozu denn?«
»Gegen die Pest.«
»Ich habe keine Pest.«
»Aber können sie bekommen.«
»Ich? Lassen Sie sich doch nicht auslachen, Waffenmeister! Ich bin doch keine Memme, die so eine Kinderkrankheit bekommt.«
»Er hat recht«, nahm Doktor Isidor selbst für den Eskimo Partei, »dass ständiger Trangenuss gegen die Pest immun macht, ist erwiesen, und danach könnte eine Trantonne ebenso gut die Pest bekommen wie Mister Tabak.«
»Lassen Sie sich impfen!«, bestand Georg auf seinem Willen.
»Nee.«
»Ich werde Sie dazu zwingen!«
»Mich? Probieren Sie's mal.«
Und der Eskimo setzte sich schon in Positur.
»Was? Sie wollen sich wohl zur Wehr setzen?«
»Dachten Sie etwa nicht?«
»Ich bin der Kapitän!«
»Aber meiner nicht. Sie haben mir gar nichts zu be...«
Da stand der Waffenmeister mit Gedankenschnelle schon vor ihm, hatte das Handgelenk mit dem berühmten langen Messer gepackt, mit der anderen Faust die Brust — so hob er ihn vom Stuhle, warf ihn zu Boden und kniete auf ihm, des in Strömen fließenden Blutes nicht achtend.
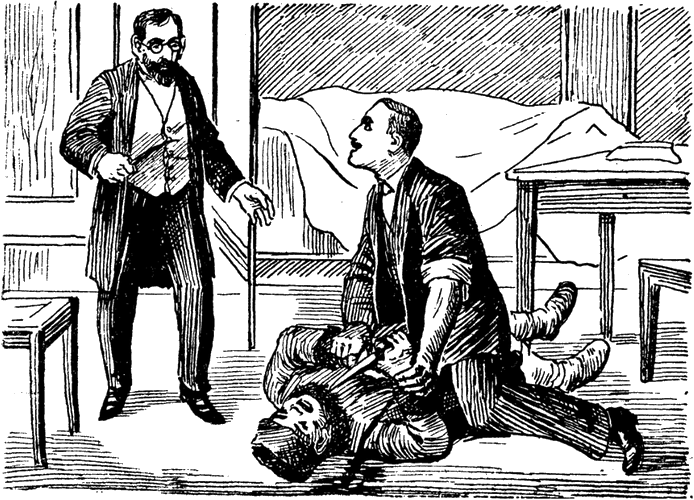
»Schiffsarzt, impfen Sie ihn.«
Doktor Isidor gehorchte, gab dem Eskimo eine Einspritzung ins Handgelenk.
Der hielt ganz still, hatte sein Froschmaul weit aufgerissen, in dem er noch eine gute Portion ungekauten Speck zeigte. So starrte er den aus ihm Knienden an.
»Fertig.« Georg erhob sich und trat zurück, wieder die Hand auf die blutende Wunde pressend.
»Stehen Sie auf! Erkennen Sie an, dass ich als Kapitän dieses Schiffes das Recht habe, Sie vom Schiffsarzte impfen zu lassen?«
Langsam erhob sich der Eskimo, klappte sein Maul zu, schluckte den letzten Speck hinter und dann war er klar zur Antwort.
»Ja, Käpten, ja — haben recht, ganz recht — der Käpten kann impfen, wen er will — und wenn's auch die Königin von England ist — ob se will oder nich. I beg your pardon.«
Sprach's gelassen, hob sein Messer auf, setzte sich wieder und frühstückte weiter. Und auch sonst konnte Georg ruhig gehen. Dieser Eskimo hätte ihm sofort das Messer in den Leib rennen können — später tat er es nicht mehr. Nachträglich war der nicht.
»Das war also der letzte gewesen!«, sagte draußen auf dem Korridore Georg zu dem Arzte.
»Ja, ich glaube.«
»Ach so — Sie selbst noch.«
»Ich? Hm.«
Da legte ihm der Waffenmeister die Hand auf die Schulter. »Wissen Sie, Doktor — Sie sind von Alkohol so durchseucht, dass Ihnen doch keine Seuche mehr etwas anhaben kann — die Pestbazillen würden in Ihrem Blute doch nur besoffen — und überhaupt, um Sie wäre es nicht schade, wenn —«
Weiter kam der Sprecher nicht. Er taumelte und schlug schwer zu Boden. Zehn Liter Blut ungefähr hat der normale Mensch in seinen Adern, zwei Liter soll er davon verlieren können, ehe er umfällt, und Georgs Experiment hatte sicher ganz bedeutend mehr gekostet.
J etzt unterband Doktor Isidor schnellstens den Arm, aus dessen Handgelenk, wenn auch nicht gerade aus der Pulsader, das warme Lebensblut noch immer ungehindert rieselte; der Eskimo, der den schweren Fall vor seiner Tür gehört hatte, war schon herausgekommen und war ihm dabei mit kundiger Hand behilflich.
»Was ist eigentlich mit dem Käpten los?«, fragte letzterer, als er den Knebel andrehte.
»Ja, mein lieber Kabat, das ist ein böser Fall! Wenn hier unser Freund wieder zur Besinnung kommt, dürfen wir diese vielleicht nicht anerkennen, das heißt, wir müssen ihn vielleicht für unzurechnungsfähig erklären —«
Doktor Isidor brach etwas erschrocken ab. Denn in diesem Augenblick, da gerade der Knebel unter dem Oberarm befestigt worden und die Blutung gestillt war, sprang der Patient, den man in tiefster Bewusstlosigkeit liegen glaubte, leichtfüßig empor. Also nicht, dass er sich nur so aufrichtete, sondern er schnellte unter den Händen der beiden plötzlich wie eine Sprungfeder in die Höhe.
»Mich für unzurechnungsfähig erklären?!«
Wirkte schon dieses plötzliche Emporschnellen des vermeintlichen Bewusstlosen ganz überraschend, so vielleicht noch mehr dieser sein Ausruf.
Denn mit lachendem Munde hatte er ihn getan, richtig jubelnd, jauchzend, dabei aber mit einem Gesicht — so vergeistert und trotzdem so furchtbar energisch — diese tiefe Falte, die der plötzlich zwischen den Augen bekommen hatte, und überhaupt, wie diese Augen plötzlich sprühten — solch ein Gesicht hatten die beiden bei ihrem Waffenmeister noch nicht gesehen.
Sie hatten nicht lange Zeit, über diese plötzliche Umwandlung zu staunen.
»Alle Mann an Deck!«
Mit diesem Rufe eilte Georg hinaus, die beiden folgten. Alle in Betracht Kommenden, d. h. alle Gesunden, befanden sich überhaupt noch an Deck, die Prozedur mit dem Eskimo und das Verbinden hatte ja nur wenige Minuten in Anspruch genommen.
»Leute! Ich habe soeben an Euch allen und an den Pestkranken eine Operation vollzogen, die Ihr Euch nicht erklären könnt und für die ich Euch auch keine Erklärung geben werde, jetzt nicht und niemals. Haltet Ihr mich deshalb für unzurechnungsfähig?«
Stumm standen die wetterharten Männer da, nur den Sprecher anblickend. Sie alle erkannten die kolossale Umwandlung, die plötzlich mit ihrem Waffenmeister geschehen war, wie er mit einem Male ein so ganz anderes Gesicht bekommen hatte, ohne es irgendwie definieren zu können. So heiter verklärt und dennoch diese furchtbare Energie — das sagt noch gar nichts. Sie konnten nur staunen, und darüber vergaßen sie die Antwort — wenn sie auf solch eine Frage überhaupt eine gehabt hätten. Aber sie sollten noch dazu gezwungen werden.
»Leute!«, fuhr Georg fort, als alles schwieg. »Ich will und muss eine Antwort von Euch haben! Ich werde Euch eine Viertelstunde allein lassen. Ihr sollt Euch beraten, ob Ihr mich für unzurechnungsfähig, für irrsinnig erklärt oder nicht. Was das zu bedeuten hat, wisst Ihr doch alle. Zeigt ein Kapitän deutliche Spuren von geistiger Umnachtung, so kann er durch gemeinsamen Beschluss der gesamten Mannschaft seiner Kommandostelle enthoben werden, bei offen hervorbrechendem Wahnsinn oder vollkommener Trunkenheit, muss dies überhaupt geschehen, und wehrt er sich, so wird er überwältigt und in Eisen gelegt.
So urteilt jetzt auch über mich.
Und ich will Euch noch etwas anderes dazu sagen.
Ja, mit mir ist plötzlich eine kolossale Umwandlung vor sich gegangen.
Wodurch und inwiefern, das werdet Ihr nie von mir erfahren.
Aber die Folgen dieser meiner Umwandlung werdet Ihr sehr bald erleben.
Ich werde Euch von jetzt an die seltsamsten Befehle geben, ganz, ganz unbegreiflich für Euch.
Ich werde oftmals die widersinnigsten Anordnungen treffen. Ich werde vielleicht manchmal für lange, lange Zeit Euch verlassen, spurlos verschwinden.
Ich werde von Euch manchmal vielleicht die unerhörtesten Anstrengungen fordern, Euch ganz planlos in die furchtbarsten Gefahren schicken, ohne dass dabei irgend ein Grund oder ein Zweck oder ein Ziel zu sehen ist, und haben wir dabei doch etwas Wertvolles erreicht oder gewonnen, so werfe ich dies vielleicht achtlos wieder fort. Kurz, Ihr werdet mich oftmals die sinnlosesten Handlungen begehen sehen. Und nun, nachdem ich Euch dies gesagt habe — und seid versichert, dass es so kommen wird — beratet Euch, ob Ihr mich als Kapitän behalten wollt oder nicht.«
Georg wandte sich und ging nach der Kajüte.
Es dauerte einige Zeit, bis die Leute Worte fanden, und dann war es erst etwas ganz anderes, was sie besprachen.
»Was ist denn nur mit unserem Waffenmeister los?!«
»Wie sah denn der aus?!«
»Gerade wie der Heiland.«
»Wie der Heiland? Du träumst! Der hatte doch nicht so ein fürchterliches Gesicht.«
»Es war doch auch ganz heiter, wie verklärt.«
»Nein, ganz grimmig war's!«
»Wie der Heiland, als er den Feigenbaum verfluchte, so sah er aus.«
»Ja, als er die Händler und Wechsler zum Tempel hinauspeitschte, so grimmig, und doch immer noch der Heiland.«
So und ähnlich, klang es durcheinander. Und das sind durchaus keine ungewöhnlichen Matrosenäußerungen — von deutschen Matrosen getan!
Ach, was man im Mannschaftslogis von deutschen Schiffen zu hören bekommen kann! Jedenfalls mehr Geist als in mancher Studentenkneipe, in welcher der Blödsinn vergöttert wird.
»Nein, akkurat wie der Sankt Georg sah er aus«, sagte jetzt der Matrose Wilm, »im Palazzo rosso zu Genua — ganz akkurat dasselbe Gesicht!«
Er hatte viel gesehen, der Matrose Wilm.
Der rote Palast in Genua ist heute ein öffentliches Museum für Skulpturen und Gemälde.
Da hängt im kleinen Tafelzimmer ein mittelgroßes Bild, den heiligen Georg darstellend, in silberner Rüstung auf weißem Rosse sitzend, wie er mit der Lanze den Drachen bekämpft.
Man weiß nicht, wer der Schöpfer ist. Jedenfalls ein Meister allererster Güte. Wer das Bild Raffael zuschreibt, mag recht haben, ebenso wie der, der Michel Angelo für den Schöpfer hält.
Überwältigend!!
Ist die Sixtinische Madonna die unübertreffliche Verschmelzung von Mutterliebe und keuscher Jungfräulichkeit, von Glück und Wehmut, im Antlitz offenbart, so gilt dasselbe für diesen Sankt Georg in männlicher Übertragung. Wie sich in diesem Jünglingsgesicht die heitere, sonnige Begeisterung mit wildem, trotzigem Wagemut paart — unbeschreiblich herrlich! Man braucht kein besonderer Kunstkenner zu sein, um diese Wirkung zu empfinden. Überhaupt besser, man steht da als ein ganz ordinärer Laie. Selbst die unbesiegbare Kraft, die in dem schlanken, erzgepanzerten Körper steckt, hat der Künstler in den Zügen wiederzugeben gewusst.
»Jungens«, nahm da Oskar, der Segelmacher, das Wort, der doch überhaupt immer das große Wort führte, »wenn Ihr damit fertig seid, ob unser Waffenmeister und nunmehriger erster Käpten wie der Heiland Jesus Christus oder wie der Apostel Petrus oder wie der Sankt Georg oder wie der Erzengel Michael ausgesehen hat, dann will ich Euch mal wat seggen.
Wir müssen uns jetzt beraten, ob wir den Käpten in die Gummitobzelle einsperren oder ihn auch fernerhin frei ohne Maulkorb und Kette herumlaufen lassen wollen. Und da ist meine Meinung nun folgende:
Etwas gepiept hat's ja bei uns allen schon immer im Kopfe, und zu uns allen hat auch unser Waffenmeister gehört.
Und wenn unser Waffenmeister und Käpten nun noch vollständig überschnappen sollte — na, da schnappen wir alle eefach ooch mit. Wat?«
So sprach der verlorene Großindustriellensohn aus Köln am Rhein.
Und niemand hatte eine Einwendung dagegen zu machen.
Es brauchte gar nicht erst abgestimmt zu werden. Gleich ging eine Deputation nach der Kajüte ab, um dem Kapitän mitzuteilen, dass, wenn er geneigt sei, vollständig überzuschnappen, sie alle ebenfalls mit überschnappen wollten. Wenn der Sprecher dies auch in etwas andere Worte kleiden würde. —
Während Georg die Erkrankten geimpft hatte, war die kleine Ilse von Klothilde zu Bett gebracht worden, unterdessen hatte sich die Patronin von ihrem Ohnmachtsanfalle, den sie ja nur durch den Anblick des blutenden Armes des geliebten Mannes gehabt zu haben brauchte — ein schlimmes Zeichen freilich war es immer — wieder erholt, auch sie hatte sich zu Bett begeben. Die Einspritzung hatte sie ruhig geduldet, ohne irgendwie nach einem Grunde zu fragen.
Georg begab sich in die Patronatskajüte, betrat durch die Nebentür das Schlafzimmer.
Dasselbe enthielt zwei freistehende Schwebebetten, die durch besondere Kugellagerungen alle Bewegungen de Schiffes aufhoben, diese also nicht mitmachten, bis auf das Auf- und Niedergehen immer in gleicher Lage blieben.
In dem einen lag Ilse, in dem anderen die Patronin. Es müssen ja kistenähnliche Betten sein, denn mögen sie auch noch so gut ausbalanciert sein, die Gefahr, herausgeschleudert zu werden, besteht doch immer, und außerdem hatte Klothilde über beide noch fürsorglich die Gurte befestigt.
Eine Ampel verbreitete gedämpftes, rosafarbenes Licht. Beide schliefen, Ilse ruhig, die Patronin warf sich hin und her, sprach im Traume.
Und was sprach sie?
»Blut — rotes Blut — wohin ich blicke, überall rotes Blut — Hilfe, ich versinke — uuuh, der schreckliche Lindwurm, der dort schwimmt — Hilfe, Hilfe, er will mich fressen — schon verbrennt mich sein Feuer — — Georg, Georg, rette mich vor dem Drachen — töte ihn, töte ihn — sei Du mein Sankt Georg —«
Und so schwatzte sie weiter im fieberwirren Traume vom Sankt Georg, der sie von dem im Blute schwimmenden Drachen erretten solle, von ihrem Sankt Georg.
Unser Held wusste nicht, wohl aber wissen wir es. Nämlich, wie jetzt gleichzeitig draußen an Deck der Matrose Wilm meinte, dass der Waffenmeister ganz genau wie der Sankt Georg im Palazzo rosso zu Genua aussehe.
Lag hier eine wunderbare Ideenübertragung zugrunde?
Nein, es brauchte durchaus nicht der Fall zu sein.
Ein merkwürdiges Zusammentreffen war allerdings vorhanden, wie so etwas aber häufig passiert; aber nichts anderes, als wenn zwei Personen in der Unterhaltung gleichzeitig dasselbe Wort aussprechen. Ilse hatte bis kurz vor ihrem Unwohlseinsunfall der Tante vorgelesen, aus einem Legendenbuche, die Geschichte vom Sankt Georg, wie er den Lindwurm tötete.
Kurz darauf war auch die Patronin über den Anblick des blutenden Geliebten in Ohnmacht gefallen. Was war da Wunder dabei, dass sie jetzt von Blut träumte, von einem ganzen Blutmeere, in dem sie schwamm, und von einem feuerspeienden Drachen, der sie bedrohte, und dass sie nun den Sankt Georg zu Hilfe rief, der für sie ganz natürlich ihr Georg, der Waffenmeister sein musste.
Das war also die ganz natürliche Erklärung.
Auf den Eingetretenen schien es keinen Eindruck weiter zu machen, was er da von der Fiebernden zu hören bekam.
Sein Gesicht strahlte noch immer wie von verklärter Heiterkeit, und dennoch darin die trotzige Entschlossenheit.
So stand er in der Mitte des Zimmers, die Arme über der Brust verschränkt, blickte auf die Träumende herab.
Dann nahm er von dem Schwebetisch ein Glas Limonade, von Klothilde schon bereit gesetzt, führte es an die Lippen der Fiebernden, oder wollte es doch tun, es gelang ihm nicht, sie wehrte sich, stieß das Glas zurück, und er hielt sich nicht lange mit seinen Bemühungen auf, stellte das Glas wieder hin, strich die Haare der Geliebten sanft zurück, trocknete ihr mit einem Tuche die feuchte Stirn, küsste sie leise, ging hin an Ilses Bett, küsste auch das Kind, noch vorsichtiger, um es nicht im Schlafe zu stören, aber vielleicht noch zärtlicher, und er verließ das Schlafzimmer wieder.
Da meldete Siddy schon die Deputation der Mannschaft an.
Aus wem sie bestand, ist gleichgültig. Man hatte schon einen geeigneten Sprecher gewählt, in diesem Falle aber lieber nicht den schnodderigen Segelmacher.
»Euer Kommando gilt nach wie vor, Kapitän!«
»Ist das gemeinsamer Beschluss?«
»Ja.«
»Niemand erhebt Einspruch?«
»Von den Wachehabenden kein einziger, die Erkrankten scheiden jetzt aus.«
»Habt Ihr es Euch auch reiflich überlegt?«
»Ja, Kapitän.«
»Es ist sehr schnell gegangen.«
»Nicht für uns, Kapitän.«
»Also Ihr führt jedes Kommando aus, das ich gebe, jedes, auch wenn es noch so sinnlos ist und ich Euch keine Erklärung dafür gebe?«
Es war eigentlich eine ganz überflüssige Frage, aber bei dem Manne brach jetzt doch einmal die Begeisterung hervor.
»Und wenn sich vor uns die Hölle mit allen Teufeln und Scheusalen öffnete, und Ihr gebt Befehl, gegen sie vorzugehen — wir gehen mit vollen Segeln und unter Volldampf mit Hurra hinein!«
Es machte auf den Kapitän keinen Eindruck. Insofern nicht, als sein Gesicht immer noch das fest entschlossene und dennoch so heiter strahlende war und blieb.
»Gut! Nehmt gleich zwei Kommandos mit: Loten! Und beide Wachen zum Arbeitsdienst!«
Die Deputation entfernte sich, gleich darauf pfiff die Bootsmannspfeife »Loten«. Georg begab sich noch einmal in seine Kabine, kam gleich wieder an Deck. Die Lotgäste der Steuerbordwache waren bei der Arbeit. Auch das Loten ist eine Kunst, die gelernt sein will. Benutzt wurde das Brookesche Patentlot, mit dem man Tiefen bis zu 1500 Meter sicher messen kann. Mit dem gewöhnlichen Handlot sind nur Tiefen bis zu dreihundert Meter zu erreichen, das heißt, dann weiß man nicht mehr, ob das Bleigewicht Grund gefunden hat oder noch fällt, weil die Leine doch selbst hinabzieht, und dabei muss das eigentliche Lot schon dreißig Kilogramm schwer sein, das Wiederaufziehen ist eine furchtbare Arbeit. Bei dem Brookeschen Patentlot wird dies alles vermieden. Nebenbei bemerkt: es ist dies die Erfindung eines fünfzehnjährigen amerikanischen Schiffsjungen. Wenn man jetzt im Konversationslexikon liest, er sei Midshipman gewesen, also Seekadett in der Kriegsmarine, so ist das falsch. Edward Brooke war im Jahre 1854, als er seine Erfindung der Marinebehörde verlegte, gewöhnlicher Schiffsjunge auf einem Küstensegler. Erst dann wurde er als Seekadett in die Kriegsmarine eingestellt. Diese seine Erfindung ist unterdessen wohl verbessert worden, aber im Prinzip übertroffen konnte sie nicht werden. Die Leine, mit Knoten und Lappen markiert, glitt durch die schwieligen Hände, der betreffende Matrose meldete die Anzahl von je zehn Metern, sang sie aus.
»70 — 80 — 90 — 300 — 10 — 20 — 30...«
»Stopp!«, kommandierte Georg. »Das genügt für meine Zwecke.«
Die dreihundert Meter Leine wurden wieder eingeholt, dabei löst sich das Blei- oder Eisengewicht von selbst ab, worin eben das Patent besteht. Es geht dabei zwar verloren, muss immer durch ein anderes Gewicht ersetzt werden, aber das schadet nichts; andernfalls geht bei solcher Tiefe gewöhnlich die ganze Leine verloren, sie reißt beim Aufziehen.
»Die Backbordwache geht mit mir!«
Es war ein Dutzend Männer und Jungen, die sich ihm anschlossen. Der Kapitän führte sie unter das zweite Deck und sie wussten, was sich hinter der Tür befand, in die er jetzt den Schlüssel steckte.
Da lagen die gleißenden Goldbarren fest aufgeschichtet, goldene Gerätschaften, meist zusammengeschlagen, in hohen Haufen, da standen Kisten und Kasten gefüllt mit Diamanten und anderen Edelsteinen aller Art, teils ausgebrochen, teils noch in goldener Fassung.
Der Flibustierschatz.
Kapitän Martin hatte ihn einmal einer eingehenderen Prüfung unterzogen und ihn auf hundert Millionen Mark mindestens taxiert.
»An Deck mit dem Zeuge!«, Die Männer und Jungen beluden sich. Schweigend. Jetzt wussten sie sofort alle, was der Kapitän vorhatte, aber niemand hatte eine Einwendung zu machen. Hätte es auch einer wagen sollen!
Aber sie flüsterten nicht einmal unter sich — sie gehorchten.
Und so war es dann auch bei den anderen, die sich dann ebenfalls daran beteiligen mussten, die fast fünfzig Tonnen schwere Last heraufzutragen oder sie doch erst bis unter die Winde zu bringen.
Noch immer leuchtete prachtvoll das Polarlicht, noch immer spielten und schnaubten die Walfische zwischen den beiden Eisbergen, da hob Kapitän Georg Stevenbrock den ersten zwei Zentner schweren Goldbarren empor und schleuderte ihn über die Bordwand in das Meer hinein, und als zweites ließ er eine ganze Kiste mit Diamanten nachfolgen, sie zerplatzte dabei, ein in allen Regenbogenfarben schillernder Tropfenregen vermählte sich mit dem Salzwasser des Indischen Ozeans.
Und so folgte ein Goldbarren und eine Edelsteinkiste nach der anderen über die Bordwand hinab, verschwand in einer Tiefe von mehr als 330 Metern, aus der es also kein Herausholen mehr gab, ganz abgesehen davon, dass man ja gar nicht wusste, wo man sich befand, man auch gar keine geografische Ortsbestimmung machen konnte, da der nächtliche Himmel vollständig bedeckt war.
Der Flibustierschatz! Dem im Grunde genommen doch die ganze Fahrt dieser modernen Argonauten gegolten hatte. Weshalb versenkte ihn der Waffenmeister der Argonauten jetzt im Meere an unbekannter Stelle?
Dieser Schatz stammte doch nicht von jener geheimen Gesellschaft, mit der er nichts mehr zu tun haben wollte, und er hätte sich seiner doch schon viel früher entledigen können.
Nein, erst heute Nacht musste ihm plötzlich dieser Entschluss gekommen sein.
Aber weshalb tat er es?
Niemand fragte danach, sie sprachen nicht untereinander darüber, auch jeden aufsteigenden Gedanken an solch eine Frage wusste jeder sofort auszulöschen.
Sie gehorchten einfach, wie sie ihm versprochen hatten.
Niemand dachte auch daran, dass doch eigentlich jeder einzelne auch einen gewissen Anspruch an diese Schätze hatte, sogar einen gesetzlich begründeten.
Hatte der Waffenmeister erst mit der Patronin darüber gesprochen? Geschah es mit ihrer Einwilligung?
Sie dachten nicht an so etwas. Es war ihnen ganz gleichgültig.
Ihr Waffenmeister und Kapitän befahl und sie gehorchten, waren mit allen Kräften bemüht, das gleißende Zeug herbeizuschleppen und über Bord zu werfen.
Einige Stunden nahm diese Arbeit doch in Anspruch. Das Polarlicht war schon längst erloschen, der Himmel hatte sich wieder aufgeklärt, und eben tauchte über dem östlichen Horizonte die Sonne empor, als der Kapitän mit eigener Hand den letzten Goldbarren über Bord warf.
»Der rote Drache ist besiegt!«, rief er dabei feierlich.
Einige waren doch dabei, die ihn verstanden.
Der Drache, mit dem Sankt Georg kämpft, ein in der christlichen Kirche so oft wiederkehrendes Bild, ist ja nur allegorisch zu verstehen: es ist die Sünde.
Und für die anderen setzte er es gleich noch deutlicher hinzu:
»Wir sind befreit von dem Fluche, der an diesem Golde haftet!«
Ja, allerdings, es war Piratenbeute gewesen, das Schiff, welches van Horn führte, war von denen, die er beständig bedrohte, »la Consolation« genannt worden, die Verzweiflung, wie viel Tränen und Wimmern und Todesseufzer mochten an diesem Golde geklebt haben.
Danach wird freilich heute nicht mehr gefragt. Geld stinkt nicht, braucht nicht geputzt zu werden. Kann man nicht auch mit gestohlenem Gelde Kirchen und Waisenhäuser stiften?
Ja und nein. Es gibt Menschen genug, die hierüber doch etwas anders denken. Sie gehören zum Sauerteige der Menschheit, sind das Salz der Erde. Und gibt es nicht auch Klöster und Waisenhäuser und ähnliche Anstalten genug, von denen es besser gewesen, sie wären nicht gestiftet worden? Weil ihre Insassen schon auf Erden in der Hölle leben?
Die modernen Argonauten stellten nicht solche Fragen. Gehorsam und sogar freudig hatten sie den gleißenden Plunder über Bord geworfen, obgleich sie wussten, dass sie nun wieder vor dem großen Nichts standen. Doch vielleicht gerade deshalb hatten sie es so freudig getan.
Da, wie Georg den letzten Goldbarren unter jenen Worten im Meere versenkt hatte, im ersten Scheine der Morgensonne, kam Doktor Isidor.
Es musste etwas mit ihm vor sich gegangen sein, er war so scheu, machte ein ganz merkwürdiges Gesicht, wie er sich dem Kapitän näherte.
»Herr Kapitän — fast muss ich es ein Wunder nennen — ich bitte um Entschuldigung — Sie haben recht behalten — Jimmy war noch nicht tot — oder Sie haben ihn wieder lebendig gemacht —«
Immer mehr geriet das kleine Krummbein ganz außer Atem.
»Und?«, fragte Georg lächelnden Mundes und seine blauen Augen strahlten mehr denn zuvor.
»Und dieses Wiederlebendigwerden zeigt sich allüberall — eine allgemeine Wendung zum Besseren — plötzlich brechen bei allen die Leistendrüsen auf, was sonst durch kein Mittel künstlich zu erzielen ist — hiermit aber ist die Krise der Pest zugunsten des Erkrankten überstanden — ich möchte sie alle schon für gerettet erklären —«
Da ging ein seltsames Zittern durch das ganze Schiff, es wurde zum Surren, dieses zum gewaltigen Ton, und dann rauschte mit mächtigen Klängen ein Tedeum über das Meer und zum Himmel empor.
So herrlich konnte nur ein einziger die Orgel spielen, ihr Erbauer und Meister, das kleine bucklige Männlein. Hämmerlein hatte sich vor zwei Tagen legen müssen, soeben war er nach einem ausnahmsweise ruhigen Schlafe erwacht, hatte sich erheben können, und sein erster Gang, wenn er sich auch nur schleppen konnte, war nach seiner Orgel gewesen.
Und die Umstehenden hatten es gehört, was der Schiffsarzt soeben gesagt.
Mit scheuem Staunen blickten sie alle auf ihren Kapitän und Waffenmeister.
Und während die Orgel im Tedeum erbrauste, wussten sie mit einem Male alle, dass der Mann mit dem strahlenden, schier verklärten Antlitz nicht umsonst sein Herzblut ihnen in die Adern gespritzt hatte.
Sankt Georg hatte den Drachen besiegt!
Wir lassen nun die persönliche Erzählung eines neuen Mannes folgen. — Ich, Ewald Ebert, hatte das Polytechnikum in Hannover absolviert. Als Sohn eines alten Artillerieoffiziers hatte ich mich ganz auf Geschützkonstruktion geworfen.
Das Resultat von jahrelangen Privatstudien war eine neue Rücklaufbremse.
Dabei hatte ich zwar mein ererbtes, kleines Vermögen vollständig aufgezehrt, nun aber konnte ich mich auch gleich als reichen Mann betrachten.
So glaubte ich!
Mir erging es, wie es schon manchem deutschen Erfinder ergangen ist. Vergebens legte ich meine Zeichnungen den Militärbehörden vor, vergebens wandte ich mich von einer Geschützfabrik an die andere.
Meine Erfindung war neu und sicher gut, aber man wollte es nicht anerkennen.
So kann man es mir nicht verdenken, wenn ich meine Erfindung zuletzt dem englischen Kriegsministerium anbot, zumal schon der Hunger an die Tür pochte.
Bemerken will ich noch, dass man solch eine Erfindung, die im Heerwesen, im Kriege eine Rolle spielen wird, ja gar nicht patentieren lassen kann. Durch das Patentieren wird sie doch veröffentlicht, dann nimmt sie kein Staat mehr ab, denn dann kann sie doch jeder nachmachen. Da kann man sein Geheimnis nur der Ehre anvertrauen.
Meine schriftliche Versicherung, eine neue Rücklaufbremse von umwälzender Bedeutung erfunden zu haben, genügte — das englische Kriegsministerium überwies mir sofort das Geld, um nach London fahren zu können.
Die Sache leitete sich vorzüglich ein. Anfangs!
Ich will nicht ausführlich schildern, wie ich schließlich um meine Erfindung betrogen worden bin. Dabei will ich der englischen Regierung keinerlei Schuld beimessen, die Schurkerei geschah zweifellos von privater Seite.
Mister Snatcher hieß der edle Herr, der mir eines Tages, als wir in dem Separatzimmer eines Hotels der Unterhandlung pflogen, kalt hohnlächelnd sagte, dass ich ja selbst erst diese Erfindung einem Engländer, mit dem ich in Hannover studiert, gestohlen habe. Darauf konnte es nur eine einzige Antwort geben: Ich schlug dem Manne ins Gesicht, dass er zwischen die Stühle flog.
Dabei mag ich — ich weiß es nicht — nicht nur mit der flachen Hand, sondern mit der geballten Faust geschlagen haben, ihn an der Schläfe treffend, und ich bin kein Schwächling.
Der Mann stand nicht wieder auf.
Tot!
Ich stellte mich selbst.
Natürlich kein vorsätzlicher Mord, aber auch nicht nur leichtfertiger Totschlag.
Das Urteil lautete auf acht Jahre schwere Arbeit, hard labour.
Das ist dem deutschen Zuchthause entsprechend, nur insofern ganz anders, als diese Strafe nicht entehrend ist, was es in England überhaupt nicht gibt. Nach Verbüßung der Freiheitsstrafe ist die Tat eben auch gesühnt. Ich will nicht kritisieren, ob das Urteil gerecht war oder nicht. Ich habe die Richter für parteilos gehalten, und mein mir gestellter Verteidiger hat alles getan, um mich zu entlasten.
Ich kam, meiner Körperkonstitution entsprechend, nach Portland in die Steinbrüche.
Sieben Jahre lang habe ich am Tage Steine gebrochen und des Nachts in der Isolierzelle geschlafen.
Ich habe mich über nichts zu beklagen gehabt.
Das heißt als Sträfling nicht!
Mein einziger Trost war der, dass es niemand in der Welt gab, der sich meiner schämte, der mich beklagte. Genug!
Das letzte Jahr wurde mir wegen guter Führung geschenkt. Nur einmal hatte ich eine kleine Insubordination begangen, um aus dem Büro, in das mich ein mir wohlwollender Beamter gebracht, wieder hinaus in den Steinbruch zu kommen, um mich in Sonnenglut und Winterkälte wieder mit den Blöcken herumbalgen zu können.
»Nummer zweihundertdreiundzwanzig!«, erklang es dann zum letzten Male.
Ich wurde in ein Zimmer geführt und hörte zum ersten Male wieder meinen Namen.
Fast wunderte ich mich, dass ich ihn noch kannte. Wäsche und ein neuer Anzug lagen für mich bereit.
Den Kragen knöpfte ich verkehrt an, mit dem Schlipse wusste ich gar nichts anzufangen.
»Hier ist ein Herr, der sich Ihrer annehmen will!«, hieß es dann.
Ich kannte ihn nicht. Ein noch junger Mann, im schwarzen Gehrock, mit so einem weichen, breitrandigen Filzhute — jedenfalls ein Geistlicher oder so ein Missionar, der sich entlassener Sträflinge annimmt.
»Kommen Sie, Herr Ebert«, sagte er zu mir auf deutsch.

Er führte mich in ein Hotel. Ob wir unterwegs was gesprochen haben, weiß ich nicht, bezweifle es. Ich befand mich ja in einer ganz fremden Welt, eckte überall an, vor einem Automobil fürchtete ich mich fast.
In einem Separatzimmer gab er mir die Speisekarte. Ich wusste nichts damit anzufangen. Er bestellte. Eine ganze Kalbskeule kam auf den Tisch. Als ich auf dem ersten Bissen kaute, fing ich zu weinen an. Der Herr selbst rührte nichts an, schaute mir nur zu und trank Rotwein.
»Weshalb weinen Sie denn?«, fragte er nach; einiger Zeit, als meine Tränen nicht zu fließen aufhörten.
»Weil es mir so gut schmeckt!«, schluchzte ich.
Da lächelte er.
Leise weinend aß ich die ganze Kalbskeule auf. Kalbsbraten mit Spargel und Champignons hatte es im Zuchthaus nicht gegeben.
»Wissen Sie eigentliche wer ich bin?«, fragte mich der Herr dazwischen einmal.
Nein. Wusste noch nicht einmal, ob er mir schon seinen Namen genannt hatte, der mich auch wenig interessierte. Für mich hatten alle Menschen nur Nummern.
»Für wen oder was halten Sie mich?«
Jetzt blickte ich ihn einmal aufmerksamer an.
Ein schönes Männergesicht, freundlich und überaus gutmütig und energisch zugleich, so braunrot gebrannt wie meines, mehr noch als die breiten Schultern verrieten die sonst wohlgepflegten Hände die diesem schlanken Körper innewohnende Muskelkraft, dazu nun der schwarze Anzug und der Missionarshut —.
»Für einen Geistlichen, für einen Landpfarrer, der viel im Garten arbeitet!«, lautete mein Urteil.
Da plötzlich brach der Herr in ein schallendes Gelächter aus. Eine Erklärung für diesen Heiterkeitsausbruchs erhielt ich nicht, verlangte sie auch nicht — ich vertiefte mich wieder mit nassen Augen in meine Kalbskeule.
Der Kellner oder Geschäftsführer kam, fragte, ob wir gestatteten, dass zwei Gentlemen in diesem Zimmer dinierten.
Gewiss!
Zwei ältere Herren nahmen, ohne uns zu beachten, an einem Nebentische Platz, dinierten, sprachen nur von Hausse und Baisse. Börsenjobber.
Dann vertieften sie sich in Zeitungen, bis der eine eine Bemerkung machte und die Unterhaltung wieder in Gang brachte.
»Sapristi! Die Vorstellung gestern Abend in der Alhambra hat den Argonauten wieder einen Reingewinn von zweitausend Pfund Sterling eingebracht, die sofort dem Seemannsasyl überwiesen wurden!«
»Die hätten doch nicht nötig, solche Vorstellungen zu geben, wenn sie wohltätig sein wollen!«, meinte der andere.
»Allerdings nicht. Es macht ihnen eben Spaß, so öffentlich zu mimen. Ja, diese Bande! Die Firma Harrison hat wieder fast tausend Pfund Ambra von ihnen gekauft, beste Qualität, hat 150 000 Pfund Sterling dafür gezahlt.«
»Wird denn nur so viel von dem Zeuge gebraucht?«
»Besonders der Orient kommt gar nicht ohne Ambra aus. Der Verbrauch und daher die Nachfrage dort ist enorm. Einmal freilich wird der Preis ja sinken, wenn solche Massen auf den Markt geworfen werfen, vorläufig aber ist noch nichts davon zu merken. Wie steht der Ambra heute an der Börse? Erste Sorte 4775 Franken, zweite 4350, dritte 3800. Das ist immer noch beste Hausse; obgleich dieser Kapitän Stevenbrock im Laufe eines Jahres für wenigstens zehn Millionen Franken Ambra auf den Markt geworfen hat.«
»Wo bekommt der nur das Zeug her?«
»Ja, wenn man das wüsste! Der weiß eben irgendwo eine Ablagerungsstelle, wo Pottwale und Moleschots vielleicht schon seit undenklichen Zeiten ihren Blasenstein absetzen.«
»Ob denn nicht so ein Mann von der ›Argos‹ zu ködern ist, dass er einmal plaudert?«
»Wird wohl nicht zu machen sein. Die haben doch sicher alle Anteil am Gewinn, und Sie haben doch selbst das Antrittslied gehört, das sie immer zuerst beim Keulenschwingen singen — festgenietet sind wir, hei, festgeschmiedet sind wir, hei!«
»Na, so viel ich weiß, sind diese Argonauten keine Abstinenzler, und Whisky hat schon manche Zunge gelöst.«
»Hm«, brummte der andere, uns einen schnellen Seitenblick zuwerfend, »wenn die Kerls nur nicht so wie Kitt zusammenklebten.«
»Es geht mancher als Ordonnanz allein an Land. Neulich hat einer auf der Hauptpost neben mir am Schalter gestanden, er war allein, ich sah ihn dann auch auf der Straße gehen. Oder einmal einen instruierten Mann an Bord schmuggeln, einen scharfen, auch nautisch gebildeten Detektiv, so einen wie den Sparrow, der gut aufpasst, wo die Argonauten ihr Ambra herholen.«
»Na — dieser Kapitän Stevenbrock ist doch mit allen Hunden gehetzt.«
»Und Sie scheinen solch eine Spürnase wie den Sparrow nicht zu kennen.«
»Die Argonauten nehmen gar keinen Fremden mehr unter sich auf.«
»O, das ließe sich schon arrangieren!«, meinte der andere, gedankenvoll mit seinem Weinglase spielend.
Hierbei bemerke ich gleich, dass die beiden ja gar nicht an die Ausführung solch eines Vorhabens dachten, sonst hätten sie doch nicht so laut davon gesprochen, dass es andere hören konnten.
Allerdings — erst kommt der Gedanke, dann die Tat. Ein dritter alter Herr kam.
»Gentlemen, wissen Sie schon das Neueste?«
»Was?«
»Endlich ist es heraus, wo Mister Dikil die wunderbaren Diamanten, Rubine, Smaragde und Saphire her hat, die er seit einigen Tagen an der Edelsteinbörse haufenweise anbietet.«
»Nun?«
»Vom Kapitän der Argonauten. Die müssen irgendwo ein Edelsteinlager entdeckt haben, das sie heimlich ausbeuten.«
Von meiner Kalbskeule war nur noch der Knochen übrig, und mein Begleiter fragte mich, ob ich zum Aufbruch bereit sei. Ich war es.
Von jener Unterhaltung war mir kein Wort entgangen, aber interessiert hatte es mich durchaus nicht. Die Argonautensage kannte ich natürlich, aber was das für Argonauten waren, von denen jene sprachen, das war mir ganz gleichgültig, obgleich ich sonst nicht so ein Nevermindman bin. Aber wenn man sieben Jahre lang als Nummer im Steinbruch von Portland gearbeitet hat, und man wird dann als freier Mensch vor einen großen Kalbsbraten gesetzt, dann kümmert man sich nicht um Ambra und unverdauliche Edelsteine und Argonauten.
Wir fuhren direkt nach dem Bahnhof, mein Begleiter sprach am Schalter, wir wurden von einem Beamten nach dem Zuge geleitet, ein anderer trug einen kleinen Koffer nach, sein Coupé erster Klasse wurde geöffnet und hinter uns wieder geschlossen.
Kurz vor Abgang des Zuges kam noch eine größere Gesellschaft von sehr eleganten Herren und Damen, ein allgemeiner Ansturm auf die Kupees erster Klasse erfolgte, man rüttelte auch an unserer Tür und schimpfte.
Da merkte ich, dass sich mein Begleiter ein separiertes Kupee geleistet hatte. Ein Landpfarrer?
Wir rollten; er setzte sich behaglich in den Polstern zurecht und präsentierte mir zum zweiten Male sein gefülltes Zigarrenetui. Ach, dieser Genuss, so eine Havanna.
»Was beabsichtigen Sie nun zu tun, Herr Ebert?«
Ich wusste es nicht, hatte noch keinen Plan gefasst.
»Ihre Rücklaufbremse ist von der englischen Regierung verwertet worden.«
Das glaubte ich schon.
»Als Hockward'sche Bremse. Sie sind um Ihre Erfindung betrogen worden. Werden Sie in dieser Sache noch einmal vorgehen?«
»Vorläufig denke ich nicht daran, und am liebsten möchte ich überhaupt niemals wieder daran denken.«
»Recht so. Haben Sie schon von den Argonauten gehört?«
»Vorhin zum ersten Male. Als sich die beiden Herren über sie unterhielten. Es scheint ein Schiff zu sein, das ›Argos‹ heißt, und danach werden die Leute darauf Argonauten genannt.«
»So ist es. Und wie hieß der Kapitän dieser neuen Argonauten?«
»Stevenbrock.«
Lächelnd schnipste er die Asche seiner Zigarre zum Fenster hinaus.
»Dieser Kapitän Stevenbrock bin ich.«
Himmel noch einmal! War ich denn nur blind gewesen?! Ja natürlich, war das doch ein Seemann, wie er im Buche steht! Freilich der schwarze Gehrockanzug und der Missionarshut. Und überhaupt, jetzt konnte ich das gut sagen — niemand hätte in ihm gleich den Seemann erkannt.
»Herr Ebert, glauben Sie an eine Bestimmung im Schicksale des einzelnen Menschen?«
»Dass das Schicksal eines jeden Menschen von vorn herein bestimmt ist? Dass man diesem Schicksal nicht entgehen kann? Nein, daran kann ich nicht glauben.«
»Recht so!«, erklang es wiederum in ganz eigentümlichem Tonfall. »Glauben Sie so lange nicht daran, als bis Sie davon überzeugt worden sind. Wollen Sie in meine Dienste treten?«
»Als was?«
»Als mein — Sekretär, will ich sagen.«
»Als Schreiber?«
»Ja.«
»Ich bin des Schreibens sehr ungewohnt geworden, und Büroarbeit ist auch nicht gerade meine Liebhaberei.«
»Sie werden auch bei mir verdammt wenig zu schreiben haben!«, lächelte er wieder, und man hatte nichts von einem Fluchworte gehört, er hätte es in der besten Damengesellschaft sagen können. »Ich werde Sie schon Ihrem Geschmack entsprechend zu beschäftigen wissen. An Bord meines Schiffes, denn an Bord müssen Sie kommen. Vertrauen Sie mir? Wollen Sie in meine Dienste treten?«
Er sah mich fest an, ich blickte ihm in die Augen.
Und da erlebte ich etwas. Es war ein trüber, nasskalter Herbsttag.
Und da plötzlich drang aus diesen blauen Augen ein goldener Sonnenstrahl in mein Herz, es bis in alle Fasern erwärmend.
»Ja, ich will, Herr Kapitän.«
Er reichte mir die Hand hin, drückte meine.
»Gut, abgemacht! Sie sind ein Argonaute. Sie gehören mit zu uns. Sie —«
»Herr Kapitän, wie komme ich nur dazu? Ich kenne Sie doch gar —«
»Halt, nicht solche Fragen, keine einzige!«, unterbrach er mich, nicht etwa unfreundlich, ganz im Gegenteil, aber auch aufs allerbestimmteste. »Sie haben eingewilligt, jetzt bin ich Ihr Kapitän. Was das zu bedeuten hat, das werden Sie später merken, wenn Sie erst wissen, was Bordroutine ist. Jetzt kann ich das noch nicht verlangen, weil Sie kein Seemann sind. Aber Sie werden es werden, und dann werden Sie verstehen, weshalb man den Kapitän nichts fragen darf, was nicht zur Sicherheit des Schiffes gehört.
Oder fällt Ihnen etwa ein, den lieben Gott einmal zu fragen: Höre mal, weshalb lässt Du eigentlich aus dem Ei erst eine Raupe kriechen, die sich mühsam wieder in einen Schmetterling verwandeln muss? Weshalb lässt Du nicht gleich aus dem Ei den fertigen Schmetterling schlüpfen?
Ich bin nicht der liebe Gott. Aber Sie werden später noch einmal merken, wenn Sie erst die Bordroutine im Leibe haben, dass jeder Kapitän an Bord seines Schiffes doch so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem lieben Gott hat. In jener Hinsicht, worauf es hierbei ankommt. Wie es so etwas sonst nirgends wieder auf der Erde gibt. Jede Zeitung kann die Worte und Handlungen des Landesherrschers öffentlich kritisieren, aber im Reiche des Kapitäns gibt es so etwas nicht oder es erfolgt sofort eine Katastrophe mit Blitz und Donnerschlag.
Aber freiwillig will ich Ihnen gleich eine Offenbarung machen.
Sie sind vom Schicksale dazu bestimmt, mein Begleiter zu werden, mein Vasall, mein treuer Leibknappe. Dass es so kommen muss, das werden Sie später einsehen, wenn es sich eben erfüllt hat.
Deshalb habe ich Sie von Portland abgeholt.
Ich hätte Sie auch schon früher herausholen können, mit List oder Gewalt.
Ich tat es nicht.
Nicht unseretwegen nicht, damit wir uns nicht in Unannehmlichkeiten brächten, sondern Ihretwegen taten wir es nicht.
Sie mussten erst Ihre Strafe abbrummen. Es ist geschehen, und nun stehen Sie wieder unschuldig da wie ein frisch aus dem Seifenbad gekommener Engel.
Und nun werde ich ein Stündchen schlummern.
Hier, mein lieber Ebert, haben Sie mein Zigarrenetui und hier den Schlüssel zu meinem Koffer, da finden Sie etwas Trink- und Essbares darin, falls Sie Bedürfnis darnach haben. Oder Sie können auch schlafen, brauchen nicht etwa für mich zu wachen. Wenn Sie einmal für mich wachen sollen, dann werde ich es Ihnen schon sagen.
Und wenn Sie sich etwa genieren, in meinem Koffer zu wühlen, nachdem ich Ihnen die Erlaubnis dazu gegeben habe, dann müsste ich Sie erst in die Vorschule zur eigentlichen Bordroutine stecken, was mir sehr leid täte. Gute Nacht.«
Sprach's und streckte sich, die Hände in den Hosentaschen, der Länge nach aus auf dem Polster.
Ich hatte Zeit zum Grübeln; tat es aber nicht viel, sondern gab mich ganz dem behaglichen Gefühle hin, das sich immer mehr meiner bemächtigte. Ich hätte nicht aus dem Zuchthause zu kommen brauchen; auch so hätte ich mich plötzlich wie in eine ganz neue Welt versetzt gefühlt.
Nach einer halben Stunde hielt der Schnellzug zum ersten Male in Yeovil.
Hier wollten einige Passagiere einsteigen, die gar nicht das Recht dazu hatten.
Es war eine irländische Familie, bestehend aus Vater und Mutter, jedes auf dem Arme einen Säugling tragend, am Rocke hingen noch einige andere Sprösslinge, alle mit brennend roten Haaren, starrend vor Dreck, an der Nase lange, ungefrorene Eiszapfen, was man auf gut deutsch Rotznasen nennt.
Sie wollten nach Salisbury, natürlich dritter Klasse, dieser Zug hier führte nur erste und zweite, sie mussten eben den Personenzug benutzen, der eine Stunde später ging, und das war den guten Leutchen nicht begreiflich zu machen; die Frau bestand auf ihr vermeintliches Recht, machte einen Heidenskandal, ging dem Stationsvorsteher direkt zu Leibe. Und nun so eine echte Irische, was die für gewählte Ausdrücke hat, mit ihrem merkwürdigen Englisch!
»Ist sich eine Schweinebande vermistigte! Hat sich wohl Trichinen im Schädel stinkiges! Soll sich blutig was schämen, pft, pft, pft.«
Der Stationsvorsteher flüchtete vor dem feuchten Bombardement. Aber einsteigen konnte die siegreiche Familie doch nicht, alle Passagiere hielten natürlich von innen die Türen zu, und in der nächsten halben Minute musste sich der Schnellzug wieder in Bewegung setzen.
Kapitän Stevenbrock, der sanft geschlummert hatte, war von dem Skandal erwacht, trat ans Fenster, hörte einige Augenblicke zu, dann öffnete er schnell die Tür.
»Hier herein mit Euch!«
Das ließen die sich nicht zum zweiten Male sagen. Und die Zugbeamten durften sie nicht hindern, in unser Coupé zu steigen, das war bezahlt, gehörte uns, wir konnten mitnehmen, wen wir wollten, sogar ohne Fahrkarte.
Sie stiegen ein, machten es sich auf den Samtpolsterin bequem, ohne viel zu denken. Oder überhaupt gar nicht. Es war doch ihr gutes Recht, hier mitzufahren, sie hatten doch bezahlt.
Zuerst einmal den Futtersack aufgemacht. Entweder war von vornherein nicht viel drin gewesen oder man hatte ihn schon stark in Anspruch genommen. Einige Stücke Hartbrot und eine Käserinde, das war alles. Es wurde verteilt und heißhungrig verschlungen. Den beiden Säuglingen, übrigens keine Zwillinge, sondern zehn Monate auseinander, kaute die Mutter die Bissen vor, stopfte ihnen den Brei mit dem Finger in den Schlund. Friss, Vogel, oder stirb. Kapitän Stevenbrock erhob sich alsbald, entfernte sich durch die Durchgangstür, kam gleich wieder, beladen mit einem ganzen Korbe voll belegten Brötchen, Schokoladentafeln, Konfekt und dergleichen. Er musste im Speisewagen das ganze Büfett abgeräumt haben.
»Hier, esst — aber seht Euch etwas vor, Ihr kleinen Säue, schmiert die Polster nicht so voll — dass ich die dann nicht auch noch zu bezahlen habe.«
Nun ging das Futtern erst richtig los. Was nicht bewältigt werden konnte, verschwand im leeren Proviantsack.
Dann wurden die Säuglinge trocken gelegt. Im Luxuszug erster Klasse. Die Affenliebe dieser irischen Mutter war wirklich rührend. Nur durfte man nicht sehr eklig sein. Statt Schwamm und Wasser benutzte sie einfach ihre Zunge, leckte einfach ihre Lieblinge dort, wo sie es nötig hatten, ab. Tatsächlich! Ich glaube überhaupt, solche Szenen kann man gar nicht erfinden.
Einmal setzte sie mir das eine nackte Baby nolens volens auf den Schoß, nahm es mir bald wieder ab — da aber hatte es schon auf meiner neuen Hose ein nasses Andenken hinterlassen. Dabei rauchte die Frau aus einem Kalkstummel einen Tabak, der, glaube ich, auch einen preußischen Grenadierwachtmeister zur Strecke gebracht hätte.
Unterdessen unterhielt sich der Kapitän in der anderen Ecke mit dem ihm gegenübersitzenden Vater dieser lieblichen Bande. Verstehen konnte ich nichts, hörte auch gar nicht hin, hatte anderes zu tun.
Endlich, endlich war Salisbury erreicht. Wenn es auch wieder nur eine halbe Stunde gedauert hatte. Eine Minute Aufenthalt, die Familie musste sich mit dem Aussteigen beeilen.
Aber ich hatte ihnen Unrecht getan, wenn ich geglaubt, so etwas wie Dank kennten die gar nicht.
Auf dem Perron winkte das rote Teufelsweib.
»Wird sich nie vergessen, soll sich Frau Deiniges Kinderchen kriegen wie die Läus!!«
»Danke, danke!«, winkte der Kapitän zurück und legte sich mit einem tiefen Seufzer wieder zum Schlafen hin.
Ich dachte mein Bestes. Ach Du schöne Zuchthauszeit! Ich möchte Dich faktisch nicht in meinem Leben vermissen. Das heißt: solch ein Austritt und Eintritt in eine ganz neue Welt gehört dazu.
»Was haben Sie denn da für einen großen nassen Fleck auf Ihrer Hose?«, fragte der Kapitän, nach mir blinzelnd. »So ein Säugling hat Sie beglückt? Na, bis nach London wird's schon wieder trocknen, sonst warten Sie, bis wir in die Passatwinde kommen, da trocknet sogar das Schweißtüchlein eines griechischen Maurers. Haben Sie so einen mal mauern sehen?! Sehen Sie lieber nicht zu. Bis der zehn Steine zusammengeklebt hat, sind dem Zuschauer Schwämmchen auf'm Buckel gewachsen.«
Und dann nach einer Pause:
»Wissen Sie, wovon mir der rote Paddy immer erzählt hat? Egal von seinen Reichtümern. Hat zu Hause einen echt strohgedeckten Palast mit zwei Kammern, die er mit seiner Familie und nicht weniger als sechzehn schlachtreifen Schweinen teilt. Und dieser Krösus fährt dritter und speist kalte Käserinde!«
Ach, und da muss man nun ernst bleiben! Ich glaubte, es bleiben zu müssen, weil der dies alles so ernst und trocken hervorbrachte.
Oder aber — man hat nicht umsonst sieben lange Jahre in Portland Steine gebrochen und des Nachts in der Isolierzelle gelegen, nicht immer schlafend, lange, lange, ewig lange Nächte!
Da muss man das Lachen erst so nach und nach wieder lernen.
Basingstoke, eine Minute Aufenthalt!
Der Stationsvorsteher öffnete mit seinem Schlüssel unsere geheiligte Tür.
»Verzeihen die Herren — alle Plätze sind besetzt — vielleicht gestatten Sie gütigst, dass ein Gentleman —«
Er wurde zur Seite gedrängt; von einem finofeinen Herrn, der Zylinder so glänzend wie die ausgeschnittenen Lackschuhe, die noch die bunten, gestickten Seidenstrümpfe zeigten, duftend nach allen Wohlgerüchen des Orients.
»Ach was, da braucht gar nichts gestattet zu werden! Der Zug ist voll und hier ist noch Platz und damit basta! Ich bin der Marquis Jodella du Balay, Attaché der französischen Gesandtschaft!«
Mit diesen Worten sprang er in unser Coupé und warf sich in eine Ecke.
Donnerwetter noch einmal, Attaché der französische Gesandtschaft, Marquis dazu, ja dann freilich!
Ich rutschte andachtsvoll zur Seite. Auf dem anderen Polster lag nach wie vor lang ausgestreckt Kapitän Stevenbrock, die Hände in den Hosentaschen, blinzelte gemütlich, und ebenso gemütlich erklang es jetzt:
»Ebert, schmeißen Se mal den Fatzken naus!«
Wohl, das war etwas anderes — also ich packte den Herrn Marquis und französischen Gesandtschaftsattaché beim Samtkragen, hob ihn zur Tür hinaus, setzte ihn fein säuberlich auf den Perron nieder, schlug die Tür zu — und da setzte sich der Zug auch schon wieder in Bewegung.
»Gut gemacht, mein lieber Ebert!«, erklang es gemütlich weiter. »Sehen Sie, wenn der Kerl höflich gebeten oder auch nur ganz einfach gefragt hätte, ob er hier Platz nehmen könne, selbstverständlich hätte ich es ihm erlaubt. Da bin ich doch nicht so. Aber so, wie der denkt, geht es nicht. Der mag sich uff de Puffer setzen, da gehört er hin.
Und dann nach einer kleinen Weile:
»Ja, mein lieber Ebert, das Hinaussetzen hatten Sie ganz hübsch gemacht. Aber ganz das Richtige war es doch noch nicht, es fehlte dabei — sozusagen die elegante Fixigkeit. Ich werde es Ihnen bei Gelegenheit einmal vormachen, Ihnen dabei so ein paar geheime Griffe und Kniffe zeigen, wodurch die Sache erst den richtigen Schwung bekommt. Oder Sie können auch gleich beim langen Heinrich in die Lehre gehen. Das ist nämlich unser Trainingmaster im Hinausschmeißen. Der eigentliche Waffenmeister bin ich, aber der lange Heinrich hat sich ganz aufs Hinausschmeißen gelegt. Und da hat dieser Kerl — natürlich durch viel Übung — da drin etwas losbekommen — was der für eine kraftvolle Höflichkeit mit ruhiger Grazie zu verbinden weiß — dieser elegante Schwung, den der zuletzt noch gibt — — na, Sie müssen es selbst einmal sehen, wenn der jemanden hinauspfeffert. Dieser lange Heinrich, obgleich nur gewöhnlicher Matrose, ist überhaupt sozusagen unser Anstandslehrer. Und die Kunst des Hinausschmeißens gehört heutzutage mit zur allgemeinen Bildung, sonst kommt man nicht durch die Welt, bleibt überall stecken. Nun geben Sie mir mal aus dem Koffer die Buttel her, vorausgesetzt, dass Sie noch etwas drin gelassen haben.«
Gegen 7 Uhr trafen wir in London ein, Liverpoolstreet-Station.
»Sind Sie müde?«
»Gar nicht, Herr Kapitän!«
»Hungrig?«
»Auch nicht.«
Wir nahmen ein geschlossenes Cab. Das Ziel, das der Kapitän dem Kutscher angab, hörte ich nicht.
»Wir fahren nach dem Alhambra-Theater. Dort geben meine Jungens eine Vorstellung. Verläuft alles programmmäßig, so hat sie schon angefangen, wir kommen eine halbe Stunde zu spät, ich muss Ihnen daher eine Erklärung geben, sonst geht Ihnen der tiefe Sinn des Ganzen verloren. Es handelt sich um ein Drama. Der Verfasser dieses Dramas bin ich. Es ist das einzige Drama, dass ich geschrieben habe und je schreiben werde, aber es genügt, um mir unsterblichen Ruhm für alle Ewigkeit zu sichern. Sein Titel ist: Kling Klang Klung, der Schrecken des gelben Meeres, oder der blutige Popanz in der Kleiderkiste. Der Inhalt ist kurz folgender.«
Er begann ihn mir zu schildern, so weit ich ihn wissen musste, weil ich den Anfang versäumte.
Ich hätte beim besten Willen nicht einmal lächeln können, aufrichtig lächeln. Was ich da zu hören bekam, war der horrendeste Blödsinn, der je mein Ohr getroffen. Ich konnte den Kapitän faktisch gar nicht begreifen, wurde fast etwas misstrauisch ob seiner gesunden Vernunft. Dass er es wagte, mir so etwas zu erzählen, wahrscheinlich doch in der Meinung, es sei etwas sehr Witziges.
Wir erreichten das Theater und auf Seitenwegen eine reservierte Loge.
Das Alhambra-Theater fasst 6000 Zuschauer, die riesige Bühne ist besonders für große Balletts bestimmt, ungeheure Spektakelstücke und dergleichen, bei denen manchmal mehr als tausend Personen mitwirken.
Das Theater war bis auf den letzten Platz besetzt, förmlich vollgepfropft, und auf der Bühne wurde schon feste gemimt.
Ich weiß, was dem Leser schon bekannt ist, und werde es nicht wiederholen. Bemerken will ich nur, dass die Menagerie, die sich auch besonders um seltene, exotische Tiere vermehrt hatte, noch viel mehr bei der Posse mitwirken musste, dass auch ganz neue Szenen hinzugekommen waren, die ich aber nicht schildern will.
Betonen dagegen muss ich, dass ich bisher nur von einem Schiffe »Argos« gehört hatte, deren Besatzung sich die Argonauten nannte, ja aber noch gar keine Ahnung von einem »Gauklerschiffe« hatte!
Nun lässt sich denken, wie mir zumute war, als ich auf der Bühne den Blödsinn mit der Unmenge von Tieren beobachtete.
Bald wandte ich meine Aufmerksamkeit unten dem Publikum zu, und das konnte ich um so eher tun, als auch neben mir der Kapitän, die Arme auf die Brüstung gelegt, unausgesetzt hinabspähte, nicht nur mit einem heiteren, sondern mit einem von Seligkeit wahrhaft verklärten Gesicht.
Ja, worüber lachten denn nur eigentlich die Menschen dort unten und auch oben auf den Galerien und in den anderen Logen so fürchterlich?
Fürchterlich sage ich mit Absicht.
Ich will nicht beschreiben, wie sie sich alle vor Lachen schier wälzten.
Es war aber überhaupt ein ganz merkwürdiges ein schreckliches Lachen.
Was die alle dabei für Grimassen und Fratzen schnitten!
Und dieses Kreischen, diese gellenden Töne dazwischen! Das war gar nichts Menschliches mehr.
Und weshalb trugen sie reihenweise die gleichen Uniformen oder doch ganz gleiche Anzüge? Der Kapitän bemerkte, dass auch ich hinab ins Publikum sah, und er näherte seinen Mund meinem Ohr, musste schreien, brüllen, um sich mir verständlich machen zu können.
»Das sind lauter Taubstumme! Alle Taubstummenanstalten Londons und Umgegend haben heute Abend ihren Inhalt hier ausgeschüttet. Natürlich Gratisvorstellung. Auch die eventuelle Fahrt bezahlen wir. Das Letztere sage ich, weil es meine eigene Freude ist. Diese armen Menschen werden in ihren Anstalten wohl nicht viel zu lachen haben. Und morgen Abend kommen die Kinderkrüppelheime dran. Da müssen einige Szenen gestrichen werden. Dafür aber wird mehr musiziert. Auch unser Albert wird singen, was heute Abend wenig angebracht wäre. Nun aber passen Sie auf! Jetzt kommt August der Starke, unser zweiter Bootsmann, als Kaiserin-Mutter von China, produziert sich als Ballettöööööse!!!«
So hatte mir der Kapitän aus Leibeskräften ins Ohr gebrüllt. Ich gehorchte, und plötzlich hatte ich ein so eigentümliches, warmes Gefühl in der Brust, als ich meine Blicke wieder der Bühne zuwandte. Und fünf Minuten später war es geschehen.
Erst hatte es einen Knacks gegeben, und dann hatte ich etwas wie ein Rutschen gefühlt.
Und da plötzlich wusste ich, weshalb die dort unten und die dort oben so furchtbar lachten.
Und da plötzlich machte ich mit.
Ich lachte unter Tränen und weinte unter Lachen. Und da plötzlich waren alle die ungeheuren Steinmassen, die ich während sieben Jahre in Portland gebrochen, von meinem Herzen heruntergerutscht!
>Die Vorstellung war aus. Wir versetzen uns in ein dem Alhambra-Theater nahes Hotel. Es hat keinen guten Ruf, dieses Hotel.
In einem Hinterzimmer saßen drei Herren. Zu beschreiben brauchen wir sie nicht, es hätte auch keinen Zweck. Der schlimmste von ihnen sah am harmlosesten aus, der wirklich gutmütigste schielte auf beiden Augen und fletschte die Zähne, und der Geldmann unter ihnen war schäbig gekleidet.
Schweigend rauchten sie und tranken Soda mit Whisky, und der Geldmann griff gern nach einem fremden Glase und den Zigarrenstummel steckte er in die Westentasche.
Manchmal hörte man Weiberkreischen.
Jetzt ein ganz besonderes Quieken.
»Das war die Arabella.«
»Nee, das war die saure Sally, so kann nur die quietschen.«
»Lord, war die Geheimrätin vorhin schon wieder besoffen!«
»Wissen Sie schon? Die Madonna ist in Berlin geklappt worden, hat drei Jahre Zuchthaus aufgeschmettert bekommen.«
»Viel zu wenig. Die hätte schon dreimal gehangen werden sollen.«
Wieder längeres Schweigen.
»Ob es der Phöbe gelingt?«
»Müssen's abwarten.«
»Es wird wieder nichts.«
»Diese Kerls können alle wie die Löcher saufen.«
»Sie müssen ein Mittel haben, das die Wirkung des Alkohols aufhebt.«
»Gibt es nicht.«
»Das sagen Sie, Mister Cratch?! Dann glauben auch wir nicht an Ihr Mittel.«
»Sie werden's erleben, dass es wirkt.«
»Ja, Hypnose erzeugen. Aber auch im tiefsten hypnotischen Schlafe ist es nicht möglich, einem willensstarken Menschen ein Geheimnis zu entlocken, das er wahren will.«
»Ich werde beweisen, dass es dennoch möglich ist.«
»Diesen Beweis verlange ich auch, eher bekommen Sie nicht meine tausend Pfund!«, sagte Mister Fischer, der Geldmann, der sich aber hier in England nur mit sh schrieb.
Da wurde die Tür aufgerissen, heftig trat eine Dame ein, ein blendend schönes Weib.
Nur durfte man es sich nicht gar so genau ansehen.
Es war gar zu viel Farbe aufgetragen.
Und unter einer Flechte sah man, dass ihr prächtiges aschblondes Haar eigentlich fuchsbraun war, auch schon stark zu ergrauen begann. Immerhin, ein wirklich berückend schönes Weib!
Und reich!
Ihre mit Diamanten förmlich gepanzerten Finger konnte man auf mindestens zweimalhunderttausend Mark taxieren.
Vorausgesetzt, dass es wirklich Diamanten gewesen wären.
Der eine Goldreif, von dem zwei zehnkarätige Diamanten, drei Rubinen und vier erbsengroße Perlen ausgebrochen waren, färbte sogar ab.
Immerhin das Kostüm, das sie trug, mehr für Ball als Gesellschaft berechnet, war noch vor zwei Monaten in der Regent Street mit hundert Guinees ausgezeichnet gewesen, 2100 Mark. Freilich hatte es inzwischen viermal die Besitzerin gewechselt, und schon die zweite hatte mit dem großen Rotweinfleck, eingerahmt von Mayonnaisensauce, herumlaufen müssen, und bei der dritten war noch ein zartes Ornamentmuster von hellgrüner Oliventunke dazugekommen.
»Ick haabe eenen jekitscht!«, jubelte der schöne Mund mit den wunderbar roten Lippen, natürlich zum Küssen wie geschaffen, nur dass sie etwas aufgeplatzt, waren, und wie sie dabei die Federboa zurückwarf hatte sie oben so ziemlich gar nichts mehr an, es begann erst wieder unter den Achseln.
»Sprechen Sie englisch, Madame Phöbe! Einen Matrosen?!«
Groß war die Aufregung.
»Den ersten Steuermann.«
Noch größer wurde die Aufregung.
»Ist nicht möglich!«
»Was krieg ich, wenn er's ist?«
»Von der ›Argos‹?«
»Sicher.«
»Wie heißt er?«
»Ernst Scholz!«
»Stimmt! Der erste Steuermann von der ›Argos‹! Haben Sie ihm das Pulver schon beigebracht?«
»In einer Tasse Kaffee.«
»Er schläft?«
»Wie eine chloroformierte Ratte.«
»Einen Whisky sollen Sie für diese Botschaft haben!«, sagte Mister Cratch, der so harmlos Aussehende, im Übrigen der eleganteste Gentleman, nach der Flasche greifend.
»Ja, Lude, jieb mich erst eenen Whisky!«, fiel Madame Phöbe noch einmal in ihre Muttersprache zurück.
Mister Cratch alias Lude schenkte ein Wasserglas halb voll Whisky und wie er es dem Weibe reichte, beim Zugreifen mit der Hand darüberfahrend, war es schon geschehen, ohne dass auch der schärfste Aufpasser etwas davon bemerkt hätte.
Es war ein ausgezeichneter Taschenspieler, der in die gelbe Flüssigkeit etwas hatte gleiten lassen, was sich sofort auflöste.
Madame Phöbe nahm das Glas, goss die große Portion Whisky hinter, als wäre es Wasser. Mit einem Male ging ein Ruck durch ihren Körper, sie verdrehte die Augen ganz nach oben, dass man nur noch das Weiße sah, dann begannen die Lider zu zittern, senkten sich, und so stand sie da, wie sie in der letzten Bewegung gestanden, das Glas mit einem kleinen Rest Whiskys noch an den Lippen, regungslos, wie erstarrt.
Der elegante Gentleman machte gegen die anderen beiden Männer eine Verbeugung mit entsprechender Handbewegung nach dem Weibe.
»Da ist der Beweis, dass mein Mittel wirksam ist. Ich habe ihr in dem Trank das Pulver beigebracht.«
»Beweis?«, meinte Mister Fischer. »Vorläufig sehe ich noch gar keinen Beweis. Dass es auch innerliche Mittel gibt, um hypnotischen Schlaf zu erzeugen, sofort, weiß ich selber.«
»Aber Sie sollen den vollgültigsten Beweis sofort erhalten, dass durch mein Mittel jedes Geheimnis entlockt werden kann. Madame Phöbe, hören Sie mich jetzt sprechen?«
Leise, wie jetzt immer gesprochen wurde, aber mit scharfer Stimme hatte es Mister Cratch zu der Erstarrten gesagt. Ein Seufzen und Zittern ging durch den ganzen Körper.
»Ich... höre!«, erklang es dann lallend aus dem etwas geöffneten Munde.
»Sie werden mir unbedingt gehorchen!«
»Ich... gehorche.«
»Sie können ganz fließend sprechen! Ich befehle es Ihnen! Was können Sie?«
»Ich kann ganz fließend sprechen!«, erklang es jetzt ganz anders.
»Madame Phöbe! Was ist die letzte Tat, die Sie begangen haben, die jetzt schwer Ihr Gewissen beunruhigt, weil Sie eine Entdeckung befürchten. Na? Antwort!«
Er definierte näher, was er meinte, wenn sie sich sträubte, befahl eindringlicher, zu beichten, und schließlich kam es heraus, wobei sie sich in dieser seelischen Verfassung wieder ihrer geliebten Muttersprache bediente:
»Ick haab ihm zwee Sovereigns un enne halbe Krone un enne Fünfpfundnote jeklaut.«
»Wem?«
»Meinem Jeliebten.«
»Dem Mister Key, der ist doch jetzt Ihr Geliebter!«
»Ja.«
»Und dem haben Sie dieses Geld gestohlen?«
»Nee.«
»Wem denn nur sonst?«
»Ihm.«
»Wer ist dieser ›Ihm‹. Erklären Sie es näher, ich befehle es Ihnen!«
»Dem Steuermann!«
Ahaaa!
Sie gestand es ausführlicher.
Sie hatte den Herrn, den sie auf der Straße aufgelesen, freilich nicht etwa so zufällig, und mit in dieses Hotel gebracht, durch ein Tränklein im Kaffee betäubt, und wie er so schlafend im Lehnstuhl gesessen, hatte sie es nicht über sich gebracht, hatte erst einmal seine Taschen untersuchen müssen.
In der Hosentasche mehr Gold als Silber, in der Brusttasche ein ganzes Bündel Fünfpfundnoten, und da hatte sie es noch weniger über sich gebracht, sie hatte eine halbe Krone, zwei Goldstücke und eine Fünfpfundnote entwenden müssen.
Es gehörte mit zu dem Metier dieses Frauenzimmers.
»Haben Sie dieses Geld bei sich?«
»Ja.«
»Wo?«
Nicht etwa in der Tasche. Sie nannte ein ganz intimes Versteck an ihrem Körper.
Weshalb hatte sie das gestohlene Geld nicht einfach in der Tasche? Es zeigte sich dann, dass sie tatsächlich viel Geld einstecken hatte, in der Taschenbörse und auf dem Busen, was bei solch einem Weibe doch nicht auffällig war.
Aber ganz folgerichtig war es, dass sie dieses zuletzt gestohlene Geld äußerst sorgfältig versteckt hatte. So versteckt auch der Rabe das Meiste, ohne es nötig zu haben.
Und das wussten diese drei Männer, sie wunderten sich nicht im Geringsten. Die kannten solche verkommene Frauencharaktere besser als der geschickteste Psychiater.
»Bitte, untersuchen Sie sie selbst, meine Herren, ob es stimmt, ich will meine Hände ganz davon lassen!«, sagte Mister Cratch. Ganz skrupellos gingen die beiden anderen Männer an die intime Leibesvisitation. Das genannte Geld wurde richtig an der bezeichneten Stelle gefunden, dort natürlich auch gelassen.
Wieder machte der Hypnotiseur eine tiefe Verbeugung. Er hatte ganz sicher schon auf der Bühne gestanden.
»Nun, Mister Fischer, genügt Ihnen dieser Beweis, dass in diesem hypnotischem Zustande, durch das von mir erfundene Mittel, auch der stärkste Eigenwille vollständig gebrochen wird?«
Der Gefragte rieb sich das glattrasierte Kinn.
»Ja dann allerdings — — oder nee, noch nicht — da könnte doch — da weiß ich noch etwas anderes — — fragen Sie sie doch einmal — — oder kann ich sie nicht einmal etwas fragen?«
»Gewiss. Ich muss nur erst die Willensgewalt auf Sie übertragen.«
»Tun Sie es.«
Es geschah durch entsprechende Befehle.
»Madame Phöbe, hören Sie mich sprechen?«, fragte jetzt Mister Fischer, der jedenfalls in solchen hypnotischen Experimenten mit allem ihrem Unfug auch schon sehr bewandert war.
»Ich höre Sie.«
»Sie werden mir bedingungslos gehorchen!«
»Ich gehorche bedingungslos.«
»Mir die absolute Wahrheit sagen.«
»Die absolute Wahrheit.«
»Wie alt sind Sie, Madame Phöbe?«
Ein Zögern, ein Ringen mit sich selbst, dann aber kam es auch ohne weitere Aufforderung heraus:
»Achtunddreißig Jahre.«
»So, det jeniegt mir als Beweis, dass Ihr Mittel wirkt«, sagte Mister Fischer einfach, den Klemmer, den er einmal auf seine etwas zerfressene Nase gepflanzt hat, wieder in die Westentasche steckend, »wecken Se se uff.«
Mister Balin, wie er genannt wurde, der dritte dieser Ehrenmänner, schielte nach beiden Wänden und fletschte die Zähne.
»Was, 38 Jahre?! Sie sagt immer, sie wäre erst 24, das gibt sie auch vor Gericht an. Aber erst gestern hat sie in Crispis Blair beim Haupte ihres Kindes, das zugegen war und an dem sie mit wahrer Affenliebe hängt, geschworen, dass sie 29 Jahre alt wäre, nicht älter. Oder ihre Nelly solle auf der Stelle sterben. Und nun gesteht sie, dass sie schon 38 ist.«
»Ja, eben deswegen genügt es mir. Mister Cratch, wenn Sie jetzt auch aus dem Steuermann das herausholen, was wir wissen wollen, dann haben Sie sich die tausend Pfund verdient. Wecken Se se uff.«
Es geschah mit einigen Vorbereitungen. Natürlich musste es ein erinnerungsloses Wachen sein.
»Wachen Sie auf!«
Ein Ruck durch den ganzen Körper, die Augen öffneten sich, die Pupillen kehrten zurück, der letzte Rest des Whiskys wurde ausgetrunken — und das Weib wusste nichts anderes, als dass es soeben das Glas erhalten und geleert habe. Ein Zeitunterschied kam nicht in Betracht. Dies alles hätte sich ja viel, viel schneller abgespielt, als es erzählt und gelesen werden kann, es war alles Schlag auf Schlag gegangen.
»Na dann vorwärts, wir dürfen den Schläfer nicht lange allein lassen!«
Alle vier traten hinaus, durchschritten den Korridor. Ob sie gesehen würden oder nicht, war ihnen gleichgültig. In diesem Hotel geschah noch etwas ganz anderes als solch eine Massenwanderung aus einem Zimmer ins andere.
»Sie kann ihn doch nicht etwa schon ausgefragt, ihm das Geheimnis schon entlockt haben?«, flüsterte Mister Fischer dem Hypnotiseur auf diesem Wege nur einmal zu.
I Gott bewahre! Darüber konnte Mister Cratch den ängstlichen Geldmann mit einigen wenigen Worten beruhigen.
Er hatte dem Weibe doch natürlich nur ein Tränklein gegeben, um den geköderten Mann von der »Argos« einfach zu betäuben. Jenes andere Mittel gab er nicht aus der Hand, das war sein ureigenstes Geheimnis, das er der Hölle entwendet hatte.
Vor einer der nummerierten Zimmertüren zog Madame Phöbe einen Schlüssel hervor und schloss sie auf.
In einem Lehnstuhle schlummerte sanft ein Herr, den wir zur Genüge kennen — unser Freund Ernst, ehemals der zweite, jetzt also der erste Steuermann der »Argos«. Sein Vorgänger hatte schon vor einem halben Jahre die große Reise angetreten, von der es keine Rückkehr gibt — eine brechende Trosse hatte ihn ins Jenseits befördert.
Ernst trug natürlich keinen blauen Anzug nach Seemannsschnitt, mit trichterförmigen Hosen. Sonst wäre er doch ein Matrose gewesen. Er trug ganz einfach, wie jeder andere Mensch, der es sich leisten kann und kein Geck ist, einen modernen, sehr gediegenem aber ganz unauffälligen Straßenanzug.
Aber jedes Kind in irgend einem größeren Hafen der Welt, wenn es diesen schneeweißen Umlegekragen — Stehkragen vollständig ausgeschlossen — und darüber das kupferbraune Gesicht sah, konnte sofort sagen: das ist ein Offizier, ein Steuermann von einem deutschen Handelsschiffe!
»Sie schlafen! — — Sie werden mir gehorchen, bedingungslos gehorchen! — — Sie können ganz fließend sprechen! — — Sie werden mir immer die Wahrheit sagen, ich befehle es Ihnen!«
So und ähnlich traf der Hypnotiseur wieder seine ersten Vorbereitungen, diesmal noch viel umständlichen viel vorsichtiger.
»Wie heißen Sie?«
»Ernst Scholz.«
»Was sind Sie?«
»Seemann!«
»Welche Stellung bekleiden Sie jetzt?«
»Ich bin erster Offizier auf der ›Argos‹.«
»Wie heißt der Kapitän dieses Schiffes?«
»Georg Stevenbrock.«
»Wissen Sie, wo der die Ambra und die Edelsteine herbekommt, die er schon wiederholt in den verschiedensten Hafenplätzen der Welt auf den Markt gebracht hat?«
Der Schläfer wurde unruhig, bejahte aber auf nochmaligen Befehl, gehorsam zu sein und immer die Wahrheit zu sagen.
»Sie wissen es?«
»Ja.«
»Wo haben Sie die Ambra her?«
Es erfolgte keine Antwort, wie der Hypnotiseur auch fragte und befahl.
»Sie wollen es mir nicht sagen?« — »Nein.«
Wir haben schon öfters über die Hypnotik und die Grenzen ihrer Macht gesprochen, brauchen es nicht zu wiederholen. Im Kriminaldienst versagt sie vollkommen. Das heißt jene Hypnotik, die wir heute kennen.
Mister Cratch zog aus seiner Tasche eine rohe Kartoffel hervor, mit der er sich für gewisse Zwecke verstehen hatte.
Man wollte sich hier doch nicht etwa mit hypnotischen Experimenten belustigen. Dieser Mann wusste schon, was er tat.
»Öffnen Sie die Augen!«
Zitternd hoben sich die Lider, nur das Weiße vom Auge war zu sehen.
»Sehen Sie mich an.«
Die Pupillen wanderten nach unten, die gläsernen Augen starrten. »Sehen Sie mich?« — »Ja.«
»Was habe ich hier in meiner Hand?« — »Eine Kartoffel.«
»Sie irren.« — »Nein.«
»Das ist doch ein Pfirsich!«
»Nein, es ist eine Kartoffel.«
»Ich sage Ihnen aber, dass es ein Pfirsich ist!«
»Ja, es ist ein Pfirsich!«, gab der Hypnotisierte jetzt kleinlaut zu.
So etwas ist in der Hypnose möglich, das ist auch wieder etwas ganz anderes.
»Nein, es ist ein Apfel!«
»Es ist ein Apfel!«, wurde jetzt auch gleich wieder zugegeben
»Nehmen und essen Sie den Apfel!«
Der Hypnotisierte griff zu, biss in die rohe Kartoffel hinein.
»Schmeckt der Apfel gut?« — »Ja.«
»Der schmeckt doch ganz sauer!«
Der Hypnotisierte hörte auf zu kauen, verzog den Mund und das ganze Gesicht.
»Ja, ganz sauer.«
»Nein, er schmeckt süß und lieblich!« — »Ja, ja.«
Mit Wohlbehagen verspeiste der Hypnotisierte weiter die rohe Kartoffel. Mister Cratch suchte etwas in dem Innenfutter seines Gehrockes.
»Ich hatte doch... Madame Phöbe, haben Sie nicht eine Nadel bei sich?«
Ja, eine lange Hutnadel hatte sie in der Frisur.
»Was wollen Sie tun?«, flüsterte Mister Fischer. »Ihn doch nicht etwa stechen?«
»Ja, ich muss ihn auch noch dieser Probe unterziehen. Oder vielmehr ihn vorbereiten. Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit ihm. Er hat noch zu viel Eigenwillen. Dann, wenn ich ihm das andere Mittel gebe, ist das nicht mehr möglich, das wirkt wieder ganz anders. Ich muss ihn einmal stechen...«
»Aber wenn er erwacht!«
»Ganz ausgeschlossen. Das wissen Sie doch selbst, Mister Fischer, Sie haben doch selbst oft genug hypnotisiert.
»Ich meine nachher beim Erwachen, da merkt er doch die Stichwunde, hat Schmerzen.«
»Nun, da hat ihn Madame Phöbe einfach versehentlich mit ihrem Haarspieß in den Arm gestochen, sie nimmt eine entsprechende Stellung ein, der suggerierte Schmerz ist zugleich das Signal zum Erwachen. Darüber instruiere ich Sie nachher noch, Madame Phöbe.«
Der Hypnotisierte hatte die rohe Kartoffel mit Wohlbehagen ganz aufgegessen.
»Sehen Sie hier die lange Nadel in meiner Hand?« — »Ja.«
»Ich werde Sie jetzt ziemlich tief in den linken Arm stechen.«
Sofort verzog der mit offenen Augen Schlafende schmerzhaft das Gesicht und streckte abwehrend beide Hände vor.
»Nein, nein!«
»Sie werden nicht den geringsten Schmerz dabei empfinden.«
»Doch, doch...«
»Nein, sage ich! Sie werden nicht den geringsten Schmerz dabei empfinden, wenn ich Sie jetzt in den Arm steche!«
»Nicht den geringsten Schmerz!«, murmelte der Hypnotisierte jetzt gehorsam.
Mister Cratch stach ihn mit der Nadel in den rechten Oberarm, ziemlich tief. Einen Zentimeter tief musste die Nadel mindestens ins Fleisch gedrungen sein. Bluten tat die Wunde natürlich, aber es waren ja Hemd und Jacke darüber.
Der Hypnotisierte hatte mit keiner Wimper gezuckt.
»Hat es weh getan?«
»Gar nicht.«
»Haben Sie überhaupt gemerkt, dass ich Sie gestochen habe?«
»Ja — nein — ja — ich weiß nicht...«
Jedenfalls hatte er nicht den geringsten Schmerz dabei gehabt.
Das ist möglich, in der Hypnose vollkommene Schmerzlosigkeit zu suggerieren! Jede Operation lässt sich schmerzlos ausführen. Aber aus gewissen Gründen, die hier nicht erörtert werden können — es sind psychische oder sogar ethische — ist eine betäubende Narkose irgend welcher Art immer vorzuziehen. Das Hypnotisieren sollte ganz verboten werden. Wer etwa sein Kind hypnotisiert, begeht einen viel größeren Frevel, als wenn er ihm Schnaps zu trinken gibt, um sich an den im berauschten Zustande begangenen Torheiten zu ergötzen.
»So, jetzt ist er präpariert. Madame Phöbe, verlassen Sie das Zimmer, warten Sie, bis wir Sie wieder rufen.«
Das Weib entfernte sich, hinter ihr wurde wieder die Tür geschlossen.
Diese dunklen Ehrenmänner hatten dieses Weib natürlich ganz in der Hand, die durfte nichts verraten, aber zu hören brauchte sie doch nicht alles.
Jetzt füllte Mister Cratch aus der Wasserkaraffe ein Glas, hatte wieder etwas hineingemischt, ohne dass es jemand gemerkt.
»Trinken Sie dieses Wasser.«
Der Hypnotisierte leerte das Glas. Eine Veränderung an ihm war nicht zu beobachten.
»Sie werden mir bedingungslos gehorchen!«
»Ich gehorche.«
»Mir auf jede Frage nur die reine Wahrheit antworten!«
»Nur die reine Wahrheit.«
»Wie heißen Sie?«
»Ernst Scholz.«
»Das ist nicht wahr!«
»Doch.«
»Nein! Sie heißen Fred Bendmann! Wie heißen Sie?«
»Ich heiße Ernst Scholz.«
Jetzt musste es also wohl eine ganz andere Art von Hypnose sein.
»Woher bekommen Sie die viele Ambra?«
Da fing der Hypnotisierte doch wieder zu zögern an.
»Antwort! Ich befehle es Ihnen! Wo bekommen Sie die viele Ambra her?«
Da war der Widerstand besiegt.
»Wir finden sie.«
»Wo?« — »An einer Küste.«
»An welcher Küste?«
»Bei der Wollastone-Insel!«
»Wo liegt die?«
»Südlich vom Feuerland.«
Der zähnefletschende Mister Balin, der den Eindruck eines Seemanns machte, hatte unterm Arm eine große Ledermappe mitgebracht, entnahm ihr jetzt sofort einige Land- und Seekarten, hatte die des südlichsten Teils Amerikas schnell gefunden, breitete sie auf dem Tische aus.
»Gibt es dort eine Wollastone-Insel?«
»Wollastone-Insel, stimmt.«
»Am Fundort ist doch gewiss eine geografische Ortsbestimmung gemacht worden?«, wurde der Hypnotisierte weiter bearbeitet. — »Ja.«
»Ist sie Ihnen bekannt?« — »Ja.«
»Haben Sie sie im Kopfe?« — »Ja.«
»Nun, wie lautet sie?«
Wieder einmal ein Zögern, das aber schnell besiegt wurde.
»51 Grad 2 Minuten 42 Sekunden südliche Breite, 67 Grad 34 Minuten 18 Sekunden westliche Länge!«, kam es dann fließend heraus.
Solche bemerkenswerte Bestimmungen behält jeder Seemann im Kopfe, wenn es nicht ein ausgesprochener Blechkopf ist; das gehört zu seinem Berufe, so wie jeder andere Mensch eine Unmenge von Hausnummern, Geburtstagsdaten und dergleichen im Kopfe hat, ganz abgesehen von Geschichtszahlen.
Schon wurden die angegebenen Zahlen, die noch zweimal wiederholt werden mussten, von drei Bleistiften notiert, und zwei davon zitterten vor Aufregung.
»Es ist gar nicht nötig, meine Herren, dass Sie sich das mitschreiben, das besorge ich schon«, meinte Mister Fischer, dessen Hand allein nicht vor Aufregung zitterte.
»Besser ist besser.«
»Dass Sie die Notiz nur nicht in fremde Hände kommen lassen.«
»Ohne Sorge, so wenig wie Sie.«
Die Karte wurde noch einmal befragt. Ja. Diese geografische Bestimmung bezog sich gerade auf die Wollastone-Insel.
Der Hypnotisierte wurde wieder vorgenommen. Er offenbarte weiter, durch geeignete Fragen unterstützt, dass sich dort in einer riesigen Wassergrotte die Ambra in ungeheuren Massen aufgespeichert hatte.
Dort in dieser unwirtlichen Inselregion des Feuerlandes gibt es eben noch zahllose Pottwale, deren abgesetzter Blasenstein durch die Meeresströmung wahrscheinlich gerade in diese Grotte getrieben wurde, und das war nun schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden geschehen.
Die Menge der dort aufgehäuften Ambra hatte noch gar nicht taxiert werden können.
Die Felsengrotte lag in einer Bucht, die Einfahrt war auch für das größte Schiff bei einigermaßen gutem Wetter und nicht gar zu hohem Seegange, gar nicht schwierig.
Die angegebene Ortsbestimmung genügte vollkommen, um diese Bucht zu finden, dann sah man den Eingang zu der Grotte sofort, und auch schon vorher war alles Wasser mit schwimmender Ambra bedeckt
Das war aus dem Hypnotisierten nach und nach herausgebracht worden. Ein geläufiges Berichten gibt es in diesem Zustande ja nicht.
»Woher hat Kapitän Stevenbrock von diesem Ambralager erfahren?«
»Das weiß ich nicht.«
Es wurde zum zweiten Teile übergegangen.
»Wo bekommen Sie die Diamanten und anderen Edelsteine her?«
»Wir finden sie.«
»Wo?«
Diesmal zögerte der Hypnotisierte nicht im geringsten mehr, den Verrat zu begehen.
An der brasilianischen Küste, dort, wo das Gebirge von Parahyba bis ans Meer tritt, in der Mündung eines Flusses, der zu denen gehörte, die in dem Riesenreiche noch nicht einmal einen Namen besitzen, obgleich breit und tief genug, um das größte Schiff einzulassen. Aber es ist von dort nichts zu holen, oder anderswo hat man es doch viel bequemer, man kennt schon das Fahrwasser.
Nun, der erste Steuermann der »Argos« konnte Kurs und Peilung ganz genau angeben, und Mister Balin notierte.
Etwa acht Meilen stromauf, Seemeilen, dann vor einer großen Insel rechts in einen kleineren Fluss abbiegen, der aber immer noch ein Schiff von 5000 Tonnen wie die »Argos« auch zur wasserärmsten Zeit bequem trug, dieser Fluss kam aus einem kleinen See heraus, oder richtiger einem Bassin, denn es war von hohen Felswänden eingefasst, ein mächtiger Wasserfall stürzte herab, und auf der anderen Seite des Bassins, diesem Wasserfalle genau gegenüber, da lagen in einer Tiefe von sechs bis acht Metern, je nach dem Wasserstande, die Diamanten und Rubine und Smaragde und Saphire massenhaft auf dem kiesigen Grunde.
Es waren sogenannte Waschedelsteine. Sie wurden durch einen unterirdischen Fluss aus ihrer Lagerungsstelle herausgewaschen, die natürlichen Kristallflächen waren schon tüchtig abgeschliffen.
Unermesslich waren die Schätze, die hier lagerten. Auch für diese Fundstelle wurde die geografische Ortsbestimmung gegeben, und jetzt zitterte auch Mister Fischers Hand vor Aufregung, als er sie notierte.
Mag auch die Ambra dem Gewichte nach den doppelten und dreifachen Wert des Goldes haben — solche Edelsteine bedeuten doch noch etwas ganz, ganz anderes! Zumal Rubine! Der Rubin ist bekanntlich noch weit kostbarer als der Diamant, übertrifft ihn um das fünf- bis zehnfache, und sein Karatwert wächst auch noch ganz anders. Kostet ein Karat Rubin 1000 Mark — und unter dem ist es heute kaum noch zu haben — so würde einer von derselben Schönheit, aber von fünf Karat, schon 80 000 Mark kosten!
Und dort auf dem kiesigen Grunde lagen die Rubine wie die reifen Kirschen herum, wenn der Sturm den Baum tüchtig geschüttelt hat oder ein Schwarm Amseln eingefallen ist.
Und dasselbe galt von all den anderen Edelsteinarten. Man musste Maß halten, sonst konnte der ganze Edelsteinmarkt entwertet werden.
Die »Argos« war erst ein einziges Mal dort gewesen, was die Taucher aufgesammelt hatten, kam gegen die ungeheure Menge gar nicht in Betracht, und obgleich man schon an verschiedenen Handelsplätzen hunderte der schönsten Steine verkauft hatte, immer heimlich unter der Hand, befand sich an Bord noch ein großer Korb voll der glitzernden Dinger. Woher dem Kapitän oder einem anderen diese Fundstelle unter Wasser bekannt geworden, wusste der Steuermann auch in diesem Falle nicht. Er war der erste Offizier, aber kein Vertrauter des Kapitäns und der Patronin, wurde in die Geheimnisse nicht eingeweiht.
So, das war erledigt, nun musste man sich nur noch über eines vergewissern, und Mister Fischer übernahm das Fragen selbst.
»Haben Sie dort eine Wache zurückgelassen?« — »Nein.«
»Oder sonstige Sicherheitsmaßregeln getroffen?« — »Welche?«
»Etwa Minen gelegt?« — »Wozu?«
»Um ein anderes Schiff, welches dorthin kommt, in die Luft zu sprengen.« — »Nein.«
»Gar nichts dergleichen?« — »Gar nichts.«
»Kann das Edelsteinlager nicht von anderen durch Zufall gefunden werden?« — »Nein.«
»Sollte das Wasser nicht in solch einem Felsenbassin ganz rein und klar sein?« — »Das ist es.«
»Sieht man da die Edelsteine in solch geringer Tiefe nicht auf dem Grunde liegen?« — »Nein.«
»Weshalb nicht?«
»Weil der Wasserfall die ganze Oberfläche des Bassins kräuselt.«
Dann allerdings ist die Durchsichtigkeit auch des klarsten Wassers aufgehoben. Oder es bedarf erst eines besonderen Mittels, um die Wirkung der Wellen oder nur Kräuselung aufzuheben, wie später gezeigt werden soll.
»Wann fahren Sie wieder an diese Fundstelle?«
»Das weiß ich nicht.«
»Wohin fahren Sie von hier aus?«
»Nach Rangoon.«
»Was wollen Sie dort?«
»Wir nehmen 3000 Tonnen Weizen oder Mehl mit.«
Wozu diese Fracht, danach braucht nicht gefragt zu werden, das wusste man dann von selbst sofort. In Hinterindien war infolge der diesjährigen Missernte eine Hungersnot ausgebrochen.
»Ist sonst noch etwas zu befragen?«
Man wusste nichts.
Madame Phöbe wurde wieder herbeigeklingelt, sie erhielt ihre Instruktion, der Hypnotisierte seine Suggestion wegen des erinnerungslosen Erwachens.
Die drei Männer entfernten sich.
Das Weib setzte sich dem Schläfer auf den Schoß, umschlang ihn.
»Erwache!«
Der Steuermann zuckte zusammen, verzog schmerzhaft das Gesicht, griff mit der rechten Hand nach dem linken Oberarm.
»Auuu — verdammt, Mädel, was war denn das?!«
»O, entschuldige, ich habe Dich wohl mit meiner Hutnadel etwas gestochen.«
»Na, ich danke, etwas! Das war ja gerade, als ob — — never mind, ich bin nicht so empfindlich. Ich habe wohl geschlafen? Ja, ich war schon vorhin hundemüde. Nun ist's vorbei. Na da komm her, Du Zuckerschnutchen...«
Die »Argos« lag im East-India-Dock und hatte 3000 Tonnen russischen Weizen eingenommen, in England zollfrei, dazu noch fast 1000 Tonnen Fleisch und Konserven und andere Nahrungsmittel aller Art.
Diese Fracht nahmen die Argonauten selbst über, kein fremder Arbeiter durfte das Schiff betreten. Sie verfügten ja auch über mehr als hundert Paar starke Arme. Und das meiste besorgten ja die Krane, nur die Fässer und Kisten mussten verstaut werden, der Weizen floss, durch Ex- oder hier vielmehr Inhaustoren, eingepumpt von ganz allein in den unergründlichen Schiffsbauch.
Sonst brauchten nur noch einige nicht eben sehr rücksichtsvolle Matrosen als Posten auf der Laufbrücke zu stehen, um den Ansturm des neugierigen Publikums abzuwehren, eine Flut von Briefen, wie damals in Gibraltar ausführlich geschildert wurde, gab es nicht mehr.
Es wurde einfach kein einziger Brief mehr angenommen. Mit Ausnahme, wenn das Kuvert den aufgedruckten Vermerk trug: In Service of His Majesty. Also amtliche Schreiben. Von denen der König natürlich nichts zu wissen braucht. Wer nun dem Kapitän oder sonst jemandem an Bord dieses Schiffes etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen hatte, der hatte hierzu immer noch eine Möglichkeit. Er ging zur nächsten Polizeibehörde oder zu einer sonstigen königlichen Behörde, trug sein Anliegen vor, und wurde dieses für wichtig genug befunden, so wurde das Protokoll darüber oder sein eigenes Schreiben im amtlichen Kuvert weiterbefördert.
Es ist dies eine höchst praktische Einrichtung in England. Eine wahre Wohltat besonders für reiche und berühmte Leute, die sonst mit Briefen erstickt würden, und gelesen müssen sie doch schließlich alle werden, denn es kann doch einmal etwas Wichtiges darunter sein.
So einfach ist es nun freilich nicht, einen Privatbrief durch eine königliche Behörde an die gewünschte Adresse vermitteln zu lassen. Liebesbriefe und Angebote von wahnsinnigen Erfindern werden natürlich nicht befördert. Da ist schon mancher schwärmerische Backfisch mit einem Donnerwetter an die frische Luft gesetzt worden. Außerdem kann solch ein Antrag auch bestraft werden, ebenso als wenn man unnötiger Weise eine Feuerglocke gezogen hätte.
Ebenso schwer ist es, solch ein amtliches Kuvert nachzuahmen. Die Aufschrift muss gedruckt sein, es ist schon ein ganz besonderes Papier, und auf Fälschung des Stempels steht hard labour, Zuchthaus.
Dasselbe gilt auch für Postpakete.
Ab und zu lief ja ein privates Schreiben in solch einem amtlichen Kuvert auf der »Argos« ein, aber doch nur ganz spärlich und auch diese Briefe waren bisher ohne jede Bedeutung gewesen.
Wohin Angehörige ihre Briefe zu richten hatten, das wussten diese, und von dort wurden sie abgeholt.
Wieder einmal war solch ein Brief »Im Dienste Seiner Majestät« gebracht worden. Wie immer von einem einfachen Briefträger.
Kapitän Stevenbrock befand sich gerade an Deck, nahm ihn ab, erbrach ihn.
Ich beschwöre Sie, mich heute Nacht zwischen zehn und elf an Bord zu empfangen. Eine furchtbare Gefahr bedroht Sie und Ihr ganzes Schiff. Wenn Sie mich >empfangen wollen, so lassen Sie einen Wächter auf dem Laufbrett einen roten Schal um den Hals tragen. Ich selbst werde über dem rechten Auge eine schwarze Binde haben. Verlassen Sie sich darauf: Ihr Schiff und die ganze Mannschaft ist rettungslos verloren, wenn Sie mich nicht hören.
Ein Verbrecher, der gern wieder ein ehrlicher Mensch werden möchte.
Stevenbrock steckte den Brief in die Brusttasche.
»Was geht heute letzte Wache?«, fragte er den nächsten Matrosen.
»Steuerbord.«
»Ist der Zweite an Bord?«
»Dort achtern steht er.«
»Hole ihn.«
Er kam, der jetzt den Rang des zweiten Steuermanns einnahm, einer, der einmal neu hinzugekommen war, Olas Folkenstorm, ein junger, riesenhafter Norweger, ganz aus Erz gegossen.
»Heute in der letzten Wache legt einer der Brückenläufer ein grellrotes Schaltuch um den Hals. Wenn ein Mann mit einer schwarzen Augenbinde kommt — er wird mir vorgelassen. Verstanden?«
»Ay, ay, Käpten.«
»Gut.«
Wie Stevenbrock dem Kommenden entgegengeblickt, so blickte er jetzt dem Davongehenden nach.
»Ich bewundere keine nordische Heldengestalt aus Erz mehr«, murmelte er, »ich habe eine lebendig an Bord.«
Er begab sich in die Kajüte.
Das war am späten Nachmittage gewesen, und dieser verging vollends.
Die Nacht brach an und mit ihr der Temperaturwechsel.
Während es in dem ganzen Inselreiche jetzt immer feuchtkalt gewesen war, hatte drüben in Frankreich eine außergewöhnliche Wärme geherrscht, jetzt im September. Und jetzt trug der neu eingesetzte Südwind diese Hitzwelle, aus Afrika kommend, über den Kanal herüber, ohne eine Abkühlung zu finden.
Es herrschte plötzlich, besonders im Gegensatz zu früher, eine Temperatur wie in einem Backofen.
Kurz vor acht erschien der Kapitän wieder an Deck.
»Steuermann der Wache!«
Der erste Offizier meldete sich, unser Ernst.
»Der letzten Wache übergeben: Laufbrettwache wird heute Nacht verdoppelt, unter Bootsmann.«
»Laufbrettwache wird heute Nacht verdoppelt, unter Bootsmann!«, wiederholte der Offizier.
»Sonst ist nichts belegt.«
»Sonst nichts belegt.«
»Recht so.«
Der Kapitän begab sich wieder in die Kajüte.
Um acht zog die neue Wache auf, die beiden Offiziere tauschten aus, der erste übergab den letzten Befehl, wodurch aber an den früheren Anordnungen nichts belegt, nichts aufgehoben wurde.
»Bootsmann!«
Der neue Unteroffizier kam, August der Starke, nur in Hemd und Hosen, das Hemd vorn auf der zottigen Brust weit offen, und obgleich er bisher an einer kühlen Stelle ruhig gelegen hatte, war der kolossale Dickwanst wie gebadet in Schweiß. In den Tropen schwitzte er nicht so. Es brachte der plötzliche Umschlag mit sich.
»Die Laufbrettwache wird verdoppelt.«
»Wohl.«
»Ihr selbst geht mit.«
»Wozu denn das?«, durfte der Bootsmann, der doch noch etwas anderes ist als ein militärischer Unteroffizier oder Feldwebel, den Steuermann wohl einmal fragen.
»Befehl des Kapitäns.«
»Wohl.«
»Wenn ein Mann mit einer schwarzen Augenbinde kommt — er wird zum Kapitän geführt.«
»Very well.«
»Und Ihr bindet hier diesen Schal um.«
Und der riesenhafte Steuermann zog aus der Hosentasche, die seinen Körperverhältnissen entsprach, einen knallroten Schal aus gestrickter Wolle hervor, so einen norwegischen, viermal um den Hals zu wickeln, für 30 bis 40 Grad Kälte bestimmt.
»Den soll ich umbinden? Wozu denn das?!«, durfte der Bootsmann jetzt mit Recht erschrocken staunen.
»Als Erkennungszeichen für den mit der schwarzen Augenbinde.«
»Dann kann ihn doch ein Matrose...«
»Geht nicht, Ihr seid als Bootsmann mit bei der Laufwache, dann könnt auch nur Ihr diese Auszeichnung tragen.«
»Muss es denn nur gerade so ein Schal...«
»Einen roten Schal, hat der Käpten gesagt, und das ist einer.«
»Vielleicht um den Bauch...«
»Um den Hals, hat der Käpten gesagt. Na, nun vorwärts!«
Der Bootsmann musste sich fügen — da half nun alles nichts, der Offizier selbst wickelte ihm das Monstrum viermal um den Hals und steckte hinten mit einer Sicherheitsnadel zu.

So gesellte sich der schwitzende Bootsmann der verdoppelten Laufbrettwache bei.
Ach, wie dieser Fleischkoloss aussah, der für seinen ungeheuren Körper einen sehr kleinen Kopf hatte, nur in Hemd und Hosen, und nun unter diesem kleinen Kopfe der umgewürgte rote Schal, dicker als der Kopf!
»He jüh, Bootsen, Ihr habt wohl Halsschmerzen?!«
»Ja, Mandelentzündung!«, knurrte der Unglückliche.
»Und da geht Ihr so mit offenem Hemd...«
»Das mache ich, wie ich will, und Du hältst Dien Mul.«
So musste der Unglückliche drei geschlagene Stunden auf dem Laufbrett ausharren, der dicke Körper umspült von einer feuchten Backofenatmosphäre, der Hals noch extra in dieser warmen Verpackung, nicht anders wissend, als dass er nun auch noch die letzte Stunde seiner Wache so schwitzen müsse.
Denn der Mann mit der schwarzen Augenbinde kam nicht.
Die Schiffsglocke schlug sechs Glasen — elf Uhr — der Kapitän betrat das Deck, näherte sich dem Laufbrett.
»Noch nichts von seiner schwarzen Binde gesehen?«
»Nein, Herr Kapitän.«
»Ja, Bootsmann, was habt Ihr denn da um den Hals gewürgt?!«, fing da Stevenbrock zu staunen an, das rote Monstrum erst jetzt bemerkend. »Der Zweite sagte, ich sollte als Erkennungszeichen einen roten Schal...«
»Mein Gott, das brauchte doch nur ein ganz dünnes Tüchlein zu sein, nur ein Gewebe!«
Da kam über den Kai, von vielen Laternen erleuchtet, eine Gestalt geschritten, in einen dunklen Staubmantel gehüllt, unter dem Schlapphut sah man schon von weitem die schwarze Binde, die das rechte Auge bedeckte.
Der Mann überschritt das Laufbrett.
»Kommen Sie mit.«
Der Kapitän geleitete ihn nach der Kajüte.
Hinter ihnen ballte der dampfende August seine ungeheuren fünfzinkigen Schaufeln zu ansehnlichen Kegelkugeln zusammen.
Aber es war kein Racheschwur, der von seinen Lippen kam, dazu war dieser ehemalige Bäckergeselle viel zu gutmütig, etwas ganz anderes war es, was er wehmütig flüsterte, ehe er den Schal von seinem Halse löste.
»Unser Käpten ist doch so gut wie allwissend geworden.
Konnte er da nicht wissen, dass der Kerl mit der schwarzen Binde erst um elf kommt?
Konnte er nicht wissen, dass der Zweite mir statt seines Tüchleins solch einen Teppich um den Hals gewürgt hat?
Freilich — mit Kleinigkeiten wird sich seine Allwissenheit wohl nicht befassen.
Aber diese drei Stunden waren für mich durchaus keine Kleinigkeit.«
»Setzen Sie sich. Wer sind Sie. Was wollen Sie? Welche Gefahr droht uns? Machten Sie es kurz.«
Der Mann nahm Schlapphut und schwarze Binde ab, und es war gar kein so unsympathisches Gesicht, das sich mit zwei ganz gesunden Augen zeigte.
Wer solch einen eleganten Staubmantel, den er nicht ablegte, trägt, muss auch darunter gut gekleidet sein, der verhungert noch nicht.
»Einer kleinen Einleitung bedarf es doch, Herr Kapitän.« — »Los!«
»Ich heiße Dan Russell. Ich bin geboren worden...«
»Das merke, ich die näheren Einzelheiten Ihrer Geburt brauche ich nicht zu erfahren.«
»Bitte, Herr Kapitän, lassen Sie mich sprechen! Sie haben mich ganz in der Hand.« — »Wieso?«
»Glauben Sie, dass eine internationale Verbrechergesellschaft existiert, welche die ganze Welt beherrscht?«
»Mir ganz egal, ob die existiert oder nicht. Meine Welt, in der ich lebe, die ich mir selbst geschaffen habe, beherrscht sie nicht.«
»Doch. Sie werden ihre Macht bald furchtbar fühlen.«
»Sie wollen mich also warnen. Los!«
»Ich brauche eine Sicherheit.«
»Sie meinen, ich könnte Sie jetzt festnehmen und ausliefern? Ich denke nicht daran.«
»Dieses Versprechen genügt noch nicht. Ich begehe einen Verrat. Das werden die, deren Sklave mit Leib und Seele ich geworden bin, schon morgen erfahren. Und sie werden mich zu finden wissen, wo in der Welt ich mich auch verberge. Und schrecklich ist das Los, das dann meiner wartet.«
»Hm. Sie wollen wohl hier an Bord bleiben?«
»Das ist es! Nur bei Ihnen bin ich geschützt.«
»Hm. Ich verstehe Sie schon. Wenn Sie mir tatsächlich eine große Gefahr offenbaren, in der wir schweben, vor der Sie uns schützen können, so will ich Sie recht gern an Bord behalten.«
»Ich danke Ihnen, Herr Kapitän! Ich brauche nicht erst Ihr spezielles Ehrenwort mit Handschlag...«
»Bekommen Sie auch nicht. Mein einfaches Wort genügt. Na?«
Der Mann holte etwas aus.
»Ich bin von Beruf Kupferstecher. Ich will mich nicht entschuldigen. Es war keine Not, die mich dazu trieb, Banknoten zu fälschen. Ich habe gespielt.
Schließlich wurde ich gefasst. Fünf Jahre Tretmühle. Ich habe sie ausgehalten.
Als ich entlassen wurde, holte mich mein alter Kompagnon ab, den man nicht gefasst hatte. Weil ich ihn nicht verraten hatte.
Er nahm sich meiner an. Erzählte mir. Er gehörte einer internationalen Verbrechergesellschaft an.
Ich unterlag der Versuchung. Wurde ebenfalls Mitglied. Solch einen geschickten Kupferstecher konnte man gerade gebrauchen. Denn vielleicht wissen Sie, was dazu gehört, englische Banknoten nachzuahmen.
Doch Papiergeld brauchte ich im Dienste jener Gesellschaft nicht zu fälschen. Hauptsächlich musste ich Stempel nachmachen. Auch das Kuvert stammt von mir, in dem Sie meinen Brief erhielten.
Im übrigen kann ich Ihnen von dieser internationalen Verbrechergesellschaft so gut wie gar nichts sagen. Nur zwei Herren habe ich kennen gelernt, die mich ab und zu in meiner Werkstatt besuchen...«
»Mann, kommen Sie zur Sache!«, wurde der Erzähler von dem Kapitän unterbrochen. »Ich will nur hören, was den Anschlag gegen mein Schiff betrifft, nichts weiter.«
»Sehr wohl, Herr Kapitän. Gestern wurde ich wieder von einem der Herren in meiner Werkstatt besucht. Er legte verschiedene Schriftstücke auf den Tisch die ich auf die Kupferplatte übertragen sollte. Als er sich wieder entfernt hatte, fand ich unter den Papieren eines, das absolut nichts mit meinem Auftrage zu tun haben konnte. Es war nur versehentlich dazwischen gekommen. Der Herr kehrte denn auch sehr bald zurück und nahm es wieder mit. Ich aber hatte es schon gelesen. Es war ein vollständig ausgearbeiteter Plan, wie man sich Ihres Schiffes bemächtigen wolle, mit dem aktenmäßigen Vermerk eines anderen, dass die einleitende Hauptsache schon ausgeführt worden und geglückt sei.«
»Nun, was war das für ein Plan?«, fragte Stevenbrock, als Jener wieder eine Kunstpause machte
»Haben Sie nicht gestern von dem Speditionsgeschäft Gebrüder Miller in der Cable Street eine einzelne große Kiste erhalten, gezeichnet M. O. 148?«
»Allerdings.«
»Was befindet sich in dieser Kiste? Gestatten Sie, dass ich diese Fragen stelle.«
»Meißner Porzellan, das ich mir aus Deutschland hierher habe schicken lassen, es ist ein Geschenk.«
»Diese Kiste ist vertauscht worden. In dieser Kiste, die Sie bekommen haben, befindet sich kein Porzellan.« — »Sondern?«
»Da ist ein Mann drin. Mit Nahrungsmitteln und Getränk versehen. Und außerdem mit einem Fläschchen, das genug Gift enthält, um eine ganze Kompanie ins Jenseits zu befördern. Dieser Mann soll, wenn sich die ›Argos‹ auf hoher See befindet, als blinder Passagier zum Vorschein kommen. Bis zum nächsten Hafen müssen Sie ihn doch an Bord behalten. Da aber ist es schon geschehen. Das Gift wird in das gemeinschaftliche Kaffee- oder Teewasser geschüttet werden. Was es für ein Gift ist, weiß ich nicht, wohl aber, dass seine furchtbare Wirkung erst nach ungefähr einer Stunde ganz plötzlich eintritt. Es wird an Bord Ihres Schiffes nur noch Tote geben. Und dann wird ein anderes Schiff, das sich immer in Ihrer Nähe aufgehalten hat, heranfahren und Ihre ›Argos‹ ausplündern. Wie dies alles arrangiert wird, weiß ich nicht, ich bin auch kein Seemann, aber so, wie ich es hier schildere, stand es in jenem Schriftstücke. Und nun, Herr Kapitän, sehen Sie nach ob in der Porzellankiste nicht ein Mann mit einem Fläschchen Gift steckt. Nach jenem Vermerk ist diese erste Einleitung zu dem teuflischen Anschlage schon glücklich ausgeführt worden.«
Der Sprecher schwieg.
Immer starrer hatte ihn der Kapitän angesehen. Dann erhob er sich.
»Warten Sie hier, bis ich wiederkomme.« Er verließ die Kajüte.
Wir brauchen nicht dabei zu sein, wenn er die große Kiste öffnen lässt und alle Angaben dieses Dan Russells bestätigt findet. Anstatt des Porzellans befand sich in der Kiste ein Mann, gut verproviantiert, das Fläschchen wurde bei ihm gefunden, seinen Inhalt bekam Doktor Isidor zur chemischen Untersuchung, obschon der gleich erklären konnte, dass es eine wässerige Lösung von Blausäure sei, das furchtbarste Gift, das wir kennen.
Der Mann, der verstockt noch jede Auskunft verweigerte, wurde vorläufig in die Arrestelle gesperrt. Unterdessen saß Dan Russell in der Kajüte, ganz gelassen, hatte die Hände gefaltet und drehte die Daumen. Kein heimlicher Beobachter hätte etwas Besonderes an ihm bemerken können.
Nach einer Viertelstunde kehrte Kapitän Stevenbrock zurück. Es wäre geradezu unnatürlich gewesen, hätte dieser eiserne Mann eine besondere Aufregung gezeigt.
»Ihre Angaben haben sich bestätigt!«, sagte er ganz ruhig. »Anzeigen tue ich die Sache natürlich nicht, das ist nicht mein Fall. Der Mann bleibt an Bord, ich werde ihn mir später vorknöpfen. Ich bin Ihnen, Mister Russell, zum größten Danke verpflichtet. Selbstverständlich bleiben Sie bei mir an Bord. Haben Sie noch etwas an Land zu besorgen?«
»Ich darf gar nicht wagen, das Land auch nur mit einem Schritte wieder zu betreten, jetzt muss es schon heraus sein, dass ich...«
»Well, dann bleiben Sie eben gleich hier. Wir gehen morgen früh die Themse hinauf und in See.
Da fällt mir gerade etwas ein. Sie sind also Kupferstecher. Ich verstehe von dieser Profession gar nichts. Aber können Sie da nicht sehr gut zeichnen?«
»Zeichnen? Kunstzeichnen? Malen?«
»Nein, nur nachzeichnen, Land- und Seekarten, mit Zirkel und Lineal.«
»O gewiss, das ist ja gerade mein Beruf!«
In dieser Kajüte stand der bekannte, ungeheure Panzerschrank, der Kapitän öffnete mit seinem Schlüsselbund drei Schlösser und dann immer noch zwei Fächer, ehe er das Gesuchte zum Vorschein brachte.
Es war eine Weltkarte in Mercator-Projektion, Handzeichnung, überaus sauber und akkurat mit schwarzer Tusche ausgeführt, nur hier und da war ein roter Punkt eingetragen, mit einer Zahl versehen. Am freien Papierrande standen einige geografische Ortsbestimmungen, die sich jedenfalls auf diese nummerierten Punkte bezogen.
»Können Sie so etwas kopieren?« — »Ei gewiss, tadellos!«
»Vortrefflich. Da kommen Sie mir wie gerufen. Ich habe nämlich schon immer eine Kopie von dieser Karte, die ich nur geliehen erhalten, haben wollen, aber auch noch von vielen anderen, und von meinen Leuten kann das niemand, so wenig wie ich, wir haben alle viel zu schwere Hände bekommen. Und an Land kann ich die Karten nicht geben, nicht in fremde Hände. Denn die Sache muss geheim gehalten werden, verstehen Sie? Ganz geheim!«
»O, Herr Kapitän, da können Sie mir...«
»Ich weiß, ich weiß. Nach diesem Beweis, den Sie mir soeben geliefert haben.
Nun, wir sprechen über diese Zeichnerei noch ausführlich. Jetzt wird Ihnen der Steward Ihre Kabine anweisen, und was Sie sonst brauchen, verlangen Sie einfach. Sie gehören fortan zu uns. Gute Nacht, Mister Russell.«
An der Küste von Parahyba kroch ein kleiner Dampfer unter englischer Flagge hin. Wir kennen die drei Herren schon, die an Deck unter einem Sonnensegel sitzen, und wollen uns nun etwas näher mit ihnen befassen. Mister Abraham Fischer war Diamantenhändler gewesen, ein marktbeherrschender.
Bis ihm wegen unsauberer Manipulationen der Besuch der Diamantenbörse, die ganz international ist, verboten wurde.
Und da ist dann nichts mehr zu machen.
Na ja, man kann noch ein paar Diamanten kaufen und weiter verschachern, aber damit sind doch keine Millionen zu verdienen, wie es bei Mister Fischer der Fall gewesen war.
Nun, er setzte sich mit rund 150 000 Pfund, drei Millionen Mark, einfach zur Ruhe.
Aber diese Ruhe hielt der jüdische Spekulant nicht lange aus. Auch genügten ihm die normalen Zinsen nicht.
Wodurch kann man sein Kapital wohl am besten verzinsen?
Mister Abraham Fischer wusste es, daher stammte auch schon die eine Million, die ihm sein braver Vater hinterlassen hatte.
Er lieh Geld zu Wucherzinsen aus.
Aber er hatte Pech, der gute Vater Abraham, so vorsichtig er auch war, sich nur mit festangestellten Beamten befasste und zehnfache Sicherheit verlangte.
Alle seine Klienten gingen ihm durch die Lappen, entweder durch Selbstmord oder per Schiff und Eisenbahn, und mit der Sicherheit war es auch immer nichts.
Nach vier Jahren dieser segensreichen Tätigkeit hatte Mister Abraham Fischer nur noch die Hälfte seiner drei Millionen. Jetzt fing er in Häusern zu spekulieren an.
Und ein Jahr später war wieder eine Million futsch.
»Wie haisst, der Gott meiner Väter hat mich geschlagen mit Dalles!«, jammerte er.
Er war ein Engländer, aber bei großer seelischer Erregung mauschelte er Deutsch.
Er wandte sich der Spekulation in Börsenpapieren zu, hauptsächlich Schiffspapiere und Seehandel.
Und wieder ein Jahr später hatte er nur noch rund 10 000 Pfund auf der Bank.
Das ist ja noch ein nettes Kapital, von dessen Zinsen ein einzelner Mann recht gut leben kann — aber doch wenig, wenn man einmal dreifacher Millionär gewesen ist.
Mister Fischer privatisierte, fest entschlossen, nun nicht wieder so etwas anzufangen.
Da kam die »Argos« nach London, ihr Kapitän brachte die beste Ambra und die herrlichsten Edelsteine haufenweise auf den Markt. Und da dachte Vater Abraham mit Sehnsucht an seinen Diamantenhandel zurück.
»Wo mögen diese Kerls nur diese prachtvollen Edelsteine her bekommen?«
So sprach er zu seinem alten Freunde Balin.
Das war einmal ein begüterter Kapitän gewesen, der sein eigenes Schiff gefahren. Dieser hatte aber ebenfalls großes Pech gehabt.
Erst sein Kapitänspatent verloren und dann in Spekulationen sein ganzes Vermögen.
Jetzt machte er noch den Winkelagenten beim Lloyd, an der Schiffsbörse schlug sich gerade so durch. An den Verlusten seines Freundes hatte er keine Schuld. Ja, wenn der nur jene Frage hätte beantworten können!
»Ob das nicht herauszubringen ist? Wenn man so einen Matrosen, der doch auch etwas davon wissen muss, einmal bezecht macht?«
Es wurde probiert. Man kam aber nicht über die Einleitung hinaus. Der alte Seekapitän konnte eine gute Nummer vertragen, aber der Matrose sowohl wie der Heizer, die man nacheinander im Hinterzimmer einer Bar vorgenommen, hatten ihn jedes Mal untern Tisch getrunken, und Vater Abraham, der sehr, sehr sparsam geworden war, jammerte wieder über die zwecklose Geldausgabe.
Doch den einmal gefassten Gedanken brachte er nicht wieder aus dem Kopfe.
»Ob man so einen Kerl nicht einmal hypnotisieren kann?«
»Hypnotisieren?!«, stutzte Balin. »Du, da habe ich neulich wieder den Mister Cratch getroffen. Du kennst ihn nicht? Er gab früher hypnotische Vorstellungen hat jemanden dabei einmal an seiner Gesundheit geschädigt, oder so was ähnliches, musste dafür ein halbes Jahr Tau zupfen, und — und...«
Dass auch Mister Balin im Gefängnis einmal Tau gezupft hatte, und dass daher dieser Bekanntschaft stammte, davon sprach er nicht gern.
In jenem Hotel, in dem solche Winkelagenten verkehrten und in dem der ehemalige Hypnotiseur noch ganz besonders tätig war, fand schon die erste Zusammenkunft statt. »Nein, meine Herren, so wie Sie sich das denken, geht es nicht. Sie überschätzen die Macht der Hypnose. Da ist kein Geheimnis herauszubringen. Und trotzdem — hm — ich wüsste ein Mittel...«
Er verlangte tausend Pfund Sterling, wenn er es anwendete.
Vater Abraham fiel vor Schreck fast auf den Rücken. Aber Mister Cratch blieb fest.
Schließlich gab der Geldmann nach.
Und es war keine Zeit zu verlieren, jede Minute konnte das Gauklerschiff wieder abdampfen.
Bis zum Abend musste doch gewartet werden.
Nach jener Vorstellung in der Alhambra gelang es einem der Weiber, die so halb und halb in den Diensten dieses Gauners standen, den ersten Steuermann der »Argos« in dieses Hotel zu verschleppen.
Was dann weiter geschah, wissen wir.
So, das Geheimnis war entlockt worden.
Nun brauchte man nur hinzufahren und die Ambra und die Diamanten und Rubine und Smaragde und Saphire abzuholen.
Auf welche Weise?
Nun einfach indem man eben mit einem Passagierdampfer nach dem Hafen fährt, der jener Stelle am nächsten ist, dort mietet man sich ein kleines Fahrzeug oder kauft es, nur ein Boot, fährt die Küste entlang, den bezeichneten Strom und Fluss hinauf und fischt die Edelsteine heraus. Eventuell nimmt man noch einen Taucher mit, der sich am Gewinn beteiligt. Nein, so einfach war die Sache nicht!
Ganz abgesehen von wilden Indianerstämmen und dergleichen.
Mister Fischer war Diamantenhändler gewesen und hatte genug von den brasilianischen Verhältnissen gehört. Mister Balin hatte genug Welterfahrung und Mister Cratch war selbst in Brasilien gewesen.
Alles, was in Brasilien irgendwie mit Diamanten und anderen Edelsteinen zu tun hat, das Suchen, Finden, Graben, Waschen und Verkaufen, ist Monopol der Regierung.
Ja sogar das Anfassen, kann man sagen.
Wer in Brasilien irgendwo einen Diamanten am Boden liegen sieht, hat ihn ruhig liegen zu lassen. Fasst er ihn an, hebt er ihn auf, so muss er ihn der nächsten Behörde abliefern.
Er muss aber schnell machen, denn kommt er in den Verdacht, einen Diamanten gefunden zu haben, und man findet ihn noch in seinem Besitz, so hilft kein Eid, dass er ihn habe abliefern wollen, auf dem Wege dazu sei — er wird hart bestraft.
Liefert er den Diamanten ab, so bekommt er einen Finderlohn, noch nicht 10 Prozent des niedrigsten Taxwertes.
Wer aber einen anderen anzeigt, dass er sich einen herrenlosen Diamanten angeeignet hat, bekommt den dreifachen Finderlohn.
Ja noch mehr: Sträflinge und solche, die es werden wollen oder können, die etwas auf dem Kerbholz haben, sind frei, die Strafe ist ihnen erlassen, wenn sie jemanden anzeigen, der unrechtmäßiger Weise einen Diamanten besitzt.
Nun allerdings nicht gerade, dass jemand einen Menschen totschlägt, dann steckt sein Freund einen rohen Diamanten in die Tasche — »der da hat einen Diamanten gefunden und ihn nicht abgeliefert, ich kann für den Mord nicht bestraft werden« — so wird die Sache ja nun nicht gehandhabt, aber im Grunde genommen sichert doch solch eine Denunziation Straffreiheit.
Es sind dies schier unglaubliche Verhältnisse.
Und das ist der Grund, weshalb heute in Brasilien das Diamantengraben ganz brach liegt.
Werden noch heute an zwei ganz verschieden gelegenen Gebirgsgegenden Brasiliens die schönsten Diamanten sehr zahlreich gefunden — alle nach Europa kommenden Diamanten sind brasilianische, die südafrikanischen gehen nur nach Amerika — so wird es in dem ungeheuren Reiche wohl noch andere Diamantenlager geben.
Aber niemand sucht danach
Es ist gar zu gefährlich und lohnt sich nicht.
Einer traut dem anderen nicht.
Diamanten sind dort wie bei uns die Dynamitpatronen, die man doch auch nicht gern anfasst.
Dies alles wussten diese drei Männer.
Es gab hier nur eines: Gleich hier in England einen Dampfer kaufen oder doch chartern, mieten. Das in einem brasilianischen Hafen machen zu wollen, daran war gar nicht zu denken. Dann hätte man sein Diamantengeheimnis nur gleich öffentlich in den Zeitungen annoncieren können.
Wurde ein kleiner Dampfer gechartert, so musste der Kapitän natürlich zugleich Eigentümer des Schiffes sein.
Eine Reederei lässt doch nicht ihr Schiff in irgend einem unbekannten Küstengewässer herumgondeln.
Der Kapitän durfte auch keine Schulden auf sein Schiff haben.
Immer wieder ist es die Versicherung, die alle solche Abenteurerei illusorisch macht.
Leicht erdacht und erzählt, aber in der Wirklichkeit ganz ausgeschlossen.
Also gleich hier einen kleinen Dampfer chartern, dessen Kapitän zugleich sein schuldenfreier Besitzer war.
Mister Fischer kannte die Verhältnisse und war bereit, deshalb auch noch sein letztes Kapital zu opfern. Er sah keinen anderen Ausweg.
Man möchte meinen, die drei Verbündeten hätten doch mit solch einem Kapitän Kompanie machen können. Sie offenbarten ihm ihr Geheimnis, unter der Bedingung, dass er die ganze Fahrt auf seine Kosten übernahm, wofür er dann natürlich auch seinen Anteil von dem Diamantenschatze bekam.
Wer gab denn aber eine Garantie, dass dieser Kapitän dann, wenn er das Geheimnis kannte, die drei nicht zum Teufel jagte, nach Brasilien fuhr und die Steine für sich selbst aufsammelte? Oder das konnte er auch erst drüben an Ort und Stelle tun.
Gewiss, es wäre eine Schurkerei gewesen — aber diese drei Männer waren selbst Schurken, trauten deshalb so etwas auch jedem anderen Menschen zu.
Nein, es musste ein eigenes Schiff entweder gekauft oder gechartert werden, ganz regelrecht auf gesetzlichem Wege, dann war der Kapitän ihnen verpflichtet, einen Anteil von dem gehobenen Schatze erhielt er nur als Geschenk, dasselbe galt von der ganzen Mannschaft.
Herrlich wäre es ja gewesen, wenn Balin das Schiff selbst geführt hätte, und der war ja Kapitän. Aber er durfte es nicht, er hatte wegen eines strafwürdigen Vergehens in Sachen der Seemannschaft sein Patent verloren.
Im übrigen wollen wir alle die Erwägungen und Zweifel übergehen, mit denen sich die drei Dunkelmänner herumquälten, immer auf der Suche nach solch einem geeigneten Schiffe und Kapitän.
Man war ja nicht nur auf England angewiesen, auch Deutschland, Frankreich, Holland kamen in Betracht, aber da konnte man doch nur die Schiffslisten studieren, das konnte dann brieflich und telegrafisch abgemacht werden, aber immerhin, solche Kapitäne, die ihr eigenes schuldenfreies Schiff fahren, sind doch gezählt, und sie befinden sich doch mehr auf See oder im Auslande, als dass sie gerade im Hafen des nördlichen Europas liegen. Da gibt es schon mehr Jachtbesitzer, aber die kamen nicht in Betracht. Wer sich eine Dampfjacht leisten kann, der vermietet sie nicht so leicht.
Als diese Woche vergangen war, war der sehr behäbige Mister Fischer schon ganz zusammengeklappert, vor Sorge und Aufregung.
»Jetzt haben wir den richtigen Mann gefunden!«, jubelte da eines Nachmittags Balin, Lloyds Schiffsliste schwingend. »Heute früh ist in Liverpool Kapitän Kettel mit seiner ›Recovery‹ eingetroffen, von Algier kommend. Das ist unser Mann!«
Er berichtete ausführlicher. Kapitän Kettel war schuldenfreier Besitzer eines Dampfers von tausend Tonnen. Der tüchtigste Seemann. Um Fracht auf eigene Rechnung zu nehmen, dazu langte wohl sein Kapital nicht, oder er tat es überhaupt prinzipiell nicht. Am liebsten vercharterte er sein Schiff, war dann zu jeder abenteuerlichen Fahrt bereit, wenn er nur viel Geld dabei verdiente. Dass er auch Schmuggel triebe, besonders Salzschmuggel nach Afrika, das war ein Gerücht, das man nicht laut verbreiten durfte. Solch ein Schwätzer hatte schon einmal schwer bluten müssen.
»Dieser Kapitän Kettel ist tatsächlich ein tadelloser Ehrenmann, für den ich garantiere, dem können wir uns anvertrauen.«
Sie fuhren sofort nach Liverpool, natürlich immer auf Mister Fischers Kosten. Während der Fahrt wurden sie sich einig, dem Kapitän Kettel gleich so ziemlich ganz reinen Wein einzuschenken. Sie wussten an der Küste von Parahyba in einem Stromgebiet einen immensen Diamantenschatz liegen, leicht zu heben. Woher sie das wussten, das brauchte der Kapitän natürlich nicht zu erfahren, nichts von der Hypnotisiererei. Am besten war es, sie boten ihm gleich den vierten Teil des Schatzes an, womit er aber auch seine Leute ablohnen musste.
Kapitän Kettel, ein kleiner, dürrer Mann, wie in der Kaffeetrommel geröstet, hörte sie mit unerschütterlicher Ruhe an.
»Well, ich bin bereit dazu. Pro Tag und Tonne zwei Schilling, und das für hundert Tage. Also zehntausend Pfund Sterling. Natürlich im voraus zahlbar.«
»Sie bekommen aber doch...«
»Jedes Handeln ist zwecklos.«
»Wir bieten Ihnen die Hälfte des Schatzes an!«, sagte Fischer.
»Well, das nehme ich an. Aber bei den 10 000 Pfund bleibt es.«
Vergebens wand sich Vater Abraham wie ein Wurm, Kapitän Kettel gab keinen Penny nach.
»Denken Sie denn etwa, ich begebe mich mit meinem Schiffe in ein unausgepeiltes Küstenwasser, fahre ganz unbekannte Flüsse hinauf? Der Diamantenschatz liegt todsicher dort, sagen Sie? Wohl, dann können Sie auch ruhig die 10 000 Pfund riskieren. Oder wenn Sie die nicht haben, dann müssen Sie die Finger von solchen gewagten Sachen lassen. Mir ist der Sperling in der Hand immer lieber als die Taube auf dem Dache gewesen, ich lasse mich prinzipiell in nichts ein, wenn ich nicht vollständige Sicherheit für mein Schiff habe.«
Es blieb nichts anderes übrig, als nachzugeben, die verlangte Summe im voraus zu zahlen. Aber 10 000 Pfund besaß Fischer gar nicht mehr, nachdem er schon 1000 Pfund dem Hypnotiseur für seine Bemühungen hatte zahlen müssen.
Doch hatte Mister Cratch sein Geld bei sich und war bereit, das noch Fehlende hinzuzufügen, ungefähr 600 Pfund Mehr besaß der auch nicht.
Es ging sofort auf das Seemannsamt, und eine Viertelstunde später war es geschehen, für 10 000 Pfund war Mister Abraham Fischer so gut wie der Besitzer der »Recovery«, Kapitän Kettel stand in seinen Diensten, freilich nur für hundert Tage, von der Abfahrt an gerechnet.
»Für 10 000 Pfund Sterling hätten Sie eigentlich auch so ein Schiff wie die ›Recovery‹ kaufen können, mehr ist der Dampfer gar nicht wert!«, meinte Mister Balin, sobald Fischer seinen Namen unter den Chartervertrag gesetzt hatte.
Dieser erstarrte. Wie Schuppen fiel es ihm plötzlich von den Augen.
»Mensch, und das sagen Sie mir erst jetzt?!«, schrie er seinen alten Freund an.
Er hätte es selbst wissen können. Er war vor Erregung ganz blind gewesen. Die »Recovery« löschte ihre Ladung algerischen Wein, drei Tage später ging sie wieder in See, mit allem ausgerüstet, was für diese Expedition nötig war, was nun natürlich alles auch Kapitän Kettel stellen musste.
Und er war tatsächlich ein Ehrenmann, das musste man ihm lassen. So zum Beispiel war die Verpflegung, die er den drei Herren zuteil werden ließ, ganz ausgezeichnet, fast wie auf einem Salondampfer in erster Kajüte, obgleich man bei der großen Schnelligkeit, mit der das Geschäft abgeschlossen worden war, über so etwas gar nicht gesprochen hatte.
Fünf Wochen dauerte es, ehe man die Küste von Parahyba in Sicht bekam. Der kleine Dampfer machte nur acht Knoten, kroch wie eine Schnecke, und bei jeder Gelegenheit, wenn es nur ein bisschen neblig war, ließ ihn der vorsichtige Kapitän Kettel halbe Kraft gehen.
Trotz der ausgezeichneten Kost, die ihm täglich in fünf Mahlzeiten vorgesetzt wurde, wollte Mister Fischer sein früheres Gewicht nicht wieder annehmen, er magerte nur immer mehr ab, man erkannte ihn schon gar nicht mehr wieder. Auch bei Mister Cratch wollte diese Mastkur nicht anschlagen, nur Mister Balin bekam in diesen fünf Wochen einen stattlichen Schmerbauch und ein Vollmondgesicht.
Die von dem hypnotisierten Steuermann genau bezeichnete Flussmündung wurde wirklich gefunden, alle Einzelheiten stimmten genau. Zum ersten Male begann Mister Fischer frei zu atmen. Fürchterlich war es nur, wie langsam der Dampfer jetzt den Fluss stromauf ging, so wie er sich schon der Küste genähert hatte. Ununterbrochen ließ Kapitän Kettel loten, schickte dazu sogar ein Boot voraus.
Endlich kam die große Insel, quer über den Strom gelagert, und da war rechterhand auch der Nebenfluss.
Die »Recovery« fuhr ihn hinauf, immer noch langsamer als zuvor.
Da aber war das Ziel erreicht!
Ein herrlicher Anblick, eine köstliche Szenerie!
Ein fast kreisrundes Wasserbassin von etwa 200 Meter Durchmesser, eingerahmt von pittoresken Felsmassen, linkerhand brach aus dem Gestein der Strom hervor, nicht gerade als Wasserfall, sondern mehr als Kaskade, sodass er nicht eben sehr viel Geräusch machte.
Und auf der gegenüberliegenden Seite, dort sollte noch ein anderer Fluss aus dem Felsen hervorbrechen, aber vollständig unterirdisch, also auch gleich unter Wasser mündend, und dort sollte der Grund ganz mit Edelsteinen bedeckt sein, durch jenen unterirdischen Fluss hervorgewaschen.
Alles stimmte, dort war der Felsen, der ungefähr wie ein ungeheurer Menschenkopf aussah, so genau hatte der hypnotisierte Steuermann alles angegeben, und dorthin steuerte jetzt der Dampfer.
Der Anker rasselte herab, fand bei sechs Meter Grund. Das mit Talg eingeschmierte Lot hatte, als der Ankergrund untersucht wurde, weißen Kies mit heraufgebracht, aber kein einziger Edelstein hatte daran geklebt, auch kein noch so kleiner.
Nun, deshalb ließ sich Mister Fischer noch nicht entmutigen, dort, wo das Lot den Grund berührt, hatten eben gerade keine Edelsteine gelegen, und man brauchte auch nicht erst an anderen Stellen das Lot auszuwerfen, da gab es ein einfacheres Mittel, um den Grund zu erforschen, noch ehe man einen Taucher hinabschickte.
Das Wasser war zweifellos ganz klar, aber es wurde von der Kaskade gekräuselt, und da hört die Durchsichtigkeit auf.
Doch da gibt es ein Mittel, um diese Wirkung des Kräuselns aufzuheben. Wir haben es wohl zuerst von den orientalischen Schwammfischern gelernt. Die nehmen, wenn sie den Meeresboden vom Boot aus nach Beute erforschen wollen, einfach einen Eimer, von dem der Boden ausgeschlagen ist, stecken ihn zur Hälfte ins Wasser und blicken von oben hinein. Durch die Wände des Eimers wird die Ursache der Wellenbewegung doch abgehalten, also ist das Wasser innerhalb des Eimers ganz ruhig, also kann man durch den Eimer auch durchs Wasser blicken, unter Umständen, je nach Wasserklarheit und Sonnenstand, bis zu einer Tiefe von 25 Meter.
Jeder ist wohl imstande, diesen Versuch im Kleinen auszuführen, eine Waschboje genügt, die Wirkung solch eines Schutzmittels ist ganz überraschend. Oder man kann auch, zumal gleich von Bord des Schiffes aus, ein langes Gasrohr von größerem Durchmesser nehmen. Die Wirkung ist dieselbe. Das durch Wellenbewegung undurchsichtige Wasser wird plötzlich durchsichtig. Noch besser ist ein weites Glasrohr, weil das eben selbst schon das Tageslicht durchlässt.
Merkwürdig ist es, dass dieser denkbar einfachste Apparat noch nicht weiter vervollkommnet worden ist. Da muss sich durch Anordnung von konkaven und konvexen Spiegeln doch irgendwie eine Art von unterseeischem Fernrohr schaffen lassen. Es hat einmal ein derartiges amerikanisches Patent gegeben, man hat nichts wieder davon gehört.
Die »Recovery« hatte Taucherkostüme und zwei als Taucher ausgebildete Mann an Bord, schon waren auch einige lange, weite Glasröhren zur Stelle. Kapitän Kettel hatte in solchen Dingen eben schon seine Erfahrung.
Mister Fischer war der erste, der mit zitternder Hand nach solch einer Glasröhre griff, sie über die Bordwand hinabsenkte, bis sie ins Wasser tauchte, und dann legte er oben an das andere Ende sein Auge.
Jetzt war ganz deutlich der Grund zu sehen.
Aber alles nur weißer Kies von meist erbsengroßen Steinen. Von glitzernden Diamanten und roten Rubinen und grünen Smaragden und blauen Saphiren gar keine Spur.
Schon fühlte Mister Fischer, wie ihm plötzlich sein Herz still stand. Schon wollte ihm eine fürchterliche Ahnung aufgehen. Doch was war das dort? Da stand dort unten auf dem schneeweißen Boden eine große schwarze Kiste.
Auch die anderen beiden Kompagnons hatten sich schon mit solchen Glasröhren bewaffnet, nichts von glitzernden und farbigen Edelsteinen bemerkt, nur diese große schwarze Kiste.
»Die Argonauten haben schon alle Edelsteine zusammengelesen und in dieser Kiste verpackt, sie hier zurücklassend!«, sagte Mister Balin mit ziemlicher Ruhe.
»Hoffen wir, dass es so ist!«, entgegnete Mister Cratch, und es klang wie ein Ächzen.
»Unbedingt ist es so!«, schrie Mister Fischer wie ein Wilder auf.
Unterdessen hatte Kapitän Kettel, der ganz kalt blieb, schon die Vorbereitungen getroffen, ein Taucher hatte sich bereits kostümiert, er stieg hinab, um zuerst einmal diese Kiste heraufzuholen. Weiter war ja auch von dort unten nichts zu holen, höchstens noch weißer Kies.
Durch die Glasröhren sah man, wie schwer die Kiste sein musste, obgleich jedes Gewicht im Wasser doch stark verliert, wie sich der Taucher mit ihr abmühte. Gut war es, dass sie zwei Handhaben hatte, so konnte das Seil leichter befestigt werden.
»Die muss ganz, ganz voll von Edelsteinen sein!«, flüsterte Mister Fischer.
Er wiederholte es, als die Kiste aus dem Wasser kam und jetzt das Seil fast zu reißen drohte, weshalb noch ein zweites befestigt wurde. So wurde die Kiste an Deck gewunden.
Sie war von Eisenplatten gefertigt, hatte ungefähr einen halben Meter im Kubik. Oben zeigten sich Schrauben.
Diese wurden gelöst, was ohne Mühe geschehen konnte, und als der Deckel abgehoben worden war, zeigte es sich, dass diese Kiste eine zweite enthielt, nur etwas kleiner, sodass sie gerade hineinging, wieder aus Eisen, oben mit zwei Handhaben versehen, an denen sie herausgehoben wurde, wieder mit der Winde, Menschenkraft reichte dazu nicht aus. Das heißt, weil nicht so viel Hände zugreifen konnten.
Die folgende Szene lässt sich kaum beschreiben. Diese zweite Kiste barg nämlich eine dritte, und diese eine vierte — und so ging das immer weiter, bis zuletzt schon elf Eisenkisten an Deck standen, natürlich immer viel kleiner werdend.
Jetzt kam die zwölfte aus der elften, nur noch eine eiserne Schatulle.
Die konnte Mister Fischer bequem selbst herausheben, sie war unverschlossen, er schlug den Deckel zurück — ein zusammengefaltetes Pergamentpapier lag darin.
Wir wollen nicht versuchen, Mister Fischers Gesicht zu schildern, wie so eine Kiste nach der anderen herausgeholt worden war, immer kleiner werdend.
Und wie er jetzt in dieser letzten Schatulle dieses zusammengefaltete Pergament sah, nichts weiter.
Noch weniger können wir seine Gedanken wiedergeben. Er faltete mit zitternden Händen das Pergament auseinander.
Vielleicht doch noch ein kolossal wichtiges Geheimnis, das sicher unermessliche Schätze einbrachte? Na doch ganz, ganz sicher!
Also er hatte das Pergament auseinander gefaltet. Und da war mit großen Schriftzügen zu lesen:
»Guten Morgen, Herr Fischer!«
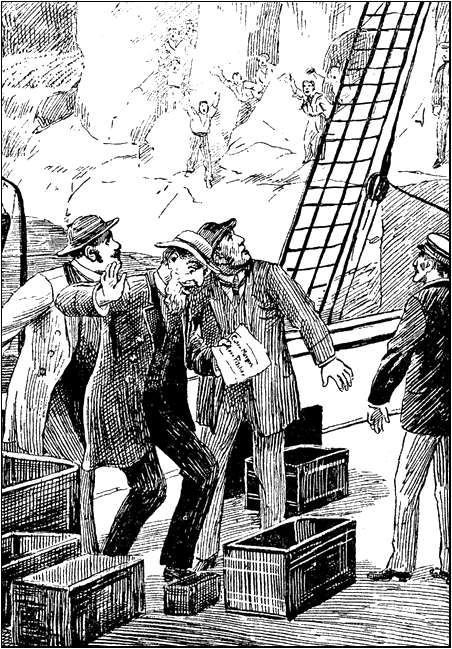
Wie erstarrt blickte der Jude nieder auf die wenigen Worte, die das Schrei-
ben enthielt und die kurzweg lauteten: »Guten Morgen, Herr Fischer!«
Wie gesagt, diese ganze Szene ließ und lässt sich nicht beschreiben. Auch nicht, wie jetzt der Herr Abraham Fischer zusammenknickte. »Waih geschrien, ich bin betrogen, ich bin ein ruinierter Mann!«
Dieser Jammerruf fand alsbald ein Echo. Allerdings kein wörtliches.
Plötzlich brach ein schallendes Gelächter los.
Aber nicht etwa an Bord dieses Schiffes.
Das Schiff lag ganz nahe an dem hohen, felsigen Ufer, durch einen tüchtigen Sprung zu erreichen, und plötzlich tauchten dort auf den Vorsprüngen und in Spalten und Höhlen überall menschliche Gestalten auf, Männer, offenbar Seeleute.
»Guten Morgen, Herr Fischer! — Guten Morgen, Herr Fischer! — Guten Morgen, Herr Fischer!«, So erklang es dort immer wieder, fröhlich wurde dabei gewinkt, Tücher und Mützen wurden geschwenkt, und dazwischen immer wieder schallendes Gelächter.
Wer waren diese fremden Männer? Nun, wenn man sie nicht gleich erkannte, so lag eine Ahnung doch sehr, sehr nahe.
Aber der eine wurde auch gleich erkannt, wenigstens von unseren drei Kompagnons, und diese Erkennung genügte.
Dieser junge Mann stand ganz vorn auf einem Felsvorsprung, zog wiederholt seine Mütze und machte Verbeugungen.
»Guten Morgen, Herr Fischer! Guten Morgen, Herr Balin! Guten Morgen, Herr Cratch! Besonders Sie wiederzusehen, Mister Cratch, das macht mir ungeheures Vergnügen.«
Da plötzlich machte Mister Cratch einen Satz nach der nahen Kajütentür und war darin verschwunden.
Und dann folgte Mister Balin mit einem ebensolchen Satze nach, und dann auch Mister Fischer, um in der Kajüte Schutz zu suchen, vor dem Manne, der dort oben so isoliert stand.
Denn das war der erste Steuermann von der »Argos«, jetzt ganz unhypnotisiert. Den hatten sie gleich wiedererkannt. Und da zogen sie es vor, hinter sich die Kajütentür gleich ganz abzuschließen.
»Wer sind denn die?!«, wunderte sich jetzt auch Kapitän Kettel, obgleich der sich nicht so leicht über etwas wunderte. Das Nichtvorhandensein von Edelsteinen und das Auspacken der vielen Kisten mit dem letzten Inhalte hatte ihn vollkommen kalt gelassen. Er hatte ja seine 10 000 Pfund in der Tasche, hatte auf alle Fälle ein feines Geschäft gemacht.
»Hallo, ist das nicht der Kapitän Stevenbrock von der ›Argos‹, der Waffenmeister von den Argonauten?!«
Die beiden hatten sich einmal in irgend einem Hafen der Welt kennen gelernt, hatten sogar eine sehr angenehme Bekanntschaft gemacht, an einem feuchten Kneipabend, wenn die Bekanntschaft auch nicht weiter gegangen war.
»Kann ich zu Ihnen an Bord kommen, Mister Kapitän Kettel?«
»Na sicher, warum denn nicht? Ich werde...«
Er dachte wohl an ein Boot oder Laufbrett, da aber war Stevenbrock schon von seinem erhöhten Standpunkt leichtfüßig an Deck gesprungen, wozu allerdings ein Paar ganz besondere Sprungbeine gehört hatten.
Dann saßen die beiden in der Kapitänskajüte bei einer Flasche Portwein, Stevenbrock berichtete, ganz offen, so weit er es sein konnte. Die letzten Geheimnisse durfte er ja nicht preisgeben.

»Das ist ja unerhört!«, sagte Kapitän Kettel, als jener seinen Bericht beendet hatte. »Hätte ich das gewusst, dann hätte ich mein Schiff natürlich nicht an diesen Schuft verchartert. Zu solchen Schurkereien gebe ich meine Hand nicht her.«
»Das glaube ich Ihnen, Kapitän, das brauchen Sie mir nicht erst zu versichern.«
»Also Ihr erster Steuermann hat sich nur so gestellt, als ob er hypnotisiert gewesen wäre?«
»Wie ich Ihnen ausführlich erzählt habe.«
»Er hatte ein Gegenmittel eingenommen?«
»Ja.«
»Er hatte sich mit Absicht von dem Frauenzimmer nach dem Hotel verschleppen lassen?«
»Gewiss.«
»Da wussten Sie schon von dem Plane dieser Schufte?«
»Ich kannte ihn, und ich wollte sie nur bestrafen.«
»Woher war Ihnen denn dieser Plan bekannt?«
»Herr Kapitän — verzeihen Sie — es kommen dabei Sachen in Betracht, über die ich nicht sprechen darf...«
»Never mind, never mind! Ich bin der letzte der in fremde Geheimnisse zu dringen sucht.«
»Danke. Ja, wie ist es aber nun weiter mit diesen Ehrenmännern? Werden Sie sie mir ausliefern? Wenigstens den einen. Den Mister Fischer will ich laufen lassen, der ist schon bestraft genug. Auch der Mister Balin mag hinlaufen. Aber den Mister Cratch möchte ich mir doch erst einmal vorknöpfen. Das bin ich meinem ersten Steuermanne schuldig, wenn ich ihm den Kerl nicht zur eigenmächtigen Bestrafung ausliefere. Natürlich nicht, dass er ihn foltert. Nicht einmal durchpeitschen soll er ihn, so sehr es der Kerl auch verdient hat. Also wollen Sie mir diesen Mister Cratch ausliefern?«
Bedächtig hob Kapitän Kettel die Schultern.
»Nein, mein lieber Stevenbrock, das kann ich beim besten Willen nicht. Ich will Ihnen ganz offen sagen, wie es mit mir steht. Ihnen gegenüber kann man doch ganz offen sein, da braucht man nicht erst ein Versprechen abzufordern.
Ich bin ein verwegener Bruder, der sich in jedes Abenteuer einlässt, wenn es dabei etwas zu verdienen gibt. Und wenn es nicht gegen mein Gewissen, gegen meine Ehre geht.
Ja, ich habe gepascht genug. Ihnen kann ich's sagen. Nach New York Oberhemden und Spirituosen, nach Chile eine ganze Schiffsladung Streichhölzer und nach Afrika Salz massenhaft.
Darin sehe ich nichts weiter. Die Harmlosigkeit solcher Schmuggelei liegt ja auch schon darin ausgedrückt, dass man nur bestraft wird, wenn man sich dabei erwischen lässt. Eine Bestrafung hinterher gibt es nicht. Und es erfüllt mich sogar mit Genugtuung, den armen Negern billiges zollfreies Salz und den Nordamerikanern billige Oberhemden und den Chilenen billige Streichhölzer zu liefern.
Ich habe auch noch andere Schiebungen ausgeführt, die mich schwer mit dem Strafgesetzbuch in Konflikt gebracht hätten.
Aber nie habe ich etwas getan, was gegen mein Gewissen und meine Ehre geht. Dieser Mister Abraham Fischer offenbarte mir, dass er in der Provinz Parahyba ein Diamantenlager wisse, das er ausbeuten wolle. Das ist an sich ja schon gar nicht erlaubt. Erwischt mich hier die brasilianische Regierung, so werde ich ja schwer bestraft, man nimmt mir mein Schiff weg.
Aber das Kapitänspatent kann man mir nicht nehmen! Und bin ich glücklich wieder heraus, kann man mir auch hinterher nichts wollen.
Also ich ging darauf ein, ließ mein Schiff chartern, Mister Fischer hat mir die geforderten 10 000 Pfund bar bezahlt.
Hätte ich gewusst, durch was für eine Schurkerei er in den Besitz dieses Geheimnisses gekommen, so hätte ich mich nie mit ihm eingelassen.
Aber ich wusste es nicht, so ist es geschehen.
Somit stehe ich für 100 Tage, von denen erst 34 verflossen sind, in den Diensten dieses Mister Fischers, als meines Charterpatrons, ich habe ihm bis zu einem gewissen Grade bedingungslos zu gehorchen — wie weit, das wissen Sie als Schiffskapitän selbst ganz genau und jedenfalls habe ich ihn an Bord meines Schiffes unter englischer Flagge aus besten Kräften zu schützen, ihn mit aller meiner Mannschaft zu verteidigen.
Und dasselbe gilt für die anderen beiden Männer, welche die Gäste meines Patrons sind unter meinem Schutze.
Nein, Herr Kapitän Stevenbrock, ich kann Ihnen keinen dieser drei Herren ausliefern.
Und wenn Sie versuchen, sie mit Gewalt von Bord meines Schiffes zu holen, so werden wir, ich und alle meine Leute, sie bis zu unserem letzten Blutstropfen mit Waffengewalt verteidigen.«
Kapitän Kettel schwieg. Ein Ehrenmann hatte gesprochen.
»Wenn sie aber nun einmal das Land betreten, und ich fange sie von dort weg?«, fragte Stevenbrock.
»Das geht mich nichts an!«, durfte Kapitän Kettel mit Recht erwidern. »Mein Schutz, den ich ihnen angedeihen lassen muss, bezieht sich nur unter der Flagge an Bord meines Schiffes.«
»Sie würden sie auch nicht zurückfordern?«
»Zurückfordern, ja, das wohl. Aber deswegen nicht mit Gewalt gegen Sie vorgehen. Ob das nun Zweck hätte oder nicht.«
»Und wenn ich sie durch eine List von Bord zu locken weiß?«
»Dann ist eben geschehen. Zurückholen tue ich sie nicht. Durchschaue ich aber Ihre beabsichtigte List, so ist es auch meine Pflicht, die Bedrohten davon in Kenntnis zu setzen, sie zu warnen.«
Es war offenbar ein großer Fehler gewesen, dass sich die Argonauten, die mit ihrem Schiffe in der Nähe versteckt lagen, gleich gezeigt hatten. Jetzt hatten sie wenig Aussicht noch, sich dieser Gentlemen oder auch nur eines einzigen zu bemächtigen. Die verließen doch die Kajüte nicht mehr. Aber diese Begrüßung des Herrn Fischer hatten sie sich doch wieder unmöglich entgehen lassen können.
»Wie lange bleiben Sie hier liegen?«
»So lange mein Charterpatron will. Das heißt, bis zu drei Wochen. Länger nicht. Denn ungefähr am hundertsten Tage will ich wieder in Liverpool oder London sein. So ist im Charterkontrakt ausgemacht worden.«
»Wenn er nun jetzt sofort wieder abfahren will?«
»Dann muss ich eben gehorchen. Und mir scheint, jetzt kommt schon diese Aufforderung.«
Der Steward hatte die Kajüte betreten.
»Mister Fischer wünscht den Herrn Kapitän Kettel zu sprechen.«
Dieser erhob sich sofort.
»Vielleicht warten Sie noch, mein lieber Stevenbrock, wir sprechen dann weiter. Wenn ich Ihnen auch keine Hoffnungen machen kann.«
Er verließ die Kajüte, noch vor dem Steward.
Es war nur eine improvisierte Kapitänskajüte, die er während dieser Fahrt benutzte, seine eigene, den besten Raum des Schiffes, hatte er dem Charterpatron und dessen Gästen überlassen.
Der für seine Größe oder vielmehr Kleinheit sehr breit gebaute Dampfer hatte ein erhöhtes Achterdeck, in diesem lag die Kajüte. Vorher hatte man noch einen kurzen Gang zu durchschreiten, auf dem hüben und drüben noch Kabinen lagen, deren größte jetzt also Kapitän Kettel als seine Kajüte, als seinen Arbeitsraum benutzte. Demnach brauchte er, wenn er jetzt diesen Raum verließ, nur noch einige Schritte nach hinten zu gehen, so stand er vor der Tür der eigentlichen Kajüte.
Er fand sie verschlossen.
»Was ist denn das?«
»Sind Sie's, Herr Kapitän?«, erklang es drinnen recht kläglich.
»Jawohl, ich bin's. Weshalb haben Sie sich denn eingeschlossen?«
»Herr Kapitän Kettel, bürgen Sie für unsere Sicherheit?«
»Na selbstverständlich stehen Sie unter meinem Schutze!«
»Fahren Sie jetzt sofort zurück?«
»Sofort, wenn Mister Fischer befiehlt. Nun aber machen Sie auf, ich bin nicht gewohnt, durch verschlossene Türen zu sprechen!«
Die Türe ward denn auch gleich aufgeschlossen.
Die drei Hasenfüße hatten ja unterdessen Zeit zur Beratung gehabt, und sie waren zur Überzeugung gekommen, dass man diesem Kapitän unbedingt trauen durfte.
Mister Cratch war es, der die Schiebetür zurückzog. In demselben Augenblick prallte er auch schon zurück. Und nicht minder erschrocken oder doch erstaunt war Kapitän Kettel.
Nämlich weil plötzlich neben ihm Stevenbrock stand, den er drüben in der kleinen Kajüte wähnte.
Er hatte zwar die Schiebetür in den Rollen laufen hören, war aber der Meinung gewesen, dass dies natürlich der Steward sei, der die Kajüte wieder verließ.
Stevenbrock aber blieb nicht so neben ihm stehen, sondern er sprang mit ausgestreckten Händen vor, hatte den Mister Cratch gepackt und war im Nu auch schon wieder zurückgesprungen, an Kettel vorbei.
»Steh oder ich schieße!«, schrie dieser.
Aber ehe er auch nur nach seinem Revolver greifen konnte, war Stevenbrock mit seiner Beute schon zum Korridore hinaus, und wie Kettel ihm nachsetzte, stand jener schon auf der Bordwand und sprang.
Nicht nach der Felswand hinüber. Erstens gab es in dieser Höhe gar keinen geeigneten Absatz, und dann war die Entfernung denn doch zu weit, um mit solch einem erwachsenen Menschen in den Armen hinüberspringen zu können.
Stevenbrock sprang direkt ins Wasser hinab.
Als er wieder auftauchte, hatte er den Mister Cratch vor sich, so regelrecht, wie es eben sein muss, wenn man einen Menschen, ob er nun schwimmen kann oder nicht, vor sich über Wasser halten will, was nicht weiter beschrieben werden kann.
So schwamm er, nur mit den Füßen ausstoßend, einer Felsenspalte zu, die sich bis hinab zum Wasser erstreckte, nur eine kurze Entfernung, und dort erwarteten ihn schon einige Argonauten.
»He da, Sie da, Kapitän Stevenbrock«, schrie oben Kettel, »geben Sie mir mal den Gentleman wieder her! Was wollen Sie denn mit dem da unten anfangen?«
»Ay ay, Käpten!«, lachte Stevenbrock zurück, das Wasser von sich blasend.
Er wusste, dass er keinen Schuss und nichts zu fürchten brauchte. Kapitän Kettel hatte ihm ja deutlich genug gesagt, wie er sich in solch oder einem ähnlichen Falle verhalten würde.
Gewiss, seine Absicht war es nicht gewesen, diesen Mann durch List oder Gewalt entführen zu lassen. Er hätte zugepackt, vielleicht sogar geschossen.
Aber er hatte eben keine Zeit dazu gehabt. Stevenbrock war mit seiner Entführung gar zu fix gewesen.
Und da er sich mit seiner Beute nun schon außerhalb der Schiffswände befand, kümmerte sich Kapitän Kettel auch nicht viel um seinen Schützling.
Das hatte er ja auch schon in seine Worte zu legen gewusst.
Und es sollte noch besser kommen.
Mister Cratch war vor Schreck ganz betäubt gewesen, war es auch noch, als er wieder auftauchte.
Erst nach einigen Sekunden kehrte ihm die Besinnung zurück.
»Hilfe, Hilfe«, zeterte er aus Leibeskräften, »Hilfe, ich bin wasserscheu!«
Ein brüllendes Gelächter antwortete an Bord der »Recovery«.
Der Mister Cratch hatte ganz unbewusst einen famosen Witz vom Stapel gelassen, wenn er in seiner Wirkung oder vielmehr Ursache auch nicht so leicht wiederzugeben ist.
Dass dieser Mister Cratch sehr wasserscheu war, hatten sie alle während der Reise schon gemerkt. Waschen tat er sich, ja, auch einmal ein Bad nehmen, das war etwas ganz anderes — aber sonst ging er auch dem feinsten überdammenden Sprühregen ängstlich wie eine Katze aus dem Wege. Er fürchtete sich überhaupt tatsächlich vor dem Regen, wollte eben nicht nass werden.
Und nun jetzt dieser Ruf!
Hätte er geschrien: »Hilfe, Hilfe, ich ertrinke, ich kann nicht schwimmen!«, — das wäre ganz begreiflich gewesen, darüber hätte niemand gelacht.
Aber nun so, wie der Kerl nach einigen Sekunden wieder an der Oberfläche des Wassers zu sich kommt, und plötzlich fängt er zu schreien an: »Hilfe, Hilfe, ich bin wasserscheu!«, — es wirkte urkomisch!
Die englischen Matrosen und Heizer brüllten vor Lachen. Sie wären gar nicht fähig gewesen, jetzt einen Befehl auszuführen, um der beiden wieder habhaft zu werden.
Und da hatte Stevenbrock auch schon jene Felsspalte erreicht, ein halbes Dutzend Arme zogen ihn und seine Beute hinauf, sie waren verschwunden.
»Nun, mein geehrter Mister Cratch, wollen wir uns ein bisschen unterhalten.«
Mit diesen Worten setzte sich Ernst, der erste Steuermann der »Argos«, in seiner Kabine jenem gegenüber. Zuerst hatte man den unfreiwilligen Besuch, nachdem man ihm einen Revolver und ein Dolchmesser abgenommen, in den Aschenlift gesperrt.
Das ist ein Raum, der sich über den Heizanlagen befindet, der Aschenauszug geht durch. Hier hängen die Leute ihre nassen Sachen auf, die in wenigen Minuten trocknen, weil hier immer ein starker, heißer Luftzug herrscht.
So war auch Mister Cratch bald wieder getrocknet. Dann wurde er vom ersten Steuermann abgeholt, in seine Kabine geleitet und höflich zum Sitzen eingeladen.
»Nun, mein geehrter Mister Cratch, wollen wir uns ein bisschen unterhalten.«
Es war kein besonderer Held, dieser Mister Cratch. Er zitterte an allen Gliedern, was nicht von Kälte herrühren konnte.
Schon in dem Aschenraum hatte er erwogen, ob es nicht besser sei, lieber gleich freiwillig aus dieser Welt zu scheiden.
Haken waren genug vorhanden, und Hosenträger hatte er an.
Aber mit dem Selbstmord ist es auch so eine dumme Geschichte.
Es könnte doch vielleicht weh tun.
Und nun gerade hängen — da kriegt man keine Luft! Also Mister Cratch verzichtete lieber aufs freiwillige Sterben.
Er fing lieber zu beten an.
Wir würden so etwas hier nicht sagen, es wäre Frevel, wenn wirs nicht erlebt hätten. Als sich bei einer Schiffskatastrophe solche miserable zweibeinige Geschöpfe, die sonst an nichts glaubten, auch das Heiligste verhöhnten und verspotteten, öffentlich auf die Knie warfen und winselnd zu beten anfingen.
»Ach — ach — a — a — a — a...« konnte Mister Cratch jetzt nur noch stammeln.
»Wenn Ihnen das Sprechen schwer fällt, geben Sie sich keine Mühe weiter, ich...«
»Ach, mein geehrtester Herr Steuermann!«
»Was wollen Sie?«
»Sie sind doch ein Christ, nicht wahr?«
»Ein Christ? Hm. Ja. Das bin ich. Sie wohl ooch?«
»Wenn Sie ein Christ sind, dann wissen Sie doch, dass wir vergeben sollen und unsere Feinde lieben und...«
»Pschschscht!«, machte Ernst mit erhobenem Finger. »Halten Sie mal die Luft an. Jetzt werde ich erst mal sprechen, dann später, wenn ich fertig bin, können Sie mir eine Katechismusstunde geben.
Sehen Sie, Mister Cratch, ich hatte früher noch gar nichts von der ganzen Hypnotisiererei gewusst.
Gehört hatte ich wohl schon davon, aber niemals geglaubt, dass so etwas möglich sei.
Sie haben mir's erst als Tatsache bewiesen und gezeigt, wies gemacht werden muss.
Nun werde ich mal probieren, ob ich das auch kann. Also passen Sie auf, ich werde Sie hypnotisieren.
Schlafen Sie ein! Ich befehle Ihnen, dass Sie schlafen! Schließen Sie Ihre Augen! Na, wollen Sie gleich schlafen?«
Dabei fuchtelte Ernst ihm mit gespreizten Fingern vor dem Gesicht herum, und da machte Mister Cratch gute Miene zum bösen Spiel, er schloss die Augen.
Natürlich gar keine Ahnung, dass er etwa wirklich in Hypnose gefallen wäre.
»Sind Sie hypnotisiert?« — »Ja.«
»Hören Sie mich sprechen?« — »Ja.«
»Sie werden mir bedingungslos gehorchen.«
»Ich gehorche bedingungslos.«
»Ich befehle Ihnen, dass Sie mich lieb haben. Haben Sie mich lieb?«
»Ja, ich habe Sie lieb.«
»Dann machen Sie mal Ihre holden Guckäugeleins auf.«
Mister Cratch öffnete die Augen, versuchte ihnen einen starren Ausdruck zu geben.
»Was habe ich hier in meiner Hand?«
Und Ernst hatte aus seiner Hosentasche eine rohe Kartoffel geholt.
»Eine — eine — Pfirsich!«
»Was, ein Pfirsich wäre das?!«, stellte sich Ernst erstaunt. »Was ist das?«
Der Hypnotisierte war gar zu entgegenkommend gewesen.
»Eine Kartoffel!«, verbesserte er sich.
»Ja, eine Kartoffel. Doch nein, Sie irren, das ist eine Aprikose.«
»Ja, eine Aprikose.«
»Nein, das ist ein Apfel!«
»Ja, es ist ein Apfel!«
»Ein schöner, rotwangiger Apfel!«
»Ein schöner, rotwangiger Apfel!«, wurde gehorsam wiederholt.
»Nehmen Sie diesen Apfel, essen Sie ihn auf!«
Mister Cratch nahm ihn, biss herzhaft hinein, aß weiter.
»Schmeckt er Ihnen?«
»Sehr gut.«
»Wirklich?«
»Sehr, sehr gut!«, versicherte Mister Cratch eifrig beißend und kauend und zungenschnalzend dabei ein ganz verzücktes Gesicht machend.
Der Steuermann hatte sich in seinem Stuhle zurückgelehnt, die Hände über dem Leibe gefaltet, so betrachtete er den Kauenden, und so schüttelte er jetzt nachdenklich den Kopf.
»Merkwürdig, ganz merkwürdig! Frisst der Kerl ne rohe Kartoffel und denkt, 's ist 'n Appel! Also es ist doch wirklich etwas dran an der Hypnotik. Hab's niemals für möglich gehalten!«
Es war wirklich schade, dass diese Szene kein Publikum hatte.
Die rohe Kartoffel war verspeist.
»Nun will ich mal sehen, ob man in der Hypnose jemandem auch befehlen kann, dass er keinen Schmerz fühlt.«
Mit diesen Worten zog Ernst aus dem Innenfutter seiner Jacke eine lange Nadel hervor.
Da war es mit der markierten Hypnose vorbei, da fiel Mister Cratch aus der Rolle.
»Ach bitte, mein liebster, bester Herr, bitte, bitte nicht!«, fing er mit gerungenen Händen zu winseln an.
»Ruhig! Wollen Sie gleich schlafen? Ich befehle es Ihnen! Ich werde Sie jetzt in den linken Oberarm stechen, ziemlich tief. Aber Sie werden nicht den geringsten Schmerz fühlen. Verstanden?«
»Ach, mein allerbester Herr, seien Sie doch barmherzig, denken Sie an unsern Herrn und Heiland...«
»Mensch, wenn Du noch einmal diesen Namen in Deinen Mund nimmst, noch ein einziges Mal mit so etwas anfängst, dann schlage ich Dir alle Zähne ein!«
Und der plötzlich ganz umgewandelte Steuermann hob seine braune, knochige, haarige Faust zum Schlage empor.
Da verstummte der Bösewicht.
Weil er vor Schreck erstarrte.
Da erkannte er, dass es doch weit, weit besser gewesen wäre, wenn er sich vorhin aufgehängt hätte.
Er war diesem Steuermanne, an dem er die Macht der Hypnose erprobt hatte, zur Bestrafung ausgeliefert worden, zur Rache, zur Vergeltung, und der war auch entschlossen, dieses Recht der Vergeltung an ihm auszuüben!
Mister Cratch sah sich verloren. Die rohe Kartoffel war nur ein unschuldiges Vorspiel gewesen.
Jetzt kam die Vergeltung mit der Nadel dran.
Und was dann, das war ganz dem Willen dieses Mannes überlassen, dessen dunkelgebranntes, sonst eigentlich sehr gutmütiges Gesicht plötzlich einen ganz anderen Ausdruck bekommen hatte, als seine Augen plötzlich so aufgeflammt waren, einen furchtbar wilden.
Von diesem Manne hatte er keine Schonung zu erwarten, sondern alle Folterqualen, die der nach Rache dürstende Mensch irgendwie ersinnen kann.
Plötzlich wusste dies Mister Cratch mit furchtbarer Deutlichkeit.
Und da plötzlich hatte er ein ganz merkwürdiges Gefühl.
Dieser Mann, obgleich ein echter Engländer, hatte ein südländisches Aussehen, wie man es ja überhaupt oft bei der englischen Rasse findet — romanisches Blut — er hatte kohlschwarze Haare, etwa zwei Zentimeter lang, die er glattanliegend trug — — und da plötzlich war es ihm, als ob sich diese Haare aufrichteten. Er fühlte es ganz deutlich. Obgleich es gar nicht der Fall war. Kein Härchen sträubte sich.
Es ist nicht umsonst, dass wir dies so ausführlich beschreiben. Die Pointe wird später kommen.
Und es sollte überhaupt alles ganz anders kommen. Der Steuermann hatte seine Faust wieder sinken lassen. Sein wildes Gesicht hatte sich wieder geglättet, die dunkle Glut daraus war verschwunden, wenn es auch nicht ganz seinen ursprünglichen, so überaus gutmütigen Ausdruck annahm.
Jedenfalls war er wieder ganz ruhig geworden.
Und so begann er jetzt zu sprechen.
Und er sprach, wie ein Seemann, wie so ein von der Pike auf gedienter Steuermann spricht, der keine Glacéhandschuhe kennt, wahrscheinlich schon deshalb nicht, weil es für solche Pfoten wohl gar keine Nummer in Glacéhandschuhen gibt.
Und dieser Seemann, der erste Offizier des Gauklerschiffes sprach also:
»Siehst Du, Du Schweinehund!
Du hast mich damals eine rohe Kartoffel fressen lassen.
Du hast mich mit einer langen Nadel tief in den Arm gestochen, tief, tief in die Muskel hinein, dass ich vierzehn Tage lang meinen Arm nicht gebrauchen konnte und unser Doktor schon an eine lebenslängliche Muskellähmung glaubte.
Du Schweinehund Du!
Jetzt bist Du mir von unserem Kapitän zur Bestrafung ausgeliefert worden.
Jetzt kann ich Wiedervergeltung üben.
Auch ich habe Dich eine rohe Kartoffel auffressen lassen. Mehr kann ich nicht. Ich kann Dich nicht stechen, ich kann Dich nicht durchpeitschen und ich kann Dir nicht wehe tun.
Weshalb nicht, das weiß ich nicht. Nicht etwa, weil ich dazu zu edel bin. Ich bin nicht edel. Ich bin ein Dammichbruder und ein blutiger Raufbold. Aber ich bin ein Mensch, Du aber bist kein Mensch.
Weshalb Du eigentlich geschaffen worden bist, das verstehe ich nicht.
Ich grübele manchmal darüber nach, weshalb eigentlich der liebe Gott Giftschlangen und Wanzen und ähnliches Viehzeug geschaffen hat, das allen anderen Geschöpfen doch nur schädlich ist.
Du bist eine Giftschlange, Du bist eine Wanze! Deshalb kann ich Dich nicht schlagen.
Ich könnte Dich nur zertreten.
Aber Du hast durch ein Versehen der Schöpfungskraft eine menschliche Gestalt bekommen.
Deshalb kann ich Dich auch nicht zertreten.
Geh, Du menschenähnliche Wanze, geh, verkriech Dich in Deiner Ritze. Geh!«
Der Steuermann war ausgestanden, öffnete die Tür, trat zurück.
Stumm, den Kopf gesenkt, schritt Mister Cratch an ihm vorüber.
Ein Wink des Steuermanns, und ein draußen stehender Matrose übernahm die Führung.
Auch die »Argos« lag in einem von Felswänden eingeschlossenen Wasserbassin, war mit dem Lande durch ein Laufbrett verbunden. Mister Cratch bekam seinen Revolver und das Dolchmesser wieder, der Matrose führte ihn weiter, immer vorangehend, ohne sich umzusehen. Der andere folgte gehorsam, den sonst aufrecht getragenen Kopf etwas gesenkt.
Es ging durch einige kurze Schluchten hindurch, dann durch eine Höhle oder einen Tunnel, und da lag die »Recovery«, von diesem Höhlentunnel aus führte jetzt ein Laufbrett hinüber.
An Deck stand Kapitän Kettel.
Als er den Mister Cratch kommen sah, wunderte er sich. Vorausgesetzt, dass sich dieser eiserne Mann überhaupt über etwas wundern konnte.
Plötzlich aber fing er wirklich zu staunen an, schon sein Gesicht drückte es aus.
»Nanu! Was ist denn mit Ihnen los?! Haben Sie denn Ihr Haar gefärbt?!«
Das kohlschwarze Haar jenes Mannes war plötzlich schneeweiß geworden!
Und wer es nicht glaubt, dass schwarzes, braunes, blondes Haar nicht nur in einer Nacht, sondern in einer einzigen Minute schneeweiß erbleichen kann, der muss es einmal erleben.
Hoffentlich nicht an sich selbst.
Wie es möglich ist — darüber freilich schweigt sich unsere Wissenschaft aus.
Aber als ob der Natur mit ihren unerschöpflichen Hilfsmitteln nicht das möglich wäre, was wir Menschlein fertig bringen!
Wir schmieren eine Fotografienplatte mit einem Chemikal ein — ein Lichtdruck in finsterer Nacht, und die weiße Platte hat sich schwarz gefärbt.
Wir lassen nun wieder jenen Ewald Ebert persönlich erzählen. Ich war als dritter Maschinist regelrecht angemustert worden. Obgleich ich von der Schiffsmaschine nur theoretisch etwas verstand, von ihrer Bedienung als Maschinist absolut gar nichts.
Ich sagte es dem Kapitän.
»Das lassen Sie meine Sache sein!«, war seine Antwort. Eine Antwort, die ich noch gar oft zu hören bekommen sollte, bis mir endlich voll und ganz zum Bewusstsein kam, wie unnötig ich oftmals schwatzte. Da war ich von dieser Schwäche kuriert, da erst wurde ich ein richtiger Argonaute.
Zunächst merkte ich, dass meine Registrierung als dritter Maschinist überhaupt nur eine Form gewesen war.
Ich kam gar nicht an die Maschine, sah sie nur manchmal durch das Skylight, das Lichtfenster.
Aber das hinderte den Kapitän nicht, mich gleich am zweiten Tage, als wir auf hoher See waren und der zweite Maschinist sich wegen heftiger Kopfschmerzen krank meldete, auf Wache an die Maschine zu schicken, ohne weiteres, ohne mir ein Wort der Instruktion zuteil werden zu lassen.
Und es ging ganz famos! Obgleich eine furchtbare See war, die Schraube ständig aus dem Wasser schlug, dass dann alle Planken zitterten, als ob sie aus den Nieten gehen wollten, sodass ich die Hände nicht vom Ventil nehmen konnte.
Denn ein automatischer Regulator, der schneller funktioniert als das Gehirn und die Hand des Menschen, ist noch nicht erfunden.
»So gut hat noch niemand die Schraube reguliert, das muss ich sagen, und wenn's auch die anderen Maschinisten übel nehmen würden, was es aber bei uns nicht gibt!«, sagte dann der erste Offizier zu mir.
Aber so weit sind wir noch nicht.
Vorläufig lagen wir noch im Londoner East-India-Dock. Was ich eigentlich für eine Rolle an Bord spielte, darüber war ich mir lange im unklaren. Bis ich zur Überzeugung kam, dass ich doch der Stellvertreter des Waffenmeisters und sogar des Kapitäns sein müsse.
»Hier schreiben Sie immer die Meldungen auf, die Ihnen gemacht werden«, sagte Kapitän Stevenbrock gleich in der ersten Stunde in der Batterie zu mir, wie hoch oder weit einer gesprungen ist, wieviel er gehoben hat, und so weiter. Jeder Matrose wird Ihnen sagen, wies gemacht wird, Sie sehens ja überhaupt gleich selbst.«
So war ich also der registrierende Turnwart und Sporttrainer der Argonauten geworden.
So hatte ich also doch eine schriftliche Beschäftigung bekommen, die ich durchaus nicht liebte.
Und was hatte ich zu schreiben! Ich bekam den Bleistift und Federhalter gar nicht aus der Hand, und war in unausgesetzter Tätigkeit.
Und wenn ich nach sechzehnstündiger ununterbrochener Arbeit, selbst das Essen nur so nebenbei verschluckend, einmal nicht schlafen konnte, und ich betrat um Mitternacht die Batterie, da konnte ich meine schriftliche Arbeit gleich wieder aufnehmen.
Ich will das Treiben in dieser Turn- und Sporthalle, Batterie genannt, nicht schildern, nicht die erstaunlichen Leistungen, die ich da zu sehen bekam.
Aber das eine will ich sagen: das hier war eine schriftliche Arbeit, die mir nicht zuwider war, die ich nicht überdrüssig bekam!
Schon am zweiten Tage verlegte ich meinen Schlafplatz aus meiner Kabine und Koje in die Batterie auf eine Springmatratze, und wenn ich nicht geweckt wurde, um eine besonders gute Leistung selbst registrieren zu können, dann wurde ich angehalten. Das sagt wohl genug.
Wie es sonst da drin zuging, darüber möchte ich sagen, dass die ganze Batterie bei Tag und Nacht ein einziger guter Witz war. Wenn ich mich so ausdrücken darf. Es wird schon verstanden werden. Ich musste mir erst das Lachen abgewöhnen. So wie die anderen, die dabei immer ganz ernst und trocken blieben. Bis dann plötzlich aus irgend einem Grunde, den ich anfangs meist gar nicht verstand, ein Gejohle anfing, als ob es sich auch hierbei um ein Meisterschaftsjohlen handele. Rot gegen Grün. Ein Gejohle, wie ich es gar nicht für möglich gehalten hätte, dass hundert Menschen solch einen Höllenspektakel fertig bringen. Oftmals mitten in der Nacht. Anfangs wunderte ich mich, dass sich die neben uns liegenden Schiffe nicht über nächtliche Ruhestörung beschwerten. Zum Glück gibts so etwas nicht im See- und Hafenleben. Die Dampfpfeifen und Dampfsirenen machen auch Spektakel genug. Und dann lag ich selbst wohl schlafend auf meiner Matratze, hörte das Toben und Johlen zwar, aber stören tat es mich durchaus nicht.
Aber auch zu seinen persönlichen Diensten zog mich der Kapitän oftmals heran.
Jedoch in einer Weise, die ich unmöglich schildern kann.
Ich sah niemals einen Zweck dabei.
Weshalb musste ich ihn manchmal an Land begleiten, um eine ganz belanglose Geschäftsunterredung mit anzuhören?
»Hier lesen Sie diesen Brief.«
So sagte der Kapitän zu mir am letzten Abend, den wir im Hafen verbrachten.
Es war das Schreiben jenes Verbrechers, der gern wieder ein ehrlicher Mensch werden wollte.
Da fiel mir wieder einmal etwas ein.
An jene Unterhaltung der drei Börsenjobber dachte ich, was die für Pläne besprochen hatten, wenn auch sicher nicht mit dem Vorsatze, sie ausführen zu wollen.
Ich hatte noch nie zum Kapitän darüber gesprochen, er hatte es ja selbst mit angehört. Jetzt aber musste ich ihn doch einmal warnen, ich hielt es für meine Pflicht.
Weit kam ich mit meiner Warnung nicht.
»Das lassen Sie nur meine Sache sein!«, wurde ich alsbald unterbrochen.
Nicht etwa unfreundlich! Lächelnd hatte er mir dabei die Hand auf die Schulter gelegt.
»Seien Sie heute Abend fünf Minuten vor elf in meiner Kajüte!«, setzte er noch hinzu.
Der Mann mit der schwarzen Binde wollte zwischen zehn und elf kommen — und kam nicht. Indem man da doch so an halb elf denkt, dann noch eine Viertelstunde zugebend.
Ich aber betrat fünf Minuten vor elf mit dem Pünktchen die Kapitänskajüte.
Wenn ich vielleicht noch nicht pünktlich gewesen wäre — an Bord lernt man Pünktlichkeit! Auf jedem Handelsschiffe. Mehr noch als bei den Soldaten. Der Chronometer zeigt Zehntelsekunden.
Der Kapitän empfing mich.
»Setzen Sie sich hier hinter den Vorhang und verhalten Sie sich still, Sie sollen eine Unterredung belauschen.«
Die Kajüte hatte noch einen anderen Ausgang, nur durch eine Portiere abgeschlossen, dahinter kam erst eine kleine Kammer, in diese also musste ich mich setzen, konnte auch zwischen einer Spalte des Vorhangs in die Kajüte spähen. Der Kapitän ging wieder hinaus, kam schon nach einer Minute zurück, und in seiner Begleitung befand sich der Mann mit der schwarzen Binde.
Nun zunächst eine Frage: hatte denn der Kapitän gewusst, dass dieser Mann gerade um elf kommen würde? Ich selbst konnte diese Frage nicht lösen und will mich auch nicht weiter damit beschäftigen.
Also ich wurde Zeuge der Unterhaltung.
Der Mann hatte das Geständnis abgelegt.
Der Kapitän ging, kam bald wieder zurück und teilte mit, dass man den blinden Passagier mit einem Giftfläschchen tatsächlich in der Porzellankiste gefunden habe.
Dann zeigte der Kapitän dem Kupferstecher die Kartenzeichnung, ob er die kopieren könne.
Nun freilich ging mir hinter meiner Portiere schon eine kleine Ahnung auf.
Ich hätte doch ein sehr beschränkter Kopf sein müssen, wenn das nicht der Fall gewesen wäre.
Deshalb will ich auch dem Leser weiter keine Erklärung geben, als höchstens: Wenn hier von einer Verbrechergesellschaft uns etwa eine Schlinge gestellt wurde, so baute unser Kapitän bereits eine Gegenfalle auf.
Dan Russell wurde entlassen, dem Steward übergeben.
»Kommen Sie mit, Ebert.«
Wir stiegen hinab zur Arrestzelle. Es war ein kleiner, gedrungener Mann, den man in der Kiste gefunden hatte, vielleicht dreißig Jahre, höchstens.
Er war verstockt, verweigerte jede Auskunft, machte durchaus kein ängstliches Gesicht. Zwei handfeste Matrosen — was aber ein Pleonasmus ist, andere als »handfeste« gab es hier nicht — waren bei ihm, sie hatten ihn völlig entkleidet, der Schiffsarzt Doktor Cohn untersuchte ihn, behorchte ihm soeben Brust und Rücken mit dem Stethoskop, dem ärztlichen Hörrohr.
»Er hat Lungenspitzenkatarrh und offenbar Neigung zur Schwindsucht.«
»Gut. Er bleibt in Ihrer Behandlung, wird aufs Beste verpflegt.«
So sprach der Kapitän.
Fertig!
Ich bekam keine Erklärung, jetzt nicht und niemals. Wir dampften ab, mit dreitausend Tonnen Weizen und eintausend Tonnen Salzfleisch, Konserven und anderen Nahrungsmitteln an Bord.
Also es ging nach Rangoon, um den in Hinterindien Hungernden beizuspringen.
Woher wusste ich denn eigentlich, dass es nach Rangoon ging? Wenn ich es mir recht überlegt, wusste ich gar nicht, woher mir das bekannt war.
Ich musste es wohl irgendwo gehört haben.
Sicher aber nicht an Bord dieses Schiffes.
Immer mehr erfuhr ich, was das Wort »Bordroutine« zu bedeuten hat.
Ein Wort, das man aber unmöglich erklären kann.
»Wir fahren nach Rangoon?«, fragte ich einmal den ersten Steuermann.
Der sah mich nur groß an, nichts weiter — aber, weiß der Teufel, plötzlich wurde ich ganz rot vor Scham.
Eine ganz, ganz merkwürdige Geschichte mit dieser Bordroutine, die keine Frage gestattet, die sich nicht gehört, wofür es aber keine Vorschrift gibt, das muss man herausfühlen, was gestattet ist und was nicht, und zuletzt fühlt man es auch mit absoluter Sicherheit heraus, da gibt es dann gar keinen Irrtum mehr.
Immer mehr lebte ich mich ein, machte meine Erfahrungen und Beobachtungen, sie ganz allein durch eigene Kraft verdauen müssend.
Erst auf hoher See bekam ich die Patronin zu sehen, die Freifrau von der See, Helene Neubert, Capitanea et Valvasora, Honorable.
Diesen Titel hatte ich auf einem Briefe gelesen, den ich dem Briefträger abgenommen hatte, »In Service of His Majesty«.
Was war denn das für ein merkwürdiger Titel? Was für ein merkwürdiges Latein?
Nun, ich brauchte nur im englischen Titularlexikon der Schiffsbibliothek nachzuschlagen. Da stand es. Mehr freilich, wie sie zu diesem ausgestorbenen Titel gekommen, erfuhr ich jetzt noch nicht.
Also erst auf hoher See bekam ich sie zu sehen. Ich wurde zur Tafel in die Patronatskajüte geladen. Zweifellos musste sie ja krank gewesen sein, hatte das Bett gehütet, das war nun aber vorbei, es konnte überhaupt nicht schlimm gewesen sein. Vielleicht hatte sie sich auch nur krank gestellt, um nicht einer Einladung an den königlichen Hof folgen zu müssen.
Eine schlanke und doch volle Gestalt, mit einem schönen Antlitz wie Milch und Blut, bei lebhafter Unterhaltung erst recht blühend wie eine Rose.
Sie war die Liebenswürdigkeit selbst. Aber sie sprach nur über das Sportleben an Bord, über die Übungen ihrer Argonauten, ihrer Jungen, ihrer Kinder, und ich hatte ja auch nichts weiter im Kopfe.
Aber da plötzlich ging etwas Seltsames vor sich. Mitten in der lebhaftesten Unterhaltung verstummte sie, ein schwerer Seufzer zitterte von ihren Lippen.
Dann war sie gleich wieder aufgeräumt wie zuvor, hatte sich auch nicht etwa verändert.
Ich aber hatte in einem einzigen Momente etwas gesehen!
Statt dieses blühenden Weibes einen verklärten, vergeistigten Engel!
Im übrigen kann ich es nicht schildern.
Am anderen Tage war schönes Wetter, ruhige See. Da kam sie an Deck.
Wurde auf einem Rollstuhl gefahren!
Ein weher Schmerz zuckte mir durch die Brust.
Wie gelähmt!
Richtig, ich hatte sie ja gestern auch nur sitzen sehen, nie war sie aufgestanden.
Aber im nächsten Augenblick wurde meine Spekulation wieder einmal zuschanden gemacht. Plötzlich stand sie auf, ging leichten, graziösen Schrittes nach der Bordwand, hob dort etwas von Deck auf und ging nach ihrem Stuhle zurück.
Nein, die war doch nicht gelähmt!
Die war ja wie ein junges Mädchen gehüpft!
Und weshalb wurde sie da im Rollstuhl gefahren?
Ich hatte gerade Gelegenheit, sie unauffällig zu beobachten, musste es sogar tun, konnte gar nicht an ihr vorbeiblicken.
Und wieder machte ich seltsame Beobachtungen.
Es war ein Vögelchen, das sie von Deck aufgehoben hatte.
Ein Vögelchen, das die herbstliche Reise nach dem Süden angetreten, sich vom Schwarme verloren und auf unserem Schiffe Schutz gesucht hatte. Wie es häufig vorkommt, mitten im Ozean.
Und nun, ehe sie es zu füttern versuchte, betrachtete sie es.
Und da, wie sie das kleine Vögelchen zwischen ihren feinen Fingern hatte, überkam es mich plötzlich wiederum wie eine Vision.
Es war und blieb das schöne Antlitz wie Milch und Blut, mit den Rosen der Gesundheit.
Es war nach wie vor das holdselige Lächeln, mit dem sie das Vögelchen betrachtete.
Ich glaube nicht, dass sie wirklich schmerzlich gelächelt hat. Plötzlich aber sah ich ganz deutlich das von unsäglichem Weh verklärte, nicht verzogene Antlitz der Madonna, der Jungfrau Maria, wie sie zu ihrem Sohne am Kreuz aufblickt.
»Ist denn die Patran krank? Was fehlt ihr?«
Mit dieser Frage wandte ich mich an den nächsten Matrosen! Und ich wusste, dass diese Frage erlaubt war!
Gesetzt den Fall, der Patronin hätte ein Finger an der Hand gefehlt — ich hätte niemals fragen dürfen, wie und wo sie den Finger eingebüßt. Das wäre gegen die Bordroutine gegangen. Mindestens gegen die dieses Schiffes.
Denn dieser Finger fehlte ihr und war ihr weder durch meine Neugier, noch durch mein Mitleid wieder zu ersetzen.
Es ist dies wenigstens eine Erklärung, die ich einmal zu geben versucht habe, inwiefern Bordroutine mit gesellschaftlichem Anstand übereinstimmt.
Aber wenn mich mein Mitleid dazu trieb, zu fragen, ob die Dame krank sei, was ihr fehle — das war erlaubt!
Das wusste ich ganz bestimmt, so weit hatte ich die Bordroutine nun schon im Leibe.
Der vermeintliche Matrose, an den ich diese Frage gestellt, hatte mir den Rücken zugedreht, wendete sich um und — vor mir stand der erste Steuermann im gewöhnlichen Arbeitsanzuge.
Derselbe, der mir dadurch eine harte Lektion gegeben, dass er mich auf meine Frage, ob wir nach Rangoon führen, nur groß und schweigend angesehen hatte.
Diese Frage jetzt aber beantwortete er sofort.
»Ja, herzkrank. Sie hat wohl schon immer einen Herzfehler gehabt, es ist nur nicht bemerkt worden. Vor einem halben Jahre aber trat's ganz deutlich zum Vorschein. Die fährt mal ganz plötzlich ab. Sie soll sich so wenig als möglich bewegen, sonst könnte noch Wassersucht hinzukommen. Aber wir können sie doch nicht festbinden. Ja, die geht uns mal ganz plötzlich durch die Binsen.«
Und mit einem tiefen, tiefen Seufzer wandte sich der Steuermann wieder von mir ab. —
Ich machte weitere Erfahrungen und Beobachtungen. Einmal war ich nach der Kapitänskajüte beordert worden, musste warten, betrachtete unterdessen die Bilder an der Wand.
Ich hatte das schon mehrmals getan.
Aber die kleine Fotografie hatte ich noch nicht gesehen, die war mir bisher entgangen.
Ein reizendes, vielleicht dreijähriges Kind, ein Holzpferdchen am Bändel, die Peitsche in der Hand.
Waren das mir nicht bekannte Züge?
»Erkennen Sie diese Züge in dem Kindergesichtchen wieder?«, fragte da Kapitän Stevenbrock, der plötzlich neben mir stand.
Ich merkte gar nicht, dass er doch meine Gedanken erraten haben musste. Wozu allerdings auch nicht viel gehörte.
»Ist das nicht eine Ähnlichkeit mit Fräulein Ilse? Oder gar mit der Patronin selbst?«
»Ja. Ihr Kind. Mein Kind. Wir sind verheiratet. Vor Gott. Es war unser Kind. Es ist gestorben.«
Ich bekam eigentlich nichts Neues zu hören.
Ich hatte es schon immer wie geahnt.
Und ich bekam noch mehr solcher Ahnungen.
Der Mann, der die Patronin im Rollstuhl fuhr, sie überhaupt, wenn sie sich an Deck aufhielt, bediente, war ein Matrose.
Der Matrose Hans, unser bester Hochspringer.
Ein wahrer Apollo von Gestalt und Antlitz. Nur mit einem Bärtchen.
Also er bediente die Patronin, fuhr sie herum, geleitete sie die Treppen hinab, holte, was sie wünschte, hüllte sie, wenn es kühl wurde, in ein Umschlagtuch und dergleichen mehr.
Aber nur an Deck!
Nicht etwa, dass er den Kammerdiener spielte!
Da gab's gerade bei dem nichts!
Der fühlte sich als Seemann vom Scheitel bis zur Sohle und in jedem Nerv. Noch mehr als Argonaute. Er machte seine Schiffsarbeit mit, ging Wache, und sonst absolvierte er seine vorschriftsmäßigen Leibesübungen, die nötig waren, dass eine Farbe gegen die andere in jeder Leistung wetteifern konnte, oder er schwebte mit angezogenen Füßen in der Luft. Springen, immer springen, mit gewaltigen Bleigewichten an den Sohlen.
Nur wenn die Patronin an Deck kam, stellte er sich ihr zur Verfügung.
Und mit einem Male wusste ich, dass dieser Matrose Hans die Patronin liebte, und dass diese um seine Liebe wusste, und dass auch dem Kapitän dieses Verhältnis bekannt war und dass er es duldete!
Aber ganz ausdrücklich muss ich betonen: auch nicht das geringste äußerliche Kennzeichen war vorhanden, es konnte nicht vom schärfsten Auge entdeckt werden, dass hier solch ein Verhältnis vorlag!
Dieser Matrose Hans war alles andere als ein schwärmerischer Jüngling.
Keine Spur von Schwermut oder so etwas Ähnlichem. Ein ganz lustiger Geselle.
Und die Dienste die er der kranken Patronin leistete, führte er nur mit jener ritterlichen Höflichkeit aus, die jedem dieser Argonauten in Fleisch und Blut übergegangen war.
Kein zärtlicher Blick, keine wie zufällig herbeigeführte Berührung.
Ganz ausgeschlossen!
Als Hans einmal Ruderwache ging und die Patronin kam an Deck, wurde sie vom Matrosen Jochen bedient. Der war noch weit, weit aufmerksamer und zärtlicher gegen die kranke Herrin als Hans, sah ihr alles an den Augen ab, was es eigentlich bei Hans nicht gab. Der machte nicht mehr, als was nötig war.
Und dennoch wusste ich es plötzlich ganz, ganz bestimmt: dieser Matrose Hans ist zu unserer Patronin in Liebe entbrannt! Sie weiß es, sie erwidert diese Liebe zwar nicht, aber sie duldet sie, erfüllt mit unendlichem Mitleide für den armen Jungen. Und dasselbe gilt für den Kapitän. Er weiß um uns und er duldet es gern. Er hat diesen jungen Matrosen ebenso lieb wie seine sterbenskranke Frau.
Nur eine Ahnung war es, die mir dies alles sagte, aber auch gleich mit absoluter Beweiskraft der Wahrheit!
Und solche Ahnungen hatte ich jetzt gar häufig. Während ich bisher so etwas noch gar nicht gekannt hatte.
Jetzt war mir manchmal, als ob es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen fiele, als ob ich im Zimmer alle Dinge lesen könne, nicht nur in den Herzen der Menschen ihre geheimsten Gedanken erkennend.
Wie kam das nur?
Ich habe später einmal ein englisches Buch gelesen. »The power of silence« — die Macht des Schweigens von dem Amerikaner Ralph Waldo Trine. Dieser war bis zu seinem zweiundzwanzigsten Jahre Waldarbeiter, Holzfäller, hat sich dann nachträglich ausgebildet und studiert, ist heute wohl der gelesenste Moralschriftsteller Amerikas und Englands.
Es gibt Übersetzungen seiner Bücher ins Deutsche, aber gerade von diesem erwähnten noch nicht.
Da steht unter anderem drin, wie man in sich systematisch die Gabe der Prophetie entwickeln kann.
Sammle möglichst viel Geheimnisse an und — sprich nicht darüber!
Deshalb braucht man seine Nase nicht fortwährend in fremde Sachen zu stecken. Jeder Tag bringt schier zahllose Neuigkeiten und Geheimnisse, und nichts zwingt mich, darüber zu anderen zu schwatzen.
»An jedem Tee- und Biertisch wird täglich so viel Kraft vergeudet, mit der man, richtig benutzt, Berge versetzen könnte!«
Dann, wenn Du solche Geheimnisse genügend in Deinem Busen aufgestapelt hast, kommt Dir plötzlich eine Kraft, von der die Welt nichts weiß. —
Genug hiervon!
Ich machte noch andere Entdeckungen, immer nur ahnungsvoll, und doch mit felsenfester Gewissheit.
Da war Fräulein Ilse, die Nichte der Patronin, zwölf Jahre alt. Nicht eben groß und stark für dieses Alter, ein bildhübsches Mädel, ein heiteres, naives Kind.
Als ich ihr vorgestellt wurde, hielt sie mir treuherzig die Hand hin.
Eine kleine, wohlgepflegte Hand.
Oben!
Als ich sie nahm, fühlte ich unten hartes Sohlenleder. Und dann bekam ich einen Druck, dass ich fast aufgeschrien hätte, mindestens schmerzhaft das Gesicht verzog.
»Ooooh, ich habe Ihnen doch nicht weh getan?!«, rief sie erschrocken.
Ja, das hatte sie. Ich dachte erst, sie hätte mir die Knochen zermalmt. Und ich kam aus Portland, wo ich sieben Jahre lang Steine gebrochen hatte, immer bei der schwersten Arbeit angestellt worden war.
»Kommen Sie, ich zeige Ihnen etwas Schönes, was Sie noch nicht in Ihrem Leben gesehen haben.«
Sie führte mich in eine größere Kabine, mehr eine kleine Kajüte, ihre eigene, und da allerdings bekam ich auch eine Art von Weltwunder zu schauen.
Es war ein mittelgroßer Schrank mit Glastür. Schon dieser Schrank war ein Meisterwerk der Holzschnitzerei. Über und über mit Sternchen und Arabesken und Seeschlangen und Schiffchen bedeckt, mit Stiftchen angenagelt, deren goldene Köpfe wiederum Arabesken und andere Figuren bildeten.
Und hinter der Glastür nun, auf Regalen in Reih und Glied stehend, nicht weniger als achtundzwanzig Paar Kinderstiefelchen. Von den denkbar verschiedensten Formen. Wunderbar fein gearbeitete Phantasieware und dann wieder auch ganz unheimliche Gurken von Stiefel. Immer für ein etwa sechsjähriges Kind berechnet.
Nun, der Leser weiß. Der Glanzpunkt von Ilses erstem Geburtstag, den sie an Bord dieses Schiffes gefeiert hatte.
Sie zeigte mir noch vieles, vieles andere, diese Kabine war tatsächlich eine Schatzkammer von untaxierbarem Werte, obwohl sie nur Arbeiten enthielt, von den Matrosen und dem anderen Schiffspersonal bei besonderen Gelegenheiten für ihre kleine Ilse angefertigt, lauter Bastelarbeit, ich erwähne nur einen umfangreichen Blumenstrauß, bis auf die feinsten Staubfädchen aus Elfenbein geschnitzt, und zwar aus einem einzigen Zahne, dem kolossalen Backzahne eines Mammuts, den man in Sibirien gefunden, und dann wieder ein gewöhnlicher Kirschkern, wenn man den unter ein starkes Vergrößerungsglas nahm, so konnte man mehr als hundert eingeschnitzte Namen lesen, die der ganzen Besatzung, er konnte wie eine Büchse aufgeschraubt werden, enthielt etwas Weißes, das konnte man auseinanderfalten, es war chinesisches Papier oder irgend ein mir unbekanntes Gewebe von märchenhafter Feinheit, dann war's ein Bogen von fast einem Meter im Quadrat, der in dem kleinen Kirschkern gelegen, und auf diesem Papierbogen nun die sämtlichen Argonauten im Bilde wiedergegeben, ihrer kleinen Ilse gewidmet und so bekam ich noch Hunderterlei zu sehen, eines immer kurioser und kostbarer als das andere — aber ihr Prunkstück war und blieb der Glasschrank mit den achtundzwanzig Paar Kinderstiefelchen! Doch ich schweife ab. Ich wollte ja etwas ganz anderes erzählen.
Wieder einmal saß die Patronin bei herrlichem Wetter in ihrem Rollstuhl an Deck, wie immer von Hunden und allen möglichen und — ich möchte fast sagen unmöglichen Tieren umlagert.

Auch Ilse befand sich bei ihr, saß auf einem gewaltigen Grizzlybären, der doch eigentlich für unzähmbar gilt, das Tier lag platt auf dem Bauche und dennoch saß das Kind wie auf einem Tische. So saßen die beiden da, die Patronin hatte eine Hand des Kindes in der ihren, sie träumten, freuten sich am goldenen Sonnenschein und am glitzernden Kräuselspiel des unendlichen Meeres.
Da kam auch der Kapitän. Sagte etwas, die Patronin lächelte, und dann fingen sie wieder zu träumen an, jetzt zu dritt.
Der Kapitän stand an der anderen Seite des Stuhles, sich halb daran lehnend, einen Fuß auf eine Dogge gestemmt, und auch seine eine Hand war von der der Patronin ergriffen werden. Ein ganz, ganz seltsames Bild!
Weshalb so seltsam, was mich plötzlich so furchtbar packte — ich vermag es nicht zu sagen.
Aber da plötzlich hatte ich wiederum etwas wie eine Vision.
Plötzlich sah ich dort in dem Rollstuhl nicht mehr ein irdisches Weib sitzen, sondern einen verklärten Engel.
Und nicht genug hiermit, sondern plötzlich öffneten sich auch meine Ohren.
Wenn es die Ohren waren, mit denen ich hörte.
Es war ein geistiges Hören.
Sie sprachen ja auch gar nichts.
Und dennoch hörte ich diesen Engel ganz, ganz deutlich sagen:
»Bald muss ich Euch verlassen, Ihr meine Lieben. Und das ist gut. Ich war nicht für Dich bestimmt, mein Georg. Aber ich lasse Dir meine Ilse zurück, und sie wird Dir dereinst sein, was ich Dir niemals sein konnte.«
So hörte ich den Engel ganz, ganz deutlich sprechen. Dann war es vorbei.
In dem Rollstuhl saß wieder die Patronin.
Es war nur eine Vision gewesen.
Aber die Erinnerung daran blieb mir.
Und es sollte sich noch bewahrheiten.
Obwohl damals doch niemand, niemand auch nur den kleinsten Gedanken daran hatte, dass der jetzt schon in den dreißiger Jahren stehende Mann noch einmal dieses jetzt zwölfjährige Kind an den Altar führen würde.
Da darf man wohl wirklich von einem prophetischen Ahnungsvermögen sprechen, das plötzlich über mich gekommen war. Wir fuhren nicht nach Rangoon, nicht nach Indien. Da hätten wir einen ganz anderen Kurs halten müssen, ob es nun durch den Suez-Kanal oder um das Kap der guten Hoffnung oder um Kap Hoorn gehen sollte.
Wir fuhren immer südwestlich, bis in den Golf von Mexiko hinein — und hier blieben wir liegen.
Und nicht etwa, dass es nur einmal eine Zwischenstation war, dass wir dann unseren Weg nach Rangoon fortgesetzt hätten.
Wir haben die dreitausend Tonnen Weizen gar nicht nach Indien gebracht. Wir sind untätig im Golfe von Mexiko liegen geblieben, viele Tage lang. Das heißt: das Schiff war untätig, lag still, weit außerhalb des Golfstromes.
Bei der Mannschaft gab es keine Untätigkeit. Es wurde gesprungen und geschwungen und gesungen und musiziert, und gerade in der Nacht — herrliche Nächte — ließ Meister Hämmerlein am häufigsten seine Orgel erbrausen.
Und wir hatten selten einmal ein zuhörendes Publikum auf einem vorüberfahrenden Schiffe, der Golf von Mexiko ist groß genug, und der Schiffsverkehr ist dort sehr, sehr spärlich. Welcher Hafen kommt denn außer New Orleans groß in Betracht? Wenn erst einmal der Panama-Kanal fertig ist, dann freilich wird das dort anders werden.
Am zweiten Tage unseres zwecklosen Hierliegens, nachdem durch mehrtägige Windstille die See glatt wie ein Spiegel geworden war, wurde eine geografische Ortsbestimmung bis zur zehntel Sekunde gemacht, was auf diesem Breitengrade einem Rechteck von etwa drei Meter Länge und zwei Meter Breite entspricht. Oder richtiger gesagt: drei Meter breit und zwei Meter lang.
Ich will nicht schildern, wie dieses Kunststück gemacht wird, kann es überhaupt gar nicht. Ausführen kann das nur der wirkliche Astronom. Es ist dies ein Wunder der astronomischen Berechnungskunst. Die Formeln werden mit fünfzehnstelligen Logarithmen berechnet, selbst die Schwankungen der Erdachse müssen dabei in Betracht gezogen werden.
Nur noch eines möchte ich dazu anführen: Jedes Jahr tritt ein englisches Kriegsschiff eine Reise um die Erde an, die mindestens drei Jahre währen muss, sodass mindestens immer drei solcher »Chronometerschiffe« unterwegs sind. Von den Seekadetten werden sie aber »Zitterrochen« genannt. Weil die Herrchen, die darauf kommandiert sind, drei Jahre lang zittern. Nachdem das Schiff den Heimathafen verlassen hat, öffnet der Kapitän auf einem gewissen Grade oder zu einem bestimmten Termine eine versiegelte Order.
Da steht drin, wohin er zu fahren hat. Es ist immer eine Küstengegend, oder eine Bank, jedenfalls eine Untiefe, über der keine Strömung herrscht.
Aber wo die sich nun befindet, das weiß vorher niemand als die gelehrte Kommission, welche diese Order ausgesetzt hat. Die ganze Welt kommt dabei in Betracht. Es kann dicht am Heimatshafen sein oder sonstwo an der britischen Küste, oder bei Afrika, oder bei Australien oder mitten im Meere, oder sonstwo.
Dorthin fährt das Kriegsschiff, wartet ganz stilles Wetter ab, lotet eine Untiefe aus, und jetzt müssen die Seekadetten unter Leitung eines Astronomen eine Ortsbestimmung bis zur zehntel Sekunde machen.
An der berechneten Stelle wird eine Kanonenkugel frei versenkt.
Dann erst macht das Kriegsschiff seine eigentliche Reise um die Erde, absolviert alle vorgeschriebenen Stationen.
Nach drei Jahren kehrt es nach jener Stelle zurück. Wieder müssen die Seekadetten eine Berechnung bis zur zehntel Sekunde machen, diesmal ganz allein, jeder für sich — die Formeln muss allerdings der Astronom geben — und dann wird ein großer Magnet über Bord gelassen.
Dieser Magnet muss die Kanonenkugel wieder heraufziehen, die vor drei Jahren hier versenkt worden ist.
Es handelt sich dabei um eine Prüfung des mitgenommenen Chronometers, nach den Resultaten innerhalb von Jahrzehnten werden die Schwankungen der Erdachse berechnet, deshalb dieses Experiment immer an den verschiedensten Punkten der Erde.
Und für die Seekadetten handelt es sich dabei darum, ob sie dann zum letzten Examen zugelassen werden oder nicht. Deshalb der »Zitterrochen«, auf dem sie drei Jahre lang zittern. Wenn's auch nicht gar so schlimm sein mag. Sie können's nämlich überhaupt alle nicht! —
Wir lagen über einer Untiefe von ungefähr hundertzwanzig Metern, die natürlich schon ausgesucht worden war, wozu aber nur eine ganz einfache Berechnung nötig gewesen war, die jeder Steuermann ausführen kann.
Hier wurde eine Boje verankert. Eine Strömung gab es nicht. Nun wurde die Lage dieser Boje berechnet bis zur zehntel Sekunde, was aber nur Doktor Isidor, wie auch ich ihn gleich nennen will, ausführen konnte.
Von Zeit zu Zeit wurde die Lage dieser Boje verändert. Nach ungefähr fünf Stunden unausgesetzten Rechnens war es geschehen.
Jetzt wurde dicht neben der Boje ein großer, starker Elektromagnet hinabgelassen. Wenn die Sache stimmte, dann ging unser bester Schiffschronometer zwei und vierzehntel Sekunden nach. Denn natürlich muss bei so etwas auch erst die Ortszeit astronomisch berechnet werden! Das ist ja eben das Kunststück dabei!
»Ich kann's nicht glauben!«, meinte Kapitän Stevenbrock, der sich in einer Aufregung befand, wie ich eine solche selten bei ihm gesehen, mir um so unbegreiflicher, wie ich selbst von dieser ganzen Sache ja gar nichts verstand.
»Sie werden's ja gleich sehen«, entgegnete Doktor Isidor, »und wenn's nicht stimmt, dann will ich nie wieder einen Kognak trinken.«
»Dann trinken Sie eben Rum oder anderen Schnaps.«
»Auch nicht. Dann werde ich Abstinenzler. Freilich ist das so gut wie mein Tod, aber — da, da, da — meine Herrschaften, ich werde dem Leben erhalten bleiben.«
Der heraugezogene Magnet tauchte wieder auf, noch etwas höher, und man sah daran etwas Großes, Schwarzes von viereckiger Form hängen.
Jetzt geriet Kapitän Stevenbrock erst recht in Aufregung. Aber einen Witz oder irgend etwas Drastisches musste es doch dabei geben, ohne das ging es hier nun einmal nicht.
»O Wunder über Wunder!! Doktor Isidor, Doktor Isidor!! Mensch, wenn Sie doch nur nicht so saufen täten!!«
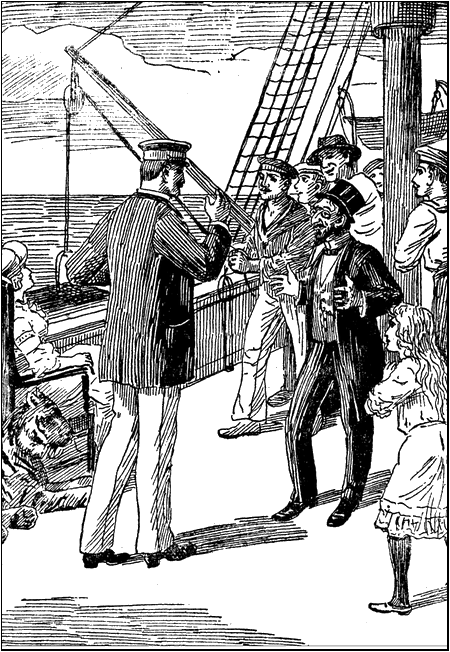
»O Wunder über Wunder!«, rief Kapitän Stevenbrock dem
vor ihm stehenden Doktor Isidor zu, als der Magnet aus dem
Meer tauchte und etwas Großes, Schwarzes hochbrachte.
»Tja, dann könnte ich's aber ooch nich!«, versetzte das kleine Krummbein, den Zylinder im Nacken, den Klemmer auf der krummen Nas' dabei mit beiden Händen eine Bewegung genau wie ein polnischer Schacherjude machend.
Nun muss ich erst noch etwas erwähnen. Die Berechnungen hatte Doktor Isidor wohl allein gemacht, aber nicht mit eigener Hand.
Das konnte er nicht.
Er konnte wohl Zahlen schreiben, konnte sie aber dann selber nicht lesen.
Dermaßen hatte er den Tadderich, und zwar den permanenten.
Bezecht konnte der überhaupt nicht mehr werden, sogar schon das Delirium hatte er als eine Kinderkrankheit hinter sich. Früher sollte er ziemlich behäbig gewesen sein, jetzt war er schon längst zur Mumie ausgetrocknet. Der Alkohol, der sich ja gierig mit Wasser verbindet, hatte ihm alle Feuchtigkeit aus dem Leibe gesaugt. Der hatte sich gewissermaßen von innen heraus in Spiritus eingesetzt.
Aber der böse Tadderich! Den konnte er nicht bemeistern. Auch nicht mehr durch neuen Alkohol. Der Tadderich ging ihm schon bis in die Knie hinab und noch weiter. Nur der Kopf zitterte noch nicht. Bis auf die Ohren, die fingen auch schon an.
Also schreiben konnte der nicht mehr. Wenn er eine kleine Eins hinmalen wollte, wozu doch nur ein einziger Strich nötig ist, so wurde eine ganze Landkarte daraus, die hundertarmige Nilmündung.
Also er hatte seine Berechnungen nur diktieren können. Die Offiziere hatten Nebenrechnungen auszuführen, und alle anderen schienen nicht sehr fürs Rechnen oder auch nur fürs Zahlenschreiben eingenommen zu sein. Freiwillig meldete sich niemand. Oder doch — der Matrose Moritz trat keck hervor. Aber der konnte nicht einmal das kleine Einmaleins, und ein bisschen Rechenkunst ist denn doch nötig, auch wenn einem alles diktiert wird.
»Weißt Du, was ein Komma ist, Moritz?«
»Ja.«
»Na, was denn?«
»Was so am Himmel herumfährt, mit einem langen Schwanze.«
»Du meinst wohl einen Kometen?«
»Ja.«
Moritz wurde als unbrauchbar zurückgestellt.
Und andere wollten sich nicht freiwillig melden.
Da musste wohl kommandiert werden. Infolgedessen hatten sich bereits einige Geister unsichtbar gemacht.
»Diese Hasenfüße!«
Oskar, der Segelmacher, hatte plötzlich die schrecklichsten Bauchkneipen bekommen, hatte willig ein großes Glas Rhizinusöl geschluckt, saß schon seit zwei Stunden auf jenem Örtchen, das sich an Bord des Schiffes immer unter der Gallion befindet. Da aber meldete sich doch noch jemand freiwillig. Mister Russell, der den ganzen Tag in seiner eigenen schönen Kabine Landkarten kopierte, ohne irgendwie getrieben zu werden.
Er sei zwar kein besonderer Mathematiker, aber für das, was da verlangt würde, reichten seine Rechenkünste wohl aus.
Gut, er war es, dem der Astronom die endlosen Zahlenreihen in den Bleistift diktierte.
Und nun also hatte der Elektromagnet den gesuchten Gegenstand wirklich zum Vorschein gebracht, vom Meeresgrund heraufgeholt.
Es war ein Kasten von etwa einem Meter im Quadrat, das heißt von oben gesehen, doch sicher aus Eisen, sonst hätte ihn der Magnet nicht angezogen und festgehalten, von schwarzer Farbe.
Das war alles, was ich zu sehen bekam, und das auch nur zur Hälfte, denn weiter sollte der Kasten gar nicht aus dem Wasser kommen.
Ebenso erfuhr ich auch nicht, was er enthielt, nur eine Andeutung bekam ich vom Kapitän zu hören.
»Sieh, Helene«, wandte er sich an die Patronin, die dicht an der Bordwand saß, »das ist der Eisenkoffer, der jenes Geheimnis birgt, das mehr wert ist als alle Schätze der Erde. Mag er dort unten weiter ruhen, bis die Zeit gekommen ist, da wir dieses Geheimnis ausbeuten werden. Dort unten ist er sicherer aufgehoben als in der Stahlkammer der Bank von England.«
Der elektrische Strom wurde unterbrochen, der Eisenkoffer löste sich ab von dem wirkungslos gewordenen Magneten, senkte sich neben der Bojenleine wieder hinab auf den Meeresgrund.
Und ich sah den gierigen Blick, den Mister Russell ihm nachsandte, wie er wieder unter Wasser verschwand.
Aber den Kapitän warnte ich nicht mehr. —
Also wir hatten doch nicht zwei Tage so zwecklos hier gelegen, sondern ganz stille See abgewartet, um diesen Kasten einmal aus hundertzwanzig Meter Tiefe ans Tageslicht zu befördern, oder doch um einmal auf hoher See auf beweglichem Schiffe solch eine geografische Ortsbestimmung bis zur zehntel Sekunde auszuführen.
Nun aber vergingen wiederum drei Tage, und wir lagen noch immer zwecklos auf derselben Stelle, wenn auch nicht so ganz genau auf derselben, denn wenn die Strömung auch gar nicht bemerkbar war, so wurden wir doch etwas nach Norden getrieben.
Doch was heißt zwecklos?
Im menschlichen Leben wird manche Beschäftigung höchst wichtig genommen, mit tiefstem Ernste betrieben, die tatsächlich ganz zwecklos ist.
Wir aber freuten uns des Lebens, dabei versuchte sich jeder in seiner Weise möglichst zu vervollkommnen, und das ist durchaus nicht zwecklos.
Am fünften Tage gegen Mittag tauchte am nördlichen Horizonte wieder einmal ein Dampfer auf, der sich uns schnell näherte, anscheinend direkt auf uns zuhielt, und das war sehr merkwürdig. Denn alle Dampfer fahren doch die genau bekannten Kurslinien, von denen sie möglichst wenig abzuweichen suchen, und wir lagen außerhalb aller solchen Dampferlinien. Die Schiffe, die bisher in unsere Nähe gekommen, waren ausschließlich Segler gewesen, spärlich genug, nur ab und zu hatten wir einen Dampfer von weitem gesehen, und der hatte sich eben auf seinem Kurse verirrt, war gezwungen worden, ihn zu verlassen, was am häufigsten durch Maschinendefekte passiert, wenn der Dampfer durch Strömungen abgetrieben wird.
Dieser Dampfer hier hielt nun direkt auf uns zu, das war sehr merkwürdig, so viel wusste nun auch ich schon.
Am merkwürdigsten aber fand ich, dass unsere Mannschaft diesem Dampfer so wenig Beachtung schenkte. Wohl blickten sie beim Gang über Deck darnach, aber kleine Segler, die sich uns genähert, hatten sie ganz anders beobachtet, hatten über sie geurteilt, während ich hier keine einzige Bemerkung zu hören bekam.
Unterdessen war er in gute Augensicht gekommen, wollte westlich an uns vorüber.
Es war ein stattlicher Frachtdampfer, den ich nun schon auf sechstausend Tonnen taxieren konnte — so etwas lernt man schnell — der entweder ganz neu gebaut sein oder eben erst das Dock verlassen haben musste, denn er war ganz frisch gemalt, sah wie geleckt aus, wie aus dem Ei geschält.
Auffallend war auch, wie hoch er ging. Der schwarze Strich der Ladelinie ragte mehr als einen Meter über das Wasser. Er musste wohl nur eine ganz kurze Reise von Hafen zu Hafen vorhaben und ganz bestimmt mit bestem Wetter rechnen, dass er sich nicht mehr mit Ballast beschwert hatte, denn sonst kann solch ein hoher Gang doch sehr gefährlich werden.
Am Heck flatterte das Sternenbanner der Vereinigten Staaten, einen Namen konnte ich auch durchs Fernrohr noch nicht erkennen. Denn der steht ja nebst dem des Heimathafens außer hinten am Heck nur auf den Rettungsgürteln, auf Holzeimern und dergleichen, und solch einen Gegenstand bekam ich nicht gleich in mein Fernglas.
»Die ›Germania‹ von New Orleans!«, sagte da Kapitän Stevenbrock neben mir. »Gefällt Ihnen der Kasten?«
»Ein sehr schönes Schiff.«
»Es gehört Ihnen.«
»Mir?«
Ich wusste gar nicht, was der Kapitän jetzt wieder für einen Witz herausstecken wollte. Oder schenkte er mir diesen Dampfer etwa so, wie man einem Kinde den Mond oder einen vorbeifliegenden Sperling schenkt.
»Der gehört Dir, mit dem kannst Du machen was Du willst.«
»Gewiss. Wenigstens sind Sie Mitbesitzer von diesem Schiffe. Es ist als erstes aus der Germania-Werft zu New Orleans hervorgegangen. Limited, also Aktiengesellschaft, und auch Sie sind von dieser Gesellschaft Aktionär.«
Der Kapitän ging wieder.
Ich hatte genug gehört. Oder ich wäre sehr beschränkt gewesen, wenn ich mir nicht selbst gleich weitere Erklärungen hätte geben können.
Also die modernen Argonauten begnügten sich nicht nur damit, abenteuernd in der Welt herumzufahren, nur hin und wieder einmal eine Fracht zu nehmen, so wie jetzt, sondern sie befassten sich jetzt auch schon mit Schiffsbau und Reederei im Großen, und zwar nach kommunistischem Prinzip.
Dass diese Germania-Werft in New Orleans den Argonauten gehörte, das konnte der anderen Welt noch nicht bekannt sein, sonst hätte ich in London sicher schon davon gehört.
Nun wunderte ich mich aber auch nicht, als jetzt der Dampfer direkt auf uns zuhielt, und eine Viertelstunde später lag er Bord an Bord neben uns.
»Hallo, Fritz, wie geht's?«
Mit diesen Worten sprang Kapitän Stevenbrock hinüber und schüttelte einem jungen Manne, der nur der Kapitän sein konnte, die Hand.
Es war die einzige Begrüßung, die stattfand. Sofort wurden hüben wie drüben die Lukendeckel geöffnet und Rohre gelegt, und wenn es kein spezielles Getreideschiff war, so hatte der Dampfer doch einen gewaltigen Exhaustor an Bord, der mit mehreren Röhren in der Stunde dreihundert Tonnen Getreide saugte, in der Sekunde fast hundert Liter. So war es innerhalb von zehn Stunden geschehen: Unsere dreitausend Tonnen russischer Weizen waren hinüber in den anderen Schiffsbauch gewandert, und unsere Bunker hatten sich zum Teil mit Wasserballast gefüllt.
Und in derselben Zeit auch wurde von den tausend Tonnen anderer Nahrungsmittel, hauptsächlich Salzfleisch und Konserven, die Hälfte mit Winden hinübergehoben. Die andere Hälfte behielten wir selbst.
Punkt elf Uhr in der Nacht schlossen sich die Luken wieder. Es war eine ungeheure Arbeit gewesen, die wir in diesen zehn Stunden geleistet hatten. Wir, sage ich, denn auch alle Offiziere hatten mit zugreifen müssen, ich nicht ausgenommen, nicht nur die übergehenden Ladungen notierend.
Trotz dieser ungeheuren Arbeitsleistung gab es dann keine Ruhe. Sofort fand ein Fest statt. Die sechsundvierzig Mann Besatzung der »Germania« kamen zu uns herüber, und ihr Schiff führte seinen Namen mit Recht, lauter germanische Männer dem Gesicht, wie der Gestalt nach, erst wurde getafelt, und dann gaben ihnen die Argonauten in der Batterie eine Vorstellung, die bis früh um vier dauerte!
Ich konnte nur staunen. Dass diese Kerls nach solcher Arbeit noch so turnen und so auf der Bühne herumspringen konnten, mit dem fröhlichsten Humor! Es schien eine Art von Mobilmachung zu sein, die Kapitän Stevenbrock einmal arrangierte, um die Leistungsfähigkeit seiner Leute für den Ernstfall zu prüfen, und ich kann nur sagen, dass es eine glänzende Leistung war. Dann noch einmal große Tafel, wobei diesmal auch ganz tüchtig pokuliert wurde, und dann ging es immer noch nicht zur Ruhe, dann fand immer noch ein Austausch von Bord zu Bord statt.
Eine Unmasse von Turngerätschaften aller Art, von deren Vorhandensein ich gar nichts gewusst hatte, wurden ausgepackt und wanderten nach der »Germania« hinüber, wurden zum Teil gleich montiert, und dann gingen auch noch zwei von unseren Matrosen hinüber, um drüben zu bleiben: Der riesenhafte Advokatenschreiber Häckel und der Schriftsetzer Starke, zwei von jenen acht Meisterschaftsturnern.
Letzterer war übrigens schon Steuermann, hatte schon vor zwei Jahren in einem australischen Hafen sein Examen bestanden und war vom deutschen Konsul beglaubigt worden. Ging aber an Bord der »Argos« immer noch als Matrose. Wie es neunzig Prozent von allen Steuerleuten tun.
Die letzte gemeinschaftliche Mahlzeit war zugleich eine Abschiedsfeier gewesen. Obgleich deswegen kein Trinkspruch ausgebracht worden, kein einziges Wort gefallen war. So etwas schien es an Bord der »Argos« gar nicht zu geben.
Was die beiden dort drüben sollten, brauche ich wohl nicht erst besonders zu erwähnen, nachdem ich gesagt, dass auch Turngerätschaften aller Art hinübergekommen waren.
Diese beiden neuen Argonauten wurden die Turnlehrer und Trainingsmeister der neuen Germanen. Erst nachdem diese beiden selbst wieder Schüler und vollwertige Meister herangebildet, jenes ganze Schiff nach unserem Muster eingerichtet hatten, sollten sie sich wieder mit uns vereinigen.
Zwar erfuhr ich von alledem nichts, es wurde Spektakel genug gemacht, über alles mögliche gesprochen, nur nicht über so etwas — aber es lag ja nur zu klar auf der Hand, da brauchte man keine besondere Ahnungen zu haben.
Ich aber hatte dennoch wieder einmal eine Ahnung. Ich ahnte, was unser Kapitän da Gewaltiges vorhatte.
Auf diese Weise ein neues Germanengeschlecht heranzuzüchten, seebeherrschende Wikinger, die nur nicht von der alten Welt, sondern von einer neuen aus, von Nordamerika aus, wie es eben der Lauf der Zeit mit sich bringt, hinausziehen sollten, um alle Meere zu erobern, wohl im friedlichen Wettkampfe, aber auch geübt und gestählt für jeden Ernstfall.
Und herrschte nicht auch in jedem hundertriemigen Wikingerschiffe vollkommene Gleichberechtigung? Wurde die Beute nicht gleichmäßig verteilt?
Genug davon!
Und noch ein anderer Mann verließ uns, wanderte hinüber auf die »Germania«.
Der Mann aus der Porzellankiste.
Ich habe über ihn nichts weiter zu sagen, als dass er während der ganzen Reise unter ärztlicher Behandlung gestanden hatte. Er bekam ein besonderes Essen, ausgesuchte, leichtverdauliche Speisen, musste sich an Deck bewegen, ohne irgendwelche Arbeit zu leisten, wurde wie ein fürstlicher Patient in einer Privatklinik verpflegt.
Er blieb verstockt, wollte nichts über seine Personalien angeben. Aber er wurde auch gar nicht mehr darnach gefragt. Und doch, es ging eine starke Umwandlung in seinem Innern vor sich. Manchmal, wenn er so der Batterie oder an Deck dem Turnen und den Spielen der Argonauten zusah, gewahrte ich in seinen Augen ein sehnsüchtiges Leuchten. Ach, wie gern hätte er mit daran teilgenommen! Er wurde nicht dazu aufgefordert, und er selbst wendete nach einiger Zeit dem Treiben verächtlich den Rücken, um dann doch wieder sehnsüchtig zuzuschauen.
»Der Mann ist von seinem Lungenspitzenkatarrh geheilt, meine erste Ansicht, er neige zu Lungenschwindsucht, war übereilt. Gar keine Spur davon.«
So meldete Doktor Isidor dem Kapitän, als wir am dritten Tage hier gelegen hatten.
Die Mannschaft war gerade mit Deckwaschen beschäftigt.
»Dann kann ich ja auch mit arbeiten!«, sagte der Mann sofort, nach einem Eimer greifend.
Nein, er durfte auch fernerhin keinen Handgriff tun, also sich natürlich auch nicht an den Übungen und Spielen beteiligen.
Und jetzt, zwei Tage später, wurde er hinüber an Bord der »Germania« gebracht.
Ich hörte keine Erklärung. Aber ich brauchte eine solche auch gar nicht. Ich wusste es von allein, was man mit diesem verstockten Sünder vorhatte, auf welche Weise man ihn in die Dressur nahm.
Der Kupferstecher sah ihm mit recht unsicheren Blicken nach.
Als sich die Sonne über dem Horizonte erhob, löste sich Bord von Bord, die »Germania« rauschte unter Volldampf nach Südosten davon.
»Vergiss nicht, unseren alten Freund Hermann in Rangoon aufzusuchen!«, rief Stevenbrock noch einmal dem Kapitän zu.
Jetzt erst erfuhr ich es. Vorher war auch nicht das geringste Wort darüber gefallen.
Also die dreitausend Tonnen russischer Weizen und wenigstens die Hälfte der anderen Nahrungsmittel gingen doch noch nach Rangoon für die Hungernden.
Wozu da dieser Umweg? Weshalb der Austausch auf hoher See? Ist in Nordamerika der Weizen nicht ebenso billig zu haben wie in England?
Ganz zwecklose Fragen?
Unser Kapitän hatte es so gewollt, und der wusste schon, was er wollte, weshalb er so etwas tat.
Auch wir gaben Dampf, durch Ölfeuerung, und fuhren nach Norden davon.
Doch gar nicht weit, so blieben wir schon wieder liegen, immer noch auf spiegelglattem Wasser.
»Loten!«
Hallo, nur sechsundzwanzig Meter Tiefe! Und die Seekarte gab hier überall eine Tiefe von achthundert Metern und noch mehr an.
Wir mussten uns über einem unterseeischen Gebirge befinden, über seinem Kamme, was schon bei jenen hundertzwanzig Metern der Fall gewesen war, und von diesem Gebirge war der anderen Welt noch nichts bekannt.
Teilte Kapitän Stevenbrock diese seine Kenntnis — gleichgültig woher er sie hatte — nun den Seewarten mit, auf dass darnach die Seekarten berichtigt wurden?
Er hatte hierzu durchaus keine Verpflichtung, weder als Seemann noch als moralischer Mensch. Denn eine Tiefe von sechsundzwanzig Metern bedeutet für kein Schiff irgendwelche Gefahr. Ganz gleichgültig, ob man tausend Meter oder sechsundzwanzig unter sich hat. Also konnte er, wenn er aus irgend einem Grunde wollte, diese seine Kenntnis ganz ruhig für sich behalten.
Wieder wurde der Elektromagnet am ausgestreckten Stagbaum aufgehängt, das Schiff wurde noch ein klein wenig dirigiert, dann musste er schnell fassen.
»Hoch!«, kommandierte der Kapitän, als die Leine den 25. Meterknoten zeigte.
Als der Magnet wieder heraufkam, da hing etwas daran.
Es war ein Gestell von eisernen Stäben, wie ein Gitterkäfig, nur die Stäbe sehr weit voneinander abstehend, und unten auf den Gitterstäben lag eine ungeheure Muschel, wohl dreißig Zentimeter lang und zwanzig breit.
Ich hatte wohl schon größere Muscheln in Museen gesehen, aber das hier schien, meiner Ansicht nach, eine gewöhnliche Pfahlmuschel zu sein, doch auch wieder etwas an eine Auster erinnernd, und von solchen riesigen Pfahlmuscheln oder Austern hatte ich noch nichts gehört.
Sie hatte sich mit ihrem Barte an die Gitterstäbe geklammert, war geschlossen. Der ganze Käfig kam in ein größeres Gefäß mit Glaswänden, das mit Salzwasser gefüllt wurde. Doktor Isidor goss aus einem Fläschchen eine wasserhelle Flüssigkeit hinein, und gar nicht lange dauerte es, so öffnete sich die Muschel, weit, so weit sie konnte.
Und da sahen wir es.
Zwischen den Weichteilen und der Schale lag sicher gebettet eine runde Perle.
Eine weiße Perle vom schönsten Glanze, so groß wie eine welsche Nuß, wie eine große Kastanie.
»Die ist schon wieder ganz hübsch gewachsen!«, meinte der Kapitän.
Nichts weiter.
Ich bekam nichts anderes zu hören.
Das Gittergestell wurde wieder aus dem Gefäß gehoben, über Bord geschwungen, es kehrte samt der Muschel wieder auf den Meeresgrund zurück.
Ich staunte und staunte.
Weniger darüber, dass hier auf dem Meeresgrunde an bekannter Stelle in einer mächtigen Perlenmuschel eine Perle zur Riesengröße gezüchtet wurde.
Nein, hier lag noch ein ganz anderes, ein unergründliches Rätsel vor. Auch jener Eisenkasten war an einer ganz bestimmten Stelle gehoben worden, nachdem man diese mit zehntel Sekunde berechnet hatte.
Das war ein astronomisches Kunststück gewesen, aber doch begreiflich.
Der Kapitän selbst hatte darüber gestaunt, wie unser Doktor Isidor das fertig gebracht, trotz unseres falschgehenden Chronometers, dessen Fehler er nicht gekannt hatte.
Und jetzt ließ der Kapitän hier ohne jede weitere Berechnung den Elektromagneten ganz einfach hinab und holte sofort den Gitterkasten herauf!
Denn eine Berechnung war nicht etwa vorhergegangen, das wusste ich bestimmt.
Der Leser versteht, worüber ich so staunte.
Hier gab es für mich nur eine einzige Erklärung, die aber an sich wieder selbst etwas Märchenhaftes hatte: entweder war dieser Kapitän Stevenbrock selbst ein Gott oder doch Halbgott, mit Allwissenheit begabt, oder er stand mit solchen Geistern in Verbindung. —
Von hier aus gingen wir direkt nach Havanna. Wozu, weiß ich nicht.
Doch nicht nur darum, dass wir ein paar hundert Kisten »Echte« an Bord nahmen.
Wohl nur, damit sich die Leute wieder einmal ein paar Tage amüsieren konnten. Eine Vorstellung gaben wir nicht, sondern wir ließen uns eine von der Bevölkerung geben.
In Havanna wurde gerade das Fest der glücklichen Tabaksernte gefeiert. Wozu aber nicht nur gehört, dass die Blätter glücklich vom Felde hereingebracht worden sind, sondern sie müssen auch schon glücklich die Gärung durchgemacht haben. Daher das Dankfest erst so spät im Herbst, Anfang Winter.
Eigentlich kamen wir etwas zu spät. Das große Volksfest, einige Tage während, mit Tanz und den unvermeidlichen Stiergefechten, war schon vorüber. Immerhin, es herrschte noch immer Festzeit, jetzt kamen die Feuerwerke daran.
Aber mit Feuerwerk war den Argonauten nicht gedient. Wir mieteten den großen Stierkampfzirkus, machten Propaganda, und schon am anderen Tage tanzten vor uns in der Arena rund fünftausend junge Zigarrenarbeiterinnen, führten ihre Nationaltänze auf, den Fandango und die Tarantella und wie sie alle heißen, den Bauchtanz nicht zu vergessen.
Nur vor uns hundert Argonauten!
Anderes Publikum hatte keinen Zutritt.
Wofür jedes der fünftausend bildhübschen Mädels drei spanische Dollars erhielt, zwölf Mark.
Wie es dabei zuging, darüber schweigt des Sängers Höflichkeit.
Toller als toll!
Doch hätte dieses »Amüsement« für uns auch übel ablaufen können. Diese fünftausend bildhübschen Zigarrenarbeiterinnen hatten den angebotenen drei Dollars nicht widerstehen können, obgleich viele schon verheiratet waren, die anderen hatten doch schon ihre Verlobten oder Geliebten oder doch Brüder und dergleichen.
Und diese waren nicht zufrieden damit, dass uns ihre Weiber und Bräute und Schwestern da drin hinter verschlossenen Türen den Bauchtanz vormachten.
Caracho di bognetti!
Nieder mit den deutschen Hunden!
So erklang es draußen.
Aber wir brauchten nichts zu fürchten, es kam auch zu keinem Kampfe.
Unser Kapitän und sein Generalstab hatte schon für alles gesorgt.
Ehe die wütenden Männer die Tore stürmten und die Bretterwände einrissen, wurde sie freiwillig eingelassen, und da kam gleich der zweite Teil daran.

Die Argonauten gaben doch noch eine Vorstellung. Nur nicht eine solche, wie es sonst der Fall war.
Es waren in der Stadt noch gegen zwei Dutzend beste Kampfstiere vorhanden gewesen, die standen bereits in den Ställen, waren schon genügend wild gemacht worden, und die wurden jetzt in die Arena zum Kampfspiel getrieben.
Na, und wer den Spaniolen ein Stiergefecht gibt, der hat sie doch schon überhaupt gewonnen, kann mit ihnen machen, was er will. Aber nicht genug hiermit, nicht dass wir fremde Kämpfer engagiert hätten, sondern die Hälfte der Argonauten selbst ließ sich gleichzeitig mit den wilden Biestern ein.
Ich will die Szenen nicht schildern, keine einzige. Jedenfalls großartig!
Und wie die Stiere auch gereizt wurden, so gab es doch gar keine Picadores, welche die Tiere nur necken und dann schleunigst über die Bretterwand retirieren, sondern jeder einzelne der fast fünfzig Mann war ein Toreador, der sich mit solch einem Ungetüm Auge in Auge in einen Kampf einließ, ihm ausweichend, über ihn wegspringend und dann von neuem ihn wieder reizend, bis er ihm, ohne vorhergehende Quälereien, den Todesstoß gab.
Bei den spanischen Stiergefechten geht es ja eigentlich ganz anders zu, da wird der Stier erst ganz schauderhaft gequält, aber jedenfalls hatten die Kubaner solch eine großartige Bravour noch nie gesehen!
Und nun muss man nur wissen, was bei diesen Spaniolen ein nur einigermaßen guter Toreador oder Torero oder Matador zu bedeuten hat! Berühmt braucht er gar nicht zu sein, er kann ja vielleicht das erste Mal auftreten. Was der im gesellschaftlichen Leben für eine Rolle spielt, was der für Vorrechte genießt!
Es kann nicht weiter beschrieben werden, denn wir haben für so etwas gar kein Verständnis.
Nur das eine kann gesagt werden: Solch ein Toreador gilt nicht mehr als ein Mensch, sondern als ein Gott. Im buchstäblichen Sinne des Wortes! Zum Beispiel insofern, als es sich auch die vornehmste und moralischste Familie zur höchsten Ehre anrechnet, wenn solch ein Toreador als Hausfreund ein und aus geht. Als Hausfreund in jenem bekannten Sinne. Also ganz einfach, wenn er der Galan der Hausfrau oder der Tochter ist!
Das von ihm erzeugte Kind gilt als Hidalgo, resp. als Hidalga, und wenn es auch von der ärmsten Fabrikarbeiterin stammt.
Und das wird sogar gesetzlich anerkannt!
Das sind eben spanische Verhältnisse, für die wir germanischen Völker gar kein Verständnis haben.
Aber wir haben so etwas schon einmal im alten Griechenland gehabt, mit den siegreichen Athleten in den olympischen Spielen.
Und diese Zeit kann auch für uns noch einmal kommen. In England hat man bereits angefangen, den berühmten Fußball- und mehr noch Kricketspielern Denkmäler zu setzen, sie in Erz und Stein zu verewigen.
Kurz, wir brauchten nichts zu fürchten.
Alle diese Spaniolen, die uns erst hatten massakrieren wollen, sie tobten vor Begeisterung, und ungeheuerlich war erst recht dann der Enthusiasmus, mit dem sie uns an Bord begleiteten.
Sonst will ich nur noch eines erwähnen: Zwanzigtausend »Echte« hatten wir ehrlich gekauft. Dreißigtausend bekamen wir dazu geschenkt. Sie wurden uns bündel- und kistenweise in die Taschen gesteckt. Natürlich lauter gemauste Zigarren. Und ebenso natürlich hatten diese Zigarrenarbeiter und ihre Weiber und Bräute und Schwestern nichts Schlechtes gemaust. Die besten Zigarren werden in Kuba noch heute selbst verkonsumiert, kommen gar nicht zum Export. Ob diese gefährliche Spielerei sonst gut abgelaufen war?
»Wem etwas passiert, den lasse ich kielholen, auch noch als toten Leichnam!«
So hatte Kapitän Stevenbrock die sich zum Kampfspiel Meldenden gewarnt.
Dem Heizer Franz war die linke Wade etwas aufgeschlitzt und dem Matrosen Hahn zwei Vorderzähne eingeschlagen worden, das war alles. —
Von Havanna ging es nach der Küste von Parahyba, einen ansehnlichen Strom hinauf, der aber auch auf den genauesten Landkarten nur problematisch angedeutet war, vor einer großen Insel wieder einen Nebenfluss hinauf, wir gelangten in ein weites Wasserbassin, in das sich der Zufluss als Katarakt ergoss. Diesem gegenüber wurde nahe den Felswänden ein großer, sehr schwerer Eisenkoffer versenkt.
Wieder glaubte ich, über den Zweck nicht eingeweiht zu werden. Die Leute machten dabei keine einzige Bemerkung. Da aber nahm mich der Kapitän vor, berichtete mir. Der Leser weiß, was er mir erzählte. Wenn ich auch nichts weiter hinzufügen kann, nicht, in welcher Weise der erste Steuermann dem Komplott entgegengekommen war und sich vor dem hypnotischen Mittel zu schützen verstanden hatte.
Das Wasserbassin hatte noch einen anderen Zufluss, den fuhren wir hinauf, durch eine enge Felsenschlucht, kamen in ein kleineres Bassin, und hier blieben wir liegen.
Aus alledem musste ich annehmen, dass die »Argos« nicht zum ersten Male hier war. Die Fahrt auf dem doch sehr gefährlichen Wasser wurde gar zu sicher ausgeführt.
Hier blieben wir bis zum anderen Tage liegen, dann ein Befehl, und die meisten, darunter auch ich, begaben sich über Land, durch Schluchten und Felsentunnel hindurch, nach dem großen Wasserbassin zurück, wo sich jeder ein geeignetes Versteck suchte.
Nicht lange, so kam ein kleiner Dampfer in das Bassin gefahren, die Glasröhren wurden gebraucht, Rufe der Enttäuschung, dass keine Edelsteine auf dem weißen Grunde zu sehen waren, die einzige Hoffnung klammerte sich an die große Kiste, ein Taucher ging hinab, sie wurde heraufbefördert, wie eine Zwiebel auseinander geschält.
Ein leises Zeichen und wir verließen unsere Verstecke.
»Guten Morgen, Herr Fischer! Guten Morgen, Herr Fischer!«
Der Leser weiß alles.
Auch wie Kapitän Stevenbrock den Hypnotiseur von Bord holte, wie dieser vom ersten Steuermann vorgenommen wurde. Was ich selbst erst später aus seinem eigenen Munde erfuhr. Nun aber muss ich etwas ganz, ganz Merkwürdiges erwähnen.
Russell war dabei, wie die große, schwere Eisenkiste in dem Bassin versenkt wurde, und der mochte sein Gehirn ja nicht schlecht anstrengen, was wohl da drin sein möge.
Aber von all den anderen Szenen erfuhr er nichts, merkte er nichts.
Hatte keine Ahnung, dass da noch ein anderer Dampfer gekommen war, der kaum zehn Minuten weit von uns entfernt lag.
Nicht etwa, dass er während dieser Zeit in seine Kabine eingesperrt wurde.
So etwas gab es gar nicht.
Er konnte sich auch frei an Land bewegen.
Als wir abgerückt waren, hatte er freiwillig in seiner Kabine bei der Arbeit gesessen, und als er dann wieder zum Vorschein kam, zum Nachmittagskaffee, war alles schon geschehen, die »Recovery« war sogar schon wieder davongefahren. Die Entfernung war doch zu weit, als dass er das Lachen und Johlen der Matrosen hätte hören können, auch waren Felswände dazwischen.
Und natürlich wurde ihm auch nichts davon berichtet. Immerhin, ich empfand es als etwas ganz, ganz Merkwürdiges, wie dieser Mann in so vollkommener Ahnungslosigkeit bleiben konnte, über alle diese Szenen, die sich in solcher Nähe abgespielt hatten.
Und ich selbst hatte nicht etwa Instruktion erhalten, ihm nichts davon zu erzählen. Es fiel mir ja auch gar nicht ein, aber immerhin, ich glaubte und glaube noch heute, dass so etwas nur an Bord eines Schiffes — nein, nur an Bord dieses Gauklerschiffes möglich ist und war. Einen Menschen so in vollkommener Ahnungslosigkeit darüber zu lassen, was in seiner dichten Nähe passiert, ohne ihn in seiner Freiheit zu beschränken.
Es war trotz aller Lebensfröhlichkeit seiner Besatzung das Schiff des Schweigens und daher der Geheimnisse. Aber wir waren nicht nur deshalb hierher gekommen, um denen, die es auf unsere Geheimnisse abgesehen hatten, solch einen Streich zu spielen und uns an ihrer Enttäuschung zu ergötzen.
Es ging weiter den Fluss hinauf, ein Labyrinth von Inselchen kam, in dem ich nicht wusste, wie sich der Kapitän zurecht fand, und dann ein sandiger Küstensaum, an dem wir beilegten.
Die Matrosen begaben sich mit Spaten an Land und begannen zu schaufeln.
Und wo sie auch gruben, da brachten sie aus geringer Tiefe gelbe Steine und ganze Blöcke zum Vorschein.
Bernstein! Den schönsten Bernstein, matt geadert, den ich je gesehen. In Blöcken bis zu Zentnerschwere, und der Bernstein ist ja fast so leicht wie Wasser. Also was für große Blöcke!
Bernstein in Brasilien?
Nun warum denn nicht?
Der Bernstein ist das Harz einer Konifere, eines Nadelbaumes, der jetzt nicht mehr existiert, der wahrscheinlich kurz nach der Eiszeit wieder die neue Vegetation einleitete — oder aber durch die Eiszeit vernichtet wurde. Nun, und auch ganz Amerika hat seine Eiszeit gehabt, und was für eine!
Und es ist überhaupt gar nicht richtig, glauben zu wollen, dass der Bernstein nur in der Ostsee vorkommt. Das wäre doch eine große Anmaßung.
Von der Ostsee brachten zuerst die Philister den Bernstein nach dem Orient, auf dem Landwege, um 1500 vor Christi.
Wie das die Bewohner so genau ausgerechnet haben wollen, weiß ich nicht, aber ich will es glauben.
Erst 200 Jahre später drangen die Sidonier auf dem Seewege nach der Ostsee vor, um ganz Europa herum, nur wegen dieses Elektrons, des Bernsteins.
Nun aber hat man schon in ägyptischen Pharaonengräbern Bernsteinschmuck gefunden, und man weiß bestimmt, dass diese Gräber aus der Zeit 4000 vor Christi stammen.
Woher hatten die denn ihren Bernstein?
Nun, noch heute wird auch im Libanon Bernstein gefunden, und in China an gar vielen Stellen. Er ist den Chinesen unentbehrlich. Jeder Chinese trägt wenigstens ein kleines Stückchen Bernstein bei sich, als vermeintlichen Talisman gegen Krankheiten. Allerdings ist er nicht so schön wie der von der Ostsee. Also auch hier in Brasilien gab es Bernstein, und zwar massenhaft und dem der Ostsee nicht im geringsten an Schönheit nachstehend. Auch hier hatten einmal jene Koniferen gestanden. Übrigens musste hier einmal das Meer gespült haben. Es war Seesand, vermischt mit echten Seemuscheln. Woher dem Kapitän diese Lagerstätte bekannt war, erfuhr ich nicht, und auch erst später, dass er schon einmal die kostbare Substanz von hier abgeholt hatte.
Zwei Tage lang wurde Bernstein gegraben und an Bord geborgen.
Russell schaute zu, beteiligte sich daran, und auf seine Frage, ob er ein durchsichtiges Stückchen, in das eine Mücke eingeschlossen war, behalten dürfe, erhielt er vom ersten Steuermann die Antwort:
»So viel Sie wollen.«
Der Kupferstecher war bescheiden, aber noch eine andere Frage hatte er.
»Wie sind Sie zur Kenntnis dieses Bernsteinlagers gekommen?«
»Fragen Sie den Kapitän danach.«
Russell fragte ihn aber lieber nicht.
Wir hatten den Fluss wieder verlassen und segelten langsam nach Süden hinab. Es ging die gewöhnliche Lebensweise, die man nie überdrüssig bekommen konnte, oder man passte eben nicht zu diesem Schiffe, bei Windstille blieben wir liegen, wo wir lagen, dann wurde eifrig der Schwimm- und Rudersport betrieben. Auch solche Wasserspiele wie das sogenannte Fischerstechen und dergleichen waren dann an der Tagesordnung, und alles war eine lachende Lust.
Ein tüchtiger Sturm, den wir auf der Höhe von Kap Martin, schon Patagonien, durchzumachen hatten, war nur eine angenehme Abwechslung. Ebenso angenehm wurde es aber auch empfunden, dass wir dafür dann das Kap Hoorn bei schönstem Sommerwetter umsegeln konnten, ein Ereignis, das in dieser Region der ewigen Stürme selten vorkommt.
So konnten wir uns weit der Gruppe der Hermite-Inseln nähern, deren südlichste die Insel Horn ist, richtiger Hoorn, und deren südlichster Punkt das eigentliche Kap Hoorn ist.
Wer hat, und wenn er auch schon ein Dutzend mal um Kap Hoorn gefahren ist, dieses eigentliche Kap, den südlichsten Punkt des amerikanischen Kontinents, schon gesehen?
Es müsste ein Zufall gewesen sein, eine Fahrlässigkeit des Kapitäns oder ein Walten höherer Mächte, wenn dieses Kap in Sichtweite gekommen ist.
Vorsicht! Vorsicht! So weit wie möglich abhalten von diesen Inseln!
Ach, wie es dort unten aussieht!
Desolation — das Land der Verzweiflung! Das sagt schon genug.
Und doch, es ist etwas Großes, diesen äußersten Punkt des amerikanischen Kontinents zu sehen, der sich auf der anderen Seite der Erdkugel bis hinauf zum Nordpol erstreckt. Wenn das Kap Hoorn auch nicht auf dem Festlande selbst, sondern auf einer Insel liegt. Genau so aber ist es ja auch mit dem nördlichsten Punkte Europas. Dieses Nordkap liegt ebenfalls auf einer Insel, auf Magerö. Der nördlichste Punkt des europäischen Festlandes ist Kap Nordkyn. Aber wer kennt das. Nicht einmal dem Namen nach. Nur das eigentliche Nordkap auf der Insel Magerö kommt in Betracht.
Und so ist es auch hier. Kap Hoorn auf der Insel Horn ist der südlichste Punkt von Amerika.
Wir hatten einmal das Glück schönen Wetters und ziemlich ruhiger See, so durften wir uns ihm in bequeme Sichtweite nähern.
Es ist eine schwarze, 416 Meter hohe Felsenmasse, die nach Süden glatt wie eine Mauer ins Meer hinabfällt. Von Norden her ist ein Aufstieg möglich.
Zum letzten Male ist das Kap im Jahre 1892 von einem englischen Vermessungsschiffe besucht, der Felsenberg von einer Expedition bestiegen worden. Der Dampfer hätte schließlich doch noch beinahe Schiffbruch erlitten, obgleich damals spiegelglatte See gewesen war. Zwischen den Inseln aber tobt eben ständig eine fürchterliche Brandung.
Ich stand an Deck und ließ den Eindruck auf mich wirken, den südlichsten Punkt des amerikanischen Kontinents in einer Entfernung von kaum zwei Seemeilen vor mir zu haben.
»So, mein lieber Ebert«, sagte da Kapitän Stevenbrock neben mir, »der scheidende Längengrad ist überschritten, wir befinden uns bereits im Stillen Ozean, den wir aber hier lieber Südsee nennen wollen, somit gehören Sie mit zu den wenigen Menschen, die Kap Hoorn umschifft haben, und nun wollen wir dieses noch etwas näher besichtigen.«
Und schon wendete die »Argos«, die jetzt mit Ölfeuerung Dampf gab, nach Steuerbord. Wir drangen ein in das Insel-Labyrinth. Lauter hohe Felsenmassen, zwischen denen es trotz der stillen See dort draußen fürchterlich brandete.
Aber immer wusste unser wackeres Schiff, vom Kapitän selbst gesteuert, einen sicheren Weg zu finden.
So vergingen ungefähr zwei Stunden.
Wieder türmte sich vor uns eine große, nackte Felsenmasse auf, und auf diese ging es jetzt direkt zu.
Und da sah ich etwas wie ein Wunder, mir wenigstens völlig unerklärlich.
Links und rechts eine tobende Brandung, zwischen den Klippen und Riffen spritzte der weiße Gischt haushoch empor, und in der Mitte ein ganz ruhiges Wasser, die schmale Einfahrt zu einer Bucht. Ich bekam keine Erklärung für dieses Phänomen, jetzt noch nicht.
Wir benutzten die stille Einfahrt, kamen in eine kesselförmige Bucht, eingeschlossen von glatten Felswänden, mindestens vierhundert Meter hoch.
Ja, glatt waren diese Felswände, aber doch von zahlreichen Löchern, von Höhlen unterbrochen, besonders in der Nähe des Wasserspiegels.
An einer solchen Höhle legte die »Argos« bei, wurde an starken Eisenringen befestigt, die in die schwarze Felswand eingelassen waren, und sowohl mit dem Vorder- wie mit dem Hinterteil erreichte das Schiff auch noch je eine andere Höhle.
»Kommen Sie mit, Ebert!«, sagte der Kapitän zu mir. »Sie betreten eine Insel, welche in der Geografie noch keinen Namen hat, weil sie eben der Welt noch ganz unbekannt ist. Wir nennen sie die Zuchthausinsel. Aber es ist ein falscher Name. Die Insel der Liebe sollte sie richtiger heißen, der Nächstenliebe. Sie werden einigen Personen vorgestellt. Aber Sie brauchen keine Komplimente zu sagen, kein einziges Wort, und wenn Sie sich vielleicht linkisch benehmen sollten, so wird dies hier nur als ein günstiges Zeichen für Ihren Charakter aufgefasst. Eine Erklärung erhalten Sie später.«
Wir betraten die mittlere Höhle. Noch von Tageslicht erfüllt, zeigte sie sich ganz nackt.
Hinten hatte sie eine rechtwinklige Fortsetzung, hier hätte es schon ganz finster sein müssen, aber noch immer herrschte volles Tageslicht, und ich sah doch keine Quelle, woher dieses kommen könne, staunte auch schon, dass ich von mir und meinem Begleiter keinen Schatten bemerkte.
»Sie werden später die Erklärung bekommen, was das für ein Licht ist. Vorläufig lassen Sie sich gesagt sein, dass Sie sich in einem Reiche befinden, dessen Bewohner oder doch Gründer der anderen Welt an Erfindungen um hunderte von Jahren voraus sind. Wenn Sie davon auch nicht viel anderes als dieses Licht bemerken werden, denn solch einen elektrischen Fahrstuhl hier kennt doch auch schon die andere Welt.« Wir traten in eine Nische, deren Boden mit einem Teppich belegt war, und alsbald ging es in die Höhe, jetzt in einem geschlossenen Raume.
Die eine Seite öffnete sich wieder und wir befanden uns in einem Korridor, teppichbelegt, die Wände mit schöner Mosaik verziert. Vielleicht gab es noch anderes, aber mehr sah ich nicht. Höchstens noch die Türen. Denn mein Staunen lässt sich denken, hier in diesem Felsen am Feuerlande solch eine ganze Wohnungseinrichtung zu finden.
Der Kapitän klinkte eine Tür auf.
In dem Zimmer, in das ich geführt wurde, sah ich wieder nur die Gestalt, die uns stehend empfing.
Es war eine Matrone mit schneeweißem Haar, in ein dunkles Gewand nonnenhaft gekleidet — und von dieser Matrone sah ich wiederum nur das Gesicht.
Es war von einer überirdischen Güte verklärt.
Mehr vermag ich nicht zu sagen.
Der Kapitän war auf sie zugegangen, küsste ehrerbietig die feine Hand, die ihm lächelnd entgegengehalten wurde.
Ich glaube, sie sprachen auch etwas zusammen, aber ich verstand es nicht, obgleich es deutsche Worte waren, denn ich befand mich wie im Traume.
So war ich in den Anblick dieses Antlitzes versenkt.
»Mutter Anna — das ist unser Freund Ewald Ebert!«, hörte ich dann den Kapitän sagen.
»Friede sei mit Dir, mein lieber Sohn!«, erklang dann eine wunderbare Stimme wie Glockengeläute, und auch mir wurde die Hand entgegengehalten.
Ich glaube, auch ich habe sie geküsst.
Ich weiß es nicht.
Dann befand ich mich schon wieder draußen, aber auch nicht mehr auf dem Korridor, sondern bereits auf einer Galerie, blickte hinab in einen weiten Saal, in dem viele Stühle und Tische standen, auf denen Werkzeuge, und gelbe Steine lagen. Menschen waren nicht zu sehen.
»Nun, mein lieber Ebert, erfahren Sie, wo Sie sich befinden.
In einem Zuchthause.
Hier in diesem Saale werden zweiundvierzig Sträflinge, mit Bernsteinarbeiten beschäftigt.
Sie sind gerade beim Mittagsessen, aber wir würden doch zu spät kommen, um sie dort zu beobachten, so wollen wir sie hier erwarten.
Es sind zweiundvierzig der schwersten Verbrecher, die Sie gleich zu sehen bekommen werden.
Raubmörder, unverbesserliche Einbrecher und nicht zum wenigsten solche, welche die schwersten Sittlichkeitsdelikte begangen haben, an wehrlosen Frauen und Kindern.
Ich habe sie der Bestrafung durch die irdische Gerechtigkeit entrückt.
Jener irdischen Gerechtigkeit, welche die Menschheit kennt.
Ich habe sie in mein eigenes Zuchthaus genommen. In ein Zuchthaus, welches ich nach den Plänen jener Mutter Anna hier mit ihrer Unterstützung angelegt habe, worüber sie selbst die Kontrolle führt.
Ich selbst sammle mit meinen Argonauten nur solche Verbrecher und auch entlassene Sträflinge in aller Welt auf und bringe sie hierher.
Wozu?
Mein lieber Ebert, Sie selbst sind sieben Jahre im Zuchthause gewesen, nicht unschuldig — aber Sie haben Ihre Schuld gesühnt.
Sie sagen, Sie hätten dort in den Steinbrüchen von Portland nicht eben zu klagen gehabt.
Wohl, aber indem Sie dies sagen, erklären Sie zugleich, zu wissen, dass es auch andere Zuchthäuser gibt.
Zuchthaus.
Was ist das?
Ein Haus, in dem man einem Menschen Zucht beibringen will. Und Zucht ist doch eigentlich nichts anderes als eine Erziehung, wenn uns diese ureigentliche Bedeutung auch schon fast gänzlich verloren gegangen ist.
Nur in Sprichwörtern und dergleichen findet man sie noch wieder.
Wen Gott lieb hat, den züchtigt er.
Nun wollen wir einmal sehen, wie es mit unseren Zuchthäusern beschaffen ist und was für Resultate diese Erziehung zum Guten zeitigt.«
Und Kapitän Stevenbrock sprach weiter.
Es war eigentlich nichts Neues, was ich zu hören bekam. Wie oft, ach wie oft hatte ich schon selbst solche Gedanken gehabt und habe sie noch heute!
Ich spreche nicht gern darüber.
Der Menschheit ganzer Jammer packt mich an, wenn ich nur daran denke.
Der Leser weiß genau, was ich meine.
Welcher Reform bedarf doch unsere Justiz, auf deutsch Gerechtigkeit, und vor allen Dingen unser ganzes Strafwesen, um das zu sein, was es sein sollte und eigentlich auch sein will.
Es ist eben ein Strafwesen. Es ist nichts weiter als Rache!
Ist denn aber der Menschheit irgendwie gedient, wenn man sich an einen Menschen für irgendwelche Untat rächt?
Da hat ein Mann ein Verbrechen begangen, einen Totschlag oder ein schweres Sittlichkeitsdelikt.
Wir wollen dabei nicht unterscheiden, ob er ein geborener Verbrecher ist, der es aus einem inneren, doch zweifellos krankhaften Triebe begangen hat, oder — sonst ein ganz harmloser Mensch — im Alkoholrausche.
Obgleich dabei doch ein gewaltiger Unterschied ist. Er wird einige Jahre ins Zuchthaus gesteckt. Zuchthaus!
Erhält er denn da drin irgendwelche Erziehung zum Besseren?
Glaubt man wirklich, dass ein geborener Verbrecher das Zuchthaus als besserer Mensch verlässt? Man hat ihn doch nur für einige wenige Jahre unschädlich gemacht.
Wird er entlassen, mit noch einigen Jahren Ehrverlust, der es fast ganz ausschließt, dass er irgendwo Arbeit bekommt, so hetzt man ihn als Raubtier und Scheusal doch nur von neuem auf die Menschheit los!
Genug davon!
Eine weite Tür öffnete sich, sie kamen herein — zweiundvierzig Männer strömten herein — die eine Hälfte in blauen, die andere in grauen Arbeitsgewändern. Alle sahen gesund und wohlgenährt aus, auch heiter, so wurde geplaudert und gelacht.
»Nur in den ersten Tagen sind sie nicht so lustig«, erklärte der Kapitän, »da lassen sie die Köpfe hängen mit finsteren oder verstockten Gesichtern, aber das legt sich bald.«
Sie nahmen an den Arbeitstischen Platz, trotz der verschiedenen Kleidung bunt durcheinander, das Gesicht alle nach einer Richtung, wo auf einer erhöhten Stelle ein Tisch und Pult stand.
Ein Geistlicher betrat den Raum.
Wenn jemand einen schwarzen Talar trägt und ein sogenanntes Pfaffengesicht hat, muss es doch wohl ein Geistlicher sein. Er setzte sich auf den erhöhten Stuhl, legte ein dickes Buch auf das Pult und begann mit volltönender Stimme vorzulesen.
Und was las er vor?
Na, das dicke Buch war doch natürlich die Bibel. Oder irgend ein anderes Erbauungsbuch.
Nein, eben nicht!
Nur einige Minuten brauchte ich zuzuhören, und ich wusste, was diesen Verbrechern vorgelesen wurde.
Es war Jules Vernes phantastische Erzählung »Reise nach dem Mittelpunkt der Erde«, in englischer Übersetzung.
Das wurde diesen Verbrechern und Sträflingen vorgelesen, und sie lauschten und spalteten und schnitzten und schmirgelten dabei ihren Bernstein, emsig, jedes unnütze Geräusch vermeidend.
Ich will hierzu etwas anderes erwähnen.
Wir kamen von Kuba.
Gerade auf Kuba findet man es sehr häufig, unter den Zigarrenarbeitern, Strohhutflechtern und dergleichen, die bei ihrer Arbeit kein besonderes Geräusch machen. Auch in Spanien ist es nicht selten, gerade aber auf Kuba ist es fast überall verbreitet.
Nämlich dass sich die Arbeiter — und auch die Arbeiterinnen, wenn diese gesondert beschäftigt sind — in ihrem gemeinschaftlichen Arbeitssaale vorlesen lassen. Entweder von einem professionellen Vorleser, oder der beste Sprecher und Vorleser wird aus ihrer Mitte gewählt. Sie bezahlen ihn aus eigener Tasche, er erhält seinen gewöhnlichen Tagelohn. Sind es also hundert Zuhörer, so hat jeder täglich etwa fünf Pfennige zu geben. Es wird Unterhaltungslektüre vorgelesen, Romane und Novellen, besonders auch die beliebten spanischen Ritterballaden.
Mir ist in Deutschland und in ganz Europa nichts Ähnliches bekannt.
Wir sind nur zu sehr geneigt, die spanischen Kubaner auf einen noch sehr tiefen Grad der Kultur und Bildung stehend zu halten. Sind sie aber in dieser Hinsicht uns nicht weit überlegen, dass sie sich während ihrer Arbeit ständig vorlesen lassen?
Überall lässt sich das ja nicht durchführen, nicht bei Hämmern und schnarrenden Maschinen — aber wo es möglich ist, und wie viele solcher stillen Arbeitssäle gibt es nicht, da sollte dieses Beispiel der Kubaner doch nachgeahmt werden.
Und könnte man so etwas nicht auch in den Strafanstalten einführen?
Ich sehe einige Leser lächeln. Solchen Sträflingen, solchen Zuchthäuslern, solchen Verbrechern auch noch Romane vorlesen, aus den »Fliegenden Blättern«, weiter fehlte doch nichts!
Nun wohl — also ist es besser, diese Menschen während der Arbeit mit ihren Gedanken allein zu lassen? Glaubt man etwa, dass dabei etwas Gutes herauskommt?
Aus Witzblättern soll auch nicht vorgelesen werden. Ebenso verkehrt aber wäre es, diesen Menschen Erbauungsschriften vorzulesen.
Wir haben in der Weltliteratur Sachen genug, die mit sittlichem Ernst und Belehrung zugleich die höchste Spannung verbinden. Im Anhören solcher Lektüre kann sich der Sträfling vertiefen, während er seine Tüten klebt oder ähnliche Arbeiten verrichtet, da bleiben ihm andere, schwarze Gedanken fern, da denkt er auch noch hinterher daran, und er freut sich schon wieder auf die Fortsetzung am folgenden Tage.
Und dann natürlich überhaupt ein ganz, ganz anderes Erziehungs- oder meinetwegen Zuchtsystem! —
»Es sind dies die englisch sprechenden Männer der Anstalt, und zwar fast ausschließlich Seeleute!«, erklärte der Kapitän.
»Wie viele sind im ganzen hier?«, fragte ich, und ich wusste, dass ich es durfte.
»Im ganzen 283.«
»Nur Männer?«
»Nur Männer. Wir haben auch Frauen und Mädchen untergebracht, in die Erziehung genommen, aber die sind anderswo, mit denen habe ich nichts zu tun. Das Ganze geht von der Schwester oder Mutter Anna aus, die Sie noch näher kennen lernen werden, und ich habe nur germanische Seeleute unter mich bekommen. Das heißt nur insofern, dass ich sie hier abliefere und später wieder abhole, sie dann weiter beschäftige.«
»Nach welcher Zeit?«
»Bis die hiesigen Leiter überzeugt sind, dass aus diesen notorischen Verbrechern moralische Menschen geworden sind. Das kann ein halbes Jahr oder auch viele Jahre lang dauern. Wie dies zu erkennen ist, dafür haben diese Leiter schon ihre Mittel.«
»Und wo kommen sie dann hin, wenn sie von hier entlassen werden?«
»Entweder als Arbeiter auf unsere Germania-Werft in New Orleans oder als Seeleute auf die Schiffe, die wir von dort aus in alle Welt schicken werden. Sehen Sie, das ist der Grund, weshalb ich dieses Unternehmen nicht nach Deutschland und nirgends anderswohin auf den europäischen Kontinent verlegen konnte. Weil dort der Mensch überall Papiere braucht, eine Vergangenheit hat. Nur in England und im freien Amerika ist das nicht der Fall. Da wird nicht nach Papieren, nicht nach einer Vergangenheit gefragt.«
»Werden sie hier nur mit Bernsteinindustrie beschäftigt?«
»Nein. Auch noch mit dem Schleifen von Diamanten und anderen Edelsteinen, und ferner befindet sich auch hier eine Werft, wenn auch nur für den Bau von kleineren Booten.«
»Weshalb sind die einen grau, die anderen blau gekleidet?«
»Zum Unterschied der Parteien. Es ist dasselbe wie bei uns, was Sie ja nun schon zur Genüge kennen gelernt haben. Auch hier herrscht ein ewiger Wettkampf zwischen den beiden Farben, in der Arbeit sowohl, wie in Spiel und Sport. Grau gegen Blau, wobei jeder persönliche Ehrgeiz ganz ausgeschlossen ist, da es immer nur um die Ehre der Partei geht.« —
Ich bekam auch die anderen zu sehen, bei ihrer Arbeit in der Edelsteinschleiferei und auf der Bootswerft, und dann später in weiten Hallen, mit allen möglichen Turngeräten versehen, bei Spiel und Sport.
Acht Stunden Arbeit, zwei Stunden für Mahlzeiten und häusliche Beschäftigungen, sechs Stunden körperliche Übungen — wenn sich diese »Sträflinge« des Abends zur achtstündigen Ruhe niederlegten, fielen sie augenblicklich in tiefen Schlaf. Die hingen keinen schwarzen Gedanken mehr nach, dazu hatten sie gar keine Zeit, keinen einzigen Augenblick.
Es war eine Lust, hier zu leben. Und darnach bildet sich der Charakter, der ja nur ein Resultat der Macht der Gewohnheit ist.
»Kennen Sie den hier?«
Stevenbrock ließ mich durch die Klappe einer Tür blicken.
In einer Zelle saß kein anderer als Mister Dan Russell, trübselig die Arme auf den Tisch gestemmt und den Kopf in die Hände. Dieser einfache Tisch, ein Stuhl und ein hartes Lager war das ganze Meublement.
»Er hat seine Rolle ausgespielt. Ich brauche Ihnen nur noch wenige Erklärungen zu geben.
Es existiert tatsächlich eine internationale Verbrechergesellschaft, die hauptsächlich zur See arbeitet, ihre eigenen Schiffe fahren lässt.
Auch auf unsere »Argos« hatten sie es abgesehen. Aber sich einfach unseres Schiffes zu bemächtigen, damit allein wäre ihnen wenig gedient gewesen.
Unsere Geheimnisse wollten sie erfahren, woher wir die Ambra und die Edelsteine bekämen.
Da wurde jenes Ihnen bekannte Komplott in Szene gesetzt, ganz raffiniert ausgedacht
Eine für mich bestimmte Kiste mit Porzellan wurde mit einer leeren vertauscht, ein Mann kam hinein. — Decloir heißt er, es ist ein Franzose — ein anderer, dieser Russell, musste ihn denunzieren, um sich so in mein Vertrauen zu schmeicheln, um an Bord meines Schiffes bleiben zu können.
Fragen Sie nicht, woher mir dies alles von vornherein bekannt war.
Sie werden vertrauter mit unseren Verhältnissen, mit unserer Vergangenheit werden, Sie werden die führenden Personen, die hier als Aufseher und Leiter hausen, näher kennen lernen, und dann wird Ihnen alles klar werden, was ich Ihnen jetzt unmöglich mit Worten schildern kann.
Also ich ging natürlich auf alles ein, ließ mich scheinbar übertölpeln. Dieser Dan Russell, wie er sich jetzt nennt, ist ein geschulter Astronom, der einst auf einem nordamerikanischen Vermessungsschiff angestellt war, ein ganz genialer Mensch, der auch die Karten, die er entwarf, selbst in Kupfer stach. Wegen Verrats militärischer Geheimnisse bekam er Sing-Sing, fiel dann unter die Räuber, reihte sich jener internationalen Verbrechergesellschaft ein. Der frühere Vermessungsoffizier ist heute nicht mehr zu erkennen.
Also ich gab ihm Landkarten zu kopieren, in denen geheimnisvolle Punkte mit geografischen Ortsbestimmungen eingetragen waren.
Wozu?
Nun weil der doch eben unsere Geheimnisse ergründen sollte, die er dann doch natürlich an jene Verbrechergesellschaft verriet.
Und das ist denn auch bereits geschehen.
Russell hat doppelte Kopien angefertigt, hat diese in Havanna einem Agenten der Verbrecher ausgeliefert.
Die eingetragenen Punkte sind natürlich ohne jede Bedeutung. Es handelt sich nur darum, die einzelnen Verbrecherschiffe nach abgelegenen Orten zu locken, wo sie festgenommen werden. Teils besorgen wir das selbst, teils sind auch schon andere Schiffe unterwegs, mit uns im Bunde stehend, um diese modernen Piraten abzufangen und für immer unschädlich zu machen, sie in unsere liebevolle Erziehung zu nehmen. In den nächsten Tagen wird auch hier solch ein Schiff erscheinen, in der Hoffnung, ein Lager von Ambra zu finden. Wenn es nicht von selbst festrennt, so nehmen wir es mit eigenen Händen fest. Sie werden dabei sein, wenn es geschieht.
Solch ein Schiff verschwindet dann mit der gesamten Mannschaft aus der Welt, es ist einfach mit Mann und Maus untergegangen.
Mehr habe ich vorläufig nicht zu sagen.
Jener Mann in der Porzellankiste war übrigens in gewisser Hinsicht ein Held, denn er musste darauf gefasst sein, dass wir ihn, wenn er nichts gestehen wollte, in die Tortur nahmen, ihn mindestens in den Kohlenbunkern beschäftigten.
Wie ich ihn behandeln ließ, haben Sie gesehen. Bei uns gibt es keine Rache, nicht einmal eine Bestrafung, sondern nur eine Erziehung zum Besseren.
Da er ein Franzose ist, ein Romane, kommt er in eine andere Besserungsanstalt, die sich im indischen Archipel befindet, mit der ich nichts zu tun habe, die aber jedenfalls ebenso eingerichtet ist wie diese hier.
Wir beschäftigen uns hier nur mit Männern germanischer Rasse. Russell ist ein Engländer, deshalb wird er hier bleiben.
Jetzt muss er erst ein paar Tage seinen Gedanken in der Einsamkeit nachhängen, dann wird er in liebevolle Behandlung genommen.
Nun wollen wir einmal die Bäckerei und die Küche besichtigen.«
Schon seit vier Tagen lagen wir hier. Ich schaute mich noch immer in diesem »Zuchthause« um, will aber nichts weiter beschreiben.
Also es war am vierten Tage, ich befand mich in einem weiten Saale, in dem soeben ein Fußballmatch stattgefunden hatte, gerade rückten die Kämpfer zum Abendessen ab, als Kapitän Stevenbrock zu mir trat.
Zum ersten Male sah ich ihn wieder.
»Nun, mein lieber Ebert, wie gefällt's Ihnen hier?«
»Immer besser.«
»Werden Sie sich auch nicht langweilen?«
»Ich wüsste nicht, wie das zugehen sollte.«
»Na, na! Wenn Sie immer nur zusehen —«
»Wenn es gestattet ist, werde ich mich bald auch an den Spielen beteiligen.«
»Hier ist alles gestattet. Nun muss ich Sie aber erst einmal vornehmen, der Termin dazu ist gekommen. Denn dass wir hier stark in Terminen arbeiten, haben Sie wohl schon gemerkt.
Sie wissen, dass unsere biedere ›Argos‹ auch das Gauklerschiff genannt wird.
Die Ursache für diesen Namen ist ja klar genug; weil wir eben alle samt und sonders Gaukler sind, Seiltänzer, Akrobaten und dergleichen mehr.
Aber für diesen Namen ist auch noch ein anderer Grund vorhanden. Wir haben früher wirklich einmal stark gegaukelt, getaschenspielert, gehext, gezaubert.
Wir haben einmal einen arabischen Derwisch an Bord gehabt, der uns die ungeheuerlichsten Illusionen vormachte, und durch jene geheime Gesellschaft, die hier herrscht, wovon Sie doch nun wenigstens schon eine Ahnung bekommen haben müssen, gerieten wir immer tiefer in diese Gaukelei hinein. Bis zuletzt uns und speziell mir diese ganze Gaukelei zum Ekel wurde, ich deswegen mit dieser geheimen Gesellschaft brach — ganz ungerechtfertigter Weise, muss ich offen gestehen.
Wir sind wieder zusammengekommen durch das gemeinschaftliche Bestreben, uns solcher verlorener Menschen anzunehmen.
Das ist jetzt unser Lebenszweck, der uns voll und ganz beschäftigt, der uns beglückt, und dabei führen wir ja noch immer das alte Leben.
Nur gegaukelt darf nicht mehr werden.
Und doch, wollen Sie ganz einer der Unsrigen werden, so ist es aus gewissen Gründen unbedingt nötig, dass Sie jetzt das noch nachholen, was wir einst durchgemacht haben.
Kommen Sie mit. Erst sollen Sie praktisch erleben, dann hinterher erhalten Sie die theoretische Erklärung.«
Wir verließen den Saal, betraten nach einem kurzen Gange einen runden Raum, in dem sich nichts weiter als eine große Glaskugel befand, ungefähr drei Meter im Durchmesser, von Stangen durchkreuzt, in der Mitte eine Art von Sitz mit Pedalen und anderen Vorrichtungen.
»Was meinen Sie, was das ist?«
»Ein Verlok'sches Kugelveloziped!«, rief ich erstaunt.
»Wie, Sie kennen schon das Ding?!«
Ja, ich hatte es schon gesehen, damals, als ich mich in London noch als freier Mann bewegt hatte, mich als zukünftigen Millionär fühlend. Auf der Radrennbahn des Hippodroms wurde sie vorgeführt, die neue Erfindung eines gewissen Verlok, das neue Veloziped, welches die Zukunft beherrschen sollte.
Hierzu noch eine Bemerkung, damit man nicht glaubt, diese Erfindung entspränge nur meiner Phantasie. Es hat einmal eine deutsche illustrierte Zeitschrift gegeben, »Vom Fels zum Meer«, sie erschien in Stuttgart, existiert aber heute nicht mehr. In einer Nummer, ungefähr der Jahrgänge 1880 bis 1885, ist dieses gläserne Kugelveloziped ausführlich beschrieben.
Ich selbst habe es also im Londoner Hippodrom vorführen sehen, mit einigen neuen Verbesserungen.
Also eine hohle Glaskugel, aus einzelnen Stücken zusammengesetzt, von ungefähr drei Meter Durchmesser, in der Mitte durch Stangen ein Sitz angebracht, auf dem der Fahrer sich immer im Gleichgewicht befindet, wie sich die Kugel auch bewegt, er hat die Füße immer nach unten.
Bei dem ersten Modell, in jener Zeitschrift beschrieben, musste der Fahrer noch mit den Füßen gegen die Innenwände selbst treten, so die Kugel bewegend, ich sah schon eine große Verbesserung, da wurden Pedale getreten, welche die rotierende Bewegung in anderer Weise auf die Kugel übertrugen.
Natürlich haben sich die Hoffnungen des Erfinders nicht erfüllt. Auf der Landstraße wird die Glaskugel durch sich anheftenden Schmutz und Staub doch schnell undurchsichtig. Auf dem Wasser, wofür das Vehikel auch hauptsächlich geplant, hat es sich ebenso wenig bewährt. Es fehlt die richtige Reibung, und dann müssen doch auch Luftlöcher vorhanden sein, und nur eine kleine falsche Bewegung, dann läuft da das Wasser herein. Bliebe nur noch der Sport auf künstlicher Bahn. Aber wozu da solch eine Kugel aus zerbrechlichem Glas?! Die Erfindung ist im Orkus der Vergessenheit verschwunden. Im Kensington-Museum sind noch zwei solcher Kugeln zu sehen, die eine stark zerbrochen.
So hatte ich dem Kapitän berichtet.
»Richtig. Auf demselben Prinzip beruht auch dieses Vehikel hier. Es hat aber doch noch ganz andere Eigenschaften. Vor allen Dingen ist das kein Glas, sondern eine ganz andere Masse, unzerbrechlich, Sie können mit voller Wucht gegen eine Mauer fahren, es passiert nichts, und ebenso wenig kann sich auch nur ein einziges Körnchen Staub anheften.«
»Was ist denn das für eine wunderbare Masse?«
»Das weiß ich selber nicht, bin auch gar nicht neugierig. Ferner besitzt diese Masse die Eigenschaft, dass sie die Luft durchlässt. Also Sie brauchen keine Klappe zu öffnen, Sie ersticken nicht und können dennoch über Wasser fahren. Wasser geht nicht durch. Wollen Sie aber heraus, so können Sie es. Alle die einzelnen eingefassten Abteilungen sind Klappen, die sich von innen durch einen Federdruck öffnen lassen. Von außen nur mittels dieses Schlüssels, den ich Ihnen hiermit überreiche. Verlieren Sie ihn nicht. Hier ist an jedem Abteil ein kleines Loch, in das der Schlüssel passt. Schließen Sie einmal eine auf.«
Ich tat es, die Klappe konnte geöffnet werden, wollte aber wie durch Federzug von selbst wieder zurückgehen.
»Ja, das tut sie. Sie müssen sie also beim Hineinkriechen halten. Feststellen lässt sie sich nicht, deshalb eben dürfen Sie den Schlüssel nicht verlieren. Bevor Sie nun hineinkriechen und mir hier in diesem Raume etwas vorfahren, will ich Ihnen noch eine andere Eigenschaft dieser glasähnlichen Masse zeigen.«
Stevenbrock griff hinein, berührte etwas — was, hatte ich nicht sehen können, es ging zu schnell — und mit einem Male hatte sich die Glaskugel tiefschwarz gefärbt, war undurchsichtig geworden.
»Das ist aber nur von außen. Nur von außen ist sie schwarz und undurchsichtig. Wer drin sitzt, der sieht immer noch wie durch farbloses Glas —«
»Wie ist das möglich?!«
»Na, darüber zerbrechen Sie sich lieber nicht den Kopf.
Nehmen Sie nur alles, wie es Ihnen gegeben wird. So, jetzt kriechen Sie einmal hinein und fahren erst hier ein bisschen im Kreise herum. Zu erklären brauche ich Ihnen nichts, Sie werden mit den paar Hebeln und Rädern schon allein fertig.«
Ich kroch hinein, hinter mir schnappte die Klappe zu, ich befand mich in einer durchsichtigen Glaskugel, bestieg den Sitz.
Es war nur eine Art von Reitsattel, aber sehr bequem, hinten eine gepolsterte Rückenlehne.
Die Füße fanden von selbst die Pedale, nur ein leichtes Treten, sofort begann die Kugel zu rollen, so leicht, dass ich als erstes sofort gegen die Wand krachte.
Das heißt mit der Kugel. Der hatte es nichts geschadet, mir auch nichts. Der Sitz war nach allen Seiten wunderbar gefedert; trotz der Vehemenz, mit der die Kugel gegen die Wand geschmettert war, hatte ich selbst nur einen ganz kleinen Ruck bekommen.
»O, Sie können noch ganz anders gegen die Wand sausen. Dass Sie einmal aus dem Sattel geschleudert werden, ist ganz ausgeschlossen.«
Zunächst wunderte ich mich — ich war doch Ingenieur — den Kapitän so ganz deutlich sprechen zu hören, als wäre ich durch keine dicke Glaswand von ihm getrennt.
»Wie kommt das, dass ich Sie so deutlich sprechen höre?«
»Weil diese Masse ein vorzüglicher Schallleiter ist. Nun fahren Sie weiter herum, probieren Sie die einzelnen Hebel und Räder.«
Ich tat es, und in wenigen Minuten wusste ich genau Bescheid. Es war auch einfach genug. Die Pedale hatten Freilauf, durch Rückwärtstreten wurde gebremst, doch konnte durch eine Hebelstellung auch zum Rückwärtsfahren eingestellt werden, zum Lenken genügte schon eine Neigung des Körpers, obschon auch eine Lenkstange vorhanden war. Dann entdeckte ich noch, dass auch verschiedene Geschwindigkeiten eingestellt werden konnten, was ja besonders bei unebenem Terrain, wenn es einmal bergauf geht, von größtem Vorteil ist.
»Fertig? Nun muss ich Ihnen doch noch einige Erklärungen oder Instruktionen geben. Aber Sie können gleich drin sitzen bleiben.
Es ist ein Wunderland, in das ich Sie schicken werde; ein Zauberland.
Sie werden Wunderbares, Märchenhaftes genug erleben, oftmals auch in die größten Gefahren geraten.
Aber Sie brauchen sich nicht zu fürchten.
Es geht Ihnen niemals ans Leben und an die Gesundheit.
Eine Erklärung, wie das scheinbar Unmögliche zustande kommt, werden Sie nachträglich erhalten. Jetzt zunächst nur eine Andeutung.
Schon bevor Sie nach Portland kamen, gab es Kinematografie, Sie haben, wie Sie mir einst sagten, solche Theater besucht, wenn die Sache damals auch noch sehr mangelhaft war; dann, als wir noch in London lagen, habe ich Sie einmal mit in ein gutes Kino genommen.
Die Kinematografie und ihre Wiedergabe scheint heute kaum noch vervollkommnet werden zu können, wenn man mit solchen Behauptungen auch sehr vorsichtig sein muss.
Sie sahen in jener Vorstellung auch einige sogenannte Trickfilme. Märchenhafte Sachen, Verwandlungen und dergleichen Unmöglichkeiten. Da kam zum Beispiel ein Mädchen mit einem Körbchen voll Eiern, es schlug die Eier auf, und aus jedem Ei kam eine kleine Tänzerin zum Vorschein, die auf dem Tische wirklich tanzte, also doch lebendig sein musste. Dann braute die junge Dame eine Bowle, steckte die kleinen Tänzerinnen hinein, sie verschwanden, die Dame schöpfte aus der Bowle Weingläser voll, und plötzlich waren die kleinen Tänzerinnen wieder in den Gläsern, tanzten auch in diesen.
Erstaunt fragten Sie mich, da es zu Ihrer Zeit solche Trickfilme noch nicht gegeben hatte, wie man denn so etwas nur zustande brächte; denn schließlich müsse das alles doch erst in Natura fotografiert werden.
Ich gab Ihnen eine Erklärung, so weit ich konnte. Sie genügte Ihnen. Gewiss, vor den Fotografenapparat muss dies alles erst in Natura kommen, sonst ist die kinematografische Wiedergabe unmöglich. Es handelt sich dabei um ein Fotografieren mit Unterbrechungen, während der Zwischenpausen werden die Verschiebungen vorgenommen, das Ganze beruht nur auf perspektivischer Täuschung des Beschauers.
Also meine Erklärung genügte Ihnen. Sie verstanden mich sofort. Und nun, mein lieber Ebert, diese Menschen, die hier als Leiter hausen, eine geheime, man möchte sagen wissenschaftliche Gesellschaft bildend, haben noch eine andere Art von Kinematografie erfunden. Man möchte sie eine plastische Kinematografie nennen, und auch ihre Wiedergabe ist eine plastische. Einst wird die ganze Menschheit diese Erfindung besitzen und sich daran ergötzen, vorläufig aber wird sie hier geheim gehalten. Verstehen Sie, was ich mit dieser plastischen Kinematografie sagen will?«
»Ja, so ungefähr verstehe ich Sie!«, entgegnete ich.
»Gut. Also Sie werden vor Staunen oder vor Schreck nicht den Verstand verlieren?«
»Fällt mir gar nicht ein!«, lachte ich. »Kann ich denn auch die Kugel einmal verlassen?«
»So oft Sie wollen.«
»Und was sehe ich dann? Wo bin ich dann?«
»Das werden Sie schon selbst erleben!«, lachte auch der Kapitän jetzt. »Also Sie versprechen mir, sich über das, was Sie schauen werden, nicht Ihren Kopf zu zerbrechen?«
»Ich verspreche es Ihnen.«
»Dieses Ihr Versprechen ist mir sehr wichtig. Drum wiederhole ich es: Sie versprechen mir, niemals außer sich zu geraten, niemals in grübelnden Tiefsinn zu verfallen?«
»Ich verspreche es Ihnen!«, konnte auch ich nur wiederholen.
»Dann fahren Sie los!«
Mit diesen Worten hatte der Kapitän eine zweite, weite Tür geöffnet, die sich in dem runden Raume befand, gleich zwei Türflügel zurückstoßend, eine Handbewegung, dass ich durch diese Tür fahren sollte, und ich gehorchte, trat sofort kräftig in die Pedale, sauste mit Vehemenz direkt durch die offene Tür.
Im nächsten Augenblick vergaß ich schon mein gegebenes Versprechen.
Ich riss vor Staunen die Augen und vielleicht auch den Mund auf.
Ob ich eigentlich schon etwas durch die offene Tür gesehen hatte, als ich mich noch in dem runden Raume befand, weiß ich gar nicht mehr. Ich war gar zu schnell losgefahren.
Jetzt aber befand ich mich plötzlich auf einer Landstraße, mit Kirschbäumen besetzt, hüben und drüben wogende Getreidefelder mit noch grünen Halmen, und dies alles übergossen vom goldenen Sonnenschein; schon gewahrte ich summende Bienen und gaukelnde Schmetterlinge, und hoch in den Lüften jubilierten die Lerchen!
Na, mein Staunen lässt sich denken!
Hier im Feuerlande gab es solch eine Landschaft natürlich nicht!
Wäre ich zur Winterszeit am Nordpol gewesen, ich wäre aus einer Schneehütte herausgetreten, und plötzlich befand ich mich in einer tropisch-indischen Landschaft — es wäre nichts anderes gewesen. Doch nach wenigen Sekunden dieses ersten Staunens erinnerte ich mich meines Versprechens und der vom Kapitän gegebenen Erklärung.
Also alles nur Kinematografie! Oder doch deren Wiedergabe. Bleiben wir aber nur beim Ausdruck Kinematografie, was jeder versteht.
Was man sonst in den Theatern an einer ebenen Wand zu sehen bekommt, das wurde hier gegen die runden Wände der Glaskugel gezaubert.
Das war doch ganz einfach; um mir das gleich sagen zu können, brauchte ich nicht gerade Ingenieur zu sein.
Plastische Kinematografie?!
Gewiss, das war ein ganz richtiger Ausdruck.
Auch an den ebenen Wänden unserer Kinos bekommt man ja manchmal Landschaften und andere Bilder von vorzüglicher plastischer Naturtreue zu sehen, aber das konnte sich mit dieser Wiedergabe hier nicht im entferntesten vergleichen.
Eine wunderbare Naturtreue!
Diese Perspektive der ganzen Landschaft!
Diese Plastik der Bäume!
Ja, ich staunte. Aber dieses Staunen war erlaubt.
Was war eigentlich hinter mir?
Meine Kugel rollte noch immer langsam dahin, ohne dass ich noch trat, weil eben Freilauf, ich wandte mich im Sattel.
Hinter mir eine hohe Felswand, schon in beträchtlicher Entfernung aber ich sah noch das Tor, aus dem ich gekommen, jetzt freilich schon wieder geschlossen. Hm, merkwürdig, sehr merkwürdig!
In welchen anderen Raum war ich denn da hineingerollt?
Hopsa!! Schnell brachte ich mein Gesicht wieder nach vorn. Meine Kugel war gegen einen Kirschbaum gerannt, ein klein wenig zurückgeprallt.
Hallo! Gegen einen Baum gerannt?
Nein, ein Kirschbaum mit reifen Früchten konnte das in Wirklichkeit wohl nicht sein, einen solchen gab es hier im Feuerlande doch nicht.
Der existierte nur als Lichtbild in den Glaswänden meiner Kugel.
Aber gegen irgend etwas musste ich doch in Wirklichkeit gerannt sein.
Nun, ich machte es kurz, es war mir ja erlaubt worden — ich öffnete eine seitliche Klappe, ein Druck auf eine sichtbare Feder genügte, dann konnte ich die eingefasste Rundscheibe weiter herausdrücken.
Da aber, wie ich nur durch die Öffnung sah, erfasste mich neues grenzenloses Staunen.
Kaum wagte ich durchzukriechen.
Schließlich tat ich es doch.
Und nun stand ich in sommerlicher Mittagssonne auf staubiger Landstraße unter einem Kirschbaum zwischen wogenden Feldern!
Ich pflückte einige Gräser und Blumen und betrachtete sie! Ich pflückte einige rote Kirschen, verspeiste sie und spuckte die Kerne aus!
Ich fing eine Biene und wurde ganz empfindlich gestochen!
Ja, da soll man nun nicht staunen, nicht in tiefsinniges Grübeln fallen!
Kinematografie? Plastische?
Das war doch ganz einfach volle Wirklichkeit!
Wie war das zu erklären?
Befand sich in dem Felsenberge am Kap Hoorn vielleicht ein Gewächshaus, ein Wintergarten, in den man mich geschickt hatte?
Aber ein künstlicher Wintergarten von solch endloser Ausdehnung?
Oder war diese endlose Ausdehnung der Szenerie nur eine perspektivische Täuschung, künstlich hervorgerufen?
»Bitte, Herr Ebert, erinnern Sie sich Ihres Versprechens: Nicht grübeln, nicht grübeln, nach keiner Erklärung suchen! Sie werden die Erklärung schon später bekommen. Jetzt nehmen Sie nur alles, wie es ist, essen Sie Früchte, legen Sie sich ins Gras, tun Sie, was Sie wollen, aber nur nicht tiefsinnig werden!«
So war es erklungen — mit Kapitän Stevenbrocks Stimme — in meiner dichten Nähe. Aber zu sehen war er nicht. Stand er hinter der schwarzen Kugel? Denn von dort her war die Stimme gekommen.
»Wo sind Sie, Herr, Kapitän?«
Keine Antwort kam, was ich auch für weitere Fragen stellte.
Ich ging um die Kugel herum, zuletzt rennend — ich sah den Kapitän nicht.
Ich benutzte den Schlüssel, schloss eine Klappe auf, blickte hinein — in der Kugel war er auch nicht.
Na, jedenfalls hatte die nochmalige Ermahnung des unsichtbaren Kapitäns genützt.
Ich gab alles unnötige Grübeln auf, pflückte eine gute Portion Kirschen, legte mich in das Gras neben dem Straßengraben und begann sie zu verspeisen.
Solche ausgezeichnete Glaskirschen im November am Kap Hoorn — das lässt man sich gefallen, da soll man nicht lange fragen, woher sie kommen, wie so etwas möglich ist.
Dann erhob ich mich, steckte einige Kirschkerne in die Tasche, schloss eine Klappe auf, kroch hinein, und die schwarze, undurchsichtige Kugel hatte sich von innen wieder in eine mit hellen, durchsichtigen Glasscheiben verwandelt. Im Gegensatz zu der sommerlichen Mittagshitze dort draußen war es hier drin recht angenehm kühl, die Masse musste ein sehr schlechter Wärmeleiter sein, das Innere behielt die ursprüngliche kühle Temperatur, durch das häufige Öffnen einer Klappe wurde daran nicht viel geändert.
Weiter ging es in mäßigem Tempo, vielleicht zwei Meilen in der Stunde, das ist die normale Schnelligkeit eines Radfahrers, einer elektrischen Straßenbahn. Es blieb bei der Kirschbaumallee mit den grünenden Kornfeldern zu beiden Seiten. Eine deutsche oder überhaupt mitteleuropäische Landschaft mit intensivem Ackerbau.
Menschen waren nicht zu sehen, kein Dorf, kein Kirchturm, kein einzelnes Haus, keine Hütte, kein aufsteigender Rauch, auch kein Pferd, kein Rind. Sonst aber ein reges Tierleben. Mitteleuropäische Insekten aller Art, Vögelchen, hoch in den Lüften zog ein Habicht seine Kreise, die Lerchen verstummten und suchten Deckung, da huschte eine Eidechse, jetzt lief ein Hase über den Weg, verschwand wieder im jungen Getreide.
Das ging so wohl eine Viertelstunde, es änderte sich nichts. Das kann man auf jeder Landpartie finden, noch viel länger ohne Szeneriewechsel, auch im schnellsten Automobil.
Ich war das monotone Treten nicht gewohnt, der Freilauf entschädigte mich wenig, bald empfand ich den Wunsch, wieder etwas zu Fuß zu gehen.
Weshalb nicht? Ich bremste, verließ die Kugel wieder. Ja, es war herrlich hier draußen, die Sonnenwärme genierte mich nicht. Schade, dass ich nur so ein wenig hin und her gehen konnte, lieber hätte ich die Kugel wie ein Fahrrad neben mir her geführt.
Das war bei solch einer großen Kugel nicht möglich. Aber konnte ich sie nicht vor mir her stoßen? Wie schwer war das Ding eigentlich? Zum ersten Male befasste ich mich mit solchen Eigenschaften meines Vehikels. Schwer war sie, ungemein schwer! Wie ich mich auch stemmte und anstrengte, ich brachte die schwarze Kugel keinen Zoll vom Fleck, sie rührte sich nicht.
Darüber musste ich mich wundern. Sie war so leicht zu treten. Ich brauchte nur ein Pedal herunterzudrücken, ohne jede Anstrengung, dann lief sie fort, federleicht. Und von hier draußen konnte ich sie trotz aller Kraftanstrengung nicht vom Flecke bringen?
Da machte ich eine noch seltsamere Entdeckung.
Auf der Landstraße lag eine gutes Schicht Staub. Ein Glück, dass es ganz windstill war.
Dort, wo die schwarze Kugel lag, hatte sie sich tief in den grauen Staub eingebettet. Wie hätte es auch anders sein sollen.
Ja, wo war denn aber nun die Spur, die sie in einer Breite von etwa einem Viertelmeter in dem Staube hinter sich lassen musste?
Keine Andeutung von solch einer Spur! Meine Füße hinterließen Abdrücke, von denen der Kugel war nichts zu bemerken.
Wie war das zu erklären? Diese Frage war doch wohl erlaubt.
Dazu musste ich mich wieder in die Kugel begeben und in die Pedale treten. Federleicht ließ sich die sonst so schwere Kugel in Bewegung setzen. Jetzt blickte ich einmal direkt unter mich, konnte meine Beobachtungen um so leichter anstellen, da sich der Schwebesitz in jeder Lage immer etwas nach hinten befand. Ja, die Kugel drückte sich immer in den Staub ein, das war deutlich zu beobachten, ebenso aber auch, dass sie absolut keine Spur hinterließ. Es war nicht anders, als ob der Staub Wasser sei, das hinter ihr sofort wieder zusammenfloss, nur eben, dass der Staub diese Eigenschaft sonst nicht zeigte, nicht unter meinen Füßen, nicht unter meinen Händen, da blieb er so vertieft oder so angehäuft, wie ich ihn formte.
Noch einmal heraus und vor der Kugel einen tüchtigen Wall von Staub angehäuft, wieder hinein und in die Pedale getreten — ich sah deutlich, wie die Kugel in dem Staubdamme eine tiefe Furche schnitt, ihn auf einen Viertelmeter Breite ganz niederdrückte, aber sobald sie darüber hinweg war, stand hinter mir der Damm wieder da, obgleich ich nicht erkennen konnte, in welcher Weise er sich wieder aufrichtete.
Nochmals verließ ich die Kugel, oder wollte es erst tun, diesmal in besonderer Weise. Ich wollte in flotter Fahrt zu der geöffneten Klappe herausspringen.
Es sollte mir nicht gelingen. Sobald ich nur eine Feder drückte, welche solch eine Klappe öffnete, irgend eine, alsbald stand die Kugel wie festgenagelt! Solch ein Druck auf irgend eine Feder wirkte wie die schärfste Bremse, noch besser als die Rücktrittsbremse.
So verließ ich die Kugel in ihrem Ruhestande. Die Arme über der Brust verschränkt, einige Schritte von ihr entfernt stehend, betrachtete ich das rätselhafte Vehikel.
Da hatte ich so einen Einfall, und ich wusste nicht, wie ich dazu kam.
»Bist Du etwa ein lebendiges Wesen oder wohnt Dir doch eine selbstständige lebendige Kraft inne? Dann komm mal hierher!«
So sprach ich.
Hallo!!
Doch fast entsetzt sprang ich zurück!
Denn kaum hatte ich jene Worte gesagt, als sich die Kugel in Bewegung setzte und auf mich zu rollte!
Und da ich nun zurück sprang, rollte sie mir weiter nach.
Aber als ich stand, blieb auch sie stehen, dicht vor mir. Was sollte ich hiervon denken?
Das Denken war nicht erlaubt.
Ich ging einige Schritte weiter, drehte mich wieder um.
Die Kugel stand noch da, wo sie gestanden hatte, so wie früher.
»Komme hierher!«
Da kam die Kugel angerollt, blieb vor mir stehen.
»Rolle zurück!«
Sie rollte zurück.
»Schneller!«
Sie rollte schneller.
»Halt!«, kommandierte ich, schon etwas von Angst erfasst, sie könnte mir für immer entweichen.
Mit seinem Ruck blieb sie stehen.
»Komme wieder hierher!«
Sie kam wieder zurückgerollt.
»Rolle neben mir her!«, Sie rollte neben mir her, langsam und schnell, je nachdem ich ging oder rannte, immer in meiner dichten Nähe.
»Sei nicht so aufdringlich, bleib etwas weiter von meiner Seite!«
Sofort entfernte sie sich etwas weiter von mir ab. Ich blieb stehen, sie auch.
Was wollte ich mehr? Nun hatte ich ja, was ich gewünscht: Ich konnte zu Fuß, gehen, die Kugel trollte wie ein Hund neben mir her, ich brauchte sie nicht zu führen.
Ja, da soll man nun nicht staunen und grübeln! Meine geistige Energie brachte es fertig, so etwas zu unterdrücken. Aber weitere Experimente machen, das durfte ich wohl.
Ich schloss wieder eine Klappe auf, aber ohne hineinzukriechen, nur hineinblickend und dazu musste man also die Klappe überhaupt halten, sonst schloss sie sich von selbst wieder.
»Komme mit mir!«
Da aber verweigerte die Kugel den Gehorsam, sie rührte sich nicht.
Ich sah mich um, hob einen für meine Absicht gerade passenden Ast auf, klemmte ihn zwischen Klappenrand und Kugel, trat zurück.
»Komme hierher!«
Es nützte nichts. Die Klappe musste geschlossen sein, sonst gehorchte die Kugel nicht, wurde nicht lebendig.
Auf der einen Seite der Chaussee zog sich ein Graben hin, etwa ein Meter breit und ebenso tief. Es war mir nicht eingefallen, einmal meine Kugel während des Fahrens in diesen Graben zu lenken, ich hätte mich schön gehütet.
Jetzt sprang ich über den Graben.
»Komme hierher!«
Sofort setzte sich die Kugel in Bewegung, auf den Graben zu, sprang hinüber. Wie ein Gummiball. Nur dass sie, als sie jenseits des Grabens wieder den Boden berührte, nicht weiter hüpfte, sondern plötzlich wie festgenagelt stand.
Ich sprang zurück, ein Befehl, und auch die Kugel sprang sozusagen aus freier Hand, das heißt ohne jeden Anlauf, mit wahrer Eleganz wieder über den Graben, folgte mir weiter nach, wie ich wollte.
Ich wieder hinein.
»Fahre vorwärts!«
Kein Befehl nützte. Wenn ich mich innerhalb der Kugel befand, hörte die eigene Lebendigkeit der Kugel auf, da musste ich treten.
Ich fuhr gegen den Graben los, in der sicheren Erwartung, hineinzufallen.
Aber nein, mit einem eleganten Sprunge war die Kugel von selbst darüber gesetzt, und da ich dann nicht bremste, fuhr sie auch noch weiter, in das Getreidefeld hinein.
Und da bemerkte ich wiederum das Seltsame!
Unter mir legte die Kugel die meterhohen Halme nieder, drückte sie platt an den Boden, aber sobald sie darüber hinweg war, richteten sich die Halme wieder kerzengerade auf! Ich wieder heraus, mitten im Getreidefeld, ließ die Kugel rollen, nur auf mein Kommando. Es blieb dasselbe. Mein Fuß zerknickte die Halme, dass sie liegen blieben; die Kugel aber drückte sie nur nieder, ohne sie zu zerknicken, und sofort richteten sich die Halme wieder auf. Wieder nach der Landstraße zurück, zu Fuß, die Kugel auf meinen Befehl mir nach. Als sie über den Graben sprang, wollte ich sie mitten im Sprunge aufhalten, streckte ihr beide Hände entgegen, wurde aber von unwiderstehlicher Kraft zurück geschleudert. Dieses Experiment machte ich lieber nicht wieder, das konnte gefährlich werden!
Und ebenso wenig gelang es mir, ihren Lauf, als ich sie langsam rollen ließ, durch einen kräftigen Stoß von hinten zu beschleunigen. Es war nicht anders, als ob ich mit den Händen gegen eine Mauer gestoßen wäre.
Rätselhaft, ganz rätselhaft!
»Stoße dort gegen den Baum!«
Sie stieß dagegen, prallte nur wenig zurück.
»Stoß heftiger dagegen!«
Sie rollte von selbst schneller, stieß mit Wucht gegen den Baum, dass er bis in die Krone erzitterte, alle Kirschen herabfielen.
»Noch heftiger, zersplittere ihn, brich ihn ab!«
Die Kugel nahm, etwas weiter zurückgehend, von selbst einen Anlauf, schoss plötzlich vorwärts, ein Krach und zersplittert lag der Baum, dessen Stamm wenigstens zwanzig Zentimeter Durchmesser hatte, am Boden! Und ruhig und unbeschädigt stand die Kugel da. Etwas wie Grausen erfasste mich.
Träumte ich denn nur?
Keine Ahnung davon. Eben stach mich eine Mücke in den Hals, ich klatschte sie tot, sie hatte schon längere Zeit gesaugt, mein Blut spritzte aus ihrem zerquetschten Leibe.
Na, dann noch weiter experimentiert.
Ich packte den gestürzten Baumstamm, mit aller Kraftanstrengung gelang es mir, ihn quer über die Straße zu schleifen.
»Springe über den Baumstamm!«
Die Kugel sprang hinüber, sprang zurück, wie ich befahl.
»Jetzt springe über die Zweige!«
Dieses Laubgeäst bildete einen Hügel von etwa zwei Meter Höhe, und auch darüber setzte die wunderbare Kugel gehorsam hinweg, aber doch in ganz besonderer Weise. Es war eigentlich kein Springen, sondern sie rollte oder glitt mehr das Geäst hinauf, ohne es besonders niederzudrücken, und so glitt sie auf der anderen Seite wieder hinab. Also sie machte es sich möglichst bequem, und zu einem freien Sprunge über dieses Geäst war sie durch keinen Befehl zu bewegen.
Ich setzte mich wieder hinein, fuhr gegen den Stamm los. Auch ohne Befehl sprang die Kugel darüber hinweg, ebenso dann über das Geäst, das nun aber wieder mehr ein Gleiten war.
Ich wieder heraus.
»Springe auf der Stelle frei in die Höhe! Springe im Laufen in die Höhe!«
Beides wurde nicht befolgt. Sie rollte, aber sprang nicht ohne Grund. Es musste ein zu überwindendes Hindernis vorhanden sein.
Dann natürlich gelang es mir auch nicht, sie frei in der Luft schweben zu lassen, wovon ich schon geträumt hatte. Aus der Kugel einen mir gehorsamen Luftballon zu machen, in dem ich dann auch nach Belieben fliegen konnte.
Könnte die Kugel aber nicht sonst noch etwas leisten? Ich musste nur nachsinnen.
»Stoße oder schiebe den Baumstamm in den Straßengraben hinein!«
Sofort machte sich die lebendige Kugel ans Werk, stieß hier und stieß da gegen den Stamm, ihn schiebend, und innerhalb drei Minuten lag der ganze Baum im Straßengraben!
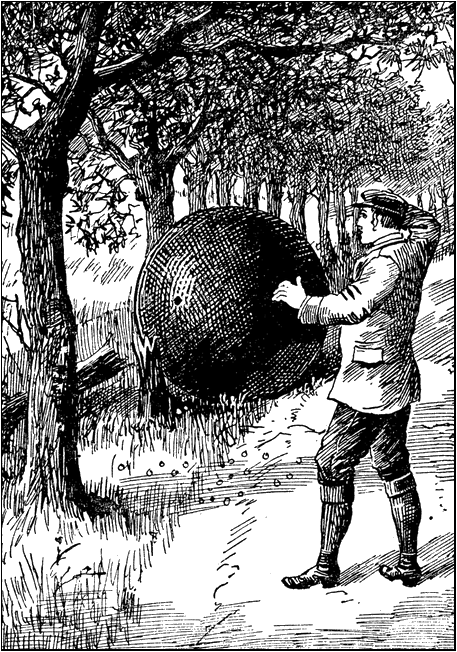
Die Kugel schoss plötzlich vorwärts, ein
Krach — und zersplittert lag der Baum am Boden.
Nicht grübeln, Ewald, nicht grübeln! Lieber denke darüber nach, wie Du selbständig etwas erforschen kannst!
Ich dachte an den klopfenden Tisch der Spiritisten.
»Hörst Du mich sprechen? Wenn ja, so rolle etwas vorwärts, wenn nein, so rolle etwas zurück.«
Aber hierauf ging sie nicht ein, wie plausibel ich es ihr auch machte, wie schlau ich meine Fragen auch stellte.
Wohl rollte sie noch immer vorwärts und rückwärts, wie ich befahl, aber nicht, wenn sie dadurch eine Bejahung oder Verneinung ausdrücken sollte. Schade, dass ich sie so nicht zum Sprechen bewegen konnte. Wieder ein neuer Einfall!
Ich nahm ein Stück Ast, schleuderte ihn weit weg.
»Apport, hol den Stock!«
Richtig, die Kugel setzte sich in Bewegung, rollte über den Ast, und mit einem Male war dieser an der schwarzen Kugelschale, an der sonst kein Stäubchen haftete, kleben geblieben, eine seitliche Drehung und jetzt klebte der Ast eben auf der Seite, und so kam die Kugel zu mir zurückgerollt, blieb vor mir stehen, ein rutschender Ruck und sie präsentierte mir den Ast.
Es war nicht anders, als ob er daran klebe, ließ sich aber ganz leicht ablösen. Als ich ihn jedoch wieder daran heften wollte, ging das nicht. Doch ich brauchte nur zu befehlen
»Halte den Ast fest!«
Sofort blieb der Ast wieder kleben.
»Er wird von einer magnetischen Kraft nach Belieben festgehalten und wieder losgelassen.«
So sagte ich mir, um nur irgendwie eine Erklärung zu haben, die der denkende Mensch nun einmal haben muss, um nicht tiefsinnig zu werden.
Da rannte in einiger Entfernung wiederum ein Hase über den Weg.
»Jage dem Hasen nach, fang ihn, schnell!«
Sofort setzte sich die Kugel in Bewegung, schneller und immer schneller, ich hätte nicht drin sitzen mögen. So sprang sie über den Graben, schoss in das grüne Getreide hinein, machte weite Sätze, über die Halme hinweg, sprang wie ein fliegender Gummiball, beschrieb einen großen Bogen, blieb einen Moment stehen und kehrte langsamer zurück.
Ein jämmerliches Schreien erscholl.
Der große Hase stieß es aus, der seitwärts an der Kugel klebte, natürlich immer um seine eigene Achse rotierend, und so wie ein kleines Kind schreit der Hase in Todesängsten.
Noch war ich fähig, ihn abzulösen, er wusste sich aus meinen Händen gleich wieder zu befreien und suchte das Weite — dann setzte ich mich auf den Rand des Straßengrabens und ließ den Kopf hängen.
Jetzt ging's mir über die Hutschnur!
»Nicht träumen, Ebert, nicht grübeln denken Sie an Ihr Versprechen!«, erklang da eine Stimme. »Sie bekommen später eine vollkommene Erklärung, jetzt seien Sie doch froh, dass Sie eine so gut dressierte Hundekugel haben!«
Wieder die Stimme des Kapitäns!
Zu sehen war er wieder nicht, und von der Kugel her kam die Stimme auch nicht, eher war es hinter mir erklungen, aber vergebens blickte ich mich um.
»Herr Kapitän, wo sind Sie?«
Keine Antwort.
»Geben Sie mir gleich jetzt eine Erklärung, ich flehe Sie an!«
Keine Antwort Und doch, sie kam. Nur in ganz anderer Weise, als ich sie erwartet hatte.
Noch immer stand die strahlende Sonne im Zenit. Mit meinen Experimenten war ja kaum eine Viertelstunde vergangen.
Und da plötzlich rutschte diese strahlende Sonne über den blauen Himmel hin und stand dicht über dem Horizont!
Erst war mein staunender Schreck über dieses Naturphänomen ja groß, dann aber musste ich herzlich lachen.
Ja, das war auch eine Antwort gewesen, in gewisser Hinsicht sogar eine Erklärung.
Also hier handelte es sich nicht um Wirklichkeit, sondern nur um eine künstliche Theaterdekoration!
Plastische Kinematografie! In der ich selbst mitwirkte!
Wie das zu verstehen, wie das möglich war, darüber sollte ich eben später völlig aufgeklärt werden. Jetzt hätte es wahrscheinlich nur gestört.
Also ich war beruhigt, wollte meine Fahrt fortsetzen. Der plötzliche Tiefstand der Sonne sollte doch offenbar andeuten, dass es nun bald Abend würde, da durfte ich doch sicher auf neue Überraschungen gefasst sein.
Ehe ich den Schlüssel gebrauchte, um eine Klappe zu öffnen, fiel mir etwas ein.
»Öffne eine Klappe! Diese hier! Oder irgend eine andere. Sie soll sich von selbst öffnen! Ich befehle es!«
Ich befahl vergebens. In diesem Falle verweigerte mir die Kugel den Gehorsam. Ich musste meinen Schlüssel benutzen, vor dessen Verlust mich der Kapitän wohl nicht umsonst gewarnt hatte.
Ich trat kräftig in die Pedale. Da tauchte in der Ferne an der Landstraße ein Haus auf, das erste, das ich erblickte.
Beim Näherkommen erkannte ich ein einstöckiges Bauernhaus, mit roten Schindeln gedeckt.
Noch war ich einen halben Kilometer davon entfernt, als die letzte Sonnenscheibe unter dem Horizont verschwand, und mit einer Plötzlichkeit wurde es finstere Nacht, als ob ich mich unter dem Äquator befände.
»Hören Sie, geehrter Herr Kapitän, Sie müssen Ihre plastische Kinematografie doch etwas mehr den wirklichen Verhältnissen anpassen!«, lächelte ich.
Dann aber hatte ich mich zu orientieren. Doch es war nicht gar so finster, besonders die weiße Landstraße leuchtete noch deutlich vor mir.
Und jetzt flammten dort auch Lichter auf, alle Fenster des Hauses wurden erleuchtet, und gleichzeitig hörte ich Musik, ein nicht gerade künstlerisches Konzert von Klarinetten und Geigen und Brummbass.
Außerdem gewahrte ich jetzt an den erleuchteten Fenstern die Köpfe von menschlichen Gestalten, sah sie sogar noch deutlicher, Männer in langschößigen Bauernröcken, Frauen mit mächtigen Puffärmeln, sogenannte Kuken auf den Köpfen.
Sie standen herum, ich sah auch, wie sie sich nach den Klängen der Musik im Kreise drehten. »Ein bäuerliches Fest. Vielleicht Hochzeit. Ich soll mitmachen. Und wenn ich eintrete, dann finde ich nur Knochenskelette in altertümlicher Tracht oder gar in Leichenhemden.«
So sagte ich mir mit lächelnder Ruhe.
Also ich war schon gewappnet. Jetzt in der Nacht kam wahrscheinlich das Gruseln daran.
Aber ich will keine solche Bemerkung mehr im voraus machen, denn wenn ich in gewisser Hinsicht auch recht hatte, sonst kam es immer ganz anders, als ich gedacht hatte.
Ich hatte das Haus erreicht, fuhr durch das weitgeöffnete Hoftor.
Zuerst hatte ich an einer hohen Mauer entlang fahren müssen, während dieser Zeit war plötzlich die Musik verstummt, die Fenster, das ganze Haus hatte ich überhaupt nicht mehr sehen können, und wie ich nun um die Ecke bog, in den Hof fuhr, waren alle Fenster dunkel!
Nur eine Stalllaterne brannte, die neben der geschlossenen Haustür am Boden stand.
Gut, sie sollte mir genügen. Ich hielt, stieg aus, nahm die große Laterne oben beim Henkel.
Die Tür ließ sich aufklinken.
Ich muss gestehen, dass es mich ganz gehörig gruselte, als die Türe quietschend und ächzend zurückging.
Sollte es mich auch nicht gruseln!
Sonst wäre ich kein fühlender Mensch gewesen. Ein wirkliches Fürchten, das ist wieder etwas ganz anderes. Nein, das tat ich nicht. Dieses gruslige, schauerliche Gefühl war mir sogar sehr angenehm. Ich lachte still in mich hinein. Aber mein Herz schlug mir doch wie ein Lämmerschwanz.
Die Hausflur war leer. Nur überall Spinneweben. Ebenso war es mit allen anderen Zimmern beschaffen, die ich mit der Laterne durchschritt. Alle leer, nackt, nur reichlich mit Spinneweben dekoriert.
Nein, hier hatte nicht soeben eine Hochzeitsfeier stattgefunden. Ebenso wenig aber sah ich auch Gerippe oder dergleichen.
Halt, da kam doch einmal etwas anderes!
In diesem Zimmer hier, reinlich gehalten, stand an der Wand ein mächtiges Himmelbett, die Federkissen mit schneeweißen Linnen überzogen, in einer Ecke ein bäuerlicher Waschtisch, rot und grün angemalt, mit allem versehen, was zum Waschtisch gehört, so weit man das in einem einfachen Bauernhause verlangen kann, in der Mitte ein richtiger einfacher Tisch und ein ebensolcher Stuhl.
Ich machte es kurz, setzte die Laterne auf den Tisch, zog die Jacke aus, krempelte die Hemdsärmel hoch und benutzte die Waschgelegenheit. Hatte es auch sehr nötig. Diese plastische Kinematografie färbte sogar ab, ganz echt. Besonders der Kirschbaum, den ich angepackt, hatte es getan. Es passierte nichts dabei, das Wasser spielte mir keinen Streich, die Seife schäumte wie jede andere gute Kernseife, das grobe, aber saubere, neue Handtuch färbte mich nicht nachträglich schwarz.
So, ich zog meine Jacke wieder an, hing die Laterne an einen Deckenhaken, der sich gerade über dem Tische befand, setzte mich auf den Stuhl, der kommenden Dinge harrend. Was ich erwartete?
Nun ganz natürlich war das doch ein Tischleindeckdich. Ich brauchte nur zu wünschen, dann standen die ausgesuchtesten Speisen darauf; oder die ganze plastische Kinematografie hat gar keinen Zweck. So weit war ich bereits gekommen.
Aber das Tischlein wollte sich nicht decken.
Ach so, ich musste erst wünschen, kommandieren!

»Tischlein deck Dich! Erst eine Suppe à la reine, dann ein Beefsteak à la Chateaubriand, dann getrüffelten Schweinskopf, zum Nachtisch eine Käseplatte und dergleichen mehr. Das nötige Getränk natürlich nicht zu vergessen.«
Aber ich wünschte und kommandierte vergeblich, das Tischlein wollte sich nicht deckten. Das war sehr fatal.
Als ich diese Reise ins Märchenland angetreten hatte, war es gleich Zeit zum Abendessen gewesen, das ich also versäumt hatte, und ich war überhaupt schon hungrig gewesen.
Übrigens, fiel mir jetzt erst ein, stimmte ja da die ganze Zeit nicht. Wie war denn plötzlich die Sonne in den Zenit gekommen? Doch daran dachte ich jetzt nicht weiter, es hatte sich ja überhaupt schon aufgeklärt, durch die rutschende Sonne, und jetzt war ich vor allen Dingen hungrig.
Also mein Wünschen und Kommandieren nützte nichts, das Tischlein wollte sich nicht decken. Da aber geschah etwas, worüber ich doch sehr erschrak.
Kommt da plötzlich seitwärts unter dem Tische, dicht unter der Tischplatte, eine menschliche Hand hervor!
Na, da muss man wohl erschrecken.
Das nächste war, nachdem ich einige Momente das Phänomen angestarrt hatte, dass ich mit den Beinen ausstorchte, mit den Füßen unter den Tisch trat und dann erst darunter blickte.
Höflicher wäre es gewesen, wenn ich erst darunter geblickt hätte, dann hätte ich ja noch immer nach dem Besitzer dieser Hand treten können — ich machte es aber in meinem ersten Schreck gerade umgekehrt.
Beides hatte keinen Zweck. Weder fanden meine Füße einen Widerstand, noch war unter dem Tische etwas zu erblicken. Das Licht der Laterne hätte dazu vollkommen ausgereicht.
Aber die Hand blieb. Nun betrachtete ich sie mir auch näher. Eine schöne, feine, schneeweiße Frauenhand. Auch der Unterarm war noch zu sehen, ebenso fein und weiß, wie aus Marmor gemeißelt, mit blauen Äderchen fein durchzogen, und dann noch ein Stück hellblauer Spitze daran, gerade noch unter der Tischplatte hervorlugend. Die Finger bewegten sich etwas, sonst aber wurde die Hand offen hingehalten. Mein Schreck und Staunen waren überwunden.
»Wer bist Du, Besitzerin dieser Hand?«, begann ich mein Examen.
Keine Antwort, aber die Hand kehrte sich mir noch mehr zu.
»Du willst mir wohl die Hand geben?«
Unter dem Tische erscholl ein leises, dreimaliges Händeklatschen.
»Soll das ein Ja sein?«
Ein wiederholtes leises Klatschen.
Ich nahm die Hand in die meine. Eine weiche, lebenswarme Frauenhand!
Ich drückte sie etwas, meine wurde wiedergedrückt.
»Darf ich auch Deinen Arm anfassen?«
Unter dem Tische wurde nur einmal leise in die Hände geklatscht.
»Soll das ein Nein sein?« — »Ja.«
»Ich darf Deinen Arm nicht anfassen?« — »Nein.«
»Weshalb nicht?«
Keine Antwort.
Ich tat es dennoch und es wurde geduldet.
Auch der Arm war ganz lebenswarm, ich fühlte am Handgelenk den Pulsschlag.
Plötzlich aber, wie ich immer weiter griff, wurde der Arm immer heißer, ich näherte mich wie einer intensiven Hitzequelle und zog meine Hand schleunigst zurück, sonst hätte ich mich tüchtig verbrannt. Dasselbe geschah, als ich den Arm unter dem Tische von hinten ergreifen wollte. Auch hier kam ich wie einer sehr heißen Flamme zu nahe, obgleich von einer solchen nichts zu sehen war, so wenig wie von der Hand, wenn ich unter dem Tisch durchblickte.
Ich machte diesen Versuch nicht wieder, ließ es überhaupt bei der harmlosen Hand bewenden.
»Kannst Du nicht sprechen?«
Nein wurde unter dem Tische einmal geklatscht, oder es konnte ja vielleicht auch durch Zungenschnalzen hervorgebracht werden.
»Oder Dich durch Zeichen verständlich machen?« — »Nein.«
»Ich buchstabiere das Alphabet, wenn der betreffende Buchstabe kommt, klatscht Du —«
»Nein!!«, wurde ganz energisch geklatscht.
Also ich sollte keine Möglichkeit haben, auf diese Weise schon jetzt eine Aufklärung zu erhalten.
»Bist Du vielleicht eine verwunschene Prinzessin?« — »Ja.«
Aha! Die berühmte verwunschene Prinzessin! Diese Frage war mir nur so in den Sinn gekommen. Und sie wurde denn auch gleich prompt bejaht.
»Du hast wohl hier in diesem Hause einmal etwas Fürchterliches ausgefressen?« — »Ja.«
»Ein Kind ermordet?« — »Nein.«
»Deinen Geliebten, Vater oder Mutter?« — »Nein.«
»Sonst irgend einen Mord begangen?« — »Ja.«
»Doch natürlich an irgend einen Menschen?« — »Nein.«
»Nanu! Ein Tier?« — »Ja.«
»Vielleicht einen Frosch?« — »Ja.«
»Doch nicht etwa den Froschkönig?« — »Ja.«
Siehe da! Was war ich doch für ein Rateluder!
Ich musste herzlich lachen.
Die Besitzerin dieser Hand hatte wenigstens Humor!
Dann würden wir auch schon zusammen auskommen.
»Du warst mit diesem Froschkönig wohl verlobt?« — »Ja.«
»Natürlich wider Deinen Willen?« — »Ja.«
»Und hast ihn getötet?« — »Ja.«
»Recht so! Und dafür musst Du nun hier spuken?« — »Ja.«
»Kannst Du mir weiter nichts zeigen als Deine Hand?« — »Nein.«
»Sonst ist von Dir nichts weiter übrig geblieben?« — »Nein.«
»Alles andere an Dir ist wesenlos?« — »Ja.«
»Kannst Du mir mit dieser Deiner Hand sonst noch etwas vormachen?«
»Ja.«
»Bitte, dann mal los.«
Sofort zog sich die Hand zurück, kam gleich wieder zum Vorschein und präsentierte mir ein großes, weißes Paket.
Ich nahm es, es war feine Leinwand, zusammengelegt, ich faltete sie auseinander, immer weiter — —.
Ahaaaa, ein Tischtuch!
Jetzt fiel es mir wie Schuppen von den Augen! Tischlein deck Dich!
Wie sollte es sich denn decken?
Ich hatte als erstes eine Suppe verlangt.
Sollte die etwa plötzlich auf der hölzernen Tischplatte als Pfütze schwimmen?
Wie das in jenem bekannten Märchen gehalten wird, weiß ich nicht mehr so genau, aber so einfach wie in einem Märchen geht die Geschichte jedenfalls nicht, das hier war plastische Kinematografie, da verlangt man logische Handlungen —!
Na, also ich deckte den Tisch, vorläufig mit dem Linnen.
Da war die Hand schon wieder da, präsentierte mir einen Porzellanteller.
Dann reichte mir die Hand Messer, Gabel und Löffel, dann kam die sogenannte Menage daran, dann zwei Weingläser, dann eine Flasche Weißwein, dann eine Flasche Rotwein, ohne Etikette, aber schon entkorkt, dann ein Körbchen mit Schwarz- und Weißbrot, und dann endlich kam die Hauptsache, die — — die bestellte Suppe?!
Nein. Es sollte überhaupt immer alles anders kommen, als ich mir gedacht hatte.
Plötzlich kam unter dem Tisch hervor ein wunderlieblicher Duft.
Und da hielt die auftauchende Hand auch schon eine Schüssel, in der ein wunderliebliches Rebhuhn lag, regelrecht mit Speckseiten umwickelt, in mit saurer Sahne angerührter Tunke. Und dann noch eine gute Schüssel Rotkraut.
Ahhh! Über Rebhuhn kann ich schwach werden! Im Zuchthause von Portland hatte es niemals eins gegeben. Dann aber auch nicht in London, die Saison war noch nicht gewesen. Auf dem Meere waren auch keine Rebhühner herumgeflogen, in Brasilien auch nicht, bei Kap Hoorn auch nicht.
O Du wunderbare plastische Kinematografie!
Wenn Dich die Menschheit erst allgemein besitzt! Aber der Humor verging mir doch etwas, als ich zu speisen begann, ich wurde doch wieder etwas tiefsinnig, so vorzüglich mir das Rebhuhn auch schmeckte.
Wie war dies alles nur möglich?
Plastische Kinematografie, was soll man denn hierunter verstehen?
Ich träumte doch nicht etwa?
Dieses Rebhuhn in saurer Sohne war ganz reell, auch die Knochen so reell, dass ich mir ein Stückchen Backzahn abbrach. Nein, ein hartes Schrotkorn war es gewesen, auf das ich gebissen.
Ja, was sollte man denn hiervon denken?
Ich erinnerte mich meines Versprechens, löschte solche grübelnde Gedanken in meinem Gehirn aus.
Das Rebhuhn war bis auf die Knöchelchen verschwunden.
»Holdselige Prinzessin, sind Sie noch da?«
Ein dreimaliges Händeklatschen unter dem Tische bejahte.
»Darf ich noch um etwas Nachtisch bitten?« — »Ja.«
»Dann bitte als Nachtisch noch ein zweites solches Rebhuhn.«
Fast sofort tauchte die Hand auf, hielt schon eine Schüssel — da lag ein zweites solches Rebhuhn darauf! Na gut. Ich hatte es ja bestellt.
Aber die Unterhaltung mit dem Geisterwesen wollte sich doch nicht wieder so versäumen.
»Ist es Ihnen angenehm, gnädige Prinzessin, dass sich Sie noch einiges frage?« — »Ja.«
»Fühlen Sie sich glücklich in Ihrem jetzigen Spukzustande?« — »Nein.«
»Möchten Sie erlöst werden?« — »Ja.«
»Bin ich vielleicht derjenige, welcher?« — »Ja.«
»Doch gewiss durch einen Kuss?« — »Ja.«
»Genügt ein Kuss, auf Ihre schöne Hand?« — »Nein.«
»Auf Ihr Mündchen?« — »Ja.«
»Können Sie sich denn in ganzer Figura sichtbar machen?« — »Ja.«
»Bitte, so tun Sie es doch.« — »Nein.«
»Weshalb nicht? Ach so, direkt antworten können Sie ja nicht. Würde ich mich vielleicht fürchten, wenn Sie mir in ganzer Gestalt erschienen?« — »Ja.«
»Mich entsetzen?« — »Ja.«
»Sind Sie etwa gar so hässlich?« — »Ja.«
»Eine hässliche alte Hexe?« — »Nein.«
»Was denn sonst? Können wir uns sonst nicht auf irgend eine Art und Weise unterhalten?«
Es kam keine Antwort, dafür aber sehr bald die Hand wieder unter dem Tische hervor, sie hielt ein Blatt Papier.
Ich nahm es, sah eine Bleistiftzeichnung daraus, und plötzlich fiel es mir wiederum wie Schuppen von den Augen.
Ilse! Fräulein Ilse! Unsere kleine Ilse! Sie war es, die sich hier einmischte!
Ich muss nachträglich etwas erwähnen, wovon der Leser bisher noch nichts erfahren hat.
Die kleine Ilse war nämlich ein Wunderkind. Hatte ein wunderbares Zeichentalent. Konnte alles, was sie sah, mit wenigen Strichen naturgetreu skizzieren, leistete auch im Porträtieren Vortreffliches, Erstaunliches. Das war ihr angeboren, sie hatte es schon als kleines Kind gekonnt, es entwickelte sich immer mehr. Eine besondere Schule hatte sie deshalb noch nicht bekommen, das sollte erst später werden.
Und dabei besaß das jetzt zwölfjährige Mädel einen großen Mutterwitz, einen köstlichen Humor, der sich besonders in solchen Skizzen offenbarte. Ganz genial. Eine gottbegnadete Karikaturenzeichnerin.
»Kommen Sie her, Mister Tabak, ich will Sie mal abmalen.«
Ein Stück Papier hergenommen, einen Bleistift — eins, zwei, drei — man glaubte wirklich, sie mache nur drei Striche — und da war der Eskimo fix und fertig.
Aber als Seehund, einen Fisch verschlingend, mit einer Flosse seine Tabakspfeife gegen die Brust drückend.
Ja, es war ein vollkommenes Seehundsgesicht, aber doch zugleich hatte sie vollkommen die Physiognomie des Eskimos hineinzulegen gewusst. Mister Tabak, wie er leibte und lebte, nur als Seehund.
Ganz wunderbar, wie sie das machte! Oder sie wollte den Doktor Isidor porträtieren. Dann hing der an einem Baume, der mit Kognakflaschen dekoriert war, Doktor Isidor, wie er leibte und lebte, aber mit einem Schafskopf, auf dem er den Zylinder balancierte, sonst die Hände in den Taschen seiner krummen Hosen, und dieser echte, gehörnte Schafskopf doch ganz deutlich das Gesicht des jüdischen Schiffsarztes — zum Totschießen!
Jetzt also hatte ich aus der Hand das Blatt Papier genommen. Auch solch eine Karikaturenzeichnung!
Das Ganze stellte unverkennbar hier dieses Zimmer dar. Dort stand das große Himmelbett, mit nur wenigen Strichen markiert, aber doch von wunderbarer Ähnlichkeit, in der Mitte der Tisch, an diesem saß ich, in hohen Stiefel und meinem Wams, aber ich hatte einen langohrigen Eselskopf auf, und dennoch waren es ganz genau meine Züge, wie sie mir aus dem Spiegel bekannt waren, ich hatte eine Gabel in der Hand und an ihr eine große Distel gespießt, die ich mir eben in das geöffnete, zungenleckende Maul schieben wollte.
Wenn ich nicht so grenzenlos überrascht gewesen wäre, allein über diese Zeichnung, weil ich aus der ganzen Stilart gleich den Urheber erkannte, so hätte ich jetzt eine Erklärung für alle diese Wunder finden können. Mir wurde mit diesem distelfressenden Esel, der ich selbst war, doch zweifellos eine starke Andeutung gegeben. Der Leser versteht. Ich aber verstand nicht, weil ich eben aus einem anderen Grunde so überrascht war.
»Fräulein Ilse, Sie also sind das?!«
Nein, wurde unter dem Tische geklatscht, während die Hand noch hervorsah.
Diese Hand war allerdings nicht die unserer Ilse, es war die Hand eines reifen Weibes, einer erwachsenen Dame, aber dadurch wurde ich nicht irre.
»Gewiss, das sind doch Sie, Fräulein Ilse, das ist doch eine Ihrer Karikaturenzeichnungen!« — »Nein.«
Nun gut, ich wollte darauf eingehen.
»Dann können Sie aber doch auch schreiben?« — »Nein.«
Man wollte durchaus keine Möglichkeit schaffen, um sich mit mir direkt zu verständigen.
»So zeichnen Sie mir einmal Ihre eigene Gestalt.« — »Nein.«
»Weshalb nicht? Sie können es doch. Haben Sie kein Papier mehr?«
»Nein.«
Ich hatte meine Brieftasche bei mir, zog sie.
»So werde ich Ihnen ein Stück Papier geben, oder Sie können ja die Rückseite dieses Blattes benutzen.« — »Nein.«
»Sie wollen nicht mehr zeichnen?« — »Nein.«
»Wollen Sie mir etwas anderes vormachen?« — »Ja.«
»Dann bitte sehr.«
Da sah ich, wie die Hand das Tischtuch fasste, ein Ruck, und mit großer Schnelligkeit wurde das ganze Tuch unter den Tisch gezogen, mit allem, was sich darauf befand.
Die beiden Teller, die Menage mit Salz, Pfeffer, Senf, Essig und Öl, die beiden Weinflaschen — alles war unter dem Tische verschwunden. Es war alles wie auf dem Tischtuche kleben geblieben. Auch die Knöchelchen waren dabei nicht von den Tellern gefallen, kein Salz hatte sich verschüttet. Es war auch alles ohne Klappern und sonstiges Geräusch abgegangen.
Das war ja schon erstaunlich genug gewesen. Dass unter dem Tische nichts zu erblicken war, brauchte ich wohl nicht erst zu sagen.
Aber es war auch noch etwas anderes Erstaunliches dabei.
Dass alles mit dem Tischtuch herabgezogen worden war, darf ich nicht sagen.
Ich hatte sowohl ein Glas Weißwein, wie Rotwein getrunken. Das Rotweinglas war noch halb gefüllt gewesen, es hatte ziemlich in der Mitte des Tisches gestanden, und da stand es auch noch jetzt, auf der hölzernen Tischplatte. Nur dieses halbgefüllte Rotweinglas hatte den Weg unter den Tisch auf dem Tuche nicht mitgemacht.
Wie war das möglich? Auch als Taschenspielerkunststück gar nicht zu erklären. Nun, ich suchte nach gar keiner Erklärung, erwartete das Weitere.
Alsbald begann sich der dunkle Rotwein in dem Glase zu bewegen, die Oberfläche kräuselte sich, stieg, der Wein begann zu kochen, floss über den Glasrand. Als ich das Glas einmal anfassen wollte, konnte ich es nicht, ich hätte mir die Finger verbrannt. So begnügte ich mich, weiter zu beobachten.
Der Wein floss und floss aus dem Glase, ergoss sich über den Tisch, nach allen Seiten hin. Aber nicht weiter als bis zum Tischrand. Dort staute sich die Flüssigkeit bildete einen Wall. Eigentlich eine ganz natürliche Erscheinung. So rückt ja jede Flüssigkeit, die eine Quelle hat, auf ebener Fläche vor, sie bildet immer eine scharf begrenzte Erhöhung, eine Folge der Adhäsion. Unnatürlich war nur, wie der Wein hier so gerade bis zum Tischrand vorrückte, dort nicht hierüber und herunter floss, sondern die überschüssige Menge dann nach den Tischecken, die von dem Glase doch weiter entfernt waren, vorschickte.
So hatte sich in wenigen Minuten die ganze Tischplatte, ungefähr ein Meter im Quadrat groß, mit Rotwein überzogen, in einer Höhe von vielleicht einem Zentimeter.
Da hörte das rätselhafte Glas zu fließen auf. Und gleichzeitig bemerkte ich, wie sich die Flüssigkeit auf dem Tische zu verändern begann. Sie wurde heller und heller, färbte sich ganz weiß, und da merkte ich, dass es plötzlich kein roter, flüssiger Wein mehr war, sondern massives Eis.
Die ganze Tischplatte war mit einer weißen Eisfläche bedeckt, fühlte sich wie solches an, war ganz kalt, strömte die Kälte aus.
Was sollte das? Ein wiederholtes Händeklatschen veranlasste mich, seitwärts zu blicken, wo die Hand immer erschien.
Sie war denn auch wieder aufgetaucht und hielt zwei kleine Figuren, menschliche Figuren.
Ich nahm sie der Hand ab, betrachtete sie. Es waren ein Männlein und ein Weiblein, ein Herr und eine Dame, spannenlang, oder nicht einmal, ungefähr zehn Zentimeter, beide in eleganten Pelzjacken, auf den Köpfchen Pelzmützen, der Herr in Kniehosen, die Dame mit einem fußfreien Röckchen, unten an den Sohlen der hohen Stiefelchen blitzende Eisenschienen, mit Lederriemchen befestigt.
Also Schlittschuhe — Schlittschuhläufer!
Wenn ich wagen wollte, daran zu glauben, so musste ich ja nun schon wissen, was jetzt kommen würde.
Erst aber sollte ich noch eine andere Überraschung erleben, eine sehr angenehme.
»Herr Ebert!«, erklang da Kapitän Stevenbrocks Stimme.
Sie konnte unter dem Tische hervor, aber auch anders woher kommen.
»Herr Kapitän?!«
»Ich will mein Schweigen brechen, auch fernerhin noch öfter zu Ihrer Verfügung stehen.
In der Voraussetzung, dass Sie mich niemals nach einer Erklärung fragen.
Sie werden eine solche später bekommen, jetzt würde sie Ihnen nur alles zerstören. Sind Sie sich bewusst, dass Sie dies alles nicht nur träumen?«
»Kein Gedanke daran, dass ich mich nur in einem Traumzustande befände!«, durfte ich sofort erwidern, mit ehrlichster Überzeugung, brauchte mich nicht erst an Ohr und Nase zu zupfen, ich hatte mir schon die Finger genug verbrannt, wenn es auch nicht nachträglich schmerzte.
»Recht so! Eine Gaukelei ist es ja nur, das kann ich Ihnen gleich sagen, das wissen Sie doch selbst.
Sie befinden sich eben auf einem Gauklerschiffe, sind von diesem aus in dieses Märchenland geschickt worden.
Nun betrachten und untersuchen Sie erst einmal die beiden Puppen genauer, Sie brauchen auch der Dame gegenüber nicht penibel zu sein, es sind nur Wergpuppen, made in Germany.«
Ich tat es. Ja, die Dame hatte unter dem Sportkostüm nur Gliedmaßen aus Leinwand, ein mit Werg oder Sägespäne ausgestopfter Puppenbalg. Keine innere Befestigung, die Beine und Arme schlenkerten hin und her, alles war ganz biegsam. Sie konnten nicht etwa stehen, sie lagen da, wie ich sie hinlegte, in ganz unnatürlichen Stellungen. Die weißen Handschuhe waren angeklebt.
Bemerkenswert aber waren die Köpfe. Aus hartem Wachs, die Gesichter vortrefflich modelliert, die Haare, die unter den Pelzmützen hervorsahen, schienen echt zu sein, die Wimpern, sogar der Schnurrbart des Herrn. Zwischen den roten Lippen blitzten die weißen Zähnchen. Die gläsernen Augen natürlich starr, aber doch aufs genaueste nachgeahmt. »Legen Sie die Püppchen auf das Eis. Es steht Ihnen dann frei, sie immer wieder zu ergreifen.«
Ich legte die Püppchen hin. Alsbald erscholl unter dem Tische ein Glöckchenspiel, wahrscheinlich eine Spieldose, ein faszinierender Marsch, und sofort erhoben sich die beiden Figuren, begannen Schlittschuh zu laufen und produzierten sich als Kunstläufer.
Mehr habe ich kaum zu sagen. Es waren perfekte Menschen geworden, lebendige Menschen, nur in winziger Miniaturausgabe. Sie produzierten sich als die geschicktesten Kunstläufer, gefielen sich in den graziösesten und geschicktesten Evolutionen, erst einzeln, einer schaute dem anderen zu, dann gleichzeitig, dann im Paar, fuhren im großen Bogen auf einander zu, reichten sich die Händchen, schleuderten sich gegenseitig ab, tanzten zusammen, und so weiter, und so weiter.
Und dabei lachten sie, dass die Zähnchen noch mehr blitzten, und nicht nur, dass sie dabei überhaupt lachende Gesichter machten, sondern ich hörte dieses Lachen sogar, ein dünnes, silbernes Lachen, ihrer Größe entsprechend.
Mein Staunen lässt sich denken. Ich geriet außer mir. Bis ich mich jener Erlaubnis entsann.
Mitten im Laufe erhaschte ich das Männlein.
Sofort hatte es sich in meiner Hand in eine tote Puppe verwandelt, schlaff hingen Beine und Arme herab. Gleichzeitig aber war auch das Dämchen leblos auf dem Eise zusammengesunken. Doch kaum hatte ich das Männlein wieder auf das Eis gelegt, meine Hand zurückgezogen, als beide wieder aufsprangen und ihr Spiel fortsetzten.
Die Musik verstummte, die Püppchen sanken von selbst zusammen.
»Nun«, hat es Ihnen gefallen, Herr Ebert?«
»Herr Kapitän, Herr Kapitän, geben Sie mir eine Erklärung für dieses Wunder!«
»Morgen. Jetzt gehen Sie schlafen. Benutzen Sie dort das Himmelbett.«
»Kann ich nicht gleich an Bord des Schiffes oder doch in den Felsen zurückkommen?«
»Nein. Sie sollen hier noch andere Überraschungen erleben. Aber nicht mehr in der Nacht. Ich will Sie auch während der Nacht mit Spuk und dergleichen verschonen. Sie sollen ruhig schlafen können. Sind Sie nicht recht müde?«
In der Tat, ich fühlte mich mit einem Male recht schläfrig. Vielleicht hatte der Wein eine besondere Wirkung ausgeübt.
»Also gute Nacht, mein lieber Ebert. Morgen sprechen wir weiter.«
Ich ließ die Püppchen liegen, zog mich aus, wenigstens Stiefel und Oberkleider, versenkte mich in die hochgebauschten Federkissen.
Fast im Nu war ich entschlummert, kein Traum störte mich.
Als ich erwachte, graute der Tag.
Verwirrt rieb ich mir die Augen. Dass ich noch in demselben Bett lag, war das einzige, was mich an meine gestrige Umgebung erinnerte, und an diesem Bett fehlte jetzt auch der »Himmel«, das Gestell, an dem ich übrigens die Vorhänge nicht zugezogen hatte, und auch alles andere hatte sich total geändert.
Nicht mehr die gestrige Bauernstube, sondern ein ganz anderer Raum, viel höher, mindestens vier Meter hoch. Mein Bett stand nicht mehr an der Wand, sondern in der Mitte dieses Raumes. Gestern waren zwei Fenster vorhanden gewesen, jetzt zwei an jeder Wand, also zusammen acht, mit durchsichtigen, das heißt sorgsam geputzten Fensterscheiben versehen. Dort an der Wand eine Badewanne aus Marmor, daneben in Leibeshöhe ein kleineres Bassin, also ein Waschbecken, über beiden je ein Wasserhahn. Dann noch ein Tisch und ein Stuhl, aber andere als gestern; auf dem Stuhle lagen meine Kleider.
Wie war ich denn hierher gekommen? Ich stellte diese Frage laut an den Kapitän.
Keine Antwort.
Ich sprang aus dem Bett. Erst so im Stehen konnte ich richtig durch die Fenster blicken, trat an ein solches heran.
Was ich da erblickte, daraus wurde ich lange Zeit nicht klug.
Grüne Wiesen, ganz dicht abgemäht, oder wohl eher Moos als Gras, mit bunten Pünktchen dazwischen, und dann hier und da ein Stückchen niedriger Busch, wie Heidekraut oder wie niedriger Buchsbaum, will ich lieber sagen, es kam mir vor, als wenn es winzige Laub- und Nadelbäume wären.
Und dann ab und zu ein ebenso winziges Häuschen, ein Puppenhäuschen, das größte kaum zwanzig Zentimeter hoch, meistenteils mit einem Gitterchen umgeben, und hinter diesen Gittern sah ich kleine winzige Tierchen sich bewegen.
Da freilich, besonders durch die niedlichen Häuschen, ging mir eine Ahnung auf, ich dachte an die beiden Püppchen von gestern Abend, und meine Ahnung sollte auch gleich bestätigt werden.
»Guten Morgen, Herr Quinbus Flenstrin!«, erklang da wieder des unsichtbaren Kapitäns Stimme aus einem unbekannten Jenseits, das mir aber doch ganz nahe war.
»Wie nennen Sie mich?«, rief ich erstaunt.
»Quinbus Flenstrin. Das ist in deutscher Übersetzung so viel wie Menschberg. Na, Herr Menschberg, wo befinden Sie sich?«
Ja, nun wusste ich es, falls ich etwa noch einen Zweifel gehabt hätte.
Ich hatte mich erst vor kurzem mit der Patronin und dem Kapitän bei Tisch darüber unterhalten, nämlich über Jonathan Swifts Werk »Gullivers Reisen«, wohl sicher jedem Leser bekannt.
Mir war nämlich in der Schiffsbibliothek dieses Buch in die Hände gefallen, eine Prachtausgabe mit zahlreichen Illustrationen, eine höchst selten gewordene Ausgabe. Da hatten wir uns bei Tisch darüber unterhalten. Über dieses Buch im besonderen und über Phantastisches im allgemeinen. Und wir waren zu der gemeinsamen Überzeugung gekommen, dass in der Literatur hauptsächlich alles rein Phantastische ewigen Bestand zu haben scheint. Mit welcher kleinen Andeutung ich mich hierbei begnügen will. Denke der geneigte Leser nur selbst einmal darüber nach was in der Literatur dauernden Bestand hat, was schon unsere Großeltern mit Vergnügen gelesen haben und was wir heute noch gern lesen, unseren Kindern wieder zu lesen geben, und wie schnell alle realistischen und naturalistischen Romane, wie sie auch einmal verschlungen worden sind, doch wieder in die Nacht der Vergessenheit versinken. Und ist nicht zum Beispiel auch ein Drama wie Goethes »Faust« aus lauter Unmöglichkeiten aufgebaut? Sein Roman »Werthers Leiden« hingegen beruht auf lauter Realistik.
Wer aber liest diesen Roman heute noch? Genug hiervon!
»Ich bin im Lande der Liliputaner!«, rief ich.
»Erraten. Sie sind auf der Insel Liliput. Fragen Sie nicht, wie Sie hierher gekommen sind. Aber eine Einleitung sollen Sie erhalten.
Sie sind nicht etwa der erste riesenhafte Bergmensch oder richtiger Menschberg, der von den winzigen Zwergen hier gefangen gehalten wird.
Schon vor zehn Jahren erreichte ein Schiffbrüchiger den Strand dieser Insel, er legte sich zum Schlafen hin, und wie er erwachte, war er mit Stricken umwunden und angepflockt.
Wir wollen diesem Schiffbrüchigen, der ein Mensch wie Sie war, den nicht ungewöhnlichen Namen Friedrich Wilhelm Schulze geben.
Also Herr Schulze hat hier alles durchgemacht, was einst Gulliver unter den Liliputanern erlebte, welche Geschichte Sie ja genau kennen.
Nachdem er sich lange Zeit mit sehr engen Wohnungsverhältnissen hatte begnügen müssen, konnte er hier dieses Haus beziehen, das die Liliputaner im Laufe von drei Jahren für ihn gebaut hatten. Gegen fünftausend Liliputaner haben drei ganze Jahre lang unablässig daran gearbeitet, der Menschberg mit seiner Riesenkraft hat selbst dabei wacker mit helfen müssen, und wenn Sie etwa denken, dieses Haus, das nur zwei Räume enthält, hätte vielleicht nur fünftausend Mark gekostet — nein, fünf Millionen hat es den Liliputanern gekostet; weil es eben Liliputaner sind.
Dieses ungeheure Haus liegt im Nationalpark, der allerhand Sehenswürdigkeiten und Vergnügungsstätten enthält.
Auf der einen Seite sehen Sie den Zoologischen Garten, auf der anderen die Rad- und Pferderennbahn, nach Süden liegen hauptsächlich Restaurationen, Gartenlokale mit Karussells, Schaubuden und dergleichen, eine ständige Vogelwiese und nach Norden erblicken Sie die Hauptstadt Mildendo. Dazwischen liegt ein sehr großer See, für Sie natürlich nur eine Pfütze, auf dem jeden Sonntag und noch öfter eine internationale Ruder- und Segelregatta stattfindet.
Acht Jahre hat Herr Friedrich Wilhelm Schulze hier gelebt, bis er starb. Er hatte mit seiner Gabel einen ganzen Ochsen in den Mund gesteckt, natürlich einen gebratenen, den er, ohne ihn erst zu kauen, versehentlich verschluckte, und das war doch etwas zu viel für ihn, er erstickte an diesem Bissen. Er wurde in einem Kanal begraben, an dem man schon viele Jahre gearbeitet hatte, den man dann aber nicht gebrauchte, die Liliputaner mussten über die Leiche nur wieder Sand schaufeln.
Da Herr Schulze ein sehr gutmütiger Charakter war, durfte er sich frei im Lande ergehen. Natürlich unter den nötigen Vorsichtsmaßregeln, nur auf den breitesten Landstraßen, nur zu gewissen Tageszeiten, dass er mit seinen ungeheuren Füßen, für die Liliputaner zwei Meter lang, nicht etwa Schaden anrichtete.
Trotzdem hatte man diese feine Wohnung gleich so eingerichtet, dass man ihn hier auch als Gefangenen einsperren konnte.
So kommt es, dass Sie hier alles gleich vollständig eingerichtet finden. Die Fenster gehen nicht zu öffnen, die Scheiben bestehen aus einer besonderen Glasmasse, auch für unsere Kraft durch nichts zu zertrümmern. Rund um das Haus zieht sich, wie Sie dann sehen werden, ein Gitter herum, auch oben geschlossen. Sie befinden sich in einem vollständigen Käfig. Also, mein lieber Ebert, gestern sind auch Sie als Schiffbrüchiger vom Meere hier ans Land gespült worden, sind gleich in Schlaf gefallen, man hat Sie gefunden, Tausende von Zwerglein haben Sie auf komplizierten Maschinen hierher befördert, in der Nacht, während Sie schliefen. Wahrscheinlich haben Sie auch noch einen Schlaftrunk oder eine betäubende Einspritzung bekommen.
Haben Sie mich verstanden? Akzeptieren Sie diese Voraussetzung?«
»Ich akzeptiere sie!«, entgegnete ich lachend.
»Gut. Dann brauche ich Ihnen weiter keine Instruktionen zu geben. Alles Weitere wird sich schon finden. Seien auch Sie nur recht sanftmütig, stecken Sie nicht gleich Ihre Hand durch das Gitter, um solch ein Menschlein zu haschen, dann werden auch Sie später größere Freiheit genießen.
Als zweiter Menschberg, der hier strandet, haben Sie den großen Vorteil, dass Sie für Ihre Unterbringung und Bequemlichkeit alles schon fix und fertig eingerichtet finden. Bedenken Sie nur, wie es dem armen Gulliver zuerst ergangen ist. Was der sich für Untersuchungen und Verhöre gefallen lassen musste. Und dasselbe war natürlich auch bei Herrn Schulze der Fall. Bei Ihnen ist das alles nicht mehr nötig. Herr Schulze ist erst seit einem Jahre tot, die Erinnerung an ihn ist noch ganz frisch im Gedächtnis. Natürlich freut man sich ungemein, wieder solch einen Menschberg erwischt zu haben, das ganze Land, über Nacht telegrafisch verständigt, befindet sich in ungeheurer Aufregung; um sechs Uhr, wenn der Zoologische Garten geöffnet wird, werden die Scharen angezogen kommen, um das neue Wunder anzustaunen.
Übrigens können Sie sich mit den Leutchen nicht durch Worte verständigen. Auch Herr Schulze hat trotz seines neunjährigen Aufenthaltes hier ihre Sprache nicht erlernt. Einfach deshalb nicht, weil selbst das lauteste Schreien dieser winzigen Zwerglein für unser Ohr nur ein durchdringendes Mäusepiepen ist, unsere Sprache für sie ein furchtbares Donnern. Also bitte, mäßigen Sie Ihre Stimme, sprechen Sie womöglich gar nicht, bedienen Sie sich nur der Gesten.
Wenn wir uns hier unterhalten, das hören sie überhaupt nicht, weshalb nicht, das geht Sie gar nichts an.
Sonst noch etwas? Ja. Man ist so höflich gewesen, Ihnen alle Ihre Sachen zu lassen, Ihre Uhr und alles andere, was Sie in den Taschen hatten. Eben weil das den Liliputanern nichts Neues mehr ist, weil sie schon ihren ersten Menschberg gehabt haben, der noch viel besser ausgerüstet war als Sie.
Unter anderem hatte er auch einen sehr guten Feldstecher bei sich, von Ihnen Opernglas oder noch lieber Operngucker genannt. Ferner in der Westentasche ein Vergrößerungsglas. Man ließ ihm diese beiden Instrumente, die er gerade in diesem Lande so gut gebrauchen konnte. Sie blieben dann in diesem Hause, das als ein Museum zum Andenken an den Menschberg diente. Sie finden diese beiden Instrumente und alles andere, was dem Herrn Schulze gehörte, was er sich zum Teil selbst angefertigt hatte oder geliefert bekam, im Nebenzimmer.
Dann nur noch eines: Sie können das Haus jederzeit verlassen, vorausgesetzt, wenn Sie die Türen öffnen können. Befinden Sie sich aber draußen, und eine auf dem Hause angebrachte Klingel ertönt, für die Liliputaner eine ungeheure Glocke, so müssen Sie sofort wieder ins Haus gehen, die Türen werden hinter Ihnen wieder geschlossen.
Herrn Schulze ist dieser Dressurakt erst mit großer Mühe beigebracht worden, das ist bei Ihnen nicht nötig, indem ich es Ihnen hiermit sage. Die Liliputaner werden über Ihre schnelle Auffassungskraft und Willfährigkeit staunen.
Sonst habe ich Ihnen nichts weiter zu sagen. Also Schluss! Müssen Sie noch etwas erfahren, werde ich mich schon wieder melden.«
Mein Mentor war verstummt.
Ich hätte ihn auch nichts weiter zu fragen brauchen, er war ausführlich genug gewesen.
Also ins Märchenland der Liliputaner war ich versetzt worden.
Wohl, ich wollte es nehmen, wie es mir gegeben wurde, eine vollständige Erklärung sollte ich ja später bekommen. Das Grübeln hatte ich mir nun schon abgewöhnt. Wundern und Staunen war etwas anderes, das durfte ich.
Ich begab mich von einem Fenster zum anderen. Ja, jetzt erst bemerkte ich, dass sich rings um das Haus ein Gitter zog, in einem Abstande von etwa zehn Metern, oben geschlossen, es musste also auch noch über das ganze Haus weggehen. Recht starke Eisenstäbe, durch die ich höchstens gerade die Hand zwängen konnte.
Auf der einen Seite sah ich also einen Miniaturpark, in dem die Tierzwinger lagen, was ich sonst erblickte, das will ich jetzt nicht schildern, da ich es dann viel deutlicher sehen sollte, auf der anderen Seite ebenfalls solch ein Park mit Wald und Wiese, als Hauptsache darin ein runder Kreis und ein größerer, mehr ovaler, worin ich nun die Rad- und die Pferderennbahn erkannte, auf der dritten Seite viele Häuschen und Zelte, nach der vierten Seite hin erblickte ich einen kleinen Teich, mehr eine Wasserlache zu nennen, und weiter dahinter eine Puppenstadt.
Weiter will ich jetzt also nichts beschreiben.
Wo war denn nun der andere Raum, von dem der Kapitän gesprochen? Zwei Türen gab es. Die eine war geschlossen, die andere konnte ich öffnen.
Richtig, das Haus hatte noch einen kleinen Anbau, zwischen zwei Fenstern gelegen. Es war die Toilette meines Vorgängers gewesen, als Museum erhalten geblieben, auch wieder durch zwei Fenster erleuchtet.
Es war alles vorhanden, was der Mensch braucht, um nicht zum Tier herabzusinken. Wozu schon der Kamm gehört, den ich bereits gestern in dem Bauernhause schwer vermisst hatte. Ich brauchte nur zu suchen, ich fand alles, in einer Kommode und in einem Kleiderschranke und auf Regalen, und immer mehr musste ich über die wunderbare Kunstfertigkeit staunen, mit der hier alles hergestellt worden war.
Es waren eben zwerghafte Handwerker gewesen, die dies alles nach den Angaben meines Vorgängers oder auch nach seinen rohen Modellen angefertigt hatten.
Der Schrank und die Kommode aus lauter kleinen Holztäfelchen zusammengesetzt. Die Anzüge und Hemden aus einem wunderbaren feinen Gewebe oder Gespinst, obgleich nicht etwa gerade so dünn, wohl wie aus Spinnweben, aber doch für uns von normaler Stärke. Man musste nur näher hinsehen, um dieses Wunder zu erkennen.
Im Übrigen will ich mich hierbei nicht weiter aufhalten, es würde gar zu weit führen.
Vor allen Dingen sah ich auf einem Regal das Vergrößerungsglas und den Krimstecher liegen. Dass letzterer zweifellos derselbe war, der mir an Bord der »Argos« zur Verfügung gestellt worden, darüber wunderte ich mich jetzt durchaus nicht mehr. Auch der Leser versteht schon; denn auch die Liliputaner durften sich doch nicht wundern, wenn ich plötzlich ein Doppelfernglas hatte. Das ganze Märchenspiel war aufs beste arrangiert, ich musste nur willig auf alles eingehen, und wenn ich dann hinter die Kulissen des Theaters blickte, wurde ich doch nur enttäuscht. Mit diesen beiden Instrumenten begab ich mich in den großen Raum zurück. Eben erhob sich die Sonne über dem Horizont, hoffentlich regelrecht im Osten, oder, wenn es Sommer war, nur mit einer kleinen Abweichung nach Norden.
Jetzt richtete ich erst einmal meinen Feldstecher nach dem Zoologischen Garten. Das ausgezeichnete Instrument vergrößerte zehnmal. Oder nein — es zog zehnmal heran, verkürzte die Entfernung scheinbar auf den zehnten Teil, so muss es heißen! Ein Fernglas darf ja nie vergrößern. Tut es das, besonders bei geringer Entfernung, erscheint der Gegenstand dann größer, als er in Wirklichkeit ist, so ist es fehlerhaft konstruiert, es wird dann auf größere Entfernungen versagen, die Bilder meist verzerren.
Also wenn das nächste Häuschen von mir dreißig Meter entfernt war, so hatte ich es, wenn ich durch das Doppelglas blickte, scheinbar nur noch drei Meter vor meinen Augen, und da lässt sich ja nun schon etwas erkennen.
Wunderbar war es, was ich da erblickte.
Es war der Elefantenzwinger, und der Insasse machte den ersten Morgenspaziergang in seinem freien Gehege. Ein perfekter Elefant, aber nicht größer als ein Karnickel. Es ist ein etwas unpassender Vergleich, aber mir fällt nicht gleich ein anderer ein. Oder meinetwegen wie ein Mops, wie ein kleiner Mops, noch nicht ganz ausgewachsen. Natürlich vorne den Rüssel und hinten den Schwanz, und auch die Stoßzähne fehlten nicht. Und was für ein stattlicher Elefant war das! Das konnte ich nämlich daraus beurteilen, weil jetzt der Wärter das Gehege betrat, und das war, kann ich gleich versichern, ein vollständig ausgewachsener Mann, obgleich nur wie gestern die Püppchen ungefähr zehn Zentimeter hoch, hatte einen großen Vollbart.
Er beschäftigte sich mit dem dickhäutigen Riesen aus Liliputs Reiche, wie es auch sonst in dem Zoologischen Garten überall lebendig wurde.
Überall kamen aus den Häuschen Tiere zum Vorschein, um sich im Freien zu ergehen, so weit es ihnen das Gehege oder ein solideres Gitter erlaubte, Kamele und Giraffen und Zebras und Strauße und Büffel und Hirsche und Rehe, dort in den erhöhten Käfigen dehnten sich Löwen und Tiger und Panther und Hyänen und andere Raubtiere, und ich will nur nochmals sagen, dass hier die Höhe eines erwachsenen Menschen zehn Zentimeter betrug, so kann sich jeder ein Bild von der Größe oder vielmehr Winzigkeit dieser Tiere machen, die mir mein Doppelglas dicht vors Auge zauberte.
Ein entsetzlicher Anblick!
Doch da sah ich etwas, was mich noch mehr fesselte. Plötzlich standen da vor dem Glasfenster, durch das ich blickte, eine ganze Menge solcher winziger Männlein und Weiblein.
Wie ich jetzt erst bemerkte, befanden sich vor allen Fenstern, also draußen, Galerien, Fenstersimse hätte man ja auch sagen können, aber es waren Galerien, für die Zuschauer bestimmt, die den Menschberg hier drin beobachten wollten, mit Brüstungen versehen. Diese Galerien liefen draußen um das ganze Haus herum, ab und zu führte ein Treppchen herauf.
Diese Galerien, von denen aus man mich in meiner Wohnung selbst beobachten konnte, war nur für ein erlesenes und geladenes Publikum bestimmt, oder, wie ich alles später erfuhr oder merkte, nur gegen hohes Entree zugänglich, das große Volk konnte mich nur sehen, wenn ich mich draußen im vergitterten Hofraum erging.
Trotz der frühen Morgenstunde, es war erst etwas nach vier Uhr, und obgleich die Tore des Zoologischen Gartens noch geschlossen waren, hatten sich schon einige Honoratioren aus der Hauptstadt Mildendo eingefunden, um den neu eingefangenen und über Nacht hierher transportierten Menschberg zu bewundern.
Es waren sieben Herren, die dort draußen standen, junge und alte, sogar solche mit weißen Vollbärten, und vier Damen, die mich staunend betrachteten, und ich konnte sie ebenso betrachten, ohne meine Augen besonders anstrengen zu müssen, wenn es auch noch nicht einmal spannenlange Püppchen waren.
Jonathan Swift ist in seinem berühmten Buche auch betreffs der Daten äußerst gewissenhaft. Er lässt seinen Helden Gulliver am 4. Mai 1699 seine abenteuerliche Fahrt von Bristol aus antreten. Das war damals der Anfang der sogenannten Rokokozeit, und infolgedessen tragen auch die kleinen Liliputaner Rokokotracht. In den besseren Ausgaben des Buches wird das bildlich sehr genau wiedergegeben.
Wir lebten jetzt nicht mehr in der Rokokozeit. Schließlich hätten diese modernen Liliputaner hier ja ihre Kostüme nach eigenem Geschmack tragen können, aber das war eben nicht der Fall, sie hatten sich dem Weltgeist angepasst, der über die ganze Erde weht und alle Originalität in der Kleidung auslöscht, sodass sich heute ein moderner Türke genau so kleidet wie ein Pariser oder ein New Yorker.
Schon vorhin der Elefantenwärter mit aufgekrempelten Hemdsärmeln hatte nicht anders ausgesehen als ein Elefantenwärter im Zoologischen Garten von Berlin oder Amsterdam, und das war hier auch bei diesen winzigen Gestalten vor meinem Fenster der Fall.
Die jüngeren Herren schienen ihre Garderobe aus London zu beziehen, die Damen durchweg aus Paris, so elegant und schick nach neuester Mode waren sie gekleidet. Die älteren Herren nahmen es wohl nicht so genau, die ließen sich ihre Röcke und Hosen wohl von einem ganz ordinären Liliputaner-Schneidermeister machen, aber modern waren doch auch sie gekleidet.
So modern waren sie hier, dass sie sogar alle kurzsichtig zu sein schienen. Die Damen musterten mich durch Lorgnetten, die meisten der Herren hatten Klemmer auf der Nase, einer kokettierte mit einem Monokel, nur die älteren Herren bevorzugten solide Brillen, und es fehlte auch nicht an Tüchlein, die gezogen würden, um die Gläser erst einmal zu putzen.
Dazu nun eine lebhafte Unterhaltung, es fehlte nicht an dem nötigen Staunen, mit dem ich ungeschlachter Menschenberg betrachtet wurde, und der alte Herr mit dem weißen Vollbart war sicher ein Professor, der machte schon seine gelehrten Bemerkungen.
Ein entzückendes Bild! Diese winzigen Figürchen! Die Schlittschuhläufer gestern waren nichts dagegen gewesen. Hier kam noch vielerlei anderes dazu. Soeben zog ein Herr den Handschuh aus, ich sah an den winzigen Fingerchen einige Goldreife blitzten. Ich sah, wie eine Dame ein Riechfläschchen an das Näschen brachte. Ach, was ich alles sah!

Und um das entzückende Bild fertig zu machen, kam jetzt hinter den Röcken der einen Dame ein kleines Mädchen hervor, nicht größer als fünf Zentimeter, das sich bisher hinter der Mama versteckt gehalten hatte.
Gerade die Furcht dieses kleinen Mädchens aber brachte mich auf einen besonderen Gedanken.
Kapitän Stevenbrock hätte mir gar nicht zu raten brauchen, mich einer besonderen Höflichkeit zu befleißigen, ich sah sofort selbst ein, dass es das Beste war, diesen kleinen Leutchen ein recht gutes Urteil über mich beizubringen.
Und ich hatte bereits gesehen, wie der eine junge Herr, der etwas später gekommen sein mochte, vor den anderen zur Begrüßung tief das Strohhütchen gezogen hatte, und dieser Gruß war ebenso erwidert worden, die Damen hatten sich leicht verneigt, hatten ihm wohl auch die Hand gereicht, die Hand der einen Dame war über dem Handschuh ehrerbietig geküsst worden.
Also alles genau wie bei uns.
Gut, da sollten die merken, dass es bei uns ungeschlachten Riesen zu Hause auch solch höflichen Anstand gab.
Also ich nahm schnell meine Mütze, die ich gerade auf dem Tische vor mir liegen sah, setzte sie auf, aber nur, um sie gleich wieder abzureißen, sie wiederholt schwenkend, dazu vor den Zwerglein meine schönsten Komplimente machend, sogar mit dem Fuße auskratzend.
Meine Höflichkeit wurde gewürdigt. Seitens der Zwerglein ebenfalls allgemeines Hutziehen und Verbeugen gegen mich, die Damen verneigten sich und winkten mir mit den Händchen, wenn es dabei auch nicht ohne Lachen abging.
Jedenfalls aber machte es mir den Eindruck, als hätte man von dem neuen Menschberg gar nicht solch eine Höflichkeit erwartet. Mein Vorgänger, Herr Schulze, hatte wahrscheinlich ein ganz anderes, plumpes Benehmen zur Schau getragen. Ich wurde denn auch gleich ganz stolz auf mich.
»Bravo, bravo!«, lobte mich da auch schon die Stimme des unsichtbaren Kapitäns. »Herr Ebert, das haben Sie sehr schön gemacht! Jetzt haben Sie die Herzen dieser Liliputaner bereits bezwungen, und das wird heute Abend schon in sämtlichen Tageszeitungen des Landes stehen. Ihre außerordentliche Höflichkeit, verbunden mit so gewandtem Auftreten. Dass Sie sich dabei barfuß in Hemd und Unterhosen befinden, hat gar nichts —«
Himmelbombenelement noch einmal!
War ich denn nur ganz von Sinnen?
Wie konnte mir denn nur so etwas passieren?
Nun, ich hatte diese Zwerglein eben bisher nicht für richtige Menschen gehalten. Ich mochte an die beiden gestrigen Schlittschuhläufer gedacht haben, die doch nur Wergpuppen gewiesen waren, durch irgend eine Gaukelei Leben erhalten hatten. Vor diesen hätte ich mich ja durchaus nicht geniert, mich auch nur in Badehosen an den Tisch zu setzen und sie in die Hand zu nehmen, sie wurden darin doch wieder sofort nur leblose Puppenbälge.
Das hier war aber doch etwas ganz anderes! Das hier waren wirkliche Menschen, nur in winziger Miniaturausgabe! Ich hatte ja allerdings gar keine Garantie dafür, es konnten ja ebenfalls nur Puppenbälge sein, nur durch eine Gaukelei scheinbar lebendig gemacht, aber — —.
Nein, nein, das waren wirkliche Menschen, nur eben winzig klein!
Plötzlich wusste ich das ganz bestimmt!
Und ich hier vor diesen jungen eleganten Damen barfuß in Hemd und Unterhosen!
Entsetzt machte ich einen Sprung vom Fenster weg nach der nächsten Ecke, wo ich von dort aus nicht mehr gesehen werden konnte. Da bemerkte ich, dass auch an allen den anderen sieben Fenstern solche Gruppen von eleganten Herren und Damen standen, die mich mit Interesse beobachteten!
Himmel, wo sollte ich nun hin?!
Hier gab es kein Versteck, nicht einmal unters Bett konnte ich kriechen, es war zu niedrig.
In die Kammer hinüber?
Da war genau dasselbe wie hier.
Ich wollte vor Scham vergehen.
»Nein, nein, mein lieber Ebert«, erklang da lachend die Stimme des Kapitäns, »Sie brauchen sich durchaus nicht zu genieren! Denken Sie nicht etwa, dass Sie hier als Mensch betrachtet werden. Sie sind für die Liliputaner nichts weiter als ein menschenähnlicher Affe von riesenhafter Größe, so menschenähnlich sind diese ungeheuren Affen aus einem unbekannten Weltteil, dass sie sogar Kleidung tragen. Aber ein wirklicher Mensch sind Sie durchaus nicht. Sie können sich ganz ruhig entkleiden und ein Wannenbad nehmen. Es wird sogar gehofft, dass Sie dies bald tun. Die Liliputanerin aus besserer Familie ist zwar prüder als die prüdeste Engländerin, aber hierbei wird sie durchaus nichts finden. Es ist für sie nichts weiter, als wenn ein nackter Elefant ein Bad nimmt —«
Der Kapitän führte seine Erklärung noch etwas weiter aus.
Es hatte schon genügt.
Es war mir nicht anders, als hätte ich plötzlich eine kalte Dusche bekommen. Sehr schmeichelhaft war das ja gerade nicht für mich, was ich da zu hören bekam, wie man hier über mich dachte, aber jedenfalls war ich dadurch doch schnell von meiner Verlegenheit und Scham kuriert.
Ich kleidete mich an, ließ Wasser in das Becken, unten darunter lag ein Stück Seife, für die Liliputaner wahrscheinlich zentnerschwer, drüben in der Kammer fand ich Handtücher und alles, was ich sonst brauchte, sogar ein Rasiermesser, das ich denn auch gleich benutzte, und nie hatte ich ein schärferes in der Hand gehabt. Auch ein großer Rasierspiegel mit Konkavschliff war vorhanden, alles.
Ein Glöckchen ertönte. Das vornehme Publikum, das sich vor den Fenstern immer mehr angehäuft hatte, verließ die Galerien. Ich sah die Figürchen die Treppchen hinabsteigen, aber sie schritten nun nicht über den freien Platz, sondern verschwanden im Boden in einem Mauseloch. Also hatten diese Galerien jedenfalls einen unterirdischen Zugang. Überhaupt musste, wie ich später merkte, mein ganzes Haus untertunnelt sein.
Noch einmal ertönte das Glöckchen. An einem Fenster erschien wieder ein Mann, einfacher gekleidet, der mir eifrigst winkte. Kapitän Stevenbrock brauchte mir keine Erklärungen zu geben, ich verstand schon die Gesten des kleinen Mannes.
Richtig, ich konnte die Klinke jener anderen Tür, die ins Freie führen musste und die vorhin geschlossen war, jetzt niederdrücken, die Tür öffnen.
Ich trat ins Freie. Sobald ich die Tür, die einigen Zug ausübte, losließ, schloss sie sich wieder von selbst und zwar vollständig, ich konnte sie dann nicht wieder öffnen.
Den Krimstecher und das Vergrößerungsglas hatte ich eingesteckt, indem ich das Weitere schon ahnte.
Ich erging mich in dem umgitterten Raume, der das ganze Haus umgab. Merkwürdig war es, dass ich von außen nicht durch die Fenster sehen konnte. Die waren jetzt wie schwarz angestrichen. Nun, das war eben auch so eine besondere Glasmasse wie die meiner Kugel.
Was mochte aus der geworden sein?
Würde ich sie noch einmal benutzen können? Never mind.
Ich nahm alles, wie man mir es bot, hatte durch das Fernglas meine Freude an der Umgebung, benutzte jetzt auch manchmal das Vergrößerungsglas.
Um das Gitter herum lief ein breiter Weg, breit für die Liliputaner, mein Fuß hätte darauf kaum Platz gehabt. Ab und zu kam aber die Vegetation doch bis dicht an das Gitter heran, und die Stäbe waren weit genug auseinander, dass ich gerade meine Hand durchzwängen konnte.
So gelang es mir, einige der winzigen Gräser und Blätter und Blumen abzupflücken. Winzig! Für das Auge kaum sichtbar. Unter dem Vergrößerungsglas erkannte ich unsere Grasarten, Wiesenblumen und eine Rose mit allen Staubfäden.
Ich erhaschte eine Fliege im Fluge. Unter dem Vergrößerungsglase erkannte ich eine Taube.
Ich geriet noch immer aus einem Staunen ins andere. Stundenlang oder wahrscheinlich auch tagelang hätte ich solche Untersuchungen anstellen können, ohne einmal Langeweile zu empfinden.
Außerdem stellten sich nun auch noch Zuschauer vor dem Gitter ein, und es konnten nicht dieselben sein wie die vorhin vor den Fenstern. Sie kamen von allen Seiten aus dem Parke, zum Teil mit Geschirr, in Jagdwägelchen, in Equipagen, auch beritten zu Pferde.
Reizende, entzückende Bilder, die ich da zu sehen bekam! Ich konnte mich nicht sattsehen.
Aber es musste immer noch ein geladenes, vornehmes Publikum sein. Das sah man gleich an den Kleidern und Manieren, auch bei denen, die zu Fuß kamen. Für den großen Plebs war der Zoologische Garten noch immer nicht geöffnet, die würden dann noch in ganz anderen Scharen angewandert kommen. Dort hinter jenem Walde sah ich durch mein Fernglas auch schon eine ungeheure Menge »kriebeln und wiebeln«.
Übrigens bemerkte ich bald, dass die meisten Fußgänger alle nur von einer Seite her kamen. Als ich mich nach dieser begab, der ich bisher noch keine Aufmerksamkeit geschenkt hatte, um das Haus herum, hatte ich wiederum solch einen entzückenden Anblick.
Hier war der Nationalpark hügelig, oder für die Liliputaner vielleicht sogar gebirgig, für mich waren es nur etwas unregelmäßig gestaltete Termitenhaufen von einem bis zwei Meter Höhe, und soeben kam aus solch einem »Gebirge«, d. h. aus einem Tunnel, unter Volldampf eine Lokomotive heraus, ein Dutzend Wagen nachziehend, das allerliebste Kinderspielzeug passierte einen Wald, dann eine Hängebrücke, die einen wenigstens meterbreiten »Strom« überspannte, der zuvor einen Niagarafall bildete; der niedliche Eisenbahnzug verschwand wieder im Tunnel seines »Gebirges« oder doch Berges, kam auf der anderen Seite wieder zum Vorschein, erreichte eine Station, einen offenen Bahnhof, die Püppchen stiegen aus, nur elegante Passagiere, eilten nach dem Riesenaffenhaus, um die neueste Attraktion des Zoologischen Gartens zu bewundern.
Nun, ich ließ mich denn auch gern bewundern, kam dem hochverehrlichen Publikum in jeder Weise entgegen. Nachdem ich eine Weile gesprungen und gerannt war, den Parademarsch und Freiübungen gemacht hatte, legte ich mich hier und da platt auf den Boden hin, den Kopf auf dem Arm, dicht am Gitter. Auf diese Weise konnte ein erwachsener Mann mit ausgestreckter Hand gerade meinen Mund erreichen.
Und das wurde denn auch getan. Wenn auch nicht immer sogleich. Jedenfalls aber gab es doch weniger Furcht oder gar Entsetzen, als man hätte erwarten sollen. Die Liliputaner waren eben schon an meinen Vorgänger gewöhnt gewesen, und dass auch ich ein ganz harmloses Ungeheuer war, das musste man wohl bald heraus haben.
Bald wurde von den zierlichen, winzigen Händchen mein Mund, mein Kinn, meine Nase betastet, wozu ich freilich das gebeugte Gesicht ganz dicht ans Gitter drücken musste, und gar nicht lange dauerte es, so stach mich ein liebreizendes Dämchen mit seinem Sonnenschirmchen ins rechte Nasenloch. Die Folge dieser Kitzelei war, dass ich einmal herzhaft niesen musste.
Hei, darauf war man freilich nicht gefasst gewesen! Wie Streu vor dem Wirbelsturme stob alles auseinander, ich hörte die dünnen Stimmchen vor Entsetzen quieken.
Aber gar nicht so lange, so sahen sie ein, dass sie gar keinen Grund zur Furcht hatten, sie kehrten zurück, und als ich herzlich lachte, hörte auch ich ihr piepsendes Lachen, sah es noch mehr ihren Gesichtern an.
In dieser Lage hatte ich noch den Vorteil, auch meine Zuschauer näher betrachten zu können. Auch das Vergrößerungsglas muss man doch dem zu besichtigenden Gegenstande ziemlich nahe bringen.
Vorhin in dem Zimmer, als die Zwerge auf der hohen Fenstergalerie gestanden, hatte ich nicht daran gedacht, jetzt tat ich es ungeniert, und man ließ mich ruhig gewähren, dass ich das runde Glas, für sie doch ein Wagenrad, ziemlich dicht über ihre Köpfe brachte.
Es war ein ausgezeichnetes Vergrößerungsglas, hatte überhaupt etwas merkwürdige optische Eigenschaften, die nicht ganz den physikalischen Gesetzen entsprachen, man brauchte gar nicht so genau nach dem Brennpunkt zu suchen.
Doch wie dem auch sei, es tat seine Pflicht vorzüglich. Jetzt erschienen mir die winzigen Köpfchen in normaler menschlicher Größe, ich sah die Gesichter, die beweglichen Mienen, ich sah, wie die eine Dame recht geschminkt war, ich sah die unbekleideten Hände — nein, das hier waren keine solche Wergpüppchen wie gestern Abend die Schlittschuhläufer, nur durch irgend eine Gaukelei scheinbares Leben erhaltend, das hier waren ganz richtige Menschen aus Fleisch und Blut, die Knochen nicht zu vergessen, nur in winziger Miniaturausgabe.
Ja, wie war das nur möglich, dass hier — —.
Hallo, Ewald, Du sollst doch nicht grübeln! Das könntest Du Dir doch nun endlich abgewöhnt haben!
Da erscholl wieder dasoben auf dem Hausdache angebrachte Glöckchen.
Ich erhob mich, zumal das Publikum alsbald davoneilte, in Häuschen verschwand, die hier und da standen. Jedenfalls Eingänge zu den unterirdischen Tunnels, die wieder nach den Fenstersimsen hinauf führten.
Aber ich konnte die Tür nicht öffnen, sie war geschlossen.
Doch da, wie ich noch probierte, erklang wieder das Glöckchen, und nun vermochte ich die Tür zu öffnen.
Also das Signal für mich war immer das zweite Klingeln.
Ein ebenso überraschender, wie lieblicher Anblick erwartete mich in dem Hauptzimmer.
Zunächst erwähne ich, dass das Bett unterdessen nicht gemacht worden war, ich konnte mir auch gar nicht vorstellen, wie das diese Zwerge hätten fertig bringen sollen.
Ebenso fast unbegreiflich war mir aber, wie sie das alles hatten da auf den für sie turmhohen Tisch bringen können. Sie mussten dazu doch wohl eine Maschinerie haben, Winden und dergleichen, die ich nur nicht sah. Schüsseln und Teller, Messer und Gabel, alles war vorhanden, für solch einen normalen Menschenberg berechnet — vor allen Dingen aber auf den Schüsseln die verschiedensten Braten und Speisen.
Da lagen zunächst drei gebratene Meerschweinchen, alle viere von sich streckend. In Wirklichkeit aber waren es stattliche Ochsen, im ganzen gebraten, am Spieß oder sonst wie.
Dann ein halbes Dutzend gebratene Mäuse oder eigentlich ausgewachsene Schafe, wie ich gleich verraten will. Und dann noch eine Menge kleineres Zeug, für mich ein Ragout bildend, für die Liliputaner zusammengehäufte Hühner, Gänse, Enten und dergleichen mehr.
Die eigenartigen weißen Bohnen, die ich als Gemüse aß, waren Eier, was ich aber erst später erfahren sollte. Ich hatte sie für weiße Bohnen gegessen, auf eine mir unbekannte Art zubereitet.
Als Getränk waren zwei Hektoliter Wein aufgefahren worden, die für mich zwei gute Gläser bedeuteten. Des Effektes wegen hatte man den Wein gleich in den Fässern gelassen, nur den Boden herausgeschlagen.
Ich ließ mich nicht lange nötigen, und wenn das erste Frühstück morgens um sechs Uhr hier immer so war, dann ließ ich es mir wohl gefallen.
An den Fenstern drängte sich jetzt eine vielhundertköpfige Menge, und ich zeigte ihr, wie solch ein Menschberg speist. Aus Rücksicht für die, die einen schlechten Platz bekommen hatten, hinter mir standen, schob ich manchmal meinen Stuhl um den Tisch herum, trank den Zuschauern aus den Fässern zu, und reichliches Händeklatschen zollte mir Beifall.
Wenn mein Vorgänger solch einen ganzen Ochsen in den Mund hatte stecken können, so musste er allerdings ein sehr großes Maul besessen haben, ich konnte das nicht, vier Bissen brauchte ich doch dazu, um solch einen Meerschweinchen-Ochsen verschwinden zu lassen, auch die Knöchelchen verschluckte ich lieber nicht mit, aber die Schöpse verschwanden spurlos mit einem Bissen, und alles andere war eben nur Ragout für mich, das ich mit der Gabel oder auch gleich mit dem Löffel aß.
Nach absolvierter Vorstellung durfte ich mich wieder ins Freie begeben.
Ich fasse die anderen Vormittagsstunden kurz zusammen.
Es schien im Liliputanerlande Sitte zu sein, dass die Sport- und Festspiele schon am Vormittag stattfanden.
Zuschauer hatten sie allerdings nicht viele, die drängten sich alle um meinen Riesenaffenkäfig herum, aber sie mussten wohl programmmäßig abgehalten werden, und ein desto aufmerksamerer Beobachter war ich.
Ich sah durch mein Fernglas, obschon auch die bloßen Augen genügt hätten, wie dort auf der Kurvenbahn die winzigen Radfahrer im Kreise herumjagten, dort auf der ovalen grünen Bahn die Pferdchen mit Jockeis in bunter Seide, wie sie stürzten, sich überschlugen, Knochen brachen und wohl auch das Genick — ich sah, wie dort auf der mächtigen See-Pfütze um die Preise gerudert wurde, in allen möglichen Booten, wie die Jachten segelten, solche kleine Dinger, wie sie unsere Kinder auf dem Goldfischteich, oder gar in der Badewanne schwimmen lassen — ich sah dort auf dem grünen Plan ein Regiment Soldaten exerzieren, Kavallerie machte Reiterattacken nach den Klängen einer Musikkapelle, deren Klänge ich gerade noch vernahm, obgleich nur fünfundzwanzig Meter von mir entfernt — ich sah — —.
Ich sah noch Hunderterlei und konnte mich nicht sattsehen.
Mich wunderte nur, dass es schon zwölf Uhr geworden war, als mich das Glöckchen wieder ins Haus lockte.
Ah, das war mir ebenfalls sehr angenehm.
Die zweite Fütterung war schon vorbereitet, noch ausgiebiger als das Frühstück, diesmal ließ ich fünf gebratene Ochsen und ein ganzes Dutzend Schafe verschwinden, und von den erbsengroßen Semmelchen soll ich nach liliputanischem Gewichte an die vier Zentner verschlungen haben.
Nach dieser reichlichen Mahlzeit, gewürzt mit drei Fässern Wein, fühlte ich mich müde, ich hatte ja den ganzen Vormittag seit Sonnenaufgang schon genug getan — ich legte mich, angekleidet wie ich war und unbekümmert um die Zuschauer, auf das Bett und war bald eingeschlafen.
Als ich erwachte, blickte ich in das gelbe Licht einer elektrischen Glühlampe, die in Kopfeshöhe an der Wand befestigt war, an der auch die grünumsponnenen Drähte hinliefen, die dann in einer Ecke verschwanden.
Ich erwähne nachträglich, dass diese Wände mit Holz bekleidet waren, oder wohl richtiger mit einer Holzmasse, vielleicht als flüssiger Holzbrei aufgetragen, die dann erstarrte, trocknete, denn nirgends war eine Fuge zu sehen.
Jetzt aber waren die acht Fenster verschwunden. Auch sie waren mit Holz verkleidet. Obgleich früher nicht etwa Läden vorhanden gewesen. Und ich konnte auch nichts von den Fugen solcher Läden bemerken. Der ganze Raum war innen eine einzige, zusammenhängende Holzverkleidung. Die Liliputaner mussten da eine ganz besondere Holztechnik besitzen.
Sonst war es noch derselbe Raum. In der Mitte stand noch mein Bett, auf dem ich angekleidet lag, dort der Tisch und Stuhl, dort war die Marmorwanne, daneben das Becken.
Während meines Nachmittagsschläfchens, das wahrscheinlich durch ein narkotisches Mittel in dem Wein mit Absicht vertieft worden war, hatten die Zwerge den Tisch abgeräumt, hatten die Fenster geschlossen und dort die elektrische Glühbirne angebracht, die Drähte dahin gelegt.
Wozu dies?
Nun, ich würde es schon noch erleben.
Meine Uhr wies auf um drei. Freilich konnte ich wenn ich an einen Schlaftrunk dachte, ebenso gut vierzehn Stunden wie nur zwei geschlafen haben, dann war es jetzt draußen noch Nacht.
Dies alles beobachtete und bedachte ich, während ich noch auf dem Bette lag.
Aufgestanden! Da, wie ich mich dabei mit der einen Hand abstützte, ergriff ich mit dieser Hand etwas, was neben mir auf dem Bett lag.
Ein Degen! In Scheide. Ein ganz merkwürdiger, prachtvoller Degen! Wie ihn ein türkischer Pascha tragen mag, wenn er einen geraden Degen dem krummen Säbel vorzieht.
Die Scheide aus Goldblech und zwar musste ich es für echt halten, was auch von den bunten Edelsteinen galt, mit denen die Scheide besetzt war. Golden und edelsteinbesetzt, auch der Griff, während die Kette, um die Waffe an den Gürtel zu hängen, wohl aus härterem Silber war.
Ich zog die Klinge. Ein vorzüglicher Stahl, so weit ich das beurteilen konnte, jedenfalls haarscharf und spitz geschliffen. Ziseliert oder damasziert war er nicht, was bei solch einer wertvollen Waffe eigentlich auffallend war.
Weshalb hatte man diesen Degen neben mich gelegt? Sollte ich etwa eine Fechtvorstellung geben?
Hatte dies schon mein Vorgänger tun müssen, war deshalb dieser Degen für ihn angefertigt worden? Weshalb da so überaus kostbar? Wenn das echtes Gold und echte Edelsteine waren, dann repräsentierte die Waffe für die Liliputaner ja einen ungeheuren Wert, der war für sie ja zehn Meter lang, die Steine müssten für sie die Größe von Kokosnüssen haben. Oder die Verhältnisse stimmten nicht mehr. Oder aber Gold und Edelsteine spielten hier keine Rolle.
Diese Untersuchung des Degens hatte ich schon im Stehen erledigt. Da man ihn mir doch gegeben hatte, dass ich ihn für irgend einen Zweck benutzen sollte, hing ich ihn mit den Karabinerhaken der Kette gleich an meinen Gürtel, der die Hosenträger ersetzte, alles passte ganz famos.
Zunächst begab ich mich in die Kammer hinüber, da vielleicht die Fenster noch — —
Nein, auch hier hatten die beiden Fenster eine Holzverkleidung erhalten, auch hier brannte an der Wand eine elektrische Glühbirne. Sonst war alles beim Alten.
Zurück und die andere Tür probiert. Ich war schon überrascht, dass sie sich wirklich öffnen ließ, mehr noch aber über das, was ich dann weiter sah.
Nämlich nicht mehr den umgitterten Hofraum, weder bei Tag noch bei Nacht.
Eine Tischlerei! Eine Hobelbank! Hobel und Sägen und anderes Werkzeug, dazu ein stattlicher Brettervorrat — das nennt man doch wohl eine Tischlerei.
Dann aber dachte ich auch wieder an eine Schlosserei. Denn dort an einem anderen Werktisch ein Schraubstock, dort eine Bohrmaschine, dort eine kleine Hobelmaschine, beide mit elektrischem Antrieb, wie ich gleich erkannte, wie hier auch drei Glühbirnen leuchteten, und es gab noch andere, man brauchte sie nur anzudrehen.
Was war denn das? Wie kam denn dieser geschlossene Raum mit Tischlerei und Schlosserei plötzlich hierher? Plötzlich?
Hatte ich etwa tagelang oder gar wochenlang geschlafen, die Zwerge hatten unterdessen hier noch einen anderen Raum an das Haus geklebt, für mich darin eine Tischlerei und Schlosserei eingerichtet, in der ich mich praktisch betätigen sollte?
Ich fühlte keinen Hunger. Fühlte mich durchaus nicht entkräftet. Wenn ich nicht irrte, hatte ich zwischen den Zähnen noch etwas von dem gebratenen Ochsen.
Nicht grübeln, Ewald! Weiter forschen!
Auch dieser Raum hatte auf der anderen Seite noch eine zweite Tür.
Sie ließ sich öffnen, aber finster gähnte es mir entgegen. Nur schwach sah ich vor mir wieder eine Wand, die rund zu sein schien, weiter reichte das Licht der hinter mir befindlichen Glühbirnen nicht aus.
Doch dort auf einer großen Blechkiste, auf einem Holzgestell ruhend, stand eine Lampe. Nicht wieder solch eine Stalllaterne, sondern eine recht handliche Lampe, die man sich mit einem Haken auch am Gürtel befestigen konnte.
Sie roch etwas nach Petroleum, oder auch der ganze große Blechkasten, der unten einen Hahn hatte, oben an der Seite einen Stöpsel, und als ich den entfernte, sah ich einen Spiegel schimmern, es war ein Petroleumtank. Doch der Behälter der Lampe selbst war noch mit Petroleum gefüllt. Ein Taschenfeuerzeug hatte ich bei mir, ich entzündete sie.
Es war ein Tunnel mit runden Wänden, den die Lampe beleuchtete, und zwar bestanden die Wände zweifellos aus Zink.
Eine Zinkröhre von etwas mehr als zwei Meter Durchmesser. Was in aller Welt wollten denn die Liliputaner mit der? Für sie musste das ja ein Rohr von etwa zwanzig Metern Durchmesser bedeuten!
Wir untertunneln jetzt ja besonders Flüsse und Ströme auch mit solchen enormen Röhren, aber zwanzig Meter Durchmesser gibt es da nicht! Höchstens vier bis fünf.
Ich ging die Röhre entlang, vielleicht dreißig Schritte, da wurde sie durch eine eingelassene Wand versperrt. Sie war offenbar aus Holz, aber mit Blech benagelt, auch mit Eisenbändern belegt. Und dann besaß sie eine kleine Tür, mit zwei starken Riegeln aus Eisen versehen.
Ich zog sie ohne Schwierigkeit zurück, das Türchen drehte sich in Angeln — Licht schimmerte mir entgegen, allerdings ein sehr gedämpftes.
Ich kroch durch das Türchen. Kaum einen Meter hoch, und kam einfach in die Fortsetzung der Zinkröhre hinein, hatte jetzt aber nur noch wenige Schritte zu tun, so hatte ich ihr Ende erreicht.
Ja, ins Freie mündete sie allerdings. Wenn man das eine »Freiheit« nennen durfte
Schwer wird es mir ja, das zu schildern, was ich da alles sah und erlebte, was mir Kapitän Stevenbrock da —
—. Doch ich will nicht vorgreifen. Vorausgesetzt, dass es bei dem scharfsinnigen Leser nötig wäre.
Ich hatte über mir eine ebene Decke, noch etwa einen halben Meter von meinem Kopfe entfernt, und die ganze Decke war vielleicht fünfundzwanzig Meter lang und fünfzehn breit.
Anders kann ich es vorläufig nicht beschreiben, eben deshalb muss ich jetzt solche Maße in Zahlen angeben. Es wird bald schon noch deutlicher kommen.
Diese mächtige Decke war von Holz, von gewaltigen Brettern zusammengefügt, hier und da hing Bindfaden herab, recht schmutzig, als hätte er im rußigen Schornstein gehangen.
Der hölzerne Boden dagegen, auf dem ich stand, war ganz sauber.
Diese gewaltige Decke ruhte auf gewaltigen Pfeilern. Wenn Pfeiler da das richtige Wort ist. Es waren mehr viereckige Klötze, Holzquader, fast ebenso breit wie hoch, also mehr als zwei Meter. An jeder Ecke stand einer, auf diesen ruhte die gewaltige Holzdecke. Ich als Ingenieur staunte ganz besonders über diese ungeheure Spannweite der Bretter oder Balken über mir. Mir ganz unbegreiflich.
Es herrschte also Dämmerlicht, das alles noch erkennen ließ, dort jenseits der Decke aber war es viel heller.
Ich schritt unter der Decke hin nach dem Rande. Vorläufig sah ich nichts weiter als einige sehr dicke, meterdicke Pfeiler, die sich hier und da erhoben, deren Ende ich also unter der Decke hervor noch nicht absehen konnte.
Aber wie ward mir nun, als ich unter der Decke hervortrat!
Im Augenblick sah ich nur ein einziges, unerklärliches Etwas.
In einer ungeheuren Halle, gegen welche das Innere der größten Kirche oder eines Doms verschwindet, dort oben in mittlerer Höhe ein ungeheures Bild, dreißig Meter hoch und zwanzig Meter breit, ein farbiges Gemälde, das Brustbild einer schönen Dame mit ausgeschnittener Büste, der Kopf allein so an die fünf Meter im Durchmesser, die Schulterbreite fünfzehn Meter, mit Augen wie die Wagenräder, jedes der Fingerchen, die einen Fächer hielten, anderthalb Meter lang.
Mehr sah ich nicht.
»Warte, da habe ich so'n Luder erwischt!«
So hatte eine menschliche Stimme gebrüllt. Gebrüllt wie der Kanonendonner einer ganzen Batterie. Aber als ob diese Batterie noch oben an einem Berge abgefeuert würde. Auch mit grollendem Gewitterdonner zu vergleichen. Also das Ohr nicht gerade beleidigend, die Trommelfelle nicht zersprengend.
Und dabei war ich von hinten gepackt worden, gar nicht so sanft, gelbliche Riesengürtel umspannten meinen Leib, ich sauste durch die Luft, ich sah so etwas Ähnliches wie dort oben das Bild in Natura vor mir, und dann —. Ich kann es nicht beschreiben, mir war der Atem ausgegangen, ich war so halb und halb bewusstlos.
»Ei, da wird sich die allergnädigste Prinzessin aber freuen!«
Das hörte ich noch mit Donnerstimme rufen. Ich sah wohl auch noch das menschliche Ungetüm davonlaufen, durch ein Tor, das sich öffnete und wieder schloss, verschwinden, aber einen richtigen Eindruck hatte ich davon nicht bekommen.
Erst so nach und nach kam ich wieder zu mir.
Da saß ich mit gespreizten Beinen unter — ich will es gleich kurz machen — unter einem Wasserglase, das der Kerl einstweilen über mich gestülpt hatte. Innen anderthalb Meter weit und drei Meter hoch, die Glaswand entsprechend dick, vielleicht drei Zentimeter.
Oben darauf hatte er, falls meine Kraft doch ausreichte, das Riesenglas umzuwerfen, ein Buch gelegt, fünf Meter lang, vier Meter breit und einen Meter dick. Das musste viele, viele Zentner wiegen, die konnte ich nicht liften, da musste ich wohl unter meinem Wasserglase stecken bleiben.
Solcher Bücher lagen auf dem Tische noch mehrere herum. Denn auf einem Tische befand ich mich doch natürlich. Natürlich, sage ich. Das menschliche Ungeheuer hatte das Wasserglas doch nicht am Boden über mich gestülpt, hatte mich doch erst noch durch die Luft sausen lassen.
Also solcher Riesenbücher lagen noch mehrere auf dem Tisch, lauter Prachtexemplare, Salonausgaben mit Goldschnitt. Ich hätte die ungeheuren Buchstaben, die zum Teil auch außen ausgedruckt waren, die Titel, vielleicht auch entziffern können, aber für diese Bücher hatte ich jetzt kein Interesse.
Mehr für das mächtige Wasserbassin, was da in der Mitte der runden Scheibe stand, mindestens dreißig Meter im Durchmesser haltend, runder Salontisch genannt.
Dieses Wasserbassin hatte die Form eines Weißbierglases, aber eines solchen, das an einem schlanken Stiele ruht. Es war ein Goldfischglas, will ich gleich sagen. Aber was für eins! Und dementsprechend waren auch die drei Goldfische. Goldene Walfische. Doch nein, ich will nicht übertreiben — sie waren höchstens zwei Meter lang. Und das genügt ja auch schon. Ich hätte in diesem Bassin kein Bad nehmen mögen. Soeben sperrte der eine den Rachen auf und verschluckte ein Ameisenei. Ich dachte aber erst, es wäre ein gelbes Hühnerei gewesen, ein Solei. Und diese Goldfischchen konnten noch etwas ganz anderes verschlucken. Ein Straußenei, eine große Kokosnuss, hätten mir also mit Bequemlichkeit auch beide Beine abknipsen können. Dort unter jenem Schranke war ich hervorgekommen. Denn ein Schrank war das gewesen, das wusste ich nun.
Ein fünfzig Meter hoher und entsprechend breiter Schrank mit Glastüren, und hinter diesen standen auf Regalen Nippfiguren, meist aus Porzellan. Porzellanene Männchen, die größer als ich waren, und nun sonst die verschiedensten Figuren und Sachen, Tiere, die weit alles Irdische, für uns normale Körpermaßen übertreffen. Ein kleiner Mops so groß wie ein Ochse, und so alles dementsprechend.
Nebenbei will ich noch bemerken, dass die schmutzigen Bindfaden und Stricke, die von jener Decke herabgehangen hatten, nichts anderes als Spinnweben gewesen waren. Der Boden konnte auch unter dem Schranke reinlich gehalten werden, nicht der untere Teil des Schrankbodens.
Diese Tischdecke, auf der auch ich saß, bestand aus einem überaus groben Gewebe, aus förmlichen Stricken, die quadratische Löcher bildeten, aber weich waren sie doch.
Zunächst wurde meine Aufmerksamkeit jetzt von einer Fliege gefesselt, die über die Tischdecke auf mich zugekrochen kam. Ja, es war eine Fliege, die da auf mein Glas zugekrochen kam, eine gewöhnliche Stubenfliege.
Wie groß ist eine Stubenfliege, was für Dimensionen hat sie? Ich habe noch keine mit dem Zollstock ausgemessen.
Na, sie mag fünf Millimeter hoch sein, will ich sagen, wenn sie aufgerichtet mit ihren sechs Beinen den Parademarsch macht.
Diese hier war beim Parademarsch mindestens zehn Zentimeter hoch! Diese behaarten Beine! Und dieser Rüssel! Wie der sich in eine halbe Semmel versenkte, die dort als Krümelchen auf der Decke lag! Ich sah ganz deutlich den Tropfen, den sie aus dem Rüssel absonderte, um die harte Speise erst zu erweichen. Es war ein ganz ansehnlicher Wassertropfen.
Und dann kam ein anderes Insekt unter hörbarem Rauschen angeschwirrt, vor dem ich mich zu fürchten begann!
Unverkennbar eine Wespe. Aber was für eine! Wenn bei uns eine stattliche Wespe fünfundzwanzig Millimeter lang ist, so diese hier einen halben Meter! Diese Flügel! Diese Augen! Und dieser Stachel, den sie einmal zum Vorschein brachte! Den hätte ich ja nicht in meinen Bauch gebohrt haben mögen!
Als sie sich an mein Glas heftete, sprang ich erschrocken auf, dachte im Augenblick nicht an dieses uns trennende Glas, das außerordentlich fein geschliffen und daher durchsichtig war, ich dachte nur, die wollte mir etwas tun, zog zur Verteidigung gleich mein Schwert.
Da erschrak wohl auch sie, das Biest schwirrte wieder davon.
»Nun, mein lieber Ebert, was sagen Sie denn nun zu dieser neuen Situation?«, erklang da die mir wohlbekannte Stimme des Kapitäns.
Zu sehen war er natürlich wiederum nicht.
Ich war von meinem ersten Schreck noch etwas atemlos.
»Kapitän, Herr Kapitän, machen Sie diesem Gaukelspiel ein Ende!«
»Wie, sprechen Sie im Ernst?«
»Ich bin wahrhaftig über diese schreckliche Wespe erschrocken!«
»Die kann Ihnen doch nichts tun, Sie stecken doch unter einem Glase.«
»Ja, aber werde ich auch immer unter diesem Glase stecken bleiben? Und denken Sie überhaupt, es ist mir sehr angenehm, hier unter solch einem Wasserglase zu stecken?«
»Sie werden schon bald aus Ihrem gläsernen Käfige befreit werden!«, lachte der unsichtbare Kapitän.
»Und dann bin ich erst recht den Angriffen solcher Wespen und ähnlicher Ungeheuer ausgesetzt!«
»Da brauchen Sie keine Sorge zu haben, niemals wird Ihnen etwas Ernstliches passieren.«
»Sie können diese Gaukelei nach Belieben lenken?«
»Gaukelei?«
»Na dann meinetwegen. Ihre plastische Kinematografie. Sie ist ganz verdammt plastisch. Die können Sie nach Belieben arrangieren?«
»Ja, das kann ich. Also Sie wollen wirklich aufhören?«
»Nein, wenn's so ist, dann nicht, dann mag das Spiel meinetwegen noch weiter gehen.«
»Wissen Sie, wo Sie sich jetzt befinden?«
»Als Gulliver im Lande der Riesen.«
»Erraten.«
»Dazu ist auch sehr wenig Scharfsinn nötig. Wollen Sie mir nicht auch für diese meine neue Situation eine kleine Einleitung geben?«
»Wohl, die können Sie haben. Sie sind wiederum nicht der erste Mäusemensch der nach Brobdingnag, dem Lande der Riesen, kommt, Sie haben sogar einige Vorgänger gehabt.
Vor einigen Jahren machten ein Dutzend deutscher Monteure von Hamburg aus, wo sie gemeinsam beschäftigt waren, eine gesellige Vergnügungsfahrt nach Helgoland, dort nahmen sie ein Segelboot zu einer kleinen Partie, wurden von Sturm und Strömung verschlagen, endlich erblickten sie eine Insel, wurden auf einen sandigen Strand getrieben, da kam ein menschlicher Riese von an die vierzig Meter Länge geschritten, und ehe die vollständig erschöpften Menschlein an eine Flucht denken konnten, waren sie sämtlich gehascht worden,
Der biedere Fischer brachte die Zwerglein in seiner Mütze nach dem Heimatdorfe, von dort kamen sie nach den mannigfaltigsten Abenteuern nach der nächsten Stadt, von dort nach der Residenz, der König sah sie und kaufte sie dem letzten Besitzer ab, als lebendiges Spielzeug für seine Tochter Kunigunde.
Dadurch entgingen die Mäusemenschen, wie sie genannt wurden, dem traurigen Schicksale, Zeit ihres Lebens als Schauobjekte dienen zu müssen, wenn sie nicht schon vorher von ärztlichen Forschern tot oder gar lebendig seziert wurden.
Bei Ihrer Königlichen Hoheit, der Prinzessin Kunigunde, hatten sie es sehr gut. Zu Spielereien wurden sie ja freilich auch benutzt, aber sie waren doch wenigstens vor Misshandlungen geschützt. Immerhin, die deutschen Monteure sannen ständig auf ihre Befreiung. Einer nach dem anderen entwischte bei der ersten besten Gelegenheit. Verstecke gab es ja in diesem Palaste genug, wo sie sich häuslich einrichten konnten, ohne entdeckt zu werden. Vor einem Vierteljahre gelang es dem letzten, seinem Puppenhause zu entfliehen.
Die kleine Prinzessin Kunigunde war untröstlich auch über diesen letzten Verlust, hat sich aber eben fügen müssen. Vergebens hat man die genialsten Mäuse- und Rattenfallen aufgestellt, keiner der Mäusemenschen ist hineingegangen. Nun wird sie hocherfreut sein, dass ein Lakai solch einen kleinen Flüchtling wieder gefangen hat. Der Diener sah ihn unter jenem Schranke dort vortreten, griff schnell zu und erwischte ihn gerade bei den Rockfittichen.
Sie sind zwar ein anderer, ein ganz neuer Mäusemensch, aber so genau kommt es hier nicht darauf an, so genau ist keiner unter das Vergrößerungsglas genommen worden. Sie sind einer von denen, die zuerst entflohen waren, und das ist nun schon drei Jahre her. So, ich glaube, diese Einleitung dürfte Ihnen genügen.«
»Ich hätte doch noch einiges zu fragen?«, meinte ich.
»Bitte sehr.«
»Was waren denn das vorhin für Wohnräume und Werkstätten, in denen ich mich zuerst befand?«
»Das waren ursprünglich Löcher, welche ein Rattenehepaar in den Balken hineingefressen hatte. Die Monteure, die sich nach und nach zusammenfanden, vertrieben die vierbeinigen Hausbesitzer, ebneten die Wände, richteten sich darin wohnlich ein.«
»Und die Werkstätten?«
»Es waren Monteure, geschickte Menschen, die in Holz und Eisen zu arbeiten verstehen, ich habe es Ihnen doch schon gesagt.«
»Ja, aber die Hobelmaschine, die Bohrmaschine?«
»Haben Sie noch nicht solche Maschinen als niedliches Kinderspielzeug gesehen? Von einem kleinen Motor getrieben? Prinzess Kunigunde hatte einen Bruder. Er ist gestorben. Dieser Knabe interessierte sich für solche mechanische Spielereien. Die Monteure fanden diese Sachen in der Kinderspielstube, haben die Maschinen, die sie brauchbar fanden, auseinandergenommen und in ihren Werkstätten wieder aufgebaut.«
»Aha, ahaaa!«, machte ich, denn ich musste diese erklärende Phantasie wirklich bewundern. »Aus dieser Kinderspielstube stammen wohl auch die elektrischen Glühbirnen?«
»Ganz gewiss. Für diese Riesen sind sie ja nur erbsengroß. Aber haben Sie nicht auch in Ihrer Heimat solch winzige Dingerchen gesehen? Für Kinderpuppenstuben und dergleichen. Natürlich nur für bessere Puppenstuben. Sie sind hier aber doch im Palaste des Königs, Ihre Königliche Hoheit, die Erbprinzessin Kunigunde hat doch keine ordinären Puppenstuben. Alles elektrisch erleuchtet.«
»Ahaaa! Und diese Mäusemenschen haben in dem ehemaligen Rattenloche einen Anschluss an die elektrische Leitung gefunden!«
»Na selbstverständlich, das ist doch ganz einfach. Es ist nur die Klingelleitung gewesen, die sie in der Nähe fanden, aber diese elektrische Kraft genügte schon vollkommen, um auch ihre Maschinen zu treiben. Was sie sonst dazu brauchten, fertigten sie sich selbst, es waren doch Monteure.«
»So haben sie sich auch diesen kostbaren Degen gefertigt?«
»O nein. Das war ursprünglich ein Zigarrenspitzenabschneider, den seine Majestät der König als Anhänger an der Uhrkette trug. Prinzess Kunigunde bettelte das Dingelchen dem Papa ab, benutzte es als Nagelputzinstrument. Bis sie dann einen Mäusemenschen mit dieser Waffe umgürtete. Der ist ihr dann mit dem Zigarrenabschneider durch die Lappen gegangen.«
»Ahaaaa!«, lachte ich, immer mehr amüsiert. »Und was war denn das für eine Zinkröhre, die ich zuletzt passierte?«
»Keine Zinkröhre, sondern ein Eisenblechrohr, nur innen und außen verzinkt. Das ist eine der Röhren von der ehemaligen Ventilationsanlage, mit der dieser ganze Palast durchzogen ist. Sie hat sich als unbrauchbar erwiesen. Aber entfernt können die Rohre nicht wieder werden. Oder man müsste den ganzen Palast einreißen. So haben die Mäusemenschen die schönste Gelegenheit gehabt, sich ungesehen in allen Räumen zu verbreiten. Die Rohre münden meistenteils unter Möbeln, viele auch ins Freie, dicht über dem Boden, sodass sich die Flüchtlinge auch draußen im Freien ergehen konnten.«
»Weshalb hatten sie die mit Blech benagelte Holzwand in der Röhre angebracht?«
»Sie können wirklich noch fragen?«
»Um sich vor dem Eindringen von Mäusen und Ratten und anderer gefährlicher Raubtiere zu schützen.«
»Ahem, o scharfsinniger Mann!«, bestätigte der Kapitän.
»Und wo sind denn meine Vorgänger geblieben?«
»Ja, Du lieber Gott, die haben sich so nach und nach verkrümelt, sind verloren gegangen. Der eine wurde von einer Katze gefressen, der andere fiel im heldenmütigen Kampfe mit einer bissigen Ratte, ein dritter fand ein weniger rühmliches Ende, eine Kohlenschaufel fiel um und zerschmetterte ihn, ein vierter wurde von einem der Riesen zertreten, ohne dass der etwas davon gemerkt hatte, ein fünfter kletterte auf eine Fußbank, stürzte herab und brach das Genick, der sechste wurde, als er sich draußen im Garten erging, von einer Ente verschluckt — und so sind sie eben alle nach und nach verschwunden.«
»Sooso! Und solch ein Schicksal wird hier auch mein Los werden.«
»Nein, Herr Ebert, seien Sie versichert, Sie werden immer beschützt — —«
»Ich glaube es schon, ich glaube schon!«, durfte ich hier den Kapitän einmal unterbrechen, was es ja an Bord seines Schiffes und auch sonst ja nun freilich nicht gab.
»Ja und doch, möchten Sie nicht einmal in gefährliche Lagen kommen, um ein bisschen das Gruseln zu erlernen?«
»Na, wenn es nicht gar zu schlimm wird — —«
»Ich werde Ihnen ein Mittel in die Hand geben, mit dem Sie jederzeit dieser plastischen Kinematografie, diesem ganzen Spiele ein Ende machen können.«
»Was für ein Mittel ist das?«
»Nicht in die Hand, sondern in den Mund will ich Ihnen geben, noch mehr ins Gehirn. Sobald Sie entschlossen sagen: aufhören! — dann ist das Spiel aus. Also nicht, wenn Sie dieses Wort ›aufhören‹ zufällig einmal aussprechen. Sie müssen es mit Nachdruck sagen, um sich aus einer Gefahr zu befreien. Oder wenn Sie sonst genug von der Geschichte haben. Aufhören! Dann ist's vorbei.«
»Ich verstehe schon. Und was ist dann? Wo bin ich dann?«
»Das werden Sie dann schon sehen. Dann erhalten Sie auch für alles eine vollständige Erklärung. Sobald können Sie dann freilich nicht wieder in dieses Wunderland geschickt werden. Also seien Sie vorsichtig mit Ihrem Zauberwort.«
»Gut, ich werde es sein. Sind jetzt noch einige Fragen gestattet?«
»Gewiss.«
»Hier ist wohl alles in zwanzigfacher Vergrößerung vorhanden.«
»Ja, so ungefähr. Nehmen Sie diesen Maßstab nur an, alles zwanzigmal vergrößert. Wollen Sie vielleicht auch noch Ihr Vergrößerungsglas haben?«
»Nein, das habe ich hier nicht nötig!«, lachte ich. »Und diese Riesen sprechen Deutsch?«
»Jawohl ja, ei freilich und gewiss doch — Deutsch ist hier die Landessprache. Da haben Sie den Vorteil, dass Sie diese Riesen auch verstehen können. An ihr Donnern werden Sie sich schon nach und nach gewöhnen. Und die Erbprinzessin Kunigunde ist ein reizendes Mädchen von zwölf Jahren mit nur dreißig Meter Länge, auch sonst ein sehr gutmütiges, artiges Kind, reißt keiner Fliege ein Bein aus, also auch Ihnen nicht.«
»Ich werde auch hier nicht als richtiger Mensch betrachtet?«
»Na, Sie wollen doch nicht etwa sagen, dass Sie mit Ihren zehn Zentimetern ein richtiger Mensch sind! Sie sind eine menschenähnliche Maus, die aufrecht auf den Hinterpfoten geht. Und diese fremde Mäuseart bekleidet sich auch. Nichts weiter. Oder meinetwegen sind Sie auch ein winziger Zwergaffe. Aber sicher kein richtiger Mensch, das schlagen Sie sich nur ganz aus dem Kopfe.«
»Und die Riesen verstehen auch mich?«
»Nein! Da verlangen Sie zu viel! Ihr fistliges Mäusegepiepse ist für diese Riesen unverständlich. Man hat es bei Ihren Vorgängern mit Hörrohren und dergleichen versucht, aber alles war vergeblich. Doch da fällt mir noch etwas ein, Herr Ebert. Man wird versuchen, sich mit Ihnen in anderer Weise in sprachliche Unterhaltung zu setzen. Bei Ihren Vorgängern hat man nicht daran gedacht, erst hinterher fiel es einem genialen Manne ein. In welcher Weise? Nun genau so, wie es die Spiritisten machen, wenn sie den Tisch klopfen lassen. Wie Sie ja auch Ihre Kugel zum Sprechen bringen wollten. Einmaliges Klopfen ist ein Nein, dreimaliges ein Ja. So kann man auch das ganze Alphabet klopfen, noch einfacher ist das Morsen, die Telegrafensprache. Nun aber versprechen Sie mir eines: ja und nein sollen Sie antworten dürfen. Aber niemals eine richtige Frage oder Antwort klopfen.«
»Weshalb nicht?«
»Das lassen Sie nur meine Sache sein. Oder ich will es Ihnen sagen, weshalb nicht: Weil Sie mit solch einer Unterhaltung sonst niemals fertig werden, und dann werden Sie vor eine gelehrte Kommission gezogen, und Sie werden erklären und erklären müssen, und für diese Riesen ist es doch nur ganz unverständliches Zeug. Verstehen Sie?«
»Ich verstehe.«
»Also nur Ja oder Nein antworten.«
»Ich gehorche.«
»Sonst noch eine Frage?«
»Nicht dass ich gleich wüsste.«
»Dann verlasse ich Sie jetzt wieder. Ich schwebe als unsichtbarer Schutzengel um Sie herum, und wenn es notwendig ist, werde ich mich auch wieder melden. Mooin, Herr Ebert. Amüsieren Sie sich gut.«
Ich stand unter meinem Wasserglase. An Luft mangelte es mir nicht, durch die großen Quadratlöcher der Tischdecke, so fein diese auch gewebt der gewirkt sein mochte, kam unter den Glasrändern genug durch.
So hielt ich weitere Umschau, will aber nicht etwa die Einrichtung dieses Zimmers beschreiben. Ein feiner Salon, alles wie bei uns, nur eben alles in zwanzigfacher Vergrößerung.
Die Goldfische interessierten mich noch immer, desgleichen andere Fliegen, die ich beobachtete, eine Mücke, von der ich nicht gestochen sein mochte, die hätte mir gleich einen Liter Blut abgezapft und eine faustgroße Beule hinterlassen, und dort am Boden kroch eine Ameise, die wohl auch einmal in einem königlichen Residenzschlosse vorkommen kann. Das Vieh war mindestens zehn Zentimeter lang und gehörte auch noch zur kleinsten Sorte, schleppte zwischen seinen Zangen etwas davon, das ich für einen normalen Ziegenkäse zu halten geneigt war.
Schmetternde Glockentöne erschreckten mich. Eine gewaltige Kirchturmglocke musste es sein, welche loslegte. Erst dreimal, dann in einem etwas helleren Klange viermal.
Aha, das war dort die Wanduhr gewesen! Mit drei und vier Metern langen Zeigern. Also dreiviertel vier! Das heißt, dieses Schlagwerk gefiel mir gar nicht! Und mit Grausen dachte ich schon daran, wenn hier einmal die elektrische Klingel schrillte, und der Gerufene wollte nicht gleich kommen, und es würde immer wieder geklingelt — na, das konnte ja ein schöner Spektakel werden!
Ich sollte es denn auch erleben, mich aber auch sehr bald daran gewöhnen. Als ich selbst zu brüllen anfing, dabei glaubend, ganz normal zu sprechen.
Und jetzt begannen solche Stimmen zu donnern, wohl in einem Nebenzimmer, dessen Tür offen stand.
»Also die Ursula, die Zofe, hat doch recht gehabt, als sie neulich erzählte sie hätte wieder eine Menschenmaus am Boden huschen sehen.«
»Ja natürlich, mir hat ja so'n Luder erst gestern wieder ein großes Loch in den Käse gefressen!«
Oho! Wenn alle meine Vorgänger schon längst tot waren, dann hätte doch nur ich dieses »Luder« sein können. Und ich hatte kein Loch in einen Käse gefressen.
»Weiß es denn schon Majestät, dass Johann so ein kleines Vieh gefangen hat?«
»Na, die Prinzess wird sich ja nicht schlecht freuen.«
»Ach Gott, ach Gott, nun fängt der Trödel mit der Menschenmaus schon wieder an, egal aufpassen und egal aufpassen!«
»Na, ich trete das Vieh bei der ersten Gelegenheit tot.«
»Jawohl, wagt's nur!«
»Na natürlich nicht so offen. Da hat man schon einmal eine Gelegenheit — ein schneller Griff, ich stecke das Tierchen in die Tasche — und dann schmeiß ich's in den Abtritt.«
Oho, oho! Da musste ich aber aufpassen, um rechtzeitig rufen zu können: aufhören!
»Still, sie kommen!«
Ja, da kamen sie.
Vorneweg ein liebreizendes Mädchen in weißem Spitzenkleidchen mit Wadenstrümpfchen. Natürlich Ihre Königliche Hoheit, die Erbprinzessin Kunigunde. Sie war nicht eben sehr groß für ihre zwölf Jahre, kaum dreißig Meter. Ebenso zierlich war alles an ihr. Der Mittelfinger ihres Händchens war höchstens einen Meter lang. Dafür war sie ziemlich dick. Den Umfang ihrer Wade taxierte ich auf zwei Meter.
»Ach Du allerliebstes Mäuschen, habe ich Dich endlich wieder!«
So brüllte sie mich unter meinem Wasserglase donnernd an.
Natürlich jubelnd.
Aber ich jubelte nicht mit.
Mir ward recht ängstlich zumute.
Besonders da sich nun auch erwachsene Herren und Damen um den Tisch gruppierten, ihre Riesenköpfe dem Glase näherten und mich unter Klemmer und Brillen und Lorgnetten nahmen.
»Das ist der mit meinem Zigarrenabschneider.«
»Nein, Papa, das ist ein anderer. Die Menschenmaus, die den Degen trug, hatte einen Vollbart und schwarze Augen. Ich glaube, das hier ist Dolling. Die hatte so ein reizendes Mäulchen.«
»Na, ich bin nur froh, dass ich meinen Zigarrenabschneider wieder habe!«, sagte der vorige Sprecher, der also doch sicher Seine Majestät der König war. Er trug, wenn ich mich nicht irrte, eine Husarenuniform. Er stieß bei seiner Tochter wiederum auf Widerspruch.
»Deinen Zigarrenabschneider, Papa? Das ist doch mein Nagelmesserchen, Papa!«
»Aber Kind, liebe Kunigunde, ich sage Dir — —«
»Du hast gar nichts zu sagen, Papa.«
Na, dann war's ja gut. Wenn die meine Herrin wurde, dann stand ich hier auch noch überm König.
»Aber das Mäuschen kann doch nicht unter dem Glase bleiben, das erstickt ja!«, begann dann die kleine Prinzess zu jammern. »Wo ist der Vogelbauer! Das Puppenhaus meine ich! Das letzte, das schönste, das mit den automatischen Futternäpfchen! Schnell her!«

Schon wurde es von einem Diener gebracht. Es war ein recht stattliches Puppenhaus. Acht Meter lang, sechs Meter breit und wieder acht Meter hoch.
In der Hand dieses Dieners, der es oben an einem Henkel trug, war es aber doch nichts weiter als ein mittlerer Vogelbauer, vierzig Zentimeter lang, dreißig breit und vierzig hoch.
Ich will meine zukünftige Wohnung gleich etwas näher beschreiben, wenn auch nur vorläufig, was ich so beim ersten Hinsehen erblickte.
Alle Wände bestanden aus Glas, auch die inneren.
Es gab eine untere und eine obere Etage. Die untere hatte drei Abteilungen, und zwar ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Toilette, oben war der Salon und ein Speisezimmer. Alles mit Puppenmöbeln behaglich und sogar prachtvoll ausgestattet. Das heißt mit Puppenmöbeln in den Augen dieser vierzig Meter langen Riesen. Für mich waren es ganz richtige Möbel. Sehr geschickte Puppenmöbelarbeiter und Feinmechaniker und andere Bastelbrüder mussten dies alles angefertigt haben. Aber dass es meine Vorgänger nicht selbst getan, das war doch gleich zu merken. Einiges war doch viel zu grob ausgefallen. So zum Beispiel waren Vergoldungen viel zu stark gemacht worden, aufgetragene Bronze bildete unförmliche, raue Schichten.
Die fünfzehn Zentimeter starken Glasplatten hätte ich auch mit einem Hammer nicht einhauen können, von einem Aufheben gar keine Rede. Innen die Zwischenwände waren etwas dünner, in der Mitte waren Türen aus Holz eingelassen. Erste und zweite Etage waren durch eine Treppe verbunden, sogar teppichbelegt.
Ehe ich aber diese meine Wohnung beziehen konnte, musste ich unter dem Wasserglase hervorgeholt werden, und dazu war große Vorsicht nötig.
»Dass er nur nicht wieder auskneift! Wehe, wenn Ihr ihn entwischen lasst!«
So sagte die kleine Prinzessin, die hier unbedingt das Kommando führte, und auch der königliche Papa war behilflich, mit seinen Händen um mich herum eine zwei Meter hohe Mauer zu bilden, so wie alle die anderen Herren und Damen, die den Tisch umstanden. Die Prinzessin selbst hob vorsichtig mit der einen Hand das Wasserglas, erst nur an einer Seite, mit der anderen Hand nahm sie gewissermaßen, nachdem sie die Finger etwas angeleckt hatte, einen Anlauf, griff schnell zu — schwupp, hatte sie mich erwischt! Sie griff nicht gerade derb zu, aber doch ganz sicher.
»Ach, Du allerliebstes kleines Viehchen! Na nun komm wieder in Dein Häuschen! Und Du reißt mir nicht wieder aus, gelt? Nein, diesmal will ich schon aufpassen.«
Mit diesen Worten hatte sie oben an meinem Hause eine Klappe aufgemacht, setzte mich hinein in die gute Stube, und zwar so, dass ich dabei auf allen Vieren zu liegen kam.
Aber ich blieb nicht lange so liegen, sondern zeigte, dass ich ein zweibeiniges Wesen war, und da ich nun schon meinen Schreck überwunden hatte, zog ich gleich meinen Hut, schwenkte ihn nach allen Seiten und machte meine Bücklinge.
Es war allerdings etwas Galgenhumor dabei, der aber nicht seinen Zweck verfehlte.
»Ach, das ist ja allerliebst!«, donnerten gleich zwei Damen und ein Herr los. »So possierlich waren diese Mäuschen doch früher nicht?«
Aber die kleine Prinzessin gönnte diesen Anblick den anderen nicht lange, sie wollte mich ganz allein haben, fasste oben den Henkel meines Hauses und eilte mit ihm hinaus.
Da dieser Henkel beweglich war, sie nur einen Finger hindurchgesteckt hatte, so blieb mein Haus ja ziemlich in der Balance, aber doch nicht ganz, es schaukelte doch etwas hin und her, und die Folge war, dass ein großer Kleiderschrank umfiel, der, wahrscheinlich gefüllt, sehr schwer sein musste, es gab einen mächtigen Krach, wäre ich nicht schnell zur Seite gesprungen, so hätte er mich zerschmettern können, und zwei Lehnstühle und ein runder Tisch, deren Füße mit Rollen versehen waren, bekamen den Veitstanz.
Doch da ward mein Puppenhaus schon wieder auf einen Tisch gesetzt. Es war ein privates Zimmer der kleinen Prinzess, in dem ich mich jetzt befand.
»Ach Du allerliebstes kleines Mäuschen, dass ich Dich endlich wieder habe!«, ging es dann wieder los.
Ich fasse die folgenden vier Tage summarisch zusammen.
Die kleine Riesenprinzessin, die nichts weiter zu tun zu haben schien oder in ihrer Erziehung jetzt Ferien hatte oder die einfach machte, was sie wollte, spielte mit mir wie mit einer kleinen Puppe, die auch noch den Vorzug hatte, ganz richtig lebendig zu sein.
In meine Glaswohnung kam ich gar nicht mehr hinein. Täglich kleidete sie mich einige Dutzend Male aus und an, Anzüge und phantastische Kostüme waren von meinen Vorgängern, die sicher ebenso behandelt wurden, noch massenhaft vorhanden, von Puppenschneiderinnen gefertigt, oder sie schneiderte selbst für mich, was freilich auch danach ausfiel, badete mich aller drei Stunden als Nacktfrosch, dann steckte sie mich in ein Wickelbett, trug mich auf dem Arme herum und sang Wiegenlieder, oder ich kam auch in eine wirkliche Wiege hinein, oder sie fuhr mich in einem Kinderwägelchen herum, dann wurde ich von ihr gefüttert, wozu sie mit Vorliebe selbst auf einem Spiritusofen kochte und briet, und so ähnlich weiter und weiter.
Und des Nachts? Da kam ich noch immer nicht in mein Puppenhaus hinein. Da nahm die kleine Prinzessin mich mit zu sich ins Bett. Aber mit der nötigen Vorsicht. Da schnallte sie mir erst einen Stahlgürtel um den Leib, wohl schmiegsam, weil aus Schuppen bestehend, aber für mich unzerbrechlich, an diesen kam eine für mich ganz gewaltige Stahlkette und diese befestigte sie an ein silbernes, unabstreifbares Armband. So musste ich neben ihr schlafen, oft in die Gefahr kommend, zu ersticken oder erdrückt zu werden. Und am frühen Morgen ging gleich wieder die Baderei los. Wenn sie mich nicht mit in ihre eigene Badewanne nahm. Wobei zu bedenken ist, dass dieses »Kind« eine Höhe von 30 Metern hatte. Das ist dann für uns kein Mensch mehr.
Am ersten Tage amüsierte ich mich köstlich, am zweiten Tage wurde ich die Sache gewohnt, am dritten fing ich mich an zu langweilen, diese Spielerei bereitete mir schon Unbehagen, und am vierten Tage dachte ich ernstlich daran, ob ich nicht das Wort »Aufhören!«, aussprechen solle.
Aber ich zog es vor, an eine Flucht zu denken.
Denn jetzt begriff ich, weshalb alle meine Vorgänger geflohen waren. Trotz dieser ausgezeichneten Behandlung, die eben doch ihren Haken hatte. Wenn sie mich wenigstens richtig hätte essen lassen, von eigenen Tellern, mit eigenem Messer und eigener Gabel, was ja alles vorhanden war. Aber ich war eine Puppe, oder ein Baby, das gefüttert werden musste. Und so ähnlich hatte sie es doch wahrscheinlich mit allen meinen Vorgängern gehalten, und als einer nach dem anderen ausgekniffen war, hatte sie die letzten doch nur immer sorgsamer behütet.
Zu der vom Kapitän angesagten Unterhaltung durch Klopfen oder andere Zeichen kam es nicht. Dieser Plan mochte von anderen ausgegangen sein, die kleine Prinzessin dachte nicht an so etwas, mir auch nur ein Ja oder Nein abzufordern. Ich war für sie ein Püppchen, ein zwerghaftes Baby, und das hat nicht mit Ja und Nein zu antworten, das hat sein Mäulchen zu halten, wenn es artig sein will, hat sich alle Liebkosungen gefallen zu lassen.
Wohl kam manchmal der königliche Papa — die Mama schien nicht mehr zu leben — auch andere Herren und Damen fanden sich ein, aber selten, und die stellten auch keine Fragen an mich, und die kleine Prinzessin, die hier allein das Szepter führte, wusste sie immer schnell genug wieder hinaus zu expedieren, den Herrn Papa nicht ausgeschlossen.
Einer der Besucher schien einmal deswegen mit mir anfangen zu wollen.
Es war ein alter Herr mit weißem Vollbart und goldener Brille, durch die er mich angelegentlich betrachtete. »Ich glaube doch, das ist ein richtiges menschliches Wesen, mit dem man sich unterhalten kann, man muss es nur irgendwie zum Sprechen bringen.«
»Wie soll denn so ein winziges Baby schon sprechen können!«, sagte die Prinzessin gekränkt.
»Nun, nicht ein sprachliches Sprechen, wir müssen Zeichen ausmachen, ich glaube, diese Menschenmaus versteht uns —«
»Machen Sie, dass Sie hinauskommen, Herr Geheimrat, Sie wollen mein Püppchen doch nur schlachten wie Ihre Kaninchen und Meerschweinchen!«
So rief die Prinzessin und schob den alten Herrn einfach hinaus, entließ auch gleich alle anderen.
Aber auch sonst hatte das zwölfjährige Mädchen sehr wenig Phantasie. Sie hätte doch unter eine größere Glasglocke Fliegen und andere Insekten sperren können, auch kleine Vögelchen und Mäuse, auf die ich eine Jagd veranstalten musste mit Schwert und Spieß, einen Bogen und Pfeile hätte ich mir selbst anfertigen können.
Nun, dazu mochte das Kind zu gutherzig sein, um an solcher blutigen Jägerei und Schlächterei Gefallen zu finden, oder es war zu besorgt um mich, aber da gab es doch schließlich noch anderes, was auch mich ergötzt hätte, wenigstens anfangs.
So zum Beispiel fertigte sich Gulliver ein Boot, oder es wurde ihm eins gefertigt, es wurde auf eine große Schüssel mit Wasser gesetzt, da musste er rudern und segeln, Diener bliesen dazu den Wind, mit vollen Backen Sturm, und was gab es da noch alles zu erfinden! Aber Prinzess Kunigunde erfand nichts. Nicht einmal, dass sie, wenn sie in der Badewanne saß, auf den Gedanken kam, eine Wallnussschale oder ein Näpfchen schwimmen zu lassen und mich hineinzusetzen. Wenn sie mich in der Badewanne einmal aus der Hand geben musste, so schlang sie vorher meine Kette um den Wasserhahn oder befestigte sie sonst wo sorgfältig. Sie war in steter Sorge, dass auch ich entwischen könnte, und sonst also war ich das Püppchen, das sie bemutterte.
Am vierten Tage, als sie mir wieder mit dem Löffel einen selbstgekochten Schlangenfraß in den Mund stopfte, dann hinterher mächtige Stücke von einem selbstgebackenen Kuchen, außen verbrannt und innen noch ganz schliffig, entstand in mir der feste Entschluss, entweder das magische Erlösungswort auszusprechen oder von hier zu entfliehen.
Nach kurzer Überlegung zog ich das Letztere vor. Mir selbst kam es wie Feigheit vor, das Zauberwort zu benutzen, weil es mir nicht mehr gefiel, mich als Püppchen im Wickelbett füttern und als Nacktfrosch baden zu lassen, der Kapitän hätte mich doch nur ausgelacht, ich hörte alle die anderen lachen, die doch sicher darum wussten.
Also durch eigene Kraft wollte ich mich befreien. Aber eine Flucht von hier war gar nicht so einfach. Die Prinzessin hatte meinetwegen neben ihren Gemächern ein besonderes Zimmer einräumen oder vielmehr ausräumen lassen. Es war bis auf einen großen Tisch vollkommen leer. Kein Mauseloch war vorhanden, darum handelte es sich ja eben. Aber ich konnte ja schon von der Tischplatte, die für gewöhnlich mein ständiger Aufenthalt war, gar nicht herunter kommen. Wenn bei uns ein normaler Tisch ungefähr eine Höhe von 75 Zentimeter hat, so war dieser bei zwanzigfacher Vergrößerung 15 Meter hoch. Da kann man doch nicht herabspringen, ohne alle Knochen zu brechen. Eines der Tischbeine war nicht zu erreichen, und es hätte mir auch nichts genützt, ich konnte nicht daran hinabgleiten, konnte es ja nicht einmal mit ausgebreiteten Armen umspannen.
Und wenn es mir nun einmal gelang, den Boden zu erreichen, vielleicht indem ich an dem Kleide oder an einem langen Bande meiner Herrin herabglitt, was dann? Es gab kein Löchelchen in dem nackten Raume. Das Fenster war immer geschlossen, und da eine Gardine fehlte, konnte ich doch überhaupt gar nicht hinaus auf das Fensterbrett. Die einzige Tür war immer geschlossen. Also ich wäre einfach am Boden wieder gehascht worden. Und außerdem: wenn die Prinzessin mich einmal auf dem Tische allein lassen musste, dann setzte sie regelmäßig über mich wieder eine schwere Glasglocke die ich überhaupt gar nicht liften konnte, sorgte unten nur für etwas Luftzufuhr. Und des Nachts in ihrem Bett lag ich wie gesagt an der Kette.
Der fünfte Tag war angebrochen.
Meine erste Toilette war beendet, ich war auf den Tisch gekommen, auf dem es bunt genug aussah, aber alles nichts für mich d. h. nichts, was mir zur Flucht hätte dienen können. Die Prinzessin, immer im Stehen, hoste mich schon wieder aus, zog mir eine Husarenuniform an. Die passte ja nicht gerade für einen Säugling, der noch nicht sprechen kann, andererseits aber war ich doch wieder ein Püppchen, das solche Uniformen schon verträgt. Zu dieser gehörte auch der Zigarrenabschneiderdegen.
»So, mein Püppchen, nun will ich Dir erst Dein Morgensüppchen kochen, nicht wahr?«
Und sie begann, mit dem höllischen Spiritusofen zu hantieren, für sie winzige Kesselchen mit Wasser aufsetzend, Mehl und Hirse und Salz und Zucker einem Puppenkolonialwarenladen entnehmend, auch auf einer Puppenwaage abwiegend, wie es eben Kinder tun. Für mich war das alles natürlich in richtiger Größe vorhanden. Doch das brauche ich wohl nicht immer wieder zu erwähnen.
Mit verbissenem Gesicht schaute ich ihr zu.
Was die da zusammenbraute, angebrannt und total versalzen und verzuckert, das wurde mir schwertumgürtetem Husarenoffizier dann mit dem Löffel in den Mund gepfropft, und wenn ich nicht schnell genug schluckte, dann stopfte sie mit ihrem Kinderfingerchen von einem Meter Länge und 20 Zentimeter Dicke nach. Mir immer in den Rachen hinein. Aus lauter Liebe. Weil sie dachte, so könnte ich besser schlucken. Weil man es so eben mit kleinen Kindern macht. Ich wartete schon immer darauf, dass sie es auch einmal mit einer regelrechten Amme versuchte.
»Ach, da ist ja schon wieder der Zucker alle! Kindchen, Kindchen, was brauchst Du kleines Leckermäulchen doch für viel Zucker!«
Ehe sie mit der leeren Kommodenschublade hinausging, um den gottverdammten Zucker von irgendwo selbst zu holen, deckte sie natürlich die bewusste Käseglocke über mich, nicht vergessend, durch Unterlagen einiger Kissen für Ventilation zu sorgen, ebenso wenig dann aber vergessend, draußen die Tür zuzuschließen. Den ungeheuren Schlüssel hatte sie immer an einer Ochsenkette um den Hals hängen.
Wie denn nur von hier fortkommen? Gar nichts zu machen.
Ja, dort lag Zwirn und Garn, für mich Bindfaden und Stricke, ich wollte schon solch einen langen Strick irgendwo befestigen und mich dann herablassen, wenn sie dann die Tür öffnete, wischte ich durch, drüben gab es genug Möbel, unter denen ich mich verstecken konnte — ja, wenn ich nur erst unter der Käseglocke hervor gewesen wäre!
Nein, es war keine gewöhnliches Käseglocke. Sondern das Glasgehäuse für eine Standuhr. Um so schlimmer für mich. Innen sechs Meter im Durchmesser, zehn Meter hoch, das Glas zwölf Zentimeter dick, oben noch eine mächtige Glaskugel als Griff darauf — gar kein Gedanke daran, dass ich diese Last hätte heben oder auch nur verrücken können, auch mit einem Hebebaum nicht! Das wusste sogar dieses unerfahrene Kind. Sonst hätte sie die Glasglocke doch noch irgendwie beschwert. Mit dem Kissen hatte meine Herrin zufällig auch einen Dolch unter die Glocke geschoben. Solches Zeug lag genug auf dem Tische herum, das 25 Zentimeter lange Messer hatte für sie ja noch nicht einmal eine kleine Stecknadel zu bedeuten. Für mich aber auch nichts. Nur so in Gedanken hob ich das Ding auf und betrachtete es.
Also es war ein Dolch, die Klinge 20 Zentimeter lang, mit einem Elfenbeingriff in einer blechgefütterten Lederscheide steckend.
Für diese Riesen eine wunderbar feine Präzisionsarbeit. Aber wir haben ja auch winzige Instrumente für Chirurgen, oder man betrachte die Werkzeuge eines Uhrmachers, diese kaum sichtbaren Schräubchen müssen doch erst geschnitten werden!
Da, wie ich diesen Dolch noch so betrachte, ganz achtlos, rasselte im Türschloss schon wieder der Schlüssel.
Die Tür öffnete sich, herein kam — nicht die Prinzessin! Übrigens war mir gleich aufgefallen, dass der Schlüssel recht behutsam ins Schloss gesteckt und umgedreht worden war, aber bei solchen Dimensionen geht es doch nicht ohne Rasselei ab.
Der weißbärtige Herr Geheimrat mit der goldenen Brille war es, der eintrat!
Recht auffallend, recht scheu.
Lange konnte ich ihm auch nicht beobachten.
Ein großer Schritt nach dem Tische hin, mit der linken Hand ein Griff nach dem Knopfe der Glasglocke, sie hochgehoben, mit der rechten Hand nach mir selbst gegriffen, ich war gepackt, sauste durch die Luft, Finsternis umgab mich.
Dann hörte ich wieder das vorsichtige Schlüsselrasseln, und dann ging die Schaukelei los, wie immer, wenn ich getragen wurde.
Wenn ich es mir richtig überlegte, so musste mich der Herr Geheimrat in die rechte Seitentasche seiner Jacke gesteckt haben. In dieser befand sich außer mir noch eine große Kiste, so ungefähr anderthalb Meter lang und einen breit — die silberne Schnupftabaksdose des Herrn Geheimrats.
Ich lag nicht direkt auf ihr, denn seine Finger hielten mich noch immer umklammert, nicht gerade schmerzhaft, aber doch sicher.
Das Schaukeln wie auf dem Rücken eines Dromedars ging weiter, ich in der Schwebe, das Gesicht nach unten, mit den Händen die Tabakskiste berührend.
Diese Entführung gefiel mir durchaus nicht, das nannte ich eine Abwechslung, aber keine Befreiung.
Und hatte nicht die Prinzessin gesagt, der Geheimrat wolle mich wohl ebenso schlachten wie seine Karnickel und Meerschweinchen?
Hatte nicht auch der Kapitän eine starke Andeutung gemacht, dass die ärztlichen Forscher dieses Landes so einen Mäusemenschen gern einmal lebendig seziert hätten?
Da war es vielleicht angebracht, bald mein Erlösungswort —
»Wünsche untertänigsten guten Morgen, Exzellenz«, donnerte da eine Stimme, und der ganze Riesenleib, an dem ich lag, erzitterte mit.
»Guten Morgen, Herr Geheimrat. Ach, ich hätte ein Wort mit Ihnen zu sprechen.«
»Bitte sehr, Exzellenz.«
Und das Schaukeln hörte auf, mein Riesenkamel blieb stehen, und gleichzeitig gaben mich auch die Riesenfinger frei.
Natürlich, mit der Hand in der Rocktasche konnte der Geheimrat mit einem Höherstehenden doch nicht sprechen.
War das ein Fingerzeig des Schicksals?
Schnell richtete ich mich auf.
Über mir schimmerte es hell; aber obgleich ich doch auf der Tabakskiste stand, konnte ich den Rand der Jackentasche mit ausgestreckten Händen noch immer nicht erreichen, nicht im Sprunge.
Da erst eigentlich bemerkte ich, dass ich noch immer den Dolch in der Hand hatte.
Und ich benutzte diesen Wink einer gütigen Vorsehung.
Zwar war ich ja auch mit dem Zigarrenabschneiderdegen umgürtet, aber den hätte ich nicht gut gebrauchen können, dazu war es aber drin doch zu eng.
Das Messer gezogen und losgeschnitten. Der Stoff war zwei Zentimeter dick, aber der Stahl schnitt wie Gift. Ich hätte ja nur zwei lange Schnitte zu machen brauchen, um ein Dreieck mit meterlangen Seiten herausklappen zu können, ich machte noch einen hinzu, klappte ein Viereck heraus, in banger Erwartung, was ich zu sehen bekommen würde. Denn gerettet war ich ja durchaus noch nicht, ich musste mich ja noch in einer Höhe von etwa 20 Metern befinden.
O Glück! Mein Geheimrat stand mit seiner rechten Jackentasche ganz dicht an einem Fensterbrett, ich brauchte nur einen großen Schritt zu tun, dann war ich drüben.
Und ein weiteres Glück war, dass das Fenster offen stand und ich auch schon eine Fortsetzung des Fenstersimses sah, der sich als Verzierung weiter um das Haus herumzog.
Meine Flucht konnte nicht bemerkt worden sein, sonst hätten die beiden Herren schon etwas von sich gegeben.
Also ich mich schnell um die Ecke gedrückt!
Dieser Sims, der am Hause entlang lief, mochte für diese Riesen nur 7 Zentimeter breit sein, also ein von unten kaum bemerkbarer Vorsprung. Für mich Menschenmaus aber bedeutete das fast anderthalb Meter.
Also ich hatte mich um die Ecke gedrückt, lief ein Stück hin auf dem ganz ebenen Saumpfade, ehe es mir einfiel, einmal näher an den Rand zu treten und darüber hinauf und hinab zu sehen.
O Himmel, wie ward mir da zumute!
Ich hatte ja schon gewusst, dass ich mich in der zweiten Etage befand, hatte es mehrmals zu hören bekommen, hatte aber aus dem Fenster meines Zimmers höchstens auf dem niedrig gehaltenen Arme meiner kleinen Herrin sitzend, noch nie direkt hinabblicken können.
Jetzt geschah es zum ersten Male, und zwar auf einem Simse von anderthalb Meter Breite stehend, dicht am Rande!
Blicke ich da in eine Tiefe von mindestens 250 Meter hinab!
Na ja, jedes Stockwerk 5 Meter hoch, oder 4, dazu aber noch Hochparterre und dann noch extra die Höhe des Fensterbrettes — da kommen schon 12 bis 13 Meter heraus, und das hatte hier das Zwanzigfache zu bedeuten, 250 Meter!
Ich bin kein Gämsenjäger, kein Kraxler, nicht im Gebirge aufgewachsen.
Obgleich sonst nicht gerade von Schwindelanfällen geplagt, fühlte ich doch plötzlich eine unwiderstehliche Sehnsucht, dort hinabzufallen und auf den Steinfliesen zu zerschmettern, wie eine magnetische Kraft zog es mich hinunter.
Mit einer letzten Willensanstrengung gelang es mir, mich noch zurückzuwerfen, gleich auf den Boden hin.
Na, es wurde überstanden. Ich erhob mich wieder, drückte mich gegen die Mauer, blickte gar nicht mehr nach dem Rande.
So setzte ich meinen Weg auf dem himmelhohen Gebirgspfade fort. Und merkwürdig! Kaum hatte ich hundert Schritte getan, so konnte ich schon ganz frei gehen, wenn ich auch noch nicht wagte, wieder in jene fürchterliche Tiefe zu blicken.
Ich kam an zwei Fenstern vorüber, die beide geschlossen waren, und ich zog es vor, auf Händen und Füßen an ihnen vorbei zu kriechen, hinter der Erhöhung, die doch unten das Fensterkreuz bildet, Deckung suchend.
Da versperrte mir ein riesiger Felsenblock den Pfad. Er hatte bizarre Formen, ich glaubte etwas zu erkennen, wenn ich mir auch nicht ganz klar wurde — ich will es gleich sagen: es war einer der phantastischen Drachenköpfe, die hier und da die Fassade des Hauses verzierten, jeder einen halben Meter hoch, sonst hat solch ein Schmuck doch keinen Zweck, man sieht ihn gar nicht, was hier aber zehn Meter zu bedeuten hatte!
Nein, dieser Drachenkopf sollte für mich nicht ein unüberwindliches Hindernis bedeuten. Er hatte auf der Seite ein Loch, nur wenig über dem Sims erhaben, ich konnte es auf Händen und Füßen bequem passieren, und es war ein Tunnel, der durch den ganzen Drachenkopf ging. Die Durchbohrung war wahrscheinlich für den Bildhauer nötig gewesen, um das Werkstück bearbeiten, es aufhängen und hin und her drehen zu können.
Schon sah ich durch diese Röhre auf der anderen Seite wieder das Tageslicht schimmern. Erst aber erweiterte sich die Röhre ganz bedeutend, ich kam in einen großen Hohlraum, in dem ich mich aufrichten konnte.
Was das war? Das war der aufgesperrte Rachen dieses Drachenkopfes. Oder nein, das war nur der Schlund. Vorn der Rachen war noch viel weiter geöffnet, dann kam erst wieder eine Verengerung, der eigentliche Schlund, hinter diesem befand ich mich jetzt, so gewissermaßen zwischen Schlund und Speiseröhre, oder wie das nun ist. Ich bin nicht so anatomisch gebildet und will nicht erst Anatomie zu studieren anfangen.
Nenne ich es also einfach den Schlund des steinernen Drachenkopfes, in dem ich mich befand.
Wenn ich mich aber etwa in diesem Drachenschlunde einmieten wollte, so kam ich zu spät.
Hier hatte sich schon jemand anders häuslich eingerichtet.
In der Mitte am Boden befand sich ein rundes Ding, anderthalb Meter im Durchmesser, ganz merkwürdig aus Ästen und Bambusrohr und Stricken und anderen undefinierbaren Sachen zusammengebaut, innen mit grauen und braunen Straußenfedern ausgepolstert, und da lagen denn auch drei Straußeneier.
Doch nein, solche riesige Straußeneier gibt es gar nicht. Ich kann ihr Maß ganz genau angeben, ich habe sie dann gemessen. Genau 45 Zentimeter lang und 30 Zentimeter dick. Wenn es dabei auch auf einen Zentimeter nicht ankommt. Bräunlich oder rötlich und mit aschgrauen Spritzern bedeckt.
Noch bewunderte ich diese drei Rieseneier, als sich der verengerte Schlundeingang verdunkelte, es schlüpfte etwas herein, und ich erkannte einen gewaltigen Adler, vor dem ich mich respektvoll in den Hintergrund des Schlundes zurückzog, schon den blanken Degen in der Hand. Doch nein, es war kein Adler, sondern ein Spatz. Nun erkannte ich ihn. Und nun nehme man ein Sperlingsei her und messe es, oder orientiere sich in einem zoologischen Buche, ob das nicht stimmt: im Durchschnitt 23 Millimeter lang und 16 dick. Hier aber war alles ins Zwanzigfache übersetzt. Und das sehr liederlich zusammengestoppelte Nest bestand aus Ästlein, Heu, Stroh, Werg, Borsten, Wolle, Haaren, Papierschnitzel und dergleichen Lumpereien mehr, war aber äußerst sorgfältig mit den weichsten Brustfedern dick ausgefüttert.
Nein, es war auch kein Spatz, sondern eine Spätzin. Sie setzte sich auf das Nest, flatterte mächtig mit den gewaltigen Fittichen und machte einen Heidenspektakel dazu, und nicht lange dauerte es, so schlüpfte hinten etwas Großes heraus, und in dem Nest lag ein viertes Ei.
Sie musste es äußerst eilig gehabt haben, sich dieser Last zu entledigen, denn sie beachtete mich gar nicht, obgleich sie mich doch sicher schon bemerkt hatte, denn solch einem Vogelauge entgeht doch nicht so leicht etwas, zumal in der Nähe des Nestes.
Und als sie fertig war mit ihrer Eierlegerei, ging Frau Spatz denn auch gleich auf mich los, mit einem Mordsspektakel und mit ihren Fittichen einen wahren Wirbelwind erzeugend.
Ich aber stand schon in Fechterparade, fiel aus und brachte ihr mit meiner Degenklinge über dem Schnabel eine tüchtige Wunde bei, dass das Blut nur so spritzte und floss. Ja, du lieber Gott, ich musste mich doch meiner Haut wehren, und mit solch einem Sperling aus Brobdingnag ist nicht zu spaßen!
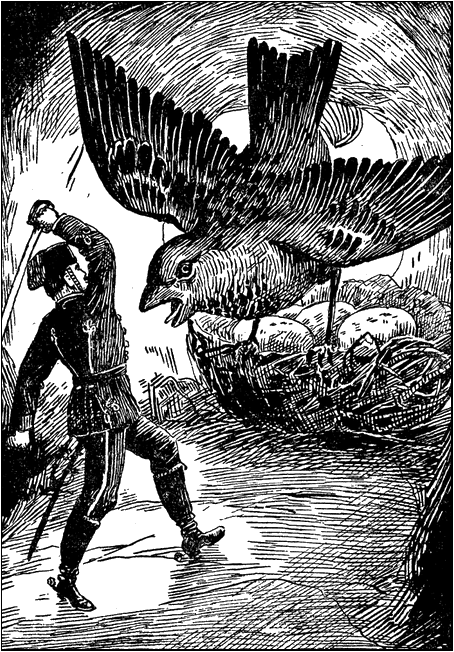
Der Husar brachte mit seiner Degenklinge der Frau Spatz aus
dem Riesenreiche eine gewaltige Wunde über dem Schnabel bei.
Da hatte die Frau Spätzin auch gleich genug, wandte sich und verschwand aus dem Schlund.
Jetzt war ich Besitzer dieser Drachenkopfwohnung, des Restes und dieser vier Sperlingseier. Wenn die Frau Spätzin wiederkam mit ihrem Herrn Gemahl, mit einer ganzen Legion von Kameraden — ich war bereit, meine Eroberung zu verteidigen.
Die vier Eier interessierten mich sehr. Ich hatte doch noch nicht gefrühstückt und schon eine tüchtige Arbeitsleistung hinter mir. Außerdem hier diese frische Gebirgsluft!
Das letzte Ei war noch ganz warm, das verschmähte ich. Frischgelegt waren ja alle. So bohrte ich mit Messer und Schwert ein nicht zu weites Loch durch die Kalkmauer, natürlich an einer Spitze, hob das Ei mit beiden Händen empor, ich war doch ein starker Kerl, hatte doch in Portland sieben Jahre lang Steine gebrochen, allzu schwer war es ja auch nicht, und so fing ich an zu nutschen.
Ausnutschen konnte ich es natürlich nicht, das wäre zu viel verlangt gewesen. Ich kann Sperlingsei nur empfehlen. Eiweiß wie Dotter schmeckten delikat. Und nicht etwa, dass dieser Inhalt nun etwa auch eine zwanzigfache Verdickung gehabt hätte. Er war ganz normal. Dann kroch ich einmal durch den verengten Schlund in den eigentlichen Drachenrachen, natürlich mit der nötigen Vorsicht. Sie war nicht nötig. Der Gaumen war ganz eben in horizontaler Lage. Trotzdem kroch ich lieber auf Händen und Füßen und rutschte zuletzt ganz auf dem Bauche, um über den Rand hinabzuspähen. Ich war Kavallerieoffizier, der hat im Hochgebirge nichts zu suchen, zumal wenn er kein Pferd zwischen den Beinen hat. Den Degen behielt ich immer in der Faust, in der Hosentasche den Dolch.
Wunderbar war es, was ich da erblickte!
Zunächst direkt unter mir eine Fahrstraße, an die 200 Meter breit, und dann hüben und drüben noch extra ein sogenannter Bürgersteig, vornehmer ausgedrückt Trottoir, auch wieder so 50 Meter breit, wobei ich natürlich nicht die perspektivische Täuschung aus meiner schwindelnden Höhe in Betracht ziehen darf. Ich selbst schwindele übrigens nicht, wenn ich auch noch nicht ganz schwindelfrei war. Aber so auf dem Bauche liegend fühlte ich doch nicht so die magnetische Anziehungskraft, da war zu viel Adhäsion vorhanden.
Diese Straße war ja nun eigentlich nichts so besonders Bewundernswertes, aber ich hatte eben noch gar keinen solchen Ausblick ins freie Riesenland gehabt, und nun kamen doch auch noch Straßenpassanten und Fuhrwerke und Reiter in Betracht. Was ich da für Dimensionen erblickte, will ich nicht weiter beschreiben, man braucht ja nur immer unsere Verhältnisse zwanzigfach zu vergrößern. Da war zum Beispiel ein Damenhut, dessen Durchmesser ich auf 15 Meter taxierte. Mag das genügen.
An diese Straße grenzte ein Park mit Blumenbeeten und Waldbestand. Das war nun erst recht etwas ganz Neues für mich. Doch will ich diesen Anblick auch nicht weiter schildern, weil ich noch selbst dort unten an Blumenstängeln in die Höhe klettern sollte.
Froh war ich nur, dass ich hier ein Sperlingsnest und nicht ein Storchnest gefunden hatte. Denn dort unten an einem Weiher spazierte ein Storch, so an die 20 Meter groß. Der hätte mit mir Husarenleutnant ja nun wenig Federlesens gemacht. Die Eidechse, die er soeben verschlang, war sicher bedeutend länger als ich.
Nachdem ich mich an alledem genügend geweidet, zog ich mich zurück.
Das Letzte, was ich unter mir erblickt, war eine Bauernfrau gewesen, einen Wagen ziehend, der mit fünfzölligen Kanonenkugeln beladen war. Doch nein, es waren Heidelbeeren.
Schließlich will ich auch noch einer anderen Frau gedenken, die dort in einem stillen Straßenwinkel saß und Krebse verkaufte. Oder sollten es vielleicht Hummern sein, die sie im Korbe hatte? Auf vier Meter Länge schätzte ich sie im Durchschnitt, es waren aber auch noch ganz andere Exemplare dabei. Da waren es doch wohl eher Hummern als Krebse.
Und jetzt kam ein Hundeköter angelaufen, eine Dogge von Tischhöhe, also ungefähr 15 Meter hoch, er hob erst einmal an einem Laternenpfahl das Bein und dann beschnoberte er in dem Korbe die Hummern.
Na, na, Tyras und der Hummer werden doch nicht etwa —
Mir stand das Herz vor Erwartung still.
Weiß der geneigte Leser, woran ich denke? Kennt er nicht die Geschichte von Tyras und dem Hummer?
Ein Herr kommt mit seinem großen Hunde am Markt vorüber. Da sitzt eine Frau, hat Hummern in ihrem Korbe. Der Hund beschnüffelt die Hummern, plötzlich kneift einer zu und sitzt fest an der Nase. Der Hund natürlich den Schwanz zwischen die Beine genommen und das Weite gesucht, vorn an der Nase den großen Hummer.
Die Marktfrau ist außer sich.
»Pfeifen Sie doch Ihrem Hunde, pfeifen Sie doch nur Ihrem Hunde!«
Der Herr aber entgegnet ganz kaltblütig:
»Was geht Sie denn mein Tyras an, pfeifen Sie doch Ihrem Hummer.« —
Nein, dieses Geschichtchen sollte sich hier im Lande Brobdingnag nicht wiederholen.
Tyras ging noch einmal an seinen Laternenpfahl zurück. Und ich zog mich in den Drachenschlund und in mein Sperlingsnest zurück.
Ja, ich wollte es benutzen. Ich fühlte mich nach all den heutigen Abenteuern äußerst erschöpft, zumal ich die letzten Nächte am Busen Ihrer königlichen Hoheit der Erbprinzessin Kunigunde nur sehr unruhig geschlafen hatte, immer in Gefahr des Erstickens und Erdrückens. Also ich hob die Eier heraus, legte sie neben das Nest und mich selbst in dieses, brauchte, wenn ich mich nicht etwas zusammenrollen wollte, nur die Füße auf den Rand zu legen. Die Brustfedern dieser Riesenspatzen waren durchaus nicht borstig, sondern weich wie Wolle, und so lange noch unbebrütete Eier im Neste sind, halten alle Vögel auf äußerste Sauberkeit desselben, eben weil sie hierzu später nicht mehr so viel Gelegenheit haben, sogar der Wiedehopf.
Sorglos überließ ich mich dem Schlaf. Die Spatzen sollten nur kommen! Sie würden in dem Husarenleutnant einen furchtbaren Gegner finden! Na, und wenn mir der Kampf doch zu ungleich wurde, dann sagte ich einfach: aufhören!
Ein Höllenlärm von Glockengetöse weckte mich.
An Glocken aller Art hatte ich mich ja nun schon gewöhnt, mich konnten weder Kirchturmglocken noch elektrisches Klingelgeschmetter stören, oder es schreckte mich doch nicht mehr, wenn ich den Radau auch nicht angenehm empfand.
Aber diese Bimmelei hier war mir ganz neu. Ja, eine Bimmelei war es nur, im Gegensatz zu anderen Glockentönen, wenn auch noch grässlich schmetternd genug.
Da musste ich einmal nachsehen, was das war, zumal die schreckliche Bimmelei immer näher kam.
Was war's? Ganz einfach die Feuerwehr. Übrigens nur zwei Leiterwagen, die mit galoppierenden Rossen durch die Straßen sausten, natürlich dann am meisten bimmelnd, wenn es am wenigsten nötig war. Ja, das war ganz einfach — die Feuerwehr. Es brannte irgendwo, das waren die Rettungsleitern. Die Spritze ging mich nichts an.
Aber einfach fand ich die Sache nicht mehr, als die beiden Wagen gerade hier unter mir hielten, die Leitern abgepackt und hochgeschraubt wurden, als alles zu mir emporblickte.
Hallo! Mein Schlupfwinkel war doch nicht etwa entdeckt worden, ich sollte doch nicht etwa aus dem Neste genommen werden?
Oder brannte es vielleicht über mir? Das wäre mir auch nicht gerade angenehm gewesen.
Zuerst wurde eine Leiter in einiger Entfernung angelegt, aber auch dort, wo sich solch ein Drachenkopf befand. Ein Feuerwehrmann stieg hinauf, steckte den ganzen Arm in das Drachenmaul, wirtschaftete darin herum.
»Sechs Eier!«, hörte ich ihn brüllen, und wie er eine Hand wieder hervorzog, lief von ihr eine weiße und gelbe Sauce herab.
Aha, nun wusste ich es! Diese Leute hier im Riesenlande waren auch so klug wie mein Vater.
Der königliche Palast sollte von Sperlingen gesäubert werden, die doch alles beschmutzen. Aber es ist gar nicht so einfach, die dreisten Spatzen zu vertreiben, und mögen sie sonst noch so harmlos sein, sie werden manchmal doch eine rechte Last. Wenn sie über einem Balkon nisten, kann man diesen kaum noch benutzen, und da nützt es nichts, ihre Nester zu zerstören, nichts, ihre Jungen wegzunehmen, sie kommen immer wieder, bauen sich neu an.
Aber wenn ihre Eier im Neste zerdrückt werden, das können sie nicht leiden. Dann kommen sie nicht wieder, bis die ganze Generation ausgestorben ist.
Dasselbe besorgte hier also die Feuerwehr, auch dieser Drachenschlund würde von einer tastenden Hand untersucht werden.
Nun, verloren war ich ja deshalb nicht etwa. Ich brauchte mich doch nur in einen der seitlichen Tunnel zurückzuziehen, da war ich sicher geborgen.
Aber ich war nicht geneigt, mir meine Eier zerquetschen zu lassen. Denn ich beabsichtigte, mich hier für längere Zeit niederzulassen, und die vier Sperlingseier sorgten noch für viele Tage für meine Nahrung. Nicht aber mehr, wenn sie so ein Feuerwehrmann zerdrückt hatte.
Also ich wälzte die vier Eier, davon eines »angerissen«, nach dem linken Tunnel, hob sie hinein, rollte sie noch weiter nach hinten, um sie auch vor einem nachgreifenden Finger zu sichern. Den rechten Tunnel reservierte ich für mich selbst. Natürlich musste ich ein Ei nach dem anderen vornehmen, die Dinger hatten doch ziemliches Gewicht.
Eben hatte ich das letzte in den Tunnel hineingehoben, dachte darüber nach, ob ich nicht auch irgendwie das schöne Nest vor einer zerstörenden Hand sichern könnte, als sich plötzlich der Raum verdunkelte und da kam auch schon in den Drachenschlund etwas Mächtiges, Fünfzinkiges hereingefahren.
Ach du großer Schreck! Ich hatte die Zeit verpasst; die Feuerwehrleute waren schneller gewesen, als ich gedacht hatte.
Ich war verloren!
Dieser Tunnel hier war mir durch die Eier verstopft, den anderen konnte ich nicht mehr erreichen, die Hand war schon zu weit vorgekommen, und sie füllte den Raum fast gänzlich aus, ich konnte nicht daran vorbeikommen!
Nur nach hinten konnte ich mich noch retirieren. Und das tat ich natürlich.
Vergebliche Hoffnung, der Arm könnte nicht weiter nachgreifen. Über das Nest hatte die Hand bereits hinausgegriffen, aber die Grenze der Greifbarkeit hatte sie noch nicht erreicht.
Und was für eine Hand war das, die sich mir immer mehr näherte, was waren das für Finger! Ich war bisher nur die wohlgepflegten, zarten Hände von vornehmen Damen und Herren gewöhnt gewesen, auch die Hände des Schlosspersonals hatten immer reinlich sein müssen und nichts von schwerer Arbeit gezeigt, das hier aber war eine Feuerwehrmannspfote! Schon allein der Dreck unter den Nägeln war staunenswert, in jeder Abteilung konnte man einen kleinen Gemüsegarten anlegen!
Und diese schwarzen, riesenhaften, klobigen Finger rückten mir immer näher und näher auf den Leib!
Kaltes Entsetzen packte mich. Merkwürdig! Weshalb schrie ich jetzt nicht einfach: aufhören!
Weil ich eben ganz kopflos vor Schreck und Angst geworden war.
Da aber plötzlich verwandelte sich die Angst in kühnen Mannesmut — nein, ich will ehrlich sein: der wilde Mut der Verzweiflung packte mich, den Degen konnte ich schon nicht mehr ziehen, aber den Dolch riss ich aus Hosentasche und Scheide und zog über die Spitze des Zeigefingers einen Kreuzschnitt, dass sofort das Blut spritzte, obgleich dieser Finger mit einem außergewöhnlich dicken Leder bekleidet war.
Es half. Blitzschnell zog sich die Hand zurück, verschwand aus meiner Wohnung.
Wie dann der behelmte Riesenkopf des abwärtssteigenden Mannes an der Öffnung vorbeikam, sah ich, dass er den verwundeten Finger im Munde hatte.
»Hier ist kein Sperlingsnest drin«, schrie er dann hinunter auf die Frage des Vorgesetzten, ob er etwas gefunden hätte, »aber eine Ratte ist drin, sie hat mich in den Finger gebissen!«
Der Kerl hatte in zwanzigfacher Vergrößerung gelogen. —
Nun war ich in Sicherheit.
Aber für die Dauer war das nichts.
Ich hatte mich einige Tage hier aufhalten wollen, nach den Strapazen der Ruhe pflegend, das Leben unten auf der Straße und im Parke beobachtend, aber noch in derselben Nacht fasste ich den Entschluss, mit Morgengrauen die Weiterreise anzutreten.
Rohe Sperlingseier eignen sich auf die Dauer doch nicht als einziges Nahrungsmittel für den Menschen. Wenigstens nicht für mich, ich wurde schon von den grausamsten Verdauungsstörungen geplagt. Ich hätte meinen diamantenbesetzten Säbel im Werte von einer halben Million für ein paar Choleratropfen hingegeben. Noch nie hatte ich so große Lust gehabt, und noch nie wäre es auch so angebracht gewesen als jetzt das große Wort auszusprechen: Aufhören!
Die Nacht brachte ich noch mannhaft hin, beim ersten Morgengrauen trat ich den Weitermarsch an. Natürlich zum anderen Loche hinaus. Wenn man mal einmal auf Reisen geht, will man doch auch etwas Neues sehen.
Ein Fenster war vom anderen immer ungefähr 50 Meter entfernt. Ich kam an mehreren vorüber, aber alle waren geschlossen, und einbrechen, diese Glasscheiben einschlagen, hätte ich beim besten Willen nicht vermocht.
Da war der Sims zu Ende! Das heißt, ich war an die Hausecke gekommen, brauchte nur herumzubiegen.
Das tat ich denn auch, erkannte aber gleich, dass ich nun tatsächlich die Wanderung nach dieser Richtung aufgeben musste.
Die Fassade des Palastes nach dieser Seite, auch wieder mit Aussicht auf den Park, war vom Architekten ganz anders ausgestattet worden. Der Sims machte nur noch einen ganz kurzen Vorsprung, dann war hier die bisher glatte Hauswand mit Schnörkeln und Ornamenten und Rautenkränzen und dergleichen bedeckt, für mich ein unentwirrbares Durcheinander von dicken Vorsprüngen.
Ja, ein Gämsenjäger hätte ganz bequem an dieser Wand herumklettern können, jeder Kraxler wäre sofort leidenschaftlich drauf los gegangen — ich aber war Schiffsingenieur und gegenwärtig Husarenleutnant, ich wollte mit solcher Kraxelei an schnörkelhafter Ornamentik nichts zu tun haben.
Also ich musste wieder zurück, es blieb nichts anderes übrig. Ich würde schon irgendwo anders noch ein offenes Fenster finden und durch dieses den Weg zu einer Speisekammer.
Und richtig, kaum hatte ich mich umgedreht, da ward auch schon das letzte Fenster, mir also das nächste, geöffnet, keine 20 Meter entfernt.
Aber das Öffnen dieses Fensters entsprach nicht meinen Wünschen.
Es war jedenfalls ein Doppelfenster, ging nach draußen auf, eine Riesenhand kam einmal zum Vorschein und befestigte es mit einem Haken.
Das hätte ja an sich nichts zu sagen gehabt.
Nur schade, dass dieses Fenster so tief ging, mit dem unteren Ende gerade über den Sims hinstrich und so stehen blieb, nur eine Spalte lassend, durch die ich meinen Leib unmöglich quetschen konnte. Ich war gefangen! Hier die Fensterbarriere und dort die Ornamentik!
Ich will es kurz machen.
Das heißt, ich will die zwei Stunden überspringen, während welcher ich darauf wartete, dass dieses vermaledeite Fenster wieder geschlossen würde.
Dann fasste ich einen heldenhaften Entschluss.
So ging das nicht weiter.
Es hatte gar keinen Zweck, hier zu stehen oder zu sitzen und darauf zu lauern, ob es denen gefiel, das Fenster wieder zu schließen.
Außerdem stand ich ja immer in Gefahr, gesehen zu werden, es brauchte ja jemand nur zum Fenster nach rechts zu blicken.
Ich musste die Klettertour an der Skulpturenrautenkranzornamentik wagen. Irgendwo musste ich doch ein Loch finden, das mich durchließ, wenn kein Fenster, dann eine kapute Dachrinne.
Ja, und sollte ich 500 Meter hoch hinauf bis aufs Dach klettern, ich war entschlossen dazu, mutig allen Schrecken des Todes zu trotzen.
Diese meine todestrotzende Courage hatte freilich seine guten Beweggründe.
Ich hatte mir bereits überlegt, dass ich gestern in dem Drachenrachen doch ein rechter Narr gewesen war, mich vor der Feuerwehrmannspfote so furchtbar zu entsetzen, dass ich gleich die Cholerine davon bekommen hatte, woran sicher nicht nur die Sperlingseier schuld gewesen waren. Wenn er mich wirklich gepackt hätte — na, ich hätte doch nur »aufhören!«, zu sagen brauchen.
Und so machte ich's auch jetzt, und diesmal wollte ich das nicht wieder vergessen, sondern immer das erlösende Zauberwort im Gedächtnis haben. Am besten war es, ich nahm die erste Silbe, das »Auf« von vornherein gleich auf die Zunge, dann hatte ich später, wenn's nötig war, nicht mehr so viel zu sprechen, das »hören« brachte ich dann schon noch heraus, und wenn ich auch schon durch die Luft sauste, nach unten.
»Also, Ewald«, sagte ich mir, »Du unternimmst kühn die Klettertour, bis Du irgendwo ein genügend weites Loch findest, das Dich ins Innere des Palastes führt, am liebsten in eine Speisekammer. Und solltest Du in die Tiefe stürzen, oder nur erst abgleiten, nur noch an einer Hand irgendwo hängen, ohne mit den Füßen irgendwo noch zu stehen, dann brüllst Du aus Leibeskräften: ›Aufhören!‹, oder auch nur ›hören!‹, Das ›Auf‹ steckst Du Dir zur Vorsicht schon vorher in die Kehle hinein. Ja, Ewald, das machst Du, das vergisst Du nicht, so wahr Du ein ganzer Mann vom Scheitel bis zur Sohle bist, noch dazu in einer Husarenleutnantsuniform mit einem diamantenbesetzten Zigarrenabschneidedegen.«
Also ich hing mir diesen Degen an meinen Gürtel mehr nach hinten, damit er mir beim Klettern nicht so zwischen den Beinen herumquirlte, legte mir das Wörtchen »Auf« auf der Zunge zurecht und trat die Skulpturenrautenkranzornamentikkraxelei an. Es ging ganz vortrefflich. Ich habe es mir auch schon immer gedacht: zu der ganzen Kraxelei gehört außer der nötigen Gewandtheit nichts weiter als ein bisschen Mut. Da seilen sich die Kraxler, diese Feiglinge, immer gegenseitig an, während ich hier ganz frei —
»Auf!«, brüllte ich aus Leibeskräften.
Denn mein Fuß war abgerutscht.
Glücklicherweise hatte er gleich wieder festen Halt gefasst, ich war nicht über das »Auf« hinausgekommen. Diese erste Silbe wirkte noch nicht als Zauberwort, und nun war's ja gut, nun konnte ich mir die beiden anderen Silben auch aufsparen.
Wer wagt, gewinnt — dem Mutigen gehört die Welt! Diese goldenen Sprüche sollten sich bei mir wieder einmal bewahrheiten.
Ich war noch gar nicht lange geklettert, als ich einen normalen Sims erreichte, und da war auch schon ein Fenster, und zwar ein offenes!
Mit der nötigen Vorsicht, die stets eine Tugend auch des kühnsten Helden ist, lugte ich vorsichtig erst etwas über dem unteren Fensterkreuz hervor.
Es war eine Kammer, die nichts weiter enthielt, als zwei Eimer und einen Besen.
Dieser Besen lehnte am Fenster, in meiner erreichbaren Nähe und der Stiel war auch höchstens einen halben Meter dick, den konnte ich schon noch umklammern, um mich daran hinabzulassen. Dass ich dies beabsichtigte, daran war vor allen Dingen die Tür schuld, die nur angelehnt war, der Spalt ließ mich noch durch.
Also ich nahm Abschied von der freien Gebirgswelt und ihrer schönen Umgebung.
Unterwegs, bemerke ich nachträglich, hatte ich öfters daran gedacht, wie es gewesen wäre, wenn dort unten Leute hier oben einen Husarenleutnant an der Häuserwand herumklettern gesehen hätten. Die hätten am Ende gar die Gartenspritze geholt, um mich herunterzuspritzen, so wie man einen entflohenen Kanarienvogel einfängt.
Aber es hatte nicht sein sollen.
Also ich umklammerte mit Armen und Beinen den Besenstiel und rutschte vom Fensterbrett hinab, fünfzehn Meter tief.
Dann lugte ich vorsichtig durch die Spalte der angelehnten Tür, ehe ich meinen Körper nachfolgen ließ.
Und was für ein Anblick erwartete mich da, der sofort meinen niederträchtig knurrenden Magen vor Freude hüpfen ließ!
Ich war richtig in eine Speisekammer geraten! Und die ist in solch einem königlichen Residenzschlosse doch nicht klein.
Das erste, was mein staunendes Auge fesselte, war eine Zervelatwurst von ungefähr 20 Meter Länge und einem Meter Dicke. Und die hatte noch gar viele, viele Geschwister und Schinken und Speckseiten und dergleichen mehr — freilich für mich in nicht erreichbarer Nähe — lauter Trauben, die mir zu sauer waren — sie hingen oben an der 80 Meter hohen Decke.
Aber da gab es noch genug anderes, was ich recht wohl erreichen konnte.
Da lag zum Beispiel am Boden eine Blutwurstschale, ganz frisch, mit noch so viel Blutwurst dran — die Schale ließ sich wohl schlecht ablösen — dass sich ein hungriger Mann sättigen konnte — ein Zwerg wie ich — meine ich. Und gleich daneben lag eine Käserinde, die auch noch genug abgab, ich hätte es nicht auf einen Sitz aufessen können. Und dort hinten am Tischbein lag eine halbe Semmel, 1 Meter 20 Zentimeter im Durchmesser.
Ehe ich mich aber an diese vom Tisch gefallenen Brosamen machte, wollte ich mich einmal auf diesen Tisch selbst machen, der sich an der ganzen Wand entlang zog, jedenfalls ein sogenannter Anrichte- oder Aufschneidetisch und wenn ich Zwerg ihn nicht überblicken konnte, so musste ich doch mit Sicherheit annehmen, dass da noch verschiedenes Essbare darauf lag, weil ich wenigstens eine dicht an der Kante liegende Zungenwurst erblickte, eine ungeheuerliche Bombe von vier Meter Durchmesser, angeschnitten, mit Speckgriefen darin von 25 Zentimeter im Quadrat, von den eigentlichen Zungenstücken gar nicht zu sprechen.
Die Hauptsache war natürlich, dass sich niemand in der Speisekammer befand und ich die Möglichkeit hatte, auf diesen Tisch auch hinaufzukommen.
Diese Möglichkeit war vorhanden. An dieser Riesenzungenwurstbombe war nämlich noch der Strick befestigt, an dem sie einst an der Decke gehangen hatte, er hing von der Tischplatte herab, war reichlich lang, sodass er fast den Boden berührte, für mich gab er gerade ein gutes Klettertau ab, und dass diese gewaltige Zungenwurst mein Gewicht trug, das war ganz selbstverständlich.
Also ich ging hin, spuckte in die Hände und zeigte meine Kletterkunst. Ich hatte in der Batterie der »Argos« nicht nur immer registriert, hatte mich auch praktisch mit an der Turnerei betätigt — die zu überwindenden 15 Meter waren eine Kleinigkeit für mich. Nur an einer Stelle, wo das Tau recht fettig war, hatte ich mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Glücklicherweise klebte auch etwas Sirup daran, mit dessen Hilfe wurde diese schwierige und schmierige Stelle glücklich überwunden.
Kaum hatte ich mich über die Tischkante geschwungen, als ich sofort meinen Degen zog und mich in Fechtpositur setzte.

Denn da saß ziemlich dicht vor mir ein gewaltiges Raubtier, halb dunkelbehaarter Löwe, halb Elefant, halb Bär, saß aufrecht auf den Hinterpfoten, hielt zwischen den Vordertatzen einen großen holländischen Käse und biss davon ab, schlug seine fürchterlichen Zähne hungrig hinein. Die erste Maus, die ich erblickte! 60 Zentimeter hoch, so auf den Hinterbeinen sitzend aber noch viel höher. Sie war ebenso erschrocken wie ich, aber nicht so mutig wie ich. Freilich hatte sie auch nicht so einen Säbel wie ich.
Sie ließ den kürbisgroßen holländischen Käse fallen und suchte das Weite, sprang mit einem Satze einfach vom Tische herunter und verschwand unter einem Schranke.
Nachdem ich so die naschhafte Maus in die Flucht geschlagen hatte, sah ich mich weiter um.
Richtig, meine Ahnung hatte mich nicht betrogen! Auf dem Tische lagen Würste aller Art, schon angeschnitten, ich brauchte nur noch weiterzuschneiden, und nun sonst noch alles, was ins Reich der sogenannten Fressalien gehört.
Da lag ein halber Schweizerkäse, die Schnittfläche 8 Meter lang und 6 Meter hoch. Es gibt Schweizerkäsebrote von noch ganz anderen Dimensionen — bei uns in zwanzigfacher Verkleinerung. Ein ganz vorzüglicher Schweizerkäse, mit großen Löchern, in denen das Wasser perlte. Ich liebe Schweizerkäse, besonders auf nüchternen Magen. Also ich zog meinen Dolch und stieß ihn dem Schweizerkäse in den Bauch. Und fuhr auch gleich mit dem ganzen Arm und sogar mit dem Kopfe in den Schweizerkäse hinein. Denn ich hatte gerade in solch ein großes Loch gestochen, vor dem sich nur ein dünnes Häutchen Käse befunden hatte, da war ich durchgebrochen, und dieses Loch hatte 40 Zentimeter im Durchmesser und war 80 Zentimeter tief. Dieser Schweizerkäse eignete sich für Restaurationen, mit dem konnte man sparen.
Der Leser kennt doch das Geschichtchen mit der Schweizerkäsesemmel.
Ein Gast bestellt eine Schweizerkäsesemmel.
»Aber der Schweizerkäse muss auch gut sein! Muss ganz große Löcher haben!«
»Er hat ganz große Löcher«, versicherte der Kellner.
Er bringt die halbe Semmel, sie ist nur mit Butter gestrichen.
»Ich hatte doch eine Schweizerkäsesemmel bestellt!«
»Das ist eine Schweizerkäsesemmel.«
»Da ist doch gar kein Schweizerkäse drauf!«
»Nicht? Da haben Sie jedenfalls gerade ein großes Loch erwischt.«
Ich zog mich aus der Schweizerkäsehöhle wieder zurück, schnitt ein gutes Stück ab und warf es vom Tisch herab.
Denn hier oben durfte ich nicht frühstücken, nicht lange verweilen. Wenn nun jemand kam und die Zungenwurst verrückte, mein Klettertau einzog? Dann war mir der Rückweg abgeschnitten, es gab keinen anderen. Ich musste mich beeilen.
Also ich ließ dem Stück Schweizerkäse ein Knackwürstchen nachfolgen, etwas größer und dicker als ich, dann wollte ich mit Schwert und Dolch einen rosenroten Schinken in Angriff nehmen —
Da erzitterte der Boden, eine mir schon bekannte Erscheinung, die Erschütterung kam immer näher, mit genialem Feldherrnblick hielt ich Umschau und war mit einem Satze unter einem Teesieb verschwunden, das etwas hochgekippt war, sodass ich bequem darunterkriechen konnte und das mir als geeignetstes Versteck gedünkt hatte.
Richtig, die andere Tür wurde geöffnet. Was da auf Filzschuhen hereinkam, war unverkennbar eine Köchin. Ein mächtiges Stücke!
»Da sind wieder Mäuse auf dem Tische gewesen!«, war ihr erstes Wort.
Ja, das stimmte. Ich hatte selbst eine gesehen und verjagt.
»Solche naschhafte Ludersch!«
Ja, die Mäuse!
Sie begann Wurstscheiben aufzuschneiden und auf einem Teller zu arrangieren.
Einen Zentner schnitt sie auf, einen halben Zentner fraß sie dabei selber. Wie es alle Köchinnen machen. Alle Köchinnen im Riesenland Brobdingnag meine ich natürlich.
Dann holte sie aus einem Schranke zwei Kannen, zweifellos Milchkannen, leer. Auf dem Tische stand eine große Schale mit Milch, die über Nacht eine dicke Schicht Sahne gebildet hatte. Diese Sahne schöpfte sie mit einem Löffel ab, diesen zunächst mehrmals in ihren eigenen Mund führend. Dann füllte sie mit der Sahne die eine Kanne, in die andere goss sie entrahmte Blaumilch.
»Die hier ist für Johann, die hier für Seine Majestät — dass ich's nicht etwa wieder verwechsele.«
So sprach sie, als sie den Teller mit Aufschnitt und die beiden Kannen auf ein Servierbrett stellte.
Also die Sahne war für Johann bestimmt, der natürlich ihr Herzallerliebster war, vielleicht nur ein Hausbursche oder sonst ein Diener, die Blaumilch bekam der König.
Ein Glück, dass so etwas nur im Riesenreiche Brobdingnag passieren kann.
Da sind unsere Köchinnen doch anders! Wenn die einmal naschen, so begnügen sie sich mit Wurstschalen, Käserinden und anderen unbrauchbaren Abfällen.
Sie schob mit ihrem Servierbrett ab.
Ich verließ mein schützendes Sieb, durch dessen Löcher ich doch alles hatte beobachten können, gestehe erst jetzt, dass ich etwas Angst geschwitzt und immer die erste Silbe »Auf« auf der Zunge gehabt hatte, von wegen des prophezeiten Tottretens, sobald ich erwischt würde, und sah mich nach weiterem Proviant um, den ich an den Boden und dann weiter unter den Schrank zu befördern gedachte, um dann unter diesem in aller Gemütsruhe zu frühstücken.
Vor allen Dingen aber hatte ich Durst, jetzt merkte ich's. Die Milchschale war noch mehr als halbgefüllt. Ich hätte darin noch baden, schwimmen und mit einem Boote rudern können, auch konnte ich ihren Rand erreichen, aber Milch ist nicht mein Fall, zumal wenn sie schon abgerahmt ist. Meine kleine Herrin hatte mich weidlich mit solcher abgerahmter Milch geplagt.
Aber da standen auch noch einige andere Töpfe. Nur schade, dass sie alle zu hoch waren, ich nicht hineinsehen, bei mehreren nicht einmal den Rand im Sprunge erreichen konnte.
Nun, die Menschenmaus wusste sich schon zu helfen. Die sehr rissige Rinde eines Schwarzbrotlaibes bot Händen und Füßen genügend Anhaltungspunkte, und gleich daneben, sodass ich bequem hineinblicken konnte, stand ein Topf.
Ich führte die Klettertour aus, erreichte den Gipfel, blickte in den Topf hinein.
Richtig, er war fast bis zum Rande mit schwarzem Kaffee gefüllt!
Wie nun den herausbekommen? Wie schöpfen? Vielleicht dort mit dem Wurstzipfel, den ich nur auszuhöhlen brauchte, um einen Eimer zu haben, das Seil war auch gleich dran.
Wie ich noch so überlegte, rutschte ich plötzlich aus, verlor die Balance und stürzte herab.
Zu meinem Glück gerade in den Topf mit schwarzem Kaffee hinein.
Aber es war gar kein schwarzer Kaffee. Es war Sirup.
Ein wirkliches Glück war es, dass ich nicht mit dem Kopfe voran abgestürzt war. Sonst wäre es mir ja traurig ergangen. Wenn man mit dem Kopfe voran in ein großes Sirupbassin fällt, dann ist nicht mehr viel zu wollen. Da kann man Meisterschwimmer sein, da ist sogar ein Seehund rettungslos verloren.
Ich war von dem Brotlaib abgerutscht, war nur geschusselt, so war ich glücklich mit den Füßen zuerst hineingekommen.
Aber gefährlich war die Sache für mich immer noch sehr. Nie hätte ich geglaubt, dass man in dickflüssigem Sirup so schnell untersinken könnte.
Ehe es mir noch richtig zum Bewusstsein kam, dass das kein schwarzer Kaffee, sondern Sirup war, ging mir dieser auch schon bis zur goldgestickten Halsbinde meiner Husarenleutnantsuniform.
Da aber hatte ich noch rechtzeitig mit beiden Händen den Topfrand erwischt. Was sonst passiert wäre, das wagt sich meine Phantasie nicht auszumalen.
So war ich gerettet. Vorläufig. Nun handelte es sich nur noch darum, dass jetzt nicht die Köchin kam und mich hier im Sirup fand, und zweitens, wie nun wieder aus dem Sirup herauskommen.
Ich kann ja den Klimmzug machen, zehnmal hintereinander, Flüssigkeiten vermindern doch das Gewicht eines jeden Körpers, Sirup muss es eigentlich noch viel mehr tun als Wasser, aber Sirup ist in gewisser Hinsicht eine höllische Flüssigkeit, klebt bekanntlich wie Fliegenleim.
Na, kurz und gut — es gelang mir schließlich doch, mich auf den Topfrand hinaufzuschwingen. Wenn auch unter unsäglichen Schwierigkeiten. So schwer hatte ich noch nie gearbeitet, auch nicht im Steinbruch von Portland.
Endlich saß ich auf dem Topfrande. Dass ich jetzt noch eine Husarenleutnantsuniform trug, das durfte ich nicht mehr behaupten. Niemand hätte es mir geglaubt.
Na, ich sprang von meinem Topfrande herab.
Und sprang gerade in eine Schüssel mit Paniermehl hinein.
Stürzte auch noch hin und umkugelte mich einmal. So, nun fehlte nur noch die Bratpfanne mit Butter.
Dann konnte der Herr Husarenleutnant schön braun gebacken werden.
Ich wusste, was ich zu tun hatte. Es half alles nichts, nun musste ich doch einmal meine Scheu vor Milch überwinden.
Ein Brett mit Querleisten — wozu es diente, weiß ich nicht — kam wie gerufen. Ich legte es an den Rand der Schüssel und erklomm es, machte einen Hechtsprung in die Milch hinein.
Bald aber kam ich zur Überzeugung, dass die Sache doch nicht so ging, wie ich sie mir gedacht hatte. Paniermehl und Sirup ließen sich doch nicht so einfach abspülen, sondern jetzt wurde ich in eine Art Pfannkuchenteig eingewickelt, der sich erst recht nicht ablösen ließ.
Da schälte ich mich doch lieber gleich ganz aus meinen Kleidern. Und ich tat es, zog des Königs Rock aus, Hosen und Stiefel dazu, überhaupt alles.
Aber das Richtige war es noch längst nicht. Ich war nun einmal sirupig geworden, die Milch dazu, und jetzt verrieb ich mir den Sirup mit Paniermehl nur direkt auf der Hand.
Ich entstieg dem Milchbade, so wie mich Gott geschaffen hat. Ich ließ alles in der Milch gleich liegen. Ob es nun auf dem Meeresboden lag oder oben schwamm — mir ganz egal.
Doch nein, ganz nackt war ich nicht. Ich hatte meinen Degen umgeschnallt. Den Dolch hatte ich auf dem Tische liegen lassen.
Was nun? Wie sollte ich diesen Kleister los werden? Ich musste Umschau halten, ob in einem der Töpfe nicht doch irgend eine Flüssigkeit war, die man als richtiges Badewasser benutzen konnte. Wenn ich dann nur auch noch —
War das nicht Seife? Gewiss, es war Seife. Ich hatte den riesigen Block erst für einen Limburger Käse gehalten.
Ich schnitt mir hocherfreut ein gutes Stück davon ab, und nun brauchte ich eben nur noch eine geeignete Badeflüssigkeit.
Mit Hilfe der Bretterstiege konnte ich leicht jeden Topf erklettern.
In dem ersten, in den ich blickte, war Quark. In Quark kann man sich nicht abwaschen. Oder das soll mir erst einmal jemand vormachen.
Im zweiten Topfe war Bouillon. Das ging schon eher. Wenn nur nicht so große Fettaugen darauf geschwommen hätten. Ehe ich diese Bouillon benutzte, wollte ich doch die anderen Töpfe untersuchen, vielleicht schon im nächsten, aller guten Tage sind doch drei —
Nein, da war wieder Sirup drin.
Oder halt! Ich stach erst einmal mit dem Degen hinein. Das stach sich ganz anders als Sirup. Ich leckte am Degen.
Richtig, diesmal war's nun kein Sirup, sondern gerade schwarzer Kaffee.
Den wollte ich benutzen. Ich habe einmal gehört, dass es sehr gesund für die Augen sein soll, sie manchmal mit kaltem Kaffee auszuwaschen. Dann muss es doch auch gesund für den ganzen Körper sein.
Ich zog das Brett herüber und versenkte es in den Topf, wie eine Laubfroschleiter. An dieser stieg ich hinab. Der Kaffee ging mir bis zur Brust. Die Höhe war also ganz geeignet zum Baden, sonst konnte ich mich ja auch auf das Brett setzen.
Ehe ich mit der Seife loslegte, trank ich mich satt, hatte dabei freilich schon die Beine drin. Aber als ob man so etwas nicht oft genug im Wasser machte! Wenigstens unsereins. Und sonst freilich auch nicht in der Badewanne.
Nach einer Viertelstunde war es geschehen. Rein wie ein Engel entstieg ich dem Kaffeebade. Nur etwas angebrannt. Der Kaffee dagegen hatte seine schwarze Farbe kaum verändert, es war ja ein Bassin von drei Meter Durchmesser, da kann man schon tüchtig mit der Seife schäumen, ehe in zehn Kubikmetern Kaffee etwas davon zu merken ist. So. Jetzt konnte ich den Tisch verlassen und unter dem Schranke frühstücken.
Aber so im Adamskostüm nur mit dem Schwerte umgürtet, fühlte ich mich doch nicht recht behaglich.
Nun, da lag ein geeignetes Stück Bratwurstschale, noch unaufgeschnitten, wie starkes Pergament, ziemlich reinlich — mit diesem schürzte ich meine Lenden.
Ich ließ mich an dem Klettertau wieder herab, schaffte den herabgeworfenen Proviant, auch Schwarz- und Weißbrot, unter den Schrank, unter dem ich schon vorher die Öffnung einer Ventilationsröhre erblickt hatte, sodass mein Fortkommen von hier wohl gesichert war.
Ich hatte meine lukullische Mahlzeit ziemlich beendet, als sich wieder das bekannte Zittern bemerkbar machte, die auf Filzschuhen gehende Köchin betrat wieder die Speisekammer.
Nachdem sie einige Zeit herumhantiert hatte, griff sie nach meinem Kaffeetopfe, führte ihn an die Lippen. Die von mir angerichtete Schweinerei schien sie noch nicht bemerkt zu haben.
Einige Schlucke, dann setzte sie ihn bedächtig ab.
»Hm. Schmeckt der Kaffee nicht nach Seefe? Da hat die Guste wieder einmal den Kaffee nicht ordentlich nachgespült. Hat aber auch sonst einen komischen Beigeschmack, wie nach Sirup.«
Und wie nach Husarenleutnant, setzte ich in Gedanken hinzu. Um diesen Beigeschmack ihres kalten Kaffees, den sie sonst wohl schwarz trank, wegzubringen, goss sie Milch zu aus jener Schüssel.
Dann jedoch trank sie erst einmal direkt aus der Milchschüssel.
Einige Schlucke, mit einem Male machte sie ein überraschtes Gesicht, schnitt eine Grimasse, setzte die Schale hin, griff sich in den Mund, brachte einen Husarenstiefel zum Vorschein.
»Was ist denn das? Wie kommt denn der Puppenschuh in die Milch? Und war da nicht noch etwas drin?«
Eine Gabel hergenommen, in der Milch herumgestochert, und da hing an der Gabel eine Husarenleutnantshose.
Mehr beobachtete ich nicht, mein Frühstück war beendet, ich schlug mich seitwärts in das Ventilationsrohr hinein.
Nun aber sollte meine Reise auch sehr bald ein Ende finden. Der Leser wird staunen.
Gerade jetzt dachte ich am allerwenigsten daran, das magische Erlösungswort auszusprechen, und doch lag es nur acht Meter von mir entfernt.
Acht Meter dick war nämlich die Mauer, die ich in dem Ventilationsrohr zu passieren hatte.
Und kaum trat ich auf der anderen Seite aus dieser heraus, ohne weitere Umschau gehalten zu haben, weil ich wegen des Dämmerlichtes bestimmt vermutete, mich wieder unter einem Schranke oder anderem Möbel zu befinden, da sausten plötzlich zwei glühende Augen auf mich los, so groß wie Suppenteller. Ich konnte eben noch die Umrisse einer riesenhaften Katze erkennen, und da befand ich mich auch schon zwischen den Klauen und sogar zwischen den Zähnen des Ungeheuers.
Es war nur eine gewöhnliche Hauskatze, aber eben in zwanzigfacher Vergrößerung.
Merkwürdig, dass ich diesmal daran dachte, obgleich ich schon meine Knochen krachen hörte.
»Aufhören!«, brüllte ich aus Leibeskräften.
Was mit mir geschah, weiß ich nicht.
Aber jedenfalls saß ich plötzlich in meiner alten Glaskugel, saß auf dem Reitsattel, an das Rückenpolster angelehnt, ringsherum eine runde Felsenwand, und dort stand der Kapitän Stevenbrock.
»Also Sie wollen aufhören, Herr Ebert?«
Einige Sekunden brauchte ich, um zur Besinnung zu kommen.
»Ich habe das alles wohl nur geträumt?«
Der Kapitän bestätigte es.
Ich war nicht aus dieser Kugel, gar nicht aus diesem Raume herausgekommen.
Ja, nun wusste ich auch, dass ich dies alles nur geträumt hatte. Aber im Traume selbst war mir hier nicht der leiseste Gedanke gekommen.
»Wie lange bin ich denn in der Kugel gewesen?«
»Wie lange der Traum gewährt hat, müssen Sie fragen.
Im Grunde genommen nur einen einzigen Augenblick. In dem Moment, da Sie sich in den Sattel setzten, trat die Membrane dieser Illusionskugel, wie wir den Apparat nennen, in Tätigkeit, der Traum wurde Ihnen suggeriert.
Sie sind nicht einmal hier im Kreise herumgefahren. Die Pedale lassen sich wohl treten, aber die Kugel wird dadurch nicht in Bewegung gesetzt, wie Sie sich jetzt überzeugen können.
Das ist diejenige Erklärung, die ich meinerseits Ihnen geben kann.
Wollen Sie eine ausführlichere, eine wissenschaftliche Erklärung haben, wie diese Illusionskugel wirkt, so müssen Sie sich an Doktor Isidor wenden oder direkt an jenen Mann, der diesen Apparat ersonnen hat. Ich werde Sie mit ihm dann bekannt machen.
Nur fürchte ich, dass Sie die wissenschaftliche Theorie ebenso wenig verstehen werden wie ich. Den letzten Grund von alledem begreift nicht einmal unser scharfsinniger Doktor Isidor.
Die Männer, die zum Teil hier hausen, sind unserer Welt eben um Jahrhunderte, wenn nicht um Jahrtausende voraus.
Wohl wird diese Erfindung noch dereinst Gemeingut der ganzen Menschheit werden, heute ist sie uns noch so fremd wie — uns vor 25 Jahren die ganze Kinematografie war, vor 50 Jahren das Telefon, vor 75 Jahren die Telegrafie, vor 100 Jahren die Eisenbahn. Und nun frage ich Sie: wollen Sie eine Fortsetzung dieses Traumes haben?«
»Das ist möglich?«
»Sonst würde ich Sie nicht fragen. Aber hier muss es geschehen. An Bord meines Schiffes ist keine Gaukelei irgend welcher Art mehr erlaubt, kein solcher Apparat, der von jener geheimen Gesellschaft stammt, dessen Wesen wir uns nicht erklären können, darf an Bord meines Schiffes kommen.
Hier aber haben Sie Gelegenheit, sich solche Illusionen vorgaukeln zu lassen. Also wollen Sie die Fortsetzung Ihres Traumes haben?«
»O ja, sehr gern, Nur hoffe ich, dass ich der Todesgefahr glücklich entgehe.«
»Welcher Todesgefahr? Wo haben Sie den Traum unterbrochen?«
»Das ist Ihnen gar nicht bekannt?«
»Wie soll ich denn das wissen! Wenn der ganze Traum nur einen einzigen Moment währt.
Aber ich selbst habe dies alles erlebt, wir alle haben schon in dieser Kugel gesessen, immer denselben Traum gehabt, wenn auch mit den verschiedensten Variationen. Individuell bleibt der Traum immer. Also wo haben Sie den Traum unterbrochen?«
»Eine Katze überfiel mich.«
»Aha! Also Sie befanden sich als Pygmäe im Lande der Riesen. Ja, ja, ich weiß schon. Das habe ich nämlich auch alles durchgemacht. Sie waren in den Sirup gefallen, dann ins Paniermehl, hatten sich in schwarzem Kaffee abgeseift, die Köchin fischte aus der Milch Ihre Hose heraus, nachdem Sie schon beinahe Ihren Stiefel verschluckt hatte. Sie befanden sich unter dem Schrank, hatten gefrühstückt, passierten das Ventilationsrohr, da kam eine Katze gesprungen behandelte Sie als Maus — nicht wahr?«
»Wunderbar, wunderbar!«, fing ich statt einer Bestätigung noch einmal zu staunen an.
Nämlich weil der Kapitän und alle anderen, die in der Kugel gesessen, dies als ebenfalls erlebt hatten.
»Sie glaubten wohl, die Katze würde Sie verspeisen?«
»Ich hörte und fühlte schon, wie meine Knochen zwischen ihren Zähnen krachten.«
»Das war nur Einbildung. Die Katze ritzt Ihnen nicht die Haut, nimmt Sie fein säuberlich beim Genick und bringt Sie ihren Jungen, lehrt diesen an Ihnen das Mäusefangen —«
»Na ich danke!«
»Bitte sehr. Kein Haar wird Ihnen gekrümmt. Sie entwischen der Katze, klettern in der Nacht die Treppen herab, kommen in den Park, bestehen als erstes einen Kampf mit einem Regenwurm — und so weiter. Wollen Sie diese Fortsetzung haben?«
»Hm. Könnte nicht vielleicht die Episode mit der Katze übersprungen werden?«
»Mein lieber Ebert, Sie sind kein besonderer Held!«, lachte der Kapitän. »Na, ich verstehe schon. Wenn ich Ihnen von vornherein gesagt hätte, dass alles nur ein Traum ist, würden Sie wohl auch nicht um Hilfe geschrien haben.
Ja, es ist möglich, eine und die andere Episode nach Belieben auszuschalten. Aber ich selbst kann das nicht, da müsste ich erst einen von jenen Eingeweihten holen. Lassen Sie sich nur ruhig von der Katze im Maule davontragen. Sie werden sofort bemerken, dass das Tier Sie ganz sorgsam, sogar zärtlich behandelt, um die Menschenmaus seinen Jungen lebendig zu bringen. Es dauert auch gar nicht lange.«
Ich war bereit dazu.
»Dann steigen Sie einmal heraus aus Ihrer Kugel, steigen Sie wieder hinein und setzen Sie sich.«
Ich tat es, und kaum saß ich wieder im Sattel, als —
Ja, das kann ich nun unmöglich beschreiben.
Der Film, zu dessen Betrachten oder richtiger Erleben ich einige Tage gebraucht hatte, schnarrte jetzt in einem einzigen Augenblicke ab.
Anders kann ich mich nicht ausdrücken.
Ich war mir bewusst, alles noch einmal zu erleben und wusste es eigentlich dennoch nicht. Nämlich nicht, dass ich es schon erlebt hatte und jetzt noch einmal erlebte.
Man sieht, so etwas kann man nicht schildern.
Kurz, ich befand mich plötzlich zwischen den Klauen und Zähnen der Katze.
Weshalb ich jetzt nicht in fürchterlicher Todesangst das Zauberwort brüllte, ob ich mich dabei der letzten Unterhaltung mit dem Kapitän erinnerte oder nicht, vermag ich ebenfalls nicht zu sagen.
Ja und nein. Der Traum ist für uns noch ein vollkommenes Rätsel, die Wissenschaft muss sogar erst begründet werden, die sich mit ihm beschäftigt.
Also das Spiel ging weiter. Ich schildere es nicht. Denn ich habe noch viele Tage lang im Riesenlande Brobdingnag zugebracht.
Bis ich dann meine Kugel wiederfand, sie aber erst nicht benutzen konnte, weil mir der Schlüssel dazu fehlte, endlich verstand ich die Klappe zu öffnen. Ich kroch hinein, nicht zu meinem Vorteil, denn Riesenkinder fanden die hübsche Kugel, spielten mit ihr Fangball und Fußball, ich immer drin, bis ich nach ganz logisch aufeinanderfolgenden, wenn auch phantastischen Erlebnissen wieder auf der Kirschbaumallee rollte, in das Felsentor hinein und in dem runden Raume wieder aus der Kugel stieg.
Ich überspringe die Zeit, die wir noch in diesem Felsen zubrachten. Auch schildere ich nicht, wie nicht weit von diesem Felsen entfernt ein Dampfer zwischen den Riffen festfuhr, wie die Mannschaft von unseren Leuten in Booten abgeholt, gerettet wurde, aber nur, um sie in diesem Felsen verschwinden zu lassen, wie dann der Dampfer in die Luft gesprengt wurde.
Ich schildere es nicht, weil ich selbst nicht zugegen war, dies alles erst später erfuhr. Denn zu derselben Zeit unterhielt ich mich mit einem Herrn, der sich Beireis nannte und der seine Erklärungen durch wunderbare Experimente ergänzte. Dann setzten wir unsere Fahrt nach Westen um das Feuerland fort, immer nur segelnd, langsam bei mäßigem Winde.
Es war ein schönes Wetter, wie man es selten hier unten trifft, und es war ein mir unvergesslicher Abend, von dem ich jetzt berichten will, der ihn einleitete, den Tag des Zorns.
Der Tag des Zorns!
Kennst du ihn, lieber Leser, diesen Tag des Zorns? Gehörst du der römisch-katholischen Kirche an, dann kennst du ihn selbstverständlich.
Aber man braucht auch kein Katholik zu sein, um ihn zu kennen.
Dies irae, dies illa — —
Es war ein herrlicher Abend.
Diesmal war es die Schöpfung selbst, die uns eine Zaubervorstellung gab. Von der schon untergegangenen Sonne war der östliche Horizont noch blutrot gefärbt, ganz wunderbarer Weise aber lag der Himmel im Norden bereits im dunklen Schatten, dort funkelte bereits das mächtige Sternbild des Kreuzes, noch schwärzer war der Himmel im Osten, dort wetterleuchtete es, schon zuckten die Blitze, schon grollte der Donner und im Süden schließlich flammte ein Polarlicht auf.
Wir standen an Deck und staunten und staunten. Weshalb nur behält sich der äußerste Süden der Erdkugel das Recht vor, solche Naturphänomene zustande zu bringen, hier unten, wo es gar keine Menschen gibt, um diese Zauberei der Schöpfung zu bewundern. Nur Feuerländer, die kaum den Namen von Menschen verdienen.
Ich habe zahllose Male mitten in Deutschland, nicht von hohen Bergen aus, sondern im platten Lande, mitten in der Großstadt, in Berlin, Sonnenuntergänge beobachtet, mit Färbungen des Himmels und der Wolken, die ich als Maler nicht wiederzugeben wagen würde! Weil man mir nicht glauben würde, dass es in Wirklichkeit so etwas gibt, wie ich da auf der Leinwand schildern will.
Wir standen an Deck und staunten und staunten.
Da plötzlich begannen leise Orgeltöne das Schiff zu durchziehen.
Die Töne schwollen und schwollen, und wir bekamen das Gewaltigste zu hören, was wir je von Hämmerleins Meisterhand gehört hatten.
Es war ein Oratorium. Er hatte es noch nie gespielt, auch sonst uns allen unbekannt.
Furchtbar mächtig, donnernd und brausend. Herzerschütternd, seelenzerreißend, nervenzerschneidend und dennoch wahre Musik.
Unbeschreiblich!
Diese Posaunentöne, welche diese Orgel plötzlich von sich geben konnte — wir hörten etwas ganz anderes als unsere Orgel.
Mit einem verrollenden Donner war das Stück ausgeklungen.
»Was war das?«
Atemlos wurde es überall gefragt.
Ja, wir alle hatten kaum zu atmen gewagt. Hämmerlein kam an Deck und gab die Erklärung. Dies irae — Tag des Zorns.
So lautet, nach den Anfangsworten, der Titel einer lateinischen Hymne, das jüngste Gericht schildernd, nach dem Propheten Zephania 1. Kapitel, Vers 14 bis 18.
Mit Sicherheit wissen wir nur, dass diese Hymne im 18. Jahrhundert entstanden sein muss, der Dichter ist unbekannt, man hat aber alle Ursache, für diesen den Franziskanermönch Thomas von Celsano zu halten.
Seit dem 16. Jahrhundert wurde diese Hymne in die römisch-katholische Kirchenmusik aufgenommen oder vielmehr in den Kirchendienst, sie folgt dem Requiem der Seelenmesse und des Totenamtes, in lateinischer Sprache.
Fast alle großen Komponisten haben sich an ihrer Vertonung versucht. Am bekanntesten sind die Kompositionen von Haydn und die von Mozart, obgleich mir die von Palestrina und von Winter fast besser gefällt.
»Von wem war diese Komposition der Hymne?«
Wie gewöhnlich wurde das bescheidene Männlein ganz rot vor Verlegenheit, als es gestehen musste, es sei seine eigene Schöpfung.
»Georg, wenn ich begraben werde — das lass mein Grablied sein.«
So flüsterte die Patronin.
»Helene, wie kannst Du —«
»Versprich es mir, Georg!«
»Ich verspreche es Dir.«
Hiermit war die Sache erledigt. Keine Spur von Sentimentalität dabei. Lachend hatte sie es natürlich auch nicht gesagt.
Wir fuhren von Westen her in die Magellanstraße ein, jetzt unter Volldampf, am anderen Morgen näherten wir uns dem südlichen Ufer, passierten bei fast ganz stiller See eine schmale Wasserstraße, kamen in eine Bucht.
Der Leser kennt sie — die Argonautenbucht.
Die »Argos« machte an derselben Stelle fest, wo sie schon zweimal gelegen hatte.
Laufbrett aus, die ganze Menagerie an Land! Das war immer das erste.
Der Kapitän hatte mich gebeten, ihm zu folgen. Ich weiß, nicht, was er mir zeigen wollte, habe es auch nicht erfahren.
Auch die Patronin hatte sich gleich an Land begeben. Doktor Isidor hatte gegen einen kleinen Spaziergang nichts einzuwenden gehabt.
Die beiden, der Kapitän und die Patronin, waren mir einige Schritte voraus.
»Weißt Du noch, Georg«, hörte ich die Patronin sagen, als wir uns vielleicht erst 50 Schritt von dem Schiffe entfernt hatten, uns etwas nach rechts haltend, dort wo der ganze Boden mit großen, abgerundeten Steinen bedeckt war, »weißt Du noch, Georg, wie wir zum ersten Male hierher kamen, wie die Hunde und Willy und die Marchesse unserem Boote nachschwammen, wie wir dann — ach, Georg!«
Sie hatte heiter mit lächelndem Munde gesprochen. Nur das letzte Wort hatte anders geklungen, wie ein Seufzer.
Dabei war sie plötzlich stehen geblieben, wandte sich halb um, jetzt sah ich ihr Gesicht, blühend wie immer, mit einem Male ward es schneeweiß, es sah aus, als wolle sie dem Kapitän beide Hände auf die Schultern legen, aber die Hände glitten an seinen Armen herab, so sank sie vor ihm zu Boden.
»Um Gott, Helene!«

»Um Gott, Helene!«, rief der Kapitän aus, als die
Patronin plötzlich wankte und vor ihm zu Boden sank.
Es war sein einziger Verzweiflungsschrei gewesen. Am andern Morgen zu derselben Zeit ward sie an derselben Stelle begraben.
Ich sage das so kurz, weil es tatsächlich so einfach vor sich ging.
Nicht anders, als wie man einen toten Hund verscharrt, den man nicht einmal besonders geliebt hat.
Die Leiche hatte in der Patronatskajüte gelegen. Schon nach 20 Stunden stellten sich die Leichenflecke ein, wohl das einzige sichere Zeichen, durch das man Scheintod von wirklichem unterscheiden kann, da gab der Schiffsarzt den Körper zum Begräbnis frei, was im Logbuch vermerkt werden musste.
Klothilde wusch die Leiche, zog sie an. Womit, weiß ich nicht. Viel mehr als ein Hemd wird es wohl nicht gewesen sein.
Unterdessen hatte der arabische Schiffszimmermann Hammid schon den Sarg gefertigt, wenn man den aus sechs zusammengenagelten Brettern bestehenden Kasten Sarg nennen durfte. Die bei der Arbeit abgefallenen Hobelspäne kamen hinein, auf diese die Patronin, und ich hörte das Nageln.
Nicht einmal angemalt wurde er!
Zwei Matrosen, die ersten besten, hoben den Kasten auf, trugen ihn davon, vier kommandierte Matrosen folgten mit sechs Schaufeln.
»He, Maschinist«, sagte der Kapitän so im Vorbeigehen zu mir, »nun können Sie auch noch das Eingraben überwachen.«
Ich hatte nämlich schon gestern mit einem Erdbohrer konstatieren müssen, dass es dort weder Felsen noch Grundwasser gab, dass die Stelle also geeignet war, um in einer Tiefe von nur einem Meter einen Sarg aufzunehmen. Also ich überwachte die Arbeit, wozu eigentlich, weiß ich nicht. Schweigend gruben die sechs Matrosen das Loch, ließen den Sarg an Seilen hinab, schaufelten das Loch wieder zu, stampften die Erde mit den Füßen fest.
Fertig, abrücken!
Nun, der Leser wird wohl nicht glauben, dass die Argonauten ihre Patronin wie einen toten Hund verscharrt hätten.
Aber so, wie sich es hier schildere ging es doch wirklich zu.
Dazwischen freilich wurden auch schon andere Vorbereitungen getroffen
Schon gestern hatten alle Leute bis zum späten Abend im nahen Walde Holz gefällt und gesägt, auch Exklusive wie Juba Riata und der Eskimo hatten sich eifrig daran beteiligt, und gerade bei letzterem wollte solch eine Arbeit doch etwas heißen, und heute wurde dieses Holz in acht mächtigen Haufen um den schmucklosen Grabhügel herum aufgestapelt, wozu dann noch massenhaft zerkleinertes Bretterholz vom Schiff kam.
Gegen Mittag war diese Arbeit beendet. Es wurde gegessen, dann musste alles zur Koje gehen. Und der Seemann muss auch auf Kommando schlafen können.
Um sechs Uhr wurde geweckt und Abendbrot gegessen, und dann begab sich alles an Land, alles. Mit Ausnahme von Meister Hämmerlein.
Hundertundvierzehn Männer waren es, welche den Grabhügel schweigend umstanden, dazu noch Ilse und Klothilde. Männer, sage ich — von Jungen durfte man nicht mehr sprechen.
Halb acht nach Ortszeit ging die Sonne unter.
Es war klarer Himmel, schönes Wetter, kleiner und kleiner wurde ihre Scheibe am westlichen Horizont.
»Fertig!«, rief Kapitän Stevenbrock, als der letzte Streifen der roten Scheibe untergetaucht war.
Er beugte sich, legte die Hand, in der ein Flämmchen zu sehen war, unten an den Holzstoß, neben dem er stand, gleichzeitig taten dies sieben andere Männer, und gleichzeitig schlug das lodernde Feuer aus allen acht Holzstößen empor, die mit Petroleum übergossen und mit Pech imprägniert worden waren.
Und gleichzeitig begann im nahen Schiffe die Orgel zu brausen.
Dies irae, dies illa — —
Diese Hymne, das Weltgericht schildernd, nur Gottes Zorn, nichts von Güte und Gnade wissend, passte ja durchaus nicht als Grablied, am wenigsten für diese Tote.
Denn dieser Tag ist ein Tag des Zorns, ein Tag der Trübsal und Angst ein Tag des Unwetters und Ungestüms, ein Tag der Finsternis und Dunkelheit, ein Tag der Wolken und Nebel, ein Tag der Posaunen und Trompeten.
Nein, es passt nicht für ein Begräbnis, am wenigsten passte es für dieses hier.
Was hatte denn dieses arme Weib hier mit dem jüngsten Gerichte zu tun.
Wenn die ins Gericht kam, dann — ging ich gleich freiwillig in die Hölle.
Aber sie hatte dieses Lied gewollt, und das Versprechen wurde gehalten.
Es war ja auch nur Meister Hämmerleins Musik, die sie für ihr Begräbnis bestimmt hatte.
Und als nun die Feuer aufflammten und als die ersten Orgeltöne donnernd erbrausten, da ging Kapitän Stevenbrock als erster dorthin, wo die runden Steine, die rundgewaschenen Trümmer einer eingestürzten Felswand, massenhaft lagen, vielleicht zu Hunderttausenden, es war gar nicht weit, und er hob einen gewichtigen Stein auf, und trug ihn zurück, legte ihn als ersten mitten auf den Grabhügel.
Und Hundertfünfzehn andere Menschen folgten seinem Beispiele. Und als neun Stunden später die ausgebrannten Holzstöße zusammenstürzten, als halb fünf auf der anderen Seite des Firmaments die Sonne wieder auftauchte, da erblickte sie eine gewaltige Steinpyramide von wenigstens fünfzehn Meter Höhe, die sich über den kleinen Grabhügel erhob.
Es war eine gewaltige Arbeit, die wir geleistet hatten! Neun ganze Stunden haben wir unter Feuerschein und Orgelbrausen Steine getragen und aufgebaut, ununterbrochen, ohne Hast aber ohne Rast, ohne einen Bissen zu essen, ohne einen Trunk. Dabei wanderte kein Stein aus einer Hand in die andere, sondern immer holte jeder den seinen, trug ihn hin, legte ihn an eine ausgesuchte Stelle und immer höher und höher musste geklettert werden. Und jeder suchte sich immer jenen schwersten Stein aus, wenn er ihn nur noch tragen konnte, August der Starke sowohl wie die kleine Ilse.
Neun ganze Stunden haben wir so ununterbrochen Steine getragen, sie zu einer symmetrischen Pyramide anhäufend, immer unter den brausenden Klängen der Orgel.
Auf mindestens zwanzigtausend Steine schätzte ich sie, die wir so geschleppt und aufgetürmt haben, darunter zweizentrige Blöcke.
Denn ich selbst habe meine gezählt, einhundertsechsundneunzig habe ich geschleppt, und einhundertsechzehn Personen waren wir, und ich war durchaus nicht der eifrigste gewesen — da müssen in neun Stunden, wohl zwanzigtausend Steine herauskommen. Wer hat schon solch ein Begräbnis bekommen, wem ist in einer Nacht aus zwanzigtausend Steinen solch ein Denkmal gesetzt worden?
Ich kenne in der Welt kein anderes Beispiel.
So haben die Argonauten ihre Patronin bestattet. Ganz prunklos, so einfach wie irgend möglich, so wie sie es gewünscht hatte, unter den von ihr gewünschten Orgelklängen. Nur noch eine Zugabe hatten die Argonauten gemacht, in neun Stunden, ohne einen Bissen, ohne einen Trunk, ohne ein einziges Wort dabei zu sprechen.
Und da stand sie nun, die Pyramide aus zwanzigtausend mächtigen Steinen!
»An Bord!«
Der Kapitän hatte es gerufen.
Das erste Wort nach neun Stunden.
Wir hatten nichts mitzunehmen. Denn wir hatten nichts mitgebracht, nichts.
Und doch, etwas musste zurückgetragen werden. Doktor Isidor.
Das kleine, von Alkohol ausgelangte Krummbein hatte die neun Stunden Steine geschleppt wie jeder andere. Hatte getragen, was er tragen konnte.
Gerade, wie der erste Sonnenstrahl über dem östlichen Horizonte aufgezuckt war, war er ohnmächtig zusammengebrochen.
»Kapitän«, sagte da Oskar, der ihn mit trug, »ich glaube, der hat ein Sterbchen gemacht. Dem seine Nase ist ganz aus der Fasson gekommen.«
Ja, Doktor Isidor Cohn war tot! Die Leiche wurde einstweilen im Lazarett untergebracht.
»Unser Doktor Isidor aber bekommt ein Seemanns-Begräbnis. Natürlich wird er in ein Kognakfass ingespundt, richtig in Kognak eingesetzt.«
So hörte ich einige Matrosen sprechen, und ich sah, wie nasse Augen gewischt wurden.
Beim Tode der Patronin war so etwas nicht zu bemerken gewesen.
»Dampf auf!«
Unter den Kesseln hatte die ganze Nacht kleines Ölfeuer gebrannt, es wurde verstärkt, und schon zehn Minuten später war volle Dampfspannung vorhanden.
Wir hatten allen Grund, die Bucht schnellstens zu verlassen.
Diese seit Tagen anhaltende Windstille war in dieser Gegend etwas ganz Phänomenales, das musste sich rächen, und jede Minute konnte denn auch der Tanz losgehen.
Ja, die Sonne war in strahlender Pracht aufgegangen. Aber dort der helle Streifen am östlichen Horizont war auch das einzige, was man noch vom blauen Himmel sah. Sonst war er wie von einer Bleimasse verdeckt, die sich schwärzer und schwärzer färbte, man dachte unwillkürlich an Blei, denn etwas wie schweres Blei lag in der ganzen Atmosphäre.
Irgend etwas Fürchterliches stand in der Schöpfung bevor. Wohl lagen wir in dieser Bucht gesichert, aber wenn es losbrach, konnten wir nicht mehr durch die enge Wasserstraße hinauf, dann mussten wir vielleicht wochen- und selbst monatelang untätig hier liegen, ehe wir eine Durchfahrt wieder wagen durften.
Hatten wir einmal das offene Wasser erreicht, dann mochte Sturm und See toben wie sie wollten; genügend von der Küste entfernt, hat ein wackeres Schiff wie das unsere doch nichts zu fürchten.
So dachten wir! Wir Menschlein!
Wir erreichten das freie Wasser, kamen außer Gesichtsweite der Küste.
Dann brach es los.
Aber nun wie!
Wenn man so etwas beobachten könnte, so würden wir ein höchst interessantes Naturphänomen beobachtet haben, das es übrigens auch im nördlichen Deutschland gibt.
Bist Du, lieber Leser an der Ostsee gewesen, wenn auch nur als Badegast, hast Dich aber noch für anderes interessiert als nur für die Arrangements der Badeverwaltung, für Toiletten, Flirt und dergleichen?
Dann hast Du vielleicht auch schon vom sogenannten »Seebär« gehört, einem Naturphänomen, das wohl auch anderswo auf der Erde vorkommt, hauptsächlich aber in der Ostsee beobachtet, studiert worden ist, während man es in der benachbarten Nordsee gar nicht kennt. Nach windstillen Tagen ist das Meer glatt wie ein Spiegel. Allerdings bereitet sich in der Atmosphäre etwas vor, man darf einen baldigen Sturm erwarten.
Da plötzlich steigt irgendwo im Meere ein gewaltiger Wasserberg empor, und zwar unter einem furchtbaren Brüllen, die ganze Umgegend in eine tobende Flut verwandelnd, und gleichzeitig kommt ein orkanartiger Sturm einhergebraust, oder er kommt vielmehr wie von allen Seiten herangerast, schnell wieder aussetzend, also böenartig, dann sich nach einer gewissen Richtung als Wirbelsturm fortsetzend und nun natürlich das ganze Meer in Aufruhr bringend.
Das ist der Seebär. Früher haben die Küstenbewohner und Schiffer geglaubt, im Meere hause ein bärenartiges Ungeheuer, das steige manchmal brüllend empor, daher der Name.
Sie sind selten, diese Seebären. Manchmal vergehen Jahrzehnte ehe einer beobachtet wird, wobei freilich zu bedenken ist, dass doch nicht jeder gesehen wird. Das letzte Mal wurde dieses Naturphänomen in der Nacht vom 16. zum 17. Mai 1888 in der Ostsee beobachtet.
Unsere Vorväter an der Waterkant waren mit ihrer Erklärung, es sei ein riesenhaftes Meerungeheuer, das brüllend aufstiege, fix und fertig. Das zurückfallende Wasser musste doch einen luftleeren Raum bilden, das heißt, die Luft musste nachströmen, daher nach der Windstille der plötzliche Sturm, von allen Seiten kommend. Das ist natürlich eine Fabel. Schade nur, dass unsere Gelehrten bis heute noch keine andere Erklärung für dieses Phänomen gefunden haben.
Das heißt, das Heer der Wissenschaft ist in zwei große Lager geteilt.
Die eine Partei behauptet es fände ein Erd- oder vielmehr Seebeben statt, die Ostsee habe vulkanischen Boden. Dann kommt also weiter die Theorie der nachströmenden Luft nach dort in Betracht, wo der Wasserberg wieder zusammengebrochen ist.
Hiervon will die andere Partei nichts wissen. Die Ostsee hat keinen vulkanischen Boden. Im Jahre 1888 besaß man schon ganz vortreffliche Seismometer — der erste dieser Apparate, welche Erdbeben anzeigen und die Schwingungen aufzeichnen, ist bereits von dem Italiener Salsano konstruiert worden — und in der Nacht vom 16. zum 17. Mai ist nirgends an den Küsten der Ostsee ein Erd- oder Seebeben gemeldet worden. Dass erst der Wasserberg emporsteige und dann der Sturm einfalle, sei eine Täuschung. Erst entsteht der Wirbelsturm dadurch, dass die heiße Luft, die bisher nicht in die Höhe kommen konnte, plötzlich emporsteigt, dort strömt alle Luft der Umgebung zusammen, mit so furchtbarer Gewalt, dass das Wasser berghoch mit emporgerissen wird, und dass das Wasser beim Emporsteigen brüllt, ist ebenfalls eine Täuschung, es brüllt beim Zusammenstürzen! Das ist die ganz einfache Erklärung. Jawohl, ganz einfach! Nun, meine Herren, warum kennt man denn dieses Phänomen nicht auf der benachbarten Nordsee? Einmal müsste es doch auch dort beobachtet worden sein!
Nein, meiner Überzeugung nach handelt es sich dabei um ein ganz regelrechtes Seebeben — ob die Ostsee nun vulkanischen Grund hat oder nicht.
Das ist eigentlich sogar schon bewiesen. Die Gegenpartei ignoriert nur immer diesen Beweis.
Der gewaltigste Seebär, dem viele Schiffe zum Opfer fielen, wurde am 1. November 1755 von Lübeck aus beobachtet. Die Lübecker Chronik erzählt ganz ausführlich davon, was dieser Seebär für Opfer gefordert und Schaden angerichtet hat, auch noch weit über die Küste ins Land hinein, alles überflutend und mit zurückreißend.
Und am 1. November 1755 wurde bekanntlich Lissabon von jenem fürchterlichen Erdbeben heimgesucht, wobei das Meer plötzlich meilenweit zurücktrat, überhaupt ganz verschwand, bis es plötzlich wieder als eine ungeheure Wassermauer angebrüllt kam und beim Zurückgehen nahm es mehr als dreißigtausend Menschen für immer mit!
Na also!
Dieses Zusammentreffen eines regelrechten Erdbebens in Portugal, das alles einstürzen ließ, das aber auch im Meere einen regelrechten Seebären erzeugte, und dieser fast gleichzeitige Seebär in der Ostsee, das ist doch nicht etwa nur ein Zufall gewesen!
Es war vormittags gegen elf. Fast möchte ich es nicht schildern, denn Alles, was ich beschreiben kann, verblasst gegen das, was wir in Wirklichkeit erlebten. Dafür gibt es keine Worte.
Der Tag hatte sich in finstere Nacht verwandelt.
Wir dampften volle Fahrt östlichen Kurs, wie auf einem Teiche.
Plötzlich hörte ich auf Steuerbordseite ein fürchterliches Brüllen — es war ein Brüllen, anders kann ich nicht sagen — und da plötzlich stand der ganze Himmel in Flammen, ich glaubte, der Donner habe einmal schon vor dem Blitze gebrüllt, sonst konnte ich mir dieses schreckliche Brüllen ja gar nicht erklären — — da aber sah ich in diesem Himmelsfeuer unter mir auf Steuerbordseite plötzlich das ruhige Wasser sich auftürmen, immer höher und höher. Ich starrte und starrte.
Über mir ein donnerndes Krachen, unter mir jenes furchtbare Brüllen.
Dass unser Schiff bereits mit ungeheurer Schnelligkeit nach Norden davongewälzt wurde, mit der Breitseite, das merkte ich gar nicht.
Plötzlich aber fing es wie ein Kreisel sich um sich selbst zu drehen, und nun dazu noch ein anderer Ton, ein Heulen in der Atmosphäre, und nun noch dazu — —.
Nein, ich kann es nicht beschreiben.
Ich wusste nichts mehr von mir. Obgleich ich nicht etwa bewusstlos war.
Weiß nicht, ob wir nur einige Minuten oder Stunden lang so seitwärts getrieben worden sind, uns dabei immer im Kreise drehend. Die Zeit war plötzlich für mich stille gestanden.
Die Ewigkeit war angebrochen.
»Das ist der Welt Untergang!«
Weiter dachte ich nichts. Vielleicht nur einen Moment, für mich eine Ewigkeit.
Und wie ich das dachte — »das ist der Welt Untergang, das ist der Welt Ende!«, — da plötzlich mischte sich in das Donnern und Krachen und Brüllen noch ein anderer Ton.
Da plötzlich fängt die Orgel zu spielen an.
Dies irae, dies illa — —
O Tag des Zorns, o Tag des Grimms!
Und da plötzlich ein schmetternder Krach, meine linke Hand wurde gepackt und ich in die Nacht der Vergessenheit geschleudert.
Als ich die Augen wieder aufschlug, lachte am blauen Himmel die Sonne. Ich lag auf einem ebenen Steinboden, hier und da erhoben sich Felsen, und dort unten brandete das Meer, nicht eben so furchtbar.
Dort rechter Hand war ein niedriger Buchenwald. Ach, und was ich nun sonst um mich herum erblickte! Nur wenige Schritte von mir entfernt — das war das erste, was ich sah — lag ein Menschenknäuel.
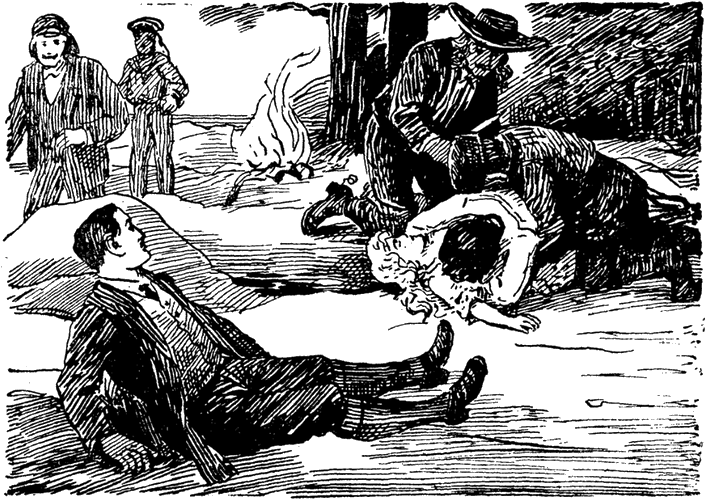
Ich erkannte Klothilde, sie lag quer über der kleinen Ilse, hatte diese mit den Armen umklammert, und über diese beide wieder lag der Eskimo, hatte seinen linken Arm um Klothilde geschlungen, und daneben kniete Juba Riata und war beschäftigt mit einem langen Jagdmesser — seines Freundes rechten Arm abzuschneiden!
Dicht oben an der Achsel!
Hatte nur noch Fleisch und Sehnen zu durchschneiden.
Und dann, wie dies geschehen, wie das Blut in Strömen floss, sprang Juba Riata auf, nach dem Holzfeuerchen, das dort brannte, in dem mit dem einen Ende ein kurzer Baumknüppel oder ein dicker Ast schwebte.
Diesen Feuerbrand herausgezogen, ihn mehrmals auf den Felsboden gestampft, dass die Funken stoben, wieder hingesprungen und schnell das rotglühende Kohlenende gegen den blutenden Armstumpf gepresst.
Der Eskimo bewegte sich etwas und stöhnte furchtbar. Ich stöhnte mit ihm.
Ich fühlte seinen furchtbaren Schmerz mit ihm.
Nur merkwürdiger Weise in den Fingern meiner linken Hand.
Wie ich den Arm hob, die linke Hand, sah ich, dass Mittel- und Zeigefinger als formlose Masse herabhingen.
»Was ist mit ihnen?«
Kapitän Stevenbrock hatte es gesagt, neben mir auftauchend.
Er nahm meine Hand beim Gelenk.
»Tja, da is nischt zu machen.«
»Fertig!«, sagte Juba Riata und stand auf, kam auf uns zu.
Nur einen Blick auf meine Finger geworfen.
»Halten Sie ihn fest.«
Plötzlich umschlang mich der Kapitän von hinten, zugleich mein linkes Handgelenk mit eisernem Griff packend, es auf einen flachen Stein niederdrückend.
»Um Gott, da ist ja Ilse!«, flüsterte er.
Er sah das Kind erst jetzt unter Klothilde liegen, hatte also überhaupt noch gar nicht gewusst, ob es vom Meere ausgespien worden war, und wie konnte er jetzt wissen, ob Ilse noch lebe.
Aber er sprang nicht etwa sofort hin, er ließ mich nicht los.
Juba Riata ordnete meine beiden zerquetschten Finger auf der Unterlage, setzte sein Messer an, nahm einen Stein, schlug kräftig auf die Klinge — das waren meine beiden Finger.
Ich brüllte auf und verlor das Bewusstsein.
Dann fühlte ich nochmals einen furchtbaren Schmerz, als die beiden Stummel ausgebrannt wurden, fühlte die Glut aber mehr im Gehirn als an der Hand, und es war auch nur ein Moment, dann fiel ich in noch tiefere Ohnmacht.
Man darf dies alles nicht gar zu schrecklich finden. Das Betäuben bei Operationen ist erst ums Jahr 1840 eingeführt worden, erst mit Äther, sieben Jahre später mit Chloroform. Vorher kannte man so etwas noch gar nicht. Und wie geht es denn noch heute in jedem Kriege zu! Auf und hinter dem Schlachtfelde sind nicht immer narkotische Mittel zur Stelle, da wird eben losgeschnitten, und das beste Antiseptikum ist noch immer Feuer. Und der Mensch hält nicht mehr aus, als wie er eben vertragen kann, dann sorgt die Natur schon dafür, dass er nichts mehr fühlt. In anderer Hinsicht freilich ist es ja schrecklich genug.
Fünf Tage lag ich im Wundfieber, nur selten zur Besinnung kommend und hatte dann für meine Umgebung gar kein Interesse.
Als ich wieder richtig zu mir kam, mich auf alles besinnen konnte, lag ich auf einem ungegerbten Guanakofelle, das auf dem Grase unter den dichten Zweigen einer niedrigen Buche ausgebreitet war.
Rings um mich herum lagen noch andere Patienten, denen zum Teil Gliedmaßen fehlten, sonst mit geschienten Beinen und Armen oder sonstigen Verbänden.
Ich will sie nicht namentlich anführen, die ich hier erblickte, nur wenn es so die Gelegenheit mit sich bringt.
Im Augenblick interessierte mich auch am meisten Mister Tabak, der gerade zwischen den Bäumen anspaziert kam, auf der linken Schulter eine Lanze, ein junger Baumstamm, nur mit dem Messer zugespitzt und im Feuer angekohlt, an die er einen prächtigen fast meterlangen Lachs angespießt hatte, und es wäre doch nicht Mister Tabak gewesen, wenn er nicht gequalmt hätte. Freilich aus einer sehr primitiven Naturpfeife. Ein Stück Schilfrohr, daran ein kurzes Stück Holz, ein Ast, der im rechten Winkel doppelt durchbohrt war.
Hatte ich denn bei meinem Erwachen nur geträumt? Nein. Nicht umsonst trug der Eskimo die Lanze auf der linken Schulter. Der rechte Arm fehlte ihm, dort hatte er an der Achsel nur eine dicke Kugel, einen wulstigen Verband.
»Armer Tabak!«, sagte ich erschüttert.
Weil ich eben meine Umgebung noch nicht näher gemustert hatte.
Der Eskimo hatte es gehört, blieb vor mir stehen.
Er hatte meine Worte falsch verstanden, bezog den Namen auf den Inhalt seiner Pfeife, und, des Deutschen doch nicht so völlig mächtig, nahm er das Wort »arm« wohl für »armselig«.
»Wat? Schlechter Tabak wäre das? Sie denken wohl, ich rauche getrocknetes Moos wie die anderen? Nee, da ist unsereins schlauer. Als ich merkte, dass die Sache kladrig gehen würde, polsterte ich mich schnell noch hinten und vorn mit Tabak aus.«
Ich ließ ihn in seinem Irrtum, dass ich das von ihm gerauchte Kraut schlecht gemacht hatte.
»Wann war das denn?«
»Als wir hier ausstiegen? Vor fünf Tagen.«
»Und Sie können schon wieder auf den Fischfang gehen?«
»Warum denn nicht? Der Stumpel heilt gerade so gut, wenn ich spazieren gehe als wenn ich immer liege. Sie meinen, ob mir der rechte Arm fehlt? Nee. Ich schmeiße mit dem linken genau so gut. Na ja, fehlen tut er mir ja ein bisschen. Ich weiß immer nicht, wie ich die Schnupftabaksdose halten soll, wenn ich eine Prise nehmen will. Aber daran gewöhnt man sich schon mit der Zeit.«
»Glücklicher, beneidenswerter Mensch!«
»Was ist von unserem Schiffe übrig geblieben? Hat es Tote gegeben? Wo sind wir hier?«
»Hören Sie, das lassen Sie sich gefälligst von einem anderen erzählen. Ich hab's schon dreimal getan, ich habe die Geschichte satt.«
Sprach's und ging davon.
Ich sollte es aus des Kapitäns eigenem Munde erfahren, ich war der einzige, dem er davon so ausführlich berichtete.
Aber nun wie er es tat, diese eigentümliche Einleitung! Ich hielt den Kapitän zuerst für irrsinnig.
Kaum war der Eskimo gegangen, als Kapitän Stevenbrock kam, gleich direkt auf mich zu.
»Na, Ebert, wie geht's, wie steht's? Was macht Ihre lädierte Pfote?«
Das war es nicht, weshalb ich ihn für etwas irrsinnig hielt. Solche Ausdrucksweise wird man an Bord des Schiffes schnell gewöhnt. Dass auch alle anderen, ob sie nun jetzt Krüppel waren oder nicht, die ganze Geschichte so auf die leichte Achsel nahmen, sich deshalb um keine Linie verändert hatten, davon werde ich noch später berichten.
Ich hatte ein merkwürdiges Gefühl in der verbundenen Hand, nichts weiter.
»Sagen Sie mal, mein lieber Ebert — —«
Der Kapitän streckte sich neben mir im Grase aus, holte eine halbe Platte Kautabak aus der Tasche, biss, ab, blinzelte behaglich mit den Augen. »Sagen Sie mal, mein lieber Ebert — wie hat Ihnen damals die Geschichte im Lande der Zwerge und der Riesen gefallen?«
Ja, diese Frage freilich ließ mich ganz an dem gesunden Verstand des Kapitäns irre werden. Denn man bedenke nur die ganze Situation. Und jetzt, wie mich der Kapitän zum ersten Male bei vollem Bewusstsein findet, fängt der sofort von jener Illusionskomödie an!
Was sollte ich davon denken?
»Ich will Ihnen etwas sagen«, fuhr er gleich von selbst fort, ohne meine Antwort abzuwarten, »diese ganze Geschichte, die Sie da scheinbar erlebt haben, ist nämlich auf besondere Weise entstanden. Denn entworfen muss so etwas doch erst werden. Die inneren Glaswände der Kugel werden gewissermaßen oder auch wirklich besprochen, so wie doch erst die Walze oder Platte eines Grammofons besprochen werden muss. Es geschieht ja bei der Illusionskugel in ganz anderer Weise, die ich Ihnen jetzt nicht erklären kann, aber im Prinzip ist es doch dasselbe.
Diese ganze Komödie ist also erst entworfen und ausgearbeitet worden. Und zwar von uns selbst, von uns Argonauten, von der ganzen Mannschaft. Oder doch von denen, die sich daran beteiligen wollten. Und zwar in der Weise, dass jeder seinen Senf dazu gab, ohne dass die anderen davon wussten. Wie das gemacht wurde, kann ich Ihnen nicht weiter schildern. Sie verstehen mich schon. Als Hauptthema war dabei aufgegeben worden, der Mann, der sich in die Kugel setzt, soll Abenteuer im Lande der Zwerge und der Riesen erleben, in Anlehnung von Swifts phantastischer Erzählung »Gullivers Reisen«.
Besonders ausführlich wurden die Abenteuer im Lande der Riesen behandelt.
Sie haben ja alles selbst erlebt.
Nun sagen Sie, Ebert, war das, was Ihnen da vorgemacht wurde, eine Wiederholung von Gullivers Abenteuern? Haben wir den Verfasser Swift bestohlen? War es eine direkte Nachahmung?«
»Durchaus nicht!«, entgegnete ich. »Es war nur eine Anlehnung an jene bekannte Erzählung, aber durchaus keine Imitation. Alle Abenteuer, die ich erlebte, alle Situationen, in die ich versetzt wurde, es war alles durchaus originell.«
»Aha, originell!«, rief der Kapitän mit sichtbarer Befriedigung. »Sehen Sie, mein lieber Ebert, das ist, was ich von Ihnen hören wollte, zu hören hoffte. Originell!
Sie sind doch nun lange genug bei uns. Sie werden zugeben, dass auch sonst bei modernen Argonauten alles originell ist. Wir haben niemals ein Vorbild gehabt, das wir zu imitieren suchten. Immer Original! Nun haben wir unser Schiff verloren. Sagen Sie, Ebert, wenn Sie auch noch selbst keinen Schiffbruch erlebt haben, Sie haben doch sicher schon Schiffbrüchige schildern hören, von Augenzeugen, haben Berichte gelesen, haben in Romanen und dergleichen erfundene Schiffbrüche gelesen, geschrieben von Stümpern oder von gottbegnadeten Dichtern — aber ist nicht auch dieser unser Schiffbruch, den wir Argonauten erlitten, durchaus Original?«
Aha, nun wusste ich, wo hinaus der Kapitän wollte, wozu erst jene Einleitung. In der Tat, er hatte recht, und selbst diese seine Einleitung war originell. Dabei will ich gar nicht von dem Begräbnis der Patronin sprechen.
»Wir haben hier in der Magellanstraße einen Seebären erlebt!«, fuhr der Kapitän fort.
»Sie wissen, was das ist, ein Seebär, wir haben uns einmal ausführlich darüber unterhalten.«
Man hat Seebären hauptsächlich in der Ostsee und sonst nur noch an der Westküste von Mexiko beobachtet.
Dass auch hier unten so etwas schon einmal vorgekommen ist, davon ist mir nichts bekannt.
Nun, Seebären werden wohl überall vorkommen, wo der Meeresboden vulkanisch ist.
Aber wir haben die Ehre gehabt, einen Seebären hier in der Magellanstraße dicht neben unserem Schiffe entstehen zu sehen, wir haben ihn in nächster Nähe brüllen hören. Er hat uns sozusagen direkt ins Gesicht gebrüllt.
Dieser brüllende Seebär hat uns mit unheimlicher Schnelligkeit, von der wir uns vielleicht gar keinen Begriff machen können, nach Norden davongetragen.
Wenn ich mir überlege, so müssen wir in der Stunde mindestens vierzig Knoten gemacht haben, wahrscheinlich aber sogar fünfzig, und das ist eine Fahrt, die noch kein einziges Schiff in der Welt gemacht hat. Unsere ›Argos‹ hatte also die Ehre, die schnellste Fahrt gemacht zu haben, die je ein Schiff gemacht hat!
Und dabei hat es sich auch noch wie ein Kreisel um sich selbst gedreht!
Unsere ›Argos‹ ist an der Felsenküste Patagoniens zerschmettert.
Sie muss wie ein hohles Ei zerdrückt, nein sie muss in Atome zersplittert sein. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Der Anprall war gar zu ungeheuerlich.
Sagen Sie mal, mein lieber Ebert, wo sind denn nun die Trümmer von unserem Schiffe?«
Ich blickte den Kapitän an, der gar so eigentümlich sprach, und dann blickte ich dorthin, wo ich das Meer in der Nachmittagssonne glänzen sah.
Die Küste war felsig und flach, also nicht gebirgig, meine ich, Riffe und Klippen schienen zu fehlen.
»Ja hat man denn keine Trümmer gefunden?!«
»Nichts, nichts, absolut gar nichts!«
»Ja, wie ist denn das möglich?!«
»Das frage ich eben Sie. Ich will Ihnen aber gleich die Erklärung geben, die wir uns zurecht gelegt haben.
Wir sind eben vor dem Seebär hergerollt, von der furchtbaren Flutwelle getragen.
Das Schiff zerbarst mit einem schmetternden Krach in Atome.
Gewiss, es müssen Trümmer an Land geschleudert worden sein.
Aber die Flutwelle rollte nach, überflutete die ganze Küste und riss alles wieder mit ins Meer hinein. Sicher sind auch die drei Masten sofort abgeknickt, aber sie hingen doch am Tauwerk, und auch sonst war alles gut befestigt, und so ist eben alles an diesem Tauwerk wieder zurückgerissen worden. Wir haben bisher auch nicht eine einzige Pütze gefunden.
»Ja, wie sind wir Menschen denn da dem Tode entgangen?«
»Einfach dadurch, weil wir nicht angelascht waren. Hätten wir uns festgebunden, so wie es immer in Büchern beschrieben wird, wenn einmal ein Schiff so in Sturm und Not kommt, wenn sich die haushohen Wogen über das Deck ergießen, alle binden sich an den Mastbäumen und sonst wo fest, wies ja aber in Wirklichkeit niemals vorkommt — nun dann wären wir natürlich ebenfalls von der Flutwelle mit zurückgerissen werden.
Aber wir haben glücklicherweise solch einen Unsinn nicht gemacht, uns anzulaschen. Und so sind wir denn sämtlich in weitem Bogen durch die Luft geflogen.
Wir sind, alle an Deck stehend, von dem Schiffe abgeschleudert worden.
Ungefähr so, wie ein Reiter abgeschleudert wird, wenn ein Pferd über eine Hecke oder einen Graben springen will, im letzten Augenblicke, schon zum Sprunge ansetzend, besinnt es sich anders, es stoppt ab, vermag stehen zu bleiben, der nicht ganz sattelfeste Reiter aber muss kraft des Beharrungsvermögens über den Pferdekopf hinaus eine Reise durch die Luft machen. So sind auch wir sämtlich von unserem Schiffe abgeschleudert worden. Und zwar so weit, dass die nachstürzende Flutwelle uns nicht mehr erreichen konnte. Die weiteste Reise scheint der Matrose Franz gemacht zu haben, der fand sich dann 126 Meter von der Küste entfernt auf dem Boden liegen. Die Strecke ist genau ausgemessen worden. Und dabei hat der Kerl das unverschämte Glück gehabt, dass er sich nicht einmal den kleinen Finger verstaucht hat. Ein Riss in der Backe, nichts weiter. Na, Ebert, ist das nicht ein origineller Schiffbruch gewesen?«
Ich schloss die Augen und stöhnte. Plötzlich fühlte ich meine mir abgehackten Finger wieder, sie schmerzten.
Aber ich stöhnte aus einem anderen Grund.
Auch ich fühlte mich wieder durch die Luft sausen, obgleich ich selbst damals doch gar nichts davon gemerkt hatte.
Die ganze Tragik dieser furchtbaren Katastrophe packte mich eben noch einmal an, oder eigentlich sogar zum ersten Male.
»Ja, mein lieber Ebert, wir haben ein fabelhaftes Schwein gehabt!«, fuhr der Kapitän in seiner gemütlichen Weise fort. »Ein paar Arme und Beine hat's gekostet, ein paar gebrochene Knochen, ein paar tüchtige Quetschungen. Kunos Nasenbein ist dabei flöten gegangen. Jakob kann sich nur gleich ein künstliches Gebiss machen lassen, am übelsten hat's dem kleinen Fritz mitgespielt, der hat einen doppelten Schädelbruch davongetragen, aber ich glaube, wir bringen den Jungen doch noch durch, wir leimen seinen Schädel wieder zusammen. — Ebert, halten Sie so etwas denn nur für möglich? Ist das nicht alles originell gewesen?«
»So hat also niemand dabei seinen Tod gefunden?!«, begann ich jetzt wirklich zu staunen.
»Meister Hämmerlein war der einzige, der sich zur Zeit der Katastrophe noch unter Deck befand. Der ist natürlich hops gegangen. Fängt das Männchen noch einmal zu orgeln an! Na, er hat seine Orgel eben nicht in Stich gelassen, ruht jetzt zwischen ihren Trümmern, zwischen seinen Orgelpfeifen mit auf dem Meeresboden, und wir werden diesem Helden eine Pyramide in unserem Herzen setzen.
Sonst war nur noch Doktor Isidor unten im Raume. Na, der war ja so wie so schon eine tote Leiche.
Ja, und dann fehlt noch einer.
Wir haben ihn noch nicht finden können.
Brauchen auch nicht mehr nach ihm zu suchen.
Der ist für immer futsch!
Der ist nun auch drüben im großen Hafen.
Der ist bei seiner — —«
Immer unsicherer war des Kapitäns Stimme geworden, immer mehr zitterte sie. Und dann neigte er langsam den Kopf, legte langsam die Hände vors Gesicht.
»Hans — mein Hans — ach mein Hans!«, erklang es schluchzend.
Und da, wie ich diesen Kapitän Stevenbrock neben mir in seine Hände weinen sah, wie ich diese Worte schluchzen hörte, wie er die hervorbrachte — »ach mein Hans!« — da habe ich in meinem Lebens die furchtbarste seelische Erschütterung gehabt. Da fühlte ich, wie mein Herz förmlich zermalmt wurde.
Das Schicksal hat es gewollt, dass ich später noch einmal an dem Sterbebett meines einzigen Kindes stehen musste.
Es war mein ein und mein alles, und ich musste es sterben sehen.
Da aber bin ich nicht so zermalmt worden wie damals, als ich diesen eisernen Mann neben mir so um den Tod eines Matrosen weinen sah!
Elf Tage haben wir hier an Patagoniens Küste gelegen. Wir entbehrten nichts. In dem Buchenwalde, dessen Ausdehnung wir nicht erforscht haben, wimmelte es von Vögeln, sogar von chilenischen Papageien, die hier brüteten, sie lieferten uns Fleisch und Eier in Überfluss, ein Bach mit kristallklarem Wasser versorgte uns mit Forellen und Lachsen, ab und zu wurde auch ein Hase oder gar ein Guanako erlegt, wir lebten geradezu lukullisch. Und es war Hochsommer, in dieser Zeit fällt hier kein Regen, wir hatten nicht einmal nötig, für die Schwerkranken ein Zelt zu errichten. Am elften Tage wurde ein Dampfer gesichtet, der nach Westen steuerte.
Wir Schiffbrüchigen hatten es gar nicht so eilig, ihn um Hilfe zu rufen, dass er uns abholte.
Da wurde der alte Kasten erst ganz eingehend betrachtet und beraten, ob oder ob nicht.
Nämlich ob er auch das genügend an Bord hatte, was uns fehlte.
Wir entbehrten nichts, hatte ich gesagt.
Ja, wir entbehrten doch etwas, und wie!
Dasjenige, ohne was sich ein Seemann heutzutage die ganze Seefahrerei gar nicht mehr vorstellen kann.
Den Tabak!
Fast jeder hatte ja etwas Tabak in der Tasche gehabt, aber länger als zwei Tage reichte der Vorrat bei keinem, und dann waren noch die zu bedenken, die gar nichts bei sich gehabt hatten. Nur der Eskimo hatte sich, wie er selbst geschildert, reichlich verproviantiert, als er irgend eine Katastrophe schon kommen sah, hatte sich zwischen Haut und Kleidung mit ungefähr fünf Pfund Tabak ausgepolstert.
Er stellte ja seinen Schatz gleich der Allgemeinheit zur Verfügung, aber gern tat ers nicht, das sah man ihm gleich an, und das konnte man ihm auch gar nicht verdenken. Tabak ist Tabak, er spielt im Leben des Seemanns eine Rolle, die nur der zu würdigen weiß, der schon selbst als Seemann gefahren ist. Wenn in einer Seemannserzählung nicht auch die Tabaksfrage behandelt wird, dann weiß man sofort, dass sie von einem Skribifax hinterm Ofen erfunden worden ist. Dann könnte er aber auch gleich ein Schiff schildern, das beim Verlassen des Hafens aus Versehen Wasser und Proviant mitzunehmen vergessen hat. Bei einem Schriftsteller wie etwa Friedrich Gerstäcker hingegen, der selbst alles durchgemacht hat, wird man ständig den Tabak erwähnt finden, und wenn er einen Seemann schildert, oder etwa einen Mississippischiffer, so wird er auch ständig dessen Tabakkauen erwähnen, weil er sich den beim Schreiben in seiner Erinnerung so wenig ohne tabakkauenden Mund vorstellen kann, wie ein uniformschwärmender Backfisch einen Leutnant ohne Säbel.
Also der Eskimo stellte seinen Tabaksvorrat zwar sofort der Allgemeinheit zur Verfügung, aber gern tat er es nicht, und nun wurde sein Angebot auch nicht gleich angenommen, so lüstern auch jeder nach dieser Leckerei oder vielmehr Würze des Lebens war, sie wollten sich mit trockenem Moos, Laubblättern und dergleichen feinen Sorten begnügen, bis es Kapitän Stevenbrock kurz machte, den Vorrat für Gemeingut erklärte und ihn in mehr als hundert gleiche Portionen teilte, auch Klothilde bekam ihren Teil, wofür sie auch bei dieser höchst umständlichen Aufteilung half.
Nun konnte jeder nach Gutdünken machen, was er wollte, seine 25 Gramm Tabak als sorgloser Verschwender entweder sofort verkonsumieren oder diese 25 Gramm mit einigem Pfund trockenem Moos, Buchenblättern oder Heu mischen. Wer aber zu den Verschwendern gehörte, der bekam später auch nichts von seinem besten Freunde, er mochte stehen und auf den Knien herumrutschen wie er wollte, das wurde gleich ausgemacht.
Jedoch wurde noch ein besserer Ersatz gefunden. Die Kartoffel stammt ja aus Chile, und sie kommt auch noch hier im südlichsten Patagonien wild vor. Die Knollen sind zwar ungenießbar, die eigentliche Kartoffel ist eine Veredelung durch Kultur, aber die Blätter sind dieselben. Wir fanden solche Kartoffelpflanzen massenhaft, die Blätter wurden getrocknet und einem Schnellgärungsprozess unterworfen, und so wussten wir die Tabakskalamität einigermaßen zu beseitigen. Wenn auch der Sturm tobte und wir in mancher Nacht schauderhaft froren, dann wurde eine Schilfpfeife mit edlem Kartoffelkraut gestopft und losgedampft, und alles war all right.
Jetzt am elften Tage also wurde ein Dampfer gesichtet.
»Macht er noch eine weite Reise, die er unseretwegen nicht unterbricht und die Mannschaft ist nicht genügend mit Tabak versehen, dann verzichten wir und warten auf eine bessere Gelegenheit. Kartoffelkraut ist immer noch besser als zerzupftes Tauwerk.«
So wurde in der Beratung ausgemacht.
Nun handelte es sich aber erst darum, ob wir uns dem Dampfer, der sich doch sehr weit von der Küste entfernt hielt, auch bemerkbar machen konnten.
Ja, es gelang uns. Der Dampfer zeigte als erste Antwort seine Flagge, schon mit bloßem Auge erkenntlich.
O weh, ein Portugiese!
Höchstens zweimal in der Woche Fleisch, nicht einmal täglich warmes Essen, meist nur Hartbrot mit getrockneten Feigen, Oliven und dergleichen Zeug, Knackmandeln und Rosinen nicht zu vergessen, was ein germanischer Magen in gesättigtem Zustande eben nur als Nachtisch betrachtet.
Nun, die Beköstigung war das Wenigste, wir brachten unseren eigenen Proviant gleich mit. Dass wir nicht gerade auf einen Passagierdampfer kommen würden, damit hatten wir doch von vornherein gerechnet, und wir waren mehr als hundert Menschen, die brauchten täglich einige Zentner Nahrung, und nach langer Reise haben es Frachtdampfer manchmal nicht mehr so übrig.
Wir hatten uns die meiste Zeit mit Jagd und Fischfang vertrieben, hatten ein Räucherhaus gebaut, an zahllosen Stangen hingen viele Hunderte von geräucherten Vögeln und getrockneten Fischen, die wollten wir dann mitnehmen.
Aber der Tabak!
Und diese Portugiesen und Spanier drehen sich doch nur ab und zu ein Zigarettchen, die Stummel werden sorgfältig gesammelt und wieder zu einer neuen Zigarette verwendet, und danach sind diese Kerls auch mit Tabak verproviantiert.
»Auf diesen Portugiesen gehen wir nicht, und wenn wir auch noch vier Wochen hier Kartoffelkraut qualmen sollen!«
»Wir können uns ja genug Kartoffelblätter mitnehmen!«, meinte jemand.
»Dann können wir aber auch gleich hier bleiben.«
Natürlich, so war's!
Nun, erst musste doch einmal signalisiert werden, so weit war der Dampfer unterdessen vorsichtig herangekommen, dass er unsere Semaphorzeichen, die wir mit Fahnen gaben, aus Stöcken und Hemdstücken hergestellt, erkennen konnte.
Kapitän Stevenbrock meldete den Schiffbruch der Hamburger »Argos«.
»Wollt Ihr abgeholt sein?«
»Bitte Name.«
»Rondinella, Lissabon, Kapitän Cigogna.«
Merkwürdig! Der Dampfer hieß Schwalbe — rondinella — und wurde von — einem Storche geführt — cigogna.
»Wohin?«
»Valdivia.«
»Wir sind 113 Personen.«
»All right.«
Na, nach Valdivia war es nicht weit, bis dahin gedachte uns dieser portugiesische Kapitän Storch schon durchzufüttern, natürlich alles gegen reichliche Bezahlung.
»Habt Ihr Tabak für uns?«
Auch diese Portugiesen waren Seeleute, auch ihnen konnte diese Frage nicht etwa merkwürdig vorkommen.
»Brasilianischen Tabak geladen.«
Haaah!
Aus des Eskimos' Mundwinkeln lief gleich die Sauce heraus.
»Nehmt uns an Bord. Georg Stevenbrock, Hamburg und New Orleans! Kapitän und Reeder, bin gut für alles.«
Noch einige Fragen wegen der Landungsverhältnisse, und dann stellte es sich heraus, dass von den vier auf dem Dampfer vorhandenen Booten überhaupt nur eine einzige Jolle seetüchtig war, die anderen leckten wie die Siebe.
In der Brandung, so mäßig sie auch war, wäre beinahe auch noch diese Jolle in die Brüche gegangen, die fünf portugiesischen Matrosen durften sie gar nicht wieder zurückrudern, mussten einstweilen an Land bleiben, wir übernahmen jetzt die Fuhren, zehnmal ging es hin und her, dann war alles geborgen, auch unser eigener Proviant — die portugiesische Bootsmannschaft nicht zu vergessen.
Sieben Tage später setzte uns der wie eine Seeschnecke kriechende Dampfer in Valdivia an Land.
Und nun sieben ganze Jahre später! Ich, Ewald Ebert, bin es noch immer, der das Folgende erzählt. Den Hafen von New Orleans verließ ein Dampfer von dreitausend Tonnen, die »Germania«, der Werft und Reederei Germania gehörend, eine eingetragene Gesellschaft, die aber keine Aktien ausgab, die schon achtzehn stattliche Dampfer und Segler nach allen Weltteilen gehen ließ, und nur auf die Eröffnung des Panamakanals wartete, um sich dann zu verdoppeln und verdreifachen. Denn die Durchstechung der Landenge von Panama wird eine Veränderung der kommerziellen Weltkarte erzeugen, wird das südliche Nordamerika emporschnellen lassen, wie es wohl noch keine Zeitung geschildert hat!
Die »Germania« war doch etwas zu groß, um als Kampfjacht zu gelten. Sie sollte ja später auch arbeiten. Jetzt aber war das neuerbaute Schiff doch wirklich eine Vergnügungsjacht.
Mister Georg Stevenbrock, Bürger und Senatsmitglied von New Orleans, Kapitän und Reeder, machte auf ihr seine Hochzeitsreise.
Mit wem? Nun eben mit seiner Frau, und die hieß Missis Ilse Stevenbrock.
Der Leser wird sich ja nicht besonders wundern.
Zeit und Gelegenheit genug um sich gegenseitig kennen zu lernen, hatten die beiden ja gehabt.
Wie es zuletzt gekommen, wie die beiden sich fürs Leben zusammengefunden hatten, bis vor dem Traualtar, weiß ich freilich nicht, ich bin nicht dabei gewesen, als es zum Treffen kam.
Aber sonst hatte ich ja gewusst, wie es kommen würde, ich hatte es ahnungsvoll im voraus gesehen, damals wie die Patronin an Deck saß, links von ihr stand ihre kleine Nichte und rechts der Kapitän, wie sie deren Hände in den ihren hielt.
Nur immer originell! Zur Originalität gehört aber auch, dass sie nicht gesucht werden darf; es muss sich alles von allein geben.
Die Argonauten existierten nicht mehr, sie hatten ja ihr Schiff verloren, und keine neue »Argos« wurde gebaut; kein anderes Schiff erhielt diesen Namen. Es hatte eben in der Welt nur eine einzige »Argos« gegeben, und die ruhte mit ihrer ganzen Menagerie auf dem Meeresgrunde in der Magellanstraße.
Wir hatten uns von Valdivia sofort nach New Orleans begeben, meist die Eisenbahn benutzend, und hier fing das neue Leben an, ein Leben, das nur ernster Arbeit gewidmet sein sollte.
Die Germania-Gesellschaft verfügte bereits über vier große Dampfer und zwei Segler, und auf diesen wurden die Argonauten, wie sie sich ja schließlich noch immer nannten, verteilt, die Schiffe bekamen aber auch noch andere Mannschaft, und sie gingen hinaus in die Welt, kehrten zurück und fuhren wieder davon, sieben ganze Jahre lang, und es kamen immer neue Schiffe hinzu, auf eigener Werft erbaut.
Und auch sonst traten große Veränderungen ein.
»Jungens, macht Euch hier ansässig!«, sagte Stevenbrock. »Ich würde es gern sehen, wenn Ihr heiratet. Ihr kommt nun nach und nach ins Alter, wo der Junggeselle eine klägliche Rolle zu spielen beginnt. Ihr seid eben keine Jünglinge mehr, und Ihr habt Euch auch ausgetobt genug, wilden Hafer genug gesät. Es genügt nicht, dass ich hier in New Orleans für Euch ein Seemannsheim und ein Klubhaus geschaffen habe. Ihr müsst, wenn Ihr von der Reise zurückkommt, ein eigenes Häuschen vorfinden, und darin eine hübsche Frau und ein halbes Dutzend ungezogene Kinder. Die Dampfer bleiben doch selten länger als ein Vierteljahr aus! Und wer durchaus nicht heiraten will, na, der kann auf die Segler kommen, die machen Jahresreisen, und so eine Frau ist freilich nicht beneidenswert, die ihren Mann nur aller Jubeljahre einmal sieht.«
So hatte Stevenbrock gesprochen.
»Ah, ah, Käpten!«, hatten die Argonauten geantwortet. Und sie gehorchten, wie sie immer gehorcht hatten.
Sie sahen sich um unter den Töchtern des Landes, wählten und heirateten. Alle freilich nicht. Brauchten es ja auch nicht, es war ihnen ja ganz freigestellt worden, wenn man da überhaupt kommandieren darf. Diese Unverheirateten kamen dann, wie ausgemacht, für weite Reisen auf die Segelschiffe.
So vergingen sieben ganze Jahre. Die Germaniaschiffe mehrten sich, immer mehr wurden die ehemaligen Argonauten verteilt, und auch die Gartenkolonien mit den reizenden Häuschen wurden immer größer. Weil einer nach dem anderen noch eine Frau hinzubrachte und eine Familie gründete.
Und in dieser Argonautenkolonie wechselten auch Geburt und Tod miteinander ab, wie hätte es anders sein sollen in dieser Welt, auch mancher Argonaute wurde auf den kleinen Friedhof hinausgebracht, oder sein Tod wurde uns aus einem fernen Hafen gemeldet, ein Seemannsbegräbnis auf hohem Meere. Sieben ganze Jahre — wie hätte da so etwas ausbleiben können!
Georg Stevenbrock aber hatte während dieser sieben Jahre New Orleans niemals wieder verlassen. Er nannte sich nicht mehr Kapitän, er war nur noch Kaufmann und Reeder, sieben Jahre lang widmete er sich rastloser Arbeit in dieser Hinsicht, und ich war seine rechte Hand.
»Herr Ebert, arbeiten Sie mal aus, wie wir im Oktober dieses Jahres alle unsere alten Argonauten hier zusammenbekommen können. Ist es nicht anders möglich, so sollen sie hier zurückbehalten werden und auch als Passagiere herkommen. Aber der Schiffsbetrieb soll doch so wenig wie möglich darunter leiden, und dass wir nicht gar zu viel fremde Leute einstweilen anstellen müssen. Na, Sie verstehen mich schon, machen Sie nur Ihre Sache.«
So hatte Mister Stevenbrock im April zu mir gesagt. Also ich hatte ein halbes Jahr Zeit, aber der Leser darf glauben, dass es eine ganz kitzlige Aufgabe war, die mir da gestellt worden. Wir hatten schon sechzehn Schiffe fahren, sie waren über die ganze Erde zerstreut, da wollten die darauf befindlichen Argonauten hier an einem bestimmten Termin zusammengezogen sein, ohne dass in den Schiffslisten eine Revolution stattfand und ohne dass Geld zum Fenster hinausgeworfen wurde. Und dabei ist zu bedenken, dass fast alle die ehemaligen Matrosen jetzt diese unsere Schiffe als Kapitäne oder doch als Steuerleute führten, die ehemaligen Heizer waren alle Maschinisten. Das hatte sich in den sieben Jahren natürlich geändert. Als gewöhnlicher Arbeiter an Deck oder als Heizer und Kohlentrimmer fuhr von den ehemaligen Argonauten natürlich niemand mehr. Und auch schon viele von den Schiffsjungen hatten ihr Steuermannsexamen gemacht, wenn sie auch noch auf unseren Schiffen als Matrosen angestellt waren, bis eine Offiziersstelle für sie frei wurde. Auf unserer Werft befanden sich schon wieder vier neue Schiffe im Bau.
Von sonstigen Hauptpersonen erwähne ich nur noch, dass sich Juba Riata und Mister Tabak fast ständig auf Reisen befanden, entweder eines unserer Schiffe benutzend oder auch ein anderes. Gegenwärtig waren die beiden Freunde unterwegs nach Norwegen, nach Lappland, um auf Bären und Rentiere zu pirschen. Klothilde hingegen war ganz häuslich geworden, sie führte die Wirtschaft in der Pension, in der Fräulein Ilse Hartung untergebracht worden war, um ihre doch etwas vernachlässigte Schulbildung nachzuholen vor allen Dingen aber akademischen Malunterricht nehmend.
Nun, es gelang mir, meine Aufgabe zu lösen. Am 16. Oktober traf das letzte Schiff von Adelaide ein, unser eigenes, von Kapitän Starke, dem ehemaligen Schriftsetzer, geführt, nun hatte ich alle die alten Argonauten zusammen, und keiner hatte länger als vierzehn Tage untätig in New Orleans gelegen, und alle ihre Stellen waren auf sämtlichen Schiffen vorübergehend durch gute Hilfskräfte ersetzt. Auch Juba Riata und Mister Tabak waren zurückgekommen.
»Ich glaubte nicht, dass Sie das fertig bringen würden!«, sagte Stevenbrock zu mir.
Am ersten Abend war Versammlung in unserem großen Klubsaal, und Mister Stevenbrock nahm das Wort.
»Jungens, Leute, meine Herren Kapitäne und Offiziere! Ich habe Euch eine Mitteilung zu machen. Ich bin schon seit längerer Zeit verlobt — —«
»Hip hip hip hurra für Käpten Stevenbrock!«, erklang es jubelnd aus fast hundert Kehlen.
»Danke! Die Dame, mit der ich mich verlobt habe, ist Euch nicht fremd. Ihr Name ist Fräulein Ilse Hartung — —«
»Hip hip hip hurra für Fräulein Ilse!«
»Na, Kinners nun haltet mal die Luft an, nachher könnt Ihr hippen so viel Ihr wollt, jetzt lasst mich erst einmal aussprechen. Also übermorgen punkt sieben Uhr findet unsere Trauung in der Hafenkirche statt.
Ihr alle seid unsere Brautführer. Jeder bringt seine Frau mit als Brautjungfer — grinse nicht, Oskar, und wer keine Frau hat, bringt irgend was anderes anständiges Weibliches mit. Dass verheiratete Männer und Frauen die Rotte der Brautführer und Brautjungfern spielen, ist zwar ungewöhnlich, aber Seine Hochwürden Reverend Pitch gestattet einmal diese Ausnahme. Weil es sich hierbei eben um etwas ganz Besonderes handelt. Dass nicht etwa so jemand mit Frack und Angströhre kommt! Einfacher Straßenanzug! Natürlich blau. Dementsprechend sind Eure Frauen und Mädels angezogen.
Ihr werdet mit Wagen abgeholt. Es soll sonst alles ganz regelrecht zugehen, nur in Frack und Angströhre mag ich Euch nicht sehen, und hiermit ist der vortreffliche Reverend Pitch auch ganz einverstanden.
Ordnen könnt Ihr Euch, wie Ihr wollt. Wie die Wagen eben vorfahren. Nur die erste Stelle hinter uns ist reserviert. Die wird von Mister Kabat eingenommen, er führt als Brautjungfer Miss Klothilde Gracco. Feixe nicht, Oskar! Miss Klothilde Gracco ist zwar katholisch, deshalb hatte Seine Hochwürden Reverend Pitch einige Einwendungen zu machen, aber Miss Gracco ist bereit, sich umtaufen zu lassen — Himmeldunnerwetter noch einmal, Oskar, was hast Du denn nur egal zu feixen?! Das ist doch nicht etwa lächerlich zu nehmen, wenn jemand nach reiflichem Überlegen aus innigster Überzeugung seine Religion wechselt?!«
Der Redner führte sich ein frisches Stück Kautabak zu Gemüte. Ich benutze diese andachtsvolle Pause, um zu bemerken, dass der ehemalige Segelmacher Oskar jetzt Kapitän Colly hieße. Er führte schon längst seinen Segler, unseren größten Viermaster. Colly war nicht der Vatersname dieses geborenen Kölners. Er hatte einen anderen angenommen, aus Gründen, die schon wiederholt angedeutet worden sind. Im freien Nordamerika ist das ja erlaubt. Weshalb er gerade so einen Hundenamen gewählt hatte, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil er selbst wusste, dass er noch immer ein richtiger Witzbold war, auch noch als Kapitän. Auch er hatte auf den Wunsch Stevenbrocks beinahe geheiratet — beinahe — war drei Stunden vor der angesagten Trauung ausgekniffen, hatte sich einige Zeit unsichtbar gemacht, und als er wieder zum Vorschein gekommen, hatte Stevenbrock unterdessen alles geregelt, die verlassene Braut hatte sich abfinden lassen.
Trotz dieser nicht ganz einwandfreien Affäre gehörte Kapitän Oskar Colly zu den wenigen, die mit unserem Patron auf Du und Du standen.
Die Backentaschen waren gefüttert worden, was natürlich im weiten Saale allgemeine Nachahmung gefunden hatte.
»So, das wäre der erste Teil gewesen.
Nach der Trauung muss doch natürlich auch ein Hochzeitsfest stattfinden.
Natürlich? Nee, daraus wird bei uns nischt! Kein Mensch muss müssen.
Ich als Bürger, Senatsmitglied, Großkaufmann und Reeder habe hier in New Orleans mancherlei gesellschaftliche Verpflichtungen, aber in diesem Falle habe ich mich davon zu befreien gewusst. Das seht Ihr ja schon daraus, dass nur Ihr allein als meine Ehrengäste mit in die Kirche kommt. Andere haben höchstens als Zuschauer Zutritt, und wenn es der Senatspräsident mit Gattin ist, eingeladen sind sie nicht. Ich habe mich da in anderer Weise abzufinden gewusst, das neue Ehepaar wird eine Stiftung machen. Aber auch für Euch findet hinterher keine Festlichkeit statt. Bildet Euch nicht etwa ein, dass Ihr Euch hinterher vollfressen und das Tanzbein schwingen könnt.
Sofort, wenn Ihr aus der Kirche tretet, schiebt Ihr Eure Frauen und Mädchen ab! Sie können mit den Equipagen wieder nach Hause fahren. Dort allerdings wird jede etwas vorfinden, was sie für das ausgefallene Hochzeitsfest reichlich entschädigt, dafür ist bereits gesorgt.
Und Ihr selbst marschiert uns sofort nach, uns, dem Brautpaar, oder vielmehr uns Neuvermählten. Nur wenige Schritte, nur bis zum Kai.
Dort liegt die neuerbaute »Germania«, die erst neulich unsere Werft verlassen und ihre Probefahrt bestanden hat, wir begeben uns sofort an Bord, treten auf ihr sofort unsere Hochzeitsreise an, und alle meine Argonauten sollen uns begleiten. Ein Jahr setzen wir daran, um eine Reise um die Erde zu machen wir wollen noch einmal alle Gegenden und Orte aufsuchen, wo wir einst — —«
Der Sprecher kam nicht weiter.
Ach, dieses Jubeln und Gejohle, das jetzt den weiten Saal erfüllte!
Und es war alles programmmäßig verlaufen. Aus der Kirche gingen die Neuvermählten und sämtliche männliche Hochzeitsgäste direkt an Bord der »Germania«, die unter Volldampf am Kai lag.
Die ganzen Vorbereitungen der Argonauten hatten nur darin bestanden, dass sie ihre Zeugsäcke und Kleiderkisten an Bord gebracht hatten. Sonst war alles schon vorhanden, was man während dieser Weltreise zu gebrauchen gedachte. Natürlich machten die Hochzeitsgäste diese Reise nicht etwa als Passagiere mit!
Das wäre doch nichts gewesen!
Nein, es waren wieder die alten Argonauten! Kapitän Stevenbrock übernahm das Kommando, Kapitän Scholz war wieder der erste Offizier, Kapitän Falkenstorm der zweite, als dritter, um mehr Freizeit zu schaffen, kam noch Kapitän Starke hinzu, aber Kapitän Colly war wieder Oskar der Segelmacher, und alle die anderen nunmehrigen Kapitäne und Steuerleute verrichteten wieder als einfache Matrosen die Arbeit an Deck, und die ehemaligen Heizer, jetzt alle Maschinisten, Ingenieure, sie gingen wieder vor die Kesselfeuer!
Ein Unterschied gegen früher freilich war dabei. Die »Germania« hatte wohl zwei Masten, aber keine Takelage, und die Kessel wurden mit Ölfeuerung geheizt. Die Heizer hatten nur die Hähne zu regulieren. Und das war gut. Denn die meisten dieser ursprünglichen Argonauten gingen ja schon stark auf die vierzig los, da kann man nicht mehr viel Arbeit in der Takelage und vor Kesseln und Kohlenfeuerung verlangen, zumal wenn man dieser Arbeit schon entwöhnt worden ist.
Aber sonst war es wieder die alte Bordmannschaft, die nunmehrigen Kapitäne und Offiziere scheuerten wieder als Matrosen das Deck um die Wette, und auch sonst ging alles wieder um die Wette. Rot gegen Grün, auch das wurde wieder hergestellt. Mit dem Turnen freilich war es ebenfalls vorbei. Wohl war im Zwischendeck eine vollkommene Turnhalle eingerichtet worden, es wurde auch noch geschwungen und gesprungen, nur kann man von solchen Herren, die in die Vierzig gehen, keine Weltrekorde mehr verlangen, nicht, dass sie die Riesenwelle machten.
Und trotzdem, es ging wieder Rot gegen Grün, jeder tat eben sein Bestes, um seiner Farbe die meisten Punkte zu sichern, wieder wurden Prämien verteilt, die hin und her wanderten, noch mehr wurde wieder gemeinschaftlich musiziert, und alles war wieder eine Lust und ein Lachen.
Wir fuhren aus dem Golf von Mexiko heraus und wandten uns südwärts.
Aber Para blieb rechts liegen. Das Eldoradogebirge. Und zumal die Sandbank im brasilianischer Urwald, auf der einst die Argonauten so köstliche Zeiten verlebt hatten — jetzt kannte ich alles aus Erzählungen — sollten erst auf der Rückreise besucht werden, besonders auch weil diese Sandbank jetzt unter Wasser lag.
Auch Rio de Janeiro wurde nicht angelaufen, wo die Argonauten ihren ersten Sieg im Wettrudern über eine fast internationale Kriegsflotte davon getragen hatten, wo es auch sonst noch manche alte, schöne Erinnerungen zu durchkosten gab.
Zuerst war ein anderes Ziel vorgenommen worden. Die Argonautenbucht im Feuerlande. Wo die »Argos« erst richtig zum abenteuerlichen Gauklerschiffe geworden war, die Mannschaft sich erst richtig in ritterliche Argonauten verwandelt hatten.
Und dann natürlich dort die Steinpyramide, welche die irdischen Reste der Patronin überdeckte, der Freifrau von der See, der Gebieterin der Argonauten! Diese Pyramide wollte man erst besuchen, die Argonauten wollten ihrer unvergesslichen Herrin erst ein Opfer bringen, dann erst sollte die eigentliche Erinnerungsreise angetreten werden.
Nebenbei bemerke ich, dass noch keiner der Argonauten diese Steinpyramide wiedererblickt hatte. Obgleich schon so mancher unserer Dampfer die Magellanstraße passiert hatte. Aber diese ist gar breit, und den Dampfern ist der Weg in diesem gefährlichen Wasser genau vorgeschrieben, da darf nicht etwa ein Abstecher nach der Küste gemacht werden, nur immer so weit als möglich von den unbekannten Küsten entfernt! Die Segelschiffe gehen alle um Kap Hoorn.
Wir steuerten in die Magellanstraße ein, hatten natürlich wieder Argonautenwetter, wie es schon sprichwörtlich hieß.
Zum dritten Male diese von ewigen Stürmen heimgesuchte Gegend ganz ruhig, die See nur etwas gekräuselt.
»Die Stelle, wo uns die ›Argos‹ an Land gesetzt hat, wollen wir aber gleich besichtigen«, sagte Kapitän Stevenbrock, »denn auf der Rückfahrt gehen wir um Kap Hoorn herum.«
Also wir hielten uns mehr nach rechts, auf der nördlichen Seite der Straße.
Wir selbst hatten damals ja keine geografische Bestimmung der Schiffbruchsstelle machen können, aber das war doch natürlich von dem portugiesischen Dampfer besorgt worden.
So wussten wir, wo wir hinzuhalten hatten.
Vorher, noch ehe wir diese Stelle in Sicht bekamen, wurden einige Felseninseln passiert. Wir befanden uns also zwischen diesen und der eigentlichen Küste des Festlandes.
Und nun kommt es!
Der Kapitän und die beiden Offiziere stehen auf der Kommandobrücke und mustern teils diese Inseln, teils drüben die Küste durch das Fernrohr.
Da lässt Kapitän Stevenbrock sein Fernrohr sinken und streckt die Hand aus.
»Ilse, Kinders«, ruft er erschüttert, »dort liegt unsere Argos!«
Ja, da liegt sie!
Wer kein Fernglas bekam, konnte es bald mit bloßen Augen erkennen.
Eine schwarze formlose Masse, sie war nicht einmal als ein Schiffswrack zu erkennen.
Woher wollten wir denn da wissen, dass es unsere Argos war?
Nun, weil es da groß und breit zu lesen war, mit weißen Buchstaben auf schwarzem Grunde.
»Argos, Hamburg.«
Diese Worte übereinander stehend waren nämlich nicht mit weißer Farbe angemalt gewesen — keine sich selbst überlassene Farbe hätte sieben Jahre lang allen Unbilden der Witterung getrotzt — sondern diese Buchstaben hatten aus stark verzinktem Kupfer bestanden, waren angenietet. Die halten etwas aus.
Wir fuhren hin, konnten in Booten landen.
Das Wrack lag fest eingekeilt zwischen Felsen, so hoch, dass es auch von der höchsten Sturmflut, von keiner Woge erreicht werden konnte.
Aber was es da hinaufgeschleudert hatte, das war eine Flutwelle gewesen, die von einem unterseeischen Erdbeben erzeugt worden war, und was solch eine Wassermauer alles fertig bringt, davon muss man einmal ein Resultat gesehen haben, um es glauben zu können. Wie beim Erdbeben von Lissabon und auf Ceylon, wo beide Male die größten Schiffe und die schwersten Strandgeschütze auf hohe Berge hinaufgesetzt worden sind.
Wohl musste unser Schiff schon dort an der Küste des Festlandes, vielleicht anderthalb Kilometer von hier entfernt, total zerschmettert sein, aber es wurde von der Flutwelle so schnell wieder zurückgerissen, dass es gar nicht zum Sinken kam, die noch zusammenhängenden Trümmer wurden dort oben hinaufgeschleudert.
Es war gar kein Wrack zu nennen, was wir da erblickten. Ein fürchterlicher Anblick.
Ein unentwirrbares Durcheinander von Eisenplatten. Nun aber dennoch das Schiff erkennbar, darin lag eben das Fürchterliche. Es war ganz unbegreiflich, wie sich das alles durcheinander geschoben hatte.
Wohl war hinten das Heck mit dem Namen, in dieses aber hatte sich die Galionsfigur hineingerammt, die doch vorn am Bug ist, und unten zum Kiel als eine Mastspitze heraus!
Alles verschoben und verdreht und durcheinander gezerrt, alles sich gegenseitig durchdrungen!
Wir kletterten zwischen den Felsen um den Trümmerhaufen herum. Es konnte doch sein, dass es noch hohl war, dass wir Kabinen fanden; nur musste man erst einen Zugang suchen. Denn Luken und Türen gab es nicht mehr, die waren alle verbarrikadiert oder ganz verschwunden, die Eisenplatten hatten sich zusammengeschoben. Da, wie ich mit Kapitän Stevenbrock und seiner Gattin gerade neben einer Schiffswand stehe, die sich aufrecht gehalten hat, hören wir plötzlich ein Geräusch; es kann nur aus dem Innern des Schiffes, das heißt des Trümmerhaufens kommen, wir alle drei blicken unwillkürlich nach dem nächsten Bullauge, das natürlich wie alle anderen damals, als das Unwetter nur drohte, sofort mit der inneren Eisenplatte wasserdicht geschlossen worden war — und da wird diese Eisenplatte hier nach innen zurückgezogen und an dem runden Bullauge erscheint ein menschlicher Kopf. Unser Schreck lässt sich denken.
Doch währte er nur einen Augenblick, dann hatten wir das uns wohlbekannte Gesicht erkannt.
Es war der Maschinist oder vielmehr jetzige Heizer Peter, einst unser bester Weitspringer. Der kleine Kerl hatte einen Durchschlupf ins Innere des Trümmerhafens gefunden.
»Frau Stevenbrock, nu raten Se mal, was ich hier gefunden habe!«
Er ließ uns nicht lange raten, sondern er brachte es gleich zum Vorschein.
Und was war's, was er uns durch das Bullauge präsentierte?

Einer der prachtvollen Kinderstiefel aus Seehundsfell, von Mister Tabak gefertigt, der zweite folgte gleich nach, und sie stanken noch genau so nach Tran und Tabaksschmant!
»'s is iewerhaubt noch als da. Ä bissel liederlich sieht's ja hier drinne aus, awwer da is noch alles, alle die Schtiwweln un Schuhe, un hier is ooch der Schrank, wo se drinne schtanden.«
Und außer den dreißig Paar Kinderstiefelchen, alle ganz wohlerhalten, soweit sie die kleine Ilse seiner Zeit nicht selbst abgetragen hatte, wurde uns auch der Schrank zu dem Fensterchen herausgereicht. Allerdings nicht so wohlerhalten, er war in Trümmer gegangen, aber immerhin, die einzelnen Bretter brauchten nur wieder zusammengenagelt werden, neue Glastüren hinein — dann war der ganze Schrank wieder fertig.
Ach, dieses Glück der Frau Ilse!
»Meine Schuhe, meine Kinderstiefelchen!«
Sie fing vor Freude zu weinen an. Freilich mochten diese Tränen auch noch eine andere Ursache haben. Fünf Tage haben wir hier gelegen, die Trümmer abräumend, so weit es möglich war.
Noch vielerlei haben wir gefunden, teuere, heilige Andenken, welche die Argonauten mit unaussprechlicher Freude erfüllten.
Einer der ersten Gegenstände der unter den Trümmern zum Vorschein kam, war eine meterhohe Figur aus getriebenem Silber, einen englischen Infanteristen darstellend — die erste Siegestrophäe der Argonauten, damals beim Atlantik-India-Atlantik-Marsch in Kapstadt errungen — zwar verbeult, aber sonst noch ganz wohl erhalten.
Ach, diese Freude der Argonauten, als sie diese Figur wieder erblickten!
Und so wurde eine Trophäe nach der anderen hervorgeholt, nur wenige wurden dann noch vermisst.
Merkwürdig war nur, dass wir dies alles niemals dort fanden, wo wir es suchen zu müssen glaubten.
So war auch der Schrank mit den Stiefelchen Ilses an einer ganz anderen Stelle gefunden worden, dort hatte Ilses Salonkabine niemals gelegen! Und wir kannten deren Lage im Schiffe doch ganz genau.
Dermaßen war bei der Katastrophe das ganze Schiff durcheinander geschoben worden — einfach ganz unbegreiflich.
Ich habe später einmal den Herd eines Erdbebens besucht, das vor einigen Jahren dort stattgefunden hatte, bei Damaskus und die dort wohnenden Leute haben mir versichert, dass sich die Felder durch dieses Erdbeben total verschoben haben. Dieselben Rosenkulturen, die jetzt im Norden liegen, lagen früher im Süden, die Hanffelder sind in entgegengesetzter Richtung gewandert, ein großer Palmenwald hat sich fast achtzig Meter verschoben, dabei einen Kreis beschreibend, und dies alles geschah, ohne dass eigentlich die Felder zerrissen wurden. Eben eine Verschiebung der Oberfläche der Erde.
Das muss man aber gesehen haben, um es glauben zu können. Und so ähnlich wer es auch hier mit unserem ehemaligen Schiffe. Wie sich das alles kreuz und quer durcheinander geschoben hatte, manchmal ohne jede Verletzung!
Dann vor allen Dingen fanden wir Knochen — Knochen die schwere Menge.
Die ganze Menagerie war ja zur Zeit des Unwetters unter Deck eingeschlossen gewesen, und natürlich konnte nichts weiter noch vorhanden sein als nur Knochen.
»Das war mein treuer Pluto!«, konnte Juba Riata sofort sagen, als er einen Hundeschädel in die Hand nahm.
Ich will nicht etwa aufzählen, was wir für Skelette zusammenbrachten, so weit sich das jetzt überhaupt unterscheiden ließ.
Was wir an Knochen fanden, nahmen mir mit, sie dann in New Orleans mit Hilfe von erfahrenen Osteologen zu Gerippen zusammengesetzt worden, die Skelette stehen heute noch in unserem Klubsaal, schon mehr in unserem Museum, als Andenken an unsere einstige »Argos«, die nie wieder eine Nachfolgerin bekommen hat, weil es eben nur ein einziges Mal in der Welt eine »Argos« mit Argonauten gegeben hat. Dabei wurde von einer willkürlichen Ergänzung der fehlenden Teile abgesehen. So kommt es, dass unser Lulu keinen Rüssel, dass mancher Hund und manches andere Tier unserer einstigen Menagerie nur ein ganz unvollkommenes Knochengerüst besitzt.
Und wie wir dann einen großen Haufen zertrümmerter Orgelpfeifen wegräumten, ebenfalls ganz unbegreiflich, wie die gerade hierher gekommen waren, da fanden wir auch ein menschliches Skelett, das heißt versteinerte menschliche Knochen.
Außer der Schädelbildung sagten uns die nicht ganz normalen Rippen und sonstige Teile des Brustkastens, wem diese Knochen einst gehört hatten.
Unserem Meister Hämmerlein. Die Orgelpfeifen wölbten sich als Grabhügel über ihn.
Wir haben wohl keine Pietätlosigkeit begangen, wenn wir diese letzten Reste weder dem Meere noch der Erde überlieferten, sondern wenn wir auch dieses menschliche Skelett in unserem Museum in einem Glasschranke aufgestellt haben.
Und am fünften Tage, als wir schon eiligst abfahren wollten, weil das schöne Wetter nicht mehr lange anhalten konnte, da wurden endlich auch die Reste des zweiten Menschen gefunden, der sich damals während der Katastrophe unter Deck aufgehalten hatte, allerdings bereits als Leiche.
Doktor Isidor Cohn!
Und wie fanden wir ihn! Wir konnten nur staunen! Was dem auch ohne unsere Hilfe für ein vorläufiges Begräbnis zuteil geworden war.
Seine Knochen waren mit lauter Glasscherben zugedeckt.
Von zerbrochenen Flaschen herrührend.
Und zwar meistens Kognakflaschen, die damals noch voll gewesen.
Neben dem Lazarett, in dem die Leiche gelegen, hatte sich nämlich die Bottlerei befunden, die Flaschenniederlage, speziell die für Spirituosen, zwar ohne Verbindungstür, aber die Wand war eingedrückt worden, Lazarett und Bottlerei hatten sich völlig durcheinander geschoben, der Inhalt der zerbrochenen Kognakflaschen musste sich über die Leiche ergossen haben.
»Na, na, wenn der nur nicht auch noch als tote Leiche — —«
Doch ich will sie nicht wiedergeben, die Matrosenwitze, die bei dieser Gelegenheit gerissen wurden.
Denn die gehörten nun einmal unbedingt mit dazu, oder es wären doch keine Argonauten, keine deutschen Seeleute gewesen, die hier die vielen Flaschenscherben und Menschenknochen forträumten und sortierten.
Aber ihre Wiedergabe ist ganz unmöglich, sie würden nur ein total verzerrtes Bild zeitigen.
Auch unser Doktor Isidor steht jetzt mit seinen Säbelbeinen und seinem genialen Schafschädel als ein beinernes Denkmal in einem Glasschranke unseres Museums — nein, unseres Klubraums, des Spielsaales, er sieht und hört mit zu, wenn nach langer Reise die Argonauten im Heimathafen wieder einmal zusammentreffen und sich beim Becherklange erzählen, von ihren jetzigen Reisen und ganz besonders von der alten Argonautenherrlichkeit!
Am fünften Tage dampften wir ab, um nicht schlechtes Wetter zu erleben, das uns die Einfahrt in die Argonautenbucht hätte verwehren können.
Und nun will ich ihn berichten, den Schluss dieser ganzen Erzählung — einen Schluss, den sicher kein einziger Leser ahnt!
Wir steuerten südlich quer über die Straße, bis wir die jenseitige Küste erblickten, hatten direkten Kurs auf die Argonautenbucht genommen.
»Dort ist sie, die Pyramide!«
Wieder war es des Kapitäns Fernglas gewesen, das sie zuerst entdeckt hatte.
Ja, dort erhob es sich das Grabmonument unserer Patronin.
»Mir kommt sie viel, viel größer vor, als ich sie in meiner Erinnerung habe«, sagte Frau Stevenbrock.
»Das ist immer so, wenn ein längerer Zeitraum dazwischenliegt«, meinte ihr Gatte. »In der Erinnerung wird jeder Gegenstand, den man einmal mit Interesse betrachtet hat, dessen Größe einem imponierte, noch viel größer, und wenn man ihn dann zum zweiten Male erblickt, so ist man enttäuscht. Ganz besonders ist das der Fall, wenn man beim ersten Beschauen noch ein Kind gewesen ist, dann legt man als Maßstab die eigene Größe an, man wächst mit den Jahren, aber der betreffende Gegenstand tut es nicht — —«
Des Kapitäns schulmeisterliche Erklärung wurde unterbrochen.
»Die Pyramide ist viel viel größer geworden, ohne jeden Zweifel!«, erklang es von verschiedenen Seiten.
»Hm, mir kommt es jetzt auch so vor«, musste da Kapitän Stevenbrock selbst kleinlaut zugeben.
Wir kamen näher, brauchten nicht mehr das Fernglas zu benutzen, und da musste es als Tatsache konstatiert werden, die Pyramide hatte ihre Höhe und ihren Umfang mindestens verdreifacht.
Hatten wir hundert Menschen damals eine Pyramide von etwa zwölf Meter Höhe und zehn Meter Durchmesser an der Basis aufgeführt, so musste sie jetzt auf mindestens dreißig Meter Höhe und ebensolchem Durchmesser an der Basis geschätzt werden!
Wer hatte da während unserer Abwesenheit diese Unmasse von Steinen zusammengetragen?
Welche Schiffsmannschaft hatte sich diesen Scherz geleistet, hatte davon nichts der Welt verkündet, was wir doch sonst wohl sicher erfahren hätten?
Hier lag ein Rätsel vor, das man nur richtig verstehen muss, um unser grenzenloses Staunen begreifen zu können. Wir fuhren in die Bucht, legten bei, gingen an Land. Die Tatsache blieb bestehen, wurde nur noch handgreiflicher.
Nach derselben Arbeitsweise, die wir damals eingehalten, war weiter ein Stein auf den anderen gelegt worden, bis die Pyramide, wie wir jetzt trigonometrisch schnell berechneten, eine Höhe von einunddreißig Meter erhalten hatte, das ist anderthalb mal so hoch wie ein normales vierstöckiges Haus, an der Basis war sie im Verhältnis noch etwas breiter geworden, fünfunddreißig Meter wurden gemessen, und, wie wir weiter schnell berechneten, wenn wir damals rund zwanzigtausend Steine verbraucht hatten, so enthielt diese jetzige Pyramide mindestens dreihundertfünfzigtausend Steine von ebensolchem Kaliber!
Dort, wo einst der ganze Strand mit rundgewaschenen Steinen bedeckt gewesen war, die wir auf Hunderttausende geschätzt hatten, deren Abnahme man nach unserer Arbeit gar nicht gemerkt, lagen jetzt gar nicht nicht so viel solcher Steine da, man konnte sie schon zählen, Sie waren alle hier symmetrisch aufgehäuft worden.
Wir standen vor diesem gewaltigen Monument und staunten und staunten, bis ein Ruf Juba Riatas erklang.
Dieser war wohl der einzige von uns gewesen, der sich nicht lange mit Staunen und Berechnen und Grübeln über dieses Rätsel aufgehalten hatte, sondern gleich ausgegangen war, die Umgegend nach Spuren abzusuchen, welche unsere unbekannten Nachfolger bei diesem Werke hinterlassen haben mochten.
»Hier haust ein Mensch!«
Wir hingeeilt, wo Juba Riata stand und uns winkte. Von der einst hier eingestürzten Felswand, welche diese im Laufe der Jahrtausende von Ebbe und Flut rundgespülten Steine geliefert hatte, stand noch ein kleiner Rest, er zeigte hier und da Höhlenbildung und nach solch einer Höhle hatte Juba Riata eine Spur verfolgt.
Ja, hier in dieser Höhle hauste ein Mensch!
Hatte nicht früher einmal darin gehaust, nur vorübergehend, sondern er musste noch jetzt darin wohnten, ganz primitiv eingerichtet.
Einige Guanakofelle, Federn und ganze Bälge von Möven und anderen Vögeln, die hier vorkommen, sehr viele Eierschalen, eine Wurfkeule, wie sie die Feuerländer benutzen, ein Steinmesser, und dann vor allen Dingen eine Feuerstelle, zwar erloschen, aber noch einen ganz frischen Eindruck machend, überhaupt das verkohlte Holz noch warm — ja, hier hauste noch jetzt ein Mensch!
Wer konnte das sein? Ein Feuerländer?
Ich kann es nicht schildern, weshalb wir alle von vornherein den Gedanken abwiesen, es könnte ein hier allein wohnender Feuerländer sein. Man hat eben noch nie einen einsiedlerischen Pescherräh gesehen.
Ein Schiffbrüchiger?
Sollte er etwa zu dieser Pyramide in Beziehung stehen?
Wie wir noch so flüsterten — eine eigentümliche Scheu bewog uns, die Meinungen nur flüsternd auszusprechen — wurde mein Arm gepackt, ich weiß nicht von wem, eine Hand deutete, und da sahen wir ihn schon alle!
Einen Menschen!
Einen alten Mann, mit langen, schneeweißen Haaren, der Vollbart ebenfalls schneeweiß aber nur sehr dürftig gewachsen, eine magere, schon mehr skelettartige Gestalt, nur mit einem Schurz von Vögelbälgen bekleidet, sonst ganz nackt, die Haut wie braunes Pergament, aber doch ohne jeden Zweifel sofort als Europäer erkennbar.
Dieser alte Mann, einem sagenhaften Meergreis vergleichbar, war hinter der niedrigen Felswand hervorgetreten, er musste den großen Menschenhaufen vor der Höhle doch unbedingt sehen, aber er sah ihn nicht, das heißt, er kümmerte sich gar nicht um uns, er ging dorthin, wo noch die letzten Steine von den Hunderttausenden lagen, bückte sich, hob einen gewichtigen Block auf, schleppte ihn mühsam nach der Pyramide, legte ihn dorthin, wo eben ein neuer Wall angefangen worden war, ging zurück, um einen neuen Stein zu holen.
Da löste sich Kapitän Stevenbrock von uns los, und ging auf ihn zu.
Aber nun wie er es tat!
Es war kein Gehen, sondern ein Schleichen.
Etwas vorgebeugt, die Hände vor sich hinhaltend, so schlich der Kapitän auf den alten Mann zu, blieb vor ihm stehen, vertrat ihm den Weg.
Da endlich sah der alte Mann, dass jemand vor ihm stand. Und so standen sich die beiden gegenüber, der Kapitän noch immer halb gebückt, den Kopf weit vorgereckt.
O, Leser, wie soll ich es schildern!
Wie unser Kapitän da endlich die Sprache fand, wie wir ihn sprechen hörten.
»Hans — Hans — bist Du es denn wirklich, Hans?!«
Er war es wirklich der Matrose Hans, den wir jetzt hier als skelettartigen Greis mit schneeweißen Haaren sahen, zum nackten Wilden herabgesunken.
Niemand hätte ihn wiedererkannt, unseren Hans, der Kapitän konnte nur eine Ahnung, eine Offenbarung gehabt haben.
Und wir erfuhren es nicht etwa von ihm selbst, dass es Hans war.
Ich muss vorgreifen.
Wir haben uns alles später nur so nach und nach zusammengereimt, obgleich wir dann auch einige Pescherrähs fanden, die uns über diesen Einsiedler, der Steine für die Pyramide zusammentrug, berichten konnten.
Als wir damals an der patagonischen Küste den schrecklichen Schiffbruch erlitten und Hans vermisst wurde, wir auch seine Leiche nicht fanden, mussten wir doch unbedingt annehmen, dass er eben ein Opfer dieser Katastrophe geworden sei.
Oder höchstens, dass er schon unterwegs, als wir von der Flutwelle des Seebären davongetragen wurden, über Bord gewaschen oder gestürzt oder sonst wie verunglückt sei. Diese Annahme war ja noch möglich, machte aber keinen Unterschied aus.
Daran, dass der Matrose Hans damals in der Argonautenbucht, das heißt an Land bei der Pyramide zurückgeblieben sein könnte, hatte ja während der sieben Jahre niemand von uns auch nur mit einer Ahnung gedacht.
Und doch konnte es nicht anders gewesen sein. Der Matrose Hans war damals zurückgeblieben.
Ganz zweifellos mit voller Absicht.
Wenn wir auch sehr schnell aufgebrochen waren, die Bucht verlassen hatten — es hatte doch erst Dampf aufgemacht werden müssen, zehn Minuten waren doch vergangen, und es war eben ganz ausgeschlossen, dass Hans die Abfahrt des Schiffes versehentlich hätte versäumen können.
Weshalb er sich versteckt hatte, wahrscheinlich drüben im Walde, zwischen den Hügeln, im Gebirge, um nicht mit uns zu gehen, um hier zu bleiben — nun, der Leser weiß es!
Was in dem Jüngling vor sich gegangen, während wir innerhalb der neun Nachtstunden rastlos die Steine vor dem Grabe unserer Patronin aufgestapelt hatten — das wussten wir nicht, einerseits nicht, ob er vielleicht irrsinnig geworden war — andererseits wussten wir es ja ganz genau.
Kurz und gut, Hans hatte sich versteckt gehabt!
Wir waren ohne ihn abgefahren, sein Fehlen war in den ersten Stunden nicht bemerkt worden, was bei den mehr als hundert Köpfen der Schiffsbesatzung doch so leicht erklärlich war.
Und dann war ganz plötzlich das furchtbare Unwetter losgebrochen, wobei nicht erst alle Mann zur Kontrolle auf ihre Stationen gerufen werden konnten.
Und dann nach dem Schiffbruch hatte der Matrose Hans eben gefehlt.
So war es gekommen.
Und während der ganzen sieben Jahre hat der Unglückliche unser Werk fortgesetzt. Hat ununterbrochen vom ersten bis zum letzten Sonnenstrahl und auch noch manche Nacht bei Mondschein Steine getragen, um die Pyramide immer höher zu bauen, welche die irdischen Reste unserer Patronin deckte, seiner Patronin, seiner Herrin, die er mehr geliebt hatte als wir alle zusammen, die ihm noch mehr gewesen als uns allen!
So haben uns dann die Pescharrähs berichtet.
Von dem einsamen Manne, der zu jeder Jahreszeit der glühendsten Sommerhitze wie dem eisigen Schneesturme trotzend, ununterbrochen von früh bis spät hier Steine zusammengetragen hat, sieben ganze Jahre lang!
Ein Stamm Pescharrähs war bald nach unserem Fortgange hierher gekommen, hatten den einsamen Mann gesehen, und da der Stamm hier in der Nähe wohnen blieb, sie ihn sieben ganze Jahre lang beobachtet, sich auch etwas um ihn kümmernd.
Nur in der allerersten Zeit hatte Hans selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen müssen, hatte sich hauptsächlich von Vögeln, Eiern und Muscheln ernährt, alles andere vernachlässigend.
Dann hatten sich seiner die Pescherrähs angenommen. Denn wie es gewöhnlich bei solchen wilden Völkern ist — dass sie hier einen Irrsinnigen vor sich hatten, das hatten diese Feuerländer bald gemerkt, oder das Treiben dieses Menschen war ihnen doch ganz rätselhaft — und da hatten sie ihn als einen Heiligen verehrt.
Das heißt, sie hatten ihn wenigstens mit Nahrungsmitteln versehen, und was er sonst brauchte, im übrigen hatten sie sich ja ängstlich von ihm ferngehalten. Es war eben ein rätselhafter Heiliger, dem sie gewissermaßen Opfer darbrachten.
Dass er dabei zum nackten Wilden herabsank, das hatten diese Feuerländer natürlich nicht verhindern können.
Und so hatte Hans sieben ganze Jahre hingebracht, einen Stein nach dem anderen herbeischleppend und ihn zur Pyramide hinzufügend!
Auf mindestens dreihundertfünfzigtausend Steine mussten wir es berechnen, was er in diesen sieben Jahren geschleppt und aufgetürmt hatte.
Und nun fanden wir ihn wieder.
Das ist es, was ich alles im Voraus sagen musste. Damals konnten wir dies alles ja durchaus noch nicht begreifen, wir standen ganz einfach vor etwas Unfassbarem.
»Hans — Hans — bist Du es denn wirklich, Hans?!«
So hatten wir Kapitän Stevenbrock sagen hören. Aber nun in welchem Tone, in welcher Stellung! O, Leser, wie soll ich es überhaupt schildern!
Ich weiß nicht einmal mehr, wie ich plötzlich mit dort stand, mit all den anderen zusammen, die beiden umringend.
»Hans!«
Mit blinden Augen blickte der alte Mann um sich. Da aber plötzlich kam Leben in diese erloschenen Augen, sie flammten auf.
Er öffnete den Mund, zuerst kamen nur unartikulierte Laute über die Lippen dieses Unglücklichen, der sieben ganze Jahre lang kein einziges Wort gesprochen hatte.
Dann aber wurden aus diesen unartikulierten Lauten verständliche Worte.
»Argonauten — meine — Ilse — mein — Kapitän — Helene — ich bin wieder bei Euch — Hans — alle zusammen — Gott — gnädig — —«
So hörten wir ihn deutlich sprechen, wenn auch immer noch stammelnd und dabei ging es über das eingefallene Greisengesicht immer mehr wie eine selige Verklärung — und plötzlich sahen wir alle unseren Hans vor uns.
Und da, wie er noch die letzten Worte stammelte, neigte er sich vorwärts, taumelte, es sah aus, als wolle er den vor ihn stehenden Kapitän und dessen junge Frau umklammern, fast genau so, wie es damals die Patronin getan hatte, auch er konnte mit den Händen nur eben noch ihre Kleider berühren, so brach er vor ihnen Füßen zusammen — —
Tot! Und hiermit schließt dieser Liebesroman, der nie einen Anfang gehabt hat!
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.