
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software


"Das zweite Gesicht," Band 1, Verlag Dieter von Reeken, 2020

"Das zweite Gesicht," Lieferung 1, Umschlagseite 1.
Der vorliegende erste Band[1] dieser Neuausgabe enthält den ungekürzten Text der Kapitel 1—31 (Lieferungen 1 bis 12 teilweise) des von Robert Kraft (1869—1916) verfassten Kolportageromans
Das zweite Gesicht oder Die Verfolgung rund um die Erde. Lieferungs-Roman von Robert Kraft. Heidenau-Nord: Mitteldeutsche Verlagsanstalt G.m.b.H. o.J. [1919], 46 Lieferungen mit je 64 fortlaufend paginierten Seiten, Format ca. 12,7 x 18,8 cm, illustriert, in 5 Bänden gebunden. Die 46 Frontispize und 57 weiteren Illustrationen sowie die Umschlagzeichnungen der Lieferungshefte wurden wahrscheinlich (ohne Signatur) von Georg Hertting (1882—1951) gezeichnet.
[1] Band 2 wird die Kapitel 32—58 (Lieferungen 12 teilweise bis 23 teilweise) enthalten, Band 3 die Kapitel 59—83 (Lieferungen 23 teilweise bis 35 teilweise), Band 4 die Kapitel 84—103 (Lieferungen 35 teilweise bis 46).
Die Erstausgabe war 1913 im Dresdner Roman-Verlag, Dresden, erschienen. Wegen der Daten zu weiteren Auflagen verweise ich auf die umfassende Bibliografie von Thomas Braatz.[2] Ausführliche Informationen über Robert Kraft und sein Werk enthält die farbig illustrierte Biografie von Walter Henle und Peter Richter. [3]
[2] Thomas Braatz: Robert Kraft — Farbig illustrierte Bibliographie zum 100. Todestag. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer, 3., erweiterte Aufl. 2016. — 1032 S. mit über 1000 farbigen Abb.
[3] Walter Henle, Peter Richter: Unter den Augen der Sphinx. Leben und Werk Robert Krafts zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer 2005. — Das Buch ist vergriffen; eine Neuausgabe ist für 2023 geplant.
»Der (...) Roman schildert den Verzweiflungskampf einer Mutter, die ihr Kind verloren hat und nun im Wahne ein fremdes Kind für das ihre hält. Der Vater des Knaben ist ein einfacher Hinterwäldler und gegen das Geld der Milliardärin machtlos, aber ein erfahrener Weltmann, aus einem deutschen Fürstenhause stammend, nimmt sich der beiden an, befreit den Vater aus der Irrenanstalt und den Sohn aus goldenem Käfig, das wahnsinnige Weib verfolgt sie, dabei sich eines kleinen Mädchens bedienend, welches die Gabe des zweiten Gesichtes besitzt, im somnambulen Zustande hellsehend ist, und nun beginnt die Jagd rund um die Erde (...) — und gleichzeitig ist es ein ständiger Kampf um dieses hellsehende Kind, welches (...) Wunder erzählt von einer unbekannten, rätselhaften Welt, über welche eine ›Königin der Nacht‹ herrschen soll — bis das Märchen zur Wahrheit wird, die Verfolgten in diese unbekannte Welt eindringen (...).«[4]
»Allerdings verwickelte sich die Handlung dieses gleichzeitig in mehreren Welten spielenden Romans in solchem Maße, daß sie bei der Lieferung Nummer 46 abgebrochen werden musste. An die Leser erging eine ›Benachrichtigung‹ von einer ›Krankheit des Autors‹, allerdings dürfte vielmehr die Vermutung naheliegen, daß Robert Kraft und seinem Verleger Remert ›vor der ungehemmten Fantasie des eigenen Werkes Angst geworden‹ war. (...) Mit diesem Roman begab sich Robert Kraft erneut auf das Feld des Okkultismus, von dem die Erscheinungen des ›Zweiten Gesichtes‹ als eine seiner Eigenschaften bekannt sind. Gerade die Ausweitung seiner Romane auf das Okkult-Phantastische brachte den Unterschied zu Jules Verne und war möglicherweise der Schlüssel zu seinem Erfolg.«[5]
[4] Umschlagtext, zitiert aus Henle/Richter (wie Anm. 2), S. 233, 235.
[5] Ebenda, S. 235.
Der im Original in Fraktur gesetzte Text ist in Antiqua (Garamond Standard) umgewandelt und an die seit 1996 geltenden neuen Rechtschreibregeln angepasst worden. Aus »Neuyork« wurde also »New York«, aus »Bureau« »Büro«, aus »Telephon« »Telefon« usw. Offensichtliche Rechtschreibfehler und Schreibweisen sind stillschweigend berichtigt worden, z. B. »Boxhorn« in »Bockshorn«, »Gondelier/Gondolier« in »Gondoliere«, »Guiseppe« in »Giuseppe«, »Sennor/Sennora/Sennorita« in (spanisch) »Señor/ Señora/Señorita« bzw. (portugiesisch-brasilianisch) »Senhor/Senhora/Senhorita«, »San Franzisko« in »San Francisco« und »Lybien/lybisch« in »Libyen/ libysch«.
Fußnoten mit Sternchen (*) stehen so auch im Originaltext, solche mit hochgestellten Zahlen () sind vom Herausgeber eingefügt worden.
Da die 64-seitigen Original-Lieferungen oft mitten in einem Absatz enden, der dann in der Folgelieferung unmittelbar fortgesetzt wird, wird in der vorliegenden Ausgabe der Text im Wege der »Ab- oder Aufrundung« kapitelweise gegliedert. Auf die Seitenzahlen des Originals wird bei den Kapitel-Überschriften jeweils hingewiesen.
Die Wiedergabequalität der Abbildungen war abhängig von der überwiegend sehr schlechten Papier- und Druckqualität der Vorlage.
Für freundliche Unterstützung durch den Originaltext der Erstausgabe, für Bilder, Informationen und Hinweise bedanke ich mich bei Thomas Braatz, für das Korrekturlesen bei Ellen Radszat und Mike Neider.

Furchtbar brannte die Julisonne der vierten Nachmittagsstunde auf die schwarzen Basaltfelsen herab, wenn sie in dieser Höhe von mehr als 3000 Metern auch an geschützten, humusreichen Stellen nur dürftiges Knieholz gedeihen lassen konnte.
Da tauchte aus einer Spalte, die das trostlose Felsenplateau durchzog, ein menschlicher Kopf auf, die breiten Schultern eines Mannes folgten nach, worauf dieser sich vollends hinaufschwang.
Es war eine hohe, ungemein kräftige Gestalt, nur bekleidet mit indianischen Mokassins, Hosen und Jagdhemd, alles aus feingegerbtem Leder, aber von tausend Strapazen mitgenommen, ebenso wie die eigentümliche Kopfbedeckung, zu der ein Igel seine stachlige Haut hatte lassen müssen, die aber im Laufe der Zeit fuchsfeuerrot geworden war. Am Gürtel hingen der große Revolver im Futteral, ein Jagdmesser in der Scheide und ein ansehnlicher Lederbeutel, sonst nur noch über dem Rücken eine für Amerika auffallend kurze Doppelbüchse.
So musste man ihn für einen professionellen Jäger halten, der für den beschwerlichen und gefährlichen Aufstieg anscheinend unten seine Decke und das Kochgeschirr zurückgelassen hatte und aus seinen tieferen Jagdgründen in die Region des Adlers emporgestiegen war. Ein jagdlustiger Sportsman hätte sich nie in solch primitiver Ausrüstung ohne Führer so hoch hinaufgewagt, ohne Wasserflasche und Proviantsack, und dann vor allen Dingen zeigte das vorn zurückgeschlagene und an den Armen aufgekrempelte Jagdhemd, dass diese hochgewölbte Brust und diese muskulösen, von Sehnen starrenden Arme genau so tiefbraun gebrannt waren wie das Gesicht, während man doch mit einem Blicke tiefer verwunderlicherweise eine schneeweiße Haut sah.
Hinwiederum wurde man an dem berufsmäßigen Wald-, Prärie- und Felsenjäger irre, wenn man sein Gesicht näher betrachtete. Denn das waren ja, so verbrannt und verwittert sie auch sein mochten, die durchgeistigten Züge eines Gelehrten!
Aber auch diese Merkwürdigkeit vergaß man wieder, wenn man in seine Augen blickte. Mächtige, blaue, strahlende Augen, aus denen bei Gelegenheit ein wahres Flammenmeer hervorbrach! So wie vorhin, da er, seinen Kopf über den Rand der Spalte erhebend, einen Blick über das ganze Plateau gesandt hatte. Wie ein blauer Feuerstrahl, aus diesen Augen kommend, war es über die ganze Gegend gezuckt, und als er dann beim Emporschwingen die Lider etwas gesenkt hatte, war es nicht anders gewesen, als wenn man einen blauen, scharfgeschliffenen Stahl in die Scheide steckt.
Sonst ist nur noch zu bemerken, dass er einen kurzen Vollbart trug, blond wie sein schlichtes Haar, also unbedingt ein echter Germane, wie es bei solchen blauen, strahlenden Augen überhaupt gar nicht anders möglich war.
Jetzt nahm er den kurzen Doppelstutzen, an dem noch der Stempel der Schweizer Waffenfabrik zu sehen war, unter den Arm und ging schnellen, elastischen Schrittes über das ziemlich ebene Plateau, immer die Augen am Boden geheftet. Nur einmal, als über ihm der heisere Schrei eines Raubvogels erklang, blickte er empor. Dabei musste für den, der ihn scharf beobachtete, etwas Unerklärliches stattfinden. Der Raubvogel wäre wohl auch für jedes andere normale menschliche Auge zu erblicken gewesen, wenn auch nur als dunkler Punkt — und ein anderer Mensch hätte ihn doch nicht gesehen, weil man von hier aus dabei direkt in die Sonne blicken musste.
Aber dieser Mann blinzelte nicht im Geringsten dabei, legte nicht die Hand schützend über die Mütze, deren Schild nur die Igelschnauze bildete, mit weit geöffneten Augen konnte er ungeblendet in die feurige Kugel sehen, die sonst dem Sterblichen ihren Anblick nur durch geschwärzte Gläser erlaubt.
Dann, die Augen wieder senkend, setzte er seinem Weg fort. Offenbar verfolgte er eine Spur. denn zweimal wechselte er die Richtung, an der einen Stelle stehen bleibend und noch aufmerksamer den Boden betrachtend.
Aber wie auf diesem glatten Felsgestein, auf dem auch nicht ein Grashälmchen Wurzel gefasst hatte, eine Spur verfolgen?!
So näherte er sich einer Felsformation, die sich als kleines Gebirge wieder auf diesem Plateau erhob oder die man auch als einen breiten Grat betrachten konnte.
»Hände hoch!«, donnerte es ihm da aus einiger Entfernung entgegen, und ein Gewehrschloss knackte, wurde entsichert. Bei dieser klaren, dünnen Luft war auch das geringste Geräusch außerordentlich weit zu vernehmen.
Der Jäger blieb wohl stehen, wozu er gar nicht aufgefordert worden war, aber die Hände hob er nicht hoch, obgleich er doch sicher wusste, was dieser Befehl in Amerika und zumal in solch einer Gegend zu bedeuten hatte. Wenn er nur noch einen Augenblick zögerte, beide Hände hochzuwerfen, konnte er eine Kugel durch den Kopf bekommen.
»Das ist der Anruf eines Räubers«, entgegnete er ruhig mit sonorer Bruststimme, »und mir kann man nichts rauben. Nicht einmal meine Waffen würden ihm einen Vorteil bringen, denn er versteht sie nicht zu benutzen.«
»Ich bin kein Räuber, wohl aber ein Desperado!«, erklang es zurück. »Wisst Ihr, Fremder. was das ist?«
»Ein Verzweifelter — ein Mann, der vom Gesetze verfolgt wird und der geschworen hat, jeden Menschen, der sich ihm über die Grenze einer gewissen Entfernung nähert, sofort niederzuschießen. Aber Ihr habt nichts von mir zu fürchten. Ich bin ein Mann des Friedens, und wenn ich doch einmal Gebrauch von meinen Waffen mache, so ...«
»Spart Eure Worte, Fremder! Ihr habt die Grenze bereits überschritten, und wenn ich Euch noch keine Spitzkugel zwischen die Augen setze, so tue ich dies nur deshalb nicht, weil ich erst erfahren will, wie es möglich ist, dass Ihr auf dem harten Steinboden meine Spur verfolgen könnt, wo ich doch selbst die feinste Nase des besten Spürhundes zu täuschen verstehe!«
»Aber meine Augen könnt Ihr nicht täuschen.«
»Das ist ja gar nicht möglich, dass Ihr auf dem harten, nackten Steinboden, auf dem auch nicht ein Stäubchen liegt, meine Spur erkennen könnt!«
»Und ich sage Euch, dass Ihr auf dem linken Fuße hinkt.«
»Was?! Woher wollt Ihr denn das wissen?!«
»Ihr habt nicht immer gehinkt, sondern erst vor ganz kurzer Zeit, ich schätze es auf zwei bis vier Stunden, habt Ihr Euch unten im Cañon an einer Quelle den linken Fuß verletzt. Ihr hinkt ganz tüchtig, und eben deshalb bin ich Euch gefolgt, denn ich bin sonst kein Nachspionierer, aber ich glaubte, vielleicht könntet Ihr meine Hilfe brauchen.«
»Mann, Mann, wer seid Ihr denn nur?!«, erklang es aus dem Versteck in immer größerem Staunen. »Solche Augen hat ja nicht einmal der weiße Adler besessen, der doch aus jeder Fährte das Alter eines jeden Tieres bestimmen konnte!«
»Ihr meint den Häuptling der Chocktaws?«
»Ja. Sie waren meine Freunde, bis sie nach einem fernen Territorium verpflanzt wurden.«
»Dann müsst Ihr auch meinen Namen kennen, denn die Chocktaws waren auch meine Freunde.«
»Wie heißt Ihr?«
»Die Chocktaws nannten mich Chil-ma-u-mak.«
»Was, Ihr wäret Flammenauge?!«, erklang es in immer größerem Staunen.
»Ich bin es.«
»Der ungeblendet in die strahlende Sonne blicken kann?!«
»Ich kann es.«
»Herr, gebt mir erst diesen Beweis, ehe ich Euch glauben kann, jetzt einmal ... doch da müsstet Ihr Euch umdrehen ...«
»Wenn Ihr von der Schärfe meiner Augen schon gehört habt, so kann ich Euch einen anderen Beweis geben. Mit dem Gewehre, dessen Mündung ich da zwischen den Steinen hervorlugen sehe, würdet Ihr mich niemals treffen, vorausgesetzt, dass Ihr beim Zielen über das Korn visiert. Bei Eurem Sturze vorhin an der Quelle scheint sich das Korn einige Striche nach links verschoben zu haben.«
Eine kleine Pause — dann sprang in einer Entfernung von etwa dreißig Schritt hinter den Felsblöcken ein Mann empor, eine verwilderte Gestalt, der schwarze Vollbart graumeliert.
»Bei allem, was lebt, wer solche Augen hat, der kann eben nur der Mann sein, der bei den Indianern den Namen Flammenauge führt, und was ich von diesem Manne schon alles gehört habe — wird er mich nicht verraten! Seid mir willkommen, Freund meiner indianischen Freunde.«
Der Jäger ging hin, sie schüttelten sich die Hände.
»Und wer seid Ihr, der Ihr Euch einen Desperado nennt und hier oben wie ein Adler haust?«
»Habt Ihr von Bob Snyder gehört?«
»Wie, Bob Snyder?«, stutzte der andere. »Der im Sacramento-Tale eine kleine Farm besitzt?«
»Besaß, besaß!«
»Den man allgemein den stillen Bob nannte, den friedlichen Bob, den glücklichen Bob?«
Da lachte der alte Mann wild auf, grimmig und furchtbar höhnisch.
»Der glückliche Bob, hahahahaha!«
Doch schnell hatte er sich wieder beruhigt.
»Also Ihr kennt mich, wenigstens dem Namen nach. Dann habt Ihr doch auch noch mehr von mir gehört.«
»Nicht dass ich wüsste.«
»Die ganze Welt spricht doch davon.«
»Wovon?«
»Von dem Verzweiflungskampfe, den ein Bettler mit einer Milliardärin um ein Kind führt.«
»Die Welt ist groß, mein lieber Freund.«
»Aber alle Zeitungen stehen doch voll davon. Nicht weniger als eine Million Dollars sind auf meinen Kopf gesetzt, und diese Prämie wird immer als Annonce in allen Zeitungen erneuert.«
»Eine Million ist viel, von solch einer Prämie auf einen Menschenkopf habe ich allerdings noch nie gehört. Aber ich bin inzwischen, mehr als zwölf Jahre lang, in fernen Erdteilen gewesen, in Asien und Afrika, habe mich immer in Wildnissen aufgehalten, bin erst seit zwei Wochen wieder in Amerika und habe aus besonderen Gründen immer nur die einsamsten Gegenden aufgesucht, jedes Stück Zeitungspapier benutzte ich nur, um Pflanzen dazwischen zu pressen — nein, ich weiß von dem Falle nichts.«
»So lasst ihn Euch erzählen. Kommt, folgt mir in mein Versteck. Ja, ich hoffe sogar, in Euch eine mächtige Hilfe zu finden, wie ein Blitz ist es plötzlich in mir aufgegangen, und seid von vornherein versichert, ehe Ihr selbst entscheiden sollt, dass Ihr es mit einem Ehrenmanne zu tun habt.«
Der Alte schulterte sein Gewehr und führte mit etwas hinkendem Schritte an.
Die Gegend hatte sich verändert, aus dem ebenen Plateau war ein Labyrinth von Felsblöcken geworden, die sich immer mehr auftürmten, bis sie ein richtiges Gebirge bildeten.
Den Weg, den der Alte führte, hätte nach einmaliger Begehung niemand wieder finden können, wohl auch der beste Jäger nicht, deshalb sei er nicht weiter beschrieben.
Nur zehn Minuten dieses mehr Kletterns und Kriechens als Gehens, dann schlüpfte der Alte in eine schmale Felsenspalte, die sich aber gleich erweiterte, dann noch um eine Ecke herum, und die Eindringenden kamen in einen größeren Raum, erleuchtet durch ein Feuerchen.
Es war ganz wohnlich eingerichtet, die Felswände und der Boden mit Fellen und Pelzen belegt, von einer Art Gerüst hingen Schinken und Speckseiten und Pemmikansäcke, voll getrocknetes und gemahlenes Fleisch unseren Würsten entsprechend, massenhaft sonstige Utensilien, die ein einsamer Jäger gebraucht, und an dem Feuer saß ein Knabe von etwa zwölf Jahren, ebenso in abgetragenes Leder gehüllt wie der Alte, aber dennoch einen sauberen Eindruck machend, überhaupt ein hübscher, intelligent und brav aussehender Junge.
»Erschrick nicht, Fred — es ist ein guter Freund, den ich mitbringe, von dem wir keinen Verrat zu fürchten haben — sieh, das ist Flammenauge, der berühmte Jäger und Pfadfinder, von dem ich Dir schon so viel erzählt habe, wenn auch ich ihn noch nie persönlich gesehen hatte — und hier, das ist mein Sohn Fred, um den ich, so gut wie ein Bettler, mit einer Milliardärin, mit der Eisenbahnkönigin Isabel Allan seit nun schon zwölf Jahren einen Verzweiflungskampf führe, weil sie diesen Jungen für ihr Kind hält. Nun setzt Euch, Freund, ehe ich Euch erzähle, sollt Ihr essen, auch ich bin hungrig.«
Vater und Sohn trugen auf, und als der Hunger gestillt war und die beiden Erwachsenen ihre Pfeifen angezündet hatten, begann der Alte zu berichten.
Ich, Bob Snyder, bin in San Francisco, das wir einfach Frisco nennen, gebürtig. Mein Vater war Schreiber auf dem Gericht, kein höherer Beamter, hatte aber eine gut bezahlte Lebensstellung mit späterer Pension.
Als ich 14 Jahre alt war, brachte er auch mich auf dem Amtsgericht in Frisco als Schreiberjunge unter. Ganz gegen meinen Geschmack. Denn ich war zwar immer ein sehr lebhafter Junge gewesen, der sich am liebsten in den Wäldern herumtrieb, zugleich aber auch ein unverbesserlicher Träumer, ein fast menschenscheues Kind.
Ich hatte nämlich von jeher von einer einsamen Hütte am schattigen Bachesrande geträumt, wo ich ganz allein hausen könnte, mich vom Ertrage meines Gärtchens und von der Jagd ernährend.
Da passte ich ja nun freilich auf den Schreibsessel in der dumpfen Aktenstube wie die Faust aufs Auge. Aber einmal war ich ein gehorsamer Sohn, das lag mir durch gute Erziehung in Fleisch und Blut, und zweitens sah ich ein, dass ich es als Amtsgerichtsschreiberjunge doch noch besser hatte als in irgend einem anderen Berufe, wenn der sonst auch meinen Körperkräften mehr entsprochen hätte. Denn das Amtsgericht wurde täglich schon um drei Uhr geschlossen, dann war ich schon Herr meiner selbst, konnte dann ja ganz meinen Neigungen leben.
Das tat ich denn auch und spielte in meiner vielen Freizeit nach wie vor den Robinson. Das Richtige freilich war es nicht. Aber sechs Jahre habe ich es doch brav ausgehalten. Bis meine Mutter starb. Der Vater war ihr schon vorausgegangen. Meine Mutter war in den letzten Jahren gelähmt gewesen, ich war ihr ein und ihr alles, der hätte ich es ja nicht antun können.
Nun aber machte ich kurzen Prozess. Ich ging mit meinen Ersparnissen und dem bisschen, was ich geerbt hatte, nach Osten, und im Sacramento-Tale fand ich das, was ich in meinen Träumen mir immer ausgemalt hatte. In einer Wildnis ein Stückchen Land, das ich für mich registrieren ließ. Hier erbaute ich mir am Bachesufer eine Blockhütte und legte ein Gemüsegärtchen an.
Zwei Jahre habe ich hier gehaust, im Frühling und Sommer das Land bebauend, im Herbst und Winter der Jagd nachgehend, die höchst ergiebig war. Denn, ich betone nochmals, es war eine völlige Wildnis — und dennoch ging dicht neben meiner Hütte nicht nur die Pacific vorüber, sondern auch eine große Eisenbahnstation mit einer ganzen Villenkolonie und einem prächtigen Hotel befand sich keine halbe englische Meile von mir entfernt.
Wie das zu erklären ist? Einfach indem meine kleine Farm an einer unübersteigbaren Felswand lag, die mich und die ganze weltverlassene Wildnis von jenen Menschen trennte. Aber gleich im Anfang meiner Einsiedlerzeit entdeckte ich bei Verfolgung eines Wildes eine Höhle, die sich als Spalte durch die ganze Felswand fortpflanzte, auf der anderen Seite auch wieder an einem ganz einsamen Orte zu Tage tretend.
Für mich war diese Passage natürlich von größter Bedeutung. So konnte ich, wie ich wünschte, in meiner Wildnis in absoluter Einsamkeit leben und dennoch jederzeit mit Menschen in Verkehr treten, hatte ein nahes Absatzgebiet für meine Felle und Pelze und Gartenprodukte, die ich nicht selbst verwerten konnte, musste nur mein Geheimnis behüten, dass mir nicht etwa neugierige Menschen auf den Hals kamen. Doch in jener Ansiedlung herrschte der Dollar, niemand fragte, woher der arme Jäger kam, der ab und zu seine Beute gegen Mehl und Munition und Salz und Tabak vertauschte.
So also habe ich hier zwei Jahre gelebt. Zwei Jahre ganz allein, meine ich. Ich fühlte mich in meiner Einsamkeit glücklich, sehr glücklich. Wohl stieg in meinem Herzen manchmal eine heimliche Sehnsucht auf, die ich mir aber als eine Narrheit immer auszureden wusste.
Da schenkte mir von ganz allein, ohne dass ich ihn darum gebeten, der Himmel das, was mir zu meinem vollständigen Glück noch gefehlt hatte. Die nächste Farm lag acht englische Meilen von mir entfernt. Ich kam doch einige Male hin. Ich mache es kurz. Der Farmer hatte eine Tochter. Mary wurde mein Weib, teilte mit mir meine Einsamkeit. — — — —«
Der Erzähler machte eine kleine Pause. Traumverloren blickte er in das Feuer. In dem verwetterten, von zahllosen Fältchen durchzogenen Gesicht zuckte es. Endlich fuhr er fort:
»Ach, Fremder, war das eine glückliche, glückliche Zeit! Ich will sie nicht auszumalen versuchen. Das Herz könnte mir dabei verbluten. Und dann erreichte mein Glück seinen Höhepunkt. Als mir meine Mary einen Knaben schenkte. Sind alle Väter solche Kindernarren wie ich damals einer gewesen bin? Wenn ich das kleine zappelnde Wesen auf meinen Armen hatte, wenn es mir mit den Händchen ins Gesicht patschte und an meinen Haaren zerrte — ach, wie soll ich es beschreiben!
Nicht länger als zwei Wochen sollte meine Seligkeit währen. Dann kam die Katastrophe.
Erwähnen muss ich noch, dass ich für die Zeit der großen Not von der Farm meines Schwiegervaters eine Frau zu mir genommen hatte. Die Jessy, eine alte Negerin. Mir hatte das Weib mit dem schielenden Blick niemals gefallen, aber sie war schon Marys Amme gewesen, meine Frau wollte keine andere haben als sie. So fügte ich mich. Ich weihte sie sogar in mein Geheimnis ein, in die Passage durch die Felswand, weil damals doch viel aus der nahen Bahnstation zu besorgen war, und das schwarze Weib war schlau genug, um das Geheimnis zu wahren.
Nicht länger als zwei Wochen sollten meine Vaterfreuden währen. Ich hatte damals täglich nach den Biberfallen zu sehen, dass nicht Raubtiere die kostbaren Pelze angingen, was mich immer einige Stunden abhielt. Sonst hätte ich meine Hütte ja gar nicht mehr verlassen, aber es stand doch gar zu viel auf dem Spiele, und eben deshalb hatte ich der Negerin den geheimen Weg nach Greenville — so hieß die Kolonie mit Station — gezeigt, falls schnell einmal etwas zu besorgen war.
Eines Nachmittags — also als der kleine Fred, wie ich ihn nach meinem Vater genannt hatte, zwei Wochen alt war — kam ich von den Biberfallen zurück. Schreiend rannte mir die alte Negerin entgegen.
›Das Kind ist tot, Mary hat es im Schlafe erdrückt!‹
So war es. Ich will nicht den Jammer der Mutter beschreiben, nicht von mir sprechen, wie ich vor der kleinen Leiche stand.
Überhaupt dauerte meine Verzweiflung oder Betäubung gar nicht lange.
Fremder, Ihr wisst wohl, was so ein kleines Wurm von wenigen Tagen zu bedeuten hat. Rein gar nichts. Ich meine: Ihr wisst wohl, wie schwer solche kleine Kinder voneinander zu unterscheiden sind. Wenn sie nicht ganz besondere Merkmale haben. Sonst ist ja alles noch so unentwickelt, es ist noch kein charakteristischer Ausdruck im Gesicht vorhanden.
Meine Frau hatte wie gewöhnlich ihren Nachmittagsschlaf gehalten, wobei sie neben sich das Kindchen zu liegen hatte — als sie erwachte, hatte der kleine Fred halb unter ihr gelegen — tot!
Selbstverständlich war es Fred. Mary zweifelte nicht im Geringsten daran. Das waren doch dieselben blonden Härchen, das waren dieselben Züge ... es war eben unser Kind.
Na, was für ein Kind sollte es denn sonst auch sein?!
Das Mutterauge ließ sich täuschen. Da erwachte kein Instinkt. Mein Auge ließ sich nicht täuschen.
Ich war in den drei Jahren ein gar tüchtiger Jäger geworden. Für mich glich nicht mehr ein Fuchs dem anderen, jeder Fuchs besaß für mich eine andere Physiognomie. Wahrhaftig, ich kann jeden Fuchs und jedes andere Tier schon am Gesicht, an den Augen unterscheiden, denn ich bin ein Jäger, der ... doch das brauche ich Euch nicht erst zu erzählen.
Nur ein starrer Blick genügte.
›Das ist ja gar nicht unser Fred! Das ist ein fremdes Kind!‹
Und wie ich das noch rufe, da sehe ich die schielenden Augen der schwarzen Hexe auf mich gerichtet — mit so einem ganz besonderen Ausdrucke — so lauernd und mit so furchtbarer Angst zugleich — und da geht mir auch gleich eine Ahnung auf — nein, da weiß ich plötzlich alles ganz bestimmt ...
›Weib, Du hast ein fremdes totes Kind untergeschoben!‹
Und da dreht sich die Negerin auch schon um und flieht davon — ich ihr nach — stürze einmal, wodurch sie einen großen Vorsprung bekommt — und dann geht die Jagd in das Schluchtengebiet hinein — die alte Hexe, wie eine Wahnsinnige schreiend, läuft über einen schmalen Grat, sie will den Eingang zu der Felsspalte auf einem näheren Wege gewinnen — plötzlich rutscht sie aus, wirbelt durch die Luft, verschwindet in einer Tiefe von einigen hundert Metern.
Ich habe ihre zerschmetterten Knochen später einmal betrachtet. Damals dachte ich nicht daran, ihr nachzusteigen.
Wie ich plötzlich nach Greenville gekommen bin, weiß ich nicht. Ebenso wenig weiß ich, was ich dort eigentlich wollte. Nicht, als ob mich etwas wie eine Ahnung erfasst hatte.
Aber etwas anderes muss ich noch nachträglich erwähnen.
Gerade vor elf Tagen war es gewesen, da hatte in Greenville Mister Eugen Allan den Pacificzug mit Gattin und einiger Dienerschaft verlassen, um in dem Hotel Aufenthalt zu nehmen. An sich ein ganz unbedeutender Mensch, aber er hatte die Miss Isabel Forman geheiratet, das einzige Kind des Eisenbahnkönigs Forman.
Und seine Gattin war während einer Reise unvermutet von ihrer Niederkunft, ihrer ersten, überrascht worden. Sie erfolgte also in dem Hotel, es sollte eine sehr schwere gewesen sein, Mistress Allan würde nach Ausspruch der Ärzte auch nie wieder eine haben, aber sie hatte doch einem gesunden, kräftigen Jungen das Leben geschenkt. Auch war er auf Wunsch der sehr bigotten Mutter von einem zufällig anwesenden Missionar schon getauft worden, auf den Namen Fred. Vorläufig weilten die Eltern noch in Greenville, die Mutter war eben noch nicht reisefähig.
Dies alles war mir bekannt, da ich erst vor einigen Tagen in Greenville gewesen war.
Zuckte mir jetzt plötzlich eine Ahnung auf, etwa deshalb, weil dieses Kind zufällig ebenfalls den Namen Fred erhalten hatte?
Ich weiß nichts davon, dass ich solch eine Ahnung gehabt hätte. Ich weiß nur, dass ich mich plötzlich auf der Eisenbahnstation befand.
Und da sehe ich auf dem Bahnsteig eine Gesellschaft stehen, reisefertig, den Zug erwartend.
Und da sehe ich neben einer hocheleganten Dame eine Frau, eine Dienerin, offenbar eine Amme, welche ein Kindchen auf dem Arme hat.
Und da streckt mir dieses Baby mit jauchzendem Kreischen die Ärmchen entgegen.
Nicht etwa, dass es mich erkannt hätte. Das kann man von einem vierzehntägigen Kinde nicht verlangen, weiß ich.
Aber ein einziger Blick von mir genügte auch schon.
›Das ist mein Kind, das ist mein Fred!‹
Fremder, verlangt keine Beschreibung von der Szene, die sich da auf dem Bahnhofe abspielte.
Hier ein Vater, der sein Kind wieder haben wollte, und dort eine Mutter, die dasselbe Kind als das ihre beanspruchte.
Hier seht, mir fehlt an der linken Hand der kleine Finger — ich hab die Ehre, dass ihn mir die Eisenbahnkönigin Mistress Isabel Allan, die reichste Frau der Erde, höchsteigenzähnig abgebissen hat — dort auf dem Bahnhofe von Greenville. Glatt abgebissen!
Dafür muss die Dame heute noch auf ihrem schönen Kopfe eine talergroße Stelle ohne Haare haben. Die habe ich ihr ausgerissen.
Zwei ihrer Diener und einen Eisenbahner habe ich zu Krüppeln geschlagen. Sicher ganz unschuldige Menschen. Ich konnte nichts dafür. Warum mischten sie sich ein.
Dann war ich überwältigt.
Und dann — ob am anderen Tage oder erst eine Woche später, das weiß ich nicht — stand ich vor dem Untersuchungsrichter.
›Ja, was wollen Sie denn nur eigentlich?‹
›Mein Kind wollte ich wiederhaben.‹
›Wie kommen Sie denn nur dazu, dieses fremde Kind für das Ihre zu halten?‹
Nein, ich wusste nicht, ob ich nur einen Tag oder eine ganze Woche vor mich hin gebrütet hatte.
Aber was ich zu antworten hatte, das wusste ich, klipp und klar!
Wenn eine junge Mutter ihr Kind im Schlafe erdrückt und erstickt hatte, so war es die da, die Mistress Isabel Allan! Möglich, dass sie selbst davon gar nichts wusste. Aber andere hatten davon gewusst, hatten den größten Schreck bekommen. Wie den Schaden wieder gut machen?
Jessy, die schwarze Hexe, war gerade in Greenville gewesen.
›Wisst Ihr nicht ein Kind von etwa vierzehn Tagen, einen gesunden Jungen, ungefähr so und so aussehend? Könnt Ihr uns den nicht schnellstens unter der Hand beschaffen? Wir zahlen jeden Preis. Nur dass die Mistress Allan, wenn sie erwacht, ihr Kind nicht tot findet. Sonst macht die uns ebenfalls tot.‹
Ja, die alte Negerin hatte solch ein Kind gewusst, genau so aussehend wie dasjenige, dessen Leiche ihr wahrscheinlich auch gezeigt worden war. Und sie hatte meinen kleinen Fred von der Seite der schlafenden Mutter geholt. Es war ja nur eine Viertelstunde hin und her.
Oder ist es nicht so, eh?!
Da schwur die Lucy Batterson, die Amme des Goldkindes, auf die Bibel, dass sie während der ganzen Zeit, während welcher der Austausch nur hätte vorgenommen werden können, ihren Pflegebefohlenen nicht von den Armen gelassen hätte.
Und dann schwor Señor Domingo Lazare, der Haushofmeister dieses Gesindels, als spanischer Katholik auf das Kruzifix, dass er während dieser selben Zeit, die nur in Frage kommen konnte, die Amme und das Goldkind auf ihren Armen nicht aus den Augen gelassen habe.
Und da sprang ich über die Barriere und schmetterte den spanischen Jesuiten mit dem vermaledeiten Fuchsgesicht mit demselben Kruzifix zu Boden! 's hat ihm leider weiter nichts geschadet.
Und dann war ich in Frisco, in einer Zelle mit Gummipolstern, in einem Narrenhaus, der Privatirrenanstalt des Professors Eli Smart.
Fremder, lasst's mich kurz machen.
Man hat mich in der Zelle nicht lange halten können. Nicht länger als drei Wochen. Dann war ich draußen. Hatte freilich den Weg durchs Fenster genommen.
Die Allans wohnten, wie noch heute, in Frisco. Das wusste ich. Und ich wusste auch den Weg in das Zimmer zu finden, in dem mein kleiner Fred schlief. Da habe ich ihn mir natürlich herausgeholt. Und so bin ich mit ihm auf die Wanderschaft gegangen. Nach dem Sacramentotale. Erst mal meine Frau wiedersehen wollte ich. Habe unterwegs den kleinen Kerl nur mit Eiern gefüttert, die ich den Waldvögeln aus den Nestern entnahm.
So erreichte ich die Farm meines Schwiegervaters.
Ich fand ihn nicht mehr am Leben, er hatte einen Schlaganfall gehabt, weil seine Tochter, meine Frau, ins Wasser gegangen ...«
Ein schluchzender Laut erstickte einmal die Stimme des Erzählenden. Doch nur ein energisches Kopfschütteln, und er konnte fortfahren:
»Dann hatte man mich wieder. Die, die mich mit dem Kinde gefangen, konnten hunderttausend Dollars unter sich verteilen.
Ich kam wieder ins Irrenhaus, in dasselbe.
Diesmal musste ich vier ganze Jahre in der Gummizelle aushalten, ehe ich entschlüpfen konnte.
Die Mistress Isabel Allan residierte immer noch in oder bei Frisco, jetzt aber als Witwe. Es war am hellerlichten Tage, als ich in den Garten des Palastes drang. Aber in was für einen Garten! Nämlich wie der geschützt war, meine ich! Über drei Mauern musste ich weg, über noch mehr Gitter, alle möglichen Signalzeichen abstellen, ein paar Duzend Hunde hatte ich zu beschwichtigen.
O, Freund, Irrsinnige sind gar schlau!
So kam ich in den Garten und sah meinen kleinen Fred.
Und verdammt will ich sein, wenn der vierjährige Bengel, in Samt und Seide eingewickelt, nicht gleich wusste, wer ich war. Obgleich ich nur in Lumpen gehüllt war.
›Was willst Du denn?‹, lachte er mir entgegen.
›Willst Du mit mir kommen, mein Kind?‹
›Wohin denn? Wer bist Du denn?‹
›Ich bin Dein Vater.‹
›Wenn Du das sagst, dann glaube ich's Dir, und dann komme ich mit Dir.‹
Und da nahm ich ihn mit mir, über alle die Mauern und Gitter hinweg, und bin mit ihm ins Coloradogebirge, und da haben wir zusammen fünf Jahre gehaust, so ungefähr wie hier, und es war eine schöne, eine glückliche Zeit!
Fünf Jahre! Dann hatten sie uns wieder, mich und meinen Jungen. Und die uns gefangen, die konnten unter sich eine halbe Million Dollars verteilen.
Wieder rein ins Narrenhaus, immer wieder zu Professor Eli Smart! Der musste nun doch schon seine Erfahrung haben, wie man den unheilbaren Geisteskranken einmal endgültig unschädlich machte.
Aber es half alles nichts — diesmal brauchte ich nur ein Jahr, dann hatte ich wieder ein Schlupfloch gefunden.
Und wiederum holte ich mir meinen Jungen aus dem Palaste der Milliardärin. Aber fragt nicht, wie ich das fertig gebracht habe. Was ich diesmal für Hindernisse zu überwinden hatte! Ich musste gewissermaßen erst einen dreifach gepanzerten Geldschrank aufknacken, in den man ihn eingesperrt hatte. Wenn das auch nicht wörtlich zu nehmen ist. In anderer Hinsicht war seine Befreiung noch viel, viel umständlicher.
Diesmal ging die Flucht bis hierher in den wildesten Teil des Felsengebirges. Ein alter Jäger, dem ich mich anvertraute, führte mich hier in dieses Versteck, in dem ich nun seit zwei Jahren mit meinem Jungen lebe.
Das ist meine Geschichte!«
Der Alte, der nach seinen Zeitangaben erst 35 Jahre zählte, schwieg. Mit unerschütterlichem Gleichmut hatte ihm der andere zugehört, ohne ihn irgendwie zu unterbrechen.
»Es scheint verdammt wenig Eindruck auf Euch gemacht zu haben, Fremder, was ich Euch da erzählt habe!«, meinte jener denn auch.
»Lasst das meine Sache sein, was dieses schier unglaublich Klingende auf mich für einen Eindruck macht. Aber ich glaube Euch jedes Wort. Nun gestattet mir mal erst einige Fragen.«
»Fragt los.«
»Ihr seid tatsächlich der festen Überzeugung, dass Euer lebendes Kind mit dem toten der Mistress vertauscht worden ist?«
»Ja!«, erklang es ganz einfach zurück, es war auch wirklich kein Wort weiter nötig.
»Könnt Ihr irgend einen Beweis dafür bringen?«
»Nein.«
»Ihr meint, jene Amme und der Haushofmeister haben darum gewusst und einen Falscheid geleistet?«
»So ist es ganz ohne Zweifel.«
»Leben diese beiden noch?«
»Die Amme war vor zwei Jahren schon tot, der spanische Jesuit war noch immer Haushofmeister bei der Allan.«
»Glaubt Ihr, dass die Mistress Allan selbst um die Vertauschung wusste oder nachträglich davon erfahren hat?«
»Ganz sicher nicht. Sie ist in dem Wahne, dass es wirklich ihr Kind ist. Und das ist es eben, weswegen ich diesem Weibe nicht einmal zürnen kann.«
»Ihr seid ein edler Mensch. Nun muss ich erst eine offene Frage stellen. Dass Ihr jetzt bei ganz klarer Vernunft seid, das merke ich. Seid Ihr aber einmal irrsinnig gewesen?«
»Niemals! Wenn ich in meiner ersten Verzweiflung manchmal einen Tobsuchtsanfall hatte, das heißt Wutausbrüche, und dann mich einem dumpfen Brüten hingab, so war das etwas ganz anderes. Nein, irrsinnig bin ich nie gewesen, keinen Augenblick. Man hat mich zu Unrecht für geisteskrank erklärt. Der körperlichen Vergewaltigung hat man auch eine geistige hinzugefügt.«
»Habt Ihr nie daran gedacht, Euer Kind der Dame freiwillig zu überlassen?«
»Weshalb sollte ich dies tun?«, fragte Snyder zurück, ganz ruhig, was sehr zu beachten war.
»Weil Ihr doch ein Mann von ziemlicher Bildung seid. Ihr seid Gerichtsschreiber gewesen. Ihr müsst doch erwogen haben, dass Euer Kind bei der reichen Dame eine ganz andere Erziehung bekommt und für später, abgesehen von einer Erbschaft, ganz andere Aussichten hat, als wenn Ihr Euren Sohn hier in der Wildnis aufwachsen lasst. Deshalb bleibt er ja immer Euer Sohn, und wenn er Euch als Vater anerkennt, kann er ja später bei seiner Volljährigkeit Euch als solchen reklamieren.«
»Herr, was Ihr da sagt, hat alles Hand und Fuß«, entgegnete der Alte. »Ja, das habe ich alles erwogen. Gut, ich bin sofort bereit, meinen Fred der fremden Dame zu überlassen, mag sie ihn meinetwegen für ihr Kind halten. Aber nur unter der Bedingung, dass Fred selbst hiermit einverstanden ist.«
»Er ist es nicht?«
»Fragt ihn selbst.«
Der Junge brach in ein Lachen aus, das halb fröhlich, halb bitter klang.
»Nein, nein, nein! Niemals, niemals! Lieber will ich wie ein wilder Wolf gehetzt werden — ja eher lasse auch ich mich ins Irrenhaus in so eine Polsterzelle sperren, so Fürchterliches mir mein Vater auch davon erzählt hat, ehe ich freiwillig zu jener verrückten Frau zurückkehre, die sich meine Mutter nennt.«
»Ich denke aber doch, Du hast es bei ihr sehr gut gehabt.«
»Gut? Hahaha!«, lachte Fred immer noch. »So gut, dass ich mich gar nicht mehr als Mensch fühlte! Nein, ich wurde von ihr wirklich nicht als Mensch behandelt, sondern als Hund, als geliebter Schoßhund. Ach, wenn ich erzählen wollte! Was die alles mit mir aufgestellt hat! Diese Verrücktheiten! Das glaubt aber gar niemand, wenn man es erzählt! Ich schäme mich auch, davon zu sprechen. Kurz und gut, noch in meinem zehnten Jahre war ich ein Hündchen, oder ein Äffchen, das sie, weil es entfliehen könnte, in einem goldenen Käfig gefangen hielt, und zwar tatsächlich in einem goldenen Gitterkäfig! Da fütterte sie mich mit Zuckerchen und anderen Leckerbissen, um auf diese Weise meine Liebe zu gewinnen. Aber sie wollte mich auch zu Kunststückchen abrichten ...«
»Hm«, brummte der Jäger, seine Augen wieder auf den Vater richtend, »sollte diese Lady vielleicht nicht ganz geistesnormal sein?«
»Ihr sagt es!«, entgegnete jener. »Einen Geistesgesunden sperrt man ins Narrenhaus, eine Geistestranke lässt man auf freiem Fuße. Und nicht etwa, dass sie erst durch den Verlust ihres Kindes oder vielmehr schon durch die schwere Niederkunft ein bisschen verrückt geworden ist. Sie hat schon als unverheiratete Miss Forman tolle Streiche begangen — nein, das waren keine Streiche mehr — besonders auch scheußliche Tierquälereien, auch, auch an Menschen, an Dienerinnen, was nur nicht in die Öffentlichkeit gekommen ist. Sonst hätte die öffentliche Gerechtigkeit Zuchthausstrafe verlangt — oder eben, dass man sie in einem Irrenhause unschädlich machte.«
»Nicht in die Öffentlichkeit gekommen? Woher habt Ihr das dann erfahren?«
»Aus den Geheimakten des Gerichtes. Denn es hat einmal ein Prozess gegen sie wegen solch einer Gräueltat geschwebt, der aber unterdrückt wurde. Ich habe ein Protokoll von misshandelten Dienern und Dienerinnen gelesen, die ihre Herrin direkt des Wahnsinns bezichtigten.«
»Aha! Ja, warum geht Ihr dann nicht auf Grund dieses Protokolls gegen Eure Feindin vor? Dreht den Spieß herum, bringt sie selbst in einer Irrenanstalt unter!«
»Fremder, Ihr sprecht naiv, oder Ihr seid ganz unerfahren. Ich bin so gut wie ein Bettler, und die ist eine Milliardärin. Doch davon ganz abgesehen. Ich will Euch den Hauptgrund sagen, weshalb ich mir meine Kenntnis über ihr Vorleben niemals zunutze machen kann. Als ich vier Jahre als Gerichtsschreiber tätig gewesen, kam ich, eine hohe Vertrauensauszeichnung, in die Geheimkanzlei. Natürlich wurde ich auf Wahrung des Amtsgeheimnisses vereidigt. Und diesen Eid halte ich unter allen Umständen! Und wenn es noch um etwas ganz anderes ginge als um Leben und Ehre, und wenn ich mein Kind dadurch vom Feuertode retten könnte — diesen Eid breche ich nicht, so wenig wie mein gegebenes Wort!«
Wohl mit Betonung, aber sonst doch ganz einfach hatte es der Alte gesagt.
In den Augen des anderen aber flammte es wieder einmal mächtig auf, als er jenem die Hand hinstreckte.
»Hier, nehmt meine Hand!«
Stumm wurde sie genommen und der Druck erwidert.
»Diese Sache ist erledigt. Wie stellt Ihr Euch aber nun das Weitere vor? Was soll zuletzt daraus werden?«
»Das ist einfach genug. Mit dem achtzehnten Jahre wird mein Sohn wie jede andere männliche Person nach amerikanischem Gesetz volljährig. Bis dahin kann ihn Missis Allan, die ihn nun einmal für ihr Kind hält, was auch gesetzlich anerkannt ist, mit Polizeigewalt reklamieren, kann ihn einsperren. Dann aber nicht mehr. Mit seinem achtzehnten Jahre ist er ein freier Mann, steht nicht mehr unter elterlicher Zucht. Also muss ich ihn noch sechs Jahre dieser Verfolgung entziehen. Dann kann er hervortreten. Und was er dann tut, soll mir gleichgültig sein. Aber jetzt gebe ich ihn noch nicht heraus. Es ist nicht mehr ein Kampf von väterlicher Affenliebe, sondern es ist ein Kampf der liebevollen Vaterpflicht, den ich gegen dieses unglückselige Weib führe.«
»Und glaubt Ihr, Euch hier noch sechs Jahre lang verborgen halten zu können?«
»Ich glaube, ja. Wie Ihr Euch hier heraufgefunden habt, das ist mir noch ein Rätsel, das Ihr mir erst erklären müsst. Denn dass Ihr meine unsichtbare Spur verfolgen könnt, das ist noch keine genügende Erklärung. Übrigens aber hättet Ihr mich deshalb noch nicht zu finden brauchen. Diese Höhle ist ein Fuchsbau mit Hunderten von Ausgängen, hier kann uns niemand festnehmen.«
»Und Ihr könnt Euch hier ernähren?«
»Sehr gut. In der Umgegend gibt es Wild genug.«
»Ihr habt noch andere Bedürfnisse als nur Fleischnahrung, ich sehe noch vieles andere hier, was Ihr oftmals ergänzen müsst.«
»Ich habe unten im Tale einen Vertrauten. Jener alte Jäger, der sich meiner annahm und mir dieses Versteck zeigte, ist gestorben, aber er hinterließ mir einen anderen Nothelfer. Früher ebenfalls Jäger, diese ganze Gegend wie seine Tasche kennend, ist Tom O'Bryar, jetzt Tunnelwärter an der Pacific, die unten vorbeiführt. Der versorgt mich mit allem, was ich brauche, wofür ich ihm die erbeuteten Felle abliefere.«
»Er kennt auch den Weg zu diesem Versteck?«
»Ja.«
»Und dieser Mann ist treu?«
»So echt wie Gold — so echt wie sein rotes Haar, das er als echter Irländer hat. Er weiß ja, dass auf meine oder vielmehr meines Kindes Wiederergreifung jetzt eine Prämie von einer ganzen Million Dollars steht, die für diese Milliardärin, der auch noch fast alle amerikanischen Eisenbahnen Dividenden zahlen müssen, übrigens nicht viel zu bedeuten hat — — aber wenn mich dieser Tom O'Bryar wegen schnöden Geldes verrät, dann will ich —«
Der Sprecher brach ab, beugte sich lauschend vor, und gleichzeitig taten der fremde Jäger und Fred dasselbe.
»Vater, das sind Menschen!«, flüsterte letzterer mit allen Zeichen des Schreckens.
»Wahrhaftig, und sie kommen vom Hintergrunde der Höhle!«
»Nein, von der Außenseite.«
»Sie kommen von beiden Seiten!«, ergänzte der fremde Jäger.
»Fort, fort, dass wir den Seitenausgang noch erreichen!«
Mit diesen Worten sprang Snyder auf, brach aber gleich mit einem Weheruf wieder zusammen. Er hatte seinen verstauchten Fuß vergessen, der sich erst jetzt richtig bemerkbar machte.
Und da tauchten in dem Feuerschein schon von beiden Seiten menschliche Gestalten auf, teils abenteuerlich gekleidete Männer, teils in Uniformen.
»Verrat, wir sind verraten!«
»Keinen Widerstand, Bob Snyder!«
»Ha, Tom O'Bryar!!«
Der rothaarige Mann hatte sich vergebens hinter Uniformen zu verstecken gesucht.
»Nehmt Vernunft an, Snyder«, wollte er sich jetzt entschuldigen, »ich meinte es nur gut, es ist das für Euch —«

»Judas Ischariot, so nimm auch von mir Deinen Lohn!«,
rief Bob Snyder,
indem er sein Gewehr an die Wange riss. Im nächsten Augenblick krachte
ein Schuss und tödlich getroffen brach der Verräter zusammen.
»Judas Ischariot, da nimm auch von mir Deinen Lohn!!«
In Snyders Hand donnerte das Gewehr, und tödlich getroffen brach der Verräter zusammen. Dann waren Vater und Sohn überwältigt.
Von der Anwesenheit eines Dritten hatten die Häscher gar nichts bemerkt. Der fremde Jäger hatte sich, noch ehe er gesehen werden konnte, gegen die dunkle Wand geworfen und war wie ein wesenloser Schatten verschwunden.
Nahe bei San Francisco reckt sich ins Meer hinein eine schmale Landzunge, deren verbreitertes und etwas gebirgiges Ende mit einem burgähnlichen Gebäude gekrönt ist.
Es ist denn auch ursprünglich eine Festung gewesen, welche die Spanier, die ehemaligen Herren dieses Landes, hier angelegt hatten. Die amerikanische Regierung hat sie als ganz bedeutungslos für den modernen Verteidigungskrieg schon längst aufgegeben. Im Laufe der Zeiten war das »Seeschloss« im Besitze verschiedener reicher Liebhaber von solchen romantischen Wohnungen, bis es vor drei Jahren von der »tollen Lady« erworben wurde, wie man die Tochter und Erbin des amerikanischen Eisenbahnkönigs allgemein bezeichnete.
Das war damals gewesen, als Mistress Isabel Allan ihren Sohn nach fünfjährigem Verlust zum zweiten Male wiederbekommen hatte. Alle Vorsichtsmaßregeln in ihrer bisherigen Villa gegen eine Entführung hatten also nichts genützt. Da erwarb sie das Seeschloss und traf Sicherheitsvorkehrungen, so dass dieses im Volksmunde den Namen »Zwingburg« bekam.
Allein sie sollte die Zwingburg nicht zu dem Zwecke gebrauchen können, zu dem sie sie angelegt hatte. Ehe sie ihr nunmehr zehnjähriges Kind hier unterbringen konnte, war der Irrsinnige schon wieder ausgebrochen und hatte es ihr zum dritten Male geraubt.
Doch wiederum hatte sich ihre Verzweiflung in seliges Glück verwandelt, die ausgesetzte Prämie von einer Million hatte ihre Schuldigkeit getan, und nun brachte sie ihren wiedergefundenen Sprössling in der Zwingburg unter, aus der es keine Entführung mehr gab. Dafür hatte sie zu sorgen gewusst.
In dem Manne, der an einem Vormittag die Landzunge betrat, hätte schwerlich jemand wieder jenen Jäger erkannt, den wir auf der Adlerhöhe des Felsengebirges kennen gelernt haben. Wohl war es noch dieselbe hohe, athletische Gestalt, es waren noch dieselben edlen, tiefgebräunten Züge, dieselben großen, strahlenden Augen, er trug noch denselben kurzgehaltenen Vollbart — aber als tadelloser Gentleman im schwarzen Gehrockanzug mit Zylinder war er doch ein total anderer geworden.

Weit konnte er den gebahnten Weg nicht verfolgen, so stieß er gegen eine wohl sechs Meter hohe Mauer, welche die ganze Landzunge von einer Wasserseite bis zur anderen überspannte, und auch zu Wasser konnte man sie nicht umgehen, denn dieses Wasser starrte, so weit das Auge reichte, von spitzen Felsenriffen, durch die kein Boot kommen konnte, und so war die ganze Umgebung dieser Landzunge beschaffen.
Und ehe der Herr noch das schwere Eisentor erreicht hatte, sprang er erschrocken oder doch schleunigst einen Satz nach rückwärts. Denn plötzlich war unter seinen Füßen der Kiesboden gewichen. Dann, in Sicherheit stehend, sah er auch, wie sich vor ihm ein Stück des Weges wieder hob. Durch den hochgestreuten Kies entstanden dabei weiter keine Unebenheiten.
Oben in einer schmalen Spalte der Mauer, kaum ein Fenster zu nennen, zeigte sich ein Menschenkopf.
»Sie wünschen?«
»Ich bin für heute früh Punkt zehn Uhr hierher bestellt worden, und die Zeit stimmt.«
»Ihr Name?«
»Doktor Oskar Reichard.«
Eine kleine Pause entstand.
»Ja, die Fotografie ist die Ihre!«, erklang es dann aus der Spalte.
»Fotografie? Meine? Ich habe keine Fotografie abgegeben.«
»Aber Sie sind fotografiert worden, verlassen Sie sich nur darauf. Das Beglaubigungsschreiben haben Sie doch bei sich. Doch das geht mich nichts an, ich habe nur Ihre Fotografie zu prüfen. Das Tor ist offen.«
»Da scheint aber erst eine Falltür zu sein, durch die man in die Tiefe stürzt.«
»Keine Falltür, nur eine Senkvorrichtung, die, wenn man darauf tritt, ein Läutewerk im Schlosse in Bewegung setzt. Kommen Sie nur unbesorgt heran.«
Der Herr ließ sich noch einmal einige Zentimeter einsinken, dann öffnete sich vor ihm das mächtige Tor. Es war die Mauer eines schmalen Gebäudes, ein Torweg führte hindurch, ein grimmig ausblickender Mann, der eher den Namen »Kerl« als »Herr« verdiente, wenn er auch wie ein Gentleman gekleidet war, nahm den Fremden in Empfang.
»Kommen Sie, ich habe Sie ohne Aufenthalt nach dem Schlosse zu geleiten.«
Zunächst war auffallend, wie mörderlich schlecht der Weg gleich hinter der Mauer war. Von einem Wege überhaupt gar keine Spur, die ganze Landzunge war von einer Wasserseite bis zur anderen und das bis zum Aufstieg zum Schlosse über und über mit großen Steinen bedeckt, mit ganzen Felsblöcken, und wo einmal keine Steine lagen, da schien der Boden mit Absicht aufgerissen zu sein.
»Brechen Sie sich nicht den Hals bei dem Spaziergange!«, warnte der Führer denn auch gleich.
»Weshalb ist denn dieser Weg nicht in besserer Verfassung?«, fragte der Herr.
»Weshalb, weshalb?«, echote spottend der andere. »Wissen Sie denn nicht, wo Sie hier sind?«
»Im sogenannten Seeschloss —«
»Nein. in der sogenannten Zwingburg. Und wissen Sie denn nicht, wozu diese Zwingburg angelegt worden ist und wer nun auch seit acht Tagen darin gefangen gehalten wird?«
»Das weiß ich nicht, aber — deshalb können doch die Steine fortgeräumt werden.«
»Nein, das können sie eben nicht! Denn dann könnte die Landzunge von einem Automobil befahren werden, in dem vielleicht der Goldprinz sitzen möchte, neben seinem Entführer, und vielleicht wäre es ein Panzerautomobil, das gleich durch die ganze Mauer raste. Aber auf solch einem Wege kommt kein Automobil fort, und wenn es auch sonst dank seiner Konstruktion über jeden Sturzacker fahren könnte. Das ist die Sache, Herr. O, wir sind sehr vorsichtig!«
Jetzt spannte sich quer über die ganze Landzunge ein hohes, enges Gitter, dessen Stäbe wie Gold glänzten, wenn sie sicher auch nur von Kupfer waren.
»Wissen Sie, wozu dieses Gitter dient?«
»Damit man ohne Erlaubnis nicht weiter kann.«
»Das ist wohl richtig, aber so einfach, wie Sie denken, ist die Sache nicht. Was meinen Sie wohl, was passierte, wenn Sie jetzt diese Gittertür öffnen wollten?«
»Nun?«
»Dann wären Sie sofort ein Häufchen Asche.«
»Asche?!«
»Jawohl, Asche. Dann brauchen Sie sich später mal nicht erst ins Krematorium schaffen zu lassen. Oder Sie können dieses Gitter auch irgendwo anders berühren. Da geht nämlich ein elektrischer Strom durch, und was für einer, von mehreren tausend Volt Spannung.«
Der Mann blickte scharf nach dem Schlosse, das sich in einigen hundert Metern Entfernung noch auf einem Felsen erhob.
»Ja, die rote Scheibe ist verschwunden, es wird eine weiße gezeigt. Also der Strom ist abgestellt. Aber den Teufel noch einmal, wenn sie sich einmal versehen oder wenn die Vorrichtung nicht funktioniert! Ich bin kein Angsthase, aber wenn ich diese Tür öffnen soll, dann mache ich mich immer darauf gefasst, im nächsten Augenblick nicht mehr wert zu sein als eine ausgerauchte Zigarre, von der man auch noch den Stummel aufgekaut hat. Na, da wollen wir es wieder einmal riskieren.«
Er leckte an den Fingerspitzen, klinkte die Gittertür auf, warf sie hinter sich wieder zu.
»So, noch einmal ein unverbrannter Mensch geblieben. Da ist die rote Scheibe schon wieder.«
Sie kraxelten weiter über die Steine.
»Also Sie sind der zukünftige Hauslehrer des Goldprinzen!«, fing der martialisch blickende Mann, der einige gewaltige Narben im Gesicht hatte, bald wieder an. »Na, da gratuliere ich Ihnen! Nein, wissen Sie, ich bedaure Sie aufrichtig. Hören Sie, Herr Doktor, alles, was mit dem Herzen zu tun hat, habe ich auf Schlachtfeldern und in Kolonien als Beamter zurückgelassen, der von den Eingeborenen die Steuern eintreiben musste. Aber wenn ich hier einen neuen Mitbewohner der Zwingburg einführe, dann befällt mich wahrhaftig so etwas wie Mitleid.«
»Ist es denn gar so schlimm hier?«, lächelte Doktor Reichard.
»Schlimm? Fein hat man's hier, wie im Paradiese! Aber — ja, wenn eben die Aber nicht dabei wären. Wenn Sie eine Ahnung hätten, an was für Abgründen Sie hier vorüberwandeln!«
»An Abgründen?«
»Jawohl, auch an wirklichen Abgründen. Falltüren allüberall, wo Sie in die Tiefe stürzen können. Ferner Fußangeln, Selbstschüsse, Dynamitminen und Gott weiß was sonst noch. Das kann alles nur in meiner Begleitung gefahrlos passiert werden, weil da eben erst alles vom Schlosse abgestellt wird, von der Lady selbst, die den Weg immer im Spiegel beobachtet. Wenn die Sache aber nun einmal nicht klappt? Und nun gar erst dieser Rampenweg, den wir jetzt emporsteigen müssen, welche Todesarten einen da umlauern! Na, Señor Lazare hat Ihnen doch gesagt, was Sie hier zu erwarten haben, ehe er Sie als Hauslehrer engagierte.«
»Das hat er.«
»Gut, dann begeben Sie sich freiwillig in diese paradiesische Hölle. Folgen Sie mir.« —
In einem Turmzimmer stand die Herrin der Zwingburg.
Sie war mit ihren dreiunddreißig Jahren, obgleich von der Mutter aus mit spanischem, früh alterndem Blut in ihren Adern, noch immer ein berückend schönes, junonisches Weib, dessen Teint wie Milch und Blut durch das schwarze spanische Spitzenkostüm nur umso mehr zur Geltung kam.
Wohl flackerte in ihren großen, schwarzen Augen ständig ein unruhiges Feuer, aber für irrsinnig hätte sie niemand gehalten, zumal da sie die Verwaltung ihres riesenhaften Vermögens selbst so ausgezeichnet leitete. Wie kann denn zumal in Amerika bei solch finanziellen Talenten jemand für irrsinnig erklärt werden?
Nach einem Klingelzeichen trat ein Diener ein.
»Doktor Oskar Reichard.«
»Ich lasse ihn bitten.«
Es wäre sonst ein durchaus zeremonieller Empfang geworden — wenn nicht etwas anderes dazwischen gekommen wäre.
Kaum war der Gemeldete eingetreten, als Mistress Allan in höchster Bestürzung vor ihm zurückprallte.
»Um Gott — königliche Hoheit —«
Ruhig stand die hohe Gestalt an der Tür, nur eine leise Verwunderung prägte sich in den edlen Zügen aus.
»Gnädige Mylady scheinen mich zu verkennen.«
Aber Doña Isabel, wie sie sich lieber nennen ließ, verharrte in ihrer fassungslosen Stellung, ihre brennenden Augen schienen den schönen Mann verschlingen zu wollen.
»Nein, nein, ich kann mich nicht irren — wir haben uns doch — am Hofe der Königin von Italien — Sie sind doch — der Erbprinz Joachim von — —«
»Mylady verkennen mich. Ich bin Doktor Oskar Reichard, der von Ihnen engagierte Hauslehrer.«
Noch einen glühenden Blick, dann änderte sie plötzlich ihr Benehmen, raffte sich auf, fuhr sich mit der feinen Hand über die weiße Stirn, als wolle sie dort einen Traum verscheuchen.
»Ja, ja — jetzt erkenne ich meinen Irrtum — eine merkwürdige Ähnlichkeit, aber schließlich doch ein ganz anderer —«
Sie nahm die langgestielte Lorgnette vom Gürtel, betrachtete den vor ihr Stehenden nicht anders, als wie sie wahrscheinlich ein ihr zum Kauf angebotenes Pferd betrachtet hätte.
»Also Sie sind von Señor Lazare als Lehrer und Erzieher meines Sohnes engagiert worden. Was Señor Lazare, mein ehemaliger Beichtvater, der mir zu Liebe, um sich weltlichen Geschäften widmen zu können, dem geistlichen Stande entsagt hat, tut, heiße ich in jedem Falle gut. Also Sie sind engagiert. Hat der Haushofmeister Sie instruiert?«
»Vollkommen.«
»Dann habe ich Ihnen nur noch Master Fred — das ist seine Anrede — zu übergeben. Folgen Sie mir.«
Eine Treppe hinab, einen Korridor entlang und sie blieb vor einer Tür stehen.
»Warten Sie hier einen Augenblick — oder kommen Sie mit mir herein. Es handelt sich um eine Angelegenheit meines Sohnes, wie hier in diesem Hause überhaupt alles, alles, und da müssen Sie mit dabei sein.«
Sie betraten den Raum, der mit Kisten und Paketen angefüllt war, zum Teil mit der Post geschickt und noch uneröffnet. Ein Aufbewahrungsraum, ein Lagerplatz in dem einsamen Hause für eintreffende Sendungen.
Ein Mann kam aus der Nebenkammer, zum Büro eingerichtet, verbeugte sich vor der Herrin.
»Ist das Gewehr für Master Fred noch nicht da? Die Lieferzeit ist doch schon überschritten.«
»Soeben ist es angekommen.«
Der Mann brachte unter anderen Sachen ein langes, dünnes Postpaket zum Vorschein, eine Rolle Packpapier. die sehr wohl ein Gewehr mit geradem Schaft enthalten konnte.
»Halt!«, wehrte ihm Doña Isabel, als er die Hülle entfernen wollte. »Doktor Reichard, wenn Señor Lazare Sie wirklich genügend instruiert hat, so wissen Sie, dass ich wegen meines Sohnes Tag und Nacht für Sie zu sprechen bin, Sie können mich mitten in der Nacht wecken lassen, und wenn es auch die scheinbar unbedeutendste Frage ist, die Sie wegen meines Sohnes an mich zu stellen haben. Ich bin Ihnen immer dankbar dafür. Und ich will auch sonst immer von Ihnen gefragt sein. Sie sollen nichts anderes mehr als meinen Sohn im Kopfe haben. Dafür bezahle ich Sie fürstlich. Fällt Ihnen nun jetzt nicht etwas auf?«
»In der Tat.«
»Nun? Immer fragen Sie, sprechen Sie. Ich verlange es von Ihnen.«
»Señor Lazare sagte mir, dass Master Fred bei seinen Mahlzeiten weder Messer noch Gabel benutzen dürfe.«
»Weshalb darf er das nicht?«
»Weil er sich mit diesen scharfen und spitzen Instrumenten verletzen könnte.«
»Nun und?«
»Und nun wundere ich mich allerdings, dass Sie von einem Gewehr sprechen, das Ihr Herr Sohn bekommen soll.«
»Ja, aber mein Sohn, der mehr als die Hälfte seiner Jahre als Jäger verbracht hat, wünscht sich ein Gewehr, um eben schießen zu können, und was mein Sohn begehrt, bekommt er unter allen Umstanden, jeder Wunsch soll ihm erfüllt werden, wenn das einem sterblichen Menschen nur irgendwie möglich ist. Nun?«
»So geben Sie ihm gewiss ein Luftgewehr in die Hand, eine Windbüchse, oder eine, bei welcher das Geschoss durch Federkraft getrieben wird.«
»Halten Sie solch eine Waffe für ganz ungefährlich?«
»O, es kann doch eine ganz schwache Feder sein.«
»Aber er kann das Gewehr einmal gerade so halten, dass die Mündung nach seinem Auge gerichtet ist, es geht los, die Bleikugel oder Erbse geht in sein Auge. Ein spitzer Stechbolzen kommt natürlich gar nicht in Betracht. Schon eine Erbse genügte, um ihn Zeit seines Lebens unglücklich zu machen — und mich auch.«
»Dann würde ich Bogen und Pfeil vorschlagen. Natürlich keine spitzen Pfeile. Zwar ist der Bogen kein eigentliches Gewehr, aber das ist auch ein gar weiter Begriff. Auch das schwertähnliche Messer des Soldaten wird Seitengewehr genannt —«
»Sehr richtig! Ein eigentliches Gewehr braucht es gar nicht zu sein, nur irgend eine Schusswaffe. Aber der Pfeil könnte abprallen und sein Auge verletzen, die Sehne könnte reißen und ihm ins Gesicht schnellen — nun, haben Sie keinen anderen Gedanken?«
»Dann denke ich an ein Blasrohr.«
Ein freundliches Nicken, und Doña Isabel griff nach dem langen, dünnen Paket, entfernte die letzte Hülle. Es war ein meterlanges Blasrohr aus Ebenholz, mit Gold und Elfenbein ausgelegt, das sie zum Vorschein brachte.
»Señor Lazare hat in Ihnen wie immer den rechten Mann gefunden. Es freut mich ungemein, dass Sie auf den richtigen Gedanken gekommen sind. Ja, ein Blasrohr ist die einzige Schusswaffe, die ich meinem erst zwölfjährigen Sohne in die Hand zu geben wage. Mit einem Blasrohr kann man sich niemals in sein eignes Auge schießen. Denn ein Blasrohr geht vorn nur los, wenn man hinten hineinbläst. Oder meinem Sie nicht?«
Aufmerksam blickten die blauen, ruhig strahlenden Augen in die schwarzen, unruhig flackernden der Dame.
Irrsinnig!
Gerade dieser Mann, der sich auch für einen Doktor der Medizin ausgab, als solcher eben die Stelle eines Hauslehrers gesucht hatte, konnte dies beurteilen.
Denn der erfahrene Psychiater vermag den Irrsinn ohne sonstige weitere Beobachtung des Verdächtigten im Auge zu erkennen. Viel Erfahrung gehört freilich dazu. Sonst ist nur noch das Zittern der ausgestreckten Zunge ein ziemlich sicheres Zeichen, dass das Gehirn anormal funktioniert. Auch bei Pferden — und mancher lenkt einen Gaul, ohne zu ahnen, dass es ein irrsinniges Tier ist, ist nur grimmig darüber, dass es bei jeder Gelegenheit, beim geringsten Stutzen durchgeht — erkennt man den Irrsinn am flackernden Auge und an der zitternden Zunge.
Freilich lag bei diesem Weibe hier ein ganz besonderer Fall vor. Gerichtliche Sachverständige hätten es niemals als wirklichen Irr- oder Wahnsinn gelten lassen, der eine Entmündigung oder gar Internierung nötig machte. Sie hätten höchstens von übertriebener Mutterliebe gesprochen. Und doch war es ein regelrechter Irrsinn. Alles was einst die verwöhnte, exzentrische Milliardärstochter zu tollen Streichen veranlasste, hatte sich jetzt in ängstliche Fürsorge um ihr Kind verwandelt. Ja, man konnte sogar ihre erste und einzige Mutterschaft als eine gerechte Vergeltung betrachten. Sie hatte einst als Mädchen ihre Dienerschaft bis aufs Blut gequält, man sprach sogar von Tierquälereien — jetzt wurde sie selbst ständig von furchtbarer Angst um die Sicherheit ihres Kindes gequält, wobei es gar nicht nötig gewesen wäre, dass ihr dies schon mehrmals entführt worden war. Sie glaubte überhaupt, ihr Sohn befände sich in ständiger Lebensgefahr. Das genügte schon, um ihr das Leben zur Hölle zu machen. Nun kam auch noch, um das Maß voll zu machen, die Sache mit dem wahnsinnigen Jäger dazu, der ihr Kind für das seine hielt.
»Was würden Sie nun bei diesem Blaserohr für Geschosse vorschlagen?«
»Erbsen.«
»Mein Sohn kann aber aus Versehen einmal die einziehen, wenn er das Rohr gerade am Munde hat, er kann von der harten, unverdaulichen Erbse im Magen die fürchterlichsten Beschwerden bekommen.«
»Dann weichgekochte Erbsen.«
Das hatte aber Doktor Reichard nicht gesagt, wir wollen nur annehmen, dass er es gedacht hatte.
»Dann Zuckererbsen. Das heißt, ich denke dabei an kleine Zuckerkugeln.«
»Aber auch die können einmal abprallen, sein Auge verletzen.«
»Nun, dann vielleicht so kleine Gummibonbons —«
»Wahrhaftig, Sie sind der richtige Mann, den mir Lazare geschickt hat!«
Freudestrahlend hatte sie es gerufen und brachte aus der Tasche eine Schachtel zum Vorschein, die eben solche Kügelchen aus einer süßen, gummiartigen, essbaren Masse enthielten.
»Sie sehen, ich habe genau denselben Gedanken gehabt. Und was für ein Ziel würden Sie nun vorschlagen, nach dem mein Sohn schießt?«
»Wenn Ihr Herr Sohn schon als wirklicher Jäger gelebt hat —«
»Hat er, hat er! Selbst einige Bären hat er schon mit eigener Hand erlegt! Sogar einen Bärenkampf nur mit dem Messer bestanden!«
»Dann würde ich Tiere vorschlagen, nach denen er schießt.«
»Was für Tiere? Ich will ganz genau Ihre Meinung hören. Es ist immer noch eine Prüfung, ob Sie sich auch als Erzieher meines Sohnes eignen, denn wenn Sie auch schon fest engagiert sind, so können Sie doch laut Kontrakt jederzeit wieder entlassen werden.«
»Nun, Vögel, Rehe und dergleichen.«
»Sie wissen wohl noch nicht, dass der Platz im Freien, der ihm zur Verfügung steht, nur beschränkt ist, und Rehe können doch überhaupt nicht in Betracht kommen. Wie oft ist nicht schon ein Reh, selbst ein weibliches, auf den Jäger losgegangen und hat ihn verletzt.«
»Kaninchen, Meerschweinchen.«
»Gut. Aber wie nun diese Tiere mit diesen Gummibonbons totschießen?«
Der Magazinverwalter hinter ihrem Rücken machte ein unbeschreibliches Gesicht, schnitt eine fürchterliche Grimasse, nur um sich das Lachen verbeißen zu können. Doktor Reichard sah es, aber dessen Gesicht blieb unerschütterlich, mit tiefstem Ernste blickte er in die präsentierte Schachtel mit den süßen Gummikügelchen hinein, mit denen Kaninchen und Meerschweinchen durch das Pusterohr totgeschossen werden sollten. Ein Problem, das noch zu lösen war.
»Hm, das ist allerdings nicht gut möglich. Dann schlage ich vor, lieber gleich tote Tiere als Zielscheiben aufzustellen, die vielleicht auch hin und her gezogen werden können.«
»Sehr richtig, sehr richtig!«, wurde der neue Hauslehrer wieder belobt. »Aber was für tote Tiere meinen Sie nun? Hölzerne? Ausgestopfte?«
»Hm — wie wäre es, wenn der zwölfjährige Knabe, der in seiner Phantasie auf lebendige Tiere schießt, dann die glücklich erlegte Beute auch gleich verspeisen könnte?«
Mit einer graziösen, vielsagenden Handbewegung wandte sich Doña Isabel nach dem Magazinverwalter um, der seine Fratze schnellstens wieder in ernste Falten legte.
»Wann wird die Sendung von der Schokoladenfabrik eintreffen, Mister Cotch?«
»Unbedingt heute noch.«
Sie drehte sich wieder nach dem Hauslehrer um.
»Da sehen Sie, wie ich bereits an alles gedacht habe. Aber es freut mich doch ungemein, dass Sie nachträglich ganz dieselben Gedanken haben wie ich. Ich habe, sofort als mir Fred seine Wünsche äußerte, eine große Schokoladenfabrik in San Francisco beauftragt, mir alle möglichen Tiere in Lebensgröße und in natürlichen Farben zu liefern. Aus Schokolade. Die verschiedensten Arten Vögel, Hasen, Füchse, Rehe, Hirsche — sogar einen braunen Bären in voller Lebensgröße. Nach diesen Tieren kann dann mein jagdlustiger Sohn nach Herzenslust schießen. Und wenn er sie an einer tödlichen Stelle getroffen hat, so kann er die Beute auch verspeisen. An guter Schokolade verdirbt man sich nie den Magen, das weiß ich aus Erfahrung. Allerdings kann man sie überdrüssig bekommen. Und so habe ich meine Pläne schon weiter ausgesponnen. Trotzdem soll mein Sohn fernerhin alles, was er essen will und muss, immer mit seinem Blaserohr selbst erbeuten. Es werden auch solche Tiere aus Porzellan gefertigt, innen hohl, da werden alle seine Speisen hineingefüllt, diese werden dann in seinem Zimmer an Drähten hin und her gezogen und, wenn es Vögel sind, an Drähten hin und her geschwungen, vielleicht auch wirkliche Tauben und Waldhühner und dergleichen, schon gebraten, aber noch einmal mit ihrem Flügelkleid umhüllt, dass sie einen ganz natürlichen Eindruck machen, aber selbstverständlich müssen schon sämtliche Knochen herausgenommen sein, denn wie oft schon ist ein kleines Knöchelchen die Todesursache eines gesunden Menschen geworden — meinen Sie nicht, Herr Doktor? Wie finden Sie diese Idee?«
Die Grimasse, die jetzt Mister Cotch hinter ihrem Rücken schnitt, die hätte unbedingt auch den trübseligsten Melancholiker zum Lachen gebracht. Aber dieser Hauslehrer schien sich keine Mühe geben zu brauchen, um ernst bleiben zu können.
»Ich bewundere die Fürsorge, die Sie um Ihren Sohn haben!«, sagte er, und es klang ganz aufrichtig.
Da löste sich von den roten Lippen der schönen Frau ein qualvoller Seufzer.
»Ja, wenn man Mutter ist, nichts weiter zu verlieren hat als das einzige Kind, und dabei in ständiger Angst, dass es — doch genug, nun wollen wir zu ihm.«
Nach einem kurzen Gange hielten sie wieder vor einer Tür. Die Dame zögerte erst etwas.
»Hat Ihnen Señor Lazare auch mitgeteilt, wie mein Sohn untergebracht ist?«
»Er tat es.«
»Ich muss mich begnügen, mit meinem Sohne die gleiche Luft atmen zu dürfen. Also bewohnen wir ein und denselben Raum, aber — wir sind durch ein Sicherheitsgitter voneinander getrennt.«
»Ich weiß es.«
»Mein Sohn vergreift sich tätlich an mir.«
»Señor Lazare berichtete mir davon.«
»Ist das nicht schrecklich?«
»Er wird sich schon noch an Sie gewöhnen!«, tröstete Doktor Reichard, aber es war, als ob die Stimme des Mannes dabei etwas zittere.
»Ich hoffe es. Auch dass er mich endlich noch als seine Mutter anerkennt. Ach, dieses Leid, dieses Leid, das jener irrsinnige Mann über mich gebracht hat. Denn hätte er mir das Kind nicht wiederholt geraubt, es die meiste Zeit seines jungen Lebens immer bei sich gehabt, so wären solche Gedanken, es habe eine andere Mutter gehabt, doch gar nicht in dem Kinde entstanden. Ach, ich Unglückliche!«
Sie zog ein Spitzentuch, betupfte ihre Augen, da war nicht etwa Künstelei dabei.
»Das einzige, das mich aufrecht hält, ist, dass ich diesen unglücklichen Irrsinnigen auch noch bedauern, ihm verzeihen kann. Da lernt man erst die Kraft kennen, die der aufrichtigen Verzeihung inne wohnt. Doch treten wir ein. Also es ist mein Schlafzimmer, in das ich Sie führe. Es ist nicht anders möglich, wie die Verhältnisse nun einmal liegen. Denn selbstverständlich will ich auch bei Nacht bei meinem Sohne sein, die gleiche Luft mit ihm atmen.«
Es war ein langer, sehr breiter Raum, der direkt, ohne besondere Tür, ins Freie mündete. Dies aber gegen hundert Meter hoch über dem Meere, und zwar war es wirklich das Meer, das dort unten zwischen den Klippen brandete und in weiterer Entfernung, so weit das Auge reichte, wie ein blauer Spiegel glänzte. Also das eigene Zimmer ging in einen vorgebauten Altan über, der mit Blumentöpfen und Palmen und anderen Bäumen besetzt war, wobei man den Eindruck der Natürlichkeit hatte hervorrufen wollen.
Dieser Altan war wie ein Raubtierkäfig mit einem Gitterwerk umschlossen, auch oben, und ferner wurde auch der ganze Innenraum durch ein bis zur Decke reichendes Gitter in zwei Hälften geteilt.
Auf der einen Seite wohnte der Sohn, auf der anderen die Mama. Das Scheidegitter hatte sich nötig gemacht, denn Master Fred war gleich im Anfange seiner diesmaligen Gefangenschaft, als man ihn hierher geschleppt hatte, dem Weibe, das er nicht als seine Mutter anerkannte, zu Leibe gegangen, hatte mit sehr kräftigen Ausdrücken geschworen, dass er jeden, den er erreichen könne, niederschlagen oder mit seinen Händen erwürgen werde, und mit dem zwölfjährigen. sehr starken Jungen, gewandt wie ein Panther, war durchaus nicht zu spaßen.
Wie es sonst in den beiden Abteilungen aussah, wollen wir nicht weiter beschreiben. Jedenfalls seltsam genug. Der zwölfjährige Junge wurde eben noch als Baby betrachtet, hatte allerlei Spielzeug hineinbekommen, Bälle und dergleichen. Nur nichts, womit er sich hätte irgendwie beschädigen können. So gab es in seiner Spielstube auch nicht eine einzige Ecke, an der er sich mit bestem Willen eine Brausche hätte holen können. Alles abgerundet und dick gepolstert. Auch die Gitterstäbe waren mit Polsterung umgeben.
Also hier weidete sich die »glückliche« Mutter an dem Anblick ihres Sohnes, war Tag und Nacht bei ihm. Dort stand ihr Himmelbett. Nur immer durch ein Schutzgitter von ihm getrennt; dass der liebevolle Sohn sie nicht etwa abmurkste.
Jetzt lag er auf einem in der Mitte stehenden Diwan. Das kindliche Matrosenkostüm hatte er mehr nach seinem Geschmack verändert, hatte den dummen Kragen und die blauen Manschetten abgerissen. Zuerst hatte er auf der Seite gelegen; als er die Eintretenden hörte, wälzte er sich schnell herum und legte das Gesicht in die auf dem Kopfpolster gekreuzten Arme.
»Fred, mein lieber, lieber Fred!«
»Ach geht und hängt Euch!«, wurde in die Arme gebrummt, und eine andere Antwort war von dem unbändigen Hinterwäldlerjungen nicht gut zu erwarten.
»Hier hab ich Deinen Lehrer mitgebracht.«
»Er soll sich neben Euch aufhängen!«
»Und hier habe ich Dir auch das Gewehr mitgebracht, das Du Dir gewünscht hast. Du sollst schießen, so viel Du willst.«
Da richtete sich der Junge auf und kam heran.
Es konnte nicht anders sein. er musste zuerst den fremden Herrn erblicken.
Und da ließ dieser seine großen, blauen Augen einmal mächtig aufflammen, gleichzeitig aber auch blitzschnell die Lider wieder niederschlagend.
Und der Knabe zuckte zusammen. Freilich nur für das schärfste Auge bemerkbar. Ein scharfer Blick, und er kümmerte sich nicht mehr um den fremden Herrn, der sein Lehrer sein sollte.
Dieser aber wusste, dass ihn der Junge erkannt und seine Warnung verstanden hatte, überhaupt alles, was ihm das aufflammende Auge gesagt hatte.
»Du kennst mich — und ich komme Deinetwegen hierher — ich will Dich befreien — aber Du darfst mich nicht kennen!«
Dies alles hatte das aufflammende Auge in einenm Moment gesagt, und der Junge hatte es verstanden. Und er spielte seine Rolle ausgezeichnet. Der fremde Mann, der ihn nun auch noch belästigen sollte, existierte nicht mehr für ihn.
»Wo ist das Gewehr?«
»Hier.«
Sie hielt ihm das Blasrohr durch das Gitter hin, Fred nahm es schon mit verwundertem Gesicht, betrachtete es immer erstaunter von allen Seiten.
»Das ist — ist doch — doch ein Pusterohr?!«
»Ja, damit kannst Du schießen, so viel Du willst, und noch heute bekommst Du einen Schokoladenbären.«
Da warf der Junge das Rohr hin und sich selbst auf den Diwan zurück — und lachte und lachte, dass er fast ersticken wollte.
Und die Mutter?
»Ach, wie ich mich freue, dass er sich so freut!«, sagte sie ganz glückstrahlend.
Und dann bückte sie sich und zog das Blaserohr wieder durch das Gitter zu sich heran, nahm es und küsste es, küsste und küsste es immer wieder an den verschiedensten Stellen.
»Hier — hier — haben seine Hände gelegen — seine lieben Hände —«
Da fühlte der sie beobachtende Mann ein tiefes, tiefes Weh in seinem Herzen emporsteigen, bis in seine schönen Augen hinein, und wer in diese geblickt, der hätte sie feucht schimmern sehen.
Das an der Wand befindliche Telefon schrillte, Doña Isabel raffte sich auf aus ihrer Verzückung und trat hin.
»Lazare. Professor Smart ist da.«
»Ich komme sofort.«
»Nun, Herr Doktor«, wandte sie sich an diesen, »Sie sind jetzt mit Master Fred allein, versuchen Sie sein Herz zu gewinnen.«
Sie ging hinaus, und auch wir lassen die beiden allein, die sich schon zu verständigen wissen würden, ohne sich heimlich belauschen oder beobachten zu lassen.
Aber bei der Schlossherrin wollen wir noch einmal verweilen.
Kaum hatte sie die Tür hinter sich geschlossen, als ihr schönes Gesicht einen ganz anderen Ausdruck annahm, sie presste die Hand auf den plötzlich hochfliegenden Busen.
»Und er ist es doch!«, flüsterte sie. »Prinz Joachim! Er hat sich meiner wieder erinnert, hat mich aufgesucht in der Maske eines Hauslehrers, in der Hoffnung, dass ich ihn nicht erkennen würde. Das ist ja so seine Weise. Ach, dass ich ihn damals verkannte, ihn so schnöde behandeln musste! Aber nun, nun — o, dieses Glück, das ich vor meinen Augen auftauchen sehe — mein Kind nun für immer in meiner Nähe und auch ihn, ihn, dem als Weib stets alle meine Gedanken galten, an der Seite eines ungeliebten, verächtlichen Gatten, und jetzt sucht er mich auf, um durch das Herz meines Sohnes auch mein eigenes —«
Sie vollendete den Satz nicht, mit glückstrahlendem Antlitz setzte sie ihren Weg fort. —
Doktor Richard hatte sich, nachdem er längere Zeit bei seinem kleinen Pflegebefohlenen verweilt, auf sein ihm angewiesenes Zimmer begeben.
In Gedanken versunken saß er am Schreibtisch — den Kopf in die Hand gestützt.
Wir können diesen Mann nicht murmeln oder flüstern lassen, wir wollen seine Gedanken erraten.
»Armes Weib, arme, arme Isabel! Was Du auch gesündigt haben magst — Du hast Deine Strafe dafür erhalten, dadurch bist Du entsühnt. Aber ich fühle mich dazu bestimmt, noch schwereres Leid über Dich zu bringen. Denn wohl noch bedauernswerter als Du ist dieser Knabe, der in ungebundenster Freiheit aufgewachsen ist und den Du auf diese menschenunwürdige Weise gefangen hältst, und dasselbe gilt von dem Manne, der sich für seinen Vater hält, ob er es nun wirklich ist oder nicht. Auch ihn, an dessen Stelle eigentlich Du gehörst, muss ich unbedingt befreien, ich halte es für meine Pflicht. Allerdings wird es mir sehr schwer werden, bei solchen Sicherheitsmaßregeln —«
Ein Rascheln unterbrach seinen Gedankengang, aufmerksam blickte er nach dem Kamin, von wo das Geräusch kommen musste.
Hinter der großen Klappe, durch welche man den Rauchfang kontrollieren konnte, erscholl nochmals ein Rascheln mit nachfolgendem Quieken.
Rasch öffnete er die Klappe, um dem Rattenspiel ein Ende zu bereiten.
Es war eine sehr große Öffnung, der Kamin war wohl niemals benutzt worden, keine Spur von Ruß, und er steckte etwas den Kopf hinein, ob er die Ursache des Geräusches vielleicht sehen könne.
Da drangen Stimmen an sein Ohr.
In einem Zimmer, weit entfernt von diesem, saßen zwei Männer im Gespräch. Von dem einen ist nicht viel zu sagen, ein Durchschnittsmensch, desto bemerkenswerter war das Aussehen des anderen.
Das schwarze, talarähnliche Gewand, obgleich es nicht eigentlich ein geistlicher Ornat war, nur ein Kostüm, umschloss die kleine, hagere Gestalt eines schon älteren Mannes, dem wohl niemand zugetraut hätte, dass er sich mehr als die Hälfte seines Lebens in aller Welt umhergetrieben hatte, und zwar nur in den unzugänglichsten Wildnissen, in Urwäldern, Dschungeln, Steppen und Wüsten, unter den furchtbarsten Strapazen und Gefahren, nämlich als General-Kontrolleur der Missionen, welche die Gesellschaft Jesu, deren Mitglieder wir einfach Jesuiten nennen, in aller Welt unterhält.
Er gehörte diesem Orden schon seit vielen Jahren nicht mehr an — vorausgesetzt, dass es da überhaupt eine Entlassung gibt — aber seinem Aussehen nach war er doch noch der Jesuit geblieben. wie man sich einen solchen wenigstens nun einmal vorstellt.
Das hagere, glattrasierte Gesicht mit dem hervorstehenden Kinn, der scharfen Nase und den ungemein klugen Äuglein verriet die unbeugsamste Willenskraft, verbunden mit eiserner Strenge, und war doch immer vom gütigsten Lächeln verklärt — die Menschenfreundlichkeit selbst, die er bei jeder Gelegenheit auch durch Taten bewies, und dabei war dennoch der Grundcharakter dieses Mannes die rücksichtsloseste Habgier.
Das war Señor Domingo Lazare, der ehemalige Jesuitenpater, jetzt Haushofmeister der Mistress Isabel Allan, deren Beichtvater er früher gewesen.
Die Unterhaltung war schon seit längerer Zeit im Gange.
»Ja, mein lieber Professor Smart«, sagte er jetzt, dabei nach seiner Weise, wie er es mit Vorliebe tat, immer die Spitzen der gespreizten Finger zusammentippend, »es hat mir viele, viele Mühe gekostet, den armen Irrsinnigen zum vierten Male in Ihrer Anstalt unterzubringen. Dass Bob Snyder das erste Mal ausbrach — nun, das konnte geschehen. Auch das zweite Mal war entschuldbar. Nun aber, dachten wir, müssten Sie doch Ihre Erfahrung haben. Nein, Sie ließen ihn zum dritten Male entwischen. — Bitte, wollen Sie sich nicht noch eine Zigarre anbrennen? Darf ich Ihnen einmal einschenken?«
Schon immer hatte der Irrenarzt ganz geknickt auf seinem Stuhle gesessen, er wurde immer verwirrter, gerade durch diese Liebenswürdigkeit, mit der ihm der hier allmächtige Haushofmeister auch nochmals das Glas mit dem köstlich duftenden Weine voll schenkte, ihm das brennende Streichholz hinhielt, immer mit seinem gütigen Lächeln.
»Ja, ich weiß wirklich gar nicht, wie ich dazu komme —!«, konnte er nur murmeln.
»Dass ich Ihnen den Irrsinnigen jetzt zum vierten Male anvertraue? Ja, ich habe meine ganze Überredungskunst aufbieten müssen, um der Mistress begreiflich zu machen, dass aller guten Dinge nicht drei sind. Und was mich anbetrifft, so muss ich wohl meinen besonderen Grund dazu haben.«
Es war in einer Weise gesagt worden, dass Professor Smart gleich stutzend aufhorchte.
»Einen besonderen Grund —?!«
Wenn dieser ehemalige Jesuitenpater ein bestimmtes Ziel vor Augen hatte, dem er sich ohne Weiteres nähern konnte, dann tat er es auch, dann verschwendete er kein einziges Wort mehr. Jetzt ging es mit überraschender Schnelligkeit.
»Dreimal ist Bob Snyder auf eigene Faust ausgebrochen. Diesmal werden Sie ihn selbst entlassen.«
»Aaahhh!«, stellte sich der Professor maßlos bestürzt.
»Machen Sie keine Umstände, mein lieber Professor, Sie wissen ganz genau, was ich beabsichtige. Nun?«
Der andere kaute erst an seiner Zigarre, ehe er eine Antwort gab.
»Gut, ganz offen — Sie wollen sich die Prämie, die auf die Wiederergreifung des Vaters und Sohnes ausgesetzt wird, einmal selbst verdienen.«
»Recht so! Ich sehe nicht ein, weshalb die andere bekommen sollen. Jetzt hat der Bruder des Weichenstellers, der an dem Schusse gestorben ist, als sein Erbe eine Million Dollars ausgezahlt erhalten, von meiner Hand. Das ist ja lächerlich. Was will denn der ungebildete Arbeiter mit solch einem Kapital! Und Bob Snyder bricht ja doch wieder aus, wenn nicht bei Ihnen, dann aus einer anderen Anstalt, und seinen Sohn weiß er ja doch wieder zu befreien. Da wollen wir die Sache doch lieber gleich in die eigene Hand nehmen, wie, he?«
Es war ausgesprochen, der Irrenarzt nahm eine ganz andere Haltung an.
»Wann?«
»Heute Nacht noch.«
»So bald schon?!«
»Was ist da weiter aufzuschieben?«
»Ja natürlich. Und der Sohn?«
»Das lassen Sie meine Sache sein. Den bringe ich selbst von hier fort. Natürlich auch wieder durch einen Vertrauensmann. Bei Ihnen handelt es sich nur um den Irrsinnigen, der ebenfalls unbedingt befreit werden muss, weil der Junge, wie ich ihn kenne, nicht ohne ihn gehen würde, alles daran setzen würde, um seinen Vater zu befreien.«
»Wie soll ich die Sache nun arrangieren?«
»Heute Nachmittag wird an Ihrer elektrischen Lichtleitung etwas in Unordnung sein. Sie telefonieren nach der Station. Ein Monteur wird kommen und nach dem Rechten sehen. Diesem Monteur vertrauen Sie sich an, der wird Ihnen alles Weitere sagen. Verstanden?«
»Wie gibt sich der Mann zu erkennen?«
»Es ist kein Stichwort und nichts nötig.«
»Kann keine Verwechslung vorkommen?«
»Ausgeschlossen. Vertrauen Sie sich dem elektrischen Monteur an, der wird alles Weitere veranlassen. Nur eines können Sie ihm noch sagen. Eine Änderung möchte ich in unserem Plane eintreten lassen. Das Rendezvous findet doch lieber bei Gardenhill unter der großen Pinie statt.«
»Meinen Sie die große Pinie, welche in der Schlucht von Gardenhill nach —«
»Es gibt dort nur diese einzige Pinie. Sie sehen übrigens, wie ich Ihnen vertraue.«
Dass der Jesuitenpater hierzu seine besonderen Gründe haben mochte, das sagte er freilich nicht.
Und ob Professor Smart an diesen Rendezvousplatz auch glaubte? Dieser Mann sah auch nicht gerade beschränkt aus.
»Dort trifft Bob Snyder mit seinem Sohne zusammen?«
»Ja natürlich. Aber das lassen Sie nur meine Sache sein. Der Monteur besorgt alles. Sie brauchen nicht etwa mit. Es ist sogar gut, wenn Sie eine Stunde später die abermalige Flucht Ihres Patienten bemerken und Lärm schlagen, gleich Mistress Allan benachrichtigen.«
»Gut. Und was bekomme ich für meine Bemühungen?«
»Hm. Sie haben sehr wenig Bemühungen.«
»Wie viel bekomme ich?!«, wiederholte der Irrenarzt energisch.
»Wie viel verlangen Sie?«
»Eine Million Dollars.«
»Waaaas?!«
»Sie lassen die beiden doch von Ihren Helfershelfern entführen und an einen Ort bringen, um sie dort wieder festnehmen zu lassen und sich so die Prämie zu verdienen, die Doña Allan wieder aussetzen wird.«
»Ja selbstverständlich!«, gab der biedere Lazare zu.
»Ich bin fest überzeugt, dass Sie die Prämie diesmal auf mindestens zwei Millionen Dollars hinaufschrauben werden.«
»Sie vergessen, dass ich noch gar viele Hände zu füllen habe.«
»Und von den Summen, welche die Detectivs ständig erhalten, werden Sie auch nach wie vor ein gutes Teil in die eigene Tasche stecken.«
»Nach wie vor? Herr, wie meinen Sie das?«, fragte der Jesuitenpater ganz gemütlich, immer mit seinem freundlichsten Lächeln.
»Machen Sie mir doch nichts vor!«, wurde jetzt der Professor geradezu unverschämt.
»Können Sie dafür irgend einen Beweis bringen?«
»Ich verlange eine Million Dollars!«, ging jener wieder zur Hauptsache über.
Dieser Handel währte noch einige Zeit, dauerte viel länger als alles andere — aber sie wurden handelseinig.
»Abgemacht! Sonst ist nichts weiter zu besprechen.«
Prozessor Smart ging. Señor Lazare blickte nach der Tür, die sich hinter ihm geschlossen hatte. Auch jetzt, da er allein war, blieb noch das ungemein gütige Lächeln in den hageren Zügen. So nickte er liebevoll nach der Tür — tippte dabei freilich mit der Fingerspitze auch gegen seine Stirn, doch eine sehr vielsagende Bewegung.
»Ich melde mich vom Urlaub zurück.« Mit diesen Worten wurde Professor Smart in der Anstalt von einem seiner Assistenzärzte empfangen.
Walter Müller war akademischer Arzt, ohne sein Doktorexamen gemacht zu haben — was ja auch durchaus nicht notwendig ist, nur die bestandenen Staatsexamen geben den Ausschlag — speziell Psychiater, in Deutschland in mehreren Irrenanstalten tätig gewesen, hatte sich dann um eine Stelle in Amerika beworben, eine solche dank seiner vorzüglichen Zeugnisse in der hochangesehenen und sogar berühmten Irrenklinik des Professors Smart erhalten.
Man sah es ihm nicht an, dass er ein so scharfsinniger Seelenforscher war, der aber in einem seiner Zeugnisse auch als ganz außerordentlicher Operateur empfohlen wurde. Ein semmelblonder Jüngling von etwa fünfundzwanzig Jahren, ein kleines, zierliches, unansehnliches Männchen mit blassem, nichtssagendem Gesicht vor den etwas blöden Vergissmeinnichtaugen zwei mächtige Brillengläser, überaus bescheiden, fast schüchtern. Aber Professor Smart hatte schnell erkannt, welch tüchtige Kraft er in dem jungen Manne für ein Spottgeld erworben hatte, fragte ihn bei jeder Gelegenheit um Rat, freilich dann die geborgten Federn als seine eigenen betrachtend, und dass er ihm schon nach zweimonatiger Tätigkeit den kontraktmäßig jährlichen Urlaub von drei Wochen bewilligt oder ihm vielmehr zudiktiert hatte, das hatte ebenfalls nichts mit einem Entgegenkommen zu tun.
Denn jetzt im heißesten Monat war gerade die ungünstigste Zeit für einen Erholungsurlaub, in Kalifornien hat man ganz andere Ferienzeiten, aber der neue Assistenzarzt, dieser tölpische Deutsche, war aufgefordert worden, seinen Urlaub schon jetzt zu nehmen und hatte auf einen anderen in günstiger Jahreszeit schriftlich verzichten müssen.
»Ich melde mich vom Urlaub zurück.«
»Freut mich, Sie wiederzusehen, Mister Müller. Sind Sie immer in dem kleinen Gebirgsneste gewesen?«
»Jawohl, Herr Professor.«
»Sie scheinen sich aber nicht eben erholt zu haben?«
»O doch, Herr Professor. wenn ich überhaupt eine Erholung nötig gehabt hätte.«
»Sie sehen noch immer so blass und leidend aus.«
»Das ist nun einmal meine Gesichtsfarbe, Herr Professor.«
»Sie sollten mehr turnen, Sport treiben.«
»Das habe ich früher genug getan, es ändert mein Aussehen nicht, und ich fühle mich durchaus gesund und kräftig!«, lächelte der junge Mann verlegen.
»Na, na, trumpfen Sie mal nicht mit Ihrer Kraft auf!«, lachte Smart. »Ja, also Sie übernehmen wieder dieselben Patienten zur Beobachtung.«
Der junge Arzt zögerte.
»Noch eins, Herr Professor — ich hätte es sofort gemeldet, es war nur noch keine Gelegenheit — ich habe eine fremde Person mit ins Haus gebracht, sie befindet sich in meinem Zimmer —«
»Wie, eine fremde Person?!«, fuhr der Professor, der sich schon abgewendet hatte, jäh herum. »Wen denn?«
»Ein menschliches Rätsel.«
»Was, ein menschliches Rätsel? Was soll das heißen?!«
»Gestatten Herr Professor, dass ich von Anfang an berichte.«
»Aber kurz, bitte ich mir aus!«
Der schüchterne Mensch fasste seinen Bericht, der sonst Stoff zu einer langen Erzählung gegeben hätte, außerordentlich kurz zusammen.
»Bei einem Ausfluge in jenem Gebirge verirrte ich mich in die Hütte eines armen Waldarbeiters mit sehr vielen Kindern.
Das eine davon, ein Mädchen, Deasy, jetzt siebenjährig, ist mit gelähmten Beinen und einem gelähmten Arm, dem linken, geboren.
Aber es ist nur eine Nervenlähmung, die Gliedmaßen haben normale Blutzufuhr und haben sich daher auch ganz normal entwickelt.
Schon vor zwei Jahren bemerkten die Eltern durch einen Zufall, dass dieses Kind die Gabe des zweiten Gesichtes besitzt.
Was man hierunter versteht, weiß der Herr Professor doch.
Die kleine Deasy ist hellsehend, aber nur zeitweilig unter ganz merkwürdigen Umständen.
Für gewöhnlich also ist ihre linke Hand, wie der ganze Arm, kalt und willenlos wie der eines Leichnams, auch im Schlafe. Aber wenn sie schläft und man gibt ihr etwas in diese Hand, was von einem lebenden Wesen stammt, also ein Stückchen Haut oder ein Haar oder ein Schnitzel vom Fingernagel, so beginnt sich fast sofort die Hand und der ganze Arm zu erwärmen, er bekommt Leben, und dann sieht Deasy das betreffende Geschöpf, wo sich dieses auch befinden mag.
Ferner sieht das Kind auch alles, was dieses Geschöpf sieht, wo es zur Zeit gerade hinsieht.
Aber hierbei ist ein Unterschied zu machen.
Stammt die Substanz von einem Menschen, so sieht Deasy tatsachlich alles, was dieser Mensch erblickt.
Stammt das Mittel von einem Tiere, ist es etwa das Schwanzhaar eines lebenden Pferdes, so erblickt sie zwar auch etwas, und zwar sicher das, was dieses Pferd erblickt, vermag es aber nicht zu beschreiben. Einfach deshalb nicht, weil der Mensch nicht mit den Augen eines Pferdes oder gar einer Fliege sehen kann, oder er müsste auch das Gehirn eines Pferdes oder einer Fliege besitzen.
Ist das betreffende Geschöpf, Mensch oder Tier, tot, so wirft das Kind die betreffende Substanz sofort mit Abscheu von sich.«
Walter Müller hatte seinen Bericht beendet.
Mit immer größerem Staunen hatte ihm Professor Smart zugehört.
»Das ist ja gar nicht möglich!«
»Ich habe mit dem Kinde im Laufe von zwei Wochen Hunderte von Versuchen in dieser Beziehung angestellt, und es hat auch die kompliziertesten Aufgaben gelöst, niemals auch nur der kleinste Irrtum.«
»Und Sie haben das Kind mitgenommen?!«
»Ja. Die Eltern, ganz einfache Leute, in ihrer Waldeinsamkeit ganz weltfremd, haben sich zuerst an dieser Gabe des Kindes, als sie sie zufällig entdeckten, belustigt, dann haben sie sie manchmal benutzt, um etwa zu erfahren, wo sich ein ausbleibendes Mitglied befinde, oder wenn sich ein Schaf im Walde verlaufen hatte — aber glücklicherweise sind die Eltern nie auf den Gedanken gekommen, das Kind zu schaustellerischen Zwecken zu benutzen, und kein Fremder ist zu ihnen gekommen, der ihnen solch einen Vorschlag gemacht hätte. Als ich bat, das Kind mitnehmen zu dürfen, um diese Sache wissenschaftlich weiter zu untersuchen, sagten die Eltern sofort zu. Ich hatte zuletzt bei ihnen gewohnt, ich gefiel ihnen, sie trauten mir. Sie sind froh, einen unnützen Esser los zu sein und ihn dabei in guten Händen zu wissen. Sie wollten kein Geld als Geschenk annehmen.«
»Und das Kind ist hier?!«
»Oben in meinem Zimmer. Ich bin erst vor einer Viertelstunde angekommen, habe es gleich zu Bett gebracht, denn es ist ja gelähmt. Aber sonst ist es ein ganz gesundes Kind, wenn auch von sehr zarter Konstitution.«
»Ja, dann einmal hinauf! Das wäre ja ganz wunderbar!«
Sie begaben sich hinauf, in das Wohn- und Schlafzimmer des Assistenzarztes.
In dessen Bett lag das Kind — ein reizendes Mädchen, das halbe Gesichtchen von blonden Locken eingerahmt — lag da wie ein kleiner Engel.
Im rechten Arm hielt es ein Püppchen, mit dem es gespielt haben mochte, bis es darüber eingeschlafen war.
»Es ist ein Zufall, dass die Kleine gerade schläft!«, sagte Müller, ohne seine Stimme oder beim Nähertreten seinen Schritt zu dämpfen. »Wir brauchen nicht vorsichtig zu sein, auch nicht leise zu sprechen, ihr Schlaf ist immer ein sehr tiefer, ob es nun ein natürlicher ist, eben durch Müdigkeit erzeugt, oder ob sie absichtlich eingeschläfert wird —«
»Absichtlich eingeschläfert?«, wiederholte der Professor fragend.
»Ja. Wenn auch nicht etwa durch ein Opiat oder ein sonstiges Schlafmittel. Sie müssen mir jetzt. Herr Professor, eine nähere Erklärung gestatten, denn vorhin fasste ich mich Ihrem Wunsche gemäß so kurz wie möglich.
Es liegt hier ein ganz, ganz seltsamer, sowohl physiologischer wie auch psychologischer Fall vor, zu dessen Ergründung man ganz streng wissenschaftlich vorgehen muss. Mit einfachen Experimenten, etwa gar nur angestellt, um die Neugierde zu befriedigen, ist es da nicht abgetan.
Im Anfange, als man die wunderbaren Beobachtungen machte, und auch im Anfange meiner eigenen Experimente, wurde das Kind nur hellsehend, wenn es bereits im natürlichen Schlafe lag und wenn man ihm solch ein Medium in die Hand gab.
Das änderte sich aber bald, und zwar um so schneller, je öfter ich mit dem Kinde im Schlafe solche Experimente anstellte.
Schon immer hatte die kleine Deasy mich und auch bereits früher die Eltern und Geschwister gebeten, solche Versuche recht oft mit ihr zu machen. Denn obgleich sie dabei im tiefsten Schlafe liegt, weiß sie, was mit ihr vorgeht, wie sie hellsehend wird, was sie dabei erblickt, sie erinnert sich dessen auch nach dem Erwachen, wenn auch nur wie eines Traumes — aber nicht nur das, sondern sie merkt auch ganz deutlich, wie dann das Blut in ihrem toten Arme und selbst in den gelähmten Beinen warm zu pulsieren beginnt.
Und das ist es eben, was das Kind dabei immer mit der größten Freude erfüllt. Und infolgedessen ahnt das Kind instinktiv, ist fest davon überzeugt, dass diese Experimente nicht nur ihm nicht schädlich sind, sondern direkt zu seiner einstigen Gesundung beitragen.
Je öfter ich nun meine Experimente wiederholte, desto sensitiver wurde die kleine Deasy, bis ich schließlich gar nicht mehr nötig hatte, darauf zu warten, dass sie erst vor Müdigkeit in Schlaf fiel. Ein künstlich erzeugter Schlaf nützt auch nichts, da reagiert sie auf kein solches Medium. Aber ich brauchte ihr fernerhin, wenn sie sich auch im vollsten Wachen befand, nur so etwas in die Hand zu geben, sofort fiel sie in Schlaf, wurde hellsehend. Und zwar so lange, bis ich ihr das Medium wieder aus der Hand nahm. Dann kehrte sie wieder in das Wachbewusstsein zurück, während sie, wenn der Schlaf infolge von Ermüdung eingetreten ist, auch weiter schläft.
Und so ist dies alles noch jetzt. Dabei ist nun freilich etwas sehr Wichtiges zu beobachten. Wenn dem Kinde durch Anregung und Benutzung seiner Gabe ein so großes Behagen bereitet wird, was ganz offenbar auch zu seiner Gesundung beiträgt, so könnte man ihm doch ständig solch ein Medium in das Händchen geben. Entweder im natürlichen Schlaf, oder man kann ja dadurch auch sofort Schlaf erzeugen, der dann beliebig lange anhält.
Aber so einfach ist die Sache denn doch nicht. Jetzt kommt das Psychologische hinzu, das seelische Rätsel. Das Kind ist doch zweifellos somnambul veranlagt. Aber dieses Hellsehen tritt nicht nicht von allein ein, sondern muss erst durch den Willen einer anderen Person geweckt werden. Gewissermaßen durch den Willen eines Hypnotiseurs, obgleich eigentlich gar keine Hypnose vorliegt. Jedenfalls aber muss man erst seine ganze Gedankenkonzentration darauf richten, dass das Medium in Funktion tritt, sonst bleibt es in der Hand des Kindes wirkungslos. Also von allein bleibt es nicht etwa immer hellsehend, der sonst tote Arm lebendig. Verstehen der Herr Professor den Unterschied? Habe ich mich klar genug ausgedrückt?!«
»Gewiss, gewiss doch!«, entgegnete dieser ungeduldig, und es war begreiflich, dass er erst Handgreifliches sehen und Wunderbares erleben wollte. »Welches ist nun der tote Arm?«
»Dieser hier, der linke.«
Das Kind, nur mit einem Hemdchen bekleidet, hatte beide Ärmchen entblößt. So war an diesen gar kein Unterschied zu bemerken, der linke Arm war ganz ebenso entwickelt wie der rechte.
Wohl aber merkte der Professor den Unterschied, wie er die beiden Arme und Hände befühlte. Der rechte war lebenswarm bis in die Fingerspitzen hinein, die Finger machten auch selbstständige Bewegungen, obgleich das Kind schlief, so ließen sie sich doch nicht so ohne Weiteres aus der normalen Lage bringen — der linke Arm aber war wie die Hand ganz kalt und ohne eigene Bewegung, wie bei einer Leiche, zeigte auch nicht den geringsten Pulsschlag.
»Nun führen Sie doch solch ein Experiment aus.«
Walter Müller zog aus seinem Rock eine Brieftasche hervor, führte immer aus, was er sagte, dabei war er nur der wissenschaftlich beobachtende oder jetzt erklärende Arzt und dachte nicht daran, seinem Vorgesetzten etwa sensationelle Überraschungen bereiten zu wollen.
»Ich habe hier verschiedene Medien, wie ich also solche Substanzen nenne, von Menschen oder Tieren stammend, die an dem Körper des betreffenden Lebewesens einst gewachsen sind. Haare, Nägel, Hautstückchen, Zähne und dergleichen. So nehme ich jetzt hier eine Haarlocke einer Person, von der ich weiß, dass sie nicht mehr am Leben ist. Es ist nämlich eine Locke von meiner seligen Mutter. Also ich lege sie in die schlaffe Hand des Kindes, schließe die Fingerchen darüber — so — und nun wollen sich Herr Professor selbst überzeugen, wie sich die tote Hand nach und nach zu erwärmen beginnt, wie sie lebendig wird.«
Müller trat zurück und überließ dem anderen die weitere Untersuchung.
In der Tat, Professor Smart, den Daumen an der Pulsader des Handgelenks, musste konstatieren, wie der Puls des Kindes nach kurzer Zeit zu schlagen begann, erst ganz langsam und leise, dann immer schneller und kräftiger, bis er so gut wie normal ging, gleichzeitig begann sich die Hand und der ganze Arm zu erwärmen.
Da aber mit einem Male nahm das Gesichtchen der kleinen Schläferin einen Ausdruck des Abscheus an, verzog sich wie im Schreck, und mit einer ebensolchen Bewegung schleuderte die linke Hand die Haarlocke von sich, mit einer Kraft, dass der Professor das Händchen nicht hätte halten können, auch wenn er darauf gefasst gewesen wäre.

»Da sehen Sie«, erläuterte Müller, »wie das Kind sofort, sobald es soweit ist, genau unterscheidet, ob die betreffende Person noch lebt oder nicht —«
»Ach, das hat das Kind ganz einfach gehört, dass es sich um die Haarlocke von einer toten Person handelt!«, wurde der Sprecher unterbrochen.
»Nein, das Kind hört uns im Schlafe nicht sprechen. Mit Ausnahme, wenn wir es erst durch einen kraftvollen Befehl dazu auffordern. Vorher nicht.«
»Beweisen Sie die Wahrheit dessen, was Sie da behaupten!«
»Bitte, das können Sie ja selbst tun. Sie werden doch irgend solch ein Medium von einer Person besitzen, gleichgültig, ob diese noch lebt oder schon tot ist. Wollen Sie die Prüfung selbst ausführen!«
Professor Smart blickte suchend im Zimmer umher, dabei in den Westentaschen fingernd, verließ das Zimmer und kehrte nach einigen Minuten zurück.
»Hier ist ein Knochensplitter aus dem Oberarm eines Mannes, der diesen vor einem halben Jahre gebrochen hat und bald darauf an Blutvergiftung starb. Ich selbst war bei seinem Begräbnis zugegen.«
»So wollen Sie den Knochensplitter dem Kinde in die Hand geben, die unterdessen schon wieder wie der ganze Arm erkaltet ist.«
»Also ich muss meine Gedanken auf den Toten konzentrieren?«
»,Ja, das müssen Sie; wenn auch nicht gerade eine besonders starke Konzentration dazu nötig ist. Das Experiment gelingt in jedem Falle. Es muss nur ein besonderer Wille, eine Absicht vorhanden sein. Wenn das Kind in wachem Zustande irgend einen Knochen in die Hand bekommt, der doch sicher einmal irgend einem lebenden Wesen angehört hat, so wird es dadurch nicht von selbst hellsehend. Das Medium muss ihm von einer anderen Person in der bestimmten Absicht gegeben werden, dass es einschläft und hellsehend wird. Das ist der ganze Unterschied dabei, das werden Sie nach und nach selbst herausfinden.«
Professor Smart überzeugte sich erst, dass der ganze Arm wieder erkaltet war, dann legte er die schlaffen Fingerchen an den kleinen Knochensplitter, beobachtete, wie sich die kalte Hand nach und nach wieder zu erwärmen begann.
Aber vergebens wartete der Assistenzarzt darauf, dass das Kind diesmal wieder das Medium einer toten Person fortschleudern würde. Auch der Ausdruck des Abscheus stellte sich nicht wieder ein, im Gegenteil, nach einiger Zeit begann das Mädchen im Schlafe glücklich zu lächeln.
»Was ist das? Das sieht doch ganz danach aus, als ob jener Mann gar nicht tot sei!«
Professor Smart trat einen Stritt zurück, mit einem ganz verdutzten Gesicht.
»In der Tat, jetzt muss ich der Wahrheit die Ehre geben! Ich habe das Kind nur irre führen wollen, indem ich mehrmals sagte, der Mann sei schon tot, glaubend, das Kind höre auch schlafend uns sprechen. Der Knochensplitter stammt aus dem Oberarm meines eigenen Bruders, aber dieser lebt noch.«
Unbeleidigt hatte Müller diese Worte vernommen. Es war ja auch gar kein Grund zu einer Beleidigung vorhanden. Der Professor hatte nur sehr klug gehandelt
»So werde ich jetzt das Weitere einleiten, um Ihnen zu zeigen, wie es gemacht wird. Das Kind muss erst zum Sprechen veranlasst werden, von allein geschieht das nicht.«
Müller trat hin, ergriff die warm gewordene Hand mit dem Knochensplitter.
»Hörst Du mich sprechen, mein liebes Kind?«
Nur ein kleines Zögern, dann begann die Schläferin zu flüstern, allerdings sehr abgebrochen, musste immer aufgefordert werden.
»Ja — ich — höre — Dich.«
»Wen erblickst Du?«
»Einen — Mann.«
»Wie sieht der Mann aus?«
»Er ist — groß — und dick — hat einen großen schwarzen Bart —«
»Hier liegt offenbar Gedankenübertragung vor!«, mischte sich da der Professor schnell ein. »Ich stelle mir meinen Bruder jetzt im Geiste vor, wie er eben ist, kann ihn mir gar nicht anders vorstellen, und das Kind liest meine Gedanken. Denn an Gedankenübertragung glaube ich, bin davon überzeugt worden; aber an so etwas wie ein zweites Gesicht oder an Hellsehen glaube ich nicht, ja so etwas gibt es gar nicht.«
Sein Assistenzarzt blieb ihm die Antwort schuldig.
»Was tut der Mann?«, fuhr er die Schläferin zu fragen fort.
»Er — geht hin und her — jetzt — bleibt er stehen —«
»Und was erblickt er?«
Eine kleine Pause, und immer glücklicher begann das Kind im Schlafe zu lächeln.
»O wie schön, wie schön!«, flüsterte es dann. »Die schönen Blumen! Und die Bäume mit den schönen Früchten! Und der Wasserstrahl, der in die Höhe springt! Ein wunderschöner Garten —«
»Unsinn!«, ließ sich der Professor, seine Taschenuhr ziehend, wiederum in höhnischem Tone vernehmen. »Mein Bruder, der Senator Smart, befindet sich gegenwärtig in einer Sitzung der Stadtverordneten, das weiß ich ganz bestimmt.«
»Aber augenblicklich befindet er sich in einem Garten«, entgegnete Müller ruhig, »dieses Kind sieht alles, was die Augen jenes Herrn erblicken, sieht ihn selbst in dem Garten auf und ab gehen!«
»Nein, sage ich, er befindet sich gegenwärtig in einer Stadtratssitzung!«
»So hat er sich einmal in einen Garten begeben.«
»Ausgeschlossen! Dort in der Nähe und in der weiteren Umgebung befindet sich gar kein Garten.«
»Könnten Sie sich nicht mit Ihrem Herrn Bruder telefonisch in Verbindung setzen?«
»Können wir machen.«
Professor Smart verließ das Zimmer, kehrte erst in zehn Minuten zurück, ganz verstört.
»Wahrhaftig!«, stieß er hervor. »Jetzt muss ich an das Hellsehen dieses Kindes glauben, denn da kann auch keine Gedankenübertragung vorliegen! Mein Bruder ist der Senatssitzung ferngeblieben, hat sich im letzten Augenblick unwohl melden lassen, hat einen Freund besucht, der in einer Vorstadt wohnt, hält sich tatsächlich zur Zeit in dessen Garten auf, ich habe schon persönlich mit ihm gesprochen!«
Die Versuche wurden fortgesetzt. Es sei nur noch erwähnt, dass Deasy auch einen Herrn beschrieb, mit dem der Senator Smart in jenem Garten sprach, ihn ganz genau beschrieb, so zum Beispiel auch, dass er über dem linken Auge eine große Warze hatte, welchen Herrn aber der Professor gar nicht kannte, dies alles aber wurde dann telefonisch bestätigt, so dass also jede Gedankenübertragung ausgeschlossen sein musste.
Die verschiedensten Versuche, immer komplizierter werdend, wurden auch fortgesetzt, als das Kind erwachte. Es brauchte ihm eben nur solch ein Medium in die Hand gegeben zu werden, mit der Absicht, dass es hellsehen werde, so fiel es sofort in den gewünschten somnambulen Zustand, der in diesem Falle so lange anhielt, als man sich mit dem Kinde beschäftigte, es befragte, was es erblicke.
Hiermit ist der kleinen Deasy Morton rätselhafte Begabung, welche die Schottländer »second sight« nennen, zweites Gesicht, zur Genüge geschildert. Es sei nur noch erwähnt, dass das Kind weder schreiben, noch lesen konnte, aber aus angeborenem Talent sehr gut zu zeichnen verstand. Das sollte noch von größter Bedeutung werden. Denn man muss nur bedenken, dass das siebenjährige Mädchen des armen Waldarbeiters doch noch gar keine Erfahrung hatte, die meisten Gegenstände, die es im hellsehenden Zustande erblickte, konnte es sich ja gar nicht deuten, nicht einmal beschreiben. Da half ihr Zeichnen, auch im schlafenden Zustande ganz regelrecht ausgeführt, außerordentlich viel zur Erklärung mit.
Die immer interessanter werdenden Versuche wurden so lange fortgesetzt, bis sich Professor Smart seines Auftrags erinnerte und sich beeilte, etwas an der elektrischen Lichtleitung in Unordnung zu bringen, um dann die elektrische Zentrale anzurufen.
Die Nacht war angebrochen. Die an Professor Smarts Irrenklinik Vorübergehenden wunderten sich, dass so viele Fenster des Hauses, die um diese Zeit erleuchtet waren, noch kein Licht zeigten, oder doch nur ein gelbes, ganz schwaches.
Durch den Korridor der zweiten Etage schritt ein Mann in blauem Monteuranzug, eine Werkzeugtasche tragend, ihm nach folgten Professor Smart und drei handfeste Wärter, die mit Petroleumlampen leuchteten, der eine über der Schulter eine Bockleiter.
Ab und zu, wo er die an den Wänden hinlaufenden grünumsponnenen Drähte erreichen konnte, blieb der Monteur oder Installateur stehen, durchstach mit einem kleinen Instrument die Isolierschicht der Drähte und beobachtete ein Elektroskop.
»So, der Fehler ist gefunden. Hier in dieser Zelle ist der Kontakt unterbrochen.«
»Bob Snyder, Verfolgungswahnsinn, unheilbar, gefährlich. Vorsicht!«, stand auf einer Tafel der betreffenden Zellentür mit großer Rundschrift geschrieben, wie es die inspizierende Sanitätspolizei forderte, und dann auf einer Schiefertafel noch ärztliche Angaben für die Wärter wegen Diät, Behandlung und dergleichen.
»Sie müssen hinein?«
»Selbstverständlich.«
»Dauert es lange?«
»Kann ich gar nicht sagen.«
»Hm. Ich weiß gar nicht, wo ich den Mann einstweilen unterbringen soll. Platz genug hätte ich ja schließlich noch, aber dieser Mann darf durchaus in keine andere Umgebung kommen — na, da müssen wir ihn eben einstweilen festschnallen. Also passt mal auf, Leute.«
Weiterer Instruktionen bedurfte es nicht, so etwas kam ja hier stündlich vor. Die drei Wärter setzten ihre Lampen hin, einer, der den Schlüsselbund führte, schloss auf, die anderen standen schon sprung- und griffbereit.
Der Professor hatte eine elektrische Taschenlampe bei sich, der Monteur ebenfalls, beide waren mit Scheinwerfern versehen, aber es hatte wenig Zweck, den Strahl erst durch das in der Tür angebrachte Guckloch in die Zelle zu senden. Dadurch konnte man nicht viel sehen.
Die Tür schnell aufgerissen, jetzt freilich wurde das Licht hineingeschickt, die drei Wärter sprangen hinein, packten die Gestalt, die sie auftauchen sahen, und da lag der Mann auch schon auf der gepolsterten Pritsche, an den geeigneten Stellen waren Eisenbänder und Riemen angebracht, ein paar Griffe und der Überraschte konnte sich nicht mehr rühren.
»Na, nun mal los!«, sagte Smart, ohne sich um den Unglücklichen zu kümmern. »Ich kann nicht hier bleiben. Brauchen Sie denn alle drei Leute?«
»Nur einen Mann, der mir leuchtet.«
»Dann bleibt Ihr hier, Briar.«
Der Wärter bekam einen Schlüssel zur Tür, denn die wurde von draußen wieder zugeschlossen. Ohne die Möglichkeit, sich selbst zu befreien, durfte aber kein Wärter in eine Zelle eingeschlossen werden.
Der Monteur machte sich an die Arbeit. Die Wände waren bis zu einer Höhe von zweieinhalb Metern mit Leder gepolstert, oben darüber hin, auch durch Sprung von keiner Hand zu erreichen, liefen die grünen Drähte nach der an der Decke angebrachten elektrischen Glühbirne, die jetzt nicht brennen wollte.
Also der Monteur rückte seine Bockleiter und prüfte die Drähte mit dem Elektroskop. Hier in dieser Zelle mussten sich seiner Behauptung nach die blanken Drähte berühren oder sonst eine Unterbrechung des elektrischen Stromes stattfinden.
Da schmetterte durch das ganze Haus eine dröhnende Glocke.
»Großer Alarm!«, rief der Wärter erschrocken. »Da ist was passiert! Ich muss auf meine Station!«
»Na da geht mal!«, sagte der Monteur, ein noch junger Mann, gleichmütig, ohne sich in seiner Beschäftigung stören zu lassen.
»Ihr müsst aber mit heraus!«
»Wozu denn?«
»Ich kann Euch doch nicht hier in der Zelle allein lassen!«
»Ach, macht doch keine Geschichten! Denkt Ihr denn, ich bin zum ersten Male hier? Ich kenne dieses Haus besser als Ihr.«
Der Wärter durfte bei diesem langen Alarmzeichen nicht lange zögern.
»Ich muss Euch aber einschließen!«
»Meinetwegen. Der Kerl dort liegt doch fest, wenn Professor Smart selbst dabei war, als er angefesselt wurde.«
Der Wärter eilte hinaus, schloss von draußen ab.
Der Monteur stieg von seiner Bockleiter herab, zum ersten Male blickte er aufmerksam nach dem Gefesselten, machte es im Übrigen äußerst kurz.
»Bob Snyder«, begann er mit gedämpfter Stimme, »Ihr seid nicht wahnsinnig, ich weiß es. Ich soll Euch befreien. Euer Sohn Fred ist auch schon befreit. Ihr sollt heute Nacht noch zusammentreffen. Versteht Ihr mich? Kommt Ihr willig mit mir?«
Wir wollen das bisherige Gesicht des Unglücklichen nicht zu beschreiben versuchen. Jetzt paarte sich darin freudiges Staunen mit Misstrauen.
»Wer seid Ihr?«, flüsterte er.
»Keine Umstände! Keine Minute ist zu verlieren! Traut Ihr oder traut Ihr mir nicht?«
»Auch mein Fred wird befreit?«
»Jawohl, der mus schon unterwegs sein. Ein Mann, der die Güte selbst ist, hat sich Eurer angenommen, er hat die Macht dazu, Euch beide vor diesem wahnsinnigen Weibe zu schützen.«
»Ich folge Euch!«
Die Riemen aufgeschnallt, mit einem Instrument die Schnappschlösser der Eisenbänder geöffnet und Bob Snyder erhob sich. Der Monteur zog schnell den blauen Leinwandanzug aus, den er nur als Schutz über sein eigentliches Straßenkostüm trug.
»Den zieht Ihr an. Eure graue Sträflingstracht ist doch etwas zu auffällig, wir müssen durch ein paar Straßen. Zieht den Arbeitsanzug nur gleich über Eure Sträflingskleider, er passt Euch, denn wir haben eine Figur. Hier ist auch ein Schal und hier eine Mütze.«
In drei Minuten war die Umwandlung geschehen. Der Monteur lauschte an der Tür, öffnete das Sicherheitsschloss mit einem richtigen Schlüssel, den er in der Tasche gehabt.
»Fort. Meine Werkzeugtasche kann hier bleiben, ich brauche sie nicht mehr, und wer der Entführer gewesen ist, darüber kann kein Zweifel walten.«
Der Korridor war finster. Aber der Monteur wusste Bescheid, er führte den anderen bei der Hand, brauchte seine Lampe nicht aufleuchten zu lassen.
Eine Strecke entlang, eine Treppe hinab, eine zweite und sie traten auf die Straße, von Gaslaternen erleuchtet. Es war eine Hintertür gewesen, durch welche sie das Haus verlassen hatten.
»Nun vorwärts, wir haben noch einen tüchtigen Marsch zu machen!«, sagte der Monteur, als er die Tür hinter sich wieder zugeschlossen hatte.
Sie gingen den wenigen Straßenpassanten und mehr noch den Laternen aus dem Wege, und als der Monteur die Richtung veränderte, wurde das Häuserviertel einsamer.
»Wo bringt Ihr mich hin?«, brach Bob Snyder das Schweigen.
»Kennt Ihr die Teufelsbrücke?«
»Die Teufelsbrücke bei Colma?«
»Ja. Dort trefft Ihr mit Eurem Sohne zusammen.«
»Ach, ist's möglich, wie ist's nur möglich!«, stammelte der überglückliche Vater. »Wer ist es nur, dem ich das zu verdanken habe?«
»Das ist das einzige, was ich Euch nicht verraten darf. Jedenfalls aber ein Mann, der ein irdischer Engel ist, der mich für diese meine Dienste nicht so hoch zu bezahlen brauchte, für den ich auch so durchs Feuer gehen würde. Und dieser Mann hat eingesehen, dass es eigentlich die Mistress Allan ist, die ins Irrenhaus gehört.«
Sie hatten die Vorstadt Ocean View hinter sich. Wegen des Sandbodens, reine Wüste, gibt es dann keine Häuser mehr. Aus dieser Wüste, südlich von San Francisco, steigt ziemlich unvermittelt ein ansehnliches Gebirge empor, die Sierra Morena. Die nächste Station der Eisenbahn, die südwärts nach San José führt, ist Colma, schon hoch oben im Gebirge liegend. Die Bahn muss in großen Windungen mächtig klettern. Vor Colma überspannt eine kühne Hängebrücke eine tiefe Schlucht, in der ein furchtbares Wasser braust, die Devils Bridge, die Teufelsbrücke. So genannt, weil in der Nähe ein großer Felsblock einige Ähnlichkeit mit einem Menschenkopfe hat, aber mit zwei Hörnern geschmückt.
Die beiden hatten es viel, viel näher als die Eisenbahn, um nach Colma hinaufzukommen, sie mussten nur tüchtig steigen.
Es war Neumond, aber am kalifornischen Himmel leuchteten mit wunderbarer Pracht die Sterne, sie genügten, um den sehr guten Weg erkennen zu lassen. Nur im dichten Walde musste der Monteur ab und zu seine Taschenlampe aufflammen lassen.
Nach dreiviertel Stunde Steigens hatten sie die Höhe erreicht. Vor ihnen bezeichnete eine doppelte Lichterreihe die Lage der Teufelsbrücke, linkerhand die kleine Station Colma mit farbigen Signalen. San Francisco war von hier aus nicht zu sehen, ein Wald verdeckte die Aussicht, nur ein roter Schein am nördlichen Horizont verriet die Lage der goldenen Stadt, die sich jetzt zur allabendlichen Festlichkeit rüstete.
»Na, da wollen wir mal sehen, ob sie schon da sind.«
Einmal ließ der Monteur den Blendstrahl seiner Lampe aufblitzen, dann zweimal kurz hintereinander, dann noch einmal lang.
Und dort aus dem dunklen Walde kam das Gegensignal, dreimal kurz und einmal lang.
»Ja, sie sind schon da, in fünf Minuten könnt Ihr Euren Sohn in die — —. Vorsicht, nicht so weit nach rechts! Hört Ihr es brausen? Das ist der Teufelsbach dort unten in der Tiefe. Wer dort hinabpurzelt, der kommt erst im Meere wieder zum Vorschein, und auch da nur als ein Ragout.«
Aber Bob Snyder ließ sich nicht halten. Und da kam schon dort aus dem Walde eine andere, kleinere Gestalt hervorgeeilt.
«Fred, mein Fred!«
Der Monteur kümmerte sich nicht viel um die beiden, drang tiefer in den Wald.
»Macroy, seid Ihr's?«, erklang eine Stimme.
»Jawohl, Mister Cotch!«, entgegnete der Monteur.
Also der Magazinverwalter von der Zwingburg war es, der den Knaben hierher geführt hatte.
Die beiden standen dicht an der Schlucht, die durch ein eisernes Geländer geschützt war. Nur leise hörte man dort unten in furchtbarer Tiefe den Wildbach brausen.
»Wie lange seid Ihr schon da?«
»Eine Viertelstunde. O Gott, o Gott, o Gott!«
»Was ist denn los?!«, fragte der Monteur erstaunt.
»Was ich in dieser Viertelstunde hier durchgemacht habe!«, ächzte der Magazinverwalter.
»Ja was denn nur?«
»Immer muss ich daran denken — wenn die Mistress Allan ihren Fred vermisst — wenn nicht heute Nacht noch, dann eben morgen früh — ich hab's doch schon einmal erlebt — damals, wie sie nach Hause kam und ihr Fred war verschwunden — Macroy, ich sage Euch — wie die sich gebärdet hat — wie die geschrien hat — mir sträuben sich noch jetzt die Haare — mir gellt dieses Schreien noch jetzt in den Ohren — wie die —«
Entsetzt packten sich die beiden an.
Ein gellender Schrei hatte die Nacht zerschnitten, die Nacht und Nerven und Rückenmark der beiden.
Ein langgedehnter Schrei, so furchtbar gellend, dass ihn menschliche Ohren nicht ertragen konnten.
»Um Gott, Macroy, da ist sie schon!«, stöhnte der Magazinverwalter.
»Ach Unsinn,« versuchte sich der andere selbst zu beruhigen, »das kam unten aus der Schlucht —«
Da noch einmal der entsetzliche, grässliche Schrei, noch länger als vorhin während.
Die beiden aber hatten keine Zeit mehr, Bemerkungen auszutauschen, sie sollten sogleich noch eine ganz andere Überraschung erleben.
Plötzlich, wie die beiden noch so dicht zusammen standen, legte sich etwas um sie herum, schnürte sie noch enger zusammen, auch gleich ihre Arme an den Leib.
Wie die beiden noch gar nicht wussten, wie ihnen geschah, noch ganz von Gespensterfurcht beherrscht, sich von Geisterarmen umschlungen glaubend, kamen Vater und Sohn herbeigestürzt.
Sie hatten nur die beiden grässlichen Schreie gehört. Jetzt aber erkannten ihre geübten Jägeraugen trotz aller Finsternis dort auch einen dritten Mann.
»Wer hat hier so geschrien?! Wer ist das?!«
»Chil-ma-u-mak!«, entgegnete eine ruhige, tiefe Stimme. »Seid mir mal behilflich, die beiden vollends zu fesseln. Hier habt Ihr Riemen.«
Chil-ma-u-mak! Für die beiden Stadtmenschen war das ein unverständliches Wort gewesen, das sie nicht einmal wiederholen konnten.
Die beiden Jäger konnten es übersetzen. Flammenauge!
Dabei aber wussten diese Jäger der Wildnis auch sofort, dass sie keinen anderen Namen nennen sollten. Sonst eben hätte dieser Mann nicht nur seinen indianischen Namen benutzt, um sich zu erkennen zu geben.
»Helft mir sie vollends binden, hier sind Riemen!«
»Sie haben uns befreit, sie wollen uns in Sicherheit bringen —«
»Nein, eben nicht! Alles ist Lüge, wenn diese beiden auch selbst Opfer der Lüge sind! Ihr wäret nur in ein noch festeres Gewahrsam gekommen! Ich erkläre Euch alles später, jetzt vertraut mir nur! Ich bin es, der Euch wahrhaftig befreit! Schnell, dort kommt schon der Zug über die Brücke! Wir müssen ihn in Colma noch erreichen, steigen natürlich nicht als Passagiere ein, sondern springen heimlich auf, wenn er hinter der Station noch etwas langsam fährt.«
Während dieser Worte hatte Dr. Reichard, wie wir ihn nun auch nennen können, schon dem einen der beiden, die sein Lasso zusammenschnürte, die Arme auf dem Rücken gebunden, und jetzt gaben Vater und Sohn ihr letztes Zögern auf, waren schnell behilflich, das Werk der Fesselung zu vollenden.
Über die illuminierte Brücke sah man einen Eisenbahnzug mit seinen erleuchteten Fenstern fahren, von San Francisco kommend.
»Was waren das nur für grässliche Schreie?«, fragte Bob Snyder einmal, als er dem letzten der beiden, die schon am Boden lagen, die Füße mit Riemen umschlang.
»Gleichgültig, und wenn's auch des Teufels Großmutter selbst gewesen ist! Fertig? Dann fort, dass wir den Zug noch erreichen!«
Und die drei stürmten fort in die Nacht hinein, dorthin, wo die Lichter der Station Colma flimmerten.
Die beiden Männer lagen gefesselt am Boden.
Es war alles weit, weit schneller vor sich gegangen, als hier erzählt werden konnte. So schnell, dass die beiden noch gar nicht daran gedacht hatten, auch ein einziges Wort hervorzubringen. Es war eben eine vollkommene Überrumpelung gewesen, und nun kam noch hinzu, dass sie noch ganz unter dem lähmenden Schreck standen, den ihnen die grässlichen Schreie eingeflößt hatten. Minuten vergingen, und die beiden waren noch immer keines Wortes fähig.
»Macroy, o Macroy, was war das?«, stöhnte endlich der Magazinverwalter.
»Ich weiß es nicht, ich kann's noch gar nicht glauben«, entgegnete ächzend der Monteur. »Was waren das für furchtbare Schreie, die mir noch in den Ohren gellen?«
»Die Mistress Allan war's, sie sucht ihr Kind.«
»So kann kein irdisches Weib schreien, des Teufels Großmutter war's, hörte ich doch.«
»Nein, der Teufel selbst war es, der uns hier mit seinen langen, dürren Armen umschlang, ich fühlte ganz deutlich seine Klauen.«
»Oder, Cotch, ob wir dies alles vielleicht nur träumen?«
Sie schienen wirklich nachzusinnen, ob sie nicht nur einen bösen Traum hatten, weil sie jetzt wieder längere Zeit ganz still dalagen.
Da tauchte zwischen den Bäumen eine Gestalt auf.
Das heißt, man musste Augen besitzen, welche die schwärzeste Finsternis durchdrangen, um diese Gestalt erkennen zu können.
Wir besitzen solche Augen, und wir erkennen einen kleinen, hageren Mann im schwarzen Gehrockanzug mit breitrandigem Missionarshut, wir erkennen ein faltiges, glattrasiertes Gesicht, in dem sich listige Fuchsschlauheit mit freundlich lächelnder Herzensgüte paart — wir erkennen Señor Domingo Lazare!
Wenn wir aber nun einmal mit unseren Augen diese Finsternis durchdringen können, so wollen wir ihn auch gleich noch weiter beobachten, und wir werden Staunenswertes bemerken.
Wie dieser Mann schleichen konnte! Er trug derbe Stiefel, solch ein einfacher Missionar kann doch nicht mit eleganten Schuhen kokettieren, er schlich eigentlich auch gar nicht, ging nur langsam seines Weges einher, gemütlich die Hände auf dem Rücken, der Waldboden war mit trockenen Zweigen genug bedeckt — aber kein Ästlein knackte, kein dürres Blatt raschelte unter seinen Füßen!
Wie ein wesenloses Gespenst der Nacht wandelte er lautlos einher!
Jetzt hatte er die beiden am Boden Liegenden erblickt und blieb stehen.
Hatte er sie erblickt? Wie wäre denn das möglich gewesen?
Wir maßen uns nur solche Augen an, welche diese Stockfinsternis durchdringen können. Denn Stockfinsternis herrschte hier unter den dichtbelaubten Bäumen, nicht die Hand vor den Augen war zu erkennen.
Wir wollen es gleich sagen; Dieser ehemalige Jesuitenpater, der sich als Heidenmissionar in allen Wildnissen der Erde herumgeschlagen hatte, besaß wirklich solche Augen! Er sah die beiden ganz deutlich vor sich liegen, er sah ihre Fesseln, er sah alles!
Nun aber noch etwas anderes, etwas ganz Rätselhaftes. Etwas, was für den Menschenkenner, der zu beobachten versteht, für den Psychologen geradezu etwas Unheimliches an sich haben musste!
Señor Lazare hatte die beiden, Vater und Sohn, von seinen Helfershelfern befreien lassen, den einen aus der Irrenanstalt, den anderen aus der Zwingburg.
Hier in diesem Walde an der Teufelsbrücke bei Colma sollten die beiden Befreiten zusammengebracht werden, von hier aus wollte Lazare die Weiterexpedierung selbst übernehmen.
Seine Angabe, der Treffpunkt sei jene Pinie bei Gardenhill, war doch nur eine Finte gewesen, um Professor Smart irrezuführen, falls der etwa selbst Anlage zum Spürhund haben sollte.
Nun war Señor Lazare zur angesagten Stunde und Minute hier bei der Teufelsbrücke eingetroffen, doch in der Erwartung, Vater und Sohn mit ihren beiden Befreiern hier vorzufinden.
Statt dessen sah er jetzt hier seine Vertrauensmänner, die »Befreier«, schwer gefesselt am Boden liegen!
Was hätte denn nun ein anderer Mensch in seiner Enttäuschung getan? Was hätte er wenigstens für ein Gesicht gemacht? Hier im Finstern, ganz unbeobachtet!
Das schlaue Fuchsgesicht dieses Mannes hier nahm höchstens einen etwas gespannten Ausdruck an, nichts weiter — das gütige Lächeln blieb.
Und das eben war es, worüber sich ein feiner Menschenkenner, der ihn beobachtet, förmlich entsetzt hätte!
Weil es einen furchtbar gewaltigen Charakter offenbarte, der diesem so unscheinbaren Männlein innewohnte — einen Charakter, der niemals etwas Gutes hervorbringt, wohl aber im Bösen mit allen Teufeln der Hölle konkurrieren kann!
»Cotch? Macroy? Seid Ihr's?«
Den beiden war diese Stimme wohlbekannt, und sie hatten ihn ja auch hier erwartet.
»Señor Lazare, o Gott, o Gott!«
»Haben Euch die beiden hier überwältigt?«
»Nein, nein —«
Das hatte Lazare auch von vornherein nicht geglaubt. Mit Bob Snyder hatte er selbst ja nicht gesprochen, auch nicht mit dessen Sohne, er wollte seine Hände bei dieser Entführung ganz rein halten, erst hier hätte er die Maske fallen lassen — aber besonders den Jungen hatte er ganz genau instruieren lassen, natürlich nur mit falschen Vorspiegelungen — jedenfalls aber war er sofort überzeugt, dass nicht Vater und Sohn ihre Befreier hier gefesselt hatten. Er hätte es nicht geglaubt, und wenn es ihm diese beiden hier auch noch so heilig versichert hätten.
»Wer denn sonst?«
»Der Teufel, der Teufel!«
»Der Teufel? Habt Ihr ihn gesehen?«, war die ganz gelassene Frage.
»Dann war's eben die Mistress Allan selbst, die so entsetzlich geschrien hat, hier in unserer dichten Nähe.«
»Die Señora Allan? Nein, meine Lieben, die kann jetzt nicht hierher kommen und kann auch nicht schreien. Die liegt jetzt im friedlichen Schlafe.«
»Aber die grässlichen Schreie —«
»Die habe auch ich gehört, wenn auch nicht in meiner dichten Nähe. Aber es stimmt schon, hier aus dieser Gegend mussten sie kommen. Das ist der afrikanische Hyänenvogel gewesen, der neulich aus dem zoologischen Garten entflohen ist, er scheint sich hier versteckt zu haben und lässt nun sein schönes Nachtliedchen ertönen. Im Zoologischen Garten hat man vergebens darauf gewartet, dass dieser äußerst seltene Vogel einmal seine furchtbare Stimme erschallen ließ.«
Die natürliche Erlärung war gegeben, dadurch erst kamen die beiden richtig zur Besinnung, sie schämten sich ob ihrer Gespensterfurcht.
Sie schämten sich so, dass sie erst gar nicht daran dachten, jenen zu bitten, er möchte sie von ihren Banden befreien. Sie blieben liegen, wie sie lagen, ließen sich befragen und berichteten, so weit sie berichten konnten.
»Nur ein einziger Mann war es?«
»Zweifellos nur einer.«
»Die beiden Snyders hatten ihn hier nicht erwartet?«
»Es kam uns gar nicht so vor, sie waren erst gar nicht recht damit einverstanden, dass sie mit helfen sollten uns zu binden.«
»Wie wusste er sie dazu zu bewegen?«
»Alles sei Lüge.«
»Was sei Lüge?«
»Dass wir sie wirklich hätten befreien wollen.«
Die beiden berichteten weiter, so viel sie eben konnten. Es war herzlich wenig. Sie selbst hatten ja den Sprecher gar nicht verstanden.
»Die Unglücklichen! Sie haben sich von einem Fremden irreführen lassen! Hat der Mann meinen Namen genannt?«
Die beiden konnten sich nicht besinnen, so sehr Lazare auch gerade hierauf drängte.
»Habt Ihr ihn gesehen?«
»Es war ja stockfinster wie jetzt.«
»Ihr hattet doch Lampen.«
»Wir konnten sie nicht benutzen, die anderen haben auch kein Licht gemacht.«
»Nannte er seinen Namen, wurde er von den anderen genannt?«
»Nein. Einmal, gleich zuerst, hatte der Fremde ein oder einige fremde Worte gesprochen. Aber das konnte doch ebenso gut ein ganzer Satz wie nur ein Name gewesen sein, und die beiden vermochten die Silben auch gar nicht zu wiederholen.«
»Sie wollten den Zug noch erreichen, der jetzt zuletzt von San Francisco kam, wollten hinter der Station Colma, wenn der Zug noch etwas langsam fuhr, ungesehen aufspringen?«
»So hat der Fremde sogar zweimal gesagt.«
»Zweimal?«
Die beiden konnten versichern, dass hiervon der Fremde zweimal gesprochen hatte.
Lazare schien etwas zu überlegen, nickte mehrmals, als wäre er mit dem, was er zu hören bekommen, sehr, sehr zufrieden.
»Señor Lazare, wollen Sie nicht endlich unsere Fesseln abnehmen? Sie schneiden furchtbar ins Fleisch«, sagte da Mr. Cotch mit kläglicher Stimme.
»Gewiss, ei gewiss doch! Ach, Ihr Ärmsten, dass Euch so etwas passieren musste!«
Es kam etwas spät, dieses Mitleid, und es klang überhaupt recht seltsam.
Jetzt aber bückte sich Lazare sofort, beschäftigte sich mit den beiden.
Sie lagen ganz still.
Ganz, ganz still.
Der gute Engel nahm sich Zeit, die beiden zu befreien, durchschnitt die Bande nicht, obgleich doch natürlich einer der Männer, wenn nicht er selbst, ein Messer in der Tasche hatte, sondern er knüpfte die Knoten auf, und wenn man diese betrachtete, so hätte man es sehr, sehr merkwürdig gefunden, dass er sie überhaupt aufknüpfen konnte; mancher Matrose hätte es nicht fertig gebracht, denn sie waren in ganz besonderer Weise geschürzt, er steckte jeden einzelnen Riemen in die Tasche — und die beiden Männer lagen ganz still.
Lazare erhob sich, ging in den Wald hinein, wie vorher mit unörbarem Schritte.
Und die beiden Befreiten lagen ganz still.
Von der anderen Seite kam der Jesuitenpater wieder auf die beiden zu, und diese lagen noch immer ganz still da.
Und da geschah wiederum etwas ganz Rätselhaftes.
Das kleine, dürre, ausgemergelte Männchen bückte sich, schob die eine Hand und den halben Arm unter den des einen Mannes, tat dasselbe mit der anderen und dem anderen Arme bei dem zweiten Manne, und dann richtete er sich auf, wie zwei Mehlsäcke hingen die beiden Männer unter seinen Armen, und mit dieser Last von ziemlich drei Zentnern schritt dieses alte, kleine, dürre, fast verhutzelt aussehende Männlein wieder in den Wald hinein, dorthin, wo in der furchtbaren Tiefe der Teufelsbach leise brauste.
Nach zwei Minuten trat Lazare wieder auf die kleine Waldblöße.
Die beiden so stillen Männer trug er nicht mehr.
Aufmerksam betrachtete er die Stelle, wo sie gelegen hatten, bückte sich, hob ein kleines Stückchen grünumsponnenen Draht auf — in dieser Stockfinsternis hatte er es im Grase liegen sehen! Dann schritt er mit seinen lautlosen Sohlen davon, dorthin, wohin jene drei Männer gegangen waren, er folgte ihren Spuren, die Hände auf dem Rücken, in seinem klugen, schlauen Gesicht immer noch das gütige Lächeln.
Und da gellte hinter ihm noch einmal der entsetzliche Schrei des Hyänenvogels, eines afrikanischen Mitteldings zwischen Geier und Eule, nur des Nachts auf Raub ausgehend oder vielmehr nach Aas ausspähend.
Diesen Mann hier konnte der grässliche Schrei nicht erschüttern, ruhig setzte er seinen Weg fort, mit unfehlbarer Sicherheit den Spuren folgend, und nicht lange währte es, so konnte er schon konstatieren, dass sich jene drei nicht nach der Station Colma gewandt hatten, sie hatten plötzlich eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Als ob er eine recht erfreuliche Entdeckung gemacht habe, so rieb er sich mit leisem, kaum hörbarem Kichern das spitze Kinn.
»Natürlich, natürlich! Der hat das von dem Zuge doch nur gesagt, sogar zweimal, um einen Verfolger irrezuführen. Wollen aber sehen, ob es ihm gelingt, den schleichenden Fuchs auf eine falsche Spur zu bringen, wollen mal sehen, hihihihihi.«
Assistenzarzt Walter Müller lag schlafend in seinem Bett. Er hatte einen aufregenden Nachmittag und Abend hinter sich. Erst die vielen Experimente mit dem Kinde, die ihn wegen der unbedingt erforderlichen Willenskonzentration stets sehr erschöpften, dann das Versagen des elektrischen Lichtes, wo er in seinem Revier alle Hände voll zu tun gehabt hatte, um überall sofort wieder für die nötige Beleuchtung zu sorgen, dann der Generalalarm, weil ein Irrsinniger einen Tobsuchtsanfall bekommen und seinen Wärter überfallen hatte, und dann schließlich die bald entdeckte Flucht eines Irrsinnigen, natürlich mit Hilfe des Monteurs, der in jener Zelle den Defekt gesucht hatte.
Diese Flucht oder Entführung ging diesen jungen Assistenzarzt nichts an, es war in einem anderen Reviere geschehen, er kannte diesen Bob Snyder gar nicht, hatte ja wohl schon von der ganzen Geschichte mit Mistress Allan gehört, aber ach, wenn sich solch ein Hilfsarzt in einer Irrenklinik, die fast zweihundert Geisteskranke birgt, um die Familienverhältnisse eines jeden einzelnen kümmern wollte, um den Grund, weshalb der Betreffende den gesunden Verstand verloren, da hätte er ja etwas zu tun!
Immerhin, in die ganze Aufregung war er doch mit gezogen worden.
Eigentlich hatte er nur bis abends acht Dienst gehabt, zwei Stunden war er noch hingehalten worden, dann erst hatte er sich für die dienstfreie Nacht auf sein Zimmer begeben können.
Jetzt lag er friedlich schlummernd in seinem Bett. Daneben stand ein Kinderbett — solch eine große Klinik verfügt doch über Betten aller Art — in dem die kleine Deasy lag.
Die elektrische Lichtanlage funktionierte wieder, ein Glühlämpchen erleuchtete noch schwach das Zimmer des vielgeplagten Assistenzarztes, der auch in seinen dienstfreien Nächten jeden Augenblick gerufen werden konnte, es ließ erkennen, wie aufmerksam der nunmehrige Pflegevater für seinen Schützling gesorgt hatte, ein Tischchen war gedeckt mit allem, was Gaumen und Auge solch eines Kindes erfreuen kann, in seinem gesunden Ärmchen hielt es zärtlich ein Püppchen.
So lag das reizende Mädchen da, im Schlafe glücklich lächelnd.
Da fuhr der Assistenzarzt empor.
Hatte es nicht heftig an seiner Tür gepocht?
Das wäre das erste Mal gewesen, und wozu das?
Wurde er gebraucht, dann schrillte neben seinem Bett die Klingel, und dort an der Wand war das Telefon.
Da wurde noch einmal gepocht, gegen die Tür gedonnert.
»Wer ist da?«
»Professor Smart! Machen Sie schnell auf!«
Heraus dem Bett und im Nu in die Oberkleider und Hausschuhe gefahren, die Tür geöffnet. Nur einen Blick noch hatte er auf die Uhr geworfen. Gleich um eins. Ohne Weiteres trat Professor Smart ein, ihm nach ein Herr und eine Dame.
Wir kennen sie — Señor Lazare und Mistress Allan — Müller kannte sie nicht.
Wir wollten nicht dabei sein, als Mistress Allan, aus einem tiefen Schlafe erwachend, der vielleicht nicht ganz ein natürlicher gewesen war, in dem von ihr durch das Gitter getrennten Nebenraume, immer hell erleuchtet, ihren Sohn nicht erblickte, als er auf ihr Rufen keine Antwort gab.
Wir wollen nicht wissen, ob sie geschrien, wie sie sich gebärdet hatte, als sie überzeugt sein musste, dass Fred verschwunden war.
Natürlich sofort das ganze Haus alarmiert.
Nur drei Personen fehlten in der Zwingburg.
Señor Lazare, Dr. Reichard und Magazinverwalter Cotch.
Ersterer war Herr seiner selbst, konnte gehen und kommen, wie er wollte. Der zweite, der neue Hauslehrer, hatte heute Nachmittag noch einmal für 24 Stunden Urlaub bekommen, um sein Gepäck zu holen, um alles zu erledigen, was er noch zu erledigen hatte. Aber das Fehlen des Magazinverwalters war unentschuldbar.
»Er hat meinen Fred entführt!«
Mochte diese Frau nun auch so viel geschrien haben wie sie wollte, in was für einer Seelenverfassung sie sich auch befand — ganz logisch von ihr war es, dass sie sich sofort mit Professor Smarts Irrenklinik in telefonische Verbindung setzen ließ.
Das Telefon funktionierte nicht. Das ihre wohl, aber das andere nicht, sie bekam aus der Irrenklinik keine Antwort. Die künstliche Störung der elektrischen Lichtanlage mochte auch das Telefon in Mitleidenschaft gezogen haben.
Davon aber wusste Mistress Allan nichts, und sie mochte umso bestürzter sein, von der Irrenanstalt keine Antwort zu bekommen, als ihr vom Telefonamt versichert wurde, sie sei ganz richtig verbunden.
Also persönlich hin! Ohne Begleitung die Zwingburg verlassen, fliegenden Fußes über die Landzunge gerannt, dann das erste Automobil angehalten, und wäre es besetzt oder ein Privatfahrzeug gewesen, sie hätte es dennoch für sich requiriert.
Das war gegen Mitternacht gewesen.
Zehn Minuten vor Mistress Allan war Señor Lazare in der Irrenklinik eingetroffen.
»Was, Bob Snyder ist ausgebrochen?«, rief er, als es noch andere hören konnten.
Wissen musste er es. Das war doch schon in ganz San Francisco bekannt, um diese Zeit sprach man noch in allen Lokalen davon, dass der Irrsinnige, der den Sohn der tollen Lady für den seinen hielt, nun glücklich zum vierten Male aus Professor Smarts Anstalt entwischt war.
Nur Mistress Allan selbst hatte bei ihrer rasenden Automobilfahrt nichts davon vernommen.
»Ich muss Sie sprechen, Professor Smart.«
Sie waren wieder allein, diese beiden dunklen Ehrenmänner.
»Ich hoffe, dass alles nach Wunsch gegangen ist und ich somit meine Million Dollars verdient habe«, eröffnete Smart das Gespräch.
Der Jesuitenpater lächelte freundlich und tippte gegenseitig seine Fingerspitzen.
»Nach Ihrem Wunsche wohl, Herr Professor, aber nicht nach meinem.«
»Inwiefern nicht?«
»Der Monteur ist mit dem Flüchtling nicht dort an der Pinie bei Gardenhill eingetroffen.«
»Was?«
»Wie ich sage.«
Sofort nahm Smart eine durchaus ablehnende Haltung an.
»Das geht mich gar nichts an, ich habe mir meine Million verdient.«
»Na warten Sie mal, geehrter Herr Professor, wollen wir den Fall doch ganz ruhig besprechen —«
Aber Smart ließ ihn nicht aussprechen. Er sah seine Million gefährdet, hatte sie noch nicht bekommen und so gar keine Sicherheit, sie von diesem geriebenen Fuchse zu erpressen.
»Halt! Da fällt mir etwas ein! Ein wunderbarer Zufall! Es gibt ein Mittel, um zu erfahren, wo sich der Entflohene jetzt befindet! Allerdings müssen wir dazu etwas von ihm haben —«
»Was für ein Mittel? Was von ihm haben?«, lächelte mit unendlicher Seelenruhe das Männlein.
Mit fliegenden Worten berichtete ihm der Professor von dem Schützling seines Assistenzarztes, von der hellsehenden Gabe dieses Kindes.
»Sie haben solchen Experimenten schon beigewohnt?«
»Wie ich soeben berichte, das habe ich heute Mittag selbst mit erlebt!«
»Parbleu, das ist ja erstaunlich. Das interessiert mich sehr. Ja, da wollen wir einmal gleich —«
Da wurde die Mistress Allan gemeldet, sie stürmte freilich schon an dem meldenden Diener vorbei.
»Der Magazinverwalter hat meinen Fred entführt, er ist verschwunden!«
»Auch das noch — o Gott, wie strafst Du diese arme Mutter hart!«, seufzte Lazare, einmal die tippenden Hände faltend und die Augen nach oben verdrehend. »Aber er hat uns auch das Mittel gegeben, um sofort erfahren zu können, wo sich Ihr Liebling befindet, um ihn jenem verruchten Übeltäter wieder abzujagen.«
Nachdem Mistress Allan noch erfahren, dass auch der irrsinnige Vater, für den er sich wenigstens hielt, richtig wieder ausgebrochen war, mit fremder Hilfe, erfuhr sie weiter von der kleinen Deasy.
»Ja, nun müssen wir aber erst solch ein Medium haben —«
»Ich habe ein Milchzähnchen von meinem Fred, das erste, das er verloren hat, ich habe es bei mir!«, rief fast jauchzend die Mutter, die mit fast wunderbarem Scharfsinn die wenigen Andeutungen, die man ihr jetzt hatte geben können, sofort völlig verstanden hatte, und sie zog aus dem Busen ein goldenes Kettchen, an dem in Einfassung ein Kinderzähnchen befestigt war.
»Das ist ja vortrefflich! Dann vorwärts, kein Augenblick ist zu verlieren!«
So wurde der Assistenzarzt geweckt, die drei traten ohne Weiteres ein
»Wir haben mit dem Kinde ein Experiment zu machen!«, sagte Smart in brüskem Tone.
Zwischen den Augenbrauen des so harmlos aussehenden und sich so schüchtern benehmenden jungen Mannes entstand eine kleine Falte.
»Es ist mitten in der Nacht, das Kind schläft —«
»Machen Sie keine Umstände! Wir müssen unbedingt erfahren, wo sich der Irrsinnige, der heute Abend entflohen ist, jetzt befindet —«
Da erwachte die kleine Deasy, konnte sich nicht gleich besinnen, sah sich in einer fremden Umgebung, die fremden Menschen, die sich so laut benahmen — sie fing zu weinen an.
»Unter solchen Umständen ist es gar nicht möglich, die hellsehende Gabe des Kindes zu benutzen,« sagte Müller, »wenn Deasy weint oder nur etwas aufgeregt ist, nicht in glücklicher Stimmung ist, lässt sie sich nicht in hellsehenden Schlaf bringen.«
Professor Smart schwieg bestürzt. Er gehörte zu denjenigen Männern, die einem weinenden Kinde gegenüber ganz ohnmächtig sind, und das umso mehr, je energischer, rücksichtloser sonst der betreffende Mann ist. Und das ist ja auch ganz richtig so, einem weinenden Kinde gegenüber hat auch der Kaiser das Recht verloren, ein Welteroberer wird machtlos, der Staatsanwalt steht ratlos da.
Da nahm Señor Lazare, der seine klugen Augen zwischen dem weinenden Kinde und dem plötzlich so energisch auftretenden jungen Manne hatte hin und her wandern lassen, das Wort, nachdem er seine Hände gefaltet.
»Mein lieber, junger Freund«, begann er mit entsprechender, überaus sanfter Stimme, »bitte, nehmen Sie sich doch unser, nehmen Sie sich dieser Dame an. Sie ist eine unglückliche Mutter, der nun schon zum vierten Male ihr einziges Kind geraubt worden ist —«
Und so sprach er noch einige Minuten weiter, den Assistenzarzt in alles einweihend, und dieser Jesuitenpater wusste zu sprechen.
»Bitte, bitte, versuchen Sie doch das Kind zu beruhigen, dass es dieser bedauernswerten Mutter behilflich sein kann.«
Der Assistenzarzt war bereits besiegt, das sah man ihm gleich an, und auch die kleine Deasy hatte unterdessen zu weinen aufgehört und mit größter Teilnahme jenen Worten gelauscht.
»Ach, ich will der armen Frau doch helfen, dass sie ihren Sohn wiederbekommt!«, sagte das silberne Kinderstimmchen.
Nun ging es schnell. Das Zähnchen brauchte nicht aus der Fassung genommen zu werden, die ganze Kette konnte daran bleiben.
»Nimm dieses Kinderzähnchen in die Hand, schlafe ein und sieh die Person, der dieses Zähnchen gehört!«
So sprach Müller mit allem Nachdruck, als er den Zahn dem Kinde in die tote Hand legte und die Fingerchen darüber schloss.
»Schlafe ein!«
Vielleicht war dieser hypnotische Befehl — denn mit Hypnotik hatte es schließlich doch etwas zu tun — gar nicht nötig, Deasy sank mit geschlossenen Augen schon selbst in die Kissen zurück. Oder es genügte eben schon das Medium, hier das Zähnchen, um sie in Schlaf zu versetzen, weil nun einmal ihr Wille, einzuschlafen, dabei vorhanden gewesen war.
Der Assistenzarzt prüfte den Puls des toten Ärmchens, und nicht lange dauerte es, so begann sich dieses zu erwärmen.
»Jetzt — jetzt kommt der Pulsschlag — immer lebhafter wird er — jetzt kann es so weit sein — was siehst Du, mein Kind?«
Die Lippen bewegten sich, dann konnte das Kind im Schlafe ganz gut sprechen.
»Ich sehe — ihn.«
»Dem dieses Zähnchen gehört?«
»Ja.«
»Wie sieht er aus?«
»Es ist — ein Knabe.«
Schon fuhr Mistress Allan empor. Eine Bewegung Müllers ließ sie sich noch beherrschen.
»Wie alt mag der Knabe sein?«
»Ich — weiß nicht.«
»Vielleicht so alt wie Dein Bruder Jack?«
»Ja, ja!«, wurde lebhaft bestätigt.
»Also ungefähr zwölf Jahre. Was hat er für einen Anzug an?«
»Einen — gelben.«
»Das stimmt nicht, er trägt einen blauen Matrosenanzug!«, sagte Mistress Allan aufgeregt.
»Bitte Ruhe. Ihr Sohn kann doch einen anderen Anzug angelegt haben. Ist der Anzug wirklich gelb, mein Kind? Sieh ordentlich hin!«
»Gelb, ganz, ganz gelb. Ach, das ist ja ein kleiner Chinese!«
Ganz glücklich hatte es das Kind im Schlafe gerufen. In San Francisco gibt es ja Chinesen massenhaft. Deasy hatte solche beim Passieren der Stadt genug gesehen und eine Erklärung erhalten.
Auf Mistress Allan musste es natürlich einen zweifelhaften Eindruck machen, ihren Sohn als Chinesen wiederzusehen.
»Er hat einfach ein chinesisches Kostüm an bekommen«, wurde sie beruhigt. »Er wird doch entführt, da soll er vielleicht als Chinese gelten. Was für Farbe hat sein Haar, mein Kind?«
»Blond, ganz hellblond.«
»Hellblonde Chinesen gibt es nicht. Betrachte Dir einmal genau sein Gesicht.«
»Ich — tue es.«
»Findest Du in diesem Gesicht irgend etwas Auffallendes?«
»Ja.«
»Was ist das?«
»An der linken Schläfe — ein roter Strich — eine rote Narbe —«
»Fred, es ist mein Fred!«, brach da der Jubel der Mutter los.
Der Assistenzarzt bat um Ruhe, wurde dabei von den anderen beiden Herren unterstützt. Das Schwierigste kam ja noch, den Aufenthaltsort des Knaben auszukundschaften.
»Dies wäre der erste Teil gewesen. Ich weiß ja nicht, wie weit die Herrschaften vom Herrn Professor eine Erklärung erhalten haben. Dieses Hellsehen ist immer in zwei scharf von einander getrennte Teile geschieden. Entweder das Kind sieht die Person selbst, oder es sieht das, was diese Person mit ihren eigenen Augen erblickt. Beides zusammen ist nicht möglich aus leicht erklärbaren Gründen. Das kann abgewechselt werden, nur zuerst sieht es immer bloß die Person selbst. Wenn Deasy dabei auch immer gleich den Anzug beschreiben kann, den die betreffende Person trägt, so kommt das einfach daher, weil Kleidung und Person in unserer Ideenverbindung nun einmal unzertrennlich sind. Merkwürdig hingegen ist es, dass sie niemals die Augen und deren Farbe näher beschreiben kann. Wahrscheinlich eben deshalb, weil sie mit diesen Augen der betreffenden Person erst selbst sehen muss. Die Augen, die sie wieder mit diesen Augen erblickt, die kann sie dann beschreiben. Verstehen die Herrschaften diesen Unterschied?«
»Kommen Sie zur Sache!«, gebot Smart. »Was erblickt Deasy durch die Augen des Knaben?«
»Deasy, was sieht der Knabe?«
Es dauerte einige Zeit, ehe die Antwort erfolgte.
»Nnnichts,« erklang es dann zögernd und müde.
»Der Knabe schläft wohl?«
»Ja — er — schlä —«
Das letzte Wort brachte das Kind schon nicht ganz heraus, es begann anders zu atmen, öffnete etwas den Mund.
»Auch Deasy fällt in natürlichen Schlaf. Da sehen Sie die vollkommene psychische Ineinanderverschmelzung des hellsehenden Kindes mit der betreffenden Person.«
,»Und wie lange dauert das?«, fragte Mistress Allan mit nervöser Unruhe.
»Bis Ihr Sohn erwacht. Da ist nichts zu machen. Aber warten Sie — wir wollen doch einmal sehen, wo der entflohene Irrsinnige geblieben ist, der sich für seinen Vater hält. Vielleicht ist der bei ihm. Ist von dessen Körper nichts vorhanden?«
,»Ja, es sind ihm neulich die Haare geschnitten worden,« meinte Smart, »es wäre ja möglich, dass —«
Er eilte hinaus.
»Bis der Knabe erwacht,« nahm Walter Müller wieder das Wort, »so lange müssen wir allerdings warten, ehe wir mit seinen eigenen Augen die Umgebung sehen können. Aber ihn selbst können wir ja wieder von Deasy betrachten lassen. Das ist nur nicht möglich, wenn die betreffende Person selbst im Dunkeln liegt, da kann das Kind auch die Person selbst nicht sehen. Aber der Raum, in dem er liegt, ist jetzt erleuchtet.
Zu diesem Zwecke, wenn man das jetzt in natürlichem Schlafe liegende Kind wieder ins Hellsehen zurückversetzen will, ist es das Beste, man nimmt ihm das Medium einmal aus der Hand —«
Müller tat es, legte den Zahn in die Hand, die aber warm geblieben war, zurück, schloss die Fingerchen darüber.
»Was siehst Du, mein liebes Kind?«
»Ich sehe — ihn.«
»Wieder den kleinen Chinesen?«
»Ja.«
»Nun, meine Herrschaften, will ich Ihnen zeigen, wie man auch noch auf andere Weise die Identität einer Person beweisen kann, ohne dass man sie sich beschreiben lässt. Dieses siebenjährige Kind ist an sich schon ein geborenes Zeichentalent, in diesem somnambulen Zustande aber wird dieses Talent zum phänomenalen Genie.«
Müller nahm ein Blatt Papier, legte es auf eine Unterlage und vor dem Kinde auf dem Bettchen zurecht, dazu einen Bleistift ins rechte Händchen.
»Bitte, liebe Deasy, zeichne einmal den Kopf des Knaben ab, nur den Kopf, hauptsächlich das Gesicht, die Züge.«
Und das Kind begann zu zeichnen. Nicht eben mit schnellen, genial hingeworfenen Strichen, sondern sehr langsam, aber auch ganz sicher, nie einen Strich wiederholend, nichts verbessernd.
In drei Minuten war das Gewünschte fertig.
»Fred, das ist mein Fred, wie er leibt und lebt!«, jubelte die entzückte Mutter, das Blatt Papier immer wieder an ihre Lippe pressend.
Es war auch wirklich fabelhaft, was das Kind da in drei Minuten fertig gebracht hatte. Keine flüchtige Skizze, sondern ein vollkommenes Porträt, nur eben mit Bleistift ausgeführt, und wer den Knaben kannte, der sah ihn eben im Leben vor sich stehen.
Auffallend war, dass Deasy das Gesicht nach oben gezeichnet hatte.
»Wie kommt das?«, fragte Señor Lazare.
»Jedenfalls liegt der Schläfer auf dem Rücken.«
Das deswegen befragte Kind bestätigte es.
»Dass er so auf dem Rücken liegt, kann Deasy noch sehen, aber nicht mehr die Unterlage, auf der er liegt, weil diese Unterlage eben nicht wie die Kleidung zur Charakterisierung einer Person gehört.«
Professor Smart kam zurück.
»Nein, von den abgeschnittenen Haaren Bob Snyders ist nichts mehr vorhanden, die sind schon längst in der Kehrichtgrube verschwunden. Auch sonst ist nichts von ihm zurückgeblieben, kein Nagelschnipsel.«
»So müssen wir eben warten, bis der kleine Schläfer erwacht.«
Da begann sich Deasy unruhig zu bewegen.
»Was hast Du, mein Kind?«
»Ich — muss mich bewegen.«
»Bewegt sich der Knabe?«
»Ja — er schlägt die Augen auf — er richtet sich empor —«
»Was sieht er?«
»Einen Mann, der vor ihm steht.«
»Sieht er ihm direkt ins Gesicht?«
»Ja, er spricht mit ihm. O, was dieser Mann für schöne, blaue Augen hat!«
»Halt! Sieh vorläufig nichts anderes, auch wenn Fred anderswohin blickt! Merke Dir dieses Gesicht, zeichne es hier ab.«
Hierzu ist wieder eine Erklärung nötig.
Was die kleine Somnambule einmal gesehen mit eigenen Augen oder mit denen derjenigen, die sie beobachtete, mit der sie im Rapport stand, konnte sie auch noch hinterher beschreiben und nachzeichnen, aber eben nur so lange sie sich in diesem Zustande befand. Denn sie erwachte immer erinnerungslos, wusste dann gar nichts mehr von alledem.
Wenn sie nun freilich mit einer Beschreibung oder Zeichnung aufgehalten wurde, so sah sie nicht mehr, was während dieser Zeit jene Person erblickte. Dann musste sie erst aufgefordert werden, ihre Beobachtung wieder aufzunehmen.
Solche Erklärungen sind hin und wieder nötig, bis wir die wunderbare Sehergabe dieses Kindes, das immer überraschendere Resultate geben sollte, völlig kennen gelernt haben.
Der Assistenzarzt hatte mit Recht angenommen, dass von größter Wichtigkeit sei, diesen Mann, den der erwachte Knabe jetzt zuerst erblickte, näher kennen zu lernen, deshalb hatte er das weitere Hellsehen des Kindes durch einfachen Befehl unterbrochen, um sich erst einmal das Gesicht dieses Mannes zeichnen zu lassen.
Schnell war ein anderes Blatt Papier vorgelegt, der Bleistift wurde wieder in das gesunde Händchen gegeben.
»Bitte, zeichne den Kopf des Mannes, den Fred vorhin gesehen hat oder vielleicht auch jetzt noch sieht. Oder hast Du die ganze Gestalt des Mannes deutlich gesehen?«
»Der Knabe sah den ganzen Mann.«

»Das ist mein Fred, wie er leibt und lebt!«, jubelte die entzückte
Mutter, das Bild immer wieder an ihre Lippen pressend.
»So zeichne auch den ganzen Mann, vor allen Dingen aber recht deutlich die Gesichtszüge.«
Das schlafende Kind begann die Bleistiftspitze auf dem Papier zu bewegen. Während es aber vorhin, als es mit eigenen Augen gesehen, den Kopf des Knaben ganz langsam porträtiert hatte, zeichnete es jetzt aus der Erinnerung mit schier fabelhafter Geschwindigkeit. Jetzt war es ein geniales Hinwerfen der Striche, und dennoch alles mit vollkommenster Deutlichkeit wiedergebend.
Merkwürdigerweise fing die kleine Zeichnerin unten an. Zuerst kamen die hackenlosen Schuhe, selbst ein Muster entstand im Nu darauf, ein Sachverständiger musste sofort indianische Mokassins erkennen, dann kamen Gamaschen, dann entstand ein moderner Sportanzug, wie ihn Jäger tragen — vorn am Gürtel drei Knöpfe, nichts wurde vergessen! Was dann entstand, konnte nur ein kurzer Vollbart sein. Hierauf kam der Kopf, das Gesicht, eben mit fabelhafter Schnelligkeit hin geworfen —
»Joachim!«, schrie Mistress Allan leidenschaftlich auf.
»Doktor Reichard, unser Hauslehrer«, sagte Señor Lazare ohne besonderes Staunen, worüber dieser Mann erhaben war, aber das gütige Lächeln verschwand doch einmal aus seinem Fuchsgesicht.
»Oskar!«, setzte Walter Müller mit größtem Staunen hinzu.
»Der neue Hauslehrer ist es, der meinen Fred entführt hat!«, rief jetzt Mistress Allan.
Für Señor Lazare war das nun so klar, dass er es nicht erst noch bestätigte, wenn er auch überhaupt eine ganz andere Entführung meinte als die, an welche die Mutter dachte — er wandte sich an den Assistenzarzt.
»Sie kennen diesen Mann?«
»Ja, das ist mein Freund — Dr. Oskar Reichard, ganz zweifellos!«
Der Assistenzarzt hatte beim Nennen des Namens offenbar etwas gezögert, er blickte auch recht unsicher nach der Dame, die den Namen Joachim genannt hatte.
»Woher kennen Sie ihn?«
»Wir haben zusammen studiert, sind Jugendfreunde.«
»Wissen Sie, dass dieser Dr. Oskar Reichard als Hauslehrer dieses Knaben engagiert worden ist?«
»Ach was! Ich weiß noch gar nicht, dass er hier in San Francisco ist, überhaupt in Amerika!«
Der Blick, den Señor Lazare dem jungen Arzt ins Auge sandte, musste bis ins Herz dringen und darin lesen können, dass jener die Wahrheit sprach, denn er schien zufrieden zu sein.
»Dieser Dr. Reichard, dieser unser Hauslehrer, hat heute Nacht den Knaben dieser seiner Mutter entführt!«
»Ach nein!«, stieß Walter, wie wir ihn jetzt kurz nennen wollen, bestürzt hervor. »So etwas tut Oskar nicht!«
»Ich versichere es Ihnen! Nur er ist der Räuber dieses Knaben, wenn er auch noch Helfershelfer gehabt hat!«
»Dann, dann — hat Oskar auch ein Recht dazu gehabt!«
»Was für ein Recht?«
»Weil, weil — dieser Mann niemals eine unrechte Handlung begeht!«
Der junge Assistenzarzt war sich seiner Bestürzung, in die er geraten, bewusst geworden — nur bei den letzten Worten hatte er sich wieder aufgerafft.
Doch Lazare schien dies alles gar nicht zu beachten, ganz gelassen wandte er sich wieder zu Mistress Allan, die unterdessen das Papier an sich genommen hatte und mit flammenden Augen den schönen Mann verschlin-gen wollte, den eine von einer übernatürlichen Kraft geführte Kinderhand mit so haarscharfer Deutlichkeit aufs Papier geworfen hatte.
»Ja, Señora, dann ist's eben der neue Hauslehrer gewesen, der Ihren Sohn entführt hat, der Magazinverwalter ist ihm dabei nur behilflich gewesen. Dieser nette Hauslehrer hat uns zu täuschen gewusst. Nur deshalb hat er sich bei uns eingeschlichen, hat sich noch einmal bis morgen Nachmittag Urlaub geben lassen.«
Mistress Allan hatte sich aus ihrer Verzückung aufgerafft.
»Ja, er ist es! Wo aber befinden sich nun die beiden!«
»Das wird Mister Müller wohl auch noch durch dieses Kind herausbringen. Bitte, mein lieber Freund, wollen Sie nun die kleine Deasy weiter beobachten lassen. Es handelt sich jetzt also darum, zu erfahren, wo sich Master Fred gegenwärtig befindet.«
Walter hatte sich wieder gesammelt, kaltblütig setzte er das Experiment fort.
»Was erblickt der Knabe jetzt, mein liebes Kind? Immer noch den Mann, den Du soeben gezeichnet hast?«
»Nein.«
»Sondern?«
»Ich sehe —«
Plötzlich fing das Kind im Schlafe herzlich zu lachen an.
»Was siehst Du? Worüber lachst Du?«
»Ach wie komisch!«, lachte die Schläferin noch immer. »Ein Chinese — aber so dick, so furchtbar dick! Und was der auf der Brust hat!«
»Was hat er auf der Brust?«
»Ein Tier, ein rotes Tier.«
»Was ist es für ein Tier?«
»Ich habe so eins noch nie gesehen. Nein, was das für ein Tier ist!«
»Er hat es auf den Armen vor sich an der Brust?«
»O nein, der dicke Chinese hat eine gelbe Jacke an, darauf ist das rote Tier gemalt — oder gestickt.«
»Also! Willst Du uns nicht auch diesen Chinesen zeichnen?«
Wieder war das Konterfei im Nu entstanden, einen äußerst dicken Chinesen mit lachendem Gesicht darstellend, über dem gewaltigen Schmerbauch auf der Brust eine große Figur. wahrscheinlich eingestickt.
Es war nichts anderes als ein Löwe, was das Kind da mit wenigen Strichen scharf charakterisiert hatte, ein Löwe, wie er in der Natur nicht vorkommt, so ein heraldischer Löwe, wie man ihn gewöhnlich im Wappen darstellt, auf den Hinterfüßen stehend, mit den Pranken schlagend, die Zunge weit zum Maule herausstreckend, überhaupt etwas Drachenähnliches dabei.
Man hatte des roten Tieres, welches der Chinese auf der Brust tragen sollte, vorher gar nicht geachtet, jetzt aber bei der bildlichen Darstellung desselben ging sofort bei zweien der Herren die Erkenntnis auf.
»Das ist ja niemand anders als Li Wang, der Wirt vom roten Löwen!«, rief Professor Smart sofort.
»Die Höhle des roten Löwen, Tea Street Nummer 67«, ergänzte Señor Lazare. »Mich hat eine fromme Mission wiederholt in dieses Haus geführt, es galt eine verlorene Seele zu retten.«
Diese Bemerkung war für den ehemaligen Jesuitenpater auch sehr notwendig. Schon bei dem weltlichen Professor war es nicht gerade hübsch, dass er diesen Chinesen so genau kannte.
In San Francisco leben mindestens 20 000 Chinesen, die in ihrem eigenen Stadtteil wohnen. Zur Charakterisierung dieses Chinesenviertels genügt die Bemerkung, dass kein Diebstahl und kein Verbrechen, auch kein Mord, der in diesem Chinesenviertel begangen worden ist, strafrechtlich verfolgt wird. Wer sich in dieses Chinesenviertel begibt, tut es auf eigene Gefahr, stellt sich außerhalb des Schutzes der Gesetze. In allen Straßen, die nach diesem Viertel führen, sind dementsprechende Warnungstafeln aufgehangen.
Wohl veranstaltete die Polizei ab und zu eine Razzia, aber nur, um Personen, die unfreiwillig hierher verschleppt worden sind, besonders weiße Mädchen, zu befreien, aber auch hierbei gibt es niemals eine Arretierung oder gar Verhaftung, sondern die Polizisten begnügen sich, alles Chinesische, was ihnen in den Weg kommt, mit ihren Gummiknüppeln tot oder doch zu Krüppeln zu schlagen.
Es sind dies für uns ungeheuerliche, unfassbare Verhältnisse, aber es hat sich eben als unmöglich erwiesen, dass die Polizei in diesem Chinesenviertel Ordnung halten, die Justiz rächend eindringen kann. Das Erdbeben im Jahre 1906 hat gezeigt — was man allerdings schon immer gewusst hatte — dass dieses Chinesenviertel unterirdisch wie ein Ameisenhaufen von Gängen durchzogen ist, in denen eben die jeder Beschreibung spottenden Orgien stattfinden. Und es ist nicht möglich, die Chinesen anderswo anzusiedeln, weil dem Chinesen das Haus und das Stück Erde, wo ein Familienmitglied gestorben ist, heilig ist, dort muss den Geistern der Verstorbenen geopfert werden — Ahnenkultus — und wird ihm das in der Fremde versagt, so muss er das Land verlassen, er müsste nach seiner Heimat, nach China zurückkehren, und San Francisco ist von diesen billigen chinesischen Arbeitskräften so abhängig geworden, dass solch eine Massenauswanderung die ganze Stadt vor einen wirtschaftlichen Ruin bringen würde.
Die Tea Street — Teestraße — ist darin die verrufenste Straße, und die größte Lasterhöhle in dieser war die des roten Löwen, einem Li Wang gehörend.
Mistress Allan unterdrückte noch ihren Jubel, jetzt den Aufenthaltsort ihres Sohnes erfahren zu haben, sie kannte dieses chinesische Viertel doch wenigstens dem Hörensagen nach, und ein berechtigter Zweifel tauchte in ihr auf.
»Ob es aber auch gerade das Haus dieses Chinesen selbst ist, in dem er sich jetzt befindet? Der Wirt des roten Löwen kann doch auch einmal ein anderes betreten haben.«
»Nein, das ist ausgeschlossen«, konnte der Professor sie beruhigen, »ich weiß zufällig, dass dieser Li Wang einen Schwur getan hat, niemals die vier Wände seines Hauses zu verlassen, wie es so manche Chinesen zur Ehrung ihrer Ahnen tun.«
»Dann ist mein Fred auch gefunden, dann habe ich ihn wieder, nun schnell die Polizei benachrichtigen!«
So ließ Mistress Allan jetzt ihrem Jubel freien Lauf, als sie nach dem Telefon stürzte.
Ehe sie die Erfahrung machen musste, dass dieses noch immer nicht funktionierte, spielte sich eine andere Szene in diesem Zimmer ab.
»Halt, mein Freund, wo wollen Sie denn hin?«
Mit diesen Worten vertrat Señor Lazare dem Assistenzarzte den Weg, der sich nach der Tür gewandt hatte.
In das blasse Gesicht des schüchternen jungen Mannes schoss vor Verlegenheit das Blut.
»Ich wollte — ich wollte —«, fing er zu stammeln an.
»Sie wollten Ihren Freund vor uns warnen, nicht wahr?«, kam ihm Señor Lazare zu Hilfe.
Da war es mit der Verlegenheit Walters vorbei, er richtete sich energisch empor, wenn er dabei auch einen nur noch röteren Kopf bekam.
»Allerdings! Ich weiß, dass dieser mein Freund keiner irgend welchen üblen Tat fähig ist, und wenn er jenen Knaben wirklich entführt hat, so muss er auch einen guten Grund haben —«
»Siie werden dieses Zimmer nicht verlassen«, wurde er von Lazare unterbrochen, der immer sein gütiges Lächeln beibehielt.
Noch trotziger richtete sich der junge Mann empor.
»Wollen Sie mich etwa daran hindern?«
»Jawohl, ich.«
»Aus welchem Grunde?«
»Na, ganz einfach, weil Sie mit diesen Räubern entweder schon unter einer Decke stecken oder ihnen jetzt helfen wollen. Ich halte Sie mit Gewalt hier fest! Keinen Widerstand, mein Herr! Professor Smart, seien Sie mir behilflich, dass dieser Mann das Zimmer nicht verlassen kann —«
Da geschah es schon.
Der Assistenzarzt mochte einsehen, dass es einen Weg durch diese einzige Tür nicht mehr gab.
Außer Señor Lazare hatte sich auch Professor Smart vor dieser Tür aufgepflanzt. Und gesetzt auch den Fall, es wäre dem jungen Manne, dessen Figur man freilich so etwas nicht zutraute, gelungen, die beiden Männer zur Seite zu drangen, zu schleudern, sich durchzuschlagen, was ihm aber wohl bei dem starken, fast hünenhaft gebauten Professor nicht so leicht gelungen wäre, so wusste er doch, wie schnell dieses ganze Haus alarmiert werden konnte, wozu das Telefon nicht zu funktionieren brauchte.
Aber der junge Arzt wusste auch noch einen anderen Ausweg.
Dort war das Fenster, und es stand offen. Ja, aber wusste er denn nicht, dass sein Zimmer in der ersten Etage lag, zehn Meter hoch über dem Erdboden, über Trottoir und hartem Straßenpflaster?
Wie dem auch sei — umgedreht und mit einem plötzlichen Satze stand der junge Mann auf dem Fensterbrett, war von diesem verschwunden — war hinabgesprungen!
Besonders Professor Smart stand da, als habe er eine Vision gehabt.
Dieser blasse, blöde Mensch mit der großen Hornbrille, dieser linkische, schwächliche Jüngling, dem er schon wiederholt geraten, doch etwas Sport und körperliche Übungen zu treiben, um sich etwas zu kräftigen — springt der mit einem drei Meter langen Satze dort auf das hohe Fensterbrett hinauf und auch gleich hinab! Schon diesen ersten Satz, der einem Seiltänzer alle Ehre machte, konnte der Professor gar nicht begreifen, glaubte das nur geträumt zu haben.
»Das ist ja gar nicht mööööglich!«
Señor Lazare zweifelte nicht an der Möglichkeit der Tatsache. Wenn auch er zuerst ganz erstarrt dagestanden hatte. Im nächsten Augenblick aber stand er am Fenster und blickte hinab, um sich den Waghalsigen zu betrachten, der doch natürlich dort unten auf dem Straßenpflaster mit gebrochenen Knochen liegen musste. Es war eine hohe erste Etage über dem Hochparterre.
Aber der kühne Springer lag eben nicht dort unten.
»Dort läuft er! Er muss Knochen von federndem Stahl haben! Schnell ihm nach, dass er uns nicht zuvorkommt!«
Und das dürre Männlein verwandelte sich in ein Wiesel, so huschte es zur Tür hinaus, diesen Weg doch dem zum Fenster hinaus vorziehend.
Wir versetzen uns in ein chinesisch eingerichtetes Gemach und wollen gleich verraten, dass dieses 12 Meter unter der Erde liegt. Es wurde von einer Lampe mit wohlriechendem Öl erhellt, und im Scheine derselben las Doktor Oskar Reichard, bequem auf einigen Kissen sitzend, in einem Buche, rauchte eine kurze Pfeife, deren Qualm einen unsichtbaren, aber vortrefflich wirkenden Abzug fand, und schlürfte ab und zu aus einer feinen Porzellantasse köstlich duftenden Tee.
Da wurde ein Wandteppich zurückgeschlagen, herein wälzte sich ein unförmig dicker Chinese, so eine richtige Pagodenfigur mit ganz dünnem, aber bis auf die Brust herabhängendem Schnurrbart und ewig lachendem Gesicht.
»Mister, da ist ein Mister, Ihr Freund ist er, Baron von Walten[3] heißt er.«
[3] Im Original steht »Salten« statt »Walten«.
Mit maßlosem Staunen blickte der Lesende auf, und daran konnte wohl nicht nur diese seltsame Reimerei schuld sein.
»Wie heißt er?«
»Baron von Walten, königliche Hoheit.«
Wir wollen die beiden Freunde, die sich nach langer, langer Trennung hier in Frisco im chinesischen Viertel tief unter der Erde wieder zusammenfanden, in der Höhle des roten Löwen, etwas näher kennen lernen.
Prinz Joachim war eng verwandt mit einem regierenden Fürstenhause, und zwar mit dem Prädikat Durchlaucht, weil die Mutter wieder mit dem russischen Zarenhause verwandt war.
Aber fürstliche Verpflichtungen gegen sein Vater- oder Mutterland hatte dieser Prinz durchaus nicht gehabt. Der hochbegabte Knabe hatte wie jeder andere, dessen Eltern es sich leisten können, das Gymnasium besucht, dann die Universität, hatte Medizin studiert — anfangs, dann Naturwissenschaften im Allgemeinen, hauptsächlich Botanik, und schließlich war er Forschungsreisender geworden, hatte schon alle Weltteile kreuz und quer durchwandert.

Da war ein Thronnachfolger gestorben, und ihm der nächste war Prinz Joachim gewesen.
Er hatte sofort verzichtet, was auch von vornherein für diesen Fall als ganz selbstverständlich angenommen worden war.
Er hatte, ohne seinen Fürstenrang niederzulegen, schon immer bürgerliche Namen geführt, einmal diesen, einmal jenen, war eben immer inkognito gereist, was gerade für seine Zwecke doch viel bequemer war, nur den Vornamen Oskar hatte er immer mit Vorliebe gewählt, aber obgleich er nun auf die Thronfolge verzichtet hatte, was auch angenommen worden war, musste er doch, wie es die Verfassung jenes Landes nun einmal vorschrieb, als Erbprinz mit dem Prädikat »königliche Hoheit« geführt werden, so lange der Thron noch besetzt war, und wenn auch schon ein anderer Nachfolger bestimmt war.
Das war Prinz Joachim gewesen, doppelter Doktor der Medizin und Philosophie.
Und nun zu seinem Freunde, dem Baron Walter von Walten.
Er hatte sich mit Prinz Joachim zusammen, der sich aber schon damals lieber bei seinem zweiten Vornamen Oskar nennen hörte, alle Bänke des Gymnasiums gedrückt, beide meist ein und dieselbe Bank, sie hatten beide zusammen Medizin studiert, ganz selbstverständlich auf derselben Universität. Nur dass sich Baron von Walten dann mehr der Psychiatrie, der ärztlichen Seelenheilkunde, zugewandt hatte, er war Irrenarzt geworden.
Und dann war die große Trennung der beiden Freunde gekommen. Oskar wollte hinaus in die Welt, in Wildnisse, und Walter wollte hinter die Mauern von Irrenanstalten.
Und dann war es gekommen, wie es so immer geht. Anfangs hatten sie sich viel geschrieben, soweit Oskar in seinen Wildnissen überhaupt Briefe absenden und empfangen konnte, und schließlich hatten sie sich ganz aus den Augen verloren. Hierzu kam eben noch, dass Prinz Joachim immer unter anderen Namen reiste, und dasselbe galt von Baron Walter, was soll denn auch so ein Freiherr und Baron als lernbegieriger Hilfsarzt in einer Irrenklinik, zumal dieser Baron hier noch so bescheiden war, dass er nicht einmal sein Doktorexamen gemacht hatte, wirklich aus lauter Bescheidenheit nicht. Wie es ja überhaupt auch genug Hochschulprofessoren ohne Doktorgrad gibt, und die stehen den anderen nicht etwa nach.
»Was, Baron von Walten — mein Walter hier in Frisco?«, rief Oskar noch immer in ungläubigem Staunen.
»Hier hat er noch etwas auf einen Zettel gemalt, als Erkennungszeichen.«
Auf das Stückchen Papier war ein Schnörkel gezeichnet, mit einiger Mühe konnte man drei Buchstaben erkennen, in einer Linie verschlungen, ein sogenannter Studentenzirkel.
»Wahrhaftig, unser Zirkel! Und dabei auch unser geheimes Erkennungszeichen markiert! Walter, mein Walter —!«
Oskar stutzte.
»Ja, woher weiß der denn, dass ich hier bin?«
»Das habe ich mich auch gefragt.«
»Sie haben ihn gefragt?«
»Ihn nicht, ich werde mich doch hüten!«, lachte der dicke Chinese. »Ich habe ihm natürlich gesagt, hier wäre kein Prinz Joachim und kein Doktor Oskar Reichard —«
»Was, auch diesen Namen hat er schon genannt?«, stutzte Oskar noch mehr.
»Hat er, hat er — mir auch ganz unbegreiflich.«
»Was hat er denn sonst gesagt?«
»Mir drohe die größte Gefahr.«
»Was für eine?«
»Sie wären entdeckt, Señor Lazare und Mistress Allan wären schon unterwegs.«
»Was zum Teufel —?«
»Mir auch ganz rätselhaft.«
»Na, dann herein mit ihm.«
»Natürlich, wenn Sie ihn wirklich kennen.«
»Und wie! Herunter und herein mit ihm!«
Der Chinese verschwand, nach einer halben Minute trat Walter ein.
Mit ausgebreiteten Armen wollte ihm der Freund entgegeneilen, aber eine abweisende Handbewegung hielt ihn zurück.
»Erst antworte mir, Oskar: Hast Du den Sohn einer Mistress Allan entführt?«
Der hünenhafte Mann war stehen geblieben, verschränkte die Arme über der breiten Brust, und er antwortete eben so kurz, wie er gefragt worden war:
»Ja.«
»Hast Du hierzu ein Recht?«
»Ja.«
»Welches Recht denn?«
»Das Recht des Stärkeren und des Klügeren.«
»Weshalb hast Du diesen zwölfjährigen Knaben der Mutter geraubt?«
»Weil die Mistress Allan gar nicht seine Mutter ist, sie hält sich nur in ihrem Wahne dafür, sie gehört ins Irrenhaus, während man einen geistesgesunden Mann, Bob Snyder, der wirklich der Vater dieses Knaben ist, statt ihrer für wahnsinnig erklärt hat.«
»Ist denn dieser Fall nicht auf gesetzlichem Wege auszufechten?«
»Nein, auf keine Weise. Das Gold dieser Milliardärin ist allmächtig. Ich habe ganz richtig gehandelt.«
Da war es der kleine Mann, der plötzlich an der Brust des Hünen lag.
Dann berichtete er mit nur wenigen Worten, aber auch ganz klar, wie die Entdeckung dieses Schlupfwinkels durch das hellsehende Kind herbeigeführt worden war.
»Das ist ja ganz wunderbar, was Du mir da erzählst.«
»Vor allen Dingen aber gefährlich! Ihr werdet hier gefangen, jeden Augenblick können die Verfolger eintreffen, sicher haben sie schon Polizei requiriert!«
»Sei ohne Sorge, Walter, hier sind wir sicher.«
»Sie umstellen das Haus —«
»Wir befinden uns in einem Dachsbau —«
»Sie graben Euch aus!«
Der blonde Riese lächelte.
»Dann will ich lieber sagen: Wir stecken hier in einem Karnickelbau. Weißt Du noch, Walter, was wir uns manchmal für Mühe gegeben haben, in dem Wäldchen hinter der Galgenschenke Kaninchen auszugraben? Was für gewaltige Löcher wir auswarfen, was für Tunnel wir bohrten, und unser Ehrgeiz ließ uns nicht ruhen. Haben wir etwa nur ein einziges Karnickel auf diese Weise bekommen? Nein, wilde Kaninchen sind auf ihnen zusagendem Terrain niemals auszugraben. So sind auch wir hier nicht zu erwischen. Und wenn auch Hunderte von Verfolgern sämtliche Ausgänge dieses unterirdischen Baues ausgekundschaftet und vernetzt haben, es gibt immer noch andere Schlupfgänge, oder im Nu werden neue geschaffen. Verlasse Dich darauf, Walter, es ist ganz und gar unmöglich, uns hier auszunehmen.«
Dr. Reichard hatte mit einer Sicherheit gesprochen, dass sein Freund jede weitere Warnung für überflüssig hielt. Nur noch eine kam in Betracht.
»Auch der Besitzer dieses Hauses wird als Mitwisser bei einem Kindesraube verhaftet werden, alle seine Diener und sonstigen Hausbewohner.«
»Li Wang? Das ist ein chinesisches Kaninchen, das lässt sich noch weniger ausgraben als ein deutsches, und am allerwenigsten von einem amerikanischen Fuchse.
Dort hinter dem Vorhange steht er, er hat alles mit angehört, und das genügt.«
»Er kann sich aber nie wieder zeigen —«
»Ist auch nicht nötig. Li Wang hat bereits diese seine Spelunke verkauft, oder er gibt sie einfach auf, denn er muss in den nächsten Tagen in seine Heimat zurück, und das ganze Hausgesinde begleitet ihn.«
Walter zog seine Uhr.
»O weh, ich erreiche den Zug nicht mehr! Nun muss ich bis um vier warten, der nächste Zug geht erst in drei Stunden.«
»Wo willst Du hin?«
»Nach Sommerset.«
»Was ist das?«
»Dort wohnen die Eltern der keinen Deasy, es ist wenigstens die nächste Station.«
»Was willst Du bei ihnen?«
»Du fragst noch? Nun ja, Du kannst es ja nicht wissen, und es ist auch eine weite Ideenverbindung. Abgesehen davon, dass Eure Verfolger jetzt immer ein Mittel in den Händen haben, um Euch zu sehen, wo Ihr auch seid — nein, vor allen Dingen will ich dieses zarte Kind nicht in diesen fremden Händen lassen.
Als ich den Eltern den Vorschlag machte, mir ihr Töchterchen anzuvertrauen, dachte ich ja nicht im Entferntesten daran, dass so etwas kommen könnte.
Die Eltern haben mir die kleine Deasy auf Treu und Glauben überlassen, etwas Schriftliches konnte ich nicht verlangen. denn diese einfachen Leute können nicht schreiben, und an eine gesetzliche Abtretung des Kindes habe ich damals eben gar nicht gedacht.
Nun ist es so gekommen.
Ich fürchte mich durchaus nicht, vor jene Mistress Allan öffentlich hinzutreten und das hellsehende Kind zurückzufordern, die Gerichte in Anspruch zu nehmen. Wenn ich mich dadurch, dass ich Dich warnte, einer strafbaren Tat schuldig gemacht habe — gut, so will ich die Strafe auch abbüßen.
Aber ich sehe jetzt bereits ein, dass mir auf diese Weise das Kind nicht ausgeliefert wird. Ein auf Treu und Glauben durch einfachen Handschlag abgeschlossener Vertrag gilt nicht vor Gericht, am wenigsten vor einem amerikanischen. Das will etwas Schriftliches sehen, unter solchen Umständen auch von einem Notar betätigt.
Wohl, so fahre ich mit dem nächsten Zuge nach Sommerset, nehme gleich einen Notar mit — morgen oder vielmehr schon heute früh um acht bin ich der Adoptivvater der kleinen Deasy Morton, sie heißt fernerhin Baroness Deasy von Walten. Familiär stehen mir hierbei nicht die geringsten Hindernisse im Wege.
So, und dann soll man mir einmal mein Kind nehmen wollen! Zwar glaube ich schon, dass jenes Weib alles daran setzen wird, um sich dieses kostbaren Mediums wieder zu bemächtigen, und vielleicht sperrt man mich auch ein — aber mein Kind sollen sie nicht bekommen, um es zu solchen Experimenten zu benutzen!
Ich weiß in der Nähe von Frisco einen Mann wohnen — Du kennst ihn nicht, ich ihn desto besser — es ist ein deutscher Farmer, Gustav Hartmann, dem übergebe ich mein Kind — und zu dem sollen sie mal kommen! So lange der lebt und einige Hundert Farmknechte dazu, ist mein Kind in Sicherheit.«
So hatte Walter gesprochen, ganz ruhig, bescheiden wie immer, aber energisch genug.
Und er hatte vorhin nicht etwa erzählt, dass er zum Fenster der ersten Etage auf das Straßenpflaster hinabgesprungen war, ohne sich einen Fuß zu verstauchen. Er war eben davongeeilt.
Übrigens zeigte sich auch jetzt, wie sehr man sich in diesem schüchternen »Jüngling« irren konnte. Er war doch ein Schul- und Klassenkamerad von diesem Hünen gewesen, war auch wirklich gleichaltrig mit ihm, und wir können gleich sagen, dass Prinz Joachim alias Dr. Oskar Reichard schon 32 Jahre zählte. Also auch sein Freund Walter hier. Aber der sah aus, als hätte er eben erst die Zwanzig überschritten und dabei noch etwas recht Knabenhaftes, Unreifes an sich behalten.
»Jetzt sind sie da«, sagte Li Wang, der nur deshalb hinter einer Portiere stand, weil in dem kleinen Nebenraume an der Wand ein Sprachrohr herablief, an dessen Mündung er sein Ohr gelegt hatte. »Es müssen eine ganze Menge Männer sein — ah, das ist der Polizeiwachtmeister Hobbins, mein alter Freund, der so brüllt.«
»Wer hat ihnen aufgemacht?«
»Niemand. Sie finden das ganze Haus schon leer, alle sind schon unten. Alles schon besorgt.«
»Müssen wir diesen Raum schon verlassen, noch tiefer oder weiter kriechen in Deinem Karnickelbau?«
»Noch nicht, noch nicht, noch lange nicht. Ich werde Euch schon warnen und dann weiterführen.«
»Kannst Du die Verfolger aber auch überall hören?«
»Überall, überall.«
»Wo ist der Knabe?«, fragte Walter.
»Hier nebenan, er wird schlafen.«
»In einem erleuchteten Zimmer?«
»Ja, eine Lampe brennt drin.«
»Dann kann er aber gesehen werden, wenn man das Kind noch immer benutzt, was ich vermute.«
»Was tut's?«
»Das ist aber nicht nötig. Ich habe überhaupt eine Idee.«
Mit kurzen Worten berichtete Walter über die Einzelheiten der Sehergabe des Kindes und dann über seine Idee, die sofort ausgeführt wurde.
In einem Nebenraume lag Fred und schlief. Zuerst wurde das Licht ausgelöscht, in dem jetzt ganz dunklen Zimmer wurde der Knabe geweckt und eingeweiht.
Er musste es sich gefallen lassen, dass man ihn in eine große Kiste legte, deren Deckel geschlossen wurde, sein Vater und ein chinesischer Diener hoben die Kiste auf und trugen sie im Geschwindschritt davon, das heißt dabei immer nur auf der Stelle tretend oder höchstens im Kreise herum marschierend.
Diese List gelang vollkommen, wie sich Dr. Reichard selbst am Sprachrohr, welches das ganze Haus zu beherrschen schien, überzeugen konnte.
Die kleine Deasy war tatsächlich auch in diese chinesische Spelunke gebracht worden, wenn nicht sofort, dann eben nachträglich, der Lauscher hörte die Stimmen, ihm vor seinen geistigen Augen auch die ganze Szene ausmalen kannten, die jetzt dort oben stattfand, wie das Kind auf einem Diwan lag, das Milchzähnchen in der Hand, und von Señor Lazare befragt wurde, und dazwischen immer Rufe einer Frauenstimme, der Mistress Allan.
»Was siehst Du, mein Kind?«
»Nichts, nichts — finster, ach, ist das finster — ich liege in einem Sarge!«
»Mein Gott, mein Gott, sie haben ihn getötet!«, schrie verzweifelt das Weib.
»Unsinn, sie haben ihn nur in eine Kiste gelegt, um ihn vollends den Augen dieser Hellseherin zu entziehen, wie sie schon vorher das Licht ausgelöscht hatten. Bemerkst Du sonst nichts, mein Kind?«
»Ich schaukle — ich werde getragen —«
»Also er wird fortgetragen. Hm, das ist freilich fatal. Wird er immer noch getragen?«
Diese Frage wurde, wenn man nach der Uhr kontrollieren wollte, mindestens alle Minuten gestellt, wenn nicht von Lazare, dann von Mistress Allan.
Ja, Fred wurde noch immer in einem Sarge oder einer Kiste im Eilmarsch davongetragen, immer weiter, immer weiter.
Nach einer Stunde mussten sich die Träger schon kilometerweit entfernt haben.
Und dabei marschierten sie mit der Kiste 12 Meter unter demselben Raume nur immer im Kreise herum, wenn sie nicht gar nur auf der Stelle traten.
Konnten die dort oben nicht auf den Gedanken kommen, dass hier solch eine List ausgeübt wurde?
Ja, solch ein Gedanke ist leicht ausgesprochen, wenn man ihn einmal gedacht hat. So ungefähr hat auch Kolumbus gezeigt, wie man ein Ei auf der Spitze stehen lassen kann.
Nein, die dort oben kamen auf keinen solchen Gedanken. Die glaubten, der Knabe würde davongetragen. Das einzige, was man tun konnte, war, dass man die ganze Polizei auf die Beine brachte, dieses Chinesenviertel umzingeln ließ, ganz San Francisco, alle Ausgänge besetzte, alle Landstraßen, alle Bahnhöfe beobachtete, alle Schiffe kontrollierte.
Das Hauptquartier der Verfolger aber blieb hier in der Höhle des roten Löwen, und das war auch ganz richtig so. Hier waren die Entführer mit dem Knaben gewesen, hier konnte eine Spur ganz sicher aufgenommen werden.
Aber nur erst den Anfang dieser Spur finden!
So viele Menschen nur ankommen konnten, so viele Hacken wurden geschwungen, Dielen aufgerissen, Spaten und Schaufeln warfen die Erde hoch.
Ja, man legte ein unterirdisches Zimmer nach dem anderen frei, immer behaglich oder gar luxuriös eingerichtet, aber dieser Kaninchenbau wollte kein Ende nehmen, und man kam auch nicht dahinter, wie diese Chinesen aus einem Raum in den anderen gelangen konnten. Die Verfolger konnten sich die Wege immer nur mit Beil, Hacke und Spaten schaffen.
»Eine Million, zehn Millionen, hundert Millionen, wer mir meinen Sohn wieder bringt!«, jammerte die Mutter.
Sie hätte auch ihre ganze Milliarde und alle ihre Einkünfte als Prämie ausbieten können, mehr als die ganze Spelunke in einen Trümmerhaufen verwandeln und bis nach dem Mittelpunkt der Erde graben konnte man hier nicht, und dadurch wurde weder Master Fred Allan noch der ausgebrochene Irrsinnige, der sich für seinen Vater hielt, noch irgend einer der Entführer zur Stelle gebracht, aber auch kein Chinese, der noch vor wenigen Stunden diese Spelunke bewohnt hatte, und die ganze chinesische Nachbarschaft wusste absolut nichts von alledem, man hätte jeden einzelnen wirklich foltern können, und ebenso wenig lief von irgendwo anders her eine Nachricht ein, dass man von den Verfolgten eine Spur entdeckt hätte.
Und unter diesem Hauptquartier, wo sich auch das hellsehende Kind befand, trugen zwei Chinesen den Kasten mit dem Knaben immer im Kreise herum, nur zur Abwechslung einmal auf der Stelle trampelnd.
»Die Entfernung kann die Hellseherin nicht taxieren?«
»Nein, dies geht ihr völlig ab, daraufhin habe ich schon die genauesten Versuche angestellt. Aber nun könnten wir den Knaben doch auch wirklich gleich forttragen lassen.«
»Vorläufig bleiben wir ruhig hier. Du hast ja selbst durchs Sprachrohr gehört, wie sie alle Ausgänge von San Francisco besetzt halten. Das muss sich erst ändern. Vorläufig sind wir ganz sicher aufgehoben. Li Wang garantiert dafür, und was der sagt, darauf kann man sich verlassen.«
»Nimmst Du Dich des Knaben dann weiter an?«
»Sicher. Diese Sache soll jetzt meine eigene sein. O, ich will den Jungen dann schon an einem Orte unterbringen, wo er ruhig die sechs Jahre bis zu seiner Mündigkeit aushalten kann, und alle Hellseher der Erde sollen ihn dort nicht finden, solch ein Versteck weiß ich, und nicht etwa in einem finsteren Kellerloche. Ich berichte Dir später davon.«
»Ich muss jetzt fort.«
»Wohin?«
»Nun, nach Sommerset, zu den Eltern des Kindes, um das mit der Vormundschaft oder vielmehr Adoption gleich zu regeln.«
»Du, das ist gefährlich! Wenn man Dich erwischt!«
»Ich muss es unbedingt tun. Ich lasse dieses Kind nicht länger in den Händen von jenen Menschen, da ich es vermeiden kann.«
,»Ja, das wäre auch recht schön, wenn wir selbst dieses Kind hätten, ich selbst möchte einmal Experimente mit solch einer Hellseherin machen. Mir würdest Du es doch erlauben. Also, nun sprich erst einmal mit Li Wang darüber, wie Du von hier fortkommst, und er wird Dir auch sonst gute Ratschläge geben können. Der Dickwanst ist mit allen Hunden gehetzt.«
»Halt, da kommt Dein Freund zu spät!«, ließ sich in diesem Augenblicke Li Wang vernehmen, der immer das Ohr an einem der Sprachrohre hatte, welche hier unten alle Keller durchzogen.
»Was, zu spät?«
»Dieser Señor Lazare, den ich recht wohl kenne, hat schon denselben Gedanken gehabt, um auf dieses Kind einen gesetzlichen Anspruch zu haben. Aber er hat es kürzer gemacht, alles telegrafisch, und mit so viel Geld kann ja auch alles erreicht werden. Soeben hat er ein langes Telegramm vorgelesen, wonach das Ehepaar Morton in Sommerset alle Rechte auf seine Tochter Deasy auf Mistress Isabel Allan übertragen, das Kind ist ihr adoptiert worden, alles ist bereits notariell abgemacht!«
Während Dr Reichard eine leise Verwünschung in seinen Bart murmelte, blieb sein Freund, den diese Mitteilung doch hauptsächlich betraf, ganz ruhig.
Dann allerdings sagte er etwas, aber auch ganz ruhig und leidenschaftslos.
»Nein, sie sollen das Kind nicht haben! Ich habe größere Ansprüche darauf und sei es auch nur, dass ich diese rätselhafte Sache in den Dienst der Wissenschaft stellen will. Wohl, so muss auch ich Gewalt anwenden. Mr. Li Wang, kann man noch immer von hier unten dort hinaufdringen auf einem heimlichen Wege und und ungesehen wieder herabgelangen?«
Der dicke Chinese, immer noch das Ohr am Hörrohr, blieb die Antwort schuldig, er winkte, machte ein ganz eigentümliches Gesicht dabei.
»Still! Kommt mal her! Hört selbst, was das Kind jetzt dem Señor Lazare erzählt, ob Ihr daraus klug werden könnt! Das Kind scheint im Fieber zu reden, merkwürdig nur, dass es Lazare immer ganz regelrecht befragt.«
Die beiden Freunde traten abwechselnd an das Sprachrohr.
Oben in der Teestube, von der nur noch die Decke und die Hälfte der Wand stand, alles andere war schon niedergerissen worden, lag auf einem Diwan das Kind, im linken Händchen den goldgefassten Milchzahn, daneben saß Señor Lazare, um wegen des fortgetragenen Knaben immer wieder vergebliche Fragen zu stellen.
Bis vor wenigen Minuten hatte sich Mistress Allan noch eifrig an diesen Fragen beteiligt, dann war sie, nachts gegen drei, von der Müdigkeit überwältigt worden. Sie hatte sich auf einige Kissen hingelegt, war vor Erschöpfung sofort eingeschlafen.
Señor Lazare blickte nach der Schläferin, blickte sich weiter um, bis sein Auge auf einem bestimmten Gegenstande haften blieb.
Es war ein großer Pagode, der dort in der Ecke stand. Unter Pagode, richtiger Pogodi, versteht man in China sowohl einen Tempel wie die darin aufgestellten Figuren, Götzenbilder.
Auch dieser Pagode war irgend ein chinesischer Gott, der, mit untergeschlagenen Beinen auf einer Platte kauernd, sich vor Lachen den Bauch hielt, was ganz wörtlich zu nehmen ist. Die Figur war aus Erz und groß genug, um in ihrem Hohlraum zwei Menschen aufnehmen zu können.
Natürlich hatte man sie untersucht, aber sich begnügt zu konstatieren, dass sie durch Menschenkraft nicht so leicht vom Platze zu rücken war. Vier der stärksten Konstabler hatten sich vergebens damit abgemüht, sie war eben am Boden noch besonders befestigt, und die Hauptsache war, dass diese Figur, wie man doch leicht konstatieren konnte, aus einem einzigen Gusse bestand, also nicht etwa eine Tür enthielt, die dann weiter nach unten führte.
Señor Lazare blickte auch aus keinem anderen Grunde nach dieser Figur, als weil sein Auge irgend einen Ruhepunkt haben musste, damit seine Ohren desto schärfer lauschen konnten.
Unter der Erde erklang dumpfes Geräusch von Hämmern und Hacken, nichts weiter.
Und in diesem Raume befand sich sonst niemand.

Señor Lazare blickte wieder nach der schlafenden Mistress Allan.
»Endlich!«, flüsterte er. »Endlich habe ich einmal Gelegenheit, dieses Kind für meine eigenen Zwecke zu benutzen. Wie habe ich dieses Weib schon verwünscht, dass ich es durch nichts einmal hinausschicken kann. Sie schläft! Jetzt schnell! Und werde ich gestört — nun, dann höre ich eben sofort auf.«
Bei diesen Worten, die er freilich mehr gedacht als geflüstert hatte, dieser Mann führte nicht so leicht ein hörbares Selbstgespräch, hatte er tief in den Brustausschnitt seines Gehrockes gegriffen, er brachte eine kleine, silberne Kapsel zum Vorschein, entnahm ihr eine Haarflechte, eine rabenschwarze Locke.
Dann nahm er aus dem Händchen den Zahn, legte dafür schnell diese Locke hinein, und die lebendig gewordenen Fingerchen der sonst toten Hand schlossen sich von allein darüber.
Es muss nochmals betont werden, dass diese Experimente dem Kinde selbst das größte Behagen bereiteten. Am liebsten lag es ständig in diesem hellsehenden Schlafe. Zweifellos diente dieser häufige Somnambulismus dazu, um nach und nach Deasys Gesundheit herbeizuführen, das tote Ärmchen für immer lebendig zu machen, vielleicht auch die Lähmung der Beine aufzuheben. Wonach sie freilich auch die Gabe des Hellsehens verlieren würde, was aber doch ebenfalls nur eine Krankheit ist.
Unbehagen bereiteten ihr nur solche Medien, die von Tieren stammten, weil sie dann eben, wie schon erwähnt, mit den Augen dieser Tiere wohl sah, aber mit ihrem eigenen Gehirn dabei denken musste, dadurch nur Zerrbilder erblickte, die sie nicht verstand, sie fürchtete sich davor, und dann freilich durfte man ihr auch keine solche Mittel von toten Menschen oder Tieren in die Hand geben, da konnte sich ihr Widerwillen und ihr Schreck bis zu Krämpfen steigern.
Aber alles andere, was man ihr in die Hand gab, wodurch sie einen lebenden Menschen erblickte, bereitete ihr das größte Behagen, wobei es auf den Charakter des Betreffenden gar nicht ankam. Nur schade, dass man sie dadurch nicht ständig in solchem Zustande halten konnte. Es genügte eben nicht allein, ihr so etwas in die Hand zu geben, es musste auch der Wille einer anderen Person dabei sein, die sie immer anregte etwas zu sehen, sie musste immer gefragt werden. Sobald Deasy sich allein überlassen wurde, auch wenn sie solch ein Medium umklammert hielt, fiel sie entweder in natürlichen Schlaf, oder, wenn sie überhaupt nicht schläfrig gewesen war, erwachte sie sofort.
Während der folgenden Vorgänge ließ Señor Lazare immer seine Augen nach allen Richtungen schweifen, damit er nicht etwa beobachtet oder belauscht werden könnte, die Wände des Raumes waren ja halb zerstört worden, wie leicht konnte sich jemand heranschleichen oder überhaupt unbemerkt herankommen, aber dieses Mannes Auge und Ohr ließ sich nicht so leicht überraschen, und er selbst, sich tief über das Kind beugend, dämpfte seine Stimme zum leisesten Flüstertone herab, und so leise antwortete dann von ganz allein auch die kleine Hellseherin.
»Was siehst Du, mein Kind?«
»Ich sehe —«
Das Weitere kam nicht gleich, dafür aber ging über das liebreizende Gesicht des kleinen Mädchens erst ein Staunen, dann ein lächelndes Glück.
»O, wie schön, wie schön!«, erklang es flüsternd.
Und Señor Lazare nickte schon jetzt zufrieden. »Was siehst Du, mein Kind?«
»Eine Frau. O, wie schön, wie schön die ist! So etwas Schönes habe ich noch nie gesehen!«
Wieder ein zufriedenes Nicken.
»Wie ist sie gekleidet?«
»O, was für ein schönes Kleid! Ganz schwarz, mit lauter goldenen Sternen darauf!«
Wieder ein zufriedenes Nicken.
Und dass Señor Lazare so zufrieden nickte, das müssen wir immer wiederholen, was natürlich nicht umsonst geschieht.
»Was bemerkst Du sonst Auffälliges an dieser Dame?«
»O, diese schneeweiße Haut, die diese Frau hat! Und dieses schwarze Haar! Und dieses schöne Gesicht!«
Señor Lazare nickte zufrieden.
»Was trägt sie für einen Schmuck?«
»Einen goldenen Gürtel — o, wie der glänzt — und auf dem Haupte eine wunderschöne Krone aus purem Golde mit bunten Steinen, wie die leuchten!«
Der Jesuitenpater nickte zufrieden ob des Gehörten.
»Und was trägt sie sonst noch für einen Schmuck?«
»Viele Armbänder und an den weißen Fingern wunderschöne Ringe —«
Diesmal nickte Lazare nicht, sein kluges Gesicht, in dem das gütige Lächeln jetzt fehlte, nahm immer mehr den Ausdruck von ungeduldiger Spannung an.
»Hat sie nicht vorn etwas am Gürtel hängen?«
»Ja, ach ja.«
»Was ist es?«
»Ein — ein — ein ganz merkwürdiges Ding.«
»Es ist ein großes Dreieck, nicht wahr?«
In diesem Augenblicke stellte sich Lazare die ganze Erscheinung, wie sie das Kind bisher beschrieben, lebhaft vor seinen geistigen Augen dar, und an dem goldenen Gürtel hatte das Weib ein großes goldenes Dreieck hängen.
Er tat dies aus keinem anderen Grund als um das Kind wieder einmal zu prüfen, ob bei dieser ganzen Hellseherei nicht etwa Gedankenübertragung zu Grunde läge, womit man nämlich bei Somnambulen nicht vorsichtig genug sein kann.
»Ein großes Dreieck, nicht wahr?«
Aber über eine so lebhafte Einbildungskraft dieser asketische Jesuit auch verfügte, die kleine Deasy bestand die Probe, ließ sich nicht irre führen.
»Nein, nein, es ist kein Dreieck, was sie vorn am Gürtel hängen hat.«
»Sondern?«
»Wie — wie — wie ein großer Schlüssel sieht es aus — ja, es ist ein großer, goldener Schlüssel!«
Da nickte Señor Lazare wiederum zufrieden. Er brauchte diese Prüfung nicht zu wiederholen und zufrieden war er auch in noch anderem Sinne.
»Und was siehst Du nun mit den Augen dieser schönen Frau?«
Wie immer, wenn das Hellsehen auf Befehl in dieses zweite Stadium trat, erfolgte erst eine kleine Pause.
»O, wie schön, wie schön!«, wurde dann wieder mit freudigem Staunen geflüstert. »Ich sehe einen weiten, weiten Saal, alle Wände sind von Gold — aber ach, überall sind große, hässliche Löcher darin —«
Señor Lazare blickte zufrieden, konnte also nicht viel Neues zu hören bekommen.
»Weshalb sind denn nur die großen, hässlichen Löcher in den schönen, goldenen Wänden?«, konnte das Kind in diesem Zustande auch eine selbstständige Frage stellen.
Lazare beantwortete sie nicht, sondern stellte eine Gegenfrage.
»Was siehst Du in diesen Löchern an der Wand?«
»Nichts, gar nichts.«
Wenn diesmal Lazare auch nicht zufrieden nickte, so schien er doch nicht viel anderes erwartet zu haben.
»Was sieht die Dame sonst?«
»Vor ihr steht ein Mann, sie spricht mit ihm.«
»Wie sieht der Mann aus? Wie ist er gekleidet?«
»O, wie seltsam! Wie schön! Es sieht aus, als hätte er gar nichts an, als wäre er nur mit Silber überzogen, oder als wären es lauter silberne Fischschuppen, mit denen er bedeckt ist —«
Es war offenbar eine Schuppenrüstung, welche das Kind beschrieb.
»Trägt dieser Mann sonst etwas Auffälliges an sich?«
»Ja, um den Leib einen roten Gürtel oder von Gold — nein, er ist nur rot gefärbt — und daran hängt ein — ein — langes Messer —«
»Ein Schwert?«
Dieses Hinterwäldlerkind hatte noch nicht einmal ein Bilderbuch in der Hand gehabt, hatte noch nie das Wort »Schwert« gehört. Da begreift man, wie schwer es manchmal war, sich mit der kleinen Hellseherin zu verständigen.
»Ein Schwert? Es ist wie ein furchtbar langes Jagdmesser in silberner Scheide —«
»Ja, ja, das nennt man ein Schwert oder es kann auch ein Degen sein —«
»Ein Degen? Was ist das?«
»Lass nur, mein Kind. Also es ist ein langes Messer, was er an dem Gürtel oder an der Schärpe von scharlachrotem Tuche hängen hat.«
Also dieser Jesuitenpater wusste bereits, dass es nur ein Stoffgürtel, eine Schärpe war, wovon das Kind doch gar nichts gesagt hatte.
»Wie ist der Griff dieses langen Messers geformt?«
»Ganz seltsam! Auch wieder wie so ein großer Schlüssel.«
Lazare nickte zufrieden.
»Und was sieht die Dame sonst?«
»Ach, ihr zu Füßen sitzen ja lauter solche schöne Jünglinge, wie mit Fischschuppen bedeckt — jetzt strecke ich die Hand aus —«
Wie es öfters vorkam, zumal wenn sich die betreffende Person bewegte, wahrscheinlich aber, wenn diese von einer besonderen seelischen Erregung ergriffen wurde, verschmolz die kleine Hellseherin vollends mit der Person, mit der sie in magnetischem Rapport stand, identifizierte sich mit ihr.
»O Gott, was ist denn das? Wie schön, wie schön! Diese vielen, vielen schönen Mädchen! Der ganze Saal ist voll von ihnen. Und wie schön sie gekleidet sind! Und jetzt fangen sie zu tanzen an —«
Es war nichts anderes als ein großartiges Ballett, was das Kind jetzt zu beschreiben begann, und nach der Tanzart und nach der Kleidung schienen es indische Bajaderen zu sein.
Ihre Anzahl konnte Deasy nicht angeben, nicht einmal irgendwie schätzen, dieses siebenjährige Hinterwäldlerkind konnte noch nicht einmal zählen, aber durch äußerst geschickte Fragen bekam Señor Lazare doch einen ungefähren Begriff von der Anzahl dieser tanzenden Bajaderen.
»So viel wie Dein Vater Schafe hat?«
»Ach viel, viel mehr!«
»So viel wie Sterne am Himmel stehen?«
»Nein, ganz so viel nicht.«
Es sind dies nur zwei Fragen, die äußersten Grenzen, die wir herausgreifen, um zu zeigen, wie der Pater das Kind befragte.
Er musste schließlich zur Überzeugung kommen, dass es einige tausend Mädchen waren, die dort in dem weiten Saale ein indisches Ballett aufführten.
Sehr merkwürdig war, dass auch alle diese braunen Tänzerinnen als Schmuck besonders goldene Schlüssel trugen, einen großen als Kopfschmuck in den Haaren, kleine Schlüsselchen waren in den Ohren befestigt, von Arm- und Fußspangen hingen solche herab.
Und Señor Lazare nickte bei dieser Beschreibung, die er durch Fragen unterstützte, immer zufrieden mit dem Kopfe.
Da machte die kleine Schläferin plötzlich ein ängstliches Gesicht.
»Was ist denn das?«, stieß sie erschrocken hervor.
»Was siehst Du, mein Kind?«
»Aus allen den Löchern an der Wand kriechen plötzlich Schlangen hervor — huh, huh, ich fürchte mich —«
»Du brauchst Dich nicht zu fürchten, mein Kind, es sind zahme Schlangen.«
»Sie haben alle etwas auf dem Kopfe, eine goldene Krone, und auf dieser ist auch wieder so ein Schlüssel —«
»Richtig, richtig«, nickte Señor Lazare zufrieden.
»Furchtbar große Schlangen, viel, viel größer als die schrecklich große Klapperschlange, die Jim einmal erschlagen hat — und jetzt gleiten diese Schlangen von den Wänden herab, sie mischen sich unter die tanzenden Mädchen — huh, ich fürchte mich, die armen Mädchen —«
»Sei ohne Sorge, sie tun den Mädchen nichts, sie tanzen nur mit ihnen —«
»Huh, jetzt aber kommt eine Schlange, so lang wie eine ganze Straße, ihr Kopf ist so groß wie der von einem Ochsen und in in ihrem Rachen zwischen den furchtbaren Zähnen hat sie ein kleines Kind —«
»Fürchte Dich nicht, Deasy, das ist —«
Der Sprecher brach ab, lauschte, nahm dem Kinde schnell die Haarlocke aus der Hand, steckte sie in die Brusttasche, stand auf, um nachzusehen, was das für besonderes Geräusch gewesen war, das draußen erklungen war.
Kaum hatte er den demolierten Raum verlassen, als plötzlich die eherne Figur des Pagoden vorn zur Hälfte aufklappte, ein Mann sprang heraus, Baron von Walten, einen Satz nach dem Diwan, er hatte das Kind gepackt, zurückgesprungen — hinter ihm kippte die Figur wieder zusammen.
Señor Lazare kam wieder herein, nur zehn Sekunden war er draußen gewesen.
»Es war nur ein Hund, der —«
Er erstarrte.
»Wo ist das Kind?«
Das Kind war weg.
Und als man dann den eisernen Pagoden doch noch mit Gewalt entfernte, stieß man wohl wiederum auf eine nach unten führende Treppe, aber etwas Neues war das nicht, solche Treppen hatte man schon viele gefunden, und dann stieß man auch bei dieser wieder gegen eine Mauer, die keine geheime Tür zeigte, was für geniale Köpfe und Hände auch danach suchten, die erst mit Hammer und Meißel durchbrochen werden musste, diese Chinesen besaßen eine höllische Zementart oder sonst etwas, hart wie Eisen, und die Mauer war einen halben Meter dick, und als man endlich durch war, stand man gleich wieder vor so einer Mauer, wieder musste das Meißeln und Bohren beginnen —
Aber das Kind wurde dadurch nicht wiedergebracht, so wenig wie Mistress Allan durch ihr Schreien und Geldausbieten etwas erreichen konnte.
Wir versetzen uns nach Ägypten. Drei Kilometer nordöstlich von den Weichgrenzen Kairos entfernt liegen die Ruinen des uralten Heliopolis, der Sonnenstadt, mit dem gewaltigen Tempel des Sonnengottes Re.
Das heißt, damals, als Heliopolis blühte, dessen Anfänge sich in vorgeschichtlicher Zeit verlieren, hat es noch kein Kairo gegeben.
Das jetzige Kairo ist erst ums Jahr 670 nach Christi Geburt von dem arabischen Eroberer Gohar al Kaid ganz neu gegründet worden, es war eine Laune dieses Kalifen, aus einem Nichts eine große Stadt entstehen zu lassen.
Damals lag das alte Heliopolis schon längst in Trümmern. Von dem 26 Kilometer weiter entfernten Ninive, der Königsstadt, war überhaupt gar nichts mehr zu sehen gewesen, so wenig wie jetzt, wenn man nicht dicke Sandschichten abräumt.
Heute sind auch von dem einst so prächtigen Heliopolis kaum noch Ruinen zu erkennen, zumal jener Eroberer die schönen Bausteine für seine neue Stadt el Kahira, das ist die Siegreiche, von dort herholen ließ.
Nur der gewaltige Sonnentempel ist damals verschont worden, er ist noch heute ziemlich gut erhalten, natürlich steht er da mit der unvermeidlichen Umrahmung von englischen Hotels mit deutscher Bedienung, daneben ist eine Eisenbahnstation, den ganzen Tag bimmelt die Elektrische — —«
Bei Heliopolis war ein internationales Wettfliegen.
Bei Heliopolis!
Es klingt anders als bei oder in Kairo.
Die meisten Leser werden dieses internationale Wettfliegen von Heliopolis noch in der Erinnerung haben, die Zeitungen haben seiner Zeit wochenlang darüber berichtet.
Auf der Rennbahn, die sich wieder hinter dem Sonnentempel befindet, zwischen den Militärschießplätzen und dem königlichen Palais, fand es statt.
Alle namhaften Beherrscher der Lüfte hatten sich mit ihren Ein- und Doppeldeckern und sonstigen Maschinen eingefunden in der Hoffnung, neue Rekorde im Hoch- und Dauerflug aufzustellen und Prämien bis zu 100 000 Franken einheimsen zu können Ein solch internationales Flugmeeting mit solchen Preisen wie damals bei Heliopolis ist auch noch nicht wieder da gewesen.
Die wenigen Flieger, die es sich leisten konnten, wohnten gleich in den Hotels von Heliopolis — kein Zimmer unter 100 Franken pro Tag — die anderen zogen es vor, billigeres Quartier in Kairo zu nehmen, wenn sie nicht gar wie die Monteure und der ganze Tross der Hilfsmannschaften in den Baracken auf der Rennbahn kampierten.
Auch Edward Scott bewohnte in Kairo ein billiges Hotel. Es war dies umso bemerkenswerter, als der junge Engländer ein freier, unabhängiger Flieger war, seine eigene Maschine steuerte, alle Kosten selbst trug, wozu doch schweres Geld gehört. Die meisten Flieger, mögen sie auch noch so berühmt sein, stehen doch in den Diensten von Flugzeugfabriken oder Unternehmern, die alle Kosten tragen, von denen sie fest besoldet werden, denen sie aber natürlich auch den allergrößten Teil der gewonnenen Preise abtreten müssen. Es gibt schon ein vollkommenes Fliegerproletariat.
Wir werden die Verhältnisse dieses jungen Engländers, der in unserem Roman eine Hauptrolle spielen soll, später noch näher kennen lernen, jetzt genügt die Angabe, dass Edward Scott seinen Doppeldecker, den er »Kondor« getauft, selbst konstruiert und gebaut hatte, speziell für Dauerflüge. Er hatte zwar noch keine neuen Rekorde geschaffen, aber doch schon ansehnliche Leistungen erzielt, manche Prämie gewonnen, und das Bemerkenswerteste war, dass er seit einem Jahre immer noch dieselbe Maschine fuhr, seinen alten »Kondor«, obwohl er beim Landen schon manche Havarie erlitten hatte, aber immer hatte er ihn wieder zu reparieren gewusst, immer neue Verbesserungen geschaffen, ihn immer stabiler gemacht, und bei allen Sachverständigen galt Edward Scott als Favorit für den Hunderttausendfrankenpreis im Dauerfliegen im Doppelsitzer, mit einem Passagier, das morgen früh um acht Uhr begann, wobei man sich dem Erdboden nicht mehr als 200 Meter nähern durfte, was ein automatischer Höhenmesser registrierte.
Es war der Abend vor diesem Tage. Edward Scott ging in seinem kleinen Hotelzimmer auf und ab.
Wenn der junge, schlanke Mann nicht schon immer solche eiserne Gesichtszüge gehabt, so hatte er sie in diesem letzten Jahre bekommen. Denn es will etwas heißen, so hoch in den Lüften dahinzusausen mit der Schnelligkeit einer Taube, ja sogar einer Schwalbe, 35 Meter in der Sekunde, 120 Kilometer in der Stunde und heute noch mehr, bis zu 200, ständig mit den verschiedensten Luftströmungen kämpfend, von Wirbelwinden hochgeschraubt und niedergedrückt, immer damit rechnend, dass der Motor einmal versagt, dann im Gleitflug eine günstige Landungsstelle erspähen müssend — da, kann man fast sagen, hört der Mensch auf, ein Mensch zu sein, da wird etwas ganz anderes daraus.
Auf dem Tische stand ein Gläschen Milch, von der er ab und zu nippte. In den Hotels von Heliopolis kostete solch ein Gläschen Kuhmilch wie im Hôtel du Nil zwei und drei Franken, hier wurde es schon für einen halben abgegeben. Dorthin, wo man in Kairo das Oka beste Milch, ein und einviertel Liter, schon für anderthalb Piaster bekommt, 15 Pfennige nach deutschem Gelde, konnte dieser Gentleman nicht gehen. Und seitdem er Flieger geworden, lebte der einst so lebenslustige junge Mann hauptsächlich nur von Milch und Schrotbrot und Hafergrütze, aber auch dies nur genossen, weil warme Speisen unnatürlich nervös machen sollen, auch Fleisch macht nervös, sogar Selterswasser macht nervös — von alkoholischen Getränken, und sei es auch nur Einfachbier, und Tabak gar nicht zu sprechen.
Alles, alles hatte dieser junge Mensch aufgegeben, um in den Lüften Herr seiner Nerven zu sein, um Erfolge zu erringen. Es ist ja nicht gesagt, dass alle Flieger so asketisch leben, aber viele halten es wirklich so, und zu diesen gehörte auch Edward Scott.
Es klopfte.
»Herein!«
Der Zimmerkellner trat ein, selbstverständlich ein Deutscher, der aber besser Englisch und Französisch sprach als mancher geborene Engländer und Franzose, vielleicht noch italienisch und arabisch dazu.
»Ein Herr wünscht Sie zu sprechen.«
Mit diesen Worten überreichte er eine Visitenkarte, nicht auf dem berühmten silbernen Teller, nicht einmal auf einem von Steingut.
»Charles Boissin, Paris. Kenne ich nicht. Was will er?«
»Mr. Edward Scott sprechen.«
»Kann jeder sagen. Ein anständiger Mensch?«
»Ein feiner, alter Herr. Ich weiß übrigens, dass er im Hôtel du Nil wohnt, erste Etage vorn heraus, zwei Zimmer mit Bad und eigener Bedienung.«
»Kann mir nicht imponieren. Herein mit ihm.«
Ja, es war ein feiner, alter Herr, der hereintrat, die Hosenfalte, mit welcher der Franzose erst als richtiger Mensch anfängt, ganz besonders sorgfältig gebügelt, der Zylinder glänzend wie die Lackstiefelchen. Diese Beschreibung genügt.
»Na?«, wurde er begrüßt.
»Boissin ist mein Name.«
»Weiß ich.«
»Ah, ich habe die Ehre, schon von Ihnen gekannt zu werden?«
»Nee. Hier steht's auf Ihrer Karte.«
»Darf ich Sie einmal unter vier Augen sprechen?«
»Wir sind allein und nun legen Sie los!«
»Wie lange brauchen Sie mit Ihrem zweisitzigen Doppeldecker, um von Kairo bis nach Alexandrien zu fliegen mit Passagier?«
»Was geht denn das Sie an?«
»Wollen Sie heute Nacht mit einem Passagier nach Alexandrien fliegen?«
»Ich? Nee.«
»Darf ich fragen, was Sie davon zurückhält?«
»Weil ich morgen früh für den Zweisitzerdauerflug starte.«
»Bis dahin können Sie schon wieder zurück sein.«
»Ha, Monsieur, haben Sie eine Ahnung von der Fliegerei! In einer halben Stunde gehe ich zu Bett, wenn ich nicht sofort einschlafe, nicht ununterbrochen zehn Stunden schlafen kann, dann habe ich meine Willenskraft nicht genügend trainiert, und dann habe ich morgen nicht einmal Aussicht auf den letzten Trostpreis von lumpigen 1000 Franken.«
»Sie sind wohl ganz sicher, den ersten Preis von 100 000 Franken zu gewinnen?«
»Ach, lassen Sie solche Fragen! Wie kann man denn über so etwas sprechen!«
»Was fordern Sie, wenn Sie heute Nacht einen Passagier nach Alexandrien bringen?«
»Ich fliege nicht.«
»50 000 Franken.«
Edward Scott kreuzte die Arme über der Brust und betrachtete sich den patenten Greis etwas genauer.
50 000 Franken war der zweite Preis für das Dauerfliegen, für das er starten wollte.
»Zweimalhunderttausend Franken.«
»Herr, das ist viel!«
»Nicht zu viel für mich.«
»Der erste Preis beträgt ja nur 100 000.«
»Aber die Ehre, der Ruhm kommt noch hinzu. Und wenn ich in diesem Heliopolisrennen auch nur den dritten Preis gewinne, dann allerdings bin ich ein gemachter Mann. Dann wird mich mein patentierter ,Kondor‹ zum Millionär machen.«
»Sie haben 200 000 Franken gefordert, und ich gehe darauf ein — 200 000 Franken für einen Flug heute Nacht nach Alexandrien!«
Da freilich stutzte der junge Mann. Es war ja schließlich noch gar keine Abmachung gewesen, er hätte noch zurücktreten können — aber dieser Favorit fühlte sich seines Sieges morgen doch nicht so sicher, nicht einmal des dritten Preises, und gewann er den nicht, so waren seine Mittel völlig erschöpft, dann musste auch er in fremde Dienste treten — nein, diese 200 000 Franken ließ er sich nicht entgehen, dann konnte er noch lange auf eigene Faust ringen.
Freilich verlor dieser Mann nicht gleich die Besinnung.
»Ehe ich meine definitive Zusage gebe«, sagte er kalt, »muss ich mich doch erst etwas nach den näheren Verhältnissen erkundigen. Sie selbst wollen mitfliegen?«
»Nein, eine Dame, Madame de Lanotte, Paris, jetzt wohnhaft hier im Hôtel du Nil.«
»Es handelt sich um eine Wette?«
»Durchaus nicht.«
»Die Dame muss also unbedingt heute noch nach Alexandrien? Weshalb benutzt sie denn da nicht die Eisenbahn, was doch viel einfacher und vor allen Dingen gefahrloser wäre als eine Fahrt auf dem Aeroplan, bei der man für eine glückliche Erreichung des Zieles niemals garantieren kann!«
»Sie haben vollkommen recht, aber hier liegt der Fall so, dass die Dame heute Nacht spätestens um ein Uhr in Alexandrien sein muss, und der Schnellzug fährt um zwölf ab und ist erst ein Uhr fünfzig in Alexandrien.«
»Es fährt aber doch schon um acht einer, dann noch ein Personenzug, der auch noch vor eins in Alexandrien ist.«
»Sie erwartet hier erst ein Telegramm, ob sie kommen soll oder nicht, und das kann nicht vor zehn hier eintreffen. Es handelt sich um eine große Entscheidung, ob ja oder nein.«
»So fährt sie eventuell gar nicht! Hören Sie, auf Reugelder kann ich mich nicht einlassen!«
Ohne ein Wort der Erwiderung fasste der geheimnisvolle Fremde plötzlich in seine Brusttasche und bracht zum nicht geringen Erstaunen des jungen Engländers ein Scheckbuch zum Vorschein, in das er rasch mit Tintenstift einige Worte und Zahlen schrieb. Dann riss er das beschriebene Blatt aus und übergab es Scott mit den Worten:
»Bitte, hier. Die Ottomanische Bank ist jetzt die ganze Nacht offen, Sie können das Geld sofort erheben.«
Der junge Mann starrte auf den Scheck, und auch die Hand des nervenlosen Fliegers konnte vor Erregung etwas zittern.
200 000 Franken, dem Überbringer sofort zahlbar auf der Ottomanischen Bank in Kairo, vom Guthaben des Monsieur Charles Boissin, Paris.
»Wenn aber nun die Dame gar nicht mitfährt?«
»Ja, was dann? Dann hat sie eben verspielt. Seien Sie ruhig, die kann es sich leisten.«
»Wenn ich aber nun bis um ein Uhr nicht in Alexandrien eingetroffen bin?«
»Bis nach Alexandrien sind es 180 Kilometer, die durchfliegen Sie mit Ihrem berühmten ›Kondor‹ bequem in anderthalb Standen, wir kennen Ihre Leistungen doch. Und Sie haben sogar drei Stunden Zeit.«
»Aber ich kann doch eine Havarie haben, werde zu einer Landung gezwungen, mein ›Kondor‹ kann —«
»Das Geld gehört Ihnen! Wenn Sie die Verhältnisse dieser Dame kennten und wüssten, was von dieser nächtlichen Reise abhängt, so würden Sie dies alles gar nicht so erstaunlich finden. Und wir vertrauen Ihnen und Ihrem Können, mehr brauche ich nicht zu sagen.«
»Gut, danke.«
Kaltblütig faltete Scott den Scheck zusammen und steckte ihn in die Brusttasche.
»Ich werde mein Bestes tun und hoffe spätestens schon um Mitternacht in Alexandrien zu sein. So Gott will! Wir Flieger werden zwischen Himmel und Erde alle ein bisschen fromm, um freilich anderseits nur desto mehr zu fluchen. So wie es fast allen Seeleuten geht. Obgleich ich aber nun den Auftrag schon definitiv angenommen habe, muss ich doch noch einige Fragen stellen.«
»Bitte sehr.«
»Wann soll der Aufstieg stattfinden?«
»Punkt zehn wird Madame de Lanotte auf der Rennbahn sein, an Ihrem Schuppen — Nummer acht, nicht wahr? Schön. Dann haben Sie doch wohl Ihren Apparat fix und fertig. Ist Madame de Lanotte Punkt zehn Uhr nicht da, dann kommt sie überhaupt nicht, Sie haben sich die Summe ohne jede Bemühung verdient.«
»Wohl. Und wo soll in Alexandrien gelandet werden? Bei diesem windstillen Wetter, das auch heute Nacht bleiben wird, kann ich das vorher ziemlich genau bestimmen.«
»Womöglich auf den Kalifenfeldern bei der Stadt, wo auch der Bahnhof in der Nähe ist, es ist eine freie Sandfläche. — Kennen Sie Alexandrien? Sonst kommt es nicht so genau darauf an.«
»Ich kenne Alexandrien, habe es mir aus der Vogelperspektive genug betrachtet, werde mich auch bei Nacht zurechtfinden, um diese Zeit ist ja alles noch hell erleuchtet. Ist die Dame schon einmal im Aeroplan geflogen?«
»Schon wiederholt, und sie hat überhaupt Nerven aus Stahl.«
»Wie viel wiegt sie? Nur ungefähr. Das muss ich wissen, wegen des Ballastes und Ausbalancierens.«
»Wie viel sie wiegt?«, lächelte der alte Herr. »Na, 130 bis 140 Pfund.«
»Hm, ein ganz nettes Gewicht.«
»Mit Kleidern.«
»Freilich, die muss sie anhaben. Und zwar warme! Wir haben jetzt Dezember, die ägyptischen Winternächte sind manchmal doch recht kalt, und nun in unserer luftigen Höhe. Ich gestatte noch 30 Pfund Pelzsachen. Sonst ist kein besonderes Kostüm notwendig.«
»Ich werde alles ausrichten. Übrigens — eine Frage — kennen Sie die Madame Cecilie de Lanotte nicht?«
»Ich habe nicht die Ehre.«
»Die Königin der Nacht.«
»Wie?«
»Sie wird in Kairo allgemein so genannt.«
»Königin der Nacht, weshalb denn das?«
»Nun, wegen ihres Namens, der doch mehr italienisch als französisch ist.«
»Ach so, richtig.«
Jetzt erst fiel dem jungen Engländer, der als weit herumgekommener Mann auch ein paar Brocken Italienisch konnte, dieser Name auf, d. h. er übersetzte ihn in sein Englisch.
La notte ist italienisch die Nacht, de la notte von der Nacht oder der Nacht. Da kann die Besitzerin dieses Namens, wenn sie sonst danach beschaffen ist oder auch nur aus Ironie leicht zu dem Spitznamen »Königin der Nacht« kommen.
Der junge Mann dachte sich absolut nichts weiter dabei.
»Sonst noch etwas, Monsieur Boissin?«
»Nicht dass ich wüsste. Nur möchte ich Sie bitten, nicht über diesen nächtlichen Passagierflug zu sprechen.«
»Nicht darüber sprechen? Ja, ich muss melden, dass ich morgen nicht starte, ich muss meine beiden Monteure, denen der eine mich morgen begleiten würde —«
»O, das ist doch etwas ganz anderes! Verheimlicht braucht diese nächtliche Fahrt der Dame nach Alexandrien durchaus nicht zu werden. Ich meine nur, dass die Sache nicht so in die breite Öffentlichkeit kommt. Madame de Lanotte ist eine gar so bekannte Person, obgleich sie ganz zurückgezogen lebt, aber sie wird von Neugierigen ständig belästigt — und ich meine also, dass ihre Abfahrt heute Nacht nicht etwa ein öffentliches Ereignis wird, dass man sie auf der Rennbahn nicht umdrängt —«
»Ich verstehe. Ohne Sorge, ich hätte überhaupt kein unnötiges Wort darüber gesprochen, es ist dies gar nicht mein Fall und — wir Flieger lernen in der Stille des Weltalls das Schweigen. Sonst noch etwas auszumachen?«
»Nun weiß ich nichts mehr.«
»Ich werde mit meinem ›Kondor‹ spätestens um zehn Uhr bereit sein, und sollte vorher etwas an der Maschine passieren, so wird ein anderer guter Aeroplan zur Stelle sein, den ich steuern werde. Wir haben da immer eine große Auswahl. Vertrauen Sie mir.«
»Wir wissen, dass wir Ihnen unbedingt vertrauen können. Ich habe die Ehre.« — —
Eine halbe Stunde später befand sich Edward Scott auf der Ottomanischen Bank und präsentierte am Nachtschalter den Scheck über 200 000 Franken.
Der Beamte nahm ihn gleichgültig, ging an ein Pult, schlug in einem dicken Buche nach, kam zurück.
»Bar auszahlen? In was für Papiergeld wünschen Sie die Summe?«
»Kann ich die Hälfte nach London überweisen und die andere Hälfte hier als mein Guthaben deponieren?«
»Gewiss, sehr gern.«
In drei Minuten war es geschehen.
Dann stand der junge Mann wieder auf der Straße. Es war die Muski, die Hauptverkehrsstraße Kairos. In endloser Reihe fuhren und rasten Equipagen und Automobile, auf den Trottoirs vor den prächtigen Schaufenstern drängte sich das elegante Publikum, das sich besonders im Winter aus aller Welt hier in diesem afrikanischen Paris ein Rendezvous gibt, ein wahrhaft babylonisches Sprachengewirr, und zwischen den Pariser und Londoner Toiletten türkische und arabische Nationaltrachten, vermummte Weiber und halbnackte Bettler, die ihre Gebrechen zur Schau trugen, und schließlich die Eseltreiber nicht zu vergessen, die den allgemeinen Spektakel vervollkommnen halfen.
Gleichgültig schweifte des jungen Mannes Blick über dieses bunte, lärmende Bild, tief atmete er auf, und seine eisernen Züge nahmen einmal einen sanften, freundlichen Ausdruck an, so wie dieses Gesicht früher gewesen sein mochte.
»Hallo, Mister Scott, auch einmal auf dem Bummel?«
So wurde er von einem jungen Stutzer angeredet, der sich gleich an seinen Arm hing.
Die eisernen, unbeweglichen Züge waren wieder vorhanden, aber diesen aufdringlichen Schwätzer wäre auch der größte Grobian nicht so bald wieder losgeworden.
»Ich muss auf die Rennbahn.«
»Ich komme mit. Aaah, die Königin der Nacht!«
In der Tat, es war eine königliche Gestalt, die dort drüben schritt, ganz schwarz gekleidet, einfach und doch von auffallender Eleganz, einen dichten, schwarzen Schleier vor dem Gesicht, eine schlanke und doch üppige Figur. In der Haltung in dem ruhigen, sicheren Schritte, wie sie sich durch die hastende oder bummelnde, schwatzende und lärmende Menge bewegte, lag das Königliche der ganzen Erscheinung.
»Sie kennen doch die Königin der Nacht?«
»Nein.«
»Dann sind Sie der einzige in ganz Kairo, der sie nicht kennt.«
»Möglich.«
Der junge Stutzer begann von ihr zu erzählen, von der Madame Cecilie de Lanotte, der Königin der Nacht.
Vor ungefähr zwei Wochen war sie hier eingetroffen mit drei Kammerzofen und zwei Dienern, hatte im Hôtel du Nil in der teuersten Etage eine ganze Zimmerflucht bezogen. Sie ging höchstens des Abends aus, einen Bummel durch die belebtesten Straßen machend, immer von einem ihrer Diener begleitet, die man für Albanesen hielt, wahre Herkulesse, immer tief verschleiert, und im Hotel bekam kein Kellner ihr Gesicht zu sehen.
.Madame Cecilie de Lanotte aus Paris mit Bedienung.
So hatte sie ins Fremdenbuch eingeschrieben.
Und das war alles, was man von ihr wusste, absolut nichts weiter.
Kein Pariser kannte sie. Paris ist groß. Dann hätte man doch auch einmal ihr Gesicht sehen müssen. Und wer sagte denn, dass sie wirklich so hieß und aus Paris war? Sie hätte sich überhaupt gar nicht ins Fremdenbuch einzuschreiben brauchen.
Ägypten ist in gewisser Hinsicht, wie später noch ausführlich geschildert werden soll, das freieste Land der Erde, freier als England und Amerika. Nicht nur, dass es so etwas wie eine polizeiliche Anmeldung gar nicht gibt, sondern es ist den Behörden auch ungemein schwer gemacht, einen Ausländer sogar wegen Mordes zu verhaften! Nur wegen der einfachen Verhaftung muss schon die ganze diplomatische Maschinerie der Welt in Bewegung gesetzt werden. Weil nämlich, wie hier nur kurz angedeutet sein mag, niemand weiß, wem Ägypten eigentlich gehört. Eine Nation wacht eifersüchtig über die andere, dass in diesem Lande »Rühr-mich-nicht-an« ihre Rechte nicht verletzt werden. Der Ausländer, der selbst beim schwersten Verbrechen überrascht worden ist, braucht nur immer eine andere Nationalität anzugeben, und er wandert immer von einem Konsulat zum anderen, immer in der Begleitung zweier prachtvoll kostümierter Dragomans, Konsulatsdiener, unter der höflichsten Führung eines ägyptischen Offiziers, der aber in türkischen Diensten steht und meist ein Österreicher ist, und nur dadurch ist der Kerl mürbe zu bekommen, dass man ihm eben auf diese Weise keine Ruhe lässt. Von einem ägyptischen Polizisten darf ein Ausländer nicht einmal angesprochen. werden.
Und Madame de Lanotte ließ sich auch von keinem anderen ansprechen. Sie gab einfach keine Antwort. Und ebenso schienen die beiden riesigen Kawassen, ihre albanischen Wächter, orientalisch gekleidet, taubstumm zu sein. Desgleichen zwei der Dienerinnen, nicht eben einnehmende Persönlichkeiten. Nur die dritte sprach, was mit dem Hotelpersonal unbedingt zu sprechen war, und mehr brachte man aus dieser alten Hexe auch nicht heraus.
Nur desto mehr natürlich wurde die Neugier dieser vornehmen oder manchmal auch sehr wenig vornehmen Müßiggänger angestachelt, die alle Hotels, Straßen und Spelunken erfüllten.
Ach, was sich in diesem afrikanischen Babel für ein Gesindel zusammenfindet! In Monte Carlo ist es noch nicht so schlimm. Monaco steht doch immer noch etwas unter polizeilicher Kontrolle. Um das kennen zu lernen, dazu genügt es freilich nicht, mit dem roten Baedeker in der Hand einmal einen Abstecher ins Pharaonenland zu machen. Da muss man dort längere Zeit gelebt und sich auch wirklich überall herumgetrieben haben. Da kann man aber moderne Raubritter kennen lernen! Und Raubritterinnen! Es soll noch geschildert werden, wie es dort zugeht.
Wer war sie, die Königin der Nacht, wie sie nun einmal getauft worden? Weshalb zeigte sie nie ihr Gesicht? War sie so hässlich? Oder hatte sie das Galeerenzeichen auf die Stirn gebrannt? Weshalb ging sie nur des Nachts aus? Woher bekam sie das viele Geld, das sie verschwenderisch ausstreute? Verheiratet? Verwitwet? Wer war ihr Galan? Denn ohne den geht's doch nicht.
Ach, die armen Gehirne, wie die geplagt wurden!
Vorgestern war im Hôtel du Nil ein alter Herr eingetroffen, Monsieur Charles Boissin aus Paris, hatte ihren sechs Zimmern gegenüber zwei genommen. Der kannte sie, sie verkehrten zusammen, natürlich nur hinter verschlossenen Türen.
Aber sonst war aus dem auch nichts herauszubringen. Bei der Ottomanischen Bank hatte er 250 000 Franken deponiert. Eine viertel Million — parbleu!
So hatte der junge Stutzer berichtet, noch viel, viel ausführlicher.
»Und von alledem wissen Sie noch gar nichts?«
Drüben ging sie, die geheimnisvolle Königin der Nacht.
Sollte der junge Mann sie, mit der er heute Nacht zwei Stunden lang hoch oben durch die Lüfte sausen würde, eng Seite an Seite, nicht mit gespanntestem Interesse betrachten?
Er hatte kaum einen Blick nach ihr hinübergeworfen.
Er dachte nur an die 200 000 Franken, die jetzt ihm gehörten.
Ganz gleichgültig von wem die stammten.
Aber dabei hatte er dennoch ein Weib vor seinen geistigen Augen, er sah ein Bild, und das ließ das Herz dieses jungen Mannes mit den eisernen Zügen vor unaussprechlichem Glück erzittern.
Er sah in einem bescheidenen Kämmerlein zu London eine ältliche Frau sitzen, gebeugt über eine Stickerei, durch welche sie ihre kleine Witwenpension zu verbessern suchte.
Seine Mutter! Die alles, was sie einst besessen, geopfert hatte, damit ihr einziger Sohn seine im buchstäblichen Sinne hochfliegenden Pläne verwirklichen konnte.
Und nun endlich konnte er zurückzahlen, was sie für ihn getan, nun konnte er mit Ruhe sein Genick brechen oder alle Knochen zerschmettern. Sie brauchte wenigstens nicht mehr zu darben.
Daran dachte Edward Scott, während er, nach der königlichen Erscheinung dort drüben nur einen Blick werfend, die vorüberziehenden Esel musterte, die alle schon ihren Reiter hatten.
»Halt, da ist einer —«
Er riss sich von dem Arme des Stutzers los, saß mit einem Sprunge auf dem Rücken des Grauschimmels, der von seinem zerlumpten Besitzer als frei angepriesen wurde, und er war in der Menge verschwunden — — —
Fünf Minuten vor zehn Uhr kurbelte Edward Scott zur Probe den Motor des Aeroplans an, der neben dem Schuppen auf einer langen hölzernen Laufbahn stand.
Die beiden Monteure meldeten, dass alles in Ordnung sei.
Es war eine herrliche, windstille Nacht, aber am Himmel funkelten die Sterne.
Da näherte sich eine in Pelze gehüllte Frauengestalt, tief verschleiert.
»Mister Scott?«, fragte eine volle Altstimme.
»Ich bin es. Madame de Lanotte?«
»Ja.«
»Ich bin bereit.«
»Ich auch.«
»Sind Madame schon im Aeroplan gefahren?«
»Sehr oft, nur gesteuert habe ich noch keinen.«
Noch eine kurze Instruktion, wie sich die Dame zu setzen und sonst zu verhalten habe, und die beiden nahmen Platz.
»All right.«
»Go ahead!«
Die Monteure sprangen zurück, der Motor knatterte, der Propeller surrte immer schneller und schneller, der Aeroplan rollte auf seinen Rädern nach vorn und schwang sich mit einem plötzlichen Sprunge in die Luft empor.
Höher und höher schwebte der Riesenvogel zum sternenfunkelnden Himmel hinauf, immer weiter nach Norden, immer kleiner wurde er, immer schwächer das Surren.
Und niemand hat sie wieder gesehen, den »Kondor« und seine beiden Fahrgäste.
Die Dienerschaft und Monsieur Boissin hatten aber die Madame de Lanotte nicht als vermisst angemeldet.
Die hatten noch in derselben Nacht das Hotel verlassen. Monsieur Boissin hatte noch den Rest seines Guthabens abgehoben, dann waren sie alle spurlos verschwunden gewesen, niemand wusste wohin.
Zuerst waren die beiden Monteure über das Ausbleiben jeder Nachricht von ihrem Herrn beunruhigt gewesen. Und als dann eine Anfrage in Alexandrien erfolglos blieb, musste das Schlimmste befürchtet werden.
Aber vergebens wurde nachgeforscht, ob ein Doppeldecker zwischen Kairo und Alexandrien irgendwo eine Landung ausgeführt habe. Vergeblich ließen die Behörden das ganze Niltal absuchen.
Der Winter ging zu Ende, die Felder wurden bestellt, und es fanden sich keine Trümmer von einem Aeroplan.
Dann kam eine alte Dame nach Kairo, legitimierte sich als Missis Mary Scott aus London, als Mutter und als Erbin des nun unterdessen schon tot erklärten Edward Scott, sie erhob von der Ottomanischen Bank die 100 000 Franken und verwendete davon ein gutes Teil, um noch einmal von Reitern zu Pferd und zu Kamel die benachbarten Wüstenstrecken des Niltals zwischen Kairo und Alexandrien absuchen zu lassen — alles vergebens, die Leichen der beiden wurden nicht gefunden, keine Trümmer eines Aeroplans.
Die Sensation war groß.
Bis man über eine neue Sensation die Königin der Nacht, den unglücklichen Flieger und die noch unglücklichere Mutter vergaß.
Von Kairo nach Venedig! Wir kennen die beiden Personen, die in einem Hotelzimmer, in einem Prunksalon, auf etwas zu warten scheinen, die schöne Frau mit den glühenden Augen und den kleinen, dürren Mann mit dem gütig lächelnden Gesicht.
Sie waren erst heute früh in Venedig eingetroffen, Mistress Allan und Señor Lazare, kamen von Bombay.
Was sie in Indien, nicht nur in Bombay, gemacht hatten, werden wir gleich erfahren.
»Die Gondel ist vorgefahren«, meldete ein Diener.
»Ist es ein zuverlässiger Mann?«
»Giuseppe ist der sicherste Fahrer, deshalb eben mussten die Herrschaften etwas warten, weil dieser erst geholt wurde.«
Das sagte aber dieser Diener und jeder andere dienstbare Hotelgeist im Hotel in jedem einzelnen Falle, immer musste erst ein besonderer Gondoliere geholt werden, während sie draußen massenhaft herumlungerten.
Sobald sie aus dem Portal des Hotels traten, standen sie dicht am Canale di San Marco, den man schon als offenes Meer betrachten kann.
Es war ein Sommerabend, über die stille Flut huschten wie gespenstische Schatten die langen, schwarzen Gondeln, vorn mit dem hohen, eigentümlichen Schmucke, wie ein gezacktes Beil aussehend, ganz hinten der Gondoliere stehend nach vorn rudernd, mit einer einzigen Ruderstange, in der Ferne die Lichter von Dampfern und Seglern, wie auch schon die Gondeln ihre Lämpchen angezündet hatten.
Giuseppe rückte unter dem Baldachin die Kissen zurecht.
»Ponte Salvatore«, sagte Señor Lazare, nachdem er der Dame beim Einsteigen behilflich gewesen war.
Giuseppe lächelte mitleidig. Warum fuhren denn alle diese vornehmen Herrschaften nicht immer gleich direkt nach der Via Bragora? Denn sie wollten doch nur zur Schlangenmutter.
So hieß die alte Hexe, die aus ihren mit Ruß und Öl eingesalbten Fingernägeln wahrsagte. Das nennt man nach einem griechischen Worte Onychomantie. Sieht der Wahrsager die Bilder in einem Spiegel, so heißt diese Kunst Katoptomantie. Ist es ein einfacher Wasserspiegel, so heißt sie Hydromantie. Ist das Wasser in einer bauchigen Flasche, welche spiegelt, so ist es Gastromantie. Und so geht das immer weiter.
Man braucht nicht nach Venedig zu gehen, um dies alles kennen zu lernen. Das kann man alles sehr schön auch in Berlin studieren, sämtliche Arten der Wahrsagekünste. In Berlin wird auch sehr schön aus Kaffeesatz geweissagt. Ganz abgesehen vom Kartenschlagen. Und vor den Türen solcher Propheten und mehr noch Prophetinnen halten Equipagen, wenn es deren Besitzer nicht vorziehen, durch ein Hintertürchen einzuschleichen.
Wenn Señor Lazare es richtig berechnete, nichts vergessen hatte, so musste die berühmte Schlangenmutter in Venedig die sechsundneunzigste hellsehende und wahrsagende Person sein, zu der er seine Gebieterin führte, auf dass sie durch solche Prophetengabe den Aufenthalt ihres Sohnes erführe.
Deswegen hatten die beiden schon China und ganz Indien bereist, wo ja solche Seher ganz besonders zu Hause sind.
Señor Lazare hatte seine Taktik geändert. Es war ihm ganz gleichgültig, wo sich der Junge und seine Entführer befanden, ob sie noch lebten oder wie es ihnen sonst ging. Wenn sie nur nicht aufgefunden wurden.
Es hatte ihm in der Zwingburg nie gefallen. Er liebte das Reisen, weite, weite Reisen, wie er sie früher gemacht hatte. Rastlos umherwandern, tage- und wochenlang auf der Eisenbahn und auf dem Schiffe. Und daneben liebte er das rote Gold. Wenn es auch vorläufig als Papiergeld knisterte. Und während solcher rastlosen Reisen hatte er ja die allerschönste Gelegenheit, die goldene Gans hier nach besten Kräften zu rupfen.
Die Fakire und Derwische und sonstigen Seher und Seherinnen, die spickte er vorher natürlich. Die mussten nach seiner Instruktion aussagen, wo sich jetzt Fred befände, natürlich dort, wo Señor Lazare hinzureisen gedachte, weil es dort etwas für ihn Interessantes zu sehen gab oder ihm dort alte, liebe Erinnerungen aus vergangener Missionszeit geweckt wurden.
Aber nicht etwa, dass er für solche Seherdienste und Geisterbeschwörungen außergewöhnlich hohe Summen forderte und dann den Propheten und Magiern nur einen kleinen Teil davon gab. Nein, mit solchen Kleinigkeiten ließ er sich nicht ein, sondern er annoncierte, um den verschwundenen Sohn wiederzubekommen. Denn es konnte ihn doch einmal jemand sehen, wenn nicht den Master Fred Allan, dann den Bob Snyder oder den Dr. Reichard oder den Walter Müller oder die kleine Deasy Morton.
Und wie Señor Lazare annoncierte! In sämtlichen Zeitungen der Welt! Seitenlange Aufrufe! Sogar in solchen Zeitungen, die überhaupt gar nicht existierten!
Denn in Wirklichkeit gab Señor Lazare für derartige Annoncen keinen Pfennig aus. Er hätte sich doch schön gehütet. Durch solch eine einzige Annonce hätte man den Aufenthalt des entschwundenen Knaben oder seiner Begleiter doch einmal entdecken können. Und dann wäre es mit diesem herrlichen Reiseleben und dieser Einnahmequelle vielleicht für immer vorbei gewesen.
Aber Mistress Allan bezahlte alle die Rechnungen, die ihr Señor Lazare über solche Annoncen vorlegte, ohne einmal solch eine Zeitung sehen zu wollen. Sie glaubte ihrem Beichtvater alles, alles aufs Wort.
Nicht etwa, dass sie so dumm gewesen wäre.
Nein, dumm war die nicht.
Sie war irrsinnig.
Sie verrannte sich immer mehr in den Wahn, dass sie nur durch die hellseherische Gabe irgend eines Menschen ihr Kind wiederfinden könnte.
Dieser Wahn war bei ihr, die ja überhaupt niemals ganz normal gewesen, durch jenes erste, wirklich hellsehende Kind erzeugt worden, und ihr Beichtvater bestärkte sie nur immer mehr in diesem Wahne.
Und eben dadurch wurde sie nur immer mehr von diesem kleinen Manne abhängig, sie hatte bereits gar keinen eigenen Willen mehr.
Nur musste sich Señor Lazare hüten, dass er sie aus seinen Händen ließ. Sie durfte wo möglich gar nicht mit anderen Menschen in Berührung kommen.
Denn jeder einigermaßen erfahrene Mensch, der sie einige Zeit beobachtet, hätte sofort gesagt: »Dieses Weib ist ja irrsinnig!«
Das war auch der Grund, weshalb Lazare keine anderen Manipulationen vornahm, um sich in Besitz ihres Geldes zu bringen. Denn er hätte nur zu befehlen brauchen: »Gib mir alles, was Du hast, verschreibe mir Dein ganzes Vermögen« — sie hätte ihm sofort gehorcht, weil sie eben gar keinen eigenen Willen mehr hatte. Sie befand sich im hypnotischen Banne dieses Mannes, obgleich er keine direkte Hypnotik anwandte.
Das hätte aber doch nur gerichtlich geschehen können, sie hätte vor die Öffentlichkeit treten müssen, und da hätte es schon genug erfahrene und ehrliche Menschen gegeben, die den Irrsinn der Milliardärin erkannt, wie sie im Banne dieses ihres Beichtvaters stand, und die dann für Entmündigung gesorgt hätten, dass sie unter gesetzliche Vormundschaft kam.
So etwas durfte Señor Lazare also nicht wagen. Er begnügte sich, ihr Rechnungen für Zeitungsannoncen und Besoldungen von Detektiven vorzulegen, die er in aller Welt besolden wollte, und diese Gelder für sich selbst zu behalten. Die Summen, die er so aus ihr herauspresste, wollen wir nicht nennen, sie gingen ins Unglaubliche. Es machte ihm, wie der Charakter dieses Mannes nun einmal beschaffen war, überhaupt das größte Vergnügen, sie so zu betrügen und auf diese Weise nach und nach auszuplündern, und dabei kam noch der Genuss des ununterbrochenen Reisens hinzu.
Und er hatte es ja auch so leicht, seinem eigenen Amüsement nachzugehen, ohne sie mitnehmen zu brauchen, ohne sorgen zu müssen, diese goldene Gans könnte ihm geraubt werden. Er brauchte nur zu sagen: »Señora, ich suche jetzt einen Hellseher auf, der mir ganz, ganz bestimmt angeben wird, wo sich Ihr Sohn befindet, aber es ist dazu unbedingt nötig, dass Sie sich so lange, bis ich zurückkehre, in Ihrem Hotelzimmer einschließen, keinem Menschen öffnen, mit keinem Menschen sprechen« — sie gehorchte bedingungslos. Ohne eine Frage nach dem Warum zu stellen, schloss sie sich ein und wäre lieber verhungert, als dass sie geöffnet hätte.
Irrsinnig! Anders kann man das doch wohl nicht nennen. Oder eben völlig im Banne einer fremden Willensmacht, was so ziemlich auf dasselbe hinausläuft.
Auf diese Weise wusste er sie überall von jeder Gesellschaft fernzuhalten. An Bord des Schiffes brauchte er nur zu sagen: »Da ist jemand, der uns beobachtet, der kennt unser Ziel, will uns zuvorkommen, um die Entführer Ihres Sohnes zu warnen, lassen Sie sich von ihm gar nicht blicken« — na, dann verließ die unglückliche Frau während der wochenlangen Seereise auch gar nicht ihre Kabine, während der ehemalige Jesuitenpater geistreiche und gelehrte Unterhaltung aufsuchte, während sie glaubte, er horche jenen vermeintlichen Spion aus.
Dass da auch ihre Korrespondenz durch seine Hände ging, dass er die an sie gerichteten Briefe erst erbrach und las und alle, die ihm nicht passten, unterschlug, ist ganz selbstverständlich, muss aber doch erwähnt werden, weil es von Bedeutung ist — —
Jetzt also waren sie mit einem italienischen Salondampfer direkt von Bombay gekommen, durch den Suezkanal.
Zwar ist das Land der Pharaonen ebenfalls reich an hellsehenden Magiern, aber Señor Lazare mochte einen Grund haben, Ägypten links liegen zu lassen.
Der letzte Fakir, der in Bombay nach dem verschwundenen Sohne befragt worden war, hatte ihnen versichert, sogar aus Geistermund, — es waren dabei Geister aus dem Boden gewachsen, durch Räucherung, was schon genug sagt — dass Fred noch lebe, dass die Mutter ihn finden würde, aber nicht hier in Bombay könne sie seinen Aufenthaltsort erfahren, sondern in einer anderen Stadt, und nach langer Beschreibung war die Lagunenstadt Venedig herausgekommen, und in der Person, die dann von Geistermund beschrieben wurde, von der sie alles Weitere erfahren würde, hatte der weitgereiste Jesuitenpater sofort die alte Schlangenmutter erkannt.
Sie ist bis vor wenigen Jahren eine Berühmtheit von Venedig gewesen, die alte Schlangenmutter. Wenn der Vergnügungsreisende nichts von ihr gehört hat, so kommt es eben daher, weil er nicht nach Venedig gefahren ist, um solche Existenzen kennen zu lernen, und dann hält doch auch immer eine gewisse Scham diejenigen, die sie gerade am besten kennen, davon ab, von ihr zu sprechen.
Sie wohnte in der Via Bragora in der ersten Etage eines baufälligen Hauses, das heute noch steht, keine alte Hexe, sondern eine recht hübsche Frau, nur sehr dick und furchtbar schmutzig, hatte die Gicht in den Füßen, konnte gar nicht mehr gehen, nur humpeln, wollte aber von keiner Bedienung etwas wissen, dazu war sie viel zu misstrauisch.
Also eine Onychomantistin. Sie rieb sich den Nagel des linken Mittelfingers mit Ruß und Öl ein, in dieser etwas spiegelnden Fläche erblickte sie dann, wenn sie nach einer Weile in Verzückung geriet, das Bild der oder des Zukünftigen oder die Zahlen, die im nächsten Lotto gewinnen würden, oder was der Betreffende sonst zu wissen begehrte.
Das Öl musste — natürlich darf man wohl sagen — von Priesterhand geweiht sein, und nicht nur das, sondern es musste aus dem ewigen Lämpchen, das vor dem Muttergottesbild brennt, aus irgend einer Kirche oder Kapelle um Mitternacht gestohlen werden. Womit sie es wohl nicht so genau gehalten haben wird. Öl ist in Italien billig genug. Und der Ruß musste von Giftschlangen stammen, besonders die schwarze Viper soll sich dazu vorzüglich eignen, und hiermit nahm sie es tatsächlich ganz genau.
Sie hat sich jahrzehntelang drüben vom Festland schwarze Vipern schicken lassen, für die sie jeden Preis zahlte, verbrannte und destillierte sie, das verkohlte Fleisch und Fett gab den Russ für ihre Salbung ab.
Der Hauptgrund aber, dass sich die Vettel Giftschlangen schicken ließ, mochte ein anderer sein. Man hat bei ihrem Tode in der stinkigen Rumpelkammer, in der sie schlief, noch etwas mehr als 400 000 Lire versteckt gefunden in Geldsorten aus aller Welt. Die einsame Frau, deren Einkünfte man kannte, die alles Geld im Hause behielt, hat sich vor Einbrechern schützen wollen. Die Giftschlangen mussten erst einige Zeit einer besonderen Ernährung und Behandlung unterworfen werden, ehe sie aufs Feuer kamen. Jedem Besucher erzählte sie hiervon, ließ ihn durch ein Wandfensterchen in ihre Schlafkammer blicken. Da sah man die schwarzen Reptilien überall herumkriechen, sie lagen auf ihrem Bette. Die Frau mochte ihnen die Giftzähne ausbrechen. Natürlich behauptete sie selbst, dass sie gegen das Gift gefeit sei, brachte wohl auch eine heraus, die sie aus einem Gewahrsam nehmen mochte, fest hinten am Genick gepackt, ließ sie eine Maus beißen, die nach wenigen Minuten tot war.
Das genügte! In dieser Lagunenstadt gibt es keine Schlangen, um so größer musste doch die Furcht vor diesem Hause sein. Doch abgesehen von den italienischen Banditen. Es gibt auch andere Einbrecher, deren Arbeitsfeld die ganze Welt ist, besonders Engländer. Wenn da so einer in London erfuhr, dass in Venedig etwas Tüchtiges zu holen war, der machte gleich einen Abstecher nach der Lagunenstadt, orientierte sich und dann rückte er los auf sein Ziel, mit Stemmeisen und Dietrich.
Aber bei dieser einsamen Frau ist niemals eingebrochen worden, so lange sie dort gehaust hat, mit Hunderttausenden unter ihrem Strohsack. Es hat sich doch etwas in solch eine Kammer zu dringen, wo furchtbare schwarze Vipern massenhaft herumkriechen! — — —
Señor Lazare war, nachdem er Mistress Allan in ihre Hotelzimmer eingeschlossen hatte, schon heute früh bei der Schlangenmutter gewesen, die er überhaupt schon kannte.
Sie wurde von ihm so instruiert, wie er den Fakir in Bombay instruiert hatte
Wenn die Dame fragte, wo sie ihren Sohn finden würde, sollte die alte Vettel auf ihrem spiegelnden Fingernagel die Petruskirche von Rom erblicken.
Und dann weiter eine Straße und ein gewisses Haus, was alles genau beschrieben wurde, und wenn Mistress Allan dort ihren Sohn nicht selbst fand, so würde sie dort in diesem Hause doch ganz, ganz bestimmt erfahren, wo er sich jetzt befände.
Aber dieses Haus dürfe sie erst in vier Wochen betreten. So stand es im Buche des Schicksals geschrieben. Konnte sie ihre Ungeduld nicht bezähmen, ging sie eher hin, so war alles vorbei, so würde sie ihr Kind niemals wiedersehen.
Die Schlangenmutter bekam für ihre Dienste bezahlt, was sie forderte, und Lazare würde dann, wenn sie alles geschickt erledigt hatte, auch noch ein gutes Trinkgeld hinzufügen.
So wurde die Sache gehandhabt. Wir haben ein typisches Beispiel mit einer historischen Persönlichkeit herausgegriffen, um es einmal zu schildern, wie dieser geriebene Mann es ständig machte.
Diese vier Wochen Frist benutzte er dazu, um die Sehenswürdigkeiten von Venedig, Mailand, Turin, Genua und Florenz zu berichtigen. Die Mistress Allan konnte ihn dabei immer begleiten, wenn nicht, wenn er allein sein wollte, so sperrte er die goldene Gans eben einstweilen ein, und wenn er mehr als vier Wochen brauchte, nun, da erfand er eben wieder etwas anderes, auf alle Fälle ging es dann in Rom so weiter.
Ein herrliches Leben, das sich dieser geistliche Abenteurer da geschaffen hatte! Eben das Abenteuerliche war es, was ihm dabei so behagte, und dazu kam noch die ständige Befriedigung seines Gelddurstes, seines Geizes, worin aber bei diesem ständigen Betrügen und Ausplündern doch auch so etwas Romantisches lag — —
Der braune Gondoliere, wie aus Erz gegossen, ließ seine athletischen Glieder spielen.
Wunderbar, wie diese venezianischen Gondolieri ihre Fahrzeuge hinten im Stehen rudern, das kann ein anderer niemals lernen, das wird den Kindern dieser Kaste angeboren. Und wenn man es lernt, so ist doch diese ruhige Grazie niemals nachzuahmen, die diese malerisch gekleideten Gestalten dabei entwickeln.
Die Gondel bog in einen engen Kanal ein, von diesem aus bald wieder in einen anderen.
Es war ein ganz einsames Wasserviertel, in das sie bald gerieten. Nur hier und da klimperte jemand in einem Boote auf der Gitarre oder Mandoline, brachte seinem Liebchen ein Ständchen und geklimpert und gesungen wurde in allen Häusern, und von hundert Liedern war es neunzigmal »Santa Lucia«, das dort schon vor 50 Jahren geklimpert worden ist und sicher nach hundert Jahren dort auch noch unermüdlich geklimpert werden wird.
Sie war erreicht, die Ponte Salvatore. Einsam lag das elende Brückchen mit dem schönen Namen im Scheine einer traurig brennenden Gaslaterne da.
Unten am schmalen Bürgersteig, der den Kanal begrenzt, ziehen sich Läden von Handwerkern hin, jetzt waren sie alle verschlossen, und wer jetzt auf der Straße sein wollte, der suchte den nahen Giovanniplatz auf.
Kein Mensch und kein Boot war zu sehen. Giuseppe befestigte seine Gondel an einem Eisenring, die Fahrgäste stiegen aus.
»Ihr wartet hier, bis wir wiederkommen«, sagte Señor Lazare, dem Gondoliere als Einsatz ein Zwanziglirestück gebend.
Sie sind ehrlich, diese venezianischen Gondolieri, man kann ihnen einstweilen auch einen Tausendlireschein zum Aufheben geben.
»Si, si, Signore«, entgegnete Giuseppe, nachdem er das Goldstück erst genau auf seine Echtheit untersucht, auch einmal darauf gebissen hatte. Denn die fremden Fahrgäste sind manchmal weniger ehrlich.
Die beiden verschwanden in dem finsteren Gässchen.
Wir brauchen sie nicht zu begleiten, nicht dabei zu sein, wenn Mutter Anna ihnen aus ihrem geschwärzten Fingernagel wahrsagt. Das alles ist vorhin schon besser geschildert worden, als es durch diese persönliche Beobachtung möglich wäre.
Giuseppe lehnte an dem Brückenpfeiler und rauchte seine Pfeife.
Da kam auf dem Bürgersteig ein Mann daher, in einen Wettermantel eingehüllt, den Sombrero tief über die Augen gezogen.
Der Gondoliere beachtete ihn wenig, und er brauchte nicht so athletisch gebaut zu sein, er wusste schon, dass er hier nichts zu fürchten hatte.
»St, Gondoliere«, wurde da geflüstert, und die vermummte Gestalt blieb im Schatten der Häusermauer stehen.
Jetzt freilich wurde Giuseppe aufmerksam, musterte die Gestalt näher.
»Signore?«
»Was kostet Eure Gondel, amico mio? Sie gefällt mir, ich möchte sie kaufen. Was kostet die Gondel?«
Eine weltbekannte Frage für den, der Venedig wirklich kennt. Nicht etwa, dass man die Gondel wirklich kaufen will, sondern den Gondoliere braucht man für irgend etwas, was die Polizei nicht erlaubt.
»Ihr wollt die Signora entführen?«, fragte Giuseppe, der ehrlichste und zuverlässigste von allen Gondolieri, auch gleich prompt.
»Ja.«
»Den Alten auch?«
»Ja.«
»Wie wollt Ihr's anfangen?«
»Wenn es geht, werden sie gleich hier festgenommen.«
»Seid Ihr allein?«
»Dort hinter der Ecke liegt meine eigene Gondel mit einem Dutzend Männern.«
»Gondolieri?«
»Meine eigenen Leute, fremde, die aber Venedig kennen.«
»Die Leute sind sicher?«
»Wie der Tod.«

Der braune Gondoliere stand wie aus Erz gegossen auf seinem Platze und
lenkte seine Gondel mit einer seltenen Gewandtheit und Geschicklichkeit.
Giuseppes Blicke wanderten die hohen Häusermauern hinauf. Alle Fenster waren finster, es waren hier nur Speicher.
»Ihr müsst mich schon vorher hier überfallen.«
»Tun wir.«
»Mich binden und knebeln.«
»Weiß ich.«
»Tausend Lire kostet meine Gondel.«
»Hundert.«
Der Gondoliere hätte jenem doch gar nicht getraut, wenn der nicht gleich den zehnten Teil geboten hätte.
»Ihr seid von der Madonna verlassen — was ich aufs Spiel setze —«
»Gar nichts! Ich kenne Euch doch. Hundertfünfzig will ich geben.«
»Neunhundert.«
»Zweihundert.«
Bei vierhundertundfünfzig waren sie zusammen, was gar nicht lange gedauert hatte, und der Fremde zählte ihm fünfundzwanzig Goldstücke in die Hand, fünfhundert Lire, die sofort alle für echt befunden wurden.
»Grazie, Signore, Ihr seid nobel, und Ihr sollt Giuseppe Sparati als einen ehrlichen Menschen kennen lernen.«
Nein, er riskierte auch durchaus nichts, dieser Gondoliere.
Es war nichts weiter als eine kleine Entführung, die in Venedig sicher in jeder Nacht einige Male vorkommt. Venedig ist der klassische Boden des Entführens. Die Gondolieri haben dabei ein förmlich gesetzliches Recht dazu, haben, wenn sie dabei erwischt werden, höchstens eine Woche abzubrummen, wobei es sogar ein paar Dolchstiche gegeben haben kann.
Noch eine kurze Ausmachung, dann stieß der Fremde einen leisen Pfiff aus, und von rechts her kamen einige ebenfalls vermummte Männer heran.
Der Gondoliere wurde in aller Gemütlichkeit gebunden und geknebelt und in seinen Kahn gelegt, dann verteilten sich die Männer, drückten sich gegen die dunkelsten Häuserwände und lugten hervor.
»Vorsicht, Spirtsch, der Jesuit hat Augen wie ein Luchs!«, warnte der Anführer, der die Sache eingeleitet hatte.
Sie brauchten nicht lange zu warten, so kamen die beiden schon wieder zurück.
»Wieder vier ganze Wochen warten!«, hörte man eine Frauenstimme stöhnen.
»Sie werden vergehen, und dann werden Sie Ihren Sohn ganz bestimmt wiedersehen, um mit ihm für immer vereint zu sein. Wo ist unser Gondoliere? Verrat!«
Sobald die beiden aus der Gasse heraus auf den Bürgersteig des Kanals getreten waren, hatten sich von beiden Seiten einige Männer auf sie gestürzt, und ein Beobachter musste merken, wie gut sie instruiert waren, wie sie sich gleich verteilten.
Zwei auf die Dame, die etwas wie einen Ballen vors Gesicht gedrückt bekam, zwei auf den Herrn, und die anderen umringten sofort diese Gruppe, um ein Entkommen vollends unmöglich zu machen.
Die Dame war denn auch gleich abgetan, sie sank sofort lautlos zusammen, hing schlaff in den Armen eines Mannes, nicht aber ging das so mit ihrem Begleiter.
Auch er hatte solch einen Ballen — einen mit einer betäubenden Flüssigkeit getränkten Schwamm wollen wir gleich sagen — vors Gesicht gedrückt bekommen sollen, aber bei dem gelang das Manöver nicht.
Er hatte das Wort »Verrat«, nachdem er mit sanfter, salbungsvoller Stimme seine Begleiterin getröstet hatte, in nur etwas erhobenem Tone gesagt, ohne Erregung, und so gelassen benahm er sich auch trotz aller Schnelligkeit, die er entwickelte.
Die Hand mit dem Schwamm, der ihm ins Gesicht klatschen sollte, sauste durch die Luft, im selben Moment hatte sich der kleine Mann gebückt, und im selben Moment auch glitt er unter den beiden Händen und Armen weg, die sich nach ihm ausstreckten, ein anderes Händepaar packte ihn dennoch, und es waren gar harte Fäuste, die zugriffen, aber nur eine blitzschnelle Drehung, und Señor Lazare war wieder frei, hatte sich den Händen wie ein Aal entwunden, er wollte nach links, wollte nach rechts, wollte wieder in die Gasse hinein, alles gleichzeitig, so blitzschnell zuckte er hin und her, sah sich umstellt, sah nach diesen Seiten hin kein Entkommen — da wandte er sich und war mit einem Satze in dem schwarzen Wasser des Kanals verschwunden.
Es lässt sich nicht schildern, diese Plötzlichkeit, mit der sich dies alles abgespielt hatte, wie der einen Kopfsprung ins Wasser gemacht hatte.
Diese Männer hier ließen sich gewiss nicht so leicht verblüffen, jetzt aber waren sie ganz verblüfft, starrten ins Wasser, obwohl da wegen der Finsternis überhaupt gar nichts zu sehen war.
»Eine Wasserratte!«, flüsterte der eine.
»Nein, ein Aal war's. Sapristi, so was von Aalglattheit ist mir noch nicht vorgekommen!«
»Fangt ihn!«
»Nein, lasst ihn laufen oder ersaufen«, befahl aber der Anführer, »fort!«
Die Bewusstlose wurde davongetragen, um die Ecke herum, wo das Boot der Entführer liegen sollte.
»Auf Wiedersehen, Mister Doktor Reichard, königliche Hoheit!«, erklang es ihnen aus dem schwarzen Wasser nach.
Isabel — wie wir Mistress Allan fernerhin nennen wollen, wenn wir selbst von ihr sprechen — schlug die Augen auf, ließ sie verwundert durch das Zimmer schweifen, dessen Wände mit Geweihen und Jagdtrophäen aller Art bedeckt waren.
»Wo bin ich?«
»Bei Ihrem Sohne«, sagte eine tiefe Männerstimme mit sanftem Klange.
Erst jetzt sah sie den blondbärtigen Mann, der in einem modernen, aber stark abstrapazierten Jagdkostüm vor dem Diwan saß, auf dem sie in einem türkischen Damenschlafrock — oder Morgenkostüm — lag.
»Joachim!«
»Herr Koschinsky!«, wurde sie verbessert. »Ich habe das gesetzliche Recht, meinen Namen nach Belieben zu ändern, wenn ich inkognito bleiben will, und auf diesen Namen ist mir ein Pass ausgestellt worden, wie ich auch allen meinen Begleitern einen Pass auf einen beliebigen Namen ausstellen lassen kann. Nun, Mistress Allan, wie fühlen Sie sich?«
Sie wollte aufspringen, konnte es nicht, sich überhaupt nicht erheben, obgleich sie nicht etwa gebunden war, sie fühlte sich wie gelähmt.
»Nur eine Gliedersteifheit, nichts weiter, das wird sich sehr bald geben. Aber geistig sind Sie doch ganz frisch, nicht wahr? Wollen Sie mir nun einige Minuten ruhig zuhören?«
»Bei meinem Sohne wäre ich?«, flüsterte sie zunächst, sich nur dieser Worte erinnernd.
»Ja.« — »Wo ist er?« — »Hier in diesem Hause.«
Wieder hatte sie aufspringen wollen und konnte sich nicht einmal bewegen, höchstens Arme und Hände.
»Ich werde ihn sehen?«
»Sofort, wenn Sie mich angehört haben, wird er zu Ihnen kommen und Sie als seine liebe Mutter begrüßen.«
»Es ist nicht möglich!«
»Sie werden es erleben, sobald Sie mich angehört haben, eher aber nicht. Erst müssen Sie mich sprechen lassen.«
»Sprechen Sie!«
Mit seiner tiefen, wohlklingenden Bruststimme begann Oskar, wie wir ihn auch weiterhin nennen wollen:
»Ich fasse mich so kurz wie möglich, um Sie nicht so lange warten zu lassen.
Es ist ein Jahr her, seitdem ich Ihnen Ihren Sohn entführte.
Eigentlich war ich's gar nicht, ich griff nur ein — doch hierüber sprechen wir ein andermal.
Sie sind während dieses Jahres rastlos in aller Welt umhergereist, unter der Führung des Señor Lazare, um Ihren Sohn durch eine hellsehende Person wiederzufinden.
Dieser Señor Lazare ist ein ganz großer Schuft. Inwiefern, diese Erklärung will ich mir jetzt ersparen, denn Sie würden es doch nicht glauben. Später wird es schon gelingen, Sie von der Schuftigkeit dieses Mannes zu überzeugen.
Ich weiß von alledem, denn ich habe Sie ständig beobachten lassen, von einigen Detektiven, wo in der Welt Sie sich auch befanden. Denn es ist doch nicht anzunehmen, dass die kleine Deasy die einzige Person in der Welt ist, welche die Gabe des zweiten Gesichtes besitzt, Sie konnten doch einmal einen richtigen Hellseher auftreiben, der Ihnen das Versteck Ihres Sohnes angab. Deshalb musste ich auf meiner Hut sein.
Aber, Mistress Allan, Sie tun mir in der Seele leid.
Ob Sie nun wirklich die Mutter dieses Knaben sind oder nicht — gleichgültig, Sie fühlen sich doch als seine Mutter.
Und wozu denn nun all dieses grenzenlose Herzeleid?
So habe ich mich oftmals gefragt.
Ja, Mistress Allan, ich kann Sie begreifen, ich fühle mit Ihnen.
Es ist und bleibt für Sie der Sohn, an dem Sie mit allen Fasern eines liebenden Mutterherzens hängen und der von Ihnen nichts wissen will, den man Ihnen entführt hat. Geht denn das nun gar nicht zu ändern? Ist denn da gar kein gütlicher Vergleich möglich?
O ja, es ist möglich!
In einen Käfig dürfen Sie den Jungen natürlich nicht wieder stecken. Das lässt der sich nicht gefallen.
Aber es lässt sich auch anders arrangieren.
Ich trat mit solchen Vorschlägen an Sie heran. Brieflich. Alle diese Briefe sind von Señor Lazare unterschlagen worden. Weshalb er solch einen gütlichen Vergleich durchaus nicht zustande kommen lassen wollte, werden Sie später verstehen, wenn Sie über den Charakter dieses Mannes, der Sie auch sonst fortwährend schmählich betrogen hat, orientiert sind.
Also es gelang mir nicht, mich mit Ihnen in Verbindung zu setzen, und das etwa persönlich zu tun, das wäre von mir heller Wahnsinn gewesen.
So musste ich zur List greifen, sogar zur Gewalt. Aus keinem anderen Grunde, als weil ich das Leid und Weh, mit dem Sie sich herumquälen, nicht mehr mit ansehen konnte. Jeder Bericht, den mir meine Vertrauensleute über Sie einschickten, ließ mein Herz von Neuem bluten.

Ich erfuhr, dass Sie von Bombay nach Venedig fahren wollten, um dort auch wieder so eine Wahrsagerin zu befragen.
Da war mein Entschluss gefasst. Als Sie von der Wahrsagerin zurückkamen, habe ich Sie abgefangen. Auch des Señor Lazare wollte ich mich bemächtigen, um einmal mit ihm Abrechnung zu halten, er entkam uns — hat schließlich nichts zu sagen.
Sie kamen per Schiff nach Triest, von dort machten Sie weiter die Reise in einer Klavierkiste, als Piano, das für Österreich-Ungarn schon verzollt war.
Sie befinden sich hier in Ungarn, im Herzen Siebenbürgens, in einem Jagdschlosse, das mit meilenweiter Umgebung dem Grafen Kosy gehört, meinem speziellen Freunde, den ich in alles einweihte und der uns hier eine sichere Zuflucht gewährte, einfach ganz unentdeckbar.
Nun hören Sie mich weiter ruhig an, geehrte Mistress, dann werden Sie vernünftig sein, indem Sie nur einsehen können, wie herzlich gut ich es mit Ihnen meine.
In diesem Schlosse werden Sie fünf Jahre gefangen gehalten, nämlich bis zur Mündigkeit Ihres Sohnes.
Es stehen Ihnen im Erdgeschoss mehr als ein Dutzend Zimmer zur Verfügung, mit allem nur denkbaren Komfort, und außerdem der ehemalige Bärenzwinger, jetzt ein schöner Park, in dem man sich verlaufen kann, mit einer Mauer umgeben, und ich mache nur die kleine Andeutung, dass an diese Mauer der ganzen Länge nach die Schäferei grenzt, mit einem halben Hundert ungarischer Wolfshunde, die niemanden über diese Mauer lassen.
Sie können Briefe schreiben und empfangen, aber die Korrespondenz geht durch meine oder meines Stellvertreters Hände.
Ja, Mistress Allan, Sie werden hier gefangen gehalten werden. Aber Sie werden die Gefangenschaft mit Ihrem Sohne teilen, der Sie als seine liebe Mutter anerkennt.
Und Sie brauchen seine Liebe mit keinem Anderen zu teilen — Bob Snyder ist tot, ist hier auf der Jagd verunglückt.
Fred, komm her, umarme Deine liebe Mutter!«
Oskar stand auf und verließ schnell das Zimmer, statt seiner trat Fred ein, ein hochaufgeschossener Knabe, fast schon ein Jüngling zu nennen, eilte auf Isabel zu, beugte sich über sie und küsste sie.
»Meine liebe Mutter!«
»Fred, mein Fred, mein lieber Sohn!«, erklang es jauchzend. — —
Wir werden später schildern, wie Isabel diese Gefangenschaft ertrug, wie Mutter und Sohn zusammen lebten.
Jetzt wäre das noch verfrüht. Jetzt stand die Mutter noch ganz unter dem Eindruck des ersten Wiedersehens, und das für Tage hinaus, und dasselbe galt auch für Fred, der sich erst in seine Rolle hineinleben musste.
Der vaterlos gewordene Junge hatte sich, in die Verhältnisse eingeweiht, bereit erklärt, die fremde Frau, die er früher höchstens gehasst hatte, als seine leibliche Mutter anzuerkennen, wenn er auch nicht daran glaubte. Der intelligente Knabe sah eben ein, was hier für ein großes, edles Werk arrangiert werden sollte; es galt, eine verzweifelte Frau glücklich zu machen, er war bereit, das Seinige mit beizutragen, das Opfer zu bringen.
Natürlich musste sich der Junge, eben weil es offener Charakter war, anfangs noch sehr linkisch betragen, aber das würde sich legen, und das Mitleid, das er jetzt für die unglückliche Frau fühlte, konnte sich auch noch in echte Kindesliebe verwandeln, das hing nur von Isabel ab.
Ebenso natürlich konnte sie hier ihren Sohn mehr mit ihrer übertriebenen Zärtlichkeit peinigen. Fred konnte bei ihr jederzeit frei ein und aus gehen, wofür einfach durch einen besonderen Raum mit doppelter Tür gesorgt worden war. Erst musste die eine Tür wieder geschlossen sein, ehe die andere geöffnet werden konnte, so wie der Raubtierbändiger den Käfig betritt und wieder verlässt.
Der Junge hatte ja auch noch anderes zu tun. Er hatte bis zu seinem zwölften Jahre ja noch nicht einmal schreiben und lesen können, was er nun alles nachholen musste, und er tat es gern. Und es lag nur an Isabel, ob er seine Schularbeiten in ihrer Gegenwart oder in seinem eigenen Zimmer, das sie nicht betreten konnte, erledigte. Er hatte auch sonst seine freie Zeit, konnte in der waldreichen Umgebung Jagdausflüge machen. Aber der Junge verzichtete freiwillig darauf, er widmete sich so viel wie möglich der unglücklichen Frau, die er als seine Mutter, die er liebte, anzuerkennen sich energisch vorgenommen hatte. Nur einige Schulstunden gingen täglich ab; sonst befand er sich von früh bis abends in den Zimmern oder im Park bei seiner Mutter. Schlafen tat er jetzt freilich allein. Umso schöner war dann immer das Wiedersehen am Morgen.
Und es kam noch eine dritte Person hinzu.
Die kleine Deasy.
Aber nicht, dass das Kind noch getragen oder gefahren werden musste.
Es war alles so gekommen, wie Walter vorausgesagt hatte.
Dadurch, dass das Kind so oft wie möglich dauernd im somnambulen Zustande gehalten wurde, war der Arm immer lebendiger geworden, immer länger nach dem Erwachen die normale Blutzirkulation angehalten, bis zuletzt der Arm überhaupt nicht mehr erkaltet war.
Und dasselbe galt von den Beinchen, die ja überhaupt immer normal, das heißt wohlgestaltet gewesen waren, nur eben tot, ohne fühlbare Blutzirkulation. Aber schon immer hatten sich in jenem Zustande mit dem linken Arme auch immer beide Beine erwärmt.
Und als der Arm völlig wiederhergestellt war, waren es auch die beiden Beine. Die kleine Deasy konnte jetzt laufen wie jedes andere Kind, hatte es nur erst lernen müssen.
Aber mit dieser normalen Gesundheit hatte sie, wie ja auch vorausgesagt, die Gabe des zweiten Gesichtes verloren.
Kein Medium wirkte mehr, das sie in die Hand nahm, sie fiel überhaupt nicht mehr in diesen unnatürlichen Schlaf.
Mit Ausnahme eines einzigen Mediums, das noch seine alte Kraft behalten hatte.
Sobald das Kind in die linke Hand eine Haarflechte von Fred nahm, fiel es noch immer sofort in Trance — wie der Kunstausdruck für diesen Zustand lautet — erblickte es den Knaben noch immer, wo er sich auch befand, genau so wie früher.
Das konnte daher kommen, weil mit dieser Haarflechte — es konnte aber auch eine andere von seinem Kopfe sein, oder ein abgeschnittenes Stückchen Fingernagel — überhaupt immer experimentiert worden war, durch diese Haarlocke war sie fast ständig im somnambulen Schlafe gehalten worden, dadurch war ihre körperliche Gesundung herbeigeführt worden.
Kein anderes Mittel übte auf sie noch irgend welchen Einfluss aus, nur noch diese Haarflechte ihres Spielgefährten, es mochte Gewohnheit sein, oder auch gewissermaßen eine Dankbarkeit — oder es war eben die große Sympathie, welche die kleine Deasy, bei aller körperlichen Gesundheit doch zweifellos immer noch ein sehr sensitives Kind, auch seelisch mit dem Knaben verband.
Diese ihr noch übriggebliebene Gabe wurde nun eifrigst im Garten und in den Zimmern verwendet. Die drei spielten Verstecken zusammen, Fred musste gesucht werden, was man dadurch schwieriger gestaltete, dass er dabei die Augen schloss. Und das wurde von denen, die hier zu befehlen hatten, um so lieber gestattet, weil solche Experimente der kleinen Deasy noch immer das größte Vergnügen bereiteten, sie fühlte ein wunderbares Behagen, wenn sie mit Freds Locke in der Hand in Trance lag, vielleicht diente es auch dazu, sie immer mehr in ihrer Gesundheit zu festigen.
Die beiden Freunde Oskar und Walter saßen in der großen Bibliothek des Schlosses, hatten sich zwischen Büchern förmlich vergraben, indem sie, durch schriftliche Anmerkungen eines Buches hingewiesen, immer neue Bücher aus den Regalen holten, die sich bis zur Decke emporzogen, und die alten einstweilen neben sich legten, und so entstanden immer höhere Stapel, die erst später wieder von Dienern abgetragen und geordnet wurden.
Der verstorbene Vater des jetzigen Grafen Kosy war ein gelehrter Sonderling gewesen, der die ganze Welt bereist hatte, nur um Bücher und Handschriften einer bestimmten Richtung zu sammeln, bis es eine Bibliothek von fast 20 000 Bänden und Manuskripten geworden war, letztere zum größten Teil aus Pergamentrollen bestehend, zwischen denen er die letzten Jahre seines Lebens verbracht hatte.
Welcher Richtung diese Bücher angehörten, werden wir später erfahren. Jedenfalls war diese Bibliothek so interessant, dass die beiden gar nicht mehr daran dachten, dieses Schloss zu verlassen. Die fünf Jahre wollten sie mindestens hier aushalten. Freilich gehörten auch ihre Sprachkenntnisse dazu, besonders die altorientalischen Oskars, der seinem Freunde oft aushelfen musste, um die meisten der Bücher und noch mehr Handschriften lesen zu können.
»Hast Du schon von der chinesischen Sekte der sogenannten Totenbrüder gehört, Walter? Nein, so etwas, so etwas! Ach, wo bleiben da unsere Druiden, Rosenkreuzer und Freimaurer! Und da hat mir mein Freund Kosy noch kein Wort davon gesagt, dass sein Vater hier solch eine unbezahlbare Bibliothek zusammengetragen hat!«
So rief Oskar jetzt, und so oder ähnlich sagte er täglich mehrmals.
Ein Diener, der einen recht seemännischen Eindruck machte, trat ein.
»Da ist eine Frau, Missis Mary Scott heißt sie, aus London will sie sein, die möchte Sie sprechen«, meldete er denn auch nicht gerade wie ein geschulter Diener.
»Aus London? Mich sprechen?«
»Ja, den Mister Koschinsky. Sie spricht nämlich nur Englisch. Sie kommt mit dem Wagen aus Ukarösk, hat als Dolmetscher einen Ungarn bei sich, der auch Englisch kann, freut sich riesig, dass hier alles englisch spricht.«
»Was will sie denn?«
»Hat sie nicht gesagt. Möchte den Mister Koschinsy sprechen, in ganz dringender Angelegenheit.«
»Lass sie eintreten.«
Es war eine ältliche Dame im einfachen Reisekleid, die sanften Züge vergrämt.
Oskar empfing sie freundlich, nötigte sie zum Sitzen.
Vor allen Dingen aber fiel ihm auf, wie die alte Dame ihn unverwandt anblickte, förmlich anstarrte.
»Ja. Sie sind es.«
»Kennen Sie mich denn?«
»Ja — nein — ja — ich habe Sie noch nie gesehen, und dennoch sind Sie mir wohlbekannt.«
»Von einem Bilde her?«
»Nein, auch nicht — Mister Koschinsky, darf ich Ihnen erzählen?«
»Erzählen Sie.«
»Es ist aber etwas ganz Wunderbares. Sie werden's kaum glauben.«
»Erzählen Sie nur.«
»Ich bin Missis Mary Scott aus London, die Mutter von Edward Scott, dem Flieger, der im Dezember vorigen Jahres das Wettfliegen von Heliopolis in Ägypten mitmachen wollte, am Abend zuvor aber eine Dame nach Alexandrien brachte, auf welcher Fahrt er verschwunden ist.«
»Aaaah, in der Tat, ich entsinne mich, ich habe davon gelesen!«, rief Oskar überrascht. »Sie sind die Mutter von dem unglücklichen jungen Manne?«
»Ich bin es.«
»Ja, nun erinnere ich mich auch des Namens der Mutter, Mary Scott in London. Was führt Sie zu mir?«
Sie berichtete zunächst davon, wie sie selbst nach Ägypten gereist war und fast 50 000 Franken geopfert hatte, um auch die Wüstengrenzen des Niltales nach ihrem Sohne und seiner Begleiterin absuchen zu lassen, nach den Trümmern des Aeroplans.
Alles war vergeblich. Die allgemeine Annahme, dass der Aeroplan in den Nil gestürzt und darin verschwunden sei, musste wohl die richtige sein.
»Ich kehrte nach London zurück. Meine Stimmung können Sie sich denken. Ich bin Witwe, es war mein einziger Sohn, mein einziges Kind. Dass durch das viele Geld, das er für die nächtliche Fahrt bekommen hatte, meine alten Tage sichergestellt waren, konnte mich über seinen Verlust nicht trösten.
Nun hören Sie das Wunderbare.
Jene unglückselige Fahrt hatte in der Nacht des 2. Dezember stattgefunden.
Und genau ein halbes Jahr später, in der Nacht zum 2. Juni — woran ich aber erst später dachte — träumte mir von ihm.
Zum ersten Male. Wohl weilten meine Gedanken ständig bei ihm, aber dass ich von Edward geträumt hätte, kann ich nicht bestimmt behaupten.
In jener Nacht aber, am 2. Juni, erschien er mir im Traume.
Ich erkannte ihn sofort, so sehr er sich auch verändert hatte, so fremdartig er auch aussah.
Er hatte wieder die sanften, gutmütigen Züge, die er als Kind gehabt und auch später noch, bis er Flieger geworden war, wodurch er nach und nach ein ganz anderes, unbewegliches Gesicht mit harten Zügen bekommen hatte — jetzt sah ich das sanfte Gesicht wieder, aber es sah unsäglich traurig aus, und nun kam auch die fremdartige Kleidung hinzu.
Er trug ein weites, weißes Gewand, wie ein langes Nachthemd, aber doch mehr den Eindruck eines richtigen Kostüms machend, an den Füßen hatte er Sandalen, und nun war sein blondes Haar auch noch ganz lang, es fiel ihm bis auf die Schultern, war in der Mitte gescheitelt, dazu ein blonder Vollbart, was ich an meinem Sohne gar nicht gewohnt war, und nun auch noch die schmerzensreiche Miene — kurz und gut, ich glaubte erst den Heiland vor mir zu sehen, in seiner morgenländischen Tracht, und doch war es mein Edward.
Ich wollte ihn anreden und konnte nicht. Auch er sprach nicht.
Er stand vor mir und blickte mich nur immer mit seinen unsagbar traurigen Augen an.
Mit einem Male — wie es eben im Traume zugeht — befand ich mich auf dem Boden meiner Wohnung, holte unter dem Gerümpel einen alten, gelben Koffer hervor.
Ich hatte diesen Koffer vor vielen, vielen Jahren — vielleicht vor zwanzig Jahren — mehrmals zu Reisen gebraucht, hatte nie wieder an ihn gedacht, wusste gar nicht, dass er noch dort oben auf dem Boden lag.
Und es war ja überhaupt nur ein Traum, dieser gelbe Koffer war schon längst bei einem Trödler oder überhaupt in anderen Händen, wenn er noch existierte.
Dann plötzlich befand ich mich mit diesem Koffer auf meinem Zimmer und packte ihn mit allem voll, was man für eine längere Reise braucht.
Und dann trat ich unten aus der Haustür, vor der ein Cab hielt, mit der Nummer 838, und der Kutscher hatte eine furchtbar große, rote Nase und war gerade damit beschäftigt, seine zerbrochene Peitsche zusammenzubinden.
Ich stieg ein und fuhr fort, den gelben Koffer neben mir. Und dann plötzlich sah ich mich auf der Liverpool Street Station, stand am Schalter, und der Beamte trug eine Brille mit einem weißen und einem blauen Glase. Das rechte war blau.
›Kann ich eine direkte Fahrkarte zweiter Klasse nach Budapest bekommen?‹, fragte ich.
,Gewiss, fünf Pfund acht Shilling neun Pence‹, sagte der Beamte und gab mir auf die sechs Guineen, die ich schon hingelegt hatte, elf Shilling und drei Pence heraus.
›Heute Abend acht Uhr zehn Minuten von hier ab‹, setzte er noch hinzu, als er mir ein Fahrscheinbuch gab, ›via Queensborough-Vlissingen, und am besten ist es, rate ich Ihnen, Sie lösen auf dem Schiffe für fünf Shilling eine Zuschlagkarte für die erste Kajüte, können dann sechs Stunden lang schlafen.‹
So sprach der Beamte.
Ich bemerke dabei, dass ich diese Reise noch nicht etwa gemacht habe, ich bin noch gar nicht auf dem Kontinent gewesen, habe gar keine Ahnung von solchen Fahrpreisen und Fahrzeiten.
Doch will ich solche Bemerkungen nicht mehr machen, es sollte ja alles noch viel, viel wunderbarer kommen.
Plötzlich befand ich mich auf einem anderen großen Bahnhofe, hörte von den Menschen eine fremde Sprache, wusste im Traume, dass ich in Budapest sei.
Ein uniformierter Mann ging vorüber, der auf dem linken Beine hinkte. auf dem Arme hatte er einige Flaggen, darunter auch die englische.
Was ich ihn fragte, weiß ich nicht, aber ich hörte ihn antworten.
›Nach Kolozs? Wo liegt denn das? Bei Klausen?[1] Ah, das ist Erdély, Siebenbürgen. Warten Sie —‹
[1] Richtig muss es wohl »Klausenburg« (heute Cluj-Naposa, Rumänien) heißen.
Er zog ein Buch, blätterte nach.
›Wollen Sie gleich weiterfahren? Da haben Sie noch zwei Stunden Zeit. Sechs Uhr fünfundzwanzig Minuten fährt der nächste Schnellzug, der auch in Großwardein sehr guten Anschluss hat. Da müssen Sie aber nach dem Ostbahnhof, Sie sind hier auf dem Westbahnhof. Sie können mit der Elektrischen fahren. Soll ich Ihnen einen englischsprechenden Mann besorgen?‹
Und dann war ich auf einem anderen Bahnhofe, dann wurde mir in Großwardein ein Billett nach Klausen gelöst, dort nach Kolozs, hier fragte ich in einem Hutgeschäft, in dem man Englisch sprach, wie ich nach dem Jagdschlosse des Grafen Kosy komme, ich wurde zum Wagenvermieter begleitet, ein dreispänniger Wagen brachte mich in vierstündiger, schneller Fahrt hierher nach diesem Schlosse, ein Portier fragte mich auf Englisch nach meinem Begehr. Dann kam ein anderer englischsprechender Mann, derselbe, der mich hier hereingebracht hat, ich habe dieses Bibliothekzimmer schon im Traume gesehen, dort liegt das Buch mit der roten Lederdecke und den Holzecken. Ich habe Sie, mein Herr, schon im Traume gesehen, Zug für Zug, ich weiß, dass Sie Koschinsky heißen, und dort ist der andere Herr, den Sie Walter anreden —«
Die Erzählerin machte eine Pause.
Es lässt sich denken, wie die beiden Freunde staunten.
»Also Sie haben einen Wahrtraum gehabt«, sagte dann Oskar.
»Ja, das nennt man wohl einen Wahrtraum.«
»Alles, was Sie im Traume sahen, haben Sie auch in Wirklichkeit gesehen?«
»Alles, alles. Doch darüber muss ich ja erst berichten.«
»Haben Sie schon öfters solche Wahrträume gehabt?«
»Noch nie!«
»Oder sind Sie sonst — verzeihen Sie die Frage — irgendwie somnambul veranlagt? Sie wissen doch, was man hierunter versteht?«
»Ja, ich weiß es. Nein, nicht im Geringsten. Ja und doch —«
»Was dennoch?«, kam Oskar der Stockenden zu Hilfe.
»Es dürfte sich doch vielleicht um eine vererbte Anlage handeln, die bei mir nur noch nicht zum Vorschein gekommen ist.«
»Aha! Wie das? Bitte, sprechen Sie ganz offen.«
»Mein Großvater mütterlicherseits, ein Schottländer, besaß die Gabe des zweiten Gesichtes.
Er sah den Tod von verwandten oder ihm sonst lieben Personen im Voraus, indem er sie einige Tage vorher im Sarge erblickte. Über welche Gabe er sich unglücklich fühlte, er sprach auch nicht darüber, aber bei Gelegenheit kam so etwas doch heraus und immer, immer traf es zu. Vielleicht, dass ich doch so etwas geerbt habe, was erst jetzt über den Verlust meines Sohnes bei mir zum Durchbruch gekommen ist. Anders kann ich es mir nicht erklären.«
»Sehr richtig. Doch bleiben wir erst bei der Sache. Sie traten nun die Reise an?«
»Nein, nicht sofort.
Also ich sah mich zuletzt im Traume hier in diesem Bibliothekzimmer Ihnen gegenübersitzen, und dort saß jener Herr, so wie er jetzt sitzt.
Wundern Sie sich nicht, dass ich jetzt für alles das kein Staunen mehr übrig habe. Weil ich auf der ganzen Reise ein solches Wiedersehen gehabt habe, mein ganzer Traum ist in Erfüllung gegangen, da bin ich dies alles schon gewohnt geworden.
Also wie ich Ihnen hier gegenübersaß, war der Traum beendet, ich wachte auf.
Es war schon Tag. Ich wusste nicht, was ich damit anfangen sollte. Ich war ja sehr erregt, aber — es war eben ein Traum. Und ich habe niemals an solche Wahrträume geglaubt.
So verging der Tag unter meiner gewöhnlichen häuslichen Beschäftigung.
Merkwürdigerweise dachte ich gar nicht daran, einmal auf den Boden zu gehen oder einen Fahrplan zur Hand zu nehmen.
Ja, meine Teilnahmslosigkeit war seltsam. Anderseits doch ganz erklärlich. Was hatte ich denn mit Budapest und Siebenbürgen zu tun, wie sollte ich denn das mit meinem Sohne in Verbindung bringen, und überhaupt — es war eben ein kurioser Traum gewesen, nichts weiter.
So verging der Tag.
Und da, in der Nacht, erschien mir mein Sohn abermals im Traume.
Ganz so wie in der vorigen Nacht.
Nur dass er ein noch schmerzbewegteres Gesicht hatte.
Und diesmal machte er mit beiden Händen bittend Bewegungen.
Und wieder war ich plötzlich auf dem Boden und holte den alten, gelben Koffer hervor, packte ihn wieder auf dem Zimmer, trat wieder zur Haustür heraus, wieder das Cab Nummer 838, wieder der Kutscher mit der unförmlichen roten Nase, wieder auf der Liverpool Street Station der Beamte mit der Brille, das rechte Glas blau, er sagt mir ganz genau dieselben Worte, und so mache ich ganz genau dieselbe Reise bis hierher, bis ich Ihnen gegenübersitze —
Da erwache ich.
Und nun allerdings gehe ich gleich auf den Boden.
Und wie wird mir da, als ich unter dem Gerümpel den alten, gelben Koffer finde, von dem ich ganz bestimmt glaube, ich hätte ihn einmal verkauft.
Jetzt lasse ich mir einen Fahrplan kommen.
Ich brauche ja nur nachzusehen, wann abends ein Schnellzug nach Queensborough geht.
Acht Uhr zehn Minuten!
Und ich versichere Ihnen, meine Herren, dass ich hiervon auch nicht die geringste Ahnung gehabt hatte.
Wie viel kostet es denn zweiter Klasse von London nach Budapest?
Das stand in dem Buche ebenfalls drin.
Fünf Pfund acht Shilling neun Pence.
Gibt es denn auch in Ungarn eine Station Klausen und Kolozs? Ich gestehe, dass ich noch nicht einmal von Großwardein etwas gehört hatte.
Ich sah auf der Karte nach. Alles stimmte. Siebenbürgen heißt auf Ungarisch Erdély.
Meine Herren, da habe ich den Koffer gepackt.
Diesen gelben.
Weshalb denn gerade den? Ich hatte noch zwei andere, sehr gute.
Wie ich ihn in meiner Stube näher untersuchte, fand ich die Erklärung, weshalb mir im Traume gerade dieser vergessene alte Koffer erschienen war.
Wenn man das eine Erklärung nennen darf.
Ich muss natürlich etwas erzählen.
Als mein Edward vier Jahre alt war, wurde er mal von Verwandten mit nach Southend an die See genommen, für längere Zeit. Dort war er einmal fotografiert worden, meine Schwester schickte mir die Fotografie, hatte ihm dazu ein blondes Löckchen abgeschnitten, legte es dem Bilde bei.
Diese Fotografie mit der Haarlocke war mir abhanden gekommen, ich wusste nicht, wo sie geblieben war.
Und jetzt, wie ich den alten, gelben Koffer säubere, fällt mir auf, dass es in dem Fache, in das man die kleinen Toilettesachen tut, knistert, ich mache die Klappe auf, ein Kuvert — die Fotografie meines Edward mit seiner Haarlocke!«
Und die alte Dame brachte aus einem Handtäschchen die betreffende Kinderfotografie und eine blonde Haarlocke zum Vorschein, mit einem verblichenen roten Seidenbändchen zusammengehalten. Die beiden Freunde wechselten Blicke. Dann stellte Oskar einige geschickte Fragen, die wir jedoch nicht wörtlich wiederzugeben brauchen.
Nein, Mrs. Scott hatte nicht die geringste Ahnung davon, dass hier ein kleines Mädchen mit hellseherischer Veranlagung lebe. Sie glaubte, der Besitzer dieses Schlosses hieße Koschinsky.
»Nun, und was weiter?«
»Ich packte den Koffer, machte mich reisefertig. Am Nachmittage ließ ich eine Droschke holen. Und wie ich aus der Haustür trete, da sehe ich an dem Cab die Nummer 838, und der Kutscher hat eine große rote Nase und bindet eben seine zerbrochene Peitsche zusammen. Und der Beamte am Billetschalter hat eine Brille, bei der nur das rechte Glas blau ist. Und so ist das weiter und weiter gegangen, alles während der ganzen Reise habe ich schon im Traume gesehen, wenigstens auf den Stationen, immer wenn es darauf ankam, den hinkenden Dolmetscher in Budapest, das Hutgeschäft in Kolozs — und nun sitze ich Ihnen gegenüber, den ich schon im Traume gesehen.«
»Ja, sehr merkwürdig! Und weshalb sind Sie nun hierher gekommen?«
»Ich weiß es nicht«, erklang es zaghaft.
»Wir aber wissen es. Sie sind durch einen Wahrtraum nicht umsonst zu uns geführt worden. Aller Voraussicht nach nicht. Einen Augenblick.«
Oskar drückte den Knopf der elektrischen Klingel, der Diener kam. »Deasy soll einmal zu mir kommen.« Dann wandte sich Oskar wieder an die alte Dame.
»Sie glauben nach alledem, dass Ihr Sohn noch am Leben ist?«
»Ach, wenn ich es hoffen dürfte!«
»Recht so. Einen festen Glauben dürfen Sie noch nicht haben, aber die Hoffnung bleibt Ihnen unversagt. Man hat auch nichts wieder von jener Madame de Lanotte gehört, welche die Königin der Nacht genannt wurde?«
»Gar nichts wieder.«
»Nichts von ihrer Dienerschaft, nichts von dem Monsieur Boissin?«
»Auch nichts.«
»Nicht herausgebracht, wer diese Dame gewesen ist?«
»Nein.«
»200 000 Franken für solch eine Fahrt von zwei Stunden, das ist doch ein ganz märchenhafter Preis.«
»Der Franzose sagte, für diese Dame hätte das gar nichts zu bedeuten.«
»Woher wissen Sie denn, dass er dies gesagt hat?«
»Mein Sohn schrieb es mir, schilderte die ganze Unterredung.«
»Ach so! Haben Sie diesen Brief — nun, lassen das jetzt.«
Deasy kam. Das achtjährige Mädchen hatte sich gar nicht verändert. Nur dass es eben laufen und die linke Hand normal bewegen konnte Sonst war es immer noch das liebreizende Kind mit den engelhaften Zügen, umrahmt von blonden Locken. Merkwürdig war, dass auch die heißeste Sonne ihre Haut nicht bräunte. Sonst ein durchaus gesundes Kind, lebhaft und aufgeweckt, verfügte es auch über einen stark ausgeprägten Witz.
»Ja, Onkel Oskar?«
»Setze Dich hierher, mein liebes Kind. Sieh, diese gute Frau hat vor einem halben Jahre ihren Sohn verloren, er ist in Ägypten verschwunden, niemand weiß, wo er geblieben ist. Vielleicht ist er gar nicht tot. Nun kommt die Mutter aus London zu uns, bringt eine Locke mit, die dem Sohne gehört hat, ihm einst als Kind abgeschnitten wurde. Willst Du nun einmal die Locke in die Hand nehmen, ob Du den Sohn vielleicht siehst?«
»Aber, Onkel, Du weißt doch, dass das Mittel nicht mehr wirkt, nur bei Fred geht es noch«, sagte das Kind betrübt.
»Versuche es nur einmal, bitte, Deasy. Nimm Dir recht fest vor, den zu sehen, dem dieses Haar gehört hat.«
Er gab dem Kinde die Locke in die linke Hand — und fast sofort schloss Deasy mit einem Seufzer die Augen und sank in ihrem Lehnstuhle zurück.
Es war wunderbar, dass jetzt noch solch ein Medium wirkte.
Im Übrigen aber, wie alles nun einmal gekommen war, hatten es die beiden Freunde doch nicht anders erwartet.
Hier wurde wieder eine geheimnisvolle Sympathie, durch die Liebe der Mutter zu ihrem Sohne erzeugt, mächtig wirksam, es übertrug sich auch auf dieses Kind, das seine Gabe ja noch immer nicht ganz verloren hatte.
»Was siehst Du, mein Kind?«
»Ich sehe — ich sehe — es ist ganz unklar — halt, jetzt wird es deutlicher — es ist ein toter Mensch, der ganz vertrocknet unter der Erde liegt.«
Mrs. Scott stieß einen Schreckensschrei aus.
»Tot, also ist mein armer Sohn doch tot!«
»Halt, nicht so voreilig!«, beruhigte sie Oskar. »Ich kann es allerdings nicht behaupten, aber ich glaube doch nicht, dass sich dieses Kind, über dessen Gabe ich Ihnen später berichten werde, darin viel geändert haben wird. Wäre der Mann, den sie sieht, wirklich tot, so würde Deasy die Haarlocke gar nicht in der Hand behalten. Wie sieht der Mann aus?«
»Ganz vertrocknet.«
»Es ist wohl eine Mumie?«
»Eine Mumie?«
»Er besteht nur aus Haut und Knochen, das Fleisch ist ganz zusammengetrocknet.«
»Ja, ja, so ist es!«
»Ist der Mann bekleidet?«
»Nur mit Fetzen von einem weißen Tuche.«
»Siehst Du seinen Kopf, sein Gesicht?«
»Ja, er liegt auf dem Rücken.«
»Kannst Du das Gesicht beschreiben?«
»Es ist alles nur Knochen mit Haut überzogen. ich sehe einen langen, weißen Bart, dagegen auf dem Kopfe gar keine Haare.«
»Ist der Mann denn tot?«
»Gewiss, er liegt doch unter der Erde.«
»Unter der Erde?«
»Nein, es ist gelber Sand.«
»Wie tief liegt er darunter?«
»Mindestens zehn Meter.«
»Und Du weißt bestimmt, dass der Mann tot ist?«
»Ich weiß es ganz bestimmt.«
»Woher weißt Du das so bestimmt?«
»Weil ich es weiß.«
»Sage, Deasy, stammt denn die Haarlocke, die Du in der Hand hältst, von diesem Manne?«
»Nein, o nein!«
Merkwürdig! So etwas war noch nicht vorgekommen, dass das Kind einen Menschen sah, von dem das betreffende Medium gar nicht stammte, noch dazu einen Toten!
»Weshalb erblickst Du denn da diesen toten Mann?«
»Weil er den Schlüssel hat.«
»Was denn für einen Schlüssel?«
»Den steinernen Schlüssel, der — ach, das ist ja genau so ein Schlüssel, wie solche damals alle die Jünglinge und die tanzenden Mädchen trugen, an den Gürteln oder sonst als Schmuck, sogar die Schlangen hatten solche auf den Köpfen! Nur dass das alles goldene Schlüssel waren, der hier aber ist aus Stein!«
Mit freudigem Staunen hatte es das Kind gerufen.
Denn während Deasy aus diesem somnambulen Schlafe immer erinnerungslos erwachte, erinnerte sie sich in diesem Zustande immer wieder, was sie während einer früheren Vision gesehen hatte.
Und schon hatten die beiden Freunde wieder Blicke gewechselt.
Sie dachten an jene Beschreibung, die damals in der chinesischen Teestube Deasy dem Señor Lazare gegeben hatte, was von Oskar am Sprachrohr, so leise die beiden auch gesprochen haben mochten, belauscht worden war, während Walter schon, oder doch zuletzt, in der Pagodenfigur gesteckt hatte.
Was war es gewesen, was die kleine Hellseherin geschaut und beschrieben hatte?
Sie hatten sich oftmals darüber unterhalten.
Aber es hatte ja gar keinen Zweck, sie kamen dabei niemals weiter.
Nun aber sah Deasy in ihrer Vision wiederum solch einen Schlüssel!
»Wo hat er den Schlüssel?«
»Zwischen seinen beiden Händen, die er auf der Brust gefaltet hält. Aber diese Hände sind für mich wie von Glas, ich sehe durch sie hindurch, so kann ich auch den Schlüssel ganz deutlich erkennen.«
»Was hat dieser Schlüssel für eine Bedeutung?«
»Mit ihm findest Du den Mann, dem die Haarlocke gehört, die ich in der Hand halte.«
»In welcher Weise finde ich ihn durch diesen Schlüssel?«
»Das weiß ich nicht. Erst muss ich den Schlüssel haben.«
»Der Mann, dessen Haar Du in der Hand hast, lebt noch?«
»Ja.«
»Woher weißt Du das?«
»Ich weiß es ganz bestimmt.«
In dieser Beziehung weiter zu fragen hatte dann keinen Zweck, und noch weniger, das Kind etwa durch Wegnahme der Haarlocke aufwecken zu wollen. Dann wusste es von alledem gar nichts mehr.
»Durch diesen steinernen Schlüssel wird der noch lebende Mann gefunden?«, vergewisserte sich Oskar nochmals, denn hierauf kam ja alles an.
»Ja. Aber nicht Du, niemand anderes, sondern ich selbst muss diesen Schlüssel in die Hand nehmen.«
»Und was ist dann?«
»Dann sehe ich den Mann, dem die Locke gehört.«
»Jetzt kannst Du ihn noch nicht sehen?«
»Nein.«
»Und wo liegt nun diese Mumie mit dem Schlüssel?«
»Ich will es Dir zeigen.«
Was sie hiermit meinte, war den beiden ganz klar.
Durch die vielen, vielen Experimente hatten sie ja ihre Erfahrungen gemacht.
Also Deasy hatte niemals sagen können, wie weit die betreffende Person sich von ihr befand, ob nur einen Meter oder ob tausend Meilen, und das war auch heute noch so in Bezug auf Fred, da verließ sie jede Ahnung.
Hingegen hätte sie schon damals angeben können, dass Fred immer unter ihr im Kreise herumgetragen worden war. Denn die Richtung, wo sich die betreffende Person befand, konnte sie bezeichnen, ohne sich zu irren, hatte es damals schon können. Sie war deswegen nur nicht befragt worden. Die betreffende Person zog ihre ausgestreckte Hand wie ein Magnet an, was auch beim Versteckspielen im Garten benutzt wurde, und wie das sonst noch verwendet wenden konnte, werden wir später sehen.
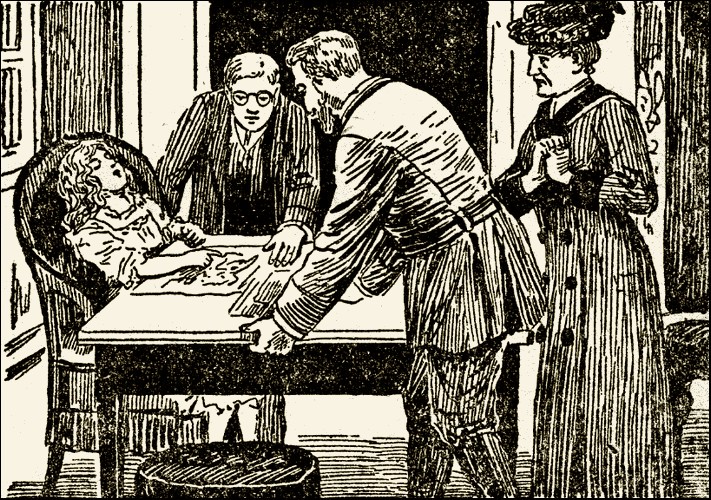
Und zweitens gab es noch ein anderes Mittel, um den Aufenthaltsort der betreffenden Person immer genau auszukundschaften So, wie es Oskar jetzt tat. Bemerkt sei nur, dass Deasy die beiden Freunde selbst erst auf dieses Mittel aufmerksam gemacht hatte, damals, als sie den ersten Unterricht in der Geografie bekommen hatte.
»Ich will es Dir zeigen«, hatte sie auf die Frage geantwortet, »wo die Mumie mit dem Schlüssel liegt!«
Oskar breitete vor ihr eine Weltkarte aus und legte Deasys rechte Hand darauf.
Sofort begann sie mit ausgestrecktem Zeigefinger darauf herumzufahren, aber nicht unsicher, ganz zielbewusst, fuhr sie über ganz Nordamerika weg, über den atlantischen Ozean und durch die Wüste Sahara, bis die Fingerspitze in Ägypten Halt machte.
»Also in Ägypten.«
»Dort, wo mein Finger ruht, liegt die Mumie.«
Ägypten war auf dieser Karte in Mercator-Projektion nun freilich sehr klein, schon die Spitze dieses Kinderfingerchens bedeckte es ganz.
Schnell eine Karte von Ägypten her.
Das Fingerchen rutschte durch das Mittelländische Meer nach Ägypten, ungefähr den Nil entlang, verließ diesen und hielt etwas oberhalb eines blauen Fleckes, der Wasser bezeichnete.
»In der Oase Fayum, am Birket el Kerun?«
»Dort, wo mein Finger haftet, liegt die Mumie«, konnte das Kind nur sagen.
»Oskar, eine große Karte von der weiteren Umgebung Kairos!«
Schnell war sie zur Stelle, und wieder wurde die Fingerspitze wie von einem magnetischen Punkt angezogen.
»Genug! Deutlicher kann sie jetzt nicht werden. Im Geistergebirge von Fayum haben wir die Mumie zu suchen!«
Achtzig Kilometer südlich von Kairo liegt am Nil die Eisenbahnstation Kerimat, von der aus eine Zweigbahn westwärts durch eine wilde Felsenschlucht, den ehemaligen Josephs-Kanal, in einstündiger Fahrt nach der Oase Fayum führt.
Unter einer Oase darf man sich nicht nur immer mitten in der Wüste ein Stückchen grünes Land um einen Brunnen mit ein paar Dattelpalmen vorstellen.
Diese Oase Fayum, allerdings auch eine der größten und bestimmt die dichtbevölkertste, umfasst 1300 Quadratkilometer und hat nicht weniger als 37 000 Einwohner. Also kommen auf den Quadratkilometer fast 300 Menschen, die sich nicht nur allein ernähren, sondern auch noch eine Unmasse von den herrlichsten Früchten, besonders Weintrauben, ausführen. Diese Oase, über und über mit Kanälen durchzogen, ist von der kolossalsten Fruchtbarkeit.
Ziemlich am Nordrande, nämlich weil dort die Felsenschlucht ausmündet, liegt die Hauptstadt Medinet mit 20 000 Einwohnern.
Von hier aus hat man noch eine Stunde zu Fuß, dann erreicht man die scharfgezogene Grenze der Oase, dann noch drei Stunden tüchtig marschieren nach Norden, jetzt aber durch richtige Wüste, in der auch kein Grashälmchen gedeiht, und man gelangt an den Birket el Kerun, einen See von 40 Kilometer Länge und 10 Kilometer Breite mit einigen Inselchen darin, alle unbewohnt.
Ägypten ist das märchenhafte Land der Wunder, fast überall. wo man auch im Sande gräbt, gräbt man irgend etwas Merkwürdiges aus, man darf sich das Graben nur nicht verdrießen lassen, eine Mumie oder ein paar Menschenknochen oder ein Krokodil oder einige Götzenbilder kommen immer zum Vorschein, das Niltal hat ja einst ganz anders ausgesehen als jetzt, da hat sich ein Tempel an den anderen gereiht — und hier am Birket el Kerun vollends hat sich einst das ganze Priesterwesen zusammengedrängt.
1 Bahr Yusuf.
Hier erheben sich noch jetzt drei Pyramiden, schon sehr zusammengebrochen und anderseits kaum noch aus dem Flugsande herausragend, an deren Alter das der Pyramiden von Gizeh nicht heranreichen kann, und hier hat einst das Labyrinth gestanden, von dem Herodot und Strabo erzählen, mit 1500 Kammern über der Erde und 1500 Kammern unter der Erde, in denen hauptsächlich die Mumien der heiligen Krokodile aufbewahrt wurden und in denen sonst die Priester ihren Hokuspokus trieben. Der dazu gehörende Tempelbau hatte 27 große Höfe.
Dieses Labyrinth ist heute noch vorhanden, wenn auch nichts davon zu sehen ist. Alles vom Flugsand zugedeckt. Aber man muss nur graben, dann findet man immer einmal eine Kammer, die allerdings nichts weiter enthält als Krokodils- und Menschenknochen. Oder man bricht auch einmal ein und hat dann seine liebe Not, wieder herauszukommen, muss Sand und Knochen aufhäufen.
Systematische Ausgrabungen werden hier ja noch einmal die größten Raritäten zutage fördern. Vorläufig ist das Ausgraben noch nicht erlaubt. Weshalb nicht, werden wir gleich sehen.
Dieser Birket el Kerun ist der Rest des alten Moeris-Sees , in den die Ägypter vor Jahrtausenden das überschüssige Nilwasser leiteten, eben durch den jetzt trockenen Josephs-Kanal — sein Erbauer soll Joseph in Ägypten gewesen sein — und dann das Wasser in der Zeit der Dürre wieder abfließen ließen.
Durch einen Dammbruch soll dieser See das ganze fruchtbare Land verwüstet haben, nur die Oase Fayum blieb übrig, und dann eben der jetzige See, immer noch groß genug.
Dieser Birket el Kerun ist jetzt salzig. Aber nur im Sommer. Im Winter wird er wenigstens brakig, man kann das Wasser zum Löschen des Durstes zur Not gerade noch trinken. In seiner Mitte hingegen hat er immer ganz süßes Wasser.
Hierbei ist kein besonderes Rätsel. Der See steht einfach unterirdisch mit dem Nil in Verbindung, der im Winter steigt und im Sommer fällt. Es kommen auch darin viele echte Nilfische vor, also Süßwasserfische, die aber, wenn sie ins umgrenzende Salzwasser geraten, absterben und dann ans Ufer gespült werden.
Die Folge hiervon ist, dass es an den Ufern dieses Sees von Geiern, Füchsen, Schakalen und Hyänen geradezu wimmelt. So viel haben diese Raubtiere dort an Fischleichen zu fressen, dass selbst noch Hasen massenhaft vorkommen, und außerdem sehr viele Wildschweine. Und in dem Schilfe des Ufers wimmelt es erst recht von Wasservögeln aller Art, die wieder Ichneumons anziehen.
Die Umgegend des Birket el Kerun wäre das reine Jagdparadies.
Die Jagd ist in Ägypten frei. Aber an diesem See darf oder kann nicht so leicht gejagt werden, wenn es auch die Polizei nicht verbietet.
2 Qarun-See.
Diese Gegend der libyschen Wüste gehört dem Beduinenstamme der Beni Suefs, welchem auch der jetzige Vizekönig entsprossen ist, ferner gehen von diesem Stamme aus die heiligsten Derwische und andere Kirchenhäupter — kurz, durch alles dies haben die Beni Suefs die größten Privilegien erhalten.
Sie gestatten ganz einfach in ihrem Wüstengebiet keine Ausgrabungen und keine Jagd. Wer ausgraben oder jagen will, ja eigentlich nur ihr Gebiet betritt, die Oase verlässt, muss ein Ferman, einen Erlaubnisschein vom Vizekönig haben, von ihm als ihrem Oberscheik handschriftlich selbst ausgestellt, und der ist natürlich nicht so leicht zu bekommen. Oder überhaupt gar nicht.
Dabei sind diese Wüstenritter die vortrefflichsten Menschen. Wenn ein einsamer Jäger dort einige Zeit haust oder ein armer Handwerksbursche, der sich einmal ein bisschen als Jäger etabliert, gegen den haben sie nichts, lassen ihn ruhig jagen, nehmen ihn gastfreundschaftlich in ihren Zelten auf. Aber wenn eine große Expedition kommt, die da große Treibjagden veranstalten will, die fangen sie ab, nehmen den Herren und Dienern die Gewehre weg und schicken sie wieder nach Hause. Und hiergegen ist vorläufig gar nichts zu machen. Die Beni Suefs halten die ganzen Beduinen von Ägypten in Schach, und von diesen ist das Land noch gar zu sehr abhängig.
Ebenso also gestatten die Beni Suefs hier keine Ausgrabungen. Ein einzelner Mann kann so viel schaufeln wie er will, auch zwei und drei — aber sobald die Sache im Großen betrieben wird, erscheinen die Beduinen und pfänden ganz einfach die Expedition. Und nun soll man einmal versuchen, sich gegen diese Wüstensöhne zu wehren!
Und nun kommt noch etwas anderes hinzu, weshalb die Europäer in dieser Beziehung so gar keine Hilfe von den Eingeborenen der Oase Fayum und des ganzen Niltals finden, weshalb diese ganze Gegend von diesen wie ein Pestherd gemieden wird.
Birket el Kerun erstreckt sich mit seinen 40 Kilometern von Osten nach Westen in die Libysche Wüste hinein. Sein südliches Ufer ist stark beschilft, dann kommt ein breiter Streifen von Mimosengestrüpp, in dem die Wildschweine und Hasen sich verbergen.
An das Nordufer dagegen tritt ein Gebirge heran, ein nacktes Felsengebilde, und zwar ein solches von furchtbarer Zerrissenheit. Die höchsten Felsen mögen sich 100 Meter hoch erheben, aber das nun ganz jäh aus der Wüste heraus, dadurch machen sie doch einen ganz kolossalen Eindruck, und nun alles mit Schluchten und Höhlen durchsetzt, die bizarrsten Formen bildend.
Wer einige Phantasie besitzt, kann aus jedem einzelnen Felsen eine Figur machen, Menschen und Tiere und fabelhafte Ungeheuer, die miteinander kämpfen und ringen, und jeder Vorsprung ist wieder ein Gesicht oder ein ganzes Geschöpf von ungeheuerlicher Gestaltung.
In diesem Felsenlabyrinth hausen die Füchse, Schakale und besonders die Hyänen, von hier aus gehen sie des Nachts auf Raub aus.
Die Hyäne ist dem Mohammedaner »toglo«, heilig, gefeit, unantastbar. Man wird keinen Araber und keinen anderen Mohammedaner bewegen können, mit auf Hyänenjagd zu gehen, auch wenn er dabei nur als Treiber oder Diener helfen soll. Er freut sich, wenn ein Fremder, ein Giaur, eine Hyäne tötet, aber er selbst wird sich vor solch einem Frevel hüten.
Der Koran verbietet die Zauberei. Der Zauberer kommt nach seinem Tode nicht einmal in die Dschehenna, in die Hölle, die ist noch zu gut für ihn, er wird in eine Hyäne verwandelt, die des Nachts Leichen ausscharren muss. Und um sich an dieses Los schon vorher zu gewöhnen, verstehen es alle Zauberer, sich schon bei Lebzeiten in Hyänen zu verwandeln.
Alle Hyänen sind also böse Menschen und böse Geister.
Es ist das Dschebel el Ghossar, das sich vom Nordufer des Birket el Kerun aus weit in die Libysche Wüste hinein erstreckt, das Geistergebirge.
Nur die Beni Suefs wagen diese Schluchten zu durchziehen, weil sie nun einmal die Herren dieses Landes sind und weil sie sich durch privilegierte Koransprüche vor den bösen Geistern zu schützen wissen. Das gilt aber auch nur für den hellen Tag. Bei Nacht wird auch kein Beni Suef wagen, die scharfgezogene Gebirgsgrenze zu überschreiten.
Ein anderer Araber aber wird dieses Gebirge auch nicht bei Tage betreten, nicht für alle Schätze der Welt, und das gilt nicht etwa nur für die umwohnenden Beduinen und Fellahs. Kommt ein Mohammedaner aus dem fernen Indien nach Ägypten und er hört von dem Dschebel el Ghossar, so wird er sich doch erkundigen, weshalb das Gebirge diesen Namen führt, und dann wird er sich hüten, auch nur nach jener Richtung zu blicken, in der das Geistergebirge liegt, oder er muss dazu gewisse Koransprüche murmeln, um seine Seele vor Schaden zu bewahren.
Es war um die Mittagsstunde, als eine Karawane die Schluchten dieses Gebirges durchzog.
Sie bestand aus neun Kamelen, von denen sechs beritten, drei hochbepackt waren, obgleich auch die anderen außer ihren Reitern noch viel Gepäck tragen mussten.
Die Reiter trugen zwar Beduinengewänder, zeigten aber durchweg germanische Gesichter, meist blondbärtige, an Farbe freilich mit denen der dunkelsten Araber wetteifernd.
An der Spitze ritt auf einem edlen Hedjin, einem schlanken Rennkamel, vielleicht teuerer als das edelste Pferd, ein Mann, der vor sich in einem Hilfssattel ein Kind hatte, ein kleines Mädchen, ebenfalls als Beduinin kostümiert, über das er einen Sonnenschirm hielt, und das war auch nötig, denn mit furchtbarer Glut brannte die Mittagssonne in diese Felsenschluchten hinein.
Fortwährend zweigten solche links und rechts ab, und jetzt hob das kleine Mädchen die rechte Hand und deutete in einen Engpass.
Die Karawane schwenkte ab, verfolgte die neue Richtung.
Seit Stunden ging dies schon so. Deasy, die Haarlocke von Edward Scott in dem linken Händchen, lag in Trance, bezeichnete immer die Richtung, die zu nehmen war, um sich immer mehr der Stelle zu nähern, wo tief unter dem Sande die Mumie mit dem steinernen Schlüssel lag. Ohne Aufforderung sprach sie nichts, und was sollte man sie befragen. Am wenigsten hätte die Frage einen Zweck gehabt, wie weit man noch von dieser Stelle entfernt sei.
Wohl aber konnte man dies von ihr auf andere Weise erfahren.
Ein schnalzender Laut, das Hedjin stand und mit ihm die ganze Karawane.
Oskar breitete vor dem Kinde einen Bogen Papier aus, auf dem ein längliches Viereck zu sehen war, im das hin und wieder ein kleines Kreuz gezeichnet war. Das lange Rechteck sollte dieses Gebirge vorstellen, das wusste Deasy.
»Wo sind wir jetzt, mein Kind?«, fragte Oskar, nach seiner Uhr sehend.
Das Fingerchen fuhr über das Papier hin und blieb haften.
An dieser Stelle machte Oskar mit Bleistift ein kleines Kreuz. Da er dies alle halbe Stunde so machte, konnte er sich die Entfernungen von einem Kreuze zum anderen immer berechnen, also auch die, die ihn noch von dem Punkte trennte, auf dem, wie Deasy bezeichnet hatte, die Mumie liegen sollte.
Danach war man von dieser Stelle kaum noch 150 Meter entfernt, allerdings nur in der Luftlinie berechnet.
Die Karawane setzte sich wieder in Bewegung, immer wieder ging es links und rechts in Seitenschluchten hinein, die Kinderhand gab die Richtung an, bis sie auf eine Felswand deutete.
»Hier geht es aber in keine Schlucht hinein.«
»Dort liegt die Mumie.«
Und schon deutete Deasys Hand nach unten auf den Boden.
Gehorsam knieten die Kamele auf eigentümliche Zurufe nieder, sie wurden gekoppelt und abgeladen, wobei ein Sachverständiger sofort erkennen musste, dass diese neun Männer kundige Kamelreiter waren.
Das Kind wurde von Oskar aus dem Sattel gehoben, es behielt die Locke in der Hand, so blieb es auch in Trance, und dennoch konnte es in diesem Zustande mit geschlossenen Augen wie in vollem Wachen gehen, hätte nicht einmal geführt zu werden brauchen.
Deasy führte ihren Begleiter bis direkt an die glatte Felswand.
»Hier liegt die Mumie!«, sagte sie, sich bückend und mit der rechten Hand den Boden berührend, gelben, ziemlich feinen Sand, dicht neben dieser Felswand.
»Wie tief liegt sie? Kannst Du es jetzt genauer beurteilen?«
Das Kind schien bei weiten Entfernungen doch nicht richtig schätzen zu können, auch da schien eine perspektivische Täuschung zu wirken. Zuerst hatte Deasy von mindestens 10 Metern Tiefe gesprochen. Je näher man aber dieser Stelle gekommen, also also während der ganzen Reise nach Ägypten, desto geringer hatte sie diese Tiefe angegeben.
»Sechs Meter tief, sicher nicht tiefer!«, sagte sie jetzt.
Wenn das stimmte, so durften die Mitglieder der Expedition mit dieser letzten Angabe sehr, sehr zufrieden sein.
Es ist nämlich gar nicht so einfach, in einer sandigen Wüste ein Loch von 10 Meter Tiefe zu graben. Das ist so leicht erzählt, aber schwer ausgeführt. Wer es selbst einmal probiert hat, in solch einem Sandozean zu paddeln, der kann dann etwas anderes erzählen. Da lernt man auch ohne besondere mathematische Kenntnisse bald den Inhalt eines Kegels berechnen, und dann flucht man immer noch über das niedrige Gefälle des trockenen Sandes, der immer wieder nachstürzt.
.Bei einer Tiefe von 10 Metern hätte hier dieses Trichter- oder Kegelloch oben eine Basis von mindestens 16 Metern Durchmesser haben müssen, das hätte rund 600 Kubikmeter Sand bedeutet!
Nun rechne man sich aus, wie lange die neun Männer gebraucht hätten, um diese 600 Kubikmeter auszuschaufeln und immer höher in die Höhe zu heben!
Mindestens drei ganze Tage lang hätten sie ununterbrochen von früh bis abends arbeiten müssen!
Da sieht man, was es zu bedeuten hat, in der Wüste versunkene Städte auszugraben, was das kostet!
Lag die Mumie aber nur 6 Meter tief, wie Deasy jetzt ganz bestimmt behauptete, so kamen nach der Formelberechnung nur noch rund 160 Kubikmeter in Betracht — denn es ist dabei doch immer mit Kubikmaß zu rechnen — und dann kam noch hinzu, dass die Mumie dicht an der Felswand liegen sollte, wodurch das Kegelloch wiederum um die Hälfte reduziert wurde, und außerordentlich günstig war auch, dass in erreichbarer Höhe längs der sonst glatten Felswand ein Grat hinlief, auf dem man stehen konnte, von dem aus also der Sand dann aus größerer Tiefe in Körben oder Säcken herausgezogen werden konnte.
Die Kamele wurden mit etwas Reis und Mais gefüttert, die Reiter löschten ihren Durst aus den Wasserschläuchen, die den Tieren, wenn es drauf ankam, noch lange verschlossen bleiben würden, aßen einige Bissen, dann legten sie ihre Beduinenkostüme ab, unter denen sie derbe Tropenanzüge von weißer Baumwolle trugen, und machten sich sofort an die Arbeit, nicht erst die Mittagshitze vorüber lassend.
Sie packten Schaufeln und Körbe aus, und der königliche Prinz arbeitete mit wie der eifrigste Tagelöhner.
Auch der kleinen Deasy, die nach Abgabe der Locke sofort erwacht war, machte es den größten Spaß, mit in dem Sande zu schaufeln, zumal sie es unter dem kleinen Sonnenzelte, das man für sie aufgeschlagen hatte, vor Hitze doch nicht aushielt, oder sie betrachtete die Figuren, welche die bizarren Felsmassen überall bildeten.
»Sieh nur, Onkel, sieht das nicht gerade aus wie ein Mann, der mit einem Bären kämpft? Und dort das Pferd, es ist gestürzt! Und dort, was ist denn das für ein schreckliches Ungeheuer?!«
3 Gemeint ist »buddeln«, also graben.
Ja, überall, wohin man auch blickte, sah man solche merkwürdige Figuren, teils in Lebensgröße, teils von riesenhaften Umrissen, oder auch zwerghaft klein, und man kommt manchmal fast auf die Vermutung, dass hier menschliche Bildhauer geschaffen haben müssten.
Das Sandloch hatte bald drei Meter Tiefe erreicht, als Oskar nach seiner Uhr blickte.
»Deasy, in Kolozs ist es gleich vier Uhr!«, sagte er.
Er entnahm einer Kapsel, die er auf der Brust trug, eine andere blonde Haarlocke, die von Freds Kopfe stammte, und kaum hatte Deasy diese in die Hand genommen, als sie wieder in Trance fiel.
»Was siehst Du, mein Kind?«
Deasy sah ihren Spielgefährten im fernen Siebenbürgen in einem Zimmer des Jagdschlosses an einem Tische sitzen, mit seinen Augen blickte sie nach der Uhr, wie diese gleich auf um vier wies, sah Baron Walten, wie sich dieser jetzt setzte und auf einen Bogen Papier schrieb:
Alles in Ordnung. Briefe nicht angekommen. Herzliche Grüße. Walter.
Dann schrieb noch Fred seine Grüße und einige Bemerkungen darunter, und die hellsehende Telefonverbindung wurde wieder gelöst.
Aus diese Weise konnte Oskar immer erfahren, wie es dort in Siebenbürgen stand. Alle vier Stunden am Tage wurde diese Verbindung durch das hellsehende Kind hergestellt.
»Wenn nur auch wir mit ihnen sprechen könnten!«, meinte Deasy, als ihr Freds Locke aus der Hand genommen worden war und sie den Bericht erfahren hatte.
»Vielleicht lösen wir auch dieses Problem noch einmal!«, lachte Oskar. »Nun nimm gleich auch noch Edwards Locke, was die Mumie macht.«
Sie lag noch an derselben Stelle, über der Brust die knöchernen Finger gefaltet, in diesen den steinernen Schlüssel.
Die darüber arbeitenden Leute konnte das Kind ja nicht sehen, wohl aber ganz bestimmt angeben, dass sie jetzt neben der Leiche nur noch von einer höchstens drei Meter dicken Sandschicht getrennt wurden, obgleich die Schlafende auch diese Sandschicht nicht sah. Das musste mehr etwas wie ein Ahnungsvermögen sein, was vorlag. Jedenfalls wurde der senkrechte Tunnel genau darauf zu gegraben.
Die Arbeit wurde fortgesetzt, die immer schwieriger wurde, da oben die trichterförmige Öffnung ja immer erweitert werden musste.
Wenn Oskar keine Wachen ausgestellt hatte, so wusste er eben, dass solche gar keinen Zweck hatten, und deshalb konnte man auch nicht sagen, dass die Arbeitenden überrascht worden wären, als plötzlich hinter einer Felswand ein Beduine auf prächtigem Pferde auftauchte.
Oskar erwartete ihn ruhig, ließ die Arbeit deshalb gar nicht einstellen.
Der Beduine, mit Lanze und schöner Doppelbüchse bewaffnet, ließ langsam sein Ross herangehen, ohne das Gesichtstuch zu lüften.
»Wer seid Ihr denn?«, erklang es jetzt hinter diesem, und dass der einleitende mohammedanische Gruß fehlte, war eigentlich schon ein schlimmes Zeichen.
»Wir sind friedliche Männer, die hier graben!«, entgegnete Oskar in demselben reinen Arabisch.
»Was habt Ihr denn da zu graben?!«, erklang es herrisch wie zuvor. »Wer hat Euch denn hierzu die Erlaubnis gegeben?«
»Der, welcher Herr ist dieses Gebietes.«
»Das ist Scheik Hassan ben Soliman, und der bin ich!«
»So habe ich Dir Grüße von Deinem Oheim zu bringen.«
»Von wem?!«
Schon hatte Oskar unter seiner Weste ein Pergament hervorgezogen, von dem ein Siegel herabhing, er überreichte es auseinandergefaltet dem Scheik.
Dieser nahm es, erkannte mit einem Blick einen Ferman des Khediven, des Vizekönigs von Ägypten, womit er dem Besitzer des Passes, namentlich aufgeführt, die Erlaubnis zum Jagen und Graben im Gebiete der Beni Suefs gab, mit noch anderen Schutzempfehlungen.
Der Scheik machte eine ehrfürchtige Bewegung, dann ein Ruf, und jetzt tauchten hinter den Felsecken überall solche Beduinen auf herrlichen Rossen auf.
Zu einer weiteren Auseinandersetzung aber sollte es nicht kommen.
»Da ist sie, die Mumie!«, erklang es in diesem Augenblicke dort unten in der Grube, wo sich die Arbeitenden also nicht hatten stören lassen.
Sie hatten zuletzt ganz behutsam geschaufelt, und nun brauchten sie den Sand bloß noch mit Tüchern wegzufegen, so lag das gesuchte Objekt plötzlich ganz frei da, nur die Füße waren noch verdeckt.
Also ein sehr alter Mann, wenigstens nach dem langen, weißen Barte zu urteilen. Sonst waren es ja nur Knochen, wie mit Pergament bedeckt, wenn auch das Fleisch selbst eingetrocknet sein mochte, von einigen wenigen Lumpen umhüllt. Er lag auf dem Rücken, zwischen den auf der Brust gefalteten Händen einen kaum mehr als spannenlangen grauen Schlüssel, als solcher gleich erkennbar. Nur dass den Griff nicht ein Ring, sondern ein Knopf bildete. Dafür war deutlich der Schlüsselbart zu erkennen. Soweit das jetzt eben im ersten Augenblick zu unterscheiden war.
Oben an der Grube hielten die Beduinen, vielleicht ein Dutzend, und blickten hinab.
Aber sie betrachteten nicht lange, was diese Franken da im Sande ausgegraben hatten.
Im nächsten Augenblick passierte etwas ganz Merkwürdiges.
»Dais el Dschebel! Mufta el Ghossar!«
So hatte es plötzlich erklungen.
Wie aus einem einzigen Munde kommend — und zwar wie ein Schrei des Entsetzens.
Und gleichzeitig die Pferde herumgeworfen und wie ein Wirbelwind in die nach Westen führenden Schluchten hineingefegt! Weg waren sie!
»Was war denn das?!«, durfte Oskar mit Recht staunen.
Denn es war gar zu plötzlich gegangen, dieses Verschwinden nach jenem Schreckensschrei.
Zunächst aber ging er dorthin, wo der Scheik das Pergament hatte fallen lassen, hob es auf.
»Der Alte vom Berge! Der Schlüssel der Geister!«
Ja, das hatten jene arabischen Worte bedeutet. Aber weiter zu erklären vermochte er sie nicht.
Nun, jedenfalls hatte man jetzt die Mumie und hauptsächlich den Schlüssel gefunden, dessentwegen man diese weite Reise nach Ägypten gemacht hatte.
Oskar begab sich hinab in die tiefe Grube. Ziemlich leicht gelang es ihm, die eingetrockneten Finger zu öffnen, ihnen den Schlüssel zu entwinden.
Er war von einem grauen, sehr harten Steine, zeigte einige verschnörkelte Punkte, kaum als Hieroglyphen zu deuten, nichts weiter.
Was sollte nun dieser Schlüssel? Warum hatte ihn die kleine Hellseherin immer erblickt, sobald sie Edward Scotts Haarlocke in die Hand genommen?
Jetzt bekam sie diesen Schlüssel in die linke Hand.
Nichts war es!
Deasy fiel nicht in Trance!
Auch kein Befehl und kein eigener Wille wirkte.
Und als sie jetzt wieder Edwards Locke in die Hand nahm, wirkte auch diese nicht mehr.
Die Nacht war angebrochen. Man hatte in der Nachbarschaft ein kleines Tal gefunden, in dem einiges Mimosengestrüpp gedieh, hier war das Lagerfeuer angezündet worden.
An diesem saß Doktor Oskar Reichard und grübelte über das Rätsel nach, das ihn hierher geführt hatte, anscheinend so ganz zwecklos, dabei aber auch wissend, dass es ebenso zwecklos war, über dieses Rätsel auch nur nachzugrübeln.
Mit den anderen acht Männern konnte er nicht darüber sprechen. Es waren seine getreuen Begleiter, mit denen er schon so manche Forschungsexpedition in aller Welt gemacht, wir werden sie später näher kennen lernen, er hatte keine Geheimnisse vor ihnen, aber über so etwas unterhalten konnte er sich mit keinem. Er war der Herr, und sie waren die Diener.
In dem kleinen Zelte schlief Deasy wohlgebettet, zwei der Männer mussten sich immer neben ihr befinden, dort drüben lag in eine Decke gewickelt die Mumie.
Es war eine herrliche Nacht. Am mondlosen Himmel funkelten die goldenen Sterne wunderbar. Schauerlich aber war das Geheul der Raubtiere, noch grässlicher klang das Lachen der Hyänen, am unheimlichsten aber war wohl, wie unruhig im flackernden Feuerschein alle die benachbarten Felsgestalten von den bizarrsten Formen Leben zu bekommen schienen.
Da streckte Oskar die Hand aus, und das an sich schon leise geführte Gespräch seiner Begleiter verstummte.
»Da kommt jemand, ein Mensch!«
Dort, wohin er in die Nacht blickte, war nichts zu sehen, aber diese Männer wussten schon, dass ihr Herr und Meister andere Augen und Ohren besaß als sie.
Und da tauchten auch wirklich schon aus der Finsternis die helleren Umrisse einer menschlichen Gestalt auf, kamen in den Bereich des Feuers.
»Salem aleikum — Friede sei mit Euch!«, sagte eine sonore Männerstimme.
»Friede sei mit Dir.«
Die Gestalt kam vollends ans Feuer heran.
Es war ein Araber, in braune Beduinengewänder gehüllt, ein noch junger Mann mit kurzem, schwarzem Vollbart, ein edles, wahrhaft klassischschönes Gesicht mit Adlernase und brennenden Augen. Waffen waren nicht zu sehen.
»Ich komme als Dein Freund.«
»Du botest uns schon Deinen Frieden.«
»Nicht jeder Freund bringt Frieden. Darf ich mich zu Dir setzen?«
»An meinem nächtlichen Lagerfeuer hätte auch mein Feind Platz, wenn er mich darum bittet. Aber ich glaube Dir — ich empfange Dich als meinen Freund.«
Oskar, der von den anderen schon getrennt saß, rückte etwas zur Seite, der Fremde ließ sich mit untergeschlagenen Füßen nieder.
»Ich kenne Dich, aber Du kennst nicht mich!«, fuhr er dann gleich wieder fort. »Nenne mich Almansor.«
»Du bist ein Beni Suef?«
»Ja und nein, und nein und ja.«
»Was soll das heißen?«
»Frage einen Beni Suef danach, was das bedeuten soll. Dann weißt Du es — wenn Dir jemand eine Antwort gibt.«
»Du sprichst in Rätseln, Freund.«
»Die Du später lösen wirst.«
»Du kennst mich? Nun, wer bin ich?«
»Prinz Joachim, und Du nennst Dich Doktor Oskar Reichard.«
»Das steht in meinem Ferman, Scheik Hassan hat Dir davon gesagt.«
Das schöne, dunkle Gesicht lächelte etwas.
»Ich kenne Dich sehr, sehr gut. In einem Kloster an der belgischen Grenze ...«
Er brach offenbar mit Absicht ab.
Und es hatte auch genügt.
Die Augen des Mannes, dem nordamerikanische Indianer den Ehrennamen Flammenauge gegeben hatten, öffneten sich plötzlich übernatürlich weit, wahrhaft entsetzt fuhr er vor dem Sprecher zurück.
»Mensch, wer bist Du?!«, stieß er hervor.
Durchdringend betrachteten ihn die schwarzen Augen des anderen.
»Kennst Du mich nun?«
»Nein! Nein! Ja und doch ... es beginnen mir Züge aufzudämmern ...«
»Nun?«
»Der geheimnisvolle Chaldäer von Paris!«
»Ich bin es.«
»Es war ein steinalter Mann, den ich um die Zukunft befragte und dem ich mein tiefstes Geheimnis anvertraute.«
»Ich bin es.«
»Er starb zu derselben Stunde noch in meinen Armen, noch ehe er einen anderen hätte sprechen können.«
»Ich bin es.«
»Ich sah ihn — das grässlichste Ereignis meines Lebens — plötzlich in Staub und Moder zerfallen!«
»Ich bin es, der mit Dir spricht!«, erklang es immer wieder.
Staunend beobachteten die anderen Männer diese Szene, diese furchtbare Erregung ihres Herrn, wie sie ihn noch nie gesehen.
Wir werden später erfahren, was es mit diesem Chaldäer von Paris für eine Bewandtnis hatte, was Prinz Oskar mit ihm für ein Erlebnis gehabt.
»Sagte ich Dir damals nicht«, fuhr der Beduine fort, »dass wir uns in sechs Jahren wiedersehen würden?«
Oskar hatte sich von seiner namenlosen Bestürzung wieder aufgerafft.
»Ja, das sagtest Du ... sagte der Chaldäer.«
»Du glaubtest ihm nicht.«
»Weil ich ihm auch sonst nichts glauben konnte.«
»Die sechs Jahre sind vergangen.«
»Noch aber bin ich durch nichts überzeugt, dass Du wirklich jener Chaldäer bist.«
»Die Nonne in dem belgischen Kloster ist nicht Juliette, sondern ...«
»Genug, genug, ich glaube, ich glaube!«, schrie da plötzlich Oskar, auch gleich empor springend, die Hände abwehrend ausstreckend.

»Genug, genug, ich glaube, ich glaube!«, schrie Oskar, auch gleich
empor springend und die Hände abwehrend ausstreckend.
Auch der Beduine hatte sich erhoben.
»Willst Du mir folgen?«
»Wohin?«
»Etwas abseits von Deinen Leuten.«
»Weshalb?«
»Ich habe allein mit Dir zu sprechen. Gedenke, was Dir der Chaldäer Chebrazzim damals vor sechs Jahren versprochen hat.«
Auch dieser Name machte auf Oskar wieder den größten Eindruck.
»Ich bin bereit.«
Noch einige kurze Instruktionen für seine Abwesenheit, und er folgte dem geheimnisvollen Beduinen in die Nacht hinein, die aber doch vom Sternenschein etwas erhellt war.
Doch nicht weit, hinter ihnen das Feuer mit den darumsitzenden Personen war noch deutlich zu erkennen, so blieb der Führer stehen. Oskar sah an den Umrissen, wie er sich bückte, hörte Zweige knacken, es blitzte am Boden auf, und nicht lange währte es, so flammte ein kleines Feuerchen auf, das durch mehr Zweige schnell vergrößert wurde. In Armweite wuchs überall niedriges Gestrüpp, neues Feuerholz gebend, und das der Mimose brennt ausdauernd wie Holzkohle.
Eine einladende Handbewegung, und die beiden setzten sich gegenüber, Oskar so, dass er sein Lagerfeuer vor Augen hatte, in einer Entfernung von etwa hundert Schritten.
»Lass mich noch einmal von der Vergangenheit sprechen!«, nahm der Beduine wieder das Wort.
»Es war vor sechs Jahren, als Du Dich in Paris aufhieltest. Du befandest Dich in tiefster seelischer Bekümmernis. Ein Weib, ein Mädchen, das Du mit ganzem Herzen geliebt, war Dir untreu geworden, war von Dir geflohen oder es war verschwunden.
In Deiner Ratlosigkeit wolltest Du noch einmal versuchen, den Aufenthalt der Geliebten durch übersinnliche Kräfte zu erfahren, obgleich Du über so etwas bisher immer verächtlich gesprochen hattest und auch wirklich nicht daran glaubtest.
In Paris gab und gibt es solche Kreise genug, wo Du Dir Rat holen konntest, wo man Dir sofort entgegen kam.
Du experimentiertest mit Medien und Wahrsagern und wurdest nur immer mehr enttäuscht und mit Verachtung gegen diesen sogenannten Spiritismus und Okkultismus erfüllt, und das mit Recht, denn Deinem scharfen Auge und Geiste konnte es nicht entgehen, wie Du fortwährend nur betrogen wurdest.
Da, wie Du alle diese fruchtlosen Versuche schon aufgeben wolltest, teilte Dir ein Unbekannter in einem Briefe mit, dass in einem kleinen Gasthause auf dem Montmartre jetzt ein alter Orientale logiere, wahrscheinlich ein Perser, ein chaldäischer Magier, der alle Deine Fragen beantworten könnte.
Das ganze Schreiben war so geheimnisvoll gehalten, dass es Dich noch einmal reizte, hinzugehen.
Du fandest das armselige Gasthaus, ein Orientale empfing Dich, es war ein Diener, der Dich zu seinem Herrn führte.
Er nannte sich Chebrazzim und sagte Dir auf den Kopf zu, weshalb Du zu ihm kämst. Soll ich Dir wiederholen, was er Dir alles sagte?«
»Es ist nicht nötig!«, flüsterte Oskar, den anderen immer mit großen Augen anstarrend.
»Du aber ließest Dich nicht von seiner magischen Sehergabe überzeugen.«
»Weil er dies alles auch von anderer Seite gehört haben konnte, so wie auch die betrügerischen Medien immer meine Vergangenheit vorher ausgekundschaftet hatten.«
»Du verlangtest einen vollgültigen Beweis von seinen übernatürlichen Fähigkeiten.«
»Und diesen Beweis versagte er mir.«
»Nein, er war bereit dazu.«
»Aber er forderte, dass ich sein Schüler würde, sein Diener, sein Sklave mit Leib und Seele, und das auf Lebenszeit.«
»Nein, sondern nur so lange, bis Du die nötige Stufe erreicht hättest, dass er Dich freigeben könne.«
»Niemals ließ ich mich auf so etwas ein!«
»Da konnte Dir der Magier auch nicht solch einen Beweis geben. Aber er versicherte Dir, dass Du sechs Jahre später von selbst zu ihm kommen würdest, Du würdest ihn wiederfinden, ganz unvermutet, und dann würdest Du mit ihm das jetzt unterbrochene Gespräch fortsetzen.«
»So sagte er.«
»Und was tatest Du?«
»Ich lachte.«
»Und was geschah dann?«
»Da sagte mir der Chaldäer, der er sein wollte, er würde mir dennoch zu Willen sein. Da er aber hierdurch ein heiliges Gelübde bräche, bedeute dies für ihn den Tod.«
»Und weiter?«
Wieder wurde der sonst so eiserne Mann von der größten Erregung ergriffen.
»Da offenbarte mir der Chaldäer etwas, was er unmöglich von anderer Seite hatte erfahren können, denn es waren die tiefsten Geheimnisse meines Herzens.«
»Und dann?«
»Und da, als ich ihn mit meinen Händen gefasst hatte, wie er von mir gefordert, zerfiel der ganze Mann plötzlich unter diesen meinen Händen wie in Staub, oder er zerfloss wie in Luft, ich behielt in meinen Händen nur ein Bündel loser Kleider.«
»Und was tatest Du?«
»Ich floh entsetzt davon, in mein Hotel. Dort erst kam ich wieder zur Besinnung. Und da sagte ich mir mit Ruhe, dass ich dies alles nur geträumt haben könnte, oder es war nur eine Illusion durch Suggestion gewesen, und das umso mehr, da der Magier vorher in dem Zimmer mit süßlich duftenden Kräutern geräuchert hatte. Als ich mich am anderen Tage in jenem Gasthofe erkundigte, sagte man mir, dass die beiden Orientalen über Nacht abgereist seien. Zwar hatte man nur den einen mit seinem Gepäck davon gehen sehen, aber das tat ja nichts weiter zur Sache. Ich war eben wiederum das Opfer eines Betrügers geworden. Jene Offenbarungen hatte ich nur in meiner Einbildung gemacht, oder sie waren mir eben in narkotischem Rausche abgenötigt worden.«
Mit völliger Ruhe, die er wiedergewonnen, hatte es Oskar gesagt.
»Hast Du denn nicht oft an dieses Begebnis gedacht?«
»Das wohl, aber immer habe ich derartige aufsteigende Gedanken mit Energie zu unterdrücken gewusst.«
»Weshalb?«
»Weil es mir unliebsam war, daran zu denken. Weil ich mich schämte, weil ich mich als Opfer eines Betrügers fühlte.«
»Unterdessen bist Du anderer Ansicht geworden?«
»Nein, durchaus nicht.«
»Du zweifelst noch immer, dass es Menschen gibt, die über magische Kräfte gebieten?«
»Ja.«
»Bist Du durch jenes Kind nicht anderer Ansicht geworden?«
»Das ist etwas ganz anderes. Dass es so etwas wie Mondsüchtigkeit, Somnambulismus und dergleichen gibt, daran habe ich überhaupt nie gezweifelt, diese Möglichkeit ist heute schon wissenschaftlich ergründet, so weit sich so etwas ergründen lässt. Aber das, was man einfach Zauberei nennt, nein, an so etwas glaube ich nicht.«
»Hast Du nicht fast das ganze letzte Jahr eifrigst in einer Zauberbibliothek studiert?«
»Woher ist Dir dies bekannt?!«, stutzte Oskar wiederum etwas.
»Ich weiß es. Bitte antworte.«
»Ja, ich tat es, ich las über die altorientalischen Geheimakten, äußerst interessant war es allerdings, aber ich amüsierte mich doch nur darüber, was es für einen Aberglauben in der Welt gibt.«
»Hast Du auch vom Megalis el Hiemit gelesen, vom Hause der Weisheit?«
»Nein.«
»Von den Kebirs el Mufta, von den Fürsten der Schlüssel und ihrer geheimen Verbrüderung, welche die ganze Welt umfasst?«
»Auch nicht.«
»Du gehörst mit zu dieser Verbrüderung.«
»Nicht dass ich wüsste.«
»Du wirst ihr beitreten.«
»Ich habe nicht die Neigung dazu.«
»Du bist vom Schicksal dazu bestimmt.«
»An solch eine Schicksalsbestimmung glaube ich nicht.«
»Du wirst Dich überzeugen lassen müssen, dass kein Mensch seinem Schicksal entrinnt.«
»Darauf lasse ich es erst ankommen.«
»Hast Du denn nicht bereits einen Beweis der Wahrheit davon erhalten?«
»Inwiefern?«
»Die sechs Jahre sind verflossen. Du hast mich wiedergefunden, wie ich Dir damals prophezeit habe.«
»Da müsstest Du mir erst beweisen, dass Du wirklich jener Chebrazzim bist.«
»Habe ich es Dir nicht schon bewiesen?«
»Durchaus nicht.«
»Du selbst sagtest doch vorhin, dass niemand anders wissen könne, was Du damals mit jenem Chaldäer gesprochen hast.«
»Das sagte ich nur so in meiner ersten Aufregung. Wie ich sonst darüber denke, habe ich Dir ja mitgeteilt. Der Chaldäer hat mir meine geheimsten Gedanken in einem narkotischen Rausche entrissen und sie dann anderen verraten. Du hast erfahren, dass ich hier in Ägypten bin, und nun näherst Du Dich mir, um Deinen alten Hokuspokus wieder zu beginnen.«
»Nein, nicht ich habe mich Dir genähert, sondern Du Dich mir. Du bist es, der mich gesucht und gefunden hat.«
»Wie das?«
»Hast Du nicht die Mumie mit dem Schlüssel gesucht und gefunden?«
»Was hat diese Mumie mit Dir zu tun?«
»Dieser alte Mann, der fast schon tausend Jahre dort unter dem Wüstensande vergraben gelegen hat — der war einst ich! In dieser jetzigen Mumie hat einst meine Seele gewohnt!«
Mit spöttischem, allerdings auch etwas unsicherem Lächeln blickte Oskar den jungen Beduinen an, der das so ganz gelassen gesagt hatte.
»Du glaubst wohl an Seelenwanderung?«
»Ich glaube an das, was ich als Wahrheit erkannt habe.«
»Wer ist denn dieser alte Mann gewesen, der schon vor tausend Jahren gelebt hat?«
Der Scheik el Dschebel — richtiger der Dais el Dschebel — der Alte vom Berge.«
»Aaaaah!«, kam es langgedehnt aus Oskars Munde. Plötzlich fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Schon vorhin bei dem Schreckensruf der entfliehenden Beduinen hätte er gleich darauf kommen können, nur weil sie statt Scheik das Wort Dais gebraucht hatten, das hatte ihn irre geführt.
Aber der Scheik el Dschebel, der Vetulus de montanis, wie er in den lateinisch geschriebenen Chroniken genannt wird, das freilich war ihm ein bekannter Name. Vor diesem hat einst die ganze Welt, so weit sie damals bekannt gewesen, gezittert!
Wir werden später darauf zurückkommen.
»Hassan der Assassine?«
»Ja.«
»Der Stifter der furchtbaren Sekte der Fedawihs?«
»Ja.«
»Er starb im Juli 1125.«
»Du bist genau unterrichtet, soweit es Jahreszahlen nach Eurer Rechnung anbetrifft. Doch wo ist er gestorben?«
»Das weiß ich allerdings nicht.«
»Wo ist er begraben worden?«
»Auch das ist mir unbekannt.«
»Niemand hat ihn sterben sehen, er ist verschwunden — sela.«
»Und dieser Alte vom Berge willst Du gewesen sein?«
»Ich war es und ich bin es noch. Der Alte vom Berge ist unsterblich. Nur seinen Körper kann er wechseln, wie er will, seine Seele, sein eigentliches Ich bleibt immer dasselbe.«
»Deine Seele kann nach Belieben den Körper verlassen und eine andere Gestalt annehmen?«
»Du sagst es.«
»So mache mir das einmal vor.«
»Du sollst es schauen. Nur gestatte mir noch einige Fragen. Weißt Du, wo Du Dich hier befindest?«
»Im Deschebel el Ghossar.«
»Ja, im Geistergebirge — im Reiche der Geister — und hier herrscht der Alte vom Berge, und der bin ich. Willst Du mein Schüler werden?«
»Schon einmal hast Du — wenn Du damals wirklich derselbe gewesen bist — diese Frage an mich gestellt.«
»Ich wiederhole sie jetzt.«
»Weshalb tust Du das?«
»Weil Du vom Schicksal dazu bestimmt bist, mein Schüler und Nachfolger zu werden.«
»Wenn ich vom Schicksal dazu bestimmt bin, so kommt das ja ganz von allein, da brauchst Du mich ja gar nicht erst zu fragen.«
»Doch, ich muss es. Wie das zu verbinden ist, das verstehst Du jetzt noch nicht. Ich bin verpflichtet, Dich zu fragen, ob Du bereit bist, ganz freiwillig mein Schüler und Anhänger und Nachfolger zu werden.«
»Was forderst Du dafür?«
»Unbedingten Gehorsam.«
»Niemals!«
»Wenn ich Dich tausend Meilen von hier sende, so hast Du schweigend zu gehen, ohne nach dem Warum zu fragen, hast Aufträge auszuführen, die Dir völlig unerklärlich, sogar sinnlos erscheinen.«
»So etwas würde ich nie tun.«
»Hast, wenn ich es Dir gebiete, Deine Verwandten und Freunde zu verleugnen ...«
»Höre auf von so etwas!«
»Und wenn ich Dir den Dolch in die Hand gebe und befehle — töte den, töte jenen ... Du hast es auszuführen, ohne nach dem Warum zu fragen.«
»Und was soll mir denn nun für solch bedingungslosen Gehorsam werden?«, lächelte der germanische Hüne.
»Dafür gebe ich Dir alle Macht der Erde.«
»Was heißt das, alle Macht der Erde?«
»Du bist Herr dieser Erde, Du gebietest über die Elemente, über Sturm und Meereswogen — und an diese Erde sind alle Geister gebunden — auch über sie gebietest Du.«
»Du willst mich ganz einfach, wie man so sagt, zum Zauberer ausbilden.«
»Du sagst es.«
»Werde ich mit dieser Allmacht sofort belehnt?«
»Nein, das ist nicht möglich, das kannst Du auch nicht verlangen. Du musst von Stufe zu Stufe klimmen. Denn Du kannst ja jederzeit mir abtrünnig werden, mir den Gehorsam verweigern, kannst überhaupt ganz freiwillig zurücktreten. Natürlich erhältst Du als Belohnung niemals mehr, als was Du verdient hast, und so geht das von Stufe zu Stufe.«
»Gut, ich sehe ein, dass das recht und billig ist«, ging Oskar wenigstens zum Scheine auf diesen seltsamen Vorschlag ein. »Nur muss ich erst sehen, dass ich durch solchen Gehorsam auch wirklich in Sachen der Magie etwas erreichen werde. Erst musst Du selbst mir etwas vormachen.«
»Ich bin bereit dazu.«
»Das sagtest Du schon damals vor sechs Jahren, wusstest aber immer wieder Ausflüchte.«
»Die sechs Jahre sind verstrichen, jetzt kann ich es Dir beweisen.«
»Dann los einmal, zaubere mir etwas vor!«
Der Beduine griff unter seinen Burnus, zog eine schwarze Büchse hervor, öffnete sie, schüttete etwas in seine Hand und warf es ins Feuer. Es qualmte mächtig, ein intensiver Rauch entwickelte sich.
»Ahaaa, Du gebrauchst schon wieder solche Räucherungen, um mich zu betäuben!«, rief Oskar, sich zurückbeugend.
»Sind wir nicht im Freien?«
»Das bleibt sich gleich, dieser betäubende Rauch kann auch im Freien wirken.«
»Riechst Du etwas, merkst Du etwas, dass er Dich betäubt?«
»Das allerdings noch nicht, aber ...«
»Er betäubt Dich nicht, versichere ich Dir!«
»Wozu gebrauchst Du denn da diesen Rauch?«
»Das werde ich Dir später erklären, wenn Du mich erst verstehen kannst, was jetzt noch gar nicht möglich ist. Nun passe auf.«
Immer stärker hatte sich der an sich ganz geruchlose Rauch entwickelt, er schwebte in Wolken und schleierartigen Strichen durch dass ganze Tal, auch an dem anderen Feuer wurde man darauf aufmerksam, Oskar sah, wie seine Leute hierher blickten.
Der Beduine streckte beide Arme aus, und es war nicht anders, als ob er den Rauch mit den Händen fassen könne, so zog er ihn an sich heran und ballte ihn um sich herum, bis er ganz in eine Wolke eingehüllt war, die ihre runde Form von festen Umrissen beibehielt.
»In welcher Gestalt willst Du mich erblicken?«, erklang es aus dieser undurchsichtigen Rauchwolke hervor.
»Das überlasse ich zunächst Dir!«, entgegnete Oskar, diesen Vorgang zunächst nur mit gespanntem Interesse beobachtend.
Er war schon im Orient gewesen, nicht nur in Ägypten, auch in Indien und China, hatte Gaukeleien ähnlichen Schlages schon zur Genüge gesehen.
Die arbeitenden Hände zogen die Wolke wie einen Schleier auseinander und ... statt des jungen, schönen Arabers mit dem kurzen, schwarzen Vollbarte saß da ein alter, pockennarbiger Mann mit langem, weißem Vollbarte, der ihm bis auf die Brust wallte. Nur dass das Beduinenkostüm dasselbe geblieben war.
»Der Chaldäer — bei allem, was lebt, der Chaldäer Chebrazzim!«, stieß Oskar wahrhaft erschrocken vor.
»Ich bin es!«, sagte eine ganz andere Stimme.
Schnell hatte sich Oskar wieder gefasst. Er war eben solche Gaukeleien schon gewohnt, wenn er sie sich auch nie hatte erklären können.
»Wie bringst Du diese Umwandlung zustande?«
»Das nennt man eben Magie.«
»Es ist nur Einbildung.«
»Was Einbildung?«
»Das gaukelst Du mir nur vor, das beruht nur auf Gedankenübertragung.«
»Fasse meinen Bart an.«
Oskar tat es. Der lange Bart war echt.
»Es ist dennoch nur Illusion.«
»Rufe Deine Leute, die mich auch vorhin gesehen haben, ob jetzt hier nicht ein ganz anderer sitzt.«
Oskar blickte nach seinem alten Feuer. Es war zwischen den auf und ab schwebenden Wolken und Streifen des Rauches doch noch deutlich zu sehen, ebenso die daran sitzenden Personen. Aber er verzichtete darauf, jemanden zu rufen.
»Zeige mir etwas anderes.«
»Wen willst Du sehen?«
»Den, an den ich denken werde.«
Wieder floss der Rauch um die Gestalt zusammen, ging wieder auseinander, und statt des Arabers saß da jetzt ein junges, schönes Weib mit blonden Haaren und lächelte ihr Gegenüber an.
Mit einem wahren Schreckensschrei was Oskar aufgesprungen.
»Juliette!«
Er breitete die Arme aus — doch schon wurde das junge Weib wieder von dem Rauche umflossen, der jetzt von ganz allein auf die Gestalt zuströmte, er wich wieder, und da saß wieder der junge Beduine.
Oskar hatte sich schnell wieder beruhigt.
»Sinnestäuschung!«
»So sagst Du!«
»So gib mir eine andere Erklärung.«
»Du würdest sie jetzt gar nicht verstehen. Ich werde Dir einen dritten Beweis geben, dass ich mich verwandeln kann, und zugleich einen Beweis, dass keine Sinnestäuschung vorliegt. Willst Du Dir irgend einen Gegenstand aus Deinem Lager holen lassen?«
»Welchen Gegenstand?«
»Irgend einen. Nur nicht gar zu groß und zu schwer möchte er sein, und dann vor allen Dingen musst Du ihn auch genau als Dein Eigentum erkennen.«
»Ich vermisse meinen Tabaksbeutel, ich habe ihn im Zelt liegen gelassen.«
»So lasse diesen holen. Hast Du ein Blatt Papier bei Dir, auf das Du schreiben kannst?«
Oskar zog einen Notizblock aus der Tasche.
»So schreibe auf, dass Deine Leute Dir Deinen Tabaksbeutel schicken sollen.«
»Durch wen?«
»Durch den Überbringer der Botschaft.«
»Wer ist das?«
»Das wirst Du sehen, wenn sich die Rauchwolke wieder geteilt hat. Den Zettel steckst Du in die Kapsel. In welche Kapsel, das wirst Du dann schon selbst sehen. Hast Du geschrieben?«
»Ja.«
»So pass auf.«
Noch immer schwebten Rauchwolken als Ballen und Streifen ringsumher, diesmal arbeiteten wieder die Hände, sie zogen den Rauch wieder zusammen, bis er den Beduinen in einer dichten Wolke umgab, gleich darauf teilte er sich wieder und ... statt des Beduinen saß da am Feuer ein Hund.
Eine Art Schäferhund, den es auch im Orient gibt, ein ledernes Halsband um, von dem eine Kapsel herabhing.
Oskar — wie wir ihn aus besonderen Gründen noch nennen wollen, da er bald einen anderen Namen bekommen sollte — staunte über diese Verwandlung weniger, als man hätte annehmen müssen, nachdem er bei beiden vorhergehenden doch so aufgeregt worden war.
»In ein Tier, in einen Hund kannst Du Dich verwandeln?«, fing er sogar zu lachen an.
Der Hund hatte sich aufgerichtet und wedelte freudig mit dem Schwanze.
»Also Du willst meine Botschaft befördern?«
Eine Art von Niesen bejahte, wie es manche Hunde ganz von selbst verstehen.
Zunächst streichelte Oskar das Tier, was es sich wohlgefallen ließ, dann fasste er es am Halsbande, mit der anderen Hand griff er in die Tasche.
»He, was meinst Du denn nun, wenn ich Dir jetzt Deinen schönen Schwanz abschnitte?«
»Du würdest mich verstümmeln!«, erklang es zurück, wie aus dem Hundemaule heraus, obgleich sich dieses nicht bewegt hatte.
»Aha, aha!«, lachte Oskar. »Nein, Herr Almansor. ich will Sie nicht verstümmeln. Hier, übernimm die Botschaft, Du braves Hundevieh.«
Er öffnete die Kapsel am Halsband, steckte den zusammengefalteten Zettel hinein, schloss sie wieder, und sofort eilte der Hund in der Richtung des anderen Lagerfeuers davon.
Wenn ihn Oskar nicht auf dem Wege selbst beobachten konnte, so musste er ihn doch dort im Feuerscheine wieder auftauchen sehen, und er blickte wohl auch einmal hin, hielt sich aber nicht lange damit auf, sondern er ging um dieses Feuer hier herum, trat einmal dort, wo der Beduine gesessen hatte, mit den Füßen auf, so vertrieb er sich die Zeit.
Nicht lange, so tauchte der gelbe Hund aus der Finsternis wieder auf und präsentierte im Maule den Tabaksbeutel. Dann setzte er sich wieder an seine alte Stelle, der Rauch zog sich von selbst um ihn herum, und als sich der undurchsichtige Nebel wieder hob, saß dort wieder der junge Beduine.
»Nun gehe hin und frage Deine Leute, ob nicht ein Hund bei ihnen gewesen ist mit Deinem Befehl, ihm Deinen Tabaksbeutel mitzugeben.«
»Ich verzichte.«
»Du willst nicht hingehen?«
»Nein.«
»Weshalb nicht?«
»Weil ich von vornherein überzeugt bin, dass sie bei Ehre und Gewissen schwören, einen richtigen Hund vor sich gehabt zu haben.«
»Nun, ist Dir das dann kein vollgültiger Beweis für das, was ich behauptet habe?«
»Ich will Dir etwas sagen, Almansor. Wie Du das gemacht hast, ist mir ganz gleichgültig. Entweder auch die dort drüben sind hier von diesem Rauche betäubt worden, Du hast sie suggeriert, den Hund nur in ihrer Einbildung zu sehen, während Du selbst dort gewesen bist, oder ... doch ich habe es ja schon gesagt: Es ist mir ganz, ganz gleichgültig, wie Du diese Gaukelei zustande gebracht hast. Denn es ist doch nichts weiter als eine Gaukelei. Und da habe ich übrigens in Indien von den Fakiren schon viel, viel wunderbarere Kunststückchen gesehen. Aber das eine will ich doch auch noch sagen: Du kannst Dich in keinen Hund und in kein anderes Tier verwandeln, Du und kein anderer Mensch! Mehr brauche ich nicht zu sagen.«
Der Beduine zuckte die Achseln.
»Und Du wirst dennoch mein Schüler und Nachfolger!«, sagte er dann.
»Weshalb soll ich denn nur Dein Nachfolger werden?«
»Weil es Bestimmung des Schicksals ist.«
»Lass einmal diese Schicksalsbestimmung aus dem Spiele. Was hast Du eigentlich mit mir vor? Nun einmal frei heraus mit der Sprache!«
»Du hast den Mufta el Ghossar gefunden.«
»Was hat es denn nur mit diesem Geisterschlüssel für eine Bewandtnis?«
»Wer ihn besitzt, dem sind alle an die Erde und ihre Elemente gebundenen Geister untertänig.«
»Nun gut, ich will einmal drauf eingehen. Diesen Geisterschlüssel besaß der sogenannte Alte vom Berge, Hassan der Assassine?«
»Du sagst es.«
»Er verlor ihn?«
»Er wurde dort, wo Du ihn fandest, von einer Sandlawine verschüttet. Es war sein Verhängnis.«
»Vor tausend Jahren?«
»Vor tausend Jahren.«
»Und niemand hat seine Leiche gefunden?«
»Niemand. Er durfte nicht gefunden werden.«
»Weshalb nicht?«
»So stand es im Buche des Schicksals geschrieben.«
»Na meinetwegen. Nun aber bist Du doch selbst dieser Dais el Dschebel.«
»Ich bin es.«
»Du wirst immer wieder geboren?«
»Sofort.«
»Sofort nach Deinem jedesmaligen Tode?«
»Augenblicklich.«
»Und kannst Dich auch immer wieder entsinnen, dass Du der Alte vom Berge gewesen bist?«
»Jedes Mal in meinem zwölften Jahre kommt mir diese Erkenntnis, dann fliehe ich die Menschen.«
»Kannst Du Dich an alles und jedes in Deinen frühern Lebensläufen erinnern?«
»An alles.«
»Dann musst Du doch auch jetzt und schon früher immer gewusst haben, wo der ehemalige Alte vom Berge verunglückt ist.«
»Ich weiß es und wusste es immer.«
»Und Dir ist an dem Besitze dieses wunderbaren Geisterschlüssels doch natürlich sehr viel gelegen.«
»Sehr viel.«
»Weshalb hast Du denn da Deinen alten Leichnam nicht selbst wieder herausgeschaufelt?«
»Ich durfte es nicht.«
»Weshalb nicht?«
»Auf diesem Schlüssel ruht ein Fluch. Mehr darf ich Dir nicht sagen.«
»Na da! Dass aber so etwas kommen würde wie ein Fluch oder ein Schwur oder so etwas Ähnliches, das habe ich mir gleich lebhaft gedacht. Also Du selbst durftest Dir den Schlüssel unter keinen Umständen wieder aneignen.«
»Nein.«
»Ein anderer musste es für Dich tun.«
»Ja.«
»Und dieser andere soll nun ich sein.«
»Du sagst es. Du bist vom Schicksal dazu bestimmt.«
»Wenn Du nur Dein ewiges ... na meinetwegen. Weißt Du eigentlich, weshalb ich hier bin?«
»Ja.«
»Nun?«
»Du suchst einen Mann namens Edward Scott, der mit der Königin der Nacht auf seiner Flugmaschine verschwunden ist.«
Oskar war nicht sonderlich überrascht, dies plötzlich so deutlich aus diesem Munde zu vernehmen. Wer wusste denn, was da schon aus irgend einem Grunde für Intrigen gesponnen worden waren.
»Lebt dieser Edward Scott noch?«
»Ja.«
»Wo?«
,Du wirst es erfahren.«
»Wann?«
»Sobald Du einer der unsrigen geworden bist.«
»Da kannst Du ja lange ... na meinetwegen. Wer ist diese Königin der Nacht?«
»Auch das wirst Du erfahren.«
»Natürlich — wenn ich einer der Eurigen geworden bin. Was soll ich denn nun bei Euch?«

»Die ganze Verbrüderung der Assassinen vernichten.«
»Die Du erst gegründet hast, vor tausend Jahren?«
»Du sagst es.«
»Weshalb soll sie vernichtet werden?«
»Weil sie vom Bunde abgefallen sind, weil sie verbotene Dinge treiben. Du bist vom Schicksal dazu bestimmt, diese Sekte, die sich über die ganze Erde erstreckt, mit Stumpf und Stiel auszurotten.«
»So so. Also dazu soll ich Dir unbedingten Gehorsam schwören?«
»Ja.«
»Und wenn ich da nun nicht mitmache?«
»Du musst.«
»Oho! Mein lieber Freund, gib Dir doch keine Mühe mehr ...«
»Ehe der Mond aufgeht, hast Du mir diesen unbedingten Gehorsam geschworen.«
Kaltblütig zog Oskar seinen Taschenchronometer.
»Gleich um neun. Der Mond geht neun Uhr zwanzig auf. Da musst Du Dich aber beeilen, mein Freund.«
Der Beduine beugte sich vor, wurde zum ersten Male so vertraulich, dass er dem anderen auf das Knie des untergeschlagenen Beines die braune Hand legte, eine feine, schlanke, aber doch ungemein kräftige, muskulöse Hand.
»Höre mich an, mein Prinz, der Du von nun an wieder sein musst, weil es so im Buche des Schicksals verzeichnet steht, Prinz Joachim ...«
Wir lassen die beiden allein.
Mit wunderbarer Farbenpracht ging die Wüstensonne auf. Sie sind herrlich, die Sonnenaufgänge im Hochgebirge bei schönem Wetter, aber an Farbenpracht lassen sie sich mit denen der nordafrikanischen Wüstenregion nicht im Entferntesten vergleichen.
Das eigentliche Farbenspiel hat man kurz vor Aufgang der Sonne, ehe sie sich über den Horizont erhebt.
Erst entsteht dicht über dem Horizont ein dunkelroter Streifen, der schnell bis zum Zenit zum ganzen Farbenspektrum auswächst, also in der Reihenfolge: Rot, Orange, Gelb, Grün, Cyan, Indigo, Violett, Lavendel.
Es ist eine unbeschreibliche Pracht wie diese Farben ineinander übergehen!
Und nun dazu diese Totenstille in diesem erstarrten Sandmeere!
Und wenn nun dann die glühende Kugel auftaucht und am Firmament empor rollt!
Man soll es nicht zu beschreiben versuchen. Es ist und bleibt immer nur ein kläglicher Versuch!
Man kann in der Wüste sehr leicht zum Sonnenanbeter werden — das sagt wohl mehr als alles andere — und das ist für den denkenden Menschen, der freilich selbst längere Zeit in der einsamen Wüste gehaust haben muss, auch derjenige Grund, weshalb der Mohammedanismus mit so furchtbarem Nachdruck, was überhaupt diese ganze Religion ja ausmacht, einen einzigen Gott betont. Allah il Allah, Allah il Allah!
Nebenbei bemerkt: Dieses Farbenspektrum, das Zerlegen des Sonnenlichtes in seine einzelnen Grundfarben, kommt deshalb hauptsächlich oder überhaupt fast nur in der afrikanischen Wüste vor, bei Sonnenaufgang, weil dem glühenden Tage immer eine sehr kalte Nacht gefolgt ist, mit Temperaturunterschieden bis zu 30 Grad, am frühen Morgen wirkt wiederum die Wärme der Sonne, dadurch entstehen einzelne Luftschichten von ganz verschiedener Dichte, die sich aber regelmäßig übereinander lagern, diese zerlegen das Licht durch Brechung in seine Grundfarben. —
Dieses Farbenspiel war beendet, die Sonne hatte sich höher erhoben und blickte in das kleine Mimosental hinein, in dem die Kamelkarawane lagerte.
Die acht Männer waren mit dem Abkochen eines ausgiebigen Frühstücks beschäftigt, das, wenn es sein musste, für den ganzen Tag vorhalten konnte. Zum Beispiel schon dieser einzige Topf, in dem ein Ragout von verschiedenen geräucherten und gesalzenen Fleischsorten schmorte, hätte den Tagesproviant für eine Karawane von einem halben Hundert Beduinen gebildet, die, wenn sie tüchtig hungrig sind, ja nur eine Hand voll Datteln brauchen, und sie sind wieder gesättigt. Aber es waren germanische Mägen, die hier des ersten Frühstücks harrten. Ja, es waren lauter blondhaarige, blauäugige Germanen, die ihren fürstlichen Führer hier in die Wüste begleitet hatten. Es ist schon einmal gesagt worden und es muss nochmals betont werden. Nämlich es hängt damit zusammen, dass diese Männer auch jetzt noch in ihren Wüstenkostümen alle einen so seemännischen Eindruck machten, wie sie auch meist Plattdeutsch sprachen, und das Gericht, das sie da aus Salzfleisch und Kartoffeln zusammenstampften, nannten sie »Labskaus«, und das kennt doch nur der deutsche Seemann. Und die kleinen, durchlochten Hartbrotscheiben nannten sie »Beschüte« — nicht etwa Schiffszwieback, welchen Namen nur der gebraucht, der nichts von Schiffen oder echter Seemannschaft weiß.
Weshalb nun gerade bei diesen deutschen Seeleuten der blondhaarige und blauäugige Germanentypus so stark zum Ausdruck kam?
Da steckt ein großes Geheimnis dahinter!
Es gibt doch auch schwarzhaarige Germanen, ganz echte Germanen, sie mögen so brünett sein wie sie wollen.
Weshalb aber findet man diese denn so sehr, sehr selten unter den deutschen Seeleuten?
Weil das nordische Meer, das hinterlassene Erbe der alten Wikinger, absolut nichts von einer Beimischung fremden Blutes wissen will! Kann es nicht vertragen!
Anders lässt es sich nicht erklären, wenn es auch gar keine Erklärung ist. Genug davon.
Aber nicht etwa, dass es lauter ausgesucht schöne germanische Heldengestalten gewesen wären. Ganz und gar nicht. Manchmal sogar ganz im Gegenteil. Mancher war viel zu klein oder dick oder sogar krumm. Und da war vor allen Dingen einer dabei, bei dessen Erzeugung die Schöpfungskraft einen ganz ekligen Hopser gemacht hatte.
Ein sehr kleiner Mann! Mit seinem einen Meter vierzig hatte er das Militärmaß natürlich bei Weitem nicht, nicht einmal für die Marine, obgleich die doch alle kleinen Krepel nimmt, wenn sie nur sonst Mann stehen, besonders wegen der Torpedoboote, zwischen deren Planken sich ein normaler Mensch nur geduckt bewegen kann.
Auch die Schultern hatte die Schöpfung diesem versagt. Die Arme hingen schräg gleich vom Halse ab. Obgleich eigentlich auch kein Hals vorhanden war. Nur schräge Schulterblätter und ein Kopf. Aber was waren das auch für Arme! Mit diesen hatte ihn die Schöpfung für die fehlenden Schultern entschädigt. Ohne sich irgendwie zu bücken, konnte er sich ganz bequem gleichzeitig beide Waden kratzen. Und nur noch ein klein wenig tiefer, und er berührte mit den Spitzen der ausgestreckten Finger den Boden. Und nun außerdem diese Knochen! Man durfte nicht viel von Händen sprechen, das waren ganz einfach Pfoten oder Tatzen, die der sein eigen nannte, und dennoch waren die Handgelenke fast ebenso breit wie diese Pfoten! Wahre Bärenknochen!
Im Gegensatz zu diesen unförmlichen Händen waren die Füße klein oder sogar geradezu zierlich zu nennen, und ebenso zierlich und sogar elegant waren die Beine, indem sie nämlich einen so eleganten, runden Schwung nach außen hatten. Ohne diesen Schwung wäre der Mann auch gar nicht so klein gewesen. Die Schöpfung hatte ihn ganz einfach aus Versehen zusammengedrückt.
Nun aber dieses Gesicht! In dem fleischigen Gesicht verschwanden die ewig vergnügt blinzelnden Äuglein nur zu Strichen zusammen, und was nun an diesen Augen fehlte, das hatte die Schöpfung, sich ihrer Vergesslichkeit wohl bewusst, wieder an der Nase gut zu machen gesucht.
O diese Nase! Das war überhaupt gar keine menschliche Nase. Das war ein Rüssel. Allerdings nicht der eines Elefanten, sondern der eines — eines ... na, sagen wir es nur frei heraus: Das war ein Schweinerüssel! Es war überhaupt ein ganz regelrechtes Schweinsgesicht. Das eines Pinselschweines, Potamochoerus porcus, welches den allerschönsten Rüssel hat, die Spitze etwas nach unten hängend.
Sollte diese Schweinsähnlichkeit des noch jungen Mannes vielleicht schon bei seinen Vorahnen als erbliche Veranlagung bestanden haben, damals, als die Familiennamen entstanden? Dieser junge Mann führte nämlich den schönen Namen Jochen Puttfarken.
Puttfarken ist Plattdeutsch und heißt so viel wie kleines oder junges Ferkel.
An der deutschen Waterkant ist das gar kein so außergewöhnlicher Name. Er fällt ebenso wenig auf wie anderswo etwa der Name Junghuhn. Das ist doch ein ganz hübscher Name. Wer denkt denn dabei gleich an ein junges Huhn, das eigentlich in die Bratpfanne gehört. So ist's dort oben auch mit dem Namen Puttfarken »Mein Name ist Puttfarken« ... fällt niemandem auf.
Wenn man freilich solch eine Figur hat mit solch einer ausgeprägten Schweinephysiognomie ... »Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle: Mein Name ist Puttfarken« ... dann freilich ist's schlimm.
Na, für sein Aussehen und seinen Namen kann niemand etwas.
Aber für seinen Charakter und sein sonstiges Können ist jeder verantwortlich.
Und Jochen Puttfarken war ein tüchtiger Kerl vom Scheitel bis zur Sohle!
Er war Koch. Mehr als kochen konnte er ja allerdings nicht, aber kochen konnte er, und das genügte. Wenn nur jeder immer gerade das von Grund auf versteht, in dieser einzigen Sache Meister ist, der er sich gewidmet hat, dann wäre schon alles anders in der Welt.
Er war Schiffskoch, Karawanenkoch, Expeditionskoch. Was das zu bedeuten hat, das weiß freilich nur wieder der zu würdigen, der so etwas schon mitgemacht hat. Da ist es nicht damit abgetan, feine Braten mit farcierten Saucen herzustellen, einen Truthahn zu trüffeln, Ragouts zu brauen und Puddings zusammen zu kleistern — das verlangt man von einem geschulten Koch als etwas ganz Selbstverständliches, sonst wird er zum Teufel gejagt. Aber ein Expeditionskoch! Dazu gehört überhaupt ein Genie, das angeboren sein muss, das kann man sich nicht aneignen.
Jochen Puttfarken verstand, zehnjährige Erbsen weichzukochen, ohne dass man den geringsten Sodageschmack merkte, ja sogar, ohne dass man — auf gut Deutsch fein französisch gesagt — hinterher die Diarrhoe bekam. Jochen Puttfarken konnte eine alte abgelegte Stiefelsohle in ein zartes Beefsteak verwandeln. Ja, dieses krummbeinige Kochgenie mit dem Rüsselschweinsgesicht konnte sogar — seine ureigenste Erfindung, unpatentiert, da sie ihm sonst doch nur gestohlen worden wäre, also sein tiefstes Geheimnis — aus gewöhnlichem Gras ein delikat schmeckendes Gemüse zubereiten! Allerdings ohne Nährwert, aber doch sättigend und verdaulich. Jochen Puttfarken wusste wohl selbst nicht, was das zu bedeuten hat. Dass er im Handumdrehen ein Millionär hätte sein können. Denn wenn man nur wüsste, wie man die gewöhnlichen Grasarten für den Menschen durch Kochen genießbar machen könnte. Das ist so ein Problem, da liegen sie auf der Straße, die Millionen!
Und noch eine andere Tugend besaß Jochen Puttfarken, die man eigentlich bei jedem Koche als selbstverständlich voraussetzt, die aber durchaus nicht bei jedem zu finden ist. Nur die unverbesserlichsten Optimisten denken so. Er war immer von peinlichster Sauberkeit. Was sich auch schon in seinem eigenen Äußeren ausdrückte. Auch hierin musste er etwas wie ein Geheimnis besitzen. Und wenn sein fürstlicher Gebieter mit großer Weltexpedition auch tage- und wochenlang durch morastige Sümpfe marschierte, alle anderen von oben bis unten mit Schlamm bespritzt waren — dieses Kerlchen war immer schneeweiß, immer wie aus dem Ei geschält. Man wusste gar nicht, wie er es machte, dass er sich immer so sauber halten konnte. Er machte sich eben nicht schmutzig. Und dasselbe galt von seinen Kochtöpfen und von allem.
Durch alles dies war in dem kleinen Manne, der erst fünfundzwanzig Jahre zählte, noch eine andere Charaktereigenschaft entstanden, die allerdings keine Tugend war, die aber, wie die Sache nun einmal lag, auch gar nicht ausbleiben konnte:
Jochen Puttfarken war eitel, sehr eitel, schier maßlos eitel!
Nicht etwa auf sein Können, sondern auf seine Person, auf sein Äußeres.
Alles, was er verdiente, legte er in Toiletten an. Natürlich nur echt englische Kostüme. Wenn der Prince of Wales in langen, langen, schlaflosen Nächten sich zu dem Entschlusse durchgerungen hatte, das europäische Gleichgewicht dadurch zu verschieben, dass er die einzige Hosenfalte in deren zwei verwandelte, hingegen die bisherigen zwei Knopfreihen des Gehrockes auf nur eine einzige zu reduzieren, dann konnte man Jochen Puttfarken in der nächsten Stadt, die er aus der Wildnis betrat, ganz gewiss mit zwei Hosenfalten und nur einer einzigen Knopfreihe herumstolzieren sehen.
Auf der Reise hörte das natürlich auf. Aber immerhin, wenn er nicht kochte, so beschäftigte er sich doch am liebsten mit dem Binden seiner Krawatte — oder er wusch seine Arbeitssachen. Und das war es, was diesen Koch so unbezahlbar machte!
Darf man sich da noch viel wundern, wenn dieses kleine Krummbein mit dem Rüsselschweinsgesicht auch sonst sehr eingebildet auf sich war, wenn es sich für einen Apollo, für einen Adonis, für einen bezaubernd schönen Menschen hielt?
Und ein Glück für den armen Kerl, dass er's nicht anders wusste! Ein überaus glücklicher Charakter und auch sonst eine Seele von einem Menschen!
Der hatte ja auch nicht umsonst solche vergnügt zwinkernde Schweinsaugen.
Die Männer hier, die durch Not und Tod zusammengeschweißt waren, nannten ihn Zwergnase oder Nasenkönig.
»Wo ist denn der Nasenkönig?«
»Komm mal her, Zwergnase.«
Gar keine Ahnung davon, dass dies ihn etwa beleidigt oder gekränkt hätte.
Er kannte es gar nicht anders.
Das heißt aber — von anderen ließ er sich nicht etwa so nennen!
Da konnte auch Jochen Puttfarkens unendliche Gutmütigkeit mal aufhören!
Da knallte es!
Und die Schöpfung hatte diesem ihrem verunglückten Gebilde nicht umsonst solche kolossale Pfoten mit solchen Bärenknochen verliehen.
Wo der in berechtigtem Grimm hinhaute, da wuchs kein Gras mehr, das er noch kochen konnte. — — —
Also Jochen Puttfarken war mit dem Zubereiten des Frühstücks beschäftigt, hatte gar viele Töpfe auf den kleinen Reisigfeuern stehen. Die anderen sieben Männer leisteten ihm dabei nur Handlangerdienste. Nicht aber galt das von der kleinen Deasy. Die spielte mit gar wichtiger Miene wirklich die Köchin. Es machte dem Kinde ein Heidenvergnügen, so am offenen Feuer mit den Töpfen herumzuhantieren.
»Der Doktor bleibt recht lange aus!«, hieß es jetzt, als schon der Geruch ankündigte, dass das Hauptgericht fertig sein müsse.
Anderthalb Stunden hatte er gestern Abend mit an dem Feuer des fremden Beduinen gesessen.
Gegen zehn Uhr war er, nachdem er sich durch einen Beduinenhund seinen Tabaksbeutel hatte holen lassen, noch einmal gekommen.
»Ich bleibe heute Nacht aus, komme erst mit Sonnenaufgang zurück.«
So hatte er gesagt, war wieder gegangen, die Mumie in einer Decke mitnehmend.
Dann hatten die beiden Männer dort das verlöschende Lagerfeuer verlassen, waren in der Nacht verschwunden.
Man hatte ihm nichts Besonderes angemerkt.
Was hätte man ihm auch anmerken sollen?
»Wenn unser Doktor einmal erschrickt, so tut er's nur mit Absicht, aus List, um andere zu täuschen. Staunen kann er wohl einmal, aber nicht erschrecken.«
So war einmal hier in diesem Kreise über den abwesenden fürstlichen Herrn gesprochen worden.
Vielleicht also war auch das nur erkünstelt gewesen, als er gestern gestaunt und gestöhnt und vor Erregung sogar gezittert hatte, als ihm der fremde Beduine da andere Personen vorgegaukelt hatte. Denn diese Männer hier mussten ihren Herrn wohl kennen.
Eben deshalb aber wussten sie auch nichts von Sorge, als seit Sonnenaufgang schon eine Stunde vergangen und ihr Herr noch nicht zurück war, hier in der Einsamkeit des Wüstengebirges. Er hatte auch nicht einmal sein Gewehr mitgenommen gehabt.
Und da kam er auch schon!
Man merkte ihm nicht an, dass er in dieser Nacht etwas Besonderes erlebt haben müsse.
So heiter wie immer, so männlich wie immer. Die ganze wie aus Erz gegossene Figur eine einzige Verschmelzung von Güte, strotzender Kraft und ruhiger Kühnheit.
»Guten Morgen, Leute!«
»Guten Morgen, Herr Doktor!«
»Halt! Ich bin von jetzt an Prinz Joachim. So redet Ihr mich fernerhin an. Natürlich nicht königliche Hoheit, sondern einfach Prinz oder mein Prinz. So sprecht Ihr auch unter Euch von mir, auch in Gegenwart von anderen. Ich lasse mein Inkognito fallen. Verstanden?«
Das war seltsam! Oder auch nicht so sehr. Er hatte eben einen Grund, sein Inkognito aufzugeben und den Prinzentitel herauszustreichen, und damit basta.
»Für Dich, mein liebes Kind, bleibe ich natürlich Dein Onkel.«
So sprechend, hob er Deasy auf seine Arme und küsste sie zärtlich.
»Onkel Oskar oder Onkel Joachim?«
»Na, wenn Du mir die Wahl freistellst, dann möchte ich auch von Dir Onkel Joachim genannt werden!«, lachte er.
»Onkel Joachim, ach, das klingt auch viel schöner! Ich muss mich nur erst daran gewöhnen.«
»Aber, Kind, wir müssen uns jetzt trennen.«
»Trennen?!«, rief Deasy erschrocken.
»Nur für einige Zeit. Ich muss noch hier bleiben, Ihr aber müsst nach Medinet el Fayum zurück. Es geht nicht anders.«
Weitere Erklärungen gab es nicht. Wohl noch Instruktionen. aber keine Erklärungen. Feldherr und Soldaten!
Er setzte das Kind wieder an den Boden.
»Also, Leute, nach dem Frühstück brecht Ihr sofort auf, begebt Euch nach Medinet zurück und geht wieder zu Herrn Krothe ins Quartier. Dort wartet Ihr, bis ich eintreffe. Wann, weiß ich noch nicht. Länger als eine Woche werde ich wohl nicht ausbleiben. So Gott will. Nun aber noch etwas anderes. Herr Kapitän Falkenburg!«
Es war ein breitschultriger, ebenfalls noch junger Mann, an den er sich wandte.
»Herr Kapitän Falkenburg! Wir haben schon so manches Jahr zusammen die ganze Welt bereist, sind durch Urwälder und Prärien und Wüsten gedrungen.
Bei allen Expeditionen, die ich unternahm, waren Sie meine rechte Hand, waren nach mir der leitende Führer, waren in meiner Abwesenheit mein Stellvertreter. Und dass ich immer mit Ihnen durchaus zufrieden war, das dürfen Sie mir wohl glauben.
Es sind ganz besondere Umstände, die mich jetzt eine andere Disposition treffen lassen.
Und wenn ich sage, dass es zwingende Gründe sind, so weiß ich von vornherein, dass Sie auch mit allem einverstanden sind, Sie und die anderen Leute.
Ich ernenne hiermit Jochen Puttfarken zu meinem Stellvertreter. Jochen Puttfarken ist während meiner Abwesenheit Führer der Karawane, im Lager Quartiermeister, er ist Offizier der Expeditionen, seinen Befehlen ist bedingungslos Folge zu leisten, er kann Beratungen einberufen und aufheben, sein Wille gilt. Verstanden?«
Der Prinz hatte gesprochen.
Todesstille herrschte rings herum, und doch glaubte jeder einen Donnerschlag gehört zu haben, denn das allerdings war ein starkes Stückchen gewesen!
Wir haben Jochen Puttfarken ziemlich ausführlich geschildert.
Gewiss, es war ein durchaus tüchtiger Kerl.
Er war auch ein durchaus zuverlässiger Mensch und alles andere als dumm, hatte von seiner Frau Mutter eine gute Portion Schlauheit geerbt.
Den konnte man auch ganz ruhig ins Chinesenviertel von San Francisco schicken, der kam, wenn nicht alle Himmel einstürzten, ganz sicher und adrett wieder heraus. Der ließ sich von diesen gelben Spitzbuben weder in eine Spelunke locken noch sonst wie übers Ohr hauen. Dazu war er viel zu schlau und besonders viel zu adrett, wie man sagt, hielt viel zu sehr auf sich. Und eben dabei auch wirklich schlau, pfiffig, gewitzigt, gerissen. Smart sagt der Engländer.
Das war aber auch alles, was man außer seiner Kocherei von diesem Schiffskoch sonst noch sagen konnte.
Und Kapitän Falkenburg war ein patentierter Schiffskapitän und Reserveoffizier, und dann gab es unter diesen Männern noch zwei andere, die als Einjährige gedient hatten, der eine von ihnen war Ingenieur.
Und jetzt wurde dieser Schiffskoch ihnen vorgezogen, rückte plötzlich zum leitenden Führer der Expedition auf?!
Unbegreiflich, unbegreiflich!
Der Prinz führte das neue Verhältnis noch weiter aus, suchte zu mildern, aber viel Zweck hatte es nicht.
»Es ist ja nur eine rein formelle Sache. Ihr wisst doch, wie wir bisher immer zusammen gelebt haben. Auch ich war niemals etwas anderes als jeder von Euch. Wenn jemand gerade eine besondere Beschäftigung vorhatte, und das Salzfleisch musste gewaschen werden — na, dann habe ich's eben gewaschen. Ich habe manchem von Euch sowohl Wunden wie die zerrissenen Kleider geflickt. Einen Offizier hat's bei uns ja niemals gegeben. Aber, wenn ich nun einmal abwesend bin, dann muss doch auch ein Stellvertreter da sein. Schon wegen der Kasse. Überhaupt wegen allem und jedem. Ein Oberhaupt muss nun einmal vorhanden sein. Also, Herr Kapitän Falkenburg und alle Ihr anderen — erkennt Ihr Jochen Puttfarken als führendes Oberhaupt an?«
Nein, das war durchaus keine gütige Vermittlung gewesen, um diese unbegreifliche Anordnung plausibler zu machen.
Aber bemerkenswert, höchst bemerkenswert war die Antwort, die auf diese letzte gestellte Frage erfolgte.
»Jawohl, mein Prinz!«
So war es einstimmig dort in dem Felsengebirge der Libyschen Wüste erschollen, und mit am kräftigsten hatte es Kapitän Falkenburg gerufen.
Wenn es der Herr und Führer dieser Expedition so haben wollte, es so für gut fand — gut, dann wurde es auch befolgt!
Denn dann hatte er auch ganz sicher seine schwerwiegenden Gründe dafür oder er war plötzlich wahnsinnig geworden, wonach er aber gar nicht aussah, was man also auch lieber nicht annehmen wollte.
»Danke, Jungens. Also, Puttfarken, Du bist von jetzt an der erste an der Spritze. Natürlich kochst Du ruhig weiter und ... ach, ich brauche das doch gar nicht erst zu sagen! Aber immerhin, Du bist doch mein bevollmächtigter Stellvertreter, und als solcher hast Du hier auch die Hauptsache zu übernehmen ...«
Prinz Joachim, wie auch wir ihn nun wohl nennen müssen, zog an einem Kettchen aus der Brust die silberne Kapsel, welche Freds und Edward Scotts Haarlocken bargen, und hing sie dem kleinen Krummbein um den Hals.
»Also früh um acht, mittags um zwölf, nachmittags um vier und abends um acht! Wie es gemacht wird, weißt Du ja. Sonst sind die anderen dabei behilflich, wenn Deasy in Trance befragt wird. Was dort geschrieben wird, schreibst Du immer auf ...«
»Schreiben?!«, brachte da Jochen Puttfarken recht kläglich hervor.
Denn er konnte nämlich tatsächlich kaum seinen Namen schreiben. Er hatte es zwar gelernt, aber ... mit solchen Pfoten!
Jetzt musste man doch noch einmal daran denken, dass gerade dieser Schiffskoch es war, den der Prinz zu seinem verantwortlichen Stellvertreter gewählt hatte.
Nicht etwa, dass Schreiben und Lesen den Menschen ausmachen. Wer das glaubt, ach, der hat das richtige Verstehstemich noch lange nicht! Was ist es denn nun, wenn man plötzlich erblindet? Dann kann man noch immer Schlachten lenken, Welten erobern und der Menschheit die größten Gedanken und genialsten Erfindungen schenken. Nein, Lesen und Schreiben macht's nicht aus, so wenig wie Französisch und Klavierspielen und dergleichen, womit man meistenteils keinen Hund hinterm Ofen vorlocken kann. Die wahre, die echte Bildung, der Geisteswitz, das Salz der Erde — das ist etwas ganz, ganz anderes, wovon freilich in keinem Schulbuche und in keinem Konversationslexikon, diesem Gängelbande der Gebildeten, etwas steht.
Aber immerhin, jetzt dachte man doch noch einmal erstaunt daran, weshalb denn nur gerade dieser Kerl, der kaum seinen Namen schreiben konnte, vom Prinzen zum bevollmächtigten Generalvertreter ausersehen worden war? Rätselhaft, ganz, ganz rätselhaft!
»Na, dann lässt Du's eben von einem anderen nachschreiben. Jedenfalls aber bist Du jetzt für alles verantwortlich! Und für das Kind natürlich erst recht! Jungens, beneidet unsern Nasenkönig nicht etwa! Na, Ihr wisst schon, wie ich das meine. Und nun packt mein Kamel. Ist es schon gefüttert? Ich reite sofort ab. Gefrühstückt habe ich schon.«
Das Hedjin wurde gesattelt. Unterdessen schrieb der Prinz einen Brief, den er an ein Wiener Bankhaus adressierte und dem Kapitän Falkenburg zur Postbesorgung in Medinet el Fayum übergab.
»Und dass Ihr's gleich alle erfahrt — so Gott will, ist unsere Expedition nicht vergeblich gewesen. Deasy hat uns nicht umsonst hierher geführt, der Traum einer Mutter, wie ich Euch ja erzählt, wird in Erfüllung gehen — so Gott will, werde ich Edward Scott mit nach Medinet bringen.«
»So befindet er sich gar hier?!«, durfte der fürstliche Gebieter von seinen Leuten ruhig befragt werden.
»Ja, hier in der dichten Nähe wird er von Wüstenbewohnern gefangen gehalten. Und nun Gott befohlen!«
Noch einen zärtlichen Abschied von Deasy, und mit drei Rucken erhob sich das entfesselte Rennkamel, setzte sich sofort in einen schlanken Trab und war mit seinem Reiter in einer Schlucht verschwunden.
Sie standen da, die acht zurückgebliebenen Männer, und blickten dorthin, wo er verschwunden war.
Bis sich sieben von ihnen anstießen, sich gegenseitig auf den achten Mann aufmerksam machten.
Und das war Jochen Puttfarken.
Weil der gar so merkwürdig da stand.
Das rechte Krummbein etwas vorgesetzt, nur mit der Fußspitze den Sand berührend, die linke Hand auf dem Rücken, die rechte vorn im Brustlatz, den Kopf zurück, den Schweinsrüssel in die Luft reckend.

»Herr Gott, was bin ich, und was kann aus mir noch alles werden! Endlich siegt die Tugend, endlich ist meine Größe gewürdigt worden!«
So sagte er.
.Aber nicht etwa mit Worten, Gott bewahre!
Und dennoch, man hörte diese Worte ganz deutlich, aus dieser Stellung heraus.
Aber lange verharrte er nicht in dieser Imperatorstellung, dann verwandelte er sich wieder in den Koch.
»Frühstück ist fertig!«
Er teilte aus, und dann versorgte er speziell seine neue Schutzbefohlene, die etwas weinerlich gestimmt war, schnitt ihr das Fleisch, was er überhaupt immer tat.
»Weine nicht, meine liebe Deasy, sei ein Mann!«, suchte er eine andere Stimmung herbeizuführen.
Das Frühstück war beendet, jeder rieb sein Geschirr mit Sand aus, dann machte sich jeder an die Reinigung eines Topfes, Kapitän Falkenburg nicht ausgeschlossen, und dann wurden die Kamele gepackt. Da gab es nichts weiter zu befehlen, der Prinz hatte ja gesagt, sie sollten gleich nach dem Frühstück aufbrechen.
»Halt!«, ließ sich da Puttfarkens Stimme vernehmen, als sie schon aufsteigen wollten.
Verwundert blickten sie alle nach ihm. Ja, es war gleich etwas Wundern dabei.
Sie alle konnten sich dieses kleine Krummbein so gar nicht als Befehlshaber vorstellen, und schon in diesem Halt hatte so etwas ganz Eigentümliches gelegen.
Jochen Puttfarken hatte seine goldene Uhr an goldener Kette hervorgezogen.
»Was gibt's, Zwergnase?«, fragte einer.
Kein Gedanke daran, dass sich der neue Herr und Gebieter jetzt etwa solch eine Titulatur verbat! Man kannte doch diese Seele von einem Menschen. Sie waren und blieben Kameraden, daran wurde nicht das Geringste geändert.
Aber eine andere Antwort bekam man zu hören, die manchem doch recht zu denken gab, am allermeisten dem Kapitän Falkenburg.
»Es ist zehn Minuten vor acht, da können wir nun auch noch die zehn Minuten warten, bis Deasy vorgenommen werden muss. Oder das ist überhaupt das beste, weil wir dann doch gleich wieder Aufenthalt machen müssten, zumal da nachgeschrieben werden soll, und ich möchte auch, dass alle dabei sind, wenn ich Deasy befrage, und das ist zu Kamel wohl nicht gut zu machen.«
So hatte Puttfarken gesprochen. Und besonders Kapitän Falkenburg blickte plötzlich recht unsicher nach dem Nasenkönig hin. Denn der hatte ganz, ganz recht — er selbst aber, Kapitän Falkenburg — wäre nicht auf diesen Gedanken gekommen und hätte also zehn Minuten später die ganze Karawane wieder halten und absteigen lassen, was denn doch nicht gar so einfach ist.
»Übrigens«, fuhr Puttfarken fort, »brauchen wir ja nicht die Minute einzuhalten, wir können Deasy ja gleich jetzt vornehmen, sie erblickt ja Fred immer.«
»Ob das aber der Prinz auch erlaubt, dass wir sie außer der Zeit in Trance setzen?«, wurde eingewandt.
»Er hat es weder erlaubt noch verboten — das übernehme ich auf meine eigene Verantwortung!«, lautete die selbstbewusste und dennoch mit aller Bescheidenheit gegebene Entgegnung.
Die anderen glaubten ihren Nasenkönig plötzlich gar nicht mehr wiederzuerkennen.
Deasy war selbstverständlich damit einverstanden, das wusste man. Noch immer hätte sie am liebsten fortwährend in Trance gelegen, zumal sie dabei ihren Fred erblickte, von dessen Treiben ihr dann natürlich berichtet werden musste.
Puttfarken ahmte die Manipulationen nach, die er zahllose Male beobachtet hatte, benahm sich ebenso geschickt wie gravitätisch dabei, hatte dazu freilich vorher auch seine rote Krawatte noch einmal besonders schön gebunden.
»Was siehst Du, mein liebes Kind?«, flötete er dann mit seiner zartesten Stimme, die kleinen Schweinsäuglein zärtlich verdrehend.
Im fernen Siebenbürgen sprach Fred soeben mit seinem Lehrer, dem Baron von Walten.
Die beiden trafen eben schon Vorbereitungen zu dem Depeschendienst, der in wenigen Minuten zu erfolgen hatte.
Als es Punkt acht Uhr war, begann Walter zu schreiben. Es sei alles in Ordnung, allen ginge es gut, nichts weiter passiert, keine wichtigen Briefe eingelaufen, herzliche Grüße.
Es wurde hier nachgeschrieben, wie die kleine Hellseherin hier las.
Natürlich hätte sie das auch selbst nachschreiben können, sogar mit der Handschrift des Betreffenden, der dort die Feder führte.
Der Prinz hatte nur über jede einzelne Sitzung, die während seiner Abwesenheit vorgenommen wurde, ein regelrechtes Protokoll haben wollen.
Dann sandte auch Fred an seine kleine Freundin im fernen Ägypten seine eigenen Grüße, schrieb, dass er dann die Spuren eines Bären verfolgen werde, und dann ... dann kaute er ein bisschen am Federhalter.
Er wollte noch mehr erzählen, wusste aber nicht gleich was. Wie jeder gesunde Junge war er nicht sehr für's Briefschreiben eingenommen, der deutsche Aufsatz kam ihm als Popanz gleich hinter der Religionsstunde. Kindern, die gern Briefe schreiben, Aufsätze machen und Bibelsprüche auswendig lernen, denen ist nicht recht zu trauen.
»Was macht er jetzt?«, kam Puttfarken zu Hilfe, als Deasy noch immer schwieg.
»Er hat den Federhalter im Mund.«
»Kannst Du ihm nicht einmal etwas hinschreiben? Auf das Papier, das er vor sich liegen hat?«
Unter den Umstehenden entstand sofort eine kleine Bewegung.
»Ach, was machst Du denn da, Zwergnase!«, sagte Kapitän Falkenburg vorwurfsvoll.
»Na, warum soll denn das nicht gehen?«, war die ganz unbefangene Gegenfrage.
»Ach, wie soll denn das möglich sein. Dann hätte doch auch der Prinz einmal solch einen Versuch gemacht, schon früher, mit dem Baron Walten — was die beiden mit dem Kinde alles für Experimente angestellt haben!«
Aber Puttfarken zeigte plötzlich eine Hartnäckigkeit, von der seine Kameraden bisher noch gar nichts gewusst hatten.
»Sage, meine liebe Deasy, kannst Du nicht dort etwas auf das Papier schreiben?«
»Ja, das kann ich.«
Es lässt sich schwer schildern — nämlich wie die umstehenden Männer plötzlich erschrocken zurückfuhren, was sie für Blicke wechselten, weil sie sich plötzlich an jener Tür stehen sahen, die in ein dem Menschen unbekanntes, rätselhaftes Reich führt.
Jenseits dieser Schwelle lag ja auch schon das Hellsehen dieses Kindes in die Ferne, aber dessen letzte Worte hatten noch eine ganz andere Möglichkeit angedeutet.
Sie alle wurden hier bei hellem Sonnenschein von dem Grausen vor dem Übersinnlichen erfasst. Anders lässt es sich nicht ausdrücken.
Nur Puttfarken selbst blieb ganz gefasst.
»Du kannst dort auf das Papier etwas hinschreiben?«
»Ja, das kann ich.«
Wieder eine allgemeine Bewegung.
»Willst Du einen Bleistift haben? Hier ist einer.«
»Nein, so geht es nicht.«
»Wie denn sonst?«
»Ich muss ... ich muss ... ich weiß nicht!«
Eine Pause trat ein.
Mit geschlossenen Augen saß die kleine Hellseherin im Sand, atmete etwas tiefer als sonst in diesem schlafwachen Zustande.
»Nimm nur den Bleistift, versuche einmal, dort etwas auf das Papier zu schreiben, deinen Namen!«, ermunterte Puttfarken.
»Ach, Nasenkönig, nun höre doch mit solchem Unsinn auf!«, ließ sich Kapitän Falkenburg wieder vernehmen. »Wie soll denn das nur ...«
Erschrocken brach er ab.
Von des Kindes Lippen war ein tiefer, schwerer Seufzer gezittert, fast wie ein leises Stöhnen hatte es geklungen. Und gleichzeitig hatte es geklungen, als ob Glas zerbreche.
»Was war das?! Was ist da zerbrochen?!«
Da fing das Kind plötzlich heiter zu lachen an.
»Was lachst Du?«, fragte Puttfarken sofort.
»Weil Fred so erschrocken ist. Und Baron Walten auch.«
»Worüber sind sie so erschrocken?«
»Weil das Glas zerbrochen ist, das auf dem Tische steht. Ein leeres Weinglas.«
»Weshalb ist es zerbrochen?«
»Weil ich es umgeworfen habe.«
Nur Puttfarken allein machte die allgemeine Bewegung nicht mit.
»Du hast dieses Glas umgeworfen?«
»Ja, Fred blickte gerade darauf, und da fiel mir ein, das Glas umzuwerfen. Es ging schwer, sehr, sehr schwer, aber es gelang. Dabei ist es zerbrochen.«
»Du hast es mit Deiner Hand umgeworfen?«
»Ja.«
»Du hast von hier bis nach Siebenbürgen hinübergegriffen?«
Sie war ganz folgerichtig, diese Frage, durchaus nicht lächerlich zu nehmen.
»Ja — nein — ja — nein ... ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe.«
»Mit welcher Hand hast Du das Glas umgeworfen?«
»Mit der rechten.«
»Du hast doch Deine rechte Hand gar nicht ausgestreckt, gar nicht bewegt.«
»Nein — ja — nein ... das brauchte ich auch nicht ... ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Aber ich konnte das Glas umwerfen, so schwer es auch ging. Und ich glaube, das nächste Mal geht es viel leichter.«
»Was tut Fred jetzt?«
»Er spricht mit Walten. Jetzt blicken beide nach der Wanduhr.«
Wieder fing die Schläferin — denn schlafen tat das Kind, wenn es auch ein besonderer Schlaf war — heiter zu lachen an.
»Weshalb lachst Du, Deasy?«
»Weil die beiden wieder so furchtbar erschrocken sind.«
»Worüber?«
»Weil ich von der Wanduhr den Perpendikel angehalten habe.«
»Den Perpendikel hast Du angehalten?«
»Ja.«
»Wie hast Du denn das gemacht?«
»Nun, ich habe ihn ganz einfach festgehalten. Und jetzt gebe ich ihm wieder einen Stoß, jetzt bewegt er sich wieder. Ach, was die beiden für Gesichter machen!«
Hiermit brechen wir die Beobachtung dieser Versuche ab.
Das Kind war in ein zweites Stadium des Somnambulismus getreten, das man Telepathie oder Fernwirkung nennt.
Fähig hierzu war Deasy sicher schon immer gewesen, aber sie hatte erst eine Anregung dazu erhalten müssen.
Der Prinz und sein Freund hatten niemals daran gedacht, die kleine Somnambule daraufhin zu prüfen, oder aber, wenn sie es doch getan, so hatten sie es eben falsch angefangen.
Dieser einfache Schiffskoch hier hatte das Problem gelöst, wie man sich auch von hier aus nach dort verständigen konnte, die ganze Sache musste nur noch weiter ausgebaut werden.
Und wer da meint, so etwas wie Telepathie sei nicht möglich, der gleicht dem Papua oder einem anderen Wilden auf einer fernen Südsee-Insel, dem man vergeblich erzählen wird, dass wir eine ganz gewöhnliche Einrichtung haben, wir sprechen in einen Trichterkasten hinein und weit, weit entfernt davon kommen dieselben Worte zu einem anderen Trichterkasten wieder heraus.
Unsere Urgroßväter freilich hätten es auch nicht begriffen.
In schlankem Trabe eilte das Hedjin durch das Labyrinth der Schluchten und nackten Sandtäler, von seinem Reiter gelenkt. Zum ersten Male in seinem Leben befand sich Prinz Joachim im Dschebel el Ghossar. Wenn er ein Ziel hatte, wie konnte er sich in diesem Labyrinth zurecht finden? Denn sich nach Steinfiguren richten, da war hier nichts zu machen.
Wir werden es später erfahren, auf welche Weise er seinen Weg verfolgte, die abzweigenden Schluchten wählte.
Eine halbe Stunde, immer nach Westen, immer tiefer in das Gebirge dringend, und wieder lenkte er in eine Seitenschlucht, so eng, dass sie kaum von zwei unbepackten Kamelen nebeneinander passiert werden konnte.
Da plötzlich zeigte das sonst so gehorsame Tier, jetzt im Schritt gehend, Eigensinn, wollte nicht weiter, und, dazu gezwungen, steigerte sich sein Widerwillen bis zur Furcht, es stemmte sich und begann an allen Gliedern zu zittern.
Ohne es niederknien zu lassen, sprang der Prinz aus dem Sattel, nahm es an den Zügel, und jetzt folgte das Hedjin, wenn auch noch immer mit allen Zeichen der Angst.
Schnaubend und stöhnend, den Kopf unruhig hin und her werfend, ließ es sich weiter führen. Mit einem Male aber hatte es seine Sicherheit wieder.
Der Prinz blickte hinter sich. Nichts war zu bemerken, was dem Tiere solche Angst hätte einflößen können, und dass Kamele wie Pferde vergrabene menschliche Leichen wittern und sich vor ihnen entsetzen, davon ist nichts bekannt.
Und was das edle Hedjin dann erblickte, darüber musste es vor Freude erst recht alle ausgestandene Angst schnell vergessen.
Die enge Schlucht hatte einen scharfen Bogen gemacht, und plötzlich öffnete sich vor dem Prinzen ein kleines Tal, nur ein Kessel, mit grüner Vegetation, mit Dattelbäumen bestanden. Eine Kimodscheb, eine Kesseloase, wie man sie wohl auch im Wüstengebirge manchmal antreffen kann.
Sie enthielt nicht nur ein Brunnenloch, aus dem die für die Vegetation nötige Feuchtigkeit aufstieg, sondern sie wurde von einem klaren Bache durchflossen, der auf der einen Seite aus einer kleinen Höhle herausfloss und gegenüber in einem anderen Loche wieder verschwand. Nur diese eine Schlucht führte hinein.
Dass sich hier keine Menschen angesiedelt hatten, war im Geistergebirge begreiflich, und dann brauchte mit dieser Kesseloase auch nur eine besondere Sage verbunden zu sein, dass sie etwa des Teufels sei, so würden die Beduinen dort draußen eher verschmachten, ehe sie hier hereindrangen, um ihren Durst zu löschen
Weshalb aber fehlten, was auch das unerfahrenste Auge sofort erkennen musste, hier auch alle Tierspuren? Für die Raubtiere des Gebirges musste dieses fließende Wasser doch einen Himmelsbach bedeuten, es musste sie mit ihrer feinen Witterung meilenweit anlocken.
Nun, man brauchte nicht gleich anzunehmen, dass hier mit magischen Kräften ausgestattete Menschen einen Zauberstrich gezogen hatten, den vorhin auch das Kamel nicht hatte überschreiten wollen.
Die Sache ließ sich auch ganz natürlich erklären.
Wir wissen, dass einige Tiere eine Leidenschaft für gewisse Substanzen haben, sie sind gierig dahinter her, ohne dass sie ihnen eigentlich zur Nahrung dienen, sie berauschen sich förmlich an ihnen. So die Katzen für Baldrian, Hunde für faulendes Leder, einige Vogelarten für Anis.
Was aber für einige Tierarten gilt, muss auch für alle anderen gelten, von der kleinsten Mücke an bis zum Elefanten oder es gibt keine Logik mehr. Wir haben uns mit dieser Sache nur noch nicht weiter befasst, obgleich es schon Menschen gibt, die da noch ganz andere Erfahrungen gemacht haben und diese ständig vermehren. Besonders die Zigeuner haben mit solchen »Witterungen« etwas los. Aber es wird eben noch nicht beachtet. Bis dann einmal der Erdgeist unsere gelehrten Stubenhocker anbläst, und dann wird wieder eine neue »Wissenschaft« begründet.
Gibt es aber für jedes Tier eine »Witterung«, für die es leidenschaftliche Gier hegt, so muss es für jedes Tier auch etwas geben, was es grenzenlos verabscheut. Das nennt man Logik. Einiges kennt man ja schon. Man kann dabei recht merkwürdige Experimente anstellen, die einem viel, viel zu denken geben. Die meisten Ameisenarten gehen jeden toten Fisch an. Kocht man aber Fisch, taucht einen Lappen in die Brühe und legt ihn dorthin, wo Ameisen sind, da reißen sie alle aus. Oder man streicht einem Frettchen übers Fell und hält die Hand einem zahmen Kaninchen vor die Nase. Das Karnickel rennt sich vor Angst gleich den Schädel ein oder stellt sich gleich tot, stirbt wirklich vor Angst. Ja, Frettchen und Iltis sind die Todfeinde des Kaninchens, sagt man.
Aber dieses zahme, im Stall geborene Karnickel hat noch niemals ein Frettchen gesehen und gerochen. Wie kommt denn das da? Instinkt, sagt man. Jawohl, Instinkt! Über dieses famose Wörtchen »Instinkt« hat schon Schopenhauer genug gespottet.
Kurz, es gab eine ganz natürliche Erklärung dafür, dass diese Kesseloase von den Tieren des Gebirges nicht betreten wurde, weshalb auch dieses Kamel beim Passieren der Schlucht solche Angst gezeigt hatte.
Da es nun aber einmal einen gewissen Punkt überschritten hatte, sich in dem Talkessel befand, eilte es auch sofort auf das Wasser zu, um seinen weiten Magen zu füllen.
Ja, das Kamel kann sieben Tage ohne Wasser aushalten, bei saftigem Futter sogar drei Wochen lang, das stimmt. Lieber aber säuft es täglich dreimal, um seinen besonderen Wassermagen, mit einem schwammähnlichen Zellengewebe ausgefüllt, nicht unnötig zu belasten.
Der Prinz trat von dem Tiere zurück, hielt ein wenig Umschau. Weit herumzugehen brauchte er deshalb nicht, die Vegetation war gar zu durchsichtig, die nackten Felswände glatt wie die Mauern. Der Durchmesser des ganzen, fast genau kreisrunden Kessels mochte 60 Meter betragen, noch etwas höher stiegen die einschließenden Wände empor.
Plötzlich, wie der Prinz so ganz ruhig dastand, hinter dem trinkenden Kamel, nach allen Seiten Umschau haltend, zuckte er zusammen.
Ganz merkwürdig, wie er zusammengezuckt war!
Als ob er einen elektrischen Schlag erhalten hätte, der ihm durch den ganzen Körper gegangen.
Ganz unwillkürlich hätte ein Beobachter auf diesen Gedanken kommen müssen.
Denn ein erschrockenes Zusammenfahren war das durchaus nicht gewesen. Nur ein einziger Zuck.
Aber was konnte es anders gewesen sein, als dass er über etwas erschrocken war?
Doch worüber?
Und wenn man über etwas erschrickt, blickt man dann nicht dorthin, wo sich die Ursache des Schrecks befindet?
Statt dessen schloss der Prinz seine flammenden Augen, so blieb er ruhig stehen.
Hatte dieser eiserne, so kerngesund aussehende Mann etwa eine innere Krankheit, dass ihn manchmal ein Schmerz durchzuckte?
Das wäre allerdings sehr traurig gewesen.
Dann aber hätte er doch wohl auch ein etwas schmerzbewegtes Gesicht gemacht, aber davon war absolut nichts zu bemerken.
Höchstens eine Spannung drückten die edlen, tief gebräunten Züge aus.
Erst nach etwa einer halben Minute, welche Zeit doch für solch eine Stellung etwas zu bedeuten hat, schlug er die Augen wieder auf, und sie strahlten in altem Feuer.
Jetzt noch ein zufriedenes Nicken, und er fasste das Kamel beim Zügel und führte es unter eine niedrige, weil noch junge Palme, die daher mit ihren Staudenblättern ein förmliches Zelt bildete, aber schon hoch genug, dass auch das Kamel bequem darunter ging.
Völlig geschlossen ist solch ein natürliches Palmendach nicht, man konnte zwischen den einzelnen Blättern noch immer über sich den blauen Himmel erblicken.
Wohl zehn Minuten vergingen, ruhig stand der Prinz da, immer nach oben durch das grüne Dach blickend.
Da plötzlich wendete er den Kopf, mit jener Bewegung, die man macht, wenn man angestrengt lauschen will.
Und richtig, da vernahm sein scharfes Ohr ein surrendes Geräusch. Also es sei gleich im Voraus gesagt, dass er dieses Surren nicht etwa schon vorher gehört hatte, als er vorhin so zusammengezuckt war.
Das leise Surren wurde stärker und stärker, kam näher und näher, und da tauchte dort oben über dem Felsenkessel am blauen Himmel ein dunkler Riesenvogel auf.
Ein Aeroplan, ein Eindecker!
Und jetzt senkte er sich, einen Bogen beschreibend, herab, und das Surren verstummte, er ging im Bogengleitflug nieder, gerade auf diesen Felsenkessel zu.
Er war sehr hoch gewesen, aber nicht lange dauerte es, so konnten des Prinzen Falkenaugen unter den Tragflächen zwei Menschen erkennen.
Noch eine Minute, immer in Bogen herabgehend, und der Aeroplan schwebte dicht über dem Kessel, wenigstens scheinbar für das Auge des Beobachters. Sonst mochte er sich noch immer in beträchtlicher Höhe über den einschließenden Felswänden halten.
Aber ob nun die beiden Personen dort oben so außerordentlich laut schrien, was vorher nötig gewesen war, um das Surren des Propellers zu übertönen, wenn sie sich verständigen wollten, oder ob es die reine, dünne Wüstenluft war, oder ob der Schall vielleicht von den glatten Felswänden herabgeleitet wurde ... kurz, der Beobachter unter der Palme hörte die beiden auch ganz deutlich sprechen, sich der französischen Sprache bedienend.
»Was ist das für eine Kesseloase, Monsieur Artois?«
»Die Kimodscheb el Ghossar, die Oase der Geister.«
»Bewohnt?«
»O nein, sie ist toglo.«
»Mit in das Reich der Fedawihs gehörend?«
»Jawohl, Señor Lazare.«
Señor Lazare!
Deutlich hatte der Lauscher dort unten den Namen gehört.
Dort oben in den Lüften schwebte sein Todfeind.
Denn dass der Jesuitenpater ihm ein solcher war, das wusste er.
Señor Lazare hier in Ägypten!
Aber es machte auf den Prinzen nicht den geringsten Eindruck, er nickte nur zufrieden, als habe er schon gewusst, dass Señor Lazare jetzt dort oben in den Lüften diese Kesseloase passieren würde.
»Wir können nicht einmal landen?«
»O nein, Señor Lazare, auch für uns und alle Fedawihs, für alle Schlüsselbrüder ist diese Kesseloase ebenfalls toglo, und wer sie zu betreten wagte, der würde ...«
Das andere ging für den Lauscher verloren, weil der Propeller wieder einsetzte.
Der Aeroplan hatte den Gesichtskreis des Beobachters verlassen, hatte seine Fahrt nach Süden fortgesetzt.
Wieder nickte der Prinz zufrieden, als er sein Kamel unter dem Baume herausführte.
»Wohl, Señor Lazare, ich werde Dich noch mehrmals wiedersehen müssen, ehe es mir erlaubt ist, Dich Höllenhund an die Kette zu legen. Sonst hätte ich Dich ja sofort herunterknallen können.«
Er ließ sein Kamel niederknien, wozu bei diesem edlen Hedjin nur ein besonderer Zungenschlag nötig war, packte es ab, nicht eben viel, nur sein Handgepäck, Proviantvorräte und zwei Wasserschläuche, dazu noch zwei Gewehre oder Büchsen verschiedenen Kalibers und zwei gewaltige Revolver in Futteralen mit der nötigen Munition, trug diese Sachen unter die Palme zurück, zog hier auch seinen Beduinenburnus aus, und da ihm jetzt die Kopfbedeckung fehlte, entnahm er einer Schachtel einen breitrandigen Panamahut.
Nun noch einen tüchtigen Trunk aus dem klaren Bache, und er verließ, ohne sich um das Kamel weiter zu kümmern, den Felsenkessel zu Fuß, so wie er ging und stand, in seinem weißen Tropenkostüm, ohne ein Gewehr mitzunehmen, ohne sonstige sichtbare Waffe. Wie bei einem Spaziergange in den Straßen Kairos.
Nach höchstens hundert Schritten hatte er diese enge Zugangsschlucht passiert, kam in eine breitere, wandte sich nach rechts.
Wieder nur eine kurze Strecke, und diese Schlucht teilte sich strahlenförmig gleich in drei Engpässe. Ohne zu zögern wählte er den linken, ging einige Minuten schnellen Schrittes geradeaus, seitliche Abzweigungen nicht beachtend, bis dieser Engpass ohne Fortsetzung in eine sehr breite Schlucht mündete.
Hier war der Boden durchaus felsig, glatt wie ein Tisch, ohne jede Spur von Sand. Dafür aber zog sich mitten durch die Schlucht eine Bodenspalte hin, ungefähr zwei Meter breit.
Der Prinz trat an den Rand und blickte hinab. Die Sonne stand schon ziemlich hoch, bis auf wenigstens fünfzig Meter drangen ihre Strahlen in die Spalte, aber deren Grund war noch nicht zu erblicken. Dort unten gähnte es schwarz. Es musste also bis zur Sohle dieser Spalte bereits eine furchtbare Tiefe sein.
Prinz Joachim wandte sich wieder nach rechts, schritt an der Spalte entlang. Immer näher trat auf seiner Seite die Felsenwand an die Spalte heran, bis er sich auf dem schmalen Grate kaum noch bewegen konnte, immer in Gefahr, in die Spalte zu stürzen.
Da blieb er stehen. Hier war in der Wand eine nischenartige Vertiefung mit verschiedenen Vorsprüngen. Der Prinz zog seine weiße Jacke aus. Es zeigte sich, dass er um den Leib und noch höher hinauf ein Lasso trug, das er abwickelte. Als dies geschehen war, begann er sich weiter zu entkleiden. Stiefel und Gamaschen ab, Hosen aus, Unterzeug aus, alles aus.
Aber noch stand er nicht so da, wie ihn der liebe Gott geschaffen hatte, obgleich er auch schon das Hemd über den Kopf gezogen.
Er war von den Sohlen an bis zum Halse und Handgelenk in ein enganliegendes Trikot gehüllt. Allerdings in ein Trikot ganz besonderer Art. Es war ein farbloser Stoff, den die Sonne wie frischpoliertes Silber erglänzen ließ. Aber nicht, dass es Metall sein konnte. Da hätte man doch mindestens etwas von zusammengehefteten Schuppen bemerken müssen, und das war nicht der Fall. Außerdem war der Stoff viel zu dünn. Wo Hals und Hemd begann, war absolut nichts von einem Ansatze zu bemerken, der doch wenigstens eine Linie hätte erhöht sein müssen.
Es war nicht anders, wollen wir sagen, als ob der ganze Körper des Mannes auf galvanischem Wege versilbert worden sei, nur der Kopf und die Hände nicht.
Auch dürfen wir gleich versichern, dass Prinz Joachim für gewöhnlich nicht etwa so angetan einher ging, es war diese eigenartige Ausstaffierung lediglich zu seinem heutigen Vorhaben nötig.
Um die Hüften trug er einen Gürtel, von dem mehrere Gegenstände herabhingen: ein langer Dolch ohne Scheide, ein größerer Schlüssel, ein kleinerer Schlüssel, ein größeres Fläschchen, ein kleineres Fläschchen, und schließlich noch eine Kugel von der Größe eines Billardballes.
Alle diese Gegenstände waren an dem Gürtel mit Kettchen befestigt, und auch sie bestanden wie der Gürtel aus einer silberähnlichen Masse, wenn es nicht wirklich Silber war, frisch poliert.
Zunächst löste der Prinz das größere Fläschchen von Gürtel und Kette ab, hielt es gegen die Sonne. Es war undurchsichtig. Er schraubte den silbernen Stöpsel ab, setzte die Mündung an die Lippen, nahm einen kleinen Schluck.
»Wenn ich nicht schon heute Nacht in Almansors Gegenwart das Experiment gemacht und mich von der Wirkung dieses Tränkleins und seines Gegenmittels überzeugt hätte, ich würde es nicht glauben!«, murmelte er kopfschüttelnd, als er den Stöpsel wieder aufschraubte und das Fläschchen an der Kette befestigte.
Von irgend einer Wirkung dieses Tränkleins war jetzt freilich nichts zu bemerken.
Nachdem der Prinz seine abgelegten Kleider in der Mauernische handbereit geordnet hatte, um sie schnell wieder anziehen zu können, befestigte er sein Lasso an einem der Felsenvorsprünge, der dazu wie geschaffen war, selbst ein durchgehendes Loch hatte.
Das andere Ende des Lassos, noch immer mehr als zwanzig Meter lang, warf er in die Schlucht hinab, und er begann sich hinabzulassen.
Das will nun freilich gelernt sein, an solch einem doch nur dünnen Lederstreifen hinabzugleiten, ohne wirklich ins Gleiten zu kommen. Das dürfte auch der gewandteste Turner nicht fertig bringen, wenn er sich darin nicht eben geübt hat, dazu aber auch fachliche Anweisung bekommen hat.
Wenn solch ein dünnes Seil oder ein Band keine Knoten hat, an dem die Füße, wenigstens die Zehen, Stützpunkte finden, so ist ein gefahrloses Hinabgleiten nur dann möglich, wenn man, wie es auch der Prinz getan, dieses Band vorher um die Hand schlingt. Dann wirkt diese Schlinge ständig wie eine Bremse. Mit der anderen Hand muss man dann, wenn man weiter will. ständig nachstecken, also die Schlinge lockern, die Bremse lösen. Auf diese Weise kann man dann auch wieder emporklettern. Aber das ist eben eine Kunst, die nur durch viel Übung gelernt werden kann, man muss auch jemanden haben, der es einem vormacht. Und dann natürlich die nötige Kraft, solche schwellende Muskeln gehören dazu, wie sie dieser Mann hier besaß. Sonst ist es gar nicht möglich, an einem gewöhnlichen Lasso hinabzuklettern, ohne ins planlose Rutschen zu kommen, von einem Hinaufklettern gar nicht zu sprechen. Es ist dies eine Sache, in der von Jugendschriftstellern viel gesündigt wird. Ohne diesen »Schlippsteg« ist gar nichts zu machen. Soll doch einmal jemand an einer Wäscheleine in die Höhe zu klettern versuchen.
Nun, Prinz Joachim verstand dieses Kunststück, was heute wohl kein Indianer und kein Cowboy einer Schautruppe noch ausführen kann, mögen die Burschen sonst auch noch so waschecht sein.
Vorläufig ließ er sich hinab. Etwa zwölf Meter tief, dann berührten seine Füße seitwärts nicht mehr die glatte Felswand, traten ins Leere, also in eine Höhlung tiefer hinab, und er selbst blickte in diese Öffnung, und dann bekamen seine Füße einen Rand zu fühlen, sie fassten Boden, und mit einem kleinen Schwung beförderte er sich in die Öffnung hinein.
Es war eine Höhle, ungefähr zwei Meter hoch und etwas schmäler, sie setzte sich nach hinten als Tunnel fort, dort finster werdend.
Tief atmete der Prinz auf, als er die Schlinge von seiner Hand löste und das Lasso freigab, obgleich ihn die Sache nicht besonders angestrengt zu haben schien.
»Nun denn mit Gott! Es ist viel, was ich riskiere. Ganz abgesehen von den Gefahren, die mir unten in dem rätselhaften Reiche, das mir Almansor etwas beschrieben, drohen. Aber Almansor konnte mir auch keine Garantie geben, dass meine Sachen dort oben nicht vielleicht gefunden werden könnten, und wenn das passierte, dann hätte ich das Vergnügen, so gut wie splitterfasernackt in der Wüste herumzumarschieren, vorausgesetzt, dass der Betreffende nicht auch mein Lasso mitnähme. Dann wäre ich hier unten gefangen. Denn so viel Almansor auch immer vom Buche des Schicksals spricht, was da alles drin verzeichnet steht — drin lesen kann der gute Mann eben doch nicht, nicht in die Zukunft blicken. Nun, hoffen wir das Beste, und die Sache ist es auch wert, noch etwas mehr als das Leben dabei dranzusetzen.«
Er drang in die Tunnelhöhlung ein.
Bei diesem Gehen zeigte sich ein besonderes Verhalten der am Gürtel hängenden Gegenstände, was man allerdings auch schon vorher hätte beobachten können, wenn man ein besonderes Augenmerk darauf gerichtet hätte.
Bei jedem Schritt schlugen doch diese Gegenstände gegen seinen Körper wie auch gegenseitig aneinander. Das hätte doch einen Klang geben müssen. Aber sie gaben beim Anschlagen absolut keinen Ton von sich, als wären sie von einem ganz weichen Stoffe gewesen, was aber doch nicht der Fall war.
Und jetzt zeigten sie wie der ganze Trikotstoff, der den Körper bedeckte, noch eine zweite, viel erstaunlichere Eigenschaft.
Immer finsterer wurde es. Aber nur desto mehr begann die ganze Gestalt des Prinzen zu leuchten. Bis auf seinen Kopf und die Hände, die eben nicht silbernen Überzug hatten.
Es war kein strahlendes Licht, das von dieser Substanz ausging, sondern mehr ein sanftes Leuchten, so wie gewisse chemische Farben selbst leuchten, aber so intensiv, dass auf einige Meter Entfernung hin fast Tageshelligkeit verbreitet wurde. Dies galt also sowohl von dem silbernen Trikot wie von den am Gürtel hängenden Gegenständen.
Es waren nackte Felswände, die der Prinz in diesem Lichte sah. Doch da endete schon der Tunnel, mit einer verschlossenen Tür, die aus Eisen zu sein schien.
Ein Schlüsselloch war vorhanden, und der Prinz wählte den größeren Schlüssel.
Ehe er ihn aber benutzte, zuckte er wiederum wie in jähem Schreck oder Schmerz zusammen, und die Folge war, dass er abermals die Augen schloss.
Diesmal aber kamen auch leise Worte über seine Lippen, in längeren Zwischenpausen. Es war nicht anders, als ob er ein Telefongespräch führe.
»Ja, ich höre — Es ist jemand drin? — Gut, ich warte — Halt, Almansor! — Ist es nicht möglich, den elektrischen Schlag, oder was es nun sonst ist, etwas zu mäßigen? Das ist allemal ein höllisches Gefühl! Heute Nacht waren die Schläge doch längst nicht so stark — Ja, danke.«
Er öffnete die Augen wieder.
»So, diesmal war es ganz anders, das lässt man sich eher gefallen, und genügen tut es doch, um auch einen Scheintoten zu wecken.«
So murmelte er nach einer Weile, als er nun den Schlüssel ins Loch steckte. Er ließ sich umdrehen, die schwere Tür ohne Geräusch sich zurückziehen.
Wohl die meisten Menschen, und sie brauchten durchaus keine Feiglinge zu sein, wären nicht eingetreten, wären entsetzt zurückgeflohen.
Erstens vor dem penetranten Geruch, richtiger Gestank, der ihnen entgegenschlug, und dann vor allen Dingen vor dem Anblick, der sich ihnen bot.
In dem ziemlich weiten Raume wimmelte es von riesenhaften Schlangen.
Es war die Hieroglyphenschlange, die einzig und allein hier vertreten war, so genannt nach ihrer buchstabenähnlichen Zeichnung, die Riesenschlange Afrikas, von den Eingeborenen Assala oder Tenne genannt, von uns meist als Abgottschlange bezeichnet, weil sie von vielen Negervölkern göttliche Verehrung genießt, hauptsächlich in Dahomey, aber nicht zu verwechseln mit der amerikanischen Abgottschlange, die schon von den alten Mexikanern angebetet wurde, wie heute noch von den dort hausenden Eingeborenen.
Man hat afrikanische Abgottschlangen von sechs Meter Länge erlegt und gefangen, darf aber den Versicherungen der Eingeborenen glauben, dass in den Sumpfgebieten Zentralafrikas, wo sie sich bis ins höchste Alter hinein ungestört entwickeln können, noch weit größere vorkommen.
Dass diese Riesenschlange einst auch in Ägypten ganz allgemein verbreitet gewesen ist, ergeben die häufigen Knochenfunde im Diluvialsande. Aber in historischer Zeit kann sie wohl schwerlich noch existiert haben, weil die alten Ägypter sie sonst sicher bildlich dargestellt hätten, was nicht der Fall ist.
Also auch zu der Zeit, als Flusspferde und Krokodile in zahlloser Menge — weil geheiligt, geschützt — den ganzen Nil bis zur Mündung belebten, muss diese Riesenschlange in Ägypten schon ausgestorben gewesen sein, und dass die alten Ägypter nicht einmal ihre Knochen fanden, dürfte einen besonderen Grund haben. Nach Andeutungen, die Strabo macht, ist nämlich wahrscheinlich unter allen Pharaonen das tiefere Graben im Sande verboten gewesen. Nur zum Bebauen des Landes durfte gegraben werden. Sonst war der Sand den alten Ägyptern heilig. Was er, vom Winde oder Wasser getrieben, einmal zudeckte, durfte nicht wieder ausgegraben werden. Man durfte nicht einmal Schutzmaßregeln gegen den Flug- und Treibsand treffen. Und das dürfte auch stimmen. Denn sonst ist es ja ganz unbegreiflich, weshalb die alten Ägypter, die doch sonst in der Baukunst so weit fortgeschritten waren, ihre kostbaren Tempel und Denkmäler nicht durch ganz einfache Mauern vor Versandung schützten.
Also überall, wo man in Ägypten tief genug gräbt — freilich sehr, sehr tief, da muss man noch ganz anders paddeln, als wenn man nur alte Ruinen freilegen will — stößt man außer auf Skelette von anderen prähistorischen Tieren — auch das Känguru kommt häufig vor, wie ja auch in Europa — auf Wirbelknochen von Riesenschlangen.
Und zwar auf Wirbelknochen von solch kolossaler Größe, dass man, wenn man auch noch kein vollständiges Skelett zusammensetzen konnte, auf Riesenschlangen von mindestens zehn Meter Länge schließen muss.
Und solche Exemplare waren auch hier vertreten.
Riesenhafte Riesenschlangen!
Sie lagen träge da, bildeten wirre Knäuel oder schoben sich langsam über den schwarzen Boden hin, die Zunge spielen lassend.
Hungrig konnten sie nicht sein. Es waren einige Schweine vorhanden, zwar lebendig, aber vor Angst schon halb tot, sie hatten sich still in ihr zukünftiges Schicksal ergeben.
Noch stand der Prinz in der offenen Tür.
»Alle guten Geister!«, flüsterte er. »Almansor hat's mir erzählt, ich hab's geglaubt, — aber so etwas selber sehen, das ist doch etwas ganz anderes! Für solch ein Vieh bin ich das, was für eine normale Riesenschlange ein Karnickel ist! Die schluckt mich nur so in Gedanken hinter! Ich soll sie nicht zu fürchten brauchen — ja aber Teufel noch einmal, was nützt da einem jeder Garantieschein, die verschluckt den einfach mit ... halt, Ausgang geschlossen!«
Nein, von Entsetzen war der Prinz nicht befallen worden, dieser Mann kannte nicht einmal Furcht. Sonst hätte er sicher nicht so gehandelt, wie er jetzt tat.
Solch ein fabelhaftes Ungeheuer schob sich direkt auf ihn zu, die funkelnden Augen auf ihn gerichtet, die lange Zunge spielend, und dadurch einen um so fürchterlicheren Eindruck machend, weil die Fangzähne, die es hier in der Gefangenschaft wohl nicht genügend benutzen konnte, auf beiden Seiten weit zum Rachen herausgewachsen waren.
Aber schnell hatte der Prinz die Tür hinter sich wieder zugezogen.
Und dann löste er noch schneller den Dolch von der Kette, erhob ihn zum Stoße, — so erwartete er die Schlange.
Was wollte er mit diesem Spielzeug gegen solch ein Ungeheuer ausrichten?
Doch es sollte zu keinem Kampfe kommen.
Näher und näher war das Scheusal gekrochen, jetzt richtete es sich empor, zuckte hin und her, es sah aus, als wolle es sich auf den Menschen stürzen, um ihn wie eine Pille zu verschlucken, schon riss es den Rachen furchtbar auf ... plötzlich warf es sich zurück, schoss gleich in die entfernteste Ecke, mit einer Schnelligkeit, die man solch einem ungeheuren Körper gar nicht zugetraut hätte.
»Die Probe bestanden, Almansor sprach die Wahrheit, ich kenne die Abgottschlange — sie war willens, mich anzugreifen, nichts mehr hätte sie abgehalten, sie konnte die Witterung nicht vertragen!«
So atmete der Prinz tief, tief aus, und diese Seelenerleichterung nach solch einer Situation war begreiflich.
Nach diesen Worten aber schien es auch, als ob diese Schlangen sich doch nicht vor jedem anderen Menschen so zurückgezogen hätten.
Der Prinz verschloss die Tür auch noch mit dem Schlüssel und durchschritt den weiten Raum, über die baumdicken Leiber steigend, wo es nötig war. Der Raum war finster, nur das von ihm selbst ausgehende Licht erhellte ihn, und auf diese Weise bekam er jetzt immer mehr solche Ungetüme zu sehen.
Hin und wieder wurde er angezüngelt, aber stets wichen die Schlangen wie von Entsetzen gepackt mit einer blitzschnellen Bewegung vor ihm zurück.
Er hatte die gegenüberliegende Wand erreicht. Hier wieder eine eiserne Tür.
Ehe er den Schlüssel benutzte, griff er nach der am Gürtel hängenden Kugel, führte sie an den Mund, wozu die Kette ausreichte, hauchte dagegen und berührte sie auch mit der Zunge.
Ohne dass irgend eine Wirkung zu bemerken war, schien er doch mit dem Resultate zufrieden zu sein.
Er schloss die Tür auf und hinter sich wieder zu, und er befand sich in einem Gange, immer noch finster, nur stets vor ihm auf einige Meter durch das von ihm selbst ausstrahlende Licht erhellt.
Dort hinten aber schimmerte anderes Licht. Es war ein Quergang, den der Prinz erreichte, durch hier und da angebrachte Lampen erhellt.
Prinz Joachim wendete sich ohne Zögern nach links.
Da, wie er noch nicht viele Schritte auf lautlosen Sohlen gemacht hatte, kam ihm wieder ein Ungeheuer in den Weg, aber ein solches auf vier Beinen.
Es war ein Löwe, der, um eine Ecke biegend, ihm entgegentrottete, aber was für einer!
Der Berberlöwe, der stattlichste von allen, erreicht eine Schulterhöhe von einem Meter. Wenn man solche Riesenexemplare auch selten zu sehen bekommen mag. Einer der Löwen aber, die seiner Zeit der Sultan Menelik von Abessinien dem englischen König zum Geschenk machte, zwei Jahre im Londoner Zoologischen Garten ausgestellt, maß an der Schulter ein Meter vier Zentimeter.
Man kann sich von solch einer Mächtigkeit gar keinen Begriff machen, wenn man es nicht selbst gesehen hat. Was man sonst in Tiergärten an Löwen zu sehen bekommt, fast immer in der Gefangenschaft geboren, das verschwindet alles dagegen, obgleich es da doch auch manches stattliche Exemplar darunter gibt.
Dieser Löwe hier mochte noch fünfzehn Zentimeter höher sein. Ein fürchterliches Tier! So lautlos er auch gemächlich einher schritt, glaubte man doch, der ganze massive Felsen müsse erzittern. Man musste an einen vorsintflutlichen Höhlenlöwen denken. Der aber hatte — in Frankreich hat man in Salzlagern wohlerhaltene Felle von ihm gefunden — keine Mähne, dafür war sein ganzer Körper mit einem wolligen Pelze bedeckt, dem kalten Klima vor oder kurz nach der Eiszeit angepasst.
Dieser Löwe hier aber war normal behaart, sein riesiger Kopf war von einer ungeheuren Mähne umwallt. Ein echter Berberlöwe, nur von kolossalen Dimensionen.
Wenn er sich auch in ganz gemütlicher, gesättigter Stimmung befinden mochte, so war doch der finstere Grimm nun einmal der Ausdruck dieses Gesichtes, durch die langen Schnauzenhaare noch verstärkt.
Und so kam das Ungeheuer herangetrottet.
Wieder löste der Prinz schnell den Dolch von der Kette, stellte sich aber nicht in Kampfesposition, sondern trat zur Seite, schmiegte sich an die Wand, nur für den Notfall den langen Dolch zum Stoße erhoben.
Doch wieder sollte es anders kommen, der Löwe sollte ihn in dem engen Gange gar nicht passieren.
Jetzt blieb das Ungeheuer stehen, nur noch zehn Schritte von dem Menschen entfernt, witterte. Und mit einem Mal warf es sich auf den Hinterbeinen herum, kniff den Schwanz ein und jagte in großen Sprüngen zurück, dabei ein Gewinsel ausstoßend, so kläglich und dünn, wie man solch einem Ungetüm gar nicht zugetraut hätte, dass es solche hohen, dünnen, jämmerlichen Töne überhaupt hervorbringen konnte.
Der Löwe war um die nahe Ecke verschwunden, aber noch immer erklang sein Gewinsel.
»Was hat denn Baal?«, hörte der Prinz eine Stimme auf Arabisch fragen.
»Er wird den Melkart gewittert haben.«
»Den Melkart? Der sitzt doch schon längst hinter Gittern.«
»Ja, aber wo dieses schmutzige Teufelsvieh seine Losung hingesetzt hat, da wagt sich noch heute kein anderes Tier vorüber, nicht einmal der furchtbare Moloch, er schreit wie ein kleines Kind, und das ist durch kein Waschen und kein Räuchern wegzubekommen. Obgleich wir selbst gar nichts riechen.«
Baal, Melkart, Moloch — lauter Namen von phönizischen Göttern, die einst im ganzen Orient verehrt wurden, wenn auch nur heimlich neben einer anderen Landesreligion, bekannter Maßen nicht zum wenigsten von den Juden, selbst Salomo schwenkte ja immer einmal zu ihnen ab, weil ihre Verehrung mit den sinnlichsten Orgien verbunden war.
Der Prinz setzte seinen Weg fort. Da kam ihm ein neues Hindernis entgegen, mit dem er wohl nicht so leicht fertig werden konnte.
Ein Mensch!
Ein junger Araber, der es sehr eilig hatte.
Die Entdeckung war geschehen, da gab es nun kein Verstecken mehr, der Fremdling musste schon erblickt worden sein.
Nur Flucht konnte ihn noch einer Gefangennahme entziehen, wollte er es nicht auf einen Kampf ankommen lassen.
Doch Prinz Joachim wandte sich nicht zur schleunigen Flucht, machte auch nicht wieder den Dolch bereit. Er stellte sich einfach mit dem Rücken gegen die Wand.
Und der junge Araber schritt achtlos an ihm vorüber, an der menschlichen Gestalt, die hier in dem spärlichen Lichte von zwei weit entfernten Lampen sogar noch stark leuchtete.
Was war das gewesen?
War dieser Araber denn blind?
Jetzt verlor er einen kleinen Gegenstand, es klirrte, er blieb stehen, bückte sich, hatte mit einem Griff das Verlorene aufgenommen, verschwand um die nächste Ecke.
Nein, der war nicht blind gewesen!
Der Prinz streckte seine Hand aus und betrachtete sie.
»Wunderbar, wunderbar!«, murmelte er kopfschüttelnd.
Also er wunderte sich selbst, dass er nicht gesehen worden war. Den Grund freilich wusste er.
Ein neues Hindernis tauchte auf!
Jetzt kamen zwei arabische Männer, zwischen sich einen Henkelkorb voll Reis tragend.
Die beiden füllten mit ihrer Bürde den Gang gerade aus, ihre freien Hände streiften noch die Wände.
Da gab es also kein »Zur-Seite-Drücken« mehr, jetzt musste der Fremdling sogar von einem Blinden entdeckt werden.
Aber Prinz Joachim dachte anders. Er stellte sich in die Mitte des Ganges, erwartete die beiden, rechtzeitig ein hoher Satz, und er war über den Korb gesprungen.
Ohne jedes Geräusch war es abgegangen, die Gegenstände am Gürtel hatten nicht geklappert.
Aber ganz ohne Eindruck blieb dieser Sprung nicht.
Der eine Träger zögerte, der andere musste mit stehen bleiben.
»Musch kete — was war das?«
»Was denn?«
»Das war doch wie ein Windzug.«
»Ich habe nichts gemerkt.«
Sie setzten ihren Weg fort, der Prinz tat desgleichen.
Er kam an der ersten offenen Tür vorüber, blickte in einen Raum, mit Teppichen, Polstern und Kissen orientalisch eingerichtet, freilich recht dürftig. Ein alter Araber saß darin, streichelte eine große Katze — die Wohnung eines Dieners, eines Wächters.
Weiter als mit einem Blick hielt sich der Prinz nicht auf, er schritt vorüber.
Da ein neues Hindernis, und diesmal wirklich ein unüberwindbares.
Drei Männer kamen nebeneinander den Gang entlang, diesen ganz ausfüllend, zumal der eine sehr dick war.
Sie unterhielten sich, die beiden äußeren zeigten sich sehr respektvoll gegen den mittelsten.
Es war ein kleiner, hagerer Mann im arabischen Burnus, beim Sprechen tippte er immer die Fingerspitzen zusammen, und dazu nun dieses schlaue Fuchsgesicht mit dem so überaus gütigen Lächeln ...
Señor Lazare!
»Es scheint sich hier in den langen Jahren gar nichts geändert zu haben.«
»Was soll sich bei uns ändern?«
»Die Macht der Schlüsselbrüder ist doch unterdessen ins Ungeheure gewachsen.«
»Hier im Megalis el Hiemit bringt das keinen Unterschied hervor.«
»Im Megalis el Hiemit — im Hause der Weisheit — hihihihi!«, kicherte der Jesuitenpater.
»Ja freilich, der Weisheit und Wissenschaft wird hier nicht mehr viel gehuldigt!«, stimmte der andere bei. »Wir haben genug damit zu tun, Vorsichtsmaßregeln gegen den Alten zu treffen.«
»Ist er wieder aufgetaucht?«
»Niemand weiß, wo er sich befindet.«
»Das Megalis darf noch nicht verlassen werden?«
»Mit keinem Schritt, und dieses Verbot wird auch nie wieder aufgehoben werden. Das ließe sich schließlich auch noch ertragen, was soll man draußen in der Wüste.«
»Bis nach Kairo ist es doch nur ein Katzensprung.«
»Das ist nur für die Kebirs, wir anderen sind hier in den Felsen gebannt, selbst wir Fedawihs.«
»Nun, dieser Felsen ist groß genug.«
»Aber er hat Mauern. Ja, wenn man nur einmal nach einer Kolonie versetzt werden könnte. In der eintönigsten geht es lustiger zu als hier.«
»Nun, ich dächte, an Ergötzlichkeiten fehlte es hier doch nicht, die Königin weiß für Abwechslung zu sorgen.«
»Nein, Neues kann auch sie nicht mehr erfinden.«
»Wann beginnt das Fest der Astarte?«
»Ein Glockenzeichen verkündet es.«
»Kann ich den unheimlichen Melkart einmal sehen?«
»Ich führe Dich in sein Verlies.«
Sie sprachen noch weiter, aber mehr hörte der Prinz nicht, er musste jetzt ernstlich an sein Entkommen denken, und da half kein Rückzug, denn jetzt kamen dort hinten die beiden Korbträger wieder, oder andere, jedenfalls ihren Korb so hoch mit Wäsche bepackt, dass es kein Darüberspringen mehr gab, auch kein Darunterwegkriechen.
Nun, noch hatte er Zeit, in jenen Raum zu treten, er brauchte nur einige Schritte rückwärts zu machen, und er tat es.
Da aber folgten ihm diese drei Männer auch schon nach. Der Prinz drückte sich zur Seite.
»Nun, Abimelech, wie geht's?«
Der Alte hatte sich erhoben, schien den Frager nicht zu kennen, bis er ganz begeistert wurde.
»Heil, Lazarus, Astarte schenke Dir Kinder wie Sand in der Wüste, auf dass sie Moloch verschlingen kann, und er wird Dir gnädig lächeln!«
So hatte der Alte gerufen, sich demütig verneigend. Das war nun freilich kein mohammedanischer Gruß gewesen.
»Hähähähähä!«, feixte der ehemalige Jesuitenpater.
»Du bist lange nicht bei uns gewesen, Bruder Lazarus.«
»Du weißt, weshalb nicht.«
»Ist Deine Verbannung beendet?«
»Sonst wäre ich nicht hier.«
»Bleibst Du für immer hier?«
»Nein, und nicht einmal lange.«
»Schade. Hast Du uns wieder junge Weiber und Kinder mitgebracht?«
»Noch nicht, aber ich werde sie noch bringen, hihihi!«
»Auch wieder solche Kinder wie damals?«, erklang es mit förmlicher Gier aus dem Munde des Alten.
»Habe etwas ganz Feines in Aussicht, Moloch und Baal werden sich freuen, ein Kind, ein kleines Mädchen, das mit geschlossenen Augen in die Ferne blickt, alles sieht, wo auch auf der Erde etwas geschieht, und wenn dieses Kind in Molochs Leibe verbrennt, wird sein Opferrauch auch uns zum Hellsehen begeistern.«
So sehr sich der Prinz auch für dieses Gespräch interessieren musste, da hierbei doch offenbar niemand anders als Deasy gemeint war, zog er es doch vor, eine günstige Gelegenheit zu benutzen, um wieder zur Tür hinaus zu schlüpfen.
Die Gänge, die er durcheilte, ohne trotz ihrer fortwährenden Verzweigungen einmal im Einschlagen der Richtung zu zögern, wurden immer luxuriöser, der Boden mit kostbaren Teppichläufern bedeckt, die Wände mit herrlichem Mosaik aus bunten Steinchen belegt, immer prächtiger wurden die Lampen, die überall brannten.
Aber auch immer gefährlicher wurde es für den Fremdling in diesem siebartig durchlöcherten Ameisenfelsen. Immer mehr Menschen bewegten sich in den Gängen, nur Männer, alle arabisch gekleidet, obwohl nicht alle Araber, der Prinz sah auch europäische Gesichter genug, und wenn auch niemand den Fremdling in seinem Trikotkostüm bemerkte — weshalb nicht, dafür bedarf der Leser wohl keine Erklärung mehr — wurde es doch immer schwieriger, der Menschenmenge auszuweichen, sich von ihr nicht einschließen und einpressen zu lassen. Denn das hätte ja nun freilich eine Überraschung gegeben, wenn die Nächststehenden gegen einen luftigen Raum gepresst worden wären, der durchaus nicht weichen wollte. Da hätten zweifellos ja sofort fanatische Hände genug zugegriffen.
Noch wusste der Prinz solch eine gefährliche Situation zu vermeiden, aber immer näher rückte sie, immer größere Menschenscharen vereinigten sich aus allen Nebengängen in diesem hier, um einer Richtung zuzuströmen.
»Der Melkart — der Melkart wird gefüttert!«
Das war das Thema, um das sich alles drehte, auf Arabisch, Türkisch, Persisch, Hindustanisch und in anderen orientalischen Sprachen und Dialekten, und von europäischen vernahm der Prinz hauptsächlich Russisch, Spanisch, Italienisch und Französisch.
»Aha, Monsieur Kaltoff, der dicke Getreidehändler aus Kairo — auch hier im Geistergebirge, um den Melkart anzubeten und dem Moloch zu opfern und dann sich ein bisschen mit der Astarte zu amüsieren?! Und, Sapperlot, ist der dürre Hering dort in dem Beduinenburnus nicht der italienische Oberkellner vom Hotel Luxor, der sich zwei Wochen Erholungsurlaub hat geben lassen?! Na warte, mein Bürschchen, Du sollst nicht mehr lange Deine blutigen Mörderhände fürs Trinkgeld hinhalten!«
Nun aber hatte der Prinz wirklich keine Zeit mehr, unter den arabischen Gewändern nach alten Bekannten zu suchen, jetzt stieg die Gefahr, eingekeilt zu werden, aufs Höchste.
Da aber sah er schon einen Ausweg, einen besonderen Weg, den er benutzen konnte um dieselbe Richtung zu verfolgen, ohne mit den anderen Passanten in Berührung zu kommen.
Nach Überschreiten eines Seitenganges, auch schon mit Menschen dicht gefüllt, änderte sich die Architektur dieses Hauptweges.
Die Wände bekamen in einer Höhe von etwa zwei ein halb Meter eine Verzierung in Gestalt eines vorspringenden, sehr breiten Simses, an dem auch die Lampenkandelaber angebracht waren.
An solch einen Kandelaber angesprungen und sich hinaufgeschwungen! Wozu freilich eine ganz außerordentliche turnerische oder schon mehr akrobatische Gewandtheit gehört hatte.
So, nun konnte er ganz gemächlich seinen Weg fortsetzen, hoch über den Köpfen der Menge. Der Sims und die Höhe der Decke gestatteten ein ganz bequemes Gehen.
Und dabei zeigte sich wieder etwas.
Die Lampen selbst waren noch bedeutend über diesen Sims erhaben, und wenn er nun solch eine Lampe passierte, so hätte doch an der Wand sein Schatten entstehen müssen. Es geschah aber nicht.
Dieser Mann in seiner strahlenden Versilberung warf keinen Schatten!
Dann konnte man auch nicht verlangen, dass ihn die Augen dieser irdischen Menschen erblickten. Obgleich er sich selbst sah, seine unversilberten Hände sowohl wie seine versilberten Füße.
Da freilich hörte dieser Sims schon wieder auf, er wurde von einem Quergang unterbrochen, und auf der jenseitigen Wand wurde er nicht fortgesetzt.
Aber dieser Quergang war ausnahmsweise menschenleer, niemand ging hinein, ohne dass er abgeschlossen war. Dagegen waren die Wände dieses Ganges ausnahmsweise brennend rot getäfelt, von derselben Farbe der Teppichläufer.
Der Prinz nahm die am Gürtel hängende Kugel, hauchte sie wie schon einmal an, berührte sie mit der Zungenspitze, und dann schien er mit geschlossenen Augen zu lauschen.
Das Resultat dieses merkwürdigen Telefongesprächs — denn um etwas anderes konnte es sich dabei wohl nicht handeln — war, dass der Prinz vom Sims herabsprang und seinen Weg in diesem roten Gange fortsetzte.
Ganz ausgestorben war er nicht, jetzt kamen doch einige Menschen, Männer und Knaben, alle brennend rot gekleidet, mit wunderlichen Mützen, qualmende Weihrauchgefäße tragend — also Priester mit ihrem jugendlichen Stabe.
Diesen auszuweichen war ein Leichtes. Der Prinz verfolgte einen Seitengang, immer noch rot gehalten, eben nur für die Priester und ihr Personal bestimmt, noch eine Ecke genommen, und der Gang mündete in eine weite Halle.
Staunend stand der Prinz da.
Kopf drängte sich an Kopf, nicht nur Hunderte, sondern Tausende von Menschen füllten die weite Halle, die hinten ringsherum amphitheatralisch angelegte Sitz- oder Stehplätze hatte. Nur Männer waren anwesend, auch Jünglinge, aber keine Kinder, keine eigentlichen Knaben.
Und draußen auf den Gängen wogte es doch auch noch!
»Sapristi, wo kommen diese Tausende von Menschen nur her?! Womit ernähren sie sich hier?! Na ja — Almansor hat es mir ja gesagt, alles erklärt — man muss es erst gesehen haben, ehe man's glauben kann.«
In der Mitte des Saales stand, weswegen alle diese Menschen hier zusammengeströmt waren, ein großer Käfig aus goldenen Stäben, und in demselben saß auf einer Stange der Gott Melkart, der jetzt gefüttert werden sollte.
Natürlich kein Mensch.
Auch kein vierbeiniges Tier. wie sonst der Prinz erst angenommen hätte.
Es war ein Uhu.
Der größte Uhu, der in Deutschland erlegt wurde, im Bayrischen Hochwald, war siebenundsiebzig Zentimeter hoch mit einhundertachtundsiebzig Zentimeter Flügelspannweite. Ein kolossales Tier!
Im Kaukasus sind Uhus von neunzig Zentimeter Höhe gar keine Seltenheit, die Weibchen werden noch größer. Bei den Eulen eine Ausnahme unter den Warmblütern, dass die Weibchen größer werden als die Männchen.
Auch Nordafrika hat außer anderen Eulenarten einen echten Uhu, der aber selten höher als vierzig Zentimeter wird.
Das hier war ein nordasiatischer, und zwar entweder ein Ausnahme-Exemplar oder von Jugend an durch künstliche Fütterung oder sonst ein Mittel außerordentlich groß gezüchtet.
Ein Meter zwanzig maß er mindestens.
Und wie dieses Ungeheuer nun dasaß, dick aufgebläht, die Flügel gesträubt, diese Augen, wie die rollten ... man konnte es einfachen Naturmenschen gar nicht verdenken, wenn die aus diesem Vieh eine Gottheit machten.
Selbst die großen Raubtiere fürchteten sich ja vor diesem Kameraden aus dem Vogelreiche, obgleich sich doch sonst nicht einmal die feige Hyäne um den gewaltigen Aasgeier kümmert.
Es war aber auch noch etwas anderes dabei als nur Furcht vor der Stärke, vor diesem gewaltigen Schnabel und den Klauen. Die Eulen werden von allen warmblütigen Tieren gehasst, nicht nur von den Tagesvögeln. Hat man einmal gesehen, wenn sich am Tage eine Eule zeigt, wie alle anderen Vögel sich gleich vereinigen, Amsel, Drossel, Fink und Star, um gemeinschaftlich auf den Ritter der Nacht loszugehen? Ganz, ganz merkwürdig! Und so verhalten sich auch die vierfüßigen Tiere. Aber doch wieder ganz anders. Sie brauchen keine Furcht vor den Eulen zu haben ... es ist ein Widerwillen gegen diesen Nachtvogel, sie wollen mit ihm nichts zu tun haben. Das gilt besonders für den Uhu. Wo ein Uhu seine Losung und sein Gewöll absetzt, den unverdauten Mageninhalt, diese Stelle wird von allen anderen Tieren ängstlich gemieden. Und ist die Eule und besonders der Uhu nicht auch ein ganz merkwürdiges, unheimliches Tier? Das ist gar kein richtiger Vogel. Dieses menschliche Affengesicht! Es ist nicht anders, als ob die Eule und speziell der Uhu nicht mehr in unsere jetzige Erdperiode passe, das ist ein Zwittergebilde aus einer prähistorischen Zeit, welches die immer arbeitende Schöpfungskraft bei Schaffung einer neuen Erdperiode zu vernichten vergessen hat. Und das scheinen alle anderen Tiere zu fühlen —
Der unsichtbare Prinz, wie wir nun gleich sagen wollen, konnte den Melkart aus allernächster Nähe betrachten.
Um den goldenen Käfig herum war noch ein breiter Platz freigehalten worden, durch eine Schnur abgegrenzt, die von der Menge äußerst respektiert wurde, und dieser für die Priester reservierte Gang führte gerade da hinein, obgleich sonst nur ein einziger Priester als Wächter sich darin aufhielt.
Also der Prinz begab sich hinein, stellte sich direkt vor den Käfig hin, nur acht gebend, dass nicht etwa jemand von hinten kam, um in den vermeintlich freien Luftraum, den er selbst ausfüllte, hineinzutreten.
Aber sahen ihn vielleicht Tieraugen? Sah ihn dieser Uhu? Oder nahm er nur eine Witterung wahr, die ihm nicht behagte?
Der sowieso schon aufgepustete Riesenvogel schwoll zur Kugel an, die gesträubten Federn schlugen ein förmliches Rad, und so pustete und fauchte er in schier ungeheuerlicher Weise dorthin, wo der Prinz stand.
Die Menge schien diese Aufregung ihres sonst jedenfalls sehr teilnahmslosen Gottes Melkart als ein günstiges Zeichen aufzufassen, sie brach in ein jubelndes Johlen aus.
Da plötzlich verstummte alles wieder, und auch der Uhu lenkte seine Aufmerksamkeit einer anderen Richtung zu.
Ein Priester brachte auf goldener Schüssel für den Raubvogel das Futter, dem Gotte die Mahlzeit.
Ein kleines Kind, das einen noch ganz frischgeborenen Eindruck machte!
Lebendig!
Es zappelte auf der Schüssel herum, schien bei recht guter Laune zu sein und patschte kreischend die Händchen zusammen.
Und ehe der Prinz, der auf der anderen Seite stand, es hätte verhindern können, war es schon geschehen.
Der Priester hatte eine Tür aufgeklappt und die Schüssel mit einem Stoß bis in die Mitte des Käfigs geschoben.
Und da rauschte der Riesenvogel schon herab.
Das Kindchen jauchzte ihm lallend entgegen, bis sich ihm die nadelspitzen Krallen ins zarte Fleisch gruben, und da hackte schon der furchtbare Schnabel los.
Der Prinz sah es nicht mehr, er hatte sich abgewandt.
Die erhobene Faust schüttelnd, ließ er laut seine Stimme erschallen:
»Des Todes seid Ihr — Ihr alle seid des Todes, Ihr Bluthunde, die Ihr den Namen Menschen nicht mehr verdient! Herr im Himmel, nimm meinen Schwur an: Nicht rasten und ruhen will ich, als bis ich die letzte dieser zweibeinigen Bestien von Deiner Erde vertilgt habe, und in welchem Höllenloche sie sich auch verkriecht, ich will sie ans Licht der Sonne ziehen, um sie mit diesen meinen Händen zu erwürgen — dies schwöre ich, so wahr mir Gott helfe!«
So schrie der Prinz, außer sich, mit dröhnender Stimme.
Er konnte es getrost tun.
Der tosende Jubel, der losgebrochen war, als der Gott Melkart so wohlgefällig sofort das Opfer angenommen hatte, was sonst nämlich selten geschah, hätte auch das Donnern des Himmels übertönt.
Er setzte seine Wanderung auf der anderen Seite des Saales fort, wo auch wieder solch ein separierter roter Gang einmündete, war wieder ganz gefasst, wenn sein sonst so gutmütiges Gesicht auch etwas Starres, Eisernes angenommen hatte.
»Dank Dir, Almansor«, flüsterte er mit etwas zitternden Lippen, »habe Dank für das, was Du mir jetzt gezeigt hast. Ja, schon jetzt kann ich Dir versprechen, dass ich den bedingungslosen Gehorsam, den ich Dir vorläufig nur für diesen einen Tag zugeschworen habe, in lebenslänglichen verwandele, wenn Du mich nun einmal für das Werkzeug hältst, das vom Himmel dazu bestimmt ist, um diese blutigen Ungeheuer von der Erde zu vertilgen. Immer zeige mir neue Scheußlichkeiten, ich kann mich beherrschen, ruhig will ich zuschauen, bis Du selbst mir den Befehl gibst, als rächender Würgeengel einzugreifen — bis Dein Signal erfolgt, um diese ganze wahnsinnige Sippschaft mit einem einzigen Schlage zu vernichten. Ja, Almansor, rätselhaftes Wesen, in mir hast Du den richtigen Mann gefunden, ich kann mich beherrschen; sobald ich will, ist mein sonst so mitleidiges Herz von Stein, gepanzert mit Stahl — ich kann mich beherrschen, bis dass Dein Befehl zum Angriff erfolgt!«
Es war gut, dass sich der Prinz dies so fest vornahm. Denn er sollte gleich noch etwas anderes erleben.
Dieser Gang mündete nach kurzer Strecke auch wieder in einen Saal, in eine weite Halle, noch viel größer als jene, noch mehr amphitheaterartig angelegt, die Stufen und alles aus dem Felsen herausgehauen.
Auch hier wieder Tausende von Menschen.
Aber es muss betont werden, dass dieses Amphitheater noch einmal so viel gefasst hätte, die Hälfte der Plätze war unbesetzt, obgleich das Glockensignal schon längst gegeben worden und die Vorstellung schon in vollem Gange war.
Und was für eine Vorstellung, was für ein aufregendes Schauspiel!
Wenn Madrid einen Zirkus für 100 000 Zuschauer besäße, und hier würde alltäglich solch ein Schauspiel gegeben, dieser Zirkus wäre alltäglich bis auf den letzten Platz gefüllt, ganz Madrid würde gar nicht mehr arbeiten.
Wir wählen als Beispiel gerade die Hauptstadt von Spanien als desjenigen Landes, wo die scheußlichen Stiergefechte mit allerhöchster Erlaubnis noch in vollster Blüte stehen — wofür ja auch Spanien dem unaufhaltbaren Untergange geweiht ist, so wie es mit Rom zur Blütezeit seiner Gladiatorenspiele war. Denn das Volk, das an blutigen Grausamkeiten Vergnügen findet, ist rettungslos verloren. Das lehrt die Weltgeschichte mit eiserner Konsequenz.
Hier aber wurde noch etwas ganz Anderes gezeigt als nur ein Stiergefecht. Der wollüstige Nervenkitzel durch unmenschliche Grausamkeiten ließ sich gar nicht mehr überbieten.
Und dennoch war nicht einmal die Hälfte der Plätze besetzt. Obgleich die Leute wussten, was jetzt hier stattfand. Sie gingen gar nicht mehr hin, sahen lieber zu, wie ein Riesenuhu ein lebendiges Kind zerhackte, zwar ebenfalls ein scheußlicher Anblick, aber doch nicht zu vergleichen mit dem, was hier geboten wurde.
Was konnte man hieraus schließen?
Dass diese Menschen, die hier hausten oder ab und zu hier heimlich zusammenkamen, um religiöse Orgien zu feiern, mit solchen Grausamkeiten schon ganz und gar übersättigt waren — — —
Nur eine einzige Gruppe im Publikum muss näher beschrieben werden, auch der Prinz betrachtete sie mit Interesse.
An bevorzugter, erhöhter Stelle saß unter einem Thronhimmel ein berückend schönes Weib, schwarz wie die Nacht und dennoch weiß wie Schnee — so musste man unwillkürlich denken, nämlich bei Anblick dieser wunderbar weißen Haut, die so seltsam gegen das tiefschwarze Haar abstach, und nun die üppige Gestalt auch in ein schwarzes, eng anliegendes Gewand gekleidet, das mit goldenen Sternen übersät war — so sah es wenigstens erst aus, blickte man aber genauer hin, so gewahrte man, dass die goldenen Punkte lauter kleine Schlüssel waren, eingewebt, und ein großer goldener Schlüssel bildete auch ihren Kopfschmuck, goldene Schlüssel in den Ohren und an Armbändern und an Fußspangen.
Und ihr zu Seiten und zu Füßen saßen Hunderte von jungen Männern, durchweg ausgesucht schöne Jünglinge, in silberglänzenden Schuppenrüstungen, bei denen der Schlüssel als irgend ein heiliges Symbol, als Helmschmuck, als Schwertknauf und als Dolchgriff angebracht war, und weiter unten wieder Hunderte von schönen jungen Mädchen, aufs verführerischste gekleidet, auch wieder den Schlüsselschmuck tragend.
Die Königin der Nacht, die hier herrschte — ganz unwillkürlich musste man auf diesen Namen kommen, bei diesem schwarzen Kleide mit den goldenen Punkten — blickte gelangweilt auf das Treiben in der Arena hinab.
Obgleich es durchaus nicht langweilig war, was dort unten geboten wurde.
Soeben kletterte ein athletisch gebauter junger, brauner Mann an einer Stange empor, die in der Mitte der Arena aufgestellt war, durch straff gespannte Seile, oben angebracht, aufrecht gehalten.
Etwa vier Meter über dem Boden musste die Stange mit einer schlüpfrigen Substanz eingerieben sein, denn weiter kam der Kletterkünstler nicht, von dort rutschte er immer wieder herab.
Es sah possierlich aus, wie der Mann sich anstrengte, über diese Stelle hinauszukommen, wie er immer wieder abglitt, aber im Grunde genommen doch ein sehr harmloser Witz.
Weshalb aber machte denn der Mann solch ein verzweifeltes Gesicht, weshalb gellten manchmal seine Angstschreie durch die weite Halle?
Ja, wenn nur dort unten nicht der Königstiger gewesen wäre, ein stattliches Exemplar, aber recht mager aussehend, als hätte er eine kleine Hungerkur durchgemacht.
Ja, da freilich hörte der harmlose Spaß auf!
Das Raubtier wusste zweifellos, dass ihm die Beute dort oben nicht entgehen konnte, es hätte sich ruhig hinlegen können, aber es war zu hungrig, konnte nicht geduldig warten, und so umsprang es unaufhörlich die Stange, wirklich zungenleckend.
Und der Kletterkünstler?
Nun, dem hatte man wahrscheinlich gesagt:
»Wenn Du die mit Seife eingeschmierte Stelle überwinden kannst, dann hast Du Dein Leben gerettet, bist frei, einer der Unsrigen.«
Deshalb quälte sich der Mann so verzweifelt ab.
Denn wenn er nur ein wenig Besinnung und Mut gehabt hätte, so hätte er sich doch lieber gleich hinab gestürzt, in den Tigerrachen hinein. Wenn nun mal sein Schicksal besiegelt war. Was man freilich recht gut sagen kann, wenn man nicht selbst an solch einer Stange klettert, und unten leckt ein Tiger die Zunge.
Aber immerhin — über sich sah der Mann noch eine Rettung, deshalb quälte er sich verzweifelt ab.
Amüsant, da zuzusehen, nicht wahr?
Ach, wenn doch die spanische Regierung solche Schaustellungen erlaubte! Dann ginge es mit diesem unglückseligen Volke ja noch viel schneller zu Ende, dann würden die unermesslichen Schätze der Kirchen und Klöster frei, unermessliche Landgebiete von höchster Fruchtbarkeit, die aber jetzt nur ein paar Rinder und Schafe ernähren, würden endlich unter Kultur genommen!
Da ein gellender Schrei ... alle war's.
Es wurde ja Beifall gezollt — wem eigentlich, das war schwer zu sagen — aber mit dem tosenden Jubel, mit dem man dem Uhugotte applaudiert hatte, ließ er sich nicht im Entferntesten vergleichen. Nicht einmal so laut war der Jubel, dass er das Krachen der Knochen zwischen den Tigerzähnen übertönt hätte.
Der mit seiner Mahlzeit beschäftigte Tiger wurde sehr geschickt mit Netzen gefangen — das war wirklich erstaunlich, wie schnell das die nackten Knechte fertig brachten, eben die kolossale Übung — er wurde samt seinem Opfer hinausgeschleift, die Arena mit Sägespänen und Sand von Blut gesäubert, die Stange abgebrochen. Unterdessen sang das Publikum ein eintöniges Lied, in dem immer wieder der Name Astarte vorkam.
Also dieser Göttin zu Ehren, der Göttin der Fruchtbarkeit, aber auch der Vernichtung, ganz der indischen Kali vergleichbar, fanden diese Schauspiele statt.
Jetzt wurde in die Arena, deren unterste Stufe vier Meter hoch war, eine große Kugel gerollt, vielleicht zweieinhalb Meter im Durchmesser haltend. Es musste hohles Holz sein, sie war außerordentlich leicht, wie man gleich merkte. Sie wurde gehalten, an einer angelegten Leiter kletterte ein anderer junger brauner Mann hinauf, so wie ihn der liebe Gott geschaffen.
Also er produzierte sich als Kugelläufer. Er schien es aber in seiner Kunst nicht weit gebracht zu haben, denn er war recht unsicher. Doch war es ja auch eine sehr, sehr große Kugel, da konnte man sich trotz ihrer Leichtigkeit schon darauf halten.
Und dem Manne war die Aufgabe gestellt, die Kugel an die Arenawand heranzubringen, nichts weiter, dann konnte er sich mit leichter Mühe hinaufschwingen, dann hatte er seine Aufgabe gelöst, konnte sich unter das Publikum mischen, und das würde er schon fertig bringen, so lange konnte er sich halten, es war wirklich gar nicht so schwer, auf dieser großen Kugel im Stehen zu balancieren und sie durch Treten in Bewegung zu setzen.
Ja, wenn aber dort unten in der Arena nur nicht der große sibirische Bär gewesen wäre, auch so mager und verhungert aussehend! Und das Tier schien zu wissen, was dem Manne dort oben für eine Aufgabe gestellt worden, wodurch er sich befreien konnte, es machte dieses Spielchen wahrscheinlich nicht zum ersten Male mit. Der Bär drehte, sich aufrichtend, die Kugel immer gerade nach der entgegengesetzten Richtung, wohin der Mann wollte, ließ sie nicht an die Wand kommen, und sprang auch mit mächtigen Sätzen dagegen, um den Mann herabzustürzen, um ihn dann verspeisen zu können — —
Lieber Leser, glaubst Du, dass der Schreiber dieses all dies persönlich mit angesehen hat?
Tatsächlich!
In Indien, in Colombo auf Ceylon.
Freilich war dort der Stangenkletterer ein Affe, und der Kugelläufer war ein Hund. Unten lauerten einige hungrige Panther.
Es war sehr, sehr interessant und amüsant.
Aber hinterher schämte man sich.
Das heißt, wenn man ein Mensch war, ein wirklicher Mensch, sich sozusagen als Ebenbild Gottes fühlte.
Dann schämte man sich hinterher, an so etwas Gefallen gefunden zu haben.
Wenn es auch nur Tiere gewesen waren, an deren verzweifelten Kapriolen man sich ergötzt hatte.
Nur Tiere?
Das Publikum in Colombo bestand aus Mohammedanern und aus Christen, aus sehr vielen Christen. Aber Buddhisten waren nicht darunter.
Kein einziger.
Ein Buddhist wird sich hüten, zu solch einem Schauspiel zu gehen.
Tatwam asi — das bist Du!
Der Affe und der Hund und ich und Du — wir alle haben das gleiche Brahma, die gleiche göttliche Weltseele.
Wehe Euch, die Ihr so etwas arrangiert, und nicht minder Euch, die Ihr an so etwas Gefallen findet!
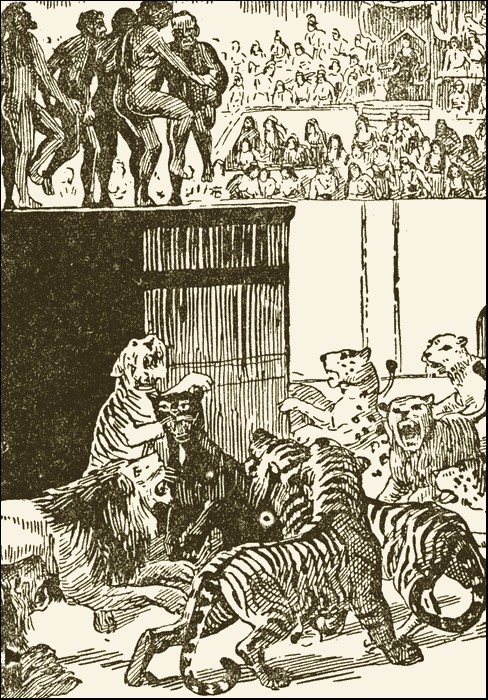
Die Männer auf der eisernen Plattform hoben unruhig die nackten
Füße, denn der Eisenbau wurde durch Feuer zur Gluthitze gebracht.
Es gibt eine ewige Gerechtigkeit, es gibt einen unerbittlichen Ausgleich im Schicksal!
Wir Menschlein sind nur zu blind, um dies ohne Weiteres erkennen zu können.
Aber wird denn um uns herum nicht fortwährend Gleiches mit Gleichem vergolten?
Man braucht nur die Augen zu öffnen, die inneren Augen.
Ach, was man da erblickt!
Klettert denn nicht mancher von uns ständig an einer mit Seife eingeschmierten Stange, balanciert auf einer rollenden Kugel, und unten lauern die zermalmenden Zähne? Mit qualvoller Verzweiflung klettert und balanciert er, bis er endlich den fruchtlosen Kampf freiwillig aufgibt, er springt freiwillig hinab — er hängt sich auf.
Genug! Wer Augen hat, der sehe. — — —
Wieder ein gewaltiger Sprung gegen die Kugel, zugleich mit List von der Seite ausgeführt, ein gellender Schrei, und der furchtbare Bär hatte sein ersehntes Opfer zwischen den Pranken, zerdrückte ihm erst die Rippen.
Applaus und das Loblied der Astarte, der Bär und seine zerfleischte Beute wurden beseitigt und die Vorbereitungen zur nächsten »Nummer« getroffen.
In der Mitte der Arena wurden Platten ausgehoben, über der entstandenen Öffnung im Boden Eisenplatten zusammengeschraubt, bis sie eine Plattform von drei Meter Höhe bildeten, oben ein Quadrat von fünf Metern Durchmesser.
Auf diese Plattform kletterten an einer Leiter ein Dutzend nackte Männer hinauf, die Leiter wurde weggenommen, eine kleine Tür an der Arenawand spie gleich einige Dutzend Löwen und Tiger und Panther aus.
Heute war großer Raubtiertag. Es gab auch noch andere Tage mit ganz anderen »Nummern«, wie wir später noch sehen werden. Die Tiere mussten wahrscheinlich heute unbedingt gefüttert werden.
Ein rauchiger Geruch erfüllte die weite Halle.
Und bald begannen die Männer dort oben auf der eisernen Plattform unruhig die nackten Sohlen zu heben.
Es sagt genug.
Der Eisenbau wurde geheizt. Entweder sich braten lassen, oder freiwillig dort zwischen die Raubtiere hinabspringen.
Allerdings immer mit der Möglichkeit, sein Leben zu retten. Dort in der Arenawand war eine kleine Öffnung, mit einer Klappe verschlossen. Wer hinabsprang, die Klappe erreichte, dem wurde sie geöffnet, er konnte hineinkriechen, war gerettet.
Aber wem sollte das gelingen!
Der Prinz, in dem für die Priester reservierten, fast menschenleeren Raume stehend, führte die an dem Kettchen hängende Kugel an den Mund, hauchte dagegen.
»Ich kann sie nicht retten?«, flüsterte er. »Ich darf sie nicht retten? Sie sind nicht zu bemitleiden? Sie haben nichts anderes verdient? Gut, ich glaube. Aber höre, Almansor, hier in dieser selben Arena werde ich Gleiches mit Gleichem vergelten ... ich dürfe als Christ keine Rache ausüben, sagst Du? Nein, ich will mich auch nicht rächen. Aber auch ich werde dereinst hier ein Kampfspiel veranstalten, wie es die Welt noch nicht gesehen — ein ritterliches Turnier — eine Vergeltung soll es sein, die eines germanischen Christen würdig ist ... ja, ich höre. Ich gehorche.«
Er verließ den Zirkus.
Der erste Todesschrei in dieser »Nummer« gellte ihm nach.
Auf einem einsamen Korridore stand ein Mann, ein junger Araber, einer von den Jünglingen, die wir schon beschrieben, in eine schmiegsame, stählerne Schuppenrüstung gehüllt, stützte sich auf sein gezogenes Schwert.
Er stand als Wächter vor einer der Türen, die von diesem Korridore abgingen, schwere, eiserne Türen, mit Riegeln und Schlössern versehen. Nur dass die Augenlöcher daran fehlten.
Aber obgleich der gepanzerte Wächter den Korridor entlang blickte, sah er doch nicht den Mann kommen, der in seiner silbernen Trikotrüstung noch ganz anders erglänzte.
Der Prinz schritt ungesehen an ihm vorüber, drehte sich um, trat hinter ihn, hob seinen Dolch, näherte die Spitze vorsichtig dem ungeschützten Nacken, ein behutsamer Stich, der nicht viel anders wirken konnte als der Stich eines Wespenstachels, der Araber hob auch schnell die Hand, um das vermeintliche Insekt abzuwehren, totzuschlagen ... da brach er schon zusammen.
Der Prinz hatte ihn aufgefangen, ließ ihn zu Boden gleiten.
Der kleinere Schlüssel öffnete die Tür.
In dem orientalisch ausgestalteten Raume saß der Heiland.
Der typische Christus, wie er auf Bildern immer dargestellt wird.
Trotz der sanften, etwas schmerzlichen oder traurigen Züge eine kräftige Nase — das Weibliche in diesen Zügen fernzuhalten, dennoch kraftvolle Energie hineinzulegen, wobei es der Bart allein nicht tut, das eben ist die Kunst der Christusdarsteller — der etwas spärliche Vollbart nicht eben gepflegt, dagegen das lange Haar sorgsam in der Mitte gescheitelt, die etwas hagere Gestalt von einem weiten Gewande umflossen.
Dieser Heiland hier hieß Edward Scott.
Dass der spätere Flieger nicht immer solch eine eiserne Maske gehabt hatte, ist ja schon gesagt worden. Als Kind hatten die Eltern aus ihm einen Jesusknaben mit langen Locken gemacht, künstlich gewellt, bis der Junge durch Hänselei seiner Kameraden selbst darauf aufmerksam geworden war und sich diese Spielerei energisch verbeten hatte.

Hier war er abermals zum Heiland herausstaffiert, herangezogen worden. Einsamkeit und geeignete Diät müssen die harten Züge des Fliegers schnell wieder verändert haben.
Was hatte man denn mit diesem imitierten Gottessohne vor?
Nun, für den, der etwas Erfahrung hatte, war die ganze Sache durchsichtig genug.
Er brauchte nur zu wissen, dass hier phönizischer oder überhaupt Götzendienst und Teufelskultus getrieben wurde.
Man lese nur solche Werke, die das Hexenwesen und anderen Aberglauben des Mittelalters behandeln.
Wie es diesen Hexen und Zauberern und anderen Teufelsdienern immer darauf angekommen ist, sich von Priesterhand geweihte Hostien zu verschaffen, einfach dadurch, dass sie die beim Abendmahl gereichte Hostie im Munde mit nach Hause nahmen, und was sie dann mit dieser Hostie für schauerlichen Hokuspokus trieben.
Oder man lese, was für eine Rolle immer das Kruzifix bei magischen Künsten spielen musste, beim Gießen der Freikugeln und dergleichen, immer frevelhaft verwendet.
Die Hostie ist von Mehl und Wasser, das Kruzifix von Holz oder Metall.
Hier hatte man sich einen Christus aus Fleisch und Blut fabriziert, und wenn es auch nur ein Symbol war, es war immerhin doch etwas ganz anderes als Mehl und Holz und Metall.
Das musste dann später, wenn Götter und Teufel in Menschendienst gezwungen wurden, natürlich sicher durch Opferung dieses christlichen Symbols unter scheußlichen Qualen und Zeremonien doch noch ganz anders wirken.
Wir werden uns hüten, solche Szenen in lebendiger Darstellung wiederzugeben. Dafür ist hier kein Platz.
Dagegen soll eine Rechtfertigung ausgesprochen werden. Mohammedaner konnten es nicht sein, die solchen Unfug begingen. Glaubenstreue Mohammedaner!
Alle Erzählungen, dass Mohammedaner gefangene Christen gezwungen haben, das Kruzifix anzuspeien und es mit Füßen zu treten, beruhen auf freier Erfindung, das ist eine niederträchtige Verleumdung, nur dadurch entschuldbar, dass die Erzähler es eben nicht anders wissen, sich ihres Irrtums nicht bewusst sind!
Dem Mohammedaner ist der christliche Gottessohn ebenfalls heilig! Er schützt und verehrt doch auch die christlich geweihten Stätten in und bei Jerusalem! Auch ihm ist Christus ein göttlicher Prophet. Die Sache ist nur die, dass er seinen Religionsstifter Mohammed als ersten Propheten über Christus stellt —
Edward Scott blickte auf, sah die Tür aufgehen, sah sie sich wieder schließen und ... nun, dann war die Tür eben wieder geschlossen. Höchstens vermisste er, dass draußen nicht der Riegel wieder vorgeschoben und der Schlüssel umgedreht wurde.
»Pst! Mister Edward Scott! Erschrecken Sie nicht! Ich bin ein Mensch wie Sie, kann mich aber unsichtbar machen. Einfach durchscheinend wie Glas. Einen schönen Gruß von Ihrer Mutter. Ich will Sie befreien. Dazu müssen Sie auch unsichtbar gemacht werden. Ziehen Sie sich aus, fix, fix! Zeit haben wir nicht zu verlieren. Ist das reines Wasser? Well, ich gieße etwas hier in diese Schale. Na, zum Kuckuck, so ziehen Sie doch nur Ihren Kittel endlich aus!«
Es war dem jungen Manne nicht zu verübeln, dass er mit halbgeöffnetem Munde ein wenig geistreiches Gesicht machte.
Erklingt da im luftigen Raume eine sonore Männerstimme, nur etwas leise, auf dem Tische wird eine arabische Kaffeeschale gerückt, ein Krug schwebt von allein hoch, gießt in die Schale Wasser hinein.
Da aber machte Erward Scott auch schon wieder seinen Mund zu, sogar mit einem hörbaren Klapp, man hörte die Zähne aufeinanderschlagen, was in solchen Fällen immer ein gewisses Zeichen von Energie ist, und begann dafür behend seine Kleidung abzulegen.
»Auch das Hemd?«
»Ja, wenn Sie glücklicher Mensch im Besitz eines solchen sind. Ich bin's nicht. Sie brauchen sich nicht zu genieren, ich bin keine Jungfrau. Aber etwas leiser können Sie sprechen, so leise wie möglich. Es könnte jemand lauschen, und die brauchen nicht zu wissen, dass Sie hier den Besuch eines Geistes erhalten haben.«
»Sie sind ein Geist?«
»Ich? Nee.«
»Sie können sich vergeistigen, aus Ihrem Leibe heraustreten?«
»Ooch nich. Hier meine Hand darauf, dass ich's nicht kann.«
Edward Scott bekam eine Hand zu fühlen, welche die seine schüttelte und ganz empfindlich drückte.
»Vielleicht kann ich später einmal aus meinem Leibe heraustreten, ohne dabei zu sterben — vorläufig kann ich mich nur ganz einfach unsichtbar machen. Ja, eine ganz einfache Geschichte. Wenn man weiß, wie's gemacht wird. Das heißt, wenn man das Mittel dazu besitzt. Und selber machen kann ich's auch nicht. Na, ist das Hemdchen endlich herunter? Mensch, Sie sind ja gewachsen wie ein Apollo-Pökling, der zu lange im Rauchfang gehangen und alles Fett ausgeschwitzt hat!! So, nun nehmen Sie hier den Lappen, tauchen ihn hier ins Wasser und reiben sich vorn ein, nur eben dass die Haut nass wird, aber auch überall — doch das sehen wir dann schon, wo's fehlt — ich tue dasselbe hinten, so geht's am schnellsten, und auf dem Rücken können Sie doch nicht einreiben.«
Es war dem jungen Manne gewesen, als ob in die Wasserschale noch etwas anderes gegossen worden wäre, aus einem unsichtbaren Gefäß, und dann sah er, wie unsichtbare Hände zwei Fetzen von dem Hemd abrissen, der eine wurde ihm gegeben, der andere zusammengeballt und in die Schale mit Wasser getaucht, und dann fühlte er auf seinem Rücken schon die kühle Feuchtigkeit. Und da vollzog sich auch schon das Wunder!
Sobald die Feuchtigkeit auf seiner Hand getrocknet war, sah Edward Scott diese seine Hand verschwinden, und so geschah es mit allen Gliedmaßen, die er einrieb, sie wurden unsichtbar und blieben es, auch wenn man jetzt noch einmal von dem Wasser auftrug.
»Wie ist das möglich?!«
»Es ist ein Amalgam in wässriger Lösung, das, eingetrocknet, wenn die Haut auch noch so fein überziehend, die Lichtstrahlen durchlässt, und zwar derartig, dass es den dazwischenliegenden Körperteil nicht erblicken lässt, also einfach unsichtbar macht.
Lassen Sie sich mit dieser Erklärung vorläufig genügen. Eine andere kann ich überhaupt selbst nicht geben. Aber ich glaube der Versicherung des Mannes, der diese Erfindung gemacht hat, dass dereinst die ganze Menschheit dieses Mittel besitzen und benutzen wird, wonach auch wieder eine Brille erfunden werden muss, um für das menschliche Auge diese Unsichtbarkeit wieder aufzuheben, denn sonst bräche für die Herren Diebe eine paradiesische Zeit an.
Und diese Brille ist von demselben Manne ebenfalls schon erfunden worden. Allerdings keine, die man vors Auge nimmt. Sondern sie muss ins Auge hinein gelegt werden. Sehen Sie hier, ich betupfe wieder Ihren Arm.«
Der Prinz nahm, was Edward Scott freilich nicht sah, das kleinere an seinem Gürtel hängende Fläschchen, schraubte den Stöpsel ab, befeuchtete seinen Finger, rieb auf dem unsichtbar gewordenen Arm des jungen Mannes, und alsbald sah dieser den betreffenden Fleischteil seines Armes wieder.
»Ich habe die Wirkung des Amalgams durch ein Gegenmittel aufgehoben. Oder vielmehr den Amalgamüberzug durch dieses Gegenmittel ganz einfach wieder abgewischt, was sonst nämlich nicht so leicht möglich ist. Dieses Zeug klebt wie Teufelspech. Es lässt sich sonst nicht anders entfernen, als dass man die Haut abzieht, oder man muss warten, bis sich die Haut von selbst abschält, viele Tage lang, man kann diesen Vorgang höchstens durch Reiben mit Sand und Bimsstein unterstützen.
Dies alles lässt sich nun aber auch von innen heraus erreichen. Man kann die unsichtbar machende Amalgamlösung auch innerlich einnehmen. Nur dauert das dann etwas länger. Ein Tränklein zu nehmen, das plötzlich unsichtbar macht, das wäre ein Zaubermittel, so etwas gibt es nicht, ich könnte mir die Möglichkeit gar nicht vorstellen, während es so, wie es hier verwendet wird, recht wohl möglich ist, physikalisch zu erklären ist.
Das Mittel muss vom Körper erst assimiliert werden. Was man unter Assimilation versteht, wissen Sie wohl. Alle Nahrungsstoffe, Eiweiß, Fett, Kohlehydrate und Salze, müssen vom tierischen Körper assimiliert werden, ehe sie zur Wirkung gelangen. Magen und Därme verdauen sie, das heißt bereiten sie zur Aufnahme vor, die Drüsen saugen sie auf und befördern sie ins Blut, das Blut pumpt sie bis in die fernsten und feinsten Körperteile, die bisher fremden Stoffe werden Teile des tierischen Körpers selbst. Das nennt man Assimilation.
Von allen Nahrungsmitteln dürften am schnellsten die nährenden Bestandteile der Fleischbouillon assimiliert werden, Eiweiß und hauptsächlich Salze. Schon in drei Stunden haben sich diese dem eigenen Körper vermählt. Eine ganz richtige Vermählung — ein Fleisch und ein Blut, und selbst von einer Seele möchte man fast sprechen.
Es gibt aber künstliche Nährpräparate, bei denen es noch schneller geht. Oder es können ja auch Medizinen sein. Diese Amalgamlösung hier braucht zwei Stunden, bis sie von Blut und Fleisch in die feinsten Teile assimiliert worden ist, die kleinste Zelle hat ein Teilchen davon aufgenommen — der Kerl ist unsichtbar, ist es von innen heraus geworden.
Noch schneller eigentlich müsste es gehen, wenn das Mittel direkt ins Blut gespritzt würde. Das ist auch Tatsache, dann geht's fix. Aber man kann davon auch böse Anfälle bekommen. Sollen mal sehen, wenn ich Ihnen mit einer Klistierspritze eine Tasse Ochsenschwanzsuppe ins Blut pumpe, wie Sie zappeln!
Also man wartet lieber zwei Stunden, löst sich so nach und nach in Dunst auf, bis man spurlos aus dieser schnöden Welt verschwunden ist. Dazu haben wir jetzt aber keine Zeit, man könnte Sie unterdessen beim noch sichtbaren Schlafittchen nehmen, deshalb pinsele ich Sie lieber von außen an, das wirkt momentan.
Und genau so nun ist es auch mit dem Gegenmittel. Anstatt mit ihm auswendig das Amalgam wieder abzulösen, kann man es auch innerlich einnehmen, dann wirkt es von innen, aber auch erst in ungefähr zwei Stunden.
Aber dieses Gegenmittel hat eine doppelte Wirkung. Ungefähr so wie der Alkohol.
Alkohol ist ebenfalls ein Kohlehydrat, das, wenn man nicht gar zu starken Schnaps trinkt, vom animalischen Körper in Fett verwandelt wird. In dieser Beziehung ist verdünnter Alkohol, also Bier und Wein und sogar Schnaps, ebenfalls ein Nahrungsmittel.
Nun aber haben diese edlen Getränke bekanntlich noch eine andere Wirkung, und zwar eine fast augenblickliche. Der Alkohol geht sofort ins Gehirn, steigt zu Kopfe, erzeugt dadurch ganz eigentümliche Erscheinungen, macht die Zunge schwer, verschiebt das Gleichgewicht, erzeugt eine eigentümliche Vorliebe, Laternenpfähle zu umklammern, und was dergleichen mehr ist. Wie und warum das so ist, darüber sind sich unsere Gelehrten durchaus noch nicht einig, das hat noch nicht einmal der Droschkenkutscher August Schulze in Berlin ergründet, obgleich er zum Studium dieses Rätsels täglich achtundvierzig Kümmel mit Rum trank, bis er durch diese fortwährenden Experimente eines elendiglichen Todes starb, also sozusagen ein Märtyrer der Wissenschaft geworden ist. Ehre seinem Angedenken, dem Droschkenkutscher August Schulze in Berlin!
Ebenso nun verhält es sich mit diesem Gegenmittel. Außer dass es nach zwei Stunden, innerlich eingenommen, die Unsichtbarkeit wieder aufhebt, wirkt es auch fast augenblicklich aufs Gehirn. Aber nicht, dass es berauscht, sondern die spezielle Wirkung äußert sich in den Sehnerven, was der Alkohol allerdings auch tut. Das bekannte Doppelsehen — wenn man Billard mit sechs Bällen spielt. Sondern es ... es hebt ganz einfach für das eigene Auge die Unsichtbarkeit wieder auf, obgleich diese fortbesteht, das heißt für alle die, die dieses Tränklein nicht genommen haben. Hier trinken Sie mal. Aber nicht so viel, das Zeug ist kostbar. Ein kleines Schlückchen genügt.«
Dem jungen Manne ward ein Fläschchen in die Hand gedrückt, auch die unsichtbare Hand des anderen blieb daran liegen, so führte es Edward Scott an den Mund, nahm ein Schlückchen.
»Wie schmeckt's?«
»Ungefähr wie Bouillon.«
»Na, Sie können hier nicht sehr mit Ochsenschwanzsuppen und anderen Kraftbrühen verwöhnt worden sein, dass Sie dieses Luderzeug Bouillon nennen. Es schmeckt höchstens nach Spülwasser, in dem Teller abgewaschen worden sind, die schon ein Hund abgeleckt hat. Und was merken Sie?«
»Nichts ... und doch ... ich habe plötzlich so eine merkwürdige Empfindung in den Augen ... ah!«
Nicht nur, dass Edward Scott, an sich herabblickend, seinen eigenen Körper wieder sah, in einem silbernen Glanze, sondern jetzt sah er dort auch den bärtigen Mann stehen, ebenso glänzend, bis auf Hände und Gesicht, die zeigten natürliche Fleischfarbe, sehr sonnenverbrannt.
»Herr, wer sind Sie?!«
»Prinz Joachim. Kennen Sie nicht? Angenehm. Bin sogar eine königliche Hoheit. Diesen Titel können Sie sich aber ersparen. Nennen Sie mich nur ganz einfach Prinz. Auf diesen Titel halte ich, weil ich dazu verpflichtet worden bin. Bin übrigens ein ganz gemütlicher Prinz. Wünschen Sie sonst noch etwas zu wissen? Jetzt ist noch Zeit zum Plaudern. Ich bekomme ein Zeichen, wenn ich dieses Zimmer verlassen soll. Dann aber muss es auch höllisch fix gehen.«
»Ihre Hände und Ihr Gesicht sind doch nicht mit Amalgam bedeckt!«
»Weil ich diesen Überzug überhaupt nicht nötig hätte. Ich habe vor zwei Stunden mein Tränklein genommen und nehme ab und zu immer noch ein Schlückchen aus der Buttel.«
»Weshalb haben Sie dann den übrigen Körper dennoch überzogen?«
»Weil ich nun einmal heute Nacht mit dem Zeuge eingeschmiert worden bin, und das Gegenmittel ist kostbar, das verschwendet man nicht so leichtsinnig.«
»Ich denke, ein Schlückchen des Gegenmittels genügt, um die Unsichtbarkeit wieder aufzuheben, innerhalb von zwei Stunden.«
»Ja, wenn man die Unsichtbarkeit auch von innen heraus erzeugt hat. Den äußeren Überzug aber kann man nur durch Einreiben wieder entfernen. Sonst muss man warten, bis sich die Haut wieder abschält. Ich warte, ich habe Zeit.«
»Aber doch auch Ihr Bart und Ihr Kopfhaar war unsichtbar!«
»Ist es auch jetzt noch. Nur für Ihr geöffnetes Auge nicht mehr. Na ja, dieses innerlich eingenommene Mittel wirkt eben auch auf die Haare. Wissen Sie nicht, dass jedes Haar seinen Kanal, ja, wie jetzt durch die Mikroskope bewiesen worden ist, sogar sein eigenes Adersystem hat? Auch in jedem Härchen kreist das Blut. Ihnen aber, lieber Freund, muss ich das Haar erst noch einschmieren, und dazu ist das Beste, wenn ich es erst kürze. Denn das Zeug ist rar und Sie können nicht verlangen, dass ich hier lange Damenhaare wasche. Ich bin nur auf Herrenkopfwäsche geeicht. Gestatten Sie gütigst.«
Und ohne Weiteres packte der Prinz den anderen beim Haarschopfe, löste den Dolch und schnitt ihm das Haar ab, so weit er konnte. Der Dolch schien scharf wie ein Rasiermesser zu sein, aber freilich um Haare zu schneiden ist das doch kein geeignetes Instrument.
»Und nun auch etwas den Bart.«
Ab war er, so weit das mit einem Messer möglich ist.
Der Prinz trat zurück und musterte sein Werk mit kritischem Blick.
»Hm. Haben Sie keinen Spiegel da? Schade. Oder es ist auch besser so. Ich würde Ihnen nicht raten, hinein zu blicken. Wie der Heiland sehen Sie nämlich nicht mehr aus. Eher wie ein Verbrecher, der aus dem Zuchthaus entsprungen ist. Na, sobald ich eine Schere erwische, mache ich wieder einen feinen Jüngling aus Ihnen. Nun noch die Kopfwäsche. Das müssen Sie aber selbst besorgen, ich will mir die Finger nicht mehr versilbern, als vorhin unvermeidlich war. Also passen Sie auf, ich gieße etwas auf Ihren Kopf, reiben Sie tüchtig.«
Es geschah. Auch die Haare zeigten, sobald das wenige Wasser verdunstet war, einen silbernen Glanz, und ebenso wurde dann der letzte Rest des Bartes behandelt.
»Strahlt der Amalgamüberzug nicht ein Licht aus?«, fragte Edward Scott bei dieser Beschäftigung.
»Tut er. In der Finsternis so stark, dass man bequem dabei lesen kann.«
»Und auch dieses Leuchten wird nicht gesehen?«
»Nicht von anderen Augen, nein.«
»Seltsam!«
»Es gibt noch ganz andere seltsame Dinge in der Welt, und eines der seltsamsten ist wohl, dass ein Wurm um sich herum aus Fäden ein Ei aufbaut und dann als Vogel wieder zum Vorschein kommt. Oder meinetwegen als Schmetterling. Aber das soll einmal ein Mensch nachmachen, das würde ich seltsam finden! Nun lassen Sie sich bewundern.«
Wieder trat der Prinz zurück, um den anderen zu mustern, diesmal aber die Kugel vor das eine Auge haltend, das andere zukneifend.
»Durch diese Kugel wird die Unsichtbarkeit oder Durchsichtigkeit auch für Ihr Auge wiederhergestellt?«
»So ist es. Diese Kugel hat aber auch noch ganz andere Eigenschaften. Ja, wir haben ganz gut geschmiert, Sie sind ein wesenloses Gespenst ohne Tädelchen, Sie können in Castans Panoptikum — — halt, Ihre linke Haxe muss noch ein bissen nachgeschmiert werden!«
Es geschah, und der musternde Prinz hatte nichts mehr auszusetzen.
»Aber fertig sind wir noch immer nicht. Jetzt muss ich auch noch Ihre Augenlider einpinseln. Und hierzu gleich noch eine Bemerkung mit Instruktionen: Auch den Augapfel einzupinseln, das geht nicht. Um auch diesen unsichtbar zu machen, muss man unbedingt das Mittel innerlich einnehmen. Aber das wirkt erst nach zwei Stunden, und da hoffe ich schon weit von hier zu sein. So begnüge ich mich, Ihre Augenlider zu verquecksilbern. Also, passen Sie auf: Wenn wir dann an Menschen vorbeikommen, so schließen Sie Ihre Augen. Ich werde Sie dann führen. Oder Sie sorgen sonst dafür, dass man nicht ein menschliches Augenpaar in der Luft herumschweben sieht. Verstanden?«
»Sehr wohl, mein Prinz.«
»Gut. Wer so wie Sie tausend Meter hoch und noch höher in der Luft herumgondelt, der ist auch von leichter Auffassungsgabe und weiß sich zu helfen, sonst liegt er bald einmal plötzlich auf der Erde. Das weiß ich. Ich kann mich auf Sie verlassen. Sie spielen mir keinen bösen Streich, so weit Sie es irgendwie vermeiden können. Also schließen Sie Ihre holden Guckäuglein, damit ich sie anpinseln kann. Haben Sie sonst noch etwas zu fragen?«
Denn so viel der Prinz auch sprach, keine Sekunde blieb dabei unbenutzt.
»Mit diesem Mittel kann man überhaupt jeden Gegenstand unsichtbar machen, wenn man ihn damit anmalt?«
»Nein, nur organische Substanz, und auch nur, wenn sie lebendig ist. Sie verstehen den Unterschied. Wenn man ein Stück Haut abschält, vom Körper trennt, so ist sie sofort tot. Das zeigt sich schon dadurch, dass sie jetzt von der Sonne gebleicht wird, nicht mehr gebräunt, es geschieht, so lange sie mit dem Körper verbunden ist, von ihm ernährt wird.«
»Aber an Ihrem Gürtel hängen doch verschiedene Sachen, die ich vorhin nicht gesehen habe, und das gilt von dem Gürtel selbst.«
»Ja, diese Gegenstände müssen aus einem anderen Stoffe bestehen, das weiß ich selbst nicht. Oder vielleicht sind auch sie nur angepinselt, aber nicht mit diesem Zeuge hier. Das wirkt nur, wenn es auf lebendige organische Substanz aufgetragen wird, also einfach auf einen tierischen Körper, der aber immer leben muss. Einen toten Hund kann man einsalben, wie man will — er wird versilbert, aber nicht unsichtbar. So, auch Ihre Augen sind präpariert. Wo können wir nun hier Ihre Hinterlassenschaft verschwinden lassen?«
»Hier ist ein leerer Kissenbezug.«
»Wozu dient er?«
»Ich weiß nicht. Zu gar nichts. Er ist schon hier, so lange ich diese Zelle bewohne.«
»Dann rin damit!«
Die abgelegten Sachen wurden hineingestopft, desgleichen die abgeschnittenen, sorgsam gesammelten Haare, auch die beiden gebrauchten Läppchen vergaß der Prinz nicht, die jetzt nach dem Trocknen ebenfalls versilbert waren.
»Da sehen Sie, das ist reine Wolle, also doch eine organische Substanz, jede Faser ist mit Amalgam überzogen, das aber bleibt sichtbar. Wozu Sie jetzt allerdings, um dies zu unterscheiden, durch meine Kugel blicken müssen. Da haben Sie's. Mich und Ihre Hand sehen Sie nicht mehr, wohl aber noch diese versilberten Läppchen. Wo kommt das Kissen hin? So, legen wir es hierher. Sind Sie fertig? Mitnehmen dürfen Sie überhaupt nichts, es sei denn, Sie können es in der Hand oder im Munde vollkommen verbergen. Denn was von der unsichtbar gemachten Hand eingeschlossen wird, wird natürlich ebenfalls unsichtbar. So, nun wollen wir gehen.«
Der Prinz wandte sich der Tür zu.
In diese hatte er beim Eintreten innen seinen Schlüssel gesteckt, ihn nur halb umdrehend, nicht wirklich zuschließend.
So lange die Prozedur währte, hätte ja auf keinen Fall jemand die Zelle betreten dürfen, und dazu genügte bei diesem Schnappschlosse, dass innen der Schlüssel einfach halb umgedreht wurde, dann konnte von draußen kein Schlüssel hineingesteckt werden.
Was dann passiert wäre, wenn jemand den Gefangenen hätte besuchen wollen, diese Möglichkeit auszudenken hat gar keinen Zweck.
Es war geglückt, sie waren fertig geworden, jetzt konnten sie die Zelle ungesehen verlassen.
Da, wie der Prinz noch auf dem Wege nach Türe war, blieb er stehen, schloss die Augen.
»Alle Wetter!«, flüsterte er dann. »Jetzt sitzen wir drin in der Patsche! Der Wächter ist wieder zu sich gekommen! Hören Sie? Jetzt schiebt er den Riegel wieder vor! Er mag glauben, er habe ihn beim Umfallen zurückgerissen. Almansor hat mir versichert, dass die Wirkung des betäubenden Stiches, wenn auch noch so leicht beigebracht, einige Stunden anhält, und jetzt kann sich der Kerl schon nach kaum zehn Minuten wieder erheben, ist wieder ganz frisch! Da sieht man, dass auch dieses rätselhafte Wesen doch nur ein Mensch ist, der sich irren kann!«
»Sie haben den Wächter betäubt?«
»Ja.«
»Woher wissen Sie denn, dass er wieder erwacht ist? Den Riegel kann doch auch ein anderer wieder vorgeschoben haben.«
»Pst, Freund, solche Fragen sind nicht erlaubt! Jetzt verüble ich sie Ihnen noch nicht, ich werde Sie später instruieren, was Sie fragen dürfen und was nicht.«
»Verzeihen Sie ...«
»Gut, ich weiß, die Neugierde ist keine Untugend von Ihnen — Ihre Frage war ganz angebracht, aber beantworten tue ich sie nicht. Dagegen frage ich Sie jetzt um Rat, wie wir unbemerkt von hier wieder hinauskommen.«
»Nun, wir werden doch gar nicht gesehen, wir sind doch unsichtbar.«
»Aber wir müssen doch die Tür öffnen.«
»Das darf nicht geschehen?«
»Nein, dieser Wächter und kein anderer Mensch in dieser Felsenbehausung darf etwas davon ahnen, dass hier unsichtbare Menschen ihr Wesen treiben. Fragen Sie nicht nach dem Warum. Auch ich habe meine Verbote bekommen.«
»Also dürfen wir den Wächter auch nicht überwältigen?«
»Nein, ihn und keinen anderen auch nur mit einer Fingerspitze berühren. Dass ich ihn betäubte, das war etwas ganz anderes. Er mag geglaubt haben, von einem giftigen Insekt gestochen worden zu sein, hat einfach einen Ohnmachtsanfall gehabt.«
»Aber — bitte, noch eine Bemerkung von mir — Sie können ihn doch zum zweiten Male heimlich stechen.«
»Da würde er aber doch schon vorher gemerkt haben, wie sich die Tür geöffnet hat. Nein, es darf nicht sein. So geht es nicht. Auch ich habe meine Instruktionen. Hat dieses Zimmer noch eine andere Tür?«
Eine solche war nicht zu sehen, da aber die Wände nach orientalischer Art mit Teppichen verkleidet waren, hätte ja doch hinter einem solchen noch eine andere sein können.
»Nein, nur diese einzige Korridortür.«
»Ich setze voraus, dass Sie wegen einer Flucht alle Möglichkeiten untersucht haben.«
»Habe ich, so weit es ein intelligenter Mensch irgendwie tun kann, und ich bewohne diese Zelle fast schon ein Jahr.«
»Und wie sieht es hier draußen aus?«
Die hochangebrachte Fensteröffnung war stark vergittert, darunter stand der Tisch, der Prinz stieg hinauf und hatte seinen Kopf gerade am unteren Rande dieses Fensters, konnte eben noch, ohne einen Klimmzug machen zu müssen, hinaussehen.
In einer Entfernung von vielleicht dreißig Metern zog sich gegenüber wieder eine nackte Felswand hin, diese Felsenmauer hier war mehr als einen Meter stark.
Mehr konnte der Prinz nicht konstatieren.
Nachträglich aber wollen wir bemerken, dass er, um hier in diesen Korridor zu gelangen, viele, viele Treppen emporgestiegen war, er musste sich wenigstens vier Etagen, mindestens zwanzig Meter hoch über dem Erdboden befinden.
Der Prinz war wieder herabgestiegen, ging nach der Tür, drehte jetzt den Schlüssel leise um, zog ihn ab und befestigte ihn wieder an dem Kettchen seines Gürtels.
»Wie werden Sie hier bedient? Wie bekommen Sie Ihre Mahlzeiten?«
»Sie werden mir gebracht.«
»Von wem?«
»Von zwei oder auch drei arabischen Dienern.«
»Sind das immer dieselben?«
»Ja, immer.«
»Wann kommen die?«
»Eine Uhr fehlt mir, aber ich schätze die regelmäßigen Zwischenpausen auf vier Stunden. Und zwar früh um acht, mittags um zwölf und nachmittags um vier. An der Sonne kann ich die Mittagszeit doch ziemlich genau bestimmen.«
»Was werden dabei für Sicherheitsmaßregeln getroffen?«
»Alle vier Stunden wird, wie ich beobachtet habe, draußen die Wache abgelöst, Tag und Nacht. Am Tage dann, wenn die Diener meine Zelle betreten. Das Ablösen der Wache erfolgt durch eine starke Patrouille. Ich höre ihren Schritt draußen auch auf dem weichen Teppich dröhnen. So lange die Diener hier drin sind, bleibt die Tür weit offen. In doppelter Reihe stehen die gepanzerten Männer dicht vor der Tür, mit gezücktem Schwerte. Sechs solcher Ritter sehe ich immer. Sie mögen sich aber noch viel weiter den Korridor hinziehen.«
»Sie wollen hiermit sagen, dass es kein Entkommen für Sie gegeben hat.«
»Mein Prinz! Als ich hierher kam, vor fast einem Jahre, war ich ein starker, kühner Mann, nur aus federnden Knochen und stählernen Muskeln bestehend, und ich war ein Flieger, es gab keine Gefahr, vor der ich zurückgeschreckt wäre. Nein, ich sah keine Möglichkeit, mich durch diese Reihen zu schlagen. Keine! Was hätte mir dort das Tischbein genützt. Und nicht einmal die Möglichkeit hatte ich, einem ein Schwert zu entreißen. Ehe diese arabischen Ritter es ziehen, wird der Griff mit einer Kette durch einen sofort wirkenden Mechanismus am Handgelenk befestigt. Und jetzt bin ich schon lange nicht mehr imstande, so etwas auszuführen, auch wenn ich nicht erkannt hätte, dass so etwas heller Wahnsinn wäre.«
Mit tiefem Mitleid blickte der Prinz in dieses hagere, leidensvolle Gesicht, das jetzt ohne die langen Haare und den Bart erst recht einen ganz jämmerlichen Eindruck machte.
»Sie sind krank?«
»Nein, ich bin nicht krank. Ich fühle mich ganz wohl. Aber ich bin nicht im Entferntesten mehr das, was ich früher war. Ich habe als Flieger vegetarisch gelebt, aber sehr, sehr kräftig, fast nur von Milch, Hafergrütze und Schrotbrot, führte meinem Körper täglich fast einhundertundfünfzig Gramm Eiweiß zu. Seit meiner Gefangenschaft habe ich hier nichts weiter als Reis bekommen. So viel ich essen mag, immer anders zubereitet, immer anders gewürzt, immer schmackhaft, ich habe ihn noch nicht zum Überdruss bekommen. Aber es ist nichts für mich, dieser in Wasser gekochte Reis. Orientalen mögen davon leben können, ein Chinese braucht täglich nur eine Hand voll Reis und kann dabei die kolossalsten körperlichen Arbeiten leisten, Strapazen aushalten. Ich bin kein Orientale und kein Chinese. Für mich ist das nichts. Ich habe eine andere Konstitution, vor allen Dingen wohl einen anderen Verbrennungsprozess. Ja, ich fühle mich durchaus gesund. Aber mir ist, als ob ich bei aller Sättigung langsam verhungere. Mir fehlt Eiweiß. Ich bin total von Kräften. Es strengt mich schon an, wenn ich dort auf den Tisch steige. Es ist für mich eine Klettertour, die mich total erschöpft.«
»Haben Sie das nicht einmal jemandem gesagt?«
»Ich habe es. Man hat aber hier kein Verständnis dafür.«
»Na, wo ich Sie dann hinbringe, so weit kommen Sie schon, und dann will ich Sie bald wieder herausgefüttert haben. Also Sie halten es nicht für möglich, auch in diesem unsichtbaren Zustande zur Tür hinauszuschlüpfen, wenn die Diener kommen?«
»Nein. Die Patrouille steht wie eine gepanzerte Doppelmauer dicht vor der Tür. Man müsste geradezu über sie hinwegspringen können.«
»Hm. Und bekommen Sie sonst niemals außer diesen regelmäßigen Zeiten einen Besuch?«
»Nie.«
»Hm. Führt nicht über die Diener immer jemand die Aufsicht, sieht als verantwortliche Person nach dem Rechten, dass Ihnen nichts fehlt?«
»Allerdings.«
»Nun, wer ist das?«
»Ein Weib. Dasselbe, das mich von Kairo hierher entführt hat, durch eine List, indem sie sagte, ich sollte mit ihr nach Alexandrien ...«
»Schon gut, schon gut. Das erzählen Sie mir ein andermal, obgleich es nicht viel geben wird, was ich nicht schon weiß. Die Königin der Nacht, nicht wahr?«
»So wurde sie in Kairo genannt. Ein Spitzname. Sonst hieß sie Madame de Lanotte, aus Paris, welche Angaben ja aber nicht zu stimmen brauchten.«
»Und wie wird sie hier genannt?«
»Wenn die Diener sie wirklich einmal anreden, auf eine Frage antworten, so benutzen sie den Titel Sultana oder Padischina.«
»Das ist Kaiserin, Königin.«
»Ja. Und dann kam ein einziges Mal — es ist schon lange her — noch ein anderer Mann mit in die Zelle, furchtbar grimmig aussehend, ein Araber oder eher ein Perser, sah aber fast aus wie ein alter Ägypter, wie sie auf Steintafeln abgebildet sind, wie so ein alter Pharaone, hatte seinen langen Vollbart in lauter kleine Zöpfe geflochten, und so war der Bart ganz eckig geschnitten, auch ein ganz sonderbarer Kopfputz, die Diener krochen nur so vor ihm — und der nannte das Weib, als er mit wildrollenden Augen hier um sich blickte, einmal Fatime.«
»So so. Also diese Sultana kommt immer mit den Dienern.«
»Immer.«
»Ist sie nicht einmal allein gekommen?«
»Nie.«
»Was macht sie denn hier?«
»Sie sieht nur zu, wie die Diener mir auftragen und meine Zelle reinigen.«
»Was spricht sie mit Ihnen?«
»Sie hat noch kein einziges Wort mit mir gesprochen.«
»Also sonst kümmert sie sich gar nicht um Sie?«
»Was kümmern?«
»Nun, Sie sind einfach Luft für sie? Blickt sie Sie auch niemals an?«
»Ja, das allerdings. Sie blickt mich sogar fortwährend an.«
»Hat sie Ihnen nicht einmal ein Zeichen gegeben?«
»Was für ein Zeichen?«
»Nun, ein heimliches Zeichen.«
»Nein«
»Ihnen nicht einmal mit den Augen zugeblinzelt?«
»Ich habe nie etwas davon gemerkt.«
»Hm.«
Der Prinz schien besser zu wissen als dieser Gefangene, dass hier irgend etwas vor sich ging, wovon der Häftling eben noch gar nichts gemerkt hatte, obgleich der sonst sicher nicht auf den Kopf gefallen war.
»Hm. Auf der Luftreise haben Sie sich nicht viel mit der Dame unterhalten können, sie hat Sie gleich betäubt. Aber hat denn dieses schöne Dämchen Sie nicht wenigstens ...«
Der Prinz brach ab, schloss die Augen.
»Alle Wetter!«, flüsterte er dann, wie ja immer nur im leisesten Tone geflüstert wurde. »Jetzt kommt sie, die besucht zweifellos Sie, die ist auf verbotenem Wege — — schnell, wo stehen wir hier am besten?«
Nun, wenn man unsichtbar ist, kann man eigentlich stehen, wo man will, man ist immer versteckt. Aber einen Unterschied gab es doch dabei.
»Hier neben die Tür! Sie links, ich rechts! Und passen Sie auf — wenn die Gelegenheit günstig ist, so springe ich zur Tür hinaus und Sie springen nach, und können Sie mir nicht folgen, dann springe ich eben nicht. Achtung!«
Die beiden standen in Positur.
Wenn draußen gesprochen wurde, so konnte es hier drin nicht gehört werden, dazu war die eiserne Tür zu dick.
Sehr, sehr leise und vorsichtig wurde der Riegel zurückgeschoben, ebenso behutsam der Schlüssel eingesteckt und umgedreht.
Die Tür öffnete sich.
Aber ein Hinausschlüpfen gab es nicht.
Die eintretende Person selbst schlüpfte herein, nur durch einen schmalen Spalt, und da war die Tür schon wieder zu und draußen der Riegel vorgeschoben.
Es war die Königin der Nacht.
Eine Pause in der Zirkusvorstellung mochte sie benutzt haben, um sich hierher zu schleichen.
Und ferner mochte der Wächter ein ihr treu ergebener Mann sein, dem sie ihr Geheimnis ausnahmsweise anvertrauen konnte.
Denn auf verbotenen Wegen befand sie sich unbedingt.
Sie war furchtbar erregt.
Mit hochfliegendem Busen, die Hände darauf gepresst, stand das schöne Weib da. Ein bezaubernd schönes Weib!
Sie bediente sich der englischen Sprache, brachte aber die Worte kaum hervor, nur keuchend kamen sie über die roten, vollen Lippen.
»Endlich — endlich ist es mir gelungen — Mann, ich muss mit Dir sprechen — ich muss Dich retten — ich muss, ich muss — weil — ich Dich liebe — weil — ich nicht mehr ohne Dich leben — —«
Sie brach ab.
Jetzt erst bemerkte sie, dass ja gar niemand in dem Zimmer war.
Das heißt, sie sah niemanden.
»Edward — Edward, wo bist Du denn?«
Natürlich bekam sie keine Antwort.
Sie wollte die einzige Möglichkeit nicht glauben, sie musste ihr auch ganz unmöglich erscheinen. Jedenfalls hatte ihr der Wächter draußen gar nichts von seinem Ohnmachtsanfall gesagt, er schämte sich dieser Schwäche, also auch nicht, dass er wahrscheinlich im Zusammenbrechen den Riegel zurückgeschoben hatte. Übrigens war die Tür dann ja noch immer verschlossen, mit einer Vorrichtung, die durch nichts anderes zu öffnen war als durch einen Sicherheitsschlüssel mit ganz kompliziertem Bart, und solch einen Schlüssel besaß der Wächter gar nicht, hätte sich keinen verschaffen können.
»Weshalb versteckst Du Dich denn, Edward?«
Als sich noch immer niemand meldete, ging sie mit fieberhafter Eile an eine Untersuchung des Raumes.
Denn möglich war es, dass er sich hätte verstecken können, wenn auch Möbel wie Schränke fehlten. Aber da war der Diwan, auch als Nachtlager dienend, er konnte unter das hölzerne Gestell gekrochen sein, da gab es aufgestapelte Kissen genug, er konnte sie über sich aufgehäuft haben.
Also das Weib hob den leichten Diwan hoch — da war niemand darunter, sie warf die Kissen und Polster durcheinander, alles mit fieberhafter Hast ...

Da musste sie überzeugt sein, dass sich der Gefangene nicht mehr in diesem Raume befand.
Wie vom Donner gerührt stand das schöne Weib da, die nachtschwarzen Augen vor starrem Schreck weit geöffnet.
Und dann kam wieder Leben in sie, furchtbares Leben.
»Der Gefangene ist geflohen, geflohen, geflohen!«
So klang es gellend in der Zelle.
Das war draußen zu hören, und da allerdings musste der Wächter sich selbst von dieser Ungeheuerlichkeit überzeugen. Sein Tod war es ja doch.
Den Schlüssel der Sultana hatte er draußen behalten, er schloss auf, stürzte herein.
»Der Gefangene entflohen?! Es ist nicht wahr!«
Die Tür brauchte nicht weiter geöffnet zu werden, als es der Wächter getan hatte, sie hinter sich offen lassend. Die beiden unsichtbaren Geister huschten hinaus.
Hinter ihnen schrie noch immer gellend das Weib, jetzt donnerte eine Alarmglocke, vom Wächter in Bewegung gesetzt, Männer in Rüstungen und Beduinengewändern kamen von beiden Seiten des Korridors angestürmt, — doch diesen konnten die beiden in dem breiten Korridore leicht ausweichen, und dann befanden sie sich in einem einsamen Gange.
»Na, das ist noch gut abgegangen!«, sagte der Prinz.
»Aber dieses arme Weib, das hat sich eine böse Suppe eingebrockt, mit ihrer Schreierei! Das war sehr unklug von ihr gewesen. Das hätte sie alles anders arrangieren können. Nun ist's zu spät. Na ja freilich, in ihrem ersten Schreck.«
»Sie liebt mich!«, sagte Edward Scott erschüttert.
»Na, haben Sie's nun endlich gemerkt, Sie unschuldsvoller Jüngling Sie?! Die ist von allem Anfang an ganz vernarrt in Sie gewesen. Allerdings nicht schon vorher. Auf dem Aeroplan fing es an. Vorher kannte sie Sie noch gar nicht. Sie musste in jener Nacht schnellstens hierher, das konnte sie nur mittels eines Aeroplans, ein beliebiger Flieger wurde auserwählt, natürlich einer der tüchtigsten — das waren Sie. Aber auf der nächtlichen Luftreise ist es auch schon mit ihrer brennenden Liebe losgegangen. Woher ich das weiß, werde ich Ihnen später berichten, wenn ich's für gut befinde.«
»Sie hat mich befreien wollen!«, murmelte der junge Mann, noch immer tief erschüttert.
»Ja, das wollte sie. Die hat mit Ihnen fliehen wollen. Und mit der hätten Sie gar keine so schlechte Partie gemacht. Wenn sie Ihnen auch nicht viel mitgebracht hätte. Dieses Weib ist nämlich gar nicht so schlimm. Da gibt es draußen in der Welt ganz andere Damen, die sich höchst ehrbar geben und sich selbst dafür halten, und dabei sind es die reinen Höllenköder, bis zum Platzen gefüllt mit Hass und Neid und Gift und Galle. Aber hier diese Königin der Nacht, das ist gar kein unrechtes Weib. Die ist das Opfer unglückseligen Verhängnisses. Die wird hier selbst gefangen gehalten, ist die Sklavin eines Teufels in Menschengestalt. Sie muss den Scheußlichkeiten, die hier verübt werden, gezwungen beiwohnen, in ihrem Herzen hat sie keinen Teil daran. Ein tief, tief unglückliches Weib, vielleicht das bedauernswerteste, das es gibt.«
»Scheußlichkeiten, die hier verübt werden?«
»Das wissen Sie gar nicht?«
»Nein.«
»Na ja, ich verstehe schon, woher sollen Sie. Wissen Sie denn eigentlich, wo Sie hier sind?«
»Nein. Alle diesbezüglichen Fragen blieben unbeantwortet.«
»Sie müssen sich doch irgendwelche Gedanken gemacht haben, ob Sie in Afrika oder in Australien sind.«
»Was, in Australien?!«
»Nenee, so war das nicht gemeint. Aber Sie müssen sich die Sache doch irgendwie in Ihrer Einsamkeit zurechtgelegt haben.«
»Ich bin in Ägypten.«
»Ja, das sind Sie. Und wo da wohl?«
»Nun, ich vermute, dass ich in einer mohammedanischen Moschee oder in einem sonstigen Heiligtum, einem Tempel gefangen gehalten werde.«
»Und wo stände wohl dieser Tempel?«
»In Alexandrien, bei Alexandrien?«, erklang es fragend zurück.
»Sie glauben, Sie sind damals wirklich nach Alexandrien geflogen?«
»Ja, was soll ich sonst anders glauben — ich weiß nur, dass mir meine Begleiterin plötzlich, wir waren erst zehn Minuten geflogen, ein Tuch vors Gesicht drückte, ein süßlicher Duft ... und wie ich wieder zu mir kam, befand ich mich hier in dieser Zelle. Und ich hatte direkt nach Norden gesteuert, auf Alexandrien zu. Was soll ich da anderes wissen?«
»Na ja, freilich. Ihre Begleiterin ist umgelenkt, ist gerade entgegengesetzt nach Süden geflogen. Sie befinden sich im Dschebel el Ghossar in der Nähe der Oase Fayum.«
Das Gehörte machte auf den jungen Mann nicht den geringsten Eindruck. Er kam immer wieder auf die Sultana als diejenige Person zurück, die ihn hatte befreien wollen.
»Inwiefern hat sie sich selbst eine böse Suppe eingebrockt, wie Sie sich vorhin ausdrückten?«
»Na, das ist ja ganz klar. Die ist doch heimlich und unerlaubt zu Ihnen gekommen. Es hat niemand wissen dürfen. Nur diesen einen Wächter hat sie ins Vertrauen gezogen. Nun sind Sie entwischt. Das Weib ist unschuldig daran. Nun hätte sie aber schweigen und ruhig wieder hinausgehen und zu dem Wächter sagen müssen: Höre mal, alter Junge, so und so steht die Geschichte. Ich darf von nichts wissen, ich bin nicht hier gewesen, und für Dich ist es vielleicht das Beste, wenn Du spurlos verschwindest. Oder schneide Dir die Kehle durch, wenn Du Deinen Panzer nicht durchstechen kannst. Das wird für so einen arabischen Jüngling im Dienste seiner schönen Gebieterin wohl nicht viel zu bedeuten haben.
Dann wäre die Sache glatt abgegangen. Statt dessen hat das Weib zu schreien angefangen, und nun konnte einer von den beiden auch gleich noch die Sturmglocke ziehen, nun war's zu spät.
Jetzt werden die doch zur Verantwortung gezogen. Jedenfalls vor allen Dingen das Weib. Der alte Pharao, von dem Sie gesprochen, scheint doch hier Herr im Hause zu sein und gerade kein gemütlicher. Der dürfte die verliebte Sultana jetzt wohl vornehmen. Was hast Du denn da drin bei dem Gefangenen zu suchen gehabt? Oder ist es nicht so?«
»Ja, Sie haben recht!«, erklang es kleinlaut. »Können Sie das arme Weib nicht retten?«
»Ich will sehen, was sich machen lässt. Vielleicht irre ich mich ja auch. Hoffentlich. Denn ich hätte mit dieser Sultana, die hier doch so ziemlich das allmächtige Szepter führt, wenn auch gezwungen und widerwillig, überhaupt eine Anknüpfung gesucht. Ich hätte sie auf meine Seite zu bringen versucht. Denn — ich habe hier noch viel vor. Setzt sie sich mit ihrem Gebieter im Guten auseinander — nun, dann ist die Sache eben all right, dann führe ich meinen Plan auch aus, ich nähere mich ihr, um sie für meine Pläne zu gewinnen. Verliert sie aber ihren Posten, wird sie gefangen gesetzt, hat sie das Schlimmste zu erwarten — nun, dann will ich sie mit Gottes Hilfe zu befreien versuchen. Wenn sie mir dann auch nicht mehr nützlich sein kann.«
»Mit Gottes Hilfe, mit Gottes Hilfe!«, erklang es in ganz eigentümlichem Tone neben dem Prinzen nach.
Dieser blickte überrascht und dann aufmerksam seinen Begleiter an.
Der junge Mann hatte die Hände auf der Brust gefaltet, blickte mit wahrhaft verklärtem Antlitz zur getäfelten Decke empor.
Ja, so sehr ihm auch das Messer das Haar und den Bart verstutzt hatte, dass er ganz struppig aussah, es war immer noch das Christusantlitz, jetzt aber nicht mehr schmerzlich, sondern von Seligkeit rein verklärt, wozu nun noch kam, dass in dem etwas düsteren Gange gerade die versilberten Haare so leuchteten. Der Kopf war wie von einem Heiligenschein umgeben.
Immer mehr schien der Prinz zu staunen, wie er so seinen Begleiter von der Seite betrachtete. Aber er sagte nichts. Oder dann doch etwas ganz anderes, als er jetzt vor einer Tür stehen blieb und den kleinen Schlüssel ins Schloss steckte.
»Hier wollen wir eintreten, hier sind wir gesichert.«
Es war ein sehr großer Garderoberaum. Überall hingen an Stellagen rote Gewänder und Kostüme, waren in Regale hineingepfropft oder zu hohen Stapeln aufgehäuft, teils geordnet, teils wild durcheinander, alle gebraucht, aber noch ganz reinlich, keine alten Lumpen.
»Wie mir soeben mitgeteilt wird — oder wie ich weiß, will ich gleich sagen — werden hier die alten Priesterkostüme abgelagert, die niemand mehr braucht, es ist eine Rumpelkammer, niemandem fällt es ein, sie einmal zu betreten. Also sind Sie hier ganz ungestört Ich will Sie nämlich einmal verlassen. Mir ist etwas eingefallen. Vielleicht geht eine famose Sache zu arrangieren. Aber ich spreche über so etwas erst, wenn's geglückt ist. Und dann muss ich auch etwas zu essen schaffen. Haben Sie Hunger?«
»Nicht eben Hunger.«
»Aber Sie würden essen, wenn ich Ihnen etwas Nahrhaftes bringe, dass Sie wieder zu Kräften kommen.«
»O ja.«
»Auch Fleisch?«
»Gewiss.«
»Ich denke, Sie waren schon als Flieger Vegetarianer?«
»Nein, nicht eigentlich Vegetarianer. Ich vermied Fleisch nur, weil ich glaubte, es mache mich nervös. Bouillon machte mich auch tatsächlich nervös. Als Flieger gesprochen.«
»Und auch in der Gefangenschaft haben Sie sich den Fleischgenuss nicht ganz abgewöhnt?«
»Das musste ich wohl, ich bekam kein Fleisch!«, lächelte der junge Mann ganz unbefangen, nicht etwa trübselig, vielmehr heiter.
»Also Sie essen Fleisch, wenn ich Ihnen welches bringe?«
»Gewiss. Hat unser Heiland nicht auch alles dankbar angenommen, was ihm geboten wurde?«
»So, hm.«
Wieder ein merkwürdiger Seitenblick von dem Prinzen.
»Nun, ich gehe also. Warten Sie ruhig, bis ich wiederkomme. Lange werde ich nicht bleiben. Sollte doch jemand diesen Raum betreten — nun, Sie können nicht gesehen werden und haben auch sonst hier Verstecke genug.«
Der Prinz, der mit jenem bis in die Mitte des Raumes gegangen war, wandte sich wieder der Türe zu.
»Halt, noch eine Frage, mein Prinz!«
»Ja?«
»Begeben Sie sich vielleicht noch einmal nach meiner Zelle?«
»Allerdings. Ich muss dort lauschen, wie über Ihr Verschwinden gesprochen wird.«
»Ich hätte eine große Bitte an Sie.«
»Und?«
»Aber dass Sie sich deswegen ja nicht in Gefahren stürzen.«
»Sprechen Sie!«
»In der Schublade des Tisches liegt ein kleines Kruzifix aus Zinn, nicht größer als mein kleiner Finger, an einem silbernen Kettchen. Ich trug es immer auf meiner Brust. Als Sie eintraten, hatte ich mich gerade gewaschen, hatte es einstweilen in die Tischschublade gelegt. Es wäre mir sehr, sehr viel daran gelegen, wenn ich es von hier mit fortnehmen könnte.«
»Hm. Sind Sie denn Katholik, Mister Scott?«
»Nein, protestantisch, englische Hochkirche.«
»Wie kommen Sie denn da zu dem Kruzifix?«
»Es hat eigentlich gar nichts mit Religion und Frömmigkeit zu tun. Ursprünglich nicht. Eher im Gegenteil. Ich trug es immer aus Aberglauben bei mir, als Talisman. Wir Flieger sind alle abergläubisch, wohl jeder hat so seinen Talisman, wie alle diese Menschen, Sportsleute, Akrobaten und dergleichen, die ständig dem Tode ins Auge blicken. Sie haben irgend etwas, und wenn sie's nicht bei sich haben, dann, denken sie, geht's nicht. Und dann geht's auch gewöhnlich wirklich nicht, dann passiert etwas. Weil sie eben nicht die nötige Ruhe haben, sie werden unsicher. Aber ob sie solch einen Talisman vom Himmel oder vom Teufel selbst bekommen, das ist ihnen ganz gleichgültig. Der Teufel würde bei einer Wahl sogar vorgezogen. Weil er nun einmal der Fürst dieser Welt ist, der allen Erfolg verspricht.
Ich wollte Flieger werden. Natürlich ganz gegen den Willen meiner guten Mutter. Und ich war in fester Lebensstellung, war schon Beamter.
Als die Entscheidung nahte, ob oder ob nicht, was nur von meinem Willen abhing, befand ich mich auf Urlaub in Southend an der See. Eines Tages nahm ich ein Seebad, schwamm ziemlich weit hinaus.
Da plötzlich kam mir so der Gedanke: Jetzt endlich muss es sich entscheiden, jetzt musst Du Deinen Entschluss fassen!
Du willst einmal das Schicksal befragen.
Du tauchst hier unter, so tief und lange Du kannst. Natürlich mit der Reserve, dass Du auch wieder hinkommst.
Erreichst Du mit den vorgestreckten Händen den Grund, dann kündigst Du Deine Stellung heute noch, wirst Flieger. Wenn nicht, dann bleibst Du, was Du bist.
Gedacht, getan.
Ich tauchte kopfüber hinab, schwamm nach unten. Ich bin ein guter Schwimmer und Taucher — ja — aber besonders geübt habe ich nie.
Und ich war fest überzeugt, den Grund nicht erreichen zu können.
Ich war, wie gesagt, sehr weit draußen.
Ja, ich hoffte vielleicht sogar, den Grund nicht zu erreichen.
Mein Entschluss war bereits gefasst, meiner armen Mutter den Kummer nicht anzutun.
Ich ließ es eben nochmals drauf ankommen.
Und da, wie mein Atem noch lange nicht zu Ende war, stieß ich plötzlich auf den Grund!
Vielleicht eine Sandbank, eine Untiefe.
Und da kam mir etwas zwischen die Finger meiner vorgestreckten Hand, ich stieß direkt drauf, auf etwas, was nicht auf den weichen Sand gehörte, auf etwas kreuzweis Zackiges.
Dass es vielleicht ein Seestern sein könnte, daran dachte ich im Augenblick gar nicht.
Und überhaupt, so fühlt sich kein Seestern an, das wusste ich, dieses Ding lief nur in vier Spitzen aus.
Ich nahm es mit hinauf.
Es war ein kleines Kruzifix aus Zinn.
Eine Stunde später hatte ich meine Stellung gekündigt, ich bin Flieger geworden, habe es bis an jenen Abend niemals zu bereuen gehabt.
Das Kruzifix trug ich fernerhin immer auf meiner Brust. Ich wiederhole: als Talisman, aus Aberglauben. Damals glaubte ich nicht an einen Gott, oder es war mir ganz gleichgültig, ob es einen gab oder nicht. Ich wäre niemals aufgestiegen, wenn ich nicht das kleine Kruzifix an meiner Brust gewusst und gefühlt hätte, die nötige Sicherheit hätte mir gefehlt.
So habe ich das kleine Ding herzlich lieb gewonnen. Wenn es noch möglich ist, und Sie können es mir ohne Gefahr bringen — bitte, tun Sie es. Es liegt in der Schublade des Tisches.«
Aufmerksam hatte der Prinz zugehört, der Erzähler hätte noch viel ausführlicher sein können.
»Hat man Ihnen denn das Kruzifix gelassen?«
»Erst hatte man es mir genommen wie alles andere, aber schon am zweiten oder dritten Tage gab man es mir zurück, gerade dieses kleine Kruzifix, nichts anderes von meinen Sachen.«
»Hm!«, brummte der Prinz nachdenklich. »Und haben Ihre Gefangenenwärter und die Sultana vielleicht auch sonst gemerkt, dass Ihnen an dem Kruzifix sehr viel gelegen war?«
»Jawohl, das mussten sie wohl merken.«
»Wodurch? Haben Sie es vielleicht manchmal geküsst?«
»Das gerade nicht, aber während meiner ganzen Gefangenschaft habe ich es niemals mehr direkt auf der Brust unter den Sachen getragen, sondern immer ganz offen hatte ich es vorn auf der Brust hängen, um es immer vor Augen zu haben.«
»Vortrefflich, vortrefflich!«, sagte der Prinz, seinen Bart streichend, ganz in Gedanken versunken. »Das passte vortrefflich in meinen Plan, wenn ich dieses Kruzifix noch fände. Nun, ich werde sehen, was sich machen lässt.«
Er verließ den Raum, verschloss von draußen wieder die Tür. Und dann schüttelte er erst einmal nachdenklich den Kopf.
»Diesem Jungen ist was passiert! Der hat während seiner Gefangenschaft etwas erlebt. Seelisch! Mit dem ist eine große Veränderung vor sich gegangen. Dem ist das Kruzifix nicht nur noch der Talisman. Der ist nicht mehr derselbe, der er früher gewesen ist — wenn ich ihn auch gar nicht gekannt habe, aber das weiß ich, das fühle ich sofort heraus. Über den ist der heilige Geist gekommen — Ja, das mit dem Kruzifix wäre vortrefflich! Freilich will ich ja gerade das Entgegengesetzte tun, als was er wünscht, aber ... na, wir werden sehen.«
Er ging denselben Weg zurück, blieb einmal an einer offenen Korridortür, die er schon vorhin passiert, aber nicht beachtet hatte, stehen, trat nach kurzem Besinnen ein.
Ein überraschender und auch schrecklicher Anblick erwartete ihn.
Es war eine weite, weite Halle, um die sich in beträchtlicher Höhe eine Galerie herumzog, auf welche er getreten war.
Und dort unten in der Mitte der Halle stand ein furchtbares Ungeheuer.
Nur eine Figur, an der aber ihr Schöpfer auch seine ganze Einbildungskraft verschwendet hatte, um sie möglichst scheußlich zu machen.
Der Hauptgestalt nach war es ein Elefant, der aber keinen Rüssel hatte, überhaupt einen mächtigen Ochsenkopf mit Hörnern, sogar gleich mit vieren, und statt der Elefantenzähne ragten aus dem nur ein wenig geöffneten, mit furchtbaren Zähnen bewehrten Maule ein paar menschliche Arme mit Händen hervor, wie auch der ganze Leib auf menschlichen Beinen und Füßen ruhte, wenigstens galt dies für die vorderen, während die hinteren wieder von Vogelklauen gebildet wurden.
Die ganze Figur war wenigstens zehn Meter hoch und einem Elefanten entsprechend dick.
»Aha, das dürfte der menschenfressende Moloch sein!«
Er sah eine Treppe, benutzte sie, um von der Galerie hinabzusteigen, um sich die Figur näher zu besehen. Denn es war ziemlich dunkel, nur unten brannten einige Lampen. Dann sei noch bemerkt, dass dieses Seitenpförtchen, das er beim Betreten der Galerie benutzt, eine rote Umrahmung hatte, also wohl nur für Priester bestimmt war, andere durften nicht hier eintreten. Die Haupttore unten waren auch geschlossen, und die rote Farbe genügte, um jeden Unbefugten fern zu halten.
Der Prinz hatte den Boden des Saales erreicht, schritt nach der Mitte und ging um das Ungeheuer herum.
Da bemerkte er, dass sich dicht hinter der Figur am Boden ein viereckiger Ausschnitt befand, ein viereckiges Loch, ungefähr zwei Meter tief, acht Meter lang und sechs breit. Eine Art von Bassin, nur nicht mit Wasser gefüllt.
Dort unten lag eine schwarze Masse. Der Prinz musste sich erst an die Dunkelheit gewöhnen, dann erkannte er ein Tier und noch dazu aus dem Grunzen, das erscholl, ein Schwein, ein Wildschwein.
Jetzt richtete es sich auf. Himmel Herrgott, war das ein fürchterliches Vieh!
Man kennt wohl das Wildschwein und seinen Charakter.
Mancher Jäger, der schon einmal seine Erfahrung mit solch einem borstigen Teufel gemacht hat, geht fernerhin lieber mit dem Revolver einem angeschossenen Löwen nach, als dass er sich noch einmal einem Wildschweine zum Kampfe gegenüberstellt. Und wenn es Junge hat, die zebragestreiften Kinderchen spazieren führt, dann geht ihm auch der gewaltige Königstiger ängstlich aus dem Wege, der Sau, obgleich die doch gar keine Hauer, sondern nur etwas vorstehende Backenzähne hat. Da fängt sogar der Tiger auf Bäume zu klettern an.
Wir haben stattliche Schweinerassen. Zahme Schweine. Meterhohe! Da muss man nach Pommern gehen. Auf solch einem Schweine kann man reiten. Brehm erzählt in seinem »Tierleben« ganz ausführlich, wie ein Bauersmann wettete, die zwei Meilen nach der nächsten Stadt auf seinem Schweine in einer Stunde zu reiten, um den Marktplatz zu galoppieren und wieder zurück, und er gewann seine Wette. Das ist auch ganz glaubhaft. Und in den ungarischen Eichenwäldern sieht man noch gewaltigere Exemplare, immer noch Hausschweine, wenn auch schon halb verwildert.
Nun aber die sibirischen Wildschweine und die des nördlichen Himalaja! Solche Wildschweine bekommen wir aber im zoologischen Garten gar nicht zu sehen. Es ist gar nicht möglich, solch einen vierbeinigen Teufel zu transportieren. Der zerfetzt die stärksten Eichenbalken, und gegen eiserne Gitter wütet er so lange, bis er seinen eigenen dicken Kopf ganz zerschunden hat und daran zugrunde geht. Im Jahre 1902 wurde ein gefangenes Wildschwein aus dem Himalaja im Pandschab mit der Eisenbahn transportiert, in einer starken Holzkiste, mit Eisenbändern beschlagen. In demselben Waggon befand sich ein in Kisten verpacktes Karussell und ein Zinksarg mit der einbalsamierten Leiche eines englischen Beamten. Als nach zehnstündiger Fahrt der Wagen untersucht wurde, war der Schwarzkittel weg, hatte seine Kiste zertrümmert und sich durch die Waggonwand ein Loch geschaffen, und nicht nur das, sondern er hatte auch die sämtlichen Karussellkisten zertrümmert, hatte alle die Holzpferde kurz und klein zerhackt, und außerdem hatte er den Zinksarg erbrochen und von dem einbalsamierten Engländer ein gutes Viertel gefressen. Und das war ein kleiner, noch junger Eber gewesen.
Aber was war nun das dort unten für ein furchtbares Ungeheuer!
»Wie ein Klavier, wie ein Pianino!«, sagte sich der Prinz im Stillen, wie man eben manchmal auf solche Vergleiche kommt.
Nun, ganz so groß war der Eber ja nicht. Aber jedenfalls doch ein ungeheuerliches Vieh! Dieser borstige Leib, diese kolossalen Hauer, und diese tückischen Augen. wie die jetzt nach dem Menschen dort oben hinaufschielten.
»Komm nur herunter, Freundchen.«
Nein, in einen Käfig voll verhungerter Löwen und Tiger zu gehen, das musste ja das reine Vergnügen dagegen sein!
Und dabei konnte es sehr leicht passieren, dass einmal ein Mensch diesem Teufel einen Besuch abstattete, einen unfreiwilligen. Die Grube war durch keine Barriere geschützt.
Jedenfalls war das der furchtbare Moloch, der, wie der Prinz gehört hatte, ebenfalls die Witterung des Melkart nicht vertragen konnte, vor Angst wie ein Kind zu schreien begann. Das mochte ja sein, aber sonst hatte dieses Ungeheuer nichts Kindliches an sich.
Jedenfalls war dort die Figur das Symbol des menschenfressenden Gottes, das hier war er wirklich, oder sein lebendiges Attribut, oder wie sich das diese Götzenanbeter nun sonst zusammenreimten.
Der Zwinger war sehr reinlich gehalten. Der Prinz dachte daran, wie man diese Reinigung wohl ausführt. Eine Vorrichtung, um das Tier in ein anderes Abteil zu bringen, war nicht zu erblicken, kein Senkloch, nichts.
Da wurde seine Aufmerksamkeit auf zwei Männer gelenkt, die durch den Saal geschritten kamen.
Es waren Arbeiter in kurzen Kitteln, sie trugen zwischen sich einen Menschen, offenbar einen Toten, bis der Prinz erkannte, dass es nur eine Puppe war, die aber wohl das Gewicht eines erwachsenen Menschen besaß.
Sie wurde auf die ausgestreckten Hände der Molochfigur gelegt, die sehr weit nach unten reichten, einer der Arbeiter beschäftigte sich unten an dem einen ungeheuren Fuße, und plötzlich wirkte ein Mechanismus, die Hände und Arme der Figur gaben einen Ruck, die Menschenpuppe wurde hoch nach oben geschleudert, gleichzeitig warf das eherne Ungetüm seinen Ochsenkopf zurück, sperrte weit den Rachen auf, um die Puppe aufzusaugen.
Aber die Sache funktionierte nicht richtig, die Puppe fiel auf die Nase des Götzen, blieb dort hängen. Ein Mann kletterte an Vorsprüngen hinauf, warf sie herab, unterdessen schraubte der andere Arbeiter an den Füssen herum, und das Experiment wurde wiederholt. Diesmal wurde die Puppe etwas seitwärts geschleudert. Zum dritten Male dasselbe und jetzt war die Sache in Ordnung. Gott Moloch, der jedes Mal seinen Ochsenschädel wieder gesenkt hatte, fing die Puppe richtig mit dem Rachen auf, sie verschwand darin.
Da plötzlich sah der Prinz, wie die Menschenpuppe hinten zu der Öffnung, die außerordentlich groß war, wieder zum Vorschein kam und direkt in die Grube fiel.
Die beiden Arbeiter, als sie merkten, wohin die Puppe gewandert war, schrien, machten einander die heftigsten Vorwürfe, jeder sollte daran schuld sein, dass diese Öffnung nicht verschlossen war.
Da war es aber schon zu spät.
Hei, wie das Teufelsvieh dort unten auf die Puppe stürzte! Die Fetzen und der Werg flogen nur so!
»Moloch, o Moloch, mein Liebling, was tust Du denn?!«
So erklang da eine quäkende Fistelstimme. An dem Rand der Grube stand ein kleines Männlein, fast ein Zwerg, bucklig und überaus hässlich, der ungeheure Turban rot und auch die Schärpe rot, also wohl ein Halbpriester.
Ohne Weiteres sprang der Zwerg die zwei Meter in die Grube hinab.
Und sofort ließ der Eber von seinem Zerstörungswerke ab, stürzte auf das Männlein zu, um es mit stürmischen Liebkosungen zu überhäufen, aber doch vorsichtig, um ihm nicht wehe zu tun.
So etwas kann vorkommen. Man hat eine Ringelnatter beobachtet, welche die innigste Freundschaft mit einem Zeisig geschlossen hatte, während sie sonst jeden anderen würgte. Am liebsten zirpte das Vögelchen sein Liedchen auf dem Kopfe der Schlange. Bekannter, weil viel häufiger, sind Freundschaften zwischen Vögeln und Katzen.
Der Zwerg suchte die Fetzen der Puppe zusammen und warf sie hinauf, dann erwiderte er erst einmal die Zärtlichkeiten, indem er das Ungetüm umarmte und innigst auf die Schnauze küsste, wobei er sich gar nicht zu bücken brauchte — obgleich nicht ein eigentlicher Zwerg, nur ein kleines Männlein — dann zog er aus dem Gürtel Kamm und Bürste und begann das zottige Fell zu striegeln, unter den süßesten Kosenamen, und das Biest grunzte vor Behagen.
Jetzt wollte der Zwerg den Zwinger wieder verlassen, wohl erst auf den Rücken des Tieres steigen, aber das war nicht so einfach. Herein hatte ihn der Eber gelassen, aber hinaus ließ er ihn nicht wieder, aus Liebe nicht, er hielt ihn immer am Hosenboden oder anderswo fest, ganz sanft, aber doch energisch.
Der Zwerg hatte vergebens in seinen Taschen nach etwas gesucht.
»Bringt mir was zu fressen her!«, rief er hinauf.
Einer der Arbeiter rannte davon, kam gleich wieder, in der einen Hand ein blutiges Messer, und was er in der anderen Hand hatte, das war nichts anderes als ein frisch aus dem Gelenk geschälter Menschenfuß.
Der Zwerg fing ihn auf, lockte den Eber nach der Wand, ein einziges Schmatzen, und der große Menschenfuß war verschwunden.
So frisst und schlingt kein anderes Tier. Selbst der gefräßige Wolf, der von allen Raubtieren im Schlingen das Fabelhafteste leistet, zermalmt erst solche Knochen wie diese. In den Stall eines großen Schweines verirrt sich ein Huhn, man sieht's, man springt zu, um das Tier zu retten — mit einem Schnapp ist das Huhn verschwunden. Man weiß wirklich gar nicht, wie das Schwein das macht.
Doch dieser eine Augenblick hatte dem Zwerg genügt, mit affenartiger Behändigkeit hatte er sich auf den Rücken des hohen Tieres und gleich weiter auf den Rand der Grube hinauf geschwungen.
Unten raste der vierbeinige Freund vor Jammer, aber der Zwerg warf seinem Liebling nur noch einige Kusshände zu, dann verschwand er in der Finsternis.
Und die beiden Arbeiter packten die Bruchteile und Fetzen ihrer Puppe zusammen und verließen gleichfalls den Saal.
Sinnend blickte der Prinz in den Zwinger hinab.
Dann wandte er sich dorthin, wo der Arbeiter mit dem blutigen Menschenfuße hergekommen war, wo aus einer offenen Tür helleres Licht kam.
Das war ja ein netter Anblick, der den Prinzen erwartete!
Eine große Leichenkammer.
Aber nicht so hübsch geordnet wie bei uns.
Kreuz und quer lagen die nackten Männer übereinander, wie sie so hingeworfen worden waren.
Sehr erschüttert war der Prinz nicht, er mochte schon anderes gesehen haben, Schlachtfelder und dergleichen.
»Hm, das wird ja immer besser für meine Pläne«, murmelte er, »hier habe ich ja die Auswahl. Nun muss ich mich aber beeilen, dass ich auch ...«
Wieder schritten durch den Saal zwei Männer, die wieder eine menschliche Figur an Füßen und Armen gepackt zwischen sich trugen.
Aber das war jetzt keine Puppe, sondern das war ein richtiger Mensch, ein Mann, ein Jüngling, das blutleere Antlitz noch immer klassisch schön — blutleer, weil alles Blut aus der Kehle geflossen sein musste, die durchschnitten war.
Freds Vater, Bob Snyder, hatte einst gesagt, dass er als erfahrener Jäger jeden Fuchs am Gesicht vom anderen unterscheiden könne.
Dann musste dies wohl auch für diesen Mann gelten, den nordamerikanische Indianer Flammenauge genannt hatten.
Ja, der Prinz erkannte diesen Jüngling sofort wieder, obgleich er sein Gesicht nur ganz flüchtig gesehen, obgleich dieser, jetzt nackt, in seiner Schuppenrüstung damals so einen ganz anderen Eindruck gemacht hatte.
Es war jener Wächter.
Hatte der Prinz eine Ahnung gehabt?
Zweifellos hatte sich der gepanzerte Ritter, ehe er sich verantworten musste, die Kehle durchschnitten.
Aber nicht etwa, dass der Prinz jetzt Mitleid fühlte. Er wusste schon, was hier für Menschen hausten, einer wie der andere.
»Des Todes seid Ihr alle!«
Jubb!
Die beiden Arbeiter hatten die Leiche auf den Haufen geschlenkert.
»Wie viele liegen hier?«, fragte der eine, wahrscheinlich ein Neuling.
»Das weiß ich nicht, die werden nicht gezählt.«
»Die bekommt der Moloch zu fressen?«
»Diese Leichen? Der bekommt doch nur lebendige Menschen vorgeworfen.«
»Weshalb kommen denn diese Selbstmörder und Hingerichteten hierher?«
»Weiß ich auch nicht. Das ist nun einmal hier die Leichenkammer.«
»Und was wird nun mit den Leichen gemacht?«
»Die kommen in die Küche.«
Die beiden gingen wieder.
Der Prinz blickte ihnen nach.
»So! In die Küche! Da will ich nachher nur gut aufpassen, dass ich nicht etwa einen Topf Reis mit Menschenklein erwische.«
Also es schien keinen Eindruck auf ihn gemacht zu haben, was er da zu hören bekommen.
Er war schon gut vorbereitet worden.
Immer noch ein anderer Mann kam, durch rote Farbe so als halber Priester oder Tempeldiener gekennzeichnet.
Er hatte ein langes Rohr mit umgebogenem Ende, so blies er die wenigen Lampen aus, auch die in der Leichenkammer.
Finsternis herrschte in der weiten Halle. Umso mehr erstrahlte die silberne Gestalt des Prinzen, auf einem Umkreis von einigen Metern ein weißes Licht verbreitend.
Der Tempeldiener ging dicht an ihm vorüber, er hätte geblendet die Augen schließen müssen, aber er tat es nicht, der merkte nichts von Licht.
Auch der Prinz verließ den Saal, wieder den Weg zur Galerie hinauf nehmend.
Allzu lange hatte er sich hier nicht aufgehalten, dies alles war viel, viel schneller gegangen, als es sich hier erzählen ließ.
So erreichte er wieder den breiten Hauptkorridor. Es war hier nicht etwa ein Treiben und Jagen. Die Aufregung über den entflohenen Gefangenen hatte sich schon wieder gelegt.
Nur vor der Zellentür, die weit offen stand, machten einige Männer den letzten Versuch, zwei Bluthunde auf eine Spur zu setzen. Aber die Hunde wollten nichts davon wissen, gebärdeten sich ganz kopfscheu, wollten entfliehen oder kniffen die Schwänze ein und winselten.
»Das ist nicht anders, als wenn der Melkart hier gewesen wäre.«
So hieß es, und sie zogen mit ihren Hunden nach der anderen Richtung ab.
Die Zellentür war offen geblieben.
Der Prinz begab sich vollends hin.
In dem Zimmer stand wieder so ein gepanzerter Jüngling als Wächter, stützte sich wieder auf sein blankes Schwert. Zu bewachen hatte er ja weiter nichts. Es war eben jemand als Hüter der Ordnung hierher kommandiert worden.
Das Zimmer war nicht mehr ganz in derselben Verfassung. Die Hälfte der Teppiche und Polster und Kissen war schon ausgeräumt worden.
»Das wäre ja fatal, wenn ... nein, da liegt es noch!«
Es war der leer gewesene Kissenbezug, in den die abgelegten Sachen gepfropft worden waren. Man hatte nichts von diesem leeren Kissenbezug gewusst, es war jetzt eben ein Polsterkissen, dem man keine Beachtung weiter geschenkt hatte. Der entschwundene Christensklave konnte doch nicht drin stecken.
»Ja, wie dieses Kissen nun unbemerkt herausbringen? Da muss Almansor noch etwas anderes schaffen, er doch auch Gegenstände durchsichtig, unsichtbar machen. Na, dieses Problem werde ich auch so lösen. Erst einmal das Kruzifix, ob das überhaupt noch vorhanden ist.«
Die Schublade des Tisches war geschlossen. Deshalb aber konnte sie schon geöffnet und das Kruzifix herausgenommen worden sein. Der Prinz begab sich hin, schritt vorn an dem Wächter vorbei, der ziemlich in der Mitte des Raumes stand.
Und da sah er etwas!
Ein ganz klein wenig war die Schublade doch herausgezogen, und zwischen ihrer Kante und der des Tisches hatte eine afrikanische Buchspinne ihr Netz gesponnen, sie zog soeben die letzten Fäden!
Wie gesagt, dies alles, was wir hier geschildert haben, hatte sich ja weit schneller abgespielt, als man es erzählen und lesen kann. Es sind viele Zwischenbemerkungen eingeschaltet worden.
Von dem Augenblicke an, da die beiden aus dieser Zelle geschlüpft waren, bis zum jetzigen Augenblick war ja kaum eine Viertelstunde vergangen.
Und dieser Mann aus deutschem Fürstenhause hier war ein Naturwissenschaftler, ein zünftiger Zoologe, der genau wusste, wie lange eine afrikanische Buchspinne im Durchschnitt für ihr Netz braucht. Wir werden später noch einmal zeigen müssen, was solch ein Naturwissenschaftler heute mit der Uhr und Mikrometerschraube alles beobachtet.
Diese Schublade war seit einer Viertelstunde nicht wieder geöffnet worden!
Das wusste der Prinz so genau, wie er wusste, dass kein Mensch in der Minute mehr als 600 Silben sprechen kann, das hält aber auch die abgebrühteste Kaffeeschwester keine Viertelstunde aus, dann hat sie eine Zungenlähmung, den Lippenkrampf und die Maulsperre.
Diese Spinne hier hatte unbedingt ihre Arbeit schon begonnen, als sich die beiden noch in dieser Zelle befunden hatten.
»Famos! Das Kruzifix liegt noch drin, und niemand weiß davon, alle werden annehmen, der Flüchtling trage es noch auf seiner Brust. Nun muss ich bloß noch dem jungen Manne dort das Gesicht in den Nacken drehen.«
Denn der arabische Ritter blickte gerade nach dem Fenster, unter dem der Tisch stand, und seinen Augen konnte man gleich ansehen, dass er träumte und nicht so ohne Weiteres aus seinen Träumen erwachen würde.
So aber konnte der Prinz unmöglich die Schublade aufziehen, um sich mit einem schnellen Griffe des Kruzifixes zu bemächtigen, oder der Rittersmann hätte dann von einem »Spuk« erzählen müssen, und einen solchen in Szene zu setzen, das war dem Prinzen wohl nicht erlaubt.
Er blickte sich suchend um.
Und da sah er dort neben der Tür, also hinter dem Rücken des Ritters, am Boden ein ziemlich dickes Buch liegen, mit einem goldenen Kreuze drauf.
Zweifellos eine Bibel. Fleisch oder überhaupt nahrhafteres Essen als Reis hatte man dem Gefangenen versagt, aber seinen Wunsch nach einer englischen Bibel hatte man erfüllt, eben weil man diesen Christen als christlichen Heiland hatte den eigenen Göttern opfern wollen.
Der Prinz begab sich hin, hob den Buchdeckel. Richtig, eine englische Bibel. Vorhin hatte sie nicht hier gelegen, sie war erst bei der Wühlerei hierher geworfen worden.
Und unter dem Deckel ein loses Blatt Papier, darauf einige Zeilen geschrieben, mit Bleistift, den man dem Gefangenen wohl ebenfalls nicht versagt hatte.
Derer die Welt nicht würdig war,
Die sind im Elend gangen;
Den Fürsten dieser ganzen Schar
Hat man ans Kreuz gehangen.
Nichts weiter.
Was war es, was den Prinzen so mächtig packte, dass man es seinen blauen, strahlenden Augen so deutlich ansah?
»Derer die Welt nicht würdig war! Armer Junge! Bei Dir kommt es etwas zu früh. Einmal kommt's ja schließlich bei jedem Menschen, in dessen Brust nur ein bisschen von jenem Funken glüht, durch den sich der Mensch vom Tiere unterscheidet. Wenn sich der Knochenmann anmeldet, wenn die eigenen Knochen nicht mehr fortwollen und wenn man das Zipperlein bis in den Magen fühlt, der nicht mehr mitmachen will — ja, dann kommt man wohl endlich zum Schlusse aller der Weisheit und wird wehmütig die bekannten Worte sagen: Du hast gesiegt, Galiläer! Aber bei Dir, mein armer Junge, kommt das viel zu früh. Dann möchte ich Dich in keine Lebensversicherung aufnehmen.«
Nein, dann würde der, der dieses in einsamer Zelle geschrieben, auch nicht lange mehr leben.
Frömmelnde Jünglinge und Jungen, die ihre Hosen nicht zerreißen — beide sind sie Ekel. Verhasst bei Gott und aller Welt. Das fühlt jeder heraus, der für so etwas feinfühlig ist, und bei der großen Masse ist es der gesunde Instinkt, der solche frömmelnde, augenverdrehende Jünglinge und gar so artige Knaben mit Misstrauen begegnen lässt.
Natürlich gibt es auch hier, wie überall, Ausnahmen. Die bilden dann das Salz der Erde, das Licht der Welt. Aber alt werden die niemals. Dafür sorgt ein ehernes Gesetz. Ein ganz richtiges Naturgesetz. Das Licht, wenn es leuchten will, muss sich selbst verzehren, und das geht umso schneller, je stärker es leuchtet. Das ist auch das Schicksal aller sogenannten Wunderkinder. Oder sie verlieren ihre unnatürliche Begabung, und nichts weiter bleibt zurück als ein tief, tief unglückliches Alter, schon in jungen Jahren, die nun am schnellsten durch Ausschweifungen abgekürzt werden.
Eltern, die Ihr ein übermäßig begabtes Kind habt, das etwa mit drei Jahren schon politische Zeitungen lesen oder vierstellige Zahlen im Kopfe multiplizieren kann — treibt ihm diese Weisheit mit der Rute beizeiten aus! Wer sein Kind lieb hat, züchtigt es. Oder es geht auch auf andere Weise zu unterdrücken, die geistige Entwicklung wieder in normale Bahnen zu lenken. Wenn Ihr freilich zu denen gehört, die ihre eigene Missgeburt gegen Entree einem schaulustigen Publikum zeigen — na, dann freilich ist jedes Wort verloren. Dann könnt Ihr Euer eigenes verzerrtes Fleisch und Blut auch auffressen, das bleibt sich dann gleich. —
Der Prinz nahm das kleine Blatt Papier, trat an die Wand, klopfte mit dem Knöchel dagegen, ließ das Papier fallen.
Schnell drehte sich der gepanzerte Jüngling auf das Geräusch hin um, sah das Papier noch flattern.
Es musste ihn ja stutzig machen. War das ein Spuk? Doch was ist so ein dünnes Blättchen Papier, welch schwacher Luftzug genügt, um es zu bewegen, und was klopft nicht alles. Wenn der junge Araber hierin einen »Spuk« sah, dann gehörte er eben zu denen, die einen Eingriff höherer Mächte wittern, wenn es einmal in ihrem Bauche im Akkord knurrt. Die Tischschublade, wenn die vor seinen Augen plötzlich von allein herausgefahren wäre, das freilich wäre etwas ganz anderes gewesen. Wenn das einmal passiert, dann freilich wird's faul, dann kann man sich nur gleich in einer Kaltwasserheilanstalt einmieten. Dann lassen die Ratten und Mäuse auch nicht mehr lange auf sich warten.
Dieser arabische Jüngling schien nicht abergläubisch zu sein, oder er tat einfach seine Pflicht, nur gestutzt hatte er, dann ging er hin, blickte erst einmal zur Tür hinaus, sah niemand, hob den Zettel auf, der eben durch einen Luftzug bewegt worden war.
Da stand der Prinz bereits am Tisch, hatte mit einer Handbewegung das ganze Spinnennetz weggefegt. Nun kam es nur darauf an, ob sich die Schublade auch ohne Geräusch herausziehen ließ. Das freilich musste riskiert werden.
Ja, es gelang. Und da lag das kleine, abgescheuerte Kruzifix an einem Kettchen. Mit einem Griff war es in des Prinzen Hand verschwunden, wirklich verschwunden, die unsichtbare Hand, die es umschloss, machte es selbst lichtdurchlässig, einfach unsichtbar.
Was wäre sonst geschehen, wenn jenes rätselhafte Amalgam nicht auch diese doppelte Eigenschaft besessen hätte?
Da lassen sich die wunderlichsten Fälle ausdenken.
Da wäre zum Beispiel, wenn der sonst unsichtbare Mensch ein Beefsteak gegessen hätte, dann in Magenhöhe eine Portion Ragout fin frei in der Luft geschwabbelt.
Noch ehe sich der Wächter nach dem Papier gebückt, erst zur Tür hinausgeblickt hatte, war es schon geschehen gewesen, die Schublade auch wieder geräuschlos geschlossen worden.
Der Araber las die englischen Verse, oder versuchte es doch, ließ das Blatt achtlos fallen und stellte sich wieder in der Nähe des Fensters und Tisches auf.
»So, der erste Teil wäre erledigt. Aber die Hauptsache war das Kruzifix gar nicht. Das Kissen — wie bringe ich das Kissen hinaus!«
Das Hinausbringen war schließlich einfach genug. Der Wächter wandte der Türe ja den Rücken. Wenn aber nun dem unsichtbaren Prinzen auf dem Korridor ein Mensch begegnete? Dann sah der durch die Luft ein Kissen schweben. Und wollte der Prinz hier keinen Spuk aufkommen lassen, wozu er wahrscheinlich streng verpflichtet worden, so musste er das Kissen rechtzeitig hinlegen, und der andere würde sich wundern, wie das Kissen hierher kam, nun wäre sein Inhalt sicher ans Tageslicht gezogen worden.
Und der Korridor lief nicht weit geradeaus, er hatte viele Ecken, und das eben war die schlimme Sache, der Prinz konnte ja nicht wissen, ob hinter solch einer Ecke nicht gerade jemand kam.
Aber der Prinz besaß ein Mittel, um auch um die Ecke blicken zu können.
Er trat einmal hinaus auf den Korridor, etwas entfernt von der Türe, hob die Kugel, hauchte dagegen und berührte sie mit der Zungenspitze.
»Hörst Du, Almansor?«, flüsterte oder hauchte er nur dagegen. »Weißt Du, was ich vorhabe? Meinen Plan kennst Du ja, ich habe ihn Dir schon mitgeteilt, und Du heißt ihn gut. Ich will also jetzt in den Molochstempel. Kann ich das Kissen mitnehmen? Ist jemand unterwegs? Ja? Ich soll noch warten? Wie? Ja — ja — ja ...«
Das Telefongespräch war beendet, und schnell huschte der unsichtbare Geist wieder in die Zelle, wo der Wächter noch immer nach dem Fenster blickte. Der Prinz hatte das betreffende Kissen gefasst, war wieder draußen, und nun in eilendem Laufe den Korridor entlang, sorglos um die Ecken gebogen und dann in den roten Gang hinein, wo ihm nur noch ein Priester oder Tempeldiener gefährlich werden konnte, der ihm aber auch nicht begegnete.
Also der Molochtempel war wieder sein Ziel, den er abermals durch die Galerietür betrat.
Jetzt herrschte schwarze Finsternis darin.
Nur der strahlende Mann erhellte sie einige Meter um sich selbst im Umkreis.
Jetzt wollen wir aber einmal die Augen der anderen Menschen haben.
Auch für uns ist alles schwarze Finsternis.
So vergingen vielleicht zehn Minuten.
Da dort unten ein dumpfer Fall.
Sofort ein wütendes Grunzen und Bollern. Und dann ein behagliches Grunzen und Schmatzen.
»Guten Appetit, Herr Moloch. Und wenn Sie auch das Kruzifix verschlucken sollten, dann vergessen Sie ja nicht, das Zinn bald wieder aus Ihrem Leibe zu schaffen, Ihnen macht's doch nur Bauchkneipen und ich möchte es gern wiederhaben.« — — —
Eine Viertelstunde später sah Edward Scott seinen Freund wieder eintreten. Ein anderer Mensch freilich hätte nur eine gebratene Hammelkeule und einen Krug in einigem Abstand voneinander durch die Luft schweben sehen.
»Nun, ist Ihnen die Zeit lang geworden? Hier bringe ich Proviant. Ei, das war aber ein Kunststück, diese Hammelkeule und diesen Krug Wein hierher zu eskamotieren! Die Herren Diebe, Einbrecher und Zunftgenossen könnten mir eine Meisterschaftsmedaille verehren.«
»War es so schwierig, den Proviant aus Küche und Keller unbemerkt zu bekommen?«
»Im Grunde genommen nicht. Da schmorten ganze Hammel und Ochsen genug am Feuer, das eigentliche Mausen war dabei ganz Nebensache! Aber haben Sie schon einmal eine Hammelkeule gesehen, die drahtlos durch die Luft schwebt? Ich bin unsichtbar, kann aber dieses Zeug nicht unsichtbar machen. Nun, es ist mir gelungen, alles glücklich in den Hafen zu bringen. Langen Sie zu. Sie müssen sich freilich mit den Fingern behelfen. Ich tu's auch. Trinken Sie Wein? Recht so. Ein wunderbarer Rotspon. Ein dicker Priester, der dicht an mir vorüber kam — natürlich hatte ich schon meine Sachen versteckt — fing gleich mit der Zunge zu schnalzen an, kam mir mit seiner Nase immer näher ins Gesicht, und ich konnte nicht mehr ausweichen, der roch, dass ich von dem Weine schon eine tüchtige Kostprobe genommen hatte, immer näher kam mir der Kerl mit seiner versoffenen Nase ins Gesicht und schnoberte mich an, schon gab ich mich verloren, oder es musste etwas passieren — da nieste er mir direkt ins Gesicht und ich und er waren gerettet. Er setzte seinen Weg fort, meine Hammelkeule und der Weinkrug taten das gleiche.«
Edward Scott lächelte. Er sprach dem delikaten Braten mäßig zu, nahm manchmal einen Schluck aus dem Kruge. Sie hatten sich zu der Mahlzeit hinter eine Stellage gesetzt, die voll lauter solcher Priesterröcke hing. Überrascht konnten sie nicht so leicht werden.
»Waren Sie noch einmal in oder an meiner Zelle?«, fragte dann der junge Mann.
»Ja. Ich habe auch Ihr Kruzifix mitnehmen können habe es aber zu einem anderen Zwecke benutzt. Hören Sie.«
Er berichtete über sein Vorhaben und wie er es ausgeführt hatte.
Wir brauchen es nicht mit anzuhören, werden dann aber den Erfolg von dem miterleben, was sich der Leser ja selbst leicht vorstellen kann.
»Ich hoffe, Ihr Kruzifix doch noch wiederzubekommen.. nachdem es seine Dienste als Ihr spezielles Erkennungszeichen getan hat. Sie erblicken in so etwas doch nicht einen Frevel?«
»Durchaus nicht.«
»Es kann vielleicht erst einmal den Leib des Ebers passieren.«
»Es hat nichts zu sagen, auch wenn ich das Kruzifix nicht wiederbekäme. — Sie haben meine Mutter gesehen?«
Es war bisher wirklich noch keine Zeit und Gelegenheit für diese Frage gewesen.
»Sie weiß, dass Sie gerettet werden, und in acht Tagen können Sie sie umarmen. Genügt Ihnen jetzt diese Erklärung?«
»Sie genügt mir!«, war die einfache, etwas überraschend einfache Antwort.
»Bitte.«
»Wissen Sie eigentlich, was man hier mit Ihnen vor hatte?«
»Ich sollte als fleischliches Symbol des Christentums — oder vielleicht Christus selbst — einem heidnischen Kultus geopfert werden.«
»Hat man Ihnen das gesagt?«
Nein, mit keinem Worte war ihm auch nur solch eine Andeutung gemacht worden.
Der junge Mann war scharfsinnig genug gewesen, um von selbst zu dieser Erkenntnis zu kommen.
Höchstens hatte er sich in dem Irrtum befunden, dass es Mohammedaner sein könnten, die so ihren Hass gegen den christlichen Gottessohn äußern wollten. Übrigens aber hatte er selbst im Laufe der Zeit seine erste Meinung geändert. Er hatte an verschiedenen Zeichen gemerkt, dass es wohl gar keine Mohammedaner waren, die er zu sehen bekam.
»Und wie fassten Sie das nun auf, als Sie zu der Erkenntnis kamen, dass Sie einen Märtyrertod erleiden sollten?«
Der junge Mann, mit gekreuzten Beinen am Boden sitzend, lehnte sich gegen die Wand zurück.
»Mein Prinz, interessiert Sie das, wenn ich ausführlich berichte, was ich während meiner Gefangenschaft durchgemacht habe?«
»Sonst würde ich nicht fragen. Es interessiert mich sogar sehr, sehr.«
»So will ich Ihnen berichten.
Meine ganze Gefängniszeit zerfällt in drei Perioden. Ich habe die Zeit verloren, schätze aber, dass ich ein dreiviertel Jahr hier gewesen bin.
Welchen Monat haben wir jetzt? August? Dann stimmt es ungefähr.
Ich fasse mich so kurz wie möglich.
Während des ersten Vierteljahrs war und blieb ich trotz der kärglichen Kost im Vollbesitz meiner Kräfte und habe mich immer mit Fluchtplänen beschäftigt.
In dieser Zeit trieb ich viele Freiübungen und grübelte nicht weiter darüber nach, weshalb ich wohl hier gefangen gehalten würde.
Dann begann die dürftige Kost zu wirken, ich verlor meine körperliche Kraft und meine geistige Energie.
Ich verlor die Hoffnung auf eine Befreiung, ich gab mich grübelnden Gedanken hin, weshalb ich denn hier gefangen gehalten würde, ohne diese Frage beantworten zu können, ich brach immer zusammen, weinte fast ständig.
Das war die zweite Periode, die auch wieder ungefähr ein Vierteljahr gewährt haben muss.
Nun kommt die dritte Periode, welche die große Umwandlung brachte.
Eines Abends befand ich mich wieder in der verzweifeltsten Stimmung. Ich hatte mich an diesem Tage fast blind geweint.
Wie ich so vollkommen erschöpft auf meinem Diwan lag, nicht einmal mehr des Weinens fähig, da plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen.
Plötzlich wusste ich, weshalb ich hierher gebracht worden, weshalb man mich hier gefangen hielt, weshalb man mir das kleine Kruzifix zurückgebracht und mir ohne Aufforderung eine Bibel gegeben hatte, weshalb man nicht erlaubte, dass ich mein Haar und den Bart kürzte, weshalb man dieses mein Haar und den Bart so pflegte.
Plötzlich wusste ich, dass ich mich in der Gewalt einer mohammedanischen oder heidnischen Sekte befand, die mich aus Hass gegen das Christentum als Christus opfern wollte. Ich war zum Märtyrertod bestimmt.
Diese felsenfeste Erkenntnis beruhigte mich wunderbar. Nun wusste ich doch wenigstens, woran ich war.
Gut, so wollte ich den Märtyrertod sterben.
So schlief ich beruhigt ein.
Und da hatte ich einen Traum. Da erschien mir der Heiland in überirdischer Verklärung. Und er sprach zu mir:
Siehe, ich habe die Welt überwunden. Ich bin für Dich am Kreuze gestorben, Du brauchest nicht mehr für mich zu sterben.
Nichts weiter. Er verschwand wieder.
So muss ich jetzt berichten.
Aber so etwas kann man überhaupt nicht erzählen. Diese Erscheinung des Heilandes dauerte für mich eine Ewigkeit, und auch eine Ewigkeit hörte ich diese seine Worte.
Und außerdem nun von einer überirdischen Pracht, seine Worte von einer sanften Lieblichkeit, und trotzdem von einer Wucht, die jeder Beschreibung spotten.
Ich erwachte.
Erfüllt von einer unendlichen Ruhe, von einer namenlosen Seligkeit. Ich wusste, dass ich von hier befreit würde. Aber das war mir schließlich ganz Nebensache.
Ein wunderbarer, seliger Friede füllte mein ganzes Innere aus.
Jetzt fühlte ich mit Genugtuung, wie meine körperlichen Kräfte immer mehr abnahmen, meine geistigen dagegen immer mehr zu.
Wenn sich diese zunehmende geistige Kraft auch in einer einzigen Hinsicht äußerte.
Während dieser dritten Periode habe ich unausgesetzt in der Bibel gelesen, die ich bisher gar nicht beachtet hatte.
Hauptsächlich die Evangelien, die Bergpredigt, immer die Bergpredigt im Evangelium Matthäi.
Dass ich Christi Lehren plötzlich verstand, das war das Resultat meiner geistigen Kraft.
Aber so etwas kann man nicht schildern.
Ich las plötzlich wie mit geistigen Augen. Ich verstand alles, was mir früher ganz unverständlich gewesen war.
So habe ich ruhig gewartet, bis ich befreit werden würde. Denn dass dies geschah, wusste ich nun ganz bestimmt, mit felsenfester Gewissheit.
Weil ich wusste, dass ich auf Gottes Befehl eine Mission zu erfüllen habe.
Als Sie eintraten, als ich plötzlich die Stimme eines unsichtbaren Wesens hörte, mag ich vielleicht sehr erstaunt oder sogar sehr erschrocken gewesen sein — ich weiß es nicht — das ist dann aber nur äußerlich gewesen.
Innerlich fasste ich das als etwas ganz Selbstverständliches auf. Obgleich ich nicht etwa an einen himmlischen Engel dachte.
Jedenfalls wusste ich, dass ich jetzt befreit würde. Und nun weiß ich auch, was ich weiter zu tun habe.«
Der Erzähler schwieg.
»Was werden Sie tun?«, fragte der Prinz.
»Ich werde das Evangelium predigen!«, erklang es einfach und bescheiden zurück, ohne jeden theatralischen Ton und Geste.
»Wo?«
»Dort, wohin mich Gott führen wird. Denn ich weiß, dass mich Gott zu dieser Mission bestimmt hat und dass er es noch, damit ich mich nicht in einem Irrtum befinden kann, durch ein besonderes Zeichen bestätigen wird.«
»Durch was für ein Zeichen?«
»Ich muss erst noch einer Person begegnen. Das ist dann das Zeichen, dass ich beginnen soll, das Evangelium zu predigen.«
»Was ist das für eine Person? Wenn ich fragen darf.«
»Mein Prinz! Es ist schwer zu schildern, was ich während dieser letzten Periode alles erlebt habe.
Ich habe nur von der Erscheinung Christi, die ich im Traume hatte, gesprochen.
Hierbei ist weiter gar nichts zu erklären. Ich habe diesen Traum, diese Erscheinung Christi, nie wieder gehabt.
Aber ich habe dann in jeder Nacht — in jeder! — noch einen anderen Traum gehabt, der mir völlig unerklärlich ist, und zwar auch jetzt noch.
Jede Nacht erscheint mir im Traume ein Kind. Ein sieben- oder achtjähriges Mädchen von wunderbarem Liebreiz, von einem himmlischen Lichte umflossen. Aber nicht etwa ein Engel.
Das blondlockige Kind ist mit einem weißen Kleide angetan, ein modernes Kinderkostüm, mit einer blauen Schärpe, an beiden Achseln blaue Schleifen, die Halseinfassung ist durchbrochen und ebenfalls mit einem blauen Bande durchzogen. Merkwürdig ist, dass ich immer sehe, obgleich das doch ganz belanglos ist, dass die Schleife der Schnürsenkel an ihrem rechten gelben Stiefelchen aufgegangen ist.
So steht das kleine Mädchen jede Nacht vor mir, hat in der linken Hand einen großen, grauen Schlüssel, der aussieht, als ob er von Stein wäre, hält ihn mir hin, hat tiefernste Augen, aber lächelt dabei, und so sagt sie zu mir: Das ist der Schlüssel zum Paradies!
Jede und jede Nacht dasselbe!
Dabei fällt mir auch immer auf, außer der aufgegangenen Schleife am rechten Stiefelchen, dass ihre linke Hand, in der sie mir den Schlüssel entgegenhält, dünner und sozusagen durchsichtiger ist als die, die sie herabhängen hat. Der Unterschied zwischen den beiden Händchen ist ganz minimal, aber mir fällt es doch immer auf.
Das ist der Schlüssel zum Paradies!
Weiter nichts. Aber jede und jede Nacht dasselbe.
In der zweiten Nacht nach jener Christuserscheinung erschien mir das Kind zum ersten Male, heute Nacht vorläufig zum letzten Male.
Was das zu bedeuten hat, weiß ich nicht. Aber das eine weiß ich ganz, ganz bestimmt: ich werde dieses Kind in dem weißen Kleidchen, mit der blauen Schärpe und den blauen Schleifen auch im Leben erblicken, und dann hat mir Gott das Zeichen gegeben: Gehe hin und predige das Evangelium!
Aber nicht mit Worten soll ich es predigen, sondern durch Taten.
Wie das zu verstehen ist, weiß ich wiederum nicht. Nur das weiß ich, dass es so ist, dass ich nicht mit Worten das Evangelium predigen soll, sondern die Wahrheit der Lehren Christi durch Taten beweisen.
Mehr kann ich nicht sagen. Ich fühle, dass ich unter der Führung Gottes stehe, und ich harre seines Kommandos.«
Wieder schwieg der Erzähler.
Und mit namenlosem Staunen blickten die großen, strahlenden Augen des Prinzen ihn an.
Dieses weiße Kinderkostüm mit der blauen Schärpe und den blauen Achselbändern, das hatte er der kleinen Deasy erst vor drei Tagen beim Betreten des ägyptischen Bodens in Alexandrien gekauft!
Sie hatte es nicht anprobiert, er wusste nicht, ob sie es schon getragen.
Und dieser junge Engländer hier hatte das Kind in diesem Kleidchen schon vor einem Vierteljahre im Traum erblickt!
Und dass Deasys linkes Händchen noch ein klein wenig hinter dem rechten in der Entwicklung zurückgeblieben war, das stimmte ebenfalls!
Die Erscheinung des Schlüssels hätte vielleicht erklärt werden können. Er hatte hier solche Schlüssel als symbolisches Abzeichen oftmals erblickt.
Aber wie kam er gerade auf einen grauen, steinernen Schlüssel?
Nein, nein, nur nicht solche natürliche Erklärungen suchen wollen!
»Mann, besitzen denn auch Sie die Gabe des zweiten Gesichtes?!«
»Des zweiten Gesichtes? Gehört habe ich ja schon davon. In Schottland soll es unter einfachen Landleuten häufig vorkommen. Nein, ich bin durchaus nicht mediumistisch veranlagt.«
»Aber Ihr Großvater oder Urgroßvater besaß doch das zweite Gesicht.«
»Mein Urgroßvater?«
»Wissen Sie nichts davon? Hat Ihnen Ihre Mutter nicht davon erzählt?«
Nein, Edward wusste absolut nichts davon.
»Nun sagen Sie mal — sind Sie vielleicht vor ungefähr drei Wochen im Traume einmal in Ihrer Wohnung zu London gewesen, haben Sie von Ihrer Mutter geträumt?«
Jetzt war es Edward Scott, der den Prinzen verwundert anblickte.
»Woher wissen Sie denn das? Davon habe Ihnen doch gar nichts gesagt?«
»Sprechen Sie!«
»Ja. Ungefähr drei Wochen mag es her sein. Da wurde ausnahmsweise das Kind mit dem Schlüssel von einer anderen Person verdrängt, es war meine Mutter, sie packte einen alten gelben Koffer — und plötzlich war sie auf der Straße, sie trat aus der Haustür, dieser gelbe Koffer, den ich sonst noch nie gesehen hatte, wurde ihr nachgetragen, und vor der Haustür stand ein Wagen, ein geschlossenes Cab, der Kutscher band seine zerbrochene Peitsche zusammen, und merkwürdig war, dass ich so deutlich die Nummer des Wagens sah, Nummer 838!«
»Genug, genug! Noch immer geschehen Zeichen und Wunder!«
Ganz erschüttert hatte es der Prinz gesagt.
Er war aufgestanden, beruhigte sich wieder.
»Ja, Mister Scott, Sie werden dieses Kind bald zu sehen bekommen, und dann ...«
Er brach ab, schloss die Augen, öffnete sie wieder.
»Ja, ich komme. Mister Scott, ich muss Sie nochmals allein lassen, für längere Zeit. Wir werden überhaupt noch einige Zeit hier bleiben, es hat sich unterdessen manches geändert. Noch vor fünf Minuten hätte ich zu Ihnen gesagt: Fürchten Sie nichts, und sollte mir etwas zustoßen, weil ich ein irdischer Mensch bin, der sich nicht einmal erklären kann, worauf diese Unsichtbarkeit beruht, so würde sich ein anderer Mensch, mächtiger als ich, Ihrer annehmen und Sie von hier fortbringen. Aber das habe ich jetzt nicht mehr nötig. Sie auserwählter Mann stehen unter einer anderen Führung als unter einer menschlichen. Sie sind und bleiben Gott befohlen.«
Der Prinz verließ den Raum, schloss hinter sich die Türe wieder zu. Erst hier draußen zeigte es sich, wie mächtig erschüttert er noch war.
»Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, von denen unsere Schulweisheit sich nichts träumen lässt! Dieses Wort bleibt bestehen. Ich hätte ja eigentlich schon genug erlebt in der letzten Zeit, um über so etwas nicht mehr zu staunen. Aber muss man denn nicht immer wieder staunen? Ja, und sind wir denn nicht überall von Rätseln und Wundern umgeben? Ach, wenn mir doch nur einmal jemand erklären könnte, wie sich die Raupe in einen Schmetterling verwandelt! Was sind wir doch für elende Stümper! Wie schon der gelehrte Thomasius seine Zunftgenossen vom Professorenstuhl verspottet hat: Ihr glaubt, alle Geheimnisse des Himmels und der Erden erforscht zu haben, es gibt für Euch nichts Unerklärliches mehr, und dabei wisst Ihr noch nicht einmal, wie man eine Laus macht!«
In einem prachtvoll ausgestatteten orientalischen Gemach standen sich zwei Personen gegenüber.
Die eine war die Königin der Nacht, die andere ein Mann. Zweifellos derselbe, den Edward Scott schon beschrieben hatte, der ein einziges Mal ihn besucht hatte.
Das Auffallendste an dem großen, stark gebauten Manne war der schwarze, bis auf die Brust reichende Bart, der aus lauter dünnen Zöpfen bestand, die wiederum zusammengeflochten waren, und dieses ganze Flechtwerk war dann zu einem regelrechten Viereck geschnitten worden.
Dieser seltsame Bart gab in Verbindung mit den buschigen Augenbrauen dem an sich schon finsteren Gesicht einen wahrhaft furchtbaren Ausdruck.
Gekleidet war er in ein langes, prächtiges Gewand aus einem kostbaren Purpurstoffe, mit blauen Ornamenten verziert, die wieder mit Goldstickereien eingefasst waren, auf dem gewaltigen Kopfe mit den buschigen Haaren eine hohe, spitze Mütze, auch wieder purpurn mit Blau und Gold ...
Ja, man glaubte einen alten Pharaonen vor sich zu sehen, wie ihn uns die Steintafeln zeigen, wie man ihre Mumien in solchen prachtvollen Gewändern in Sarkophagen findet — noch lebhafter aber musste man unwillkürlich an den Vers eines Dichters denken:
»Der König furchtbar prächtig wie blut'ger Nordlichtschein ...«
So blickte er, die Arme über der gewaltigen Brust verschränkt, auf das vor ihm stehende Weib herab.
»Was hast Du bei dem Christenhunde zu suchen gehabt? Zum letzten Male frage ich Dich, Fatime. Antwort!«
Fassungslos stand das schöne Weib vor ihm, die Hände gefaltet, nach Atem ringend, seinen furchtbaren Blicken ausweichend.
Dann raffte sie sich auf, richtete sich empor, ihre Augen begegneten den seinen, und keuchend erklang es von den schönen, jetzt aber farblos gewordenen Lippen.
»Weil — ich ihn liebe!«
So leise sie es auch gesagt, nur gehaucht, hatte es doch wie ein Verzweiflungsschrei geklungen.
Etwas wie Erstaunen malte sich in den finsteren Zügen des Mannes wider, und er sagte es, worüber er staunte.
»Dass Du diesen Christenhund liebst, darüber wundere ich mich nicht, das habe ich schon längst gewusst, denn ich habe Dich schon immer beobachtet. Der Grund, weshalb Du selbst immer den Gefangenenwärter kontrollieren wolltest, war mir bald klar. Ich bin nur überrascht, dass Du mir das zu gestehen wagst!«
Noch höher richtete sich das Weib auf, ein wilder Trotz prägte sich in dem schönen, weißen Antlitz aus.
»Ja, ich liebe diesen Mann! Höre es, Ahasver: Ich liebe ihn, ich liebe ihn!«
Ahasver? So wird in der Bibel der Perserkönig Xerxes genannt. Es ist aber auch der Name des bekannten ewigen Juden.
»Du wolltest ihn befreien!«
»Ja, ich wollte ihn befreien, mit ihm entfliehen aus dieser Hölle der Gräueltaten, in der auch ich gefangen gehalten werde! Und nun töte mich, quäle mich langsam zu Tode, Du Ungeheuer von einem Wüterich!«
In das furchtbare Gesicht des Mannes trat nur ein Lächeln.
»Fatime, bin ich Dir nicht immer ein gütiger Vater gewesen?«
»Nenne Dich nicht meinen Vater, Du Auswurf der Hölle!«, schrie das Weib außer sich. »Mache ein Ende mit Deiner Macht, die Dir ein unbegreifliches Schicksal über mich gegeben hat! Töte mich, töte mich! Ach, dass ich mir nicht selbst den Dolch ins Herz stoßen kann!«

Das Lächeln wurde nur tückischer.
»Nein, meine Tochter, einen Selbstmord habe ich Dir unmöglich zu machen gewusst. Und Deine Liebe zu diesem Christensklaven ist hoffnungslos.«
»Aber wenigstens ist er frei!«, rief sie triumphierend.
»Woher weißt Du das?«
»Ich weiß es, die Flucht ist ihm gelungen, ich weiß es, ich weiß es — eine innere Stimme sagt es mir!«
»Bah, innere Stimme — sie betrügt Dich. Der Christenhund ist bereits tot.«
Sie wollte vor Schreck erstarren, raffte sich wieder auf.
»Tot? Du lügst, Du lügst!«
»Er hat sich selbst dem Moloch geopfert. Er hat sich im Finstern in den Molochstempel verirrt, er ist in die Molochsgrube gestürzt, man hat seinen zerfleischen Leib und die Fetzen seines Gewandes gefunden.«
»Du lügst, du lügst!«
Der Mann löste die Verschränkung seiner Arme, legte die rechte Hand an den geflochtenen Bart.
»Bei Baal und Melkart, ich spreche die Wahrheit. Hier, behalte das als Andenken an deinen toten Geliebten.«
Seine andere Hand öffnete sich, er warf ihr ein kleines Kruzifix an silbernem Kettchen zu, dieses verfing sich gerade an den Fingern ihrer Hand.
Ein Blick — und mehr noch musste ihr wohl dieser Schwur des Mannes sagen — sie zweifelte nicht mehr ... mit einem gellenden Schrei stürzte sie hinaus.
Der finstere Mann blickte ihr unerschüttert nach, wie zufrieden nickte er mit tückischem Lächeln.
»Gut so! Gut so! Der Christengott ist uns entgangen — es hat nichts zu sagen. Wir werden uns einen anderen herrichten. Gut so, dass es so gekommen ist. Ich habe dieses seltsame Weib niemals der Liebe für fähig gehalten. Aber auch ich kann mich irren. Sie hat ihn geliebt. Und dieses Weib — darin irre ich mich nicht — wird niemals einer anderen Liebe fähig sein, sie wird auch dem Toten treu bleiben — wohl, hierdurch habe ich sie fest, nun brauche ich keine Vorsichtsmaßregeln mehr zu treffen, um ihr Entweichen zu verhindern, nun wird sie sich in alles, alles fügen — das weiß ich jetzt bestimmt!«
Auch er verließ den Raum, aber nach einer anderen Richtung.
Nicht weit von hier entfernt lag die Königin der Nacht kniend auf Kissen, sich ihrem Jammer hingebend.
Nein, weit entfernt von diesem Zimmer war es nicht, alle Zugänge nach hier waren schwarz mit Gold gehalten, im schwarzen Grunde lauter kleine seidene Schlüssel, und wir wollen verraten, dass diese schwarzgoldene Zone nicht einmal jener Mann zu betreten gewagt hätte, der durch seinen purpurblau-goldenen Ornat noch weit, weit über den roten Priestern stand, hier überhaupt den höchsten Rang einnahm. Aber dieses schwarz-goldene Gebiet war auch ihm verschlossen, oder er hätte aufgehört, hier die Rolle des Königs zu spielen. Denn äußerlich war auch er der Königin der Nacht unterstellt. Denn er war nur der König, sie aber war die erste Priesterin, die geistige Herrscherin und daher die mächtigste Person in diesem ungeheuren Tempel, von Tausenden von fanatischen Götzenanbetern bewohnt.
»Sst!«
Die Kniende blickte auf.
Und dass sie da einen Beduinen stehen sah, das war in diesem schwarz-goldenen Revier etwas so Ungeheuerliches, dass sie darüber alles andere vergessen musste. Ganz abgesehen davon, dass er auch das Kopftuch über sein Gesicht gezogen hatte, was es hier überhaupt nicht gab, das Gesicht durfte hier nicht verhüllt werden.
Ganz fassungslos, das Unmögliche nicht glauben könnend, hatte sie sich aufgerichtet.
»Mensch, wer bist Du, dass Du dieses Heiligtum zu betreten wagst!«

»Mensch, wer bist Du, dass Du dieses Heiligtum zu be-
treten wagst?«, fragte erstaunt die Königin der Nacht.
»Ein Freund von Dir, der Dir die frohe Botschaft bringt, dass Dein Geliebter noch am Leben und in Sicherheit ist!«, erklang es dumpf hinter dem Gesichtstuch.
Da freilich war der ungeheuerliche Frevel, dass hier ein Mensch eingedrungen war, ob Mann oder Weib, ganz Nebensache geworden.
Wir aber wohnen dem Weiteren nicht bei. — —
Eine halbe Stunde später geschah wieder etwas Ungeheuerliches, was aber diesmal diesen ganzen von Menschen wimmelnden Ameisenbau in die kolossalste Aufregung brachte.
Durch die Korridore schritt eine Gestalt, unverkennbar ein großer, starker Mann, in einen weiten Kaftan gehüllt, oder auch wieder ein Beduinenburnus, den man hier so viel sah, aber dieser hier war von schwarzem Atlas, und über und über waren goldene Schlüssel eingewirkt, und solch ein schwarzes Atlastuch mit goldenen Schlüsselchen verhüllte auch das Gesicht, nur kleine Augenlöcher frei lassend.
Und wer diesen Mann sah, ihm begegnete, der prallte vor Staunen zurück, und dann warf er sich, Priester oder Ritter oder Arbeiter oder irgend ein anderer in irgendwelchem Kostüm, sofort platt an den Boden, das Gesicht in den Händen vergrabend, und erst wenn der Mann sich schon wieder weit entfernt, mindestens die nächste Ecke passiert haben musste, so dass er also nicht mehr zu sehen war, wagte man sich wieder zu erheben, und dann blickte niemand hinter sich, und so wagte ihn auch niemand zu überholen; wenn man ihn auch nur von hinten erblickte, so warf sich doch alles schon platt auf den Boden, das Gesicht gegen den Teppich drückend.
»Wer war denn das?!«
So fragte ein Beduine, der aber ein europäisches, ein französisches Gesicht hatte, erstaunt seinen Begleiter, einen echten Beduinen oder doch überhaupt Araber.
Er mochte ein Neuling sein, ein Laie, der dies gefragt, diese allgemeine Respektsbezeugung nur nachgeahmt hatte.
»Still, still!«, flüsterte der andere ganz außer sich. »O Wunder des Baals, die Sultana, seine Priesterin, sie hat einen von uns erwählt!«
»Als was erwählt? Als ihren Geliebten?«, fragte der andere, und es brauchte nicht gerade ein Franzose zu sein, um gleich auf diesen Gedanken zu kommen.
»Still, still! Mensch, wie wagst Du zu fragen! Und blicke Dich doch nur nicht um! Baal sieht es und hört es — aber es braucht nur ein anderer zu sehen, dass Du Neugier zeigst, er denunziert Dich, und Du wirst kennen lernen, was es heißt, dem Baal geopfert zu werden!«
»Ja aber ... ich muss doch erst in so etwas eingeweiht werden ...«
»Du bist es noch nicht?! Frage einen Priester, frage einen Priester! Nur mich nicht, nur mich nicht! Ich möchte nicht einmal der Astarte geopfert werden! Wehe Dir, wenn Du auch nur fragst, wohin wohl dieser Heiligste aller Heiligen jetzt seine Schritte lenken möchte!«
In derselben Etage, aber in einem anderen Flügel des weiten Felsenbaues, schritt auch König Ahasver durch den Korridor. Majestätisch, die Arme über der Brust verschränkt, wandelte der finstere Mann einher, ohne weitere Begleitung.
Auch vor ihm warf sich alles auf den Boden nieder, aber nur die ihm Entgegenkommenden, und auch nur auf die Knie, die Arme kreuzend und den Kopf neigend.
Und wäre es die Sultana und Oberpriesterin gewesen, die Königin der Nacht, so hätte sich ebenfalls alles vor ihr auf die Knie geworfen, außerdem aber noch das Gesicht des tiefgesenkten Kopfes in den Händen vergrabend, mit der Stirn den Boden berührend. Und König Ahasver selbst wäre vor ihr respektvoll zur Seite getreten, wenn auch ohne Verneigung. Aber zur Seite getreten wäre er, hätte sie hier in der Öffentlichkeit nicht ansprechen, ihr nicht folgen dürfen. Das forderte das Zeremoniell, noch mehr, ein religiöser, heiliger Kultus.
Da begegneten sich die beiden, der König in seinem purpurblau-goldenen, prachtstrotzenden Ornat und der andere in seinem schwarz-goldenen Kaftan, das Gesicht verhüllt.
Und da, wie jener den Schwarzgoldenen erblickte, prallte auch er vor Staunen förmlich zurück.
Und dann kniete auch dieser finstere, allmächtige Mann nieder und beugte sein Haupt tief, tief vor dem Vorübergehenden, nur dass er die Arme über der Brust verschränkt behielt, sie jetzt erst recht kreuzweis legte, und der Schwarzgoldene schritt vorüber, ohne ihn irgendwie zu beachten.
König Ahasver hatte sich wieder erhoben. Es sah aus, als wolle sein noch immer maßlos erstauntes, bestürztes Gesicht jenem nachblicken. Aber er wagte offenbar nicht, den Kopf zu wenden. Dafür beschleunigte er seine Schritte.
So erreichte er wieder jenes Revier, in dem überall Purpur mit Blau und Gold vorherrschte, wie auch schon in den zuführenden Gängen, wo Ahasver auch schon vorhin die Königin der Nacht vorgenommen hatte.
Also auch dieser allmächtige Herrscher in diesem Reiche hatte vor der Oberpriesterin, ob diese nun seine eigene Tochter war oder nicht, respektvoll zur Seite zu treten. In der Öffentlichkeit. Das Zeremoniell forderte es. Hier in seinem eigenen intimen Heiligtume war das ja etwas ganz anderes.
Er zog stürmisch an einer Klingelschnur, bediente sich eines daneben angebrachten Sprachrohres.
»Fatime, bist Du da? Komme sofort zu mir!«
»Wenn ich will, nicht wahr?«, erklang die weibliche Altstimme zurück.
Der finstere Mann zuckte zusammen, dann aber lächelte und nickte er zufrieden.
»Ich bitte Dich, Dich zu mir bemühen zu wollen, o Padischina, o Priesterin des Baals.«
»Ich komme.«
Sie kam, nicht mehr verzweifelt, niedergebeugt, sondern stolz wie eine Königin.
»Was willst Du?«, fragte sie ganz ruhig.
Der finstere Mann aber konnte seine furchtbare Aufregung kaum bemeistern.
»Ich habe einen schwarzgoldenen Mann mit verhülltem Gesicht gesehen ..!«
»Nun und?«
»Es ist nicht möglich!«
»Es muss wohl möglich sein, denn er kam aus meinem Gemächern.«
»Ja aber, Fatime, wie soll ich es fassen ... Du hast Dir öffentlich einen Gemahl gewählt ...«
»Nun, habe ich etwa dieses Recht nicht?! Ich habe davon Gebrauch gemacht.«
»Ja aber, Fatime, nach alledem, was soeben geschehen, was Du mir offenbart, wenn ich es auch schon längst gewusst ...«
Da richtete sich das schöne Weib stolz empor, Triumph sprach aus ihren Zügen.
»Ich wollte Dir nur zeigen, dass Du Dich geirrt hattest, o Ahasver, der Du Dich rühmst, Dich niemals irren zu können! Du hast geglaubt, ich würde mich über den Verlust des Christensklaven nie trösten können? Nicht wahr? Nur Dir zum Trotz habe ich mir einen gewählt, der fernerhin meine Gemächer mit mir teilen wird, hahaha!«
König Ahasver schien nichts Unangenehmes gehört zu haben, danach war sein Gesicht.
»Nun wohl, ich bin's zufrieden, solchen Trotz lasse ich mir von meinem Töchterchen gefallen. Fahre so fort. Und wer ist der Glückliche, wenn ich fragen darf, auf den Deine Wahl gefallen ist, wodurch Du ihn zum Mächtigsten aller Schlüsselbrüder machst und daher ihn noch weit, weit über mich stellst, indem er ja nun auch der mächtigste Mann der ganzen Erde geworden ist?«
Da fuhr das Weib nicht nur stolz, sondern wild empor, furchtbar loderten plötzlich ihre Augen auf.
»Was wagst Du da zu fragen?! Mensch, noch ein einziges solches Wort, und es ist Dein letztes gewesen! Dann werde ich Dir zeigen, wie weit Deine Macht hier nur geht! Dann werde ich Dir zeigen, wer hier in Wahrheit das erste Zepter führt, Du oder ich! Ich verkünde öffentlich, was Du mich zu fragen gewagt hast, und Du wirst sehen, wie schnell Du Deine Rolle als Oberfürst hier ausgespielt hast, wie sie alle über Dich herfallen und Dir Deine Attribute herunterreißen werden!«
Furchtbar erschrocken war König Ahasver vor diesem plötzlichen Zornesausbruch zurückgeprallt. Es musste ihm ganz und gar unerwartet gekommen sein, dass dieser Mann so erschrecken konnte.
»Kind, ich bin Dein Vater ...«
»Ein Scheusal bist Du in meinen Augen, aber nicht mein Vater! Nie habe ich Dich als solchen anerkannt, und ich weiß es, dass Du es nicht bist! Nur weil Du meine Mutter in Deiner Gewalt hast, schone ich Dich Ungeheuer noch, gehorche Dir noch! Aber auch das hat einmal seine Grenzen! Bete mich an, König Ahasver!«
Und der König gehorchte, verschränkte wenigstens die Arme über der Brust und verneigte sich tief, tief.
»Ich bete Dich an, Priesterin aller Priesterinnen, ohne die wir vergeblich zu unsern Göttern beten, die allein alle Macht der Erde haben!«, murmelte er demütig.
Als er sich wieder aufrichtete, sah er nur noch den letzten Saum ihres schwarzen Gewandes in der offenen Tür.
Das grimmige Lächeln, mit dem er ihr jetzt nachblickte, konnte nur Genugtuung ausdrücken.
»Recht so, recht so, mein Töchterchen! Endlich, endlich hast Du es erfasst, was Du hier für eine Rolle zu spielen hast. Immer tritt auch mir gegenüber so auf, ich beuge mich gern vor Dir, sogar hier in meinen eigenen Gemächern. Denn ein Werkzeug in meiner Hand bleibst Du ja doch, wenn Du davon auch nichts merken wirst. Gut so, gut so, dass es endlich so gekommen ist. Dieser Christenhund hat mir sogar noch mehr geleistet, als ich in meinen kühnsten Träumen durch seinen Opfertod zu erreichen gehofft habe.« — — —
Der schwarzgoldene Mann, der Priestergemahl, wie wir ihn nennen wollen, der bisher vielleicht der armseligste Sklave gewesen sein konnte, war in jenen einsamen roten Korridor gegangen und hatte mit einem Schlüssel jene Tür geöffnet, hinter der Edward Scott zwischen roten Priesterröcken saß.
Es hatte den Priestergemahl niemand beobachtet, dafür hatte der eben gesorgt, und wehe auch dem, der ihm nachgeblickt hätte! Nur zufällig hätte das geschehen können, aber das hatte der Schwarzgoldene eben zu vermeiden gewusst.
Edward Scott lugte vorsichtig zwischen den Priesterröcken hervor, die eine Stellage zur Wand machten, dann ließ er schleunigst und lautlos die halbe Hammelkeule und den Weinkrug hinter solchen Kitteln verschwinden.
»Ohne Sorge, Ihr Freund ist es!«, erklang es da aber schon, und das schwarze Atlastuch wurde vom Gesicht zurückgeschlagen.
Vom Gesicht?
Ein Mensch mit normalen Augen hätte etwas ganz Wunderbares erblickt.
Gewissermaßen oder auch tatsächlich ein leeres Loch, von dem schwarzen Atlas gebildet, nichts von einem Menschenkopfe, nichts von einem Gesicht.
Die besonders präparierten Augen des jungen Mannes aber erblickten das bärtige Gesicht des Prinzen.
»Ja, da staunen Sie wohl, mich in so einem feinen Schlafrocke zu sehen, was, eh? Ja, wenn Sie aber erst wüssten, was dieser Schlafrock zu bedeuten hat! Nur ein Wörtchen von mir, und wir können mit tausend Menschenköpfen Kegel schieben, als Kegel stellen wir die abgehackten Beine auf. Außerdem können Sie mir gratulieren. Ich habe mich in aller Plötzlichkeit verheiratet. Freilich eine ganz platonische Ehe. Hier schickt Ihnen meine Frau Ihr Kruzifix. Ich werde sie Ihnen später vorstellen. So sehr sie auch danach brennt, Ihre werte Bekanntschaft zu machen, jetzt müssen wir erst einmal fort von hier. Wie Sie sich später als Hausfreund bei mir einrichten, ob oder ob nicht, das soll dann Ihre Sache sein. Vorläufig muss meine Frau noch warten. Sie ist auch damit einverstanden, ist schon hochbeglückt, dass Herr Moloch statt Ihrer einen anderen Kerl gefressen hat, eine tote Leiche. Und jetzt stärken Sie sich noch einmal, mir geben Sie auch noch einmal das Hammelbein her, an dem Sie doch hoffentlich noch was drangelassen haben — — jetzt geht's erst durch eine Riesenschlangengrotte und dann per Kamel durch die Wüste, hundert Kilometer weit, direkt nach Kairo!«
Und wieder zwei Tage später sehen wir die beiden in einem guten, wenn auch nicht einem vornehmen Hotel Kairos.
Der vollbärtige Herr im Sportanzug hatte sich im Fremdenbuch als Prinz Joachim mit seinem fürstlichen Familiennamen eingetragen, der andere im schwarzen Gehrockanzug nur als Mister Scott, und das genügte, man hat diese Eintragung überhaupt nicht nötig, es ist wegen der Anrede, wegen der Schlüsselnummer.
Scott ist ein englischer Name wie bei uns Schulze oder Müller, und den ehemaligen Flieger mit den eisernen Zügen erkannte niemand wieder.
Sie waren jetzt so sanft und weich geworden, obgleich so tiefernst, und doch so freundlich — in den Augen lag es — und noch immer war es der Christuskopf, obgleich das Haupthaar kurz geschnitten, nun freilich regelrecht geschnitten, und die Stoppeln, die des Prinzen Dolch übrig gelassen, hatten sich schon wieder zum zukünftigen Backenbart geordnet. Denn einen Anfang muss der doch einmal haben. Aber sogar mit diesem kurzen Haar und den Stoppeln war es noch immer ein Christusgesicht.
»Sie kommen!«
Eine neue Schar Gäste machte sich eine Treppe tiefer im Portal bemerkbar.
Es waren die Getreuen aus Medinet el Fayum, telegrafisch herbeigerufen.
»Jawohl, meine Herrschaften — hier logieren Seine Durchlaucht — Seine Gnaden erwarten schon — hab' die Ehr', Herr Baron — alleruntertänigster Diener, Herr Graf — küss die Hand, gnä' Freilein — biteee wollen's g'fälligst hier hereinspozieren.«
Der österreichische Zimmerkellner, der immer mehr in seinen heimatlichen Dialekt fiel, hatte die Tür aufgerissen. Grafen und Barone waren es natürlich nicht, die hereinspazierten. Aber jeder kavaliermäßig gekleidete Herr wird in Kairo nicht unter einem Baron genommen, da fängt dort der Mensch erst an, ein Mensch zu sein. Vorausgesetzt natürlich, dass er Geld hat und genügend Bakschisch gibt, Trinkgelder.
Es waren Kapitän Falkenburg und Jochen Puttfarken, die als erste eintraten, um Bericht abzustatten, oder eigentlich muss Jochen Puttfarken zuerst genannt werden, und dann natürlich Deasy.
Es war ein naives Kind, wie es in solchen Jahren sein muss.
Nicht erst eine freundliche oder gar höfliche Begrüßung mit Knicks.
Sie sah den, an dem sie von ganzem Herzen hing, jetzt ja wieder, was brauchte sie ihm denn da erst zu sagen, wie sehr sie sich darüber freue!
Das Kind hatte etwas gefunden, was ihm die größte Freude machte, und da war es doch ganz folgerichtig, wenn es dies dem Manne, den es liebte, sofort zeigte, um ihm dieselbe Freude zu machen.
»Onkel, was ich gefunden habe! Was meinst Du wohl?«
So stand sie da, in einem weißen Kleidchen, mit blauer Schärpe, an den Achseln blaue Schleifen, der Halseinsatz mit einem blauen Bande durchzogen, so stand das reizende Mädchen da, das Gesichtchen von blonden Locken umrahmt, ganz aufgeregt vom schnellen Laufen und vor Freude, und so schnell war es gelaufen, dass sich am rechten, gelben Schnürstiefelchen die Schleife der Senkel aufgelöst hatte.
Schon staunte der Prinz!
Aber noch hatte sie nicht gezeigt, was sie denn gefunden, noch hatte sie die linke Hand auf dem Rücken.
Und nun erst sah sie auch den fremden Herrn, in ihrer Artigkeit blickte sie jetzt diesen an, ihm hielt sie jetzt lächelnd das linke Händchen hin.
»Das ist der Schlüssel zum Paradies!«
Aber es war nicht etwa ein grauer, steinerner Schlüssel.
Jenen der Mumie besaß der Prinz gar nicht mehr, kein anderer dieser Gesellschaft.
Es war auch kein anderer Schlüssel.
Es war eine blaue Lotosblume!
Unten im Springbrunnen des Gartenhofes dieses Hotels gediehen solche.
Das Kind hatte die wunderbaren, seltsam geformten Blüten gesehen, hatte gefragt, Kapitän Falkenburg hatte ihr schnell eine kleine Erklärung gegeben.
Der Lotos ist den brahmanischen und buddhistischen Indern heilig, er ist ein religiöses Symbol, das Symbol der Herzensreinheit, welche den Himmel, das Nirwana erschließt.
Der Lotos ist unser Himmelsschlüsselchen, das aber seine Bedeutung verloren hat.
So hatte Kapitän Falkenburg ungefähr erklärt.
»Du, wenn Du diese Blume richtig anwendest, dann kannst Du mit ihr das Paradies aufschließen, das ist der Schlüssel dazu.«
Und nun brachte Deasy diese ihre Weisheit an, und zwar in ihrer Artigkeit gegen den fremden Herrn.
»Das ist der Schlüssel zum Paradies!«
Und Edward Scott?
Der brauchte keinen grauen, steinernen Schlüssel zu sehen. Er blickte das Kind an, und dann faltete er die Hände und blickte zur Decke, zum Himmel empor.
»Gott, nun hast Du mich als Deinen Diener angenommen!«
»Amen!«, flüsterte der Prinz, furchtbar erschüttert, und auch er faltete die Hände. »Herr, ich verlange kein Zeichen mehr, um an Dich zu glauben. Amen!«
Die nunmehr aus elf Köpfen bestehende Gesellschaft wohnte noch immer in dem Hotel, rüstete sich aber schon zum Umzug. Prinz Joachim hatte sich ein eigenes Haus gekauft. Hatte dabei einen recht seltsamen Geschmack gezeigt.
Wir müssen uns Kairo erst einmal etwas ansehen. Aber mit unseren eigenen Augen! Nicht mit denen des roten Baedekers oder eines anderen Reiseführers.
Kairo, hört und liest man, hat sein orientalisches Gepräge fast vollständig verloren.
Teufel noch einmal!
Das sagen und schreiben eben diejenigen, die das eigentliche Kairo überhaupt gar nicht gesehen haben, die nur nach dem neuen, europäischen Stadtviertel Ismailia gekommen sind, sich immer um den Eskanderia-Platz herumgedreht haben!
Kairo hat heute 600 000 Einwohner, und hiervon sind nur 25 000 Europäer, zu 75 000 wollen wir die Inder und Perser rechnen, die anderen 500 000 sind Araber mit einem Prozentsatz Türken und gemischten Negern, und die Hälfte von diesen sind froh, wenn sie ein langes Hemd zum Anziehen haben. Meist nur für den Sonntag, das heißt bei den Mohammedanern für den Freitag. Sonst laufen sie in der Badehose herum, die manchmal auch noch sehr mangelhaft ist.
Und nun die 523 Moscheen, wenn auch sehr viele davon in Trümmern liegen, aber mitten in der Stadt, und ebenso für den Fremden, der aber schon ein Jahr lang herumgekrochen sein kann, einfach unzählbar die Basare — und da sagt nun jemand, Kairo habe sein orientalisches Gepräge verloren!

Aber der Europäer muss als schlichter Arbeiter oder als armer reisender Handwerksbursche kommen, wenn er in dieses eigentliche Kairo eindringen und wirklich etwas sehen will. Ein solcher wird von den Mohammedanern ganz gastfreundlich aufgenommen, alle Schnaps- und Bierbuden — Busa, Hirsebier; Schnaps und Bier hat der Prophet nämlich zu verbieten vergessen, einfach weil er's selber noch nicht kannte — und die Haschischhöhlen und sonstigen Spelunken stehen ihm ohne Weiteres offen.
Diese Araber freuen sich, dem Fremden dies alles zeigen zu können. Sie sind stolz auf ihre Schmutzigkeiten, sie renommieren damit. Denn in diesen Spelunken kann man ja nun etwas sehen und erleben! Diese Zotenlieder der arabischen Sängerinnen, diese Tänze! Da können die kleinen Varietees von Amsterdam noch lange nicht mit, und die leisten doch auch Starkes in so etwas.
Oder montags und donnerstags die Weibermärkte! Das Stück von einem Taler an bis zu tausend. Gleich zum Mitnehmen. Als lebenslängliche Sklavin. Ebenso gibt es aber auch Märkte für männliche Sklaven.
Man lacht ja darüber, wenn man von der Abschaffung der Sklaverei hört. Übrigens wird jetzt von den Behörden ehrlich zugegeben, dass die Abschaffung der Sklaverei im Orient gar nicht möglich ist. Nur die Sklavenjagden können unterdrückt werden, aber der eigentliche Handel mit Sklaven so wenig wie die nun einmal bestehende Haussklaverei. Und die meisten der Sklaven wüssten ja, wenn sie entlassen würden, auch gar nicht wohin, so wenig wie ein Haushund, wenn er fortgejagt wird.
Aber man muss eben als ganz einfacher Arbeiter oder Handwerksbursche kommen, dem es zum Amüsement in der Neustadt zu teuer ist, dann wird man überall zugelassen, überall! Mit Ausnahme der Moscheen. Das ist ja auch etwas ganz anderes.
Es ist, als ob diese Araber wüssten — und anders ist es auch nicht, sie wissen es — dass man solchen armen Schluckern ja doch nicht glaubt, was sie dann erzählen. Wo sollen sie denn auch erzählen. Auf der Penne, auf der Herberge, im Kreise von anderen armen Schluckern. Die schreiben doch keine Zeitungsfeuilletons. Und sollen sie es tun — das wird doch von keiner Zeitung aufgenommen. Entweder die Berichte sind unglaublich, oder sie sind für die Veröffentlichung unzulässig. Das könnte nur in Buchform geschehen. Da müsste aber die ganze Sache einen wissenschaftlichen Anstrich bekommen, ein gelehrter oder sonst bekannter Name müsste dahinterstecken.
Und die, die solch einen Namen haben, die kommen nicht in das eigentliche Kairo hinein! Sie können in den Sackgassen herumirren, aber in die Spelunken kommen sie nicht, niemals!
Da steckt der eingeborene Wirt den Mohammedaner heraus, verbietet dem ungläubigen Franken den Eintritt, und hiergegen ist nichts zu machen, da hilft keine Polizistenbekleidung und gar nichts! Sobald die Religion in Frage kommt, ist es alle! Und da nützt es auch nichts, sich ärmlich anzuziehen und Hände und Gesicht zu schwärzen, die Haare struppig zu machen. Diese Imitation erkennt doch solch ein Spelunkenwirt auf den ersten Blick.
Ja, wenn man nur erst einmal solche Penn- und Tippelbrüder zu Worte kommen lassen würde! Und nicht etwa, dass sie nur Schmutzigkeiten erzählen können und sollen. Ach, was könnten die alles berichten! Sven Hedin war der erste Europäer, der Tibet durchquerte, unter ungeheuren Kosten, er hat dann aber auch mit seinen Werken Millionen verdient und ist geadelt worden.
Der erste Europäer?
Im Jahre 1889, zehn Jahre vor Sven Hedins erstem Reiseantritt, saßen in Bombay auf der deutschen Herberge, bei der Mutter Kühne auf dem Horseway, zwei deutsche Handwerksburschen, ein Bäckergeselle und ein Tapezierer, diese beiden waren zwei Jahre lang in der Haupt- und Klosterstadt Lhasa gewesen, im Allerheiligsten, was auch dem Sven Hedin verschlossen blieb. Der Bäckergeselle hatte sogar eine Tibetanerin geheiratet, hatte einen Gurkenhandel betrieben, und der Tapezierer hatte für ein Kloster Besen gebunden.
Diese beiden konnten etwas erzählen! Geadelt sind sie freilich nicht worden.
Aber hatten sie denn nicht die nötige Bildung, um so etwas auch schriftlich wiedergeben zu können?, wird der Leser fragen.
Ach Du lieber Gott — diese sogenannte Bildung! Mark Twain, der die höchsten Honorare bekam, die jemals gezahlt worden sind, war von Haus aus ein Schiffsheizer, und Ralph Waldo Trine, heute der einflussreichste philosophische Moralschriftsteller, war ein Waldarbeiter.
Aber das sind Amerikaner!
Die wandern nicht mit dem Fellranzen.
Das machen ausschließlich nur die Deutschen und Deutschösterreicher. Andere Walzbrüder gibt es nicht.
Und die lässt man nicht zu Worte kommen. Das ist es!
Der Schreiber dieses könnte alles dies nicht berichten, wenn er früher nicht selbst solch ein Vagabund gewesen wäre. — — —
Kairo liegt auf der rechten Seite des Nils. Es führt eine große Brücke hinüber, aber Häuser gibt es drüben nicht. Wegen der Nilüberschwemmungen. Der Bahndamm ist mit ungeheuren Kosten angelegt. Dort drüben ist alles fruchtbares Land, unter höchster Kultur stehend.
Dann weiter grenzt auch im Norden an Kairo, also an die Neustadt Ismailia, Ackerbauland. Sonst ist Kairo ringsum von der Wüste umgeben. Hier hört die Straße auf, und hier fängt die Wüste an. Der Flugsand würde in die Straßen dringen, wenn dieser ganze Teil nach Osten und Süden nicht durch natürliche Wälle geschützt wäre. Dagegen dringen des Nachts Hyänen ein, tief in das Innere der Stadt hinein. Noch heute!
Man sollte es nicht für möglich halten, aber es ist ja so.
Und was ist denn da überhaupt Unmögliches dabei?
Diese Hyänen sind ganz harmlos, die holen keine kleinen Kinder weg. Dagegen holen sie alles ab, was selbst die Aasgeier verschmähen, sie sind die besten Straßenreiniger, sorgen für die Sanität. Und wenn sie einmal einen berauschten Haschischin antreffen, einen Hanfraucher, der nicht weiter kann — na, der merkt gar nichts davon, der träumt ruhig weiter, er amüsiert sich im siebenten Himmel, und wacht er auf und merkt, es fehlen ihm ein paar Finger und ein Fuß — na, da findet er nun wieder mitleidige Seelen, die ihm einen Piaster geben, mit dem er sich wieder zu den Huris versetzen kann.
Auf diesem Walle, der sich rings um Kairo herumzieht, nur im Norden nicht, stehen zahllose kleine Windmühlen, aus Stein gebaut, aber anders aussehend als die holländischen. Sie werden nicht benutzt, haben gar keine Flügel mehr.
Auf diesen alten Windmühlen sitzen den ganzen Tag ungeheure Scharen von Geiern, ganz gewaltige Tiere, die ab und zu einen Flug über die Stadt machen, um zu sehen, ob für sie wieder etwas auf den Straßen liegt. Sie treiben sich darin herum, wie bei uns die Tauben und Sperlinge. Und da sagt man nun, Kairo hätte kein orientalisches Gepräge mehr!
In der Neustadt Ismailia freilich gibt's keine Hyänen und Geier mehr, das stimmt.
Nur im Südosten grenzt dicht an die Häuser statt der Wüste ein Gebirgszug, der Dschebel Mokattam, ein recht stattliches Felsengebirge, jäh aus der Wüste emporsteigend, neun Kilometer lang und drei breit. An seinem östlichen Ausläufer befindet sich der berühmte versteinerte Palmenwald, in der Mitte auf der südlichen Seite ist ein Steinbruch, in dem eingeborene Sträflinge arbeiten — schwere Jungen, immer je zwei sind mit Ketten zusammengeschmiedet, und dennoch kneift ab und zu solch ein Zwillingspaar aus — auf derselben Seite liegen nahe der Stadt die Mamelukengräber, gegenüber die Kalifengräber, lauter Dinger, die ein armer Stromer aus Europa ruhig besichtigen kann, während es einem besseren Fremden nicht geraten ist, oder man muss in großer Gesellschaft unter militärischer Bedeckung kommen und wird dann regelmäßig dorthin geführt, wo es nichts zu sehen gibt, und dabei werden die Herrschaften noch mit kleinen Götzenbildern und Mumien und dergleichen Raritäten, alle in einer Londoner Fabrik gemacht, übers Ohr gehauen, dass ihnen die Augen übergehen — und dann am Rande des Gebirges hoch oben über der Stadt eine zerfallene Zitadelle, und unterhalb dieser auf der nördlichen Seite schließlich noch ein wohlerhaltenes, aber verlassenes Kloster.
Es ist von Benediktinern angelegt worden. Ob sie ihren Kümmel gebrannt haben, weiß der Verfasser nicht. Gewiss aber ist, dass sie eine rege Missionstätigkeit entwickelten. Sie wollten die Mohammedaner zum Christentum bekehren.
Das ist für einen Christen höchst lobenswert. Es scheint nur, dass die biederen Mönche nicht genau orientiert waren. Sie hatten es hauptsächlich auf die Seelen der Mohammedanerinnen abgesehen. Da aber kamen sie an die falsche Adresse. Nämlich insofern, weil bei den Mohammedanern die Frau überhaupt gar keine Seele hat. Oder wenn sie eine hat, dann geht diese Seele beim Tode heidi, sie verpufft im Weltenraume. Jedenfalls kommt die Mohammedanerin nach dem Tode niemals in einen Himmel, nicht einmal in den alleruntersten, und wenn sie auch wie eine Heilige gelebt hat. Aber sie kommt auch nicht in die Dschehenna, in die Hölle. sie kann ausgefressen haben, was sie will. Da ist die Mohammedanerin fein heraus.
Nun, die braven Mönche dachten eben anders, glaubten an eine Seele auch des mohammedanischen Weibes, wollten diese in den christlichen Himmel bringen.
Aber bei diesen wohllöblichen Bemühungen kamen sie auch noch in anderer Weise an die falsche Adresse.
Viele, viele Jahre lang haben die arabischen Nachbarn in Kairo diese Bekehrungsbemühungen an ihren Frauen und Töchtern mit angesehen.
Eines Tages aber — es war in den sechziger Jahren — bekamen sie diese Geschichte satt, griffen einige Mönche auf, die eine Hälfte steinigten sie, der anderen Hälfte gaben sie eine Bastonade auf die Fußsohlen, wobei sie es sehr bequem hatten, denn es waren Benediktiner von der strengen Observanz, also Barfüßler, sie brauchten ihnen nicht erst Schuhe und Strümpfe auszuziehen.
Das musste natürlich gesühnt werden! Wer sich daran beteiligt hatte, wurde gehangen — vorausgesetzt, dass er sich erwischen ließ, sonst nicht — die anderen, die nur so ein bisschen zugesehen hatten, kamen in den Steinbruch. Nun musste aber doch auch das »Warum« untersucht werden.
Und die Folge war, dass bischöflicherseits das ganze Kloster nicht nur auf- und ausgehoben wurde, sondern es wurde sogar samt Grund und Boden von Rom aus mit dem Bannfluch belegt! Also nichts Katholisches durfte da wieder Fuß fassen. Es müssen da nette Sachen passiert sein, die man an die Öffentlichkeit zu ziehen sich hütete.
Seit dieser Zeit steht das Kloster leer. Einen neuen Besitzer hatte es bald bekommen. Es wurde der Kirche von einem englischen Bankier abgekauft, der in Ägypten dieselbe Rolle spielt wie der New Yorker Rechtsanwalt James Brown an der Riviera. Wenn man da eine idyllische Burg aus alten Zeiten auf hohen Felsen thronen sieht, oder man wird in eine Höhle geführt, und man fragt: wem gehört denn diese Burgruine, diese Höhle? Dem Advokaten James Brown. Der kauft an der Riviera alles zusammen, was eingestürzt und hohl ist, heute noch, nimmt Entree und macht wahrscheinlich noch ein feines Geschäft damit.
So hielt es damals in Ägypten ein englischer Bankier Rodman. Wenn irgendwo eine unterirdische Kammer aufgedeckt wurde, so kaufte er gleich die ganze Wüste, ohne sich dann weiter darum zu kümmern. So hatte er auch dieses Kloster gekauft. Er starb, die Erben wollten teilen, suchten alles wieder zu verkaufen.
Das hielt aber bei diesem Kloster schwer. Obgleich alles noch ganz gut imstande war. Noch keine Mauer eingestürzt, durch das Dach kam kein Tropfen Regen.
Zumal da es in Ägypten überhaupt so gut wie nie regnet. Aber wirklich, alles noch ganz gut bewohnbar. Das wussten besonders die Hyänen, Schakale und Füchse. Auch ein sehr schöner Klostergarten war vorhanden. Wachsen tat freilich nichts drin. Alles Sand. Die Mönche hatten bei ihren Bekehrungsbemühungen keine Zeit für den Garten übrig gehabt. Aber ein Brunnen lieferte wirklich ausgezeichnetes Wasser.
Ein berühmter englischer Kunstmaler hätte das Kloster beinahe einmal gekauft, hatte schon eine Anzahlung gemacht. Wie er das Refektorium besichtigte, sonnte da ein Schlangenehepaar seine zahlreichen Kinderchen, und wie er durch den Garten ging, schnellte eine auf, die vorher gar nicht zu sehen gewesen war, unter dem Sande vergraben, und biss ihn in den Stiefelschaft.
Hornvipern! Der indischen Brillenschlange an Giftigkeit nicht nachstehend, und außerdem die unangenehme Gewohnheit habend, am Tage sich wie ein Regenwurm unsichtbar unter dem Sande hinzuwühlen.
Daher von den Arabern Basr el Nile genannt, Nilwurm. Nun lese man »Antonius und Kleopatra«, da sieht man, wie gewissenhaft Shakespeare gearbeitet hat. Er nennt die Schlange, von der sich Kleopatra beißen lässt, den Nilwurm! Alle Hochachtung!
»Ich werde mich von solchen Würmern schikanieren lassen!«, sagte der Maler und ließ seine Anzahlung als Reugeld.
Ein weiterer Käufer fand sich nicht. Zumal das Kloster außer Hyänen, Schlangen und Skorpionen noch einen anderen Übelstand hatte. Solche niedliche Tierchen kann man schließlich vertreiben, aber da war auch eine böse Nachbarschaft, die nicht zu vertreiben war.
Auch auf dieser nördlichen Seite des Gebirges, nur 500 Meter von dem Kloster entfernt, liegt noch ein Steinbruch.
In diesen kommen alle diejenigen Sträflinge, die aus dem auf der anderen Seite schon einmal ausgekniffen und wieder gehascht worden sind, als Zwillinge oder solo.
Hier müssen sie als zusammengeschweißte Drillinge und Vierlinge arbeiten. Weiter aber ist mit ihnen nichts zu machen. Es sind nur mohammedanische Verbrecher, die nach dem Koran abgeurteilt werden, und der schreibt, dass Sträflinge, die arbeiten müssen, nicht weiter eingesperrt werden dürfen. Und die einmal verhängte Strafe ist auch nicht abzuändern, muss erst abgebüßt werden. Hat also etwa jemand fünf Jahre leichtes Gefängnis abzusitzen und er schlägt während dieser Zeit seinen Wärter tot, so muss er erst diese fünf Jahre abmachen, ehe er wegen des Mordes zur Verantwortung gezogen werden kann.
Also hier in diesem zweiten Steinbruche arbeiten die Wenigen, die dort drüben schon einmal ausgebrochen sind, die haben doch nun schon ihre Erfahrung gemacht, und die Sicherheitsmaßregeln sind sehr mangelhaft. Die Folge davon ist, dass die Hälfte von ihnen sich immer auf Urlaub befindet, den sie sich selbst gegeben haben, sie machen Kunstreisen.
Das ist doch natürlich eine sehr unangenehme Nachbarschaft. Da darf man bei der Wohnungseinrichtung, wenn man es hübsch gemütlich haben will, auch die Kanonen nicht vergessen — — —
Dieses alte Kloster hatte Prinz Joachim von dem Agenten in Kairo, der hiermit beauftragt war, gekauft, für ein Spottgeld, hatte aber immer noch viel zu viel dafür gezahlt.
»Die Hyänen und Geier werden Sie ja bald hinausgetrieben haben, das macht keine Mühe weiter, die gehen von selbst, und wegen der Schlangen empfehle ich Ihnen den Muley, das ist ein tüchtiger Schlangenfänger — oder Schlangenbeschwörer, wie er sich nennt. Er ist immer in der Mastikataverne vom Bacchalisten Demetri zu finden. Ich will ihn Eurer Hoheit zuschicken. Der Kerl hat wirklich etwas los, Schlangen hervorzulocken.«
So sagte der liebenswürdige Agent, aber erst, nachdem er seinen Scheck bekommen hatte.
»Was Hyänen, was Geier, was Schlangen?!«, stutzte der Prinz.
»Nun, Eure Hoheit wissen doch, dass in dem alten Kloster lauter solches Raubzeug haust.«
»Dass sich Fledermäuse darin angesiedelt haben, kann ich mir lebhaft denken, meinetwegen auch Geier und Hyänen — aber Schlangen?!«
»Es wimmelt darin von Schlangen, wohin man tritt, tritt man auf einen Nilwurm!«, entgegnete der Agent und barg auch den Kaufkontrakt im Panzerschrank. »Ist Eurer Hoheit denn das gar nicht aufgefallen, als Sie das Kloster besichtigten?«
»Ich bin noch gar nicht dort gewesen.«
Das war allerdings sehr, sehr merkwürdig. Aber dieser englische Agent wunderte sich nicht weiter, dem genügte es, dass er Kaufkontrakt und Scheck in Sicherheit und seine Provision verdient hatte.
»Ich habe das Kloster im Auftrage eines anderen gekauft, wenn auch alles auf meinen Namen geht.«
»So so. Nun, ich empfehle Ihnen also den alten Muley. Ich werde ihn Eurer Hoheit zuschicken.«
»Wenn Sie so freundlich sein wollen. Bitte recht bald.«
»Heute noch, bestimmt heute noch. Nach Ihrem Hotel? Heute noch. Der alte Muley kann auch sehr gut Geister beschwören!«
»Geister?!«
»In dem Kloster spukt's mächtig.«
»Ach was!«
»Das sind die arabischen Frauen und Mädels, die in dem Kloster ihren Tod gefunden haben, die gehen jetzt drin um. Aber auch ein paar Mönche haben keine Ruhe im Grabe, besonders der Abt spukt wie ein toller Hund.«
»Ach nee!«
»Das ist in ganz Kairo bekannt.«
»Ich habe noch nichts davon gehört, mich allerdings auch noch nicht weiter darum gekümmert.«
»Ich habe selbst einmal so einen Geist oben auf dem Dache herumkriechen sehen.«
»Sie selbst?!«
»Es ist noch gar nicht so lange her. Ich hatte eine Automobilfahrt nach Hesly gemacht, wir kamen erst spät in der Nacht zurück. Da sahen wir dort oben auf dem Klosterdache so eine weiße Gestalt herumzappeln.«
»Es war einfach ein weißgekleideter Mensch, der dort oben einen nächtlichen Spaziergang machte.«
»Nein, die weiße Gestalt schwebte eine gute Strecke weit frei durch die Luft, das kann kein Mensch.«
»Haben Sie die Sache nicht näher untersucht?«
»Ich hatte keine Zeit, ich musste in den Klub.«
»Sie sind wohl Spiritist?«
»Nein.«
»Aber Sie glauben an die Existenz von Geistern?«
»Möglich, dass es welche gibt. Ich habe keine Zeit, mich um so etwas zu kümmern, ich bin geschäftlich zu sehr in Anspruch genommen. Aber der alte Muley soll wirklich ein sehr guter Geisterbeschwörer sein.«
»Na ja, da schicken Sie mir nur den Muley zu. Apropos, weil Sie von Automobilen sprachen, selbst fahren — Automobile gibt's ja in Kairo genug zu kaufen, ich habe mir schon eins angeschafft — aber ich möchte gern auch einen flotten Renner haben, da scheint in ganz Kairo keiner auf Lager zu sein. Wissen Sie vielleicht zufällig einen aus zweiter Hand?«
Mister Achilles Pimplin, ein altes Männchen, rieb sich nachdenklich das glattrasierte Kinn.
»Hm. Das passte vortrefflich. Ja, ich weiß jemanden, der einen vierzylindrigen Mercedes hat, 120 Kilometer in der Stunde, will ihn verkaufen.«
»120 Kilometer in der Stunde?!«
»Es ist ein Sportrenner.«
»Läuft die Karre aber auch noch?«
»Tadellos, noch ganz neu.«
»Nun wohl, wer ist der Herr, wo treffe ich ihn?«
»Bitte, das wäre dann mein Geschäft, das ich vermittele. Ich bin sehr bescheiden mit meiner Provision.«
»O gewiss. So vermitteln Sie das Geschäft.«
»In einer Stunde werden Sie den Preis und alles wissen. Und wie ist es denn nun mit den Arbeitern zur Vorrichtung des Klosters? Denn Sie sagten doch, Sie wollten es bewohnen.«
»Nun, ich werde doch Arbeiter und Handwerker bekommen ...«
»Das dürfte schwer halten.«
»Weshalb?«
»Wegen der Schlangen und Geister. Aber ich weiß einen arabischen Unternehmer, einen Baumeister, würden wir sagen, der beschäftigt eine Bande, die sich vor allen Teufeln nicht fürchtet. Dabei geschickt und durchaus zuverlässig.«
»Gut, setzen Sie mich mit dem Manne in Verbindung. Ich dachte, Mister Pimplin, Sie seien nur Haus- und Grundstücksagent?«
»O nein, ich mache jedes Geschäft, wobei sich etwas verdienen lässt. Ich vermittle alles. Wenn vielleicht Hoheit — ehem — sich — ehem — einsam fühlen ehem — mit Gedanken an eine Heirat umgehen — habe hier gerade ein paar gute Nummern auf Lager, da wäre gerade etwas für Sie darunter ...«
»Ich danke, ich danke, ich denke vorläufig noch nicht ans Heiraten.«
»Schade. Dann wollen Sie sich später bei Bedarf meiner erinnern. Streng solid! Und billig! Oder brauchen Sie vielleicht Fausthandschuhe? Dick gefüttert. 5000 Paar.«
»Wie kommen Sie denn zu denen?«
»Sie waren nach Norwegen bestimmt, sind versehentlich nach Ägypten gekommen. 5000 Paar. Brauchen Sie?«
»Ach, was soll ich denn hier in Ägypten mit 5000 dickgefütterten Fausthandschuhen!«
»Nun, man weiß nicht, wie es manchmal kommt. Das Barometer fällt ständig, und vor 14 Jahren sind Pyramiden mit Schnee bedeckt gewesen. Oder holländischen Käse? Sehr empfehlenswert. Tausend Zentnerlaibe. Außerdem habe ich die Generalvertretung von Professor Swindlers weltberühmtem Trichinenelixier. Sie können die Trichinen löffelweise blank essen, schadet Ihnen absolut nichts.«
»Na, wissen Sie was, Mister Pimplin, wir bleiben erst einmal bei dem alten Muley, bei dem Rennautomobil und bei dem Arbeitsunternehmer, über das andere sprechen wir später einmal, nicht wahr?«
»Wie Eure Hoheit wünschen.«
Der Prinz befand sich draußen auf der Straße, schüttelte den Kopf.
»Ein Kloster — mit Hyänen und Schlangen — gefütterte Fausthandschuhe — Geister — holländischen Käse — Automobile — eine schöne reiche Frau mit Trichinen ... allmächtiger Gott, hat der ein reich assortiertes Lager!«
Jochen Puttfarken stand am Fenster des Hotelzimmers und blickte auf die belebte Straße hinab.
Da plötzlich dort unten eine allgemeine Bewegung, ein Schreien und Hasten und Drängen, offenbar eine allgemeine Flucht.
Vier arabische Arbeiter, jeder ein rotes, schwarzumrändertes Kreuz auf der Brust, trugen eine verhüllte Bahre, auf der eine Tafel aufrecht stand, auf beiden Seiten mit großen Buchstaben beschrieben, mit lateinischen und arabischen Zeichen:
Basralla! — Lepra!«
Also ein an Aussatz Erkrankter, der in die Leproserie, in das ummauerte Asyl gebracht wurde, von der Welt noch bei Lebzeiten für immer verschwindend.
Der Aussatz, der Maalzei des Mittelalters, ist die scheußlichste, unheimlichste Krankheit, die wir kennen. Von der Cholera und Pest braucht man noch nicht angesteckt zu werden, aber wer mit einem Aussätzigen in nähere Berührung kommt, der ist rettungslos verloren.
Alles bedeckt sich mit Schwären, das Fleisch wird ganz schwammig und löst sich von den Knochen, und dass dies im Durchschnitt zwölf Jahre lang dauert, ehe der Tod vor Erschöpfung eintritt, das eben ist das Furchtbare dabei! Vier bis sechs Jahre quälen sich die Kranken unter schrecklichen Schmerzen immer herum, man hat schon achtzehn Jahre beobachtet. Und alles, alles, um den Leprabazillus zu bekämpfen, hat sich als fruchtlos erwiesen. Aber diese Fürchterlichkeit hat auch eine großartige Gegenseite!
Nämlich dass es Menschen gibt, Ärzte und Krankenwärter und besonders auch Frauen und Mädchen, barmherzige Schwestern, die freiwillig in diese Leproserien gehen, um die Aussätzigen zu pflegen. Nie kommen sie wieder hinter den doppelten Mauern hervor. Sie können Briefe empfangen, die wie alles andere über die Mauer geworfen werden, aber sie selbst können keinen Brief mehr ihren Angehörigen senden. Telegraf und Telefon wären ja möglich, die Bazillen pflanzen sich doch nicht an den Drähten fort, aber die fanatischen Orientalen dulden auch diese Einrichtung nicht. Nur an ausgesteckten Tafeln wird verkündet, wenn wieder einmal jemand gestorben ist.
»Du, Hein, was tragen die denn da unten? Was reißen die denn alle aus?«
Hein, ein Matrose, trat ans Fenster.
»Lepra? Das ist ein Aussätziger. Der wird fortgeschafft.«
Jochen Puttfarken hatte wohl schon vom Aussatz gehört, war aber, so weit er auch schon in der Welt herumgekommen, nicht weiter darüber orientiert.
»Was ist denn das eigentlich, der Aussatz?«
Der Matrose Hein wusste es.
»Nu nu — da wird die Haut und das Fleisch ganz weiß — und immer weißer — und immer weißer — wie Milchglas — und dann wird alles ganz durchsichtig — bis das ganze Fleisch weg ist — und dann frisst's die Knochen auch noch weg — bis gar nischt mehr übrig bleibt.«
So erklärte der Matrose Hein. Er wusste es nicht anders. Einerseits hatte er es auch ganz richtig geschildert, zumal da es auch ohne Schwärenbildung abgehen kann.
Aber Jochen Puttfarken war eine sehr feinfühlige Natur. Ihm wurde plötzlich ganz flau im Magen. Wunden und Verstümmelungen konnte er sehen — aber von solchen Krankheiten mochte er nichts hören. Sehen und hören ist auch zweierlei.
»Und das steckt an?«, fragte er ganz kläglich.
»Nee, anstecken tut der Aussatz nicht. Oder wie man's nimmt. Ob man sich davor fürchtet oder nicht, darauf kommt's an. Oder ob man's weiß oder nicht. Wenn man einen Aussätzigen anfasst, von dem man gar nicht weiß, dass er den Aussatz hat, dann schadet's nicht. Dasselbe gilt von seinen Kleidern. Wenn man Sachen von einem Aussätzigen anfasst und man weiß, die Sachen sind von einem Aussätzigen, und man hat Angst, erschrickt — auch hinterher noch — dann hat man selber den Aussatz. Sonst nicht. Wenn so ein Kranker fortgetragen wird, sollte das nicht so offen geschehn, die Leute dürften gar nichts davon wissen. Da läuft unter uns mancher Aussätziger herum, bei dem's noch nicht so sicher ist, er selbst weiß es, aber sagt nichts — der müsste doch sonst durch seine Berührung die ganze Stadt, das ganze Land anstecken, oder immer wieder einer den anderen.«
Vielleicht, dass dieser Matrose da eine große Weisheit aussprach.
Dass bei allen anderen ansteckenden Krankheiten, besonders auch bei der Pest, die Furcht vor der Ansteckung die größte Rolle spielt, das ist ja bekannt genug. Wie es eine orientalische Fabel ausdrückt.
Der Engel des Lichtes begegnet dem Engel des Todes.
»Wohin gehst Du?«, fragt der Engel des Lichts.
»Ich gehe nach Damaskus, um 20 000 Menschen mit der Pest zu schlagen.«
Nach einiger Zeit treffen sich die beiden wieder.
»Du sprachst die Unwahrheit, Du hast 50 000 an der Pest sterben lassen!«
»Nein. Ich tötete nur 20 000; die anderen 30 000 sind vor Angst gestorben.« —
»Wie lange dauert denn das, ehe man daran stirbt?«, fragte Jochen weiter.
»Ach, einen ganzen Haufen Jahre. Da kann man dabei manchmal alt wie Methusalem werden.«
»O jeh, o jeh!«
»Jaaaa, das ist was Schreckliches — wenn man so weiß wird — und immer weißer — und immer durchsichtiger — und erst geht alles Fleisch weg — und dann alle Knochen — — bis gar nischt mehr da ist ...«
»Hein, hör up, Hein!«
Wieder wurde es dem Nasenkönig ganz schwach zumute.
Die besondere Klingel des Prinzen schellte, und heute hatte Jochen Puttfarken den Adjutantendienst. Seinen führenden Rang nahm er ja nun nicht mehr ein, zu kochen hatte er im Hotel auch nicht.
Wie er das Wohnzimmer des Prinzen betrat, ging dieser gerade zu einer Nebentür hinaus.
»Eine Minute, ich komme gleich wieder.«
Da, wie Jochen so dastand, fühlte er plötzlich eine Schwäche in seinen Beinen, dass er sich kaum aufrecht halten konnte.
Vielleicht, dass der sonst kerngesunde und bärenstarke kleine Mann wirklich von einem Unwohlsein angewandelt wurde, eine Krankheit drohte auszubrechen, ein seelischer Abscheu hatte das Signal dazu gegeben.
Aber von so etwas wollte ein Jochen Puttfarken nichts wissen, er hätte sich doch geschämt, einen Ohnmachtsanfall zu bekommen, das musste durch Willenskraft überwunden werden, und dann gibt's dazu auch noch andere Hilfsmittelchen, wie zum Beispiel ein guter ...
Dort auf dem Tische stand eine offene Champagnerflasche mit Etikett. Alter Jamaikarum.
Jochen Puttfarken wusste, was er durfte und was er nicht durfte. Sein Herr hätte ihm hinterher Vorwürfe gemacht, wenn er sich nicht zu helfen gewusst hätte.
Er ging hin, nahm die Flasche, roch hinein — ja, das war Rum — ein Glas sah er nicht, trank gleich aus der Buttel, nahm einen tüchtigen Schluck, drei Schlucke.
Wie Feuer rann ihm der Rum die Kehle hinab und gleich durch alle Adern, vorüber war sofort die Schwäche. Ja, es geht manchmal nichts über einen guten Schnaps.
Als der Prinz wieder eintrat, stand Jochen längst wieder an seiner alten Stelle, und zu sagen brauchte er nichts.
»Hier, Jochen, Du kannst mal diesen Brief besorgen, gleich eine hübsche Partie, hoch zu Esel, Du reitest doch gern. Kennst Du die Pulvermühle? Auch Teufelsmühle genannt? Wohl nicht. Obgleich sie in Kairo eine Berühmtheit ist. So wird der Flecken Chijam genannt, wo früher einmal eine Pulvermühle gewesen ist, jetzt ist es die Kolonie einer religiösen Sekte, Engländer und Amerikaner, die sich immer mit dem Teufel herumbalgen. Brave Leutchen. Hier.«
Der Prinz hatte eine große Karte von Kairo und Umgegend ausgebreitet.
»Du reitest über die Brücke, die Du zu finden weißt, hier diesen Weg nach Bulak hinauf, dort passierst Du den untertunnelten Eisenbahndamm, dann immer weiter direkt geradeaus nach Chijam. Du brauchst keine Karte, brauchst nicht zu fragen, kannst Dich gar nicht verirren. Es sind von der Brücke aus genau sieben Kilometer.
Wo Du anzuklopfen hast, wirst Du schon sehen. Die ganze Ansiedlung ist von einer Mauer umgeben. Wer Dir das Tor öffnet, dem sagst Du: Einen schönen Gruß von Prinz Joachim, und Du möchtest Mister Harry Poulsen sprechen.
Der Herr wird kommen. Du gibst ihm diesen Brief und dieses Paketchen. Er wird beides gleich öffnen und sagen, ob Du warten sollst oder nicht. Mister Poulsen ist ein tüchtiger Chemiker, hat dort ein modernes Laboratorium. Wir sind befreundet. Er soll mir eine Substanz untersuchen. Vielleicht kannst Du warten, bis die Analyse fertig ist. Nicht umsonst wähle ich zu dieser Mission gerade Dich aus, Jochen. Diese Teufelsfechter, wie sie genannt werden, sind eigentümliche Leutchen. Brav und bieder und herzensgut, sind aber von Schrullen ganz durchsetzt. Überall wittern sie den Teufel, danach richten sie ihr ganzes Leben ein. So lassen sie wohl jeden zu sich hinein, aber nicht wieder heraus, wenigstens nicht vor 24 Stunden. Sonst raubt der Teufel ihnen den Frieden. Und so ist es bei ihnen mit allem und jedem. So ohne Weiteres kann man das gar nicht schildern.
Aber ich weiß, Jochen, Du bist der gewandteste Weltmann, weißt Dir in jeder Lage zu helfen, Du wirst mit jedem fertig, gleichgültig, ob Edelmann oder Bettelmann, ob Räuberhauptmann oder ein religiöser Sektenhäuptling, Du lässt Dich nicht verblüffen und bleibst immer der Kavalier.
Also ich brauche Dir gar keine weiteren Instruktionen zu geben. Vor 24 Stunden erwarte ich Dich überhaupt nicht zurück. Meinetwegen aber kannst Du auch noch länger ausbleiben, so eilig ist die Sache nicht. Wenn Dich Mister Poulsen fragt, ob Du Zeit hast, so bejahst Du. Nun schmeiße Dich in Wichs. Suche Dir unten den schneidigsten Esel aus. Hier liegt der Brief, es kommt noch das Paketchen dazu, das holst Du Dir dann ab, falls ich schon fort sein sollte. Vergiss Deine Brille nicht, Du reitest immer der Nachmittagssonne entgegen.«
Jochen ging, seine Säbelbeine schlenkernd und sich in den Hüften wiegend.
Der Prinz hatte ihm nicht etwa nur eine Schmeichelei gesagt. Es sind schon einmal Andeutungen gemacht worden, dass sich dieses kleine Krummbein, auch wenn es kaum seinen Namen schreiben konnte, tatsächlich in jeder Lage zu helfen wusste, den konnte man mit einem vollen Geldsack auf dem Rücken sogar in das Chinesenviertel von San Francisco schicken, direkt in eine Opium- und Spielhölle, der brachte den ihm anvertrauten Geldsack wieder heraus; er hatte schon mehrmals starke Beweise für solche Zuverlässigkeit gegeben.
Anderseits war es ja doch eine Schmeichelei gewesen, aber der Nasenkönig freute sich natürlich, so etwas aus dem Munde seines Herrn zu hören, eben weil der sonst nicht so war.
Also Jochen warf sich in Wichs, und seine Koffer erlaubten ihm, eine Toilette zu wählen. Angebracht wäre ja ein weißes Tropenkostüm gewesen, aber so lief jetzt hier jeder Kerl herum, der sich das irgendwie leisten konnte.
»Der Prinz hat gesagt, ich wäre ein Kaviller, und ich werde den Leuten dort beweisen, dass ich auch wirklich ein Kaviller bin.«
Natürlich meinte Jochen einen Kavalier, nicht einen Schinder, Abdecker und Pferdeschlächter. Aber im Grunde genommen hatte er gar nicht so Unrecht, die Wurzel beider Worte ist ein und dieselbe.
Also er wählte aus dem reichen Schatze seiner Garderobe eine braun und schwarz gestreifte Hose, die eng anliegend den eleganten Schwung seiner Säbelbeine zur schönsten Geltung brachte, weiße Weste mit roten Blümchen, gelbes, offenstehendes Jackett mit blauem Samtkragen. Dazu knallrote Halbschuhe mit weißen Schleifen, schwarze Seidenstrümpfe mit hellblauen Vergissmeinnichten. Noch knallröter die Glacéhandschuhe, die er sich immer extra anfertigen lassen musste, diese Nummer gab's im Handel nicht. Natürlich Oberhemd mit festen Manschetten, der hohe Stehkragen umso höher erscheinend, weil dieses Männchen überhaupt gar keinen Hals hatte. Grüner Schlips mit goldenen Tüpfelchen. Echter Panama mit grün-rot-weißem Bande.
Der Kaviller hatte im Wandspiegel nichts an sich auszusetzen. Nun sorgte er auch noch für die zukünftige Schönheit, indem er sich die haarlose Rüsselschnauze kräftig mit einem Barterzeugungselixier einrieb, Preis des Fläschchens acht Mark, Wert acht Pfennige. Pomade und Parfüm dagegen liebte er nicht, das fand er unmännlich. Ebenso wie Schmuck, Ringe und dergleichen.
Nun noch in die Taschen, was ein Kaviller nötig hat, was alles schon wohlgeordnet auf dem Tische lag: vor allen Dingen ein flaches Toilettenecessaire mit Spiegel, Haarbürste, Bartbürste, desgleichen zwei Kämme, Nagelschere, Nagelfeile, Nagelpolierstein und was eben ein Kaviller sonst noch alles braucht, einige Taschentücher mit verschiedenfarbigen Rändern, die Monogramme wunderbar gestickt, von ihm selbst gestickt, eine grünseidene, vollgespickte Börse, in die hintere Hosentasche einen ansehnlichen Revolver, daneben in einer besonderen, ganz schmalen, aber langen Tasche ein Dolchmesser, in die linke Westentasche die schwergoldene Uhr mit ebensolcher Kette, in die rechte ein Schächtelchen mit 25 Patronen, und schließlich nicht zu vergessen die elegante Brieftasche, die als Hauptsache Visitenkarten enthielt:
JOCHEN PUTTFARKEN, BLANKENESE,
SCHIFFS- UND EXPEDITIONSKOCH.
Diese Visitenkarte gab eigentlich zu denken!
Wer sich so herausputzte, der, hätte man meinem sollen, hätte sich einen anderen Beruf beigelegt, so etwa den eines Barons oder Grafen.
Das gab's aber bei Jochen Puttfarken eben nicht! Der schmückte sich nicht mit fremden Federn, spiegelte nichts Falsches vor, bei dem war alles echt, und wie er sich kleidete, das ging keinen Menschen und keinen Teufel etwas an!
Und schließlich die blaue Brille nicht zu vergessen!
Jochen hatte einmal eine Augenentzündung gehabt, und seitdem konnte er nicht mehr gegen die Sonne blicken. Die hochstehende Sonne, so sehr sie auch brannte und von weißem Gestein auch reflektiert wurde, genierte ihn nicht, aber er konnte nicht gegen die tiefstehende Sonne gehen, die direkten Strahlen entzündeten seine Augen, und da half auch kein Schirm und kein beschattender Hut, nur blaue Gläser schützten ihn dagegen.
Man wird beobachten, dass zivilisierte Neger, die sich von der europäischen Kultur durchdrungen fühlen, mit Vorliebe recht große Brillen tragen. Doch aus keinem anderen Grunde, als um aufzufallen, und weil eine große Brille einen weit stärkeren Anstrich von Gelehrsamkeit und sogar Überstudiertheit gibt als eine kleine Brille oder gar etwa der nun schon abgedroschene Klemmer. Dieselbe Vorliebe für recht auffallend große Brillen findet man übrigens noch bei Chinesen, Japanern — und schließlich noch bei den Spaniern.
So etwas gab's bei Jochen Puttfarken nun freilich nicht. Der wollte die Aufmerksamkeit durchaus nicht auf sich lenken. Er wusste, dass er schön war, und damit genug. Er trug bei Gelegenheit nur deshalb eine Brille mit solch ungeheuren blauen Gläsern, eine wahre Automobilbrille, weil solch große Gläser eben am besten ihren Zweck erfüllten. Natürlich in Gold gefasst mit goldenen Bügeln. Wenn sich das nicht solch ein Koch leisten konnte, wer soll denn sonst die Goldarbeiter in Nahrung setzen. Und hierbei ist gar nicht so viel übertrieben. Wenn ein tüchtiger, erfinderischer Koch, der seine eigenen Spezialgebiete hat, sich nicht schon in mittleren Jahren als Rentier zur Ruhe setzen kann, dann ist's ein Lumich gewesen, und da braucht er immer nur während der Saison gearbeitet zu haben. Was meint man denn wohl, was solche Köche in großen Hotels und noch mehr bei reichen Privatpersonen, die ein glänzendes Haus führen, bekommen! Die werden wie die Minister bezahlt, manchmal wie die Heldentenöre, ja unter Umständen sogar wie die berühmten Jockeys. Und wenn Prinz Joachim, obgleich er es sich hätte leisten können, diesem seinem Expeditionskoch auch nicht solch ein riesiges Gehalt zahlte, so musste er den Mann, den er der Welt entzog, doch wenigstens in etwas entschädigen. Jochen Puttfarkens Zukunft war glänzend gesichert.
So, nun hinab in den Stall, in dem die eigenen Esel des Hotels standen, und sich den edelsten Grauschimmel ausgesucht.
Wer im Orient den Esel einmal kennen gelernt hat, will von Pferden gar nichts mehr wissen. Das heißt für den Zweck nicht, für den man den Esel eben verwendet, für die Reise, einfach als vierbeiniges Transportmittel. Sechzehn Stunden ununterbrochen Trab, ohne Fütterung, ohne Tränken, ohne jede Pflege — das gibt's ja bei einem Pferde gar nicht. Solch ein Reitesel kostet aber auch genau so viel wie ein gutes Reitpferd. Will man aber im Orient zu Pferde paradieren, so muss man ein Tier haben, das schier unerschwinglich ist, oder jeder Bettler lacht einen aus. Auf einem Pferde zu sitzen, das bei uns noch als schön und edel gilt — es wäre im Orient nichts anderes, als wolle man bei uns mit einem räudigen Hunde spazieren gehen. Der Orient ist mit Pferden so überaus verwöhnt.
Während das auserwählte Tier gefüttert und gesattelt wurde, begab sich Jochen wieder hinauf, um Brief und Paket zu holen. Da auf der Treppe wurde er wiederum von solch einer Schwäche angewandelt!
Etwa den Ritt deshalb aufgeben? Na, weiter hätte doch nichts gefehlt! So schnell ließ sich Jochen Puttfarken nicht werfen, da hätte es noch ganz anders kommen müssen. So lange er noch kriechen konnte, kroch er — und niemand hätte ihm davon etwas anmerken sollen.
Aber Vorsicht war natürlich am Platze
»Ich werde mir einen Schnaps mitnehmen.«
Also er holte sich aus seiner Stube erst noch ein Fläschchen. Wenn er dieses unterwegs in einer Destillation hätte füllen lassen, oder etwa gar hier zu Hotelpreisen — Jochen hätte sich geradezu lächerlich gemacht, so lange noch eigener Vorrat vorhanden war.
Der Prinz war nicht mehr in seinem Zimmer, vielleicht schon fort, dort aber stand noch die Rumbuttel, und Jochen wusste, was er durfte und was er nicht durfte.
Erst einen tüchtigen Schluck, der abermals sofort die Schwäche verschwinden ließ, dann füllte er sein Fläschchen voll, verkorkte es gut, steckte es ein, barg Brief und das ganz dünne Päckchen in der Innentasche der Weste, ging wieder hinab, ließ den Esel herausführen, schwang sich elegant in den Sattel und schmiegte seine Beine um den Leib, rund wie eine Bombe. Dass man alle halben Stunden einmal absteigen und den Sattelgurt nachziehen muss, das ist das einzige Unangenehme, das man mit solch einem Esel hat, der viel, viel lieber Hafer als Disteln frisst und sich seinen Wanst ganz unheimlich voll schlagen kann, ebenso mit Wasser, darin ähnelt er fast dem Kamel. er ist dann aber auch wieder, wenn es sein muss, so genügsam, begnügt sich mit der uralten Schilfmauer einer Hütte, frisst den Lehm gleich mit. Aber das gilt alles nur für den trockenen Orient, schon in Italien und Spanien ist jeder Esel nach einem halben Jahre ein ganz anderes Tier geworden.
Es ging die belebten Straßen entlang, schon die mächtige blaue Brille auf dem Schweinerüssel, die Hosen hochgerutscht, was damals aber, von Engländern eingeführt, beim Reiten modern war, weswegen eben Halbschuhe mit Seidenstrümpfen getragen wurden, sogar durchbrochene, und wenn man sich setzte, wurden die absichtlich bis an die Waden hochgezogen. »Wenn eine Prinzessin hinkt, hinkt jede Konfektioneus«, sang in den vierziger Jahren ein Gassenhauer, als das Hinken modern wurde, weil eine tonangebende Fürstentochter sich den Fuß verletzt hatte und hinkte. Damals soll Darwin seine zur Genüge bekannte Lehre von der Abstammung des Menschen aufgestellt haben.
Der Reitersmann sah wohl aller Blicke auf sich gerichtet, aber lachen sah er niemanden. Ehe das losging. da war er schon immer weit weg. Vorher waren sie alle viel zu starr vor Staunen gewesen.
Ein glücklicher Mensch! Und man hätte ihm auch direkt ins Gesicht lachen können, er hätte es niemals auf sich bezogen.
Über die Brücke hinweg, und nun auf schönen Landstraßen zwischen grünenden Feldern hindurch, die bald die dritte Jahresernte zu geben versprachen. Ohne Düngung, ohne Regen, ohne Pflügen! Die Düngung besorgt der im Oktober austretende Nil, der aus den Gebirgen des Sudans einen grünen Schlamm mitbringt, der sich während fünf Monaten absetzt, von kolossaler Fruchtbarkeit. Dann im März braucht der noch feuchte Boden für den Samen nur angeritzt zu werden, und so immer wieder für jede neue Saat. Freilich künstliche Bewässerung. Überall kreuz und quer kleine Kanälchen, in welche aus dem Nil und aus größeren Kanälen das Wasser gepumpt wird. Und dann in der Nacht reichlicher Taufall, und dass dieser so eiskalt ist, dürfte ebenfalls von großer Bedeutung sein. Dadurch ruht die treibende Kraft während der Nacht, die Pflanze verschließt sich gegen die Kälte, um nun am Tage unter den heißen Sonnenstrahlen nur umso intensiver zu arbeiten. Nach zwei Monaten schon liefert das gesteckte Weizenkorn seine hundertfältige Frucht ab, vom Felde weg bekommt man für einen Groschen sechs und noch mehr große Gurken. Eine große Melone für nur eine kleine Kupfermünze. Aber ohne Erlaubnis darf man nichts nehmen, nicht wie bei uns eine Feldblume abpflücken, das wird übel genommen, und das natürlich auch ganz mit Recht. Deshalb eben sind auch bei den Fellahs, den Bauern, die Fremden so verhasst, weil die ganz einfach auf die Felder gehen und abpflücken, dann nicht einmal ein Bakschisch geben, weil sie denken, so eine Unkrautblume ist ja nichts wert, sie kennen es von zu Hause nicht anders. Ein armer Teufel aber braucht nur zu bitten, oder, wenn er nicht Arabisch kann, nur den Finger in den Mund zu stecken, zu schmatzen und darauf zu deuten, was er gern haben möchte, er bekommt sofort alles geschenkt, die schönste Melone wird für ihn gebrochen.
Es war ganz einsam. Ab und zu an einem größeren Kanal ein Schöpfwerk, genau noch so eingerichtet wie vor Tausenden von Jahren. Ein Ochse dreht einen Göpel, der setzt durch Holzzähne ein vertikales, großes Rad in Bewegung, das etwas ins Wasser taucht, an ihm sind Tongefäße gebunden, die schöpfen das Wasser heraus und gießen es in den kleinen Kanal, aus dem es sich in Rinnen über das ganze Feld verteilt. Daneben kauert ein Junge oder Mann und sucht sich Läuse ab.
Bei kleineren Kanälen wird das Wasser auch mit einer langen Hebelstange herausgepumpt, aber immer taucht nur ein einfacher Krug hinein und kippt oben um.
Und wenn solch ein Arbeiter seine Mahlzeit hält, immer nur aus Ehsche, das ist ungesäuertes Brot aus Durrha, Hirsemehl, als dünne Fladen zwischen heißen Steinen gebacken, hartem, weißem Quarkkäse und Zwiebeln bestehend, und ein Fremder geht vorüber, der nicht danach angezogen ist, dass der Fellah glaubt, er könne eine ihn kränkende Absage bekommen, dann winkt er eifrigst, der Fremde soll mit ihm das Mahl teilen, und dann fragt er, ob man Tabak hat, aber er will ihn nicht geschenkt haben, sondern er tauscht seinen eigenen dagegen aus, immer nur ein Zigarettchen oder ein Pfeifchen, und dann fragt er oder drückt durch Zeichen aus, ob man schreiben kann und Papier und Bleistift bei sich hat, dann muss man seinen Namen auf ein Stückchen Papier schreiben, das rollt er zusammen, niemals wird es gefaltet, und wickelt es in seinen Turban, das ist das sichtbare Zeichen, dass Allah seine Gastfreundschaft belohnen wird, es ist sein Talisman, der ihm besonders zahlreiche Kinder sichert. Und am Abend nimmt er den fremden Wandersmann mit in sein Dorf, dort wird ihm besser aufgetischt, er muss erzählen, und dann marschieren die irdischen Huris auf, unter denen er wählen darf oder vielmehr muss, aber ohne vorher den Schleier lüften zu dürfen. Es wäre die schwerste Beleidigung, da eine Absage zu geben. Und am anderen Morgen sitzt der fremde Wandersmann am Wegesrande und sucht sich gleichfalls die Läuse ab.
Ein herrliches Leben in diesem Lande, wo noch heute Milch und Honig fließt. Nur die ägyptischen Fleischtöpfe sucht der Wandersmann vergebens.
Jochen Puttfarken kam nicht in die Lage, steinhartes Hirsebrot und Zwiebeln kauen zu müssen.
Die Hüter an den Schöpfrädern und ab und zu ein ihm entgegenkommender Fellah, sie sperrten Maul und Nase auf bei dem Anblick dieses Reitersmannes.
»Ja, da staunst De wohl, wat? Ja, solch einen schönen, patenten, schneidigen Kerl gibt's aber auch nicht zum zweiten Male auf der Welt.«
Er fing an zu transpirieren. Ehe er sein Tüchlein benutzte, zog er einmal seinen Taschenspiegel.
Und da erstarrte auch Jochen und sperrte sein Maul auf. Was war denn das?!

Als Jochen Puttfarken in seinen Taschenspiegel
blickte, erstarrte er und riss entsetzt den Mund auf.
Sein sonst so gesundes, gebräuntes Gesicht plötzlich ganz weiß!
Aber noch viel mehr als weiß, die Haut so durchscheinend, als wäre sie von Glas, und das darunter liegende Fleisch ebenfalls!
Schon konnte er die inneren Adern erkennen!
»Allmächtiger Gott, ich habe den Aussatz! Ich habe die Trage mit dem Aussätzigen gesehen, ich bin erschrocken, habe mich gefürchtet, nun bin ich wahrscheinlich noch mit einem Aussätzigen direkt in Berührung gekommen — ich habe den Aussatz!«
Nur im Gesicht?
Er zog seinen linken Handschuh aus.
Ach, Du großer Schreck, da waren schon die Knochen zu sehen!
Sonst war die Hand überhaupt schon weg, zwei Finger fehlten bereits gänzlich, obgleich sie noch mit vollem Fleisch zu fühlen waren.
Wie das möglich war, darüber grübelte der arme Jochen jetzt nicht nach.
»Das ist der Aussatz! Es setzt eben alles aus — daher der Name Aussatz. Nun lebe wohl, Du schöne Welt — ich habe den Aussatz — ich setze aus.«
Dort hinten kam ihm ein Mann entgegen. Der brauchte nicht zu sehen, dass Jochen den Aussatz hatte.
Sonst erschrak er, fürchtete sich, und dann hatte er gleichfalls den Aussatz.
Das wollte Jochen nicht, dazu war er ein viel zu guter Kerl.
Rechterhand war ein Dattelpalmenwäldchen, an einem Kanal zog sich auch Buschwerk hin.
Jochen schlug sich mit seinem Esel rechts zwischen die Büsche.
Chijam heißt der Flecken, der sieben Kilometer nordwestlich von Kairo im Niltale liegt. Hier hat früher einmal eine Pulvermühle gestanden, um sie herum waren die Arbeiter angesiedelt.
Sie wurde aufgegeben, damit hörte auch die ganze Ansiedlung auf, neue Dörfer entstehen im Niltale nicht, weil in jedem immer genau so viele Fellahs wohnen, wie zum Bebauen der umliegenden Felder nötig sind, die anderen müssen außerhalb auf Arbeit gehen.
Das nun einmal vorhandene Baugelände, übrigens immer so hoch gelegen — ganz natürlich — dass es vor der winterlichen Überschwemmung geschützt, daher auch immer sandig ist, wurde von einer religiösen Sekte angekauft, einer christlichen, die sich häuslich und behaglich einrichtete.
Der Prinz hatte nur einige Andeutungen gemacht, wir müssen die Sache noch etwas weiter ausführen.
Es waren Amerikaner und Engländer, ehemals Quäker, die ja an sich schon in schier zahllose Untersekten gespalten sind, und die hier hatten wieder eine neue gegründet.
Sie selbst nennen sich »Kämpfer Christi« oder »christliche Kämpfer« — christian fighters — vom Volke werden sie »devil's fighters« genannt, Teufelsfechter.
Sie haben nämlich die negative oder defensive Kampfesweise angenommen, um den Himmel zu erobern.
An Gott und Christus glauben sie natürlich — na und wie! — aber der Fürst dieser Welt ist doch nun einmal der Teufel, der einem egal Knüppel zwischen die Beine wirft, der muss vor allen Dingen bekämpft werden.
Und so balgen sich die guten Leutchen von früh bis spät und auch noch in der Nacht mit dem Teufel herum.
Überall wittern sie den Teufel, alles ist Teufel, Teufel, Teufel!
Wenn jemand niest, so sagen sie nicht »Gott helf«, sondern »der Teufel verschone Dich«. Über ihren Türen steht nicht »Gott segne Deinen Eintritt«, sondern »der Teufel bleibe draußen«. Wenn sie einen Schluck Tee nehmen, so muss aus der Tasse erst der Teufel vertrieben werden, obgleich er schon vorher aus der Teekanne gebannt worden ist. Wenn sie einen Strumpf anziehen, muss er erst unter gewissen Formeln zusammengedrückt durch die Hand gezogen werden, weil der Teufel drin sitzen könnte und auch ganz gewiss drin sitzt. Denn er liebt alles Hohle. Also alle Eierschalen ja recht sorgfältig zerdrücken! Sie essen keinen Schweizer Käse weil sich in den Löchern der Teufel so gut verstecken kann. Und gerade das mit dem Schweizer Käse ist nicht etwa hier erfunden, sondern das ist Tatsache!
Es sind ungefähr zwanzig Familien mit 100 Köpfen, die sich in der Pulvermühle das Leben so sauer wie möglich machen. Dabei sind sie hoch angesehen, denn erstens sind sie durch Legat eines schwerreichen Teufelsfechters frei von allen pekuniären Sorgen, sie machten auch nichts anderes, als mit dem Teufel im Kampfe zu liegen, und zweitens tun sie sehr viel Gutes. Allerdings muss man persönlich zu ihnen kommen. Niemand klopft vergeblich an das Tor der hohen Mauer, welche das ganze Häuserareal umgibt, mit vielen Gärten. Vor dem geschäftlichen Bankrott retten sie freilich nicht. Aber sonst wird jeder gastfreundlich aufgenommen, er erhält Zehr- und Reisegeld, wird gekleidet, Kranke erhalten Anweisungen für gute Freibetten in den Hospitälern der Hauptstadt.
Zum zweiten Male freilich klopft ohne zwingendste Gründe nicht so leicht jemand an. Man wird da drin vom Teufel gar zu sehr gezwiebelt. Man muss sich an dem Teufelskampfe mindestens vierundzwanzig Stunden beteiligen, und dann ist man fertig. Weil man solche Kriegsstrapazen nicht gewohnt ist. Und wenn man ganz und gar vom Unglück verfolgt wird, dann kommt man gerade, wenn eine ihrer Wochenschlachten beginnt. Da muss man eine ganze Woche lang mitmachen! Sie lassen einen nicht wieder hinaus. Da muss man heimlich über die Mauer klettern — — —
Die Nachmittagssonne stand noch immer ziemlich hoch am Himmel, als an dem Haupttore dieser Mauer ein Reiter hoch zu Esel hielt.
Erst zog er die Glocke, dann stieg er ab, sein Tier am Zügel haltend. Nicht lange, so wurde die eine Hälfte des Tores geöffnet, ein graugelockter Mann, aber vor Gesundheit wie ein Pfirsich blühend, im braunen Schößenrock, der bis auf den Boden reichte, tauchte auf.
Verwundert oder sogar erschrocken starrte er den Fremdling an.
Und dazu hatte er auch allen Grund.
Es war Jochen Puttfarken.
Sein Äußeres ganz noch so, wie wir es beschrieben haben.
Nur in einer Hinsicht nicht.
Er hatte kein Gesicht mehr — das heißt, es war davon nichts zu sehen.
Jochen hatte sich mit Hilfe von drei Taschentüchern und dem unteren Teile seines Oberhemdes sehr geschickt einen Verband um den ganzen Kopf gemacht. Nur dort, wo sich der Mund befand, hatte er ein kleines Löchelchen gelassen. Allerdings auch für die Augen, aber diese Löcher sah man nicht, weil er auch noch über den dicken Verband seine blaue Brille trug, die Bügel hinten mit Bindfaden zusammengebunden. Und da auch sein Panamahut auf dem verdickten Kopfe keinen Halt mehr fand, hatte er auch diesen mit einem Stricke festgebunden. Schließlich auch noch unter dem Vatermörder einen Verband um den Hals.

Nun stelle man sich dieses Bild vor!
Dieser elegante Säbelbeinmann in der stutzerhaften Toilette, unten mit den bunten, durchbrochenen Seidenstrümpfen, und oben der eingepackte Kürbiskopf mit dem festgebundenen Strohhut, und nun vor dem eingewickelten Gesicht die mächtige blaue Brille, darunter als Mund ein winziges Löchelchen!
Da war es begreiflich, dass der Pförtner staunte und starrte und sich vielleicht auch fürchtete.
»Bist Du der Teufel?!«
»Nee, ick hab mir nur verbrannt.«
Jochen sprach Englisch, das aber auch seine platten Dialekte hat, auch ein besonderes Schiffsplatt.
Aber der Pförtner hatte gar nicht wegen dieses Verbandes gleich an den Teufel gedacht, er erfüllte nur seine Pflicht mit dieser Frage.
»Ob Du der Teufel bist, will ich wissen!«
Und nun verstand auch Jochen sofort, nicht umsonst war gerade er vom Prinzen für diese Mission auserwählt worden.
»Icke? Der Deiwel? Nee, ick bin enn gauter Christ.«
»Sprich nach: Ich glaube an Gott den Vater ...«
»Ick gläuw an Gott dn Vaddr ...«
Und Jochen sprach weiter nach, was ihm vorgesagt wurde, er glaubte an alles, was man von ihm verlangte.
»Sage nach: Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen, dass ich nicht der Teufel bin.«
Jochen sprach es nach. Es kam dumpf und etwas undeutlich aus dem kleinen Löchelchen heraus, mit der berühmten Grabesstimme, aber zu verstehen war es doch noch.
»Sprich: Wenn ich jetzt ein Kreuz gegen meine Brust schlage, und ich bin der Teufel, so werde ich in Dunst zerfließen und einen fürchterlichen Gestank hinterlassen.«
Jochen sprach es.
»Nun schlage das Kreuz.«
»Nun schlage das Kreuz!«, wiederholte Jochen gehorsam.
»Nein, das sollst Du selbst tun!«
»Ach so, kann ick ooch taun.«
Und Jochen streckte seine ungeheure, rote Pfote und schlug andachtsvoll gegen seine Heldenbrust ein kräftiges Kreuz, löste sich dabei nicht in Dunst auf, machte auch keinen fürchterlichen Gestank.
»Was fehlt Dir denn, mein lieber Bruder?«, hieß es jetzt nach dieser bestandenen Teufelsprobe in ganz anderem Tone.
»Ick hab mi das Gesicht mit heißem Fett verbrannt.«
»Ooooo! Und da willst Du Aufnahme haben in einem Hospital?«
»Nee, ick kurier mir alleen. Einen scheunen Gruß von dem Prinzen Joachim soll ick sagen, und den Mister Harry Poulsen möcht ick sprechen.«
Der Name des Prinzen brachte schon bei diesem Pförtner eine große Wirkung hervor.
»Ah, von dem Prinzen Joachim kommst Du, lieber Bruder?!«
»Wie ick sag.«
»Du kennst ihn?«
»Ick bin sien Kock.«
»Er ist in Kairo?«
»Einen scheunen Gruß vom Prinzen Joachim soll ick sagen, und den Mister Harry Poulsen möcht ick sprechen, wenn er noch lebt und hier ist.«
Der Pförtner merkte, wen er vor sich hatte, dass es da nicht viel Plaudern gab.
»Warte einen Augenblick.«
Vorläufig wurde das Tor wieder geschlossen, doch wenn nicht nur einen Augenblick, so brauchte Jochen nur eine Minute zu warten, und das Tor öffnete sich wieder.
Jetzt stand da außer dem Pförtner noch ein jüngerer Mann, ebenfalls im braunen Schößenrock, auch schon mittleren Alters. Er roch stark nach Chlor und anderen Chemikalien aller Art.
Es war übrigens hoch anzuerkennen, dass diese Teufelsfechter einen Mann unter sich duldeten, der in Schmelztiegeln und Retorten braute und kochte. Die alten Alchemisten sind doch immer mit dem Teufel verbunden gewesen. So sind diese Leutchen hier also durchaus nicht, sie haben allen Respekt vor den modernen Wissenschaften.
»Kann ich Dir helfen, mein armer Bruder?«, war seine erste mitleidsvolle Frage, als er das verbundene Gesicht sah. »Ich verstehe etwas von ärztlicher Kunst.«
»Nee, dat heelt von ganz alleen.«
»Du hast Dich mit Fett verbrannt?«
»Jau.«
»Ist es sehr schlimm?«
»Nee, nur enne neie Pelle kräg is, es sieht nich scheun ut.«
»Bist Du in ärztlicher Behandlung?«
»Jau.«
»Und Du darfst schon solche weite Ritte machen?«
»Ja, ick soll mien neue Pelle spazieren führen.
»Auch die Augen sind verletzt worden?«
»Nee, aber schonen muss ick see.«
»Gut. Was bringst Du mir von meinem lieben Bruder Joachim?«
Jochen gab Brief und Paketchen ab, beides wurde mit starkem Misstrauen genommen, dabei ein fragender Blick nach dem Pförtner.
»Er hat die Teufelsprobe bestanden, er kann auch keinen Teufel bei sich getragen haben!«, beruhigte dieser.
Also auch dieser Chemiker, ein Naturwissenschaftler, war ganz vom Teufelsglauben besessen. Etwas, was man gerade unter den größten englischen und amerikanischen Gelehrten findet, dass sie an Übersinnliches glauben. Auch Edison ist ein ausgesprochener Spiritist.
Jetzt wurde der Brief ohne weiteres Misstrauen erbrochen und gelesen.
»Ja. Ich werde sofort an die Analyse gehen. Wie lange das dauert, kann ich nicht sagen, weiß ja gar nicht, was in dem Paket ist. Kannst Du bis morgen um diese Zeit warten, mein lieber Bruder?«
»Auch noch länger.«
»So komm herein, mein Bruder, und lass den Esel draußen.«
Mit Jochen Puttfarken hatte das nichts weiter auf sich — vorläufig — der war als teufelsrein befunden worden, aber das galt nicht von dem Esel.
Dem musste der Teufel erst noch exkommuniziert werden, noch hier draußen, das geschah unter allerhand Zeremonien, wozu noch zwei andere Männer in braunen Schoßröcken kamen, der Esel wurde auch gleich getauft, wenigstens bekam er einen Eimer Wasser über den Kopf gegossen, natürlich kein gewöhnliches Wasser, was sich der Grauschimmel sehr wohl gefallen ließ, dann durfte auch er eintreten, wurde in den Stall geführt und bekam sofort eine tüchtige Portion Hafer vorgeschüttet, geschrotenen, vollständig zerquetscht, schon mehr Grütze, so dass es ganz unmöglich war, dass sich ein Teufelchen noch in einem Haferkorn hätte verstecken können, es wäre mit zerquetscht worden —
Hierzu noch eine kleine Bemerkung:
Es wird viele geben, besonders sogenannte Gebildete und Aufgeklärte, die über diese Teufelsfechter lächeln, spotten werden.
Diese Herren Gebildeten und Aufgeklärten mögen sich nur an der eigenen Nase zupfen.
Diese Leutchen hier kämpfen mit den Teufeln — jene balgen sich heute ständig mit Bazillen herum!
Und das ist nämlich gehupft wie gesprungen.
Dieser vierbeinige Esel hier bekam wegen der Teufel zerquetschten Hafer zu fressen — die zweibeinigen sterilisieren die Milch und kochen das Trinkwasser.
Die einen machen sich das Leben so sauer wie die anderen.
Heute ist in London bereits ein Haus zu sehen, das hermetisch verschlossen ist, die zum Atmen nötige Luft wird eingepumpt, muss erst die verschiedensten Vorrichtungen passieren, in denen die Bakterien und Bazillen getötet werden.
Wenn das so weiter geht, das kann ja noch nett werden. Wenn erst die Suppe mit Chlorkalk gekocht wird.
Aber es gibt noch viele Menschen, die da nicht mitmachen.
Ein geistig vollkommen gesunder Mensch wird an Bazillen glauben, er kann auch, wenn er nun einmal zur Überzeugung davon gekommen ist, an Geister und Dämonen glauben — Kant, Schopenhauer, Goethe, waren das etwa nicht geistig gesunde Menschen? Nun, die waren von dem Größenwahnsinn frei, dass es über und neben uns Menschlein nicht noch höhere Wesen gebe — aber wird sich vor Geistern so wenig fürchten wie vor Bazillen.
Das ist die Sache!
Und genug hiervon. —
Zwischen den niedlichen Häuschen und den gepflegten Gärtchen promenierten und spielten Männer und Frauen und Kinder, alle in Schoßröcken mit Pumphosen und Kniestrümpfen respektive in korsettlosen Kitteln.
Sie gingen auf den Fremden nicht direkt zu, wer ihm begegnete oder an wem er vorüberkam, der gab ihm die Hand.
»Guten Tag, mein lieber Bruder, der Teufel verschone Dich«, sagte auch der kleinste Hemdenmatz zu ihm.
Sonst aber kümmerte sich niemand um ihn, er wurde nicht wegen seiner Brandwunden befragt, man blickte nicht nach seinem verbundenen Gesicht.
Der Pförtner hatte wohl schon berichtet, es war bekannt geworden, was es damit für eine Bewandtnis hatte, und damit genug.
Diese Leutchen, die kaum hinter ihrer Mauer hervor kommen, wollen mit nichts Weltlichem zu tun haben, das überlassen sie alles dem lieben Gott, sie selbst treiben nur den Teufel aus, wo sie können, aber Gesundbeter sind sie nicht, sie sind auch keine Quietisten, lassen bei Krankheit einen Arzt kommen, wenn sie keinen unter sich haben.
Noch immer führte der Pförtner, sie betraten ein niedriges, langgestrecktes Gebäude, das kein Wohnhaus sein konnte. Die Karawanserei, wollen wir sagen.
»Hast Du Hunger und Durst, mein lieber Bruder?«
»Vorläufig noch nicht.«
»Nun musst Du erst ein Bad nehmen.«
»Ick hab mir erst heut früh gebadet.«
»Aber Du musst auch hier noch ein Bad nehmen.«
»Wozu denn?«
»Der Teufel muss Dir erst abgewaschen werden.«
»Ick habe doch bewiesen, dass ick keen Deuwel bin, hab weder gedunstet noch gestunken.«
»Ja, aber Du musst erst ein Bad nehmen, damit die Teufelsatmosphäre von Dir abgewaschen wird, es geht nicht anders.«
Na gut, wenn's nicht anders ging, dann war Jochen damit einverstanden.
Nur über eines musste er sich erst noch orientieren, ehe er seine Zusage gab.
»Ick werde doch nicht etwa von jemandem anders abgewaschen?«
»O nein, das machst Du selbst.«
»Et kiekt mir ook niemand tau?«
»O nein, das gibt's bei uns nicht.«
»Denn will ick mir baden.«
»Kannst Du denn auch den Verband abnehmen?«
»Nee, dat kann ick nich, dat geht nich!«, wollte Jochen schon wieder auf das Bad verzichten.
Aber er wurde schnell beruhigt.
»Na, das ist auch nicht nötig, dann gehst Du nur bis zum Hals ins Wasser. Aus Deinem Kopfe treiben wir dann den Teufel in anderer Weise aus.«
Sie betraten ein Badezimmer, höchst komfortabel eingerichtet, in die emaillierte Wanne ließ schon ein Bademeister heißes Wasser ein.
»Hier in dieses Nebenkabinett legst Du Deine Sachen, schließt die Tür, und wenn Du in einer viertel bis halben Stunde fertig bist, holst Du Dir Deine Sachen wieder. Aber auch alles musst Du da hineinlegen!«
»Wozu denn das?«
»Deine Sachen müssen ausgebrannt werden.«
»Ausgebrannt? Ick häw keen Lüs.«
»Aber der Teufel kann drinstecken.«
»Und denn is das Gelumpe ganz verbrannt, wie's mir in Wien mal gegangen ist, wo ich mir mal ausbrennen ließ, weil ick mit slowakischen Auswanderern in einem Kupee zusammengefahren bin.«
»O nein, die Sachen werden nur mit heißem Bügeleisen ausgeplättet, das schadet ihnen nichts, sie werden sogar wie neu. Aber auch alles, was Du in den Taschen hast, musst Du hinlegen.«
»De Glock ook, die Uhr?«
»Jawohl, Deine Uhr auch. Da kann leicht der Teufel drinstecken.«
»Die Uhr wird ook utplättet? Mit dem heißen Bügeleisen?«
»Nein, die kommt in einen heißen Raum.«
»Dat mag für'n Deuwel sehr gesund sein, aber nich für ne goldne Uhr. Die geht dabei gliekfalls zum Deiwel.«
»O nein, das ist alles danach eingerichtet, wir räuchern unsere Uhren die Woche zweimal aus, es schadet durchaus nichts, und einige Brüder haben gar vortreffliche Chronometer.«
»Na, da meinetwegen. Auch die Brieftasche?«
»Alles. Aber Du brauchst keine Sorge zu haben, wir lesen keinen Brief.«
»Und hier der Revolver, die Schachtel Patronen?«
»Muss alles ausgeräuchert werden, wie leicht kann in solch einer Patrone ein Teufel stecken.«
»Na, da wünsche ich vergnügte Explosion.«
Die Badewanne war vollgelaufen, alles bereit, Pförtner und Bademeister verließen den Raum.
Jochen schloss und riegelte innen die Haupttür ab, blickte sich in dem Zimmer um.
Nirgends ein Guckloch, in der Tür kein Fenster, das lichtspendende an der Wand aus Milchglas. Auch die nach dem Nebenkabinett führende Tür konnte verschlossen und verriegelt werden.
Jochen war zufrieden.
Wenn dieser arme Mann noch über irgend etwas zufrieden sein konnte.
Er begann sich zu entkleiden.
Zuerst zog er den linken Glacéhandschuh aus.
Ach, ach, ach, ach!
Da war keine Hand mehr zu sehen. Zu fühlen war sie noch mit voller Deutlichkeit, zu sehen absolut nichts mehr. Nichts vom Fingernagel und gar nichts.
An der weißen Wand saß eine Fliege.
Jochen hielt in einiger Entfernung seine Hand davor, so betrachtete er die Fliege.
»Ick gläuw, mien Hand vergrößert etwat. Nee, de Flieg is in natürlicher Größ. O, o, so'n verflixte Krankheit!«
Er zog auch den rechten Handschuh aus.
»Ja, der Aussatz ist tatsächlich enne epidemische Krankheit, die rechte Hand is ook futsch.«
Er nahm die Brille ab, begann die Bandagen abzuwickeln.
An der Wand hing ein großer Spiegel, in dem man sich in voller Lebensgröße bewundern konnte.
Jochen konnte es nicht.
»O Jochen, o Jochen, wo is Dien Kopp, wo is Dien Näs?«, erklang es kläglich.
Ja, da gab es keinen Kopf mehr.
Unten war noch alles, rote Schuhe, braun und schwarz gestreifte Säbelhose, weiße Weste mit roten Blümchen, gelbes Jackett, grüner Schlips mit goldenen Tüpfchen, hoher Stehkragen — aber mit diesem Stehkragen hörte Jochen oben auf!
Jochen schüttelte den Kopf, machte den Mund auf, steckte die Zunge heraus.
Der Stehkragen wackelte im Spiegel etwas mit — nichts weiter. Der Kopf im Spiegel konnte nicht mitwackeln, weil keiner vorhanden war.
»O, o, o! Schon geköpft und noch lebend!«
Er öffnete vorn sein Oberhemd.
O jeh, o jeh!
Was er da erblickte!
Nämlich gar nichts.
Er blickte in eine leere Höhle hinein.
Und er hatte gehofft, dass der Aussatz nur auf diejenigen Extremitäten beschränkt geblieben wäre, die man für gewöhnlich unbekleidet trägt, also Kopf und Hände. Es war so eine Idee gewesen, eine Hoffnung, an die er sich verzweifelt geklammert hatte.
»Aal Aussatz, aal setzt ut.«
Er entkleidete sich vollends, besah sich im Spiegel. Wollte es wenigstens tun.
Ach, da war kein Jochen Puttfarken mehr im Spiegel zu sehen!
»Und da kann man nun dabei alt werden wie Methusalem. Na da, na da!«
Er trug die Sachen ins Nebenkabinett, legte alles hin, auch die Handschuhe, an deren Bedeutung er nicht gleich dachte, behielt nur die Kopfbandagen und die Brille im Badezimmer.
Das hatte er sehr schnell und vorsichtig gemacht, da ja das Nebenkabinett von draußen betreten werden konnte.
Dann schloss er auch diese Nebentür ab und zog, wie ihm noch gesagt worden war, die Klingelschnur, zum Zeichen, dass nun das Kabinett wegen seiner Sachen betreten werden konnte.
»Hm. Luft bin ich noch nicht. Das Wasser wird noch zur Seite geschoben. Ich dachte, ich könnte mich nur noch selbst fühlen. Merkwürdig, merkwürdig. Nee, so'n Aussatz! Da setzen alle Naturgesetze aus. Ob'ch wohl ook flägen kann?«
Ehe er probierte, ob er auch fliegen konnte, setzte er sich ins Wasser.
Er fing an zu grübeln.
Seinen Auftrag hatte er ausführen müssen, wenn ihm auch schon die Beine abgefault wären, ein Jochen Puttfarken hätte auch im Himmel keine Ruhe gehabt.
Was aber nun weiter?
Sollte er zum Prinzen, zu seinen Kameraden zurück?
Wenn die aber nun merkten, wie die Sache stand, wenn sie erschraken, und sie bekamen alle den Aussatz, verschwanden bei lebendigem Leibe aus der Welt?
Durfte er ihnen das antun?
Was sollte er machen?
Wir lassen Jochen mit seinen grübelnden, traurigen Gedanken in der Badewanne allein —
Drüben waren die Kleider und Sachen abgeholt worden, sie kamen in einen anderen Raum, wo ihnen der Teufel ausgetrieben wurde.
Wie das geschah, wollen wir nicht weiter schildern. Der Schößenrockmann, dessen spezielle Obliegenheit das war, verstand jedenfalls seine Sache.
Da kam aus einer Tasche auch das Fläschchen mit Rum zum Vorschein.
Der Teufelsaustreiber entkorkte es, roch hinein.
Ach du großer Schreck!
Branntwein!
Schnaps gibt es in dieser frommen Pulvermühle nun natürlich nicht!
Das ist doch der persönliche Teufel selbst in flüssiger Gestalt.
Der Schößenrockmann erschrak ob dieses ihm bekannten Geruches wirklich dermaßen, dass er die Flasche gleich zum Fenster hinausfeuerte.
Dann besann er sich, das ging nicht so.
Die Flasche wurde gesucht.
Aber nicht gleich gefunden, nicht ihre Scherben.
Dass sie gerade in das Wassergefäß gefallen sein konnte, das dort soeben aufgefüllt worden war, daran dachte niemand, dieses Gefäß stand so ganz anders, als man nach der Ballistik die Flugbahn der Schnapsflasche berechnen konnte.
Als sie dann doch noch gefunden wurde, da war es zu spät, da hatte der Inhalt der entkorkten Flasche schon das Unheil angerichtet.
Auf dem Hofe trieben sich ziemlich viele Tiere herum, Hunde und Katzen und andere, für diese war der große Trinknapf mit frischem Wasser hingestellt worden.
Zuerst kam eine zahme Elster geflogen, trank und wollte baden.
Sie wurde von einem Hunde verscheucht, der seinen Durst löschte.
Dann kam ein Kätzchen und tat desgleichen.
Das Gefäß war groß und ganz voll Wasser, und das Fläschchen war nur klein. Jochen hatte unterwegs noch zweimal einen Schluck genommen, und, am Boden liegend, vermischte sich sein Inhalt doch nicht sofort mit dem Wasser.
Die Tiere schienen von dem Rumgeschmack nichts zu merken.
Dann kam auch ein Äffchen, um das Gefäß dort zu untersuchen.
Man sieht Affen eigentlich selten trinken. Wenn sie saftiges Obst haben, brauchen sie gar kein Wasser.
Aber dieses Äffchen witterte den Spiritus, nun soff es mit Gier.
Alle Affen berauschen sich gern an Schnaps, und das braucht ihnen nicht so wie den Studentenhunden beigebracht zu werden. Daher eben ihre Menschenähnlichkeit.
Es kamen auch noch andere durstige Tiere herbei. —
An der Nebentür des Badezimmers klopfte es.
»Deine Sachen sind teufelsrein, mein lieber Bruder, Du kannst sie wieder holen und anziehen, wenn Du fertig bist.«
»All right!«
Mit seinem Entschlusse, wie er die Sache weiter arrangieren sollte, war Jochen noch nicht fertig, hatte sich aber unterdessen abgeseift.
Er entstieg der Wanne, hüllte seinen unsichtbaren Leib ins Badetuch, trocknete sich ab.
»Ist noch jemand drüben?«
Keine Antwort.
Ehe er den wirklichen Eintritt wagte, steckte er vorsichtig den Kopf durch die Türspalte.
Er hätte gar nicht so vorsichtig zu sein brauchen, sein Kopf war ja gar nicht zu sehen.
Er holte seine Sachen, begann sich anzuziehen. Die Flasche vermisste er noch nicht.
Alles war noch ganz warm, auch die Uhr und die Schachtel mit den Revolverpatronen.
»Ach, wie schön ist's doch, wenn man sich so nach und nach wieder sieht!«, seufzte Jochen, auf dem Stuhle sitzend, seinen linken, bestrumpften Fuß betrachtend, während sein rechtes Hosenbein noch sozusagen blind endete.
»Sogar mein Hühnerauge hat den Aussatz bekommen — einfach futsch. Schade nur, dass ich's noch so deutlich fühle.«
Als er so weit war, begann er seine Haare zu kämmen und zu bürsten, brauchte dazu nicht erst in den Spiegel zu blicken, in dem sah er nur Kamm und Bürste in der Luft herumschwabbeln.
»Nee, so'n Aussatz! Sogar die Haare sind angesteckt worden! Und was nützt es mir denn nun, dass ich ein Dutzend Flaschen Haarwuchsbalsam verbraucht habe, die Flasche zu zwei Dollars? Und wenn der Schnurrbart nun endlich doch noch kommt — was nützt mir der Schnurrbart, wenn ihn niemand sieht?«
Traurig vollendete Jochen seine Toilette.
Das letzte war, dass er wieder seinen ganzen Kopf mit Bandagen umwickelte, am sorgfältigsten den Schweinerüssel, nur für den Mund ein kleines Löchelchen lassend, wozu großes Geschick gehörte.
Zumal wenn man es vor dem Spiegel macht und in diesem seine Hände nicht erblickt.
»Wo sind meine Handschen?«
Die Glacéhandschuhe waren nicht zu finden.
Als Jochen überzeugt war, dass sie fehlten, zog er die Klingel, bald meldete sich jemand an der Tür.
»Was willst Du, mein lieber Bruder? Bist Du fertig?«
»Nee, ich finde meine Handschuhe nicht.«
»Ja, mein lieber Bruder, die haben wir verbrennen müssen.«
»Warum denn?«
»In dem rechten saß ein Teufel, und da haben wir auch gleich den anderen verbrannt.«
»Was für ein Teufel?«
»Einer aus der vierten Hölle, er nannte sich Malefixius.«
Jochen fragte nicht, wie die das herausgebracht hatten.
»Ich muss Handschuhe haben.«
»Wofür denn nur?«
»Für meine Hände.«
»Weshalb denn Handschuhe?'
»Ich habe mir auch meine Hände mit heißem Fett verbrannt.«
»Ach so, auch die Hände!«
»Na und wie.«
»Aber Du hast sie doch ausgezogen.«
»Kann ich, aber die verbrannten Hände sehen schrecklich aus, da geniere ich mich.«
»Ja, mein lieber Bruder, wir haben hier keine Handschuhe —«
Schon war Jochen im Geiste bereit, sich selbst aus dem Oberhemd, soweit er nicht schon den unteren Teil für Bandagen benutzt hatte, handschuhähnliche Futterale zu fertigen.
»Halt, wir haben doch welche, für den Winter, aber es sind Fausthandschuhe. Bei den anderen verkriechen sich die Teufel so leicht in den Fingern, wie auch bei den Deinen zu sehen war.«
»Meinetwegen können es Fausthandschuhe sein. Nur etwas große, wenn ich bitten darf, sie müssen ganz lose sitzen, sonst scheuern sie die neue Haut.«
Dass er so große Pfoten hatte, das brauchten die doch nicht zu wissen. Und wenn sie sich schon über seine großen roten Glacéhandschuhe gewundert hatten — nun, da hatte er eben noch einen dicken Verband drunter.
Sonst war Jochen Puttfarken mit seinen Händen gar nicht so penibel, nur gerade jetzt, wo er sich Handschuhe leihen musste.
»Warte, ich hole ein Paar.«
Es dauerte nicht lange, so wurde wieder geklopft.
»Hier sind die Handschuhe.«
»Lege sie nur hin, ich hole sie mir dann.«
»Mache doch die Tür auf.«
»Nee, lege sie nur hin.«
»Bist Du denn noch nicht anzogen?«
»Nnnnein. Ich fange das Anziehen immer mit den Handschuhen an. Das heißt, seitdem ich mich verbrannt habe — sonst nicht. Ich muss noch die Hände schonen.«
»Höre mal, lieber Bruder, Du leidest doch nicht etwa an einer Hautkrankheit?«
Ach du großer Schreck!
Und wenn die jetzt erschraken, da bekamen die alle den Aussatz!
Und Jochen war ein Gewissensmensch.
»Nein, o nein, ick hab mir nur mit Fett verbrannt!«
»Natürlich, sonst hätte Prinz Joachim Dich doch nicht geschickt. Ich lege die Handschuhe hierher, lieber Bruder.«
Jochen hörte, wie sich der Mann wieder aus dem Kabinett entfernte, öffnete die Tür, lugte vorsichtig durch die Spalte, zur Vorsicht auch noch die Hände in den Hosentaschen — nein, in dem Kabinett war niemand, und dort lagen die Fausthandschuhe.
Das waren ja tüchtige Dinger! Für eine Polarexpedition bestimmt, darunter trägt man noch einige andere. Was brauchte man solche in Ägypten? Vielleicht, dass Mister Achilles Pimplin hier schon einige von seinen 5000 Paar Fausthandschuhen angeschmiert hatte?
Nun, Jochen war glücklich, solche Finger bekommen zu haben.
Seine ungeheuren Hände gingen ganz bequem hinein, etwas gar zu bequem, die Dinger fielen von allein wieder ab.
Na, Jochen wusste sich zu helfen, er machte es genau so wie mit dem Panamahute, den er auch schon wieder mit einem Strick auf den unförmlich gewordenen Kopf gebunden hatte, und er hatte noch mehr Bindfaden bei sich.
Also er band die ziemlich langen Fausthandschuhe am Handgelenk fest. Erst den linken, bei dem ging es leicht, schwerer beim rechten. Mit solch einem Fausthandschuh lassen sich schlecht Knoten schürzen. Schließlich brachte es der Seemann, der doch auch der Schiffskoch war, mit Hilfe der Zähne fertig.
So, wieder ein ganz normaler Mensch, vom Scheitel und sogar vom Strohhut an bis zur Sohle vollkommen sichtbar, trat Puttfarken auf den Korridor hinaus.
Da kam wieder der Pförtner, der aber doch eigentlich einen höheren Rang einzunehmen schien, nur heute diesen Dienst hatte.
»Nun, mein lieber Bruder, ist Dir das Bad gut bekommen?«
»Sehr gut.«
»Fühlst Du Dich teufelsrein?«
»Ganz rein.«
»Hast Du Hunger?«
»Ja, jetzt habe ich Appetit bekommen.«
»Aber, mein lieber Bruder, da musst Du nun noch ein Viertelstündchen warten. Jetzt ist alles in der Kirche, auch wir anderen müssen gleich noch hinein, um den letzten Segen gegen den Teufel zu bekommen. Dann findet die allgemeine Abendmahlzeit statt.«
»Ich kann doch allein essen.«
»Nein, das kannst Du nicht.«
»Weshalb denn nicht?«
»Du könntest aus Versehen einen Teufel mit verschlucken.«
»Ich passe gut auf, kaue recht langsam und spucke ihn wieder aus.«
»Nein, es geht wirklich nicht, lieber Bruder, hier darf niemand allein essen. Nur ein Viertelstündchen, höchstens, so lange geduldigst Du Dich noch, nicht wahr? Du gehst hier einstweilen spazieren, ja?«
Jochen war damit einverstanden, es blieb ihm auch nicht viel anderes übrig.
Er erging sich zwischen den Gärten und in einem benachbarten Hofe, bald war er der einzige Mensch. In der kleinen Kapelle erscholl vielstimmig ein kriegsmarschmäßiges Lied, jetzt ging es den Teufeln eklig zu Leibe, nur einige Haus- oder vielmehr Stubentiere leisteten ihm Gesellschaft, die den schönen Nachmittag noch im Freien genossen.
Mit einem Male, wie er an einem hohen Fenstersims vorüberging, saß ihm ein Äffchen auf der Schulter und liebkoste seinen bandagierten Kopf.
Jochen war ein Tierfreund, er erwiderte die Liebkosungen, nahm das Äffchen auf den Arm, setzte es wieder auf die Schulter.
Nun nahm er den Affen noch einmal auf die Arme.
Ja, was war denn das?
War der Affe nicht noch vor drei Minuten ganz braun gewesen?
Färbte der sich jetzt nicht heller und immer heller?
Wurde der nicht ganz weiß? Und wie schnell das ging! Und — wurde der Affe jetzt nicht förmlich durchsichtig?
»O Jammer, o Jammer, o Millionen Jammer — ich habe den Affen angesteckt, der hat den Aussatz bekommen. Der hat's irgendwie gemerkt, dass ich den Aussatz habe, ist darüber erschrocken — schrumm, hat der ooch den Aussatz, setzt ganz einfach aus!«
Jochen selbst war über diese Erkenntnis so erschrocken, dass er den Affen gleich von sich schleuderte.
Nun aber erschrak auch der Affe, sprang einem Rattenpinscher auf den Rücken, der hierüber natürlich ebenfalls erschrak.
Nachdem der Hund das Äffchen abgeschüttelt hatte, sprang er dem Fremden entgegen, um ihn zu begrüßen. Nanu, verfärbte sich nicht der Rattenpinscher plötzlich, wurde der nicht plötzlich wie durchsichtig?
»Ach, Du lieber Gott, jetzt hat der aussätzige Affe wieder den Hund angesteckt, jetzt setzt der auch aus! Und wie fix das bei diesen Tieren geht! Wenn es nur die Menschen hier nicht merken, dass die nicht auch noch angesteckt werden, vor Schreck, alle durch mich! Ach Gott, ach Gott, was soll ich denn nur machen?«
So hatte Jochen Puttfarken noch nie seine Fassung verloren, so gewimmert.
Und da sah er auch schon einen Vogel herumhüpfen, in dem er kaum noch eine Elster erkannte, so verflossen schon ihre Umrisse, immer durchsichtiger wurde sie, schon sah man die Knochen, und auch schon diese begannen zu verblassen.
Jochen wollte gar nichts mehr sehen.
»Wenn die Ludersch nur wenigstens ganz in Dunst zerfließen, ehe die Leute hier etwas davon merken!«, stöhnte er.
So verging der Rest der Viertelstunde.
Jochen sah nichts mehr, wollte nichts mehr sehen.
Die Kapelle entleerte sich.
»Komm, lieber Bruder, nun teilst Du mit uns das Abendessen.«
Der ganz gebrochene Puttfarken, wenn auch innerlich gebrochen, ließ sich mitschleifen.
Dann saß er in einem Parterrezimmer der Karawanserei an einer langen Tafel zwischen ungefähr vierzig Männlein und Weiblein, Kinder fehlten.
Was Jochen da auf dem Tische erblickte, gab ihm die Besinnung wieder, denn er fühlte gewaltigen Hunger.
Die Teufelsfechter lebten nicht schlecht hier in der Pulvermühle.
Große Schüsseln mit Beefsteaks, Hammel- und Kalbskoteletten, gebratene Hühnchen und Täubchen — da kann man wohl gegen den Teufel kämpfen, alle Kriegsstrapazen aushalten!
Wenn Jochen nur seinen ansehnlichen Mund hätte richtig gebrauchen können, nicht nur vorn in seiner Bandagierung so ein kleines Löchelchen gehabt hätte.
Es wurde viel gesprochen, aber nur über den Teufel. Eigentlich unterhielt sich jeder auch nur für sich. Aus jedem Bissen und jedem Schluck Tee musste der Teufel getrieben werden, mit Spruch und Formel und Kreuzschlagen, und da gab es die verschiedensten Teufel zu berücksichtigen, in dem Hammelkotelett steckte doch natürlich ein ganz anderer Teufel drin als in dem Kalbskotelett, ganz genau so, wie der Hammel doch auch von anderen Bazillen heimgesucht wird als das Kalb.
Eine ganz knifflige Geschichte, das setzte große Kenntnisse voraus, die Sache musste erst gelernt werden.
Für den fremden Gast besorgten denn das auch andere, wie man ihn überhaupt sehr aufmerksam bediente.
Das Löchelchen in der Gesichtsbandagerie war diesmal so klein ausgefallen, dass er kaum den Teelöffel hineinbrachte.
Sofort war ein dicker Strohhalm zur Stelle, nun konnte er saugen.
Hm, der Tee schmeckte recht merkwürdig, so schleimig, war so dick. Offenbar war auch Haferschleim dabei. Oder — oder — Gummiarabikum?
Der Strohhalm. so dick er auch war, hatte sich versackt. Jochen, ihn waagerecht haltend, nachdem er ihn eingetaucht hatte, blies einmal hinein.
Da entwickelte sich am Ende des Halmes eine große Seifenblase und wurde immer größer.
»Was's denn dat?«, staunte Jochen.
Ob die anderen nun über diese rätselhafte Teeseifenblase staunten oder nicht — sie alle hatten sofort nur einen einzigen Gedanken.
»Der Teufel, der Teufel, schlagt ihn tot!«
Das heißt, nicht, dass sie die Seifenblase selbst als Teufel betrachteten, sondern die Blase war doch hohl, wie leicht konnte sich da ein Teufel drin verstecken. Oder ganz sicher saß schon einer drin.
Klatsch! — zwei Hände schlugen zusammen, und mit der Seifenblase war auch der Teufel totgeschlagen.
Und so und ähnlich ging es weiter.
Jochen schob die winzigen Bissen in das Löchelchen und verschluckte sie ohne zu kauen.
Jetzt hätte er sich gern an so ein Täubchen gemacht.
Er langte ziemlich weit über den Tisch, ergriff die Gabel, glaubte wenigstens, sie ergriffen zu haben, die Fausthandschuhe waren gar zu dick, spießte die Taube an, zog die Hand zurück — ja, die Hand hatte er zurückgezogen, aber sein rechter Fausthandschuh lag dort auf der Schüssel samt Gabel und Täubchen.
Nein, Jochen Puttfarken ließ sich nicht so leicht ins Bockshorn jagen.
Aber wie er da seine Hand auf der Bratenschüssel liegen ließ, nur den Ärmel mit der leeren Manschette zurückzog, das war ihm zu viel, da verlor er die Fassung.
Und viele hatten dasselbe gesehen, also nicht nur, dass der Fremdling aus Versehen seinen rechten Handschuh abgestreift, sondern gleich seine ganze Hand hatte liegen lassen, indem er nur den leeren Ärmel zurückgezogen hatte.
»Was war denn das? Wo ist denn Deine Hand geblieben?«
Jochen hatte den leeren Ärmel mit der unsichtbaren Hand schnell unter den Tisch gesteckt, nun aber in seiner Verwirrung beging er den Fehler, mit derselben unsichtbaren Hand auch noch nach dem Handschuh zu greifen, ihn von der Bratenschüssel wieder herabzunehmen, jetzt also schwebte der Handschuh auch noch frei durch die Luft.
Und dieses Wunder sahen nun vollends auch alle anderen, schon quiekten verschiedene alte und junge Weiblein entsetzt auf.
Da wusste Jochen plötzlich, was er jetzt zu tun hatte.
Nur nicht erschrecken, nur nicht erschrecken! Sonst bekamen die alle den Aussatz, und das durfte er nicht auf sein Gewissen laden.
Und er hatte eine Idee bekommen. Ob sie gerade sehr gut war, das war allerdings die Frage, aber er hielt sie für die beste.
Er sprang auf.
»Erschrecken Sie nicht, meine Herrschaften — ick bin unsichtbar — ick kann mir unsichtbar machen!«
So rief er und riss nun auch noch den linken Handschuh herab, zeigte, dass diese Schulterextremitäten mit Ärmel und Manschetten endeten und dass er dennoch in einiger Entfernung davon die beiden Handschuhe halten konnte.
Nein, sehr glücklich war diese Idee gerade nicht gewesen, mindestens verfehlte die Ausführung ihren Zweck, sie beruhigte die Herrschaften nicht.
Alles war vor Entsetzen ob dieses Anblicks starr und sprachlos.
Das sah Jochen, da musste er auch noch weiter gehen, und überhaupt, was der machte, das machte er auch ganz, niemals nur halb.
»Seien Sie ruhig, meine Herrschaften — da ist gar nix dabei — ick kann mir nur unsichtbar machen!«
Und — eins, zwei, drei — den Strohhut hatte er gar nicht mehr auf, den hatte er schon vorher abgebunden und abgelegt — und er hatte auch die ganze Bandage von Kopf und Gesicht gerissen.
Da stand am Tische eine weiße Weste mit roten Blümchen, ein gelbes Jackett, abgeschlossen von einem hohen Stehkragen mit grünem Schlips mit goldenen Tupfen — mit diesem Stehkragen aber hörte der Mensch auf. Und wie Jochen Puttfarken so kopflos dastand, selbst ganz erschrocken, passierte ihm in diesem seinem Schreck noch etwas ganz Besonderes.

Dasselbe, was Grimmelshausens Simplicissimus passiert, gleichfalls vor Angst und Schreck, im 32. Kapitel — »Wie er den Tanz verderbet« — wofür er von seinem Herrn in den Gänsestall gesperrt wird, worüber Simplicissimus am Schlusse dieses Kapitels noch eine längere, höchst lehrreiche Betrachtung anknüpft und zuletzt zu der Meinung kommt, dass, wenn einem so etwas vor Angst und Schreck passiert, es noch von einer ganz besonderen, eigentümlichen physiologischen Wirkung ist.
Dem Jochen passierte etwas, was eigentlich keinem Kavalier passieren darf, nicht einmal einem Kaviller, wenn er bei Tische sitzt, was aber schließlich doch jedem Menschen passieren kann.
Es ist sogar einmal einer Königin bei Tafel passiert.
Der Königin Elisabeth von England, der jungfräulichen Königin.
Und da half kein Stuhlrücken mehr.
Aber in dem Saale befand sich ein Mann, der die Situation mit wunderbarer Geistesgegenwart und Geschicklichkeit auszubeuten wusste.
Hinter dem Stuhle der Königin stand als Ehrenposten ein junger Seeleutnant, noch ganz unbekannt, der sich noch durch nichts ausgezeichnet hatte, der nur wegen seiner schönen Gestalt und seines einnehmenden Gesichtes als Ehrenposten aufgestellt worden war.
Dieser junge Leutnant verließ in der peinlichen Stille der Verlegenheit sofort den Saal.
Er nahm die Sünde seiner Königin auf sich.
Und dann nach beendeter Tafel ließ Königin Elisabeth ihn sofort zu sich kommen und ernannte ihn zum Kapitän und Kommandeur der Kriegsfregatte »Judith« mit den Worten:
»Wer mit bösen Winden so gut umzugehen weiß, der muss ein eigenes Schiff führen.«
Und der junge Leutnant entwickelte sich nach und nach weiter zum Seehelden, machte die zweite Erdumsegelung und brachte uns von Amerika die Kartoffeln — Francis Drake!
Und das ist historisch.
Nicht nur das mit den Kartoffeln, sondern auch das andere.
Sir Samuel Hasting, Leibsekretär und Biograf der Königin Elisabeth, ist damals mit dabei gewesen und hat der Nachwelt ganz ausführlich darüber berichtet.
Also wenn das sogar einer regelrechten, noch dazu jungfräulichen Königin bei der Galatafel passieren kann, dann konnte es auch dem Kaviller und sogar Kavalier Jochen Puttfarken passieren.
Aber Glück brachte es ihm nicht.
Nun war er natürlich erkannt.
Jetzt durfte er nicht mehr sprechen: Wenn ich je ein Kreuz gegen meine Brust schlage, und ich bin der Teufel, so werde ich in Dunst zerfließen und einen fürchterlichen Gestank hinterlassen.
Es war bereits geschehen.
Und nun wussten natürlich auch diese Männlein und Weiblein, wer unter ihnen weilte.
Der Brief des Prinzen Joachim sagte gar nichts, so etwas weiß jeder Teufel zu drechseln.
»Der Teufel, das ist der Teufel!«
So erklang es vierzigstimmig in allen möglichen Tonarten.
Und bei dieser Schreierei und Brüllerei und Quiekerei blieb es nicht.
Diese Männlein und Weiblein fürchteten sich nicht, die ergriffen nicht etwa die Flucht.
Die hatten mit dem Teufel schon theoretisch so viel gefochten, dass sie nun auch in der Praxis zu diesem Kampfe befähigt waren.
Die packten sofort zu.
Ehe Jochen wusste, wie ihm geschah, war er schon gepackt, zunächst an den Armen, auf beiden Seiten, und zwar waren es gerade zwei Damen, eine Frau und eine Jungfrau, die zuerst zugegriffen hatten.
»Der Teufel, der Teufel, haltet den Teufel fest!«
Nun aber wusste Jochen, wie ihm geschah, und sein Feldherrngeist übersah sofort den Schlachtenplan und erkannte, was hier am angebrachtesten war.
Er verwandelte sich in den keuschen Joseph, der Potiphars Weibe sein Gewand zum Andenken hinterlässt.
Jochen ließ in den Händen der beiden Damen vorläufig wenigstens sein gelbes Jackett, war aus den Ärmeln geschlüpft.
Doch da war er von hinten auch schon an der Weste gepackt.
Geistesgegenwärtig riss Jochen vorn sofort die Knöpfe auf und verzichtete auch auf seine weiße Weste mit den roten Blümchen, samt goldner Uhr und Kette.
Nun aber ging Jochen ganz energisch mit dem Vorsatz um, dieses ungastliche Zimmer zu verlassen.
Der Weg zur Tür war ihm durch Menschen verbarrikadiert, so wendete er sich nach dem Parterrefenster.
Es stand schon offen, er hob das eine Bein, kniete schon darauf ... da wurde ihm der eine Fuß gepackt und gleich darauf auch der andere.
»Haltet den Teufel, haltet den Teufel!«
Dermaßen wurde an seinen Füßen gezogen, dass sie ihm die Beine lang zogen, dass er also nicht mehr auf dem Fensterbrett kniete, und um nicht vollends heruntergezogen zu werden, umklammerte Jochen das Fensterkreuz.
Die Folge dieser Zieherei war natürlich, dass sie ihm die Schuhe auszogen.
Sie griffen weiter zu und zogen ihm auch noch die schwarzen Seidenstrümpfe mit den blauen Vergissmeinnichten aus.
Jetzt hatte Jochen keine Füße mehr, seine Hosenbeine endeten sozusagen blind im Wesenlosen.
Diese Füße waren zwar noch zu fühlen, aber diese Männlein und Weiblein wollten nicht nur fühlen, sondern auch sehen, was sie anpackten, und sie packten weiter die Beine und Hosen und zogen.
Da gab es einen Knall, einen doppelten — auf der einen Seite von der Hose waren sämtliche Knöpfe abgeplatzt, auf der anderen Seite war der Hosenträger gerissen.
Auf diese Weise wurden dem Teufel die Hosen ausgezogen.
Mit einem einzigen Ruck waren sie herunter, die Männlein und Weiblein hinter ihm, die schöne Hose in den Händen, purzelten durcheinander.
Unterzeug trug Jochen nicht.
Und für besonders schamhafte Leser noch extra die Beruhigung, dass er ja unsichtbar war.
Außerdem hatte er ja auch noch das Hemd an. Allerdings schon etwas kurz, weil er die untere Hälfte als Bandage für seinen Kopf verwendet hatte. Dafür aber oben auch noch Kragen und Krawatte.
Doch dieses Hemdes sollte er sich nicht lange mehr erfreuen.
Gerade ging draußen eine junge Dame ohne Taille vorüber — Fräulein Ludmilla Sappel war ihr Name — die hörte da drin das Geschrei — »haltet den Teufel, haltet den Teufel!«, — und sie sah da drin am Fenster das Hemd mit Kragen und Krawatte herumzappeln, da wusste sie sofort, was hier los war und was sie zu tun hatte, und das umso mehr, weil sie Vorkämpferin bei den Teufelsfechtern war — also Fräulein Ludmilla Sappel sprang sofort hin, packte Jochen oder vielmehr den Teufel oder noch vielmehr das Hemd bei den Armen und fing an zu ziehen.
Nun aber hatte Jochen wieder festen Fuß gefasst und fing gleichfalls an zu ziehen.
Fräulein Ludmilla Sappel zog nach draußen, Herr Jochen Puttfarken zog nach innen.
Die Folge von dieser Zieherei war, dass Fräulein Ludmilla Sappel Herrn Jochen Puttfarken alsbald das Hemd über den Kopf gezogen hatte.
Nun noch ein Reißen, sowohl oben der Bund wie die zusammengeknöpften Manschetten waren geplatzt, und Jochen war seines Hemdes ledig.
Aber nicht etwa, dass er nun ganz nackt gewesen wäre — durchaus nicht!
Der Kragen war so beschaffen, dass er diese Verabschiedung nicht hatte mitzumachen brauchen, also Jochen war noch immer mit dem Stehkragen bekleidet. Und außerdem hing an diesem auch noch der grüne Schlips mit den goldenen Tupfen.
Das ist nun freilich etwas wenig Bekleidung, für den ärmsten Teufel, aber doch immerhin etwas.
Vor allen Dingen aber sah Jochen jetzt die günstigste Gelegenheit, sich einer weiteren Verfolgung zu entziehen. Durchs Fenster konnte er nicht, da draußen stand als Wache Fräulein Ludmilla, mit dem Hemd als Siegesfahne, und außerdem kamen dort noch andere Teufelsfechter herbeigeeilt, die nicht am Abendessen teilgenommen hatten.
Dagegen war es hinter ihm frei geworden. Die Männlein und Weiblein, die ihm mit einem kräftigen Ruck die Hosen ausgezogen hatten, lagen noch durcheinander gepurzelt, versperrten den anderen den Weg zum Fenster.
Also Jochen retirierte nach rückwärts, wieder ins Zimmer hinein, wusste die Barrikade zu umgehen.
Aber es half ihm nichts.
»Haltet den Teufel, haltet ihn, fangt ihn!«
Und wieder alles hinter ihm her.
»Deiwel, ick bin doch unsichtbar?«, sagte sich Jochen.
Ach so, nun wusste er, weshalb man ihn noch verfolgen konnte!
Sein Vatermörder und die Krawatte schwebten noch frei im Zimmer herum, denen ging die Jagd nach!
Dieses letzte sichtbare Zeichen abgerissen, den Kragen einer Dame verächtlich ins Gesicht geschleudert, den schönen Schlips einem männlichen Teufelsfechter um die Ohren gehauen — so, nun war er für menschliche Augen verschwunden, und das merkte er sofort.
Die wilde Jagd blieb stehen.
Desto mehr wurde geschrien.
»Wo ist er, wo ist er! Lasst ihn nicht entkommen. Schließt die Türen, schließt die Fenster!«
Da ergriff, nachdem schon eine Handbewegung genügt hatte, um sich Gehör zu verschaffen, ein alter, würdiger Patriarch in schneeweißen Locken das Wort.
Es war der Häuptling dieser Teufelsfechter.
Er hatte schon stark den Tadderich, vom Knie an bis zum Haupte, seine milde Stimme zitterte schon vor Altersschwäche, aber noch immer leuchteten seine Augen in heiligem Kampfeseifer.
Was er schon im Kampfe mit dem Teufel geleistet, das zeigten die vielen Narben, die sein durchrunzeltes Gesicht durchzogen. Denn in jungen Jahren hatte er schon einmal den Teufel persönlich gejagt und war dabei mit dem Kopf durch eine Fensterscheibe gefahren.
Dieser alte Häuptling also ergriff jetzt mit sanfter, zitternder Stimme das Wort:
»Ruhe, meine lieben Kinder, immer nur Ruhe.
Stille, seid nur stille.
Er kann uns nicht entkommen, der Teufel.
Nein, Ihr braucht nicht die Türen zu schließen, nicht die Fenster. Im Gegenteil, macht sie wieder auf, die Türen und die Fenster.
Denn ich, Euer Vater, habe gleich dafür gesorgt, dass der Teufel nicht wieder heraus kann.
Ihr alle habt gesehen und habt gefühlt und habt gerochen, dass es der Teufel war.
Auch ich habe es gesehen und gerochen.
Und da habe ich nicht vergessen, sofort den Bannspruch zu sprechen, welcher geschrieben steht in unserem Teufelsbrevier, Kapitel 468, Vers 127 bis 129.
Also seid stille, meine lieben Kinder, seid stille. Ruhe, nur Ruhe.
Er kann nicht wieder fort von hier, der Teufel, ich habe ihn gebannt.
Ja, öffnet wieder die Türen und Fenster, es ist besser so.
Es muss alles so sein, wie es im Anfang war, sonst könnte er doch noch durch die Wand gehen.
Aber jetzt befindet er sich noch hier. Ich weiß es. Ich sehe ihn, ich fühle ihn, ich rieche ihn.
Stille, meine lieben Kinder, seid stille.
Ruhe, nur immer Ruhe.
Der Teufel ist hier gebannt, wir werden ihn totschlagen.
Jeremias, hole mir mein Schwert.«
Ein Jüngling rannte.
Die Türen und Fenster wurden wieder geöffnet, alles verharrte in regungslosem Schweigen.
Jochen stand in einer Ecke des sehr großen Raumes.
Er hätte jetzt die beste Gelegenheit gehabt, einfach zur Tür hinaus zu spazieren, aber die Sache begann ihn zu interessieren.
Er stieg sogar auf einen Stuhl, um besser Umschau halten zu können.
Natürlich jedes Geräusch vermeidend.
Denn in dem Zimmer herrschte Mäuschenstille, so regungslos verhielten sich die vorzüglich eingedrillten Teufelsfechter, Männlein wie Weiblein.
»Stille, meine lieben Kinder — Ruhe, nur immer Ruhe!«, ermahnte der alte Häuptling trotzdem noch einmal mit seiner zitternden, so überaus sanften Stimme. »Wartet nur, bis ich mein Schwert habe, dann wollen wir den Teufel gleich haben — stille, seid nur stille.«
Der Jüngling kam zurückgerannt und brachte dem Häuptling sein Schwert, mit dem er schon so manchen Teufel zur Strecke gebracht hatte.
Dieses Schwert sah ganz genau aus wie eine Fliegenklatsche.
»Ich danke Dir, mein lieber Jeremias.
Nun, Ihr meine lieben Kinder und Kampfesgenossen — — seid stille, ganz stille.
Ihr alle kennt dieses Schwert, welches mir einst mein seliger Freund Hieronymus gab, der nun schon längst befreit ist von allem Teufelsstreit, der einer der besten Teufelskenner gewesen ist und auch unser Teufelsbrevier sowie den großen Leitfaden für den siegreichen Kampf gegen alle Arten von Teufeln verfasst hat.
Er hinterließ mir dieses Schwert, mit welchem er so manchen Teufel zur Strecke gebracht hat.
Ihr kennt die Eigenschaften dieses Schwertes, oft schon habe ich Euch davon erzählt.
Sobald ich irgend einen Teufel mit diesem Schwerte kräftig berühre, kann er sich nicht mehr rühren, er ist gebannt, er ist in unserer Macht.
Ich werde jetzt versuchen, den Teufel, der uns aufgesucht hat und sich noch hier in diesem Zimmer befindet, mit diesem Schwerte zu bannen, ihn sozusagen festzunageln.
Was es für ein Teufel ist, weiß ich noch nicht.
Daraus, in welcher Gestalt er zu uns gekommen ist, lässt sich noch gar nichts schließen.
Denn jeder Teufel kann bekanntlich jede beliebige Gestalt annehmen.
Sobald ich ihn jedoch mit diesem meinem Schwerte treffe, muss er sich in seiner eigentlichen Gestalt zeigen.
Und wie ich bestimmt vermute, besonders nach dem gräulichen Gestank, den er hinterlassen hat, als er sich entlarvt sah, ist es ein Teufel aus der achten Hölle.
Nur ein ganz kleines Teufelchen, in seiner wahrem Gestalt nicht größer als — als ... als die Salamiwurst dort, aber trotzdem einer der schlimmsten aller Höllengeister, gleich mit drei Hörnern auf dem Kopfe, dagegen mit sehr kurzem Schwänzchen.
Nun, wir werden ja gleich sehen, sobald ich ihn durch einen Schlag meines Schwertes festgebannt habe.
Also seid stille, meine lieben Kinder, ganz still, und singt unser Kampfeslied, welches beginnt: Kommt her, Ihr Teufel, kommt heran, gewappnet stehn wir Mann für Mann, wir sind die Teufelsstreiter ... und so weiter.«
Das angesagte Lied erscholl vierzigstimmig, ein sehr schönes Lied. Glücklicherweise hatte es nur zwei Verse Einen Erfolg hatte es nicht. Denn der unsichtbare Teufel verhielt sich ganz ruhig auf seinem Stuhle und überlegte, wie er dort vom Tische so ein Beefsteak bekommen könne.
Auch von dem Häuptling schien noch gar kein Erfolg dieses Liedes erwartet zu sein, oder er wusste sich eben den Verhältnissen anzupassen, kam niemals in Verlegenheit.
»So, meine lieben Kinder«, fing seine sanfte, zittrige Stimme wieder an, nachdem die letzte Strophe verklungen war, »seid nur stille, ganz stille. Nachdem wir unser Kampfeslied gesungen haben, wollen wir nun das große Locklied singen, mit welchem man den Teufel zum Kampfe herausfordert, Nummer 695 in unserem Liederbuch, das Ihr ja aber alle kennt, gedichtet und komponiert von unserem seligen Bruder Hesekiel, dessen genialer Dichtergeist uns leider viel zu früh verlassen hat, welches mit den Worten beginnt: Erscheint, Ihr Teufel, hier sofort, erscheint allhier an diesem Ort, juchhei, juchheh, an diesem Ort ... und so fort.«
Das Locklied erscholl.
Jochen fand dieses Lied nicht weiter merkwürdig. Er kannte die Heilsarmee in England und Amerika. Die hat noch ganz, ganz andere Lieder. Daran gewöhnt man sich bald.
Aber was war denn das?
Auch Jochen begann zu staunen, sogar viel mehr als alle die anderen, die nun einmal das Erscheinen des Teufels erwarteten.
Das Locklied des seligen Dichtergenius Hesekiel tat wirklich seine Wirkung!
Plötzlich vollzog sich dort auf dem Tische ein Spuk. Dort wurde plötzlich ein in einer leeren Tasse steckender silberner Teelöffel lebendig, hob sich und fiel klappernd in die Tasse zurück.
Der Gesang wollte verstummen.
»Stille, meine lieben Kinder, seid nur ganz stille, immer singt weiter!«, gebot aber schnell der Häuptling, zog unter dem Patriarchenrock aus der Westentasche einen Klemmer hervor, pflanzte ihn ganz vorn auf die Nasenspitze, holte mit dem Fliegenklatschenschwert weit zum Schlage aus.
Der silberne Löffel bewegte sich noch immer in der Teetasse, klapperte.
Mit einem Male ging er vollends in die Höhe.
Klatsch!
Das furchtbare Schwert war herabgesaust.
Es hatte die Porzellantasse vollständig zerschmettert. Aber der Löffel ging seitwärts davon.
Also nun nochmals schnell ausgeholt und zugeschlagen — klatsch! — mit Vehemenz klatschte die schwere Lederklappe in eine große Schüssel mit Apfelmus hinein, dass es nur so nach allen Seiten spritzte.
»Tot ist er!«, sagte der Schwertkünstler mit hoher Befriedigung, ganz glückstrahlend, sich das Apfelmus aus dem Gesicht wischend und den Klemmer auf der Nase wieder ordnend. »Ich habe ihn zur Strecke gebracht. Wo liegt er?«
Jetzt natürlich war der Gesang verstummt.
»Er ist mit dem Löffel zum Fenster hinausgeflogen!«, hieß es.
Ja, so war es gewesen. Der silberne Löffel war glatt zum offenen Fenster hinausgeflogen.
Der eigentliche Teufel dort auf dem Stuhle wusste eine Erklärung für dieses Phänomen.
»Das war die Elster, die den Aussatz krägen hat, die hat den Löffel geklaut.«
Davon aber wussten die anderen nichts, und der Patriarch wollte es überhaupt nicht glauben. Schließlich musste er es doch, es wurde ihm vierzigstimmig versichert.
Es machte für ihn nichts aus.
»Seid nur stille, meine lieben Kinder, ganz stille. Dass der Löffel zum Fenster hinausgefahren ist, das ist nur ein Teufelsspuk, eine Täuschung, ein Blendwerk der Hölle. Der Teufel kann gar nicht aus diesem Zimmer heraus, ich habe ihn gebannt, mit Kapitel 468, Vers l27 bis l29. Wir werden den Löffel dann hier schon irgendwo finden, mit einem Male wird er wieder hier sein. Die Hauptsache ist, dass ich den Teufel getroffen habe. Wo liegt er?«
Aber vergebens wischte der alte Häuptling auch von seinem Klemmer das Apfelmus ab, putzte ihn sorgfältig, pflanzte ihn noch mehr auf die Nasenspitze und beäugte den Tisch — er sah das Teufelchen ebenso wenig wie die anderen.
»Sollte ich ihn wirklich verfehlt haben? Oder, halt, sollte er vielleicht in ...«
Er nahm eine Gabel und stocherte in dem Apfelmus herum.
Nein, er brachte das Teufelchen nicht aus dem Apfelmus zum Vorschein.
Aber der alte Herr war und blieb ein Optimist.
»Seid nur stille, meine lieben Kinder und Kampfgenossen, ganz stille. Ich habe ihn gefehlt, aber das nächste Mal werde ich ihn nicht fehlen. Also singen wir jetzt das Lied ...«
Es war kein neues Locklied nötig. Da fing der Spuk schon wieder an.
Jetzt bewegte sich auf einer Schüssel eines der gebratenen Täubchen, ging etwas in die Höhe.
Der alte Häuptling rückte schnell seinen Klemmer zurück und holte mit der Fliegenklatsche zum Schlage aus.
Klatsch!
In demselben Augenblicke aber war die gebratene Taube schon davon geflogen.
In einiger Höhe über den Tisch hinweg, hinab, und flog in geringer Höhe über den Boden weiter zur offenen Tür hinaus, flog in ganz eigentümlicher Weise, den Sterz nach vorn, den Hals nach hinten. Dafür war es auch eine gebratene Taube.
»Das war entweder der Rattenpinscher, der den Aussatz krägen hat, oder eine Katze, was da die Taube vom Tische geholt hat!«, dachte Jochen.
Die anderen wussten hiervon nichts.
»Wo liegt er?«, fragte der Häuptling wiederum.
»Die gebratene Taube ist zur Tür hinaus geflogen!«, hieß es.
»Das habe ich gesehen — seid nur stille, meine lieben Kinder, ganz stille — aber wo liegt der Teufel?«
Er lag nicht auf dem Tische.
»Nun, das ist alles nur Lug und Trug der Hölle, die gebratene Taube wird schon wiederkommen!«, sagte dieser glückliche Optimist. »So wollen wir es nun einmal mit dem Lied versuchen ...«
Da machte sich der Teufel schon wieder bemerkbar. Diesmal war's ein Kalbskotelett, das abging.
Erhob sich einfach, lief ohne sichtbare Füße über den Tisch, sprang hinab und huschte zur Tür hinaus.
Und gleich darauf folgte ein Beefsteak nach, das aber die entgegengesetzte Richtung nahm und durchs Fenster verschwand.
Beide Male war der alte Häuptling nicht zum Schlage gekommen, immer nur zum Ausholen, so fix war's gegangen.
»I drrr Deiwel, i drrr Deiwel!«, fing er jetzt doch etwas bestürzt zu murmeln an, mit seinem Fliegenklatschenschwerte schlagbereit stehend.
Ja, da soll man wohl bestürzt werden.
Die anderen Teufelsfechter wurden es auch.
Nur dort der leibhaftige Teufel auf seinem Stuhle nicht.
»Wenn das so weiter geht, bleibt for mir gar nix mehr auf dem Tische übrig, die Ludersch holen mir alles weg.«
Und es ging so weiter.
Auf dem reichbesetzten Tische stand auch ein schöner Glasaufsatz mit Früchten, — Apfelsinen, Feigen, Datteln, Weintrauben, Mandeln und dergleichen mehr.
Und mit einem Male ging eine Feige ab.
Diesmal aber hatte der Schwertfechter aufgepasst, furchtbar sauste die Waffe herab und legte den Glasaufsatz in Trümmer.
Doch schon kletterte die Feige an der Fenstergardine empor und setzte sich oben auf die Gardinenstange — nein, blieb noch etwas darüber frei in der Luft schweben, nahm zusehends ab, als wenn sie aufgegessen würde.
Dem Häuptling war das ganz egal, was dort oben vor sich ging.
»Getroffen! Diesmal habe ich den Teufel getroffen! Wo liegt er?«
Auf dem Tische lag er wieder nicht. Der saß oben auf der Gardinenstange und fraß seine Feige.
Dafür aber stand jetzt ein großes Brathuhn auf, schwebte hinab und zur Tür hinaus, und so fix war das gegangen, dass der alte Herr gar nicht zum Schlagen gekommen war.
»Stille, liebe Kinder, seid nur ganz stille — das ist alles nur ein Gaukelspiel der Hölle — das kommt schon wieder.«
»Nee, ick gleuw nich, dat det wiederkommt!«, dachte aber Jochen.
Und doch, da kam das Brathuhn schon wieder zur Tür herein, noch viel schneller, als es hinaus spaziert, war, sozusagen in vollem Galopp. Man glaubte nämlich, wirklich etwas wie einen Galopp zu hören.
Und das Brathuhn ging auch nicht wieder auf den Tisch zurück, sondern es galoppierte weiter in dem großen Zimmer herum, aber nicht stille, ganz stille, sondern unter einem wahren Höllenspektakel von Hundegebell und Hundegeheul, es musste mindestens ein halbes Dutzend Köter sein, die sich um das Brathuhn balgten, das dabei natürlich bald in Stücke ging.
Wir wollen die nachfolgende Szene nicht beschreiben. Sie ist auch unbeschreiblich.
Denn jetzt blieben die Teufelsfechter nicht mehr stille. ganz stille, sie ließen sich von ihrem Häuptling nicht im Zaume halten, sie gingen zur Offensive über. Die Männlein und Weiblein ergriffen alles, womit man schlagen kann, und schlugen auf die einzelnen Teile des Brathuhns los, die sich immer mehr in dem weiten Zimmer zerstreuten, immer in voller Lebendigkeit.
Jochen Puttfarken aber spielte nicht mehr den Zuschauer, er benutzte das allgemeine Durcheinander, den schrecklichen Tumult, um sich vom Tisch einige Beefsteaks und Koteletts und anderes zu holen, brachte alles glücklich zur Türe hinaus, ohne dass es bemerkt worden war.
In dem ersten Stockwerk des alten Klosters mauerten und zimmerten und tapezierten und malten einige Dutzend arabische Handwerker, arbeiteten mit überraschender Geschicklichkeit und Schnelligkeit. Es war eine Lust, ihnen zuzusehen, wie sie einen Fensterrahmen einsetzten und auch gleich die Scheiben einzogen, während das Holz schon gemalt wurde. Alles ging Hand in Hand ohne Frühstücks- und Mittagspause. Dafür aber geben sich diese Orientalen, wenn sie ihre Akkordarbeit so schnell wie möglich erledigt haben, wieder lange Zeit dem süßen Nichtstun hin, lassen sich durch das günstigste Angebot zu keiner neuen Arbeit verlocken. Bis sie wieder Geld brauchen.
Die Leute des Prinzen schafften heran, was diese Handwerker bedurften. Das eine Automobil, obgleich ein eleganter Personenwagen, war als Lastfahrzeug immer unterwegs, die Fahrt bis zur Stadt, obgleich alles Sand, bot keine Schwierigkeiten, weil auf festem Steingrund nur eine dünne Schicht Sand lag, denn in der eigentlichen Wüste mit ihrem Flugsand hört ja das Automobilfahren auf, alle besonderen Räderkonstruktionen haben sich bisher als unbrauchbar erwiesen, so wurden auch schon die notwendigsten Möbel herbeigeschafft, bis dann der ganze Möbeltransport auf einmal kommen würde, und das Rennautomobil wurde zum Depeschendienst benutzt.
Außerdem waren die sieben Leute des Prinzen — der achte Mann, Jochen Puttfarken, fehlte an diesem ersten Tage des Einzuges — damit beschäftigt, das Kloster von den bisherigen Bewohnern zu säubern, die keine Miete bezahlt, hatten aber wenig Erfolg dabei.
Die Hyänen und Füchse waren vor den Spektakel machenden Menschen ja von allein davon geflohen, man hatte wirklich nicht weniger als fünf Hyänen in die Wüste hineinfliehen sehen, desgleichen gingen die zahllosen Fledermäuse freiwillig davon, man musste sie nur aus ihrem Tagesschlafe wecken, die Geier wurde man nicht so leicht los, die blieben ruhig auf dem Dache des Klosters sitzen, kamen immer wieder, so oft sie auch davongescheucht wurden, eben weil diese Geier wissen, dass sie geheiligt sind, sie dürfen nicht geschossen werden, die Mohammedaner dulden es nicht — nun, die würde man, wenn man diese unsauberen Nachbarn los sein wollte, schon auf andere Weise fortbringen, dagegen wusste der erfahren Prinz ein Mittel — aber das Beseitigen der Schlangen war vorläufig noch ein ungelöstes Problem.
Der alte Muley war für den frühen Morgen bestellt worden und war nicht gekommen, wie er auch schon sein Versprechen nicht gehalten, am Nachmittage zuvor in das Hotel des Prinzen zu kommen, damit dieser erst einmal mit ihm sprechen konnte. Der alte Sünder hatte noch Geld gehabt, war wie immer dann in der Schnapsbude des Griechen Demetri gewesen, hatte sich sinnlos betrunken und lag noch jetzt schlafend und röchelnd in einem Winkel der Spelunke.
Ehe man einen anderen Schlangenbeschwörer zitierte, wollte man doch einmal selbst gegen die Schlangen vorgehen, auf ganz natürliche Weise. Man suchte überall an Orten nach, die für Schlangen als Schlupfwinkel in Betracht kommen konnten. Der Erfolg war ein ganz negativer. Jener englische Kunstmaler hatte im Refektorium, wenn er die Wahrheit gesprochen, eine ganze, zahlreiche Schlangenfamilie gesehen, die sich in der Sonne, die durch die Fenster gefallen, gewärmt hatte. Die Hornviper, der Nilwurm, konnte das gar nicht gewesen sein, denn diese Giftschlange lebt nur im Sande, hält sich des Tages über drin verborgen und kommt nur in der Nacht zum Vorschein, geht dann allerdings gern dem Lagerfeuer nach, um sich daran zu wärmen.
Was der Maler gesehen hatte, waren jedenfalls Efas gewesen. Die Efa ähnelt der Hornviper zum Verwechseln, nur dass ihr auf dem Kopfe die beiden fleischigen Hörner fehlen. Das ist eine Tagesschlange, und die kommt in Häusern häufig vor, mitten in Kairo. Aber obwohl sehr giftig, wird sie doch nicht sehr gefürchtet. Sie zeigt sich nämlich nur in alten Häusern, die lange unbewohnt gewesen sind. In fortwährend bewohnten Häusern kommt sie niemals vor. Die Eingeborenen mögen schon recht haben, wenn sie behaupten, dass diese Schlange die menschliche Stimme nicht vertragen kann. Oder überhaupt nicht die Anwesenheit von Menschen.
So spotteten auch hier diese arabischen Handwerker über die Ängstlichkeit, die besonders einige der Franken wegen der Schlangen zeigten. Diese Ängstlichkeit war begreiflich, deshalb braucht man kein Feigling zu sein. Immerhin, es war bewundernswert, wie diese arabischen Handwerker mit ihren nackten Füssen sorglos zwischen dem Schutt herumliefen.
»Solange man spricht, kann man von keiner Efa gebissen werden!«, sagten sie.
Und dieses Schutzmittels bedienten sie sich denn auch aufs gründlichste. Schwatzen müssen diese Leute ja überhaupt ständig bei der Arbeit, jetzt aber zeigten sie erst, was sie im Schwatzen leisten konnten. Kein Mundwerk stand auch nur eine Sekunde still, jeder sprach unaufhörlich, auch wenn er keinen Zuhörer hatte, wenn ihm nichts geantwortet wurde.
Nun, mochte auch ein Aberglaube dabei sein, er gab ihnen doch den Mut, sorglos ihrer Arbeit nachgehen zu können.
Also innerhalb der Mauern wurde keine Schlange gefunden, wie man auch geeignete Orte und Verstecke, wo man sie vermuten konnte, untersuchte, was ja nun freilich seine Schwierigkeiten hat, auf diese Weise eine Schlange aufstöbern zu wollen.
Ebenso wenig nützte es etwas, in den Räumen Holzfeuer anzuzünden. Ob man nun den Raum verdunkelte oder nicht, keine Schlange kam zum Vorschein. Außerdem ist es auch gar nicht bekannt, dass die Efa nach Feuerschein und Feuerwärme geht.
Nun wollte jener Maler auch draußen im Garten von einer Hornviper angesprungen worden sein.
Wenn es hier wirklich solche »Nilwürmer« gab, dann musste man die doch auch auffinden können.
Der Klostergarten war etwa 4000 Quadratmeter groß, von einer hohen Mauer umgeben. Von einem »Garten« durfte man eigentlich nicht sprechen, es war, wie schon einmal gesagt, alles Sand. Aber diese Sandschicht lag kaum einen Viertelmeter hoch, dann kam fester, ebener Felsboden.
Wenn man nun mit einem geeigneten Instrument wie mit einer tiefgehenden Harke den Sand strichweise durchwühlte, so musste man doch vorhandene Schlangen zum Vorschein bringen.
Gedacht, getan, schon nach einer halben Stunde waren drei eiserne Harken mit sehr langen Zähnen zur Stelle, das Abharken wurde unternommen, wozu die Männer lange Schaftstiefel trugen, zur Vorsicht, falls nach solch einem Reptil gegriffen werden musste, auch noch starklederne Handschuhe.
Aber wie man auch harkte, den Sand förmlich siebte, auf diese Weise wurde keine Schlange ans Tageslicht befördert. Und die arabischen Handwerker lachten ob dieser Bemühungen der Franken.
»Weshalb lacht Ihr denn?«
»Weil Ihr am Tage Nilwürmer fangen wollt.«
»Sie sind nur in der Nacht zu fangen?«
»Ja, da braucht man nur ein Feuer anzuzünden, da kommen sie hervor.«
»Alle?«
»Nein, alle nicht, nur die, welche wollen. Alle durch Feuer hervorzwingen, das kann nur der Haui, der Schlangenbeschwörer, der seine Seele dem Teufel verschrieben hat.«
»Man muss sie aber doch auch so hervorharken können, wenn man nur genügend sorgfältig harkt. Was lacht Ihr uns da aus?«
»Am Tage gibt es ja überhaupt gar keine Nilwürmer.«
»Weshalb denn nicht?«
»Das sind Geister, die erst in der Nacht zu Schlangen werden.«
Der Prinz kannte diesen arabischen Glauben oder Aberglauben schon, er war es auch nicht gewesen, der gefragt hatte. Dieser Aberglaube drückt wenigstens aus, wie schwer sichtbar die gelbe Hornviper ist, auch wenn sie am Tage einmal über den Sand kriecht.
So ging das bis zum Mittag hin, der alte Muley, nach dem man sich einmal erkundigt hatte, schlief noch immer seinen Mordsrausch aus.
Da verwandelte sich dort oben in der ersten Etage das ewige Schwatzen der Araber in einen Höllenspektakel.
Sie hatten unter einem abgeräumten Schutthaufen eine Efa entdeckt, ein stattliches Exemplar, 80 Zentimeter lang, größer werden sie nicht, ebenso wie die Hornviper, und wenn diese Handwerker auch keine Furcht vor Schlangen hatten, so brachte es dennoch die größte Aufregung hervor. Natürlich war das Tier von ihnen sofort totgeschlagen worden, was sie auch mit einem Nilwurm gemacht hätten. Das sind wieder ganz andere Geister als die Hyänen.
Auch unter den Leuten des Prinzen brachte dieses Intermezzo große Aufregung hervor. Denn schon hatte man sich der Hoffnung hingegeben, dass die ganze Sache hier mit den massenhaften Schlangen nur eine Fabel sei. Diese einzige Efa hier genügte, um die Sorge vor Schlangen wieder aufleben zu lassen, und sie sollte gleich noch verstärkt werden.
Der Prinz öffnete den Leib des Tieres, um zu untersuchen, wovon sich die Schlangen hier nährten, fand in dem Magen Überreste von Mäusen und Eidechsen, außerdem aber noch an anderer Stelle sieben junge Schlangen, wie die Regenwürmer, die, wie es häufig vorkommt und bei einigen Schlangenarten immer, noch im Mutterleibe aus dem Ei gekrochen waren.
Das konnte natürlich nicht zur Beruhigung dienen.
Da machte sich die kleine Deasy bemerkbar.
Das Kind war natürlich mit ins Kloster gekommen, hielt sich entweder in einem Raume auf, den man mit Teppichen und Möbeln schon wohnlich eingerichtet hatte, oder sah im Garten zu, wie man den Sand durchharkte.
»Gib mir doch einmal etwas von der toten Schlange in die Hand, nur ein Stück Haut!«, sagte sie jetzt.
Das war ein ganz seltsames Verlangen von dem Kinde!
Wie schon früher geschildert, hatte Deasy niemals gern in ihrem somnambulen Zustande Tiere gesehen, denn hierbei trat sie immer ganz von selbst in das zweite Stadium des Hellsehens ein, also dass sie nicht nur das betreffende Tier erblickte, sondern auch alles mit dessen Augen sah, was sie aber dann in ihrem menschlichen Gehirn nicht begreifen konnte, und dieser Widerwille, ein Medium von einem Tiere in die linke Hand zu nehmen, war bei ihr im Laufe der Zeit immer stärker geworden, bis sie ein solches gar nicht mehr in die Hand nahm, es sofort mit Zeichen des Abscheus von sich schleuderte.
Außerdem aber hatte sie diese Gabe ja bereits verloren, nur einzig und allein auf Freds Locke reagierte sie noch — das mit der Haarlocke von Edward Scott, wodurch sie die Mumie mit dem steinernen Schlüssel erblickt, war eine unerklärliche Ausnahme gewesen — und schließlich forderte sie jetzt sogar ein Medium von einem toten Tiere! Auf etwas von einem toten Geschöpf hatte sie ja überhaupt niemals reagiert, hatte es von allem Anfange an mit Abscheu von sich geschleudert!
Und jetzt forderte das Kind ein Stück Haut von dieser toten Schlange!
Natürlich, Deasy sah die vergeblichen Bemühungen ihrer Freunde, ihre Sorge wegen der Giftschlangen, wollte ihnen helfen.
Aber immerhin, es war doch etwas ganz Merkwürdiges dieses ihr Verlangen.
»Die Schlange ist doch tot, Deasy.«
»Ich will etwas von ihr in die Hand nehmen — oder die ganze Schlange — ich glaube, ich werde die anderen Schlangen, die sich hier aufhalten, dadurch sehen.«
Und hierauf bestand das Kind hartnäckig weiter.
Nun gut, man wollte ihren Willen erfüllen.
Deasy hatte ja schon gezeigt, dass sie noch andere Gaben besaß, die nur entdeckt werden mussten. Denn wenn sie auch nicht mehr auf jedes Medium reagierte, das von einem lebenden Menschen stammte, so war dafür durch Jochen Puttfarkens Vermittlung ein wunderbares Fernwirken hinzugekommen, worüber später berichtet werden soll.
Eigentlich, hätte man glauben können, das Kind hätte doch gar nicht viel zu bitten brauchen, es nahm von selbst die tote Schlange in die linke Hand. Aber es ist schon früher betont worden, dass unbedingt der feste Wille einer anderen Person dabei sein musste, wenn das Kind etwas erblicken sollte. Um eine Art von Hypnose handelte es sich doch wohl.
Also der Prinz schnitt der Schlange den Schwanz ab, um ihn als Medium zu gebrauchen.
Das Experiment wurde in dem Wohnzimmer vorgenommen, die Araber brauchten nichts davon zu merken.
Und richtig, kaum hatte Deasy den kurzen Schlangenschwanz in das linke Händchen genommen, als sie sofort die Augen schloss und in Trance fiel!
Das war das erste Wunder.
Das zweite bestand darin, dass sie den Schwanz des toten Tieres nicht sofort von sich schleuderte.
Und nun sollte gleich noch das dritte Wunder hinzu kommen. obwohl etwas ganz Ähnliches schon einmal passiert war, indem Deasy damals nicht die Person erblickt hatte, deren Haarlocke sie in der Hand gehalten, sondern jene Mumie im fernen Ägypten mit dem steinernen Schlüssel.
Etwas Ähnliches sollte hier kommen, aber doch wieder etwas ganz anderes.
»Was siehst Du, mein Kind?«
Lange blieb die Schläferin die Antwort schuldig, auch auf Wiederholung dieser Frage, bis sie endlich doch zu sprechen begann.
»Ich sehe ...«
Wieder verstummte sie
»Eine Schlange?«
»Einen Mann, einen Araber.«
Also wieder etwas ganz Ähnliches wie bei Edward Scotts Haarlocke.
Dann hob Deasy von selbst die rechte Hand, deutete nach oben.
»Dort oben ist er.«
»Einer der arabischen Handwerker?«
»Ja. Er hat einen langen gelben Stock, mit dem misst er an der Wand.«
Zweifellos ein Zollstock, auch Schmiege genannt, von den Engländern »footrule«, auf Arabisch »rassa«, und zwar bedienten sich diese arabischen Handwerker des Dezimalsystems, also des Meterstocks.
Deasy hatte in diesem Jahre fast vollständig Deutsch gelernt, in diesem schlafwachen Zustande aber bediente sie sich immer ihrer Muttersprache, des Englischen.
»Ja, ein Zollstock!«, wollen wir sie dennoch antworten lassen, weil wir hier nun einmal nicht englisch erzählen können. »Diesen Zollstock will ich haben. Halt! Jetzt knickt der Araber den Zollstock zusammen, legt ihn auf eine Kiste, auf der ein Topf steht, aus dem zwei Pinsel hervorsehen. Diesen Zollstock will ich haben.«
»Wozu, mein Kind?«
»Das weiß ich nicht. Ich will diesen Zollstock haben, ich brauche ihn.«
Der Prinz selbst ging hinauf.
Richtig, da stand eine Kiste mit einem Kleistertopf, aus dem die Stiele von zwei Pinseln hervorsahen. Aber ein Zollstock lag nicht auf der Kiste.
»Hat hier eine Rassa gelegen?«, fragte er trotzdem.
Jawohl, er brauchte nur näher zu fragen — ein Arbeiter hatte vor einer Viertelminute seinen Zollstock dorthin gelegt gehabt, hatte ihn aber unterdessen zur Benutzung schon wieder weggenommen.
Der Zollstock wurde ihm gern überlassen.
Der Prinz begab sich wieder hinab, wo ihm sofort berichtet wurde, dass Deasy gesehen hatte, wie der Araber seinen Meterstab wieder von der Kiste genommen hatte.
Es war einer von zwei Meter Länge, mit einschnappenden Federn an den Gelenken, sodass bei Geradestellung ein Zusammenknicken von allein verhindert wurde.
»Was willst Du nun mit diesem Zollstock, mein Kind?«
»Öffne ihn ganz auseinander. So. Nun knicke ihn genau in der Mitte zusammen. So. Nun gib ihn mir, in jede Hand ein Ende.«
Es geschah. In der linken Hand behielt das Kind dabei noch den Schlangenschwanz, sagte, dass dies nötig sei, ohne aber selbst angeben zu können, wozu es dies alles tue.
Und alsbald stand Deasy von ihrem Stuhle auf, mit geschlossenen Augen, den in sehr spitzem Winkel geknickten Zollstock etwas nach unten haltend, und so ging sie geradeaus, beschrieb dann einen Bogen, näherte sich der mit einem Teppich verhangenen Wand, hier blieb sie stehen und schlug mit der Spitze des Holzwinkels nahe des Bodens gegen diese Wand.
»Ach, jetzt habe ich es!«, rief da der Prinz. »Sie benutzt den Zollstock als Wünschelrute!«
Die Wünschelrute!
So weit sich die Geschichte der Menschheit zurückverfolgen lässt, hat es bei allen Völkern zu allen Zeiten Personen gegeben, welche mit einem Instrumente, meist einem gabelförmigen Zweige, den man also mit beiden Händen fassen kann, Verborgenes und Verstecktes aufsuchten: Wasser, Kohlen, Gesteine, Erzgänge, Metalle und so weiter, ferner können sie auch einen Dieb ausfindig machen, die Spuren eines Mörders verfolgen und so weiter. Schließlich wird durch die Rute auch die Uhrzeit angegeben, die Zukunft befragt und so weiter.
In der Bibel erwähnt die Wünschelrute der Prophet Hosea, wo er im vierten Kapitel den Israeliten über ihre Abgötterei und Zauberei eine Strafpredigt hält, wo es in Vers 12 heißt: Mein Volk fragt sein Holz, und sein Stab soll ihm predigen.
Womit doch zweifellos nichts anderes als die Wünschelrute gemeint ist.
Sonst erzählen über die Rhabdomantie, wie der wissenschaftliche oder doch gelehrte Name für die »Rutengängerei« ist, noch Moses Maimonides, St. Chrysostomus und Saxo Grammaticus, also über diesen Aberglauben, wie er im Altertume betrieben wurde.
Wir überspringen das ganze Mittelalter und wenden uns einem Falle zu, der sich im Jahre 1692 in Lyon abspielte, worüber die gerichtlichen Protokolle und sonstigen Urkunden noch heute erhalten sind. Für das Publikum wiedergegeben sind sie in einem Werke von Vallemont, Paris 1692, ins Deutsche übersetzt von Wille, unter dem Titel »Der heimliche Naturkündiger oder Beschreibung der Wünschelrute«, Nürnberg 1694.
Am 5. Juli 1692 wurde zu Lyon ein Weinhändler mit seiner Frau auf raffinierte Weise ermordet, von dem Täter fehlte jede Spur, und nun heißt es in dem genannten Buche:
Ein Nachbar, den die Tat äußerst schmerzte, erinnerte sich, daß er einmal von einem Bauern namens Jacob Aymar gehört habe, in der Nähe von Lyon, welcher die Kunst verstände, Räubern und Mördern nachzuspüren. Er ließ ihn nach Lyon kommen und stellte ihn dem Königlichen Gerichtsprokurator vor, dem dieser Bauer versprach, daß er, wenn man ihn an den Ort, wo der Mord geschehen, führe, damit er sich die Impression davon recht machen könne, dem Schuldigen gewiss auf dem Fuße nachfolgen und ihn, wo er auch immer sein möchte, ausfindig machen wolle. Hierzu brauche er eine Wünschelrute; doch sei es gleichgültig, von was für Holz, zu welcher Zeit und ohne Zeremonie geschnitten. Die Richter schickten ihn dann in das Gewölbe, worin die Tat geschah. Hier sah man eines der seltsamsten Phänomene. Der Bauer kam ganz außer sich, sein Puls schlug als wie im heftigsten Fieber, und die Rute, die er in den Händen hielt, schlug an beiden Orten, wo man die entseelten Körper des Weinhändlers und seiner Frau gefunden hatte, mit aller Macht. Sobald er nun die Impression recht gemacht hatte, folgte er seiner Rute durch alle Gassen, durch welche der Mörder seinen Weg genommen hatte. Er ging in den Hof des Erzbischofs und kam also an das Tor der Rhône, welches verschlossen war.
Das Weitere soll kürzer wiedergegeben werden.
Jacob Aymar verfolgte innerhalb von dreizehn Tagen mit seiner Wünschelrute die Spur des Mörders fünfundvierzig geografische Meilen weit, immer kreuz und quer, die Rute schlug in Wirtschaften auf Stühle, auf denen der Mörder gesessen hatte, auf Krüge und Gläser, aus denen er getrunken hatte, auf Betten, in denen er geschlafen, bis die Rute den Bauern endlich nach der Stadt Beaucaire führte, in die Kaserne hinein und hier einen Soldaten als den gesuchten Mörder bezeichnete.
Ob das nun aber auch wirklich der Mörder war, das war doch noch sehr die Frage.
Auffallend war vorläufig nur, dass sich dieser Mann, der sich Bossu nannte, erst vor acht Tagen zu den Soldaten hatte anwerben lassen.
Doch man brauchte nicht lange zu warten.
Dieser Soldat Bossu gestand fast sofort, ohne Anwendung der Folter, vor zwei Wochen in Lyon den Weinhändler und seine Frau ermordet zu haben!
Aymar kam an den königlichen Hof, musste mit seiner Wünschelrute Kunststückchen vormachen, versteckte Gegenstände suchen und dergleichen mehr und ... verlor bald seine Gabe.
Wie es auch allen spiritistischen Medien geht, sobald sie aus ihrer Gabe einen Beruf machen, sich öffentlich für Geld produzieren. — — —
Damals lebte in Halle a. S. ein Privatgelehrter namens Johann Gottfried Zeidler, Magister der Philosophie, ein wegen seiner Gelehrsamkeit, Rechtlichkeit und Wohltätigkeit hochangesehener Mann.
Dieser las das erwähnte französische Buch, das den Fall Aymar behandelt, kam auf die Idee, es einmal selbst mit der Wünschelrute zu probieren und fand zu seinem Staunen, dass auch in seinen Händen das Winkelholz auf alles anschlug, worauf er seine Gedanken konzentrierte. Er fand in seinem Garten und im benachbarten Walde und anderswo alles, was man versteckte, auch er konnte jede Spur verfolgen, auch kam er auf die Idee, ein großes Zifferblatt zu malen, und wenn er die Rute darüber hielt, mit der Absicht, die richtige Zeit zu erfahren, die er nicht wissen konnte, so gab die aufschlagende Rute diese Zeit richtig bis zur Minute an. Auch entdeckte er, dass er diese seine wunderbare Gabe auf jede andere Person übertragen konnte, er brauchte nur hinter sie zu treten und ihre Handgelenke zu fassen, manchmal genügte es auch schon, die beiden Ohren zu berühren, bis er fand, dass er die Verbindung auch durch nasse Stricke, später durch Kupferdrähte herstellen konnte. Dann schlug die Rute auch in den Händen der mit ihm so verbundenen Person.
Zeidler hat innerhalb von fünf Jahren zahllose Experimente dieser Art gemacht, hat seine Erfahrungen in seinem Buche niedergelegt, betitelt »Pantomysterium oder Neues von der Wünschelrute als einem Werkzeuge menschlicher verborgener Wissenschaft, samt Widerlegung des dabei gehegten Aberglaubens.« Erschienen Halle 1700.
Dann weiter hat sich mit der Wünschelrute auf streng wissenschaftlicher Basis der berühmte Mailänder Mineraloge Carlo Amoretti beschäftigt, der als erster ganz natürliche, elektrische Einflüsse annahm, daher auch zuerst das Wort »Elektrometer« gebrauchte. Das Resultat seiner Forschungen und Experimente, mit 152 für die Wünschelrute empfänglichen Personen angestellt — denn er selbst war es nicht — hat Amoretti in seinem Werke »Della Raddomanzia« niedergelegt. Mailand 1808, ins Deutsche übersetzt von C. U. von Salis, Berlin 1809.
Und was hat nun zu alledem die Wissenschaft, das heißt die geschlossene Kompanie der gelehrten Welt gesagt? Gar nichts!
Wünschelrute, bah, so was gibt's doch gar nicht, mit solch einem Aberglauben beschäftigen wir uns doch gar nicht!
Infolgedessen ist in der letzten Ausgabe von Brockhaus' großem Konversationslexikon, 1908, folgendes zu lesen:
Wünschelrute, ein zauberhaft heilbringender Stab, war in Deutschland von altersher bekannt und wurde besonders im spätern Mittelalter zum Gegenstand eines bis in die neuere Zeit fortdauernden Aberglaubens. Man glaubte mittels der Wünschelrute verborgene Schätze, Erzadern, Wasserquellen, ja selbst Verbrecher entdecken zu können und brach sie unter gewissen Bedingungen und Formeln von dem gabeligen Aste eines Haselstrauches oder Kreuzdorns, oder machte sie auch aus Metalldraht und unterschied mehrere Arten: Feuerrute, Springrute, Schlagrute usw. Bei dem Gebrauche kam es darauf an, sie unter Hersagung der nötigen Formeln richtig in der Hand zu halten; dann zeigte sie durch ihre Bewegung, ob und wo die gewünschten Gegenstände verborgen seien.
So das Konversationslexikon, das man doch als die Quintessenz aller menschlichen Weisheit betrachten muss, im Jahre des Heils 1908.
Dabei beachte man auch, wie jener französische Bauer, schon vor mehr als 200 Jahren ausdrücklich erklärt, dass es gleichgültig sei, aus welchem Holze und an welchem Orte er seine Wünschelrute schneide und dass er dies ohne jede Zeremonie tue! Und in allen den erwähnten Büchern wird ebenso betont, dass das Schlagen der Wünschelrute ohne alle Formeln und sonstigen Hokuspokus vor sich geht, es kommt immer nur darauf an, ob die betreffende Person dazu veranlagt ist oder nicht, und Amoretti nun vollends erklärt die ganze Sache auf rein wissenschaftlichem Wege mit Hilfe der Elektrizität.
Übrigens haben noch viele andere darüber ebenso geschrieben, die hier angeführten Bücher sind nur diejenigen, welche der Schreiber dieses selbst gelesen hat.
Für die gelehrte Welt in summa, für die Kathedergelehrten, haben alle diese Männer vergebens geschrieben! Sie existieren einfach nicht für diese gelehrte Kompanie, sie werden totgeschwiegen!
Nun aber passiert ein nettes Geschichtchen.
Eben in demselben Jahre, also 1908, meldet sich beim deutschen Kolonialministerium ein Staatsbeamter, ein Regierungsrat, und beweist vor einer Kommission, dass er die Gabe besitzt, mit der Wünschelrute verborgene Wasseradern zu finden.
Der Herr wird sofort nach Deutsch-Südwestafrika geschickt, und wo seine Wünschelrute anschlägt, da wird tatsächlich überall Wasser gefunden, und glaubt man, er habe sich einmal geirrt, so braucht nur noch tiefer gebohrt zu werden, und immer wieder stößt man auf Wasser! Allerdings manchmal erst in einer so großen Tiefe, dass es nicht mehr gehoben werden kann.
»Schrumm, ein ander Bild!«, sagt der Guckkastenmann.
Zwei Jahre später, also 1910, erscheint vom Brockhaus das Supplement, und da ist zu lesen:
Wünschelrute. Verschiedene Erfolge, die in neuester Zeit mit der Wünschelrute auch von wissenschaftlich und technisch gebildeten Männern beim Aufsuchen von Wasseradern in wasserarmen Gegenden erzielt wurden, haben dazu geführt, eine wissenschaftliche Erklärung zu versuchen. Diese glaubt man in der Radioaktivität des Grundwassers gefunden zu haben, das die aus dem umgebenden radioaktiven Gestein abgesonderte Emanation aufgenommen hat. Die Betastrahlen durchdringen dann die über dem Grundwasser lagernden Schichten, wenn diese nicht zu mächtig sind, elektrisieren die darüber befindliche Luft negativ und beeinflussen die durch das Tragen der Wünschelrute angespannte Armmuskulatur bis zur Muskelzuckung. Eine auch nur geringe Zuckung gibt dann Anstoß zum Aufschlagen der Rute.
Aaaaah, was für eine Weisheit, die da im Jahre 1910 zutage kommt!
Nur schade, dass Zeidler dies alles schon vor 200 Jahren genau ebenso erklärt hat, nur dass er das Radium noch nicht kannte, sondern einfach von elektrischen Einflüssen sprach, dafür aber nicht nur von der Wirksamkeit der Wünschelrute auf Wasser, sondern überhaupt auf alles, alles, worauf man seinen Willen konzentriert! Und wieder 100 Jahre später, jetzt vor 100 Jahren, hat Amoretti diese theoretische Erklärung noch viel exakter ausgeführt und weiter bewiesen, dass man die Wirksamkeit der Wünschelrute noch dadurch sehr unterstützen kann, dass man von der Substanz, auf welche die Wünschelrute anschlagen soll, etwas in eine oder beide Hände nimmt. Sucht man Wasser, so nimmt man also etwa einen nassen Schwamm in die Hand, beim Suchen nach Kohle etwas Kohle, und so weiter.
Hiervon war dem Konversationslexikon also auch im Jahre 1910 noch nichts bekannt.
Nun aber ging die Sache schnell weiter, der Stein war einmal ins Rollen gekommen.
Im September dieses Jahres, 1913, tagte zu Halle eine gelehrte Kommission, aus ganz Deutschland zusammengekommen, um das Wesen der Wünschelrute zu ergründen.
Und da ist der bisherige Aberglauben der Wünschrute einstimmig als eine Tatsache anerkannt worden!
Wir lassen, um etwas Handgreifliches zu geben, wovon sich jeder überzeugen kann, hier einen Bericht aus dem »Dresdner Anzeiger« folgen, von Dienstag, dem 23. September 1913, unter der Rubrik »Kunst und Wissenschaft« stehend:
Auf dem deutschen Wünschelrutentag in Halle a. S. berichtete der Berghauptmann Scharf über die Rutengänge bei Schöneberg, Eisleben und Köthen. Bei Schöneberg wurden drei Kalilager angegeben, die auch durch die Grubenkarten bestätigt wurden. Außerdem wies die Wünschelrute zwei Kalilager auf, deren Vorhandensein dem Staate außerordentlich angenehm sein würde. Es werden Bohrungen vorgenommen werden. Bei Eisleben konnten unterirdische Hohlräume festgestellt werden. Bei Köthen zeigte die Wünschelrute genau die Braunkohlenlager an, die man schon aus früheren Bohrungen kennt. An einigen Stellen handelt es sich jedoch um bisher noch unbekannte Kohlenlager, die noch abgebohrt werden >müssen. — —
So geht's, meine Herrschaften! So ist es auch dem Hypnotismus ergangen, und so wird es auch noch einmal dem Spiritismus ergehen.
Gott, Du bist groß!
Himmel und Erde sind voll Deiner Wunder!
Aber — wie Du es selbst gesagt hast durch den Mund Deiner Propheten — Du verheimlichst sie den Klugen und Hoffärtigen, die Du von ferne kennst, und offenbarst sie den Kindern und Unmündigen!
Die Unmündigen sind hierbei diejenigen Männer der Wissenschaft, die von der anderen gelehrten Welt totgeschwiegen, mundtot gemacht werden!
Und nun zum Schlusse dieser Ausführungen noch ein Wort von Goethe, welches er spottend den damaligen Gelehrten zuruft:
Was Ihr nicht tastet steht Euch meilenfern,
Was Ihr nicht faßt das fehlt Euch ganz und gar,
Was Ihr nicht rechnet glaubt Ihr, sei nicht wahr,
Was Ihr nicht wägt, hat für Euch kein Gewicht,
Was Ihr nicht münzt das meint Ihr, gelte nicht.
(...)
Ihr durchstudiert die groß' und kleine Welt,
Um es am Ende gehn zu lassen,
Wie's Gott gefällt.
»Ach, jetzt habe ich es! Sie benutzt den Zollstock als Wünschelrute!«
So hatte Prinz Joachim gerufen, als das Kind mit geschlossenen Augen, also in Trance befindlich, aufgestanden war und auf einem kleinen Umwege sich nach der Wand begeben hatte, gegen diese nahe des Bodens mit der Spitze des zum Winkel zusammengeknickten Zollstockes klopfend.
In jener okkultistischen Bibliothek des siebenbürgischen Schlosses hatten sich auch viele Bücher über die Wünschelrute befunden, auch das erwähnte von dem Franzosen, der den Fall Aymar behandelt, das von Zeidler und das von Amoretti, der Prinz hatte sie gelesen, ebenso noch manche andere.
Er war niemals so wenig wie sein Freund Walten auf den Gedanken gekommen, das mediumistisch veranlagte Kind daraufhin zu prüfen, ob es vielleicht auch auf die Wünschelrute reagiere.
Es hatte eben nicht sein sollen.
Und Deasy hatte niemals etwas von einer Wünschelrute gehört.
Sie war durch andere, durch übersinnliche Weise dazu veranlasst worden, einmal solch einen Versuch zu machen, durch einen innerlichen Trieb oder wie man das nun sonst nennen mag.
Das Kind hatte die Sorge seiner Freunde wegen der Giftschlangen gesehen — seine eigene Furcht kam dabei wohl gar nicht in Betracht — es hätte so gern geholfen, da war es plötzlich auf die Idee gekommen, etwas von der getöteten Schlange in die Hand zu nehmen, mit Hartnäckigkeit, weil eben einem Unbewusstsein entspringend, hatte es auf seinem Willen bestanden, und da war es auch in Trance gefallen, hatte jenen Zollstock gesehen, als das geeignetste Instrument, mit dem es seinen Freunden helfen konnte, ohne natürlich selbst dafür irgend eine Erklärung zu wissen.
Und es sollte auch noch ganz, ganz anders kommen.
»Ja, was ist denn das? Weshalb stehe ich denn hier mit dem Zollstock?!«
So fragte Deasy plötzlich, den Prinzen mit großen, erstaunten Augen anblickend.
Sie war aus der Trance erwacht.
Aber der Prinz brauchte nicht zu fürchten, dass hiermit nun die Sache vorbei sei. Es sollte immer noch besser kommen.
»Was ist denn das?! Warum zuckt denn der Zollstock so, als wäre er lebendig?!«
Erschrocken und ängstlich warf sie den Zollstock und auch den Schlangenschwanz von sich.
Sie wurde beruhigt, bekam eine kleine Erklärung, so weit das Kind verstand, und willig nahm sie wieder den Zollstock in beide Hände, und zwar diesmal ohne den Schlangenschwanz.
Und trotzdem schlug die Spitze des Zollstocks wieder gegen jene Stelle der Wand, ohne dass sie etwas dazu tat, wie man ganz deutlich erkennen konnte.
Das mediumistisch veranlagte Kind hatte sich im unbewussten Zustande selbst auf die ihm noch unbekannte Gabe aufmerksam gemacht. Wie es bei den meisten Medien geschieht, wenn man nur alles richtig beobachtet, frei von jedem Vorurteil, wozu natürlich auch gehört, dass man nicht von vornherein sagt: So etwas ist ja gar nicht möglich!
Also dort in der Wand, wo die Wünschelrute ausschlug, saß eine Schlange.
So musste man doch annehmen.
Dass dies eine falsche Annahme war und wie leicht man da zu solchen Trugschlüssen kommt, soll später geschildert werden.
Der Teppich wurde gehoben, an der Wand war kein Löchelchen zu bemerken, durch das die Schlange hätte eingeschlüpft sein können. Nun, so war sie eben anderswo eingeschlüpft, die Mauer hatte einen hohlen Gang.
Alles falsche Schlüsse, wie später ergründet werden sollte!
Zunächst ließ man die Schlangen einmal sein. Erst gab es noch anderes zu konstatieren.
Deasy, jetzt also vollkommen wach, musste hinausgehen, in Begleitung eines Mannes.
Der Prinz nahm aus der Tasche ein Goldstück — Gold ist Gold, daran denkt man immer zuerst —, verbarg es unter dem Teppich, der ziemlich den ganzen Boden des großen Zimmers bedeckte.
Das Hauptmuster dieses Teppichs bestand aus Längs- und Querstreifen, jeder ungefähr einen Meter vom anderen entfernt.
Das Goldstück lag gerade unter dem Kreuzpunkt zweier solcher Streifen.
Jetzt wurde Deasy hereingerufen und ihr der geknickte Zollstock in die Hand gegeben.
»Unter dem Teppich liegt irgendwo eine englische Guinee, ein Goldstück, willst Du es suchen?«
Das Resultat entsprach durchaus den gehofften Erwartungen.
Deasy schritt kreuz und quer auf dem Teppich herum, kam mit dem Zollstock in die dichte Nähe des Goldstückes, aber die Wünschelrute wollte nicht anschlagen.
»Nun gehe einmal immer auf den Längsstrichen, der Reihe nach, die Winkelspitze immer dicht über dem betreffenden Strich.«
Es geschah, und da allerdings schlug die Wünschelrute auf dem Punkte, unter dem das Goldstück lag, stark an. Jetzt wurde Deasy wieder hinaus geschickt, die Lage des Goldstückes verändert, sie wurde wieder hereingerufen und bekam diesmal in ihre linke Hand ein Goldstück.
Und nun geschah das Merkwürdige.
Kaum hatte Deasy das Goldstück und den Zollstock in die Hand genommen, als dieser förmlich verdreht wurde, bis die Winkelspitze dorthin wies, wo das versteckte Goldstück lag.
Sie wurde aufgefordert, sich noch einmal umzudrehen. aber es gelang ihr kaum, man sah deutlich, wie sich der Zollstock in ihren Händen förmlich wand, die Gelenke knickten ein, und hätte er keine solche Gelenke gehabt und das Mädchen wäre kräftig genug gewesen, ihn festzuhalten, so wäre er jedenfalls zerbrochen. So wie Zeidler berichtet, dass auch ihm die Rute, wenn er ihr nicht folgen wollte, oftmals aus den Händen gewunden wurde, oder sie zerbrach.
Aufgefordert, nun dem geheimnisvollen Willen des Zollstocks nachzugeben, ging Deasy stracks nach jenem Punkte hin, wo der spitze Winkel heftig ausschlug.
Wieder hinaus, wieder herein.
»Hier hast Du wieder das Goldstück in Deine Hand, nun suche das versteckte Goldstück.«
Diesmal war die Wünschelrute nicht wieder so gehorsam. Wohl drehte sie sich auch jetzt in den Händen des Kindes, aber nicht so heftig wie vorhin.
Es dauerte einige Zeit, bis der Winkel den richtigen Punkt anklopfte.
Und da allerdings zeigte es sich, dass der Prinz gar kein Goldstück versteckt hatte, sondern einen silbernen Shilling, und dem Kinde hatte er auch kein Goldstück in die Hand gegeben, sondern unbemerkt von ihr einen kupfernen Zweipfenniger!
Also es kommt gar nicht darauf au, dass es immer die gleichen Metalle oder Substanzen sind, welche die gegenseitige Wechselwirkung ausüben, was aber auch schon Amoretti ausführlich behandelt und theoretisch erklärt hat. Wohl kommen dabei elektrische Schwingungen in Betracht, aber das sind ganz andere als die, die wir aus der Natur kennen. Hierbei spielt die Hauptrolle der tierische Magnetismus, der von der Einbildungskraft reguliert wird.
Dass aber auch wirklicher Magnetismus eine Rolle spielt, das zeigte ja eben, dass die Wünschelrute am lebhaftesten reagierte, wenn das Kind dasselbe in der Hand hatte, was versteckt worden war. Nahm sie aber die betreffende Substanz in die rechte Hand, so versagte die Wünschelrute vollkommen. Nur ihr linker Arm war so ungemein sensitiv.
Wir überspringen die zahllosen, immer verwickelter werdenden Versuche, die der Prinz mit dem Kinde anstellte, und geben nur die interessantesten Hauptsachen wieder.
Anfangs hatte sich Deasy vor dem in ihren Händen lebendig werdenden Zollstock gefürchtet, aber bald gewöhnte sie sich daran, es bereitete ihr die größte Freude, mit sich solche Experimente anstellen zu lassen.
Wie war es nun mit der persönlichen Übertragung?
Das gelang nicht.
Der Prinz nahm den Zollstock in beide Hände, Deasy trat hinter ihn, fasste seine beiden Handgelenke — die Wünschelrute schlug niemals an, gleichgültig ob sie oder er das Goldstück oder irgend etwas anderes in die linke oder in die rechte Hand oder in alle beide nahm.
Darüber brauchte man sich nicht zu wundern.
Amoretti sagt, dass von den 152 »Rutengängern«, mit denen er experimentiert hat, jeder total andere Eigenschaften gezeigt hat als der andere, jeder einzelne musste ganz individuell behandelt werden. Hier liegen eben nicht nur einfache Naturgesetze vor, die man berechnen und in Formeln zwängen kann, hier liegt etwas Psychologisches, Geistiges vor, hier kommt das magische Seelenleben des Menschen in Betracht.
Infolgedessen, eben weil der Prinz hierüber schon so viel gelesen hatte, verlor er nicht gleich den Mut, auch alle anderen mussten einmal antreten.
Vergebens, die Gabe dieses Kindes war nicht übertragbar.
Und doch!
Ganz zuletzt kam auch der Matrose Hein daran.
Und kaum hatte Deasy seine Handgelenke von hinten gefasst, als die von Hein gehaltene Rute heftig ausschlug.
Das Goldstück oder etwas anderes wurde nochmals versteckt, Hein wusste es immer zu finden, wenn Deasy hinter ihm her marschierte und seine Handgelenke oder seine Ohren berührte, und wenn entweder er oder sie die Gegensubstanz in der linken Hand hielt.
Dasselbe wurde erzielt, als man die Handgelenke der beiden durch Kupferdrähte verband. Wenn dann Hein der Richtung nicht folgen wollte, welche der Zollstock angab, so drohte dieser, festgehalten, zu zerbrechen, knickte in den Gelenken zusammen.
Wie kam denn nun gerade dieser Matrose Hein dazu? War dieser Kerl etwa mediumistisch veranlagt? Ausgeschlossen!
Sinnend betrachtete der Prinz den tabakkauenden Matrosen.
Und da ging ihm auch gleich eine Ahnung auf, er wusste schon, dass er die Erklärung gefunden hatte.
Wie schon erwähnt, trugen die Männer alle wegen der Schlangen hohe Stiefel, auch Deasy starke lederne Gamaschen, bis an die Knie reichend. Nur der Matrose Hein machte eine Ausnahme, er trug amerikanische Patentgummistiefel.
Der Prinz brauchte diese nicht erst anzuziehen, er hatte in seinem Gepäck, das sich bereits hier befand, Gummischuhe.
Sie wurden geholt, er zog sie über seine Stiefel.
Und es war wirklich so! Obgleich kein anderer Wünschelrutenschriftsteller darüber geschrieben hat, dass der Betreffende, auf den das Medium seine Gabe übertragen will, sich durch Gummisohlen isolieren müsse. Es lassen sich hierbei eben gar keine Gesetze machen, es muss bei jedem einzelnen Medium fortgesetzt experimentiert werden.
Hier tat die Gummiisolierung ihre Wirkung. Jetz konnte auch der Prinz empfinden, wie es war, wenn sich die Wünschelrute seinen Händen entweder zu entwinden oder zu zerbrechen drohte, wenn sie daran gehindert wurde, der magnetischen Anziehungskraft nachzugehen und auf den betreffenden Punkt aufzuschlagen. Dabei war es wieder gleichgültig, ob Deasy seine Handgelenke oder seine Ohren gefasst hatte oder ob sie durch meterlange Drähte mit ihm verbunden war. Es konnte auch Eisendraht sein. Aber er durfte nicht den Boden berühren, sonst wurde der tierische Magnetismus, oder was das nun sonst war, in den Boden abgelenkt. Also am besten umsponnene Kupferdrähte.
Der Matrose Hein war ein äußerst phlegmatischer Mensch. Er hatte, als es zuerst bei ihm geglückt war, nur ein etwas dummes Gesicht gemacht. Der Prinz dagegen war außer sich vor Staunen, er fürchtete sich fast noch mehr als vorhin das Kind vor diesem Zollstock. wie der in seinen Händen lebendig wurde, sich wand und bog und krümmte, ihn herumriss! Ein ganz unheimliches Gefühl! Bis man sich daran gewöhnt hatte.
Nun noch einmal einen Vergleich: Gesetzt den Fall, der gewöhnliche Magnetismus wäre uns noch ganz unbekannt — und diese Zeit hat es doch auch einmal gegeben — und da kommt jemand, zeigt ein großes Stück Eisen, legt ein anderes, kleines Stück hin, und plötzlich springt das kleine Stück in die Höhe, hängt sich an das große fest, lässt sich nur mit Gewalt wieder abreißen — was würden wir dazu sagen?
»O Wunder über Wunder!«, würden die Zuschauer rufen.
»So etwas gibt's ja gar nicht, und wenn ich's sehe, ich würde es noch lange nicht glauben, da ist irgend eine Taschenspielerei dabei.«
So würden die anderen sagen, denen man es erzählt.
So etwas kann man nämlich heute noch bei unkultivierten Völkern erleben. Es ist genau dasselbe wie hier mit der Wünschelrute, nur dass jener Magnetismus auf rein physikalischen Naturgesetzen beruht, dieser Magnetismus hier auf psychischen Gesetzen des unbewussten Ichs, die sich nicht messen und berechnen lassen, wenigstens vorläufig noch nicht.
Es hat eben jedes Ding zwei Seiten.
Alles hat ein zweites Gesicht!
Wolle sich der geneigte Leser dieses Wortes am Ende dieses Romans erinnern. — — —
Nun wollte man aus dieser wunderbaren Wünschelrute aber auch praktischen Nutzen ziehen.
Also das Suchen nach Schlangen wurde wieder aufgenommen.
Und da, nun schon gewitzigt, erkannte man bald, dass man die Wand dort, wo die Wünschelrute vorhin angeschlagen hatte und wo sie es auch jetzt noch tat, ganz umsonst demoliert hätte!
Denn glücklicherweise kam man auf den Gedanken. erst einmal in den benachbarten Raum zu gehen. Jetzt hätte die Wünschelrute doch an derselben Stelle der Mauer anschlagen müssen, nur auf der entgegengesetzten Seite.
Aber es fiel ihr gar nicht ein.
Sie führte das Kind wieder nach der nächsten Mauerwand, klopfte dort wieder an. Aber nicht wieder auf der gegenüberliegenden Seite. Sondern sie klopfte erst wieder auf der anderen Seite des Raumes an.
Was war daraus zu schließen?
Nun, die Rute gab eben nicht direkt den Ort an, wo die Schlange lag, sondern erst einmal die Richtung, und nun wollte die Wünschelrute gleich durch die Mauer hindurch!
Hierzu könnte nun mit Recht gesagt werden: Ja, dann hat das doch gar kein Ende. Irgendwo auf der Erde gibt es doch immer eine Schlange, oder auch speziell eine Efa, sie kommt auch in Indien vor, also da will die Wünschelrute nun auch bis nach Indien?
Nein, so weit geht die Sache nicht.
Es hat alles seine Grenzen.
Obgleich auch dieses Wort wie alles in der Welt eine Ausnahme hat.
Der Weltenraum selbst hat keine Grenzen.
Aber in diesem Falle gibt es Grenzen.
Die Anziehungskraft der Wünschelrute ist selbstverständlich eine beschränkte. Je weiter entfernt der gesuchte Gegenstand ist, desto schwächer wird die Wirkung, was bei jedem einzelnen »Rutengänger« ausspekuliert werden muss.
In der Erde ist doch schließlich alles vorhanden, alles. Wenn nicht hundert Meter tief, dann eben 10 000 Meter tief. Da aber schlägt die Wünschelrute eben nicht mehr an, und das ist ja eben das Schöne, dass bei solchen Entfernungen die Wirkung aufhört. Sonst würde man ja fortwährend genarrt.
Nun aber kommt auch noch etwas anderes hinzu. Das Mitwirken des unbekannten Ichs des Mediums.
Das Kind wusste bei vollem Bewusstsein, dass es ihren Freunden jetzt nur darauf ankam, die innerhalb dieser Klostermauern befindlichen Schlangen aufzuspüren. und auch nur erst einmal in diesem Erdgeschoss, in dem sie sich jetzt befanden. Das übertrug sich auf des Kindes unbewusste Intelligenz, also zeigte die Rute auch nicht auf Schlangen, die sich außerhalb der eigentlichen Hausmauern befanden, zeigte nicht nach oben und nicht nach unten, vorläufig kamen auch nicht die Schlangen im Klostergarten in Betracht. Ja, es brauchte dem Kinde nur gesagt zu werden, es solle nur anzeigen, ob sich in dem betreffenden Raume eine Schlange befände, so schlug die Rute auch nicht mehr an, wenn sich in dem benachbarten Raum eine Schlange aufhielt, obgleich das Kind ja selbst die Rute gar nicht kontrollieren konnte. Das geschah eben aus dem Unbewussten heraus.
Auf diese Weise konnte konstatiert werden, wo sich tatsächlich eine Schlange in der Mauer aufhielt. Wenn die Rute nicht einmal log. Sie schlug auch auf der anderen Seite gegen dieselbe Stelle der Mauer. Hier wurde einmal mit Hacke und Stemmeisen nachgeforscht. Da aber passierte etwas sehr Unangenehmes. Gar nicht lange währte es, so fing der Zollstock in Deasys Händen wieder zu schlagen an, klopfte längs der Wand hin.
Was hatte das zu bedeuten?
Nun, die Schlange hatte da drin einfach einen Tunnel, in dem nahm sie jetzt vor dem Geräusch die Flucht, und auf solch einen Mäusegang stieß man denn auch tatsächlich.
Da verzichtete man aber lieber auf weiteres Nachgraben, oder man hätte ja gleich alle Wände demolieren können. Diesen Schlangen hier im Mauerwerk musste später auf andere Weise zu Leibe gerückt werden, da hoffte man noch auf einen Haui, einen Schlangenbeschwörer.
Anders war es in dem Klostergarten, in den man sich jetzt begab.
Musste da aber das Kind nicht etwas von einer Hornviper in die Hand nehmen, wenn es solche aufspüren wollte?
Das war durchaus nicht nötig. Es handelte sich um Schlangen, da tat das Schwanzende der Efa dasselbe. Ja, man hätte dem Kinde schon jetzt irgend einen Lappen in die Hand geben können, von ihm ungesehen, mit der Behauptung, es sei ein Stück Schlangenhaut, der Lappen hätte dieselbe Wirkung erzeugt. Das sind alles nur gewissermaßen mnemotechnische Hilfsmittel, zum Anreizen der Einbildungskraft, zum Befördern der Gedankenkonzentration. Später hatte Deasy dies alles gar nicht mehr nötig.
Sehr nötig allerdings war eine Aufforderung von anderer Seite.
»Also, Deasy, nun zeige einmal, wo sich hier im Sande eine Schlange verbirgt.«
Erst jetzt, aber auch sofort, begann der geknickte Zollstock in den Kinderhänden lebendig zu werden, bog sich nach einer bestimmten Richtung, Deasy folgte ihr. Dabei tippte der spitze Winkel bei jedem Schritte des Kindes einmal auf den Sand nieder, was die Wünschelrute aber auch schon oben auf dem Teppich getan hatte, was aber etwas ganz, ganz anderes war als ein richtiges Klopfen. Zunächst gab die Rute gewissermaßen an, dass ihr Träger auf dem richtigen Wege war.
Nur wenige Schritte, und der spitze Winkel schlug mit Vehemenz auf den Sand nieder, wieder und immer wieder, peitschte ihn förmlich.
Mit Harke und Schaufel wurde der Sand aufgewühlt. Die anderen standen mit Stöcken bereit.
Hatte sich die Wünschelrute geirrt? Der Sand war entfernt, der glatte Steinboden lag frei, und nichts von einer Schlange war zu sehen. Unterdessen stand Deasy ruhig daneben, die Rute gab kein Zeichen mehr.
»Da da da da!«, schrie plötzlich der Prinz, sprang einen Schritt seitwärts und schlug mit seinem Stocke zu.
Er hatte eine große Hornviper getötet.
Nur sein Falkenauge hatte sie erblickt, wie sie sich schon wieder in den Sand einbohren wollte.
Das gelb gefärbte Tier war in dem gelben Sande eben kaum zu erkennen. Und ist der Sand weiß oder rot, so färbt sie sich weiß oder rot, verändert ihre Farbe wie das Chamäleon.
»Noch mehr Schlangen?«
Sofort begann die Wünschelrute wieder zu arbeiten.
Nun aber brauchte man nur zu wünschen, das heißt das Kind aufzufordern, die Rute möchte auf die ungesehen ausgeworfene Schlange schlagen, und es geschah, was vorhin also nicht der Fall gewesen war.
Und in noch nicht einer Stunde wurden auf diese Weise in dem Sande des Klosterhofes achtzehn Hornvipern aufgespürt und totgeschlagen!
Dann zeigte die Wünschelrute innerhalb der einschließenden Mauern keine Schlange mehr an — die sich außerhalb dieser Mauern befanden, gingen sie nichts an.
Man war absolut sicher, dass der Garten jetzt frei von Nilwürmern war.
Es wurde zu anderen Experimenten geschritten.
An den Umfassungsmauern und den Klosterwänden wurden Markierungszeichen angebracht, zwischen diesen musste ein Mann kreuz und quer hin und her gehen, Deasy durfte nicht hinsehen, der Prinz zeichnete den Weg, den jener genommen, auf einem Blatt Papier auf, wozu eben die Markierungszeichen.
Dann wurde der ganze Platz geharkt, Deasy musste mit der Wünschelrute folgen. Zuerst bekam sie von dem Manne eine abgeschnittene Locke in die linke Hand, dann später sein Taschentuch, zuletzt gar nichts mehr, und es ging auch.
Ab und zu tippte der spitze Winkel des Zollstockes auf den Sand nieder, und zwar, wie man leicht berechnen konnte, immer genau dorthin, wo der Mann seinen Fuß gesetzt hatte, und wenn er eine scharfe Schwenkung gemacht hatte, so krümmte sich der schmiegsame Stab nach der neuen Richtung, er hätte sich ihren Händen entwunden, wenn sie nicht gefolgt wäre, und so ging das weiter, bis die Wünschelrute den Betreffenden unter allen den anderen herausgefunden hatte, heftig auf seine Füße schlagend.
»O Wunder!«, staunte der Prinz immer wieder.
Ja, was man hiermit noch machen konnte, das musste erst die Zeit lehren und die Gelegenheit bringen.
Eine solche Gelegenheit kam sofort.
Kapitän Falkenburg hatte vorhin beim Graben sein Taschenmesser verloren.
Und immer wieder geschah etwas ganz anderes, als man erwartet hatte.
Deasy bekam einen eisernen Nagel in die Hand, der Zollstock gab die Richtung an, schlug heftig auf.
Als man nachgrub, fand man im Sande ein altes Hufeisen.
Ja, so etwas konnte natürlich passieren! Da musste erst noch viel experimentiert werden, ehe man sich gegen solche Irrtümer schützen konnte. Wenn man das überhaupt einen Irrtum nennen durfte.
Die Wünschelrute ging willig von Neuem auf die Suche, schlug auf — man fand ein Stück verrostetes Bandeisen.
»Ich will lieber keinen Nagel in der Hand haben!«, sagte das Kind von selbst.
Trotzdem bog sich auch jetzt noch die Rute in Deasys Hand, benahm sich aber ganz anders, berührte nicht mehr tippend den Boden, sondern die Spitze ging gleich frei durch die Luft, und zwar auf niemanden anders zu als auf Kapitän Falkenburg, berührte dessen Füße, die Spitze des Zollstockes kletterte gewissermaßen an seinem Bein in die Höhe, ging mehr nach hinten, Deasy musste folgen, und schlug ganz energisch gegen das Hinterteil des Kapitäns.
Dieser, gar nicht wissend, was das bedeuten solle, so wenig wie die anderen, griff schließlich doch dorthin, wo die Rute immer aufschlug und ... brachte mit ganz verdutztem Gesicht aus der hinteren Hosentasche sein vermisstes Messer zum Vorschein!
Er hatte nicht gewusst, dass er es dorthin gesteckt, glaubte ganz bestimmt, er habe es vorhin im Sande verloren.
Hierbei aber war, musste man annehmen, auch noch das unbewusste Hellsehen des Kindes in Betracht gekommen.
Ein neues Experiment, das auch wieder einen ganz unerwarteten Ausgang nehmen sollte.
Ungefähr in der Mitte des Klostergartens befand sich der ummauerte Brunnen.
Aus einem gewissen Grunde hätte der Prinz gern gewusst, welchen Lauf die unterirdische Wasserader nahm. Denn eine solche konnte hier nur in Betracht kommen, kein Grundwasser.
Ein Läppchen wurde nass gemacht, Deasy nahm es in die linke Hand.
Aber wiederum ging der spitze Winkel des Zollstockes nicht auf den Boden nieder, sondern schwebte frei durch die Luft nach der Seite hin.
Auf dieser südlichen Seite war der Klostergarten nicht durch eine künstliche Mauer, sondern durch die jäh aufsteigende Felsenwand des Gebirges begrenzt, und dorthin ging die Wünschelrute, berührte diese Felsenwand, erst hier machte sie in Brusthöhe Sprünge, bis sie nach kurzer Zeit stehen blieb und heftig aufschlug.
War dort etwa eine noch verschlossene Quelle, die nur der Befreiung wartete?
Man musste es annehmen, zumal dann auch noch die Wünschelrute die unterirdische Wasserader angab, die den Brunnen speiste.
Und nach wenigen Tagen schon sollte denn auch hier dem angebohrten Felsen eine dauernde Quelle entspringen, die dem sandigen Garten bald ein ganz anderes Aussehen gab.
Moses schlug mit dem Stabe an den Felsen, und es sprang Wasser heraus.
Das wäre ein unbegreifliches Wunder gewesen.
Diese Sache lässt sich aber noch von einer anderen Seite betrachten.
Diese Stelle der Bibel ist vorhin nicht mit zitiert worden als ein Beleg, dass schon die alten Israeliten die Wünschelrute gekannt haben.
Aber kommt man da nicht auf den Gedanken, dass Moses das Wasser in der Wüste mit der Wünschelrute gesucht und gefunden hat?
Das wäre dann eine ganz natürliche Erklärung dieses Wunders, besonders wenn man nun auch die Wünschelrute als etwas ganz Natürliches betrachtet, wie es jetzt auch schon die Gelehrten tun.
Und dass Moses, von ägyptischen Priestern erzogen. in ihre Magie eingeweiht, mediumistisch veranlagt war, »Gesichter« gehabt hat und dergleichen mehr, daran ist doch gar kein Zweifel, oder man kann nur gleich den ganzen Moses als historische Persönlichkeit fallen lassen, was aber doch wohl niemand im Ernst tun wird.
Jetzt wollte der Prinz aus der Wünschelrute wieder einen praktischen Nutzen ziehen, wollte dasjenige erfahren. weswegen er dieses alte Kloster gekauft und bezogen hatte.
»Passe einmal auf, Deasy. Du weißt doch, dass wir heute schon den ganzen Tag unten im Keller die Wände und den Boden abgeklopft haben. Wir suchen nämlich nach einem unterirdischen Gange, der sich vermutlich hier befindet. Bisher haben wir noch keinen Hohlraum durch Abklopfen erkennen können, und wir wollen doch nicht alle Wände demolieren, zumal es sich dabei um die Grundmauern handelt, auf denen das ganze Gebäude ruht. Willst Du nun einmal versuchen, diesen unterirdischen Gang auszukundschaften. Er braucht aber nicht unter dem Kellerboden zu sein, er kann sich vielleicht auch seitwärts befinden. Wie wollen wir das nun machen, um in Dir das Bewusstsein zu verstärken, dass Du mit der Rute einen verborgenen Hohlraum anschlagen sollst. Vielleicht dass Du in Deine linke Hand eine leere Schachtel nimmst ...«
»O nein, das ist nicht nötig«, unterbrach Deasy, die bisher aufmerksam zugehört hatte, »wenn Du es gern willst, dann geht es gleich auch so.«
Also das Kind drückte hiermit schon aus, dass der Hauptanreiz zur Wirksammachung dieser Gabe darin besteht, dass man den Wunsch einer anderen Person, die man liebt, gern erfüllen möchte. Wenigstens traf das bei diesem völlig uneigennützigen Kinde zu. In eigenem Interesse konnte Deasy, wie sich später erwies, die Wünschelrute überhaupt gar nicht benutzen.
Und schon wurde der Zollstock in ihren Händen wieder lebendig und hüpfte mit der Spitze über den Sand hin.
So ging es in die Klosterpforte hinein, einen seitlichen Gang entlang, eine Treppe hinab in den Keller. Schon waren mehrere Laternen entzündet.
Hinterlassene Hämmer, Hacken und Brecheisen verrieten, dass des Prinzen Leute schon den ganzen Tag hier unten tüchtig mit Maurerarbeiten beschäftigt gewesen waren.
Es gab alte Schutthaufen genug, aber auch neue waren hinzugekommen, ab und zu war in einer Wand ein frisches Loch geschaffen worden.
Die Wünschelrute führte nach solch einem alten Schutthaufen, schlug heftig auf.
Der Haufen von alten Steinen und Sand und Kalk war gar nicht beträchtlich, schnell war er von geschäftigen Händen abgeräumt worden.
Und da zeigte sich etwas, was man auch noch nicht gewusst hatte.
Nämlich dass sich hier am Boden eine hölzerne Falltür befand.
Sie ließ sich öffnen, eine Treppe zeigte sich, die in einen zweiten Keller führte, dessen Existenz also noch gar nicht bekannt gewesen war!
Ein sehr geräumiger Keller mit vielen Nebengelassen, alles aus dem Grundfelsen herausgehauen, sonst weiter nichts. Höchstens dass man hier und da in den Verliesen an den Wänden eingelassene Ringe und auch Ketten erblickte.
»Na, das sieht schon mehr dem Burgverlies eines Raubritters ähnlich als einem Klosterkeller!«, flüsterte jemand.
Der Prinz gebot Stille. Niemand wäre ein Mensch gewesen, der nicht das Schauerliche herausgefühlt hätte. Dazu nun die dumpfe Luft, obgleich sie erträglich war.
Die Wünschelrute sprang weiter über den Boden hin, jetzt aber viel kräftiger aufschlagend als zuerst.
»Hier unten ist der Boden schon hohl«, sagte Deasy, frei von jeder Furcht, »die Rute schlägt es schon an, aber das Richtige ist es noch nicht, sie führt mich noch weiter.«
Jetzt ging die Rute seitwärts nach der Wand, kletterte förmlich hinauf und schlug ganz energisch an.
»Hier ist das, was Du suchst, Onkel!«, sagte das Kind jetzt ganz direkt, natürlich ohne zu wissen, woher es das wusste.
Hacken und Brecheisen waren zur Stelle, es wurde gebrochen.
Gar nicht lange, so ging die erste Spitzhacke durch. Nun konnte das Loch schnell erweitert werden, die Mauer war kaum einen Viertelmeter stark.
Schon erblickte man gelbe Knochen. Und dann sah man ein aufrecht stehendes Menschenskelett.
Es hatte einem Manne angehört, der hier ganz nackt eingemauert worden war, denn sonst hätte man doch wohl wenigstens noch Spuren von Kleiderresten gefunden. Nichts von alledem.
Ebenso unheimlich wie sehr interessant, zumal wenn man annahm, dass dieser Mensch doch jedenfalls lebendig eingemauert worden war; aber eigentlich war man enttäuscht.
Wohl hatte die Wünschelrute einen Hohlraum angegeben, aber das war es nicht gewesen, was man gesucht hatte.
Doch was war das?
Das Skelett, freigelegt, war zusammengebrochen und den lebendigen Menschen entgegengefallen, es wurde ohne viel Zeremonie vollends herausbefördert — aber die Wünschelrute schlug noch immer energisch gegen die hintere Wand des Hohlraumes an.

Also dort dahinter war immer noch ein Hohlraum!
Den hätte man nun freilich nicht so leicht vermutet.
Wieder arbeiteten Hacken und Brecheisen und Meißel. Wieder brach eine Spitzhacke durch, wieder wurde das Loch in der nicht allzu dicken Wand erweitert.
Der Prinz ließ den Blendstrahl seiner Laterne durchfallen.
Er beleuchtete als erstes eine breite Treppe, eine ungeheure Treppe, wenigstens zwanzig Meter breit, die in die Tiefe hinabführte.
»Gefunden!«, rief der Prinz. »Und hier kann auch ein Automobil hinab!«
Ja, es war durch die Wünschelrute das gefunden worden, weshalb der Prinz dieses Kloster gekauft hatte.
Aber was er sonst noch darin finden würde, das hatte er nicht geahnt, und das hatte ihm auch jener geheimnisvolle Mann nicht sagen können, der ihn erst veranlasst hatte, dieses Kloster zu kaufen
Am späten Nachmittage, die arabischen Handwerker hatten sich schon entfernt, betrat den Klostergarten durch das Tor, das noch gar nicht geschlossen werden konnte, ein Bettler, wie sie überall herumlaufen und in den Ecken sitzen.
Ein bejahrter Mann, in Lumpen gehüllt, auf dem Rücken den Bettelsack.
Aber es war gar kein zunftmäßiger Bettler.
Er stellte sich vor als Muley der Haui, der Schlangenbeschwörer.
Dass er sein Versprechen schon zweimal nicht gehalten hatte, schon zweimal nicht gekommen war, entschuldigte er damit, dass er in »Verzückung« gelegen habe.
Nun, es mochte ja sein, dass der gute Mann, um seine geheimnisvolle Kunst ausüben zu können, sich manchmal besaufen musste, wie es auch andere Genies tun, die etwas können, was andere Menschen nicht können.
Er roch noch stark nach Schnaps, schien aber sonst ganz nüchtern zu sein, machte auch auf den Prinzen gar keinen so unsympathischen Eindruck. Faustdick hatte der es ja freilich hinter den Ohren sitzen, das sah man gleich dem verschmitzten Gesicht an.
Sie stehen im üblen Rufe, diese Hauis, man muss sich vor ihnen vorsehen. Der Fremde, der nach Kairo kommt und sich ein »Garçonlogis« nimmt, bei einer griechischen oder italienischen Familie, oder auch bei einem Mohammedaner, was sehr wohl möglich ist, da gibt es immer Nebengelasse, besonders alte Backstuben werden warm empfohlen — und solch ein »Garçonlogis« ist ja auch unbedingt nötig, wenn man eine fremde Stadt richtig kennen lernen will, da ist doch nichts in einem Hotel zu wollen, wo man immer dieselben Tee- und Biergesichter sieht — also solch ein Fremder kann sicher sein, dass ihn alsbald ein Haui besucht, der sich erbietet, einmal nachsehen zu wollen, ob sich in dem betreffenden Raume nicht etwa eine Schlange aufhält. Da er sich verpflichtet, die Sache ganz kostenlos zu machen, lässt man ihn gewähren. Lockt er eine Schlange hervor, dann natürlich muss man ihn bezahlen, wenn auch nur einen Franken pro Stück.
Und der Kerl lockt regelmäßig mit seinem Pfeifchen eine fürchterliche Giftschlange aus einem Winkel hervor. Die er nämlich erst hineinpraktiziert hat. Diese Schlange ist sein eiserner Bestand. Von seinen mohammedanischen Wirten wird man manchmal oder sogar meist vor diesem Betrug gewarnt, von griechischen niemals, die teilen den Raub mit dem Schwindler.
Hier war ja nun solch ein Betrug ausgeschlossen, und Muley machte auch gar keinen Hokuspokus dabei, gab sich ganz natürlich.
»Willst Du Deine Schlangenbeschwörung noch heute Abend ausführen?«
»Ja, wenn Du es gestattest, Effendi.«
»Hast Du alles bei Dir?«
»Alles.«
»Es kann sofort losgehen?«
»Sofort.«
»Können wir dabei zusehen?«
»Gewiss. Nur müsst Ihr Euch so setzen, dass Ihr den Schlangen nicht im Wege seid, was auch gefährlich werden kann, also Ihr müsst Euch mit untergeschlagenen Beinen auf Stühle oder Tische setzen.«
»Was verlangst Du nun eigentlich für Deine Bemühungen?«
»Für jede giftige Schlange, die ich hervorlocke und töte, fünfzig Franken.«
»Was?!«
»Du bist ein mächtiger und reicher Fürst und kannst das bezahlen.«
Dem Prinzen fiel bei dieser Forderung aber doch gleich etwas auf.
»Hm. Gehört denn dieses viele Geld, das Du verdienst, Dir?«
»Nein.«
»Wem musst Du es abliefern?«
»Der Moschee der Rufais.«
»Du gehörst den heulenden Derwischen an?«
»Nein.«
»Weshalb musst Du ihnen denn da Deinen Verdienst abliefern?«
»Weil sie für mich beten.«
»Es ist wohl Zauberei, was Du treibst, Du hast dafür die Dschehenna verwirkt, die Hölle, aber die frommen Derwische entsühnen Dich, nicht wahr?«
Der alte Mann machte eine ungeduldige Bewegung. als habe er schon zu viel gesagt.
»Soll ich die Schlangen fangen, willst Du mir für jede fünfzig Franken geben oder nicht?«
Der Prinz hatte zweifellos das Richtige erraten. Wenn er es nicht schon vorher bestimmt gewusst hatte.
»Ich bin mit dem Preise einverstanden.«
»Gut. Und wenn Du morgen bis zum Sonnenuntergang hier zwischen diesen Mauern noch eine Giftschlange fangen kannst, durch einen anderen Haui oder auf irgend eine andere Weise, so zahlt Dir die Moschee der Rufai dreihundert Franken für jede einzelne Schlange.«
Es machte einen großen Eindruck, diese Sicherheit, mit der dieser zerlumpte und verlumpte Kerl das gesagt hatte.
»Ich nehme diese Garantie an. Es ist doch gleichgültig, wo Du beginnst, ob im Klostergarten oder im Hause.«
»Ich möchte hier draußen mit den Nilwürmern anfangen, es ist schon dunkel genug.«
»Ich wünschte aber, dass Du im Hause anfängst!«
»Weshalb?«
Am besten war es, wenn der Haui gar nicht erfuhr, dass man den Garten schon von Schlangen gesäubert hatte, und sicher erfuhr er nicht die Art und Weise, wie man das zustande gebracht hatte.
»Uns ist am meisten daran gelegen, das Haus von Schlangen zu säubern.«
»Wie Du willst, Effendi!«, gab der Mann gleich nach.
Sie begaben sich in das Erdgeschoss, die Laternen waren entzündet, der Haui durchschritt einige Räume, aber durchaus nicht alle, bezeichnete eine weite Halle, das ehemalige Refektorium, als den geeignetsten Ort, wo er die Sache vornehmen wolle.
»Holzkohlen habe ich mitgebracht, auch eine eiserne Schale — kann ich aber hier auf den Steinplatten ein größeres Feuer anmachen?«
»Das kannst Du.«
Der Gaukler ging in die Mitte des Raumes, entnahm seinem Bettelsack eine ziemliche Quantität Holzkohlen, häufte sie zusammen, schlug mit Stahl und Stein mühsam Feuer, erst Zunder zum Glimmen bringend, dann die Kohlen anblasend. Streichhölzer und ein modernes Feuerzeug wies er zurück, auch Holzspäne, um erst die Kohlen besser anbrennen zu können. Es schienen also keine gewöhnlichen Holzkohlen zu sein, sie waren schon »geweiht«.
Unterdessen hatten die Gefährten des Prinzen einige Tische herbeigeschafft, bauten sie im Kreise herum auf und setzten sich mit ihren Lampen darauf.
Der Haui musterte sie scharf.
»Das Kind darf nicht dabei sein und ... dieser Mann dort auch nicht.«
Er meinte Edward Scott.
Wir haben von ihm hier im Kloster nichts erwähnt, weil er sich so gar nicht bemerkbar machte. Er hatte allen den Experimenten ruhig zugesehen, war mit in den Keller gegangen, ohne ein Wort zu sagen. Er war ein stiller Träumer geworden. Statt des schwarzen Gehrockanzuges trug er jetzt ein Beduinengewand, nur der Bequemlichkeit halber.
Auch er hatte sich mit auf den Tisch gesetzt.
»Du sagtest doch, wir könnten alle zusehen.«
»Ich habe nicht gewusst, dass ein Kind dabei sein könnte.«
»Dass Du die Anwesenheit eines Kindes nicht haben willst, kann ich verstehen. Aber dieser Mann ist doch kein Kind mehr.«
»Er darf nicht dabei sein.«
»Weshalb denn nicht?«
»Sonst gelingt mir die Beschwörung nicht.«
Schon erhob sich Edward Scott ohne weitere Aufforderung, Deasy begab sich mit ihm in den eingerichteten Wohnraum, auch ein anderer Mann oder sogar Herr ging freiwillig mit, um dem Kinde Gesellschaft zu leisten.
»Weshalb darf dieser Mann nicht dabei sein?«, fragte jetzt der Prinz nochmals. »Weshalb gelingt Dir in seiner Anwesenheit die Schlangenbeschwörung nicht?«
»Weil er toglo ist.«
»Heilig?«
»Ja.«
»Woher weißt Du denn das?«
»Ich weiß es, ich sehe es ihm an.«
In der Tat, der junge Mann glich ja auch noch mit seinem kurzen Haare ungefähr einem Heiland, hatte noch immer so einen Christuskopf — aber sehr merkwürdig war diese ganze Sache doch, gerade von einem Mohammedaner ausgesprochen.
»Sind wir anderen denn gottlos?«
»Das nicht, aber heilig seid Ihr nicht.«
»Und das Kind?«, fiel es dem Prinzen nochmals zu fragen ein.
»Das ist ebenfalls heilig.«
Weiter fragte der Prinz nicht. Das war aber doch eine starke Andeutung gewesen, dass diese Schlangenbeschwörung mit Teufelszauberei zusammenhing, wenigstens für diesen Mohammedaner.
Das Feuer brannte, der Haui hatte tüchtig geblasen, jetzt kauerte er sich davor an den Boden hin, griff in seinen Sack.
»Ich beginne mit der Beschwörung, Ihr dürft immer mit mir sprechen, mich fragen — nur müsst Ihr verzeihen, wenn ich einmal nicht antworte, entweder weil ich Euch gar nicht höre, oder weil ich nicht antworten will, nicht darf.«
Er zog aus dem Sacke eine hölzerne Büchse hervor, schüttete etwas Pulver in seine Hand, warf es ins Feuer. Ohne weiteren Qualm entwickelte sich ein brenzliger Geruch.
»Was ist das für eine Substanz?«
»Der Geruch zieht die Schlangen an.«
»Riecht das nicht nach verbranntem Fett, sogar nach verbrannten Schlangen?«
»Ja, so etwas Ähnliches ist es.«
Weiter zog der Haui aus seinem Sack eine kleine Pfeife oder Flöte und begann mit quiekenden, durchdringenden Tönen eine monotone Melodie zu spielen.
Und gar nicht lange dauerte es, so hatte diese »Beschwörung« einen Erfolg.
Auch Doktor Alfred Brehm, der alles bezweifelt, was nicht ganz natürlich zu erklären ist, hat sich, wie er in seinem »Tierleben« berichtet, überzeugen lassen müssen, dass arabische und indische Gaukler die Kunst verstehen, Schlangen aus ihren Verstecken hervorzulocken, meist durch Spielen auf einer Pfeife.
Nun mag es ja sein, dass Schlangen gewissermaßen »musikalisch« sind, sich durch Pfeifentöne anlocken lassen.
Aber ein anderer kann pfeifen und musizieren, so viel er will, da kommt keine Schlange hervor, das ist eben die Sache.
Außerdem hat sich Brehm auch überzeugen lassen müssen, dass solche Gaukler ein Gegenmittel selbst gegen den Biss der furchtbaren Brillenschlange haben, das auch bei anderen Menschen hilft, und dass sie sich selbst von Kobras mit vollen Giftdrüsen beißen lassen können, ohne die geringste schädliche Wirkung zu bemerken.
Weshalb geben denn solche Leute ihr Geheimnis nicht preis, zum Segen der Menschheit oder um Reichtümer zu verdienen?
Weil sie im Dienste von Klöstern und Tempeln stehen, weil es ein religiöses Geheimnis ist! Gewiss, man kann es erfahren, aber man muss der Welt Valet sagen, man muss selbst solch einem religiösen Orden beitreten, und da kommt man nicht wieder heraus. Oder nur als derjenige Mensch, der dieses Geheimnis und andere dazu wieder nicht verrät und dem es ein Hochgenuss ist, deswegen zu Tode gemartert zu werden. —
Ein Zischen ertönte. Trotz der durchdringenden Pfeifentöne noch deutlich hörbar.
Unter dem einen Tische kam aus dem dunklen Hintergrunde eine Schlange hervor, eine Efa, reichlich einen halben Meter lang.
Die funkelnden Augen ganz starr auf den Haui gerichtet, kroch sie auf diesen zu.
Der hatte schon vorher aus seinem Sack eine eiserne Zange gezogen, mit der packte er, jetzt nur mit der linken Hand die Pfeife haltend und die paar Löcher bedienend, die Schlange beim Halse, steckte sie einfach ins Feuer, sie darin festhaltend, bis sich ihr furchtbares Winden ausgetobt hatte, bis sie allein weiterschmoren konnte. Gut roch es nicht.
Da kam von der anderen Seite her schon eine zweite Schlange gekrochen, weit größer als die erste.
Diesmal packte der Haui sie gleich mit der linken Hand beim Halse, gar nicht mit einem schnellen Griffe, ganz sorglos und ... hielt diese seine linke Hand mit der Schlange mitten in das Feuer, in die Glut hinein!
So verharrte er mindestens eine Minute, die linke Hand und dazu den halben Arm mitten in der lodernden Glut, bis die Schlange verbrannt oder doch tot war, dabei die Zuschauer auf den Tischen mit einem höhnischen Grinsen ansehend.
Dann zog er die Hand aus dem Feuer zurück, zeigte sie, dass sie unverbrannt sei.
»Wie machst Du das, dass Deine Hand nicht verbrennt?«
Der Haui gab keine Antwort.
Man muss es gesehen haben, um es glauben zu können.

Der Haui hielt die Schlange mit der linken Hand in die lodernde Glut, wobei
nicht das geringste Zeichen von Schmerz auf seinem Gesicht zu sehen war.
Der Prinz und seine Begleiter staunten wenig, sie hatten solche Beweise von Unverbrennlichkeit schon öfter gesehen und noch ganz anderes dazu.
Unmöglich? Es gibt Eisen- und Metallgießer genug, die gegen ein gutes Trinkgeld ihre Hand und den ganzen Arm in glühendflüssiges Metall stecken, manchmal es gar nicht so eilig haben, die Hand wieder heraus zu ziehen. Das lässt sich nach dem sogenannten Leidenfrost'schen Gesetze erklären. Als ob es aber nun nicht noch andere Gesetze in dieser Hinsicht gebe, die wir noch nicht kennen!
Eine dritte Schlange tauchte auf, hinter dem Haui, und zwar ohne zu zischen.
Der Mann konnte sie doch nicht sehen. Und trotzdem griff er hinter sich, packte sie sofort beim Halse und warf sie ins Feuer, sie dann mit der eisernen Zange niederdrückend, bis sie ausgelebt hatte.
Jetzt setzte er die Pfeife einmal ab.
»Da kommt die Schlangenkönigin!«, sagte er. »Sie wird mir erzählen, wie viele Schlangen noch hier unten und oben sind.«
Er begann wieder zu pfeifen, rechts von ihm kroch unter dem Tische eine vierte Efa hervor, die, wenn sie wirklich die Schlangenkönigin war, weder eine goldene Krone trug, noch sich durch besondere Größe auszeichnete, noch durch sonst etwas.
Und nun begann ein merkwürdiges, ebenso interessantes wie unheimliches Spiel.
Der Haui beugte sich weit vor, also auch tief, brachte die Pfeife, immer weiter spielend, ganz in den linken Mundwinkel, zum rechten steckte er auffallend weit die Zunge heraus, so ließ er die lebhaft züngelnde Schlange sich nähern, immer weiter, und sie richtete sich auf und begann mit ihrer Zunge an der menschlichen zu spielen, zu lecken.
Was sollte man hierzu sagen?
Man konnte nur beobachten.
Nachdem sich die beiden, Mensch und Schlange, einige Zeit gegenseitig bezüngelt hatten, ließ der Haui die Pfeife sinken, nahm seinen Sack her, öffnete ihn etwas, und sofort kroch die Schlange hinein.
»So, die gehört mir!«, sagte er, und dann machte er noch ein Taschenspielerkunststückchen vor — von diesem Sacke, dem Attribute solcher Gaukler, kommt übrigens unser Wort Taschenspieler — nahm den Sack her, fasste ihn hinten an den äußersten Enden, schüttelte ihn, um zu zeigen, dass nichts drin sei, rollte ihn zusammen, schlug ihn sich um den Leib, stülpte ihn sogar vollständig um, stülpte ihn zurück, warf ihn hin, und doch kam aus der Öffnung gleich wieder der Schlangenkopf zum Vorschein, der sich aber auf sein Kommando schnell wieder zurückzog.
»Nun, was hat Dir die Schlangenkönigin erzählt?«, fragte der Prinz, dieses Kunststückchen nicht weiter beachtend.
Wieder grinste der Haui recht höhnisch.
»Sie hat mir gesagt, dass sich hier unten nur noch zwei Efas befinden, zusammen waren es sechs, und oben sind noch sieben, nachdem heute schon die achte getötet worden ist — und weiter hat sie mir erzählt, dass Ihr heute schon draußen achtzehn Nilwürmer erschlagen habt, und das waren alle, es gibt keine mehr dort draußen zwischen den Mauern.«
»Das haben Dir wohl die Handwerker erzählt, wie?«
»Hm, Effendi, Du beurteilst mich falsch, aber ich verüble es Dir nicht. Die Schlangenkönigin hat es mir soeben wirklich erzählt, ob Du es glaubst oder nicht. Das heilige Kind hat die achtzehn Nilwürmer mit dem Stabe des Moses gefunden. Stimmt es oder stimmt es nicht?«
Man musste fast annehmen, dass dieser Haui ebenfalls hellsehend war. Übrigens schien er manchmal auch in einen anderen Zustand zu kommen, die Zuschauer hatten sich schon gegenseitig darauf aufmerksam gemacht: Dann wurden seine Augen ganz starr und verschoben sich nach oben, bis nur noch das Weiße zu sehen war, was aber immer nur kurze Zeit währte. Hauptsächlich geschah dies, wenn er eine Schlange griff, und dann auch war es während der ganzen Minute der Fall gewesen, als er die Hand ins Feuer gehalten hatte.
Am interessantesten war es dem Prinzen zunächst, dass dieser Araber vom Stabe Moses sprach, wobei er doch zweifellos die Wünschelrute meinte.
»Aber Ihr irrt«, fuhr der Mann fort, »es gibt noch drei andere Nilwürmer hier, die Euch gefährlich werden können.«
»Hier im Hause?«
»Nein.«
»Im Keller?«
»Da sind keine Schlangen.«
»Wo denn da sonst?«
»Oben auf dem Dache.«
Das konnte allerdings sein. Auch das flache Dach des Klosters war mit Sand bedeckt.
»Und außerdem ist auf dem Dache noch eine mächtige Haie.«
»Wie kommt denn die auf das Dach hinauf?«
»Sie ist als kleine Schlange von einem Geier ergriffen und auf das Dach fallen gelassen worden.«
»Das hat Dir alles die Schlangenkönigin erzählt?«
»Ja.«
»Nun gut, locke hier die anderen Schlangen hervor.«
In kurzer Zeit kamen noch zwei Efas hervor.
»So, das war die letzte, die hier unten war!«, sagte der Haui, als er auch die zweite ins Feuer geworfen hatte, zog aus dem Sacke, den er vor zehn Minuten als ganz leer gezeigt hatte, eine beträchtlich Eisenschale hervor, wenigstens dreißig Zentimeter im Durchmesser, und begann die glühenden Kohlen darauf zu schaufeln, mit den bloßen Händen.
»Dieses Kloster ist doch groß. Können die Schlangen denn aus den entferntesten Räumen bis hierher kommen?«
»Sie können es.«
»Sie kommen durch die Türen?«
»Durch die Wände.«
Es mochte sein. Wenn nicht Mauselöcher, so gab es überall Risse, durch die sich solch eine Schlange quetschen konnte. Seltsam war ja freilich diese ganze Sache genug.
»Die Schlangenkönigin hat mir gesagt, dass sie ihrer hier unten sechs waren, und die sind nicht mehr vorhanden. Für jede Schlange, auch für jede andere, die Du bis morgen zum Sonnenuntergang hier fängst, zahlen Dir die Rufais 300 Franken.«
»Weshalb nur bis morgen Abend?«
»Einmal können doch noch welche wieder zukommen, das ist nicht zu vermeiden, die Geier lassen manche fallen.«
Ja, dieser Termin war ganz gerecht.
»Gibt es hier auch keine jungen Schlangen?«
»Nein, jetzt nicht.«
»Die Efa, die heute Mittag von den Handwerkern getötet wurde, hatte sieben ausgekrochene Junge im Leibe.«
»Sie sind zu spät geboren. Sie würden in dieser Jahreszeit bald sterben.«
Solch ein Haui weiß von Schlangen natürlich mehr als alle Naturforscher zusammen, wenigstens von den Schlangen, die ihre Spezialität bilden. Wenn sie nur sonst nicht so lügen täten.
Es ging mit dem Kohlenbecken hinauf in die erste Etage, der Haui wählte wieder einen Raum aus, diesmal einen kleineren, und hier wieder genau dasselbe. Nur dass diesmal keine Schlangenkönigin kam, mit der er sich küsste.
Sieben Schlangen wurden verbrannt, eine auch noch einmal in der bloßen Hand, ohne dass diese mit verbrannte.
Dann hinauf auf das flache Dach, das ebenfalls mit Sand bedeckt war. Ein großer Haufen von alten Brettern und Fassdauben lag da, jedenfalls noch aus den Mönchszeiten stammend, von diesem benutzte der Haui, um ein größeres Holzfeuer anzuzünden, zumal seine Kohlen zu Ende gingen.
Wieder das Pulver hinein, wieder die monotone Weise, kein Unterschied war zu hören, etwa dass jede Schlangenart eine besondere Melodie bevorzugt hätte, und kurz hintereinander kamen über den Sand offen drei Hornvipern angekrochen, jetzt im Feuerscheine viel besser zu unterscheiden als im Tageslichte.
Der Haui blies weiter, jetzt allerdings glaubte man eine andere Melodie zu hören, wenn auch ebenso monoton wie die vorige, sie wurde auch viel leiser gespielt, und trotzdem war es eine weit größere Schlange, die bald von dorther, wo der Holzstoß lag, herangekrochen war, weit über einen Meter lang.
Es war eine Uräusschlange oder Aspis, von den Arabern Haie genannt, wovon auch das Wort Haui kommt, weil sich die Gaukler eben nur dieser Schlangen bei ihren Vorstellungen bedienen. Sie »tanzt« genau so wie die indische Brillenschlange, ähnelt dieser ja auch dadurch, dass sie, wenn sie zornig wird, am Halse eine Art von Schild aufbläst.
Muley packte sie, als sie weit genug herangekommen war, mit schnellem Griffe am Halse, mit der linken Hand, zog sie blitzschnell durch seine rechte Hand, wenn er auch nicht bis an das Schwanzende reichen konnte, und da war die Schlange steif wie ein Stock geworden.
»Jetzt ist es eine Ara, der Stab des Moses. Fasse sie ruhig an, Effendi, Du brauchst ihre Zähne nicht zu fürchten.«
Der Prinz hatte dieses Kunststück oft, oft gesehen, aber immer nur von arabischen Gauklern, immer nur mit der Haie, die indischen Gaukler machen es nicht mit ihren Brillenschlangen, und der Prinz hatte auch nie solch eine steif gewordene Schlange anfassen dürfen.
Jetzt tat er es. Die Schlange war einfach steif wie ein Stock.
Es ist also dasselbe Kunststück, welches Moses ausführte, der es von den ägyptischen Priestern gelernt hatte, wovon die Mohammedaner recht wohl wissen, denn auch Moses ist ihnen ein heiliger Prophet, das alte Testament ihnen eine heilige Schrift.
»Du lähmst sie durch einen Druck auf einen besonderen Rückenwirbel?«
»Das, Effendi, ist ein Geheimnis der Rufais, die es den Hauis lehren.«
»Mache sie wieder lebendig.«
Der Haui packte sie um die Mitte des Leibes, plötzlich krümmte sich die Schlange zusammen, wollte blitzschnell mit dem Kopfe nach der sie haltenden Hand fahren, doch schneller war der Haui, ein Druck, und sie streckte sich sofort wieder.
Dann geschah etwas, was der Prinz trotz aller seiner Erfahrungen mit ägyptischen Schlangengauklern noch nicht gesehen hatte. Diesem Haui hier kam es nicht darauf an, die sonst sehr kostbare Aspis zu besitzen, er warf sie ins Feuer, aber nur mit dem Schwanzende, oder mit einem Drittel des ganzen Leibes.
Zischend schmorte das Fleisch, aber die Schlange blieb mit starren Augen steif wie ein Stock liegen.
Da griff der Haui wieder zu, ein Druck in der Mitte des Leibes, und da wurde die Schlange wieder lebendig, krümmte sich in ihren furchtbaren Schmerzen.
Lange ließ der Haui dieses schreckliche Schauspiel nicht beobachten, er packte das Tier mit der Zange und ließ es vollends verbrennen.
Immerhin, er hatte bewiesen, dass die Schlange aus diesem Starrkrampfe durch keinen Schmerz, auch nicht durch Feuersglut, zu erwecken war.
Noch sei bemerkt, dass diese Gaukler auch andere Tiere wie Katzen, Hunde und sogar Esel und Pferde durch einen Griff in solchen Starrkrampf versetzen können. Es ist dies eine Sache, die noch ganz und gar nicht studiert worden ist. Wir stehen hier einfach vor einem Rätsel. Das können auch die indischen Gaukler, nur bei den Schlangen scheinen sie es nicht machen zu dürfen, weil diese ihnen heilig sind. Ob sie auch Menschen so in Starrkrampf versetzen können, weiß man nicht, man hat es noch nicht gesehen, sie antworten nicht auf diese Frage, wie sie ja überhaupt gar nichts beantworten, was ihre Geheimnisse anbetrifft — — —
In einer Zelle, die sich der Prinz vorläufig als sein Arbeitszimmer hatte einrichten lassen, fand die Abrechnung statt.
»Sechzehn Schlangen — das machte 800 Franken.«
»Du sagst es, Effendi.«
»Bekommst Du das Geld?«
»Wer denn sonst?«
»Ich dachte, weil Du von den Rufais sprachst, denen Du ...«
»Was gehen Dich die Rufais an?«
Der Prinz zog seine Brieftasche und zählte acht Hundertfrankenscheine auf den Tisch. Gleichgültig ließ sie der Alte in seinem Sacke verschwinden.
»Ich fragte vorhin nur, weil Du doch sagtest, Du müsstest alles den Rufais abliefern.«
»Das ist auch so, Effendi.«
»Dann gestatte mir noch eine Frage: Erhältst Du denn von diesem Gelde etwas?«
»Nein, gar nichts. Nicht einmal Essen. Ich muss mir mein Brot betteln.«
»Dann nimmst Du doch ein Bakschisch an.«
»Gewiss!«
Freudig hatte es der Alte gerufen. Eigentümlich aber war es gewesen, dass er als Orientale nicht selbst gleich ein Bakschisch verlangt hatte.
Der Prinz reichte ihm noch eine Fünfzigfrankennote hin. Gierig griff der Alte danach.
»Das alles ist mein?!«
»Ja. Du hast es Dir reichlich verdient.«
»Effendi, Du bist ein nobler Mann, aber ... ein guter Mensch bist Du nicht.«
»Was?! Weshalb denn nicht?!«
Der Alte lachte verschmitzt, aber auch etwas trübselig.
»Weil Muley jetzt eine ganze Woche lang keine Schlangen mehr fangen kann.«
»Weshalb denn nicht?«
»Weil er nicht kann.«
»Du meinst, weil Du Dich täglich betrinken wirst, bis dieses Geld alle ist?«
»Du sagst es!«, war die ehrliche Antwort.
»Hm, schade. Na, ich will nicht versuchen, Dich auf einen anderen Weg zu bringen ...«
»Das kannst Du auch nicht.«
»Glaube ich schon. Aber Du gestattest mir wohl noch einige andere Fragen.«
»Frage. Wenn ich sie beantworten darf.«
»Dieses Schlangenbeschwören verbietet Eure Religion?«
»Ja.«
»Aber das ist doch ein höchst nützlicher Beruf.«
»Gewiss.«
»Und trotzdem erwartet Dich dafür die Hölle?«
»Ja. Wenn mich die heiligen Rufais nicht entsühnten.«
»Was ist denn nur so strafbar dabei?«
»Weil ich kein gewöhnlicher Haui bin.«
»Du gebrauchst dazu Teufelskünste?«
»Ja.«
»Nun sage, Muley, ich habe gehört, dass Du auch Tote beschwören kannst.«
»Kann ich!«, erklang es ganz einfach zurück.
»Kommen sie denn aber auch wirklich?«, musste der Prinz lächeln.
»Sie kommen.«
»Jeder Tote, den Du beschwörst?«
»Ja.«
»Ich kann ihn sehen?«
»Ja.«
»Auch mit ihm sprechen?«
»Auch das.«
»Wenn ich nun zum Beispiel ... den alten König Salomo sehen und sprechen möchte. Den kennst Du doch?«
»Der kommt nicht.«
»Weshalb nicht?«
»Weil das ein Heiliger ist. Heilige erscheinen nicht, dürfen auch gar nicht beschworen werden.«
»Nun denn ... hast Du einmal von Alexander dem Großen gehört, dem König von Makedonien?«
»Ja. Der kommt.«
»Der ist doch schon einige tausend Jahre tot.«
»Weiß ich. Der kommt. Effendi, frage nicht so weiter, es hat keinen Zweck. Willst Du, dass ich einen Toten beschwöre oder nicht? Ich bin verpflichtet zu dieser Frage.«
»Ja, das möchte ich gern einmal erleben.«
»Bist Du bereit zu heute über sieben Tagen?«
»Ja.«
»Soll ich da wieder hierher kommen?«
»Ja.«
»Hast Du etwas zum Schreiben da? Kannst Du Arabisch schreiben?«
»Ja.«
»So schreibe nach, was ich Dir diktiere. Ich bin verpflichtet, Dir sofort die Bedingungen zu nennen, unter denen ich Dir einen Toten oder auch mehrere erscheinen lassen kann, sonst hat es gar keinen Zweck, weiter darüber zu sprechen.«
Gut, der Prinz nahm ein Blatt Papier und Feder zur Hand, setzte sich und begann von rechts nach links nachzuschreiben, was der Alte ihm diktiere.
Es sind dieselben Bedingungen, die einst dem Schreiber dieses diktiert wurden.
1. Du musst sieben Tage und Nächte lang in völliger Einsamkeit verbringen, darfst keinen Menschen sehen und sprechen.
2. Während dieser sieben Tage darfst Du nichts Berauschendes trinken, rauchen und essen (Opium).
3. Kein Fleisch essen, nichts Gekochtes und Gebackenes, nur frische oder getrocknete Früchte und Nüsse. Auch keine Milch, nichts von einem Tiere.
4. Während dieser sieben Tage darfst Du möglichst keinen Zorn, keine Leidenschaften, keinen unkeuschen Gedanken in Dir aufkommen lassen.
5. Du hast Dich in möglichst ständigem Gebete mit Deinem Gotte und mit Gedanken an den Tod zu beschäftigen.
6. Du darfst keinen Heiligen zu sehen begehren. Ich kann ja nicht wissen, ob es nicht ein Heiliger ist. Du aber weißt ganz genau, wen Du als einen Heiligen bezeichnen kannst.
7. Keinen im Irrsinn Gestorbenen.
8. Keinen Selbstmörder, keinen richterlich zum Tode Verurteilten und von Henkershand Hingerichteten.
9. Gegen den Toten, den Du zu sehen begehrst. darfst Du nicht jetzt noch Hass hegen.
10. Du darfst den Toten, wenn er Dir erscheint, nicht berühren.
11. Du darfst ihn alles fragen, aber nicht zum zweiten Male dieselbe Frage stellen, wenn er sie nicht beantwortet.
12. Nachdem Dir nun der Tote erschienen ist, hast Du sofort den zehnten Teil Deines Vermögens den Armen zu geben, und zwar die Hälfte davon den Rufai-Derwischen, die andere Hälfte anderen Armen nach Deinem Belieben.
13. Du hast ein ganzes Jahr lang als Bettler von Almosen zu leben, welches Jahr sofort anzutreten ist. Hast Du kein Vermögen, von dessen Zinsen Du lebst, so hast Du ein Jahr lang fleißig zu arbeiten und alles, was Du verdienst, den Armen zu geben, in derselben Teilung, und darfst während dieses Jahres nur von Wasser, Brot und Hülsenfrüchten leben.
»Dies sind die Bedingungen«, schloss der Alte, »unter welchen ich Dir heute über sieben Tagen einen Toten oder auch mehrere erscheinen lassen werde, welche Du willst, bis auf die genannten Ausnahmen. Und kommst Du Deinen nachträglichen Verpflichtungen nicht nach, so trifft Dich Allahs Fluch, er wird Dich mit allen Plagen schlagen — hier und dort.«
Der Prinz erhob sich.
Beim Nachschreiben der letzten Bedingungen war er ganz verblüfft geworden.
»Die ersten Paragrafen lasse ich mir gefallen — aber die beiden letzten — den zehnten Teil seines Vermögens hergeben und gar ein ganzes Jahr als Bettler leben — um einmal einen Toten zu sehen — das ist stark!«
Da trat der alte Mann einen Schritt zurück.
Richtete sich auf.

Ein furchtbarer Hohn prägte sich in seinem hageren Gesicht aus, und ebenso erklang es:
»O Mensch! O Menschlein!
Du willst den König Salomo sehen und Alexander den Großen, und willst nicht einmal den zehnten Teil Deines Geldes den Armen geben und nur ein einziges Jahr selbst als Armer leben?!
Und was verlange ich denn überhaupt? Bist Du ein Christ? Glaubst Du an ein Himmelreich?
Nein.
Aber gut, ich will annehmen, Du seiest ein wirklicher Christ.
Wo ist denn das Himmelreich?
Siehe, es ist nicht hier und ist nicht da, sondern es ist inwendig in Euch.
Und wie gelangst Du in dieses Himmelreich?
Halte Deine zehn Gebote! Hältst Du sie?
Ich will annehmen, dass Du es tust.
Dann aber kommst Du noch lange nicht in Dein Himmelreich.
Verkaufe alles, was Du hast, und gib es den Armen!
Darum kommt Ihr nicht herum! Da sitzt Ihr fest!
Da sind wir Mohammedaner besser dran.
Wir brauchen nur den zehnten Teil unseres Einkommens den Armen zu geben.
Und das tut auch jeder ehrliche Mohammedaner. So verdienen wir uns nach dem Tode das Paradies.
Freilich ...«
Der Alte brach ab.
Immer betroffener blickte der Prinz ihn an, der sich plötzlich so total verändert hatte.
Auch jetzt wieder, jetzt sank die hagere Gestalt wieder ganz zusammen, und in solchem Tone erklang es weiter:
»Freilich ... es gibt noch einen anderen Weg, um das Paradies zu erreichen.
Schon hier auf Erden.
Ich habe es einst unternommen, die Leiter zu erklimmen, die 777 Stufen hat.
Christlicher Fürst, der Du bist, höre mich an, sieh mich an. Ich kenne Dich.
Aber Du kennst mich nicht ...«
Und wieder verwandelte sich der Alte, richtete sich stolz empor, verschränkte die Arme über der Brust, und mit maßlosem Stolz erklang es:
»Du fragtest mich, ob ich schon einmal von Alexander dem Großen gehört hätte, dem König von Makedonien.
Hahahaha!
Vor der Macht meiner Ahnen ist Alexander in Indien umgekehrt!
Und auch ich war ein Maharadscha!
Auch ich saß auf dem Throne!
Fünfzigtausend Krieger standen zu meiner Linken. Und fünfzigtausend Krieger standen zu meiner Rechnen. Und zu meinen Füßen saßen dreitausend Frauen.
Und zwanzig Elefanten trugen nicht die Last meiner Schätze.
Ich habe alles, alles hingegeben, die Leiter zum Paradiese wollte ich besteigen ...«
Der Alte brach wieder zusammen.
»777 Stufen hat sie.
Nicht die hundertste habe ich erreicht. Da stürzte ich und zerschmetterte auf dieser Erde.
Ich bin Muley, der Haui, der sich jeden Tag mit Schnaps besäuft.
Lebe wohl, edler Fürst. Friede sei mit Dir.«
Der Alte schwang seinen Bettelsack auf den Rücken und wandte sich der Türe zu.
Ganz fassungslos blickte der Prinz ihm nach.
So etwas hatte er in seinem Leben noch nicht gehört. Nämlich so etwas von solcher Wucht!
Dass der einmal ein Maharadscha auf dem Throne gewesen sein wollte, das war dabei fast ganz Nebensache.
Doch da kehrte der Alte an der Tür noch einmal um.
»Effendi, ich möchte Dir noch etwas sagen. Aber über das, was Du soeben gehört hast, sprichst Du nicht mehr, nicht wahr?«, erklang es in bittendem Tone.
»Nein!«, konnte der Prinz schon wieder mit Ruhe antworten.
»Ich bin Muley, der Haui, der mit jedem Bakschisch zufrieden ist.«
»Ja.«
»Also das mit den Toten wollen wir vorläufig lassen. Vielleicht sprechen wir später noch einmal darüber. Aber ein paar Geister will ich Dir beschwören.«
»Geister? Sind denn Tote nicht auch Geister?«
»Nein. Oder, Effendi, da wollen wir lieber den Unterschied nicht zu erklären suchen. Ich kenne ihn selbst nicht. Da musst Du einmal einen von den ersten befragen, er wird Dir aber wohl nicht antworten. Ich kann nur so viel sagen, dass es Geister gibt, die niemals Menschen gewesen sind und niemals welche werden können, also Gespenster und Dämonen, die gewöhnlich auch ein ganz anderes Aussehen haben, dann aber gibt es auch Menschen, die nach dem Tode Geister werden. Die erscheinen auch als Menschen. Vielleicht aber sind es gar keine menschlichen Seelen, sondern echte Dämonen, die sich nur für Menschen ausgeben. Genügt Dir diese Erklärung?«
Sie genügte dem Prinzen. Wenn nur alle unsere modernen Spiritisten so dächten.
»Hier in diesem Kloster sind Geister.«
»Woher weißt Du das?«
»Ich habe davon genug gehört, und ich fühle auch ganz deutlich, dass solche um uns sind.«
Unwillkürlich blickte sich der Prinz um, besonders in die Ecken hinein.
»Die alten Mönche, die hier einmal gehaust haben? Ihre Opfer, von denen gemunkelt wird?«
»Das weiß ich nicht. Geister sind überall in der Luft und im Feuer und im Wasser und in der Erde und überall. Hier sind Geister, die sich beschwören lassen, die sich überhaupt von Menschen angezogen fühlen, das fühle ich sofort heraus. Was es aber für Geister sind, in welcher Gestalt sie erscheinen werden, das kann ich nicht sagen.«
»Und zu welchen Bedingungen willst Du diese Beschwörung tun?«
»Da sind keine Bedingungen nötig, das darf ich tun. Wenn ich den Mann, dem ich es zeigen will, dafür für würdig erachte, und das ist bei Dir der Fall.«
»Wann?«
»Jetzt sofort.«
Die Sache wurde ja immer einfacher.
»Ich habe alles bei mir, um die Räucherung zu machen.«
»Ach, räuchern willst Du?!«, erklang es enttäuscht.
»Das muss sein. Die Gestalten können sich nur als Rauchwolken bilden.«
»Diese Räucherungen kenne ich! Man wird betäubt, glaubt die Gestalten nur in seiner Einbildung zu sehen, wenn der Gaukler sie einem nicht gar suggeriert.«
»Nein, Effendi, diese Art Gaukelei treibe ich nicht, der Rauch betäubt nicht, ich versichere es Dir! Du kannst das Pulver selbst erst in das Kohlenbecken werfen, in einem anderen Raume, kannst den Rauch einatmen, wie Du willst, ob Du davon irgendwie betäubt wirst. Du kannst übrigens auch draußen bleiben im Freien, blickst durch ein Fenster, durch eine dicht schließende Glasscheibe in den Raum, in dem ich die Geister beschwören werde, ob Du sie nicht ebenfalls siehst. Oder Du lässt einige von Deinen Leuten draußen, ob sie nicht dieselben Gestalten wie Du sehen.«
Das war allerdings etwas anderes, und der Prinz glaubte dem Manne, er fasste immer größeres Zutrauen zu ihm.
»Nun gut, ich bin bereit.«
»Ich auch.«
»Keine Vorbereitungen?«
»Was ich dazu brauche, habe ich bei mir. Die Holzkohlen reichen dazu noch aus. Oder sonst kann es auch Holz sein.«
»In welchem Raume?«
»Den Du bestimmst. Nur innerhalb dieser Mauern.«
»Gut, ich weiß. Also auch meine Leute können dabei sein?«
»Jawohl. Nur das Kind und jener Mann nicht, beide sind heilig.«
»Es würde ihnen etwas schaden?«
»Nein, eher im Gegenteil — die Geister würden in ihrer Gegenwart nicht erscheinen.«
»Schadet es uns — unserem Seelenheile?«
Der Prinz hatte es nur scherzhaft gefragt.
»Nein. Es ist zwar Teufelsspuk, aber schaden tut er Euch nicht. Wie Ihr Euch verhalten sollt, sage ich Euch nachher noch. Es ist einfach genug.«
»Nun gut, so will ich meine Leute holen.«
»Tue es.«
Der Prinz begab sich in das große, eingerichtete Nebenzimmer, in dem die ganze Gesellschaft auch während der Nacht kampierte, so gut es eben ging, um gleich morgen in aller Frühe ihre heimliche Arbeit im Keller wieder aufnehmen zu können.
Nur Deasy schlief schon.
»Jungens, meine Herren — der Haui will uns Geister zitieren!«
Mit förmlichem Jubel wurde diese Mitteilung aufgenommen.
»Mister Scott, Sie bleiben wohl hier bei dem Kinde?«
»Gewiss.«
»Und dann möchte noch jemand anders hier bleiben, man kann nicht wissen — wir befinden uns hier in einem fremden Hause mit unverschließbaren Türen.«
Es meldete sich sofort jemand. Übrigens konnte er ja vielleicht auch einmal abgelöst werden. Edward Scott zeigte nicht die geringste Neugier. Er war durchaus nicht teilnahmslos, aber eben ein stiller Träumer geworden.
Dann gab der Prinz noch einige Instruktionen, der Haui wurde befragt, was etwa noch fehle, wegen des Lichtes — jawohl, so viele Lampen wie möglich, desto deutlicher sah man dann die Geister, wenn die Lampen dann auch innerhalb eines Kreises stehen müssten — sie begaben sich, jeder mit einer brennenden Lampe versehen, in den vom Prinzen auserwählten Raum.
Dieser lag in der ersten Etage, der größte, ein ganzer Saal, und die Hauptsache war, dass hier schon sämtliche Fenster eingezogen waren und dass vor denselben draußen eine Stellage befestigt war, von den Handwerkern angebracht, die dort draußen eben etwas zu mauern hatten.
Dem Haui wurde der Rest seiner Holzkohlen gebracht, den er auf dem Dache gelassen hatte, auch das letzte Holzfeuer lieferte noch solche, unterdessen hatte der Mann seinem unerschöpflichen Sacke schon ein großes Stück Kreide entnommen, malte höchst kunstfertig aus freier Hand in der Mitte des weiten Raumes einen großen Kreis, ungefähr fünf Meter im Durchmesser haltend, nur ein Stück nach jenem Fenster freilassend — es war bemerkenswert, dass er nicht erst den ganzen Kreis malte und die betreffende Stelle dann wieder weglöschte, man sah, wie sorgsam er hierbei war — und malte nun auch nach diesem Fenster gewissermaßen einen Gang von etwa zwei Meter Breite.
»Das ist die Bannlinie, welche die Geister nicht überschreiten können!«, erklärte er. »Sie können um den Kreis herumgehen, aber nicht über diesen Gang, der bleibt für uns nach dem Fenster frei.«
»Und auch wir dürfen diese Bannlinie nicht überschreiten?«
»Das könnt Ihr gar nicht.«
»Weshalb denn nicht?«
»Das werdet Ihr sehen. Es ist möglich, dass ich Dir, Effendi, einmal die Erlaubnis gebe, die Bannlinie zu überschreiten, ohne dass es Dir gefährlich wird, aber das kann ich Dir vorher nicht versprechen, dazu muss ich gewisse Zeichen beobachten.«
Wieder entzündete der Haui die Holzkohlen, diesmal in dem eisernen Becken, mit seinem primitiven Feuerzeug, was immer sehr lange dauerte, Streichhölzer und dergleichen zurückweisend.
»Ist das für die Beschwörung unbedingt nötig, dass das Feuer nur mit diesem Deinem Stahl und Stein und Zunder entzündet wird?«
»Ja, und es darf auch kein anderes solches Feuerzeug sein.«
Man denke an das heilige Feuer der Vestalinnen, welches, wenn es einmal erlosch, umständlich und unter Zeremonien mit dem Feuerbohrer erneuert werden musste, ein Feuerkultus, der durch die Religionslehren aller Völker geht, auch bei den alten Germanen mussten die Opferfeuer in ganz besonderer Weise entfacht werden, und das Christentum hat davon noch die Weihkerzen und das ewige Lämpchen übrig behalten, schließlich auch den Weihrauch, die Weihnachtskerzen.
Unterdessen hielt der Prinz mit seinen Getreuen die letzte Verabredung. Zunächst begaben sich Ingenieur Brause und ein anderer Mann auf die Stellage vor das Fenster hinaus, auch eine Laterne mitnehmend. Die Hauptsache waren dabei die Zeichen, die verabredet wurden, mit denen sie sich gegenseitig kontrollieren wollten, um Wirklichkeit von Illusion unterscheiden zu können.
Die Holzkohlen glühten, der Haui zog aus seinem Sacke eine andere Büchse, schüttete etwas schwarzes Pulver in seine Hand, warf es auf die Glut. Eine Wirkung war noch nicht zu beobachten, auch kein besonderer Geruch.
»Darf ich mit Dir sprechen?«
»Immerzu.«
»Darf ich fragen, aus was dieses Pulver besteht?«
»Der Hauptsache nach aus Blut, Eiern und Honig.«
Blut, Eier und Honig — dieselben Ingredienzen, die schon Homer den Odysseus benutzen lässt, wie er die Schatten aus dem Hades beschwört — welche aber auch ebenso seit undenklichen Zeiten sowohl der Priester der Samojeden wie der Südsee-Insulaner wie der Patagonier benutzt, wenn er Tote erscheinen lassen will.
Durch diese rätselhafte Übereinstimmung wird das kulturhistorische Studium der Nekromantie (Totenbeschwörung) und des ganzen Okkultismus aller Völker der Erde zu einem der interessantesten Gebiete der Ethnografie und Anthropologie.
Wie ist es möglich, dass der Gespensteraberglaube der Chinesen vor mehr als 2000 Jahren so vollständig genau mit dem der alten Germanen übereinstimmt?
Diese Frage lässt sich wieder nur mit Hilfe des Okkultismus beantworten.
»Dann müsste das aber doch kein Pulver, sondern eher eine schmiegsame Paste sein.«
»Es ist alles getrocknet und schon einmal gebrannt worden!«, lautete die Antwort.
Natürlich war noch etwas anderes dabei. Erst nach etwa fünf Minuten begann die Rauchentwicklung, nun aber auch ganz intensiv.
Rauch ist ja nur ein bedeutungsloses Wort. Es gibt doch die verschiedensten Arten von Rauch. Er kann so schwer sein, dass er sich sofort am Boden niederlagert, er kann sofort in die Höhe schweben und dort verschwinden.
Dieser Rauch hier war nur mit Nebel zu vergleichen. Ganz geruchlos, die Atmungsorgane kaum bemerkbar belästigend, ging er in dem vor jeder Zugluft geschützten Saale ganz gleichmäßig nach allen Richtungen von dem Feuer aus, unten nicht dicker als oben, alles wurde wie in einen Nebelschleier eingehüllt. Die Decke und die dunklen Wände waren allerdings bald nicht mehr zu sehen, dagegen erblickte man noch ganz deutlich dort die beiden Gesichter an dem Fenster, obgleich dieses von dem äußersten Ringe des Kreises noch immer gegen sechs Meter weit entfernt war, man sah auch die Laterne dort noch immer brennen.
Hier in diesem Kreise waren fünf Laternen am Rande aufgestellt worden, der Haui kauerte am Fenster, bewegte murmelnd die Lippen. Also doch wohl Beschwörungsformeln.
Die Rauchquelle wurde immer schwächer.
»Da, da — ist das nicht eine menschliche Gestalt?!«
Gar nicht lange hatte es gedauert, als so einer den anderen auf die Erscheinung aufmerksam machte.
Ja, dort in untaxierbarer Entfernung vollzog sich etwas!
Der weiße Nebel ballte sich in Kopfeshöhe zu einer dunkleren Kugel zusammen, zerfloss wieder, dafür entstand darunter etwas wie ein Rumpf, Arme kamen zum Vorschein, dafür aber zerfloss wieder der Rumpf, dann kam wieder der Kopf, und so ging das immer weiter, dabei auch langsam hin und her schwebend.
Der Prinz blickte nach dem Fenster, wo er selbst von dem Matrosen ununterbrochen beobachtet werden musste, hob die Hand.
Der Matrose machte den Ingenieur aufmerksam, dieser schlug mit der Hand ein liegendes Kreuz. Das sollte nach der Abmachung heißen: Ich sehe etwas Ähnliches wie eine menschliche Gestalt.
Das war von dem Ingenieur auch ganz richtig ausgedrückt.
Zu behaupten, dass das dort wirklich eine menschliche Gestalt gewesen wäre, hätte auf Selbsttäuschung beruht. Das konnten auch nur runde Nebelgebilde sein, aus denen sich die Phantasie einen Menschen zurechtformte. Da wird bei so etwas ja viel gesündigt.
Das Nebelspiel ging weiter, ohne dass etwas Fertiges daraus wurde.
Der Haui war aufgestanden, an den Rand des Kreises getreten, und betrachtete mit nicht weniger Interesse als die anderen, als wenn ihm das etwas ganz Neues wäre, die Erscheinung.
Jetzt streckte er die Hand aus, dann zog er sie wieder zurück.
»Ja, die Beschwörung hat gewirkt, das ist kein Trugbild. Es ist ein Geist, der zunächst versucht, sich sichtbar zu machen, was ihm nicht gleich gelingt. Die Geister haben bereits die Bannlinie gezogen. Versuche, Effendi, den Kreis zu überschreiten.«
Der Prinz wollte es tun.
Da erlebte er ein wunderbares Phänomen.
Er konnte den Kreidestrich nicht überschreiten.
Weshalb nicht, das hätte er selbst nicht zu schildern vermocht.
Schon wenn er die Hände vorstreckte, war es nicht anders, als ob er mit ihnen gegen ein sehr nachgiebiges Polster drückte, oder gegen ein gespanntes Tuch, je weiter er die Arme vorstreckte, noch über den Kreis hinaus, desto stärker wurde der Widerstand.
»Wie kommt das?!«
»Es ist der Nebel, den Du zusammendrückst, bis er sich nicht weiter zusammendrücken lässt. Anders kann ich es Dir nicht erklären. Ich weiß es selbst nicht. Vielleicht kannst Du später den Kreis überschreiten, ohne dass es Dir schadet. Jetzt kann auch ich es noch nicht, mein Amulett wirkt noch nicht. Die Geister bereiten sich erst vor, sich sichtbar zu machen, da wollen sie nicht gestört sein.«
Die Nebelkugeln dort hatten sich aufgelöst, bildeten sich nicht wieder.
Da wurde der Prinz von einem anderen am Arme gefasst, sein Blick nach der entgegengesetzten Richtung gelenkt.
Dort im Nebel wandelten zwei Gestalten, in langen Gewändern, jetzt ganz deutlich als menschliche Figuren zu erkennen!
»Das sind zwei Mönche!«, wurde sofort geflüstert.
»Dann sind das aber doch Tote!«, setzte der Prinz hinzu.
»Mache nicht immer den Unterschied zwischen Toten und Geistern!«, entgegnete der Haui. »Ja, es können Menschen gewesen sein, die gestorben sind, aber solche Tote, wie ich Dir zeigen kann, wenn Du auf meine Bedingungen eingehst, sind es nicht, welche Dir Aufschluss über das Jenseits geben können. Die hier sind dann noch an die Erde gebunden, es sind Gespenster.«
Die beiden Mönchsgestalten waren wieder verschwunden, hatten sich aber nicht wieder aufgelöst, sondern waren eben tiefer in den Nebel hineingegangen.
Da sauste etwas Dunkles hin und her, immer im Kreise, jedoch niemals den durch Kreidestrich markierten Gang passierend, hier stets wieder umkehrend, aber so schnell, dass man auch hierbei nicht unterscheiden konnte, was es eigentlich war.
Mit einem Male blieb es stehen.
Und da erst sah man, dass es ein großer, schwarzer Hund war.
Kaum hatte man dies erkannt, als die Erscheinung auch schon wieder verschwunden war.
»Da siehst Du, dass es keine Toten sein können«, sagte der Haui, der dies alles mit demselben Interesse betrachtete wie die anderen, »Tiere haben doch keine Seelen. Es sind nur die Träume von Gespenstern, von Geistern aus dem Schattenreiche.«
Plötzlich fuhr alles erschrocken zusammen.
Erst ein dumpfer Knall, und dann ein langandauerndes Geräusch. Es klang nicht anders, als wenn unten in der Tiefe Ketten rasselten, zusammengeworfen würden
»Was war das?«
Da bemerkte man das Seltsame, dass sich auch der Haui zu fürchten begann.
»Ich weiß es nicht, Effendi, ich weiß es nicht!«, flüsterte er ängstlich, sich scheu nach allen Seiten umsehend. »O, Allah, wenn die Geister auch solche Töne von sich geben — das dürfte nicht sein, das dürfte nicht sein.«
»Das ist doch nicht Deine erste Geisterbeschwörung?«
»Nein, o nein.«
»Kommen denn nicht sonst solche Geräusche dabei vor?«
»Nein, niemals, niemals! O Allah, das sind die Geister aus der ersten Hölle, die sich uns nähern, das habe ich freilich nicht erwartet!«
Scharf betrachtete der Prinz den alten Mann.
Nein, er konnte nicht glauben, dass diese Angst erkünstelt sei, dass der Mann ihn also betrügen wolle. Es passierte etwas, was auch ihm zu viel wurde.
Zunächst zeigte sich nichts weiter, das Geräusch wiederholte sich auch nicht wieder.
Der Prinz begab sich nach dem Fenster, öffnete es, stieg auf die hängende Plattform hinaus, schloss das Fenster wieder.
Die kühle Nachtluft umgab ihn, die konnte nicht so leicht Illusionen aufkommen lassen.
Aber die beiden Beobachter hier draußen hatten dort drin genau dasselbe gesehen, erst die Kugelgebilde, dann die beiden Mönchsgestalten, dann den hin und her jagenden Hund, und schließlich hatten sie auch den dumpfen Knall und das Kettengerassel gehört.
»Es war nicht anders, als ob das Geräusch tief unten aus der Erde käme!«, sagte Ingenieur Brause.
Auf dem Gerüst lag ein starkes, langes Seil, der Prinz befestigte es gut und ließ sich hinab, ging um das Kloster herum, entzündete seine Taschenlampe, ging durch den Garten, betrat wieder das Kloster, erstieg die Treppe.
Erschrocken blieb er stehen.
Denn da ertönte wiederum in der Tiefe das Kettenklirren, und zwar in einer Weise, dass man förmlich die Mauern zittern fühlte.
Ja, erschrocken war der Prinz. Oder er wäre ja kein Mensch gewesen.
Aber es gehörte auch viel dazu, dass er jetzt im Scheine seines Lämpchens seinen Weg ruhig fortsetzte.
So betrat er den Wohnraum.
Deasy schlief sanft, Edward Scott las in der Bibel, dagegen zeigte der zurückgebliebene Gesellschafter große Aufregung, was umso bemerkenswerter, weil Steuermann Spintsch sonst ein eiserner Mann war.
»Was ist das für ein Kettengerassel?«
Also auch er hatte es gehört. Selbstverständlich, wenn es der Prinz auch auf der Treppe vernommen hatte.
Aber immerhin doch sehr, sehr merkwürdig.
Der Prinz konnte keine Erklärung geben.
»Wenn wir nicht annehmen wollen, dass die ganze Sache arrangiert ist, dass da unten Leute sind, die mit Ketten rasseln, so handelt es sich hierbei eben um ein echtes Spukphänomen. Ihr fürchtet Euch doch nicht, Spintsch?«
»Fürchten, Gott bewahre — aber es ist doch wohl erlaubt, dass man sich über so etwas sehr wundert.«
»Was meinen Sie dazu, Mister Scott?«
Der Lesende blickte nur flüchtig einmal auf.
»Es kümmert mich nicht.«
»Gehört haben Sie den Knall und das Kettenrasseln auch?«
»Ja.«
Der Prinz verließ das Zimmer wieder, hatte von hier aus nur einen kurzen Gang zu machen, so stand er vor der Tür, welche in den großen Saal führte.
Dieser war also von den Handwerkern zuerst vorgerichtet worden, auch mit neuen Türen versehen, die ganz ausgezeichnet schlossen, von dem Rauche, der dort drin herrschte, war hier draußen auf dem Korridore nicht das Geringste zu bemerken, was man gerade sehr gut durch den Blendstrahl der Laterne beurteilen konnte.
Leise und vorsichtig öffnete der Prinz die Tür. Nun freilich quoll ihm der dichte Nebel entgegen.
Aber auch von hier aus waren dort im Zentrum im Scheine der im Kreise stehenden größeren Laternen ganz deutlich die fünf Menschen zu erkennen, nämlich der Haui und die vier Leute des Prinzen, und dem war die Hauptsache, zu konstatieren, dass diese einen ganz natürlichen Eindruck machten, durch den Nebel nicht etwa selbst solche Nebelgestalten wurden, also gar nicht zu vergleichen mit jenen Gestalten, die man vorhin außerhalb des Kreises gesehen hatte.
Nein, das hier waren und blieben richtige Menschen aus Fleisch und Blut, auch die Farben waren in diesem eigentümlichen Nebelrauche noch ganz deutlich zu unterschneiden.
Ein kurzes Besinnen, der Prinz schloss hinter sich geräuschlos die Tür und schritt, ohne sich hörbar zu machen, nach dem Mittelpunkte.
Dort ein allgemeines Erschrecken oder doch Staunen, als man plötzlich den Prinzen in dem Nebel kommen sah, und am meisten war das Erschrecken bei dem Haui der Fall.
»Inschallah, der Prinz!«
Dieser hatte den Kreis betreten.
»Worüber wunderst Du Dich so?«
»Wie kannst Du durch den Nebel gehen?!«
Der Prinz hatte eben absolut nichts von einem Widerstande oder sonst etwas verspürt.
Wohl aber konstatierte er jetzt, dass er nun nicht mehr den Bannkreis verlassen konnte, da trat ihm wieder jene unsichtbare, etwas nachgiebige Mauer entgegen.
Passiert war unterdessen nichts, das heißt, es hatten sich keine neuen Gestalten gezeigt, wohl aber war auch hier jenes zweite unterirdische Kettenrasseln zu hören gewesen, noch viel machtvoller als das erste Mal.
Der Prinz selbst war bei seinem Herkommen in dem Nebel als richtiger Mensch zu sehen gewesen, natürlich etwas schleierhaft verhüllt, aber nicht zu vergleichen mit jenen Nebelgestalten, die eben gerade ganz scharfe Konturen gehabt hatten, dafür aber farblos gewesen waren, nur dunkler als der weiße Nebel.
»Du sagtest doch, Muley, Du hättest ein Mittel, um den Bannkreis zu ...«
Der Prinz brach ab und wich erschrocken zurück.
Er hatte am äußersten Rande des Kreises gestanden, und da plötzlich ging dicht an ihm eine Gestalt vorüber.
Es war ein sehr großer, stark gebauter Mann mit langem Vollbart, unverkennbar ein Araber, er trug auch einen gewaltigen Turban, sonst aber wie ein mittelalterlicher Ritter gepanzert, und dennoch immer noch das Orientalische erkennen lassend — ein gewappneter Sarazene aus der Zeit der Kreuzzüge, wollen wir gleich sagen.
Ganz, ganz langsam wandelte er dicht an dem Kreise vorüber, in der rechten Faust das mächtige krumme Schwert, den Kopf scharf gewendet, den Prinzen direkt ansehend.
Wunderbar, dieser Anblick!
Einfach geisterhaft.
Alles farblos, nichts weiter als verdichteter Nebel, und dennoch durch Schattierung alles auch bis ins Kleinste aufs Deutlichste erkennen lassend.
So konnte man auch sofort sagen, dass dieser lange Vollbart von schwarzer Farbe war.
Die Agraffe an dem Turban bestand aus weißen Diamanten und farbigen Edelsteinen.
Ebenso war auch die Schwertscheide reich mit solchen Steinen besetzt, desgleichen die Griffe der beiden Dolche im Gürtel.
Alles farblos, nur aus etwas dunklerem Nebel bestehend, und dennoch dieser Farbenunterschied ganz deutlich erkennbar!
Aber wie, auf welche Weise, das hätte unmöglich jemand definieren können.
So wie ja auch diese scharfen Umrisse der Nebelgestalt ganz rätselhaft waren.
Langsam, ganz langsam, die zurückgesetzte Spitze des gepanzerten Fußes immer etwas am Boden ruhen lassend, schritt die Gestalt vorüber, mit scharf gewendetem Kopfe, dem Prinzen direkt ins Gesicht blickend.
Dieser sah die Pupillen der Augen, er sah alles, jedes einzelne Härchen des Bartes. Und trotzdem alles nur Nebel!
Und jetzt hob der gepanzerte Ritter, der aber auch noch einen orientalischen Umhang trug, den krummen Säbel, den er bisher waagerecht gehalten hatte, hob ihn langsam höher, um ihn dann langsam wieder zu senken, bis die Spitze fast den Boden berührte, so schritt er an dem Prinzen vorüber, hob den Säbel wieder, wandte den Kopf und verschwand im Nebel.
»Das war ein Sarazene aus dem zwölften Jahrhundert, aus dem dritten Kreuzzuge«, flüsterte der Prinz.
Er hatte es aus der Rüstung, aus dem ganzen Kostüm erkannt. In der Kostümkunde haben es unsere Forscher weit gebracht.
»Bei Allah und dem Propheten«, flüsterte auch der Haui ganz außer sich, »ein Sarazene aus Saladins Zeiten, und er hat Dich gegrüßt, Effendi!«
Aus Saladins Zeiten!
Saladin, der Sultan von Ägypten und Syrien, ist noch heute für den Araber, was für uns Deutsche einst Kaiser Barbarossa war.
Übrigens waren die beiden ja auch Zeitgenossen. Kaiser Friedrich I. und Saladin, das waren doch die beiden Gegner im dritten Kreuzzuge.
Kaiser Friedrich fand seinen Tod in den Wellen des Saleph bei Kalykadnos in Kleinasien, er ertrank beim Baden.
Nicht für das deutsche Volk, nicht für die deutsche Sage. Er lebte noch, saß als Kaiser Barbarossa schlafend im Kyffhäuser. Bei der Kaiserkrönung zu Versailles soll er erwacht sein.
Sultan Saladin starb am 3. März 1193 zu Damaskus, wahrscheinlich infolge eines Hufschlags seines Pferdes.
Nicht für die Araber.
Für die Araber lebt Sultan Saladin noch heute.
Er schläft irgendwo, und er wird dereinst erwachen und die Fremden zum Teufel jagen, wird sein arabisches Volk zur alten Sarazenenherrlichkeit zurückführen.
Jeder Araber weiß das und träumt von dieser Zukunft, und jedes Kind kann den Sultan Saladin beschreiben. Obgleich es kein Bild von ihm gibt. Der Mohammedaner darf den Menschen nicht in Bild und Figur nachahmen. Es geht von Mund zu Mund. Ein kleiner, schlanker, zierlicher Mann, aber aus Erz gegossen, mit mächtigen, feuersprühenden Augen. Man denkt bei dieser Beschreibung unwillkürlich immer an Hans Joachim von Ziethen. Trotz dieser zierlichen Gestalt ein Ritter, der selbst den furchtbaren Richard Löwenherz zum Zweikampf auf Schwert und Streitaxt herausforderte. Welcher Zweikampf nicht stattfand, weil beide vorher einen Freundschaftsbund schlossen. —
Also die Gestalt war im Nebel wieder verschwunden, durch die Entfernung, nicht dass sie sich aufgelöst hätte.
Doch da kam schon eine andere geschritten, wieder ein Sarazene, ein arabischer Ritter, dieser mit einer gewaltigen Streitaxt über der Schulter, und auch er wandte wie mit einem Ruck den Kopf, schaute direkt den Prinzen an, und dann nahm er die Streitaxt von der Schulter, auch er senkte die Waffe langsam vor dem Prinzen, ihm zweifellos so seine Ehrfurcht erweisend, verschwand im Nebel.
Da aber war schon der dritte Sarazene aufgetaucht. Und so zog einer nach dem anderen an ihm vorüber, mit Säbeln und Schwertern und Äxten und Streitkolben, immer die Waffe vor dem Prinzen senkend, ihn starr anblickend.
Wenigstens zwei Dutzend solcher Gestalten hatte man gezählt.
Jetzt aber kamen Frauen, meist junge Mädchen, orientalisch gekleidet, aber mit unverhüllten Gesichtern, ganz deutlich konnte man die schönen Züge sehen, die mandelförmigen Augen, den Schmuck, besonders die Ringe an den feinen Fingern — und auch sie alle wandten den Kopf nach dem Prinzen, kreuzten die bisher herabhängenden Arme über der Brust und verneigten sich im Gehen vor ihm.
»O, Allah, Allah, was ist das nur?!«, stöhnte der Haui.
Dies alles musste ihm nicht in das Programm passen. Er erlebte etwas, was er nicht zu erleben erwartet hatte. Der Mann war ganz außer sich, er verkroch sich vor Furcht hinter den anderen.
Und da plötzlich Trompetengeschmetter und Trommelwirbel!
Wie in weiter, weiter Ferne ertönend, aber doch so ganz deutlich. Ein richtiges Trompetengeschmetter, halb Signale, halb ein Marsch.
Wimmernd warf sich der Haui auf die Knie nieder.
»O Allah, o Allah — beende diesen Teufelstrug — das, das habe ich nicht gewollt — Sultan Saladins Kriegsmarsch ...«
Die anderen kamen nicht dazu, über dieses Gebaren und diese Bemerkung des Hauis zu staunen.
Neue Gestalten in geschlossener Reihe tauchten auf, Jünglinge in Schuppenpanzern, mit kurzen Schwertern bewaffnet, auf dem Rücken lange Bogen und mit Pfeilen gespickte Köcher.
Sie zogen vorüber, ihre Schwerter vor dem Prinzen senkend.
Näher und näher kamen die Trompeten- und Trommelklänge, aber die Spielleute sollte man nicht zu sehen bekommen.
Und jetzt ein weißes, herrliches Ross, prächtig aufgezäumt, und im morgenländischen Sattel ein kleiner, zierlicher Mann, das edle Antlitz mit lang herabhängendem Schnurrbart und Adlernase; über dem Schuppenpanzer fiel ein Leopardenfell herab, alles nebelhaft und doch so ganz deutlich.
»Sultan Saladin!«, schrie der Haui und warf sich platt zu Boden, das Gesicht in den Händen vergrabend und gegen die Steinfliesen drückend.
Man achtete seiner nicht.
Denn jetzt geschah das Unerklärlichste von allem.
Die Gestalten zogen mit der linken Seite an dem Kreise vorüber.
Und jetzt beugte sich der Reiter, ebenfalls den Prinzen starr anblickend, etwas im Sattel, streckte ihm die linke Hand entgegen.
Streckte also den Arm bis noch über den Ellenbogen über den gezogenen Kreidestrich hinaus in das Innere des Kreises.
Und da war das keine farblose nebelhafte Hand mehr, sondern so wie sie und der Arm über den Strich hervorkamen, war es eine richtige Hand von Fleisch und Blut, und der Arm von silbernen Schuppen eingehüllt.
Der Prinz war vor dieser Hand etwas zurückgewichen, dabei aber sie doch aufmerksam betrachtend.
Eine braune, feine und doch überaus kräftige, muskulöse Hand!
Und am Zeigefinger funkelte als einziger Schmuck ein goldener Reif, oben drauf eingefasst ein flacher, schwarzer Stein, wahrscheinlich schwarzer Achat, und auf diesem eingegraben ein kleiner goldener Schlüssel!
Betroffen starrte der Prinz auf dieses ihm so wohlbekannte und dennoch immer noch ganz rätselhafte Zeichen, zumal ihm rätselhaft an dieser Hand!
Mit einem Male wandelte ihn das Verlangen an, diese Hand zu packen und festzuhalten.
Dabei hatte der Reiter ja nicht etwa gehalten, dies alles spielte sich ja in nur einer Sekunde ab.
In demselben Moment aber, da der Prinz zugreifen wollte, wurde die Hand wieder zurückgezogen, war jenseits des Kreidekreises wieder zu einer Nebelhand geworden, wenn man den Ring am Finger auch noch sah.
Und im nächsten Moment ertönte wieder ein dumpfer Knall, wie tief unten in der Erde, und gleichzeitig zerflossen Ross und Reiter und alle die anderen Gestalten, die ihm vorausgegangen waren und noch folgten, in ein Nichts.
»Allah, o Allah, sei gnädig mit mir verworfenem Sünder!«, hörte man den Haui am Boden winseln.
Betroffen blickten sich die anderen an, nicht wissend, was sie von alledem denken sollten.
Da kam in den weißen Nebel, der übrigens immer dünner wurde, eine Bewegung.
Es kam daher, weil die Tür geöffnet worden war, denn jetzt sah man von dort her Steuermann Spintsch durch den Nebel geeilt kommen.
»Hoheit, Deasy ist erwacht und verlangt nach Ihnen, das Kind ist sehr aufgeregt!«
So rief er schon von Weitem.
Sofort sprang der Prinz in jener Richtung davon, nicht darauf achtend, dass er jetzt ohne Weiteres den Kreis verlassen konnte.
Hinter ihm richtete sich der Haui empor, blickte verstört um sich, sprang vollends in die Höhe, raffte seinen Sack auf und eilte den beiden nach, ward aber vorläufig nicht mehr gesehen. Er musste sich im Finstern die Treppe hinabgetastet haben und weiter ins Freie, hatte dieses Haus verlassen, in welchem er einen auch ihm ganz unerwarteten Spuk erlebt hatte.
Der Prinz betrat das gemeinschaftliche Zimmer. Jetzt lag Edward Scott schlafend auf einem Diwan, dafür war Deasy erwacht. Aufgeregt war das Kind gerade nicht, es machte nur ein recht merkwürdiges Gesicht.
»Onkel, ich muss Dir etwas erzählen! Aber nur Du allein darfst es hören.«
Ein Wink, und der mit eingetretene Steuermann verließ wieder das Zimmer.
»Und unser Freund dort?«
Deasy blickte hin.
»Der schläft, und der dürfte es auch hören. Denke Dir, Onkel, was ich geträumt habe. Aber das kann doch gar kein Traum gewesen sein? Aber geträumt habe ich. Plötzlich steht vor mir ein Ritter, er sieht aus wie ein Araber, hat auch statt des Helmes einen Turban auf, ein ziemlich kleiner, niedlicher Mann, gar nicht grimmig aussehend, aber doch ein Ritter — er sprach mit mir freundlich — was er gesagt hat, weiß ich nicht mehr — und doch: ich soll Dir, dem Onkel Joachim, etwas geben — aber er hat noch viel mehr gesagt — das weiß ich nur nicht mehr — und da zieht er vom Finger einen Ring — und da plötzlich wache ich auf — eben jetzt, vor ein paar Minuten — und da habe ich hier in der Hand ...«
Deasy streckte das linke Händchen vor, öffnete es — in der Hand lag ein goldener Ring mit schwarzem Stein, in den vertieft ein kleiner goldener Schlüssel geschnitten war!
Noch starrte der Prinz auf den Ring, hatte ihn noch nicht genommen, konnte so, wie der Ring gerade in der Hand lag, alles erkennen — da schloss Deasy von selbst wieder die Fingerchen über den Ring, schloss die Augen, lehnte sich mit einem keinen Seufzer in die Kissen zurück — war in Trance gefallen.
Auf der von Chijam nach Bulak führenden Landstraße schwebte im ersten Morgensonnenschein eine blaue Brille entlang. Zwar saß sie auf einer Nase, und auf was für einer! — Dieser Schweinerüssel gehörte auch einem Menschen an — aber von alledem war nichts zu sehen. Nur die große blaue Brille schwebte entlang, in jener gewissen Höhe, in der eine blaue Brille zu schweben hat, die auf der Nase eines ziemlich kleinen Menschen sitzt.
Jochen Puttfarken hatte die Nacht im Eselstalle verbracht, tief im Heu vergraben.
Die ganze Nacht hatte dort drüben die Teufelsbalgerei mit einem Mordsspektakel gewährt, Puttfarken aber hatte sich nicht darum gekümmert, hatte seine gebratene Beute verzehrt, sich in Decken gewickelt, noch tiefer ins Heu vergraben und war sanft entschlummert.
Als er erwachte, graute der Morgen durch die blitzblanken Stallscheiben.
Jochen kroch aus seinem Versteck hervor, gleich von Vornherein auf die Decken verzichtend und sich nicht etwa der Hoffnung hingebend, dass sich in der Nacht etwas geändert habe, dass er sich selbst jetzt sehen könne.
Der Aussatz ist unheilbar, man kann dabei alt wie Methusalem werden, eine Besserung kann da also nie eintreten.
»O jemineh, o jemineh, wenn das so weiter geht mit der Unsichtbarkeit, wenn ich mich zuletzt auch nicht mehr fühlen werde!«, seufzte der arme Jochen.
Alles war still. Die Tür konnte er öffnen, er verließ den Stall.
Auch draußen war niemand zu sehen. Er begab sich nach dem langgestreckten Gebäude, in dem gestern Nachmittag und die ganze Nacht hindurch die Teufelsschlacht stattgefunden hatte.
Die Tür war geschlossen, aber ein Fenster stand offen. Das sah ja nett da drin aus! Es war noch nicht aufgeräumt worden. Alles ein Tohuwabohu von Stühlen und Stöcken und zerbrochenem Geschirr.
Vorsichtig stieg Jochen durchs Fenster. Hier ein Frühstück zu finden, darauf musste er verzichten. Dafür hatten Hunde und Katzen gesorgt. Aber vergebens hatte Jochen gehofft, seine Uhr und Brieftasche und Geldbörse mitnehmen zu können.
Seine ihm ausgezogenen Kleider waren nicht zu erblicken.
Und was sollte er auch mit dem Zeuge, wohin seine Uhr und Börse stecken?
Jetzt erst fiel es ihm ein, dass er so etwas ja gar nicht mehr gebrauchen konnte.
Dagegen begrüßte er mit Freuden seine blaue Brille, die er unter einem Schranke liegen sah. Ja, die konnte er gebrauchen, die musste er unbedingt haben, wenn es einmal gegen die Sonne ging. Sonst bekam er entzündete Augen, zweifellos auch noch als unsichtbarer Geist.
Und er wusste auch, dass diese Brille ihm nicht zum Verräter werden konnte. Denn er hatte schon gestern erfahren, dass alles, worüber er die Finger schließen konnte, ebenfalls spurlos in seiner Hand verschwand. Und die beiden Bügel der goldenen Brille hatten in der Mitte Scharniere zum Einklappen, um die andere Hälfte hinters Ohr zu legen, und so eingeklappt konnte Jochen die ganze Brille recht wohl in seiner großen Pfote verbergen.
Er kletterte wieder zum Fenster hinaus. Das Tor war selbstverständlich geschlossen, innen steckte kein Schlüssel, ein Erklettern des Tores oder der hohen Mauer gab es nicht, es fehlte an jeglichen Vorsprüngen. Aber dort am Hause lehnte eine lange Leiter. Noch einmal inszenierte Jochen auf diesem heiligen Boden einen Teufelsspuk, indem er diese Leiter selbstständig durch die Luft schweben ließ. Aber er hatte ja keinen Beobachter. Alles war wie ausgestorben.
So lehnte er die Leiter gegen die Mauer, kletterte hinauf, ließ sich an der anderen Seite hinab und dann noch anderthalb Meter tief fallen.
So, nun konnte sein neues Leben beginnen.
Denn wie er dies als unsichtbarer Aussätziger führen würde, das hatte er sich nun unterdessen überlegt.
Zu seinem Herrn und den Freunden kehrte er nicht zurück. Die wollte er nicht anstecken. Und das könnte auch mit einem Briefe geschehen. Abgesehen davon, dass Jochen ja gar nicht schreiben konnte. Ob er sie auf andere Weise, also wohl durch mündliche Botschaft von seinem Schicksale benachrichtigte, das würde sich später finden, vorläufig geschah es noch nicht.
Kurz und gut, Jochen Puttfarken, der auch in seiner Heimat ganz allein stand, hatte beschlossen, sich als unsichtbares Wesen schlecht und recht durchs Leben zu schlagen. Denn so wenig er auch sonst von Aussatz wusste, so hatte er doch schon von solchen Leproserien gehört, in die man die Aussätzigen einsperrt, und so lebendig hinter Mauern begraben ließ er sich auf keinen Fall.
Dass ihm niemals etwas mangeln würde, wusste er ja auch schon, aber dieser Gedanke, sich so als unsichtbarer Geist durch die Welt schlagen zu müssen, immer nur von Diebstahl lebend, machte ihn nicht etwa glücklich, das Abenteuerliche dabei belästigte ihn wenig, und gerade jetzt umso weniger, als es ihn in seinem Adamskostüm in der frischen Morgenluft ganz schauderhaft fror.
Immer so nackt herumzulaufen, das hatte er ja allerdings nicht nötig. Wenn er auch das Experiment mit dem bandagierten Kopfe nicht wiederholen wollte. Aber da gab es auch noch einen anderen Ausweg. Gerade hier in Ägypten wie im ganzen Orient hatte er es ja sehr bequem. Er ging einfach als mohammedanisches Weib, mit verschleiertem Gesicht. Nur freilich musste er immer darauf gefasst sein, einmal sein Gewand fahren zu lassen, um als unsichtbarer Geist zu entweichen und sich dann ein neues solches Kostüm zu verschaffen. Denn das alte konnte er dann doch nur in den seltensten Fällen mitnehmen.
Mit solchen Gedanken wanderte er in der Morgendämmerung die Landstraße entlang, sich manchmal kräftig die Arme um den Leib schlagend, und seine einzige Freude bestand darin, dass er es wenigstens noch klatschen hörte.
»Wenn's erst nicht mehr klatschen tut, nachher ist der Aussatz ganz und gar perfekt, vorläufig aber — ha — hazzieh! — hävv ik enn tüchtigen Schnuppen krägen.«
Schlimm war es nicht, Jochen war wetterfest, und die Sache besserte sich, als die Sonne emporstieg, jetzt im Spätherbst gegen sieben, und obgleich Jochen absolut keinen Schatten warf, also ihre Lichtstrahlen durchließ, absorbierte sein Körper doch ihre wohltuende Wärme.
Nur musste jetzt, da er gegen die Sonne ging, die blaue Brille in Aktion treten.
Manchmal blickte er hinter sich, damit ihn nicht jemand überhole, ein auf nackten Sohlen lautloser Wandersmann ihm von hinten gleich direkt in den Rücken laufe.
Als ihm ein Fellah entgegenkam, nahm er rechtzeitig die Brille ab, barg sie in der Hand, blieb auch so lange stehen und drehte der Sonne den Rücken. Denn es war ihm wirklich höchst unangenehm, gegen die niedrig stehende Sonne zu blicken. In fünf Minuten konnte er entzündete Augen haben, die ihn dann zwar nicht am Sehen hinderten, ihn aber zu schmerzen begannen.
Jetzt kam ihm ein Jagdwägelchen entgegen, gelenkt von dem einzigen Insassen, einem eleganten Herrn.
Noch ehe Jochen ihn passierte, hielt der Wagen, der Herr stieg aus, beschäftigte sich mit dem Geschirr. Wie Jochen jetzt sah, war ein Strang gerissen, der Herr flickte ihn mit Bindfaden.
Das ging aber doch nicht so schnell, es war mehr Arbeit nötig, und der Herr zog dazu sein gelbes Satinjackett aus, hing es an den Ast eines Chausseebaumes, krempelte die Manschettenärmel hoch und setzte so seine Arbeit fort, um sich möglichst wenig zu beschmutzen.

Da hatte Jochen eine Idee. So oder so, einmal musste doch der Anfang gemacht werden.
Er ging hin nach der aufgehängten Jacke und untersuchte mit der nötigen Vorsicht ihre Taschen, ein Auge auf den arbeitenden Herrn am Wagen gerichtet behaltend.
In der einen Innenseite eine Brieftasche. Die ließ Jochen kalt. Was wollte er denn mit Geld. Aber in der anderen Innentasche — ah, ein gefülltes Zigarrenetui!
Jochen war so bescheiden, sich nur eine einzige Zigarre herauszunehmen. Nun musste er aber auch noch ... richtig, da hatte er seine Sehnsucht schon in einer der äußeren Seitentaschen gefunden, ein silbernes Büchschen, Schwefelhölzer enthaltend, durch einen anderen Zündsatz überall anreißbar, in Ägypten allgemein verbreitet, weil nicht so hoch versteuert wie die schwedischen Zündhölzer.
Drei Stück würden wohl für die Zigarre genügen.
Und in der anderen Seitentasche?
Ein in weißes Papier gewickeltes Päckchen, es war auf der einen Seite etwas geöffnet, und da schaute ihm ein braungebackenes Brötchen entgegen, dazwischen eine rosige Schinkenscheibe
Das war ein gefundenes Frühstück! Jochen ließ es mitgehen.
Ja, es ist sehr schön, wenn man solche große Hände hat, noch dazu solche, die alles darin Enthaltene unsichtbar machen!
In genügender Entfernung von dem Wagen, an dem der elegante Mann immer noch emsig arbeitete, gab sich Jochen dem Genusse der Schinkensemmel hin.
Sein Herz pochte ihm ein wenig. Es war in seinem Leben, wenn er sich richtig besinnen konnte, sein erster Diebstahl. Solche kleine Annektierungen, welche der Seemann »Besorgen« nennt, werden ja nicht mitgezählt.
Trotzdem, die Schinkensemmel schmeckte ihm ganz ausgezeichnet. Schade, dass sie nicht die dreifache Länge hatte. Dann setzte er die Zigarre in Brand.
Ah, schmeckte die köstlich am frühen Morgen!
Und gerade bei einem unsichtbaren Menschen erfüllt eine Zigarre den Zweck, den Unterschied erkennen zu lassen, wo hinten und vorne ist.
So sagte sich Jochen.
Allerdings tat dies ja auch seine Brille, aber ...
Ja, was war denn das?
In seiner wirklichen Angst, seinen ersten wirklich Raub unbemerkt in Sicherheit zu bringen, und dann in dem Genusse, den ihm die Schinkensemmel und dann die Zigarre bereitete, hatte er gar nicht daran gedacht, seine Brille wieder aufzusetzen, hielt sie noch in der Hand.
Und war er nicht schon länger als fünf Minuten gegen die Sonne gegangen, zehn Minuten, hatte immer direkt hinein geblickt?
Und er empfand gar nicht das ihm sonst so bekannte, unangenehme Gefühl in den Augen, das sich schon jetzt bis zu heftigen Schmerzen steigern musste?
Nicht die geringste Empfindung davon!
»Meine Augen sind durch den Aussatz wieder gesund geworden!«
So sagte sich Jochen.
Er mochte recht haben. Nur dass es nicht der Aussatz war, der diese Schwäche behoben hatte.
Jochen behielt zwar noch die Brille, warf sie vorsichtiger Weise nicht gleich weg, setzte sie aber nicht wieder auf.
Und auch jetzt, obgleich er es erwartete, was doch gewöhnlich viel mit dazu beiträgt, wollten sich die Schmerzen in seinen Augen nicht einstellen.
Ja, seine Augen wenigstens waren gesund geworden!
Nun gab er sich erst recht dem Genusse der Zigarre hin. Hochbeglückt setzte er seinen Weg fort.
Aber dieses Glück sollte nicht länger währen, als bis er die Zigarre aufgeraucht und den Eisenbahndamm erreicht hatte.
In der Untertunnelung standen eine Menge schwatzender Araber, die auf etwas warteten, Jochen hätte unbemerkt gar nicht so leicht an ihnen vorbei kommen können. Doch diesen Weg hatte er ja auch gar nicht nötig. Er überschritt ein unbestelltes, steinhartes Feld und erkletterte den hohen Bahndamm.
Da lag vor ihm Masr el Kahira, die Siegreiche, im Glanze der Morgensonne mit ihren zahllosen Moscheen.
Und da mit einem Male bei diesem herrlichen Anblicke überkam Jochen die tiefste Niedergeschlagenheit.
Was wollte er denn eigentlich da drin in der Stadt?
In den Straßen splitterfasernackt herumlaufen, jedem Menschen ängstlich ausweichen müssend, sich vom Diebstahl nährend?
Ja, was sollte er überhaupt noch auf der Welt?
Er dachte noch anderes, aber wir können seine Gedanken nicht schildern, wie alles kam.
Nicht jeder Selbstmordskandidat braucht etwas auf dem Gewissen zu haben. Es braucht keine unglückliche Liebe, kein unersetzlicher Verlust, kein unerträglicher vorzuliegen. Einfach Lebensüberdruss. Und da kann der Entschluss vielleicht in einem einzigen Momente zur Tat reifen. Vielleicht! Wer vermag's zu sagen, der es nicht selbst durchgemacht hat?
Bei dem armen Jochen war's der Fall.
Er blickte auf das Häusermeer hinab, starrte vor sich auf die Schienen nieder, und dann blickte er nach rechts und dann links.
Und dort von links, von Alexandrien her, kam soeben ein Zug, noch in weiter, weiter Ferne, man sah gerade etwas Schwarzes und darüber die Rauchwolke.
Und da war der plötzliche Moment gegeben!
»Ick werd mir überfahren lassen.«
Gedacht, getan! Wenn schon, denn schon — auch in solch einem Falle war Jochen Puttfarken ein Mann der Tat.
Er blickte wieder nach links.
Die vier Schienenstränge gleißten wie poliertes Silber in der Sonne.
Aber das konnte er sehen, wie der Zug mit ganz unheimlicher Schnelligkeit herankam. Es musste ein Schnellzug sein.
Er blickte nach rechts.
Die Station Bulak war noch eine gute Strecke entfernt, der Zug würde hier seine Fahrt noch nicht mäßigen. Übrigens hielt der Schnellzug hier auch gar nicht, fuhr glatt durch. Der Hauptbahnhof für Kairo auf dieser Seite des Nils liegt ganz anderswo.
Nun war Jochen mit seiner letzten Kalkulation auf dieser Erde fertig.
Er legte sich hin auf die Schienen. Auf die Seite und etwas schräg, das Gesicht nach Bulak hin.
»Erst wird mir der Kopf abgefahren, dann der Brustkasten eingedrückt, dann gehen die Beine flöten — dann bin ich ganz sicher tot.«
Das war sein letzter Gedanke.
Denn sonst wusste er nichts weiter, woran er denken sollte.
Die Schienen begannen zu zittern, Jochen schloss das linke Auge.
Der Erdboden begann zu zittern und Jochen kniff auch das rechte Auge zu.
Und jetzt begann es zu donnern.
Noch einmal ein Gedanke, der allerletzte: »Nun ade, Du schnöde Welt!«
Da donnerte der Zug über den armen Jochen hinweg! Er befand sich im Jenseits.
Jetzt fing Jochen im Jenseits zu denken an.
»Tot, tot, jetzt bin ich tot.«
Er öffnete im Jenseits die Augen, aber was er da erblickte, das sah eigentlich genau so aus wie vorher.
Und wenn er sich nicht irrte, lag er noch genau so, wie er vorhin gelegen hatte.
Jochen griff sich an den Kopf.
Der war noch dran.
»Hm, das Überfahrenlassen habe ich mir eigentlich anders vorgestellt!«
Ja, und was war denn das für ein Zug dort, der nach der Station Bulak strebte, sich von ihm entfernte?
Da ging Jochen die Ahnung der Wahrheit auf.
»Ick bin gar nicht tot!«
Nein, er konnte es nicht sein, wenigstens nicht den Tod durch Überfahrenlassen gefunden haben, denn er hatte sich auf das falsche Schienengleis gelegt. Er hatte vergessen, dass in Ägypten wie in England und überhaupt in den meisten Ländern die Züge links fahren.
Und auf welchem Gleise vorhin der Zug angebraust gekommen war, das hatte er nicht erkennen können, die gleißenden Stränge hatten ihn gar so sehr geblendet.
Jetzt aber kam dort aus der geschlossenen Halle der Station Bulak ein anderer Zug herangebraust, jetzt also auf dem Gleise, auf dem Jochen noch immer lag.
Also er hatte noch immer guten Anschluss zur Fahrt ins Jenseits, seine Ankunft dort konnte sich höchstens um eine halbe Minute verzögern.
Aber Jochen verpasste den Anschluss.
Er stand schnell auf und trat noch schneller zur Seite, um diesen zweiten Schnellzug an sich vorüberzulassen.
»Nee, zum zweeten Male lass ick mir nich überfahren! Ick nich!«
Da hatte Jochen auch wieder ganz recht.
Einmal im Leben sich Kopf und Beine von einem Eisenbahnzuge abfahren zu lassen, das genügt vollkommen. Man soll nichts übertreiben.
Jochen blickte dem vorübergelassenen Zuge nach.
Dann atmete er tief die sonnige Morgenluft ein.
»Ick fühle mir wie neugeboren!«
Ja, das soll wohl sein — wenn man sich von einem Zuge hat überfahren lassen und hat sämtliche Gliedmaßen noch an seiner vorschriftsmäßigen Stelle.
Kurz und gut: Bei Jochen war durch dieses verfehlte Experiment die volle Lebensfreudigkeit wieder eingekehrt!
Er kletterte den Bahndamm auf der anderen Seite hinab und setzte mit federnden Säbelbeinen seinen Weg fort, brauchte auch als neugeborener Mensch die Brille, die er während seines Todes nicht aus der Hand gelassen, nicht mehr aufzusetzen.
»Jetzt möcht ick bloß noch so 'ne Schinkensemmel finden.«
Er sollte in dieser seiner neuen Lebensperiode gleich noch etwas ganz anderes finden als nur eine Schinkensemmel.
Nicht weit vom Bahndamm entfernt stand an der Landstraße eine sehr schöne Gartenvilla, und aus dem Tore trat soeben eine sehr schöne junge Dame. Und elegant dazu! Vom Scheitel bis zur Sohle, alles neueste Pariser Mode. Pompös!
Jochen war gerade seitwärts vorübergegangen, hatte der Dame gerade in das blühende, wirklich auffallend hübsche, wenn nicht schöne Gesicht geblickt.
Und wie erstarrt stand er da!
»Das ist doch — das ist doch ...«
Jawohl, das war sie.
Karoline Schinke war ihr Name. Damals, als Jochen ihre Bekanntschaft in Hamburg gemacht hatte, Büfettmamsell in einem feinen Restaurant. Kalte Büfettmamsell. Jochen hatte sie erblickt, hatte sich ihr genähert und mit einem echten Diamantring ihr jungfräuliches Herz betört. Wenigstens beinahe ganz echt. Mit weiteren fürstlichen Geschenken hatte er die wirklich auffallende Schönheit sogar so weit gebracht, dass sie mit ihm spazieren ging, und nicht nur, wenn es ganz finster war, allen Laternen ausweichend.
Aber vielleicht waren die fürstlichen Geschenke gar nicht nötig gewesen. Aller Wahrscheinlichkeit nach hatte das schöne Mädchen das kleine Krummbein mit der Schweinerüsselnase wirklich geliebt, war stolz auf ihren Jochen gewesen. Wie das so manchmal vorkommen kann. Erstens sind die Geschmäcker verschieden, und zweitens, wo die Liebe hinhaut, da wächst bekanntlich kein ... nein, wo sie hinschlägt, da liegt sie eben. Die Liebe ist eben blind.
Kurz und gut, es war ein sehr, sehr glückliches Liebesverhältnis gewesen.
Kurz und gut im buchstäblichen Sinne dieser Worte.
Sehr gut, sehr schön, aber nicht lange während.
Aber die Schuld des Fräulein Karoline Schinke war das nicht gewesen.
Die Liebe der kalten Büfettmamsell war eine wirklich heiße gewesen.
Dagegen war Herr Jochen Puttfarken eines Tages ohne Abschied auf und davon gegangen.
Denn er war ein Seemann.
Das war vor anderthalb Jahren gewesen. Jochen hatte wohl manchmal an sie gedacht — vorhin freilich, als er den Tod auf den Schienen suchte, nicht.
Und jetzt stand sie vor ihm! Immer noch das schöne, niedliche Mädchen.
Jochens Entschluss war sofort gefasst. Und in der Ausführung zeigte er, dass er wirklich jeder Lage gewachsen war.
Fräulein Karoline Schinke hatte ihren roten Spitzensonnenschirm aufgespannt, wandte sich, um den Weg nach der Stadt oder der Station einzuschlagen.
»Pst!«
Sie drehte sich um, sah niemanden, setzte ihren Weg fort. Ein Irrtum.
»Pst, pst!«
Sie blieb stehen, drehte sich wieder um.
»Was ist denn das? Das klingt ja gerade, als ob eine Weißbierflasche zischt.«
»Pst, ick bin es, Jochen Puttfarken.«
Zunächst ließ Fräulein Karoline den Sonnenschirm fallen, und dann schien sie Lust zu haben, sich daneben zu legen.
»Still, Karoline — nur keen Bange — ick bin enn Engel.«
Denn er wusste, dass sie an Engel glaubte, sie hatte es ihm einmal ganz ausführlich erzählt. Wie ihrer Großmutter einmal ein Engel erschienen war, und ihr selbst gleichfalls, in der Nacht, vor ihrem Bett. Dieser letztere Engel hatte sich dann zwar als ein an der Wand hängendes Handtuch erwiesen, aber das tat ihrem Glauben keinen Abbruch, dass sie einen richtigen Engel gesehen habe.
Jetzt freilich begann sie sich zu fürchten. Sollte sie es auch nicht. Ein Glück, dass sie vor Schreck nicht fähig war, auszureißen oder nur zu schreien, hinwiederum auch nicht schwach genug, um umzufallen.
»Ick bin's, Karline — Jochen Puttfarken aus Blankenese — ick bin tot un enn Engel woorn.«
Mit sanftester Stimme hatte es Jochen geflüstert, wie es einem Engel gebührt.
Und da geschah das Unfassbare, dass Fräulein Karoline die Besinnung behielt und auf alles einging
Die Sache war aber eben die, dass Jochen sie zur Genüge kannte.
»Jochen — Du — Du — bist tot?«
»Tjo.«
»Du bist im Himmel?!«
»Tjo.«
»Du bist ein Engel?!«
»Tjo.«
»Und Du — Du — kommst — um mich auf Erden aufzusuchen?!«
»Tjo.«
Mit immer verklärterem Gesicht hatte sie ihre Frage gestellt, dabei aber auch nicht vergessen, ihren Sonnenschirm aufzuheben und auch gleich mit einem Seidentüchlein den Staub abzuwedeln.
Diese Szene konnte weder belauscht noch beobachtet werden, die Villa lag ganz hinten im Garten, auch von den Fenstern aus konnten die beiden nicht gesehen werden, dafür sorgte schon der schlaue Jochen.
»Woran bist Du denn gestorben?«
»An — an — an 'ner Lokomotive, ick bin überfahren woorn!«, blieb Jochen bei der Wahrheit.
»Wann denn?!«
»Das — das — das därf ick noch nich sagen. Meine Leiche ist noch nicht gefunden worden.«
»Deine Leiche noch gar nicht gefunden?!«
»Nee.«
»Und so lange die noch nicht gefunden worden ist, darfst Du nicht darüber sprechen?!«
»Nee.«
»Wo ist denn das geschehen?«
»Darf ick ooch nich seggen. Bis man mich gefunden hat.«
»Du bist vollständig überfahren worden?«
»Kopp ab, Arme ab, Beene ab, alles ab!«, fing der Engel jetzt doch zu lügen an. Es blieb ihm ja schließlich nichts anderes übrig.
»Ach Du Ärmster, und nun bist Du gleich in den Himmel gekommen?«
»Tjo.«
»Wie sieht es denn nun im Himmel aus?«
»Nu — nu ... scheun greun.«
»Sind da so ... recht schöne paradiesische Landschaften?«
»Nu, ick segg Dir ... aal scheun greun, aal scheun greun.«
Weiter wusste der prosaische Jochen die Landschaften des Paradieses nicht zu beschreiben — alles schön grün.
»Was machst Du denn nun so den ganzen Tag im Himmel?«
»Nu — nu ... ick piep up dee Fleut.«
»Und da darfst Du auch wieder auf die Erde kommen?«
»Tjo. Ick hävv Urlaub krägen.«
»Extra um mich zu besuchen?«
»Tjo.«
»Und Du bist unsichtbar?«
»Wie Du siehst.«
»Und zu fühlen bist Du auch nicht?«
»O tjooo! Fühl mal.«
Fräulein Karoline, deren Geisteskraft wir nun zur Genüge kennen gelernt haben, befühlte erst den Arm und dann die Brust, wobei Jochen immer mehr den Bauch einzog.
»Du hast ja nicht einmal ein Hemd an!«
»Nee. Dat kräg ick erst noch.«
Karoline befühlte ihm hinten den Rücken
»Und Flügel hast Du auch nicht?«
»Nee. Die wachsen mir erst noch.«
»Also kannst Du auch nicht fliegen?«
»So lang ick Urlaub auf der Erde habe — nee.«
»Wie lange hast Du denn Urlaub?«
»So lange wie ick haben will. Bis mir die Flügel gewachsen sind. Ja, Karline, wie kommst Du denn nun hierher nach Ägypten?«
»Das weißt Du nicht?«
»Nee.«
»Bist Du denn nicht allwissend?«
»Nee, dat kommt erst noch.«
»Wie hast Du mich denn hier zu finden gewusst?«
»Ick hävv nen Wink krägen.«
Mit diesem Bescheide ließ sie sich begnügen und berichtete. Wie sie vor einem Vierteljahr in Hamburg stellenlos gewesen und von einer deutschen Herrschaft, die in Ägypten ansässig, mit hierher genommen worden war, als Gouvernante für ein paar kleine Kinder. Jetzt war die ganze Familie in Italien, sie selbst war nicht mitgegangen, es war ihr schon wieder gekündigt worden, am nächsten Ersten bekam sie wieder freie Reise nach Hamburg zurück, wenn sie sich hier nicht eine andere Stellung suchen wollte.
»Wo wolltest Du denn jetzt hin?«
Nach Kairo, um etwas zu besorgen, um sich die Stadt zu besehen, frei hatte sie jetzt immer.
»Da bist Du wohl ganz allein in der Villa?«
O nein. Da waren noch die deutschen Hausleute da, ein altes, kinderloses Ehepaar, und einige arabische Diener.
»Ja, Karline, musst Du denn unbedingt in die Stadt?«
Durchaus nicht. Die kalte Büfettmamsell, die sich wohl nicht recht als Gouvernante geeignet hatte, war ganz Herrin ihrer selbst.
»Hast Du nicht ein Zimmer? Kannst Du mich nicht mitnehmen?«
Gewiss, das war möglich. Sie hatte es sich einfach anders überlegt, blieb zu Hause und war in ihrem Zimmer auch vollständig ungestört. — — —
Eine Stunde später öffnete Fräulein Karoline wiederum das Gartentor.
Niemand sah den unsichtbaren Geist, der neben ihr zur Tür hinausschlüpfte.
»Na da adje, mein lieber Jochen und besuche mich recht bald wieder, so lange ich noch hier bin.«
»Ja, ja, wenn ich Urlaub bekomme, besuche ich Dich immer, und ob hier oder in Hamburg oder sonst wo, das ist unsereinem ja ganz egal.«
So sprach der Engel und pilgerte wieder die Landstraße entlang.
Er befand sich in vorzüglichster Laune. Nur das Gehen fiel ihm etwas schwer, dermaßen hatte er sich während der letzten Stunde mästen lassen. Es ging in diesem Hause aus dem großen Topfe, niemandem war es aufgefallen, dass die Gouvernante so viele gute Sachen aus Küche und Keller auf ihr Zimmer gebracht hatte.
O ja, dieses Leben gefiel dem Engel, das wollte er so fortsetzen. Und wenn nicht Fräulein Karoline Schminke, dann würde es schon noch genug andere geben, die es sich zur höchsten Ehre schätzten, mit einem Engel ein Liebesverhältnis anzuknüpfen.
Aber aus diesem herrlichen Leben sollte nichts werden.
Er war noch nicht weit gekommen, als er hinter sich Hufschlag hörte, ein edles Ross sah, das in langgestrecktem Trab die Landstraße einher kam, auf dem Rücken ein Beduine, in einiger Entfernung davor jagte ein großer Schweißhund mit lang herabhängenden Ohren, die Nase dicht am Boden.
Die Gartenvilla war noch zu sehen, aber Jochen fiel es nicht weiter auf, dass der Hund erst einmal an das Tor lief, dort einen Bogen beschrieb und sich wieder vors Pferd setzte.
In einer Minute hatte ihn der Beduine, der das Gesichtstuch heruntergelassen, erreicht, das heißt, er musste ihn passieren.
Jochen ahnte noch immer nichts, er trat zur Seite, um Hund und Reiter an sich vorbei zu lassen.
Da aber schwenkte der Hund plötzlich ab und direkt auf ihn zu!
O weh! An solche Möglichkeiten, dass er von einem Hunde gewittert werden könne, hatte Jochen noch gar nicht gedacht. In der Pulvermühle war ihm das trotz der vielen Tiere gar nicht passiert, kein Hund hatte sich um seine Spuren gekümmert, in der Villa hatte es keine Hunde gegeben, noch keiner war ihm begegnet.
Und dieser Schweißhund hier begnügte sich nicht, nur die Spuren eines unsichtbaren Menschen zu untersuchen, sondern er schoss sofort auf ihn zu, richtete sich an ihm empor und drückte ihn gegen den Baumstamm, an dem Jochen gerade gestanden hatte, wies ihm knurrend die Zähne.
Was sollte Jochen nun tun?
Abgesehen davon, dass er als einzige Waffe nur seine blaue Brille in der Hand hatte.
Aber bei dem Hundemanöver blieb es nicht einmal.
»Jochen, bist Du's?!«
Der Beduine hatte sein Pferd gezügelt und das Gesichtstuch gelüftet.
Ach, Du großer Schreck!
Die Stimme und das Gesicht seines Herrn! — —
Dem Prinzen war sein Abgesandter, den er schon gestern Nachmittag hatte zurückerwarten können, doch etwas zu lange ausgeblieben, oder es war ihm daran gelegen gewesen, die Analyse des chemischen Präparates, das er seinem Freunde in die Pulvermühle geschickt, noch eher zu erfahren — kurz, er hatte sich heute in aller Frühe selbst auf den Weg gemacht, eines der Pferde nehmend, die er bereits gekauft hatte, die nur noch in anderer Stallung standen, weil sie im Kloster noch nicht gut untergebracht werden konnten, auch in Begleitung eines Hundes, der ebenfalls schon sein Eigentum war, der nur noch nicht im Kloster sein konnte, einfach, weil er bei unverschlossenen Türen nicht geblieben wäre, er wäre wieder nach Hause gelaufen.
Dem Pferde, welches der Prinz benutzte, folgte Odin willig, zumal der Reiter über seinem Anzug das in Ägypten auch von europäischen Reitern so geliebte Beduinenkostüm trug, das dem bisherigen Herrn des Hundes gehörte. Da war unterwegs bald die Freundschaft zwischen den beiden geschlossen, Odin folgte und gehorchte seinem neuen Besitzer.
Der Prinz erreichte die Pulvermühle, wurde unter den bekannten Zeremonien eingelassen. Von einer Aufregung unter den Teufelsfechtern war nichts mehr zu bemerken, sie hatten eben den Gottseibeiuns besiegt.
Von seinem ehemaligen Studiengenossen, dem Chemiker Poulsen, der schließlich doch etwas anders geartet war, erfuhr der Prinz alles, was vorgestern und noch gestern passiert war.
Wir haben nur noch hinzuzufügen, dass einige der Tiere, die von dem Wasser getrunken und dadurch lichtdurchlässig geworden, also einfach unsichtbar geworden, erschlagen worden waren, und fast sofort, kaum hatten sie ihre Seele ausgehaucht, war ihre Struktur wieder zum Vorschein gekommen, von innen heraus, erst waren die Knochen sichtbar geworden.
Für diese Leutchen war dies ja aber nur ein vollgültiger Beweis, dass sie den Teufel erschlagen hatten, der eben in diese Tiere gefahren war.
Der Prinz hatte Lust, die Hände über dem Kopfe zusammenzuschlagen, als er dies alles aus seines Freundes Munde vernahm, nicht zum Wenigsten natürlich von seinem Jochen, wie der sich hier aufgeführt hatte.
Nun aber ging dem Prinzen auch gleich die Erkenntnis auf.
»Der Unglückswurm hat aus der Flasche getrunken, die ich auf dem Tische habe stehen lassen — eine alkoholische Lösung, mit der ich experimentieren wollte — und er muss etwas mitgenommen und hier verschüttet haben — es ist mein eigenes Verschulden, mein eigener Leichtsinn, kannte ich doch nicht einmal die Quantität, die sich in der Flasche befand, ist mir doch nicht einmal aufgefallen, dass daran etwas fehlte!«
So rief der Prinz und weihte den Chemiker in das Geheimnis ein, so weit er durfte und überhaupt konnte, was wir nicht weiter zu wissen brauchen.
Dafür sei an dieser Stelle etwas anderes erledigt. Es dürfte manchen Leser geben, der über dieses Unsichtbarmachen eines Menschen den Kopf schüttelt.
Genau so hätten vor fünfundzwanzig Jahren alle anderen den Kopf geschüttelt, wenn man ihnen gesagt, es hätte jemand ein Mittel gefunden, um von einem Menschen eine durchsichtige Fotografie nehmen zu können, so dass man die Knochen im Leibe erblickt.
Es gibt aber auch noch andere Vergleiche.
Von beweglichen Bildern, sprechenden Gummiplatten, drahtloser Telegrafie usw. dabei gar nicht zu reden.
Ein »böser« Finger ist gewiss eine schlimme Sache. Wirklich böse. Wenn man aus der Haut fahren will, sobald man sich nur im Geringsten daran stößt. Der Arzt pinselt diesen bösen Finger mit etwas Kokain ein und macht einen Schnitt bis auf die Knochen, ohne dass man das Geringste davon fühlt.
Vor noch nicht fünfundzwanzig Jahren wäre das für unsere Chirurgen, Mediziner und Physiologen ein unfassbares Wunder gewesen, niemand hätte geglaubt, dass so etwas möglich wäre! Durch einfaches Betupfen eines Mittels irgend ein beliebiges Glied oder irgend eine Stelle des tierischen Körpers vollständig gefühllos zu machen!
Im Grund genommen ist nämlich auch der Vorgang hierbei noch viel komplizierter als die Möglichkeit, einen tierischen Körper vollkommen lichtdurchlässig zu machen, ihn also gewissermaßen verschwinden zu lassen, wie Glas im Wasser.
Was ist denn eigentlich Glas?
Eine chemische Verbindung von Kieselsäure mit Metalloxiden.
Weshalb wird denn, wenn man undurchsichtigen Sand mit einem undurchsichtigen Metalloid zusammenschmilzt, die Masse plötzlich durchsichtig?
Das wissen wir nicht. Hier hört alle unsere Weisheit auf. Wir wissen es so wenig wie den letzten Grund, weshalb der Stein zur Erde fällt und nicht in der Luft schweben bleibt. Wir wissen nicht, weshalb die Erde und überhaupt jeder größere Gegenstand auf einen kleineren eine Anziehungskraft ausübt. So wissen wir auch nicht, weshalb die eine Substanz die Lichtstrahlen durchlässt und die andere nicht.
Die Verwandlung von undurchsichtiger Substanz in durchsichtige kommt aber auch im organischen Leben vor, vollzieht sich fortwährend. Durch den tierischen Verbrennungsprozess, durch den Stoffwechsel. Wir essen Zucker und Fett und andere feste Kohlehydrate und atmen durchsichtige und unsichtbare Kohlensäure ein. Es ist im Grunde genommen nichts anderes.
Ja, die Möglichkeit, einen Menschen unsichtbar zu machen, ist nicht einmal eine originelle Phantasie-Erfindung des Verfassers, sondern diese Sache ist in Wirklichkeit schon einmal da gewesen.
Ums Jahr 1880 meldete sich im Zoologischen Museum von Genua ein Mann namens Virto Chechi, seinem Beruf nach Barbiergehilfe, der angab, er habe in Bezug auf die Konservierung von toten Tieren und Menschen eine ganz neue Entdeckung gemacht, bot seine Erfindung der Regierung für eine Million Lire an, erklärte sich bereit, jede Leiche in kurzer Zeit so zu präparieren, für die eines Menschen verlangte er 100 000 Lire, wobei er gar nicht viel verdiene. Also sehr teuer sei freilich die Geschichte.
Zum Beweise der Wahrheit seiner Angaben brachte er vorläufig einen Frosch und eine menschliche Hand mit, die er abgequetscht in der Nähe des Ortes einer großem Eisenbahnkatastrophe gefunden haben wollte.
In der Tat, der Frosch war tot, aber noch vollkommen erhalten, man sezierte ihn, fand auch inwendig alles wohlerhalten, alles schien jeder Verwesung zu trotzen, und dasselbe galt von der Hand, die bis in ihren feinsten Teilen so war, als wäre sie erst vor einer Stunde abgequetscht worden, nur vollständig blutleer, während Chechi behauptete, die Objekte seien von ihm vor schon länger als einem halben Jahre präpariert worden.
Chechi war in Genua bekannt, er war früher einmal als Barbier selbstständig gewesen, hatte sich ruiniert, weil er leidenschaftlich Chemie getrieben hatte, sicher Alchemie, er hatte Gold machen wollen.
Man stand bei diesen Präparaten vor einem Rätsel. Denn alles, was wir sonst von Mumifizierung wissen oder etwa in Spiritus einsetzen, das war etwas ganz, ganz anderes.
Die Aufregung sollte nicht lange dauern. Der Schwindel wurde bald entlarvt.
Kaum eine Woche, so veränderte sich der Frosch, verwandelte sich in eine gallertartige, völlig durchsichtige Masse, auch die Knochen waren schon angegriffen, wurden leimig, und dasselbe galt von der menschlichen Hand.
Und Chechi war verschwunden. Es war ein Schwindler gewesen. Wohl hatte er irgend eine seltsame Erfindung gemacht, aber von einer Mumifizierung für die Ewigkeit, wie er behauptete, war keine Rede; er hatte gehofft, eine schnelle Beute zu machen.
Vier Jahre später meldete sich im Warsey-Institut von New York, in dessen Laboratorium das Wesen neuer Elemente untersucht wird, ein verlumpter Kerl, welcher bat, einige Zeit im Laboratorium arbeiten zu dürfen, er wolle eine Tinktur anfertigen, durch deren Einspritzung er jedes Tier und jeden Menschen vollkommen durchsichtig machen könne, bei vollem Leben, in mindestens drei Tagen seien auch die Knochen durchsichtig wie das beste Glas. Kostspielig sei die Geschichte allerdings, zum Durchsichtigmachen einer Maus gebrauche er mindestens ein zehntel Gramm Thallium.
Thallium ist ein metallisches Element, in der Natur rein nicht vorkommend, die Herstellung eines Gramms kostete damals noch mehr als 5000 Mark.
Nun, man prüfte den Mann erst einmal näher und fand, dass er über ganz ausgezeichnete chemische Kenntnisse verfügte. Dann besonders zeigte er das erstaunliche Experiment, reines Thallium in einer Flüssigkeit zu lösen, die er aus Horn destilliert hatte, aus Haaren, ohne Zusatz von Natrium und Salmiak, was heute noch nicht möglich ist.
Dadurch entsannen sich die amerikanischen Chemiker auf jenen Vorgang vor vier Jahren in Genua, erst wollte der Mann, der sich einen englischen Namen gab, leugnen, schließlich aber gestand er, wirklich jener Virto Chechi zu sein.
Er habe damals durchaus nicht geschwindelt. Seine einzige Lüge habe nur darin bestanden, dass er gesagt, er hebe die Präparate schon seit einem halben Jahre auf. Er hatte sie erst vor zwei Wochen präpariert. Und dass sie in Gallerte zerfallen seien, das halte er für eine Schuld jener Professoren. Gerade dadurch aber sei er auf die Idee gekommen, dass man einen tierischen Körper glasartig durchsichtig machen könne, und zwar bei vollem Leben.
Gut, der Mann bekam das kostbare Thallium, und zwar gleich genug für ein Meerschweinchen.
Seine Tinktur stellte er im Geheimen her, man konnte dann aber doch nachweisen, dass er wirklich Thallium verbraucht hatte, und zwar eben auf jene rätselhafte Weise, dass er dieses auch in Königswasser unlösbare Metall hatte lösbar gemacht.
Das Meerschweinchen rasierte er vollständig. Zwar, sagte er, würden auch die Haare durchsichtig, aber das dauere länger. Die nachwachsenden Haare jedoch wären sofort ganz durchsichtig.
Dann gab er dem Tiere einige Einspritzungen. Und es dauerte kaum eine Stunde, als sich das Meerschweinchen zu verändern begann, tatsächlich wie durchsichtig wurde, immer mehr, bis man die Knochen wie in einem Glasgehäuse sah, und auch die Knochen begannen sich schon zu verändern.
Aber wieder konnte Chechi sein Versprechen nur zum Teil halten.
Wohl lebte das Meerschweinchen eine Stunde lang, zeigte sich bei bester Gesundheit, fraß — dann aber starb es plötzlich. Und wieder löste sich Fleisch und alles in eine gallertartige, völlig durchsichtige Masse auf.
Dasselbe wiederholte sich ganz genau so bei einer Maus. Sie fing an, durchsichtig zu werden, wurde es wirklich bis auf die Knochen, aber starb.
Und hiermit hatten diese Experimente ihr Ende erreicht. Chechi, der immer niedergeschlagener geworden war, vergiftete sich im Laboratorium mit Zyankali.
Die amerikanischen Gelehrten haben vergebens experimentiert, es gelang ihnen nicht einmal, Thallium in Lösung zu bringen.
Über diese beiden Fälle, sowohl über den in Genua wie über den in New York, ist damals in allen Zeitungen berichtet worden, auch in deutschen.
Aber wer merkt sich so etwas in dieser schnelllebigen Welt, besonders wenn der Erfolg fehlt.
Die beiden Brüder Wright waren die ersten Menschen, die brauchbare Flugmaschinen konstruierten. Ihre Übungen führten sie auf ihrer einsamen Farm in Amerika aus, niemand hatte Zutritt.
Es schlichen sich dennoch Reporter ein und berichteten, wie die beiden fliegenden Menschen in der Luft herumgondelten.
Diesen Bericht gaben alle Zeitungen wieder, auch die deutschen, mit der Schlussbemerkung: wieder einmal so ein echter amerikanischer Humbug!
Das war heute vor sechs Jahren.
Im Jahre 1908 traten die Brüder Wright mit ihren Flugmaschinen an die Öffentlichkeit.
Heute fliegt schon alles in der Luft herum, die gebrochenen Genicke sind kaum noch zu zählen, man sieht manchmal, wenn man anderes zu tun hat, schon gar nicht mehr hin.
Heute weiß man, dass schon vor den Gebrüdern Wright andere Männer, wie Lilienthal und noch viele, sich mit Flugmaschinen beschäftigt haben, Gleitflüge gemacht haben.
Gesetzt aber nun den Fall, die Gebrüder Wright hätten, wenn auch Erfolg gehabt, doch ihre Versuche aufgegeben.
Was dann?
Nun, dann wäre es eben bei dem »amerikanischen Humbug« geblieben.
Vergessen, alles hätte man vergessen!
Niemand hätte mehr an Lilienthal und seine Genossen gedacht.
So ist die Welt!
Und wo ist denn die Entschuldigung für den »amerikanischen Humbug« geblieben?
Da schweigt sich alles aus.
Und so ist es auch mit jenem Virto Chechi gegangen.
Dieser simple Barbiergehilfe hatte zweifellos eine phänomenale Erfindung gemacht, er war nicht in der Lage, sie weiter verfolgen zu können — er hat sein Geheimnis mit ins Grab genommen.
Also der Prinz hatte seinen Studienfreund eingeweiht, so weit er selbst konnte und durfte.
Vor allen Dingen kam es ihm nun darauf an, dass die Welt nichts von diesen Vorgängen erfuhr.
Der Teufelsfechter war er ja sicher. Die offenbarten nichts, was in ihrer Pulvermühle vor sich ging, die waren glücklich, einen ehrlichen Strauß mit dem Teufel bestanden zu haben, sprechen taten sie nicht darüber.
Wo aber war nun Jochen, dieser Unglücksmensch? Denn dass der sich nicht mehr hier befand, das ahnte der Prinz gleich. Unterdessen waren doch fast vierundzwanzig Stunden vergangen! Der stromerte jetzt als unsichtbarer Geist in der Welt herum, wer wusste, was der jetzt für Allotria trieb. Wenn Jochen Puttfarken auch gar nicht zu Dummheiten veranlagt war. Aber da war die Versuchung doch gar zu groß.
Die Sachen, die Jochen unfreiwillig hinterlassen hatte, waren glücklicherweise noch nicht vernichtet worden, der Prinz ließ den vorzüglichen Schweißhund an den Kleidern Witterung nehmen und kam auch gleich auf den Gedanken, sofort außerhalb der Umfassungsmauer abzusuchen. Von der angelehnt gewesenen Leiter wussten die Teufelsfechter auch gar nichts, die hatte heute früh ein Arbeiter fortgenommen, ohne etwas zu sagen.
Und Odin fand denn auch gleich eine Spur, die mit der Witterung der Kleider korrespondierte, und nahm sie auf. Der Prinz ließ sich natürlich nicht vierundzwanzig Stunden lang halten, er war überhaupt schon draußen, und außerdem nahm er auch noch Jochens Uhr und Börse und Brieftasche und sonstige Sachen mit, nur die Kleider nicht, das hochelegante Kostüm war bei dieser Rauferei wirklich zum Teufel gegangen. Dass er einen nackten Menschen aufspüren würde, dachte sich der Prinz schon, er wusste aber auch, wie dem abzuhelfen sei.
Der vorzügliche Schweißhund folgte direkt der Spur auf der Landstraße, ließ sich nicht beirren, dass der Verfolgte vierundzwanzig Stunden in jener Villa verbracht hatte, lief weiter und stellte einige Minuten später an einem Baum ein unsichtbares Etwas. Bei diesem Mittel hier fehlte eben dasjenige, was den Tieren jede Witterung verleidete, und der treue, furchtlose Bluthund ließ sich auch nicht irritieren, dass er keinen Menschen erblickte.
»Jochen, bist Du's?!«
Ach Du großer Schreck!
»Nee, nee, Hoheit, ick bin's nich!«
Das war gerade kein Zeichen von großer Fassungsgabe, aber begreiflich.
Der Prinz herunter vom Pferde, das von selbst stand, und zugegriffen. Er brauchte nur einmal über diese Rüsselnase zu fahren, dann wusste er, wen er vor sich hatte, falls es da überhaupt noch einen Zweifel gegeben hätte.
»Unglücksmensch, was hast Du angerichtet!«
Was sollte Jochen sagen?
Nur um Gottes willen das nicht, dass er den Aussatz hatte. Ein Erschrecken — dann war der angesteckt ... nimmermehr!
»Ick bin unsichtbar.«
»Das ... merke ich. Das sehe ich, hätte ich beinahe gesagt!«, musste der Prinz zunächst einmal lachen.
»Ick kann mir unsichtbar machen.«
»Du hast vorgestern aus der Flasche getrunken, die in meiner Stube auf dem Tische stand!«
Diesmal aber bewies Jochen, dass er doch eine schnelle Auffassungskraft besaß.
»Der Rum macht wohl unsichtbar?«
»Jawohl, das ist eine Tinktur, eine ... die eben den Menschen und jedes Tier durchsichtig macht, einfach ganz unsichtbar!«
»Da hab ick am Ende wohl gar nich den Aussatz?«
»Was, Aussatz?!«
»Ick denk, ick hab den Aussatz, es setzt alles aus, deshalb bin ick unsichtbar woorn!«
»Unsinn, Du hast von der Thalliumtinktur getrunken, die unsichtbar macht!«
»Na, dann is ja alles gut, dann will ick gern unsichtbar bleiben!«
»Mensch, was hast Du nun während dieser ganzen Zeit angerichtet!«
Jochen bekam sofort ein böses Gewissen.
»Gor nix — enn Schinkenbrot hab ick klaut — und enne Zigaar — un dree Rietstück ...«
»Wo? Wem?«
Jochen beichtete seine Sünde.
»Der Mann hat nichts davon gemerkt?«
»Nu, dass ihm die Schinkensemmel fehlte, das wird er dann, als er sie essen wollte, schon gemerkt haben!«
»Ob er etwas gemerkt hat, wie Du ihm die Sachen nahmst!«
»Nee — goor nix.«
»Wann war das?«
»Gestern früh.«
Jochen berichtete auf Befragen ausführlicher, wie er die Nacht im Eselstalle zugebracht habe.
»Und was hast Du nun gestern den ganzen Tag gemacht?«
»Da war ich bei der Karline.«
»Wer ist denn das?«
»Nu die kalte Büfettmamsell aus Hamburg.«
Jochen berichtete weiter, wie er seine alte Liebe hier vor jener Villa getroffen, wie er sich ihr bemerkbar gemacht habe. Nur dass Jochen jetzt vorzog, zu sagen, er habe sich ihr als »Geist« vorgestellt, nicht als Engel. Er sei vor Kurzem irgendwo gestorben. Auch von dem Überfahrenwordensein sprach er nicht, er hatte seine guten Gründe dafür.
Der Prinz konnte nur staunen.
»Und das hat die Dir geglaubt?!«
»Die glaubt noch etwas ganz anderes. Die piept vor Dummheit.«
Es war ausgesprochen.
»Und da bist Du oben auf ihrem Zimmer gewesen?«
»Tjo.«
»Und davon haben die anderen Hausbewohner nichts bemerkt?«
»Gor nix.«
»Aber diese Karline erzählt doch nun, dass sie von einem Geiste besucht worden ist.«
»Nee.«
»Ganz sicher! Die renommiert damit. Gerade weil sie so beschränkt ist.«
»Nee. Ich kenne doch die Karline. Ich habe ihr gesagt, wenn sie darüber spricht, komme ich nicht wieder, und das genügt.«
Der Prinz glaubte es, der musste seine Karline wohl besser kennen.
»Ja aber — die kann jetzt nicht hier bleiben — diese Sorge kann ich nicht zurücklassen.«
»So nehmen Sie sie doch gleich mit.«
Und Jochen berichtete, wie ihr schon gekündigt sei, sie könne ihre Stellung auch sofort verlassen.
Des Prinzen Entschluss war gefasst.
»Wohl, dann hole ich sie sofort heraus.«
Der Prinz blickte sich um, streifte seinen Burnus ab, den musste jetzt Jochen anziehen und sich als Beduine aufs Pferd schwingen, musste seinen Herrn aber auch gleich bis an das Gartentor begleiten.
»Hier wartest Du, bis ich wieder heraus komme.«
Der Prinz, in Sportanzug mit Kappe, zog die Glocke, ein alter Mann kam.
»Sie sprechen deutsch?«
»Ja, ich bin ein Deutscher.«
»Ist Fräulein Schinke zu sprechen?«
»Ja, die ist da. Was wünschen Sie von ihr?«
»Ich hätte ihr eine Stelle anzubieten.«
»Da wird sie sich sehr freuen. Bitte, treten Sie nur ein.«
Ohne Weiteres, ohne dass nach seinem Namen gefragt worden wäre, wurde der Prinz ins Haus geführt und von der Gouvernante im besten Salon empfangen, wenn sie auch noch im Schlafrock war.
Der Prinz, der nun auch gleich sah, wes Geistes Kind er vor sich hatte, wenn das sonst dem schönen Mädchen auch nicht gerade anzusehen war, machte es nun gleich recht auffällig, wie er sich umblickte und seine Stimme dämpfte.
»Wir können hier doch nicht belauscht werden, Fräulein?«
»Nein. Wer sind Sie?«, flüsterte sie ängstlich zurück.
»Soeben war Jochen Puttfarken bei mir, den Sie doch wohl kennen.«
»Er war bei Ihnen?!«
»Ja.«
»Als Engel?«
»Gewiss, als Engel!«, ging der Prinz auch hierauf sofort ein.
»Sie kennen ihn?!«
»Gewiss doch, ich war doch sein Herr.«
»Wie, Sie sind doch nicht etwa Prinz Joachim?!«
»Der bin ich. Fräulein, wollen Sie zu mir kommen? Nach Kairo? Als Gouvernante? Sie haben da Gelegenheit, täglich und überhaupt alle Zeit mit Herrn Puttfarken zusammenzukommen, was hier nicht möglich ist. Wollen Sie? Und Sie können jederzeit von hier gehen? Dann, bitte, packen Sie sofort Ihre Sachen zusammen — nein, kommen Sie sofort mit, wie Sie hier sind, ziehen Sie nur einen Staubmantel über, Ihre Sachen lassen wir nachholen, die Zeit drängt, entweder jetzt oder nie ...«
So sprach der Prinz weiter, dem über alles daran gelegen war, diese junge Dame mit ihrer Engelsliaison von hier fortzubringen, sie in seinen eigenen Gewahrsam zu bekommen, und er brauchte auch gar keine große Überredungskunst aufzubieten, schon zehn Minuten später verließ Fräulein Karoline Schinke mit ihm die Villa, um sie nicht wieder zu betreten.
Schon auf dem Gange durch den Garten hatte sich der Prinz die dicken Schweißtropfen von der Stirn gewischt, obgleich es noch gar nicht so warm war.
Dermaßen hatte ihn diese ganze Affäre angegriffen, ihm den Schweiß ausgepresst.
Sie gingen zusammen die Landstraße entlang, nebenher ritt der Beduine.
»Was ist das für ein Araber?«
»Das ist mein Freund. Wir gehen zu Fuß, gleich nach Kairo, es ist nicht weit, ich wohne am äußersten Ende der Stadt, uns am nächsten. Ja, Fräulein, nun will ich Ihnen etwas offenbaren. Jochen war als Engel auch bei mir. Ich habe mit ihm gesprochen. Hören Sie, Fräulein, ich glaube, der ist gar nicht richtig gestorben, der war nur scheintot — ich glaube, den bekommen wir wieder lebendig ...«
Der Prinz schielte zur Seite, was diese Ungeheuerlichkeit auf die junge Dame wohl für einen Eindruck mache.
Nun, sie erzeugte nichts weiter als ein glückstrahlendes Gesicht.
»Meinen Sie, Hoheit?«
»Ja, ich bin fest davon überzeugt. Durch geeignete Behandlung machen wir aus dem wieder einen sichtbaren Menschen.«
»Aber wo er doch von einem Zuge überfahren worden ist?«
»Von einem — Zuge — überfahren?«, wiederholte der Prinz, und das edle Ross unter dem Beduinen machte plötzlich einen Bocksprung.
»Das wissen Sie noch gar nicht?«
»Nein.«
»Das hat er Ihnen nicht gesagt?«
»Nein.«
»Kopf ab, Arme ab, Beine ab, alles ab.«
Der Prinz nahm das feinfühlige Ross, das immer unruhiger wurde, beim Zügel.
»Na, wissen Sie, Fräulein — ich glaube, das hat der alles nur so in seiner Todesangst geträumt — der ist gar nicht überfahren worden und bildet sich jetzt nur ein, so als Engel in der Luft herumzuschweben — der liegt jetzt irgendwo als Scheintoter — und gesetzt auch den Fall, es wäre wirklich so gewesen, den flicken wir schon wieder zusammen ...«
Und so sprach der Prinz weiter, bis sie, nachdem sie sich weit oberhalb der Brücke über den Strom hatten setzen lassen, das alte Kloster erreicht hatten, und da wischte sich der Prinz immer noch den Schweiß ab, obgleich es gar nicht so warm war und er auch sonst gar nicht so schwitzte.
So hielt Fräulein Karoline Schinke ihren Einzug in dem alten Kloster, und es sollte nicht lange bei dieser einzigen Weiblichkeit bleiben.
Am Kai von Alexandrien lag unter dem Sternenbanner der »Hudson«, ein stattlicher Personendampfer, von New York kommend, und setzte als erstes seine Passagiere an Land.
Eine zahlreiche Zuschauermenge hatte sich eingefunden, elegante Europäer, Seeleute aller Nationen, zum Teil sehr verloddert, und dann alle die orientalischen Müßiggänger vom schmucküberladenen Araberdandy an bis zum mehr ganz als halb nackten Bettler.
Am dichtesten umringt wurde eine Gruppe von Passagieren, die, zusammengehörend, sich auf einem freien Platze zusammengestellt hatten und auf etwas warteten.
Sie wurden wegen der Fremdartigkeit ihrer Erscheinung sowohl angestaunt wie mit Spott überschüttet.
Es waren gegen drei Dutzend Männer. Das einzige, was sie alle gemeinsam hatten, war das Abenteuerliche, Fremdartige in ihrer Erscheinung, wie man hier so etwas noch nie gesehen hatte, sonst war jeder vom anderen total verschieden. Höchstens noch die dunkle Hautfarbe stimmte überein, von Natur so braun oder gar schwarz, oder so sonnenverbrannt, was hier aber nicht weiter auffiel. Sonst war es die reine Musterkarte eines Maskenballs, die sich hier zusammengestellt hatte.
Da war ein alter, hässlicher Kerl in einem neuen schwarzen Samtanzug, aber die neue Hose bis über die Knie zu beiden Seiten aufgeschlitzt, über und über mit Silber behangen, die Knöpfe an seinem koketten Jackett aus Silber so groß wie die Taler, wenn es überhaupt nicht große Silbermünzen waren, noch größer die silbernen Radsporen und immer noch größer die Silbermünzen, die er in den Ohren hängen hatte, auch sonst aufs Phantastischste und Eitelste herausgeputzt, das lange, bis auf die Schultern wallende Haar mit parfümiertem Öl gesalbt — und dann daneben ein hünenhafter Jüngling, gewachsen und schön wie ein Achilles, in ein Ledergewand gekleidet, das man kaum noch als einen Anzug bezeichnen konnte, so starrte alles von Fett und Schmutz und wohl auch von getrocknetem Blut — und dann wieder ein Mann, der sich nur in eine bunte Bettdecke gewickelt hatte, als sie einmal auseinander ging, sah man, dass er darunter tatsächlich nichts weiter trug, man hatte nur rotbraune Gliedmaßen gesehen — und so war ein jeder vom anderen total verschieden, in Kleidung wie in seinem ganzen Aussehen. Wir können unmöglich einen jeden beschreiben, nur noch einige Hauptsachen.

Erst glaubte man, dass auch einige Weiber darunter wären. Besonders einer sah genau aus wie eine alte Großmutter. Zumal da er um das dicke, runzlige, melancholische Gesicht ein Kopftuch gebunden hatte, so eine Bauernkuke. Bis er sich mehr sichtbar machte und bewegte, da erkannte man den Irrtum. Erstens umhüllte das enganliegende Lederkostüm kraftstrotzende Glieder, und dann vor allen Dingen, solch lange Beine und einen solchen stolzen Gang hat keine alte, melancholische Großmutter. Aber sonst genau das Gesicht einer solchen. Es waren noch andere mit solchen Altweibergesichtern darunter, aber gerade bei dem war es am auffallendsten.
Dagegen wurde man sich jetzt klar, dass sich doch wirklich zwei junge Mädchen dazwischen befanden. Man hatte sie erst für hübsche Jungen gehalten, trotz ihrer kurzen Röcke. Weil eben viele andere der Männer wirkliche Weiberröcke trugen. Die beiden hübschen Mädels sahen sich einander überraschend ähnlich, nur dass der einen kurzes Lockenhaar schwarz, das der anderen blond war. Sonst glichen sie sich wie ein Ei dem anderen.
Diese fremdartigen Erscheinungen wurden angestaunt, aber auch verspottet.
Der Spott galt ihren Pferden.
Denn jeder hatte ein Pferd am Zügel, das er auch selbst über die Landungsbrücke geführt hatte.
Wie über Pferde in Ägypten und im ganzen Orient geurteilt wird, ist schon einmal erwähnt worden. Wenigstens über Reit- und Kutschpferde. Entweder etwas ganz Schönes und Edles, oder es darf sich gar nicht auf der Straße blicken lassen.
Und das hier waren sämtlich jämmerliche Gäule. Durchweg klapperdürr, mit gesenkten Köpfen und eingeknickten Knien standen sie alle da, wie abgedroschene Droschkenpferde, die jeden Augenblick vor Altersschwäche zusammenbrechen können.
Auch die Bezäumung, auf welche die Orientalen doch ebenfalls so viel geben, war so jämmerlich, diese alten, abgeschabten Sättel, dieses Riemenzeug!
Da gaben die Eseljungen ihren Straßenwitz zum Besten, sogar die Bettler überschütteten diese Fremdlinge mit Spott und Hohn.
Die machten sich nichts daraus, schienen nichts zu hören und zu sehen. Gerade durch dieses ihr Verhalten stachen sie auch wieder so seltsam von der umgebenden schwatzenden, lachenden, johlenden und gestikulierenden Menge ab.
Wenn sie sich nicht mit ihren Pferden beschäftigten, hier und da einmal eine Schnalle anzogen, so standen sie fast bewegungslos da, stierten gleichgültig vor sich hin, rauchten aus seltsamen Pfeifen und kauten Tabak, selten dass zwei einmal einige Worte wechselten. Alles faule Teilnahmslosigkeit.
Unter den Zuschauern stand ein tabakkauender Gentleman, der seinem Begleiter Aufschlüsse geben konnte, sein Englisch durch die Nase sprechend, ein Amerikaner.
»Das ist die Arizonabande, die der Mister Clifford zusammengebracht hat.
Kennen oder kannten Sie den nicht?
Er ist vor einem halben Jahre gestorben.
Ein reicher Sportsman, hat den ganzen amerikanischen Kontinent bereist, von Patagonien an bis hinauf nach Grönland, um zu jagen, wohl mehr aber noch, um solche Burschen um sich zu versammeln. Das war so seine Liebhaberei. Berühmte Cowboys und Trapper und andere Jäger für sich zu gewinnen, weiße und rote.
Er hat dann in Arizona ein ungeheures Gebiet mit Prärie und Wald gekauft, da brachte er die ganze Bande unter.
Man glaubte erst, er wollte so ein Konkurrenzunternehmen gegen Buffalo Bill gründen, aber das ist nicht der Fall gewesen, es war nur seine Liebhaberei, solche berühmte Originale der Wildnis um sich zu haben.
Vor einem halben Jahre ist er gestorben, in Konkurs, hat alle seine Millionen verplempert. Die wilde Farm wurde von einem anderen gekauft.
Ja, die kenne ich so ziemlich alle.
Bin lange Zeit dort gewesen auf der wilden Farm. Die kennen mich auch alle.
Weiß aber schon, weshalb die meine Bekanntschaft nicht erneuern wollen. Ich kann nichts dafür. Und ich habe auch keine Neigung. Lauter Stromer und Vagabunden.
Der Alte in dem Samtanzug mit dem vielen Silber, das ist der Señor Juan, einst der berühmteste Stierkämpfer von Südamerika, verlumpte aber total und verschwand, bis er auf der wilden Farm in Arizona wieder auftauchte.
Dort der Mann mit den Stiefeln, die wie die Pferdeschenkel aussehen, weil's auch solche sind, das ist Gilli, der Gaucho.
Mich wundert nur, dass er seine Bola nicht in den Fingern hat.
Aber sie haben ja alle keine Waffen. Sie werden das Land nicht mit Waffen betreten dürfen, weil's nun einmal so Polizeivorschrift ist. In der nächsten Straße schon kann jeder eine Kanone auf die Schulter nehmen.
Der Alte dort in dem Lederkostüm, wenn da überhaupt noch etwas von Leder zu erkennen ist — kennen Sie den? Das ist eine wirkliche Berühmtheit, von der einst die ganze Welt gesprochen hat.
Lord Armstrong, einer der reichsten Männer Englands, Parlamentsmitglied. Konnte aber das Wildern nicht lassen. Nachdem ihm schon immer wieder verziehen worden war — Sie wissen doch, dass in England auf Wilddieberei Zuchthaus steht — hat er einmal in einer Nacht den ganzen Wildbestand im Parke seines Nachbarn zusammengeknallt, und da war's natürlich alle. Er ist nach Amerika geflohen, sein Vermögen und alle seine Güter sind vom Staate konfisziert worden.
Der junge Riese dort, das ist sein Sohn, Lord Charles Armstrong. Der erbt einmal alles. Erst aber muss sein Vater tot sein, vorher wird das konfiszierte Vermögen natürlich nicht freigegeben. Aber der ist ja auch schon total verwildert, das sehen Sie ihm doch gleich an.
Der Kerl da, der nur noch ein linkes Gesicht hat, die rechte Hälfte ist ihm mit dem Messer abgehauen worden, das ist ein Penchuenche, den hat ein Missionar von klein auf erzogen und studieren lassen, und wie er schon Advokat war, ist er in seine Heimat zurückgegangen und hat mit seiner roten Bande lange Zeit auf eigene Faust mit Argentinien Kriege geführt.
Eine alte Frau? Ach so, den mit dem Kopftuche meinen Sie. Jawohl, alte Frau! Das ist der schwarze Bär, ein Sioux-Häuptling. Der hat mehr Skalpe am Gürtel hängen, als Sie Finger und Zehen haben. Als er schon einmal am Galgen hing, hat man ihn wieder abgeschnitten, damit er die aufständischen Sioux wieder beruhigte, was er auch fertig brachte, wofür er begnadigt wurde, er musste aber in die Verbannung gehen.
Die beiden Mädels sind die Schwestern Hamfield, die Clarence und die Leonore. Cowgirls. Ihr Vater hatte in Kentucky eine große Farm mit Pferdezucht, war aber sehr verschuldet. Die beiden Töchter, Zwillinge, wollten sie nach seinem Tode weiter betreiben, konnten sich aber nicht halten, verkrachten. Dann traten sie einmal in Barnums Zirkus als Pferdebändigerinnen auf. Aber das Zirkusleben war doch nichts für die, die lassen sich doch nicht einsperren. Sie brannten mit einer Monatsgage durch, Mister Clifford löste sie dann aus dem Schuldturm aus.
Ja, ich kenne sie alle.
Woher?
Weil ich sie als Broker einmal alle pfänden sollte. Nach dem Tode von Clifford. Sie bildeten eine Gemeinschaft. Ein Doktor Reichard sagte für sie gut, berappte alles, und da konnte ich wieder abziehen. Nun können Sie sich denken, dass die mich nicht gerade mit freundlichen Blicken ansehen, wenn ich mich ihnen vorstellen würde.
Ja, die Pferde sehen schlecht aus.
Der ›Hudson‹ soll eine fürchterliche Reise gehabt haben. Kommt ja auch eine ganze Woche zu spät an. Drei Tage steuerlos getrieben, dann noch vier Tage vor Madeira auf der stürmischen Reede gelegen.
Das hat die Tiere natürlich angegriffen. Na, die werden sich schon bald wieder erholen.
Arabische Renner werden's freilich nicht.
Aber sonst dürften diese Cowboys und Redmen den Arabern und Beduinen auf diesen Gäulen manches vormachen, worüber die hier Maul und Nase aufsperren.
Was die hier wollen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich haben sie doch so eine neue Wildwesttruppe gebildet, wollen hier in Ägypten anfangen.
Gar kein so übler Gedanke. Wenn sie einen tüchtigen Manager haben.
Werden's ja sehen.«
Gelangweilt wandte sich der Amerikaner ab.
Ein junger Herr in elegantem Reitanzuge schritt schnell auf die Gruppe zu.
»Das Gepäck ist besorgt, alles in Ordnung!«, rief er. Also offenbar die Hauptperson, auf die man hier gewartet hatte. Aber Aufregung brachte sein Kommen und seine Meldung nicht hervor.
Faul und überaus langsam, unbeholfen kletterten sie alle ohne Ausnahme in den Sattel, nicht einmal ein Aufsteigen konnte man es nennen.
Auch der elegante Herr im englischen Reitanzug bestieg solch eine elende Mähre, die von einem anderen gehalten worden war, dürr und ohne Schwanz, ganz breitbeinig, wie auf Stelzen stehend und dann sich auch so in Bewegung setzend, wie alle die anderen Gäule. Eingeknickt hatten sie stehen können, aber laufen mussten sie ganz steif.
Nur dieser Herr hatte sich schnell und leicht in den abgeschabten Sattel seines Schinders geschwungen. Ein erfahrenes Auge hätte an diesem Aufsteigen gleich den deutschen Kavalleristen erkannt.
Das eine der beiden Mädchen, die blonde, zeigte sich jetzt etwas lebendiger, obgleich auch sie so faul und unbehilflich aufgeklettert war.
»Genieren Sie sich als preußischer Husarenoffizier denn nur gar nicht, Mister Schwarzbach, Ihre Beine über solch einen Bock zu legen?«, lachte sie.
Der Gefragte, der einen Schimmel ritt, warf einen Seitenblick auf das tiefschwarze Pferd seiner Nachbarin.
»Na, Miss Clarence, Ihr Nachtschatten sieht nicht viel besser aus als meine Silberwolke!«, lachte er zurück.
»Aber mein Gaul hat wenigstens einen Schwanz, mit den paar Haaren von Ihrem dagegen kann man ja nicht einmal mehr einen Fidelbogen bespannen.«
»Na, lassen Sie es gut sein, Miss Clarence, wir nehmen uns Zeit bis nach Kairo, bis dahin werden die Beine schon wieder geschmeidig geworden sein und die Tiere sich wieder herausgefressen haben, und für den Schwanz meiner Silberwolke habe ich bereits eine Büchse Bartwuchscreme gekauft.«
Der unglückselige Zug setzte sich langsam in Bewegung, von dem Johlen und Spotten der Menge begleitet.
Prinz Joachim stand am Fenster seines Arbeitszimmers, nun vollständig eingerichtet, und blickte in den Klosterhof hinab. Dort unten tränkten die Cowboys, wie wir sie alle zusammen einfach nennen wollen, ihre Pferde.
Gestern Nachmittag war die Kavalkade angekommen, hier in dem alten Kloster, ohne Kairo berührt zu haben.
Dass es ein Doktor Reichard gewesen war, welcher die durch den Tod des Mister Clifford in Konkurs gekommene sogenannte »Wilde Farm« in Arizona an sich gebracht hatte, haben wir ja schon aus dem Munde jenes Amerikaners gehört, und sicher kannte der Prinz alle diese Leute auch schon näher.
Die Pferde hatten in den fünf Tagen, die sie von Alexandrien gebraucht hatten, täglich vierzig Kilometer machend, schon ein ganz anderes Aussehen bekommen, wenn man auch nicht verlangen konnte, dass sie in diesen fünf Tagen fett geworden waren und dass Silberwolke in dieser Zeit ihren während der Seereise verloren gegangenen Schweif ersetzt hätte. Fett sollten sie auch gar nicht werden. Aber sie trugen die Köpfe schon ganz anders, und manches jüngere Tier gefiel sich hier auf dem Klosterhofe schon wieder in Bocksprüngen, entriss sich seinem Herrn und wollte sich nicht wieder einfangen lassen, aus lautem Übermute nicht.
Freilich der Hohn und Spott, mit dem die Kavalkade während ihres ganzen Rittes von Alexandrien nach Kairo ununterbrochen verfolgt worden war, würde auf diesen amerikanischen Präriepferden wohl so lange lasten, wie sie sich in Ägypten aufhielten. Wenn da nicht einmal irgend ein Wunder geschah.
Sie brauchten von ihren Herren nicht aus Eimern getränkt zu werden, die man mühsam erst aus dem fast fünfzig Meter tiefen Brunnen emporwinden musste. Weshalb man es den ehemaligen Mönchen gar nicht verdenken konnte, wenn sie die sandige Fläche des großem Klosterhofes nicht in einen Garten verwandelt hatten. Das wäre eine wahre Sisyphusarbeit gewesen, eine ganz zwecklose. Ein kleines Gärtchen hätte man in der Sandwüste anlegen und bewässern können, aber niemals diesen ganzen Hof. Denn aus solcher Tiefe kann das Wasser nicht mehr einfach gepumpt werden. Dazu gehörte dann die komplizierte Pumpeinrichtung mit Zwischenstation eines Bergwerkes.
Das hatte sich geändert. Jetzt entsprang dort der Felswand in Kopfeshöhe eine Quelle mit armstarkem Strahl, sprang vier Meter weit in ein gemauertes Bassin, durchfloss den ganzen Hof in einem auch schon ausgemauerten Kanal, füllte an der jenseitigen Mauer wieder ein großes Bassin, das später zum Bad erweitert werden sollte, zum Schwimmbad, und floss durch ein kleines Loch in der Mauer in die Wüste hinaus, wo sich das Wasser natürlich bald im Sande verlor, und nicht etwa, dass dadurch hier in der Nähe einmal ein sandiger Sumpf entstanden wäre. Diese Quelle hätte zehnmal, vielleicht hundertmal so stark sein können, draußen die eigentliche Wüste verschluckte das Wasser spurlos.
Jetzt aber war das etwas anderes. Es brauchte nur humusreiche Erde aufgetragen zu werden, das Abflussrohr in der Mauer wurde verschlossen, das Wasser ergoss sich über den ganzen Hof, und in kurzer Zeit war alles ... scheun greun.
Da kam er gerade, Jochen Puttfarken, in weißer Schürze und Ballonmütze, um aus dem ersten Bassin einen großen Kessel zu füllen, bis später die Quelle zur Versorgung des ganzen Hauses in die Höhe geleitet wurde.
Und Jochen hatte nicht mehr nötig, seinen Kopf mit einer Bandage zu umwickeln, um anzudeuten, wo er sein Gesicht hatte. Er strahlte wieder in vollster Mannesschönheit.
Und jetzt hob er seine Rüsselnase, schob sie etwas nach links, dorthin, wo das Parterrefenster der großen Klosterküche lag, alles schon wieder vollständig renoviert und verbessert, und er schnoberte die Luft ein.
»Karline«, rief er dorthin, »Du hast doch schon wieder den Kaffee kochen lassen?! Deine Entschuldigung, dass Du nur kalte Büfettmamsell bist ...«
Erschrocken brach er ab.
Denn wenn man neben einem großen Wasserbassin steht, und plötzlich saust in dieses etwas Gewaltiges hinein, man wird von einem Wasserregen pitschnass, soll man wohl erschrecken.
Pustend tauchte aus dem aufgeregten Wasser ein schwarzgelockter Menschenkopf auf, der entweder einem mädchenhaften Knaben oder einem knabenhaften Mädchen angehören musste, weiter kam ein lederbekleideter Körper zum Vorschein, der sich gleich auf den Rücken legte und lachend mit den Beinen zu strampeln anfing, dass Jochen jetzt erst recht mit einem nassen Regen überschüttet wurde.
»Sie, Miss Leonore, das gibt's aber hier nicht!«, rief Jochen grimmig. »Das hier ist das Wasser für die Küche! Gebadet wird dort drüben in dem anderen Bassin!«
Die Cowboys waren nämlich nicht nur mit dem Tränken ihrer Pferde beschäftigt, was diese ja überhaupt ganz von selbst besorgten. In dem Hofe befanden sich auch einige Last- und Reitkamele, die ebenfalls schon ihre Stallungen hatten, und von des Prinzen alten Leuten weihten einige die neuen Klosterbewohner in die Kunst ein, wie man Kamele behandelt, zäumt, sattelt, beladet und reitet, was auch diese Cowboys erst lernen mussten, wenn sie auch im Pferdesattel zu Hause waren.
Und man hätte diese Cowboys hier zwischen den Mauern des Klosterhofes gar nicht wieder erkannt, das waren jetzt ganz andere als vor wenigen Tagen auf dem Platze von Alexandrien.
Alles ein Lärmen, Jubeln und Lachen. Besonders das Aufstehenlassen der Reitkamele, wenn man schon im Sattel sitzt, machte ihnen unendlichen Spaß. Wenn man an so etwas nun einmal seinen Spaß findet.
Das auf seinen eingeknickten Beinen liegende Kamel steht mit drei kurzen Rucken auf, und das geschieht besonders bei den schlanken Hedjins mit einer Schnelligkeit, die man nicht beschreiben kann, weil man es nicht glaubt, wenn man es nicht selbst gesehen hat. Sobald man ein Bein um den großen Sattelknopf legt, geht es hoch, mit einer Plötzlichkeit, die dem Tiere nicht auszutreiben ist, oder es verliert die gute Dressur, durch die es sich eben auszeichnet.
Erst erhebt es sich etwas auf den Hinterbeinen, dann vollständig auf den vorderen und zuletzt völlig auf den Hinterfüßen. Diese drei Rucke muss der Reiter durch Gegenbewegungen aufheben. Das sieht höchst einfach aus, ist aber eine ganz verteufelte Geschichte. Die ersten beiden Rucke hebt man ganz von selbst auf. Nämlich weil man gar keine Zeit hat, aus dem Gleichgewicht zu kommen. Aber nach dem letzten Ruck fehlt gewissermaßen das Gegengewicht. Es gehört lange, lange Übung dazu, bis man so weit ist, bei diesem dritten Ruck nicht über den Kopf des Kamels hinausgeschleudert zu werden, selbst kopfüber. Mancher europäische, sonst ganz gute Kamelreiter zieht es Zeit seines Lebens vor, mit der Leiter oder einer sonstigen Gelegenheit hinaufzuklettern. Bei den arabischen Kamelreitern ist das ja etwas ganz anderes, die haben das von Geburt auf in Fleisch und Blut.
Schon mancher Cowboy hatte den Sand geküsst. Am besten dabei war immer das dummerstaunte Gesicht des im Sande Liegenden. Denn das geht mit einer unbeschreiblichen Fixigkeit. Wenn man denkt, es soll erst losgehen, man bereitet sich auf den zweiten Ruck vor, liegt man schon unten.
Die beiden Schwestern hatten es mit am schnellsten begriffen, sie waren ja auch schon öffentlich als Pferdebändigerinnen aufgetreten, die mussten so etwas doch wohl können. Und nun passierte es der einen, der schwarzen Leonore, doch noch einmal, dass sie abgeschleudert wurde, und sie hatte das Experiment in der Nähe des Bassins ausgeführt, flog also kopfüber mitten in das Wasser hinein.
Die Felswand gab das Echo des brüllenden Lachens wieder. Zumal wie sich das Mädchen jetzt sofort umdrehte und sich als Rückenschwimmerin produzierte, mit den Beinen strampelte. Sogar die alte »Großmutter«, die mehr als zwanzig Skalpe ihr eigen nannte, verstieg sich zu einem Lächeln, woraus freilich nur eine furchtbar grimmige Fratze wurde.
Auf dies alles blickte der Prinz herab.

»Miss Leonore, das gibt's hier nicht!«, rief Jochen grimmig. »Das ist
Wasser für die Küche, gebadet wird dort drüben in dem anderen Bassin!«
Ob er es aber auch wirklich sah?
Er hatte kein Lächeln für diese humoristischen Szenen. Seine Augen schienen auch nur ins Leere zu blicken, wie er so mit verschränkten Armen am Fenster stand, nur zufällig sah er gerade hinab.
»Der junge Mann macht mir schwere, schwere Sorgen!«, murmelte er jetzt. »Er will nicht zu seiner Mutter, er erwartet sie hier. Einmal habe ich es ihm direkt gesagt — ich kann es nicht wiederholen, und noch weniger kann ich ihn doch von hier fortjagen. Bis jetzt ist ja alles gut gegangen. Nur der Haui und die Handwerker haben ihn gesehen, die kennen ihn nicht, wissen von nichts, das hat mir Almansor aufs Bestimmteste versichert, und ich glaube ihm. Aber was soll daraus werden? Einmal wird er doch in die Öffentlichkeit treten, das weiß ich bestimmt. Und was soll dann daraus werden? Ich selbst komme in die größte Gefahr. Auch Almansor weiß ja keinen Rat. Ich werde es jetzt noch einmal probieren, ihm mitteilen, wie es mit seiner Mutter steht, dass er sie vorläufig hier nicht mehr erwarten kann und dass sich auch sonst die Verhältnisse dort ganz ändern werden.«
Er verließ sein Zimmer, ging nur wenige Schritte durch den Korridor und klopfte an eine andere Tür.
»Herein!«
Ganz kräftig hatte es geklungen.
Aber der Mann, der es gerufen, sah gar nicht danach aus, als habe er diese Aufforderung ergehen lassen.
Edward Scott, einen Beduinenburnus tragend, saß in einem Lehnstuhle am Fenster. Er war noch ganz derselbe. Höchstens dass das Christusgesicht nur noch durchgeistigter geworden war.
Man wusste nicht, was man mit dem jungen Mann anfangen sollte. Davon, dass er eine heilige Mission angetreten hätte, nachdem sein Traum durch den Anblick des Kindes so wunderbar in Erfüllung gegangen, davon war nichts zu bemerken gewesen. Er dachte nicht daran, als Prediger oder Missionar aufzutreten. Er war und blieb ganz teilnahmslos. Aber nicht etwa niedergeschlagen und melancholisch. Durchaus nicht. Er war sogar immer von einer ruhigen Heiterkeit erfüllt, die sich auch in seinem Gesicht, besonders in seinen Augen widerspiegelte. Nur dass er sich um nichts kümmerte. Er kam, wenn man ihn rief, er aß, was man ihm vorsetzte, antwortete auf jede Frage — aber das war auch alles. Er musste zu allem erst aufgefordert werden. Und dass man an diesen Mann alltägliche Fragen stellte, das war ganz ausgeschlossen, da brauchte man ihn nur anzusehen.
Sonst saß er den ganzen Tag in seiner Stube und träumte vor sich hin. Manchmal las er in der Bibel, aber selten.
So saß er auch jetzt seitlich am Fenster, aber ohne hinaus zu blicken, träumte still vor sich hin, wendete auch dem Eintretenden nicht das Gesicht zu, hatte keinen Blick für ihn. Gerade deswegen muss betont werden, dass sein ».Herein« nicht etwa matt und lebensmüde geklungen hatte, sondern ganz frisch und kräftig, und solch einen Eindruck machte er eigentlich auch. Ganz eigentümlich.
»Mister Scott, ich muss Ihnen eine betrübende Mitteilung machen. Soeben meldet mir Baron Walten durch Deasy, dass sich das Befinden Ihrer Frau Mutter heute über Nacht bedeutend verschlimmert hat. Zu dem Katarrh ist eine Lungenentzündung hinzugekommen.«
Der junge Mann gab keine Antwort. Er war ja auch nicht gefragt worden. Aber auch sonst kein Zeichen einer Teilnahme, nicht das Geringste. Ruhig blickte er vor sich hin, mit geradezu freundlichem oder sogar verklärtem Gesicht. Wenn er dabei auch nicht lächelte.
Da plötzlich überkam den Prinzen ein Gedanke!
Er hätte ihn eigentlich schon längst haben können.
Aber gerade jetzt musste er ihm zum ersten Male aufsteigen.
Toglo, heilig!
So hatte ihn der Haui bezeichnet, sobald er ihn erblickt.
Für den arabischen Mohammedaner hat dieses »toglo« aber auch noch eine andere Bedeutung.
Dafür hat er gar kein besonderes Wort für »irrsinnig«.
Der Wahnsinnige, der Geistesgestörte, ist dem Mohammedaner heilig. Im Wahnsinnigen offenbart sich Allah. Der Koran führt es näher aus, wir können es hier nicht. Wir erwähnen nur, dass man noch heute selbst in einer Stadt wie Konstantinopel manchmal einen Irrsinnigen herumlaufen sieht, der allerhand Kapriolen treibt, das Publikum sogar belästigt. Er darf nicht eingesperrt werden. Das geschieht erst, wenn er wirklich gefährlich wird, und dann wird er aufs Beste verpflegt.
War dieser junge Mann etwa wahnsinnig? Hatte das der Haui sofort erkannt?
Schnell hatte der Prinz diesen Gedanken wieder verworfen.
Nein, wahnsinnig, irrsinnig war er nicht. Oder da muss erst einmal die Grenze gezogen werden, wann sich die Sinne eines Menschen irren und wann nicht.
Tiefsinnig war er, ja, trotz seiner ruhigen Heiterkeit — aber irrsinnig durchaus nicht.
»Es ist also durchaus nicht daran zu denken, dass Ihre Frau Mutter die Reise nach hier antreten kann.«
Keine Antwort. Er war ja auch nicht gefragt worden.
»Und weiter muss ich Ihnen mitteilen«, fuhr der Prinz fort, »dass ich die anderen nun nach hier kommen lasse. Ich hatte es schon längst Fred fest versprochen, der Junge hat sich schon immer darauf gefreut, nun ist hier alles so weit, jetzt muss ich mein Versprechen halten. Natürlich kommt auch die Mistress ... doch davon wissen Sie ja gar nichts. Wahrscheinlich heute schon begeben sich einige meiner Leute nach Alexandrien, um weiter nach Triest zu fahren, um die Gesellschaft von dort abzuholen. Auf meiner eigenen Jacht. Wollen Sie diese Reisegelegenheit benutzen, um Ihre Frau Mutter zu sehen? Natürlich wird sie vorher gut untergebracht.«
Zum ersten Male wandte Edward Scott das Gesicht nach dem Sprecher.
»Nein.«
»Sie wollen hier bleiben?« — »Ja.«
»Sie wollen Ihre Frau Mutter nicht sehen?«
»Meine Mutter ist tot.«
»O nein, so schlimm steht es nicht mit ihr, nur erst den Anfang einer Lungen...«
»Wann hat sich Deasy dies melden lassen?«
»Nun, wie gewöhnlich Punkt acht haben wir uns in telegrafische Verbindung gesetzt ...«
»Welche Zeit ist es jetzt?«
Der Prinz zog seinen Chronometer.
»Genau zwölf Minuten nach acht. Ich habe nur noch einige Instruktionen gegeben, dann bin ich fast gleich zu Ihnen ...«
»Vor zwei Minuten ist meine Mutter gestorben.«
Ganz ruhig war es gesagt worden, aber bestürzt fuhr der Prinz zurück. Es hatte gerade in diesem ruhigen, sogar freundlichen Tone gelegen.
»Woher wollen Sie das wissen?!«
»Gerade, als Sie hier eintraten, war meine Mutter bei mir.«
»Ihre Mutter?!«
»Ja. Und sagte mir, dass soeben ihre Seele den Körper verlassen habe.«
Ein starrer Blick auf den Sprecher, und der Prinz eilte hinaus.
Gerade wollte Deasy die Treppe hinab gehen, um sich an den Belustigungen der Cowboys zu beteiligen.
»Noch einmal, mein Kind, muss ich Dich bemühen!«
Mit freudiger Willfährigkeit folgte ihm das Kind sofort in sein Arbeitszimmer.
Zehn Minuten später betrat der Prinz wieder Scotts Stube.
»Mann, wer bist Du, dass Du den Tod eines Menschen 300 Meilen von hier bis zur Minute erfahren kannst?!«
So rief der Prinz fast außer sich.
Es war unlogisch von ihm. Er hatte ja in letzter Zeit Seltsames genug und noch ganz anderes erlebt. Weshalb sollte denn das kleine Mädchen die einzige Person sein, die in die Ferne blicken konnte, und dieser junge Mann machte gerade den Eindruck, als ob auch er so etwas könne, als ob er seine Seele von dem Körper befreit habe, und es war seine Mutter gewesen, deren Tod er auf telepathischem Wege erfahren.
Wenn der Prinz nicht selbst gleich hieran dachte, so hätte ihn Edward Scott jetzt hierauf aufmerksam machen können.
Er tat es nicht, er gab auf diese Frage gar keine Antwort.
Er saß nicht mehr am Fenster, sondern hatte sich erhoben, stand mitten im Zimmer, als habe er den Prinzen erwartet.
»Meine Zeit hat sich erfüllt — ich gehe.«
Da ließ der Prinz sofort jenen Gedanken fallen, die alte Sorge machte sich geltend.
»Wohin?!«
»In die Einsamkeit.«
»Wo ist diese Einsamkeit?«
»Dort, wohin Gott mich führen wird. Jetzt hat er mir erst gesagt, dass ich dieses Haus sofort verlassen soll, dann wird er meine Schritte weiter lenken.«
Und der seltsame Mensch wandte sich der Türe zu, wollte an dem Prinzen vorüber gehen. Der vertrat ihm den Weg.
»Mister Scott, nehmen Sie Vernunft an. Ihre Gottesmission in allen Ehren, ich zweifle nicht daran, dass Sie wirklich dazu berufen sind, aber ... bedenken Sie, in was für Gefahren Sie mich und besonders auch sich selbst bringen! Bisher ist alles gut gegangen, obgleich Sie sich nicht vor jedem fremden Menschen ängstlich zu verstecken brauchten. Aber wenn Sie sich nun in der Öffentlichkeit zeigen, es wimmelt hier von Fedawihs, die doch nicht etwa ständig in dem Gebirge bei Fayum hausen, man erkennt Sie sofort, man wird forschen, wie Sie hierher gekommen sind ...«
Der andere hob nur die Hand, und der Prinz verstummte.
»So wahr ich unter Gottes Führung stehe, so wahr er mich das Kind mit dem Himmelsschlüssel hat finden lassen, so wahr ich soeben den Tod meiner Mutter erfuhr — so wahr ist auch meine Versicherung, die ich Ihnen jetzt gebe: dass Sie durch mich auch nicht die geringsten Unannehmlichkeiten haben werden!«
Mit der größten Feierlichkeit war es erklungen.
Und da trat der Prinz ohne Weiteres zurück, um jenen vorüberzulassen. Denn er war mit einem Male felsenfest davon überzeugt, dass jener die Wahrheit sprach.
Er hatte ja eigentlich noch vieles anführen wollen, um jenen zurückzuhalten.
Er hatte von dem Begräbnis seiner Mutter sprechen wollen, ob er diesem nicht beiwohnen wolle, in vier Tagen konnte er in Siebenbürgen sein, von der Regelung der Erbschaft und dergleichen mehr.
Jetzt aber wusste er, wie zwecklos dies alles sei. Was kümmerte sich denn dieser Mensch noch um solche wahrhaft lächerliche Kleinigkeiten!
Lasset die Toten ihre Toten begraben, Du komm und folge mir nach!
Nur noch eine Frage hatte der Prinz, als jener schon an ihm vorüber gegangen war.
»Und was soll ich der Königin der Nacht sagen, wenn sie nach Ihnen fragt?«
»Dass ich bald zu ihr kommen werde, um sie als meine Braut heimzuholen!«, erklang es zurück.
»Als Ihre Braut?!«, rief der Prinz fast erschrocken.
»Als meine Braut!«, erklang es noch einmal, und jener hatte das Zimmer verlassen.
Erschüttert stand der Prinz da. Er wusste selbst nicht recht, was eigentliche ihn so furchtbar erschütterte.
Auch wusste er nicht, wie lange er so dagestanden hatte.
Da sah er ihn wieder.
Durch dieses Fenster hatte man einen Blick auf das Mokattam-Gebirge, welches ja direkt gegen die Klostermauer stieß, es lag auf der Nordseite. Schnurgerade zog sich die jäh aus der Wüste emporsteigende Felsenwand hin. Dort in einer Entfernung von einem halben Kilometer sah man eine Einbuchtung, das war der kleine Steinbruch, in dem die schon einmal aus dem anderen großen Steinbruch entflohenen und wieder eingefangenen Sträflinge beschäftigt wurden. Doch dieses Arbeitsgebiet selbst sah man nicht.
Und dort an jener Felswand wandelte er entlang, so wie er dieses sein Zimmer verlassen hatte, angetan mit dem Beduinenburnus, der aber mit seinem auf dem Rücken herabhängenden Kopftuch ganz einer Mönchskutte glich, barhäuptig, an den Füßen derbe Schuhe — nichts weiter.
Jetzt blieb er stehen und bückte sich.
Was tat er?
Des Prinzen Falkenaugen konnten es ganz deutlich erkennen.
Er zog diese seine Schuhe aus, ließ sie einfach stehen, setzte seinen Weg barfüßig fort.
Der Prinz schüttelte den Kopf.
»Ihr sollt kein Gold noch Silber noch Erz in Euren Gürteln haben«, murmelte er, und man braucht kein Theologe zu sein, um das auswendig zu können, und diejenigen, zu denen es gesagt worden ist, kümmern sich ja heute den Teufel darum, »auch keine Tasche zur Wegfahrt, auch nicht zwei Röcke, keine Schuhe, auch keinen Stecken.«
»Da geht er hin, der neue Jünger Christi, der es noch ehrlich nimmt.
Wo geht er hin, der rätselhafte Mensch?
Nun, wo sie alle hingegangen sind, um sich auf ihre Mission vorzubereiten, ehe sie der Welt ihr Evangelium verkündeten.
Moses, Johannes, Christus, Mohammed.
Sie gingen in die einsame Wüste und fasteten vierzig Tage lang.
Hm, merkwürdig, immer vierzig Tage lang.
Ob der auch vierzig Tage lang fasten will?
Dass es möglich ist, vierzig Tage lang nichts zu essen, hat zuerst der amerikanische Doktor Tannert bewiesen, viele andere Hungerkünstler haben es ihm dann nachgemacht, und sie alle berichteten davon, dass sie gegen das Ende der Hungerkur herrliche Visionen gehabt hätten. Und nicht etwa Visionen von Schinken und Hühnerpasteten. Himmlische Visionen, die jeder Beschreibung spotten.
Nun, mag dieser Mann Gottes ziehen. Für mich ist die Hauptsache, dass ich jetzt mit wunderbarer, aber auch felsenfester Gewissheit weiß, dass er mich durch sein Gehen nicht in Verlegenheiten bringen wird. Wie sich dieser junge Mann noch weiter entwickeln wird, werden wir ja später sehen.«
Einige Stunden später durchzog die Straßen Kairos eine Karawane, welche den Spott und die Lachlust der Passanten erregte, zumal der orientalischen.
Es waren die Cowboys, wenigstens zwei Drittel von ihnen.
In die Stadt waren sie ja noch nicht gekommen, aber viele hatten sie auf ihrem Wege nach dem alten Kloster doch schon gesehen, hatten von ihnen lachend erzählt, und nun sahen sie alle selbst und ließen es nicht an Spott und Hohn fehlen.
Ach, diese elenden Pferde! Dass deren Aussehen sich etwas gebessert hatte, davon merkten doch die hier nichts.
Dass die meist ledernen Gestalten mit Gewehren und Revolvern bewaffnet waren, machte sie in den Augen dieser Orientalen nur noch lächerlicher. Wenn man nun einmal Waffen trägt, muss man doch auch sonst einen ritterlichen Eindruck machen. Aber auf solch einer Schindermähre muss doch selbst ein Cid zum Ritter von der traurigen Gestalt werden.
Zwei von ihnen ritten auf Hedjins. Wie die aber nun auf den edlen Rennkamelen saßen, wie die immer hin und her schaukelten! Zum Totlachen — mit den Augen solcher Orientalen betrachtet, die auch Städtebewohner sein können, selbst gar nicht reiten zu können brauchen. Es war nicht anders, als wenn man irgend anderswo zum Pferderennen geht, die Jockeys brausen auf ihren Rennern vorüber, da bekommt ein abgeschirrter Droschkengaul Lust, mitzumachen, schließt sich dem bunten Felde an, und nun nehme man noch an, auf seinem Rücken säße sein Herr und klammere sich am Halse fest. Da braucht man doch kein besonderer Pferdekenner und Sportsman zu sein, um diese Komik zu empfinden.
Sie hatten ziemlich viele Lastkamele bei sich. Und wie sie diese nun führten! Wie ohnmächtig sie waren, wenn einmal ein störrisches Tier nicht mehr mit wollte! Und wie jämmerlich die Kamele gepackt waren!
Es war in Kairo, wo dies alles so überaus lächerlich gefunden wurde. In Alexandrien wäre diese schlechte Kamelpackung nicht so aufgefallen. Aber Kairo — wenn es auch die Hauptstadt ist, das afrikanische Paris — es ist doch rings von der Wüste umgeben, täglich durchziehen Beduinen, echte Wüstensöhne, auf herrlichen Rossen die Straßen, fast täglich kommen Karawanen aus dem Innern Afrikas an, gar nicht zu sprechen von den jährlichen kolossalen Pilgerkarawanen, die über Kairo nach Mekka und Medina gehen. Da kann man ja nun bepackte Kamele sehen.
Jetzt passierte auch noch das Unglück, dass dem zuletzt gehenden Lastkamel ein großer Packen abrutschte und am Boden aufplatzte, Schaufeln und Hacken kamen zum Vorschein, und der Führer merkte nichts davon, musste erst vom Publikum darauf aufmerksam gemacht werden.
Versteht man, weshalb dieses orientalische Publikum sich vor Lachen krümmte?
In den Straßen Berlins eine Schwadron Kavallerie, und einer der letzten Reiter verliert seinen Sattel, vielleicht noch Karabiner und Lanze dazu, und der Mann merkt nichts davon, reitet in seinen Gedanken ruhig weiter. So ungefähr. Dass ein Kamel etwas von seiner Ladung verliert, das darf ja nun freilich nicht vorkommen. Hier waren es nicht Schusterjungen, sondern Eseljungen, die ihre Witze anbrachten, und die haben darin auch etwas los. Das dankbare Publikum applaudierte mit Johlen und Lachen.
Da stand auch ein verschleiertes Weiblein. Ein Weiblein deshalb, weil es klein und gebückt war. Wahrscheinlich so eine alte Haremsdienerin, die etwas zu besorgen hatte, womit kein Eunuch und kein anderer männlicher Diener betraut werden konnte.
Sie hatte ihren watschelnden Gang schon ausgesetzt, als sie nur den ersten Reiter erblickt hatte, ein vermummter Beduine auf dem dritten Hedjin in dieser Karawane, und vor sich hatte er in einem Hilfssattel ein Kind. Denn so verhüllt dieses auch war, ein scharfes Auge musste doch gleich eine Kindergestalt erkennen.
Wie gebannt stand das Weiblein da und ließ den Zug an sich vorüber. Da geschah das mit dem letzten Lastkamel, ein Pack fiel herab, platzte auf, Schaufeln und Hacken verstreuten sich.
Da plötzlich kam Leben in das Weiblein, trotz des watschelnden Ganges huschte es wie ein Wiesel davon, in eine Seitengasse hinein.
Eiligst kam durch diese ein Eselsjunge, seinen vierbeinigen Freund hastig mit sich reißend, er wollte sich an dem allgemeinen Gaudium beteiligen.
Das Weiblein vertrat ihm den Weg und zeigte zwischen den Fingerspitzen, die es eben hervorschlüpfen ließ, ein großes Silberstück.
Das ließ sich der Junge nicht entgehen, es sind tüchtige Geschäftsleute, diese Eseltreiber.
»Wohin soll Dich mein Sturmwind tragen, o Perle des Morgenlandes?«, fragte er, das Geldstück erhaschend.
»Zur Mutter der ewigen Freuden in der Bonkonderiah!«, lautete die mit quäkender Stimme hervorgebrachte Antwort, und schon hatte das Weiblein den einen Watschelfuß im Steigbügel und saß im nächsten Augenblick im Sattel, gleich geschickt den Kittel ordnend, dass von den sicherlich sehr krummen Beinen nichts zu sehen war. Wenn sich heute bei uns in der Stadt ein Weib auf einem Esel zeigte, es würde denselben Spott und Hohn des Publikums über sich ergehen lassen müssen wie vor ungefähr zwanzig Jahren die ersten Radfahrerinnen. Sie sind bewundernswert gewesen, diese ersten Radfahrerinnen, die der öffentlichen Meinung trotzten; das Publikum war nicht bewundernswert. Und das wird sich auch niemals ändern, es bleibt immer so albern, wie es nun einmal ist.
Im Orient hat von jeher jede Frau einen Mietsesel besteigen können, natürlich nach Männerart. Nur verschleiert muss sie dabei sein.
Und der Eseljunge sollte gleich sein blaues Wunder erleben.
Diese Miettiere gehören ja nicht zu denjenigen Reiteseln, von denen früher einmal gesprochen worden ist, von denen ein mittelmäßiger so viel kostet wie ein gutes Pferd. Das hier sind kleine, schon ganz abgedroschene Grauschimmel. Sie reagieren auf keinen Schenkeldruck; wenn sie Sporen fühlen, bleiben sie vollends stehen, sie laufen nicht anders, als wenn der Treiber ständig auf sie einhaut und sie auch einmal mit der eisernen Spitze des Stockes sticht, immer unter denselben anfeuernden Rufen. Sie kennen es nicht anders.
Plötzlich schlug dieser Esel hier einen Galopp an, wie es sein Herr noch nicht an diesem alten, faulen Tiere erlebt hatte, wie ein Donnerwetter ging es davon, noch ehe der Knüppel es berührt hatte.
»Was ist denn in Dich gefahren, mein Täubchen — o halt, Du Braut des Teufels — stehe, Du Ausgeburt der Hölle ...«
So keuchte der halbwüchsige Junge, hinterher rennend, was er laufen konnte, ohne noch einmal zum Schlagen zu kommen, und das ging so fort, bis das Ziel erreicht war. Ein baufälliges Haus in Alt-Kairo. Keine zehn Minuten hatte der Ritt gewährt.
Behänd wie eine Katze glitt das Weiblein aus dem Sattel und klopfte in ganz eigentümlicher Weise, die nicht so leicht nachzuahmen war, an die wurmstichige Tür.
Das Weiblein musste also in diesem Hause, in dem den Gästen mit den ewigen Freuden aufgetischt wurde, sehr gut bekannt sein, wenn es nicht gar zum Personal gehörte.
Die Tür wurde denn auch fast sofort geöffnet, das Weiblein schlüpfte hinein und stand einem riesenhaften Neger gegenüber, der in dem niederen Gange kaum aufrecht stehen konnte.
»Ist Raman der Räuber mit seinen Löwen noch hier?«, fragte das Weiblein hastig.
»Was willst Du von ihm? Wer bist Du?«
»Antworte, verschnittener Hund!«, erklang es da in ganz anderem Tone hinter dem schwarzen Gesichtstuche, wie überhaupt das ganze Gewand schwarz war, anders dürfen die Weiber auf der Straße nicht gekleidet gehen.
Dabei packte das kleine, gebückte Weiblein den Riesen beim muskulösen Oberarm, gar so furchtbar konnte es doch wohl nicht zugreifen, und dennoch sank der Riese fast gleich auf die Knie nieder.
»Verzeihe mir, weshalb gabst Du Dich nicht gleich zu erkennen?«, murmelte er demütig.
Also bei jenem Griffe war ein geheimes Erkennungszeichen gewesen.
»Sprich, ist Raman der Räuber mit seinen Karwanbaschis noch hier?!«, drängte das Weiblein, welches man nun einmal nach der schwarzen Kleidung annehmen musste.
Ja, sie waren noch hier, die Karwanbaschis, die echten Schiffer der Wüste, die Freibeuter der Wüste, um hier im »Hause der ewigen Freuden« ihr durch furchtbare Strapazen schwerverdientes Geld zu verjubeln, sie ließen oben die Tänzerinnen kreischen.
Wir können hier nicht die vielen, vielen Abarten der Karawanen erörtern. Die Haddsch befördert nur Passagiere, die Fullah Soldaten oder dient überhaupt zu Kriegszwecken, nur die eigentliche Karwan führt Waren mit sich. Das sind aber nur die drei Hauptarten, die sich wieder in viele Unterarten spalten, die alle ihre eigenen Namen haben.
Von den Handelskarawanen muss man besonders zwei große Arten unterscheiden. Entweder es tun sich Kaufleute zusammen, die auf gemeinschaftliche Kosten eine Sicherheitswache von Beduinen anwerben, welche aber in jedem Gebiet wechselt, so dass es gleichzeitig ein Tribut ist, den die Kaufleute den Bewohnern des betreffenden Wüstengebietes zahlen, oder kleine Kamelbesitzer vereinigen sich, um auf eigene Faust Handel zu treiben, verrichten alle Arbeit selbst und verlassen sich auf ihre eigenen Waffen.
Das sind die Karwanbaschis. Selten hat einer mehr als ein einziges Kamel, das er befrachtet, höchstens dass er noch selbst auf einem Hedjin oder einem Rosse sitzt.
Sie transportieren ihre Waren nicht kolossale Strecken weit, das hält ihr kleines Kapital nicht aus, sondern sie ziehen von Oase zu Oase, um deren Bewohner mit allem zu versehen, was diese brauchen, dafür deren Erzeugnisse eintauschend, besonders Kamelhaarwebereien, aber auch kostbare Teppiche, es sind im Gegensatz zu jenen Großkaufleuten die Hausierer der Wüste, zahlen deshalb auch keinen Tribut, eben weil sie überall sehr willkommen sind.
Dieser Hausierhandel ist aber wohl nur Nebensache. Das Hauptgeschäft bildet bei diesen Karwanbaschis der Salzschmuggel.
Das Pfund Salz kostet in Ägypten zwanzig Pfennig, weil fünfzehn Pfennige Einfuhrzoll darauf lasten. Bei Umgehung dieses Zolls lässt sich also etwas daran verdienen. Je weiter nach Süden oder in Afrika hinein, desto teurer wird das unersetzliche Salz natürlich. Man hat doch wohl gehört, dass im Innern Afrikas das Salz mit Gold aufgewogen wird. Das ist etwas übertrieben, aber immerhin, in Utondo in Koydofan kostet das Pfund schon 5000 Kauris, die einem Werte von vier Mark entsprechen, wofür man dort auch ein Fettschwanzschaf von anderthalb Zentnern Fleischgewicht bekommt.
Dieser einträgliche Salzschmuggel wird — natürlich, möchte man sagen — von englischen Schiffen eingeleitet. Die kleinen Klipper, auch Seelenverkäufer genannt — und Sklavenhandel treiben sie nebenbei ja alle —, besetzt mit den verwegensten Mannschaften, die meist wieder aus deutschen Seeleuten bestehen, bringen das englische Salz, das zollfrei durchgepascht werden soll, irgendwo in einsamer Wüstengegend an Land, entweder vom Mittelländischen oder vom Roten Meere aus. Denn so einträglich ist dieser Salzschmuggel, dass diese Klipper deshalb erst um ganz Afrika dampfen oder segeln, um ins Rote Meer hineinzukommen, weil bei der Fahrt durch den Suez-Kanal die Fracht deklariert werden muss.
Die Landungsstelle ist natürlich verabredet, da gibt es geheime Signale, die ägyptischen Zollkreuzer werden getäuscht und verlockt, es kommt auch einmal auf ein kleines Seegefecht nicht an, und ist die Landung geglückt, so wird das Salz schnell ausgeladen, die Karwanbaschis tauchen aus der Wüste auf und nehmen das Salz in Empfang.
Jetzt beginnt deren Kampf mit den Bassanis, den Zollwächtern, welche wegen dieser Salzschmuggler rastlos kreuz und quer die Wüsten durchziehen. Man muss sie gesehen haben. Was das für Kerls sind! Wie die aussehen, wenn sie nach wochenlangen Ritten in der Wüste wieder einmal in eine Stadt oder einen Flecken kommen. Wie in der Kaffeetrommel geröstet, wie die Mumien ausgedörrt. Wer nicht in drei Tagen auf dem Hedjin 300 Kilometer reiten kann, ohne einen Schluck Wasser zu nehmen, der eignet sich nicht zum Bassan. Und dabei sind es fast niemals eigentliche Wüstensöhne, keine Beduinen, keine mohammedanischen Araber, immer nur heidnische Neger und Europäer aller Art. Die Führer sind meist ehemalige österreichische Offiziere.
Diese Karwanbaschis, die Salzschmuggler, werden nämlich vom Volke vergöttert. Aus leicht begreiflichem Grunde. Weil sie den armen Leuten billiges Salz bringen. Außerdem ist es nun einmal der abenteuerliche Nimbus, der sie umgibt. So wie bei uns die Schmuggler und Wildschützen. Hier handelt es sich aber nun gar noch um Salz, um dieses Lebenselement. Infolgedessen werden die Bassanis, die Zollwächter, gehasst, verachtet. Ein Araber muss schon sehr, sehr tief gesunken sein, wenn er sich zu solch einem Bassan hergibt. Niemand will noch etwas mit ihm zu tun haben, jeder mohammedanische Wirt verweigert ihm den Eintritt in sein Lokal.
So tüchtige Kerls diese Zollwächter oder Salzjäger nun auch sein mögen, selten gelingt es ihnen, einmal eine Schmuggelkarawane abzufassen. Weil diese Karwanbaschis eben noch tüchtigere Kerls sind. Und es ist ja auch so schwer, ihnen beizukommen. Man kann die Wüste doch fast ganz mit dem Meere vergleichen. Der leiseste Wind genügt, um in dem feinen Sande jede Spur wieder zu verwischen. Außerdem nun bietet die Wüste Verstecke, man kann etwas vergraben und später wieder hervorholen, was im Meere nicht so leicht möglich ist.
Solch eine Schmuggelkarawane ist von ihren Kundschaftern umgeben, die sich in meilenweiter Entfernung halten. Wenn die Bassanis diese erblicken, können sie längst nicht die eigentlich Karawane sehen. Die Kundschafter aber können schon durch Zeichen signalisieren. Ist nun eine Flucht nicht möglich, so werden die Kamele abgeladen, das Salz wird im Sande vergraben. Und dieses Abladen und Vergraben geschieht mit einer fabelhaften Schnelligkeit. Eben die viele Übung. Dann mögen die Zollwächter nur kommen. Sie finden eine ehrbare Handelskarawane. Jede Spur ist verwischt. Und wird eine Spur gefunden, wird dort nachgegraben, so findet man alles andere, nur kein Salz. So werden die Zollwächter mit Absicht irre geführt, veralbert.
Sind die Zollbeamten aber schwächer als die Schmuggler, auf ihren abgehetzten Tieren vor allen Dingen schlecht beritten, dann kommt es zum Kampf, und da wird natürlich kein Pardon gegeben, zumal es ja immer Giauren sind, ungläubige Hunde.
Was da sonst noch aus diesen Karwanbaschis wird, lässt sich denken. Sie brauchen nur eine Gelegenheit zu haben, um sich sofort in Räuber zu verwandeln.
Trotzdem besuchen die Karwanbaschis die Flecken und Städte, um Handel zu treiben und ihr Geld zu verjubeln. Warum auch nicht? Es sind doch ganz ehrliche Handelsleute. Nachzusagen ist ihnen natürlich nichts. Darauf halten sie. Und da nützt es auch nichts, einen einmal unter die Folter zu nehmen. Denn sobald solch ein Karwanbaschi festgenommen wird, gibt er sich selbst den Tod, was aber keinen weiteren Verdacht erregen kann. Denn diese Karwanbaschis, die ja überhaupt keine Heimat und keine Familie mehr haben können, sind sämtlich Ausgestoßene ihres Stammes, haben ihn meist wegen Blutrache verlassen müssen, sie selbst brauchen gar niemanden gerötet zu haben, aber vielleicht ihr Großvater, der Enkel ist noch dafür verantwortlich, er würde wieder von den Verwandten des Gemordeten getötet werden, deshalb verlässt er den Stamm für immer nach allen Rechten des einheimischen Gesetzes. Und solch ein Mann, der im Banne der Blutrache steht, darf sich nicht festnehmen lassen, vor kein Verhör gestellt werden, er muss unbedingt Selbstmord begehen. — — —
Solch eine Bande Karwanbaschis lag hier im »Hause der ewigen Freuden«, seit gestern, hatte gleich Quartier genommen.
Ihr Anführer hieß gleich direkt Raman der Räuber. Aber das war nur ein Spitzname im Volksmunde. Niemand konnte ihm etwas nachsagen. Denn wer den als Räuber kennen gelernt hatte, der konnte nicht mehr von dieser Bekanntschaft erzählen. Ein tadelloser Ehrenmann, der sich von den Behörden seinen Handelsschein ausstellen ließ und unter seinen Leuten musterhafte Zucht hielt.
Er kam, ein Beduine, nur aus Knochen, Muskeln und Sehnen bestehend.
»Wer bist Du?«
Das schwarzgekleidete Weib, das es ja noch immer war, eben dieser Tracht nach, nur nicht mehr so gebückt dastehend, streckte ihm die Hand entgegen, und sie wurde genommen. Obgleich sich die Orientalen ja sonst nicht die Hände reichen.
Ein Druck, und der Beduine zog seine Hand zurück, um die Arme über der Brust zu verschränken und sich tief zu verneigen.
»Du bist ein Mächtiger, Raman ben Omar ist Dein Sklave.«
»Keine Umstände! Jede Sekunde ist kostbar! Wie viele seid Ihr?«
»Vierunddreißig Lanzen.«
»Alle hier?«
»Alle.«
»Wo sind Eure Tiere?«
»Nebenan in der Karawanserei.«
»Bereit für Wüstenritt?«
»Immer.«
»Habt Ihr gute Gewehre?«
»Die besten englischen Karabiner.«
»Genug Munition?«
»Jeder mehr als hundert Schuss.«
»So viel Wasser und Proviant und Futter wie möglich mitnehmen! Sofort nach der Brücke! Ich erwarte Euch auf gelber Koheye mit weißen Fesseln in gelbem Burnus. Fort!«
Der Beduine drehte sich um und rannte in den dunklen Gang hinein, das Weiblein schlüpfte wieder zur Tür hinaus. —
Eine Viertelstunde später hielt diesseits am Anfange der Nilbrücke ein Beduine in gelbem Burnus auf gelber Koheye mit gelben Fesseln.
Tayes, Manekeye, Koheye, Saklawy und Djulf — so hießen die fünf Lieblingsstuten des Propheten, von ihnen leiten sich die Stammbäume aller heute existierenden arabischen Pferde ab. Jeder Beduine kann sie von einander scharf unterscheiden, aber woran, das weiß kein europäischer Pferdekenner zu sagen. Und wenn er's schließlich selbst gelernt hat, vermag er den Unterschied doch nicht zu definieren. Es liegt nur im Blick. Im Orient werden nur Stuten geritten.
Wohl war es ein kleiner Mann, der auf dem herrlichen Rosse saß, aber niemand hätte in dem Beduinen mit der stolzen Haltung, der die Lanze in den Steigbügel stemmte, das gebückte Weiblein wieder erkannt, abgesehen davon, dass ja auch dieser Beduine das Gesichtstuch niedergelassen hatte.
Und da kamen sie schon, die bestellten Karwanbaschis, vierunddreißig Mann, alle mit Lanzen und Karabinern bewaffnet, neun zu Pferde, nur edle Tiere, die anderem auf Rennkamelen, außerdem noch ein Dutzend Lastkamele, hoch bepackt, obgleich auch die Hedjins ziemlich beladen waren.
Es waren nur Wasserschläuche und Futtersäcke, der Proviant für die Menschen kam dagegen gar nicht in Betracht, aber das konnte man dem Gepäck nicht so ohne Weiteres ansehen, man hielt den Zug eben für eine Karawane mit voller Warenladung, und erstaunlich, schier fabelhaft war nur, wie diese Karwanbaschis das in der kurzen Zeit fertig gebracht hatten und auch schon hier sein konnten. Denn so fertig gepackt hatten ihre Kamele doch nicht etwa im Stall gestanden.
Ein leichtes Winken des einsamen Reiters mit der Lanze, der Zug hielt auf ihn zu und stand. Auf diesem freien Platze seitwärts von der Brücke versammeln oder ordnen sich immer Karawanen, jetzt war in einiger Entfernung nur noch eine andere, kleinere vorhanden.
Doch da kam noch eine dritte, umjohlt von einer Volksmenge.
Die Cowboys mussten langen Aufenthalt gehabt haben, dass sie erst jetzt die Brücke passierten, und zwar taten sie es, ohne noch einmal zu halten.
Staunend betrachteten die Karwanbaschis die fremdartigen Reiter und ihre Lastkamele. Zum Lachen waren diese finsteren Wüstenritter nicht geeignet.
»Kennst Du diese Reiter, Scheik Raman?«, fragte der kleine Beduine.
»Ach, das sind sie! Inschallah, wer sind die?«
»Du hast von ihnen schon gehört?«
»Einige meiner Leute haben sie gestern gesehen und davon erzählt, wir wollten es nicht glauben, dass es solche Pferde gibt.«
»Was weißt Du von ihnen?«
»Sie sind gestern in das alte Kloster bei Mokattam eingezogen.«
»Woher kommen sie?«
»Von Amerika, es sollen dort Jäger gewesen sein. Die möchte ich ein flüchtiges Wild verfolgen sehen, eine Gazelle, hahaha!«
»Siehst Du den Führer?«
»Ich sehe ihn.«
»Was hat er vor sich im Sattel?«
»Es scheint ... es ist ein Kind.«
»Versäumst Du ein Geschäft?«
»Nein. Wir hatten uns eine Woche genommen und noch nichts verabredet.«
»Und wenn Du auch das dringendste Geschäft vor hättest und eine Kamellast Gold dabei verdienen könntest, Du hättest mir zu gehorchen.«
»Ich weiß es, Mächtiger, und ich gehorche.«
»Ohne etwas zu fordern.«
»Ich weiß es, Mächtiger, Du hast über uns zu befehlen.«
»Scheik Raman, wenn Du jenem Manne das Kind abnimmst und mir lebendig bringst, erhältst Du einen Beutel Gold.«
Hoch horchte der Räuber auf! Ein türkischer Beutel hat vier Pfund Gold im Werte von 5500 Mark.
Da mussten diese vierunddreißig Karwanbaschis lange arbeiten und schmachten, ehe sie das verdienten.
Wenn ein Lastkamel, mit acht bis zehn Zentnern bepackt, täglich sechs Mark einbringt, so sind sie höchst zufrieden.
»Du scherzest, Mächtiger.«
»Ich scherze nicht, einen Beutel Gold — beim Schwerte der Fedawihs!«
Erschrocken und scheu blickte sich Raman um. Aber er konnte beruhigt sein, der »Mächtige« hatte gewusst, dass diesen Schwur keine fremden Ohren hören konnten.
»Wo gehen diese Merikanis hin?«
»Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls in die Wüste, um Ausgrabungen anzustellen.«
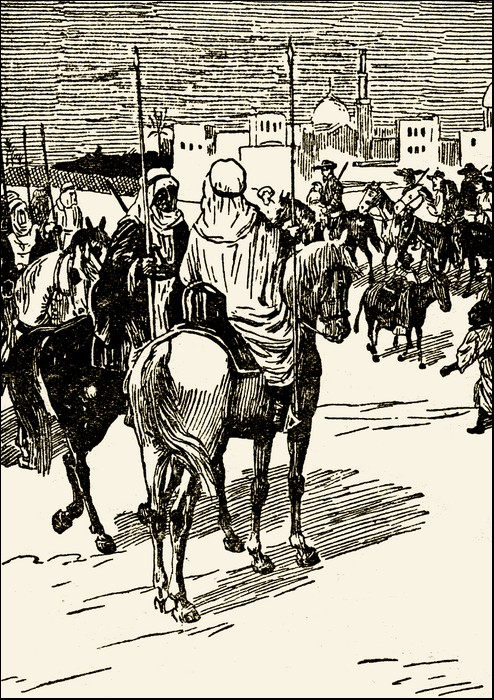
»Kennst Du diese Reiter, Scheik
Raman?«, fragte der kleine Beduine.
»So gib mir den Beutel.«
»Erst gib mir das Kind.«
»Es ist schon so gut wie Dein.«
»Wie kannst Du das behaupten?«
»Du meinst, der Mann könnte es töten, ehe er es sich nehmen lässt?«
»Niemals, das Leben dieses Kindes ist ihm heilig.«
»Nun, dann ist ihm das Kind auch schon so gut wie abgenommen.«
»Auf welche Weise denn, Raman?«
»Wie kannst Du noch fragen, Mächtiger. Du kennst doch Raman den Räuber und seine Löwen.«
»So! Also Du meinst, Du wirst mit diesen Merikanis leichtes Spiel haben?«
»Sobald sie so weit sind, wie ich sie haben will, sind sie Kinder des Todes.«
»So! Und ich sage Dir, Raman, Du wirst Dich in diesen Merikanis und ihren Pferden furchtbar irren! Wenn sie nur Euch nicht fressen.«
»Jetzt aber scherzest Du wirklich, Mächtiger. Ich schwöre Dir ...«
»Schweig!«
Der Zug war herangekommen, zog an ihnen vorüber.
Die in den Löchern der Gesichtstücher blitzenden Beduinenaugen musterten jeden Einzelnen, es wäre auch ganz verfehlt gewesen, Teilnahmslosigkeit zu heucheln, das hätte einen Erfahrenen nur stutzig machen können. Der Beduine ist nicht so teilnahmslos wie etwa der nordamerikanische Indianer. Dass sie nicht in das allgemeine Lachen und in den lauten Spott der Volksmenge einstimmten, das war wieder etwas ganz anderes.
Siebenundzwanzig Männer waren gezählt worden, auf drei Hedjins und vierundzwanzig Pferden, dazu noch acht Lastkamele.
Der letzte Reiter hatte die Brücke betreten.
»Wenn auch dieser die Brücke verlassen hat, folgen wir langsam«, sagte der »Mächtige«, der noch keinen anderen Namen genannt hatte.
»Und Du sagtest vorhin, diese jämmerlichen Männer würden uns ...«
»Schweig!«, wurde der Scheik wiederum mit herrischer Stimme, die jetzt nicht mehr so quäkend, wenn auch noch hoch war, unterbrochen. »Wir folgen der Karawane und greifen sie erst an, wenn ich das Zeichen dazu gebe, nicht eher! Verstanden?«
»Wie Du befiehlst, o Mächtiger.«
Es sollten für acht Stunden ziemlich die letzten Worte gewesen sein, die zwischen diesen beiden gewechselt wurden. Die Cowboys durchzogen das grüne Niltal, hier auf dieser Seite gegenüber von Kairo ungefähr zehn Kilometer breit, weiter nach Süden wird es schmaler und immer schmaler, passierten das Gebirge, welches auf dieser Westseite den Nil bis nach Siut hinunter begleitet, durch die Satoyaschlucht und betraten die Wüste.
Eine Stunde später kamen auch die Karwanbaschis zu dieser Schlucht heraus, nicht aber eher, als bis sie sich über die Bewegungen der Gegner durch einen Kundschafter orientiert hatten.
Da sah man die letzten Kamele der Cowboys am südwestlichen Horizonte nur noch als winzige Punkte.
Das heißt, nur diese Beduinenaugen konnten diese Punkte noch erkennen, kein anderes, sicher kein europäisches.
Es ist ja schier unglaublich, auf welche Entfernungen die Augen dieser echten Wüstensöhne noch etwas zu erkennen vermögen.
Sie folgten diesen Punkten.
In der elften Morgenstunde war es gewesen, als sie, aus der Satoyaschlucht kommend, diese Punkte zuerst erblickt hatten, und in der sechsten Abendstunde zogen sie ihnen noch immer nach!
Was während dieser sieben oder eigentlich acht Stunden — das Passieren des Niltales war ja mitzurechnen — der »Mächtige« mit Scheik Raman gesprochen hatte, bezog sich nur darauf, wie man die letzten Kamele jener Karawane immer als solche Punkte im Auge behielt.
Denn so einfach war das ja nicht etwa. Die Wüste bildet doch niemals eine völlige Ebene, überall sind Sandhügel, ständige, oftmals konnte man die Punkte lange Zeit nicht mehr sehen, einmal gleich eine Stunde lang nicht, und da musste man doch darauf gefasst sein, die Verfolgten plötzlich viel näher zu haben, wenn man nicht etwa gar plötzlich dicht vor ihrem Lager stand.
»Irre Dich nicht, Raman, dieser Mann, der diese Merikanis führt, hat noch ganz andere Augen als Du!«
So hatte der »Mächtige« auch noch gewarnt, sagte es noch mehrmals.
Und die Verfolger wollten sich doch wo möglich gar nicht blicken lassen.
Also da war dieses Nachziehen, immer nach Südwesten, nicht so einfach, da musste mancher Kundschafter erst kolossale Bogen reiten, musste, wenn er wegen der Terrainbeschaffenheit keine sichtbaren Zeichen geben konnte, erst wieder zurückkommen, ehe die unterdessen Wartenden weiterziehen durften.
So war das also bis in die sechste Abendstunde gegangen, immer nach Südwesten waren die »Merikanis« gezogen, wohl niemals in Trab, aber ohne jede Rast, dorthin, wo die Oase Fayum lag.
Da kam wieder solch ein weit vorausgeschickter Kundschafter zurückgesprengt.
»Sie lagern!«
Gleich darauf brachten noch zwei andere Kundschafter dieselbe Meldung, die dasselbe aber von ganz anderen Seiten aus beobachtet hatten.
Die Sonne stand dicht über dem Horizonte, da war man über die Situation im Klaren.
Die Cowboys lagerten für die Nacht in einer Mulde. Gerade hier war die Wüste, so weit das Auge blickte, einmal ganz eben, nur im Zentrum des Kreises nicht, den man überschauen konnte.
Dort hatte sich der Sand zu einem Ringe aufgehäuft, der vielleicht einen Durchmesser von 100 Metern hatte. Massiv konnte diese Erhöhung nicht sein, sonst hätte man doch die Menschen und Tiere oben darauf sehen müssen. Der Sandring umgrenzte eine Mulde, in dieser wollten die »Merikanis« zweifellos die Nacht verbringen.
Das sicherste Zeichen hierfür waren auch einige Geier. die hoch oben in den Lüften das Lagern der Menschen dort unten beobachtet hatten und nun sofort zur Stelle waren, um zu sehen, ob nicht etwas für sie abfiele. Ein Feuerschein war noch nicht zu sehen, dazu war es noch zu hell, aber diese zufliegenden Geier trogen nicht.
Eine Beratung fand nicht statt. Der »Mächtige« befahl nur.
Einkreisen! Jeder schleicht sich so nahe wie möglich heran, wie es die Deckung erlaubt, aber nicht näher als auf l00 Meter an den Sandring, in möglichst gleichmäßigem Abstande. Nichts, was sich über dem Sandring zeigt, wird beschossen, wohl aber alles, was diesen Ring verlässt.
So instruierte der fremde Beduine.
Aber das war nicht so ganz einfach.
Es ist manches leichter gedacht und ausgesprochen als ausgeführt.
Diese Karwanbaschis hier in der Wüste hatten erst ein mathematisches Exempel zu lösen, wenn sie dazu auch keine Formeln hatten.
Dreißig Mann bestimmte der »Mächtige« für diesem Einkreisen, die anderen sollten als seine Adjutanten bei ihm bleiben.
Wenn sich nun jeder von diesen dreißig Mann dem Sandringe bis auf 100 Meter näherte, wie weit lag dann einer vom anderen entfernt?
Einer, der von so etwas gar keine Ahnung hat, kann sich da nämlich gleich einmal um tausend Meter irren.
Diese Wüstenräuber hier aber hatten dafür ihre eigene Formel, brauchten es nicht einmal erst im Sande durch kleine Kreise auszuprobieren.
Dann lag einer vom anderen 400 Meter entfernt. Jeder Karabiner hatte also nur die Hälfte dieser Strecke zu beherrschen, um ein Durchbrechen der Eingeschlossenen zu verhindern. Und es waren die modernen Karabiner, sieben Schuss mit Magazin, da ließ sich schon etwas machen.
Diese Instruktionen waren erteilt, noch aber ließ der »Mächtige« die Leute sich nicht zerstreuen.
»Und nun noch eins! Ihr nennt Euch die Löwen der Wüste! Und ich weiß, dass Ihr diesen Namen verdient, weil Ihr die Herrscher der Wüste seid, niemand sich mit Euch vergleichen kann. Der Ruhm der Karwanbaschis von Raman dem Räuber erfüllt die ganze Welt.
Aber das eine lasst Euch gesagt sein! Wenn Ihr Löwen seid, so sind jene Männer dort Tiger! Und zwar Tiger, die den Löwen in nichts nachstehen! Verlasst Euch darauf! Ihr glaubt es mir ja doch nicht, ich sehe es Euren spöttischen Gesichtern an, aber ich muss Euch warnen. Seid auf Eurer Hut! Lasst Euch nicht beschleichen! Diese Männer schleichen des Nachts wie die Katzen! Sie wissen schon längst, dass sie Verfolger hinter sich haben, sie warten nur darauf, Euch in der Nacht zu beschleichen, um Euch die Köpfe abzuschneiden! Seid auf Eurer Hut!«
Mit größtem Nachdruck hatte es der »Mächtige« gesprochen, das Arabische wie ein Mufti, wie ein Rechtsgelehrter beherrschend, aber einmal alle arabische Floskeln vermeidend.
Aber er hatte recht, es hatte gar keinen Zweck, diese Karwanbaschis zu warnen. Sie glaubten ihm doch nicht. Die meisten hatten jetzt die Kopftücher zurückgeschlagen und er sah nur höhnische oder maßlos selbstbewusste Gesichter. Sie wagten nur nicht, dem »Mächtigen« zu sagen, wie sie da ganz anderer Meinung seien. Nun, da mussten sie eben erst ihre Erfahrungen machen, es war nicht anders möglich.
Noch immer schickte der »Mächtige« sie nicht davon, er wandte sich erst noch einmal an den Scheik.
»Welches ist Euer schnellstes Tier?«
»Für welche Zeit und Strecke?«, war erst die ganz richtige Gegenfrage.
»Für ... zwei bis drei Stunden.«
»Dort Hamins Selma.«
Der »Mächtige« blickte nach dem bezeichneten Tiere. Es war ein herrliches Ross, eine Saklawy.
Selma ist ein arabisches Wort und heißt die Flugtaube. Es gibt noch andere Tauben, die anders heißen. Eine der schnellsten Wüstentauben. Ob das mit unserem Namen Selma zusammenhängt, weiß der Schreiber dieses nicht. Bei den Arabern und besonders bei den Wüstenbewohnern ist es ein sehr beliebter weiblicher Vorname. Man wundert sich anfangs, in einem Beduinenlager so viele Selmas zu finden.
Hier hatte auch einmal ein Pferd diesen Namen bekommen. Die Flugtaube.
»Ist Hamin zuverlässig?«
»Wie alle meine Löwen.«
»So bleibt er hier. Und dann Du noch und Du. Und auch Du bleibst bei mir, Raman. Fort!«
Die dreißig Mann jagten auf ihren Rossen und Hedjins davon, um die Lagernden einzukreisen.
Aber welche Richtungen sie dazu einschlugen!
Ganz entgegengesetzte.
Doch darüber, wie sie sich heranschleichen mussten, hatten diese Wüstenräuber nicht erst Instruktionen zu erhalten brauchen.
Der fremde Beduine zog unter seinem Burnus einen ganz modernen Notizblock hervor, schrieb auf das Blatt etwas, fremdartige Hieroglyphen, riss das Blatt ab und faltete es zusammen.
»Hier, Hamin. Du kennst doch natürlich den Dschebel el Ghossar bei Fayum. Dort eilst Du hin, lässt Deine Taube fliegen. Wo der Birket el Kerun sein Wasser dicht an der Felswand ... was hast Du?«
Der Araber hatte sein Gesicht nicht mehr bedeckt, und dieses tiefbraune Gesicht färbte sich plötzlich ganz grau, und dazu hatte er eine hastige Bewegung gemacht.
»O, Mächtiger, das wirst Du doch von einem rechtgläubigen Moslem nicht verlangen!«, stieß er in furchtbarem Schreck hervor.
»Was nicht verlangen?«
»Dass ich ins Geistergebirge dringe, und noch dazu bei Nacht!«
»Du bist ein Narr! Hausen in dem Geistergebirge nicht auch Menschen?«
»Ja.«
»Was für Menschen?«
»Deren Namen ich nicht aussprechen darf.«
»Sprich ihn aus, ich erlaube und befehle es Dir, und wer ich bin, weißt Du doch.«
»Fedawihs.«
»Und wer ist der Mächtigste dieser Mächtigen?«
»Der ... Dais el Kebir.«
Trotz der einmal gegebenen Erlaubnis hatte der Beduine diesen zweiten Namen nur ganz zögernd, flüsternd ausgesprochen.
»Hat der nicht auch den Geistern dort zu befehlen?«
»Sie sind ihm untertänig.«
»Und was bin ich?«
»Auch schon ein Dais.«
»Und was bist Du?«
»Nur ein Basik.«
»Nun, wenn ich, ein Dais, einen Basik dorthin schicke, glaubst Du, die Geister können ihm etwas anhaben?«
Der Mann sah das ein.
»Ja, ich war ein Narr!«, gestand er gedrückt, richtete aber dafür wieder seine Gestalt auf.
»Und hier hast Du noch einen Talisman, der Dich besonders noch vor den Geistern schützt, noch mehr aber vor den Beni Suefs, falls sie Dich aufhalten, Du brauchst ihn nur zu zeigen, und man wird Dich führen, was aber sonst nicht nötig ist.«
Der »Mächtige« brachte unter seinem Burnus einen kleinen, eiförmigen Stein von blauer Farbe zum Vorschein, der Araber nahm ihn und küsste ihn ehrerbietig.
Es folgte eine weitere Instruktion, wie der Mann zu reiten und welche Stelle er aufzusuchen habe. Immer am westlichen Ufer entlang, aber gar nicht weit, so trat die Felsenwand ganz dicht an das Wasser heran, dafür schob sich eine kleine Landzunge mit festem Steinboden in den See hinein.
»Auf diese Landzunge stellst Du Dich hin, gleichgültig, wohin, so genau kommt es nicht drauf an — nur in einiger Entfernung von der Bergwand — und stößt Deine Lanze mit dem stumpfen Ende kräftig gegen den Boden. Das tust Du so lange, bis jemand kommt. Länger als eine Minute brauchst Du nicht zu warten. Dem Manne, der kommt, gibst Du diesen Zettel. In einigen wenigen weiteren Minuten wirst Du eine Antwort bekommen. Die bringst Du mir. Verstanden?«
Der Beduine wiederholte kurz.
»Fliege!«
Das edle Ross jagte wie ein Sturmwind, wirklich wie eine Taube mit seinem Reiter davon, dem Südwesten zu, wo noch der Tag graute, während von der entgegengesetzten Richtung her schon die Nacht heranzog, wo am Horizont schon die ersten Sterne funkelten.
Der »Mächtige« beschrieb ein zweites Blatt und wandte sich an einen anderen Mann.
»Wie heißt Du?«
Er hatte den ungewöhnlichen Namen Ali.
»Und Du reitest nach der Stadt zurück, denselben Weg, den wir gekommen sind, nach der Moschee el Zenab, klopfst am vierten Tore, welches das verschlossene heißt.
Trotz dieses Namens wird man Dir bald öffnen. Dem Manne gibst Du dieses Papier, für den Mufti Benhazar. Wie heißt der Mufti?«
»Benhazar.«
»Das Schreiben kommt auch in keine anderen Hände, oder niemand könnte es lesen. Du bekommst bald Antwort, die bringst Du mir. Eile!«
Diesmal war es ein Rennkamel, das weitausgreifend davonjagte. — — —
Die Nacht war angebrochen. Das letzte Viertel des Mondes ging erst am Morgen auf.
Wohl funkelten am Himmel die Sterne mit voller Pracht, sie verbreiteten doch ziemliches Licht, aber dieses genügte nicht, um auf zwanzig Schritt Entfernung die Gestalt erkennen zu lassen, welche auf den Sandring zuschritt.
Weil diese Gestalt einen gelben Burnus trug, der sich so gar nicht von dem gelben Sande abhob.
Aber der Mann wollte sich ja gar nicht heranschleichen, sonst wäre er doch nicht so aufrecht gegangen.
Wahrscheinlich wollte er versuchen, so weit wie möglich herankommen zu können, noch den Sandwall hinauf, um zu sehen, was hinter diesem in der Mulde vorging, ohne dann, wenn er überrascht wurde, sich den Vorwurf machen lassen zu müssen, er habe sich als Spion heranschleichen wollen. Dass er sich erst durch seine Stimme bemerkbar machte, das war ja nicht gerade nötig.
Und doch, dieses Sternenlicht genügte! Genügte für die Augen der Männer, die dort als Wachtposten hinter dem Sandwall lagen, um die gelbe Gestalt auf dem gelben Sande schon auf fünfzig und noch mehr Schritte zu erkennen.
»Ki wa ul terif — steh oder ich schieße!«, erklang eine raue Stimme.
Es war nur auf Arabisch gerufen worden, und es hatte recht merkwürdig geklungen.
Die gelbe Gestalt stand.
Nun aber war der biedere Cowboy mit seinem Arabisch fertig, mehr als jenen Anruf konnte er vorläufig noch nicht, und nun fing er auf Englisch an, was wir aber doch in Deutsch wiedergeben müssen.
»Was willst Du blutiger Lausewenzel verdammter?«
Das konnte nun wieder der Beduine nicht verstehen, das war nicht zu verlangen, aber die Hauptsache war, dass er selbst stehen blieb, und jetzt schwang er auch ein weißes Tuch durch die Luft.
»He, Flammenauge, kommt mal her, da steht ein Kerl und wedelt mit einem schmutzigen Lappen, der will wohl parlamentieren.«
Schon war der Prinz zur Stelle, lag neben dem Cowboy auf dem Walle im Sande.
Wir können sie auch nicht arabisch sprechen lassen, wollen uns auch nicht aller der fremden Ausdrücke bedienen, wofür ja jedes Land und jede Sprache seine eigenen Floskeln hat.
»Erkennst Du mich als Parlamentär an?«
Es war der kleine Beduine, der »Mächtige«, der aber jetzt eine sehr tiefe Stimme hatte, die jedoch ganz ungezwungen klang, so wie vorher seine hohe, so wie er als Weiblein im höchsten Fisteltone gequäkt hatte. Alles hatte immer ganz natürlich geklungen.
»Ich erkenne Dich an. Du bist geschützt. Komme heran.«
Der Beduine setzte seinen Weg schneller fort, doch natürlich mit der Absicht, auch den Sandwall zu erklimmen. Aber daraus sollte nichts werden.
Nur bis auf zehn Schnitte durfte er herankommen.
»Halt!«, erklang es dann wiederum. »Nicht weiter, nur noch einen einzigen Schritt, und Du hast eine Kugel durch den Kopf!«
Natürlich war der Beduine sofort wieder stehen geblieben.
»Das nennst Du einen geheiligten Parlamentär anerkennen und ihn empfangen?«, fragte dann seine tiefe Stimme höhnisch.
»Du bist doch ein Abgesandter von den Räubern. die uns hier eingeschlossen haben.«
»Es sind keine Räuber.«
»Karwanbaschis.«
»Ja.«
»Willst Du etwa behaupten, dass es keine Räuber wären?«
»Nun gut, ich bin der Abgesandte von diesen Räubern.«
»Mit Räubern parlamentiert man eigentlich nicht. Aber schließlich kann man ja doch einmal in die Verlegenheit kommen, mit ihnen unterhandeln zu müssen. Was willst Du?«
»Zunächst, dass Du Dein Wort hältst und mich als Parlamentär empfängst.«
»Du meinst, ich soll Dich hier so etwa wie einen Gastfreund empfangen?«
»Ja.«
»Nein, daraus wird nichts. Du bleibst dort stehen, und näherst Du Dich auch nur noch einen halben Schritt, so hast Du eine Kugel durch den Kopf! Und dann, sobald ich befehle, hast Du Dich wieder zu entfernen. Was willst Du nun? Was verfolgen uns diese ... aaahh!«
So hatte sich der Prinz unterbrochen, mit diesem Rufe des Erstaunens.
»Was hast Du?«, fragte der Beduine denn auch gleich.
»Seit wann tragen denn Parlamentäre ihr Gesicht verhüllt?«

Darüber durfte der Prinz, wenn er die orientalischen Sitten kannte, allerdings mit Recht staunen.
Es sollte sich aber gleich zeigen, dass er über etwas ganz Anderes so gestaunt, es nur gleich geschickt zu bemänteln verstanden hatte.
»Mich bindet ein Schwur, ich darf mein Gesicht nicht zeigen.«
»Ach, diese allerliebste Ausrede! Konntest Du nicht einmal etwas Neues erfinden?«
»Du beleidigst mich, Effendi, wenn Du es mir nicht glaubst.«
»Willst Du es nicht beschwören, dass Dich ein Schwur bindet, Dein Gesicht immer verhüllt zu tragen?«
»Beim Barte des Propheten, ich schwöre es!«, erklang es feierlich, und die Hand fuhr dorthin, wo man seinen Vollbart hat, wenn man über einen solchen verfügt.
»Das wird ja immer besser!«, lachte es jetzt dort hinter dem Sandwalle. »Schwört der Kerl beim Barte des Propheten, mit ganz tiefer Stimme! Oder«, fuhr er jetzt auf Englisch fort, »wollen Sie nicht lieber dabei Ihre Fingerspitzen zusammentippen?«
»Was?!«
»Seit wann haben Sie denn eine so tiefe Stimme, Señor Lazare?«
Da wurde ohne Weiteres das Kopftuch zurückgeschlagen, und tatsächlich kam das schlaue Fuchsgesicht des Jesuitenpaters zum Vorschein, immer noch mit demselben gütigen Lächeln.
»Ich bewundere Ihre Augen, Hoheit!«, erklang es jetzt mit ganz anderer, hoher und so überaus sanfter Stimme.
»In der Tat, ich habe Sie gleich am Gange erkannt, wenn Sie auch diesen zu verstellen suchten. Allerdings nicht direkt habe ich Sie am Gange erkannt. Ich dachte nur immer daran, dass das doch ein Bekannter sein müsse. Richtig erkannt habe ich Sie erst an der Stimme. So geschickt Sie diese auch zu verstellen wussten. Da hörte ich aber doch den Señor Domingo Lazare heraus.«
»So bewundere ich noch mehr Ihr feines Ohr, Hoheit. Sie haben etwas fertig gebracht, was ich keinem anderen Menschen in der Welt zutraue.«
»Na, lassen wir jetzt einmal die Komplimente. Was wollen Sie, Señor Lazare?«
»Sie fragen, wo sich Mistress Allan und ihr Sohn Fred befinden.«
»Und um mich das hier zu fragen, deshalb sind Sie Räuberhauptmann geworden?«
»Jawohl. Und wissen Sie, was Sie sind, königliche Hoheit?«
»Nun?«
»Sie sind ein wegen Menschenraub steckbrieflich Verfolgter. Sobald Sie an Amerika ausgeliefert werden, bekommen Sie Zuchthaus.«
»Man soll mich doch festnehmen und ausliefern!«, erklang es gleichmütig zurück.
»Sie wissen selbst am besten, weshalb dies nicht geht, deshalb haben Sie sich doch nur nach Ägypten gewandt, Ägypten liefert zwar jeden steckbrieflich Verfolgten aus, jeden einfachen Dieb, aber das steht nur auf dem Papier. Wegen der politischen Verwicklungen ist selbst die Auslieferung eines Raubmörders mit den größten Schwierigkeiten verknüpft.«
»Ich danke Ihnen für diese Belehrung. Nun ziehen Sie sich wieder zurück, Herr Parlamentär.«
»Wollen Sie mich nicht noch etwas anhören, königliche Hoheit?«
»Aber machen Sie es kurz!«
»Ich habe einfach zur Selbsthilfe gegriffen, das können Sie mir nicht verdenken.«
»Nein, ich verdenke es Ihnen nicht.«
»Die Sache der Mistress Allan ist meine eigene, ich nehme mich ihrer ganz uneigennützig an ...«
»Edler Mensch! Aber beim Barte des Propheten brauchen Sie das nicht wieder zu beschwören, es hat ja gar keinen Zweck. Sie sind doch christlicher Jesuit.«
»Im Kriege ist jede List erlaubt.«
»Jawohl, besonders bei Räubern. Und was wollen Sie nun eigentlich?«
»Die Freiheit der Mistress Allan und ihres Sohnes Fred.«
»Die bleiben gefangen. Wenn Sie nun einmal glauben, die beiden wären gefangen.«
»Sagen Sie mir, wo die beiden sind.«
»Das erfahren Sie nicht.«
»Und zweitens verlange ich die Herausgabe der Deasy Morton, die hier bei Ihnen ist.«
»Dieses Kind wollen Sie auch noch haben?«
»Selbstverständlich. Mistress Allan hat es doch als ihr eigenes adoptiert, und ich bin der gesetzliche Vormund.«
»Ahso, richtig! Ja, da müssen Sie sich des armen Kindes allerdings annehmen. Aber Sie bekommen es nicht! Ich ziehe es vor, ohne weitere Gründe anzugeben, in Ihren Augen und meinetwegen auch in denen der ganzen Welt ein Menschenräuber zu sein und als solcher steckbrieflich verfolgt zu werden. Und damit basta!«
»Prinz, lassen Sie noch mit sich sprechen!«
»Meinetwegen, plaudern wir noch etwas zusammen. Ich habe Zeit genug.«
»Sie sind hier rettungslos verloren! Es sind vierunddreißig Karwanbaschis, Salzschmuggler, Wüstenräuber, von denen Sie eingeschlossen sind. Ich weiß jetzt, wer Sie sind, der Sie von nordamerikanischen Indianern Flammenauge genannt werden, und ich habe auch schon von diesen weißen und roten Cowboys und Jägern gehört, die in Arizona ein Asyl gefunden hatten.
Ja, ich weiß, was diese Ihre Leute zu bedeuten haben.
Ich weiß, dass wir niemals einen Sturm wagen oder uns heranschleichen können.
Ebenso wenig aber können auch Sie sich durchschlagen oder durchschleichen.
Hier in Ägypten gibt es keine finsteren Nächte, immer strahlt vom Himmel volles Sternenlicht.
Und diese Wüstenräuber sind mit englischen Magazinkarabinern bewaffnet, mit denen sie umzugehen wissen, und zusammen haben wir mehr als 3000 Patronen.
Und Sie haben hier doch nicht etwa einen Brunnen entdeckt!
Hier in dieser Gegend gibt es niemals Wasser, oder es ist völlig salzig.
Prinz, nehmen Sie Vernunft an oder Sie sind rettungslos verloren!
Wenn Ihr Proviant und noch vorher Ihr Wasser alle ist, sind Sie in unserer Hand, noch lebendig oder schon tot!
Lebendig entkommt uns hier keiner!
Und geben Sie sich nicht etwa der Hoffnung hin, eine Zollkarawane oder Militärabteilung könnte in der Nähe vorbeiziehen und Sie könnten sich bemerkbar machen.
Dass Ihnen das nicht gelingt, dafür werden wir sorgen, und diese Salzschmuggler verstehen auch, solch eine Karawane, die ihnen nicht passt, anderswohin zu locken, darauf verlassen Sie sich!
Prinz, nehmen Sie Vernunft an!
Sie sind hier rettungslos verloren!
Geben Sie mir nur das Kind, die kleine Deasy. Auf die Mistress Allan und ihren Sohn will ich lieber gleich verzichten.
Aber das hellsehende Kind will ich haben. Liefern Sie es mir freiwillig aus.
Sie können es mir ja dann wieder abzujagen versuchen, was Ihnen gewiss auch Spaß machen wird.«
Das Männlein, wieder sein beliebtes Fingertippen machend, hatte mit einer Überzeugungskraft gesprochen, die einen kolossalen Eindruck machen musste.
Dieser ehemalige Missionar und Jesuitenpater wusste zu sprechen!
Und er hatte zu einem Manne gesprochen, der so etwas zu würdigen verstand.
Eben deshalb hatte jener auch die Zahl seiner Leute nicht übertrieben.
Der Schlusssatz, jener solle ihm dann das Kind doch wieder abjagen, das würde ihm doch sicher Spaß machen, war übrigens sehr gut.
Aber ganz richtig, ganz logisch!
Es sollte alles in größter Gemütlichkeit arrangiert werden. So wie es die alten Ritter hielten. Erst schüttelten sie sich die Hände, dann schlugen sie sich knochentiefe Wunden, dass das Blut spritzte, und dann hinterher zechten sie zusammen.
»Hm, die Sache ließe sich hören!«, schien denn der Prinz auch darauf eingehen zu wollen. »Was geben Sie mir denn aber nun für eine Garantie, dass wir ganz heil und unbelästigt weiter reisen können, wenn ich Ihnen das Kind ausgeliefert habe?«
»Mein Ehrenwort genügt Ihnen nicht?«
»Nee«, war die ganz offene Antwort, »so wenig als wenn Sie noch einmal beim Barte des Propheten oder bei Ihrem eigenen oder bei irgend einem anderen Voll- oder Schnurrbarte schwören, ob er nun existiert oder nicht.«
»Ich gebe Ihnen einige Karwanbaschis als Geisel, den Scheik selbst.«
»Genügt mir ebenfalls nicht. Ich kenne diese Brüder. die weder Weib noch Kind noch Kegel haben, denen es ein Hochgenuss ist, sich selber die Gurgel durchzuschneiden.«
»So bleibe ich selbst bei Ihnen als Bürge, bis Sie wieder in vollständiger Sicherheit sind.«
»Und wo bleibt unterdessen das Kind?«
»Das müssen Sie mir natürlich vorher ausliefern, das lasse ich anderswo hin bringen. Nach einer gewissen Zeit, die noch auszumachen ist, geben Sie mich dann wieder frei. Dann können Sie die Verfolgung ja wieder aufnehmen.«
»Hm, das ließe sich hören!«, brummte der Prinz nochmals. »Wozu wollen Sie das Kind eigentlich haben?«
»Um mit ihm wissenschaftliche Experimente anzustellen. Ich setze doch voraus, dass es die Gabe des Hellsehens noch in demselben Grade besitzt.«
»Und wenn das nicht der Fall wäre?«
»Dann würde ich darauf bestehen, dass Sie mir Mistress Allan und ihren Sohn ausliefern.«
»Deasy ist noch hellsehend, stärker denn zuvor.«
»Sie sprechen doch die Wahrheit?«
»Auf mein Ehrenwort.«
»Das genügt mir. Also ich begnüge mich mit Herausgabe dieses Kindes.«
»Durch das hellsehende Kind wollen Sie dann den Aufenthalt der Mistress Allan und ihres Sohnes auskundschaften und beide durch eigene Kraft befreien?«
»So ist es.«
Hiermit kam der abenteuerliche Charakter dieses ehemaligen Jesuitenpaters ganz zum Vorschein.
Es konnte aber auch noch einen anderen Grund haben, dass er auf seine frühere unerschöpfliche Goldquelle, auf die Mistress Allan verzichten und nur schnellstens dieses Kind besitzen wollte.
Señor Lazare gehörte also jener geheimnisvollen Sekte an, die wir vorläufig Schlüsselbrüder nennen wollen.
Der Prinz hatte selbst gehört, dass jener einmal verbannt gewesen war, doch wahrscheinlich für irgend ein Vergehen, dass er jetzt wieder die Erlaubnis erhalten hatte, das Megalis el Hiemit, das Haus der Weisheit zu besuchen, sich überhaupt innerhalb der Sekte zu betätigen, was doch sicher während der ganzen Verbannungszeit seine leidenschaftliche Sehnsucht gewesen war.
Weiter hatte der Prinz gehört, wie er früher immer dieser Sekte Menschen geliefert hatte, hauptsächlich junge Weiber und Kinder, welche doch sicher die Orgien mit verherrlichen mussten, wahrscheinlich auch den Götzen und dem Teufel geopfert wurden.
Señor Lazare selbst hatte damit geprahlt, er würde bald ein Kind liefern, welches die Gabe des Hellsehens besitze.
Wer wusste denn nun, was er für Vorteile haben würde, wenn er sein Versprechen einlöste, was man ihm selbst da versprochen hatte. Was für einen Rang und was für Schätze er dafür bekommen würde. Da konnte er wahrscheinlich die Milliardärin, die er bisher geschröpft, ganz aufgeben, es kam ihm nur noch auf das hellsehende Kind an.
»Nein.«
»Was nein?«
»Sie bekommen dieses Kind nicht, so wenig wie Mistress Allan und ihren Sohn.«
Die Enttäuschung des Paters musste natürlich groß sein. Der hatte doch schon geglaubt, er wäre mit dem Prinzen bereits vollständig handelseinig geworden.
»Sie haben doch gesagt ...«
»Gar nichts habe ich gesagt! Ich wollte Sie nur ein bisschen aushorchen. Und jetzt fort mit Ihnen, Herr Parlamentär! Ich habe hier eine Uhr, gebe Ihnen genau eine Minute Zeit. Sind Sie in sechzig Sekunden nicht verschwunden, wird meine Büchsenkugel Sie zu finden wissen. Fort!«
»Prinz, nehmen Sie Vernunft an ...«
»Fünf Sekunden sind schon vorüber! Mann, ich spaße nicht, Sie sind ein Kind des Todes!«
Da wandte sich der Beduine und entfernte sich schnellstens. Es hatte im Tone gelegen, was ihn zu solcher Eile antrieb.
»Und das Kind bekomme ich doch, und wir werden uns noch in anderer Weise wieder sprechen, hihihi!«, erklang es kichernd in alter Weise noch einmal aus der Nacht zurück.
Der Prinz verschmähte eine Antwort, kroch rückwärts den Sandwall hinab und richtete sich unten auf. Die Mulde war tief genug, dass auch ein aufrecht stehendes Kamel nur mit dem Kopfe über den natürlichen Wall hervorsah.
In der Mitte der Mulde war ein viereckiges Zelt aufgeschlagen worden. Ringsherum lagen die Kamele und standen die Pferde, dazwischen die roten und weißen Jäger, schlafend oder rauchend, teilnahmslos wie immer, wenn es nicht einmal solch eine Gelegenheit wie heute früh gab.
Der Prinz brauchte nicht zu erzählen, was er mit dem Parlamentär unterhandelt hatte. Wer es nicht selbst gehört hatte, der fragte nicht, obgleich ihnen das Fragen erlaubt gewesen wäre. Wohl war der Prinz der Führer, dem unbedingt zu gehorchen war, aber eine eigentliche militärische Disziplin und Subordination gab es hier nicht, das konnte man von solchen Männern nicht verlangen. Sie wussten, dass sie von Wüstenräubern belagert wurden, sie wussten, dass es die höchste Aufmerksamkeit galt, um sich ihrer zu erwehren, für das Wachegehen oder vielmehr Wacheliegen auf dem Sandwall hatten sie sich selbst untereinander abgeteilt, jeder tat seine Pflicht, und damit genug. Es war ihnen sogar ganz gleichgültig, ob dort draußen zehn oder tausend Wüstenräuber lagen, und hiermit hatten sie eigentlich auch ganz recht. Mehr als seine Pflicht tun und im Falle eines Kampfes alle seine Kraft und Schlauheit anstrengen konnte doch niemand.
Der Prinz schlug die Decke des Eingangs zurück und trat gebückt in das Zelt. Es war solch ein Zelt, wie es heute die Fabriken, welche alles liefern, was Expeditionen brauchen, ob nun für tropische oder arktische Gegenden, in höchster Vollendung herstellen. Bei der Verpackung einen erstaunlich kleinen Raum einnehmend, beim Aufschlagen alles gewährend, was man nur von einem wohnlichen Zelte verlangen kann, undurchlässig gegen den stärksten Regenguss, sogar unverbrennbar.
In der Mitte hing an einem Drahte eine Petroleumlampe. Sie verbreitete intensives Licht, und dennoch war von draußen nicht der geringste Lichtschein zu bemerken gewesen, so vorzüglich schlossen alle die einzelnen Wände ab, und da brauchte nichts nachgestopft zu werden, nur ein schnelles Knüpfen und Knöpfen, und der hermetische Verschluss war hergestellt. Auf dem kleinen Ofen, mit Kohlen, Holz, Spiritus oder Petroleum heizbar, war abgekocht worden, doch das war nun schon vorüber.
In dem Zelte befanden sich nur noch zwei Personen, die kleine Deasy und Leonore Hamfield, die schwarze der beiden Zwillingsschwestern, die mitgegangen waren. Leonore hatte dem Kinde Gesellschaft geleistet, jetzt lagen sie beide schlafend auf Decken, während Clarence draußen mit der Büchse im Anschlag auf dem Walle lag.
Der Prinz setzte sich auf einen Stuhl, den man zusammengeklappt als Spazierstock verwenden konnte, brannte sich eine Pfeife an, rauchte einige Zeit, dann streckte auch er sich auf eine Decke nieder.
Nicht lange, so betrat jener junge Mann das Zelt, der damals von dem Mädchen als Mister Schwarzbach angeredet worden war, die ihn darauf aufmerksam gemacht hatte, dass er doch preußischer Husarenoffizier sei, ob er sich denn da nicht geniere, auf solch einer elenden Mähre zu sitzen.
Jetzt aber trug er nicht mehr ein elegantes Reitkostüm, sondern einen recht abgeschabten Jagdanzug von gelbem Leder, der Oberkörper überhaupt nur von einem Lederhemd bedeckt.
»Schlafen Sie, Prinz?«
Schon wurden die flammenden Augen aufgeschlagen
»Was gibt's, mein lieber Schwarzbach?«
»Charly, der Mestize und Old Padd, die drei haben gewettet, wer einem Wüstenräuber dort draußen zuerst die Ohren abschneidet.«
»Der Teufel soll sie holen!«
Mit dieser unterdrückten Verwünschung schnellte der Prinz empor.
»Sie sind doch nicht schon fort?!«
»Sie bereiten sich erst vor. Old Padd zieht das gelbe Leder von Joseph an, in seinem schwarzen Leder ist es doch zu riskant. Erst wollte er meinen Anzug haben. Der Mestize geht nackt, der ist ja so wie so gelb.«
Schnell wandte sich der Prinz dem Ausgange zu, um diese Wette durch sein Machtwort zu verhindern.
Aber noch ehe er das Zelt verlassen, hatte er schon eingesehen, dass hiergegen gar nichts zu machen war.
Als im Jahre l898 der spanisch-amerikanische Krieg ausbrach, gründete Theodore Roosevelt, damals Unterstaatssekretär der Marine, auf eigene Kosten ein Regiment von Freiwilligen, nur aus Cowboys, Jägern, Hinterwäldlern und ähnlichen Männern der Wildnis bestehend. Roosevelt hat ja selbst viele Jahre lang das ganze Leben im Wilden Westen mitgemacht, ist auch Trapper und Cowboy gewesen. Es war das »Roosevelt Rough Riders Regiment«. Übrigens ein ganz vorzüglicher Trick, so echt amerikanisch, schon allein die Wahl dieses Namens. R.R.R.R. Sie wurden eine Berühmtheit, diese vier R, durch sie ist Roosevelt so populär geworden, dass er sich dann als Kandidat für die Präsidentenwahl aufstellen lassen konnte und auch durchkam, das sagt er selbst.
Die Rauen Reiter wurden nach Kuba geschickt, leisteten im Kundschafterdienst Außerordentliches, in der Hauptschlacht von Las Guasimas führten sie durch eine Attacke die Entscheidung herbei. Manchmal aber, wenn es sich um eine regelrechte Schlacht handelte, versagte dieses Regiment auch gänzlich, aus leicht erklärlichen Gründen.
Roosevelt hat seine Erlebnisse mit diesem seinen Regiment in einem Buche niedergelegt. Es ist wohl auch in deutscher Übersetzung erschienen. Da sind köstliche Geschichtchen zu lesen! Das lässt alles hinter sich, was phantasievolle Jugendschriftsteller jemals erfunden haben. Diese freien Männer der Wildnis als Soldaten, die gehorchen sollten! Diese Originale! Wie der alte Cowboy Trim, ein unverbesserlicher Pferdedieb, der sich aber zu rechtfertigen wusste, ein Engel Gottes war ihm im Traume erschienen und hatte ihm gesagt, dass alle Pferde auf der Erde ihm gehörten, woran er selbst fest glaubte, der den Feldzug nur mitmachte, um überall Pferde zu mausen, auch seinen eigenen Kameraden — oder wie der Gentleman-Trapper, der mitten in der Schlacht plötzlich nicht mehr mitmachte, sich das Gesicht einseifte und das Rasiermesser abzog, weil nun einmal seine Stunde gekommen war, da er sich täglich rasierte.
Roosevelt schildert genau, was er von diesen Burschen alles verlangen konnte und was nicht. Ja, sie leisteten Erstaunliches, anderseits versagten sie vollkommen. Denen war doch nicht etwa was von Disziplin beizubringen. Wenn der Wachtposten nicht wusste, weshalb er da und dort hingestellt worden war, und er dachte, man könne ihn anderswo besser gebrauchen, dann ging er eben auf und davon.
So war es auch hier. Der Prinz hatte diese Leute, unter denen er lange Zeit gelebt, nach Ägypten kommen lassen, um sie als Sicherheitswache und für gewisse Arbeiten zu gebrauchen. mit denen er keinen Araber hätte betrauen dürfen. Ein Ruf von ihm, und sie waren sofort gekommen. Sie hatten geschworen oder die Hand gegeben oder auch nur einfach genickt, nichts zu verraten, und auch schon das Kopfnicken hatte genügt. Sie verehrten diesen Mann wie einen Gott und gingen für ihn durchs Feuer, im buchstäblichen Sinne des Wortes. Aber anderseits war die Macht des Prinzen über sie ganz beschränkt. Sie ließen sich von ihm gebieten, aber nichts verbieten.
Das wusste der Prinz schon, noch ehe er das Zelt verlassen hatte. Dass er die drei, die den Kampf gegen die Wüstenräuber aufnehmen wollten, nicht zurückhalten konnte. Oder er hätte sofort aufbrechen oder irgend einen plausiblen Grund vorbringen müssen, der aber nicht so einfach zu finden war, und vor allen Dingen hätte er das Betreffende dann auch wirklich ausführen müssen.
»Jeder soll einem Wüstenräuber die Ohren abschneiden?«
»Ja. Wer von den drei da am ersten die Siegestrophäe bringt.«
»Um was haben sie denn da gewettet?«
»Der erste ist frei, der hat eben die Ehre; der zweite darf morgen nicht rauchen und kauen; und wer mit seinen Ohren zuletzt kommt, der muss vor öffentlicher Versammlung einen fetten Regenwurm lebendig verschlucken.«
Der Prinz staunte weder noch ekelte er sich, er lachte geräuschlos. Er kannte ja diese Männer. Na ja, um was sollten sie denn auch sonst wetten, Geld spielte bei ihnen keine Rolle, ob sie nun welches hatten oder nicht, ihre Waffen wurden nicht eingesetzt.
So trat der Prinz hinaus.
Old Padd, ein Irländer, übrigens noch gar nicht so alt, was das Vorwort »Old« beim Namen auch gar nicht bezeichnen soll, hatte seine Toilette schon beendet, sein schwarzes Lederkostüm mit dem gelben eines anderen vertauscht, das ihm passte, der Mestize, ein schlanker Bursche, schon nackt bis auf den Gürtel, an dem nur das Jagdmesser und ein Revolver hingen, hatte von Natur eine gelbe Hautfarbe, und der Jagdanzug des jungen Lords Charles Armstrong, des zwanzigjährigen Hünen, war Naturleder, ebenfalls gelb, wie es auch von Fett und Blut starrte.
»Hört, Jungens, das geht aber nicht«, wollte es der Prinz dennoch versuchen.
»Was geht nicht?«, fuhr der junge Lord, bei dem von einer Salonerziehung natürlich keine Rede war, gleich grimmig auf. »Sollen wir etwa hinter den Rothäuten zurückbleiben?«
»,Hinter was für Rothäuten denn?«
»Hinter Halbkopf und dem Bären.«
»Was ist denn mit denen?«
»Die sind schon fort.«
»Was?«, stieß Schwarzbach hervor.
Das hatte er noch gar nicht gewusst, dass diese bereits unterwegs waren, der schwarze Bär, der Sioux-Häuptling, der wie eine alte Großmutter aussah, und Halbkopf, der argentinische Penchuenche, dem so ziemlich die ganze linke Gesichtshälfte abgetrennt worden war, auch der Advokat genannt, weil er wirklich Jurisprudenz studiert und auch schon lange Zeit als Advokat praktiziert hatte, bis er sich eines Besseren besonnen und zum alten Berufe seiner Väter zurückgekehrt war.
»Seit wann sind die schon fort?«
»Ungefähr seit zehn Minuten.«
»Um was haben die gewettet?«
Bei denen ging es nur um die Ehre, Nord- gegen Südamerika.
»Was wollen die für eine Trophäe mitbringen?«
Das wusste man nicht. Oder vielmehr: Man verstand diese Frage des Prinzen gar nicht. Denn was die zurückbringen wollten, das war doch ganz selbstverständlich.
»Nein, Jungens, das geht nicht. Ihr dürft den Arabern nicht die Ohren abschneiden.«
Also die ganze Schleichexpedition zu verbieten, darauf hatte der Prinz von vornherein verzichtet, er hatte etwas ganz Anderes gemeint.
»Weshalb denn nicht?«, fragte der junge Lord zurück.
»Das ist eine Verstümmelung.«
»Das tut aber doch nicht weh.«
»Nicht weh?«
»Die merken doch gar nichts davon.«
»Die merken nichts davon, wenn Ihr ihnen die Ohren abschneidet?«
»Dann sind sie doch schon tot.«
»Ach so! Nein, nicht solch eine Verstümmelung. Es ist nicht nur wegen unserer christlichen Religion, um die Ihr Euch doch den Teufel schert, dass wir diesen Mohammedanern keinen schlechten Begriff von uns beibringen. Nein, nicht verstümmeln! Ihr sollt sie auch nicht töten —«
»Sind es etwa noch nicht unsere Feinde?«, knurrte der junge Lord.
»Ja, die Kriegserklärung ist allerdings schon gegeben —«
»Werden die uns etwa schonen?«
»Nein, das werden sie nicht —«
»Na, sollen wir sie dann etwa beschleichen, sie binden und mit dem Finger unter ihrem Kinn kille kille machen?«
Das war ein Witz gewesen, über den die zuhörenden Cowboys in ein Gelächter ausbrachen.
»Ich will Euch einen anderen Vorschlag machen, Jungens. Ihr sollt sie mir lebendig bringen! Dass Ihr das könnt, weiß ich. Und der erste, der mir einen Gefangenen bringt, bekommt meinen Henrydoppelstutzen.«
Es musste etwas ganz Besonderes sein, was der Prinz da als Prämie versprochen hatte, obgleich es nicht die kurze Doppelbüchse war, die er selbst immer bei sich hatte — wie ein Blitz fuhren die drei auseinander, um von dem Walle aus nach verschiedenen Richtungen ihren Schleichweg anzutreten.
Bemerkenswert aber war, dass sich nicht sofort noch andere meldeten, um sich diese wertvolle Prämie zu verdienen.
Das hatte einen ganz besonderen Grund. Und nicht etwa, dass niemand anders noch gewagt hätte, einen der Wüstenräuber zu beschleichen und als Gefangenen herbeizubringen.
Hierbei zeigte sich vielmehr, dass unter dieser Bande trotz alledem die größte Disziplin herrschte, nur dass sie diese unter sich selbst regelten, ohne erst ihren Führer davon in Kenntnis zu setzen. So wie sie ja auch das Wachegehen unter sich ausgemacht hatten.
Die beiden Indianer waren ohne Weiteres gegangen. Weil sie wussten, dass sie jetzt Zeit hatten, überflüssig waren. Was sie vorhatten, das hatten die anderen durch ihre Unterhaltung gehört.
»Was diese Redmen können, können wir auch!«, hatte es dann bei den anderen geheißen.
»Wie viele können gehen?«, war dann aber auch gleich die Frage gewesen.
Nämlich ohne das Wachegehen und die sonstige Sicherheit zu vernachlässigen.
Auf drei Mann hatten sie sich schnell geeinigt, ohne die Schläfer erst zu wecken. Die zählten eben gar nicht mit. Und dann hatten sie das Los gezogen. Lord Armstrong, der Mestize und Old Padd waren die Begünstigten gewesen.
Also alles war in vollkommener Ordnung vor sich gegangen.
»Halt, halt, halt!«, lachte jetzt der Prinz, als die drei so davongeschossen waren. »Ich komme auch mit, und da müssen wir doch wohl gleichzeitig abrücken, damit niemand im Nachteil oder Vorteil ist.«
»Ihr wollt auch einen Gefangenen herholen?«
»Na, Ihr erlaubt doch wohl, dass ich Chance habe, meinen ausgesetzten Stutzen selber zu gewinnen?«
Ob sie es erlaubten?
Dass der Prinz der Führer war, Kopf und Seele der ganzen Truppe, das hatte hierbei nichts zu sagen, niemand dachte daran, dass er vielleicht mit dem Tode abgehen könne und was dann aus ihnen selbst werden solle, hier im fremden Lande, in Afrika.
Bei diesen Männern hier herrschte noch die Ansicht, die in früheren Zeiten im Kriege gegolten hat, nämlich dass der Führer in der Schlacht vorangehen muss, womöglich den feindlichen Führer zum Zweikampf herausfordert.
Zwar war das hier kein regelrechter Kampf, wobei so etwas unbedingt gefordert wurde, aber wenn er sich an diesem »Späßchen« beteiligen wollte — selbstverständlich, der als Führer brauchte nicht erst das Los zu ziehen, ob er durfte oder nicht.
»Hipp hipp hurra für das Flammenauge!«, erklang es sofort jubelnd im Chore, die Schläfer erwachten, fragten schnell, was denn los sei, jubelten mit und ärgerten sich, dass sie geschlafen hatten, so dass sie nicht mitlosen hatten können. Es war ihre eigene Schuld, warum hatten sie geschlafen.
Schon schnallte der Prinz seinen Gürtel enger, und auch er trug einen gelben Jagdanzug, nur dass dieser aus Lodenstoff oder Khaki und noch neu war, und dabei blickte er zu den funkelnden Sternen empor, und nicht etwa nur, weil man bei solch einer Beschäftigung vielleicht unwillkürlich den Kopf hebt.
»Bis wann muss man zurück sein?«
Jetzt richteten sich aller Blicke nach den Sternen, und es waren dieselben, die über ihrer amerikanischen Heimat erglänzten. Übrigens hätte es auch der ihnen sonst unbekannte südliche Sternhimmel mit dem großen Kreuz sein können, sie hätten sich in die Bewegungen der Sternbilder schnell hineingefunden.
»Bis der Feuerstein zwischen dem Pfeifenkopf und dem Griff des Messers durchgeht.«
Bis der Mars den östlichsten Stern des Herkules und den großen Stern des Drachens passierte. Das geschah in ungefähr anderthalb Stunden.
»Well, dann vorwärts!«
Nach den vier verschiedenen Himmelsrichtungen krochen die vier Männer wie die Schlangen über den Wall und weiter durch den gelben Sand, waren schon nach wenigen Metern auch für das schärfste Auge in der Nacht verschwunden.
Wir lassen sie kriechen und bleiben in der Mulde.
»Jetzt müssen aber die Wetten geändert werden«, hieß es nun.
Denn gewettet war natürlich worden, ohne das geht es unter diesen Leuten nicht ab, und jetzt zwar ging es gegen Geld, denn das hier war ein ganz anderes Wetten, ein passives von Zuschauern.
Gewettet wurde überhaupt bei allem, was nur irgendwie als eine Wette arrangiert werden konnte. Dabei setzten sie ihren Lohn ein oder was sie sonst verdienten. Mancher hatte schon dies alles für viele, viele Jahre hinaus verwettet, als ob er alt wie Methusalem werden würde, und das wurde auch immer ruhig angenommen. Denn der, der am meisten vom Glück begünstigt wurde, der durch sein Wetten schon Reichtümer gewonnen, der hatte ja auch niemals Geld. Und wenn sie einmal etwas bekamen, dann hatten sie eben alle zusammen etwas. Aber die Beträge wurden dabei ruhig immer weiter berechnet, immer in den Schornstein geschrieben.
Mag das zur Charakterisierung genügen, wie es unter solchen Cowboys und Jägern, wenn sie zusammenkommen, in Bezug auf das Wetten zugeht.
Auch auf die beiden Indianer war schon gesetzt worden, wer von ihnen zuerst seine Trophäe brachte, denn die waren schon vorher für sich abgerückt, und an diesen Abschlüssen würde nun nichts mehr geändert.
Sie wurden ziemlich gleich gewertet. Vielleicht, dass die Fähigkeiten des Penchuenchen ein klein wenig höher geschätzt wurden. Der »Advokat« stand sich zu dem Sioux-Häuptling ungefähr wie 10 zu 9.
Bei der zweiten Partie war am höchsten Old Padd eingeschätzt worden, dann Charly, wie der junge Lord Armstrong einfach hieß, am schlechtesten stand der Mestize.
Nun aber hatte sich noch der Häuptling eingeschoben, Flammenauge, nun musste alles von Neuem arrangiert werden.
Er wurde nicht gerade sehr hoch taxiert. Als alles abgeschlossen war, zeigte es sich, dass der Prinz nur vor dem Mestizen rangierte.
»,Ja, wenn es sich um Schießen handelte, oder um das Verfolgen einer Spur, oder um das Bändigen eines Pferdes — aber so sich anschleichen — ich traue ihm nicht — ich halte nach wie vor mit zehn Dollar auf den Mestizen.«
So sprach Lord Palmer Armstrong, ein grauhaariger, ganz ausgetrockneter Sünder.
Das Vermögen an Geld und Gütern und Grundstücken, die in England einstweilen von der Regierung verwaltet wurden, bis er seine fünf Jahre Zuchthaus angetreten und abgesessen hatte, wurden auf rund zwei Millionen Pfund Sterling geschätzt, 40 Millionen Mark.
Aber, wenn es rechtlich zuging, gehörten die gar nicht mehr ihm. Die hatte er erst gestern an Don Juan den Stierkämpfer im Würfelspiel mit Knochen verknobelt.
Und das war nicht etwa das erste Mal! Es gab wenige unter der Bande, die nicht schon einmal vierzigfache Millionäre gewesen wären. Lord Armstrong hatte sein konfisziertes Vermögen schon zahllose Male verspielt und verwettet. Er hatte aber Glück, hatte die vierzig Millionen immer wieder zurückgewonnen.
Jetzt aber konnte der alte Mann nur zehn Dollars dransetzen, und die hatte er natürlich auch nicht, er hatte bereits seine sonstigen Verdienste auf 75 Jahre hinaus verpfändet, hätte also eigentlich 126 Jahre alt werden müssen, um die bezahlen zu können.
Jetzt also hatte er auf den Mestizen gewettet. Nicht einmal auf seinen Sohn. Der alte Lord wollte sich eben durchaus ruinieren.
So verging die Zeit, während die sechs Männer dort draußen auf Leben und Tod im Sande herumkrochen.
Was hätte in einer anderen Gesellschaft wohl für eine angstvolle Spannung geherrscht! Hier wurde vergnüglich gewettet, und als diese Sache ganz und gar arrangiert war, wurde, weil man nun einmal hineingekommen, geknobelt, gewürfelt, aber nicht mit eigentlichen Würfeln, sondern mit kleinen Knöchelchen, ein unter allen Indianern Nordamerikas sehr beliebtes Spiel, wobei es darauf ankommt, wie die Knöchelchen gegeneinander liegen.
Besonders der alte Lord wurde wieder einmal vom Glück verfolgt, der Stierkämpfer vom Pech. Nach ungefähr einer halben Stunde setzte Don Juan alles gegen den Lord ein, was er im Buche oder vielmehr im Schornstein stehen hatte, und gleich darauf war Lord Armstrong wieder Besitzer von seinen 40 Millionen.
»Revanche.«
»Nee, Kinder, ich bin Familienvater, ich muss für meinen Sohn sorgen«, sagte aber der alte Sünder in diesem Jahre wenigstens zum hundertsten Male, um morgen wieder sein konfisziertes Vermögen zu verspielen »Aber etwas anderes will ich Euch sagen. Es ist ganz unrecht, dass wir hier sitzen und knobeln. Wir sind hierher gekommen, um im Sande zu paddeln [3]. Heute Abend hatten wir keine Lust mehr, erst noch anzufangen, wir wollten schlafen, und Flammenauge gab gleich nach. Aber wir schlafen doch nicht. Wir sitzen hier und knobeln. Ans Schlafen ist nun doch nicht mehr zu denken. Also paddeln wir. Wer macht mit?«
[3] Gemeint ist »buddeln«, also graben.
Und der fünfzigjährige, greisenhaft aussehende Mann sprang wie ein Jüngling auf, ging hin, wo gleich neben dem Zelte die Schaufeln und Hacken lagen, wo auch schon eine Vertiefung im Sande ausgeworfen war, spuckte kräftig in die ebenso schmutzigen wie schwieligen Hände, ergriff eine Schaufel und begann aus Leibeskräften zu paddeln.
Und sie machten alle mit. Soweit sie nicht auf Wache standen oder vielmehr lagen. Der Sand wurde in Bastkörbe geschaufelt und oben auf dem Walle angeschüttet, so dass er sich immer mehr erhöhte.
Aber nicht lange sollte diese Arbeit währen.
»Da kommt was gekrochen!«
Aller Augen, soweit sie nicht zur Sicherheit nach einer anderen Richtung blicken mussten, wandten sich jener zu, die von einer Wache mit ausgestreckter Hand bezeichnet wurde.
Bald sahen sie alle den Schatten, der sich dort über den Sand hinschob, gelb auf gelb, wenn man das überhaupt noch einen Schatten nennen konnte.
»Flammenauge!«, hieß es dann, und es wurde bestätigt, noch ehe man erkennen konnte, dass er noch einen anderen Körper hinter sich her zog.
Es war der Prinz, der als erster zurückkehrte, bis zuletzt sich wie eine Schlange über den Wall windend, und hinter sich her schleifte er einen Araber, ihn einfach bei einem Fuße gepackt haltend, die Hände auf dem Rücken gefesselt, im Munde einen tüchtigen Knebel, ein zusammengeballtes Tuch.
Er war der erste, der die Aufgabe gelöst hatte, noch vor den beiden Indianern.

Er gab eine Erklärung, warum er so schnell zurück sein konnte.
»Ich habe einfach Glück gehabt. Der Kerl hier war gerade unterwegs, wollte sich ebenfalls anschleichen, nur in entgegengesetzter Richtung, wir wären beinahe mit den Köpfen zusammengerannt, und dann war meine Hand schneller als die seine —«
»Aber die Wette gilt!«, riefen die nicht allzu vielen, die auf Flammenauge gesetzt hatten.
Natürlich galt alles. Er war zuerst zurückgekommen und brachte einen Gefangenen lebendig mit.
Von einer Freude der Gewinner merkte man freilich nichts. Das wäre nicht gentlemanlike gewesen. Abgesehen davon, dass sie den Gewinn als Guthaben doch nur in den Schornstein schreiben konnten.
»Der ist ja gar nicht lebendig!«, erklang es da.
Der Prinz drehte sich um, beugte sich über den noch jungen Araber, nackt bis auf den Gürtel, so weit man das in dem schwachen Sternenlicht unterscheiden konnte, legte ihm die Hand aufs Herz.
»Weiß Gott, der Kerl ist tot! Und ich habe ihn doch nur ganz sanft gegen die Schläfe geklopft, nicht mehr, als unbedingt notwendig war, und ich habe da ein feines Gefühl. Er lebte überhaupt noch. Oder — sollte sich der Kerl vielleicht nur tot stellen?«
»Höh, höööh, Flammenauge!«, wurde gelacht. »Bindet uns mal nicht auf, dass sich jemand tot stellen kann! Das heißt für unsereinen.«
»Na, Kinder — wir sind im Orient — da passiert manches, wovon man in Amerika nur träumt — da gibt's Kerle, die sich einige Wochen begraben lassen, oben drauf wächst einstweilen Gras.«
Der Prinz hatte unterdessen seine Taschenlampe hervorgezogen und leuchtete dem Araber ins Gesicht.
»Der sieht gerade aus wie ein Stück Speck, der vor Altersschwäche blau angelaufen ist«, hieß es von anderer Seite. Ja, das Gesicht war ganz aufgedunsen und blau.
»Der ist doch erstickt! Und ich habe ihn doch fürsorglich auf dem Rücken — aha, ich ahne etwas.«
Und der Prinz zog sein langes Messer aus der Scheide, schob die Klinge zwischen die fest zusammengepressten Zähne, so öffnete er den Mund, ließ den Blendstrahl der Lampe hineinfallen, griff mit dem Finger tief hinein, beugte sich, um noch einmal ganz eingehend in den Hals zu blicken.
»Passt auf, Flammenauge, dass der Tote Euch nicht die Nase abbeißt«, musste dabei unvermeidlich gewitzelt werden.
Der Prinz zog seine Nase zurück.
»Dacht ich's mir doch! Er hat seine Zunge verschluckt.«
»Weshalb denn?«
»Um zu ersticken.«
»Kann man denn seine Zunge verschlucken, ohne sie erst abzuschneiden?«
»Ja, das kann man. Aber Du kannst es ruhig probieren, Du bringst es nicht fertig. Da muss man solch einen Derwisch oder Fakir als Lehrmeister haben, besonders auch deshalb, dass der einem die verschluckte Zunge immer wieder hervorholt.«
»Wünsche gesegneten Appetit — feines Frühstück und billig dazu.«
»Hört, Jungens, mir ist aber unterwegs etwas eingefallen, wir müssen vorsichtig —«
Ein peitschenähnlicher Knall unterbrach ihn.
Clarence hatte geschossen.
»Da kam was angekrochen«, erklärte sie kaltblütig, die Patrone im Magazin wieder ersetzend, »und ich will Zeit meines Lebens verkehrt im Sattel sitzen, wenn ich das Ding nicht zwischen die leuchtenden Augen getroffen habe.«
Erschrocken war der Prinz hingeeilt.
»Herr Gott, da ist es schon! Mädel, wenn Du einen von den Unsrigen erschossen hast, wir hatten kein Zeichen verabredet —«
»Ach, Unsinn«, wurde er unterbrochen, »ich werde doch nicht auf einen von uns schießen. So weit habe ich den Wurm schon heraufkommen lassen, bis ich seine Fratze[3] erkennen konnte.«
[3] Im Original steht hier »Judenfratze«. Als Herausgeber habe ich mir erlaubt, diesen diskriminierenden Begriff wie geschehen zu verkürzen; DvR.
»Na, dann ist's gut!«
Der Prinz tauchte noch einmal hinab, brachte einen toten Araber angeschleift, ebenfalls nackt bis auf den Gürtel, an dem nur der Dolch hing, zwischen den Augen die Kugel des Cowgirls.
Die Warnung war gegeben. Auch die Wüstenräuber versuchten sich anzuschleichen, das hier war also schon der zweite. Wenn nicht als Mörder, so doch als Spione.
Umso vorsichtiger aber musste man sein, dass man nicht auf seine eigenen Kameraden schoss, die noch draußen waren. Wer von den jetzigen Wachen sich nicht ganz sicher fühlte, dass er sich auf seine Augen verlassen konnte, trat freiwillig zurück, machte einem anderen Platz. Auch befahl der Prinz, ihn bei jeder einzelnen Entscheidung zu rufen, und das konnte er befehlen, der Mann, der hier den Namen Flammenauge führte.
»Da kommt wieder einer! Araber? Nein. das ist der schwarze Bär. Ich sehe schon seine Skalplocke nicken.«
Er kam, der finstere, rote Krieger, jetzt ganz und gar nicht einer alten Großmutter gleichend, zumal er jetzt ein enganliegendes Lederkostüm trug, sich nicht wie gewöhnlich in eine bunte Bettdecke gewickelt hatte.
Wie eine Schlange wand er sich über den Sandwall, ging sofort dorthin, wo seine Waffen und Habseligkeiten lagen, nahm seine Pfeife, stopfte sie, schlug Feuer, kauerte sich nieder und begann gleichmütig zu rauchen.
Er brachte keinen Araber mit, weder tot noch lebendig.
Davon hatten die beiden Indianer ja auch gar nichts ausgemacht.
Aber an dem Gürtel des Sioux-Häuptlings hing ein ganz frischer, noch blutiger Skalp mit schwarzen Haaren.
Man kannte den Sioux-Häuptling, er gehörte mit zu der Bande, war ein vollständiger Kamerad, seine apathische Gleichmütigkeit hielt niemanden ab, ihn anzusprechen und wohl auch einen Scherz mit ihm zu machen. Das hatte er sogar gern, man wusste es, wenn er auch nichts von sich geben konnte.
»He, schwarzer Bär«, fing da einer der Cowboys an, »Du hast den Kerl, dem Du den Skalp abgezogen hast, doch nicht etwa verstümmelt?«
Das war so ein echter, blutiger Witz aus Amerika gewesen, und nun ging es auch gleich weiter.
»I wo, so was tut doch unser schwarzer Bär nicht, der hat dem Arabman nur ein paar Locken abgeschnitten. und da ist ein bisschen Haut dran kleben geblieben.«
Weiter wollen wir diese blutigen Witze, die jetzt noch gerissen wurden, nicht wiedergeben.
Es sollte noch ein anderer kommen, den der edle Sioux-Häuptling selbst ganz unbewusst machte.
»Du hast den Mann doch vorher getötet?«, fragte der Prinz.
»Hau.«
Es wird immer »Howgh« geschrieben, weil es Engländer gewesen sind, die diese indianische Bejahung oder auch einen Laut der Überraschung in die Literatur eingeführt haben. Aber es wird wie ein ganz richtiges »Hau« gebellt, nur weit hinten in der Kehle.
»Wie war's?«
Der Prinz konnte darauf gefasst sein, lange warten zu müssen, ehe er von dieser Rothaut eine genügende Erklärung über ihre nächtliche Abenteuerfahrt bekam, der rauchte dazwischen ein Dutzend Pfeifen.
Aber diesmal sollte sich die Sache doch etwas kürzer abwickeln.
Zuerst freilich nahm der schwarze Bär ein neben sich liegendes Tuch, recht schön rot und weiß gemustert, bedeckte damit seine ölgetränkte Skalplocke und wickelte weiter den ganzen Kopf ein, bis wieder die alte Großmutter fertig war, und nachdem er dies mit möglichster Bedachtsamkeit ausgeführt hatte, erklang es in klagendem, fast weinerlichem Tone:
»Eine Seele irrt umher und singt ein Spottlied auf den schwarzen Bären: huuuiiihhh hau hau hau — der große Häuptling der Dakotas hat einen Feind erschlagen und hat ihm den Skalp nicht genommen — huuuiiihhh hau hau hau!«
Nun sollte man aus dieser Singerei und Bellerei etwas entnehmen, was der eigentlich meinte!
»Du hast ihm den Skalp nicht genommen?«
Mit unsäglicher Traurigkeit schüttelte die alte Großmutter den Kopf.
»Aber Du hast doch da einen ganz frischen Skalp am Gürtel hängen.«
»Hau.«
»Und Du sagst, Du hättest ihm den Skalp nicht genommen?«
»Hau.«
»Der Araber hat ganz einfach zwei Köpfe gehabt«, musste ein Cowboy seinem Witze Luft machen, »das hat der Bär zu spät bemerkt, er hat nur den einen abgehäutet.«
»Ruhig! Du hast zwei Araber getötet?«
»Hau.«
»Hattest aber keine Gelegenheit, ihn zu skalpieren?«
»Hau.«
»Ja, konntest Du ihn eigentlich skalpieren?«
»Hau!«, wurde noch einmal energisch als Bejahung gebellt.
»Du wurdest dabei gestört, musstest Dich zurückziehen?«
»No.«
»Ja, warum hast Du den Mann da nicht skalpiert?«
»Nicht möglich.«
Und die Rechte des Häuptlings griff in den feinen Sand und ließ ihn durch die Finger laufen.
Auf diese Weise kam es schließlich heraus, wozu freilich gehörte, dass solche Männer um ihn waren, die ihn zur Genüge kannten. Sonst hätte sich der Sioux wohl Zeit seines Lebens in tiefsinnigen Rätseln bewegt.
Der arabische Wüstenräuber, über den der rote Sohn des großen Geistes wie ein Todesengel der Nacht gekommen war, ihm das Messer ins Herz stoßend, hatte kein einziges Härchen auf dem Kopfe gehabt. Hatte die Haare nicht aus Altersschwäche verloren, nicht durch vieles Denken, hatte sie sich auch nicht wegamüsiert, sondern er hatte, wie bei den Arabern sehr beliebt, sich den Schädel rasiert. Es war gewissermaßen, euphemistisch ausgedrückt, seine von ihm bevorzugte Haartracht gewesen.
Und da hatte der edle Häuptling, nachdem er mit dem Messer schon den vorschriftsmäßigen runden Schnitt gezogen, vergebens an dem nackten Schädel herumgezupft, hatte die Kopfhaut nicht ablösen können.
Denn das ist gar nicht so einfach, das Skalpieren, das Abziehen der Kopfhaut. Es muss entweder eine kolossale Übung dazu gehören oder ein gewissenhafter Lehrmeister, der einem den richtigen Kniff beibringt, um die Kopfhaut ablösen zu können, oder nun gar mit einem einzigen Ruck abzureißen, wie es bei den nordamerikanischen Indianern der gute Ton erfordert. Das ist in unsern anatomischen Seziersälen oft genug probiert worden, von Studenten und Professoren, und beschämt mussten die Herren ihre Versuche aufgeben, wie sie auch rissen und rupften. Diese Sache ist auch noch weiter verfolgt worden, einige Forscher haben der Skalpiererei ihr ganzes Leben gewidmet. Im Englischen gibt es eine ganze Masse dicker Bücher, die nur Skalpe und die Skalpiererei behandeln. Und warum denn nicht? Der eine schreibt über Bazillen und wie man sie züchtet, der andere über Briefmarken und wie man sie einklebt, der dritte über Skalpe und wie man sie abzieht. Der große Verlag Johnston in New York gibt nur Werke heraus, welche die Tätowierungen der Indianer behandeln, Prachtwerke, die meist auf Kosten der Regierung hergestellt werden.
Ja, da allerdings würde der edle Sioux-Häuptling hier in Ägypten schlechte Geschäfte machen, da würde er wenig Trophäen mit nach Hause bringen, da würde er noch manchmal mit weinerlicher Stimme klagend von Seelen erzählen, die ihn verspotteten, weil er dem Feind die Kopfhaut nicht genommen hatte. Denn diese »Haartracht«, sich den Schädel vollständig nackt zu rasieren, alle paar Tage oder auch täglich, ist bei den Mohammedanern gar zu beliebt. Die nordamerikanischen Indianer lieben die Haare zwar ebenfalls nicht, die Barthaare rupfen sie sich gleich ganz heraus, auch sie rasieren ihre Schädel, lassen aber doch anstandshalber wenigstens noch eine Locke in der Mitte stehen, damit der Feind eine Handhabe hat, um die Haut abreißen zu können. Solch ein feines Taktgefühl besitzen die Orientalen nicht. Nebenbei bemerkt, und zwar ganz sachlich gesprochen, der Wissenschaft halber: Wenn nicht auf dem Kopfe, so rasieren sich die Mohammedaner doch sonst alle Haare vom Körper weg. Es ist Vorschrift des Korans. Auch die verheiratetem Frauen müssen es tun. Dass aber deshalb niemand nach dem Orient geht, um Damenbarbier zu werden! Das Messer ist dabei überhaupt nicht erlaubt, es geschieht mit Rhusma, einem parfümierten Kalkwasser, gelöster Ätzkalk, der die Haare in eine Gallerte verwandelt, die dann mit einem Holzmesser abgeschabt wird. Weil nun von dieser ewigen Schmiererei auch die Fingernägel angegriffen werden, wenigstens bei den Frauen, die dies selbst tun müssen, reiben sie sich die Fingernägel mit einem Gegenmittel ein, welches die Wirkung des Ätzkalkes aufhebt — Hennah heißt das Zeug, jedenfalls eine schwache Säure, welche die Fingernägel rot färbt. Das ist der Grund, weshalb alle mohammedanischen Frauen rote Fingernägel haben, und nicht, wie es sonst immer heißt, dass sie dies aus Schönheitssinn tun. — —
Eine dritte oder eigentlich schon vierte Gestalt kam herangekrochen, die noch etwas Großes über den Sand nach sich schleifte, woraus man schon wusste, dass es ein Kamerad war, der siegreich zurückkehrte.
Außerdem gebrauchte der neue Ankömmling die Vorsicht, schon in einiger Entfernung ein Erkennungszeichen zu geben.
Er brüllte wie ein Ochse — wie ein kleiner Ochse, aber nicht wie ein Kalb — gab recht eigentümliche Töne von sich.
»Das ist der Mestize!«
»Ist denn der verrückt?«, wurde von einigen Seiten gelacht. »Brüllt der Kerl hier in der ägyptischen Wüste wie ein Ochsenfrosch im amerikanischen Sumpfe!«
Nun, er war es, es war sein Ruf, der eines verliebten Ochsenfrosches, und er bracht einen Gefangenen mit.
Es war eben wieder einmal so gekommen, wie es so häufig beim Massenwetten geht. Schon der Sioux-Häuptling hatte weniger Chancen gehabt als der Penchuenche und war doch zuerst zurückgekehrt, und nun kam gar hier der Mestize als erster von jenen ursprünglichen dreien.
»Seht, Flammenauge«, schmollte der alte Lord, »wenn Ihr Euch nicht noch dazwischen gesteckt hättet, dann hätte ich jetzt zehn Dollars gewonnen.«
»Wenn er den Gefangenen nur auch lebendig bringt«, meinte der Prinz.
»Der Mestize nicht? Wetten! Ich setze mein ganzes Vermögen ein, dass der Mestize seinen Gefangenen lebendig bringt!«
Da hatte der alte Lord wieder einmal seine 40 Millionen verspielt, sie gehörten dem Prinzen! Er musste nur sehen, wie er sie bekam.
Denn es war kein Lebender, den der Mestize angeschleppt brachte.
Der hier hatte sich zur Abwechslung an beiden Handgelenken, die ihm vorn gebunden worden waren, die Pulsadern aufgebissen. Musste sich schon längst verblutet haben, er war schon ganz blutleer.
Der Mestize selbst hatte hiervon unterwegs gar nichts gemerkt, jetzt machte er ein ganz verdutztes Gesicht und kratzte sich in den langen, straffen Haaren.
»Hätte ich das gewusst, dann hätte ich ihm die Hände auf den Rücken gebunden«, meinte er.
»Und nicht zu vergessen, die Zunge über der Nase fest«, setzte ein Cowboy hinzu.
»Was sind das nur für schreckliche Menschen«, wandte sich Schwarzbach an den Prinzen, »die ihr Leben so gar nichts schätzen und auf jede Weise einen Selbstmord zu begehen wissen?«
»Sie fragen noch? Das habe ich Ihnen doch schon ganz ausführlich erklärt. Das sind Assassinen, die sich, seitdem sie den Mohammedanismus aufgegeben und sich dem altphönizischen Götzendienst, dem einst auch die Araber huldigten, wieder zugewendet haben, jetzt Schlüsselbrüder nennen. Diese Wüstenräuber hier sind freilich noch keine Eingeweihten, noch nicht einmal Fedawihs, sich Aufopfernde, es sind erst Basiks, Anwärter, die noch nicht einmal wissen, dass sie dereinst den Propheten Mohammed verhöhnen müssen — aber den unbedingten Gehorsam hat man ihnen schon beigebracht, und dazu gehört auch, dass sie sofort Selbstmord begehen müssen, wenn sie gefangen werden und in die Verlegenheit kommen, etwas von ihren Geheimnissen verraten zu können. Alle diese Karwanbaschis gehören als Basiks dem Megalis el Hiemit, dem Hause der Weisheit an, wenn darin auch keine Weisheit mehr gepflegt wird. Und ehe nur jemand Anwärter werden kann, muss er die Beweise erbringen. dass er eines Selbstmordes fähig ist.«
»Wie ist denn solch ein Beweis zu erbringen? Wie kann man jemanden daraufhin prüfen, ob er eines Selbstmordes fähig ist oder nicht?«
»Sie sollen später selbst Gelegenheit haben, diesen schauderhaften Prüfungen beizuwohnen.«
Jetzt kam auch Lord Charly angekrochen, siegreich seine Trophäe hinter sich her schleifend. Aber der Gefangene, dem die Hände längs des Leibes angeschnürt waren, hatte auch schon den Erstickungstod durch Verschlucken seiner Zunge gefunden.
»Na, das Geschäft geht ja gut«, meinte der Prinz trocken. »Eins, zwei, drei — auf den schwarzen Bären kommen zwei — einen hat Clarence erschossen — macht zusammen sechs. 34 Wüstenräuber sollen es sein, und dass Señor Lazare in seiner Bescheidenheit zu wenig genannt hat, glaube ich auf keinen Fall. Also sind es bereits nur noch 28 Stück. Und die Nacht ist noch lang und wenn wir so weiter tätig sind, werden morgen früh von den 34 Wüstenräubern nicht mehr viele übrig sein. Außerdem stehen ja auch noch der Advokat und Old Padd aus, und letzterer gilt ja als Favorit, wenn der aber so lange ausbleibt, dann wird er wohl gleich ein halbes Dutzend Arabi abfertigen. Diese Gelegenheit lässt er sich eben nicht entgehen.«
So sagte sich der Prinz, so sprachen auch die anderen zusammen.
Nun sollte es aber gerade ganz, ganz anders kommen. So wie es auch schon mit den Schätzungen der Werte gewesen war, wonach sich die Wetten arrangiert hatten. Es ist eben immer die alte Geschichte vom Menschen, der denkt, und einem anderen, der lenkt.
Vorläufig begab sich keiner weiter hinaus, um seine Kunst, seine Überlegenheit über die afrikanischen Ritter der Wüste zu beweisen. Obgleich jeder Einzelne darauf brannte, und auch die beiden Schwestern würden ihren Schleichweg antreten, das war ganz sicher, wenn sie es auch nicht für nötig fanden, ein Wort davon zu sagen. Diese beiden Cowgirls wollten doch nicht hinter den Cowboys zurückbleiben.
Erst aber wollte man noch warten, bis die beiden anderen zurück waren.
Da aber musste man noch lange warten.
Der Mars stand ganz dicht an der zwischen den beiden Fixsternen gezogenen Linie, und die beiden waren noch nicht zurück, Old Padd und der Penchuenche.
Und wenn der Planet diese Linie passierte, was in fünf Minuten geschah, mussten die beiden hier sein, oder — sie hatten eben den Rückweg nicht rechtzeitig antreten können, waren entweder tot oder gefangen.
Denn das war die Zeit, wo die beiden ihre Wache auf dem Walle anzutreten hatten.
Und wenn auch hier zwischen dieser Bande sonst gar keine Disziplin herrschte, das war eine Sache, wo das Pflichtbewusstsein eines jeden Einzelnen keine Beschränkung kannte.
Kamen die beiden nicht innerhalb von fünf Minuten, dann hatten sie eben keine Möglichkeit mehr zur Rückkehr.
Da aber tauchte schon wieder eine Gestalt auf, kroch wie eine Schlange über den Wall.
Es war das schrecklich entstellte Gesicht des Penchuenchen, das man im schwachen Sternenscheine erblickte. Entsetzlich, wie den ein Messer zugerichtet hatte!
Einen Gefangenen brachte der nicht mit. Das hatten die beiden Indianer ja nicht verabredet.
Aber einen Skalp brachte er mit.
Obgleich der betreffende Araber ebenso einen glatt rasierten Schädel gehabt hatte.
Dieser Penchuenche hatte es dennoch fertig gebracht, ihm den Skalp abzunehmen.
Auf welche Weise?
Nun, indem er einfach gleich den ganzen Schädel drangelassen hatte.
Er hatte einfach gleich den ganzen Kopf abgeschnitten.
Was er aber sowieso getan hätte.
Die Penchuenchen sind, wie die meisten südamerikanischen Pampasindianer, Kopfjäger wie die Dajaks von Borneo, nur dass sie keine Religion daraus machen, sie schneiden dem erlegten Feinde nur zur Trophäe den Kopf ab.
»He, Advokat, Du hast aber den Kerl doch hoffentlich tot gemacht, nachdem Du ihm den Kopf abgeschnitten hast«, witzelte ein Cowboy.
»Off! Old Padd kommt nicht mehr.« — »Was?«
»Gefangen, gemartert, tot.«
Todesschweigen. Solch einer Erstarrung im furchtbaren Schreck waren auch diese rauen, rohen Männer fähig. Denn es waren Menschen.
»Gemartert!«, erklang es dann flüsternd.
Ein Glück, dass dieser Penchuenche sich erinnerte, wie er früher einmal ein redegewandter Advokat gewesen war und sich dieser seiner Gabe jetzt auch bediente. Denn sonst kann solch ein Penchuenche noch wortkarger sein als der teilnahmsloseste Sioux.
Er berichtete.
Wie er, nachdem er sich schon einen Kopf angeeignet, noch einen einzelnen Mann hatte sitzen sehen, von dem er gleichfalls noch oben das Denkinstrument als Andenken hatte mitnehmen wollen.
Da bemerkte er, dass der Mann doch nicht allein war, er hatte noch einen anderen vor sich im Sande liegen.
»Wo geht Ihr hin? Was ist Euer Ziel? Was wollt Ihr hier in der Wüste? Willst Du mir nun antworten?«
So hatte der Kauernde gefragt, auf Englisch, und es war der kleine Beduine gewesen, der Parlamentär, das hatte Halbkopf sofort herausgehört, wenn er auch nur ein Ohr besaß.
»Geh und häng Dich!«, hatte der am Boden Liegende geantwortet, und es war die Stimme Old Padds gewesen.
»Ich schneide Dir ein Ohr ab, wenn Du es mir nicht sagst.«
»Immer schneide — Hund verdammter!«
»Willst Du es mir nun sagen? Ich schneide Dir auch noch das andere Ohr ab.«
»Martere mich, wie Du willst, von mir erfährt Du nichts.«
»So, nun kommt die Nase dran.«
»Wehe Dir, meine Kameraden werden mein Schicksal erfahren, wehe Dir!«
»Siehst Du hier die Nadel? Ich steche sie Dir in das linke Auge —«
Genug! Wir wollen es nicht weiter beschreiben, wie es dieser Penchuenche ganz ausführlich tat.
»Es sind ihm beide Augen ausgestochen worden.
Gestanden hat Old Padd natürlich nichts.
Ich konnte ihm nicht helfen.
Die beiden waren nicht lange allein, es kamen noch einige andere Beduinen, die sich im Kreise herumkauerten und zusahen, wie der Señor Lazare, wie der Kerl ja heißen soll, Old Padd marterte.
Wenn ich gekonnt hätte, wenn es irgendwie möglich gewesen wäre, wäre ich doch unserem Old Padd beigesprungen, das wisst Ihr doch, da kennt Ihr mich doch, Kameraden.
Es war ganz ausgeschlossen. Ich selbst wäre ein Kind des Todes gewesen.
Übrigens sahen die anderen Beduinen nicht still und teilnahmslos zu. Was sie sprachen, verstand ich ja nicht, aber das war mir ganz klar, dass sie mit dieser Tortur nicht einverstanden waren.
Der Señor Lazare kümmerte sich nicht um ihre heftigen Einwände, fuhr fort, dem Padd die Augen auszustechen, und ihn daran zu hindern, das wagte man wohl nicht.
Da aber sprang einer der Beduinen plötzlich auf und stieß dem Gefangenen den Dolch ins Herz.
Alle war's.
Wie der Señor Lazare diese Einmischung auffasste, weiß ich nicht.
Ich hatte genug gesehen, zog mich zurück.«
Der Penchuenche hatte seine Erzählung beendet.
Das Schweigen des finsteren Todes herrschte in dem Kreise der Cowboys.
Da plötzlich sprang einer von ihnen, der seiner Wut irgendwie Luft machen musste, auf den Wall hinauf, schüttelte die Faust nach jener Richtung, von welcher der Penchuenche gekommen war.
»Kanaillen, Ihr blutigen —«
Weiter kam er nicht. — Puff! Puff!
Es waren aber mehrere Schüsse gewesen, die sich zu einem kurzen Doppelknall vereinigt hatten.
Dort in der finsteren Nacht hatte es wenigstens vier- oder fünfmal aufgeblitzt.
Und der unvorsichtige Cowboy, der sich nicht hatte bezähmen können, war rückwärts von dem Walle herabgestürzt.
Eine Kugel mitten in der Brust, eine im Unterleib, und eine dritte war ihm in den Mund gedrungen und hatte hinten im Nacken die Wirbelsäule, den Halswirbel zerschmettert.
Die anderen waren gewarnt, falls sie auch noch solche Gelüste hatten, sich oben auf dem Walle zu zeigen. Die Wüstenräuber lagen auf der Lauer und passten gut auf, und das Sternenlicht genügte ihnen.
Ein einziger Wut- und Racheschrei antwortete in der Sandmulde diesem vorzüglichen Resultat.
Es hatte keinen Zweck, diese Schreierei, aber es war nun einmal menschlich, und es war auch noch die Nachwirkung dessen, was der Penchuenche soeben über das Schicksal des Old Padd berichtet hatte.
Es waren nicht nur wieder sechs Mann, die sich auf den Schleichweg machten, sondern vierzehn, mehr als die Hälfte der ganzen Truppe, um den Tod der beiden Kameraden zu rächen, und der Prinz hätte sie nicht zurückhalten können. Er selbst beteiligte sich an dem Rachezug.
»Sollen wir immer noch nur lebende Gefangene bringen, die sich selber die Pulsadern aufbeißen oder die Zunge verschlucken?«, wurde er höhnisch gefragt.
»Nein, keine Schonung mehr!«, lautete seine Antwort, und auch er verschwand in der Nacht.
Seine Nachbarn waren die beiden Schwestern, von denen die eine jetzt von ihrer Wache abgelöst worden war, die andere die ihre noch nicht anzutreten brauchte.
Auf das Ablösen der Wache kam es jetzt überhaupt nicht mehr so genau an, wenn die Sicherheit des Lagers auch nicht etwa vernachlässigt wurde. Es gab jetzt eben keine Schläfer mehr, von Spielern gar nicht zu reden.
Die Zeit verging.
Einer nach dem anderen kehrte zurück, ohne Siegestrophäe, ohne von einer Siegestat berichten zu können.
Nichts anderes meldete er, als dass er auf keinen Feind gestoßen sei, wie weit er auch herumgekrochen war.
Die Wüstenräuber waren plötzlich abgezogen, es konnte nicht anders sein.
Die Schüsse auf den Cowboy mussten das letzte gewesen sein, dann hatten sie den Rückzug angetreten.
Und weshalb sie das getan hatten, weshalb Señor Lazare hierzu den Befehl gegeben, die Belagerung plötzlich aufzugeben, das werden wir später erfahren.
Über den östlichen Horizont erhob sich die Sonne des jungen Tages mit gewöhnlicher Pracht. Sie beleuchtete die Männer, welche in der Sandmulde eifrigst schaufelten, und nach der beträchtlichen Vertiefung, die sie schon ausgeworfen hatten, den Sand immer in Körben herausbefördernd, konnten sie auch in dem Reste der Nacht nicht viel geschlafen haben.
Auf dem mehr als zwei Meter hohen Walle, der sich durch das Aufschütten an einigen Stellen auch noch immer mehr erhöhte, stand der Prinz.
Von den Wüstenräubern war nichts mehr zu sehen, und da gab es auch kein Versteck, denn, wie schon einmal erwähnt, gerade hier war die Sandwüste völlig eben, fast so weit das Auge reichte. Nur dort im fernen Westen begannen wieder die wellenförmigen Dünen, es war aber schwerlich anzunehmen, dass sich die Räuber in solch weiter Entfernung versteckt hätten.
»Ich weiß schon, weshalb sie heute Nacht abgezogen sind, nachdem sie hier vier bis fünf Stunden uns belagert haben!«, hatte der Prinz bereits gesagt, eine nähere Erklärung gebend, die sich später auch als richtig erweisen sollte.
»Weshalb ist nun gerade hier dieser Wall aufgehäuft?«, fragte Schwarzbach, sich zu dem Prinzen gesellend.
Schon wiederholt war diese Frage erörtert worden
»Sollte den Kern des Walles ein altes Mauerwerk bilden?«
Der Prinz schüttelte den Kopf.
»Ich kann es nicht glauben. Wäre ein solches vorhanden, so würde mein Berater sicher davon wissen. Aber er hat mir versichert, dass der unterirdische Eingang, einfach ein ehemaliger Brunnen, von dessen Existenz aber kein Mensch mehr etwas weiß, in der planlosen Wüste liegt.«
»Wie kann dieser Wall aber sonst entstanden sein?«
»Ich denke an einen Tornado, einen Wirbelsturm, der einmal über diese Gegend gegangen ist und gerade hier den Sand, den er mit sich führte, hat fallen lassen.«
»So kreisrund?«
»Jawohl, daher eben der Name Wirbelwind.«
»Wollen wir nicht einmal den Wall an einigen Stellen oder nur an einer einzigen durchbrechen lassen?«
»Ich halte es nicht für nötig. Almansor ist nämlich erst vor einem Vierteljahre hier gewesen, da hat es hier noch keinen solchen ringförmigen Wall gegeben. Dafür aber war sonst diese ganze Gegend mit Hügeln bedeckt. Dass sich das Aussehen der Wüste ständig ändert, wissen Sie doch. Jeder Sturm und starke Wind bringt eine Veränderung hervor. Jener Tornado hat wahrscheinlich alles eben gefegt, nur hier diesen Wall durch seinen Wirbel erzeugt. Aber gut, wir wollen den Wall einmal durchbrechen lassen.«
Es geschah, gleich an zwei Stellen wurde der Sand weggeschaufelt. Es zeigte sich keine Spur von einem Mauerwerk oder einem natürlichen Gestein, das den Kern dieses Walles gebildet hätte.
Dann war wohl die Annahme des Prinzen die richtige. Nur noch eine Einwendung hatte Leutnant Schwarzbach zu machen.
»Ist es denn nicht recht merkwürdig, dass der Wirbelwind seinen Sand gerade hier kreisförmig abgelagert hat, wo der alte Brunnen liegen soll, dass Deasy seine Lage genau im Mittelpunkt dieses Kreises angab?«
»Das ist allerdings sehr merkwürdig. Eben ein wunderbarer Zufall.«
»Liegt aber da nicht auch ein Verdacht sehr nahe?«
»Was für ein Verdacht?«
»Dass sich das Kind durch diesen Sandwall hat beeinflussen lassen? Den Brunnen gerade hier in der Mitte dieses Kreises angab?«
»Ich verstehe, Herr Leutnant. Aber nach allen Experimenten, die ich schon mit dem Kinde vorgenommen habe, muss ich der festen Überzeugung sein, dass es sich mit seiner Wünschelrute niemals irren kann. Jedenfalls können wir uns sofort davon überzeugen.«
Denn gerade kam Deasy aus dem Zelt, wo sie bis jetzt sanft geschlafen hatte. Alle Ereignisse dieser Nacht waren spurlos an dem Kinde vorüber gegangen, es hatte nichts von den Schüssen gehört, gar nichts. Doch sicher ein Zeichen von guter Gesundheit, solch ein tiefer Schlaf, wenn er ganz natürlich ist, was ja auch der Fall war.
Aber das Fehlen der Cowboys musste ihr nun erst berichtet werden, wozu auch gar keine Verheimlichung oder sonstige Unwahrheit nötig war. Ein Glück, dass dieses Kind den Tod nicht allzu tragisch nahm. Es war eben ein noch gänzlich naives Kind, das vor einer Leiche ohne besondere Erschütterung stehen kann.
Jetzt sprang Deasy erst auf den Onkel zu, um ihn am neuen Morgen zu begrüßen.
»Habt Ihr den Brunnen schon gefunden?«, war dann ihre nächste Frage.
»Nein, mein Kind, noch nicht, und Du kannst gleich einmal nachsehen, ob wir auch ganz richtig graben, dass wir nicht etwa abseits gekommen sind.«
Deasy sprang noch einmal in das Zelt und kam mit ihrer Wünschelrute zurück, jetzt mit einer ganz richtigen, aus einem gabelförmigen Zweige bestehend.
Nötig wäre es nicht gewesen, dass diese Rute von einem besonderen Baume geschnitten worden war. Schon jener französische Bauer Aymard hatte gesagt, dass es ganz gleichgültig sei, von welchem Holze seine Zauberrute wäre, und er schnitt sie zu jeder Zeit ohne jede Zeremonie.
Wenn die Wünschelruten meistenteils von einem Haselnussstrauche sind, so kommt das daher, weil in früheren Zeiten der Haselnussstrauch ein heiliges Gewächs war, das in der germanischen Göttermythe eine Rolle spielte, und die Einbildungskraft mag ja allerdings auch viel mit dazu beitragen, wenigstens um diese mediumistische Gabe erst einmal zu wecken und dann in Aktion zu halten.
Deasy hätte ebenso gut nach wie vor den Zollstock des arabischen Handwerkers benutzen können, er verrichtete noch immer dieselben Dienste. Solch ein unscheinbarer, dunkler Zweig war nur weniger auffällig, wenn man das Zaubermittel vielleicht einmal in Gegenwart von fremden Leuten benutzen musste, wenn man dabei beobachtet werden konnte.
Unumgänglich notwendig hingegen scheint es zu sein, dass die Wünschelrute von trockenem Holze ist. Es muss entweder ein dürrer Ast sein, oder, noch besser, man muss den grünen Zweig erst gut ausgetrocknet haben. Die Feuchtigkeit scheint eben den tierischen Magnetismus abzuleiten, was auch alle Magnetiseure wissen, wenn sie auch nichts mit der Wünschelrute zu tun haben, gar nicht dafür empfänglich sind. Sobald diese Leute feuchte Füße haben, verlieren sie ihre Gabe, die Nervenkraft, oder was es nun sonst ist — jedenfalls aber etwas Tatsächliches, was von der Wissenschaft trotz allen Sträubens immer mehr anerkannt werden muss — scheint statt aus ihren Fingerspitzen heraus in die Erde zu fließen, wogegen man sich am besten durch glasgesponnene Sohlen schützt, während sich Gummi gewöhnlich als ganz unwirksam erweist.
So war es auch bei diesem Kinde. Sobald die Rute feucht war oder wenn Deasy selbst feuchte Füße hatte oder gar wenn sie im Wasser stand, schlug die Rute nicht mehr an. Dagegen konnte sich dieses Kind durch einfache Gummischuhe schützen. Das ist eben bei jeder Person anders, dieser tierische Magnetismus lässt sich nicht in Gesetze und Formeln zwängen — vorläufig noch nicht, da müssen erst neue Formeln erfunden werden, vorläufig ist das eine rein individuelle Sache, und das ist es ja eben, was die Wissenschaftler so kopfscheu macht, dass sie überhaupt gar nicht an die Sache herangehen wollen.
Unterdessen hatte der Prinz seiner Brieftasche ein Pergamentzettelchen entnommen. Es war darauf mit schwarzer Farbe ein merkwürdiges Zeichen mit einigen Hieroglyphen gemalt. Man musste gleich an so ein magisches Zeichen denken, womit man Geister und den Teufel beschwört, wie in alten Zauberbüchern zu lesen und zu sehen. Übrigens darf man über so etwas nicht gleich spotten. Wenn vielleicht auch kein Geist und kein Teufel kommt. Aber das hat alles einen tiefen, tiefen Sinn, alle diese Beschwörungsformeln und magischen Zeichen, das hängt alles mit dem »Logos« der hebräischen Kabbala, der Neuplatoniker und der Gnostiker zusammen. Worüber hier aber nicht weiter gesprochen werden kann, das würde zu weit führen. Nur lächerlich soll man so etwas nicht machen.
Diesen Pergamentstreifen hatte der Prinz gestern früh durch die Post empfangen, nebst einem beiliegenden Briefe.
Eine Stunde später war die Karawane der Cowboys aufgebrochen.
Mit diesem Pergamentstreifen in der linken Hand hatte Deasy sie bisher geführt, durch die Kraft der Wünschelrute, wobei das Kind immer mit wachenden Augen vorn auf dem Kamelsattel des Prinzen hatte sitzen können. Der trockene Ast hatte die Richtung angegeben, sobald das Kind die Enden der Gabel mit beiden Händen gefasst, dann drehte sich die Rute nach einer bestimmten Richtung, und sie hätte sich den Händen des Kindes entwunden oder wäre gar zerbrochen, wenn man sie mit Gewalt nach einer anderen Richtung zugelenkt hätte.
Nur zuletzt, gestern kurz vor Sonnenuntergang, als die Rutenspitze sich immer mehr nach dem Boden hinab senkte, hatte Deasy das Kamel verlassen müssen, um nun ganz genau die Stelle anzugeben, wo gegraben werden sollte.
Dort sollte ein gemauerter Brunnen gefunden werden, durch den man einen kolossalen Vorteil erlangen würde.
Vorausgesetzt, dass man in ihn eindringen konnte. Wasserleer war er allerdings sicher.
Aber ob nicht vielleicht mit Sand ausgefüllt, das hatte auch jener rätselhafte Mann nicht sagen können, der sich jetzt Almansor nannte und einst der Alte vom Berge gewesen sein wollte.
Allwissend war er eben nicht, nicht einmal hellsehend wie dieses Kind, dessen er sich jetzt bediente, um seine eigenen Zwecke zu erreichen.
Und ob nun dieser Brunnen mit Sand gefüllt oder durch einen Deckel vor dem Eindringen von Sand geschützt war, darauf kam jetzt alles an. Im ersteren Falle war diese Expedition zwecklos gewesen, ja vielleicht hatte der Prinz jenes alte Kloster auch umsonst gekauft und eingerichtet. Oder aber es stand ihnen noch eine furchtbare Arbeit bevor, nämlich diesen Sand aus dem Brunnen wieder herauszuschaffen, was aber von hier oben wahrscheinlich überhaupt gar nicht möglich war. Dann musste man dem Sande von einer anderen Seite beikommen.
Jetzt nahm Deasy wieder diesen Pergamentstreifen in die linke Hand, und kaum hatte sie mit dieser auch das andere Ende der Gabel ergriffen, als die Rute sich auch schon wieder mit Gewalt in die Grube hinein richtete, mit aller Kraft hätte man sie nicht halten können, oder sie wäre zerbrochen.
Diese Angabe aber genügte noch nicht, man wollte die Stelle noch deutlicher angegeben haben.
Die Grube war schon gegen sechs Meter tief, wodurch wegen des niedrigen Gefälles des feinen Sandes natürlich ein Trichterloch mit sehr weiter Mündung entstanden war. Dort, wo die Arbeitenden hinab und hinauf stiegen, waren noch besondere Vorsichtsmaßregeln getroffen, um ein Nachstürzen des Sandes zu verhindern.
So stieg auch Deasy hinab. Den Grund der Grube bildete vorläufig noch ein ganz spitzes Loch. In dieses hinein aber schlug die Rute nicht, sondern ganz bedeutend seitwärts.
»Hier müsst Ihr graben, Ihr seid abgekommen — hier, hier liegt der Brunnendeckel.«
»Das ist vortrefflich, dass Du uns wieder die Richtung angibst«, sagte der Prinz, »dadurch ersparen wir uns viel Arbeit. Aber gleich von einem Brunnendeckel sprechen darfst Du nicht«
»Und warum nicht? Sucht Ihr nicht nach einem alten Brunnen?«
»Das wohl, und auch eingemauert soll er sein. Aber ob er mit einem Deckel verschlossen ist, das weiß noch niemand.«
»Warum nicht?«
»Ja, weil das eben niemand weiß.«
»Wenn aber kein Deckel darauf ist, müsste dann nicht der Sand hineingefallen sein?«
»Natürlich.«
»Nun, dann liegt auch ein Deckel darauf.«
»Weshalb denn? Woher willst Du denn das so genau wissen?«
»Weil jetzt meine Rute auf einen hohlen Raum schlägt. Das fühle ich sofort. Denn ich habe doch auch schon andere hohle Räume aufgesucht, wenn auch oftmals nur zur Probe. Und jetzt habe ich genau dasselbe Gefühl. Gestern konnte ich das noch nicht sagen, da war der Sand noch zu dick. Aber jetzt fühle ich ganz bestimmt, wie die Rute aufschlägt, dass hier drunter eine Höhlung ist.«
Und hierbei blieb das Kind.
Nun, dann war es ja gut, dann hatte man hier nicht vergebens geschaufelt und Körbe getragen, und mit neuem Eifer machten sich daher die Männer an die Arbeit.
Deasy war wieder heraufgekommen, der Prinz nahm ihr den Pergamentstreifen ab und barg ihn sorgfältig.
Nun konnte das Wunderkind mit der Wünschelrute aber auch gleich noch etwas Weiteres aufsuchen. Wenn es noch vorhanden war.
Wo hatten die Wüstenräuber Old Padds Leiche gelassen? Sie mitgenommen? Oder sie vergraben?
Der Penchuenche hatte heute in aller Frühe schon ziemlich genau die Stelle angegeben, wo der Cowboy oder Jäger gemartert worden war und seinen Tod gefunden hatte. Die Stelle war ungefähr 250 Meter von hier entfernt.
Aber einmal konnte der Indianer diese Stelle doch nicht so ganz genau angeben, das wäre zu viel verlangt gewesen auch vom Spürsinn eines Indianers, auf diesem nächtlichen Schleichwege beim schwachen Sternenschimmer, alles war hier von Hufen und Menschenfüßen zerstampft, und dann war es doch sehr die Frage, ob die Leiche auch gleich hier vergraben worden war, wie lange hätte man ja aufs Geratewohl suchen können. Ganz unmöglich.
»Deasy, von uns fehlen zwei!«, fing der Prinz die Vorbereitung an.
»Sie sind schon wieder fortgeritten?«
»Das nicht. Du weißt doch, dass wir gestern den ganzen Tag von Reitern verfolgt worden sind, die wir für Wüstenräuber gehalten haben.«
»Ach ja! Wo sind die denn geblieben?«, rief das sorglose Kind — doppelt sorglos im Schutze dieser Begleitung.
»Wir haben mit diesen Wüstenräubern heute Nacht einen Kampf gehabt.«
Ein plötzliches Erschrecken und Erstarren.
»Und die beiden Männer?!«
»Old Padd und der Cowboy O'Fail — sie sind beide in diesem Kampfe geblieben — tot.«
Es war ganz selbstverständlich, dass dieses Kind sofort zu weinen und zu jammern anfing.
Ebenso schnell hatte es sich aber nun auch wieder beruhigt, wenn auch nicht gleich so ganz und gar.
»Und — und — sie sind wohl verschwunden — ich soll sie wohl suchen?«, schluchzte Deasy.
»Der Cowboy hat bereits sein Begräbnis gefunden — in der freien, unermesslichen Wüste, wie er es sich besser wohl nie gewünscht hat — aber Old Padd fehlt noch. Wir vermuten, dass ihn die Räuber draußen verscharrt haben, und wir wollen auch ihm ein christliches Begräbnis geben.«
»Ja, ich will ihn suchen, ich will ihn suchen — waren sie denn gleich tot oder hatten sie noch viele Schmerzen?«
»Beide wurden erschossen und waren augenblicklich tot, nur dass es bei Old Padd draußen geschah, er war als Kundschafter hinausgeschlichen, aber auch er wurde sofort totgeschossen!«, berichtete Onkel Joachim nicht ganz die Wahrheit.
Er beorderte etwas von den zurückgebliebenen Sachen Old Padds, er hatte ja seinen ganzen Anzug mit einem anderen vertauscht.
»Nein, nein, ich brauche nicht so etwas«, wehrte aber Deasy gleich ab, »ich werde ihn auch so finden.«
Es war nichts Neues, was sie da vormachte oder vormachen wollte. Sobald es sich um ihr eigenes Interesse handelte und zumal, wenn noch tiefes Mitleid hinzukam, brauchte sie nichts Anderes noch in die sensitive Hand zu nehmen. Was ja auch bei jedem anderen Medium immer nur ein Anregungsmittel ist. Im Grunde genommen handelt es sich ja dabei um etwas ganz anderes.
Also Deasy nahm die Gabelrute in beide Hände, und sofort, noch ehe sie den Wall überschritten hatte, wendete sich diese mit aller Gewalt einer bestimmten Richtung zu.
Aber nicht, dass die Rute jetzt der Spur gefolgt wäre, welche gestern der Cowboy hinterlassen hatte, das heißt nicht denselben Weg nehmend, den jener gekrochen war.
Wohl wäre diese Art Verfolgung möglich gewesen, sobald es verlangt worden wäre. Dann hätte die Rute immer kreuz und quer geführt, eben wie jener gestern Nacht gekrochen war.
Aber die Forderung lautete nur dahin, die Stelle zu zeigen, wo die Leiche des Mannes begraben worden war, und das tat sie jetzt.
Dass sie es aber überhaupt tat, das zeigte auch wiederum, dass die Leiche auch wirklich in der Nähe lag. Denn die Entfernung hat eben immer ihre Grenzen. Jetzt aber reagierte die Wünschelrute oder eigentlich das sensitive Kind noch sehr stark.
Die Rute führte nach jener Richtung, die heute früh schon der Penchuenche angezeigt hatte. Dann freilich war es doch eine ganz andere Stelle, wo die Rute heftig auf den Sand schlug.
»Hier liegt er!«, sagte Deasy.
Sie wurde unter Begleitung zurückgeschickt. Das Kind sollte nicht sehen, was man hier ausgraben würde, den Angaben des Onkel Joachim durchaus nicht entsprechend.
Einige Männer waren mit Schaufeln mitgekommen. Es brauchte nicht tief gegraben zu werden, so kam die Leiche zum Vorschein und wurde vollends freigelegt.
Ein schrecklicher Anblick!
Wie der Mann verstümmelt worden war!
Bei dem Bericht des indianischen Advokaten hatte man sich das nicht so vorstellen können.
Schweigend blickten die umstehenden Männer auf den Kameraden herab.
Kein Racheschwur erscholl.
Aber in den Augen lag es!
Der eine blickte suchend am Boden herum, wo alles von Hufen und Menschenfüßen zerstampft war. Noch kein Wind hatte die Spuren wieder verweht.
»Ob Deasy nicht auch die Spur des Mörders verfolgen kann?«
»Sicher.«
»Auch die des Mannes, den sie gar nicht kennt, von dem sie nichts besitzt?«
»Zweifellos.«
»Auch wenn er auf einem Pferde oder Kamel sitzt?«
»Auch das wird sie können. Wir wollen dann einmal probieren.«
Die Leiche wurde in eine Decke geschlagen und mitgenommen, bekam ein Begräbnis. Übrigens hatten ihr die Wüstenräuber auch die Kleider ausgezogen. Dass sie sonst diese Tortur nicht gewollt hatten, dass der eine Araber dem Gequälten den Dolch ins Herz gestoßen, war nur ein geringer Milderungsgrund.
Deasy hatte auch hier die Leiche gar nicht zu sehen bekommen.
»Komm, mein Kind, ich möchte mit Dir noch einmal etwas versuchen.«
Sie begaben sich wieder zurück nach jener Stelle.
»Hier ist Old Padd ermordet worden. Man hat ihn nämlich ermordet, nicht so leichthin erschossen oder sonst wie getötet. Er war gefangen worden, erst hinterher hat man ihn ermordet. Sage, Deasy, kannst Du angeben, welchen Weg der Mörder von hier aus genommen hat?«
Ohne Weiteres machte Deasy ihre Rute bereit.
»Halt! Kannst Du es, die Spur dieses Mörders zu verfolgen?«
»Ja, das kann ich!«
Diese energische Behauptung hatte der Prinz nur hören wollen. Denn richtig angebracht wirkt so etwas noch ganz anders als irgend ein Medium.
Und die Rute schlug an, tippte hier und da auf den Boden nieder — so schritt das Kind über die vielen Spuren von Pferden, Kamelen und Menschen hin.
Aber nicht lange, so gab der Prinz diese Art von Verfolgung auf. Denn erstens, wie lange hätte man da denn folgen sollen, und zweitens, mit Hilfe dieses Kindes wollte er den Mörder nicht fassen.
Er wusste ja, wer dieser Mörder war, wer jenen Mann so scheußlich gemartert hatte, und er wollte ihm schon gegenübertreten, auch ohne Hilfe dieses unschuldigen Kindes, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen.
So kehrte der Prinz zurück.
Im Lager erwartete ihn eine große Überraschung, die ihn vorläufig alles andere vergessen ließ.
Nachdem man die Richtung des eigentlichen Loches in angegebener Weise geändert hatte, war man bald auf Felsboden gestoßen, und jetzt während der Abwesenheit des Prinzen hatte es sich bereits gezeigt, dass es kein natürlicher Felsboden war, sondern eine kreisrunde Steinplatte, auch noch mit Handgriffen versehen, mit Vertiefungen, um die Hände hineinstecken zu können.
So einfach diese Sache nun auch erscheinen mag, so bedurfte es doch noch drei Stunden emsiger Arbeit, noch viele, viele Kubikmeter Sand mussten die große Höhe hinaufbefördert werden, ehe man die Platte heben konnte oder vielmehr durfte, ohne Gefahr zu laufen, dass eine Unmenge Sand wieder hinabstürzte, wodurch die ganze Arbeit vielleicht umsonst geworden war. Endlich war man so weit. Der Deckel wurde mit vereinten Kräften abgehoben.

Das Resultat übertraf alle Hoffnungen.
Eine kreisrunde Öffnung von etwa einem Meter Durchmesser zeigte sich, oben sah man noch das Ende oder den Anfang einer Leiter aus starkem Kupferdraht, sonst blickte man natürlich in eine finstere Tiefe.
Erst wurde eine brennende Lampe hinabgelassen.
Verlöschen tat sie nicht, stickige Gase waren also dort unten nicht vorhanden.
Wohl aber hätten bald alle vorhandenen Stricke nicht ausgereicht, um die Lampe bis auf den Grund hinab zu lassen. Fast fünfzig Meter Länge wurden gebraucht. Das ist doch eine ganz beträchtliche Tiefe. Wasser hatte die Lampe nicht berührt, sonst wäre sie nass geworden und außerdem ja verloschen.
Der Prinz gab einige Instruktionen und stieg als erster hinab, gefolgt von fast der Hälfte der Cowboys, wieder bewaffnet mit Schaufeln, jetzt aber auch mit Spitzhacken und Brecheisen.
Die kupferne Leiter war tadellos erhalten. In wenigen Minuten hatte der Prinz den Boden erreicht.
Es war ein horizontaler Tunnel, in dem er sich befand, ein mächtiger Tunnel, wie ihn kein Eisenbahnbau schafft, mindestens zehn Meter breit und ebenso hoch, anscheinend von Nordosten nach Südwesten verlaufend.
Wer hatte diesen kolossalen Tunnel hier so tief unter der Erde geschaffen?
Es war nicht gerade nötig, ein Geologe zu sein, um eine Antwort geben zu können, besonders wenn man sich die Felswände näher betrachtete, die nur bis zu einer gewissen Höhe wie abgeschliffen waren, oben viel rauer.
Es war ein unterirdischer Flusslauf, der aber kein Wasser mehr enthielt. Also das Bett eines ehemaligen unterirdischen Flusslaufes.
Dass Ägypten, die Libysche Wüste und wahrscheinlich auch die ganze Sahara kreuz und quer von unterirdischen Flussläufen durchzogen ist, das hat man schon immer gewusst. Wenigstens die Wüstenbewohner haben seit uralten Zeiten davon gesprochen, in ihrer poetischen Weise aber von »Wassergeistern«, die dort unten in der Tiefe hausten.
Das hat man natürlich als eine Fabel betrachtet. Bis in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts auf Anregung eines Ingenieurs die französische Regierung Bohrungen vornehmen ließ, und jetzt weiß man, dass man fast überall, wo man in Nordafrika tief genug bohrt, auf Wasser stößt.
Dieses ehemalige Flussbett hier enthielt kein Wasser mehr, wie es solche unterirdische Läufe ja auch genug geben mag, denn deren Entstehung hat sich doch in prähistorischer Zeit abgespielt, da hat sich ja unterdessen nun Manches geändert.
Dieses trockene Flussbett ging direkt unter jenem alten Kloster weg, aber die ehemaligen Mönche hatten nichts davon gewusst, denn da hatten die Leute des Prinzen erst noch gar viele ganz neue Erdarbeiten ausführen müssen.
Dann weiter ging es unter dem Nil hindurch. Wobei gar nichts weiter ist. Wenn wir Menschlein heute jeden Strom und Fluss untertunneln können, mit einer elenden Blechröhre, so wird das wohl auch die Natur im festen Gestein fertig bringen.
Für menschliche Zwecke war dieser unterirdische Tunnel allerdings früher schon einmal benutzt worden. Denn wie hätte sonst jemand wissen können, dass dieser Tunnel vom Mittelländischen Meere aus, die Halbinsel Sinai durchkreuzend und von dort auch nach dem Roten Meere abzweigend, bis nach der Oase Fayum und noch viel weiter führte.
Jener geheimnisvolle Mann, der sich Almansor nannte, hatte dem Prinzen hiervon berichtet, hatte ihm aber nicht sagen können, ob dieser Tunnel auch noch vollkommen benutzbar sei. Er könne an einigen Stellen verschüttet oder von den Ureinwohnern Ägyptens, die ihn gebrauchten, wahrscheinlich Priester, die sich seiner für ihren Hokuspokus bedienten, mit Absicht vermauert worden sein.
Ebenso konnte Almansor den uralten, gar nicht bekannten Wüstenbrunnen angeben, der ungefähr in der Mitte zwischen Kairo und Fayum sich befand, aber nicht. ob dieser nicht total mit Sand ausgefüllt sei.
Dies alles hatte der Prinz auf eigene Faust untersuchen müssen, und das war es ja eben, weswegen sich der »Alte vom Berge« seiner bediente.
Jetzt war es geschehen. Und es war geglückt, der Wüstenbrunnen war frei von Sand gefunden worden.
Von hier aus bis nach der Oase Fayum und noch weiter war der unterirdische Tunnel frei, das hatte Almansor schon angeben können.
Nun handelte es sich nur noch darum, den Schutt wegzuräumen, welcher nach dem Kloster hin eine Barriere bildete, woran schon von der anderen Seite her gearbeitet wurde, jetzt wollte man jenen von hier aus entgegenkommen, und war auch dieses letzte Hindernis beseitigt, so konnte der Prinz jederzeit von seinem Kloster aus in das Geistergebirge eindringen, in das Megalis el Hiemit, in die Hochburg der Schlüsselbrüder, um dort als vorgeblicher Gemahl der Sultana, der Königin der Nacht, die Hauptrolle zu spielen.
Vorläufig standen die Dutzend Männer noch hier unten und beleuchteten mit ihren Lämpchen, welche in dieser Finsternis ganz verschwanden, die nackten Mauern, den glatten, wie asphaltierten Boden und die raue Decke.
Da plötzlich fuhr alles erschrocken zusammen.
Ein seltsames Geräusch wurde hörbar, wie ein Knattern, und schnell kam es näher.
Und da tauchten in der schwarzen Finsternis zwei glühende Augen auf, die immer mächtiger wurden.
»Jesus Christus und General Jackson, was ist das?!«, stieß ein Cowboy als erster entsetzt hervor.
Denn dass alle diese Männer vor Schreck ganz entsetzt waren, das lässt sich begreifen.
Das konnte doch nichts anderes sein als ein schnaubendes Ungeheuer, etwa ein feuerspeiender Drache, das hier fünfzig Meter tief unter der Erde hauste und das sich jetzt auf die erspähten Menschlein stürzte, um ihnen den Garaus zu machen.
Nur der Prinz war durchaus nicht erschrocken.
»Na, was soll es denn sein?«, lachte er. »Doch nichts anderes als unser ...«
Da war es schon herangekommen, das knatternde Ungeheuer, stand vor den Lampen still, und der Prinz hatte noch ganz besonders die seine geschwungen.
Es war das Rennautomobil!
Den Arbeitern auf der anderen Seite war es unterdessen gelungen, den Schutt, dessen Dicke sich als gar nicht so schlimm herausgestellt hatte, wie man anfangs vermutet, wegzuräumen, das bereits in den Keller des Klosters und noch tiefer hinabgebrachte Rennautomobil hatte seine erste freie Fahrt angetreten.
Nun stand der Weg von dem Kloster bis nach dem Geistergebirge offen, ein fast schnurgrader Weg wie auf asphaltierter Straße, eine Entfernung von rund 100 Kilometern, welche dieses Rennautomobil, wenn man es riskieren wollte, in noch nicht einer Stunde durchjagen konnte.
Und dass es dann von hier unten aus auch eine Verbindung in jene Felsenburg der Schlüsselbrüder gab, und zwar direkt in die heiligen Gemächer der Sultana Fatime hinein, das war ganz selbstverständlich, oder dies alles hätte ja gar keinen Zweck gehabt, und wenn sich die heiligen Räume der Königin der Nacht nicht von je her gerade an günstiger Stelle befunden hatten, nun, so hatte sie diese ihre Gemächer eben dorthin verlegen müssen.
Diese allmächtige Priesterin konnte doch alles arrangieren, ganz wie ihr beliebte.

Aus dem fast undurchdringlichen Dunkel tauchte ein leuchtendes
Ungetüm auf, das mit knatterndem Geräusch immer näher kam.
Es war einige Tage später. Durch das Kloster, das in Nachmittagsstille dalag, hallte ein Glockenton. Alle im Kloster Befindlichen wurden aus ihrer Ruhe aufgerüttelt.
»Flammenauge — das ist der Prinz.«
»Das braucht Ihr nicht immer zu sagen!«, ermahnte Schwarzbach, der jetzt hier das Oberkommando führte.
Er selbst eilte die Treppen hinab, eine Falltür nach der anderen öffnend, ganz geheim und unsichtbar angebracht, mit einer Lampe leuchtend.
Doch da tauchte er schon aus der Finsternis auf, der Prinz, gleichfalls mit einem Lämpchen leuchtend, in einen dunklen Mantel gehüllt.
»Wie geht es Deasy?«, war seine allererste Frage.
»All right.«
»Sonst etwas passiert?«
»Gar nichts.«
»Brief oder Telegramm angekommen?«
»Auch nicht.«
»Wo befindet sich Falkenburg?«
»Die Jacht hat gestern früh um sieben Triest verlassen.«
»Ist alles gut gegangen?«
»Alles.«
Diese Fragen stellte der Prinz, der also einige Tage abwesend gewesen war, während er mit Schwarzbach die Treppen hinauf schritt.
»Wie war die Rückkehr der Karawane?«
»Es ist nichts passiert. An Hohn und Spott hat man es ja natürlich wiederum nicht fehlen lassen, als wir durch die Straßen zogen.«
»Ist nicht bemerkt worden, dass zwei oder vielmehr drei Männer fehlten?«
»Ich habe nichts davon gemerkt!«, konnte Schwarzbach nur antworten.
»Hat Mister Scott etwas von sich sehen oder hören lassen?«
»Nein.«
»Ist er auch nicht von anderen gesehen worden?«
»Mir ist nichts zu Ohren gekommen.«
»Wie haben sich die Cowboys eingerichtet?«
»O, die amüsieren sich jeden Tag ganz vortrefflich in Kairo.«
Natürlich, einsperren hier hinter Klostermauern konnte der Prinz doch diese seine Leute nicht.
Sie lungerten herum oder beschäftigten sich mit irgend etwas, ritten ihre Tiere, wobei sie aber nicht nur auf den ummauerten Klosterhof angewiesen waren, die angrenzende Wüste in ihrer Endlosigkeit stand ihnen dabei zur Verfügung, nur dass sie sich nicht gar zu weit entfernten, nicht außer Gesichtsweite, das war die einzige Vorschrift, die sie deswegen bekommen hatten und der sie gehorchten, und dann, dass sie keine besonderen Reiterkunststückchen machten — sonst tummelten sie in der Stadt herum.
Vom Besuchen von Sehenswürdigkeiten gab es ja bei diesen Leuten nun freilich nicht viel. Sie lagen mehr in den Kneipen und Spelunken. Aber sie hielten zusammen, das war die Hauptsache. Deshalb konnten auch nicht so leicht Ausschweifungen vorkommen, keiner ungesehen verschwinden. Und wenn sie zur Stelle sein mussten, dann waren sie da.
Sie hatten das erste Stockwerk erreicht.
»Von Geisterspuk ist doch auch nichts gemerkt worden.«
»Geisterspuk? Nee«, entgegnete der junge Leutnant trocken.
Der Prinz hatte ihm über jene Geisterbeschwörung ausführlich berichtet. Aber so etwas muss man selbst gesehen haben, um es glauben zu können, und wenn es einem auch von der sonst glaubwürdigsten Person erzählt wird. Vorläufig konnte sich Schwarzbach noch gar keine Vorstellung davon machen.
»Also auch kein unterirdisches Kettenklirren mehr?«
»Ooch nich. Gar nichts ist passiert, sonst hätte ich doch so etwas schon berichtet, wenn sich Geister gezeigt und Spektakel gemacht hätten. Ja aber, mein Prinz ...«
Vor dem Arbeitszimmer des Prinzen blieben die beiden stehen, und das Gesicht des jungen Mannes nahm plötzlich einen ganz anderen Ausdruck an, so streckte er jenem die Hand hin, und es schien sogar, als ob er plötzlich ganz feuchte Augen bekäme.
»Ich sagte, es wäre kein Brief und kein Telegramm angekommen. Für Eure Hoheit nicht, meinte ich. Ich selbst habe einen Brief bekommen. Aus meiner Heimat. O, Prinz, wie großmütig sind Sie ...«
Und überquellenden Herzens schüttelte und drückte er jenem die Hand.
»Schon gut, schon gut!«, wehrte jener ab, obgleich er herzlich den Händedruck erwiderte. »Hätte ich eher gewusst, wie Sie zu Hause in der Geldklemme sitzen, hätte ich das doch schon längst arrangiert.«
Also jedenfalls ein deutscher Offizier, der so wie mancher andere wegen Schulden des Königs Rock hatte ausziehen müssen und abenteuernd nach Amerika gegangen war.
»Aber ich hoffe doch, dass Sie mich nun nicht etwa verlassen, Schwarzbach?«
»Niemals! Ganz abgesehen davon, dass ich mich nie mehr in solchen Militärdienst wieder eingewöhnen könnte. Aber auch sonst — so lange Sie leben, haben Sie über mich zu befehlen.«
»Schon gut, mein lieber Schwarzbach. Na, da rufen Sie mir mal Deasy. Wo ist das Kind?«
»Im Hofe und hilft mit, die Wüste in einen Garten zu verwandeln.«
»Ist schon ein Paradies daraus geworden mit verbotenen Apfelbäumen?«
»Na, vorläufig wird erst die Erde dazu aufgetragen. Aber Apfelbäume sind tatsächlich schon bestellt, nebst vielen anderen, und die arabischen Gärtner sollen ja darin etwas los haben, die größten Bäume mit den Wurzeln auszuheben und anderswo wieder einzusetzen.«
»Also bitte, rufen Sie mir das Kind. Onkel Joachim hat auch etwas Schönes mitgebracht. Eine Puppenstube — oder eine Menagerie zu nennen. Sie, Leutnant Schwarzbach, werden später selbst gern damit spielen. Es ist nämlich etwas ganz Fabelhaftes von orientalischer Spielerei, was wir in Europa nun freilich noch nicht kennen. Erst aber das Kind.«
Der Prinz hatte sein Arbeitszimmer betreten, aber die Türe offen gelassen. Einfach weil hinter ihm noch ein Matrose kam, ihm einiges Gepäck nachtragend. Derselbe, der außer dem Chauffeur mit im Rennautomobil gesessen, ihn mit auf unterirdischem Wege nach der Felsenburg begleitet hatte.
»Ich danke Dir!«, sagte der Prinz, als der Matrose das Gepäck auf den Tisch niedergelegt hatte, und er war hinter geschlossener Türe allein.
Den Mantel abwerfend, ging er einige Zeit im Zimmer auf und ab.
»Viel, viel habe ich mit dem Kinde vorzunehmen!«, flüsterte er nach einiger Zeit. »Ganz neue, unvorhergesehene Aussichten hat mir dieser rätselhafte Mann da eröffnet, der mich seiner persönlichen Begegnung endlich wieder einmal gewürdigt hat. Übrigens ein ganz vortrefflicher Herr, in dessen Dienste ich mich gestellt habe, nicht anders als ein Sklave mit Leib und Seele.
Aber solch eine Art von Sklaverei lässt man sich recht wohl gefallen. Das ist immer noch etwas ganz anderes, als wenn man im Militärrock vor einem Vorgesetzten steht, selbst wenn man als Untergebener ein Prinz ist.
Ja, aber vor allen Dingen muss ich das Kind benutzen, um mein Versprechen zu halten, das ich der Sultana gegeben habe. Das arme Weib! Die lauert und lauert, bis ich mit ihm komme, der eigentlich an meiner Stelle in dem schwarzen Schlafrock mit den goldenen Schlüsseln stecken sollte, und jetzt kann ich ihr nichts anderes berichten, als dass der geliebte Mann wahrscheinlich irgendwo in der Wüste sitzt und vielleicht wie weiland der Prophet Johannes rohe Heuschrecken verspeist.
Doch halt — erst muss ich meine Vorbereitungen treffen, muss auspacken, was der Onkel Joachim mitgebracht hat.«
Und er packte aus. Aus einem flachen Holzkasten kam ein zusammengeklapptes Gestell zum Vorschein und dann einige Glastafeln, die in das Gestell eingeschoben werden konnten, es vollkommen schließend.
Das ganze Gestell war ungefähr einen halben Meter hoch und etwas weniger im quadratischen Durchmesser, so dass es ungefähr einem Vogelbauer mit Glaswänden glich, und das umso mehr, als der Prinz jetzt auch noch einen kleinen Baum hineinsetzte, das heißt nur aus Ästen bestehend, so ein Ding, wie es gewisse Vögel in ihrem Käfig haben, um darauf herumhüpfen zu können.
So weit war der Prinz mit seinem Aufbau gekommen, als es an die Tür klopfte und gleich darauf, ohne das »Herein« abzuwarten, Deasy hereinsprang, sehr erhitzt und von der Gartenarbeit etwas schmutzig.
»Bist Du wieder da, Onkel — was hast Du mir mitgebracht?!«
Es wäre doch kein richtiges Kind gewesen, wenn das nicht ihre erste Frage gewesen wäre, zumal sie eben schon wusste, dass es der Fall war.
Dann aber war auch seitens des Onkels keine weitere Begrüßung und Liebkosung nötig, sondern nur immer nur zur Hauptsache kommen, gerade solch einem Kinde gegenüber!
»Na nun sieh mal, Deasy, was ich Dir hier Schönes mitgebracht habe.«
Und er entnahm einer weiteren Schachtel einen kleinen Bär, ungefähr sechs Zentimeter hoch und acht lang, mit natürlichem oder künstlichem Pelze, mit Glasaugen, die Glieder beweglich — im Übrigen ein ganz billiges Kinderspielzeug.
»Was ist das?«
»Ein Bär! O wie schön, o wie schön!«, jubelte das Kind, obgleich es schon solchen Kram genug hatte. Es war eben ein artiges, naives Kind, das sich noch immer über alles freute, das gar nicht verwöhnt werden konnte.
»Hier nimm ihn. Was hältst Du von diesem Bären?«
»Was soll ich davon halten?. Ich halte ihn doch in der Hand.«
»Der ist doch tot.«
»Tot?«
»Na, der ist doch ausgestopft.«
»Du meinst, Onkel, das war einmal ein wirklicher, lebendiger Bär?!«
»Nenee, so war das nicht gemeint!«, lachte der Onkel. »Solche kleine Bären gibt's im Leben nicht. Das ist doch nur ein Spielzeug.«
»Aber Du kannst ihn lebendig machen, Onkel?!«, war sofort die eifrige Frage.
Der gute Onkel kratzte sich einmal in den Haaren. Er hatte die Sache nicht richtig eingeleitet. Dieses Kind blickte gar zu vertrauensvoll zu ihm empor, als sei eine Allmacht bei Onkel Joachim ganz selbstverständlich.
»Na, ich will mal sehen, ob ich ihn lebendig machen kann!«, ging er aber nun auch darauf ein. »Hier, sieh zu, wie's gemacht wird, damit Du es dann später selbst machen kannst — hier in dem Käfig ist eine kleine Glastür, die öffne ich mit der Klinke, lege oder werfe den Bär einfach hinein, schließe die Tür wieder, drehe die Klinke gut herum — na, was siehst Du nun, mein Kind?«
Der in den Käfig geworfene Bär war auf den Rücken gefallen. Kaum aber war das Türchen wieder geschlossen worden, als er die Glieder bewegte, aufstand, sich dehnte und streckte, dabei tüchtig gähnte, wobei auch die rote Zunge zu dem Mäulchen herauskam, und dann trabte er einige Male in dem Käfig hin und her, bis er den Baum untersuchte und ihn zu erklettern begann.
Das Kind war natürlich außer sich vor Staunen.
Aber auch jeder erwachsene Mensch wäre es ebenfalls gewesen.
Es waren vollkommen natürliche Bewegungen. die der winzige Bär ausführte, und jetzt schienen auch die Glasaugen ganz natürlich zu sein. Er konnte diese Augen zukneifen.
Übrigens war es mehr ein freudiges Staunen, von dem dieses Kind befallen wurde.
»Ein ganz richtiger Bär, nur ein ganz, ganz kleiner!«, jubelte es. »Wie alt ist der denn, Onkel? Du hast ihn doch nicht etwa seiner Mutter weggenommen, dass die nun traurig ist?«
Es kam nicht ganz so, wie es der Onkel erwartet hatte, und da sah er sich nun schon vor großen Schwierigkeiten stehen.
»Der kleine Bär ist nur in diesem Glaskäfig lebendig.«
»Warum denn nur da drin?«
»Sobald ich die Tür öffne, ist er wieder tot.«
Der Prinz tat es, brauchte nicht einmal die Tür zu öffnen, nur die kleine Klinke herumzudrehen, und der Bär dort oben auf dem Baume verlor wieder sein kurzes Leben, fiel nur deshalb nicht herab, weil er gerade in einem Gabelaste hängen geblieben war.
Der Prinz fischte ihn heraus und zeigte, dass es nur ein toter Balg war.
Zuletzt musste es Deasy wohl glauben.
»Er ist nur da drin in dem Glaskasten lebendig?«
»Jawohl, mein Kind, jetzt hast Du's erfasst.«
»Alles, was man da hinein tut, wird lebendig?«
»Jawohl, alles was man da hinein tut, wird lebendig, das heißt, wenn ...«
Weiter kam der gute Onkel nicht, er hätte seine Einschränkung vorneweg und nicht hinterher machen sollen.
Blitzschnell hatte Deasy in ihre Tasche gegriffen und einen Hampelmann zum Vorschein gebracht, einen entsetzlichen Kerl, das Gesicht saß ihm im Genick, ein Bein fehlte ihm gänzlich, der eine Arm hing nur noch an einem Faden, und zur Heldenbrust hing ihm Herz und Lunge heraus, das heißt, das hineingestopfte Werg.
Ebenso schnell hatte Deasy das Glastürchen aufgemacht, den traurigen Hampelmann hineingeworfen und die Tür wieder geschlossen, die Klinke herumgedreht.
»Aber der wird doch gar nicht lebendig, Onkel?«, erlang es dann vorwurfsvoll.
Nein, dieser Hampelmann blieb liegen, wie er lag. Onkel Joachim aber kratzte sich noch einmal hinter dem Ohre.
»Höre, mein Kind, da verlangst Du allerdings zu viel, wenn Du denkst, dieser Hampelmann mit seinem einen Beine soll Two Step tanzen. Nein, es ist nur dieser Bär, der in dem Kasten lebendig wird. Es gibt noch andere Figuren, aber die gute Tante hat in ihrer Rumpelkammer vorläufig nur diesen Bären finden können. Sie wird weiter suchen, und was sie sonst noch an Figuren findet, wird sie Dir später schicken. Lasse Dir einstweilen an diesem Bären genügen.«
Das Kind war auch gänzlich zufrieden mit diesem einen Bären, der statt des Hampelmanns wieder in den Glaskasten getan und auch sofort wieder lebendig wurde, dabei ganz andere Bewegungen ausführend als vorhin.
»Ja, Onkel, wie ist denn das nur möglich?!«, musste dann auch dieses achtjährige Mädchen natürlich einmal fragen, oder es wäre idiotisch gewesen.
»Das, mein liebes Kind, kann ich Dir nicht erklären. Ich weiß es selbst nicht. Und die Dame, die Dir dieses Spielzeug aus ihren eigenen Kinderjahren schenkt, wusste es noch weniger als ich. Denn eine kleine Ahnung habe ich. Aber es ist nicht möglich, dass ich Dir davon auch nur eine Andeutung machen kann. Du würdest mich nicht verstehen.
Nimm es also als ein Spielzeug aus einer orientalischen Kinderstube, deren Papa ein Zauberkünstler ist.
Lass Dir das vorläufig genügen, mein Kind. Vielleicht kommst Du später einmal selbst hinter das Geheimnis.
Nun spiele einstweilen, ich habe hier noch Einiges zu tun.«
Der Prinz setzte sich an den Schreibtisch und begann in einem dicken Buche zu schreiben, wahrscheinlich ein Tagebuch, in dem er die mit dem hellsehenden Kinde angestellten Experimente sorgfältig verzeichnete. Auch schon Baron Walten hatte seine Eintragungen gemacht.
»Onkel, jetzt weiß ich, wie's gemacht wird!«, erklang es da bald hinter ihm in jauchendem Tone.
»Wirklich?!«
Überrascht drehte sich der Prinz um.
»Wenn man den Bären durchschneidet, dann geht's nicht mehr!«
Und freudestrahlend hielt ihm Deasy den Bären hin, aber in jeder Hand eine Hälfte — sie hatte mit der Papierschere den Bären glatt durchgeschnitten.
»Ei, mein Kind, das ist ja großartig! Du musst mal studieren, Du eignest Dich zum streng wissenschaftlichen Forscher!«
So scherzte der Prinz, dieses Halbieren des Bären durchaus nicht übel nehmend. Es wäre ja kein gesundes Kind gewesen, wenn es nicht dem Geheimnis des Bären auf diese Weise zu Leibe gerückt wäre!
Der durchschnittene Bär zeigte inwendig nichts weiter als Werg oder Baumwolle. Das hatte aber der Prinz schon vorher gewusst. Von einem Mechanismus konnte hier natürlich keine Rede sein.
Jetzt wurde der halbierte Bär aber nicht mehr lebendig, die beiden Hälften blieben in dem Glaskasten liegen, wie man sie hineingeworfen hatte.
»Na, ich will ihn Dir wieder lebendig machen. Wir brauchen die beiden Hälften nur wieder zusammenzunähen, recht sorgsam, dass Fell und Werg wieder in möglichst innige Berührung kommen. Denn darauf scheint das Ganze hinauszulaufen, dass ... doch das verstehst Du nicht, mein Kind. Aber die Glastafeln darfst Du in Deinem Forschungseifer nicht etwa zerbrechen! Die können wir nicht wieder zusammenflicken, da hilft es auch nicht, andere Glasscheiben einzuziehen. Denn in diesen durchsichtigen Tafeln hier steckt jedenfalls der Hauptwitz, das ist überhaupt gar kein Glas, das ist etwas ganz anderes, und die sind wahrscheinlich als kinematografische Platten präpariert.
Also, mein Kind, es wird alles wieder in Ordnung gebracht, dann kannst Du weiter spielen, so viel Du willst. Willst Du Dich aber nicht erst einmal in Trance versetzen und sonst einige Experimente mit Dir vornehmen lassen?«
Gewiss, Deasy war jederzeit bereit dazu, es machte ihr immer selbst das größte Vergnügen, deshalb hätte sie sofort noch eine ganz andere Spielerei aufgegeben.
»Du hast doch den Mister Edward Scott sehr lieb gehabt?«
»Freilich, sehr, sehr lieb.«
»Denkst Du nicht manchmal an ihn?«
»Sehr oft.«
»Wo mag er wohl sein?«
Wie sollte das Deasy wissen?
»Hast Du nicht einmal daran gedacht, mit der Wünschelrute nach ihm zu forschen, Dir von ihr wenigstens die Richtung angeben zu lassen, wo er sich befindet, was doch immer ein Lebenszeichen von ihm ist?«
Nein, niemals. Von allein nahm das Kind die Wünschelrute überhaupt niemals in die Hand. Ganz abgesehen davon, dass, wenn der Wunsch von ihr allein ausging, die Rute gar nicht anschlug. Sie musste dabei unter dem Einflusse einer willensstärkeren Person stehen. genau so wie bei ihrem Hellsehen.
»Nun, da wollen wir einmal sehen, wo ungefähr sich Onkel Edward aufhält.«
Der Prinz hatte in seinem Arbeitszimmer eine ganze Auswahl von Wünschelruten, mit denen er experimentiert hatte, zur Überzeugung kommend, dass alle das gleiche Resultat lieferten, wenn sie nur nicht feucht waren.
Er nahm eine beliebige, das Kind fasste sie vorschriftsmäßig.
»Nun denke einmal fest an Onkel Edward. Wo befindet er sich jetzt?«
Die Spitze der Rute hätte sich sofort einer bestimmten Richtung zuwenden müssen. Sie tat es nicht, war in den Händen des Kindes einfach ein toter Gegenstand.
»Denke einmal an Fred. Wo ist jetzt Fred?«
Sofort drehte sich die Spitze der Rute mit aller Gewalt dorthin, wo Fred jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach auf dem Mittelländischen Meere schwimmen musste.
»Denke einmal an den Mörder von Old Padd. Wo befindet sich der jetzt?«
Sofort wurde die Rute von einer unsichtbaren Gewalt der entgegengesetzten Richtung zugelenkt.
Und so konnte der Prinz eine Person nennen, welche er wollte, stets gab die Spitze der Rute die Richtung an, in welcher sich die betreffende Person aller Wahrscheinlichkeit nach befand, gleichgültig ob hier in der Nähe oder in einem fernen Weltteil.
Oder vielmehr ganz bestimmt gab es die Rute an! Dass des Prinzen Einbildungskraft dabei keine Rolle spielte, dass also keine Gedankenübertragung vorlag, dafür sollte er sofort einen Beweis erhalten.
Durch das Fenster, an dem er stand, hatte er soeben unten im Hofe Jochen Puttfarken stehen sehen.
»Wo ist Jochen?«
Deasy konnte den Koch nicht sehen, sie stand nicht so, war überhaupt zu klein, um durch das Fenster direkt auf den Hof hinabsehen zu können.
Das Kind hatte gerade einmal das Taschentuch gebrauchen müssen, dadurch war eine Minute vergangen, ehe es die Wünschelrute wieder in die Hände nahm.
Und da zeigte die Rute nach einer ganz anderen Richtung, in einem rechten Winkel zu jener, in der Jochen stand.
»Jochen Puttfarken meine ich, unseren Koch!«
»Ja, ja, dort ist er, wohin die Rute zeigt.«
Der Prinz blickte hin, wo er Jochen soeben hatte stehen sehen.
Da aber stand der nicht mehr!
Das Arbeitszimmer des Prinzen lag an einer Ecke, jetzt blickte er zum anderen Fenster hinab, dorthin, wohin die Rute wies.
Richtig, jetzt stand Jochen auf der anderen Seite des Klosters, er hatte während der Minute seinen Standort verändert, war über den Hof und um das Kloster herum gegangen, ohne dass der Prinz etwas davon bemerkt, weil er eben unterdessen nicht wieder zum Fenster hinausgesehen hatte.
Also ein vollgültiger Beweis, dass keine Gedankenübertragung vorliegen konnte, durch welche der Experimenteur und gläubige Spiritisten sonst so oft gefoppt werden!
Aber auf die Frage, wo sich Edward Scott befände, versagte die Rute.
»Seltsam, ganz seltsam!«, meinte der Prinz kopfschüttelnd. »Hast Du hierfür eine Erklärung, Deasy?«
»Es soll eben niemand wissen, wo er sich aufhält, er will es nicht.«
»Er will es nicht. Aber ...«
Doch wie konnte er von diesem Kinde da eine Erklärung verlangen!
»Oder doch nicht etwa ... tot?!«
Doch die Wünschelrute hatte ja auch die Leiche Old Padds gefunden, sie zeigte ja auch jeden unbelebten Körper an, und das tat sie auch jetzt noch.
»Nun wollen wir Deine Empfindsamkeit einmal durch seine Haare verstärken.«
Der Prinz entnahm einem Wandschränkchen ein Büschelchen von jenen Haaren, die er damals Edward Scott abgeschnitten hatte.
Nein, die Rute wollte auch nicht reagieren, wenn Deasy diese Haare in ihre linke Hand nahm.
Scott hatte ja einige Sachen hinterlassen, zum Beispiel waren seine Schuhe geholt worden, die der seltsame Mensch abgestreift und einfach in der Wüste hatte stehen lassen.
Ein Klingelzeichen, und innerhalb einer Minute hatte der aufwartende Matrose Hein diese Schuhe gebracht.
Der Prinz versteckte den einen im Zimmer, Deasy sollte ihn suchen, das Haarbüschel in der sensitiven Hand. Die Wünschelrute fand ihn nicht, ging dicht daran vorüber, ohne anzuschlagen.
»Seltsam, ganz seltsam. Weshalb versagt die Rute nur gerade bei dem?!«
»Wir wollen es doch einmal mit der anderen Locke versuchen, die ihm als Kind abgeschnitten worden ist, durch die ich die Mumie mit dem steinernen Schlüssel gefunden habe!«, schlug Deasy vor.
Die barg der Prinz in seiner Brieftasche, holte sie hervor.
An einen Erfolg glaubte er nicht. Er hatte es schon wiederholt probiert, aber diese Locke übte seitdem so wenig Wirkung auf Deasy aus wie jedes andere Medium, das von einem Menschen oder Tier stammte. Deasy war in dieser Hinsicht eben nur noch für ihres Freundes Fred Haarlocke empfänglich, dann wurde sie hellsehend, sonst durch kein anderes Mittel. Durch Edward Scotts Kinderhaar war eben jene Mumie gefunden werden, dann hatte sie nie wieder irgendwelche Wirkung ausgeübt.
Es sollte sich wieder einmal zeigen, dass sich diese mediumistische, seelische Kraft, die mehr oder weniger jedem Menschen inne wohnt, durchaus in keine Gesetze und Formeln zwängen lässt, dass man jeden einzelnen Fall als eine Ausnahme von allen anderen Fällen betrachten kann.
Kaum hatte Deasy diese Locke in die linke Hand genommen, als sie die Augen schloss und mit einem kleinen Seufzer etwas zurücktaumelte, bis sie gegen ein Sofa stieß, auf das sie sich halb liegend setzte. Die Rute hatte sie noch in der rechten Hand, ließ sie aber jetzt fallen.
Staunend betrachtete der Prinz das Kind. Zum ersten Male, dass es durch ein anderes Mittel als durch Freds Locke wieder in Trance versetzt wurde!
Es war nachmittags gegen vier Uhr, einige Sonnenstrahlen drangen ins Zimmer.
»Was siehst Du, mein Kind?«
Keine Antwort.
Und der Prinz wurde besorgt, wurde ängstlich.
Das früher so zarte Kind, obgleich immer noch zart genug, hatte mit der Zeit eine durchaus gesunde Gesichtsfarbe bekommen.
Diese hielt auch an, wenn Deasy durch Freds Locke in Trance fiel. Da blieben die roten Wangen dieselben.
Jetzt aber war das hier etwas ganz anderes!
Das gebräunte Gesichtchen war plötzlich ganz weiß geworden.
Das fiel umso mehr auf, weil ein durch das Fensterkreuz gebrochener Sonnenstrahl ihr über den Hals ging.
Noch aber zögerte der Prinz, ihr die Locke schnell wieder aus der Hand zu nehmen. Dass hier etwas ganz anderes vorlag als der gewöhnliche Trancezustand, das ahnte er sofort, ihr Aussehen war ein so ganz und gar anderes als sonst, ganz vergeistigt, und da musste er doch erst etwas näher forschen, das war zu interessant.
»Was siehst Du, mein Kind? Hörst Du mich sprechen? Kannst Du nicht antworten?«
Da begann sich das Kind unruhig hin und her zu bewegen, es verzog das Gesichtchen wie im Schmerz.
»Soll ich Dir die Locke aus der Hand nehmen?«, fragte der Prinz erschrocken, nicht daran denkend, dass Deasy, wenn ihr irgend etwas nicht passte, das betreffende Medium ja selbst sofort von sich schleuderte.
»Nein, nein — aber — das Licht — die Sonne — sie tut mir weh —«
Auch wieder zum ersten Male so etwas!
Dass in Trance liegende Medien kein helles Licht vertragen können, ist ja sonst etwas ganz Gewöhnliches.
Aber dieses Kind hatte früher ja sogar im heißesten Sonnenbrande seine Visionen gehabt, auf dem Rücken eines schaukelnden Kamels sitzend, wie damals, als die Mumie gesucht wurde.
Schnell zog der Prinz die Vorhänge der beiden Fenster zu. In dem Zimmer herrschte Halbdämmerung, die jedoch für das Auge bald immer heller wurde.
Deasy lag wie zuvor da. Nur der schmerzhafte Zug war von ihr gewichen, jetzt begann sie sogar glücklich zu lächeln.
»Was siehst Du, mein Kind?«
»Still, still — ich spreche mit ihm.«
»Mit wem?«
»Mit ihm — still, still.«
Einige Minuten vergingen. Genau vier Minuten. Der Prinz kontrollierte die Zeit nach seiner Uhr.
Da begann Deasy von allein wieder zu sprechen, zu flüstern.
»Ich war bei ihm — bei Onkel Edward.«
Hast Du mit ihm gesprochen?«
»Ja.«
»Was denn?«
»Das ... darf ich jetzt noch nicht sagen.«
Es musste aber etwas recht Heiteres oder doch Angenehmes gewesen sein, weil das Kind dabei so glücklich lächelte.
»Wo ist denn Onkel Edward?«
»Er lebt in einer Höhle.«
»Wo ist denn diese Höhle?«
»Das ... darf ich jetzt noch nicht sagen!«, erklang es wiederum. »Er hat es mir verboten.«
Der Prinz wusste nicht, was er hiervon denken sollte. Dass Deasy einer Fernwirkung fähig war, das war ja nun schon längst bekannt.
Aber das bezog sich nur auf ihren Freund Fred, mit dem sie eben durch eine besondere Sympathie in Rapport, in Verbindung stand. Wenn sie in Trance lag, Freds Locke in der Hand, konnte sie leicht Gegenstände umwerfen, den Perpendikel der Uhr anhalten und wieder in Bewegung setzen und dergleichen mehr, vorausgesetzt, dass der Knabe gerade auf diesen Gegenstand blickte.
Dies war bereits benutzt worden, um zwischen den beiden eine regelrechte Korrespondenz herzustellen. Nach einem Briefe, den der Prinz geschrieben, hatte man damals in dem Schlosse zu Siebenbürgen einen kleinen Apparat gefertigt, einen sogenannten Psychografen. Auf ein Brett waren die Buchstaben des Alphabets im Kreise geordnet, in der Mitte war eine Art ganz leichte Magnetnadel befestigt, sich spielend leicht drehend, aber unmagnetisch, und durch ihren bloßen Willen konnte das somnambule Kind diesen Zeiger nach Belieben drehen, so dass er also bei einer Mitteilung immer auf den betreffenden Buchstaben wies. Auf diese Weise konnten ganze Briefe buchstabiert werden, wobei die Entfernung gar keine Rolle spielte. Jetzt funktionierte dieser Psychograf, ausbalanciert, aufgehängt, auf der Jacht, welche gegenwärtig das Mittelländische Meer durchkreuzte. Voraussetzung war nur immer, dass der Knabe seine Augen direkt auf diesen Apparat geheftet hatte und seine Gedanken nicht allzu sehr abschweifen ließ. Dies konnte aber nur zu bestimmten Stunden geschehen, die vorher ausgemacht sein mussten, bis zur Minute genau. Denn vorher ein Zeichen zu geben — das Kind hätte doch ebenso gut etwa den Klöppel einer Glocke in Bewegung setzen können — das war eben deshalb nicht möglich, weil Fred den betreffenden Gegenstand erst fest ins Auge nehmen musste.
Dass es solch eine Art von Telepathie und Fernwirkung gibt, daran ist nicht mehr zu rütteln. Die Psychic Research Company in London, eine wissenschaftliche Gesellschaft für psychologische Forschungen, aus bekannten, bedeutenden Gelehrten aller Zweige bestehend, hat hierüber mehr als achthundert Versuche angestellt und die dabei erzielten Resultate in einigen dicken Bänden veröffentlicht. Das müssten doch entweder ungeheure Schwindler oder die größten Narren sein, wenn sie so etwas in die Welt setzten, ohne dass es auf Tatsache beruhte. Nein, in dieser Hinsicht ist die Macht des Materialismus bereits gebrochen, seine bisher gläubigen Anhänger, die noch nicht gleich abschwenken wollen, hüllen sich vorläufig in ignorierendes Schweigen. Wie der Vogel Strauß den Kopf in den Sand steckt, wenn ihm eine Gefahr droht, der er nicht entgehen kann und die er daher lieber gar nicht sehen mag.
Also das mit der telepathischen Wirkung war bei diesem Kinde hier und für seine Umgebung schon eine alte Sache. Dass diese telepathische Verbindung nur mit ihrem Freunde Fred stattfinden konnte, damit hatte man sich abfinden müssen.
Aber das hier, was das Kind jetzt offenbarte, das war ja nun wieder etwas ganz, ganz anderes!
»Du hast mit Onkel Edward persönlich gesprochen?« — »Ja.«
»Hat er Dir geantwortet?!« — »Ja.«
»Du darfst mir nicht sagen, was Ihr zusammen gesprochen habt?«
»Nein, jetzt noch nicht.«
»Aber gesehen hat er Dich doch nicht.«
»O ja.«
Der Prinz trat einen Schritt zurück und betrachtete das geisterhaft blass gewordene Kind, das mit geschlossenen Augen in der Sofaecke lag.
»Deasy, hörst Du mich sprechen?«
»Ich höre Dich.«
»Befindest Du Dich jetzt in einem anderen Trancezustand als sonst, wenn Du mit Fred verkehrst?«
»Nein — ja — nein ... das weiß ich nicht.«
»Weißt Du, Deasy, was man unter dem Astralleib versteht?«
»Nein.«
»Kannst Du Dich auch mir sichtbar machen?«
»Ja ... ich ... bin doch hier.«
»Kannst Du aus Deinem Körper heraustreten? Verstehst Du, was ich hiermit meine? Hast Du solch ein Gefühl?«
»Ja.«
Einen immer gespannteren, selbst etwas ängstlichen Ausdruck nahm das männliche Gesicht des Prinzen an.
Er ahnte, dass er jetzt an der letzten Grenze des Übersinnlichen stand, dass jetzt noch etwas Ungeheuerliches kommen könne.
»Deasy, kannst Du einmal dort an das Fenster gehen?«
»Ja.«
»Bitte, tue es.«
Das Kind bewegte sich unruhig, blieb aber liegen.
»Nun?«
»Ich stehe am Fenster.«
In halb vorgebeugter Haltung blickte der Prinz bald nach der kleinen Schläferin — denn in wachem Zustande war sie ja durchaus nicht — bald nach dem bezeichneten Fenster.
Dort war natürlich keine Deasy zu sehen.
Aber der Prinz hatte nicht umsonst so viel in der okkultistischen Bibliothek jenes alten Schlosses gelesen.
»Du stehst jetzt am Fenster?« — »Ja.«
»Ich kann Dich aber nicht sehen.«
»Nein.«
»Deasy, mein Kind ... fühlst Du Dich vielleicht doppelt?«
»Ja.«
»Wo befindest Du Dich gleichzeitig?«
»Ich liege hier auf dem Sofa, stehe aber auch dort am Fenster.«
»Kannst Du einmal hierher zu mir kommen?«
Es erfolgte keine Antwort, jetzt bewegte sich auch das Kind nicht mehr.
»Nun?«
»Ich bin bei Dir.«
»Wo stehst Du?«
»Vor Dir.«
Der Prinz fuhr mit der Hand vor sich hin und her.
»Fahre ich jetzt mit meiner Hand durch Dich hindurch?«
»Nein — ja — nein ...«
»Gib mir doch einmal die Hand. Kannst Du das?«
»Ja.«
»Bitte, tue es.«
Der Prinz streckte die Hand vor sich hin, und da war es ihm nicht anders, als ob ein kühler Hauch über seine Hand hingehe. Er war sich aber gleich bewusst, dass dies nur eine Täuschung, eine Einbildung sein könne.
Er bückte sich etwas.
»Streiche mir doch einmal über ...«
Erschrocken fuhr er zurück.
Nein, das war keine Einbildung gewesen.
Nicht nur wie ein kühler Hauch, sondern wie eine kalte Hand war es über sein Gesicht gegangen, wenn diese auch ganz wesenlos gewesen war.
Und das war geschehen, noch ehe er seine Forderung ganz ausgesprochen hatte.
Der Prinz blickte sich suchend im Zimmer um.
Dort auf dem Nebentische, drei Meter von ihm entfernt, stand eine Klingel mit Handgriff.
»Deasy, siehst Du die Klingel dort auf dem Tische stehen?«
»Ich sehe sie.«
»Kannst Du diese Klingel herholen und sie mir in die Hand geben?«
»Ja, das kann ich!«, erklang es sofort, wohl noch flüsternd, aber doch ganz bestimmt.
Der Prinz wurde von einer mächtigen Erregung gepackt, und das war begreiflich.
Alles, was das Kind an Fernwirkung leistete, war ja schon erstaunlich genug. Aber das war ihm nun schon nichts Neues mehr.
An der Wand tickte eine Uhr mit Perpendikel.
Er hätte verlangen können, das Kind sollte mit seinem unbewussten Ich, oder wie man dieses »Ding« nun sonst nennen mag, diesen Perpendikel anhalten.
Das tat Deasy ja auch in weitester Entfernung hin. Hier aber im Zimmer wäre es dennoch etwas ganz anderes gewesen, der Prinz wäre erschrocken, wenn es ausgeführt worden wäre.
Das war eben einmal Handgreifliches vom Übersinnlichen!
Aber nein, dieser Beweis genügte ihm immer noch nicht, gerade auf jene Klingel hatte er es abgesehen, die sollte ihm das unsichtbare Etwas bringen.
So war ihm plötzlich der Gedanke gekommen.
Und das Kind hatte ganz einfach und doch so bestimmt gesagt: »Ja, das kann ich.«
Das war es, was den Prinzen schon jetzt mit förmlichem Grauen erfüllte.
»Nun gut, tue es, trage mir die Klingel zu.«
Einige Zeit verging.
Wie viel, das kann nicht gesagt werden. In solchen Situationen lassen sich weder Minuten noch Sekunden zählen.
Nichts geschah!
Die Klingel dort rührte sich nicht.
Wohl aber fing jetzt Deasy sich zu bewegen und zu stöhnen an.
»Du kannst mir die Klingel wohl nicht bringen?«
»Sie ist zu schwer!«, erklang es stöhnend.
»Mühe Dich nicht ab, Kind! Und doch, nur solch einen einzigen Beweis bringe mir, dass es so etwas wie einen spiritistischen Apport gibt. Nur ein Haar lass frei durch die Luft schweben, und es soll mir genügen. Oder hier, dieses Taschentuch, ist Dir das zu schwer? Kannst Du mir das herbringen? Nur bis an die Füße.«
Der Prinz hatte sein Taschentuch gezogen, feiner, leichter Batist, warf es hin, zwei Schritte von sich entfernt.
»Kannst Du das?«
»Ja, ich kann es.«
»Bitte, bringe mir das Tuch her, nur bis vor meine Füße.«
Im nächsten Moment geschah es. Aber etwas ganz, ganz Anderes, als was der Prinz erwartet hatte.
Eigentlich war es etwas ganz Gewöhnliches, etwas Selbstverständliches für diejenigen, die sich mit so etwas befassen — dass nämlich ein spiritistisches Medium nicht locker lässt, als bis es die ihm einmal gestellte Aufgabe gelöst hat. Erst sagt es, es könne die Aufgabe nicht lösen, sie sei ihm zu schwer, nun braucht man ihm nur eine leichtere aufzugeben, dann kommt der gekränkte Ehrgeiz — mit einem Mal bringt es fertig, was ihm selbst zuerst unmöglich erscheint.
Um das Taschentuch zu sehen, musste er der Klingel den Rücken kehren.
Plötzlich hinter ihm ein Klingeln und ein klirrender Aufschlag — die Glocke war vom Tische auf den Boden gefallen!
Und hier blieb sie nicht liegen.
Sie setzte sich in Bewegung, aber in ganz eigentümlicher Weise.
So wie der Küfer oder Böttcher ein leeres Fass auf der Straße rollt, es immer nur auf einer Kante sich drehen lassend, so rollte auch diese Glocke über den Teppich, auf den Prinzen zu.
Dieser wich erschrocken zwei Schritte zurück. Die Glocke ihm nach, und zwar ziemlich schnell. Bis sie ihn erreicht hatte. Und jetzt war es nicht anders, als ob sie auch auf diese Weise an seinem Beine empor rollen wolle.
Aber das gelang nicht, zweimal fiel sie wieder herab.
Da wieder ein Stöhnen des auf dem Sofa liegenden Kindes, und da plötzlich schnellte die Glocke hoch empor, flog mit dem Griff direkt in die rechte Hand des Prinzen, die er wie abwehrend vorgestreckt hatte, flog so, schlug so hinein, dass er ganz unwillkürlich die Finger über dem Griff schließen musste.
Im nächsten Augenblick drehte sich der Prinz um und rannte nach der Tür.
Es sah nicht anders aus, als wolle der Prinz vor Schreck die Flucht ergreifen. Nur hinaus aus diesem Spukzimmer!
Was nämlich jedem Menschen passieren kann, der so etwas einmal erlebt, dass er im ersten Schrecken auskneift. Wer das nicht glaubt, der hat eben so ein Spukphänomen noch nicht erlebt.
Aber der Prinz hatte gar nicht entfliehen wollen. Sein Ziel war nur das neben der Tür befindliche Telefon gewesen, mit dem das Kloster schon ausgestattet worden war, wie auch schon mit elektrischem Licht. Im Keller arbeitete automatisch ein Petroleummotor, der eine kleine Dynamomaschine trieb.
Ehe er das Telefon benutzte, drehte er sich noch einmal um.
»Greift Dich das sehr an, Kind?«
»Gar nicht, Onkel.«
»Weil Du manchmal so stöhnst,«
»Weil ich mich angestrengt habe, die Klingel war sehr schwer.«
Dabei wog sie, wie dann konstatiert wurde, nur 150 Gramm. Aber hierbei lag ja natürlich etwas ganz anderes vor. Alles außerhalb jeder Berechnung. Dieser selbe Astralkörper des Kindes sollte später noch Lasten heben, welche Deasy selbst niemals heben konnte.
»Sind Dir diese Experimente nicht unangenehm?«
»Gar nicht.«
»Du machst sie gern?«
»Sehr gern.«
»Kannst Du das mit dieser Glocke noch einmal wiederholen?«
»So oft Du willst, Onkel, und jetzt wird es auch ganz leicht gehen.«
»Kannst Du dasselbe und Ähnliches auch in Gegenwart von einer zweiten Person machen?«
»Nnnein«, erklang es zögernd, »ja — nein ...«
»Nicht bei jeder Person?«
»Nein.«
»In Gegenwart von Leutnant Schwarzbach?«
»Ja, gewiss!«, erklang es sofort in ganz anderem Tone.
»Kann ich Schwarzbach rufen?«
»Ja, rufe ihn.«
In drei Minuten, während welcher der Prinz im Zimmer auf und ab gegangen, war der junge Schwarzbach zur Stelle.
»Leutnant, jetzt ist unsere Deasy in ein neues, in das letzte Stadium des Somnambulismus getreten, das wir kennen!«
Und der Prinz berichtete, hauptsächlich von dieser Klingel.
Ungläubig lächelte der junge Mann.
»Ah, Hoheit, das haben Sie nur geträumt!«
Es war seltsam. Schwarzbach glaubte nichts, was er nicht mit eigenen Augen sah. Er bezweifelte noch heute, dass Deasy in Siebenbürgen oder jetzt auf der Jacht den Zeiger in Bewegung setzen könne. Natürlich geschehe es ja, nur dieses Kind könne das nicht zustande bringen, da müsse irgend eine andere Kraft im Spiele sein. Nur an solch eine Fernwirkung glaubte er nicht! Von der Tatsächlichkeit der Wünschelrute hatte er sich ja überzeugen lassen müssen. Na ja, das sei eben einmal etwas ganz Wunderbares.
Am wenigsten glaubte er, dass der Prinz und seine Leute damals in dem Refektorium die von dem Haui beschworenen Geister gesehen hatten. Irgend etwas mochten sie ja gesehen haben, Nebelgestalten ... nur keine Geister und Gespenster! Und schließlich hatte er da ja auch ganz recht.
Und der Ring mit dem schwarzen Steine und dem goldenen Schlüssel, den Deasy beim Erwachen plötzlich in der Hand gehabt?
Den hatte sie schon vorher irgendwo im Kloster gefunden, hatte ihn schon beim Einschlafen in der Hand gehabt, ohne davon zu wissen.
So wusste der junge Mann für alles eine Erklärung. Für den Ring wusste der Prinz freilich auch keine andere zu geben.
»Sie meinen, ich hätte dies mit der Klingel nur geträumt?!«
»Pardon — es war eine Illusion, die Sie sich nur eingebildet haben — oder an der Klingel hängt ein Faden. Sie sind hängen geblieben, eine Gummischnur ...«
»Hören Sie, Leutnant, Sie machen aber große Sprünge!«, lachte der Prinz »Sie lassen Ihre Illusionen an Gummischnüren zappeln! Nun, ich habe Sie eben gerufen, um einen möglichst ungläubigen Zeugen für die weiteren Phänomene zu haben, die uns Deasy hoffentlich vormachen wird. Außerdem können Sie fotografieren, wir wollen dann doppelte Fotografien aufnehmen, von einander unabhängig, mit dem Licht wird es sich schon vormachen lassen. Deasy, willst Du uns das mit der Klingel noch einmal vormachen?«
»Ja.«
Bitte, Leutnant, wollen Sie die Klingel untersuchen.«
Der tat es mit äußerster Gewissenhaftigkeit.
»Hm, zu merken von einem Faden ist an der Glocke wenigstens nichts!«, meinte er dann.
»O Gott! Dann denken Sie wohl an ein unsichtbares und wesenloses Gummifädchen, das aber genau so funktionieren muss wie ein richtiges? Ist ein Faden oder etwas Ähnliches dran oder nicht!«
»Nein.«
»So setzen Sie die Klingel selbst auf den Tisch.«
Schwarzbach tat es, trat drei abgemessene Schritte zurück, ohne die Glocke einmal aus den Augen zu lassen.
»Nun, Deasy, willst Du die Glocke noch einmal ...«
Weiter kam der Prinz nicht.
Es geschah etwas, was niemand erwartet hätte. Wie man bei so etwas aber überhaupt niemals etwas erwarten kann. Stets kommt es anders, als wie man es sich denkt.
Furchtbar erschrocken fuhren die beiden Männer herum.
Hinter ihnen stand an der Wand ein Schrank, von der Größe eines normalen Kleiderschrankes, aber viel flacher Er enthielt die Apotheke des prinzlichen Arztes, in Büchsen und Gläsern die meisten der üblichen Medikamente. Die vollständig eingerichtete Apotheke eines englischen Arztes. Außerdem unten auf besonderen Regalen noch Retorten und andere chemische Gerätschaften, in denen der englische Arzt seine Rezepte selbst ausführt. Die Türen dieses Schrankes waren voll, das heißt ohne Glasscheiben. Und in diesem Schranke nun hatte es ein Geräusch gegeben. Aber was für ein Geräusch!
Ein Klirren und Brechen von Porzellan und Glas, in dem Schranke musste alles kurz und klein geschlagen worden sein.
Es war nicht viel anders gewesen, als ob der ganze Schrank umgefallen sei. Obgleich er dort ganz ruhig stand, und es war sehr die Frage, ob er sich überhaupt etwas bewegt hatte.
Aber jedenfalls konnte in dem Schrank nicht mehr viel Ganzes vorhanden sein.
Ein schrecklicher Lärm von Zusammenstößen und Zerbrechen von gläsernen Sachen war es gewesen.
»Um Gottes willen, Kind, was machst Du!«, rief der Prinz erschrocken, sprang hin, drehte den Schlüssel um und öffnete gleichzeitig beide Türen.
Da aber war von der Ursache des Höllenspektakels nichts zu bemerken!
Wohlgeordnet und unversehrt standen alle die Büchsen und Gläser und Retorten und Kochflaschen in Reih und Glied auf den Regalen!
»Da, Leutnant, das war einmal so ein echtes Spukphänomen!«
»Spukphänomen? Das war also nur eine Gehörshalluzination.«
»Gehörshalluzination?«, echote jetzt auch der Prinz.
»Es kann doch nichts anderes gewesen sein. Es ist doch gar nichts zerbrochen.«
»Ja, aber das Geräusch des Zerbrechens haben wir doch wirklich gehört.«
»Ich glaube nicht. Das war nur eine Vortäuschung, nur in diesem Zimmer möglich ...«
An der Tür klopfte es.
Es war der Matrose Hein.
»Ich wollte nur fragen, ob hier etwas umgefallen und zerbrochen wäre.«
Hinter dem Matrosen standen hilfsbereit noch zwei Cowboys, von dem Spektakel angelockt. Sie alle hatten es draußen auf dem Korridor und noch viel weiter entfernt gehört.
Sie konnten wieder gehen.
»Und dennoch kann das doch nur ...«
»Leutnant, lassen wir doch lieber diese Erklärungen! Ja, wo ist denn die Klingel geblieben?«

Die stand nicht mehr auf dem Tische.
»Deasy, wo ist die Klingel?«
»Ich — weiß — nicht!«, erklang es recht schläfrig.
»Weißt Du, dass es hier in dem Schranke so gekracht hat?«
»Ja. Bist Du böse, lieber Onkel?«
»Durchaus nicht. Aber wie hast Du das gemacht?«
»Ich ... weiß nicht.«
Es wäre auch ganz zwecklos gewesen, zu fragen, weshalb sie das getan hätte. Kein Medium kann in diesem Zustande seine Handlungen kontrollieren. Weshalb nicht, werden wir später sehen.
Da ertönte ein lautes Klingeln, direkt über ihnen. Wie die beiden zu der weißgetünchten Decke emporblickten, sahen sie dort oben die gesuchte Glocke, aber bereits im Fallen begriffen.
Mit natürlicher Geschwindigkeit fiel sie herab, direkt auf Schwarzbach zu, der erschrocken den Kopf zur Seite neigte, da er glaubte, heftig ins Gesicht getroffen zu werden, was sonst wohl auch geschehen wäre.
Oder auch nicht.
Der Prinz sah noch ganz deutlich, wie im letzten Augenblick der schnelle Fall in freier Luft fast ganz aufhörte, wie gebremst wurde, und ganz leise setzte sich die Glocke auf Schwarzbachs linke Schulter.
Übrigens begann es jetzt doch schon etwas dunkel zu werden. Es war fünf Uhr im Dezember.
»Kannst Du Dich sichtbar machen, Deasy?«
»Nein.«
»Deinen Astralleib meine ich.«
»Nein.«
»Weißt Du jetzt, was ich unter Astralleib verstehe?«
»Ja.«
»Kannst Du diesen Astralleib bewegen, wie Du willst?«
»Ja — nein — ja — nein ...«, erklang es zögernd.
Sie war dieses ihres zweiten Ichs so wenig vollkommen Herr wie den Bildern in ihren Träumen oder wie überhaupt ihrer eigenen Person im Traume.
Und das ist es auch, worauf es hierbei ankommt, wie alles das zu erklären ist! Worüber aber erst später gesprochen werden soll.
Jedenfalls also konnte sie ihre Handlungen nicht kontrollieren und war dafür nicht verantwortlich zu machen, so wenig wie für ihre Träume im normalen Schlafe.
»Können wir ...«
Schon der Gedanke hatte genügt, die Frage brauchte nicht wörtlich gestellt zu werden, und sie wurde sofort durch eigene Tat bejaht.
Plötzlich flammte an der Decke das elektrische Licht auf. Der neben der Tür befindliche Schaltegriff war von unsichtbarer Hand umgedreht worden.
Gegen künstliches Licht irgendwelcher Art, auch gegen das blendendste, zeigten sich die Medien viel weniger empfindlich als gegen Sonnenlicht, und wenn es auch noch so gedämpft wird.
Der Prinz nahm ein Stück Bindfaden von einem halben Meter Länge.
»Kannst Du in diesen Bindfaden einen Knoten knüpfen?«
»Ja ... nein ...«
»Bedarfst Du hierzu erst Vorbereitungen?«
»Ja.«
»Was für welche?«
»Auf dem Schreibtisch steht eine Zigarrenkiste, lege den Bindfaden hinein.«
Der Prinz öffnete die Kiste, die zur Hälfte noch mit Zigarren gefüllt war.
»Wie viele Zigarren sind das?«
»Sechsundzwanzig!«, erklang es sofort.
Sie wurden gezählt, es stimmte.
Dabei hatten beide die Anzahl auf mindestens vierzig geschätzt. Es kam daher, weil die Zigarren lose und durcheinander darin lagen.
Zunächst tat der Prinz noch Weiteres, band den Faden mit seinen beiden Enden zusammen, zündete ein Stearinlicht an, nahm eine Stange Siegellack, machte auf den Knoten einen tüchtigen Klecks, drückte in den Lack sein Petschaft und ließ es erkalten.
So war also eine Schnur ohne Ende entstanden.
Der Prinz sagte nichts weiter, wollte es gleich darauf ankommen lassen, legte diesen Bindfaden in die leere Kiste, schloss den Deckel und ließ sie auf dem Tische stehen.
»Nun, bitte, Deasy, knüpfe in den Bindfaden einen richtigen Knoten.«
Einige Zeit verging.
Da stöhnte das Kind wieder schmerzlich, bewegte sich so, als wolle es sich auf dem Sofa umdrehen.
»Stört Dich das Licht? Soll ich es ausdrehen?«
»Nein. Bedecke mein Gesicht.«
Ein großes, schwarzes Tuch war vorhanden, der Prinz hüllte den Kopf des Kindes damit ein.
»Den ganzen Körper, bitte.«
Es geschah, bis auf die Füße, welche vom Sofa noch herabhingen, ohne den Boden zu berühren.
Das Stöhnen hörte auf, nur manchmal zuckte es noch unter dem schwarzen Tuche.
Plötzlich wurden die beiden von einem tüchtigen Sprühregen überschüttet, der von der Decke kam.
Wie sie sich aber gleich überzeugten, waren sie nicht im Geringsten nass geworden, was sonst unbedingt der Fall hätte sein müssen, wenn das mit natürlichen Dingen zugegangen, wenn das überhaupt richtiges Wasser gewesen wäre.
»Da sieht man«, sagte Schwarzbach, wieder zur Decke emporblickend, »dass dies alles nur Illusion ...«
Quatsch! Er hatte einen tüchtigen Klatsch Wasser ins Gesicht bekommen, dass er nur so triefte.
»War das auch nur eine Illusion?«, lachte der Prinz, und er konnte schon wieder aus vollem Herzen lachen.
Schwarzbach zog schnell sein Taschentuch und trocknete sich das triefende Gesicht, den ganzen Kopf.
»Nee, das war keine Illusion, nun weiß ich aber wirklich nicht mehr, was ich davon denken soll!«
»Überlassen wir das Denken und Erklären nur anderen, wir wollen jetzt einfach beobachten.«
Da wurde die Zigarrenkiste mit Vehemenz vom Tisch geschleudert, wobei der Deckel aufging, der Bindfaden kam halb zum Vorschein.
Der Prinz hob ihn auf.
Der Lack umgab noch die zusammengeknüpften Enden, das Siegel war unverletzt, und in die Mitte des Fadens war ein regelrechter Knoten geschlagen.
Das kann kein Taschenspieler nachahmen, ist überhaupt nicht möglich, ohne dass das Siegel zerbrochen, die Enden also wieder aufgeknüpft werden oder der Faden anderswo geöffnet, zerschnitten wird.
Dieses Phänomen lässt sich nur mit Hilfe einer vierten Dimension erklären, also unter der Annahme, dass es noch eine andere Dimension gibt als die drei uns bekannten: Höhe, Länge und Breite, und dass es Wesen gibt oder einen Zustand des Menschen, in welchem er diese vierte Dimension beherrscht, verwenden kann.
Hiervon kann man sich keine Vorstellung machen, es geht über unsere Begriffe, eben über unser Vorstellungsvermögen. Wohl aber kann man sich vorstellen, dass es Wesen gibt, welche nur über zwei Dimensionen verfügen, die also nur mit Punkt und Linie arbeiten können. Für diese wäre es unmöglich, in einen Faden einen Knoten zu knüpfen, das bedeutete für diese Wesen ein unbegreifliches Phänomen.
Am deutlichsten erklärt das Wesen oder doch die Möglichkeit solch einer vierten Dimension Professor Friedrich Zöllner in seinen »Wissenschaftlichen Abhandlungen«, der berühmte Astronom, der selbst dieses Phänomen von dem amerikanischen Medium Slade schier zahllose Male unter den schwierigsten Bedingungen hat ausführen lassen.
»Was sagen Sie hierzu?«
Schwarzbach untersuchte alles aufs Sorgfältigste, löste den Knoten, das heißt so weit, dass er ihn auf dem Faden hin und her schieben konnte. Richtig aufknüpfen konnte er ihn ja nicht, oder er hätte das Siegel zerbrechen und die beiden Enden aufknüpfen müssen.
»Hm, wie mag die das nur gemacht haben, die Enden zu lösen, ohne das Siegel zu zerbrechen?«
»Sie meinen das Kind dort auf dem Sofa?«
»Nein, o nein, Deasy ist natürlich nicht aufgestanden — da ist eine andere Kraft im Spiele, das gebe ich schon zu — aber irgendwie muss die geschlossene Schnur doch erst geöffnet worden sein, sonst kann man doch keinen Knoten hineinknüpfen, das müssen Sie doch auch zugeben, oder sonst ginge das doch gegen den gesunden Menschenverstand.«
Wehe, wer das, was er nicht begreifen kann, mit seinem sogenannten gesunden Menschenverstand erklären will! Über kurz oder lang verfällt er rettungslos der Lächerlichkeit! Einer unserer größten Denker und Dichter hat gesagt: Die Geschichte des sogenannten gesunden Menschenverstandes ist die Geschichte seiner Blamagen.
»Ja, wenn ich die beiden Enden mit dem Siegel dabei in meiner Hand behalten könnte«, setzte der ungläubige Thomas noch hinzu, »und dann würde der Knoten hineingeknüpft, dann könnte ich es glauben.«
»Hast Du gehört, Deasy, was Herr Schwarzbach jetzt sagte?«
»Ja!«, erklang es unter dem Tuche.
»Kannst Du das unter diesen Bedingungen noch einmal ausführen?«
»Ja.«
»Es ist Dir doch auch möglich, diesen Knoten wieder aufzuknüpfen?«
»Gewiss.«
»Nun, Herr Schwarzbach, was verlangen Sie, stellen Sie Ihre Forderungen.«
»Es sollen noch zwei weitere Knoten hineingeknüpft werden.«
»Willst Du das tun, Deasy?«
»Ja.«
Also Schwarzbach nahm die beiden versiegelten Enden in seine Hand, schloss die Finger sorgfältig darüber, hielt die Schnur vor sich hin, starrte darauf, wollte nun zusehen, wie das Kunststückchen ausgeführt würde.
Einige Zeit verging, ohne dass jetzt das Kind stöhnte.
»Das kann ich nicht!«, erklang es dann.
»Weshalb nicht?«
»Nicht so. Es muss dazu entweder ganz finster sein oder Herr Schwarzbach muss seine Hand mit dem Bindfaden auf den Rücken halten und niemand darf hinsehen.«
»Aha, aha!«, spottete Schwarzbach sofort.
Jawohl, aha, aha!
Das ist so ein Grund, den die ungläubigen Herren immer hervorbringen, um zu beweisen, dass die ganze Spiritisterei nur auf irgend einem Hokuspokus beruhe. Weil so herzlich wenig im hellen Tageslicht und vor den zuschauenden Augen ausgeführt würde. Alles müsse im Finstern geschehen oder müsse verdeckt werden oder müsse sonst wie heimlich geschehen, den beobachtenden Augen verborgen.
Ganz mit Unrecht!
Können wir denn etwa eine feine Arbeit, bei der wir unsere Augen gebrauchen müssen, im Finstern ausführen?
Nun, und das psychische Ich kann eben nicht im hellen Lichte arbeiten!
Nicht umsonst spricht man von einer Nachtseite der menschlichen Seele, die hierbei in Aktion tritt.
Schwarzbach gab nach, hielt die Hand mit dem Faden hinter sich auf den Rücken.
Fast in demselben Augenblick klapperte es heftig hinter ihm. Fast erschrocken brachte er seine Hand wieder vor.
Da war aus dem geschlossenen Bindfaden der Knoten schon entfernt. Zwei weitere waren, wie gewünscht worden, nicht hineingeknüpft worden.
Wohl aber hingen an dem Faden jetzt zwei große Holzringe.
Wo kamen die her?
Bald war es erkannt.
Sie fehlten dort oben an der Gardinenstange.
Unbegreiflich war es, wie sie im Moment von dort herab, wie die beiden aus einem Stück Holz gedrechselten Ringe über den geschlossenen Faden gekommen ... doch es war ja überhaupt alles unbegreiflich.
Der Prinz zerschnitt den Bindfaden, nahm die beiden Holzringe, untersuchte sie, dass keine Naht vorhanden, legte sie in die Zigarrenkiste, stellte diese auf den Tisch.
»Deasy, kannst Du diese beiden Ringe ineinander schieben, so dass sie zusammenhängen?«
Keine Antwort.
Dafür gleich darauf hinter den beiden ein Klappern. Als sie sich umdrehten, sahen sie die Ursache.
Um ein Tischbein, das fest auf dem Teppich stand, hing ein Holzring. Er fehlte jetzt in der Zigarrenkiste. Der andere lag noch darin, aber in viele kleine Stücke zerbrochen.
Auf Kommando wird selten etwas ausgeführt. Manchmal wohl, aber selten. Das Medium will wohl den Wunsch erfüllen, aber es träumt und kann diese seine Träume nicht kontrollieren, ihnen nichts Bestimmtes vorschreiben.
Da plötzlich packte Schwarzbach, der kaltlächelnde Zweifler, jetzt aber ein ganz verstörtes Gesicht machend, den Prinzen beim Arm, als wolle er sich in Todesschreck daran festklammern.
»Da — da — unterm Sofa ... sehen Sie ...?«
Deasy lag in der linken Ecke des Sofas, das rechte Ende desselben stand schon im Schatten eines Schrankes.
Und da kam dort auf dieser rechten Seite unter den Fransen, die bis auf den Teppich hingen, eine ungeheure Hand hervor, in einem grünlich-weißen Lichte scheinend, phosphoreszierend.
Eine Hand, die einem Riesen Goliath angehören musste.
»Aha, aha«, sagte diesmal der Prinz, aber es klang nicht spöttisch, sondern frohlockend, »sie beginnt sich schon zu materialisieren, obgleich sie immer sagte, sie könnte es nicht. Weil sie eben selbst nicht daran glaubte. Jetzt kommt es von ganz allein, und das wird nun immer besser werden.«
»Aber — aber ... das kann doch nicht ihre Hand sein?!«
»Sie meinen, weil die Hand so furchtbar groß ist?«
»Das nicht, das nicht — das ginge mit Handschuhen zu machen aber sie liegt doch unter dem Tuche, die Hand ist doch wenigstens zwei Meter von ihr entfernt!«
Der Prinz warf einmal einen Blick auf den jungen Mann und schüttelte den Kopf.
Dieser junge Mann war nicht etwa beschränkt. Ganz im Gegenteil. Er repräsentierte nur gewissermaßen die ganze Menschheit, so weit sie sich die »gebildete und aufgeklärte« nennt. Er war noch mit einem gewissen Klebstoff behaftet, und um von diesem befreit zu werden, muss man erst einen Läuterungsprozess in einem Feuer durchgemacht haben, das nicht von dieser Erde ist.
Die riesige Hand, bis zum Gelenk hervorgekommen, verhielt sich regungslos.
Das Kind aber unter der schwarzen Decke begann zu wimmern.
Und in diesem Augenblick wurde der Prinz von einem gewissen Schamgefühl erfasst.
Von jenem Gefühl, das jeden rechtlichen Menschen einmal packt, wenn er solche Experimente anstellt, gleichgültig, ob die vermittelnde Person, die man benutzt, ein unmündiges Kind oder ein für sich selbst verantwortlicher erwachsener Mensch ist.
Nicht umsonst hat das Alte Testament und noch mehr der Koran alle Magie und Zauberei aufs Strengste verboten.
Es ist und bleibt ein Frevel.
Aber alles mit Unterschied.
Wer einen toten Menschen verstümmelt, begeht Leichenschändung. Aber etwa auch der Arzt mit dem forschenden Seziermesser? Bei dem kann sogar die Vivisektion entschuldigt werden! Vorausgesetzt, dass er es in ehrlicher Absicht tut, um dadurch dereinst der leidenden Menschheit helfen zu können.
Jene mit furchtbaren Drohungen verbundenen Verbote sind von weitsichtigen Männern, von Propheten, offenbar nur deshalb gegeben worden, um die große, urteilslose Menge von solchen Kunststückchen abzuhalten. Weil sie nicht reif ist, den Kern zu begreifen. Weil sie dadurch erst recht in die bodenlose Nacht des Aberglaubens versinkt und dadurch von der Wahrheit immer mehr abirrt. So wie es bei den modernen Spiritisten ganz deutlich zu sehen ist, die aus den Phänomenen, welche der aus dem Medium hervortretende Ätherleib liefert, die Seelen von verstorbenen Menschen machen, deren hanebüchenen Quatsch, den sich das Medium da zurechtträumt, für »himmlische Botschaften« nimmt, einfach aus diesem ganzen Hokuspokus eine Religion macht. Das ist dann der Anfang des Wahnsinns.
Jene aber, die mit unauslöschlicher Schrift das erste Gebot im Herzen tragen, können es ruhig wagen, den Schleier vom Bilde zu Sais zu lüften. Denen schadet es nichts, bei diesen bedeuten diese Experimente auch keinen Frevel, eben dadurch nicht, weil sie selbst sich dessen bewusst werden.
Jetzt hatte der Prinz einmal solch ein Gefühl der undefinierbaren Scham.
»Was hast Du, Deasy?«, fragte er ganz erschrocken.
»Nichts — nichts — ich fürchte mich nur!«, erklang es wimmernd.
»Willst Du aufhören?! Soll ich Dir die Locke aus der Hand nehmen?!«
»Nein — nein — bitte nicht ...«
Na, wenn das Kind selbst darum bat, dann konnte es ja weiter gehen.
»Hast Du denn Schmerzen?«
»Nein — nein — ich fürchte mich nur.«
»Wovor fürchtest Du Dich denn?«
»Weil — weil — — ich weiß nicht.«
»Weißt Du, dass unter dem Sofa eine große Hand hervorsieht?«
»Eine Hand? Nein.«
Sie wusste also gar nichts davon.
»Wo bist Du denn jetzt? Deinen Astralleib meine ich.«
»Ich — ich ... weiß nicht. Das ist es eben, wovor ich mich fürchte, ich habe so ein ängstliches Gefühl. Ah, es ist vorbei ...«
Die Riesenhand hatte sich wieder unter das Sofa zurückgezogen.
»Ach, jetzt weiß ich, ich war unter dem Sofa und streckte meine Hand hervor!«, erklang es da in ganz anderem, ruhigem Tone unter dem Tuche.
»Es war aber eine riesengroße Hand.«
»Ja? Wie ist denn das möglich?«
»Kannst Du Deine Hand jetzt noch einmal hervorstrecken?«
»Ja, jetzt kann ich es.«
»Bitte tue es. Und kann ich diese Hand anfassen?«
»Ach bitte nicht!«
»Gut, ich tue es nicht.«
Gleich darauf kam an derselben Stelle unter den Sofafransen wieder etwas Großes, Leuchtendes hervor.
Aber eine Hand war es diesmal nicht.
Sondern ein Menschenkopf von normaler Größe, weiß leuchtend, jedoch nicht eigentlich strahlend, von ganz scharfen Umrissen, so dass man ganz deutlich ein chinesisches Gesicht erkannte.
Und jetzt öffnete dieser Chinesenkopf seinen Mund, eine weiße Ratte schlüpfte heraus, lief ein kurzes Stück über den Teppich hin, schlüpfte blitzähnlich wieder zurück und in den Mund hinein, der Chinesenkopf zog sich wieder zurück.
»Nun hört aber doch alles auf!«
Wir wollen eine Erklärung zu geben versuchen, so weit eine solche hierbei möglich ist.
Diese Erscheinungen sind nichts anderes als gefrorene Träume des Mediums.
Gefrorene Träume!
Mancher Leser dürfte lächeln.
Dieses Wort ist auch nur deshalb gewählt worden, um dem Kinde einen Namen zu gehen und weil ein besonderes Gleichnis herangezogen werden soll.
Gesetzt den Fall, in dem unbekannten Innern Australiens hätte sich ein Volk selbstständig entwickelt, ohne mit der anderen Welt in Berührung zu kommen.
Das ist doch wohl denkbar.
Dieses isolierte Volk hat es auch in den Naturwissenschaften sehr weit gebracht, seine gelehrten Forscher beschäftigen sich viel mit Chemie und Physik.
Im flachen Australien gibt es weder Eis noch Schnee.
Und noch keiner dieser Forscher ist in seinem Laboratorium einmal auf den Gedanken gekommen, eine Kältemischung herzustellen.
Nun verirrt sich einer von uns in diese fremde Welt und erzählt den Leuten dort, dass es auch gefrorenes Wasser gibt, festes Wasser, Eis. Ohne dass er selbst imstande ist, durch eine Mischung von Chemikalien eine Temperatur unter 0 Grad hervorzubringen.
Gefrorenes Wasser? Was ist denn das? Festes Wasser? Das glaubst Du wohl selber nicht! Mache uns das doch einmal vor. Es ist jenem Menschen nicht möglich.
Also es wird diesen Leuten ganz und gar unbegreiflich sein, wie man Wasser fest machen kann. Es erscheint ihnen überhaupt als ein Unsinn. Sie können es einfach gar nicht fassen. Und zwar werden gerade die Gebildetsten, Gelehrtesten am meisten an so etwas zweifeln, werden über solch einen Wahnsinn spotten. —
So ist es auch hier mit diesen sogenannten spiritistischen Erscheinungen.
Vor zehn Jahren war es für die große Menge noch nicht denkbar, dass ein Mensch auf einem Apparat wie ein Vogel durch die Luft fliegen könne.
Das ist ein mechanisches Problem gewesen, welches gelöst worden ist.
Das Gefrieren des Wassers ist eine physikalische Sache.
Wird das Wasser in seine Bestandteile zerlegt, in Wasserstoff und Sauerstoff, so ist das ein chemischer Vorgang, der sich aber schon einem geistigen Prozesse nähert, besonders wenn diese Zersetzung durch den elektrischen Strom stattfindet. Denn Elektrizität ist doch keine materielle Sache mehr, und den Grund, warum sich das Wasser zersetzt, begreifen wir ja überhaupt nicht.
Diese Erscheinungen bei dem Spiritismus nun liegen auf rein geistigem Gebiet.
Das Medium, sich in einem besonderen Zustande befindend, zwischen Wachen und Schlafen, was wir Trance nennen, träumt etwas, und diesen Traumgebilden vermag es durch seine Nervenkraft — oder wie das Zeug nun sonst noch heißen mag — sichtbare Gestalt zu geben, und das kann sich weiter steigern bis zur festen, fühlbaren Masse, die selbst zugreifen und etwas heben kann, was aber nicht hindert, dass die »gefrorene« Masse sich einmal sofort wieder auflöst, schmilzt, durch eine Wand greift oder geht und jenseits sofort wieder fest erstarrt.
Für uns ist das ja freilich noch ganz unbegreiflich. Ebenso wie für jene hochgelehrten Australier das Gefrieren des Wassers. Und wenn man ihnen ein Stück Eis in die Hand gebe — — na, was dann? Das Eis zerschmilzt wieder, und dann ist eben der »Spuk« wieder vorbei.
Deshalb wurde hier von gefrorenen Träumen gesprochen.
Bis zu einem gewissen Grade kann sie das Medium kontrollieren, regeln. Weil das Publikum immer Tote wünscht, präsentiert sich die sichtbare und manchmal sogar fühlbare Traumfigur auch als der gewünschte Tote. Werden himmlische Geister gewünscht, so kommen die, aber ebenso gut auch Tiere.
Dann weiter hört die Kontrolle auf. Die Träume in diesem Zustande sind meist ebenso unregelmäßig bis zur Sinnlosigkeit wie im normalen Schlafe des Menschen. Daher auch meist die ganz sinnlosen Antworten und Auskünfte. Manchmal freilich auch höchst genial, eben Irrsinn und Genialität eng zusammengegrenzt.
Das ist die Sache!
Eine andere Erklärung gibt es vorläufig noch nicht.
Dieses mediumistisch veranlagte Kind hatte heute oder früher davon gelesen, dass Chinesen Ratten fressen, und nun träumte es davon, statt der gewünschten Hand erschien unter dem Sofa hervor ihr Traumgebilde als ein Chinesenkopf, aus dessen Munde eine Ratte huschte und wieder hineinschlüpfte. —
»Weißt Du, Deasy, dass jetzt unter dem Sofa ein Chinesenkopf hervorschaute?«
»Ein Chinesenkopf? Nein — nein — davon weiß ich nichts!«, erklang es ängstlich.
»Deasy, kannst Du mir unter dem Sofa etwas auf ein Stück Papier mit Bleistift schreiben?«
»Ja, das kann ich.«
»Oder auf einen berußten Teller mit Deinem Finger?«
»Auch das.«
Gut. Ein Teller war vorhanden, der Prinz berußte ihn über dem Stearinlicht.
»Warum das?«, fragte Schwarzbach. »Weshalb nehmen Sie nicht einfach Papier und Bleistift?«
»Das werden Sie gleich sehen. Ich ahne schon etwas. Zwar habe ich noch keine spiritistische Sitzung mitgemacht, aber schon viel über dergleichen gelesen.«
Der Teller war berußt.
»Soll ich den Teller unter das Sofa schieben?«
»Ja. Was soll ich darauf schreiben?«
»Was Du willst.«
Der Prinz kniete nieder, schob den Teller unter die Fransen — in demselben Augenblick wurde ihm der Teller aus der Hand gerissen und mit Vehemenz bis in die Mitte des Zimmers geschleudert.
Auf dem schwarzen Grunde zeigte sich eine weiße Schrift, und zwar eine ganz, ganz andere, als die das Kind besaß.
»Ich bin der Erzengel Gabriel.«
So! Nun hätten hier waschechte Spiritisten dabei sein sollen. Die wären jetzt niedergekniet und hätten dort unterm Sofa den Erzengel Gabriel als rattenfressenden Chinesen angebetet!
»Nun wollen wir gleich das Kind untersuchen, ob sich meine Vermutung bestätigt!«, sagte der Prinz, ging hin, lüftete das schwarze Tuch etwas, zog das rechte Händchen hervor — die Spitze von Deasys rechtem Zeigefinger war mit Ruß eingeschwärzt!
Was hätten nun kritische »Wissenschaftler« gesagt, wenn sie zugegen gewesen?
»Da hat man es ja! Alles Schwindel! Das Kind, unter dem Tuche versteckt liegend, hat mit dem Finger selbst auf den berußten Teller geschrieben. Hier ist doch der unumstößliche Beweis! Es hat eben mit dem Arm durch das Sofa gelangt. Wie es das gemacht hat, das ist uns ganz egal, und wenn die Entfernung auch noch mehr als zwei Meter beträgt — hier ist der Beweis, des Kindes Finger ist mit Ruß angeschwärzt!«
Nein, meine Herren, so einfach ist das nicht!
Woher das kommt, dass sich so etwas von dem materialisierten Traumgebilde, wofür wir es halten, auf das Medium selbst überträgt, kann hier nicht erklärt werden. Das würde viel zu weit führen.
Wer sich hierfür interessiert, der lese das Werk von Professor Luys, Rektor der technischen Hochschule zu Paris, »Meine Experimente mit Oberst Rochas«, Paris 1898. Da ist dieses Phänomen sehr verständlich erklärt, und da sind Experimente ausgeführt worden, die alles das, was hier beschrieben wird, weit in den Schatten stellen.
Aber etwas anderes mag hierbei noch gesagt werden.
Glaubt man denn wirklich, dass Männer wie Zöllner, der Kometenlaufberechner und Erfinder der Untersuchung des kosmischen Lichtes durch Spektralanalyse, wie Professor Crookes, der berühmte Physiker, Erfinder des Radiometers, wie Barley, der eine Methode angegeben hat, wie man bis auf den Meter berechnen kann, wo ein unterirdisches Kabel gerissen ist, und noch viele, viele solche der genialsten Männer, darunter auch Thomas Alva Edison — kann man denn wirklich glauben, dass sich solche Männer jahrelang in ihrem eigenen Laboratorium von einem kleinen Kinde oder irgend einer hysterischen Frauensperson an der Nase herumführen lassen?!
Es ist geradezu eine Albernheit, so etwas anzunehmen! Dann glaubt man doch lieber ganz einfach an Gespenster!
Aber jeder kann sich auch selbst von der Realität solcher Phänomene überzeugen. Man muss es sich nur einmal ein paar Taler kosten lassen. Doch besser ist es, man geht nicht in solche spiritistische Cercles, wo ja allerdings dem Betruge alle Türen geöffnet sind und wo man nur den passiven Zuschauer spielt. Man kann es auch selbst arrangieren. Gute Medien sind überall zu finden, man muss nur suchen. Dann aber handelt es sich darum, durch den eigenen, lauteren Charakter deren Vertrauen zu gewinnen. Solche abnorme Geisteskinder fühlen sich meist höchst unglücklich und sind sehr menschenscheu. Denn sie wissen schon, dass sie, wenn sie in die Öffentlichkeit treten, doch einmal als Schwindler entlarvt werden. Denn das bleibt nie aus. Einmal wird jedes Medium »geklappt«. Denn zuletzt betrügen sie alle. Unbewusst. Wie das zu verstehen ist, soll dann gleich gezeigt werden. Denn auch Deasy sollte zuletzt noch als kleine Schwindlerin überführt werden.
»Deasy, kannst Du Deine Hand einmal in Wasser tauchen?«
»Ja, das kann ich.«
Schnell traf der Prinz seine Vorbereitungen. Es sollte kein gewöhnliches Wasser sein, in welches solch ein Wesen seine Hand oder etwas anderes tauchte.
Der Prinz holte aus seinem angrenzenden Schlafzimmer ein Waschbecken, wärmte auf einem Spiritusapparat das nötige Wasser, die Temperatur mit dem Thermometer prüfend, schmolz ein Stück Paraffin und goss es hinein, wo es als ganz dünne Schicht auf dem Wasser schwamm, vorläufig noch flüssig.
Deasy erklärte sich damit einverstanden, in diese Waschschale ihre Hand zu tauchen. So weit sie das eben jetzt bestimmen konnte. Jedenfalls war sie willens dazu. Vielleicht kam wieder etwas ganz anderes, aber das war nun einmal nicht zu ändern. Es musste versucht werden, was möglich war.
»Soll ich die Schale unter das Sofa schieben?«
»Nein.«
»Wohin sonst?«
»Setze sie dort auf den Tisch und stülpe den großen Kasten darüber, der in der Ecke steht.«
Es geschah. Doch kaum hatte der Prinz den leeren Holzkasten, eine Kiste, die Glas enthalten hatte, über die Schale gesetzt, als sie auch schon fast sofort wieder herausgeschleudert wurde, auf den Boden polterte und Schwarzbach ziemlich schmerzhaft ans Schienbein traf.
Und da schwamm auf dem Wasser eine kleine Hand! Nur aus einem ganz, ganz dünnen Paraffinhäutchen bestehend, also innen hohl.
Hätte ein Mensch seine Hand in dieses Wasser getaucht, so wäre über derselben beim Zurückziehen gleichfalls solch eine dünne Paraffinschicht entstanden, die auch sofort erhärtet wäre.
Aber niemals hätte solche ein Gebilde wie dieses hier entstehen können. Die Hand war nämlich noch über das Gelenk hinaus eingetaucht. Nimmermehr hätte sie eine menschliche Hand herausziehen können, ohne diese ganz dünne Schicht zu zerbrechen.
Es war eine sehr kleine, linke Hand, die auf dem Wasser schwamm. Man brauchte sie nicht erst herauszufischen, alles war auch so deutlich erkennbar.
Die feinsten Hautporen hatten sich scharf abgedrückt, auch von außen ganz deutlich erkennbar.
Oben auf dem Handrücken war etwas wie eine kleine Narbe.
Und auf der linken Seite war eine kleine Erhöhung, wie eine kleine Warze.
Und das stimmte alles, wie man sich ja sofort überzeugen konnte.
Deasy hatte oben auf der linken Hand eine kleine Schnittnarbe, und an der linken Seite gegenwärtig eine kleine Warze!
Sie hatte ihre eigene Hand in die Flüssigkeit getaucht! Natürlich konnte es nicht ihre reelle Hand gewesen sein. Das Kind lag auf dem Sofa, der Tisch stand reichlich drei Schritte von dem Sofa entfernt. Ganz abgesehen von der darüber gestülpten Kiste und der Gedankenschnelle, mit der das ausgeführt worden war.
Da, wie die beiden noch die Hand des Kindes, das jetzt wirklich zu schlafen schien, betrachteten, erscholl ein dreimaliges Klopfen.
Sofort blickten die beiden Männer nach der Tür, an welcher nur geklopft sein konnte, und dann sich gegenseitig an, etwas furchtsam oder doch bestürzt.
Da nochmals das dreimalige Klopfen.
Gewiss, das konnte nur an jener zweiten Nebentür sein! Und diese Tür führte in einen kleinen Raum, der zum fotografischen Dunkelkabinett eingerichtet worden war, und dieser Raum hatte sonst weiter keinen anderen Eingang.
Das war eben das Merkwürdige dabei.
Dort drin konnte niemand sein, und doch klopfte es gegen die Tür.
Und zwar jetzt zum dritten Male.
»Herein!«
Die Tür öffnete sich nicht, nichts geschah, nur das Klopfen wiederholte sich immer wieder, noch energischer.
»Gehen Sie mal hin, Schwarzbach, sehen Sie nach, was da klopft!«, sagte der Prinz, noch des Kindes Hand untersuchend, um zu konstatieren, dass keine Spur von Paraffin daran haftete. Denn das war diesmal nun gerade nicht der Fall, dass sich die Hand mit Paraffin befleckt hätte.
Aber Leutnant Schwarzbach hatte keine Lust, die Tür zu öffnen und nachzusehen, was da klopfe.
»I der Deiwel, Hoheit, was mag denn das sein, was da drin klopft?«, flüsterte er ganz zaghaft.
Also er fürchtete sich.
Und das war begreiflich.
Sonst war dieser junge Mann alles andere als ein Feigling.
Aber er wusste, dass dies das Dunkelkabinett war, ohne weiteren Zugang, es war dort drin stockduster — es hatte sich etwas, da ohne Weiteres hinzugehen, die Türe zu öffnen und hineinzublicken!
Wer wusste denn, was man da Ungeheuerliches erblickte?
Und wer hierüber anders denkt, der ist ein Renommist. Mindestens musste der junge Mann erst sozusagen einen moralischen Anlauf nehmen.
Ehe er aber hiermit fertig war, war der Prinz schon gegangen.
Gerade klopfte es innen noch einmal gegen die Tür.
Schnell öffnete der Prinz die Tür, die nach innen aufging.
Er blickte in einen stockfinsteren Raum, der durch das hohe Deckenlicht dieses Arbeitszimmers nur in der allerersten Zone etwas erhellt wurde.
Nichts war zu sehen.
»Ist jemand hier?«
Keine Antwort.
Der Prinz drehte den neben der Tür befindlichen Schalter, das elektrische Licht flammte auf.
Nichts anderes als die Einrichtung des fotografischen Kabinetts war zu sehen.
Der Prinz drehte das Licht wieder aus, wollte die Tür wieder schließen, um zu sehen, was aus dieser Klopferei weiter werden würde.
Aber er konnte die Tür nicht wieder schließen.
Wohl vermochte er sie zurückzuziehen, aber nur unter großer Kraftanstrengung. Es war nicht anders, als ob jemand hinter der Tür stehe und sie festhalte.
Er drehte wieder das Licht an und blickte hinter die Tür.
Nichts zu sehen.
Licht aus und die Türe zu schließen versucht.
Wieder dieser seltsame Gegenzug.
Im Finstern hinter die Tür geblickt — keine weiße Gestalt und gar nichts.
»Hoheit, sehen Sie da!«, rief da Schwarzbach leise.
Schnell drehte sich der Prinz um.
Hinter der Sofalehne war dort, wo Deasys Kopf lag, eine weiße Hand hervorgekommen, fein und schlank, aber nicht die des Kindes, dazu war sie zu groß, und sie fasste das schwarze Tuch, welches etwas von Deasys Gesicht gerutscht war, wenigstens die Stirn war entblößt worden, und zog es wieder vollends darüber.
Dann zog sich auch die weiße Hand wieder hinter der Sofalehne zurück.
Ein ganz gewöhnlicher Vorgang, dass der »Geist« sein Medium vor Licht zu schützen sucht.
Der Prinz war näher gekommen, um sich diese Hand genauer zu betrachten.
Da wurde er von Schwarzbach wieder am Arme gepackt.
Er deutete mit bestürztem Gesicht nach jener Tür, die offen geblieben war.
Wie sich der Prinz umdrehte, sah er aus dem Kabinett eine weiße Gestalt hervortreten.
Niemand anders als Deasy selbst!
Ganz genau so gekleidet wie die auf dem Sofa liegende, im kurzen Kleidchen mit einer Schürze, nur eben alles weiß, farblos — eben ätherisch, aber doch alles von den schärfsten Umrissen.
So schritt sie auf ihren derben Stiefelchen durch das Zimmer, natürlich völlig geräuschlos, fest auftretend und dennoch mehr ein Schweben — ein Gang, den überhaupt gar kein irdischer Mensch nachmachen kann, auch nicht die trainierteste Balletteuse — auch im vollen Schein des elektrischen Lichtes noch immer ätherisch, geistig bleibend, menschlich aber doch insofern, als sie den beiden Männern zunickte, zulächelte, ihnen mit der Hand zuwinkte — so schritt sie durch das Zimmer nach dem Sofa, beugte sich über ihre Doppelgängerin, beschäftigte sich mit ihr, und gleich darauf erhob sich die eigentliche Deasy.
Nun hatte man den wundersamen Anblick, ein und dieselbe Person in zwei Ausgaben nebeneinander zu sehen. Deasy aus Fleisch und Blut und daneben ihre Doppelgängerin. Nur dass die eine ein farbiges Kleid trug, überhaupt natürliche Farben zeigte, die andere ein weißes, durchgeistigtes, ätherisches Wesen war. Und dann dass die eigentliche Deasy den Kopf verhüllt hatte. Ihre geistige Doppelgängerin hatte ihr das schwarze Tuch sorgfältig um den Kopf gewickelt, mit ganz normalen Händen und Griffen, ganz deutlich hatte man es gesehen.
So schritten die beiden durch das erleuchtete Zimmer nach dem Dunkelkabinett, Hand in Hand, die körperliche Deasy etwas taumelnd, ihre geistige Doppelgängerin frei und sicher. Sie spielte die Führerin ihres leiblichen Ichs.
In der Tür drehte sich das geistige Wesen noch einmal um, lächelte und winkte nach den beiden Männern zurück, dann waren die beiden ganz gleichen und doch so verschiedenen Gestalten hinter der rechtwinklig aufstehenden Tür verschwunden.
Die beiden Männer hatten wie in einem Banne dagestanden, ihren Augen nicht trauend, nicht zu atmen wagend.
»Sapristi!«, brach Schwarzbach endlich das Schweigen. »Ja, nun muss man glauben, dass auch noch heute Wunder geschehen!«
Eine landläufige Redensart, nichts weiter. Der junge Mann hatte in dieser Stunde ja schon Wunder genug gesehen.
»Eine perfekte Spaltung des leiblichen und des geistigen oder seelischen Ichs!«, sagte der Prinz.
»Was wollen die in der Dunkelkammer?«

»Deasy hat den Wunsch gehabt, sie zu benutzen, um uns noch andere Phänomene vorzuführen, dazu muss sie als Medium vollständig im Dunkeln sich befinden, das hat sie aber nur mit ihrem unbewussten Ich erkannt, deshalb kam sie auch gar nicht auf den Gedanken, uns zu sagen, wir sollten sie in das Dunkelkabinett bringen, so hat sie durch ihren Astralkörper diese Absicht gleich vollkommen ausführen lassen, hat sich selbst zu helfen gewusst.«
Jedenfalls eine ganz richtige Erklärung.
»Wo sind die beiden geblieben?«
Zweifellos saß jetzt Deasy in dem Lehnstuhl, der gleich hinter der Türe stand.
Schwarzbach zog seine elektrische Taschenlampe, hatte Lust, einmal hineinzuleuchten.
»Um Gottes willen nicht!«, hielt ihn der Prinz zurück. »Das Kind hatte sich doch eben in die Finsternis zurückgezogen, weil das Licht es stört, ihm weh tut.«
Und da tauchte dort im Dunklen auch schon wieder eine weiße Gestalt auf, trat heraus in den Lichtschein.
Aber nicht etwa wieder die geistige Doppelgängerin von Deasy.
Jetzt fingen die spiritistischen Materialisationen erst richtig an, das Kind hatte unbewusst alles selbst arrangiert.
Es war ein mittelgroßer Araber mit schwarzem, herabhängendem Schnurrbart.
Mit schwarzem Schnurrbart, sagen wir.
Obgleich die ganze Gestalt doch nur aus weißem Licht bestand.
Aber es ist schon einmal gesagt worden, damals bei den Nebelgestalten, dass man in solchen Fällen dennoch die Farben unterscheiden kann.
Man muss annehmen, dass unser Auge auch noch eine andere Empfänglichkeit für Farbenunterschiede hat als die unter normalen Verhältnissen übliche. Bei solchen spiritistischen Erscheinungen kommt diese Fähigkeit zum Vorschein. Mehr kann hierüber jetzt nicht gesagt werden.
Also es war ein mittelgroßer, schlanker Mann mit schwarzem Schnurrbart, ein brünetter Araber, mit Turban, daran mit diamantfunkelnder Agraffe ein Reiherbusch befestigt, ein Ritter, ein Sarazene in silbernem Schuppenpanzer, aber eben doch ganz orientalisch, mit krummem Schwert, dessen Griff ebenso wie die im goldenen Gürtel steckenden Dolche von Edelsteinen funkelte, vom Rücken herab wallte ein Pantherfell ...
»Sultan Saladin!«, flüsterte der Prinz außer sich.
Ja, es war dieselbe Gestalt, die damals im Nebel auf weißem Rosse an ihm vorüber geritten war!
Und bestürzt wich der Prinz zurück.
Denn mit majestätischem Gange, schwebend und dennoch wie ein Löwe schreitend, ging die Gestalt direkt auf ihn zu, ihm die Hand entgegenstreckend.
Wer weiß, wie es gekommen wäre, was die beiden noch alles erlebt hätten. Denn wahrscheinlich wäre es doch nicht bei dieser einzigen Geistergestalt gebliebe. Jedenfalls wären jetzt auch Offenbarungen gekommen.
Leutnant Schwarzbach sollte alles verpfuschen.
Gott wusste, was dem jungen Manne plötzlich einfiel.
Vielleicht, dass er die Schlappe wieder gut machen wollte, die er sich dadurch geholt, dass er sich vorhin gefürchtet hatte, die Tür des Dunkelkabinetts zu öffnen.
Kurz und gut, kaum war die weiße Gestalt an ihm achtlos vorübergeschritten, als Schwarzbach von hinten zupackte!
Da war die weiße Gestalt plötzlich verschwunden!
Aber nicht etwa, dass sie sich in nichts aufgelöst hätte.
Es war die kleine Deasy, die Schwarzbach plötzlich in den Händen hielt.
Und nicht etwa ihre geistige Doppelgängerin, sondern Deasy in Fleisch und Blut, in ihrem Spielkleidchen mit Schürze, noch etwas schmutzig von der Gartenarbeit.
Sie war als kleine Schwindlerin entlarvt worden. —
Und so werden die spiritistischen Medien einmal entlarvt, des Betruges überführt!
So ist auch im Jahre 1880 die Florence Cook als Schwindlerin entlarvt worden, nachdem Professor Crookes und Barley jahrelang mit ihr einwandfrei experimentiert hatten.
In einer späteren Sitzung von Gelehrten funktionierte sie als Medium, aus dem Dunkelkabinett trat eine alte Frau in wallenden Gewändern heraus, die behauptete, eine Hofdame der Königin Maria Stuart gewesen zu sein. Jemand packte zu ... und hatte die Florence Cook in Händen, im Unterrock und Korsett.
So ist auch im Jahre 1884 der Amerikaner Bastian von dem Erzherzog Johann — dem späteren Johann Orth — als Betrüger entlarvt worden, was damals ein so kolossales Aufsehen hervorrief.
Baron Lazar von Hellenbach, damals der bedeutendste Okkultist, hatte auf Wunsch des Kronprinzen Rudolph eine spiritistische Sitzung arrangiert, sie fand in der Wohnung des Erzherzogs statt, als Medium funktionierte der Amerikaner Bastian.
Obgleich alle die Herren ihr Ehrenwort gegeben hatten, nicht einzugreifen, da dies dem Medium sehr schaden könnte, wurde, als aus dem Dunkelkabinett eine weiße Gestalt trat, aber schon die fünfte, durch eine Schnur die Verbindungstür zugeschlagen, jemand packte zu und hatte Herrn Bastian in den Händen!
Nun war der ganze spiritistische Schwindel aufgedeckt!
Erzherzog Johann schrieb darüber eine Broschüre, welche den ganzen Spiritismus vernichten sollte — nicht wissend, was er damit der Sache des Spiritismus für gute Dienste leistete.
Erzherzog Johann war doch gar nicht der Mann danach, um diese Sache geistig zu erfassen. Das hat am besten seine Bibliothek bewiesen, die dann versteigert wurde.
Überdies hatte Baron Hellenbach von vornherein erklärt, dass man, wenn man zugreife, zweifellos das Medium in Händen haben würde.
Und wo waren denn nun die weißen, wallenden Gewänder geblieben? Bastian musste sich sofort entkleiden, man hat ihn bis unters Hemd untersucht und absolut nichts gefunden.
Abgesehen davon, dass Bastian fünf Fuß zwei Zoll maß und einen kurzen Vollbart hatte und dass einmal ein Inder von sieben Fuß Höhe kam, ein andermal wieder ein kleines Mädchen im kurzen Kleidchen.
Ja, wie ist das aber nun möglich, dass da irgend eine ätherische Gestalt kommt, die mit dem Medium absolut keine Ähnlichkeit hat, die Körpermaße stimmen gar nicht, und wenn man zupackt, hat man plötzlich das Medium in Händen?
Das ist eines der tiefsten Geheimnisse bei dieser ganzen Sache.
Man nennt es Transfiguration. Es gibt verschiedene Erklärungen dafür, die sich aber ganz widersprechen.
Jedenfalls kann dieser »Schwindel« bei jeder spiritistischen Sitzung vorkommen.
Das Medium besitzt eben zwei Möglichkeiten, solche Gestalten hervorzubringen. Entweder es lässt aus seinem Körper den Astralleib treten, was wir »gefrorenen Traum« genannt haben, oder es transfiguriert direkt seinen ganzen Körper auf eine Weise, von der wir uns keine Vorstellung machen können und was wir auf dieser irdischen Ebene wohl auch niemals begreifen werden. Jedenfalls eine Dematerialisation, was aber schließlich doch nur ein leeres Wort ist.
Und diese Transfiguration scheint für das Medium der bequemere Weg zu sein, um seinen Zweck zu erreichen, fremde Gestalten hervorzubringen. Sobald das Medium nicht sorgfältig beobachtet und in Gewahrsam genommen wird, dass es seinen festen Platz nicht verlassen kann — wobei aber kein Binden und Fesseln nützt, mit seinen Astralhänden löst das Medium alles sofort auf — benutzt es regelmäßig diese Transfiguration.
Greift man dann die Gestalt, so hat man regelmäßig das Medium in Fleisch und Blut in Händen.
Von einem Schwindel und Betrug ist dabei natürlich gar keine Rede.
Im Gegenteil, hierbei offenbart sich die phänomenalste Fähigkeit des magischen Seelenlebens.
Hiermit wollen wir die erklärenden Abhandlungen schließen und wieder den Boden des Romans betreten.
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.