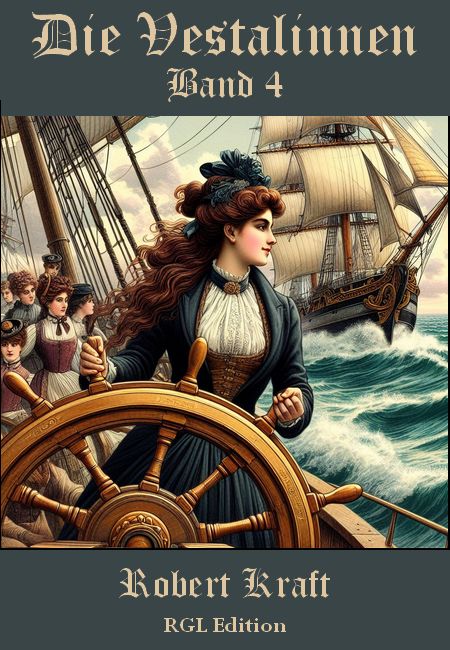
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.
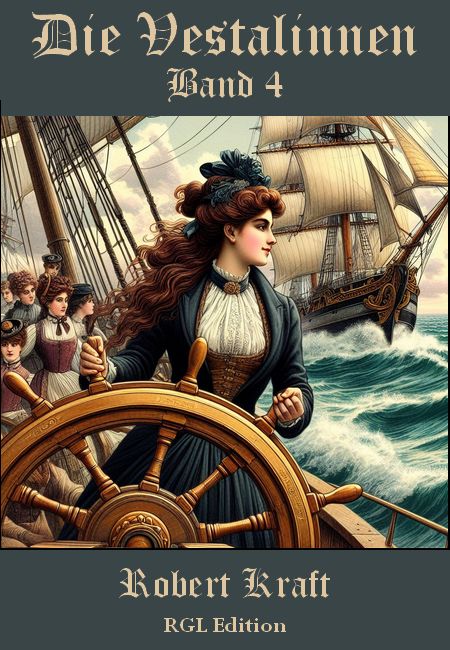
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software


"Die Vestalinnen," Illustierte Ausgabe, 1924
Das Land war damit beschäftigt, sich aus den Gerüchten, welche täglich die Zeitungen brachten, ein Ganzes zusammenzusetzen, aber aus den Gerüchten wurden Tatsachen, und man erfuhr, daß nichts erlogen war.
Am meisten war dabei eine große, blühende Stadt am Rhein interessiert, denn der sensationelle Roman, wie er nicht besser erdacht werden konnte, spielte sich unmittelbar in ihrer Nähe ab, auf jenem Schlosse, welches hoch auf dem Felsen den Rhein übersah, dessen Besitzer einst die Schutz- und Schirmherren der Stadt gewesen waren, ein edles und beliebtes Geschlecht.
Wochen auf Wochen waren vergangen, ehe der Roman zum Abschluß kam, schließlich aber lag alles offen vor den Augen der Welt, und amtliche Berichte bestätigten die anfänglichen Mutmaßungen.
Freiherr Rudolf von Schwarzburg war gestorben, sein Sohn Johannes, der bei der Kaiserlichen Marine als Kadett die Seeoffizierskarriere begonnen, hatte an seinem Sterbebette gestanden und den letzten Segen empfangen; die Stadt trauerte um ihren Schirmherrn, aber vergebens erwarteten die Bürger den neuen Freiherrn, um ihm zujauchzen zu können — er ließ sich nicht sehen.
Und doch war es nicht der Schmerz um den verlorenen Vater, welcher den Sohn zurückhielt! Woher das Gerücht kam, wo es entstanden war? Man wußte es nicht. Aber mit Blitzesschnelle durchlief die Nachricht die Stadt, Johannes sei gar nicht der Sohn des alten Freiherrn, er sei ein untergeschobenes Kind. Oben im Schlosse befände sich ein Mann, welcher dies haarscharf bewiese und Zeugen anführe, welche dies eidlich bekunden würden.
Noch war man sich nicht darüber einig, ob man dies glauben sollte oder nicht, als schon wieder ein neues Gerücht unter die Menge gesprengt wurde.
Eine Karosse war vor das Schloß angejagt gekommen, einige ältliche Herren ihr entstiegen, einen jungen Mann, der sich zu sträuben schien, mit sich schleppend, und wenige Minuten später hatte sich schon wieder die Nachricht verbreitet, der richtige Sohn des Freiherrn wäre gefunden, in einigen Wochen würde erwiesen sein, daß er wirklich Anrechte auf das Majoratserbe des Freiherrlichen Geschlechts derer von Schwarzburg zu erheben habe.
Diese einigen Wochen waren vorüber, und es hatte sich alles bewahrheitet. Nach und nach erfuhr man das Staunenswerte vollkommen, ohne daß noch Zweifel aufsteigen konnten.
Emil von Schwarzburg, dessen fluchwürdiger Sohn wegen Wechselfälschung im Zuchthaus saß, dieser Auswuchs des edlen Geschlechtes, hatte die Amme von Johannes bestochen, ihm ein anderes Kind unterzuschieben und ihn in Pflege einer Frau zu tun, welche Kinder dunkler Herkunft aufzog.
Diese Pflegemutter lebte noch, und vor Gericht machte sie Aussagen, welche den Betrug bestätigten. Ebenso fand man Papiere bei dem in Mgwana verstorbenen Freiherrn Emil, aus denen die Wahrheit ersichtlich war.
Die Amme selbst war zwar noch nicht aufzufinden, vielleicht war sie tot, vielleicht nur verschollen, doch brauchte man sie nicht, um Hannes Vogel, den Matrosen, als Majoratsherrn proklamieren zu können; er hatte warme Freunde, die energisch für ihn auftraten.
Kein Streit war zwischen den beiden Rivalen entstanden.
Als der ehemalige Freiherr, der Seekadett, noch tiefbetrübt über den Tod seines vermeintlichen Vaters, von dem wirklichen Sachverhalt erfahren, war er wohl eine Zeitlang niedergeschlagen, dann aber nahm er die dargebotene Hand des neuen Freiherrn und erwiderte den herzlichen Druck derselben. Er war ein Mann, kein empfindsames Kind, das über eine Laune des Schicksals in Tränen ausbricht.
Der Seekadett verwünschte nicht seine Geburt, er bejammerte nicht sein Los, auch zürnte er nicht dem jungen Manne, der nun an seine Stelle trat, noch dessen Ratgebern, er zürnte höchstens den Personen, welche sich mit frevelnder Hand in sein Schicksal gemischt hatten. Doch derjenige, der die Hauptschuld daran trug, war tot, er lag in fremder Erde, gleich einem Abenteurer, der hinter einem Busch sein Leben aushaucht, und das Herz des Seekadetten war edel, es verzieh auch diesem irrenden Manne.
Die beiden jungen Männer, die sich einst schon in Batavia im Garten des Holländers als Rivalen gegenübergestanden und dann noch einmal bei der Ersteigung des Berges in Neu-Seeland, während deren es dem Seekadetten zum Bewußtsein gekommen war, daß er diesem fröhlichen Matrosen gegenüber keine Hoffnung bei der jungen Amerikanerin zu erwarten habe, befanden sich lange allein in einem Zimmer, und als sie dasselbe wieder verließen, da gingen sie Arm in Arm, und ihre Züge waren ernst und heiter zugleich — innerhalb einer halben Stunde waren sie Freunde geworden, die sich offen aussprachen, und von denen der eine vom anderen ein Geschenk anzunehmen, sich nicht schämte.
Johannes blieb Seekadett, und so lange er Unterstützung gebrauchte, erhielt er dieselbe vom neuen Freiherrn. Das offene Anerbieten von Hannes, alles miteinander zu teilen, schlug er dagegen energisch aus.
Dann war das Nächste, was der Kadett tat, daß er seine noch lebenden Eltern aufsuchte, einfache, in ärmlichen Verhältnissen lebende Handwerksleute, die ihren ersten Sohn als Säugling auf rätselhafte Weise verloren hatten.
Sie wurden auf den Empfang des wiedergefundenen Sohnes vorbereitet. Wohl jauchzte das Herz der Mutter beim Gedanken auf, den lange beweinten Sohn wieder in die Arme schließen zu können, und doch wurde sie von einem ängstlichen Gefühl befallen, erinnerte sie sich daran, daß der Erwartete zwanzig Jahre lang Freiherr tituliert worden und jetzt Offizier des Kaisers war.
Noch ängstlicher war der Vater. Je näher die Stunde des Wiedersehens kam, um so öfter betrachtete er unruhig seine harten Arbeitshände, und um so nervöser zupfte er an dem ungewohnten, steifen, leinenen Kragen, der den braunen Hals umschloß.
Die jüngeren Kinder waren eher neugierig, als verlegen, machten aber durch ihre fortwährenden Fragen, ob Hans einen großen Säbel trage, ob er zu Pferd käme, und ob er Orden auf der Brust hätte, die Eltern noch unruhiger.
Da öffnete sich die Tür; jetzt mußte der Erwartete eintreten; ratlos standen die guten Leutchen da.
Aber es kam kein sternbesäeter Offizier mit einem Säbel herein, ein einfacher, junger Mann war es, welcher mit ausgebreiteten Armen auf die bleiche Frau zuging, sie umarmte, wieder und immer wieder küßte und sie Mutter nannte, so zärtlich, daß ihr die Tränen unaufhaltsam aus den Augen stürzten. Vorbei war alle Zaghaftigkeit. Die Mutter lag weinend und lachend an der Brust des stattlichen Sohnes, sie schämte sich nicht, ihn mit Kosenamen zu überschütten, die ihm in seiner Kindheit aus ihrem Munde zu hören versagt blieben; der Vater war außer sich vor Freude und zugleich stolz darüber, daß die Hand seines Sohnes weder an Härte, noch an Kraft der seinen nachgab, obgleich er als Freiherr gelebt hatte, und daß sein braunes Gesicht dem des Sohnes gegenüber an Farbe noch weiß zu nennen war.

Ein einfacher, junger Mann war es, welcher die bleiche Frau umarmte..
Und der Seekadett? Eben noch eine Waise, saßen ihm jetzt rechts zur Seite die Mutter, links der Vater, auf beiden Knieen die Geschwister, und um alles in der Welt hätte er nicht mehr mit dem neuen Freiherrn auf dem verlassenen Schlosse getauscht, er lachte und weinte und war glücklich. — —
Zu derselben Zeit stand im Schlosse von Schwarzburg ein in Schwarz gekleideter Herr an einem Fenster und schaute hinaus auf die Landschaft, die sich vor ihm eröffnete. Es war ein weißes Leichentuch, welches der Winter über Felder und Fluren gebreitet hatte. Etwas weiter erhob sich der mächtige Wald, dessen Bäume unter der Last des Schnees die Zweige neigten, und am Fuße des Felsens floß der Rhein. Er war noch nicht zugefroren; aber lange konnte es nicht mehr dauern, dann bedeckte eine dicke Eiskruste den Strom, denn schon trieben große Eisschollen denselben hinab, stauten sich am Ufer und zogen sich immer mehr der Mitte zu.
Die Aussicht war jetzt zwar traurig genug, aber im Sommer, wenn die Felder im Aehrenschmuck prangten, die Wiesen, vom Rhein bespült, in frischem Grün, und wenn im herbstlichen Wald das Jagdhorn lustig erschallte, dann mußte es hier prächtig sein, umsomehr, als der Besitzer dieses Schlosses, welcher jetzt durch das Fenster schaute, alles Land, das er übersehen konnte, als sein Eigentum betrachten durfte.
Für ihn wurde das Feld im Tale bestellt, für ihn weideten drunten die Herden auf den Wiesen, wurde das Wild im Walde gehegt; die Berge dort in der Ferne, mit Weinreben bedeckt, gehörten ihm, und die Schiffe, welche hier anlegten, um die Erzeugnisse des Bodens einzuladen, zahlten ihm den Preis dafür.
Der junge Mann ließ lange das blaue Auge sinnend auf den weißen Fluren ruhen, dann seufzte er tief auf; im nächsten Augenblicke aber huschte ein flüchtiges Lächeln über sein hübsches, tiefbraunes Gesicht. Er wandte sich um und ließ sein Auge über die gegenüberliegende Wand schweifen, welche mit Gemälden bedeckt war, seine Ahnen vorstellend; am rechten Flügel Ritter in eisernen Rüstungen, dann kamen einige in Rokoko-Kostümen, mit bauschigen Aermeln und hoher Halskrause, nach und nach paßte sich die Kleidung mehr der jetzigen Mode an, und schließlich blieben die Blicke des jungen Mannes auf dem linken, letzten Bilde haften, einem alten Herrn mit weißem Vollbart und ernsten, aber milden Augen darstellend.
Langsam ging der Einsame auf das Bild zu, stellte sich mit gekreuzten Armen ihm gegenüber hin und blickte ihm fest in die gemalten Augen.
»Was siehst du mich so ernst an?« murmelte er nach einer Weile. »Bist du nicht zufrieden, daß ich dein Nachfolger geworden bin? Warst du mein Vater, dann mußt du es sein, und daß ich bisher nur Matrose gewesen bin, dafür kann ich wahrhaftig nichts. Armer, alter Mann, du hast Schweres durchmachen müssen! Ein Glück ist es, daß du nicht noch das Letzte erfahren hast, daß der, den du geliebt, gar nicht dein Sohn gewesen ist. Armer Mann! Ich soll dich betrauern, und doch, ich kann es nicht. Aber man hat mir gesagt, die schwarze Kleidung schon drücke die Trauer aus, nun, die kann ich dir zu Gefallen schon tragen. Ich habe zwar noch nie getrauert, aber ich glaube, hätte ich es je getan, ich würde mich nicht deswegen anders angezogen haben.«
Seufzend blickte der junge Mann nach der leeren Stelle neben dem letzten Bilde.
»Dort also soll ich einmal hängen, als Freiherr Johannes von Schwarzburg, einstiger Matrose, der nun von allen als Herr Baron angeredet wird. Hätte ich es mir doch nicht träumen lassen, als ich einst in Alexandrien von den Eselsjungen immer mit Herr Baron angeredet wurde, weil ich viel Geld in der Tasche hatte und freigebig war, daß die Kerle die Wahrheit sagten. Dies also sind meine Vorfahren, und dort,« er sah nach der anderen Wand, wo nur Frauengestalten hingen, »dort baumeln meine Urgroßmütter. Mein Platz ist noch frei, aber der Nagel zum Bild ist schon eingeschlagen, und dort zu den Frauenzimmern soll einst meine Frau hinkommen, Freiherrin Hope vom Schwarzburg. Hm, klingt ganz hübsch, wenn ich sie nur erst gefunden hätte.«
Der junge Freiherr hatte vergebens gesucht, sich in einen scherzhaften Ton hineinzureden; aus den letzten, leise gesprochenen Worten klang ein tiefer Schmerz hervor.
Er wandte sich wieder dem Fenster zu und blickte auf den Rhein, in dessen Wasser sich die Nachmittagssonne spiegelte, und dessen Eisschollen die Strahlen derselben reflektierten.
Eben fuhr ein kleiner Kahn stromab, und so groß die Entfernung auch war, die scharfen Augen des einstigen Seemanns konnten deutlich wahrnehmen, was auf dem kleinen Fahrzeug vor sich ging.
Der Kahn war gedeckt. Vorn entquoll einer Esse dünner Rauch, die Schiffersfrau bereitete dem Manne also unten in dem engen Raume den Kaffee, und der Schiffer selbst saß am einfachen Steuerbaum. Hannes sah, wie der Mann seine Pfeife ausklopfte, in die Tasche griff, einen Beutel zum Vorschein brachte, frisch stopfte und den Tabak anzündete.
Hannes blickte dem kleinen Fahrzeug nach, so lange er konnte, bis er nicht mehr zu unterscheiden vermochte, ob die Rauchwolke dem Schlot oder der Pfeife entquoll.
Plötzlich überflog die Züge des jungen Mannes ein halb glückliches, halb pfiffiges Lächeln. Noch einmal schaute er sich in dem reich möblierten, mit weichen Teppichen belegten Salon um, dann fuhr er mit den Händen in die Hosentaschen und wühlte darin herum, aber er mußte nicht finden, was er suchte, denn er zog die Hände mit einem unwilligen Gebrumme wieder heraus und begann die anderen Taschen zu untersuchen.
»Freiherr, Baron oder Matrose,« murmelte er, »ist mir ganz Wurst, der Geschmack bleibt doch immer derselbe, und wenn ich auch auf dem feinsten Smyrnaer Teppich stehe. Ach so,« unterbrach er sich und zog die Hände aus den Rockschößen, »daran habe ich ja gar nicht gedacht. Na, brauche ja nur zu klingeln, dann kommen meine Diener.«
Er ging an die Tür und setzte einen Klingelzug in Bewegung. Er mochte aber wohl zu heftig daran gerissen haben, denn die golddurchwirkte Borte löste sich ab und fiel ihm auf den Kopf.
»Alle Mann an Deck,« lachte der Freiherr und zog den Kopf ein, »die Takelage kommt von oben.«
Er öffnete die Tür.
»August, Johann, Friedrich oder wie du heißt,« schrie er hinaus, »fix einmal herein, die Takelage kommt von oben.«
Ein eiliger Schritt ward auf dem Korridor hörbar, ein betreßter Diener trat in den Salon und blieb nach einer Verbeugung an der Tür stehen, die Befehle des neuen Freiherrn erwartend.
»Wie heißt du, mein Sohn?« fragte Hannes, während er die Borte vom Boden aufhob und das obere Ende und die Stelle, wo sie losgerissen, prüfte.
»Georg, Herr Baron,« antwortete der backenbärtige Diener, der Hannes' Vater sein konnte.
»So, also Georg — hatte einmal einen Bootsmann, der so hieß. — Sag' mal, Georg, das ist ja ein merkwürdiges Gerümpel hier im Hause, vorgestern breche ich mit dem Tische zusammen, auf den ich mich setzen wollte, gestern trete ich durch einen Rohrstuhl, und jetzt kommt hier dieses Zeug von oben. Hol' der Teufel das ganze Haus, zuletzt fällt es mir noch über dem Kopf zusammen!«
»Es wird sofort repariert werden, Herr Baron,« antwortete der Diener, ohne eine Miene zu verziehen.
»Unsinn, ich will es lieber selbst machen, dann hält es wenigstens. Bring' mir mal eine Malspike und zöllige Drahtstifte, und dann, Georg, gehe in das Zimmer, wo meine Lumpen liegen, welche ich hier auszog, in der Büx an Steuerbordseite steckt mein Pip und greifst du an derselben Seite in meinen Flaus, so findest du eine Tüte mit swartem Krusen, das bringe alles her, und dann kannst du mir helfen, denn ich habe schon gesehen, ihr faulen Schlingel lungert den ganzen Tag im Bedientenzimmer herum und scharwenzelt mit den Dienstmädchen.«
Stumm stand der Bediente wie eine Statue in der Tür und schaute den neuen Freiherrn fragend an.
»Nun, was gibt es noch?«
»Ich habe den Herrn Baron nicht verstanden.«
»So! Habe ich mich dir nicht deutlich genug erklärt?«
»Ich weiß nicht, was eine Malspike ist, und auch das andere ist mir nicht bekannt, Herr Baron.«
»Du weißt nicht, was eine Malspike ist?« fragte der Baron erstaunt. »Herr Gott, du bist wohl in gar keine Schule gegangen? Ach so, ihr Landratten habt für alles eine andere Bezeichnung.«
Nun erklärte er, daß er Hammer und Nägel haben wolle, daß ›Steuerbord‹ rechts, ›Büx‹ Hose, ›Flaus‹ Jacke und ›Pip‹ Pfeife heiße, und daß ›schwarzer Krauser‹ seine Lieblingssorte Tabak wäre.
Bald brachte der Diener das Verlangte, das Handwerkszeug in der einen Hand, die Kalkpfeife und den Tabak auf einem silbernen Teller in der anderen tragend.
Erfreut griff der junge Baron nach der schmutzigen Kalkpfeife, stopfte sie schmunzelnd und sog mit wonnigem Behagen den Dampf ein.
»Haha, das ist ein Tabakchen, nicht?« rief er, und blies dem Diener die grauschwarzen Rauchwolken ins Gesicht, so daß dieser zu niesen anfing und scheu zurückwich. »Ja, ja, wenn den einer raucht, dann fallen zehn Mann um.«
»Nun rücke einmal mit mir diesen Bücherschrank hierher,« kommandierte der Baron, »dann werde ich wohl hinauflangen können; den Hammer kannst du einstweilen an Deck legen! Herr Gott, Mensch, stell' dich doch nicht so ungeschickt an! So kannst du ihn doch nicht heben, unten mußt du ihn anfassen. So, eins — zwei — drei — hoch!«
Krach, ging es in diesem Augenblicke.
»Was war denn das?« fragte Hannes, setzte den Schrank wieder hin und ging zum Diener. »Na, deine Hose sieht gut aus, die ist ja hinten von oben bis unten geplatzt!«
»Auch Ihr Beinkleid hat Schaden gelitten, Herr Baron,« meldete der Diener.
Hannes besah sich im Spiegel und lachte.
»Wir sehen beide famos aus,« lachte er, »gerade wie kleine Kinder, denen das Hemdchen hinten heraushängt, macht aber nichts, besser als ein Bein gebrochen.«
Der Schrank wurde an die bestimmte Stelle gerückt.
»Nun stelle dich hierher,« fuhr Hannes fort, »ziehe den Kopf etwas ein, und wenn ich auf dich springe, dann brich nicht zusammen. Paß auf: eins — zwei — drei — hopp!«
»Au,« rief der Diener und sank in die Knie, aber der Baron stand schon oben auf dem Schranke.

»Himmel, Donnerwetter,« fluchte jetzt Hannes, »hier sinkt man ja bis an die Knöchel in Staub ein! Na wartet, morgen lasse ich die gesamte Mannschaft mit Besen an Deck treten. Das ganze Schloß wird von oben bis unten unter Wasser gesetzt, und so lange ich irgendwo auch nur ein Spinngewebe entdecke, bekommt ihr nichts zu essen. Ich will euch schon kriegen, euch faules Pack! Jetzt hole mir einmal einen Eimer mit Wasser und einen Lappen.«
Während der Diener das Verlangte holte, trieb der Baron mit wuchtigen Schlägen die Nägel in die Wand und befestigte die Klingelschnur so daran, daß sie drei Männer getragen hätte.
Dann begann der Freiherr mit eigener Hand sämtliches Inventar abzuwischen, wobei der unter seiner Last seufzende Diener oft als Leiter dienen mußte.
»Herr Berger,« meldete ein anderer Diener dem mit herabhängenden Beinen auf einem hohen Schranke sitzenden Baron.
»Immer herein,« rief Hannes fröhlich.
Herr Berger, der Detektiv und Freund von Nick Sharp, trat herein und war nicht wenig erstaunt, den neuen Freiherrn in einer solchen Situation zu finden.
Mit einem Sprunge war der Baron vom Schrank herunter und stand vor dem Eintretenden, ihm die staubige Hand entgegenstreckend.
»Nur keine langen Komplimente,« rief er, als Herr Berger sich verbeugen wollte. »Gott sei Dank, daß ich wieder einmal jemanden habe, mit dem ich vernünftig sprechen kann, ohne Baron hinten und Baron vorn zu hören. August oder Gustav, nimm den Eimer heraus und komme nicht wieder herein, ich mag deine pomadisierte Haarfrisur nicht mehr sehen.«
»Ist sie gefunden?« fragte er dann, als er Herrn Berger gegenübersaß.
»Ja und nein,« antwortete dieser.
»Wie soll ich das verstehen?«
»Sie war gefunden, ist aber wieder entschlüpft. Ich muß Ihnen ausführlicher erzählen, Herr Baron, was sich alles seit der Ankunft der ›Urania‹ ereignet hat, damit Sie ein klares Bild erhalten.«
»Dann fangen Sie an, vermeiden Sie aber das Wort Baron,« sagte Hannes, »ich denke immer, man will mich damit höhnen.«
»Unser Telegramm hatte die Polizeibehörde in Hamburg vorbereitet,« begann Berger, »um beim Einlaufen der ›Urania‹ Herrn Renner wegen Mordversuchs zu verhaften und sich zugleich Miß Stauntons zu vergewissern und ihr mitzuteilen, daß Sie am Leben wären.«
»Das weiß ich. Ich war ja selbst mit dabei, als Sie das Telegramm in Sierra Leona Eine Stadt an der Westküste Afrikas. aufgaben.«
»Wie ich nun erfahren habe, machte die Verhaftung des Herrn Renner bedeutende Schwierigkeiten, er war ein baumstarker Mann, und die ganze, nach der ›Urania‹ abgesandte Polizei mußte eingreifen, um denselben zu bändigen; daher konnte niemand ein Auge auf Miß Staunton haben, und als man das junge Mädchen suchte, hatte es mit dem wenigen Gepäck das Schiff bereits verlassen. Alle Nachforschungen innerhalb Hamburgs während einer Woche nach ihr blieben erfolglos.
»Da kam mit einem Schnelldampfer ein Bevollmächtigter ihres Bruders an — gleich nach uns — und während wir damit beschäftigt waren, ihre Legitimität zu beweisen, gelang es diesem Herrn unter Aufwendung großer Geldmittel, den Aufenthalt Miß Stauntons zu erfahren. Sie wohnte unter einem angenommenen Namen in einem Hotel Hamburgs.
»Entweder war nun dieser Bevollmächtigte ein sehr schlechter Diplomat, oder Kapitän Staunton hat ihm sehr schlechte Ratschläge gegeben, wie er das junge Mädchen ihrem Bruder wieder zuführen sollte. Ich kenne Miß Staunton zwar nicht, aber ich glaube, daß kein Mädchen, welches liebt, unter solchen Angeboten einen Fehltritt bereut und wieder gutzumachen sucht, indem es zurückkehrt.«
»Hope hat keinen Fehltritt begangen, Mister Berger,« unterbrach ihn Hannes unwillig.
»Ich weiß, das Wort war falsch gewählt,« fügte der Erzählende schnell hinzu. »Ich meinte, kein liebendes Mädchen würde unter solchen Bedingungen seiner Liebe entsagen.«
»Was für Bedingungen waren es?«
»Zuerst erklärte ihr der Bevollmächtigte des Bruders rücksichtslos, daß sie ein armes Mädchen geworden wäre, welches nichts weiter besäße, als dasjenige, was es mitgenommen habe, ein paar Hundert Dollar und dann —«
Der Sprecher zögerte plötzlich.
»Und dann?« fragte Hannes unruhig.
»Und dann gab der Bevollmächtigte Hope zu verstehen, daß sie nur für den Fall Unterstützung bei ihrem Bruder fände, wenn sie gewillt wäre, dem Leutnant Murbay, der sie liebe, die Hand zu reichen.«
»Verdammt,« platzte Hannes heraus und sprang mit geballten Fäusten auf.
»Er verstand sehr gut, dem jungen Mädchen die Vorteile der reichen Heirat auszumalen.«
»Was entgegnete ihm Hope?« stieß Hannes mit funkelnden Augen hervor.
»Miß Staunton entgegnete ihm stolz, auf solche Vorschläge würde sie nie eingehen. Sie würde niemals heiraten, um in bessere Vermögensverhältnisse zu kommen, sie wäre sich selbst genug, Unterstützung brauche sie nicht und nähme von jetzt ab nicht einmal solche von ihrem Bruder mehr an.«
»Bravo,« schrie Hannes freudig, »daran erkenne ich Hope, sie konnte nicht anders antworten. Sprach dieser Bevollmächtigte nicht auch von mir? War es Hope nicht schon zu Ohren gekommen, daß ich noch lebte und Aussicht besaß, Freiherr zu werden? Damals war es doch bekannt geworden.«
»Allerdings, er sprach von Ihnen, sagte auch, daß Sie als Freiherr anerkannt wären, aber Miß Staunton wußte dies schon.«
»Und was sagte sie dazu?«
Berger zögerte etwas und sagte dann:
»Sie brach plötzlich in Tränen aus und bat den Vermittler, sie allein zu lassen.«
»Sie weinte?« rief Hannes erstaunt. »Ja, aber warum denn? Sie sollte sich doch darüber gefreut haben.«
»Der Vermittler wird ihr etwas gesagt haben, was sie sehr gekränkt hat.«
»Was sollte das gewesen sein?«
»Etwas, was sie vielleicht auch schon gedacht hat und was von diesem unklugen oder vielmehr boshaften Vermittler grausam bestätigt wurde.«
»So sprechen Sie doch,« drängte Hannes.
»Er hat ihr angedeutet, daß Sie als Freiherr, reich, mächtig und bald viel umschwärmt, nichts mehr von dem verarmten Mädchen wissen wollten.«
»Donner und Doria,« schrie Hannes und rannte mit großen Schritten im Zimmer auf und ab. »So ein Halunke, so ein Spitzbube; ich suche ihn auf, ich reise ihm nach, und habe ich ihn, so prügle ich ihn windelweich.«
»Geben Sie dem Manne nicht alle Schuld,« sagte Berger schnell, »ich glaube, Sie täten ihm unrecht. Ich vermute, daß Miß Staunton selbst schon derartiges gedacht hat.«
Wie erstarrt blieb Hannes stehen, und seine Stimme bebte, als er nach einer stummen Pause fragte:
»Woraus schließen Sie das?«
»Aus ihrem Benehmen und daß sie bei dieser Andeutung in Tränen ausbrach; ja,« fügte Berger leise hinzu, »sie gab es selbst zu. Sehen Sie, Miß Staunton hielt sich für eine reiche Erbin, Sie für einen armen Matrosen, und sie war stets stolz darauf, daß sie Ihretwegen alles aufgab. Sie selbst haben es erzählt, daß sie gern Anspielungen darauf machte, natürlich ganz unschuldig, sie freute sich eben darüber wie ein Kind, welches ein Spielzeug mit Freuden verschenkt — dieser Stolz war nichts Unrechtes. Nun erfährt sie aber plötzlich, wie töricht ihr Benehmen gewesen ist, und nun, da Sie reich geworden, schämt sie sich, arm zu Ihnen zu kommen. Wie wäre es sonst übrigens möglich, daß Miß Staunton sich Ihnen noch nicht genähert hat, da Ihr Aufenthaltsort doch bekannt ist?«
Lautlos und unbeweglich hatte Hannes dem Sprecher gelauscht, dann aber mußte sich sein Herz Luft machen, ein unbeschreiblicher Jammer übermannte ihn. Wie ein Rasender begann er plötzlich durchs Zimmer zu laufen.
»Das also hat mir mein Freiherrntitel eingebracht,« rief er dabei. »Zum Teufel mit dem Freiherrn, zum Teufel mit dem Baron, ich bin Hannes Vogel, der Matrose, und wer mir dies von jetzt an abstreiten will, den prügele ich tot. Mein Gott,« rief er plötzlich, blieb stehen und bedeckte sich das Gesicht mit beiden Händen, »Hope, wie kannst du so kleinlich von mir denken, da ich dir gern alles opfern würde, da ich dir zuliebe betteln gehen wollte! Ich soll deiner jetzt nicht mehr gedenken, weil ich einen Titel und Geld bekommen habe!«
»Halten Sie ein,« sagte Berger, der zu ihm getreten war und ihm sanft die Hand auf die Schulter legte, »noch ist ja nichts verloren! Wie können Sie zürnen, daß Gott Ihnen Macht und Reichtum beschert hat? Sie sollten sich darüber freuen, denn ein um so angenehmeres Leben können Sie Ihrer Geliebten dadurch verschaffen.«
»Hope, was gilt mir alles, wenn ich dich verloren habe!«
»Sie ist Ihnen doch nicht verloren,« sagte Berger freundlich, »sie lebt ja. Denken Sie nur an das Wiedersehen! Wie sich das junge Mädchen freuen wird, wenn Sie es wiedergefunden haben und als Freiherrin auf Ihr Schloß führen! Wie wird es sich in seinem Glücke schämen, daß es auch nur einen Augenblick an Ihrer Treue hat zweifeln können.«
Ein Hoffnungsstrahl blitzte in Hannes' Seele auf; fragend schaute er den Sprecher an.
»Glauben Sie, daß ich Hope finden kann?«
»Aber warum denn nicht?« rief der Tröster fröhlich. »Es ist doch in Deutschland eine Kleinigkeit, jemanden aufzufinden, der sich verbirgt. Selbst die abgefeimtesten Personen findet man, um wieviel mehr ein unschuldiges Mädchen! Bei Ihrem Ansehen und Ihren Mitteln ist es Ihnen ein Leichtes, den Aufenthaltsort von Miß Staunton zu erfahren, ja, ich will sie auf eigene Faust bald gefunden haben, und sicher ist es doch, daß, wenn Sie öffentlich nach ihr suchen lassen, sie sich bald einstellen wird, denn daraus erkennt sie doch Ihre Liebe! Aber unterlassen Sie dies, erlassen Sie keinen öffentlichen Aufruf! Lassen Sie das junge Mädchen nur einige Zeit in dem Glauben, Sie kümmerten sich nicht um es, das schadet dem kleinen Trotzkopf gar nichts. Und habe ich den Aufenthaltsort gefunden, so kommen Sie unvermutet, holen es fort, und dann passen Sie auf, was das für eine Freude sein wird.«
Hannes' Züge hatten sich bei diesen Worten immer mehr aufgeklärt.
»Einverstanden,« rief er und schüttelte dem Detektiven die Hand, »ja, so wird es gemacht. So lange wir sie nicht gefunden haben, mag sie für ihren Eigensinn zappeln, dann aber hole ich sie als Freiin von Schwarzburg heim, und dann soll in diesen alten Räumen ein Leben beginnen, daß meine Ahnen und Großmütter dort an der Wand Tag und Nacht lachen.«
Berger mußte über den neuen Burgherrn lachen; er wußte schon, wie wenig derselbe zu dieser Würde passe.
»Haben Sie schon Besuch empfangen?« fragte er. »Als Freiherr haben Sie Pflichten übernommen, von denen Sie vorher wohl wenig Ahnung hatten.«
»Ach, wenn ich nur von diesen Besuchen verschont bleiben wollte,« rief Hannes in komisch verzweifeltem Tone. »Denken Sie nur, fast jeden Tag erhalte ich Besuch von irgend so einem Grafen oder Baron oder Von aus der Nachbarschaft, meist noch ganz junge Burschen mit pomadisierten Köpfen und nach Parfüm duftenden Schnurrbärten, gekleidet sind sie wie Harlekins, blau oder rot oder grün, und die heulen mir dann mit schnarrender Stimme die Ohren voll, wie sehr sie sich freuten, mich als Kameraden begrüßen zu können; von etwas anderem aber, als von Pferden, ist mit ihnen gar nicht zu sprechen, und ich bin gewöhnlich so grob gegen sie, daß sie froh sind, wenn sie die Tür von draußen wieder zumachen können.«
»Hat Ihnen der alte Haushofmeister nicht schon etwas erzählt?« fragte Berger.
Hannes wurde etwas verlegen.
»Ich glaube,« sagte er dann kleinlaut, »ich habe den alten Mann sehr gekränkt. Er wollte mir nämlich eine Lektion im Anstand geben, und da wurde ich furchtbar grob und gab ihm deutlich zu verstehen, ich brauche keinen Hofmeister mehr, und auf seinen Vorschlag, in den nächsten Tagen alle adeligen Nachbarn einzuladen, männliche und bezopfte, verbat ich mir dies ganz energisch. Ich sagte, ich würde die Schloßbrücke aufziehen und ›Verbotener Eingang‹ daranschreiben lassen.«
»Sie müssen sich aber Ihren Nachbarn vorstellen und später auch noch andere Besuche machen, werden wahrscheinlich selbst um eine Audienz beim Landesfürsten nachsuchen müssen.«
»Unsinn,« rief Hannes energisch. »Lassen Sie mich nur erst einmal Hope gefunden haben, dann ade Schloß Schwarzburg. Glauben Sie etwa, ich könnte es hier an Land aushalten? Gott bewahre, ich muß sofort wieder aufs Meer, sonst werde ich krank. Jetzt habe ich Geld, ich kaufe mir ein fixes Schiff, besorge eine tüchtige Mannschaft, und dann fahren wir beide, Hope und ich, wieder in der Welt herum. Das Schifferexamen zu machen habe ich nicht mehr nötig, die Sonne aufnehmen kann ich, Hope ebenso, und noch vieles mehr, was mancher Kapitän nicht kann. Wir werden uns wieder dem ›Amor‹ und der ›Vesta‹ anschließen und denen einmal zeigen, wie ein richtiges Segelschiff bedient werden muß.«
»Mein Freund Sharp hat mir schon von diesem Ihren Lieblingsplan erzählt. Also das Leben, welches Sie jetzt führen, hat für Sie keinen Reiz?«
»Ganz und gar nicht, ich fühle mich als Matrose auf einem Schiffe am wohlsten. Das Meer ist nun einmal meine Heimat geworden. Ich werde schon wehmütig, wenn ich auf den Rhein dort unten blicke.«
»Nun, Herr Baron,« sagte Berger und stand auf, »ich werde also mein möglichstes tun, um Miß Staunton zu finden, und sobald ich ihren Aufenthalt weiß, teile ich Ihnen denselben mit.«
»Tun Sie das und scheuen Sie keine Ausgabe! Eilen Sie, als gälte es Ihre Seligkeit zu retten! Und wissen Sie, was ich einstweilen tun werde? Ich habe meinen Entschluß geändert, ich werde diesen adeligen Leutchen einmal zeigen, daß ein Matrose sich auch in den feinsten Salons zu benehmen weiß; ich werde Besuche empfangen und erwidern, sonst denken sie, ich sei so ein ungelenker Kerl, dem beim Anblick einer Dame gleich das Herz in die Hosen fällt.«
»Der Haushofmeister wird Ihnen mit Winken zur Seite stehen.«
»Bah,« sagte Hannes verächtlich, »den brauche ich nicht. Bücklinge mache ich sowieso nicht, na, und tanzen kann ich wie nur irgend einer. Wenn ich aber mit der Sprache ins Holpern komme, dann fang ick plattdütsch to snacken an, darin bin ick en Düvel.«
Ellen war von dem Mädchen, das sie für ihre Freundin gehalten, den Verfolgern ausgeliefert worden.
Einen verzweifelten Blick warf sie noch auf die Verräterin, dann ließ sie sich willenlos die Hände binden; eine furchtbare Trostlosigkeit hatte sich plötzlich ihres Herzens bemächtigt. Wie ein Schleier fiel es von ihren Augen, ja, eine Ahnung stieg in ihr auf, daß sie Johanna doch vielleicht unrecht getan habe.
Sie wurde nach dem kleinen Wasserfall geführt, wo die anderen acht Mädchen bereits, gleich Ellen, gebunden, mit niedergeschlagener Miene ihrer Kapitänin warteten.
Da entfuhr Ellens Lippen ein Ausruf des Erstaunens, denn der Mann, der jetzt auf sie zutrat, war niemand anders als Mister Anderson, der Detektiv, den sie in Afrika befreit hatten, und der zuerst Johanna anschuldigte.
Er war besser gekleidet als die übrigen Männer, welche sich in Anzug und Benehmen als Seeleute verrieten; auch versuchte er einen höflichen Ton anzuschlagen.
»Es tut mir leid, Miß Petersen,« begann er, »daß ich den mir von Ihnen geleisteten Dienst mit Undank vergelten muß. Gern würde ich Ihnen als Helfer entgegentreten, aber ich bin gezwungen, zu handeln ...«
»Lassen Sie die Entschuldigungen!« unterbrach ihn Ellen heftig. »Ich sehe, Sie sind im Einverständnis mit diesen Piraten und jedenfalls selbst ein solcher. Zu beklagen ist nur, daß ich Sie damals nicht Ihrem Schicksal überlassen habe, wenn Ihre Gefangennahme nicht auch nur eine Komödie war.«
Tannert zuckte die Achseln.
»Ich bitte Sie, fügen Sie sich geduldig in ihre Lage. Es ist das einzige, was ich Ihnen raten kann, weil ich dadurch nicht genötigt werde, Gewalt anzuwenden. Im übrigen ist Ihr und der anderen Damen Schicksal kein so schlimmes, wie Sie glauben. Ihr Leben ist gesichert, und Sie werden sich über nichts zu beklagen haben. Jede Ungehörigkeit, welche sich diese Leute zu schulden kommen lassen, melden Sie mir, und,« Tannert griff an seinen Revolver und sah sich im Kreise der Piraten um, »es wird Ihnen Genugtuung werden.«
»Versuchen Sie nicht, als Ritter aufzutreten,« entgegnete Ellen höhnisch. »Wohl gibt es Wegelagerer zu Land und zu Wasser, denen Ritterlichkeit nicht abzustreiten ist, diese vergelten aber eine gute Tat nicht mit Undank. Sie rechne ich zu der Kategorie ganz gemeiner Räuber.«
Tannert wurde durch diese Worte nicht gereizt.
»So folgen Sie unbedingt meinen Befehlen,« sagte er kalt. »Sie werden jetzt dort zwischen die Hügel geführt und von dieser Dame,« er deutete auf Miß Morgan, »genau nach Waffen untersucht werden. Versuchen Sie keinen Widerstand, und sinnen Sie nicht auf Selbstbefreiung, ein Ruf dieser Dame holt sofort Hilfe herbei, und ich würde mich dann genötigt sehen, Gewalt anzuwenden, was ich aber möglichst vermeiden möchte.«
»Was soll mit uns geschehen?« konnte Ellen sich nicht enthalten, zu fragen.
»Sie kommen wieder an Bord Ihres Schiffes und werden nach einem Orte gebracht, wo Sie ihr ferneres Schicksal erfahren werden,« antwortete Tannert, lüftete etwas den Hut und wandte sich ab.
Die neun Mädchen wurden wirklich in eine kleine Schlucht geführt und dort mit Miß Morgan allein gelassen. Diese hatte bis jetzt kein Wort mit ihren früheren Kameradinnen gesprochen, auch die auf sie gerichteten, teils entsetzten, teils verächtlichen Blicke nicht beachtet, sondern sich mit gleichgültiger Miene mit einem alten, grauhaarigen und einäugigen Burschen unterhalten, dem Seewolf, der Tannerts Auftreten mit mißgünstigen Augen und unter zornigem Brummen beobachtete.
Jetzt wandte sich Ellen zum ersten Male zu ihr.
»Miß Morgan,« sagte sie, »wie soll ich mir Ihr Benehmen erklären?«
Die Gefragte lachte laut und höhnisch auf.
»Sind Sie darüber noch im unklaren?« entgegnete sie. »Ich dächte doch, meine Stellung Ihnen gegenüber läge nun offen zu Tage: in die Falle gelockt habe ich Sie und Ihre Freundinnen, und Sie sind hineingegangen, wie die Maus an den gebratenen Speck. Nun muß ich bitten, Miß Petersen, sich von mir eine Durchsuchung ihrer ganzen Kleidung gefallen zu lassen; doch es wird schnell gehen, ich weiß ja, wo die Vestalinnen ihre Waffen zu verbergen pflegen. Seien Sie froh, daß ich dazu auserkoren bin. Die Männer dort würden mit Freuden eine derartige Untersuchung an Ihnen vornehmen.«
Nach dieser frivolen Rede begann sie, einem der Mädchen nach dem anderen Revolver und Dolch aus der Tasche zu ziehen und außerdem noch durch Betasten des Körpers sich davon zu überzeugen, daß keine anderen Waffen verborgen waren. Sie beachtete dabei weder die wütenden, noch verächtlichen Blicke, noch die Ausdrücke des Abscheus, welche von allen Seiten an das Ohr der Verräterin schlugen. Wurde ihren handgreiflichen Untersuchungen Widerstand entgegengesetzt, so lachte sie stets höhnisch auf, und zwang die gebundenen Mädchen, sich dieselben doch gefallen zu lassen. Mit Spott verschonte sie die Wehrlosen vorläufig noch.
Als sie dem letzten Mädchen die Waffen genommen und beiseite gelegt hatte, lagerte sie sich neben dem aufgestapelten Haufen ins Gras und betrachtete schadenfroh ihre Opfer.
»Nun, meine Damen,« begann sie, nachdem sie sich genügend an diesem Anblicke geweidet hatte. »Sind Sie nicht begierig, zu erfahren, auf welche Weise ich Sie hierhergelockt habe?«

»Sind Sie nicht begierig, zu erfahren, wie ich
Sie hierhergelockt habe?« fragte Miß Morgan.
Keine der Damen antwortete, sie wandten der Sprecherin verächtlich den Rücken, mit Ausnahme von Ellen und Miß Sargent.
Erstere blickte das Mädchen fragend, aber stumm an, letztere mit einem seltsamen Ausdruck im Auge. Miß Morgan kannte dessen Bedeutung. In dem Mädchen kochte es, aber sie brauchte dessen Wut nicht mehr zu fürchten.
»Es war mein Werk,« fuhr Miß Morgan fort, »daß das Wasser in der Nähe dieser Insel ungenießbar wurde, ich habe in der Nacht vorher alle Fässer und Tanks versalzen, mit Wissen dieser Männer hier, welche Sie sehnsüchtig erwarteten.«
»Schlange!« stieß Ellen hervor.
»Ja, zischen Sie nur,« lachte das satanische Mädchen, »es nutzt Ihnen doch nichts. Sie können nicht mehr beißen. Ein Glück für mich war es, daß Sie Miß Lind aussetzten, dieselbe hätte bald meinen Anschlag zuschanden gemacht.«
»Johanna?« fragte Ellen entsetzt.
»Jawohl, Johanna! Sie haben Ihre Klugheit verleugnet, als Sie Ihren Schutzengel von sich stießen.«
»Mein Gott,« stöhnte Ellen auf, »so bestätigt sich meine Ahnung!«
»Ihr Seufzen kommt zu spät,« lachte Miß Morgan wieder, »das arme Mädchen kann froh sein, aus Ihrer Gesellschaft befreit worden zu sein. Aber es war auch die höchste Zeit für mich, daß sie ging, denn sie sah mir zu scharf auf die Finger. Was sagen Sie übrigens zu meinem Briefstil, Miß Petersen? War er dem der englischen Herren nicht vortrefflich nachgeahmt, desgleichen die Handschrift?«
»So waren die Briefe in der Kassette Johannas von Ihnen geschrieben?«
»Natürlich! Johanna war überhaupt ganz unschuldig, ebenso Lord Harrlington. Er hat niemals an mich geschrieben, sondern ich selbst habe mir die Briefe geschickt und sie Ihnen in die Hände gespielt. Ist das nicht köstlich? Der arme Lord, wie er sich grämt, daß Sie ihm zürnen, während er sich gar keiner Schuld bewußt ist.«
Miß Morgan hätte noch lange mit teuflischem Behagen Ellens Herz mit Dolchstößen gemartert, wenn sie nicht unterbrochen worden wäre.
»Sind Sie fertig, Miß Morgan?« ließ sich Tannerts Stimme hinter dem Hügel vernehmen, und Miß Morgan verschwand für einige Minuten.
»Sprechen Sie nicht mehr mit diesem elenden Weibe,« sagte Miß Sargent zu Ellen, »jedes Wort ist verschwendet. Sie ist die teuflischste Kreatur, die mir je vorgekommen ist.«
Ellen antwortete nicht, sie war vollkommen niedergeschmettert von dem, was sie eben erfahren. Und das waren nur Andeutungen, was mochte ihr erst ein offenes Geständnis alles enthüllen!
Miß Morgan kam zurück und mit ihr ein Trupp Piraten.
Die Vestalinnen wurden in die Mitte genommen und nach ihrem Schiffe gebracht.
Die übrigen Piraten waren bereits damit beschäftigt, die Fässer und Tanks zu reinigen und mit Wasser zu füllen, die ›Vesta‹ war also entweiht, Männer, und noch dazu der Auswurf der Menschheit, befanden sich auf ihren Planken.
Von den übrigen Vestalinnen war nichts zu sehen, entweder weilten sie gar nicht an Bord, sondern waren anderswo hingeschleppt worden, oder sie lagen gebunden im Zwischendeck. Doch darüber sollten sie bald von Tannert aufgeklärt werden, welcher den Damen gegenüber überhaupt den Sprecher machte, während sie von seinen Kameraden vollkommen unbelästigt blieben.
Als die neun Mädchen an Deck standen und mit traurigen Blicken dem Treiben der Männer zusahen, trat Tannert zu ihnen.
»Sie sollen während der jetzt vorzunehmenden Reise eine gute Behandlung an Bord der ›Vesta‹ haben, meine Damen,« begann er, »wenn Sie keinen Widerstand versuchen oder Anstalten treffen, die Freiheit wiederzuerlangen, was Ihnen auch nicht gelingen würde. In dem Raume, wo Sie und Ihre Freundinnen untergebracht werden, finden Sie Ihre Koffer mit Kleidern, ziehen Sie Ihre Damenkostüme an, wie es sich schickt«. Ellen wollte ihn heftig unterbrechen, doch beherrschte sie sich.
»Fügen Sie sich in das Unvermeidliche,« fuhr Tannert lächelnd fort. »Wie gesagt, Sie werden über nichts zu klagen haben, weder über Verpflegung, noch über Behandlung, allerdings müssen Sie sich gefallen lassen, daß Sie beobachtet werden, um Ihre eventuellen Pläne rechtzeitig entdecken zu können. Doch soll die Beobachtung soviel als möglich durch Miß Morgan geschehen. Bitte, folgen Sie jetzt mir in den Ihnen zum Aufenthalt angewiesenen Raum.«
»Wollen Sie nicht sagen, was mit uns geschehen soll?« fragte Ellen noch einmal.
»Ich weiß es selbst nicht, nur so viel, daß Sie von einigen Personen verlangt werden, die sich lebhaft für Sie interessieren. Sie können über Ihr Schicksal beruhigt sein.«
»Die englischen Herren!« durchzuckte es Ellens Gehirn, doch gleich verwarf sie diesen Gedanken wieder.
Sie wurden in einen Raum gebracht, der früher als Aufbewahrungsort für Proviant gedient hatte. Jetzt waren die Fässer und Kisten herausgeräumt und dafür Möbel und Betten hineingebracht worden, desgleichen die notwendigsten Garderobenbehälter der Damen. Beim Oeffnen derselben fanden diese, daß man dieselben vorher genau untersucht hatte, wahrscheinlich unter Aufsicht von Miß Morgan, damit keine Waffen in die Hände der Damen kämen.
Ja, selbst die Betten und Möbel hatte man genau untersucht, denn die Vestalinnen waren als energische und kühne Mädchen bekannt, welche sicher auf Befreiung sannen und im Besitze von Waffen das Aeußerste versucht hätten.
Der Seewolf und seine Mannschaft konnten genug davon erzählen.
Aber nicht genug damit, nicht einmal allein sollten die Mädchen bleiben. Aus der Tür wurde eben ein viereckiges Stück herausgesägt, so daß die Damen beständig beobachtet werden konnten, und kaum war die Tür hinter den neun Gefangenen ins Schloß gefallen und der Schlüssel herumgedreht worden, so erscholl schon Miß Morgans Stimme am Guckloch, ihnen zurufend, sie sollten warten, bis die Bewußtlosen aus ihrem Rausche erwacht wären und dann sich von diesen befreien lassen.
Auf den Sofas, Betten und in den tiefen Stühlen lagen nämlich die übrigen Vestalinnen in festem Schlafe, hervorgerufen durch das Narkotikum, welches ihnen Miß Morgan in das Trinkwasser gemischt hatte.
Doch dauerte es nicht lange mehr, so kam eins der Mädchen nach dem anderen zum Bewußtsein, schaute sich erst mit starren Augen um und brach dann in Verwünschungen über die treulose Verräterin aus.
Nachdem sich die Wut gegen jenes Weib, welches dort durch das Guckloch ihnen zusah und höhnische Worte nicht sparte, etwas gelegt hatte, befreiten sie ihre Freundinnen von den Fesseln, indem sie die Knoten mühsam mit den Fingern lösen mußten.
Auf einen Wink Ellens, welche ihre Ruhe wiedergewonnen hatte, zogen sich alle in die entfernteste Ecke des geräumigen Gemaches zurück, damit ihre Unterhaltung nicht von der Beobachterin an der Tür gehört werden konnte, und berieten sich in flüsterndem Ton miteinander.
»Wir sind in die Hände derselben Piraten gefallen,« sagte Ellen, »welche als Schiffbrüchige in der chinesischen See an Bord der ›Vesta‹ kamen, um uns zu fangen, was durch Mister Youngpig vereitelt wurde, ich erkenne die Burschen alle wieder. Es sind auch dieselben, welche uns fortwährend verfolgt haben, der alte grauhaarige, weißäugige Kerl hat mich in Kairo in der Tragbahre fortgebracht und in Konstantinopel rauben wollen, er entführte auch Miß Staunton. Sie sind eben gedungen, uns irgend jemandem auszuliefern, und wenn wir die Sache kaltblütig überlegen und uns keinen Illusionen hingeben wollen, so müssen wir gestehen, daß diesmal ihr Anschlag gelungen ist.«
»Sehr scharfsinnig gesprochen, Miß Petersen,« lachte Miß Morgan an der Tür, »Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen, es verhält sich alles wirklich so.«
»Wir müssen noch leiser sprechen,« sagte Ellen, im Gesicht dunkelrot werdend, »kommen Sie noch näher zusammen!«
»Sollten die englischen Herren ...« brachte ein Mädchen zögernd hervor.
»Auf keinen Fall!« flüsterte Miß Murray unwillig. »Wie kann auch nur eine solche Vermutung in Ihnen auftauchen?«
Auch die anderen Vestalinnen verwarfen diesen Gedanken.
»Was mich anbetrifft,« flüsterte Ellen wieder, »so glaube ich bestimmt zu wissen, daß man nach meinem Leben trachtet.«
»Aus welchem Grunde?« fragte Miß Thomson.
»Um in den Besitz meines Vermögens zu kommen.«
»Dann ist anzunehmen, daß dies bei uns allen der Fall ist. Wir sind alle ohne Ausnahme Waisen. Sterben wir, so fällt unser Vermögen an sehr entfernte Verwandte, die wir kaum kennen, und die kein Anrecht auf unser Vermögen haben. Ich zum Beispiel habe in meinem Testament ihnen wohl eine Summe ausgesetzt, den Hauptteil aber, wenn ich, ohne verheiratet zu sein, sterben sollte, zur Errichtung eines Erziehungshauses für Seemannswaisen bestimmt.«
So sprach Miß Thomson, und fast alle Damen stimmten ihr bei und bemerkten, daß sie ähnlich gehandelt hätten. Sie waren auf der richtigen Spur, wenn sie glaubten, ihre Gefangennahme wäre von Verwandten ausgegangen, welche nach ihrem Vermögen Sehnsucht hatten.
»Um dieses zu erlangen, müßten wir aber getötet werden,« sagte Miß Sargent. »Ich bin jedoch fest überzeugt, daß dies nicht unser Los ist.«
»Warum nicht?«
»Weil niemand wagt, in unsere Nähe zu kommen.«
»Sprechen Sie deutlicher! Wir verstehen Sie nicht,« sagte Ellen.
»Angenommen, jenes Weib dort würde in dieses Gemach treten,« erklärte Miß Sargent ruhig, »so könnte ich doch schwören, daß sie es lebendig nicht wieder verläßt, wenn ich nicht durch Gewalt davon abgehalten werde, meine Hände um ihren Hals zu legen und sie so lange zu würgen, bis sie den letzten Atemzug getan hat. Dasselbe würde ich wahrscheinlich mit dem ersten Piraten machen, der dieses Gemach beträte. Da nun aber niemand hereinkommt, so fürchten sie uns wahrscheinlich und wagen nicht, vor uns zu erscheinen, weil sie sonst Gewalt anwenden, und, um ihr Leben zu sichern, vielleicht sogar mit den Waffen in der Hand uns gegenübertreten müßten.«
»Es liegt etwas Wahres in dieser Annahme,« entgegnete Ellen nachdenkend. »Ja, wahrhaftig, sie wollen unser Leben schonen, sonst würden sie uns ganz anders behandeln. Aber warum? Jedenfalls müssen sie uns erst irgendwo abliefern, wo wir vielleicht gezwungen werden sollen, Unterschriften oder etwas Aehnliches auszustellen. Nun, meine Damen, ich brauche Ihnen wohl nicht erst Mut einzusprechen, daß Sie keine derartigen Bedingungen eingehen, und wenn Sie zu Tode gemartert werden sollten! Denn sofort, wenn die Schurken in den Besitz dessen gelangt sind, was sie von uns haben wollen, sind wir erst recht verloren; so lange wir ihnen aber nicht willfährig sind, ist noch Hoffnung vorhanden, daß wir dem Leben erhalten bleiben und auf Rettung sinnen können. Daher, meine Damen, keine unnötigen Weigerungen und Widersetzlichkeiten! Wir müssen vorläufig gute Miene zum bösen Spiele machen, dabei aber nichts außer acht lassen, was uns Hilfe bringen könnte. Nur so können wir hoffen, den Piraten abermals zu entgehen.«
Es wurde noch lange unter den Gefangenen hin- und herberaten, was ihr Los sein könne und wie es abzuwenden möglich sei, ferner wurde ausgemacht, die Piraten und besonders jenes Weib, welches von allem Anfang an ihre Feindin gewesen und im Einverständnis mit ihren Verfolgern gearbeitet hatte, völlig zu ignorieren, bis Miß Morgan die Mädchen abermals aufforderte, ihre Matrosen-Kostüme abzulegen und Damenkleider anzuziehen.
Eingedenk der Ermahnung Ellens führten die Mädchen den gegebenen Befehl sofort aus — sie zogen sich um.
Dann rief ihnen Miß Morgan weiter zu, sie sollten sich jetzt ruhig an dem Platze verhalten, wo sie eben ständen, sonst würde ihnen kein Essen verabreicht werden, und gleich darauf wurde die Tür halb geöffnet, einige Schüsseln mit Essen hereingeschoben und der Raum schleunigst wieder verschlossen. Man sah deutlich, daß die Mädchen gefürchtet wurden und daß die Piraten zugleich von höherer Stelle den Befehl bekommen hatten, sie in Ruhe zu lassen und jeden Gewaltakt zu vermeiden. Für ihre Sicherheit war wahrscheinlich Mister Anderson, jener angebliche Detektiv verantwortlich.
Obgleich die Damen wenig Hunger verspürten, folgten sie doch schließlich dem guten Beispiele Ellens und langten tapfer von den wohlbereiteten Gerichten zu, indem sie einsahen, daß durch Zurückweisung der Nahrung ihre traurige Lage noch hoffnungsloser werden mußte.
Das Hin- und Herwandern von Schritten an Deck dauerte noch bis tief in die Nacht fort, die Piraten füllten anscheinend sämtliche Tanks und Fässer ohne Ausnahme, und noch in derselben Nacht wurden die Anker gelichtet. Die ›Vesta‹ stach in See.
Die Vestalinnen hatten unterdes jenes Schiff gesehen, mittels dessen die Piraten auf der Insel gelandet waren, eine Bark, die gegen Nachmittag die ›Vesta‹ passierte und gegen Norden kreuzte. Es mochten nur zehn Matrosen an Deck stehen, um die Takelage bedienen zu können, während die auf der ›Vesta‹ Befindlichen wohl auf dreißig zu schätzen waren.
Die ›Vesta‹ fing an, auf der See zu schlingern, aber die Mädchen wußten nicht, wohin der Kurs ging, denn das Auge entdeckte durch das Fenster an dem bewölkten Himmel keine Sterne, die natürlichen Wegweiser des Seemanns.
An Deck wurde die ganze Nacht gearbeitet. Fortwährend erschallten spanische Kommandos, Fluchen und Schwören, Hin- und Herlaufen, und schwere Gegenstände fielen heftig auf. Als die niedergeschlagenen Mädchen gegen Morgen in einen unruhigen Schlummer verfielen, hörten sie noch im Traum dieses Hasten und Arbeiten, und als sie bei hoher Sonne erwachten, hatte es auch noch nicht nachgelassen.
An dem Schiffe wurde gezimmert, so viel hatten die Gefangenen herausbekommen. Was aber hätte an der ›Vesta‹, diesem prachtvollen, immer in gutem Stande erhaltenen Schiffe, repariert werden sollen?
Der Tag verging ohne besonderes Vorkommnis. Die Damen wurden gut verpflegt und bis auf einen Beobachter an der Tür völlig in Ruhe gelassen. Diesen Posten nahm meistenteils Miß Morgan ein, nur selten und für kurze Zeit erschien ein bärtiges Gesicht an der Oeffnung.
In der Stimmung der Mädchen war unterdes ein bedeutender Umschlag erfolgt. Die Niedergeschlagenheit war geschwunden. Es wurde noch einmal ernst erwogen, was ihr Los sein könne, und nach der Ansicht der meisten bestand es in Sklaverei. Einige der Mädchen entwickelten sogar wieder Humor. Eine erklärte, einmal in die Sklaverei zu kommen, wäre ihr gar nicht so unangenehm, denn erstens hätte man dann eine herrliche Gelegenheit zu einer kühnen Flucht, und zweitens könne man nach Gelingen derselben etwas erzählen, was sonst nur in Romanen zu lesen sei. Dieses Beispiel von guter Laune steckte an, es wurde bloß noch von Abenteuern gesprochen, die einer Sklavin, und noch dazu einer schönen Weißen, warteten, und die Folge war, daß die Spannung, welche zwischen den Vestalinnen seit der Aussetzung Johannas geherrscht hatte, vollkommen schwand, neue Freundschaft entstand, und von neuem das Gelübde wiederholt wurde, in Leben und Tod treu zusammenzuhalten.
Die Nacht brach wieder an, und die Mädchen genossen diesmal einen tiefen Schlaf, nach dem sie gestärkt und erquickt an Körper und Seele erwachten.
»Land,« sagte Ellen und deutete auf eine felsige Insel in der Ferne, »und wir segeln auf dasselbe zu.«
»Wissen Sie, zu welcher Gruppe diese Insel gehört?« fragte ein Mädchen.
»Ich sehe nur diese einzige Insel,« entgegnete Ellen, »und es scheint mir, als sei sie eines jener Felseneilande, welche, Spiele der Natur, mitten im Ozean einsam daliegen, wahrscheinlich durch vulkanische Eruptionen des Meeresgrundes entstanden. Ich wage aber nicht einmal anzudeuten, wo wir uns befinden.«
Das Eiland, auf welches die ›Vesta‹ zusegelte, erhob sich mit hohen Felsen aus dem Wasser, ohne irgend eine langsam ansteigende Küste zu zeigen. Man trifft im Meere oftmals auf solche sich jäh erhebende Inseln.
»Was mögen die Piraten auf dieser Insel wohl zu suchen haben?« äußerte ein Mädchen fragend. »Dieselbe scheint völlig unbewohnt, ja, sie sieht aus, als könne man nicht auf sie gelangen, denn die Felsen verwehren den Zutritt. Man müßte denn mit Leitern und Tauen sich den Eingang erzwingen.«
»Jener Anderson sagte, wir sollten an einen sicheren Ort gebracht werden,« meinte Ellen. »Könnte dieser jene Insel sein? Es wird schon irgendwo ein Zugang existieren.«
Die ›Vesta‹ hatte sich der Insel so weit genähert, daß man die zerklüfteten Felsen und die in den Höhlen wütende Brandung erkennen konnte. Die Piraten fuhren um das Eiland herum, ohne daß ein Platz zu sehen war, von welchem ein Besteigen der Insel möglich gewesen wäre. Zuletzt aber entdeckten die Mädchen doch eine wie von vulkanischer Kraft erzeugte Bresche in dem Felsen, und auf diese hielt die ›Vesta‹ zu.
»Wir sollen also doch hier gelandet werden!« rief Ellen. »Nun denn, meine Damen, so werden wir Robinson spielen müssen!«
»Das wäre das Schlimmste noch nicht,« entgegnete ein Mädchen. »Aber dem äußeren Aussehen nach ist die Insel nichts weiter als ein Felsenriff, die Bresche in dem Gestein eröffnet dem Blick ein völlig kahles Plateau ohne jede Vegetation.«
»Und doch kommen wir darauf! Hören Sie, die Boote werden ins Wasser gelassen!«
Da wurde die Tür geöffnet, und zum ersten Mal betrat ein Mann den Raum — es war Tannert. Er hatte sich davon überzeugt, daß die verwegenen Vestalinnen nicht gewillt waren, einen Befreiungsversuch zu unternehmen, vorläufig wenigstens nicht, und so hielt er sich für sicher.
»Meine Damen,« begann er höflich, »ich bin damit beauftragt, Sie auf dieser Insel, welche Sie durch das Fenster sehen können, auszusetzen. Ich bitte Sie dringend, nichts zu unternehmen, was einem Fluchtversuch oder einer Verteidigung ähnlich sieht, sonst wäre ich genötigt, Gewalt anwenden zu lassen.«
»Wir sollen auf dieser verlassenen Insel ausgesetzt werden?«, rief Ellen entrüstet. »Das gleicht einem Morde!«
»Sie irren, die Insel ist zwar unbewohnt und besteht nur aus Felsen, aber es sind bereits alle Vorkehrungen zu Ihrem Lebensunterhalt getroffen worden. Sie werden Zelte, Wasser, Lebensmittel, Bücher und so weiter drüben vorfinden. Nichts ist unterlassen, um Ihnen den unfreiwilligen Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Ich bitte Sie also nochmals, bei der Ueberfahrt keinen Widerstand zu leisten. Je ruhiger Sie sich verhalten, desto schneller sind Sie wieder sich selbst überlassen und von der Gegenwart der Piraten befreit.«
»Und wer ordnet dies alles an?« fragte Ellen mit klopfendem Herzen.
»Das kann ich Ihnen nicht sagen, einfach darum, weil ich es selbst nicht weiß,« entgegnete Tannert lächelnd, welcher immer bemüht war, sich in ein möglichst gutes Licht zu setzen.
Die Damen hatten natürlich keine Ahnung davon, welch strengen Befehl Tannert unter dem Siegel des Meisters empfangen hatte, die Damen mit ausgesuchtester Höflichkeit zu behandeln und alles zu vermeiden, wodurch die Mädchen zum Widerstand gereizt werden konnten, so daß man sie mit Gewalt zum Gehorsam zwingen müßte. Furchtbare Drohungen schlossen den Brief, wenn den Damen auch nur ein Haar gekrümmt würde, wenn man ihnen auch nur mit einem Worte zu nahe träte, und wäre Miß Morgan darin nicht vergessen worden, so hätte auch diese die einstigen Freundinnen ganz anders behandeln müssen.
Tannert zitterte bei dem Gedanken, daß die Mädchen sich nicht fügen würden, denn, mußte er zur Schonung seines eigenen Lebens den Damen Schaden zufügen, so war sein Kopf verloren.
Aber glücklicherweise versicherte ihm Ellen aufrichtig, sie würden nicht widerstreben, jene Insel zu betreten, nur sollte er möglichst schnell machen und ihnen dann noch eine Unterredung gönnen.
Tannert bat darauf, daß je vier Damen zugleich den Raum verließen.
Ellen befand sich unter den ersten der vier Mädchen, welche das Deck betraten.
Ach, wie hatte sich die ›Vesta‹ verändert! Ihre früheren Besitzer konnten sie kaum noch erkennen, zugleich aber konnte Ellen nicht die Bewunderung verhehlen, mit welcher Geschicklichkeit die Piraten das Aussehen eines Schiffes zu verwandeln verstanden.
Das einst völlig weiße Schiff war gelb angestrichen worden, das Deck dunkel gebeizt, der Schiffsrumpf aber war, wie sie vom Boote aus bemerkten, mit einer schwarzen Farbe versehen worden.
Selbst die Masten und Raaen hatten den gelben Anstrich erhalten.
Das waren aber nur Aeußerlichkeiten, denn das Schiff selbst hatte eine andere Form erhalten.
Es waren nicht mehr an jedem Mast sechs Raaen angebracht, sondern deren nur fünf, die obersten fehlten; die Masten waren gekürzt worden. Das Häuschen am Ruder hatte einem anderen Platz machen müssen. Die Kombüse war nicht mehr zu erkennen, der Klüverbaum war kürzer geworden, und das Heck hatte einen Aufbau erhalten, daß das ganze Aussehen der ›Vesta‹ total verändert wurde. Die Mädchen selbst konnten ihr eigenes Schiff nicht wiedererkennen. Sie hätten geglaubt, sich auf einem anderen zu befinden, wenn sie nicht wußten, daß sie die ›Vesta‹ gar nicht verlassen hatten.
Der Seewolf weidete sich am Erstaunen der Mädchen, das seine Kunstfertigkeit bezeugte. Er stand vor der Front von zwanzig Matrosen, welche so postiert waren, daß die vier Damen auf dem Wege nach dem Fallreep zwischen zwei Reihen hindurch mußten. Bei dem geringsten Zeichen zur Widersetzlichkeit wären sie sofort überwältigt worden.
Die Damen stiegen in das Boot, in dem sich außer acht Matrosen Tannert befand. Es stieß ab und erreichte nach wenigen Ruderschlägen die Bresche zwischen den Felsen, dem einzigen Zugang zu dem Inneren der Insel.
Die Damen stiegen gelassen aus.
»Nehmen Sie Besitz von der Insel und Ihrem Eigentum,« rief ihnen Tannert beim Abstoßen des Bootes zu, »dies jungfräuliche Eiland gehört Ihnen.«

Die vier Mädchen befolgten seinen Rat. Wohl zwanzig Meter mußten sie durch die schmale Felsspalte gehen, dann tat sich vor ihren Augen ein weites Plateau auf, welches völlig nackt war, wenigstens seiner Natur nach, jetzt aber standen in weitem Kreise fünfundzwanzig Zelte herum, in denen die Mädchen ihre eigenen wiedererkannten.
»Es sind schon vorher Vorbereitungen getroffen worden, uns zu empfangen,« rief Ellen erstaunt. »Das hat wahrscheinlich jenes Schiff getan, welches schon vorher an uns vorbeigefahren ist.«
Sie eilten von Zelt zu Zelt und fanden die Aussagen des Mister Anderson bestätigt. Ein jedes enthielt die vollständige Garderobe jeder einzelnen Dame, alles, was sie auf der ›Vesta‹ zu ihrer Toilette gebraucht hatten, nichts war vergessen worden, aber nicht nur dies, sondern auch die gesamte Bibliothek war vorhanden, in den einzelnen Zelten verteilt. Selbst das Klavier hatte man ausgeladen und in einer geräumigen Höhle aufgestellt, deren in den Felswänden noch unzählige vorhanden waren.
Als die Damen einzeln dieselben besichtigten, fanden sie diese zu ihrem grenzenlosen Erstaunen mit fast allen Möbeln ausgestattet, die sich auf der ›Vesta‹ befunden hatten, selbst Geschmack war entwickelt worden. Eine jede Höhle zeigte eine andere Einrichtung; unter den Piraten mußte es einen Mann mit künstlerischem Blick geben. Vor den Eingängen zu den Höhlen waren Portieren in schönem Faltenwurf angebracht und die Wände, ebenso wie der trockene Boden mit Teppichen belegt.
Der Befehl des Meisters in Verbindung mit seinen furchtbaren Drohungen mußte diese Leute zu einer fabelhaften Schnelligkeit anspornen.
»Das ist ja wirklich reizend,« rief ein Mädchen förmlich entzückt, »das ist ja fast so ein Eiland, wie es sich einige Damen gewünscht haben, um darauf ihr Leben zu beschließen, wenn es auch keine paradiesische Schönheiten aufzuweisen hat.«
Es kamen nach und nach immer mehr Damen an, und alle waren anfangs sprachlos vor Staunen.
Sie untersuchten eine Höhle nach der anderen, und immer fanden sie alles, was sie auf Jahre hinaus zum Leben nötig hatten. Fässer mit Trinkwasser, gesalzenes Fleisch, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, eine Unmenge von Büchsen und Konserven, ferner einen ungeheuren Vorrat von kleingespaltenem Holz und Kohlen.
Bald aber bemerkten die Mädchen, daß der Anführer der Piraten, Tannert, bei Auswahl aller dieser Gegenstände eine ganz besondere Vorsicht hatte walten lassen; soviel sie unter den Vorräten auch suchten, außer Löffeln, kleinen Gabeln und Tischmessern fanden sie nichts, was einer Waffe geglichen hätte, nicht einmal eine Axt wurde vorgefunden, und zum Oeffnen der Fässer waren nur ein Meißel und ein Holzhammer vorhanden.
Alle zweiundzwanzig Mädchen waren an Land gebracht worden, und zu ihrer Verwunderung wurden auch noch die dreizehn befreiten Sklavinnen gelandet.
Mit dem letzten Boote begab sich auch Tannert ans Land und trat unbefangen unter die Vestalinnen, während die Matrosen in der Felsspalte beschäftigt waren, aber da diese eine starke Krümmung machte, von den Mädchen nicht bemerkt werden konnten.
»Haben Sie Ihre Vorräte untersucht, und haben Sie sonst noch einen Wunsch?« fragte Tannert.
»Wir möchten erfahren, wem wir diese Vorsorglichkeit zu danken haben,« entgegnete Ellen, »und wer es ist, der uns hat fangen lassen, um uns hier auszusetzen. Die Insel gleicht einem Gefängnis. Wir können sie nicht verlassen, wenn Sie wegfahren, also beraubt man uns der Freiheit. Von wem geht dies aus und was wird dabei bezweckt?«
»Ich darf Ihnen diese Fragen nicht beantworten und kann es auch nicht; es hat keinen Zweck, wenn Sie weiter fragen. Aber ich versichere Ihnen, meine Damen, bald werden Sie alles erfahren. So viel haben Sie wohl schon gesehen, daß man Ihnen wohl will, und sollten Ihnen diese Vorräte ausgehen, so werden dieselben erneuert werden. Not brauchen Sie also niemals zu leiden. Vertreiben Sie sich die Zeit, so gut Sie können, ich bin der festen Ueberzeugung, daß sich jemand von Zeit zu Zeit nach ihrem Ergehen erkundigen wird, dem sie eventuelle Wünsche mitteilen können. Und nun lassen Sie es sich gut gehen, meine Damen, ich glaube, Sie können meinem Betragen Ihnen gegenüber nur das beste Zeugnis ausstellen.«
Schnell wandte sich Tannert um und war im nächsten Augenblick in der Felsspalte verschwunden, ehe er noch von einem der Mädchen zurückgehalten werden konnte.
Erstaunt sahen sich diese an.
»Was soll man davon denken?« rief endlich Ellen. »Sollen wir denn hier, abgeschlossen von aller Welt, für immer gefangengehalten werden? Wir wollen schnell noch einmal nach der Küste eilen und sehen, was aus der ›Vesta‹ wird, und ob sie abgesegelt.«
Sie gingen nach der Spalte, Ellen voran.
Da prallte diese entsetzt zurück.
»Wir werden eingemauert,« rief sie erschrocken.
Die Piraten hatten, während die Damen mit der Besichtigung der Vorräte beschäftigt gewesen waren, in die Boote eine Menge Steine geworfen, ausgeladen und zu einer sechs Meter hohen Mauer aufgetürmt, welche sich am Wasserrand erhob. Wie stark sie war, konnten die Damen nicht berechnen, aber jedenfalls stark genug, um ein Durchbrechen mittels der schwachen, zurückgelassenen Messer nicht zu gestatten.
Auf dieser Mauer, welche noch immer wuchs, standen einige Matrosen und gossen aus Eimern, welche ihnen von unten zugereicht wurden, dünnflüssigen Zement über das Steingefüge. Die Masse drang in die Fugen und stellte so eine feste Verbindung her. Die unteren Schichten waren schon erstarrt und fest.

Die Matrosen gossen dünnflüssigen Zement über das Steingefüge.
»Warum mauert man uns hier auch noch ein?« rief Ellen den Matrosen zu.
Diese antworteten nicht. Sie gossen die letzten Eimer Zement in die Fugen der Mauer und verschwanden auf der anderen Seite. Die Mädchen hörten, wie sie in das Boot sprangen, wie die Riemen auf die Bordwand fielen und ins Wasser klatschten. Ein Kommandoruf erscholl, und das Boot setzte vom Ufer ab.
Ellen rannte mit Wucht gegen die Steinmauer, als wollte sie dieselbe niederreißen, aber sie spottete aller Anstrengungen, auch der vereinigten Kräfte der Mädchen. Dieselben waren gefangen, denn die natürlichen Felswände rings um das Plateau erhoben sich senkrecht. An ein Ersteigen derselben war nicht zu denken, selbst wenn sie Stricke und Hacken gehabt hätten, und die künstliche Mauer mit ihrer Zementverbindung bot ein weiteres unübersteigliches Hindernis.
Noch standen die Mädchen da, selbst wie versteinert auf dieser steinernen Insel, noch konnten sie ihr Schicksal nicht fassen, als über der Mauer die äußersten Spitzen von Masten erschienen. Sie gehörten der ›Vesta‹, welche die Anker gelichtet hatte und sich von der Insel entfernte.
Da brach bei einigen Mädchen eine Art von Verzweiflung aus. Sie stürzten stöhnend zu Boden. Ein unnennbares Gefühl von Verlassenheit war über sie gekommen.
»Mut, meine Freundinnen,« rief da Ellen, »wir wollen uns nicht der Verzweiflung hingeben! Es ist besser, die Piraten verlassen uns, als daß wir uns in ihren Händen befinden. Die Zeit wird uns schon zeigen, wem wir dies alles zuzuschreiben haben. Ich erwarte ganz sicher einen Besuch von ihm.«
Kap Horn! Schrecklicher Name für einen Seemann. Es gibt wohl schwerlich einen Menschen, der sein Gewerbe auf dem Meere betreibt, der beim Klange dieses Namens nicht an den Verlust eines teuren Kameraden denkt.
Es ist, als ob auf der Südspitze Amerikas ein Fluch läge, als ob dieser Weltteil nicht wolle, daß er umsegelt werde, denn zahllos sind die Schiffe, welche bei dem Versuch, um die Landspitze zu kommen, zu Grunde gegangen sind, und nicht immer ist die Mannschaft gerettet worden.
Nicht allein der dort fast immer hausende Sturm, verbunden mit schneidender Kälte und Schneegestöber, undurchdringlicher als Nebel, ist an der Dezimierung der Schiffe schuld; gerade hier treten meist Unfälle ein, welche sonst nur selten den Schiffen drohen. Diese sind: Explosion von feuergefährlicher Ladung, Selbstentzündung von Kohlen, Umsturz des Ballastes, wodurch das Schiff kentert u. s. w.
Gerade letzteres ereignet sich bei Kap Horn häufig.
Die Westküste von Südamerika versorgt fast die ganze Welt mit Salpeter; ungezählte Schiffe nehmen dort denselben als trockene, pulverige Masse ein, und zwar so, daß er einfach in den Kielraum bis an das Deck hinauf aufgeschichtet wird. Man stampft den Salpeter nicht zusammen, sondern er bleibt eben liegen, wie er fällt. Es entsteht dadurch eine Ladung, welche unten das ganze Schiff ausfüllt, oben aber in einem Kamme spitz zuläuft. Der trockene Salpeter zieht Wasser an, wird aber dadurch nicht weich, sondern im Gegenteil ganz hart, und bildet eine feste Kruste.
Bricht der Kamm der Masse während der Fahrt ab und stürzt an der Seite herab, so muß das Schiff unwiderruflich kentern, so beträchtlich wird das Gleichgewicht gestört. Doch dieses kommt natürlich sehr selten vor, sonst würde man den Salpeter sorgfältiger laden, etwa in Säcken und diese gleichmäßig verstauen. Passiert es aber doch, dann ist fast immer die Nähe von Kap Horn als Unglücksstätte ausgewählt.
Nirgends in der Welt wüten so heftige Stürme, wie dort, und nirgends findet man einen so heftigen und ungleichmäßigen, oft von allen Seiten zugleich kommenden Seegang, wie dort. —
Wieder einmal hatte ein furchtbarer Sturm das Meer bis in die Tiefe aufgewühlt, und zum zweiten Male dampfte der ›Amor‹ mit geknickter Takelage, wie ein flügellahmer Vogel anzusehen, seinen Weg nach Norden hinauf.
Gestern hatte er noch stolz die Landspitze umsegelt; der Morgen, der ihn dem Norden und Guanosaca zuführen sollte, fand ihn als ein halbwrackes Fahrzeug — Kap Horn hatte der Brigg einen Denkzettel mitgegeben.
Erschöpft standen die Herren an Deck, die Hände von allzuschwerer Arbeit blutend, einige mit Binden um den Kopf, denn die herabfallende Takelage, Stücke von Raaen, Segel und Stricke hatten manchen der Herren verletzt, aber kein Menschenleben war zu beklagen, die Verwundungen waren unbedeutend, und so war auch die Stimmung keine niedergedrückte.
Das ist einmal das Los, welches jedem droht, der sich auf die See wagt; so lange man noch mit ungebrochenen Gliedern aus dem Sturm hervorgeht, hat alles andere nichts zu bedeuten.
Das einzige, was die Engländer bedrückte, war die Unkenntnis über das Schicksal der ›Vesta‹. Sie hatten das Vollschiff nun schon seit zwei Wochen nicht gesehen, aber es war doch anzunehmen, daß es sich auch in diesen Breiten befand, also auch in die Regionen des Sturmes gekommen war, und als Segelschiff mit ungeheuer hoher Takelage, im Vergleiche zu der die des ›Amor‹ verschwand, mußte es ungleich härter mitgenommen worden sein, als dieser.
Gar manchem Segler begegnete der ›Amor‹ am Tage nach dem Sturm, aber ach, wie sahen alle die stolzen Schiffe ohne Ausnahme aus!
Die Masten waren bis zum Rumpf gekürzt. Einige hatten überhaupt keine Raaen mehr. Notsegel waren aufgezogen, und oft glich das Deck einem glatten Tanzboden, kein Haus, kein Boller, kein Steuerrad mehr darauf, alles von der See abgewaschen, das Ruder mußte mühsam mit Stricken regiert werden, und nur zu oft bekamen die Engländer fernerhin Schiffe in Sicht, deren Mannschaft an den Pumpen standen und hastig die Räder drehten, um das Schiff wenigstens so lange über Wasser zu halten, bis der nächste Hafen erreicht worden war.
Aber die Engländer warteten vergebens darauf, von so einer hilfsbedürftigen Mannschaft um Aufnahme gebeten zu werden. Ein Kapitän gibt nicht so schnell sein Schiff und die wertvolle Ladung auf, besonders nicht hier, in der Nähe der Küste, und das Schleppen durch einen Dampfer kostet immer schweres Geld.
Langsam wie die Schnecken krochen die beschädigten Schiffe der Küste entlang, dem nächsten Hafen zustrebend, und immer bereit, wenn das Wasser im Kielraum zu sehr steigen sollte, so daß ein Sinken des Schiffes, nicht mehr zu umgehen war, auf Grund zu laufen.
»Was wird das Los der ›Vesta‹ sein?« dachte mancher der Engländer seufzend. »Werden die Mädchen den Sturm glücklich überstanden haben, und wenn von ihnen doch eine den Elementen zum Opfer gefallen sein sollte, welche wird es sein?«
Wieder kam dem ›Amor‹ ein Schiff entgegen, ein holländischer Segler. Daß es ein solcher war, konnte man an keiner Flagge sehen, denn die Fahnenstange war abgebrochen, aber einmal verrieten die Bauart, die eigentümliche Form des Rumpfes und mehr noch als dieses die Konstruktion der Pumpen, die Herkunft des Schiffes. Die Holländer haben nämlich an ihren Pumpen stets eine Windmühle angebracht, welche das Umdrehen des Rades besorgt und somit das Wasser auspumpt, ohne daß Mannschaft dazu nötig wird. Auch die skandinavischen Schiffe haben oft dieselbe Einrichtung, die holländischen aber durchweg, und es ist sonderbar, daß die Schiffe anderer Nationen diese sinnreiche Einrichtung nicht ebenfalls anwenden.
Es ist zu bemerken, daß die hölzernen Schiffe allesamt immer etwas lecken, weshalb man jede Woche mindestens eine Stunde pumpen muß — eine dem Matrosen sehr lästige Arbeit, die er manchmal verflucht. Bei hohem Seegang leckt das Schiff mehr, als bei ruhigem Wetter, nach einem Sturme am allermeisten, ohne daß es gerade undicht geworden zu sein braucht. Nach und nach schließen sich meist die entstandenen Fugen wieder, tun sie es nicht, dann erst sagt man, das Schiff habe ein ›Leck‹.
Die holländische Bark war vom Sturme etwas mehr verschont geblieben, als andere Schiffe. Ihr Vormast stand noch. Keine Raa fehlte. Nur der Besanmast, der hinterste, war etwas gekürzt, und der mittelste Mast, der Großmast, war abgebrochen, vielleicht von der Mannschaft selbst gekappt worden, um dadurch das Schiff retten zu können.
Im Fallen hatte er die eine Seite der Bordwand zerschmettert, sonst war das Schiff unbeschädigt und vollkommen segel- und manövrierfähig.
Es lief mit dem Winde, gegen welchen der ›Amor‹ anzudampfen hatte.
»Er heißt am Vormast Flaggen,« rief Lord Harrlington, »er will uns ein Signal geben.«
Das Signalbuch ward aus dem Kartenhaus geholt und die Verstandenflagge auf dem ›Amor‹ hochgezogen, das Zeichen, daß man bereit sei, das Signal abzulesen.
Auf dem Holländer flatterten eine Reihe von Wimpeln in der Luft.
»Kommt in Rufweite, es fehlen uns Flaggen!« las Harrlington ab.
»Der Holländer ist nicht mehr im Besitz aller Flaggen,« erklärte Harrlington, »der Sturm wird ihm die betreffende Kiste geraubt haben. Er will uns aber eine Mitteilung machen; wir müssen also an ihn heranfahren.«
Er gab die geeigneten Befehle. Der ›Amor‹ änderte etwas den Kurs und dampfte auf die Bark zu. Zu weit durfte er sich dem Schiffe nicht nähern, denn der Seegang war noch immer sehr hoch, aber eine deutliche Verständigung mittelst des Sprachrohrs doch möglich, als der ›Amor‹ querab von dem Holländer lag, Gegendampf gab und rückwärts fuhr, mit der Bark gleiche Fahrt haltend.
Der Kapitän stand auf der arg beschädigten Kommandobrücke, das Sprachrohr in der Hand; die Matrosen waren an Deck mit Reparaturen beschäftigt, nähten Segel, und einige unterstützten auch noch die selbsttätige Pumpe. Die Bark mußte also stark lecken.
»Was für ein Dampfer ist das?« drang es in jenem eigentümlichen, durch Luftschwingungen erzeugten Tone aus dem Sprachrohr zu Lord Harrlington herüber.
»Der ›Amor‹, Lustfahrzeug des englischen Yachtklubs ›Neptun‹, Insel Wight,« erwiderte Harrlington.
Der Kapitän lüftete die Mütze, eine Frage nach dem Führer dieser Brigg war nicht nötig. Derartige Lustfahrzeuge haben keinen Kapitän von Profession, der befähigteste Mitbesitzer des Schiffes wird als solcher gewählt — das war ihm wohlbekannt.
»Bark ›Marie‹, Amsterdam, Kapitän Niedenbrock,« stellte der Kapitän sein Schiff und sich selbst vor. »Wir kommen von Sant Blas mit Holz. Heute morgen 6 Uhr 15 Minuten sahen wir in der Morgendämmerung westlich von uns Raketen aufsteigen und hörten das Nebelhorn heulen. Der Sturm hatte nachgelassen, aber es war neblig und der Seegang hoch; ich versuchte nach dem hilfsbedürftigen Schiffe zu kreuzen, konnte aber bei dem Nordwinde nicht aufkommen. Nach einer Stunde gab ich den Versuch auf. Der ›Amor‹ ist das erste Schiff, dem ich begegne. Kapitän, ich bitte Euch, dampft nach der Stelle, welche ich Euch jetzt so genau als möglich angeben werde.«
Harrlington griff nach Papier und Bleistift und erklärte sich bereit, das Schiff aufsuchen zu wollen.
»Ich konnte den Ort nicht genau bestimmen,« fuhr der Kapitän durch das Sprachrohr fort, »kann Euch also nur meine Fahrt angeben. Paßt auf: Zehn Minuten nach 7 Uhr nahm ich die Fahrt nach Süden wieder auf und steuerte direkt südlich, aller Viertelstunden loggend. Die ›Marie‹ fuhr erst 9 Knoten, dann, 10, 10, 9, 8, 8 und jetzt wieder 9 Knoten. Was ist die genaue Uhrzeit jetzt?«
»Zwei Minuten vor neun Uhr,« antwortete Harrlington.
»Stimmt mit meiner Uhr,« erscholl es wieder vom Holländer herüber, »rechnet aber nicht 14 Knoten, sondern 15. Nach Osten sind wir einen Viertelstrich abgetrieben. Genügt das, um den Ort ungefähr finden zu können?«
»Es genügt, danke Euch, Kapitän! Wohin fahrt Ihr, damit ich Euch Nachricht geben kann, ob mir die Rettung geglückt ist?« rief Harrlington.
»Wir laufen den Hafen von Adelaide an und gehen dort in Dock. Bitte, benachrichtigt mich!«
»Braucht Ihr Hilfe?«
»Nein, die ›Marie‹ hat Holz geladen, sie kann nicht sinken. Beeilt Euch! Wie ist Euer Name?«
»Lord Harrlington, England.«
»Dann Gott befohlen, möge er Euch vergelten, daß Ihr meinen Kameraden beistehen wollt!«
Noch einmal grüßte der Kapitän mit der Hand, die englischen Herren schwenkten die Mützen, dann stoppte die rückwärts arbeitende Schraube des ›Amor‹, und schon nach einigen Minuten hatte die Brigg das holländische Schiff hinter sich gelassen.
»Loggen«, kommandierte Harrlington, den Apparat mit welchem man die Schnelligkeit eines fahrenden Schiffes mißt, hinten am Heck befestigend und als Kurs Norden mit einer kleinen Abweichung nach Westen angebend.
Die Logg-Vorrichtung besteht aus einer Leine, einer Rolle, einem Brettchen und einer sogenannten Sanduhr. Die Leine ist durch eingeschlagene Knoten geteilt, und je ein Teil bezeichnet eine Meile oder, wie der Seemann sagt, einen Knoten. Vorn ist ein Brettchen befestigt, welches unten mit Blei beschwert ist, so daß es, wenn es ins Wasser geworfen wird, in demselben senkrecht schwimmend steht, es folgt demnach nicht dem wegfahrenden Schiff, sondern bleibt an einer Stelle. Die Leine läuft an einer Rolle, und so viele Knoten, wie dem Matrosen durch die Hand gleiten, während der Sand der Sanduhr in den leeren Glasbehälter rinnt, so viele Knoten macht das Schiff. Es ist keine Umrechnung nötig, die Sanduhr und die Leine sind so gearbeitet, daß die Menge der Knoten in der Leine sofort die richtige Zahl der zurückgelegten Meilen in der Stunde angibt.
Eine neuere Einrichtung ist die, daß an einer Leine eine Schraube, nach Art der Schiffsschrauben konstruiert, im Wasser nachschleppt. Dadurch setzt sich die Schraube in Umdrehung, mit ihr die Leine, diese endigt in einer Uhr, welche nun durch Zeiger die zurückgelegten Meilen anzeigt.
Eine Vorrichtung letzterer Art besaß auch der ›Amor‹.
»Wir fahren 14 Knoten in der Stunde,« meinte Harrlington zu Hastings, dem ersten Steuermann, nach Besichtigung der Logguhr. »In einer Stunde müßten wir uns ungefähr da befinden, wo die ›Marie‹ die Raketen hat aufsteigen sehen. Da aber das hilfsbedürftige Schiff, wenn es noch auf dem Wasser schwimmt, vom Winde uns entgegengetrieben wird, so können wir darauf rechnen, es schon eher zu sehen. Wir wollen daher schon jetzt scharf Ausguck halten. Hoffen wir, daß es der Mannschaft gelungen ist, sich über Wasser zu halten, und daß wir das Schiff finden, wenn es auch nur ein Wrack ist.«
»Die Leute müssen in einer gefährlichen Lage gewesen sein, sagte Lord Hastings, »sonst hätten sie nicht Raketen steigen lassen. Es ist auch leicht möglich, daß die Mannschaft, da sie keine Hilfe erhielt, ihre Rettung in den Booten versucht hat und wir ein leeres Wrack oder auch dieses nicht mehr finden.«
»Wir wollen uns nicht mit Befürchtungen quälen,« entgegnete Harrlington, »sondern das tun, was in unserer Kraft liegt. Stoßen wir auf ein Wrack ohne Mannschaft, dann suchen wir heute und auch noch diese Nacht unter Aussendung von Raketen das Meer ab, um die in den Booten befindliche Mannschaft zu retten; sehen wir auch kein Wrack mehr, dann wollen wir ebenfalls noch suchen, in der Hoffnung, daß sich die Leute doch in Boote gerettet haben, das Schiff aber gesunken ist. Mehr können wir nicht tun, das andere muß Gott überlassen bleiben. Wir haben nichts zu versäumen. Einen Tag können wir also zum Suchen der Schiffbrüchigen opfern, vielleicht, wenn wir es für gut befinden, auch noch mehr.«
Alle Herren wurden an Deck verteilt und mußten mit Hilfe von guten Ferngläsern den Horizont abspähen. Der Nebel war gefallen, der klare Morgen gestattete eine weite Fernsicht, und es war nicht so leicht möglich, daß den scharfen Augen der jungen Sportsleute ein Wrack entging, ja, selbst schwimmende Schiffsplanken hatten ihre Aufmerksamkeit erregt.
»Hier ungefähr hat die ›Marie‹ die Raketen aufsteigen sehen,« rief eine Stunde später Harrlington. »jetzt aufgepaßt!«
Der ›Amor‹ dampfte langsamer, und die Herren strengten ihre Augen noch mehr an.
Eine Viertelstunde verging, und noch war nichts bemerkt worden. Die Herren tauschten schon untereinander Bemerkungen aus, daß das Schiff entweder bereits von einem anderen Dampfer weggeschleppt worden oder vielleicht auch gesunken war.
»Wir müssen Bogen fahren,« erklärte Harrlington und ließ den ›Amor‹ in weitem Bogen dampfen, bald nach links, bald nach rechts, wodurch eine viel weitere Umschau ermöglicht wurde.
Aber auch dies war vergeblich, nichts war zu erblicken.
»So bleibt uns nur noch übrig, nach den Booten zu suchen,« sagte Harrlington niedergeschlagen, »und zwar müssen wir östlichen Kurs einschlagen, denn wenn die Mannschaft sich in Booten gerettet hat, so versuchten sie sicher, die Küste zu gewinnen. Lassen Sie Osten steuern, Lord Hastings!«
»Halt,« rief da plötzlich Sir Hendricks, »ist das dort ein toter Fisch, der mit den Rückenflossen aus dem Wasser heraussieht, oder ein anderer Gegenstand?«
Aller Augen wandten sich der bezeichneten Richtung zu und sahen etwas aus dem Wasser ragen, was wirklich den Flossen eines großen Fisches ähnlich sah, etwa denen eines sehr großen Haies.
»Es ist der Kiel eines gekenterten Bootes,« rief jedoch Lord Harrlington, welcher nicht so getäuscht wurde, wie es fast immer bei denen geschieht, welche ein gekentertes Boot zum ersten Male sehen.
Der ›Amor‹ durchfuhr die Strecke von einigen hundert Metern und setzte ein Boot aus. Sir Williams befestigte einen Haken an einem Tau, und mit Hilfe der Winde wurde das Boot durch die vereinten Kräfte der Herren emporgezogen.
Kaum ragte es zur Hälfte aus dem Wasser heraus, so entfuhr fast gleichzeitig ein Schreckensruf den Lippen aller.
Das Boot war weiß angestrichen, und hinten stand in goldverzierten Buchstaben der Name ›Vesta‹.
»Ein Boot der ›Vesta‹,« stammelte Harrlington mit bleichen Lippen, »und ohne Korkfassung.«

Die Boote der ›Vesta‹ konnten ebenso, wie die des ›Amor‹ mit einem Korkgürtel umgeben werden, um bei hohem Seegang das Boot vor Kenterung zu bewahren, gewöhnlich war aber diese Schutzvorrichtung nicht daran, denn sie hinderte die Schnelligkeit der Fahrt.
Lange Zeit wagte niemand zu sprechen. Alle starrten sprachlos, entsetzt das weiße Boot an, welches zur Hälfte in der Luft hing und beim Schlingern des ›Amor‹ jedesmal dröhnend an den Schiffsrumpf schlug. Sie konnten die Augen nicht von den schwarzen Buchstaben ›Vesta‹ wenden.
»Die ›Vesta‹ hat Schiffbruch erlitten,« murmelte endlich Lord Hastings.
»Ziehen Sie das Boot völlig an Deck!« sagte dann Harrlington. »Wir wollen es untersuchen.«
Es wurde hochgewunden, die Davits, in denen die Boote hingen, eingeschwungen und das Fahrzeug lag an Deck. Es enthielt nichts weiter, als die Sitzbretter, alles andere war heraus, die kupfernen Dollen, in denen die Riemen bewegt wurden, das Steuerruder und jede andere Ausrüstung.
»Die Damen haben es bei dem Sturme versucht, sich in Booten zu retten,« sagte Harrlington mit zitternder Stimme. »Es ist der Kutter der ›Vesta‹ den wir hier vor uns haben. Er wurde von den Damen mit zwölf bis vierzehn Personen besetzt, also muß noch ein anderes Boot bemannt worden sein. Und beim Himmel,« rief Harrlington laut und sich emporrichtend, »ich will nicht eher ruhen, als bis ich dieses andere Boot gefunden habe.«
Die plötzliche Energie, welche Harrlington entwickelte, vermochte nicht die übrigen Herren in eine andere Stimmung zu bringen. Bis zum Tode erschrocken über das Resultat ihrer Untersuchung waren sie alle. Die Herzen einiger wurden aber von einer namenlosen Verzweiflung erfaßt, und derjenige, welcher sonst jedes Unglück als unabwendbar gleichmütig ertrug, brach diesmal wie gebrochen zusammen und vergrub das Gesicht in den Händen — Charles Williams.
Er war außer sich, er wollte nicht auf die Trost- und Hoffnungsreden hören, er glaubte vor Schmerz vergehen zu müssen.
»Tot — tot,« murmelte er wieder und wieder unter hervorbrechenden Tränen, »alles dahin!«
Aber es mußte schnell gehandelt werden. Vielleicht trieb das andere Boot, vielleicht deren mehrere — denn die Vestalinnen hatten die Sklavinnen sicher nicht im Stich gelassen — auf offener See umher, und die Insassen warteten sehnsüchtig auf ein nahendes Schiff.
Wieder begann der ›Amor‹ unter der Leitung Harrlingtons große Bogen zu fahren, jetzt aber mehr auf die Westküste Südamerikas zuhaltend, von der sie dreihundert Meilen entfernt waren.
Noch einmal stießen sie auf eine weißgestrichene Tonne, welche ebenfalls, wie alles an Bord dieses Schiffes, den Namen ›Vesta‹ eingebrannt führte. Es war dieses wieder ein Zeichen, daß die ›Vesta‹ gesunken war, und zwar in dieser Gegend, und um jede Hoffnung auszuschließen, fand man auch noch einige Planken des Schiffes auf dem Meere.
In einigen Herren, darunter auch in Harrlington, war als letzter Hoffnungsstrahl der Gedanke geblieben, daß das Boot nur durch Wogen losgerissen worden wäre, besonders, weil die Korkeinfassung an demselben fehlte, jetzt aber durfte man sich keiner solchen Hoffnung mehr hingeben, und als Männer sprachen die Engländer offen ihre Vermutung über die ›Vesta‹ und das Schicksal der Damen aus.
Die ›Vesta‹ war jedenfalls, wie es oft geschieht, von den eigenen Masten leck gerammt worden, welche der Sturm über Bord geworfen hatte und deren Taue von der Mannschaft nicht schnell genug gekappt werden konnten. Das Schiff sank rasch, es war keine Zeit mehr, die Boote mit dem Kork zu bekleiden, sie wurden einfach ins Wasser gelassen und notdürftig ausgerüstet. Die Mädchen nahmen in den schwankenden Nußschalen die Fahrt nach der Küste auf.
Eins der Boote hatten die Herren bereits gefunden. Es war gekentert, und die unglücklichen Insassen mußten ertrunken sein, denn selbst wenn das andere Boot in der Nähe gewesen wäre, war bei dem hohen Seegang doch eine Aufnahme der im Wasser Schwimmenden nicht möglich gewesen.
Hatte sich das andere Boot oder die anderen Boote gehalten? Oder war ihr Suchen fruchtlos, ruhten die jungen Mädchen auch schon auf dem Meeresboden? Diese Fragen schnürten die Brust der Engländer zusammen, während der ›Amor‹ dem Osten der Küste zustrebte.
Unablässig spähten die Herren durch Fernrohre den Horizont ab, jedes ihnen begegnende Schiff wurde gefragt, ob es ein bemanntes Boot ›aufgefischt‹ oder ein leeres, gekentertes oder ob sie überhaupt eins gesehen hätten, es war alles vergeblich — weder entdeckte der Amor die Schiffbrüchigen, noch erfuhr man von fremden Schiffen über den Verbleib derselben.
Die Nacht brach an und fand die trostlosen Männer noch immer bei ihrer Arbeit. In der Finsternis wurden Raketen zum Himmel aufgeschickt. Bei Nebel ertönte ununterbrochen die Dampfpfeife, um dem Boote ein Zeichen zu geben — nichts. Am Morgen sahen sich die Männer mit bleichen Gesichtern an, sie wußten, sie durften keine Hoffnung mehr haben, aber keiner sagte es dem anderen; sie trösteten sich gegenseitig.
Und wieder wurde den ganzen Tag das Meer abgesucht, ebenso die kommende Nacht, und am anderen Morgen beleuchtete die Sonne ein wildes, zerklüftetes Gestade — die Küste von Chile.
Das bloße Auge schon konnte dort ein kleines Dorf liegen sehen, wahrscheinlich ein Fischerdorf, denn zahlreiche, bemastete Fahrzeuge schaukelten sich in einer Bucht. Dahin beschlossen die Herren erst einmal zu fahren.
»Es könnte sein,« hatte Lord Harrlington gesagt, »daß das Boot die Küste erreicht hat — hoffen wir es! Es wäre zwar wunderbar, aber diese Fischer, welche weit längs der Küste fischen, können vielleicht erfahren haben, daß irgendwo ein Boot mit Schiffbrüchigen angelaufen ist, so etwas pflanzt sich schnell an der ganzen Küste fort. Hören wir hier nichts, so führen wir direkt nach Valdivia, gehen zum englischen Konsul und setzen eine Summe aus für die Mitteilung, daß irgendwo ein Boot mit Schiffbrüchigen landen gesehen worden ist. Für eine schnelle und weite Verbreitung der Ausschreibung müssen wir Sorge tragen. Das ist das einzige Mittel, wie wir am schnellsten erfahren können, ob ein Boot gerettet worden ist. Der Konsul wird das Seinige dazu tun, daß alle Seemannsämter der Welt veranlaßt werden, jedes Schiff zu fragen, ob es ein Boot mit Damen aufgenommen hat. Dann müssen wir in Valdivia warten, bis wir die Depeschen erhalten.
In dem kleinen Fischerdorfe, welches die Herren in Booten besuchten, erfuhren sie nichts. Die Fischer hatten bei dem letzten Sturm selbst Kameraden verloren und trauerten um dieselben. Man hinterließ ihnen, daß sie sofort nach Valdivia berichten sollten, wenn sie noch etwas erführen, Gutes oder Schlimmes, wenn zum Beispiel die Leichen der Mädchen an die Küste getrieben würden. Ein reiches Geschenk veranlaßte die armen Fischer zu der Beteuerung, sie wollten die ganze Küste von Chile absuchen und von jetzt ab nur noch mit den längsten Netzen fischen — eine Bemerkung, welche die Herren erschaudern machte.
Der ›Amor‹ steuerte nach Valdivia.
Sie waren nicht mehr weit ab von diesem chilenischen, großen Hafen. Sie glaubten, gegen Abend den Leuchtturm desselben sehen zu können, als sie von einem spanischen Fischerfahrzeug, das sich dem ›Amor‹ zu sehr genähert hatte, beinahe am Heck gerammt worden wären.
Ein Zusammenstoß wäre für den aus Stahl gebauten ›Amor‹ ohne jede Bedeutung, für das hölzerne Fahrzeug aber verderblich gewesen. Doch gelang es den beiden im Boote befindlichen Fischern noch rechtzeitig, durch ein geschicktes Segelmanöver des Klüvers das Boot frei zu bekommen.
Lord Harrlington stand am Heck, beugte sich weit über die Brüstung und beobachtete mit Interesse das kühne, schnelle Handeln der beiden Männer.
»Nehmt euch in acht vor der Schraube,« rief er auf spanisch hinunter, denn das Boot geriet in die Strudel, welche jedem Dampfer nachfolgen, und es fing an, stark zu schwanken.
»Ay, Ay, Senor,« lachte der eine Mann unten fröhlich, »hat nichts zu bedeuten.«
Dann sprang der Fischer, dem nach überstandener Gefahr sofort sein Geschäft wieder einfiel, hinter ins Boot und hob einen Eimer empor, der mit Fischen angefüllt war.
»Makrelen, Senor, frischgefangene Makrelen, zart wie Milch,« rief er.
Wie außer sich stürzte Lord Harrlington plötzlich nach dem Sprachrohr und schrie dem Heizer zu, die Maschine stoppen zu lassen. Der Eimer, der ihm entgegengehalten worden, war weiß angestrichen, und an der Seite stand der Name der ›Vesta‹.
»Komm an Bord,« sagte der Lord zu dem Fischer mit vor Aufregung bebender Stimme, »ich will die Fische kaufen. Nein, nein,« rief er dem Manne zu, welcher die Fische in ein Netz schütten wollte, »bringe den Eimer mit herauf!«
Verwundert schaute der Fischer auf, kam aber dann der Aufforderung nach. Er schwang sich an einem zugeworfenen Tau an Deck des stilliegenden Dampfers und zog den Eimer mit Fischen nach.
Mit klopfendem Herzen umstanden die Herren dieses neue Andenken an die Vesta! Würde man jetzt etwas von dem Verbleibe der Damen erfahren? Vielleicht aus dem Munde dieses spanischen Fischers?
Lord Harrlington sagte dem Spanier, der seine Waare mit geläufiger Zunge anpries, daß er die Fische kaufen würde, doch erst sollte er ihm erklären, wie er zu diesem Eimer käme.
»Heute morgen sah ich ihn auf dem Wasser schwimmen, als ich fischte,« war die Antwort.
»Hast du nichts weiter gefunden?«
»Nein.«
»Kannst du diesen Namen lesen?« fragte Harrlington, auf die schwarzen Buchstaben deutend.
Der Spanier schüttelte lächelnd den Krauskopf, er verstand diese Kunst nicht.
»Er heißt ›Vesta‹,« erklärte Lord Harrlington, »hast du vielleicht gehört, daß ...«
»Ay, ›Vesta‹,« rief der Spanier mit allen Zeichen des Erstaunens, »gewiß, die Senorita ist auf der ›Vesta‹ gewesen, die Stephano aus den Wellen gezogen hat.«
Atemlos hatten die Umstehenden diese Worte vernommen, ihre Herzen gedachten zu zerspringen. Fast wäre Harrlington auf den Spanier zugestürzt, um ihn zu packen, weil dieser tat, als wolle er das Schiff wieder verlassen.
Aber er war nur an die Bordwand getreten.
»Wo ist die Senorita, wer ist Stephano?« stieß Harrlington mühsam hervor.
»Stephano da kann's erzählen,« antwortete der Fischer, auf seinen Kameraden im Boot deutend.
Nach wenigen Augenblicken stand der Gerufene an Deck.
»Hast du eine Dame aus dem Wasser gerettet? Wann? Wie hieß sie? Wie sah sie aus? Lebt sie noch? Wo ist sie?« So klang es von allen Seiten gleichzeitig, bis Lord Harrlington das Verhör übernahm und erfuhr, daß Stephano vor zwei Tagen, nach einer sehr stürmischen Nacht, weit draußen im Meere gefischt habe.
Da sah er mit einem Male auf den Wogen einen Menschen treiben, der sich an ein Stück Mast klammerte. Nach langem Bemühen gelang es Stephano, an den Schwimmenden heranzusegeln, ohne daß sein gebrechliches Fahrzeug von dem Maste getrennt wurde. Als er den Menschen im Boote geborgen hatte, bemerkte er zu seinem Erstaunen, daß es ein in einen Männeranzug gekleidetes Mädchen war.

Jetzt konnten die Herren ihre Zungen nicht mehr im Zaume halten, sie unterbrachen den Erzähler, fragend, wie das Mädchen ausgesehen hätte.
Der Fischer lächelte verlegen.
»Eben wie ein Mädchen, sie hatte lange Haare, kleine Hände und Füße.«
»Wie sah das Haar aus?« fragte Harrlington ungeduldig.
»Hellblond, und wenn ich nicht irre, hatte sie tiefblaue Augen.«
»War sie klein?« fragte Williams hastig.
»Nein, eher groß.«
»Ihr Name, ihr Name?« drängte Harrlington.
Der Fischer griff bedächtig unter das auf der Brust offene Hemd.
»Ehe sie mit ihrem Freunde, den sie traf, nach Villa Rica abreiste, schenkte sie mir ein Andenken und sagte, sie würde es einst wieder einlösen. Ich glaube es ihr, denn ihr Begleiter gab mir zehn Goldstücke, nur so zum Geschenk, damit ich mir ein neues Boot kaufen könne. Also muß die schöne Senorita sehr reich sein.«
Der Spanier brachte eine kleine goldene Kapsel zum Vorschein.
»Miß Petersen,« riefen zwei Stimmen zugleich, und zwei Hände streckten sich gierig nach dem Kleinod aus. Doch ehe sie es noch erfaßt hatten, blieben sie mitten in der Bewegung halten, und die beiden Besitzer der Hände sahen sich an — es waren Lord Harrlington und John Davids.
Wie hatte sich letzterer seit drei Tagen verändert! Lord Harrlington erkannte es mit Entsetzen. Die Augen lagen tief in den Höhlen, die Züge waren eingesunken, die Backenknochen traten weit hervor — das ganze Gesicht zeigte etwas Gespensterhaftes.
»Es ist das Medaillon von Miß Petersen, welches sie immer an der Uhrkette trug,« sagte Davids, sich zur alten Ruhe zwingend, und zog die Hand zurück.
Harrlington kannte diese herzförmige Kapsel sehr gut. Im nächsten Augenblick hielt er sie in der Hand, ein Druck auf die Feder, und der Deckel sprang auf.
Plötzlich wurde der Lord purpurrot im Gesicht, aber zugleich schoß ein Strahl von Seligkeit über dasselbe; er griff mit der Hand an sein Herz und schlug die Augen zum Himmel auf, das Medaillon enthielt sein eigenes Bild, mit Oelfarbe in Miniatur gemalt.
Dann trat er auf Davids zu und zog ihn etwas abseits.
»Mister Davids,« sagte er, »ein ebensolches Bild besitzen Sie von Ellen. Wollen Sie mir jetzt erklären, wie Sie in den Besitz desselben kamen? Sie boten mir oft an, diese Erklärung zu geben, ich aber schlug sie stets ab.«
»Sie können es erfahren,« entgegnete Davids. »Ich selbst habe dieses, Ihr Bild gemalt, auf Wunsch von Miß Petersen, welche es besitzen wollte. Als Dank bat ich um die Gunst, auch sie malen zu dürfen, um ein Andenken von ihr zu haben. Sie gestattete es mir, unter der Bedingung, daß sie das Bild jederzeit von mir zurückfordern könne.«
Erschüttert trat Lord Harrlington zu dem Fischer zurück und hörte dessen weiteren Erzählungen zu. Es war allen anfangs unbegreiflich, daß Miß Petersen nach einer Hazienda in der Nähe von Villa Rica gereist sei, ohne sich vorher um das Schicksal ihrer Freundinnen gekümmert zu haben. Doch der Fischer gab die nötige Aufklärung.
»Die Senorita war vollständig erschöpft, als ich sie in mein Boot nahm, und auch, als ich dort in jener Nebenbucht, wo mein Fahrzeug immer liegt, landete, war sie noch ohne Bewußtsein, lebte aber.
»Sehen Sie dort das schöne Haus stehen?« fuhr der Fischer fort, auf einen weißen Punkt fern im Lande deutend, wo schon die grüne Vegetation anfing. Es mußte ein Haus sein, denn die Sonne brach sich in den Fensterscheiben. »Dorthin brachten wir die ohnmächtige Senorita, und ein Herr, der dort zum Besuch war, nannte sie eine alte Bekannte. Am anderen Tage brachen beide nach der Hazienda des Don Alappo auf, welche bei der Villa Rica liegt. Ihr Freund wohnt dort.«
»Wie heißt dieser Herr, den du als Freund der Senorita bezeichnetest?« fragte Harrlington.
»Ich weiß seinen Namen nicht, Ihr könnt ihn in jener Villa erfahren.«
»Hat jene Bucht dort genügend Wasser, um dieses Schiff einzulassen?«
»Genug, und wenn die Brigg noch einmal so tief ginge.«
Das Fischerboot stieß mit seinen beiden Insassen Vom ›Amor‹ ab. — Der ›Amor‹ steuerte der Küste zu.
»Bei den Wunden Christi,« lachte Stephano, als sich die Brigg weit genug entfernt hatte, daß er nicht mehr gehört werden konnte, »das nenne ich einen Handel! Ich hatte nie geglaubt, daß man durch Lügen so viel verdienen kann. Nun halte reinen Mund, Guiseppe, diese Goldquellen werden noch nicht so bald versagen.«
Die Westküste von ganz Amerika, der nördlichen Hälfte sowohl, als der südlichen, wird von einem mächtigen Gebirge durchzogen, welches niemals durchbrochen wird, auch nicht in der Landenge von Panama, höchstens, daß Pässe den Durchgang gestatten. Die Bezeichnungen für dieses Gebirge sind in den einzelnen Gegenden verschieden, aber das Gebirge selbst ist dasselbe. In Nordamerika wird es im allgemeinen Rocky-Mountains oder Felsengebirge genannt, in Südamerika werden die einzelnen Gebirgszüge im allgemeinen als ›Anden‹ bezeichnet.
Ab und zu überragt ein himmelhoher Berg noch den Gebirgsrücken, und gerade dort findet man gewöhnlich die Pässe.
Chile und Argentinien, diese beiden, in ewigen Reibereien befindlichen, benachbarten Republiken werden durch die Anden voneinander getrennt, und nur Pässe erlauben das Ueberschreiten dieser natürlichen Grenze. Chile ist ein langes, aber kaum hundert englische Meilen breites Land, und sehr fruchtbar, wie die zahlreichen, besonders am westlichen Abhange der Anden liegenden Haziendas beweisen.
Hazienda heißt in Südamerika ein großes Landgut, der Besitzer derselben Haziendero.
Gelangt man durch einen Paß nach Argentinien hinüber, so wechselt das Bild. Dem Auge bieten sich nicht mehr blühende Landschaften dar, sondern unermeßliche Grassteppen, Pampas genannt, auf denen Indianer noch ein zügelloses Reiterleben führen, von der Jagd und Kriegsbeute lebend.
Der gesamte Stamm der auf den Pampas hausenden Indianer zählt zu dem der Araukaner, und der zahlreichste, tapferste und daher auch mächtigste Unterstamm davon ist der der Penchuenchen. Diese beherrschen die Pampas im südlichen Teile Südamerikas.
Dieselben sind gleich den Prärien Nordamerikas, ungeheure Grasebenen, nur daß auf ihnen noch weniger Baumwuchs vorkommt, als auf jenen. Trifft man auf Baumgruppen, so bestehen diese meist aus Aepfelbäumen, aus deren Früchten die Indianer berauschenden Most herzustellen wissen.
In dem mannshohen Grase schleicht der blutgierige Panther die Antilope an. Die buntschillernde Schlange lauert auf die Rohrdommel, und in Sumpf und Fluß wartet der Alligator auf seine Beute. Unzählige Herden wilder Mustangs, das sind Pferde, tummeln sich auf dem unermeßlichen Spielplatz, und die Indianer fangen die schönsten Tiere und reiten sie zu.
Die Penchuenchen sind neben den Cowboys, den Ochsen- und Pferdehirten Nordamerikas, und den diesen gleichenden Vaqueros, welche die Büffelherden an der Ostküste Argentiniens beaufsichtigen, die besten Reiter der Welt. Sie wachsen auf den Pferden auf und sterben auf den Rücken derselben. Schon ihr eigentümlich schleppender Gang verrät, daß sie lieber zu Pferde als zu Fuß sind, und sie scheinen sich auf ebener Erde in allen ihren Bewegungen unsicher zu fühlen. Aber, wie gesagt, es scheint nur so, denn gerade die Penchuenchen sind die besten Läufer und Springer. —
Auf der Hazienda des Don Alappo war große Festlichkeit, denn die Hochzeit seines Sohnes mit der Tochter eines benachbarten Hazienderos wurde gefeiert.
So großer Pomp war selten bei einer solchen Gelegenheit entwickelt worden. Keiner der geladenen Gäste konnte sich entsinnen, jemals einer ähnlichen beigewohnt zu haben; nicht etwa darum allein, weil die immer gefüllte Börse des Don ihm einen großen Luxus erlaubte, sondern weil die Hazienda gerade ungeladene Gäste bekommen hatte: Einquartierung vom chilenischen Militär. Unter den fünfzig Mann waren allein zwanzig Musiker, welche nun dazu beitragen mußten, die Feststimmung zu erhöhen, und die sechs Offiziere drehten sich nach den feurigen Klängen mit den glutäugigen Schönen.
Außerdem war noch ein Gast erschienen, bei dessen Ankunft eine allgemeine Aufregung entstanden war, und welcher bald der Mittelpunkt der ganzen Gesellschaft wurde.
Der Aufseher der Hazienda, der in Geschäften an der Küste gewesen, war gerade dazugekommen, wie zwei Fischer am Ufer landeten, welche eine Schiffbrüchige aus dem Wasser gerettet hatten — so erzählte er — und wunderbarerweise kannte er die Dame. Es war Miß Ellen Petersen, auf deren Farm er vor Jahren als Verwalter tätig gewesen war.
Es gelang ihm, die Bewußtlose ins Leben zurückzurufen; sie erkannte ihn und ging dann auf seinen Vorschlag ein, ihm nach Don Alappos Plantage zu folgen und so lange dort zu bleiben, bis ihre von dem Schreck angegriffene Gesundheit wiederhergestellt sei. Während Miß Petersen einstweilen noch in einer am Strande gelegenen Villa blieb, reiste der Aufseher nach dem nicht weit entfernten Valdivia, ordnete dort an, daß nichts unversucht bleibe, um noch andere Schiffbrüchige der ›Vesta‹ dem Tode in den Wellen zu entreißen, und nahm dann Miß Petersen mit nach der Hazienda.
Diese Miß Petersen war freilich ebensowenig von dem Fischer aus dem Wasser gezogen worden, als Fernando jemals auf ihrer Plantage als Aufseher gewesen war.
Don Alappo und seine Familie nahmen die Unglückliche mit offenen Armen auf, und alle waren bemüht, der Tiefniedergeschlagenen ihr Los vergessen zu machen. Auch hier interessierte man sich für die kühnen Vestalinnen. Die Zeitungen hatten Abbildungen von ihnen gebracht, und Miß Petersen glich im großen und ganzen jenem Bilde, welches eine englische Zeitung in einem nicht gerade guten Holzschnitt von ihr gegeben hatte.
Der Tag des Festes war angebrochen und wurde mit Schmausen und mit Festlichkeiten aller Art verbracht. Der Nachmittag hatte die ganze geladene Gesellschaft im Garten der Hazienda zum Tanz versammelt.
Die zwanzig Musiker saßen auf der Veranda und spielten feurige, spanische Weisen, und die Herren und Damen drehten sich auf den kurzgeschorenen Rasenplätzen nach deren Klängen. Die Spanier sind leidenschaftliche Tänzer; dabei kennt diese sonst so stolze Nation keinen Klassenunterschied; arm tanzt mit reich, und so durften auch hier die Offiziere wagen, trotz der Anwesenheit vornehmer Damen mit den auf der Hazienda bediensteten Mädchen zu tanzen, während die Damen von malerisch gekleideten, langbespornten Vaqueros aufgefordert wurden. Keiner war vom Feste ausgeschlossen worden, und wäre er noch so gering gewesen; heute, am Tage der Freude war alles ebenbürtig — darauf hielt Don Alappo.
Nur wenige waren nicht am Tanze beteiligt, sondern standen von dem Rasenplätze entfernt und schauten den sich Drehenden zu. Dazu gehörten Pedro, der Sohn Alappos und seine junge Frau, welche in kosendem Geplauder unter einem Granatenbaume standen, der Aufseher, der sich mit Miß Petersen leise unterhielt, und der alte Don Alappo, der mit dem Capitano, dem Hauptmann des einquartierten Militärs, ein Gespräch führte.
Der Capitano erzählte ausführlicher, was ihn eigentlich hierhergeführt habe — bis jetzt war dazu noch keine Zeit gewesen, der Vater zu glücklich, um so etwas Geschäftliches geduldig anzuhören.
»Es war ein Zufall,« fuhr der Hauptmann fort, »daß ich mit den Musikern zusammentraf, in deren Begleitung sich vier Offiziere befanden. Wie mir der führende Offizier erzählt, werden Sie schon morgen früh Ihre lästige Einquartierung los werden, ich dagegen, Don Alappo, werde wohl noch einige Tage mit meinen dreißig Mann hier liegen bleiben müssen.«
»Ihre Anwesenheit hier soll mir stets angenehm sein,« erklärte der Haziendero höflich. »Betrachten Sie mein Haus als das Ihre. So sind also wieder Streitigkeiten mit den Indianern zu befürchten?« fuhr er besorgt fort. »Zwei Jahre haben wir nun Frieden mit ihnen gehabt; es ist doch zu schrecklich, daß wegen einiger Pferde von neuem der Kriegsruf erschallen soll.«
»Es hilft nichts; das Recht muß gewahrt werden,« entgegnete achselzuckend der dicke Kapitän. »Fordern wir diesen räuberischen Penchuenchen nicht unter Drohung von Waffengewalt die gestohlenen Pferde wieder ab, so hören diese Pferdediebstähle nicht auf, sie vermehren sich dann in einem geradezu schrecklichen Maße.«
»Sie werden mit Ihren paar Mann nicht viel ausrichten können,« meinte Don Alappo mit einem Blick auf die bunt uniformierten Männer, die sich auf dem Rasenplatze drehten.
»Ich erwarte jeden Tag noch mehr Leute; vorläufig haben wir ja auch nichts Feindliches vor, und so lange der Krieg noch nicht erklärt ist, sind diese dreißig Mann schon eine ganz stattliche Kriegerzahl, welche es mit einem Stamm von hundert Indianern recht wohl aufnehmen kann.«
»Unterschätzen Sie diese nicht. Sie sind tüchtige Krieger, besonders die Penchuenchen. Die letzten Kämpfe haben dies gezeigt,« ermahnte der vorsichtige Haziendero.
»Don Alappo,« sagte der Kapitän stolz, richtete seine kleine, dicke Gestalt stramm auf und legte die Hand an den Degengriff, »ich habe mich schon einmal mit den Penchuenchen gemessen, sie kennen meine Klinge und fürchten sie.«
Der Haziendero antwortete nichts; ein bitteres Gefühl stieg plötzlich in ihm auf. Allerdings hatte dieser Mann einst seinen Degen mit dem Blute von Indianern gerötet; aber es waren nur unschuldige Weiber und Kinder gewesen, die er und seine Leute hingeschlachtet hatten, als sie das verlassene Indianerdorf angriffen. Die Penchuenchen draußen in den Pampas spotteten ihrer Verfolgung; aus den weiten Grasebenen waren sie sicher; als sie aber von der scheußlichen Metzelei erfuhren, da hatten sie sich furchtbar gerächt. Dieser Kapitän war ihrer Rache entgangen, weil er bald darauf versetzt wurde, aber er hätte nicht nach jenem, tausend Meilen von hier entfernten Gebiet kommen dürfen, die Indianer dort dürsteten nach seinem Blute.
»Welcher Stamm ist es, welcher die für die Kavallerie bestimmten Pferde beim Transport geraubt haben soll?« fragte er dann.
»Sein Häuptling wird ›der springende Panther‹ genannt,« sagte der Kapitän.
»Der ›springende Panther‹? Nimmermehr!« rief der Haziendero energisch. »Ich zähle diesen Häuptling zu meinen Freunden. Ich erwarte ihn bald, ich habe ihm den Auftrag gegeben, mir Pferde zu liefern, und er hat sich bis jetzt immer ehrlich und zuverlässig erwiesen.«
»Es ist gut, daß Sie hinzufügen ›bis jetzt‹,« sagte der Kapitän spöttisch, »eine Rothaut ist nie ehrlich, es liegt in ihrer Natur, sie kann sich höchstens einmal so stellen.«
»Und doch behaupte ich, der Indianer ist ehrlich, wenn man ihn rechtschaffen behandelt. Vom Dringenden Panther bin ich wenigstens davon überzeugt. Ich glaube nicht, daß er diese Pferde geraubt hat.«
»Er hat es getan,« versicherte der Hauptmann, »er verheimlicht es gar nicht.«
»Haben Sie die Pferde gekauft gehabt?«
»Allerdings. Die Regierung hat sie gegen Tauschmittel von den Indianern eingehandelt.«
»Vom springenden Panther?«
»Nein, von einem Stamme weiter östlich.«
»Und der springende Panther soll sie beim Transport durch sein Gebiet den begleitenden Soldaten abgenommen haben?«
»Es ist so! Er behauptet, es wären seine Pferde, sie wären ihm erst von einem benachbarten Stamme gestohlen worden.«
»Ah,« rief Don Alappo, »dann ist es etwas anderes, dann wäre der Häuptling in seinem Rechte!«
»Er wäre in seinem Rechte?« fuhr der Hauptmann mit gerunzelten Augenbrauen finster auf. »Seit wann sprechen die Spanier so? Sind die Pferdeherden nicht eigentlich unser? Ist es nicht nur eine Gnade, daß wir die Indianer als Hüter dieser Herden überhaupt in den Pampas lassen?«
»Da sind wir verschiedener Ansicht,« entgegnete der Haziendero achselzuckend, »aber jedenfalls wäre es besser, Sie ließen dem springenden Panther die paar Pferde, ehe Sie Blutvergießen heraufbeschwören. Gutwillig gibt dieser kriegerische Häuptling sein Eigentum nicht auf.«
»So nehmen wir es ihm mit Gewalt!« rief der Kapitän. »Ich handle übrigens im Auftrage der Regierung und nicht nach eigenem Ermessen. Gibt der springende Panther die Pferde nicht heraus, so drohe ich ihm mit Krieg, und ist es mir möglich, so bemächtige ich mich seiner Person. Dann kann er im Gefängnis von Valparaiso nachdenken, ob es recht oder unrecht ist, von der Regierung gekaufte Pferde zu rauben.«
»Und wenn er wieder frei ist, so läßt er den Kriegsruf erschallen, und in die jetzt so friedliche Hazienda wird die Brandfackel geschleudert,« fügte Don Alappo bitter hinzu. »Weiber werden weggeschleppt, Säuglinge an den Mauern zerschmettert und die Köpfe der Väter an den Lanzenspitzen der Indianer befestigt.«
»Was haben jene Schufte mit den friedlichen Hazienderos zu tun? Wir Soldaten sind es, mit denen sie kämpfen sollen.«
»Ist dem Indianer Unrecht zugefügt worden, so rächt er sich an dem Weißen, und es ist ihm gleichgültig, ob er Freund oder Feind den Kopf abschneidet; die Rasse ist es, die er haßt.«
»Aber wir werden dafür sorgen, daß die Hazienderos und ihre Familien und Angestellten ruhig schlafen können,« sagte der Kapitän stolz. »Die Zeiten sind vorüber, da das Militär mit Indianern förmliche Kriege führte. Eine kleine Metzelei, weiter nichts, eine Reiterattacke, und die Indianer sind in alle Winde gesprengt. Doch beenden wir dieses unerquickliche Gespräch, welches doch zu keinem Schlusse kommt, weil wir anderer Ansicht sind,« fuhr der Kapitän höflicher fort. »Sehen Sie dort Ihren Sohn und seine junge Gemahlin, sie werden aufgefordert, ein Solo zu tanzen.«
Die Neuvermählten waren vermißt worden, man hatte sie gesucht, sie in einem Gebüsch auf einer Bank gefunden und zog sie jetzt lachend und scherzend nach dem Rasenplatz. Da sie sich so lange von dem allgemeinen Vergnügen ausgeschlossen hatten, sollten sie jetzt zur Strafe ein Solo tanzen, während die übrigen zusahen.
Die Spanier kennen viele Einzeltänze, wie wir sie nicht haben. Höchstens das französische Menuett und allenfalls unser Kontre sind mit ihnen zu vergleichen; aber es tanzen dort stets nur zwei zusammen, ein Herr und eine Dame.
Auf öffentlichen Bühnen kann man öfters einen spanischen Nationaltanz sehen, etwa die Esmeralda, Castagnette, besonders häufig die Tarantella; aber es ist vollkommen falsch, wenn man glaubt, diese auftretenden Tänzer ahmten mit ihren unnatürlichen Beinverrenkungen und grotesken Sprüngen einen spanischen Nationaltanz nach; dies sind selbsterfundene Phantasietänze; der spanische Zigeuner tanzt wohl einmal für Geld so, aber niemals der wirkliche Spanier.
Alle spanischen Einzeltänze sind eher Schritttänze, die Bewegungen sind langsam und gemessen, es kommt dabei nur auf Grazie an, und die Spanier und Spanierinnen sind darin unerreichbar. Jeder Schritt wird mit einer unnachahmlichen Zierlichkeit gemacht, der Körper graziös hin- und herbewegt, ein Tuch dabei wellenförmig, geschwenkt, und das gegenseitige sich Nähern und Entfernen, wie bei unserem Kontre, hat viel mehr Bedeutung, als bei diesem, denn die Bewegungen drücken bald Liebe, bald Zorn, bald Widerwillen aus, und selbst in den Zügen läßt man dies erkennen.
Aber nie sieht man in Spanien jenes unnatürliche Beinwerfen, welches in Theatern endlosen Applaus hervorruft, und wer den wirklichen Spanier hat tanzen sehen, dem ist dieser natürliche Tanz tausendmal lieber, als jener phantastische.
So drückten jetzt Donna Mercedes und Don Pedro alles noch einmal im Tanz aus, was sie seit einem Jahre erlebt und erlitten hatten; wie er sich jetzt langsam mit ihr im Kreise drehte, so hatte er mit ihr vor einem Jahre zum ersten Male in der Villa ihres Vaters getanzt.
Wie Donna Mercedes jetzt plötzlich Don Pedros Hände von sich stieß und ihm den Rücken kehrte, so hatte sie es gemacht, als er in einem Nebenzimmer ihr auf den Knieen seine Liebe gestand; wie er dann der langsam sich Zurückziehenden mit ausgebreiteten Armen folgte, so war er seitdem der Scheuen gefolgt, und wie er sich im Kreise um sie herum bewegte und unter das, vor das Gesicht gehaltene Tuch zu spähen versuchte, um einen Blick aus ihren schwarzen Augen zu erhaschen, so war er bei Tag und bei Nacht um das einsame Haus gestrichen, um ab und zu die Geliebte zu sehen zu bekommen.
Endlich hielt er ihre Hand fest, aber nochmals entschlüpfte ihm die graziöse Tänzerin, nicht hastig, — das hätte Flucht bedeutet — nein, verschämt und doch scheu, doch Pedro ließ nicht eher nach, als bis er Mercedes gefangen hatte.
Beifallsrufe belohnten die beiden Tänzer. Noch hielt er sie in seinen Armen, da wand sich Mercedes noch einmal, diesmal aber hastig aus den Armen des Geliebten — es gehörte nicht zum Tanz — und deutete mit einem Rufe der Ueberraschung nach dem Eingange zum Garten.
Aller Augen wandten sich dorthin, die eben noch lebhaften Gruppen verstummten, und die Musik brach plötzlich mit einem disharmonischen Tone jäh ab.
An der Gartentür lehnte eine dunkle, hohe Gestalt, ein Indianer, der wahrscheinlich schon lange unverwandt dem tanzenden Paare zugeschaut hatte, denn noch jetzt hingen seine schwarzen Augen wie gebannt an Mercedes, welche unter diesem glühenden Blicke plötzlich erschauerte.

An der Gartentür lehnte zuschauend ein Indianer.
Der Oberkörper des Wilden war nackt und ließ die sehnigen Muskeln sehen, und die Arme, mit denen er sich auf den Gartenzaun stützte, verrieten eine furchtbare Kraft. Er trug lange, lederne Beinkleider, unten weit und ausgefranst, an den Nähten ebenfalls mit Fransen geschmückt, und die durch einen Gürtel gehalten wurden, in welchem ein Messer stak. Die Füße waren mit zierlich gestickten Mokassins bekleidet.
Der Indianer war nicht zu Fuß gekommen; nicht weit von ihm stand sein Pferd an einen Baum gebunden, ein prachtvoller Mustang, und an demselben Baume lehnte die Lanze, ein langes Bambusrohr, an welchem mit Lederschnüren ein langes Messer gebunden war.
Alle Hochzeitsgäste hatten so vertieft dem Tanz des jungen Paares zugeschaut, daß niemand die Ankunft des Eingeborenen bemerkt hatte.
»Der springende Panther,« rief Don Alappo und flüsterte noch schnell dem neben ihm stehenden Kapitän, der neugierig die schwarze Gestalt musterte, zu:
»Er ist mein Gast, ich bitte Sie, ihn unbehelligt zu lassen, solange er sich auf meiner Hazienda befindet, denn die Gastfreundschaft ist mir heilig.«
Dann eilte er nach der Gartentür, schob den Riegel zurück, öffnete sie, und streckte dem Indianer die Hand entgegen.
»Es freut mich, daß der springende Panther mich besucht,« sagte er. »Tritt ein, Häuptling, und nimm teil an dem Feste, welches zur Feier der Hochzeit meines Sohnes stattfindet.«
Der Häuptling nahm die Hand, drückte sie, schüttelte aber den Kopf.
»Der springende Panther kann deine Einladung nicht annehmen,« entgegnete er auf spanisch, »seine Krieger warten auf ihn; auch kann er dir keine Pferde geben.
»Warum nicht, hast du keine? Ich brauche sehr notwendig welche, meine Rinderherden müssen ohne Aufsicht weiden, weil ich keine schnellen Pferde habe.«
»Die Krieger der Penchuenchen brauchen ihre Pferde selbst,« sagte der Häuptling finster.
Verwundert horchte der Haziendero auf, so finster hatte er den Häuptling, mit dem er in Frieden lebte, noch nie gesehen.
»Wozu? Habt ihr nicht genug, die ihr zureiten könnt?«
»Wir brauchen Tiere, die dem Zügel gehorchen, damit sie vor den grünen Reitern nicht fliehen.«
Mit den grünen Reitern meinte der Häuptling die auf der Hazienda liegenden Dragoner, die grüne Uniformen trugen. Also wußte der Häuptling schon, daß diese Soldaten seinetwegen hier waren. Das konnte schlimm werden. Jetzt galt es vor allen Dingen, sich der Freundschaft des Indianers zu versichern.
»Du bist sicher bei mir,« sagte Don Alappo freundlich. »Komm in mein Haus und stärke dich mit Speise und Trank.«
»Der weiße Häuptling ist falsch,« entgegnete der Indianer, »der springende Panther traut ihm nicht.«
»Fürchtest du dich vor ihm?« rief Don Alappo, und durch diese Frage hatte er den Widerstand beseitigt.
»Der springende Panther jemanden fürchten?« lächelte der Häuptling spöttisch und betrat den Garten.
Unterdes hatten sich die Gäste um den Häuptling versammelt und betrachteten ihn neugierig, denn nicht alle hatten ihn schon gesehen. Nur die Soldaten hielten sich entfernt und besprachen sich leise, besonders die Offiziere und der Kapitän blickten dabei mehrmals angelegentlich nach dem Indianer.
Donna Mercedes hatte überhaupt noch keinen wilden Penchuenchen gesehen; sie kannte sie nur vom Hörsagen, und betrachtete daher am gespanntesten die dunkelhäutige Gestalt. Indianer waren ihr nichts Neues, aber an der Küste hielten sich solche nur als Bettler und Landstreicher auf, verkommene Subjekte; hier bot sich ihr ein Urbild der Rasse dar.
»Die Frau meines Sohnes.« sagte Don Alappo lächelnd, weil er sah, wie der Häuptling mit durchdringendem Blicke die schlanke Gestalt Mercedes' musterte.
»Die Libelle tanzt schön, sie erfreute das Herz des springenden Panthers,« sagte der Indianer mit der seiner Rasse eigentümlichen Höflichkeit, welche diese Fremden, besonders Frauen gegenüber, stets beobachten.
»Was meint er mit der Libelle?« fragte verwundert Donna Mercedes. »Doch nicht etwa mich?«
»Gewiß,« bestätigte Don Pedro, ihr Gemahl, lachend.
»Die Indianer geben jedem, den sie zum ersten Male sehen, sofort einen Namen, der ihr Aussehen und ihren Charakter ausdrückt. Und er hat recht, wenn er dich mit einer Libelle vergleicht.«
Donna Mercedes streckte lachend dem Häuptling die Hand hin, und ehrfurchtsvoll erfaßte er dieselbe mit den Fingerspitzen, dieselbe nicht zu drücken wagend. Dann ließ er seinen Blick über sie hinwegschweifen, nach zwei Personen, welche etwas entfernt standen — dem Aufseher und Miß Petersen. Beide hatten die Augen fest auf den Häuptling gerichtet, und dieser blinzelte unmerklich mit den seinen, zwischen den dreien fand also eine Verständigung statt.
»So komm' jetzt ins Haus!« nötigte Alappo nochmals, und als Mercedes den Häuptling an der Hand faßte, um ihn fortzuziehen, fügte er hinzu: »Das ist recht, Mercedes, zeige dem springenden Panther einmal, daß auf der Hazienda unter deiner Leitung dieselbe Gastfreundschaft herrschen soll, wie unter der meinigen. Bewirte ihn selbst, so ist es alter, spanischer Brauch.«
Mit unverhohlener Bewunderung ließ der Häuptling sein Auge auf dem wunderbar schönen Gesicht des jungen Weibes, wie man sie so häufig unter den spanischen Kreolen findet, ruhen und folgte willig dem Drucke der kleinen Hand.
Mercedes führte ihn ins Hans, ließ ihn in einem der Säle, in welchem der Speisetisch noch gedeckt war, Platz nehmen und war ganz damit beschäftigt, darauf für den neuen, hungrigen Gast zu decken. Es war das erste Mal, daß Mercedes hier als Hausfrau schaltete, und der Gast ihres Schwiegervaters soll nicht in den Hütten seines Dorfes erzählen, die neue Haziendera wäre zu stolz gewesen, den roten Mann selbst zu bedienen.
Dann eilte sie hinaus, um Esten zu bestellen, und lange blickte der Häuptling mit düsteren Augen nach der Tür, durch welche sie verschwunden war. Da öffnete sich die Tür abermals, schnell sah er wieder geradeaus, denn nichts gilt den Indianern als schimpflicher, denn Neugier, Teilnahme, Freude und andere Gefühlsstimmungen zu verraten.
Aber nicht Mercedes war es, die hereintrat, sondern Fernando, der Aufseher, der mit dem Häuptling gut bekannt war. Er sah sich schnell um und trat zu dem Indianer.
»Hast du das Mädchen gesehen?« fragte er diesen.
»Ja,« entgegnete der springende Panther, »aber ich werde sie nicht rauben lassen. Deine Geschenke werde ich dir zurücksenden.«
»Warum nicht?« flüsterte Fernando unwillig. »Du warst doch bereits dazu entschlossen.«
»Weil ich glaubte, Don Alappo sei mir feindlich gesinnt.«
»Er ist es auch.«
»Du lügst,« entgegnete der Indianer finster. »Don Alappo ist redlich, sein Mund spricht so, wie sein Herz denkt. Er würde den springenden Panther nicht bewirten, wenn er ihm feindlich gesinnt wäre.«
»Was hat das mit dem weißen Mädchen zu tun? Entführe sie, sie folgt dir willig, und liefere sie dann mir aus.«
»Ich kann es nicht, weil sie ein Gast des Don Alappo ist. Wäre sie es nicht, so würde ich deinen Wunsch erfüllen, den ich zwar nicht verstehe, aber ich frage nicht darnach, denn ich bin dir Dank schuldig.«
Fernando hatte einst bei einem Jagdausflug den Häuptling aus Lebensgefahr gerettet. Er hatte das Raubtier, welches den Häuptling schon verwundet, erschossen, und der springende Panther war ihm dankbar dafür.
»Das ist kein Grund für mich.«
»Aber für mich,« fugte der Häuptling stolz. »Gib dir keine Mühe mehr, der springende Panther hat gesprochen.«
Mit einem wütenden Blick auf den Indianer verließ Fernando das Zimmer, denn draußen erklangen Schritte. Mercedes trat ein und hieß die nachkommenden Mägde die Schüsseln auf den Tisch setzen, schenkte selbst den roten Wein ins Glas und setzte sich dem Häuptling gegenüber, ihm zuschauend und bedienend.
Ohne sich nötigen zu lassen, langte der Indianer zu. Himmel, was konnte dieser Mensch essen! Ohne daß er sich der Gabel oder des Tischmessers bediente, verschwand ein Gericht nach dem anderen in den grundlos scheinenden Magen, die prachtvollen Zähne zermalmten die stärksten Knochen, als gehörten sie wirklich dem Gebiß eines Panthers an, und jedesmal, ehe er ein Glas Wein hinuntergoß, wischte er sich die fettriefenden Finger in dem langen, straffen Haare ab, das ihm wild und ohne Schmuck um den Kopf hing.
»Habt Ihr lange nichts gegessen?« fragte Mercedes teilnahmsvoll und schenkte ihm das Glas wieder voll.
»Seit zwei Tagen und zwei Nächten haben die Lippen des springenden Panthers nichts berührt.«
»Armer Mann, dann kann ich mir Euren Hunger und Durst erklären.«
»Der springende Panther hungert nie,« entgegnete der Indianer einfach, »er ißt, wenn er Essen hat, und braucht keins, wenn er nichts hat.«
»Wenn Ihr in Eurer Hütte seid, sorgt aber doch Eure Frau dafür, daß Ihr genug zu essen habt.«
»Der springende Panther besorgt sich seine Mahlzeit selbst,« entgegnete er, »seine Hütte ist leer — er besitzt keine Squaw, die für ihn sorgt.«
Mercedes betrachtete den Mann ihr gegenüber jetzt genauer und mußte sich gestehen, daß etwas Schönes in seinen ehernen Zügen war. Es lag etwas Herausforderndes neben der unbändigen Wildheit darin, und das große, schwarze Auge mußte in der Leidenschaft furchtbar blitzen können.
»Ist es wahr, daß die Penchuenchen weiße Mädchen rauben?« fragte sie dann schüchtern.
»Nur ihren Feinden, aber jetzt leben wir mit den Weißen in Frieden.«
»Aber wie kann ein Mädchen den Mann lieben, der sie mit Gewalt entführt?«
Der Häuptling stand auf.
»Der springende Panther ist ein großer Häuptling, das Mädchen würde ihn lieben lernen,« war die selbstbewußte Antwort, »und wenn es ihn nicht liebt, so würde er es zur Liebe zwingen.«
Mercedes schrak zusammen. Sie sah plötzlich, mit welcher Glut das Auge des Häuptlings auf ihr ruhte; eben, als er die letzten Worte sprach, schloß die Musik draußen mit einem leidenschaftlichen Crescendo — die wilde, dunkle Gestalt vor ihr — sie begann sich in dem Zimmer zu fürchten.
»Geht in den Garten, ich bitte Euch,« sagte sie ängstlich, »Don Alappo erwartet Euch.«
Ein düsteres Lächeln umspielte die schmalen Lippen des Häuptlings, als er der Aufforderung gehorchte. Er ging nach der Tür, welche ins Freie führte, und betrat den Garten. Auf den ersten Blick sah er, daß sein Pferd nicht mehr draußen, sondern im Garten angebunden stand und die Lanze sich nicht in der Nähe befand.
Neben dem Pferde stand Don Alappo und besprach sich eifrig mit dem dicken Hauptmann. Eine Menge Soldaten lagerten um sie her. Trotz der eintretenden Dunkelheit entging dem Häuptling nicht, daß die Soldaten ihre Lassos in den Händen zum Wurfe bereit trugen.
Die an den Grenzen der Indianergebiete liegenden Soldaten tragen alle Lassos, in Nordamerika sowohl, wie in Südamerika, und sie wissen sie fast ebensogut zu gebrauchen, wie die Indianer selbst, einfach daher, weil diese Menschen meist selbst in der Nähe von Indianern aufgewachsen sind, früher auch oft Vaqueros oder Cowboys gewesen sind.
»Die Schuld falle auf Sie!« rief Don Alappo heftig. »Ich wasche meine Hände in Unschuld.«
Er hörte nicht mehr die spöttische Bemerkung des selbstbewußten Hauptmanns, sondern wandte sich kurz um und ging nach dem anderen Teile des Gartens. Den Häuptling hatte er nicht aus der Villa heraustreten sehen.

Langsam, ohne Unruhe zu zeigen, schritt der springende Panther auf sein Pferd zu. Er beachtete weder die erwartungsvoll dastehenden Gäste, noch die Soldaten, die sich um das Pferd drängten.
Da trat ihm der dicke Hauptmann entgegen.
»Springender Panther,« rief er, die Hand am Degen, »du bist mein Gefangener, versuche keinen Widerstand!«
Doch schnell sprang er erschrocken zur Seite, in der hochemporgehobenen Hand des Häuptlings funkelte das Messer. Mit einem Satz war derselbe unter den Soldaten, die ebenfalls erschrocken zurückwichen, und im nächsten Augenblick saß der Häuptling im Sattel. Ein Schnitt mit dem Messer, das Pferd war frei, es fühlte den Schenkeldruck seines Herrn, bäumte sich hoch auf und wollte die Reihen der Soldaten mit flüchtigem Huf durchbrechen.
Da schallte ein vielstimmiges Gelächter durch den Garten, aus den Kehlen der Soldaten kommend, der springende Panther war einer ihrer Listen zum Opfer gefallen.
Er hatte in dem hohen Grase nicht bemerkt, daß an den Hinterfüßen seines Pferdes eine Schlinge befestigt war, welche einige Soldaten in der Hand hielten. Wohl machte das Roß einen Satz nach vorwärts, dann aber wurde die Schleife zugezogen, und Roß und Reiter wälzten sich am Boden.
Noch ehe der springende Panther den Boden berührte, hatten sich die Soldaten schon über ihn geworfen, und ehe er von dem Messer, seiner einzigen Waffe, Gebrauch machen konnte, war er von den in derartigen Sachen geschickten Soldaten der Wildnis schon gebunden.
Hilflos lag er am Boden.
»Der springende Panther macht seinem Namen keine Ehre,« lachte der dicke Hauptmann, sich über ihn beugend. »Na, Bursche, jetzt wirst du die Pferde wohl hergeben müssen, sonst hast du die Pampas zum letzten Male gesehen. Diesen neuen Kniff kanntest du wohl noch gar nicht, he?«
Der Häuptling beachtete den Spott nicht, er sah gleichgültig vor sich hin, und als Don Alappo auf ihn zugeeilt kam und ihm beteuerte, daß diese Gefangennahme wider seinen Willen vorgenommen worden wäre, wandte er dem Sprecher verächtlich den Rücken.
Er wurde in eine hochgelegene Kammer der Villa gebracht und von zwei Soldaten scharf bewacht, welche niemandem den Zutritt erlauben sollten, selbst dem Hausherrn nicht, weil der Hauptmann von diesem einen Befreiungsversuch fürchtete.
In der kleinen Werkstatt für Damenkonfektion der Frau Werner arbeiteten fünf Mädchen, und eines davon war erst seit etwa vierzehn Tagen neu angenommen worden, eine junge Person, fast ebenso kränklich aussehend, wie alle jene Mädchen, die sich ihr Brot mühsam mit Nähen in dumpfer Stube verdienen müssen, aber braun im Gesicht und an den Händen, denen man es ansah, daß sie einst schwere Arbeit hatten tun müssen.
Martha Erdmann hatte sie sich genannt, eine in Amerika geborene Deutsche, die ihre Verwandten hatte besuchen wollen, weil sie drüben niemanden mehr besaß, der ihr in Liebe begegnete, aber auch in Deutschland die Verwandten nicht mehr am Leben fand.
Frau Werner war nicht nur eine Schneiderin, welche ihre Kunden, nur aus guten Kreisen, stets zur völligen Zufriedenheit bediente, sondern sie verstand auch, die sie besuchenden Damen durch ihre Unterhaltung zu fesseln. Während sie Maß nahm und anprobierte, wußte sie die sämtlichen Neuigkeiten der Stadt zu erzählen, und da dieselbe ziemlich groß war, so war die Skandalchronik mannigfaltig und pikant genug, um die Kunden zu fesseln, ja sogar, sie eigens nach der Werkstatt zu führen, nur um die Fortsetzung der interessanten Plaudereien zu vernehmen.
Auf eine Annonce von Frau Werner hin hatten sich wohl fünfzig junge Mädchen gemeldet, um bei ihr zu arbeiten, und da sie gern nach dem Aeußeren ging, so besah sie sich erst alle gründlich, ehe sie eine Wahl traf. Sofort fiel ihr ein Mädchen durch ihr fremdartiges, zurückhaltendes Wesen auf, und zu ihrem Erstaunen mußte sie bei ihrer ersten Frage hören, daß diese Person gar nicht ordentlich Deutsch sprach — es war eine Amerikanerin, wenn auch von deutschen Eltern abstammend.
Das war ja herrlich, eine Amerikanerin! Frau Werner engagierte sie sofort, vorläufig drei Tage auf Probe, sagte sie wenigstens, aber in ihrem Herzen war schon beschlossen, daß diese Amerikanerin für immer bei ihr arbeiten sollte. Die zweite Frage war nämlich gewesen, ob Martha Erdmann jene Damen kenne, welche auf einem Schiffe um die Welt führen, und auf die Antwort, sie kenne einige derselben persönlich, ward sie engagiert, und wenn sie auch keinen Stich hätte nähen können.
Dazu kam noch, daß die neue Schneiderin sofort auf den Vorschlag einging, bei Frau Werner zu wohnen, und somit einen längstgehegten Wunsch derselben erfüllte. Bis jetzt war es der Frau Werner nämlich noch niemals gelungen, ihr leerstehendes Zimmer an eine bei ihr arbeitende Schneiderin zu vermieten, weil sie als eine gar strenge, gottesfürchtige Person verschrieen war, die scharf auf Hausordnung hielt, und eine Fremde wollte sie auch nicht bei sich wohnen haben.
Martha Erdmann war also als Schneiderin und Mieterin zugleich bei Frau Werner angenommen.
Schon am ersten Tage zeigte sich, daß die neue Schneiderin nicht eben sehr gewandt im Anfertigen von Damenkleidern war, wenn sie auch die Nadel schnell genug zu handhaben wußte. Sie machte die Stiche zu groß und wußte vom Zuschneiden soviel wie nichts, wodurch sie auf den Gesichtern ihrer Mitarbeiterinnen manches spöttische Lächeln hervorrief.
Doch das machte nichts. Frau Werner war mit ihr zufrieden, denn sie konnte in ihrem gebrochenen Deutsch viel von den Vestalinnen erzählen, welche sie in New-York kennen gelernt und deren Ruderübungen sie beigewohnt hatte, ja, sie war sogar bei einer von ihnen in Dienst gewesen, wie ein Zeugnis bewies.
Schade war nur, daß Martha sehr traurig und niedergeschlagen und sehr schwer zum Erzählen zu bringen war. Jede Antwort mußte aus ihr erst herausgezogen werden, und es schien fast, als ob sie nur ungern den Zeitungsberichten über die Vestalinnen — Frau Werner war eine eifrige Zeitungsleserin — nähere Erklärungen hinzufügte. Erheitert wurde sie jedenfalls dadurch nicht, sondern im Gegenteil immer trauriger.
Doch mit dem, was aus ihr herauszubringen, war Frau Werner auch schon zufrieden, es wurde noch etwas ausgeschmückt und dann den Kunden aufgetischt, und wenn die vornehmen Damen verwundert fragten, woher sie so genau über die Vestalinnen und deren Schiff orientiert sei, so deutete Frau Werner auf ihre neue Schneiderin, erklärte, sie sei eine Amerikanerin und kenne jene Damen ganz genau, ja, mit einigen sei sie sogar befreundet.
Die gute Frau merkte nicht, wie unangenehm dies alles dem jungen Mädchen war, warum sollte dies denn auch ein Thema sein, welchem es gern aus dem Wege ging?
Nebenbei drehte sich die Debatte auch unter den Schneiderinnen selbst noch um einen anderen Gegenstand, und als man für längere Zeit nichts mehr über die ›Vesta‹ erfuhr, weil das Schiff nach Amerika zurücksegeln wollte und nun unterwegs war, nahm dieser zweite, ebenso interessante Gegenstand die Zeit und Aufmerksamkeit aller in Anspruch.
Es handelte sich um den neuen Freiherrn Johannes von Schwarzburg.
Martha war ein solides Mädchen, sie ging zur unaussprechlichen Freude der Frau Werner nie aus, und so kam es, daß sie mit der ohne Familie dastehenden Frau in intimeren Umgang trat und von ihr mit allem vertraut gemacht wurde, was ihr am Herzen lag.
Dazu gehörte ihre Meinung über die neuesten sensationellen Zeitungsberichte, die frühmorgens, noch vor Beginn der Arbeitszeit, mit Martha erläutert und über welche dann am Tage die Schneiderinnen um ihre Meinung befragt wurden, und daher kam es, daß Frau Werner ihre Kundinnen über alles so genau informieren konnte.
Für dieses zweite Thema empfand Martha mehr Interesse als für das erstere, sie selbst stellte oft neugierige Fragen, aber sie wurde noch trauriger als früher, ohne daß sich die scharfsinnige Frau Werner die Ursache hierzu erklären konnte.
»Der neue Freiherr von Schwarzburg hat beschlossen, diesen Winter auf seinem Schlosse zu verbringen,« las Frau Werner beim Kaffeetrinken ihrem neuen Schützling vor. »Die inneren Räumlichkeiten werden vollständig renoviert. Es steht zu erwarten, daß sich in Schloß Schwarzburg bald die höchsten Kreise versammeln werden, Johannes ist bereits allgemein beliebt geworden. Der auf dem Meere aufgewachsene Baron versteht es, die Herzen für sich einzunehmen, es geht ein urnatürlicher Hauch von ihm aus, wie man ihn so liebt und doch so selten findet. Gestern wohnte er den Festlichkeiten im Schlosse Hohenfels bei.«
»Ja, ja,« fügte Frau Werner mit einem Blick auf die stumm dasitzende Martha bei, »der junge Mann hat Glück gehabt, und ich kann es ihm gar nicht verdenken, wenn er nun mit vollen Zügen sein Leben genießt. Als Matrose wird er wohl auch keine schöne Zeit gehabt haben, das ist ein saures Brot. Meinst du nicht, liebes Kind?«
»Ich weiß nicht,« sagte Martha leise. »Haben Sie den Freiherrn schon einmal gesehen?«
»Ei gewiß, schon öfters. Er fährt ja oft genug durch die Straßen.«
»Wie sieht er denn aus?«
»Er ist ein hübscher, schlanker Mensch mit einem kleinen Schnurrbart und blauen Augen. Aber du solltest doch einmal ausgehen und ihn dir selbst ansehen, auch hängt in jedem Bildergeschäft seine Photographie. So etwas muß ein gebildeter Mensch wissen.«
»Sieht er gesund aus?« fragte Martha weiter.
»Gesund wie ein Fisch,« entgegnete Frau Werner. »Der arme Junge ist nur zu sehr von seinem früheren Berufe verbrannt, und so eine braune Hautfarbe sieht gar nicht fein aus. Mancher wird seine Nase darüber rümpfen.«
»Ist er immer recht fröhlich?«
»O ja, vorgestern sah ich ihn in einer Equipage fahren, und neben ihm saß Gräfin Haugwitz. Er erzählte ihr etwas, und das muß etwas sehr Lustiges gewesen sein, denn trotzdem Gräfin Haugwitz sonst eine sehr distinguierte Dame ist, lachte sie doch laut auf, und das mitten auf der Straße.«
»Und was tat der Baron?«
»O, der lachte auch mit, der lacht überhaupt immer, und seine Augen strahlten vor Freude. Man munkelt ja, er soll der Tochter der Gräfin Haugwitz sehr den Hof machen. Das ist aber auch ein reizendes Mädchen, kaum fünfzehn Jahre alt, aber schon die richtige Dame, so klug kann sie sprechen.«
»Wissen Sie das bestimmt?«
»Gewiß, die Erzieherin der jungen Gräfin ließ bei mir arbeiten, kurz, ehe du kamst, und sie erzählte es mir. Die junge Gräfin soll schon eine vollkommene Weltdame sein, so schlau und listig, wie nur irgend eine.«
»Ach, nein, ich meine, ob er ihr wirklich den Hof machen soll?«
»Das habe ich als ganz bestimmt von dem Bruder meines Schwagers gehört, der Kammerdiener bei der Haugwitz ist. Der Baron soll den ganzen Abend nur immer mit ihr getanzt haben. Aber wie siehst du wieder bleich aus, Martha,« unterbrach sich Frau Werner schnell, »du darfst frühmorgens keinen Kaffee mehr trinken, der macht bleich, lieber Schokolade. Fühlst du dich krank?«
»Nein, mir ist ganz wohl,« entgegnete Martha, stand auf und räumte das Frühstücksgeschirr vom Tisch.
Die anderen Nähmädchen kamen, die Arbeitszeit begann und mit ihr wieder die Unterhaltung. Es war ja nicht zu verlangen, daß die jungen Mädchen bei ihrer mechanischen Arbeit sich still verhielten, und hätten sie nicht von selbst angefangen, so wären sie von Frau Werner dazu aufgefordert worden.
»Wissen Sie schon, daß der neue Freiherr wieder auf dem Meere fahren will?« begann eines Morgens ein Mädchen die Unterhaltung.
»Nicht möglich,« erklang es, wie aus einem Munde.
»Doch, ich habe es von einer ganz sicheren Person erfahren,« behauptete die Sprecherin. »Freiherr von Schwarzburg hat in Hamburg ein großes Schiff mit drei Masten gekauft und die Matrosen gleich mit dazu.«
»Ist er in Hamburg gewesen?« warf Martha dazwischen.
»Nein, aber er soll früher auf demselben Schiffe gefahren sein, und jetzt ist es in Hamburg angekommen.«
»Wissen Sie, wie das Schiff getakelt ist?« fragte Martha.
»Wie es was ist?«
»Ich meine, ob das Schiff ein Vollschiff, eine Bark, Brigg, Schoner oder Brigantine ist. Oder es ist doch nicht etwa eine Bark, die am Großmast eine einfache Bramstange und hinten eine Gaffel führt?«
Verwundert schauten die Mädchen auf die ins Feuer geratene Kameradin.
»Ei,« rief Frau Werner erstaunt, »du weißt ja gerade wie ein Kapitän von den Schiffen zu sprechen! Wo hast du denn das gelernt?«
Martha wurde etwas verlegen, ihr blasses Gesicht wurde purpurrot, und sie beugte sich tief auf ihre Arbeit.

Sie hörten drinnen ein leises Schluchzen und Flüstern.
»Bei uns in Amerika lernt jedes Kind in der Schule Schiffsbau,« sagte sie dann.
»Das ist ja merkwürdig,« riefen die Mädchen.
»So genau kann ich Ihnen das nicht sagen,« beantwortete die erste Sprecherin die Frage Marthas, »ich habe den Namen wohl gehört, ihn aber vergessen.«
»Heißt er vielleicht ›Kalliope‹?«
»Ja!« rief das Mädchen erstaunt. »Woher kennen Sie dieses Schiff denn?«
»In amerikanischen Zeitungen wurde einmal von Hannes Vogel gesprochen, weil er doch, wie Sie wissen, mit auf dem ›Amor‹ fuhr,« erklärte Martha, »und dort hieß es, er sei lange Zeit auf der ›Kalliope‹ gewesen.«
»Der Freiherr hat angeordnet, daß das Schiff neue Masten bekommt und neue Segel, und hat deswegen schon einen Schiffsbaumeister kommen lassen, um mit ihm darüber zu sprechen.«
Unter solchen Gesprächen verging nicht nur dieser Tag, sondern einer nach dem anderen. Von der ›Vesta‹ erfuhr man nichts mehr, ebensowenig von dem ›Amor‹, denn beide Schiffe waren unterwegs, also außer Bereich der Zeitungsreporter. Desto mehr erfuhr man aber von dem Freiherrn: es hieß, er ginge wirklich mit der Absicht um, ein eigenes Schiff auszurüsten und auf diesem als Kapitän wieder zur See zu fahren.
Frau Werner schüttelte immer bedenklicher den Kopf, wenn sie ihren Schützling verstohlen von der Seite betrachtete. Das Mädchen war krank, man sah es ihm an, und die Krankheit wurde immer schlimmer. Doch behauptete es stets, es sei gesund, aber Frau Werner kam schließlich zu der Ueberzeugung, daß Martha von einem Seelenleiden geplagt werden müßte.
Sie hatte schon manchmal ganz deutlich gehört, wenn sie des Abends lauschend vor der Thür von Marthas Schlafzimmer stand, wie drinnen leise geweint wurde, und wenn sie dann das junge Mädchen blaß, mit rotgeweinten Augen und eingefallenen Wangen am Kaffeetisch sitzen sah, bat Frau Werner es oft mütterlich, doch immer vergebens, ihr das Herz auszuschütten. Martha behauptete, den rotgeweinten Augen zum Trotz, von keinem Schmerze, weder physischen, noch seelischen, zu wissen, und versuchte sogar, zu lächeln, was ihr aber nie recht gelang.
Sie wurde immer trauriger und verschlossener, und an dem Gespräch in der Werkstatt beteiligte sie sich immer weniger, obgleich sie demselben volle Aufmerksamkeit schenkte, aber nur, wenn es sich um den Freiherrn von Schwarzburg und dessen in Aussicht stehende Unternehmung handelte.
»Man sagt, auf dem Schiffe sollen auch Damen mitfahren,« meinte eines Tages ein junges Mädchen, »es werden alle Vorbereitungen dazu getroffen, daß solche beherbergt werden.«
»Wer sollte das wohl sein?«
»Auch ich habe davon gehört,« erklärte Frau Werner, »der Freiherr soll von einigen Damen mit Bitten bestürmt worden sein, mit ihnen eine Seereise zu unternehmen. Es soll also eine zweite ›Vesta‹ werden.«
»Die Damen wollen auch als Matrosen arbeiten?« fragte ein Mädchen zweifelnd.
»Nein, dazu eignen sich unsere deutschen Damen wohl nicht,« lächelte Frau Werner. »Zu so etwas sind nur Amerikanerinnen fähig. Aber immerhin, sie wollen doch auf einem Segelschiff Reisen unternehmen, und der Freiherr will das Schiff kommandieren.«
»Wie wird dasselbe wohl heißen?«
»Auch das habe ich schon erfahren, der Freiherr sprach neulich davon, als meines Schwagers Bruder im Salon war, daß er es ›Hoffnung‹ taufen werde.«
»Hoffnung!« schrie da plötzlich Martha mit glühenden Wangen auf.
»Nun ja, was ist denn da weiter dabei?« sagte Frau Werner verwundert. »Der Name ist wahrscheinlich mit Recht erwählt worden. Es steht zu erwarten, daß die junge Gräfin von Haugwitz ebenfalls mitfährt, und da ist wohl Hoffnung dazu vorhanden, daß aus der Fahrt gleich eine Hochzeitsreise werde.«
»Ach, das muß reizend sein, so in der Welt herumfahren zu können!« seufzte eine bleichsüchtige Schneiderin und schob eine duftige Bluse unter die Maschine.
»Und noch dazu als Freiherrin,« fügte eine andere hinzu.
Eines Sonntags wurde Martha von Frau Werner aufgefordert, mit ihr ins Freie zu gehen; es war das erste Mal, daß Martha am Tage das Haus verließ, sonst hatte sie ihre Besorgungen nur des Abends in Begleitung der geschäftigen Frau Werner gemacht und die Einladung Sonntags ausgeschlagen.
Doch heute war der prachtvolle Wintertag zu einladend, und die gutmütige Frau Werner ließ mit Bitten nicht eher nach, als bis das junge Mädchen einwilligte, sie zu begleiten.
Deren Haus lag mitten in der Stadt, und ehe sie ins Freie gelangten, hatten sie menschenbelebte Straßen zu durchwandern.
Martha hüllte sich dicht in ihren warmen Mantel ein und versteckte den Kopf in die Kapuze, so daß ihr Gesicht gar nicht zu sehen war, aber sie achtete auch nicht auf das fröhliche Treiben in den Straßen, stumm schritt sie am Arm ihrer Begleiterin daher, den Blick zu Boden gesenkt.
Vergebens suchte Frau Werner sie auf die wenigen, auch am Sonntag geöffneten Schaufenster aufmerksam zu machen, ihr einige bekannte Personen zu zeigen, meist vornehme Damen, für welche sie arbeitete oder gearbeitet hatte. Martha zeigte keine große Teilnahme.
Da kam eine Equipage hinter ihnen hergerollt.
Frau Werner drehte den Kopf und hatte kaum einen Blick auf das prächtige Zweigespann geworfen, auf den elegant livrierten Diener, der die feurigen Rosse zügelte, als sie rief:
»Da kommt er, der Freiherr von Schwarzburg! Nun hebe aber einmal dein Köpfchen und betrachte ihn, Martha!«
Wie gebannt blieb das junge Mädchen stehen, hob die Kapuze etwas und wandte sich der Straße zu, ihr Gesicht offen zeigend.
In der Equipage saßen der Freiherr, ein Offizier und eine junge Dame. Ersterer sprach eifrig zur letzteren, und die Dame mußte die Unterhaltung sehr anziehend finden, denn sie bog sich weit vor, um kein Wort des Sprechers zu verlieren.
»Das ist Gräfin Haugwitz, und der Offizier ist ihr Bruder,« erklärte Frau Werner.
Jetzt wandte der Freiherr den Kopf und neigte sich der Dame zu, um sie bei dem Wagengerassel verstehen zu können. Dabei fiel sein Blick auf das Trottoir, er streifte die beiden weiblichen Gestalten, welche regungslos dastanden, und plötzlich sprang der Freiherr mit einem Freudenausruf auf und wollte Miene machen, den Schlag zu öffnen, wandte sich dann aber nach dem Kutscher um und rief diesem etwas zu.
»Was hast du, Martha?« fragte Frau Werner verwundert das junge Mädchen, das sie am Arme faßte und gewaltsam in eine Nebenstraße zog.
»Fort,« flüsterte diese mit bebender Stimme. »Ich bekomme einen Schwindelanfall, ich muß mich setzen.«
Erschrocken faßte Frau Werner die schon halb Bewußtlose unter den Arm und führte sie oder schleppte sie vielmehr nach einem Café, in welchem sich Martha langsam von dem Anfall erholte.
»Du kommst zu wenig in die frische Luft,« sagte die besorgte Frau Werner. »Du mußt von nun ab mehr spazieren gehen.«
Aber Martha schüttelte den Kopf und verließ seitdem das Haus gar nicht mehr. Doch ihr Gesundheitszustand ward immer schlimmer, ihre Wangen immer bleicher und magerer, und das Mädchen, welches vor vier Wochen noch als eine recht stattliche, wenn auch immer schlanke Person zu Frau Werner gekommen war, glich jetzt nur noch einem Schatten.
Frau Werner ließ einen Arzt holen, aber Martha weigerte sich, sich untersuchen zu lassen. Sie erklärte ganz entschieden, gesund zu sein. Aber die gute Frau wußte es besser. Sie sah das Mädchen, welches sie liebgewonnen hatte, mit schnellen Schritten dem Tode zueilen.
Eines Tages trat eine Dame in die Werkstatt, welche noch nie hier gewesen war, und begehrte Frau Werner zu sprechen. Nachdem sie den Wunsch ausgesprochen hatte, sich ein Kleid machen zu lassen, wurde sie in ein Nebenzimmer geführt und zugleich Martha herbeigerufen, weil diese der Frau während des Maßnehmens Handreichungen leisten mußte.
»Das junge Mädchen ist keine Deutsche?« fragte die Dame, als Martha einmal auf einen Augenblick hinausgeschickt wurde, um etwas zu holen.
»Nein, sie ist eine Amerikanerin,« erklärte Frau Werner und begann das Schicksal ihres Zöglings zu erzählen, obgleich Martha wieder ins Zimmer getreten war.
»Martha Erdmann?« sagte die Dame sinnend. »Wie ist mir denn, war das nicht eine Deutsche, welche mit ihren Eltern vor etwa zehn Jahren nach Amerika auswanderte? Sie sind doch nicht etwa das junge Mädchen?«
Sie blickte dabei die bleiche Näherin fest an und sah, wie das blasse Gesicht plötzlich wie eine Purpurrose zu glühen begann.
»Nein,« stammelte sie, »ich bin in Amerika geboren.«
»Es kann auch gar nicht sein,« fuhr die Dame kopfschüttelnd fort, »denn soviel ich weiß, ist jene Martha Erdmann drüben gestorben, als sie bei einer gewissen Familie Staunton in Dienst stand.«
Die Dame beeilte sich, das Anprobezimmer verlassen zu können, und verabschiedete sich von Frau Werner, ohne die immer noch furchtbar verlegene Martha, die an allen Gliedern zitterte, zu beachten.
Kaum war sie hinaus, als Martha plötzlich der alten Dame zu Füßen stürzte und in ein krampfhaftes Schluchzen ausbrach, ihr Gesicht in die Schürze der Erschrockenen verbergend.
»Aber was hast du denn?« rief Frau Werner bestürzt und suchte die Knieende aufzurichten.
»Lassen Sie mich fort!« schluchzte das Mädchen. »Jetzt gleich, ich kann nicht mehr bleiben! Ich werde verfolgt; ich bitte Sie, lassen Sie mich gehen!«
»Um Gottes willen,« rief Frau Werner und trat entsetzt einen Schritt zurück. Ein fürchterlicher Gedanke stieg plötzlich in ihr auf, sie glaubte es mit einer Verbrecherin zu thun zu haben.
Da tönte draußen ein hastiger Männerschritt, die Tür ward aufgerissen, und ein Herr stürzte in das Zimmer herein.
Martha hatte sich mit entgeisterten Augen aufgerichtet, und kaum hatte sie den Mann erblickt, so flüchtete sie sich, wie von einer entsetzlichen Angst erfaßt, durch die Tür, welche in die Werkstatt führte, aber der Herr eilte ihr nach, und als das aufschreiende Mädchen auch die Werkstatt mit flüchtigem Fuße verließ und den Weg nach ihrem Zimmer nahm, ließ der Herr trotzdem mit seiner Verfolgung nicht nach.
Oben ward eine Tür zugeschlagen, dann war alles wieder still.
Sprachlos vor Staunen schauten Frau Werner und die fünf Näherinnen sich gegenseitig an.
»Freiherr von Schwarzburg,« rief eine andere. »Was will er von Martha? Kennt er sie? Wo ist sie?«
Mit großen Schritten eilte Frau Werner die Treppe hinauf nach dem Schlafzimmer Marthas, hinter ihr her die neugierigen Mädchen, welche um keinen Preis der Welt zurückgeblieben wären.
Es war schon eine geraume Zeit vergangen, ehe sie sich zu dieser Handlung aufraffen konnten. Lauschend blieben sie an der Tür stehen. Sie hörten drinnen ein leises Schluchzen, ein noch leiseres Flüstern, eine vorwurfsvolle Frage und eine weinerliche Entgegnung. Dann lachte die helle Männerstimme fröhlich auf, und plötzlich sang dieselbe Stimme in jubelndem Tone:
»Gern gäb' ich Glanz und Reichtum hin
Für dich, für deine Liebe!«
»Wehe Ihnen,« rief Don Alappo, außer sich vor Entrüstung, als er dem kaltlächelnden Hauptmanne gegenüberstand. »Das Blut, welches wegen dieser Ihrer Handlung fließen wird, komme über Sie! Sie bringen Unglück über mich und mein Haus, denn der springende Panther glaubt, ich habe meine Hand zu Ihrem Streiche geboten.«
»Seien Sie unbesorgt und machen Sie nicht so viel Aufhebens wegen der Festnahme eines erbärmlichen Indianers!« entgegnete der Hauptmann. »Vorläufig bleibe ich mit meinen Leuten bei Ihnen und gehe nicht eher, als bis ich die Ruhe wiederhergestellt habe. Frisch, Musikanten, spielt auf, wir wollen uns in unserem Vergnügen nicht stören lassen!«
Die militärischen Musiker waren an dergleichen Fälle gewöhnt, sie mußten ja auch während der Schlacht spielen. Aber so lustig die Klänge auch durch den Garten schmetterten, der Frohsinn war gelähmt, die Gäste konnten nicht mehr auf dem Rasenplatze tanzen, sondern standen in Gruppen zusammen und besprachen flüsternd das Vorgefallene.
Don Alappo eilte nach der Kammer, wo der Häuptling gefangen lag, und wollte die Tür öffnen. Sie war verschlossen.
»Aufgemacht!« schrie der in seinem Rechte verletzte Hausherr und donnerte gegen die hölzerne Tür.
»Wir haben den strengen Befehl, niemanden zu dem Gefangenen zu lassen,« antwortete drinnen einer der Soldaten.
»Was, ihr wollt mir, dem Besitzer dieses Hauses, den Zutritt in meine Räumlichkeiten verweigern?« rief der Haziendero empört. »Bei allen Heiligen, öffnet, oder ich lasse die Tür sprengen und euch durch meine Diener aus dem Fenster werfen.«
Diese Drohung wirkte; die beiden Soldaten wußten, daß Don Alappo keine leere Drohung sprach. Sie öffneten die Tür, und der Haziendero trat ein.
»Häuptling,« redete er den auf einer Bank bewegungslos liegenden Indianer an. »Bei dem Gott meiner Väter, ich bin unschuldig, daß du gefangen worden bist. Glaubst du mir das?«
Der Indianer antwortete nicht, rührte sich nicht, öffnete nicht einmal die Augen, auch dann nicht, als Don Alappo ihn an der Schulter rüttelte. Er stellte sich schlafend, schlief aber natürlich nicht. Die Hände waren ihm auf den Rücken gebunden, die Füße waren frei.
Noch mehrmals versuchte Don Alappo, den Indianer zu überzeugen, daß er an dessen Gefangennahme unschuldig war, daß sie gegen seinen Willen ausgeführt worden sei. Aber der Häuptling schien ihn nicht zu hören.
Schließlich mußte der Haziendero seine Bemühungen aufgeben, wohl wissend, daß er jetzt in dem Häuptling einen Feind für immer bekommen habe. Gern verließ er das Zimmer, denn er fürchtete schon immer, daß, wenn der Häuptling zu sprechen anfinge, er von dem sich als Freund ausgebenden Manne fordern würde, ihm die Banden zu zerschneiden und die Freiheit zu schenken; dies zu tun, ging aber über die Macht des Haziendero.
Durch die Befreiung des Gefangenen ward er selbst straffällig, denn der Häuptling war von einem Beamten der Regierung gefangen genommen worden, und der Befreier wurde geächtet.
In gedrückter Stimmung verließ er das Gemach und begab sich in den Garten zurück, nachdem er den beiden Soldaten vorher noch mit recht deutlicher Stimme befohlen hatte, so daß es der Häuptling hören mußte, es dem Gefangenen an nichts fehlen zu lassen.
Auch diese List war vergeblich gewesen, der Indianer lag bewegungslos wie ein Block auf der Bank.
Im Garten traf Alappo zwei Männer, welche sich eben von ihren Rossen, halbwilden Mustangs, schwangen und diese am Gartenzaun anbanden.
Der eine der Männer war groß, knochig und sehr mager, fast wie ein Gerippe anzusehen, aber dabei äußerst kräftig gebaut, der schmale Mund, die eigentümlich geschlitzten und doch großen Augen und besonders das straffe, schwarze Haar verrieten, daß er von einem Indianer, ebenso aber die helle Haut, daß er auch von einem Weißen abstamme. Er war also ein Mestize, das Kind eines Spaniers und einer Penchuenchin.
Hätte er nicht noch ein Jagdhemd über dem Oberkörper getragen, so wäre er wie ein Indianer bekleidet gewesen. An die Mokassins hatte er riesige, stählerne Sporen geschnallt, an Waffen führte er nur einen Revolver und das Messer im Gürtel. Ueber die Schulter schlang sich ein kunstvoll geflochtener Lasso, der fast doppelt so lang war, wie die gewöhnlichen.
Sein Genosse war ebenso ausgerüstet, nur trug er einen einfachen Lasso. Er war von kleinerer Statur, machte aber einen ritterlicheren Eindruck, als sein knochiger Gefährte.
Der größere hatte soeben von einem Gaste, einem benachbarten jungen Haziendero, das Vorgefallene erfahren, brach in ein kurzes, rauhes Lachen aus und wünschte dann mit einem Fluche alle hier versammelten Dummköpfe, wie er sich ungeniert ausdrückte, zur Hölle. Dann wandte er sich an seinen Begleiter und sprach leise mit diesem.
»Wer ist dieser ungehobelte Kerl?« fragte der Hauptmann den Sohn Alappos.
Dieser warf dem Frager einen finsteren Blick zu.
»Juba,« antwortete er, »ein Mestize, von den Indianern Riata genannt, wegen seiner Geschicklichkeit im Lassowerfen. Seinen Begleiter kenne ich nicht, sehe ihn überhaupt hier zum ersten Male.«
Der Hauptmann wollte noch mehr Fragen an Pedro stellen; dieser wandte sich jedoch kurz ab und ging zu der ängstlich gewordenen Mercedes.
Riata ist in Südamerika der Ausdruck für Lasso, vom spanischen Mata kommend, was soviel als Strick, Schlinge bedeutet.
Don Alappo eilte auf die Ankömmlinge zu.
»Ein Glück, daß du gerade jetzt hierherkommst, Juba Riata,« rief er, »du hast schon erfahren, was passiert ist? Gehe zum Häuptling und beschwichtige ihn! Sage ihm, daß seine Gefangennahme nur von kurzer Dauer sein soll, ich werde mich für ihn verwenden, er soll mich auch fernerhin für seinen Freund halten.«
Juba Riata, der Lassowerfer, stand mit den Indianern auf vollkommen freundlichem Fuße, er hatte bei einem Stamme sogar eine Hütte stehen, aber er lebte für sich, fast nur von der Jagd, und diente gelegentlich auch reisenden Weißen als Führer. Er war ein Mann, der ungebundene Freiheit über alles liebte; nicht einmal das Leben unter den Indianern bot ihm freie Bewegung genug. So lebte er ganz unabhängig für sich, überall, bei Weißen, wie bei Indianern in hohem Ansehen stehend, alle bewarben sich um seine Freundschaft.
»Die Pest über euch alle zusammen,« rief der Schwarzhaarige, »wenn ich eine Dummheit gemacht habe, so muß ich sie auch allein auslöffeln. Juba Riata wird sich hüten, sich einzumengen; der Lasso der Regierung ist ihm zu lang, er geht ihm aus dem Wege. Komm', Don,« wandte er sich an seinen Gefährten, »unter solche Dummköpfe passen wir nicht.«
Er war mit einem Satze auf seinem Pferde, sein Kamerad folgte ihm.
»Gib mir wenigstens einen Rat, wie ich den Häuptling versöhnen kann,« bat Don Alappo, welcher vor seinem Auge schon ein schreckliches Unglück aufsteigen sah.
»Befreie ihn, nimm die Soldaten gefangen und liefere sie ihm aus, dann ist er versöhnt,« entgegnete Juba Riata vom Pferde herab.
»Wie könnte ich das?«
»Dann töte den springenden Panther und seinen ganzen Stamm, nur so bist du vor seiner Rache sicher. Glaubst du, ich würde den nicht strafen, in dessen Hause ich gefangen wurde, ohne daß er mir beisteht? Karamba, ich würde ihn nicht lange am Leben lassen.«
Er gab seinem Mustang die Sporen und verschwand mit seinem Gefährten zwischen den Aepfelbäumen im Dunkel des Abends.
»Da sehen Sie, was Sie angestiftet haben!« sagte der Haziendero vorwurfsvoll zu dem Hauptmann.
Dieser zuckte die Achseln.
»Das ist ein Mann, welcher die Sitten der Indianer genau kennt, er selbst ist einer.«
»Bah,« entgegnete der dicke Kapitän geringschätzend, »ein Schwarzseher und ein feiger Patron ist er, weiter nichts. Militär der chilenischen Regierung wird sich vor Indianern fürchten — lächerlich!«
Er gab den Befehl, wieder zu spielen, und dank der Bemühungen der chilenischen Offiziere, welche keck auftraten und nicht die geringste Besorgnis verrieten, sondern über alles Vorgefallene scherzten, gelang es, wieder Leben in die Gruppe zu bringen.
Es wurden Lanzen mit Fackeln um den Grasplatz herum aufgestellt, und als nur einmal der erste Tänzer sich wieder zu drehen begann, wurde die Fröhlichkeit nach und nach wiederhergestellt, wer noch niedergedrückt war, ließ es sich nicht merken, sondern schloß sich den anderen an. — — —
Der springende Panther lag noch immer bewegungslos auf der Bank. Er schien weder die Musik unten im Garten zu vernehmen, noch das Gespräch der beiden Soldaten, die ihm als Wächter beigegeben waren.
Diese waren äußerst übler Laune. Ihre Kameraden unten vergnügten sich bei Tanz und Wein, und sie saßen hier oben und schienen vergessen zu sein. Der einzige Besucher war Don Alappo gewesen, und der hatte auch nicht daran gedacht, ihnen Speise und Trank zu senden. Das Fenster war vergittert und führte außerdem auf einen menschenleeren Hof hinaus. Die Stube zu verlassen wagten sie nicht. Der Kapitän war ein gar strenger Mann, der an seinen Leuten wegen Verletzung der Disziplin nur zu gern ein Beispiel statuierte.
Als die Nacht anbrach, wurde es den beiden Soldaten aber doch etwas einsam.
»Ich gehe hinunter und schlage Lärm,« sagte einer, »und wenn es mir den Hals kostet. Sollen wir hier vielleicht verschmachten? Caracho!«
»Geh' wenigstens bis an die Treppe und sieh zu, ob du nicht eine Hausdirne vor die Augen bekommst. Sei nicht zu laut, du weißt, der verdammte Kapitän versteht keinen Spaß.«
»Unsinn,« brummte der erste mürrisch. »Kein vernünftiger Mensch kann verlangen, daß wir dieses roten Halunken wegen verdursten.«
»Es ist wahr, ein verdammter Streich ist es. Warum hat Gott nur diese Spitzbuben geschaffen,« philosophierte der zweite. »Das Gesindel kann nichts weiter als stehlen und rauben, das beste wäre, man schickte alle Indianer mit einem Male zur Hölle.«
»Ja, wenn das so schnell ginge; die Regierung wäre wohl auch damit einverstanden.«
»Wenn's weiter nichts ist,« sagte der zweite Sprecher, »ich wüßte wohl ein Mittel. Man ladet einmal alle Indianer zusammen zu einem Trinkgelage ein; kannst dich darauf verlassen, es fehlt kein einziger, denn Schnaps saufen sie gar zu gern, und man mischte ihnen eine ordentliche Dosis Gift hinein.«
»Hahaha,« lachte der erste. »Heh, springender Panther, was meinst du zu diesem Vorschlag? Würdest du wohl noch springen können, wenn du eine Unze Arsenik im Bauche hättest?«
Er rüttelte den Indianer roh an der Schulter, aber dieser rührte sich nicht.
»Du bist wohl noch betrunken von dem, was dir Donna Mercedes kredenzt hat?« rief der Soldat. »Natürlich, da hast du dich gleich toll und voll gesoffen. Pfui, du altes Vieh!«
Er verabreichte dem Häuptling einige derbe Fußtritte. Der Indianer schrie nicht, er veränderte auch sein Gesicht nicht, keine Muskel zuckte, aber er wurde durch die Fußtritte aus seiner alten Lage gebracht, er lag jetzt so, daß er mit dem Rücken, also auch mit den Händen der Wand zu lag.
»Ich gehe,« sagte der erste Soldat nochmals, »ich muß etwas zu trinken haben, oder ich verdurste.«
»Denke an mich!« rief der andere ihm nach, als jener die Tür öffnete und hinauslauschte.
In diesem Augenblicke heulte draußen ein Schakal zweimal auf. Unmerklich zuckte der Indianer zusammen.
»Huh, wie das Tier schreit,« sagte der Zurückgebliebene.
»Das ist nichts. Er streitet sich mit seinem Weibchen,« entgegnete der, welcher den Kopf zur Tür hinaussteckte, und verließ das Zimmer.

Noch einmal ertönte das Heulen des Schakals. Der Indianer stöhnte tief auf, wälzte sich etwas auf die Seite und zog die Beine an.
»Na, dir wird's wohl ungemütlich?« spottete der Soldat. »Möchtest du zu deinem Kollegen draußen, du Kojote?« Kojote ist der Steppenhund Südamerikas.
Der andere Soldat kam wieder herein, in der einen Hand einen Krug, in der anderen eine brennende Lampe haltend.
»Hier, trink!« sagte er. »Ich habe Glück gehabt. Unten traf ich den Verwalter, Fernando, glaube ich, heißt er. Er wußte schon, warum ich kam und holte mir den Wein hier, sagte auch, er würde gleich selbst heraufkommen und uns Essen und Karten bringen.«
»Wenn wir nur abgelöst würden!« knurrte der zweite Soldat, sich den Mund wischend.
»Dafür will er auch sorgen, und dann wollen wir das Versäumte nachholen.«
Die Musik spielte unten noch immerfort, man hörte Lachen, Rufe von tiefen Männerstimmen und Weiberkreischen — der Wein begann seine Wirkung zu tun — und auf der anderen Seite, welche dem Gebirge zu lag, erscholl ein lautes Heulen und Krächzen von Schakalen.
»Karacho,« fluchte der eine Soldat, »die Schakale sind vor Liebe toll, gerade so, wie die Menschen da unten.«
Er trat an's Fenster, sein Kamerad mit ihm, und beide blickten hinaus in die vom Mond schwach beleuchtete Nacht.
»Wahrhaftig, da unten schleichen sie herum. Hätte nicht geglaubt, daß sie sich so nahe an die Hazienda —«
»Heranwagten,« wollte er sagen, da aber legten sich um den Hals der beiden Soldaten zugleich zwei eiserne Hände, und die Köpfe wurden mit furchtbarer Gewalt zusammengeschlagen, noch einmal und zum dritten Mal. Lautlos, mit zerschmetternden Schädeln, sanken die Soldaten zu Boden, ihr brechendes Auge sah nur noch einmal in das vor Leidenschaft glühende Auge des Häuptlings, den sie verspottet und getreten hatten — er hatte sich wieder in den Panther verwandelt.
Da zuckte der Indianer zusammen und duckte sich wie zum Sprunge, die Tür öffnete sich, aber der springende Panther schnellte nicht dem Eintretenden entgegen, um ihn zu erwürgen, denn der Verwalter erschien im Türrahmen.

Der Häuptling beugte sich herab, ohne den Lauf des Rosses zu mäßigen.
Entsetzt prallte dieser zurück und ließ die in der Hand gehaltene Schüssel mit kaltem Fleisch und Brot zu Boden fallen.
»Jesus Christus!« stieß er mit bebenden Lippen hervor.
Hochaufgerichtet stand der Häuptling vor ihm.
»Der springende Panther hält sein Wort,« rief er. »Die weiße Senorita soll dein sein, und er holt sich das Weib, das ihm gefällt.«
Mit einem Satze stand er am Fenster und stieß den schrecklichen Kriegsruf der Penchuenchen aus, mit der Hand schnell auf den Mund schlagend und dadurch einen tremulierenden Ton erzeugend.
Fernando hatte den Kriegsruf der Penchuenchen schon oft gehört, aber noch nie in solcher Nähe. Bleich vor Schreck mußte er sich an die Wand lehnen.
Der Ruf des Häuptlings fand ein hundertstimmiges Echo. Ueberall tauchten wilde Reiter auf, auf flüchtigen Rossen der Hazienda zufliegend.
Der springende Panther nahm die Lampe und zerschmetterte sie am Boden, das Petroleum ergoß sich über die Bretter, fing Feuer, und im Nu standen die ausgedörrten Planken des Zimmers in Flammen. Der Indianer stürzte zur Tür hinaus, dabei den Verwalter mit fortreißend.
»Zeige dich nicht auf dem Hofe, sonst bist du verloren,« schrie er ihm ins Ohr, dann sprang er mit einem Satze die Treppe hinunter.
»Die Penchuenchen kommen,« gellte unten entsetzt der Schrei.
»Ins Haus hinein, zu den Waffen,« ertönte der Ruf des Kapitäns, aber alles wurde noch übertönt durch den Kriegsruf der Wilden.
Mindestens hundert Rosse waren es, welche von einer Seite gestürmt kamen und mit kühnem Sprunge über die hohe Fenz des Gartens setzten. Auf ihnen saßen wilde Gestalten mit fliegenden Haaren, in den Händen die langen Lanzen mit funkelnden Messern als Spitzen, und fort und fort tönte aus ihrem Munde jenes schreckliche, nervenerschütternde Gellen.
Mit Ausnahme der Soldaten dachte niemand an Verteidigung. Wohl wissend, wie sich die Indianer bei einem solchen Ueberfall verhielten, suchte alles Rettung in eiligster Flucht, aber nicht in das schon brennende Haus hinein, sondern in den nahen Apfelbaumwald. Denn ebenso schnell wie die Indianer kamen, verschwanden sie auch wieder. Was sich ihnen in diesen wenigen Augenblicken von Männern in den Weg stellte, wurde niedergemacht. Die Weiber wurden quer über die Pferde geworfen, und fort ging es dann wieder, in die Pampas zurück.
Kreischend eilten Frauen und Männer dem schützenden Walde zu, während die Soldaten in das Haus zu dringen versuchten, um in den Besitz ihrer Waffen zu kommen und Gebrauch davon machen zu können.
Aber den wenigsten gelang es.
Wie der Blitz waren die Penchuenchen über ihnen, und unter ihnen wie durch Zauberei der springende Panther auf seinem eigenen Mustang. Im Mondstrahl zuckten die Lanzenspitzen, und bei jedem Aufblitzen stürzte ein Soldat röchelnd zu Boden, mit seinem Blute das Gras färbend, auf dem er eben noch getanzt hatte.
Der springende Panther brauchte keine Waffen, wie der Wind fegte er über den Rasen, hinter ihm her eine Bande von Indianern. Er erreichte den Waldessaum, als eben eine Frauengestalt mit fliegenden Haaren in den Schutz der Bäume eilen wollte. Der Häuptling beugte sich herab, ohne den Lauf seines Rosses zu mäßigen, schlang das schwarze Haar der Fliehenden um die Hand, und bog sich noch weiter herab — ein Griff mit der anderen Hand, und das Mädchen lag quer über seinem Sattel.
Zugleich drückte er die Flanken des Rosses so mit den Schenkeln zusammen, daß es sich aufbäumte, sich auf den Hinterfüßen herumwarf und zurückgaloppierte.
»Mein Weib,« gellte da plötzlich eine Stimme, und ein Mann warf sich dem Pferde entgegen. »Gib mir Mercedes wieder, Räuber!«
Ein Revolver blitzte dem Häuptling entgegen, aber in demselben Augenblick stürzte Don Pedro, von der Faust des Indianers mächtig an den Kopf getroffen, zu Boden. Die Hand des springenden Panthers brauchte keine Waffe im Kampfe, sie glich einer furchtbaren Tatze.
Zurück jagte der Häuptling und mit ihm seine Genossen. Fast jeder hielt ein Mädchen in seinen Armen, die schönste Beute, welche sie machen konnten.
Da griff der springende Panther plötzlich an den Sattel und wirbelte im nächsten Augenblick eine an einem kurzen Lederriemen befindliche Kugel um seinen Kopf. Eben hatte der dicke Hauptmann das Haus erreicht, da brach er, wie vom Blitz getroffen, im Türrahmen zusammen — eine Leiche. Die von der nie fehlenden Hand des Häuptlings geschleuderte Kugel hatte ihm die Wirbelsäule zerschmettert.
Schnell, wie sie gekommen, waren die Wilden wieder verschwunden, noch ehe das brennende Haus die Gegend weithin mit seinen Flammen erleuchtete. Einige Schüsse wurden ihnen nachgesandt, ein Indianer verlor die Zügel und neigte sich mit gesenktem Kopfe schwer auf die Seite, als wolle er aus dem Sattel stürzen, aber auf einen Ruf des springenden Panthers waren ihm schon zwei andere zur Seite und hielten ihn, denn die Indianer lassen ihre Toten nicht in den Händen der Feinde.
Der Verwundete starb auf dem Pferde, ohne durch das leiseste Stöhnen seine Schmerzen verraten zu haben.
Nach und nach kamen die Geflüchteten wieder aus dem Wäldchen heraus, aber ach, welcher Jammer, als die Anwesenden gezählt wurden; gar viele wurden vermißt, und zwar hauptsächlich Mädchen. Pedro war trostlos, er hatte seine jungfräuliche Frau verloren; und das Eintauschen der geraubten Mädchen von den Indianern ist keine leichte Sache.
Auch die eben erst gerettete Miß Petersen war in den Händen der Entführer.
Aber wo waren denn die tapferen Soldaten, auf deren Schutz man sich verlassen und von denen man wenigstens eine sofortige Verfolgung erhofft hatte?
Nur kurze Augenblicke hatten die Verfolger sich sehen lassen, aber nur wenige Soldaten waren den tödlichen Lanzenstichen entgangen, und die waren auch noch in dem brennenden Hause umgekommen, als sie nach ihren Waffen gesucht hatten.
Außer zwei Soldaten waren alle tot oder lebensgefährlich verwundet, desgleichen zwei Gäste, vier zur Bedienung gehörende Männer, geraubt waren sieben Mädchen.
Außerdem vermißte man noch Fernando, den Verwalter, er war weder unter den Toten, noch unter den Lebenden zu finden.
Noch standen alle in ratloser Verzweiflung da, ohne einen Entschluß fassen zu können, als eine Reiterschar durch das Gartentür auf den freien Rasenplatz gesprengt kam.
Bei dem Bilde, das ihnen die Flammen des dem Einstürzen nahen Gebäudes zeigten, parierten sie entsetzt die Pferde.
Es waren Lord Harrlington, Hastings, Williams, Hendricks und John Davids, welche unter der Leitung eines Führers hierhergekommen waren, um Miß Petersen aufzusuchen. Die übrigen Herren waren in Valdivia zurückgeblieben, die Erfolge der Expedition ihrer Freunde abwartend.
In kurzen Worten wurde ihnen mitgeteilt, was geschehen war — Miß Petersen war also abermals der Fürsorge der Herren entgangen; die letzte der Vestalinnen war in der Gewalt der rohen Indianer.
»Ließ sich Miß Petersen ohne jeden Widerstand von den Räubern fortschleppen?« fragte Lord Harrlington den Erzähler, einen Beamten der Hazienda, der nicht, wie fast alle die übrigen, den Verlust einer geliebten Person zu beklagen hatte.
»Ich kann es nicht sagen. Jeder dachte in dem Augenblick nur an seine eigene Rettung,« war die Antwort.
Verächtlich musterte Harrlington die vor ihm stehende Gestalt und auch die anderen Spanier; in seinem eigenen Schmerz beachtete er nicht den Kummer des trauernden Vaters und des jungen Ehegatten. Es war ihm unbegreiflich, daß diese jetzt jammern konnten, anstatt Vorbereitungen zur Verfolgung der Indianer zu treffen.
»Wer schließt sich mir an, die Indianer zu verfolgen und Miß Petersen zu befreien?« wandte sich Harrlington an seine Begleiter.
Diesmal war es der sonst so schweigsame Lord Hastings, welcher das Wort nahm.
»Ich spreche für meine Freunde,« sagte der auf einem mächtigen, schwarzen Wallach sitzende Lord. »Uns alle hält nichts mehr ab, unser Leben zu schonen, wir stellen es in dem Dienste der Miß Petersen Ihnen zur Verfügung, James.«
Die Stimme des Lords klang seltsam, fast klagend.
»Ich danke Ihnen! Und wer von Ihnen will sich mir anschließen?« wandte sich Harrlington an die Spanier.
»Auch wir wollen natürlich die Räuber verfolgen,« nahm Don Alappo schmerzerfüllt das Wort, »aber so schnell geht das nicht. Wir müssen erst militärische Hilfe erwarten und uns Tauschartikel verschaffen. Ohne diese können wir nichts gegen die Indianer ausrichten.«
»Ich bin anderer Meinung,« entgegnete Harrlington unwillig, »wir brechen sofort auf.«
Die Herren stimmten ihm bei und machten keinen Versuch mehr, die Spanier zum Mitkommen zu überreden.
»Kannst du uns den Weg führen, den der springende Panther mit seiner Beute eingeschlagen hat?« fragte Harrlington den mitgenommenen Führer.
»Auf so etwas lasse ich mich nicht ein,« erwiderte dieser erschrocken, »außerdem bin ich nur Führer zwischen der Küste und dem Gebirge. Im Gebiete der Penchuenchen, in den Pampas will ich nichts zu tun haben.«
»Feigling!« murmelte Hastings in den Bart.
»Seht ab von diesem Versuche,« warnte Don Alappo, und die anderen wollten ihm beistehen, wurden aber unterbrochen.
»Wah!« schrie in diesem Augenblick eine rauhe Stimme an der Gartentür, und man sah Juba Riata neben seinem Begleiter zu Pferde halten. »Der springende Panther hat sich schneller gerächt als ich dachte. Liegt dort nicht der dicke Capitano, Don? Dem Fettkloß ist recht geschehen, allen heimtückischen Schuften soll es so ergehen.«
»Das ist der Mann, den Ihr braucht, Senor,« flüsterte der Führer Harrlington zu.
Die Herren ritten sofort zu ihm und fragten ihn, ob er als Führer in den Pampas dienen wolle.
»Ich diene nie,« war die stolze Antwort.
»Ihr sollt uns führen.«
»Gut. Habt Ihr Tauschwaren bei euch?«
»Nein, doch wir haben Freunde, welche uns nachfolgen und Tauschwaren mitbringen werden.«
Riata besprach sich mit seinem kleinen Gefährten, den er Don nannte.
»Ich traue euch,« sagte er dann laut, »und ich bin bereit, euch zu führen. Was wollt ihr vom springenden Panther, meinem Freunde?«
»Eine Dame, die er geraubt hat.«
»Nur eine?«
»Ja, auf diese kommt es uns hauptsächlich an.«
Wenn ihr dem springenden Panther Tauschwaren versprecht, so werde ich für euch gutsagen, werdet ihr aber auch euer Wort mir gegenüber halten?«
»Wir werden es.«
»Gut, ich traue euch,« wiederholte Riata und besprach sich abermals leise mit dem Don.
»Was für Waffen habt ihr bei euch?« fragte er dann und überzeugte sich selbst davon, daß dieselben in Revolvern, Jagdmessern und Winchesterbüchsen bestanden.
»Wollt ihr mir unbedingt folgen, und mir auch gehorchen, selbst wenn ihr die Zweckmäßigkeit des Befehls nicht einsehen könnt?«
»Ja.«
»Gut, so steige dieser Senor ab,« er deutete auf John Davids, der ein weißes Roß ritt, »und tausche sein Pferd um. Don Alappo wird ihm ein anderes geben. Schimmel sind in den Pampas nicht zu gebrauchen. Sie werden zu weit gesehen.«
John Davids stieg gehorsam ab, und Don Alappo »verschaffte ihm ein anderes Pferd.
»Ich schreibe meinen Freunden, zweiundzwanzig Mann, daß sie nachkommen und Tauschartikel mitbringen,« sagte Harrlington zu dem Mestizen.
Wieder besprachen sich die beiden Jäger leise.
»Tu' so,« war dann die kurze Antwort.
Harrlington riß ein Blatt Papier aus seinem Notizbuch, schrieb darauf, was hier vorgefallen war, und bat seine Freunde, mit Tauschwaren, welche der Ueberbringer des Schreibens bestimmen würde, sofort nachzukommen. Wenn auch nicht alle sich der Expedition anschlössen, möchten doch einige dem Lord als Freunde beistehen.
»Wer soll dieses Schreiben überbringen?« fragte Harrlington den Mestizen.
Dieser musterte mit durchdringendem Blicke den Führer.
»Der Mann da,« sagte er, nahm ihn zur Seite und sprach lange mit ihm, hauptsächlich wegen der mitzunehmenden Geschenke.
»Und wenn du hier wieder angekommen bist,« schloß Riata, »bist du deines Amtes enthoben; du feiger Schlingel, wagst dich doch nicht in die Pampas. Ein anderer Führer wird dich ablösen. Aber wage nicht, mich zu hintergehen. Du kennst mich und weißt, daß ich nicht eher ruhen würde, als bis mein Lasso dich erreicht hätte und ich dich hinter meinem Pferde schleifte.«
Demütig versicherte der Führer, daß er sein möglichstes tun werde, alles schnell auszurichten.
»Getrauen sich die Senores noch heute nacht zu reiten?« fragte Riata die Herren.
»Jede Minute Verzögerung ist schädlich, wir sind bereit!« riefen alle gleichzeitig.
Riata ließ sich einige Ledersäcke mit getrocknetem Fleische geben, ferner Vorräte von Tee, Salz, Tabak und so weiter, auch einige Töpfe, verteilte alles gleichmäßig, und die kleine Kavalkade verließ die Hazienda, von den erstaunten Blicken der Spanier begleitet.
Den ersten Tag hatten die auf der Felseninsel eingemauerten Vestalinnen untätig verbracht. Sie konnten sich noch nicht in ihre Lage finden; sie glaubten, es sei ein böser Traum, daß sie hier gefangen saßen.
Teilnahmlos gingen sie aneinander vorüber, bereiteten sich das Essen einzeln, oder die eine aß von dem, was die andere gekocht hatte. Unterhaltung fand gar nicht statt, und am Abend legten sie sich alle zur Ruhe in die Zelte, mit solchem Bedürfnis nach Schlaf, als hätten sie den ganzen Tag schwer gearbeitet — so waren sie seelisch ergriffen.
Doch der nächste Morgen brachte neuen Mut.
»Wir wollen die Mauer erklettern,« schlug Ellen vor, »und sehen, ob wir vom Meere Hoffnung auf Befreiung zu erwarten haben.«
Die Ersteigung der Mauer war keine schwere Arbeit. Es wurde ein Faß hingerollt, umgestürzt und ein Stuhl darauf gesetzt, und der Mauerrand war erreichbar. Aber ein Sitzen darauf war sehr unangenehm, denn die Matrosen hatten die Mauer oben scharf zugehen lassen, und der Rand war durch den Zement so fest geworden, daß weder mit den Händen, noch durch Schläge mit einem Stuhlbein etwas davon abgebröckelt werden konnte.
Die Mauer fiel jäh zum Wasser ab.
»Ein Floß oder etwas Aehnliches herzustellen, wäre ganz unnütz,« sagte Ellen, »denn wir können es nicht ins Wasser lassen. Diese Mauer bietet uns also mehr Schwierigkeiten, als ich erst glauben wollte.«
»Wie sollten wir übrigens ein Floß herstellen?« entgegnete Miß Murray. »Holz hätten wir in Gestalt von Kisten und Fässern wohl genügend, aber wir haben kein Werkzeug, denn die Gabeln und Messerchen sind doch ganz unbrauchbar.«
»Aus den Faßreifen würden schon schneidende Instrumente herzustellen sein, und Steine müßten Hämmer vertreten. Aber ich schlage vor, erst einmal ruhig abzuwarten, was uns die nächste Zeit bringen wird. Mit uns soll noch etwas ganz Besonderes geschehen, vermute ich, und ich bin wirklich neugierig, was dies ist.«
»Sagte nicht jener verräterische Anderson, wir würden Besuch zu erwarten haben?«
»Ja, das sagte er,« entgegnete Ellen, »und ehe wir diesen nicht bekommen haben, bin ich gar nicht gewillt, die Insel zu verlassen, ich brenne vor Neugier.«
Es wurde beschlossen, sich in die häuslichen Geschäfte zu teilen und überhaupt recht fleißig zu arbeiten, soviel es ging, nach dem alten Grundsatze, daß nichts die Zeit so schnell vergehen läßt und nichts den Menschen so sehr befriedigt, wie Arbeit.
Die Zelte wurden anders geordnet, die Mädchen quartierten sich in Gruppen zusammen. Die Sklavinnen wurden auf die einzelnen Zelte verteilt. Man richtete die Höhlen noch bequemer ein, entfernte das Steingeröll von dem Plateau, und wirklich erlangten die Mädchen bald ihre gute Laune wieder.
Was war es denn weiter, als ein Abenteuer mehr zu den schon erlebten, und zwar fast das interessanteste? Ans Leben ging es ihnen nicht. Not brauchten sie nicht zu leiden, also darum nur frischen Mut bewahrt! Ihr einziger Traum galt der ›Vesta‹, dem Schiffe, welches sie geliebt, an dem ihr Herz gehangen hatte.
Doch kommt Zeit, kommt Rat, die ›Vesta‹ existierte noch, vielleicht, daß sie doch noch auf ihr die Heimreise nach New-York antreten konnten!
»Unser Wunsch ist in Erfüllung gegangen,« meinte Miß Murray einmal, »jetzt haben wir ein Eiland, verlassen und einsam im bläulichen Meer.«
»Das Laub welkt auch nie am Baum, weil es keins gibt,« fügte eine andere lachend hinzu.
Der Abend fand die jungen Mädchen lachend und scherzend um drei große Küchenfeuer versammelt, über denen es in Töpfen zischte und brodelte. Während der Mahlzeit, aus Salzfleisch und Kartoffeln bestehend, wurden großartige Pläne geschmiedet. Morgen wollte man an der Felswand aus Steinen einen Backofen bauen, Mehl war in Ueberfluß vorhanden, und so sollte es fortan nie an Brot fehlen.
»Wir müßten uns ja schämen,« scherzte ein Mädchen, »wenn wir Besuch bekämen und könnten ihm nicht einmal ein Stück Kuchen vorsetzen. An Schiffszwieback dürften sein Magen und seine Zähne nicht gewöhnt sein.«
Bei völlig wolkenlosem Himmel hatten sie sich schlafen gelegt, aber während der Nacht zogen schwere Wolken auf, grelle Blitze und fürchterlicher Donner schreckten die Schläferinnen auf, und ehe sich diese noch vergegenwärtigten, daß ein Gewitter über ihrer Insel schwebte, prasselte schon ein klatschender Platzregen auf die Leinwandzelte herab.
Diese waren zwar in New-York als wasserdicht gekauft worden, aber welche Leinwand widersteht wohl einem Tropenregen? Es regnete nicht mehr in Tropfen, sondern endlose Wasserstrahlen stürzten senkrecht vom Himmel herab, alles im Nu durchnässend.
Einige der Mädchen liefen nach den Höhlen, wo sie Schutz fanden, wurden aber von Ellen aufgefordert, in denselben alles zu bergen, was vom Wasser Schaden erleiden konnte und durch Trocknen nicht wieder seine alte Beschaffenheit erlangte.
Das waren die Fässer mit Schiffszwieback, die man im Freien hatte stehen lassen, und dann ganz besonders die in den Zelten befindlichen Bücher und Schriftsachen.
Ehe dies alles in Sicherheit geschafft war, brach der Morgen an. Der Regen ließ nach und hörte plötzlich auf. Der Himmel strahlte wieder in gewöhnlicher Bläue, doch die Damen selbst waren bis auf die Haut durchnäßt, und die zum wechseln nötigen Kleider waren ebenfalls feucht geworden.
Doch was galt dies Menschen, welche über zwei Jahre lang in Sonnenschein, Sturm und Regen an Deck gestanden hatten, denen oft genug die Meereswogen über den Kopf gegangen waren, und welche es nicht immer für nötig befunden hatten, die nassen Kleider zu wechseln, sondern sie einfach am Körper trocknen ließen.
Man zog die am wenigsten feuchten Kleidungsstücke an und legte die nassen auf das Plateau in die Sonnenstrahlen zum Trocknen, denn es zeigte sich wieder einmal, daß die Damen doch nicht mit allem versehen waren, was sie brauchten, so zum Beispiel mit Stricken, die sie als Trockenleinen hätten benutzen können, oder aber auch — zum Zusammenbinden eines Flosses und Erklettern der Felsen.
»Jetzt erst einmal Feuer anmachen und Kaffee kochen,« meinte Ellen. »Ist einmal der Magen gewärmt, so schadet die nasse Kälte weniger.«
Einige Damen machten sich sofort daran, unter einem vorspringenden Felsen auf dem Platz, der schon vorher als Feuerherd gedient hatte, einen Holzhaufen aufzutürmen.
»Sind Sie krank?« fragte Miß Murray, Ellen besorgt in die Augen sehend, denn diese zeigte eine seltsame Unruhe und ein schlechtes Aussehen. Ihre Augen glänzten merkwürdig, und auf den Wangen machten sich rote, scharf abgegrenzte Flecken bemerkbar.
»Nicht im mindesten,« entgegnete Ellen, »ich habe schlecht geschlafen, oder vielmehr gar nicht, der Regen hat auch nicht gerade dazu beigetragen, mich heiter zu stimmen und ebensowenig die nächtliche Arbeit. Ich lechze jetzt nach einer Tasse Kaffee.«
Sie ging in eine Höhle, um die dort untergebrachten Vorräte zu ordnen. Gleich darauf kam ein Mädchen zu ihr und fragte sie, ob sie Streichhölzer unter den Vorräten habe, die, welche sie bis jetzt benutzt hätten, seien durchnäßt worden.
Ellen öffnete eine große Kiste, welche nur Streichhölzer enthielt, aber, o weh, die Schachteln waren alle ohne Ausnahme feucht, die Hölzer fingen kein Feuer.
Alle Mädchen wurden zusammengerufen, ein sorgfältiges Suchen nach diesem wichtigen Bedarfsartikel, dessen Wert man erst schätzen lernt, wenn man ihn nicht besitzt, begann; aber alle gefundenen Streichhölzer hatten unter der Nässe gelitten, sie fingen kein Feuer.
»Haben die Piraten uns nicht irgend einen optischen Apparat dagelassen, in welchem sich Vergrößerungsgläser befinden?« fragte ein Mädchen. »Mittels eines Brennglases könnten wir Feuer anzünden.«
Ellen verneinte. Die Piraten hatten es nicht für nötig gehalten, die Damen mit Ferngläsern, Mikroskopen oder dergleichen zu versehen.
»Oder wir können auch durch Reiben von Holz Feuer erzeugen,« schlug ein anderes Mädchen vor.
Trotz ihrer nervösen Laune mußte Ellen über diesen Vorschlag lachen.
Sie wußte, wie schwer es ist, auf diese Weise Feuer zu gewinnen. Es gehören dazu Hölzer von ganz besonderer Art, eins davon muß weich, das andere hart sein, und zum Reiben gehört die Geschicklichkeit und Ausdauer eines Wilden. Höchstens der Feuerbohrer kann von einem Uneingeweihten benutzt werden; aber das passende Holz zu wählen, bleibt dabei die Kunst, ohne welche man nie Feuer erhält, und wenn man auch stundenlang riebe.
»Ich bin imstande, ein Brennglas herzustellen,« sagte Ellen, »aber es wird zu schwach sein, um bei dem niedrigen Stande der Sonne das Holz in Brand zu setzen, erst gegen Mittag wird es kräftig genug wirken. Doch können wir jetzt schon einen Versuch anstellen, vielleicht entzündet es Papier.«
Sie legte solches in die Morgensonne, damit es möglich trockene, und ließ sich dann zwei gleiche Uhrgläser geben. Die Taschenuhren waren ihnen von den Piraten gelassen worden. Diese gewölbten Uhrgläser wurden mit Wasser gefüllt, soweit dies möglich war, und die Strahlen der Sonne wurden durch diesen Apparat wirklich so konzentriert, daß ein schwaches Brennglas hergestellt wurde.
Nun wurde versucht, das Papier in Brand zu setzen, doch es gelang nicht; es sengte wohl, fing aber kein Feuer.
»Wir müssen warten, bis die Sonne ihren höchsten Punkt erreicht hat,« meinte Ellen. »Wirkt es dann noch nicht kräftig genug, so müssen wir fortan auf warme Speisen verzichten und das Fleisch durch Klopfen verdaulicher machen.«
Enttäuscht sahen die umstehenden Mädchen den vergeblichen Versuchen zu.

»Kann man die Streichhölzer nicht trocknen?« fragte eine.
»Nein, sie fangen nie wieder Feuer, wenn sie einmal naß geworden sind.«
Da stieß ein Mädchen, welches sich umgewendet hatte, einen lauten Schrei der Ueberraschung aus und deutete dorthin, wo die Holzstapel unter dem Felsen aufgeschichtet worden war. Der Holzstoß stand in lichterlohen Flammen.
»Wer hat das getan?« fragte Ellen, halb freudig, halb unwillig darüber, daß eine Vestalin den Besitz von Streichhölzern verheimlicht und Ellen unnötig bemüht hatte.
»Ich nicht,« erklang es einstimmig und bestimmt.
Man besichtigte den lustig brennenden Holzhaufen, aber nichts verriet, wodurch er in Flammen gesetzt worden war.
Der Vorgang war und blieb allen ein Rätsel.
»Wenn die Insel keine übernatürlichen Wesen beherbergt, welche durch ihr Machtwort Feuer hervorrufen können, so muß hier außer uns noch ein Mensch existieren,« so dachten einige, darunter z. B. Miß Murray und Miß Thomson, und machten sich daran, die einzelnen Höhlen genauen zu untersuchen, ohne an das Kaffeetrinken zu denken. Diesmal war Ellen wunderbarerweise nicht unter den Wißbegierigen, sie saß auf einem Steine und sah teilnahmslos der Zubereitung des Morgentrunkes zu.
Das Suchen war erfolglos gewesen, die Höhlen waren leer und hatten das Aussehen, als waren sie noch von keinem Menschen betreten worden. Höchstens fand man Spuren, daß hier einst zahlreiche Vögel gehaust hatten.
Miß Murray kehrte wieder zu Ellen zurück und teilte ihr das Ergebnis der Untersuchung mit.
»Was ist Ihnen denn?« unterbrach sich die Sprecherin plötzlich und schaute Ellen erschrocken an.
Das auf dem Steine sitzende Mädchen, dessen Wangen noch eben fast unnatürlich rot gewesen, verlor plötzlich alle Farbe und griff mit beiden Händen in die Luft. Dann schloß sie die Augen und glitt besinnungslos vom Steine herab.
Auf dem Schreckensruf Miß Murrays sprangen noch einige andere Mädchen hinzu und trugen die Bewußtlose in eine Höhle, wo sie auf ihr Bett gelegt wurde. Ihr Puls hatte fast aufgehört zu schlagen, sie glich einer Toten.
»Auch das noch,« jammerten ihre Freundinnen, indem sie Ellen durch Reiben wieder zum Bewußtsein zu bringen suchten.
Ein Mädchen sollte die Schiffsapotheke bringen, von der man bestimmt voraussetzte, die Piraten hätten sie ihnen gelassen, die Abgeschickte kehrte aber bald mit der Bestürzung verbreitenden Nachricht zurück, der Medizinkasten sei nicht unter den Vorräten.
Alles Suchen nach ihm war fruchtlos.
Das Einzige, was man tun konnte, war, daß man Ellens Kleider öffnete, ihr so mehr Luft verschaffte und kalte Umschläge anwendete. Wirklich kam sie bald wieder zu sich, aber das sonst so kräftige Mädchen war mit einem Male so schwach geworden, daß es kaum sprechen konnte.
»Um Gottes willen, liebste Ellen,« flehte Jessy, »was fehlt Ihnen? Sagen Sie es! Fühlen Sie Schmerzen irgendwo, oder ist es nur ein plötzliches Unwohlsein?«
»Ich weiß nicht, was es ist,« entgegnete Ellen mit matter Stimme, »ich fühle mich unsäglich schwach, mein Kopf ist mir zentnerschwer.«
»Sie haben sich diese Nacht in den nassen Kleidern erkältet.«
Ellen lächelte; es wäre das erstemal gewesen, daß sie sich erkältet hatte. Nein, die Aufregung, welche seit einigen Tagen fortwährend ihre Seele in Spannung hielt, hatte das Leiden hervorgerufen. Die sonst so starke Natur des Mädchens hatte diese nicht mehr aushalten können, je mehr die Unruhe um ihr künftiges Schicksal wuchs, desto größer wurde diese seelische Spannung, bis sie endlich bewußtlos zusammengebrochen war.
Ein heftiges Fieber war im Anzug, wie es an Stärke nur in tropischen Gegenden die Menschen heimsucht. Schon jetzt begannen die Pulse der Kranken furchtbar zu jagen, und der Kopf glühte. Innerhalb eines Tages mußte das Fieber bereits seinen höchsten Punkt erreicht haben, und wurde die Krisis nicht zu Gunsten des Lebens abgewendet, so war Ellen dem Tode verfallen.
Noch wußte dies jetzt zwar weder Jessy, noch ein anderes Mädchen, aber jede ahnte, daß diese Krankheit nicht leicht zu nehmen war.
»Wir können die Apotheke nicht finden,« klagte Jessy.
»Ich weiß es,« lispelte Ellen, »sie ist nicht auf die Insel gebracht worden. Machen Sie mir kalte Umschläge, liebe Jessy, damit mir mein Kopf nicht springt. Oder nein, unterlassen Sie es, das hat doch keinen Zweck.«
Ellen selbst also fühlte, trotz ihres bewußtlosen Zustandes, daß sie wenig Hoffnung auf Genesung hatte.
Man tat alles, was man konnte. Die Höhle wurde mit Portieren verhangen, so daß das helle Tageslicht den angegriffenen Augen nicht wehtat; den ganzen Tag wechselten die Damen in der Pflege ab, aber immer blieb nur eine in dem Räume, um jedes Geräusch zu vermeiden. Ununterbrochen wurden die nassen Tücher auf dem Kopf gewechselt und der Trinkbecher an die heißen Lippen der Durstigen gehalten.
Es war alles umsonst. Das Fieber nahm stetig zu, denn alles fehlte, womit ein derartig Kranker behandelt werden muß, vor allen Dingen Chinin, jene nicht zu ersetzende Medizin, ferner Eis und dann leichte Nahrung, hauptsächlich Milch, Fleischbrühe und höchstens Reis. Das schwere Salzfleisch und Hülsenfrüchte sind für Fieberkranke Gift, und auch Präserven können von dem schwachen Magen nicht verdaut werden.
Gegen Abend schon nahmen die Kräfte Ellens sichtlich ab. Sie lag entweder in heftigen Phantasien oder bewußtlos da, doch kam sie einmal zur Besinnung, so sprach sie der trostlosen Freundin, die gerade bei ihr war, Mut ein. Sie sollte ihretwegen nicht verzagen, sei sie nicht mehr am Leben, dann würden die übrigen Mädchen auch aus dieser Gefangenschaft befreit werden.
Es war in der Nacht, als Miß Thomson bei der Kranken Wache hielt. Mit angehaltenem Atem und klopfendem Herzen lauschte sie den Phantasien Ellens. Diese sprach fortwährend von ihrem Stiefvater, von einem Vetter, von Eduard, und beschuldigte beide des Mordes. Dann rief sie wieder mit gellender Stimme nach Harrlington, flehte ihn an, er solle sie nicht verlassen, solle sie vor dem Stiefvater schützen, und bat darauf Johanna um Verzeihung. Ein leises Wimmern löste diese wilden Phantasien ab, und endlich lag die Kranke stumm und bewegungslos da, die plötzlich ganz weiß gewordenen Hände über der Brust gefaltet.
Da wurde draußen vor der Höhle leise Miß Thomsons Name gerufen. Sie begab sich hinaus, und ein Mädchen teilte ihr mit, sie habe, auf der Mauer sitzend, geangelt und einen großen Fisch gefangen. Ob die Kranke davon essen könne? Es wurde hohe Zeit, daß Ellen etwas zu sich nahm. Salzfleisch und die vorhandenen Hülsenfrüchte wagte man ihr nicht zu geben, ebensowenig Kartoffeln und Brot. Die süße, präservierte Milch aber verschmähte die Kranke unter Zeichen des Widerwillens.
Betty bejahte und ordnete an, daß man den Fisch gleich abkochen sollte. Erwachte die Kranke, so sollte sie zu essen bekommen. Das Feuer war immer unterhalten worden.
Als Betty die Höhle wieder betrat, fand sie Ellen erwacht, bei Besinnung und ganz merkwürdig gut gelaunt.
»Sie haben den Medizinkasten gefunden?« rief sie der Eintretenden entgegen.
Betty verneinte.
»So hat eine der Damen Chinin bei sich gehabt?«
Betty verneinte abermals verwundert.
»Aber soeben hat mir doch jemand Chinin mit einem Teelöffel eingeflößt,« sagte Ellen, »ich glaubte, Sie wären es gewesen.«
»Ich war in diesem Augenblick gar nicht bei Ihnen, Sie haben geträumt, Miß Petersen ...«
»Wie soll ich geträumt haben,« rief diese, fast unwillig, »ich habe ja noch den bitteren Geschmack im Munde, habe die Person, welche mir es gab, neben mir stehen sehen und weiß noch ganz bestimmt, daß ich etwas von dem Chinin verschüttet habe. Ueberzeugen Sie sich davon, ob nicht etwas auf der Bettdecke liegt.«
Zu ihrem unaussprechlichen Erstaunen fand Betty wirklich etwas weißes Pulver auf der Bettdecke liegen, sie kostete es — es war Chinin; Ellen hatte nicht geträumt.
Betty ließ Ellen nichts von ihrem Erstaunen merken, aber sie mußte hinauseilen und es ihren Freundinnen verkünden, zugleich fragend, ob jemand Ellen Chinin eingegeben habe. Wie am Morgen beim Anzünden des Feuers, so behauptete auch jetzt eine jede, nichts davon zu wissen. Wer das Feuer angemacht hatte, gab Ellen auch das Chinin ein — ein unbekannter Inselbewohner.
Schnell eilte Betty wieder in die Höhle, nahm eine Lampe vom Tisch und untersuchte jeden Winkel, fand aber nichts, was darauf schließen ließ, daß diese einen anderen Zugang hätte, als den von vorn. Sie war ziemlich tief, die Wände erschienen rauh, aber durchaus nicht zerklüftet.
Das Mädchen stand vor einem Rätsel, doch die Hauptsache war, daß Ellen Chinin erhalten hatte. Vielleicht wurde sie auch noch fernerhin von dieser geheimnisvollen Person mit Medizin versehen, dann konnte Rettung erhofft werden, sonst nicht, denn eine einmalige Dosis hielt die Krankheit wohl auf, vermochte aber nicht, sie zu beseitigen.
Gedankenvoll saß Betty neben der schon wieder phantasierenden Kranken. Ein seltsam unheimliches Gefühl überschlich sie, wenn auch nicht das der Furcht. Dieser zweimalige Beweis der Anwesenheit eines Wesens, sei es eines übernatürlichen oder natürlichen Ursprungs, das Anteil an dem Schicksal der Vestalinnen nahm, hatte doch etwas Aufregendes für das Mädchen.
Als Betty abgelöst wurde, übergab sie nur ungern die Wache einem anderen Mädchen, denn die Kranke phantasierte wieder heftiger, denn je, das Fieber hatte bedeutend zugenommen, und eine Krisis stand unmittelbar bevor.
Doch sie durfte sich nicht weigern, der Freundin den Platz abzutreten, denn die Pflege Ellens wurde als heilige Pflicht betrachtet.
Mit sorgenschwerem Herzen verließ Betty die Höhle und begab sich zum Schlafen in ihr unterdes getrocknetes Zelt.
Noch hatte sich am Morgen die Sonne nicht über den Felsrand erhoben, noch herrschte eine unsichere Dämmerung, als sich die Vestalinnen schon vollzählig um den Eingang zur Höhle versammelt hatten.
Daß das Feuer in der Nacht erloschen war, weil die Mädchen, durch die Aufregungen der letzten Zeit zu ermüdet, vergessen hatten, regelmäßig Holz nachzulegen, darauf achtete vorläufig niemand. Ellen hatte etwas gekochten Fisch zu sich genommen, das war die Hauptsache, und außerdem brannte auch noch die Lampe im Krankenraum.
Jetzt war man begierig, zu erfahren, wie es mit der Kranken stände.
Mit niedergeschlagener Miene trat die Krankenpflegerin aus der Höhle und verkündete, daß es mit Ellen schlimmer wäre denn je, sie käme fast gar nicht mehr zum Bewußtsein.
»Wir wollen das Gebot aufheben, daß nur eine die Höhle betreten darf,« sagte Miß Murray, »kommen Sie, wir wollen zusammen die Kranke besichtigen.«
Ein trauriger Anblick bot sich ihnen dar. Ellen ging wirklich mit raschen Schlitten ihrer Auflösung entgegen; jede Stunde konnte dieselbe bringen.
»Chinin müssen wir haben,« rief Jessy, »sonst stirbt sie uns unter den Händen. Wenn die Person, welche der Kranken schon einmal Medizin eingeflößt hat, ein Herz hat oder doch Anteil an uns nimmt, so wird sie, so muß sie zum zweiten Male helfen. Hörst du es, rätselhafte Person?« rief Jessy laut in den Hintergrund der Höhle.
Die Umstehenden schauerten zusammen, es war ihnen, als wohnten sie einer Geisterbeschwörung bei, und wirklich glich das Verhalten von Miß Murray einer solchen Handlung.
In der Höhle blieb es still, es zeigte sich weder ein Gesicht, noch eine unheimliche Gestalt, nur Ellen stöhnte tief auf und wälzte sich auf ihrem Lager.
Doch Jessy nahm ihre Geisterbeschwörung völlig ernst, sie versuchte es noch einmal.
»Wenn du willig bist, uns zu helfen, so gib uns ein Zeichen,« rief sie in die Höhle hinein.
Da schraken die Mädchen plötzlich zusammen, ein unterirdisches Rollen, verbunden mit leisem Donner, erschütterte den Boden der Insel, und gleichzeitig erscholl draußen ein seltsames Prasseln und Knattern.
Die Mädchen stürzten, von Entsetzen erfaßt, zur Höhle hinaus, sie glaubten nicht anders, als die Vulkane der Insel begännen ihre alte Tätigkeit wieder, als sie aber draußen standen, glaubten sie ihren Augen nicht trauen zu dürfen. Unter dem Felsvorsprung, wo das ausgebrannte Feuer lag, war ein neuer Holzstoß aufgerichtet worden, und eben züngelte die Flamme daran empor.
Das erste Wunder hatte sich wiederholt, aber wiederum ließ sich niemand sehen.
Während alles noch sprachlos vor Staunen dastand, eilte Miß Thomson, von einem Instinkt getrieben, in die Höhle zurück und blieb beim Anblick der Kranken wie gebannt stehen.
Auf dem Kopfe Ellens lag eine Eiskompresse, jener Gummibeutel, in dem Eis aufbewahrt werden kann, ohne daß das Wasser herausläuft.
Dann stürzte Betty plötzlich schnell nach dem Tische, nahm die noch brennende Lampe und eilte nach dem Hintergrunde der Höhle. Es war ihr, als hätte sie dort eine dunkle Gestalt gesehen.

Betty eilte mit der Lampe nach dem Hintergrunde der Höhle.
Da, wirklich — sie erkannte eine in dunkle, lange Frauengewänder gehüllte Gestalt.
»Wer du auch seiest,« rief Betty außer sich, aber furchtlos, »steh, und zeige dich!«
Sie sprang vorwärts, aber in diesen: Augenblicke durchstrich ein kalter Luftzug die Höhle, die Lampe erlosch, und Betty stand im Dunkeln. Dennoch tastete sie vorwärts, doch wohin sie auch griff, sie fühlte nur die rauhe Felswand. Die Höhle war so eng, daß die eben gesehene Gestalt sich nirgends verbergen konnte. Aber sie war verschwunden. Und doch hätte Betty auf ihre Seligkeit schwören wollen, kein Gebilde ihrer Phantasie gesehen zu haben.
Schnell verständigte sie die unterdes wieder hereingekommenen Freundinnen; die Lampe wurde wieder angezündet und damit die Höhle beleuchtet. Die Wände wurden ganz genau untersucht, aber es wurde nichts gefunden. Die Wand zeigte keine Fuge, keine Spur, daß hier eine geheime Tür vorhanden war, und um nach Fußabdrücken forschen zu können, waren die Damen nicht erfahren genug.
»Wissen Sie, wen ich zu erblicken glaubte?« sagte Betty. »Die Gestalt war zwar dicht verschleiert, aber die Figur und hauptsächlich der Gang erinnerten mich an Johanna, daß ich diese ganz bestimmt vermutete. Jedenfalls ist es jetzt über allen Zweifel erhaben, daß diese Insel von einem Wesen bewohnt ist, welchem übernatürliche Kräfte zur Verfügung stehen oder doch solche, welche wir uns nicht zu erklären vermögen. Wie könnte sie sonst aus dieser Höhle ohne Ausgang spurlos verschwinden?«
»Und woher bekommt sie Eis?« fragte ein Mädchen.
Man betrachtete die Kompresse. Sie war wirklich mit Eis gefüllt, es mußte hier in dieser heißen Gegend natürlich künstlich hergestellt oder durch das Machtgebot eines Gottes entstanden sein.
»Was steht denn hier unter dem Bett?« rief plötzlich ein Mädchen, deren Fuß an etwas Hartes gestoßen hatte, bückte sich und zog zwei Kästchen hervor, die vorher nicht unter dem Lager gestanden hatten.
Da war ein Mahagonikasten, den Damen vollständig unbekannt, d. h., er gehörte nicht zu dem Inventar der ›Vesta‹. Er enthielt eine kleine, aber vollständige Apotheke, und als man die Flasche aufhob, welche beim Hervorziehen des Kastens von demselben heruntergefallen war, da leuchtete in den Strahlen der Sonne den Damen in großen Buchstaben die Aufschrift ›Chinin‹ entgegen. Der andere, eiserne, schwere Apparat mit einem Handkübel war eine Eismaschine, mittels welcher man mit Leichtigkeit Eis erzeugen kann, indem man durch Luftverdünnung Kälte erzeugt.
Ellen konnte ihren Freundinnen erhalten bleiben.
Pustend und schnaubend sauste der Pacificzug durch die Fluren des Südens von Nordamerika, mit Windeseile an den goldigen Feldern vorüberfliegend, dann in den Schatten der Urwälder einlaufend und dann wieder über Präirien mit verbranntem Graswuchs jagend. Scheu hob der wilde Indianer den mit Federn geschmückten Kopf über das hohe Gras und schüttelte drohend den Tomahawk dem dampf- und feuerspeienden Ungetüm nach.
Immer weiter drangen die eisernen Schlangen, die Eisenbahnschienen in das Gebiet des roten Mannes hinein, und wo der Dampfwagen erschien, da mußte jener seinen Wigwam abbrechen und mit Weib und Kind auswandern, denn das Wild konnte die lärmende Erfindung der Kultur nicht vertragen. Es floh vor dem unheimlichen Zischen und Heulen, und wohin es sich wendete, dahin nahm auch der Indianer seinen Weg, denn seine Existenz hängt von dem Wildreichtum ab.
Einige Herden blieben wohl noch in der Nähe der Schienenstränge, weil sie sich nach und nach daran gewöhnt hatten, denn schon stießen sie überall auf solche, aber der Indianer konnte sich nicht mehr sättigen, er mußte häufig den großen Geist um fette Büffel bitten, und dazu kam noch, daß aus den Waggons oft genug weiße Männer mit langen Büchsen stiegen, welche unter den den Indianern gehörenden Herden fürchterliche Metzeleien anrichteten, nur um ihre Jagdlust zu befriedigen.
Durch Nordamerika geht nicht mehr nur eine einzige Pacificbahn, es existieren jetzt vier, sie durchkreuzen den Erdteil von Osten nach Westen, von Norden nach Süden, nichts gibt es, was den Bau der Eisenbahnen zu hindern vermocht hat. Der Ingenieur der Gegenwart weiß jedes Hindernis zu beseitigen.
Er lacht und spricht:
Geht dieses nicht,
So geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere ... und nirgends bewies er dies so, wie bei dem Bau der Pacificbahn von Nordamerika.
Bald führen himmelhohe, schwankende Brücken über schwindelnde Abhänge, bald bohrt die eiserne Schlange schier endlose Kanäle durch Gebirge, die Eisschollen der Ströme suchen vergebens mit donnerndem Anprall die soliden Steinsäulen zu zerstören, auf denen die mächtigen Bogen liegen — sicher rast der Zug darüber, und hat dies dem Ingenieur besser gefallen, so führt gar ein Tunnel unter dem Strome durch, und der Passagier kann mit klopfendem Herzen das Getöse der zornigen Wogen über seinem Haupte vernehmen.
Die Pacificbahn kennt keinen Unterschied von Tag und Nacht; in rasender Geschwindigkeit jagt die Lokomotive dahin, gleichgültig, ob es hell oder dunkel ist, ob die Sonne scheint oder ob eisige Winterstürme das Blut des Personals erstarren machen. Mit ihrem cowcatcher, zu deutsch Kuhfänger, einer vor der Lokomotive angebrachten Vorrichtung, wirft sie alles rücksichtslos beiseite, was ihr in den Weg kommt, meist Kühe und Ochsen, welche in ihrer Dummheit dem Ungetüm blind entgegenrennen. Ganze Herden von Schafen werden oftmals von ihr vernichtet, aber früher kam es auch vor, daß ein Indianer, der in dem feuerspeienden Ungeheuer den Verderber seines Volkes sah, ihm mit geschwungenem Tomahawk entgegensprang und als zerfetzter Leichnam zur Seite geschleudert wurde.
Die von der Lokomotive nachgeschleppten Wagen sind so eingerichtet, daß die Passagiere die Reise durch ganz Amerika machen können, ohne nötig zu haben, nur einmal auszusteigen. Nichts fehlt darin. Speiseräume, Schlafcoupés, Toiletten-, Rauch- und Spielzimmer — alles ist vorhanden.
Alles ist glänzend eingerichtet, und doch ist die Reise durchaus nicht kostspielig, und zwar rührt das von der Konkurrenz her, denn die einzelnen Pacificlinien suchen sich gegenseitig totzumachen.
Die beiden Herren, welche in einem eleganten Coupé erster Klasse im Pacificzug saßen, der von New-York über Philadelphia, Knoxville nach Tuscalosa fuhr und hundert Meilen hinter dieser Station direkt nach Westen abbog, hatten wenig Interesse für die reichen Naturszenerien, welche im raschen Wechsel an den Fenstern vorbeiflogen. Nur ab und zu ließen sie teilnahmlos das Auge darauf haften. Viel lieber blickten sie den blauen Wölkchen ihrer Zigaretten nach oder verkürzten sich die Zeit durch geschäftliche Gespräche.
Es waren Yankees, also keine für die Natur begeisterten Menschen — sie konnten höchstens für Geld schwärmen und dachten bei Ansicht eines Waldes nur an den Gewinn, den man aus dem Verkauf dieser mächtigen Bäume ziehen konnte.
Am Morgen hatte der Zug Jackson verlassen, drei Stunden später in dem achtzig Meilen davon entfernten Vicksburg weniger als eine halbe Minute gehalten und hastete nun mit rasender Eile, nach Ueberschreitung des Mississippi, von den Indianern ›der Vater der Gewässer‹ genannt, dem Staat Louisiana zu.
»Hundertundzwanzig Meilen noch, und wir müssen den Red-River passieren,« sagte einer der Herren, zum Fenster hinaussehend.
Sie fuhren durch eine prärienartige Gegend.
Der andere Herr antwortete nichts, er gähnte laut auf. Das eben Gehörte war ihm ganz gleichgültig.
»Der Red-River mündet in den Mississippi,« fuhr der erste fort, »und ungefähr an der Mündung liegt Miß Petersens Besitzung.«
»Ah,« rief jetzt sein Gegenüber, sich interessiert aus seiner bequemen Stellung erhebend und ebenfalls durch das Fenster blickend. »Kommen wir an der Besitzung vorüber?«
»Nein, aber sehen Sie dort in der Ferne die dunkle Linie? Es ist der Waldgürtel, etwa zehn Meilen breit, welcher das Besitztum Miß Petersens begrenzt. Es liegt zu beiden Seiten des Red-River, ist ungefähr achtzig Meilen lang und fünfzig Meilen breit, hat also den Umfang von etwa viertausend Quadratmeilen.«
»Nicht möglich, Spurgeon,« rief der Herr und richtete sich mit einem Male stramm auf, »dann wird ja Flexan ein Mann, dessen Land dem manches Fürsten in Europa gleichkommt.«
»Allerdings, Kirkholm,« entgegnete der mit Spurgeon Angeredete gleichgültig. »Zwar ist nicht alles bebauter Boden, denn es gehört ein selbst für Amerika ganz ansehnlicher Wald dazu, in dem Indianer noch Hirsche jagen, und weite Prärien liegen dazwischen, aber auf diesen tummeln sich Herden von Pferden und Rindern in unglaublicher Anzahl, und alle tragen ein und dieselbe Brandmarke. Deren Wert allein ist einfach unschätzbar. Den Ertrag der Felder will ich gar nicht rechnen.«
Die beiden Männer sahen gedankenvoll vor sich hin. Spurgeon sowohl, wie Kirkholm gehörten bekanntlich zu jener Gruppe von Herren, welche sich beim Hazardspiel amüsierten, während ihr Freund Chalmers, der von Gott begnadete Redner und bibelfeste Mann, im Andachtsklub die jungen Mädchen erbaute.
»Ich weiß nicht,« begann Spurgeon nach einer Weile wieder, »mir gefällt das Vorgehen Flexans nicht.«
»In betreff der Vestalinnen?«
Spurgeon nickte.
»Warum nicht?« fragte Kirkholm.
»Mir wäre es tausendmal lieber gewesen, wenn Flexan die Weiber spurlos hätte von der Erde verschwinden lassen, anstatt sie auf einer Insel auszusetzen. So einsam und verlassen diese auch liegen und so wenig ein anderes Schiff auch Grund haben mag, sie aufzusuchen, eine Rückkehr von dort ist doch immer möglich.«
»Zum Verschwindenlassen ist noch immer Zeit,« lachte sein Gefährte.
»Das gebe ich zu, aber warum hat er sie nicht sofort dem Meere überliefert, sondern nur den Schiffbruch der ›Vesta‹ und den Untergang der Besatzung ausgesprengt?«
»Flexan wird seine Gründe dazu haben.«
»Gut, welcher Art mögen aber dieselben sein?«
»Ich kenne sie nicht, aber ich ahne sie,« entgegnete Kirkholm.
»Flexan liebt Ellen Petersen und will erst versuchen, ob sie ihm willfährig ist. Geht sie auf seine Bedingungen ein, das heißt, ergibt sie sich ihm in Liebe, heiratet sie ihn, so setzt er sie auf freien Fuß, und beide kehren als Mann und Weib auf Miß Petersens Besitzung heim.«
»Und die anderen Mädchen? Sollen wir uns etwa wegen Flexans Liebe die endlich erjagte Beute aus den Zähnen rücken lassen?«
Kirkholm lachte höhnisch auf.
»Torheit! Die werden einfach nach Hause geschickt und auf dem Wege geht ihr Schiff unter und sie mit ihm, diesmal aber wirklich. Einer Dynamitgranate werden seine Planken wohl nicht widerstehen können.«
Spurgeon sann einen Augenblick mit einem teuflischen Gesichtsausdruck nach.
»Ich traue diesem Flexan aber doch nicht,« sagte er dann. »Er handelt mir überhaupt viel zu eigenmächtig. Er ist der einzige, welcher sein Recht auf die Plantage nicht mit falschen Papieren beweist, sondern dieselben durch die Heirat zu erlangen sucht, und im Falle dieses mißglückt, eine Erbin eingesetzt hat, Martha, glaube ich, heißt sie, welche Ellen liebt, und die wiederum ihn zum Erbantritt berechtigt, denn Martha ist Eduard Flexans rechtmäßiges Kind. Er kann sich darüber legitimieren.«
»Mein Gott, Spurgeon,« verteidigte Kirkholm Flexan, »wenn wir solche Mittel in der Hand hätten, würden wir doch auch nicht anders handeln! Eduard ist ja wirklich ein sehr naher Verwandter Ellens, und daß er die Erbschaft dereinst nicht bekommen würde, liegt ja nur daran, daß das eigensinnige Mädchen ihn nicht leiden kann. Solche Intrigen kommen doch heutzutage überall vor. Uebrigens hält er treu zu uns, und sollte er abfallen, so haben wir ihn in der Hand. Er ist der in unsere Geschichten am meisten verwickelte Mann, und die Entdeckung eines von uns angestifteten Verbrechens zieht auch Flexan mit ins Verderben. Es ist also unmöglich, daß er verräterisch handelt, und er ist ja gerade der gewesen, der am meisten dabei getan hat, nicht nur für sich, sondern auch in unserem Interesse. Das muß man ihm lassen, er ist unermüdlich tätig gewesen.«
Spurgeon mußte dem beistimmen.
»Auch gefällt mir nicht,« sagte er trotzdem, »daß Flexan gar zu unersättlich ist. Nun lockt er wieder die englischen Lords ins Innere von Südamerika, um sie dort vernichten zu lassen. Sollten wir nicht mit unserer Beute zufrieden sein, anstatt uns von neuem in Verwickelungen und Unannehmlichkeiten aller Art zu stürzen?«
»Das betreibt Flexan auf eigene Faust,« entgegnete Kirkholm. »Wir werden, wenn der Plan gelingt, was ich gar nicht bezweifle, keinen Anteil von der Beute bekommen. Die Sache ist nicht schlecht angelegt. Durch jene vorgebliche Miß Petersen werden die Herren immer weiter ins Innere gelockt und schließlich von den Eingeborenen vernichtet werden.«
»Dadurch zieht er aber immer neue Personen ins Spiel, die um seine Pläne wissen und die er erst wieder verderben muß, damit sie später nicht zu Verrätern werden.«
»Mit nichten,« lächelte Kirkholm, »sein Plan mag wohl bekannt sein, einigen wenigstens, aber nicht seine Person selbst, ebensowenig wie die unsrige, dafür hat Flexan, der schlaue Fuchs, schon gesorgt. Die Indianer werden nur aufgehetzt, die Engländer zu töten, und haben sie das aus Sucht nach Beute getan, so werden sie von der Regierung dafür aufgehängt. Das ist alles und für Flexan vollkommen ungefährlich.«
»Wenn Flexan nun aber Miß Petersen wieder als sein Weib auftauchen läßt, was wird dann aus der Doppelgängerin?« fragte Spurgeon zweifelnd.
»Sehr einfach,« lachte sein verbrecherischer Genosse, »dann verschwindet diese Person, oder Flexan läßt sie verschwinden, seine Macht befähigt ihn dazu.«
»Aha, und im anderen Falle verschwinden beide, desgleichen die Engländer, und Flexan beginnt wieder Testaments- und ähnliche Schwindeleien.«
»So ist es,« bestätigte Kirkholm.
»Ein gefährliches Spiel, viel gefährlicher, als das Vermögen der Vestalinnen zu erschleichen, denn sie sind alle ohne Ausnahme unabhängig, sie können über ihr Vermögen frei verfügen, diese englischen Lords aber nicht, sie haben noch Eltern.«
»Nicht alle, und wenn nur etwas abfällt, so ist schon viel dabei gewonnen.«
»Dann operiert also Flexan ebenso wie bei den Vestalinnen?« fragte Spurgeon.
»Gewiß. Er selbst setzt Erben unter der Bedingung ein, daß sie so und so viel jährlich abgeben. Verrat ist dabei nicht zu befürchten; die eingesetzten Erben dürfen nicht versuchen, mehr Ansprüche zu machen, sonst sind sie verloren, denn sie wissen nicht, wer sie zum Erben eingesetzt hat. Alles ist genau so, wie bei den Vestalinnen.«
»Hahaha,« lachte Spurgeon laut auf, »die Gesichter der Verwandten möchte ich sehen, wenn ihnen das Testament verkündet wird und sie hören müssen, daß sie nur mit einer kleinen Summe bedacht sind, während einer ihnen vollständig unbekannten Person die ganze Erbschaft zufällt, und wenn sie dann weiter wüßten, daß dieser Erbe gar nicht der eigentliche Besitzer ist, sondern sozusagen das Vermögen nur für einen anderen verwalten muß und dafür einen hübschen Gehalt erhält.«
»Ja, wir haben diesmal ein glückliches Los vom Schicksal gezogen. Verwandt sind wir acht Mann alle mit den Vestalinnen, das kann uns nicht streitig gemacht werden, und die Summe, welche wir jährlich von dem Erbe der übrigen vierzehn Damen erhalten, beträgt an sich schon jedesmal ein Vermögen, von dem es sich bequem leben ließe. Wir können uns dann an Reichtum mit dem Silberkönig messen.«
»Apropos, Kirkholm,« unterbrach ihn Spurgeon, »wie weit ist Flexan mit Hoffmann gekommen? Hat er schon eine Ahnung, mit welchen Erfindungen Hoffmann sein Schiff ausgerüstet hat? Flexan soll sich doch in den Besitz des Geheimnisses zu bringen suchen.«
Kirkholm zuckte mit den Achseln und sagte, seine aufgerauchte Zigarette zum Fenster hinauswerfend, kurz:
»Weiß nicht, Flexan läßt sich nicht in seine Karten blicken.«
Er wußte mehr von diesem Vorhaben, als er gestehen wollte, denn er selbst war dabei mit Flexan im Bunde.
Eben passierte der Zug einen Strom, einen Nebenfluß des Mississippi. Von der schwindelnden Höhe der stählernen Hängebrücke herab sah man einige Dampfboote den Fluß befahren, und obgleich die Schiffe Nußschalen glichen, war die Luft so klar, daß man selbst die Besatzung und die Passagiere darauf noch erkennen konnte, wenn sie auch nur sich bewegenden Punkten glichen.
Gedankenvoll blickte Kirkholm auf die Dampfer dort unten, dann wandte er sich mit einem Ausdruck des Abscheues in seinem bleichen Gesicht vom Fenster weg und sagte zu seinem Freunde:
»In der nächsten Zeit wird der Totenacker auf dem Meeresboden mit vielen bevölkert werden, und die Haifische werden sich mästen können.«
»Wieso?« fragte Spurgeon, über den eigentümlichen Ton des Sprechers erschrocken.
»Flexan wird dafür sorgen, daß wir keine Mitwisser haben, denn obgleich unsere Helfer uns gar nicht kennen, darf keiner von ihnen am Leben bleiben, es ist dies Flexans ernster Vorsatz.«
»Wie? So sollen alle jene, welche seit Jahren für uns gearbeitet haben, als Dank für ihre Mühe und Arbeit mit dem Tode belohnt werden? Es sind einige Hunderte!«
Selbst der hartgesottene Spurgeon schauderte bei diesem Gedanken, aber Kirkholm erwiderte gleichgültig:
»Was macht's? Sie waren in unseren Händen nur tote Werkzeuge; wir werfen sie fort, wenn wir sie nicht mehr gebrauchen, und das beste ist es auch für die Burschen, daß sie von der Erde verschwinden. Der Galgen ist doch ihr Los, und sofort, wenn sie sich selbst überlassen sind, bricht Hader unter ihnen aus. Ueberall entstehen Verräter, weil sie die Hand eines geheimnisvollen Allmächtigen nicht mehr fühlen, und der Galgen rückt mit einem Male dicht vor sie. Angesichts des Todes könnten sie aber doch noch etwas ausplaudern, was für uns nicht zum Vorteile wäre. Also fort mit ihnen!«
Der Zug verließ die einsame Prärie, die Gegend zeigte schon hier und da angebaute Felder, die mühsam dem grasigen Boden abgerungen waren. Man sauste an Farmen vorüber, und schließlich sah man in der Ferne die Kirchtürme einer Stadt sich über die Bäume erheben.
Das war Shreveport, eine bedeutende Stadt, auf deren Station der unermüdliche Pacificzug aber ebenfalls nur eine halbe Minute hält.
Innerhalb einer Viertelstunde mußte der Ort erreicht sein.
»Sie steigen hier aus?« fragte Kirkholm.
»Ja,« antwortete Spurgeon und griff nach seinem leichten Handgepäck — das übrige lag im besonderen Gepäckraum und wurde auf der Station, nach welcher es signiert war, herausgeworfen. »Ich habe von hier den bequemsten Weg nach Miß Thomsons Plantage, weil ich ein gutes Stück des Weges auf dem Flusse zurücklegen kann. Was meinen Sie, werde ich besondere Schwierigkeiten beim Antreten der Erbschaft vorfinden?«
Er stellte die letzte Frage zwar lächelnd, man sah ihm aber an, daß es ihm doch nicht geheuer war.
»Warum?« entgegnete Kirkholm. »Es ist ja alles in Ordnung, und Sie sind ja außerdem ein naher Verwandter der Thomson.«
»Aber die Texaner sollen ein heißblütiges Volk sein. Diejenigen, welche auf die Plantage gehofft haben, werden nicht so ohne weiteres den Verlust überwinden können.«
»Bah, fürchten Sie sich etwa?« sagte Kirkholm verächtlich.
»Sie haben das Recht auf Ihrer Seite und können jederzeit gesetzliche Hilfe in Anspruch nehmen. Mein Stand im Staate Kolorado ist viel gefährlicher, denn einmal wohnt dort wirklich ein rauher und tatkräftiger Menschenschlag, halb Indianer, halb Weiße, und außerdem ist Miß Murray die einzige, welche Verwandte hat, die gerechten Anspruch auf die Erbschaft erheben können. Ich darf nicht so, wie Sie, einfach hervortreten und sagen: hier sind meine Legitimationen, meine Urkunde, und dort der Rechtsanwalt, der alles beglaubigt, sondern ich muß mich erst aufs Spionieren legen, worüber vielleicht lange Zeit vergehen kann.«
»Kennen Sie einen dieser Verwandten?«
»Nur insofern, daß er Verwandter jenes Altascarez ist, dem einst alle Silberminen in Amerika gehörten. Aber die Verwandtschaft soll eine sehr weitläufige sein. Miß Murray ist ein Schwesterenkelkind des alten Altascarez.«
»Und der Verwandte, der Ihnen gegenübertreten kann?«
»Ich kenne ihn noch nicht, weiß nicht einmal seinen Namen.«
»Und wenn er Ihnen gegenüber nun den Sieg zu behaupten scheint?« fragte Spurgeon lauernd.
Kirkholm drehte sich eine neue Zigarette und antwortete:
»Dann gibt es noch Mittel, um diesen Verwandten der Miß Murray aus dem Wege zu räumen.«
Die Lokomotive stieß einen schrillen Pfiff aus. Sie näherte sich der Station von Shreveport.
Spurgeon nahm sein Gepäck in die Hand.
Der Zug brauste mit außerordentlicher Gewalt daher, ein Knirschen, ein Ruck, alles flog an die Wand, und Spurgeon riß die Tür auf.
»Success — guten Erfolg,« klang es noch einmal aus Spurgeons Munde, dann sprang er hinaus.
»Good luck, viel Glück,« rief Kirkholm ihm nach.
Eine halbe Minute verstrich, aber der Zug setzte sich noch nicht in Bewegung. Die wenigen Leute, die ihn benutzen wollten, waren schon längst eingestiegen, die ausgestiegen waren, hatten den Perron schon verlassen, nachdem sie ihr herausgeworfenes Gepäck zusammengesucht, die Schaffner standen bereits auf den Trittbrettern, denn beim Pacificzug gibt es kein Nachspringen, aber der Stationsvorsteher zögerte, das Abfahrtszeichen zu geben.
Neben dem Coupé von Kirkholm klammerte sich ein Schaffner, wie die anderen, an das Messinggeländer und blickte erwartungsvoll nach hinten.
Kirkholm steckte den Kopf zum Fenster hinaus.
»Was ist los?« fragte er. »Es sind nun schon fünf Minuten verstrichen.«
»Ein Herr wird noch erwartet,« entgegnete der Beamte.
»Und darum wartet der Zug?« fragte Kirkholm erstaunt. »Seit wann nimmt die Pacificbahn denn solche Rücksicht?«
Der Beamte antwortete nicht; er lächelte schlau und machte nur mit den Fingern die Zeichen des Geldzählens.
»Ach so.« Kirkholm hatte sofort verstanden. »Das ist aber ein teures Vergnügen. Was kostet denn die Minute, welche der Zug für jemanden auf Bestellung wartet.«
»Zehn Sekunden hundert Dollar, jede Sekunde mehr gilt für voll.«
»Alle Wetter,« lachte Kirkholm, dem es gleichgültig war, ob er früher oder später sein Ziel erreichte. »Das macht ja schon dreitausend Dollar aus.«
»Den, der das Warten des Zuges bestellt hat, geniert das nicht weiter,« sagte der Schaffner geheimnisvoll.
»So, wer ist es denn? Vielleicht ein Aktionär von der Pacific-Eisenbahn?«
»Weit vorbeigeschossen, so einer überlegt es sich reiflich, ehe er für zehn Sekunden hundert Dollar bezahlt, das bringt's ihm denn doch nicht ein. Nein, der Silberkönig soll es sein, habe ich munkeln hören.«
»Alle Wetter!«
In diesem Augenblick kam gemächlichen Ganges ein großer, starkgebauter Herr mit langem, blonden Vollbart auf den Perron, in der einen Hand einen kleinen, eisernen Kasten tragend, und hinter ihm her ein herkulischer, breitschultriger Neger, welcher seines Herrn ziemlich gewichtige Effekten nachschleppte, als hätte er Federkissen auf der Schulter.
»Da hinein, Cäsar,« rief der Herr, auf den Gepäckwagen deutend. Gib gut acht auf den Lederkoffer und setze dich nicht auf den Rohrkorb! Halt, den gelben Koffer nehme ich selbst mit.«
Er nahm dem Schwarzen den Koffer ab und wandte sich dann an den Stationsvorsteher.
»Hat sich jemand beschwert?«
»Durchaus nicht,« versicherte der Beamte mit einer Verbeugung, »die Verspätung wird ja wieder eingeholt.«
»Wieviel Minuten habe ich gebraucht?«
Der Mann zog die Uhr.
»Fünf Minuten vierzig Sekunden.«
»Danke, ich hinterlege die Summe auf meiner Endstation. Nein,« sagte er, als der Vorsteher ihm ein leeres Coupé öffnen wollte, »ich liebe auf der Reise Gesellschaft.
Er stieg in den Wagen, an dessen Fenster soeben noch Kirkholms Kopf zu sehen gewesen war.
»Kapitän Hoffmann,« hatte dieser beim Anblick des Reisenden in unsagbarer Verwirrung gemurmelt, »also hatte Flexan doch recht, obwohl ich ihm nicht glauben wollte. Kapitän Hoffmann ist der Silberkönig. Was will er hier?«
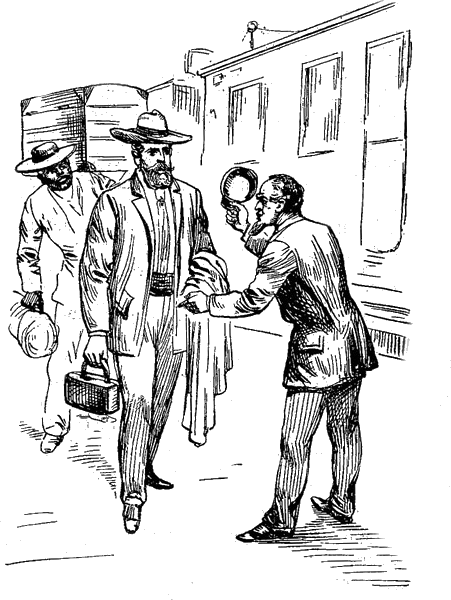
Der Herr stieg zu ihm ein.
»Ready,« riefen die Schaffner und verschwanden in ihren Abteilungen, die Lokomotive pfiff, und im nächsten
Augenblick hatten die Räder schon ihre normale Umdrehungsgeschwindigkeit erreicht, um die Verzögerung wieder einzuholen, und die Aktionäre der Pacificbahn konnten sich in die Summe von dreitausendvierhundert Dollar teilen, welche sie innerhalb fünf Minuten und vierzig Sekunden verdient hatten.
Gegenüber Kapitän Hoffmann — denn dieser war es wirklich — saß Kirkholm, und blitzschnell jagten dem jungen Manne die Gedanken durch den Kopf.
Das also war der Silberkönig, Kapitän Hoffmann, dessen Bild er von Flexan, gezeigt bekommen hatte; aber er hätte ihn schon aus dessen Beschreibung erkannt.
Dies war der hohe, athletische Wuchs, der lange, goldigstrahlende Vollbart und das lockige Haar, die hohe, weiße Stirn, die scharfe, gerade Nase und die strahlenden, tiefblauen Augen, die zierlich geschwungenen Lippen und die kleinen Füße und Hände, die Erbschaft der Mutter; er hätte ihn erkannt, auch wenn dieser Mann oberhalb der rechten Augenbraue nicht die kleine Narbe gehabt hätte, die von einem Streifschuß herstammte.
Also hatte Flexan doch recht gehabt, Kapitän Hoffmann war der Silberkönig, der Nachfolger von Altascarez und der Besitzer jener Silberminen, welche ihm seinen Titel eintrugen.
Was wollte er hier? Nun ja, er machte eine Inspektionsreise nach seinen Gruben.
Sonst nichts Wetter?
Miß Murray war eine entfernte Verwandte von Altascarez, Kapitän Hoffmann ein naher Verwandter, wenn sich beide auch vielleicht nicht kannten. Er, Kirkholm, war aus dem Wege nach Kolorado, wo die Besitzungen des Mädchens lagen.
Und Hoffmann? Konnte er nicht dieser Verwandte sein, dessen Namen er noch nicht erfahren hatte, der die Erbschaft antreten wollte?
Krampfhaft umspannten Kirkholms Finger den Revolver, den beständigen Begleiter der Reisenden in Amerika, den jeder ohne Ausnahme in der Rocktasche trägt.
Der junge Mann hatte seinen furchtbarsten Feind vor sich, der alle seine seit Jahren geschmiedeten und kunstvoll angelegten Pläne zu schunden machen konnte. Es war nicht Zufall gewesen, daß sich nach Abreise der Vestalinnen die acht jungen Männer zusammengefunden hatten, die alle etwas verwandt mit den Damen, aber Wüstlinge im vollsten Sinne des Wortes waren.
In New-York, der Metropole Amerikas trieben sie ihr Wesen oder vielmehr ihr Unwesen, sie kannten sich schon vorher, und nach und nach hatten sie sich, erst durch Blicke, dann mit Worten zu verstehen gegeben, welcher Gedanke sie beherrsche, nämlich: wie schön es wäre, wenn die Mädchen nicht wieder zurückkehrten und sie die Erben würden.
Dann waren sie in die Hände Eduard Flexans geraten, eines Menschen, der von Jugend auf als Verbrecher tätig gewesen, ja, als solcher erzogen worden war.
Er hatte ihnen gesagt, wie es zu machen wäre, um gefahrlos und sicher in den Besitz des Erbes der Mädchen zu kommen. Jahrelang hatten sie daraufhingearbeitet, in Angst und Sorge, und nun sie endlich dem Ziele nahe waren, kam dieser Mann und wollte Kirkholms fein angelegte Pläne zunichte machen.
Oho, er wollte sich seine Beute nicht so ohne weiteres entreißen lassen.
Und dann noch eins!
Vor Kirkholm saß jener Mann, welcher das Geheimnis auf der Brust trug, nach dessen Besitz sich Flexan sehnte. Kirkholm selbst sollte in dem Plane, den Flexan zu dessen Erlangung vorhatte, tätig sein, und glückte dies dem unermüdlichen Flexan, dann hatte er seinem Freunde eine Prämie von zweitausendfünfhundert Dollar versprochen.
Was mochte also erst dieses Geheimnis selbst wert sein! Der Chemiker Kinnaird, ihr verbrecherischer Genosse, sollte es enträtseln, das hatte Kirkholm erfahren.
Seine Finger umspannten noch fester den elfenbeinernen Kolben des Revolvers.
Ein Ruck, ein Druck hätte genügt, und Hoffmann läge ihm als Leiche gegenüber. Kirkholm hätte ihn nicht mehr als gefährlichen Nebenbuhler zu fürchten brauchen und wäre im Besitze des Geheimnisses gewesen.
Aber würde die kleine Revolverkugel dieses Riesen Lebenslicht sofort ausblasen können? Wäre ein solcher Angriff nicht gewesen, als schösse ein Kind mit einem Blasrohr nach einem Löwen?
Kirkholm fürchtete immer, diese blauen, strahlenden Augen, welche jetzt teilnahmsvoll in die schöne Landschaft blickten, könnten sich auf ihn wenden, und sie müßten seine Gedanken auf der Stirn lesen, so sehr schien dieser scharfe Blick Verborgenes erforschen zu können.
Es war ein gewagtes Spiel, diesen Mann mit dem Revolver in der Hand anzugreifen, und hier im Waggon unmöglich.
War Hoffmann denn überhaupt der, welcher sich um die Erbschaft von Miß Murray bemühte? Das war erst noch die Frage.
War dies der Fall, so konnte sich Kirkholm ihm als Begleiter anbieten, er hätte sich als einen Handelsmann ausgegeben, der in Kolorado Geschäfte abzuwickeln habe, und auf dem Wege durch die unwirtlichen Wildnisse dieses Staates gab es hundertfache Gelegenheit, diesen Mann aus dem Leben zu schaffen und sich seines Geheimnisses zu bemächtigen.
Aber Vorsicht, erst ausspionieren, wohin Hoffmann wollte! In Amerika ist es schwer, jemanden über Ziel und Zweck seiner Reise auszufragen, oder nach seiner Beschäftigung, denn selbst unter den ärmlichsten Arbeitern gilt ein solches ›Ausholen‹ für unanständig.
Ein Gespräch zwischen zwei Reisenden im Coupé dreht sich hauptsächlich ums Wetter, um die Gegend, um die Verhältnisse der Bewohner und um alles andere; nur über private Angelegenheiten wird nicht gesprochen; nicht die kleinste Andeutung darüber, weder eine Frage, noch Antwort kommt vor, es sei denn durch Zufall, wenn etwa die Bequemlichkeit in Betracht kommt.
Doch Hoffmann selbst begann das Gespräch, welches Kirkholm ersehnte.
Nach einer Einleitung, das Wetter betreffend, fragte Hoffmann, ob die Betten im Schlafwagen gut seien.
»Nicht besonders,« antwortete Kirkholm, »die Federn sind nicht sehr gut, und man verspürt daher selbst im Schlafe das Rütteln des Wagens. Sie bedürfen der Reparatur.«
»Eine solche Reise von einer Küste zur anderen ist schrecklich; wenn man den Wagen verläßt, ist man wie gerädert.«
Kirkholm stimmte bei.
»Nun, ich habe glücklicherweise nur eine Nacht in dieser unangenehmen Lage zu verbringen; morgen früh acht Uhr habe ich erst mein Ziel erreicht,« sagte Hoffmann lächelnd.
Ha, das war's ja, was Kirkholm hören wollte, auch er mußte um dieselbe Zeit den Zug verlassen, um die Reise hinauf nach dem gebirgigen Kolorado anzutreten.
Hoffmann war also derjenige, welcher ihm die Erbschaft streitig machen wollte; noch einmal drückte Kirkholm die Finger krampfhaft um den Revolver, dann zog er die Hand aus der Tasche und führte die Unterhaltung liebenswürdig fort. Aber dabei schoß blitzähnlich noch einmal sein ganzes Leben an ihm vorüber.
Ein heiteres Knabenalter, bewacht von treuen, ehrlichen und wohlhabenden Eltern, dann deren Tod, schlechte Gesellschaft, Nächte in Saus und Braus, am Spieltisch, mit Balletteusen, eine Zeit, welche den kräftigen Jüngling entnervte, und dann kam der Ruin seines Vermögens, und dann — ja dann kam der Teufel, welcher ihm wieder aufhalf, aber unter Bedingungen — Eduard Flexan.
Das wüste Leben fand seinen Fortgang, Geldmittel waren immer vorhanden, manchmal im Ueberfluß, manchmal mangelhaft, aber immer genügend, um die Nächte durchzubringen und die Tage im weichen Bett zu verschlafen.
Flexan brauchte Kompagnons, welche Handschriften nachahmen konnten, welche in den Gesetzen der Vereinigten Staaten zu Hause waren, welche die Kunst der Bestechung kannten, welche auf die Herzen der Menschen einwirken konnten und so weiter, und Kirkholm war in diesen Künsten bewandert, er schwor zur Fahne Flexans.
Bis jetzt waren seine Hände noch rein von Blut, aber an diesem Manne da vor ihm wollte er zum ersten Male probieren, ob er sich auch zum Mörder eigne.
Eine halbe Stunde später war er mit Kapitän Hoffmann, den er gar nicht zu kennen vorgab, einig, daß er ihn auf seiner Reise durch Kolorado begleite. Zu zweit reist es sich angenehmer, besonders, wenn der Weg nicht recht geheuer ist.
Die Röte der Gesundheit begann Ellens bleiche Wangen wieder zu färben, aber lange hatte es gedauert, ehe ihre starke Natur den Sieg über die Krankheit errungen hatte.
Das Leiden stammte aus dem Herzen; der beständige Kampf des Stolzes mit der Liebe hatte es hervorgerufen, und letztere hatte gesiegt.
Ja, trotzdem Ellen äußerlich gesund war, zermarterte sie sich mit Vorwürfen, welche sie innerlich zu verzehren drohten. Lord Harrlington und Johanna, das waren die Personen, mit denen sie sich beschäftigen mußte und die ihr des Nachts im Traume erschienen, aber niemals zürnend, sondern immer gütig, manchmal traurig, so wie sie dieselben zuletzt im Leben gesehen hatte.
Ach, wäre Ellen doch nie von dieser Kränkelt genesen, wäre eine Höhle der Felseninsel doch ihr Grab geworden, wo sie, durch Steine von ihren Freundinnen getrennt, niemals mehr die mahnende Stimme des Herzens vernommen hätte, die ihr fort und fort vernehmlich zuflüsterte:
»Du hast Lord Harrlington zeitlebens unglücklich gemacht, du hast Johanna, welche Tag und Nacht über dein Leben gewacht hat, um dich dem Geliebten zu erhalten, auf dem endlosen Meere dem Tode ausgesetzt und vielleicht für immer, weil du im frevelndem Uebermut sie einst zu diesem Wagnis herausgefordert, die Begleitung der treuen Engländer beständig abgelehnt und schließlich der warnenden Stimme Johannas kein Gehör geschenkt hast. Dich, dich allein trifft die Schuld, und die Freundinnen denken ebenso, wenn sie es dir gegenüber auch nicht merken lassen, weil sie dein Unglück nicht vergrößern wollen. Durch Anschuldigungen wird ihre Lage nicht gebessert, sie sind zu edel, um es dir fühlbar zu machen.«
Solche Gedanken waren es, welche Ellen fort und fort quälten, und welche sie nicht mehr wagen ließen, offen den Blicken ihrer Freundinnen zu begegnen. Sie vermied dieselben, wo sie nur konnte, war meist allein mit ihren schrecklichen Gedanken und redete sich immer aus, wenn die Damen mit aller Kraft versuchten, sie aufzuheitern und sie ihrem Trübsinn zu entreißen.
Die jungen Mädchen dachten freilich gar nicht daran, Ellen Vorwürfe zu machen, niemals war ihnen Aehnliches eingefallen, aber Ellens Trübsinn malte ihr dies vor.
Sie war eine Kopfhängerin geworden.
Fast den ganzen Tag saß sie in der Höhle und suchte die peinigenden Gedanken dadurch zu verscheuchen, daß sie über die geheimnisvollen Kräfte der Insel nachbrütete, von denen sie gleich am Anfang selbst eine Probe gesehen, das Erlebnis während ihrer Krankheit hatten ihr die Freundinnen erzählt, und in der letzten Zeit war etwas geschehen, was die geheimnisvollen Kräfte in ein noch zauberhafteres Licht setzte.
Ellen hatte ein Geschenk erhalten — wer konnte sagen, von wem — und wenn dieses Geschenk nur hätte sprechen können, dann wäre das Geheimnis der Insel gelüftet gewesen.
Acht Tage nach Ueberstehung der Krisis kam die Kranke erst wieder völlig zur Besinnung, die sie bisher nur von Zeit zu Zeit erlangt hatte. Während dieser Periode gebrauchte die Rekonvaleszentin hauptsächlich leichte, angemessene Nahrung, und wunderbar war es, wie für diese von jenem geheimnisvollen, unsichtbaren Bewohner der Insel gesorgt wurde.
Neben den in einer Höhle aufgespeicherten Vorräten fand man eines Morgens Kisten, welche alles enthielten, was eine Fieberkranke zur Nahrung nötig hatte, und zwischen den Fässern gackerte eine stattliche Anzahl von Hühnern herum, deren Fleisch das beste ist, was ein Kranker genießen kann.
Neues Staunen unter den Vestalinnen, weniger über die Art und Weise, wie dies alles hierhergekommen, daran waren sie schon gewöhnt, als vielmehr über die Vorsorglichkeit, mit der alles ausgewählt worden war. Ein Arzt mußte die Speisen ausgesucht haben.
Aber das Staunen der Damen steigerte sich noch.
Das Mädchen, welches die Kranke zu pflegen hatte, wollte ihr das Frühstück bringen, aber entsetzt fuhr sie zurück, als sie die halbdunkle Höhle betrat.
Da lag auf Ellens Bett, quer über der Brust der Kranken, ein gelbes Tier und starrte die Eintretende mit grünlich funkelnden Augen an.

Ein gelbes Tier starrte die Eintretende mit grünlich funkelnden Augen an.
Es hätte nicht viel gefehlt, so hätte die Krankenpflegerin die Tasse mit Schokolade fallen lassen, denn mit einem Satze war das etwa zwei Fuß hohe, katzenähnliche Tier von dem Bett herunter und sprang außer sich vor Freude, bald an dem Mädchen empor, bald wieder nach der schlafenden Ellen zurück.
»Juno,« schrie da plötzlich das Mädchen, setzte die Tasse auf den Tisch und nahm das Tier Ellens, das sich wahrend der kurzen Fahrt in die Herzen aller einzuschmeicheln gewußt hatte, auf den Schoß.
Die junge Löwin, die erst mit der Milchflasche ausgezogen werden mußte, hatte sich während des Aufenthalts bei den Vestalinnen — drei Wochen — prächtig entwickelt, und, nach einer Trennung von zehn Tagen, konnte man ein deutliches Wachstum bemerken.
Innerhalb zweier Monate hatte sie schon die volle Größe erreicht, sie versprach ein prachtvolles Tier zu weiden.
Bekanntlich sind weibliche Löwen völlig zähmbar, das heißt, ohne jede Gefahr für den Menschen, den sie kennen, bleiben aber immer Raubtiere solchen gegenüber, auf welche sie gehetzt werden. Bei männlichen Löwen kann die angeborene Wildheit dagegen immer wieder hervorbrechen, besonders während der Brunstzeit, und sie werden dann selbst ihrem Herrn gefährlich.
Juno hatte die kleinen Kunststücke noch nicht vergessen, die ihr Ellen beigebracht hatte, sie stellte sich auf Befehl tot und nahm die ihr gereichten Leckerbissen nur auf ein bestimmtes Wort aus der Hand, wie sich das Mädchen und ihre herbeigerufenen Freundinnen auf der Stelle überzeugten.
Wie kam Juno hierher? War sie von allem Anfang hier gewesen und hatte sie sich nur versteckt? Das war nicht möglich, das zarte Tier wäre verhungert, hätte sich überhaupt nicht von den Damen und besonders Ellen, an der es mit großer Zärtlichkeit hing, entfernt halten können.
Ja, wenn das kleine Maul mit den spitzen Zähnchen hätte erzählen können, dann wäre die Neugier der Mädchen wenigstens in etwas befriedigt worden.
Juno hätte gesagt, daß sie von den rohen Piraten über Bord geschleudert wurde, weil sie einem Manne, der sie in den Schwanz kniff, empfindlich in die Finger gebissen hatte, wie sie gleich nach dem Sturz ins Wasser wieder aufgefischt worden war und auf dieser Insel schon mehrere Tage, und zwar recht schöne verlebt hatte.
Sie erkannte Ellen sofort wieder, als sie dieselbe sah, liebkoste sie auf ihre Art, und wunderte sich, daß diese Liebkosungen nicht erwidert wurden. Destomehr aber fand dies jetzt von seiten der übrigen Mädchen statt.
Die junge Löwin trug noch dasselbe goldene Schuppenhalsband, welches Ellen an der Küste sich von einem in dergleichen Arbeiten bewanderten Neger hatte anfertigen und auf dem sie den Namen ›Juno‹ hatte eingravieren lassen. — Der gebissene Pirat hatte nicht gewagt, dem nach seiner Hand schnappenden Tiere diesen Schmuck abzunehmen — aber es wurde darunter kein Zettelchen gefunden, welches Aufklärung in die Sache gebracht hätte, wie man zuerst noch hoffte.
Juno war da, und man empfand wenigstens Trost, daß es sich immer mehr zeigte, daß auf dieser Insel noch jemand lebte, der wohlwollenden Anteil an den Mädchen nahm. Es war allen eine Beruhigung, man fühlte sich nicht verlassen und baute auf dieses Mächtigen Schutz.
Hauptsächlich freute man sich Ellens wegen, wenn diese davon vernahm, denn sie hatte das Tier wirklich geliebt und war trostlos gewesen, als sie bemerkte, daß die Piraten ihren Liebling mitgenommen hatten.
Ellen empfand auch wirklich eine unaussprechliche Freude beim Wiedersehen ihrer Juno, sie lachte seit langer Zeit zum ersten Male wieder, und als ob das Tier Einfluß darauf gehabt hätte, besserte sich ihr Zustand zusehends.
Sie ließ es nicht mehr von sich, es schlief zu ihren Füßen, es nahm mit ihr seine Mahlzeit ein, und die Hauptbeschäftigung Ellens bestand jetzt darin, ihren Liebling abzurichten.
Wie gesagt, sie mied den Umgang mit ihren Freundinnen, denn seit ihr kräftiger Körper die Krankheit besiegt hatte, war eine Umwandlung in ihrem Herzen vor sich gegangen. Sie fühlte sich schuldig, wohin ihre Erinnerung auch schweifte. Sie konnte den Anblick der Mädchen nicht mehr ertragen, weil sie in deren Blicken Vorwürfe zu lesen glaubte.
Stundenlang konnte sie in der Höhle sitzen, mit der Löwin spielen, sie Kunststücke lehren und nebenbei darüber nachdenken, auf welche Weise sie wohl hierhergekommen sei. Nur dadurch gelang es ihr, die Stimme des Gewissens zu betäuben. Wohl gestattete sie, daß ihre speziellen Freundinnen, wie Miß Thomson und Miß Murray, sich mit ihr unterhielten, aber da man es ihr ansah, wie viel lieber sie allein war, so entfernten auch diese sich meist bald wieder.
Was die Mädchen vornahmen, um sich den Aufenthalt in dem Felsengefängnis zu erleichtern, wie sie sich die Zeit vertrieben, das alles ließ Ellen gleichgültig. Sie zeigte nur Teilnahme, wenn ihr berichtet wurde, wie wieder die geheimnisvolle Hand ihnen mit irgend etwas behilflich gewesen war, was ziemlich oft passierte.
Es brauchte nur etwas zu fehlen, und die Mädchen hatten nur nötig, den Wunsch auszusprechen, daß sie es besitzen möchten, so konnten sie darauf rechnen, es am anderen Morgen zu finden. Aber niemand wurde dabei gesehen. Nur einmal behauptete ein Mädchen, eine weibliche Gestalt in einer Höhle gesehen zu haben, ebenso wie das erste Mal Miß Thomson, aber in einer anderen, doch ebensowenig, wie vorher, konnte man eine Spur von ihr finden oder eine Tür in jener Höhle entdecken.
Solchen Berichten lauschte Ellen gern. Sie grübelte darüber nach und sagte gelegentlich zu ihren Freundinnen, sollten sie wirklich einen Besuch bekommen, so dürfe diesem nichts verraten werden, daß außer den Vestalinnen noch ein anderes oder andere Wesen die Insel bewohnten, durch welche sie unterstützt würden. Selbst die Spuren der Geschenke müßten dann schnell beseitigt werden.
Dieser von Anderson angedeutete Besuch war es, der Ellen in nervöser Aufregung hielt. Sie wußte nicht, ob sie ihn ersehnte, oder ob sie sich vor ihm fürchtete, aber sie ahnte, daß er eine Entscheidung bringen mußte, und sie, Ellen, würde diese herbeiführen.
Woche nach Woche verging. Ellens nervöse Spannung steigerte sich, und schon fürchteten ihre Freundinnen einen Rückschlag der Krankheit, als endlich die Prophezeihung des Piraten in Erfüllung ging — der Besuch kam.
Eines Morgens erblickten die Vestalinnen hoch über den Felsspitzen der Insel eine Rauchwolke schweben, erst zusammengeballt, dann aber sich im blauen Aether auflösend, sie veränderte fortwährend ihren Standpunkt, aber immer strömte der zerfließenden Wolke neuer Rauch nach.
Bald waren die Damen zu der Ansicht gekommen, daß dieser von einem Dampfer herrühren müßte, welcher der Insel zustrebte, denn die Wolke ward immer dichter. Ein Mädchen erkletterte die Mauer, sah aber nichts, denn das Schiff näherte sich von der anderen Seite.
Ellen war von der Atmung durchdrungen, daß dieses Schiff den versprochenen Besuch brächte, und bat, nicht mehr nach ihm auszuschauen.
Es dauerte auch nicht lange, so konnten die Damen an der Lücke in der Felswand die beiden Masten eines kleines Dampfers vorbeigleiten sehen, dann hörte man Kommandos erschallen, Ketten rasseln und ein Plätschern im Wasser — der Dampfer ging an der Insel vor Anker, er war ihretwegen hierhergekommen.
Der Tag verging jedoch, ohne daß man ein Lebenszeichen von der Mannschaft erhielt, das Schiff konnte man von der Mauer aus auch nicht sehen, und so blieb nichts anderes übrig, als geduldig zu warten.
Die Mädchen standen zusammen und unterhielten sich. Es war seit einem Monat das erste Mal wieder, daß Ellen sich unter ihnen befand. Was sie in dieser Zeit über das rätselhafte Wesen der Insel und seine Hilfe sich zurecht gelegt hatte, teilte sie jetzt ihren Freundinnen mit und fand deren völlige Beistimmung.
»Derjenige,« sagte sie, »welcher uns auf dieser Insel ausgesetzt, hat selbst keine Ahnung davon, daß die Insel außer uns noch bewohnt war, sonst hätte er es uns jedenfalls mitgeteilt und gesagt, wir sollten uns, im Falle uns etwas fehlte, an diesen Helfer wenden. Im Gegenteil. Anderson sagte, es würde von Zeit zu Zeit ein Schiff kommen, das uns mit allem Nötigen versehen würde, und wenn uns etwas fehlte, so sollten wir es ihm gleich oder bei seiner Rückkehr sagen.«
Die Freundinnen stimmten ihr bei.
»Da sich das geheimnisvolle Wesen, welches jedenfalls im Innern der Insel wohnt, uns nicht selbst zeigt,« fuhr Ellen fort, »so will es jedenfalls auch nicht, daß wir den Piraten davon erzählen oder überhaupt durch irgend etwas andeuten, daß über uns jemand wacht. Haben Sie daher jede Spur vernichtet, welche die fremde Hilfe verraten könnte?«
Die Mädchen versicherten, daß nichts zu finden sei, weder Kiste, noch Faß, noch Huhn, noch sonst etwas, was im Laufe der Zeit zu ihnen gekommen war. Alles war sorgfältig in eine entlegene, schwer zugängliche Höhle versteckt worden.
»Daß meine Annahme richtig ist,« sagte Ellen wieder, »zeigt sich mir noch in einem anderen, ebenfalls ganz sonderbaren Umstand. Ich hatte Juno in eine Kiste gesperrt und diese in dem äußersten Winkel meiner Höhle versteckt. Kurz darauf wollte ich noch einmal nach dem Tier sehen, um es mit Futter zu versehen, aber zu meinem größten Erstaunen fand ich die Kiste leer und Juno spurlos verschwunden. So zeigte mir das geheimnisvolle Wesen also selbst an, daß es nicht verraten sein will.«
Ein Mädchen eilte plötzlich nach jener Höhle, in der alles andere versteckt worden war, und kehrte mit der staunenerregenden Nachricht zurück, daß die Gegenstände ebenfalls spurlos verschwunden wären.
»Es ist ein deutliches Zeichen, wie sehr sich dieses Wesen für uns interessiert,« rief Ellen, zum ersten Male wieder freudig. »Was uns nun auch bevorstehen mag, wir haben einen Helfer zur Seite, von dessen Macht ich überzeugt bin. Wer einen nassen Holzstoß aus der Ferne anzünden kann, der wird wohl auch imstande sein, uns vor unrechtmäßigen Handlungen zu schützen.«
»Und dann,« rief Miß Murray, »sind wir auch nicht die Personen, welche sich ohne weiteres einem Befehle fügen, welcher uns nicht passend erscheint. Haben wir auch keine Waffen, so sind wir doch noch im Besitze unserer Arme und Hände, und in denen sollen selbst die kleinen Messer zu furchtbaren Waffen werden.«
»Trotzdem bitte ich die Damen dringend,« entgegnete Ellen, »sich zu keiner voreiligen Handlung hinreißen zu lassen. Ich bin fest davon überzeugt, daß dieser Besuch mir gilt. Lassen Sie den Betreffenden, der mich vielleicht sprechen will, zu mir und ruhig bei mir bleiben! Ich vertraue auf die Hilfe der unsichtbaren Person, des Schutzgeistes, welcher mir das Leben gerettet hat und mir wohl auch fernerhin zur Seite stehen wird. Und im Falle der höchsten Not, kann ich ja auch auf Sie zählen. Aber tun Sie nichts, was eine Unterredung stören könnte, ich bitte Sie darum.«
Die Damen versprachen dies.
Da tönte in der Felsenbresche ein Schuß, hundertfach brach sich das Echo an den Steinwänden, und die Mädchen sahen durch den Schatten des Abends einen Mann langsam auf sich zukommen.
»Seinem Gange nach ist es Mister Anderson, der angebliche Detektiv,« flüsterte Miß Sargent. »Er kündigt durch den Schuß an, daß er Waffen bei sich führt. Wirklich, das ist sehr vorsichtig von dem Manne.«
»Bleiben Sie hier,« flüsterte Ellen ihren Freundinnen zu, »ich werde ihm etwas entgegengehen, damit er nicht Mißtrauen schöpft und erst lange Unterhandlungen wegen der Sicherheit seiner Person anfängt. Ich werde so laut sprechen, daß Sie alle es verstehen können.«
Sie ging dem Ankommenden entgegen und blieb zehn Schritte vor ihm stehen. Er stand ebenfalls.
»Wer ist es, der diese Insel betritt?« fragte Ellen laut.
Der Mann räusperte sich verlegen, dann erwiderte er ebenso deutlich.
»Sie kennen mich, ich nannte mich Ihnen gegenüber Mister Anderson. Sie sehen, ich komme in friedlicher Absicht, verhalten Sie und Ihre Gefährtinnen sich ebenfalls friedlich, und nichts soll Ihnen geschehen. Im anderen Falle aber werde ich mich verteidigen, und auf meinen Schuß strecken sich Ihnen dort über die Mauer zwanzig Gewehrläufe entgegen.«
»Schon gut,« unterbrach Ellen den Sprecher, »wir werden in Frieden miteinander verhandeln. Sie haben uns ja keine Waffen gelassen. Was führt Sie hierher?«
Anderson war verblüfft und verlor die Fassung. Er hatte sicher geglaubt, die Mädchen entweder im Zustande der tiefsten Niedergeschlagenheit und Zerknirschung anzutreffen oder in einem Grade der Verzweiflung, der sie zu allem fähig machte. Nicht ohne Besorgnis hatte er auf Befehl diesen Gang unternommen; wie leicht konnten die Mädchen sich auf ihn stürzen und durch nichts zu halten sein, denjenigen, der sie in diese trostlose Lage gebracht hatte, mit bloßen Händen zu erwürgen.
Daß aber Ellen ihm entgegnete, als wäre sie Gebieterin dieser Insel, und die übrigen Mädchen sich wie eingeschulte Soldaten verhielten, die nur das Kommando zum Angriff erwarteten, beunruhigte ihn nur noch mehr
Doch er mußte antworten.
»Sie haben also nicht die Absicht, irgend etwas Feindseliges gegen mich und die, welche mir folgen werden, zu unternehmen?«
»Nein, wenn wir nicht gezwungen werden, uns zu verteidigen.«
»Auf Ihr Ehrenwort?«
»Auf mein Ehrenwort.«
Der Unterhändler war zufrieden.
»Als ich Sie vor fünf Wochen auf dieser Insel Ihrem Schicksal überließ, kündigte ich Ihnen an, daß Sie von einem Herrn aufgesucht werden würden.«
»Ich wüßte nicht, daß Sie von einem Herrn gesprochen hätten, Sie sagten nur von einem Besuch.«
»Ich meinte meinen Herrn damit. Dieser ist nun angekommen und wünscht mit Ihnen, Miß Petersen, eine Unterredung. Wollen Sie ihm dieselbe gewähren?«
»Ja.«
»Ohne einen Versuch zu machen, sich seiner zu bemächtigen?«
»Dieser Herr scheint sehr ängstlicher Natur zu sein,« sagte Ellen spöttisch.
»Da irren Sie sich,« entgegnete Tannert oder Mister Anderson, »aber er würde sich natürlich nicht fangen lassen, damit Sie an ihm Ihr Mütchen kühlen könnten, sondern er würde sich wehren, Hilfe würde sofort erscheinen, es würde Gewalt angewendet werden, und das will er vermeiden.«
»Wo soll die Unterredung stattfinden?«
»Auf dieser Insel.«
Ellen atmete erleichtert auf, und unter den lauschenden Mädchen entstand eine Bewegung. Sie hatten schon gefürchtet, Ellen sollte von ihnen entführt werden, was sie allerdings nicht geduldet hätten, ebensowenig, wie Ellen eingewilligt hätte.
»Ich bin bereit, ihn zu empfangen,« sagte Ellen.
»Wo auf dieser Insel wünschen Sie ihn zu sprechen?«
»Auf demselben Platze, wo wir jetzt stehen.«
»Das geht nicht. Die Unterredung soll eine geheime sein, kein fremdes Ohr darf Zeuge derselben sein. Versprechen Sie, daß die anderen Damen dem Gespräch nicht zuhören?«
»Ich verspreche es Ihnen im Namen meiner Freundinnen,« sagte Ellen schnell. »Sehen Sie dort rechts die vierte Höhle? In dieser werde ich den Herrn erwarten, dort soll er mit mir allein sprechen können.«

Tannert freute sich, daß er sich seines Auftrages so schnell erledigen konnte.
»Wer ist der Herr?« fragte Ellen.
»Ich kenne ihn nicht.«
»Wann wird er kommen?«
»Erwarten Sie ihn um 10 Uhr nachts.«
»Gut, ich werde ihn dort empfangen, und sagen Sie ihm, daß seine ihm so überaus wertvolle Person gesichert bleiben soll,« sagte Ellen spöttisch, »denn wir verschmähen es, unsere Hände durch die Berührung jemandes zu besudeln, den wir für ehrlos halten. Wer unschuldige Menschen ohne Grund ihrer Freiheit beraubt, ist in unseren Augen ein Schurke. Sagen Sie ihm das und zugleich, daß er sich nicht zu fürchten braucht, so lange er sich höflich benimmt.«
»Haben Sie sonst noch etwas hinzuzufügen?« fragte Tannert, der nichts sehnlicher wünschte, als die Unterredung mit dem Mädchen abzubrechen, in dessen Nähe es ihm unbehaglich wurde, weil es wie eine Königin auftrat und ihn wie einen Diener behandelte.
»Nein.«
»So gehe ich und werde alles ausrichten, bis auf Ihre letzten Worte; also um 10 Uhr, rechts die vierte Höhle,« sagte Tannert, verbeugte sich höflich und ging dem Eingange der Bresche zu.
»Bestellen Sie Ihrem Herrn getrost auch die letzten Worte,« rief Ellen ihm noch nach.
»Endlich,« sagte Ellen, als sie sich ihren Freundinnen wieder zugesellt hatte, »endlich wird sich alles aufklären, was mich während zweier Jahre unzählige Male bedrückt hat; der Moment ist gekommen, da sich zeigen wird, warum wir stets und ständig, zu Wasser und zu Lande, von bösen Menschen verfolgt worden sind, die uns zu fangen, ja, selbst zu töten suchten.«
Und nun begann Ellen von ihrem Stiefvater zu erzählen. Es war das erste Mal, daß sie sich ihren Freundinnen betreffs dieser Sache aussprach.
Sie schilderte, wie dieser Mann sie haßte, weil er alle seine Bemühungen, in den Besitz ihres Vermögens zu kommen, scheitern sah; sie erzählte, wie er versucht habe, durch eine Heirat mit seinem Neffen sich dasselbe zu sichern, und bezeichnete ihn als denjenigen, welcher sie während der ganzen Reise verfolgen lassen und oft zu töten versucht habe.
Daß darunter die anderen Mädchen gleichfalls leiden mußten, wäre ihr erst später zum Bewußtsein gekommen, jetzt aber müsse sie sich schwere Vorwürfe deswegen machen. Ellen zweifelte nicht, daß der alte Flexan, ihr Stiefvater, sie fangen und hier aussetzen ließ, um eine Unterschrift von ihr zu erlangen, und sie zweifelte auch nicht, daß er selbst mit ihr sprechen würde.
Die Freundinnen wiesen energisch die Behauptung zurück, daß Ellen allein an ihrem Unglück Schuld trüge, sie waren vielmehr nach und nach zu der Ansicht gekommen, daß es auf sie alle abgesehen wäre.
»Wie dem auch sei,« sagte Miß Murray, »gewähren Sie dem Mister Flexan die Unterredung und hören Sie ihn ruhig an. Natürlich müssen wir von Ihnen verlangen, Miß Petersen, daß Sie in keine Bedingung willigen, welche Ihrer Ehre zuwiderliefe, nur darum, um unser Schicksal zu mildern. Ebensowenig, wie ich etwas derartiges tun würde, verlange ich es von jemandem anders, und am allerwenigsten von einer Freundin, denn was dieser geschieht, geschieht auch nur.«
»So gehen Sie in Ihre Zelte oder in Ihre Höhlen,« entgegnete Ellen, ohne auf die Ermahnung der Miß Murray zu achten, »die Zeit bis 10 Uhr ist kurz. »Ich bitte sie nochmals, uns allein zu lassen, ich teile Ihnen das Gespräch später mit. Einmal traue ich auf den Schutzgeist der Insel, ich bin fest überzeugt, daß er mir auch diesmal hilfsbereit zur Seite stehen wird, und brauche ich dennoch Hilfe, um mich eines Angriffes zu erwehren, so wird mein Ruf Sie immer noch rechtzeitig erreichen.«
Die Damen versprachen was von ihnen verlangt wurde, und begaben sich in ihre Zelte oder Höhlen, gespannt die Zeit erwartend da der Unbekannte, wahrscheinlich also Ellens Stiefvater, die Insel betreten würde.
Ellen schritt ungeduldig, fieberhaft erregt, in ihrer Höhle, die sie allein bewohnte, auf und ab. Sie glaubte, das Herz müsse ihr zerspringen, so pochte und hämmerte es gegen das enge Kleid.
Was mochte ihr die nächste Stunde bringen?
Ellen war fest entschlossen, nicht nachzugeben und lieber den Tod zu ertragen, als in Bedingungen zu willigen, wodurch sie diesen Mann, den sie immer mehr zu hassen begann, an das Ziel seiner ehrgeizigen Pläne brächte.
Aber was würde dann aus ihren Freundinnen? Sollten diese ihretwegen zur ewigen Gefangenschaft auf dieser Insel, ja, vielleicht dem Tode geweiht sein?
Nein, das ging auch nicht! Heiliger Gott, gab es denn nur gar keinen Ausweg?
Da wurde die Portiere zurückgeschlagen, und eine hohe Gestalt trat herein, in einen dunklen Mantel gekleidet, der selbst das Gesicht verhüllte.
Er schritt auf Ellen zu — der den Erdboden bedeckende Teppich dämpfte seinen Schritt — und blieb vor dem Mädchen stehen.
Es mußte der Stiefvater sein, dies war seine Gestalt.
Langsam entfernt der Mann die Umhüllung vom Gesicht, und mit einem Schrei taumelte Ellen zurück.
Das schwache Licht der Lampe beleuchtete nicht ein altes, sondern ein junges, leidenschaftlich erregtes Gesicht; die Augen hingen begehrend auf ihren Zügen. Auch ihn haßte sie, sie hatte es ihm oft gesagt, sie verabscheute seine Liebe, seine Person, und doch kam er aus keinem anderen Grunde, als um abermals ihre Liebe zu begehren. Es war Eduard Flexan.
»Mister Flexan,« hauchte Ellen mit bebenden Lippen, »träume ich oder wache ich?«
»Ich bin's, Eduard Flexan,« entgegnete der Mann ruhig, »derjenige, der Ihnen schon einmal seine Liebe gestanden hat, die Sie aber abgewiesen haben, der nur immer an Sie gedacht hat, und der jetzt noch einmal vor Ihnen steht, Sie um Erhörung anflehend.«
Ellen war einen Schritt zurückgetreten und hatte die Hände abwehrend vorgestreckt. Sie wollte nicht noch einmal in dieses vor Leidenschaft glühende Gesicht sehen; sie wandte sich halb ab.
»Gehen Sie weg von hier!« sagte sie mit dumpfer Stimme. »Diese Insel hat nicht Platz für uns beide. Jetzt erkennen meine Augen mit einem Male mit furchtbarer Klarheit, wem wir all unser Unglück, das, welches früher schon öfters über uns hereinbrach, und dieses neue zu verdanken haben. Sie, Elender, sind es gewesen, der uns unermüdlich hat verfolgen lassen, gedungene Straßen- und Seeräuber auf unsere Spur gelenkt und uns endlich auf dieser Insel ausgesetzt hat.«
Doch plötzlich fühlte Ellen, wie ihre Kniee umschlungen wurden; Flexan lag ihr zu Füßen. Vergebens versuchte sie sich ihm zu entwinden, es gelang ihr nicht.
Willenlos mußte sie dulden, daß Flexan sie immer fester umschlang und ihr heiße Worte zuflüsterte.
»Ellen, habe Erbarmen! Was habe ich dir getan, daß du mich von dir stößest? Bin ich dir jemals anders als höflich oder liebevoll entgegengetreten? Du aber nahmst meine Liebe stets für Zudringlichkeit, du wiesest mich kalt ab, doch ich ließ mich nicht abschrecken, ich folgte dir immer, ich zürnte dir auch nicht, als du mich damals auf der Plantage mit Spott und Schmach überhäuftest, als du mich in den Sumpf locktest. Meine Liebe zu dir blieb immer dieselbe. Ich sah, du verachtetest mich, aber trotzdem mußte ich dich lieben. Ich folgte dir auf deiner Reise, ich erspähte jede Gelegenheit, dich in meinen Besitz zu bekommen — warum sollte ich es jetzt verleugnen — aber es gelang mir nicht — bis jetzt! Endlich, Ellen, endlich habe ich dich. Himmel und Hölle, — jetzt endlich mußt du mir gehören; du mußt mir sagen, daß du mich liebst, nur ein einziges Mal, oder —«
Flexan hielt inne; Ellen gab plötzlich ihre Anstrengungen, sich zu befreien, auf, sie beugte ihr purpurrotes Gesicht zu dem Knieenden herab und fragte leise:
»Oder was?«
»Oder du wirst deine Liebe niemals einem anderen schenken können.«
»Ist das alles?« lachte Ellen bitter. »Ich sehne mich gar nicht so nach der Liebe eines Mannes.«
»Du forderst meinen Haß heraus,« fuhr der nach Atem ringende Flexan fort.
»Ich habe ihn nicht zu fürchten.«
»Ellen,« flehte Flexan, »sprich nicht so! Ich vergehe vor Liebe, und du sprichst von Haß. Meine Liebe zu dir ist stark, sie überwindet alles, aber fürchte meinen Haß, er könnte noch gewaltiger sein! Alles, was du mir bis jetzt getan, deine Verachtung, dein Hohn konnten ihn nicht erwecken, noch liebe ich dich. O, Ellen, spiele nicht mehr mit meiner Liebe!«
Er umklammerte Ellens Kniee noch fester, da aber gelang es dem Mädchen, sich durch eine verzweifelte Anstrengung zu befreien.
»Ich sehne mich nach Ihrem Hasse mehr, denn nach Ihrer Liebe, und da bisher nichts vermochte, Sie davon abzubringen, so wird vielleicht dies es bewirken, Elender.«
Ehe Flexan ahnte, was Ellen vorhatte, fühlte er einen Schlag auf seiner Wange brennen, und derselbe war so kräftig gewesen, daß der auf den Knieen Liegende, hintenüberfiel.
Ein Wutschrei gellte durch die Höhle.
Einen Augenblick blieb Flexan am Boden liegen, als hätte ihn der Schlag getötet, dann aber sprang er zähneknirschend auf. Schaum stand ihm vor den Lippen.
»Weib,« schrie er, »das sollst du mir büßen!«
Ellen stand im Hintergrunde der Höhle, das Gesicht bleich und die Augen fest auf den Wütenden gerichtet. Sie brauchte sich nicht zu fürchten, sie verstand es, auch waffenlos einem Bewaffneten zu begegnen und ihm den Dolch aus der Hand zu ringen.
Flexan trat auf sie zu, er hatte sich wieder etwas beruhigt, sein Gesichtsausdruck war höhnisch aber furchtbar, als er sagte:
»So, du glaubtest, dadurch würdest du mich los? Hahaha, törichtes Weib, ich habe die Macht, dich zur Liebe zu zwingen, wenn du sie mir nicht freiwillig gibst, und ich werde von dieser Macht Gebrauch machen.«
»Ich verabscheue Sie,« sagte Ellen verächtlich.
»Immerzu, je mehr du dich sträubst, desto besser wird der Sieg mir schmecken. Die Liebe wird besser, wenn man sie erzwingt.«
»Versuchen Sie es nicht, es wäre Ihr Tod.«
»Und du?« lachte Flexan. »Wisse denn, daß du, wenn du dich weigerst, mir gehorsam zu sein, dem Tode verfallen bist!«
»Ich ziehe denselben Ihrer Liebe vor.«
Flexan geriet durch diesen Widerstand außer sich. Er wollte sich auf das Mädchen stürzen, aber er sah in die fest auf ihn gerichteten Augen und in die energischen Züge und besann sich im letzten Augenblicke eines anderen. Dieses Mädchen zu zwingen, war doch nicht so leicht.
»Ellen,« sagte er nochmals in flehendem Tone, »nimm Vernunft an, ich bitte dich! Auch diese neue Schmach, die du mir zugefügt hast, will ich dir verzeihen. Du und deine Freundinnen, ihr seid in meiner Gewalt, es bedarf nur eines Wortes von mir, so fliegt die Insel mit allem, was darauf ist, in die Luft; Vorbereitungen dazu sind getroffen. Ich verlange ja nichts Ungebührliches von dir; sei mein Weib, folge mir nach, ich selbst bin vermögend, ich brauche deinen Reichtum nicht. Oder gehe mit mir in deine Heimat, ich will nichts haben, nichts annehmen, was dir gehört, ich will dich nur als mein Weib haben!«
»Aber ich will Ihr Weib nicht sein!« entgegnete Ellen fest.
»Und ich halte mein Wort; folgst du mir nicht, so bist du mit deinen Freundinnen verloren; niemals werdet ihr in eure Heimat zurückkehren; kein Mensch wird jemals erfahren, wo ihr geblieben seid. Schon jetzt geltet ihr als verschollen; man glaubt, die ›Vesta‹ sei untergegangen und ihr mit.«
»Wir haben Freunde, welche nicht eher ruhen werden, als bis sie uns gefunden haben.«
»Denkst du an Lord Harrlington und seine Freunde? Da irrst du. Sie haben euch längst schon als Tote beweint. Sie sind nach Südamerika gegangen, um auf dem Landwege nach eurer Heimat zu kommen und das Unglück selbst zu verkünden, sind aber samt und sonders in einem Indianeraufstand zugrunde gegangen.«
»Sie lügen, wie Sie immer gelogen haben,« fuhr Ellen hastig auf.
»Ich lüge nicht, es ist so,« behauptete Flexan.
Ellen glaubte ihm aber doch nicht.
»Kommst du als mein Weib mit mir,« fuhr Flexan fort, »so bist du frei und mit dir alle deine Freundinnen. Noch diese Nacht, jetzt gleich werden sie auf das Schiff gebracht, welches euer harrt, und wir fahren dorthin, wo die ›Vesta‹ liegt. Sie können dann gehen wohin sie wollen, du aber bleibst bei mir und folgst mir.«
»Trauen Sie mir auch, wenn ich Ihnen verspreche Ihnen anzugehören?«
»Ich traue dir, denn eine Rückkehr wäre nicht mehr möglich. Noch ehe ihr diese Insel verlaßt, würde ich von dir mehr als ein Versprechen fordern.«
»Ich verstehe, ich verstehe,« unterbrach ihn Ellen, wieder purpurrot werdend, mit unheimlich glühenden Augen. »Für was halten Sie mich? Glauben Sie, mein Leben sei mir lieber als meine Ehre? Von Ihnen ist so etwas zu erwarten, aber nimmermehr von Ellen Petersen.«
»Oho, es wird dir noch klar werden, daß meine Liebe angenehmer ist, als der Tod,« entgegnete Flexan, »du bist in meiner Macht, vergiß das nicht! Dein Leben gehört nicht mehr dir, sondern mir, ebenso wie das deiner Freundinnen.«
Der Mann gewann immer mehr seine Fassung wieder, seine Worte, wie seine Züge wurden immer teuflischer.
»Nochmals, ich ziehe den Tod vor!«
»So würdest du es ertragen können, zu sehen, wie deine Freundinnen hier auf dieser Insel langsam den Hungertod sterben? Erschrick nur nicht, ich spreche nicht von dir, sondern von deinen Freundinnen, die du doch zu lieben vorgibst. Wie wäre dir denn zu Mute, wenn du selbst im Ueberflusse in einem Käfig säßest und zusehen müßtest, wie deine Gefährtinnen langsam verhungern, wie sie nach deinem Ueberfluß schmachten und du doch unfähig bist, ihnen etwas zu geben, und wenn dann der Hunger über die Menschlichkeit siegt, wenn sie sich gegenseitig mit lüsternen Blicken betrachten, wenn sie übereinander herfallen und die aufessen, die sie früher Freundin genannt? Nun, Ellen, würdest du auch dann nicht bereuen, meine Liebe mit schnöden Worten abgewiesen zu haben?«
Ellen war starr. Sie fühlte, wie sich ihr Haar sträubte, als dieser Mensch ihr solche Bilder vor das Auge führte.
»Sie Teufel in Menschengestalt,« sagte sie endlich leise, »solcher Handlungen wären Sie fähig?«
»Warum nicht?« versetzte Flexan kalt, die Arme übereinander kreuzend. »Um dich zu erlangen, scheue ich kein Mittel. Mein bist du doch, dagegen hilft kein Widerstreben, nur durch Selbstmord könntest du mir entgehen. Aber wisse, legst du Hand an dich selbst, so müssen deine Freundinnen für dich büßen. Einzeln, langsam lasse ich sie zu Tode martern, damit sie dir und deiner Hartnäckigkeit noch mit dem letzten Atemzuge fluchen. Weigerst du dich, mir als Weib zu folgen, muß ich Gewalt anwenden, um das zu erlangen, was ich besitzen will, so ist der Tod ebenfalls ihr Los, ich kenne kein Erbarmen mehr. Bist du aber mein Weib, dann, Ellen, dann bist du frei. Du kehrst mit mir in deine Heimat, nach Louisiana zurück, und auch deine Freundinnen sind frei, es steht ihnen nichts im Wege. Jetzt wähle, Ellen! Entweder du liebst mich, und ihr seid frei, oder ich zwinge dich, und euer Tod ist unvermeidlich. Bedenke, außer deinem Leben liegt noch das von einundzwanzig jungen Mädchen in deiner Hand, sie hoffen, daß du mir willfahrest. Bin ich ein so häßlicher Mann, daß du mich nicht leiden magst, glaubst du nicht —«
»Genug,« unterbrach ihn Ellen, »malen Sie mir das Leben an Ihrer Seite nicht weiter aus!«
Flexan wartete eine Antwort ab, während Ellen wie geistesabwesend vor sich hinstarrte und unverständliche Worte murmelte. Sie mußte zusammenbrechen, so griff dieser Kampf der Ehre mit der Liebe zu ihren Freundinnen sie an, aber die Kraft der Verzweiflung hielt sie aufrecht.
»Entscheide dich,« begann Flexan wieder, die Uhr ziehend, »sei mein Weib, oder zwinge mich zur Gewalt, welche den Tod deiner Freundinnen nach sich zieht.«
»Nie kannst du mich zwingen, Scheusal!« stieß Ellen hervor.
»So gehst du mit deinen Gefährtinnen unter; aber erst sollst du an ihnen die Folgen deiner Torheit sehen. Du wirst sie sterben sehen.
»Gut denn,« fuhr er nach einer Pause fort, als Ellen nicht antwortete, »ich gehe. Meine Leute werden dich auf das Schiff schleppen und sich deiner Freundinnen bemächtigen.«
Er wandte sich zum Gehen, doch Ellen stürzte auf ihn zu, wurde aber von den kräftigen Händen des jungen Mannes an den Gelenken gepackt und zu Boden gedrückt.
»Laß mich,« schrie Ellen. »Ja, meinetwegen sei es, ich will dein Weib sein, aber befreie meine Freundinnen jetzt gleich, und laß sie mir nie, nie wieder vor die Augen kommen. Nimm mich hin, aber bringe erst die Mädchen von der Insel.«
»Ellen!« jauchzte Flexan und stürzte auf das bleiche, mit geschlossenen Augen an der Wand lehnende Mädchen zu, um es zu umarmen.
»So wahre ich Lord Harrlingtons Rechte,« ließ sich da eine Summe vernehmen, und der Rasende erhielt einen Stoß gegen die Brust, der ihn zu Boden warf.
Neben Ellen stand eine andere weibliche Gestalt, den Arm weit ausgestreckt. In der Hand blitzte ein Revolver, während die zürnenden Augen den bestürzt am Boden Liegenden anfunkelten.
»Johanna!« schrie Ellen auf: sie hatte die Retterin sofort erkannt, und mit einem Male verstand sie das Rätsel dieser Insel.

»Johanna!« schrie Ellen auf; sie hatte die Retterin sofort erkannt
»Nein, Elender,« fuhr sie dann fort, sich eines anderen besinnend, »freue dich noch nicht! Hinaus mit dir! Scheusal, tue, was du willst, aber erwarte nie, daß ich dir angehören soll. Hinaus, hinaus,« schrie sie, außer sich vor Zorn, und trat den noch immer Daliegenden mit dem Fuße, »oder ich jage dich samt deiner Sippschaft mit Steinwürfen davon!«
Flexan meinte nicht anders, als diese plötzlich auftauchende Gestalt sei eine Vestalin, die sich versteckt gehalten habe, und der es gelungen sei, bei der Untersuchung einen Revolver zu verbergen.
Er sah die Gefährlichkeit seiner Lage ein; diese Mädchen verstanden keinen Spaß. Mit einem Satze war er hinter der Portiere verschwunden, draußen ertönte ein gellender Pfiff, die Piraten stürzten aus der Bresche hervor, ein allgemeiner Tumult entstand, den sich die Vestalinnen, welche in einer Höhle versammelt waren, nicht zu erklären vermochten.
Dann sahen sie Ellen über das Plateau eilen, welches von Männern wimmelte, sie eilten in die Zelte, schlugen Ellen zu Boden, und ehe die Freundinnen, welche vollkommen fassungslos waren, Ellen zu Hilfe eilen konnten, stürzten die Piraten wieder zurück, der Bresche zu, die dreizehn Sklavinnen auf den Armen tragend. Im Vorbeilaufen sah man noch, wie sie blitzschnell die Wasserfässer mit Steinen zerschmetterten, so daß sich das Wasser über das Plateau ergoß. Dann waren sie in der Bresche verschwunden.
Noch einmal ertönte ein höhnisches Lachen.
»Ich komme wieder, wenn du anders gesonnen bist,« erschallte eine Stimme, es war die Flexans. »Hunger und Durst werden euch schon demütiger stimmen.«
Ellen war nicht bewußtlos geworden von dem Schlage, den sie von einem Manne mit einem harten Gegenstande erhalten.
Sie teilte den Freundinnen mit, was vorgefallen war; sie verschwieg nichts, und die Mädchen stimmten ihr vollkommen bei. Sie wären empört gewesen, wenn Ellen nachgegeben hätte.
Man eilte in die Höhle, wo Johanna aufgetaucht war, aber ebenso plötzlich, wie Johanna erschienen, war sie auch wieder verschwunden. Kein Suchen half; man wußte jetzt nur, daß Johanna jene Person war, welche den Vestalinnen bisher geholfen hatte.
Aber auf welche Weise sie hierhergekommen, wo sie sich verbarg, woher sie die Gegenstände, mit denen sie die Vestalinnen beschenkt hatte, genommen, das blieb allen ein ungelöstes Rätsel.
Man besichtigte den Schaden, den die Piraten angerichtet hatten, und fand, daß die Wasserfässer bis auf ein einziges alle zertrümmert waren. Den festen Nahrungsmitteln hatten sie bei der Schnelligkeit, mit der alles vor sich gegangen, natürlich nichts anhaben können. Aber von diesen waren nur noch wenig vorhanden. Sie hielten höchstens für eine Woche vor, etwa so lange, wie das noch vorhandene Wasser reichte. Aber was schadete das?
Jetzt war es ja klar, daß man Hilfe zu erwarten hatte — nicht von den Piraten oder Flexan, denn diese würden nicht eher wieder zurückkehren, als bis er die Mädchen halb verschmachtet glaubte, um dann seine Forderungen noch einmal zu wiederholen, aber man hoffte auf Hilfe von Johanna, jenem Schutzgeiste, der Undank mit guten Werken vergalt.
Warum hatten die Piraten die befreiten Mädchen mit sich genommen, was wollten sie mit ihnen beginnen?
Man wußte es nicht; jedenfalls sollten sie verkauft werden, wie es erst beschlossen worden. Die Sklaverei wartete ihrer, oder die Piraten behielten sie für sich.
Als Ellen sah, wie leicht ihre Freundinnen die Sache nahmen, wie sie sich freuten, daß Ellen diesem Manne nicht zum Opfer gefallen war, und überhaupt gar nicht mehr an ihr eigenes Schicksal dachten, zog wieder Freudigkeit in ihr Herz ein.
Sie begann zu hoffen, daß alles doch noch ein gutes Ende nähme. Johanne war bei ihnen wahrscheinlich mit anderen im Bunde, die über sie wachten. Die Zukunft würde das Rätsel lösen.
Lord Harrlington lebte, daran zweifelte Ellen nicht, und war sie erst von dieser Insel fort und stand Lord Harrlington gegenüber, dann wollte sie das Unrecht wieder gutmachen, welches sie ihm zugefügt hatte.
»Wir müssen uns einschränken,« sagte sie dann, an die Zukunft denkend, »denn wir dürfen nicht auf unsere Schutzgeister rechnen, wenn wir auch bestimmt hoffen, daß sie uns nicht verlassen. Das Wasser reicht noch für acht Tage, desgleichen die Nahrungsmittel. Die Räuber waren so unhöflich, uns nicht nur keine neuen Vorräte mitzubringen, sondern auch noch die uns gebliebenen zu zerstören. Sie sollen der Strafe nicht entgehen.«
Mit seltsamen Empfindungen legten sich die Mädchen schlafen.
Sie waren noch mehr denn je geneigt, zu glauben, daß ein Gott auf dieser Insel wohne. Es hätte nicht viel gefehlt, so würden sie Dankgebete und Bitten um fernere Unterstützung zu ihm emporgesandt haben.
Am meisten ward Ellen von dieser Empfindung beherrscht.
Dazu kam noch, daß sie, als sie ihr Lager aufsuchte, auf demselben Juno schon vorfand, die ihre Herrin schnurrend empfing.
Die ganze Nacht träumte Ellen, sie ränge mit Flexan, aber immer, wenn sie zu unterliegen drohte, berührte Johanna sie mit einem Oelzweige, und eine wunderbare Stärke erfüllte dann jedesmal ihre Glieder.
Einen besseren Namen als ›Swift‹ — hurtig, geschwind — konnte die Kreuzerfregatte nicht führen, welche mit vollen Segeln gegen den Wind aufluvte. Trotzdem dieser fast von vorn kam, von Norden, fuhr das wie ein Vollschiff getakelte Fahrzeug ihm doch schnell genug entgegen, und jedesmal, wenn die Raaen gewendet wurden, was alle Stunden geschah, flogen diese mit einer wunderbaren Schnelligkeit herum; das Schiff legte sich auf die andere Seite, und wieder ging es mit zwölf Knoten Fahrt dem Norden im Zickzack entgegen.
Wie der Name ›Kreuzerfregatte‹ schon sagt, war es ein Kriegsschiff; man hätte dies schon an der Bauart, an den durch die Bordwand lugenden Kanonenmündungen erkannt, auch wenn nicht am Großmast der lange Kriegswimpel geweht hätte, das Zeichen, daß die Kanonen ge, laden waren, daß sich das Schiff in Kampfbereitschaft befand.
Als Kreuzerfregatte führte der ›Swift‹ natürlich eine Maschine, aber sie wurde trotz des ungünstigen Windes nicht benutzt, denn Kapitän und Mannschaft verstanden es, ihr Schiff auch gegen den Wind schnell segeln zu lassen; es mußte ihrem Willen gehorchen; sie waren Meister in der Kunst des Segelmanövers.
Der Matrose auf dem Ausguck meldete ein Segel, das vom Norden her der Fregatte entgegenkam.
»Eine Bark,« sagte der aus der Kommandobrücke stehende Kapitän, der das Schiff durch das Fernrohr gemustert hatte, zu den beiden wachestehenden Offizieren.
»Sie ändert ihren Kurs, als fürchte sie ein Zusammentreffen mit uns,« rief sofort einer der letzteren.
»Kurs Nordost zu Ost,« rief der Kapitän den steuernden Matrosen zu und wandte sich dann wieder an seine Offiziere.
»Sie weicht uns sichtlich aus, was mag sie dazu veranlassen? Sollten wir abermals einen Fang machen?«
Die Fregatte war von der nordamerikanischen Regierung ausgeschickt worden, den Sklavenhändlern das. Handwerk zu legen, weil zwischen Afrika und Brasilien wieder einmal ein lebhafter Handel mit schwarzer Ware entstanden war.
Der ›Swift‹ kreuzte als sogenannter Sklavenjäger an der brasilianischen Küste.
»Die Bark sieht nicht verdächtig aus, sie ist zu sauber.«
»Der Schein trügt oft,« erwiderte der Kapitän, »jedenfalls scheint es ein schnellsegelndes Schiff zu sein.«
Das stimmte allerdings, denn die Bark flog wie ein Pfeil vor dem Winde dahin, den sie seit der neuen Wendung etwas von links bekam. Da aber auch der ›Swift‹ seinen Kurs geändert hatte, mußte er der Bark den Weg abschneiden.
»So treffen wir gerade mit ihr zusammen,« sagte der Kapitän. »Bin begierig, was für ein Schiff es ist, segelt prachtvoll. Alle Wetter!« rief er plötzlich aus.
Nur noch einige hundert Meter waren sie von der Bark entfernt; schon konnten sie deutlich die Matrosen auf Deck arbeiten und den Kapitän und noch einen anderen Mann auf der Kommandobrücke sehen, als plötzlich gleichzeitig alle Raaen auf der Bark herumschwenkten. Die Matrosen warfen das Besansegel am hintersten Maste nach Steuerbord, und sofort fiel das Schiff nach der anderen Seite ab und schoß, ehe der amerikanische Kapitän noch ein Kommando geben konnte, in einer Entfernung von hundert Metern am ›Swift‹ vorüber:
»Er will uns entschlüpfen,« rief der Amerikaner »Hißt die Flagge — wir wollen seinen Namen haben!«
Das Sternenbanner der Vereinigten Staaten stieg an dem Flaggenstock empor, aber die Bark gab keine Antwort, sie zeigte weder ihre Nationalität, noch ihren Namen an. Mit unveränderter Schnelligkeit schoß sie dahin und hatte bald den ›Swift‹ weit hinter sich gelassen.
Das merkwürdigste aber war, daß das Heck der Bark mit einem großen Segel verdeckt war, durch das der Name des Schiffes verhüllt wurde.
Doch im nächsten Augenblick donnerte ein Kanonenschuß vom ›Swift‹ hinüber, welcher dem ungehorsamen Kapitän sagen sollte: ›Halt, oder wir bringen dein Schiff mit Gewalt zum Stillstand!‹
»So etwas ist mir doch noch nicht vorgekommen,« rief der Amerikaner. »Es ist das erstemal, daß mir ein Schiff Trotz zu bieten wagt. Hollah, Jungens, jetzt bietet eure ganze Kraft auf, es gilt eine Wettfahrt! Wir entern die Bark.«
»Hip, hip, Hurra.« jauchzte es aus dreihundert Kehlen auf.
Das war so etwas für die amerikanischen Blaujacken, eine Wettfahrt, ohne die Maschine zu gebrauchen, nur mit den Segeln die Schnelligkeit ihres Schiffes zu zeigen.
Wie die Eichhörnchen jagten sie die Wanten hinauf, enterten auf die Raaen, spannten die Segel straffer und ließen sich nicht in ihrer Arbeit stören, wenn sie auch wie Bälle in der Luft herumgeschleudert wurden.
Der ›Swift‹ flog herum; es wurden noch mehr Segel gesetzt, und wie ein Pfeil schoß die Fregatte der Bark nach, um ihr zu zeigen, daß ein Handelsschiff es nicht mit einem schnellsegelnden Kriegsschiffe aufnehmen könnte.
Aber schon nach den ersten fünf Minuten zeigte sich, daß die Bark ein vorzüglicher Segler war und unter der Führung seines Kapitäns wohl mit der Fregatte an Schnelligkeit wetteifern konnte.
»Fünf Minuten warte ich noch,« sagte der Amerikaner, die Uhr in der Hand. »Zeigt sich dann, daß wir noch nicht naher kommen, so lasse ich Dampf aufnehmen.«
»Schicken Sie ihm eine Kugel in den Bauch, das wird ihn mürbe machen,« schlug ein Offizier vor.
Der Kapitän schüttelte den Kopf.
»Ich habe noch niemals zu einem solchen Mittel gegriffen und werde es auch jetzt nicht tun,« erwiderte er. »Es ist mir immer, als wäre jedes Schiff ein lebendes Wesen, welches gleich uns Schmerz empfindet. Was kann das Schiff dafür, wenn es mit verbotener Fracht beladen wird? Es müßte ebenso unschuldig leiden, wie das Pferd, welches erschossen werden sollte, weil es von einem Räuber genommen worden war. Aber fangen wollen wir es und den Kapitän und die Mannschaft für ihren Ungehorsam büßen lassen.«
»Die Bark manövriert wieder,« unterbrach ihn ein Offizier plötzlich.
Matrosen waren aufgeentert und beschäftigten sich mit den Segeln. Schon wollte der Fregattenkapitän den Befehl geben, die Kessel heizen zu lassen, als auf der Bark plötzlich einige Segel eingezogen wurden, wodurch ihr Lauf bedeutend verringert wurde.
Schnell näherte sich ihr die Fregatte.
»Klar zum Entern!« kommandierte der Kapitän.
In einigen Minuten mußte sein Schiff an Steuerbord der Bark liegen.
Da aber, fast hatte man die Bark schon erreicht, die Yankee-Matrosen legten schon die Enterhaken bereit, schwenkte das verfolgte Schiff plötzlich nach Osten herum, die Segel rollten herunter, und schnell wie der Wind fuhr es in der neuen Richtung davon, während der ›Swift‹ über sein Ziel hinausschoß und einige vorzeitig geworfene Haken sogar ins Wasser klatschten.
»Damn it,« schrie der Kapitän, war aber doch erstaunt über die Geschicklichkeit, mit welcher der fremde Schiffer sein Fahrzeug lenkte.
Das Manöver grenzte fast an Zauberei.
Die Offiziere und die Matrosen fluchten laut; die Mannschaft auf der Bark dagegen schwenkte die Mützen, und man konnte noch ihr fröhliches Lachen hören.
»Sie halten uns zum Narren. Ein Sklavenhändler ist er nicht; er spielt nur mit uns. Aber jetzt wollen wir einmal Ernst machen. Dampf auf!«
Dem Schlot der Korvette entstieg eine wirbelnde Rauchwolke; bald durchzitterte die tätige Maschine den Schiffsrumpf des ›Swift‹. Jetzt gab es kein Entkommen mehr, die Bark mußte eingeholt werden.
Aber dennoch war es nicht so leicht, sie zu nehmen. Bald sprang sie mit dem Winde von hinten wie ein Känguruh übers Wasser, und hatte die Fregatte sie schon erreicht, so entschlüpfte sie schnell zur Seite, aber endlich war ihr der Wind abgeschnitten worden, sie konnte nicht mehr am ›Swift‹ vorbei, nicht mehr gegen den Wind ansegeln und mußte in kürzerer oder längerer Zeit doch an den Enterhaken liegen.
Der Kapitän der unbekannten Bark sah dies ein, doch wollte er sich nicht fangen lassen, sondern tat so, als ergäbe er sich seinem Schicksal. Auf sein Kommando rollten die Segel auf, die Barke legte bei, und einige Minuten später befand sich der ›Swift‹ dicht an ihrer Seite.
Mit dem gezogenen Degen in der Faust, vor Zorn dunkelrot im Gesicht, sprang der Kapitän als erster an Bord der Bark. Ihm nach folgten zwei Offiziere und ein Trupp Matrosen, alle den blanken Stahl in der Hand.
Doch sie trafen auf keinen Widerstand, die Matrosen des genommenen Schiffes standen auf der anderen Seite an der Bordwand und sahen den Drohenden lächelnd entgegen. Einige stopften sich sogar nach der harten Arbeit eben gemütlich eine Pfeife. Der Kapitän stand nach wie vor auf der Kommandobrücke und betrachtete ruhig die Szene da unten, nur den Kopf über der Schutzvorrichtung sehen lassend.
»Im Namen der Vereinigten Staaten von Nordamerika,« rief der Korvettenkapitän, über den Gleichmut noch mehr aufgebracht, »wo ist der Kapitän dieses verdammten Schiffes?«
»Hier ist der Kapitän dieses verdammten Schiffes,« antwortete da eine lustige Stimme, und hinter der Treppe der Kommandobrücke trat eine hell gekleidete Frauengestalt hervor. »Hätten Sie nicht Dampf aufgemacht, würden Sie uns doch nicht bekommen haben. Meinen Sie nicht, Kapitän Staunton?«
Salutierend legte die junge Dame die Hand an die Mütze, die keck auf dem blonden Lockenkopf saß.
Sprachlos starrte der Angeredete in das lachende Gesicht der Sprecherin, desgleichen seine Offiziere und Leute, und die Matrosen der Bark verzogen die Mundwinkel von einem Ohre bis zum anderen.
»Jesus Christus und General Jackson,« brachte der Kapitän endlich hervor, »nun bleibt mir aber der Verstand stehen.«
Dann warf er plötzlich den Degen weg und lief mit ausgebreiteten Armen auf die Dame zu.
»Hope,« rief er jubelnd, »hole mich dieser oder jener! Bist du es, oder bist du es nicht?«
»Gewiß bin ich es,« lachte das übermütige Mädchen und flog dem Offizier in die Arme. »Aber nun sage erst einmal, hättest du uns bekommen, wenn der ›Swift‹ keinen Dampf aufgemacht hätte?«

»Nein denn, zum Teufel, wenn du es so gerne hören möchtest, aber wo steckt denn dein Mann? Ist es denn möglich, ist das wirklich die ›Hoffnung‹, mit dem Freiherrn von Schwarzburg als Kapitän an Bord?«
»Gewiß, siehst du Hannes nicht da oben stehen, wie er sich über dein dummes Gesicht halbtot lachen will?«
Schmeichelhaft war diese Antwort eben nicht, aber sie veranlaßte den Kapitän doch, sein Auge nach der Kommandobrücke zu wenden, und er entdeckte dort wirklich ein Gesicht, das vor unterdrücktem Lachen ganz rot war.
Mit einem Satze sprang ein junger Mann die Treppe herunter und streckte dem verblüfften Kapitän die Hand entgegen.
»Schwager, ich und meine Frau sind Ihre Gefangenen,« rief er, »verfahren Sie gnädig mit uns!«
»Freiherr von Schwarzburg,« entgegnete Kapitän Staunton, die Hand an die Mütze legend, »habe ich die Ehre?«
»Nichts da,« unterbrach ihn Hannes, »ich bin einfach Kapitän Schwarzburg; das Meer und der Wind machen sich den Teufel daraus, ob ich Freiherr bin oder nicht; sie reden mich auch nicht mit ›Baron‹ an, wenn sie mit mir Fangball spielen. Und das hier,« er deutete auf Hope, »ist der erste Steuermann; er leitete die Manöver, durch welche die ›Hoffnung‹ Ihnen entkommen wäre, wenn Sie nicht Dampf angewandt hätten.«
»Macdonald, zürnst du mir?« wandte sich Hope in bittendem Tone an ihren Bruder.
»Meine liebe Schwester, hast du nicht die Depesche erhalten, die ich dir nach Hamburg sandte?«
»Nein.«
»Sie enthielt meinen Glückwunsch zu eurer Hochzeit und zugleich die Versicherung, daß der Vermittler ganz und gar nicht meinen Instruktionen nach gehandelt hat, wie ich später erfuhr. Er handelte nach eigenem Ermessen; nie würde ich meiner Schwester solche harte Worte haben sagen lassen. Du weißt ja ...«
»Ich weiß, wie sehr du mich liebst,« sagte Hope zärtlich, »ich besann mich auch später, daß du mir so etwas sicher nicht hättest sagen lassen, es wäre zu hart gewesen.«
»Wie kommt es aber, daß ihr die Depesche nicht erhalten habt? Ich erfuhr von eurer Hochzeit zwei Tage zuvor und gab das Telegramm sofort auf, es muß euch doch also noch am Tage der Hochzeit erreicht haben?«
»Wir hatten aber keine Zeit mehr,« lachte Hannes. »Der Boden brannte uns unter den Füßen. Wir mußten wieder auf schwankenden Planken stehen. Kaum hatte der Pfaffe Amen gesagt, so rannten wir gestreckten Laufes nach dem Hafen, die ›Hoffnung‹ war fix und fertig, uns aufzunehmen; meine Matrosen, alles alte Freunde, hatten sie prachtvoll ausgeschmückt, füge ich Ihnen, alles mit Tannenreis und Flaggen deklariert ...«
»Dekoriert,« verbesserte ihn Hope.
»Richtig, dekoriert,« fuhr der Baron fort. »Als unser Boot das Schiff erreichte, lagen schon die Anker an Deck; die Leute am Ufer schrieen Hurra, meine Matrosen schwenkten ihre funkelnagelneuen, roten Schnupftücher, die sie sich extra gekauft hatten, weil meine Frau an Bord kam; ich brauchte bloß zu pfeifen, die Segel flogen 'runter, und fort ging's, die Elbe herunter und hinaus!«
»Und wohin geht die Fahrt jetzt?« fragte Kapitän Staunton, im stillen über diesen freimütigen, tatkräftigen Freiherrn lächelnd.
»Wir suchen die ›Vesta‹ auf,« sagte Hope lachend.
»Wissen Sie noch nicht, daß dieselbe untergegangen sein soll?« wandte sich Staunton an Hannes.
»Erfahren haben wir es. Wir sind über ihr und des ›Amor‹ Schicksal ganz genau unterrichtet worden,« antwortete dieser, »aber Sie haben recht, wenn Sie das ›soll‹ betonen. Ich glaube noch lange nicht, daß die ›Vesta‹ untergegangen ist. Die Mädchen sollten das Boot ohne Korkfassung ausgesetzt haben? Glaube ich nicht, dazu war immer noch Zeit, und wenn das Deck schon unter Wasser stand. Sie sagen, die Korkfassung könne von der Brandung abgerissen worden sein? Geht nicht, ich kenne die Boote der ›Vesta‹ so genau wie meinen Wachstuchhut hier. Nein, der Schiffbruch ist nur simuliert. Die Vestalinnen wurden stets verfolgt, eine Bande Schurken versucht beständig, sie zu fangen, und das ist ihr nun auch gelungen; sie haben die Boote ausgesetzt, vielleicht auch ein paar Planken von der ›Vesta‹ abgerissen, um die Welt glauben zu machen, sie sei untergegangen. Aber, ob ich nun Freiherr oder bloß Hannes Vogel bin, glauben tut das keiner; ich kalkuliere, die ›Vesta‹ lebt noch, ebenso wie ihre Besatzung. Und wir werden sie suchen und auch finden, oder ich will Freiherr von Matz heißen.«
»Ich werde Ihnen auf die Spur helfen können,« sagte Staunton. »Wir haben heute morgen nämlich einen seltsamen Fang gemacht, Personen, welche Sie kennen werden und die Ihnen mehr Aufschluß geben können.«
Nun erzählte Kapitän Staunton den aufmerksam Zuhörenden, wie er, als er an der Küste von Brasilien kreuzte, einem Schiffe begegnet sei, dem er als Sklavenhändler schon lange auflauere. Dasselbe verhielt sich auch sehr verdächtig, es wendete sich und fuhr zurück, steuerte dann aber wieder denselben Kurs, das heißt, es kam dem ›Swift‹ entgegen.
Eine Untersuchung an Bord ergab nichts; das Schiff mußte freigelassen werden.
Als der ›Swift‹ den alten Kurs weiterfuhr, entdeckte er plötzlich ein Boot auf dem Meere schwimmen, voller Menschen, und zu seinem Erstaunen fand Staunton in diesen Personen Mädchen, meist Kreolinnen und Mestizen aus Südamerika.
Die dreizehn Mädchen waren äußerst ängstlich, nur schwer konnte man aus ihnen etwas herausbringen, aber man erfuhr so viel, daß sie diejenigen waren, welche einst von den Vestalinnen befreit wurden.
Wie sie hierherkamen, konnte man nicht verstehen. Staunton sagte, sie sprächen ganz ungereimtes Zeug zusammen. Bald schwatzten sie von den Vestalinnen, von einer Insel, auf der es Geister gäbe, von Löwen, von Piraten, die ebenfalls auf der Insel wohnten, dann wieder von einem Ueberfall, abermals von der Insel und Geistern, kurz und gut, sie sprachen solchen Unsinn zusammen, daß man annehmen könne, schloß Staunton, sie seien geistesgestört.
»Sie sind es,« rief Hope, »unsere befreiten Sklavinnen! Leben sie, dann leben auch noch die Vestalinnen! Sind sie an Bord, Macdonald? Schnell, führe uns zu ihnen, damit wir sie ausfragen können, mich kennen sie und werden vernünftiger antworten.«
»Gemach, gemach,« unterbrach ihr Bruder sie. »Sie sind allerdings drüben an Bord, und ihr könnt sie nachher sprechen. Erst laß mich weiter erzählen. So viel erfuhr ich doch, daß sie auf demselben Schiffe gewesen waren, welches ich eben durchsucht hatte. Der schlaue Sklavenhändler hatte mein Schiff entdeckt und als eins erkannt, welches auf seinesgleichen Jagd macht. Er wußte, daß er mir nicht entkommen konnte und setzte deshalb seine Ware in einem Boote aus. Ich fuhr sofort zurück und begann ihn zu suchen, konnte ihn aber nicht finden. Deshalb lief ich den nächsten Hafen an, gab Namen und Signalement des verdächtigen Schiffes an und fuhr weiter. Mehr konnte ich nicht tun.«
»Wird nicht viel Erfolg haben,« meinte Hannes. »Diese Sklavenhändler verstehen ausgezeichnet, das Aeußere ihrer Schiffe zu ändern. Ich wette, daß es niemals wieder in irgend einem Hafen erblickt wird. Solche Schufte haben immer genügend falsche Papiere bei sich.«
»Möglich. Ich konnte nichts anderes tun.«
»Wo befinden sich die Mädchen jetzt?«
»Im Zwischendeck, sie schlafen. Ich traf sie in einem sehr erschöpften Zustande; der Sklavenhändler wird ihnen übel mitgespielt haben. Ich habe ihnen einen abgeschlossenen Raum angewiesen, damit sie von der Mannschaft nicht belästigt werden.«
»Kapitän,« sagte Hannes, »wollen Sie mir diese Madchen überlassen?«
»Die Mädchen? Nein, das geht nicht,« rief Staunton, »es ist meine Pflicht, sie abzuliefern.«
»Sie sind doch unumschränkter Herr Ihres Willens. Warum sollten Sie uns die Befreiten nicht überlassen, wenn wir Sie davon überzeugen, daß dies einmal für die Mädchen selbst und dann auch für die Vestalinnen von größtem Vorteil ist?«
»Wie meinen Sie das?«
»Sehr einfach! Erst vernehmen wir einmal die Mädchen, wann sie die Vestalinnen verlassen haben.«
»Das können Sie auch an Bord meines Schiffes tun,« erwiderte ihn Staunton.
»Das wohl, aber wir brauchen die Mädchen auch fernerhin. Ich kalkuliere nämlich, die Vestalinnen sind auf einer Insel, und die Sklavinnen sind ihnen von dort entführt worden, wie es schon öfters passiert ist. Nun gilt es, diese Insel aufzusuchen, und zwar mit Hilfe der Aussagen dieser Mädchen.«
»Das ist ein schwieriges Geschäft.«
»Aber nicht unmöglich! Jedenfalls müssen die Befreiten noch viel genauer vernommen werden, als es von Ihnen geschehen ist. Täglicher Umgang mit ihnen ist nötig, und zwar ein ganz vertraulicher. Hope wäre dazu geeignet, um so mehr, als sie diese kennen. Gelingt es uns aber dennoch nicht, die Vestalinnen zu finden, so gebe ich diesen Plan vorläufig auf und schaffe die Mädchen, wenn ich alles erfahren habe, was sie aussagen können, einzeln in ihre Heimat, führe also die Absicht aus, welche die Vestalinnen schon vorhatten. Wollen Sie mir die Mädchen jetzt noch vorenthalten?«
Kapitän Staunton sah die Richtigkeit des Planes ein, zögerte aber noch, einzuwilligen.
Da nahm Hope das Wort.
»Bruder,« sagte sie, »bedenke doch, diese Mädchen sind dem Schutze der Vestalinnen nur entzogen worden; du hast den Räubern ihre Beute wieder abgenommen, aber keine Zeit, sie den Damen zurückzugeben, weil die Pflicht dich an der Küste von Brasilien hält. Nun kommen wir, die wir die Vestalinnen aufsuchen wollen; ich selbst war oder bin sogar noch eine Vestalin und fordere dir die Mädchen ab. Traust du uns etwa nicht?«
Staunton lächelte.
»Es ist aber keine gewöhnliche Ware, es sind Sklavinnen, Menschen,« sagte er.
»Ja, doch das bleibt sich gleich. Dich kann kein Gerichtshof der Welt verurteilen, wenn du uns die von dir befreiten Sklavinnen überläßt. Hast du sie überhaupt befreit? Nein, du hast sie nur gefunden, vielleicht sind es Schiffbrüchige, und solche uns zu überlassen, wirst du dich wohl nicht weigern. Also liefere sie uns aus!«
Es wurden noch mehr Gründe vorgebracht, und schließlich sah der bedrängte Kapitän ein, daß er wirklich ohne Gewissensbisse die dreizehn Mädchen an Bord der ›Hoffnung‹ bringen könnte.
Aber er verlangte, daß Freiherr von Schwarzburg und dessen Frau ein Protokoll unterschrieben, in dem die ganze Sache dargelegt wurde, so daß Staunton keiner Pflichtverletzung beschuldigt werden konnte. Die Offiziere seines Schiffes, sowie der zweite Steuermann der ›Hoffnung‹, früher der erste Steuermann der ›Kalliope‹, fungierten als Zeugen.
Die Schiffe blieben bei dem ruhigen Wetter nebeneinander liegen, während die Sache an Deck der ›Hoffnung‹ vorschriftsgemäß abgemacht wurde. Die dabei nicht gerade beteiligten Personen gaben sich unterdes der Freude des Wiedersehens hin, es gab ja noch so viel zu erzählen.
»Also habe ich wirklich alles durchgebracht?« lachte Hope sorglos, als ihr Bruder mit eigenem Munde bestätigte, daß von dem Vermögen des Vaters nichts mehr vorhanden wäre.
»Du hättest mich eher über die Verhältnisse aufklären sollen, damit meiner leichtsinnigen Verschwendung ein Ziel gesetzt wurde.«
Der Bruder versuchte vergebens, ihr eine andere Ansicht beizubringen; Hope hielt sich nun einmal für schuldig an dem Familienruin, fügte dann aber auf ihre gewöhnliche, naiv-gutmütige Art hinzu:
»Na, Macdonald, wenn du einmal in Verlegenheit bist, dann komme nur zu uns. Wir beide zerbrechen uns schon manchmal den Kopf, wie wir das viele Geld auf eine möglichst anständige Weise durchbringen sollen. Aber sag', was macht Leutnant Murbay, er hat die Sache doch nicht etwa tragisch genommen und den verschmähten Liebhaber gespielt?«
»Er hat sich wie ein Mann benommen,« antwortete Staunton einfach, »indem er sich in das fügte, was nun einmal nicht mehr zu ändern war.«
»Und seine Schwester ist auch ohne mich gesund geworden! Es ist ein Glück, daß ich nicht zu ihr ging, ich hätte sie mit meinen Launen doch nur zu Tode gequält.«
Hannes rief die Geschwister an den Tisch. Nach einigen Minuten war alles erledigt.
»Was hätten Sie gemacht, wenn ich mich unserer Verwandtschaft nicht erinnert, sondern Sie, Hope und die ganze Mannschaft in einem nordamerikanischen Hafen zur Bestrafung wegen Ungehorsam gegen ein Kriegsschiff ausgeliefert hätte? Würden Sie sich das ruhig haben gefallen lassen?«
»Warum denn nicht?« lachte Hannes, »viel kann dies Vergehen doch nicht kosten.«
»Außer einer Geldstrafe gibt es immer ein paar Monate Gefängnis.«
»Wenns weiter nichts ist! Das wäre nicht das erstemal, daß ich wegen eines Vergehens gegen die Gesetze im Loche säße, manchmal war ich schon unschuldig darin: viel schöner ist es aber doch, wenn man sich schuldig weiß. Sind Sie schon einmal eingesperrt worden, Schwager?
Staunton bedauerte lächelnd, dieses Glück noch nicht genossen zu haben.
»Das ist prachtvoll, sage ich Ihnen, wenn so die ganze Mannschaft, sogar der Kapitän mit, in einem Loche zusammensitzt. Ganz wunderbare Sachen werden da ausgeheckt, um die Langeweile nicht aufkommen zu lassen, wie man sie am Lande gar nicht kennt. In Valparaiso wurde einmal die ganze Besatzung der ›Kalliope‹ eingelocht, weil wir den Lootsen gekielholt hatten.«
»War dies nicht früher die ›Kalliope‹?«
»Es ist dasselbe Schiff noch, ist nur lange in Dock gewesen. Ein schönes Schiff, nicht? Auch die Mannschaft ist fast noch dieselbe. Weißt du noch, Bootsmann, wie wir in Valparaiso dem schlafenden Posten Gewehr und Hirschfänger gestohlen haben und ihm dafür einen Besen in den Arm und einen Löffel in den Gurt gesteckten?«
Der Bootsmann, ein alter Bekannter aus dem ›Schiffsanker‹ zu Sidney, hatte, etwas seitwärts stehend, der Unterredung seines jungen Kapitäns mit dem Offizier gelauscht. Jetzt antwortete er:
»Ja, und als der revidierende Offizier kam, präsentierte der Kerl mit dem Besen. Ich glaubte schon, jene goldenen Zeiten wären vorbei, jetzt scheinen sie aber wiederzukommen. Mit der ›Hoffnung‹ ist wieder ein Schiff jener Art entstanden, die wie Schwäne das Meer befuhren, wie Möwen sich vom Sturme treiben ließen, ohne die Segel zu bergen, und die noch keinen Dampfer kannten, welcher sie in den Hafen schleppte. Ob Vor- oder Achterwind, wir segeln in den Hafen und bergen die Leinwand erst, wenn der Anker sich in den Grund bohrt.«
»Wir vergessen über dem Gespräch unsere Aufgabe,« unterbrach Hope. »Wir wollen die Mädchen jetzt an Bord der ›Hoffnung‹ nehmen.
»Noch eins,« sagte Hannes zu seinem Schwager. »Mir kam die Nachricht zu, die Herren des ›Amor‹ hielten sich im Innern von Südamerika auf. Wissen Sie vielleicht, was sie dazu veranlaßt?«

»Auch ich bin darüber noch nicht aufgeklärt worden,« entgegnete der Fregattenkapitän. »Ich bin schon lang auf der See, und in dem Hafen, welchen ich heute morgen anlief, erfuhr ich nichts auf meine Erkundigungen hin. Was wissen Sie darüber?«
»Nur soviel, daß die Engländer die Küste abgesucht haben, wo der Schiffbruch der ›Vesta‹ stattgefunden haben soll. Es verlautete ja, das Schiff wäre dort an einem Felsenriff zerschmettert worden. Ich hoffe, wenn ich nach Chile komme, alles zu erfahren, vielleicht auch schon eher, in einem anderen großen Hafen; die Berichte darüber müssen ja nun heraus sein. Ich vermute bestimmt, es liegt wieder eine Teufelei vor, die vielleicht den Zweck hatte, die Herren ins Innere zu locken und sie nach und nach aufreiben zu lassen. Bestätigt sich das, so werde ich den Engländern beistehen.«
»Sie haben viel vor.«
»Eins nach dem anderen; erst will ich den Aufenthalt der Vestalinnen aufspüren. Also bitte, lassen Sie die Mädchen an Deck kommen!«
Mit niedergeschlagenen Gesichtern kamen die jungen Geschöpfe nach oben; sie meinten nicht anders, als neues Ungemach harre ihrer. Sie kamen aus dem Unglück nicht heraus. Glaubten sie sich schon sicher, so wurden sie wieder fortgeschleppt und fielen abermals in fremde Hände.
Ach, was für Freude entstand unter ihnen, als sie in Hope eine der Vestalinnen erkannten, eine ihrer Retterinnen! Neue Hoffnung tauchte in ihnen auf, abermals schien ihnen der Weg in ihre Heimat geöffnet zu sein. Der Kapitän, der sie aufgenommen hatte, war also kein Pirat gewesen. Hope unterhielt sich ja liebevoll mit ihm.
Das junge Paar, Hope und Hannes, verzichtete jetzt darauf, aus den Mädchen irgend etwas herauszubringen. Dieselben waren in ihrer Freude zu aufgeregt, um klare Antworten geben zu können.
Es wurde ihnen an Bord der ›Hoffnung‹ ein bequemer Aufenthaltsort angewiesen. Später erst sollte Hope versuchen, alles von ihnen zu erfahren, was das Schicksal der Vestalinnen betraf. Es war schwer, von diesen Mädchen, denen jede Kenntnis einer Ortsbestimmung abging, die Lage einer Insel zu erforschen, aber vielleicht war es doch möglich, daß Geduld zu einem guten Resultate führte.
Die Offiziere beider Schiffe nahmen voneinander Abschied. Nach einer herzlichen Umarmung wurden die Enterhaken gelöst, der›Swift‹ gab Dampf, um sich von der Bark freizumanövrieren, aber ehe noch die Schraube sich drehen konnte, war es der ›Hoffnung‹ schon gelungen, nur unter Anwendung der Segel abzusetzen.
Noch einen Abschiedsgruß, ein Tücherschwenken, und die beiden Schiffe verloren sich in der Weite des Ozeans. Der ›Swift‹ steuerte nach Norden, die ›Hoffnung‹ nach Süden.
Hope konnte ihre Neugier nicht unterdrücken. Sie befragte noch an demselben Tage die Mädchen und erfuhr überraschende Neuigkeiten: die Aussetzung Johannas, die Geschichte mit dem ungenießbaren Trinkwasser, von Miß Morgans Verrat, von der Felseninsel mit ihren Wundern und dem Besuch der Piraten auf derselben.
So unklar die Erzählung der Mädchen auch war, man konnte doch allerlei Schlüsse aus ihr ziehen.
Hannes erkundigte sich so genau wie möglich, wie lange die ›Vesta‹ gefahren war, ehe sie wegen Wassermangel eine kleine, schönbewaldete und wasserreiche Insel angelaufen sei, besprach sich hierauf lange mit Hope und dem zweiten Steuermann und gab dann den Kurs nach den Juan-Fernandez-Inseln an.
Die sieben Reiter hatten, Juba Riata an der Spitze noch in derselben Nacht den Paß von Villa-Rica, den einzigen Weg durch das Gebirge, passiert und erst am frühen Morgen mitten zwischen riesigen Bergen einige Stunden im Freien der Ruhe gepflegt.
»Zwei Tage müssen wir unsere Gäule in scharfem Trab halten,« hatte der mürrische Juba erklärt, »ehe wir das Dorf des springenden Panthers erreichen,« das heißt, wenn es sich noch dort befindet, wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Unter Umständen können wir aber auch noch zwei Wochen galoppieren, ehe wir ihn finden.«
»Sollten wir ihn nicht einholen können, wenn wir unseren guten Pferden die Sporen zu kosten geben?« fragte Harrlington.
Juba warf ihm einen spöttischen Blick zu.
»Warst du schon einmal im Westen Amerikas?« fragte er gelassen.
»Nein.«
»Dann weißt du auch nicht, wie Indianer reiten. Versuche eher, den Sturmwind einzuholen, als einen Indianer, solange er ein Pferd zwischen den Beinen hat und einen Vorsprung.«
Damit streckte sich der lange Mestize gemächlich neben dem Feuer aus, welches die kühle Morgenluft erträglich machte, zog eine Pfeife aus dem Gürtel und begann in langen Zügen den Rauch in die Lunge zu ziehen, ihn dann in dunklen Wolken aus Mund und Nase zugleich wieder ausstoßend. Nachdem er sich so einige Minuten dem Genüsse des Rauchens hingegeben hatte, wickelte er sich in seine Decke, die er vor dem Sattel auf das Pferd geschnallt trug, und lag in der nächsten Sekunde in tiefem Schlaf.
Sein Gefährte, Don, hatte gleich von vornherein auf unsere Freunde einen besseren Eindruck gemacht, als der grobe, aber aufrichtige und treue Juba. Er hatte eine einnehmende Physiognomie, redete auch, was aber bisher nur ein einziges Mal geschehen war, die Herren auf englisch an und zeigte überhaupt in seinem ganzen Benehmen ein gebildeteres Wesen, als man bei einem wilden Pampasjäger vermuten sollte.
Jetzt rückte er zu den Herren an das Feuer, welche sich noch unterhielten, und sagte:
»Nehmt nichts für ungut, Juba ist ein braver Kerl, nur etwas ungeschliffen! Er hat aber recht, einen Indianer kann man bei einem Vorsprung schwer einholen. Wißt Ihr, wie wir in Amerika über die Reiter denken?«
»Nun?« fragte Hendricks, den dieses Thema ganz besonders interessierte.
»In ganz Amerika gilt dasselbe Gesetz, gleichgültig, ob es Nord- oder Südamerika ist: der weiße Mann im Osten reitet sein Pferd so lange in schnellster Gangart, bis es zusammenbricht; der Mann des Westens jagt sein Pferd so lange, bis es stürzt, reißt es wieder auf und reitet weiter, bis es abermals zusammenbricht; der Indianer aber spornt seinen Gaul so lange zum schnellsten Jagen an, bis das Tier krepiert; Mitleid kennt er weder mit sich, noch mit irgend einer anderen Kreatur. Die Beschaffenheit des Landes mag einen solchen Unterschied hervorbringen, der rauhe Westen erzieht derbere Menschen, als der mildere Osten.«
Nicht ohne Erstaunen hatten die Engländer dem Jäger zugehört; sie glaubten einen Philosophen vor sich zu haben, wie man sie oft unter Leuten, welche beständig in der Einsamkeit leben, vorfindet.
»Ich glaube, Ihr seid nicht immer Jäger gewesen,« meinte Charles Williams. »Seid Ihr Amerikaner?«
»Ich bin Amerikaner,« sagte der junge Mann. »Amerika ist mein Vaterland, welches ich in unbeschränkter Freiheit durchstreife, ich kenne keine Grenze, ich nenne kein Haus mein eigen, kein Bett, keine Familie; der ganze Erdteil gehört mir, und ich bin glücklich. Ich bin einst zu etwas Besserem erzogen worden, aber ich durchkreuzte die vorsorglichen Pläne meines Vaters und bereue nicht, dies getan zu haben. Ich bin glücklich, denn — ich — bin — frei!«
Beim Sprechen der letzten Worte hatte sich der Mann hintenüberfallen lassen, und kaum war die letzte Silbe verklungen, so schnarchte er schon mit Juba Riata um die Wette. »Er ist wirklich ein glücklicher Mensch,« seufzte Charles Williams, wickelte sich in seine Decke und versuchte ebenfalls, die wenigen Stunden schlafend zu verbringen, denn der kommende Pampasritt erforderte die Kräfte eines ausgeruhten Mannes.
Durch den Ruf: ›Halloh, Jungens‹, wurden einige Stunden später die Schläfer geweckt, und sahen, noch traumumfangen, Juba Riata bereits neben einem frisch angemachten Feuer sitzend, den Kessel mit dampfendem Kaffeewasser behütend, während Don die spärlichen trockenen Zweige von Büschen zusammensuchte, um dem Feuer, neue Nahrung zu geben.
Gedrückt schlürften die Herren den in Blechtassen gereichten Kaffee und kauten das zähe, getrocknete Fleisch. Müde und niedergeschlagen, wie sie jetzt waren, mundete ihnen das Picknick durchaus nicht.
Dann ging es weiter; die ausgeruhten Pferde tänzelten unter den Reitern, aber nicht zu besonderer Freude der englischen Herren. Von dem Schlafe auf feuchter, harter Erde schmerzten ihnen die Glieder.
Die beiden Führer ritten stumm nebeneinander durch das kniehohe Gras, selten einmal ein Wort wechselnd, und die Herren verhielten sich gleichfalls schweigsam.
Als die Sonne schon bald den Zenit erreicht hatte, zügelte Don sein Pferd und blieb neben den Engländern, während Juba, stumm und finster, wie gewöhnlich, zehn Meter vorausritt und nur ab und zu seinem Pferde eine Liebkosung sagte. Das Tier war das einzige, welches trabte, schon dadurch seine Güte zeigend. Man sieht in Amerika nur wenige, einst wild gewesene Tiere, welche sich diese Gangart angeeignet haben, denn der Mustang bewegt sich nur im Schritt, Galopp oder Karriere, der Trab ist ihm fremd.
»Das sind die Pampas,« sagte Don, sein Roß neben die Engländer lenkend, und beschrieb mit dem Arm einen Kreis.
Es kam den Freunden vor, als wolle er mit diesen Worten und dieser Bewegung ihnen das Gebiet bezeichnen, über welches er wie ein König zu befehlen habe, jenes ungeheure, jetzt noch wellenförmige Steppenland, bei dessen Anblick die eigene Person plötzlich zu einer unsagbaren Kleinheit, zu einem Nichts zusammenschrumpft.
Die sieben Männer waren die einzigen lebenden Wesen in dieser Graswüste, die durch die grünen Halme huschenden Insekten abgerechnet, wenigstens schien es so. Die Tiere in den Pampas sind ungeheuer weitsichtig, sie erkennen den Menschen schon, wenn sie selbst diesem nur wie Punkte erscheinen, und ziehen sich scheu vor ihm zurück oder verstecken sich.
Es gehören schnelle Rosse dazu, das Wild der Pampas zu jagen, Schußwaffen werden wenig nutzen. Die Indianer bedienen sich weder des Pfeiles und Bogens, noch des Gewehres, wenn sie jagen; die Bola und ihr halbwilder Mustang, der mehr dem Schenkel, als dem Zügel gehorcht, genügen ihnen.
Mit der Bola fangen sie Pferde, Gazellen, den Kasuar — das ist der amerikanische Strauß — und selbst den Panther. Die Bleikugeln werden mit nie fehlender Sicherheit geschleudert. Auf was der Indianer zielt, das ist im nächsten Augenblick von den drei Riemen umschlungen.
Am Abend erreichten die Reisenden einen breiten Strom, und ohne sich auch nur umzusehen und ein Wort zu sprechen, lenkte Juba Riata sein Roß in die Fluten. Willig begann dieses die Schwimmtour durch das reißende Gewässer.
»In den Pampas gibt es keine Fährleute,« wandte sich Don lächelnd an die Herren, »auch wir müssen dem Beispiele Jubas folgen. Schwimmen Eure Pferde gut?«
Man hatte noch keine Probe damit gemacht, aber es zeigte sich, daß sie das Wasser nicht scheuten. Die Pferde von Südamerika sind an derartige Reisen schon gewöhnt. Wacker kämpften sie gegen die Strömung und hatten nach einer Viertelstunde das jenseitige Ufer erreicht, sie waren allerdings weit abgetrieben worden.
Das Unangenehmste für die Reiter war, daß sie die Waffen beständig über Wasser halten mußten, was für eine Viertelstunde eine große Anstrengung bedeutete. Juba wie Don hatten es sich bequem gemacht, sie trugen Revolver wie Munition mittels ihrer Lassos auf den Kopf gebunden.
Mit triefenden Kleidern wurde weitergeritten, doch Don teilte den Engländern mit, daß Juba bald einen geeigneten Lagerplatz wählen würde. Es wehte ein kalter Wind, der an Heftigkeit immer zunahm, und am Horizont stiegen schwere Wolken auf. Juba Riata wollte daher hügeliges Terrain erreichen, von dem man mehr Schutz vor dem Winde erwarten konnte.

Mit triefenden Kleidern wurde weitergeritten.
Aber dem Regen konnte man nicht entgehen, wenn er wirklich fiel. Das konnte eine nasse Nacht geben.
Eine Stunde später flackerte zwischen zwei Hügeln ein prächtiges Feuer, an welchem sieben Männer ihre nassen Kleider trockneten und die durchfrorenen Glieder wärmten. Man befand sich ziemlich weit im Süden, und die Nächte waren daher kalt.
Juba hüllte sich, wie gewöhnlich, in seine Decke, brannte die Pfeife an und fühlte sich nun in einer recht gemütlichen Stimmung, was man daraus ersah, daß er gesprächiger wurde. Er hatte bis jetzt den Herren kein Wort gegönnt, nicht einmal einen Blick, sondern war immer ernst und schweigsam zehn Meter vorangeritten, unablässig die Pampas abspähend, ohne aber etwas entdecken zu können. Wenigstens hatte er niemals etwas davon gesagt.
Harrlington brachte aus seinen mitgenommenen Vorraten eine wohlgefüllte Flasche mit Brandy zum Vorschein, und schon beim bloßen Anblick dieses Belebungsmittels verzogen sich die sonst so grimmigen Züge des Lassowerfers zu einem schmunzelnden Lächeln. Weder er, noch Don verschmähten dieses Produkt der Zivilisation. Mit Wohlbehagen ließen sie den belebenden Trank durch die Kehle laufen.
»Das wärmt besser, als die dickste Decke,« schmunzelte Juba, die am Schnurrbart hängengebliebenen Tropfen mit der Zunge sorgsam ableckend. »Der Brandy ist doch ein bedeutend besserer Stoff, als der verdammte Aepfelwein der Indianer, nach dem man noch acht Tage lang Leibschmerzen verspürt.«
»Müssen die Trinkfeste jetzt nicht bald beginnen?« fragte ihn sein Gefährte.
»Die Aepfelquetschen arbeiteten schon vor vierzehn Tagen,« war die Antwort, »und hätte ich nicht gewußt, daß wir jetzt gerade zu den Zechgelagen eintreffen, so hättest du mich wohl schwerlich bei dieser Jahreszeit zu einem Ritte durch die Pampas verleiten können.«
Juba leckte abermals mit der Zunge über die bärtigen Lippen, der Gedanke an eine Trinkerei in Aepfelwein mußte ihm doch nicht so unangenehm sein, wie er gesagt hatte, wenigstens verschmähte er das saure Getränk nicht, so lange er kein anderes hatte.
»Was für Festgelage sind das, von denen Ihr sprecht?« wandte sich Harrlington an den gefälligeren Don; doch Juba war guter Laune, er selbst übernahm die erwünschte Erklärung.
»Sieh, Fremder,« sagte er, »ein jedes Volk in ganz Amerika kann irgend ein Getränk bereiten, nach dem man sich leicht fühlt, als müßten einem Flügel anwachsen, und welches das Herz fröhlich macht. Ich bin weit herumgekommen, aber überall wird etwas gebraut, entweder aus Wurzeln, Beeren, Früchten, Blättern oder sonstwie; ja, mir erzählte einmal ein Indianerhändler, oben im Norden machten sie aus Kuhmist einen lieblichen Schnaps. Alle Indianer lügen zwar furchtbar, würde ihm dies auch nicht glauben, wenn ich nicht dort« — Juba deutete nach Nordosten — »selbst einmal bei einem Volke gesehen hätte, welches in großen Wäldern lebte, pfundschwere Ringe in Nase und Ohr trug und durch ein hohles Rohr Pfeile blies, wie es sich einen noch viel ekelhafteren Trank bereitete, nach dem sie aber wie angeschossene Fischreiher herumtaumelten. Alte, häßliche Weiber saßen um eine große Schüssel herum, kauten Brot klein und spuckten dieses in das Becken, dann kam Milch darüber, das Gebräu blieb einige Tage stehen und wurde getrunken. Die Leute sagten, der Speichel dieser alten Weiber schmecke süßer als Honig, und tranken dieses eklige Gebräu mit dem größten Behagen. Faktum ist es aber, daß sie furchtbar betrunken wurden.«
»Es waren Botokuben,« unterbrach Williams den plötzlich redselig gewordenen Mestizen, »Eingeborene von Brasilien. Der menschliche Speichel hat die Fähigkeit, einige Substanzen zur Gährung zu bringen, wodurch Alkohol entsteht.«
Der Mestize spuckte nachdrücklich aus, um seinen Ekel zu zeigen, obgleich er gar nicht wählerisch war, wie die Herren später erfahren sollten.
»Wie kamt Ihr nach Brasilien?« fragte ihn Davids.
Einem anderen hätte Inda Riata vielleicht geantwortet: »das geht dich nichts an,« dem ernsten Manne gegenüber mit den festgeschlossenen Lippen, die sich fast niemals öffneten, und der immer so kalt und besonnen blickte, benahm er sich höflicher.
»Hatte mich einer Expedition angeschlossen,« knurrte er, »bin aber desertiert, denn das Schleichen im Walde gefiel mir nicht, mußte zu oft zu Fuße gehen.«
Der Mestize sah nachdenkend vor sich hin, dann lachte er mit einem Male auf.
»Dachte damals, die Leute mit den Brillen, die an jeder Blume herumschnüffelten und über jeden Vogel stundenlang stritten, könnten doch nicht ordentlich reiten. Im Walde waren die Pferde sowieso überflüssig, und so band Juba Riata eines Nachts zehn Pferde an seinen Lasso und juchhei, fort war er, auf Nimmerwiedersehen. Kaufte mir für die zehn Pferde eine Frau von den Penchuenchen, habe den Kauf aber bereut, die Pferde wären mir jetzt lieber, als eine Frau, die nicht genug arbeiten kann.«
Das offene Geständnis gab unseren Freunden zu denken.
Juba hatte die Expedition also bestohlen, er schämte sich nicht einmal, es zu gestehen, sondern prahlte noch damit. Doch was half's, sie brauchten ihn jetzt. Ueberdies machte der Mestize trotz alledem einen günstigen Eindruck auf sie, und noch mehr sein Gefährte Don. Auf letzteren hätten sie sich unbedingt verlassen; auch ersterer war jedenfalls treu, nur über die Begriffe von Gut und Böse war er sich nicht völlig klar.
Behandelte man ihn gut, oder fügte man sich ihm vielmehr, so war von ihm nichts Schlechtes zu erwarten, aber die Dienste eines Dieners durfte man nie von ihm verlangen.
»Die Indianer der Pampas brauen sich Wein aus Aepfeln?« begann Harrlington nach einer Weile wieder.
»So ist es,« nickte der Mestize, der in seine alte Schweigsamkeit gefallen war, wahrscheinlich, weil er sich voll und ganz mit seiner Pfeife beschäftigte.
»Und die Trinkgelage beginnen jetzt?« wandte sich der Lord an den höflicheren Don.
»Sie müssen bald anfangen.«
»Ihr wollt die Indianer, welche sich jetzt am Trinken ergötzen, aufsuchen und an den Zechereien teilnehmen?« fragte Harrlington weiter, und eine böse Ahnung stieg in ihm auf.
Der Pampasjäger lächelte.
»Wir müssen die Häuptlinge aufsuchen, durch deren Gebiet wir reiten,« antwortete er dann, »sonst würden wir sie bald auf unseren Fersen haben und ihre Lanzenspitzen vor uns sehen. Wo aber ein Zechgelage stattfindet, müssen wir auf die Einladung hin daran teilnehmen, oder wir dürfen nie auf die Unterstützung hoffen, die wir gebrauchen. Der Indianer ist nie empfindlicher, als betreffs der Gastfreundschaft; wer sie verschmäht, ist sein Todfeind.«
Dagegen ließ sich also nichts machen.
»Ihr könnt Euch leicht denken, wie besorgt wir um das Schicksal der Dame sind, zu deren Befreiung wir uns hier befinden,« sagte Harrlington zu Don, hoffend, von diesem eher, als von dem brummigen Riata etwas über das zu erfahren, was die Herren stetig mit Besorgnis erfüllte. »Sie ist eine Freundin von uns. Werden die Indianer sie gegen ein gutes Geschenk ausliefern?«
»Hätten wir, Riata und ich, uns sonst als Führer von Euch anwerben lassen?« war die einfache Antwort. »Wir sind vielleicht rohe Menschen, aber ehrlich, allerdings nach unserer Weise, die Ihr nicht immer verstehen werdet. Nie hatten wir uns zu diesem Unternehmen dingen lassen, wenn wir uns keinen Erfolg versprachen. Für Lohn allein arbeiten wir nicht, wir müssen Erfolg in Aussicht haben, sonst fehlt uns der Antrieb.«
Die Herren, welche erwartungsvoll der Antwort des Jägers entgegengesehen hatten, denn diese Frage brannte schon lange auf ihren Zungen, atmeten freudig auf.
Aber noch eins mußten sie erfahren, ehe sie ihre Unruhe bemeistern konnten.
»Wie behandeln die Penchuenchen ihre weiblichen Gefangenen? Sie rauben die Mädchen doch, um sie zu ihren Weibern zu machen. Gebrauchen sie, um das zu erreichen Gewalt?«
Noch hatte Harrlington diese in verzagtem Tone gestellte Frage nicht völlig ausgesprochen, als Hendricks leise seinem Freunde Williams zuflüsterte:
»Was zum Teufel lacht dieser Kerl nur immer? Dies Lachen bei einer so ernsten Sache gefällt mir nicht.«
»Ich kann es mir auch nicht erklären,« gab Charles ebenso leise zurück, »mir scheint fast, als hätte Don etwas zu sagen, womit er nicht herauswill. Mir kommt es manchmal vor, als amüsiere er sich über uns.«
»Seid ohne Sorge um ihr Schicksal!« entgegnete Don, der wirklich ein sehr heiteres Gesicht gemacht hatte.
»Die Penchuenchen machen allerdings die gefangenen Mädchen zu ihren Weibern, aber nicht so schnell, wie Ihr vielleicht glaubt. Der Penchuenche ist nicht roh, er versucht erst, die Liebe eines Mädchens zu erlangen, und solange er dies nicht erreicht, betrachtet er sie nur als Sklavin, daß heißt, er läßt sich von ihr bedienen. Ein Glück ist es immer für die Geraubten, daß es für einen Krieger sehr schimpflich gilt, seine Leidenschaft nicht im Zaume halten zu können. Der Indianer weiß übrigens, daß ein weißes Mädchen ihn doch nicht so liebt, wie ein rothäutiges, und er zieht es vor, ein Lösegeld für sie zu erhalten. Wird dieses nicht geboten, so kann es allerdings vorkommen, daß er sie wirklich zu seinem Weibe macht, aber dies sind Ausnahmen und ereignen sich nicht oft.«
»Was wird dann aus dem Mädchen?«
»Sie bleibt seine Sklavin und ist unglücklicher, als wäre sie sein Weib, denn sie muß dieselbe schwere Arbeit verrichten, wie die Indianerinnen, wird aber noch dazu verachtet. Der Indianer, dem sie ihre Liebe verweigert hat, straft sie auf diese Weise. Selten braucht er Gewalt, dann aber niemals sofort, es vergehen Wochen, ja Monate, ehe dies geschieht. Ich kenne die Penchuenchen, glaubt meinen Worten!«
»Gott sei Dank!« seufzte Harrlington auf. »Auch den übrigen Männern fiel eine Zentnerlast vom Herzen, und John Davids' bis jetzt so furchtbar finsteres Gesicht klärte sich seit langer Zeit zum ersten Male wieder auf.
Die Nacht hatte sich vollkommen herabgesenkt, der Wind hatte sich gelegt, aber kein Stern zeigte sich am Firmament. Der Himmel wurde von einer dunklen Wolkenschicht vollkommen bedeckt. Das Feuer drohte zu erlöschen.
Juba Riata erhob sich von seiner Decke, klopfte die Pfeife an einem Stein aus und winkte Don. Beide entfernten sich in die Nacht hinaus, kehrten aber bald zurück, jeder einen großen Arm voll Reisig tragend, mit dem sie das Feuer wieder anschürten, den Rest schichteten sie daneben auf.
»Es ist die letzte Nacht, die wir an einem Holzfeuer zubringen,« sagte Juba. »Morgen schon feuern wir mit Pferdemist, den wir jeden Abend sammeln müssen. Wird das die Herren auch nicht genieren?«
Es sollte Spott in diesen Worten liegen, aber Harrlington antwortete ruhig:
»Wir kennen das. In den Gegenden, wo Kamele existieren, also in Sandwüsten, kann auch nur von deren Unrat Feuer gemacht werden.«
»Gib mir noch einmal deine Flasche,« wandte sich Juba an den Lord und musterte den Himmel, »wenn man sich innerlich angefeuchtet hat, empfindet man die äußerliche Nässe weniger.«
Der Pampasjäger prophezeite also Regen. Das konnte eine böse Nacht werden, ohne Zelte, ohne Schutz, ohne trockene Kleider — nur die wollenen Decken zum Einwickeln.
Jeder suchte sich einen geeigneten Platz zum Lager aus; die Nähe des Feuers wurde nicht beachtet, die schnell verbrennenden Aestchen lieferten nicht genug Wärme, sie diente nur zur Bereitung des Abendbrotes. Gefahr war nicht zu fürchten, sie stammte denn von Menschen, und diese ließen sich auch von einem Feuer nicht abschrecken.
Juba und Don verschwanden wieder in der Finsternis, sie suchten sich einen Schlafplatz abseits, und ebenso gingen Hendricks und Williams etwas vom Feuer ab, weil sie eine Bodensenkung gefunden hatten, in der sich mit Hilft der Decke ein recht angenehmes Bett machen ließ.
Bald lagen die beiden Engländer nicht weit voneinander entfernt am Boden und waren mit ihrer Schlafstelle auch ganz zufrieden.
»Wie schön wäre es,« seufzte Williams, ehe er nach dem ermüdenden Ritte einschlummerte, »könnten wir hoffen, alle die wiederzufinden, für welche wir zwei Jahre lang gesorgt haben. Ach, nur eine einzige ist davon übrig. Warum wartete sie nicht auf uns? Konnte sie sich nicht denken, daß wir vor Angst um sie vergehen? Nein, dieses Mädchen muß sich natürlich sofort wieder von den Indianern rauben lassen!«
»Wirklich, es ist herrlich hier,« sagte Hendricks nach einer kleinen Weile, um seinen in letzter Zeit sehr niedergeschlagenen Freund auf andere Gedanken zu bringen, »es ist das erstemal, daß ich eine kalte Nacht im Freien verbringe, aber sie ist wirklich so schön, wie eine tropische, wo man vor Hitze nicht schlafen kann. Unter meiner Decke fühle ich mich ganz behaglich. Wenn es nur nicht regnet; das könnte eine schöne Geschichte werden! Was meinen Sie, Williams, werden wir verschont bleiben?«
Doch Williams antwortete nicht mehr; er mußte entweder schon schlafen oder hing wieder trüben Gedanken nach, sich schlafend stellend, um nicht darin gestört zu wenden.
»Wenn es nur nicht regnet,« dachte Hendricks nochmals, wickelte sich fester in die Decke, so daß nur Augen und Nasenspitze heraussahen, warf noch einen besorgten Blick nach dem trüben Himmel und war gleich darauf sanft entschlafen.
Auch Williams hatte sich nicht nur verstellt; er schlief wirklich, und der Traumgott zauberte ihm Bilder vor, nach deren Verwirklichung der arme Charles sich sehnte. Der Traum mußte ihm Ersatz für das Leben bieten
Ihm träumte, er befände sich mit einer Person in einem Boote und fuhr auf dem blauen Meer, das Herz voll Glück und Ruhe, die Arme fest um die andere Person geschlungen, und er konnte nichts weiter als deren Namen nennen, Betty! Aber in diesem einen Worte lag alles, was er zu sagen gehabt hätte. Ja, es war Miß Thomson, die bei ihm war; er wunderte sich nicht darüber, daß er sich in einem Boote auf dem Meere befand; er sorgte sich auch nicht darum, daß sie weder Wasser, noch Nahrungsmittel bei sich hatten; er dachte überhaupt nicht an die Zukunft, sondern er stammelte nur den Namen des Mädchens, das er liebte, und lauschte dann wieder dem Worte, welches sie lispelte: Charles. Es klang ihm wie himmlische Musik, er wurde nicht müde, es zu hören.
Da aber mischte sich ein anderer Klang in diese Engelstimme; es war ein dumpfer Donner, und als er erschrocken aufblickte, sah er, daß sich der Himmel unterdes mit finsteren Wolken überzogen hatte, aus denen fortwährend unter Donnergekrach die Blitze zuckten.
Noch war ihm die Größe der Gefahr nicht zum Bewußtsein gekommen, als schon das Meer, obgleich gar kein Wind vorhanden war, furchtbar zu wüten begann; die Wellen zischten schrecklich, aber noch schrecklicher war, daß sich das Boot mit Wasser zu füllen anfing und Charles vergebens versuchte, die Arme von dem geliebten Mädchen zu lösen. Es schien mit ihm verwachsen zu sein, er konnte also nichts tun, um das Wasser aus dem Boot zu schöpfen.
Das kleine Boot sank schnell. Schon fühlte Charles das Wasser an seinen Füßen, schnell kam es höher und benetzte bereits seinen Leib.
»Charles!« rief Betty noch immer. Sie schien keine Angst zu fühlen.
Die Wellen drohten schon des Mannes Mund zu verschließen; mit der letzten Anstrengung, sich über Wasser zu halten, rief er laut:
»Halte dich fest, ich will dich retten, aber bewege dich nicht, sonst müssen wir ertrinken.«
»Schwimmen Sie schon?« rief da plötzlich eine männliche Stimme über Charles. »So weit ist es bei mir noch nicht, mir reicht es erst bis an die Kniee. Aber so stehen Sie doch auf, Williams, Sie liegen ja noch immer am Boden. Gerechter Gott, was für einen Schlaf haben Sie. Sie liegen ja wie in einer gefüllten Badewanne.«
Erschrocken fuhr Williams auf. Hendricks rüttelte ihn am Arm und half ihm auf. Das Wasser ging dem am Boden Liegenden schon über den ganzen Körper weg.
Himmel, was für ein Regen war das!

Es regnete nicht. Es goß wie mit Eimern herab, immer einen Strahl nach dem anderen, und dazu zuckten die Blitze wie feurige Schlangen durch die Luft, und der Donner rollte unaufhörlich.
»Wo sind unsere Gefährten?« rief Charles, seine Decke, die nur noch ein nasser Lappen war, aufraffend.
»Ertrunken oder weggeschwemmt,« stöhnte Hendricks, im Wasser herumpatschend.
Alles Rufen war vergebens.
»Wie lange sind Sie schon wach? Regnet es schon lange?« schrie Charles seinem Freunde zu.
»Bin auch eben erst erwacht,« war die Antwort, »als Sie mich aufforderten, ich solle mich an Sie anklammern. Lange kann es aber noch nicht regnen, sonst wäre ich sicher eher aufgewacht.«
»Unsinn,« schrie Charles und patschte weiter ziellos im Wasser herum, »es muß schon lange regnen, das Wasser steht ja schon einen halben Meter hoch.«
»Der Regen läßt nach.«
»Was hilft das, wenn die ganze Gegend innerhalb einer Viertelstunde überschwemmt ist? Himmel, Herrgott, ich bin wie aus dem Wasser gezogen!«
»Sind wir auch,« gab Hendricks kleinlaut zu, »und keine Aussicht, vor morgen früh trocken zu werden.«
Das Gewitter dauerte noch lange an, aber der Regen hörte bald auf. Kein Tropfen kam mehr vom Himmel, doch das Wasser fuhr fort, unter ihnen zu rauschen. An ein Niederlegen war nicht zu denken, und so weit sie auch gingen, sie fanden keinen trockenen Boden.
Schließlich blieben die beiden Durchnäßten ruhig stehen und ließen sich das Wasser um die Füße spülen. Charles fand sogar seinen Humor in dieser verzweifelten Lage wieder, wenn ein Blitz die traurige Figur seines Freundes beleuchtete.
»Durch und durch naß,« jammerte Hendricks, »wie zum Teufel sollen wir nur die Füße trocken bekommen, wenn die ganze Pampas unter Wasser steht?«
»Stellen Sie sich immer auf einen Fuß und lassen Sie den anderen trocknen,« riet ihm Charles. »Ohne Regenschirm wage ich mich aber niemals wieder in die Pampas, und ein zusammenlegbares Boot nehme ich das nächste Mal auch mit.«
Es war ein Glück, daß die beiden schon lange geschlafen haben mußten, ehe sie zur Einsicht ihrer verzweifelten Lage kamen, denn nur eine halbe Stunde standen sie so da, als sich die Nacht zu lichten begann.
Bald mußte der Morgen anbrechen, und sie konnten sich dann wenigstens darüber orientieren, ob ihre Freunde noch da waren.
Noch ehe es so hell wurde, daß sie die Gegend erkennen konnten, hatte sich das Wasser zu ihren Füßen verlaufen, sie standen wieder im Trockenen, doch das Wasser rann noch aus ihren Kleidern.
Beim ersten Morgenstrahl erkannten die beiden Freunde gleichzeitig zwei Gestalten, die auf sie zukamen. Es waren Lord Harrlington und Hastings.
»Das war ein Schauer diese Nacht,« rief ihnen der letztere als Morgengruß zu. »Ein Glück, daß er nur einige Minuten gedauert hat und unsere Decken Wasser ziemlich gut abhalten, sonst wären wir durch und durch naß geworden.«
»Nun hört doch alles auf,« schrie Hendricks in voller Wut, »Sie tun ja gerade, als wären Sie allein vom Regen verschont geblieben.«
»Das gerade nicht,« sagte Harrlington lächelnd, »tüchtig genug hat es geregnet, aber nur für wenige Minuten. Meine Decke hat den kurzen Regen abgehalten.«
»Stand bei Ihnen das Wasser nicht einen Meter hoch?«
»Nein. Sind Sie denn naß geworden?«
»Na, sehen Sie einmal her,« entgegnete Charles und rang den Zipfel seines Rockes aus.
»Das kann ich mir nicht erklären. So schlimm war es bei uns nicht,« rief der Lord erstaunt.
»Dann sind wir gerade in einen Strichregen gekommen,« klagte Hendricks in komischer Verzweiflung.
In diesem Augenblicke tauchten in der Dämmerung Don und Juba neben den beiden Lords auf. Mit einem Blick hatten diese die Situation erkannt.
»Weh,« rief Juba und tat, als wäre er ganz erstaunt, »Ihr habt doch nicht etwa in dieser Regenrinne geschlafen?«
Die beiden Durchnäßten blickten sich in dem jetzt heller werdenden Morgenlicht um. Don aber brach plötzlich ungeniert in ein lautes Gelächter aus; auch Harrlington und Hastings konnten das Lachen nicht unterdrücken, und die beiden Unglücksraben hätten vor Wut und Scham in den Boden sinken mögen, in den Boden der Regenrinne, in welcher das in der Umgegend angesammelte Wasser über sie hinweggeflossen war.
»Da möchte man sich doch gleich selbst ohrfeigen,« rief Charles und kletterte neben seinen Unglücksgefährten aus der Senkung heraus.
Die beiden Jäger machten sich daran, ein Feuer zum Bereiten des wärmenden Tees anzuzünden, wobei sie mit Bewunderung von den Engländern beobachtet wurden. Wie es ihnen gelang, das völlig nasse Holz nur mit Hilfe eines erbärmlichen Feuerzeuges in Brand zu bekommen, war den Zuschauern ein Rätsel, aber es gelang doch. Endlose Geduld war das Zauberkraut, mit dem sie die Nässe des Holzes überwältigten. Hundertmal schlug Don den Stahl an den Feuerstein, so daß ein Funke in den mit Pulver eingeriebenen Lappen sprang, aber hundertmal erlosch der schon glimmende Zunder unter den feuchten Zweigen, obgleich Juba Rita seine Lunge wie einen Blasebalg arbeiten ließ. Doch die beiden gaben nicht nach, der eine nicht mit Funkenerzeugen, der andere nicht mit Blasen, bis ein lustiges Feuer flackerte.
Eine Viertelstunde später schlürften alle heißen Tee, der die Körper wieder durchwärmte.
»Die nächste Nacht schlafen wir unter Dächern,« wollte Juba trösten, »und es ist gut, daß wir gerade zum Weintrinken kommen, denn dann kann man in den Zelten wenigstens ruhig schlafen.«
»Wieso?«
»Im nüchternen Zustande kann nur ein Vollblut-Indianer in seinem Zelte schlafen, von Fremden verlangen die springenden Gäste Tribut,« lachte Don.
Der heitere Jäger musterte nachdenklich die verstimmten Gesichter seiner Schutzbefohlenen, als sie die Pferde bestiegen; es schien fast, als ob er mit Lord Harrlingtons Schmerz Mitleid empfände.
Plötzlich ritt er dicht an diesen heran und flüsterte ihm zu:
»Verzaget nicht, Senor, Ihr werdet bald freudigere Nachrichten bekommen; vor allen Dingen fügt Euch uns.«
Ehe der erstaunte Lord noch fragen konnte, galoppierte Don schon wieder an der Spitze des Trupps.
Durch den Engpaß, welcher die Sierra Madre, einen Teil des Felsengebirges, unterbricht und dadurch Neu-Mexiko mit Kolorado verbindet, bewegten sich drei Reiter. Zwei von ihnen ritten nebeneinander. Ihre kräftigen Pferde hatten nichts weiter als ihre Herren und deren Felleisen zu tragen, während der dritte, ein riesiger Schwarzer, noch allerlei Gepäck auf seinen knochigen Gaul geschnallt hatte. Außerdem trieb er vor sich noch ein Maultier, welches an jeder Seite einen Koffer vom Rücken herabhängen hatte.
Die Reiter waren Kapitän Hoffmann und Kirkholm, mit des ersteren Diener Cäsar, beide auf dem Wege nach Kolorado.
Kirkholm hatte sich für einen Handelsmann ausgegeben, der in der Nahe von Cayenne Geschäfte abzuschließen habe, und war von Kapitän Hoffmann gern als Reisebegleiter angenommen worden.
Von der Station, in welcher sie die Pacificbahn verlassen, hatten sie die regelmäßige Postverbindung benutzt, mit welcher sie innerhalb vier Tagen nach Santa Fé gekommen waren.
Hier aber hätten sie wenigstens drei Tage warten müssen, ehe die Post weiter nördlich ging. Der Weg, den sie durch das Gebirge zu fahren hat, ist überdies schrecklich zerklüftet, steil, jäh abfallend und halsbrecherisch, besonders in einem schlechten Postwagen mit einem rücksichtslosen Kutscher, und so hatte Hoffmann vorgeschlagen, diesen Weg auf Pferden und ohne weitere Begleitung zurückzulegen.
Kirkholm ließ sich die Freude nicht merken, die ihn bei diesem Vorschlag beseelte. Endlich also konnte er einmal mit diesem Manne allein sein, denn die Postkutsche wäre stets mit Passagieren besetzt gewesen, wodurch nicht nur jeder Plan, sondern auch fast jede intimere Unterhaltung unmöglich wurde.
Was er tun mußte, wußte Kirkholm noch nicht; die Hauptsache war, daß er erst einmal mit seinem Nebenbuhler allein war. Eine Gelegenheit zur Ausführung der finsteren Pläne würde sich schon finden, und je länger Kirkholm in der Gesellschaft Hoffmanns war, mit desto furchtbarerer Entschlossenheit grub sich der Vorsatz in seinem Herzen ein, allein das Ziel dieser Reise zu erreichen.
Cäsar war zwar ebenfalls mitgekommen, aber das durfte ihn nicht hindern — der Schwarze mußte eben seinem Herrn in die Ewigkeit nachgeschickt werden.
Die Pferde waren bald von dem in alle Verhältnisse des Weges eingeweihten Hoffmann besorgt worden, und noch vor Tagesanbruch verließ die kleine Karawane Santa Fé, um auf eigene Faust das Gebirge zu durchqueren.
Wild türmten sich zu beiden Seiten des Pfades die Felsmassen auf; grundlose Spalten gähnten zu den Füßen der Reisenden; Wasserfälle stürzten rauschend von hoch oben herab, das zerstäubende Wasser benetzte noch die Gesichter der Wanderer, und schwankende Stege, eben stark genug, um die Postkutsche tragen zu können, führten über grausenerregende Schluchten. Es waren jene wildromantischen Bilder, an denen der Westen Nordamerikas so überaus reich ist, Szenerien, bei deren Anblick der Reisende bald mit Schauer, bald mit Bewunderung erfüllt wird, während er sich selbst unendlich klein vorkommt.
Stunde auf Stunde verging; aber noch immer ritten die beiden Reisenden wortlos nebeneinander. Kirkholm war ganz in Gedanken versunken, nur mit seinem Vorhaben beschäftigt, ohne die Landschaft zu beachten, während Hoffmann völlig in Betrachtung derselben versunken zu sein schien. Ja, als Cäsar hinter ihnen einmal ein lustiges Lied zu pfeifen anfing, verbot er ihm dies streng. Die Gassenhauer entweihten dies schöpferische Kunstwerk Gottes.
Endlich mußte Kirkholm das Schweigen doch brechen; er hielt es nicht länger aus.
»Werden wir diese Nacht in einer Poststation bleiben?« fragte er.
Hoffmann war zu höflich, um auf eine Unterhaltung seines Gefährten nicht einzugehen, er riß sich von der Bewunderung der Naturschönheiten los.
»Es kommt darauf an, ob Sie Bequemlichkeit der Romantik vorziehen,« sagte er und wandte das lächelnde Gesicht Kirkholm zu.
»Ich füge mich Ihrem Vorschlag.«
»Wir haben die Wahl, in einer dumpfigen, zugigen Poststation zu bleiben, wo wir die Nacht auf Bärenfellen und vielleicht in Gesellschaft von rohen, trinkenden und rauchenden Menschen verbringen, oder in einem kleinen Blockhaus, zwar nur auf einem selbstbereiteten Blätterlager, vielleicht auch nur in unsere Decken gehüllt, auf ebener Erde, aber allein und inmitten der herrlichsten Natur. Am nächsten Morgen könnten wir als einzige Zuschauer den prächtigsten Sonnenaufgang genießen.«
Kirkholm horchte auf, Hoffmann kam ihm entgegen.
»Letzteres wäre Ihr Wunsch?«
»Ja, ich ziehe das einsame Blockhaus der Station vor, wenn Sie damit einverstanden sind. Wie Sie wissen, habe ich mich in Santa Fé genügend verproviantiert, ich brauchte überhaupt nirgends einzukehren, sondern bin mit allem Nötigen versehen.«
»Ich bin gern dabei, mich Ihnen anzuschließen, wenn Sie auch mir Ihren Proviant zur Verfügung stellen; ich bin mit wenigem zufrieden,« lächelte Kirkholm. »Wo ist dieses Blockhaus gelegen?«
»Abseits vom Wege; aber nur wenigen ist der Pfad bekannt, der zu ihm führt. Am Nachmittag müssen wir einige Stunden schneller reiten, dadurch passieren wir die Poststation noch vor Sonnenuntergang. Wir reiten an dieser vorüber und begeben uns nach der Blockhütte, wo wir Abendbrot essen und eine herrliche Nacht und einen noch herrlicheren Morgen genießen werden.«
»Und Cäsar kommt mit?«
»Nein, er bleibt auf der Poststation. So gern ich auch sonst den braven und treuen Burschen um mich habe, in solchen Fallen bin ich lieber allein oder in Gesellschaft einer Person, deren Gemüt gleicher Empfindungen fähig ist, wie das meine. Cäsar ist ein prosaischer Mensch, er zieht in kalter Nacht einen heißen Grog der schönsten Natur vor. Wir versehen uns in der Station mit allem, was wir brauchen, und reiten dem Blockhaus zu.«
»Wie weit ist es von der Station?«
»Noch zwei Stunden. Sind Sie schwindelfrei? Sonst dürfte ich Sie nicht zur Begleitung auffordern.«
»Ich habe Schwindel nie gekannt. Warum fragen Sie das? Ist der Weg gefährlich?«
»Allerdings, sehr, wenn wir keine Gebirgspferde und keine schwindelfreien Köpfe haben. Der ganze Weg führt auf einem kaum meterbreiten Grat entlang, zu dessen beiden Seiten grundlose Tiefen gähnen. Das Blockhaus liegt auf einem Vorsprung, es ist einst von Jägern erbaut worden.«
»Und dann reiten wir nach der Station zurück und nehmen den alten Weg auf?«
»Nein. Der Grat führt noch einige Stunden fort, dann aber stößt er wieder auf die Poststraße. Gegen Mittag würden wir diese wieder erreichen.«
»So treffen wir also dort wieder mit Ihrem Diener zusammen?«
»Auch nicht; so lange mag ich Cäsar nicht vermissen, denn er führt sehr wertvolles Gepäck bei sich. In der Station ist er während der Nacht gut aufgehoben, aber gerade von der Station aus wird die Poststraße sehr unsicher, es kommen sehr oft räuberische Ueberfälle vor. Er reitet des Morgens nach der Blockhütte, wo wir ihn erwarten. Auf dem schmalen Grat ist sein Leben nicht gefährdet; eine Begegnung mit einem Feinde auf ihm braucht der kräftige Schwarze nicht zu fürchten, und eine Kugel aus dem Hinterhalt hat keinen Zweck, denn sie wirft den Getroffenen samt seinen Schätzen bedingungslos in die unzugängliche Felsschlucht, die Beute ginge den Räubern daher verloren. Sind Sie also mit meinem Vorschlage einverstanden?«
Kirkholm war es.
Sein Herz pochte ungestüm; er fürchtete fast, er könnte seine Freude dem Manne an seiner Seite verraten.
Hätte er es bester treffen können?
Zwar hatte Hoffmann noch durch kein Wort verraten, daß er sich auf dem Wege nach Miß Murrays Plantage befand, um dort eine Erbschaft anzutreten, aber Kirkholm war fest davon überzeugt, und selbst wenn er nur eine Ahnung davon gehabt hätte, hätte dieser Mann sterben müssen.
War es nicht möglich, sich zugleich des Geheimnisses zu bemächtigen, welches Hoffmann auf der Brust trug, dessen Besitz ihm Millionen einbrachte? Sie schliefen beide allein in einem einsamen Blockhause, weit abgelegen von der Verkehrsstraße, von jedem menschlichen Wesen! Wie leicht war es dort, dem ahnungslos Schlafenden einen Schuß beizubringen, ihm das Geheimnis abzunehmen und ihn dann in die Schlucht zu stürzen. Und Cäsar? Bah, was galt des Negers Leben, der Kirkholms Ansicht nach überhaupt kein Mensch war?
Wild jagten die Pulse des jungen Verbrechers; sein Entschluß stand jetzt bei ihm felsenfest.
Die Mittagsstunden verbrachten die beiden lang hingestreckt unter dem Schatten eines alten Baumes. Die Landstraße war wie ausgestorben; nur ein einziges Mal waren sie einem Wagen mit vier Pferden begegnet, der Reisende beförderte, sonst keinem menschlichen Wesen.
Cäsar bediente die Herren, und es zeigte sich, daß Hoffmann auf solchen Reisen nicht schlecht zu speisen gewöhnt war. Der Neger brachte aus den geheimnisvollen Tiefen des Mantelsackes immer neue Delikatessen hervor, denen die beiden volle Würdigkeit angedeihen ließen; gebratenes Wildbret und Geflügel, Pasteten und eine Flasche französischen Rotweins — besser konnte man in einem Hotel ersten Ranges nicht dinieren, als hier inmitten eines unwirtlichen Gebirges.
Kapitän Hoffmann war nicht schwatzhaft, aber er wußte nicht, warum er nicht mit jemandem über etwas plaudern sollte, was diesen eigentlich nichts anging. Er war ja ein Deutscher und kein Yankee, der alles, was seine Person betrifft, in tiefes Geheimnis hüllt. Der Wein löst überdies die Zunge.
Der schlaue Kirkholm merkte das, und geschickt wußte er das Gespräch auf den Zweck von Hoffmanns Reise in diese Gegend zu bringen. Es war das erstemal, daß dieses Thema von ihm berührt wurde, und Hoffmann ging darauf ein.
Mit angehaltenem Atem lauschte der junge Mann, als sein freundlicher Wirt ihm unverhohlen erzählte, daß er wegen Regelung einer Erbschaft in Kolorado zu tun habe. Ob er schon von den Vestalinnen gehört habe. Ja? Nun, dann wisse er wohl auch, daß alle diese Damen ihren Uebermut mit dem Leben gebüßt hätten; die ›Vesta‹ sei untergegangen, und die amtlichen Berichte hätten den Tod der Damen bestätigt.

Er, Hoffmann sei mit einer dieser Damen verwandt, mit einer gewissen Miß Murray; ihr Besitztum stamme von Altascarez ab, und kraft einer alten Urkunde müsse dieses stets wieder an die Familie der Altascarez oder deren direkten Nachkommen zurückfallen; Miß Murray könne überhaupt kein Testament aufsetzen, oder wenn sie es täte, so hätte ein solches überhaupt keine Gültigkeit, so lange ein Blutsverwandter der Altascarez existiere. Er, Hoffmann, sei ein solcher, und er sei nicht geneigt, den Stammsitz seines Großvaters in andere Hände kommen zu lassen.
»Man hat mir schon gesagt,« schloß der Erzähler, »es existiere noch ein anderer Verwandter von Miß Murray, aber ich kenne ihn ebensowenig, wie ich Miß Murray gekannt habe, obgleich ich mit ihr zusammengetroffen bin. Es gibt eben viele Familien mit dem Namen Murray. Ob diese Verwandten nun Ansprüche machen oder nicht, ist mir gleichgültig, sie sind unberechtigt, ja, selbst ein Testament von Miß Murray zu seinen Gunsten wäre ungültig, so lange ich lebe. So viel habe ich aus sicherer Quelle erfahren. Miß Murray wird von diesen Bestimmungen wenig Ahnung gehabt haben; sie soll sich mit derartigen Geschäften nie befaßt, sondern alles ihrem Rechtsanwalt überlassen haben.«
Hoffmanns Tod war nun erst recht beschlossen; während er seinem Gaste das Glas vollschenkte, überlegte dieser kaltblütig, wie er ihn am leichtesten aus dem Wege räumen könnte, ohne der Anklage des Mordes ausgesetzt zu werden.
Am Nachmittage wurden die Pferde öfters zu einem Trabe genötigt, und die Folge davon war, daß man noch weit vor Sonnenuntergang die Poststation erreichte.
Hoffmann ließ sich von Cäsar den Mantelsack hinten aufs Pferd schnallen; der Schwarze blieb zurück, und die beiden Weißen ritten weiter.
Als Kirkholm an der Station vorüberkam, aus deren Fenstern mehrere Männer sahen, wandte er sein Gesicht zur Seite und betrachtete angelegentlichst die Landschaft zur linken. Er wünschte nicht, daß sein Gesicht zu genau beobachtet würde.
Doch im Westen Amerikas wird wegen des Verschwindens einer Person wenig Aufhebens gemacht. Steht nicht eine hohe Belohnung auf der Entdeckung des Mörders, und zwar ausgesetzt von einem Verwandten oder Bekannten, so kümmert sich kein Mensch um die Sühne, nicht einmal die Polizei. Amerika ist das Land des Selbstschutzes. Wer sein Leben nicht verteidigen kann, ist nicht wert, daß er es hat. Ueberall lauert hier der gewaltsame Tod: auf der Landstraße, auf der Eisenbahn, im eigenen Hause. Der Morde sind so unzählige, daß sie nur wenig Beachtung finden.
»Hier ist der Weg,« sagte Hoffmann zu seinem Begleiter und deutete zur Rechten auf einen schmalen Pfad, der von der Landstraße abzweigte, aber sofort in einem Felsen zu enden schien.
»Führt er denn weiter?« fragte Kirkholm verwundert.
»Nicht wahr,« lachte Hoffmann, »es sieht gerade aus, als ob er gleich wieder aufhörte? Wie Sie an dem Felsgeröll sehen werden, ist es auch kein richtiger Weg, sondern durch ein Spiel des Zufalls erzeugt. Hier ist einmal ein Felsen abgestürzt und dadurch die Oeffnung entstanden. Kommen Sie, bald erreichen wir den Grat.«
Es zeigte sich, daß der Weg allerdings eine Fortsetzung hatte.
Man konnte um die Steinwand biegen und befand sich mit einem Male in einem Felsenkessel, durch den ein meterbreiter Grat führte; zu beiden Seiten öffnete sich ein schwindelnder Spalt, und dieser wurde wieder von himmelhohen Bergen eingefaßt.
»Geben Sie die Zügel frei,« sagte Hoffmann, als er sein Pferd zuerst auf diesen schmalen Weg lenkte, »es geht so sicherer. Seien Sie unbesorgt, diese Pferde sind im Gebirge geboren, ihr Tritt ist ganz sicher, solange sie sich selbst überlassen bleiben.«
Schaudernd blickte Kirkholm in die Tiefe und dann wieder auf den Vorreiter, der so ahnungslos seinem Tode entgegenritt. Schon hier hätte der Schurke mit Leichtigkeit seinen Zweck erreichen können, es wäre nicht einmal nötig gewesen, den Revolver loszudrücken; er hätte nur das Roß vor ihm durch einen Hieb zu reizen brauchen, und es rollte mit seinem Reiter in den Abgrund.
Aber das Geheimnis auf der Brust wäre dann mit verloren; in diese Schlucht gab es keinen Abstieg.
Nein, nur Geduld; in der Hütte war bessere Gelegenheit dazu.
»Geben Sie acht auf den morgenden Sonnenaufgang,« plauderte Hoffmann weiter, »er wird großartig; wir bekommen einen schönen Tag. Wir haben nicht einmal nötig, zeitig aufzustehen, denn es dauert lange, ehe die Sonne den Gipfel der Berge erklommen hat. Nie habe ich ein herrlicheres Schauspiel gesehen, als wenn die Bergspitzen in der Morgensonne in goldenem Glanze strahlen.«
»Waren Sie schon öfters hier und haben diesem Schauspiel beigewohnt?«
»Nur ein einziges Mal, vor vielen Jahren, aber immer hat es mich verlangt, mich noch einmal diesem Genusse hingeben zu können.«
»Wird das Blockhaus auch noch stehen?«
»Erst vor wenigen Monaten erzählte mir ein Freund, der diesen geheimen Weg auch kennt, daß er es vorgefunden hätte. Hier im Gebirge zerstört man überhaupt nicht so leicht etwas, was dem Reisenden zum Schutze oder zur Bequemlichkeit dient.«
Kirkholms letzte Besorgnis schwand.
Dem Sonnenuntergang hatte man nicht beiwohnen können, der feurige Ball war schon hinter den Bergen verschwunden, ehe man diesen Weg betrat. Aber es blieb noch lange hell; denn so lange die Sonne nicht wirklich unter dem Horizonte verschwunden war, wurde die Gegend noch immer vom Licht übergossen.
Nach zwei Stunden erblickte man in der Ferne auf dem Grate einen dunklen Punkt. Es war die Blockhütte. Da, wo sie stand, verbreiterte sich der Weg, so daß er an der einen Seite die Felswand berührte, und an diese Steinmauer lehnte sich das aus Brettern aufgeführte Häuschen.
Vor ihm und zu beiden Seiten tat sich aber noch immer der bodenlose Abgrund auf. Das Plateau war zehn Meter im Quadrat, also vollkommen groß genug, um auch die Pferde aufzunehmen. Aus Ritzen an dem Felsen wuchs sogar genügend Gras hervor, daß die Tiere Futter fanden; es wäre also gar nicht nötig gewesen, daß Hoffmann für dieselben Hafer mitnahm.
Die beiden Reiter sprangen von den Pferden und betraten, die Tiere sich selbst überlastend, die Hütte.
Sie war nur klein und enthielt nichts weiter, als eine rohgezimmerte Bank und einen Tisch. Es mußte große Mühe gekostet haben, das zum Bau nötige Holz hierherzuschleppen. Wahrscheinlich hatte hier einst ein äußerst menschenscheues Wesen seine Wohnung aufgeschlagen, um sein Leben in Gesellschaft von Geiern und Adlern zu verbringen.
»Jetzt wollen wir uns erst gemütlich ausruhen,« meinte Hoffmann, öffnete sein Felleisen und zog ein Paket Lichter hervor, von denen er zwei anzündete, denn in der Hütte war es bereits dunkel. Darauf brachte er aus demselben Sack noch eine Menge von appetitlichen Sachen hervor, und außerdem noch einige Flaschen Wein, so daß eine Tafel entstand, welche der am Mittag durchaus nichts nachgab.
»Der Portwein wird uns Wärme für die kalte Nacht geben,« fuhr Hoffmann fort, zwei rotgekapselte Flaschen auf den Tisch stellend. »So, nun nehmen Sie Platz und langen Sie ungeniert zu!«
Zum zweiten Male war Kirkholm Hoffmanns Gast, aber seine Gedanken wurden dadurch nicht geändert, er brütete noch immer darüber, wie er am besten und gefahrlosesten den Deutschen aus der Welt befördern konnte.
Der Wein, den Hoffmann in zinnerne Becher schenkte, war gut, aber auch stark. Der Deutsche schien eine reichliche Quantität dieses Getränkes zu seinen Mahlzeiten gewohnt zu sein, er schenkte sich fleißig ein und nötigte auch Kirkholm wiederholt zum Trinken.
Die Nacht begann wirklich empfindlich kalt zu werden. Kirkholm hatte sich zwar vorgenommen, mäßig zu bleiben, aber diese Kälte zwang ihn doch, mehr von dem Getränk zu sich zu nehmen, als er vertragen konnte.
Er fühlte nach und nach, wie sein Kopf immer schwerer wurde, die Zunge wurde unbeholfen, und die Gedanken begannen unklar zu werden. Weit entfernt von Trunkenheit, merkte er doch, daß er nicht mehr der Alte war; der schwere Wein begann langsam seine Wirkung zu tun.
Das Essen war vom Tisch verschwunden, die Kerzen niedergebrannt. Hoffmann zündete zwei neue an, entkorkte eine Flasche Portwein und forderte seinen Gast auf, den Schlaftrunk zu sich zu nehmen, um, die Nacht in gesegneter Ruhe auf der Bank zubringen zu können.
»Trinken Sie nur,« wiederholte er, »ich garantiere Ihnen, daß Sie morgen ohne Kopfschmerzen erwachen werden. Er ist unverfälscht, direkt aus Oporto bezogen.«
Dabei blitzte Hoffmann sein Gegenüber mit den blauen, strahlenden Augen an, und Kirkholm trank.
Das Gespräch hatte sich bis jetzt nur um gleichgültige Sachen gedreht, nun aber kam Hoffmann wieder auf das vorige Thema, auf die Erbschaft.
Kirkholm begann zu fühlen, daß er betrunken wurde, es drehte sich alles in der Hütte, er selbst mit, aber immer blitzten ihn die blauen Augen an, welche das einzige in dieser Hütte waren, das sich nicht bewegte. Alles andere drehte sich um diese leuchtenden Punkte, wie die Gestirne um ein Sonnensystem.
Der junge Mann wußte genau, daß er dummes Zeug schwatzte, er nahm sich hundertmal vor, nicht mehr auf die so harmlos scheinenden Fragen zu antworten, die der Deutsche an ihn richtete, er war fest davon überzeugt, daß er manchmal etwas sagte, was er nicht gesagt hätte, wenn er nüchtern gewesen wäre. Nein, redete er sich dann wieder vor, du bist nicht betrunken, du bist ja ganz nüchtern, nur diese strahlenden Sterne, diese verdammten Augen haben es dir angetan.
Kirkholm wehrte und sträubte sich, er fluchte innerlich über seine Dummheit, aber er antwortete trotzdem immer wieder auf die an ihn gestellten Fragen, und daran waren nur die strahlenden Augen schuld.
Kirkholm glaubte, er träume einen beängstigenden Traum. Er fürchtete die Augen und trachtete nur danach, sie nicht zu erzürnen.
Er befand sich in einer seltsamen Aufregung.
Einmal, als Hoffmann den Kopf zur Seite wandte, bekam Kirkholm einen lichten Moment, doch wurde er noch vom Wein beherrscht.
»Mister Hoffmann,« lallte er mit schwerer Zunge, »ich glaube, Sie sind Hyp— Hypnotiseur.«
Da waren die strahlenden Sterne, die ihn faszinierten, schon wieder auf ihn gerichtet.
»Hypnotiseur?« klang es lachend in sein Ohr. »Ich habe mich niemals mit solch brotlosen Künsten befaßt. Jetzt, Mister Kirkholm, trinken Sie ihr Glas aus und legen Sie sich schlafen. So — Sie sind nicht recht fest auf den Beinen, warten Sie, ich werde Ihnen helfen.«
Hoffmann bereitete ihm sorgsam, wie einem Kinde, das Lager und hüllte ihn in eine Decke.
Noch einmal war es dem schon im Halbschlafe Befindlichen, als höre er ein Murmeln in seinem Ohr, das bald zu einem donnernden Geräusch anschwoll, er sah wieder zwei funkelnde Sterne in der Luft schweben, diesmal aber riesengroß, schrecklich anzusehen, dann wurde ihm plötzlich unwohl, er fühlte sich mit einem Male furchtbar beengt, geängstigt, er wollte schreien, konnte aber nicht, dann verlor er das Bewußtsein, er lag in tiefem Schlafe.
Wie lange er so geschlafen hatte, wußte er nicht, es deuchte ihm, als er erwachte, es wäre nur ein Augenblick gewesen, den er in solch traumlosem Schlaf zugebracht. In der Hütte herrschte schon die Morgendämmerung, und der erste Blick Kirkholms fiel auf den Deutschen, welcher auf der Bank neben dem noch voller Weinflaschen stehenden Tisch lag.
Plötzlich fiel Kirkholm alles wieder ein, was er sich gestern vorgenommen hatte, sein Vorsatz stieg wieder mit eiserner Gewalt in ihm auf, und leise, wie eine Katze, sprang er plötzlich von der Bank auf und stand, ehe er sich noch recht besinnen konnte, schon vor Hoffmann.
Dieser schlief ruhig. Der Deutsche schien das Bedürfnis einer Decke gar nicht zu kennen, wie Kirkholm jetzt merkte, hatte er die seinige ihm noch übergedeckt, er lag auf der harten Bank und hatte auch noch die Jacke ausgezogen, welche er sich unter den Kopf gelegt hatte.
Selbst das Hemd hatte der gegen Kälte unempfindliche Nordländer aufgeknöpft, Kirkholm sah, wie die weiße Brust sich ruhig hob und senkte. Alles an dem Schläfer deutete Ruhe und Sorglosigkeit an, auf den sein geschwungenen Lippen lag ein leises Lächeln.
Da nahmen Kirkholms Augen plötzlich einen teuflischen Ausdruck an, auf der entblößten Brust sah er ein Ledertäschchen liegen, das von einem Riemen um den Hals gehalten wurde.
Dort ruhte das Geheimnis, welches Flexan erstrebte, um damit Millionen zu erbeuten.
Kirkholms Hand griff nach dem geladenen Revolver. Jetzt oder nie, tönte es in seinem Innern, nie bot sich ihm wieder eine solche günstige Gelegenheit.
Aber erst mußte er sich überzeugen, daß sich niemand in der Nähe befand, daß nicht etwa gerade Cäsar, der Neger, daherkam.
Nein, kein lebendiges Wesen war zu sehen.
Mit einem Schritte stand Kirkholm wieder vor der Bank, die Waffe in der Hand. Ein Zittern durchlief seinen Körper, aber im nächsten Augenblick beherrschte er sich, seine Hand hielt mit festem Griff die Waffe umklammert.
Hoffmann atmete tief und ruhig, er träumte nicht einmal, daß der Mann, den er gestern bewirtet hatte, jetzt vor ihm stand, fest entschlossen, ihn zu töten.
Kirkholm hob den Revolver und brachte die Mündung ganz nahe an die Herzgegend des Schlafenden, die nicht einmal von einem Hemd geschützt wurde. Doch berührte er den Körper nicht, er hätte ihn wecken können.
Noch einen Augenblick zögerte Kirkholm, dann plötzlich ein Druck, ein Knall, ein leises Stöhnen, ein krampfhaftes, letztes Zucken des gewaltigen Körpers, er stürzte von der Bank — und Kirkholm stand vor der Leiche seines Gefährten, er war sein Mörder.
Jetzt kannte Kirkholm keine Rücksicht mehr, der erste Schritt war getan.
Mit fester Hand drehte er den Toten um, öffnete die Ledertasche und hielt ein mit seltsamen, ihm unbekannten Schriftzeichen bedecktes Pergament zwischen den Fingern — das Geheimnis des ›Blitz‹.
Im nächsten Augenblick war es in seiner Brusttasche geborgen, der Revolver eingesteckt, Kirkholm schleppte den Leichnam hinaus und warf ihn in den Abgrund. Ein teuflisches Hohnlachen begleitete den fallenden Körper.
Diesem nach folgte dann alles, was Hoffmann gehört und mitgebracht hatte: Flaschen, Gläser, der Mantelsack — alles wurde hinabgeschleudert. Erst als der Mörder die Hand nach der eisernen Kassette streckte, zögerte er eine Sekunde.
Hoffmann hatte diese immer sehr sorgsam behandelt, sie mußte stets neben ihm stehen, er vertraute sie selbst dem treuen Diener nicht an. Sie mußte also wertvolle Papiere enthalten, denn sie war nur so schwer, als etwa ihr eigenes Gewicht betragen mochte.
Aber was konnte ihr Inhalt Kirkholm jetzt nutzen? Die Hauptsache besaß er.
Von einem plötzlichen Wahnsinn erfaßt, schleuderte er mit einem Fluche auch den Kasten in den Abgrund, und schon erhob er den Revolver, um auch des Gemordeten Pferd seinem Herrn nachzuschicken, als er sich Cäsars erinnerte.
Halt, dieser mußte getäuscht werden. Er konnte jeden Augenblick kommen, und wenn er seines Herrn Pferd nicht sah, hätte er leicht Argwohn schöpfen können.
Da war es Kirkholm, als sähe er weit, weit entfernt, wo der Grat nur so breit wie ein Messerrücken erschien, sich einen dunklen Punkt bewegen.
Das konnte nur Cäsar sein.
Schnell war Kirkholm wieder in die Hütte geschlüpft und spähte, den Revolver schußbereit in der Hand, durch das offene Fenster, den Reiter erwartend.
Dieser kam zwar schnell näher, aber es dauerte Kirkholm doch zu lange. Das Pferd sollte als Zielscheibe dienen, dies war sicherer.
Endlich hatte Cäsar bald das Plateau erreicht, hinter ihm kam das Maultier.
»Halloh, Mister Hoffmann,« schrie der Schwarze fröhlich — es war sein letztes Wort.
Ein Schuß krachte, das Pferd bäumte sich wild auf, schlug hinten aus, traf das Maultier, und beide Tiere und der Neger stürzten in die Tiefe. Ein Schrei gellte noch herauf, dann war alles wieder still.

Ein Schuß krachte, und das Pferd bäumte sich wild auf.
»Nun du nach,« knirschte Kirkholm zwischen den zusammengebissenen Zähnen hervor und zielte auf Hoffmanns Pferd, welches dicht am Abhange graste. Wieder entlud sich der Revolver.
Getroffen sprang der Hengst zur Seite und verschwand in dem Abgrunde.
Kirkholm blickte mit blutunterlaufenen Augen um sich; er und sein Pferd waren die einzigen lebenden Wesen hier. Mit der größten Ruhe, als nähme er eine ganz alltägliche Verrichtung vor, untersuchte er die Hütte, ob noch irgend etwas darin wäre, was die Anwesenheit Hoffmanns verraten konnte; er schleuderte noch einen Pfropfenzieher in die Tiefe, dann war er überzeugt, nichts vergessen zu haben.
Als er aus der Hütte heraustrat, hatte die Sonne eben den Gipfel der Berge erreicht und beleuchtete sie blutigrot. Es mochte wohl ein wunderschöner Anblick sein, aber nicht für jemanden, der eben einen doppelten Mord begangen hat. Der Mann dachte an etwas anderes.
»Blut,« murmelte er durch die Zähne und steckte den Revolver in die Seitentasche.
Wie gebannt hing sein Auge an dem purpurroten Streifen, er konnte es nicht abwenden.
»Auf dieses Schauspiel hatte er sich gefreut,« flüsterte er, »nun kann er sich dort unten daran ergötzen. Der Tor, hahaha!«
Er brach in ein krampfhaftes Lachen aus, das nicht enden zu wollen schien.
Plötzlich aber brach er ab und wurde aschfahl; ein furchtbarer Schwindel befiel ihn, die Kniee schienen ihm brechen zu wollen, nur mit der größten Anstrengung konnte er sich noch in die Hütte schleppen, ließ sich dort auf die Bank fallen, wo er die Nacht geschlafen hatte, und sank sofort in einen bewußtlosen Schlaf.
Als er wieder zu sich kam, konnte er nicht sagen, wie lange er so gelegen hatte; in seinem Kopfe wütete ein entsetzlicher Schmerz, die Kehle war ihm wie ausgebrannt, und er zitterte am ganzen Leibe.
»Das war ein furchtbarer Traum,« murmelte er, den Kopf in beide Hände stützend. »Noch jetzt liegt mir der Schreck in allen Gliedern. Zwei Menschen ermordet, entsetzlich, wie kann ich nur solchen Unsinn zusammenträumen! Richtig, der Wein war zu schwer, und ich habe zuviel davon getrunken. Wein — Wein?« fragte er dann erstaunt. »Richtig, Mister Hoffmann, wir haben gestern zusammen gezecht.«
Er blickte auf und sah sich um, sprang dann aber mit einem Schreckensruf auf. Die Hütte war leer. Hoffmann war fort, sein Gepäck auch, und auf dem Plateau weidete nur noch sein eigenes Pferd. Auf dem Tische standen keine Flaschen mehr.
»Ja, wie ist mir denn, träume ich, oder wache ich?« Er schlug sich vor die Stirn. »Es ist dies alles doch kein Traum gewesen? Ich, ich hätte Hoffmann ermordet, und Cäsar, seinen Diener, auch mit?«
Seine Miene wurde immer entsetzter, stier blickte er um sich, aber er sah niemanden.
»Habe ich wirklich dreimal geschossen? Erst Hoffmann, dann Cäsar, und dann Hoffmanns Pferd? Unsinn, dann müßte ich das ja an meinem Revolver sehen können!«
Er zog die Schußwaffe hervor, untersuchte sie und ließ sie vor Schreck zu Boden fallen.
Drei Patronen waren abgeschossen worden.
»Mein Gott,« murmelte er schreckensbleich, »so ist dies alles kein Traum gewesen? Noch zweifle ich an der Wahrheit! Bah, das Pergament, von dem ich träumte, habe ich das vielleicht in der Tasche?«
Er verzog die bebenden Lippen zu einem Lächeln, als er in die Brusttasche griff, aber es erstarb sofort wieder — in der Hand hielt er wirklich ein mit seltsamen Zeichen bedecktes Pergament, das Geheimnis des ›Blitz‹.
Starr blickte der Mann auf das Blatt in seiner Hand, immer finsterer wurden seine Augen, immer drohender runzelte sich seine Stirn zusammen.
»Und wenn ich es getan habe, was schadet es?« stieß er mit heiserer Stimme hervor. »Jetzt besinne ich mich auf alles, ich habe nicht bloß geträumt, die Aufregung hat mich dies glauben lassen. Nein, Hoffmann ist wirklich tot, von mir ermordet liegt er dort unten in der Schlucht, zu der es keinen Zugang gibt, und mit ihm sein Diener, sein Gepäck und sein Pferd. Und ich, hahaha,« Kirkholm lachte gell auf, »ich bin den Nebenbuhler los; Miß Murrays Plantage gehört mir, ich bin der rechtmäßige Erbe, und hier halte ich das Geheimnis in den Händen, aus dem ich Millionen ziehen kann. Ein Narr wäre ich, wollte ich Flexan zum Mitwisser davon machen.
»Haha, ich glaubte, es sei alles nur ein Traum gewesen, diese Ausführung des Planes, mit der ich mich in letzter Zeit Tag und Nacht beschäftigt habe. Der erste Mord hat mich etwas angegriffen, meine Gedanken verwirrten sich. Jetzt aber fort von diesem Platze, oder ich werde wahnsinnig. Glückauf, Kirkholm, der Weg zum Glück ist dir jetzt geebnet, du hast es dir mit Gewalt dienstbar gemacht.«
Immer noch lachend schwang sich der Raubmörder auf sein Pferd und ritt den Grat entlang, von dem blutigroten Scheine der über den Beigen schwebenden Morgensonne beleuchtet.
Mit bleichen Zügen standen die Mädchen um ihre Kapitänin und sahen erwartungsvoll derselben zu. Es war ein längst erwarteter Augenblick, der jetzt kam, an den schon lange eine jede mit Furcht und Zittern gedacht hatte: die Austeilung des letzten Wassers und des letzten Schiffszwiebacks; dann sahen alle dem Hungertode ins Auge.
Die acht Tage waren verstrichen, und weder hatte der Dampfer Flexan zurückgebracht, noch hatte die frühere, geheimnisvolle Hilfe sich wieder bemerkbar gemacht. Und doch waren alle fest entschlossen, eher des Hungertodes zu sterben, als daß Ellen in jene Bedingungen einwilligte, die ihnen die Freiheit brachte. Kehrte Flexan mit seinen Piraten zurück, und die rettende Hilfe erschien nicht, so wollten die Mädchen diese Schurken mit bloßer Hand angreifen und nicht eher ruhen, als bis man sie überwältigt hatte. Dann konnte man mit ihnen tun, was man wollte, aber niemals würden sie zugeben, daß Ellen sich für ihre Freundinnen opferte.
Das letzte Mittagessen, bestehend aus einer Tasse Wasser und einem Stück Hartbrot! Ach, wie sehnten sich die hungrigen Magen nach diesem Labsal; mit zitternden Händen wurde diese spärliche Gabe in Empfang genommen, und manche Träne fiel heimlich auf das unter den Zähnen knirschende Brot. Aber keine ließ sich den Kummer merken, man heuchelte Gleichgültigkeit, um Ellen nicht noch mehr Schmerz zu bereiten. Denn diese fühlte jetzt doppelt ihre Schuld, ihren Eigensinn, ohne welchen sie jetzt sicher nicht auf dieser Insel als Gefangene wären.
Nicht nur Ellen, auch die übrigen Mädchen hatten bald einzeln, bald paarweise, zweimal sogar vollzählig das geheimnisvolle Wesen auf der Insel um Hilfe angerufen. Ellen zweifelte nicht, daß die Person, welche sie damals, mit dem Revolver in der Hand, von Flexan geschützt hatte, Johanna gewesen war.
Alles vergeblich — weder Johanna, noch jemand anders ließ sich sehen, und die früheren, freigebigen Unterstützungen blieben seitdem aus.
Schon Miß Thomson wollte einst Johanna erkannt haben, Ellen versicherte es bestimmt; man zweifelte auch nicht an der Wahrheit ihrer Behauptungen, warum aber galten sie Johanna nichts mehr? Wie kam sie überhaupt hierher? Wo hielt sie sich versteckt, und woher nahm sie die Unterstützungen? War es nicht mehr Johanna in Fleisch und Blut, sondern nur ihr Geist?
Die Mädchen fingen an, sich nach und nach immer mehr mit übernatürlichen Dingen zu beschäftigen; keine lachte mehr, wenn sie irgendwo in einer Ecke eine Unterhaltung über Geister und Gespenster hörte.
Dazu kam noch, daß man oftmals, bei Tag und in der Nacht, ein seltsames, unterirdisches Geräusch hören konnte. Bald klang es wie ein Donner, bald war es ein Klopfen und Hämmern, oft wurde die ganze Insel in ihren Grundfesten erschüttert.
Völlig gebrochen kehrte Ellen in ihre Höhle zurück. Sie wünschte sich den Tod, und sie fühlte auch, daß sie die erste wäre, welcher diese Insel zum Begräbnisplatz werden würde. Nicht ihr Körper war krank, aber ihre Seele, der Sitz des Lebens.
Mit müder Hand brockte sie der jungen Löwin den Zwieback ins Wasser. Die Vestalinnen hatten bisher alles redlich mit Juno geteilt. Warum sollte das Tier hungern, so lange sie noch einen Bissen hatten? Jetzt aber war es vorüber. Bald hatte sie ihre volle Größe erreicht, man sah ihr noch nicht an, daß sie unter der anfangs nur widerwillig genommenen Brotnahrung litt, bald aber mußte ein Siechtum der an Fleisch gewöhnten Löwin eintreten. Es wäre besser gewesen, man hatte Juno ins Meer gestürzt, denn das Tier war schon recht gut fähig, einen Menschen zu zerreißen, und wer wußte, ob es seine Herrin noch kannte, wenn der Hunger erst mit voller Gewalt auftrat?
Miß Thomson und Miß Murray traten zu Ellen in die Höhle.
»Wäre es nicht besser, wir würfen Juno über die Mauer?« fragte Ellen die Eintretenden.
»Schlachten und aufessen wäre immer noch besser,« entgegnete Miß Thomson, »aber erst wollen wir noch einen Versuch machen, ob uns nicht, wie früher, geholfen wird. Glauben Sie wirklich. Miß Petersen, daß Ihnen Johanna erschienen ist? Haben Sie sich nicht getäuscht?
»So deutlich, wie ich jetzt Sie vor mir stehen sehe, habe ich auch sie gesehen,« lautete die bestimmte Antwort. »Und ich könnte auch darauf schwören, in jener Gestalt damals Johanna erkannt zu haben,« sagte Betty. »Ihre Aussage bestätigt, daß ich mich nicht geirrt habe.«
»So ist Johanna also hier anwesend,« nahm nun Miß Murray das Wort, »es ist kein Zweifel mehr daran. Wir wollen uns nicht darüber den Kopf zerbrechen, wie sie hierhergekommen ist, denn das wäre zwecklos. Eine andere Frage ist, ob sie sich noch hier befindet.«
»Wer kann das sagen, da sie sich nicht mehr zeigt, noch uns eine Antwort zukommen läßt,« meinte Ellen kleinlaut.
»Aber ich glaube, sie ist noch da und beobachtet uns,« fuhr Jessy fort, »oder wir haben doch von anderer Seite Hilfe zu erwarten, und zwar stütze ich meine Behauptung auf folgende Gründe: Johanna ist jedenfalls nicht zufällig gerade hierhergekommen, wo wir uns befinden, nachdem sie von uns ausgesetzt worden ist, vielleicht wußte sie sogar vorher, daß wir hier auch gelandet wurden, und wußte ferner auch, daß hier im Innern der Insel noch andere Wesen existieren. Denn so viel ist doch klar, meine Damen, daß das Innere der Insel Personen beherbergt. So lange ich bei gesunder Vernunft bin, glaube ich nimmermehr an das Vorhandensein von Geistern, welche dem Menschen nach Willkür schaden und helfen können. Warum sollen nun aber hier im Innern der Insel, in unterirdischen Gängen, nicht Menschen leben, welche mit allem Nötigen ausgerüstet sind, vielleicht mehr Kenntnisse besitzen als wir, und Erfindungen benutzen, die wir noch nie gesehen haben? Das ist nicht unmöglich, vielmehr erscheint es mir jetzt vollkommen so, das unterirdische Arbeiten bestätigt dies; das Getöse kann nicht von vulkanischer Kraft herrühren, es ist zu verschieden und zu häufig. Mit diesen Personen steht Johanna in Verbindung, und durch sie werden wir beobachtet und beschützt. Habe ich recht?«
»Wohl, aber warum zeigt sich die hilfreiche Hand jetzt nicht mehr?«
»Das weiß ich nicht, vermute aber, weil wir es eigentlich gar nicht verdienen, denn, offen gestanden, wir haben Johanna schweres Unrecht zugefügt. Warum sollte sie uns nun nicht dafür bestrafen?«
»Sie kann auch nicht mehr hier sein.«
»Auch möglich; dann ist sie entweder gestorben oder hat die Insel verlassen; jedenfalls haben wir dann aber von denjenigen Hilfe zu erwarten, die uns früher geholfen haben. Aber ich glaube doch, daß Johanna noch hier ist und uns etwas bange machen will, was ich ihr gar nicht verdenken kann. Miß Petersen,« Jessy trat auf Ellen zu und erfaßte ihre Hand, »wir wollen es einmal wie kleine Kinder machen, die unrecht getan haben und um Verzeihung bitten. Wir wollen hier in dieser Höhle, wo Johanna schon zweimal erschienen ist, ihr unser Unrecht eingestehen, sie um Verzeihung bitten. Eine Ahnung sagt mir, daß sie uns auch zum dritten Male erscheinen wird.«
»Ich habe schon so oft nach ihr gerufen,« seufzte Ellen, »aber immer umsonst.«
»Auch ich habe dies getan,« sagte Miß Thomson, »aber es war eben nicht das richtige. Wir haben bisher immer nur getan, als handele es sich um die Beschwörung eines Geistes; nein, wir wollen es so machen, wie Jessy sagt. Und, Ellen, wir müssen offen miteinander sprechen, Sie sind die schuldigste von uns, denn gerade Ihretwegen wurde Johanna verstoßen. Sie hat es so gut mit Ihnen gemeint, aber Sie haben ihr alles mit Undank belohnt und sie außerdem noch mit Spott, Hohn, ja, mit Schmach überschüttet. An Ihnen ist es jetzt, Johanna um Verzeihung zu bitten, und Ihnen und uns allen wird wieder geholfen werden. Nehmen Sie diese offenen Worte nicht übel!«
Ellen antwortete nicht, sie bedeckte ihr Gesicht mit beiden Händen und brach plötzlich in Weinen und Schluchzen aus. Es war das erstemal, daß sie anderen Personen gegenüber solch einen Gefühlsausbruch sehen ließ. Die letzte Zeit hatte sie sehr erschüttert, sie war nicht mehr imstande, die Tränen zurückzuhalten. Alles, was sie bis jetzt energisch niedergekämpft hatte, brach bei diesem Vorwurf, dessen Berechtigung sie erkannte, mit einem Male hervor.
»Martern Sie mich nicht mehr,« schluchzte sie, »ich bin schon so furchtbar unglücklich. Ja, ich gestehe, ich bin schuld an allem, ich habe schwer, ach, so schwer an Ihnen gesündigt, an Lord Harrlington, den ich durch meinen Eigensinn unglücklich gemacht habe, und vor allen Dingen an Johanna. Johanna!« schrie sie plötzlich laut auf und stürzte mit ausgebreiteten Armen nach dem Hintergrunde der Höhle, wo sie auf die Kniee sank. »Ach, Johanna, verzeihe mir, ich kann nicht, ich mag nicht mehr leben, so lange ich dich hier weiß und deine Verzeihung nicht erlangt habe. Johanna, Johanna, verzeihe mir, oder mir bricht das Herz!«
»Ich verzeihe Ihnen,« sagte da eine Stimme im Dunkeln der Höhle, und die beiden Mädchen, über diesen leidenschaftlichen Ausbruch Ellens schon äußerst erschrocken, sahen, wie plötzlich vor Ellen eine Gestalt auftauchte, ihr beide Hände reichte und die Knieende emporzog.
»Sie und die übrigen Damen haben genug gelitten; es war nicht meine Schuld, daß die Prüfungszeit eine so lange war,« fuhr die Stimme fort. »Gern hätte ich Ihnen geholfen, aber ich durfte nicht. Gern verzeihe ich Ihnen alles, Ellen, ich denke schon längst nicht mehr an das Geschehene.«
»Johanna,« riefen jetzt die beiden anderen Mädchen wie aus einem Munde und stürzten auf die Wiedergefundene zu, »ist es möglich? Also doch, Sie, Johanna, sind unser Schutzengel?«
»Ja, ich bin's,« lächelte das Mädchen mit Tränen in den Augen und streckte den Freundinnen, die ihr auch in der schwersten Stunde beigestanden hatten, die freie Hand entgegen, denn mit der anderen hielt sie die weinende Ellen umschlungen.
»Der Dampfer kommt,« riefen in diesem Augenblick mehrere Vestalinnen und stürmten in die Höhle, »gleich muß er hier sein, wir sehen schon die Rauchwolken — Johanna,« schrie die erste und prallte bestürzt zurück.

»Ich weiß, der Dampfer kommt,« entgegnete das Mädchen, es war jetzt keine Zeit zum Begrüßen, »und deshalb bin ich hier, um Sie zu holen. Schnell jetzt, alle hier in die Höhle und mir nach, die Besatzung des Dampfers soll keine Person mehr auf der Insel vorfinden.«
Im Nu waren alle Vestalinnen von dem Erscheinen Johannas verständigt worden. Niemand fragte jetzt um nähere Aufklärung, denn es war allen klar, daß sie durch Johanna gerettet werden sollten, sie hatten ja deren Stimme erkannt.
Die Mädchen drängten sich um Johanna, diese überflog noch einmal die Anzahl der Vestalinnen und wandte sich dann dem Hintergrunde der Höhle zu, von diesen gefolgt.
Plötzlich strahlte den Mädchen ein intensives Licht entgegen, so weiß und blendend, daß sie erst die Augen schließen mußten. Die hintere Wand der Höhle war verschwunden, dafür aber tat sich ihnen eine Art von Gemach auf, dessen Fußboden aus Holz war, und an dessen Wänden sich Stahltaue hinzogen. Sonst war es völlig leer.
Das intensive, elektrische Licht kam von oben herein, aber die Quelle desselben konnte man nicht entdecken.
»Wo sind wir?« fragte ein Mädchen, außer sich vor Staunen.
»Im Magazin des ›Blitz‹. Auf dieser Insel hat Kapitän Hoffmann seine mechanische Werkstätte, hier rüstet er sein Schiff von Zeit zu Zeit wieder aus,« sagte Johanna. »Fürchten Sie sich nicht, was auch geschehen mag.«
In diesem Augenblick begann der Boden unter ihren Füßen zu zittern, und mit Blitzesschnelle sausten die Mädchen in die Tiefe, ein Ruck, und der Fußboden stand wieder.
»Ein Aufzug,« flüsterte Ellen.
Da sprang schon von selbst eine Tür auf, und die Mädchen blickten in einen hellerleuchteten Gang, der in die Felsen gehauen sein mußte.
»Folgen Sie mir!« sagte Johanna und schritt voran.
Sie kamen an mehreren großen, eisernen Türen vorüber, welche in die Felswände eingelassen worden waren, bis sich plötzlich, wie durch Zauberei, eine davon öffnete.
Die Mädchen traten abermals in ein Gemach, in einen Salon, der auf die luxuriöseste und bequemste Art ausgestattet war.
Ein Herr kam den Vestalinnen entgegen.
»Willkommen unter dem Meeresgrund,« rief er lächelnd und verbeugte sich leicht, »ich heiße Sie im Namen Kapitän Hoffmanns herzlich willkommen.«
»Mister Anders,« riefen die Mädchen, den Ingenieur Hoffmanns erkennend, dessen Bekanntschaft sie schon gemacht hatten.
»Ihr Schutzpatron,« fügte Johanna hinzu und wandte sich nun an die Damen, jede einzelne herzlich begrüßend.
»Aber wie kommen Sie nun hierher?« rief endlich ein Mädchen, als das Staunen sich etwas gelegt hatte. »Mir kommt alles das wie ein Traum vor.«
»Später will ich Ihnen alles erzählen,« lachte Johanna, welche so fröhlich war, wie man sie nie gesehen hatte, sie strahlte vor Vergnügen im ganzen Gesicht, »jetzt wird Ihnen erst eine ordentliche Mahlzeit gut tun. Mir hat das Herz geblutet, als ich Sie so leiden sah, während ich im Ueberfluß lebte. Aber ich durfte Ihnen nicht helfen, nur ausnahmsweise, auf mein dringendes Bitten hin, wurde es mir manchmal gestattet.«
Wieder sauste der Fahrstuhl herab, der unterdes seine Reise nach oben angetreten hatte, und diesmal stand eine lange Tafel darauf, mit Gerichten gedeckt, bei deren Anblick das Herz der jungen Mädchen zu jubeln begann.
Eine Minute später saßen die Damen um den Tisch herum und fielen mit Heißhunger über die Speisen her, während Johanna die Wirtin spielte und den Essenden lächelnd zusah. Der junge Ingenieur hatte den Salon verlassen.
»Denken Sie, Sie wären in einem Zauberschloß, in welchem Sie nur etwas zu wünschen brauchen, so steht es Ihnen schon zur Verfügung,« hatte Johanna gesagt, und es war auch wirklich so. Aus einer in die Felsen gehauenen Nische konnte man alles herbeiholen, was nur einer der Freundinnen zu wünschen einfiel.
»Aber so sagen Sie doch nur, wie Sie hierhergekommen sind,« begann Ellen, als der erste Hunger gestillt war, und streichelte die nicht vergessene Juno. »Sie können nicht glauben, wie sehr ich mich freue, Sie gerettet zu sehen, und was ich mir schon für Vorwürfe über meine Kurzsichtigkeit gemacht habe.«
»Wir wollen nicht mehr an das Vergangene denken,« entgegnete Johanna abwehrend. »Meine Rettung war sehr einfach. Ich verließ die ›Vesta‹ nicht weit von dieser Insel, der ›Blitz‹ entdeckte mich in dem Boot, Kapitän Hoffmann brachte mich hierher, und so hatte ich öfters Gelegenheit, Ihnen helfen zu können.«
»Wußte denn Kapitän Hoffmann, daß wir hierherkommen würden, oder war nur ein Zufall im Spiele?«
»Durchaus nicht. Herr Hoffmann wußte allerdings, daß Sie hierhergebracht werden sollten, er hatte es von Nick Sharp, dem Detektiven, welcher wirklich mein Bruder ist, erfahren. Dieser war in die Pläne jenes Mister Flexan, Ihres Cousins, eingedrungen und hatte den Ort erfahren, wo Sie ausgeliefert werden sollten. Ein Zufall war es allerdings, daß dieser gerade die Insel ist, in welcher der ›Blitz‹ seinen Hafen hat. Dieselbe hat eigentlich keinen Zugang; während wir aber in Afrika waren, sprengten die Piraten eine Bresche in der Felswand, die sie bei ihrem Fortgang wieder vermauerten.«
»Die Piraten kommen jetzt wieder?«
»Ja, und sie finden die Insel völlig leer. Die Leute Hoffmanns haben bereits alles weggeräumt, was Sie zurückgelassen hatten. Es befindet sich schon hier unten.«
»Was werden die Piraten tun?«
»In die furchtbarste Bestürzung geraten, weil sie glauben, Sie hätten sich selbst befreit.«
»Flexan wird allerdings wüten, wenn er sein Opfer entschlüpft sieht,« meinte Ellen.
»Das ist es nicht allein, das ganze verbrecherische Gewebe wird dadurch zerstört werden; Flexan wird alles aufbieten, um das Schiff zu vernichten, welches Sie, seiner Vermutung nach, aufgenommen hat.«
»So wäre der Tod also unser Los gewesen?«
»Der Tod wäre sowieso Ihrer aller Los gewesen, auch Sie, Miß Petersen, wären davon nicht verschont geblieben,« entgegnete Johanna. »Es ist das Gerücht ausgesprengt worden, daß die ›Vesta‹ untergegangen sei. Gefundene Trümmer derselben haben dies bestätigt, das Seemannsamt in Valparaiso hat die Nachricht proklamiert, und nun, meine Damen,« Johanna erhob ihre Stimme, »tauchen überall in Amerika Herren auf, welche, mit untergeschobenen Testamenten in den Händen, Ihre Besitzungen und Ihr Vermögen in Empfang nehmen wollen. Sie freuen sich bereits ihres Raubes und warten nur auf die Nachricht, daß die Vestalinnen wirklich nicht mehr existieren.«
Rufe der Bestürzung unterbrachen die Sprecherin, aber Johanna war über alles genau orientiert, sie wußte sogar, was jetzt in Amerika vorging, denn die Insel stand durch ein Kabel mit dem Festlande in Verbindung.
Sie verschwieg nichts.
Johanna erzählte von der Auffindung der Trümmer durch den ›Amor‹. Die Planke, das Boot und der Eimer stammten allerdings von der ›Vesta‹, diese aber existierte noch, die Gegenstände waren nur an die Fundstelle gebracht worden.
Sie erzählte weiter, wie die treuen Engländer ins Innere von Südamerika gelockt worden seien, um die angebliche Miß Petersen zu befreien, und wie dann nach dem Tode der Herren ebenfalls Testamentsfälschungen vorgenommen werden sollten. Rufe der Entrüstung wurden laut, als sie die Namen der acht Personen nannte, welche sich in das Vermögen der Vestalinnen teilen wollten. Die Mädchen kannten sie gut, es waren alles entfernte Verwandte von ihnen, und sie erfuhren auch die näheren Umstände, auf welche Weise die acht Verbrecher sich in den Besitz der Dokumente gebracht hatten.
»Und Kapitän Hoffmann war dies alles schon vorher bekannt?« fragte Ellen atemlos.
»Alles, und zwar durch meinen Bruder, welcher das verbrecherische Gewebe aufzudecken beschlossen hatte.«
Johanna begann vom Meister zu erzählen, und daß diese acht Herren unter diesem Namen schon lange verbrecherische Handlungen hatten ausführen lassen.
»Aber wenn Hoffmann schon alles vorher wußte, warum traf er da nicht Maßregeln, um die Absicht der Verbrecher zu durchkreuzen?«
»Dann konnte man die Verbrecher nicht entlarven, welche schon lange ihr Unwesen trieben. Man kannte ja nicht sie selbst, sondern merkte nur ihre Hand, jetzt über zeigen sie sich öffentlich, und mein Bruder wird dafür sorgen, daß sie auf immer unschädlich gemacht werden.«
»War es denn nötig, daß wir auf der Insel blieben, mit dem Bewußtsein, Gefangene zu sein?« fragte eine Vestalin. »Hätte Kapitän Hoffmann uns nicht gleich den Trost geben können, daß dieses Gefängnis nur ein scheinbares war?«
Johanna wurde etwas verlegen.
Da nahm Ellen das Wort:
»Ich verstehe, warum er so gehandelt hat, und ich billige es,« sagte sie. »Uns haben die zwei Monate auf dieser Insel nichts geschadet, am allerwenigsten mir; meine Augen sind mir geöffnet worden, und ich werde Kapitän Hoffmann noch oft für diese Heilung danken.«
»Es ist so,« nickte Johanna.
»Ging dieser Plan nur von Hoffmann aus?« fragte Miß Thomson lächelnd.
»Nur,« versicherte Johanna. »Ich habe ihn oft gebeten, Ihr Schicksal zu erleichtern, aber er weigerte sich hartnäckig. Er hatte sogar vor, Sie noch viel länger in der Gefangenschaft zu lassen.«
»Ei, ei,« lachte Miß Murray. »Wer hätte dem schüchternen Hoffmann eine solche Hartherzigkeit zugetraut?«
»Er ist nicht hartherzig,« verteidigte ihn Johanna.
»Warum verkürzte er endlich unsere Leidenszeit? Tat er es auf Ihre Bitte hin, oder fühlte er doch Mitleid mit unserer Lage?« fragte Ellen.
Johanna wurde plötzlich purpurrot, dann aber lächelte sie freudig, als sie, Ellen ansehend, sagte:
»Nicht meine Bitte hat dies vermocht, sondern ich habe ihn dazu gezwungen.«
»Gezwungen?« rief man erstaunt.
»Ja, gezwungen,« wiederholte Johanna lächelnd. »Ich habe ihm nämlich gesagt, ich würde ihm nicht eher am Altare die Hand reichen, als bis die Vestalinnen wieder sicher in ihrer Heimat wären.«
»Johanna!«
»Darum hat er es nun doppelt eilig, die Verbrecher mit Hilfe meines Bruders zu entlarven.«
»Johanna, ist es möglich?« wiederholten die Vestalinnen wie aus einem Munde, und diese erzählte ferner noch, was die Damen interessieren konnte, von den englischen Herren, von Miß Morgan und so weiter.
»Wo ist Kapitän Hoffmann jetzt? Warum zeigt er sich nicht, damit wir ihm danken können?«
»Er befindet sich in Amerika, um den Verwandten der Miß Murray, welcher seine Erbschaft antreten will, dingfest zu machen. Wie Sie nun wissen, ist Mister Hoffmann selbst ein Verwandter von Ihnen, Miß Murray.«
Von dem jüngsten Abenteuer des Geliebten wußte Johanna noch nichts, aber sie sprach davon, wie er zugleich den zu fangen suche, der dem Geheimnis des ›Blitz‹ nachstrebte.
»Fürchten Sie nicht für ihn,« fragte Ellen, »wenn er sich einer so gefährlichen Aufgabe unterzieht?«
»O,« rief Johanna mit leuchtenden Augen, »um Felix brauche ich keine Sorge zu tragen. Mit seinen scharfen Augen erkennt er jede Gefahr, und wenn er sie für unüberwindlich hält, vermeidet er sie; aber er scheut keinen Feind und braucht dies auch nicht. Wohl ist er vor einem Meuchelmord nicht sicher. Eine hinterlistige Kugel kann ihn überall treffen, aber er steht in Gottes Hand. Lernen Sie Hoffmann so kennen, wie ich ihn kenne, dann erst werden Sie ihn zu schätzen wissen. Betrachten Sie seine Werke hier, ich werde sie Ihnen nachher zeigen, und Sie sollen über diesen Mann staunen. Aber er ist nicht nur ein Gelehrter, der über Erfindungen grübelt, sondern auch ein Mensch, der keinem Feinde weicht. Ich kenne seine Lebensgeschichte und weiß es daher. Sie selbst können sich vielleicht auch noch davon überzeugen.«
Johanna geriet in Begeisterung, als sie von ihrem Geliebten sprach. Jetzt endlich durfte sie dies ja tun.
»Arme Johanna!« sagte Ellen und ergriff des Mädchens Hand. »Wie habe ich Ihnen unrecht getan. Ich habe Sie für eine Spionin angesehen, Sie verspottet, verhöhnt, Sie sogar gehaßt, und Sie haben alles geduldig ertragen. Wie kann ich das wieder gut machen?«
»Es ist vergeben und vergessen. Miß Morgan hätte das alles zu hören verdient, was Sie mir vorgeworfen haben. Doch sagen Sie, Miß Petersen, haben Sie Ihre Gesinnung gegen Lord Harrlington geändert?«
Ellen antwortete nicht, und Johanna wußte, wie sehr Ellen sich geändert hatte. Oft genug hatte sie heimlich die Verzweiflungsausbrüche und Selbstanschuldigungen des Mädchens mit angehört. Sie wußte genau, wie heiß Ellen Lord Harrlington liebte.
»Werde ich ihn wiedersehen?« fragte diese mit erstickter Stimme.
»Ganz gewiß.«
»Glauben auch die Herren, daß wir mit der ›Vesta‹ untergegangen sind?« fragte ein anderes Mädchen.
»Vorläufig, ja, sie meinen, nur Miß Petersen sei gerettet, die sie irrtümlich zu befreien suchen. Lange dauert es nicht mehr, so bekommen sie die Wahrheit zu hören, doch trotzdem sollen sie so tun, als jagten sie noch immer der vorgeblichen Miß Petersen nach, einmal, um die Verbrecher sicher zu machen, und dann, damit wir erfahren, ob diese nochmals Testamentsfälschungen betreffs der Herren vornehmen.«
Der junge Ingenieur trat wieder ins Zimmer und nahm an der Unterhaltung teil.
»Aber was macht der Dampfer jetzt, den wir vorhin haben ankommen sehen?« fragte plötzlich eine Vestalin. »Sind die Piraten schon auf der Insel? Ich möchte ihre Gesichter sehen, wenn sie uns nicht mehr vorfinden.«
»Der Dampfer ist noch nicht gelandet,« entgegnete Herr Anders, der Johanna beiseite genommen und leise mit ihr gesprochen hatte. »Die Piraten wollen die Insel noch nicht betreten, weil ein anderes Schiff in Sicht ist. Bald aber sollen Sie aus sicherem Verstecke die Piraten und den Anführer Flexan beobachten. Es wird ein lustiges Intermezzo geben, denn auch das andere Schiff wird auf jeden Fall seine Mannschaft ans Land setzen. Sie treffen auf ihm zwei alte Bekannte.«
»Wen?« riefen die Damen stürmisch.
Johanna vertröstete lachend auf nachher; sie wollte die Freundinnen überraschen.
Dann erklärte sie noch, daß die Mädchen die Heimreise antreten könnten, sobald Hoffmann oder der in Amerika weilende Sharp das Zeichen dazu gäbe. »Und,« fügte sie triumphierend hinzu, »sogar auf der ›Vesta‹.«
Ein allgemeiner Jubel brach bei dieser Verkündigung unter den Mädchen aus, sie wollten wissen, wie den Piraten die ›Vesta‹, die sie doch mit eigenen Augen hatten umwandeln sehen, wieder genommen worden wäre. Johanna konnte jedoch nur sagen, daß die ›Vesta‹ von Hoffmann, welcher die Piraten nicht aus den Augen gelassen hätte, genommen worden sei, als sie bereits von unter dem Meister stehenden Leuten bemannt und zu verbrecherischen Zwecken hatte benutzt werden sollen, und dann bat sie Ellen, in ein Nebenzimmer zu kommen, es handele sich um Enthüllungen über deren Stiefvater, die ihr durch Snatcher gemacht werden sollten.
Dieser war ebenfalls auf die Insel gebracht worden und völlig genesen. Ellen gab ihre Einwilligung, den Mann anzuhören und ihn als Werkzeug gegen ihren Stiefvater benutzen zu wollen. Daß dieser zu einem Morde fähig war, gab sie zu — sie hatte ja selbst Beweise dafür.
»Ich hatte schon gehört, daß Lord Harrlington einen Mann kennt, der gegen Mister Flexan auftreten kann,« sagte sie. »Meine Absicht war schon immer, diesen Mann zu vernehmen, doch Verhältnisse halber schob ich es auf.«
»Es war besser so, außerdem war Snatcher immer krank. Nicht nur ihn, sondern auch seine Familie hat Hoffmann hierhergeholt, damit der arme Mann wenigstens keinen Kummer betreffs seiner Lieben hat,« entgegnete Johanna und führte Ellen in den Salon zurück.
»Es ist Zeit, daß wir die Beobachtungen beginnen,« empfing sie der junge Ingenieur, »der Dampfer will landen. Sie werden ein interessantes Schauspiel zu sehen bekommen, erwarte ich.«
»Und ich freue mich auf ihre Gesichter,« fügte Johanna freudig hinzu, »wenn sie alte Bekannte wiedersehen werden.«
Die Damen wanderten durch einen langen Gang, dem anzusehen war, daß er künstlich angelegt war.
»Wir befinden uns bereits unter dem Meeresgrund,« erklärte der vorausschreitende Ingenieur. »Dieser Gang, sowie die sich abzweigenden Kammern, Gemächer und andere Gänge sind teils eingehauen, teils gesprengt worden.«
Den Mädchen klopfte das Herz, als sie daran dachten, daß über ihnen die Meereswogen rauschten.
»Bekam beim Sprengen nicht öfters das Meer Zutritt ins Innere, wenn die Kraft des Dynamits zu groß war?« fragte Ellen leise.
»Kam es vor, so wurden die entstandenen Oeffnungen von Tauchern zugemauert und das einströmende Wasser wieder ausgepumpt. Kapitän Hoffmann versteht dergleichen Arbeiten, davon haben Sie sich ja selbst überzeugt,« fügte der Ingenieur hinzu.
In den Nebenräumen waren teils Maschinen aufgestellt, welche die Damen kannten, teils andere, seltsam konstruierte, die ihnen fremd waren. Andere Gemächer waren wie Laboratorien eingerichtet, wieder andere nur mit einer Unmenge von Kisten und Ballett angefüllt. In einem domähnlichen Saale stand eine riesige Maschine, deren vier Kurbeln meterdick waren.
»Das Pumpwerk,« erklärte der Ingenieur.
»Durch welche Kraft wird die Maschine bewegt?« fragte ein Mädchen.
»Sie wird durch Elektrizität getrieben. Die Gemächer des Kapitäns, der sich viel hier aufhält, liegen oben in den Felsen, desgleichen die Wohnungen der Leute, also auch die meinige. Der Saal, in dem Sie vorhin waren, liegt unten, weil oben für seine Größe kein Platz mehr vorhanden war.«
»So haben Sie noch mehr Leute hier?«
Der Ingenieur bog in einen abzweigenden Gang, welcher ebenfalls mit elektrischem Licht beleuchtet war, aber keine eisernen Türen enthielt, dagegen in Augenhöhe mehrere Fenster mit dicken Gläsern.
Den Mädchen bot sich ein seltsamer Anblick dar, als sie durch diese Fenster sahen.
In einem großen und sehr hohen Saal standen eine Menge von großen Apparaten, fast wie Retorten anzusehen, ferner Kessel, unter denen Feuer zu brennen schien, wenn das weiße Licht nicht verraten hätte, daß hier durch Elektrizität Hitze erzeugt würde, Maschinen und so weiter.
Der ganze Saal war mit einem weißlichen Nebel angefüllt, der nur schwer die Einzelheiten erkennen ließ.
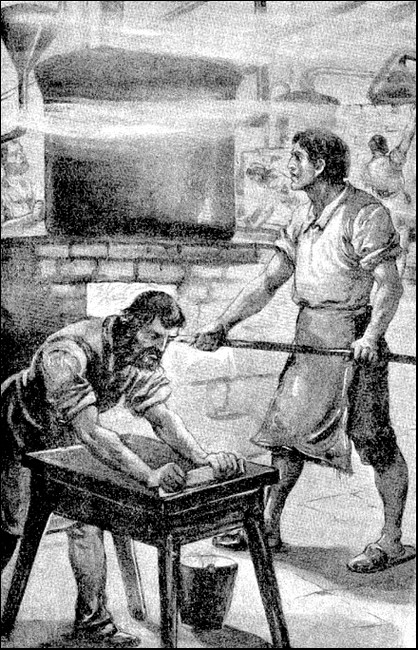
Der ganze Saal war mit einem weißlichen Nebel angefüllt.
Doch entdeckte man gegen dreißig Männer, welche teils die Apparate bedienten, die Kessel beaufsichtigten oder mit Instrumenten an schwarzen Platten schabten und diese dann abwuschen.
»Mein Gott,« rief ein Mädchen entsetzt aus, »wie sehen diese Leute alle bleich und elend aus!«
»Hier läßt Kapitän Hoffmann aus Quecksilber die chemische Substanz bereiten, durch welche er Elektrizität erzeugt. Die Quecksilberdämpfe schaden der Gesundheit.«
»Geben sich denn die Leute dazu her, solch eine gefährliche Arbeit zu verrichten?«
Anders lächelte.
»Gibt es denn nicht überall Quecksilber- und Arsenikhütten, in denen Menschen gegen hohen Lohn arbeiten?« fragte er.
Die Damen mußten das zugeben.
»Diese Leute sehen aber alle so eigentümlich aus, sie haben fast alle einen tierisch rohen Gesichtsausdruck und doch wieder so vergnügte Gesichter. Werden sie gut bezahlt?«
»Sie bekommen nichts weiter als Essen und Trinken, es sind Gefangene.«
»Gefangene?«
»Allerdings,« versicherte der Ingenieur, »Kapitän Hoffmann hat alle Männer, die er während seiner Reisen auf der Seeräubern betroffen und als schwere Verbrecher erkannt hat, gefangen genommen und verwendet sie hier zu Arbeiten, welche er für andere Menschen für zu gefährlich hält. Diese Leute haben auch die Sprengungen und Bohrungen in den Felsen vorgenommen; die leichten Uebeltäter verwendet er nun zu anderen Arbeiten, zu Dienstleistungen an der Maschine und so weiter, nur die schwersten Verbrecher müssen im Quecksilberraum arbeiten. Ihr Los ist jedoch kein so hartes; für ihre Gesundheit wird bestens gesorgt, und die Arbeitszeit ist eine kürzere, als in den Quecksilberhütten.«
Das Erstaunen der Mädchen wuchs von Minute zu Minute.
»Und diese Leute fühlen sich, ihren fröhlichen Mienen nach zu schließen, glücklich?« fragte ein Mädchen zweifelnd.
»Sie sind glücklich, ohne daß sie es wollen, sie sind dazu gezwungen.«
»Wir verstehen Sie nicht.«
Der Ingenieur zögerte, sich deutlicher auszusprechen.
»Ich darf mich nicht vollkommen darüber auslassen,« sagte er endlich, »es ist ein Geheimnis Hoffmanns. Nur so viel kann ich Ihnen erklären, daß alle diese Leute sich in einer Art von Hypnose befinden. Erst Verbrecher, sind sie jetzt harmlose und willige Menschen. Kennen Sie das Kunststückchen der Hypnotiseure, daß sie jemandem eine rohe Kartoffel zu essen geben und ihm einreden können, er äße einen wohlschmeckenden Apfel?«
»Ich kenne es,« erwiderte Ellen. »Also diese Arbeiter sind hypnotisiert und es wird ihnen vorgeredet, sie hätten ein angenehmes Leben und könnten deshalb glücklich und zufrieden sein?«
»Nein, sie sind nicht hypnotisiert,« sagte der Ingenieur, »aber das Mittel, welches Kapitän Hoffmann bei ihnen anwendet, erzeugt eine ähnliche Wirkung wie Hypnose, nur hält es länger an, unter Umständen für das ganze Leben. Diese Leute befinden sich in einem traumähnlichen Zustande, sie führen alle gegebenen Befehle aus, ja, man kann sogar ihren Gefühlen und Empfindungen befehlen. Kennen Sie die Geschichte der Osmanen?« fragte der Ingenieur plötzlich.
»Jenes fanatischen, arabischen Geschlechtes, welches in Asien die ungeheueren Eroberungszüge machte?« fragte ein Mädchen.
»Dieselben. Diese Beherrscher besaßen ein Heer und ganz besonders eine Leibgarde, die zu Taten fähig war, wie sie nie wieder von solchen großen Massen geleistet worden sind. Für ihren Anführer sich abschlachten zu lassen, war ihnen eine Wonne.«
»Ich weiß,« unterbrach ihn Ellen. »Osman versprach allen, die für ihn im Kampfe fielen, das Paradies, und einzelnen, die er für seine Sache begeistern wollte, verschaffte er schon hier auf Erden Eintritt in den siebenten Himmel. Er gab dem jungen Manne einen Schlaftrunk, brachte ihn in ein Haus, und wenn der Betäubte erwachte, so glaubte er sich für einige Tage wirklich in das Paradies versetzt. Er wurde von Huris, den himmlischen Mädchen, bedient, und es gab keine Freude, die ihm versagt worden wäre. Nach drei Tagen wurde er wieder eingeschläfert und der Erde zurückgegeben. Dann sagte Osman: ›Diese Freuden, die du innerhalb dreier Tage gekostet hast, sollen dir ewig währen, wenn du für mich im Kampfe fällst,‹ und des Jünglings einziges Bestreben von da an war nur noch, für Osman zu fechten.«
»Die Jünglinge haben die paradiesischen Freuden nicht in Wirklichkeit genossen,« entgegnete der Ingenieur, »sie wurden ihnen nur eingeredet, während sie schliefen, denn sonst hätten sie sich nicht wirklich glücklich gefühlt, etwas wäre ihnen doch noch zu wünschen übrig geblieben. Der Trunk, den sie bekamen, enthielt ein Mittel, das sie in eine Art von hypnotischen Zustand versetzte.«
»Ah, und woher hat man dies erfahren?«
»Aus Schriften von gelehrten Zeitgenossen Osmans, doch sind diese Schriften nur sehr wenig bekannt geworden.«
»Und was für ein Mittel ist dies?«
»Dies zu nennen, kann ich nicht verantworten. Fragen Sie Kapitän Hoffmann selbst, er wird Ihnen sicherlich Auskunft darüber geben. Zudem ist dieses Mittel noch jetzt bekannt, nur wird es in anderer Form verabreicht. Afrikareisende erzählen, daß Priester von Negerstämmen es verstehen, aus wilden, rohen und blutdürstigen Menschen, ja, aus einem ganzen Volke, ein friedliebendes, ackerbautreibendes zu machen, allein durch ihren Befehl, den sie ihnen in einer Art von traumhaftem Zustand geben.«
»Ich weiß es jetzt,« rief da ein Mädchen, »es ist das Hanfrauchen. Die Leute rauchen Hanf, werden davon betäubt und führen auch nach dem Erwachen einen ihnen in diesem Zustande gegebenen Befehl willig aus, sie befinden sich in einem der Hypnose ähnlichen Zustand. Ich habe einst eine Abhandlung darüber gelesen, in welcher vorgeschlagen wurde, mit unseren Verbrechern ebenso zu verfahren. Spielt der Hanf vielleicht auch hier eine Rolle?«
Aus des Ingenieurs Schweigen konnte man auf eine Bejahung schließen. Das Mädchen hätte das Richtige getroffen.
Plötzlich ertönten die Klänge einer Glocke.
»Wir haben schon zu lange hier gezögert,« sagte der Ingenieur hastig, »folgen Sie mir schnell, meine Damen, die Piraten sind gelandet. Die Szene wollen wir uns nicht entgehen lassen.«
Er trat in den Gang zurück. In demselben war ab und zu eine Nische angebracht, und in eine derselben trat der Ingenieur ein, den Damen winkend.
Sie fühlten einen Holzboden unter den Füßen, und wieder liefen Stahltaue an den Wänden hinauf, es war also ebenfalls ein Aufzug.
Der Ingenieur drehte einen Hebel an der Wand. Einige blauweiße Funken sprühten aus dem Apparat, aus den Drähten, und plötzlich setzte sich der Aufzug in Bewegung. Die Mädchen fuhren so schnell in die Höhe, daß ihnen der Atem verging.
»Wir sind jetzt in den oberen Felsen,« sagte Anders, als er den beweglichen Boden verließ.
Vor den Blicken der Damen tat sich wieder ein langer, gebogener Gang auf, der aber vom Tageslicht erhellt wurde, welches durch Spalten in der Felswand hineinschien.
»Das sind die Oeffnungen, welche von unten wie kleine Höhlen aussehen,« erklärte der Ingenieur, »sie sind aber künstlich eingehauen worden. Durch sie beobachteten wir Ihr Treiben, konnten es aber mittels anderer Vorrichtungen auch in den Höhlen tun. Doch,« fügte der junge Mann scherzhaft hinzu, »kann ich Ihnen die Versicherung geben, daß es nie zu unrechten Zwecken benutzt worden ist. Jetzt verteilen Sie sich an die einzelnen Spalten, und geben Sie acht, was sich ereignet.«
Die Mädchen folgten seinem Geheiß.
»Dort,« fuhr er fort, auf einen Dampfer deutend, der sich eben der künstlichen Mauer näherte, um Anker zu werfen, »dort, wo der Dampfer sich gerade befindet, liegt an der Meeresseite eine Höhle, und in diese hat der teuflische Flexan eine Dynamitgranate hineinlegen lassen. Sie ist groß genug, um die ganze Insel in die Luft zu sprengen. Um bei den Piraten keinen Verdacht zu erregen, haben wir sie liegen lassen, natürlich aber unschädlich gemacht.«
»Warum hat man dieselbe dorthin gelegt?« fragte eine Vestalin.
»Sie war für Sie bestimmt. Hätte selbst Miß Petersen in dieses Schurken Bedingungen gewilligt — ich habe die Unterredung mit angehört — Ihr Schicksal wäre doch gewesen, in die Luft zu stiegen, nachdem sich Ihre Kapitänin auf seinem Schiffe befunden hätte, man würde Zunder an die Granate gelegt haben. Im anderen Falle hätte auch Miß Petersen auf dieselbe Weise ihren Tod gefunden.«
Die Mädchen schauderten zusammen.
»Es ist sehr leicht möglich, daß Flexan doch noch seine Freveltat, diese Insel in die Luft fliegen zu lassen, versucht,« fügte der Ingenieur hinzu. »Nun, er wird vergebens die Zündschnur anlegen oder nach der Granate, einem Ding von einem Meter Länge, schießen lassen.«
Von der Höhe konnte man das Verhalten der Mannschaften auf dem Dampfer erkennen. Sie setzten Boote aus, bemannten sie und warfen Leitern und Stricke hinein, um über die Mauer steigen zu können.
Unter den Matrosen befand sich ein Mann, in einen langen Mantel gehüllt, der sein Gesicht mit einer schwarzen Maske unkenntlich gemacht hatte. Er saß still im Boot, ohne sich um die übrigen zu kümmern oder ihnen zu befehlen.
»Eduard Flexan,« flüsterte Ellen, »dein Kommen ist vergeblich. Gott sei gedankt dafür!«
»Sprachen Sie nicht vorhin von einem anderen Schiffe,« fragte ein Mädchen, »und von Bekannten, die wir wiedersehen sollten?«
»Auf der anderen Seite der Insel liegt es,« entgegnete der Ingenieur, der ebenso, wie die immer freudig lächelnde Johanna, über alles orientiert zu sein schien. »Um es zu sehen, müßten wir weit von hier gehen, aber wir wollen jetzt die Piraten beobachten. Dieses Schiff hat sich viele Mühe gegeben, den Piraten unschuldig zu erscheinen, als ginge deren Benehmen sie gar nichts an. Nun kommt es von der anderen Seite, von den Piraten unbemerkt, heran, und ich glaube fast, es wird Boote aussetzen, und eine Mannschaft wird der Insel ebenfalls einen Besuch abstatten, vielleicht auch mit den Piraten in Konflikt kommen.«
»Und wir kennen Leute von diesem Schiff?«
»Sehr gut, besonders den Kapitän und den ersten Steuermann,« lachte Johanna, »und noch eine Menge Passagiere.«
»So ist es ein Passagierschiff?« riefen die Damen verwundert.
»Ich darf jetzt nichts mehr verraten,« erklärte Johanna energisch. »Sie werden alles erfahren. Da — die Piraten stoßen ab.«

Die Aufmerksamkeit wandte sich wieder dem kleinen Schraubendampfer zu.
Das Boot stieß ab und fuhr erst dorthin, wo nach Aussage des Ingenieurs die Granate liegen sollte. Von den Ritzen der kleinen Felswand aus konnten die Mädchen selbst sehen, wie der Maskierte in die Höhle sprang, wahrscheinlich, um die Granate auf ihre Tauglichkeit zu untersuchen.
Da er gleich wieder zurückkehrte und das Boot nach der künstlichen Mauer fuhr, so mußte der Maskierte mit seiner Untersuchung zufrieden gewesen sein.
Ferner sahen die Mädchen, wie das Boot jetzt an der Mauer hielt und eine Leiter angelegt wurde, wie der Maskierte über das Mauerwerk sprang, durch die Bresche schlüpfte und am Ausgang derselben mit einem Schreckensschrei, so laut, daß er selbst das Ohr der Beobachter erreichte, erst zurückprallte und dann stehen blieb, als wäre er, gleich den Felsen um ihn, zu Stein geworden.
Den Bemühungen des Kapitäns der ›Hoffnung‹ und seiner Gemahlin war es doch gelungen, die Insel zu finden, auf welcher die Vestalinnen frisches Wasser an Bord hatten nehmen wollen und dabei gefangen worden waren.
Lora, eine spanische Kreolin von Jamaika, konnte die klarste Auskunft geben, und aus ihren Schilderungen hatte Hannes — wir wollen ihn noch so nennen — geschlossen, daß die Insel zu der Gruppe der Juan-Fernandez-Eilande gehören müßte.
Er selbst war einmal auf einem Schiffe gewesen, welchem während der Reise das Wasser ausging, und welches auf einer dieser Inseln solches wieder eingenommen hatte. Dieser steuerte er daher zu, und kaum kam das Eiland in Sicht, so erklärten nicht nur Lora, sondern auch die anderen Mädchen, daß es der Ort wäre, wo das Unglück der Vestalinnen seinen Anfang genommen habe.
Eine Untersuchung der Insel blieb, wie man nicht anders erwartet hatte, fruchtlos, es war nicht möglich, einen Anhaltspunkt zu finden.
Nun blieb es schwierig, den Kurs zu bestimmen, den man weiter einzuschlagen habe. Die Mädchen konnten nicht angeben, wohin sie sich damals gewandt hätten, sie waren ja im Zwischendeck eingesperrt gewesen und hatten sich noch dazu in tiefster Verzweiflung befunden.
Hannes und Hope standen auf der Kommandobrücke und versuchten vergebens, von der zierlichen Kreolin weitere Aufschlüsse zu erhalten; es gelang ihnen nicht.
Da meldete der Matrose auf Ausguck in dem langgezogenen, singenden Tone, in dem auf deutschen Kauffahrtei-Schiffen jede Meldung gemacht wird, ein Schiff backbord voraus, oder, wie der seemännische Ausdruck lautet: er sang ein Schiff aus.
»Ein kleiner Schraubendampfer, hat kaum 600 Tonnen Gehalt,« meinte Hannes, das Fernrohr am Auge, »was hat diese Nußschale hier zu suchen, wohin sich nur Segelschiffe verirren? Er steuert fast direkt Westen, also Afrika zu. Hm, sonderbar!«
»Das Deck steht voller Menschen, wir werden von ihnen durch Fernrohre beobachtet,« fügte Hope hinzu, welche ebenfalls das Glas zur Hand genommen hatte, »das Fahrzeug wird für eine wissenschaftliche Expedition bestimmt sein.«
Die mandelförmigen Augen der Kreolin hingen wie gebannt auf dem kleinen Dampfer, welcher sich ihnen schnell seitwärts näherte.
Plötzlich stieß sie einen kleinen Schrei aus, und ein Zittern durchflog ihre Glieder.
»Ah, Senora,« rief sie, sich an Hope wendend, »das ist das Schiff, welches uns von der Insel weggeschleppt und dann, als das große Kriegsschiff kam, in einem Boot ausgesetzt hat.«
»Alle Wetter,« rief Hannes erstaunt, »das könnte mit einem Male Licht in die Sache bringen. Was meinst du dazu, Hope?«
»Ist es der kleine Dampfer, welcher euch von der einsamen Felsen-Insel aus der Mitte der Vestalinnen geschleppt hat?« fragte Hope die Kreolin.
»Ja, auf ihm war der schwarze Mann, der mit Miß Petersen auf der Insel während der Nacht eine Unterredung gehabt hat, und der dann von den Damen fortgejagt wurde,« war die Antwort.
»Und die Damen sagten wirklich, sie erwarteten den Besuch dieses Mannes noch einmal?«
»Das weiß ich nicht, dann kamen wir ja von den Damen fort. Vorher haben sie aber immer auf ihn gewartet; sie sprachen wenigstens immer von einem Besuch.«
»Du erkennst den Dampfer wirklich als denselben wieder?« forschte Hope weiter.
»Ganz bestimmt. Jetzt kann ich sogar sehen, daß die Fahnenstange hinten abgebrochen ist, geradeso wie bei jenem.«
»Dann bleiben wir ihm auf der Spur,« rief Hannes, »ich zweifle nicht daran, daß er nochmals die Damen aufsuchen will. He, Bootsmann,« rief er an Deck hinunter, »wieviel Knoten fahren wir?«
»Vierzehn Knoten, Kapitän,« war die prompte Antwort, »habe soeben loggen lassen.«
»Und jener Dampfer fährt höchstens zehn Knoten, bei diesem Winde kann er uns nicht entgehen, wir haben ja nicht einmal alle Segel beigesetzt. Glaubst du, Hope, daß er die Insel nochmals anlaufen wird?« wandte er sich an seine kluge Frau.
»Ich denke es ganz bestimmt,« antwortete Hope, »aber Vorsicht, Hannes. Wir dürfen nicht merken lassen, daß wir dem Dampfer folgen wollen, denn das Ziel, welchem er zustrebt, wird er zu verheimlichen suchen.«
»Natürlich fahre ich ihm nicht direkt nach,« lachte Hannes, »du hältst mich manchmal auch für etwas zu dumm, Hope. Er fährt etwas nach Norden, wir wollen nach Süden steuern, er glaubt dann, wir kreuzen, und kommt weit vor uns vorbei. Geh' in das Kartenhaus, Lora, und du, Bootsmann,« rief er hinunter, »sorge dafür, daß keins von den braunen Mädchen sich an Deck sehen läßt, der Dampfer könnte seine Passagiere wiedererkennen und Argwohn schöpfen.«
Diesen Worten folgten Kommandos, die ›Hoffnung‹ wendete und steuerte südlicher, während der Dampfer seinen Kurs weiterfuhr.
Bald konnte man das Heck des Dampfers sehen und also auch den dort angeschriebenen Namen lesen.
»Wie hieß jener Dampfer?« fragte Hannes die Kreolin im Kartenhaus, dabei den Namen durch das Fernrohr buchstabierend.
»Ich entsinne mich seiner nicht mehr, es war ein langes, englisches Wort.«
»Hieß er ›Sempiturnity‹?« fragte Hannes weiter, der den Namen von Kapitän Staunton erfahren hatte.
»Ja, so war es.«
»Dann ist es ein anderer Dampfer,« sagte Hope niedergeschlagen, »der hier heißt ›Snake‹.«
»Fehlgeschossen,« lachte aber Hannes, »jetzt glaube ich erst recht, daß wir den richtigen Dampfer vor uns haben. Besieh ihn dir nur ordentlich, es ist ein alter, furchtbar schmutzig aussehender Kasten; der Rumpf ist nicht wieder gestrichen worden, seit er die Werft verlassen hat. Nur das Heck ist frisch bemalt worden, und die Buchstaben sind noch ganz weiß, sie sind neu aufgetragen worden.«
»Du hast recht, Hannes,« rief Hope fröhlich, »mein Bruder sagte ja auch, der Name würde wohl geändert werden.«
»Natürlich, ich habe ja auch meinen Namen geändert, wenn ich einmal in einer Stadt eine Dummheit gemacht hatte. Nein, wir sind auf der rechten Spur. Halloh, Jungens,« rief er seinen alten Freunden und jetzigen Matrosen zu, »wir verfolgen diesen Dampfer, steht aber nicht da und gafft ihn an, sonst schöpft er Verdacht und führt uns ein paar Wochen lang an der Nase herum.«
»Zwei Tage ist damals die ›Vesta‹ gesegelt, ehe sie die Felseninsel erreichte,« fuhr er dann zu Hope fort, »so lange braucht dieses Schiff auch, denn es macht seinem Namen Ehre, es kriecht wie eine Schlange. Snake heißt Schlange, sempiturnity Ewigkeit. Wir halten uns so weit südlich von ihm entfernt, daß wir eben noch seine Mastspitzen über Wasser sehen können.«
Am Morgen des zweiten Tages tauchte vor der ›Hoffnung‹ ein dunkler Punkt auf, den man beim Näherkommen für ein sehr großes Felsenriff hielt.
»Das könnte die Insel sein,« rief Hannes erwartungsvoll und ließ Lora auf die Kommandobrücke rufen. Ehe diese erschien, hatte man sich der Insel schon wieder bedeutend genähert.
»Sie ist es,« sagte das Mädchen sofort, »und dort, wo sich zwei spitze Kegel erheben, befindet sich die Mauer, welche die Piraten aufgebaut haben.«
Der Dampfer zeigte plötzlich ein seltsames Benehmen, es schien fast, als wolle er die Insel vermeiden, denn er steuerte jetzt viel weiter nördlich.
Die Nacht war neblig gewesen, und Hannes hatte weiter an ihn heranfahren müssen, um das Toplicht nicht zu verlieren. Hätte der Dampfer keine Lichter geführt, so würde er ihn sogar verloren haben, wenn er nicht dicht an ihn herangefahren wäre, aber glücklicherweise hatte die fremde Besatzung diese Vorsichtsmaßregel nicht angewendet.
Am Morgen befand man sich daher nicht weit von ihm, und als die Insel in Sicht kam, änderte der Dampfer sogleich seinen Kurs, sich so den Anschein gebend, als hätte er nichts bei dieser zu suchen.
Doch Hannes ließ sich nicht täuschen, dieses unschuldig aussehende Manöver bestätigte ihm sogar die böse Absicht des Dampfers.
Er ließ die ›Hoffnung‹ wieder wenden und fuhr nach Süden, als kreuze er beständig.
»Wir genieren den Dampfer furchtbar,« sagte er zu Hope, »er möchte gern nach der Insel, um ein Stündchen mit den hübschen Mädchen plaudern zu können, will aber dabei keinen Nebenbuhler haben.«
»Solange wir hier sind, wird er wohl überhaupt nicht die Insel besuchen,« meinte Hope, »er braucht es ja auch nicht. Wir kommen ihm einfach zuvor und holen die Mädchen ab. Das wird eine Freude sein!«
»Ich habe eine andere Ansicht,« entgegnete Hannes, »wir müssen den Dampfer landen lassen, denn ich bin furchtbar neugierig, zu erfahren, was diese Leute, und ganz besonders jener berühmte schwarze Mann, von dem die Mädchen wie von einem Popanz sprechen, mit den Damen zu tun haben. Dieser Unterhaltung muß ich unbedingt beiwohnen, und wenn mir dabei etwas mißfällt, na, Hope, dann arrangiere ich eine regelrechte Keilerei, mir und meinen Matrosen juckt es schon lange in den Fäusten. Sieh nur da den Bootsmann, wie er immer so wehmütig seine schwarzbraunen Hände besieht und sie sorgsam aneinander reibt, dem dauert es schon zu lange, daß er sie nicht richtig anwenden konnte.«
»Ach ja, hübsch wäre das schon,« meinte Hope, »aber der Dampfer wird nicht landen, solange er uns in Sicht hat.«
»Ich habe einen famosen Plan, wie wir ihn täuschen können,« sagte aber Hannes. »Diese Insel ist ja himmelhoch, hätte gar nicht geglaubt, daß es so hohe Felsen im Meere gibt. Wir fahren jetzt direkt nach Süden, bis wir den Dampfer nicht mehr sehen können, wenden dann und fahren wieder so heran, daß die Insel immer zwischen uns liegt. Der Dampfer ankert ohne Zweifel nicht weit von jener Mauer dort, von welcher die braunen Mädchen immer erzählen.«
»Wenn wir aber wieder um die Insel segeln,« warf Hope ein, »so werden wir entdeckt, die Leute gehen wieder auf den Dampfer und fahren davon. An die andere Seite der Insel können wir bei diesem Winde wohl kommen, aber nicht schnell genug um sie herum, dazu müssen wir kreuzen.«
»Das machen wir anders, Hope. Wir segeln gar nicht an die Mauer, sondern bleiben auf der anderen Seite vor Anker liegen, setzen Boote aus und schleichen uns dann um die Insel herum. Ehe sich's jene Leute dann versehen, sind wir bei ihnen, klettern über die Mauer und fragen sie höflich, was sie mit den Damen zu tun hätten. Treffen wir sie bei irgend etwas Unrechtem, etwa bei einer Liebelei, so geben wir den Segen dazu mit den Handspeichen und nehmen ihnen auch noch ihr niedliches Schiffchen weg.« — —
»Was haltet Ihr von dem Schiffe, Maat?« fragte an Bord des Dampfers eine Person, deren Gesicht mit einer schwarzen Maske verhüllt war, einen neben ihm stehenden, weißhaarigen und einäugigen Gesellen.
»Es ist eine Bark und segelt gut,« brummte der Gefragte mürrisch.
»Das sehe ich,« brauste der andere heftig auf. »Ich meine, ob Ihr gegen dieses Schiff Verdacht hegt. Gestern den ganzen Tag hat es sich bei uns aufgehalten, und heute früh, wie ich denke, endlich seine lästige Gesellschaft los zu sein, steht dieses verdammte Schiff wieder da.«
»Es kreuzt, daher kommt es.«
»Sollte es sich nicht absichtlich in unserer Nähe halten?«
»Quien sabe — wer weiß es?«
»Hört, Seewolf,« klang es drohend unter der Maske hervor, »benehmt Euch anders gegen mich, legt Euren gegenwärtigen Ton ab, oder ich springe anders mit Euch um. Noch habt Ihr mir zu gehorchen, noch habe ich Macht über Euch, und noch ist es Zeit, Euch das Siegel des Meisters auf die Stirn zu drücken.«
»Wie lange soll das noch dauern?« knurrte der Seewolf. »Habe ich Euch nicht die Mädchen gefangen und dort abgeliefert, wohin ich sie bringen sollte? Nun gebt mir mein Geld, oder zum Teufel damit, behaltet es, aber gebt mir die Freiheit. Doch Ihr haltet mich von einem Tage zum anderen damit hin; verdammt, wenn da einer nicht aufgebracht werden soll!«
»Ihr sollt beides haben, Geld und Freiheit,« sagte der Maskierte ruhig, »wir sind auf dem Wege, Euch nach dem amerikanischen Hafen zu bringen, wo Ihr das Land zu betreten wünscht.«
»Ihr habt aber einen anderen Kurs steuern lassen; ich sehe schon, Ihr wollt jene blutige Insel, die da vor uns liegt, anlaufen und mit den Mädchen kokettieren.«
»Wahrt Eure Zunge!«
»Ihr habt Euer Wort nicht gehalten. Ihr verspracht mir in jenem letzten, amerikanischen Hafen, mich sofort nach meinem Ziele zu bringen.«
»Werde ich auch, verlaßt Euch darauf! Dort erhaltet Ihr Eure Prämie in Gold ausgezahlt und die Freiheit dazu. Nun sagt aber, was denkt Ihr von jenem Schiffe?«
Der Seewolf war etwas beruhigt, er wandte seine Aufmerksamkeit der Bark zu, um als erfahrener Seemann sein Urteil abzugeben.
»Sie kreuzt,« behauptete er, »es ist nur ein Zufall, daß sie immer in unserer Nähe bleibt.«
»Aber ich wünsche nicht, daß sie unsere Landung an der Insel beobachtet.«
»Steuert erst einen anderen Kurs.«
Auf die Bestätigung des Maskierten gab der Seewolf, der sich hier nur als Passagier befand, dem Kapitän eine nördlichere Richtung an, und die ›Snake‹ schwenkte ab.
»Da, seht,« rief einige Minuten später der Seewolf, »jetzt ist die Bark in den Wind gekommen, sie steuert direkt nach Süden, so muß sie bald unseren Blicken entschwunden sein. Na, meinetwegen, mich geht's nichts an.«
Wirklich fuhr die Bark jetzt direkt nach Süden, mit spannender Ungeduld beobachtete der Maskierte, wie das Schiff immer kleiner und kleiner wurde, wie die Masten am Horizonte untertauchten, bis auch die Spitze des Großmastes verschwunden war.
Die ›Snake‹ hatte sich durch den neuen Kurs wieder von der Insel entfernt und war schon vorbeigefahren, doch jetzt ließ der Kapitän auf den Zuruf des Maskierten wenden und steuerte direkt auf die Insel zu, nach dem Ort, wo er schon vor einigen Tagen angelegt hatte.
Als die Anker herabrasselten, trat ein Mann, der sich bisher abseits gehalten hatte, zu dem Maskierten. Es war Tannert.
»Wollen Sie diesmal Begleitung mitnehmen?« fragte er. »Ich rate es Ihnen: die Damen könnten sich in verzweifelter Stimmung befinden.«
»Sie haben vor diesen Weibern einen gewaltigen Respekt,« klang es spöttisch hinter der Maske hervor.
»Ich habe Grund dazu, denn ich kenne die Damen,« war die Antwort. »Bedenken Sie, daß der Hunger und der Durst bei ihnen schon zu wirken begonnen haben werden, und daß unter solchen Verhältnissen der Mensch anderer Handlungen fähig ist, als in normalem Zustande.«
»Ich nehme auch so viele Matrosen mit, wie in zwei Booten Platz haben,« entgegnete der Maskierte und hing sich einen langen Mantel um. »Bestellen Sie das Herunterlassen von zwei Booten, und sorgen Sie dafür, daß ungefähr zwanzig Mann bewaffnet werden. Zwar fürchte ich mich nicht, aber ich werde die Leute vielleicht brauchen.«
Tannert führte den Auftrag aus.
Der Maskierte bestieg das zuerst ausgerüstete Boot und ließ sich, ehe es sich nach der Mauer wendete, einer Höhle zurudern, in welche er ging, aus der, er aber nach einigen Augenblicken wieder herauskam.
»Alles noch in Ordnung,« sagte er befriedigt zu dem ihn begleitenden Tannert.
Die Höhle enthielt die Granate, von welcher Ingenieur Anders gesprochen hatte.
Während das Boot an der Mauer hielt, und Vorbereitungen getroffen wurden, dieselbe zu ersteigen, stieß vom Dampfer ein anderes Boot mit zehn Matrosen ab. Nur wenige Mann blieben als Besatzung auf dem Dampfer zurück.
»Ich gehe allein,« sagte der Maskierte, die Leiter besteigend, »auf einen Ruf von mir lassen Sie alle Leute aus den Booten steigen und mir nacheilen. Nur zwei Mann bleiben darin zurück.«
Nach diesen kurzen Befehlen kletterte der Mann auf die Mauer, zog eine andere, ihm gereichte Leiter hinüber und verschwand auf der anderen Seite.
»Ich möchte, die Mädels bissen ihm den Hals durch,« murmelte der Seewolf, der aus Neugier an dieser Expedition teilgenommen hatte.
»Still,« raunte ihm Tannert zu, der aufmerksam lauschte, »behaltet Eure Bemerkungen für Euch.«
»Die Pest über ihn,« knurrte noch einmal der grimmige Alte, dann aber sprang er erschrocken auf, ebenso wie die anderen.
Ein Schrei, wie ihn nur der höchste Schrecken auspressen kann, war in ihr Ohr gedrungen.
»Hinüber und ihm zur Hilfe,« schrie Tannert und trieb die Matrosen die Leiter hinauf, »es kostet euch den Hals, kommt ihr nicht schnell genug!«
Der Seewolf war der erste, welcher die Leiter erklettert hatte. Er wünschte durchaus nicht, daß dem Herrn etwas zustieße, denn war dieser nicht mehr am Leben, so rückte seine Belohnung wieder in weite Ferne.
Der Schwarzmantel hatte ihm versichert, er habe vom Meister den Auftrag, ihm die versprochene Summe auszuzahlen, ungefähr viertausend Dollar, das heißt, die Prämie für jedes gefangene, ausgelieferte Mädchen, und jener erste Herr, der ihm für die Vernichtung der Vestalinnen eine Million Dollar versprochen, habe diese doch noch auf einer Viertelmillion stehen lassen.
Der Seewolf schmunzelte, wenn er daran dachte, daß er nun ein reicher und freier Mann sei; der Maskierte hatte ihm überdies noch versprochen, ihn nach Afrika zu bringen, wo er sich in einer großen Hafenstadt niederlassen wollte.
Aber der Maskierte mußte am Leben bleiben, sonst konnten noch große Hindernisse eintreten.
Die über die Mauer und durch die Bresche stürmenden Leute, der Seewolf an der Spitze, alle den Revolver in der Hand, fanden den Maskierten vor Entsetzen starr an der Felswand lehnen, und auch ihnen rieselte ein gewaltiger Schreck durch alle Glieder.
Die Insel war leer, völlig öde, ebenso, wie sie dieselbe vor einigen Monaten gefunden hatten, als sie die Bresche in die Felsmauer sprengen mußten.
Kein menschliches Wesen, kein Zelt, keine Kiste, kein Faß war mehr zu finden. Alles war verschwunden, selbst die Portieren vor den Höhlen.
Der Seewolf war der erste, der dieses minutenlange Schweigen brach.
»Fort sind sie,« stieß er rauh hervor, »aber was geht es mich an, ich habe sie richtig abgeliefert, ich will mein Geld und die Freiheit haben.«
»Still davon jetzt!« herrschte ihn der Maskierte mit heiserer Stimme an. »Untersucht die Höhlen, Leute, vielleicht haben sie sich nur versteckt. Und du, Seewolf, wagst du nur noch einen Ton zu sagen, so schieße ich dich wie einen tollen Hund nieder!«
»Oder ich dich,« zischte der gereizte Pirat dem Fortgehenden nach.
Die Höhlen wurden untersucht, aber außer der ehemaligen Feuerstelle und einigen Kochgerätschaften wurden keine Spuren von den Vestalinnen gefunden. Wären diese Sachen nicht zurückgelassen worden, man hätte überhaupt nichts von ihrer einstigen Anwesenheit gemerkt.

Wie vom Donner gerührt, stand der Schwarzmantel vor der ausgebrannten Feuerstelle.
»Sie sind fort,« stammelte er, »entflohen, befreit worden — alle meine Plane sind zu schanden geworden. Himmel und Hölle, warum habe ich mich verführen lassen, diese Weiber nicht gleich in die Luft zu sprengen!«
»Nicht wahr, das wäre besser gewesen,« sagte hinter ihm eine erstickte Stimme, aus welcher Wut und Hohn zugleich sprachen. »Dann hätte ich meine Million Dollar gleich verdient gehabt. Also Ihr seid der Bursche gewesen, dem ich den zweiten, unsinnigen Befehl zu verdanken gehabt habe?«
Der Seewolf war es, der, außer sich vor Wut über diese Enttäuschung, die Worte gerufen hatte.
»Aber meine versprochene Prämie will ich mir doch nicht entgehen lassen,« fuhr er zähneknirschend fort, »ich verlange sie von Euch.«
»Hund verdammter,« brauste der Maskierte auf und riß den Revolver aus der Tasche, »willst du mich noch durch deinen Unsinn reizen?«
Doch ebenso schnell blitzte ihm der Revolver des Piraten entgegen.
»Schießt, und mein Revolver wird antworten,« lachte er höhnisch.
Mit einem furchtbaren Fluche wandte sich der Schwarzmantel ab. Was nutzte ihm jetzt der Tod dieses Menschen; die Mädchen, wo waren sie, wer hatte sie befreit, wie waren sie geflohen? Diese Fragen jagten jetzt blitzschnell durch seinen Kopf.
Plötzlich befiel ihn ein neues Entsetzen, ebenso wie die anderen Leute. Von dort, wo sich die Bresche befand, ertönten Stimmen, und gleich darauf kamen gegen fünfzehn fremde Menschen aus ihr heraus, an der Spitze ein junger Mann und eine Dame.
»Ich bin in einer Falle, diese haben die Vestalinnen befreit, sie sind von der Bark,« schoß es durch des Schwarzmantels Kopf, und er erbleichte so, daß selbst die Maske dies nicht ganz verdecken konnte.
Doch sofort hatte er sich wieder zusammengerafft und erwartete mit furchtbar funkelnden Augen die Ankömmlinge, die Finger um den Revolver in der Tasche gelegt. Sein Weg ging wahrscheinlich über die Leichname dieser Fremdlinge hinweg.
»Es ist Miß Staunton, und ihren Begleiter habe ich auf dem ›Amor‹ gesehen,« murmelte er noch, dann hatten die beiden ihn erreicht.
Ihre Leute hielten sich etwas entfernt hinter ihnen, sie schienen nicht bewaffnet. Die Piraten sammelten sich schnell um den Maskierten. Sie wußten, daß es jetzt eine ernste, vielleicht furchtbare Szene geben würde; sie fühlten sich schuldbewußt, als Verbrecher, und diesen Menschen mit den ehrlichen Gesichtern gegenüber doppelt. Es waren ihre Todfeinde, die vor ihnen standen.
Wunderbarerweise schienen die beiden Ankömmlinge gar keine Notiz von den Piraten zu nehmen, sie unterhielten sich plaudernd und blieben wie zufällig nicht weit von dem Maskierten stehen.
»Die Damen scheinen nicht zu Hause zu sein, sind wahrscheinlich spazieren gefahren,« meinte eben der Mann zu der jungen Dame.
»Scherze nicht!« sagte Hope ängstlich, weil sie die Freundinnen nicht sah. »Wo mögen sie nur sein?«
»Nun, wir können ja mal fragen; diese Insel hat noch andere Kolonisten. He, Alter,« wandte sich Hannes an den nicht weit entfernten Seewolf, »könnt Ihr mir nicht verraten, wo die Damen jetzt sind, die vor zwei Monaten etwa sich hier niedergelassen haben?«
Der Seewolf antwortete nicht; mit stieren Augen glotzte er den kecken Sprecher an.
Flexan, der Maskierte, ahnte eine Komödie. Doch er war nicht willens, etwa eine komische Rolle zu spielen; entweder — oder, es mußte sofort eine Entscheidung herbeigeführt werden, denn vielleicht führte dieser Mann absichtlich eine Verzögerung derselben herbei, weil er von irgendwoher Hilfe erwartete. Die Piraten waren zwanzig Mann gegen fünfzehn, er war also mit seinen verwegenen Gesellen im Vorteil.
Mit festen Schritten trat er auf den jungen Mann zu, die hohe Gestalt in dem langen, schwarzen Mantel noch höher reckend. Seine Augen schossen stechende Blicke. »Sind Sie auf diese Insel gekommen, weil Sie uns hier vorzufinden erwarteten?« erklang es in drohendem Tone unter der Maske hervor.
Als wäre er erstaunt, plötzlich von jemandem angeredet zu werden, so wandte Hannes langsam den Kopf nach dem Sprecher und musterte ihn von oben bis unten.
»Wer sind Sie denn, daß Sie mich so ohne weiteres ansprechen?« sagte er ruhig. »Wer mit mir spricht, von dem verlange ich, daß er mir sein Gesicht zeigt. Hinter einer Maske kann sich der größte Spitzbube verstecken, und mit dem spreche ich nicht.«
»Wie soll ich diese Worte nehmen?« zischte der Maskierte, und seine Leute griffen vielsagend nach den Pistolen in ihren Gürteln.
»Wahrscheinlich so, wie ich sie sagte. Komm', Hope,« fuhr Hannes zu dieser gewandt fort und nahm ihren Arm. »Die Vestalinnen sind schon fort, diese Leute scheinen sie ebenso vergeblich gesucht zu haben, wie wir.«
Er wandte sich zum Gehen.
»Hannes,« rief in diesem Augenblick Hope warnend aus, sie hatte noch gesehen, wie der Schwarzmantel einen Revolver aus der Tasche zog, aber ihre Besorgnis war unnötig.
Hannes hatte jenen nicht aus den Augen gelassen. Blitzschnell drehte er sich um, war mit einem Sprunge bei Flexan und traf mit seiner Faust so kräftig dessen Unterarm, daß er mit einem Schmerzensschrei die Waffe fallen ließ. Im Nu hatten sich beide gepackt.
Die Umstehenden waren unterdessen keine müßigen Zuschauer geblieben.
»Dich habe ich schon lange gesucht,« brüllte der Bootsmann der ›Hoffnung‹, der in dem Seewolf denjenigen erkannt hatte, der ihm in Sydney mit dem Messer zu Leibe gegangen war. Seine Faust sauste herab, und bewußtlos fiel der alte Pirat auf die Steinplatte.
Revolver wurden sichtbar, Dolche und Messer blitzten, Auge in Auge standen sich die Männer gegenüber, schon wurden die Waffen zum tödlichen Stoß, zum nahen Schuß erhoben, als plötzlich die Arme wie gelähmt am Körper herabfielen, die meisten stürzten zu Boden, aber keiner war unter ihnen, der noch an Kampf dachte.
Ein furchtbarer Donner erschütterte die Luft, so entsetzlich, wie sie ihn noch nie gehört hatten, und dabei schwankte der Erdboden wie die aufgeregte See.
»Der Vulkan bricht aus,« schrie Hope und stürzte auf Hannes zu, der schon längst den Schwarzmantel losgelassen hatte und jeden Augenblick das Bersten des zitternden Bodens erwartete.
»Nach den Booten,« rief er dann, und plötzlich kam wieder Leben in die Erstarrten.
Schon wollten sie alle nach der Bresche stürzen, als eine neue Erscheinung ihre Schritte abermals hemmte.
Da kamen aus mehreren Höhlen zugleich viele Gestalten, die Gesichter todbleich, die Augen eingesunken, Toten ähnlich, die schon längst begraben und jetzt wieder auferstanden waren.
»Das Meer gibt seine Toten wieder,« schrie plötzlich der Seewolf. Er stürzte auf die Kniee und streckte die Arme der Gestalt entgegen, die mit stieren Augen auf ihn zugeschritten kam. »Bill, was willst du von mir? Rühre mich nicht an, Bill!«
Da wurden ihm schon von dem totgeglaubten Bill die Arme mit furchtbarer Gewalt zusammengepreßt, und im Nu lagen sie in Eisen. Immer mehr Gestalten kamen mit langsamem Schritt aus den Höhlen hervor; den Piraten sträubten sich die Haare vor Entsetzen, denn sie erkannten in ihnen ehemalige Gefährten, welche sie schon längst auf dem Meeresgrund liegen glaubten, und ehe sie noch zur Besinnung ihrer Lage kamen, fühlten sie schon ihre Hände auf dem Rücken gefesselt.
Nicht minder entsetzt waren die Matrosen der ›Hoffnung‹, ja selbst Hannes und Hope, aber die unheimlichen Menschen kümmerten sich nicht um sie, sie beschäftigten sich nur mit ihren einstigen Gefährten.
Dazu rollte noch immer der unterirdische Donner, der Boden schwankte, aber er öffnete sich nicht, um die Geister und deren Gefangene aufzunehmen.
Jetzt kam die Reihe auch an Flexan.
Langsam trat ein bleicher Mann auf ihn zu, die Handschellen vor sich haltend. Schon wollte er sie um die Hände des Bewußtlosen legen, als in diesen plötzlich wieder Leben kam.
»Verdammte Mummerei,« schrie er und sprang wie ein Tiger auf den Mann zu, warf diesen durch sein Gewicht zu Boden und setzte in langen Sprüngen durch die Reihen der verblüfften Matrosen.
Da begriff Hannes mit einem Male, um was es sich handelte; das waren keine Geister, sondern Menschen aus Fleisch und Blut, welche die Piraten gefangen nehmen wollten.
»Haltet ihn,« schrie er, riß sich von Hope los und eilte dem Flüchtlinge nach, der fast die Bresche erreicht hatte.
Aber die Flucht gelang Flexan nicht.
Kurz vor der Bresche stürzte aus einer Höhle ein Mann hervor und warf sich wie ein wütendes Tier auf den Fliehenden, ihn durch den Anprall zu Boden schleudernd.
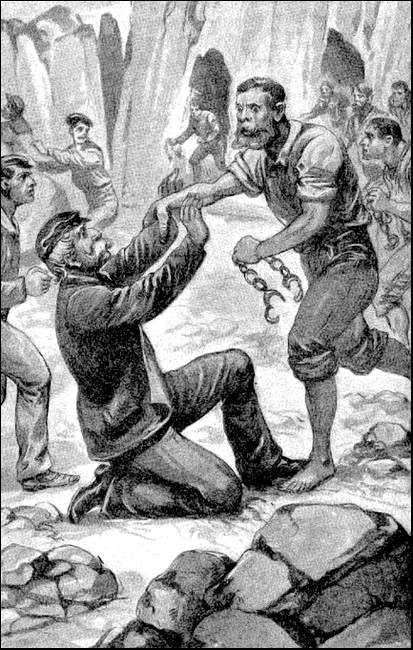
Ein großer, starker Mann warf sich wie ein wütendes Tier auf den Fliehenden.
»Habe ich dich,« schrie der große, starke Mann, der auf dem Liegenden kniete, und riß ihm die Maske vom Gesicht. »Ja, es sind dieselben Züge, die deines verfluchten Vaters; den Sohn habe ich, nun kommt er selber noch daran, Jonathan Hemmings oder Flexan, oder wie er heißt.«
Die langen, hageren Finger umschlossen krampfhaft den Hals des Bewußtlosen, er wäre erstickt, wenn Hannes nicht eine Ahnung bekommen hätte, wer der Mann mit der Maske war.
Er hatte Snatcher erkannt, und er hatte von dessen Schicksal und von Flexun, dem Stiefvater Ellens, schon genügend erfahren.
Mit Aufbietung aller seiner Kräfte gelang es ihm, den Halberstickten aus den Händen des Wütenden zu befreien, er sorgte aber dafür, daß der Schuft sich weder vom Boden erheben, noch Gebrauch von seinen Armen machen konnte.
Als Hannes sich dann emporrichtete und zurückblickte, glaubte er seinen Augen nicht trauen zu dürfen.
Eben schleppten die bleichen Männer die Gefangenen in eine Hohle hinein, aus einer anderen aber kamen viele Gestalten in Frauenkleidern heraus — die Vestalinnen.
Mit einem Jubelschrei flog Hope ihnen entgegen, schlang ihre Arme um Ellens Hals und lief von einem Mädchen zum anderen.
»Aber wundern Sie sich denn gar nicht, daß wir mit einem Male hier sind?« rief sie, als die erste Freude des Wiedersehens vorüber war. »Wir kamen, um Sie zu befreien, die ›Hoffnung‹ ist da, um Sie abzuholen.«
Die Vestalinnen wußten jedoch bereits alles; was ihnen der Ingenieur nicht erzählte, hatten sie mit eigenen Augen gesehen.
Es dauerte lange, ehe alles aufgeklärt werden konnte.
Das war also keine öde Felseninsel, sondern sie wimmelte von Menschen, und jene bleichen Männer, einst auch Piraten oder doch Verbrecher, waren jetzt Gefangene des Kapitäns Hoffmann und dessen Arbeiter.
Hannes begrüßte die Damen; er, wie auch Hope hatten jetzt ihren ganzen Humor wiedergefunden. Warum sollten sie auch nicht? Die Vestalinnen lebten, die englischen Lords lebten, und sie selbst waren ein glückliches Paar. Ihr Herz quoll über vor Seligkeit.
»Baron Schwarzburg,« rief Ellen und schüttelte dem jungen Mann herzlich die Hand, »ich gratuliere Ihnen zu Ihrem neuen Titel und Ihrer Eroberung. Dank Johannes' Mitteilungen weiß ich so ziemlich alles, Sie brauchen mir nicht erst Ihr Liebesleid und Ihre Liebesfreude zu schildern. Ankert die ›Hoffnung‹ hier? Nun fehlen in unserer Mitte nur noch die Schützlinge, welche uns ...«
Sie brauchte diesen Wunsch nicht auszusprechen, die Ersehnten kamen schon Hand in Hand aus der Bresche heraus. Heller Jubel brach unter den Damen aus, als sie die Sklavinnen wiedersahen, welche ihnen schon so oft entführt worden waren.
»Meine Damen,« sagte Hannes, nachdem er noch von dem Ingenieur begrüßt worden war, »die ›Hoffnung‹ ist bereit, Sie und Ihre Schützlinge aufzunehmen und dorthin zu bringen, wohin Sie befehlen. Wünschen Sie in die Heimat gebracht zu werden, oder sollen wir beide, Hope und ich, die braunen Damen zu den ihrigen bringen? Wir sind mit Freuden dazu bereit, denn wir wollen unsere Hochzeitsreise mit einigen Abenteuern würzen.
»Nicht so schnell, Baron,« unterbrach Ellen den fröhlichen Sprecher. »Folgen wir erst der Einladung des Mister Anders, und begeben wir uns in das Innere dieses Zauberschlosses, dort können wir uns aussprechen. Wir können von Ihrem freundlichen Anerbieten keinen Gebrauch machen.«
Alle wurden in den Saal geführt, welcher die Vestalinnen zuerst aufgenommen hatte, und die deutschen Matrosen, wie auch Hope und Hannes, glaubten zu träumen, als sich vor ihren Augen die Wunder der Insel auftaten.
Die ›Hoffnung‹ blieb ohne Besatzung draußen verankert; die ›Snake‹ war verschwunden; Hoffmanns Leute hatten das Schiff bereits geborgen.
Jetzt erfuhren die neuen Gäste das Schicksal der Vestalinnen und deren wunderbare Erlebnisse. Dank gegen Hoffmann erfüllte die Herzen aller.
Als man an der Tafel saß, setzte Herr Anders auseinander, daß die Damen noch längere Zeit auf der Insel bleiben müßten, um die Verbrecher in Sicherheit zu wiegen. Die gefangenen Piraten sollten die Arbeit auf der Insel beginnen.
»Und Flexan?« fragte Ellen.
»Den werden wir als Zeugen gegen seine Genossen und gegen seinen Onkel oder Vater gebrauchen, ebenso den Seewolf. Sie bleiben alle in unserem Gewahrsam. Snatcher hat schon gegen Ihren Stiefvater ausgesagt. Und Sie, Baron, bleiben nebst Ihrer Gemahlin bis morgen früh hier; für Ihre Leute wird gleichfalls eine Nacht an Land und in weichen Betten eine Erholung sein.«
»Aber um eins muß ich bitten,« fügte Hannes, »nämlich, daß mir die Mädchen überlasten bleiben. Ich mache es mir zur Pflicht, sie in ihre Heimat zu bringen, denn, wenn die Damen von hier abreisen, um Rechenschaft über ihre Besitzungen zu fordern, haben sie doch keine Zeit dazu.«
Nach längerem Beraten wurde dieser Vorschlag als gut erklärt. Die Mädchen sollten wieder auf die ›Hoffnung‹ kommen.
»Wir werden sie zum Schweigen über die Vorfälle bestimmen,« fuhr Hannes fort, »betreffs meiner Leute können Sie beruhigt sein, die schwatzen nicht. Haben wir, Hope und ich, diese Aufgabe gelöst, die Mädchen in die Heimat gebracht, was nicht viel Zeit in Anspruch nehmen wird, so suchen wir die englischen Herren auf und schließen uns ihnen an. Die Reise durch Südamerika machen wir zusammen, und wir wollen schon dafür sorgen, daß wir sicher den Norden erreichen, und dann, meine Damen, hoffen wir, in Ihrer Heimat einen freundlichen Empfang von Ihnen zu bekommen.«
Träge schlängelte ein kleiner Fluß sein schmutziggelbes Wasser durch die Pampas, er machte oft große Bogen, wenn er an felsigen Grund kam, und spülte an dem weicheren Ufer mit unermüdlicher Geduld die Erde ab, um sich sein Bett weiter und bequemer zu machen.
Auf einer Stelle, welche wie eine Halbinsel durch den Fluß eingeschlossen wurde, erhoben sich unter Apfelbäumen etwa zwanzig Hütten, aus Pfählen und Pferdehäuten hergestellt, und zwischen diesen trieb sich ungefähr die dreifache Anzahl von dunkelhäutigen Menschen umher. Nicht weit von diesem Zeltlager, auch noch auf der Halbinsel, weideten gegen hundert Pferde, alle an Lassos gepflöckt, so daß ihnen ein großer Weideplatz zur Verfügung stand.
Ein Stamm Penchuenchen hatte hier seine Zelte aufgeschlagen. Der Platz war sehr günstig wegen des Ueberflusses an Wasser, denn in den Pampas ist dieses nötiger als anderswo. Wenn es die roten Söhne der Wildnis auch nicht zum Waschen brauchen — Indianer nehmen nur unfreiwillige Bäder, Zeugwäsche ist ihnen ein unbekannter Begriff — so brauchen sie es doch für sich und ihre Pferde zum Trinken und zum Kochen.
Das Wasser des Flusses sah sehr unappetitlich aus, der letzte Regenguß hatte es gelb gefärbt und mit Schlammteilen vermengt, doch der Indianer prüft das Wasser nicht erst auf Klarheit, ehe er es trinkt, er beugt sich zu der ersten besten Pfütze hinab und löscht seinen Durst. Aber heute sah man trotzdem keine wasserschöpfenden Weiber, es wurden keine Kessel mit Wasser auf das Feuer gesetzt, höchstens näherten sich die Pferde, denen der lange Lasso es gestattete, dem Ufer, oder die Hunde.
Sollten die Indianer heute doch einmal das schmutzige Wasser verschmähen?
O nein, dieser Abscheu vor Wasser rührte aus einem ganz anderen Grunde her; die Fässer waren daran schuld, welche rings um das Zelt des Häuptlings aufgestellt waren, und vor denen viele Indianer andächtig und schweigsam saßen.
Die Fässer enthielten Aepfelwein. Die Pampas sind reich an großen Aepfelbaumwäldern.
Die Indianer mußten eine unnennbare Sehnsucht haben nach diesem trüben, säuerlichen Getränk. Niemand, er mochte noch so großen Durst haben, ging hinab zum Wasser, es wäre ja eine Sünde gewesen, diesen köstlichen Durst in einem so gewöhnlichen Stoff zu löschen. Je größer der Durst wurde, desto mehr freuten sie sich auf den baldigen Genuß, denn hier gab es kein Zuteilen oder Bezahlen, ein jeder trank, bis er besinnungslos zu Boden fiel, und scharfe Speisen, ja, sogar das Essen von bloßem Salz mußten bewirken, daß immer der nötige Durst vorhanden war.
Ach, wenn der Häuptling nur erst das Zeichen zum Beginn des Trinkens gegeben hätte, aber der schluckende Geier war ein gerechter Mann, zehn seiner Leute waren ausgeschickt worden, um ihm über etwas Bericht zu erstatten, und solange diese nicht zurück waren, durfte das Gelage nicht beginnen.
Der Häuptling lag vor seinem Zelte, umgeben von Fässern, dicht neben einem kleinen Gebinde, auf welches er wie liebkosend seine Hand gelegt hatte, während die andere die dampfende Pfeife hielt. Es war ein schon ältlicher Mann, dieser Häuptling, aber seine Glieder waren noch kräftig und wohlgeformt, und das Einnehmendste an ihm war sein Gesicht; es zeigte treuherzige und edle Züge, eine gewisse Liebenswürdigkeit lag darauf, wie man sie selten unter den Indianern findet. Im übrigen neigte er etwas zur Fettleibigkeit.
Der schluckende Geier hatte seinen Namen nicht davon, daß er viel Aepfelwein schlucken konnte, einen solchen Namen hätte sich der große Krieger nicht gefallen lassen. Er stammte von seinem Reichtum her, denn der schluckende Geier war wirklich sehr reich an Kriegern, Pferden, silbernen Schmucksachen, Zaumzeug, wertvollen Pfeifen und Weibern — nach dieser Reihenfolge ungefähr taxiert der Penchuenche seinen Besitz — er hatte während seiner Herrschaft ungeheures Glück gehabt, er hatte immer viele Pferde gefangen und reiche Geschenke geschluckt, und daher mochte wohl sein Name entstanden sein.
Der Häuptling trug ebenso, wie seine kräftigen Krieger, die ausgefranste Lederhose, an den Füßen riesige, wenigstens vier Zoll lange Sporen, welche aber nicht aus Stahl, sondern aus dem schwersten Silber waren, und um den Oberkörper war nachlässig, gleich einem Poncho, sein größter Schmuck, sein Stolz, mit dem er in jeder Häuptlings-Versammlung prahlte, geschlungen — ein alter Soldatenmantel. Doch er trug dieses Bekleidungsstück auf der verkehrten Seite, so daß das schwarze Tuch nach innen kam und das rote Futter, schon etwas schmutzig, prachtvoll in der Sonne leuchtete. Knöpfe waren nicht mehr daran, der Mantel wurde durch eine Schlinge am Halse zusammengehalten. Die abgeschnittenen Messingknöpfe trug der schluckende Geier, an einer Schnur gereiht, um den Nacken, und seine Frauen mußten sie immer mittels Sand in glänzendem Zustande erhalten.
Die Sonne begann schon zu sinken, aber der Durst sank nicht mit, er wuchs immer mehr. Dort das gelbe, trübe Wasser — hier der gelbe, trübe Aepfelwein — nun wählet, Penchuenchen!
Endlich! Unter den beiden ersten Zelten hockenden Indianern entstand eine Bewegung, die sich blitzschnell durch das ganze Lager fortpflanzte. Aber die Männer sprangen nicht auf, sie durften ihre Aufregung nicht verraten, das wäre schmachvoll gewesen, doch das Gemurmel und raschere Bewegungen, ein Kopfdrehen konnten nicht vermieden werden.
Am Horizont tauchten Punkte auf, die sich mit rasender Schnelligkeit dem Lager näherten, denn in der nächsten Minute schon konnte man in ihnen Reiter erkennen.
Der schluckende Geier wußte wohl, um was es sich handelte, auch er litt Durst, aber als Häuptling verriet er keine Aufregung.
Langsam erhob er sich, warf den roten Mantel gravitätisch zurück, streckte den Arm aus und sprach nur ein Wort.
Himmel, das mußte ein Zauberwort gewesen sein, alle Teufel der Welt schien es entfesselt zu haben. Die Indianer sprangen auf, schrieen, heulten und brüllten, die Kinder jauchzten; die Weiber in den Zelten kreischten, die Hunde bellten, und die Pferde bäumten und schlugen aus.
Im Nu wurde ein Faß von zwölf sehnigen Armen auf ein anderes gelegt. Andere brachten mächtige Büffelhörner herbeigeschleppt, überall flackerten plötzlich Feuer auf, unter wütendem Gebrüll wurde eine weiße Stute herbeigezogen und in der Mitte des Lagers an einen Apfelbaum gebunden — kurz, es entstand ein Höllenspektakel.
Da kamen plötzlich, wie der Wind, zehn Reiter auf schäumenden Pferden ins Lager gestürmt; fort ging es, über Feuer, Kinder, Hunde und Fässer. Unter dem Gebrüll, das diesen wilden Ritt begleitete, konnte man sein eigenes Wort nicht verstehen, eins davon klang fast wie ›Riata‹ und so undeutlich diese Meldung auch war, sie wurde doch von allen verstanden.
Ein Lärmen entstand, gegen welches das vorige noch ein Flüstern zu nennen war. Alles stürzte nach den angepflöckten Pferden, zwei Reiter konnten die Gäule nicht mehr parieren, sie kugelten sich plätschernd im Wasser, waren im nächsten Augenblick wieder im Trockenen und jagten den anderen sechzig Mann nach, die wie der Wirbelwind hinaus auf die Pampas stoben, als waren sie plötzlich alle vom Wahnsinn befallen worden.
Nur der Häuptling und die Weiber und Kinder blieben im Lager zurück.
Die plötzlich anscheinend toll gewordene Reiterschar brauste durch das hohe Gras, aber ihr Gebrüll war verstummt, man hörte nichts weiter als den donnernden Hufschlag der Pferde, und die Reiter saßen, wie aus Erz gegossen, auf dem Rücken, leicht vornüber gebeugt, die vier Meter lange, schwankende Bambuslanze hochaufgerichtet.
Vor ihnen tauchte eine kleine Reiterschar auf. Es waren sieben Mann, wahrscheinlich Weiße.
Blitzschnell waren sie von den wilden Reitern erreicht, plötzlich lagen die langen Lanzen an der Seite, die glänzenden Spitzen waren auf die Ankommenden gerichtet, die Pferde berührten mit dem Bauch fast den Boden, und jetzt erscholl markerschütternd, betäubend der gellende Kriegsruf der Penchuenchen.
Doch die Männer machten keine Miene zur Verteidigung, sie griffen nicht nach Gewehr oder Revolver, ruhig blieben sie sitzen und hielten ihre Pferde in gleichem Schritt. Sie schienen die ankommenden Feinde gar nicht einmal zu beachten, gleichgültig sahen sie geradeaus, und einer zündete sich eben seine Pfeife an.
Da hatten die Penchuenchen sie erreicht.
Pferd an Pferd, Mann an Mann, kamen sie dahergesprengt, schon berührten fast die Lanzenspitzen die Brust der weißen Reiter, als sich plötzlich der ganze Zug teilte und der Schlachtruf verstummte.
Doch sie sammelten sich wieder, ritten im Bogen zurück und wiederholten dasselbe Manöver nochmals und zum dritten Male, ohne die fremden Reiter in Unruhe bringen zu können.
Inda Riata und Don hatten ihre Schutzbefohlenen gut instruiert, je gleichgültiger man sich bei dem Willkommengruß der Penchuenchen zeigte, in desto größerer Achtung stieg man bei ihnen, und desto öfter wurde einem nachher das Büffelhorn gereicht.

Beim letzten Zusammentreffen hinter dem Rücken der Ankömmlinge war durch einen Zusammenprall ein Indianer vom Pferde geschleudert worden; im Fallen erfaßte der Penchuenche den langen Schweif seines Rosses, erhielt ein paar Huftritte, wurde von dem unbändigen Tiere einige Meter weit geschleift, ohne daß der Mann den Halt fahren ließ, dann faßte er plötzlich Fuß, kam mit großen Sätzen an die Seite des Pferdes, ein Sprung, und er saß auf dem Rücken desselben. Ein paar Hiebe mit der Faust über den Kopf waren die Strafe des Tieres, dann kam der Penchuenche zu seinen Gefährten zurückgesprengt und wollte sich über den Spaß halbtot lachen, obgleich sein Kopf und die Brust von Blut trieften.
Das Pferd hatte ihm ein Ohr abgeschlagen, auf der Brust hatte er von einer Schulter bis zur Hüfte einen zentimeterbreiten Riß und den Kopf voller Beulen.
Was wäre das Leben in den Pampas, wenn nicht manchmal so ein Spaß vorfiele!
Als die tolle Reiterschar sich den sieben Fremden zum vierten Male von vorn näherte, war die Ordnung gelöst.
»Riata — Riata — Juba Riata,« gellte es von allen Lippen. Jeder wollte sich an den Mestizen herandrängen, da aber keine Zeit zum Händeschütteln war, so suchte ihm jeder Indianer einen derben Puff auf Rücken oder Schulter beizubringen, und wäre des Mestizen Körper nicht wie von Leder gewesen, so wäre er bei diesem Zeichen der Freundschaft grün und blau geschlagen worden.
Glücklicherweise wurden unsere fünf Freunde von dieser Begrüßung verschont, ebenso Don, den man nicht kannte.
»Deine Freunde sind unsere Gäste,« brüllte ein Indianer, der den Anführer vertrat, dem Mestizen zu, »sie können das Funkeln unserer Lanzenspitzen vertragen, sie sind Männer. Uff!«
»Uff!« ertönte es im Chor, und ehe die Engländer noch wußten, was nun mit ihnen geschehen sollte, waren sie schon von den Indianern umzingelt, und fort ging es, in rasender Jagd dem Lager zu. Sie brauchten den Pferden nicht die Sporen zu geben, sie fielen, von den Mustangs angesteckt, von selbst in Karriere.
Wieder ging es in geschlossenem Trupp durchs Lager, über Kinder, Hunde und Fässer hinweg. Ein Weib wurde überritten, als es sich aber nach Passieren des Zuges vom Boden erhob, da eilte es unverletzt und scheltend in ein Zelt.
Riata war zuerst abgesprungen und trat zum Häuptling, während die übrigen noch weitere Manöver machten, immer die Gäste in der Mitte behaltend.
»Uff, Riata,« sagte der Häuptling und streckte dem Mestizen die Hand entgegen, »dein Zelt steht dort, deine Weiber haben dir das Lager bereitet, wir haben dich erwartet.«
»Ich habe Freunde mitgebracht,« antwortete Riata einfach, denn der Häuptling verschmähte, Neugier zu zeigen.
»Uff, sie sind meine Gäste.«
»Sie sind reich.«
»Was haben sie?«
»Tabak.«
Des Häuptlings Züge leuchteten auf; seine Tabakvorräte begannen zu schwinden.
»Was noch?«
»Mehr Tabak.«
Des Fragers Augen begannen zu strahlen.
»Was noch?«
»Tabak, Messer, Revolver für dich, silberne Sporen, Zaumzeug,« zählte Riata auf.
»Halt ein,« unterbrach ihn der schluckende Geier, »ist das Zaumzeug mit Silber verziert?«
»Ja, es strahlt von Silber.«
»Was weiter?«
»Wollene Decken, Pulver, Kessel, Schokolade für deine Frauen, Zucker für deine Kinder, daß sie fett werden, Pfeifen, Nadeln, bunte Wolle und,« Riata dämpfte seine Stimme herab, »und Rum.«
Der Indianer hörte mit sichtlichem Vergnügen zu, plötzlich aber überschatteten sich seine Züge wieder.
»Meine Augen sehen nichts,« sagte er, »wo sind die Geschenke der Gäste?«
»Sie kommen nach,« versicherte Juba Riata.
»Wann?«
»Ehe die Sonne dreimal untergeht.«
»Der schluckende Geier glaubt dir,« sagte jetzt der Häuptling. »Inda Riata ist ein großer Mann. Die Lüge ist ihm fremd. Seine Freunde sind willkommen.«
Die Penchuenchen waren aufgesprungen und führten die sechs Mann im Triumph dem Häuptling zu. Um Juba kümmerten sie sich nicht, der war einer der Ihrigen.
Aber auch der schluckende Geier begrüßte seine Gäste nicht mit Worten, sondern auf eine andere feierliche, manchem vielleicht sehr angenehme Art.
Eigenhändig entkorkte er mittels eines Messers das hochgelegte Faß, und ein starker Strahl Apfelwein sprudelte in das vorgehaltene Horn. Als dieses voll war, hielt schon ein anderer Indianer ein neues vor. Einen Hahn gab es hier nicht, der Trank floß so lange in die rechtzeitig vorgehaltenen Hörner, bis das Faß leer war, und daß er nicht danebenfloß, daß leere Büffelhörner immer rechtzeitig vorhanden waren, dafür sorgten schon die durstigen Indianer.
Mit gravitätischer Bewegung hielt der Häuptling das Büffelhorn dem von Don vorgeschobenen Williams hin, der es ergriff, an den Mund setzte und einen kräftigen Zug von dem säuerlich, aber gut schmeckenden Getränk tat. Dann wollte er es Lord Harrlington hinreichen.
»Aus, aus!« ermahnte ihn aber Don lächelnd. »Trinkt Ihr es nicht aus, so fühlt sich der Häuptling höchlichst beleidigt.«
»Gerechter Gott,« dachte Charles, »da sind wenigstens vier Liter darin.« Aber er gehorchte, schluckte, schluckte und schluckte und reichte endlich mit einem tiefen Seufzer das geleerte Horn dem Häuptlinge zurück.
»Je schneller Ihr es austrinkt, desto höher steigt Ihr in der Achtung der Indianer,« flüsterte Don dem jetzt an die Reihe kommenden Lord Harrlington zu.
Harrlington war kein starker Trinker, doch er nahm sich zusammen. Langsam, aber ohne abzusetzen leerte er das Horn, welches nun an Davids kam.
»Wie schmeckt es denn?« fragte Hendricks in banger Besorgnis seine Freunde.
»Köstlich, nie habe ich einen besseren Trunk getan,« log Charles, bei dem sich der Schalk zu regen begann. »Ich könnte zwei Hörner voll hintereinander austrinken.«
Dabei fühlte sich Williams aber ganz unsagbar elend, der Magen war bis zum Platzen angefüllt, der saure Stoff wühlte unheimlich darin herum, und den Mund hätte er am liebsten von einem Ohre bis zum anderen verzogen, wenn er seinen Freunden nicht den Appetit hätte verderben wollen.
Außerdem fühlte er den Alkohol der vier Liter Apfelwein sich schon zu Kopfe steigen; er brauchte nur noch einen Schluck zu trinken, und er war vollkommen betrunken.
Das konnte ja gut werden.
Davids hatte das Horn ebenfalls langsam, aber auf einen Zug geleert; die umstehenden Indianer, welche schon wacker tranken, murmelten beifällig.
Jetzt kam Hendricks an die Reihe.
Mutig setzte er das Büffelhorn an den Mund, trank und spuckte den ersten Schluck wieder aus, aber ein Blick des Häuptlings belehrte ihn, daß dieser kostbare Stoff nicht zum Wegspucken wäre. Wieder trank er, seufzte, stöhnte, schluckte, drückte und gluckte, bis er den Trank halb hinunter hatte.
»Schmeckt wie Nektar, nicht?« sagte Charles und stieß ihn in die Seite.
Der arme Hendricks! Plötzlich fühlte er Lust zum Lachen, und ehe er es verhindern konnte, brach es schon los. Aus Nase und Mund kam der Apfelwein wieder heraus, und hätten ihm die Indianer nicht mit sicherem Griff das Büffelhorn aus der Hand genommen, so wäre der köstliche Wein verschüttet worden.
»Kein starker Mann,« sagte der Häuptling kopfschüttelnd, und die Indianer nickten mißbilligend.
Aber dann brachen sie in ein donnerndes Beifallsrufen aus, Lord Hastings hatte den ihm gereichten Wein hintergegossen, als hätte er nur ein Gläschen zu leeren gehabt. Das war ihr Mann, vor dem hatten sie Respekt, aber sie sollten noch mehr Respekt vor ihren Gästen bekommen. Diese mußten sich neben den Häuptling setzen, Don, der Pampasjäger, ebenfalls ein wackerer Zecher, mit ihnen, und das Büffelhorn wanderte von Hand zu Hand, und jedesmal, wenn der schluckende Geier ihnen das Horn reichte, flüsterte er ihnen geheimnisvoll zu, daß bald etwas Besseres kommen würde.
Sie brauchten das Horn jetzt nicht mehr auf einen Zug zu leeren, ein guter Schluck genügte. Es wurde von des Häuptlings Tochter gefüllt und überbracht, einem reizenden, sechzehnjährigen Mädchen, in einem Gewande aus weißgegerbten Antilopenfellen. Die Indianer machten ihr jedesmal ehrerbietig Platz, wenn sie sich dem Fasse näherte, und wenn der Wein ihr nicht schnell genug floß, weil sich eine Apfelschale vor das Spundloch gesetzt hatte, so steckte sie ihr niedliches Fingerchen ins Loch, so daß der Wein über ihren entblößten, rotbraunen Arm floß.
Juba Riata hatte sich unter die Indianer gemengt, welche in weitem Bogen um das Faß herumsaßen und sich mit vollem Behagen diesem im Jahre nur einmal wiederkehrenden Genüsse Hingaben. Wenigstens zehn Hörner waren immer unterwegs. An einem Ende wurden dieselben gefüllt, und auf dem anderen wanderten sie leer zurück. Die Indianer tranken tüchtig, kein Tropfen blieb dann.
Mit regem Interesse sahen die Gäste diesem Gelage zu.
Gott im Himmel, was können diese Indianer trinken! Wer es nicht gesehen hat, hält es nicht für möglich. Schlucken gibt es gar nicht, der saure Wein fließt nur so durch die Kehlen.
Was sie ansetzen, trinken sie aus, ohne einmal Atem zu schöpfen; ich glaube, ein nettes Fäßchen würde kein anderes Los haben, als mit einem Zuge ausgetrunken zu werden. Dabei kennen sie keine Magenbeschwerden. Kann derselbe das Getränk nicht mehr fassen, so entledigen sie sich hinter einem Zelte der unnötigen Last und kehren mit einem Durst zurück, als hätten sie wochenlang keinen Tropfen über die Lippen gebracht.
Nur ein Volk gibt es noch, welches die Penchuenchen im Trinken übertrifft, das sind die Bewohner des Kaukasus. Auch sie stürzen zur Zeit der Weinernte große Büffelhörner, die aber nicht mit Apfelwein, sondern mit dem schweren, roten Wein ihrer Berge gefüllt sind, ohne abzusetzen, hinunter. Und so ein Horn faßt ungefähr sechs unserer Rotweinflaschen, etwas mehr oder etwas weniger.
Der Wein erfreut des Menschen Herz — und wenn es auch nur Apfelwein ist. Die Augen der Indianer begannen zu leuchten, die sonst so schweigsamen Zungen lösten sich. Manchmal sprang einer aus der Reihe und begann einen monotonen Gesang, dessen Refrain die anderen mitsangen, oder führte einen wilden Tanz aus.
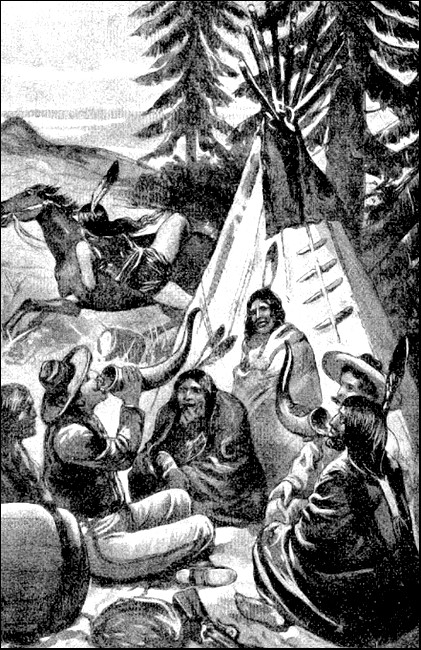
Die Augen der Indianer begannen zu leuchten,
die sonst so schweigsamen Zungen lösten sich.
»In einer Stunde gleicht der Ort einem Lager von Teufeln,« sagte Don und reichte das Horn seinem Nachbar Harrlington.
»Kommen nie Ausschreitungen vor? Streitigkeiten oder Roheiten?«
»Selten. Die Indianer bleiben gemütlich, bis sie wie tot umfallen.«
Auch die Herren wurden fröhlicher. Der Wein trieb ihnen die Sorgen um die Zukunft aus den Herzen; selbst Davids' Augen begannen zu leuchten.
Unter den Penchuenchen saß auch jener, dem sein Pferd übel mitgespielt hatte. Den Kopf mit dem abgeschlagenen Ohr hatte er verbunden, die Brust zeigte aber die offene Wunde, aus welcher das Blut noch hervorsickerte. Doch den Mann genierten solche Kleinigkeiten nicht, er stürzte den Apfelwein mit ebensolchem Wohlbehagen hinunter, wie die anderen.
»Er kann den Brand davontragen,« sagte Davids zu Don, »wenn die Wunde während der kalten Nacht offen bleibt.«
»Quien sabe! So oder so, einmal muß er doch sterben,« sagte der philosophische Jäger.
»Ich will ihn verbinden, ich habe Verbandzeug bei mir.«
Don redete mit dem Häuptling in dessen Sprache; der Indianer nickte lebhaft und wandte sich dann an Davids.
»Du Medizinmann?« fragte er in gebrochenem Englisch
David bejahte.
»Gut, du sollst den kranken Mann heilen.«
Der Verwundete wurde gerufen, und als die anderen erfuhren, um was es sich handelte, umdrängten sie die Gruppe, in deren Mitte sich der Indianer begeben mußte.
Davids entnahm seiner Tasche ein Päckchen Watte, Bandagen und ein Besteck und legte dem Indianer einen kunstvollen Verband um das Ohr. Die desinfizierende Watte verhütete jede Eiterung, die sonst unfehlbar eingetreten wäre und vielleicht eine Blutvergiftung bewirkt hätte.
Dann bedeutete Davids dem Indianer, sich auf den Boden zu legen, was dieser tat, indem er aber dabei eine heillose Angst verriet. Er bebte an allen Gliedern, dieser Mann wäre unbedenklich in die Lanzen der Feinde gelaufen und hätte dabei gelacht, aber von einem Medizinmann, und noch dazu von einem weißen, behandelt zu werden, das jagte ihm Entsetzen ein, denn dabei kamen Geister ins Spiel.
Davids zog aus dem Besteck eine Schere heraus, und kaum erblickte der Indianer das blitzende Instrument, als er erschrocken aufsprang und schreiend davonlief; doch kehrte er unter dem Gelächter seiner Genossen zurück, als ihm bedeutet wurde, daß nur das Pflaster zerschnitten werden solle.
Die Wunde auf der Brust wurde ausgewaschen und mit einem Pflaster verdeckt. Die Enden der Wunde, wo die Haut nur geschlitzt war, nähte Davids zusammen, und erschrocken blickten die Indianer auf den Medizinmann, der dies so kaltblütig tun konnte, als hätte er es mit einem zerrissenen Hemd zu tun.
Der Indianer hielt vollkommen still unter der schmerzenden Nadel, die Umstehenden flüsterten, das weiße Pflaster mit den breiten Querstreifen sehe wunderschön aus, man beneidete den Genossen um diesen Schmuck.
»Hei,« schrie der schluckende Geier, »mir auch ein Pflaster, aber noch schöner.«
Auf Jubas Rat gab Davids diesem sonderbaren Verlangen nach; er schmückte nicht nur des Häuptlings Brust mit Kreuz- und Querstreifen, sondern auch dessen Rücken und Gesicht. Der Häuptling war glücklich; zwar sah er aus, wie ein über und über mit Wunden bedeckter Mensch, aber sein Gesicht strahlte vor Entzücken, und seine aus dem Zelt gekommenen Weiber klatschten in die Hände und jubelten über ihren schönen Gebieter.
»Nun sage dem Verwundeten, Don, er dürfe nicht mehr trinken, sonst würde sein Blut zu sehr erhitzt, und er könnte schädliche Folgen davontragen.«
Kaum war dem Indianer dies übersetzt worden, so machte er Anstalten, das Pflaster wieder von der Wunde zu reißen. Nur den Bemühungen Davids' und Dons gelang es, ihn davon abzuhalten.
»Wenn ich nicht mehr trinken darf, dann will ich kein Pflaster haben,« lautete die Antwort des durstigen Kriegers.
»Dann trinke weiter!« entgegnete Davids.
Auch der Häuptling fragte den Medizinmann im geheimen, ob er mit dem Pflaster weitertrinken könne, ohne daß die bösen Geister ihm deswegen zürnten, und er war sehr fröhlich, als Davids es ihm erlaubte.
Nach dieser kleinen Unterbrechung nahm das Zechgelage seinen ungestörten Fortgang, nur daß die Indianer übermütiger wurden und nicht mehr auf der Erde hockten, sondern herumrannten, einander in die Arme fielen, heulten, sich gegenseitig ins Wasser warfen und andere Späße ausführten. Ab und zu fiel es auch einem Indianer ein, sich plötzlich auf ein Pferd zu werfen, in rasender Karriere davonzujagen und fünf Minuten später das schweißtriefende Tier wieder anzupflöcken. Oder ein Indianer produzierte sich auch in seiner Reitfertigkeit, saß bald auf dem Halse des Pferdes, hing dann an dessen Bauch, rannte hinter ihm her, sich am Schwanz festhaltend, und so weiter.
In Hendricks Kopf blitzte ein Gedanke auf. Der Wein hatte den Geist nicht so umnebelt, wie sie anfangs geglaubt. Man konnte schon eine reichliche Quantität davon vertragen. Nur der erste Trunk war etwas zu anstrengend gewesen.
»Können deine Krieger auch auf dem Kopfe reiten?« fragte Hendricks den Häuptling.
»Auf dem Kopfe? Nein, das geht nicht, da fällt man um,« entgegnete der schluckende Geier erstaunt.
»In meiner Heimat wird viel auf dem Kopfe geritten,« sagte Hendricks gleichgültig.
»Was, auf dem Kopfe? Das sollst du uns vormachen. Das Pferd, auf welchem du so reiten kannst, gehört dir.«
Der Häuptling rief seinen Begleitern etwas zu. Ein lautes Gelächter erscholl, und sofort wurde ein gesatteltes Pferd vor Hendricks geführt. Spöttisch sahen die Indianer auf den Mann, der die Steigbügel abnahm und in den Sattel sprang. Er hatte ja nicht einmal das Horn austrinken können, wie sollte er auf dem Kopfe reiten können, was keiner von ihnen vermochte, was überhaupt nicht ging?
Edgar Hendricks war kein besonderer Reiter, er hatte noch niemals ein wildes Pferd gebändigt, aber er war sehr gewandt. Auf seiner Besitzung in Devonshire besaß er eine eigene Reitschule, in der er mehrere Stunden jedes Tages verbrachte, und wo er Reiterstückchen gelernt hatte, um die ihn mancher Zirkuskünstler beneiden konnte.
Hendricks ließ das Pferd ausgreifen, wendete es, und als er durch die Zeltgasse jagte, stand er kerzengerade auf dem Kopfe, sich nur der Hände als Stütze noch bedienend. Beim Zurückreiten ließ er eine Hand los, ergriff die Zügel und ließ das Pferd noch über ein Faß springen, ohne seine Stellung zu verändern.
Mit der grenzenlosesten Ehrfurcht wurde er alsbald von den Indianern umringt. Das Kunststück hatte seinen guten Namen wiederhergestellt. Selbst Hastings' Ruf als großer Trinker wurde durch diese Leistung verdunkelt.
Gleich darauf hatte aber auch er Gelegenheit, die Indianer mit neuer Bewunderung zu erfüllen.
Das erste Faß war leer, ein zweites sollte auf das Gestell gehoben werden, aber sechs Mann konnten dieses kaum emporheben, und mehr Hände hatten nicht Raum, es anzufassen.
»Platz da!« rief der vom Wein lebhaft gewordene Hastings, sprang hinzu, stieß die Indianer weg, ein Griff, ein Schwung — und das Faß lag auf dem Gestell.
Hatten die Indianer über Hendricks Leistung gejubelt, so betrachteten sie den starken Engländer mit stummer Bewunderung. Scheu wichen sie ihm aus, und nur der Häuptling glaubte ein Recht zu haben, näher an ihn heranzukommen.
Mit allen Zeichen der Hochachtung trat er vor Hastings, und als dieser ihn lächelnd ansah, wagte er sogar, den Körper des Starken wie den eines Schlachtviehs zu betasten. Er untersuchte die Muskeln des Lords.
»Du stärker als Krieger,« staunte der schluckende Geier. »Ich niemals so etwas gesehen habe.«
»Ist es so etwas Wunderbares?« lachte Hastings, erwischte zwei Indianer an den Gürteln, hob sie vom Boden auf und hielt sie fast eine halbe Minute in den ausgestreckten Armen, in jeder Hand einen.
Die Indianer waren außer sich; sie wollten weitere Beweise dieser Körperkraft sehen, und Lord Hastings mußte auf ihren Wunsch ein leeres Faß über ein Zelt werfen, einen armdicken Ast über dem Kopfe durchbrechen, einen um seine Hand geschlungenen Strick durchreißen. Schließlich machte er sich selber anheischig, ein an den Füßen gefesseltes Pferd auf dem Nacken durch das Lager zu tragen.
»Bist du auch so stark?« wandte der schluckende Geier sich an Lord Harrlington, als sich die Jubelrufe gelegt hatten.
»Ich bin nicht so stark wie mein Freund,« entgegnete der Lord und griff nach der Winchesterbüchse, »aber ich will euch etwas zeigen, was ihr auch nicht oft sehen werdet.«
Der bereits instruierte Charles hatte sechzehn Aepfel von einem Baume gepflückt. Harrlington ließ dieselben besichtigen, ging fünfzehn Schritte zurück, und als Charles schnell hintereinander die sechzehn Früchte in die Luft warf, knallte jedesmal ein Schuß aus der Büchse Harrlingtons.
Das grenzte an Zauberei. Jeder Apfel hatte in der Mitte ein Loch, er war also von einer Kugel durchbohrt worden, und außerdem war es ein Wunder, sechzehnmal schießen zu können, ohne wieder laden zu müssen.
Der schluckende Geier wich zurück, als Harrlington ihm das Gewehr hinhielt, um dessen Konstruktion zu erklären.
Die Penchuenchen machen keinen Gebrauch von Gewehren, höchstens von Revolvern, weil ihnen jene beim Reiten hinderlich sind. Ihre Waffe, mit der sie ein fernes Ziel zu erreichen suchen, ist der Lasso, die schon früher beschriebene Bola und die Bleikugel am kurzen Riemen; aber trotzdem nötigt ein guter Schütze ihnen stets Achtung ab.
Der schluckende Geier fühlte sich überstolz, solche Gaste in seinem Lager zu haben. Einen Mann, der auf dem Kopfe reiten konnte, einen, dessen Kraft nichts widerstand, den besten Schützen, den er je gesehen, und einen Medizinmann, der Wunden zusammennähen konnte, wie ein Indianer einen zerrissenen Mokassin, wenn er sich weitab vom Zelte auf der Reise befand.
»Ihr habt gute Freunde bekommen,« sagte Juba Riata zu Harrlington. »Der Häuptling sowohl, wie seine Krieger gehen für Euch durchs Feuer.«
Obgleich die Magen der Indianer mit Apfelwein bis zum Springen gefüllt waren, wurde der Hunger dadurch nicht beschwichtigt, er machte sich jetzt fühlbar.
Das vorher abgesonderte weiße Pferd wurde von dem Lasso befreit, und das Tier, durch die Trennung von seinen Kameraden und das wüste Lärmen schon sowieso ängstlich gemacht, flog, von einigen Hieben angefeuert, in die Pampas hinaus.
Im Nu saßen ein Dutzend Penchuenchen auf ihren Mustangs und jagten hinter dem Flüchtlinge her, die Bolas um die Köpfe schwingend, und durch ihr wildes Geschrei den Schimmel zu immer schnellerem Laufe antreibend.
Sie hatten sich verteilt, und oftmals wäre es ihnen bereits möglich gewesen, das Tier mit der Bola zu fangen, aber sie unterließen dies noch; immer ließen sie die geängstigte Stute wieder einen Ausweg zur weiteren Flucht finden.
»Was soll das bedeuten?« fragte Charles verwundert Don. »Warum befreien sie das Pferd, jagen ihm nach und fangen es doch nicht?«
»Sie wollen sein Fleisch schmackhafter machen,« antwortete Don lachend.
Dem Engländer wurde der Zweck dieser wilden Jagd bald klar.
Nach zehn Minuten brachten die Indianer das über und über schäumende und dampfende Pferd doch zurück; sie führten es wieder unter die Aepfelbäume. Im Nu lag ihm um den Hals ein starker Lasso, welcher über einen Ast lief. Es wurde emporgezogen, und als es schon mit den Vorderfüßen in der Luft strampelte, wurde über seinen Hals ein haarscharfes Messer gezogen.
Ein dicker Blutstrahl entquoll der klaffenden Wunde, aber er erreichte nicht den Boden, sondern wurde in einer hölzernen Schale aufgefangen.
»Das Fleisch schmeckt besser,« erklärte Don, »wenn das Tier vorher gejagt worden ist, so sagen wenigstens die Indianer, und das Blut fließt schneller und ballt sich nicht so leicht in Klumpen, wenn das Tier mit den Füßen um sich schlägt, wie es jetzt tut.«
»Wir sollen doch nicht etwa Pferdefleisch essen?« meinte Hastings, sich schüttelnd. »Ich rühre keinen Bissen an, das sage ich vorher.«
»Dann werdet Ihr hungern müssen, es gibt nichts anderes. Die Indianer sind überhaupt schlauer als Ihr, sie wissen, daß Pferdefleisch besser schmeckt als jedes andere.«
Don hatte recht. Es ist schade, daß gegen das Pferd als Schlachtvieh ein so großes, völlig unbegründetes Vorurteil herrscht. Das Pferdefleisch enthält ein Drittel Nährstoff mehr und ist außerdem gesünder, denn das Pferd bleibt von vielen Krankheiten verschont, von welchen das Rind befallen wird, zum Beispiel Tuberkulose, und so weiter.
Unbedingt würde sich nach Ueberwindung des Vorurteiles gegen den Genuß von Pferdefleisch die Pferdezucht heben, sie würde sich sowohl vergrößern, als auch veredeln, weil man nur die schönsten Tiere als Zug- und Reittiere behalten, die anderen dagegen schlachten würde.
Hastings sah ein, daß ihm nichts übrig blieb, als nach dem Spruche: ländlich — sittlich — sich auch an einem Pferdesteak zu delektieren, wollte er nicht wieder an dem zähen, nach Leder schmeckenden, getrockneten Büffelfleisch, Pemmikan genannt, kauen. Doch vorläufig wurden erst Vorbereitungen zum Abendessen getroffen, Feuer angeschürt und der Schimmel zerlegt.
Die Freunde wurden von Juba zum Häuptling gerufen, welcher unterdes das Fäßchen, auf dem er den ganzen Nachmittag gesessen, mit eigener Hand entspundet hatte.
Er reichte dem zuerst ankommenden Hendricks mit wohlwollendem Lächeln einen gefüllten Literbecher.
»Das ist eine bessere Sorte Wein,« dachte Hendricks, als er den Becher zum Munde führte, aber beim ersten Schluck glaubte er, die Kehle müsse ihm verbrennen.
»Guter Brandy« Brandy ist der englische Name für Branntwein, aber auch für Kognak. flüsterte der Häuptling ihm zu, »wir acht Männer das ganze Faß austrinken.«
Es war aber kein Kognak, sondern gewöhnlicher Spiritus, den der schluckende Geier sich auf irgend einer Faktorei gegen einige Pferde eingetauscht hatte. Doch das machte nichts, die Hauptsache war, daß er in der Kehle brannte, und das tat er zur Genüge, wie unsere Freunde einer nach dem anderen erfuhren.
Es half ihnen nichts, jeder mußte den Becher an die Lippen führen, wollte er den Häuptling nicht erzürnen, aber zum Austrinken, wie Juba Riata sie wiederholt ermahnte, waren sie nicht zu bewegen. Das konnten nur der schluckende Geier und Riata, vielleicht hätten es auch die übrigen Indianer vermocht, aber diese mußten sich alle zusammen mit einem Büffelhorn begnügen, aus welchem das edle Getränk jedem in einem Pulvermäßchen zugeteilt wurde.
Daraus, wie sie das Maß ausleckten, konnte man ersehen, wie sehr sie den Spiritus liebten.
Der Abend, die Nacht brach an, aber es wurde weiter gezecht. Im Scheine von Feuern, welche von weithergetragenem Holze genährt wurden, lagen die Indianer am Boden und brüllten ihre monotonen Gesänge entweder zum Himmel auf oder in die Erde hinein, Heldengesänge, welche 200 bis 300 Verse hatten, und bei jedem Vers sangen die übrigen einen endlosen Refrain mit. Nur das Büffelhorn brachte ab und zu eine Unterbrechung hervor, oder wenn die hungrigen Magen nach einem saftigen Pferdesteak begehrten.
Und unsere Freunde?
Sie tranken ebenfalls Apfelwein, dann wieder Spiritus und schworen dem schluckenden Geier, nie etwas lieblicheres getrunken zu haben. Von Holztellern aßen sie gebratenes Pferdefleisch, und sie löffelten sogar mit Don zusammen eine große Schüssel einer dunkelroten, pfeffrigen Substanz aus, welche sehr angenehm schmeckte.
Vergebens versuchten sie Don zu überreden, ihnen mitzuteilen, was für eine Speise dies sei, solange noch etwas in der Schüssel war, hielt der Pampasjäger reinen Mund. Als aber der letzte Bissen verschlungen war, sagte er:
»Wenn Ihr nach England zurückkommt, so erzählt, was ihr hier gegessen habt: es war Pferdeblut, vermischt mit Cayennepfeffer.«
Fort stürzte Hendricks, und der ihm besorgt nachfolgende Williams fand ihn in einem unbeschreiblichen Zustande hinter einem Zelt. Doch der Spiritus kurierte den Kranken wieder, es wurde weitergetrunken, die Indianer brüllten und tanzten, bis einer nach dem anderen zu Boden sank, um einen langen Schlaf zu tun. Da, wohin er fiel, blieb er liegen, ein anderer Indianer stolperte über ihn hinweg und stand nicht wieder auf — weil er nicht konnte.
Das gleiche Schicksal hatte Don, und er stolperte über keinen anderen als Williams. Auch dieser war seiner Glieder nicht mehr mächtig, aber er war doch noch bei Besinnung.
»Don,« lallte er mit schwerer Zunge, »mein lieber, guter Don, mir ist so furchtbar weh zumute.«
»Mir nicht,« entgegnete Don, gleichfalls lallend.
»Was machen wir denn morgen?«
»Trinken,« war die lakonische Antwort.
»Trinken? Um Gottes willen, ich habe schon jetzt zuviel getrunken, ich halte es nicht mehr aus.«
»Zuviel ist niemals gut, nur zuviel trinken ist gerade genug,« bemerkte der philosophische Don.
»Was soll denn aber aus Miß Petersen werden?« fragte Williams in weinerlichem Tone.
»Zur Hölle mit Eurer Miß Petersen, Ihr Narren, laßt das Weib einen Indianer heiraten.«
Don antwortete nicht mehr, er schlief, und Charles mußte bald seinem Beispiel folgen.
Die Feuer waren erloschen, und um sie her lagen die betrunkenen Indianer. Nur ein einziges Feuer flackerte noch schwach, und vor diesem saßen auf einem kleinen Faß zwei Männer Arm in Arm und tranken sich zu, fortwährend einander die gegenseitige Hochachtung beteuernd — Lord Hastings und der schluckende Geier.
Der Lord sagte: »Du bist ein großer Häuptling.« Der schluckende Geier sagte: »Du bist ein tapferer Trinker,« und dann tranken die beiden jedesmal gemeinschaftlich ein Büffelhorn mit Apfelwein aus.
Auch ihr Feuer erlosch endlich. Der Mond beleuchtete die Szene, aber die beiden unverwüstlichen Zecher, mit denen sich selbst der eiserne Juba nicht messen konnte, hätten nicht einmal des Lichtes bedurft. Solange sie den Mund finden konnten, genügte es.

»Uff,« sagte der Häuptling, »du bist ein tapferer Trinker, wenn das große Wasser kommt, wird der schluckende Geier dir eine trockene Stelle zeigen.«
»Du bist ein großer Häuptling. Was für ein großes Wasser ist das?«
»Der Strom.«
Der Lord verstand nicht, was der Häuptling meinte, nur erinnerte er sich, daß Juba früher von der bald eintretenden Regenzeit gesprochen hatte.
»Willst du meine Freunde auch mitnehmen?« fragte er dann.
»Alle, alle,« rief der Indianer, stand auf und wollte die Arme ausbreiten, um seine Worte begreiflicher zu machen, schlug aber rückwärts über das Faß und war sofort eingeschlafen.
Ob Charles diese Nacht wieder geträumt hatte, wußte er selbst nicht, aber jedenfalls war es ihm beim Erwachen abermals, als flösse Wasser über ihn hinweg, und zwar besonders über Kopf, Gesicht und Hals. Es war ihm nicht unangenehm, im Gegenteil, äußerst wohltuend, denn es kühlte seinen brennenden Kopf, in dem entsetzliche Schmerzen wüteten.
Mit einem Male erschreckte ihn ein starkes Plätschern, welches so laut und deutlich an sein Ohr schlug, daß er erschrocken auffuhr, in der Meinung, die gestrige Nacht wiederhole sich, aber er sah bald, daß er nicht nur geträumt hatte.
Charles blickte gerade einem indianischen Weibe ins Gesicht, welches sich eben über ihn beugte und aus einem Kruge gelbes, schmutziges Flußwasser langsam über seinen Kopf laufen ließ. Der kühlende Strahl tat ihm so gut, daß er noch ein paar Minuten still hielt, ohne zum klaren Bewußtsein der Situation zu kommen.
Er sah, wie noch mehrere Weiber umherstanden und den schlafenden Indianern Wasser über die Köpfe gossen; sie weckten ihre betrunkenen Ehegatten am Morgen aus dem Schlafe, und die überzähligen Weiber taten dies aus Gefälligkeit auch mit den Engländern.
Lachend sprang Charles auf; mit einem Fluche erhob sich Hastings, sich wie ein Pudel das Wasser abschüttelnd, und einem Indianer nach dem anderen gelang es mit Hilfe seiner Frau, sich auf die Beine zu stellen. Kaum war dies etwa zehn Männern geglückt, als sie daran gingen — nicht etwa Toilette zu machen — nein, ein neues Faß Apfelwein aufzulegen. Der Häuptling gab das Signal zum Beginn des neuen Gelages, und die Morgensonne beleuchtete schon wieder trinkende Indianer.
Charles fiel ein, was ihm Don am Abend gesagt hatte, er blickte sich nach dem Pampasjäger um, konnte ihn aber nirgends entdecken. Eben wollte er sich an Juba Riata wenden, als dieser schon von Harrlington gefragt wurde:
»Wo ist Don?«
Juba blickte nach den Pferden.
»Richtig, sein Pferd ist schon weg, also Don auch,« sagte er dann. »Er ist zeitig aufgewacht. Er hat eine gesunde Natur. Don reitet nach Villa Rica und bringt Eure Freunde direkt hierher.«
Die Engländer freuten sich, dieses zu hören.
»Freut Euch nicht zu zeitig,« sagte Juba, »ich fürchte, die Regenzeit bricht diesmal eher los, auch der schluckende Geier und seine Leute glauben dies. Haben sich Eure Freunde nicht beeilt, so daß Don sie nicht antrifft, so kann es leicht sein, daß wir ohne sie abziehen müssen und sie erst später treffen. Gegen die Überschwemmung hilft nur Flucht.«
Jetzt begriff Hastings mit einem Male, was der Häuptling mit dem ›großen Wasser‹ gemeint hatte: die baldige Überschwemmung der Pampas.
»Wohin gehen wir, wenn die Pampas unter Wasser steht?« fragte er.
»Die Indianer kennen hochgelegene Flecken, welche vom Wasser nie erreicht werden.«
»Wie lange dauert die Überschwemmung?«
»Unter Umständen vier Wochen.«
»Und wovon leben wir in dieser Zeit? Die Indianer führen doch keine Vorräte mit sich.«
»Nicht?« lachte Juba. »Auf jeden Mann kommt ein Pferd. Das reicht schon. Und diese Hügel wimmeln außerdem noch von Tieren.«
»Wenn bis dahin wenigstens unsere Freunde bei uns sind,« dachten seufzend die Engländer.
Noch drei Tage dauerte das Gelage, und wäre mehr Apfelwein vorhanden gewesen, so hätte es eben so lange gedauert, bis er weggetrunken war. Am dritten Tage wurde das sechsundzwanzigste Faß ausgetrunken, und unter dem Apfelbaum lagen die Häute von acht geschlachteten Pferden — gewiß eine ansehnliche Leistung.
Das letzte Faß und das letzte Pferd wanderten am Abend schon unter strömendem Regen in den Magen der Indianer, das Gelage mußte in Zelten fortgesetzt werden, die Regenzeit hatte begonnen, und Don war mit den Freunden noch nicht zurück.
»Die Regenzeit setzt diesmal früh ein und gleich mit kolossaler Heftigkeit,« sagte Juba zu unseren Freunden, als er noch nüchtern war. »Ist Don morgen nicht hier, so können wir nicht mehr auf ihn warten. Morgen schlafen sich die Indianer von ihrem Rausch aus, und übermorgen geht es nach den Hügeln.«
»Wird uns Don wiederfinden, wenn er wochenlang von uns getrennt bleibt?«
»Warum nicht?« entgegnete Juba und wandte seine Aufmerksamkeit dem Horne zu.
Das waren trübe Aussichten, aber es konnte nicht geändert werden. Alles geschah so, wie Juba gesagt hatte.
Am Abend legten sich die Indianer zum letzten Male betrunken schlafen, die Engländer in Jubas Zelt, und standen am folgenden Tage gar nicht auf. Was hätte das auch für Zweck gehabt? Der Apfelwein war ja alle. Sie sprachen nicht einmal miteinander, denn ihre Kehlen waren vom Singen und Trinken wie Reibeisen geworden, ihre Sprache glich nur noch einem heiseren Grunzen.
Es goß fortgesetzt vom Himmel; plätschernd schlug der Regen gegen die Pferdehäute der Zelte, und es war ein Glück, daß die Penchuenchen es verstehen, dieselben wasserdicht herzustellen. Durch die Dorfgasse rieselten unzählige Wasserbäche dem Westen zu, und die ganze Pampa glich, wenn man in die Ferne sah, einem ungeheuren Stromnetz. Ueberall flossen die grauen Bächlein, immer mehr schwollen sie, ab und zu vereinigten sich zwei, und nicht lange konnte es dauern, so glich die Glasfläche nur noch einer See mit Inseln.
Am folgenden Morgen war der Regen toller als je. Beim ersten, nebligen Tageslicht suchte Juba Riata den Häuptling auf, der sich gar nicht mehr sehen ließ, sondern im Zelte seiner Weiber den Katzenjammer ausschlief, jedoch manchmal durch Juba, seinen intimen Freund, den Engländern einen Gruß zuschicken ließ.
Für das Pferdefleisch sorgte der Mestize, die Engländer waren seine Gäste.
»Der schluckende Geier kann nicht mehr auf Eure Freunde warten,« sagte Juba achselzuckend, als er wieder ins Zelt trat, »das Wasser steigt immer höher, er muß der Gefahr ausweichen. Er hat zwei Krieger ausgeschickt, um nach dem Strom zu sehen, den wir passiert haben. Droht er auszutreten, dann müssen wir unverzüglich fliehen, wollen wir nicht alle ersaufen.«
»Aber unsere Freunde! Was wird denn ihr Los sein?« fragte Lord Harrlington.
»Don ist zu erfahren in den Pampas, um sich von der Überschwemmung überraschen zu lassen. Entweder hat er die Reise gar nicht angetreten, weil er weiß, daß der Strom jetzt nicht mehr zu passieren ist, oder er sitzt mit Euren Freunden bereits auf einem Hügel und wartet im Zelte ab, bis der Regen nachgelassen und das Wasser sich wieder verlaufen hat.«
Eben hatte Juba das letzte Wort gesprochen, als zwei Reiter durch das Lager sprengten und sich vor dem Zelte des Häuptlings vom Rosse warfen. Sie riefen nur ein Wort in das Zelt hinein, aber es fand sofort allgemeinen Widerhall, der Häuptling kam herausgerannt, die Indianer stürzten aus den Zelten und zu den Pferden, und alle riefen das gleiche Wort.
»Der Strom kommt,« rief jetzt auch Juba. »Zu den Pferden! In fünf Minuten sind die Zelte abgebrochen, dann geht es fort. Schnürt euer Gepäck.«
Als hätte ein Wirbelwind das Lager niedergerissen, so klappten die ledernen Zelte plötzlich zusammen, und noch waren keine fünf Minuten vorbei, so lagen die Felle schon zusammengeschnürt auf den Rücken der Pferde, einige mußten die Zeltstangen schleppen, und ebenso schnell waren andere mit dem wenigen Gepäck der Indianer beschwert.
Die Männer selbst verrichteten die wenigste Arbeit dabei, sie stellten fast nur die Arbeitenden an, und höchstens wenn einer derselben oder die Frau unter der Last zusammenzubrechen drohte, griff er mit an, aber erst verabreichte er dem Betreffenden derbe Hiebe oder gar Fußtritte.
Es gibt keine bedauernswerteren Geschöpfe unter Gottes schöner Sonne, als die indianischen Frauen. Sie haben eine schöne Kinderzeit; als erwachsenes Mädchen genießen sie noch vollkommene Freiheit, fertigen höchstens leichte Stickereien für Vater und Geschwister, und auch die Periode, während welcher sie von einem Krieger geliebt werden, ist schön zu nennen. Der Indianer ist seiner Geliebten wirklich bis in den Tod ergeben, treu, zärtlich, und seine Aufmerksamkeit gegen sie kennt keine Grenzen. Er hungert für sie, kämpft für sie, ja, sie braucht nur zu winken, und ihr Geliebter würde alles tun, was sie fordert, könnte er dadurch die verlorene Neigung wiedergewinnen.
Die Indianer haben dieselbe Sitte, wie so viele asiatische Volksstämme. Bei ihnen heißt es, wie bei den Kurden:
Geraubt muß das Liebchen sein.
Unter Lachen und Scherzen wird die Braut auf schnellem Rosse entführt, die Verwandten suchen die Flüchtigen einzuholen, doch nur zum Schein — so schreibt es die Sitte vor — denn der Bräutigam hat ja seine Zukünftige durch so und so viele Pferde, Felle, Sattel und so weiter vom Vater erkaufen müssen.
Die Flitterwochen währen nur kurze Zeit, dann fängt das Unglück des indianischen Weibes an. Man kann wohl sagen, sie ist fortan kein menschliches Geschöpf mehr. Ein Sklave auf einer Baumwollen-Plantage hat ein bei weitem besseres Los, als die Frau eines Indianers.
Derselbe kann nicht lange im Zelte ausharren, er muß hinaus auf die Jagd, und damit beginnt die Arbeit der Weiber. Sie müssen die Felle waschen und gerben, in Nordamerika sogar die erbeuteten Büffel erst ins Lager schleppen, eine sehr schwere Arbeit, vor allen Dingen aber die Zelte abbrechen und wieder aufstellen.
Arbeitet die Frau nicht genug oder zu langsam, so erhält sie schon drei Wochen nach der Hochzeit erst Schelte und böse Worte, dann Schläge, und nach der Ankunft des ersten Kindes wird sie nicht besser als ein Tier behandelt. Mit Fußtritten wird sie gezwungen, an die Arbeit zu gehen.
Lebenslängliches Siechtum ist die Folge; daher sieht man nie ein indianisches Weib, welches hübsch zu nennen ist, während man unter den Mädchen viele Schönheiten trifft. Uebermäßige Arbeit und schlechte Behandlung machen die Squaws bald zu vorzeitig gealterten und häßlichen Megären.
Unter den Augen ihrer strengen Gebieter brachen auch hier die Frauen die Zelte ab. Wunderbar schnell war alles verschwunden, was noch eben gestanden hatte; die Männer sprangen auf die Pferde, die Weiber setzten sich ebenfalls rittlings auf die ihrigen, und fort ging es, dem Osten zu.
Der Regen ließ nicht nach, er nahm noch immer zu, und die Pampa glich wirklich einem See. Noch reichte das Wasser nur bis an die Fesseln der Pferde, aber man konnte schon merken, wie schnell es stieg. Der ausgetretene Strom machte sich bemerkbar.

Der Regen ließ nicht nach, und die Pampa glich einem See.
Gegen Mittag erreichte der die Bande führende Häuptling einen hohen, leicht bewaldeten Hügel, auf dem sofort Fuß gefaßt wurde. Während die Weiber die Zelte wieder aufschlugen, machten die Indianer unter lautem Halloh Jagd auf die Unmasse von Tieren, welche an diesem sicheren Orte Schutz vor dem Wasser gesucht hatten.
Schon bei dem Kommen der Indianer war ein Trupp Mustangs geflüchtet und jagte nun, das Wasser in hohem Bogen aufspritzen lassend, in die Pampas hinaus, um einen anderen, hochgelegenen Ort aufzusuchen.
Diese in Beispiel konnten die kleineren Tiere nicht folgen, sie wären dabei ertrunken.
Die Indianer erbeuteten daher eine Unmasse von Hasen, Kaninchen und anderen Nagetieren, töteten einige Schakale, Wölfe und Kojotes, und schließlich zahllose Ratten und Mäuse, welche den Raubtieren eine willkommene Nahrung während der Ueberschwemmungszeit geboten hätten.
»Hier bleiben wir, bis das Wasser sich verlaufen hat,« sagte Juba zu den Engländern, »und Ihr seid meine Gäste. Macht Euch auf vier Wochen gefaßt, die können wir hier zubringen.«
Es war zum Verzweifeln. Unseren Freunden begann der Mut zu sinken. Sie mußten untätig hier liegen bleiben, während Miß Petersen in der Gewalt des springenden Panthers war. Sie erinnerten sich noch recht gut der Worte des Pampasjägers, einige Wochen warteten die Penchuenchen wohl, dann aber machten sie die geraubten Mädchen zu ihren Sklavinnen, wenn nicht zu ihren Weibern, welche noch mehr Verachtung zu ertragen haben, als jene.
Ein Tag verstrich nach dem anderen. Ein ewiger Regen plätscherte von dem bleigrauen Himmel gegen die Häute der Zelte, und das Auge sah nichts als einen endlosen See, aus dem sich hier und da ein Inselchen erhob. Charles konnte durch sein Taschenfernrohr lebende Wesen auf ihnen erkennen, darunter auch Mustangs, welche ebenfalls das Verlaufen des Wassers abwarten mußten, aber keine Menschen.
Wer wußte, auf welchem Hügel jetzt der springende Panther mit seinen Kriegern und seinen Gefangenen lebte! Ach, er war vielleicht Hunderte von Meilen entfernt.
Wenn die Indianer nicht schliefen, was sie meist taten, so rauchten sie oder schwatzten oder aßen, aber das Fleisch konnte nur durch Klopfen halbgar gemacht werden, weil es an Brennholz mangelte. Das Holz der Apfelbäume war so grün, daß an ein Feuermachen gar nicht zu denken war. Ueberhaupt war alles naß. Anfangs blieb zwar das Innere der Zelte trocken, später wurden aber durch das öftere Aus- und Eingehen auch alle Gegenstände im Zelte feucht, so daß es ungemütlich zu werden begann. Man fror in der Nacht.
Die Engländer konnten nichts tun, als wie die Indianer, rauchen, essen, schlafen — zum Plaudern fehlte ihnen die Lust, dafür aber grübelten sie um so mehr, und das heitert den Menschen nie auf.
Aus den Tagen wurde eine Woche; auf die erste Woche folgte eine zweite, dann eine dritte, und der Regen hatte noch nicht nachgelassen. Das Wasser stieg immer noch. Die untersten Zelte hatten schon abgebrochen und weiter oben auf dem Hügel aufgebaut werden müssen, und jeden Morgen musterten die Indianer das steigende Wasser. Aber noch erhob sich ja der Hügel, noch konnte das Wasser zwei Meter steigen, ehe sie alle zusammengedrängt mit ihren Pferden auf einem Flecke standen, und die Indianer kannten keine Sorge um die Zukunft.
Harrlington hatte vorgeschlagen, mit Hilfe der Zeltstangen aus den Häuten Boote zu machen, war aber von Juba einfach mit der Bemerkung abgewiesen worden, die Penchuenchen verständen sich nicht auf so etwas. Sie könnten nichts anderes, als was sie von ihren Vätern erlernt hätten, und das sei in diesem Falle: Warten. Der Regen würde schon aufhören und das Wasser sich verlaufen.
Drei Wochen waren schon in solch trostloser Lage vergangen, als der Regen nachließ und schließlich ganz aufhörte; das Wasser begann zu fallen. Die Engländer jubelten, den Indianern war es gleichgültig, aber auch sie sehnten sich nach dem längstvermißten Anblick der Sonne. Die Regenzeit ist ihnen ganz angenehm, sie verschlafen dieselbe, wenn die Decken nur trocken sind, damit sie nicht zu frieren brauchen.
Das Wasser fiel immer mehr. Schon sah man die Mustangs ihre Insel verlassen, um erträglichere, hochgelegene Weiden aufzusuchen. Die armen Tiere waren während der drei Wochen auf der beschränkten Weide sehr abgemagert.
Es ist merkwürdig, wie klug sich die Mustangs bei Ueberschwemmung der Pampas zeigen. Sie wissen recht gut, daß sie für einige Wochen von dem Grase leben müssen, das auf dem betreffenden Hügel wächst, welcher sie vor dem Ertrinken rettet, und daß sie, wenn ihrer zu viele sind, hungern oder gar verhungern müssen. Ist die Herde daher eine sehr große, so teilt sie sich und besetzt zwei Hügel; nie aber dulden sie, daß andere Pferde auf denselben kommen, weil dadurch ihre Nahrung geschmälert wird. Mit Bissen und Hufschlägen werden die Neuankommenden ins Wasser zurückgetrieben.
Der schluckende Geier kam eines Morgens zu den Engländern ins Zelt. Das Wasser stand nur noch meterhoch.
»Wißt ihr bestimmt, daß eure Freunde euch aufsuchen werden?« fragte er.
»Ganz bestimmt.«
»Und werden sie auch Geschenke mitbringen?«
»Auch das ist sicher. Wir bleiben so lange bei dir, bis du die versprochenen Geschenke erhalten hast.«
»Ich glaube euch. So werde ich so lange mit meinen Kriegern warten, bis sie hier sind. Das Wasser wird bald verlaufen sein.«
»Wäre es Apfelwein, die Indianer hätten die Pampas trocken getrunken,« dachte Charles, und laut sagte er: »Können wir Weißen den springenden Panther nicht allein aufsuchen?«
»Nein,« entgegnete Juba für den Häuptling. »Ohne Geschenke könnt Ihr bei dem nicht viel ausrichten, denn ich kann nicht, wie hier, für Euch gut sagen. Ich kenne wohl den springenden Panther und er mich, aber wir sind keine Freunde, wie der schluckende Geier und ich. Doch dieser Häuptling sagt Euch seine Hilfe während der Reise zu, er gibt Euch Krieger mit, und so werdet Ihr bei dem springenden Panther einen besseren Empfang haben. Seid dem Häuptling dafür dankbar!«
»Wann wird Don Eurer Berechnung nach hier ankommen, Juba?« fragte Harrlington.
»In zwei Tagen kann sich das Wasser verlaufen haben,« meinte der Mestize, »vielleicht, daß Don dann schon zu uns stößt, denn er kann ja in fußhohem Wasser reiten lassen; vielleicht kommt er später, wenn er Unglück gehabt hat. Einzelne Pferde können leicht in Löcher stürzen, die das Wasser verdeckt.«
»Wolle Gott, sie wären erst da!« seufzte Harrlington.
»Das schlimmste ist überstanden,« tröstete ihn Davids, »wir haben wenigstens Hoffnung, weiterzukommen.«
Die zwei Tage waren vergangen, und am Morgen des dritten Tages stieß Charles ein Jubelgeschrei aus. Durch die Ritze der beiden vor dem Zelteingang hängenden Decken fiel ein goldener Strahl der aufgehenden Sonne. Im Nu waren die Freunde draußen und fanden schon die Indianer sich in der Sonne wärmen. Alle begrüßten freudig die langentbehrte Lebensquelle.
Das Wasser hatte sich während der Nacht vollkommen verlaufen. Zwar war der Boden noch nicht trocken, aber doch begannen sich die Grashalme in dem zurückgelassenen, gelben, äußerst fruchtbaren Schlamm wieder aufzurichten. Sie reckten die Spitzen der Sonne entgegen.
Die Indianer unternahmen kleine Ausflüge, um die steifgewordenen Pferde, von denen so manches fehlte, weil es aufgegessen worden war, wieder in Bewegung zu bringen, und auch die Engländer konnten der Versuchung nicht widerstehen, die wundgelegenen Glieder wieder zu gebrauchen. Es war eine Lust, so über die Pampas zu jagen, spritzte auch der gelbe Schlamm bis hinauf ins Gesicht, das machte nichts, und da sie westlich ritten, so war vielleicht Hoffnung vorhanden, den ankommenden Freunden zu begegnen.
Aber sie trafen dieselben nicht. Erst am Nachmittag kehrten sie nach dem Hügel zurück, und unterwegs sprachen sie dem mitgerittenen Juba die Befürchtung aus, daß Don sie nicht finden könnte. Die Pampas wären groß, unermeßlich weit, wie sollte Don da gerade diesen Ort finden, wo sie lagen.
»Der schluckende Geier hat ihm gesagt, wohin er sich wenden soll, um ihn zu finden, und Don eilt direkten Weges auf das Ziel.«
»Ohne Kompaß?« fragte ein Engländer zweifelnd.
»Die Sonne und der Schatten dienen ihm als Kompaß,« war die Antwort.
Es war gegen Abend; die Sonne stand wie ein glühender Ball am Horizont, welcher vom Nebel umrahmt war, während die Luft in der Nähe des Berges völlig klar blieb. Die Engländer saßen im Zelte Jubas und aßen seit langer Zeit das erste warme Gericht, über getrocknetem Pferdemist gebratenes Fleisch, als vor den Zelten plötzlich ein Lärm entstand.
Juba horchte, ließ den Knochen aus der Hand fallen und sprang auf.
»Das blaue Bild zeigt sich,« rief er, »kommt und seht es Euch an.«
Er eilte hinaus, und die Engländer folgten ihm, begierig, zu erfahren, was mit dem blauen Bilde gemeint sei, welches die Indianer, ganz ihrer Gewohnheit zuwider, so in Aufregung versetzte.
»Eine Fata Morgana,« sagte Charles, nach Osten in die Höhe deutend. »Ein Schiff! Wunderbar!«
Fast über ihnen, etwas östlich, schwebte ein Schiff in der Luft. Es sah fast aus, als wäre es an den blauen Firmament genagelt, aber vorläufig war das Bild noch nicht recht deutlich.
Eine solche Fata Morgana ist eine Luftspiegelung, welche Wüstenreisenden Menschen, Oasen oder Landschaften vorzaubert, die sich an weit entfernten Orten befinden. Die Erscheinung wird durch eine Brechung der Sonnenstrahlen im Nebel erzeugt; das Bild wird auf eine andere Nebelschicht an der Erde oder auch auf eine dünne Wolkenschicht am Himmel geworfen. Ersteres ist besonders der Fall in der Wüste, letzteres in sumpfigen Grasebenen, so zum Beispiel in Südamerika, tritt aber dort viel seltener und meist nach der Regenzeit auf.
Eine derartige Erscheinung war hier zu sehen. Vielleicht tausend Meilen entfernt trieb auf dem Ozean ein Schiff, und die Sonnenstrahlen warfen sein Bild auf eine Wolke. Man konnte bemerken, wie das Schiff nach und nach kleiner, aber auch immer deutlicher wurde.
Staunend betrachteten es die Engländer, zitternd die unwissenden Indianer.
»Es ist ein Segelschiff,« rief Hendricks jetzt.
»Jedenfalls wie ein Vollschiff getakelt,« brummte Hastings. »Ob es einen Schornstein hat oder nicht, kann man nicht behaupten. Es muß erst noch deutlicher werden.«
»Sechs Raaen an jedem Mast,« zählte Charles. »Es ist kein Dampfer, sondern ein Segelschiff, die Masten sind zu hoch. Außerdem müßte man jetzt den Schornstein erkennen können.«
Das Bild wurde immer kleiner und immer deutlicher.
»Wahrhaftig, man kann sogar die Mannschaft erkennen!« rief Harrlington erstaunt. »Da — jetzt krabbeln die winzigen Dinger auf dem Großmast herum.«
Charles versuchte vergebens, mittels des Fernrohrs das Bild näher heranzuziehen. Das optische Instrument blieb hier wirkungslos.
»Die Farbe ist weiß,« sagte Davids, »ist die Flagge an der Stange nicht das amerikanische Sternenbanner? Können Sie nicht schon die Flagge am Top...«
»Mein Gott,« schrie plötzlich Harrlington auf und preßte den Arm des neben ihm stehenden Williams mit den Fingern, »es ist die ›Vesta‹!«
»Nicht möglich,« lächelte Charles.
»Und doch, sie ist es. Sehen Sie den Bau an die Takelage, alles so, wie auf der ›Vesta‹, das Sternenbanner, und ich glaube ganz sicher, die das Feuer schürende Priesterin erkennen zu können.«
»Wahrhaftig,« rief da auch Davids, »es kann nur die ›Vesta‹ sein. Die ›Vesta‹, die untergegangene ›Vesta‹!«
Davids schlug sich vor die Stirn, als zweifelte er an seinem Verstand. Harrlingtons Glieder bebten, und auch die anderen Freunde waren außer sich vor Staunen.
Es war kein Zweifel mehr, das Bildchen dort oben war die verkleinerte ›Vesta‹, ganz genau so, wie sie dieselbe früher gesehen hatten. Aber die ›Vesta‹ war doch untergegangen?
»Seit wann zaubert die Fata Morgana Bilder der Vergangenheit?« murmelte Davids.
»Die Fata Morgana zeigt nur die Wirklichkeit,« schrie Harrlington und stürzte mit ausgestreckten Armen vorwärts, als wolle er das Phantom erhaschen, »es ist die ›Vesta‹.«
»Halt, nur bedachtsam,« unterbrach ihn Williams. »Kann es nicht ein Schiff sein, welches den Namen der ›Vesta‹ angenommen hat und ganz nach deren Muster erbaut worden ist?«
»Nein, es ist die ›Vesta‹, ich weiß es,« schrie Harrlington, der sich wie wahnsinnig gebärdete, »ich kann ja dort Ellen stehen sehen. Sehen Sie nicht, wie sie mir winkt, wie sie lächelt?«
»Harrlington,« bat Hastings und legte dem Freunde beide Hände auf die Schultern, »nehmen Sie doch Vernunft an, Sie erschrecken mich ja! Die ›Vesta‹ ist doch untergegangen und Miß Petersen von den Indianern geraubt worden!«
Wie gebrochen sank Harrlington zusammen.
»Sie haben recht,« stöhnte er. »Es kann nicht die ›Vesta‹ sein. Und, doch, diese Aehnlichkeit!«
Williams hatte unterdes das Bild am Firmamente ebenfalls betrachtet. Es hatte seine deutlichste Form angenommen, schon begann es wieder zu wachsen und zu verschwimmen.
»Das Schiff heißt aber doch ›Vesta‹,« rief jetzt Charles wieder. »Soeben konnte ich seinen Namen deutlich am Heck lesen. ›Vesta, New-York!‹ Was soll man davon halten, meine Herren?«
»Machen Sie mir keine trügerische Hoffnung,« bat Harrlington, »oder ich werde wahnsinnig. Um Gottes willen, was kann mir Klarheit bringen, damit dieser plötzlich aufsteigende Zweifel ein Ende findet?«
»Dieser Brief,« ertönte da neben den Herren eine Stimme, und plötzlich stand Don in ihrer Mitte, dem Lord ein großes, versiegeltes Schreiben hinhaltend.
Don kam nicht allein, er war nur denen, welche er führte, vorausgeritten. Hinter ihm kamen die übrigen englischen Herren. Keiner hatte sich geweigert, dem Rufe Harringtons zu folgen, selbst Hannibal und Kasegorus befanden sich neben der stattlichen Anzahl von Packpferden, welche den Zug beschlossen. Doch Harrlington hatte keine Zeit, seine Gefährten zu bewillkommnen. Er achtete nicht auf die Worte des treuen Hannibal, noch auf die sich um den Häuptling scharenden Indianer. Sein Auge hing wie gebannt auf dem ihm von Don gegebenen Briefe.

»Gut oder schlecht?« fragte Charles, der den Lord besorgt betrachtete.
Langsam wandte der Lord den Kopf seinem Freunde zu, sah ihn einen Augenblick wie geistesabwesend an, dann aber stürzte er mit einem Jubelschrei auf ihn zu und fiel ihm um den Hals.
»Gut, sehr gut, mein lieber Charles,« rief er ein Mal über das andere. »He, Don, wer überbrachte dir dieses Schreiben?«
»Derselbe, der den Brief unterzeichnet hat.«
Harrlington riß die Augen auf.
»Wie, du kennst ihn?«
»Natürlich kenne ich Nikolas Sharp, ich habe mich vor vielen Jahren mit ihm zusammen in den Pampas herumgetrieben.«
»Meine Herren,« rief Harrlington den Freunden zu, welche sich noch über das am Himmel stehende, undeutlich werdende Bild besprachen, »das Schiff ist die ›Vesta‹ sie hat keinen Schiffbruch gelitten, sie existiert noch und mit ihr die Besatzung. Innerhalb einiger Wochen können wir die Damen wiedersehen.«
Und damit reichte er den teils jubelnden, teils zweifelnden Herren den Brief des amerikanischen Detektiven.
Man hört öfters die Meinung, die Städte im fernen Westen oder im fernen Süden müßten recht elende Ortschaften sein, besonders die im südlichen Amerika, schmutzig, mit ungepflasterten Straßen, kleinen, aus Holz aufgeführten Häusern, in denen ein von Ungeziefer strotzendes Gesindel wohnt, die Hotels seien wahre Räuberherbergen und so weiter, und so ist der Reisende beim Besuch dieser fremden Städte verwundert, wie sehr er sich getäuscht hat.
Er tritt in breite Straßen mit Palästen, Kirchen und öffentlichen Gebäuden; jedes Wohnhaus ist eine kleine Villa; man sieht die elegantesten Damentoiletten; die Herren sind, als kämen sie von einer Festlichkeit, in Frack, weiße Weste und Zylinder gekleidet, und nichts vermißt man, was die Zivilisation der europäischen Städte den Einwohnern bietet. Eisenbahnen, Pferdebahnen, auch elektrische Bahnen, Equipagen, Post, Telegraphen, die feinsten Hotels, die prächtigsten Schaufenster, Polizei, Militär und so weiter sind vorhanden. Kurz, die südamerikanischen Städte stehen den europäischen in nichts nach, einige, wie zum Beispiel Rio de Janeiro, Montevideo, Valparaiso und Santiago übertreffen sie noch an Pracht und Reichtum, einfach daher, weil sie keine alten Gebäude aufzuweisen haben, denn alle diese Städte sind ja neueren Ursprungs.
Es gibt aber Vorstädte, in welchen der unkundige Reisende das gedachte Bild vorfinden würde; enge, schmutzige Straßen, baufällige Häuser und Menschen mit listigen, scheuen Physiognomien; aber dahin braucht er nicht zu gehen; er kommt überhaupt selten dorthin, weil sie die Wohnorte der arbeitenden, spanischen oder eingeborenen Bevölkerung sind, bei denen er nichts zu suchen hat. Geschäfte findet er dort überhaupt nicht, höchstens elende Kramläden.
Auch Santiago in Chile, achtzig Meilen von Valparaiso entfernt, ist eine Stadt, welche allen Anforderungen einer Hauptstadt entspricht. Schöne Villen wechseln mit großen Geschäftshäusern ab, in deren Schaufenstern alles ausgestellt ist, was man in Paris, Berlin oder London kauft, und Schilder zeigen an, daß in vielen Häusern Bureaus eingerichtet sind.
In deutschen Zeitungen findet man öfter Annoncen, deren Inhalt lautet:
»Für das Ausland, Nord- und Südamerika, Afrika, Australien werden deutsche Gouvernanten, Kindergärtnerinnen, Dienstmädchen und so weiter gesucht. Freie Reise, beste Bedingungen. Man wende sich vertrauensvoll an den und den.«
Ach, da steigt in manchem Herzen wohl der Wunsch auf, dem Rufe zu folgen. Es ist doch etwas Schönes, fremde Menschen und fremde Länder zu sehen, man kann ja jederzeit in die Heimat zurückkehren, wenn es einem nicht gefällt. Zu schade, daß man an die Familie gebunden ist, an Eltern, Geschwister oder andere Verwandte, denen zuliebe man nicht ohne weiteres der Sehnsucht seines Herzens folgen darf.
Aber spaßeshalber schreibt man an die betreffende Agentur, vielleicht nach Hamburg, und erhält sofort jede Auskunft über die Stellung.
Wie staunt man über den Gehalt, der geboten wird!
Gouvernanten, Deutsch, Französisch und Englisch sprechend, erhalten monatlich achtzig Dollar bei freier Station, ohne diese zweihundert Dollar. Kindermädchen fünfundvierzig Dollar mit freier Station, Dienstmädchen dreißig Dollar, Kellnerinnen in seinen Hotels fünfundzwanzig Dollar inklusive Toilette, Mädchen für Landwirtschaft zwanzig Dollar und so weiter.
Gewöhnlich bittet der Agent, im Falle der Annahme eines Engagements, um die Photographie und sichert strengste Diskretion zu.
Man kann ihm glauben, daß er nicht viel über das abgeschlossene Geschäft plaudern wird.
Ach, wie schade, daß man diese glänzenden Bedingungen nicht annehmen kann, sonst würde man nach einigen Jahren mit einem hübschen Vermögen zurückkehren, wenn man nicht vielleicht draußen sein Glück finden sollte.
Das Glück! — —
›Vermittlungs-Bureau‹ nannte sich das Geschäft, welches in einer Seitengasse der Hauptstraße von Santiago lag. Es war nur eine kleine Stube mit einem Schreibtisch, zwei Stühlen und einem Regal ausgerüstet, in welch letzterem wenige Bücher standen, aber dem Aussehen des wohlbeleibten Herrn nach zu schließen, welcher am Schreibtisch sitzend, die Feder führte, mußte das Geschäft seinen Mann nähren, und zwar sehr gut.
Noch ein anderer Herr befand sich im Zimmer und sah dem Schreibenden zu, ein junger, hübscher, äußerst geckenhaft aufgeputzter Mensch, mit Lackschuhen, gelben Glacéhandschuhen und einer Rose im Knopfloch.
»So, hier haben Sie die Bescheinigung,« sagte der dicke Herr in näselndem Tone, faltete das beschriebene Papier zusammen, steckte es in ein Kuvert und reichte es dem Gecken. »Seien Sie recht zuvorkommend gegen sie und halten Sie sich nicht länger auf als nötig. Heute nachmittag erwarte ich Sie bestimmt zurück, ich habe es Senor Pueblo sicher versprochen.«
»So soll sie schon heute abend ihre Stellung antreten?« fragte der Stutzer, das Kuvert einsteckend.
»Wenn sie auch noch nicht beschäftigt wird, so will sie Senor Pueblo doch wenigstens in seinem Hause haben. Er ist ein ängstlicher Mensch und sehr besorgt um seine Pflegebefohlene.«
Es lag etwas Spöttisches in dem Tone, in dem der Dicke diese Worte sprach.
»Beeilen Sie sich,« fuhr er dann zu dem Stutzer fort. »Die ›Florida‹ wird um elf Uhr in Valparaiso erwartet, muß aber bis abends sechs Uhr auf der Reede bleiben, weil dann erst Flut ist. Das ist günstig für Sie, so können Sie das Mädchen gleich mit einem Boote abholen, dadurch, wird alles Aufsehen vermieden.«
»All right,« sagte der Stutzer, eine goldene Uhr hervorziehend. »Es ist erst um acht, um zehn Uhr bin ich in Valparaiso, hole die Dame sofort ab, diniere mit ihr und komme dann direkt hierher. Good bye.«
»Dehnen Sie das Diner nicht zu lange aus,« rief der Dicke dem Fortgehenden nach.
Der Stutzer sprang in eine vorüberfahrende Pferdebahn, die an dem Bahnhof vorbeikam, und schon zehn Minuten später saß er in dem Zuge, der in zwei Stunden Valparaiso erreicht.
Wenn man aus dem Bahnhof von Valparaiso tritt, bietet sich dem Auge sofort das Panorama des Hafens dar, des größten an der Westküste Südamerikas. Schiffe aller Nationen ankern dicht an dem Quai, im Bassin liegen sie eng nebeneinander, und da die Reede eine sehr gesicherte ist, so bleiben viele Schiffe tagelang draußen liegen, ehe sie in den Hafen kommen, um die Ladung zu löschen, das heißt, um die Waren auszuladen oder neue einzunehmen. Auch der Verkehr von Passagierdampfern ist ein äußerst reger.
Der junge Mann schlenderte am Quai auf und ab. Er fragte einmal einen Hafenbeamten, für wann die ›Florida‹ angemeldet sei, und erfuhr, daß sie laut Depesche bereits den nördlichen Leuchtturm passiert habe. In einer Viertelstunde müßte man die Masten sehen können.
Der Wartende zündete sich eine Zigarette an und schlenderte weiter an dem blauen Wasser entlang, er merkte nicht, wie ein Herr auf ihn zukam, bis derselbe ihn ansprach.
»Bitte um Entschuldigung,« sagte der ebenfalls junge, aber einfach gekleidete Mann auf englisch zu dem Stutzer, »ich kann mich nicht mit dem Beamten verständigen, weil ich des Spanischen nicht mächtig bin.«
»Ich spreche Englisch,« sagte der Stutzer höflich. »Womit kann ich dienen?«
»Ich möchte gern von einem Beamten erfahren, wann die ›Florida‹ hier eintrifft.«
»Auch ich habe mich danach erkundigt; in einer halben Stunde können wir an Bord gehen.«
»Danke,« sagte der des Spanischen Unkundige, zog den Hut und entfernte sich.
»Ein Grünfink,« dachte der Stutzer, »jedenfalls ein Deutscher, denn er spricht ein schlechtes Englisch. Wetter, sollte das schon die ›Florida‹ sein?« unterbrach er sich und blickte nach dem Horizont, wo man die Rauchwolken eines Dampfers aufsteigen sah. »Dann ist sie verdammt schnell gefahren.«
Nach zehn Minuten hatte das große Passagierschiff die Reede erreicht, konnte aber nicht in den Hafen einlaufen, sondern mußte draußen vor Anker gehen. Es ist ein Nachteil des Hafens von Valparaiso, daß große Schiffe nur bei Flut in denselben gelangen können, doch ist es ja zum Beispiel in Hamburg und Bremerhaven ebenso.
Der Stutzer sprang in ein Mietsboot, um sich nach dem eben angekommenen Schiffe rudern zu lassen, aber noch ehe das Boot abstieß, gesellte sich jener Mann zu ihm, der ihn vorher angeredet hatte.
»Sie erlauben?« sagte er höflich.
»Gewiß, sehr gern.«
Der Stutzer war nämlich der festen Meinung, dieser Mann wollte sich ebenfalls nach der ›Florida‹ rudern lassen.
Das Boot wurde von dem Schiffer kreuz und quer durch den Hafen gerudert, um an den vielen Schiffen vorüberzukommen, passierte dann eine Schleuse und strebte direkt der ›Florida‹ zu.
Auf der Reede trieben sich nur wenige Boote umher, die Verbindung zwischen den Schiffen und dem Lande herstellend. Nach der ›Florida‹, welche eben erst ankerte, fuhr nur noch ein kleiner Dampfer, der den Agenten, der betreffenden Kompanie an Bord bringen sollte. Alle anderen, welche etwas auf diesem Schiffe zu suchen hatten, hatten es nicht so eilig, wie die beiden Herren, denn die sofortige Fahrt in einem Boot nach einem eben erst angekommenen Schiffe ist doppelt so teuer, als später, die Bootsführer wissen eben die Ungeduld der Passagiere auszunutzen.
Einige hundert Meter rechts, aber noch vor der ›Florida‹ lag ein großes Segelschiff.
»Dorthin, Bootsmann,« rief der später ins Boot gesprungene Mann dem Ruderer zu und deutete auf dieses Schiff, eine Bark.
»Well, Sir,« entgegnete der Englisch sprechende Schiffer und lenkte sein Fahrzeug.
»Was?« rief der Stutzer überrascht. »Sie wollen nicht nach der ›Florida‹?«
»Ich? Nein,« sagte der Engländer und zeigte jetzt mit einem Male gar nicht mehr die vorige Höflichkeit — er trat sehr energisch auf. »Ich will dort nach der Bark.«
»Was geht das mich an?« rief der Stutzer zornig. »Ich war zuerst im Boot. »Da,« er warf dem Ruderer zwei Dollar zu, »erst nach der ›Florida‹.«
»Erst nach der Bark,« entgegnete aber der Engländer und warf dem Ruderer ein Goldstück zu. »Wir machen ja nur einen kleinen Umweg Sie können sich dann ja nach der ›Florida‹ bringen lassen.«
»Das ist eine Unverschämtheit,« brauste der Spanier wütend auf. »Ich habe Sie in dem Glauben in das Boot steigen lassen, daß Sie ebenfalls nach der ›Florida‹ wollten. Machen Sie, daß Sie aus dem Boote kommen, oder ich werde Ihnen chilenisches Recht beibringen.«
»Soll ich vielleicht über Bord springen?« lachte der Mann, welcher wirklich im Unrecht war, höhnisch.
»Meinetwegen, oder Sie müssen eben erst mit nach der ›Florida‹ kommen und dann nach Ihrer verdammten Bark fahren. Vorwärts,« wandte er sich an den Ruderer, »drehe um!«
»Wer am besten bezahlt, dem gehorche ich,« entgegnete aber der Mann, der um alles in der Welt dem Engländer das Goldstück nicht zurückgegeben hätte.
»So fahre zu und sei verdammt,« knirschte der Geck, »sei aber versichert, daß ich dich zur Anzeige bringen werde! Und wir,« er kehrte sich wieder dem Fremden zu. »wir werden uns noch näher bekannt machen.«
»Sollte mir sehr angenehm sein,« entgegnete gelassen der Unbekannte.
Der Stutzer murmelte etwas wie ›Flegel‹, mußte sich aber gefallen lassen, daß jener erst nach der Bark gebracht wurde.
Dieselbe lag ziemlich abseits von anderen Schiffen auf der Reede. Auf der Seite, der das Boot jetzt zusteuerte, sah man kein Fallreep, also mußte es sich auf der anderen befinden. Das Boot war daher gezwungen, um das Schiff herumzufahren, infolgedessen es weder von der Landseite, noch von einem anderen Schiffe gesehen werden konnte.
Der Stutzer hatte freilich nicht geglaubt, auf dieser Bootsfahrt ein Abenteuer zu erleben.

Kaum war das Boot um das Schiff gebogen, wo es also von niemandem gesehen werden konnte, als von der Mannschaft der Bark — die Matrosen lehnten auch alle an der Bordwand und blickten nach dem Boot hinunter — als plötzlich der vermeintliche Deutsche auf den Stutzer zusprang, ihn auf den Boden des Fahrzeuges drückte und durch Zuschnüren der Kehle am Schreien hinderte.
In der nächsten Minute lag er schon, gebunden und geknebelt, hilflos da; der Angreifer muhte in derartigen Sachen eine außerordentliche Uebung besitzen. Der Ruderer sah diesem Manöver zu, ohne dem Ueberfallenen beizustehen; er war schon instruiert worden.
»Bravo,« rief von oben eine Stimme auf deutsch, »nun binden Sie den Kerl an das Tau hier, und wir wollen ihn an Deck hissen.«
Der, welcher sich über die Bordwand beugte und diese Worte hinabrief, war kein anderer als Hannes, der Kapitän der ›Hoffnung‹, und neben ihm stand Hope.
Wie einen Sack hißten die lachenden Matrosen den vor Angst fast weinenden Spanier an Bord, der Deutsche gab dem Bootsführer eine Weisung und bestieg dann ebenfalls das Deck.
Der Bootsmann wartete ruhig am Fallreep, er war ganz sicher, wegen Zulassung eines Verbrechens in seinem Boote nicht zur Verantwortung gezogen zu werden, denn der vermeintliche Deutsche, der übrigens gut Spanisch sprechen konnte, hatte sich ihm gegenüber als amerikanischer Detektiv legitimiert und ihm eine hübsche Summe eingehändigt, damit er schwiege.
Es war kein Zufall gewesen, daß der Stutzer gerade in dieses Boot stieg, es war so arrangiert worden.
»Ist das der Richtige?« fragte Hannes oben an Deck den jungen Mann, in welchem der Leser, schon Nick Sharp erkannt haben wird.
»Ganz sicher, ich habe ihm lange genug aufgelauert,« entgegnete Sharp, »und ich glaube, er wollte gerade einen neuen Fang machen. Doch ich will bald alles Nötige von ihm erfahren haben. Lassen Sie mich ein halbes Stündchen mit ihm allein, er soll mir alles Wissenswerte erzählen.«
Sharp nahm den Gebundenen wie ein Kind auf die Arme und verschwand mit ihm im Zwischendeck, wo er sich in eine Kabine einschloß.
»Hört ihr's?« sagten oben die Matrosen, als bald darauf laute Jammerlaute zu ihnen heraufschollen. »Jetzt muß das Kerlchen erzählen, und tut er es nicht, dann kneipt ihn Sharp. Gnade dem, der dem Detektiven in die Hände fällt und sich trotzig zeigt.«
Noch war keine halbe Stunde vergangen, als der Stutzer abermals an Deck erschien und auf Hannes zuging. Die Matrosen wunderten sich nicht wenig, den Spanier plötzlich wieder frei zu sehen, er sah sogar ganz fröhlich aus, der Strohhut saß keck auf dem schwarzen Krauskopf, und die behandschuhte Rechte drehte den kleinen, schwarzen Schnurbart.
»Nun, wie gefalle ich Ihnen?« sagte der junge Mann zu dem verblüfften Hannes.
Da besann sich dieser, ein Lächeln flog über sein Gesicht.
»Ich will gehangen werden, wenn das nicht Nick Sharp ist!« rief er dann lachend. »Wollen Sie die Rolle des Spaniers weiterspielen?«
»Natürlich,« nickte der verkleidete Detektiv, »ich habe alles erfahren, was ich zu wissen nötig habe, um dies zu können. Selbst die Photographie des Mädchens habe ich, welches er abholen soll. Hier ist sie.«
»Herr Gott, die sieht ja fast aus wie Hope!« rief Hannes erstaunt.
»Es ist etwas Aehnlichkeit vorhanden,« entgegnete der Detektiv.
»Unser Gefangener heißt Senor Jerome und wird von dem Vermittlungsbureau in Santiago geschickt, um das Mädchen, eine deutsche Lehrerin, abzuholen.
»Jetzt fahre ich an Bord der ›Florida‹ und bringe das Mädchen hierher. Dann wollen wir sehen, was sich weiter tun läßt, um diesem Ehrenmann sein Handwerk zu legen. Ich kalkuliere, wir können ihm einen Streich spielen, an den er sein Leben lang denken wird.«
»Wie denn?« fragte Hope neugierig. »Ich denke, gerichtlich können wir ihn nicht belangen lassen.«
»Gerichtlich nicht, aber auf eigene Faust.«
Sharp ließ sich nicht weiter über seinen Plan aus, er sprang ins Boot und wurde nach der ›Florida‹ gerudert.
Auf dem Dampfer standen die Passagiere an Deck und musterten mit neugierigen Blicken das Land, welches von jetzt ab ihre Heimat werden sollte. Schön war allerdings der Anblick, der sich ihnen darbot, der prächtige Hafen mit den bewimpelten Schiffen, der breite Strand mit den hohen Sandsteingebäuden, das grüne Ufer mit der tropischen Vegetation und die schneeigen Gipfel der Anden — aber doch schlug manches Herz banger bei dem Gedanken, ein fremdes Land betreten zu müssen, der Sprache unkundig zu sein und ganz auf sich selbst angewiesen, im harten Kampfe dem Leben eine Existenz abzuringen.
Die Passagiere waren fast alle deutsche Auswanderer; die ›Florida‹ war ein deutsches Schiff. Wie vielen würde es wohl gelingen, die Hoffnung zu verwirklichen, die sie im Vaterlande geträumt hatten? Wie viele gingen wohl aus Mangel an Glück, Energie und Freunden zugrunde? Wie viele kehrten arm, mittellos und gebrochen an Leib und Seele nach der Heimat zurück, als einzigen Besitz eine schlimme Erfahrung mit sich bringend?
Der Falkenblick des Detektiven brauchte nur die Reihe der an der Bordwand lehnenden Leute zu überfliegen, so hatte er schon die Person gefunden, mit welcher er es zu tun haben sollte. Er trug ja ihre Photographie bei sich.
Man ließ den eleganten, sicher auftretenden Herrn sofort an Deck. Sharp ging, ohne von den ihn angaffenden Steuerleuten, Matrosen und Passagieren Notiz zu nehmen, direkt auf ein junges Mädchen zu, welches an der Bordwand stand und nach dem Hafen sah, und sagte, den Strohhut etwas lüftend, auf deutsch:
»Fräulein Eugenie Ebeling?«
Das junge, hübsche, blondlockige Mädchen, ein schüchternes Benehmen zeigend,, war sehr erfreut, auf deutsch angeredet zu werden und verlor sogleich die Befangenheit.
»Gott sei Dank, daß ich abgeholt werde,« sagte sie, »ich hatte schon furchtbare Angst, wenn ich daran dachte, hier sofort an Land gesetzt zu werden und mich dann allein in einer fremden Stadt zu befinden.«
»Unser Bureau sorgt dafür, daß seine Schützlinge nie in Verlegenheit kommen. Waren Sie von meiner Ankunft benachrichtigt?«
»Mir wurde in Hamburg gesagt, ich würde sofort bei meiner Ankunft abgeholt werden.«
»Sehen Sie, wir halten Wort! Bitte, steigen Sie gleich ins Boot, dann kommen Sie aus dem Gedränge, welches bald entstehen wird. Geben Sie mir Ihren Gepäckschein — so, in einigen Minuten ist alles im Boot.«
Dem jungen Mädchen fiel eine Last vom Herzen, das ging alles so glatt von statten, wie sie es nicht vermutet hatte, und gegen den Herrn konnte sie keinen Argwohn schöpfen. Er war so höflich und trat den Matrosen gegenüber, von welchem er sich das Gepäck herbeiholen ließ, so energisch auf, daß sie sofort Zutrauen zu ihm faßte.
Als das Gepäck im Boot war, stieg der verkleidete Sharp nach, und das Boot stieß ab.
»Mein liebes Fräulein,« sagte Sharp in väterlichem Tone und betrachtete das junge Mädchen mit den unschuldigen und sanften Zügen mit wirklichem Mitleid, »ich habe Ihnen eine Mitteilung zu machen, über welche Sie anfangs wohl erschrecken werden, aber Sie werden einsehen, daß alles, was wir mit Ihnen vorhaben, nur zu Ihrem Besten dient.«
Das junge Mädchen erbleichte; die Hände, welche auf dem Schoße eine Hutschachtel hielten, begannen zu zittern.
»Mein Gott,« stammelte sie mit bebenden Lippen, »so ist die Stellung schon vergeben? Ach, hätte ich doch den Warnungen Gehör geschenkt, mich nicht nach dem Auslande schicken zu lassen.«
Die Tränen stürzten ihr plötzlich aus den Augen.
»Sie irren,« sagte Sharp freundlich, »ich bin kein Agent des Vermittlungs-Bureaus, wie Sie meinen, aber glauben Sie mir, ich nehme mich Ihrer an, um Sie dem Verderben zu entreißen, in welches Sie gestürzt werden sollten. Ich bringe Sie jetzt zu meinen Freunden, bei denen Sie gut aufgehoben sind. Trauen Sie mir?«
Entsetzt starrte das Mädchen den Sprecher an und blickte dann ratlos um sich. Sie hatte noch gar nicht recht verstanden, was ihr jetzt eröffnet wurde.
»Sehen Sie dort das Schiff?« fuhr der Detektiv fort, auf die ›Hoffnung‹ deutend, der das Boot zusteuerte. »Dort sind Menschen, welche Sie mit offenen Armen aufnehmen werden. Ich versichere Ihnen auf mein Ehrenwort, daß Sie dort gut aufgehoben sind, und die Enthüllungen, welche ich Ihnen noch machen werde, werden Sie vollkommen überzeugen.«
Sharp sprach noch lange auf das Mädchen ein, um es zu beruhigen, und ehe das Boot die ›Hoffnung‹ erreicht hatte, war ihm dies auch so ziemlich gelungen. Zwar wußte Eugenie nicht, was ihr eigentlich bevorstand, aber so viel hatte sie doch schon erraten, daß sie kaum einer Gefahr entgangen wäre, wenn dieser Mann sich ihrer nicht angenommen hätte.
Der junge Mann mit den offenen Augen machte einen guten Eindruck auf sie, sie hätte ihm allerdings auch getraut, wenn er böse Absichten gehabt hätte.
Willig folgte sie ihm an Bord der ›Hoffnung‹ und wurde von Hannes und Hope herzlich bewillkommnet. Beim Anblick dieser beiden schwand im Herzen des jungen Mädchens das letzte Mißtrauen. Diese Menschen konnten sicher nichts Böses mit ihr vorhaben.
Sharp trat etwas zurück, als er seinen Schützling vorstellte, Hannes und das Mädchen scharf beobachtend.
»Fräulein Eugenie Ebeling — Freiherr von Schwarzburg ...«
Er konnte diese Vorstellung nicht beenden. Plötzlich wich das Mädchen einen Schritt zurück, schlug die Hände vor das Gesicht und stöhnte tief auf.
Bestürzt schauten Hannes und Hope erst auf das Mädchen, dann auf den Detektiven, dessen Benehmen ihnen unerklärlich war, aber über Sharps Gesicht huschte ein Lächeln.
»Kennen Sie den Namen Ebeling, Hannes?« fragte er den Kapitän.
»Ebeling? Nein, Doch ja,« unterbrach er sich plötzlich. »Hieß nicht jenes Weib so, nach welchem wir die vergeblichen Nachforschungen anstellten?«
»Ich kalkuliere, sie ist die Enkelin jener Amme, der Sie als Kind den Umtausch verdanken, und Fräulein Eugenie scheint etwas davon zu wissen, sonst würde sie nicht so erschrecken. Ich dachte mir es schon beim Lesen ihres Namens.«
Aller Augen richteten sich jetzt auf das Mädchen, welches krampfhaft schluchzte und niemanden anzusehen wagte.
»Ach, Gott,« stöhnte sie endlich, »was kann ich dafür — ich bin — ich wollte —«
Da trat die weichherzige Hope schnell auf sie zu, nahm ihr die Hände vom Gesicht und blickte ihr lange in die unschuldigen Züge.
»Was können Sie für das, was andere getan haben?« sagte Hope zärtlich, welche sofort die Situation des Mädchens erfaßt hatte. »Kommen Sie mit mir, Sie stehen unter meinem Schutz! Und Sie,« wandte sie sich an den Detektiven, als sie die Willenlose mit sich fortzog, »Sie sind ein ganz roher, ekliger Patron, der in jedem Menschen einen Verbrecher finden möchte.«
»Und der Sie dann gleich einmal sprechen möchte, weil er Sie braucht,« rief ihr Sharp nach.
Es war schon gegen Abend, als zwei Mädchen an die Tür des Vermittlungsbureaus klopften und auf das sofort gerufene ›Herein‹ eintraten.
Senor Rodrigo, der Besitzer des Bureaus, war trotz seiner Körperfülle schnell aufgesprungen, sank aber beim Anblick der beiden Mädchen, Kreolinnen, in armseligen, aber bunten Kleidern, ebenso schnell wieder in den Lehnstuhl zurück und murmelte einen Fluch in seinen Bart.
»Was wollt ihr?« herrschte er in grobem Tone die beiden an.
»Haben Sie eine Stellung für uns?« sagte die eine und trat vor.

»Haben Sie eine Stellung für uns?«
fragte eines der Mädchen.
Der Dicke schüttelte unwillig den Kopf, doch gab er sich wenigstens Mühe, die Fragenden anzusehen. Er schraubte die Lampe höher, setzte einen Klemmer auf die Nase und wandte den Kopf nach dem Mädchen, sie von oben bis unten prüfend betrachtend.
Diese Untersuchung hätte jedem anständigen Mädchen das Blut in die Wangen gejagt, aber nicht diesen; ruhig hielten sie seinen Blicken stand und sahen ihm frech lächelnd in die Augen.
Die eine mochte etwa zwanzig, die andere fünfundzwanzig Jahre alt sein. Beide waren hübsch zu nennen, aber der Beruf, dem sie oblagen, hatte seinen Stempel auf ihr Gesicht gegraben, das eingefallene, hohle Züge, tiefliegende Augen und eine gelblich graue Hautfarbe aufwies. Die Hände zeigten, daß sie nicht zu arbeiten gewohnt waren, obgleich der Kleidung nach die beiden doch zum Arbeiterstande gehören mußten.
»Weggelaufen, he?« fragte der Dicke dann in rohem Tone.
»Ja,« entgegnete die ältere, die Sprecherin, »wir kommen von Iquique.«
»Warum?«
»Wir bekamen nicht genug zu essen.«
»Bah, das ist kein Grund. Habt ihr Schulden gemacht?«
»Gemacht haben wir keine, aber es bleiben noch welche übrig.«
»Da haben wir's ja,« rief der Dicke entrüstet und schlug mit der Faust auf den Tisch, »und woher bekamt ihr das Reisegeld?«
»Wir verkauften unsere Kleider.«
»Und da wagt ihr, mich nach einer anderen Stellung zu fragen?« rief der Biedermann und tat, als wäre er vor Entrüstung außer sich.
»Was sollten wir denn machen?« lachte das eine Mädchen höhnisch.
»Aushalten solltet ihr, bis ihr euren Vorschuß abverdient hattet, dann konntet ihr hingehen, wohin ihr wolltet.«
»Da könnte man Großmutter werden, ehe man dazu käme.«
»Was geht das mich an? Schert euch zum Teufel! Ich kann euch unter solchen Verhältnissen keinen anderen Platz verschaffen! Schließlich sendet euch euer Mietsherr die Polizei nach, weil ihr ihn bestohlen habt, und auch ich bekomme sie über den Hals.«
»Unser Herr wird sich hüten, sich mit der Polizei einzulassen, und Sie, Senor Rodrigo,« sagte das Mädchen drohend, »wissen auch recht gut, daß Sie nichts gegen uns machen können.«
Wütend sprang der Dicke auf.
»Hinaus mit euch,« rief er, »oder ich lasse euch fortjagen, ihr Gesindel!«
Die Mädchen wurden eingeschüchtert.
»Was sollen wir denn machen,« sagte die jüngere in bittendem Tone. »Geben Sie uns Stellung, wir nehmen jede an.«
Der Dicke wurde etwas besänftigt.
»Habt ihr Geld?« fragte er.
»Nein, keinen Peso.«
»Schmuck?«
»Nichts.«
Noch einmal warf der Dicke einen prüfenden Blick auf die beiden Mädchen und fand, daß deren Kleider nichts wert waren.
»Ich habe nichts für euch,« jagte er dann.
»Wir sind mittellos,« sagte wieder die jüngere in stehendem Tone. »Bedenken Sie doch, daß Sie es gewesen sind, der uns in das Unglück gestürzt hat.«
Der Mann brach in ein lautes Lachen aus.
»Schwatzest du auch noch solchen Unsinn?« lachte er. »Ich dachte doch, du könntest nun endlich klug geworden sein. Ich euch ins Unglück gestürzt? Ihr waret anständige Dienstmädchen, wer hieß euch denn, euch jedem Kerl hinzugeben?«
Die Mädchen schwiegen, sie wußten besser, was Hunger und schlechte Behandlung auf der einen Seite, gutes Leben, Vorspiegelungen schöner Kleider und gleißenden Schmuckes — wenn er auch nur geliehen ist — auf der anderen Seite, bewirken können.
»Ich habe nichts für euch,« wiederholte der Dicke hartnäckig.
»Wir haben seit heute morgen nichts gegessen, verschaffen Sie uns irgend etwas.«
»Geht mich nichts an!«
»Wir nehmen alles an!«
Der Dicke nahm aus seiner Westentasche zwei Blechmarken und hielt sie den Mädchen hin.
»Wollt ihr da schlafen?«
Ein langes Schweigen folgte. Mit glanzlosen Augen betrachteten die beiden Mädchen die Marken, sie verschafften ihnen den Eintritt zu den gewöhnlichsten Arbeiterschenken in Santiago. Dort erhielten sie Essen und Schlafstelle und ab und zu auch von einem Gaste ein Glas Bier oder Branntwein, aber eine Woche mußten sie bleiben, ehe sie wieder freigelassen wurden.
Es braucht wohl nicht näher angedeutet zu werden, auf welche Art die Mädchen dort ihr Brot verdienen mußten.
»Ja,« hauchte endlich die jüngere und griff nach einer Marke, »ich habe Hunger.«
Stumm griff auch das andere Mädchen zu. Sie verließen das Zimmer, ohne ein Wort zu sagen.
»Sind das dumme Geschöpfe,« murmelte der Dicke, als er allein war. »Rennen aus dem Regen in die Traufe. Kann mir aber gleichgültig sein, zwei Dollar habe ich wenigstens verdient.«
Er sah nach der Uhr.
»Wo zum Teufel bleibt aber Jerome? Es wird die höchste Zeit, daß er das Mädchen bringt, der Senor hat schon dreimal nach ihm gefragt.«
Da erscholl draußen ein Männerschritt, die Tür wurde aufgerissen, ein ›Bitte‹ erscholl, und herein trat eine junge Dame. Aber ihr Begleiter kam nicht mit, er machte die Tür von draußen zu, und man hörte ihn sich wieder entfernen.
Der Dicke war aufgesprungen, machte vor der jungen Dame eine tiefe Verbeugung und rückte ihr einen Stuhl hin, war überhaupt ganz Höflichkeit.
»Miß Eugenie Ebeling?« fragte er auf englisch. »Sehr angenehm, mein Name ist Rodrigo, mein Hamburger Agent wird Ihnen diesen Namen schon genannt haben.«
Er hatte bei Eintritt der Dame ihre Gestalt schnell von oben bis unten gemustert und war mit ihrer schlanken, doch üppigen Erscheinung zufrieden, und dieses kindliche, unschuldige Gesichtchen, welches beim Lachen reizend aussehen mußte, entzückte selbst sein hartes Herz.
Die Dame war etwas befangen gewesen, sie hatte sich linkisch auf den Stuhl gesetzt; jetzt aber schlug sie die blauen Augen voll zu dem Herrn auf und sagte mit wohltönender Stimme:
»Ich bin Eugenie Ebeling und von Herrn Jerome, der sich mir vorstellte, vom Schiff abgeholt worden. Hier sind meine Papiere,« sie entnahm einem Ledertäschchen einige Schriftstücke und übergab sie dem Herrn. »Bitte, überzeugen Sie sich von der Richtigkeit!«
Rodrigo hielt dies nicht für nötig; er legte die Papiere einfach auf den Tisch.
»Waren Sie mit Senor Jerome zufrieden? Haben Sie keinen Anlaß zur Klage gehabt?« fragte er.
»Durchaus nicht, er war sehr zuvorkommend.«
Dann kamen die Fragen über die Reise, ob sie gutes oder schlechtes Wetter gehabt habe, ob sie seekrank gewesen sei und so weiter, bis Eugenie der Zweck ihres Hierseins einzufallen schien.
»Wie steht es mit meiner Stellung als Erzieherin, kann ich bald antreten? Nicht wahr, mein Engagement bringt mich auf eine Plantage in der Nähe von Santiago? O, wie ich mich darauf freue!«
»Liebes Fräulein,« begann Rodrigo nach einer kurzen Pause, verlegen mit der goldenen Uhrkette spielend. »Leider muß ich Ihnen eine unangenehme Mitteilung machen. Jene Stellung als Lehrerin ist bereits vergeben.«
»Bereits vergeben?« rief das Mädchen erschrocken.
»Das hat aber nichts zu sagen,« beeilte sich Rodrigo hinzuzufügen, »mein Bureau ist imstande, Sie jederzeit mit einer anderen, angemessenen Stellung zu versorgen.«
»Ah so,« atmete die Dame erleichtert auf.
»So zum Beispiel können Sie Stellung als Erzieherin für die Kinder eines hiesigen Hoteliers erhalten, ein sehr angenehmer Platz. Nebenbei führen Sie die Wirtschaft, haben die Wäsche unter sich und sind völlig Herrin des Hauses. Der Hotelier hat zu viel in seinem Geschäfte zu tun.«
»Ist er ein ehrenwerter Mann?«
»Durchaus. Er ist der Besitzer des feinsten Hotels in Santiago und allgemein als ein braver, ehrenwerter Mann bekannt. Sein Hotel wird nur von der Aristokratie besucht.«
Er sprach noch lange über den grundehrlichen Charakter dieses Mannes, eines Franzosen Namens d'Aubertin, den Ruf des Hotels, und schließlich war Eugenie einverstanden, diese Stellung anzunehmen.
»Werden meine Kenntnisse aber auch genügen?« warf sie noch einmal ein. »Ich bemerke, daß ich des Spanischen nicht mächtig bin.«
»Macht nichts,« versicherte Rodrigo, »die Kinder des Hoteliers sprechen Französisch, und die Hauptsache ist, daß Sie Deutsch und Englisch lehren können.«
»Und wie steht es mit meiner Gage?«
»Darüber müssen wir erst den Senor selbst sprechen, jedenfalls aber werden Sie vollkommen damit zufrieden sein. Soviel ich weiß, hat die vorige Gesellschafterin Toilette extra geliefert erhalten.«
»Gesellschafterin?« fragte Eugenie erstaunt. »Was habe ich mit einer Gesellschafterin zu tun?«
Rodrigo wurde für einen Augenblick verlegen, sammelte sich aber schnell wieder, so schnell, daß das unerfahrene Mädchen seine Verlegenheit sicher nicht wahrgenommen hatte.
»Nun, der Hotelier liebt kleine Gesellschaften, und in solchen Fällen müssen Sie nicht nur als Lehrerin der Kinder, sondern auch als deren Mutter auftreten, das heißt, die Repräsentation des Hauses übernehmen. Es sind sehr anständige Gesellschaften, welche d'Aubertin gibt.«
In dieser Versicherung lag etwas, was das Mädchen mißtrauisch hätte machen sollen.
»Wo werde ich diese Nacht zubringen?«
»Gleich in dem Hotel.«
»In welchem Hotel?«
»Nun, in demselben, in welchem Sie die Stellung antreten.«
»Das geht so schnell?« rief das Mädchen verwundert.
»Natürlich, warum sollte es nicht? Hier in Chile geht alles schnell, wie Sie noch manchmal bemerken werden.«
»Aber ich glaubte, ich sollte nicht im Hotel, sondern im Hause des Herrn d'Aubertin bleiben,« sagte das Mädchen ängstlich.
»Seine Wohnung befindet sich nicht im Hotel,« erklärte der Agent, »Ihre Sachen sind von Senor Jerome bereits dorthin gebracht worden. Sind Sie bereit, mir nach dort zu folgen? Ruhe wird Ihnen nach der anstrengenden Reise wohltun, und ich kann Ihnen versichern, daß Sie mit offenen Armen aufgenommen werden.«
»Ich bin bereit, Ihnen zu folgen, doch kann ich mich nicht genug wundern, wie schnell das alles geht.«
Senor Rodrigo ging nach der Tür, um einen Klingelzug zu ziehen, und es war schade, daß er daher den Gesichtsausdruck seines Schützlings nicht sehen konnte. Er wäre darüber nicht wenig erstaunt oder erschrocken gewesen.
Auf sein Klingeln kam Jerome herein, machte vor der Dame eine Verbeugung und entfernte sich wieder um dem Auftrage, einen Wagen zu holen.
»Nun wollen Sie, bitte, dieses Formular unterzeichnen,« sagte Rodrigo zu dem Mädchen, »wodurch Sie bescheinigen, daß Sie durch meine Vermittlung die Stellung erhalten haben.«
»Es ist spanisch gedruckt, ich kann es nicht lesen.«
»Ich werde es Ihnen übersetzen.«
Rodrigo füllte einige freigelassene Stellen im Druck aus und las dann vor, daß Eugenie Ebeling durch seine Vermittlung freiwillig bei dem Hotelier d'Aubertin eine Stelle als Gesellschaftsdame angenommen habe.
»Gesellschaftsdame?« fragte Eugenie.
»Als Gesellschafterin der Kinder.«
Das Mädchen unterschrieb; der Vermittler war somit gedeckt, was auch kommen mochte.
»Für meine Bemühungen erhalte ich den Betrag von zehn Dollar,« sagte darauf Rodrigo, »die Reisekosten und so weiter hat Herr d'Aubertin zu tragen.«
»Der Agent in Hamburg hat mir fast gar nichts gelassen, nur einiges deutsches Geld ist noch in meinem Besitz. Der Herr sagte, bis zum Antritt der Stellung hätte ich kein Geld nötig, ich habe auch wirklich keins gebraucht, aber vor Antritt der Reise desto mehr.«
»So geben Sie mir das, was Sie haben; seien Sie aber so gut und sagen Sie dem Hotelier das nötige, damit ich von ihm das übrige Geld erhalte.«
Seufzend gab Eugenie ihr letztes Zehnmarkstück hin, sie hatte nichts mehr.
»Der Wagen,« meldete Jerome.
»Sie kommen mit,« rief Rodrigo.
»Gewiß.«
Die Dame ward von den beiden Herren hinuntergebracht, sie stiegen in den Wagen, und dieser rollte davon, nachdem Rodrigo dem Kutscher eine Adresse zugerufen hatte.
Es war Nacht geworden, ehe die Fahrt angetreten wurde. Der geschlossene Wagen rollte erst durch breite, erleuchtete Hauptstraßen, schien sich aber immer mehr von der inneren Stadt zu entfernen, denn die Straßen wurden schmäler und waren, spärlicher beleuchtet.
Rodrigo suchte dem Mädchen soviel wie möglich von der Annehmlichkeit der neuen Stellung zu erzählen, von dem Herrn, einem Witwer, von seinen Kindern, die er genau zu kennen vorgab, und so weiter.
Bis jetzt hatte Jerome ruhig zugehört, da aber unterbrach er den Erzähler plötzlich mit einer überraschenden Frage.
»Ich habe noch gar nicht gehört, daß Monsieur d'Aubertin Kinder hat?«
Rodrigo war anfangs sprachlos. So weit das schwache Licht der Wagenlaternen es erlaubte, musterte er die Züge seines Helfers, und fast schien es ihm, als ob er auf dem Gesicht desselben ein teuflisches Lächeln bemerken könne.
»Jerome, was fällt Ihnen denn ein? Monsieur d'Aubertin hat keine Kinder?« stammelte er endlich.
»Nicht, daß ich wüßte,« entgegnete Jerome ruhig, »und im übrigen sind Sie im Irrtum, wenn Sie mich für Ihren Kompagnon halten. Ihr sauberer Gefährte sitzt bereits im Gewahrsam und erwartet Ihre Gesellschaft.«
Rodrigo sank, wie vom Schlage getroffen, in die Kissen des Wagens; das Bewußtsein drohte ihm zu schwinden.
Der junge Mann, den er schon seit Jahren kannte, und der für ihn arbeitete, hatte plötzlich den Schnurrbart abgerissen, ein bartloses, energisches Gesicht zeigte sich, welches nicht mehr die geringste Aehnlichkeit mit Jerome hatte, und ein paar finstere Augen blitzten drohend dem Schinken entgegen.
Das war es aber nicht allein, was den Vermittler so fassungslos machte; fürchterlicher war die Mündung eines Revolvers, die auf seine Brust gerichtet war.
»Einen Laut, eine Bewegung, und ich spreche deutlicher mit Ihnen, Halunke!« raunte ihm der Mann zu.
»Und wenn Sie glauben, ich sei Eugenie Ebeling, so sind Sie gleichfalls im Irrtum,« sagte neben ihm mit bebender Stimme das Mädchen. »Gott sei gedankt, daß das arme Mädchen nicht in Ihre Klauen geraten ist! O, wir kennen das Hotel des Monsieur d'Aubertin ganz genau; wir werden nachher noch ein Wörtchen miteinander darüber sprechen.«
Mit entsetzlicher Angst ließ der Agent seine Augen von dem einen zu dem anderen rollen; er sah nur erbarmungslose Gesichter und den drohenden Revolver.
»Die Dame hat unterschrieben. Ich habe das Recht auf meiner Seite. Niemand kann mir etwas anhaben,« stöhnte er.
»Das wird sich bald finden, ob Ihnen jemand etwas anhaben kann oder nicht,« sagte das plötzlich so entschlossene Mädchen an seiner Seite, während der Mann keine seiner Bewegungen aus dem Auge ließ, bereit, jeden Fluchtversuch zu verhindern.
»Wohin fahren Sie?« fragte der Agent.
Er hatte bemerkt, daß der Wagen einen anderen Weg fuhr, als den zum Hotel.
»Nach dem Hotel jedenfalls nicht. Monsieur d'Aubertin wartet vergebens auf sein Opfer, und ebenso der Dragoneroffizier auf sein neues Liebchen.«
Der Agent erstarrte immer mehr. Dieser Mann wußte alles. Jerome mußte ihm alles verraten haben. Aber der Schurke war zu weich, um irgend etwas zu unternehmen, was einem Fluchtversuch oder einer Gegenwehr ähnlich sah. Der Revolver bändigte ihn vollkommen.
Jetzt rollte der Wagen aus der Stadt. Vollkommene Dunkelheit herrschte ringsum, und die schlechten Wege verrieten, daß man sich auf einer Landstraße befand. Noch eine halbe Stunde dauerte es, ehe der Wagen hielt.
»Aussteigen,« herrschte Sharp, denn dieser war es natürlich, den Agenten an.
Willenlos gehorchte der Vermittler und sah sich sofort von dunklen Gestalten umgeben, die ihn in die Mitte nahmen und über ein Stoppelfeld führten.
Es gab kein Entrinnen mehr. Der Vermittler, der moderne Sklavenhändler, welcher sich raffiniert gegen jede gesetzliche Anklage wegen seiner Vergehen zu schützen wußte, war in die Hände von Männern gefallen, welche sich zu Richtern über ihn aufgeworfen hatten.
Nach einem kleinen Marsche wurde die Gegend hügeliger als zuvor, und endlich befand man sich vor dem Eingange eines Schachtes.
Rodrigo wußte jetzt, wo er sich befand. Es war eine verlassene, ehemalige Silbermine. Die Gegend rings umher war vollkommen öde; er hätte noch so laut schreien können, niemand hätte seinen Hilferuf vernommen.
»Hier hinein!« sagte ein Mann barsch zu ihm, und mit Faustschlägen und einem Fußtritt wurde der Zögernde in den Eingang des Schachtes befördert.
Ein heller Lichtschein leuchtete den Kommenden entgegen, und kaum waren sie um eine vorspringende Ecke des Ganges gebogen, so befanden sie sich in einem hohen, gewölbten Räume, von dem aus die Einfahrt in die Tiefe ging. Jetzt aber war das finstere Loch in der Erde mit Brettern zugedeckt; eine Menge Fackeln erleuchteten den Raum, und rings an den steinernen Wänden standen Männer.
Erschrocken fuhr Rodrigo zurück. Es sollte also wirklich Gericht über ihn gehalten werden. Noch mehr steigerte sich sein Entsetzen, als er Jerome mit gebundenen Händen in einer Ecke stehen sah, und ferner in einer anderen Ecke sechs Mädchen. Das Gewissen schlug ihm bei deren Anblick. Waren sie vielleicht auch seine Opfer, derentwegen er zur Verantwortung gezogen wurde? Leicht möglich!
Rodrigo wurde von seinen Begleitern in die Mitte des Raumes geführt und von den Männern umringt. Ein noch junger Mann trat auf ihn zu — es war Hannes.
»Haben Sie dieses Mädchen,« er deutete dabei auf die angebliche Eugenie Ebeling, »von Deutschland kommen lassen, um ihr hier eine Stelle als Erzieherin zu verschaffen?«
»Ja, und ich hätte auch Wort gehalten, aber die Stelle war schon vergeben,« stammelte der Vermittler.
»Wohin wollten Sie das Fräulein jetzt bringen?«
»Nach dem Hotel des Monsieur d'Aubertin,« entgegnete Rodrigo, wohl wissend, daß ihm Lügen nicht half.
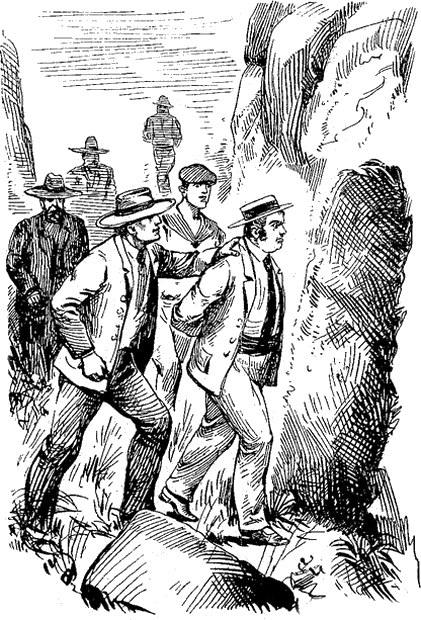
»Als was?«
»Als Gesellschaftsdame.«
»Was für ein Hotel ist das?«
Rodrigo schwieg.
»Es ist ein bekanntes Freudenhaus von Santiago. O, Sie brauchen mich nicht zu unterbrechen, Ihre Ausreden würden Ihnen gar nichts helfen. Wir wissen recht gut, was das Los des Mädchens gewesen wäre. Noch in dieser Nacht würde ihr klar gemacht worden sein, wo sie sich befand, und wäre sie nicht willig gewesen, so hätte man sie gezwungen oder sie durch Schlafmittel willig gemacht. Aus diesem Hause käme sie nicht eher, als bis sie wegen Unbrauchbarkeit entlassen würde. Die Behörde kann ihr nicht helfen, denn sie selbst hat, des Spanischen unkundig, einen Kontrakt unterschrieben, in dem sie sich damit einverstanden erklärt, in dem Freudenhaus oder Hotel als öffentliches Mädchen einzutreten, und sie kann dasselbe nicht wieder verlassen, weil sie durch die ihr aufgedrungene Toilette und Schmuckgegenstände Schulden gemacht hat, die sie erst abverdienen muß.«
Hannes schwieg, und ebenso Rodrigo, er wagte nicht zu antworten, denn er war sich seiner Schuld bewußt und sah diesen Mann in alle Verhältnisse eingeweiht. Was half hier Leugnen? Er war auf Gnade und Ungnade seinen Richtern überlassen.
Auf einen Wink von Hannes traten die sechs Mädchen, alles Spanierinnen aus Chile, hervor.
»Kennen Sie diese Mädchen?«
»Nein.«
»Vor zwei Jahren suchten Sie für ein spanisches Hotel in Konstantinopel, wie Sie sagten, Dienstmädchen, und diese fünf hier haben sich dazu gemeldet. Entsinnen Sie sich jetzt?«
Der Agent schwieg.
Da näherten sich ihm von hinten zwei Männer, Matrosen der ›Hoffnung‹, und ehe Rodrigo noch ihre Annäherung merkte, lag er schon am Boden, und ein Tauende sauste einigemale auf seinen Rücken herab.
»Ja, ja,« heulte er jetzt, »ich entsinne mich.«
Er war geständig.
»Wußten Sie, wozu diese Mädchen gebraucht wurden?«
»Ja.«
»Wußten Sie, wer der Schiffer war, welcher Ihnen die Mädchen gegen Geld abnahm?«
Rodrigo zögerte, aber das Tau brachte ihn schnell zum Reden.
»Er suchte Mädchen für türkische Harems,« wimmerte er, auf den Knieen liegend.
»Und Sie haben ihm dieselben als Sklavinnen verkauft, ebenso, wie Sie heute abend diese Dame in ein Freudenhaus verhandeln wollten.«
Hannes deutete auf die angebliche Eugenie — es war Hope, deren Ähnlichkeit mit Eugenie es möglich gemacht hatte, daß sie die Rolle der unerfahrenen, ängstlichen Eugenie übernehmen konnte.
»Sie haben kein Recht, sich als Richter meiner Handlungen aufzuwerfen,« sagte Rodrigo, noch einmal sich aufraffend, »ich wünsche, dem Gericht übergeben zu werden, wenn Sie mich eines Verbrechens schuldig finden.«
Alle Männer brachen in ein Gelächter aus. Rodrigo sank wieder zusammen, er hatte keine Hoffnung mehr.
»Jetzt wirst du deine Strafe empfangen, Mädchenhändler,« donnerte ihn Hannes an, »und mit dir dein sauberer Kompagnon Jerome, welcher noch viel mehr gestanden hat. Kommt,« wandte er sich an die fünf Mädchen und seine Frau, »ihr sollt der Bestrafung dieser Elenden nicht beiwohnen.«
Einige Matrosen wurden auserlesen, unter deren Schutze sie an Bord gebracht werden sollten, während Sharp und Hannes zurückblieben. Die Mädchen waren noch nicht weit gegangen, als schon ein entsetzliches Jammergeschrei ihr Ohr traf.
»Das tut ihnen gut,« meinte Karl, der Bootsmann, zu Hope, »schade, daß ich der Exekution nicht beiwohnen und mitschlagen darf.«
In einer Viertelstunde wurden sie von den übrigen wieder eingeholt, aber Rodrigo und Jerome waren nicht unter ihnen.
»Sie werden morgen früh den Weg wohl allein zurückfinden,« sagte Hannes, »heute können sie doch nicht mehr gehen. Vielleicht schicke ich morgen einen Vertrauensmann hin, der sie zufällig findet, sollten sie sich nicht allein forthelfen können. Ihr braucht keine Sorge zu haben,« fuhr er, zu den Kreolinnen gewendet, fort, »daß euch dieser Mann etwas anhaben kann, wir bringen euch schon morgen zu euren Eltern und lassen euch unter dem Schutze von Freunden zurück, welche auf euch und Rodrigo ein scharfes Auge haben werden.«
»Ich kalkuliere,« meinte Sharp, »Rodrigo und Jerome werden auf einige Zeit verschwinden, aber das Geschäft werden sie nicht aufgeben. Dieser Mädchenhandel ist zu einträglich. So lange es Fliegen gibt, gibt es auch Spinnen.«
Lustig flatterte das Sternenbanner im Winde, lustig der Wimpel der feuerschürenden, priesterlichen Jungfrau. Aber am lustigsten waren die Vestalinnen selbst. Tag und Nacht trällerten sie Lieder. An Deck, in den Kabinen, in allen Winkeln des Schiffes erschollen Lachen und Scherzworte; noch nie waren die Mädchen so ausgelassen gewesen, wie während der letzten Seereise.
Es ging ja der Heimat zu, und noch dazu auf ihrem eigenen Schiff, auf ihrem Stolze, der ›Vesta‹. Sie waren alle noch am Leben, gesund und munter, wie die Fische; nicht eine war da, welche Grund zur Klage gehabt hätte.
Eine war verheiratet in Batavia — die war sicher nicht traurig. Eine hatte nach einjähriger, heimlicher Liebe ihre Sehnsucht durch kecke Flucht gestillt — man hatte Hope als eine glückliche, junge Frau noch vor wenigen Wochen beglückwünscht. Johanna stand unter dem Schutze ihres Bräutigams, und die übrigen, nun, was sollte ihnen fehlen, wenn sie die glücklich wußten, welche sie liebten und um die sie sich einst gesorgt hatten?
Jetzt ging es der Heimat zu, und nicht einen Kampf, nein, ein fröhliches Spiel sollte es geben, wenn man die Erbschleicher entlarvte. Es war nur schade, daß sich diese wahrscheinlich schon vor ihrer Ankunft dem Arme der Gerechtigkeit entziehen würden, denn sicher hatten sie von dem Wiederauftauchen der ›Vesta‹ und der Vestalinnen erfahren. Sie würden fliehen und alles Errungene im Stich lassen.
Doch war es besser so, dann stand der Freude der Rückkehr in die Heimat nichts im Wege. Und sollten die Verbrecher doch noch einmal versuchen, sie zum Schweigen zu bringen und in den Tod zu schicken, so wußten die Mädchen jetzt, wer ihnen hilfreich zur Seite stand. Auf Hoffmann konnten sie sich verlassen, und jetzt endlich hatten sie auch den Wert Johannas und Sharps erkannt. Mit diesen dreien im Bunde wollten sie die Pläne der Unholde zu schänden machen — oder ihrer überhaupt nicht achten.
Es war einstimmig beschlossen worden, nicht direkt nach New-York zu fahren, sondern erst in den Golf von Mexiko einzubiegen, und von dort das Land zu betreten, denn von hier aus waren am leichtesten die Besitzungen von Miß Petersen, Thomson, Murray und anderen Damen zu erreichen. Man hoffte die Erbschleicher zu überraschen, wenn sie sich gerade des gelungenen Raubes freuten.
Dann konnte man noch immer im Triumph in den Hafen von New-York einsegeln.
Jetzt hatte die ›Vesta‹ bereits Kuba hinter sich, man befand sich schon im Golf von Mexiko und konnte den warmen Strom bewundern, welcher bekanntlich seine Wirkung noch hoch oben im Norden ausübt. Durch ihn hat Irland seine grüne Küste erhalten, welche ihr den Namen der ›grünen Insel‹ eingebracht hat.
Der Golfstrom ist außerordentlich reich an Fischen, und überall, wohin er sich auch erstrecken mag, trifft man auf dieselben Arten von Fischen, selbst im Norden, welche sonst nur in den tropischen Gewässern vorkommen.
Es ist wunderbar, wie der Golfstrom seine Wärme behält.
Bekanntlich friert das Meerwasser infolge seines Salzgehaltes erst bei 40 Grad Celsius, fühlt sich also in solchem Zustande bedeutend kälter als Eis an. Es ist dem Matrosen ein Schrecken, muß er in solchem Wasser sein Zeug ausspülen, es gefriert ihm unter den Händen, und diese erfrieren oft genug dabei. Da sieht er vor dem von Eis starrenden Schiffe plötzlich eine grüne Masse auf dem Meere treiben, und der Ruf ›das Golfgras‹ pflanzt sich von Mund zu Munde fort. Auch die vielen großen Schiffe deuten an, daß man sich im Golfstrom befindet.
Schnell wird ein Eimer mit Wasser heraufgeholt, alle Hände tauchen hinein, und die Vermutung bestätigt sich. Das Wasser, das eben noch bitter kalt war, ist plötzlich lauwarm geworden, man könnte sich mit Wohlbehagen darin baden. Einige Stunden später befindet man sich unter Umständen wieder zwischen Eisschollen.
Wegen seines Fischreichtums wird der Golfstrom von Fischern aufgesucht, die sich weit vom Festlande entfernen, und im Golf von Mexiko, welcher von Nord-, Mittel- und Südamerika eingeschlossen wird, wimmelt es von Fischerbooten.
Soeben näherte sich auch die ›Vesta‹ einer Gruppe von wohl hundert Fischerbooten, welche, in gemessenen Zwischenräumen voneinander entfernt, ihre Netze auswarfen. Die Fischer gehörten sowohl der spanischen, wie der nordamerikanischen und englischen Rasse an. Auch Eingeborene sah man darunter.
Die Boote, an denen die ›Vesta‹ vorüberkam, strebten an das große Schiff heranzukommen, um Fische zu verkaufen. Doch die Mädchen wollten erst das Schauspiel genießen, das sich ihnen bot, ehe sie an eine Vermehrung ihres Proviants dachten.
Es wurden kleine und große Fische gefangen, denn die Leute fischten mit engmaschigen, aber starken Netzen, und nicht selten passierte es, daß sie sogar Delphine an die Oberfläche zogen, unter deren Gewicht das Boot zu kentern drohte. Dann mußte die Last auf mehrere Boote verteilt werden, und das Emporziehen des Netzes geschah mit vereinten Kräften.
Ja, sogar der gefährliche Sägefisch mit der über einen Meter langen Säge am Kopf, wurde ans Tageslicht befördert, zum Aerger der Fischer, denn das Netz ward durch seine Waffe jedesmal vollständig zerfetzt.
»Was macht denn der Mann dort in dem kleinen Boote?« rief ein Mädchen. »Fischt der auch?«
Der fragliche Fischer, dem sich jetzt die Aufmerksamkeit aller zuwandte, befand sich in einem sehr kleinen Boote, welches gar nicht zum Fischfang bestimmt schien. Segel und Ruder wurden von einem Knaben bedient, während der Mann, ein weißhaariger Greis, einer seltsamen Beschäftigung oblag.
Er warf immer ein Tau so weit wie möglich in das Meer hinaus, das eine Ende in der Hand behaltend, zog es langsam aufrollend ins Boot zurück, und war das andere Ende wieder an der Oberfläche erschienen, so bog er sich weit über die Bordwand, zog immer langsamer an und brach dann in ein lautes Wehklagen aus.
»Hast du ihn, Vater?« fragte der Knabe am Ruder.

»Hast du ihn, Vater?« fragte der Knabe am Ruder.
»Nein, er ist noch immer nicht daran,« schrie der Alte in herzzerreißendem Tone und warf von neuem das Tau in das Meer hinaus.
Immer das gleiche Manöver, dieselbe Frage des Knaben, dieselbe Antwort des Vaters und dann das gleiche Weinen und Wehklagen der beiden, des Jungen wie des Alten.
Wohl zehnmal hatten die Damen diesem merkwürdigen Schauspiel zugesehen, ehe sie sich querab von diesem Boote befanden, und da Ellen einige Kommandos gegeben hatte, so lag die ›Vesta‹ jetzt außer dem Winde still und ganz nahe an diesem Boote.
»Hast du ihn?« fragte die klägliche Stimme des Knaben.
»Nein, er ist wieder nicht daran,« schrie der Alte.
»Versuche es noch einmal!« flüsterte der Kleine jetzt tonlos und weinte ebenso wie der Alte.
Von dem großen Schiffe nahmen beide keine Notiz, während sich die übrigen Boote um dasselbe drängten.
»Es muß jemand über Bord gefallen und ertrunken sein,« sagte Ellen, »und der Alte fischt nach der gesunkenen Leiche. Warum hat er denn aber keinen Haken am Tau, wie soll das Seil den Toten fassen können?«
»Und die anderen Fischer kümmern sich gar nicht um die beiden,« meinte ein anderes Mädchen. »Das ist doch merkwürdig! Eine solche Teilnahmlosigkeit findet man sonst unter den Fischern nicht.«
»Fische, Fische!« rief da ein Mann und legte mit seinem Boot neben der ›Vesta‹ an.
»Kommen Sie herauf!« rief Ellen hinunter.
Sie wollte von dem Fischer etwas über das sonderbare Benehmen dieser beiden erfahren. Die Regel, daß kein Mann die ›Vesta‹ betreten sollte, war zu oft verletzt worden, als daß sie noch aufrecht gehalten wurde. Ellen kaufte dem Spanier zwei Körbe voll Fische ab und fragte ihn dann, wer die beiden seien, und was ihr Jammer zu bedeuten habe.
»Danke,« sagte der Spanier und steckte das Geld schmunzelnd ein. »Sie meinen den Alten und seinen Sohn? Die sind beide wahnsinnig.«
»Wahnsinnig?« riefen die Mädchen entsetzt. »Und sie fahren hier auf dem Meere herum?«
»Warum nicht?« fragte her Mann achselzuckend. »Es sind Fischer, sie sind auf dem Meere verrückt geworden, und jedesmal, wenn ihre Kameraden — es sind Texaner — zum Fischfang in die Boote steigen, fahren auch sie mit, denn sie sind in dem Wahne befangen, den Sohn oder Bruder doch noch eines Tages aus dem Meere retten zu können.«
»Sprecht deutlicher, Mann, wir können Euch nicht verstehen.«
Der Mann erzählte, was Vater und Sohn gleichzeitig zum Wahnsinn getrieben hätte. Es war sehr traurig.
Der Vater war ein Fischer und alle seine Söhne ebenfalls. Nur einer davon, der älteste, hatte Lust bekommen, eine größere Reise auf einem Schiffe anzutreten, um dann mit vollem Geldbeutel wieder heimzukehren.
An der texanischen Küste ist die Strandräuberei noch recht zu Hause. Man bittet den Himmel und alle Heiligen, doch recht viele Schiffe an dem Strande zerschellen zu lassen, denn, was angeschwemmt wird, gehört den Strandbewohnern. In jenen einsamen Gegenden gibt es keine Behörde, welche den Leuten ihre Beute streitig macht.
Wir brauchen übrigens nicht weit zu gehen, um auf dieselbe Art von Strandräuberei zu stoßen. Es ist noch nicht so lange her, daß in einem Dorfe an der Ostseeküste jeden Sonntag in der Kirche der Pastor im Schlußgebet den lieben Gott ersuchte, doch recht viel Schiffe an ihrer Küste scheitern zu lassen, damit seine Gemeinde recht reich würde.
Die texanischen Fischer aber begnügen sich nicht nur damit, die Kisten, Ballen und Fässer zu bergen, sondern sie ziehen auch die Schiffbrüchigen ans Land, aber nur um den vom Tode Erretteten den Gnadenstoß zu geben, ihn nach Wertgegenständen zu untersuchen und dann wieder ins Meer zu werfen. Sind es angeschwemmte Leichen, so brauchen sie natürlich nicht erst zum Mörder zu werden.
Mit langen Tauen stehen sie am tobenden Meere, und wo sie einen Kopf, einen Arm, eine Hand aus dem Wasser sich recken sehen, da stiegt das sicher geschleuderte Tau hin. Krampfhaft klammert sich die Hand an das rettende Seil, die braven Fischer ziehen den Menschen ans Land, sie beugen sich anscheinend liebevoll über den Geretteten und schlagen ihm den Kopf ein.
Ein solches Handwerk trieb auch der Alte. Bei jedem Sturm, in der finsteren Nacht stand er draußen und spähte nach einer Rakete, nach einem Licht oder lauschte auf einen Kanonenschuß, den ein in höchster Not befindliches Schiff löste.
So klein sein jüngster Sohn auch war, er mußte doch schon dem Vater bei diesem Geschäft helfen, und nicht immer hielt es dieser für nötig, ihn wegzuschicken, ehe er dem ans Land Gezogenen mit dem schweren Beil den Kopf einschlug.
Doch sei gleich bemerkt, daß sich die Fischer deswegen durchaus nicht für Mörder halten, das Meer gehört ihnen und alles, was sich in ihm befindet. Wenn sie die Schiffbrüchigen nicht ans Land zögen, müßten diese doch sterben. Denn wem gelingt es denn einmal, das Land zu erreichen, ohne von der mächtigen Dünung wieder in den Schlund hinabgerissen zu werden?
Dann ist es aber um die Wertsachen schade, welche verloren gehen würden. Darum bringen sich die Fischer erst in den Besitz derselben und stoßen dann den Geretteten wieder zurück. Was das Meer haben will, bekommt es doch, daher wäre Mitleid ganz falsch angebracht. Die Ermordung der Schiffbrüchigen beschwert das Gewissen der Leute durchaus nicht.
Wieder einmal stand der alte Fischer beim tobenden Sturm in finsterer Nacht am Strande, neben sich den Knaben, der die brennende Laterne trug.
Schon vor einigen Stunden hatten sie Kanonenschüsse gehört und von ihrer Hütte aus Raketen aufsteigen sehen. Ein Schiff war in Gefahr und der Berechnung des Fischers nach unrettbar verloren. Von den Felsenriffen der Küste gab es kein Abkommen mehr; was dazwischen kam, war dem Verderben geweiht.
»Es ist ein Schoner, Vater,« sagte der zehnjährige Knabe, als ein heller Blitz einmal das Meer weithin beleuchtete und ein Fahrzeug hatte erkennen lassen, das wie ein Spielball von den Wogen umhergeschleudert wurde.
»Meinetwegen,« brummte der Alte.
Nach einiger Zeit, hörten beide unter dem Donner ein anderes Geräusch, ein furchtbares Krachen. Die Kanonenschüsse waren schon längst verstummt.
»Es ist zerschellt, es ist auf das Riff geraten,« jubelte der Alte, hing die Laterne an einen langen Stock, steckte diesen in den Dünensand und ging dem schäumenden Strande zu, das Seil mit dem Haken bereits in der Hand, das Beil im Gürtel.
Bald kamen Kisten und Fässer herangetrieben, und es gab eine schwere Arbeit für die beiden. Der Alte warf das Tau geschickt, der Haken faßte, der Gegenstand wurde herangezogen, bei einer überrollenden Woge ans Land gesetzt und sofort den Strand hinaufgerollt, ehe eine neue Woge kam und ihn wieder zurückriß, womöglich die beiden mit, weil sie sich weit vorwagen mußten, um die Beute fassen zu können.
Da streckte sich neben einem Fasse eine Hand aus den Wogen. Sofort flog das Seil dorthin, der Haken traf die Kleidung, vielleicht auch das Fleisch — was schadete es — und der Alte begann strandaufwärts zu ziehen.
»Sieh' nach der Laterne, sie geht aus,« rief der Alte.
Der Knabe wußte schon, warum er fortgeschickt wurde. Schnell lief er weg.
Dem Alten war es gelungen, den Schiffbrüchigen vor den wütenden Wogen in Sicherheit zu bringen, das Beil sauste auf den Kopf des Unglücklichen, dann wurde er visitiert und dem Meere zurückgegeben.
Ein anderer Mensch wurde ans Ufer gezogen. Er war nicht besinnungslos, mit starkem Arm hatte er gegen die Fluten gekämpft. Der Alte hätte das Tau umdrehen müssen, aber nein, er schleuderte den scharfen Haken, er saß, und plötzlich hörte der Mann auf zu schwimmen.
»Dem brauche ich nicht erst den Hirnschädel einzuschlagen,« dachte der Alte, »der Haken hat ihm das Lebenslicht ausgeblasen.«
Die Brandung hatte zugenommen; der Alte konnte den Körper nicht allein ans Ufer ziehen, der Sohn mußte helfen.
Jetzt lag der Mann vor ihnen, ein Leichnam. Der schwere, scharfe Haken hatte ihm den Hals fast durchschnitten.
Beide beugten sich herab, der Vater habgierig, der Sohn neugierig, als ein Blitzstrahl die Nacht erhellte.
»Alex,« schrie der Alte plötzlich auf und starrte entsetzt den Unglücklichen an, wahrend der Junge zu Boden gestürzt war, als hätte ihn der Blitz getroffen.
Der Fischer hatte seinen ältesten Sohn ermordet.
Am anderen Morgen fanden ihn die benachbarten Fischer am Ufer stehen, fort und fort das Tau, aber mit dem unteren Ende, ins Wasser schleudernd und wieder herausziehend. Teilnahmlos blickte ihm sein Sohn zu und stellte dann die Frage:
»Ist er dran, Vater?«
»Nein, noch nicht.«
Und dann brachen beide in Jammer aus.
So ging es seitdem Tag für Tag, sie waren beide wahnsinnig geworden und versuchten immer wieder den Sohn und Bruder, dessen Körper eine mächtige Woge zurückgenommen hatte, wiederzubekommen. Sie glaubten beide, er lebe noch, aber nie mehr warfen sie den Haken, immer nur das lose Tau.
»In einer lichten Stunde hat der Alte sein Schicksal erzählt,« schloß der Erzähler. »Wir glaubten schon, er sei kuriert, da aber sagte er zu seinem Sohne: ›Komm, wir wollen Alex retten, sonst ertrinkt er.‹ Und beide gingen wieder an den Strand und warfen das Tau aus. Wenn die Fischer ihre gemeinsamen Fahrten machen, dann schließt er sich wohl auch noch wie früher ihnen an, fischt aber nicht, sondern wirft nur das Tau, und sein Junge steuert das Boot. Freunde füttern beide durch. Weil sie aber doch nicht fischen, haben sie ihnen das Fischerboot genommen und ihnen dafür ein anderes gegeben. Sie merkten es gar nicht.«
»Entsetzlich,« sagte Ellen.
Das Boot war zufällig mit dem Schiffe getrieben, die Mädchen sahen Vater und Sohn noch immer bei der unheimlichen Arbeit und hörten die gleichen Fragen und Antworten.
»Etwas anderes sprechen sie niemals?«
»Doch. Wenn sie ein Schiff bemerken, so warnt der Alte den Kapitän, nach dem Strande, wo er wohnt, zu segeln, weil dort der Schoner seines Sohnes untergegangen ist.
»Aber er bemerkt doch unser Schiff gar nicht, obgleich wir dicht vor ihm sind.«
»Ja, das hält etwas schwer, er muß ans Schiff rennen oder angerufen werden. He, Alter,« rief der Fischer hinüber, »hast du Alex noch nicht gefunden?«
Der Wahnsinnige hob die stieren Augen und schien erst jetzt das Vollschiff zu sehen.
Plötzlich warf er das Tau in das Boot, streckte beide Hände nach dem Schiffe aus und schrie:
»Zurück, zurück, ihr segelt auf die Matagorda-Riffe, zurück, sage ich euch, ihr kommt nicht wieder los, euer Schiff muß dort scheitern! Seht ihr ihn schwimmen, dort, dort, den Menschen mit dem durchschnittenem Hals, sein Schoner ist auf den Matagorda-Riffen gescheitert.«
Der Alte schwatzte weiter, griff aber schon wieder zum Tau, um es nach dem eben gesehenen Phantom mit dem durchschnittenen Hals, seinem Sohne, zu schleudern.
Die Nennung des Namens Matagorda brachte unter den Damen eine unangenehme Bestürzung hervor. Das war der Hafen, dem sie jetzt zusteuerten, und den sie noch diese Nacht zu erreichen hofften.
Am Morgen hatte Ellen gesagt, daß in der Nahe dieses Hafens eine Kette von Riffen sei, an welchen schon unzählige Schiffe den Untergang gefunden hätten, und daß die dortigen Bewohner nur von Strandräuberei lebten. In der Nähe der Riffe müßten alle Vestalinnen auf dem Posten sein, um ein Unglück rechtzeitig verhindern zu können.
»Zurück, zurück, sage ich euch, segelt zurück!« rief unten der Wahnsinnige, der sein Tau schon wieder vergebens auswarf und einzog. »Segelt nicht nach Matagorda, ihr müßt scheitern, ihr müßt. Seht ihr dort die Leichen schwimmen? Ihre Schiffe sind alle an den Matagorda-Riffen gescheitert.«
Es wurde den Mädchen unbehaglich; der alte Mann glich einem krächzenden Unglücksraben.
»Geht in Euer Boot,« sagte Ellen zu dem Fischer, »wir wollen wieder in den Wind steuern.«
Der Mann warf die zwei leeren Körbe in sein Boot und schwang sich über die Bordwand, um sich am Tau, an welchem er emporgeklettert war, wieder hinabzulassen.
Aber sei es, daß er den Halt verlor oder einen Fehltritt tat, kurzum, er stürzte plötzlich mit einem Schrei kopfüber ins Wasser.
Er kam zwar sofort wieder an die Oberfläche, aber man sah auch ebensoschnell, daß der Fischer, wie so viele Küstenbewohner, nicht schwimmen, sondern sich nur eben über Wasser halten konnte, nach dem Grundsatze jener Leute, daß das Schwimmen nur den Todeskampf verlängert.
Schon sprangen die Mädchen nach Tauen; Ellen warf das ihrige zuerst dem im Wasser Zappelnden zu, da aber ergriff der Fischer ein anderes, welches nicht von der ›Vesta‹ geworfen worden war.
»Ich habe ihn, ich habe ihn.« jubelte plötzlich der Alte auf und zog das Tau mit furchtbarer Schnelligkeit ein.
»Siehst du, Jeremy, Alex ist nicht tot, wie du immer sagtest; er lebt.«
Den schon halb ertrunkenen Fischer umklammerten zwei starke Arme, aufblickend sah er in die Augen des Alten, und ein plötzliches Entsetzen befiel ihn. Er wollte sich nicht in das Boot heben lassen, ein wildes Ringen entstand, der eine im Wasser, der andere im Boot, das Fahrzeug neigte sich stark auf die Seite, da plötzlich sprang auch der Sohn hinzu, um seinem Vater zu helfen, und das Boot kippte um.
Krampfhaft umschlungen tauchten die beiden Männer wieder auf, aber auch jetzt noch suchte sich der Fischer zu befreien. Er stemmte sich mit beiden Händen gegen die Brust des Wahnsinnigen, ihn zurückdrängend, aber dieser ließ nicht los. Keiner griff nach den von der ›Vesta‹ ihnen zugeworfenen Tauen, schon tauchten sie immer seltener auf, und bald mußten sie für immer verschwinden.
Der Junge war schon von einem Fischerboot aufgenommen worden, aber an die beiden Ringenden konnte jetzt niemand herankommen, die ›Vesta‹ war im Wege.

Schnell hatte Ellen an einem dünnen Tau eine Schleife gemacht, und als die beiden noch einmal auftauchten, warf sie ihnen den so entstandenen Lasso mit unfehlbarer Geschicklichkeit über den Kopf, wartete bis beide wieder sanken, und zog die Schlinge zu.
Dieselbe war stark genug, um die beiden Männer tragen zu können. Die Mädchen zogen das Tau durch einen Block und brachten die Verunglückten an Deck.
Der Spanier war schon bewußtlos, nicht aber der Wahnsinnige, er glaubte noch immer, seinen Sohn gefunden zu haben.
»Alex,« schrie er immer wieder, »habe ich dich endlich? Nicht wahr, du bist nicht tot, du lebst, dein Hals ist nicht durchschnitten?«
Andere Fischer erkletterten das Deck, und endlich gelang es, den Fischer von dem Alten zu befreien. Er blickte auf und bemerkte jetzt erst, daß er sich auf einem Schiffe befand.
»Ihr wollt nach Matagorda?« rief er mit allen Zeichen des Entsetzens. »Fahrt nicht hin, ihr scheitert! Ihr sterbt! Die scharfen Riffe schneiden euch den Hals durch. Alex, wo ist Alex?«
Er suchte den Sohn, den er wiedergefunden zu haben glaubte, er lief an Deck herum, wie es eben nur ein Wahnsinniger kann.
Schließlich bezwangen ihn aber seine Gefährten doch, und er wurde gebunden in dem Boote untergebracht, wo sich bereits sein teilnahmloser Sohn befand. Der besinnungslose Fischer war wieder zum Bewußtsein gekommen und hatte in seinem Boote Platz genommen. Es hätte nicht viel gefehlt, so wäre er durch die plötzliche, furchtbare Angst ebenfalls wahnsinnig geworden, mit solchem Entsetzen blickte der abergläubische Mann um sich. Ja, er griff sich sogar fortwährend an den Hals, als fürchte er, dieser wäre wirklich durchschnitten.
Die Vestalinnen waren froh, als sich der Wind wieder in die Segel legte und sie den Unglücksplatz bald hinter sich hatten.
»Das war eine entsetzliche Szene,« sagte Ellen »Eine unglücklichere Begegnung konnten wir gar nicht haben.«
»Ich schlage vor, wir ändern unseren Kurs. Die Warnung des Wahnsinnigen, nicht nach Matagorda zu segeln, hat mich ängstlich gemacht,« sagte ein Mädchen.
Doch alle waren gegen diesen Vorschlag. Man dürfe dem Aberglauben nicht Vorschub leisten, sagten sie, aber innerlich wurden sie doch von einem Schauer erfüllt, wenn sie des Wahnsinnigen und seiner Worte gedachten.
Ellen ließ die Sonne aufnehmen und berechnete, daß sie nur noch zweihundert Meilen von Matagorda entfernt seien, eine Strecke, die sie bei diesem Winde in achtzehn Stunden zurücklegen konnten.
»Wir sind viel zu weit westlich getrieben worden,« meinte Miß Murray, »ich spähe schon immer nach der Küste aus. Daß wir nahe an derselben sind, verrät uns die Anwesenheit so vieler Fischerboote.«
»Gewiß, sind wir der Ostküste nahe,« entgegnete Ellen. »Kann ich aber etwas dafür?«
Das behauptete niemand. Der Wind war direkt Ost, die ›Vesta‹ trieb also immer nach Westen ab, mit Ausnahme, wenn sie dem Winde direkt entgegenkreuzte, ein sehr langweiliges Unternehmen.
»Das Meer ist an der Ostküste von Mexiko überall tief genug, um selbst bis dicht an den Strand segeln zu können,« nahm Ellen das Wort, »und solange wir die Küste nicht sehen können, haben wir wirklich keinen Grund zur Besorgnis. Wir fahren jetzt nach Norden, so daß wir mit der Küste immer parallel bleiben, und sollten wir doch einmal Land oder bei Nacht Leuchtfeuer, mit denen die Küste ziemlich besetzt ist, erblicken können, so müssen wir eben für einige Stunden gegen den Wind kreuzen, um abzukommen. Es schadet ja nichts, wenn wir Matagorda einige Stunden später als beabsichtigt erreichen.«
Die Mädchen sahen das richtige des Vorschlages ein und stimmten ihm alle bei.
Der Wind war gut, nicht zu heftig und nicht zu schwach, aber merkwürdig schwül, und der Seegang war im Verhältnis zu diesem Winde gering — kein gutes Zeichen.
»Die Möwen fliegen so schwer,« sagte Miß Murray, die neben Miß Thomson stand, »sie rennen immer gegen das Schiff, das bedeutet nichts Gutes.«
»Ach was,« lachte Betty, »die letzte Szene bedrückt Ihre Gedanken.«
»Es ist so schwül.«
»Nicht mehr als gewöhnlich, wir befinden uns in der heißen Zone.«
Da strich plötzlich eine Möwe so nahe an dem Kopf der sorglosen Sprecherin vorbei, daß ihre Flügel deren Mütze herunterwarfen.
»Freches Tier,« lachte Miß Thomson, »war das vielleicht auch ein böses Zeichen?«
Ellen kam aus ihrem Arbeitszimmer an Deck und rief:
»Wenn das Barometer nicht trügt, können wir uns gegen Abend auf einen heftigen Sturm gefaßt machen. Bereiten Sie sich auf eine unruhige Nacht vor!«
»Ein Zimmer für mich frei?« fragte eines Tages in Austin, einer großen Stadt von Texas, ein junger, bleicher Mann den Oberkellner des Hotels.
Der befrackte Diener musterte mit einem Seitenblick die vornehme Erscheinung des Gastes, der eben in dem Hotelwagen vom Bahnhof gekommen war, bejahte und brachte das Fremdenbuch herbei.
Mit nervöser Hast blätterte der junge Mann die aufgeschlagene leere Seite herum, überflog die letzten Namen und schrieb dann darunter:
»August Bredford, Kaufmann, St. Louis.«
»Welche Nummer?« fragte er.
Der Kellner blickte den nervösen Gast noch einmal an und entgegnete:
»Nummer 54, vierfenstriges Zimmer, vorn heraus.«
»All right. Ist Mister Vavalin, welcher, wie ich hier sehe, Zimmer 52 erhalten hat, im Hotel?«
»Er ist auf seinem Zimmer. Wünschen Sie ihn zu sprechen?«
»Bemühen Sie sich nicht, ich gehe zu ihm,« sagte der Herr und sprang auf. »Bringen Sie unterdes mein Zimmer in Ordnung.«
Er ging hinaus.
»Der hat merkwürdige Eile,« murmelte der Kellner, »die Worte sprudelte er nur so heraus.«
Der Herr war inzwischen die Treppe zum ersten Stock hinaufgestiegen und blieb lauschend an der mit 52 bezeichneten Tür stehen.
Ein Flüstern ertönte hinter derselben.
Da klopfte er schnell entschlossen, die Laute verstummten sofort, ein Männerschritt wurde hörbar, und die Tür öffnete sich etwas.
»Endlich!« sagte der Mann leise, welcher von innen geöffnet hatte. »Wir haben Sie lange erwartet.«
»Guten Abend, Chalmers,« rief ein anderer Herr, sich vom Stuhle erhebend und auf den Ankömmling zutretend.
»Wie, Kirkholm, auch Sie hier? Doch es ist gut. Was sagen Sie nun, meine Herren, wollen wir uns die Kehle durchschneiden oder wie Hunde davonjagen lassen?«
Der Sprecher schleuderte mit einer verzweifelten Miene den Zylinder auf einen Stuhl.
»Sie fassen die Sache noch immer kaltblütiger auf als ich,« sagte Spurgeon, der Bewohner dieses Zimmers. »Ich war beim Lesen des Zeitungsberichtes, daß die ›Vesta‹ wieder aufgetaucht ist, nahe daran, den Verstand zu verlieren.«

Der Leuchtturm von Matagorda.
»Vorsicht,« ermahnte Kirkholm, »die Wände könnten Ohren haben.«
»Wo wohnen Sie, Kirkholm?« fragte Chalmers.
»Zimmer 53, hier nebenan.«
»Das paßt ja herrlich, so liegt das Ihrige zwischen den unseren. Wenn meines fertig ist, wollen wir uns in 53 begeben und weitersprechen. Jetzt aber kein Wort mehr, was uns verraten könnte!«
Die drei Herren saßen wohl eine Stunde schweigend da, nur mit ihrer Zigarre beschäftigt. Was aber in ihrem Inneren vorging, das konnte man in ihren Gesichtszügen lesen. Bleich, die Lippen fest zusammengepreßt, ungeduldig hin- und herrückend, saßen sie da, es dauerte ihnen eine Ewigkeit, ehe sie hörten, daß die Kellner das Zimmer 54 verließen.
Dann begaben sie sich alle in die 53. Hier konnten sie unbesorgt miteinander sprechen und ihrer Wut Ausdruck geben.
»Wann haben Sie meinen Eilbrief erhalten?« fragte Chalmers, sich an Spurgeon wendend.
»Vor vier Tagen. Ich hielt es für meine Pflicht, auch Kirkholm die Schreckensnachricht mitzuteilen und ihn hierherzubestellen.«
»Ich bin stehenden Fußes abgereist und habe zwei Pferde totgeritten,« sagte Kirkholm, »so lieblich war die Nachricht für mich. Hölle und Teufel, als ich das Zeitungsblatt mit der blauangestrichenen Rubrik in der Hand hielt und die Botschaft las, glaubte ich nicht anders, als der Schlag sollte mich rühren.«
»Mir ging es nicht anders,« fügte Spurgeon hinzu. »Ich hatte eben ein kleines Fest für meine Plantagenarbeiter arrangiert, um mich bei diesen Leuten in ein gutes Licht zu stellen. Da kommt die Zeitung, welche ich wöchentlich einmal erhalte, und das erste, was mir in die Augen fällt, ist der in großen Lettern gedruckte Name der ›Vesta‹. Und nun lese ich, die ›Vesta‹ ist von einem Schiffe im südlichen Ozean gesehen worden, mit allen Mädchen an Bord, die Nachricht von ihrem Untergange müßte also dementiert werden. Ich glaubte, meinen Augen nicht trauen zu dürfen, ich hielt mich für wahnsinnig, der Boden begann unter meinen Füßen zu schwanken. Aber alle anderen Zeitungen schrieben dasselbe, und andere Schiffe brachten weitere Nachrichten von der ›Vesta‹. Ja, meine Herren, was nun? Die ›Vesta‹ ist wieder da, die Damen haben sich befreit, und Flexan ist verschwunden, das ist ein Faktum.«
Chalmers war, obgleich selbst sehr aufgeregt, doch immer noch der besonnenste von den dreien.
»Ist es ein Faktum, so wollen wir nicht weiter darüber sprechen,« sagte er, »sondern beraten, was zu tun ist, um uns den errungenen Besitz nicht wieder nehmen zu lassen.«
»Das heißt mit anderen Worten, den Mädchen nochmals zu Leibe zu gehen.«
»Natürlich, uns bleibt nichts anderes übrig!« fuhr Chalmers fort und brachte ein Zeitungsblatt zum Vorschein, »ich bin ja derjenige unter uns, der am nächsten an der Eisenbahnstation lebt und daher am besten mit neuen Nachrichten versorgt ist. Hier, meine Herren, das Neueste!«
Chalmers las vor:
»Laut Mitteilung des amerikanischen Flaggschiffes ›Defender‹ segelt die ›Vesta‹ nicht, wie wir erst Annahmen, nach New-York, sondern nach Matagorda im Golf von Mexiko. Der Grund dazu wird der sein, daß die Besitzungen der meisten Damen in der Nähe dieses Golfes liegen, besonders in Mexiko, Texas und Louisiana. Die Erben der Damen werden wohl mit gemischten Empfindungen die Weltumseglerinnen begrüßen; hoffen wir, daß die Verwandtschaftsliebe die Oberhand behält. Der›Defender‹ erfuhr dieses Reiseziel auf seine Anfrage hin, ob die Ankunft der ›Vesta‹ in New-York angemeldet werden solle.«
»Erben, Verwandtschaftsliebe,« lachte Kirkholm krampfhaft auf.
»Still,« sagte Chalmers, der bei der Ausübung seiner religiösen Pflichten mehr Selbstbeherrschung gewonnen hatte, »jetzt wissen wir das Ziel, dem die ›Vesta‹ zustrebt, und nun gilt es, sie nochmals verschwinden zu lassen, diesmal aber besser. Wir sind Flexan keinen Dank schuldig, daß er die Mädchen am Leben gelassen hat, wir aber werden weniger mitleidsvoll mit ihnen verfahren.«
»Haben Sie schon einen Plan?«
»Ja, während der Reise hierher ist er mir eingefallen. Spurgeon, Sie sind an der Küste bekannt?«
»Nein, ich bin ja erst einige Wochen hier.«
»Aber Sie haben Leute auf der Plantage, welche an der Küste geboren sind?«
»Solche habe ich.«
»Gut. So müssen wir noch vor der Ankunft der ›Vesta‹ Vorbereitungen treffen, daß sie den Hafen nie erreicht.«
Die beiden schauten den Sprecher erstaunt an, dessen Worte klangen so bestimmt, als könnte der Plan gar nicht fehlschlagen.
»Wie wollen Sie das einrichten? Flexan ist es nicht einmal gelungen, die Mädchen aus der Welt zu schaffen.«
»Bah, Flexan,« sagte Chalmers verächtlich, »ich kenne noch andere Mittel, um Schiffe scheitern zu lassen. An der Küste des Golfs herrscht noch das Strandrecht, das müssen wir benutzen, und keine erreicht lebendig das Ufer. Wir lenken die ›Vesta‹ mit Truglichtern auf den Strand.«— —
Matagorda liegt nicht direkt an der Küste, sondern einige Meilen weiter im Lande, steht aber mit seinem gleichnamigen Hafen durch den schiffbaren Kolorado in Verbindung.
Der Hafen von Matagorda hat eine sehr günstige Lage. Durch eine mit der Küste parallel laufende Halbinsel wird eine Bucht gebildet, und mag draußen der Sturm auch noch so sehr wüten, mögen himmelhohe Wogen mit donnerndem Getöse gegen die Felsengestade prallen — das Wasser in der Bucht kräuselt kaum seine Oberfläche, die Schiffe ruhen sicher im Schutze der natürlichen Mole.
Aber einen Fehler hat der Hafen, er hat nämlich einen sehr gefährlichen Eingang. Derselbe ist nur schmal, und irrt sich das Schiff, kommt es zu weit links oder zu weit rechts, so drohen ihm überall die furchtbarsten Gefahren.
Rechts erstreckt sich die Halbinsel in allmählicher Abflachung ins Meer hinein — das Schiff würde also leicht auf den Strand laufen können, und links erheben sich die Matagorda-Riffe, wohl hundert Meilen der Küste entlang. Das Fahrzeug, sei es ein Dampfer oder ein Fischerboot, welches von dem Winde auf diese jäh emporsteigenden Felsen getrieben wird, ist verloren, denn wenn der in dieser Gegend unbekannte Kapitän versucht, durch die Riffe zu steuern, weil hinter ihnen das Wasser ruhig erscheint, so geht das Schiff bei diesem Versuche regelmäßig zugrunde. Die Brandung zwischen den Felsen ist so stark, daß das Schiff immer auf ein Riff geworfen wird, wenn sein Rumpf nicht schon vorher von einer scharfen, im Wasser verborgenen Klippe wie mit einem Messer halbiert worden ist.
Doch Matagorda hat dafür gesorgt, daß weder die eigenen, noch fremde Schiffe diesen Gefahren zu sehr ausgesetzt sind, sonst würde es sich wohl nicht zu einer solchen blühenden Seestadt entwickelt haben.
Am Tage kreuzen weit draußen auf offener See zahlreiche Lotsenboote, dem sich nahenden Fahrzeuge, das die Lotsenflagge zeigt, den erfahrenen Piloten an Bord bringend, und auf der südwestlichen Spitze der Halbinsel erhebt sich ein mächtiger Leuchtturm, dessen weithin sichtbares Licht während der Nacht dem Schiffe den sicheren Weg zur Einfahrt zeigt.
Wer noch nie zur See gefahren ist oder noch nie Gelegenheit gehabt hat, einen Leuchtturm zu sehen, wird der Meinung sein, in einem solchen brenne einfach ein helles Licht, welches vielleicht durch große Reflexspiegel noch verstärkt wird.
Solche Leuchttürme sind aber die der ältesten Art. Jetzt bedient man sich einer anderen Konstruktion, um dem nach dem Wege suchenden Schiffe besser sein Ziel zeigen zu können.
Die Aufmerksamkeit der Seefahrer wird bedeutend mehr erregt, wenn das Feuer des Leuchtturms nicht immer strahlt, sondern abwechselnd aufblitzt und wieder verschwindet, wie bei den sogenannten Blinklichtern, oder wenn es seine Farbe verändert, einmal blau, dann rot, dann grün, dann wieder weiß erscheint, wie zum Beispiel in Calais, bei welchem auch noch zugleich die dritte Konstruktion angebracht ist, daß sich nämlich das Licht immer in großem Bogen bewegt.
Der Leuchtturm von Matagorda besitzt ein Blinklicht, welches erst weiß, dann grün, dann rot erscheint, zur Unterscheidung von dem benachbarten Hafen, Galveston, dessen Leuchtfeuer, nur in Weiß, bald erglänzt, bald verschwindet.
Erzeugt wird das Licht durch eine elektrische Bogenlampe, und jeden um die Besichtigung bittenden Fremden, der sich überzeugen will, wie die farbigen Gläser vor derselben vorbeigezogen werden, zeigt der Beamte gern die sinnvolle Einrichtung und die dazu nötigen Maschinerien.
Der Leuchtturmwärter, der gerade einen wißbegierigen Besucher herumführte, fühlte sich durch das ihm in die Hand gedrückte Goldstück veranlaßt, die ganze Maschinerie in Bewegung zu setzen, nur die Bogenlampe brachte er nicht zum Glühen, denn es war ja noch heller Tag.
Der Fremde, ein junger, ernster Mann, konnte nicht oft genug seine Verwunderung darüber aussprechen, daß dies alles so einfach war, während er eine komplizierte Maschinerie zu finden erwartet hatte.
»Bei einer solchen Einrichtung,« entgegnete der Wärter, ein alter, invalider Seemann, dem die Ehrlichkeit aus den Augen sprach, »kommt es hauptsächlich auf Einfachheit an. Je komplizierter die Maschinerie ist, desto leichter kann sie einmal versagen, und denken Sie sich nur einmal aus, was dann für Unglücke entstehen können, wenn plötzlich das Licht versagen sollte. Hunderte von Menschen würden ihr Leben lassen müssen, weil das Leuchtfeuer nicht sichtbar wäre.«
»So kam es noch niemals vor, daß die Vorrichtung nicht funktionierte?« fragte der Fremde. »Meiner Ansicht nach könnte dies doch sehr leicht eintreten, denn die Gläser sitzen ganz lose in dem einfachen Holzrahmen und das Rad wird nur einfach von einem Strick gedreht, den die Maschinerie bewegt. Reißt derselbe, dann stehen die Gläser still.«
»Das macht weiter nichts,« lachte der Alte, »dann drehe ich das Rad einfach mit der Hand, bis der Morgen anbricht und das Feuer außer Betrieb gesetzt werden kann. Der Strick wird durch einen anderen ersetzt, und der Schaden ist repariert. Bricht ein Glas, nun, so habe ich einen Vorrat davon da, und ein anderes ist leicht eingesetzt. Wäre das Rad aber ein schweres, eisernes, wären die Gläser mit Blei eingefaßt und könnte die Vorrichtung nur mittels eines starken Riemens gedreht werden, na, dann würde ich alter Krüppel das Ding wohl nicht drehen können, wenn der Riemen reißen sollte.«
»Aber kann die Bogenlampe nicht einmal versagen?«
»Ist bis jetzt noch nicht vorgekommen,« entgegnete der Alte. »So lange die Dynamomaschine geht, kann das auch nicht passieren. Zum Betriebe derselben sind zwei Dampfmotoren da, einer zur Reserve, und ebenso kann auch eine andere Dynamomaschine eingeschaltet werden. Wir haben hier zwei Elektrotechniker, und die sorgen schon, daß alles für die wenigen Stunden der Nacht funktioniert, sie haben ja am Tage Zeit genug zum Nachsehen, und Jakob, der Heizer, nun, der weiß mit seiner Maschine Bescheid.«
Der Leuchtturmwärter war vollkommen überzeugt, daß ein Nichtfunktionieren des Feuers gar nicht möglich sei. Er war ja von Anbeginn hier tätig gewesen, und nie war ihm ein Unglück passiert. Auch der Fremde mußte zugeben, daß ein Verlöschen des Feuers oder des Farbenspiels unmöglich sei. Er begab sich dann in den Maschinenraum, wo er sich von einem Techniker den mechanischen Betrieb erklären ließ
Aus den Fragen des Fremden entnahm der Techniker, daß dieser von dem Wesen der Elektrizität keine Ahnung hatte, und führte ihn in die Hauptelemente derselben ein, um ihm das Funktionieren der Dynamomaschine begreiflich zu machen.
»Stehen Sie auch mit anderen Leuchttürmen an der Küste in Verbindung?« fragte der Fremde, der seit einiger Zeit öfters nach der Uhr sah.
»Gewiß, mittels eines elektrischen Telegraphen können wir mit dem Leuchtturm von Galveston und einem anderen westlich von uns sprechen. Aber,« fuhr der Techniker fort, »wenn Sie dessen Leuchtturm in Tätigkeit sehen wollen, so ersuche ich Sie, in etwa vier Stunden wiederzukommen, wenn Sie nicht vorziehen, gleich hierzubleiben. Um neun Uhr beginnt das Feuer zu spielen!«
»Es ist jetzt bald fünf Uhr.« sagte der Fremde, abermals nach der Uhr sehend, »es tut mir leid, nicht länger hierbleiben zu können, ein Geschäft ruft mich nach Matagorda zurück. Wollen Sie aber die Güte haben, mir noch einmal die Dynamomaschine zu erklären, es ist mir noch unverständlich, auf welche Weise sie die Elektrizität erzeugt.«
»Sehr gern,« entgegnete der Techniker und führte den Fremden in den Raum zurück, in welchem die beiden Dynamomaschinen, von denen aber nur die eine gebraucht wurde, standen. Eine Menge mit grüner Seide umsponnene Drähte liefen die Wände und die Decke des Gemaches entlang.
Eben wollte der Techniker die an ihn gestellte Frage beantworten, als eine Stimme in dem Treppenhause des Leuchtturmes rief:
»Mister Grave, Sie werden von einem Herrn im Leuchtturm Galveston zu sprechen gewünscht.«
»Entschuldigen Sie mich,« wandte sich der Techniker an den Fremden, »ich muß für eine Minute an den Telegraphenapparat, komme aber sofort zurück.«
Er eilte hinaus, den Fremden allein in dem Gemach zurücklassend.
Dieser blickte sich schnell um, er war allein.
»Fünf Uhr,« murmelte er, »Chalmers hat Wort gehalten, jetzt schnell ans Werk!«
Mit einem Schritt trat er an die Dynamomaschine, warf noch einmal einen scheuen Blick umher und machte sich dann an zwei dicht zusammenstehenden Spitzen der Maschine zu schaffen, er schien sie zu verbiegen. Aber nicht genug damit, er löste auch einen grünen Draht ab, zog einen anderen, ganz ähnlichen aus der Tasche und schraubte diesen an die Stelle des ersten, so die Verbindung wieder herstellend.
Ebenso machte er es an der zweiten Maschine. In höchstens einer Minute war alles geschehen. Man sah den Apparaten nicht an, daß etwas mit ihnen vorgenommen worden war. Die Verbiegung der Spitzen war fast unmerklich, die verwechselten Drähte fielen nicht auf. Die richtigen hatte der Fremde in seine Tasche gesteckt.
Wie gewöhnlich, so wurden aus der vom Techniker versprochenen einen Minute fünf. Der Fremde trat an ein Fensterchen und blickte auf das Meer hinaus, welches unruhig zu werden begann. Schon der Leuchtturmwärter hatte gesagt, es wäre für diese Nacht ein Sturm zu befürchten.
»Es kommt, wie es nicht besser sein könnte,« murmelte der Fremde durch die Zähne. »Besorgen die anderen ihren Auftrag ebensogut, wie ich den meinen, so muß die Sache glücken. Der Techniker und der Alte werden in keine schlechte Angst geraten, wenn ihre Apparate nicht funktionieren wollen und sie vergeblich nach der Ursache suchen. Und wenn die ›Vesta‹ nicht diese Nacht hier einlaufen will, sondern erst morgen bei Tage, so muß Spurgeon ihr einen Lotsen an Bord schicken, der sie auf der Strand laufen läßt. So oder so, glücken muß es!«
Der Techniker trat wieder herein.
»Haben Sie auch schon von der ›Vesta‹ gehört?« fragte er den harmlosen Besucher.
»Die ›Vesta‹? Gewiß! Was ist mit dieser?«
»Sie kommt jedenfalls diese Nacht in den Hafen. Es wurde mir bereits vor einigen Stunden von Galveston aus telegraphiert. Sie hat ihre Absicht einem anderen Dampfer signalisiert. Alle Wetter, ist deswegen hier eine Aufregung. Soeben fragte mich der Telegraphist in Galveston auf Bitte eines Herrn, der dort den Leuchtturm besichtigt, ob die ›Vesta‹ schon zu sehen wäre. Das kann natürlich nicht der Fall sein. Vor Mitternacht können wir sie gar nicht erwarten.«
Der Fremde bedankte sich für die freundliche Erklärung, legte in die Sparbüchse für Schiffbrüchige eine reichliche Spende und verabschiedete sich von dem Personal des Leuchtturms. Er ließ sich in einem Mietsboot durch den Hafen rudern und stieg an der Küste des Festlandes aus.
Sofort gesellte sich ihm ein anderer Herr zu, der schon auf ihn gewartet haben mußte. Beide durchschritten schweigend die Dockstraße, bis sie das Ende der Hafenanlage erreicht hatten, wo ein leichter Landwagen stand.
Erst, als der Kutscher, ein Spanier, die beiden Rosse zum Laufe antrieb, nahm der Fremde das Wort:
»Spurgeon,« flüsterte er leise, und nur mit Mühe konnte er seine Freude verbergen, »es ist alles geglückt. Diese Nacht wird zum ersten Male das Leuchtturmfeuer nicht zu sehen sein.«
Spurgeon atmete auf; eine furchtbare Aufregung hatte sich seiner plötzlich bemächtigt.
»Werden die Techniker nicht den Schaden, den Sie angestiftet haben, bemerken und wieder gutmachen können, Kirkholm?«
»Nicht so schnell, daß dadurch unser Plan gestört würde! Ich kann Ihnen nicht auseinandersetzen, was ich gemacht habe, denn Ihnen fehlt die Kenntnis der Dynamomaschine, wahrend ich als Ingenieur ausgebildet worden bin. Nur soviel kann ich Ihnen sagen, daß ich den Techniker auf eine falsche Spur geleitet habe. Ich habe nämlich zwei Spitzen, über welche der elektrische Strom springen muß, etwas verbogen, und wenn die Maschine nicht funktioniert, so glauben die Techniker nicht anders, als daß dies die Strömung verursache. Sie werden sich nun bemühen, die ursprüngliche Stellung der Spitzen wieder herbeizuführen, aber sie können machen, was sie wollen, die Maschine funktioniert doch nicht mehr, weil ein Draht an ihr fehlt.«
»Das werden sie aber bald herausfinden.«
»Auch nicht, denn ich habe einen anderen eingeschaltet, der den: ursprünglichen ganz ähnlich sieht, aber gar kein Draht ist, sondern nur aus Seide mit Gummi-Einlage besteht, also vollkommen isoliert. Erst aber operieren sie stundenlang an den Spitzen herum, dann schalten sie die andere Dynamomaschine ein, darüber allein wird es schon Morgen, und ehe sie den Fehler wirklich gefunden haben, vergehen Tage, vielleicht Wochen.«
»Gut denn,« sagte Spurgeon, »und mit meinem Erfolge können Sie auch zufrieden sein.«
»Haben Sie den Lotsen gefunden?«
»Ja, jener ehemalige Lotse ist für Geld willig, die ›Vesta‹ auf den Strand laufen zu lassen, doch wir brauchen seine Dienste nicht. Die ›Vesta‹ wird nach den neuesten Nachrichten diese Nacht einlaufen. Wir haben Glück, es wird stürmisches Wetter.«
»Und wie steht es mit den Vorbereitungen, um die ›Vesta‹ auch bei Nacht auf die Riffe laufen zu lassen?«
»Alles ist besorgt; die Fischer sind schon engagiert, und sie gingen mit Freuden auf meinen Vorschlag ein, denn er verspricht ihnen reiche Beute zu bringen. Ich glaube, sie werden von jetzt ab noch öfters mit Truglichtern operieren, auch ohne mein Geheiß,« schloß Spurgeon mit einen häßlichen Lächeln.
»An wie vielen Stellen lassen Sie die Lichter sehen?« fragte Kirkholm.
»Bei Anbruch der Nacht stammen solche an vier Stellen zugleich auf, so, daß sie von den Leuchttürmen nicht gesehen werden können. Die ›Vesta‹ muß in die Falle gehen; ein Feuer bekommt sie wenigstens in Sicht und hält dies dann für das von Matagorda.«
»Und vielleicht noch manches andere Fahrzeug,« fügte Kirkholm hinzu.
»Was macht es aus,« entgegnete Spurgeon gleichgültig, »ob ein Menschenleben mehr oder weniger geopfert wird? Hauptsache ist, daß die Vestalinnen den Strand nicht betreten, und dafür, kalkuliere ich, werden die Strandbewohner schon sorgen. Die Schiffbrüchigen gehören ihnen. Aber unter diesen Umständen, bei dieser stürmischen Nacht werden die Mädchen wohl schwerlich den Fischern lebendig in die Hände fallen, morgen werden wir das Meer mit Schiffsplanken bedeckt sehen. Glück auf, Kirkholm!«
»Feuer voraus!« rief eine jugendliche Stimme; doch kaum ließ der wütende Sturm die Worte das Ohr der Kapitänin erreichen.
»Wechselfeuer,« erklang es dann noch.
In weiter, weiter Ferne erschien bald ein weißes, bald ein rotes, bald ein grünes Licht; jede Farbe leuchtete einige Sekunden auf und verschwand dann wieder, um einer anderen Platz zu machen.
»Gott sei gepriesen, das Leuchtfeuer von Matagorda,« jubelte Ellen aus tiefstem Herzen, »wir haben die Riffe westlich passiert.«
»Der Sturm treibt uns furchtbar nach Norden,« ertönte neben ihr eine Stimme, aber sehen konnte man die Sprecherin nicht, so finster war die Nacht.
»So laufen wir direkt nach Matagorda,« entgegnete Ellen. »Ich fürchtete, wir würden den Riffen zutreiben, wir haben sie aber glücklich hinter uns. Mag der Sturm uns noch so nahe der Küste treiben, jetzt liegt es in unserer Hand, in den Hafen zu laufen.«
Gerade vor der ›Vesta‹ tauchten die Lichter auf immer in der gleichen, bunten Reihenfolge, die sogenannten Wechsellichter, und die ›Vesta‹ steuerte diesem Ziele zu.
Es war eine furchtbare Nacht. Der Sturm kam von Süden; manchmal aber schien er von allen Seiten zugleich zu brausen. Welle auf Welle ergoß sich über Deck. Die Mädchen, welche oben zu tun hatten mußten sich bei jedem Schritt anklammern, und der Ausguck auf der Back war am Gangspill festgebunden worden.
Am Steuerrad standen zwei Mädchen, und doch konnten sie kaum das wildschlagende Steuer bändigen. Schon zweimal hatte das Rad die Steuernden zu Boden geworfen.
»Gestern abend dünkte mich, wir wären bald an der Ostküste von Mexiko; ich glaubte schon, das Land zu erkennen,« sagte wieder das Mädchen neben Ellen, Miß Murray, »und jetzt sind wir schon in der Nähe von Matagorda. Das ist bei diesem Südwind seltsam.«
»Der Wind wechselt fortwährend! nur die Hauptrichtung ist von Süden,« entgegnete Ellen.
Schweigend betrachteten die Mädchen an Deck die aufsteigenden bunten Lichter. Sie versprachen ihnen nach mühseliger Nacht Ruhe und Sicherheit. Bald lag die ›Vesta‹ in ruhigem Wasser, und weder Sturm, noch Wogen konnten ihnen etwas anhaben.
Die drei Mädchen auf der Kommandobrücke durften ihre Gedanken nicht bei diesen friedlichen Feuerzeichen verweilen lasten, die Sicherheit ihrer Freundinnen hing von der Aufmerksamkeit ab, mit der sie vorläufig Segel, Kompaß und Kurs beobachteten. Aber auch das Meer wollte Berücksichtigung haben.
»Festgehalten!« donnerte es diese Nacht zum ungezählten Male durch das Sprachrohr von der Kommandobrücke herunter, den Sturm übertönend.
Alle Hände streckten sich instinktmäßig nach einem festen Gegenstande aus, man wußte, was dieser Ruf der Kapitän in zu bedeuten hatte.
Wieder kam eine ungeheure Woge dahergerollt. Erst stürzte das Schiff in einen Abgrund, dann schoß es einen Berg hinauf, aber es war nicht so schnell wie das Wasser, der Kamm überschlug sich und schwemmte manneshoch über das Deck hinweg.
Als das Schiff auf dem höchsten Kamme schwebte und mit fortgerollt wurde, ohne vom Winde abhängig zu sein, entdeckte der erste Blick der aus dem Wasser auftauchenden Mädchen, daß das Kombüsenhäuschen mit allem, was darin gewesen, fortgeschwemmt worden war.
»O weh,« rief eine noch gutgelaunte Vestalin, »morgen früh gibt es keinen Kaffee.«

Ganz anders waren die Betrachtungen, welche die drei Mädchen auf der Kommandobrücke anstellten, wahrend die ›Vesta‹ noch immer auf dem Kamme der haushohen Welle tanzte.
»Was ist das?« rief Ellen und deutete nach Westen, »wo man, allerdings sehr weit entfernt, aber doch deutlich, ein ähnliches Wechselfeuer wie das vor ihnen liegende erblicken konnte.
Miß Murray, wie auch das andere Mädchen, waren über diese neue Erscheinung höchlichst erstaunt. Sie währte nur einen Augenblick, dann schoß das Schiff wieder jäh in die Tiefe und kam die ganze Nacht nicht wieder so hoch, um die neuen Lichter erkennen zu lassen.
»Es waren die Lichter eines Leuchtturmes, den ich nicht kenne und der auf der Karte nicht verzeichnet steht,« rief Miß Murray.
»Es waren dieselben wie die von Matagorda, denen wir zusteuern,« fügte das zweite Mädchen hinzu, »oder könnten es nicht die von Matagorda sein?«
Diese Frage wurde nicht beantwortet; ein langes Schweigen trat ein. Alle blickten starr nach der Gegend, wo sie einmal die Lichter hell leuchten gesehen hatten, aber sie kamen nicht wieder.
»Welcher Leuchtturm ist nach unserer Karte der nächste westlich von Matagorda?« fragte Ellen endlich.
»Der von Brownsville.«
»Dieser kann es nicht sein, wir haben Brownsville schon links hinter uns.«
»Dann ist es ein neuer Leuchtturm,« entschied Miß Murray, »von dessen Errichtung uns in dem halben Jahre nichts mitgeteilt worden ist. Sehr schlimm allerdings!«
In jeder größeren Hafenstadt teilt das Seemannsamt einem ansagenden Kapitän kostenfrei mit, welche neuen Leuchttürme erbaut wurden sind, ob Schiffe gesunken sind, deren unter dem Wasser verborgenen Masten anderen Schiffen gefährlich werden können. Man bezeichnet genau die Lage solcher gefährlicher Stellen, kurz, benachrichtigt den Fragenden über alles, was seinem Schiffe von Vorteil oder von Nachteil sein könnte, und der Kapitän berichtigt demgemäß seine Seekarten.
Die Seemannsämter machen sich solche Mitteilungen gegenseitig durch Depeschen.
Die ›Vesta‹ hatte sich die letzten Berichtigungen in Mgwana vom Seemannsamt in Kapstadt zutelegraphieren lassen, aber ein neuer Leuchtturm an der Südostküste der Vereinigten Staaten war nicht gemeldet worden.
»Es ist gleichgültig, ob die Lichter von Matagorda oder von einem anderen Leuchtturm herrühren, jedenfalls winken sie uns zu, daß wir dort geborgen sind, und wir wollen ihrer Aufforderung Folge leisten,« sagte Ellen. »Ich wage nicht, bis zum Tagesanbruch ohne Segel auf dem Wasser liegen zu bleiben, denn der Südwind würde uns doch an die Küste treiben. Besser, wir segeln direkt auf diese Lichter zu.«
Die anderen beiden Mädchen, also der erste und der zweite Steuermann, sahen die Richtigkeit dieser Worte ein. Man richtete seine Aufmerksamkeit nur noch auf die vorausliegenden Feuer.
Noch immer war man weit von ihnen entfernt, trotzdem die ›Vesta‹ fast achtzehn Knoten segelte. Leuchtfeuer sind eben sehr, sehr weit zu sehen. Abwechselnd tauchten die weißen, roten und grünen Punkte in der dunklen Nacht auf, dem einsamen Schiffer gleichsam zuwinkend.
Noch schauten die Mädchen dem bunten Farbenspiel träumerisch zu, als plötzlich die ›Vesta‹ wie sie sich gerade wieder einmal in die Tiefe senkte, einen merklichen Stoß erhielt.
Es ist entsetzlich, so einen Stoß am Schiff zu merken, wenn man sich auf dem Meere glaubt. Alle Nerven schrecken zusammen, und man meint nicht anders, als im nächsten Augenblick müsse das Schiff auseinanderbersten.
Erschrocken stürzten die Mädchen nach den Booten, denn nur diese konnten eventuell Rettung bringen. An sie denkt man im Augenblick einer solchen Gefahr zuerst.
Da erscholl schon Ellens Stimme durch das Sprachrohr.
»Es war ein gesunkenes Wrack, hat nichts zu bedeuten. Peilen!«
Die Mädchen kamen durch diese Worte ebenso schnell wieder zur Besinnung. Wie sollte man auch hier auf offenem Meer auf ein Felsenriff treffen, wo jeder Zoll des Wassers bekannt war und die Karten Meter für Meter die Meerestiefe angaben! Es hätte gerade durch vulkanische Kraft ein neues Riff entstanden sein müssen. Doch wann kam dies vor?
Nein, Ellen hatte zwar nur geraten, aber es konnte nicht anders sein, es lag ein Wrack hier, dessen Mastspitzen bis an die Wasseroberfläche reichten. Wäre es ein schöner Tag gewesen, so hatte man die Stelle nach der Sonne aufgenommen, wo das Wrack lag, im nächsten Hafen gemeldet, und das Seemannsamt würde das Wrack durch Taucher haben sprengen lassen, wenn das Heben sich nicht mehr verlohnte.
Jetzt aber mußte gepeilt werden, das heißt, das im Kielraum stehende Wasser gemessen werden — wie schon früher bemerkt, lecken hölzerne Schiffe immer mehr oder weniger — es konnte leicht sein, daß die ›Vesta‹ wirklich ein Leck davongetragen hatte.
Die Meßschnuren wurden an verschiedenen Stellen des Decks hinabgelassen.
»Zwanzig Zentimeter,« rief ein Mädchen nach der Kommandobrücke hinauf.
»Pumpen,« war die Antwort.
Die ›Vesta‹ hatte entweder infolge hohen Seeganges viel Wasser eingelassen, oder sie leckte wirklich. In der nächsten halben Stunde mußte man das nach einem energischen Pumpen entscheiden können.
Die eine Hälfte der Mädchen sprang nach den Pumpen und setzte das Schwungrad in Bewegung. In Strömen ergoß sich zu beiden Seiten das ausgepumpte Wasser über Deck; es stand also hoch im Kielraum.
Da wurde Ellens Arm plötzlich von einer Hand gepackt, und mit erregter Stimme flüsterte ihr Miß Murray ins Ohr:
»Still, horchen Sie! Klingt das nicht wie das Rauschen der Brandung?«
Ellen wollte schon eine unwillige Antwort auf die so ängstliche Bemerkung geben, als sie sich plötzlich weit über die Brüstung der Brücke lehnte und in die tosende Nacht hinauslauschte, als könne sie so besser einen außergewöhnlichen Ton vernehmen. Dann begannen mit einem Male ihr die Kniee zu schwanken; auch ihr Ohr hatte ein entferntes Rauschen und Donnern vernommen.
»Die Brandung?« kam es bebend aus ihrem Münde. »Hilf Himmel, Jessy, auch ich höre etwas, was ich mir nicht erklären kann!«
»Segelt nicht nach Matagorda, ihr kommt auf die Riffe,« stammelte mit schreckensbleichen Lippen das dritte Mädchen, die Worte des Wahnsinnigen wiederholend.
»Das Leuchtfeuer ist noch zu sehen.«
»Was hilft uns das?« rief Jessy. »Wir segeln aus die Riffe zu. Nur an einer zerrissenen, felsigen Küste kann die Brandung so donnern. Miß Petersen, lassen Sie wenden, oder wir sind verloren.«
Schon hatte Ellen das Sprachrohr an ihren Mund gesetzt. Jetzt zitterten die Hände nicht mehr.
»Wenden!« schmetterte es durch die Nacht.
Erstaunt vernahmen die Mädchen an Deck dieses Kommando. Sie wußten nicht, was dieses Manöver jetzt, da sie dem Hafen zusegelten, bedeuten sollte, aber eine Ahnung sagte ihnen, daß Wichtiges auf dem Spiele stehen müsse. Das seltsame Geräusch hatten sie noch nicht gehört.
Sie ließen die Pumpen ruhen und sprangen an die Brassen, jede auf ihre Station.
»Fertig!« schallte langgezogen der Ruf aus achtzehn Kehlen, anzeigend, daß man bereit war, das nächste Kommando auszuführen.
»Los die Brassen!«
Die Taue glitten auf der einen Seite durch die Hände der Mädchen, auf der anderen wurden sie so schnell als möglich eingeholt. Die losen Raaen wurden gerichtet, sie flogen herum und sollten schon wieder festgemacht werden, als plötzlich die Hände der Mädchen wie gelähmt herabsanken, und die frischen Gesichter sich mit Aschfarbe bedeckten.
Die ›Vesta‹ erhielt einen Stoß, dann noch einen, einen dritten, und dann löste sich das starre Entsetzen der Mädchen.
»Die Riffe,« schrie es gellend zum Himmel hinauf »die Matagorda-Riffe.«
Alles stürzte nach den Booten; da gab es kein Halten mehr, und es war auch das einzige, was man tun konnte. Jetzt erhellte ein Blitz plötzlich die finstere Nacht, und was man da sehen konnte, ließ das Blut in den Adern erstarren.
Vor der hastig schwankenden ›Vesta‹ war kein Meer zu sehen, wohl aber eine zischende, dampfende Wassermasse. Wie Fontänen spritzte der Gischt zum Himmel auf, und der Blitz zeigte auch schon die drohenden, schwarzen Riffe, ganz in der Nähe, kaum hundert Meter von der ›Vesta‹ entfernt.
Nur energisches Handeln konnte vor einem Scheitern retten, und Ellen besaß Kaltblütigkeit genug, um die Lage sofort zu erfassen.
»Hol an die Backbordbrassen — los die Steuerbordbrassen — Ruder hart Steuerbord!«
Die Mädchen zeigten, daß sie noch nicht durch die Angst um ihr Leben völlig besinnungslos geworden waren. Hier gab es kein Ankern. Die Tiefe, aus denen die Felsen emporragten, war grundlos. Man mußte versuchen, gegen den Wind zu kreuzen, und gelang dieses nicht, dann mußte man zu den Booten seine Zuflucht nehmen.
Die Raaen wurden gewendet, aber noch drehte sich das Schiff nicht, um den Wind von der Seite zu bekommen. Wenn es aber durch neue Stöße leck gerannt worden war, was dann? Dann mußte man in den Booten sein nacktes Leben zu retten suchen.
Es kam noch schlimmer.
»Ruder hart Steuerbord!« rief Ellen mehrmals schnell hintereinander den beiden Steuernden zu. Sie war außer sich, daß ihr Kommando nicht befolgt wurde.
Wohl drehten die beiden Mädchen das Rad nochmals herum, aber es folgte plötzlich so leicht und willig, es widerstand gar nicht, und Ellen wußte, welches neue Unglück sie betroffen hatte. Das Steuer war zerbrochen.
Der Ruf hallte von Mund zu Mund; eine wilde Aufregung entstand; jetzt war die ›Vesta‹ ein Spiel der Wellen, sie wurde vom Südsturm direkt auf die Riffe zugetrieben, die Brandung machte sich schon donnernd bemerkbar, immer wiederholten sich die Stöße gegen vorspringende Felsen.
»An die Boote!«
Schon waren die Mädchen damit beschäftigt, dieselben auszusetzen, eine beim Sturm sehr gefährliche Arbeit, als der Himmel auch dieses verhinderte.
Der Sturm schien noch einmal seine ganze Macht zeigen zu wollen; er hatte etwas nachgelassen, aber im letzten Anprall vereinigten sich alle seine Kräfte. In der wild um sich schlagenden Takelage heulte und pfiff es plötzlich furchtbar, und da kam auch schon eine mächtige Woge herangetrieben, auf die ›Vesta‹ und die Küste zu.
»Festgehalten!« schmetterte es noch einmal durch das Sprachrohr, dann sprang auch Ellen nebst ihren Gefährtinnen von der Brücke herab und klammerte sich an einen Anker; der nächste Augenblick konnte ihnen vielleicht den Untergang bringen.
Wie ein Ball wurde die ›Vesta‹ emporgeschleudert, blitzschnell sauste sie fort, dem donnernden Geräusch entgegen, dann folgte ein Krachen, ein Splittern — ein gellender Schrei rang sich von aller Lippen, dann war es wieder still.
Die Mädchen lagen auf den Knieen, sich an irgend etwas klammernd, und wagten kaum zu atmen. Jeden Augenblick erwarteten sie einen zweiten Stoß, der die Fugen lösen, die ›Vesta‹ zerschmettern und sie selbst ins tosende Meer schleudern mußte.
Aber es folgte kein neuer Stoß, kein Krachen und Splittern ward hörbar, die Mädchen hoben langsam die Köpfe und wurden jetzt erst inne, daß die ›Vesta‹ nicht mehr schaukelte und schwankte, sondern still lag. Nur die Wogen brandeten nach wie vor an den hölzernen Rumpf und ergossen sich ab und zu noch über Deck.
»Wir sitzen fest!« hörten sie dann Ellens Stimme rufen. Eine frohe Nachricht war das nicht. Wer wußte, ob nicht die nächste große Woge das Schiff wieder losriß und gegen ein Riff schleuderte, oder ob der scharfe Felsen den Rumpf durchschnitten halte und die Planken nur noch ganz lose zusammenhingen?
Der Himmel hatte jedoch Mitleid mit den Geängstigten; er wollte sie wenigstens ihre Lage deutlich erkennen lassen. Die Wolken teilten sich, der Mond trat in die entstandene Oeffnung und zeigte den Mädchen, wo sie sich befanden.
Ringsum starrte es von Felsen, über die sich fortwährend die Wellen ergossen, wo zwei Riffe nahe zusammenstanden, spritzte die Brandung wenigstens zehn Meter hoch empor.
Es war wunderbar, wie die ›Vesta‹ den Weg hierhergefunden hatte. Hundertmal schon hätte sie auf Riffen, die hinter ihr lagen, zerschellt sein müssen, aber eine gütige Hand hatte das Schiff geführt, bis es von der mächtigen Woge hier abgesetzt wurde.
Jetzt lag es zwischen zwei Felsen eingeklemmt, das Vorderteil tiefer als das Hintere, und etwas auf der Seite, doch konnte man beim Schein des Mondes erkennen, daß diese Lage eine sichere war, allerdings auch eine solche, aus welcher sich die ›Vesta‹ ohne fremde Hilfe nicht wieder freimachen konnte. Die ›Vesta‹ lag hoch; nur der Kiel berühre das Wasser, und die aufgeregten Wogen konnten nur den Rumpf treffen. Oftmals, wenn das Meer zurücktrat, kam selbst der Kiel zum Vorschein, und man konnte noch deutlicher sehen als sonst, wie fest das Schiff zwischen den beiden Felsen eingekeilt war.
Nichts als Felsen um sie herum, zwischen denen die Brandung wütete, waren zu sehen, und trotzdem spielten dort noch immer die farbigen Lichter des Leuchtturmes. Dort mußte die Küste sein. Wie aber konnte auf ihr der Leuchtturm stehen? Er lockte ja die Schiffe, statt sie in Sicherheit zu führen, auf die Riffe!
Jetzt war keine Zeit, darüber nachzudenken. Der Tag sollte erklären, wie man zwischen die Riffe gekommen war. Man dankte Gott, daß die ›Vesta‹ auf den Felsen saß, anstatt in tausend Teilen auf dem Wasser zu treiben und mit ihnen auf alle Fälle die Mädchen.
»Klar bei den Booten!« kommandierte Ellen schon wieder mit ruhiger Stimme.
Die Mädchen gehorchten willig, aber Miß Thomson fragte die Kapitänin vorwurfsvoll:
»Sie wollen die Boote aussetzen lassen? Wir kommen keine zehn Meter vom Schiffe ab.«
»Nein, aber ich lasse die Boote vorbereiten, damit wir uns sofort in sie begeben können, sollte die ›Vesta‹ doch noch bersten oder ihren Halt verlieren.«
Es wurden Vorbereitungen getroffen, um die Boote beim ersten Zeichen einer neuen Katastrophe über Bord lassen zu können, und schon rüstete man sie mit allein Nötigen aus, umgab sie auch mit den Korkgürteln. Des gleichen legten die Mädchen auf Ellens Geheiß selbst Korkwesten an, um im Wasser nicht bloß aufs Schwimmen angewiesen zu sein. Man mußte sich auf das Schlimmste gefaßt machen.
»Drei Uhr,« sagte Ellen, als alles so weit ausgeführt worden war. »In einigen Stunden bricht die Morgendämmerung an.«
Der Sturm ließ merklich nach; aber an der See war davon noch nichts zu merken. Nach wie vor brauste und spritzte die Brandung zwischen den Riffen und erzeugte jenes unheimliche Geräusch, bei dessen Klang das Herz des kühnsten Seemannes erbebt.
Das Lichterspiel dauerte weiter. Man erwartete weniger darum so sehnsüchtig den Anbruch des Tages, um zu sehen, wo man sich befand, wo die Küste lag, sondern mehr, um diesen rätselhaften Leuchtturm sehen zu können, dessen Feuer man hauptsächlich das Unglück zuzuschreiben hatte.
Zwei lange, bange Stunden vergingen in Vermutungen und Harren. Sie schienen sich zu Ewigkeiten ausdehnen zu wollen. Dann verschwand plötzlich das Wechselfeuer, und schon wenige Minuten später brach der erste Morgenstrahl im Osten hervor. Immer deutlicher tauchten die Riffe aus dem Dunkel auf.
»Dort steht er,« sagte Ellen, auf eine dunkle Säule deutend, die mehr und mehr in der Ferne sichtbar wurde.
»Es ist gar nicht so weit von uns, und doch glaubte ich immer, er wäre weit entfernt, den kleinen Lichtern nach wenigstens zu schließen,« meinte Miß Murray.
»Oder er hat wirklich nur sehr kleine Feuer, dann ist er aber nicht der von Matagorda,« erwiderte Ellen. »Wie in aller Welt aber kommt er nur hierher? Ist er hier, um Schiffe auf den Strand zu locken?«
»Wo soll der Leuchtturm sein?« rief plötzlich die scharfsichtige Miß Thomson. »Das ist kein Turm, kein Gebäude, es ist nur ein hoher, schlanker Felsen.«
Die nächste Minute ließ die Morgendämmerung voll heraufkommen, und sofort konnten sich alle Mädchen von der Wahrheit der Behauptung ihrer Freundin überzeugen.
Soweit das Auge reichte, sah es links und rechts nichts weiter als aus dem Wasser hervorragende Riffe, hinter ihnen lag das offene Meer, und vor ihnen, einige hundert Meter entfernt, eine zerklüftete Küste; aber kein Leuchtturm war zu sehen, nur ein hoher, steiler Felsen, der die anderen weit überragte.
»Auf diesem haben die Lichter gebrannt,« rief Ellen bestimmt, »sie sind schuld, daß wir gestrandet sind, ja, ich habe fast eine Ahnung, daß wir — —«
Ellen brach ab und sah nachdenklich vor sich hin.
»Daß wir durch sie auf die Riffe gelockt werden sollten,« ergänzte Miß Thomson. »Ja, meine Damen, es ist gar kein Zweifel, das trügerische Feuer ist unsertwegen diese Nacht hier unterhalten worden, und es hat seinen Zweck auch so ziemlich erreicht. Vielleicht haben diejenigen, welche das Truglicht hier leuchten ließen, gehofft, heute morgen nur noch die Planken der ›Vesta‹ treiben zu sehen. Nun, Gott sei Dank, sie haben sich getäuscht! Die ›Vesta‹ ist zwar wrack, vielleicht für immer, aber wir leben.«

Miß Thomson hatte diese Worte mit fester Stimme gerufen, und die Mädchen, selbst Ellen, stimmten ihr schweigend bei. Die Männer, welche sie bisher immer verfolgt, hatten noch einmal versucht, die Mädchen zu beseitigen. Das schurkischste Mittel war von ihnen gewählt worden; denn nicht nur das eine Schiff, auf welches sie es abgesehen, sondern alle Schiffe, die hier kreuzten, waren derselben Gefahr ausgesetzt gewesen wie die ›Vesta‹.
Wer wußte, ob nicht schon so manches Schiff diese Nacht zwischen den Riffen seine Reife für immer beendet hatte?
»Und wo ist der Leuchtturm von Matagorda?« fragte Ellen. »Wir sind auf die Matagordariffe geraten, aber warum haben wir das Feuer des Leuchtturmes in der Nacht nicht gesehen?«
»Das Verbrechen wird fein eingefädelt worden sein,« meinte Miß Murray. »Unter Umständen haben unsere lieben Verwandten sogar ganz Matagorda in die Luft gesprengt, nur um unser Schiff sicher auf den Strand laufen zu lassen.«
Jetzt brach der Morgen mit vollem Glanze an; die Sonne tauchte in goldener Pracht am Horizonte auf und schien auf Wind und Wellen einen besänftigenden Einfluß auszuüben.
Immer schwächer wurde die Brandung. Schon spritzte sie nicht mehr meterhoch empor. In einer Stunde mußte sich das Wasser völlig beruhigt haben.
Sicher hing das Schiff zwischen den beiden Felsen; kaum berührte das Wasser noch den Kiel, so hoch war es von der Woge emporgeschleudert worden, und mit Schaudern sahen die Mädchen, daß, wenn sich die ›Vesta‹ auf ein anderes Riff gesenkt hätte, sie unwiderruflich geborsten wäre, denn überall zeigten die Felsen scharfe Grate, und nirgends standen zwei so eng, daß ihr Schiff sich gerade zwischen sie legen konnte. Die Woge war mitleidig gewesen, sie hatte Schiff und Mannschaft vor dem sicheren Untergange gerettet. Noch war es möglich, die ›Vesta‹ wieder flott zu machen, wenn auch nicht durch die eigene Kraft der Besatzung.
Die Küste zeigte ein wildes Panorama. Felsig, zerklüftet war sie. In einiger Entfernung konnte man aber schon den Saum eines mächtigen Urwaldes sehen. Texas ist ja das Land der Urwälder. Eine friedliche Stille lag über der Gegend ausgebreitet. Kein Mensch, kein lebendes Wesen war am Lande zu erkennen.
In andächtiger Betrachtung standen die Mädchen und blickten um sich. Das Bewußtsein, einer furchtbaren Gefahr entronnen zu sein, erfüllte ihre Herzen mit einer Freudigkeit, für welche der Mund keinen Ausdruck fand.
Endlich brach Ellen das Schweigen.
»Meine lieben Freundinnen,« sagte sie in bewegtem Tone. »Es ist heute Sonntag, und noch nie haben wir während unserer Reise eine derartige Gelegenheit gehabt, Gottes schützende Hand zu erkennen wie heute. Er wollte nicht, daß wir als Leichen angespült wurden, er hat uns aber gezeigt, was unser Los gewesen wäre, wenn es in seinem Rate nicht beschlossen gewesen, uns noch länger auf Erden leben zu lassen. Wahrlich, wir haben Grund dafür, ihm an dem von ihm geheiligten Tage dankbar zu sein.«
Ellen entblößte den Kopf, die Mädchen taten desgleichen, und aus den Herzen aller stieg ein heißes Dankgebet zu dem auf, der in der Nacht das Ruder aus ihren Händen gerissen und selbst das Schiff mit seiner allmächtigen Hand geführt hatte.
Dann wurde die Frage erhoben, was jetzt zu tun sei. An ein Flottmachen der ›Vesta‹ war vor der Hand nicht zu denken. Man mußte sie ihrem Schicksal überlassen und entweder auf dem Landweg oder dem Seeweg, das heißt, in Booten nach Matagorda reisen und dort alles zur Anzeige bringen, besonders das rätselhafte Feuer, durch welches sie auf die Riffe geraten war.
Mit Hilfe der Sonne berechnete Ellen ihre Lage und fand, daß sie ungefähr 110 Seemeilen von Matagorda oder 80 von dessen Leuchtturm entfernt waren, denn die Halbinsel, auf deren Spitze der Leuchtturm steht, erstreckt sich dreißig Meilen ins Meer hinein.
Es wurde natürlich beschlossen, Matagorda in den Booten zu erreichen, wozu zwei Tage nötig waren, und bei günstigem Winde weniger Zeit, wenn sie nicht unterwegs von einem Schiffe aufgenommen wurden. Jetzt konnten sie vorläufig nicht daran denken, denn hinter ihnen, zwischen den Riffen, war die Brandung noch so stark, daß sie den Booten gefährlich war, nach der Küste zu dagegen hätten sie die Fahrt schon wagen können, und daher machte Ellen einen anderen Vorschlag.
»Es vergehen noch einige Stunden, ehe sich das Wasser vollkommen beruhigt hat, und ich denke, wir statten in dieser Zeit der Küste einmal einen Besuch ab, um uns davon zu überzeugen, wo und wie die Irrlichter gebrannt haben. Wir müssen doch noch eine Spur von ihnen finden. Miß Thomson, Sie sind ja hier zu Hause, was für Leute bewohnen diese Küste?«
»Fischer verschiedener Nationen,« entgegnete die Gefragte, »Spanier, Nordamerikaner mit englischem Blut und Mestizen. Den Leuten ist nicht zu trauen, vor allen Dingen nicht, wenn man ihnen als Schiffbrüchige näherkommt, weil bei ihnen das Strandrecht in Blüte steht. Aus der Erzählung des Spaniers betreffs des Wahnsinnigen haben Sie ja Schauderhaftes genug gehört. Sie irren übrigens, Miß Petersen,« fügte das Mädchen lächelnd hinzu, »wenn Sie annehmen, daß ich hier bekannt bin. Meine Plantage liegt zwar in Texas, aber dieser Staat ist groß, ich bin ungefähr vierhundert Meilen von hier zu Hause.«
»Nun, wir werden die Küste doch betreten und erst einmal Nachforschungen anstellen,« meinte Ellen. »Bewaffnet werden wir die Strandbewohner wohl nicht zu fürchten haben. Kommen Sie alle mit, meine Damen, wir rüsten zwei Boote aus und bewaffnen uns gut! Doch glaube ich, wir müssen uns abermals trennen, zum letzten Male, Einige von uns müssen nach Matagorda fahren, die anderen hierbleiben, um das gestrandete Schiff vor den Strandbewohnern zu schützen, und da ein Aufenthalt auf dein Riff doch gefährlich ist, so muß sich der wartende Teil am Strande häuslich einrichten. Darum wollen wir alle dort nach einem geeigneten Platz suchen und dann Rat halten.«
Die zweiundzwanzig Mädchen verteilten sich gleichmäßig in zwei Boote und strebten in diesen dem Lande zu. Die Fahrt zwischen den Riffen war gefährlich; oftmals kam ein Boot in Gefahr, an einem Felsen zerschmettert zu werden, aber lange Uebung, Geschick und Kaltblütigkeit hatten die Mädchen zu Meistern in der Bootsführung gemacht. Immer wußten sie die Boote mit Stangen von den Felsen abzusetzen, oder doch die Wucht des Stoßes durch ein gewandtes Rudermanöver zu schwächen, so daß nur die Korkeinfassung gedrückt wurde, bis endlich beide Boote sicher an einem geeigneten Landungsplätze lagen.
Die erste, welche mit leichtem Fuß ans Ufer sprang, war Miß Thomson.
»Sei mir gegrüßt, mein Vaterland,« rief sie. »Nach dreijähriger Abwesenheit küsse ich deinen Boden wieder.«
Damit warf sich das lustige Mädchen auf die Erde nieder und küßte den steinigen Boden.
Auch Ellen und die übrigen Mädchen wurden von teils freudigen, teils ernsten Gedanken bewegt, als sie den Boden ihres Vaterlandes, der Vereinigten Staaten, wieder betraten.
Ellen eilte, mit Büchse und Revolver bewaffnet, den steilen, jäh emporragenden Felsen hinauf.
»Sehen Sie hier,« rief sie, auf das Gras deutend, das den Felsen umwucherte, »der Rasen ist zertreten worden, die Halme haben sich noch nicht aufgerichtet. Diese Nacht waren Leute hier anwesend, sie haben den Felsen wahrscheinlich mit Hilfe von Seilen und Leitern erstiegen und auf ihm Raketen oder Leuchtkugeln steigen lassen, welche von weitem ähnlich aussehen, wie die Lichter eines Leuchtturms. Suchen Sie, ob Sie eine abgeschossene Rakete oder etwas Aehnliches finden, es kann uns als Beweismittel gegen die Anstifter dieses Bubenstückes dienen!«
Alle Damen hatten die an Ketten gelegten Boote verlassen und waren Ellen gefolgt. Das Ufer senkte sich etwas dem Lande zu, auch verhinderten Felsen die Aussicht nach dem Strande, so daß man die Boote nicht sehen konnte, wohl aber die hoch auf dem Riff hängende ›Vesta‹.
Man verteilte sich und begann zu suchen. Immer mehr fand man die Behauptung Ellens bestätigt. In der Nacht waren wirklich viele Leute hier tätig gewesen. Man hob Stückchen von Seilen, Holzspäne, ein Tuch vom Boden auf, und Ellen ordnete an, alles sorgfältig aufzubewahren, wodurch man die Täter feststellen konnte, so z. B. ein rotes Tuch, wie es von Fischern in jener Gegend viel getragen wird, ferner ein Schiffsmesser, in welchem ein aus sieben Punkten bestehendes Kreuz eingeschlagen war, ein plumper Hammer und anderes mehr.
»Sie hatten Leuchtkugeln,« rief Ellen und hob die Hülse von einem Feuerwerkskörper auf, »also habe ich mich in meiner Vermutung nicht getäuscht.«
Die Messinghülse führte als Fabrikstempel eine Krone und darunter die Buchstaben M. G. Ellen steckte sie in die Tasche.
Menschen selbst ließen sich nicht sehen, und das war ganz natürlich. Wenn welche hier wohnten, so waren sie ganz sicher an dem nächtlichen Werk beteiligt gewesen und hatten ein böses Gewissen, wenn sie auch nur, wie die Damen als ganz bestimmt annahmen, auf Aufforderung eines Mannes handelten, der Grund hatte, die Wiederkehr der Mädchen zu fürchten. Aber vielleicht wurden dieselben vom Walde aus, der einige hundert Meter nördlich lag, beobachtet. Die Mädchen konnten erkennen, daß zwischen den Bäumen reges Leben herrschte. Langbeschwänzte Affen, bunte Vögel, Papageien, tummelten sich in den Zweigen und am Boden umher. Texas ist reich an Tieren, namentlich an jagdbarem Wild.
Während die Mädchen die Umgegend noch absuchten, kamen sie auf die eigentlichen Bewohner des Landes zu sprechen.
»In Texas hausen die Apachen?« fragte Ellen die des Landes kundige Miß Thomson.
»Ja, und sie sind ein wilder, kriegerischer Volksstamm,« entgegnete das Mädchen. »Das beste ist, man meidet jede Begegnung mit ihnen. Muß man aber doch mit ihnen verkehren, so soll es möglichst in Freundschaft geschehen. Sie sind ein Reitervolk, das nur von Jagd und Kampf lebt, und seine einzige Tugend ist, daß es den Feind offen angreift, nicht heimtückisch überfällt. Aber die Grausamkeit der Apachen kennt keine Grenzen; sie morden die Gefangenen auf die furchtbarste Weise.«
»Sind Sie mit ihnen zusammengekommen?«
»Auf meinen Plantagen stellen sie sich zu gewissen Zeiten ein, um Geschenke an Vieh, Tabak u. s. w. in Empfang zu nehmen. Ich habe sie ihnen stets geben lassen und die strengste Weisung hinterlassen, immer freundlich mit ihnen zu verkehren. Allerdings bin ich von meinen Nachbaren deshalb oft scharf getadelt worden; man sagte, man solle den Indianern nie Geschenke geben, weil sie dadurch in ihren Anschauungen, die für die jetzige Zeit nicht mehr passen, bestärkt werden, aber ich habe eingesehen, daß ich mich dabei gut stehe. Meine Plantagen werden von ihrer Raubsucht verschont; sie respektieren alles Vieh, was meinen Stempel trägt, und auch meine Arbeiter sind vor ihren Lanzen sicher. Natürlich herrscht dort ein anderer Stamm als hier; die Apachen liegen ja untereinander in ewiger Fehde, die nicht eher aufhören wird, als bis sie alle vernichtet sind. Man zählt ungefähr noch siebentausend Apachen, die in viele, unter eigenen Häuptlingen stehende Stämme zerfallen. Haben Sie von den Apalachen gehört?
»Es ist ein ausgestorbener Volksstamm, zu dessen Mitgliedern auch die in meiner Heimat, Louisiana, hausenden Indianer einst zählten. Selbst die Irokesen gehörten zu ihnen.
»Die Apachen sagen, sie waren die direkten Nachkommen der Apalachen, und behaupten, es existierten noch zwei Menschen aus dem Häuptlingsgeschlecht derselben, ein Knabe und ein Mädchen. Ich glaube, es ist eine Mythe, die sich unter ihnen fortpflanzt. So, wie die Juden auf einen irdischen Messias hoffen, der sein Volk zur alten Herrlichkeit bringen soll, so hoffen auch die Indianer auf einen Befreier und sprechen von einem sagenhaften Knaben, der in einer Höhle mit Bären und anderen Raubtieren aufgezogen wird, vom Medizinmann geheime Wissenschaften lernt und von dem uralten Waffenbruder eines ehemaligen Häuptlings der Apalachen in Waffenkünsten erzogen wird. Der Knabe hat eine Schwester, welche in gleicher Weise erzogen wird, und ist die Zeit gekommen, so treten beide hervor, führen alle Indianer, ohne Unterschied des Stammes, zum gemeinschaftlichen Kampf gegen die weißen Eindringlinge an, und sind die Stämme alle frei, so heiraten Bruder und Schwester. Aus ihnen gehen dann die Häuptlinge hervor, welche über alle Indianer herrschen.«
»Und wann soll diese Zeit kommen?« fragte ein zuhörendes Mädchen.
»Wenn der Waffenmeister stirbt. Ein alter Häuptling der Apachen, mit dem ich mich gut stand, hat mir oft davon erzählt, und merkwürdig ist es, wie weit diese Sage verbreitet ist, und wie sie überall übereinstimmt.«
»Wie alt sollen denn die Geschwister sein?«
»Jedes Jahr, sagte der Häuptling, seien sie ein Jahr älter geworden, daraus könnte man fest schließen, daß doch etwas Wahres an der Erzählung ist, ich meine, daß es nicht nur zwei Menschen sind, welche einen ewigen Schlaf tun, bis sie einst erwachen und ihr Volk zum Siege führen, wie solche Sagen gar manche Völker haben, auch völlig zivilisierte. Als ich vor drei Jahren den Häuptling zum letzten Male sprach, sagte er mir geheimnisvoll, Arahuaskar — so heißt der Knabe — sei jetzt vierzehn Jahre alt, und der Waffenmeister müsse bald sterben.«
»Der Name Arahuaskar erinnert an die Zeiten der alten Inkas,« sagte Ellen.
»Und seine Schwester sei dreizehn Jahre alt,« fuhr Betty fort. »Es ist gar nicht so unmöglich, daß etwas Wahres daran ist. Warum sollten nicht von einem Medizinmann und einem Häuptling zwei Kinder erzogen werden, welche als Abkömmlinge der mächtigen Apalachen ausgegeben werden, und betreffs deren man dem Volke vorredet, sie würden es wieder zum alten Glanze bringen? Dann folgen die Indianer ihnen mit fanatischem Mute in den Kampf; jeder Hader zwischen ihnen muß schweigen, und verlieren sie doch, was gar nicht anders möglich ist, so wird der junge Krieger als falscher Prophet betrachtet, und die ihm eben noch zugejubelt haben, töten ihn. Die Geschichte kennt ähnliche Beispiele.«
»Und wie alt soll der Waffenmeister sein?« forschte Ellen weiter, welche sich für solche Sagen wilder Stämme höchlichst interessierte.
»Der Häuptling schätzte ihn auf über hundert Jahre, aber andere sagen, er wäre dreihundert Jahre alt.«
Die Mädchen hatten die Gegend genau abgesucht, und zwar noch mehrere Gegenstände gefunden, aber keine Menschen, auch kein Haus und keine Hütte gesehen. Auf den Ruf Ellens versammelten sie sich um ihre Kapitänin und hörten dem Vorschlage derselben zu.
Die Hälfte der Mädchen sollte in einem Boot nach Matagorda fahren, die anderen hier bleiben und die ›Vesta‹ vor räuberischen Uebergriffen der Strandbewohner schützen. Aber an Bord des gestrandeten Schiffes zu bleiben, war zu gefährlich; leicht konnte es von einem Sturme von dem Felsen herabgeworfen und zerschmettert werden.
Die zurückbleibenden Mädchen sollten sich daher mit Werkzeugen versehen und am Strande eine Hütte errichten. In spätestens vier Tagen würde Ellen, wenn kein neues Unglück sie beträfe, mit Hilfsmannschaften zurückkehren. Schon jetzt ermahnte sie die Freundinnen, allen Feinden energisch, mit der Waffe in der Hand, entgegenzutreten und immer auf ihrer Hut zu sein.
Sie begaben sich an den Strand zurück.
Da entfuhr ein Schreckensschrei den Lippen aller — die Boote waren fort, zwischen der Klippe aber, nahe der ›Vesta‹ fuhr ein Fischerfahrzeug und schleppte die beiden geraubten Boote.
Außer sich riß Ellen die Büchse von der Schulter, aber noch ehe sie den Kolben an der Wange hatte, um die Räuber wenigstens mit einer Kugel bestrafen zu können, bog das erste Boot um die Felsen, auf denen die ›Vesta‹ lag, und die Ruderer waren in Sicherheit, die Zurückgebliebenen hörten noch ihr höhnisches Lachen.
»Es sind Strandbewohner,« rief Miß Thomson, »sie werden die ›Vesta‹ plündern.«
Ellen blickte starr nach derselben, den Kolben des Gewehres noch immer an der Wange, weil sie hoffte, die Fischer würden sorglos das Deck erklettern und könnten dann sofort mit Kugeln begrüßt werden. Aber die Leute waren schlau. Vorläufig zeigten sie sich noch nicht, oder sie hatten das Schiff bereits unbemerkt erstiegen.
Da sah Ellen, wie ein großes, gelbes Tier an Deck hin und hersprang.
»Juno,« rief sie, die Hand emporstreckend.
Die Löwin hörte den Ruf, zögerte einen Augenblick, brüllte laut auf und stürzte sich dann in das Wasser, dem Ufer zuschwimmend.
Ellen wollte sie nicht den meuchlerischen Kugeln der Räuber aussetzen; sie konnte das Tier vielleicht noch gebrauchen.
Die durch die Pampas reisende Gesellschaft hatte ihre Zelte in weitem Halbkreise aufgeschlagen. In der Mitte desselben brannten die von Pferdemist genährten Feuer, über denen Fleischstücke schmorten; außerhalb der Zelte standen die Pferde angepflöckt, und noch weiter draußen in den Pampas konnte man andere Feuer leuchten sehen, die Wachtfeuer, an denen die meisten mitgekommenen Indianer als treue Wächter lagen.

Das Lager in den Pampas.
Die englischen Herren, die Matrosen des ›Amor‹, saßen um ein Zeltfeuer und ließen sich das Nachtessen schmecken, zwischen ihnen tauchte ab und zu ein bronzefarbenes Gesicht auf, und in der Nähe hockten zwanzig Spanier, die berittenen Treiber der Lasttiere.
Im ganzen bestand die Karawane aus allen Herren des ›Amor‹, nebst Hannibal und Kasegorus, Williams' neuem Diener, sowie aus zwanzig Indianern, welche der schluckende Geier zum Schutze mitgegeben hatte, aus den Lasttiertreibern und aus Juba Riata und Don.
Sie zogen schon wieder seit drei Tagen vereint nach Osten, und noch immer waren sie nicht auf das Lager des springenden Panthers gestoßen, hatten es aber nach Versicherung der Indianer und der weißen Führer auch nicht verpaßt. Doch das machte nichts, die Engländer waren wieder so lustig und guter Dinge, wie sie nur jemals in ihrer glücklichsten Zeit gewesen. Ob sie die angebliche Miß Petersen jetzt fanden oder nicht, das war ihnen ganz gleichgültig. Ihre Absicht war nur, sich einige Wochen recht fröhlich die Zeit zu vertreiben, nach Buenos Aires zu reiten, von dort mit der Eisenbahn nach dem Norden Südamerikas zu fahren und dann über den Golf von Mexiko nach Nordamerika überzusetzen. Dort mußten sie später oder früher die Vestalinnen wieder treffen, das hatte ihnen Nick Sharp in seinem Briefe mitgeteilt und noch viel mehr, sie waren über alles orientiert.
Dennoch wollten sie versuchen, die geraubten Mädchen durch reiche Geschenke aus den Händen der Penchuenchen zu befreien, denn der Haziendero, der zum Ritt durch die Pampas erst militärische Hilfe verlangte, schien sehr saumselig zu sein, und bekamen sie dabei das Mädchen zu fassen, welches sich für Miß Petersen ausgab, sowie ihren schurkischen Begleiter, Fernando, dann gnade ihnen Gott, die Engländer wollten sich dafür rächen, daß sie an der Nase herumgeführt worden waren. Zwei von der Verbrecherbande, von der sie nun schon genug erfahren, und über die sie Nick Sharp in seinem Briefe aufgeklärt hatte, hatten sie nun sicher, und an diesen beiden wollten sie einmal ein Exempel statuieren.
»Und was wurde einstweilen aus dem ›Amor‹?«
»Laßt ihn zum Teufel gehen,« hatte Williams gesagt, als die Herren gleich nach der Wiedervereinigung auf ihn zu sprechen kamen, »meinetwegen können ihn die Heizer behalten, zu ihrem Vergnügen weiter auf ihm fahren oder eine Tanzbude auf ihm einrichten. Mir hängt die Seereise jetzt zum Halse heraus. Bin ich erst in Buenos Aires, dann löse ich mir ein Billett direkt nach Texas und gehe nicht eher von der Eisenbahn oder dem Passagier-Dampfer, als bis sie mich herunterwerfen — das ist ein Faktum, Charles Williams hat gesprochen, uff!«
Die Herren lachten über ihren Freund, der seine Rede nach Art der Penchuenchen schloß, aber Harrlington sprach mit Juba Riata, der sich willig erklärte, nach Erledigung der übernommenen Pflichten mit einem Briefe an das englische Konsulat nach Valdivia zurückzukehren. Der Konsul sollte den ›Amor‹ nach irgend einem noch zu nennenden Hafen dirigieren lassen.
Don wollte bei den Herren bleiben, er hatte keine Heimat wie Juba, die ganze Welt war sein, nach dem Wahlspruch: ubi bene, ibi patria, d. h., wo es dir gut geht, da ist dein Vaterland.
Alles in dem Lager war Humor und Fröhlichkeit, die ernsten Indianer, ja selbst der würdevolle Hannibal und der mürrische Juba wären davon fast angesteckt worden, wenn es sich mit ihrer Ehre hätte vereinbaren lassen.
»Jetzt wäre mir so ein Apfelweingelage schon recht,« meinte Charles zu Chaushilm. »Wurde ich schon damals, als mich traurige Gedanken peinigten, von dem sauren Zeuge heiter gestimmt, daß ich meine Sorgen vergaß, wie würde ich erst jetzt ausgelassen werden und alle anderen mit mir! Ach, Chaushilm, wie schade, daß Sie damals nicht bei uns waren. Sie lieben doch Rum so, nun, ich sage Ihnen, der uns kredenzte Branntwein war über alle Kritik ausgezeichnet!«
»War es wirklich echter Kognak?« fragte Chaushilm zweifelnd, dem sehr viel Von dem Gelage erzählt worden war.
»Bah, Kognak? Neunzigprozentiger Spiritus war es, so stark, daß mir die Kehle noch jetzt brennt, wenn ich daran denke! Es war herrlich! Jetzt erst verstehe ich den Ausdruck Feuerwasser, wie die nordamerikanischen Indianer den Schnaps nennen. Seinetwegen schon sollten Sie unter den Penchuenchen bleiben.«
Don kam langsam auf das Feuer der beiden zugeschlendert, die Pfeife zwischen den Zähnen.
»He, Don,« rief ihm Williams zu, »setzt Euch einmal auf ein Viertelstündchen hierher. Ich habe Euch etwas zu fragen.«
Don wußte schon, worüber er gefragt werden sollte er hatte schon vielen Herren deshalb Rede stehen müssen, aber immer war der gefällige, gutmütige Pampasjäger dazu bereit gewesen.
»Woher kennt Ihr eigentlich Nick Sharp?«
Das war aus Charles Munde dieselbe Frage, die Don wenigstens schon zehnmal hatte beantworten müssen. Er begann abermals zu erzählen, wie er vor vielen, vielen Jahren einst mit Rick Sharp auf einem Schiffe als Leichtmatrose gefahren habe, und wie sie beide auf gemeinschaftliche Verabredung in einem kleinen, südamerikanischen Hafen wegen schlechter Behandlung vom Schiff gelaufen seien. Sie hätten sich einer Expedition ins Innere von Südamerika angeschlossen, sich mit Indianern herumgeschlagen, von der Jagd gelebt, Pferde gefangen, kurz, ein derartiges Leben geführt, daß sie schon nach Verlauf eines Jahres zu richtigen Pampasjägern ausgebildet worden seien. Er, Don, habe Gefallen daran gefunden, Nikolas dagegen sei dieses unruhige Leben noch immer zu ruhig gewesen, er kehrte wieder nach der Küste zurück, und einige Jahre später habe Don ihn als berühmten Detektiven wiedergesehen. Wenn Sharp durch Geschäfte in diese Gegend geführt wurde — und Sharp befände sich immer auf Reisen — suchte er ihn stets auf, und sie begegneten sich wieder mit der herzlichsten Freundschaft. Don sei Jäger geblieben, hielte es aber in keiner Gegend lange aus, sondern durchzöge ganz Amerika, von den Indianern überall als Freund bewillkommnet.
Williams blies nachdenklich den Rauch seiner Pfeife von sich und sah Don eigentümlich an.
»Kennt Nick Sharp den Fuba Riata?« fragte er.
»Er war unser Lehrmeister. Sein Revier, wo wir ihn trafen, war aber damals weiter nördlich. Erst später nahm er indianische Frauen und blieb hier.«
»So, so,« brummte Charles. »Wo gab Euch Nick Sharp den Brief?«
»Er traf mit den übrigen Herren bei Villa Rica ein.«
»Hm, sagt mal offen, Don — Ihr braucht keinen Verrat von mir zu fürchten — wußte Sharp schon früher, daß diese Miß Petersen gar nicht die richtige ist, hatte er es nicht schon vorher zu Euch beiden, dir und Juba, gesagt, und seid Ihr von ihm abgeschickt worden, um uns in die Pampas und hinter dieser hierher zu locken?«
Ueber das sonnenverbrannte Gesicht des Pampasjägers flog ein verschmitztes Lächeln, er nahm mit den harten Fingern ein Stückchen glühendes Holz, legte es auf die Pfeife und fetzte diese mit tiefem Zuge in Brand.
»He, Don, wußtet Ihr schon, daß diese ganze Geschichte nur erlogen war? Steckt Ihr mit Nick Sharp unter einer Decke?«
»Quien sabe? (Wer weiß?)« sagte Don langsam, (die gewöhnliche Antwort der Spanier auf eine Frage, wenn sie nichts wissen wollen) erhob sich und schritt lächelnd nach einem anderen Feuer.
»So ein verdammter Detektiv,« sagte Charles zu Chaushilm. »Läßt uns hier in den Pampas herumjagen, im Freien schlafen und bald ertrinken, und weiß recht gut, das wir auf einer falschen Spur sind.«
»Aber warum hat er dies getan?« fragte Chaushilm. »Das ist doch unverzeihlich.«
»Durchaus nicht,« entgegnete Williams. »Sharp kannte uns besser. Freiwillig wären wir doch nicht auf die Pläne der Verbrecher eingegangen, sondern hätten Hals über Kopf weiter nach der ›Vesta‹ geforscht, die doch untergegangen war. Erst, als wir uns schon in den Pampas befanden, schickte er uns die Nachricht, und nun bleibt uns nichts anderes übrig, als eben weiterzureisen, wollen wir nicht hier bleiben. Wahrhaftig, solche Schlauheit hätte ich Sharp doch nicht zugetraut.«
»Und ich ihm nicht solche Rücksichtslosigkeit,« brummte Chaushilm.
In dem Lager wurde es nach und nach still. Ein langer, anstrengender Ritt hatte die Herren müde gemacht, sie zogen sich bald in ihre Zelte zurück, denn morgen sollte schon beizeiten der Ritt wieder aufgenommen werden.
Die trägen Spanier lagen schon lange in ihre Decken gewickelt am Boden und schliefen, die Indianer und die Pampasjäger, an Strapazen solcher Art gewöhnt, saßen noch lange an den Feuern und rauchten schweigsam die Pfeift«.
Da erscholl plötzlich draußen, wo die Feuer brannten, in regelmäßigen Zwischenräumen das Geheul des Schakals.
Die Indianer, wie auch die beiden Führer horchten auf, das war ein Zeichen von den Wächtern. Noch ehe die Männer sich aber erheben konnten, schritt ein Indianer zu dem Anführer des Trupps, sprach kurze Zeit mit ihm und deutete dann auf Don.
Auf einen Wink des Häuptlings rückten die beiden Weißen und die Indianer näher zu ihm heran, und eine leise Unterhaltung begann, besonders in der den Indianern eigentümlichen Fingersprache geführt, welche überall in Amerika dieselbe ist. Darauf standen alle auf, gingen etwas außer den Bereich des Feuerkreises und spähten scharf nach Norden.
Dort konnte man einen schwachen Lichtschein erkennen; auf den Pampas mußten mehrere Feuer brennen.
»Kennt mein Bruder ihn?« wandte sich der Führer der Indianer an Don.
»Er ist unser Freund,« entgegnete Juba Riata für seinen Gefährten.
Die Indianer streckten sich gleichgültig wieder neben das Feuer, Juba sprach noch einige Worte mit Don, dann kehrte auch er an das Feuer zurück, während Don mit dem Indianer einem Wachtfeuer zuschritt.
An demselben lag ein junger Mann, fast ebenso wie Don gekleidet, und rauchte ruhig seine Pfeife, ohne daß er die um das Feuer hockenden Indianer beachtete, oder daß diese ihm Aufmerksamkeit schenkten. Bei Annäherung der Kommenden stand er auf und erwartete sie.
Mit einem Sprunge war Don bei ihm.
»Sehe ich recht, du selbst bist hier?« rief Don erstaunt.
»Gewiß, und bringe Gesellschaft mit.«
»Aber woher weißt du, daß wir gerade hier sind?«
»Ich habe heute vormittag eure Reiter gesehen und die gefunden, welche ich suchte. Du kennst meine Augen. Doch nun etwas anderes, morgen mehr.«
Die beiden Männer setzten sich nebeneinander ans Feuer und besprachen sich lange. Don nickte lebhaft unter Lachen und schien ganz auf die Pläne seines Freundes einzugehen.
Der Fremde stand auf.
»Können wir unbemerkt in euer Lager kommen?« fragte er.
»Die Engländer schlafen wie die Ratzen. Wären wir nicht da, man könnte ihnen die Zelte über den Köpfen stehlen.«
»All right, in einer halben Stunde bin ich zurück,« entgegnete der Fremde, schnallte sich den Gürtel enger und verschwand bald in der Nacht, während Don am Feuer sitzen blieb und die Rückkehr seines Freundes erwartete, der sich nach dem Feuerschein zu entfernt hatte.
Charles Williams war ein Frühaufsteher. Er hatte aber auch noch eine andere Eigenschaft, welche energische Menschen besitzen: daß er des Morgens zu der Zeit aufwachen konnte, die er sich des Abends zuvor vorgenommen hatte.
Auf Juba Riatas Rat sollte früh bei Sonnenaufgang der Weiterritt erfolgen, dann konnte man vielleicht noch denselben Tag das Lager des springenden Panthers erreichen; er selbst war schon zeitig auf, desgleichen Don. Beide weckten die Lasttiertreiber. Diese mußten Feuer machen und Kaffee kochen, bis zu dessen Fertigstellung, die völlig angezogenen Engländer noch schlafen durften.
Kaum aber trieb der eiserne Juba mit einem Fluch, wohl auch mit Fußtritten, die gähnenden Spanier vom Boden auf, als auch schon Charles die Augen aufschlug.
»Kaffee kochen,« brummte er. »Noch eine Viertelstunde Zeit. Hm, bin noch kolossal müde.«
In seinem Zelte schliefen außer ihm noch Hendricks, Chaushilm und Kasegorus. Aber diese wachten nicht auf, sie schnarchten in verschiedenen Tonarten ruhig weiter; deshalb konnte Charles sein Gespräch auch fortsetzen.
»Es ist eigentlich eine schlechte Angewohnheit, immer eine Viertelstunde eher aufzuwachen als andere,« murmelte Charles. »Besonders dem Diener ist es verwünscht unangenehm, wegen des Ehrgeizes seines Herrn, immer als erster zu Pferd sitzen zu wollen, so zeitig aufstehen zu müssen.«
Charles dachte noch über den Wert des Schlafes und über den des Frühaufstehens nach und kam schließlich dahin, daß schlafen jedermann kann, Frühaufstehen aber eine Tugend ist.
»Dann soll mein Diener aufstehen und mir die Sporen bringen. Kasegorus!« rief Charles, ohne sich umzudrehen.
»Kasegorus!«
Keine Antwort.
»Kasegorus!«
Hinter ihnen ertönte ein Geräusch. Der kleine Schwarze mußte den Ruf vernommen haben, brach aber nicht wie sonst in Seufzen, Stöhnen und Gähnen aus, sondern erhob sich ohne Murren.
Charles wunderte sich darüber, hielt es aber nicht für der Mühe wert, den Kopf nach dem Diener zu wenden.
»Kasegorus,« rief Charles in sanftem Tone, »bringe mir die Sporen und sieh dann nach meinem Pferde!«
Er hörte die Sporen klirren, wie sie vom Boden aufgenommen wurden, und daß ein leichter Schritt sich ihm näherte.
Aber kein Wort ward hörbar. Der sonst so geschwätzige Schwarze muhte geschworen haben, heute kein Wort über seine wulstigen Lippen kommen zu lassen.
»Kasegorus?«
»Hier,« sagte da eine Stimme.
Charles fuhr bei diesem Klange herum, lag einen Augenblick wie gelähmt da und sprang dann entsetzt auf, vorläufig unfähig, ein Wort zu sagen.
Vor ihm stand ein junger Mann, in einem ledernen Anzug, wie Don, hielt die eine Hand in der Hosentasche, die andere mit den Sporen dem Engländer hin und machte dabei ein ganz ernsthaftes Gesicht.
»Nun, wollen Sie Ihre Sporen nicht?« fragte er ruhig.
Charles antwortete noch immer nicht; erstaunt blickte er auf den jungen Mann vor ihm, dann im Zelte herum, betastete sich, ja, griff sich sogar an die Nase und kniff hinein, als wolle er sich davon überzeugen, daß er nicht träume.
Aber er träumte nicht, die Nase tat ihm weh, wenn er daran zog, die Finger knackten, und draußen hörte er ganz deutlich die herzhaften Flüche Jubas.
»Ich träume wirklich nicht?« sagte endlich Charles in fast kläglichem Tone.
»Sie sind wohl ein bißchen verrückt?« entgegnete der junge Mann unbefangen dem Baronet. »Hier sind Ihre Sporen. Wollen Sie dieselben nun endlich nehmen?«
»Hannes, ist es möglich?« erklang es in maßlosem Erstaunen.
»Stimmt, das ist mein Name! Wollen Sie mir nun aber Ihre Sporen abnehmen, oder soll ich sie Ihnen etwa auch noch anschnallen? Sie wissen doch, das steht nicht in unserem Kontrakt.«
»Wie kommen Sie denn hierher? So sprechen Sie doch nur um Gottes willen, sonst rührt mich noch der Schlag.«
»Seit wann sind Sie denn so schreckhaft geworden? Wie ich hierherkomme? Sehr einfach, ich fand in Hamburg keine Arbeit, und damit wir nicht verhungerten, bin ich Ihnen nachgereift und bitte Sie nun, mich wieder als Ihren gehorsamen Diener annehmen zu wollen.«
»Ja, Hannes,« rief Charles, der nach und nach zur Besinnung kam, während sein Staunen noch immer wuchs. »Wo ist denn deine — Ihre Frau, Miß Staunton wollte ich sagen?«
»Die ist auch mit hier, aber mit der Miß ist es jetzt aus, die heißt Frau Vogel. Haben Sie nicht für die irgend eine Beschäftigung? Sie ist zu jeder Arbeit willig.«
Charles wußte nur, daß Hannes mit Hope geflohen war; dann hatte er nichts mehr von den beiden erfahren. Mit großen Augen starrte er den Sprecher an, er glaubte plötzlich, daß er noch in tiefem Schlafe läge und das alles nur träume.
Da kam mit einem Male Leben in ihn. Das Zelt wurde ihm zu enge, er mußte hinaus, um seine wüsten Gedanken in Ordnung bringen zu können. Wie ein Wahnsinniger, den Kopf mit beiden Händen haltend, stürzte er an Hannes vorüber ins Freie, blieb aber hier vor Staunen wie angewurzelt stehen.
An einem Feuer kauerte eine weibliche Gestalt und goß eben kochendes Wasser in den Kaffeetopf — Miß Staunton, wie sie leibte und lebte.
»Miß Staunton!«
Die Gerufene sah sich um, richtete, sich auf und ging mit ausgestreckten Händen auf den an seinem Verstand Zweifelnden zu. Sie konnte aber nicht, wie Hannes, ernst bleiben, sondern mußte laut auflachen.
»Guten Morgen, Sir Williams, der Kaffee ist schon fertig. Haben Sie gut geschlafen?«
»Miß Staunton,« stammelte Charles und ließ sich willenlos die Hand schütteln.
»Ich bin nicht mehr Miß Staunton, sondern Frau Vogel. Sie wissen doch, damals...« lachte Hope aus vollem Halse.
Charles sah sich um.
Dort stand Don und schüttelte sich vor innerem Lachen, als er aber das so völlig verdutzte Gesicht des Baronets sah, brach er in ein unauslöschliches Gelächter aus, und der neben ihm stehende Juba zog ein Gesicht, das man ebensogut für grimmig wie für traurig halten konnte, was bei ihm aber der Ausdruck der größten Freude war.

Plötzlich begriff Charles, daß er nicht träumte, daß alles Wirklichkeit war, daß mit ihm Komödie gespielt wurde, das heißt, nur darum, weil er sich so seltsam betrug, und er stimmte in das Gelächter mit ein, ebenso Hannes.
»Hannes, Herzensjunge, so bist du mir wirklich nachgereist?« rief er und umarmte den jungen Mann. »Aber wie in aller Welt hast du mich gefunden? Wie kannst du es wagen, mit deiner Frau allein durch die Pampas zu reisen? Woher hast du das Geld? Was hast du in Hamburg gemacht? Ist das wirklich deine Frau, wie geht es ihr?«
Diese und andere Fragen sprudelten nur so von den Lippen des Baronets, der wirklich über das Wiedersehen mit seinem ehemaligen Diener überaus glücklich war. Er dachte jetzt gar nicht daran, ihn Sie zu nennen, wie man es ausgemacht hatte, wohl aber Hannes, dem der alte Kontrakt sofort einfiel.
»Halt, halt, Williams,« unterbrach ihn Hannes, dem erst die Tränen in die Augen kommen wollten, der sie aber zurückdrängte, »Sie vergessen ganz, daß Sie mich nicht du nennen sollen, sonst gehe ich einfach wieder an Bord der ›Kalliope‹ zurück, das habe ich Ihnen doch schon ein paarmal gesagt.«
»Na ja, Sie — Sie verfluchter Bengel Sie, aber so antworten Sie mir doch! Wollen Sie wirklich wieder als Diener bei mir antreten und Ihre — Ihre — Frau, Miß Staunton, Pardon, Mistreß Vogel, will auch mit — Nein, nein, Hannes,« unterbrach sich Williams, verlegen werdend, aber doch lachend, »Sie treiben nur Spaß, gestehen Sie es!«
»Nun denn, ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen,« sagte Hannes, nahm eine gravitätische Miene an und faßte Hope an der Hand, »hier, Sir Williams, meine Gemahlin, Freiin Hope von Schwarzburg. Ich habe mich in Deutschland in einen Freiherrn umgewandelt. Mein Name ist jetzt Freiherr Johannes von Schwarzburg.«
Charles riß sich den Mund auf.
»Sie spaßen,« lächelte er endlich.
»Wer hier sagt, der Freiherr von Schwarzburg mache mit ernsten Sachen Spaß, der bekommt es mit mir zu tun,« sagte da plötzlich eine Stimme neben Charles.
»Nick Sharp,« rief der Baronet gleichzeitig und sprang auf den neuen Ankömmling zu. »Ja, nun fange ich wirklich an zu glauben, daß alles auf Wirklichkeit beruht. Sie schwindeln zwar auch sehr gern, Sharps aber diesmal glaube ich Ihnen.«
»Sie können es auch, es beruht alles auf Wahrheit,« rief Hope und trat zu den beiden, sich freudig begrüßenden Männern, »sonst wäre es uns wohl nicht so leicht geworden, Ihnen in die Pampas nachzureisen.«
Ein Engländer nach dem anderen kam aus den Zelten und des Staunens war kein Ende, ebensowenig des Fragens und der Erklärungen. Man freute sich, schüttelte sich die Hände, und weder Hope, noch Hannes, noch Nick Sharp wurden die Bewunderer los. Aber erstere beiden waren doch die Helden.
»Frühstück,« donnerte Juba mit seiner rauhen Stimme, »es wird Zeit zum Aufbruch.
»Pferde satteln,« schrie er dann die Treiber an.
Dabei machte er selbst aber keine Miene, sich zum Aufbruch vorzubereiten, sondern stopfte sich ganz gegen seine Gewohnheit um diese Zeit eine neue Pfeife.
»Zum Teufel mit den Pferden,« schrie Charles, der vor Freude ganz außer sich war. »Meinetwegen brecht allein auf und brecht Euch beim Reiten die Glieder. Wir bleiben hier, heute ist Rast und Ruhetag.«
»Meinetwegen,« brummte Juba, »habe mir so etwas schon gedacht.«
Er setzte sich an das Feuer zurück und schlürfte seinen Kaffee, der für ihn einen großen Genuß bildete, denn das braune Getränk mußte er entbehren, wenn er allein reiste.
»Hannes, Herzensjunge,« fügte Charles und setzte sich zwischen Hope und Hannes auf eine Decke, »also sind Sie wirklich im Handumdrehen Baron geworden? Donner und Doria, da muß ich auch einmal nach Deutschland, vielleicht machen sie aus mir armen Baronet einen Grafen. Aber nun erzählt, wir vergehen alle vor Neugier!«
Alle Herren scharten sich um das junge Paar, und kein Gesicht war darunter, welches nicht vor Freude gestrahlt hatte. Hannes war von jeher ihr Liebling gewesen, vor dem sie aber zu gleicher Zeit Respekt hatten, und für Hope wären sie zu jeder Zeit durchs Feuer gegangen; sie wurde von allen geliebt, geliebt, wie ein unschuldiges Kind. Mit tiefer Betrübnis hatten sie die Nachricht vernommen, daß Hope mit Hannes geflohen sei; jetzt aber wandelte sich diese Betrübnis in helle Freude.
Jetzt zeigte sich wieder, daß Hannes das Schoßkind des Glückes war; wie sie das junge Paar so zusammensetzen sahen, gingen aller Herzen vor Freude über.
Hannes mußte weit ausholen, um die Neugier der Herren zu befriedigen. Er tat es mit sichtlichem Vergnügen, er durchlebte seine letzte Vergangenheit noch einmal, und wenn hin und wieder sein Gedächtnis verfügte, oder er müde wurde, so nahm Hope den Faden der Erzählung auf. Die beiden Befehlshaber der ›Hoffnung‹ spannen ein langes Garn, der Faden drohte oft, sich zu verwirren, wenn einer nicht immer den anderen unterstützt hätte.
Am genanntesten wurden die Herren, als Hannes von dem Wiedersehen der Damen auf der Felseninsel sprach. Man wollte weniger von ihren seltsamen Erlebnissen und deren Lösung hören, sondern jeder fragte den Erzähler nach dem Aussehen einer besonderen Dame, nach ihrem Befinden, ob sie nicht über die Herren, über ihn gerade, den Fragenden, gesprochen hätten, und immer wußte Hannes eine humoristische Antwort zu geben, die aber die Wahrheit enthielt.
Dann erzählte Hannes, wie er von den ihm übergebenen Mädchen bereits fünf in ihre Heimat habe bringen lassen, weiter sein Abenteuer in Santiago, und daß er dann in die Pampas aufgebrochen sei, um die Ostküste Südamerikas zu erreichen und dann nach Brasilien zu fahren, denn dort müsse er abermals zwei Mädchen abgeben oder, wie Nick Sharps Ausdruck dafür war,›abladen‹.
Die Reise durch die Pampas sei in Eilmärschen vollzogen worden, weil man durch Dons Auskunft die Engländer nahe wußte und mit diesen zusammentreffen wollte. Hannes, wie Hope hatten sich sehr auf das Wiedersehen gefreut, und doch mußte dies auf eine so seltsame Weise zu stände kommen.
Gestern hatte Nick Sharp mit seinem unglaublich scharfen Blick, der selbst den des weitsichtigsten Indianers bedeutend übertraf, Reiter gesehen, er hatte spioniert und die Engländer erkannt.
Am Abend war er zu dem Wachtfeuer der Indianer geschlichen, hatte sich mit ihnen verständigt, daß er den kleinen, weißen Führer, Don, zu sehen wünsche, und diesem dann den Auftrag von Hannes überbracht.
Die Indianer wurden aufgeklärt, um was es sich handelte, die Engländer schliefen, die Treiber desgleichen, und so kamen Hannes und Hope noch vor Sonnenaufgang in das fremde Lager. Hope machte sich am Feuer zu schaffen, während Hannes leise in das Zelt von Charles schlich, Kasegorus einweihte und hinausschickte.
Hierauf übernahm Hannes die Rolle eines Dieners, was Williams solches Erstaunen einjagte.
»Sie haben zum Durchqueren der Pampas eine vollständige Expedition ausgerüstet?« fragte Lord Harrlington.
»Sie besteht aus Hope und mir, Mister Sharp, den sieben Mädchen, welche übrig geblieben sind und die auf einem Wagen reisen, einigen Treibern mit Gepäck, Geschenken für die Indianer, und einigen Indianern als Führern. Wir lagern nicht weit von hier, Don ist schon hinübergeritten, um das Lager abzubrechen und hier aufschlagen zu lassen. Wir bleiben nur diesen Tag noch hier. Daß bei diesem Wiedersehen die Unterhaltung nicht fehlt, dafür habe ich schon gesorgt,« fügte Hannes schmunzelnd hinzu.
»Und was treibt Sie, Mister Sharp, in diese öde Gegend? Wollen Sie Indianer verhaften?« fragte Lord Harrlington den Detektiven.
»Indianer nicht, aber Bleichgesichter,« entgegnete der Detektiv.
»Sehen Sie diesen Lasso hier? Wenn wir zusammenbleiben, werden Sie bald bemerken, daß ich ihn wie der geschickteste Penchuenche zu handhaben verstehe; aber ich schleudere ihn nur zweimal, einmal nach dieser Miß Petersen und dann nach Senor Fernando, und dann hänge ich beide wahrscheinlich an einen Apfelbaum.«
»So sind Sie also doch noch hinter Verbrechern her? Natürlich, einen anderen Lebenszweck haben Sie ja nicht.«
»Es sind die letzten, welche mit Ihnen zu tun haben, andere kümmern sich nicht mehr um Sie. Die, welche Sie hierhergelockt haben, um Sie von den Eingeborenen aufreiben zu lasten und sich dann womöglich durch falsche Papiere in den Besitz eines Teiles Ihres Vermögens zu bringen, denken jetzt nicht mehr an Sie, sie sind in Sorge um ihre eigene Sicherheit.«
»Schade,« sagte Hastings, »einige kleine Abenteuer hätten uns ganz gut getan. Jetzt habe ich wieder Lust, durch dick und dünn zu jagen.«
»Abenteuer und Gefahren werden Ihrer auch noch warten, ohne daß diese von jemandem heraufbeschworen werden,« meinte der Detektiv.
Roßhufe stampften den Erdboden, Peitschenknallen erscholl, und die Engländer sahen die kleine Karawane in voller Jagd ankommen. Anders konnten die Indianer ihrer Freude nun einmal keinen Ausdruck geben.
Lebhaft begrüßten die Herren die übriggebliebenen braunen Mädchen, welche sich in dem Planwagen recht gemütlich eingerichtet hatten. Sie kannten dieselben ja nun schon über zwei Jahre und hatten oft genug näher mit ihnen verkehrt. Die Indianer von Hannes, Bewohner der chilenischen Grenze, wurden von ihren Genossen in anderer Weise begrüßt. Beide Teile setzten sich ans Feuer und saßen wohl eine Stunde lang schweigend da, in die Glut starrend und die Pfeife handhabend, ehe sie ein Wort miteinander wechselten.
Um das Aufschlagen der Zelte kümmerten sie sich nicht, das war die Sache der Treiber, waren diese aber nicht dagewesen, so hätten sie nicht eher eine Hand zu dieser Arbeit gerührt, als bis die Weißen selbst ans Werk gingen.
»So sind Sie also unser Schutzengel gewesen,« wandte sich Hendriks an den Detektiven, »wie Sie und Ihre Schwester es auch früher bei den Vestalinnen waren? Können Sie aber auch von hier aus Ihre Fittiche über die Damen in Nordamerika breiten?«
»Dort wacht Mister Hoffmann über sie, und seien Sie versichert, er ist besser als ich imstande es zu tun. Sie sehen, Sir Williams,« wandte sich Sharp an diesen, »ich kann auch einmal bescheiden sein.«
»Und Johanna gibt sich nicht mehr mit ihren früheren gefährlichen Geschäften ab, seit sie Braut des Mister Hoffmann ist?« fragte Hope.
»Hoffmann läßt es nicht zu, aber sie werden zusammentreffen, und Johanna wird bei ihm bleiben, bis die Sache in Ordnung ist. Schade um das Mädchen,« seufzte Sharp, »meine Schwester hatte wie kein anderes Weib Befähigung zur Detektivin, aber diese verdammte Liebe macht nun einmal in der Welt aus sonst ganz brauchbaren Menschen plötzlich ganz unnütze Geschöpfe, die zu nichts mehr zu verwenden sind als zum Essen, Trinken, Schlafen und höchstens zum Küssen.«
»Oho,« riefen die Herren entrüstet, und Williams fügte hinzu:
»Wenn Sie dergleichen noch einmal sagen, werden Sie nach amerikanischem Gebrauch gelyncht.«
»Und können dann zusehen, wenn wir auf die Gesundheit der Damen trinken,« sagte Hannes, winkte und ließ von seinen Arbeitern eine stattliche Anzahl Weinflaschen herbeibringen.
»Zur Feier unseres Wiedersehens und damit die Freude, daß wir die Damen bald treffen, erhöht wird,« sagte er, als er die erste Flasche entkorkte.
»Und daß die keusche ›Vesta‹ dann ihr priesterliches Gewand abwirft und fernerhin dem ›Amor‹ gehorcht,« lachte Hope, den ersten Zinnbecher mit Wein füllen lassend und ihn Lord Harrlington reichend.
Zwei Tage waren wieder vergangen, als am Morgen die beiden vereinigten Karawanen am Ufer eines breiten Stromes hielten und beratschlagten.
Der Strom war sehr breit; eine weittragende Büchse hatte die Kugel wirkungslos das andere Ufer erreichen lassen, und dort drüben beschien die Morgensonne die zahlreichen Lederzelte von Indianern — es war das Lager des springenden Panthers.
Nach der Beratung lenkten Juba Riata und der Anführer der Indianer ihre Pferde in die Strömung, und weiter und weiter entfernten sich die Tiere vom Ufer des angeschwollenen Flusses, dann verloren sie den Boden, sie mußten schwimmen, gerieten in die Strömung, bis sie nach geraumer Zeit das jenseitige Ufer erreicht hatten, allerdings weit unterhalb ihres Zieles.

Nach der Beratung lenkten Juba Riata und der
Anführer der Indianer ihre Pferde in den Strom.
Die Zurückgebliebenen sahen, wie die beiden Reiter langsam auf ihren erschöpften Rossen in das Lager einritten, ohne daß sie eine Bewegung dort bemerkten. Die Indianer lagen wahrscheinlich träge in ihren Zelten, und die Frauen gingen ihrer Beschäftigung nach, sie schöpften Wasser.
Die Engländer warteten geduldig. Juba wollte ihnen ›schreiben‹, ob sie den Fluß passieren durften, ohne von den Penchuenchen feindlich empfangen zu werden.
Auch der Indianer kann ›schreiben‹, und zwar so weithin, wie das Auge sehen kann, und die Schriftzeichen, derer sie sich bedienen, sind bei fast allen Indianern Amerikas die gleichen, dieselben, die er bei der Fingersprache anwendet.
Diese Sprache ist sehr unvollkommen, noch viel unvollkommener als die Bildersprache. Wie sich die Indianer mit Hilfe der letzteren verständigen, mag ein Beispiel zeigen, welches ein lange unter den Indianern lebender Engländer erzählt:
Ein Häuptling war bei einem benachbarten Stamme anwesend, als ein Bote ihm meldete, der ›rennende Fuchs‹ habe seinen Posten verlassen, der Stamm frage, was mit dem Straffälligen geschehen solle. Der schweigsame Häuptling verschmäht, mündlich eine Antwort zu geben, oder der Bote brauchte einen schriftlichen Befehl, kurz, der Häuptling nahm ein Stückchen Leder, malte mit roter kreide ein Zelt darauf und einen rennenden Fuchs, der dem Zelte den Schwanz zudrehte, zwischen beides einen Stock, und als der Bote in das Lager zurückkehrte, wurde der ›rennende Fuchs‹ mit Stockschlägen aus dem Lager getrieben.
Noch viel einfacher ist die Zeichensprache, es ist eine Art von Luftmalerei. Man malt mit einigen Strichen ein Pferd, einen Hund, einen Hirsch, einen Baum, Busch, Wiese, Menschen und so weiter, es geht alles blitzschnell, aber der Indianer ist darin so geübt, daß er die kompliziertesten Begriffe ausdrückt. Durch solche Zeichen können sogar Begriffe wie Liebe, Haß, Tod, Verachtung und so weiter verdeutlicht werden.
»Glaube nicht, daß der springende Panther uns hinüberläßt,« sagte Hastings zu Don, welcher die Antwort Jubas übersetzen sollte, »wir sind ihm eine zu starke Anzahl von bewaffneten Leuten.«
»Das würde ihn nicht dazu veranlassen, eine abschlägige Antwort zu erteilen,« antwortete Don. »Der springende Panther ist wirklich ein tapferes Mann, der Feigheit verachtet. Vielleicht aber verbietet er es uns darum, weil dort drüben sein Gebiet anfängt. Nun, wir werden es bald sehen.«
»Und wie steht es mit den geraubten Mädchen, wird der Häuptling sie gegen Geschenke an uns ausliefern?«
»Ich vermute fast, ja; wie ich jetzt nämlich gehört habe, hat der springende Panther durch die Ueberschwemmung große Verluste gehabt, sein ganzer Vorrat von Tabak, Mehl und so weiter ist zum Teufel gegangen, ebenso viele Pferde, und zwar hauptsächlich durch die Schuld der fremden Weiber, weil diese den Indianern zu viel zu schaffen gemacht haben. Nun kommt aber bei den Pechuenchen erst Tabak und Mehl, dann das Pferd, und schließlich die Weiber, ich glaube daher, daß der springende Panther sehr gern auf einen Tauschhandel eingeht, das heißt, wenn er nicht Liebe zu einem Mädchen empfindet. Paßt auf, da tritt Juba ans Ufer.«
Der wie ein Zwerg aussehende Jäger kam aus dem Lager heraus, schnitt von einer Weide einen starken Zweig, schälte diesen, so daß er weiß wurde, und trat dicht ans Wasser. Dann fuchtelte er mit dem gut sichtbaren, weißen Stocke in der Luft herum, von links anfangend, nach rechts hingehend und dann wieder von links beginnend.
Alle hatten sich um Don versammelt, der aufmerksam hinüberschaute.
Dann fing er an, die Zeichen frei zu übersetzen.
»Die Pampas ist groß, sagt der springende Panther, warum sollen die Fremdlinge ihre Pferde nicht dahin lenken, wohin sie wollen? Der springende Panther fürchtet sie nicht, er verlangt nur Tribut in seinem Gebiet.«
Der erste Satz war zu Ende. Juba machte ein besonderes Zeichen und fuhr dann fort:
»Der springende Panther ist ein tapferer Krieger, er wird die Fremden besuchen, denn ihr Bote ist sein Freund. Der Strom ist zu tief für sie.«
Juba schloß und kehrte ins Lager zurück.
»Was soll das heißen, der Strom ist zu tief für uns?« rief Harrlington. »Wir sollen also nicht hinüber?«
»Durchaus nicht, der springende Panther ist nur höflich, er will Euch den Durchgang sparen und selbst zu Euch kommen. Dann wird er auch die Mädchen umtauschen, haltet die Geschenke bereit! Ueberlaßt das Unterhandeln aber mir und Juba!«
Wirklich kamen gleich darauf auch der springende Panther, Juba und der Anführer zum Vorschein, bestiegen die Pferde und nahmen sofort die Schwimmtour auf. Der Häuptling wollte zeigen, daß er keine Furcht kannte, indem er allein in das Lager hinüberging, welches vielleicht Feinde beherbergen konnte.
Es wurden schnell Anstalten getroffen, den Häuptling würdig empfangen zu können, und als die drei triefend das Wasser verließen, nahm der Häuptling vor einem Feuer Platz und wartete gleichgültig, bis sich die Herren um ihn gruppiert hatten. Nach dem Ratschlage Jubas wurde ihm nichts vorgesetzt, erst nach Schluß der Unterhandlung sollte er bewirtet werden.
Juba machte den Dolmetscher, Harrlington vertrat die Engländer.
Der Häuptling erkundigte sich genau, warum die Weißen hierher kämen, und war mit der Erklärung Harrlingtons zufrieden, daß sie im Auftrage des Don Alappo und dessen Sohnes handelten und die geraubten Mädchen eintauschen wollten.
Der springende Panther war zu Dons Erstaunen willig, Mercedes auszutauschen, und der geforderte Preis war kein unmäßiger. Er mußte mit Mercedes doch nicht zufrieden sein, er verschmähte das eheliche Glück mit ihr Zehn Pfund Rollentabak, ein paar silberne Sporen, zwei Sättel, zwei Zäume und ein Sack Zucker waren der Preis für sie.
Hätte der springende Panther sprechen wollen, so würde er erzählt haben, wie schnöde Mercedes ihn behandelt, daß sie ihn sogar geschlagen hatte, und nur deshalb dem Tode entgangen sei, weil der Häuptling ein hohes Lösegeld für sie zu bekommen hoffte. Aber der Verachtung seiner Weiber war er doch für einige Tage nicht entgangen, diese mußten aber dafür büßen. Indianer bleibt immer Indianer, und wenn er der tapferste Häuptling wäre.
Während die spanischen Treiber die Zelte aufschlugen — denn man wollte auf einige Tage hierbleiben, um die geängstigten Mädchen sich erholen zu lassen, vielleicht auch, um Don Alappo zu erwarten — wurden die Tauschartikel ausgebreitet. Der springende Panther ging an ihnen vorüber, prüfte alles mit ernstem Blick, hob den Tabak wägend empor und erklärte sich dann zufrieden. Als Hannes zu den Sachen noch einen Ballen aus seinen Vorräten hinzufügte und dem Häuptling erklärte, es wäre ein besonderes Geschenk, überflog ein freundliches Lächeln die bronzefarbenen Züge des springenden Panthers, denn von außen konnte er dem Ballen ansehen, daß er nur Rollentabak enthielt, den größten Schatz des Indianers, für den er alles, selbst Pferde und Weiber, verkauft.
»Wie viele Mädchen hat der springende Panther entführt?« fragte er dann Harrlington.
»Meines Wissens sieben,« entgegnete der Lord, wohl wissend, was jetzt kommen würde, und besonders Nick Sharp war mit einem Male ganz Ohr.
Der Indianer schüttelte den Kopf.
»Nein, nur sechs,« sagte er. »Fernando hat eine entführt, sie ist nicht bei mir.«
»Ich weiß,« entgegnete Harrlington schnell, »dieser Preis ist auch nur für sechs Mädchen berechnet. Wo aber ist das siebente geblieben?«
Der springende Panther sprach von Fernando und der angeblichen Miß Petersen, als er erzählte, ein Spanier und ein Mädchen hätten während der Überschwemmung mit seinem Stamme zusammen auf einem Hügel gelebt, dann aber sei Fernando eines anderen Weges geritten und habe das Mädchen mitgenommen, welches sich, wie der Häuptling wenigstens glaubte, gesträubt habe. Sie hätten die Richtung nach Norden eingeschlagen; mehr war aus dem wortkargen Indianer nicht herauszubringen, er sagte nicht einmal, daß Fernando ihn oft zu überreden versucht habe, Miß Petersen zu rauben.
Aber Juba Riata, Don und besonders Nick Sharp, wußten alles, was auch der Häuptling nicht aussprach. Ihr scharfer Verstand sagte es ihnen, und durch Schlüsse ergänzte Nick Sharp alles andere, was er zu wissen nötig hatte.
»Fernando gibt sich den Anschein, als entführe er Miß Petersen mit Gewalt,« sagte er zu den Engländern, »um sie immer weiter ins Innere zu locken, in Wirklichkeit aber folgt ihm das Mädchen willig, stellt sich aber so, als sträube es sich, damit die immerhin wahrheitsliebenden Indianer nicht zu Verrätern des Betruges werden. Ich werde die Indianer noch auszuforschen suchen, um dieser beider Menschen habhaft zu werden.«
»Und wir schließen uns Ihnen an,« fügte Hastings hinzu, »dieses Pärchen müssen wir näher kennen lernen.«
Der Häuptling war ans Ufer getreten, er erhob nur die Hand, und sofort wurde drüben ein unterdes aus Baumstämmen angefertigtes Floß ins Wasser geschoben, auf welches die sechs Mädchen gesetzt wurden, berittene Penchuenchen bugsierten das gebrechliche Fahrzeug über den Strom, und bald hieß Hope die Geängstigten in ihrem Zelte willkommen. Wenn Don Alappo nicht bald käme, dann sollten sie unter indianischer Begleitung und unter Führung des energischen Juba nach der Hazienda zurückgebracht werden.
Die Indianer kehrten nach Empfang einiger Geschenke sofort wieder über den Fluß zurück und nahmen die Tauschware auf dem Floß mit, der springende Panther dagegen blieb auf Harrlingtons Bitte für diesen Tag dessen Gast und ließ sich die vorgesetzten Gerichte trefflich schmecken. Er zeigte sich jetzt unterhaltsam und machte überhaupt den Eindruck eines recht gesitteten Menschen.
»Da sieht man doch, wie weit man mit Indianern kommen kann, wenn man sie freundlich behandelt,« sagte Harrlington zu Williams, als sich alle Mitglieder des Lagers um die Feuer gelagert hatten und die Mittagsmahlzeit einnahmen, welcher der springende Panther als Gast beiwohnte. »Hätten wir ihnen mit Drohungen die Mädchen abgefordert, Waffen gezeigt und barsche Worte gebraucht, so würde er uns hohnlachend zum Kampfe herausgefordert haben, und im Falle, daß wir ihm die Mädchen doch abnahmen, nur auf Rache gesonnen haben.«
»Wird ihn der gute Tausch aber nicht aufmuntern, sich noch öfters mit Mädchenraub abzugeben?«
Da nahm Juba das Wort.
»Den Mädchenraub hält der Penchuenche für sein Recht, wenn er seinen Feind besiegt hat,« sagte er. »Dies ist eine uralte Sitte, welche weder durch Feuer, noch Schwert getilgt werden kann. Um sich zu bereichern, raubt der Indianer dagegen kein Mädchen, er tut es auch, wenn er keinen Gewinn erhofft.«
»So meint Ihr, es sei besser, die Mädchen auszutauschen, als sie ihnen mit Gewalt wieder abzunehmen?« fragte Charles.
»Natürlich, denn ehe sich der Indianer seine Gefangenen nehmen läßt, schlachtet er sie lieber ab, wenn er noch Zeit und Gelegenheit dazu hat.«
»Könnte man ihnen diese Unsitte nicht durch Lehre und Strafen austreiben?«
Der Pampasjäger lachte rauh auf.
»Tötet die Indianer alle, dann rauben sie keine Mädchen mehr.« sagte er kurz und beschäftigte sich wieder mit seinem Essen.
Noch hatte der Pampasjäger das letzte Wort nicht gesprochen, als der Ruf eines Indianers erst seine Genossen, dann auch die Weißen aufsehen machte und ihre Aufmerksamkeit dahin lenkte, wo sie einen freien Blick aus die Pampas hatten. Außer dem springenden Panther, der ruhig sitzen blieb und weiter aß, eilten alle dorthin und betrachteten den Reiterzug, den der Indianer gemeldet hatte.
Es waren an zweihundert Reiter, die sich dem Lager im Trabe näherten, und an den bunten Kleidern, an den blitzenden Säbelscheiden konnte man erkennen, daß es chilenische Dragoner waren, aber auch einige andere Leute, welche keine Uniformen trugen.
»Don Alappo mit seiner Karawane,« rief Charles, »in Begleitung von einer Schwadron Dragonern.«
Juba stieß einen furchtbaren Fluch aus und stampfte mit dem Fuße den Boden.
»Ihr bürgt mir dafür, daß der springende Panther bei Euch in Sicherheit ist,« wandte er sich hastig an Harrlington, »diese bunten Jacken kommen in böser Absicht, und habt Ihr nicht den Willen, ihn zu schützen, dann sagt es schnell. Dann wird der Häuptling gewarnt und geht über den Fluß zurück, wir aber, ich, Don und alle Indianer gehen mit ihm, denn einen Bruch der Gastfreundschaft können wir nicht ansehen, des Häuptlings Feinde sind unsere Feinde, so lange er an uns nicht zum Verräter wird, denn wir haben mit ihm an einem Feuer gesessen und mit ihm zusammen gegessen.«
Der freie Pampasjäger, aus natürlichen Gründen der geschworene Feind des Militärs, ahnte, daß die Dragoner die Auslieferung des springenden Panthers verlangen würden. Daß sie hierherkamen, um den Ueberfall der Hazienda zu rächen, wußte er, und er hatte recht, wenn er Harrlington zur Aufrechterhaltung der Gastfreundschaft, welche jeder, der in Wildnissen gereist ist, als die höchste Tugend zu schätzen gelernt, aufforderte. Aber er hätte seine Worte etwas höflicher anbringen sollen, in seinem Tone lag ein böser Verdacht.
Harrlington ward dunkelrot, dann richtete er sich hoch auf und schaute den Sprecher mit blitzenden Augen an.
»Juba,« rief er finster, »sprecht nicht weiter aus, was mich beleidigen muß! Noch habt Ihr mich während der wenigen Wochen nicht kennen gelernt, aber verlaßt Euch darauf, Ihr würdet in mir Euren Mann finden. Im übrigen laßt Euch gesagt sein, daß auch ich die Gastfreundschaft hochschätze und meinen Gast zu schützen weiß. Der springende Panther ist mein Freund, damit genug; ob er unrecht getan hat oder nicht, ist mir gleichgültig, ich wage es nicht zu beurteilen, weil ich kein Penchuenche bin und die Pampas nicht meine Heimat sind.«
Diese Worte verfehlten ihre Wirkung auf den Jäger nicht.
»Das war brav gesprochen,« rief er, ergriff die Hand des Lords und schüttelte sie, daß der Arm im Gelenk knackte. »Wenn alle so dächten, wie wir beide, dann würden weniger Streitigkeiten zwischen Indianern und Weißen vorkommen. Nichts für ungut, Fremder, daß ich einen Augenblick an Eurer Bravheit gezweifelt habe.«

Juba Riata.
Schnell war im Lager verbreitet worden, was Juba Riata befürchtet, und schon jetzt flammte das Blut der Briten allein bei dem Gedanken auf, die Forderung hören zu müssen, sie sollten ihren Gastfreund ausliefern. Trotzdem noch nichts geschehen war, wurden schon Verwünschungen gegen die Dragoner laut, und einige wollten sogar zu dem Häuptling eilen und ihm versichern, daß sie mit Gut und Blut für seine Sicherheit in ihrem Lager einstehen würden, wurden aber von Don zurückgehalten.
»Gebt Euch vor dem Häuptling keine Blöße, er würde Euch heimlich verlachen,« sagte er.
Der springende Panther hockte noch immer beim Feuer und ließ sich sein Essen schmecken — gebratene Kartoffeln waren ihm eine seltene Leckerei — anscheinend, als höre er gar nicht, was eigentlich vorging, war aber natürlich über alles ebenso genau unterrichtet, wie die übrigen. Sein Stolz verbot ihm jedoch, Unruhe oder Sorge um die Zukunft zu verraten.
Schon konnte man die einzelnen Gestalten der herankommenden Reiter unterscheiden. Man erkannte Don Alappo, dessen Sohn, Don Pedro, mehrere andere vornehme Männer, den Gesichtszügen nach Spanier, wahrscheinlich Nachbarn Don Alappos, eine Menge Lasttiertreiber mit vielem Gepäck, einen hohen Offizier, zwei andere und ungefähr 140 Soldaten.
Selbst Musiker waren dabei, ein sicheres Zeichen, daß die Dragoner böse Absichten gegen die Penchuenchen hegten, denn das chilenische Militär geht immer unter den anfeuernden Klängen der Musik in den Kampf.
Die Engländer hörten ein Kommando, die Dragoner hielten, die Offiziere und Don Alappo besprachen sich, man sah nach dem Lager der Indianer auf dem jenseitigen Ufer und nach dem Lager unserer Freunde, es schien fast, als ob Don Alappo dem Offizier irgend etwas ausreden wollte, aber der letztere gab eine heftige Antwort, rief ein Kommandowort, die Dragoner schwenkten ab und sprangen am Ufer von den Pferden, um sich zu lagern, während Don Alappo mit mehreren Begleitern nach dem Lager ritt.
Harrlington und einige Freunde eilten ihm entgegen und trafen vor den Zelten auf ihn.
»Gute Nachrichten, Don Alappo!« rief ihm Huntington entgegen. »Freuen Sie sich, Don Pedro, Ihr Kommen war unnötig, wir haben schon alles erreicht, was wir wollten, und zwar ohne militärische Hilfe.«
Der alte Haziendero kam nicht erst zum Fragen; schon lief aus einem Zelte eine helle Gestalt in fliegenden Kleidern auf ihn zu und hing — nicht an seinem, aber an seines Sohnes Hals.
»Mercedes!«
Auch die anderen fünf Mädchen stürzten aus dem Zelte, in dem sie Hope schon lange kaum noch zurückhalten konnte, und jede fand einen Angehörigen, der um sie getrauert hatte.
»Gott sei Dank.« rief Don Alappo, als sich die erste Freude des Wiedersehens etwas gelegt hatte, »daß sich die Angelegenheit so glücklich gelöst hat! So haben wir nicht mehr nötig, die Hilfe der Dragoner erst in Anspruch zu nehmen, wir können sofort zurückkehren.«
»So war es nicht Ihr Wunsch, daß Sie von Militär begleitet wurden?« rief Harrlington verwundert.
»Ich wollte wohl Militär zu meinem Schutze mitnehmen, gewiß, denn man kann sich doch bei einem Angriffe von Indianern nicht auf gemietete Arbeiter verlassen; diese Dragoner aber haben sich mir in der Absicht angeschlossen, den Ueberfall auf der Hazienda zu rächen, das heißt, ein Blutbad anzurichten und bei dieser Gelegenheit die Mädchen zu befreien. Kehren Sie mit uns um, Senores, oder bleiben Sie wenigstens jetzt hier und sehen Sie dem Verlaufe der Dinge zu, denken Sie aber an keine Weiterreise, die Dragoner werden die Penchuenchen drüben angreifen.«
»Wenn die Herren nicht gesonnen sind, unter meiner Führung mit gegen die roten Schufte zu kämpfen,« schnarrte da eine Stimme, und neben Don Alappo trat der erste Offizier der Schwadron. Auch die anderen Offiziere waren in seiner Begleitung.
»Mister Gray,« riefen einige Engländer sofort beim Anblick des schwarzbärtigen Mannes, unangenehm erstaunt.
Sie erkannten in dem ersten Offizier einen Mann, der bis vor einigen Jahren in der englischen Armee als Offizier gedient und in ihren Kreisen verkehrt hatte. Wegen Provozierung eines in England streng verbotenen Duells wurde er aus der Armee gestoßen und gleichzeitig auch aus der Gesellschaft, weil er verschiedener Unredlichkeiten überführt wurde. Er verschwand, und hier trafen sie ihn zum ersten Male wieder, als hohen, chilenischen Dragoner-Offizier.
Mister Gray wußte wohl, wem er in den Pampas begegnen sollte, er hatte schon von den Herren des ›Amor‹ erfahren, aber das Gouvernement hatte ihm nun einmal befohlen, mit Don Alappo zu reiten, die Engländer hatten das gleiche Ziel, und so war ein Zusammentreffen nicht zu vermeiden.
Mister Gray hatte während vieler Wochen Gelegenheit gehabt, sich auf dieses Wiedersehen vorzubereiten und war daher durchaus nicht überrascht. Er hatte ja hier die Macht und das Recht auf seiner Seite und wollte demgemäß seinen ehemaligen Genossen gegenübertreten.
»Ach, meine Herren, welch freudiges Wiedersehen,« rief er, sich erstaunt stellend, »hätte nie geglaubt, Sie einst in den Pampas zu treffen, auf Ehre!«
Er legte die Hand salutierend an die Mütze; die Engländer blieben die Antwort schuldig.
»Ich sehe, Sie haben die erste Aufgabe schon gelöst,« fuhr er dann fort, nachdem er sich erst einen Augenblick auf die Lippen gebissen hatte, »Sie haben die Mädchen schon eingetauscht. Well, so bleibt nur noch die Hauptaufgabe übrig, welche zu lösen mir obliegt, die Züchtigung der Räuber. Ich lade die Herren ein, daran teilzunehmen.«
»Danke,« sagte Harrlington kalt, »uns haben die Penchuenchen nichts getan.«
»So können Sie von sicherem Versteck aus, wohin sich keine Kugel verirrt, meinem Kampfe mit den Penchuenchen zuschauen,« sagte der Offizier, grüßte und wandte sich zum Gehen.
Hastings wollte heftig auffahren, wurde aber von Harrlington zurückgehalten.
»Wir sprechen zu einer anderen Zeit noch mit Mister Gray,« sagte er laut.
Ehe dieser aber ging, flüsterte ihm ein Offizier etwas zu; er blieb stehen, horchte auf und ging dann zurück, das Lager mit den Augen überfliegend und jetzt erst den noch immer am Feuer sitzenden Häuptling bemerkend.
»Wer ist das?« rief Gray. »Der springende Panther? Ja, meine Herren, wie soll ich mir erklären, daß der Schurke, den wir suchen, in Ihrem Lager weilen darf?«
»Haben Sie vielleicht etwas dagegen?« rief Harrlington, über diesen Ton empört. »Der springende Panther hat uns die geraubten Mädchen ausgeliefert und befindet sich als Gastfreund in unserem Lager.«
Der Offizier bohrte seine boshaften Augen in die von Lord Harrlington.
»Er ist aber ein Feind der chilenischen Regierung,« sagte er langsam, »ich bin hier im Namen derselben und verlange daher, daß mir der springende Panther ausgeliefert wird, damit er bestraft werden kann.«
»Verlangen können Sie viel, aber bekommen werden Sie nichts,« platzte Lord Hastings heraus, der schon wußte, was der Offizier zu bezwecken suchte, und seinen Zorn unmöglich noch bemeistern konnte.
»Sie wollen ihn mir nicht ausliefern?« sagte Gray gedehnt. »Das tut mir leid, meine Herren, dann muß ich Gewalt anwenden.«
»Tun Sie, was Sie nicht lassen können,« lachte Williams, »aber sehen Sie sich vor, unsere Büchsen sind nicht mit Zuckererbsen geladen!«
»Wie?« brauste der Offizier jetzt auf. »Sie sollten wagen, auf chilenisches Militär zu schießen?«
»Wer unser Leben bedroht, dem kommen wir zuvor,« entgegnete Lord Harrlington kalt, »das ist das Gesetz, welches bei uns gilt.«
»Aber nicht in Chile. Wer sich der Staatsgewalt mit Waffengewalt widersetzt, hat sein Leben verwirkt, sei er ein Weißer oder eine Rothaut.«
»Sie sind ja mit einem Male Feuer und Flamme für Chile,« spottete Williams. »Bezahlt Ihr Chile auch die Summe, die Sie mir noch schulden?«
»Chile ist jetzt mein Vaterland, ich gehorche nur ihm,« entgegnete Gray, der die letzte Bemerkung nicht beachtete; aber sein drohender Blick verriet, daß er sie wohl gehört hatte.
»Ich glaubte, Sie wären ein Engländer. Wir Engländer sind sonst stolz darauf, uns als solche bezeichnen zu können,« sagte Hastings.
»Bah, England,« stieß Gray finster hervor, »ich wüßte nicht, worauf ein Engländer stolz sein könnte.«
Da trat Lord Harrlington einen Schritt an Gray heran, streckte den Arm wie drohend aus und rief:
»Honny soit qui mal y pense!«
Die Wirkung dieser Worte war die erwartete, denn sie enthielten die schwerste Beleidigung für einen Engländer. Gray erblaßte. Er taumelte zurück, als wäre er ins Gesicht geschlagen worden, und griff an seinen Degen.
»Das sollen Sie mir büßen,« stammelte er, »wir werden uns noch sprechen.«
Honny soit qui mal y pense! das heißt, verflucht, wer schlecht davon denkt, ist der Spruch des englischen Hosenbandordens.
König Heinrich der Achte, ein bekannter Frauenverehrer und Tyrann, sah bei einem Hofball, wie ein schönes Ehrenfräulein ihr Strumpfband verlor und war ihr beim Wiederanlegen desselben behilflich. Als über diesen Vorfall böse Reden laut wurden, rief er aus: ›Ein Schurke, wer schlecht davon denkt‹, gründete den Hosenbandorden, den höchsten, englischen Orden, und setzte als Devise obigen Spruch hinein.
So entstand der Hosenbandorden und der englische Wahlspruch zugleich, der aber jetzt eine ganz andere Auslegung bekommen hat, als damals.
Gray hatte verstanden, daß Lord Harrlington ihn als Schurke bezeichnen wollte.
»Wir werden uns noch sprechen,« knirschte der Offizier, »und glauben Sie nicht, Sie dürften eine Herausforderung zurückweisen, wir befinden uns nicht in England.«
»Es wird sich finden,« sagte Lord Harrlington.
»Ja, es wird sich finden,« rief Gray und bestieg mit seinen Offizieren die Pferde, »in einer halben Stunde werde ich wieder anfragen lassen, ob Sie gewillt sind, mir den springenden Panther auszuliefern, wenn nicht, so werden wir gleich Gelegenheit haben, uns mit den Waffen gegenüberzutreten.«
»Einem solchen Duell werde ich nie ausweichen,« rief Lord Harrlington dem Davongehenden nach.
»Sie hätten sagen sollen, bezahlen Sie erst Ihre Ehrenschulden, dann will ich mir überlegen, ob ich mich mit Ihnen schlage,« meinte Williams.
»Wir wollen nicht mehr darüber sprechen, sondern lieber darüber, wie wir den Häuptling sicher hinüberbringen können, denn die Dragoner sind imstande und schießen den fliehenden Indianer im Wasser nieder. Da, haltet ihn, er geht in seinen Tod,« rief plötzlich Harrlington und sprang vor, um ein Pferd aufzuhalten, das an ihm vorüberjagte, aber es kam vorbei, erreichte das Ufer, ein Sprung, es war im Wasser und begann zu schwimmen.
»Der springende Panther,« schrie Harrlington.

»Der springende Panther!« schrie Lord Harrlington..
Da knallte neben ihm ein Schuß, der Häuptling streckte die Arme weit aus und sank seitwärts vom Pferde herunter. Nick Sharp ließ den rauchenden Revolver sinken und sah aufmerksam dem weiterschwimmenden Tiere nach.
Während die Engländer mit den Offizieren sprachen, hatten die Indianer mit dem springenden Panther in ihrer kurzen, abgerissenen Weise eine Unterhaltung geführt, an der sich Juba, Don und ganz besonders Nick Sharp beteiligten. Kein Zeichen von Aufregung oder sonst etwas verriet, daß sie einen kühnen Plan besprachen, nur einmal, als Sharp eben gesprochen hatte, mußte der springende Panther lächeln, nickte mit dem Kopfe und stieß ein beifälliges Grunzen aus.
Als die Offiziere zurückritten und die Engländer wieder ins Lager gingen, saß der springende Panther mit einem Satze plötzlich auf seinem Pferde und war sofort im Wasser.
Die Dragoner sahen es, dann auch die Offiziere.
Gray wußte wohl, wer der Flüchtige war, er schrie seinen Leuten zu, zu schießen, aber noch ehe die Dragoner ihre Karabiner heben konnten, riß Nick Sharp den Revolver aus dem Futteral, zielte nach dem Häuptling, dessen Oberkörper aus dem Wasser ragte, und schoß. Sofort verschwand der springende Panther im Wasser.
»Was haben Sie getan?« schrie Harrlington außer sich, der, wie auch die übrigen Herren, sehr entrüstet war, und packte den Detektiven am Arm.
»Nun, ist denn in den Pampas das Schießen verboten?« fragte Sharp kaltblütig, nahm die abgeschossene Patrone aus dem Revolver und steckte eine neue hinein, ohne daß der Lord ihn daran zu hindern vermochte.
»Sie haben den springenden Panther, meinen Gastfreund, getötet, wir können unsere Reise nicht fortsetzen, ohne der Blutrache zu verfallen.«
Plötzlich brach Sharp in ein lautes Lachen aus, in welches Don und Juba, selbst auch die Indianer mit einstimmten, bei denen es aber mehr wie Heulen klang.
»So ist es recht, immer lauter geheult,« sagte Sharp und wandte sich dann an den verdutzten Lord. »Für die Dragoner ist der springende Panther allerdings tot, wenn Sie aber einmal so freundlich sein wollen, recht genau hinzusehen, dann werden Sie den springenden Panther ganz gemütlich neben seinem Pferde schwimmen sehen. Nun dürfen Sie aber auch meinen Arm loslassen.«
Wirklich, erst jetzt bemerkten die Engländer, wie ein Kopf, dicht an den Hals des Pferdes geschmiegt, aus dem Wasser hervorsah, so daß die weiter oberhalb liegenden Dragoner ihn nicht bemerken konnten.
Der springende Panther war von den weißen Führern beredet worden, zu fliehen, um den Engländern keine Unannehmlichkeiten zu bereiten, und Sharp hatte den besten Plan gefunden, nach welchem eine Flucht bewerkstelligt werden konnte.
Den fliehenden Panther hätten die Dragoner natürlich sofort niedergeschossen, Sharp kam ihnen aber zuvor; er schoß, der Häuptling stellte sich nach der Verabredung, als wäre er getroffen, ließ sich vom Pferde fallen, klammerte sich aber an die Mähne desselben und wurde so, unbemerkt von den Dragonern, dem jenseitigen Ufer zugeführt.
Die Engländer drückten unverhohlen ihre Freude über diese List aus, durch welche ihnen wirklich viel Verlegenheit erspart wurde. Doch Sharp verbat sich alle Lobeserhebungen und sagte, sie sollten lieber mithelfen, das begonnene Theaterstück weiterzuspielen.
Die Indianer schrieen noch immer. Don und Juba stritten sich mit Sharp herum, welch letzterer in wahre Tobsucht zu verfallen schien, und die Engländer halfen, so gut sie konnten, den Dragonern den Ernst der Sache glaubhaft zu machen.
Schon kam nämlich ein junger Offizier nach dem Lager gesprengt.
»Sie werden sich verantworten müssen, warum Sie den springenden Panther nicht ausgeliefert, sondern entfliehen und dann haben erschießen lassen,« sagte Hastings zu Lord Harrlington.
»Was soll ich sagen, Mister Sharp?« fragte Harrlington den Detektiven.
»Das überlassen Sie mir nur, ich habe den springenden Panther erschossen und kann auch die Verantwortung tragen,« rief Sharp, »und wenn das junge Bürschchen Geschichten macht, so werde ich ihm das Gesetz der Steppe bald beibringen.«
Der junge Offizier parierte sein Pferd vor Harrlington, grüßte und sagte in dienstlichem Tone:
»Oberst Gray bittet um Auskunft, aus welchem Grunde der springende Panther von Ihnen oder einem Ihrer Leute erschossen worden ist, anstatt ihn der chilenischen Regierung als Gefangenen auszuliefern, wie gewünscht wurde.«
Noch ehe Harrlington antworten konnte, sprang schon Sharp hervor und rief:
»Sagt Oberst Gray, daß ich den springenden Panther erschossen habe, und daß ich es mit jedem anderen ebenso mache, der mich beleidigt.«
»So war er Euer Feind?«
»Was geht Euch das an? Aber ich will es Euch sagen, ja, er war mein Todfeind, und nur dem Umstand, daß ich mit ihm in einem Lager gelegen habe, hat er es zu verdanken, daß ich ihn nicht schon langst über den Haufen geschossen habe. Als er floh, brauchte ich keine Rücksicht mehr gegen ihn zu beobachten. Fordert Ihr von mir Rechenschaft? Well, ich bin zu jeder Zeit bereit, Euch solche zu geben.«
Und Sharp legte vielsagend die Hand an den Revolverkolben.
Der Offizier hielt den wie einen gewöhnlichen Jäger gekleideten Mann für einen jener Weißen, die sich an den Indianergrenzen herumtreiben; er kannte ihre wilden Sitten, die sie von den Indianern angenommen hatten, die Ausübung der Blutrache und so weiter, und wußte wohl, daß mit solchen Leuten nicht zu spaßen war. Ein Menschenleben galt ihnen nicht mehr als das einer Fliege, ihr Messer sah locker in der Scheide, und die Revolver hatten sie immer schußbereit.
»Es ist gut, ich werde es dem Obersten melden,« entgegnete der Offizier und ritt zurück.
»So, der springende Panther wäre gerettet,« lachte Sharp. »Jetzt ist er schon zu weit, um gesehen zu werden, selbst wenn sie sein Pferd noch wegschießen sollten. Der wird den Dragonern wohl noch zu schaffen machen.«
Die Herren sahen dann mit bloßen Augen, wie das Pferd das gewonnene Ufer hinauftrabte, aber ohne den Indianer. Der springende Panther blieb unsichtbar, und darüber wunderten sich die Engländer, sie waren sogar besorgt, denn sie hatten geglaubt, er würde sich nun den Dragonern zeigen und ihnen höhnisch zuwinken.
»Der springende Panther ist eben klüger und edler, als Sie glauben,« erklärte Sharp. »Wenn er sich jetzt zeigte, könnten Sie noch immer die Dragoner auf den Hals bekommen, weil diese die List merken würden. Daher ist der Häuptling in das hohe Gras gekrochen und schleicht in sein Lager zurück. Es ist auch besser, wenn ihn die Dragoner für tot halten; desto kecker werden sie angreifen, aber desto mehr werden sie sich auch entsetzen, wenn ihnen der totgeglaubte Häuptling mit dem Schlachtruf begegnet.«
»Sie möchten wohl, daß die Indianer als Sieger aus einem eventuellen Kampfe hervorgingen?« fragte einer der Herren.
»Natürlich, das ist mein sehnlichster Wunsch! Am liebsten möchte ich auf ihrer Seite kämpfen. Ein Kampf ist übrigens unvermeidlich. Die Dragoner haben den Befehl, unter den Indianern ein Blutbad anzurichten, und müssen das auch versuchen. Ob es ihnen gelingt, ist eine andere Frage. Sie kennen den springenden Panther noch nicht, denn er hat bis jetzt mit den Weißen in Frieden gelebt, desto mehr aber mit nördlichen Stämmen im Kampfe gelegen, und Juba kann Ihnen davon erzählen, wie er seine Krieger anzuführen versteht.«
»Au revoir, Messieurs,« rief eine Stimme.
Es war Oberst Gray, der mit diesem Abschiedsgruß nach dem Lager winkte und mit seinen Leuten im Galopp den Fluß stromaufwärts ritt. Seine Worte waren von einem spöttischen Lachen begleitet gewesen, das die Engländer sehr wohl verstanden.
»Sein Lachen wird ihm bald vergehen,« meinte Sharp nachdenklich. »Er will weiter oben über den Fluß setzen, wer weiß, ob es ihm gelingt!«
Auch die Indianer drüben brachen auf. Schneller als gewöhnlich wurden die Zelte abgebrochen, auf die Pferde gepackt, und dann ging es, wie immer, in geordnetem Zuge fort. Erst kam ein Trupp von Männern, dann die Lasttiere, hinter diesen die Weiber und Kinder, natürlich ebenfalls beritten, und zuletzt die Hauptmacht der Krieger, etwa hundert Mann.
Einer der letzten wandte sich um und schüttelte die Hand über dem Kopfe.

»Der springende Panther,« sagte Sharp. »Er bezeugt uns seine Freundschaft.«
»Es wundert mich,« meinte Harrlington, »daß die Indianer keine Vorbereitungen treffen, die Dragoner am Uebergang über den Fluß zu hindern.«
»Wenn die Dragoner ebenso denken wie Ihr, Fremder,« sagte Juba Riata, »so werden sie das bitter zu bereuen haben. Mir kommt es nämlich so vor, als fehlten sehr viele Frauen, weil diese, als Männer verkleidet, den Schluß des Zuges bilden. Die meisten Krieger aber liegen wahrscheinlich dort am Ufer im Grase versteckt und schleichen den Dragonern nach. Mancher der bunten Männer wird mit zerschmettertem Schädel im Wasser versinken, ohne daß sein Nachbar weiß, warum.«
»Auch daß der springende Panther nicht an der Spitze des Zuges reitet, hat etwas zu bedeuten,« warf Don ein.
Als die ihrer Boote beraubten Mädchen sich vom ersten Schrecken erholt hatten, war ihr erster Gedanke, auf welche Weise sie so schnell als möglich nach der ›Vesta‹ gelangen könnten, um die Strandbewohner an einem Plündern des Schiffes zu hindern; doch war kein Mittel dazu vorhanden, sie hätten denn gerade hinüberschwimmen müssen.
»Nicht einmal sehen kann man sie,« klagte Ellen, »sie schleichen sich wie Katzen an Deck. Ich möchte ihnen gar zu gern eine Lektion zuteil werden lassen.«
»Aber vielleicht können auch sie diese Absicht haben,« sagte ein Mädchen. »Wir wollen uns lieber in Sicherheit zurückziehen, ehe wir mit einem Kugelregen bedacht werden.«
Das konnte leicht eintreten, denn den räuberischen Fischern wäre es sicher lieb gewesen, wenn die Besatzung des Schiffes nicht am Leben blieb, und so ging man hinter den Felsen und beobachtete, von hier aus das Treiben an Deck.
Es vergingen einige Stunden, aber keiner der Männer ließ sich sehen. Vorhin hatten sie etwa vierundzwanzig Mann gezählt. Auf Deck glaubte man höchstens einige vorsichtig herumschleichen zu sehen, die anderen hielten sich jedenfalls in den Kajüten auf und freuten sich der Schätze, deren Besitzer sie bald werden sollten. Die Mädchen am Ufer mußten ihnen natürlich lästig sein, und sie sannen wahrscheinlich auf Mittel, sich ihrer zu entledigen.
Ellen und die anderen waren außer sich vor Zorn über den Streich, der ihnen gespielt worden war. Was half ihnen, daß sie das Schiff beobachteten, die Räuber konnten monatelang auf der ›Vesta‹ bleiben und im Ueberfluß leben, ehe es gelang, sie zu vertreiben. Ein Schiff, das man um Hilfe hätte anrufen können, kam nicht zwischen diese Riffe, und in der Umgegend wohnten nur Fischer, welche mit diesen natürlich unter einer Decke steckten. Um aus Bäumen ein Floß zu bauen, fehlte es an Werkzeug, und außerdem wären sie bei dem Versuch, den Räubern auf einem offenen Floß auf den Leib zu rücken, samt und sonders weggeschossen worden.
Ein Mittel gab es noch, zu dessen Anwendung die Mädchen sich aber nur schwer entschließen konnten, denn dazu war abermalige Trennung nötig. Es blieb ihnen aber schließlich nichts anderes übrig, wollten sie nicht für ewige Zeiten hier liegen bleiben, das Schiff anstarren und schließlich verhungern.
Eine Anzahl von ihnen mußte zu Fuß nach Matagorda, der nächsten Stadt, marschieren, das heißt, nur bis zum Leuchtturm, also achtzig Meilen, und von dort aus telegraphisch die Sache zur Meldung bringen und um schleunige Hilfe bitten, die anderen mußten hier bleiben und die Strandräuber auf der ›Vesta‹ in Schach halten.
Nach längerem Beraten wurde dieser Vorschlag angenommen, und das Los entschied, wie sich die Mädchen verteilen sollten.
Ellen, Miß Murray und neun anderen Mädchen fiel es zu, den Weg nach Matagorda zurückzulegen; die elf anderen, darunter Miß Thomson, Nikkerson und Sargent erhielten die Aufgabe, hier zu bleiben und die Fischer am Plündern zu verhindern.
Ellen nahm an, daß sie die achtzig Seemeilen in vier Tagen gehen konnte, denn obgleich ein Fußgänger auf der Chaussee in der Stunde bequem vier Meilen (englische) macht, so ist ein Marsch durch Wildnisse, Prärien, Urwälder und so weiter, wie hier, doch ungleich schwieriger, anstrengender und daher langsamer, um so mehr, als man unterwegs durch Jagd für Nahrung zu sorgen hat. So zum Beispiel rechnet man bei Märschen in Afrika zehn bis zwölf Meilen auf den Tag.
In zehn Tagen erst konnten darum die Ausgeschickten wieder zurück sein, und bis dahin mußten sich die Zurückgebliebenen so wohnlich als möglich einrichten, sich wenigstens gegen Regen und Tau schützen, und in dem benachbarten Wald Jagd machen. Ein Fluß mündete nicht weit von ihnen in den Golf, für Trinkwasser war also gesorgt.
Auch schärfte ihnen Ellen ein, sich vor den Kugeln der auf der ›Vesta‹ befindlichen Räuber vorzusehen, die sicher keine Gelegenheit vorübergehen lassen würden, die Zahl der Mädchen zu vermindern.
Ein Glück war es, daß die Mädchen selbst mit Schießmunition reichlich versehen waren, weil sie nie die Winchesterbüchsen umhingen, ohne auch den Patronengürtel umzuschnallen und Munition für den Revolver beizufügen.
Dann nahmen die Mädchen mit schwerem Herzen voneinander Abschied. Wer wußte, ob ein böses Geschick sie nicht abermals auf lange Zeit trennte, wenn nicht auf immer?
Ellen führte ihre Schar im Schutze des Felsens nach dem Walde und war bald zwischen den Bäumen verschwunden. Versagte ihr angeborener Instinkt, konnte sie in der Wildnis den Weg nicht finden, so konnte sie sich nach einem Taschenkompaß richten, aber schnell ging dieser Marsch sicher nicht von statten.
Mit traurigen Blicken sahen die übrigen Mädchen den Davongehenden nach; die ihrer Herrin folgende Juno Verschwand zuletzt hinter den Bäumen.
»Wir müssen uns immer hinter diesem Felsen verborgen halten,« nahm dann Miß Thomson das Wort, »ohne aber selbst die Piraten aus dem Auge zu verlieren, und müssen besonders des Nachts scharf Achtung geben, daß sie das Schiff nicht verlassen und sich davonmachen. Ihrer Strafe sollen sie nicht entgehen. Jetzt müssen einige in den Wald gehen und für Brennholz sorgen, ferner Wild zu schießen versuchen und sehen, ob es junge Bäume gibt, mit deren Hilfe wir uns hier eine Art Hütte oder Schutzdach gegen den Tau der Nacht errichten können.«
Die Anordnungen brachten die betrübten Mädchen wieder auf andere Gedanken; sie folgten dem Rate Bettys, und schon nach einigen Stunden hatte man hinter dem Felsen, der unten etwa zehn Meter breit war und nach oben kegelförmig verlief, eine geräumige Hütte aufgeführt. Die zur Jagd ausgeschickten Mädchen brachten schmackhafte Beute mit, andere zogen dieselbe ab, Feuer wurden angezündet, an denen das Fleisch schmorte, kurz, es entwickelte sich das übliche Lagerbild.
Daß die Fischer auf der ›Vesta‹ wirklich mit bösen Absichten umgingen, zeigte sich bald. Als ein Mädchen unvorsichtig hinter dem Felsen hervortrat, knallte sofort ein Schuß, und erschrocken trat die Bedrohte zurück.
Dann aber kamen die Vestalinnen auf einen anderen Gedanken, daß dieser Schuß nämlich nicht der Unwichtigen gegolten habe.
Jetzt knallten nämlich auf der ›Vesta‹ fort und fort Schüsse, ohne daß ein Mädchen sich außerhalb des Felsens zeigte. Auch hörte man keine Kugel anschlagen oder pfeifen, und plötzlich stieg in Miß Thomson eine schlimme Ahnung auf.
»Sie signalisieren,« sagte sie. »Jedenfalls haben sie Freunde in der Nähe, die sie zu ihrem Beistande herbeirufen wollen. Das ist schlimm, daran haben wir noch gar nicht gedacht.«
Die Schüsse knallten fort, fanden aber keine Erwiderung, auch zeigte sich an dem Waldessaum kein Mensch.
»Miß Nikkerson,« wandte sich Betty an die Freundin, »wollen Sie mich bei einer Rekognoszierung begleiten? Es ist besser, wir verschaffen uns Klarheit darüber, ob hier wirklich jemand in der Nähe versteckt ist oder nicht. Dann können wir Maßregeln treffen, um einem Ueberfalle in der Nacht zu begegnen.«
Die übrigen Mädchen erhoben erst Einspruch dagegen, daß die beiden Freundinnen allein eine Streiftour durch den Wald machten, schließlich aber sahen sie die Zweckmäßigkeit eines solchen Unternehmens ein. Sie hatten während der Reise gelernt, sich mit Geschick in einem Walde zu bewegen und auch den Rückweg wiederzufinden.
Miß Thomson und Nikkerson gingen, mit dem Versprechen, bald zurückzukommen und bei einer etwaigen, Gefahr, bei welcher sie Hilfe der übrigen nötig hatten, einen Schuß aus der Winchesterbüchse und einen aus dem Revolver abzufeuern. Die beiden Knalle, einer scharf und hell, der andere krachend und dumpf, waren charakteristisch, sie konnten nicht verwechselt werden.
Die beiden Freundinnen betraten den Wald, von dem sie aus der Landkarte erfahren hatten, daß er einen Flächenraum von über tausend Quadratmeilen einnahm, für Deutschland allerdings ein ganz gewaltiger Wald, für Amerika aber nur einen verschwindenden Punkt für Texas ein mäßiges Holz bedeutend, denn Texas erstreckt sich über ungefähr 300 000 Quadratmeilen und besteht fast nur aus Wald und Prärien, denen Plantagen abgerungen worden sind.
Es war schwer vorzudringen, denn zwischen den Bäumen hingen Schlingpflanzen, dichte Gewebe bildend, und überall suchten Dornen die Wanderer an den Kleidern zurückzuhalten.
»Es ist unbegreiflich, wie hier ein Reitervolk, wie das der Apachen, leben kann,« meinte Miß Nikkerson, die sich eben über die manneshohe Wurzel eines Baumes schwingen mußte, »ein Pferd kann doch sicherlich nicht durch diese Schlingpflanzen hindurch, die Dornen zerfetzten es, und über solche Wurzeln kann es doch nicht setzen, ohne daß der Reiter den Hals bricht.«
»Die Apachen vermögen aber doch durch einen solchen Wald zu reiten,« entgegnete Miß Thomson, »sie sind eben daran gewöhnt, wenn sie auch die offene Prärie vorziehen. Es gibt übrigens verschiedene Stämme; die einen halten sich mehr in der Prärie, andere mehr im Walde auf, und diese leben nicht nur zu Pferde, sie sind ebensogut zu Fuß und ausgezeichnete Läufer. Aber wir wollen uns nicht oder doch nur flüsternd unterhalten, denn der Wald hat Ohren, wie der Indianer sagt.«
Miß Nikkerson bedauerte, daß ihre Freundin eine solche Vorsicht wünschte, denn sie hätte oft Gelegenheit, zu einem prächtigen Schuß gehabt. Wild gab es hier in Menge. Oft tauchte ganz dicht neben ihnen das Geweih eines Hirsches auf, ein Zeichen, daß dieser Wald nur wenig betreten wurde. Miß Nikkerson war eine leidenschaftliche Jägerin, jetzt mußte sie aber ihre Jagdlust bezähmen. Es galt ja auszuspionieren, ob sich in der Umgebung Menschen befanden.
»Seht da, was für ein merkwürdiger Baum,« flüsterte wieder Miß Nikkerson vorausdeutend.
Durch Schlingpflanzen hindurch erblickten sie eine kleine Lichtung, auf welcher ein dicker, weidenähnlicher Baum stand, der auch dieselbe Eigenschaft wie die Weide besaß, nämlich, daß er hohl war. Der Stamm hatte sich in zwei Teile gespalten, und die dadurch entstandene Höhlung, mehr eine Art Tunnel bildend, war so groß, daß ein Mann auf einem Pferde hätte hindurchreiten können.
Betty kannte diese Bäume, sie sah aber doch hin. Plötzlich faßte sie den Arm ihrer Freundin und zog diese zu Boden.
»Still,« raunte sie ihr zu, »an dem Stamme liegt ein Mann, wir wollen versuchen, uns näher zu schleichen.«
Dies war ihnen auch leicht, der Boden war mit Moos bedeckt, das den Schritt dämpfte, die Büsche standen dicht zusammen, im Walde herrschte sowieso Dämmerlicht, und die Schlingpflanzen schließlich verhinderten vollständig, daß sie gesehen wurden.
Dennoch knackte ab und zu ein trockener Zweig unter den Füßen der Mädchen; jedesmal blieben sie ängstlich stehen und horchten, ob sie ein Geräusch wie von nahenden Schritten hören könnten, aber alles blieb still. Ab und zu konnten sie einen Blick nach der Lichtung werfen. Da sahen sie den Mann immer noch an dem Stamme liegen, und schon machte Betty die Bemerkung, daß er weder wie ein Fischer, noch wie ein Jäger, noch überhaupt wie ein Waldbewohner aussehe. Nach langem Kriechen und Schleichen hatte man endlich den Saum der Lichtung erreicht. Ein Gebüsch trennte sie noch von dieser, und als sie die Zweige vorsichtig auseinanderbogen, sahen sie den Mann kaum zehn Schritte vor sich auf dem Boden ausgestreckt liegen.
Es war wirklich wunderbar, wie dieser Mann hierherkam, doch konnten sich die Mädchen jetzt nicht darüber aussprechen, sondern nur beobachten. Sie fürchteten sogar, gesehen zu werden, wenn die Augen des Liegenden ihr Versteck streiften, wie dieses Gefühl jeder hat, welcher beobachtet, wenn sein Versteck auch noch unbemerkt ist.
Miß Thomson hatte sich nicht getäuscht, der Mann dort war, seinem Anzuge wenigstens nach ein Stadtkind, selbst Stehkragen und Manschetten hatte er hier im Walde nicht abgelegt, und das bleiche Antlitz verriet, daß er sich nicht gern der Sonne aussetzte, das heißt, den Aufenthalt in Häusern gewöhnt war.
Er hatte sich auf einen Arm gestützt und drehte sich eben eine Zigarette, wobei er aber die Augen beständig scheu umherschweifen ließ, als erwarte er jemanden, wünsche aber keinen Zeugen bei dieser Zusammenkunft.
Die beiden Mädchen sahen sich an und nickten verständnisvoll, in ihren Köpfen war gleichzeitig derselbe Gedanke aufgetaucht, dieser Mann war mit den Strandbewohnern im Bunde; auf seine Anordnung hin war das Truglicht angezündet worden und — ja, vielleicht hatten sie einen von denen vor sich, welche die Mädchen zu vernichten suchten, um sich ihres Besitzes erfreuen zu können.
Aber sie kannten ihn nicht.
Jetzt zog der Fremde ein Feuerzeug aus der Tasche, entzündete erst die Zigarette und sah dann nach der Uhr.
»Sie bleiben lange aus,« murmelte er, doch noch deutlich genug, daß die Lauscherinnen es hören konnten, »ich wünschte, ich hätte niemals diese von Gott verlassene Gegend betreten, in der man von Ameisen und Mücken zerfressen wird.«
Er zog ein seidenes Taschentuch aus der Tasche seines schwarzen Gehrockes und wedelte die zudringlichen Mücken ab.
Da knackten auf der anderen Seite der Lichtung Zweige, Schritte näherten sich, derb auftretend, die Büsche bogen sich auseinander, und zwei Männer traten heraus.
»Endlich!« rief der Wartende ungeduldig, ohne sich zu erheben. »Sie haben lange auf sich warten lassen. Wenigstens Erfolg gehabt?«
Miß Thomson war nahe daran, laut aufzuschreien, als sie den einen der beiden Ankömmlinge zu Gesicht bekam. Einer von ihnen war, wie ein Fischer gekleidet, trug hohe Stiefeln, eine Flanelljacke und einen Wachstuchhut, der andere dagegen war, wie der Herr unter dem Baume, elegant gekleidet, nur daß sein moderner Anzug durch einen langen Marsch im Walde von den Dornen arg mitgenommen worden war. Auch sein Gesicht zeigte, daß der Wald nicht sein gewöhnlicher Aufenthaltsort sei, obgleich es jetzt gerötet war, wahrscheinlich von großen Anstrengungen.
»Louis Spurgeon,« hätte Betty bald laut aufgeschrieen, wenn sie sich nicht rechtzeitig besonnen hätte.
Sie hatte ihren Verwandten erkannt.
Also dieser war einer von denen, welchen die Vestalinnen so viel Unglück zu verdanken hatten, welche ihnen nach dem Leben trachteten, ihre Unterschriften fälschten und sie selbst als Sklaven verkaufen wollten. Und dieser Mann hatte einst zu Bettys Füßen gelegen und ihr unter tausend Schwüren seine Liebe versichert, aber keine Gegenliebe gefunden. Mit traurigem Herzen und zarten Worten hatte Betty ihn abgewiesen, weil sie aus bloßem Mitleid ihr Lebensglück nicht verscherzen wollte.
Also dieser Mann war hier!
Miß Thomson fühlte, wie ihr das Blut siedend heiß in den Kopf stieg. Sie umklammerte den Revolver, Spurgeon war für sie jetzt nur noch ein wildes Tier, welches zu töten sie berechtigt war.
Miß Petersen — Eduard Flexan, sie — Louis Spurgeon. Richtig, das waren die Gegner in diesem Spiel um Leben und Tod.
»Ich bin halb tot,« seufzte Spurgeon und warf sich neben Kirkholm ins Gras, während der Fischer phlegmatisch stehen blieb und sich eine Pfeife stopfte.
»So sprechen Sie wenigstens erst, haben Sie ihn getroffen?« fragte Kirkholm ungeduldig.
»Das haben wir. Aber zum zweiten Male mache ich diesen Weg nicht, Sie sehen, wie mich die Dornen mitgenommen haben.
»Schon anfangs stachen sie mich halb tot, dann mußten wir auf Händen und Füßen durch Gebüsche kriechen, wenigstens dreimal über Bäche springen, wobei ich bis an die Kniee einsank, und schließlich über einen Baumstamm rutschen, der über einen Sumpf führte.«

Der Sprecher sah wirklich so aus, als hätte er alle diese Schwierigkeiten überstanden. Nicht nur zerfetzt war seine Kleidung, sondern auch mit Schmutz bespritzt, ebenso wie sein Begleiter.
»Der Ritt über den Baumstamm brachte uns auf eine Insel im Sumpf, auf welcher nach Angabe dieses Fischers,« Spurgeon machte eine Kopfbewegung nach dem Manne hinüber, »Nathaniel wohnen sollte, und ich hatte auch das Glück, ihn in seiner Hütte anzutreffen. Es ist ein alter, harmloser, halbkindischer Fallensteller, der auf alles offene Antworten gibt und überhaupt in jeder Weise willig ist. Er sagte, er wüßte, wo der weiße Wolf sich jetzt aufhalte und forderte für Ueberbringung des Briefes nicht Geld, sondern Pulver und Blei, was ich ihm zu schicken versprach.«
Kirkholm richtete sich vor Spannung halb auf.
»Wann kann er den weißen Wolf treffen? Heute noch?« fragte er.
»Heute abend noch wollte er ihn auffinden, und ich glaube sicher, daß der weiße Wolf sofort mit seiner Bande aufbrechen wird.«
»Während Sie weg waren, fiel mir etwas anderes ein,« unterbrach ihn Kirkholm. »Wird der weiße Wolf den Brief auch lesen können?«
»Das habe ich durch Nathaniel selbst erfahren. Der plauderhafte Fallensteller sagte mir nämlich, er könne nicht lesen, dagegen der weiße Wolf sehr gut, wie er überhaupt fortwährend von ihm schwatzte. Wenn das alles wahr ist, was der kindische Alte von ihm erzählt, dann muß dieser weiße Wolf ein sauberes Subjekt sein, vor dem wir uns selbst in acht nehmen müssen, wenn er in diese Gegend kommt. Er führt als Häuptling eine Bande Apachen an und lebt nur von Raub. Uebrigens ließ mich die Höflichkeit, mit der Nathaniel von dem weißen Wolf sprach, fast darauf schließen, daß er mit ihm in näherer Beziehung steht.«
»Er ist sein Sohn, der verrückte Alte weiß es aber wohl nicht mehr,« warf der Fischer ein.«
»Da haben wir es,« rief Spurgeon.
»Dann ging also die Sache gut?« sagte Kirkholm. »Nun aber etwas anderes, Spurgeon, ich habe Ihnen eine angenehme Nachricht zu machen. Die Hälfte der Mädchen, Miß Petersen an der Spitze, ist heute morgen nach Matagorda abmarschiert, um Hilfe herbeizuholen.«
Spurgeon fuhr aus dem Grase auf und starrte den Sprecher erschrocken an, selbst der phlegmatische Fischer zuckte zusammen und stieß einen Fluch aus.
»Sie dürfen Matagorda nicht erreichen,« stieß Spurgeon zwischen den Zähnen hervor.
»Erfahren die Leute dort etwas davon, so werden die Fischer gehangen und ich zuerst,« stammelte der Mann in den Seestiefeln.
»Die Sache ist nun einmal so und gar nicht so schlimm wie sie aussieht,« sagte Kirkholm. »Die Zurückgebliebenen haben es sich hinter dem Felsen, auf dem wir das Feuerwerk abbrannten, bequem gemacht und passen auf, daß die Fischer die ›Vesta‹ nicht verlassen können, und die anderen haben gut fünf Tage zu marschieren, ehe sie den Leuchtturm in Sicht bekommen, denn der Weg führt immer durch dichten Wald, durch Schluchten und Sümpfe, die sie nicht schnell passieren können, sondern umgehen müssen.«
»Daß das blutige Schiff auf den Riffen hängen bleiben mußte!« knurrte der Fischer. »Noch niemals ist so etwas vorgekommen.«
Kirkholm beachtete diesen Einwurf nicht, sondern fuhr fort:
»Die zurückgebliebenen Damen sind uns vorläufig sicher, sie dürfen das Schiff zu unserem Glück nicht verlassen, aber die anderen müssen unterwegs vernichtet werden, und zwar durch den weißen Wolf. Dazu ist es nötig, daß derselbe benachrichtigt wird, vielleicht kann er es mit beiden Teilen zugleich aufnehmen. Wer aber will den weißen Wolf sprechen, Sie oder ich, Mister Spurgeon?«
Spurgeon schwieg, er wollte sich nicht gern einer solch gefährlichen Aufgabe unterziehen.
»Wie spricht man über den weißen Wolf?« fragte er den Fischer. »Habt Ihr ihn schon einmal gesehen?« »Nein, möchte auch seine Bekanntschaft nicht machen,« brummte der Fischer. »Er tötet alles, was ihm in die Hände fällt, auch martert er seine Opfer gern.«
»Glaubt Ihr, daß er uns etwas anhaben würde?«
»Quien sabe?«
»Nathaniel muß weiter mit ihm unterhandeln oder ihm einen neuen Brief bringen.«
»Ehe der zurückkommt, ist es zu spät,« sagte der Fischer, dem am meisten an dem Tode der Mädchen lag. »Der weiße Wolf ist eher da, als er. Wenn Ihr Euch aber für den ausgebt, der ihm die Beute verschafft, so wird er diesmal wohl anders handeln.«
»Er ist ein Weißer?«
»Ja, er hat kein indianisches Blut in den Adern, gibt sich aber für einen Apachen aus.«
»Nun, dann wird er wohl auch das Gehirn eines Weißen haben und mit sich handeln lasten, wenn es seinen Vorteil gilt,« sagte Kirkholm. »Ich werde ihn hier erwarten und ihm die Mitteilung machen. Doch besser wäre es, Spurgeon, wenn auch Sie hier blieben! Sie müssen doch nun gelernt haben, mit den Apachen umzugehen: Ihre Plantagen liegen ja in deren Gebiet.«
»Im Anfange wurden sie oft genug von den Apachen besucht, welche betteln wollten, weil meine schöne Cousine sie darin erzogen hat. Ich aber habe es so gemacht, wie mir meine neuen Nachbarn rieten, das heißt, sie mit Hunden von der Plantage hetzen lasten, weil ich die Bettelei nicht dulden wollte.«
»Sehr unvernünftig von Ihnen,« bemerkte Kirkholm. »Wer weiß, ob Sie unter den jetzigen Verhältnissen die Apachen nicht einmal als Werkzeuge gebrauchen können. Immerhin haben Sie mehr Erfahrung im Umgang mit den Apachen als ich.«
»Das mag sein.«
»Gut, so bleiben auch Sie hier und erwarten den weißen Wolf, er wird uns schon nicht gleich auffressen, wenn wir ihm ein gutes Geschenk anbieten. Tötet er uns, dann bekommt er nichts weiter als die Mädchen, behandelt er uns freundlich, so erhält er eine angemessene Belohnung. Selbst ein Indianer muß auf einen solchen Vorschlag eingehen.«
»All right,« sagte Spurgeon, »ich werde den Mann ebenfalls erwarten. Ich wünsche aber, daß wir dem Ende der Weiber nicht beiwohnen, sondern uns lieber aus dem Staube machen. Weit entfernt ist gut vorm Schuß, mir wird hier der Boden unter den Füßen bald zu heiß.«
»Können wir auch,« bestätigte Kirkholm, »wir haben nichts weiter hier zu suchen. Bringen wir nur erst einmal den weißen Wolf auf die Spur der Mädels, dann brauchen wir uns nicht mehr um ihn zu kümmern. Was sagst du dazu?«
Der Fischer verzog grinsend den Mund.
»Wonach der weiße Wolf seine Finger ausstreckt, das muß sein werden, und wenn alle seine Leute draufgingen. Ein blutdürstigeres Scheusal als den weißen Wolf gibt es gar nicht. Schon wegen eines Messers kann er einen Menschen totschlagen, und erfährt er erst, was für gute Gewehre und Revolver diese Weiber haben, so wird er Tag und Nacht hinter ihnen herschleichen.«
»Aber die Mädchen sind tapfer und geschickt im Gebrauche der Waffen.«
»Und der weiße Wolf ist in dieser Gegend aufgewachsen, er kennt jeden Schritt und Tritt und hat unzählige Kniffe, um Reisende in den Hinterhalt zu locken. Nein, um den ist mir nicht bange, er wird weder die Mädchen Matagorda erreichen lassen, noch mit den Zurückgebliebenen viele Mühe haben.«
»Aber das Schiff? Wird er nicht auch dieses plündern, und wenn Eure Genossen Widerstand leisten, auch sie hinschlachten?«
Des Fischers kleine Augen leuchteten verschmitzt auf, und grinsend verzerrte sich wieder sein Mund.
»Was gehts mich an, ich habe ja meinen Lohn schon bekommen, und erhalte ich das andere auch noch, was Ihr mir versprochen habt, so mögen sie meinetwegen alle zum Teufel fahren.«
»Ihr sollt das Versprochene bekommen und macht dann, daß Ihr Euch in Sicherheit bringt. Texas ist groß, Amerika noch größer, Ihr könnt mit Eurem Lohn ein bequemes Leben führen,« sagte Kirkholm, der dieses Fischers habgierigen, teuflischen Charakter schon kennen gelernt hatte.
Dann wandte er sich wieder zu Spurgeon.
»Wo ist Chalmers? Noch nicht zurück?«
»Er wird wohl auf dem Wege von Galveston nach hier sein. Mag sich geärgert haben, daß sein Feuerwerk vergeblich gewesen ist, destomehr aber wird er sich freuen, wenn er hört, daß es uns gelungen ist, die ›Vesta‹ auf die Riffe zu locken. He, geht nach unserem alten Platz und sorgt für ein anständiges Nachtessen, wir werden diese Nacht hierbleiben und auf den weißen Wolf warten,« fügte Spurgeon, zu dem Fischer sich wendend, hinzu.
Der Mann drängte sich durch die Büsche und machte mit seinen schweren Stiefeln viel Geräusch. Diesen Augenblick hielten daher die beiden Lauscherinnen für günstig, sich ebenfalls zu entfernen. Sie hatten genug gehört. Das Blut war ihnen manchmal während der Unterredung dieser beiden Männer erstarrt, und als sie eine kleine Strecke hinter sich hatten, atmeten sie zum ersten Male wieder auf.
»Jetzt schnell,« flüsterte Miß Thomson, »der Abend bricht an, wir müssen an den Felsen zurück und alles berichten, Flucht ist das einzige, was uns vorläufig retten kann.«
»Und die ›Vesta‹?« seufzte die andere.
»Das Schiff müssen wir einstweilen seinem Schicksal überlassen, den Rumpf können sie ja nicht davonschleppen, und die Räuber kennen wir jetzt.«
Im Laufschritt erreichten sie das Lager, wo die Freundinnen ängstlich ihrer warteten. Die Mädchen wurden natürlich schrecklich aufgeregt, als sie die schlimm Nachricht über das Schicksal erfuhren, das ihnen drohte. Aber schließlich vereinigten sie sich mit Ruhe zu einer Beratung.
Es gab nichts anderes als Flucht. Sie waren alle in Amerika geboren, die meisten waren mit dem Wesen der Indianer vertraut und wußten daher, daß ein Widerstand nichts nutzte, denn die Glieder der Bande, welche der weiße Wolf anführte, waren jedenfalls nichts weiter als Prärieräuber, die Schrecken der Wildnis. Sie griffen bei der Nacht ihre Opfer an und machten alles nieder, was ihnen in den Weg kam.
Lautlos schlichen sie durch das Gras, völlig unhörbar für das Ohr des Weißen, der nicht jahrelang in den Wäldern zugebracht hat, stürzten sich plötzlich auf die Ueberraschten und waren schon bei ihnen, ehe diese ihre Büchse gebrauchen konnten.
Ja, wenn sie einen Anführer gehabt hätten, der den Indianern an List gewachsen und in ihre Kniffe eingeweiht war, dann wäre es etwas anderes gewesen, aber so konnte eine Rettung nur in schleunigster Flucht liegen.
»Wir müssen versuchen, uns mit den anderen Damen zu vereinigen,« sagte Miß Thomson, »und die Indianer so lange wie möglich zu täuschen und aufzuhalten, durch List und durch Gewalt. Stoßen wir aber auf der Flucht nach Matagorda nicht auf hilfsbereite Menschen, so haben wir wenig Hoffnung auf Rettung. Dem schnellen Indianer entgehen wir nicht. Es ist besser, wir machen uns gleich mit dem Schlimmsten vertraut, als daß wir sorglos sind.«
Die Nacht brach bald an; aber es wurde kein Feuer angezündet, dessen Schein sie verraten konnte. Durch die Luken der ›Vesta‹ schimmerte Licht, die Fischer hatten es sich bequem gemacht.
Der kleine Zug der Mädchen bewegte sich in der von keinem Sterne erleuchteten Nacht das Ufer entlang, erst noch den Wald vermeidend, damit man nicht etwa auf die beiden Verbrecher stieß und die heimliche Flucht verriet. Als sie endlich unter Miß Thomsons Führung dem Walde zubogen, an dessen Saum hin sie diese Nacht marschieren wollten, da später der Mond aufging, blickten sie alle noch einmal nach dem erleuchteten Schiffe sich um, auf dem sie so oft trauliche Stunden verlebt hatten, in Sonnenschein und Regen, in Sturm oder auf spiegelglatter See.
Die erleuchteten Bollaugen schienen ihnen ein letztes Mal zuzuwinken.
»Lebewohl, ›Vesta‹! Werden wir dich wohl wiedersehen?« seufzten die Mädchen.
Dann schritten sie, auf dem Boden der Heimat noch von tausend Gefahren bedroht, weiter am Waldessäume entlang. — — —
Kirkholm und Spurgeon saßen unter einem Baume und wärmten sich an einem Feuer. Es war Nacht, kein Laut, höchstens einmal der klagende Schrei eines Vogels, der den Tag flieht und die Nacht liebt, unterbrach die Stille. Auch die beiden Männer wagten nicht, zu sprechen; obgleich sie schon stundenlang hier gesessen hatten, waren nur wenige Worte gefallen. Eine drückende Unruhe hatte sich beider bemächtigt.
»Kirkholm,« flüsterte Spurgeon endlich leise, »Mitternacht ist schon vorüber, und der weiße Wolf ist noch nicht da. Ich verwünsche jetzt, daß ich mich in ein solches Abenteuer eingelassen habe. Wir sind auf Gnade oder Ungnade dem weißen Wolf überlassen, wenn er —«
Ein gellendes Geheul unterbrach den Sprecher, von allen Seiten stürzten halbnackte Gestalten mit entsetzlich bunt bemalten Gesichtern auf die Lichtung, Kirkholm und Spurgeon wurden zu Boden gerissen und erblickten über sich furchtbar funkelnde Augen, Indianer knieten auf ihnen.
Lautlos waren sie herangeschlichen; kein knackender Zweig hatte ihre Ankunft verraten.
Aber das Gesicht, welches sich im Scheine des Feuers auf Kirkholm herabbeugte, war nicht das eines Wilden, wenn es auch verwildert genug aussah — es gehörte einem Weißen an. Die blutunterlaufenen Augen glühten in der Nacht wie die eines Wolfes.
»Hund, verdammter,« brüllte dieser Mensch und hob ein Messer zum Stoße gegen die Brust Kirkholms. »Willst du den weißen Wolf foppen? Wo sind die Mädchen, von denen du mir geschrieben hast? Sprich, Hund, oder ich schneide dir die Nase ab.«
Der weiße Wolf machte Ernst, Kirkholm heulte laut auf, als seine Nase von eisernen Fingern zusammengequetscht wurde, und er das kalte Messer schon daran fühlte.

Kirkholm heulte laut auf, als er das kalte Messer fühlte.
»Hohoho, weißer Wolf,« kicherte da eine dünne Stimme, »sind dir die Täubchen entgangen? Ja, ja, die sind zu zart für deine Zähne, so etwas Feines ist nicht für dich bestimmt. Fortgeflogen sind sie, vor einigen Stunden erst habe ich sie am Waldessaume fliegen sehen, den anderen nach, die nach Matagorda wollen.«
Auf die Lichtung trat ein alter Mann in schneeweißen Haaren, die mageren Glieder in Felle gehüllt, und rieb sich kichernd die Hände.
Der weiße Wolf blickte wild um sich und ließ das Messer sinken.
Es gäbe keine Trapper mehr? Die neueren Erzählungen, in denen Trapper, Fallensteller, Waldläufer u.s.w. vorkommen, müßten erdichtet sein, weil auf der Erde kein Platz mehr für solche Leute sei, behauptet man.
Nun, einen kleinen Gegenbeweis kann sich jeder selbst vor Augen führen, daß noch eine große Anzahl von Menschen einzig und allein von dem Ertrage ihres Gewehres leben, daß ihre Heimat der grüne Wald, die einförmige Steppe oder das wilde Gebirge ist. Man trete einfach vor einen Laden mit Pelzwaren und überlege sich, wer die Felle von all diesen Mardern, Zobeln und Nerzen, Ottern, Bibern und Dachsen, Füchsen, Wölfen, Luchsen, wilden Katzen, Bären und Bisams abgezogen, nachdem er die Tiere mit der Kugel getötet hat. Noch besser aber ist es, man wohne einmal einer Auktion von Pelzwaren bei, wie sie zum Beispiel in Leipzig stattfinden, dann wird man erst einen Begriff davon bekommen, wieviele Menschen von der Jagd auf Pelztiere ihr Leben fristen. Und die Zahl der Pelze, die zum Verkauf kommen, ist noch immer im Wachsen begriffen.
So betrug der Wert der in den Handel kommenden rohen Pelze (von der ganzen Erde) im Jahre 1874 vierzig Millionen Mark, im Jahre 1880 wurden aber allein in Leipzig für dreißig Millionen Mark Felle verkauft — vorher waren sie eingetauscht worden — jetzt kamen sie zum ersten Male unter den Hammer. Nach der nächsten Bearbeitung waren sie bereits um das doppelte teurer.
Leipzig ist der internationale Markt für Pelzwaren, dann kommt London, dann Petersburg. London besitzt einen speziellen Markt für Bärenfelle. Und hat man einer solchen Auktion beigewohnt, so glaubt man, es könnten gar keine Bären mehr auf der Erde existieren, so ungeheuerlich ist die Anzahl der Felle, und doch findet jedes Jahr viermal eine gleiche Auktion statt.
Dies genügt wohl, um zu beweisen, wie stark die Erde noch mit wilden Tieren bevölkert ist, und schon ein Blick auf die Landkarte zeigt, wo sie sich noch aufhalten. Ihre Heimat sind hauptsächlich die menschenöden Territorien von Asien und Amerika, und manches Jahrhundert wird noch vergehen, ehe die Zufuhr von Pelzhäuten wegen Mangel an Raubtieren aufhört.
Wer aber schießt nun alle diese pelztragenden Tiere? In Amerika tun dies hauptsächlich Indianer, von denen die Felle eingetauscht werden, ferner aber auch eine Unzahl von weißen Trappern. An der Nordküste Amerikas existieren mehrere Gesellschaften, englische, amerikanische und französische, die hauptsächlich Tauschhandel mit Indianern treiben und Trapper unterhalten, die Tiere für sie erlegen. Um von der Größe der Hudsonsbay-Gesellschaft nur einen Begriff zu geben, sei hier erwähnt, daß es in London ein Geschäft gibt, welches ausschließlich für diese Kompagnie Ausrüstungsgegenstände liefert: Decken, Ranzen, Stiefel, Jagdkleider, und so weiter, wie sie die Trapper nötig haben.
Um bei der Hudsonsbay-Kompanie als Kommis angestellt zu werden, ist eine völlige Lehrzeit nötig. Der Lehrling muß für einige Jahre an den Jagdexpeditionen teilnehmen, auf dem Flusse im Boote rudern, auf Landwegen diese tragen, mit den Indianern Tauschhandel treiben und im Winterquartier, mitten in endlosen Schneewüsten, undurchdringlichen Wäldern und eisigen Gebirgen Bären, Füchse und andere Tiere schießen oder in Fallen fangen, weil zu dieser Zeit ihre Pelze am dichtesten sind. Dann erst findet er einen Platz im Kontor der Gesellschaft.
Solch einen Trapper, der seine Lehrzeit durchmacht, nennt man Volontär. Diejenigen, welche ihr ganzes Leben Jäger bleiben, heißen dort Voyageur, und das sind in jener Gegend die richtigen Trapper, die sich nur von der Jagd ernähren. Je nachdem sie zu den verschiedenen Kompanien gehören, werden sie anders benannt, und nicht selten kommt es vor, daß zwei Jäger von zwei verschiedenen Kompanien eines elenden Fuchses wegen Kugeln wechseln, bis einer von ihnen tot in den Schnee sinkt.
Andere Trapper gehören keiner Kompanie an, sie jagen auf eigene Faust, leben mit den Indianern in Freundschaft und tauschen ihnen Felle aus, wo sie gerade Gelegenheit finden. Diese Trapper treiben sich besonders im südlichen Teile Nordamerikas umher. Ihr Leben gleicht in einem Punkte fast ganz dem eines Matrosen, auch sie müssen nämlich ein Jahr lang in hartem Kamps und schwerer Arbeit ihr Dasein verbringen, und wenn sie dann Geld für ihre Mühe erhalten haben, verschleudern sie es innerhalb einiger Tage in Saus und Braus.
Cheyenne ist einer der Orte, wo Trapper im Frühjahr ihre gesammelten Felle verkaufen. Der erste Trapper, der mit einem solchen auf einem gekauften oder gestohlenen Pferde ankommt, findet alles bereit, um ihm die kleine Summe, welche er löst, wieder abzunehmen. Es beginnt ein tolles Leben, und die drei Gegenstände, die ihm das Geld sofort wieder aus der Tasche locken, sind Whisky, Spiel und vor allen Dingen Weiber. Als arme Teufel ziehen die Jäger dann wieder hinaus in die Wildnis, den Weg mit guten Vorsätzen pflasternd, nach einem Jahre aber wieder ebenso leichtsinnig handelnd. Die gebotenen Zerstreuungen und Versuchungen nach einem mühevollen Leben reißen sie stets wieder in den Strudel hinein, ebenso wie den Matrosen, den Cow-boy und den Pferdebändiger auf den Plantagen.
Außer diesen Trappern und Fallenstellern, welche aus der Jagd ein Geschäft machen, gibt es aber noch andere, die wahren Könige der Wildnis, die sich nicht im Walde aufhalten, um aus der Jagd Nutzen zu ziehen, sondern nur aus Liebe zur Freiheit: die sogenannten Waldläufer, englisch Scouts genannt, von denen uns Cooper in seinem ›Lederstrumpf‹ ein so prächtiges Exemplar schildert.
Auch sie leben von der Jagd, schießen aber nur, was sie zu ihrem Unterhalt brauchen, essen das Fleisch, kleiden sich in die Felle, aber nie zielen sie nur aus Jagdlust nach einem Tiere. Sie stillen ihren Hunger lieber mit Beeren und Wurzeln, ehe sie ein tragendes oder säugendes Tier töten, und beachten eine Schonzeit wie der gewissenhafteste Waidmann Deutschlands.
Ferner haben sie im Gegensatz zu den Trappern keinen festen Wohnort, etwa ein Blockhaus, oder auch nur eine Laubhütte, der erste beste Baum ist ihr Zelt, das Gras ihr Bett, und wo sie sich eben befinden, da ist ihre Heimat. Ziellos streifen sie im Walde umher, harmlose Menschen denen gegenüber, welche sich freundlich zeigen, gefährlich gleich dem schlauesten Indianer, wenn sie bedroht werden. Gern folgen sie Einladungen, seien diese von Indianern oder von Weißen an sie ergangen, sie schlafen ebenso gern manchmal im Wigwam der Rothaut wie in der Villa des Pflanzers.
Ab und zu dient der Waldläufer auch einer Expedition oder Jagdgesellschaft als Führer, weniger des Lohnes willen, als aus Gefälligkeit, läßt sich aber dabei keine Vorschriften machen. Mit Geld weiß er wenig anzufangen; gewöhnlich setzt er es in der nächsten Wirtschaft, die er trifft, im Postgebäude auf einsamer Landstraße in Spirituosen um; trotzdem aber sind solche Waldläufer doch im Besitz von ganz hübschen Summen, nämlich von rohem Gold, das sie während ihres unsteten Lebens gefunden und gesammelt haben. Im übrigen gilt unter ihnen der Satz: ›was dir ist, ist auch mir,‹ und sie geben daher gern alles, was sie haben, bedürftigen Genossen.
Merkwürdig ist, was für Menschen man unter diesen Waldläufern trifft, alle Klassen sind vertreten. Solche, welche die beste Erziehung genossen, studiert haben, und dann aus Liebe zur Freiheit und Romantik das wilde Leben begonnen, Leute, welche weder schreiben noch lesen können, denen aber die Freiheit über alles geht und nebenbei die eigentümlichsten Sonderlinge, welche sich mit der Welt und deren Einrichtungen nicht vertragen konnten und sich daher zurückgezogen haben.
Gutmütigkeit ist der Hauptzug ihres Charakters; sie lieben die Freiheit, ziehen sich gern in die Einsamkeit zurück, wissen aber unter Umständen auch eine fröhliche Gesellschaft zu schätzen, und werden selbst heiter und witzig, wenn sie unter ihresgleichen sind.
Fein ist allerdings ihr Witz nicht zu nennen, und ihre Heiterkeit würde bei uns als Roheit bezeichnet werden, aber man muß dies eben ihrer Lebensweise zu gute rechnen, ebenso wie dem Seemann. Wer unter ihnen gelebt oder doch mit ihnen verkehrt hat, wird zugeben, daß es ein gemütliches Völkchen trotz einer rauhen Außenseite ist.
Um Trapper und Fallensteller kennen zu lernen, muß man im Frühjahr nach den Städten reisen, in denen sie die Felle umtauschen. Die Scouts oder Waldläufer aber, diese Einsiedler der Wildnis, trifft man auch dort nicht. Sie hassen das Stadtleben mit seinem geräuschvollen Treiben, dennoch aber gibt es Orte, wo auch sie sich zusammenfinden — die sogenannten Stores.
Unter einem Store versteht man in Amerika eine Niederlage, in welcher alles, was zum Leben notwendig ist, aufgestapelt ist. Besonders oft sind solche Stores an Landstraßen gelegen, oft zugleich mit Poststation verbunden, in welcher die Pferde gewechselt werden. Man findet sie aber auch oft mitten im Walde, in völlig einsamen Gegenden, im Gebirge an einer fast unzugänglichen Stelle, und hier besonders stellt sich der Waldläufer von Zeit zu Zeit ein, wenn er seinen Bedarf an Pulver, Blei, Tabak, Salz und so weiter ergänzen muß. Er bezahlt mit Fellen oder Goldkörnern, trinkt sein Glas Whisky und geht dann wieder in den Wald zurück, trifft er aber andere Waldläufer oder auch Trapper, die aus der Umgegend regelmäßig hierherkommen, so bleibt er wohl auch längere Zeit da, um in sein stilles Leben eine Abwechselung zu bringen.
Die Stores sind die Hotels der Wildnis. Trapper, Fallensteller, Waldläufer und Indianer sind ihre Stammgäste, nur selten einmal verirrt sich ein zivilisierter Reisender dorthin. — — —
Im Walde erhebt sich ein Blockhaus, aus rohen Balken zusammengefügt, die Ritzen mit Moos verstopft, die Fenster ohne Glasscheiben und die Tür ohne Schloß, nur mit einem hölzernen Riegel versehen.
Das Haus besteht aus zwei Räumen. In einem, dem größeren, werden die Vorräte aufbewahrt, das kleinere ist der Laden und Aufenthaltsort der Gäste. Hier schlafen sie auch, ebenso wie der Wirt, kurz, dieses Zimmer ist Schank- Schlaf- und Rauchstube, in welcher auch gekocht wird.
Der Besitzer des Store, von dem hier die Rede ist, heißt Bill, ist aber in einem großen Teile von Texas nur unter dem Namen Revolver-Bill bekannt. Er hatte früher Pferde zugeritten und war sehr tüchtig in seinem Berufe gewesen, hatte aber die schlechte Angewohnheit, zu leichtsinnig mit seinem Revolver zu spielen. So war er ihm einmal losgegangen, als ein Pferdebesitzer ihn um eine Summe Geld betrügen wollte, indem er ihm gesagt, er habe nicht zehn, sondern nur acht Pferde an einem Tage gebändigt; der Lügner that seinen Mund niemals wieder auf. Dann hatte einmal der Revolver geknallt, als Bill seinen Partner beim falschen Spiel ertappt hatte, und kurz vor Uebernahme dieses Stores erschoß Bill den Mann, der ihm sagte, Bill würde seine Kunden immer betrügen.
Aber Bill war ein ehrlicher Kerl, darüber waren sich alle Trapper und Waldläufer einig; er log nie, maß immer volles Gewicht, schenkte die Gläser bis an den Rand voll und griff nie nach dem Revolver, ohne vorher in ruhigem Tone gesagt zu haben:
»Sagst du das noch einmal mein Junge, so machst du mit diesem Dinge Bekanntschaft,« oder, »du bist nicht wert, mein Herzchen, daß dich die Sonne noch bescheint.«
Bill war eben ein braver Kerl, der nie log, ehrlich verkaufte und tauschte und nie jemanden in den Rücken schoß, und wer das Gegenteil behauptete, der bekam es mit einem jener Gesellen im ledernen Jagdhemd, breiten Schlapphut und hohen Stiefeln oder leichten Mokassins zu tun.
Wenigstens zehn solcher wilder Gestalten waren am Abend in Bills Store zusammengekommen, Trapper. Fallensteller und auch einige Waldläufer. Es war keine Einladung zu einer Zusammenkunft an sie ergangen, sie hatten sich eben zufällig hier eingefunden, und groß war die Ueberraschung, so viele Bekannte anzutreffen, denn auf einen Umkreis von vielen Meilen kannten sich alle und hielten Freundschaft.
Jeder neue Ankömmling machte mit Bill erst seinen Tauschhandel ab, empfing Pulver, Blei und alles, was er begehrte, schnitt das Blei mit dem Messer und kostete das Pulver auf Salpetergehalt. Bill dagegen prüfte die Felle und wog die Goldkörner. Dann gesellte sich der Neue zu den übrigen, welche sich die Zeit mit Plaudern, Trinken und Vergnügungen ihrer Art vertrieben.
Die Schenkstube ward von dem offenen Küchenfeuer erleuchtet, dessen Rauch durch ein Fenster abziehen sollte. Tat er dies nicht, und blieb er in der Stube, so störte das die Männer auch nicht. Der von der Decke herabhängenden Petroleumlampe fehlte es seit längerer Zeit an Nahrung.
Ein großer, massiver Tisch, einige Holzstühle, diverse Wandschränke mit Flaschen und Gläsern bildeten das ganze Mobiliar des Raumes, man müßte denn die zerstreut umherliegenden Bärenfelle dazu rechnen, aus denen sich die Gäste ihre Lager für die Nacht bereiteten. An Zimmerschmuck fehlte es nicht, die Wände hingen voll von Hirschgeweihen und anderen Jagdtrophäen, Gewehren, Bogen und Pfeilen, Pferdesätteln, Lassos, Zäumen und so weiter.
In Revolver-Bills Store ging es zwar etwas laut, aber sehr gemütlich zu.
»He! Bill,« rief eben ein vierschrötiger Trapper dem Wirte zu, der Holzklötze in das Feuer warf, »zwei Glas Brandy hierher, ohne Wasser, und dann tritt etwas aus dem Licht, wir können nichts sehen. Wer hatte das vorige bezahlt, John?« wandte er sich dann an seinen Nachbar am Tisch, den Fangschnüren nach, die er vor sich liegen hatte, ein Fallensteller.
»Ich hatte gewonnen,« antwortete John.
»Richtig, nun, diesmal wird sich das Blatt wohl wenden, oder ich will keinen einzigen Waschbären mehr fangen,« sagte der erste und griff in den Gürtel.
An einem Schranke standen zwei andere Männer, beide in hohen Stiefeln und Schlapphüten — es waren Waldläufer. Der Kleinere sprach zu dem Größeren, einer Gestalt von über sechs Fuß, und dieser hörte aufmerksam zu.
»He, Charly,« rief der Trapper dem Großen zu, »nimm doch den Kork da vom Boden und setze ihn wieder auf die Flasche«
Der Große blickte nach dem Trapper, nickte ihm zu, setzte den aufgehobenen Kork auf die leere Weinflasche, hatte aber die Hand noch nicht zurückgezogen, als schon ein Schuß krachte, und der Kork ihm aus den Fingern geschossen wurde.
»Verflucht, alte Biberratte,« rief der Trapper dem Fallensteller zu, der den abgeschossenen Revolver senkte, »wo hast du denn das Schießen gelernt? Hättest Jäger werden sollen, aber kein elender Fallensteller. Nun komme ich an die Reihe, treffe hoffentlich auch.«
Charly, der Scout, mußte nochmals einen Kork auf die Flasche setzen, war aber so vorsichtig, einen Schritt zurückzutreten, und das war gut, denn im nächsten Augenblick flogen ihm bei Splitter der Flasche um den Kopf herum.
»Ein elendes Spiel, so um zwei Gläser Whisky nach Korken zu schießen,« lachte Charly, »aber ein größeres Vergnügen kennen diese Leute nicht.«
»Mich kostet ein solcher Spaß zwei Finger,« sagte der Kleine, die linke Hand ausstreckend, an der zwei Finger fehlten. »Kanntest du den einarmigen Tom, der am Crab-River seine Hütte stehen hatte? Der wettete mit mir, mir dreimal ein Centstück aus den Fingern zu schießen. Zweimal glückte es ihm, beim dritten Male schoß er vorbei, ich hatte die hundert Dollar gewonnen, aber zwei Finger verloren. Seitdem gehe ich solche Wetten nicht mehr ein.«
Der andere lachte.

»Doch nun laß uns weitersprechen,« sagte er dann. »Du weißt also bestimmt, daß Deadly Dash »Deadly Dash« heißt auf deutsch: Tötender Schlag. bald hierherkommen wird?«
»Unter uns gesagt, ich weiß es bestimmt, aber ich vertraue es nur dir an, denn er will nicht erkannt sein. Ich weiß, du bist verschwiegen.«
»Von wem hast du es erfahren?«
»Von ihm selbst.«
»Wie?« rief Charly erstaunt. »So kennst du Deadly Dash persönlich? Offen gestanden, ich hielt seine Existenz nur für eine Fabel. Wo hat er sich diese vielen Jahre hindurch aufgehalten? Man hörte nichts mehr von ihm.«
»Weiß nicht,« entgegnete der kleinere, allerdings noch immer recht ansehnlich lange Waldläufer. »Er band sich ja schon früher niemals an eine bestimmte Gegend und mag weite Wanderungen gemacht haben, aber ich kenne ihn, ich habe einst im Norden einen Schneesturm mit ihm zusammen in einer Blockhütte verlebt. Wäre stolz, wenn wir Freundschaft geschlossen hätten.«
»Und jetzt hast du ihn wiedergesehen, Joe?«
»Ja, doch ich darf nicht weiter darüber sprechen.«
Das genügte, um Charlys Mund zu verschließen. Die mit den Indianern verkehrenden Weißen nehmen meist deren Angewohnheiten an, halten es also auch für schimpflich, Neugierde zu zeigen.
Die beiden Männer wandten sich der übrigen Gesellschaft zu, die ihr Lärmen eingestellt hatte und der Erzählung eines jungen Burschen zuhörte, welcher bereits Anstalten zur Nachtruhe getroffen, sich ausgezogen hatte, auf einem Bärenfelle saß und nun seine Erzählung unter heftigen Gestikulationen mit Armen und Beinen zum besten gab.
Es war ein Cow-boy, ein blutjunger, aber baumstarker Kerl, der sich hatte abbezahlen lassen und nun auf dem Wege nach einer Stadt war, um dort sein Geld so schnell und so angenehm wie möglich zu verjubeln, wobei ihm Dirnen getreulich mithelfen sollten.
Wie sein richtiger Name war, wußte niemand, überall, wo nur seine breite und zerfetzte Physiognomie auftauchte, wurde er Joker gerufen, was auf deutsch etwa soviel wie Spaßmacher bedeutet. Er steckte voller Tollheit und wußte beim Erzählen seiner Streiche auch noch ganz unglaublich aufzuschneiden, ohne daß er verlangte, man solle ihm Glauben schenken. Er war ein texanischer Münchhausen.
»Revolver-Bill,« sagte er nach Schluß der Erzählung zum Wirt, »nun gib nur ein paar Nägel und einen Hammer her, oder, verdamm' meine Augen, ich schlafe nicht in dieser blutigen Kammer.«
»Wozu, Joker?« fragte Bill, der für den jungen Cowboy eine ganz besondere Vorliebe besaß und sich von ihm manchen Spaß gefallen ließ.
»Damit ich das Bärenfell festnagle,« schrie der Bursche, sich die Stiefeln ausziehend, »oder glaubst du, ich will die ganze Nacht im Zimmer herumrutschen?«
»Was, Joker, du willst das Fell annageln?« rief ein Trapper lachend.
»Natürlich! Haltet nur einmal Eure Augen während der Nacht offen und schlaft nicht wie die Ratten, dann könnt Ihr bemerken, wie die Felle in dem Zimmer herumkriechen. Als ich das letzte Mal hier schlief, wurde mir angst und bange. Ich konnte nicht schlafen, obgleich ich zwei Pinten Whisky im Leibe hatte, denn plötzlich, denkt Euch mein Erstaunen, fängt das Bärenfell, auf dem ich liege, an, sich unter mir zu bewegen. Erst läuft es ganz gemütlich durch die Stube, kriecht unter den Tisch, mich mit sich nehmend, dann unter einem Stuhl weg; der fällt auf mich, und schließlich, verdammt will ich sein, wenn ich nicht die Wahrheit rede — klettert es die Wand hinauf. Dabei fiel ich natürlich herunter.«
»Oho, Joker,« lachte ein Trapper, »nicht aufschneiden! Ihr wart betrunken.«
»Durchaus nicht,« versicherte Joker, »ich war so munter wie jetzt, hatte ja nur zwei Pinten getrunken. Ich ließ mich aber nicht irremachen, riß das Fell von der Wand herunter, setzte ein Holzscheit in Brand, und was meint Ihr wohl, was ich entdeckte, als ich das Fell untersuchte?«
»Nun?«
»Ich hatte das Fell aus Versehen verkehrt umgelegt, so daß die Haare nach unten kamen, und nun liefen die paarmal hunderttausend Flöhe, die in den Haaren sahen, mit dem Felle spazieren. Nein, Bill, das lasse ich mir nicht noch einmal gefallen, gib mir Nägel und Hammer her, daß ich es festnageln kann.«
»Schnalle deine Sporen wieder an und reite das Fell zu,«, riet Bill.
»Werde mich hüten, der Racker beißt mit unzähligen Mäulern.«
»Seit wann hast du denn solche Angst vor den niedlichen Tierchen bekommen?« lachte Charly, der Waldläufer.
»Seit sie mich das vorige Mal bald aufgefressen haben. He, du alte Biberratte,« fuhr er, zu dem Fallensteller gewendet, fort, der sein Fell in die Ecke tragen wollte, um sich dann zur Ruhe zu legen, »kannst du hier nicht deine Schlingen legen, damit ich diese Nacht verschont bleibe?«
Der Fallensteller war müde, er brummte etwas Unverständliches vor sich hin, warf sich angezogen auf das Bärenfell und fiel sofort in Schlaf.
Auch die übrigen legten sich, einer nach dem anderen, nachdem sie ihre Toilette gemacht, das heißt, die Büchse an der Wand aufgehängt, eine Decke unter den Kopf geschoben und den Gürtel mit Messer und Tabaksbeutel neben sich gelegt hatten.
Doch zum Schlafen zeigten sie noch keine Lust. Alle hörten noch dem Geplauder des lustigen Joker zu, dessen Mund nicht zum Stillstehen gebracht werden konnte, solange die Augen offen standen, und jetzt, da er die Tasche voll Geld hatte, noch viel weniger.
»Noch einen Schlaftrunk, Bill,« rief er. »Ob das Geld hier draufgeht oder wo anders, ist doch gleichgültig. Da seht, die Biberratte leckt sogar im Schlaf mit der Zunge, der Kerl hat es gehört und wird gleich aufwachen.«
Der Wirt brachte das Verlangte und mußte dann dem wirklich erwachten Fallensteller auch noch einen Zinnbecher füllen.
»Habe gehört, Joker,« sagte Bill, als er dem jungen Burschen den Becher nach der Lagerstätte brachte, »du sollst ein neues Lied singen können. Jimmy sagte es mir, als er vorbeiritt. Gib es zum besten.«
Der junge Cow-boy sah im Kreise umher, und überall fand der Vorschlag Beistimmung. Er war sehr stolz auf seine Sangeskunst und vor allen Dingen darauf, daß er nur eigene Lieder sang, nach irgend einer schon bekannten Melodie.
»All right, boys,« rief er, schwang den Becher und erhob sich halb von dem Fell, »jetzt sollt Ihr eins zu hören bekommen, was ich bei der Hochzeit auf meiner Plantage vorgetragen habe.«
Die Zuhörer erhoben sich ebenfalls, stützten den Oberkörper auf die Ellenbogen und blickten gespannt nach dem Cow-boy.
Sie wußten, was er meinte. Der Haziendero, dessen Rinder er ein halbes Jahr bewachte, hatte seinen Sohn vermählt, und bei der Hochzeit mußte der sangeskundige Joker die Gaste unterhalten.
Joker räusperte sich und begann dann mit rauher, aber nicht übel klingender Stimme ein Lied zu singen, in dem er das Leben der Cow-boys verherrlichte und als das schönste pries, welches man sich erwählen kann.
Er begann mit dem Verse:
»Die Prärie unermeßlich
Selbstbewußt und stolz und kühn
Auf dem wilden Roß durchstreif ich,
Kenne weder Sorg', noch Müh'n.
Lach' dem Feinde ins Gesicht,
Meine Kugel fehlet nicht,
Richterhand mich nicht erreicht,
Denn, wer wagte, mich so leicht
Zu verfolgen? —
Hei, lustig darf der Cow-boy leben!«
schloß der Mann mit einem langgezogenen Rufe, sprang aus und hielt dem Wirte den leeren Zinnbecher zum Füllen hin.
»Hei, lustig darf der Cow-boy leben!«
jubelten die Zuhörer ihm zu, von der wilden Fröhlichkeit des tollen Burschen angesteckt, und forderten den Wirt ebenfalls auf, mit der Kruke zu ihnen zu kommen.
Dann fuhr der Cow-boy mit flammenden Augen fort zu singen:
»Auf Don Ramos reichem Rancho
Feiert man mit Pracht und Glanz
Hochzeit seines Sohnes Carlo,
Cow-boy, darf nicht fehl'n beim Tanz.
Durch den Klang der Silbersporen
Ging schon manches Herz verloren.
Feurig perlt im Glas der Wein.
Schönstes Mädchen, du bist mein.
Wein und Liebe!
Hei, lustig kann der Cow-boy lieben.
Hei, lustig kann der Cow-boy lieben.«
echote es aus zehn Kehlen nach, selbst Revolver-Bill wurde von der Lustigkeit angesteckt; er fühlte sich noch einmal jung, er war wieder zum kecken Burschen geworden.
So fuhr Joker mit seinem Gesang fort, der das schöne, ungebundene Leben des Cow-boys schilderte. Jeder Vers schloß mit einem anderen Refrain, in dem aber immer das Wort ›lustig‹ vorkam, und jedesmal fiel der Chor der Trapper und Waldläufer ein.
Joker begann den letzten Vers zu fingen:
»Cow-boys Stündlein hat geschlagen:
Er steht an des Abgrunds Rand,
Hinter ihm Apachen jagen,
Weit entfernt ist Freundes Hand.
Er faßt fester in die Zügel,
Stellt sich höher in dem Bügel,
Himmelwärts den Blick er hebt,
Wie er überm Abgrund schwebt,
Gellt es lachend:
Hei, lustig will der Cow-boy sterben!«
Diesmal blieb der Refrain aus, der Chor hatte einen anderen Schluß erwartet, dieser Paßte nicht zu dem lustigen Joker.
»Wollt ihr nicht mitsingen?« fragte dieser, und seine Stimme nahm plötzlich einen ganz anderen Ton an. »Ja, ja, auch ich kann einmal ernst werden. Der letzte Vers ist keine Dichtung, ich habe einer solchen Tat vor einem Monat selbst beigewohnt.«
»Wo, wie?« erklang es durcheinander.
»Wir, mein alter Freund Dick und ich,« erzählte der Cow-boy niedergeschlagen, »waren von den anderen versprengt worden, als die Rinderherden, durch ein Gewitter erschreckt, davongestoben waren und wir sie wieder zum Stehen bringen wollten. Dick und ich fanden uns zusammen und trieben die Tiere dein Weideplatz zu, als wir Apachen auftauchen sahen, die uns den Weg abzuschneiden suchten. Wir konnten uns nur durch Flucht retten und ritten so schnell als möglich, um den Apachen auf einem Umweg zu entkommen. Beim Ueberspringen eines ausgetrockneten Baches trat mein Gaul auf einen spitzen Stein, er konnte nicht weiter, ich sprang ab und kroch in dem Bache weiter. So bin ich den Apachen entgangen, wurde aber noch Zeuge davon, auf welch elende Weise der lustige Dick sein Leben lassen mußte. Die Apachen schnitten ihm den Weg ab, trieben ihn nach einer Schlucht zu, weil sie wußten, daß er ihnen dort in die Hände fallen mußte. Aber sie hatten sich in Dick getäuscht. Natürlich schoß er noch so viele seiner Verfolger als möglich nieder, als die Nächsten ihn aber greifen wollten, gab er seinem Rosse die Sporen und trieb es in den Abgrund hinein. Dabei stieß er ein gellendes Lachen aus, noch jetzt klingt es mir in den Ohren, ich sehe ihn noch, wie er auf dem dampfenden Pferde saß, den Kopf hintenübergebeugt, einen Augenblick über dem Abgrund schwebte und dann hinabsauste.«
Joker schüttelte sich und fuhr sich dann mit der harten Hand über die Augen.
Unter den Trappern war tiefe Stille eingetreten; sie ehrten die Trauer des Cow-boys um seinen Freund.
»Was für Apachen waren es?« fragte endlich Joe, der kleinere Waldläufer.
»Sie gehörten zur Bande des weißen Wolfes.«
Alle Zuhörer fuhren auf; der große Waldläufer, Charly, runzelte finster die Stirn.
»Es wird bald Zeit, daß diesem Schurken sein Handwerk gelegt wird,« sagte er leise.
»Und das soll fernerhin auch meine Aufgabe sein,« donnerte der Cow-boy, mit der Faust auf die Diele schlagend, fügte aber dann, wieder zurücksinkend, hinzu, »nur will ich mich erst noch etwas amüsieren, habe zu hart gearbeitet.«
»Solltest es aufgeben, das wüste Leben,« meinte Joe, »du hast keinen Vorteil davon.«
»Weiß es. Was kann man aber gegen die Natur machen? Geld brennt mir nun einmal wie Feuer in der Tasche, ich habe keine Ruhe, bis ich es an den Mann gebracht habe.«
»Gegen die Apachen sollten wir uns alle verbinden, die wir hier sind,« sagte ein Trapper. »Diese Geschöpfe sind doch nichts weiter wert, als daß sie niedergeschossen werden.«
»Malt sie nicht an die Wand,« rief ihm der alte Fallensteller, wegen seines mürrischen Wesens Biberratte genannt, zu, »mir ist es schon öfters passiert, daß sie kamen, wenn man von ihnen sprach, und besser ist es, man ...«
Ein gellendes Geheul unterbrach den Sprecher, und gleich darauf krachten zwei Gewehrsalven.
Blitzschnell fuhr alles auf, die Büchsen flogen in die Hand; im Nu saßen die Gürtel an den Lenden, und ebenso schnell hatte der Cowboy die Stiefel an den Beinen und den Revolver in der Hand.
»Was ist denn das? Indianer?«
Da donnerte es schon gegen die verriegelte Tür.
Mit einem Sprunge stand Revolver-Bill davor und gleichzeitig die übrigen Waldbewohner an den Fenstern, um die Blockhütte gegen einen Angriff verteidigen zu können.
Die Nacht war pechschwarz, erkennen konnte man draußen niemanden, wenigstens vorläufig nicht.
»Aufgemacht,« rief draußen eine tiefe Männerstimme hastig, »schnell, der Tod ist hinter uns.«
»Wer ist es?«
»Gut Freund, wir werden von den Apachen verfolgt,« erscholl es als Antwort.
Revolver-Bill war kein Freund von Zögern oder langem Nachdenken, sollte es einmal jemand versuchen, in sein Blockhaus einzudringen, ohne daß er es erlaubte. Schnell schob er den Riegel zurück und öffnete die Tür.
Ein riesiger Mann, wie ein Waldläufer gekleidet, sprang ins Zimmer.
»Deadly Dash,« rief Joe, halb erstaunt, halb erfreut, aber die Worte erstarrten ihm auf den Lippen, als sich dem Manne noch ein ganzes Dutzend Personen nachdrängte, mit Schmutz bespritzt, die Kleider von Dornen zerfetzt, aber die Augen der Trapper erkannten doch sofort, daß sie Weiber in Männerkleidern vor sich hatten. Als letzter trat ein Indianer ein, der die Tür hinter sich zuschlug und den Riegel vorschob.
Es war zwei Stunden vor Mitternacht, als die unter Führung von Miß Thomson aufgebrochenen Mädchen den Versuch aufgaben, bei Nacht durch den Wald zu dringen.
Sie hatten einige fürchterliche Stunden erlebt. Ihre erste Absicht, sich immer am Waldessaum zu halten, um wenigstens den Weg vom Mond beleuchtet zu sehen, war bald vereitelt worden, denn der Name Waldessaum ist bei einem Urwald nur ein Begriff. Undurchdringliche Büsche mußten umgangen werden, wodurch sie in den Wald gerieten, ob sie auch links oder rechts auswichen, ebenso zwangen Sümpfe sie zur Veränderung der Richtung, selbst zur Umkehr, und oft erstreckten sich die Bäume bis dicht ans Wasser, so daß man unter dem dichten Laubdach marschieren mußte und vom Monde keine Spur sah.
Es läßt sich nicht beschreiben, was die Mädchen beim Marsch durch den völlig finsteren Wald auszustehen hatten. Die eine stürzte über eine Wurzel, die andere sah plötzlich ihren Weg durch Bäume, Büsche oder Schlingpflanzen vollständig gesperrt, und als sie umkehrte, geriet sie bis an die Hüften in einen schwarzen Schlamm, aus dem sie nur mit vieler Mühe befreit werden konnte, aber bei dem Rettungsversuch stürzten wieder andere in das Schlammloch mit der trügerischen Oberdecke; kurz, bald waren die Mädchen so erschöpft und von den Dornen zerzaust, daß sie die Unmöglichkeit einsahen, den Weg weiterzuverfolgen.
»Wir müssen uns einen Lagerplatz für die Nacht suchen,« erklärte Betty endlich niedergeschlagen, als sie eben vor einem Sumpf standen, der kein Ende zu haben schien, »vor morgen früh dürfen wir nicht daran denken, weiterzumarschieren, wollen wir uns nicht aufreiben.«
Dies war schon lange die Ansicht aller Mädchen gewesen. Sie hatten es nur nicht auszusprechen gewagt und auch immer noch die Hoffnung gehabt, Ellen und ihre Genossinnen zu finden, welche sicher die Nacht an einem Lagerfeuer verbrachten.
Diese Hoffnung war aber fehlgeschlagen.
Da, wo sie gerade mit keuchender Brust und mit vor Anstrengung zitternden Gliedern standen, erstreckte sich eben ein kleiner Rasenfleck, welcher von einem mächtigen Baume überschattet wurde, und kaum hatte Betty ihre Meinung ausgesprochen, als sich auch schon alle ohne weiteres auf den Boden warfen, unfähig, irgendwelche Vorbereitungen zu einem bequemen Lager zu treffen.
Der Platz war günstig für ihre Verhältnisse. Sie selbst lagen im Dunklen; auf der Seite, von der sie kamen, war der Wald gelichtet, auch die Büsche standen weit auseinander, und der Mond erleuchtete eine weite Fläche. Links und rechts und vor ihnen zog sich der Sumpf hin, der sie am Vorwärtsgehen gehindert hatte.
»Wir können nicht alle schlafen, und wenn wir auch vor Erschöpfung sterben müßten,« sagte Betty wieder, »denn unsere einzige Rettung beruht jetzt darauf, die uns etwa nachkommenden Apachen mit der Büchse zu empfangen. Der Weg nach vorn ist uns abgeschnitten, wir können nur noch zurück und würden den Apachen in die Hände laufen. Wer will mit mir die erste Stunde wachen?«
»Ich,« sagte Miß Sargent sofort, »ich fühle mich wohl matt, aber nicht schlafbedürftig.«
»So kommen Sie hierher zu mir, wir werden die Umgegend beobachten und müssen bei etwas Verdächtigem natürlich auch die Freundinnen wecken.«
»Kann kein Feuer angebrannt werden?« fragte ein Mädchen leise. Man konnte ihr die Verzagtheit an der Stimme anhören, aber das Gras war auch naß, die Nacht kalt, und so war es wahrlich keine Kleinigkeit, ohne Feuer, ohne Decke im Freien zu kampieren.
»Auf keinen Fall,« sagte aber Betty schnell, »lieber wollen wir erfrieren, als durch ein Feuer die Apachen wieder auf unsere Spur locken.«
Die Mädchen waren zu müde, als daß sie an eine weitere Unterhaltung dachten; die Winchesterbüchsen im Arm, waren sie bald trotz der Nässe des Grases, die sich auch ihren Kleidern mitteilte, sanft eingeschlafen.
Miß Thomson und Sargent setzten sich auf eine Wurzel des Baumes und spähten aufmerksam auf die mondbeschienene Lichtung. Jeder Schatten eines sich bewegenden Zweiges, jedes Rascheln eines Blattes ließ sie zusammenschrecken und verdoppelte ihre Wachsamkeit.
»Es ist trostlos,« sagte endlich Betty. »Jahre meines Lebens wollte ich darum geben, wenn jetzt der Morgen anbräche und wir unseren Marsch fortsetzen könnten.«
»Ohne geschlafen zu haben?« sagte Miß Sargent.
Betty schwieg, sie sah ein, daß die Mädchen unter solchen Umständen schwerlich noch lange einen Marsch ausgehalten hätten.
»Was werden die Indianer tun, wenn sie uns an dem Felsen nicht mehr vorfinden?« fragte Miß Sargent dann wieder.
»Uns verfolgen,« antwortete Betty bestimmt.
»Auch bei Nacht?«
»Auch bei Nacht; die Apachen scheuen die Finsternis nicht, wie andere wilde Stämme.«
»Aber sie können unserer Spur nicht folgen.«
»Wenn sie das nicht können, so wissen sie doch, wohin wir uns gewandt haben, und daß wir uns möglichst an der Küste halten, werden sie ahnen. Treffen wir heute nicht mit ihnen zusammen, so können wir doch morgen sicher darauf rechnen und sind dann nur noch auf unsere Gewehre angewiesen. Es kann einen schlimmen Kampf geben.«
Sie unterhielten sich noch eine Zeitlang in flüsterndem Tone, sie erwogen alles, was ihnen zum Vorteil und zum Nachteil wäre, nur, um sich wachzuhalten, denn mit bleierner Schwere wollte sich der Schlaf auf ihre müden Augen senken.
Miß Sargent hatte nicht die Wahrheit gesprochen, als sie sagte, sie fühle kein Schlafbedürfnis; nur aus Mitleid mit ihren Freundinnen übernahm sie die erste Wache, um von dem Lose nicht eine todmüde Freundin treffen zu lassen. Das Mädchen glaubte, seine Energie würde den Schlaf besiegen, aber es hatte sich getäuscht. Immer mehr sank der Kopf vornüber; es mußte ihn in beide Arme stützen, um nicht von der Wurzel zu fallen, aber in dieser bequemen Lage wollte sie die Müdigkeit noch viel mehr übermannen.
Auch Miß Thomson war ebenso erschöpft, wie die übrigen. In dem Bewußtsein, für die Sicherheit ihrer Freundinnen verantwortlich zu sein, suchte sie die Augen offenzuhalten, aber es gelang ihr nicht, auch sie stützte den Kopf auf den Arm.
Das Gespräch war verstummt. Die beiden Mädchen hatten genug damit zu tun, ihre Augen offenzuhalten. Ab und zu warfen sie einen Blick in die mondbeschienene Gegend hinaus, bald aber saßen die Mädchen mit geschlossenen Augen da, bis sich auch das Bewußtsein verlor.
Einmal noch glaubte Miß Thomson, in weiter Ferne einen Schrei zu vernehmen, noch einmal riß sie die müden Augen auf, gleich aber schlossen sie sich wieder, um sich nicht mehr aufzutun. Auch Miß Sargent schlief, träumte aber, sie wache für ihre Freundinnen.
Der Mond begann zu sinken, er veränderte die Schatten des Baumes und strahlte endlich mit vollem Glänze auf die Schläferinnen. Er wunderte sich nicht wenig, die Mädchen, deren Treiben auf der ›Vesta‹ er so oft beobachtet hatte, hier in Texas wiederzufinden, auf nackter Erde, im nassen Grase schlafend, schutzlos, ohne Decken und vor Kälte zitternd. Die beiden Wächterinnen saßen noch immer auf der Baumwurzel, die Köpfe in die Hände gestützt, die Büchsen neben sich gelehnt.
Der gute, stille Mond! Fühlte er nicht Mitleid mit den Mädchen? Konnte er ihnen nicht helfen? Er sah ja alles, was jetzt unter ihm im Freien vorging, Böses und Schlechtes, er wußte, vor wem diese Mädchen flohen, er wußte aber auch, wer für sie sorgte, wer gern sein Herzblut für sie gegeben hätte, wenn sie nur in Sicherheit gewesen wären. Hätte er diesen nicht ein Zeichen geben können?
Ach, was hätte das genutzt! Die, welche um die Mädchen bangten und sorgten, waren ja auf der anderen Halbkugel, in Südamerika, und der Mond konnte sie nicht sehen. Diese wurden ihm erst sichtbar, wenn er hier unterging.
Aber der Mond schien doch keine Sorge um die schlafenden Mädchen zu haben, deren gebräunte Wangen er jetzt mit seinem milden Lichte übergoß. Er lächelte freundlich, und hätte er sprechen können, so würde er gesagt haben: Schlummert sanft, ihr könnt doch nichts anderes tun. Aber ich will dem, der euch sucht und auch helfen kann, als Leuchte dienen, damit er nicht im Dunkeln an euch vorübergeht.
Doch der Mond sagte nichts, er sah freundlich hernieder und beobachtete.
Die erste Stunde war vergangen, die Wache hätte abgelöst werden müssen, wenn es eine solche gegeben hätte.
Da raschelte es fast unmerklich im Laube. Die Büsche wurden auseinandergedrängt, es bewegte sich etwas im Schatten der Bäume, dann huschte ein großer, langgestreckter Körper über die Lichtung, so schnell, daß man ihn nicht unterscheiden konnte, und verschwand wieder im Dickicht.
Es hätte ebensogut ein Indianer, wie ein Leopard sein können, ein anderes Wesen vermochte schwerlich mit solcher Behendigkeit zu schleichen.
Dann tauchte es kurz vor der Lichtung wieder auf, an deren Anfang die beiden schlafenden Mädchen auf der Baumwurzel saßen, war jedoch abermals gleich wieder verschwunden. Die Gestalt bewegte sich leise, als kröche eine Schlange auf die Schlafenden zu, dann kam sie völlig hervor und stand plötzlich aufrecht im Mondlicht. Es war eine mächtige, prachtvolle, gelbe Dogge, meterhoch, der Körper wie von Stahl gebaut und doch geschmeidig, das wunderschöne Fell mit Narben bedeckt.
Den kleinen Kopf, dessen breite Schnauze ein furchtbares Gebiß enthielt, hatte sie hoch emporgehoben und sog mit witternder Nase die Luft ein, dabei die treuen, braunen Augen fest auf die beiden Mädchen geheftet und leise mit dem kurzen Schwanz wedelnd.
Als keine Bewegung verriet, daß die Mädchen das Tier sahen, knurrte es leise, dann huschte es vorbei, rannte in den Kreis der Schläferinnen und lief von einer zur anderen, sie beriechend. Als es zu Miß Nikkerson kam, verweilte es lange bei dieser, beschnüffelte das Mädchen von allen Seiten und fuhr ihr endlich mit der heißen Zunge über das Gesicht.
Miß Nikkerson seufzte tief auf, streckte den Arm abwehrend aus, wendete etwas den Kopf und schlief weiter.
Im nächsten Augenblick huschte die Dogge in das Dickicht zurück, die Mädchen wieder verlassend.
Sie mußte ein bestimmtes Ziel im Auge haben, denn, obgleich sie noch immer vorsichtig kroch und schlich, bald fast auf dem Bauche liegend, dann wieder lautlos über Baumstämme springend, bewegte sie sich doch schnell einer Richtung zu, ohne sich durch irgend etwas vom Wege abbringen zu lassen. Selbst Sümpfe konnten ihren Lauf nicht hemmen; mit leichten, federnden Sätzen eilte sie darüber hinweg, dem trügerischen Erdreich keine Zeit lassend, den flüchtigen Fuß zum Einsinken zu bringen.
Eine halbe Stunde mochte der Hund so gerannt sein, als er plötzlich lautlos in einem Gebüsch zusammensank und mit den wie Kohlen glühenden Augen in den Wald starrte, der von den Mondstrahlen schwach erleuchtet wurde.
Zwei menschliche Wesen waren es, welche die Aufmerksamkeit der Dogge erregt hatten. Es konnten nicht ihre Herren sein, sonst wäre sie aufgesprungen und hätte sie begrüßt, aber sich nicht verkrochen und ihr Treiben mit grimmiger Miene beobachtet.
So weit es das schwache Mondlicht erkennen ließ, waren es dunkle, halbnackte Gestalten, also Indianer. Sie krochen auf Händen und Füßen, den Kopf dicht auf die Erde gebückt, hierhin und dorthin, bogen die Grashalme mit den Händen leise auseinander, senkten den Kopf noch tiefer herab und spähten aufmerksam auf der Erde umher.
Die Dogge lag still, kein Glied zuckte an ihr, die Augen waren starr auf die beiden geheftet.
Da stieß plötzlich einer der Indianer den leisen Schrei eines Nachtvogels aus, und sofort war der andere bei ihm. Der erstere deutete auf den Rasen, flüsterte dem anderen etwas zu, und in beider Gesichter blitzte ein triumphierender Freudenstrahl auf.

Der eine Indianer deutete auf den Rasen
und flüsterte dem anderen etwas zu.
Die Dogge änderte ihre Lage. Auf dem Bauche rutschte sie langsam vor, sich im Schatten der Bäume haltend, so lautlos, daß selbst die scharfen Ohren der Söhne der Wildnis kein Geräusch vernahmen.
Aber plötzlich blieb sie wieder liegen, sich diesmal wie zum Sprunge zusammenduckend.
Die beiden Indianer hatten noch einmal leise zusammen geflüstert und den Boden untersucht, dann deutete der eine nach Osten, der andere in die entgegengesetzte Richtung. Sie richteten sich aus und wollten zurückgehen.
Aber sie sollten nicht weit kommen.
In demselben Augenblick, da sie sich aus der knieenden Stellung erhoben, knurrte das Tier leise. Blitzschnell fuhren ihre Hände nach den Messern, sie wandten sich wieder um, sie sahen den Hund; schon öffnete sich ihr Mund zu einem Schrei der Ueberraschung, da aber schossen von beiden Seiten zugleich zwei Gestalten hinter den Bäumen hervor, ein dumpfer Schlag links, rechts ein Griff und das Aufblitzen eines Stahles, und beide Indianer lagen tot am Boden, der eine mit zerschmettertem Schädel, der andere mit klaffender Wunde in der Herzgegend.
Kein Röcheln kündigte an, daß soeben zwei Seelen den Körper verließen.
Jetzt war der Bann gelöst, der bisher auf der Dogge gelegen hatte, mit einem mächtigen Satze sprang sie vor und an dem einen der Männer in die Höhe. Dieser brachte den Hund mit einer Handbewegung zur Ruhe, steckte den Tomahawk, mit dem er den tödlichen Schlag geführt hatte, in den Gürtel und bog sich zu dem Indianer herab.
Dadurch kam sein Gesicht in den Mondschein, und man konnte sehen, daß es den dunkelroten, charakteristischen Zügen nach einem Indianer angehörte, obgleich der Mann selbst wie ein weißer Jäger angezogen ging. Er trug, wie sein Gefährte, der wirklich ein Weißer war, einen ledernen, den Körper völlig bedeckenden Anzug, nur daß sein Gürtel mit Skalpen geschmückt war.
»Wieder zwei Raubtiere weniger,« sagte der Weiße, wischte das blutige Messer im Grase ab und steckte es in die Scheide.
»Mein Bruder hat recht,« entgegnete der Indianer, der die Getöteten besah. »Es sind Apachenhunde, sie folgen dem weißen Wolf. Stahlherz hat an seinem Gürtel noch Platz für ihre Skalpe.«
Damit zog er sein Messer, wickelte das lange Haar des von ihm Getöteten um die eine Hand, fuhr mit der Spitze des Messers kreisförmig um den Schädel, ein Ruck, und er hatte die Kopfhaut mit den Haaren in der Hand, den Skalp, den er an seinem Gürtel befestigte.
»Verschmäht mein Bruder noch immer den Skalp des Feindes?« fragte er dann lächelnd den Weißen.
»Noch immer,« antwortete dieser und wandte sich ab, um nicht nochmals dieselbe Greuelszene zu sehen.
Der Indianer, von seinem Gefährten Stahlherz genannt, gesellte dem ersten Skalp auch den des anderen Apachen bei.
Der Weiße, wahrscheinlich ein Waldläufer, hatte unterdes zwei Büchsen hinter einem Baume hervorgeholt, händigte die größere davon, mit einem ganz auffällig langen Laufe, dem Indianer ein und wandte sich dann an den Hund.
»Und was sagt Lizzard?«
Die Dogge wedelte mit dem kurzen Schwanze, lief einen Schritt zurück, kehrte wieder um, knurrte leise und ließ die klugen Augen von einem Manne zum anderen schweifen.
»Lizzard hat sie gefunden,« sagte der Weiße. »Komm, Stahlherz, laß uns nicht zögern! Jede Sekunde ist kostbar. Wenn die Späher nicht zurückkommen, wird der weiße Wolf Argwohn schöpfen und selbst die Spur aufsuchen wollen.«
Der Indianer antwortete nichts. Er schulterte die Büchse und stieß einen leisen Pfiff aus.
Der Hund erhob die Augen zu ihm.
»Zurück, Lizzard!«
Die Dogge senkte die Nase auf den Boden und lief dann so schnell davon, daß die beiden Männer mit großen Schritten eben folgen konnten.
Sie waren mit solchen Wanderungen vertraut, diese beiden Männer, denn obgleich da, wo der Mond nicht eindringen konnte, finstere Nacht war, schritten sie doch ebenso schnell und sicher dahin, als schiene die Sonne. Nie stieß ihr Fuß an einen Baum, nicht einmal an einen Stein, ja, sie mußten sogar, trotz der Finsternis, jeden am Boden liegenden Ast erkennen können, denn nicht das leiseste Geräusch verriet, daß hier zwei Männer in eiligem Schritt durch den Wald gingen.
Erst kam der Hund, der sich wirklich wie eine Eidechse — Lizzard heißt auf deutsch Eidechse — durch die Büsche wand, dann der Indianer und hinter diesem der Weiße. Diese drei wurden nicht, wie einige Stunden vorher die elf Mädchen, von Hindernissen aufgehalten, sie mußten die Gegend genau kennen, oder die Sümpfe und Wurzeln waren plötzlich verschwunden, ja, nicht einmal die Dornen wagten sich in die ledernen Kleider zu krallen.
Plötzlich blieb der Hund wie angewurzelt stehen, wandte den Kopf und blickte den Indianer an, aber schon mußte dieser auch etwas gehört haben, denn er hatte ebenfalls Halt gemacht.
Der Indianer hob die Hand, nach dem Hunde deutend und dann seinem Begleiter winkend.
Der Hund lief weiter, ihm folgte der Weiße wie vorher, während der Indianer geräuschlos ins Gebüsch schlüpfte und sofort verschwunden war.
Unbekümmert um das Vorhaben seines Genossen schritt der Waldläufer hinter dem Hunde her; er kannte schon des Wilden selbständiges und wortkarges Benehmen. Er brauchte aber auch nicht lange allein zu gehen, denn schon nach wenigen Minuten teilten sich die Zweige wieder, und Stahlherz gesellte sich stillschweigend dem Weißen zu.
»Was gab's?« fragte dieser.
Stahlherz sah nur an seinem Gürtel hinunter, der Weiße folgte diesem Blick und sah einen dritten, blutenden und noch rauchenden Skalp am Gürtel seines Freundes hängen.
»Der weiße Wolf zählt wieder einen Krieger weniger,« sagte er kurz.
»Der Wald scheint von Apachen zu wimmeln,« bemerkte der Weiße, »ich hätte nicht geglaubt, daß die Spione schon so weit vorgedrungen seien.«
»Er war der erste, denn er war allein. Die Apachen gehen immer zu zweien, wenn sie sich auf dem Kriegspfade befinden, nur der erste geht allein.«
»Hast du ihn überrascht? Ich habe keinen Ton gehört, daß er sich gewehrt hätte.«
»Wen Stahlherz töten will, der kann sich nicht wehren,« sagte der Indianer stolz.
Wortlos verfolgten sie eine Zeitlang ihren Weg, bis Lizzard wieder stehen blieb, ohne diesmal aber seinen Kopf nach seinem Herrn zu wenden.
»Wir müssen am Ziele sein,« flüsterte der Weiße.
Der Indianer nickte und spähte aufmerksam durch die Zweige der Büsche, welche eine Lichtung umgrenzten.
»Hugh,« stieß er dann in dem tiefen Kehlton der Indianer hervor, »deine Freundinnen schlafen.«
Der Weiße erblickte, als er noch einige Schritte nach vorwärts machte, ein seltsames Bild. Neun Mädchen lagen im Mondschein am Boden und schliefen, zwei saßen auf einer Wurzel, aber auch sie befanden sich in den Armen des Schlummergottes. Aller Hände ruhten zwar auf den neben ihnen liegenden Gewehren, aber sie waren jedenfalls so müde, daß sie keinen Gebrauch davon hätten machen können, wenn sie von einer Gefahr überrascht worden wären.
Als der Waldläufer in den hellen Mondschein trat, konnte man seine Gestalt zum ersten Male deutlich sehen. Er war ein großer, athletisch gebauter Mann, ein wahrer Hüne. Eng umspannte das lederne Gewand die schwellenden Muskeln, wie der Gürtel die schmalen Hüften, und der breitrandige, stark mitgenommene Filzhut, mit der Feder des weißen Seeadlers geschmückt, überschattete ein tiefbraunes, edles Gesicht, in dem die schmale Nase in gleicher Richtung mit der Stirn verlief.
Die kühnen, blauen Augen, der große, hellblonde Schnurrbart vervollständigten das Bild eines schönen Mannes.
Im Gegensatz zu anderen Trappern und Waldläufern, die ihren Anzug sehr vernachlässigen, sogar stolz darauf sind, wenn er recht zerfetzt ist, ebenso, wie sie weder Seife, Kamm noch Barbiermesser kennen, hielt dieser Mann auf eine gewisse Eleganz im Anzug. Das Ledergewand saß stramm; kein Riß oder Flicken war zu sehen, obgleich es nicht neu war. Die Beinkleider waren zierlich mit Fransen geschmückt, die Mokassins, welche er anstatt der Stiefel trug, mit Stickereien versehen, und selbst das Jagdhemd mit indianischen Totems, das heißt, mit Malereien bedeckt, die mit bunten, unverwischbaren Farben aufgetragen waren. Auch das glattrasierte Kinn zeigte, daß er selbst in der Wildnis etwas auf Aeußerlichkeit gab und sich selbst achtete.
Bewaffnet war er mit einer kurzen, ausgezeichnet gearbeiteten Büchse, deren ungemein dicker Kolben reich mit Silber eingelegt war, sowie einem Messer in der Scheide, und ferner trug er an seinem Gürtel mehrere größere und kleinere Ledertaschen, wie man sie sonst bei Trappern nicht zu sehen gewohnt ist. Sie mochten wohl Patronen enthalten oder Gegenstände, welche der Mann in den Wäldern zu seiner Toilette gebrauchte.
Sein Gefährte, der Indianer, war etwas kleiner, konnte aber noch immerhin für einen großen Mann gelten, proportioniert gebaut und in allen seinen Bewegungen, so bedachtsam sie auch waren, Kraft und Gewandtheit verratend. Sein Gesicht zeigte einen trüben, melancholischen Ausdruck, soweit man dies unter den Malereien entdecken konnte, die dasselbe bedeckten. Wäre er nicht völlig in Leder gekleidet gewesen, so hätte man seinen ganzen Körper nach Art der indianischen Rasse mit Tätowierungen bedeckt gesehen. Die Malereien im Gesicht, dessen linke Seite weiß, dessen rechte blau war, zeigten Aehnlichkeit mit denen auf dem Jagdhemd seines Gefährten. Die Anordnung der Ringe war dieselbe, ebenso die phantastischen Schnörkel, die sich in diesen Ringen befanden.
Er führte die schon erwähnte, lange Büchse, noch länger als die bekannte, amerikanische Rifle, ein gezogenes Gewehr. Im Gürtel stak der stählerne Tomahawk an hölzernem Stil, sowie das Skalpiermesser ohne Scheide.
Munitionsbeutel, eine Tabakstasche aus Waschbärfell und noch ein bemaltes Täschchen, der sogenannte Medizinbeutel, in dem jeder Indianer heilende Kräuter und die Farben trägt, hingen ebenfalls vom Gürtel herab. Auch er trug schön gestickte Mokassins. Daß er keiner der in dieser Gegend hausenden Apachen war, zeigte schon sein hoher Wuchs an, noch mehr aber das Vorhandensein der Skalplocke.

Der ganze Kopf war nämlich kahl rasiert, nur in der Mitte desselben erhob sich eine dunkle Locke, mit Oel getränkt in der eine Feder des weißen Seeadlers steckte. Dadurch kennzeichnete er sich als ein Indianer des nördlichen Amerikas.
Diese tragen alle Skalplocken, und zwar aus dem Grunde, um ihrem Feinde, der sie besiegt hat, das Skalpieren zu erleichtern, denn die Haare hindern das Messer, die Kopfhaut glatt vom Schädel abzutrennen, somit fordern sie also den Feind geradezu auf, sie zu skalpieren, schonen aber natürlich auch nicht den Skalp des Feindes, sollten sie als Sieger aus dem Kampfe hervorgehen.
Der Indianer mochte schon gegen fünfzig Jahre alt sein, doch zeigte nichts das heranrückende Alter an, es wären denn die runzligen Züge gewesen. Sein Begleiter dagegen hatte das dreißigste Jahr sicher noch nicht überschritten.
»Sie schlafen,« flüsterte der Weiße, und eine seltsame Bewegung zuckte über sein offenes Gesicht.
Es war fast, als übermanne ihn ein tiefes Mitleid, so traurig wurden plötzlich seine Züge, als er die jungen Mädchen in dem nassen Grase schlafen sah, schutzlos der Nachtkälte preisgegeben.
»Ermuntere sie!« entgegnete ebenso leise Stahlherz. »Der weiße Wolf ist nicht fern; bald werden wir sein heiseres Bellen hören.«
Der Waldläufer seufzte tief auf, schritt dann zu einem der sitzenden Mädchen und faßte es leise am Arm.
Es war Miß Thomson gewesen.
Das Mädchen fuhr sofort auf. Ihr Blick fiel nicht zuerst auf den Mann neben ihr, sondern zufällig auf die bewegungslose Gestalt des Indianers, sie griff nach der Büchse, öffnete den Mund und wollte einen Warnungsruf ertönen lassen, aber sofort legte sich eine Hand auf ihre Lippen.
»Still,« flüsterte ihr der Waldläufer zu, »wir sind Freunde. Nehmen Sie Ihre Fassung zusammen. Ein Schrei könnte uns verraten! Wecken Sie Ihre Freundinnen!«
»Wer sind Sie?« stammelte Miß Thomson, die jetzt auch den Weißen und den Hund sah, wodurch sie einigermaßen beruhigt wurde.
»Wir sind Freunde, die Sie retten wollen. Wecken Sie alle, wir müssen sofort aufbrechen!«
»Der weiße Wolf,« sagte das Mädchen, das noch nicht völlig bei Besinnung war, und deutete auf den Indianer.
»Nein, er ist mein Freund, der Feind des weißen Wolfes. Dieser ist auf Ihrer Spur.«
Jetzt endlich kam Miß Thomson zur Besinnung, sie erinnerte sich plötzlich, wie sie hierherkamen und der Gefahr, in der sie sich befanden, aber zugleich fiel ihr etwas anderes ein.
»Wer sind Sie?« fragte sie mit einem Male erstaunt und wandte den Kopf dem Sprecher zu.
»Sie kennen mich nicht, ich bin ein Waldläufer, der die Pläne des weißen Wolfes erfahren hat und Sie retten will.«
»Doch, ich kenne Sie!«
Der Mann trat einen Schritt zurück, so daß der Mond sein Gesicht voll beleuchtete, und Betty sah in ihr völlig fremde Züge, die sie anlächelten.
Jetzt sprang sie auf, und mit Hilfe des Waldläufers waren bald alle Mädchen geweckt und damit bekannt gemacht, daß diese beiden Männer freundliche Gesinnungen gegen sie hegten, obgleich der eine ein Indianer war.
Während sich die Mädchen bereitmachten, den Weitermarsch anzutreten, unterhielten sich die beiden Männer in einer den Damen unbekannten Sprache, worauf der Weiße zu ihnen trat und sich an Betty wandte, während sich der Indianer mit dem Hunde zu schaffen machte, dessen Kopf in die Hand nahm, streichelte, und dem er fortwährend etwas ins Ohr zu flüstern schien.
»Können die Damen noch eine Stunde schnell laufen?« fragte er.
»Wenn es zu unserer Rettung vor den Apachen nötig ist, kennen wir keine Müdigkeit.«
»Gut, so folgen Sie diesem Hunde, er wird Sie nach einem Platze führen, dem sichersten Ort, den es in diesem Walde gibt. Mein roter Begleiter und ich wollen versuchen, Ihre Verfolger auf eine falsche Spur zu locken.«
Miß Thomson zögerte, ebenso die anderen Mädchen. Sie betrachteten den Hund, der an ihnen herumschnoberte, und dann den Indianer und den Weißen, deren Züge sie in der Dunkelheit nicht erkennen konnten.
»Schnell, entschließen Sie sich!« drängte der Waldläufer »Wir haben keine Zeit zu verlieren.«
Aber Betty war mißtrauisch, sie war schon zu oft getäuscht worden. Und konnten diese Männer, von denen der eine sogar ein Indianer war, die armen Mädchen nicht nochmals in eine Falle locken?
Sie sah in die treuen Augen des Hundes, diese konnten allerdings nicht lügen.
»Wer sind Sie?« fragte Betty.
»Man nennt mich Deadly Dash,« sagte der Waldläufer einfach. »Dieser Indianer hat den Namen Stahlherz bekommen, er gehört keinem Stamme mehr an.«
»Deadly Dash,« rief Betty erstaunt und sah den Sprecher mit großen Augen an. »So sind Sie der ...«
»Genug,« unterbrach sie der Waldläufer. »Trauen Sie mir nun?«
»Ich traue Ihnen!«
»So folgen Sie dem Hunde, er wird Sie sicher führen! Wir stoßen wieder zu Ihnen.«
Stahlherz, der jedenfalls Englisch verstand, war schon hinter den Bäumen verschwunden. Deadly Dash sprang ihm nach, und die Damen sahen sich mit dem Hunde allein, der sofort vorauslief, sich einige Male umsah und die Mädchen so aufzufordern schien, ihm sorglos zu folgen.
Willig schritten ihm diese jetzt nach.
»Wer ist Deadly Dash?« fragte Miß Sargent die nachdenkend vor sich hinblickende Betty. »Kennen Sie diesen Waldläufer?«
»Ich kenne ihn nicht; ich habe vor Jahren, als ich fast noch ein Kind war, viel von ihm erzählen hören. Er soll ein Mann sein, der viel unter den Indianern gelebt hat, und bei einigen Stämmen den Rang eines Häuptling einnimmt. Auch von Stahlherz, seinem Freunde, habe ich sprechen hören. Beide sollen unter den Indianern seiner Zeit Erziehungsversuche gemacht haben, das heißt, sie von ihren ewigen Fehden untereinander abzubringen, und ihnen friedliche Gesinnungen gegen die Weißen einzupflanzen. Ich weiß nicht, ob etwas Wahres daran ist. Dann verschwand Deadly Dash plötzlich, man hörte nichts mehr von ihm, und höchstens die Indianer sprechen noch von ihm, die auf ihn warten. Ist der Unbekannte Deadly Dash, dann sind wir geborgen, ist er es nicht, so ist unsere Lage nicht schlimmer, als vorher. Jetzt still, meine Damen, wir müssen jedes unnötige Gespräch vermeiden. Wir wollen dem Hunde so schnell wie möglich folgen, er scheint den Weg genau zu kennen. Sein Verhalten ist wunderbar.«
Das war es wirklich.
Die Dogge mußte jeden Fußbreit des Waldes kennen. Während die Mädchen immerzu auf Sümpfe und Dickichte gestoßen waren, welche ein Vorwärtskommen unmöglich machten, führte der kluge Hund sie meist geradeaus und brauchte doch niemals umzukehren. Hindernisse schienen mit einem Male nicht mehr zu existieren.
Die Gewehre auf den Schultern, schritten die Mädchen, alle Kraft zusammennehmend, dem Tiere nach, und jedesmal, wenn dieses auf eine vom Mond beschienene Waldblöße kam, wandte es den Kopf und blickte mit seinen klugen Augen die Mädchen an, als wolle es sie zur Eile und zugleich zum Vertrauen auffordern.
Von dem Waldläufer und dem Indianer war die erste halbe Stunde weder etwas zu sehen noch zu hören. Dann aber unterbrach die stille Nacht plötzlich ein schwacher Schall, ganz ähnlich dem Knallen einer Peitsche.
»Das war die lange Rifle des Indianers,« flüsterte Betty, und alle Mädchen senkten unwillkürlich die Büchsen und verlangsamten ihre Schritte, blieben aber wie erstarrt stehen, als diesem Knalle ein gellendes Geheul folgte.

»Die Apachen!«
Ein drohendes Knurren lenkte die Aufmerksamkeit der Mädchen auf den Hund. Dieser blickte sich um, knurrte laut und fletschte die Zähne, aber kaum bemerkte er, daß die Mädchen ihn sahen, als er wieder umdrehte und in einem kurzen Trab in der ersten Richtung weiterlief.
»Er fordert uns zur schnelleren Flucht auf!« rief Betty. »Lassen Sie uns ihm folgen!«
Die Mädchen stürmten dem Tiere nach, und als dieses das erkannte, setzte es sich sogar in Galopp, so daß die Mädchen ihm kaum folgen konnten.
Ein Glück war es, daß sie durch ihre Kleidung nicht gehindert wurden.
Noch einmal erscholl der peitschenähnliche Knall der Rifle. Wieder antwortete ein wüstes Geheul, und die fliehenden Mädchen verdoppelten die Schnelligkeit ihres Laufes.
Sie rannten jetzt in voller Flucht dahin, immer dem Hunde nach, der einen Weg eingeschlagen hatte, auf dem sie kein Straucheln zu fürchten brauchten.
Ueberhaupt änderte sich die Gegend; der Wald lichtete sich, und ab und zu erkannten die Flüchtenden im Mondlicht einen Baumstumpf, kamen sogar einmal an einem abgeschlagenen Baume vorbei, dessen Zweige noch grün waren, der also erst vor kurzem gefällt worden sein konnte.
Man kam in eine Gegend, wo arbeitsame Weiße wohnten.
Neue Kraft durchrieselte die Glieder der Erschöpften. Sie merkten nicht, wie sie nach Atem rangen, sahen sie doch dort zwischen den Bäumen Lichter glänzen, es mußten die Fenster eines Hauses sein.
»Horch,« rief Miß Sargent und mäßigte den Lauf etwas, »ist das nicht eine Menschenstimme?«
Wirklich! Da drang zu ihnen der Gesang einer rauhen Stimme, er mußte aus der Gegend der Lichter kommen:
»Es steht an des Abgrunds Rand, Hinter ihm Apachen jagen ...«
klang es deutlich an ihre Ohren.
Mehr konnten und wollten sie nicht hören, diese Worte führten ihnen die furchtbare Gefahr vor Augen, in der sie schwebten, und schon hatte Lizzard, als er seine Schutzbefohlenen zögern sah, unwillig geknurrt.
Vorwärts ging's, den Lichtern zu, wenn auch die Kniee bald zusammenbrachen und man vergebens nach Atem rang, nur dort konnte jetzt Rettung liegen.
Die Lichter vergrößerten sich immer mehr; schon konnte man erkennen, daß sie aus den Fenstern des Blockhauses strahlten, das auf einer Lichtung stand, noch wenige Sprünge, dann war die Lichtung erreicht.
»Halt, Büchsen hoch,« donnerte ihnen da eine Stimme entgegen, und vor ihnen standen die beiden Männer, die Gewehre im Anschlag und nach der anderen Seite der Lichtung zielend.
Die Mädchen brauchten nicht erst nach den Gründen des Befehles zu fragen, schon erschienen auf der anderen Seite der Waldblöße eine Menge Gestalten, teils zu Fuß, teils zu Pferde, halbnackte Indianer, vom Monde hell beschienen.
Ein gellendes Geheul erschütterte die Luft, aber gleichzeitig krachte die Rifle des Häuptlings. Der vorderste Reiter stürzte, dann krachte eine Salve aus elf Gewehren, dann noch eine, der Schlachtruf verwandelte sich in Wehegeheul, ebenso schnell, wie sie aufgetaucht, verschwanden die Indianer, und dann stürmten die Mädchen, den Weißen an der Spitze, dem Blockhaus zu, dessen Tür sich bald hinter ihnen schloß.
»Deadly Dash,« hatte Joe erstaunt gerufen, Charly aber sprang mit dem Gewehre an der Wange, ebenso wie die anderen, an die offenen Fenster des Blockhauses.
Er sah zum ersten Male einen Waldläufer, der ihm an Größe und Starke glich, einen Rivalen, auf den er eifersüchtig hätte sein können, wenn er nicht den Namen Deadly Dash getragen hatte.
»Stahlherz, Lizzard!« erscholl gleich darauf der Ruf des Revolver-Bill. »Hurrah, Jungens, jetzt wollen wir ihnen einen warmen Empfang bereiten. Deckt Euch, Mädels,« rief er dann diesen zu, die einen Augenblick ratlos dagestanden hatten, und kaum waren sie dicht an die Wand gesprungen, oder hatten sich auf den Boden geworfen, als ein Kugelregen gegen die Stämme prasselte. Einige Geschosse fanden auch den Weg durch die Fenster und gruben sich harmlos in die gegenüberliegende Wand ein.
Der springende Panther war mit seiner Truppe am Horizont verschwunden. Die chilenischen Dragoner waren den Fluß stromaufwärts geritten, bis auch sie aus dem Gesichtskreis der Engländer kamen, und auch Don Alappo war mit den ausgelieferten Mädchen nach der Heimat aufgebrochen.
Die Engländer, Hannes und Hope blieben noch am Strome. Sie verbrachten einen frohen Nachmittag und Abend, und am anderen Tage verabschiedeten sie sich von den Indianern, die sie mit reichen Geschenken entließen.
Juba Riata und Don blieben bei ihnen, sie wären schon Nick Sharps wegen nicht gegangen, denn selbst der mürrische Juba war nicht zu stolz, sich fortwährend mit dem Detektiven zu unterhalten. Glaubte er doch, alle seine Erfolge hätte dieser ihm, Juba, zu verdanken.
Eine unangenehme Aufgabe war es, den Strom zu durchschwimmen, aber es half nichts, man mußte eben ein unfreiwilliges Morgenbad nehmen.
Kurz vor der Ueberschreitung des Flusses zeigte es sich, daß Charles Williams zwar sehr schlau war, daß aber andere Leute ebenso schlau waren wie er.
Im Karrenwagen befanden sich die sieben braunen Mädchen, denen sich beim Passieren von Flüssen Hope beigesellte.
Die vier vorgespannten Pferde wurden von einem Spanier gelenkt, der mit solchen schwierigen Reisen völlig vertraut war.
Als alle Platz genommen hatten, die Engländer auf den Pferden, die Frauen im Wagen, und der Rosselenker sich nun auch mit seinen Gäulen zu schaffen machte, fragte Charles nach Hannes und fand diesen zu seinem Erstaunen im Wagen mitten zwischen den Weibern sitzen.
»Nanu,« rief Charles, »Sie haben es sich aber hier gemütlich gemacht.«
»Schaffen Sie sich erst eine Frau und sieben Mädchen an, dann können Sie es auch so bequem haben,« lachte Hannes.
»Wollen Sie denn auf dem Wagen den Strom passieren?« sagte Charles.
»Natürlich, wie immer. Ich bin nämlich etwas wasserscheu, und zweitens kann ich auf einem schwimmenden Pferde nicht sitzen, ich verstehe es nicht zu leiten.«
»Haben Sie nicht noch einen Platz für mich auf dein Wagen? Ich bin auch etwas wasserscheu.«
»Tut mir leid, der Wagen kann gerade acht Passagiere und den Kutscher tragen. Einmal mußte ich auch nebenher schwimmen, seit ich aber den Sack Tabak verschenkt habe, ist auch bequem Platz für mich. Umsonst gab ich dem springenden Panther kein solches Geschenk.«
»Sie sind ein Egoist,« sagte Charles und ritt zu Sharp, dem Leiter der Expedition.
»Mister Sharp,« wandte er sich an denselben. »Wo rangieren Sie beim Passieren des Stromes den Wagen ein, hinten oder vorn?«
»Hinten, und ich bleibe bei ihm, denn die Partie geht nicht immer glatt von statten.«
»Dann taugt der Kutscher nichts.«
»Oho, der Kerl fährt wie der Teufel.«
»Bah,« sagte Charles, »Sie sollen mich einmal fahren sehen. Wetten Sie mit mir, daß ich mit dem Wagen ebenso schnell wie die anderen auf den Pferden, hinüberkutschiere?«
»Das ist nicht möglich.«
»Doch, das wäre schlimm, wenn vier Pferde, die gut schwimmen, und die vor allen Dingen einen guten Lenker haben, nicht ebenso schnell mit einem Wagen schwimmen, wie mit einem Reiter. Na, Mister Sharp, was gilt die Wette?«
Der Detektiv warf dem Sprecher einen merkwürdigen Blick zu und sagte:
»Gut denn, es gilt zehn Pfund! Wenn ich nicht ein anständiger Mensch wäre, würde ich um mehr wetten, denn ich weiß doch, daß Sie verlieren.«
»Angenommen! Zehn Pfund!«
Brummend stieg der Kutscher vom Wagen und setzte sich auf Williams' Pferd, während dieser Peitsche und Zügel ergriff und auf dem hohen Bock Platz nahm, überglücklich, diesmal trockenen Fußes durchs Wasser zu kommen. Wie wollte er nachher seine nassen Freunde auslachen!
»Dem Klugen gehört die Welt, nicht allein dem Tapferen,« dachte Charles, als er die Pferde antrieb.
Neben ihm ritt Sharp.
Die Räder des Wagens sanken tief ein, als sie das Strombett herunterrollten, dann aber begann er zu schwimmen, und lustig ließ da Charles die Peitsche über den Köpfen seiner Pferde knallen, die den Wagen zogen.
Aber der Wagen blieb bald hinter den Reitern zurück.
»Sehen Sie, Sie haben verloren,« spottete Sharp, »die zehn Pfund gehören mir.«
»Wirklich, ich habe mich getäuscht,« entgegnete Charles, sich betrübt stellend, »glaubte, die Gäule schwammen schneller, als unter den schweren Reitern.«
Die Fahrt ging weiter, und Sharp hielt sich besonders am Hinteren, offenen Teil des Wagens auf, wo er mit Hannes sprach.
Die Reiter hatten schon das jenseitige Ufer erreicht, als der Wagen noch ein Stück zu schwimmen hatte, schließlich bekamen aber auch erst die Zugpferde, dann die Räder Grund.
»Ich habe die zehn Pfund gewonnen,« sagte Sharp nochmals, »Sie haben sich bedeutend verspätet.«
»Ist mir ganz gleichgültig,« lachte Charles fröhlich, »für die zehn Pfund bin ich wenigstens ...«
Da, ein Ruck, der Wagen sank etwas ein, Charles gab den Pferden die Peitsche, sie zogen noch einmal an, der Wagen sank noch tiefer und stand. Die Räder hatten sich in dem schlammigen Flußbett eingegraben.
»Nun müssen wir das Fahrzeug flott machen,« sagte Sharp gemütlich, stieg vom Pferde ins Wasser und band es an den Wagen. »He, Kutscher, abgestiegen vom Bock und angefaßt.«
»Sie sind wohl verrückt,« lachte Charles, machte aber doch ein verblüfftes Gesicht, »wozu sind denn die Leute da?«
»Die sind schon weit weg. Abgestiegen und den Wagen ans Ufer gezogen.«
»Fahren Sie mich nicht so an,« entgegnete Charles, dem es doch etwas unbehaglich wurde, »ich bin Ihr Kutscher nicht. Rufen Sie die Leute zur Hilfe herbei.«

»Ich bin Ihr Kutscher nicht,« sagte Charles.
»Rufen Sie die Leute zur Hilfe herbei.«
»Kein einziger faßt den Wagen an,« sagte Sharp. »Der Kutscher ist verpflichtet, den Wagen immer durch die Flüsse zu schaffen, und Ihr Vorgänger ist bis jetzt seinen Verpflichtungen stets ohne Murren nachgekommen.«
»Ich bin aber kein Kutscher.«
»Sie haben dessen Rolle übernommen, müssen sie also weiterspielen.«
»Ich finde auch, daß Sie im Unrecht sind,« mischte sich jetzt Hannes ein.
»Springen Sie doch ins Wasser,« sagte Charles, »und helfen Sie schieben.«
»Wie können Sie so etwas von mir verlangen,« fuhr Hannes fast heftig auf. »Bin ich etwa als Kutscher engagiert? Sie haben sich uns aufgedrungen, und nun ist es Ihre verfluchte Pflicht und Schuldigkeit, daß Sie den Wagen auch hinüberbringen.«
»Still, still, Hannes,« beschwichtigte Hope ihren Gatten, »nicht gleich so aufgeregt sein! Sir Williams ist ein Mann von Wort und wird uns nicht im Stiche lassen, wenn er des Kutschers Stelle eingenommen hat. Er tut nur so, als ob er zögere, um uns in Verlegenheit zu bringen.«
»Bitte sehr, Gnädigste, ich habe durchaus nicht die Absicht, bis an den Hals ins Wasser zu springen,« entgegnete Charles, wurde aber plötzlich von einer Purpurröte übergossen.
»Nicht?« sagte Hope gedehnt und zog ein langes Gesicht. »Ja, was soll man davon denken? Gut denn, so wissen wir uns ein anderes Mal danach zu richten. Bitte, lieber Hannes,« wandte sie sich an diesen, »bringe du uns aus der Verlegenheit, in die wir durch diesen Herrn gekommen sind.«
»Himmel, Hagel, und Hahnenschwänze,« schrie Charles, »da hört sich doch alles auf.«
Patsch, war er im Wasser und sank, ebenso wie Sharp, bis an die Hüften ein.
»Jetzt angepackt,« rief dieser, während Hannes die Zügel ergriff, »eins — zwei — ja, wo fassen Sie denn an? So bringen Sie den Wagen nie von der Stelle.«
Charles warf einen Blick nach der anderen Seite und sah, daß Sharp sich gebückt hatte, um die Räder packen zu können, wodurch er natürlich bis an den Hals ins Wasser kam.
Charles war in Verzweiflung.
»Tiefer, tiefer,« rief Hope von oben herab, »so, so ist es recht, nun kräftig schieben!«
Dann wandte sie sich schnell ab und bedeckte sich den Mund mit dem Taschentuch, damit der nur mit dem obersten Teile seines Gesichtes aus dem Wasser sehende Charles ihr Lachen nicht hören könnte.
Hannes trieb die Pferde an, Sharp und Williams schoben die Räder, und nun hatte der Wagen bald das trockene Ufer erreicht.
Jetzt konnten sich weder Hope, noch Hannes mehr halten. Aus vollem Halse lachend, sprangen sie vom Wagen herab und betrachteten Charles, der diesmal nicht so wie sonst nur den Unterkörper naß bekommen hatte, wenn er auf dem Pferde ein Gewässer passierte, sondern dem sogar das Wasser in den Halskragen hineingelaufen war.
»Jawohl, nun lachen Sie mich auch noch aus,« rief Charles, der auf dem besten Wege war, wirklich ärgerlich zu werden. Da aber jetzt selbst Sharp in Lachen ausbrach und Charles nie ernst bleiben konnte, wenn alles lachte, so stimmte er schließlich mit ein.
»Das war ein teures Bad, mein lieber Sir Williams!« sagte Sharp.
»Wieso teuer?«
»Nun, zehn Pfund haben Sie auch noch an mich verloren! Sie haben die Wette verspielt.«
Das Gelächter wiederholte sich.
»Ich will Ihnen die Wahrheit gestehen,« erklärte Hannes ihm, als er sich etwas beruhigt hatte. »Sonst machen wir die Geschichte nämlich anders. Neben uns schwimmen immer einige Reiter, und wenn dann der Wagen stecken bleibt, so werden die Pferde einfach vorgespannt. Sie wollten nun aber trocken hinüberkommen. Hätten Sie uns das gesagt, so wäre vielleicht für Sie Platz im Wagen gewesen, indem Sie oder ich den Kutscher vertreten hätten. Sie machten aber Umschweife und arrangierten zuletzt eine Wette, um mit List auf den Wagen zu kommen. Das wollten wir bestrafen und ließen Sie ins Wasser springen.«
»Schön war das nicht von Ihnen,« sagte Charles. »Mich freut nur, daß Mister Sharp auch seine Portion geschluckt hat.«
»Ach, was macht das bei dem aus,« lachte Hope, »der springt wegen jeder Kleinigkeit ins Wasser!«
»Wissen Sie, Gnädigste,« nahm wieder Charles das Wort, »ich wäre überhaupt nicht ins Wasser gegangen, weil ich den Spaß schon merkte, den Sie mit mir vorhatten, aber ich las in ihren Augen das glühende Verlangen, mich ins Wasser springen zu sehen, und dem konnte ich nicht widerstehen. Wünschen Sie, daß ich noch einmal hineinspringe? Zu jeder Zeit, Tag oder Nacht, Sommer oder Winter, bin ich bereit, für Sie eine Schwimmtour zu machen, und ginge es unter Eisschollen hinweg. Soll ich?«
Charles machte Miene, sich mit einem Kopfsprung nochmals ins Wasser zu stürzen, wurde aber natürlich von Hope davon zurückgehalten.
»Nein, nein, Sir Williams, solche unmenschliche Forderungen stelle ich an niemanden und am allerwenigsten an Sie. Da Sie nun aber einmal so gern auf dem Wagen sein möchten, so erlaube ich Ihnen, diesen Vormittag in meiner und der anderen Damen Gesellschaft zu verbringen. Tröstet dieses Anerbieten Sie für Ihr Bad?«
Charles war zufrieden. Eine Stunde später saß er in getrockneten Sachen neben Hope und den braunen Mädchen und unterhielt sie, daß ihnen die Zeit wie im Fluge verging, denn eine Reise durch die Pampas ist nicht eben interessant zu nennen. Auch Hannes hielt sich im Wagen auf, er bestieg überhaupt nur ein Pferd, wenn es unbedingt nötig war.
Es war schon gegen Nachmittag, als der neben dem Wagen reitende Don — der Wagen hielt die Spitze des Zuges — die Insassen auf einen Schwarm Vögel aufmerksam machte. Da die Entfernung noch eine weite war und man die Vögel doch schon deutlich erkennen konnte, mußten es sehr große sein. Sie bewegten sich auf dem Boden hin und her, flatterten manchmal auf und schienen sich um etwas zu streiten.
»Geier,« sagte Don.
»Aasgeier,« fügte Juba hinzu, »sie müssen Beute haben, sonst würden sie sich nicht streiten.«
Als der Wagen hinzukam und die Vögel, welche sich nur widerwillig und unter schauderhaftem Krächzen von ihrem Fräße trennen konnten, aufgeflattert waren, bot sich den Reisenden ein entsetzlicher Anblick dar.
Wenigstens zwanzig Leichen bedeckten den Grasboden, und alle trugen die chilenische Dragoneruniform mit Ausnahme eines einzigen — eines Indianers. Die Körper waren von den Vögeln schon halb aufgefressen worden, aber noch konnte man erkennen, daß ihnen allen die Kehle durchschnitten war.
Juba Riata zahlte die Leichen und sagte dann ernst:
»Der springende Panther versteht, nicht nur mit Indianern zu kämpfen, das hat er hier gezeigt. Einundzwanzig Dragoner und ein Indianer.«
»Sie werden diese Nacht im Lager überfallen worden sein,« meinte Don. »Sie wurden überrascht, sonst hätten die Indianer keine Zeit gehabt, den Feinden die Kehle zu durchschneiden.«
Ja, hätten die Leichen erzählen können, wie diese Nacht plötzlich der Kriegsruf der Penchuenchen erschollen war, und wie einige von ihnen nicht mehr zum Leben erwachten, sondern aus dem Schlafe in den Tod übergingen!
Noch waren unsere Freunde nicht viel weiter geritten, als sie abermals auf Leichen von Dragonern stießen. Der springende Panther hatte sich also nicht weit verfolgen lassen, sondern war selbst zur Offensive übergegangen. Daß übrigens keine toten Indianer zu sehen waren, ließ nicht schließen, daß die Dragoner ihre Schüsse immer vergebens abgefeuert hätten. Die Penchuenchen suchen ihre Toten stets mit sich zu bekommen, um sie auf ihren Begräbnisplätzen zu bestatten.
Gegen Abend bog Juba seitlich ab, wo sich in der Ferne Hügel erhoben. Auf diesen mußte eine Quelle entspringen, und dort sollte für die Nacht das Lager aufgeschlagen werden, denn Wasser ist das Hauptbedürfnis für eine Karawane, sie lagert nie, wenn sie solches nicht wenigstens in der Nähe weiß.
Die vorausreitenden beiden Pampasjäger hatten die Quelle bald gefunden, welche nach Osten abfloß, ein Zeichen, daß man sich schon der Küste näherte, also nicht weit vom Ziel entfernt sein konnte.
Don und Juba waren von den Pferden gesprungen und bückten sich auf den Boden nieder. Die Näherkommenden glaubten, sie tränken aus der Quelle, aber trotz der anbrechenden Dunkelheit hatte der scharfsichtige Sharp schon erkannt, daß sie sich mit einem Gegenstande beschäftigten, und welcher Art dieser war.
»Schon wieder eine Leiche,« rief er, und sprengte zu den Jägern.
Nicht weit von der Quelle entfernt, lag sie, vollkommen von vierbeinigen und geflügelten Raubtieren aufgefressen. Nur das Skelett war übrig geblieben und wenige Kleidungsstücke, welche zerrissen und mit Blut getränkt, umherlagen. Nur so viel konnte man noch an ihnen erkennen, daß der Tote keiner der Dragoner gewesen war; es waren spanische Kleidungsstücke, ein Poncho, eine Serape und so weiter.
Auch Sharp sprang vom Pferde und untersuchte zuerst das Skelett.
»Auch dieser ist keines natürlichen Todes gestorben,« rief er, »eine Rippe ist zerschmettert, während die anderen heil sind oder nur von den Zähnen der Raubtiere gelitten haben. Aber hier, was ist das?«
Er zog sein Messer und bohrte damit in die Wirbelsäule hinein, worauf er ein kleines Stückchen Blei hervorbrachte.
»Hei, ist das nicht eine kleine Revolverkugel?« sagte er, sie kopfschüttelnd betrachtend. »Fast wie die Kugel aus einem Kinderteschin.«
»Oder von einem Damenrevolver,« meinte die hinzugetretene Hope. »Ich hatte einmal einen, welcher auch nur erbsengroße Kugeln schoß.«
Sharp blickte zu Don hinüber, der die von Blut starrende Serape in der Hand hielt und leise mit Juba Riata sprach.
»Wir wissen,« sagte Don, »wem dieses Gerippe gehörte, es war Fernando, der Verwalter von Don Alappo. Wir erkennen das deutlich aus der Schärpe, die seinen Namenszug trägt, und aus den Stiefeln, welche inwendig mit rotem Leder gefüttert sind.«
Grausend hörten die Engländer diese Mitteilung. So war also der, durch dessen Hilfe sie mit hierhergelockt worden waren, seiner Strafe nicht entgangen. Sie kamen zu spät.
Aber wo war seine Begleiterin?
»Dann stammt diese Revolverkugel auch aus dem Revolver des Weibes,« rief Sharp, »sie hat ihn erschossen und wie ein wildes Tier hier liegen lassen.«
»Aber aus welchem Grunde?« fragte Hope.
»Weiß es nicht,« entgegnete Sharp, »hoffen wir, die Person lebendig zu bekommen, dann wird sich dieses Rätsel lösen und wohl auch manches andere mehr.«
Das Gerippe wurde bestattet, so gut es die Verhältnisse erlaubten. Man legte es in ein mit Messern gegrabenes Loch, eben groß genug, um es aufzunehmen, und schüttete Erde darüber.
Mit den gefundenen Dragonerleichen hatte man dies nicht vorgenommen. Wenn sich nicht einmal die eigenen Kameraden ihrer annahmen, da doch selbst die Indianer um ihre Toten besorgt waren, warum hätten sie sich der Arbeit unterziehen sollen, die einen Tag in Anspruch genommen hätte?
Dann schlug man abseits von der Unglücksstätte ein Lager auf und verbrachte noch einige Stunden in ernsten Gesprächen. Der Tag war nicht geeignet gewesen, Frohsinn für die Abendstunden zu erzeugen.
»Wie weit haben wir noch bis nach Buenos Ayres, Juba?« fragte Harrlington den Jäger.
»Etwa zweihundert Meilen.«
»Ah,« riefen die Herren erstaunt. Sie hatten nicht geglaubt, ihrem Ziele so nahe zu sein.
»Die können wir in drei bis vier Tagen zurücklegen,« sagte Charles. »Uns hindert jetzt ja weder Gepäck noch sonst etwas. Der Wagen fährt in der Stunde acht Meilen.«
»Das könnt Ihr wohl,« entgegnete Juba. »Der Weg ist gut, Ihr könnt immer traben. Mich aber werdet Ihr morgen früh nicht mehr sehen, ich trete aus Euren Diensten.«
»Warum?« riefen die Herren bestürzt.
»Und mich auch nicht,« fügte der Detektiv hinzu. »Mein Freund Juba und ich werden morgen früh bei Zeiten allein aufbrechen, um die Spur dieses Frauenzimmers und dieses selbst zu finden.
»Nein, nein,« sagte er, als man ihn zum Bleiben und Vergessen der angeblichen Miß Petersen, die ihnen jetzt gleichgültig war und nicht mehr schaden konnte, überreden wollte. »Mein Vorsatz ist unerschütterlich. Die Festnahme der Dame ist für mich wichtig. Auch schlage ich jede Begleitung ab, aber ich werde Sie wieder treffen, wenn nicht in Buenos Ayres, so doch auf dem Wege nach Nordamerika. Auch mich ruft die Pflicht dorthin. Wenn Sie die Vestalinnen begrüßen, werde ich sicher dabei sein und mich Ihrer glücklichen Gesichter freuen.«
Sharp war fest, er ließ sich den Plan nicht ausreden, das wußte man.
Juba hatte bei dem Engagement als Führer nichts von seinem Gehalt erwähnt, und als ihn jetzt Harrlington darum fragte, wurde der ehrliche Jäger ordentlich verlegen.
Er forderte eine Kleinigkeit, Harrlington gab ihm das Dreifache davon, und sonderbar war es, mit welch zitternden Händen und blitzenden Augen, aus denen die Begierde sprach, der Jäger die wenigen Goldstücke in Empfang nahm. Sein Benehmen war rätselhaft.
»Der Teufel dank's Euch, daß Ihr mir so viel Geld gebt,« sagte er und ließ dasselbe in einem Winkel seines alten Lederhemdes verschwinden, »besser wäre es, Ihr hättet es ins Wasser geworfen. Dank bekommt Ihr von mir nicht.«
»Aber was habt Ihr denn?« fragte Harrlington verwundert; auch die übrigen Beiwohner dieser Szene zogen erstaunte Gesichter; nur Don und Sharp lächelten, während Juba so grimmig aussah, als wollte er Harrlington zum Danke für seine Gabe totschlagen und auffressen.
Juba hatte dem Lord schon den Rücken gekehrt und wollte hinausgehen, jetzt aber drehte er wieder um, trat dicht vor Harrlington hin und legte ihm die Hand auf die Schulter.
»Hört, Mann,« begann er, »bin ich Euch ein ehrlicher Führer gewesen?« fragte er.
»Ihr wäret es,« entgegnete der Lord.
»Habe ich Euch einmal betrogen?«
»Nein.«
»Glaubt Ihr, daß ich mein Herzblut hergegeben hätte, um Euch dadurch zu retten?«
»Ich glaube es.«
»Bin ich nicht ein ganz hübscher, stattlicher Kerl?« fragte der Mestize weiter, reckte seine knochige Gestalt höher empor und schnitt eine Grimmasse.
»Wahrhaftig, das seid Ihr,« lächelte Harrlington, und die anderen stimmten ihm bei.
Jetzt zog der Mestize wieder ein finsteres Gesicht.
»Seht Ihr, Ihr seid mit mir zufrieden, und ich bin es selbst. Nun gehe ich noch auf ein paar Tage mit Sharp, dann aber reite ich wieder nach der Küste, und was meint Ihr, was ich dann mit Eurem Gelde tun werde?«
»Auf die Sparkasse bringt Ihr es wahrscheinlich nicht,« warf Chaushilm dazwischen.
»Versaufen tue ich es,« donnerte Riata den zurückfahrenden Marquis an, »und ich höre nicht eher auf, als bis der letzte Dollar durch die Kehle gejagt ist. Dann solltet Ihr einmal Juba Riata sehen, wenn er kein Geld mehr hat, er stiehlt, was er kann, er lügt, er betrügt, nur um mehr Geld zu bekommen, ja, es kommt ihm nicht einmal darauf an, einem die Kehle zu durchschneiden, wenn derselbe Geld bei sich hat. Und daran seid Ihr schuld, Fremder,« wandte er sich wieder an Lord Harrlington, »hättet Ihr mir nicht das verfluchte Geld gegeben, dann wäre Juba Riata ein ehrlicher Kerl geblieben, so aber wird er zum Spitzbuben, bis er endlich wieder zur Besinnung kommt.«
»Aber Juba,« rief Harrlington verblüfft, »ich muß Euch doch das auszahlen, was Ihr durch ehrliche Arbeit verdient habt?«
»Ein anderer erkläre Euch, warum ich fürchte, daß Ihr mit daran schuld seid, ich kanns nicht,« sagte Juba jedoch und verließ das Zelt.
Mit sehr gemischten Empfindungen sahen ihm die Zurückbleibenden nach.
»Er scheint zu denen zu gehören, die ihr ganzes Leben lang einen Vormund brauchen,« meinte Charles.
»Jammerschade um diesen Kerl! Könnte man ihn nicht bereden, daß er das Geld einem vernünftigen, ehrlichen Manne zum Aufheben gibt?«
»Versuchen Sie es einmal,« lachte Sharp. »Machen Sie ihm nur einmal den Vorschlag, und Sie sollen sehen, daß keine Löwin ihr Junges grimmiger verteidigt, als Juba das Geld. Er hat recht, es ist sein Unglück, es bringt ihn immer mehr herunter. Er wäre schon lange ein verworfener Mensch, wenn er in der einsamen Pampas nicht immer wieder zur Besinnung käme. Wenn die Sache nicht so ernst wäre, könnte man vielleicht über einige seiner Streiche lachen, die er ausführt, um Geld zu erhalten, wenn er einmal im Trinken ist. Seine letzte Frau, die er wirklich liebt, hat er bereits viermal verkauft und viermal unter Tränen wieder eingelöst, seine erste Frau ist ihm überhaupt nur ein Pfandobjekt. Ich kalkuliere, in einer Woche wird er seine Lieblingsfrau zum fünften Male an jemanden verkaufen, und possierlich ist es dann, wenn der sonst so bärbeißige Kerl dabei weint wie ein kleines Kind.«
Auch diese Auseinandersetzung trug nicht dazu bei, die Gemüter heiterer zu stimmen. Die wenigen Wachen wurden schnell abgeteilt. Man sollte sich aller Stunden ablösen, und dann begab man sich zur Ruhe, hoffend, daß der nächste Tag wieder die gewöhnliche, heitere Stimmung brachte.
Aber die Nacht sollte den Lagernden noch manche schreckliche Szene bereiten.
Die zweite Wache wurde abgelöst, auf der rechten Seite des Lagers schritt Sir Hendricks langsam hin und her, zum Schutze gegen die Kälte der Nacht in eine Decke gehüllt, das Gewehr unter dem Arm und pfiff leise ein schwermütiges Liedchen vor sich hin.
Seine Stunde war bald zu Ende, als er plötzlich Pferdegetrappel zu vernehmen glaubte. Wie er es während der Weltreise schon öfters von in der Wildnis lebenden Menschen gesehen hatte, legte auch er das Ohr auf den Boden, weil die Erde die Schallwellen besser fortpflanzt als die Luft, wenn das Geräusch auf ihr erzeugt wird, und jetzt vernahm er dasselbe ganz deutlich.
Wie ausgemacht, weckte er erst Juba und Don, dann Harrlington, und alle drei Männer standen bald neben ihm. Ihnen gesellte sich noch Nick Sharp zu.
»Zwei bis drei Reiter, sagte Juba sofort. »Löscht die Feuer mit Wasser.«
Die wenigen Feuer, welche im Verglimmen lagen, wurden ausgelöscht.
»Sie kommen hierher,« fuhr der lauschende Juba fort, »es sind keine — halt,« unterbrach er sich, sprang zu Hendricks, der eben das letzte Feuer ausgießen wollte, riß ihm den Eimer aus der Hand und warf noch mehr Holz nach, »es sind keine Indianer, ich höre es jetzt deutlich, die Pferde haben Hufeisen unter den Füßen. Es sind Dragoner.«
»Dragoner?«
»Dragoner. Verirrt oder von den Indianern versprengt. Ich glaube das letztere.«
Das Feuer wurde zu höherem Aufbrennen gebracht, denn wenn sich fliehende Männer ihrem Lager hilfsbedürftig näherten, so sollten sie Schutz erhalten; und wenn alle Indianer der Pampas ihnen nachsetzten, die Engländer waren gewillt, sie gegen diese Feinde zu verteidigen.
Die Soldaten kämpften gegen die Indianer, weil sie dafür bezahlt wurden. Waren sie flüchtig, dann waren sie unschädlich, und ihr Leben sollte geschont werden.
Zwei Reiter tauchten in der Finsternis auf; die Gäule konnten sich kaum noch aufrecht halten, die Männer schwankten in den Sätteln, besonders der eine.
»Halt, wer da?«
»Von den Indianern Verfolgte. Nehmt uns auf, wenn Ihr Menschen seid, oder wir sterben!« kam es stöhnend von farblosen Lippen.
Don fing einen der Reiter auf, der bewußtlos aus dem Sattel stürzte. Um den Kopf hatte er ein Taschentuch gebunden, aber es vermochte nicht den roten Lebensquell aufzuhalten, welcher darunter hervordrang.
Der andere fiel mehr, als er sprang vom Sattel, obgleich er keine Verletzung hatte. Er stürzte vor Erschöpfung zu Boden, und neben ihm sein Pferd.
»Die Penchuenchen,« ächzte er, »haben die Unseren — fast alle — getötet.«
»Alle?« rief Harrlington entsetzt.
In diesen« Augenblick fiel ihm der Offizier ein, mit dem er einst freundschaftlich verkehrt hatte. Mister Gray.
»Fast alle — wir wurden — diese Nacht angegriffen und — zersprengt.«
»Wo sind Eure Kameraden?«
»Ich — weiß es nicht.«

Jetzt war keine Zeit zu weiteren Fragen.
Das Lager wurde alarmiert,« der Verletzte kam in die Behandlung John Davids', und der Erschöpfte, dessen Besinnung manchmal schwand, wurde durch Erfrischungen gestärkt und zur Ruhe gebracht.
Es stand zu erwarten, daß sich noch mehr Versprengte in den Pampas umhertrieben, um so mehr, als Juba seine Meinung dahin aussprach, der springende Panther würde wohl schwerlich die Besiegten verfolgen. Einmal liebe er das unnütze Blutvergießen weniger, als es sonst die Art von Indianern sei, er wisse die Grausamkeit seiner Krieger zu zügeln und sei stolz auf diese Tugend, und ferner wolle er mit seinem Stamme einem entfernten Ziele zureisen, um Rache an anderen Indianern zu nehmen, welche ihnen Pferde gestohlen hatten.
»Jetzt ist es aber mit dem springenden Panther vorbei,« schloß Juba kopfschüttelnd. »Die chilenische Regierung läßt nicht nach, bis er seine Strafe empfangen hat. Sie findet genug Krieger unter den Amerikanern, welche gegen eine entsprechende Belohnung nicht eher ruhen werden, als bis sie den springenden Panther und seine Krieger vernichtet haben. Sie bedienen sich dabei teuflischer Mittel. Armer Kerl! Und ich? Ich habe von jetzt ab einen weiten Weg, wenn ich meine Frauen besuchen will.«
»Und versetzen kannst du sie auch nicht mehr,« wollte Charles hinzufügen, aber er verschluckte diese Worte, weil sie jetzt nicht passend waren.
Es wurden mehrere große Feuer angezündet — Holz gab es hier in der Nähe der Quelle im Ueberfluß — damit die Versprengten von ihnen angezogen würden. Man fühlte Mitleid mit den armen Menschen, die sich für ihren geringen Lohn den Lanzenspitzen und den Bolas der Penchuenchen aussetzen mußten. Hatten sie sich auch aus eigenem Willen anwerben lassen, man konnte sie doch mit den Worten entschuldigen: Soldaten müssen sein. Waren sie es nicht, so waren es eben andere.
Die Feuer taten ihre Wirkung.
Immer mehr kamen sie heran, die gestern noch so schmuck aussehenden und froh blickenden Dragoner, jetzt verwundet und oft so zugerichtet, daß der Tod nicht abzuwenden war, oder bis zum Tode erschöpft.
Die Lanzen der Penchuenchen, die todbringenden Bolas und die Bleikugeln hatten furchtbar unter ihnen gewütet. Es dauerte lange, ehe man von den Kräftigsten erfuhr, wie sich alles zugetragen hatte.
Die Dragoner waren schon, wie Juba vorausgesagt, beim Uebergang über den Strom dezimiert worden. Als die Vordersten das Ufer fast erreicht hatten, sausten plötzlich aus dem hohen Grase des Ufers die Bleikugeln hervor, welche ihr Ziel nie verfehlten, sondern immer gerade zwischen die Augen trafen und den Schädelknochen zerschmetterten.
Die Dragoner waren nicht unerfahren im Kampfe, mit den Indianern, ebenso wußten ihre Offiziere sehr wohl vorher, daß der Uebergang nicht glatt von statten gehen würde. Es galt nur, das Ufer so schnell wie möglich zu erreichen, und die versteckten Penchuenchen, welche dann die Flucht ergriffen, zu erschießen.
Das Ufer war erreicht, aber man sah weder Indianer noch Pferde, sondern nur die Spuren von ersteren im Grase. Das Ufer wurde abgesucht, ohne etwas zu finden. Endlich entdeckte man am Horizont eine flüchtende Reitertruppe. Sie wurde verfolgt. Stunde auf Stunde verrann. Immer mehr näherte man sich ihr, als man aber bis auf Schußweite herangekommen war und die Dragoner nach den Karabinern griffen, jagten die Reiter wie der Wirbelwind davon.
Durch den wilden Ritt durstig geworden, suchten die Dragoner die nächste Quelle auf. Hier war ihnen ein Hinterhalt gelegt worden. Zwischen den Hügeln befanden sich unsichtbare Feinde, die Bleikugeln auf sie herabregnen ließen, während man doch keinen einzigen von ihnen zu Gesicht bekam.
Während der ersten Nacht schlichen sich auf rätselhafte Weise einige Penchuenchen in das Lager, richteten ein Blutbad unter den Soldaten an und flohen. Dragoner wurden ihnen nachgeschickt, doch kehrte keiner von diesen zurück, sie wurden von auf der finsteren Prärie verborgenen Indianern umzingelt und bis auf den letzten Mann niedergemacht, ehe aus dem Lager Hilfe gesandt werden konnte.
Doch dies waren nur Plänkeleien gewesen. In der zweiten Nacht erst machten die Penchuenchen auf die bereits schon völlig erschöpften Dragoner einen ernsthaften Angriff.
Unter gellendem Kriegsgeheul kamen sie angesprengt. Die Dragoner glaubten nicht anders, als der ganze Stamm käme ihnen entgegen. Sie griffen nach den Karabinern und eilten alle nach der betreffenden bedrohten Seite des Lagers, erkannten dann aber plötzlich mit Entsetzen, daß sie nur eine Herde Pferde vor sich hatten, auf denen einzelne Reiter saßen. Doch schon fielen ihnen die Penchuenchen, vom springenden Panther geführt, in den Rücken, und im Handumdrehen waren sie überwältigt.

Unter Kriegsgeheul kamen die Penchuenchen angesprengt.
Wer nicht dem Tode zum Opfer gefallen war, suchte sein Heil in der schleunigsten Flucht, und glücklicherweise gaben die Penchuenchen nach kurzer Zeit die Verfolgung auf.
Das Feuer hatte dreiundzwanzig Mann angelockt, der Rest von hundertvierzig Mann, die drei Offiziere waren nicht unter dem Häuflein der Geretteten.
»Wo ist Oberst Gray?« fragte Harrlington, als man so viel aus den Erschöpften herausgebracht hatte.
»Ich sah ihn zuletzt, wie sein Pferd, dem ein Indianer die Sprunggelenke durchschnitten hatte, unter ihm zusammenbrach,« entgegnete ein Soldat. »Neben ihm stand ein anderer Offizier und verteidigte ihn mit dem Säbel.«
So war also auch er geblieben.
Es kamen lange Zeit keine neuen Dragoner mehr; nicht alle mochten das flackernde Feuer, das ihnen Hilfe versprach, erblickt haben. Diese Leute wußten, daß ein großes Feuer nur von Weißen herrühren konnte, denn die Indianer machen nur ganz kleine Feuer an, um ihren Lagerplatz nicht zu verraten.
Dann aber hörte man noch einmal die Hufschläge eines Pferdes, schwer und schleppend, man eilte ihm entgegen und brachte ein Roß mit zwei Reitern ins Lager geführt.
Es war ein Dragoner, und in seinen Armen hielt er den bewußtlosen Oberst Gray.
Der Oberst war entsetzlich verwundet. Als er vom Pferde in die Arme Harrlingtons glitt, seufzte er noch einmal tief auf, ein krampfhaftes Zittern überlief seinen Körper, die Hände krallten sich in Harrlingtons Arm, und dieser hielt eine Leiche.
Es war eine grausige Nacht für die Engländer. Mit dem Schlaf war es sowieso vorbei. Man brachte die Verwundeten und Ermatteten unter und begrub die, welche ihnen unter den Händen gestorben waren, auch Oberst Gray.
Dann wurde beraten, was zu tun sei.
Don erbot sich, in schnellster Karriere nach der Küste zurückzureiten und Militär herbeizuholen, welches die Soldaten in Sicherheit brachte, während die Engländer hier seiner warteten.
Sharp wollte trotzdem seine Suche nach dem Weibe beginnen, hoffte aber nun mit den Herren in Buenos-Aires zusammenzutreffen und mit ihnen weiterzureiten.
Am anderen Morgen war er wirklich schon mit Juba verschwunden, aber der fortgerittene Don kam bald wieder zurück, und zwar in Begleitung von einigen hundert Dragonern, welche er unterwegs angetroffen hatte.
Sie waren ausgeschickt worden, um Oberst Gray Hilfe zu bringen, denn das Gouvernement wußte wohl, daß hundertvierzig Mann ohne Nahrungsmittel in den Pampas nicht viel gegen die Penchuenchen ausrichten konnten.
Die Hilfe kam zu spät. Proviant wurde nicht mehr von den Dragonern begehrt. Die Ankömmlinge konnten nichts weiter tun, als die Verwundeten unter sicherer Bedeckung nach der Küste bringen und dann unter einem anderen Offizier den Rachezug gegen die Penchuenchen fortsetzen.
Wer wußte, ob ihrer nicht dasselbe Schicksal wartete, wie das, das ihre Kameraden getroffen hatte?
Die Engländer brachen das Lager ab und schlugen eine andere Richtung ein, um während ihrer Reise nicht Zeugen fernerer Metzeleien zu werden.
Gegenüber vom Leuchtturm von Matagorda liegt, wie schon früher erwähnt wurde, eine Art kleiner Werft. Die Arbeiter wohnen in zerstreut liegenden Hütten, die Beamten in besseren Häusern, die armseligsten Behausungen aber liegen dicht am Strand, denn hier wohnen die Fischer, deren mühsamer, undankbarer Beruf ihnen keine Bequemlichkeit gestattet.
Die Bevölkerung ist meist spanischer Abkunft, höchstens die Beamten, welche die Werft- und Dockarbeiter beaufsichtigten, sowie die Besitzer von mehreren Fischerfahrzeugen sind Yankees. Diese letzteren lassen die armen Strandbewohner für sich fischen und zahlen ihnen einen geringen Tagelohn.
Ehe man die Ansiedelung betritt, kommt man an einem grünangestrichenen Häuschen vorüber, das, über und über mit Weinreben bewachsen, einen besseren Eindruck als die anderen Häuser macht. Hier versammeln sich abends nach harter Arbeit die Fischer und Tagelöhner, um noch einen Schoppen Wein zu trinken.
Es ist eine spanische Weinschenke.
Die dicke Wirtin, eine Spanierin, saß hinter der B [Wort unleserlich] daß sie nicht aufzustehen brauchte, um die Hähne der beiden Fässer zu drehen, aus denen weißer und roter Wein, die einzigen Sorten welche verschenkt wurden, in die tönernen Krüge floß.
Die Bedienung der an Tischen auf Schemeln sitzenden Gäste besorgte Inez, eine junge, flinke Spanierin, die Nichte der Wirtin.
Inez hatte bei ihrer Tante kein leichtes Los.
Das mutterlose Mädchen war von jener aufgenommen worden und mußte sich sein Brot durch Hausarbeit redlich verdienen. Vor zwei Jahren war sie sogar von der Tante aus dem Hause gestoßen worden, weil sie sich einem Fischerknecht, einem häufigen Gaste der Schenke, an den Hals geworfen hatte, wie die Tante sagte, und diese in ihrem spekulierenden Geiste schon große Pläne mit der schönen Nichte vorgehabt hatte.
Mancher gutgestellte Beamte, ja, sogar mancher reiche Fischereibesitzer hatte ein Auge auf die reizende Inez geworfen, aber, da kam der Tunichtgut, der leichtsinnige Pueblo, der weißen und roten Wein über alles liebte, und gleich waren er und Inez ein Herz und eine Seele.
Sie heirateten sich, die Hochzeit ging ohne Sang und Klang vor sich, denn die aufgebrachte Tante weigerte sich, auch nur einen Peso herauszugeben. Sie schliefen auf Stroh und waren doch glücklich.
Die Tante nahm ein anderes Mädchen ins Haus, jagte es fort, nahm wieder ein anderes, und so ging es weiter, nie war sie mit einem zufrieden, weil die fremden Mädchen entweder faul oder nachlässig waren oder Liebeleien mit den jungen Leuten anfingen, denen sie noch Geld aus der Kasse zusteckten, während die dicke Wirtin schlief und sie das Geschäft allein führen mußten.
Inez genas eines Kindes, und von da ab wurde Pueblo ein anderer Mensch. Er arbeitete nur noch für Weib und Kind, und während es früher öfter vorgekommen war, daß kein Brot im Hause war, wenn er zu oft ins Glas gesehen hatte — was übrigens keinen Streit hervorrief — so konnte er sich jetzt mit seiner Familie zwar ärmlich, aber rechtschaffen durchschlagen.
Dann wurde das Kind krank, der Vater ebenfalls, Inez bat die Tante um Verzeihung und Unterstützung, sie wurde für einen Sündenlohn wieder aufgenommen, weil sie ehrlich war und das empfangene Geld stets richtig ablieferte. Das Kind genas, ebenso der Vater, aber Inez blieb doch als Kellnerin im Hause der Tante, während Pueblo arbeitete.
Wenn die Schenke geschlossen wurde, was nicht zu spät geschah, so eilte Inez nach Hause und teilte mit Pueblo und dem Kinde das Essen, das sie sich tagsüber vom Munde abgespart hatte, und kam das Ende der Woche, so erhielt sie noch ein großes Silberstück.
Noch einige Jahre dauerte es höchstens, so konnte sich Pueblo ein eigenes Fischerboot kaufen, und Inez brauchte nicht mehr zu dienen.
Diese Geschichte hatte die Wirtin eben selbst einem jungen Manne erzählt, der an der Bar stand und ein Glas Wein schlürfte. Er paßte nicht in diesen Kreis, er war zu modern angezogen, aber es konnte ja ein Herr sein, der hier Geschäfte zu tun hatte und vor dem Sturm Unterschlupf suchte.
Denn draußen herrschte ein abscheuliches Wetter, der Wind pfiff und heulte und ließ oft einen Regenschauer gegen die Fenster prasseln.
Die Wirtin war sehr stolz auf sich, sie konnte es nicht oft genug wiederholen, wie sie doch Mitleid mit Inez und ganz besonders mit dem armen Wurm empfunden hätte, so daß sie Inez wieder in ihr Haus aufnahm, ›um Gottes willen‹.
Sie sprach so oft von ihrer Herzensgüte, daß der junge Mann endlich sein Lächeln hinter dem Glase, das er emporgehoben hatte, als wolle er den Inhalt prüfen, verbergen mußte. Er hatte aus der Erzählung recht gut herausgehört, daß nur der Eigennutz die Frau zu dieser Handlung getrieben hatte, weil sie von den anderen Kellnerinnen betrogen worden war, Inez dagegen ehrlich, fleißig und willig ihres Amtes waltete und sich viel sagen ließ.
»Man hat ja auch ein Herz in der Brust,« schloß die gesprächige Wirtin und bückte sich, um den ihr gereichten Krug mit Wein zu füllen.
Sinnend betrachtete der Herr das junge Weib in dem nach spanischer Art spitzenbesetzten, kurzen, roten Röckchen, dem kreuzweise über das schwarze Mieder gelegten Tuch, das den vollen Busen verbarg, die schwarz- und weißgestreiften Strümpfe, die bis an die Kniee sichtbar waren, und die schnallenbesetzten Goldschuhe.
Inez war schön. Man sah es ihr nicht an, daß sie bereits Mutter war, sie glich noch völlig einer Jungfrau. Die schwarzen Locken beschatteten ein reizendes, schelmisches Gesichtchen, in dem die überstandene schwere Zeit keine Spuren zurückgelassen hatte. Die schwarzen Augen blitzten noch ebenso heiter, wie in ihren Mädchenjahren, und selbst die harte Arbeit im Hause der Tante hatte weder die wie aus Marmor gemeißelten Arme, noch die schlanken Finger verunstalten können.
Leicht wie eine Libelle schwebte sie durch das Gastzimmer, nahm hier ein Glas, dort einen Krug vom Tische, hüpfte an die Bar, kehrte mit dem vollen Kruge zurück, schlug einem schwarzlockigen, braunäugigen Burschen, der den Arm um ihre schlanke Taille zu legen versuchte, derb auf die Hand, setzte das Glas, welches sie einem weißhaarigen Alten kredenzte, erst an die Purpurlippen, und dies alles mit lachender Miene und strahlenden Augen, welche auch nicht das fortwährende Gekeife trüben konnte, mit dem die unzufriedene Tante sie jedesmal empfing.
Der Fremde hörte schon lange nicht mehr auf das Gewäsch der Tante; er hatte nur noch Augen für Inez.
Es waren keine unsauberen oder begehrlichen Gedanken, die ihm bei diesem reizenden Bilde aufstiegen.
Was war es, das die Züge der jungen Frau in so kindlichem Glänze erstrahlen ließ?
Hatte die Alte nicht eben gesagt, welchen Kummer Inez durchgemacht hatte? Krankheit, Armut, Not, Verstoßung von der, auf deren Unterstützung sie gerechnet hatte?
War es nicht schon traurig genug, daß sie hier bis in später Nacht fremde Gäste bedienen mußte, während der müde Mann zu Hause saß? Er durfte ja nicht hierherkommen, weil er das Kind zu warten hatte, bis Inez die Hütte betrat und zu essen mitbrachte.
War diese Freundlichkeit, dieser Frohsinn nur erkünstelt, weil die Tante es so verlangte?
Wahrscheinlich.
Der Fremde verweilte in Gedanken einen Augenblick bei dem Moment, wenn Inez die Hütte betrat, ihr Mann, das Kind auf dem Arme, ihr entgegeneilte, sie es ihm abnahm und liebkoste, dann ihren Mann, hierauf das Tuch auf dem Tische ausbreitete und dem Körbchen die Ueberreste ihrer spärlichen Malzeit entnahm; das Kindchen klatschte in die Hände und streckte sie dann begehrlich nach den Speisen aus, Inez lachte, und Pueblo freute sich.
Himmel und Hölle, was schwatzte da das Weib von Gott, Maria und allen Heiligen, was scherten ihn die? Hatte er durch Zwischenfragen — der Fremde konnte zugleich denken und von etwas anderem sprechen — verraten, daß er in religiösen Fragen bewandert war?
Blitzschnell hatte er begriffen, was die Freude auf Inez' Züge zauberte. Auch sie freute sich schon auf den Moment, wenn sie die Hütte betrat, sie freute sich auf Mann und Kind, bei denen sie bis Anbruch der Morgendämmerung bleiben durfte.
Arm, von Not und Kummer bedrückt, und doch glücklich! Reich, frei und unabhängig, und doch unglücklich! Seltsam! Genügsamkeit und Unzufriedenheit, die Sucht nach mehr, das ist der Schlüssel zu diesem Rätsel der Menschenseele.
Fieberhaft jagten dem Fremden die Gedanken durch den Kopf. Wohl hörte er das Schwatzen der Alten, aber seine Augen hingen wie gespannt an Inez.
»Seid Ihr in einer Priesterschule erzogen worden?« fragte die Tante. »Ihr wißt wahrhaftig mehr, als der Kapuziner, bei dem ich beichte, aber ich denke fast, Ihr habt nicht den wahren Glauben.«
»Ich habe ihn,« murmelte der Fremde, schob die Kanne zurück und schritt durch das Gemach, sich an einen entfernten Tisch niedersetzend.
In der Stube befanden sich nur Fischer und Werftarbeiter, fast alle Spanier. Das Gespräch, welches von Tisch zu Tisch gerufen wurde, erstreckte sich ausschließlich aus die rätselhaften Vorkommnisse, die vor einigen Tagen passiert waren.
Der Leuchtturm von Matagorda hatte plötzlich versagt, ebenso wie der in Galveston und noch ein anderer, alle drei gleichzeitig; ferner waren überall die Telegraphenkabel zerstört worden und eine Verbindung nicht mehr möglich gewesen.
Die Männer erschöpften sich in Vermutungen verschiedener Art, wer daran schuld gewesen. Die wenigsten schoben diese Störung Menschenhänden zu, doch diese ernteten nur Spott wegen ihrer Behauptungen. Wie konnten Menschen so geschickt arbeiten, daß das Licht gleichzeitig erlosch, und wie konnten alle Kabeldrähte gleichzeitig zerstört werden? Es hätte ja eine ganze Bande von Spitzbuben dabei tätig sein müssen, und wozu sollten sie es getan haben?
Nein, der Teufel selbst war es gewesen, das war die Meinung der meisten, und dieser Behauptung konnte nicht widerstritten werden. Gab es etwa keinen Teufel?
War er nicht ein Feind der Menschen? Suchte er ihnen nicht in jeder Weise zu schaden?
Viel Schaden war durch das Versagen der Leuchttürme angerichtet worden. Unzählige Fischerboote waren auf den Strand gelaufen und vernichtet worden; zahllose Menschen hatten ihr Leben lassen müssen, weniger Fischer, die kannten ja die Küste wie ihre Tasche, aber viele Menschen von gescheiterten Schiffen.
Noch jetzt funktionierte die elektrische Maschine in Matagorda nicht, man half sich mit großen Petroleumlampen und Reflexspiegeln.
Was für ein Mensch hätte das sein müssen, der solches Unheil anstiftete! War er nicht der Teufel in Menschengestalt, so war er mindestens ein vom Teufel besessener Mensch, und das war einerlei, darüber waren sich alle Gäste einig.
»Hat Pueblo die Einfahrt in jener Nacht gut gefunden?« fragte ein Fischer eben Inez. »Soviel ich weiß, war er damals gerade draußen.«
Ueber das fröhliche Gesicht der jungen Frau flog erst ein trüber Schatten, dann aber strahlte es in seinem alten Glanze.
»Er war in großer Gefahr, auch sein Boot ist gescheitert,« sagte sie, »aber sein Herr machte ihn nicht verantwortlich dafür, sondern gab ihm ein anderes. Gott segne ihn dafür! Pueblo kam mit dem Leben davon, aber den Schreck vergesse ich nicht, als er mit nassen Kleidern und verstörtem Gesicht des Nachts zu mir kam und wie ein Kind weinte.
»Inez!«
Die junge Frau sah auf: der Ruf kam von dem Tisch, an welchem der Fremde saß.
Sie fürchtete sich vor diesem Gesichte, sie wußte nicht warum. Es war so bleich, ganz anders als wie das von denen, die hier lebten, und doch war etwas in seinen Augen, was sie anzog. Sie mußten einst anders, nicht so finster geblickt haben.
Inez bekam von dem Fremden den Auftrag, ihm ein Glas Rotwein zu bringen, und sie wunderte sich nicht wenig, als die dicke Tante auf das Wort hin, der Fremde habe das Glas bestellt, sich erhob, in den Hintergrund wackelte und das Glas aus dem Fäßchen füllte, welches nur bei ganz besonderen Feierlichkeiten und höchstens für Brüder des naheliegenden Klosters benutzt wurde.

Der Fremde mußte also bei ihrer Tante einen Stein im Brett haben. Natürlich, er konnte ja so vernünftig über religiöse Dinge sprechen.
Der bleiche Gast legte ein Zweidollarstück auf den Tisch. Inez wechselte es und wollte aufzählen.
»Behaltet es!« sagte der Fremde kurz.
Erstaunt blickte Inez auf, sie glaubte nicht richtig gehört zu haben und zählte weiter.
»Behaltet es,« wiederholte der Fremde diesmal freundlicher, »schenkt es Eurem Kinde!«
Inez begriff jetzt, der Fremde wollte das viele Geld nicht haben, es sollte ihr gehören. Jesus Christus, soviel nahm ja die Tante den ganzen Abend nicht ein.
»Ich darf es nicht annehmen,« sagte sie kleinlaut.
»Warum nicht?«
»Sieht die Tante nur, daß ich etwas einstecke, so wird sie schon argwöhnisch, und ist es gar Geld, so jagt sie mich sofort aus dem Hause.«
»Nehmt es, ich verantworte es!«
»Ich darf nicht, Herr, ich mache mich unglücklich.«
Wortlos strich der Fremde das Geld zusammen und steckte es in seine eigene Tasche. Er hatte seinen Entschluß plötzlich geändert.
Es war augenblicklich wenig zu bedienen, der Fremde ließ sich daher mit Inez in ein Gespräch ein. Er fragte freundlich nach dem Namen ihres Kindes, erkundigte sich teilnehmend, wie sich ihr Mann beim Scheitern des Bootes gerettet habe, und Inez gab offene Antworten; sie verlor jede Angst vor dem Fremden. Jeder, der sich nach Pueblo und ihrem Kinde erkundigte, hatte ihr Herz gewonnen, vor dem kannte sie keine Scheu mehr.
Dann stellte auch sie naive Fragen, wer er sei, woher er käme, warum er so bleich aussehe, ob er krank oder unglücklich sei.
Der Fremde sagte, er sei oben aus dem Norden und sei Arzt, aber weder krank noch unglücklich.
Das wollte Inez nicht glauben, sie scherzte mit ihm, drohte ihm lächelnd mit dem Finger, kam wieder auf Pueblo und ihr Kind zu sprechen, auf ihr Heim, und als ein Gast endlich ihre Bedienung forderte, wußte der Fremde nicht nur, wann Pueblo und das Kind geboren, wie alt sie selbst sei und so weiter, sondern auch, wie es in ihrer zweiräumigen Hütte am Strande aussah, was sie für Gerätschaften darin hatte, wie sie sich dieselben erworben, und den Weg zur Hütte hätte er mit verbundenen Augen finden können.
Der Fremde stützte den Kopf in die Hand und sah träumend vor sich hin. Nur, wenn die Tür aufging, wandte er die Augen dorthin, versank aber dann gleich wieder in sein Brüten.
»Pueblo,« schrie plötzlich Inez, »warum kommst du? Es ist doch nichts passiert — das Kind?«
Ein junger Bursche war hereingekommen, einen großen Krug und ein Fischnetz in der Hand tragend.
»Nichts! Alles in Ordnung,« lachte der junge Bursche, die ängstliche Frau, die ihm in den Arm gefallen war, sanft von sich drängend. »Das Haus brennt nicht, und das Baby schläft. Nun paß aber auf, Inez, was jetzt kommt. So etwas hast du dein ganzes Lebtag nicht gesehen.«
Er trat an die Bar, lachte die dicke Tante an, setzte den Krug auf die Bank und rief:
»Einen Krug vom besten Roten, aber, vom besten dort hinten aus der Ecke, mag er kosten, was er will, und dann noch eine ganze Menge aus Eurer Speisenkammer. Ich bezahle heute mit Gold.«
Damit warf er ein großes Goldstück auf den Tisch, in diesem Hause eine seltene Münze.
Erstaunt horchten die Gäste auf, die dicke Tante sprang vom Stuhle empor, Inez schrak zusammen, und nur Pueblo und der Fremde blieben die Alten, ersterer lustig, letzterer ernst und gelassen.
Was, Pueblo, dieser arme Teufel, hatte ein Goldstück? Woher hatte er es bekommen?
»Ja, ja, Mutter,« lachte der Bursche und ließ das Goldstück wiederholt klirren. »Jetzt her mit dem Wein, und dann schneidet Eure Vorräte in der Rauchkammer an und greift tief in den Semmelkorb. Ich habe heute abend Hunger, und das Gold ist echt, probiert es!«
»Aber, Pueblo,« stammelte endlich Inez, während die Tante sich schon des gelben Metalls bemächtigt hatte und es sorgsam prüfte, »woher hast du so schrecklich viel Geld? Du hast doch nicht etwa —?«
»Die Sparbüchse erbrochen?« unterbrach sie ihr lustiger Mann. »Gott bewahre, Gäste haben wir in unserem Hause, Inez, die mit Gold bezahlen, als wären es Kupfermünzen. Ja, ja,« fuhr er dann zu den verdutzten Gästen fort, »in meiner Hütte sind heute abend elf Damen eingekehrt.«
Plötzlich brach Pueblo in ein Gelächter ohne Ende aus, die Tränen flossen ihm über die Wangen.
»Aber denkt euch nur, die Damen haben keine Weiberröcke an, sondern Männersachen, sie sehen überhaupt ganz gefährlich aus und sind mit Waffen förmlich gespickt.«
»Du bist wahnsinnig, du weißt nicht mehr, was du sprichst,« rief ihm ein Kamerad zu.
»Ich spreche die Wahrheit,« versicherte Pueblo, jetzt ernst werdend. »Es ist noch nicht eine Stunde her, als an die Tür meiner Hütte gepocht wurde, und denkt euch meinen Schrecken, wie ich im Scheine des Herdfeuers elf bewaffnete Gestalten erblickte. Der Schrecken wurde aber zum Erstaunen, als mich eine sanfte Frauenstimme um ein Glas Wasser bat und nach dem Wege nach Matagorda fragte. Daran erkannte ich, daß alle elf als Männer verkleidete Frauen waren. Sie sahen aber furchtbar aus, zerrissen und zerfetzt, von Schmutz und Schlamm bespritzt, und so müde, daß sie kaum noch auf den Füßen stehen konnten.
»Ich ließ sie eintreten, machte ihnen Sitzplätze, so gut es gehen wollte — deine Kleider mußten herhalten, Inez — ich gab ihnen Wasser und das wenige, was unsere Hütte aufzuweisen hatte, und wunderte mich, mit welchem Heißhunger sie über das Brot herfielen.
»Dann erfuhr ich, daß es Schiffbrüchige waren, sie nannten auch den Namen des Schiffes, auf dem sie waren, habe mir ihn aber nicht gemerkt. Ueberhaupt schwatzten sie ganz seltsames Zeug, was ich nicht verstehen konnte. Ich glaube sogar, sie sagten, sie wären Matrosen und von Strandräubern überfallen worden. Weiß der liebe Gott, wie ich mir das zusammenreimen soll.
»Sie wollten in die nächste Herberge, machten mir aber dann das Angebot, mich zu bezahlen, wenn sie bei mir bleiben dürften. Ich fügte zu, denn, Mutter, es sind Ketzer, wie ich bald aus ihnen herausbrachte.«
»Um Gottes willen,« kreischte die Tante auf, »die kommen nicht in mein Haus.«
»Sie wollen ja auch gar nicht, sie bleiben bei mir und haben es sich ganz gemütlich eingerichtet. Du bist doch damit einverstanden, Inez?« wandte sich der Fischer an seine Frau, dabei unmerklich mit den Augen zuckend.
Inez nickte nur.
»Sie müssen furchtbar viel ausgestanden,« fuhr Pueblo fort, »und tagelang nichts gegessen haben, denn das Brot und die paar Fische, die ich ihnen briet, waren im Nu verschwunden. Jetzt gaben sie mir das Goldstück, damit ich Wein und mehr Essen holen sollte. Reich müssen sie sein, denn als die Dame das Gold aus der Börse nahm, sah ich lauter Goldstücke schimmern.«
Er winkte Inez zu sich heran und flüsterte ihr ins Ohr:
»Sie bleiben bei uns, sie wollen für alles gut bezahlen und mich extra belohnen.«
Inez freute sich jetzt auch. Nun begriff sie, warum Pueblo so lustig war. Er sah einen ehrlichen Nebenverdienst vor sich, der ihm vielleicht zu einem eigenen Boote verhalf.
»Es werden Schiffbrüchige sein, die damals gescheitert sind, als das Licht des Leuchtturms nicht brannte,« meinte ein Fischer.
»Das glaube ich auch,« entgegnete Pueblo, nahm den Krug mit Wein, hing das Netz, welches unterdes mit Brot, kalten, gebratenen Fischen und Fleisch gefüllt worden war, über die Schulter, steckte das herausgegebene Geld ein und schritt der Tür zu.
Der Fremde hatte teilnahmlos zugehört, das Gesicht mit der Hand bedeckend; wer ihn aber beobachtete, hätte doch gemerkt, welche Erregung sich seiner bemächtigt hatte.
Bei Beginn der Erzählung Pueblos schrak er erst zusammen. Sein bleiches Gesicht wurde noch blasser, in seinen Zügen zuckte es, dann aber hörte er ruhig weiter zu.
Als Pueblo, von Inez gefolgt, der Tür zuschritt, stand er auf und trat ihnen in den Weg.
»Es waren Damen?« fragte er.
»Ja,« entgegnete Pueblo, den eleganten Herrn von oben bis unten musternd, als aber Inez ihm etwas ins Ohr flüsterte, nahm er ein freundliches Gesicht an.
»Elf?«
»Elf.«
»Wißt Ihr, wie ihr Schiff heißt?«
»Nein, ich habe den Namen vergessen.«
»Wißt Ihr denn, wie die Damen heißen?«
Der Fischer blickte erstaunt auf.
»Nein. Kennt Ihr sie?«
»Ich? Nein, nein,« rief der Fremde schnell, »ich dachte nur an etwas.«
Trotzdem er seine Aufregung mit aller Anstrengung unterdrücken wollte, gelang es ihm doch nicht. Als er sich auf seinen Stuhl fallen ließ, klang es wie ein Aechzen aus seinem Munde.
Doch die Gäste, wie auch Pueblo waren jetzt mit anderem beschäftigt, als ihre Aufmerksamkeit dem Fremden zu schenken. Sie bemerkten sein sonderbares Wesen nicht.
Pueblo ging hinaus, gefolgt von Inez, welche mit ihm wahrscheinlich noch über die Beherbergung der vielen Gäste sprechen wollte.
Wie ein Raubtier blickte ihnen der Fremde nach. Keine Muskel zuckte mehr in dem bleichen Gesicht. Er hatte die Zähne fest zusammengebissen.
Als sich die Tür hinter den beiden geschlossen hatte, murmelte er etwas vor sich hin, griff in die Tasche und ging ebenfalls hinaus.
Der Sturm hatte aufgehört, aber die Nacht war durch schwarze Wolken undurchdringlich finster geworden.
»Setze deinen Krug hierher und komm einen Augenblick unter die Bäume, damit uns niemand sieht,« hörte der Fremde Inez flüstern.
Vor dem Hause befand sich ein Garten mit Obstbäumen. Der Fremde konnte eben noch sehen, wie zwei Gestalten zwischen den Bäumen verschwanden, dann befand er sich allein.
Aber dort, dicht an dem Hause, stand der Krug mit Wein, den Pueblo hingesetzt, weil er den einen Arm um die Taille seiner Frau geschlungen hatte.
Der Fremde, im Schutze der Mauer stehend, lauschte.
»Bist du einverstanden damit, mein Schätzchen?« erklang es.
»Gewiß, was du willst, ist mir stets recht.«
»Es bringt mir guten Verdienst ein, die Damen zahlen sicherlich nobel, wenn wir sie gut beherbergen. Und du weißt, wie langsam es geht, bis wir das Geld für das Boot zusammenhaben.«
»Werden wir auch alle Platz in der Hütte haben?« fragte scherzhaft die junge Frau.
»Wir müssen es. Sie bleiben ja nur diese eine Nacht bei uns, um sich zu erholen.«
»Und wohin wollen sie dann?«
»Nach Matagorda. Sie sagten, sie wollten etwas zur Anzeige bringen. Ich werde nicht klug aus ihren Reden.«
Der Fremde hatte unterdes aus seiner Tasche ein Fläschchen gezogen, entkorkte es, machte einen Schritt nach links und stand vor dem Kruge.
Wieder lauschte er. Die beiden unterhielten sich noch über die Damen; sie sahen ihn nicht, konnten ihn nicht sehen.
Die Hand des Fremden hob sich, eine Bewegung, und der Inhalt des Fläschchens ergoß sich in den Krug mit Wein.
Das Fläschchen verschwand wieder in der Tasche, dafür kam ein Revolver zum Vorschein.
Das Pärchen unterhielt sich jetzt über etwas anderes.
»Schlief das Kind, als du es verließest?« fragte die helle Stimme von Inez.
»Nein. Durch das Geräusch, das die vielen Menschen verursachten, wachte es auf, aber eine schöne, junge Dame hielt es auf dem Schoße und spielte mit ihm.«
»Es sah in letzter Zeit so kränklich aus,« sagte Inez besorgt, »ich habe manchmal rechte Sorge. Drinnen ist ein Herr, der sagt, er wäre Arzt, und scheint ein guter Mann zu sein, der für Fremde Mitleid hat. Was meinst du, soll ich ihn einmal fragen, ob er sich unser Kind ansehen will? Ich glaube ganz sicher, er tut es, er hat ein gutes Herz, weil er so unglücklich aussieht.«
Der Fremde zuckte zusammen, entfernte sich aber noch nicht.
»Ach was,« lachte der Vater, »das sind nur die Zähne. Ich traue keinem Arzt, das sind alles Leute, die ihre Mitmenschen mit Pillen und Tränkchen vergiften.«
Der Fremde schmiegte sich dicht an das Haus, rückte Zoll für Zoll nach der anderen Seite, bog dann um die Ecke, blieb noch einen Augenblick stehen, vor sich hinmurmelnd, und stürzte dann mehr als er ging, durch die Nacht der Richtung zu, in welcher Pueblos Hütte lag. Ein unnennbares Gefühl trieb ihn zum eiligsten Laufe, er glich dem Verbrecher, der nach der Sage der Alten von unsichtbaren Mächten zum Schauplatz seiner Tat geschleppt wird.
Die Küche der kleinen Hütte vermochte kaum die vielen Personen zu fassen, welche sich in ihr einquartiert hatten. Was nur irgend zu einem Sitzplatze dienen konnte, war als solcher benutzt worden, und außerdem mußten Kleider, Decken, alte, zerflickte Segel, ja, sogar Fischernetze dazu dienen.
Die elf Mädchen unter Führung Ellens hatten Besitz von Pueblos Hütte ergriffen.
Der beschwerliche Weg war von der energischen Ellen nicht in vier, sondern in drei Tagen zurückgelegt worden. Allerdings hatten sie auch die letzte Nacht nicht geschlafen, sondern nur eine kurze Ruhepause gemacht und ein geschossenes Reh verzehrt.
Der Marsch durch den Wald war zwar sehr beschwerlich gewesen, aber Ellen ließ ihre Schutzbefohlenen nicht zur Ruhe kommen, mochten sie klagen, wie sie wollten, ja, sie gestattete ihnen kaum genügende Zeit, um zu essen, kaum, einen Vogel zu schießen, ein Feuer anzuzünden, um etwaige in der Umgegend hausende Indianer oder räuberische Menschen nicht auf ihre Spur zu lenken.
Als sie die Hütte Pueblos, die erste Wohnung in der Nähe von Matagorda, erreichten, war es mit ihrer Kraft aber auch vorbei, sie konnten sich mit den wunden Füßen kaum noch gegen den Sturm aufrecht erhalten. Sie beschlossen, die Nacht hier zu verbringen, fragten den Fischer, ob er sie beherbergen könne, sie wären mit dem kleinsten Schlafplatz zufrieden und erhielten die Erlaubnis.
Der gutmütige Fischer gab den verhungerten Mädchen alles, was die Hütte bieten konnte. Er dachte an keinen Lohn, er hatte sogar die Absicht, in anderen Hütten sich noch mehr Brot und Fische zu erbitten, wurde aber von Ellen daran gehindert.
Sie gab ihm ein Goldstück, damit er in der Schenke, von der er gesprochen hatte, Wein und Lebensmittel besorgen könne.
Der sonst redselige und kecke Pueblo fühlte sich den vornehmen Damen gegenüber beklommen. Er sprach nicht davon, daß er verheiratet war, nicht, daß seine Frau auswärts arbeite, und daß in der Kammer nebenan sein Kind schlafe.
Wortlos brachte er aus der Kammer Decken und Kleider heraus, und aus letzteren errieten die Damen, daß auch eine Frau hier wohnen müsse. Wahrscheinlich war sie abwesend.
Dann, als Pueblo in der Kammer herumwirtschaftete, fing plötzlich ein Kind an zu schreien. Die Damen hörten, wie der Fischer den kleinen Schreihals unbeholfen zu beschwichtigen suchte, was ihm aber nicht gelang. Aus der Kehle des Kleinen drangen immer jämmerlichere Töne.
Die Damen hatten schon lange kein Kindergeschrei in solcher Nähe gehört. Sie vernahmen die liebkosenden Worte des Vaters, sie malten sich aus, wie unbeholfen er das Kind auf seinen Armen wiegte, und plötzlich fiel ihnen ein, daß sie als Frauen so etwas besser verständen als er.
Ellen war die erste, in welcher der Gedanke zum Entschluß reifte. Sie öffnete die Tür und trat in die kleine Kammer, das Schlafzimmer des Fischerpaares, wo das Kind sich befand.
Pueblo hatte das kleine Mädchen wirklich auf dem Arm und machte eben mit der freien Hand ein Bettchen zurecht. Ellen wußte sofort, was er vorhatte. Er wollte die Kiste, auf welcher das Kind bisher gelegen, frei machen und es auf die Erde legen.
»Meine Frau ist nicht zu Hause,« suchte der Fischer sich, verlegen lächelnd, zu entschuldigen, »und unsereins weiß mit so etwas nicht umzugehen.«
»Ueberlassen Sie mir das,« entgegnete Ellen und nahm ihm den Schreihals ab. »Gehen Sie und seien Sie unbesorgt, wir wollen uns des Kindes annehmen und uns inzwischen behelfen. Wir werden Ihnen die Unannehmlichkeiten, denen Sie durch uns ausgesetzt werden, reichlich vergüten.«

Der Fischer murmelte etwas, was wie eine Ablehnung des Anerbietens klang, ergriff einen großen Krug, warf ein Netz über die Schulter und verließ die Hütte.
Ellen rief ein Mädchen zu sich herein und machte mit dessen Hilfe das Bettchen auf der Kiste wieder zurecht, in welches sie das noch immer schreiende Kind legte.
»Diesem Fischer geht es wie vielen Menschen,« sagte Ellen während dieser Beschäftigung. »Wenn sie auch nur einen Gast bekommen, so wissen sie aus lauter Höflichkeit gar nicht, was sie tun. Sie werfen alles im Hause durcheinander und denken, dadurch dem Gast ihren guten Willen zu zeigen. Sie lassen ihre Familie darunter leiden, während es dem Gaste lieber wäre, wenn ihm ein ganz bescheidener Winkel angewiesen würde.«
Das Kind protestierte ebenfalls gegen die Gastfreundschaft des Vaters. Es konnte nicht einsehen, warum es wegen des Besuches plötzlich, mitten im besten Schlaf, aus dem warmen Bett gerissen worden war, und schrie erbärmlich, auch dann noch, als es von Ellen schon wieder vorsorglich gebettet war.
»Mein Gott,« sagte die andere Dame, »was kam so ein Fischerkind schreien. Das macht ja mehr Spektakel, als zehn andere zusammen.«
»Wir wollen es allein lassen und die Lampe hinausnehmen,« meinte Ellen. »Wenn es uns nicht mehr sieht und im Dunkeln ist, wird es sich schon beruhigen. Wir sind ihm fremd.«
Sie nahm die kleine Oellampe und ging zu den Gefährtinnen zurück, die Tür zumachend.
Die Damen nahmen wieder Platz und suchten sich bis zur Rückkehr Pueblos die Zeit durch Gespräche zu verkürzen. Sie stellten Vermutungen auf, wo die Frau des Fischers wäre, ob er weit bis zur Schenke zu laufen habe, aber das Gespräch kam nicht in Fluß, weil das Kind in der Nebenkammer immer noch schrie.
»Wir können das Kind nicht mehr schreien lassen, wir müssen es beruhigen,« meinte endlich ein Mädchen.
»Wenn es sich ausgeschrieen hat, hört es schon von selbst auf,« entgegnet ein anderes Mädchen.
»So denken unzuverlässige Kindermädchen, und ich denke so vom Regen,« sagte Miß Murray, »ein Kind aber muß man anders behandeln.«
Jessy stand auf und ging hinüber. Ihr folgten alle anderen Mädchen.
Es war wirklich die höchste Zeit, daß man etwas tat, denn das Kind war schon kirschrot im Gesicht und ballte die Hände wie in Krämpfen zusammen.
»Mein Gott, was sollen wir tun?« jammerte ein Mädchen.
Jessy nahm das Kleine wieder aus dem Bett, legte es auf die Arme und wiegte es hin und her — ohne Erfolg, aber es war doch ein Anfang. Die eine tätschelte es im Gesicht, die andere hielt ihm einen kleinen Taschenspiegel vor die Augen, eine dritte zupfte es am Ohr und lachte, man zeigte ihm Juno, die Pueblo für einen Hund gehalten hatte, aber das Kind war unempfindlich gegen Koseworte und achtete die Spielerei nicht, es schrie weiter.
»Wir sind zu viele, es fürchtet sich vor uns,« sagte Ellen wieder. »Wir müssen alle hinausgehen, und nur eine bleibt mit dem Kinde allein hier. Wer von uns weiß am besten mit Kindern umzugehen?«
Die Damen sahen sich verwundert an. Keine derselben hatte sich bis jetzt mit der Kunst beschäftigt, ein schreiendes Kind zu beruhigen.
»Ich kannte ein Kind,« nahm endlich Jessy das Wort, »wenn das schrie, brauchte ich ihm nur einen Spiegel vorzuhalten, und es lachte. Bei diesem hier hilft das Mittel nicht.«
»Es fürchtet sich vor dem Spiegel, weil es noch nie einen gesehen hat,« erklärte ein Mädchen.
»So will ich mein Glück versuchen,« sagte Ellen, »bitte, gehen Sie hinaus und verhalten Sie sich still! Es wird mir schon gelingen, es zu beruhigen.«
»Sie?« rief Jessy verwundert.
In Ellen hätten die Vestalinnen am allerwenigsten die Eigenschaften eines Kindermädchens vermutet.
»Allerdings,« entgegnete Ellen, »wir haben uns bis jetzt überhaupt sehr unvernünftig benommen. Wenn die Mutter nicht da ist, so ist doch anzunehmen, daß sie dem Kinde etwas zu trinken da läßt. Haben wir nun schon daran gedacht, dem Kinde etwas Milch zu geben?«
Triumphierend blickte sich Ellen im Kreise ihrer Freundinnen um.
»Das ist wahr,« sagte Jessy kleinlaut, »ich habe die volle Milchflasche in der Küche stehen sehen. Soll ich sie holen?«
»Geben Sie mir erst das Kind — so. Und nun machen Sie die Flasche warm, aber vorsichtig, und wenn es so weit ist, dann bringen Sie sie herein.«
»Aber es ist kein Gummipfropfen darauf, sondern nur ein Kork!«
»Dann wird er wohl durchbohrt sein, sonst stechen Sie ihn mit einer Gabel durch.«
Die Damen waren verblüfft über diese umsichtigen Anordnungen ihrer Führerin. Ihr hätten sie so etwas am allerwenigsten zugetraut.
Schweigend verließen sie das Zimmer und machten sich draußen mit der Flasche, die wirklich ein durchstochener Kork verschloß, mit einer Sorgfalt am Feuer zu schaffen, als hinge von der Temperatur der Milch Leben und Tod des Kindes ab.
In der Kammer saß Ellen sinnend mit dem kleinen Schreihals in den Armen und wartete auf die Milch. Als diese kam und Ellen sich durch eigenes Kosten davon überzeugt hatte, daß sie weder sauer, noch zu heiß, noch zu kalt war, steckte sie den Kork in das Mündchen mit den kleinen Zähnen.
Doch die Mühe war vergebens, das Fischermädchen hätte ihr die Flasche mit seinen kräftigen Fäustchen beinahe aus der Hand geschlagen. Es wandte den Kopf und schrie in einer anderen Tonart weiter.
Der erste Versuch war mißlungen. Andere hatten auch keine besseren Resultate. Das Kindchen wollte nur schreien, aber durchaus nicht trinken.
»Tür zu, Ruhe in der Küche!« kommandierte Ellen, als stände sie noch auf der Brücke der ›Vesta‹.
Ellen wiederholte noch mehrmals ihre Versuche, setzte aber schließlich mit einem Seufzer die Flasche weg. Sie mußte auf ein anderes Mittel sinnen.
War sie denn nicht auch einmal so klein gewesen und hatte geschrien? Ganz gewiß, vielleicht noch lauter und anhaltender als dieses Kind, denn schon als Baby hatte sie ihren Willen stets durchsetzen müssen. Aber wie sie zum Schweigen gebracht worden war, das wußte sie nicht mehr, jedenfalls durch Erfüllung ihres Wunsches.
Was wollte denn dieses Kind haben?
Ellen zermarterte ihr Gehirn. Sie blickte hilfesuchend in der kleinen, niedrigen Kammer umher, die Oellampe erleuchtete diese notdürftig und ließ die wenigen Sachen, eine Kiste, einige Frauenkleider, Oelröcke, Seestiefel und Netze kaum erkennen.
Ein kleines Bild an der Wand fesselte Ellens Auge.
Es war ein schlechter Oeldruck ohne Rahmen, welcher eine junge Frau mit einem Wickelkind im Arm, vorstellte. Darunter stand die Anzeige von einem Kindernahrungsmittel, also ein Reklamebild. Gott wußte, wie sich diese Anzeige in die Fischerhütte verirrt hatte.
Ellen fand eine Aehnlichkeit zwischen der jungen Mutter und irgend einer Person, die sie einst gekannt hatte. Sie wußte nicht gleich, wem sie glich; dann aber kam sie durch den seltsamen Kopfputz der Figur auf den richtigen Gedanken: ein ebensolches Häubchen hatte immer die Amme von Martha, ihrem Liebling, getragen, und im Nu tauchten jene alten Zeiten vor ihr auf, da sie die Amme und das Kind spazieren gefahren, wie sie Martha auf ihrem Schoße gehalten, auf ihr Pferd gesetzt hatte, wie das ängstliche Kind zu schreien anfing, und plötzlich fiel es ihr ein, wie die Amme das Kind beruhigt hatte.
Alte Melodien klangen in ihr Ohr, leise summte sie vor sich hin, Kinderlieder, die man nie wieder vergißt, wenn man sie nur einmal gehört hat. Ellen hatte sich erhoben und das Kind auf ihren Armen in eine andere Lage gebracht; ohne daß sie es wußte, ahmte sie die Haltung der Amme nach, ging auf und ab, wiegte den kleinen Schreihals und sang dazu, sie wußte selbst nicht was. Die Worte und Melodien flossen ihr, ohne ihr Wollen, von den Lippen.
Kinderlieber! Wer kann den Einfluß der Musik auf die Empfindungen leugnen? Sie hat mehr Macht, als man beim oberflächlichen Nachdenken ahnt. Ein flottes Lied macht den Traurigen heiter. Eine Trauermelodie stimmt den Fröhlichen traurig, ohne daß er Grund dazu hat, ja, ohne daß er einer für andere traurigen Handlung, wie einem Begräbnis, beiwohnt. Ein feuriger Marsch begeistert den Feigsten zu den kühnsten, todesverachtenden Taten. Ein frischer Parademarsch elektrisiert plötzlich die Glieder des fast zusammenbrechenden Soldaten; noch einmal nimmt er die Kräfte zusammen, er reckt die Glieder und marschiert dem Ziele entgegen, als rücke er eben aus dem Quartier. Eine Symphonie versetzt uns aus diesem Leben voll Arbeit und Leiden in andere Sphären, und erst bei dem Schlußton stürzen wir zurück auf die Erde, verwundert um uns schauend.
Kinderlieder aber führen uns zurück in die Jugend, so alt, so bedrückt, so voll Kummer man auch sein mag. Der Mensch mit empfänglichem Gemüt sieht sich plötzlich wieder als Kind, er hört die alten Lieder nicht von fremden Leuten spielen, er hört sie von seiner Mutter singen. Er liegt ihr auf dem Arm, in nebelhafter Gestalt tauchen die Geschwister vor ihm auf; andere Personen, an die er jahrelang nicht gedacht hat, fallen ihm wieder ein! Onkel in Perücken, Tanten mit Löckchen an den Schläfen. Ein traumhafter Zustand hat sich seiner bemächtigt, ein unsagbares Glück, welches er nicht aussprechen kann, erfüllt seine Seele. Er weiß gar nicht, daß es Glück ist, sein Wunsch ist nur, es möchte immer so bleiben. Der härteste Verbrecher glaubt sich plötzlich unschuldig, der Geizhals ist freigebig wie ein Kind, der Verschwender genügsam— ach, könnte es doch immer so bleiben, denkt man, warum denn nicht? Ich wache ja, ich träume nicht.
Da verstummt der letzte Ton, und der Träumer mit offenen Augen ist wieder der alte. Verschwunden sind Eltern, Geschwister und Freunde, und das Herz, eben noch erfüllt von den lieblichsten Bildern und Gedanken, wird wieder von den alten Begierden erfaßt. Ein Schauer rieselt durch die Glieder, der mit eisigen Krallen an die Seele greift.
Die Einfachheit der Melodie ist es, welche das Kind zum Einschlafen bringt, denn sie beruhigt die aufgeregten Nerven, wie sie auch die des Erwachsenen beruhigen kann, wenn er empfänglich ist.
Wer kennt nicht das Lied von Karl Maria von Weber:
»Schlaf Herzenskindchen, mein Liebling bist du,« und welcher Mensch mit einem weichen Herzen, kann es hören, wenn er gerade von Sorge und Kummer bedrückt wird, ohne daß es ihm die Tränen in die Augen treibt? Dann kommt der Moment, da er träumend der Vergangenheit gedenkt und nie wieder zu erwachen wünscht.
Leise ging Ellen in der engen Kammer auf und ab. Sie wiegte das Kind und sang ihm alle die Lieder vor, die sie einst von Marthas Amme gehört hatte. War ihr der einfache Text entfallen, vielleicht, weil er zu einfach war, so improvisierte sie, aber der Text war derselbe. Mochte das spanische Fischerkindchen den Sinn verstehen oder nicht, die Melodie tat ihre Wirkung. Immer schwächer wurde das Schreien, immer schwerer sank das Köpfchen gegen Ellens Brust, bis es endlich ruhig daran lag und der kleine Mund verstummt war.

Leise ging Ellen in der Kammer auf und
ab, singend und das Kind wiegend.
Ellen setzte ihren Gang dennoch fort, sie war selbst von den Liedern ergriffen. Je länger sie sang, destomehr Melodien fielen ihr ein, und desto deutlicher entsann sie sich ihrer.
Sie ahnte, daß sie in der Küche nebenan Zuhörer hatte, denn es war still draußen geworden. Die Mädchen saßen träumend auf den Kisten oder am Boden und ließen die einfachen Melodien auf sich wirken.
Aber Ellen wußte nicht, daß sie noch einen anderen Zuschauer hatte. Wäre sie selbst nicht so vertieft gewesen, so hätte sie sicher schon vor einer Viertelstunde die glühenden Augen bemerken müssen, welche durch das Fensterchen in die von der Oellampe erleuchtete Kammer starrten, und dann vielleicht auch den Wechsel, der mit diesen Augen vorging.
Erst grimmig, finster blickend, den Bewegungen Ellens gleich einem Raubtiere folgend, änderten sie nach und nach ihren Ausdruck. Je länger Ellen sang, desto mehr wurde die Wildheit des Blickes gemildert, immer feuchter wurde das Auge, und als Ellen dem schlafenden Kinde ein kleines Weihnachtslied sang vom Sankt Klaus, Sankt Klaus ist der amerikanische Weihnachtsmann. der artigen Kindern im Schlafe Spielsachen in die Strümpfe stecke, da entströmten den Augen Tränen.
Draußen lehnte ein Mann an der Wand, ein großer, erwachsener Mann, und schluchzte wie ein Kind. Er trocknete die Tränen nicht, die unaufhaltsam aus den Augen drangen, es war ja finster, und niemand konnte ihn sehen, wußte überhaupt, daß hier jemand stand und beobachtete.
Noch immer klangen leise die schmelzenden Töne aus der Kammer. Der bleiche Fremde hatte gehofft, wenn er das Mädchen und das Kind nicht mehr sähe, würden seine weichen Empfindungen schwinden, aber er hatte sich getäuscht. Gerade, da er sie nicht mehr sah, und nur sein Ohr von der Melodie berührt wurde, war die Wirkung doppelt stark.
»Bringen dich Engel zur ewigen Ruh',« verklang drinnen ein Lied.
Der bleiche Fremde wollte schon wieder ans Fenster treten, sprang aber schnell zurück, denn in diesem Augenblick kam keuchend und in schnellem Laufe ein Mensch durch die Nacht. Es war Pueblo mit Wein und Speisen. Er hatte zu lange mit seinem Weibe geplaudert und war deshalb so schnell gelaufen, wie seine Beine und Lungen erlaubten.
Ellen hörte, wie der Fischer eintrat; sie wollte ihren Schützling in das Bett legen, bei dem Versuche aber, die Aermchen vom Halse zu lösen, wachte das Kind auf und blickte Ellen freundlich ins Gesicht.
Als dagegen jetzt Ellen nochmals versuchte, es ins Bett zu legen, umklammerte es deren Hals abermals und machte Miene, wieder zu schreien.
Dem Mädchen blieb also nichts anderes übrig, als das Kind auf dem Arme zu behalten, wollte sie ein abermaliges Lamento vermeiden, und gern fügte sie sich dem kleinen Eigensinn.
Die Mädchen in der Küche hatten dem Fischer die Sachen abgenommen und empfingen nun die eintretende Ellen mit lachenden Gesichtern. Das hatte man der Kapitänin doch nicht zugetraut, daß sie durch Geduld, Sanftmut und Singen ein schreiendes Kind zur Ruhe bringen könnte. Ja, wenn es ein wildes Pferd zu bändigen gegolten hätte, dann würde niemand ihre Fähigkeit bezweifelt haben.
Nun hatte Ellen aber bewiesen, daß sie auch Anlage zur Mutter habe.
Pueblo nahm den Krug und goß in das von Ellen hingehaltene Töpfchen — Glaser und Tassen kannte man hier nicht — den süßen, roten Wein, der wie Blut in großem Bogen dem Kruge entquoll.
Schon setzte Ellen das Gefäß an die Lippen, das belebende Getränk zu schlürfen, als das erwachte Kind auf ihrem Arme verlangend die Händchen nach dem Topfe ausstreckte und das Mündchen zum Weinen verzog.
Ellen setzte ab.
»Darf sie?« fragte sie den Fischer.
Dieser nickte.
»Aber nicht zuviel,« meinte Ellen lächelnd und führte den Krug an des Kindes Lippen.
Schmunzelnd blickte der Vater auf sein Töchterchen, das mit beiden Händchen den Krug umspannte und die Lippen saugend an den Rand des Kruges legte.
Da wurde plötzlich die Tür aufgerissen, ein Mann stürzte herein, ein Schlag, und der Topf flog dem Kinde aus der Hand, ergoß den Inhalt über Ellens Gewand und lag zerschmettert am Boden.
Erstaunt blickten alle auf den Fremden mit dem geisterbleichen Gesicht und den rollenden Augen und auf die zitternde Hand, welche den Schlag geführt hatte.
»Nicht das Kind,« murmelten die farblosen Lippen. »Das habe ich nicht gewollt!«
»Chalmers!« rief in diesem Augenblick ein Mädchen. »Wie kommen Sie hierher?«
Jetzt erkannten ihn die meisten der Damen; es war der fromme Chalmers, der Straßenprediger aus New York.
Pueblo faßte die Sache anders auf. Er glaubte, einen Räuber oder etwas Aehnliches vor sich zu haben, sprang auf den Eindringling zu und wollte ihn an der Brust packen. Aber er erhielt einen Stoß, der ihn auf die Kiste schlenderte.
»Mister Chalmers,« sagte das erschrockene Mädchen, welches ihn zuerst erkannt hatte, eine Verwandte von ihm mit gleichem Namen, »was soll das bedeuten?«
Aber der stand wie versteinert da, den Arm noch vorgestreckt und die Augen auf das Kind geheftet.
»Nein, dir galt mein Tun nicht,« murmelte er wieder. »Was hast du getan, daß ich Ungeheuer dich töten sollte?«
Sprachlos vor Staunen blickten die Damen auf den Sprecher, dessen Worte ihnen unverständlich blieben.
Dann schlug dieser plötzlich die Hand gegen die Stirn, brach in ein heiseres Lachen aus und war mit einigen Sprüngen wieder zur Tür hinaus, ebenso schnell wie er gekommen war.
»Er ist wahnsinnig,« flüsterte Ellen. »War das wirklich Mister Chalmers?«
»Er war es.«
»Wie kommt er hierher? Hat ihn sein Wahnsinn — denn er litt unbedingt an religiösem Wahnsinn — hier in diese Wildnis getrieben, um Bekehrungsversuche unter den Indianern zu machen?«
Ellens Frage wurde nicht beantwortet.
Draußen erscholl mit einem Male wildes Schreien, Rufen, Fluchen. Es war, als ob Männer um Leben und Tod rängen. Zwei Revolverschüsse fielen, ein Weheruf folgte und dann ein Schrei der Ueberraschung.
»Zu den Waffen,« schrie Ellen, ließ das Kind auf eine Kiste gleiten und sprang dahin, wo die Gewehre zusammengestellt und die übrigen Schußwaffen niedergelegt worden waren.
Verschwunden war die Müdigkeit. Alle Mädchen stürzten mit Ellen gleichzeitig nach der Ecke. Dadurch entstand ein Gedränge, jede wollte zuerst ihre Waffe in der Hand haben, aber ehe die vordersten dazu kamen, wurden die hintersten schon von rohen Fäusten gepackt.
Hilferufe gellten. Man sah Pueblo mit einem Manne, wie ein Fischer gekleidet, ringen, er wurde überwältigt, und in der nächsten Minute war dies das Los aller.
Die ganze Stube wimmelte von Fischern, doch konnten es keine Bekannten von Pueblo sein. Zwischen ihnen befanden sich zwei andere Gestalten, von denen sie eine eben vorhin erst gesehen hatten — Chalmers. Auch die andere erkannten einige der Mädchen, es war Kirkholm..
»Verzeihung, schöne Cousine,« wandte sich Kirkholm mit teuflischem Lächeln an Miß Murray, deren Hände eben von zwei Fischern auf den Rücken gebunden wurden. »Verzeihung, daß ich so unhöflich mit Ihnen und Ihren Freundinnen verfahren muß, aber jeder ist sich selbst der Nächste, und mein Leben hängt davon ab, daß Sie nicht nach Matagorda kommen.«
»Sparen Sie Ihre Worte!« rief ihm Jessy zu. »Wir wissen schon längst, mit welchen schurkischen Gegnern wir es zu tun haben. Schade, daß ich nicht Zeit fand, meinen Revolver zu fassen, dann würden Sie nicht spotten.«
»Aber die Zeit wird noch kommen, da Sie und Ihre Freunde zur Verantwortung gezogen werden,« fügte Ellen drohend hinzu.
»Ich glaube kaum,« sagte Kirkholm und wandte sich dann an Chalmers, mit dem er sich besprach.
Die Mädchen waren ebenso, wie Pueblo, gebunden worden.
Die Hütte war ganz voll von Fischern, und draußen waren noch mehr, wie man an dem Stimmengewirr hören konnte. Sie mußten sich ganz sicher fühlen, sonst hätten sie nicht so laut gesprochen. Auf manchen Gesichtern lag eine dumpfe Verzweiflung, auf einigen eine wilde Freude.
Auch Kirkholm und Chalmers sprachen ganz ungeniert, ein böses Zeichen für die Mädchen.
»Das wäre eine schöne Geschichte gewesen,« lachte Kirkholm, »wenn wir Sie in der Dunkelheit nicht noch rechtzeitig erkannt hätten. Die Burschen sehen Sie nicht eben freundlich von der Seite an,« fügte er etwas leiser hinzu, »Sie haben zwei von ihnen mit dem Revolver nicht unerheblich verletzt. Sie werden draußen verbunden.«
»Was kann ich dafür?« entgegnete Chalmers finster. »Ich glaubte mich von Fremden überfallen und wehrte mich eben meiner Haut.«
»Was aber hatten Sie in der Hütte bei den Damen zu suchen?« fragte Kirkholm mißtrauisch. »Wir dachten natürlich nicht anders, als Pueblo, bei dem wir die Mädchen wußten, hätte unsere Ankunft gemerkt und wollte, Schlimmes ahnend, fliehen.«
»Ich wäre in der Hütte gewesen?« fragte Chalmers ganz erstaunt. »Dann haben Sie nicht richtig gesehen.«
»Oho,« rief Kirkholm, »meine Augen betrügen mich nicht. Ich sah ganz deutlich, wie Sie gleich einem Wahnsinnigen aus der Tür stürzten.«
»Ihre Aussage beruht auf einem Irrtum,« sagte Chalmers langsam, die Augen fest auf den Genossen geheftet, »hören Sie mich ruhig an, dann urteilen Sie.«
»Ich erwartete Sie, wie wir ausgemacht hatten, heute abend in der spanischen Weinschenke, aber Sie kamen nicht.«
»Weil ich nicht konnte. Es ist alles anders gekommen,« unterbrach ihn Kirkholm.
»Das ist mir jetzt klar geworden. Während ich Sie erwartete,« fuhr Chalmers fort, »trat dieser Mann ein, Pueblo, und wollte Wein und Eßwaren für Personen holen, welche ihn um Gastfreundschaft für diese Nacht gebeten hatten. Aus seiner Beschreibung entnahm ich, daß diese Gäste niemand anderes als die elf Vestalinnen sein konnten. Ich schlich mich Pueblo nach, sah durch das Fenster und überzeugte mich, daß ich recht gehabt hatte, und sann auf ein Mittel, um die Damen, welche ihrem Schicksal auf den Riffen entgangen waren, hier festzuhalten, als die Tür plötzlich aufging und ich, um nicht entdeckt zu werden, schnell in die Dunkelheit zurückspringen mußte. Da ich dicht neben der Tür gestanden habe, mag es so ausgesehen haben, als wäre ich aus der Hütte selbst gesprungen.«
Chalmers hatte diese unwahre Erzählung sehr laut und deutlich vorgetragen. Alle Mädchen hatten sie gehört und plötzlich tauchte in ihren Herzen eine Erkenntnis auf. Dieser Chalmers spielte seinem verbrecherischen Genossen gegenüber ein falsches Spiel, er stand vielleicht auf ihrer Seite.
»Es mag sein, ich will es nicht bestreiten,« sagte Kirkholm nach kurzem Nachdenken zögernd.
»Bestreiten?« brauste Chalmers auf.
Man hätte gar nicht vermutet, daß der sonst so stille Chalmers so heftig werden könnte, die Damen, die ihn nur als Prediger kannten, wenigstens nicht, wohl aber Kirkholm und die, welche seine wahre Natur durchschauten.
»Ich habe mich getäuscht,« rief Kirkholm schnell, »ich habe keinen Grund, Ihnen zu mißtrauen.«
»Das wollte ich auch meinen,« murmelte Chalmers mit zusammengekniffenen Zähnen.
Nun begann Kirkholm zu erzählen, wie ihr Anschlag insofern mißglückt sei, als die ›Vesta‹ von den Trugfeuern wohl zwischen die Riffe gelockt, aber auf ihnen hängen geblieben wäre. Die anderen elf Mädchen seien schon so gut wie tot, denn der weiße Wolf wäre hinter ihnen her. Kirkholm vergaß auch nicht, zu schildern, wie er selbst vom weißen Wolf bald ermordet worden wäre, wenn Nathaniel nicht erschienen und die Wahrheit seiner Aussagen bezeugt hätte, daß nämlich die Mädchen ihren alten Lagerplatz verlassen hatten.
»Ich setzte mit den Fischern, welche auf der ›Vesta‹ waren, den elf zuerst abmarschierten Mädchen nach, aber in einem Boote auf dem Seewege. Dadurch kamen wir eher als sie hier an und beobachteten, wie sie in diese Hütte einkehrten. Nun aber gilt es, sie für immer zum Schweigen zu bringen, damit wir endlich einmal in Sicherheit kommen,« schloß Kirkholm mit einem Fluche.
Schaudernd hörten die Mädchen diese Worte, sie erbebten unter dem Blicke des hartherzigen Verbrechers. Hilfesuchend wendeten sie die Augen nach Chalmers, von dem sie glaubten, er habe Besseres mit ihnen vor. Doch er starrte finster, die Arme übereinander verschränkt, vor sich hin.
»Wie wollen wir sie beseitigen?« fragte er mitleidslos.
»Nicht hier,« entgegnete Kirkholm. »Diese Leute sind zwar froh, diejenigen in den Händen zu haben, welche sie durch eine Anzeige an den Galgen bringen können, und sie brennen danach, ihnen die Gurgel zu durchschneiden, aber sie wollen es so still als möglich machen, und ich muß mich ihnen fügen. Vierunddreißig Mann sind hier, alle, die sich an dem Ueberfall auf die ›Vesta‹ beteiligten, und sie haben das Los gezogen, wer von ihnen die Mädchen auf diese oder jene Weise töten soll. Diese zehn Mann, die hier in der Stube sind, hat das Los getroffen, und sie werden ihre Aufgabe erfüllen.«
Es waren rohe, erbarmungslose Gesichter, welche die Mädchen erblickten.
»Verdammter Hund,« schrie eben einer von ihnen. Er stieß mit dem Fuße unter den Tisch, weil ihn etwas am Fuße gekratzt hatte, und sofort kam ein großes, gelbes Tier darunter hervorgesprungen.
»Juno,« rief Ellen.
»Eine Löwin,« schrieen Kirkholm und Chalmers gleichzeitig und rissen die Revolver aus der Tasche.
Doch Juno war von dem Fischer, der noch nie eine Löwin gesehen, ein solches Tier überhaupt nicht kannte, so schmerzlich in die Seite getreten worden, daß sie winselnd zur Tür hinauslief und in der Finsternis verschwand.
Wehmutsvoll blickte Ellen ihr nach.
Was hätte diese Löwin, schon vollständig erwachsen und stark, ihr für ein Schutz sein können, wenn sie nicht ein so sanftmütiges Tier gewesen wäre! Es hatte von Ellen tausend Kunststückchen gelernt, es fraß aus der Hand, ließ mit sich anstellen, was man wollte, weil es geschlagen worden war, wenn es biß, aber Juno war lammfromm und zeigte von Wildheit keine Spur. Zu spät erkannte Ellen, daß sie sich in dem starken Tier nur ein Spielzeug erzogen hatte.

Wie hätte Juno diese Hand voll Männer zu Paaren treiben können, wenn sie im Bewußtsein ihrer Kraft gewesen und auf den Mann dressiert worden wäre.
Zu spät, Juno suchte mit eingekniffenem Schwanze das Weite, um nicht wieder getreten zu werden.
»Wem gehört der Löwe, meine Damen?« fragte Kirkholm die Mädchen.
Keine Antwort.
»Ihnen, Miß Petersen?«
Ellen verschmähte, zu antworten.
»Es ist gleichgültig. Mister Chalmers, wenn sich die Bestie noch einmal sehen läßt, bekommt sie eine Kugel ins Gehirn; es ist besser so, wenn sie auch harmlos zu sein scheint.«
Dann wurden wieder Pläne gemacht.
Kirkholm und Chalmers sprachen jetzt leise zusammen und zogen dann Frankos, den spanischen Fischer, das Oberhaupt dieser Bande, mit in die Unterredung.
»Wie weit ist die Ruine, von der Ihr sprecht?«
»Leise, Herr,« erwiderte der Fischer, »wenn die Leute hören, daß wir dorthin wollen, so kommen sie nicht mit. Es ist nicht recht geheuer zwischen dem alten Gemäuer.«
»Ah, desto besser.«
»Ja, die alten Bewohner von Texas sollen dort als Gespenster umgehen und nach den Schätzen suchen, die sie einst darin versteckt hatten. Aber ich glaube an solchen Unsinn nicht. Ich lache darüber.«
»Recht so. Also dorthin sollen die Mädchen gebracht werden,« flüsterte Kirkholm.
»Ja. Findet man sie dort mit umgedrehten Hälsen, so glauben die Umwohner, die Geister hätten sie getötet, und schlagen ein Kreuz. Hihihi!«
»Wie weit ist es bis zur Ruine?«
»Man lauft zwei Tage immer durch den dichtesten Wald. Keine Seele trifft man unterwegs.«
»Kennt Ihr den Weg?«
»Wie meine Tasche. Ich bin hier geboren und kenne jeden Baum. Aber macht schnell, es ist bald Mitternacht, und wir müssen eilen!«
»Noch eins, was soll mit Pueblo geschehen?«
Der Fischer warf einen haßerfüllten Blick auf den gebundenen Pueblo, und dieser bebte zusammen. Er mußte Grund haben, Frankos Haß zu fürchten.
»Dieser Hund hat mich aus der Heimat gejagt,« knirschte Frankos durch die Zähne, »er muß mit, auch er stirbt.«
»Gut, wie Ihr wollt! Warum treibt Ihr aber so zum Aufbruche? Wir sind doch sicher.«
»Bald muß Inez, Pueblos Weib, kommen. Sie müßte so viele Menschen schon von weitem sehen oder hören, würde Verdacht schöpfen und umkehren. Sie soll aber in unsere Hände fallen, darum eben müssen, wie ich schon vorher sagte, einige Leute hierbleiben und sie abfassen, während Ihr zu Euren Genossen zurückkehrt.«
Frankos trat sehr herrisch auf. Er schien der Leiter des ganzen Unternehmens zu sein, und die beiden Herren mußten sich ihm fügen, denn er hatte die Fischer auf seiner Seite.
»Gut denn, so wollen wir uns trennen,« sagte jetzt Kirkholm zu Chalmers. »Spurgeon liegt nicht weit von hier mit noch mehr Fischern versteckt, um uns den Rücken freizuhalten. Ich kehre mit einem Teil der Leute zu ihm zurück. Boote haben wir. Sechs Leute bleiben hier, um Inez, Pueblos Weib, abzufangen. Ist es nicht so, Frankos?«
Frankos nickte.
»Und Sie begleiten Frankos mit den vom Los getroffenen zehn Mann nach der Ruine, wo die Mädchen ihr Schicksal erwartet. Ist Ihnen dies recht?«
Chalmers kam zu keiner Antwort, Frankos mischte sich dazwischen.
»Wozu? Ich brauche keine Begleitung. Oder traut Ihr mir nicht, daß Ihr mir einen Aufseher mitgeben wollt?«
»Durchaus nicht, Frankos,« beschwichtigte Kirkholm den Aufgebrachten, »aber Ihr wißt doch, wie viel uns an dem Tode dieser Weiber gelegen ist. Einer von uns muß unbedingt Zeuge desselben sein.«
»Uns ist nicht weniger daran gelegen, als Euch,« lachte der Fischer.
»Das fragt sich.«
»Ich brauche keinen Aufseher.«
»Bedenkt, daß noch eine hohe Summe dafür ausgesetzt ist, daß Ihr Euch allen meinen Anordnungen fügt.«
Dies schlug bei dem geldgierigen Fischer an.
»Sei es denn! Der Fremde mag mitkommen, die Führung aber übernehme ich. Vorschriften lasse ich mir unterwegs nicht machen.«
»Einverstanden,« sagte Kirkholm und wandte sich dann wieder an Chalmers.
»Und wollen Sie den Auftrag übernehmen und der Exekution beiwohnen, damit wir endlich in Sicherheit kommen? Sie sind der starknervigste Mann unter uns. Offen gestanden, ich könnte nicht gleichgültig dabei bleiben. Sie haben schon oft Proben von Ihrer Entschlossenheit abgelegt. Wollen Sie?«
»Ich werde die Weiber begleiten,« entgegnete Chalmers gleichgültig, »und Ihnen die Nachricht ihres Todes überbringen.«
Die Mädchen hatten ihr eigenes Todesurteil gehört und ferner, daß ihrer zurückgebliebenen Freundinnen kein anderes Los wartete, wenn ihre Skalpe nicht bereits die Gürtel der Apachen zierten.
Eine unsagbare Verzweiflung bemächtigte sich ihrer Herzen, bis sie einer vollkommenen Teilnahmslosigkeit wich.
Von Johanna wußten sie schon, daß die eigenen Verwandten ihre Feinde waren; daß diese aber solche Bestien in Menschengestalt seien, würden sie nicht geglaubt haben.
Wie leicht konnten doch ausschweifendes Leben, Spiel und Sucht nach Reichtum den Menschen zum Raubtier ohne Gewissen machen!
Schweigsam saßen sie da, apathisch vor sich hin blickend. Nur in Ellens Augen flackerte ein düsteres, unheimliches Feuer, aber sie senkte den Kopf tief auf die Brust, als fürchte sie, ihre Augen könnten ihre Gedanken verraten.
Ellen war nicht gewillt, so leichten Kaufes ihr Leben zu lassen. War ihr Tod unabwendbar, so wollte sie doch nicht allein sterben. Nur Geduld, einer dieser Schurken sollte mit ihr in den Tod, womöglich Chalmers, der sie begleitete. Sie hatte nicht umsonst ihr ganzes Leben zwischen wilden Cowboys zugebracht und mit Indianern verkehrt. Sie wußte, wie man es macht, auch mit gefesselten Händen einem Feinde furchtbar zu werden. Oft genug war sie Zeuge solcher blutigen Szenen gewesen.
Aber jetzt war noch nicht die Zeit zur Ausführung ihres Vorhabens. Erst mußten sie im Walde sein.
»Wollt Ihr die Nacht durch den Wald marschieren?« fragte Kirkholm den Führer.
»Nein, wir lagern dort. Nicht weit von hier steht ein altes Holzhaus, dort werden wir die Nacht verbringen, es ist sicher. Einige Leute sind vorausgeschickt und machen es zum Aufenthalt für diese Damen bequem,« sagte der Fischer mit einem höhnischen Grinsen.
All right, so kann ich mit den übrigen Leuten gehen. Wir treffen uns, wie wir ausgemacht haben.«
Die Mädchen wurden zum Aufstehen aufgefordert. Willenlos gehorchten sie dem rauhen Befehle.
»Adieu, schöne Cousine,« wandte sich Kirkholm an Miß Murray, »wir werden uns in diesem Leben wohl nicht wiedersehen. Seien Sie aber versichert, daß ich Ihre Besitztümer gut verwalten und von Ihren Geldern guten Gebrauch machen werde. Ich empfehle Ihnen Mister Chalmers als Beichtvater in Ihrer letzten Stunde. Er versteht sich auf solche Sachen. Holen Sie sich bei ihm Trost vor dem Tod, er kann jede Seele von allen Sünden entbinden. Er hat genug Erfahrung in New York gesammelt.«
Lächelnd verließ Kirkholm die Hütte und wurde von einigen Fischern begleitet, denen sich draußen noch andere anschlossen.
Sie schlugen den Weg nach dem Strande ein.
»Ihr sechs bleibt zurück,« sagte darauf Frankos zu einigen Fischern. »Wenn die schöne Inez kommt, so nehmt ihr sie fest und bringt sie dahin, wo ich euch gesagt habe. Haltet euch still, versteckt euch in die finstere Kammer! Das Kind bleibt bei euch, laßt es meinetwegen schreien, das lockt die Mutter besser an. Dann nehmt ihr es auch mit.«
Frankos hieß die Mädchen hinausgehen, und als eins nicht schnell genug seinem Befehle nachkam, gab er ihm einen Fußtritt, so daß es zum Fall kam.
Ellen knirschte hörbar mit den Zähnen.
»Aergert dich das?« lachte Frankos. »Wartet nur, Püppchen, ihr werdet noch mit den Zähnen klappern, aber nicht mehr knirschen. Ha, wie ich euch hasse, euch vermaledeite Brut, die ihr so hochnäsig auf uns herabzuschauen gewohnt waret!«
Frankos war so haßerfüllt, daß er nicht den drohenden Gesichtsausdruck von Chalmers bemerkte, als das Mädchen getreten wurde.
»Seid Ihr fertig?« wurde er kurz gefragt, und sofort glätteten sich seine Züge wieder.
»Ja.«
»Dann fort!«
Die Mädchen und Pueblo wurden von acht Männern in die Mitte genommen, Frankos ging voran, Chalmers hinterher. Ein Fischer hatte das Netz mit Nahrungsmitteln an sich genommen.
Sechs Fischer blieben zurück, löschten das Licht in der Kammer aus und zogen sich mit dem Kinde in dieselbe zurück.
Einen Blick voll des namenlosesten Wehs warf Pueblo noch seinem Lieblinge nach, dann bewegte sich der Zug mit ihm und den Mädchen, deren wunde Füße den Dienst zu versagen drohten, dem Walde zu.
Sie waren noch nicht weit gegangen, als Chalmers zu Frankos trat.
»Einen Augenblick,« sagte er, »ich habe meinen Tabaksbeutel in der Hütte liegen lassen.«
»Macht schnell, daß ihn die Spitzbuben in der Hütte nicht zu fassen bekommen, die wollen sonst von nichts wissen,« rief Frankos dem schon Zurückeilenden nach.
Als Chalmers in die Hütte trat und von den Fischern, die glaubten, Inez käme schon, mürrisch empfangen wurde, suchte er nicht nach seinem Tabaksbeutel, denn den hatte er in der Tasche, sondern bückte sich und brachte tief unter dem Tische einen Krug zum Vorschein.
»Hier, eine Freude für Euch,« sagte er, »der Wein war für die Weiber bestimmt. Ich sah, wie Pueblo ihn hereinbrachte. Warum soll er denn hier sauer werden? Vertreibt Euch die Langeweile damit.«
Der Krug war bisher nicht entdeckt worden, weil die Hütte von Menschen vollgepfropft gewesen war und die Lampe den Raum nur schwach beleuchtete.
Die Fischer hätten wohl kaum daran gedacht, unter den Tisch zu sehen.
Jetzt verzogen sie die erst mürrischen Mienen zu einem grinsenden Lächeln. Etwas Besseres hätte ihnen der Zurückgekehrte nicht mitteilen können.
»Das war es, weshalb ich noch einmal umkehrte. Ihr seht, ich denke auch an meine Mitmenschen,« lachte Chalmers. »Laßt Euch den Wein schmecken, steckt aber die Nase nicht zu tief in den Krug. Ihr könntet sonst einschlafen und womöglich nicht erwachen, wenn Inez kommt.«
»Dank, Senor,« riefen die Fischer Chalmers nach, der schnell die Hütte verließ und Frankos einholte, noch ehe dieser den Wald erreicht hatte.
»Habt Ihr den Beutel?« empfing ihn der Fischer Frankos, und seine Stimme klang diesmal etwas freundlicher als vorher.
»Hier ist er.«
Chalmers hatte den Wink verstanden; auch Frankos rauchte gern billigen Tabak.
Dann ging es weiter in den Wald hinein, dem Hause zu, das ihnen diese Nacht als Obdach dienen sollte. — —
In Pueblos Fischerhütte war es still geworden. Kein Laut verriet, daß sechs Männer in der Schlafkammer verborgen waren. In der Küche brannte noch immer das schwache Oellicht.
Der Sturm hatte sich gelegt, aber noch immer fegte heftiger Wind die Küste entlang und ließ die Kleider des Weibes flattern, das gegen ihn anstrebte, mit der einen Hand das Kopftuch festhaltend, mit der anderen ein kleines Paket gegen die Brust drückend.
Da blickte ihr, als sie um die Waldesecke bog, schon ganz nahe ein Licht entgegen.
»Gelobt sei Gott,« seufzte sie, aber der Seufzer klang fröhlich, »bald bin ich da.«
Je mehr sie sich der Hütte näherte, ein desto heitereres Lächeln verklärte ihre Züge, bis sie endlich die Tür aufstieß und eintrat.
Sie wunderte sich, daß ihr nicht, wie sonst, Pueblo entgegenkam und ihr das Kind entgegenhielt.
Wahrscheinlich war er in der Kammer und brachte die Kleine zur Ruhe.
Die ganze Diele war voll schmutziger Fußtapfen und — Inez blieb plötzlich wie erstarrt stehen, — da — da — heiliger Gott, klang es nicht wie ein Wimmern aus der Kammer?
Inez riß die Lampe von der Wand und stürzte in die Kammer.
»Pueblo — mein Kind,« war ihr einziger Gedanke.
Entsetzt stand Inez im Türrahmen und glaubte ihren Augen nicht trauen zu dürfen.

Entsetzt stand Inez im Türrahmen und
glaubte ihren Augen nicht trauen zu dürfen.
Am Boden lagen sechs Männer, zusammengekrümmt, halb sitzend, die Oberkörper weit vornübergebeugt.
Die Lampe beschien schreckliche, in Schmerz verzogene Gesichter; Schaum stand vor den Lippen; die Finger krallten sich in die Kleider.
Einer lebte noch etwas, der Körper zuckte, und die Augen rollten noch schwach. Die übrigen lagen starr und trugen den Stempel des Todes auf den fahlen Stirnen.
Zwischen ihnen lag ein umgeworfener Krug, der Krug, den Pueblo mit Wein hatte füllen lassen — er war leer.
Wo war Pueblo, wo war ihr Kind?
Da raschelte etwas im Winkel, ein Händchen streckte sich unter am Boden liegenden Kleidern hervor, und ein weinerliches Stimmchen wurde hörbar.
Mit einem Sprunge stürzte Inez vor und hatte im nächsten Moment ihr Kind auf dem Arme. Es lebte und lachte die Mutter mit verschlafenen Augen an.
Wo war Pueblo, wo waren die Gäste? Waren nur diese sechs Fischer dagewesen? Sprach Pueblo nicht von elf verkleideten Weibern?
In Inez' Kopfe begannen sich die Gedanken zu verwirren, sie konnte nicht mehr klar denken.
Sie drückte das Kind fest an die Brust und stürzte zurück nach den Häusern. Der Wind trieb sie vor sich her, schneller als er flog das Weib seinem Ziele zu.
»Mord, Mord!« gellte es durch die um diese Zeit sonst so stillen Dorfgassen. Die müden Fischer und Arbeiter fuhren aus ihrem Schlafe auf, konnten aber nur schwer dazu gebracht werden, die Ursache der Hilferufe zu erforschen. Die Erzählung des Weibes schien ihnen unglaublich, wenn nicht einige darunter gewesen wären, die Pueblos Rede in der Schenke angehört hatten. In der nächsten halben Stunde war die Nachricht verbreitet, Pueblo wäre von seinen Gästen ermordet worden.
Die Nacht in der Hütte, die früher einem Holzfäller gehört hatte, war schrecklich gewesen. Die Mädchen waren nicht wie Menschen, sondern wie Tiere behandelt worden.
Frankos hatte zuerst die Absicht, die Gefangenen im Freien schlafen zu lasten, sie vorher aber auch noch an den Füßen zu fesseln, doch war er bei Chalmers auf heftigen Widerstand gestoßen.
»Auch ich wünsche den Tod dieser Weiber,« erklärte er, »dulde aber nicht, daß sie gemartert werden. Ich bin kein Indianer, der seine Gefangenen vor dem Tode quält. Habt Ihr, Frankos, solche Angewohnheiten angenommen, so werde ich sie doch nicht in meiner Anwesenheit dulden.«
Diese Worte waren mit so finsterer Energie gesprochen, daß Frankos es für gut fand, seinen ersten Entschluß zu ändern.
Die Mädchen wurden in die Hütte wie Schlachtvieh zusammengetrieben; sie lagen dicht nebeneinander, aber das war ihnen gleich. Nur schlafen, schlafen und womöglich gar nicht wieder erwachen, das war ihr sehnlichster Wunsch, so erschöpft fühlten sie sich von körperlicher und geistiger Anstrengung. Noch niemals war ihnen der Begriff so klar wie jetzt geworden, was es heißt, todmüde zu sein.
Die Fischer, oder vielmehr die Räuber, lagerten sich um ein Feuer und ließen sich die mitgenommenen Vorräte schmecken, welche sich die Mädchen hatten holen lassen. Die zwei vorausgeschickten Leute hatten übrigens auch schon Proviant mitgebracht.
»Wollt Ihr die Weiber auch noch füttern?« murrte Frankus, als Chalmers Brot und Fleisch nahm und es zu den Mädchen hinübertrug.
Chalmers wandte sich um.
»Glaubt Ihr, sie können einen zweitägigen Marsch durch den Wald aushalten, wenn sie nichts zu essen und zu trinken bekommen?« fragte er. »Sie bleiben unterwegs liegen, und Ihr habt dann Mühe mit ihnen.
»Was würde das weiter machen? Ob sie eher oder später sterben, ist gleichgültig.«
»Sehet ein, Mann, daß es besser ist, wenn wir sie an dem von Euch bezeichneten Orte zusammen sterben lassen. Nach Eurer Erzählung gibt es dort viele Verstecke, wo man sie für immer verschwinden lassen kann; im Walde dagegen können die Leichen gefunden werden. Nehmt Vernunft an, Mann, und gebt Euren Leuten den Befehl, daß sie die Mädchen füttern, denn daß ich ihnen die Hände frei mache, wollt Ihr doch nicht.«
»Auf keinen Fall,« rief Frankos, sah aber die Richtigkeit von Chalmers Vorschlag ein.
So wurden die elf Vestalinnen und Pueplo von den Fischern gefüttert, und sie verschmähten die dargebotene Nahrung nicht, denn Ellen hatte ihnen bei der ersten Gelegenheit, die sie erspähen konnte, zugeflüstert, sich vorläufig in ihr Schicksal zu ergeben und alles zu tun, ihre Kräfte zu erhalten.
Sie vertrauten Ellen. Ihre Kapitänin hatte sie oft genug aus schlimmen Lagen befreit.
Glich dieses Fortschleppen durch den Wald nicht fast ganz der Gefangennahme durch die Inder, und war es damals nicht auch Ellen gewesen, die zuerst ihre Fesseln gebrochen? Und damals hatten sie es mit schlauen Indern mit wirklichen Kriegern zu tun gehabt, hier dagegen nur mit unbeholfenen Fischern. Zwei Tage standen ihnen noch zur Verfügung, und noch ein Umstand hielt ihre Hoffnung aufrecht.
Wenn sie sich nicht ganz täuschten, so stand Chalmers auf ihrer Seite. Warum suchte er denn ihre Lage zu erleichtern, warum trat er Frankos gegenüber heftig auf, wenn er ihnen grollte?
Wollte Chalmers wirklich nur Grausamkeiten verhüten? Das hätte nach dem, was er den Mädchen bis jetzt zuzufügen suchte, lächerlich geklungen. Nein, es schien eher, als besaßen sie in Chalmers einen Freund, der auf ihre Rettung sann.
Darauf also setzten die Gefangenen ihre Hoffnung, mit Ausnahme von zweien, Miß Murray und Ellen. In beider Herzen stand der Entschluß fest, die erste Gelegenheit zur Flucht zu benutzen, und sollte diese auch in den Tod führen.
Doch noch einmal sollten sie einer rohen Behandlung unterworfen werden, ehe sie sich dem langersehnten Schlafe hingeben durften, ersehnt, trotzdem sie die Nacht mit auf dem Rücken zusammengebundenen Händen verbringen sollten.
Chalmers war einmal hinausgegangen, um aus dem nahe vorbeifließenden Flusse Trinkwasser für die Mädchen zu schöpfen.
Darüber verging einige Zeit, und als er wieder in die Hütte trat, sah er, wie eben ein Fischer das letzte Mädchen mit roher Hand visitierte. Chalmers kam zu spät, diesen Akt zu verhüten. Die Fischer waren schon in, Besitz aller der Waffen und Wertsachen der Mädchen, die sie ihnen während seiner Abwesenheit schnell abgenommen hatten. Die Gefangenen hatten dies willenlos geduldet. Was hätte ihnen auch Schreien oder Sträuben genützt.
Die Beute war eine sehr reiche. Gierig zählten die Räuber das Geld. Noch nie hatten sie so viel davon beisammen gesehen, und dazu kamen noch Uhren, Ringe und andere Wertsachen.
Es wurde alles sofort verteilt, Frankos beanspruchte natürlich den Löwenanteil.
Endlich wurden aber auch die Fischer müde. Sie legten sich schlafen, nachdem sie einen Wachtposten ausgestellt hatten. Auch die Mädchen, so trostlos ihre Lage war, fielen sogleich in Schlaf, als sie unbelästigt blieben.
Nur drei Personen floh der Schlaf, den Wachtposten, Pueblo, der mit geschlossenen Augen dalag, aber oftmals seufzte und stöhnte, weil er an Frau und Kind dachte, und Chalmers. Letzterer saß an der Holzwand, die Arme übereinandergeschlagen, und starrte unverwandt in das flackernde Feuer.
Wer konnte sagen, was hinter der weißen Stirn vorging? Ein seltsames Bild bot die Hütte dar.
Um das Feuer lagen die wilden Gestalten der langgestiefelten Fischer, Haar und Bart zerzaust, ungewaschen und einen Dunst von Fisch um sich verbreitend. Dort in der Ecke schmiegten sich die jungen Mädchen zusammen, die Hände zwar gebunden, aber doch glücklich lächelnd im Schlafe, der Traum täuschte sie über ihr Los. Zwischen ihnen saß der elegant gekleidete Herr mit dem blassen Gesicht und den dünnen, weißen Fingern, deren einzige Beschäftigung bis jetzt gewesen war, in der Bibel und dem Gebetbuch zu blättern — am Tage, oder die Spielkarte zu mischen — des Nachts.
Chalmers, der Fromme genannt, wurde selbst von seinen Freunden als Spieler bezeichnet. Manche Nacht hatte er am Spieltisch durchwacht, daher entbehrte er auch jetzt nicht den Schlaf, denn als der Posten beim Morgengrauen die Kameraden und die Gefangenen weckte, erhob sich Chalmers, ohne ein Auge geschlossen zu haben, und ohne eine Spur von Müdigkeit zu zeigen.
Der Zug wurde wieder geordnet und es ging weiter, dem Ziele zu.
Voran schritt Frankos, dem sich diesmal Chalmers beigesellte, dann kamen die Mädchen zu zweien, und neben ihnen schritten die zehn Fischer. Die Stricke der Gefangenen waren am Morgen von ihnen nachgesehen worden, und so gaben sie nicht besonders acht auf ihre Opfer. Ueberdies war es nicht immer möglich, neben diesen herzugehen, denn der Marsch ging durch einen Urwald. Oftmals kam der Zug in Unordnung. Wo einer den Durchweg gefunden hatte, fand ihn der andere nicht, nun wurde es so eingerichtet, daß immer einige Fischer zurückblieben, um die Gefangenen beobachten zu können.
Die Mädchen unterhielten sich nicht. Alle Versuche, ein Gespräch anzufangen, waren ihnen barsch verboten worden.
Es mochte gegen mittag sein, als es Ellen vorkam, als wenn Jessy sie manchmal lange und eindringlich ansähe und sich möglichst weit von den Männern zu entfernen suche.
Ellen ahnte, daß die Freundin ihr etwas mitzuteilen habe, und richtete es so ein, in deren Nahe zu kommen.
Das glückte auch, ohne daß es einem Wächter auffiel.
»Kann meine Fesseln abstreifen, sie haben sich gelockert,« flüsterte Jessy.
Ellen hätte fast aufgejubelt, so wenig auch Aussicht auf ihre eigene Befreiung vorhanden war. Wenn nur wenigstens eine diesen Teufeln entschlüpfte.
»Soll ich fliehen?«
»Ja.«
»Wann?«
»Wenn der Zug sich gerade recht ausdehnt.«
»Wohin?«
Ellen zögerte einen Augenblick.
»Nach Norden, nach der Ruine.«
»Ich kenne sie nicht.«
»Halten Sie sich auf unserer Spur. Haben Sie Waffen?«
»Man hat mir alles abgenommen.«
Das flüsternd geführte Gespräch mußte abgebrochen werden, denn der Führer näherte sich beiden und trieb sie mit einem Fluche zum Schnellergehen an. Dann trat er wieder zu Chalmers, dessen Tabaksbeutel er fleißig in Anspruch nahm. Diesem hatte Chalmers es zu danken, daß er manchmal einer freundlicheren Unterhaltung von dem groben Fischer gewürdigt wurde, so wenig ihm auch daran lag.
»Ein verdammter Wald, nicht?« sagte Frankos. »Gerade noch so undurchdringlich wie vor zwanzig Jahren, da ich mich als Kind in ihm herumtrieb. Und die Mücken, brrr. Gebt mir euren Beutel, der Rauch vertreibt sie.«
Wortlos überreichte Chalmers ihm das Verlangte.
Frankos stopfte sich eben bedächtig die Pfeife, ohne im Gehen einzuhalten, als plötzlich ein lautes Schreien seiner Leute ihn veranlaßte, dieselbe schnell wieder einzustecken und nach der Pistole im Gürtel zu greifen.
»Haltet sie, sie flieht!« erklang es.
Da krachte es schon in den Büschen, Frankos sah eine Gestalt durch die Zweige brechen, ein Mädchen, Sofort schoß er nach ihm, noch andere Pistolen krachten, aber mit unveränderter Schnelligkeit floh es weiter.
»Zurück,« schrie Frankos, »zurück ihr da, sonst fliehen alle!«
Doch die Mädchen dachten mit auf dem Rücken gebundenen Händen an keinen Fluchtversuch, aber einige, und ganz besonders Ellen, hatten einer Szene beigewohnt, die für Frankos verloren ging.
In dem Augenblick, da alle zehn Fischer zugleich der Fliehenden nachsetzten, zog der hinter Frankos stehende Chalmers blitzschnell einen Revolver aus der Tasche und hielt ihn in den Rücken des Führers.
Doch der Ruf Frankos' brachte die letzten Fischer zum Stehen, Sechs von ihnen kehrten um, damit die anderen Mädchen nicht ebenfalls entflöhen, und sofort verschwand Chalmers' Revolver wieder in der Tasche.
Er hatte keine Zeit gehabt, seine Absicht auszuführen, welche vielleicht den Mädchen zum Nutzen gewesen wäre, vielleicht auch zum Schaden. Jedenfalls hatten sie jetzt erkannt, daß er auf ihrer Seite war und sie aus den Händen der Fischer befreien wollte.
Noch immer hörte man die vier Fischer durch die Büsche brechen, kein Schuß fiel mehr, denn sie hatten nur einfache Pistolen, also war anzunehmen, daß Jessys Flucht geglückt war.
Fluchend kehrten die anderen sechs zurück; noch ehe sie aber die alte Stelle erreicht hatten, fühlte Ellen plötzlich ein unbändiges Verlangen nach Freiheit in sich auftauchen. Ihre Hände waren zwar gebunden, aber mit diesen plumpen Fischern wollte sie dennoch um die Wette laufen.
Gedacht, getan! Ellen drehte sich kurz entschlossen um, ein Sprung über einen Baumstamm, und sie war schon den Augen der Verfolger entschwunden.
»Ihr nach, Brentano!« rief Frankos einem seiner Leute zu, außer sich vor Wut über diesen neuen Fluchtversuch. »Ihr übrigen bleibt hier. Und ihr,« wandte er sich wutschnaubend an die letzten neun Mädchen, die schnell zusammengedrängt worden waren, »wer von euch auch nur eine Miene macht, wegzulaufen, den schieße ich sofort nieder.«
Frankos machte Ernst. Er hielt den Mädchen die geladene Pistole entgegen, und auch seine Genossen waren schußbereit.
Man hörte in der Ferne einige Schüsse fallen, und nicht lange dauerte es, so kamen die vier Verfolger von Miß Murray mit erhitzten, aber befriedigten Gesichtern zurück.
Sie erzählten, wie die Flüchtige von ihren Kugeln erreicht worden war, als sie gerade mitten in einem Flusse war, den sie durchschwimmen wollte. Der Kopf wäre sofort unter dem Wasser verschwunden und nicht wieder aufgetaucht.
Als Frankos an der Wahrheit dieser Aussage zweifelte, schwuren die Schurken hoch und heilig, sie hätten gesehen, wie ihre Kugeln den Kopf des Weibes zerschmettert hätten, und wie das Wasser ringsum von Blut gerötet gewesen wäre. Sie sei sicher tot.
Frankos glaubte ihnen.
Aber der hinter Ellen nachsetzende Mann kam nicht zurück, und Frankos nahm nach längerem Warten den Marsch wieder auf. Vorher machte er jedoch Chalmers noch die heftigsten Vorwürfe über dessen Gleichgültigkeit.
»Zum Teufel, Mann!« schrie er. »Warum schoßt Ihr nicht nach dem Mädel? Es rannte doch ganz dicht an Euch vorüber!«
»Warum schoßt Ihr nicht?«
»Ich mußte meine Pistole laden. Ihr aber habt einen Revolver.«
»Ich verstehe nicht, mit ihm umzugehen,« entgegnete Chalmers gleichgültig. »Was sorgt Ihr Euch überhaupt um das Mädchen? Dessen Hände sind gefesselt, ich habe es deutlich gesehen, und so kann es dem Verfolger nicht entgehen. Sollte es ihm aber doch entkommen, so kann es mit gebundenen Händen doch in dieser Wildnis nicht lange leben. Verlaßt Euch darauf.«
Frankos dachte auch, daß sein Kamerad das Weib bald einholen würde, und ferner, daß er es wohl auf der Stelle töten würde. Denn die um ihre Sicherheit besorgten Fischer, denen ein Menschenleben nichts galt, wünschten nichts sehnlicher, als den Tod der Mädchen, die sie an den Galgen bringen konnten, wenn sie freikamen.
Frankos führte den Zug weiter, mochte Brentano sehen, wie er ihnen folgen konnte. —
Ellen floh trotz den auf dem Rücken gebundenen Händen wie ein Pfeil davon, wenn es der Wald erlaubte, schnellte wie eine Feder über Wurzeln und gestürzte Baumstämme hinweg und schlüpfte wie eine Eidechse durch die Büsche.
Der plumpe Fischer konnte ihr nicht folgen, immer entfernter klang das Krachen, wie er durch das Buschwerk brach, und oft schon konnte er sie nicht mehr sehen. Dennoch wurde Ellen in fortgesetzter Aufregung gehalten. Sie merkte wohl, daß der Fischer zurückblieb, dann aber war es wieder, als wäre er dicht hinter ihr, ja, manchmal sogar, als wäre er neben ihr. Oft raschelte es dicht an ihrer Seite. Sie glaubte, jemanden durch das Buschwerk huschen zu sehen, schrieb es aber ihren aufgeregten Nerven zu.
Das Blut kochte in den Adern, die Pulse flogen, mühsam rang die hochgehende Brust nach Atem, und vor den Augen begann es zu flimmern.
Lange konnte sie es nicht mehr aushalten. Solch ein Lauf mit gebundenen Händen war selbst für die gewandte Ellen zu viel.
Da wollte es das Unglück, daß ihre Schritte sie in einen dicht mit Schlingpflanzen bewachsenen Teil des Waldes führten.
Ueberall, wohin sie sich auch wandte, wurde sie von den Ranken gehemmt, die von Bäumen herabhingen, aus der Erde emporsprangen, sich wie ein Fischnetz quer über den Weg spannten und dem Fuße heimtückisch Fallen stellten.
Mit Entsetzen erkannte Ellen, in welch furchtbarer Gefahr sie sich befand.
Zurück konnte sie nicht, und die Schlingpflanzen vor ihr nötigten sie zu ganz langsamem Lauf, Schritt für Schritt. Sie mußte sich drehen und winden, um den umstrickenden Umarmungen zu entgehen; sie mußte den Fuß zurückziehen, weil sich ein grünes Seil um denselben geschlungen hatte, und oft war sie sogar gezwungen, Umwege zu machen, weil ein Geflecht von Schlingpflanzen ein undurchdringliches Hindernis bildete.
Hinter ihr ertönte ein lautes Lachen. Ellen sah sich um und erblickte in kurzer Entfernung den Fischer, der sich mit seinem scharfen Messer schnell durch die Schlingpflanzen arbeitete.
Wieder begann Ellen zu laufen, aber sie sah schon jetzt ein, daß sie dem Verfolger nicht entgehen konnte.
Mit voller Gewalt brach sie sich durch die Geflechte, sie riß sich von den Stricken los, strauchelte oftmals, stürzte, raffte sich wieder aus und floh weiter.
Endlich lag vor ihr wieder eine Lichtung und jenseits freier Wald.
Pfeilgeschwind flog sie der rettenden Blöße zu, schon hatte sie dieselbe fast erreicht, als sich plötzlich wieder Schlingpflanzen um den flüchtigen Fuß legten, sie stürzte und versuchte vergebens, den Fuß frei zu bekommen. Sie vermochte sich nicht einmal auf die Seite zu wälzen, so war sie umstrickt worden.
»Habe ich dich endlich,« schrie hinter ihr eine Stimme, und ein fürchterlicher Fluch folgte. »Zum zweiten Male sollst du mich nicht außer Atem bringen, dafür will ich sorgen; erst aber wollen wir ein Wort zusammen sprechen.«
Der Fischer sprang aus dem Gebüsch und warf sich auf Ellen. Der Mann schäumte vor Anstrengung und vor Wut, und ehe er weiter darüber nachsann, was mit ihr zu beginnen sei, wollte er erst sein Mütchen an ihr kühlen.
Mit roher Gewalt stürzte er sich aus die wehrlos um Boden liegende Ellen, drückte sie mit den Knien noch fester nieder und schlug sie mit der Faust einige Male in den Rücken.
Ellen stieß einen lauten Hilferuf aus, im Augenblicke nicht daran denkend, daß kein Retter in der Nähe war.
Vernahm diesen Hilfeschrei aber auch kein menschliches Ohr, so doch ein anderes.
Als der Fischer zum vierten Male die Faust zum Schlage erhob, wurde er plötzlich mit unwiderstehlicher Gewalt, als wäre er von einem stürzenden Felsblock getroffen worden, zur Seite geschleudert, und ehe er noch zur Besinnung gekommen war, zermalmte ein furchtbares Gebiß seinen Halswirbel.
Ellen konnte noch nicht sehen, was sie von dem Unholde befreit hatte, sie vernahm nur das Krachen der Knochen und ein dumpfes Knurren, und sofort wußte sie, wer ihr Retter sein konnte. »Juno,« rief sie, sich aufrichtend.

Auf dem Körper des Fischers stand die Löwin, die Pranken tief in das noch zuckende Fleisch gegraben, den Kopf weit vorgebeugt und mit der Zunge das rauchende Blut leckend, welches dem Halse entquoll. Es war ein furchtbarer Anblick. Selbst Ellen stockte der Atem. Kaum wagte sie sich aufzurichten.
Das Raubtier hatte zum ersten Male Menschenblut geschmeckt, seine wahre Natur war erwacht, und man konnte nicht wissen, ob es jetzt noch seine Herrin kannte.
Junos ganzes Aussehen hatte sich plötzlich geändert. Der gutmütige Ausdruck im Gesicht war verschwunden, ein furchtbar wilder, grimmiger hatte ihn verdrängt. Das Auge war schärfer und glänzender geworden, und zum ersten Male sah Ellen, wie das Tier fortwährend die Krallen aus- und einzog, jenes Spiel, mit dem die Raubtiere ihre noch lebenden Opfer so entsetzlich quälen. Früher hatte es nie die Krallen auch nur gezeigt.
Ellen selbst fürchtete sich vor dem Tiere. Doch mußte ihr Juno nicht gefolgt sein? Hatte sie den Hilferuf nicht vernommen, oder vielmehr, hatte sie sich nicht auf den gestürzt, der Ellen schlug? Es war das erste Mal, daß Juno Zeuge wurde, daß ihre Herrin tätlich angegriffen wurde, und das hatte die Umwandlung herbeigeführt.
Die Löwin hob den Kopf, sah nach Ellen, wedelte mit dem Schweif und sprang sofort zu ihr hin, sie im Gesicht leckend, wie sie es stets gern getan hatte, wenn es ihr gelang, Ellen im Schlafe oder in liegender Stellung zu überraschen.
Ellen wehrte schaudernd diese Liebkosung ab. Die Zunge des Tieres hatte soeben Menschenblut geleckt, aber zugleich wurde ihr Herz doch auch von einer unsagbaren Freude erfüllt.
Juno war ihr gegenüber noch die alte, aber Ellen wußte, was für eine treue, gewaltige Freundin sie jetzt in der Löwin bekommen hatte. Nachdem diese erst einmal die Scheu vor dem Menschen, welches jedes Tier, selbst das größte und stärkste, der Elephant, vor dem aufrechtgehenden Wesen der Schöpfung empfindet, überwunden hatte, würde sie jederzeit bereit sein, die Herrin gegen jeden Feind zu schützen.
Ellen sah nicht zu, wie das Tier von seinen, Opfer die Fleischstücke abriß und fraß, sie stand auf und überlegte, wie sie sich der Bande entledigen könne.
Der Fischer hatte ein Messer bei sich, das konnte ihr aber jetzt nichts nützen. Sie dachte auch an Juno, doch auf deren Zähne durfte sie nicht rechnen.
Da erblickte sie einen großen Stein an einem Baumstamme liegen, wie man so oft einzelne mächtige Felsblöcke da finden kann, wo sonst nur Humusboden vorhanden ist. Vulkanische Tätigkeit und Ueberschwemmungen haben ihnen vor tausenden von Jahren ihren einsamen Platz angewiesen.
Ellen fand an dem Block eine scharfe Kante. Sie lehnte sich mit dem Rücken dagegen und begann die Stricke zu zersägen. Wurde auch manchmal die Hand arg geschrammt, die steinerne Säge tat ihre Wirkung. Nach einer Viertelstunde fiel die letzte Umwindung ab, Ellen war frei.
In großen Sätzen umsprang Juno die Befreite und wurde von dieser mit Liebkosungen überschüttet. Was wäre wohl Ellens Los gewesen, wenn Juno ihr nicht gefolgt wäre und sie von dem Manne befreit hätte?
Das Mädchen schauderte, wenn sie sich in Gedanken die Bilder ausmalte.
Nun galt es, auch die Freundinnen zu retten und womöglich Jessy aufzufinden.
In zwei Tagen sollte die Ruine, von der Kirkholm gesprochen hatte, erreicht sein, bis dahin mußte Ellen die Fortgeschleppten eingeholt haben und hatte inzwischen hoffentlich Jessy gefunden, denn das Mädchen blieb jedenfalls auch in der Nähe der Gefangenen, wenigstens, wenn sie deren Spur wiederfinden konnte.
Wie leicht konnte Ellen diese armseligen Fischer niederwerfen, seit Juno ihre Feinde haßte. Sie brauchte nur ein Wort zu sagen, und die Löwin würde wie ein böser Dämon über sie herfallen, ehe sie nur an den Gebrauch der Waffe dachten.
Schon jetzt verließ Juno ab und zu die nachdenkende Herrin, kehrte zu dem toten Fischer zurück und ließ an dessen Leichnam ihre Wut aus, dabei nach Ellen blickend, als wolle sie zeigen, wie sehr sie den haßte, der Ellen etwas hatte zuleide tun wollen.
Das Mädchen nahm dem Fischer Messer, Pistole und Munition ab, ebenso die geraubten Wertsachen, und ein gutes Zeichen war es schon, daß sie bei ihm Jessys Taschentuch vorfand.
Dann rief sie Juno zu sich und machte sich auf den Weg, den sie eben in eiligem Laufe gekommen war. Auch sie hatte zwar unter den Anstrengungen der letzten Tage zu leiden gehabt, aber sie war die kräftigste von allen Mädchen, und was ihr an Kraft fehlte, das ersetzte die Energie.
Nach einer Stunde schon hatte sie den Platz erreicht, von wo aus sie geflohen war, und deutlich konnte sie die Spuren erkennen, welche die vielen Personen hinterlassen hatten.
Ein amerikanischer Wald gleicht keineswegs dem europäischen, wenn es auch in Europa noch immer mächtige Waldungen gibt. Der amerikanische Wald ist weglos. Höchstens sogenannte Indianerpfade schlängeln sich durch ihn, und daher kommt es, daß in einem solchen Walde selbst Ungeübte leicht eine Spur verfolgen können, wenn sie noch frisch ist.
Das Gras ist niedergetreten, die Zweige sind abgebrochen und in weichem oder lockerem Boden nimmt man deutlich Abdrücke von Füßen wahr, zumal, wenn nicht leichte Mokassins darüber hinweggeschritten sind, sondern schwere Schuhe.
Ellen war nicht unerfahren im Verfolgen von Spuren. Sie war darin von ihren alten Freunden unterrichtet worden, und wenn sie auch nicht die Geschicklichkeit der Indianer und der weißen Jäger erlangt hatte, konnte sie diesen Abdrücken der Fischerstiefel doch schnell und ohne Anstrengung folgen.
Auch Jessy würde wohl dieser Spur nachgehen, und so konnte Ellen, wenn sie sich beeilte, hoffen, die Freundin rechtzeitig wiederzufinden, um gemeinsam die Rettung der Gefangenen zu versuchen.
Vorsichtig um sich spähend, schritt Ellen durch den Wald, und lautlos folgte ihr Juno, als wüßte das treue Tier, um was es sich handelte.
Eine Felspartie unterbrach die Wildnis, Pflanzen hatten auf dem steinigen Boden nicht Wurzeln fassen können, und eine weite Ebene war daher vegetationslos.
Hier verlor Ellen die Spuren zum ersten Male. Sie machte den Versuche mir der Löwin, ob deren seine Nase ihr helfen könne. Aber so sehr sie sich auch bemühte, dem Tiere verständlich zu machen, was sie von ihm verlange, es war vergebens. Juno sah sie wohl mit klugen Augen an, schüttelte aber den Kopf, als wollte sie sagen, sie könne den Wunsch ihrer Herrin nicht verstehen.
Ellen mußte selbst versuchen, die Spuren wiederzufinden.
Sie überschritt vorsichtig das Plateau und begann an der jenseitigen Seite, wo der Wald und der Graswuchs wieder anfingen, nach den Spuren zu suchen, ohne vorläufig Erfolg zu haben.
War Frankos auch kein Waldmann, sondern ein Fischer, und verstand daher wenig von der Kunst Spuren zu verstecken oder zu verwischen, so hatte er doch wahrscheinlich sein möglichstes getan, etwaige Verfolger irrezuleiten.
Das Steinplateau bot ihm hierzu eine ausgezeichnete Gelegenheit, ohne jeden Zweifel war er lange auf ihm marschiert und hatte den Wald an einer entlegenen Stelle wieder betreten.
»Nur Geduld!« dachte Ellen. »Ich werde Euch schon finden. Aber vorsichtig muß ich sein, damit sie mich nicht eher sehen und nach mir schießen können.«
Wie sie so gebückt den Waldessaum abschritt, ließ ein drohendes Knurren Junos sie plötzlich zusammenschrecken. Zwischen den Büschen sah Ellen eine Gestalt. Es schien, als strebe dieselbe ihr zu, und sofort warf sie sich hinter einen Baumstamm.
»Ellen!« rief da eine Stimme.
Das Mädchen sprang hervor, sie hatte Jessy erkannt, und beide Freundinnen lagen sich in den Armen.
»Ich wollte mich schon verstecken, weil ich glaubte, es wären Verfolger,« sagte Jessy, »als ich Juno erblickte, daraufhin sah ich mir ihren Begleiter an und erkannte Sie.«
Ellen erzählte schnell, wie sie entkommen war, und Jessy, auf welche Weise sie ihrer Verfolgung ein Ende bereitete. Sie war gezwungen gewesen, ein Gewässer zu durchschwimmen. Die vier Männer schossen fast gleichzeitig nach ihr über Wasser, fehlten sie jedoch alle, und blitzschnell kam Jessy der Gedanke, ihren Tod zu heucheln. Sie war eine vorzügliche Schwimmerin, die Matrosenkleidung hinderte sie nicht in den Bewegungen, und so tauchte sie unter, tat aber, als wäre sie getroffen worden, steckte noch ein paar Mal die Hände aus dem Wasser, als suche sie einen Halt, und schwamm dann unter der Oberfläche an das andere Ufer, wo sie sich in dem dichten Schilf versteckte, bis die Verfolger, zufrieden mit ihrem Erfolge, sich entfernten.
Noch jetzt war Jessys Kleidung naß von der geglückten Schwimmpartie.
»Eben als ich Sie erblickte,« schloß Jessy, »stieß ich auf die Spur, welche auch ich verloren hatte. Hier ist sie.«
Jessy führte die Freundin nach einer Stelle der Plateaugrenze, wo man in dem weichen Boden deutlich die Abdrücke der Fischerstiefel erkennen konnte.
Während sie der neuen Spur folgten, besprachen sie sich leise, wie sie am besten die Rettung der Freundinnen bewirken könnten. Juno mußte dabei die Hauptrolle spielen, wenn nicht ein anderer Umstand hindernd dazwischen kam.
Die Mädchen von der Vesta, die Aufnahme in dem Blockhause gefunden hatten, wo die Trapper sich bereitmachten, die vom weißen Wolf geführten Apachen mit ihren Kugeln zu empfangen, waren von ersteren neugierig empfangen worden.
Mehr Aufmerksamkeit als ihnen schenkten aber die Männer dem riesigen Waldläufer, der sie hierhergebracht hatte, sowie auch dessen Begleiter, dem Indianer.
Das also war Deadly Dash, über dessen Person unter Indianern, wie auch unter den weißen Jägern so viel gesprochen wurde, obgleich ihn wenige selbst gesehen hatten. Er sollte Häuptling einiger Indianerstämme sein, mit fast allen anderen Häuptlingen in Freundschaft leben, von ihnen wie ein Gott verehrt werden und nur zu befehlen brauchen, daß sie Hütte, Weiber und Kinder im Stich ließen und ihm folgten.
Woher er diese Autorität hatte, wußte man nicht. Viele hielten das Gerücht davon überhaupt für übertrieben, zweifelten sogar daran, daß Deadly Dash überhaupt existiere. Sie sagten, er sei nur eine sagenhafte Person. Joe aber hatte ihn gesehen und war mit ihm einmal in enger Gemeinschaft gewesen, und durch seinen Ausruf erfuhr man jetzt, daß man den berühmten Waldläufer vor sich hatte, welcher von den Indianern Deadly Dash, tötender Schlag, benannt worden war. Nun, er sah allerdings aus, als könne er mit einem Schlage einen Menschen leblos niederstrecken; aber das konnte Charly auch und noch mancher andere.
Den Indianer kannte man. Er hatte sich schon vor einem Jahre in der Gegend sehen lassen. Stahlherz sollte keinem Stamme mehr angehören; vielleicht war er verstoßen, oder er hatte seine Hütte selbst verlassen, oder sein Stamm war aufgerieben, wie schon so viele andere. Man wußte es nicht, und Stahlherz sprach zu niemandem darüber. Aber so viel stand fest, daß er ein Freund von Deadly Dash war, von dem er auch die Dogge geschenkt bekommen hatte.
»Stellt euch hinter uns und reicht uns die Büchsen zu.« rief Charly den Mädchen zu, »ihr habt ja Schießdinger, so werdet ihr sie Wohl auch zu laden verstehen.«
Die Mädchen dachten aber anders, sie wollten bei der Verteidigung des Blockhauses nicht die Rolle von Büchsenladern spielen.
Schnell verständigten sie sich untereinander und traten dann ebenfalls an die Fenster, die Büchsen schußbereit in der Hand.
»Was, glaubt ihr, ihr könntet nach den anschleichenden Indianern wie nach der Scheibe schießen?« lachte Charly. »Legt euch auf den Boden, da seid ihr sicher aufgehoben. Die Apachen sind ungalant, sie kennen keine Rücksicht gegen das zarte Geschlecht.«
»Laß es gut sein,« rief ihm Deadly Dash zu, »diese Mädchen haben schon öfter um ihr Leben gekämpft als ihr.«
Der zurechtgewiesene Waldläufer hatte eine scharfe Antwort auf den Lippen, als plötzlich der Kriegsruf der Apachen erscholl und wohl gegen zweihundert Indianer zu Fuß gegen das Blockhaus anstürmten. Der Vollmond beschien hell die halbnackten, buntbemalten Gestalten mit den flatternden Haaren und wilden Zügen; die Tomahawks und Messer funkelten, und die Luft erzitterte von dem gellenden Geschrei.
Vom weißen Wolf angefeuert, stürmten sie gegen das Blockhaus vor, um so schnell wie möglich ihr Ziel zu erreichen. Reicher Lohn winkte ihnen, Skalpe, Weiber und die Vorräte des Store.
Schon manches derartige Magazin hatten die Wilden überfallen, ausgeraubt und dann geschwelgt, bis nichts Genießbares mehr vorhanden war. Dieses einsame Haus war ihren Spionen bis jetzt entgangen.
Aber nur die wenigsten der Stürmenden sollten den Wald überhaupt verlassen und die Blöße betreten.
Kaum gelangten die ersten in den Schein des Mondes, als aus den Fenstern des Hauses unzählige Feuerstrahle brachen. Ein knatternder Donner erscholl, und Reihe auf Reihe der Indianer sank, zu Tode getroffen, zu Boden.
Das war den Angreifern zu viel. Schnell, wie sie gekommen, waren sie wieder im Schatten des Waldes verschwunden. Sie hatten nicht einmal Zeit, die Toten und Verwundeten mitzunehmen, denn wo sich nur eine Gestalt sehen ließ, wurde sie von einer sicheren Kugel niedergestreckt.
»Donner und Blitz,« schrie Joe erstaunt, als der Angriff abgeschlagen worden war, »was für lange Revolver habt ihr Mädchen?«
Er hatte ebenso wie seine Gefährten nur zweimal mit seiner Doppelbüchse schießen können, die Vestalinnen sandten dagegen Schuß auf Schuß aus ihren Winchesterbüchsen in die Reihen der Feinde.
»Sollen wir euch noch die Gewehre laden und reichen?« lachte Miß Thomson, die vor Kampfeslust glühte.
Die Trapper und Waldläufer, die sich für nichts mehr interessierten als für Waffen, waren verblüfft über die Wirkung, welche die Mädchen mit ihren Büchsen erzielten, ja, selbst Stahlherz schaute mit Ehrfurcht, der sich ein Teil wirklicher Furcht beimischte, auf das Mädchen, das neben ihm am Fenster stand.
Nur Deadly Dash blieb gegen diesen Erfolg gleichgültig. Er nahm aus seiner Tasche eine Handvoll Patronen, öffnete eine Klappe am Kolben seiner kurzen Büchse und ließ die Patronen in die Oeffnung hineinfallen. Also auch er besaß ein Repetier-Gewehr.
»Hurra, Jungens,« schrie Joker, »das wird ein guter Spaß. Ich fürchte nur, die Bluthunde kommen nicht wieder, weil sie glauben, hier stecken ein paar hundert Menschen. Hol' sie der Teufel! Ich möchte, sie rennten fortwährend gegen uns an, dann hatte der weiße Wolf bald keine Apachen mehr.«
»Seid ohne Sorge,« lachte Charly, »der weiße Wolf läßt sich nicht so leicht von einem Mißerfolge abschrecken. Er hat noch Mittel und Wege genug, um uns klein zu kriegen.«
»Möchte wissen, wie!« wollte Joker antworten, da aber fiel ihm ein, daß die Indianer mit Vorliebe Feuer anlegen. Er hatte solch einer Belagerung noch nie beigewohnt, wenn er auch oft genug feindselig mit Indianern zusammengetroffen war. Das aber war stets draußen in der Prärie gewesen, wo es auf die Schnelligkeit des Pferdes und darauf ankam, wer zuerst den Revolver aus dem Futteral hatte.
Aehnliche Gedanken, wie Joker, hatten auch die übrigen, und Deadly Dash, welcher, ohne daß ihm jemand widersprach, sofort den Oberbefehl übernahm, fragte Bill:
»Habt ihr Wasser im Hause?«
»Genug zum Trinken, aber nicht zum Löschen,« war die Antwort.
»Woher bekommt ihr das Wasser?«
»Zehn Schritte hinter dem Hause fließt ein Bach. Ehe wir ihn aber erreichen, sind wir längst lahm geschossen. Es ist eine verdammte Lage. Wollte immer einen Brunnen graben, habe es aber von Tag zu Tag aufgeschoben.«
Deadly Dash wollte antworten, riß aber plötzlich die Büchse an die Wange. Doch ehe er noch losdrücken konnte, knallte es schon neben ihm aus dem Gewehre des Indianers.
Stahlherz hatte die Gegend scharf beobachtet, was den anderen mit Ausnahme seines Freundes entgangen war, hatte er bemerkt.
Aus dem hohen Grase sprang ein Indianer mit einem Schmerzensschrei hoch und sank wieder zurück. Die Kugel von Stahlherz hatte den Feind getroffen, obgleich er nicht zu sehen gewesen war. Das sich bewegende Gras hatte ihn verraten.
»Er wollte sich heranschleichen und Feuer anlegen,« sagte Deadly Dash. »Jetzt aufgepaßt, es werden noch mehrere denselben Versuch machen.«
Mit verschärfter Aufmerksamkeit lugten die Trapper aus den Fenstern, ohne sich selbst eine Blöße zu geben. Nicht umsonst schossen sie manchmal in das meterhohe Gras, immer ertönte entweder ein Schmerzgeheul, und der Getroffene blieb liegen, unfähig, aufzustehen, oder er sprang brüllend in den bergenden Wald zurück, von der sicheren Kugel eines Trappers schwer verwundet.
Keinem Indianer gelang es, sich dem Blockhaus zu nähern und die Absicht, die Belagerten zu überraschen oder auch Feuer anzulegen und sie so ins Freie zu treiben, zur Ausführung zu bringen.
Die Indianer verhielten sich eine lange Zeit still, sie schienen sich zu beraten, und auch die Eingeschlossenen sannen nach, wie man am besten zu Wasser gelangen könnte, ohne sich einer zu großen Gefahr auszusetzen. Denn daß das Blockhaus doch noch in Brand gesteckt werden würde, bezweifelte niemand, und ohne Wasser waren sie verloren.
Sie mußten das brennende Haus verlassen und wurden von den im Hinterhalt liegenden Indianern niedergeschossen, ohne daß sie sich verteidigen konnten.
»Da kommt, was ich schon lange erwartet habe,« rief plötzlich Deadly Dash.
Ein Feuerpfeil zischte durch die Luft und blieb in der Holzwand des Blockhauses haften; dann kam noch einer, dann ein dritter, und schließlich sausten von allen Seiten die Feuerbrände gegen das Haus. Es waren Pfeile, welche mit harzigem Werg umwickelt waren, das in Brand gesetzt war.
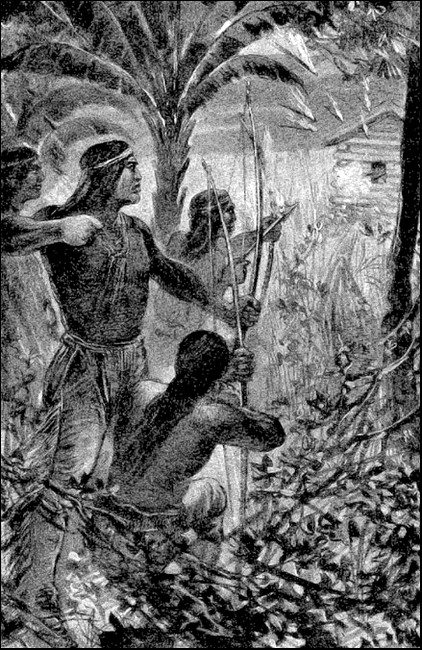
Unzählige Feuerbrände sausten gegen das Haus.
Das Holz des Hauses war ausgetrocknet. Im Nu fing es Feuer, und kaum konnte man das wenige Wasser durch die Fenster ausgießen, ohne zu fürchten, daß man dabei eine Kugel empfing.
»Es nützt nichts, daß wir den Versuch machen, das Feuer zu löschen,« sagte Deadly Dash und warf den geleerten Holzeimer unwillig auf die Erde. »Ich könnte wohl noch mehr Wasser besorgen, aber was hilft es, wenn wir es nicht ausgießen können, ohne dabei erschossen zu werden.«
»Wie wolltet Ihr das machen?« fragte Bill verwundert.
»An den Bach laufen,« meinte der Waldläufer. »Ich würde schon durchkommen, aber es hilft nichts.«
»Wir machen einen Ausfall,« rief Charly.
»Geht nicht wegen der Mädchen.«
»Dieselben bleiben zurück.«
»Wir können sie nicht allein lassen, sie würden auch nicht damit einverstanden sein.«
Vorschläge schwirrten hin und her, doch diese brachten das Feuer nicht zum Verlöschen.
Es knisterte und prasselte. Schon wurden die Blöße vom Scheine des Feuers erhellt, und schon machte sich die Glut im Innern des Hauses bemerkbar. Schon nach wenigen Minuten konnte das Haus vielleicht lichterloh brennen, so daß man es verlassen mußte, wollte man sich nicht von den glühenden Balken erschlagen lassen.
Und draußen drohten die Pfeile und Kugeln der Indianer.
Die Lage der Eingeschlossenen wurde immer kritischer.
Deadly Dash unterhielt sich hastig mit Stahlherz in einem den anderen unbekannten indianischen Dialekt. Der Indianer gab durch Kopfnicken seine Beistimmung zu erkennen.
»Kennt Ihr die Ruinen des alten, indianischen Tempels, der gute zehn Wegstunden von hier entfernt ist?« wandte sich Deadly Dash hierauf an Charly.
»Die Ruinen, darin die vielen Säulen und Gräber sind, und wo es nicht ganz richtig zugehen soll, wie die Indianer wenigstens sagen?«
»Dieselben.«
»Ich kenne sie.«
»Gut, so paßt auf, was ich Euch jetzt sage! Wir müssen fliehen, sonst verbrennen wir. Aber wir müssen auch eine List anwenden, sonst kommen wir nicht lebendig aus diesem Haus.«
»Dann kommen wir aus dem Fegefeuer in die Hölle,«, meinte Joker.
»Stahlherz und ich schleichen uns jetzt hinaus und beschäftigen die Aufmerksamkeit der Apachen. Es wird etwas Lärm entstehen, das ist das Zeichen zu Eurem Aufbruch noch nicht. Erst wenn die Indianer mehr heulen, als sie es sonst bei einem Angriff zu tun pflegen, wenn sie vor Wut wie die Teufel brüllen und zusammenstürzen, dann brecht alle zusammen aus und zwar in entgegengesetzter Richtung, als dorthin, woher das Geschrei kommt. Schlagt den Weg nach den Ruinen ein, lagert, wenn Ihr es für gut befindet! Im offenen Wald seid Ihr den Indianern überlegen. Wir stoßen bald zu Euch! Habt Ihr mich verstanden, Charly?«
Erstaunt hatten die Männer zugehört. Dieser Waldläufer war gewohnt, zu befehlen und schnell zu handeln, schon schnallte Stahlherz den Gürtel enger.
»Ich habe verstanden,« sagte Charly. »Der Tod wartet auf uns, aber draußen können wir ihm eher entgehen als im brennenden Hause.«
»Aber meine Vorräte,« meinte Bill zögernd. »Soll ich die denn alle verlieren? Es ist alles, was ich habe.«
»Bleibt Ihr hier, so verbrennen sie mit Euch, gelingt Euch die Flucht, so bemächtigen sich ihrer die Indianer, und Ihr habt Gelegenheit, sie ihnen wieder abzujagen,« erklärte Deadly Dash.
»Das war richtig gesprochen,« rief Joe, »aber sagt, was habt Ihr vor?«
»Wir rauben den Apachen die Pferde. Gebt acht auf das Geheul!« war die kurze Antwort, und ehe die Jäger und Mädchen nur ahnten, was die beiden vorhatten, sprang Deadly Dash schon mit gleichen Füßen durch das Fenster, ihm nach Stahlherz und Lizzard, man sah sie mit einigen Sätzen über die Lichtung fliehen, schneller als der Gedanke waren sie im Walde verschwunden.
Diese kühne Flucht war natürlich von den wachsamen Indianern nicht unbemerkt geblieben.
Ein wildes Geschrei erhob sich. Schüsse fielen, aber zu spät, als daß die Kugeln die Flüchtigen noch auf der Blöße hätten erreichen können. Doch dort, wo die beiden den Wald betreten hatten, mußte ein Handgemenge stattfinden. Man hörte Rufe der Wut und des Schmerzes, ja, selbst Todesschreie. Der Lärm nahm immer mehr zu — einmal heulte Lizzard laut auf — dann nahm er ab.
»Sie werden verfolgt,« raunte Charly den übrigen zu.
»Bei Deadly Dash und Stahlherz aber eine vergebliche Arbeit,« ergänzte ihn Joe.
»Jetzt aufgepaßt! Wenn es den Tollkühnen gelingt, die Pferde zu befreien und davonzusprengen, so muß ein Höllenspektakel entstehen.«
Vorläufig trat die vorige Stille ein. Die Indianer mußten die Verfolgung der beiden Flüchtlinge aufgegeben haben, denn es schien den Belagerten, als kehrten sie auf ihre alten Posten zurück.
Aber die Lage wurde immer gefährlicher. Das Feuer leckte mit gieriger Zunge empor, schon schlugen die Flammen zu einem Fenster herein, und jede Minute konnte die Männer zwingen, das Haus zu verlassen, wollten sie nicht unter den Trümmern desselben begraben werden.
Alles lauschte, daß das Signal ertönte. Es waren fürchterliche Minuten.
Da — plötzlich erscholl ein Schreckensschrei, und dann ertönte der Wald von einem furchtbaren Wutgebrüll. Gleichzeitig erzitterte der Boden, als würde er von vielen flüchtigen Rossehufen gestampft.
Die Laute kamen aus der Gegend, wo die beiden verschwunden waren. Die Indianer liefen dahin, ein wildes Durcheinander entstand, und plötzlich schien die Lichtung menschenleer.
»Jetzt ist es Zeit,« rief Charly, »drauf und dran, Tod oder Freiheit!«
Er stieß die Tür auf, und die Gefährten und Mädchen stürzten, die Büchse schußbereit in den Händen, die Messer in der Scheide gelockert, heraus, eilten über die Lichtung und erreichten den Wald, ohne daß ihnen eine einzige Kugel nachgesandt worden wäre.
Aber kaum hatten sie die schützenden Bäume erreicht, als ein neues Wutgeheul verriet, daß ihre Flucht von den Indianern bemerkt worden war. Dieselben waren unvorsichtig genug, den Flüchtlingen nachzueilen. Doch wohlgezielte Schüsse zeigten, daß die Ausgebrochenen sich den Rücken zu decken wußten; mancher Apache sank getroffen ins Gras.
»Zeigte sich nur dieser Schuft, der weiße Wolf!« knirschte Joe. »Für ihn behalte ich stets eine Kugel im Lauf.«
Der weiße Wolf setzte sich aber dieser Gefahr nicht aus.
Unter der Führung von solchen Männern war das Fortkommen durch den Wald ein leichtes. In der Wildnis aufgewachsen, besaßen sie dieselben Eigenschaften wie die Indianer und einen noch größeren Scharfsinn. Als die Apachen noch einmal einen Massenangriff auf die Fliehenden machten, belehrte eine Salve sie, daß sie vorderhand im Nachteil waren. Im offenen Kampfe konnten sie selbst mit ihrer Uebermacht nichts ausrichten, und sie ließen die Flüchtlinge einstweilen in Ruhe.
Charly machte den Führer. Er war hier zu Hause und kannte jeden Baum und Strauch.
Während sie im Geschwindschritt, von den Indianern unbelästigt, durch den Wald eilten, hatten sie Zeit genug, über das kühne Unternehmen Deadly Dashs zu sprechen.
»Beim heiligen Dunstan,« sagte Joe, »so viel Achtung ich vor diesem Manne auch schon bekommen habe, ich hätte nicht für möglich gehalten, Apachen, die sich auf dem Kriegspfade befinden, die Pferde zu stehlen. Ich glaube, er und Stahlherz stehen mit dem Teufel im Bunde.«
»Wahrhaftig,« entgegnete Charly, »ich hätte es nicht fertig gebracht. Jetzt, hier hinein, dieser Indianerpfad macht später einen Bogen und führt uns nach Osten.«
Charly machte so große Schritte, daß die anderen ihm kaum folgen konnten, und Miß Thomson ihm ohne weiteres andeutete, daß sie und ihre Freundinnen schwerlich einen solchen Marsch lange aushalten könnten. Hatten sie diese Nacht doch nur wenige Stunden geschlafen.
»Alle Wetter,« rief Charly, »das ist etwas anderes. Nun, nehmt Eure Kraft noch für eine halbe Stunde zusammen. Ich bringe Euch an eine Stelle, wo Ihr ruhig bis zum Anbruch des Tages und noch länger schlafen könnt. Unter unserem Schutze seid Ihr sicher.«
Unbelästigt von den Indianern erreichten sie den betreffenden Ort, eine kleine Waldblöße, auf welcher die Trapper eiligst Feuer anzündeten und für die Ruhe der Mädchen sorgten. Wachen wurden verteilt und alles vorbereitet, um einem etwaigen Angriff der Indianer erfolgreich begegnen zu können.
Aber diese dachten nicht an die Flüchtlinge; sie waren mit der Beraubung des Stores beschäftigt, und als sie einige Fässer aus dem brennenden Hause geschleppt hatten und dieselben mit Branntwein gefüllt fanden, stießen sie ein solches Freudengeheul aus, daß es selbst in dem entfernten Lager zu hören war.

Doch die Mädchen vernahmen es nicht. Sie lagen schon längst in tiefem Schlummer, und die des Schlafes nicht so bedürftigen Trapper und Waldläufer wachten über sie.
Bill wußte wohl, was dieses Freudengeheul zu bedeuten hatte.
»In einer halben Stunde wäre es Zeit, die Apachen zu überraschen, »und ein Blutbad unter ihnen anzurichten,« meinte er grimmig. »Ich kalkuliere, sie werden so viel trinken, daß sie sich nicht mehr rühren können.«
Doch Charly schüttelte den Kopf.
»Es sind ihrer zu viele; wir müssen froh sein, ihnen mit heiler Haut entwischt zu sein. Außerdem sind wahrscheinlich viele hinter den losgekoppelten Pferden her und werden bald zurückkehren, denn ein Pferd wieder einzufangen, ist dem Indianer doch eine leichte Sache. Hört Ihr, wie sie sich verständigen?«
Ein langgezogenes Geheul ertönte, oftmals kurz unterbrochen und dann wieder einsetzend. Es waren Zeichen, mittels deren sich die Indianer verständigten.
»Lieber wäre mir, wenn wir noch weiter gegangen wären,« fuhr Charly, zu Bill gewendet, fort, der mit ihm auf gleichem Posten stand. »Werden wir von den Apachen umzingelt, so müssen wir entweder abermals durchzuschlüpfen suchen oder uns durchschlagen. Ruhig, Bill! Bewegt sich dort nicht das Gebüsch?«
Bill verschwand blitzschnell hinter einem Baum, und Charly war plötzlich wie in die Erde gesunken. Beider Büchsen waren auf den Busch gerichtet.
Aber ruhig wurden die Zweige desselben auseinandergebogen, und Deadly Dash und Lizzard traten heraus.
»Es ist geglückt,« sagte ersterer gelassen, als hätte er sich nicht eben einer furchtbaren Gefahr ausgesetzt. »Die Apachen jagen hinter den Pferden her, welche von Stahlherz immer weiter geführt werden. Die, welche den Store plündern, sind schon betrunken, sie lassen den Branntwein in Strömen laufen, aber nicht auf die Erde.«
»Teufel!« brüllte Bill auf, »und ich soll ruhig zusehen, wie die roten Halunken meinen Whisky aussaufen? Kommt, Männer, wir wollen die Betrunkenen einschläfern, daß sie nicht wieder aufwachen:«
»Geht,« sagte Deadly Dash. »Ihr werdet leichte Arbeit haben. Ich bleibe hier und wache über die Schlafenden. Ich habe hier nichts zu fürchten, und im Falle der Not werde ich euch zur Hilfe rufen.«
Die Augen der Männer leuchteten grimmig auf. So wurde ihnen also doch Gelegenheit geboten, sich an den Apachen zu rächen, die ihre Todfeinde waren. Wären sie nicht gewesen, so hätten die Weißen im Walde ein freies und friedliches Leben führen können. Der Apachen wegen aber waren Trapper und Waldläufer gezwungen, wie wilde Tiere vorsichtig im Walde zu schleichen und dem erbeuteten Wild das Fell abzuziehen, während sie die geladene Büchse neben sich liegen hatten. Und wenn sie sich nachts am einsamen Feuer niederlegten, so wußten sie nie, ob sie von indianischen Augen beobachtet wurden. Ebenso konnten die friedlichen Fallensteller nie nach ihren Schlingen sehen, ohne die Büchsen über den Schultern zu haben. Nie saßen ihre Skalpe fest auf den Köpfen.
Und gerade der weiße Wolf mit seiner Bande war zu fürchten. Es wäre eine Wohltat für das ganze Land gewesen, wenn sie niedergemacht, wie das Vieh geschlachtet würden. Gab es doch sogar weiße Jäger, welche es nicht verschmähten, diesen Bluthunden den Skalp zu nehmen, so stark war der Haß gegen diese Räuber in ihnen eingeprägt.
»Schade, daß Ihr nicht mitkommt,« meinte Charly zu Deadly Dash.
»Ich bin ein Mann des Friedens.«
»Oho,« riefen die Trapper.
»Ich vermeide Blutvergießen.«
»Well, wir lassen nicht lange auf uns warten, wir kommen mit den Waffen der Apachen zurück, und wenn diese im Feuer liegen, dann ziehen wir weiter.«
Die Männer schlichen, mit Charly an der Spitze, davon. Deadly Dash aber setzte sich ans Feuer und streichelte sanft das Fell der Dogge.
So gedankenvoll er auch in das Feuer sah, entging ihm doch nicht des leiseste Geräusch, er schaute schon auf, wenn eine der Schläferinnen sich im Schlafe rührte Der Hund neben ihm bürgte ihm überdies auch dafür, daß er rechtzeitig auf eine Gefahr aufmerksam gemacht wurde.
Kein Laut unterbrach lange Zeit die nächtliche Stille, bis auf einmal ein klägliches Geheul erscholl — die weißen Jäger waren an der Arbeit, sie sorgten für ihre Sicherheit in späterer Zeit.
Der zweite Tag war angebrochen, und Ellen und Jessy irrten noch immer ratlos im Walde umher, ohne auch nur eine Ahnung zu haben, wo sie sich befanden, geschweige denn, wo die Ruine, ihr Ziel, lag.
Sie hatten sich verirrt und keine Hoffnung, die verlorene Spur rechtzeitig wiederzufinden, um ihren Freundinnen zu Hilfe kommen zu können.
Am letzten Abend waren sie auf einen kleinen Fluß gestoßen, wo die Spur der Schar aufhörte und sie dieselbe auch nicht wiederfinden konnten, weder an diesem, noch am jenseitigen Ufer. Entweder hatte der Zug seine Reise in Booten fortgesetzt oder man war im Wasser gewatet und so verschwunden.
Die Nacht hatten die Mädchen am Flusse gelagert, um am nächsten Morgen abermals nach der Spur zu suchen. Vorher ereignete sich aber noch etwas, was beiden Mädchen fast das Leben hätte kosten können. Durch ein Wunder waren sie gerettet worden.
Ellen wollte mit der dem Fischer abgenommenen Pistole einen Vogel zum Abendessen schießen. Sie mochte der alten Waffe aber eine zu große Pulverladung anvertraut haben, kurzum, als der Schuß krachte, flogen den Mädchen die Eisensplitter um die Köpfe.
Er war wirklich ein Wunder, daß ihre Haut nicht geritzt worden war. Nun besaßen sie aber außer einem Messer keine Waffe mehr, Juno mußte in dieser wilden Gegend ihr einziger Schutz sein, ja, sie wahrscheinlich sogar ernähren.
Die Mädchen gingen hungrig schlafen. Der knurrende Magen und ein Angstgefühl ließen sie noch vor Morgengrauen erwachen. Das Suchen wurde wieder begonnen. Ein Mädchen ging über den Fluß und forschte auf der anderen Seite, fand aber keine Spur und kehrte daher an das andere Ufer zurück. Als beide gegen Mittag noch immer kein Anzeichen dafür entdeckt hatten, daß sie sich auf dem richtigen Wege befanden, gaben sie die Versuche auf. Der Fluß hatte eine ganz andere Richtung angenommen als die, wo die Ruine liegen sollte, und außerdem hatten sie oft harte und steinige, graslose Bodenstellen am Ufer passiert, wo die Fischer mit den Gefangenen das Wasser leicht hätten verlassen können, ohne eine Spur zu hinterlassen.
Die Mädchen hatten diese eben verloren und durften nicht erwarten, in diesem pfadlosen, menschenleeren Walde sie wiederzufinden, es sei denn durch Zufall. Kam dieser über heute nicht, und erreichten sie die Ruine nicht noch vor dem Abend, so war das Leben der Freundinnen verwirkt.
Eine namenlose Traurigkeit bemächtigte sich der Herzen der beiden Mädchen. Was hätten sie dafür gegeben, daß sie den Freundinnen hätten beistehen können!
Ein Unglück kommt selten allein, das sollten die Mädchen zu ihrem Schaden heute noch erfahren. Das Unglück aber, das sie traf, hätte nicht schlimmer sein können.
Sie schlichen, Juno dicht an ihrer Seite, so vorsichtig als möglich durch den Wald, denn sie hatten die Absicht, ein Wild zu erspähen und zu versuchen, ob Juno ihre angeborene Kunstfertigkeit im Jagen zugunsten der Herrin verwenden würde. Doch der Weg war sehr beschwerlich, oft war es nötig, auf Händen und Füßen durch die Büsche zu kriechen, um das Brechen der Zweige zu vermeiden, und noch unangenehmer waren die großen Wurzeln, über welche sie klettern mußten.
Der Fuß trat oft in Löcher. Die Hacken der Schuhe klammerten sich darin fest, man mußte sich mit Gewalt losreißen und trat dann wieder in ein anderes, aus Wurzeln gebildetes Loch oder in eine Spalte.
Eben stieg Jessy über eine Wurzel, der Fuß kam auf der abschüssigen Seite auf der glatten Rinde zum Gleiten, Jessy rutschte hinab, blieb mit einem Fuße hängen und stürzte mit einem leisen Wehruf ins Gras.
Sofort war Ellen bei ihr, um sie aufzuheben. Eine furchtbare Angst schnürte plötzlich ihr Herz zusammen, denn sie sah, wie die Freundin glatt auf dem Boden lag, der Fuß aber in einer ganz unnatürlichen Lage in einer Spalte klemmte.
»Um Gottes willen, Jessy, stehen Sie auf! Hier, fassen Sie meine Hände!«
Mit zusammengekniffenen Lippen richtete Jessy sich langsam auf; als jedoch Ellen versuchte, den Fuß aus der Spalte zu ziehen, sank Jessy mit einem neuen Klagetone wieder zurück.
Ellens Vermutung hatte sich bestätigt. Jessys Fuß war, wenn nicht gebrochen, so doch verrenkt, und an ein Weitergehen war nicht zu denken.
Nach langen Bemühungen gelang es, den Fuß unter Zurücklassung des Stiefels zu befreien. Jessy bot alle Energie auf, den Schmerz zu verbeißen, dennoch entschlüpfte manchmal ein leises Jammern ihrem Munde, und was sie auszustehen hatte, das sah Ellen jetzt, als sie den Fuß ihrer Freundin im Schoße hielt. Er war sehr stark geschwollen und der Knochen gebrochen.
Ellen konnte das neue Unglück gar nicht fassen, als sie bald in das bleiche Gesicht Jessys, bald auf den gebrochenen Fuß in ihrem Schoße sah. In der Wildnis, verlassen, ohne Nahrung, ohne Hilfsmittel, einen Bruch zu schienen, und auch ohne Kenntnis, wie man eine solche Verletzung zu behandeln hat.
»Holen Sie Wasser,« flüsterte Jessy. »Machen Sie mir einen Umschlag, und dann überlassen Sie mich meinem Schicksal. Versuchen Sie, die Freundinnen zu finden und zu retten. Neun Menschenleben sind mehr wert als eins.«
Fast entrüstet wies Ellen diesen Vorschlag zurück. Sie bettete Jessy so sanft als möglich und entfernte sich dann, um Wasser zu holen. Glücklicherweise war ein Bach nicht fern, so daß sie bald mit Wasser zurückkehrte; sie trug es in der Mütze.
Erst machte sie einige kühlende Umschläge, um die Geschwulst zu mildern, was ihr einigermaßen gelang. Dann schnitzte sie mit dem Messer aus Zweigen Schienen zurecht, wie sie ihrer Erinnerung nach auf der ›Vesta‹ für einen gebrochenen Fuß vorhanden waren, und nach längeren Versuchen hatte sie die entsprechende Form gefunden.
Auf Jessys Wunsch half Ellen dem Mädchen auf, um einen Gehversuch mit der Schiene zu machen, aber schon beim ersten Schritt drohte ihr vor Schmerz die Besinnung zu schwinden.
Als Jessy nochmals bat, sie allein zu lassen und zur Rettung der anderen zu eilen, wurde Ellen ernstlich böse. Sie machte unter einem Busche, der sich wie eine Laube verzweigt hatte, aus Rasen und Moos ein weiches Lager, trug Jessy dorthin und gab ihr mit entschiedenen Worten zu verstehen, daß sie bei ihr bleiben würde, solange sie das Lager nicht verlassen könne. Für ihren Unterhalt könne sie, Ellen, und Juno sorgen.
»Ich will nicht den Versuch machen, Sie durch Tragen weiterzubringen,« sagte sie. »Einen solchen Marsch durch den Wald kann ich nicht aushalten. Wem Sie sich erst wohler fühlen als jetzt, will ich aber die Umgegend ausspähen, und finde ich einen besseren Aufenthaltsort als diesen, so bringe ich Sie dahin. Wir wollen uns jetzt nicht die Zukunft ausmalen, sondern mit dem rechnen, was wir besitzen und was uns möglich ist.«
Jessy kam sich mit einem Male unsagbar hilflos vor, und das tiefste Weh durchschnitt ihr Herz. Wenn keine andere Hilfe erschien, so mußte sie so lange liegen bleiben, bis der Fuß geheilt war, denn Ellen konnte sie nicht tragen, wenn sie auch gewollt hätte.
Ja, wenn er dagewesen wäre, was hätte da ihr Unglück bedeutet. Er hätte sie auf die Arme genommen und wäre über Wurzeln gesprungen, als hätte er eine Feder zu tragen. Der Arm, der zentnerschwere Steine durch die Luft schleudern konnte, als wären Sie Spielbälle, der hätte wohl auch ihre leichte Gestalt unermüdlich gehalten. An seiner Brust drohte ihr keine Gefahr, und wenn der Weg auch durch Feuer und Wasser gegangen wäre, sie hätte keine Angst gekannt, sie hätte gejubelt. Ach, wo war er jetzt? Wie weit waren sie voneinander getrennt? Warum konnte er jetzt nicht hier sein und ihr mit seiner tiefen Stimme, die aber doch so sanft klang, wenn er mit ihr sprach, Koseworte zuflüstern? Weit, weit war vom grausamen Schicksal das Ziel ihrer Träume gerückt worden.
Mit einem schmerzlichen Seufzer ließ Jessy das Haupt zurückfallen und schloß die von Wehmutstränen feuchten Augen.
Ellen war unterdes mit Juno etwas abseits gegangen. Sie orientierte sich genau über die Gegend, um sich wieder zurückfinden zu können, rief ihrer Freundin noch zu, daß sie bald wiederkäme, hoffentlich mit Jagdbeute, und ging dann tiefer in den Wald hinein.
Es war Nachmittag und der Sonnenschein drückend heiß, aber das dichte Laubgeflecht hielt die sengenden Strahlen ab. Es herrschte eine Ruhe im Walde, wie man sie an schwülen Sommernachmittagen findet, und die bei jedem lebenden Wesen eine einschläfernde Wirkung hervorbringt.
Lautlos kletterte Ellen über Baumwurzeln, huschte durch Büsche und bewegte sich auf den Zehenspitzen vorwärts. Juno merkte sofort, daß ihre Herrin kein Geräusch machen wollte, und nach Art der Hunde ahmte sie die vorsichtigen Bewegungen ihrer Herrin nach. Sie kroch auf dem Bauche, schmiegte sich dicht an die Stämme, und benutzte jedes Versteck, wahrscheinlich, ohne zu wissen, wozu dies nötig war.
Doch die Raubtiernatur war erwacht. Juno benahm sich wie eine Löwin, die nach Beute schleicht, und schon darin erkannte Ellen ihre Tauglichkeit zu dem bevorstehenden Versuche.
Plötzlich blieb letztere stehen, duckte sich hinter einen Busch, und im Nu war Juno an ihrer Seite, wie eine Schlange sich an den Boden schmiegend. Die Löwin hatte, dem funkelnden Blick der Augen nach, schon gesehen, was Ellens Aufmerksamkeit erregte.
Nur wenige Meter entfernt graste ein reizendes Rehkälbchen, die Mutter konnte man nicht sehen.
Ellen überwand das Mitleid, welches sie einen Augenblick beherrscht hatte. Sie, Jessy und Juno brauchten Nahrung, und sie hatte nicht erst nötig, Juno zu verstehen zu geben, was sie tun sollte — die Löwin zitterte schon vor Jagdbegierde.
Juno warf einen Blick auf die Herrin, diese streckte die Hand nach dem Reh aus, und sofort kroch das Tier auf seine Beute zu. Kein Blatt raschelte, kein Ast knackte unter den Füßen des nach Blut dürstendes Tieres.
Aber was war das? Hatte das Rehkalb einen Schutzengel, der über ihm wachte?
Erstaunt sah Ellen, wie plötzlich ein großer, schwarzer Vogel, ein Rabe, von einem Baumast auf das Kälbchen zuflog, ihm um den Kopf flatterte und krächzende Laute ausstieß.
Das Reh blickte auf, sah das anschleichende Raubtier und machte einige Sätze seitwärts, ohne weiter Furcht zu zeigen.
Nun erst bemerkte Ellen, daß sie nicht das einzige menschliche Wesen hier war. Im Jagdeifer hatten sie wie Juno gar nicht die Person gesehen, die dort im Schatten eines Baumes saß.
Ellen glaubte plötzlich die Gestalt eines alten Kindermärchens auftauchen zu sehen, sie wußte nicht gleich welche, aber es mutete sie an, als wäre sie in einem Feenland.

Ellen glaubte plötzlich die Gestalt
eines alten Kindermärchens zu sehen.
Dort saß ein braunhäutiges Mädchen, eine Indianierin von vielleicht sechzehn Jahren, aber vollkommen entwickelt und schon eine junonische Schönheit — die indianischen Mädchen reifen schnell — sie war sonderbar phantastisch angezogen.
Ein aus schneeweiß gegerbtem Hirschleder bestehendes Kleid, das mit roten Sehnen genäht war und ein zierliches Aussehen hatte, umhüllte die schlanke Gestalt. Es reichte nur bis an die Kniee und war unten mit Franzen besetzt und mit Perlenstickerei geschmückt.
Die Füße waren mit Sandalen bekleidet, deren Riemen bis hinauf an die Kniee so dicht gewickelt waren, daß man die goldbraune Haut nur durchschimmern sah.
Das Kleid war ärmellos, die runden, wunderbar schön geformten Arme waren bloß, und der volle Busen wurde von einer Art von Mieder gehalten, welches den oberen Teil der Brust sehen ließ. Neben ihr lag ein Jäckchen, ebenfalls aus weißgegerbtem Hirschleder, welches sie der Hitze wegen abgetan hatte.
Das lange, schwarze Haar fiel über den entblößten, herrlichen Nacken auf den Rücken herab und wurde nur oben auf dem Kopfe von einem seltsamen, bunten Federbusch zusammengehalten. Der Ring, in dem die Federn saßen, schimmerte wie Gold, vielleicht war er auch wirklich aus diesem edlen Metall gefertigt.
Sah man aber das Gesicht dieses Mädchens, so vergaß man darüber alles Fremdartige ihrer Erscheinung.
Es waren stolze, schöne Züge, und doch lag etwas so unendlich Kindliches in ihnen, daß man den Blick nicht wieder wegwenden konnte. Die edle, gerade Nase, mit der Stirn gleichlaufend, das dunkle, glühende Auge, die geschwungenen Augenbrauen vermochten diesen Eindruck nicht zu schwächen, ebenso wie die volle, entwickelte Figur, welche einer erwachsenen Jungfrau anzugehören schien.
Das Gesicht blieb das eines Kindes, unendlich lieblich und unschuldig, und so mußte auch die Seele dieses Wesens sein. Wie hätten solche Züge trügen können?
Die Indianerin hatte eine Menge gepflückter Blumen neben sich liegen, aus denen sie Kränze wand. Einen hatte sie schon über den rechten Arm gestreift und ihn sich an der Schulter befestigt, und nun schien sie an einem zweiten zu arbeiten.
Sie mußte dabei an etwas Heiteres denken. Ein reizendes, glückliches Lächeln schwebte auf den lieblichen Zügen, der kleine Mund mit den schwellenden Lippen war halb geöffnet und ließ die Perlenzähnchen durchschimmern.
Jetzt betrachtete sie den angefangenen Kranz, neigte dabei den Kopf etwas zur Seite, so daß er die volle Schulter fast berührte.
Das alles hatte Ellen schnell übersehen, und nun wurde sie Zeuge einer sonderbaren Szene.
Das Rehkalb war zu der Indianerin gesprungen und berührte mit dem Vorderfuß das Knie derselben. Diese blickte auf, streichelte das Tierchen, sagte in einer fremden Sprache einige liebkosende Worte zu ihm, als aber das Reh zu scharren fortfuhr und den Kopf nach der Löwin wandte, die ohne Rücksicht auf das Mädchen wieder ihr Opfer anschlich, bemerkte auch die Indianerin die drohende Gefahr.
Seltsam, sie sprang nicht auf und floh nicht. Sie schien auch nicht zu erschrecken, sondern streckte ruhig die Hand nach dem sich zum Sprunge duckenden Raubtier aus, schnalzte mit den Fingerchen und rief ihm etwas zu.
Ellen war außer sich vor Staunen. Die hungrige Löwin hatte das Tier vergessen, mit wedelndem Schwanze lief sie wie ein Lamm zu der Indianerin und leckte die Hand, welche sie streichelte. Mit einem wunderbaren Glanze ruhte das Auge des Mädchens auf der Löwin, sie schien sich über das Tier zu freuen, nicht aber sich zu wundern oder zu fürchten.
Juno schmiegte sich dicht neben ihr ins Gras. Auf der anderen Seite tat das Rehkalb dasselbe, und der Rabe setzte sich auf die Schulter des Mädchens, seinen Schnabel an ihr Ohr legend, als flüstere er ihr leise etwas zu. Es war ein Bild aus dem Garten Eden.
Ellen konnte sich nicht mehr halten. Sie mußte dieses Idyll durch ihre Dazwischenkunft stören, denn vor allen Dingen galt es, das Mädchen für sich zu gewinnen.
Diese Indianerin konnte nicht allein hier sein. Ihr Dorf mußte sich in der Nähe befinden, und zu fürchten war sie keinesfalls
Als Ellen das Versteck hinter dem Baume verließ und auf die Indianerin zuschritt, sprang diese erschrocken auf, ebenso das Rehkalb, und beide wollten sich zur Flucht wenden. Sie fürchtete sich nicht vor dem Raubtier, wohl aber vor dem Menschen. Vielleicht hatte sie Grund dazu.
»Fürchte dich nicht,« rief Ellen schnell, »ich tue dir nichts. Ich bitte dich, fliehe nicht.«
Scheu wandte das Mädchen den Kopf zurück.
»Bist du allein?«
Wieder mußte Ellen staunen.
Diese, mit einer leisen, melodischen, halb singenden Stimme vorgebrachte Frage war im reinsten Englisch gesprochen worden.
»Ich bin allein.«
Die ängstlich gewordenen Züge des Mädchens hellten sich wieder auf, das alte Lächeln strahlte wieder auf ihnen, und sofort setzte sich die Indianerin in das Gras zurück und hob den Kranz auf.
»Setze dich hierher zu mir!« sagte sie einfach.
Ellen wußte nicht, was sie tun sollte. Ihr ahnte, daß sie das seltsamste, reinste Naturkind vor sich hatte, welchem sie je begegnet. Immer mehr kam ihr das Gefühl, als befände sie sich im Paradies, und dies Gefühl wurde stärker, je länger sie mit dem kindlichen Mädchen zusammen war.
Ellen setzte sich neben dasselbe ins Gras.
»Kannst du Kränze flechten?«
Seltsame Frage, wenn sich zwei Menschen zum ersten Male in der Wildnis treffen.
»Ja, aber nicht so schön wie du.«
Ellen ging auf das Gespräch ein und fügte sich in die sonderbare Weise der Indianerin.
»Ist dies dein Spielgefährte?«
Die Indianerin deutete auf Juno.
»Es ist eine Löwin,« entgegnete Ellen, weil sie meinte, die Indianerin kenne solch ein Raubtier doch nicht, aber sie hatte sich getäuscht.
»Ich weiß, Löwen sind in Afrika,« sagte das Mädchen und strich träumerisch das gelbe, prachtvolle Fell der Katze.
Woher in aller Welt wußte diese Indianerin etwas von Löwen und Afrika? War sie in einer Schule gewesen?
»Afrika ist ein großes, großes Land, fast so groß wie Amerika, und dort gibt es Löwen,« fuhr die Indianerin in ihrer leisen, singenden Weise fort. »Ich habe Bilder von Löwen gesehen, und der alte Vater hat mir davon erzählt.«
Einen Augenblick dachte Ellen, sie habe es mit einer Wahnsinnigen zu tun, aber gleich verwarf sie diesen Gedanken wieder.
»Wie heißt du?« fragte nach einer kleinen Pause das Mädchen.
»Ich heiße Ellen.«
»Und ich werde Waldblüte genannt. Mein Bruder hat mir diesen Namen gegeben,« sagte die Indianerin, während ihre Fingerchen in den Blumen wühlten.
»Wer ist dein Bruder?«
Waldblüte schaute die Fragerin mit den großen, dunklen Augen verwundert an, lächelte dann verlegen, so daß die schneeigen Zähne wieder zum Vorschein kamen, und sagte einfach:
»Er ist mein Bruder.«
»Wie heißt dein Bruder?«
»Er hat keinen Namen, aber ich nenne ihn Sonnenstrahl, ich wüßte keinen anderen Namen für ihn, und so wird er von den anderen auch genannt. Er ist meine Sonne, wäre er nicht bei mir, so wäre es dunkel um mich.«
Die Augen des Mädchens strahlten in warmem Glanze, es vergaß ganz, den Kranz zu flechten.
Ellen wußte, daß der Indianer, wenn er zum Krieger erklärt wird, sich erst einen Namen verdienen muß. Daher fielen ihr die Worte der Indianerin nicht auf.
Sie hatte von anderen gesprochen, da mußte Ellen erfassen und ausforschen.
»Wo wohnst du, Waldblüte?«
»Hier.«
»Hier? Wo denn?« rief Ellen verwundert.
Das Mädchen lächelte.
»Du wunderst dich, weil du nicht das siehst, von dem ich spreche. Aber das soll man nicht, sagt der alte Vater.«
Die Indianerin suchte auszuweichen.
»Ist der, von dem du sprichst, dein Vater?«
Waldblüte schüttelte den Kopf.
»Ich habe keinen Vater,« sagte sie fast fröhlich.
»So ist er tot?«
»Nein, ich bin ein Sonnenkind.«
Verstohlen blickte Ellen die Indianerin von der Seite an. Wieder begann sie an deren Verstande zu zweifeln. Waldblüte hatte die Arme hinter dem Kopfe verschränkt, lehnte sich zurück an den Baum und blickte mit ihren großen Augen in die strahlende Sonne, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken.
So schien sie wirklich ein Kind der Sonne zu sein; ihre Augen durften die Mutter schauen, ohne daß sie sich schmerzhaft schlossen.
»Ich verstehe dich nicht,« sagte Ellen.
Das Mädchen streckte die Arme nach der Sonne aus und sagte lächelnd:
»Ich bin eine Prophetin.«
»Arahuaskar, Arahuaskar,« kreischte plötzlich eine heisere Stimme über dem Haupte Ellens, und erschrocken fuhr diese auf. In den Zweigen des Baumes saß der Rabe, der diesen Namen gerufen hatte.
Da schoß durch Ellens Kopf ein Blitzstrahl des Verständnisses. Jetzt konnte sie sich erklären, wer dieses seltsame Mädchen war. Sie glaubte es wenigstens, und war es zutreffend, dann war diese Begegnung ein sonderbarer Zufall.
Hatte Miß Thomson nicht schon den Namen Arahuaskar ausgesprochen? Ja, so hieß der Knabe, auf den die Indianer wie auf einen Messias hoffen, der sie zur einstigen Größe, zur alten Herrlichkeit der Azteken, der Ureinwohner Mexikos und Texas', zurückführen sollte.
Ellen wollte weiterforschen, aber auch Waldblüte war bei Nennung dieses Namens erschrocken aufgesprungen und hatte eine bestürzte Miene angenommen.
»Ich darf nicht hierbleiben und mit fremden Menschen sprechen,« stammelte sie, »und mit Weißen gar nicht. Lebe wohl!«
Doch schon stand Ellen neben ihr und hielt sie zurück.
»Bleibe bei mir!« bat sie, den Zusammenhang erfassend. »Ich verrate dich nicht, wenn du mir auch nicht helfen willst. Ich bin ein unglückliches Mädchen, ich habe mich in diesem Walde verlaufen; schon zwei Tage irre ich ohne Nahrung umher.«
»Zwei Tage?« fragte die Indianerin bestürzt. »Das ist lange, dann mußt du hungrig sei».«
»Ich bin sehr hungrig.«
»Ich werde dir zu essen bringen.«
Und wieder wollte Waldblüte davonlaufen, wurde jedoch abermals zurückgehalten.
»Ich habe dir vorhin nicht die Wahrheit gesagt,« rief Ellen, sich plötzlich Jessys und ihrer anderen Freundinnen erinnernd — sie wurde von einer bangen Angst um deren Schicksal erfaßt, »nicht weit von hier liegt eine Freundin von mir, sie hat den Fuß gebrochen und kann nicht gehen. Wir müssen beide verhungern, wenn sie nicht untergebracht wird. Weißt du keinen Ort, wo sie bleiben kann, während ich weitergehe? Ich muß fort, ich habe keine Minute zu verlieren.«
Gespannt hingen Ellens Augen an den Lippen der Indianerin.
»Den Fuß hat deine Freundin gebrochen?« sagte die Indianerin mit tiefem Bedauern. »Komm, zeige sie mir; wenn sie nicht gehen kann, so muß der alte Vater sie heilen!«
Wer war froher als Ellen? Ihr Herz jubelte in neuer Hoffnung auf. —
Jessy hatte angstvoll auf die Freundin gewartet. Wie elend kam sie sich in ihrer hilflosen Lage vor, und wie groß waren ihre Freude und ihr Staunen, als sie Ellen in Begleitung einer jungen Indianerin ankommen sah, hinter welchen Juno und ein Rehkalb wie Hunde troddelten.
Waldblüte ging sofort auf das Mädchen zu, reichte ihm lächelnd die Hand und fragte in ihrer kindlichen Weise:
»Wie heißt du?«
Jessy warf einen Blick auf Ellen und antwortete:
»Jessy.«
»Ich will deinen Fuß besehen.«
Sie kniete nieder, löste den Verband mit zarter Hand und schüttelte unwillig das Köpfchen, als sie die Schienen sah.
»Das ist nicht gut, Waldblüte wird es besser machen. Du, Ellen, kannst Wasser holen.«

Das Wasser war bald zur Stelle, und mit der Geschicklichkeit eines Arztes schiente Waldblüte den gebrochenen Fuß von neuem, so zart, daß Jessy fast gar keinen Schmerz verspürte.
Ellen wollte bei dieser Gelegenheit noch einmal das Mädchen möglichst unverfänglich auszufragen suchen, um zu erfahren, ob es wirklich die Schwester von Arahuaskar war, von denen ihr Betty erzählt hatte.
»Fürchtest du dich nicht vor der Löwin?« begann sie das Gespräch, während Waldblüte schiente.
»Ich fürchte kein Tier,« lächelte die Indianerin, »ich brauche nur zu rufen, so kommen sie alle, Rehe, Hirsche, Vögel und nehmen Futter von mir. Sogar Bären und Leoparden lassen sich von mir anfassen, wenn ich sie ansehe.«
»Warum, wenn du sie ansiehst?«
»Arahuaskar sagt, meinem Blicke müßte jedes Tier gehorchen, wenn ich es nur richtig ansehe, und er hat mich gelehrt, wie ich das machen muß. Sonnenstrahl hat noch viel mehr Macht über Tiere, als ich.«
Ellen wurde nicht klug aus dieser Rede. Wer war Arahuaskar, wer war Sonnenstrahl?
»Ist Arahuaskar dein Bruder?«
Die Indianerin schlug die großen Augen mit den langen, seidenen Wimpern erstaunt auf, ließ einen Augenblick die Hände ruhen und brach dann in ein silbernes Lachen aus.
»Arahuaskar, mein Bruder? Der ist ja alt, o, so alt und häßlich, und Sonnenstrahl ist schön wie die Sonne.«
Und das Mädchen schüttelte lachend die schwarzen Haare um den Kopf. So hatte sich also entweder Miß Thomson oder der Häuptling, der ihr dies erzählt hatte, getäuscht. Arahuaskar war alt, Sonnenstrahl ihr junger Bruder. Vielleicht war Arahuaskar, der Mann mit dem alten, mexikanischen Namen, Sonnenstrahls Vater.
»Wer ist der alte Vater, von dem du vorhin sprachst? Ist das Arahuaskar?«
»Nein, der alte Vater ist ein Weißer, er ist sehr, sehr klug, er kennt und weiß alles, was in der Welt ist, und wie es entsteht. Er kennt jeden Stern, wie weit er von uns entfernt ist und noch viel mehr. Arahuaskar aber ist ein Mexikaner, er ist der letzte der Azteken.«
Waldblüte hatte diese Worte stolz gesprochen, plötzlich aber schrak sie zusammen und blickte ängstlich um sich.
»Ich darf darüber nicht sprechen, man hat es mir verboten. Ihr werdet es aber niemandem wiedererzählen?« fügte sie bittend hinzu.
»Sei unbesorgt, wir plaudern nicht! Aber wir hoffen, daß du die Kranke bei dir behältst, bis sie gesund ist. Willst du?«
Waldblüte sah sinnend auf den geschwollenen Fuß, sie strich sanft über die gerötete Haut desselben, richtete sich dann auf und sagte:
»Ich will. Arahuaskar wird zwar schelten, wenn ich aber meinen Bruder bitte, daß er mir beisteht, so muß er nachgeben. Er fürchtet sich nämlich vor Sonnenstrahl,« sagte sie wichtig. »Sonnenstrahl ist alt genug, daß er ein Krieger wird, und er sehnt sich hinaus, um die Kunst zu verwerten die er erlernt hat, aber Arahuaskar hält ihn noch immer zurück. Er sagt, die Zeit wäre noch nicht da.«
»Welche Zeit?« fragte Ellen, obgleich sie ahnte, was Waldblüte meinte.
Die Indianerin ließ den verbundenen Fuß sinken, richtete sich hoch auf und sagte:
»Die Zeit, da Sonnenstrahl die roten Krieger um sich versammelt, und ich ihnen verkünde, daß Sonnenstrahl der Häuptling ist, vor dem sich alle anderen Häuptlinge beugen müssen. Dann ist die Zeit gekommen, da Sonnenstrahl die weißen Fremden wieder aus dem Gebiete der Indianer treibt, da kein schwimmendes Haus mehr landen darf, und da die Indianer wieder reich und mächtig werden. Sonnenstrahl wird die Krieger in den Kampf führen, und ich werde Mexitli und Huitzilopochtli Zwei Kriegsgötter der Azteken, der untergegangenen Ureinwohner von Mexiko. opfern, damit sie die Feinde mit Blindheit schlagen, und man wird mich hören.«
Die beiden Freundinnen hatten verstanden, und sie fühlten plötzlich tiefes Mitleid mit der Indianerin.
Sie, wie ihr Bruder waren wahrscheinlich Werkzeuge irgend eines alten, schlauen Indianers, der sich für einen Azteken hielt und glaubte, er könnte die alte Herrlichkeit seiner Väter wieder aufrichten. Sonnenstrahl sollte als Häuptling auftreten, und da die Indianer, ehe sie in den Kampf ziehen, den Prophezeihungen einer weisen Frau lauschen, so wurde von ihm gleich eine Prophetin — Waldblüte — erzogen, welcher er günstige Prophezeihungen in den Mund legte.
»Wo steht dein Wigwam?« fragte wieder Ellen.
»Ich habe keinen.«
»Wo wohnst du?«
»Wir leben im Tempel des Huitzilopochtli,« war die Antwort. »Jetzt sind die Mauern und Säulen zerstört; kein Stein steht mehr auf dem anderen, aber mein Bruder wird sie wieder aufbauen und, wie Arahuaskar sagt, mit dem Blute der Fremdlinge zusammenkitten. Aber mein Bruder ist gut, er wird nicht grausam sein,« fügte Waldblüte wie entschuldigend hinzu.
Es lag in der Indianerin ein seltsames Gemisch von Kindlichkeit und Erfahrung. Jedenfalls war sie sich der Rolle gar nicht bewußt, welche sie einst spielen sollte, ebensowenig des Unternehmens, welches Arahuaskar im Sinne hatte.
Doch Ellen und Jessy dachten gleichzeitig an etwas anderes. Waldblüte hatte von einer Ruine gesprochen.
»Du sagst, ihr wohnt in einer Ruine?« fragte Ellen mit angehaltenem Atem.
»Ja, so nennt auch der alte Vater manchmal den zerfallenen Tempel, aber wir wohnen unter der Erde.«
»Gibt es noch eine andere Ruine in der Nähe?«
Die Spannung der Fragerinnen wurde immer größer.
»Nein, für einen Vogel mit schnellem Flug ist eine andere Ruine wohl nahe, aber selbst der durstige Hirsch läuft zwei Tage und eine Nacht, ehe er sie erreicht.«
»Euer Tempel ist die einzige Ruine hier in dieser Gegend?«
»Die einzige.«
Ellen sprang auf die Indianerin zu und faßte sie heftig am Arm, aber Waldblüte lächelte nur verwundert.
»Sprich!« stieß Ellen hervor. »Weißt du, ob in dieser Ruine heute weiße Männer eingetroffen sind? Männer und Frauen, Mädchen wie wir? Schnell, sprich!«
Lächelnd schüttelte Waldblüte den Kopf.
»Nein, wenn sie kämen, so würden sie beobachtet, und Sonnenstrahl würde mich rufen.«
»Gott sei Dank!« stöhnte Ellen. »Sie sind noch nicht da. Wir sind ihnen zuvorgekommen, weil sie wahrscheinlich durch irgend etwas aufgehalten worden sind.«
»Oder sie haben ihr Ziel geändert,« warf Jessy ein.
»Wir wollen dies nicht hoffen. Waldblüte, wo ist die Ruine, von welcher du sprachst?«
Die Indianerin deutete nach der Seite.
»Gleich hier, ganz in der Nähe. Der Wald verdeckt sie nur, sonst könntet ihr sie sehen. Sie ist sehr groß, es ist eine ganze zusammengefallene Stadt.«
»Willst du uns aufnehmen bei dir, Waldblüte?« fragte Ellen bittend.
Die Indianerin überlegte.
»Ja, ich will,« sagte sie dann fest. »Ihr seid beide hungrig und müde, ich will euch pflegen. Wenn Arahuaskar mich schilt, so entschuldigt mich deine kranke Freundin. Sie kann ja nicht gehen. Wo soll sie bleiben, wenn ich mich ihrer nicht annehme? Ueberdies brauche ich es nur Sonnenstrahl zu sagen und ihn zu bitten, der wird sofort durchsetzen, daß ihr bei mir bleibt, bis Jessy gesund ist. Es dauert nicht lange, der alte Vater kann sehr schnell heilen.«
»Wohin gehst du?« fragte Ellen, als Waldblüte sich entfernen wollte.
»Ich hole meinen Bruder. Er wird deine Freundin tragen, denn wir sind doch zu schwach dazu. Er wird sich freuen, wenn er meinen Freundinnen dienen kann.«
»Wie weit ist es bis nach der Ruine?«
Wieder zeigte Waldblüte lachend die Zähne.
»Ihr waret sehr nahe an einem Eingange zu unserer Wohnung, ohne daß ihr es wußtet,« lachte sie. »wir leben nämlich wie die Füchse; überall haben wir Ein- und Ausgänge. In drei Minuten bin ich wieder bei euch.«
Waldblüte eilte zwischen die Baume und war plötzlich verschwunden. Jedenfalls hatte sie ein hohler Baumstamm aufgenommen, in dem sich ein Zugang zu den unterirdischen Gewölben befand, mit denen die Tempel der Azteken versehen sind. In ihnen wurden die Leichen der Könige und Vornehmen einbalsamiert aufbewahrt.
»Dieses Mädchen hat uns Gott gesandt,« rief Ellen freudig, als Waldblüte mit dem Rehkalb und dem Raben verschwunden war, »ich fühle eine wunderbare Zuversicht in mir. Ich weiß es plötzlich bestimmt, daß wir unsere Freundinnen alle retten können.«
»Wir wollen hoffen, daß die Räuber unterwegs aufgehalten worden sind. Uebrigens sprach Frankos, der Anführer, von zwei Tagemärschen, so wäre es also möglich, daß er wohl den Weg zur Ruine weiß, aber längere Zeit braucht als wir.«
»Die Hauptsache ist vorderhand, daß Sie eine Unterkunft finden, wo Sie in Ruhe den Fuß heilen lassen können. Doch still,« unterbrach sich Ellen, »dort kommt Waldblüte schon wieder. Wahrhaftig, ein Mann begleitet sie, und, den glänzenden Augen nach, muß es Sonnenstrahl, ihr Bruder, sein.«
Longfellow, ein amerikanischer Dichter, der seine Studienzeit in Deutschland zugebracht und sich um unser Vaterland insofern verdienstlich gemacht hat, als er viele deutsche Lieder und Sänge, auch Studentenlieder, übersetzte und in Amerika verbreitete, hat ein Gedicht geschrieben, welches so recht die Verhältnisse in Westindien charakterisiert. Es heißt »Das Quarteron-Mädchen« Quarterone, auch Quadrone, ist die Tochter eines Weißen und einer Terzerone, diese wieder die Tochter eines Weißen und einer Mulattin. Die Quadronen sind wegen ihrer Schönheit bekannt, man merkt wenig von ihrer Abstammung von einer Negerin. und beginnt mit dem Verse:
Vor Anker harrt das Sklavenschiff
Am Rande der Lagun'
Des Mondaufgangs, des Abendwinds,
Die schlaffen Segel ruh'n.
Beim ersten Durchlesen glaubt man, der gerade melancholisch gestimmte Dichter habe nur das Schicksal eines Mädchens geschildert und dazu eine reiche Szenerie gewählt, aber er hat ein Bild aus dem Leben gegriffen.
Es ist leider nur zu wahr, daß die Plantagenbesitzer in Amerika aus Geldsucht selbst die eigenen Kinder, die sie mit Negerinnen und Mulattinnen erzeugten, als Sklaven verkauft haben, und wie oft wiederholt sich wohl noch heute, nach Abschaffung des Sklavenhandels, derartiges.
Es ist überhaupt eine eigentümliche Sache um die Abschaffung des Sklavenhandels. Wer mit offenem Auge das Land bereist, wo Neger zu harter Arbeit verwendet werden, kommt bei unparteiischer Beurteilung wohl auf den Gedanken, daß deren Lage nicht gebessert, sondern eher verschlechtert ist, und daß überhaupt die Sklaverei noch fortexistiert, nur in anderer Form.
Der Pflanzer unterm Rohrdach schmaucht'
Gedankenvoll und träg',
Der Sklavenhändler schritt zur Tür,
Als hastet' er hinweg.
Sklavenhändler gibt es noch, also muß es auch noch Sklaven geben, und besonders nach schönen, weiblichen ist noch immer eine starke Nachfrage. Neben dem Pflanzer sitzt seine Tochter, eine Quarterone, und auf diese bietet der Händler.
Vor ihnen hebt das Köpfchen auf
In holder Schüchternheit
Mit Neugier erst, mit Schrecken bald
Die Quarteronenmaid.
Im Herzen des Pflanzers geht ein harter, aber kurzer Kampf vor sich.
»Der Boden karg und alt die Farm!«
Der Pflanzer sprach's und sann,
Erst blickt' er auf des Händlers Gold
Und auf die Maid sodann.
Im Streit lag sein Herz mit solch
Fluchwürdigem Gewinn;
Er wußte gut ja, wessen Blut
In ihren Adern rinn'.
Und der letzte Vers des ziemlich langen Gedichtes lautet:
Der Sklavenhändler schritt vors Tor,
Die Jungfrau an der Hand,
Daß sie ihm Liebchen, Sklavin sei
Im fernen, fremden Land.
Der Pflanzer hatte also sein eigenes Kind verkauft.

Der Pflanzer hatte sein eigenes Kind verkauft.
Das war ungefähr auch das Schicksal Loras gewesen. Wort für Wort konnte man das Gedicht auf sie beziehen, nur daß sie keine Quarterone, sondern die Tochter eines Kreolen und einer Indianerin in Jamaika war. Auch ihr Vater, ein Pflanzer in der Nähe von Kingston, der Hauptstadt von Jamaika, hatte Lora für schnödes Geld verkauft, um eine Spielschuld zu decken.
Wohl hätte man ihn vor Gericht zur Verantwortung ziehen können, aber einmal bat Lora wunderbarerweise selbst für den Vater, der sein Kind allerdings nicht anerkennen wollte und Lora eine Betrügerin schalt, und dann hätte eine gerichtliche Untersuchung auch lange Zeit in Anspruch genommen.
Aller Energie der englischen Herren hätte es bedurft, um Lora, einen unehelichen Mischling, zum Schwure kommen zu lassen; die Anwesenheit der Vestalinnen wäre nötig gewesen, und schließlich hätte auch die Person des Sklavenhändlers festgestellt werden müssen.
Darüber konnten unter Umständen Monate und Jahre vergehen, und den ungeduldigen Herren schienen schon die wenigen Tage, die sie bis zum Eintreffen des nächsten Schnelldampfers hier warten mußten, eine Ewigkeit.
Lora wurde daher auf ihren Wunsch in eine spanische Missionsanstalt gebracht, die Herren sorgten für sie und harrten dann untätig und sehnsüchtig der Ankunft ihres Schiffes.
Das Hotel, in dem die Engländer mit Hannes und Hope zusammen wohnten, lag auf einem Hügel, wie überhaupt Jamaika durch und durch gebirgig ist, aber die Abhänge sind äußerst fruchtbar. Auf dem Dache des Hauses erhob sich noch ein Aussichtsturm.
Gern standen die Herren auf diesem, aber ihre Augen ergötzten sich nicht an der prächtigen Landschaft, den sonnigen Abhängen, den grünen Feldern und den bunten Fluren, ihre Augen hingen an dem nördlichen Horizont, denn dort lag das Ziel ihrer Sehnsucht.
Lange schon hatten sie nichts von den geliebten Mädchen gehört, keine Depesche von unbekannter Hand war mehr an Sharp eingetroffen, welche ihn über das Schicksal der Vestalinnen orientierte. Sie wußten noch nicht einmal, ob jene ihr Ziel Matagorda erreicht hatten.
Waren sie dort? Waren sie schon auf der Landreise nach ihrer Heimat, oder hatte das Schicksal abermals mit grausamer Hand ihre Absicht durchkreuzt?
Eine furchtbare Aufregung hatte sich der Herren bemächtigt. Stunde für Stunde standen sie auf dem Aussichtsturm und starrten nach dem blauen Horizont, als könnten sie dadurch bewirken, daß ihnen eine Depesche mit günstiger Nachricht zukäme.
Zu den schon auf der Plattform versammelten Herren trat Hendricks, der sich im Hotel aufgehalten hatte.
»Morgen abend trifft der Dampfer hier ein,« rief er. »Soeben ist er von Valencia abgegangen, die Depesche ist angekommen.«
Morgen abend erst, also noch über dreißig Stunden! Die Herren hatten sich erst auf einige Tage gefaßt gemacht, weil der Dampfer anfangs für später gemeldet worden war, jetzt erschienen ihnen aber auch noch die dreißig Stunden zu lang.
»Geht denn nur kein anderer Dampfer nach Matagorda?« fragte Harrlington den Kellner, der auf dem Turme die Bedienung versah.
»Nach Matagorda direkt nicht, wohl aber nach anderen Städten von Texas, so zum Beispiel nach Galveston, aber auch erst morgen,« erwiderte der mit allen Fahrgelegenheiten vertraute Kellner. »Wenn ich Ihnen aber raten darf, so warten Sie auf den Schnelldampfer, denn ehe Sie von Galveston nach Matagorda Fahrgelegenheit bekommen, können einige Tage vergehen.«
»Es ist überhaupt kein Schiff in ganz Kingston, welches nach Matagorda fährt?«
»Wohl Segelschiffe, aber mit denen werden Sie doch keine Seereise machen?«
Es war zum Verzweifeln.
Wie bedauerten die Herren, daß der ›Amor‹ jetzt nicht hier war. Harrlington hatte den Heizern den Befehl gegeben, ihn mit Mannschaft zu versehen und dann nach Matagorda zu dirigieren.
Hannes und Sharp kamen ebenfalls herbei, sie waren seit dem Morgen fort gewesen und hatten sehr geheimnisvoll getan.
Sharp sah eher aus wie ein Reitdiener als wie ein Gentleman, er hatte ein sehr gewöhnliches Gesicht aufgesetzt, war nachlässig gekleidet und rauchte einen entsetzlich scharfen Tabak.
Niemand wußte, was ihn dazu veranlaßte, solche Maskerade zu spielen, allen war aber streng verboten, ihn mit seinem Namen anzureden. Er gab sich für den Diener Harrlingtons aus, nannte sich Ralph und besorgte wirklich alle Dienstleistungen für den Lord, mit einer Gewissenhaftigkeit, als wäre er zeitlebens Diener gewesen und würde dafür bezahlt.
Es war ausgemacht worden, daß die Briefe für Harrlington, bei denen die Adresse des Namens nur mit einem r geschrieben wären, für ihn bestimmt seien. Er öffnete sie, ohne vorher den Lord davon zu benachrichtigen.
»Meine Herren,« rief Hannes, als er auf die Plattform trat, »der Pflanzer, dieser barbarische Vater, braucht nicht erst bestraft zu werden, er ist schon bestraft genug. Ralph und ich fuhren heute morgen in der Absicht nach seiner Plantage, um zu versuchen, ob wir ihm nicht etwas am Zeuge flicken könnten. Ich ließ mich von Ralph als einen englischen Kapitän anmelden und wurde ins Vorzimmer geführt. Hier wurde ich zufällig Zeuge einer Szene, die mich meinen Vorsatz gleich wieder aufgeben ließ. Der Pflanzer scheint nämlich unter dem Pantoffel einer sehr eifersüchtigen Frau zu stehen. Ich hörte, wie seine liebliche Ehegattin ihm wegen Loras die Leviten las. Sie machte ihn so herunter, daß kein Hund ein Stückchen Brot von ihm annähme, wenn er das gehört hätte, und dann hörte ich es auch ein paarmal klatschen, worauf stets Jammertöne folgten. Ich denke, wir sprechen den Mann von der Strafe frei. Wer so eine Zuchtrute im Hause hat, der braucht nicht mehr zu sagen: Gott strafe mich!«
Die Herren zeigten wenig Interesse für die Erzählung von Hannes, sie dachten an anderes; nur Hope wollte mehr wissen, und Hannes mußte ausführlich erzählen.
»Hast du ihn dann noch gesprochen?«
»Gott bewahre mich! Mir wurde angst, mit dem Weibe zusammenzukommen, und ich empfahl mich, ohne jemanden gesehen zu haben. Ich habe die Pferde ausgreifen lassen, bis ich die Plantage aus den Augen verlor. Vor solchen Frauen habe ich eine höllische Angst, und ihre Männer bemitleide ich und bete für sie, wenn es auch meine ärgsten Feinde sind. Ich kalkuliere, dem Pflanzer wären drei Jahre hinter festen Mauern ganz lieb, wenn er nur vor der Zunge und den Fäusten seiner Frau sicher ist.«
Wo ist Ralph?« fragte Harrlington.
»Er ist unten beim Wirt, ich glaube, er hat eine Depesche für Sie.«
»Und das sagen Sie erst jetzt?« schrie Harrlington, und auch die anderen Herren sprangen von den Stühlen auf.
»Sie bekommen Sie noch immer zeitig genug,« sagte Hannes phlegmatisch und ließ seinen Blick über die Plattform schweifen, auf welcher außer den Engländern noch andere Gäste saßen.
Schon wollte Harrlington die Treppe hinunterstürzen, als Ralph ihm entgegentrat und eine Depesche hinhielt.
»Aus Matagorda,« sagte er mit pfiffigem Lächeln.
Harrlington war viel zu erregt, als daß er die Adresse betrachtet hatte. Aber wenn er sie auch noch so genau besehen, er hätte schwerlich bemerkt, daß sein Name zwar mit zwei r, also richtig geschrieben war, aber daß das eine r nachträglich eingeschaltet, nachdem das andere ausradiert war. Die Umänderung war fast unmerklich vorgenommen worden.
Hastig brach der Lord die Depesche auf. Er überflog sie. Seine Hand bebte, und kaum konnte er die Zeilen entziffern.
Die Herren hatten ihn umdrängt. Aller Augen hingen an den Lippen des Lesers.
»Nicht hier,« bat Harrlington tonlos. »Kommen Sie in unseren Salon!«
Die Herren besaßen unter ihren Zimmern einen Salon, in dem sie sich zu versammeln pflegten. Hier teilte ihnen Harrlington den Inhalt der Depesche mit.
»Den Damen ist ein neues Unglück zugestoßen,« begann er, »aber es ist nicht so schlimm, als Sie meiner ersten Erregung nach vielleicht erwarten. Ich wurde von der ersten Zeile übermannt. Hören Sie, was mir aus Matagorda mitgeteilt wird:
DIE VESTA AUF DEN MATAGORDARIFFEN GESTRANDET, DAMEN VON STRANDRÄUBERN UND APACHEN ÜBERFALLEN, DOCH ERNSTLICHE GEFAHR NICHT VORHANDEN. KOMMEN SIE SOFORT NACH HIER, WENN KEINE FAHRGELEGENHEIT, CHARTERN* SIE EIN SCHIFF.
F.H.
* Chartern ist der seemännische Ausdruck für mieten.
»Das heißt Felix Hoffmann, er wacht also über die Damen,« schloß der Lord.
»Ein Schiff chartern,« rief Williams. »Warum haben wir nicht eher daran gedacht? Es ist zwar ein teures Unternehmen, aber was macht das?«
»Ralph, Sie wissen ja alles,« wandte sich Harrlington an seinen Diener. »Welches Schiff ist im Hafen, das nicht benützt wird und so bald als möglich, womöglich noch heute, bereitgemacht werden kann, in See zu stechen?«
»Es giebt mehrere,« entgegnete Ralph und nannte einige Namen.
»Gut, ich werde sofort versuchen, was sich tun läßt. Koste es, was es wolle, wir fahren noch heute abend ab!«
»Halt!« rief der Detektiv. »Ich bitte Sie, Lord, überlassen Sie das Freiherrn von Schwarzburg! Er ist mehr Seemann als Sie, er kann besser mit den Kapitänen umgehen und weiß ein Schiff auch besser zu taxieren. Sind Sie damit einverstanden?«
Harrlington willigte nach kurzem Zögern ein, er wußte, daß Sharp nur gute Ratschläge gab und stets einen triftigen Grund dazu hatte, wenn er diesen auch nicht gleich offen aussprach.
»Und mir schreiben Sie ein Telegramm aus,« fuhr Ralph fort, »daß Sie heute abend nach Matagorda abfahren und stets unter voller Kraft dampfen lassen. Am Mast führt das Schiff die Flagge des ›Amor‹ als Erkennungszeichen.«
»Warum setzen Sie das Telegramm nicht auf?«
»Weil Sie es sollen,« entgegnete Sharp kurz.
Harrlington nahm ein Telegrammformular aus der Brusttasche.
»Kennen Sie schon ein Schiff welches sich chartern lassen wird und schnell fährt? Aber es muß bestimmt sein.«
»Ganz bestimmt! Der deutsche Dampfer ›Seeschwalbe‹ liegt ohne Fracht hier, sein Kapitän ist außer sich darüber. Er läßt sich sofort chartern. Ich garantiere dafür«
»Gut!«
Harrlington ergriff die Feder und schrieb:
FAHREN HEUTE ABEND MIT GECHARTERTEM DEUTSCHEN DAMPFER SEESCHWALBE VON HIER AB. AM MAST DIE AMORFLAGGE.
HARRLINGTON.
»Wohin soll ich adressieren?«
»Miß Forbes, Matagorda, das genügt.«
Die ebenfalls anwesende Hope blickte erstaunt auf.
Sie glaubte ihren Ohren nicht trauen zu dürfen. Das war ja ihre Tante. Doch jetzt war keine Zeit zum Fragen. Ueberdies sah Hope sofort ein, daß noch andere Menschen so heißen konnten.
Harrlington schrieb die Adresse und händigte sie seinem Diener ein, der sie auf der Post aufgeben wollte.
»Und Sie gehen sofort nach dem Schiff, Baron?« fragte er dann Hannes.
»Sofort! Habe ich Vollmacht, zu handeln, wie ich will? Der Spaß kann teuer zu stehen kommen.«
»Zahlen Sie, was der Kapitän verlangt, und wenn es eine halbe Million Pfund Sterling kosten sollte, wir sagen für alles gut.«
»So viel kostet es nicht,« lachte Hannes. »Für meine Verhältnisse wäre das auch ein bißchen viel.«
»Erst muß ich Sie aber noch sprechen,« sagte der Detektiv zu Hannes. »Gehen Sie auf Ihr Zimmer und rufen Sie mich, wie man einen Diener ruft. Ich nehme es Ihnen diesmal nicht übel, wenn Sie grob gegen mich sind.«
Hannes verließ das Zimmer.
»Machen Sie sich bereit, meine Herren!« wandte sich Sharp jetzt an die Engländer. »Und Sie, Baronin, sorgen Sie dafür, daß die Mädchen reisefertig sind! Ich denke, wir werden noch eher abreisen, als heute abend, vielleicht schon in einigen Stunden.«
Alles ging Schlag auf Schlag; es war keine Zeit zu verlieren. Die Herren trafen Anstalten zur Abreise, einige hatten noch Wege zu besorgen, und Hope bereitete die vier Mädchen, die letzten von den achtzehn Geretteten, auf die baldige Abreise vor.
Als Ralph durch den Korridor ging, die Depesche in der Hand, kam er an einem nobel gekleideten Herrn vorüber, der ihn aufmerksam ansah. Besonders an der Depesche hingen seine Blicke. Derselbe Herr saß gewöhnlich auf der Plattform, wenn die Engländer sich auch dort befanden, und suchte sich überhaupt viel in der Nähe der Lords aufzuhalten.
Den Engländern fiel dies nicht auf; es war ein stiller, anständiger Mann. Der Zufall mochte ihn immer mit ihnen zusammenführen.
Ralph ging im strammen Gange eines Bedienten über den Korridor und wollte schon die Treppe hinabsteigen, als sich eine Tür öffnete und ein Kopf heraussah.

»Ralph!«
Wie verabredet, rief Hannes den Diener, dieser blieb stehen, kehrte zurück und ging in das Zimmer hinein, von den Blicken des auf dem Korridor stehenden Herrn verfolgt, der etwas in den Bart murmelte und sich auf die Straße begab.
Ralph blieb ziemlich lange Zeit bei Hannes, aber er erhielt natürlich nicht von diesem Aufträge, sondern erteilte vielmehr ihm Instruktionen, welche dem jungen Manne sichtlich zu behagen schienen. Außerdem erledigte Ralph noch einiges Schriftliche.
Als er die Straße betrat, eilte er, ohne sich umzusehen, in schnellem Schritt der Post zu, schlenkerte mit den Armen, stieß bald hier einen dicken Kreolen zur Seite, rannte da ein eingeborenes Weib bald über den Haufen, so daß man ihm schon von weitem ansehen konnte, wie eilig er es und welch wichtigen Auftrag er hatte.
»Donnerwetter, Ralph, bist du denn blind, daß du so an mir vorbeiläufst?« lachte da plötzlich eine Stimme neben ihm, und der verwundert aussehende Bote sah einen Seemann neben sich stehen, eine untersetzte, vierschrötige Gestalt in blauem Anzuge, die Hände in den Hosentaschen, den Wachstuchhut im Nacken und die kurze Kalkpfeife zwischen den Zähnen.
»Wer seid Ihr denn? Ich kenne Euch gar nicht,« knurrte der aufgehaltene Ralph.
»Was, Ralph, du kennst mich nicht mehr? Nun hört aber doch alles auf! Wir haben doch in Philadelphia Freundschaft geschlossen, als du mit dem Transport Pferde ankamst, die ich mit ausladen half. War eine verdammte Zeit damals, jetzt geht es besser, seit ich wieder Planken unter den Füßen habe. Bin heute abgelohnt worden.«
»War niemals in Philadelphia,« knurrte Ralph.
»Nein, wirklich nicht?« fragte der Seemann erstaunt. »Das ist aber eine verdammte Aehnlichkeit. Wie man sich so täuschen kann! Richtig, Ralph hatte blondes Haar, Ihr habt aber schwarzes. Na, nichts für ungut, Fremder.«
»Ich heiße aber auch Ralph.«
»Wahrhaftig? Das ist sonderbar. Wißt Ihr was, Mann, Ihr könnt mir einen Gefallen tun. Ich will nach dem Seemannsamt, um dort Geld an Weib und Kind aufzugeben. Wollt Ihr mir den Weg dahin zeigen? Mit meinem Spanisch kann ich mich nicht durchfragen, diese Sprache zerbricht mir die Zunge.«
»Ich habe keine Zeit. Ihr habt mich sowieso schon zu lange aufgehalten.«
»Ach was,« rief der Matrose und packte Ralph am Arme, ihn zurückhaltend, »so viel Zeit werdet Ihr wohl haben! Ihr zeigt mir den Weg, und dann trinken wir eins.«
Möglich, daß der Matrose sicher glaubte, Ralph würde solch ein Angebot nicht abschlagen, denn Ralphs Nase war mit einem rötlichen Schimmer überhaucht.
»Gut denn, unter solchen Bedingungen werde ich Euch den Weg zeigen,« lachte er und beschrieb dem Matrosen die Richtung, welche er nach dem Seemannsamt einzuschlagen hatte.
»Well, habe verstanden, ich werde mich nun zurechtfinden,« meinte der Matrose und faßte den Arm Ralphs unter, »nun kommt mit, in Jamaika soll der Rum gut und billig sein.«
»Aber nicht zu weit, ich habe es eilig.«
»Was habt Ihr denn so furchtbar wichtiges?«
»Depeschen! Mein Herr hat mich beauftragt, sie so schnell wie möglich aufzugeben.«
Ralph machte auf den Matrosen den Eindruck eines etwas dummen Menschen.
»Ach was,« sagte er wieder, »darum braucht Ihr nicht so zu rennen. Der Telegraphist klappert sie sowieso nicht gleich, ein halbes Stündchen vergeht doch. Wenn Ihr ihm dann aber ein Trinkgeld gebt, so beeilt er sich, und die verlorene Zeit ist wiedergewonnen.«
»Meint Ihr?«
»Sicher, ich kenne das.«
»Ich bin aber selbst froh, wenn ich Trinkgelder bekomme. Anderen kann ich keine geben.«
»Ich gebe Euch dann einen Dollar. Jetzt aber kommt mit, ich muß in eine Schenke, wo ich Freunde erwarten will.«
Er schleppte Ralph mit sich fort.
Der Weg war sehr weit; er führte durch kleine und krumme Straßen und Gassen, ging dann ins spanische Viertel über, doch Ralph schien seine Mission vergessen zu haben, er war ganz Ohr für die Anekdoten und Schwänke, die der Matrose ihm in unerschöpflicher Fülle zum besten gab.
Ob er Ralph wirklich für so dumm hielt?
Hätte er gewußt, daß sein Begleiter, der ihm mit solch kindlichem Lachen und gläubigem Herzen folgte, der gewiefteste und schlaueste aller Detektiven war!
»Hier sind wir,« sagte der Matrose plötzlich und öffnete eine Tür, welche in eine elende, schmutzige, spanische Weinstube führte.
Er ging ohne weiteres in ein separates, gut eingerichtetes Zimmer, wo sie von dem Wirte mit einer wahren Galgenphysiognomie empfangen wurden.
»Trinkt Ihr Rum? All right, ein Glas Rum, und für mich Gin, ich mag Rum nicht, ich bekomme Rheumatismus davon.«
Ein ist ein weißer, wasserheller Branntwein, aus Wachholderbeeren bereitet.
»Gläser gibt es hier nicht,« schmunzelte der Wirt, »dann müßten die Senores nach vorn gehen.«
»Das Volk ist mir dort zu gewöhnlich; unter Spitzbuben mische ich mich nicht,« sagte der Matrose. »Dann bringt uns meinetwegen Flaschen.«
Der Wirt ging, um das Verlangte zu holen.
»Hier soll es den besten Rum von ganz Jamaika geben,« meinte der Matrose, sich in der kleinen Stube umsehend, welche wie ein Wohnzimmer möbliert war.
»Ich trinke alles, wenn nur Spiritus darin ist,« lachte Ralph.
Die Flaschen standen auf dem Tische, und der Wirt schenkte die Gläser voll.
»Brrr,« sagte Ralph, »das Zeug ist stärker, als ich je getrunken habe.«
»Wollt Ihr Wasser?« fragte der Matrose, und jedem anderen wäre der Blick entgangen, welchen er dabei dem Wirt zuwarf, aber der Detektiv hatte ihn bemerkt.
Die beiden ahnten aber nicht, welch schlauen Gesellen sie vor sich hatten.
»Danke,« entgegnete Ralph auf des Matrosen Frage, »jeder Tropfen Wasser verdirbt den Rum. Erst wenn er mir zu sehr brennt, nehme ich Wasser, aber viel darf ich jetzt sowieso nicht trinken, ich muß mich vorsehen.«
»So ist es recht,« lachte der Matrose. »Wie sagtet Ihr? Jeder Tropfen Wasser verdirbt den Rum? Ich hatte einmal einen Schiffsmaat, der sagte immer: Jeder Tropfen Wasser verdirbt den Grog, und wenn wir nun Grog tranken, schluckte er den blanken Rum hinunter, behauptete aber, es wäre Grog ohne Wasser.«
Ralph lachte aus vollem Halse. Die Glaser klangen zusammen, und es wurde getrunken.
Der Wirt kam ab und zu herein und hielt es für seine Pflicht, jedesmal die Glaser zu füllen, wenn sie leer waren. Die Flaschen waren ja von dem Matrosen bezahlt worden.
Als des Matrosen Witz versagen wollte, kam der Wirt ans Erzählen und brachte Schnurren und Schwänke vor, daß Ralph nicht aus dem Lachen herauskam.
Der Matrose trank sehr viel, er stieß fortwährend an Ralphs Glas, und dieser mußte ihm Bescheid tun.
Des Dieners Augen begannen schon zu glänzen, seine Zunge wurde schwerer, und auch der Matrose schwankte, wenn er aufstand und durch die Stube ging, aber sonst sah man ihm nicht an, daß er betrunken war.
Jetzt mußte Ralph erzählen, von den Engländern, die hinter den Vestalinnen hergefahren waren, von seinem Herrn, Lord Huntington; er wurde gefragt, ob jene nicht bald die Damen wieder aufsuchten, wo diese wohl jetzt wären und so weiter, und Ralph plauderte immer lustig aus der Schule, ohne Anstoß an den seltsamen Fragen, die an ihn gestellt wurden, zu nehmen.
Ralph oder Nick Sharp mußte wirklich betrunken sein, denn sonst hätte er wohl nicht erzählt, daß die Herren wahrscheinlich schon heute abend abfahren würden, er sprach sogar von dem gecharterten Schiffe, von der ›Seeschwalbe‹, wie er gehört hätte, daß diese die Engländer zu ihrer Reise benutzen wollten.
Des Dieners Augen wurden immer gläserner und starrer, je öfter er Rum hinuntergoß. Seinen Auftrag, die Besorgung der Depesche, hatte er ganz vergessen.
»Gebt mir Wasser in den Rum,« stammelte er mit schwerer Zunge, »sonst werde ich noch betrunken.«
Der Wirt lachte und brachte eine Flasche mit Wasser herein, aus der er in das Glas Ralphs nachgoß.
Ob der Detektiv wohl wußte, daß diese klare Flüssigkeit kein Wasser, sondern Gin war?
Er schien keinen Argwohn zu schöpfen, als er das große Glas hinuntergoß, der scharfe Rum hatte der Zunge den Geschmack geraubt.
Schon konnte Ralph kaum noch sprechen, und wenn er es tat, so brachte er Unsinn vor, ja, er kippte schon bedenklich mit dem Stuhle, und als er einmal aufstand, klammerte er sich erst krampfhaft am Tische an, aber schon beim ersten Gehversuche stürzte er zu Boden, den Stuhl mit sich reißend.
»Oho, nur langsam, Kamerad,« rief der Matrose, sprang aus und wollte Ralph in die Höhe helfen.
Doch das war nicht mehr gut möglich, denn Ralph hatte bereits die Besinnung verloren, so, wie er gefallen, war er eingeschlafen.
»Der ist gut versorgt,« flüsterte der Wirt, sich über den Betrunkenen beugend, »der Gin hat ihm den Rest gegeben.«
Der Matrose überzeugte sich, daß sein Opfer schlief, und wandte sich dann an den Wirt.
»Jetzt laßt mich allein,« sagte er. »Euer Geld für die Hilfe habt Ihr empfangen.«
»Wenn er nun wieder zu sich kommt, was soll ich ihm dann sagen? Er wird seine Papiere vermissen.«
»Sagt, der Matrose, mit dem er gezecht, hätte ihn wahrscheinlich ausgeplündert, und ein anderes Mal soll er nicht mehr trinken, als er vertragen kann. Will er dann aufmucken, so lehrt ihn die Gesetze von Kingston kennen, das heißt, werft ihn hinaus. Im übrigen kennt Ihr mich ja, Ihr habt uns schon öfter geholfen. So, nun laßt mich mit ihm allein und sorgt dafür, daß ich für fünf Minuten nicht gestört werde. Erst legt ihn jedoch mit mir auf das Sofa.«
Die beiden Männer faßten den Bewußtlosen an und trugen ihn nach einem Sofa. Dann verließ der Wirt das Zimmer.
Der Matrose, welcher seltsamerweise trotz des vielen Trinkens ganz nüchtern geblieben war, schloß hinter ihm die Tür, lauschte auf die sich entfernenden Schritte, auf das Lärmen der Gäste im vorderen Zimmer und ging dann zu dem Bewußtlosen.
»Jetzt schnell,« murmelte er. »Ich hätte nicht geglaubt, daß es mir so leicht werden würde.«
Er knöpfte Ralphs Rock und Weste auf, untersuchte die Taschen und brachte eine Menge Briefe und Schriftstücke hervor, die er in die eigene Tasche verschwinden ließ. Er las sie nicht durch, mit Ausnahme des von Harrlington geschriebenen Telegramms, weil es gerade dieses war, nach welchem er getrachtet hatte.
Ein befriedigendes Lächeln huschte über sein breites Gesicht.
»Also hat der Dummkopf vorhin doch die Wahrheit ausgeplaudert, die ›Seeschwalbe‹ soll die Engländer nach Matagorda bringen. Erkennungszeichen die ›Amor‹-Flagge. Gut, man wird dafür sorgen, daß dieses Schiff den Hafen nicht erreicht; wie, weiß ich nicht, geht mich auch nichts an, ich soll nur die Papiere bringen. Wird noch manches Interessante darin stehen, denke ich.«
Der Matrose suchte in allen Taschen Ralphs, fand aber keine Papiere mehr, sondern nur noch Messer, Pfeife, einen Schlüssel und etwas Geld, dann auch noch in der Weste eine Uhr.
»Nun gibt es zwei Möglichkeiten,« murmelte der Matrose weiter, »entweder ich nehme ihm alles, und wenn er dann zur Besinnung kommt, schlägt er Lärm, oder aber, ich nehme ihm nur die Papiere und stecke ihm ein paar Goldstücke in die Tasche. Ist er ein Spitzbube, so schweigt er und geht nicht wieder zu seinem Herrn, weil er seine Pflicht verletzt hat, und macht sich unsichtbar. Ist er aber ehrlich, so schlägt er dennoch Lärm.«
Der Matrose überlegte.
»Besser ist, ich nehme ihm alles, denn der Kerl scheint ehrlich zu sein. Dann werde ich zwar als Räuber verfolgt, aber das macht nichts, mich findet doch keiner. Die Uhr ist gut, so habe ich außerdem noch einen Profit.«

»Besser ist es, ich nehme ihm alles,
der Kerl scheint ehrlich zu sein.
Er steckte alles, was er gefunden hatte, ein.
»So, nun schlafe wohl, Ralph, und wenn du erwachst, so ertrage die Kopfschmerzen wie ein Mann,« grinste der Matrose. »Du wirst wohl noch manchmal an den Rum von Jamaika zurückdenken.«
Er schloß die Tür auf und verließ das Haus, ohne den Wirt erst noch einmal zu sprechen.
Der Matrose hatte lange Zeit gebraucht, ehe er seine Absicht erreichte; es war unterdes Abend geworden, und er hatte sich gerade noch rechtzeitig entfernt, um nicht in die Hände derer zu fallen, die ihn für sein Werk gezüchtigt hätten.
Kaum war er nämlich aus der Haustür hinaus, als einige Männer eindrangen und den Wirt zu sprechen verlangten.
Dieser sah mit einem bösen Gewissen die vier vornehmen Herren an, da solche sonst nie diese Spelunke betraten, und er wurde um so unruhiger, als er beim Eintreten der Herren gehört hatte, wie einer sagte:
»Er hat Ralph zuletzt gesehen, wie er hier eintrat, und ein Matrose war mit ihm. Chaushilm hat geschworen, daß es nur Ralph gewesen sein kann.«
Der eine Herr — Lord Harrlington — zog ein sehr finsteres Gesicht, als er den Wirt erblickte.
»Ist mein Diener bei Ihnen gewesen?«
»Ihr Diener? Ich kenne ihn nicht.«
»Ein Mann mit Reithosen, kurzer Joppe und Jockeimütze. Er war in Begleitung eines Matrosen.«
»Ach ja,« sagte der Wirt gleichmütig. »Ein solcher Mann war hier, und ich glaube er brachte einen Matrosen mit.«
»Wann sind sie wieder weggegangen?«
»Weiß ich nicht.«
»Entsinnt Euch,« rief da Lord Hastings drohend, und der Wirt, durch das herrische Auftreten eingeschüchtert, tat auch, als überlege er.
»Richtig,« sagte er dann, den Finger, an der Nase, »die zwei gingen in das kleine Zimmer und ließen sich zwei Flaschen bringen. Aber fortgehen habe ich sie noch nicht sehen. Ich glaube, sie müssen noch hinten sitzen.«
Der Wirt wollte die Herren nicht führen; er stellte sich sehr beschäftigt und gab ihnen nur den Weg an.
Die Herren, Harrlington, Hastings, Williams und Hendricks, drangen in das Zimmerchen ein und blieben bei dem Anblick, der sich ihnen bot, erschrocken auf der Schwelle stehen.
Dann aber trat Harrlington an das Sofa und schüttelte den Bewußtlosen heftig am Arm. Er wußte sofort, daß hier ein Zechgelage stattgefunden habe, infolgedessen Ralph, oder Nick Sharp, sinnlos betrunken war.
Harrlington war wirklich äußerst entrüstet; seit Stunden warteten alle Herren nur auf diesen Menschen, und jetzt lag er regungslos da. Die Abreise mußte seinetwegen verzögert werden.
»Mensch, wachen Sie auf!« rief Harrlington, den Detektiven heftig am Arm und an der Brust schüttelnd. »Wie können Sie sich betrinken, während wir auf Sie, warten?«
Plötzlich schlug der Schläfer die Augen auf und blickte dem Lord mit Augen, die durchaus klar waren, voll ins Gesicht.
»Geht Sie das etwas an, wenn ich mich betrinke?« fragte Sharp kalt. »Haben Sie etwa die Getränke bezahlt?«
Harrlington und die übrigen Herren zogen ein verblüfftes Gesicht. Es war nicht das erstemal, daß sich Sharp ernstlich jede Einmischung in seine Pläne verbat und sie zurechtwies.
»So sind Sie gar nicht betrunken?«
»Ich war es vielleicht, wenigstens für andere.«
Sharp griff in die Taschen. Die waren leer.
»Alles weg,« sagte er, »sogar die Uhr hat mir der Schuft gestohlen.«
»Alles?« rief Harrlington, »Wo ist die Depesche? Haben Sie dieselbe vorher aufgegeben?«
»Die ist auch weg.«
»Lassen Sie! Wir senden eine andere ab. Jetzt kommen Sie, wir sind vollständig reisefertig.«
»Haben Sie die ›Seeschwalbe‹ gechartert?«
»Wir haben sie bekommen.«
»Wo liegt sie?«
»Bereits auf der Reede. Die Ebbe tritt bald ein, und dann kann sie den Hafen nicht mehr verlassen.«
»Haben Sie unweit der ›Seeschwalbe‹ noch ein anderes Schiff liegen sehen?«
»Es liegen verschiedene Schiffe auf der Reede,« sagte der ungeduldig werdende Harrlington. »Erheben Sie sich endlich vom Sofa und kommen Sie! Ihr Gepäck ist bereits von Schwarzburg besorgt worden.«
Aber Ralph schien Zeit zu haben, er blieb bequem im Polster liegen.
»Nur gemach,« entgegnete er freundlich. »Wir haben es durchaus nicht eilig, und seien Sie vor allen Dingen versichert, daß ich meine Fragen nicht unnütz stelle. Liegt auf der Reede ein Schiff unter Dampf?«
»Allerdings,« nahm Williams das Wort, »ein englischer Dampfer.«
»Was für eine Flagge führt er am Großmast?« fragte Ralph beharrlich weiter. »Sie haben ja ein gutes Gedächtnis, Sir Williams.«
»Ein springendes Känguruh im blauen Felde, er heißt ›Malaga‹ und fährt nach New-Orleans. Genügt Ihnen das nun, Sie neugieriger Mensch?«
»All right,« rief Ralph und sprang auf, »meine Neugier ist befriedigt.«
Aber zum geheimen Aerger der vier Herren hielt sich Ralph noch einmal für einige Minuten in dem vorderen Schankzimmer auf, und sie waren nicht wenig erstaunt über die Unterhaltung, die er mit dem Wirte anknüpfte. Aber dieser selbst zog ein ungemein verblüfftes Gesicht, als der, den er für wenigstens zwölf Stunden besinnungslos glaubte, mit festem Gang und klaren Augen plötzlich vor der Bar stand und ein großes Glas Rum forderte.
»Es wurde mir vorhin etwas schwindlig,« meinte Ralph gelassen. »Ich habe mich ein halbes Stündchen schlafen gelegt, und was meinen Sie, was der Matrose, der vorhin bei mir war, in der Zeit mit mir gemacht hat?«
Der Wirt antwortete nicht, er starrte nur den Sprecher an.
»Ausgeraubt hat er mich! Geld, Uhr, Papiere, alles ist weg. So ein Spitzbube!«
»Ist nicht möglich,« stammelte der Wirt.
»Es ist so, aber dieses Papier hat er doch nicht gefunden,« fuhr Ralph fort und brachte eine Banknote aus einer verborgenen Tasche zum Vorschein.
»Er war doch nur ein dummer Dieb. Bitte, wechseln Sie mir die Fünfundzwanzig-Dollarnote.«
Des Wirtes Hände zitterten, als er den Schein nahm, er wagte nicht, ihn zurückzuweisen, untersuchte ihn jedoch und fand ihn echt.
Ralph fuhr während dieser Prüfung im Plaudern fort.
»Sie haben einen schönen Streich gemacht, Wirt. Als ich Wasser verlangte, haben Sie sich vergriffen und nur Gin in den Rum gegossen. Na, ist mir egal, Sie haben den Schaden davon, ich bezahle ihn nicht.«
Dem Wirt wurde es unheimlich. Kaum konnte er das Gold sehen, welches er aufzählte, so flimmerte es ihm vor den Augen.
»Möglich, das macht nichts,« murmelte er.
»Ja, ja, ich habe die Verwechslung wohl gemerkt,« plauderte Ralph gemütlich weiter, »Sie gaben die Wasserflasche dem Matrosen, und, dieser trank statt Gin immer Wasser, damit er nicht betrunken wurde und mich dann recht besonnen ausplündern konnte. Brrr,« Ralph schüttelte sich, »möchte um keinen Preis der Welt so viel Wasser schlucken, wie heute nachmittag der Matrose getan hat, und dabei immer heucheln, es wäre Gin.«
Ralph strich die vierundzwanzig Dollar und einige Cents ein, die ihm herausgegeben worden waren, grüßte den sich unbehaglich fühlenden Wirt freundlich und verließ mit den Herren das Lokal.
»Nun sagen Sie einmal, mein lieber Ralph,« begann Williams auf der Straße — und er sprach nur die stille Frage seiner Freunde aus — »was hat das alles eigentlich zu bedeuten? Waren Sie wirklich betrunken, sind Sie wirklich beraubt worden, und ist die Depesche nicht aufgegeben?«
Der pfiffige Ralph antwortete vorläufig noch nichts. Er erbat sich erst von einem der Herren ein Blatt Papier und einen Bleistift, von einem anderen ein Kuvert, schrieb etwas, ohne stehen zu bleiben, und warf das adressierte Schreiben in den nächsten Briefkasten, nachdem er sich aber vorher überzeugt hatte, daß er mit den Herren auf der einsamen Straße allein war.
»Betrunken war ich nicht,« sagte er dann, »meiner Mutter ältester Sohn kann ziemlich viel trinken, besonders wenn er dafür nichts zu bezahlen braucht. Beraubt bin ich allerdings worden, habe dies aber mit dem größten Vergnügen zugegeben, denn ich wollte es so. Die Depesche von Lord Harrlington sollte in die Hände derer kommen, welche sich für die Bewegungen und Handlungen der ›Amor‹-Mannschaften interessieren, aber schon ist eine andere Depesche unterwegs, von der diese neugierigen Leute keine Ahnung haben.«
In den Köpfen der Herren begann es zu dämmern. Der Detektiv hatte wieder einen seiner Streiche vom Stapel gelassen. Jetzt verstanden sie auch, was er vorher zu dem Wirt gesagt hatte.
»Was haben Sie vor? Was für eine Depesche haben Sie abgeschickt?« fragte Harrlington.
»Das werde ich Ihnen später ausführlich erzählen. Wohin gehen Sie, ins Hotel?«
»Nein, Baron Schwarzburg hat unser Gepäck bereits nach dem Hafen bringen lassen.«
»Desto besser, so bin ich reisefertig. Lassen Sie uns eilen.«
»Noch eins,« sagte Williams, während sie schnellen Schrittes dem Hafen zugingen. »Konnten Sie dem Matrosen die Depesche nicht auf eine andere Weise in die Hände spielen, als daß Sie eine Unmenge Rum trinken mußten?«
»War diese Art nicht ganz nett?« lächelte Ralph, oder, wie wir ihn jetzt nennen wollen, Nick Sharp. »Ich bekam so viel zu trinken, als ich forderte, ohne bezahlen zu müssen, statt des verlangten Wassers Gin vorgesetzt, und dann vom Wirt auch noch vierundzwanzig Dollar und zweiundzwanzig Cent geschenkt.«
»Geschenkt?« staunten die Herren.
»Allerdings, geschenkt,« versicherte der Detektiv. »Die Banknote war falsch, ich habe sie einmal jemandem abgenommen und trug sie lange mit mir herum. Vorhin nun habe ich die Polizei, deren Direktor ich kenne, benachrichtigt, daß der Wirt im Besitze einer falschen Banknote ist, noch heute abend wird sie ihm abgenommen.
Der spitzbübische Wirt mit dem bösen Gewissen darf nicht wagen, etwas gegen mich anzugeben. Uebrigens wird die Abnahme so schlau bewerkstelligt, daß er keinen Verdacht schöpft, daß ich der Angeber bin, es geschieht wie zufällig.«
Am Hafen empfing die übrige Gesellschaft die Ankommenden. Auch ein großes Boot lag schon bereit, welches alle an Bord bringen sollte.
Es war schon Nacht. Man konnte die auf der Reede liegenden Schiffe nicht mehr erkennen, man sah nur die Seitenlichter und die Toplaternen der Dampfer leuchten.
Ehe noch Hannes die vier Herren begrüßte, rief er Sharp beiseite und sprach einige Minuten mit ihm. Die übrigen stiegen inzwischen ins Boot, dann nahmen auch Hannes und Sharp darin Platz.
»Wohin wollen Sie gerudert werden?« fragte der Bootssteurer.
»Nach der ›Seeschwalbe‹,« rief der von ihm weit entfernt sitzende Hannes sehr laut.
Die Ruderer legten sich in die Riemen, und das Boot schoß in die Finsternis hinaus.
Nach zehn Minuten bekamen sie einen Schiffsrumpf in Sicht, und im Schein der Hecklaterne konnten sie den Namen ›Seeschwalbe‹ lesen.
»Wieviel hat der Kapitän für die Charterung gefordert?« fragte Harrlington Hannes.
Dieser blieb die Antwort schuldig, und der Lord vergaß die Frage, denn ohne daß der Steuermann Anweisung bekommen hatte, dirigierte er das Boot an dem Schiffe vorbei. Es fuhr noch weiter hinaus.
»Was soll das heißen?« riefen die Herren bestürzt.
»Das soll heißen,« nahm Sharp mit erhobener Stimme das Wort, »daß wir nicht mit der ›Seeschwalbe‹ fahren.«
»Was?«
»Nein. Die ›Seeschwalbe‹ hat auf meine und Baron Schwarzburgs Vermittlung Ladung nach Iquique bekommen, fährt aber unter der Flagge des ›Amor‹ ab. Der Kapitän ist von uns orientiert worden, und er geht auf unsere Pläne ein. Dagegen hat der Kapitän der ›Malaga‹ seine Reise nach New-Orleans aufgegeben, obgleich er sie hier angemeldet hat, ebenso wie die ›Seeschwalbe‹ nach Matagorda designiert worden ist. Der Kapitän der ›Malaga‹ erleidet hierdurch einen Schaden von dreitausend Pfund und fordert für die Passagiere nach Matagorda tausend Pfund; um die Verwechslung auf dem Seemannsamt fertig zu bringen, waren hundert Pfund nötig. Diese Summen sind vom Freiherrn von Schwarzburg angewiesen worden. Sind die Herren damit einverstanden?«
Die Herren waren sprachlos vor Staunen.
»So kommt die ›Seeschwalbe‹ gar nicht nach Matagorda?« fragte endlich einer.
»Nein. Diejenigen, auf deren Geheiß mir die Depesche abgenommen worden ist, werden vergeblich in Matagorda auf die ›Seeschwalbe‹ lauern, um uns einen Streich zu spielen, so daß wir von den Damen ferngehalten werden. Wir benutzen die ›Malaga‹, aber natürlich nicht unter der ›Amor‹-Flagge.«
»Und ist der Bootsbesatzung zu trauen?« flüsterte ein Herr leise.
»Ist uns vom Seemannsamt zur Verfügung gestellt, es sind verkleidete Hafenbeamte. Für Geld kann man alles erreichen, und Baron von Schwarzburg hat Geld und Zeit wirklich großartig auszunützen verstanden Ich muß ihm meine Anerkennung zollen.«
Waldblüte hatte Wort gehalten. Nach weniger als drei Minuten kehrte sie zu den beiden Mädchen zurück und brachte einen jungen Indianer mit, an dessen wunderbar blitzenden Augen Ellen schon Sonnenstrahl zu erkennen glaubte.
Selten hatten die Mädchen solch eine ebenmäßige Gestalt gesehen, wie hier im Urwalde vor sie trat, sie konnten dieselbe um so mehr bewundern, als sie von keiner überflüssigen Kleidung verhüllt wurde.
Eng schmiegte sich das weißlederne Beinkleid an, der Oberkörper war nackt, und sofort fiel die einzige Tätowierung auf der rotbraunen Brust, eine weiße Sonne, auf. Keine Zierraten schmückten ihn; er trug nicht einmal den gewöhnlichen Schmuck der Indianer, Ketten aus Glasperlen oder Raubtierkrallen, um den Hals. Sein einziger Schmuck, der durch nichts ersetzt werden konnte, lag in der harmonischen Schönheit seiner Figur, in der ruhigen, sicheren Bewegung der Glieder, in denen sich Kraft mit Anmut paarte.
Er mochte etwa siebzehn Sommer zählen, wenn auch der Arm schon die Kraft des Mannes verriet. Das stolze bronzefarbene Gesicht, das vollkommene Ebenbild seiner Schwester, mit der edlen Nase, welchem durch die blitzenden Augen Kühnheit und Männlichkeit verliehen wurden, war von keinen Runzeln durchzogen, von welchen sonst schon junge Indianer entstellt werden.
Er trug nicht wie die Schwester Sandalen, sondern Mokassins, mit Sonnen bestickt. Auch auf seinem langen, pechschwarzen Haar saß ein goldener Ring mit Federkrone, und um die schmalen Hüften schloß sich ein Ledergürtel, in dem ein Messer mit reichem Griff steckte. Sonst trug er keine Waffen bei sich.
So ungefähr mußten die ersten Indianer ausgesehen haben, welche Kolumbus erblickte, als er in Westindien landete.
Sonnenstrahl verriet durchaus keine Scheu, als er von seiner Schwester an der Hand zu den weißen Mädchen geführt wurde. Die Art, wie er sie begrüßte, zeigte an, daß er bei keinem modernen Zeremonienmeister in die Lehre gegangen war, aber der natürliche, ihm angeborene Anstand machte seine Begrüßung zu einer unnachahmbaren.
Ungezwungen streckte er den Mädchen die Hand entgegen, umschloß die ihre zart mit den Fingern, führte sie aber nicht küssend an den Mund und plapperte keine leeren Redensarten, sondern legte die andere Hand auf sein Herz und versicherte hochaufgerichtet, so, wie es einem Manne geziemt, den Damen, daß er erfreut sei, ihnen dienen zu können. Er sei ihr Freund, ihr Feind sei sein Feind, was sie freue, freue auch ihn, und ihr Leid wolle er teilen. Wie der Mund sprach, so fühlte auch sein Herz. Seine Züge konnten ebensowenig lügen, wie die seiner Schwester.
Auch er sprach sehr gut Englisch.
In Jessys Gedächtnis tauchte plötzlich ein Bild auf. Sie gedachte eines anderen Indianers und mußte Ellen dies mitteilen, wollte es aber diesem Jünglinge nicht merken lassen und bediente sich deshalb der französischen Sprache.
»Ist das nicht Unkas, der letzte Mohikaner, aus Coopers Lederstrumpf?«
Ehe Ellen ihre zustimmende Antwort geben konnte, sagte der Indianer einfach: ›Ich verstehe Französisch‹, und die Mädchen verstummten.
»Ihr seid mir willkommen,« fing Sonnenstrahl wieder an. »Ihr könnt bei uns bleiben, so lange ihr wollt. Fürchtet euch nicht, wenn euch nicht alle, die bei mir wohnen, willkommen heißen,« fügte er lächelnd hinzu.
»Einige sehen nicht gern fremde Gesichter, aber meinem Willen müssen sie sich fügen.«
Ehe die Mädchen wußten, was er vorhatte, bückte sich Sonnenstrahl zu Jessy hinab, hob sie wie ein Kind empor und setzte sie sorgsam auf seinem Arm zureckt, so daß sie in eine bequeme Lage kam.

Sie ließ alle Verlegenheit schwinden; sie umschlang mit beiden Armen den Hals des Indianers, um so die Last zu erleichtern. Er schritt voran, und Ellen und Waldblüte folgten ihm, letztere immer fröhlich lachend wie ein Kind, welches sich freut, wenn Besuch ins Haus kommt.
In der Höhlung des Baumes, in welcher Waldblüte vorhin verschwunden war, zeigte sich unten ein finsteres Loch, welches grundlos zu sein schien, weil vollkommene Dunkelheit darin herrschte. Wie ein Abgrund gähnte es den an, der hinunterblickte.
»Spring unbesorgt hinunter, es ist nicht tief!« sagte Sonnenstrahl. »Sonst kannst du dich auch an Wurzeln hinablassen.«
Ohne weiteres sprang er selbst mit Jessy im Arm hinunter; das Mädchen konnte einen leisen Schrei nicht unterdrücken, denn es ist ein entsetzliches Gefühl, in ein finsteres Loch zu springen, von dem man nicht weiß, wie tief es ist. Merkwürdig ist dabei, wie lange die Sekunde dauert, während welcher man in der Luft schwebt.
Auch Ellen zögerte, dem Beispiele Sonnenstrahls zu folgen, denn zwei Meter war das Loch sicher tief, der Kopf des Indianers war nicht mehr zu sehen. Derselbe mochte zwei Meter nicht tief finden, für sie war dies schon ein ganz beträchtlicher Sprung.
Waldblüte kam ihr zu Hilfe. Sie zeigte ihr, wie sie sich an den Wurzeln festhalten sollte, führte ihre Hand selbst immer an die hervorragenden Holzstücke und geleitete sie so sicher bis an den Boden.
Zwei Meter war das Loch allerdings tief; von oben schimmerte das in dem hohlen Baume an sich schon schwache Licht kaum herein, und so konnte Ellen nicht sehen, ob oder von wo ein Gang abzweigte. Aber es mußte natürlich einer existieren, denn Sonnenstrahl war mit Jessy bereits verschwunden.
Im nächsten Augenblicke war Waldblüte neben Ellen.
»Gib mir deine Hand und folge mir« sagte sie. »Du kannst aufrecht gehen und ruhig auftreten, der Gang ist hoch und breit, und der Boden vollkommen eben; kein Hindernis hemmt deinen Fuß.«
Sorglos ließ sich Ellen von Waldblüte führen, obgleich ihr Auge nicht einmal die Umrisse der Indianerin erkennen konnte, solche Finsternis herrschte in dem Gange. Wohl war der Boden eben und glatt, als wäre er gepflastert, aber Ellen merkte, daß er sich senkte. Man kam also immer tiefer in die Erde hinein.
Von Sonnenstrahl und Jessy war nichts mehr zu sehen, sie mußten schon weit voraus sein.
»Wer hat diesen Gang gebaut?« flüsterte Ellen.
»Die Priester der alten Azteken,« entgegnete Waldblüte, »Es gibt noch mehr, alle führen aus dem Tempel des Huitzilopochtli unter der Erde fort und münden im Walde an versteckten Plätzen, in hohlen Bäumen, in kaum zugänglichen Büschen, in Felsen, oder ihr Zugang ist auch mit Rasenerde bedeckt. Einige von ihnen sind verschüttet, einige noch sehr gut erhalten. Du kannst übrigens laut sprechen, wir haben niemanden zu scheuen.«
»Einige sind zusammengestürzt?«
»Nein, sie sind wahrscheinlich absichtlich verschüttet worden. Die Gänge sind sehr gut gebaut, das Gewölbe ist bei allen ausgemauert, und die Decke ruht auf Pfeilern. Du kannst sie jetzt nicht sehen, bleibst du aber länger bei uns, was wir hoffen, so will ich dir alles zeigen, es gibt hier viel zu sehen.«
Ellen nahm sich vor, ihren Rettern bei der ersten Gelegenheit ihr Schicksal zu erzählen. Aber es mußte bald geschehen, denn durch sie konnten vielleicht die anderen Freundinnen befreit werden. Ellen wünschte nur, die Fischer kämen noch nach dieser Ruine.
Jetzt erinnerte sie sich auch der Worte Frankos, daß es in derselben nicht recht geheuer sei. Leicht also konnten die abergläubischen Fischer in Furcht gesetzt und in die Flucht gejagt werden.
Fast eine Viertelstunde gingen die beiden Mädchen.
Der Gang schien kein Ende zu nehmen, als Waldblüte plötzlich stehen blieb.
»Wir sind am Ziele,« sagte sie. »Warte hier, bis ich wiederkomme! Deine Freundin befindet sich auch hier.«
»Wo?« wollte schon Ellen fragen, da aber wurde es plötzlich hell in dem Gange, und sie erblickte Jessy auf einem Lager von Binsenmatten liegen.
Waldblüte hatte einen schweren Vorhang zurückgeschlagen und ließ Ellen in das Gemach eintreten, welches durch diesen von dem Gange getrennt wurde.
Es war ein kleines Zimmer, welches von Mauern aus Steinquadern eingefaßt war und von dem durch eine kleine Oeffnung hochoben hereinfallenden Licht spärlich erleuchtet wurde. Wahrscheinlich lag das Fenster zu ebener Erde, was Ellen schon daraus schloß, daß sie immer abwärtsgestiegen war. Das Zimmer erschien besonders deshalb so klein, weil die Decke ungeheuer hoch war, man konnte kaum das Gefüge der Sandsteinblöcke erkennen.
Außer der Tür des Ganges befanden sich noch zwei Oeffnungen in den Wanden, beide durch schwere, kostbare Teppiche mit fremdartigen Stickereien verhängt. Dieselben stellten Bilder dar, wie man sie an den Gräbern der alten Azteken vorfindet; also stammten sie noch aus jener Zeit, da die Ureinwohner von Mexiko ihre kunstvollen Webereien fertigten.
Das Gemach enthielt nichts weiter als Binsenmatten, sonst war es völlig leer.
Waldblüte lockte erst das Reh und Juno zu sich herein und blieb dann lauschend stehen, selbst der Rabe auf ihrer Schulter verhielt sich regungslos und neigte den Kopf zur Seite, als bemühe er sich, das Gespräch zu verstehen, welches durch einen der Vorhänge drang.
Einmal hörte man eine hohe, oft überschnappende Fistelstimme sprechen, die einem Weibe anzugehören schien, dann die volle, melodische Stimme Sonnenstrahls. Jener fragte, und er antwortete, aber er schien, so ruhig er auch sprach, sehr energisch auf seinem Rechte zu beharren.
»Arahuaskar ist böse, daß wir euch hergeführt haben,« sagte Waldblüte, »er will, wir sollen euch sofort zurückbringen, aber Sonnenstrahl sagt, dann ginge auch er. Mein Bruder will die kranke Freundin nicht eher verlassen, als bis sie wieder gehen kann. Laßt den Alten nur schimpfen, daran sind wir schon gewöhnt. Wir tun doch, was wir wollen, und schließlich muß der Alte immer klein beigeben.«
Es lag etwas Aengstliches und zugleich Geringschätzendes in den Worten der Indianerin, und unwillkürlich mußte Ellen über die Worte und den Ausdruck im Gesicht derselben lächeln. Gerade so hatte sie gesprochen, und so hatte sie ausgesehen, wenn sie vor langer Zeit, als junges Mädchen von vierzehn Jahren, von jemandem gesucht wurde, um sie zur Unterrichtsstunde bei ihrem Lehrer oder der Gouvernante zu holen. Fand der Bote sie dann auf der Prärie bei den Rinderherden, so hatte sie fast ebensolche Worte zu dem Cowboy gesprochen, der ihr seine Heldentaten erzählen mußte.
»Laß die Gouvernante nur schimpfen,« hatte sie immer geringschätzend gesagt, »ich komme, wenn es mir paßt.«
Aber sie kam doch immer sofort, um die geliebte Mutter nicht zu erzürnen, und war sie zu lange fort gewesen, hatte sie die Stunde versäumt, so nahte sie sich dem elterlichen Hause mit Herzklopfen, aber mit einem gleichgültigen Gesicht, als wäre sie über Lob und Tadel erhaben.
Die Fistelstimme des Alten wurde immer leiser und war weniger oft zu hören, der volle Ton Sonnenstrahls dagegen öfters.
»Jetzt gibt Arahnaskar nach,« nickte Waldblüte lächelnd. »Sonnenstrahl hat seinen Willen durchgesetzt. Der Alte will euch sehen, er hat noch nicht die Neugierde überwunden, obgleich er sich immer so stellt. Da, jetzt befiehlt mein Bruder einem Indianer, daß er Essen für euch besorgt.«
»Es wird auch die höchste Zeit,« seufzte Ellen, deren Hunger sich bei diesen Worten wieder fühlbar machte.
Die Unterredung war in einer den Mädchen fremden Sprache geführt worden. Obgleich Ellen mehrere indianische Dialekte beherrschte, weil sie in der Nähe des Indianers-Territoriums — Louisiana grenzt an dieses — aufgezogen war, aber diesen Dialekt verstand sie nicht. Es mußte eine alte, ausgestorbene Sprache sein, schloß sie aus dem Klange der Worte.
Da wurde der Vorhang zurückgeschlagen, und eine Gestalt trat, von Sonnenstrahl gestützt, herein, bei deren Anblick selbst Jessy erschrocken zurückfahren wollte, hätte ihr Fuß sie nicht daran gehindert. Man glaubte nicht anders, als eine Mumie, die balsamierte Leiche eines vor Tausenden von Jahren verstorbenen Menschen, sei plötzlich wieder lebendig geworden. Der Körper, nur mit dem notdürftigsten Gewand bedeckt, bestand bloß aus Knochen und einer schmutzigschwarzen, pergamentartigen Haut, welche von Fett erglänzte. Dieses verbreitete sofort einen scharfen, unangenehmen Geruch im Zimmer, den die Mädchen schon vorher schwach wahrgenommen hatten.
Der Kopf war ein vollkommener Totenschädel; die Nase war fast nicht mehr vorhanden; nur ein Stumpf saß mitten im Gesicht; die Augen sahen aus wie leere Löcher, in deren Hintergrunde feurige Kohlen lagen. Jeder Knochen trat weit heraus, und nur die Zähne waren nicht nur vollkommen erhalten, sondern waren sogar noch von einer prachtvollen Beschaffenheit. Der Kopf ähnelte um so mehr einem Totenschädel, als auch kein einziges Haar sich mehr darauf befand, und nichts hatte der Alte getan, um alle diese Häßlichkeit zu verdecken oder zu mildern.
Der eine Knochenarm lag auf des jungen Indianers Schultern, die Spinnenfinger der anderen Hand hielten einen knorrigen Stock mit sonderbaren, eingeschnitzten Figuren, auf den sich der Alte stützte.
Unbeweglich stand der greise Indianer da, die Mädchen scharf ansehend, ohne den Mund zu öffnen.
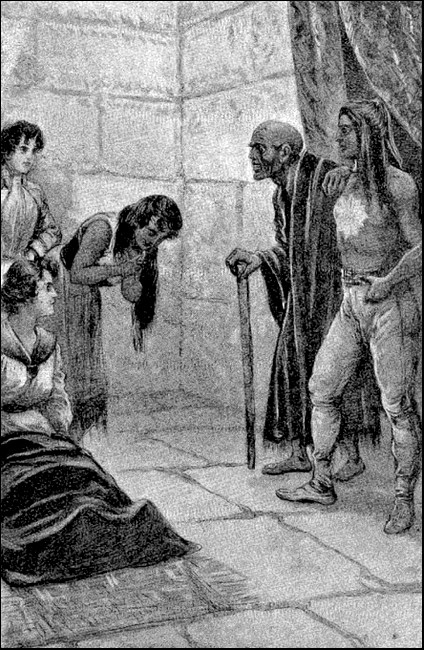
Unbeweglich stand der greise Indianer da.
Es war ein wunderliches Bild, welches diese beiden darstellten, der häßliche Greis und der blühende Jüngling, nie hatten die Mädchen solchen Kontrast gesehen. Es waren Allegorien der Jugend und des Alters, des Lebens und des Todes, der Schönheit und der Häßlichkeit. Waldblüte war zurückgetreten, kreuzte die Arme über der Brust und verbeugte sich tief vor dem Alten. Diese Bezeigung von Ehrfurcht war um so auffälliger, als sie vorhin so wenig ehrfurchtsvoll von ihm gesprochen hatte.
Langsam wandte Arahuaskar den Kopf nach der Indianerin, öffnete den Mund mit den prachtvollen Zähnen und sagte einige kurze Worte, worauf Waldblüte untertänig, aber fest antwortete, und verließ dann das Gemach ebenso langsam wieder, wie er gekommen war.
»Das war Arahuaskar,« sagte Waldblüte, als der Vorhang wieder gefallen war, »und nun seid Ihr aufgenommen. Geduldet Euch eine Minute, Ihr bekommt sofort Essen!«
Ein Indianer trat ein, schon hofften die Mädchen, endlich würde der Tisch gedeckt, aber er brachte nur eine Art Rauchgefäß herein, dem Dampf entstieg, und das er an einer Schnur durch die Luft schwang.
Ein angenehmer, süßlicher Duft erfüllte das Zimmer.
»Wozu das?« fragte Ellen.
»Arahuaskar reibt sich mit Schlangenfett ein, das erhält die Glieder geschmeidig,« war die Antwort. »Seine Diener müssen ihm Schlangen fangen, die der alte Vater selbst auskocht, aber das Fett riecht übel, und wohin Arahuaskar geht, immer folgt ihm ein Diener mit dem Ranchgefäß. Ich glaube, weil er innerlich kein Fett hat, reibt er sich wenigstens äußerlich die Haut damit ein.«
Also innerhalb dieser Mauern gab es auch Humor.
Ellen hatte noch Zeit, einige Fragen zu stellen, ehe das langersehnte Essen erschien.
»Arahuaskar hat Diener?«
»Ja, einige Indianer.«
»Wohnen diese auch hier?«
»Gewiß, wir haben viel Platz.«
»Und woher bekommt ihr die Nahrungsmittel? Müssen die Indianer jagen?«
»Nein, die umwohnenden Indianer wissen, daß in der Ruine jemand lebt. Wer, darüber sind die Meinungen verschieden. Die einen sagen, es wäre ein alter Azteke, der die Indianer wieder zu ihrer alten Macht führen will — und diese haben recht. Andere glauben, ein Geist wohne hier, die Indianer müßten ihn bedienen, und sie geben ihnen willig alles, was diese verlangen. Uns gebricht es nie an irgend etwas, wir haben stets Nahrungsmittel in Ueberfluß.«
»Ist Arahuaskar wirklich ein Azteke?«
»Ich glaube, er sagt so,« entgegnete Waldblüte ausweichend.
»Und wer ist der alte Vater?«
»Ein weißer Mann, auch sehr alt, wenn auch nicht so alt wie Arahuaskar. Er ist sehr klug.«
»Wie kam er hierher?«
»Ich weiß nicht. Er war hier, so lange Sonnenstrahl und ich uns erinnern können. Er lehrte uns fremde Sprachen, von ihm haben wir auch Englisch gelernt und noch viel mehr. Doch ich darf nicht darüber sprechen, es ist mir von Arahuaskar streng verboten worden.«
»Wie heißt er eigentlich?«
»Wir nennen ihn nur den alten Vater, einen anderen Namen haben wir nie gehört.«
»Wo ist er jetzt?«
»In seinem Turmzimmer. Dieses liegt hoch in einem halb zusammengefallenen Hause. Das Gemach ist ganz mit Büchern und Instrumenten vollgepfropft, durch die er nach den Sternen sieht.«
Ellen und Jessy sahen sich fragend an.
»Ist er ein Astronom?« fragte Jessy.
»Jedenfalls ein Gelehrter, der sich hierher zurückgezogen hat,« meinte Ellen.
»Der alte Vater kriecht fast Tag und Nacht in dem Gemäuer herum,« fuhr Waldblüte fort. »Er sammelt alles, was er finden kann, alte Schriften, Götter, Figuren, Schmucksachen und so weiter. Dann setzt er sich vor sie hin und starrt sie lange an, blättert in Büchern und schreibt.«
»Er ist ein Altertumsforscher,« dachten die Mädchen.
Das Gespräch fand eine willkommene Unterbrechung. Ein Indianer brachte auf alten, sonderbar aussehenden Steinschalen Speisen herein, setzte sie zwischen den beiden Mädchen hin, und diese warfen sich mit Heißhunger über die Maiskuchen, das gebratene und gekochte Rindfleisch und Wild her. Noch nie, glaubten sie, habe ihnen eine Mahlzeit so gut geschmeckt, wie hier im Tempel des Huitzilopochtli und von denselben Schüsseln, von denen einst die Azteken gespeist hatten.
Auch Juno wollte sich durchaus als Gast in die Gesellschaft der Mädchen eindrängen, doch ein Blick und eine Handbewegung der Indianerin genügten, um das Tier zurückzuscheuchen. Ein weiterer Wink mit der Hand, und Juno folgte mit gesenktem Kopf dem hinausgehenden Indianer. Das Raubtier mußte dem Blicke dieses Mädchens gehorchen.
»Ein Tier, welches Fleisch ißt, darf die Schüsseln der Azteken nicht berühren, sonst müssen wir sie fortwerfen,« sagte Waldblüte, setzte sich dann zu den Mädchen und bediente sie mit der größten Liebenswürdigkeit.
Ellen war nicht sehr in der Geschichte der alten Azteken bewandert, aber so viel wurde ihr aus den Worten der Indianerin klar, daß Waldblüte und wahrscheinlich auch Sonnenstrahl in der alten heidnischen Religion der Azteken erzogen worden waren.
Besonders, daß sie von einem Tiere nie fressen, sondern essen sagte, bestätigte dies, denn ebenso wie die Inder, glaubten die Azteken an Seelenwanderung, das heißt, sie glaubten, die Seele des gestorbenen Menschen ginge in ein Tier über, und daher wurden die Tiere gut behandelt, ja, man gab ihren Verrichtungen auch keine anderen Namen als den von Menschen ausgeführten. Ebensowenig sagt der Inder von einem Tiere, es frißt, säuft, krepiert und so weiter, eher gebraucht er derartige Ausdrücke bei einem verächtlichen Menschen.
Mochte Waldblüte auch eine Heidin sein, mochte sie in der barbarischen, Blut fordernden Religion der Azteken — den mexikanischen Göttern wurden Menschen geopfert — erzogen worden sein, sie besaß ein gutes Herz. Lächelnd saß sie zwischen den Mädchen, freute sich, wenn es ihren Gästen schmeckte, und ließ nicht nach, sie fort und fort zum Zulangen zu nötigen.
Als der Hunger gestillt war und Waldblütes Bitte, mehr zu essen, nicht nachgekommen werden konnte, klatschte sie in die Hände, und sofort trat Sonnenstrahl ein.
Er hatte die Mädchen durch seine Gegenwart nicht stören wollen, mußte aber draußen auf dieses Zeichen, näherzutreten, gewartet haben.
Waldblüte und ihr Bruder besprachen sich in ihrer Sprache, dann hob Sonnenstrahl Jessy wieder auf den Arm und verließ das Gemach, von den beiden Mädchen gefolgt.
Ellen durchschritt mehrere, ebenso wie das erste eingerichtete Gemächer, die gleichfalls von oben durch eine Oeffnung Licht erhielten, bis sie in ein größeres Zimmer traten, in welchem aus Binsenmatten und Decken zwei Lagerstätten errichtet waren. Man sah, daß dieselben soeben erst bereitet worden waren.
Sanft ließ Sonnenstrahl die Kranke auf das Bett gleiten und entfernte sich mit einer graziösen Neigung des Kopfes.
»Der alte Vater wird kommen und der Fuß in wenigen Wochen heilen,« sagte er im Hinausgehen.
»Dies ist Euer Zimmer,« wandte sich Waldblüte an die beiden Mädchen, »ich werde Euch Gesellschaft leisten, wenn Ihr mich wünscht. Klatscht einmal in die Hände, so komme ich, klatscht zweimal, und ein Indianer wird erscheinen, dem Ihr Eure Wünsche sagen könnt.«
»Bleibe immer bei uns,« rief Ellen und ergriff die Hand des Mädchens. »Setze dich neben mich und höre an, was ich dir schnell erzählen will, und dann sage uns, ob es dir möglich ist, zu helfen. Kannst du und Sonnenstrahl es nicht, so bleibt Jessy hier, ich aber muß sofort wieder von hier gehen.«
Nun erzählte Ellen so kurz wie möglich, wie sie in diesen Urwald kämen, wie sie von räuberischen Fischern fortgeschleppt worden wären, ihre Flucht, und wie sie glaubten, die neun Freundinnen sollten hier zwischen den Mauern der Ruine getötet werden.
Waldblüte hatte aufmerksam zugehört, ihr Gesicht nahm eine immer besorgtere Miene an, und kaum konnte sie den Schluß von Ellens Erzählung erwarten.
»Warum hast du mir das nicht eher gesagt?« rief sie dann. »Ich will es schnell Sonnenstrahl erzählen, er und andere Indianer müssen den Wald durchstreifen und sehen, wo die bösen Männer mit deinen Freundinnen geblieben sind, und ob sie hierherkommen wollen.«
»Aber er darf sich nicht sehen lassen,« rief Ellen der schon Hinauseilenden nach.
»Kannst du den Sonnenstrahl sehen oder greifen?« lächelte Waldblüte zurück. »Du kannst ihn nur fühlen oder seine Wirkung spüren, aber nicht ihn selbst sehen oder hören.«
Den beiden Mädchen fiel eine Zentnerlast vom Herzen. Auch Jessy bekam jetzt dasselbe Gefühl, von dem schon vorher Ellen gesprochen hatte, daß sie nämlich fest an die Rettung ihrer Freundinnen glaubte.
Wieder wurde der Vorhang zurückgeschlagen, und wieder trat eine alte, gebückte Gestalt herein. Diesmal war es aber kein Indianer, sondern ein Weißer, wie er auch gleich einem solchen gekleidet war.
Er mochte wohl achtzig Jahre zählen. Lange, weiße Locken umrahmten das milde Antlitz, auf dessen Stirn sich tiefe Falten hinzogen. Sorgen oder auch angestrengtes Nachdenken mochten sie eingegraben haben, denn der tiefe Blick der blauen Augen war der eines Denkers.

Der alte Vater.
Ein langer Mantel aus blauem Stoff umhüllte die gebeugte Gestalt. Auf den Locken saß ein breitrandiger Filzhut, und um den Leib hatte der Greis einen aus Leder geflochtenen Gurt geschlungen, wodurch er fast das Aussehen eines Priesters oder eines Eremiten erhielt.
Die schmalen, blutleeren Lippen hielt er fest geschlossen, als er auf die Mädchen zuschritt. Er öffnete sie weder zum Gruß noch zu einer Frage, so daß er einen finsteren oder doch sehr ernsten Ausdruck bekam, der ganz im Widerspruch zu den milden, freundlichen Augen stand.
Als sich beim Gehen der Fuß zeigte, sah man deutlich, daß auch er Sandalen trug, wodurch er noch mehr den Eindruck eines Mönches machte.
Stumm schritt er also auf Jessy zu, ließ aus dem weiten Aermel des Ueberwurfs ein Paket auf den Boden fallen und löste dann den Verband des kranken Fußes. Zarte, weiße Hände, die nie schwere Arbeit getan hatten, kamen dabei zum Vorschein.
Bald trat ein Indianer ein, der in einem Becken heißes Wasser und eine Büchse brachte.
Der alte Vater badete den verletzten Fuß, rieb ihn mit einer wohlriechenden Salbe ein und legte die Schienen wieder an. Er benahm sich dabei mit einer solchen Geschicklichkeit, daß die Mädchen vermuteten, er sei ein Arzt.
Bis jetzt war das Schweigen von keiner Seite unterbrochen worden, als der Arzt aber die Büchse dem Indianer zurückgab und Miene machte, das Zimmer zu verlassen, nachdem er eine Schachtel mit Salbe neben Jessys Lager gestellt hatte, konnte Ellen eine Frage nicht mehr zurückhalten.
»Ist der Bruch gefährlich?«
Langsam wandte der Greis den schönen Kopf nach Ellen hin, es sah fast aus, als merkte er jetzt überhaupt zum ersten Male die Anwesenheit noch eines Mädchens. Seine Lippen öffneten sich, doch gleich lagen sie wieder fest übereinander.
»Quien sabe?« murmelte er.
»Wie lange wird es dauern, bis meine Freundin wieder zum Gehen fähig ist?«
»Bis der Fuß geheilt ist,« erklang es abermals in dumpfem Murmeln, und mehr war aus dem Alten nicht herauszubringen, er raffte das Paket auf und verließ das Zimmer, ohne die Mädchen noch eines Blickes zu würdigen.
»Ein seltsamer Kauz,« sagte Ellen, als sie wieder allein waren, »er scheint in diesen Mauern das Sprechen verlernt zu haben.«
»Aber er versteht einen gebrochenen Fuß zu heilen,« entgegnete Jessy. »Die Salbe besitzt eine wunderbare Wirkung, ich fühle nicht den leisesten Schmerz mehr, selbst die Spannung hat nachgelassen.«
»Das ist die Hauptsache; mag er ein alter Brummbär sein, wenn er Ihnen nur helfen kann. Aber ich möchte doch wissen, wer er ist, warum er sich hier aufhält, und welche Rolle er hier spielt! Ich interessiere mich für solche Sonderlinge.«
»Er wird ein Altertumsforscher sein.«
»Aber er hat auch Sonnenstrahl und Waldblüte erzogen. Sollte er nicht den Plänen des alten Arahuaskar, das Reich der Azteken einst wiederaufzurichten, nahestehen? Waldblüte scheint deren Religion anzugehören, und es ist doch nicht anzunehmen, daß der alte Vater auch an Götter glaubt. Ueberhaupt muß er ein gebildeter Mann sein, er spricht viele Sprachen, scheint die aztekische Religion zu studieren und versteht Arzneikunde, also muß er doch wissen, daß die Hoffnungen Arahuaskars Luftschlösser sind, deren Zusammenbrechen jedes Schulkind einsehen kann.«
Doch der rätselhafte, alte Mann mit seinem ernsten Schweigen und dem freundlichen Blick war bald vergessen. Die Gedanken der beiden Mädchen beschäftigten sich mit anderen Sachen.
Weder Sonnenstrahl noch Waldblüte hatten sich wieder sehen lassen, und es war seit ihrem Fortgang fast schon eine Stunde verstrichen. Es mußte Nachmittag sein.
Da plötzlich sprang Waldblüte herein. Die Mädchen fuhren auf, die Indianerin mußte eine gute Nachricht bringen, denn ihr Antlitz leuchtete.
»Sie kommen,« rief sie plötzlich, »es sind zwölf Männer, einer davon ist gebunden, und ebenso die neun Mädchen. Das also sind eure Freundinnen! Die armen Geschöpfe, sie sehen so niedergeschlagen aus und konnten kaum noch gehen, ich habe sie ganz deutlich gesehen, als Sonnenstrahl mir sagte, sie kämen auf die Ruine zu.«
»Können wir sie sehen?« fragte Ellen, die ihre Ungeduld kaum bemeistern konnte.
»Gewiß; auch du, Jessy, sollst an einen Ort gebracht werden, von dem aus du deine Freundinnen beobachten kannst. Seid nur unbesorgt, sie sollen noch heute abend wohlbehalten bei euch sein.«
Da trat Sonnenstrahl mit einigen Indianern herein, und auch er verkündete, daß die Erwarteten schon in der Nähe der Ruine seien. Er wäre ihnen durch einen unterirdischen Gang vorausgeeilt, bald müßten sie hier eintreffen.
Auf seinen Wink faßten vier Indianer das Bett, auf welchem Jessy lag und trugen sie hinaus. Er, Waldblüte und Ellen, gingen voran.
Aus einem Gemach traten sie in einen langen, schier endlosen Gang. Von beiden Seiten zweigten sich Gemächer ab.
»Wozu wurden diese früher benutzt?« fragte Ellen.
»Hier wurden die aztekischen Häuptlinge und deren Familienmitglieder beigesetzt,« erklärte Waldblüte. »Arahuaskar hat einige Zimmer bestimmt, welche nicht geöffnet werden dürfen. In diesen liegen Mumien, und der alte Vater hält sich oft bei ihnen auf. Die übrigen Gemächer hat Arahuaskar ausräumen und die Mumien verbrennen lassen.«
Jetzt erst bemerkte Ellen die alten Steinbilder an den Wänden und auch die halb verblichene, einst bunt gewesene Malerei. War der alte Vater wirklich ein Gelehrter, der sich mit der Geschichte der alten Mexikaner beschäftigte, so fand er hier reichen Stoff für seine Studien.
Der Gang mündete an einer steinernen, terrassenförmigen, sehr breiten, aber schon halbzerfallenen Treppe. Der Weg hinauf war sehr beschwerlich, die Stufen lagen nicht mehr geordnet. Besonders das Tragen des Krankenbettes mußte vorsichtig geschehen.
Während dieses Aufstieges fiel Ellen eine andere Besorgnis ein.
»Die Männer sind alle bewaffnet,« sagte sie. »Habt Ihr auch die Mittel, ihnen erfolgreich gegenübertreten zu können? Ohne Waffen können wir nichts gegen sie ausrichten.«
Waldblüte wollte eben etwas erwidern, als Ellens Frage auf andere Weise beantwortet wurde.
Die Terrasse machte eine Biegung, und kaum betrat Sonnenstrahl die geräumige Plattform, als zwei mächtige, graue Bären, die furchtbarsten Raubtiere Amerikas, aus einem Winkel herausgestürzt kamen und Sonnenstrahl und dessen Schwester vor Freude bald erdrücken wollten.
Die Ruinen des Tempels des Huitzilopochtli glichen einer zusammengefallenen Stadt. Fast eine Quadratmeile war von ihnen bedeckt, und überall erstreckten sich noch Mauern und vorgeschobene Nebenabteilungen, Magazine des alten Tempels, in den Wald hinaus.
Der eigentliche Tempel des alten, mexikanischen Kriegsgottes bestand aus einer großen Halle. Doch die Wände waren eingestürzt und lagen zerschmettert am Boden; nur die großen Altäre waren verschont geblieben, auf denen so manchmal Menschenblut geraucht hatte. Auch die terrassenförmigen Gebäude, welche sich rings um den Tempel erhoben, sahen von weitem gut erhalten aus, aber in der Nähe erkannte man, daß ein Aufstieg nur schwer möglich war, ohne Leitern und Stricke gar nicht, denn die meterhohen Stufen hatten sich verschoben, sie lagen oft übereinander, ohne dem Fuß einen Halt zu gewähren, und hingen manchmal in einer gefährlichen Schwebe. Nur dem Gesamteindruck nach war diese Terrasse gut erhalten.
Sie war früher wohl zu dem gleichen Zwecke benutzt worden, wie bei den alten Griechen und Römern die Terrassen im Theater oder Zirkus, die uns in Olympia und auch in Rom erhalten geblieben sind. Auch hier saßen wahrscheinlich die Zuschauer auf den Stufen und wohnten den Menschenschlächtereien bei, durch welche die Götter gnädig gestimmt werden sollten.
Schon lange, ehe man den eigentlichen Tempel erblicken konnte, stieß man auf dessen Vorläufer, auf eingefallene Mauern und Häuser, und die Männer, welche die neun gefangenen Mädchen durch den Wald führten, blieben beim ersten Anblick einer eingestürzten Mauer erschrocken stehen.
»Wir kommen an den Tempel der Mexikaner,« flüsterte einer der Fischer mit erschrockenem Gesicht, und derselbe Schrecken spiegelte sich auch auf den Mienen der übrigen wieder.
Nur Frankos und Chalmers behielten ihren Gleichmut.
»Nun ja, was schadet das?« fragte Frankos.
»Es ist nicht geheuer hier; wir wollen einen Umweg machen, damit wir ihnen nicht zu nahe kommen.«
»Bah, Unsinn,« sagte Frankos ärgerlich, »ich habe sogar die Absicht, die Ruine zu betreten.«
»Auf keinen Fall,« riefen die Fischer entsetzt, »wir wollen uns nicht den Hals umdrehen lassen.«
Frankos, wie auch Chalmers versuchten alles mögliche, um den Männern die Geisterfurcht auszutreiben; dieselben glaubten nun einmal an Gespenster und wollten sich nicht bereden lassen, das Gemäuer zu betreten, in dem es von Spukgestalten wimmeln sollte.
Aber Frankos wußte noch ein anderes Mittel.
»Gut,« sagte er, »ihr wollt nicht in die Ruinen, ihr Hasenfüße, und ich will, daß die Weiber eben dort getötet werden. Da wir uns nicht einigen können, so befreie ich die Gefangenen und lasse sie laufen. Ich will mich schon vor ihnen hüten; ich habe weder Weib noch Kind, fliehe ich von hier, so bin ich sicher. Ihr dagegen habt Familien, und denen wird es schlecht gehen, wenn ihr erst im Zuchthaus sitzt.«
Er zog das Messer und machte Miene, die Banden der Gefangenen zu durchschneiden, wurde aber von den Fischern daran gehindert.
»Laßt sie uns hier töten,« sagte einer.
Mit Frankos' Geduld war es nun jedoch vorbei; er wurde furchtbar wild und drohte, jeden niederzuschießen, der nicht mit ihm ging und nur ein Wort des Ungehorsams sagte, und da seine Brutalität bekannt war, so wagten die Fischer nicht zu widersprechen — an diesem unheimlichen Orte gleich gar nicht. Ihr sonst so kecker Mut war dahin, es bedurfte nur einer energisch auftretenden Person, und sie folgten ihr unbedingt. Um keinen Preis der Welt wollten sie wieder zurückkehren, ohne dem Tode der Mädchen beigewohnt zu haben. Schon hier Hand an sie legen durften sie nicht, Frankos hätte jeden niedergeschlagen, und auch Chalmers stand mit seinem Revolver schußbereit neben jenem, und schon der Gedanke, ohne einen furchtlosen Mann neben dieser schrecklichen Ruine stehen zu bleiben, brachte die Haare der Feiglinge zum Sträuben.
Mit klopfenden Herzen und besorgten Gesichtern, bei jedem Geräusch zusammenzuckend, nahmen sie die Mädchen wieder in ihre Mitte und folgten Frankos, der mit finsterer Miene vorausschritt, während Chalmers kaum ein spöttisches Lächeln unterdrücken konnte.
Die Mädchen gingen also ihren letzten Gang, dort in den Mauern, wo schon so viele Menschen hingeschlachtet worden waren, sollte auch ihr Blut fließen. Aber nicht Mexitli oder Huitzilopochtli hießen die Götter, welche ihr Blut forderten; deren Herrschaft war vorüber, sie waren nicht ewige Götter gewesen. Dämon Gold hieß der Götze, auf dessen Altar die Mädchen geschlachtet werden sollten, der allmächtige, böse Geist, der entstanden ist, als zum ersten Male in der Menschenbrust die Sucht nach Gewinn auftauchte, und der bestehen wird, so lange die Erde sich nicht aus den Fugen löst, trotz aller Religion, Philosophie und allem Streben nach Veredlung des Menschengeschlechts.
Warum hatte aber Chalmers so hartnäckig darauf bestanden, daß die Gefangenen erst in der Ruine ihren Tod fanden? Er war auf ihre Rettung bedacht, darüber glaubten sich die Mädchen völlig klar zu sein, sie hatten schon genug Beweise dafür. Aber wie wollte er sein Vorhaben ausführen, und warum gerade in der Ruine? Rechnete er vielleicht mit der Gespensterfurcht der abergläubischen Fischer? Das wäre die einzige Beantwortung dieser Frage gewesen.
Und sollte Chalmers ihnen auch nicht helfen können, dann hofften die Mädchen doch noch auf Ellen. Vielleicht war es ihr geglückt, dem Verfolger zu entkommen, der nicht zurückgekommen war, und Frankos hatte nicht auf ihn gewartet. Er hoffte, der Fischer hätte Ellen getötet und wäre schon wieder auf dem Wege nach seiner Hütte, die Mädchen dagegen hofften das Gegenteil, und daß Ellen sich schon auf ihrer Spur und zu ihrer Rettung unterwegs befände.
Die unglückliche Jessy! Sie war die erste der Vestalinnen, welche ihren Tod gefunden hatte, Ihr Körper ruhte jetzt auf dem Grunde eines Flusses, und wo würden wohl ihre eigenen verscharrt werden? Ach, Raubtiere würden sich um die Leichen streiten, wie die Jessys von Fischen benagt wurde, und die Skalpe der anderen elf Mädchen jetzt jedenfalls schon an den Gürteln der Apachen hingen.
Und dieses Schicksal mußte ihrer im Heimatlande warten, nachdem sie aus so vielen Gefahren glücklich hervorgegangen waren!
Aber nur Mut! Noch lebten sie, Chalmers war ihr Freund und Ellen hoffentlich in der Nähe.
Immer öfter stießen die Wanderer auf Trümmerhaufen, zusammengestürzte Mauern und gut erhaltene Häuser, in denen Spinnen, Fledermäuse, Käuzchen und Schlangen ein lichtscheues Dasein führten, während in den zerbrochenen Simsen Vögel nisteten. Fuhr ein Käuzchen, durch den Tritt der vielen Menschen aufgeschreckt, aus dem Versteck empor und kreischte auf, so schlugen die Fischer ein Kreuz und schauten auf ihren Führer. Beides gab ihnen frischen Mut, das Kreuz durch seine unsichtbare Macht und Frankos durch sein keckes Auftreten.
Die Sonne sandte schon schräge Strahlen vom Firmament, als Frankos sein Ziel erreicht hatte und hielt. Sie befanden sich mitten im Tempel, der ringsum von Terrassen umgeben war, durch deren einzelne Teile nur drei schmale Gänge führten.
Frankos ordnete, obgleich er sich ganz sicher fühlte, an, daß jeder Gang von einem seiner Leute bewacht würde. Indianer waren nicht zu fürchten, sie scheuten diesen Ort, wohl aber hätte sich ein Weißer hierher verirren oder auch ein Gelehrter oder Reisender die Ruine besuchen können, was öfters vorkam.
Die übrigen Fischer, Frankos und Chalmers umdrängten die Gefangenen, welche angesichts des Götzenaltars ihren Tod erwarteten. Die Hoffnung auf Rettung schwand immer mehr.
»Ich denke, wir machen es kurz,« sagte Frankos, »und jagen jeder eine Kugel durch den Kopf, und fertig sind wir.«
Die Mädchen schauderten bei diesen Worten zusammen.
»Und die Leichen?« fragte Chalmers.
Frankos musterte den Himmel. In dem blauen Aether schwebten dunkle Punkte.
»Die Aasgeier werden dafür sorgen, daß nicht viel davon übrig bleibt,« meinte er. »Wir können sie ja auch in eins der Löcher werfen, deren es genug gibt. Findet man dort ihre Knochen, so denken die Herren mit der Brille auf der Nase, die Knochen gehörten einst mexikanischen Weibern, hahaha!«
Mit Entsetzen sahen die Mädchen, wie schon einige der Fischer ihre Pistolen aus dem Gürtel zogen und Zündhütchen aufs Piston setzten.
Doch noch einmal wurde ihr Tod verzögert.
»Sie durch Schüsse zu töten, ist nicht gut, es könnten dadurch in der Nähe herumschweifende Trapper angelockt werden,« sagte Chalmers.
»Das ist wahr! Aber sollen wir sie mit den Händen erwürgen? Dazu fehlt mir wenigstens die Uebung,« lachte Frankos, »aber Pueblo, dieser Schurke hier, muß etwas länger zappeln.«
»Was habe ich dir getan, daß du mich so hassest?« rief dieser schmerzlich aus.
»Aus der Heimat hast du mich gejagt, Schuft! Die Leute meines Dorfes haben mit Fingern auf mich gewiesen, aber ich habe es nicht vergessen, daß du die Ursache gewesen bist. Rache will ich jetzt an dir nehmen, furchtbare Rache.«
Der sonst phlegmatische Frankos hatte diese Worte mit leidenschaftlicher Glut ausgerufen und dabei Pueblo einen Fußtritt gegeben.
Der Mißhandelte schwieg. Was hatte ihm auch eine Verteidigung genützt oder die Behauptung, daß er damals nur recht gehandelt habe? Frankos war mit Inez versprochen gewesen. Die Verlobung ging jedoch auseinander, als Pueblo, der mit Frankos bei einem Fischer diente, seinen Kameraden als einen Dieb an seinem Herrn bezeichnete und er auch als solcher befunden wurde. Mit Schimpf und Schande wurde Frankos aus dem Dorfe gejagt, Inez aber gab die freigewordene Hand dein Retter ihrer Ehre.
»Weißt du, was ich mit dir mache?« fuhr der schrecklich erregte Frankos fort. »Dort in das Loch werfe ich dich und lasse den Eingang mit Steinen zuschütten, und wenn du vor Hunger in deine eigenen Arme beißest, dann sollst du dich an mich erinnern.«
Frankos deutete dabei auf ein großes, offenes Grab, welches seitlich in den Felsen gehauen war. Gerade über dem Zugange lag ein Stück eines mächtigen Altars so auf einem Steinhaufen, daß man nur einige Steine hätte vorziehen brauchen, und der Block wäre gerade vor den Eingang gerollt, ihn verschließend.
Das Grab glich einer geräumigen Kammer, es hätten viele Särge darin Platz gehabt.
»Erst sollen die Mädchen dran!« rief ein Fischer, unwillig über die Verzögerung. »Schießt sie tot, oder hängt sie auf, dann könnt ihr mit Pueblo tun, was ihr wollt!«
»Ich habe einen anderen Vorschlag,« sagte Chalmers, »das Grab dort hat genügend Platz, um alle Gefangenen aufzunehmen, steckt sie hinein, nehmt einige Steine hinweg, der Block kommt ins Rollen und legt sich quer vor den Eingang. Kein Spalt bleibt offen, sie sind vollständig begraben.«
»Das ist ein Gedanke,« stimmte Frankos erfreut bei, »und sollten die Gerippe einmal gefunden werden, und die Mädchen an ihren Kleidungen erkannt werden, so glaubt man, die bösen Geister haben sie hier verschüttet, als sie nach Schätzen suchten. Mancher ist schon so verunglückt, der alte Schutt kommt leicht ins Rollen.«
»Können sie sich nicht selbst befreien?« meinte einer der Fischer vorsichtig. »Die Mädchen sind kräftig, und zwölf Personen könnten den Block schon fortrollen.«
»Aber nicht, wenn wir eine tüchtige Portion Steine vorlegen und außerdem einige Keile unterschlagen,« lachte Chalmers. »Dieser Plan ist der beste. Befolgt ihn!«
»Das wollen wir tun,« sagte Frankos. »Frisch, Jungens, greift an! Marsch, fort mit euch!« fuhr er die Gefangenen an. »Zetert nicht lange, es hilft doch nichts!«

Die Mädchen schrien auch nicht, als sie mit roher Gewalt fortgestoßen wurden, dem Grabe zu, nur eine stürzte auf Chalmers zu und sank vor ihm zu Buden.
Es war Miß Chalmers, die Cousine desselben.
»Georg,« schrie das unglückliche Mädchen im höchsten Schmerz, »sei du wenigstens barmherzig! Gib nicht zu, daß wir eines so schrecklichen Todes sterben müssen! Rette uns, Georg! Sei barmherzig, es wird dir vergolten werden!«
Doch Chalmers zuckte mit den Achseln und wandte sich weg. Sein Gesicht ward noch weißer, als zuvor, seine Hände zitterten, und seine Augen blitzten plötzlich in seltsamem, finsteren Schimmer.
»Nein!« schrie er dann und stieß das Mädchen von sich. »Zur Hölle mit euch, verdammte Brut! Ich bedaure nur, daß ich euer Schmerzgeheul nicht vernehmen kann, wenn der Hunger euch zur Verzweiflung treibt.«
»So ist's recht,« lachte Frankos roh. »Nur kein Mitleid mit diesen Geschöpfen, sie würden auch keins mit uns haben. Gebt es ihnen nur immer tüchtig.«
So hart das Mädchen auch zurückgestoßen ward, es rutschte noch einmal auf den Knien zu dem Manne und suchte das steinerne Herz zu rühren.
»Georg, bei den Gebeinen unseres Großvaters, von dem wir beide abstammen, habe Mitleid mit uns! Ist uns der Tod beschieden, dann laß ihn nicht grausam sein. Du hast einen Revolver. Nimm ihn und schieße mir und meinen Freundinnen eine Kugel ins Herz! Dann sind wir tot, aber laß uns nicht Hungers sterben, dies ist ein zu entsetzlicher Tod.«
Vergebens! Chalmers blieb unerbittlich. Wieder faßte er das Mädchen an der Hand und schleuderte es weit von sich auf die Granitplatte, und so, wie Miß Chalmers fiel, blieb sie liegen, nicht weil sie unfähig war, aufzustehen, oder weil die Verzweiflung sie übermannte, etwas ganz anderes war es, was sie so in Bestürzung versetzte, daß sie das Aufstehen vergaß.
Als Chalmers sie an der Hand faßte, hatte er nicht hart zugepackt, sie hatte einen leisen Druck verspürt
Was war das? Sollte sie doch noch Hoffnung haben? Wollte Chalmers ihnen doch beistehen, und heuchelte er nur diese Grausamkeit?
Sie erhob sich und wankte zu ihren Gefährtinnen, aber ein Hoffnungsstrahl leuchtete in ihrem Herzen auf. Gar zu gern hätte sie den Freundinnen ihre Vermutung mitgeteilt, aber sie wagte es nicht, da die Pläne ihres Verwandten dadurch gestört werden könnten.
»Hallo, nun fort in die Grube!« schrie Frankos, dem diese Szene schon zu lange gedauert hatte, und mit Schlägen, Schimpfworten und lautem Gebrüll wurden die Gefangenen von den Fischern nach dem Felsengrab getrieben.
Sie wehrten sich nur schwach, es hätte ihnen doch nichts genützt, die Männer kannten keine Schonung gegen die Mädchen. Aber zuletzt, da sie in die Höhlung gestoßen wurden, sträubten sie sich doch energisch. Es half ihnen aber nichts, so sehr sie sich auch dagegen stemmten. Bald waren alle lebendig im Grabe eingeschlossen.
Schon standen einige Fischer auf dem Schutthaufen an dem Block und zogen die darunterliegenden Steine fort, die steinerne Masse bewegte sich und kam dann langsam ins Rollen.
Je näher sie der Oeffnung kam, desto mehr mußten die Fischer die Gefangenen zurückdrängen, denn einige hofften, der schwere Block würde sie erreichen, wenn sie sich gerade an der Felswand befänden. Lieber zerquetscht werden, als des Hungertodes sterben.
Die Höhle führte nicht gerade in die Felswand hinein, sondern war kellerartig angelegt, so daß man eine einen Meter tiefe Stufe hinabsteigen mußte, ehe man den Boden erreichte, und der Eingang selbst war einen Meter hoch. Dadurch wurde es den Mädchen nicht so leicht, schnell herauszukommen, sie konnten ohne Mühe von den Fischern zurückgehalten werden, und im letzten Augenblick, als der Steinkoloß fast die Wand berührte, sprangen doch alle unwillkürlich zurück. Es ist sehr schwer, dem langsam ankommenden Tode ins Auge zu sehen und ihm nicht auszuweichen.
Donnernd schlug die Säule an die Wand, und die Gefangenen waren lebendig begraben.
Aber die Hand Gottes offenbarte sich auf eine furchtbare Weise, sie lenkte den rollenden Stein.
»Zurück!« rief Frankos einem Fischer zu, der zuletzt eine Gefangene in das Loch stieß, als der Stein zum Stillstand kommen mußte.
Doch die Warnung kam zu spät.
Wohl machte der Mann einen Seitensprung, aber auch der Block bekam durch einen Sprung über ein Hindernis eine etwas andere Richtung. Ein grausenerregendes Gebrüll, ein Krachen, und des Fischers Arm ward zwischen Block und Wand zu Brei zerquetscht.
Mit schreckensbleichen Gesichtern sahen die Fischer auf ihren unglücklichen Kameraden, der bewußtlos zusammengebrochen war. Sie sprangen hinzu und wollten ihn freimachen, aber das war natürlich eine vergebliche Mühe. Sie mußten entweder den Block zurückrollen oder den Arm abschneiden.
Frankos hatte schnell einen Entschluß gefaßt.
»Laßt ihn hängen!« rief er. »Der Körper hält keine zwölf Stunden. Geht er in Verwesung über, fällt er von selbst ab.«
Aber selbst die rohen Fischer waren über diese Grausamkeit entrüstet.
»Nimmermehr,« rief einer im Tone des höchsten Zornes, »auch Eurer Rücksichtslosigkeit können Schranken gesetzt werden. Merkt Euch das, Frankos.«
Mit einem Fluche wandte dieser sich ab und ließ die Leute gewähren, welche sich um den Unglücklichen zu schaffen machten, ohne ihm im geringsten helfen zu können. Während ihn zwei hielten, versuchten die übrigen, den Block zurückzurollen. Es gelang ihnen aber nicht, weil sie sich nicht zu gleicher Zeit anstrengten. Dann holten sie Wasser und gossen es dem Bewußtlosen über den Kopf, als könnten sie derart seine Lage erleichtern. Andere stemmten sich wieder gegen den Stein, der sich nicht einmal bewegte — kurz, sie betrugen sich ganz sinnlos. Jeder handelte für sich.
Die drei Posten an den Gängen hatten ihren Platz verlassen und kamen herbeigeeilt. Sie erschraken erst, jammerten und unterstützten dann die Gefährten in ihrer vergeblichen Arbeit.
Chalmers und Frankos beteiligten sich nicht daran, sie schauten diesem Treiben zu.
»Holla, was geht hier vor?« rief da plötzlich hinter ihnen eine tiefe Stimme.
Bis zu Tode erschrocken ließen alle die Arme sinken, wandten sich um und sahen zwei riesige Gestalten, wie Waldläufer gekleidet, und einen Indianer mit einem Hund vor sich stehen.
Alle drei mußten verwundet sein, denn sie trugen blutige Verbände. Der eine hatte eine Binde um den Kopf, der andere hatte den linken Arm in einer Schlinge, und des Indianers Hemd war auf der Brust mit Blut gefärbt. Selbst der Hund zeigte einen tiefen Riß auf dem Rücken.
Da erblickten die Ankömmlinge den Verunglückten, und selbst sie konnten bei der gräßlichen Szene einen Ruf des Entsetzens nicht unterdrücken. Sie waren wohl abgehärtet, aber ihr Herz war nicht verhärtet.
»Was für Unsinn treibt Ihr da?« rief der größte der beiden Riesen, es war Deadly Dash, als die Fischer mit ihren Wiederbelebungsversuchen fortfuhren. »Hier, den Stein angefaßt die Schultern dagegengestemmt und dann zu gleicher Zeit geschoben. Schnell, Leute, in zwei Minuten muß der Mann frei sein.«
Die Fischer hatten nur eines Leiters bedurft. Willig schwangen sie sich auf den Block, traten in die Vertiefung und machten sich bereit, die Bemühungen von neuem zu beginnen.
Auch Deadly Dash, Charly und Stahlherz wollten helfen. Sie warfen schnell die Büchsen weg und machten schon Miene, ebenfalls auf den Block zu steigen und ihre Kräfte mit denen der übrigen zu vereinen, wurden aber von Frankos daran gehindert.

Deadly Dash.
Ohne weiteres ergriff er den einen Waldläufer am Gürtel und zog ihn von dem glatten Block, an der man sich nirgends festhalten konnte, herunter.
»Mischt Euch nicht in unsere Angelegenheiten!« rief er dabei in grobem Tone, »Ueberlaßt es uns, den Genossen zu befreien, und Ihr dürft meinetwegen Wild schießen, ich kümmere mich auch nicht um Eure Sachen.«
Aber bei Charly kam er an den Unrechten.
»Was wagt Ihr, Mann?« brauste er auf und ballte die Faust des gesunden Armes. »Bei Gottes Tod, ich schlage Euch zu Boden, daß Ihr das Aufstehen vergeht, wenn Ihr mir noch einmal Vorschriften macht! Ich bin ein freier Mann und kann tun und lassen, was ich will. Diesmal werde ich Eure Tat noch Eurer Dummheit zugute rechnen.«
Wieder erstieg er den Block, und Frankos wagte nicht zum zweiten Male, den herkulischen Waldläufer daran zu hindern. Deadly Dash und Stahlherz saßen bereits oben und warteten auf ihren Gefährten.
Frankos glaubte vor Angst vergehen zu müssen.
Wenn der Block auch nur so weit weggerollt wurde, daß man durch den Spalt in das Innere der Höhle sehen konnte, so waren die Mädchen entdeckt, und die verbrecherische Handlung der Fischer war verraten.
Und diese dummen Leute wollten selbst dazu helfen, ihren Mordanschlag ans Licht zu bringen.
Frankos' Gesichtsausdruck war durch die Angst auffallend geworden, daß auch die übrigen Fischer dies bemerkten, und plötzlich fiel allen fast zu gleicher Zeit ein, welchen dummen Streich sie sich selbst spielen wollten.
Einer nach dem anderen gab seine Absicht auf. Jeder verließ die Vertiefung und rutschte von dem Blocke herab. Mochte der Verunglückte hängen bleiben und so sterben, sein Tod trat sowieso bald ein. Vor allen Dingen bangte ihnen jetzt um ihr eigenes Leben.
»Was? Ihr wollt nicht helfen?« schrie Charly zornig. »Was soll das bedeuten? Herauf mit euch und Hand angelegt, oder ich werde euch wie Sklaven dazu zwingen, ihr elenden, faulen Gesellen!«
Aber keiner machte Miene, dieser Aufforderung nachzukommen. Sie umdrängten Frankos und blickten trotzig die auf dem Blocke sitzenden Männer an.
Chalmers hielt sich etwas abseits, mit gesenktem Kopf und geballten Fäusten stand er da, die Augen rollten in seinem Kopfe, und ein nervöses Zittern ging durch seine Glieder. Sein Benehmen war rätselhaft.
Da trat Deadly Dash vor.
Langsam zog er seinen Revolver aus dem Futteral, entsicherte ihn und sagte, den Arm mit der Waffe erhebend, ganz ruhig:
»Ich zahle bis drei. Wer dann nicht Anstalten trifft, auf den Block zu steigen und uns zu helfen, den behandle ich wie einen Wolf, welcher sich nicht um seine Genossen kümmert.«
Im Nu hatte auch Charly den Revolver zur Hand, und Stahlherz duckte sich zum Sprunge zusammen.
»Eins!« zählte der Waldläufer.
Eine unheimliche Stille war unter den Fischern eingetreten, sie wagten kaum zu atmen.
»Zwei!«
»Zum Teufel, Mann!« brüllte Frankos und sprang vor. »Der Stein ist viel zu schwer, als daß wir ihn fortwälzen könnten. Wir haben es schon unzählige Male versucht. Aber so ist die Sache viel einfacher und dem Krüppel ist geholfen.«
Frankos war zu dem Eingequetschten hingesprungen, sein Messer funkelte in der Hand, und ehe jemand wußte, was er vorhatte, fuhr der Stahl einige Male über den zermalmten Arm und der Körper fiel mit dem blutenden Stumpf schwer zu Boden.
»Scheusal!« schrie Charly und gab seiner Entrüstung über diese maßlose Roheit noch in anderer Weise Ausdruck.
Mit einem Satze war er von dem Blocke herab, und im nächsten Augenblick empfing Frankos einen Schlag ins Gesicht, daß er blutüberströmt zu Boden stürzte und sich noch einige Male überschlug. Das Blut quoll ihm aus Nase und Mund.
Trotzdem atmeten die Fischer erleichtert auf. Jetzt war ein Verrat nicht mehr zu befürchten, und ihrem Anführer gönnten sie diese Züchtigung, die er für alle auf sich genommen hatte. Derselbe stand auf, wischte sich das Blut aus dem Gesicht, wagte aber nicht, den schlagfertigen Waldläufer zur Rechenschaft zu ziehen. Auch er war froh, daß die Sache erledigt war, von einer Rache wollte er diesmal absehen oder sie wenigstens verschieben. »Nun macht, daß ihr fortkommt, ihr rohes, erbarmungsloses Volk,« rief der in Zorn gebrachte Charly, »oder ich hetze den Hund auf euch und mache euch Beine!«
Die Fischer ließen sich das nicht zweimal sagen, schon wandten sie sich zum Gehen, während sich Charly mit dem Sterbenden beschäftigte, der nicht mehr zum Bewußtsein kam, als Deadly Dash von der Säule heruntersprang und den Fortgehenden in den Weg treten wollte.
Doch noch ehe er seine Absicht, die Fischer aufzuhalten, ausführen konnte, geschah noch etwas anderes Unerwartetes, was dem Ganzen eine andere Wendung gab.
Plötzlich sprang der bis jetzt unbeachtet gebliebene Chalmers mit ausgestreckten Armen vor, seine Brust arbeitete heftig, und sein Gesicht war dunkelrot geworden.
»Laßt sie nicht fort!« schrie er. »Haltet sie zurück, sie müssen erst den Block wegwälzen! Es sind Mörder, sie haben Unschuldige lebendig begraben!«
»Lügner, verdammter!« brüllte Frankos, riß die Pistole aus dem Gürtel und schlug auf den Sprecher an. Aber schnell wie der Blitz war Deadly Dash bei ihm und traf den Arm des Schuftes, daß der Schuß schadlos in die Luft ging.
Im nächsten Augenblick lag Frankos wehrlos zu den Füßen des Waldläufers. Die eiserne Hand, die ihn niederdrückte, preßte ihm ein Jammergeheul aus, und Charly und Stahlherz standen bereit, jedem weiteren Mordanschlag zuvorzukommen.
»Was sagtet Ihr?« fragte Deadly Dash den furchtbar aufgeregten Mann in der eleganten Kleidung der nicht zu diesen Fischern gehörte.
»Zwingt sie, den Block zurückzurollen!« wiederholte dieser mit heiserer Stimme. »Sie haben zehn Menschen, neun Weiber und einen Mann in dem Grabe eingeschlossen, damit sie darin verhungern sollen.«
Deadly Dash ließ den Fischer los und wandte sich ganz Chalmers zu.
»Weiber,« rief er überrascht, »und neun? Schnell, Mann, wie sehen sie aus! So sprecht doch! Hatten sie vielleicht Männerkleidung an?«
»Ja,« sagte Chalmers leise.
»Faßt an, ihr Schurken!« schrie Charly wieder und trat mit dem Revolver an die Fischer heran. »In fünf Minuten muß das Loch offen liegen, oder wir schlagen euch, bis das Fleisch mürbe wird. So ist's recht, Fremder!«
Die letzten Worte galten Chalmers, welcher ebenfalls seinen Revolver gezogen hatte und mit geisterbleicher, aber furchtbar entschlossener Miene zu Frankos getreten war, der ihn entsetzt anstarrte.
So war dieser Mensch nur mitgekommen, um die Mädchen zu retten? Er benutzte diese Gelegenheit, um seine Genossen zu verraten?
Frankos konnte nicht darüber nachdenken. Sehr handgreiflich wurde ihm und seinen Genossen klar gemacht, was sie zu tun hatten. Selbst der sonst gelassene Deadly Dash war sehr erregt. Alles ging ihm zu langsam, und seine Worte, sowie seine schwere Hand trieben die Fischer zur Eile an.
Willenlos mußten sie gehorchen. Man hatte ihnen ihre Waffen gelassen, aber die waren diesen Männern gegenüber, die im Kampf mit den Indianern groß geworden, nur Kinderspielzeug. Alle stemmten sich gegen den Block, auf das Kommando des Waldläufers schoben sie gleichzeitig, dieser griff mit an, und der schwere Stein kam ins Rollen.
Weiter und weiter wurde die Spalte, schon glaubten die Fischer die Gestalten in einer dunklen Höhle in eine Ecke gekauert sitzen zu sehen. Manchmal schloß sich die Spalte wieder, weil der Block zurückrollte, aber immer wieder wurden die Fischer zu neuen Anstrengungen angetrieben, sie mußten ihre eigene Schandtat an's Tageslicht bringen.
Da endlich, ein Ruck, eine letzte Anstrengung, der Block rollte einige Meter weg, und die Oeffnung war frei.
Da taumelte Chalmers, wie vom Schlage getroffen, zurück, die Fischer dachten, vor Schreck in die Erde versinken zu müssen, und die Waldläufer ließen den Blick bald in die Oeffnung, bald fragend zu Chalmers hinübergleiten — das Grabgewölbe war leer.
Der erste, der sich von diesem verschiedenartig gesteigerten Erstaunen erholte, war Deadly Dash.
»Ich vermute, Fremder, daß Ihr mich nicht betrogen habt,« sagte er zu Chalmers, »sonst wäret Ihr und die Fischer über die leere Höhle nicht so erschrocken. Wißt Ihr, wo die Frauen geblieben sind? Sprecht schnell!«
»Ich weiß nicht,« stammelte Chalmers. »Ihr Verschwinden ist mir rätselhaft.«
Das Gewölbe wurde vom Tageslicht vollkommen erleuchtet, aber man sah keinen zweiten Ausgang. Ringsum wurde es von Steinmauern eingeschlossen.
Deadly Dash und Charly stiegen in das Grab und untersuchten die Mauern, während Stahlherz und Lizzard die Fischer bewachten, welche jetzt als Gefangene betrachtet wurden. Auch Chalmers' stand schußbereit da, aber die angsterfüllten Verbrecher dachten an keinen Fluchtversuch.
Es war merkwürdig, auf wie verschiedene Weise die beiden scharfsichtigen Waldläufer die Wände untersuchten.
Charly stemmte sich hier und da mit seinen riesigen Schultern dagegen, als wolle er sie zur Seite drücken, klopfte mit dem Messergriff an die Steine und betrachtete jede kleine Stelle aufmerksam, um eine Fuge zu entdecken.
Ganz anders ging Deadly Dash vor.
Er schob weder noch klopfte er. Er begnügte sich allein damit, die Hand langsam tastend über die Steinquadern gleiten zu lassen. Zoll für Zoll untersuchte er auf diese Weise. Die Finger glitten prüfend an den rauhen Wänden herum und kehrten oft auf ein und denselben Block zurück. Plötzlich leuchtete sein Auge auf. Die Hand blieb lange auf einer Stelle liegen, und die Fingerspitzen fühlten prüfend an einem kleinen Gegenstand herum.
Er wandte den Kopf nach Charly und sah, wie dieser in einer Ecke abermals die Schultern gegen die Wand stemmte.
»Laßt es gut sein, Charly!« sagte er jetzt gelassen. »Geht hinaus und laßt den Ruf erschallen. Die Unsrigen werden sich wundern, daß wir sie so lange warten lassen.«
Charly hatte in den wenigen Tagen, während welcher er mit Deadly Dash durch den Wald marschiert und von den Apachen bald dahin, bald dorthin gejagt worden war einen gewaltigen Respekt vor demselben bekommen. Anfangs wurde er unwillig, als Deadly Dash sofort die Führung des Zuges ergriff, dann aber mußte er zugeben, daß der Waldläufer ihm in jeder Weise überlegen war. Hatte doch schon der Pferderaub genügend gezeigt, daß derselbe es an Schlauheit und Behendigkeit mit jedem Indianer aufnahm.
Während der zweitägigen Verfolgung durch die Apachen hatte Deadly Dash Erstaunliches geleistet. Alle Trapper und Waldläufer, die sonst niemandem gehorchten, folgten ihm jetzt aufs Wort.
So ließ auch Charly sofort in seinen anstrengenden Bemühungen nach und begab sich aus dem Gewölbe ins Freie, Deadly Dash allein zurücklassend.
Draußen wurden die Fischer noch immer von Stahlherz und Chalmers scharf bewacht. Jede Bewegung war ihnen bei Todesstrafe verboten, und auch Lizzard ließ bei dem geringsten Zucken einer Hand ein drohendes Knurren vernehmen.
Die Fischer fügten sich vorläufig in ihr Schicksal. Eine Flucht war jetzt noch nicht möglich.
Der heraustretende Charly legte die Hände trichterförmig an den Mund und stieß den scharfen, mißtönenden Ruf des Geiers aus, wenn er Beute wittert, dreimal hintereinander, und gleich darauf ertönte in weiter Entfernung dasselbe Signal.
»Also ihr seid es, welche die Apachen auf die Mädchen gehetzt haben,« sagte Charly zu den Fischern. Er wußte aus den Erzählungen ihrer Schützlinge genug davon. »Der Spaß soll euch teuer zu stehen kommen. Das Blut, welches unschuldig geflossen ist, will ich doppelt und dreifach aus euch herauszapfen. Ihr seid nichts anderes wert.«
Der Waldläufer schien im Ernst zu sprechen. Auch in der Wildnis gibt es Gerechtigkeit. Da heißt es noch: Blut um Blut, Auge um Auge, Zahn um Zahn, und zwar nicht nur bildlich, sondern die Vergeltung wird in Wirklichkeit und auf der Stelle ausgeführt. Mag der Mann der Wildnis auch nicht grausam sein; mit dem Gerechtigkeitsgefühl erstickt er jede milde Regung. Seiner eigenen Sicherheit wegen muß er ein strenger Richter sein.
Durch einen der Hohlwege bewegte sich ein langer Zug von Menschen. Zwischen ihnen wurden einige Bahren getragen, auf denen Gestalten lagen, und wieder erfaßte die Fischer namenloses Entsetzen, als sie unter den Herankommenden eben die Mädchen erkannten, welche sie vorher eingeschlossen hatten.
Doch nein. Bald erkannten sie ihren Irrtum. Es waren andere Mädchen in Männerkleidung, der Rest der ›Vesta‹-Besatzung. So hatte der weiße Wolf also auch keinen besseren Erfolg gehabt als sie, seine Opfer waren ihm entgangen.
Aber es war ihnen doch übel mitgespielt worden.
Die Apachen hatten ihre Büchsen und Pfeile nicht immer vergeblich abgeschossen. Drei von den Mädchen mußten getragen werden, so schlimm waren sie verwundet worden, und Verbände trugen auch alle anderen. Auch zwei Männer lagen auf Bahren, und der eine, ein Fallensteller, war so zugerichtet, daß er nie wieder den Gebrauch seines Beines erlangen konnte — der Schenkelknochen war zerschmettert. Das Bein mußte abgenommen werden, hatte Deadly Dash erklärt, sonst wäre der Tod unvermeidlich. Aber der Mann, wie auch seine Genossen waren dagegen, er wollte lieber sterben, als mit einem Beine untätig in der Hütte liegen müssen.
Was war ihm das Leben noch, wenn er nicht mehr durch den grünen Wald schweifen konnte!
Der Zug näherte sich der Stelle, wo die Fischer gefangen gehalten wurden. Charly lief ihm entgegen und erzählte schnell, was sich hier unterdes zugetragen hatte, daß ihre Freundinnen gefunden seien, hier sein müßten, aber einen geheimen Ausgang aus der Höhle benutzt hätten. Jedenfalls seien sie in Sicherheit, und Deadly Dash suche bereits nach dem Schlüssel zu dem Geheimnis, er, Charly, kalkuliere, er würde ihn bald gefunden haben.
Dann schloß Charly mit einigen zornigen Flüchen auf die Fischer, sie sollten ihren Lohn sofort bekommen.
»Wer ist der Mann dort? Es ist kein Fischer,« sagte ein auf einer Bahre liegendes, bleiches Mädchen. Es war Miß Thomson, welche einen Schuß durch die Schulter bekommen hatte, und von Blutverlust so erschöpft war, daß sie nicht mehr gehen konnte.
Betty deutete dabei auf Chalmers, der die Fischer ganz vergessen und nur Augen für die Ankommenden hatte, während Stahlherz unverwandt die Gefangenen beobachtete.
»Das ist der Mann, dem wir es zu danken haben, daß wir von der Anwesenheit der Mädchen hier erfuhren,« entgegnete Charly. »Er hat die Fischer bei ihrer verbrecherischen Handlung wahrscheinlich beobachtet und sie an uns verraten, so daß wir Eure Freundinnen befreien wollten. Wie ich Euch erzählte, waren sie aber schon weg. Nun, wir werden sie wohl noch wiederfinden, aus der Welt können sie nicht sein. Er ist ein braver Kerl, der gibt es den Fischern ordentlich, wenn sie nur mucksen.«
Betty betrachtete den Gelobten aufmerksam, die Entfernung war noch zu groß, um ihn ordentlich erkennen zu können, kaum aber war sie nahe genug herangekommen, als sie laut aufschrie:
»Chalmers, der Straßenprediger! Fangt ihn Leute, er ist einer von denen, denen wir alles Unglück verdanken. Er spielt eine doppelte Rolle, laßt ihn nicht entkommen.«
Die Trapper brauchten keine lange Erklärung, sie hatten den Sinn dieser Worte sofort erfaßt; es war oft genug über den Schurken gesprochen worden. Auch die anderen Mädchen hatten ihn erkannt, sie stürzten auf Chalmers zu, welcher wirklich eine Bewegung machte, als wolle er entfliehen. Er drehte sich aber nur um, um seine Bestürzung zu verbergen; doch noch vor den Mädchen erreichten ihn die schnellfüßigen Männer.
Im Nu war er umringt, und Joker, der Cowboy, schnürte ihm mit einem Lasso die Arme zusammen.
Diesen Augenblick der Verwirrung hatte Frankos zur Flucht benutzen wollen; aber wenn auch Stahlherz nicht aufgepaßt hätte, Lizzard war doch gleich hinter ihm her, sprang ihn an und warf ihn zu Boden.
Ohne ein Wort zu sprechen, löste Stahlherz einige Lederschnuren von dem Gürtel ab und band Frankos an Händen und Füßen. Die Fischer wußten jetzt, was ihr Schicksal war, wenn auch sie Neigung zur Flucht zeigten.
Stahlherz hob den Gebundenen auf und trug ihn zu der Gruppe der Fischer zurück.
Charly war an Chalmers herangetreten.
»So bist du also auch ein Spitzbube?« sagte er in drohendem Tone. »Sprich, kannst du dich gegen die Anklage verteidigen, welche diese Damen gegen dich erheben?«
Mit glanzlosen Augen schaute Chalmers die Verwundete an. Er fand nicht gleich eine Antwort. Er sah sich erkannt, verraten. Diese Mädchen wußten, daß er in New York Straßenprediger gewesen war, und auch, daß er zu denen gehörte, welche in den Besitz der Reichtümer der Vestalinnen zu kommen suchten und selbst den Mord nicht gescheut hatten.
»Bin ich es nicht gewesen, der Euch gesagt hat, daß die Gefangenen hier sind?« sagte er leise.
»Nichts da,« rief aber Frankos, der jetzt alle Hoffnung auf die eigene Rettung schwinden ließ, aber wenigstens den Verräter nicht entkommen lassen wollte. »Gerade er hat uns vorgeschlagen, die Mädchen einzumauern. Er hauptsächlich wollte, daß die Mädchen sobald wie möglich sterben sollten; er wollte sie schon immer unterwegs erschießen, und nur aus Angst, daß unsere Tat doch von den beiden Waldläufern entdeckt werden könne, hat er uns verraten. Er will sich weißwaschen, aber traut ihm nicht, er ist ein größerer Spitzbube als wir alle zusammen, und seine Freunde, die er Kirkholm und Spurgeon nennt, gleichen ihm.«
Die Trapper glaubten diese teils wahren, teils erlogenen Worte um so mehr, als die Damen ihnen bestätigten, daß Chalmers mit zu einer Bande von Verbrechern gehörte. Miß Thomson hatte es ja aus Spurgeons und Kirkholms Munde mit eigenen Ohren gehört, daß Chalmers mit ihnen zusammen operierte.
Aber derselbe war von jeher ein raffinierter schauspielerhafter Schwindler gewesen. Wer jahrelang ganz New York durch seine Predigten in Aufregung setzen konnte, wer von seinen Anhängern fast für einen Heiligen gehalten wurde und doch dabei das unmoralischste, gottloseste Leben führte, ohne daß es ihm anzusehen oder anzumerken war, wer also so ungeheuer lügen konnte, wie leicht war es einem solchen Menschen, sich im letzten Augenblick unschuldig zu stellen und sich als Retter in der Not aufzuspielen, wenn es sein eigenes Leben zu schützen galt!
»Hängt ihn!« rief Joker. »Hängt alle zusammen auf, aber gleich!« ertönte es im Chor der Trapper nach.
»Wo ist Deadly Dash?«
Er war nicht unter dem Trupp, aber auch nicht im Gewölbe zu sehen.
»Er ist weitergegangen, um von einer anderen Seite den Ausgang des Grabes zu suchen,« meinte Charly.
»Never mind,« rief Joker, »wir brauchen ihn nicht beim Hängen. Dieser Waldläufer hat überhaupt mancherlei seltsame Ansichten, die nicht für Leute unseres Schlags passen. Hängt sie auf, sage ich, möglichst hoch und an dicken Stricken!«
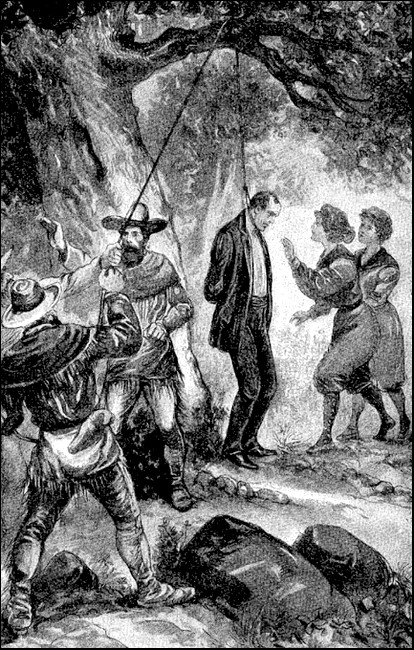
»Zieht auf!« rief Charly.
Die Trapper brauchten nicht einmal dazu aufgefordert zu werden, ihr Entschluß stand schon fest. Die letzten Kämpfe mit den Indianern hatten ihr Blut heiß gemacht. Sie haßten alles, was ihnen feindlich war, und jemanden aufzuhängen, war ihnen jetzt ein Vergnügen.
»Kennst du den Richter Lynch, heh?« schrie Joker Chalmers an. »Komm, mein Püppchen, sollst ihn kennen lernen; er hat schon lange auf dich gewartet.«
Das Lynchen ist eine Art von Volksjustiz, welche in Nordamerika da angewendet wird, wo wegen ungenügender, zu langsamer oder bestechlicher Polizei Verbrechen nicht geahndet werden. Die eigenmächtigen Richter verhängen über den auf frischer Tat Ertappten körperliche Züchtigungen oder selbst den Tod, aber auch grausame Ausschreitungen kommen vor, so zum Beispiel das »Federn«. Der Delinquent wird auf dem bloßen Leib mit Teer beschmiert, in Federn gewälzt und dann laufen gelassen; im schlimmsten Falle jagt man ihn dann noch wie ein Wild mit Hunden. Die Lynchjustiz ist in einigen, wenig zivilisierten Gegenden Amerikas sehr angebracht, denn der Arm der Gerechtigkeit reicht nicht bis dorthin, und Pferdediebe, Straßenräuber, Mädchenschänder und so weiter würden sich bald ins Ungeheuerliche vermehren, wenn das Volk nicht selbst sofortige Gerechtigkeit ausübte. Der Name kommt von John Lynch, der gegen Ende des 17. Jahrhunderts zum ersten Male auf solche Weise Leute bestrafte, welche entlaufene Sklaven versteckten.
Joker warf den schmächtigen Mann über seine breite Schulter und eilte dorthin, wo einige Bäume standen, ein Zeichen, vor welch langer Zeit dieser Tempel schon zerstört worden sein mußte.
Die übrigen machten es ebenso mit den Fischern und fanden nur wenig Widerstand. Im Nu waren die Männer gebunden und wurden dem vorausgeeilten Joker nachgetrieben oder, wenn sie nicht gehen wollten, einfach hingetragen. Mit Schlagen hielt man sich nicht auf.
Nur Stahlherz blieb nach wie vor ruhig neben der Graböffnung hocken und blickte gedankenvoll vor sich hin.
Ehe die Mädchen den Männern folgten, um der Exekution beizuwohnen, traten sie auf Stahlherz zu und fragten ihn, ob er wüßte, wo die Mädchen geblieben seien.
»Deadly Dash sucht sie,« war die kurze Antwort.
»Wo ist Dein Freund?«
»Stahlherz weiß es nicht.«
»Hat er das Gewölbe verlassen?«
»Nein, niemand ist herausgekommen. Wenn er nicht mehr in der Höhle ist, so ist er eben da, wo auch die weißen Mädchen sind. Er wird wiederkommen und sie bringen.«
Stahlherz sprach diese Worte mit einer solchen Ueberzeugung aus, daß die Mädchen nicht zweifelten. Sie untersuchten selbst einmal flüchtig das Gewölbe, ohne aber die Spur eines zweiten Ausganges entdecken zu können.
Eine unaussprechliche Freude erfüllte ihr Herz, daß sie hier die Freundinnen wiedertreffen sollten, nur das beunruhigte sie, daß sie nur von neun Mädchen hatten sprechen hören, die eingeschlossen worden waren.
Wo waren die anderen zwei, wer waren diese? Nun, sie würden dies schon erfahren. Aber ja, Chalmers oder die Fischer konnten ihnen darüber Auskunft geben, ehe die Exekution ausgeführt ward.
Sie eilten nach den Bäumen, an denen die Trapper elf Schlingen befestigt hatten. Zwei Lassos waren vorhanden, und da diese nicht ausreichten, wurden Stricke und Schnüre herangeholt, auch die Gürtel müßten herhalten, sie wurden zusammengebunden, und die elf Schlingen waren hergestellt. Nur kurzen Prozeß mit solchen Halunken gemacht, dachten die Trapper, auf frischer Tat ertappen und bestrafen, war bei ihnen eins.
»Halt,« rief Miß Sargent, welche am wenigsten verletzt war, »wir müssen diese Leute erst verhören!«
»Verhören? Wozu?«
Chalmers und Frankos waren nicht zum Sprechen zu bringen, aber die anderen Fischer legten gern ein offenes Geständnis ab. Mit Schrecken erfuhren die Mädchen, daß Jessy bestimmt, Ellen wahrscheinlich ihren Tod gefunden habe.
»Jetzt ist es genug,« sagte Charly, »Richter Lynch kann nicht länger warten. Auf, Burschen, legt ihnen die Schlingen um den Hals und dann hoch mit ihnen!«
Mit zusammengekniffenen Lippen ließ sich Chalmers ruhig die Schlinge umlegen. Er wehrte sich nicht, sein Gesicht zeigte keine Spur von Angst, und keine Muskel zuckte.
Miß Nikkerson war mit einigen Mädchen auf ihn zugetreten. Ein augenblickliches Mitleid stieg in ihren Herzen auf, als sie den Mann, der ein naher Verwandter einer ihrer Freundinnen war, der eine gute Erziehung genossen hatte, und den sie einst in anderen Verhältnissen gesehen, mit dem Strick um den Hals stehen sahen.
Wer hätte geahnt, daß der Straßenprediger von New York einst am Galgen enden sollte, eines schauderhaften Verbrechens überführt, von eigenmächtigen Richtern ohne Verhör gehenkt.
»Mister Chalmers,« fügte Miß Nikkerson leise zu ihm, »fühlen Sie keine Reue, daß Sie uns und alle Welt so schmählich hintergangen haben? Fürchten Sie sich nicht, in wenigen Minuten vor den da oben zu treten, den Sie ihr ganzes Leben verhöhnt und verspottet haben, so entsetzlich, daß mich schaudert, wenn ich daran denke?«
Zum ersten Male ging ein Zucken über das bleiche Gesicht, langsam wendete Chalmers seinen Kopf nach der Sprecherin.
»Warum erinnern Sie mich noch im Sterben an meine Schandtaten?« entgegnete er dumpf. »Bin ich noch nicht genug bestraft, daß ich dafür gehenkt werde?«
Die Mädchen wunderten sich über diese Sprechweise.
»So bereuen Sie Ihr früheres Leben?«
»Ja, ich bereue es und sühne es mit meinem Tode. Ich sterbe ruhig, ich jammere und klage nicht, wie diese dort, weil ich weiß, daß mich dort, wohin ich komme, nicht solche Qualen erwarten können, wie ich sie hier auf der Erde ertragen hatte.«
Immer erstaunter wurden die Mädchen. Jetzt, seitdem sie Chalmers in seiner wahren Gestalt kannten, hätten sie nicht solche Worte aus seinem Munde zu vernehmen erwartet. Oder spielte er noch im Sterben seine angenommene Rolle weiter? Das wäre mehr als Mut und Festigkeit, das wäre Wahnsinn gewesen.
Die übrigen hingen schon an den Bäumen hoch in der Luft, ein wenig Zappeln, noch ein Greifen mit den Händen, und es war vorbei. Die zwei Männer, welche Chalmers hängen wollten, zögerten noch, weil sich die Damen mit ihm unterhielten.
»Zieht auf.« rief Charly ihnen zu, »was zögert ihr noch?«
Die Männer machten sich bereit, der Aufforderung nachzukommen, sie ergriffen den über den Ast geworfenen Strick.
Noch einmal, ehe die Schlinge ihm die Luft wegnahm, öffnete Chalmers den Mund, und auf eine energische Handbewegung von Miß Sargent ließen die Männer den Strick wieder nach.
»Noch eins möchte ich sagen, ehe ich sterbe,« begann Chalmers mit tonloser Stimme, »Wenn es nicht frevelhaft und lächerlich von mir wäre, wenn ich bei Gott schwöre, so möchte ich meinem Worte durch einen Schwur Nachdruck geben. Aber es glaubt mir doch niemand, wenn ich auch schwöre, nachdem ich erkannt worden bin.«
»Fassen Sie sich kurz!«
»Es war meine Absicht, die elf Mädchen zu retten, und als dann zwei entflohen waren, die übrigen neun,« sagte Chalmers mit erhobener, fester Stimme, »ich wollte sie in dem Grabe von den Fischern verschütten lassen, mit den Leuten fortgehen, dann aber wieder umkehren und sie befreien.«
Charly, welcher dieser letzten Rede beigewohnt hatte, brach in ein lautes Gelächter aus, und auch die Damen zweifelten alle an der Wahrheit dieser Beteuerung. Chalmers war zu tief gesunken. Er versuchte noch in der letzten Minute, sich vom Stricke zu retten. Wodurch wäre bei ihm dann diese plötzliche Sinnesänderung bewirkt worden?
»Das sind Ausreden,« lachte Charly aus vollem Halse, »zieht an, Jungens!«
»Ich wußte es,« sagte Chalmers noch, dann legte sich die Schlinge wieder fest um die Kehle, die Worte erstickend. Die Männer ergriffen das Tau und begannen langsam zu ziehen, damit der schwache Strick nicht reiße.
Chalmers verlor den Boden unter den Füßen.
»Los den Strick!« donnerte da eine Stimme, das Seil wurde den Männern aus der Hand gerissen, und der Gehängte, noch bei Bewußtsein, fiel in die Arme von Deadly Dash.
»Hallo, was soll das heißen?« rief Charly verblüfft. »Soll der Spitzbube nicht hängen?«
»Nein, Ihr habt voreilig gehandelt. Ist er auch nicht unschuldig, seine letzte Aussage, die ich hörte, beruht auf Wahrheit.«
»Wer kann das beweisen?«
»Diese da,« sagte Deadly Dash, mit der Hand zurückweisend.
Alle Mädchen wandten sich der Richtung zu und lagen im nächsten Augenblick in den Armen der Freundinnen, unter Tränen Küsse mit ihnen tauschend.
»Ellen, Sie leben noch!« riefen die Mädchen und umringten die Totgeglaubte.
Doch jetzt war keine Zeit zum Erzählen, das konnte später geschehen. Nur so viel erfuhr man, daß auch Jessy am Leben sei. Man trat zu der Gruppe, die sich um Chalmers gebildet hatte.
»Ihr habt nicht recht gehandelt, Charly,« meinte Deadly Dash mißbilligend, »daß Ihr alle habt hängen lassen, ohne vorher ein Verhör anzustellen.«
»Ihr scheint Richter Lynch nicht zu kennen,« war die etwas scharfe Antwort, »er fragt nicht lange, sondern handelt, und das aus gutem Grunde.«
»Ich bin kein Freund des Lynchverfahrens; zu oft kommen Ungerechtigkeiten dabei vor.«
»Bester, unter zehn wird ein Unschuldiger gehängt, als daß einer von den Schuldigen entkommt und weiteres Unheil anstiftet.«
Deadly Dash behielt bei diesem kleinen Wortwechsel seine Ruhe, Charly dagegen wurde immer ausfälliger, sein Ton nahm eine beleidigende Schärfe an.
»Dann wünsche ich Euch, daß nicht Ihr einmal vom Richter Lynch unschuldig verurteilt werdet, aber klagen dürft Ihr dann nicht, wenn Ihr in der Luft baumelt,« lächelte jetzt Deadly Dash.
Charly ging sofort auf diese humoristische Wendung des ernst zu verlaufen drohenden Gespräches ein.
»So ist es recht, gebt es mir ordentlich'«lachte er und streckte Deadly Dash die Hand entgegen, der sie ergriff und schüttelte. »Nichts für ungut, wir wollen uns wegen dieser Schufte nicht streiten. Mag sein, ich oder wir alle haben etwas vorschnell gehandelt, aber ein schnelles Hängen ist, weiß Gott, manchmal nötig, die Schurken schlüpfen einem oft wie Aale durch die Finger, wenn man sie nicht sofort aufknüpft.«
Der Streit war beigelegt.
»Also dieser Gentleman ist wirklich unschuldig?« fuhr Charly fort. »Dann hätte ich allerdings einen dummen Streich gemacht, der mir schwer auf dem Gewissen gelegen hätte.«
»Ich sagte schon vorhin, daß er nicht unschuldig ist,« entgegnete Deadly Dash, »aber wahr ist, daß er die Absicht gehabt hat, die Gefangenen zu befreien. Miß Chalmers,« wandte er sich an das betreffende Mädchen. »Nicht wahr, so ist Ihr Name? Bitte, wiederholen Sie das, was Sie und Ihre Gefährtinnen mir vorhin mitgeteilt haben.«
Mit Freuden übernahm das junge Mädchen die Aufgabe, das Leben des Verwandten durch ihre Aussage zu retten. Sie erzählte, wodurch sie zu der festen Ueberzeugung gekommen sei, daß Chalmers ihnen beistehen wollte, wie er Frankos zu töten versucht habe, aber wegen der zurückkehrenden Fischer seinen Vorsatz nicht ausführen konnte, wie er ihr, als er das flehende Mädchen hart zur Seite schleuderte, durch einen leisen Händedruck ein verständliches Zeichen gegeben habe, und so weiter, und die übrigen Mädchen, auch Ellen, bestätigten diese Aussagen. Alle waren der Meinung, daß Chalmers die Absicht gehabt hätte, die Mädchen erst einschließen zu lassen, dann aber zu befreien.
Sein Leben war gerettet.
»Nun zu Ihnen,« sagte hierauf Deadly Dash und trat zu dem Befreiten. »Geben Sie offene Antwort, es soll Ihnen nicht ein Haar gekrümmt werden, wenn wir sehen, daß Sie auch noch fernerhin für die Rettung dieser Damen tätig sein wollen. Gehören Sie mit zu jener Bande von Verbrechern, welche es sich zur Aufgabe gemacht haben, durch Tötung oder Beseitigung der Vestalinnen in den Besitz von deren Vermögen zu kommen?«
Lange blieb Chalmers die Antwort schuldig. Er blickte starr in das edle, schöne Gesicht des Waldläufers, in die treuen, blauen Augen; er hörte die eben gesprochenen Worte noch in seinem Ohre klingen und wußte, daß er hier keinen gewöhnlichen Menschen vor sich hatte. Mochte sich dieser Mann auch als Waldläufer ausgeben, Chalmers hielt ihn für etwas ganz anderes, oder aber, er hatte eine gute Erziehung genossen und war aus Lust zu einem freien Leben ein Bewohner des Waldes geworden. Diesem Manne wollte er Rede stehen, mochte es kommen, wie es wollte.
»Ja, ich gehörte zu jenen, ich nannte sie meine Freunde,« entgegnete er mit fester Stimme.
Ein unwilliges Gemurmel erhob sich. Schon machte jemand wieder den Vorschlag, ihn zu hängen, aber Deadly Dash gebot Ruhe.
»Sie sprechen, als wären jene nicht mehr Ihre Freunde,« fuhr er fort. »Seit wann haben Sie Ihren Entschluß, die Damen aus der Welt zu schaffen, geändert und stehen auf deren Seite?«
»Seit vorgestern abend,« war die Antwort.
»Ich verstehe Sie nicht.«
Doch Chalmers erklärte sich auch nicht näher.
»Wodurch kam es, daß Ihre Gesinnung plötzlich eine Aenderung erfuhr?« fragte Deadly Dash. »Waren Sie mit Ihren Freunden in Streit geraten? Glaubten Sie, Sie würden von ihnen um den Gewinn betrogen werden, oder was sonst?«
Chalmers schien nicht gewillt zu sein, aus diese Fragen einzugehen; wie träumend blickte er vor sich hin.
»Ich muß diese Frage beantwortet haben.«
»Es war etwas ganz anderes,« sagte Chalmers endlich. »Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen werden, wenn ich Ihnen nur andeute, daß es Augenblicke gibt, in welchen ein schlechter Mensch aus einem langen Traume zu erwachen glaubt und sein vergangenes Leben in erschreckender Nacktheit erblickt. Dann kommt er sich mit einem Male so erbärmlich vor, er ekelt sich vor sich selber, daß er sagt: entweder es wird anders, oder du greifst zum Selbstmord, Es ist hier nicht der Platz, darüber zu sprechen, man versteht mich nicht.«
Hatten ihn die übrigen Trapper vielleicht auch nicht verstanden, so doch Deadly Dash und die Mädchen.
»O doch, ich habe Sie verstanden,« rief der Waldläufer schnell. »Ich will diesen Punkt nicht weiter berühren. Nun aber sprechen Sie: Wollen Sie fernerhin noch für die Rettung dieser Damen, welche noch lange nicht allen Gefahren entgangen sind, tätig sein? Nur dadurch können Sie das wieder gutmachen, was Sie früher an ihnen gesündigt haben.«
»Ich will!« rief Chalmers feierlich und legte die Hand aufs Herz. »Was man auch von mir fordert, ich werde es tun. Ich will gern mein Herzblut hingeben, wenn ich den Damen, welche ich früher gehaßt habe, damit nützlich sein kann, und ihre Feinde sollen von jetzt ab auch meine Feinde sein. Kann ich auch meinen ehrlichen Namen nimmermehr wiedererhalten, was frage ich darnach? Die Qualen, welche mich bis jetzt im Innersten verzehrt haben, verlassen mich wenigstens, schon fühle ich es, und darnach nur geht mein Streben.«
»Es ist gut,« sagte Deadly Dash, »Sie sind einer der Unsrigen, ich traue Ihnen. Wir werden nachher noch darüber sprechen, inwiefern Sie den Damen nützlich sein können.«
Chalmers verließ sofort die Gesellschaft und trat abseits zwischen den Steinhaufen. Anfangs wurde er von einigen Trappern, die an seiner Redlichkeit noch zweifelten, mißtrauisch beobachtet; als sie den bleichen Mann aber immer regungslos auf einem Steinblock sitzen sahen, den Kopf in beide Hände gestützt und in Gedanken versunken vor sich hinstarrend, überließen sie ihn seinem Grübeln.
Die Mädchen erzählten sich gegenseitig ihr Schicksal, und das interessanteste war das Ellens.
Doch das Mädchen verschwieg viel. Sie sagte, in diesen Mauern hausten Indianer. Eine Indianerin habe sie und Jessy im Walde gefunden, die Kranke nach den Ruinen bringen lassen, und Jessy befände sich jetzt hier in Pflege.
Durch eine Oeffnung, welche sich oben in der Terrasse befand, von unten aber viel kleiner aussah, hätten sie die Einmauerung der Freundinnen mit angesehen, und die Indianer zeigten ihnen dann einen geheimen Gang, welcher in das Grabgewölbe führte.
Auf diese Weise seien die neun Mädchen und Pueblo aus dem Grabgewölbe verschwunden, was den Fischern solchen Schreck eingejagt hatte und Chalmers zum Verrat brachte.
Deadly Dash hatte den verschiebbaren Stein gefunden. Ein einfacher, aber doch sinnreicher Mechanismus rückte ihn aus den Fugen, und in dem geräumigen Gange erblickte er die Befreiten, sowie Ellen, aber nicht die Indianer, welche sich auch den anderen Mädchen nicht gezeigt hatten.
Ellen wurde von ihren Freundinnen gefragt, wer diese Indianer seien, die hier wohnten, ob sie das braune Mädchen nicht sehen könnten, welche wie ein Schutzengel über ihr gewacht habe, aber zu ihrer Betrübnis befriedigte Ellen ihre Neugier nicht.
»Ich habe der Indianerin fest versprechen müssen,« entgegnete Ellen, »nichts über sie, noch über die anderen, welche hier wohnen, zu verraten, mich nicht die Zugänge zu ihrer Behausung, durch welchen ich zu ihnen gelangt bin. Von dem Gange, welche vorhin die Eingemauerten als Versteck benützten, führen mehrere Kammern ab, ehemalige Begräbnisplätze, und in denen können wir uns häuslich einrichten, bis unsere Freundinnen so weit hergestellt sind, daß sie die Reise nach der Küste aushalten können. Jetzt ist nicht daran zu denken, diese Reise könnte den Tod für sie bedeuten. Jessy ist vollkommen transportunfähig, und Ruhe tut uns allen gut.«
»Gibt es noch einen anderen Zugang zu diesem Gewölbe?« fragte Deadly Dash. »Der Weg durch die Steine ist sehr beschwerlich, die Tragen können gar nicht hindurchgebracht werden.«
»Allerdings gibt es noch einen anderen, bequemeren, die Indianerin hat ihn mir bereits gezeigt, und wir werden ihn benützen. Die Trapper können durch Erlegung von Wild für unseren Unterhalt sorgen, wenn sie dazu geneigt sind. Sonst hat auch Waldblüte, das ist der Name meiner neuen, roten Freundin, uns ihre Hilfe zugesagt. Aber noch einmal, Fragen über die Bewohner dieser Ruinen dürfen weder ich noch Jessy beantworten. Wir finden diese in einem der Gewölbe, schon auf uns wartend.«
Die Trapper waren einverstanden, bei den Mädchen zu bleiben, bis die Kranken genesen waren. Auch ihre Gefährten und die eigenen Wunden bedurften der Ruhe und Pflege.
Die Tragen wurden wieder aufgenommen, und der Zug setzte sich unter Ellens Führung in Bewegung.
Der Weg führte zwischen verschütteten Steinmauern, Häusertrümmern und durch Tunnel hindurch, bis sich ein geräumiger Gang auftat, welcher wieder nach dem ersten Grabgewölbe hin zurücklief. Von diesem Gange zweigten sich andere Räume ab, einstige Gräber der Azteken, alle weit, hoch und luftig, in denen es sich wohl aushalten ließ.

Der ganze Bau war in Terrassenform aufgeführt, wodurch er Aehnlichkeit mit einer Pyramide bekam, denn bekanntlich wurden in solchen auch die einbalsamierten Leichname der Pharaonen, der Beherrscher Aegyptens, beigesetzt.
Wie glücklich waren die Mädchen, als sie in einem der Gewölbe ihre liebe Jessy, auf einem Bett aus Binsenmatten liegend, fanden! Des Händeschüttelns, des Freuens war kein Ende.
Endlich hatten sie sich alle wieder zusammengefunden. Die wenigen Tage der Trennung waren ihnen wie eine Ewigkeit vorgekommen. Was aber hatten sie in dieser kurzen Zeit alles durchgemacht!
Sie trugen auch die Spuren davon an ihren Körpern, und manches Andenken, manche Narbe würden wohl davon für das ganze Leben zurückbleiben. Aber was schadete das, hatten sie doch dieses selber gerettet, und sahen sie doch nun unter dem Schutze wackerer Männer einer heiteren Zukunft entgegen.
Niemand sprach jetzt davon, aber alle hatten sie in diesem Augenblicke denselben Gedanken: Wo waren die Engländer? War es nicht möglich, daß dieselben auch hierherkamen? Nur dies fehlte zu ihrem völligen Glück, dann wünschten sie nichts mehr, nicht einmal die Rückkehr in die Heimat.
In dem alten Gemäuer fühlten sie sich wirklich heimisch.
Draußen war es, trotzdem es schon Abend wurde, drückend heiß, hier dagegen wunderschön kühl. Die Gewölbe waren reinlich, und fürsorgende Hände hatten eine Menge von Binsenmatten und Decken aufgestapelt, aber auch steinerne Teller, Schüsseln und anderes mehr waren vorhanden. Es war für alles gesorgt, und die an Entbehrungen gewöhnten Trapper und Mädchen brauchten nicht viel.
Zuerst wurden die Verwundeten sorgsam gebettet. Dann wurden die Kammern verteilt und den Kranken Pflegerinnen beigegeben. Die Mädchen ließen es sich nicht nehmen, auch für die Pflege der verwundeten Trapper zu sorgen, hatten doch diese für sie ihr Blut vergossen.
Wie lange aber würden sie wohl hier bleiben? Jedenfalls nur so lange, wie die Wunden Zeit zur Heilung brauchten, aber das alte Sprichwort: »Der Mensch denkt, und Gott lenkt,« hatte sich an den Mädchen schon zu oft bewahrheitet, als daß sie jetzt schon mit der Zukunft rechneten.
Ellen traf zufällig zwei Trapper, die Decken ausbreiteten, bei einem Gespräche über die Indianer, welche hier wohnen sollten. Sie ergingen sich in allerhand Vermutungen.
Daraufhin ließ sie durch Deadly Dash noch einmal alle Männer zusammenkommen und bat sie, niemals einen Versuch zu machen, die Geheimnisse dieses Gemäuers ergründen zu wollen, denn dann könnten diejenigen, welche jetzt ihre Freunde waren, sich leicht in Feinde verwandeln, und Vorteile hätten sie dann keinesfalls davon.
Die Trapper versprachen fest, keinen solchen Versuch zu machen, sondern so zu tun, als wären sie die einzigen Bewohner, und sollten sie doch zufällig einmal jemandem begegnen, ihn gar nicht zu beachten.
Deadly Dash sprach lange Zeit in einem abgelegenen Räume mit Chalmers. Als er denselben wieder verließ, wurde er von Pueblo angehalten, der ihm mit betrübter Miene sein Herzeleid erzählte, daß sich nämlich Inez und sein Kind jedenfalls in den Händen der zurückgebliebenen Fischer befänden.
Es war schon finster in den Gewölben, als endlich alles zum Schlafen hergerichtet war, und die Mädchen wollten auch sofort ihre Lager aufsuchen, um sich dem langentbehrten Schlummer hinzugeben.
Vorher kam Deadly Dash noch einmal zu ihnen.
»Ich gehe morgen früh mit Mister Chalmers nach der Küste,« sagte er. »Er bleibt wahrscheinlich dort, ich aber komme wieder zurück, und ist es mir möglich, so bringe ich Inez, Pueblos Weib, und dessen Kind mit. Außerdem werde ich noch Erkundigungen einziehen über das Schicksal Ihres gestrandeten Schiffes, und über den Verbleib des ›Amor‹, von dem Sie mir erzählt haben. Gute Nacht, meine Damen, Sie schlafen unter dem Schutze wachsamer Augen!«
Der Waldläufer, dessen bescheidenes, höfliches und doch wieder energisches Auftreten alle Mädchen für sich einnahm, verließ seine Schützlinge, welche bald im tiefsten Schlafe lagen.
Deadly Dash führte aber noch mitten in der Nacht die unermüdlichen Trapper nach den Bäumen, an welchen die von Richter Lynch verurteilten Fischer hingen, ließ sie abschneiden und verscharren.
»Kommen Sie, Spurgeon,« sagte in dem Zimmer eines kleinen Gasthofes zu Matagorda Kirkholm zu seinem Freunde, »wir wollen noch einmal an den Hafen gehen und uns erkundigen, wann und ob die ›Seeschwalbe‹ überhaupt heute einläuft. Merkwürdig, daß sie noch nicht signalisiert ist. Wenn ihr kein Unglück zugestoßen ist, muß sie, laut der Depesche, heute unbedingt eintreffen. Kommt sie heute nicht, so gebe ich die Hoffnung auf, diese Engländer je zu Gesicht zu bekommen.«
»Liegt Ihnen so viel an diesem Anblick?« fragte Spurgeon, der schon zum Ausgehen fertig dastand und sich eben die Handschuhe zuknöpfte.
»Ich möchte lieber, ich brauchte sie nie wiederzusehen.«
»Interessant ist es doch, die Burschen einmal zu betrachten. Schade, daß wir nichts mehr machen können. Seit Flexan fort ist, ist unsere Sache gelähmt, der Meister hat aufgehört, seine Rolle zu spielen. Möchte nur wissen, wo er sein Ende gefunden hat.«
»Doch auf einem Schiffe, oder Wilde haben ihn aufgefressen,« meinte Spurgeon gleichgültig.
»Was aber mögen wohl unsere früheren Genossen denken, wenn sie jetzt weder Aufträge, noch Geld erhalten?«
»Sie werden wohl auf eigene Faust weiteroperieren, und, da sie die Hand des Meisters nicht mehr spüren, so ungeschickt sein, daß sie bald ihr Ende am Galgen finden werden.«
»Dann sind wir sie wenigstens los,« lachte Kirkholm, »und das wäre gut, wenn wir sie auch nicht zu fürchten brauchen. Die Hauptsache ist, daß Chalmers heute abend kommt und gute Nachrichten mitbringt.«
»Eher können wir ihn nicht erwarten, und selbst dann muß er sich schon sehr beeilt haben. Haben Sie schon wieder etwas von Inez, Pueblos Frau, gehört?«
»Nein,« entgegnete Kirkholm, »sie ist nach Matagorda in ein Kloster gebracht worden, wo sie so lange bleiben soll, bis etwas Näheres über das Schicksal ihres Mannes erfahren worden ist. Nun, wir wollen hoffen, daß auch Pueblo nicht mehr zu den Lebenden zählt. Rätselhaft ist nur, von wem die sechs Fischer vergiftet worden sind. Sie müssen unbedingt etwas Giftiges gegessen oder getrunken haben.«
»Pueblo mag Rattengift in der Küche gehabt haben, und die Fischer haben aus diesem vielleicht Kuchen gebacken,« lachte Spurgeon.
Unter solchen Gesprächen zog sich Kirkholm an und verließ dann mit Spurgeon das Hotel.
»Sehen Sie! Da ist der Mann, von dem ich Ihnen erzählt«,« flüsterte Spurgeon auf der Straße, eine unmerkliche Bewegung nach einem Herrn machend, der ihnen entgegengekommen war, aber bei dem Anblick der beiden vor einem Schaufenster stehen blieb. »Er beobachtet uns, verlassen Sie sich darauf.«
»Es mag sein,« entgegnete Kirkholm ebenso leise, »mir wird der Boden hier überhaupt schon heiß. Sofort, wenn Chalmers uns Nachricht bringt, verlasse ich Matagorda und verschwinde. In einer großen Stadt im Innern Amerikas findet uns niemand. Wir können dort in Ruhe und Sicherheit unser Geld verzehren.«
»Ja, wenn Chalmers nur erst eine günstige Nachricht gebracht hatte,« seufzte Spurgeon.
»Der Streich muß geglückt sein! Wie wäre es anders möglich. Die Fischer lassen ihre Opfer sicher nicht fahren.«
»Pst, keine Namen,« warnte Spurgeon, »wir wollen hier überhaupt nichts mehr sprechen.«
Die beiden gingen schweigend dem Hafen zu, blieben aber oftmals stehen, anscheinend, um sich die Schaufenster anzusehen, in Wirklichkeit aber, um den fremden Herrn zu betrachten, von dem sie sich beobachtet glaubten.
Sie wußten, daß die Sicherheitspolizei von Matagorda seit der Zerstörung der Feuer des Leuchtturms alle Fremden scharf beobachten ließ, doch die drei Genossen: Kirkholm, Spurgeon und Chalmers, hatten alles so fein eingefädelt, daß sie für ihre Sicherheit nichts zu befürchten hatten.
Die beiden ersteren wohnten jetzt in einem kleinen Hotel und gaben sich als Pferdehändler aus, wünschten aber nichts sehnlicher, als daß Chalmers erst eingetroffen wäre, damit sie weiterreisen könnten. Seit der letzten Geschichte, wo sechs Fischer in Pueblos Hütte vergiftet gefunden worden waren, während dieser selbst samt seinen Gästen spurlos verschwunden war, wurde das fremde Element in Matagorda noch schärfer überwacht, und besonders wurden die Schiffe bei der Einfahrt und Ausfahrt genau untersucht.
Man vermutete, daß sich auch hier eine Räuberbande eingerichtet habe, wie in anderen Hafenstädten, und die Geheimpolizei hatte ihren ganzen Apparat in Bewegung gesetzt, um diesem spitzbübischen Gesindel auf die Spur zu kommen.
So fühlten sich diese beiden Männer nicht mehr sicher, besonders, weil ihnen die Hilfsmittel nicht zu Gebote standen, mit denen Flexan von überall und über alles, selbst über das Vorhaben der Polizei, Kenntnis erhielt.
Sie wußten nicht einmal, wo sich Miß Morgan befand. Sie mochte mit Flexan untergegangen sein, und ebensowenig wußten sie, wo die Dame war, welche sich als Miß Petersen ausgegeben und die Engländer nach Südamerika gelockt hatte.
Kirkholm unterhielt nur wenige Geheimagenten, sich dabei noch immer des Siegels des Meisters bedienend, so zum Beispiel um über die Bewegungen der Engländer orientiert zu werden, weil diese zu fürchten waren. Aber das Haupt des ganzen Betriebes, Flexan, fehlte, und die Maschine stand still, man konnte sich ohne ihn nur notdürftig behelfen.
Viel schaden konnten ihnen die englischen Lords nicht mehr, man mußte sich nur vor ihnen in acht nehmen. Es wäre wohl noch möglich gewesen, einen Indianerstamm oder gedungene Mörder auf sie zu hetzen, wie man es jetzt bei den Mädchen getan hatte, aber ein ganzes Schiff in die Luft zu sprengen oder verschwinden zu lassen, so etwas konnte nur Flexan fertig bringen. Wie sehr bedauerten sie dessen Fehlen!
Nun, waren die Mädchen tot, dann waren deren Mörder in Sicherheit. Jeden Augenblick konnte Chalmers diese freudige Antwort bringen.
»Er beobachtet uns nicht,« flüsterte jetzt Spurgeon dem Freunde zu. »Er dreht sich um und geht wieder zurück, ohne sich um uns zu kümmern. Aber natürlich, man hat ein böses Gewissen, wenn man etwas getan hat, was nach Paragraph so und soviel bestraft wird. In jedem, der einen nur ansieht, wittert man gleich einen Detektiven.«
»Es ist noch nicht gesagt, daß er uns nicht beobachtet, weil er uns nicht nachläuft,« entgegnete Kirkholm. »Detektive sind schlau, sie lassen sich nicht gleich an der Nasenspitze ansehen, wer sie sind. Vorsicht ist immer gut und in unserem Falle doppelt nötig.«
Aber der Fremde verfolgte sie nicht, und die beiden erreichten unbelästigt den Quai des Hafens von Matagorda.
Dort herrschte ein reges Leben, sowohl auf dem Wasser als auf dem Lande. Eine Menge bewimpelter Schiffe lagen bereit, die Anker zu lichten, andere ankerten dicht am Quai, die Schornsteine rauchten, alles Weißangestrichene mit schwarzen Rußflocken bedeckend, die Winden arbeiteten und luden große Ballen, Kisten und Fässer, Holz und so weiter aus und ein.
Auf dem Hafendamm fuhren die schwerbeladenen Wagen ab, kamen die leeren an. Andere brachten neues Frachtgut herbeigeschleppt, geschäftige Hände luden es ab, hingen es an die Haken der Winden, und diese luden es ins Schiff ein.
Dazwischen standen die Packträger und harrten auf Arbeit, und gerade jetzt waren sie zahlreich vertreten, weil zwei ankommende Schiffe signalisiert waren. Deshalb auch befanden sich so viele müßige Zuschauer am Quai, Herren und Damen, entweder nur aus Neugier die Schiffe erwartend, oder weil sie Bekannte abholen wollten.
»Sehen Sie dort die Dame?« fragte Kirkholm den Freund. »Sie kommt mir so bekannt vor. Kennen Sie dieselbe vielleicht?«
Er zeigte dabei mit dem Kopfe nach einer elegant gekleideten Dame von etwa dreißig Jahren, welche sich auf einen langstieligen Sonnenschirm stützte und auf das in der Sonne glitzernde Wasser hinausblickte. Es war eine imposante Figur mit einnehmenden, aber nicht schönen Zügen. Sie sah etwa wie eine gewesene Schauspielerin aus, das Gesicht verlebt, weich und blaß.
»Nein, sie ist mir völlig unbekannt,« entgegnete Spurgeon, »ich habe sie noch nie gesehen.«
»Ich muß ihr schon einmal begegnet sein,« sagte Kirkholm nachdenkend.
»Doch lassen wir das! Warten Sie einen Augenblick hier, ich will mich erkundigen, wie die Namen der beiden ankommenden Schiffe lauten! Hoffentlich ist eins davon die ›Seeschwalbe‹, dann ist unsere Neugier wenigstens befriedigt.«
Er ging in ein Zollwärterhäuschen und fragte, erfuhr aber zwei andere Namen.
»Wieder nicht,« sagte er, zu Spurgeon zurückkehrend, »wir können wieder gehen. Vor heute abend kommt doch kein anderes Schiff hier an.«
»Wir können ja die Ankunft der Dampfer erwarten,« meinte Spurgeon. »Chalmers kann noch nicht zurück sein. Etwas interessanter ist dies doch, als immer im Hotel Zeitungen zu lesen.«
Kirkholm war einverstanden.
Beide schlenderten am Quai entlang, Spurgeon die Schiffe betrachtend, Kirkholm fortgesetzt die Dame beobachtend und darüber grübelnd, wo er dieselbe schon einmal gesehen habe.
Ein Postdampfer kam an. Er brachte Güter, Passagiere und Briefe von jenseits des Aequators, aus Rio de Janeiro, der Hauptstadt Brasiliens.
Die sonnenverbrannten Matrosen zogen die kleinen Dampfboote der Kompanie, welcher das Schiff gehörte, heran, warfen die Taue um die Boller, legten die Laufbrücke aus, die Passagiere gingen über das schwankende Brett und wurden an Land gebracht.
Es ging alles sehr schnell; der Dampfer blieb nur wenige Stunden hier. Schon lagen schwimmende Dampfkrähne und große Kähne bereit, das Frachtgut abzunehmen und anderes auszuliefern. Dann ging es weiter, aus dem Busen von Mexiko hinaus und an der Küste von Nordamerika entlang dem Heimatshafen zu.
Zeit ist Geld, und vor allen Dingen bei einem Schiffer. Jede Stunde im Hafen kostet eine beträchtliche Summe Ankergeld. Jeder uniformierte Hafenbeamte hält gierig die offene Hand dem Kapitän hin und fordert irgend einen Zoll.
Plötzlich fuhr Spurgeon mit totenblassem Gesicht zurück und wendete den Kopf ab.
»Miß Petersen,« stammelte er.
Auch Kirkholm erschrak, als er eine Dame von einem der kleinen Dampfer an Land gehen sah, doch gleich hatte er sich wieder gefaßt.
»Unsinn,« sagte er, »es ist nicht Miß Petersen. Wie sollte sie es sein? Aber ähnlich ist sie ihr allerdings sehr.«
»Ich habe Miß Petersen nur einmal gesehen,« entgegnete Spurgeon noch immer aufgeregt. »Diese Aehnlichkeit ist zu frappant.«
»Ich kenne Miß Petersen sehr genau. Sie ist es nicht. Sie kann es ja auch nicht sein, die Fischer haben dafür gesorgt.«
»Donner und Doria,« rief plötzlich Spurgeon aus, »das ist doch nicht etwa die — die — wie hieß gleich die Dame, welche sich für Miß Petersen ausgab und die Engländer irreführte?«
»Wahrhaftiger Gott,« rief jetzt auch Kirkholm erstaunt, »das wird sie sein, Miß Leigh.«
»Wollen wir sie begrüßen?«
»Nein, auf keinen Fall,« sagte Kirkholm heftig, »es sind ihr Versprechungen gemacht worden, die ich nicht zu halten gedenke.«
»Sie hat ihre Mission auch nicht erfüllt.«
»Doch, doch! Sie hatte nur den Auftrag, die Rolle der Miß Petersen zu spielen, und das hat sie getan. Ich sollte für sie nach dem Auftrage von Flexan dreitausend Dollar deponieren, habe es aber nicht getan, weil ich erst auf die Rückkehr Flexans warten wollte. Jetzt soll sie das Geld auch nicht bekommen, ich kann es besser verwenden.«
»Wenn sie uns aber sieht?«
»Sie kennt uns nicht. Ueberhaupt weiß niemand, daß wir die Leiter des Ganzen sind, mit Ausnahme von Miß Morgan. Ich wünschte, dieses Weib wäre schon in der Hölle,« fügte Kirkholm grimmig hinzu.

»Wo mag sie jetzt sein?«
»Weiß nicht. Sie hat sich jedenfalls irgendwohin zurückgezogen und eine tüchtige Summe Geld mitgenommen. Sie war ja die Vertraute Flexans, vielleicht noch mehr, und weiß ebensogut wie wir, daß die Gesellschaft des Meisters krachen gegangen ist. Jeder zieht sich nun mit soviel Beute wie möglich aus dem Bankrott zurück, und Miß Morgan wird schon tief in die Kasse gegriffen haben.«
Die Dame, von der sie vorhin gesprochen hatten, Miß Leigh, stand an der Laufbrücke und ließ ihr Gepäck an Land bringen. Sie glich Ellen wirklich sehr. Auch sie war schön, besaß ein stolzes Gesicht und kalte Augen, aber um ihren Mund lag ein herber Zug, sie war magerer, und auch ihr Haar war dunkler als das aschblonde Ellens.
Um sie drängten sich Dienstleute, und ganz besonders war es ein Mann, welcher durchaus ihr Gepäck tragen wollte, und als der erste Koffer an Land war, ergriff er ihn, drängte einen anderen Mann rücksichtslos zurück und wartete geduldig, bis alles andere ausgeladen war. Jetzt mußte die Dame ihn nehmen, sie nannte eine Adresse, und der Träger ging voran, von noch mehreren gefolgt. Zuletzt kam die Dame, die Leute im Auge behaltend, denn nur zu oft sieht der Passagier in Hafenstädten weder Träger noch Gepäck wieder.
Sie kamen an der Fremden vorüber, welche zuerst die Aufmerksamkeit der beiden beobachtenden Freunde erregt hatte. Aber wenn sie auch noch näher gewesen wären, sie hätten doch nicht den Blick bemerken können, den die Dame auf den ersten Träger warf und der von diesem unmerklich zurückgegeben wurde.
Zwischen beiden fand also eine geheime Verständigung statt.
»Laß sie laufen,« sagte Kirkholm zu Spurgeon. »Uns kann sie nicht mehr nützen. Sie wird sich schön ärgern, wenn sie nach der angegebenen Adresse geht und einen fremden Menschen dort antrifft, der ihre Fragen ganz unverständlich findet, und wenn sie dort kein Geld bekommt.«
Kirkholm sprach natürlich von Miß Leigh.
»Könnte sie uns nicht durch einen Verrat schaden?« meinte Spurgeon besorgt.
»Bah, dann bricht sie sich selbst das Genick. Sie wird sich sehr hüten, etwas zur Anzeige zu bringen. Was will denn der Kerl von mir? Brr, ist das eine Jammergestalt!«
Den kleinen Dampfer hatte soeben ein Mann verlassen, welcher an den beiden Auf- und Abgehenden vorüber mußte. Es war wirklich eine Jammergestalt und erregte den Abscheu eines jeden, der ihn nicht bemitleidete. Das Gesicht war dick angeschwollen, am Munde und in den Backen waren tiefe Löcher, fast so aussehend, als wäre das Barthaar mit Gewalt herausgerissen worden und hätte Narben hinterlassen. Eine Haarkrankheit mußte ihn so zugerichtet haben, was dadurch Bestätigung fand, daß auch der Teil des Kopfes, welchen die Mütze nicht bedeckte, völlig nackt war. Das Gesicht war so angeschwollen, daß die Augen nur Schlitzen glichen, die Lippen blau und dick, selbst die Nase war unförmlich, ebenso auch die Hände.
Der Körper dagegen war wie ausgetrocknet, aber es schien noch Kraft darin zu sein. Er war nur notdürftig mit einem alten schäbigen Anzuge bekleidet, der ihm nicht paßte.
Aufrecht ging er an den beiden vorüber, blieb aber plötzlich vor ihnen stehen, riß die Schlitzaugen so weit wie möglich auf und starrte die beiden an, was Kirkholm Veranlassung zu seiner Frage gab.
Doch gleich wandte sich der Mißgestaltete um und setzte seinen Weg fort.
»Wer war das?« fragte Spurgeon. »Kennen Sie ihn?«
»Ich? Nein! Wer weiß, aus welchem Lande der kommt! Dort mögen die Menschen alle so sein wie er, und nun sieht er in uns vielleicht zum ersten Male Männer von wohlgefälligem Aeußeren. Darum mag er mich so angegafft haben.«
Der Mann war bald vergessen, man betrachtete das zweite Schiff, welches jetzt ankam. Es war ein kleiner Dampfer, ein gewöhnliches Frachtschiff, schien aber fast ebenso schnell wie ein Postdampfer zu fahren.
Jedenfalls arbeiteten seine Maschinen sehr angestrengt, dicke Rauchwolken wirbelten aus den Schornsteinen.
»Donnerwetter, der hat's eilig!« meinte Kirkholm.
»Jetzt hat er gleich den Hafen erreicht, und stoppt er dann nicht, so kann es den Kapitän eine hübsche Geldstrafe kosten.«
Im Hafen dürfen die Dampfer nur mit Viertelkraft fahren, Schnelldampfer mit noch weniger.
Mit voller Gewalt kam das Schiff dahergebraust. Der Kapitän und alle Offiziere standen auf der Brücke, alle Matrosen vorn am Bug, Taue, Korkfender, mit welchen die Wucht eines Zusammenpralls abgeschwächt wird, wurfbereit in der Hand. Jetzt machte das Schiff eine Schwenkung, schäumend spritzte das Wasser über Deck, der Schiffsschnabel war schon in der Schleuse, da erst drehte der Kapitän den elektrischen Signalapparat, um das Schiff langsamer fahren zu lasten.
»Das hat nun keinen Zweck mehr,« lachte Spurgeon, »er schießt ja mit voller Fahrt in den Hafen hinein.«
Unter den Beamten im Hafen entstand eine Bewegung. Alle steckten die Köpfe zusammen, zeigten auf das Schiff und sahen nach dem Hause des Hafendirektors, auf welchem sich ein Aufbau erhob.
Hier saß beständig ein Mann, der alles, was im Hafen passierte, protokollierte, hauptsächlich jedes Vergehen gegen die Hafengesetze.
Jetzt bekam er etwas zu tun.
Das Schiff war schon durch die Schleuse, aber noch immer schoß es wie ein Pfeil durchs Wasser. Der erste Steuermann stand selbst am Ruder und wich geschickt allen Hindernissen aus. Doch der Kapitän verringerte bald die Schnelligkeit. Am Heck brodelte und schäumte es, es wurde Gegendampf gegeben, die Schraube drehte rückwärts.
Schon war dem Kapitän mittels Signalen die Stelle bezeichnet worden, wo er am Quai anlegen sollte, und glatt und sicher, ohne auch nur ein Tau auswerfen zu müssen, bog das Schiff zur Seite und legte sich langsam und direkt mit der Breitseite an den Steindamm.
Der erste, der, ehe das Laufbrett ausgefahren wurde, sich über die Bordwand schwang und das Deck betrat, war ein alter Zollbeamter. Er stand im Dienste der Regierung und mußte also das Vergehen des Kapitäns tadeln, aber er war zugleich Seemann, und als solchem rang ihm dieses Manöverkunststückchen die höchste Bewunderung ab.
»Bravo, Mann,« rief er und schüttelte dem Kapitän auf der Kommandobrücke die Hand, »das war einmal ein Manöver vom alten Schlage. Mir greisem Gesellen lacht immer das Herz im Leibe, wenn ich so etwas zu sehen bekomme, selten ist es aber! Doch ich bedaure Sie, diese Fahrt kostet Sie mehr Strafe, als Sie in dem Hafenneste verdienen können,« fügte der alte Seemann mitleidig hinzu.
»Macht nichts,« lachte der Kapitän, »ich habe es nicht mit eigenem Willen getan. Einige Passagiere verlangten von mir, daß ich mit voller Kraft bis an die Schleuseneinfahrt führe, sie wollten für jeden Schaden und jede Strafe aufkommen, wenn ich zu schnell in den Hafen einliefe. Wir sind wie der Teufel gefahren, sogar an die Ventile haben sie sich gehängt, daß es den Heizern angst und bange wurde.«
Die Zuschauer des Schauspieles und besonders die seemännische Bevölkerung standen dichtgedrängt am Quai und bewunderten den Kapitän und das Schiff. Jetzt hätte ersterer nur zu wollen brauchen, und er hätte die besten Matrosen bekommen.
Auch Kirkholm und Spurgeon traten hinzu und lasen den Namen am Heck.
»Malaga, Liverpool,« entzifferte Spurgeon Namen und Heimatshafen des Schiffes, »mir wäre es lieber gewesen, wenn es die ›Seeschwalbe‹ gewesen wäre.«
»Dann würden wir uns wohl nicht so hinstellen, daß uns die englischen Lords gleich sähen,« entgegnete Kirkholm. »Wo sind denn aber die Passagiere? Und Fracht wird auch nicht ausgeladen! Das ist ja merkwürdig! Ach so, das Schiff geht wahrscheinlich nur in Dock oder es erwartet Ladung«
Die beiden Freunde wollten schon gehen, als jene Dame, welche Kirkholm schon einmal irgendwo kennen gelernt zu haben glaubte, über das unterdes ausgelegte Laufbrett schritt, mit dem Kapitän sprach, der sie sofort sehr höflich begrüßte und sie ehrerbietig nach dem Eingange zur Kajüte führte.
»Was hat denn die auf dem Schiffe zu tun?« sagte Kirkholm. »Na, meinetwegen, uns geht's ja nichts an. Kommen Sie, Spurgeon, wir wollen nach dem Hotel gehen! Hoffentlich ist Chalmers unterdes eingetroffen.«
Sie erkundigten sich noch, ob bald wieder ein Schiff ankäme, erfuhren aber, daß noch keins von dem Leuchtturm signalisiert sei. Die Schiffe fuhren von dort bis nach dem Hafen drei Stunden, so lange hatten die Verbrecher also noch Zeit.
Auf dem Rückwege beschlich sie abermals ein banges Gefühl, als sie den Fremden wieder erblickten, und sonderbarerweise wendete er sich auch wieder um und betrachtete angelegentlich ein Schaufenster, bis sie vorüber waren.
»Er ist unsertwegen hier aufgestellt worden,« flüsterte Kirkholm. »Nur so schnell als möglich fort von hier, ehe sie uns am Kragen haben.«
»Lebendig lasse ich mich nicht fangen,« sagte Spurgeon.
»Bah, so schlimm wird es nicht gleich werden. Es ist etwas Herrliches um Beweise, wenn diese nicht aufgetrieben werden können.«
Mit beschleunigten Schritten eilten sie dem Hotel zu.
»Ein Herr erwartet Sie in Ihren Zimmern,« meldete ihnen der Kellner im Hausflur.
Kirkholm nahm drei Stufen auf einmal, heftig riß er die Zimmertür auf.
»Gott sei Dank, Chalmers, daß Sie es sind,« rief er dem jungen Manne zu, der mit müden Zügen in einem Lehnstuhl saß und noch um einen Ton bleicher als gewöhnlich war. »Ist alles geglückt? Sprechen Sie, wir vergehen vor Spannung.«
»Sind wir hier ungestört? Können wir nicht belauscht werden?« fragte Chalmers vorsichtig.
»Niemand kann etwas hören, und wenn Sie schreien. Wir sind allein.«
Langsam stand Chalmers auf.
»Nun denn, es ist alles geglückt, besser als wir gedacht haben,« sagte er.
»Gott sei Dank,« jubelten die beiden auf. »Wieso aber noch besser, was heißt das?«
»Das heißt, auch die Fischer leben nicht mehr.«
»Was, die sind auch tot?« rief Kirkholm, aber sein Gesicht leuchtete dabei freudig auf. »Sie haben doch nicht —?«
»Ich? Nein, der weiße Wolf hat mir und den Fischern die Arbeit abgenommen, die Mädchen zu töten. Er hat es getan und auch die Skalpe der Fischer abgezogen. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Niemand ist mehr am Leben.«
»Erzählen Sie!«
Und nun begann Chalmers zu erzählen, eine lange Geschichte, an welcher allerdings nichts Wahres war.
Auf dem Marsche nach der Ruine war er angeblich mit den elf Mädchen zusammengetroffen, welche von den Apachen verfolgt wurden. Sie befanden sich in voller Flucht, denn ihre Munition war vollständig verschossen, und die Apachen, durch schwere Verluste zur höchsten Wut getrieben, lechzten nach ihrem Blute. Gerade, als Chalmers mit ihnen zusammentraf, wurden sie von den Wilden erreicht. Die Mädchen wehrten sich mit der Kraft der Verzweiflung, er, Chalmers und sein Trupp wurden mit in den Kampf verwickelt, doch die Pistolen und Revolver waren machtlos gegen die Ueberzahl der Indianer.
Ein Mann nach dem anderen fiel, selbst die gebundenen Mädchen wurden abgeschlachtet, sogar den Lebenden wurde der Skalp genommen, denn sie konnten sich ja nicht wehren.
Nach der Schilderung Chalmers' mußte es eine scheußliche Metzelei gewesen sein. Den beiden Zuhörern standen die Haare zu Berge, denn Chalmers war gewandt im Reden. Wie er einst die Qualen der Hölle auszumalen wußte, so verstand er es auch jetzt, den Kampf mit allen seinen blutigen Vorkommnissen so getreu zu schildern, als wäre er selbst Augenzeuge desselben gewesen.
Und doch war alles erdichtet.
»Sie sind der einzige, welcher der Metzelei entgangen ist?« fragte Kirkholm atemlos.
»Der einzige, alle anderen habe ich abschlachten sehen, auch die Mädchen, zweiundzwanzig Stück, keine einzige lebt mehr. Wie ich mich gerettet habe, ist zwar nicht ehrenvoll, aber mein Leben gilt mir mehr, als ein ruhmvoller Tod.«
»Natürlich! Was heißt ehrenvoll und ruhmvoll?« stimmte ihm Kirkholm bei.
»Gleich als die Apachen anstürmten,« fuhr Chalmers fort, »schwang ich mich in die Zweige eines Baumes, und in ihrer blinden Wut merkten sie meine Flucht nicht. Ich fand den Baum hohl, rutschte hinein und beobachtete den ganzen Vorgang durch ein Astloch. Ich habe lange gebraucht, ehe ich die Höhlung wieder verlassen konnte. Stundenlang stellte ich vergebens Versuche an, bis mir das Entkommen endlich geglückt ist. Ich habe viel auszustehen gehabt, und zuletzt noch die beschwerliche Fußwanderung hierher.«
Chalmers sah wirklich sehr angegriffen aus.
»Das hat alles nichts zu bedeuten,« lachte Kirkholm überglücklich und schüttelte Chalmers die Hand. »Jetzt sind wir endlich sicher und können uns unseres Besitzes freuen. Was Flexan mit all seiner Schlauheit nicht geglückt ist, das haben wir zustande gebracht, und das meiste haben Sie dazu beigetragen, Chalmers. Können wir Ihnen auch kein Denkmal setzen, an Dankbarkeit soll es doch nicht fehlen.«
»Ich schlage vor, wir reisen sofort nach Austin und schicken unseren Kollegen chiffrierte Depeschen über den Tod der Mädchen zu, damit sie endlich ruhig schlafen können,« sagte Spurgeon.
»Ja das wollen wir tun,« rief Kirkholm.
»Und bestimmen einen Ort, wo wir alle acht zusammenkommen und unseren endlichen Sieg durch ein solennes Fest feiern,« fuhr Chalmers fort.
»Gewiß, auch das ist ein guter Vorschlag,« entgegnete Kirkholm fröhlich. »Ich stimme ihm aus vollem Herzen bei. Und Sie, Chalmers, können für die armen Seelen der Verblichenen eine Totenmesse lesen,« schloß er lachend.
Gräfin Urbanowska nannte sich die Dame, welche vor einigen Wochen in Matagorda die ganze erste Etage eines möblierten Hauses gemietet hatte und nach Engagement einiger Dienst- und Kammermädchen ihre vielen Zimmer nur selten verließ, und zwar nur gegen Abend, wenn es dunkel war, in einem Mietswagen.
Sie las, auf dem Divan behaglich ausgestreckt, die Zeitungen, interessierte sich besonders für die Berichte über Schiffahrt, nahm auch einen Roman zur Hand, rauchte dazu eine Zigarette nach der anderen, setzte sich an das Klavier, spielte und sang zugleich und konnte dann auch wieder stundenlang über den weichen Teppich wandern, oft vor dem Fenster stehen bleibend, bis sie mit dem kleinen, zierlichen Fuße heftig auf den Boden stampfte und sich wieder auf das Sofa warf, um von neuem nach Buch und Zigarettenkästchen zu greifen.
Ihr Name war ein polnischer, also mußte sie eine Polin sein, wie auch ihre schönen Züge, ihre kräftige, üppige Gestalt, das reiche, schwarze Haar und besonders das dunkle Auge, die kleinen Hände und Füße sie zur Tochter dieser durch Schönheit sich auszeichnenden Nation stempelten, aber nie hörte man von ihr ein polnisches Wort, sie sang amerikanische oder italienische Lieder und las englische Bücher.
Auffällig war noch, daß diese Dame sehr viele Stadtbriefe empfing, jeden Tag einige, und doch keinen erwiderte. Nach jedesmaligem Empfang eines solchen orientierte sie sich erst in dem Schiffahrtsbericht der Zeitungen und verglich diesen dann mit dem Briefe.

In den Zeitungen interessierten sie
besonders die Berichte über Schiffahrt.
Von Tag zu Tag nahmen ihre Züge einen finstereren Ausdruck an, immer weniger konnte sie es in der bequemen Lage auf dem Polster aushalten. Lektüre vermochten sie nicht mehr zu zerstreuen; am liebsten wanderte sie den ganzen Tag auf und ab. Auch des Abends verließ sie das Haus nicht mehr im geschlossenen Wagen, dessen Verschlag erst draußen auf einsamer Landstraße zurückgeschlagen wurde, damit die Fahrende die frische Nachtluft genießen konnte. Der Gang durchs Zimmer war ihr Bewegung genug; ermüdet sank sie des Abends in die schwellenden Kissen, aber nur, um sich die ganze Nacht schlaflos auf ihnen umherzuwälzen; die brennenden Augenlider wollten sich nicht schließen, und doch fühlte sie sich unsagbar müde.
Eines Tages kam ein Brief, bei dessen Durchlesen ihre Züge zum ersten Male sich aufklärten; eine sonnige Freude erhellte und verschönte sie noch mehr.
»Endlich,« jubelte sie bei der ersten Zeile auf, »endlich kommen sie. Aber was ist das? Auch dieser Schurke ist wieder bei ihnen?« fuhr sie dann fort. »›Wahrscheinlich‹, schreibt er zwar nur, nun ja, dieses ›wahrscheinlich‹ kenne ich schon, es ist so gut wie bestimmt. Ha, was würde ich darum geben, wenn dieser Mensch nicht mehr existierte! Aber er scheint gegen alles gefeit zu sein, was anderen schadet.«
Sie las den Brief zu Ende und setzte ihren Spaziergang durchs Zimmer fort. Ihre Freude hatte sich etwas gelegt, das Gesicht hatte wieder einen ärgerlichen Ausdruck angenommen.
»Also mit der ›Seeschwalbe‹ kommen sie nicht, dieser elende Deutsche, dieser Detektiv, hat eine List gebraucht, um meine Spione auf eine falsche Spur zu lenken. Ein Glück, daß mein Agent schlau genug war, dieselbe zu merken, aber sehr schade, daß er nicht den Namen des Schiffes erfahren hat, mit welchem sie reisen. Doch nur Geduld, sie kommen sicher hierher! Fahren sie auch nicht direkt nach Matagorda, ihr Weg fühlt sie doch schließlich hierher, denn die Damen, das Ziel ihrer Sehnsucht, befinden sich nicht weit von Matagorda. Möchten sie dieselben nie wiedersehen, ich wünschte, die Pläne jener beiden Tölpel gelängen, und der weiße Wolf und die Fischer täten ihre Pflicht.
»Diese beiden Herren glauben natürlich fest daran, die Engländer kämen mit der ›Seeschwalbe‹,« lächelte sie nach einer Pause. »Ihr Agent in Kingston hat eine sehr plumpe List angewendet, um die Absicht der Engländer zu erfahren. Hahaha, er hielt Nick Sharp für einen Diener Lord Harrlingtons, suchte ihn betrunken zu machen und nahm ihm dann seine Papiere ab. Köstlich! Sharp wird ihn schön an der Nase herumgeführt haben!«
Sinnend blieb sie vor dem Fenster stehen und blickte auf die Straße hinaus, auf welcher es auf- und abwogte.
»Wären die Mädchen wirklich tot,« murmelte sie weiter, »so hätte ich leichtes Spiel. James wird außer sich sein, erfährt er das Ende von Miß Petersen, dann aber werde ich auftreten und langsam, aber sicher, meine Fäden spinnen, die zum Siege führen. Wie aber, wenn Miß Petersen ihrem Schicksale entgangen wäre?«
Die Züge des Weibes nahmen einen erschreckenden Ausdruck an, sie drückten eine furchtbar drohende Energie aus.
»Lebt sie doch noch, dann werde ich selbst an's Werk gehen,« kam es zischend von ihren Lippen. »Ich will Tag und Nacht nicht ruhen, bis ich meine Absicht erreicht habe, und was anderen nicht gelungen ist, muß mir glücken. Bah, was ist leichter, als einer Person einen Dolch ins Herz zu stoßen? Jene Feiglinge wagten es natürlich nicht. Immer wußten sie eine Ausrede, warum sie es unterlassen hatten, ich aber werde kurzen Prozeß machen.
»James muß mein werden, es koste, was es wolle, und wenn ich über hundert Leichen zu ihm gelangen sollte.«
Sie strich sich nachdenkend mit der Hand über die heiße Stirn.
»Doch, welche Bilder male ich mir da aus! Die Vestalinnen werden nimmermehr zurückkehren. Es war ein ganz guter Gedanke, den Kirkholm und Spurgeon hatten. Dem weißen Wolf ist nicht leicht zu entkommen. Er wird nicht eher ruhen, als bis er seine Fänge in das zarte Fleisch der Mädchen schlagen kann. Hahaha, wie werden sie unter seinen Klauen zucken! Ich denke, die keuschen Priesterinnen der ›Vesta‹ werden von den Apachen wohl ihres Schmuckes beraubt werden.«
Ein boshafter Triumph prägte sich in ihren Zügen aus.
»Und auch der Gedanke mit den Fischern ist ganz gut,« fuhr sie fort, »sie haben Angst und werden diejenigen, welche um ihr Verbrechen wissen, vernichten. Morgen kann ich vielleicht schon die Nachricht ihres Todes erhalten, aber ich selbst werde mich persönlich überzeugen.« —
Einige Tage waren nach diesem Selbstgespräch vergangen, die Spannung der Gräfin, für einige Tage gelindert, war von neuem erwacht, denn jetzt wollte sie erfahren, ob die Vestalinnen wirklich den Tod erlitten hatten.
Wieder verglich sie eines Morgens die Schiffahrtsberichte mit einem eingelaufenen Schreiben, als ihr die Kammerzofe einen neuen Brief brachte
Sie wartete, bis das Mädchen hinaus war, und riß dann hastig den Umschlag auf.
»Es ist der erwartete Brief,« flüsterte sie mit fliegendem Atem, »das geheime Zeichen ist darauf.«
Kaum hatte sie die ersten Zeilen überflogen, als sie mit tödlicher Blässe im Antlitz auf das Sofa sank und stöhnend das Papier fallen ließ.
»Meine Ahnung,« hauchte sie. »Dieses Weib ist wiederum dem Tode entgangen. Kein Haar ist ihm gekrümmt worden.«
Mit geistesabwesenden Augen starrte sie vor sich hin, sie blickten ausdruckslos ins Leere. Nach und nach wurden sie aber von einem unheimlichen Glanze beseelt, immer drohender wurden sie, immer finsterer, und zuletzt sprang die Gräfin mit einem Ausruf auf, den man nie aus ihrem Munde zu hören geglaubt hätte — es war ein Fluch.
»Himmel und Hölle,« schrie sie, »jetzt kommt die Reihe an mich! Jetzt werde ich versuchen, ob ich Eigenschaft zu einem Bravo,* welche sich für Geld dingen lassen, habe. Noch heute nacht treffe ich Anstalten zur Abreise, verkleidet schleiche ich mich in ihre Nähe, und mein Dolch soll ihr Herz nicht fehlen, und,« fügte sie langsamer hinzu, »auch nicht das mancher anderen.«
* Bravo ist der Name für italienische Meuchelmörder.
Sie hob das Schreiben wieder vom Boden auf; das Zittern hatte sie verlassen; sie war wieder ganz Ruhe und Entschlossenheit.
»Sie haben sich in den Ruinen des Tempels versteckt, in welchem ein mexikanischer Gott verehrt wurde,« las sie weiter, »und werden diese wahrscheinlich erst verlassen, wenn die Wunden einiger Damen geheilt sind. Sie haben schwere Kämpfe mit den Apachen zu bestehen gehabt. Chalmers ist hier eingetroffen und hat seinen Freunden Kirkholm und Spurgeon erzählt, die Damen seien alle vernichtet; auch er ist jetzt also auf die Seite der Vestalinnen getreten und zum Verräter an seinen früheren Kameraden geworden.«
»Chalmers? Chalmers?« flüsterte das Weib sinnend. »Ja, richtig, das ist der Mann, welcher in der Maske eines Predigers sich in fromme Kreise New Yorks zu schleichen wußte, die mit den Vestalinnen korrespondierten. Von diesen erfuhr er immer die Ziele der ›Vesta‹. Auch er ist also übergelaufen. Nun, mich soll das nicht weiter aufregen. Immer zu, sie mögen alle ihren Untergang finden! Der geheimnisvolle Meister hat seine Rolle ausgespielt, jetzt gilt es nur noch, mein Schäfchen in's Trockene zu bringen, James zu gewinnen und — Rache zu nehmen. Mögen die Herren sehen, wie sie fertig werden, sie werden wohl am Galgen enden, wenn sie es nicht vorziehen, mit leeren Händen sich zurückzuziehen! Hahaha,« lachte das Weib, »jahrelang haben sie sich abgemüht, und alles ist nun vergebens. Diese Narren!«
Sie nahm wieder den Brief auf und las ihn zu Ende:
»Gestern nachmittag ist in Matagorda ein Dampfer angekommen, die ›Malaga‹. Auf ihm waren die englischen Herren; sie hielten sich versteckt und verließen das Schiff erst bei Nacht. Es gelang mir, sie zu beobachten, sie wohnen im Hotel Merkurial. Niemand wird sie erkannt haben, sie waren in Mäntel gehüllt und redeten sich mit anderen Namen an. Den Detektiven Nick Sharp habe ich nicht unter ihnen herausgefunden. Sobald ich mehr erfahre, teile ich es Ihnen mit.«
Das Weib glaubte seinen Augen nicht trauen zu dürfen, als es den Schluß des unterschriftslosen Briefes gelesen hatte.
Also die Herren waren schon hier! James wohnte schon eine Nacht mit ihr zusammen in den gleichen Mauern, und sie hatte keine Ahnung davon gehabt!
Mit hämmernden Schläfen sprang sie auf und rannte im Zimmer auf und ab. Diesmal konnte sie sich nicht so leicht beruhigen.
Doch sie mußte sich zur Ruhe zwingen, denn das Kammermädchen trat nach kurzem Anklopfen herein und meldete, daß im Vorzimmer eine Dame warte, welche die Gräfin Urbanowska zu sprechen wünsche.
Sie überreichte der Herrin eine Karte.
Die Gräfin las einen ihr unbekannten Namen, aber sie bemerkte an dem Kärtchen ein Zeichen, daß die Person, welche sie zu sprechen wünschte, mit zu dem Bunde des Meisters gehörte oder vielmehr gehört hatte.
Sie zögerte einen Augenblick. Sie war unschlüssig, ob sie sich stellen sollte, als erkenne sie das Zeichen nicht, hieß aber dann die Dame eintreten zu lassen.
Erschrocken fuhr sie beim ersten Anblick derselben zurück, sie glaubte nicht anders, als Miß Petersen vor sich zu haben, doch lächelte sie sofort über ihre Furcht und hieß die Eintretende mit einem kurzen Gruß willkommen.
»Miß Leigh,« sagte sie kalt, sie zum Sitzen nötigend, »was verschafft mir die Ehre?«
Die junge Dame schien über diesen kalten Empfang etwas verwundert und verstimmt. Sie ließ die Blicke durch das kostbar möblierte Zimmer gleiten, überflog die schöne, üppige Figur der Gräfin und setzte sich in den ihr zugeschobenen Lehnstuhl.
»Sie nennen sich jetzt Gräfin Urbanowska, wenn ich nicht irre?« fragte sie gezwungen lächelnd.
»Allerdings. Woher haben Sie meinen Namen und meine Adresse erfahren, wenn ich fragen darf? Dies nimmt mich wunder.«
»Ich erfuhr, daß hier eine Gräfin Urbanowska wohnte, und aus der Beschreibung eines Mädchens, welches in meinem Hotel dient, entnahm ich, daß es niemand anderes als Sie wären.«
Die Gräfin biß sich auf die Lippen.
Sie hatte vor wenigen Tagen eine Kammerzofe entlassen, weil sie sich ihr gegenüber unangemessen benommen hatte, und diese hatte geplaudert. Sie hatte einen dummen Streich gemacht.
»Was führt Sie zu mir? Sie haben wohl schon vernommen, daß es mit dem Meister, welchen läppischen Namen er sich zugelegt hatte, vorüber ist. Es hat sich alles aufgelöst, es werden keine Gelder mehr ausgezahlt, weil keine mehr zufließen. Jeder hat das behalten, was er gerade besaß, der eine viel, der andere wenig, und jeder muß zufrieden sein.«
»Sie mögen zufrieden sein, ich aber bin es nicht,« entgegnete Miß Leigh, »ich habe mein bares Geld während der Reise so ziemlich verbraucht und besitze kaum so viel, wie ich zum Leben nötig habe.«
Die Gräfin zuckte die vollen Schultern.
»Ich kann Ihnen nicht helfen. Wenn Sie sich nicht während jener Zeit, in welcher Sie für den Meister tätig waren, genügend gesammelt haben, um behaglich davon leben zu können, so ist das nicht meine Schuld. Ich habe es getan.«
»Das glaube ich,« spottete Miß Leigh, sich nochmals im Zimmer umsehend, »und wer so intim mit dem Meister verkehrt hat, dem war dies wohl auch möglich.«
Die Sprecherin hatte bei diesen Worten die Gräfin scharf beobachtet, konnte aber keine Wirkung des Spottes wahrnehmen. Gräfin Urbanowska griff in das Kästchen und zündete sich langsam eine Zigarette an.
»Natürlich, je nachdem wir von dem sogenannten Meister für befähigt oder unbefähigt gehalten wurden, bekamen wir höhere oder gering bezahlte Posten,« entgegnete sie gleichgültig. »Ich hatte das zweifelhafte Glück für eine sehr gewandte — Person gehalten zu werden, den anderen Ausdruck will ich nicht gebrauchen, und wurde daher sogar als Vertraute behandelt. Ich habe mehr erfahren, als mir lieb war. Doch sprechen Sie offen mit mir! Was wünschen Sie? Wir haben zusammen gearbeitet, wir haben uns gut vertragen, und so will ich diesmal eine Ausnahme von meinen Grundsätzen machen. Was wünschen Sie?«
»Geld!«
»Hm, kurz und bündig sind Sie, das muß man Ihnen lassen. Haben Sie versucht, die Summe zu erheben, welche Ihnen nach Erledigung Ihres Auftrages bestimmt war?«
»Ja, aber es war natürlich vergebens. Ich fand fremde Gesichter vor, und das Zeichen wirkte nicht. Dann erfuhr ich auch, wie es mit der Sache des Meisters steht.«
»Sie haben nicht viel mit ihrer Mission erreicht, die Engländer leben noch.«
»Das scheint so, wenn ich auch nicht weiß, wo sie sind. Jedenfalls habe ich meinen Auftrag gut ausgeführt.«
»Wo ist Fernando, der Sie zuerst als Miß Petersen ausgab und Sie auch dem Anscheine nach rauben ließ?«
»Er ist tot. Er ist auf den Pampas in meinen Armen gestorben.«
Der Gräfin Züge nahmen einen merkwürdigen Ausdruck an.
»Sollte er vielleicht am Fieber sterben?« fragte sie leise.
Miß Leigh zögerte nicht, eine Antwort zu geben, die sie zur Mörderin stempelte. Diesem Weibe gegenüber brauchte sie sich nicht zu genieren.
»Ja, er sollte am Fieber sterben,« lächelte sie, und ihre Augen funkelten, wie die einer Katze.
Nach einer kleinen Pause, während welcher sich die Gräfin mit ihrer Zigarette beschäftigt hatte, fragte sie wieder:
»Wo wohnen Sie? Mit welchem Schiff kamen Sie?«
Das Mädchen nannte den Hotel- und den Schiffsnamen.
»Wissen Sie, daß die englischen Lords gleichzeitig mit Ihnen hier angekommen sind?«
Miß Leigh fuhr erschrocken vom Stuhle auf.
»Was?« rief sie. »Ist das wahr?«
»Sicherlich, ich weiß es bestimmt! Gestern nachmittag mit der ›Malaga‹, die fast gleichzeitig mit Ihrem Passagierdampfer hier ankam.«
»Gut, daß Sie mir das mitteilen! Ich muß mich vor ihnen in acht nehmen und ganz besonders vor einem Manne, der in ihrer Gesellschaft ist. Er war furchtbar hinter mir her; nur durch die größte List und Schnelligkeit konnte ich ihm entgehen.«
»Meinen Sie Nick Sharp, den Detektiven?«
»Eben denselben.«
Die Unterhaltung stockte lange Zeit, die Gräfin schien die Blumen des Teppichs zu zählen, und Miß Leigh zündete sich unterdes eine Zigarette an.
Plötzlich stand die Gräfin auf, ging hinaus und kehrte mit einer kleinen Schatulle zurück, der sie ein Pack Banknoten entnahm, die sie aufzählte.
»Dreitausend Dollar,« sagte sie. »Bitte, zählen Sie dieselben nach, und prüfen Sie die Scheine!«
Erstaunt blickte Miß Leigh die Gräfin an. Was hatte dieselbe zu dieser plötzlichen Sinnesänderung gebracht?
Sie mußte sich noch einmal auffordern lassen, dann aber steckte sie die Scheine ein, ohne sie gezählt zu haben.
»Ich habe mir die Sache anders überlegt,« begann die Gräfin, Miß Leigh scharf ansehend, »ich zahle Ihnen die versprochene Summe aus meiner Kasse aus, weil Sie von dem Dienst des Meisters zwar entbunden sind, ich Sie aber gern in meine Dienste nehmen möchte. Verstehen Sie mich nicht falsch,« fuhr sie rasch fort, als das Mädchen eine Bewegung machte, als wollte sie die Taille öffnen, um die auf dem Busen ruhende Summe wieder herauszunehmen, »ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. Ich will nicht die Rolle des Meisters auf eigene Faust weiterspielen, das ist ein undankbares Geschäft, aber ich möchte jemanden haben, der mir bei meinem Unternehmen hilft, welches ich vorhabe.«

»Was ist das?«
»Eine Privatsache! Wollen Sie mir beistehen? Ich stelle Ihnen glänzende Bedingungen.«
»Erklären Sie sich näher, dann will ich mich entscheiden!«
Die Gräfin rückte näher an die Besucherin heran und sprach lange und leise mit ihr. Miß Leigh schien darauf einzugehen.
»Sie übernehmen also vorläufig nur die Beobachtung, oder lassen dieselbe vielmehr besorgen, während ich abwesend bin,« schloß die Gräfin Urbanowska. »Sie selbst dürfen sich nicht sehen lassen, weil Sie erkannt werden könnten. Ich überlasse Ihnen diese Wohnung. Sie ist auf ein Vierteljahr bezahlt und ebenso das Dienstpersonal. Sind Sie mit diesem Anerbieten zufrieden?«
»Ich muß es sein, mir bleibt nichts anderes übrig.«
Miß Leigh stand auf.
»Also morgen früh reise ich ab,« sagte die Gräfin, »und eine Stunde vorher schon treffen Sie mit Ihrem Gepäck hier ein. Haben Sie sonst noch etwas zu bemerken?«
»Betreffs dieser Sache nicht, aber wegen etwas anderen,« entgegnete Miß Leigh. »Ich begegnete in Rio de Janeiro einem zerlumpten Menschen, welcher sich mir mit dem Zeichen des Meisters näherte, und zwar derart, daß ich in ihm einen Vertrauensmann erkannte. Er bat mich, für ihn die Ueberfahrt nach Mexiko, Texas oder Louisiana zu bezahlen, und ich nahm ihn mit. Hier angekommen, erfuhr er durch eine allerdings unverzeihliche Nachlässigkeit von mir — ich hatte ein Notizblatt liegen lassen — daß ich eine Gräfin Urbanowska besuchen wollte, und leider auch Ihren eigentlichen Namen. Der Mann wurde sehr aufgeregt und bestand durchaus darauf, Sie aufsuchen zu wollen. Ich machte anfangs Ausreden, aber er bestand so energisch darauf, daß ich ihm nicht wehren konnte. Er wartet jetzt unten, bis ich fertig bin, dann will er zu Ihnen. Lassen Sie ihn vor! Er muß einst eine wichtige Rolle beim Meister gespielt haben. Vielleicht hat er Ihnen wichtige Nachrichten zu bringen.«
Die Gräfin schien nicht neugierig zu sein, sie war sogar ärgerlich über Miß Leigh.
»Er hat sich nicht Ihnen gegenüber ausgesprochen?«
»Nein.«
»Er sah heruntergekommen aus?«
»Ja, sehr.«
»Hat er nicht gesagt, wie er in solche Verhältnisse gekommen ist?«
»Er hat nie darüber gesprochen, und alle meine Fragen ließ er unbeantwortet.«
»Haben Sie eine Ahnung, wer er ist?«
»Auch das nicht, er ist mir fremd.«
»Gut, ich werde ihn empfangen,« meinte die Gräfin nach langem Nachdenken, »mich seiner aber schnell entledigen, wenn er mir nicht paßt. Ich könnte noch einen Mann brauchen, der für mich geschickt zu operieren weiß und treu ist.«
Nachdem Miß Leigh das Zimmer verlassen hatte, trug Gräfin Urbanowska die Schatulle wieder fort und legte sich dann bequem auf das Sofa, eine Zigarette rauchend. Sie erwartete den neuen Ankömmling ohne jede Spannung.
»Es wird ein Bettler sein,« dachte sie, »einer jener Menschen, die früher vom Meister beschäftigt waren und nicht schlau genug gewesen sind, in den guten Zeiten für die schlechten zu sorgen. Er soll der letzte sein, den ich empfange, dann will ich sie ein für allemal mir vom Halse schaffen. Ein veränderter Name und eine andere Wohnung werden sie mir fernhalten.«
Draußen ward die Glocke gezogen; die Gräfin hörte, wie das Mädchen die Tür öffnete, und eine heisere Stimme der Zofe antworten, dann ertönte ein lauter Schrei. Ein heftiger Schritt kam über den Korridor, und die Tür zu dem Boudoir ward aufgerissen.
Schon wollte die Gräfin dem frechen Menschen, der ohne Anmeldung einzudringen wagte, ein drohendes Hinaus zurufen, aber das Wort erstarb auf ihren Lippen, als der schäbig gekleidete Mann, der die Tür hinter sich schloß und ihr so den Rücken kehrte, sich umdrehte und sie sein Gesicht sah.
Die Gräfin empfand bei diesem Anblick eine Anwandlung von Ekel; nie hatte sie einen so häßlichen Menschen gesehen. Das Gesicht dick geschwollen, die Lippen blau, die Nase kolbig, die Augen schlitzförmig und die Hände so geschwollen, daß die Finger nicht sich zu spreizen fähig waren. Das scheußlichste dazu war, daß der von keinem Hut bedeckte Kopf vollkommen nackt und ohne Haare war. Der Mann mochte die Kopfbedeckung draußen gelassen oder überhaupt keine gehabt haben.
Es war jene Jammergestalt, welche Spurgeon und Kirkholm auf dem Quai des Hafens begegnete.
Der Mann stand regungslos an der Tür, die Augen starr auf die Liegende geheftet.
Die Gräfin hatte sich schon wieder gesammelt. Sie kannte keine Furcht, sonst wäre sie wohl erschrocken aufgefahren, als der unbekannte Mensch in ihr Boudoir drang, aber sie war äußerst unwillig.
Sie warf einen Seitenblick auf ein Tischchen, auf welchem, ihr zur Hand, ein Revolver lag.
»Wie können Sie wagen, ohne Anmeldung hier einzutreten?« herrschte sie den Regungslosen an. »Ich habe wohl gehört, wie Sie meine Zofe zur Seite gedrängt haben. Wer sind Sie eigentlich?«
Die Gestalt öffnete den Mund, in dem nicht ein einziger Zahn mehr zu sehen war, und in einem schauerlich krächzenden, heiseren Tone klang es daraus hervor:
»Der Vater deines Kindes.«
Diese Antwort war selbst für die starknervige Gräfin zuviel. Die Zigarette entfiel ihrer Hand und sengte den kostbaren Teppich, aber für Minuten merkte das Weib nicht den brandigen Geruch. Es lag wie betäubt da.
»Was sagst Du, Mensch?« stammelte sie endlich.
Aber ehe die Gestalt noch Antwort geben konnte, sprang die Frau vom Sofa auf und eilte nach der gegenüberliegenden Seite, als wollte sie sich durch Flucht durch die dortige Tür dieser Erscheinung entziehen. Sie glaubte, es mit einem Wahnsinnigen zu tun zu haben.
Doch schnell sprang ihr der Mann in den Weg und streckte die Arme nach ihr aus.
»Zurück, Ungeheuer!« schrie das Weib entsetzt. »Rühre mich nicht an! Komm nicht so nahe heran! Dein Atem ist Gift, ich ekele mich vor dir! Zurück!«
Sie war zurückgewichen und hatte hinter dem Rücken den Revolver vom Tisch genommen. Schnell hielt sie ihn jetzt der Gestalt entgegen.
»Zurück!« rief sie noch einmal.
Aber der Mann war weder wahnsinnig noch furchtsam. Er blieb ruhig stehen, und ein schauderhaftes Grinsen verzerrte das scheußliche Gesicht.
»Kennst du mich nicht mehr, Sarah? krächzte er. »Schöner bin ich freilich nicht geworden. Ja, sieh mich nur entsetzt an, ich bin's wirklich, Eduard Flexan, den du seiner Schönheit wegen liebtest, wenn die Liebe auch nicht lange gedauert hat.«
Die Frau verlor die Fassung. Sie ließ den Revolver sinken und starrte den Sprecher mit einem unsagbaren Ausdruck von Entsetzen an. Noch glaubte sie nicht an die Worte, sie konnte es nicht.
»Ja, ja, ich bin wirklich Eduard Flexan,« fuhr die heisere Stimme fort. »Soll ich dir einige Erkennungszeichen geben?«
»Ihr lügt,« brachte endlich die Gräfin oder — unter welchem Namen wir sie früher kannten — Miß Sarah Morgan stammelnd hervor: »Ihr seid nicht Flexan, Ihr gebt Euch nur für ihn aus.«
»Sprich keine Torheit, Sarah,« spottete der Mann. »Wie sollte ich mich für Eduard Flexan ausgeben, da ich ihm gar nicht ähnlich sehe? Wäre das nicht Wahnsinn? Willst du aber einige Erkennungszeichen haben? Wie geht es Martha, unserem Kinde, auf der Farm meines Vaters, den ich Onkel nenne? Weißt du noch, wie ich dir die Waffe aus der Hand rang, als du einen Selbstmord begehen wolltest, weil dich Lord Harrlington erkannt und darum verschmäht hatte? Soll ich dir unsere Brautnacht schildern, der keine Hochzeit vorausgegangen war? Soll ich dir die Worte wiederholen, die ich von dir aus Eifersucht oft genug zu hören bekam, als du merktest, daß ich Miß Petersen zu besitzen begehrte? Deine Eifersucht dauerte so lange, bis du meiner überdrüssig wurdest, bis sich deine alte Liebe zu Lord Harrlington wieder regte. Soll ich dir schildern, wie du bei einem Mord zuerst als Hehlerin auftratest? O, ich habe ein vorzügliches Gedächtnis! Wort für Wort der Unterhaltung kann ich dir wiedergeben, die wir hatten, ehe du den ersten Meineid leistetest, dem später unzählige andere folgten! Soll ich ...«

»Höre auf! Höre auf!« stöhnte Sarah und sank wie gebrochen auf das Sofa zurück. Sie wollte nichts mehr hören, sie hatte den Mann jetzt erkannt. Er hatte die Wahrheit gesprochen.
Eine lange Pause trat ein. Das Weib hatte sein Gesicht in die Hände gehüllt und wagte nicht aufzublicken. Der Mann hatte sich in einem Lehnstuhl niedergelassen und starrte unverwandt, mit vorgebeugtem Kopfe die an, welche er eben als seine einstige Geliebte bezeichnet hatte.
Endlich richtete Miß Morgan den Kopf auf.
»Eduard,« sagte sie mit tonloser Stimme, »sage es noch einmal, bist du es wirklich?«
»Ja, ich bin es, Eduard Flexan.«
»Was hat dir ein so entsetzliches Aussehen gegeben? Warst du krank? Wo bist du so lange gewesen, ohne Nachricht von dir zu geben? In einem Hospital?«
»In einem Hospital? In der Hölle bin ich gewesen,« murmelte Flexan.
»Erkläre dich deutlicher! Bist du gefangen genommen worden und hast du büßen müssen für das, was du getan hast?«
»Büßen?« rief Flexan und sprang mit geballten Fäusten auf. »Ein Tag an dem Ort, wo ich fast zwei Monate gewesen bin, wäre genug gewesen für einen Mann, der hundert Morde auf dem Gewissen gehabt hätte! Er wäre wie ein Heiliger im Himmel aufgenommen worden. Ich habe gelesen, wie früher Katholiken von Kalvinisten gemartert worden sind. Dem an Händen und Füßen gebundenen und festgeschnallten Manne wurde ein kleiner, eiserner Kasten, in dem sich eine Ratte befand, auf den nackten Leib gesetzt. Auf die obere Seite wurden glühende Kohlen gelegt und der untere Deckel herausgezogen, wodurch die Ratte auf den Leib des Gebundenen kam. Sie fühlte, wie die Hitze immer größer wurde, sie fand kein Loch zum Entfliehen, und wollte sie nicht verbrennen, so mußte sie sich mit den Zähnen einen Ausweg durch den Körper des Gefangenen bahnen. Du schauderst? Das ist entsetzlich, nicht wahr? Nun, ich habe jetzt jeden Tag solche Schmerzen auszustehen, jeden Tag fühle ich, wie die Ratte in meinem Körper bohrt, an den Knochen frißt und mit den Zähnen die Gedärme zerbeißt. Bekomme ich den Anfall, so bin ich kein Mensch mehr. Ich bin ein rasendes Tier, wälze mich auf der Erde und beiße mich vor Schmerz. Warum ich mich nicht selbst töte, denkst du, ich, der ich früher dir gegenüber oft davon sprach, daß ich den Selbstmord jedem anderen Tode vorzöge? Weil ich nicht kann, nicht darf. Erst muß ich Rache genommen haben, Rache, Rache, Rache, wie sie die Welt noch nie gesehen hat.«
Sarah schauderte.
Dem Manne war Schaum vor die Lippen getreten, die Augen waren verschwunden, die unförmlich geballten Fäuste glichen Kegelkugeln, und so rannte der, dem sie sich einst in Liebe hingegeben hatte, der Vater ihres Kindes, im Zimmer auf und ab.
Ihr Mut war dahin; sie wagte vor Entsetzen kaum zu atmen.
»Erzähle, was du gelitten hast, und wie man dich behandelt hat,« sagte sie mit ängstlicher Stimme.
Der Gefragte hielt in der schnellen Wanderung durchs Zimmer nicht inne, als er seine Erzählung begann. Kurzabgerissen kamen die Worte über seine Lippen. Er glich einem Wahnsinnigen, und doch war er es nicht; er sprach die Wahrheit, und Sarah glaubte ihm.
»Du kennst jene Felseninsel, auf welcher die Vestalinnen auf meinen Befehl ausgesetzt wurden. Du selbst hast sie dahin gebracht. Die Insel war nicht verlassen, sie war bewohnt.«
»Was?« rief Sarah erstaunt.
»Sie war bewohnt,« wiederholte Eduard, »doch nicht auf der Oberfläche wohnten die Menschen, sondern in den Felswänden, und der sie dort festhielt, war Felix Hoffmann.«
»Der Kapitän des ›Blitz‹?«.
»Eben derselbe. Dort ließ er in Steinkammern jene höllische Mixtur brauen, deren Rezept ich Narr von ihm haben wollte. Ich habe sie nun selbst gemacht, aber ich kenne sie trotzdem ebensowenig wie vorher.«
»Ich weiß, wovon du sprichst,« unterbrach ihn Sarah, »du meinst die schwarze Substanz. Weiter!«
»Als ich und meine Leute die Insel betraten, fand ich sie leer; die Vestalinnen waren in unterirdischen Kammern geborgen worden. Ich und alle übrigen wurden bald gefangen genommen, ein Kreuzverhör wurde mit uns angestellt, und aus den Fragen merkte ich schon, daß unser ganzer sein gesponnener Plan verraten war, daß die Mädchen und ihre Helfer ganz genau wußten, wer wir waren, und was wir beabsichtigten. Das Siegel des Meisters war ihnen kein Geheimnis. Sie selbst bedienten sich seiner unter unserem Namen, um uns auf eine falsche Spur zu leiten, damit wir an uns selbst zum Verräter würden.«
»Ich dachte es mir,« murmelte Sarah.
»Obgleich Hoffmann nicht selbst auf der Insel ist, erfuhr ich doch, daß alle diese Leute für ihn arbeiteten. Sie hatten fast alle einst unter meinem Befehl gestanden und waren auf eine rätselhafte Weise verschwunden. Ich traf Kapitän Blutfinger, den Kapitän Elidoff, den ich in Australien warb, und andere. Sie waren alle lammfromm, was mir sehr auffiel, aber bald sah ich, daß auch meine Gefährten, so zum Beispiel der Seewolf, willige Arbeiter wurden. Wir bekamen am folgenden Morgen zum Frühstück jeder ein Glas Wein zu trinken, ich wurde etwas schwindlig davon; meine Genossen dagegen waren völlig bewußtlos. In diesem Zustande wurde uns befohlen, wir sollten von jetzt ab dem Befehle unseres Aufsehers gehorsam sein, nie Widerstand leisten, an keinen Fluchtversuch denken und so weiter. Alle murmelten ein unverständliches Ja, und von einer Ahnung erfaßt, stellte auch ich mich völlig berauscht und sagte ein Ja, obgleich ich mir völlig darüber klar war, daß ich die erste Gelegenheit zur Flucht benutzen würde. Nach einigen Stunden wurden wir getrennt, ich, der Seewolf und einige andere meiner Gefährten kamen in eine Kammer, in welcher Quecksilber destilliert und andere Arbeiten mit diesem Metall vorgenommen wurden. Ich versuchte mehrmals mit meinen Leidensgefährten zu sprechen, denn wir konnten die wenigen Aufseher erdrücken, aber sonderbarerweise waren die früheren Mörder und Räuber wie umgewandelt. Warum sollen wir von hier fort? fragten sie immer erstaunt. Wir sind glücklich, wir können es ja nicht besser haben. Es war nichts mehr mit ihnen anzufangen.«
»Sie waren hypnotisiert worden und handelten und dachten unter aufgedrängten, fremden Gedanken,« meinte Sarah.
»Nein, der Trank hat ihnen diese Eigenschaft beigebracht die allerdings auch einer Hypnose glich. Ich war davon frei geblieben.«
»Sagtest du nicht früher einmal, du hättest Opium geraucht, und keine Wirkung davon verspürt?«
»Allerdings.«
»Dann bist du eben für solche Reize nicht empfänglich. Es war dein Glück.«
»Mein Glück?« lachte Flexan furchtbar. »Nun ja, insofern war es ein Glück, als ich mich immerfort mit dem Gedanken an Flucht beschäftigen konnte und jetzt endlich auch die Gelegenheit erhalten habe, diese auszuführen. Aber damals war es kein Glück. Ich fühlte, wie das Quecksilber mich aufzehrte. Heißer als in den Kesseln kochte es in meinem Innern. Dabei hörte ich fortwährend fröhliches Lachen und Scherzen um mich herum, und was das Furchtbarste war, ich mußte mich selbst so fröhlich stellen, um die Wärter zu täuschen. Jeden Morgen bekamen wir den Trank, der uns für eine Stunde bewußtlos machte. Während dieser Zeit wurden uns die alten Befehle wiederholt eingeschärft, fleißig und gehorsam zu sein, und uns gesagt, daß wir glückliche Menschen seien, denen es an nichts gebräche und die allen Grund zur Fröhlichkeit hätten. Mit Lachen und Singen ging es dann an die Arbeit, die in kurzer Zeit den Tod von jedem herbeiführen muß.«
»Schrecklich,« sagte Sarah.
»Ja, und das Schrecklichste war, daß ich mich so verstellen mußte, und doch keine Hoffnung hatte, entfliehen zu können, weil wir zu streng bewacht wurden. Ich wünschte oft, der Trank möchte wirken, damit auch ich träumen könne, ich dachte an Selbstmord, aber der Gedanke an Rache ließ mich leben. Woche auf Woche verging so. Wir arbeiteten von früh bis abends in der Quecksilberkammer, und mein Körper und Gehirn fingen an auszutrocknen.«
»Ich hätte Hoffmann nie zugetraut, daß er so unmenschlich sein könnte,« unterbrach ihn Sarah. »Ich weiß, daß das Einatmen von Quecksilberdämpfen furchtbar schädlich ist. Daß sie aber einen Menschen so entstellen können, wie dich, hätte ich doch nicht geglaubt.«
Eduard Flexan antwortete nicht gleich, er schritt noch aufgeregter im Zimmer auf und ab.
»Ich meinte auch nicht, daß mich das Quecksilber austrocknen und so zurichten würde, wie ich jetzt aussehe,« sagte er endlich. »Wir bekamen öfter Mittel verabreicht, welche gegen jenes gut sind; wir hatten wenig zu leiden, und die Verpflegung war sehr gut. Doch glaube nicht,« setzte er schnell hinzu, »daß Hoffmann dies aus Rücksicht gegen uns als Menschen getan hat, nein, nur darum natürlich, daß er seine Arbeiter möglichst lange am Leben erhalten könne, denn so wohlfeile bekommt er nirgends wieder. Der Haß gegen meine Peiniger, die unbefriedigte Rache war es, welche mich halb wahnsinnig machte.«
»Ah so, wodurch aber wurdest du so entstellt?«
»Ich mußte zu einem furchtbaren Mittel greifen, um mich zu befreien, aber ich hätte es vielleicht doch nicht getan, wenn ich vorher gewußt hätte, daß ich ein so scheußliches Aussehen bekäme. Ueberdies war mein Fluchtplan ein wahnsinniger, und daß die Flucht glückte, ist ein Wunder. Ich merkte, daß die Wachsamkeit der Männer nachließ, man holte uns nicht mehr aus der Arbeitskammer ab, sondern schloß einfach die Tür auf und ließ uns heraus und nach dem Speisesaal gehen.
»Eines Abends führte ich meinen entsetzlichen Plan aus. Ich wußte, daß die Türen zum Arbeitsraume nicht verschlossen wurden, wenn wir ihn verlassen hatten. Wir marschierten in geordneter Reihe an dem Aufseher vorüber, der vor dem Speisesaal stand, und dieser zählte die Leute. Noch nie hatte einer gefehlt.
»Da, mit einem Male fehlte doch einer. Der Aufseher glaubte erst, sich verzählt zu haben, er rief meinen Namen, aber nicht wie sonst erklang ein freudiges: ›Hier, Sir,‹ — ach, wie oft habe ich diese erkünstelte Fröhlichkeit verflucht. Man glaubte, ich sei wahrscheinlich im Arbeitszimmer zurückgeblieben; man sah hinein, konnte aber niemanden erblicken, denn nachdem Eduard Flexan vergeblich im Speisesaal gesucht worden war, begann eine Visitation des ganzen Arbeitsraumes. Jeder Kasten wurde aufgehoben, die Fässer umgekippt, man sah in die Braukessel, in die Feuerherde, denn man glaubte nicht anders, als ich sei verunglückt. Daß sich jemand absichtlich verstecken könne, daran dachten sie nicht. Es wurde uns ja jeden Morgen so schön vorgeredet, recht artig zu sein und beim Ziehen der Glocke sofort das Quecksilberzimmer zu verlassen. Dann suchten sie die ganze Nacht die Insel ab, und bis gegen Morgen hörte ich ihr wüstes Schreien und Befehlen.«
»Ja aber, wo warst du denn?«
Flexan seufzte tief auf.
»Wo ich war? Ich hatte mich bis zuletzt in dem Raume aufgehalten, und als der letzte hinaus war, kroch ich schnell in eine riesige Retorte, unter welcher den Tag über kein Feuer gebrannt hatte. Ich mußte den Gummiverschluß, durch welchen eine Glasröhre ging, herausnehmen, konnte ihn aber glücklicherweise schnell von innen wieder einsetzen.
»In der Hölle muß es noch wunderschön sein im Vergleich zu dem Aufenthalt in der Retorte; sie war noch warm. Die giftigen Dünste umschwebten mich. Bis an die Knie stand ich in der klebrigen, warmen Masse, unfähig, mich aufzurichten oder mich zu setzen. Der Quecksilberdampf nahm mir fast die Besinnung, ich wurde wie wahnsinnig — entsetzlich,« unterbrach sich Flexan stöhnend, »ich kann es nicht beschreiben, was ich in diesen Stunden ausgestanden habe!
»Schließlich stemmte ich mich mit den Händen wenigstens auf den Boden, wodurch ich bis an die Ellenbogen in die klebrige Masse sank, und meinen Kopf lehnte ich an die Wand, welche beim Kochen ebenfalls von der Substanz bespritzt worden war. Was mich diese Stunde gekostet hat, kannst du jetzt sehen.
»Also gegen Morgen hörte das Suchen nach mir auf. Mehr tot als lebendig kroch ich aus der Retorte und ging mit vor Furcht klopfendem Herzen auf die Tür zu. Wenn dieselbe unterdessen geschlossen worden wäre, so hätte ich alle meine Qualen umsonst ausgestanden. Aber nein, sie war noch offen. Wie ein Dieb schlich ich mich durch die Gänge, ich hatte mich während der acht Wochen sehr genau orientiert, und erreichte das Freie durch eine der vielen Höhlen gerade da, wo man durch eine schmale Spalte an das Wasser gelangen konnte.
»Dort wußte ich ein ausgerüstetes Boot liegen. Ich sprang hinein, und als die Morgensonne emporstieg, war die Insel schon außer Sicht, ich war frei.
»Aber noch schwere, entsetzliche Tage kamen für mich. Die giftigen Dämpfe, welche ich eingeatmet hatte, begannen ihre Wirkung. Es riß in den Knochen, zwickte in den Gliedern und brannte mir im Innern, daß ich vor Schmerz bald vergehen wollte. Es war Windstille. Durch angestrengtes Rudern suchte ich meinen Schmerz zu betäuben, aber er vermehrte sich nur. Die Hände schwollen an. Ich fühlte, wie die Haut des Gesichts sich spannte, und ich kann dir das Entsetzen nicht schildern, was mich erfaßte, als mir plötzlich ein Zahn nach dem anderen aus dem Munde fiel, nicht einer blieb darin haften. Ebenso ging es mit Bart- und Kopfhaaren, und als ich mich dann in dem klaren Wasserspiegel besah, bekam ich vor mir selbst einen Ekel.
»Schon am ersten Tage mußte ich mit dem Rudern aufhören. Außer den Schmerzen machte mir dies der unerträgliche Hunger und Durst unmöglich, denn das Boot enthielt nichts weiter als Riemen und Segel. Drei Tage trieb ich so hilflos umher, bis mich ein Schiff auffand und nach Rio de Janeiro brachte.
»Ich erzählte ihnen ein Märchen von einem Schiffbruch. Der Schiffsarzt hielt meine Krankheit erst für Skorbut Skorbut ist eine Krankheit, bei welcher die Gliedmaßen anschwellen und das Zahnfleisch sich so entzündet, daß die Zähne ausfallen. Sie entsteht besondere, wenn der Körper zu lange mit Salzfleisch ernährt wird, und kommt daher am häufigsten auf Segelschiffen vor. und behandelte sie als solchen, bis ich ihm sagte, es sei eine Quecksilbervergiftung. Aber sein Medizinkasten half nichts, das Quecksilber geht nicht wieder aus dem Körper. Das ist meine Geschichte, und nun habe ich nur noch eine Lebensaufgabe: Die furchtbarste Rache an dem zu nehmen, der aus mir einen lebendigen Leichnam gemacht hat, und mit ihm sollen alle untergehen, derentwegen ich von Hoffmann auf der Insel gefangen gehalten wurde.«
Während der Erzählung seiner ausgestandenen Leiden war Flexan oft zusammengeschaudert, seine Stimme hatte manchmal gezittert; bei den letzten Worten aber brach eine nicht zu bändigende Wut hervor. Wie ein wildes Tier rannte er im Zimmer umher, er war plötzlich blind geworden, stieß an Tische und Stühle, rannte mit dem Kopfe gegen die Wand, kurz, benahm sich eben wie ein Wahnsinniger.
Miß Morgan wußte, daß Flexan furchtbar jähzornig war, aber so hatte sie ihn noch niemals gesehen. Plötzlich blieb der Rasende stehen, streckte die Arme aus als wolle er etwas in der Luft fassen, und stürzte dann mit einem Jammerton zu Boden. Und nun bekam das Weib etwas zu sehen, was ihr das Blut zum Stocken brachte.
Der Unglückliche wand sich wie ein Wurm auf dem Teppich, focht mit der Hand umher, krallte sich in die Wolle und stieß ein Winseln aus, welches durch Mark und Bein ging.
Miß Morgan wußte vor Entsetzen erst gar nicht, was sie tun sollte. Bewegungslos blieb sie sitzen und starrte den sich Windenden an. Hilfe durfte sie nicht herbeirufen. Die Mädchen hätten vielleicht das ganze Haus alarmiert. Es war ein Glück, daß das Dienstbotenzimmer zu weit ablag, als daß die Mädchen das Gewinsel hätten hören können.
Schon wollte Miß Morgan wenigstens Wasser besorgen, als die Zuckungen nachließen. Sie wurden immer schwächer und hörten endlich ganz auf. Flexan lag wie ein Toter da.
Miß Morgan überlief ein Grausen. Diesen Mann hatte sie einst geliebt oder glaubte doch, ihn geliebt zu haben. Sie war noch immer dieselbe wie früher, aber was war aus ihm geworden? — Eine scheußliche Gestalt, vor der man sich ekelte, wenn man ihr nur ins Gesicht blickte. Um keinen Preis der Welt hätte sie ihn angerührt.
Flexan hatte sich von seinem Anfall erholt, langsam richtete er sich auf.
»Es ist wieder einmal vorüber,« stöhnte er. »Zehn Stunden etwa habe ich jetzt Ruhe.«
»Um Gottes willen, Eduard, gibt es denn kein Mittel, um dich von diesem Leiden zu heilen?«
»Ja, eins: der Tod kann mich heilen.«
»Warst du bei keinem anderen Arzt als bei dem Schiffsarzt?«
»Ich war im Hospital zu Rio de Janeiro, das Quecksilber geht nicht wieder aus dem Körper, sagten die Aerzte, es frißt so lange, bis sich die Knochen zersetzen.«
»Aber sagtest du nicht, auf der Insel hättet ihr Medizin bekommen, dank welcher ihr von den Quecksilberdämpfen keinen Schaden erlitten habt?«
»Ja, aber hier kennen die Aerzte kein solches Mittel.«
»Dann mußt du es von Hoffmann verlangen. Suche ihn auf und bringe dich mit List oder Gewalt in den Besitz der Arznei.«
Wieder wurde Flexan wütend.
»Gewiß, aufsuchen will ich ihn,« schrie er, »aber keine Medizin will ich von ihm, sondern sein Leben muß ich haben, und wenn ich ihm das Fleisch Stück für Stück mit glühenden Zangen vom Körper reißen kann, dann wird mir schon Linderung werden, dann will ich mir gern eine Kugel durch den Kopf jagen.«
Miß Morgan wollte auf etwas anderes zu sprechen kommen. Es fiel ihr ein, daß sie Flexan vielleicht noch recht gut brauchen könne; er schien ihr jetzt zu allem fähig zu sein. Das Leben achtete er nicht mehr.
»Weißt du, daß es seit deinem Verschwinden mit dem Bunde des Meisters vorbei ist?« begann sie.
»Ich habe es erfahren, konnte es mir auch schon vorher denken,« lachte Flexan höhnisch. »In Rio de Janeiro konnte ich nicht einmal lumpige hundert Dollar zur Reise auftreiben. Niemand verstand oder wollte das Zeichen verstehen, und mich zu erkennen zu geben, wagte ich nicht. Wer hatte mir auch getraut, da ich keine Spur mehr von dem bin, was ich früher war? Nur Miß Leigh nahm sich meiner an. Sie wußte noch nichts von dem Fiasko des Meisters, weil sie aus dem Innern kam, und so gehorchte sie noch dem geheimnisvollen Fingerdruck. Auch Kirkholm und Spurgeon habe ich hier gesehen. Was machen sie?«
Sarah erzählte von den letzten Unternehmungen der beiden Freunde. Die Mädchen wären unversehrt von einigen Trappern nach einer Ruine gebracht worden. Die Ankunft der Engländer verschwieg sie vorläufig.
»Aber wo ist Hoffmann?« knirschte Flexan. »Ihn vor allen Dingen muß ich haben.«
»Seit langer Zeit schon fehlt jede Spur von ihm. Er ist überhaupt nur schwer zu beobachten. Das letzte Mal reiste er mit Kirkholm zusammen nach Kolorado, und ich glaube, letzterer hatte es auf ihn und auf das auf seinem Herzen ruhende Geheimnis abgesehen.«
»So hat ihn Kirkholm schon ermordet?« rief Flexan fast erschrocken, weil er das Opfer seiner Rache entgangen glaubte.
»Schwerlich.«
»Was meinst du, wo ich ihn treffen kann?«
»Unbedingt da, wo sich die Mädchen aufhalten,« entgegnete Sarah Morgan. »Ist er noch nicht dort, so kommt er auf alle Fälle noch hin. Willst du dich mit mir nach der nicht weit entfernten Ruine begeben, wo sie sich aufhalten? Du wirst deine Freude daran haben, wie munter und fröhlich sie sind, und wie sie über deine vergeblichen Anstrengungen spotten. Sie lachen dich tüchtig aus, Flexan, daß du von ihnen so an der Nase herumgeführt worden bist, und besonders Miß Petersen belustigt sich und spottet deiner. Du kennst doch noch Miß Petersen?« fragte Miß Morgan höhnisch.
»Weib, willst auch du meiner spotten?« sagte Flexan. »Du weißt, wie ich mit Ellen stand.«
»Sie wird sich freuen, wenn sie dich wiedersieht,« lachte das herzlose Weib. »Früher konnte sie dich nicht ausstehen, jetzt aber wird sie dir wohl entgegenfliegen.«
»Hölle und Teufel!« knirschte Flexan. »Höre auf, mich mit meiner Häßlichkeit aufzuziehen! Wohl weiß ich, daß auch Ellen sich mit Abscheu von mir wenden würde, aber eben darum, weil ich nie Liebe bei ihr fand und nie Liebe finden werde, will ich ihr von jetzt ab meinen Haß zuwenden. Ebenso, wie ich sie früher mit glühender Liebe verfolgte, soll jetzt mein Haß ihr verderblich werden. Nicht ruhen will ich, als bis sie zu meinen Füßen liegt und um Gnade bettelt. Ja, wahrhaftig, sie soll mir sagen, daß ich schön bin, wunderschön, daß sie noch nie einen so schönen Mann gesehen hat, daß sie mich liebt, dann will ich ihr ins Gesicht speien und sie soll mir doch noch die Füße küssen.«
»Das wird sie wohl nicht tun,« lächelte Sarah überlegen.
»Dann werde ich sie zu Tode martern, langsam, Zoll für Zoll, und ihr Gewinsel soll wie Musik in meinen Ohren klingen. Erst Hoffmann, dann Ellen, dann die übrigen Mädchen und zuletzt die englischen Lords, alle müssen sie daran glauben, jetzt gibt es keine Schonung mehr. Durch sie bin ich schon frühzeitig zum Greise geworden, aber ich will sie wenigstens mit mir ins Grab ziehen.«
Flexan befand sich schon wieder in einer furchtbaren Aufregung. Er redete sich fortwährend in Wut hinein, weil er darin eine Genugtuung fand.
Das paßte in Miß Morgans Plan. Dieser Mann war nicht mehr ihr Geliebter, er galt ihr nur noch als ein Werkzeug, und als solches mußte er ausgenutzt werden. Das, was an ihm ihren Zwecken nützlich war, war nur noch sein grenzenloser Haß, und vielleicht hatte ihn auch die alte Energie noch nicht verlassen.
»So willst du morgen mit mir dorthin kommen, wo sich die Mädchen aufhalten?«
»Ich komme mit.«
»Wir reisen nicht zusammen, du bist eine zu auffällige Erscheinung geworden. Hast du Geld?«
»Ich müßte mir erst welches von meinem Vater verschaffen. Einige Tage vergehen darüber.«
»So kann ich dir aushelfen. Mache dir aber keine Hoffnungen, jemals als Erbe von Ellen auftreten zu können. Eure Fälschungen und Verbrechen sind schon viel zu sehr bekannt geworden. Auch deine übrigen Freunde bilden sich umsonst ein, Besitzer großer Vermögen zu sein, sie sind es nur dem Anscheine nach.«
»Was gilt mir dieses alles? Rache will ich nehmen, nur Rache, das ist mir köstlicher als alles Gold und Silber der Erde.«
Zwischen dem Gemäuer der alten Ruine war Leben entstanden, aber nicht die ruhelosen Geister der Azteken wanderten bei Nacht umher, sondern heitere Menschen aus Fleisch und Blut, welche nicht das Licht der Sonne zu scheuen brauchten.
Wohl gab es einige unter ihnen mit bleichen Gesichtern und schleppendem Gange, aber nichtsdestoweniger waren sie ebenso fröhlich gestimmt, wie diejenigen, welche auf dem Gemäuer herumkletterten und Götzenbilder suchten oder in den Wald hinauszogen, um mit Wildbret reich beladen zurückzukommen.
Auch einige Bahren standen den ganzen Tag zwischen den gestürzten Säulen, am Morgen und des Abends in der Sonne, am Mittag im Schatten, und auf ihnen lagen die drei Mädchen und die beiden Männer, auf welche die Apachen ihre Kugeln nicht vergeblich abgeschossen hatten.
Am fünften Tage schon kam Deadly Dash und brachte zu Pueblos unaussprechlicher Freude Inez und deren Kind mit. Beide waren in einem Kloster zu Matagorda untergebracht gewesen. Auf alle Fragen, wie er sie der Obhut der frommen Schwestern entzogen hätte, antwortete Deadly Dash nur mit einem Lächeln. Charly meinte, er selbst würde sie einfach herausgeholt haben, wenn man sie ihm nicht mitgeben wollte, und sein Freund würde erst recht so gehandelt haben, Inez aber sagte, daß sie von den Nonnen herzlichen Abschied genommen habe, also konnte Charlys Vermutung betreffs der Entführung nicht richtig sein.
Chalmers war nicht zurückgekehrt. Auf dem Wege nach der Küste hatte er dem Waldläufer seine Beichte abgelegt, und dieser traute ihm jetzt vollkommen.
Auch auf Deadly Dash wartete eine wunderliche Nachricht, die selbst ihn in Erstaunen setzte.
Charly erzählte ihm, wie der Trapper, dessen Schenkelknochen zerschmettert worden war, eines Morgens von seinem Bette verschwunden gewesen wäre — gleich nach der Abreise von Deadly Dash — und alles Suchen nach ihm war vergebens. Nach zwei Tagen aber befand er sich auf eine rätselhafte Weise wieder bei ihnen, doch nur mit einem Bein, das andere war ihm abgeschnitten worden und der Stumpf mit Bandagen umwunden. Der Mann konnte nicht sagen, wie dies alles zugegangen war. Er wäre immer bewußtlos gewesen und hätte auch keinen Schmerz verspürt.
»Er ist chloroformiert worden,« meinten die Damen, aber nur Ellen und Jessy konnten sich den Vorgang erklären. Um die Neugier der anderen zu befriedigen, mußten sie wenigstens so viel sagen, daß zwischen diesen Mauern ein Mann wohne, welcher heilkundig sei.
Deadly Dash hielt sich lange bei dem Operierten auf. Er untersuchte ganz genau den Verband, fragte den Mann kreuz und quer und schüttelte oft gedankenvoll den Kopf.
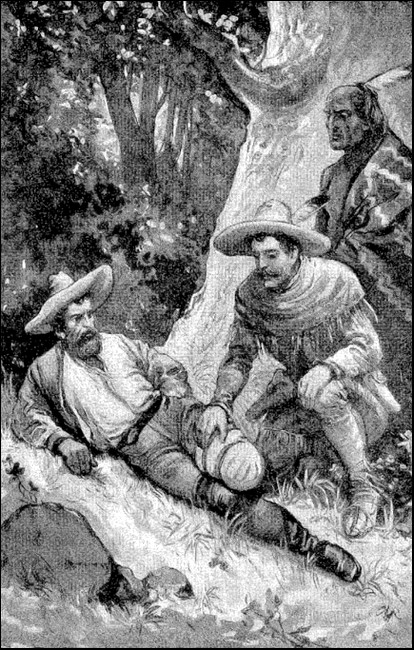
Deadly Dash untersuchte ganz genau den
Verband und schüttelte oft den Kopf.
Er sprach mit Stahlherz, und dieser deutete nur auf Lizzard, welcher schon tagelang am Eingange des Ganges lag und die Wand anheulte. Er hatte mehr gesehen als sein Herr. Wenn er nur hätte erzählen können, dann würde man alles erfahren haben.
Jedenfalls aber sorgten unsichtbare Hände für die Gäste, denn in einem bestimmten Raume fanden sie jeden Morgen frische Medizin in richtigen Fläschchen und Büchsen, welche von Ellen und Charly geschickt angewendet wurden. Die Heilmittel wirkten ausgezeichnet, die Wunden vernarbten schnell, und die Kraft kehrte den Kranken wieder.
Man hoffte, in vierzehn Tagen den Marsch nach der Küste antreten zu können.
»Haben Sie etwas von unserem Schiffe, der ›Vesta‹ gehört?« fragte Ellen den Waldläufer.
»Ja, es werden Verbuche gemacht, die ›Vesta‹ von den Klippen herunterzubringen. Ich glaube, die Felsen werden gesprengt, und dann kommt sie in das Dock von Matagorda.«
»Auf wessen Veranlassung wird dies getan?« riefen die Damen erstaunt.
»Das Seemannsamt von Matagorda hat die Arbeiter zur Verfügung gestellt. Wer dies bewirkte, weiß ich nicht,« war die ausweichende Antwort.
»Ist das Schiff ausgeraubt worden?«
»Nur wenig, und das meiste ist den Räubern wieder abgenommen worden. Es ist eine große Untersuchung gegen alle Bewohner der dortigen Gegend eingeleitet worden. Unsere Fischer können sich freuen, daß sie tot sind, sonst wartete ihrer jahrelange Zwangsarbeit.«
Von den sechs Fischern, welche in Pueblos Hütte vergiftet gefunden worden waren, erwähnte er nichts, doch erfuhren sie später durch Inez davon. Deadly Dash war der einzige, welcher wußte, daß Chalmers den Gifttrank für die elf Vestalinnen bereitet hatte, aber er verschwieg es, um nicht von neuem Mißtrauen gegen den Mann zu erwecken, den er jetzt für treu hielt.
Die Mädchen hatten die letzte und wichtigste Frage bis zuletzt aufgespart, doch zur Enttäuschung aller konnte Deadly Dash gerade diese nur um ungenauesten beantworten.
»Wo befinden sich die englischen Herren?« kam es zögernd von den Lippen, und die Augen der Fragerinnen waren ängstlich auf den Mund des Waldläufers gerichtet.
Deadly Dash hatte Erkundigungen eingezogen, aber nur sehr wenig erfahren. Die Herren befanden sich nicht mehr auf dem ›Amor‹, aber auf der Reise nach Nordamerika, nachdem sie durch ganz Chile und Argentinien marschiert waren. Der Waldläufer führte auch eine Entschuldigung an, warum er so wenig über sie erfahren hätte.
Er konnte nämlich in Matagorda nicht offen auftreten, um Erkundigungen einzuziehen, sondern suchte unter der Maske eines Arbeiters von niedrigen Hafenbeamten etwas über das Schicksal des Lords zu erfahren. Viel brachte er nicht aus den Leuten heraus, weil sie eben selbst nichts wußten.
Dann führte Deadly Dash seine Pläne weiter, die auch bei den Damen Billigung fanden.
Chalmers hatte seinen verbrecherischen Kameraden vorgespiegelt, die Vestalinnen seien vom weißen Wolf ohne Ausnahme getötet worden und ebenso die Fischer. Als Veranlassung zu dieser List gab der Waldläufer an, daß die Damen so in aller Ruhe die Genesung ihrer verwundeten Gefährtinnen abwarten könnten, ohne unter Nachstellungen leiden zu müssen. Die Verbrecher würden im Bewußtsein der Sicherheit nach ihren ergaunerten Besitzungen zurückkehren und dort sorglos leben. Waren die Kranken wieder hergestellt, so konnten Maßregeln getroffen werden, um die im Genüsse Schwelgenden zu überraschen und dingfest zu machen.
Die Damen versprachen, sich den Anordnungen des Waldläufers zu fügen, welche hauptsächlich darauf hinausliefen, jedes Lebenszeichen der Damen zu vernichten.
Sie sollten die Ruinen nur im dringendsten Notfall und dann nicht zu weit verlassen, und bei einem Zeichen der wachsamen Trapper sich sofort in einen der vielen Schlupfwinkel begeben.
Sie waren eben für tot erklärt worden und sollten diese Rolle auch wirklich spielen. — — —
Wieder war eine Woche vergangen.
Zwei der Mädchen gingen langsamen Schrittes über die zerstreut umherliegenden Steine und wanden sich zwischen den Trümmern hindurch, bis sie den großen Schutthaufen hinter sich hatten und sich einem mit Bäumen besetzten Platze näherten, wenn dieser auch noch immer innerhalb der Ruinenmauern lag.
Nach Verlauf der Jahrhunderte zeigten jetzt einige Stellen der Ruine förmliche Haine und Gebirgsszenerien, indem aus den mit Erde bedeckten Steinhaufen überall Pflanzen hervorsproßten.
Das eine der Mädchen sah bleich und angegriffen aus. Schwer stützte es sich auf den Arm der Freundin und ließ sich langsam dem Ziele, einem kleinen Haine, zuführen.
Es war Miß Thomson, die gestern zum ersten Male ihr Lager auf wenige Minuten verlassen hatte, um ihre wiedergewonnenen Kräfte zu versuchen, und heute am Arme Ellens den ersten kleinen, für sie aber großen Spaziergang machte.
Hatte die Krankheit sie auch arg mitgenommen, der Lebensmut war ihr nicht geraubt worden. Noch immer blickten die braunen Augen heiter wie früher, und noch immer wußte ihr jeder Gegenstand der Natur, die ihr jetzt doppelt lieblich erschien, ein glückliches Lächeln abzuringen, welches ihr Gesicht wie früher verschönte. Sie fühlte sich wie neugeboren; noch nie war ihr die Sonne so golden vorgekommen, noch nie die Blumen so prächtig und das Gras so grün wie heute. Sie hätte sich am liebsten auf den grünen Teppich werfen und vor Freude lachen und weinen mögen, wenn die besorgte Ellen es geduldet hatte.
»Hier wollen wir uns hinsetzen,« sagte Ellen, als sie den kleinen Orangenhain erreicht hatten. »Die Männer sind auf ihren Posten, und wenn der Geier dreimal schreit, so suchen wir uns schnell ein Versteck aus. Es gibt ja hier genug.«
Der Hain lag inmitten von Trümmern und mächtigen Steinen. Ringsum erhoben sich wildzerklüftete Mauergehänge, und in den manneshohen Spalten und Löchern konnte man leicht ein Versteck finden, wenn der Ruf des wachthaltenden Trappers die Mädchen unsichtbar machen sollte. Der Fleck glich fast einem alten Kirchhof. Es war hier ebenso still, friedlich und romantisch wie auf einem solchen, denn gerade die Friedhöfe, welche durch die den Toten gezollte Scheu und Achtung vor zerstörenden Händen geschützt sind, zeichnen sich ja besonders durch derartige idyllische Schönheit aus.
Ellen ließ die Freundin sanft ins Gras gleiten und setzte sich dann neben dieselbe.
Mit leuchtenden Augen schaute Betty um sich; sie war entzückt über die Schönheit, über die sonntägliche Stille, mit welcher das Zwitschern der Vögel harmonierte. Ellen schien nicht so empfänglicher Natur zu sein; trübe blickte sie vor sich hin und nahm nur eine heitere Miene au, wenn die Freundin ihr leise die Hand drückte.
Lange Zeit saßen die beiden Hand in Hand und stumm da, eine jede mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt.
Plötzlich brach Betty in ein heiteres Lachen aus, so daß Ellen verwundert aufschaute.
»Sehen Sie nur dort das Nest!« rief das lachende Mädchen, auf ein Vogelnest in einem Baum deutend. »Wie sich die Jungen um den Wurm streiten, den ihnen die Mutter bringt! Ist das nicht reizend, wie sie mit den Flügelchen schlagen und wie jedes das andere zu verdrängen sucht und den hungrigen Schnabel aufsperrt?«
Ellen sah wohl nach dem Neste mit den schreienden, jungen Vögeln, die von der Mutter gefüttert wurden, aber die kleine Szene vermochte ihr diesmal kein Interesse abzugewinnen, während sie sonst bei solch einem natürlichen Schauspiel stets Freude empfand.
»Es ist ein Abbild des Lebens,« sagte sie. »Jeder sucht den anderen zurückzustoßen, ihm zuvorzukommen und ihm das zu nehmen, worauf jener ein ebenso großes Anrecht hat wie er. Zugleich sieht man daraus, daß es in der Natur keine andere Liebe gibt als die der Mutter, und die, welche von Nächstenliebe und so weiter sprechen, lügen. Nirgends in der Natur sehen wir etwas von Nächstenliebe, nicht einmal etwas von Geschwisterliebe, und die Liebe des Kindes zu den Eltern, oder besser, zur Mutter, hört sofort auf, wenn es sich selbst ernähren kann. Wir Menschen haben durch Religion und Erziehung den Begriff einer Liebe erhalten, wie sie gar nicht existiert, und die Folge davon ist eine fortwährende Enttäuschung, welche aber dem erspart bleibt, der sich mit dem Gedanken vertraut macht, daß eine andere Liebe, als Mutterliebe nicht möglich ist.«
Verwundert blickte Betty die Sprecherin an.
»Wie, Ellen? Ihnen hätte ich am allerwenigsten zugetraut, daß Sie so prosaisch von Liebe sprechen könnten! Uebrigens haben Sie die Gattenliebe ganz vergessen.«
»Die gibt es nicht. Das ist keine Liebe, es ist nur ein Begehren, also vollkommen egoistisch.«
»Oho, da bin ich doch anderer Ansicht,« rief Betty entrüstet. »Aber Sie sind schlechter oder doch trüber Laune, sonst würden Sie auch anders denken. Nun sehen Sie, wie sich der kleine Vogel freut, weil er den Wurm glücklich erwischt hat, wie er pfeift und zwitschert und schwatzt.
»Der Wurm wird aber wohl nicht pfeifen und zwitschern und sich freuen,« entgegnete Ellen. »Warum muß gerade er leiden, damit der Vogel satt wird? Nein, die ganze Welt ist ein großes Schlachthaus, wo ein Wesen so lange andere frißt, bis es selbst gefressen wird. Die einzigen Wesen, welche auf der Erde nicht gefressen werden, sind die Menschen, dafür aber haben wir uns allerlei Leidenschaften geschaffen, und eine davon ist die Liebe.«
»Hören Sie auf!« bat Betty. »Sie rauben mir mit Ihren schwarzen Gedanken allen Frohsinn, und ich war doch so glücklich, als Sie sich erboten, mich ins Grüne zu führen, und es ist ja auch so herrlich hier. Muß man sich denn alles Schöne selbst verbittern? Man soll den Augenblick ergreifen und genießen, denn im nächsten Moment gehört er uns nicht mehr, er ist in die Ewigkeit hinübergerollt, und wir wissen nicht, was uns die Zukunft bringt. Ist der Augenblick aber so, daß wir uns nicht seiner freuen können, dann sollen wir wenigstens freudig in die Zukunft blicken! Hoffnung ist ein großer Trost, und Hoffnung läßt nicht zu schanden werden, und ich habe dies Wort bis jetzt immer bewahrheitet gefunden.«
»Ja, Hoffnung,« seufzte Ellen tief auf und blickte träumerisch nach dem Nestchen, in welchem noch immer der kleine Vogel seine Jungen fütterte.
Jetzt kam noch ein anderer dazugeflogen, wahrscheinlich das Männchen. Auch dieses brachte den Jungen Futter im Schnabel mit, doch kaum war ihm dieses abgenommen worden, so hüpfte es mit ausgebreiteten Flügeln zu dem Weibchen, zwitscherte laut und liebkoste es mit dem Schnabel.
Aber nicht Betty betrachtete dieses Spiel, sondern Ellen. Sie wußte, an was die Freundin jetzt dachte, und wollte sie nicht in ihren Hoffnungen stören. Ellen hatte vorhin gerade das Gegenteil von dem gesprochen, was in ihrem Herzen vorging. Betty wußte wohl, wie sehr Ellen sich nach Liebe sehnte.
Ach, und sie selbst, Betty, schmachtete sie nicht auch nach dem, der nicht einmal ahnte, wo sie sich jetzt befand? Wie gern hätte sie ihm ein Lebenszeichen gegeben, aber wie wäre dies möglich gewesen, und dann war auch noch der zwar rücksichtsvolle, aber doch auch wieder so unerbittliche Deadly Dash. Er befahl immer mit bittenden Worten, was er aber befohlen hatte, das wollte er auch ausgeführt haben, und nie hätte er geduldet, daß seine Absicht, die Damen als getötet gelten zu lassen, durch irgend einen Wunsch zu nichte gemacht würde.
Doch nur Geduld, die Zeit mußte kommen, da eine Vereinigung ohne Trennung stattfand!
Ellens Gedanken mochten wohl eine andere Richtung bekommen haben. Sie wendete den Kopf vom Neste ab und hob die Augen zum Himmel auf. Hoch oben in dem blauen Aether konnte sie einige dunkle Punkte sehen, welche in großen Kreisen über der Ruine schwebten. Es waren Geier, die ihr Jagdfeld musterten, und ihre Beute bestand in Kadavern. Der Wassermangel der Prärie lieferte ihnen zahlreiche Beute, und die Raubtiere des Waldes fraßen von den niedergerissenen Tieren nur die besten Teile, das übrige überließen sie den Aasgeiern und anderen Marodeuren.
»Könnte ich so hoch in der Luft schweben, und besäße ich den Blick des Adlers!« murmelte Ellen sehnsüchtig.
Die beiden Mädchen schraken plötzlich zusammen. Als käme der Ton aus hoher Luft, so erklang ein kurzer, mißtönender Geierschrei.
»Eins,« zählte Ellen leise, an die Verabredung denkend, »zwei — drei. Auf, Betty, wir müssen uns verstecken!«
Doch sie blieb noch sitzen. Das Signal war entweder unterbrochen worden, oder es war gar keins. Ein Geier hatte wirklich geschrien, wenn man auch keinen in der Nähe erblicken konnte.
Der dritte Ruf sollte nicht, wie die beiden ersten, kurz, sondern langanhaltend ausgestoßen werden, so hatte Deadly Dash angeordnet.
Nun setzte der Schrei auch ganz lang an, brach aber gleich am Anfang wieder ab.
»Was sollen wir tun?« flüsterte Betty.
»Es war ein Geier,« entgegnete Ellen, halb aufgerichtet.
»Es konnte aber auch ein Posten sein, der bei dem Signale unterbrochen wurde.«
»Auch das! Er wird einen der indianischen Bewohner der Ruine gesehen haben und hat signalisiert, dann aber seinen Irrtum erkannt. Diese Indianer brauchen wir ja nicht zu fürchten, sie wissen unseren Aufenthalt und schützen uns sogar.«
»Wir wollen uns lieber verstecken,« meinte Betty. »Der Posten kann auch durch etwas am letzten Schrei gehindert worden sein. Es ist besser, wir sind vorsichtig, weil es der Waldläufer so haben will.«
Ellen half der Freundin auf und führte sie langsam nach der zerklüfteten Mauer. Eine der Spalten lag so versteckt, daß man nicht direkt hineinsehen konnte, und hierher brachte Ellen das kranke Mädchen. Ein anderes Versteck gab es nicht. Wer suchte, hätte sie doch gefunden, und waren sie entdeckt, dann mußten die Trapper sowieso durch einen Schuß zu Hilfe gerufen werden.
»Warten Sie hier!« flüsterte Ellen. »Ich will mich nach unserem Quartier schleichen und fragen, ob sich jemand der Ruine nähert. Ich komme sofort wieder.«
»Bleiben Sie lieber hier,« bat Betty. »Ich fühle mich unheimlich in diesem alten Gemäuer. Es ist zwar lächerlich, daß ich so etwas sage, aber die Schwäche hat meine Nerven empfindlich gemacht.«
»Nur fünf Minuten, liebe Betty. Bedenken Sie doch! Haben wir uns getauscht, war es keine Warnung, so müßten wir ja so lange hier sitzen bleiben, bis wir von den Unsrigen gesucht werden, oder bis wir zufällig jemanden vorbeigehen sehen.«
Daran hatte Betty allerdings nicht gedacht, und so willigte sie ein, allein zurückzubleiben.
Ellen entfernte sich mit dem nochmaligen Versprechen, sofort wieder zurückzukommen, und machte sich dann auf den Weg nach dem Quartier, jeden Stein als Deckung benutzend, um sich vor einem fremden Menschen rechtzeitig verbergen zu können.
Bald hatte Betty sie aus dem Gesicht verloren.
Die fünf Minuten waren verstrichen, und Ellen war noch nicht zurückgekommen; es vergingen weitere zehn Minuten, noch eine Viertelstunde, und Betty war noch immer allein.
Dem einsamen Mädchen wurde es bange. Die Wunde hatte es wirklich sehr geschwächt, und eine Krankheit greift ja nicht nur den Körper, sondern auch die Seele an. Das sonst so mutige Mädchen war etwas furchtsam geworden. Es schauerte zusammen, wenn eine Eidechse neben ihm raschelte, oder wenn sich draußen ein Steinchen von dem Gemäuer löste und mit leisem Geräusch zu Boden fiel.
Was war denn nur vorgefallen? Warum kam Ellen nicht wieder? Sie hätte sie doch wenigstens rufen können, wenn keine Gefahr vorlag, und bei einer solchen wäre sie auch lieber an ihrer Seite gewesen.
Betty war sehr böse auf Ellen, noch böser aber auf sich selber, weil sie ihre Ungeduld gar nicht beherrschen konnte. Sie war eben furchtbar aufgeregt, und als wieder einige Minuten verstrichen waren, ohne die Erwartete zurückzubringen, brach sie sogar in Tränen aus.
Doch ebenso schnell hörten sie wieder auf; da endlich vernahm sie einen leichten, kurzen Schritt, den Schritt Ellens.
Betty konnte sich nicht bemeistern, sie mußte der Ankommenden entgegengehen. Sie ging leise nach dem Ausgang und steckte ganz wenig den Kopf heraus. Der Schritt war schon ganz nahe.
Doch ebenso schnell fuhr sie wieder zurück, preßte die Hand aufs Herz und wäre zu Boden gestürzt, wenn nicht in diesem Augenblick die Gestalt, welche sie erblickte und die ihr solchen Schrecken eingejagt, um die Ecke gesprungen wäre und sie in die Arme genommen hätte.

»Betty,« jauchzte der junge Mann auf, der sie umfaßt hielt.
»Charles! Ist es möglich?« stammelte das Mädchen, den Mann durch die von Tränen umflorten Augen kaum erkennend.
»Es ist möglich,« lachte der Mann und umschlang das Mädchen noch fester. »So überzeuge dich doch, daß ich ein Mensch von Fleisch und Blut bin! So, lege den Arm um meinen Hals, so ist es recht! Nun? Bin ich ein Geist oder wirklich dein Charles?«
Das Mädchen fand keine Gelegenheit zur Antwort; sein Mund wurde von einem anderen verschlossen. Halb besinnungslos duldete es die heißen Küsse, welche kein Ende nehmen wollten, und daß es nicht ohnmächtig war, bewies eine brennende Röte, die sich von der Schläfe bis zum Hals erstreckte.
»Mein Charles!« flüsterte es endlich mit glücklichem Lächeln, als der Wiedergefundene auf einen Moment seine eifrige Beschäftigung einstellte. »So ist es also wirklich kein Traum? Ach, bin ich glücklich! Nun aber trennen wir uns nie wieder!«
»Nie, nie, Betty,« rief Charles leidenschaftlich, ließ die Geliebte auf einen Stein gleiten und kniete selbst vor ihr nieder. »Ich bleibe von jetzt ab bei dir. Keinen Augenblick mehr lasse ich dich aus den Augen. Du armes Kind,« fuhr er teilnahmvoll fort. »Was hast du alles auszustehen gehabt! Ich habe es schon erzählen hören. Du brauchst kein Wort darüber zu sagen, strenge dich also nicht an, und wenn du etwas sagen willst, dann nur drei Worte. Weißt du welche?«
Williams hielt die auf dem Stein Sitzende noch immer umschlungen Mit feuchten Augen blickte er das Mädchen an, um dessentwillen er beinahe seinen ganzen Frohsinn verloren hatte.
»Mein lieber Charles,« flüsterte Betty und neigte den Kopf vor, ihre Lippen den seinen darbietend.
Es ward nicht mehr viel hörbar; sie hatten sich mit Worten nichts zu erzählen; die Küsse und Händedrücke waren die Sprache, in der sie sich verständigten.
Auch draußen war es still. Nur die beiden Vögelchen zwitscherten, und die unersättlichen Jungen schrien nach neuer Aesung. Aber Betty achtete jetzt nicht mehr auf sie, sie brauchte das Pärchen nicht mehr zu beneiden.
Endlich machte sie sich sanft aus der Umarmung frei. Sie dachte daran, daß sie und ihr Geliebter nicht die einzigen Menschen auf der Erde seien.
»Gibt es noch mehr Glückliche in diesen Ruinen?« fragte sie lächelnd.
»Was geht das mich an?« rief Charles lustig. »Ich bin glücklich, ich sehe dich glücklich, und nach anderen frage ich nicht.«
»Das ist nicht schön von dir.«
»Warum nicht? Glaubst du die anderen kümmern sich jetzt um uns?« scherzte Charles, der mit Betty auch seine gute Laune wiedergefunden hatte, weiter. »An verschiedenen Stellen geht es jetzt ebenso zu wie hier.«
»Wie denn?«
Charles zeigte ihr, was er meinte, das heißt, er küßte sie wiederholt.
»So sind alle Herren hier?«
»Ja, und Hope und Hannes ebenfalls. Diese sind vielleicht die einzigen, welche sich vernünftig betragen, weil bei denen die Liebe etwas Altes ist, sie sehen nur zu.«
»Pfui, Charles, das ist ungezogen! Wie kannst du so sprechen?«
»Aber wunderbar ist es,« fuhr Charles lustig fort, »was sich zwischen diesem alten Steingerümpel alles offenbart. Ich hatte mir nicht träumen lassen, daß sich schon so viele Herzen zusammengefunden haben. Das flog sich nur immer so in die Arme, eine dorthin, die andere dahin, dann fiel da ein Kuß, dann einer dort, und es war ein Jauchzen, ein Weinen und Lachen, daß es mir angst und bange wurde.«
»Wie fandest du mich?« fragte Betty lächelnd.
»Ich bemerkte gleich, daß du nicht da warst, und erfuhr das Ziel deines Spazierganges.«
»Hat Marquis Chaushilm auch ein Herz gefunden, das ihn erwartet hatte?«
»Der? Nun, ich weiß nicht, ich glaube, er hat wieder einmal mehr Glück als Verstand bei der Geschichte gehabt. Mir kam es erst vor, als wolle er sich mit ausgebreiteten Armen auf Miß Nikkerson stürzen, da aber kam zufällig Lord Hastings dazwischen, und der liebebedürftige Herzog kam an dessen breiter Brust zu liegen. Chaushilm schien erst nicht zu merken, daß er seinen Arm um einen Mann geschlungen hatte, und Hastings zog ein sehr dummes Gesicht. Dann aber packte er den Herzog am Kragen und schleuderte ihn mit einem seiner kräftigen Flüche von sich. Der Herzog drehte sich einige Male um sich selber und kam endlich an der Brust einer Dame zur Ruhe. Dort lag er noch, als ich die Gruppe verließ. Weißt du, wer die Dame ist?«
»Jedenfalls Miß Sargent.«
»Alle Wetter, sollte da doch kein Zufall vorliegen?« rief Charles erstaunt. »Na, meinetwegen, ich gönne es ihm von Herzen. Aber bei Miß Sargent kann er sich in acht nehmen, die hat ihn gleich am ersten Tage unter dem Pantoffel.«
»Und Lord Harrlington?«
»Der rannte wie ein wildes Tier herum. Richtig, nun fällt mir erst ein, was ich schon immer fragen wollte: Wo ist Miß Petersen geblieben? Sie ist nicht hier und war auch vorhin nicht bei den übrigen.«
»Sie befand sich auf dem Wege dorthin, du hättest ihr begegnen müssen.«
»So. Na, dann wird Lord Harrlington wohl auch schon zur Ruhe gekommen sein.«
»Und Mister Davids?«
Das lachende Gesicht von Charles wurde plötzlich sehr ernst.
»Mister Davids zeigte keine Freude,« entgegnete er.
»Er begrüßte die erste Dame, die er sah, sehr höflich; als sein Gruß aber unbeachtet blieb, verlor er sich zwischen den Steinen. Erst als Harrlington vergeblich nach Miß Petersen ausschaute, erbot er sich, die Vermißte zu suchen. Beide verließen die Gruppe gleichzeitig mit mir.«
»Wie habt Ihr uns eigentlich gefunden? Das ist doch kein Zufall!«
»Durchaus nicht! Wir wußten schon, daß Ihr in Matagorda wäret, und als wir im Hafen ankamen, erfuhren wir sofort durch eine Agentin, daß wir die Vestalinnen hier in den Ruinen finden würden. Hals über Kopf stürzten wir durch den Wald und ruhten nicht eher, als bis wir die Stolle in Sicht bekamen. Wie heißt der lange Kerl mit der kleinen Flinte, der hier eine Art von Aufsicht führt?«
»Deadly Dash.«
»Richtig, Deadly Dash. Dieser Mann empfing uns im Walde; er mußte schon auf uns gewartet haben, und einem Trapper, der wie ein Geier schreien wollte, legte er schnell die Hand auf den Mund, so daß der letzte Ruf kurz abbrach.«
»Das stimmt. Darum habe ich mich auch hier versteckt. Warum bleiben wir denn überhaupt hier in diesem dumpfen Loch? Laß uns hinausgehen in die Sonne.«
»Bleib' lieber hier,« bat Charles. »Hier sind wir ungestörter. Oder willst du lieber in die Sonne, weil sie dich erwärmt?«
»Wo du bist, da scheint immer die Sonne, und wenn es im dunkelsten Kerker wäre,« sagte Betty zärtlich und umschlang von neuem den Hals des Geliebten. »O Charles, wenn du wüßtest, wie ich mich nach dir gesehnt habe.«
»Und ich mich nach dir! Nun aber, da wir uns wiedergefunden haben, soll es keine Trennung mehr geben!«
»Niemals mehr!«
»Bis zum Tode?«
»Ja, bis in alle Ewigkeit.«
»Und noch ein paar Jahre länger.«
»O, Charles, kannst du denn nun gar nicht ernst sein?« schmollte das Mädchen. »Ich glaubte, die Schicksalsschläge hätten aus dir einen vernünftigen Menschen gemacht.«
»Aber Betty, wenn diese Stunde auch keine lustige ist, Grund zum Traurigsein haben wir doch nicht. Ich bin ja so fröhlich, und du weißt, wie sich meine Fröhlichkeit äußert. Oder willst du, daß ich immer ganz ernst bin? Dir zuliebe würde ich mir Mühe geben und nie wieder etwas sagen, worüber jemand lachen könnte.«
»Nein, nein, bleibe so, wie du bist!« rief Betty. »Es war nur Spaß von mir. Ich möchte dich niemals anders sehen als so, wie damals, da ich dich kennen lernte. Ich weiß, du bist kein oberflächlicher Mensch, nur Blinde und Törichte halten dich für einen solchen.«
Es währte lange, ehe sich die beiden erinnerten, daß die Freunde und Freundinnen sie vermissen und suchen könnten. Betty dachte zuerst daran, und zwar an Ellen.
»Wir müssen zurückgehen,« sagte sie. »Gib mir deinen Arm, mir fällt das Gehen schwer.«
»Meinen Arm? Nein, den gebe ich dir nicht!«
»Nicht, was soll das heißen?«
»Was habe ich dir vorhin gesagt?«
»Du hast mir so viel gesagt, Schmeicheleien, Dummheiten und Sachen, von denen vielleicht manches Lüge war, daß ich gar nichts mehr weiß.«
»Ich sagte dir, ich wollte dich mein ganzes Leben lang aus den Händen tragen, und damit will ich jetzt anfangen.«
Im Nu saß Betty auf dem Arme Charles'.
»Das ist auch wieder nicht wahr,« scherzte das Mädchen, sich an ihn schmiegend. »Dein ganzes Leben lang wirst du das wohl nicht aushalten können.«
»Nur absetzen muß ich natürlich manchmal, damit ich etwas verschnaufe.«
Unter solchen Reden trat Charles mit seiner süßen Last ins Freie, noch aber waren sie keine zehn Schritte gegangen, als wieder der Geierruf dreimal erschallte, diesmal so, wie es als Warnungssignal verabredet worden war.
»Schnell, wir müssen uns verstecken,« drängte Betty, »die Waldläufer wollen es so haben.«
»Was gehen mich die Waldläufer an,« brummte Charles und blieb unschlüssig stehen.
»Haltet ihn, laßt ihn nicht entkommen!« schrie da eine Stimme über den beiden, und als sie aufblickten, sahen sie gerade über sich auf der halb zusammengestürzten Terrasse Deadly Dash stehen, die Büchse schußbereit an der Wange.
Da raschelte es neben ihnen. Wie eine rote Schlange glitt plötzlich ein Indianer zwischen den Steinen hindurch und war im nächsten Augenblick verschwunden, doch schon kam mit mächtigen Sprüngen eine Dogge gerannt, die Nase dicht am Boden, und gleich darauf schlüpfte wieder ein anderer Indianer, Stahlherz, wie ein Schemen an ihnen vorbei.
»War das ein Schattenspiel?« rief Charles erstaunt.

Ueberrascht sah Williams zur Seite — da huschte schon wie
eine rote Schlange ein Indianer unmittelbar an ihm vorüber.
»Bindet ihn!« schrie oben wieder der Waldläufer. Unwillkürlich lenkten sie die Blicke in die Höhe, sie sahen, wie er die kurze Büchse, deren Lauf noch rauchte, zu Boden senkte, und wie er auf der anderen Seite abstieg.
Einen Schuß hatten sie aber nicht gehört.
Der Eingang zu den Räumen, welche von den Mädchen und den Trappern bewohnt wurden, lag ziemlich weit entfernt von der Stelle, wo Charles und Betty das Glück des Wiedersehens kosteten. Die Entfernung war eine so große, daß das Lärmen der vielen Menschen nicht zu ihnen drang, denn ohne Geräusch ging das Zusammentreffen doch nicht ab. Die Ausrufe der Freude und des Jubels nahmen kein Ende.
Verwundert schauten die Trapper auf die Herren und Damen, welche sich so ganz ohne Scheu um den Hals fielen und sich küßten. Sie hatten so etwas lange nicht gesehen, vielleicht überhaupt noch niemals, wie sie auch von Liebe ganz eigentümliche Begriffe hatten. Ihre Meinung war nun einmal, daß man für Liebe bezahlen müsse, und zwar so viel, daß man sich hinterher stets über den Luxus ärgerte, geliebt zu haben.
Joker, der Cowboy, war einer der Gebildetsten; er war in den Städten schon mehrmals im Theater gewesen, und da hatte er noch eine andere Art von Liebe gesehen. Schnell hatte er sich sein Urteil gebildet.
»Hol mich der Henker,« sagte er zu seinem Nachbar, dem alten Fallensteller. »Jetzt weiß ich, was für Leute das sind. Ich hätte mir das eigentlich gleich denken können, als ich die Weiber in Männerkleidung sah.«
»Nun, was für Leute sollen es denn sein? Vielleicht Geschwister?« brummte die Biberratte.
»Bah, Geschwister! Die prügeln sich lieber, als daß sie sich küssen. Ich hätte meine Schwester nie geküßt, und wenn sie mir für jeden Kuß einen Dollar gegeben hätte.«
»Das sind aber feine Leute. Bei solchen küssen sich vielleicht die Geschwister.«
»Unsinn, ich weiß jetzt, was für Leute es sind.«
»Nun?«
»Verdammt will ich sein, wenn es nicht Komödianten sind, die machen es gerade so.«
»Komödianten? Was ist das?«
»Ja, Biberratte, das ist schwer zu erklären. Komödianten sind Leute, welche sich in einem Hause gegenseitig totstechen, totschießen, prügeln, lieben und allerlei dummes Zeug treiben. Die, welche zusehen wollen, müssen Geld dafür bezahlen, einen halben Dollar bis zehn, ich bezahlte natürlich immer zehn Dollar. Die am meisten bezahlen, sitzen unten, und die ganz wenig bezahlen, oben. Ich saß immer ganz vorn. Wenn nun jemand totgestochen worden ist, dann klatschen die Zuschauer in die Hände und schreien, manchmal pfeifen sie auch, kurz, es ist ein Höllenspektakel, und ich schrie natürlich immer am tollsten, obgleich ich nicht wußte, warum. Einmal habe ich sogar mit dem Revolver geschossen, weil das noch mehr Spektakel machte, aber das hat man mir verboten.«
»Das ist ja merkwürdig,« sagte die Biberratte, den greisen Kopf verwundert schüttelnd. »Darf denn da jeder hinein?«
»Jeder, der bezahlt.«
»Und die stechen sich tot?«
»Freilich, aber sie werden wohl nicht tief stechen, denn ich habe selbst gesehen, wie einer von den Komödianten, der totgestochen worden war, nachher in einer Schenke Bier trank. Ich forderte ihn dann zu einem Glas Whisky auf, und der Kerl konnte wie ein Loch saufen.«
»Mich wundert nur, daß so etwas erlaubt ist. Dann geht es ja in der Stadt noch viel wilder her, als in der Prärie. Donnerwetter, stechen die sich ganz öffentlich tot! Hör' mal, Joker, du flunkerst mir wieder einmal etwas vor.«
»Wirklich nicht,« beteuerte der Cowboy.
»Mischen sich da die Zuschauer nicht ein? Das ist doch eine furchtbare Ungerechtigkeit.«
»Man darf sich nicht dazwischen mengen. Mein Freund Tommy war einmal mit mir in der Stadt. Wir hatten uns vorgenommen, in drei Tagen tausend Dollar durchzubringen, was uns auch geglückt ist. Ich nahm ihn mit in das große Haus. Tommy wollte nämlich nicht glauben, daß sich die Leute darin totstechen und niemand sie daran hindert. Tommy saß denn auch mit offenem Munde da und starrte sprachlos die Männer und Weibchen an, die wie Puppen herumhopsten. An dem Abend wurde nun aber keiner totgestochen, und das tat mir furchtbar leid. ›Siehst du, du hast gelogen, Joker,‹ sagte Tommy zu mir. In diesem Augenblick aber zieht ein Kerl in hohen Stiefeln und mit einer einen Meter langen Feder am Hut den Degen heraus und springt auf das Mädel zu, mit dem er ganz allein da steht. ›Willst du mein Weib sein?‹ schreit er es grimmig an. ›Nein, nein, nein!‹ heult das kleine Mädchen, weint, ringt die Hände und rutscht auf den Knien herum. ›Ich steche dich tot!‹ schreit er. ›Du lieber Gott, ist denn keiner da, der mich von diesem Ungeheuer befreien will?‹ schreit das Mädchen wieder.«
»Ist das auch alles wahr?« unterbrach die Biberratte mißtrauisch den Erzähler.
»Verdamme meine Augen, wenn es nicht so ist! Nun aber weiter! In dem Hause war es totenstill geworden, und der Kerl mit der Feder brüllt, und die Kleine heult. Da steht mein Freund Tommy auf, dreht sich um und schreit den Zuschauern zu: ›Ihr feigen Hunde, könnt Ihr denn der Kleinen nicht beistehen?‹ Und ehe ich mich versehe, saust schon sein Lasso durch die Luft, die Schlinge legt sich dem Räuber, der eben stechen will, um den Körper, ein Ruck, und der Kerl fliegt über den Boden, reißt einige Lampen um, nimmt einige Stühle mit und liegt dann vor den Füßen Tommys, der ihn am Kragen packt und links und rechts ohrfeigt. ›Du ehrloser Wicht,‹ schreit er, ›wie kannst du Lump ein wehrloses Mädchen erstechen wollen? Warte, dir will ich so etwas austreiben, du kennst Tommy noch nicht.‹ Und dabei prügelte er den Kerl windelweich.
»Nun aber ging es los. Der Räuber heulte unter den Füßen Tommys. Die Zuschauer schrien und johlten. Das Mädchen vorn jammerte, und da dachte ich, ich müßte mitmachen und schoß mit dem Revolver dreimal in die Luft. Oben saßen auch noch einige wilde Kerle, und diese schossen auch mit. Es war ein Höllenspektakel. Da tritt plötzlich vorn auf das Ding — ich glaube, es heißt Bühne — ein anderer Kerl, der gar nicht darauf paßte, weil er einen Zylinder und einen Frack trug. Man sagte mir später, es wäre der Direktor von dem Hause gewesen. Der hob die Hände auf und machte immer Bewegungen, als ob er sprechen wollte, aber wir ließen uns nicht beruhigen. Zuletzt machte er mir aber zu viel Kapriolen. Ich schnallte sachte meinen Lasso ab, und ehe der Direktor sich's versah, riß ich ihn ebenfalls von der Bühne herunter. Nun ging der Spektakel nochmals los.
»Plötzlich stürzten hinter einem Vorhange hervor ein Dutzend Menschen auf uns beide zu, wie ich sie komischer noch gar nicht gesehen habe. Der eine sah aus wie ein Mönch, der andere war ganz in eiserne Kleidung gehüllt, der dritte war fast ganz nackt. Einer hatte hellblonde, lange Haare und einen schwarzen Schnurrbart, an einem Fuße einen Pantoffel, an dem anderen einen hohen Stiefel mit Sporen, kurz, es war ein närrisches Volk.
»Wir beiden sahen gleich, daß sie uns zu Leibe wollten, und wir machten uns bereit, sie ordentlich zu empfangen. Ich griff gleich dem Mönch in seinen langen, weißen Bart, denke dir aber meinen Schrecken, als mir die ganzen Haare in der Hand blieben, und aus dem ehrwürdigen Mönche plötzlich ein junges Bürschchen von siebzehn Jahren ward!«
»Es war ein falscher Bart, wie ihn die Indianer bei ihren Medizintänzen umbinden,« bemerkte die kluge Biberratte.
»Ganz richtig, das weiß ich jetzt auch. Damals aber erschrak ich und griff nach dem Revolver. Tommy machte es ebenso, und das Dutzend Kerle flog zurück, wir schnell zwischen ihnen hindurch, unter dem Halloh der Zuschauer hinaus und auf die draußen angebundenen Pferde. Seit der Zeit bin ich nie wieder in solch einem Hause gewesen.«
Es ist kaum anzunehmen, daß die alte Biberratte nun wußte, wovon Joker gesprochen hatte, was er mit dem großem Hause und den Komödianten meinte. Der Fallensteller hatte eben noch nie von einem Theater gehört und wie man in einem solchen das menschliche Leben in Wahrheit oder Phantasie, so wie es ist oder sein könnte, darstellt.
Ueberhaupt hielt er die Erzählung des Cowboy für erlogen, aber er betrachtete jetzt die Szene da unten mit ganz anderen Gefühlen.
Das waren also Komödianten, die sich für Geld sehen ließen. Jetzt küßten sie sich, und nachher stießen sie sich vielleicht wieder. Und dafür wollten sie Geld haben? Bah, die alte Biberratte würde sich schön hüten, ihnen auch nur einen Cent für solchen Unsinn zu geben.
Die Leutchen wußten nicht, daß sie für Komödianten gehalten wurden, sie spielten ihre Rolle natürlich, die Wonne und Seligkeit, in der sie schwammen, war nicht erkünstelt.
Es war die schönste Stunde der ganzen Weltreise. Alle Vorschriften der ›Vesta‹ wurden zu Boden getreten. Niemand dachte mehr an sie, und dies alles hatte nur die lange Trennung bewirkt, während welcher die Damen in schweren Leiden so recht die Abwesenheit der Herren bedauert, bis sich das Bedauern in Sehnsucht, in namenlose, unermeßliche Sehnsucht umgewandelt hatte.
Jetzt war der Augenblick gekommen, da diese gestillt wurde. Waren es auch nicht nur Liebespaare, die sich hier zusammengefunden hatten, die meisten waren es doch, einige empfanden erst jetzt, daß sie zusammengehörten, und nur sehr, sehr wenige gab es, welche sich bloß mit herzlicher Freundschaft begrüßten.
Einige fanden nicht sofort die Person, welche sie suchten, so zum Beispiel Charles, doch der instinktive Spürsinn führte sie schnell auf die rechte Fährte.
Lord Harrlington aber suchte vergebens nach Miß Petersen. Mit klopfendem Herzen fragte er einige Damen, wo sie sich befände, aber er erhielt nur sehr ungenaue Antworten. Jeder war nur mit sich selbst und seiner Liebe beschäftigt.
Endlich erfuhr er, daß Miß Petersen mit Miß Thomson nach einem kleinen Haine gegangen sei. Der Platz wurde ihm beschrieben, und sofort machte er sich auf den Weg.
Es war nicht so leicht, sich zwischen dem Steingeröll der Ruine zurechtzufinden, eine des Weges kundige Dame fand er nicht bereit, ihn zu führen, und so wollte er schon allein aufbrechen, als sich John Davids ihm anschloß.
»Erlauben Sie, daß ich Sie begleite,« sagte er, »es ist besser, wir gehen zu zweit.«
Harrlington blieb zögernd stehen.
»Ich bin nicht so indiskret dem Wiedersehen beiwohnen zu wollen,« lächelte Davids, »nur suchen will ich Ihnen helfen.«
Jetzt gab Harrlington das Zögern auf. Er murmelte eine Ausrede und lief mit großen Schritten voraus, so daß ihm John Davids kaum folgen konnte.
Sie kamen an den beiden Männern vorüber, welche sich über Komödianten unterhielten.
»Wo ist hier ein Orangenhain?« rief Lord Harrlington den Männern schon von weitem zu.
Die Antwort blieb aus, bis sie dicht heran waren, und Harrlington wiederholte seine Frage nochmals.
»Ein Orangenhain,« brummte die Biberratte. »Ich kenne hier keinen. Habe hier niemals Orangen gesehen, aber genug Vogelbeeren.«
Doch Joker war gefälliger, er wollte sich als einen besser erzogenen Menschen aufspielen und sagte daher mit einer Verbeugung:
»Doch, doch, glaubt diesem blutigen Lügner nicht, Herr Komödiant. Geht hier gerade aus, an der verfallenen Mauer vorbei, biegt die vierte Schlucht links ein, geht etwa fünfzig Meter wieder geradeaus, bis Ihr an den Stein mit der Nase kommt, dort biegt links ein. Dann seht Ihr ein paar Orangenbäume stehen, an denen aber keine Orangen wachsen. Ihr seid dort ganz ungeniert, kein Mensch sieht es, wenn Ihr Euch totstecht.«
Die beiden Herren sahen sich verwundert an, sie begriffen den Sinn dieser Worte nicht, schlugen aber doch unverzüglich die angedeutete Richtung ein.
»Siehst du, es sind Komödianten,« erklärte Joker der Biberratte. »Jetzt gehen sie zu den Bäumen und schießen oder stechen so lange, bis einer tot ist.«
»Aber warum denn, nur so zum Spaß?«
»Hast du nicht bemerkt, wie erregt beide waren? Gerade so wurde es in dem großen Hause gemacht, und ich habe gehört, in den Städten soll es unter den feinen Herren ebenso zugehen. Wenn da nämlich einer zu dem anderen ›Du Lügner‹ sagt oder ihn nur einmal scheel ansieht, oder wenn zwei ein und dasselbe Mädchen lieben, dann ist es ihre Pflicht, sich gegenseitig totzuschießen, und wenn sie es nicht tun, dann sind sie ehrlos, und kein Hund nimmt von ihnen ein Stück Brot mehr an.«
»Nanu,« rief der Fallensteller, »alle beide schießen sich tot?«
»Nein, nur manchmal, gewöhnlich bleibt einer davon leben und zwar fast immer der, der Schuld hat. Aber du darfst nicht denken, daß sie sich vorher hassen oder schimpfen. Gott bewahre, sie sind ganz höflich miteinander, und das Komischste dabei ist, daß der, der den anderen erschossen hat, hinterher gewöhnlich weint und den Toten um Verzeihung bittet.«
»Und du meinst, die beiden wollen sich auch schießen, weil der eine den anderen beleidigt hat?«
»Sicherlich, aber ich will nicht sagen, daß sie sich beleidigt haben. Der eine kann den anderen nur auf den Fuß getreten haben, dann aber müssen sie sich schon schießen. Sie stellen sich gegenüber, zählen bis drei, und bei drei schießen sie beide los. Gewöhnlich wird der getroffen, welcher den anderen getreten hat.«
»Hahaha,« lachte der alte Fallensteller aus vollem Halse, »das kann doch kaum möglich sein. Wenn mich ein Esel tritt, dann schieße ich ihn doch auch nicht gleich tot, sondern prügle ihn ordentlich durch.«
»Feine Leute prügeln sich nie, sie schießen oder stechen nur, aber immer zu gleicher Zeit, damit der andere nicht im Nachteil ist, sagen sie.«
»Das möchte ich doch einmal sehen.«
»Das können wir. Es ist überhaupt nicht mehr nötig, daß wir hier stehen. Komm, Biberratte, wir wollen zusehen, wie sich die beiden totschießen.«
»Aber dann wollen sie Geld für das Zusehen haben,« meinte Biberratte, sich in den Haaren kratzend.
»Wenn sie es nicht vorher verlangen, gebe ich ihnen keins, und überhaupt ist dies ja kein Haus, hier kann ich hingehen und Hinsehen, wohin ich will, niemand hat es mir zu verbieten.«
Die beiden schulterten die Büchsen und gingen der Richtung zu, in welcher die Lords verschwunden waren.
Kaum hatten sich die beiden Posten entfernt, so kroch hinter dem Felsen, an welchem sie gestanden hatten, eine kleine, geschmeidige Gestalt hervor, ein Indianer, und blickte sich nach allen Seiten vorsichtig um. Ein häßliches Lächeln überflog dabei sein bronzefarbenes Gesicht.
»Fort,« murmelte er. »Besser hätte ich es nicht treffen können. Jetzt schnell zu dem weißen Mädchen! Es wird mir willig folgen, und Schmalhand wird seinen Lohn bald verdient haben.«
Wie eine Schlange wand er sich durch die Steine und schlug den Weg ein, welcher nach der Gruppe der Herren und Damen führte, die noch immer scherzend und kosend zusammenstanden. Das Weggehen der beiden Posten machte ihm diesen Weg möglich.
Vorsichtig kroch und schlich er, ehe er aber in Sicht der vielen Menschen kam, schlüpfte er schnell zur Seite und folgte dann schnell den Weg, der nach dem Orangenhain führte.
Er wurde von niemandem gesehen, denn alle hatten jetzt etwas anderes zu tun, als auf Spione zu achten.

Schmalhand, wie sich der Indianer genannt hatte, kroch so dicht auf der Erde hin, bis er vor sich einen leichten Schritt vernahm, und eine helle Kleidung zwischen den Steinblöcken schimmern sah. Er befand sich jetzt gerade in einem ganz zerstörten Teile des alten Tempels; jeder Block bot ein sicheres Versteck. Man bewegte sich hier wie in einem Labyrinth. Es gab hundert Wege. Links und rechts führten sie ab, so daß man überallhin ausweichen konnte.
Schmalhand hob den Kopf und spähte. Er befand sich hier allein, nur leichte Schritte näherten sich ihm.
Jetzt sprang er auf und stand vor dem ankommenden Mädchen, welches erschrocken zusammenfuhr, aber auf das friedliche Zeichen des Indianers hin, nicht laut aufschrie. Nur ein leiser Ruf des Schreckens war ihr entschlüpft. — — — —
Die beiden Herren, Lord Harrlington und John Davids, hätten eigentlich auf dem Wege nach dem Orangenhain Miß Petersen treffen müssen, wenn der Weg eben nicht so zerklüftet gewesen wäre und so unendlich viele Abzweigungen gehabt hätte.
Die Erklärung des Cowboys war eine sehr deutliche gewesen, aber sie fanden die bezeichneten Merkmale nicht, und schon nach kurzem mußten sie sich gestehen, sich verlaufen zu haben. Lord Harrlington wollte auf gut Glück weiter nach dem Haine suchen. Davids schlug vor, zurückzukehren und einen Führer mitzunehmen.
Auf diese Weise hatten sie also die unterdes zurückgekehrte Ellen verpaßt.
Während beide noch dastanden und berieten, was zu tun sei, erblickten sie zu ihrer Freude die zwei Männer, welche sie vorhin angesprochen hatten. Sie waren ihnen gefolgt.
»Nun, noch nicht geschossen?« rief ihnen Joker zu.
Die Frage wurde nicht verstanden; man hielt den Cowboy für etwas verrückt oder für einen unsinnigen Spaßmacher.
»Guter Freund, zeigt uns den Weg nach dem Orangenhain,« sagte Harrlington. »Ihr sollt es nicht zu bereuen haben.«
»Mit dem größten Vergnügen. Wir wollen auch weiter nichts dafür haben, als die Erlaubnis zusehen zu dürfen, wenn Ihr Euch totschießt,« entgegnete Joker.
Die beiden achteten nicht mehr auf den vermeintlichen Spaßmacher, sie hielten seine Reden für plumpe Witze oder Folgen eines überspannten Geistes. Die Hauptsache war ihnen, daß er ihnen den Weg zeigte, und dazu war er willig.
»Seht Ihr die Bäume zwischen den Felsen?« fragte Joker die Herren.
Diese bejahten.
»Das wird der Platz sein, den Ihr sucht. Vorhin ging schon ein anderer Herr hin, er suchte zwei Mädchen auf.«
Harrlington eilte voraus, jetzt konnte er seine Ungeduld nicht mehr bemeistern. Ellen, nur Ellen, das war sein einziger Gedanke und seine einzige Triebfeder.
Er war den drei anderen weit voraus. Jetzt mußte er um eine Ecke biegen. Er blieb plötzlich stehen, dann aber stürzte er mit ausgebreiteten Armen auf die weibliche Gestalt zu, die vor ihm stand, und jauchzte laut auf.
Harrlington sah Ellen vor sich stehen, aber ach, wie hatte sie sich verändert! Beim ersten Anblick sah er, wie mager sie geworden war, doch was machte das, wenn es nur seine Ellen war.
Doch Ellen zeigte keine Freude, erschrocken fuhr sie zurück, und noch ehe der Lord sie erreicht hatte, floh sie schon so schnell als möglich zurück.
Was sollte das bedeuten?
Lord Harrlington stand erst wie erstarrt, dann aber setzte er sofort der Flüchtigen nach. Sie schämte sich vor ihm, sie glaubte vielleicht, er zürne ihr, weil sie nun ihr Unrecht eingesehen habe, und der Stolz war aus ihrem Herzen noch nicht ganz entfernt.
Aber Harrlington jubelte auf. Diese Flucht zeigte ihm, wie sie sich geändert hatte, denn früher wäre sie nicht vor ihm geflohen, sie wäre ihm stolz, kalt und hochmütig entgegengetreten.
Er lief ihr nach. Ach, wie wollte er die Geliebte haschen und sie im Triumph an seinem Arme zurückkehren!
»Hah, was ist das?« rief Joker.
»Laßt sie,« entgegnete Davids, »wir wollen zurückkehren. Wir sind jetzt überflüssig geworden.«
»So wollt Ihr Euch also nicht schießen?«
»Nein, wir wollten es überhaupt niemals.«
»Daraus werde ein anderer klug,« brummte die Biberratte. »Ich glaube, Joker, du bist der größte Lügner unter der Sonne. Du hast schon gelogen, wie du als Säugling zum ersten Male den Mund auftatest.«
»Unsinn, so etwas kommt in einer Komödie immer vor,« verteidigte sich Joker, »es ist aber nicht anständig, wenn zwei hinter einem Mädchen herlaufen.«
»Was sagst du da?« schrie ihn plötzlich Davids an, und es schien fast, als wolle er den Sprecher an der Brust packen.
Doch gleich besann er sich wieder, fuhr mit der Hand über die Stirn und schlug eiligst den Rückweg wieder ein.
Kopfschüttelnd blickte ihm die Biberratte nach.
»Siehst du, er ist doch so ein halbverrückter Komödiant,« sagte Joker. »Er rennt immer halb im Traume herum und muß erst fühlen, ob er seine Augen wirklich offen hat, sonst glaubt er manchmal, er schlafe oder träume.«
Lord Harrlington gelang es doch nicht gleich, Ellen einzuholen, das Mädchen war leichtfüßig. Er wunderte sich zwar nicht wenig, warum sie vor ihm floh. Einige Schritte hätten ja genügt, um ihre Bestürzung anzudeuten, aber er kannte die Launen der Weiber. Er gab die Verfolgung nicht auf, dem gewandten Läufer konnte sie doch nicht entgehen.
Immer mehr näherte er sich ihr.
»Ellen, Ellen,« rief er, aber vergeblich.
Sonderbar, Ellen hatte schon die Ruinen hinter sich, jetzt lief sie dem Waldessaum zu. Fast hatte sie ihn erreicht, Harrlington befand sich noch zwischen den Steinen, als plötzlich etwas geschah, was ihn veranlaßte, wie eine Bildsäule stehen zu bleiben.
Ellen hatte den Wald erreicht, da aber stürzten eine Menge Indianer vor und umringten das Mädchen. Einer hob es trotz ihres Sträubens und Hilferufens auf den Arm, und ebenso schnell war alles wieder im Walde verschwunden.
Entsetzt starrte Harrlington nach der Stelle, wo sich die Szene ereignet hatte. Er glaubte nicht richtig gesehen zu haben.
Wollte denn sein Unglück nur gar nicht aufhören? Mußte die grausame Hand des Schicksals immer störend eingreifen?
Doch im nächsten Augenblick war er wieder bei Besinnung. Er riß den Revolver aus der Tasche und wollte schon den Indianern nachstürzen, als er von hinten am Gürtel gepackt wurde.
»Nicht so hitzig,« rief ihm eine Stimme in's Ohr, »Mit Kaltblütigkeit und Ueberlegung kann man zweimal so viel erreichen und doppelt so schnell zum Ziele kommen, als durch bloßen Mut.«
»Laßt mich los,« schrie Harrlington in höchster Wut und versuchte sich von dem eisernen Griff des alten Fallenstellers zu befreien, der mit Joker ihm nachgekommen. »Laßt mich los, sonst ist es zu spät!«
»Nichts da,« rief auch Joker, »allein könnt Ihr gegen die Indianer nichts ausrichten, sie skalpieren Euch im ersten Augenblick.«
Dennoch wäre es dem starken und gewandten Harrlington gelungen, sich loszumachen, wenn nicht in diesem Augenblick Deadly Dash erschienen wäre und auch seine Warnung hätte hören lassen:
»Geben Sie nach, Lord Harrlington!« rief seine mächtige Stimme. »In fünf Minuten sind wir alle bereit, der Geraubten nachzusetzen.«
Jetzt hörte Huntington auf die Ermahnung; er fügte sich und ging wenige Schritte zurück, wo er einige Trapper um einen Gegenstand stehen sah.
Er sah einen Indianer am Boden liegen, aus dessen Schenkel ein Blutstrom quoll und auf ihm kniete Stahlherz, aber nicht, um die Wunde zu untersuchen, sondern es schien, als wolle er den halb Ohnmächtigen erdrosseln.
Stahlherz Züge hatten sich furchtbar verändert; der edle Ausdruck war daraus verschwunden und hatte einem solchen von entsetzlichem Haß Platz gemacht. Die Augen, auf den kleinen Indianer geheftet, traten fast aus den Höhlen, und die Hand, welche die Kehle zuschnürte, zitterte wie im Fieber.
Die Trapper wußten gar nicht, was vorgefallen war. Sie hinderten Stahlherz nicht am Würgen, und der Verwundete wäre sicher bald erstickt gewesen, wenn des Indianers Hand nicht von einem festen Griff gepackt und er selbst von seinem Opfer hinweggerissen worden wäre.
Wütend wollte Stahlherz das Messer erheben, als er aber in die ernsten Züge von Deadly Dash blickte, ließ er es sinken.
»Es ist Schmalhand,« sagte er grimmig.
»Ich habe ihn sofort erkannt. Will mein roter Bruder den töten, der unbedingt leben muß, weil er sonst nicht sprechen kann?«
»Deadly Dash hat recht. Stahlherz hat wie ein Kind gehandelt,« gestand der Indianer, ließ aber seine Augen grimmig auf dem am Boden Liegenden heften.
»Rasch, wir haben keine Zeit zu verlieren,« drängte Harrlington. »Wißt Ihr, um was es sich handelt?«
»Ich weiß es und auch die Trapper. Wer begleitet uns?«
Alle Trapper traten vor, aber Deadly Dash suchte sich nur einige aus.
»Ihr übrigen bleibt hier und sorgt für die Sicherheit der Herren und Damen,« sagte er. »Jetzt bringt Pferde her.«
Die Herren waren zu Pferde gekommen; eine Minute später waren die als Verfolger ausgesuchten Leute beritten.
»Kommst du nicht mit, Stahlherz? Wir können dich gut gebrauchen.«
Doch Stahlherz schüttelte den Kopf.
»Ich bleibe bei diesem,« sagte er, auf Schmalhand deutend, »ich werde ihn pflegen, bis seine Wunde geheilt ist, damit er meine Rache doppelt fühlt.«
»Hebe ihn auf, bis ich zurückkomme!«
»Stahlherz wird ihn wie eine Mutter pflegen,« entgegnete der Indianer mit einem furchtbaren Lächeln.
Deadly Dash pfiff Lizzard. Die Dogge sprang an seinem Pferde empor und rannte der Reiterschar voraus, dem Walde zu. Harrlington konnte seine Ungeduld nicht mehr bezähmen, er gab seinem Rosse die Sporen zu fühlen, daß die Weichen bluteten.
Die anderen Herren und Mädchen wußten noch gar nicht, was geschehen war. Erst die zurückkehrenden Trapper brachten die entsetzenerregende Nachricht mit, daß Ellen von Indianern geraubt worden sei.
Es war den Waldläufern, selbst unter der Führung von Deadly Dash, nicht so leicht geworden, die Fährte der flüchtigen Indianer zu verfolgen. Dieselben hatten sorgfältig darauf geachtet, ihre Spur zu verwischen, und da sie mehrere Male in Kanoes auf kleinen Flüssen gefahren waren, so fand sich selbst Lizzard nicht immer zurecht.
Die Indianer waren jedenfalls schnell marschiert, hatten sich aber doch alle nur erdenkliche Mühe gegeben, die Verfolger irrezuleiten, bis man endlich gegen Abend Spuren von Pferdehufen bemerkte. Die Indianer hatten sich beritten gemacht und waren in gestrecktem Galopp davongejagt.
Die Spuren wurden deutlicher, aber man durfte nicht hoffen, die Rothäute bald einzuholen, denn jedenfalls ritten sie die ganze Nacht hindurch.
Natürlich blieben auch die Trapper die ganze Nacht im Sattel, immer hinter dem spürenden Hunde her, zuerst Deadly Dash und an seiner Seite Lord Harrlington, welcher vor Sorge um Ellen sich halb wahnsinnig fühlte.
Der erste Sonnenstrahl fand sie noch immer im Walde, aber die Gegend war hügeliger geworden. Man ritt über Berge und durch Täler, und aus Vorsicht rekognoszierte Deadly Dash stets selbst von einem Hügel das Tal, welches sie passieren wollten, denn leicht konnte ihnen dort ein Hinterhalt gestellt worden sein.
So sehr Harrlington auch diesen oftmaligen Aufenthalt verwünschte, mußte er sich doch den Anordnungen des Waldläufers fügen.
Wieder ritt Deadly Dash auf den Rücken eines Hügels voraus, während die anderen hinter einem Busch regungslos halten mußten. Als er einen Ort erreicht hatte, von dem er freie Umschau halten konnte, zügelte er sein Roß und spähte in den Talkessel hinunter.
So kalt und unempfindlich gegen alle äußeren Eindrücke Deadly Dash sonst auch war, in diesem Augenblick verlor er seine Selbstbeherrschung. Er riß dem Pferde in die Zügel, daß es hoch aufbäumte, und schrie laut auf. Im nächsten Augenblick jagte er in voller Karriere den steilen Hügelabhang hinunter, daß sich das Pferd zu überstürzen drohte.
Er hatte seine Begleiter zwar nicht aufgefordert, ihm zu folgen, aber als sie erst gesehen hatten, was den Waldläufer zu solcher Eile anspornte, hieben auch sie wie wahnsinnig auf die Pferde ein, allen voran Lord Harrlington.
Ein weiter Talkessel breitete sich vor ihnen aus, zu welchem der Abhang hinabstürzte. Das Tal war so groß, daß man eben noch die Gruppe von Menschen erkennen konnte, die am anderen Ende des Tales zusammengedrängt stand.
Harrlingtons Haare sträubten sich vor Entsetzen. Er schrie gellend auf und stieß dem Rosse die Sporen bis an die Hacken in die Seite, so daß es wie ein Pfeil dahinflog, aber wahrscheinlich auch seinen Reiter zum letzten Male trug.
Und sollte er dennoch zu spät kommen?
Die Indianer dort marterten nach ihrer Weise einen Gefangenen zu Tode, und diese Person konnte niemand anderes sein als Ellen.
So weit auch die Entfernung war; die klare Morgenluft ließ die Indianer scharf erkennen, wie sie in grotesken Sätzen um den Pfahl herumsprangen, an dem die Gefangene stand, allem Anschein nach nackt. Selbst die Flammen konnte man sehen, die zu ihren Füßen emporleckten, und sie waren schon so hoch, daß sie ihre gefräßige Arbeit begonnen haben mußten.

Ein entsetzlicher Anblick bot sich den Reitern: Indianer ver-
brannten am Marterpfahl ein Weib, das sie schreiend umtanzten.
»Zu spät, zu spät!« gellte es in Harrlingtons Ohren.
Das Blut drang ihm in die Augen; es flimmerte ihm vor denselben, dennoch aber mußte er alles sehen.
Die Gefangene schien schon ausgelitten zu haben; das Haupt hielt sie weit nach vorn geneigt, sie sträubte sich nicht.
Doch was war das?
Da stürzte ein anderes Weib hervor auf die Gefangene zu, zerstörte das Feuer mit den Füßen und wendete sich dann mit heftigen Bewegungen an die Indianer. Diese hielten in ihren Tänzen inne, deuteten auf die Gefangene und schienen ebenso hastig zu antworten.
Mehr konnten die Heranjagenden nicht sehen, denn sie selbst waren von den Indianern bemerkt worden, und wollten diese nicht von den Trappern überrascht und durch die Gewalt des Angriffes niedergeworfen werden, so mußten sie an Gegenwehr oder an Flucht denken.
Sie zogen das letztere vor.
Kaum erblickte einer von ihnen die ansprengende Reiterschar, als er die anderen schnell darauf aufmerksam machte. Sie erschraken, schwangen drohend die Tomahawks nach den Ankommenden und verschwanden im Walde, wo ihre Pferde jedenfalls angebunden waren. Gleichzeitig mit ihnen verschwand auch das Weib im Walde.
Die Gefangene war allein; aber die Flammen leckten jetzt hoch an ihrem Körper empor.
Lord Harrlington hatte das fliehende Weib wohl erkannt, es war keine andere, als Miß Morgan, die einstige Freundin Ellens, von deren eigentlicher Natur er nun aber schon genug erfahren hatte. Doch jetzt dachte er nicht an Rache, sondern nur an Ellen.
In einer Minute hatte er den Pfahl erreicht. Das Pferd brach unter ihm zusammen, der Reiter wurde zu Boden geschleudert, er raffte sich auf und stürzte auf die Unglückliche zu, doch er vermochte nicht mehr, ihr Hilfe zu leisten, er kam zu spät.
Der Anblick, der sich ihm bot, war so entsetzlich, daß dem starken Manne die Sinne schwanden und er schwer zu Boden schlug. Jetzt waren alle seine Hoffnungen zu schanden gemacht worden, er war für alle Zeiten ein unglücklicher Mensch.
Auch die nachkommenden Waldläufer waren außer sich über die Szene, die sich ihnen darbot.
Die Unglückliche war von den Indianern nackt ausgezogen worden, ehe sie an den Marterpfahl gebunden wurde, und auch den Skalp hatte man ihr nicht gelassen. Sie hing nur noch an den Stricken, welche ihren Körper an dem Pfahl festhielten, die unteren Glieder waren vollkommen verkohlt und noch immer leckte die Flamme empor. Der Tod mußte sehr bald eingetreten sein, aber auf eine furchtbare Weise. Die Gesichtszüge waren vom höchsten Schmerze verzerrt, und doch konnte man an ihnen noch Ellen erkennen
Deadly Dash sprang hinzu, um die Stricke zu durchschneiden, aber schon fiel ihm der Leichnam entgegen, die Fesseln waren durchgebrannt. Der Waldläufer kannte keinen Ekel. Er fing den verkohlten Leichnam auf und ließ ihn ins Gras gleiten.
Deadly Dash schämte sich nicht, daß ihm die Tränen über die Wangen flossen, und auch den anderen Trappern stahlen sich die Tränen in die Augen. Scheinbar am teilnamlosesten verhielt sich Harrlington. Er lag mit dem Gesicht auf der Erde und hatte die Hände fest ins Gras gekrallt. Kein Zucken, kein Schluchzen verriet seinen inneren Schmerz, er hätte für ohnmächtig gelten können, wenn er nicht so tief geatmet hätte.
»Was wollt Ihr tun?« fragte Deadly Dash den Waldläufer, welchen wir als Joe kennen.
Der Mann wollte eben sein Pferd besteigen.
»Dasselbe wie die anderen, die Indianer verfolgen und nicht eher zurückkehre«, als bis der letzte dieser apachischen Bluthunde tot ist,« antwortete Joe mit rauher Stimme, die seine Bewegung verdecken sollte.
»Begrabt erst diese Unglückliche.«
»Nein, keinen Augenblick Verzögerung wegen der Toten,« rief Joker, »Auf, Burschen, diesmal gilt es eine Jagd nach Skalpen! Wenn ich auch ein Weißer bin, so schwöre ich diesmal aber doch, jedem, der von meiner Hand fällt, den Skalp zu rauben.«
»Und ich schwöre, nicht eher zu ruhen, als bis ich den Hunden mit ihren eigenen Tomahawks ihre ruchlosen Hände abgehauen habe,« fügte Joe hinzu.
»Und ich reiße ihnen die Zungen heraus, so wahr mir Gott helfe!« ein Dritter.
Die sechs Männer saßen schon zu Pferde, die Büchsen diesmal schußbereit in den Armen. Ihre finsteren Gesichter drückten die furchtbarste Entschlossenheit und die rücksichtsloseste Grausamkeit aus
»Kommt mit, Deadly Dash!«
»Ich muß erst den Leichnam begraben und kann diesen Mann nicht verlassen! Ihr seid genug, dies Dutzend elende Feiglinge zu bestrafen.«
»Das sind wir, bei Gott,« rief Joker. » Good bye, Dash, du siehst mich entweder mit den Skalpen oder gar nicht wieder.«
Die Reitertruppe setzte sich in Bewegung. Auf seine Büchse gestützt sah ihnen der Waldläufer nach, bis die Bäume sie seinen Blicken entzogen.
Dann ging mit dem Waldläufer eine seltsame Veränderung vor. Hatte er bis jetzt nur Tränen gezeigt, so begann er nun mit einem Male laut aufzuschluchzen, und unaufhaltsam rollten Tränen über die wettergebräunten Wangen. Lange blieb er so mit gesenktem Kopfe stehen, ohne sich zu rühren, und auch Harrlington lag noch ebenso bewegungslos auf der Erde, wie zuvor.
Endlich ermannte sich der Waldläufer. Leicht berührte er mit dem Kolben der Büchse die Hand des Daliegenden, und als dieser die Berührung nicht zu bemerken schien, faßte er ihn an.
»Kommt, wir wollen sie begraben!« sagte er leise.
Lord Harrlington blickte auf. Deadly Dash sah in ein zusammengefallenes Gesicht mit glanzlosen Augen. Der Lord war plötzlich um zehn Jahre gealtert.
»Begraben?« murmelte er.
Dann sprang er auf, stürzte auf den verkohlten Leichnam zu, sank in die Knie und führte die noch unverletzte Hand an die Lippen.
»Ellen!« stöhnte er.
Weiter brachte er nichts hervor, in diesem einen Worte lag alles, sein namenloser Schmerz und seine grenzenlose Verzweiflung.
»Wir wollen sie begraben,« wiederholte der Waldläufer, ebenso leise wie zuvor.
»Begraben?« schrie da Harrlington auf. »Nimmermehr. Ich muß sie mit mir nehmen.«
»Armer Mann, das könnt Ihr nicht! Euer Pferd ist unfähig, sich wieder zu erheben, und wir haben kein Tuch, um den Leichnam einzuschlagen. Wir wollen sie hier im Walde begraben, sie hat ihn stets geliebt. Nachdem sie ausgelitten, ist es ihr gleich, wo sie ruht. Jetzt ist ihr wohl. Tröstet Euch damit, armer Mann!«
Hilfesuchend blickte sich Harrlington um, er wollte den Körper der Geliebten nicht zurücklassen.
Da sah er plötzlich einige Schritte entfernt neben einem Strauche etwas am Boden liegen. Er sprang hin und hob es vom Boden auf. Es war eine Art von Umschlagetuch, welches infolge der Aufregung den sonst so scharfsichtigen Waldläufern entgangen war.
Ein Indianer mußte es im Augenblick der Gefahr weggeworfen haben. Sonst hatten sie alle Kleider des Mädchens als Beute mitgenommen.
»Das letzte Andenken!« murmelte Harrlington. Zum ersten Male zeigten sich Tränen in seinen Augen.
Schnell trat Deadly Dash auf ihn zu.
»Das ist kein Tuch von Miß Petersen,« rief er. »Die Damen waren in Männerkleidung und hatten keine anderen Kleider oder Tücher mit sich.«
Harrlington blickte auf und ließ das Tuch wieder zu Boden fallen.
»Es wird jenem Weibe gehört haben, welches vorhin zwischen die Indianer trat,« fuhr der Waldläufer fort.
»Was sagt Ihr?« schrie da der Lord auf. »Auch Ellen hatte die Schiffskleidung an?«
»Gewiß, sie hatte gar keine anderen Sachen bei sich, ebensowenig wie die anderen.«
In dem Gesichte Harrlingtons ging plötzlich eine Umwandlung vor, es leuchtete darin wie Hoffnung auf.
»Ihr irrt Euch wirklich nicht?« rief er atemlos. »Ellen hatte keine Frauenkleider an?«
»Nein, ganz bestimmt nicht. Aber was soll das?«
»Nun denn, hört mich, Mann, so wahr, wie ich hier stehe, ich habe mich nicht getäuscht. Das Mädchen, welches vor meinen Augen von den Indianern weggeschleppt wurde, war wie ein Weib angezogen, es trug ein helles, schleppendes Kleid, welches beim Laufen aufgehoben werden mußte.«
Sprachlos starrte der Waldläufer den Sprecher an. Gegen diese Art von Ueberraschung war er nicht gefeit.
»Dann war die Gefangene auch nicht Miß Petersen,« stammelte er endlich. »Sie kann es nicht gewesen sein.«
»Mein Gott, wer sonst soll es denn aber gewesen sein?« rief Harrlington, der nicht wußte, ob er jubeln oder weinen sollte.
»Sagt mir's nochmals, trug sie keine Männerkleidung?«
»Nein, aber dennoch ...«
Harrlington blickte verstört nach dem Leichnam hinüber.
»Was denn?«
»Ich stand dicht vor ihr und habe ihr in's Gesicht gesehen. Es war dennoch Ellen, wie sie leibte und lebte.«
Lange stand der Waldläufer mit gesenktem Kopfe da. Er hörte nicht mehr auf die angstvollen Fragen des Lords, er ging nicht wie dieser zu der Leiche, um nach irgend einem Erkennungszeichen zu suchen, sondern überlegte nur, ohne aufzuschauen.
»So sprecht doch!« rief Harrlington außer sich, »Flößt mir nur eine Hoffnung ein! Was meint Ihr, sollte es gar nicht Miß Petersen sein?«
Endlich hob der Waldläufer den Kopf.
»Ich glaube, das Rätsel lösen zu können. Es ist nicht Miß Petersen, vor deren Leiche wir stehen, sondern ein anderes, uns ganz fremdes Weib,« sagte Deadly Dash, und so ruhig er sich auch stellte, so hörte der Lord doch die innere Freudigkeit heraus.
»Sprecht Ihr die Wahrheit?«
»Vorläufig nur eine Vermutung, aber bald werden wir die Wahrheit erfahren. Jetzt legt mit Hand an! Wir wollen die Unglückliche begraben. Wer es auch gewesen sein mag, ein solch furchtbares Schicksal, lebendig skalpiert und verbrannt zu werden, hat sie nach irdischer Gerechtigkeit nicht verdient. Wir wollen sie anständig begraben, so weit es unsere Hilfsmittel ermöglichen.«
Harrlington half dem Waldläufer, ein Grab herzustellen, aber so sehr er auch in den Mann drang, Deadly Dash gab keine Antwort mehr. Stumm grub er in die Erde, und Harrlington peinigte sein Herz fast bis zu Tode; er war ruhelos.
War es Ellen, oder war sie es nicht, die sie jetzt in die Erde legten? Diese Frage brachte ihn bald dem Wahnsinn nahe.
Noch war die Erde nicht über den Leichnam gedeckt, als der Klang flüchtiger Rossehufe erscholl, und eine kleine Kavalkade Reiter angesprengt kam. Der an der Spitze trieb sein Pferd zum raschestem Lauf an und schwenkte schon von weitem ein Tuch.
Harrlington erkannte in ihm Nick Sharp, der nicht mehr die Rolle eines Dieners spielte, sondern als Gesellschafter der Herren reiste.
»Wir kommen zu spät, ich dachte es mir,« rief der Detektiv und schwang sich vom Pferde.
Er kniete neben der Leiche nieder und blickte der Toten aufmerksam in's Gesicht.
»Sie ist es,« murmelte er und stand auf. Selbst er war erschüttert. »Lord Harrlington, hier liegt das Weib, welches Sie und Ihre Genossen unter dem Namen von Miß Petersen nach Südamerika lockte, es ist die Doppelgängerin jener, und als solcher ist ihr das Schicksal widerfahren, welches für Miß Petersen bestimmt war. Miß Morgan wollte ihre Feindin durch Indianer des qualvollsten Todes sterben lassen. Durch einen Zufall fiel ihnen dieses Mädchen, Miß Leigh, in die Hände, sie glaubten die Richtige zu haben, entführten sie und verbrannten sie, der Anweisung von Miß Morgan gemäß, sobald sie Gelegenheit dazu hatten.«

Erschüttert hörten Lord Harrlington und Deadly Dash diese furchtbare Nachricht.
»Wo ist Miß Petersen?« fragte Harrlington dann leise.
»In den Ruinen. Sie hatte sich verirrt und war von dem Indianer, welcher durch Euch, Deadly Dash, dingfest gemacht wurde, angesprochen worden. Schmalhand sagte, er wäre gekommen, sie zu suchen, ein Herr folge ihm, und führte sie der Richtung zu, wo die von Miß Morgan gemieteten Indianer sich aufhielten, welche sie rauben sollten.
»Miß Petersen war erst etwas mißtrauisch, dann aber folgte sie dem Indianer. Plötzlich erblickte Schmalhand seinen Feind Stahlherz. Er erschrak furchtbar und floh, doch jener war gleich hinter ihm her. Ich schoß nach ihm, und so wurde er gefangen.
»Bei dieser Aufregung achtete niemand auf Miß Petersen. Schmalhand war ziemlich weit geflohen, und so vergingen einige Minuten, ehe sie die Gruppe erreichte, die sich um den gefangenen Indianer gebildet hatte.
»Ihr waret unterdessen schon aufgebrochen, um der vermeintlichen Miß Petersen zu folgen.
»Denkt Euch unser Erstaunen, als wir die richtige Miß Petersen plötzlich in unserer Mitte sahen. Lord Harrlington wollte Miß Petersen bestimmt gesehen haben, und sofort fiel mir Miß Leigh ein, deren Namen ich erfahren hatte. So war sie also den Indianern in die Hände gefallen, welche von Miß Morgan auf Miß Petersen gehetzt worden waren. Die Indianer kannten wahrscheinlich Miß Leigh nicht, die Beschreibung aber paßte auf sie, und so wurde sie mitgeschleppt und anstatt Miß Petersen gemartert. Ihr geschah recht, ich kann sie nicht im mindesten bedauern. Wer anderen eine Grube grabt, fällt selbst hinein, ist ein altes Sprichwort, das sie hätte kennen müssen, und der Miß Morgan wird es einst auch nicht anders ergehen.«
»Aber was wollte Miß Leigh in der Ruine?« fragte Lord Harrlington.
»Das weiß ich noch nicht. Wir konnten von Schmalhand nur eben das notdürftigste erfahren, dann saßen wir auf den Pferden und jagten Euch nach, um Euch von einer vergeblichen Verfolgung abzuhalten. Jedenfalls aber ist die Tote von Miß Morgan ausgeschickt worden, um in der Ruine zu spionieren, oder sie hat sich verirrt und ist in den Tod gelaufen.«
»Dann steht sie jedenfalls noch immer mit Miß Morgan in Verbindung,« meinte Deadly Dash, somit verratend, daß er viel mehr von den Verhältnissen wußte, als er gewöhnlich vorgab. Doch Lord Harrlington achtete jetzt nicht darauf, er war außer sich vor Freude.
»Sicherlich!« entgegnete Sharp auf des Waldläufers Ausruf. »Wie käme sie sonst hierher? Doch jetzt suchen Sie sich ein Pferd aus,« wandte er sich an Lord Harrlington, »Miß Petersen erwartet Sie sehnlichst, sie wollte durchaus mit, aber ich ließ es nicht zu.«
Harrlington brauchte dies nicht zweimal gesagt zu werden.
In Sharps Begleitung waren zwei Waldläufer und drei englische Herren, Harrlington bestieg das Pferd eines Waldläufers, welcher zu Fuß nachkommen wollte, und schlug mit den übrigen die Richtung nach der Ruine ein
Wäre es nach seinem Wunsche gegangen, so wären sie ununterbrochen geritten, bis sie diese erreichten. Das wäre gegen Ende der Nacht gewesen, aber Sharp setzte es durch, daß die Pferde auf einige Stunden Ruhe erhielten.
Es wurde ein Lager im Walde hergerichtet, und trotzdem Harrlington vor Aufregung und Freude erst nicht die Augen schließen konnte, fiel er doch schließlich in einen tiefen, erquickenden Schlaf. Er hatte ja auch die vorige Nacht nicht geschlafen, und die Natur forderte jetzt eigensinnig ihr Recht, dem die stärksten und energischsten Menschen sich nicht entziehen können.
Er schlief schon lange fest, während Nick Sharp und Deadly Dash ins Gespräch vertieft waren. Hauptsächlich sprach der Detektiv, und der Waldläufer hörte ihm unter Zeichen der Beistimmung zu. Endlich aber, als der Morgen im Osten schon zu dämmern begann, legten auch sie sich eine Stunde an dem kleinen Feuer nieder. — —
Man erreichte ungefährdet die Ruine, und als den Reisenden die ersten Steintrümmer zu Gesicht kamen, konnte Lord Harrlington seine Ungeduld nicht mehr zügeln. Ueber Felsen und Steine lenkte er das Pferd. Kein Hindernis war ihm zu hoch, es wurde genommen, und der letzte Satz brachte ihn so nahe an die Herren und Damen, daß diese vor dem schäumenden Pferde entsetzt auseinanderstoben.
Niemand hatte sobald auf die Ankunft des Lords gerechnet, er erschien völlig unerwartet.
»Wo ist Ellen?« schrie Harrlington, mit einem Satze vom Pferde springend.
Er brauchte nicht lange zu fragen, noch hatte er kaum den Boden berührt, als schon eine Gestalt auf ihn zugeflogen kam.
»James,« schluchzte eine Stimme an seiner Brust.
»Ellen, endlich!« stöhnte der Mann auf und preßte die Geliebte an sich, als wollte er sie nie wieder von sich lassen. — —
Des zurückkehrenden Waldläufers erste Frage war nach Stahlherz, und er fand seinen roten Freund in einem Grabgewölbe, wo er vor der Bahre hockte, auf welcher der verwundete Schmalhand lag.
Stahlherz hatte diesen bisher mit einer Sorgfalt gepflegt, als wäre er sein bester Freund, und doch zitterte Schmalhand, wenn ihn Stahlherz berührte, und er blickte in ein Paar funkelnde Augen, wenn er ihn ansah. Stahlherz hatte ihn keine Minute verlassen, ja, er gestattete nicht einmal, daß jemand diesen Raum betrete, auch John Davids nicht, welcher die Wunde untersuchen wollte. Nick Sharp war es erst nach langem Versuchen gelungen, den verwundeten Indianer auf wenige Minuten zu sprechen, wobei ihn aber Stahlherz mit den glühenden Augen eines Jaguars beobachtete, als fürchte er, man könne ihm seinen Pflegling entführen.
Aber es war kein Mitleid, welches Stahlherz am Krankenbette wachen ließ, sondern die Angst, daß der Gegenstand seiner Rache sterben könne.
Nick Sharp hatte aus den Fieberträumen des Verwundeten nur wenig Wichtiges hören können, aber es war genug, um alles andere zu erraten. Was der Kranke verschwieg, das ergänzte des Detektiven ungemein scharfer Verstand.
Es war gut, daß Schmalhand im Fieber lag und schwatzte, sonst hatte man wohl nichts von ihm erfahren. Indianer sind nicht leicht zum Verrate eines Geheimnisses zu bringen, selbst wenn sie die äußersten Folterqualen ertragen müssen.
Stahlherz' Augen leuchteten auf, als Deadly Dash das Krankenzimmer betrat.
»Gut, daß mein Bruder kommt, Stahlherz hat lange auf ihn gewartet.«
»Was macht Schmalhand?«
»Er wird sterben!« antwortete der Indianer im Tone des tiefsten Bedauerns.
Deadly Dash nahm die Hand des Kranken und fühlte sofort, daß derselbe vom Fieber geschüttelt wurde.
»Hat sich dir nicht ein Mann angeboten, diesen hier zu heilen?« fragte er.
»Ja, er war hier, ich ließ ihn aber nicht herein.«
»Warum nicht? Er kennt viele Medizinen, es würde ihm ein leichtes sein, Schmalhand zu heilen, denn das ist doch dein sehnlichster Wunsch.«
»Aber du kannst es auch, auf dich habe ich gewartet.«
»Doch Schmalhand hätte unterdes sterben können!«
»Ich hätte trotzdem nie jemanden zu ihm gelassen.«
»Aber warum nicht, Stahlherz?« fragte Deadly Dash verwundert. »Sprich offen, ich bin dein Freund!«
»Eben deshalb lasse ich dich herein, und du darfst ihn auch berühren, aber niemand anders. Ich habe Tag und Nacht hier gewacht. Wäre ich nicht Stahlherz, ich wäre gestorben; doch Stahlherz braucht keinen Schlaf. Jede Nacht wurde der Versuch gemacht, hier einzudringen, und Schmalhand mir zu nehmen. Ich scheuchte sie zurück, doch immer kamen sie wieder.«
Jetzt wurde der Waldläufer aufmerksam.
»Wer war es?«
»Indianer, ich kenne sie nicht.«
»Konntest du keinen der nächtlichen Besucher fangen?«
»Sie entweichen wie Geister, und zu weit durfte ich mich nicht von Schmalhand entfernen. Es gibt verborgene Zugänge zu diesen Gräbern, doch Stahlherz ist nicht so klug wie du, er kann sie nicht finden, und hätte Stahlherz die nächtlichen Geister verfolgt, so wären sie anderswo hereingekommen und hätten Schmalhand geraubt oder getötet.«
Deadly Dash blickte lange nachdenklich vor sich hin.
»Du magst recht haben, Stahlherz,« sagte er dann, »du weißt, was ich dir über diese Ruinen erzählt habe.«
»Stahlherz erinnert sich und gibt es seinem weißen Bruder jetzt zu, was er früher nicht glaubte. In diesen Ruinen herrschen keine Geister, sondern böse Menschen, und zu diesen gehörte Schmalhand. Seine Brüder wollen ihn befreien oder auch töten, damit er nichts verraten kann.«
Deadly Dash nickte lebhaft mit dem Kopfe.
»So wird es sein. Schade, daß die beiden Mädchen, welche von jenen in Schutz genommen worden sind, nicht über ihren Aufenthalt in den Ruinen sprechen wollen.«
»Stahlherz wird selbst nachsehen.«
»Wir haben versprochen, das zu unterlassen.«
»Aber nicht Stahlherz,« entgegnete der Indianer finster, »er muß erfahren, wer in diesem Tempel wohnt.«
»So hast du auch jetzt noch Hoffnung?«
»Hier hat Stahlherz Schmalhand gefunden und wird vielleicht auch die finden, die er seit zwölf Jahren sucht.«
»Das war auch meine Meinung, welche ich dir nicht sagte. Du aber wolltest mir nicht glauben.«
»Ich glaube es dir jetzt. Will mein kluger Bruder den Verwundeten heilen?«
»Ja, ich verstehe das Fieber zu bannen.«
»Willst du auch für mich wachen? Schmalhand darf nicht entkommen.«
»Ich will kein Auge von ihm wenden, während du schläfst. Du kennst mich.«
Stahlherz erwiderte nichts mehr, er streckte sich auf den Boden aus, und schon nach wenigen Minuten verrieten seine tiefen Atemzüge, daß er schlief.
Wie leicht er aber schlummerte, zeigte er dadurch, daß er, als der Waldläufer an die Tür trat und laut den Namen John Davids rief, sofort zusammenzuckte.
Doch er sprang nicht auf, er wußte ja, daß sein Freund für ihn wachte.
»Sie sind Arzt?« fragte der Waldläufer den Ankommenden.
»Ich verstehe die Heilkunde.«
Der Waldläufer führte den schweigsamen Engländer an die Bahre, und Davids erklärte sich bereit, für den Kranken zu sorgen. Es wäre die höchste Zeit, meinte er, sonst hätte der Indianer an der brandigen Wunde sterben müssen. Stahlherz hätte bis jetzt alle seine Hilfsanerbieten abgeschlagen.
Lord Harrlington und Miß Petersen hielten sich nicht lange umschlungen. Letztere machte sich plötzlich hastig aus seinen Armen frei und trat einen Schritt zurück. Dieses Benehmen stach seltsam ab gegen den jubelnden Ruf, der ihr beim Wiedersehen Harrlingtons entschlüpft war.
Wie abwehrend streckte sie die Hände dem Manne entgegen, der schon wieder mit ausgebreiteten Armen auf sie zukommen wollte. Ihr Antlitz ward von einer purpurnen Röte übergossen; tief hob und senkte sich ihr Busen.
»Ellen!« stammelte Harrlington bestürzt. »Hast du kein weiteres Wort der Bewillkommnung für mich? Reut es dich schon wieder, daß ich dir in den Weg getreten bin?«
Ellen antwortete nicht; scheu wich sie seinen Blicken aus. Sie konnte die Augen der Umstehenden nicht auf sich gerichtet sehen. Kurz drehte sie sich um und verließ langsamen Schrittes, den Kopf tief gesenkt, den Platz. Harrlington glaubte, Tränen in ihren Augen gesehen zu haben.
Sofort hatte er sie wieder eingeholt und schlang den Arm um ihre Taille.
»Darf ich dein Leid nicht mit dir teilen?« flüsterte er. »Ach, Ellen, sei endlich offen gegen mich! Laß deinen Stolz fahren! Du machst mich nur unglücklich und zerfleischst dabei dein eigenes Herz auf die grausamste Art. Oder beleidigen dich auch diese Worte wieder?«
Der letzte Satz hatte etwas bitter geklungen.
»Du hast recht, James,« hauchte sie endlich unter Tränen, »ich leide und habe selbst am meisten gelitten unter meinem Trotze. Es soll nun vorüber sein.«
»Ellen!« jubelte Harrlington auf. »Also endlich kann ich dich mein nennen! Zweifelst du noch an meiner Liebe? Weißt du, was ich die letzte Zeit, ich möchte fast sagen, das letzte Jahr ausgestanden habe?«
»Ich weiß es, James, vergib mir! Du hast meinetwegen viel, ach, so viel ausstehen müssen. Ich habe dich beleidigt und mißachtet; ich habe schweren Argwohn gegen dich gehegt und dir die schwersten Kränkungen widerfahren lassen. Wie soll ich das alles wieder gut machen?«
Sie konnten nun die übrige Gesellschaft nicht mehr sehen; sie befanden sich schon in einem Labyrinth von Blöcken und Schutt.
»Auch ich war nicht schuldlos,« entgegnete Harrlington, ihr die Hände auf die Schulter legend und ihr in die gesenkten Augen blickend.
»Nein, nein, ich war allein schuld. Alles, was man mir von dir erzählt hat, war erlogen, und ich habe es sofort geglaubt. Man hat deine Handschrift gefälscht und mir Briefe von dir unterbreitet, und ich habe nur mit Abscheu an dich gedacht. Mein Gott, wie kann ich das wieder gut machen? Darum habe ich solche Angst vor dem Augenblicke gehabt, da ich dich wiederzusehen hoffte. Ich glaubte, vor Scham in den Boden versinken zu müssen.«
»Du tatest es aber nicht, Ellen,« lächelte Harrlington. »Du begegnetest mir so, wie ich es mir oft geträumt hatte. So, wie du vorhin meinen Namen riefst, hast du es noch niemals getan.«
»Es war die Ueberraschung.«
»Nein, es war die Stimme deines Herzens. Ellen, versuche doch nicht, mich und dich abermals zu tauschen! Sollen denn nur diese Täuschungen gar kein Ende nehmen?«
»Ich fühle mich dir gegenüber so beklommen, weil ich dir unrecht getan habe,« lispelte Ellen.
»Gibt es denn gar nichts, wodurch du alles Unrecht mit einem Male sühnen kannst?« fragte Harrlington vorwurfsvoll.
Ellen blickte auf.
»Wie könnte ich das?«
»Wer sein Unrecht gesteht, hat es schon halb gebüßt, in dem Bekenntnis der Wahrheit also liegt die Buße.«
»Die Wahrheit? Nun denn, du sollst sie hören!« sagte Ellen, und Harrlington erschrak, als er die Umwandlung bemerkte, die in ihrem Antlitz vorging.
Die Röte war gewichen und hatte fahler Totenblässe Platz gemacht, dann aber flammte es wieder purpurn auf, und aus den Augen brach plötzlich ein Strahl, der Harrlington bis in das Herz hinein traf. Schon breitete er die Arme aus, denn er dachte, jetzt nahe der ersehnte Moment, da Ellen sich an seine Brust werfen würde, um ihn nicht wieder zu verlassen.
Aber es kam anders.
Plötzlich lag Ellen, das stolze, unbeugsame Mädchen zu Harrlingtons Füßen und umklammerte dessen Knie.

»Du sollst die Wahrheit hören!« rief sie mit erstickter Stimme. »Ich liebe dich, James! Ich liebe dich über alles. Nimm mich hin, aber verzeihe, was ich an dir gesündigt habe.«
Harrlington war bestürzt. Solch einen Gefühlsausbruch hatte er von der sonst kalten Ellen nicht erwartet.
Liebevoll zog er die Kniende, welche sich immer wieder ihm zu Füßen werfen wollte, zu sich empor und küßte die Tränen aus ihren Augen. Ellens ganze Leidenschaftlichkeit, welche sie so standhaft zu verbergen gewußt hatte, brach plötzlich hervor, so ungestüm, wie ein Bergstrom, wenn im Frühjahr der Schnee zu schmelzen beginnt, alle Hindernisse mit sich reißend.
Ellen stürzte an seine Brust, umklammerte mit ihren Armen seinen Hals und hing mit ihren Lippen an seinem Munde. Es war nur ein einziger Kuß, aber ein so langer, daß Harrlington zu ersticken drohte, und doch konnte er sich nicht freimachen, so fest wurde er umstrickt.
»Du tötest mich,« stöhnte er endlich.
»Bist du meiner Liebe nicht gewachsen?« rief das Mädchen unter Weinen und Lachen und drohte ihn abermals mit ihren Liebkosungen zu ersticken.
Lord Harrlington erwiderte die Küsse feurig, doch gesprochen wurde nur wenig.
»Heisa, hier geht es ja lustig her,« ließ sich da eine Stimme vernehmen. »Komm, Betty, hier wollen wir uns ein bißchen hinsetzen. Die zeigen uns, wie es gemacht wird.«
Charles und Miß Thomson hatten sich diesem Platze zufällig genähert, aber weder Ellen noch Harrlington ließen sich durch ihre Ankunft aus der Fassung bringen. Sie wendeten nur den Kopf nach ihnen, ohne sich loszulassen.
»Na, endlich!« lachte Betty. »Das hat lange genug gedauert. Was aber lange währt, wird gut.«
»Sollen wir wieder gehen?« fragte Charles.
»Nein, nein, mein lieber Sir Williams,« rief jetzt Ellen, aber sie errötete doch etwas. »Ich weiß wohl, Sie haben stets gewünscht, daß es so mit uns kommen möge.«
Sie erfaßte Harrlingtons Arm und führte ihn zu den Steinen, wo die beiden neuen Ankömmlinge schon Platz genommen hatten.
Hand in Hand saßen die beiden Paare da und freuten sich ihres Glückes. Welches von beiden war wohl glücklicher? Sie stritten sich nicht darüber, aber jedes glaubte, glücklichere Menschen als sie gäbe es nicht unter der Sonne.
»Dort kommt auch Lord Hastings mit seiner Dulzinea,« rief Charles, »und hinter ihnen Hannes und Hope. Nun sind wir ja so ziemlich alle beisammen, die wir uns immer fröhlich beigestanden haben, es fehlt bloß noch Johanna.«
»Schade, daß sie nicht hier ist!« meinte Ellen bedauernd. »Ich bin aber schon glücklich, daß ich wenigstens zuletzt in Freundschaft von ihr geschieden bin. Unsere Wege werden schon noch einmal zusammenlaufen. Nicht wahr, James, du wärst damit zufrieden, wenn Johanna und ich Freundinnen blieben?«
»Johanna hauptsächlich danke ich ja, daß ich dich jetzt an meiner Seite habe,« entgegnete Harrlington. »Sehe ich sie wieder, so werde ich sie als deine und meine Freundin begrüßen, und kreuzen sich unsere Wege nicht mehr, so werde ich sie stets in treuem Andenken behalten. Sie war es ja, die dich mir zuzuführen suchte, und die meine Ellen wie ihren Augapfel behütete.«
»Ich weiß, ich weiß,« rief Ellen, »und wie habe ich das unschuldige Mädchen verkannt!«
»Nichts mehr davon! Es ist alles vergessen, was hinter uns liegt. Wir wollen uns der Gegenwart freuen und mit frohem Mute in die Zukunft schauen!«
Hastings hatte den Stein erreicht. Er führte oder trug vielmehr Miß Murray, deren Fuß schon so weit genesen war, daß sie langsam, wenn auch noch etwas hinkend, gehen konnte. Ihre zierliche Gestalt verschwand neben dem riesigen Lord.
Beide sahen sofort, was geschehen war. Freudestrahlend beglückwünschte Jessy die Freundin, und Harrlington und Hastings schüttelten sich die Hand mit einem herzhaften Druck, der mehr sagte, als Worte hätten tun können.
»Ende gut, alles gut!« rief Jessy fröhlich. »Wer hatte geglaubt, daß das Schicksal euch hier in dieser Ruine zusammenführen würde?«
»Hat lange genug gedauert,« brummte Hastings, »und dem Schicksal braucht man überhaupt nicht zu danken, es hat nur ...«
»Seine verdammte Pflicht und Schuldigkeit getan, wie mein alter Bootsmann immer sagt,« rief Hannes, der mit Hope im Arme erschienen war.
»Ist hier noch ein Platz für uns zum Sitzen?«
»Verheiratete können wir eigentlich nicht unter uns brauchen,« meinte Williams, »wenn Sie aber versprechen, sich still hinzusetzen und nicht mit Ehestandsregeln herumzuwerfen, so können Sie dort auf dem Steine Platz nehmen.«
»Danke schön!« lachte Hope. »Hannes wird sich hüten, aus der Schule zu plaudern. Sie könnten sonst vom Heiraten abgeschreckt werden, und er wünscht doch so sehr, Leidensgenossen zu bekommen. Ist es nicht so, Hannes?«
»Gott ja, man hat manche Sorge als Ehemann,« entgegnete Hannes schwermütig und kratzte sich hinter den Ohren. »Früher fragte ich den Teufel danach, wie ich mich des Nachts zum Schlafen hinlegte, ein Hausflur war mir manchmal lieber als ein weiches Bett, aber jetzt sind diese schönen Zeiten vorüber. Da heißt es »marsch ins Bett.« Einen eigenen Willen hat man überhaupt nicht mehr, und tanzt man nicht nach der Pfeife, so gibt es — nicht etwa Haue — aber Tränen die schwere Menge, und nichts ist mir entsetzlicher, als wenn ich ein Frauenzimmer meinetwegen heulen sehe.«
»Aber Hannes, wie kannst du nur so sprechen!« rief Hope entrüstet unter dem Lachen der anderen. »Das ist ein ganz unpassender Ton für einen Freiherrn.«
»Ehestandsgeschichten sind hier verboten,« sagte Williams, »und wer nicht gehorchen will, muß unseren Kreis unnachsichtlich verlassen.«
»Aber du mußt dich doch auf die Hochzeit vorbereiten,« lachte Miß Thomson.
»Damit hat es noch lange Zeit, und so lange ich nicht verheiratet bin, will ich mich der Liebe freuen. Es lebe die Liebe! Nicht, Betty?«
»Dann erlauben Sie mir von etwas anderem zu sprechen,« begann Hannes. »Wie steht es denn eigentlich mit der Wette? Ich dachte, die Herren hätten die ›Vesta‹ doch einmal für dreißig Tage aus den Augen gehabt und müßten nun ...«
»Das ist auch wahr,« rief Miß Thomson, sprang auf und klatschte in die Hände, »nun müssen die Herren unter ihrem Namen in die Zeitungen setzen lassen, daß sie von uns auf dem Gebiete des Sports geschlagen worden sind. Hurra, die englischen Sportsleute sind von den amerikanischen Damen besiegt worden!«
»Oho,« ließ sich da Charles vernehmen, »das ist doch ein bißchen viel behauptet.«
»Wieso? Haben Sie die ›Vesta‹ nicht für dreißig Tage verloren?« fragte Miß Murray.
»Und sind Sie nicht von uns besiegt worden?« entgegnete Charles.
»Wir? Daß ich nicht wüßte.«
»So! Miß Thomson hier zum Beispiel hat mir für alle Ewigkeit Treue geschworen und Gehorsam versprochen, sie hat mir hoch und heilig geschworen, keinen eigenen Willen mehr zu besitzen, mir wie eine Sklavin zu gehorchen, und da kann sie ...«
Betty verschloß ihm den Mund und drohte ihm mit dem Finger, aber Charles machte sich wieder frei.
»... kann sie doch nicht von Sieg sprechen,« fuhr er fort.
»Das stimmt,« rief jetzt auch Lord Hastings. »Ganz genau dasselbe hat mir Jessy gesagt, und wenn sie sich als Siegerin aufspielen will, so klingt das etwas übertrieben.«
»Und ich wette, selbst Miß Petersen glaubt nicht mehr daran, daß sie Harrlington gegenüber als Siegerin auftreten kann,« fügte Charles hinzu. »Die Situation, von der ich vorhin zufällig Zeuge wurde, sah gar nicht danach aus, als wenn sie über Lord Harrlington gesiegt hatte und über ihn befehlen wird, denn gewöhnlich tun das doch die Sieger gegenüber den Besiegten.«
Harrlington lächelte, und Ellen errötete. Sie schwiegen und achteten überhaupt wenig auf die Unterhaltung der übrigen, sondern verständigten sich nur durch Blicke und Händedrücke.
»Ich habe mich schön gehütet,« lachte Hope. »Ich werde mich nie dazu verpflichten, einem Manne unbedingten Gehorsam zu leisten. Denn merken sie erst, daß man sich in alles fügt, so haben sie gewonnenes Spiel.«
»Still da!« drohte Charles wieder. »Aufrührerische Reden sind hier ganz und gar verboten. Wir sind die Herren und die Meisterwerke der Schöpfung, Eva ist aus der Rippe Adams gefertigt worden.«
»Ich wollte, ich hätte meine Rippe noch im Leibe,« meinte Hannes.
Jetzt wurde es aber Hope zuviel. Sie verschloß Hannes den Mund und verbot ihm ernstlich, so über ihr Geschlecht zu sprechen.
»Aber allen Ernstes, wie soll es mit der Zeitungs-Annonce werden?« mischte sich jetzt auch Ellen ins Gespräch. »Gewonnen haben wir die Wette doch!«
»Annoncen soll es allerdings geben,« nahm Hastings das Wort, »aber ob diese die Damen als Siegerinnen bezeichnen werden, bezweifle ich doch, ich glaube eher als Besiegte. Anstandshalber müssen wir doch den Unsrigen Verlobungsanzeigen zugehen lassen.«
»Bravo, so ist es recht! Das ist der einzige Weg, wie wir den Damen zeigen können, daß wir gesiegt haben,« riefen die Herren durcheinander. »Die Vestalinnen haben ihren Vorsatz nicht ausführen können, sie sind vom ›Amor‹ besiegt worden.«
»Schade, daß niemand hier ist, der uns photographieren kann,« meinte Hannes.
»Never mind, kann besorgt werden,« rief da über ihnen, von der Terrasse herab, eine Stimme.

»Schade, daß niemand hier ist, der uns photographieren kann,« meinte Hannes. —
»Never mind, kann besorgt werden,« rief da über ihnen eine Stimme
Erstaunt blickten die Sitzenden auf und sahen, wie eine ihnen sehr wohlbekannte Erscheinung die Terrasse herunterkletterte. Alles war noch so wie früher: die karrierten Kniehosen, die Wadenstrümpfe, die schottische Mütze, und der Kasten und die Ledermappe hingen noch an derselben Stelle.
»Mister Joungpig!« klang es verwundert in verschiedenen Tonarten.
»Absalom Joungpig, never mind,« rief der Reporter, den Finger an der Mütze, blieb stehen und nahm den Kasten von der Seite.
»Jetzt machen Sie den Mund zu, Miß Petersen, den Kopf etwas mehr nach links; Sie da, junger Mann ohne Bart, die Hände aus den Hosentaschen und den rechten ...«
»Aber wie kommen Sie denn um Gottes willen hierher?« rief Miß Thomson.
»... Fuß mehr auswärts — so — stillgestanden. Fräulein, machen Sie den Mund zu! Eins — zwei — drei! Danke, never mind!«
Der junge Mann hatte den Apparat funktionieren lassen, hing ihn wieder um und begann den gefährlichen Abstieg von neuem. Die letzte Stufe war so hoch, daß es einen ganz beträchtlichen Sprung gekostet hätte, um den Erdboden zu erreichen.
Immer noch verblüfft betrachteten die Versammelten den Reporter, der jetzt auf der letzten Stufe stand und bedenklich die Tiefe betrachtete.
»Hat jemand zufälligerweise eine Leiter bei sich?« fragte er.
»Hier gibt es keine Leitern,« lachte Hope.
»Dann passen Sie auf, daß ich mir keine Knochen entzweibreche, ich mache Sie dafür verantwortlich,« meinte Youngpig und schickte sich an, den Sprung zu wagen.
»Sie dürfen nicht springen,« rief Jessy erschrocken, »es ist zu hoch. Kehren Sie um!«
»Es ist allerdings etwas hoch, aber ...«
Youngpig sprang, brach zusammen, raffte sich wieder auf und fuhr unbeirrt fort:
»... never mind, ich wagte es doch. Habe ich mir aber etwas gebrochen?« Er befühlte seine Glieder und streckte sie. »Nein, das ist ein Glück, sonst hätte meine Frau schönen Skandal gemacht, wenn ich mit einem ...«
»Wie, Sie sind verheiratet? Davon haben wir ja gar nichts gewußt,« rief Hope.
»... lahmen Beine nach Hause gekommen wäre. Das wußten Sie noch gar nicht, daß ich verheiratet bin? Never mind!, das ist auch gar nicht nötig.«
»Ihr Herr Bruder, Nikolas Sharp, sagte damals, Sie wären unverheiratet.«
»Damals, damals,« entgegnete der Reporter geringschätzend. »Seit damals sind einige Monate verstrichen, und zum Heiraten gebrauche ich nur einen Augenblick. Ich sage einfach ein vernehmliches ›Ja‹ und fertig ist der Bund für Leben und Tod.«
»Bei Ihnen geht alles sehr schnell,« lachte Charles. »Wen haben Sie denn geheiratet, eine Indianerin oder eine Chinesin? Wir sahen uns das letztemal in China.«
»Eine Chinesin? Herr, wollen Sie mich beleidigen? Meine Frau ist eine Vollblutengländerin.«
»So gab sie ihr Jawort wohl telegraphisch?«
»Nein, ich bin hingereist.«
»Um Gottes willen, das war eine kurze Hochzeit.«
»Mister Youngpig braucht zu solchen Geschichten auch nicht lange Zeit,« entgegnete der Reporter, die Hand an der Mütze.
Dann zog er sein Notizbuch hervor und sagte mit einem gewissen Stolze:
»Hören Sie zu, wie ein Reporter, der stets reisefertig und überall zu Hause ist, heiratet.«
Die Anwesenden amüsierten sich köstlich über den jungen Mann. Was er aber vorlas, das überstieg denn doch noch ihre Erwartung.
»Ich reiste mit dem ›Gladiator‹ nach London und erreichte es am 4. April. — Passen Sie auf, wie gut ich diesen Tag auszunutzen verstand! — 11 Uhr 37 Minuten in London angekommen, 11 Uhr 49 Minuten auf dem Standesamt angemeldet, 12 Uhr 14 Minuten in der Privat-Wohnung getraut, 12 Uhr 15 Minuten Lizzy — das ist meine Frau — genas eines kräftigen Jungen, 12 Uhr 32 Minuten, das Kind wurde auf den Namen Oskar getauft. 12 Uhr 33 Minuten bis 1 Uhr Hochzeits- und Kindtaufsessen, dann Abschied. 1 Uhr 30 Minuten: Abfahrt mit dem englischen Dampfer ›Queen Elizabeth‹ nach New-Orleans.«
Der Reporter klappte sein Notizbuch zu und sah sich stolz im Kreise um.
»Gott bewahre mich,« sagte Charles, der einzige, der nach längerer Pause die Sprache endlich wiederfand, »das hat sich doch nicht alles in einem Tage abgespielt?«
»Gewiß, an ein und demselben Tage. Ist das etwa unmöglich?«
»In 1 Stunde 53 Minuten?«
»Allerdings, und dabei hatte ich noch Zeit, alle Briefe nach dem abgehenden Schiffe beordern zu lassen, die ich mitnehmen sollte.«
»Mister Youngpig, Sie belieben zu scherzen! Sie hätten in anderthalb Stunden geheiratet, ein Kind bekommen und dieses taufen lassen?«
»Ich habe kein Kind bekommen, aber meine Frau — never mind das, es ist wirklich so. Und bin ich nicht ein pflichtbewußter Vater? Ich wollte Oskar nicht unehelich das Licht der Welt erblicken lassen und beeilte mich daher so, daß ich gerade noch vor Torschluß kam. War das nicht gewissenhaft von mir gehandelt?«
»Schön ist es aber nicht, wenn die Kindtaufe sogleich nach der Hochzeit fällt,« meinte jetzt Hope lächelnd, die sich von ihrem Erstaunen erholt hatte und an der Wahrheit der Erzählung dieses exzentrischen Menschen nicht mehr zweifelte.
»Ihnen mag es nicht schön erscheinen, meinem Sohn Oskar ist dies aber ganz never mind.«
»Was sagt denn nun Mistreß Youngpig dazu?«
»Die freute sich sehr, daß ich zu einer so passenden Zeit kam. Aber auf Ehre, meine Herrschaften, es war auch die höchste Zeit! Der Hochzeitsschmaus verlief sehr lustig, das zweite Gericht bildete das Kindtaufsessen, dann photographierte ich Frau und Kind, nahm einen herzlichen Abschied, nur auf einige Monate, und bin jetzt hier, um meine letzte Mission in fremden Diensten zu verrichten. Ueberdies erlaube ich mir die Bemerkung, daß meine Frau nicht Mistreß Youngpig, sondern Mistreß Lind heißt.«
Man wußte schon, daß der Reporter der Bruder des Detektiven Sharp sei, also auch der Johannas. Alle Familienmitglieder schienen andere Namen angenommen zu haben, vielleicht mit Ausnahme der letzteren. Ihre Berufstätigkeit brachte dies mit sich.
»Was sagte denn Ihr Bruder dazu?«
»In dessen Auftrage bin ich noch einmal hierhergekommen, dann mache ich mich selbständig,« antwortete Youngpig stolz.
»Sie haben Briefe mit? Für wen?« fragte Miß Petersen, wurde aber unterbrochen.
»Youngpig, bist du endlich da?« rief Sharp, der zu der Gruppe trat. »Ich erwartete dich schon gestern.«
»Never mind, konnte nicht eher kommen.«
Die beiden Männer gaben sich einfach die Hand.
»Alles in Ordnung?«
»Alles.«
»Junge oder Mädchen?«
»Junge.«
Wieder schüttelten sich beide die Hände.
»Hast aber verdammt lange Zeit gebraucht, dich zu verheiraten. Ziemlich acht Monate! Du lieber Himmel, in der Zeit heirate ich zwanzigmal und lasse mich ebenso oft wieder scheiden.«
»Machen Sie, daß Sie fortkommen,« schrie Charles, »Sie sind der Wolf unter der Schafherde. Gehen Sie, gehen Sie, wir wollen keine Entschuldigungen hören!«
Sharp lächelte, ließ den Blick über die kleine Gesellschaft gleiten, ihn lange auf Harrlington und Ellen haften, rieb sich mit dem Finger über die Oberlippe, als wolle er ein Lächeln nicht merken lassen, und sagte dann, zu Youngpig gewandt:
»Komm, Absalom, in solche Gesellschaft passe ich nicht, ich werde in derselben verlegen und weiß mich nicht zu benehmen.«
Beide verloren sich zwischen den Felsblöcken, Charles aber rief ihnen nach:
»Ja, Ihre Rollen haben Sie bei mir ausgespielt. Suchen Sie sich nur einen anderen Freund, Sie schüchterner Mensch. Weiß Gott,« fuhr er zu den übrigen fort, »so gern ich in der Gesellschaft Nick Sharps bin, manchmal könnte ich ihn vergiften. Zu gewissen Zeiten kann er auf Menschen wie ein eiskaltes Sturzbad wirken.«
Die anderen lachten und blieben noch einige Zeit in gemütlichem, teils offenem, teils leisem Zwiegespräch sitzen.
»Wie lange wird unser Aufenthalt hier noch dauern?« fragte Miß Thomson leise ihren Geliebten, aber deutlich genug, daß auch die anderen sie verstehen konnten.
Es war eine geheime Frage, die allen fortwährend auf der Zunge lag.
»Bis du gesund bist, Schatz,« entgegnete Charles.
»Es läßt sich ja auch hier ganz gemütlich leben. Einen besseren Kurort findest du nirgends. Aber dann, Betty, dann binden uns keine Rücksichten mehr, wir fahren direkt nach England und betreiben alles mit der größten Eile.«
»Aber nicht so schnell, wie Mister Youngpig,« flüsterte Betty lächelnd.
»Du wirst von den Meinen mit offenen Armen aufgenommen werden,« sagte auf der anderen Seite Harrlington seiner endlich errungenen Braut ins Ohr. »Noch ehe wir in England ankommen, ist Schloß Ailesbury, das Stammschloß meiner Väter, für uns beide eingerichtet. Zwischen seinen Mauern sollst du erst ganz erkennen, wie innig meine Liebe zu dir ist!«
»Und wie heiß die meine sein kann,« flüsterte Ellen mit einem Händedruck zurück. »Du hast mich besiegt, James. Es war ein heißer Kampf, aber der Preis, welchen du davongetragen hast, wird dich deine Wunden bald vergessen lassen.«
»Wenn Richard Löwenherz erst immer bei mir ist,« koste Miß Murray mit Lord Hastings, »wird mich so leicht kein Stein zum Straucheln bringen. Wie gut, daß es keine Drachen und andere Ungeheuer mehr gibt, sonst würdest du den Kampf gegen sie aufnehmen, und ich wüßte dich in Gefahr. Es ist doch besser so.«
»Doch! Ich werde gegen sie kämpfen, sie besiegen und dich befreien,« entgegnete Lord Hastings.
»Von Schlangen und Ungeheuern willst du mich befreien?« lächelte Jessy, welche den Sinn seiner Worte nicht verstand.
»Gewiß, von Schlangen und Ungeheuern,« wiederholte Lord Hastings ernsthaft. »Sorge und Kummer heißen diese Ungeheuer, welche sich von keinen Mauern abhalten lassen, und wären es goldene, ja, gerade die von solchen Beschützten suchen sie mit Vorliebe auf und zeigen ihnen, daß sie nirgends mehr Macht haben über die Menschen, als wenn sie sich in Sicherheit und Ueberfluß wähnen. Aber vor mir werden sie fliehen; ich werde sie töten, und bin ich dessen nicht fähig, versagt meine Kraft, so werde ich ihnen die giftige Spitze abbrechen oder mit dir unterliegen.«
»Deine Kraft wird nicht versagen. Wo du bist, sollen weder Kummer noch Sorge mir etwas anhaben können,« flüsterte Jessy, sich an ihn schmiegend.
»Und was hast du mir zu sagen, Hannes?« wandte sich Hope an ihren jungen Gatten. »Bist du nicht auch so poetisch beanlagt, mir in blumenreicher Sprache deine Liebe zu verstehen zu geben? Früher tatest du es manchmal.«
»Früher? Nun ja, wenn ich ein paar Gläschen Grog getrunken habe, kann ich recht hübsche Verschen machen, dann fehlt es mir niemals an Reimen, desto mehr, wenn ich nüchtern bin.«
»Ach pfui! Wie kannst du so sprechen? In meiner Gegenwart solltest du nie nüchtern sein.«
»Na nu, ich kann doch deinetwegen kein Trunkenbold werden.«
»Du verstehst mich nicht. Ich meine, du sollst in meiner Gegenwart nicht nüchtern, sondern poetisch, schwärmerisch sein.«
»Hol's der Henker, ich habe Hunger, da fühle ich mich stets nüchtern,« sagte Hannes. »Du paßt besser zum Dichten und Schwärmen als ich, kannst mich nachher etwas anschwärmen, erst aber sorge für eine reichhaltige und nahrhafte Mahlzeit.«
»Du behandelst mich wie deine Sklavin,« schmollte Hope.
»Ich bin auch dein Herr und Gebieter,« entgegnete Hannes lachend und stand auf.
»Ich habe nie versprochen, dir unbedingt gehorsam zu sein.«
»Das verlange ich aber.«
»Ich tue es aber nicht.«
»Das will ich sehen. Gehe voraus und besorge mein Essen!«
»Gehe du allein, ich bleibe!«
»Gut!«
Hannes ging, und Hope blieb. Erstaunt blickte die Gesellschaft die beiden an. War das Ernst? Sie hatten bisher geglaubt, Hannes und Hope lebten sehr glücklich zusammen.
Hannes war ihnen noch nicht aus dem Auge entschwunden, als ihm der Reporter, den Finger an der Mütze, entgegentrat.
»Sind Sie der Herr, welcher sich Freiherr Johannes von Schwarzburg nennt?« fragte er.
»Ich nenne mich nicht so, sondern ich werde so genannt,« entgegnete Hannes. »Was gibt es?«
»Einen Brief.«
Der Reporter brachte aus der Ledertasche ein versiegeltes Schreiben zum Vorschein.
»Woher?«
»Es war bekannt, daß ich von London aus zu Ihnen stoßen würde, und so ging mir dieses Schreiben von Deutschland aus nach einem amerikanischen Hafen meines Schiffes zu.«
»Ich danke Ihnen.«
Hannes war stehen geblieben und wollte den Brief öffnen.
Da stand plötzlich Hope neben ihm.
»Tu's nicht, Hannes, ich bitte dich.«
»Was soll ich nicht tun?« fragte Hannes erstaunt.
»Oeffne nicht den Brief, ich weiß nicht, in mir steigt plötzlich eine furchtbare Ahnung auf.«
»Aber, liebe Hope, ich muß ihn doch einmal lesen, was kann Fürchterliches darin stehen?«
Er riß ihn auf, Hope erbebte plötzlich an allen Gliedern, sie mußte sich auf seinen Arm stützen, um sich aufrecht erhalten zu können.
Hannes' Augen vergrößerten sich, als er den Brief las. Er murmelte etwas durch die Zähne, zog die Brauen finster zusammen, dann aber schüttelte er verächtlich den Kopf und brach in ein spöttisches Lachen aus.
»Sehr gut,« rief er mit ungeheuchelter Lustigkeit, »hier, Hope, lies es! Du mußt es doch zu erfahren bekommen.«
Hope nahm mit zitternden Händen den Brief. Ihre Augen wurden starr. Das Papier bebte heftig zwischen ihren Fingern, und als sie den Brief gelesen hatte, warf sie sich weinend und schluchzend an die Brust ihres Mannes.

Hannes schien verwundert und sagte eher vorwurfsvoll, als bedauernd:
»Aber, Hope, wie kannst du dir dies so zu Herzen nehmen?«
»Ich weine um dich, nicht um mich,« schluchzte Hope. »Ach, du armer Mann, was für eine Enttäuschung hast du auszustehen!«
»Ich, Hope? Um mich brauchst du wirklich nicht zu weinen, ich machte mir keinen Pfifferling daraus, wenn — wenn ...«
Hope hob das Köpfchen und blickte Hannes mit tränenverschleierten Augen an.
»Wenn was, Hannes?«
»Wenn ich wüßte, daß meine Hope mich deshalb ebenso lieb hatte, wie früher,« sagte Hannes leise.
»O, Hannes, wie kannst du so grausam sprechen?« rief Hope und warf sich von neuem an seinen Hals. »Weißt du nicht, daß ich dich erst unter anderen Verhältnissen liebte? Ich schäme mich, davon zu sprechen, weil ich mich damals oft so hochmütig benahm und dich oft beleidigte, allerdings, ohne es zu wollen. Und nun kannst du auch nur wähnen, ich würde anders denken oder handeln, weil du wieder der bist, der du früher warst? Nein, Hannes, du solltest mich doch besser kennen.«
Hannes hatte Hope innig an sich gezogen. Er schien weder betrübt noch unwillig über die Nachricht, welche er empfangen hatte, sein Gesicht strahlte vor Freude.
»Hat meine Hope nicht vorhin gesagt, sie würde sich meinem Willen nie beugen, sie wäre meine Sklavin nicht?« scherzte er.
Doch Hope schien diese Worte für Ernst zu nehmen; erschrocken blickte sie auf.
»Um Gottes willen, Hannes, das ist doch nicht dein Ernst? Nun ja, ich habe nie geschworen, wie so viele andere Mädchen, meinem Manne gehorsam zu sein bis in den Tod oder ihm eine Sklavin zu werden, aber wohin du gehst, dahin will ich auch gehen. Freud und Leid will ich mit dir teilen und tragen. Bist du traurig, so will ich dich erheitern, und kannst du nicht für dich noch für mich sorgen, so will ich es tun, so lange meine Kräfte reichen, und wenn du es auch nicht von mir haben wolltest, ich würde es doch tun. Insofern gehorche ich dir nicht unbedingt.«
»Das wußte ich von meiner Hope,« sagte Hannes mit Tränen im Auge.
Hope war schon wieder heiterer Laune.
»Hast du bemerkt, wie die vorhin erstaunt guckten, als ich dich allein fortgehen ließ?« fragte sie.
»Ja, sie glaubten, wir hätten uns gezankt, und schlossen daraus, daß so etwas öfters zwischen uns vorkäme.«
»Ach, diese Dummen! Weißt du, was ich getan hätte, nachdem du fortgegangen wärst?«
»Ich glaube, ich weiß es.«
»Nun?«
»Du wärest auf einem anderen Wege vorausgelaufen und hättest mir alles fertiggemacht.«
»Richtig geraten,« lachte Hope, ihren Mann wieder küssend. »Laß andere denken, was sie wollen, wenn sie sich nur irren.«
Dann wurde Hope wieder nachdenkend und traurig.
»Ach, Hannes, da fällt mir etwas ein, was mich recht verstimmt. Was soll denn nun aus der ›Hoffnung‹ werden?«
»Die gehört nun freilich nicht mehr uns, wir dürfen nicht einmal mehr über sie verfügen.«
»Wir fahren aber doch wenigstens auf ihr nach Hause?«
»Ich glaube kaum. Ich möchte überhaupt nicht mehr ihre Planken betreten und auch nicht mehr nach Deutschland zurückkehren.«
»Die schöne ›Hoffnung‹,« seufzte Hope, »mein Schiff tut mir am meisten leid.«
»Es kann aber nichts helfen, wir müssen sie zurückschicken oder verkaufen.«
»Ich kalkuliere, das ist nicht nötig,« rief eine Stimme, und hinter dem Felsen kam Nick Sharp hervor. »Was schwatzt ihr beiden Erbschleicher da von Sorge, Leid und Verkaufen? Hope und Hannes, ihr seid die reinsten Schoßkinder des Glücks, mit euch spiele ich einmal in der Lotterie.«
Unsere Erzählung führt uns abermals nach Deutschland, und wieder bringt sie Liebesglück und Liebesleid, den Kampf einer zarten Mädchenseele, welche nicht weiß, ob sie der Wahrheit die Ehre geben soll, wodurch sie den Geliebten verliert, oder ob sie für immer ein tiefes Geheimnis verschließen soll, wodurch sie den Geliebten zwar besitzen, aber ihm nie ihr Herz offen zeigen darf.
Es war auf dem Eise gewesen, wo sie sich kennen gelernt hatten. Er hatte sie nicht aus dem Wasser vor dem Tode des Ertrinkens gerettet, sie nicht mit Lebensgefahr unter dem Eise hervorgeholt, er war ihr nicht beim Aufhelfen nach einem Sturz auf der glatten Decke behilflich gewesen, nein, es war alles viel einfacher gekommen, und doch dünkte es beiden wie ein Beschluß des Himmels, daß sie sich zusammengefunden hatten.
Ein Grund zu der schnellen Annäherung war vielleicht, daß sie beide sehr gut fuhren. Ein gewandter Schlittschuhläufer sucht sich wohl immer als Begleiterin eine ebenfalls geschickte und graziöse Läuferin aus, und doch gibt merkwürdigerweise selbst die leidenschaftlichste Anhängerin des Eissportes diese Passion auf, wenn sie einen Bräutigam bekommt, der diese Kunst nur mittelmäßig versteht, eben weil sie sich nicht mit einem Stümper auf der glatten Fläche bewegen will, und wäre sie auch die verliebteste Braut.
Unsere beiden jungen Leutchen hatten sich dadurch zusammengefunden, daß sie sich gegenseitig als Meister des Schlittschuhlaufs erkannten. Kein anderer Herr konnte so geschickt über das Eis gleiten, wie der junge Mann mit der aufrechten, strammen Haltung, dem trotz des Winters braungebrannten Gesicht, den hellen Augen und dem blonden Schnurrbärtchen, und keine Dame wußte sich so graziös zu wiegen, wie das junge Mädchen in dem einfachen Kleide, dem polnischen Barett, mit dem winzigen Muff und dem niedlichen Gesicht.
Wohl hatten sie sich gleich das erstemal einander vorgestellt, als der junge Mann um die Ehre bat, sie eine halbe Stunde zu führen, aber, wie so oft, hatte keines in der Verlegenheit den Namen des anderen verstanden. Arm in Arm, Hand in Hand, schwebten sie stumm nebeneinander her, bald vorwärts, bald rückwärts, bald die Rollen wechselnd, ganz in dem Genusse vertieft, welchen jeder passionierte Eisläufer empfindet, nämlich in dem Gedanken, von dem Gesetze der Schwerkraft befreit zu sein und wie ein Vogel in der Luft schweben und fliegen zu können.
Jeden Tag fand sich das junge Paar zusammen, vormittags oder nachmittags, und merkwürdigerweise verabredeten sie sich doch niemals. Das kam daher, weil jedes von ihnen des Vormittags sowohl, als des Nachmittags am Teiche erschien, einige Male um ihn herumging und dann, wenn es den Erwarteten nicht sah, wieder nach Hause ging.
War der Partner da, dann wurden die Schlittschuhe schnell angeschnallt, und jedesmal konnte man dieselbe Begrüßung hören:
»Ah, wie schön, daß auch Sie hier sind! Ich hatte schon eine Ahnung, Sie diesmal vormittags — oder nachmittags — zu treffen.«
Dann wurden die Hände gereicht, einige Stunden, ohne viel zu sprechen, über den Teich geschwebt, nach der Brücke geführt, abgeschnallt, auf beiden Seiten eine stumme Verbeugung gemacht und auf zwei verschiedenen Wegen nach Hause gegangen.
Vierzehn Tage hatte dieses seltsame Spiel der beiden schon gedauert, und sie wußten noch immer nicht, wie sie hießen, noch wer sie waren. Da, eines Nachmittags, die Dämmerung brach schon an, mäßigte der junge Mann plötzlich den schnellen Lauf, bremste und kam gerade in einer Bucht des Teiches unter einige dichte Büsche zu stehen.
»Es war heute das letztemal, daß ich mit Ihnen gefahren bin, Fräulein,« sagte er.
»Ach, wie schade! Es war — Sie fahren so schön. Bleiben Sie nicht hier?«
»Mein Dienst ruft mich zurück.«
»Ihr Dienst? Ich glaubte immer, Sie wären Kaufmann.«
Der Herr lächelte.
»Als ich mich Ihnen vorstellte, nannte ich Ihnen doch meinen Beruf.«
»Ich habe Sie damals nicht verstanden. Was sind Sie eigentlich?« fragte die junge Dame naiv.
»Unterleutnant zur See,« sagte der junge Mann in einem Tone, dem man anhörte, daß er diese Stellung noch nicht lange innehatte.
»Ach, also Seeoffizier! Das ist ein interessanter Beruf.«
»Und ein ehrenvoller. Ich bin stolz darauf, die Uniform der Kaiserlichen Marine zu tragen.«
Die Dame blickte träumerisch auf die Winterlandschaft.
»Ich bitte um Verzeihung,« sagte der Herr wieder, »ebenso, wie Sie meinen Beruf nicht verstanden haben, so habe ich auch Ihren Namen überhört.«
»Eugenie Ebeling,« lächelte das Mädchen, »und mir ging es ebenso mit dem Ihrigen.«
»Johannes Vogel.«
Das Mädchen erschrak furchtbar, es versuchte nochmals seine Hände zu befreien, aber es gelang ihm nicht, der Offizier hielt sie fest.
»Warum erschraken Sie so? Sie haben keinen Grund dazu,« sagte der Offizier vorwurfsvoll. »Doch ich kann es mir erklären. Ich bin einst Gegenstand allgemeiner Neugierde gewesen, mein Name ist viel in Zeitungen genannt worden, ohne daß ich etwas Hervorragendes getan, und ohne, daß ich es gewollt hätte. Diese Hand, der Sie die Ihrige entziehen wollen, schmückte lange Zeit das Wappen eines freiherrlichen Hauses. Kann ich dafür, daß ich es unrechtmäßigerweise geführt habe? Ich glaube, nein, ich und niemand sonst kann mir einen Vorwurf machen, sonst trüge ich auch des Kaisers Rock nicht mehr.«
Wohl hatte das Mädchen diese Worte gehört, aber es bemühte sich noch, die Hände frei zu bekommen.
»Lassen Sie mich los!« sagte es in klagendem Tone. »Lassen Sie mich los, ich bitte Sie!«
Der Offizier gab es frei.
»Sie reisen ab?« fragte Eugenie.
»Morgen früh!«
»Dann leben Sie wohl auf Nimmerwiedersehenl«
Johannes sah, wie Tränen ihren Augen entstürzten, denn plötzlich jagte sie im schnellsten Laufe der Brücke zu, und ehe der bestürzte Offizier ihr folgen konnte, sah er schon, wie sie diese, mit den Schlittschuhen in der Hand verließ, ohne sich noch einmal umzusehen.
»Rätselhaft,« dachte der Offizier, schnallte auch ab und ging mit traurigen Gedanken nach Hause, um seine Koffer zu packen.
Aber mochte die Sehnsucht nach der Unbekannten wohl so stark in dem jungen Offizier sein, daß er ganz die Folgen seines Ungehorsams vergaß, oder hatte sich sein Urlaub verlängert? Am nächsten Morgen erschien er wieder mit den Schlittschuhen in der Hand am Teiche, spazierte stundenlang auf und ab, aß in einem nahen Restaurant zu Mittag, erschien dann sofort wieder am Eis und blieb dort bis gegen Abend.
Er war vergebens gekommen, Eugenie Ebeling erschien nicht.
Geduld ist eine herrliche Tugend, und der junge Seeoffizier besaß sie. Am nächsten Tage hielt er sich wieder von Sonnenaufgang bis -untergang am Eise auf, und am dritten Tage ebenso, ohne das Ziel seiner Sehnsucht zu erblicken. Sah er ein polnisches Barett, so schlug sein Herz schneller, tauchte in der Ferne eine kleine, schlanke Gestalt auf, so richtete er sich schon höher auf, aber immer wurde er getauscht.
Niedergeschlagen gab er auch am Abend des dritten Tages seine Hoffnung auf, aber morgen wollte er sein Suchen wieder beginnen, wenn auch auf eine andere Weise.
»Wer ist sie?« dachte er. »Sie geht einfach, aber geschmackvoll angezogen. Sie spricht ein reines Deutsch und drückt sich sehr gut aus, also muß sie auch gebildet sein. Sie kommt bald des Vormittags, bald des Nachmittags, also ist sie Herrin ihrer Zeit, sie gehört nicht dem dienenden Stande an. Aber es fehlt ihr der Schliff, den man in besseren Kreisen findet. Sie wird einer einfachen, bürgerlichen, soliden Familie entstammen. Die Hauptsache ist, sie gehört nicht dem dienenden Stande an, und das ist sehr, sehr gut.«
Der junge Offizier in Zivil gefiel sich in diesem Selbstgespräch. Der direkte Weg hätte ihn bald nach seiner Wohnung geführt, und da er dies nicht wollte, so schlug er den entgegengesetzten ein, der ihn in einen Wald brachte. Gemächlich wandelte er auf dem beschneiten, hell vom Monde beschienenen Wege, auf dem die Schatten der Bäume lagen.
»Warum ist es sehr, sehr gut?« führte er sein Selbstgespräch fort. »Könnte mir nicht ganz gleichgültig sein, ob sie dient oder nicht? Nur immer redlich gegen dich selbst, Johannes, Selbstbetrug ist die allergrößte Lüge. Also warum? Weil du sie liebst? Mache nur ja keine Umschweife darüber. Ja denn, ich liebe das Mädchen, und es ist meine erste, aufrichtige Liebe. Möchtest du es heiraten, Johannes? Sehr gern, am liebsten gleich auf der Stelle. Ich möchte, es wäre jetzt hier, dann würde ich zu ihm sagen: Eugenie, willst du meine liebe, kleine Frau werden?«
Des Offiziers Herz schlug schneller, und infolgedessen machte er größere Schritte, doch gleich mäßigte er sie wieder.
»Kaltes Blut,« murmelte er, »schäme dich, gleich wieder die Besinnung zu verlieren! Also heiraten möchte ich sie, das steht fest. Aber nun weiter zur Hauptfrage: Kannst du sie ernähren? Nein, denn deine zweihundertvierzig Mark Gehalt und die Zulagen reichen nicht, und eine Heiratskaution kannst du nicht aufbringen. Hat sie Geld? Ich glaube kaum. Also der Schluß ist, du kannst sie nicht heiraten. Verdammt, daß für den Offizier beim Heiraten so viele Wenn und Aber zu bedenken sind. Wir sind durchaus nicht zu beneiden, wie sich viele Leute einbilden. Herr Gott, ich bin stolz darauf, Seeoffizier zu sein, das ist wahr, aber so eine kleine Frau zu besitzen, ist auch nicht schlecht! Liebst du sie denn wirklich so?«
Wieder ging der junge Mann schneller, bis er plötzlich stehen blieb.
»Ja, ich liebe Eugenie mit aller Kraft meines Herzens,« rief er laut, daß die Bäume das Echo wiedergaben, er zusammenschrak und dann über seine Heftigkeit lachen mußte.
»Aber was hilft's?« murmelte er, den Weg fortsetzend. »Vorläufig ist die Sache aussichtslos. Mein Los wird sein, wie das so vieler anderer: Warten, warten und warten, bis man Kapitän zur See ist. Oder soll ich an die Freigebigkeit meines Nachfolgers, des Freiherrn von Schwarzburg, appellieren? Teufel, nein, das kann ich nicht! Aber helfen würde er doch. Verflucht!«
Dann fiel ihm wieder etwas anderes ein.
»Ja so, ich weiß ja noch gar nicht, wo sie wohnt, wo sie überhaupt lebt, und kenne ihre Familie nicht. Wie soll ich es denn nur anfangen, sie wieder zu treffen? Daß sie mich liebt, ist ganz sicher, sonst würde sie nicht jeden Tag wiedergekommen sein, als sie wußte, daß ich kam, und kaum habe ich ihr gesagt, ich reise ab, so kommt sie auch nicht mehr. Das ist ein sicheres Zeichen, daß sie mich liebt. Wie soll ich sie nun wiederfinden? Annoncieren? Nein, das schickt sich nicht. Ich muß auf gut Glück suchen.«
Der Weg führte Johannes an einen kleinen Fluß, dessen Eisfläche im Mondschein glitzerte.
»Es ist gegen sechs Uhr! Wenn ich hier anschnalle und geradeaus fahre, kann ich um sieben Uhr in der Stadt sein. Der Fluß läuft nicht weit von unserer Wohnung vorbei.«
Gedacht, getan! Im nächsten Moment saß der Herr Leutnant zur See im Schnee, hatte mit einem Druck die Schlittschuhe an den Füßen und schwebte in der nächsten Minute mit beflügelten Sohlen über die spiegelglatte Fläche, welche noch von keinem anderen Stahl zerrissen war.
Es war eigentlich nicht erlaubt, hier zu fahren, aber was kümmerte sich der junge Mann darum? Verbotene Früchte sind die süßesten. Hier lief es sich zehnmal schöner, als auf dem befahrenen Teiche, wo man fortwährend Leuten ausweichen mußte und aus einem Spalt in den anderen geriet.
Der Abend war wunderschön. Ein sternenklarer Himmel wölbte sich über dem einsamen Läufer. Kein Lufthauch hemmte seine Bewegungen, und das leise Kratzen des Stahles war das einzige Geräusch. Der Offizier gab sich ganz der berauschenden Ruhe hin, aber seine Gedanken waren nur bei Eugenie. Er zermarterte sein Gehirn, wie er sie erstens wiederfinden, und zweitens, wie er sie sein eigen nennen könne.
Da bemerkte er plötzlich im Mondschein auf der spiegelglatten Fläche leichte, gebogene Risse.
»Hier hat noch ein anderer von der verbotenen Frucht gekostet,« dachte er. »Immerhin ein Trost, daß ich nicht der einzige Uebertreter des Gesetzes bin. Er war ein guter Läufer, die Bogen sind schön und ohne Ecken, sicher, graziös und kühn. Hier ist er gesprungen, er setzte über und fuhr rückwärts auch Bogen. Er kann noch gar nicht vor so langer Zeit hier gewesen sein, die Einschnitte sind noch ganz frisch.«
Der Beobachter hemmte seinen Lauf und lauschte. Er hörte nicht weit von sich ein leichtes Schlürfen auf dem Eise.
»Boot ahoi, Segel grad voraus,« lächelte er, »da ist ja mein Mann. Werde mir ihn einmal betrachten.«
Der Fluß machte eine Biegung, so daß er den einsamen Läufer nicht sehen konnte.
Langsam fuhr er bis an die Ecke, bog um dieselbe und blieb überrascht stehen. Dann aber jagte er lautlos hinter der Gestalt her, welche im Mondschein Figuren in das Eis schnitt.
Es war eine Dame, die sich graziös hin- und herwiegte, klein, schlank, und auf dem Kopfe trug sie ein Pelzbarett.
Der Offizier wußte, wen er vor sich hatte. Vorbei war alle Selbstbeherrschung.
Im Nu hatte er sie unbemerkt erreicht und schlang von hinten die Arme um sie.
»Eugenie!«
Das Mädchen zuckte, wie vom Blitz getroffen, zusammen, nicht, weil es über den plötzlichen Ueberfall erschrak, sondern über den Klang dieser Stimme.
»Warum haben Sie mir das angetan?« waren die ersten Worte, die es hervorbringen konnte.
»Ich? Ich habe Sie drei Tage vergebens auf dem Schloßteiche erwartet. Denken Sie sich, mein Schiff, auf das ich kommandiert worden bin, ist noch einmal auf sechs Wochen in Dock geschickt worden, es schlingert zu toll nach dem Backbord hinüber. Verstehen Sie das? Nein. Nun, die Hauptsache ist, ich habe sechs Wochen Nachurlaub bekommen, das Eis hält auch noch, und da wollen wir tüchtig zusammen fahren. Sind Sie damit einverstanden, Fräulein Eugenie — Ebeling?« kam es langsam nach.
»Es wäre besser für mich und für Sie gewesen, der Zufall hätte uns nicht wieder zusammengeführt,« seufzte das junge Mädchen tief auf.

»Es wäre besser für mich und für Sie gewesen, der Zufall hätte uns
nicht wieder zusammengeführt,« seufzte das junge Mädchen tief auf.
»Wünschen Sie, daß ich mich entferne? Sie brauchen nur ein Wort zu sprechen, und ich existiere nicht mehr für Sie.«
Aber der Offizier blieb, weil — Eugenie ihn nicht fortließ.
Sie erzählte, sie wohne nicht weit entfernt in einem Häuschen, welches dicht am Flusse liege. Der Besitzer sei ein Fischermeister, und da er es erlaube, so dürfe sie hier fahren.
»Und jetzt stehen Sie unter meinem Schutze, ich protegiere Sie,« fügte sie lächelnd hinzu.
»Warum kamen Sie nicht wieder nach dem Schloßteiche, nachdem ich Ihnen gesagt hatte, ich würde am anderen Tage abreisen?«
Es erfolgte keine Antwort, so oft der Offizier auch fragte:
»Hatten Sie keine Zeit?«
»Ich habe immer Zeit.«
»Warum also nicht? Ich bitte Sie, beantworten Sie mir diese Frage.«
»Weil Sie nicht mehr dort waren,« kam es endlich zögernd über die Lippen des jungen Mädchens, und gleichzeitig schlug sie die Hände vor das tieferrötende. Gesicht.
›Schnell fertig ist die Jugend mit dem Wort‹, sagt Schiller, und auch mit der Tat ist sie nicht zögernd, denn beide entspringen aus demselben Gefühl. Und die Liebe ebenso. Schon nach einer halben Stunde hatten sich die beiden gestanden, daß sie sich liebten von dem Augenblicke an, da sie sich zum ersten Male die Hand reichten zum gemeinsamen Lauf.
Dann erst fiel es dem jungen Manne ein, daß er ein wenig unbesonnen gehandelt hatte, er hätte sich vorher wenigstens etwas über die orientieren müssen, der er seine Liebe schenkte, und die ihm die erste Liebe entgegenbrachte.
Er fragte, und Eugenie antwortete, verschämt, zaghaft und oft lange wartend, ohne aber etwas Beleidigendes in dem Verhör zu finden.
Sie war armer Leute Kind gewesen, hatte aber eine sehr gute Erziehung genossen. Sie stand allein in der Welt und ernährte sich — Johannes hielt den Atem an — vom Uebersetzen englischer und französischer Zeitungsberichte. Völlig selbständig verfüge sie vollkommen über ihre Zeit, habe ein gutes Auskommen und fühle sich zufrieden.
Langsam fuhren sie nebeneinander, in der Ferne tauchten die erleuchteten Fenster eines kleinen Hauses auf.
»Eine Frage muß ich noch an Sie stellen, Eugenie,« fing Johannes nach einer langen Pause mit gedrückter Summe an, er war gegen das Mädchen noch etwas zurückhaltend. »Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal gedient?«
»Nein, niemals,« entgegnete sie unbefangen.
»Gott sei Dank,« jubelte der junge Mann jetzt auf, »dann steht uns nichts im Wege, als die Zeit. Geduld müssen wir freilich haben, Eugenie; aber wie gern will ich sie üben, wenn ich doch das Ziel in der Ferne sehe.«
Das Mädchen wurde aufmerksam.
»Was verstehen Sie unter dienen?«
»Das ist eine schwierige Definition. Schließlich muß ja jeder Mensch arbeiten und dem anderen dienen, und ganz besonders wir Soldaten, aber im speziellen versteht man unter dienen die Leistung einer Arbeit für Geld bei fremden Leuten.«
»Ich war allerdings schon einmal bei fremden Leuten, aber gedient habe ich da ebensowenig, wie irgend ein Kaufmann. Ich war Direktrice in einem Geschäft. Was ist Ihnen?«
Johannes hatte ihre Hand plötzlich fallen lassen, war stehen geblieben und sah sie erschrocken an.
»Warum haben Sie mir das verheimlicht?« stammelte er.
»Wie können Sie so etwas sagen!« sagte sie traurig. »Bin ich Ihnen entgegengekommen? Habe ich Sie ermutigt, daß Sie sich mir wieder näherten? Nein, vor drei Tagen habe ich mich von Ihnen fast ohne Abschied auf Nimmerwiedersehen entfernt, und nun sprechen Sie so! Kann ich etwas dafür, daß ich ›dienen‹ mußte, und daß ich als ›dienende‹ Person für Sie zu gering bin? Hier ist meine Wohnung, leben Sie wohl!«
Sie wandte sich kurz um und wollte die Uferböschung hinaufklimmen, doch schon war Johannes neben ihr und hielt sie zurück.
»Nein, nein, Eugenie,« rief er leidenschaftlich, »du beurteilst mich ganz falsch! Nicht ich bin es, der dich verachtet, weil du eine Stellung bekleidet hast, welche die Welt als eine dienende bezeichnet, es sind die Ansichten jener Kreise, in denen zu verkehren ich gezwungen bin. Sieh, Eugenie, wir Offiziere dürfen kein Mädchen heiraten, welches jemals, auch nur einen Tag lang, eine Stellung angenommen hat, und wenn sie unbeschränkte Direktrice des größten Weltgeschäftes wäre und in den vornehmsten Kreisen ganz frei verkehrt hätte. Es sind törichte Ansichten, ich weiß es, aber ich bin von ihnen abhängig.«
»So lassen Sie mich!« sagte Eugenie dumpf, und suchte sich aus seinen Armen zu befreien. »Gute Nacht!«
»Nein, Eugenie, ich lasse dich nicht! Höre mich an, sträube dich nicht, ich gebe dich nicht frei, bis du mich hast ausreden lassen. Du kennst meine Lebensgeschichte, sie wurde genügend ausposaunt, und ich wäre unglücklich geworden, wenn mir mein Frohsinn nicht über alles hinweggeholfen hätte. Aber mein Temperament ist auch wieder ein solches, daß ich dennoch den Schicksalsschlag oft genug nachträglich verspüre, und zwar auf eine Weise, die ich nicht vertrage. Ich kann mich noch nicht selbst ernähren, dazu ist meine Leutnantsgage zu klein, und so muß ich die Unterstützungen annehmen, mit denen mich der Freiherr von Schwarzburg reichlich bedenkt. Ich nahm diese an, weil sie mir edelmütig angeboten worden sind, und weil ich sie nicht ausschlagen darf, will ich nicht zugleich die Offizierskarriere aufgeben.
»Aber doch wird es mir manchmal sauer. Ich höre hinter meinem Rücken spotten. Man nennt mich den Exfreiherrn, den abgedankten Baron und so weiter. Ins Gesicht wagt man mir natürlich so etwas nicht zu sagen, der Spott fiele auf den Urheber zurück, aber ich habe eine Natur, der so etwas weh tut. Ach, Eugenie, es ist so schwer, dergleichen zu ertragen. Im bürgerlichen Leben kennt man so etwas nicht, aber einer, welcher einst einen Adelstitel besessen hat, empfindet die Zurückversetzuug ins Bürgertum schwer. Und doch, ich hätte alles ertragen, weil ich mir meines Wertes als Mann bewußt bin, und weil ich weiß, daß ich von meinen Vorgesetzten nie darunter zu leiden habe, aber hätte ich einen Grund, ich würde mit Freuden des Kaisers Rock mit der Zivilkleidung vertauschen.
»Als Offizier kann ich dich nicht heiraten, weil du schon einmal eine dienende Stellung eingenommen hast, und jetzt habe ich einen Grund, meinen Beruf zu wechseln. Ich finde gewiß Stellung. Ich kenne mehrere Sprachen, ich bin, ohne mich loben zu wollen, ein Mensch, der in die Welt paßt, und ich will leicht ein gutes Engagement bekommen. Als ich früher einmal mit jemandem darüber sprach, erhielt ich von ihm schon das Angebot, in einer großen Schiffsreederei einzutreten, aber ich schlug es aus. Ich liebe zwar meinen jetzigen Beruf, dich aber, Eugenie, liebe ich mehr. Mit Freuden entsage ich ihm und nehme dich dafür. Und dann, bedenke, wie lange wir warten müßten, bis wir uns heiraten könnten, wenn ich Offizier bliebe. Wir sind zwar beide noch jung, aber wir könnten doch ein hübsches Alter erreichen. Eugenie, ich bitte dich, sage ja, und ich reiche mein Entlassungsgesuch ein, Sei mein, Eugenie!«
Das junge Mädchen lag an seiner Brust und schluchzte.
»Antworte mir, Eugenie, willst du?«
»Ja,« hauchte sie.
»Sage mehr!«
»Komm — morgen — zu mir,« schluchzte sie.
»Sage mir heute etwas!«
»Ich liebe dich, Johannes, aber jetzt laß mich nach Hause gehen! Komm morgen zu mir; mein Hauswirt wird dir öffnen. Ich bin so aufgeregt.«
»Gut, so komme ich morgen zu dir, da wollen wir alles noch einmal vernünftig besprechen.«
»Aber komm nicht zu früh!«
»Komm erst am Nachmittag, ich habe gerade morgen viel zu tun. Vielleicht erst gegen Abend.«
»So komme ich am Abend. Wie lang werden mir die Stunden bis dahin werden!«
»Gute Nacht, Johannes!«
Der Offizier hob das Köpfchen der Geliebten und drückte einen langen, langen Kuß auf die roten Lippen.
»Der Verlobungskuß,« sagte er ernst. »Er besiegelt meinen Abschied. Bis morgen denn!«
Das Mädchen erwiderte den Kuß innig. Noch einen Händedruck spürte der Glückliche, dann fuhr sie nach dem Ufer und erklomm, mit den Schlittschuhen an den Füßen, die Böschung.
Johannes sah ihr nach, so lange er konnte. Sie verschwand im Dunkeln, dann schlug in dem Hanse ein Hund freudig an.
Der junge Mann seufzte tief auf, aber es klang wie ein Seufzen der Erleichterung.
»Der Würfel ist gefallen, und ich werde es nicht bereuen.«
Schon wollte er die Fahrt nach der nicht weit entfernten Stadt fortsetzen, als plötzlich eine Gestalt von der Böschung, aus der Richtung des Häuschens heruntergelaufen kam und ihm in die Arme stürzte.
»Gute Nacht, Johannes,« flüsterte Eugenie.
»Schlaf wohl, Eugenie, rege dich nicht auf! Morgen wollen wir ruhiger sprechen. Auf Wiedersehen!«
»Gute Nacht, mein Geliebter!« seufzte sie noch einmal schmerzlich, dann ging sie abermals zurück.
Als sie oben stand, wandte sie sich um, winkte mit dem Tuche, und nochmals hörte Johannes ihr ›Gute Nacht!‹.
Es war ihm plötzlich, als müsse er auf sie zustürzen und sie halten, eine furchtbare Unruhe erfaßte ihn, aber er bezwang sich, rief ihr noch einen Abschiedsgruß zu und machte sich auf den Weg nach der Stadt.
Entsetzlich langsam verstrichen die Stunden des Tages nach einer schlaflosen Nacht. Kaum begann der kurze Wintertag zu dunkeln, so klopfte er an die Tür des Häuschens, welches seinen Schatz beherbergte.
Er hörte schon von draußen Kinderstimmen und zwei ältere Stimmen. Eine männliche und eine weibliche befahlen den Kleinen fortwährend Ruhe, ohne daß sie Gehör fanden, und ein Hund begleitete sie mit seinem Geheul.
»Ein ungemütlicher Empfang,« murmelte Hannes, »bin kein Freund von Kindergeschrei, muß mich aber nun langsam daran gewöhnen.«
Die Tür wurde aufgestoßen, und Johannes blickte in die geröteten Augen einer ältlichen Frau. Ehe er noch zum Worte kam, wurde er schon angeredet.
»So, Sie sind der Herr, der heute kommen sollte?« sagte die Frau in ärgerlichem Tone. »Habe mir doch gedacht, daß so etwas schuld daran war! Warten Sie draußen, ich bringe Ihnen den Brief!«
Sie ging ins Haus zurück, und Johannes, zum Tode erschrocken, blickte ihr sprachlos nach.
»Was ist denn? Ist Eugenie nicht zu Haus?« brachte er verwirrt hervor, als die Frau mit einem Briefe zurückkehrte.
»Zu Haus? Ausgezogen ist sie heute morgen Hals über Kopf. Gestern abend kommt sie weinend nach Haus, ißt und trinkt nicht, sagt uns aber auch nichts, wo wir es doch immer so gut mit ihr gemeint haben, rumort die ganze Nacht in ihrem Zimmer herum und erklärt uns heute morgen ganz einfach, daß sie ausziehen wolle und zwar sofort. Dachte mir gleich, daß da so eine Liebelei vorgefallen ist.«

»Sparen Sie sich alle Bemerkungen,« brauste Johannes auf, in dessen Adern leicht erregbares Blut wallte. »Können Sie mir sagen, wohin Fräulein Eugenie gezogen ist?«
»Gar nichts weiß ich, da ist Ihr Brief.« Damit flatterte ihm ein Brief vor die Füße, und die Tür wurde krachend zugeschmettert.
Halb betäubt stand Johannes da; dann hatte er nicht übel Lust, noch einmal energisch um Auskunft über das Mädchen zu bitten, welches er als seine Braut betrachtete. Aber er besann sich anders, ging erst mit großen Schritten auf und ab, und als die kalte Winternacht sein Blut etwas gekühlt hatte, erbrach er den Brief und las ihn.
»Herr Johannes Vogel!
»Weil ich Sie wirklich geliebt habe, wünsche ich nicht, daß Sie meinetwegen einen Beruf aufgeben, zu welchem Sie Lust und Fähigkeit besitzen, und in dem Sie es so weit bringen können, daß Sie das, was Sie verloren haben, wiedererhalten. Ich gehe von hier, ohne Sie noch einmal zu sehen. Suchen Sie mich nicht, Sie werden mich nicht finden! Vergessen Sie mich, wie ich Ihr Bild aus meinem Herzen reiße.
Eugenie Ebeling.«
»Eugenie,« murmelte der junge Mann mit gebrochener Stimme. »Das also hatte gestern dein letzter Gutenachtgruß zu bedeuten, den Abschied für immer.«
Wir wollen die Empfindungen übergehen, welche den jungen Mann marterten, als er mit langsamen Schritten und gebeugtem Haupt der Wohnung zustrebte, die er mit seinen Eltern und Geschwistern teilte. Der Offizier schämte sich nicht, Arbeiter Eltern zu nennen. Er verschmähte nicht einmal, in dem einfachen Mansardenstübchen zu wohnen; die sorgenden Hände der Mutterliebe verwandelten es durch ihre rührenden Bemühungen, dem wiedergefundenen Sohne die alte, prächtige Behausung vergessen zu machen, in ein gemütliches Heim, und Johannes war dankbar dafür.
Aber er war nicht der Mann, der sich dem Spiele des Schicksals oder einer Weiberlaune ohne weiteres fügte, denn als solche mußte er die Handlung Eugenies immer wieder bezeichnen.
Er besuchte am anderen Morgen noch einmal die früheren Wirtsleute seiner Braut und fand eine bessere Aufnahme. Es waren brave Leute. Sie hatten Eugenie wirklich geliebt und wie ihr eigenes Kind behandelt. Die Grobheit gestern abend hatte nur den Schmerz der alten Frau bemänteln sollen.
Doch Johannes erfuhr nichts Neues.
Eugenie war ohne Angabe einer neuen Adresse abgereist, hatte auf dem Tische die Miete für den künftigen Monat liegen lassen und beim Abschied der Wirtin nur einen Brief mit der Bitte eingehändigt, ihn dem jungen Herrn zu geben, welcher am Abend nach ihr fragen würde.
Tränen hatten dabei ihre Worte fast ersticken wollen.
Der Offizier nützte die sechs Wochen Nachurlaub nach besten Kräften aus, um die Verschwundene wiederzufinden, allein vergeblich. Eugenie sollte recht behalten: ›Suchen Sie mich nicht, denn Sie werden mich nicht finden.‹
Es nützte ihm nichts, daß er seine Monatsgage opferte, um sich die Beamten auf den Stadthäusern williger zu machen. Er schrieb den ganzen Tag Briefe und empfing auch Antworten, doch keine brachte die Nachricht, daß Eugenie gefunden sei.
Endlich aber kam er auf eine Spur. Sie war zuletzt in Hamburg gesehen worden, wo sie mit einem Agenten, der Mädchen nach dem Auslande verschickte, verhandelt hatte.
Mit seinem letzten Gelde bestritt Johannes die Reise nach Hamburg — und fand das Bureau des Agenten geschlossen. Er mochte Grund gehabt haben, sein einträgliches, aber unsauberes Geschäft aufzugeben.
Johannes ruhte nicht. Er musterte alle Passagierlisten, welche ungefähr zu der Zeit ausgestellt worden waren, als Eugenie verschwand. Und endlich, endlich, fand er auch ihren Namen auf der Liste eines Schiffes, das nach Chile gegangen war. Auf weitere Erkundigungen erfuhr er, Eugenie habe in Valparaiso das Land betreten, ohne anzugeben, wohin sie sich wenden wollte.
Der Urlaub war abgelaufen, Johannes mußte nach seiner Garnison zurückkehren.
Während er die Schiffslisten studierte, hatte er Bekanntschaft mit dem Direktor einer großen Reederei geschlossen. Der Direktor fand Gefallen an dem aufgeweckten, tatkräftigen, jungen Manne, und ehe Johannes abreiste, hatten beide eine längere Unterredung. Als der Offizier vor der Abreise seine Uniform anlegte, hatte er recht wehmütige Gedanken. — —
Das Eis war schon lange geschmolzen. Auf den Teichen und Flüssen tummelten sich keine Schlittschuhläufer mehr, sondern Boote und Gondeln durchschnitten das lauwarme Wasser.
An der Alster, dem mächtigen Wasserbecken Hamburgs saß auf einer Bank ein junges, tiefschwarz gekleidetes Mädchen, dessen bleiches Gesicht seltsam gegen die Trauerkleidung abstach.
Es blickte hinab auf das glitzernde Wasser, aus welchem Gondeln, von raschen Ruderschlägen getrieben, dahinglitten, und bewimpelte Segelboote geschickt oder unbeholfen kreuzten, je nachdem sie von kundiger oder unkundiger Hand gesteuert wurden.
Die weißen, fast durchsichtigen Hände des jungen Mädchens hielten eine Ledermappe umklammert, welche sie fest gegen die Brust drückte, als enthielte sie große Geheimnisse oder Schätze.
»Es muß sein,« flüsterte es endlich mit einem Seufzer, »ich darf nicht anders handeln. Hätte ich ahnen können, daß bei meiner Rückkehr in die Heimat mir solche Gewalt in die Hand gelegt würde, den einen von seiner Höhe zu stürzen, den anderen wieder erheben zu können, fürwahr, ich wäre lieber in der Fremde in Schande und Elend gestorben. Ach, ich muß nun meinem edlen Wohltäter das bitterste Leid zufügen, wie schwer mir das auch wird. Was soll ich tun? Soll ich das Rad des Schicksals in Bewegung setzen? Ja, ich muß der Wahrheit die Ehre geben, will ich nicht die Achtung vor mir selbst verlieren.«
Sie umklammerte die Mappe noch fester und erhob sich von der Bank, sank aber sofort mit einem leisen Schrei und mit noch bleicherem Gesicht, als sonst, zurück.
Eben passierten zwei Männer, die sich eifrig unterhielten, die Bank. Der eine trug die Kapitänsuniform eines Hamburger Passagierdampfers, der andere einen Zivilanzug nach modernem Schnitt.
Da begegnete das Auge des letzteren dem entsetzten Blicke des jungen Mädchens. Wie angewurzelt blieb er stehen, dann aber war er mit einigen schnellen Schritten bei dem Mädchen, die Hände ausstreckend, das Gesicht vor Freude dunkelgerötet.
»Eugenie!«
Das Mädchen fand keine Antwort. Schnell verständigte der Herr, der natürlich Johannes Vogel war, den Kapitän, daß er ihn in einigen Stunden wiedertreffen wolle, und wandte sich dann Eugenie zu, ohne weiteres ihren Arm in den seinen nehmend, und führte sie in die buschigen Anlagen, welche das Alsterbassin einschließen.
Wie gebrochen hing Eugenie an dem Arme des Geliebten. Sie wagte nicht aufzusehen, und die freie Hand drückte die Briefmappe noch fester an die Brust. Die zarten Finger zitterten dabei heftig.
Doch Johannes wußte den Bann zu brechen.
Bald mit Kopfschütteln, bald mit Bedauern hörte der junge Mann die gestammelte Erzählung von Eugenies Erlebnissen, welche oftmals durch Tränen unterbrochen worden wäre, wenn Eugenie sie nicht immer energisch zurückgedrängt hätte. Dann klangen die Worte noch unsicherer, oft traten lange Pausen ein, ehe sie weitersprechen konnte, und alles Streicheln der kleinen Hand, die auf Johannes' Arm ruhte, vermochte das Zittern nicht zu beseitigen.
Eugenie wollte ihren Geliebten nicht der Offizierskarriere entreißen, in welcher er mehr, als in jeder anderen Laufbahn erreichen konnte, und war entschlossen, sich ihm durch Flucht zu entziehen. Ihre Sehnsucht stand schon lange nach fernen Ländern. Sie nahm eine Stelle als Erzieherin in Chile an. Dort angekommen, wurde ihr mitgeteilt, daß sie Betrügern zum Opfer gefallen sei; ihr Retter schickte sie zurück, und nun war sie wieder, in der Heimat.
Kopfschüttelnd hörte Johannes diese Erzählung an, besonders beim ersten Teile derselben sah er seine Begleiterin manchmal zweifelnd von der Seite an.
»So liebtest du mich damals wirklich?« fragte er.
»Von ganzem Herzen.«
»Aber, Kind, wie konntest du mich denn verlassen, da ich erbötig war, meinen Beruf zu wechseln, damit ich dich vor aller Welt lieben und meine Braut nennen konnte?«
»Ich tat es doch nur aus Liebe zu dir,« versicherte Eugenie mit gesenkten Wimpern.
»Das ist mehr als Selbstlosigkeit, sogar noch mehr als Entsagung,« dachte Johannes.
»Und was machst du jetzt? Warum gehst du in Trauer?«
»Ich habe gestern meine Tante begraben, die hier wohnte,« entgegnete Eugenie unsicher.
Von einer Tante hatte sie ihm damals nichts erzählt, jetzt aber erfuhr er, sie habe dieselbe immer ernährt.
Nun begann Johannes seine Verhältnisse zu schildern.
Er habe den Dienst bei der Marine bald nach der Flucht Eugenies quittiert, das Angebot, das ihm gemacht worden, sei ein zu verlockendes gewesen. Er sei in Hamburg bei einer Dampfergesellschaft angestellt und gehöre mit zu dem Komitee, welches die Schiffe vor der Abfahrt auf Seetüchtigkeit untersuche und nach der Rückkehr die Reparaturen bestimme. Er wäre jetzt so gestellt, daß er — die beiden jungen Leutchen traten eben in einen schattigen, einsamen Weg — nicht nur sich, sondern auch noch eine Frau ernähren könne.
Dabei blieb Johannes stehen, zog die freie Hand Eugenies an die Lippen und blickte ihr fragend ins Gesicht.
Es erfolgte einiges Zögern, einiges Sträuben, Bitten um Bedenkzeit, Verweigerung derselben, einige Tränen, viele Küsse und ein leises, kaum hörbares ›Ja‹.
Eugenie wurde von dem glücklichen Johannes nach Hause gebracht; in wenigen Tagen sollte sie eine ihr angemessene Wohnung beziehen, in welcher sie bis zur Hochzeit, nur wenige Wochen, bleiben sollte.
Als Eugenie allein war, fiel sie auf die Knie und hob inbrünstig die Hände zum Himmel auf. Dann nahm sie die Ledermappe vom Tisch, warf sie in den Ofen und wollte schon Feuer anlegen, als sie durch die Wirtin gestört wurde. Sie warf die Mappe unter einen Haufen von Zeitungen und Büchern, schloß den Schrank ab und ließ den Schlüssel nie aus der Tasche kommen. — —
Das Rad der Zeit steht nie still, wenn es sich auch für den einzelnen sehr ungleichmäßig bewegt. Für den Glücklichen saust es im Kreise herum; der Leidende klagt über seine geringe Schwungkraft, und der sehnsüchtig Wartende verwünscht seine schneckenlangsame Bewegung. Aber es läuft immer.
So verging auch für Eugenie und Johannes Woche nach Woche, und der Tag der Hochzeit kam immer näher.
Aber Johannes machte recht seltsame Bemerkungen an seiner Braut. Besuchte er sie in der Pension, in welche er sie gebracht hatte, so kam sie ihm einmal entgegengeflogen und hing jubelnd an seinem Halse, das andere Mal bewahrte sie vor ihm eine bange Zurückhaltung und schien kaum warten zu können, bis er wieder nach Hut und Stock griff. Sie bewegte sich immer in Extremen. Entweder sie erdrückte ihn mit Liebkosungen und schalt selbst über ihr gestriges, komisches Benehmen, oder sie zeigte ihm abermals ein bleiches, banges Gesicht und bebte in seinen Armen.
Alles Fragen blieb nutzlos. Eugenie entschuldigte sich, sie sei ein törichtes Mädchen.
Eines Tages kam Johannes in das Zimmer seiner Braut gestürmt.
»Zwei große Neuigkeiten,« rief er schon auf der Türschwelle.
»Eine kenne ich schon,« lächelte Eugenie. »Heute über acht Tage findet unsere Hochzeit statt.«
»Stimmt,« sagte Johannes und drückte einen Kuß auf die roten Lippen. »Aber nun die andere Nachricht: heute hätte ich beinahe sechs Millionen Mark geerbt. Die hätten wir gebrauchen können, nicht?«
»Du scherzest.«
»Es ist Wahrheit! Denke dir nur, wie das zuging. Heute morgen sitze ich in meinem Privatkontor, als ein Herr eintritt und mich fragt, ob er die Ehre habe, Herrn Johannes Vogel zu sprechen. Ich bejahte. Ob ich zu der und der Zeit in China gewesen wäre. Ich rechne nach, nehme ein altes Notizbuch zu Hilfe und bejahe abermals. Jetzt glaubte der Herr, den richtigen vor sich zu haben, und teilte mir mit, daß ich von einer gewissen Mistreß Congrave, die in einem chinesischen Hospital gestorben sei, sechs Millionen Mark nach unserem Gelde geerbt hätte.
»Du kannst dir denken, daß ich bald von meinem Kontorsessel gefallen wäre. Jedenfalls sprang ich so hoch auf, wie du eben jetzt. Aber freue dich nicht, ich bin der falsche Mann, der richtige ist Freiherr Johannes von Schwarzburg. Dieser Glückspilz hat in China Bekanntschaft mit einer wahnsinnigen Engländerin gemacht, die an ihm, mit Verlaub zu sagen, einen Narren fraß. Sie beschäftigte sich in ihren Gedanken nur mit ihm, und als sie einige Tage vor ihrem Tode plötzlich ihre volle Vernunft wiedererlangte, setzte sie den Freiherrn als Universalerben ein. Aber was ist dir? Du wirst so blaß?« unterbrach sich Johannes befolgt.
»Nichts, nichts, fahre nur fort!«
»Das ging aber nicht alles so schnell, wie ich jetzt erzähle. Ich mußte mit auf das Gericht; ich wurde für den Erben gehalten, man wollte mir die Erbschaft mit Gewalt aufdrängen, denn ich hieß ja Johannes Vogel und war in China zu jener Zeit gewesen, sogar auch in Sha-tou, bis ich die Sache endlich dahin aufklarte, daß mein Vorgänger, Johannes oder Hannes Vogel, der jetzige Freiherr von Schwarzburg, der Gesuchte sein würde. Ich habe das Testament gesehen, es hat alles seine Richtigkeit. Ich zog mit langer Nase ab.«
Atemlos, mit starren Augen hatte ihm Eugenie zugehört.
»Nun, bemitleidest du mich vielleicht,« scherzte Johannes, »daß mir die Erbschaft entgangen ist? Ich glaube, wenn ich nicht ein ehrlicher Mensch wäre, ich hätte sie mir aneignen können. Der Beamte fragte auch so sorglos, daß ich immer mit Ja und Nein zu meinen Gunsten antworten konnte, wenn ich gewollt hätte. Kein Teufel hätte den wahren Sachverhalt erfahren.«
Eugenie sah träumerisch vor sich hin.
»Johannes, ich habe einige Fragen an dich zu richten, über die du mich belehren kannst,« begann sie dann. »Gesetzt nun den Fall, dir würde diese Erbschaft aufgedrängt werben, du wüßtest zwar, daß sie dir nicht zukommt, aber du wüßtest auch, daß der, dem sie zufallen sollte, nicht mehr lebte, würdest du sie dann annehmen?«
Johannes war über diese Frage erstaunt.
»Auf keinen Fall,« rief er, »dann kommen erst die Angehörigen des verstorbenen Erben in Betracht.«
»Ich meine natürlich, solche existieren nicht. Auch dann würdest du die Erbschaft nicht annehmen?«
»Auch dann nicht. Ich würde erklären, daß ich nicht der richtige bin, und die Erbschaft ausschlagen.«
»Aber warum denn nur?«
»Weil ich mich dann immer in Besitz eines Gutes wüßte, welches eigentlich nicht mir gehörte. Ich müßte mich selbst für einen Spitzbuben halten, und wenn ich vor der Welt noch so ehrlich dastände.«
»Denken andere Leute auch so wie du?«
»Jeder ehrliche Mensch denkt so. Wer den Wert eines reinen Gewissens zu schätzen weiß, nimmt überhaupt kein Geschenk von unbekannter Hand an.«
Wieder überlegte Eugenie.
»Ich habe meine Frage nicht richtig gestellt, ich meinte etwas anderes,« begann sie abermals. »Angenommen, dir wäre eine Erbschaft zugesprochen worden. Alles wäre in Ordnung vor sich gegangen, und du selbst zweifeltest nicht im geringsten daran, daß sie dir gehörte! Nur ich wüßte, daß sie dir nicht gehörte, sondern einem anderen. Der andere wäre mir gleichgültig, auch bedürfte er der Erbschaft gar nicht, dich aber achtete und ehrte ich, ich freute mich, daß du im Besitze des Geldes seist, und brächte daher nicht zur Anzeige, daß dir die Erbschaft gar nicht gehört, fügte es dir überhaupt auch nicht. Wäre das unrecht von mir gehandelt?«
»Sehr, sehr unrecht,« entgegnete Johannes, »es wäre sogar eine ehrlose Handlung. Würde ich erfahren, daß du von der Unrechtmäßigkeit wüßtest und es mir verheimlicht hast, so müßte ich dich verachten, und wärest du auch mein bester Freund, denn du machtest mich ohne mein Wissen und meinen Willen zum Lügner und Betrüger, ich glaubte, ich sei der rechtmäßige Erbe und wäre es gar nicht. Käme der Betrug heraus, so würde ein Schatten auf mein ganzes Leben fallen. Und so wie ich, denkt jeder brave Mensch. Um Gottes willen, Eugenie, was ist dir?« rief Johannes plötzlich erschrocken.
Eugenie war mit der Hand nach dem Herzen gefahren und mit geschlossenen Augen in den Lehnstuhl zurückgesunken. Das schwache Rot, welches in letzter Zeit ihre Wangen zu schmücken begann, war verschwunden. Totenblässe bedeckte ihr Antlitz.

Johannes wollte sie emporrichten; aber bei seiner Berührung erwachte sie aus ihrer Betäubung und richtete sich mit einem Rucke auf.
»Es ist nichts, ein kleiner Anfall,« sagte sie, sich
erhebend. »Warte einen Augenblick, ich komme gleich zurück!«
Sie ging zur Tür hinaus; der verwirrte Bräutigam hörte im Nebenzimmer einen Schrank aufschließen und ein Werfen von Büchern, dann trat Eugenie wieder herein, in ihrer Hand eine Briefmappe haltend.
Langsam ging sie auf den Tisch zu, vor welchem Johannes stand, legte die Mappe hin und sagte mit leiser Stimme, welche vor Erregung bebte: »Lies die Papiere, welche die Mappe enthält — sie sind dein.«
Verwundert sah Johannes dem Mädchen nach, welches sich schon wieder in das Nebenzimmer entfernte. Er konnte sich dieses sonderbare Benehmen nicht enträtseln.
Doch die Briefmappe da konnte ihm wohl eine Aufklärung geben.
Er schlug die schwarze Decke auf, und einige vergilbte Schriftstücke flatterten ihm entgegen.
Schon beim Lesen des ersten Papieres färbte sich sein Gesicht dunkelrot, und je weiter er las, desto unruhiger wurde er, seine Augen vergrößerten sich. Seine Brust atmete schwer, und seine Hände, welche immer wieder nach anderen Papieren griffen, zitterten heftig.
»Großer Gott,« stammelte er, als das letzte Papier seiner Hand entsank.
Da hörte er im Nebenzimmer das Knarren eines leichten Stiefels, dann wurde die Tür, welche nach dem Korridor führte, geöffnet und wieder geschlossen.
Mit einem Satze stand Johannes auch draußen und hatte eine weibliche Gestalt gefaßt, welche soeben die Treppe hinuntergehen wollte. Sie war mit einem Regenmantel bekleidet und trug einen Schirm und eine Tasche in der Hand.
»Wohin, Eugenie, was soll das bedeuten?«
Entgeisterte Augen blickten dem jungen Manne ins Gesicht, aber ehe die zuckenden Lippen Antwort geben konnten, war sie halb mit Gewalt in das Zimmer zurückgeführt worden. Sie warf einen Blick auf die geöffnete Mappe und verhüllte dann mit dem Taschentuche ihr Gesicht.
»Was soll das bedeuten, Eugenie?« wiederholte Johannes. »Ich bitte dich nicht um eine Antwort, ich verlange sie von dir. Warum hast du dich angezogen? Wolltest du mich abermals heimlich und ohne Abschied verlassen? Habe ich dir irgend einen Grund zu solch einer Handlungsweise gegeben?«
Der junge Mann sprach sehr ernst. Bitterkeit lag in seinen Worten. Mit fester Hand drückte er das Mädchen in den Lehnsessel nieder.
Eugenie erhob den Kopf; ein entgeistertes Gesicht und tränenumflorte Augen wurden sichtbar.
»Setze dich mir gegenüber,« hauchte sie, »ich will dir meine Beichte ablegen, und dann wirst du mich nicht mehr zurückhalten, du wirst mich selbst von dir stoßen. Ich bin nicht wert, deine Braut zu heißen, du wirst mich verachten, wie du es vorhin gesagt hast.«
Johannes ließ sich in einen Stuhl gleiten. Er war wieder vollkommen Herr seiner selbst. Er zeigte bei der folgenden Erzählung durchaus keine Erregung, wenn Eugenie ihn auch angstvoll anblickte.
»Ich hatte dich schon belogen, als ich dir sagte, ich stände allein in der Welt,« begann sie mit tonloser Stimme, »ich besaß eine Mutter, welche unter anderem Namen lebte, weil sie Strafe fürchtete. Sie hieß Ebeling und war die Amme des jungen Freiherrn von Schwarzburg.«
»Ist es dieselbe, welche lange Zeit vom Gericht gesucht wurde?«
»Dieselbe. Sie liebte mich, ich sie und nannte sie Tante. Wir hatten keine Geheimnisse voreinander, ich wußte, daß sie von Emil von Schwarzburg bestochen worden war, das Kind des Freiherrn von Schwarzburg zu verwechseln, und daß sie es auch getan hatte. Für das erhaltene Geld ließ sie mir eine gute Erziehung zu teil werden. Ich habe also mit dir an einer Brust gelegen.«
»Und auch mit Hannes Vogel, dem jetzigen Freiherrn.«
Eugenie beachtete diese Frage nicht, sondern fuhr fort:
»Als der alte Freiherr starb, wurde durch Recherchen festgestellt, daß du nicht der Majoratserbe seiest, sondern ein untergeschobenes Kind, und Hannes Vogel, der Matrose, wurde zum Erben proklamiert. Es traten verschiedene auf, welche dies bezeugen konnten, darunter auch die Pflegemutter jenes Hannes. Hatte doch Emil, der Anstifter des Kindesraubes, selbst auf dem Sterbebette das Gleiche ausgesagt. Der Hauptzeuge, die Amme, welche die Verwechslung vorgenommen hatte, fehlte zwar, aber sie war auch nicht mehr nötig. Meine Mutter, die alt geworden war, lebte unter anderem Namen, bereute ihr Jugendverbrechen, und fürchtete sich vor Strafe. Ich war ihr einziges Kind, und ich vergalt dankbar, was sie mir getan hatte, ohne ihr jemals Vorwürfe zu machen.
»Da lernte ich dich kennen, Johannes. Noch ehe ich wußte, wer du warst, liebte ich dich, und du kannst dir meinen Schrecken erklären, als ich deinen Namen erfuhr. Du warst also der, welcher durch den Frevel meiner Mutter in glänzenden Verhältnissen aufgezogen wurde und endlich zum Sohne eines Tagelöhners herabgesunken war. Mein böses Gewissen verbot mir, dir noch ferner zu begegnen, ich wußte auch nicht, ob du mich liebtest, doch als wir uns dann auf dem Flusse abermals trafen und du mir deine Liebe gestandest, da war ich glücklich. Schon nahm ich mir vor, durch meine Liebe wieder gutzumachen, was meine Mutter an dir gefrevelt, als du mit einem Male sagtest, meinetwegen wolltest du die Seeoffizierskarriere aufgeben.
»So hätte dich meine Mutter zum Freiherrn gemacht, damit du später gestürzt wurdest, und ich hätte dich einer glänzenden Karriere entrissen. Das war zuviel für mich. Ich floh, um dir nie wieder zu begegnen. Aber das Schicksal wollte es anders.
»Daß ich nach Chile ging als Erzieherin, weißt du, ebenso, daß ich beinahe in namenloses Elend geraten wäre, wenn sich nicht ein wackerer Kapitän meiner angenommen hätte, der mir die Augen öffnete und mich in meine Heimat zurückschickte. Ich verschwieg dir aber, daß dieser Kapitän kein anderer als Hannes Vogel, der Freiherr von Schwarzburg war.«
»Ich dachte es mir fast,« murmelte Johannes.
»Es wäre mir lieber gewesen, ich wäre in Chile geblieben, mochte es kommen, wie es wollte. Mit dem Gefühle unsagbaren Dankes gegen diesen edlen Menschen und seine Gemahlin, die sich meiner wie eine Schwester angenommen hatte, kam ich hier an und fand meine Mutter auf dem Sterbebette. In ihrer Todesstunde gab sie mir jene Dokumente und konnte mir noch mündlich ausführlich erzählen, daß sie damals die Verwechselung mit dem Kinde, für welche sie bezahlt wurde, nicht vorgenommen, sondern diese nur vorgegeben habe. Das ihr von Emil von Schwarzburg gebrachte Kind gab sie der Pflegemutter, du, der Freiherr selbst, bliebst bei ihr. Also bist du wirklich Johannes Freiherr von Schwarzburg, Hannes Vogel dagegen ist der geraubte Sohn derjenigen, welche du als deine Eltern anerkanntest, der Sohn der Tagelöhner. Meine Mutter schob die Bekanntmachung dieser Tatsache von Tag zu Tag hinaus; immer fürchtete sie sich in ihren alten Tagen vor Strafe, und erst der Tod löste ihre Zunge mir gegenüber.
»Warum ich dir nicht gleich die Wahrheit gesagt habe, sondern dich in dem Glauben ließ, du seist wirklich ein untergeschobenes Kind gewesen? Weil ich dich liebte; aber meine Liebe war eigennützig, sie konnte und durste keine Früchte bringen.
»Nachdem ich das Geheimnis erfahren und meine Mutter begraben hatte, verbrachte ich einige furchtbare Tage. Ich glaubte, du seist noch Offizier, und ich brauchte nur zu sprechen, so wärest du wieder Freiherr, Hannes Vogel aber gestürzt. Doch ich achtete diesen Mann als meinen Wohltäter. Er ist so edel, er nimmt sich der Verfolgten an, er bringt befreite Sklavinnen in ihre Heimat, seine Gemahlin unterstützt ihn, sie gleicht ihm vollkommen, und diese Menschen mühte ich durch meine Aussage ins Elend stürzen. Aber die Wahrheit siegte über meine Gefühle, ich begab mich mit diesen Papieren in der Hand nach dem Justizgebäude, um meine Aussagen zu machen. So unkundig ich auch in solchen Sachen bin, so viel weiß ich doch bestimmt, daß diese Dokumente und meine Erklärung genügen, um dich wieder als Freiherrn einzusetzen.«
»Sie genügen vollkommen,« stimmte Johannes bei.
»Als ich auf der Bank an der Alster saß, stiegen noch einmal Zweifel in mir auf. Warum sollte ich denn dem Schicksal vorgreifen? Ich dachte, du seiest als Seeoffizier glücklich, und, ob Freiherr oder nicht, ständen dir die Wege zur höchsten Ehre offen, Hannes Vogel dagegen war ohne den Freiherrntitel nichts weiter als ein Matrose und dessen doch würdig. Er verwandte seine Mittel nicht unnütz, wie so oft geschieht, sondern gebrauchte sie zum Nutzen seiner Mitmenschen. Doch diese Zweifel wurden wieder besiegt; ich dachte an mein Gewissen, auf welchem das Geheimnis stets wie ein Alp lasten würde.
»Da kamst du, Johannes; du warst nicht mehr Seeoffizier, du gestandest mir abermals deine Liebe und begehrtest mich zum Weibe. Alle meine Vorsätze zerrannen zu Nebel. Ich liebte dich, und hätte ich nun gesagt, daß du der eigentliche Freiherr seiest, so wärst du mir entgangen, denn wie konnte ich, das dienende Mädchen, die Tochter einer Amme, fernerhin an deiner Seite bleiben? Um dich besitzen zu können, verbarg ich mein Geheimnis tief in der Brust und nahm mir vor, dich durch meine grenzenlose Liebe und Hingebung zu entschädigen.
»Wohl war ich glücklich als deine Braut, aber doch kamen oft schwarze Stunden, in denen ich von Gewissensbissen gequält wurde, und diese Anfälle mehrten sich von Tag zu Tag. Dies war die Ursache eines häufigen Stimmungswechsels, über den du dich so oft wundertest, und den du dir nicht erklären konntest. Meine einzige Entschuldigung lag in dem Gedanken, daß ich aus Dankbarkeit gegen meinen Wohltäter, Hannes Vogel, das Geheimnis nicht preisgäbe, damit er aus seiner Höhe, von der aus er Gutes stiftete, nicht wieder herabsänke, und dich sah ich immer heiter und glücklich.
»Diese Entschuldigung hast du mir vorhin geraubt. Hannes Vogel hat sechs Millionen geerbt; er braucht den Freiherrntitel nicht mehr, ich weiß sogar, er macht sich sehr wenig daraus. Aber noch wollte ich dir das Geheimnis deiner wahren Abstammung nicht verraten, denn dadurch verlor ich dich. Doch eine innere Stimme trieb mich, die Fragen an dich zu stellen, welche mir deutlich sagen sollten, was ich zu tun hatte. Ich hörte, du würdest mich verachten, wenn ich einen Menschen im Besitze einer Sache ließe, die ihm nicht gehört. Jetzt frage ich dich noch einmal: Wird auch Hannes Vogel mich verachten, wenn er erfährt, daß ich um seine wahre Abstammung wußte, daß er also gar nicht der Freiherr ist?«
Gespannt hingen Eugenies Blicke an des Mannes Lippen.
»Ich kenne Hannes Vogel sehr gut. Ja, auch er würde als ein Ehrenmann dir zürnen, daß du ihn vor der Welt eine falsche Rolle spielen ließest. Er selbst würde dich zwingen, dein Geheimnis preiszugeben, er würde mir sofort alles wieder abtreten, und ich würde es ohne Zögern, ohne Haß gegen Hannes Vogel wieder annehmen.«
»Das ist, was ich hören wollte,« fuhr Eugenie mit bebender Stimme fort. »So habe ich also recht gehandelt. Ich dachte doch manchmal, auch meinem eigenen Herzen müsse ich nachgeben, es hätte ebensogut ein Anrecht auf Glück.«
Sie stand auf, knüpfte den Regenmantel zu und griff nach dem Schirme, ohne Johannes anzublicken.
»Leben Sie wohl,« sagte sie leise, die Anrede plötzlich wechselnd.
Doch da stand Johannes schon vor ihr.
»Wo willst du hin?« fragte er vorwurfsvoll.
»Ich will versuchen, meine Liebe zum zweiten Male zu vergessen, ich bin Ihnen jetzt nur im Wege,« hauchte sie mit gesenktem Blick.
Sie stand wie eine Verbrecherin, die einer Schuld überführt ist, vor ihm.
»Du darfst jetzt nicht gehen, ich brauche dich,« entgegnete Johannes, sie leise am Arme festhaltend.
»Ich weiß, daß Sie mich noch brauchen. Ich werde Ihnen meine Adresse zusenden; rufen Sie mich, und ich stehe Ihnen jederzeit zu Diensten, um meine Aussage zu geben und zu beschwören.«
Wieder versuchte sie an seiner Seite vorbeizuschlüpfen, ohne ihn anzusehen.
»Halt, ich brauche dich noch zu etwas anderem.«
»Wozu?«
»Ich bin zwar wieder das geworden, was ich ehedem gewesen bin, aber mein Schloß ist unterdes verödet, mein Vater ist gestorben, und einsam möchte ich in den großen Räumen nicht sein.«
Es lag ein fröhlicher Klang in dem Tone, der sie veranlaßte, aufzublicken, und wirklich sah sie in ein lachendes Gesicht.
Da wollte sich auch auf ihre Züge ein Schimmer von Glückseligkeit legen, aber ebenso schnell verschwand er wieder.
»Lassen Sie mich!« sagte sie mit erhobener Stimme. »Für das, was Sie aus mir zu machen gedenken, bin ich zu gut.«
»Zu gut?« klang es lächelnd zurück. »Als Offizier war ich für dich zu gut, und nun, da ich ein Freiherr, also ein freier Herr meiner Handlungen bin, bist du mit einem Male für mich zu gut! Das verstehe ich nicht. Eugenie, hörst du denn nicht? Ich brauche dich, damit ich glücklich werde, und ich brauche dich, damit ich dein liebes Gesichtchen wieder lächeln sehen kann. Eugenie, willst du mit mir kommen und als mein Weib das teilen, was du mir gebracht hast?«
Mit ausgebreiteten Armen stand Johannes vor ihr, Eugenie brauchte nicht an dem Ernste seiner Worte zu zweifeln — mit einem Freudenschrei lag sie an seiner Brust.

Eugenie brauchte nicht an dem Ernste seiner Worte zu
zweifeln — mit einem Freudenschrei lag sie an seiner Brust.
»Aber du bist ein Freiherr,« stammelte sie endlich, als der neue Bund gebührend durch Küsse besiegelt war.
»Und habe sogar gedient,« scherzte Johannes. »Laß das nur gut sein, Eugenie! Kannst du auch nicht hoffähig werden, ich sehne mich nicht besonders nach dem glatten Parkett; auf der glatten Eisdecke damals war es viel schöner. Ich bin mein freier Herr, ich habe keine Rücksichten zu beachten, denn die meines Standes existieren nicht mehr für mich, seitdem ich dich kenne. Hätte ich sonst die Offizierskarriere verlassen? Ich will mich jenen Vorkämpfern der Menschheit anschließen, welche nur Seelenadel, aber keinen Geburtsadel gelten lassen. Dereinst wird die Zeit kommen, da man über unsere jetzigen Kastenverhältnisse unbarmherzig spotten wird, die auch wirklich lächerlich sind. Aber, Eugenie, heute über acht Tage können wir nun unsere Hochzeit freilich noch nicht feiern, ein paar Wochen müssen wir uns schon noch gedulden
Hatte Sharp recht, als er Hannes und Hope Schoßkinder des Glückes nannte?
Gleichzeitig mit einem Schreiben, welches diesen ankündigte, daß Johannes Vogel, der ehemalige Freiherr, einen neuen Prozeß angestrengt habe, der ohne allen Zweifel laut der Dokumente und der letzten Aussage der alten Amme zu seinen Gunsten ausfallen würde, erhielten sie die Nachricht, Mistreß Congrave sei in Sha-tou bei vollem Bewußtsein gestorben und habe ihr Vermögen von dreihunderttausend Pfund Sterling Hannes Vogel vermacht.
Alles war in Ordnung; das Testament lag in Hamburg, desgleichen die Anweisung auf eine Londoner Bank, und Hannes hätte nur dorthin zu reisen brauchen, um seine Erbschaft anzutreten.
Nick Sharp teilte dies den beiden Sprachlosen in der größten Gemütsruhe mit, sagte ihnen, wie er mit einem Freunde in Deutschland in Verbindung stände, der ihm durch seinen Bruder, genannt Youngpig, diese Nachrichten hatte zukommen lassen, und erklärte sich bereit, im Namen von Hannes weitere Schritte zu tun, wenn dieser es vorzöge, vorläufig hier in Gesellschaft der Namen und Herren zu bleiben.
Hannes war damit einverstanden; er wußte wenig davon, wie er von hier aus in den unbestrittenen Besitz dieses Riesenvermögens kommen konnte. Er, wie auch Hope waren überhaupt Feinde aller Förmlichkeiten.
»Wissen Sie was, ich mache Sie zu meinem Rechtsanwalt,« sagte er zu dem Detektiven. »Sie haben doch sowieso nichts mehr zu tun. Bringen Sie die Sache in Ordnung, ich kümmere mich nicht weiter darum, wollen Sie?«
Der Detektiv erklärte sich dazu bereit und rechnete Hannes sofort haarklein an den Fingern vor, wieviel er für diese Mühe verlangen müsse, und welche Auslagen er dabei haben würde.
Hannes sagte nur immer ja.
»Natürlich, umsonst sollen Sie es auch nicht tun, umsonst ist nur der Tod.«
Es blieb der Gesellschaft nicht lange unbekannt, was für eine Umwandlung mit Hope und Hannes vorgegangen war. Erst betrachtete man sie mit Teilnahme, kein Wort des Spottes, wenn er auch nicht böse gemeint wäre, wurde laut, selbst Charles schluckte einige Witze über den degradierten Freiherrn hinab.
Kaum aber hatte man erfahren, daß dieser sechs Millionen geerbt, so brach es von allen Seiten los. Nun brauchte man nicht mehr zu fürchten, daß das junge Paar sich gekränkt fühlen würde, wenn man sich über Hannes' Absetzung lustig machte, denn man wußte, daß sich beide sowieso nicht viel aus dem Titel machten. Hope war eine Amerikanerin; die Verachtung gegen Rang und Titel war ihr angeboren, und Hannes hatte sich oft genug verbeten, ihn Baron anzureden.
Hannes und Hope konnten sich erst gar nicht retten, so wurden sie besonders von Charles, Hendriks und Chaushilm aufgezogen, da aber beide gleich schlagfertig waren, so zogen sie nicht immer den kürzeren; sie gaben jeden Hieb tüchtig zurück.
Die Gesellschaft war in den Gewölben zusammengekommen und widmete sich der Bereitung des Abendbrotes, was nie ohne Scherzen und Lachen vor sich ging. Ein jeder bemühte sich, nach besten Kräften tätig zu sein, da er aber oft nicht brauchbar war, so erntete er nur Spott ein.
Am Tage war von den Trappern verschiedenes Wildbret eingeliefert worden; dieses wurde jetzt abgehäutet, Feuer wurden angemacht, Bratspieße hergestellt, und bald schmorte und zischte es. Ein lieblicher Duft nach gebratenem Fleisch durchzog die Räume, so daß man sich nicht in einem Grabgewölbe, sondern in der Küche eines herrschaftlichen Hauses wähnte.
Die Leutchen hatten sich überhaupt noch nie so gemütlich gefühlt, wie hier. Man betrachtete die Ruine allgemein als einen Kurort, nannte John Davids und Deadly Dash, welche die Kranken behandelten, Kurärzte und lebte ebenso solid wie in dergleichen Plätzen, stand mit der Sonne auf und ging mit ihr schlafen, trank nur reines Quellwasser und arrangierte harmlose Spiele, welche zu erfinden Charles und seine Freunde unerschöpflich waren.
Langweile kannte man nicht, sie hatte in den Mauern der Ruine keinen Platz.
Das Abendessen war fertig. Männer und Mädchen nahmen bunt durcheinander am Boden, auf Matten oder auf Steinen Platz und schnitten mit Messern Stücke Fleisches ab. Es gab kein Ansehen der Person; der arme, unwissende Fallensteller hockte neben der gebildeten Millionärin, besaß aber doch so viel Weltgewandtheit, ihr stets die besten Fleischstücke zukommen zu lassen.
Deadly Dash und Davids waren damit beschäftigt, aus zwei steinerne Teller Fleisch zu legen. Eine Portion wurde von ihnen in seine Scheiben geschnitten, denn sie war für den kranken Indianer bestimmt, die andere, größere für Stahlherz. Dieser verließ nie das Zimmer des Kranken und schlief nur, wenn er seinen weißen Freund am Lager wachend wußte.
Schmalhand hatte die Fieberperiode überstanden, er schritt der Genesung entgegen, aber an ein Verlassen des Lagers war noch lange nicht zu denken, und Stahlherz wollte ihn ganz gesund haben.
Was Stahlherz veranlaßte, den roten Mann, den er zu hassen schien, mit solcher Sorgfalt zu pflegen, blieb fast allen ein Rätsel. Deadly Dash sprach nicht darüber, und aus dem verschlossenen Stahlherz war gar nichts herauszubekommen; er ließ sich überhaupt nicht mehr sehen.
Jedenfalls wollte er von Schmalhand ein Geheimnis erpressen, oder er hob ihn zur Befriedigung seiner Rache auf, und der Indianer ist darin so entsetzlich, daß er sein erkranktes Opfer erst gesunden läßt, damit es bei klarem Bewußtsein die Qualen doppelt empfinde.
Deadly Dash brachte stets Essen zu den beiden Indianern hinein. Davids besuchte den Kranken nur, wenn Stahlherz schlief und der Waldläufer für ihn wachte. Stahlherz war gegen jedermann, außer seinen weißen Freund mißtrauisch.
Der Waldläufer, der sich immer mehr als ein gebildeter Mensch entpuppte, je länger er mit der Gesellschaft verkehrte, nahm die zwei Teller und begab sich nach dem etwas entfernt gelegenen Gewölbe.
Da drang in Davids' Ohr ein Ruf, den Deadly Dash ausgestoßen, und sofort stand Davids im Rahmen der Tür, die zu dem Krankenzimmer führte.
Der Raum war nur schwach beleuchtet. Ganz oben in der Mauer war eine Oeffnung, durch welche der letzte Strahl der Abendsonne hereinschien und gerade auf das Lager fiel, auf dem Schmalhand bis jetzt gebettet lag — es war leer.
Daneben lag eine dunkle Masse am Boden, fast wie ein Toter anzusehen, wenn das Heben und Senken der Brust nicht das Vorhandensein von Leben verraten hätte — Stahlherz. Sein Opfer war entwichen oder ihm entführt worden. Wie mochte der sonst nimmermüde Indianer vom Schlafe übermannt worden sein?
Die beiden Männer standen noch wie gebannt im Türrahmen, als sie hinter sich ein leises Schnüffeln vernahmen, als ob jemand aufmerksam die Luft durch die Nase zöge.
»Chloroform,« sagte gleichzeitig eine Stimme.
Nick Sharp war unbemerkt zu ihnen getreten. Auch ihm hatte Stahlherz sonst immer den Zutritt verwehrt.
»Ich habe es ebenfalls gerochen,« entgegnete Deadly Dash. »Stahlherz ist durch Chloroform betäubt worden. Aber wie mag man ihm dasselbe beigebracht haben?«
Die Männer untersuchten jetzt den regungslosen Körper des Indianers und fanden wirklich, als sie ihn umkehrten, vor dessen Mund einen Schwamm gebunden, der stark nach Chloroform duftete. Stahlherz war weder gefesselt worden, noch zeigte er irgend eine Verletzung. Es war rätselhaft, wie der wachsame Indianer überrascht worden war. Selbst im Schlafe müßte er doch gemerkt haben, daß man ihm den Schwamm vorband, und dem Widerstand entgegengesetzt haben.
»Die Dosis hätte genügt, einen Menschen aus dem Leben zu schaffen,« meinte Davids. »Das ganze Zimmer ist ja von dem Gifte durchzogen. Selbst jetzt werde ich noch schläfrig davon.«
»Stahlherz hat eine feste Natur, daher sein Name,« entgegnete Deadly Dash ernst. »Jetzt ist es aber genug. Wir wollen dem Geheimnis dieser Ruine ein Ende machen. Schmalhand ist ein Verbrecher, er muß den Lohn seiner Tat empfangen, und wird er von den Bewohnern der Ruine in Schutz genommen, so wirft es ein schlechtes Licht auf diese. Wir wollen das Nest ausheben.«

»Bravo, das war recht gesprochen!« rief Sharp, und schlug dann, seine Stimme noch mehr erhebend, mit der Faust an die Wand. »Heda, aufgemacht, oder wir statten euch gegen euren Willen einen Besuch ab, der euch teuer zu stehen kommen kann. Was wetten wir, daß ich innerhalb einer Viertelstunde den geheimen Eingang gefunden habe?«
Sharp erhielt keine Antwort, die Felswände öffneten sich nicht, sondern blieben unbeweglich und stumm.
Während Davids dafür sorgte, daß Stahlherz wieder zur Besinnung kam, und daß dessen Schlaf nicht wirklich in den Tod überging, indem er ihn mit kaltem Wasser abrieb, begannen Deadly Dash und Nick Sharp die Untersuchung der Mauern.
Ersterer hatte schon einmal bewiesen, daß er geheime Zugänge sehr schnell finden konnte, und Nick Sharp war in derartigen Sachen ja auch Meister.
Es vergingen auch nur wenige Minuten, so rief letzterer schon:
»Meine Herren, ich bin dem Mechanismus schon auf der Spur. Hier in der Wand ist eine Art von Knopf befestigt. Man kann ihn nach hinten drücken, doch gleich schnellt er wieder vor. Er ist also an einer Feder befestigt.«
Das war allerdings eine wichtige Tatsache, aber soviel man auch drückte, es entstand keine Oeffnung in der Mauer; nicht einmal ein Stein bewegte sich.
»Der Knopf ist ein Teil des Mechanismus,« meinte der Waldläufer nachdenkend, »seine Entdeckung allein aber nützt nichts.«
»Kann der Mechanismus nicht auch gestört worden sein?« entgegnete der Detektiv. »Ich kalkuliere, die Halunken lauschen hinter den Mauern und haben, als sie unsere Fähigkeiten im Finden ihrer Geheimnisse bemerkten, den Mechanismus unwirksam gemacht.«
»Das kann allerdings auch sein.«
»Wir wollen die Sache einfacher machen,« fuhr Sharp fort. »Ein Loch können wir in die Mauer schon meißeln, etwas Pulver haben wir auch übrig; wir legen eine Zündschnur an, ziehen uns hübsch in Sicherheit zurück und heidi, dann wird sich uns gleich ein bequemer Eingang ins Innere bieten, wenn es die Herren da drinnen nicht vorziehen, uns das Tor zu öffnen und uns zum Eintreten zu nötigen, weil ihnen sonst Steine um die Köpfe fliegen könnten.«
Sharp hatte schon sein Messer gezogen und bröckelte den Mörtel zwischen zwei Steinquadern heraus, Deadly Dash, der diesen Vorschlag billigte, wollte ihm schon helfen, als plötzlich Ellen, ganz außer Atem, hereintrat.
»Was machen Sie da?« rief sie.
Schnell war sie über alles verständigt, was vorgefallen war, und was man vorhatte.
»Das ist allerdings sehr schlimm, aber die Unbekannten mögen einen Grund haben, den Indianer aus Stahlherz' Händen zu befreien ...«
»Und wir haben einen Grund, ihn wieder in unsere Hände zu bekommen,« unterbrach Deadly Dash die Sprecherin. »Tut mir leid, Fräulein, daß wir Ihren Bitten, die Bewohner dieser Ruine nicht zu belästigen, fernerhin nicht Gehör schenken können. Lassen Sie Stahlherz erwachen und den Gefangenen nicht mehr vorfinden, so läßt er hier keinen Stein mehr auf dem anderen.«
Ellens Züge verfinsterten sich etwas.
»Ich habe Ihnen aber noch eine andere Botschaft zu bringen,« sagte sie dann, sich zur Ruhe zwingend. »Ich hatte soeben eine Begegnung mit der Person, welcher wir, Miß Murray und ich, unsere Rettung verdanken.«
»Wer ist denn das nur?« fragte Sharp, der seine Arbeit unterbrochen hatte.
»Ich darf dies nicht verraten. Ich soll Ihnen allen hiermit verkünden, daß wir bis morgen abend die Ruine verlassen und erst eine Tagereise von hier Halt machen sollen.«
»Hahaha,« lachte Sharp rücksichtslos, »sehr gut! Wer erlaubt sich denn, solche Befehle zu erteilen?«
»Treiben Sie keinen Spott, Mister Sharp!« warnte Ellen. »Ich glaube doch, die geheimnisvollen Bewohner dieser Höhlen verfügen über ziemlich viel Macht. Es ist das beste, wir kommen der erhaltenen Aufforderung nach.«
»Sollte sie ein Befehl oder eine Warnung sein?«
»Ein Befehl im warnenden Tone gegeben.«
»Hat die betreffende Person, dieser Schutzengel oder wie sie sich nennen mag, nicht gesagt, was unser Los wäre, wenn wir dem Befehle nicht gehorchen?«
Sharp fragte, Deadly Dash hörte zu. Seine Blicke hingen an dem schlafenden Indianer, mit dem sich Davids noch immer beschäftigte. Das laute Gespräch hatte fast die ganze Gesellschaft angelockt, und bald war allen bekannt, was vorgefallen.
»Gewiß, auch das sagte sie,« entgegnete Ellen. »Fügen wir uns nicht, sind wir morgen abend noch hier, so werden wir mit Gewalt vertrieben werden, wenn es uns nicht noch schlimmer ergeht.«
»Oho,« rief Sharp höhnisch. »Diese Leute fühlen sich ja recht kräftig. Ich kalkuliere, ich werde wohl ein bißchen länger hierbleiben, und wer mich anfaßt, der mag sich die Finger nicht verbrennen. Was meint Ihr dazu, Deadly Dash?«
Auch der Waldläufer war ungehalten; auf den Gesichtern der anwesenden Trapper zeigte sich ein spöttisches Lächeln, und die Mienen der übrigen waren teils erschrocken, teils unwillig.
»Erst möchte ich erfahren, Miß Petersen,« nahm Deadly Dash das Wort, »was Sie der Person entgegnet haben. Soweit ich Sie kenne, lassen Sie sich auch nicht gern Vorschriften machen, zu denen die Erklärung fehlt,« fügte er lächelnd hinzu.
»Ich antwortete,« erwiderte Ellen, »ich würde die Forderung meinen Begleitern mitteilen. Ob diese einwilligten oder nicht, könnte ich nicht sagen. Darauf wurde ich gewarnt, keinen Widerstand zu leisten, dies könnte für uns die schlimmsten Folgen haben.«
»Und was meinen Sie dazu?«
Ellen zuckte die Achseln.«
»Ich würde wohl bleiben; gefährlich kann es nicht werden,« meinte sie dann, aber ich schlage vor, wir gehen. Warum sollen wir uns widersetzen? Wir finden einen ebenso passenden Platz wie diesen, wenn wir nicht vorziehen, gleich nach der Küste zu gehen. Wir sind hier freundlich aufgenommen worden, man hat uns unbelästigt gelassen, und so können wir uns auch dem Wunsche fügen.«
»Sie waren im Inneren der Ruine,« fuhr Deadly Dash fort. »Sie wissen, mit wem wir es zu tun haben, Sie wollen Ihres gegebenen Wortes wegen nicht sprechen. Ich ersuche Sie aber jetzt im Namen Ihrer Freunde und Freundinnen, das Schweigen zu brechen, soweit Sie es mit Ihrem Gewissen vereinigen können. Wer Chloroform anwendet, um jemandem, dem er etwas wegnehmen will, zu betäuben, der ist nicht so unschuldig; ein Indianer ist er keinesfalls.«
»Es wohnen nicht nur Indianer hier, auch Weiße befinden sich in den Ruinen.«
»Was sollen wir tun, gehen oder ihnen zum Trotz bleiben?« fragte Deadly Dash, sich an die Umstehenden wendend.
Die einen drangen darauf, zu bleiben und auf das Vorgehen der geheimnisvollen Bewohner zu warten, die anderen wollten den Platz lieber verlassen. Erstere waren neugierig, zu erfahren, wen die Ruinen eigentlich verbargen, man hoffte, daß sich die Bewohner, von denen man bis jetzt nichts gesehen hatte, bei ihrem eventuellen Verweilen zeigen würden; letztere wollten jeder Unannehmlichkeit aus dem Wege gehen, welche neue Verwickelungen, Kämpfe und Gefahren mit sich bringen mußte.
Deadly Dash überlegte noch, er hatte hierin den Ausschlag zu geben, als Sharp, welcher bis jetzt noch immer an der Wand gearbeitet hatte, ohne sich an dem Gespräch zu beteiligen, plötzlich rief:
»Achtung, ziehen Sie sich zurück, in fünf Minuten knallt es.«
Er hatte inzwischen wirklich ein Loch in die Wand gearbeitet, und jetzt ließ er den Stahl seines Feuerzeuges mehrmals kräftig schnappen. Als er die Warnung rief, sah er Deadly Dash an.
Dieser wollte den Detektiven an seinem Vorhaben hindern, aber noch ehe er den Mund öffnen konnte, legte Sharp schnell den Finger auf die Lippen und sah die Umstehenden mit einem solch eigentümlichen Ausdruck von Schlauheit an, daß alle gleich begriffen, er habe eine List vor.
Alle waren still.
Wieder schlug Nick Sharp mit dem Stahl an dm Feuerstein, schabte noch etwas an der Wand herum und sagte dann laut, fast schreiend:
»Jetzt schnell fort! Die Lunte brennt! Rasch! Wenn wir erwischt werden, zerschmettern uns die Steine zu Brei.«
Er wandte sich um, die anderen mit ihm, um den Raum schnell zu verlassen. Man wußte noch nicht, ob er im Ernst sprach oder nicht. Allerdings war ein Loch in der Mauer, eine brennende Zündschnur hing herunter, aber es kam ihnen vor, als wäre von Pulver keine Spur zu sehen.
Noch waren nicht alle heraus, Deadly Dash und Sharp standen noch im Zimmer, als plötzlich etwas geschah, was auch die anderen veranlaßte, wieder umzukehren und staunend der Verwandlungsszene zuzusehen.
Die hinterste Wand fing plötzlich an, sich zu bewegen. Wie auf Rollen schob sie sich nach hinten zurück, ein zweites, aber viel größeres Gewölbe ward sichtbar, und in der Mitte desselben stand, auf zwei Indianer sich stützend, Arahuaskar, der Herr dieses alten Gemäuers.
Die Augen in dem Totenschädel funkelten wie Kohlen; sie waren starr auf die Eindringlinge geheftet; er verriet keine Furcht vor den Weißen, dagegen spiegelte sich in seinen Zügen ein furchtbarer Haß wider.
Langsam hob er den einen knöchernen Arm empor und streckte die fleischlose Hand wie abwehrend aus.
»Was habt ihr in dem Reiche der Azteken zu suchen?« rief seine schrille, krächzende Stimme. »Wir haben keine Ruhe im Grabe. Ihr scheucht uns auf. Fort von hier, und setzt euren Fuß nie wieder in diesen Tempel!«
Die Gesellschaft war zunächst über diese Erscheinung erschrocken. Niemand hatte eine Ahnung gehabt, daß in der Ruine solche Geschöpfe existierten, welche an die Zeit der Azteken erinnerten. Die Gestalt des Greises war wirklich entsetzlich häßlich, und Arahuaskar hätte beinahe seine Absicht erreicht, die Fremdlinge durch Schreck zu verscheuchen, aber dadurch, daß er sprach und sich für einen Geist ausgab, verwischte er den ersten Eindruck wieder vollkommen.
Das plötzliche Zurückdrängen der Mauer, die skelettartige Erscheinung, der Totenschädel, alles hatte die Gesellschaft in Schrecken gejagt, aber die englisch gesprochenen Worte führten alle sofort wieder zur Besinnung zurück.
An Geister glaubten die Herren und Damen nun einmal nicht, und ein Gespenst, welches ganz gut Englisch redete, war nicht zu fürchten. Höchstens die Trapper, mit Ausnahme von Deadly Dash, waren noch erschrocken, die übrigen zeigten jetzt mehr Interesse, als Furcht.
»Wer bist du?« fragte Deadly Dash.
»Darüber bin ich dir keine Antwort schuldig,« erklang es wieder von dem Totenschädel. »Gehorcht mir! Habt ihr bis morgen abend nicht den Tempel Huitzilopochtlis verlassen, so werden bald eure Gebeine zwischen den Steinen bleichen.«
»Glaube nicht, du könntest uns durch Drohungen einschüchtern,« entgegnete Deadly Dash. »Wer du auch seiest, du kannst uns nicht glauben machen, wir hätten einen Geist der Azteken vor uns. Auch du bist ein Mensch von Fleisch und Blut, wenn auch nur wenig davon vorhanden ist. Aber wisse, ich kenne dich wohl, du bist jener, welcher sich den Letzten der Azteken nennt und die Indianer zu einem allgemeinen Aufstand gegen uns Weiße aufzuwiegeln sucht, und leider hast du durch List und Betrug schon viele Anhänger unter den Häuptlingen bekommen. Aber hoffe nicht, daß dein Vorhaben jemals gelingen wird, Arahuaskar, oder wie du dich nennst, du befindest dich in einem Irrtum, alter Mann, wenn du glaubst, du könntest die frühere Macht der Azteken wiederherstellen. Du hockst wie ein Uhu in diesen Gemäuern und weißt nicht, was unterdes draußen geschieht. Verstecke dich fernerhin, baue dir Luftschlösser und stirb, mehr wirst du nie erreichen!«
Arahuaskar verriet durch keine Bewegung, daß er erschrocken oder auch nur erstaunt sei, weil diese Männer von seiner Absicht wußten. Diese Trapper verkehrten viel mit Indianern, hatten Frauen und Kinder unter ihnen, so konnte Deadly Dash also auch von seinen Bestrebungen erfahren haben.
»Gut, du kennst mich,« entgegnete er, »aber du glaubst nicht, daß ich die Macht habe, die Weißen zu vertreiben und das Reich der Azteken wiederherzustellen?«
»Woher willst du diese Macht bekommen? Oder gedenkst du, die Weißen durch deine Häßlichkeit in die Flucht zu schlagen?« sagte Deadly Dash spöttisch.
»Du zweifelst an meiner Macht, wohlan, ich werde dir zeigen, daß es mir eine Kleinigkeit ist, Tod und Verderben rings um mich zu verbreiten,« sagte Arahuaskar und stampfte mit dem Stock, auf den er sich stützte, auf die Erde.
Gleichzeitig hallte das Gemäuer von einem Donner wider. Es fing erst in der Ferne an zu rollen, dann kam es naher und näher, bis der Boden unter den Füßen der Anwesenden erbebte und die Wände zitterten. Das alles war keine Einbildung. Kleine Stücken Kalk, von der Erschütterung losgebröckelt, fielen von den Wänden.
Diesmal behielten nur Deadly Dash und Nick Sharp die Fassung. Alle übrigen erschraken heftig, und die zum Aberglauben neigenden Trapper wären sogar vor Furcht in die Knie gestürzt, hätten sie nicht gesehen, wie die Herren und Damen sich von ihrem Schrecken schnell erholten. Es war ja nicht das erstemal, daß sie plötzlich von einem unterirdischen Donner überrascht wurden.
Deadly Dash lächelte sogar spöttisch.
»Gut gemacht!« rief er. »Der weiße Mann versteht nicht nur, Kranke zu behandeln, er kann es auch ganz schön donnern lassen.«
Arahuaskar konnte seinen Unwillen nicht verbergen, als er sah, daß der Donner keinen besonderen Eindruck auf die Fremden hervorbrachte.
»Du glaubst, ich spiele mit euch,« rief er finster. »Weißt du auch, Verwegener, woher dieser Donner stammt?«
»Wahrscheinlich von Pulver.«
»Es waren meine Krieger, welche die Büffelschilder zusammenschlugen. Ein Wort von mir genügt, und sie erheben sich, um die Weißen zu erdrücken. Zweifelst du daran?«
»Sehr stark.«
Wieder stampfte Arahuaskar mit dem Stock, und diesmal erschütterte ein anderes Geräusch das Gewölbe.
Es war ein furchtbares Geheul; deutlich konnte man die Kriegsrufe verschiedener Indianerstämme vernehmen, den gellenden Schrei der Apachen, das Bellen der Sioux, den tremulierenden Ruf der Pawnees, und dazu erklang ein Waffengeklirr, als schlügen wenigstens tausend Indianer die Tomahawks zusammen.
Triumphierend beobachtete Arahuaskar die Fremden, und jetzt wurde seine Erwartung nicht getäuscht.
Selbst Deadly Dash erschrak, als dieses Geheul erscholl; alle Teufel der Hölle schienen entfesselt zu sein.
»Was ist das?« stammelte er.
»Meine Krieger sind wieder auferstanden,« schrie Arahuaskar mit drohender Gebärde. »Sie fordern das Blut derer, die das ihrige nicht geschont haben. Flieht, weicht von hinnen, ihr Verfluchten, oder keiner verläßt lebendig diese Mauern!«
Alle wurden von Entsetzen ergriffen. Das Geheul und Waffenklirren schien sich unter der Erde fortzupflanzen, es kam immer naher, dann erklang es unter ihnen, über ihnen, und schließlich hörten sie es im Rücken.
Aus den Reihen der Männer sprang eine dunkle Gestalt hervor. Stahlherz war aus seiner Betäubung erwacht. Der Donner und der indianische Kriegsruf hatten dies wahrscheinlich bewirkt.
Die stieren Augen auf den Alten geheftet, sprang er mit ausgestreckten Armen hervor, als wollte er die Gestalt greifen.
»Die schwarze Zeder!« rief er. »Jetzt sollst du Stahlherz nicht mehr entgehen!«
Er wollte sich auf den Alten werfen, da aber verschwand dieser plötzlich, als wäre er von der Erde verschlungen worden, und Stahlherz stürzte kopfüber in ein Loch, welches sich mit einem Male vor ihm auftat.
»Zurück! Zu den Waffen,« rief Deadly Dash mit durchdringender Stimme. Dies alles war kein Spiel, keine Sinnestäuschung, es war bitterer Ernst.

»Zurück! Zu den Waffen!« schrie Deadly Dash,
In den Ruinen waren Tausende von Indianern verborgen; es schien ein Aufstand auszubrechen, und sie sollten das erste Opfer sein.
Ueberall gellten Pfiffe und durchdringende Rufe, von unsichtbaren Wilden ausgestoßen. Geschlossen stürzten die Weißen dem Ausgange zu, ihnen voran Deadly Dash und Sharp. In dem Korridor, von welchem aus die Gewölbe abzweigten, hatten sie die Gewehre stehen gehabt, sie waren fort. Der Trapper, der sie bewachen sollte, lag mit gefesselten Händen und Füßen am Boden. So ging es weiter in die Nacht hinaus, wie von Furien gepeitscht, obgleich jetzt Deadly Dash öfter seine Stimme ertönen ließ, zum Stillstehen auffordernd.
Der Schreck hatte alle übermannt; keiner dachte Anders, als eine furchtbare Metzelei müsse beginnen. Schon hatte man die Revolver in den Händen, aber die Flucht war unnötig. Keine feindliche Gestalt ließ sich blicken.
Es war schon völlig dunkel geworden, als die Männer und Mädchen hochatmend draußen im Freien standen und aufmerksam lauschten und spähten, denn jeden Augenblick erwartete man die Indianer, deren Kampfesruf man gehört hatte, mit geschwungenem Tomahawk hinter dem Mauerwerk hervorbrechen zu sehen.
Aber die Feinde kamen nicht. Alles war nur eine Drohung gewesen. Man hatte den Weißen den Abzug gestattet.
»Nun schlage Gott den Teufel tot!« brach endlich Sharp das beängstigende Schweigen. »Sind wir denn Kinder, daß wir so mit uns spielen lassen? Man will uns mit Donner und Geheul erschrecken, als wären wir im Theater. Aber der gebundene Mann, den wir ganz vergessen haben, wird uns wohl Klarheit verschaffen können.«
An diesen hatte man im ersten Augenblick der Ueberraschung nicht gedacht.
Man fand den Trapper noch ebenso, wie vorhin, in dem Vorraum liegen, als alles in wilder Flucht über ihn hinweggestürmt war. Er war unverletzt und bei vollkommener Besinnung, konnte aber nur sehr wenig aussagen.
Als der Donner durch das Gemäuer rollte, fühlte er sich von hinten gepackt. Die Glieder wurden ihm gebunden und ein Knebel in den Mund gestopft, ohne daß er außer braunen Händen etwas sehen konnte, und dann wurde er auf den Rücken gelegt.
Daß die umherliegenden und -lehnenden Schußwaffen fortgenommen worden waren, wußte er gar nicht, das unterirdische Geräusch hatte das Klirren übertönt.
Es hatten übrigens nicht sämtliche Gewehre hier gelegen. Nicht jeder stellte seine Waffe weg, ehe er die Gewölbe betrat. Einige nahmen die Büchsen mit. Andere, die Vorsichtigen, verbargen sie irgendwo, und so verschwand einer nach dem anderen, sie krochen in Spalten, in Winkel, aber immer kamen sie mit enttäuschten Gesichtern zurück, ihre Waffen waren verschwunden.
Während sie im Innern der Ruine waren und von der fast übernatürlichen Erscheinung des Arahuaskar in Schrecken gehalten wurden, hatte man ihnen die Waffen genommen. Die danach Suchenden wußten sehr gut Bescheid, wo sie lagen, keine war ihnen entgangen bis auf eine. Als Deadly Dash in der Nacht verschwand, um nach seinem Versteck zu gehen, glaubten die anderen, auch er würde mit leeren Händen zurückkommen, aber sie hatten sich getäuscht, er erschien wieder mit seiner kurzen Büchse in der Hand.
Der Waldläufer war noch schlauer, als die beobachtenden Indianer, die Bewohner der Ruine, gewesen.
Nick Sharp trug überhaupt niemals eine andere Schußwaffe, als seinen Revolver.
Jetzt entfernte sich Deadly Dash abermals von der Gesellschaft, die in wirrem Durcheinander, wie der Schrecken und eine drohende Gefahr, von der man nicht weiß, von welcher Seite sie kommt, es erzeugen, dastand. Er winkte dem Detektiven, und beide unterhielten sich wenige Minuten im Schutze einiger Felsen.
»Es scheint keine augenblickliche Gefahr vorzuliegen,« sagte Deadly Dash nach seiner Rückkunft. »Die Bewohner der Ruine haben wahrscheinlich morgen nacht etwas vor, wobei sie kein fremdes Auge beobachten darf.
»Sie haben uns gewarnt, und da wir nicht hören wollten, gaben sie ihrem Befehle Nachdruck. Die Nacht ist warm und hell, wir wollen aufbrechen und einige Meilen weit marschieren. Einige Trapper können vorauseilen und ein Nachtlager herrichten, die anderen werden von Charly geführt.«
Es entstand ein Gemurmel. Die einen waren anderer Meinung und wollten bleiben. Andere stimmten dem Vorschlage bei. Schließlich fügte man sich dem Waldläufer. Es war doch nicht mehr recht geheuer in diesen Ruinen, in deren Mauern sich viele Indianer aufhalten mußten. Sie hatten ja vorhin von Deadly Dash und auch schon früher gehört, daß die roten Männer einen Aufstand planten, und jedenfalls sollte hier eine ihrer Versammlungen stattfinden.
Es wäre eigentlich die Pflicht der Weißen gewesen, eine solche zu verhindern, aber einmal waren ihrer zu wenig, und dann auch wollten sie nicht einer neuen Gefahr entgegengehen. Sie hatten schon genug Abenteuer bestanden.
Waren die Indianer aber wirklich so zahlreich hier versammelt und wollten feindselig gegen die Weißen auftreten, ihnen den Krieg erklären, warum brachen sie nicht gleich hervor? Das war rätselhaft.
Wollten sie den Kampf noch nicht beginnen, sondern erst einen Kriegsrat halten, so mußten sie sich doch unbedingt derer vergewissern, welche um ihr Vorhaben wußten, denn so dumm waren die Indianer doch nicht, daß sie glaubten, diese Weißen würden ruhig die Ruine verlassen, froh, ihr Leben gerettet zu haben, und sich nicht mehr um die kümmern, welche sie verjagt hatten. Es waren merkwürdige Sachen hier vorgekommen, die zu denken gaben.
Oder halt! Jessy und Ellen hatten eine liebreiche Aufnahme hier gefunden. Sollten die Personen, welchen diese ihre Rettung verdankten, sich auch der übrigen angenommen haben und sie beschützen? Das war die einzige Erklärung, und so dachten auch Jessy und Ellen selbst.
Sie wußten bestimmt, daß sie nicht so leichten Kaufes davongekommen wären, wenn nicht Waldblüte und Sonnenstrahl, die beiden, welche wahrscheinlich in den nächsten Tagen hier die Hauptrolle spielen sollten, ihren Abzug verlangt hätten.
Sowohl Ellen, wie Jessy hatten während ihres kurzen Aufenthaltes in den Ruinen erkannt, daß die beiden, fast noch Kinder, sich durchaus nicht darüber klar waren, was man mit ihnen vorhatte.
Ehe man sich anschickte, einen Zug zu bilden, wurde noch eine Frage laut:
»Wo ist Stahlherz geblieben? Soll er seinem Schicksal überlassen bleiben?«
Die Antwort gab Nick Sharp, und noch nie hatte der überhaupt sehr rücksichtslose Detektiv so kurz gesprochen, wie jetzt, da er zu dem Fragenden sagte:
»Stahlherz ist in ein Loch gefallen, und wenn Sie ihn herausholen wollen, so versuchen Sie es. Ist alles fertig? Fort denn! Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren.«
Deadly Dash und dessen rechte Hand, Sharp, trieben zur größten Eile. Lautlos verließ man die Ruinen, in denen man eine so glückliche Zeit verlebt hatte. Der Mond leuchtete den Wanderern auf dem nächtlichen Wege durch den Wald.
Einige der Trapper waren auf Anordnung Deadly Dashs schon vorausgeeilt. Sie sollten einen Ort auskundschaften, wo man während der Nacht kampieren konnte. Die Herren, wie die Mädchen waren längst über alle Bequemlichkeiten erhaben; ein Lagerfeuer und Rasen genügten ihnen, um sanft schlafen zu können; selbst eine Decke rechneten sie nicht mehr zu den unbedingten Bedürfnisgegenständen. Aber lange sollte dieses Leben nicht mehr dauern, sie waren fest entschlossen, nun direkt nach der Küste zu marschieren.
Am Eingange zur Ruine harrten ihrer die Pferde, welche die Engländer mitgebracht hatten. Die Sättel wurden schnell so eingerichtet, daß die Damen bequem darauf sitzen konnten. Natürlich wurden hauptsächlich die Krankgewesenen berücksichtigt.
Als endlich kein Hindernis mehr vorlag, wurde der Marsch angetreten. Lord Harrlington gesellte sich sofort zu Deadly Dash, welcher sich zur Seite des den Zug beschließenden Detektiven hielt, während Charly führte.
»Sie begleiten uns nicht?«
»Nein, und es ist gut, daß Sie mich aufsuchen, da ich Sie sprechen wollte. Ich begleite den Zug nur dem Anschein nach. Wenn wir den dichteren Wald betreten, werde ich mit diesem Manne,« er deutete auf Sharp, »verschwinden. Setzen Sie den Weg ruhig fort, ohne sich um uns zu kümmern, Charly ist ein guter Führer, er bringt Sie schon nach der Küste, und droht Ihnen Gefahr, so sind Sie mit Hilfe der Revolver imstande ihr zu begegnen. Wir stoßen an der Küste wieder zu Ihnen. Lizzard bleibt auf mein Geheiß bei Ihnen.«
»Sie bleiben hier, um Ihren Freund Stahlherz zu befreien. Sollte er von den Ruinenbewohnern gefangen worden sein?«
»Ja. Hauptsächlich deshalb und dann auch, um Uns über das Treiben jener Indianer zu orientieren. Stahlherz kennt den Mann, welcher sich Arahuaskar nennt, ebenso wie Schmalhand. Er hat Grund, sich der beiden zu bemächtigen, denn sie besitzen das Geheimnis, wegen dessen Stahlherz unstet umherschweift. Er sucht schon lange nach ihnen. Jetzt endlich hat er sie gefunden. Wunderbar ist nur, wie Stahlherz in dem zusammengeschrumpften Greis sofort seinen alten Gegner erkannt hat.«
»Er hieß früher die schwarze Zeder?«
»So wurde er genannt.«
»Ich würde mich gern diesem Gange zur Befreiung Von Stahlherz anschließen,« fuhr Harrlington fort, »aber—«
»Sie haben jetzt andere Pflichten,« unterbrach ihn Sharp. »Es ist auch besser, wir sind allein.«
Schon wollte Harrlington wieder die Spitze des Zuges aufsuchen, als Charly plötzlich das Warnungssignal gab, und alles hielt. Noch ehe aber Vermutungen ausgesprochen werden konnten, wurde Charly schon von einigen Reitern umringt, welche ohne Scheu aus dem Gebüsch gesprengt kamen.
Es waren Joe, Joker und die übrigen, welche die Indianer, die Miß Leigh irrtümlich verbrannten, verfolgt hatten.
Sie hatten Wort gehalten; stolz zeigten sie die Skalpe, die sie den Getöteten abzunehmen geschworen hatten. Schaudernd wendeten sich die Freunde ab, als ihnen Joker die Trophäen wies, die an seinem Gürtel hingen, und als Joe gar einen Beutel öffnete, in denen blutige Fleischstücke lagen — die ausgeschnittenen Zungen der Indianer.
Nachdem sie gezeigt, daß sie ihr Wort gehalten hatten, warfen die Sieger diese greulichen Beweise fort und teilten kurz mit, was sie erlebt hatten. Die Indianer waren von ihnen überrascht und nach kurzem Kampfe besiegt worden. Sie bedauerten nur, daß zwischen ihnen nicht auch jenes Weib war, das sie im Bunde mit den Indianern wußten, und dem sie die Hauptschuld am Verbrennungstode des Mädchens zuschrieben.
Wie groß war aber ihre Freude, als sie Miß Petersen sahen! Die Männer hatten die Verfolgung der Indianer ja in dem Glauben aufgenommen, diese wäre die Verbrannte gewesen.
Obgleich sie harte Strapazen durchgemacht, waren sie doch sofort bereit, die Gesellschaft zu begleiten, und selbst der am Schenkel verwundete Joker war durchaus nicht zu bewegen aus dem Pferde zu bleiben, er stieg ab und half mit ritterlicher Galanterie einem der Mädchen in den Sattel, dann zu Fuß nebenherhinkend, einmal der Begleiterin Mut und Trost zusprechend, dann mit einigen Flüchen alle Indianer zur Hölle wünschend.
Harrlington war gesagt worden, er sollte über das Unternehmen Deadly Dashs und Nick Sharps erst sprechen, wenn sich beide schon unbemerkt entfernt hatten, damit sie keine Begleiter bekämen, denn die Trapper hätten wohl nicht so leicht eine Gelegenheit vorübergelassen, um ihre Abenteuerlust zu befriedigen.

Der zum Nachtquartier geeignete Ort war bald erreicht.
Lagerfeuer flammten auf, die Trapper überließen den der Sorgfalt Bedürftigsten ihre Decken, richteten Lager her, und nicht lange dauerte es, so war ein jeder mit seiner neuen Lage zufrieden. In zwei Tagen sollten diese Strapazen vorüber sein; man sehnte sich wirklich nach Ruhe.
Da wurden Deadly Dash und Nick Sharp vermißt.
Lord Harrlington erklärte, warum sie sich entfernt hatten, und die Männer und Mädchen gedachten schaudernd ihrer Kameraden, die jetzt in dem taunassen Walde herumkrochen, sich bei jedem Geräusch auf den Boden werfen mußten, und denen jeder Schritt eine Anstrengung kostete weil er ganz vorsichtig getan werden mußte.
Bald senkte sich ein tiefer Schlummer auf alle herab, welche um die Feuer lagen, während die etwas entfernt postierten Wachen alle Sinne anstrengten, um eine Gefahr rechtzeitig bemerken zu können.
Die Nachtvögel krächzten, die Schakale heulten, und der Koyote bellte — das Nachtkonzert des amerikanischen Waldes hatte begonnen.
Charly stand nachdenkend im Schatten eines Baumes, als er plötzlich zwei glühende Augen im Grase auf sich gerichtet sah. Ehe er noch Argwohn schöpfte, stand schon der alte Fallensteller neben ihm.
»Charly,« flüsterte die Biberratte, »ich bin im Walde geboren und alt geworden, es ist bald Mitternacht, und dies Raubzeug heult noch so, das geht nicht mit rechten Dingen zu.«
Der riesige Waldläufer und der schmächtige Detektiv, welche den Zug beschlossen, waren an der dichtesten Stelle des Waldes, wie auf ein gegebenes Zeichen, plötzlich in den Büschen zusammengesunken, hatten einige Minuten stillgelegen, waren dann wie Schlangen durch das Gras geschlüpft und einige hundert Meter zurück wieder zusammengetroffen.
»Nichts bemerkt!« flüsterte Sharp zuerst.
»Auch ich nicht,« gab der Waldläufer ebenso leise zurück. »Sie werden nicht verfolgt. Das ist seltsam, ich habe das Gegenteil erwartet. Sollte man sie wirklich ruhig abziehen lassen? Nimmermehr kann ich das glauben.«
»Wenn in der Ruine Indianer zu einer Versammlung zusammengekommen sind, so werden sie eben andere Sachen im Kopfe haben, als diese paar Leute zu verfolgen. Es steht zu erwarten, daß sie nicht lange in der Ruine bleiben, und dann wird diese wahrscheinlich überhaupt völlig verlassen.«
Deadly Dash schüttelte auf diese Bemerkung hin den Kopf, er war anderer Meinung. Jetzt aber hatte er ein anderes Ziel im Auge, wozu ihm Sharp seinen Beistand zugesagt hatte.
Es galt den Verbleib von Stahlherz auszukundschaften und zugleich sich auch zu orientieren, ob sich wirklich viele Indianer in dem unterirdischen Gange aufhielten, und was sie vorhatten. Schon vorhin hatten beide darüber gesprochen, es sei nicht unmöglich, daß das Klirren der Waffen und die Kriegsrufe nur von einigen wenigen Indianern hervorgebracht worden seien, daß aber durch die Akustik der unterirdischen Gänge Echos erzeugt würden, so daß es klang, als ob tausend Indianer dort unten ständen.
Während beide langsam und vorsichtig, Auge und Ohr anstrengend, der Ruine wieder zuschritten, erzählte Deadly Dash alles, was er von diesem Gemäuer wußte.
Er war schon einmal dort gewesen, ohne irgend ein Zeichen von etwas Lebendigem zu bemerken.
Dann setzte er dem lauschenden Detektiven die unter den Indianern verbreitete Sage auseinander, daß einst ein Häuptling erstehen werde, dem alle anderen Häuptlinge gehorchen und alle indianischen Krieger in den Kampf gegen die verhaßten Bleichgesichter folgen würden. Der junge Krieger, den niemand zu Gesicht bekäme, würde in einer Höhle von Medizinmännern erzogen, und er, Deadly Dash, glaubte fest, der Tempel des Huitzilopochtli sei der Sitz der Verschwörung gegen die Weißen, wo also auch der junge Häuptling für seine einstige Aufgabe herangebildet würde.
»Stahlherz kannte den Indianer, welcher uns vorhin erschrecken wollte und sich für einen Azteken ausgab?« fragte Sharp den Waldläufer.
»Ja, er ist der Mann, den er seit nun fast fünfzehn Jahren ununterbrochen sucht, ebenso wie Schmalhand. Dieser hat im Bunde mit Arahuaskar oder, wie er früher hieß, der schwarzen Zeder, sich eines Verbrechens schuldig gemacht, welchem Stahlherz mit zum Opfer fiel. Die schwarze Zeder war schon damals, obgleich sehr bejahrt, doch noch sehr herrschsüchtig, er träumte immer davon, das Reich der alten Azteken wiederherzustellen.
»Er schloß einst Freundschaft mit einem Gelehrten, wenn ich nicht irre, einem Skandinavier, dem er, die Stellen zeigte, wo die Urbewohner Mexikos gewohnt hatten, wo sich also viele Götzenbilder, Schmuckgegenstände und wohl auch Pergamente vorfanden. Der Gelehrte erzählte der schwarzen Zeder viel von der alten Herrlichkeit der Azteken, und so entstand in dem Kopfe der Rothaut nach und nach der Entschluß, dieses Reich wiederherzustellen. Er selbst war zu alt dazu, deswegen hat er wahrscheinlich, aber dies ist nur eine Vermutung, sich einen Knaben angeeignet, den er in seinen Ansichten erzieht zu dem Zweck, ihn später zum Häuptling aller Indianerstämme zu proklamieren. Vor fünfzehn Jahren verschwand er mit dem Gelehrten, und beide wurden nie wiedergesehen. Jetzt haben wir seine Spur gefunden, er wohnt hier in dem Tempel.«
»Und derjenige, welcher Miß Murray und Miß Petersen kuriert hat und uns mit Medikamenten versah, wird der skandinavische Gelehrte gewesen sein,« ergänzte Nick Sharp.
»So ist es, er besorgte auch das Donnern.«
»Warum soll der Weiße es aber mit der Rothaut halten? Als intelligenter Mann muß er doch wissen, daß dessen Pläne nur Hirngespinste sind.«
»Wer weiß, was für einen Pakt die beiden geschlossen haben. Ich denke mir die Sache so: die schwarze Zeder war seiner Zeit sehr bekannt in den Ruinen, welche noch jetzt von den Azteken erzählt. Er suchte in ihnen nach Gold und Silber, auch nach Pergamenten und so weiter, welche er dann bei Gelegenheit an Liebhaber verkaufte, wie die schwarze Zeder überhaupt einen ganz anderen Charakter als die Indianer sonst hat. Er war ebenso schlau, dabei aber habgierig und vor allen Dingen romantisch angelegt. Weiß der liebe Gott, woher er ihn bekommen hatte, aber jedenfalls muß er auch einen Raben gefangen oder gefunden haben, der viele Worte in der Sprache der Azteken plappern, konnte, vielleicht hat es der Vogel erst wieder von einem anderen Raben gelernt, aber er konnte es jedenfalls. Der Gelehrte suchte die schwarze Zeder und dessen Vogel aus, sah ein, wieviel dieser ihm beim Studium der alten mexikanischen Völker nützen könnte und ging vermutlich, scheinbar auf die Gedanken des Indianers ein, einen Oberhäuptling zu erziehen, um von dem kundigen Indianer möglichst viel Wissenswertes zu erfahren. Ich denke sicher, der Gelehrte bringt dem Jungen allerhand Kniffe bei, durch welche er den Indianern, welche ihm einst gehorchen sollen, als ein übernatürliches Wesen erscheinen muß. Durch ein wenig Chemie und Magie kann man ja bei den unwissenden und abergläubischen Rothäuten leicht etwas erreichen.«
Deadly Dash blieb stehen und lauschte, setzte dann aber seinen Weg fort.
»Sind die Indianerstämme mit diesem Plane der schwarzen Zeder bekannt, oder soll die Erhebung des künftigen Häuptlings ohne alle Vorbereitungen plötzlich geschehen?« fragte Sharp.
»Es werden viele Indianer darum wissen, besonders Häuptlinge, welche unumschränkt über ihre Krieger herrschen, und besonders solche, welche wegen ihres Hasses gegen die Bleichgesichter bekannt sind. Ich kenne Häuptlinge, habe auch mit ihnen über das Thema gesprochen, sie wußten aber nur dunkle Gerüchte davon, eben darum, weil sie freundschaftlich mit mir, einem Weißen, verkehrten. Auch Stahlherz kennt nur eine Sage, daß einst ein Häuptling entstehe, der das Reich der Azteken wiederaufrichten soll. Stahlherz ist schon aufgeklärt, er lacht über den Plan und bezeichnet das Ganze eben als eine Sage. Jetzt aber bin ich der festen Meinung, daß doch etwas Wahres daran ist, daß die schwarze Zeder nicht nur geträumt hat, sondern seine Pläne zu verwirklichen sucht, wobei ihn der Weiße unterstützt, jedenfalls nur scheinbar, um nur recht viel in der Gesellschaft der schwarzen Zeder sein zu können, der ihm viel Auskunft über die Ruine und die alten Azteken geben kann.«
»Und was hat Stahlherz ihm zum Feinde gemacht?« fragte Sharp.
Deadly Dash wollte auch hierauf Antwort geben, über plötzlich blieb er wie angewurzelt stehen, sah scharf in die Nacht hinaus und sank dann hinter einem Busch zusammen. Gleichzeitig tat der Detektiv dasselbe, auch er hatte einen Zweig knacken hören.
»Es ist ein Mensch,« flüsterte der Waldläufer, den Mund dicht an das Ohr des Gefährten legend.
Sharp nickte nur.
Nachdem sie einige Minuten so stumm nebeneinander gelegen hatten, verständigten sie sich durch Zeichen, diesen Platz zu verlassen und die Ursache des Geräusches zu ergründen. Kein Schatten konnte lautloser über den Boden gleiten, durch die Büsche schlüpfen und über die Wurzeln sich schwingen, als diese beiden. Sie hätten dicht neben einem Menschen vorbeikriechen können, und dieser hätte sie doch nicht bemerkt, wenn nicht sein Auge zufällig auf sie gefallen wäre.
Dann lagen sie wieder still und schmiegten sich dicht an den Boden.
Zwischen den Bäumen tauchten zwei Gestalten auf, die mit unhörbaren Schritten über die Moos- und Rasendecke schritten. Sie gingen ebenfalls auf die Ruine zu, kamen aber mehr von der Seite. Die Dunkelheit der Nacht hinderte die Augen der Beobachter nicht, die beiden Gestalten zu erkennen.
Nick Sharp sah, daß es zwei Indianer im Kriegsschmuck waren, aber er war in den Sitten der Wilden nicht bewandert genug, um an der Kleidung, der Farbenmalerei und dem Federschmuck einen Stamm von dem anderen unterscheiden zu können.
Fragend schaute er den Waldläufer an, der mit großen Augen den sich Entfernenden nachblickte, sein Gesicht zeigte eine seltene Mischung von Ueberraschung und Bestürzung.
»Was für Indianer waren es? Ich hielt sie für Sioux. Hätte nicht geglaubt, daß es hier herum welche gibt.«
»Es ist das erstemal, daß ich diese beiden in Freundschaft zusammensehe,« flüsterte Deadly Dash in erregtem Tone zurück, »ein Sioux und ein Pawnee?
»Daß die beiden jetzt ruhig nebeneinander hergehen, läßt auf schlimmes schließen. Sollte es der schwarzen Zeder durch falsche Vorspiegelungen und allerlei Kniffe gelungen sein, den Haß unter den einzelnen Stämmen zu besiegen?« fragte Deadly Dash sich selbst. Dann fuhr er laut fort:
»Das wäre allerdings eine ans Wunder grenzende Tat, dann glaube ich auch, daß er wirklich Macht hat. Sharp, der Pawnee und der Sioux hassen einander so, daß der eine das verbrennt, was der andere nur berührt hat; nur den Skalp faßt er an, um ihn abzuziehen. Das rote Weib, welches einen Mann des feindlichen Stammes nur gestreift hat, wird unbarmherzig verstoßen, und wenn es die eigene Frau, die eigene Tochter ist. Ein Pawnee tritt nicht in die Fährte des Sioux, badet erst das geraubte Pferd, ehe er sich auf dessen Rücken setzt, und jetzt gehen ein Pawnee und ein Sioux harmlos nebeneinander.«
»Und auf die Ruine zu!« fügte Sharp hinzu.
»Das hat schlimmes zu bedeuten. Der schwarzen Zeder oder Arahuaskar ist es gelungen, den Zwiespalt unter den Stämmen zu beseitigen. Jetzt ist es klar, daß ein allgemeiner Aufstand gegen die Weißen geplant wird. Sharp, und kostet es mein Leben, ich muß diesem Kriegsrat beiwohnen. Selbst an der Rettung von Stahlherz ist mir weniger gelegen als daran.«
»Wie aber wollen wir in die Ruine kommen? Kennt Ihr Eingänge zu den unterirdischen Gräbern?«
»Ja, ich habe eine Fährte gefunden, welche nach einem hohlen Baumstamme führt,« entgegnete der Waldläufer, »dort waren die beiden Damen in's Innere geführt worden, auch zwei indianische, sehr leichte Spuren waren dabei. Hätten die Mädchen nur sprechen wollen, wir würden genug erfahren haben.«
»Eine gefährliche Sache,« meinte selbst der unerschrockene Detektiv nachdenkend. »Werden wir dabei erwischt, so ist unser Leben verwirkt. Wir sitzen dann wie die Maus in der Falle und können durch das Gitter hindurch erschossen oder totgestochen werden.«
»Fürchtet Ihr Euch?«
Diese Frage aus dem Munde des Waldläufers klang nicht spöttisch, sie verlangte nur eine offene Antwort.
»Ich kenne keine Furcht, aber Vorsicht und Ueberlegung sind immer angebracht. Wir dürfen unser Leben nicht unnütz opfern, denn was für einen Zweck hat es, wenn wir den Plan der Indianer erfahren, dabei aber erwischt werden und dann keine Gelegenheit haben, ihm entgegenzuwirken? Unser Leben gehört vorläufig nicht uns, es steht in dem Dienste der Engländer und der Damen. Sind diese geborgen, dann können wir, oder dann kann vielmehr ich tun, was ich will, wenn es mir Vergnügen macht.«
»Wahr gesprochen, Mann! Aber ich stürze mich, auch nicht kopflos in eine Gefahr, wenn ich nicht weiß, ich kann sie bestehen. Ihr kennt mich zwar, Sharp, Ihr wißt, wer ich bin, aber als Deadly Dash kennt Ihr mich doch noch nicht. Vielleicht habe ich Gelegenheit, Euch diesmal zu zeigen, daß ich meinen Namen mit Recht führe. So lange ich noch eine Hand regen kann, fängt man mich nicht, und mag der Mann, der den Donner rollen lassen kann, noch so geschickt in dergleichen Kunststückchen sein, in mir hat er seinen Meister gefunden.«
Sharp lächelte.
»Ich kann es mir denken,« entgegnete er. »Los denn! Und wenn Ihr mich auch in die Hölle führtet, ich bleibe bei Euch. Wir wollen einmal erproben, was zwei Männer mit klarem Kopfe und unbeugsamer Energie erreichen können.«
Sie setzten ihren Weg fort, bis sie eine Gegend erreichten, welche von meterhohen Wurzeln durchzogen war.
»Hier ist der Ort,« flüsterte wieder Deadly Dash, »wo Miß Murray stürzte. Sie wollte zwar das Geheimnis, welches sie zu bewahren versprochen hatte, nicht ausplaudern, aber meine Fragen brachten doch, ohne daß sie es ahnte, so viel aus ihr heraus, daß sie von hier aus durch einen unterirdischen Gang das Innere der Ruine erreicht hatten. Meine Nachforschungen bestätigten dies, ich fand ihre Spur und den hohlen Baumstamm.«
»Ja ja,« lächelte Sharp, »mit Schlauheit vermag man viel. Man sagt immer, dem Tapferen gehört die Welt, ich denke aber, der Kluge kann noch mehr erreichen. Ich habe überhaupt in meiner langjährigen Praxis, die mich mit vielen Verbrechern zusammenführt, bei denen man immer auf der Hut sein muß, stets bestätigt gefunden, daß ein grimmig und furchterregend aussehender Mensch viel weniger zu fürchten ist, als einer mit einem schlauen Gesicht.«
»Das ist so gewiß wahr, als das Gehirn des Menschen eine ungleich gefährlichere Waffe ist, als die Klaue des Löwen, sonst würde es uns schwachen Menschen schlecht genug ergehen,« bestätigte Deadly Dash des Detektiven Ansicht.
»Hier ist es,« sagte er dann und hielt an einem Baumstamm.
Es war derselbe, durch welchen Ellen und Jessy von dem indianischen Geschwisterpaar in das Innere der Höhle geführt worden waren.
Schon wollten die beiden Männer in die Höhlung des Baumes schlüpfen, als sie deutliche Schritte vernahmen, daß sie annehmen mußten, ein großer Trupp von Menschen nähere sich ihnen.
Sofort verschwanden sie wieder im Walde, und bald kamen etwa zehn Indianer über die kleine Lichtung, welche ihren Abzeichen nach zu schließen, drei oder mehr verschiedenen Stämmen angehörten. Alle waren im Kriegsschmucke, die einen trugen Federkronen auf dem Kopf mit den auf den Rücken herabwallenden Federschweifen, andere trugen nur zwei Schwungfedern des Adlers in der Skalplocke, und wieder andere hatten die Haare über den Ohren mit Federn geschmückt. Alle aber waren mit Ketten aus Krallen und Klauen wilder Tiere behängt, trugen Schild, Pfeil, Bogen, Messer und Tomahawk und einige auch die hölzerne Keule mit oder ohne eiserne Stachel. Ihre bemalten Gesichter glänzten in den verschiedensten Farben und zeigten sonderbare Figuren.

Kaum hatten Deadly Dash und Sharp sich wieder verborgen,
als schon ein Zug Indianer unmittelbar an ihnen vorüberschritt.
Auch der Indianer, welcher sie führte, trug solche Abzeichen, ebenso war sein nackter Oberkörper stark bemalt.
Natürlich verhielten sie sich völlig schweigsam. Sie gingen hintereinander. Jeder trat in die Spuren des Vorangehenden, bemühte sich aber im übrigen nicht sehr, jedes Geräusch zu vermeiden.
Sie mußten sich also ganz sicher fühlen.
Mit angehaltenem Atem lagen die beiden Spione im Busch und wandten keinen Blick von dem unheimlichen Zug.
Als die Wilden im Schatten der Nacht verschwunden waren, näherte sich Deadly Dash dem Detektiven und flüsterte ihm seine Meinung ins Ohr.
»Es waren Sioux und Apachen, die anderen kenne ich nicht; sie müssen einem kleinen Stamme aus dem Indianer-Territorium angehören, der schon halb vernichtet ist. Schade, daß ich sie nicht habe sprechen hören! Dieser Trupp ist ein Beweis mehr für meine Ansicht, daß in der Ruine wirklich ein Kriegsrat stattfinden soll. Aus nah und fern scheinen die Häuptlinge zusammenzuströmen. Einen der Sioux kenne ich, er ist der unversöhnlichste Feind von allem, was weiße Haut hat. Arahuaskar wird sich schon die Unzufriedensten und Herrschsüchtigsten ausgesucht haben.«
»Wer mag der starkbemalte Indianer wohl gewesen sein, der jene führte? Er trug besondere Abzeichen.«
»Ebenso wie bei Schmalhand. Jedenfalls zählen diese zu den direkten Anhängern der schwarzen Zeder. Ich habe schon mehrmals Indianer ohne Abzeichen, die auf ihren Stamm schließen lassen, sich bei Stämmen herumtreiben sehen, doch sobald ich mich sehen ließ, verschwanden sie. Es sind die, welche Aufruhr, aber zugleich auch Einigkeit unter den Stämmen predigen. Sie sind Botschafter der schwarzen Zeder; wer hätte das gedacht? Früher war ich öfters der Meinung, eine europäische Nation, etwa die Franzosen, wollten die Indianer gegen die Engländer aufhetzen, um aus einem Kampfe Vorteil zu ziehen, aber sie konspirieren unter sich selber.«
»Wohin, mögen sie gehen?« meinte Nick Sharp. »Wenn hier ein Eingang zum Innern der Ruine ist, so können sie ja diesen benützen. Aber sie taten es nicht Was soll das bedeuten?«
»Dieser Eingang würde ihnen zu offen liegen, man würde ihre Spuren leicht darin verschwinden sehen. Doch es könnte auch ein anderer Grund zu dem Verhalten der Wilden vorliegen, und wenn meine Befürchtung wahr ist, so sind wir schlimm daran. Nun, wir werden gleich sehen.«
Beide krochen dem Baumstamme zu.
Deadly Dash ließ sich in die Höhlung hinuntergleiten, indem er sich an den Wurzeln festhielt. Unten aber fand er zwar festen Boden, doch keinen Ausweg. Der Gang war verschüttet worden. Es machte den Eindruck, als wäre überhaupt gar keiner hier vorhanden gewesen, sondern als setzte sich die Höhlung nur in Gestalt eines Erdloches noch etwas unter den Wurzeln des Baumes fort.
Er teilte seine Bemerkung dem oben wartenden Detektiven mit.
»Ich konnte es mir fast denken,« sagte dieser, »sie haben den Eingang verschüttet, welchen die beiden Damen benutzt haben. Sollten diese doch das Geheimnis der Passage verraten, dachten sie, und Unbefugte danach suchen, so sollen diese nichts finden. Es wäre möglich, daß mit dieser Verschüttung der Donner zusammenhing, den wir heute abend hörten.«
»Leicht möglich, und ich bin der Ueberzeugung, auch die anderen Zugänge sind verschüttet worden, nur ein ganz geheimer ist offen geblieben, den die ankommenden Indianer benutzen.«
»Aber den finden und ihn benutzen, ohne erkannt zu werden, ist eine schwierige Sache,« meinte der Detektiv nachdenklich. »Ich bin ziemlich erfahren in dergleichen Sachen, aber hier muß ich gestehen, daß ich unfähig bin, irgend einen Rat zu geben.«
Deadly Dash blieb lange regungslos neben seinem Kameraden liegen, den Kopf in die Hände gestützt. Er schien angestrengt nachzusinnen, und auch der Detektiv tat so.
»Wir wollen versuchen, den Spuren der Indianer zu folgen,« sagte ersterer. »Ich muß auf jeden Fall das Geheimnis erkunden, und finde ich doch keinen Eingang, oder kann ich in den gefundenen nicht hinein, so werde ich mir selbst einen schaffen.«
Verwundert schaute Sharp den Sprecher an, den er nicht verstand.
Beide verfolgten eine Zeitlang die Spuren, welche die Indianer zurückgelassen hatten. Nach kurzer Zeit bereits schienen diese immer vorsichtiger aufgetreten zu sein; es war äußerst schwer, den Merkmalen zu folgen, noch dazu in der Nacht, aber schließlich hörten sie plötzlich ganz auf.
Die Männer befanden sich gerade an einem Felsen.
»Sie können doch nicht in denselben gekrochen sein,« meinte Sharp verwundert.
Deadly Dash deutete nach oben.
Auf dem Felsen stand ein Strauch oder ein kleiner Baum, dessen Zweige so herunterhingen, daß ein aufrecht stehender Mann sie mit ausgestrecktem Arme erfassen konnte.
Wieder neigte der Waldläufer seinen Mund dicht an des Detektiven Ohr.
»Hier haben sie sich hochgeschwungen. Wir können die Zweige allerdings nicht darauf untersuchen, es ist zu dunkel und auch zu gefährlich, denn ist hier ein geheimer Eingang, so ist auch anzunehmen, daß er von einem indianischen Posten bewacht wird.«
Damit bückte sich Deadly Dash schon wieder und huschte, von Sharp gefolgt, in den Schutz des Dickichts zurück. Der Gefahr, gesehen zu werden, durften sie sich auf keinen Fall aussetzen, sonst hatten sie gar keine Hoffnung mehr, das Innere der Ruine zu erreichen.
»Zu dem hohlen Baumstamm zurück!« flüsterte der Waldläufer. »Aber merkt Euch genau, wo der Felsen liegt. Vielleicht können wir diesen Eingang noch einmal als Ausgang gebrauchen.«
Der Baumstamm war erreicht. Beide Männer lagen wieder dicht nebeneinander am Boden.
Deadly Dash öffnete eine der Ledertaschen, von denen er, wie schon früher erwähnt, mehrere am Gürtel hängen hatte, und brachte daraus einen langen, grünen Draht zum Vorschein, welcher an einem Ende einen weißen Knopf trug. Das andere Ende des Drahtes blieb in der Tasche verborgen.
»Könnt Ihr telegraphieren?« fragte er den Detektiven.
Dieser wunderte sich durchaus nicht über eine solche Frage aus dem Munde eines Waldläufers. Er bejahte.
»So nehmt diesen Knopf,« fuhr Deadly Dash fort und gab ihm das Ende des Drahtes. »Jetzt steige ich in die Höhle hinab und versuche, ob ich mir zwischen dem Schutt einen Eingang bahnen kann. Ihr legt Euch dort in ein Gebüsch, bei dem Geringsten, was Euch auffällt, drückt Ihr auf den Knopf, was ich wahrnehmen werde. Ihr sagt mir, was Euch auffällt, und ich werde den Kopf aus der Oeffnung heben und sprechen. Gesehen kann ich nicht werden. Ihr haltet den Finger immer leise an den Knopf; will ich Euch Nachricht zukommen lassen, wenn ich Euch zum Beispiel brauche, so werdet Ihr ein leises Zeichen wahrnehmen. Ein kurzes Zucken bedeutet einen Punkt, ein langes einen Strich. Seid Ihr so geübt im Telegraphieren, daß Ihr dies verstehen könnt?«
»Ich kann es.«
»So verhaltet Euch ruhig.«
Nick Sharp legte den Finger an den Porzellanknopf, murmelte etwas vor sich hin und kroch in den bezeichneten Busch hinein, während Deadly Dash die kurze Büchse von der Schulter nahm und in die Höhlung des Baumes hinabstieg.
Der Detektiv lag regungslos im Grase, von den Zweigen versteckt, und betrachtete, so gut es die Dunkelheit gestattete, aufmerksam den Draht in seiner Hand. Es war jedenfalls ein Kupferdraht, mit grüner Seide umsponnen, einer von jener Art, wie man ihn bei allen elektrischen Anlagen verwendet. Der Knopf war aus Porzellan gefertigt und lag in einem Gehäuse, in welches er leicht hineingedrückt werden konnte.
Auf die Gefahr hin, den Mann in der Höhle zu rufen, drückte Sharp einmal; ein leiser Schlag rieselte durch seine Glieder und da, wo der Knopf das Gehäuse berührte, sprang ein kleiner, weißer Funke über.
»Hagel und Gewitter,« murmelte Sharp verblüffe »das hätte ich doch nicht gedacht, daß er eine Batterie bei sich trägt. Ich habe schon manches Seltsame erlebt, aber mitten im Urwald einen elektrischen Telegraphenapparat mit sich herumzutragen, ist mir neu.«
Er teilte darauf seine Aufmerksamkeit zwischen der Umgegend und der Höhle, in welcher Deadly Dash sich befand.
Was er darin machte, wußte Sharp nicht, er hörte kein Geräusch und sah auch nichts, der Waldläufer mußte sich ganz still verhalten. Dann aber war es ihm, als ob der Boden unter ihm leise zu zittern begänne, ferner, als ob ab und zu die Wände des hohlen Baumstammes etwas erleuchtet würden, ganz wenig, blitzähnlich, und dann schlugen sogar einige Male grelle Strahlen heraus.
Sharp erschrak, das war zu auffällig.
Das schwache Leuchten konnte man für das phosphorische Glühen des faulen Holzes annehmen, aber die weißen Blitze waren unnatürlich. Er zögerte nicht, dem Manne da unten darüber Nachricht zu geben.
Der Finger druckte am Knopf, und Deadly Dash erfuhr, daß man oben die Strahlen sehen konnte.
Kaum hatte Sharp aber zu drücken aufgehört, so durchrieselte seinen Körper ein kürzeres und längeres Zucken, sein Körper war also der Apparat, auf welchen die Zeichen übertragen wurden.
Deadly Dash antwortete durch ein Verstandenzeichen, und sofort hörten die Strahlen auf; nicht einmal mehr das schwache Leuchten in der Höhlung ward sichtbar.
Sharp wunderte sich nicht so leicht über etwas, jetzt aber war er außer sich vor Staunen.
Die leise Erdbewegung hörte nicht auf, es war fast, als ob da unten eine Maschine arbeitete, oder als ob unterirdische Kräfte an der Erddecke rüttelten.
Wohl über eine Stunde lang lag Sharp so da. So sehr er sich sonst beherrschen konnte, diesmal verging er fast vor Neugierde, was Deadly Dash da unten machte, wie er es fertig bringen wollte, sich einen Weg durch den Schutt zu bahnen, und noch dazu ohne herausgearbeitete Steine aus der Höhle zu beseitigen.
Doch er erfuhr nichts, der Waldläufer ließ sich nicht erblicken, und die leichte Erschütterung währte fort, ein Zeichen, daß Deadly Dash unter der Erde emsig wie ein Maulwurf arbeitete.
Dann wurde des Detektiven Aufmerksamkeit von etwas anderem in Anspruch genommen.
Es war ihm, als hörte er gar nicht weit von sich entfernt ein Geräusch. Er strengte alle seine Sinne bis zum äußersten an, ohne etwas Genaues wahrnehmen zu können. Schon wollte er sich einreden, er habe sich getäuscht, als plötzlich zwischen den Bäumen mit geräuschlosem Schritt eine Gestalt ganz dicht neben dem Detektiven auftauchte. Der weiche Moosteppich machte ihren Schritt unhörbar, das Laub war vom Tau naß; es raschelte nicht.
Sharp zuckte zusammen, als hätte ihn die Tarantel gestochen.
Die Gestalt trug ein enganschließendes, kurzgeschürztes, graues Kleid, es war ein Weib und niemand anderes, als Miß Sarah Morgan.
In demselben Augenblick, da Sharp zu dieser Erkenntnis kam, berührte sein Finger mehrmals den Knopf, und wenn Deadly Dash auf das Zeichen achtete und sofort den Kopf zur Höhlung hinausstrecken konnte, so mußte er das Weib noch sehen, ehe es wieder im Walde verschwand.
Doch Sharp beobachtete nicht, ob dies der Fall war, seine Augen hingen nur an Miß Morgan.
Er hatte Gelegenheit, sie länger zu betrachten.
Auf der kleinen Lichtung, auf welcher der Baum stand, blieb sie plötzlich stehen, sah sich um und ging dann — dem Detektiven stockte der Atem — gerade auf den Baumstamm zu und sah in die Oeffnung hinein.
Geräuschlos zog Sharp den Revolver hervor. Wurde sein Freund entdeckt, so mußte das Weib sterben, wenn es dem aufmerksam gemachten Waldläufer nicht selbst rechtzeitig gelang, es unschädlich zu machen. Das Zittern des Bodens hatte aufgehört, also mußte jener die Warnung vernommen haben.
Miß Morgan trat zurück, besah die Gegend, ging um den Baum herum, schüttelte den Kopf und blieb wieder stehen.
Ihr Benehmen war rätselhaft. Hatte sie Argwohn geschöpft, wußte sie, daß hier ein geheimer Eingang war, oder hatte sie sich verlaufen? Was hatte sie hier zu suchen? Wie kam sie überhaupt hierher?
Teufel, schoß es dem Detektiven plötzlich durch den Kopf, sie steht mit den aufrührerischen Indianern im Bunde.
Seine Vermutung sollte sofort bestätigt werden.
Miß Morgan legte die Hände trichterförmig an den Mund und stieß das klagende Krächzen des Käuzchens mehrmals hintereinander so täuschend aus, wie es Sharp diesem Weibe nimmer zugetraut hätte. Besser hätte es kein Indianer nachahmen können. Miß Morgan mußte also recht gut mit dem Leben in der Wildnis vertraut sein.
Dann ging sie wieder nach dem hohlen Baumstamm und spähte in die Tiefe, als erwarte sie, daß dorther eine Antwort kommen würde.
Aber dieselbe erfolgte von einer anderen Seite.
In der Richtung, wo der vorhin erwähnte Felsen lag, wurden die Zweige zurückgebogen, und aus dem Busche trat ein Indianer hervor, der keinerlei Schmuck und auch keine Malerei zeigte.
Das Weib sprach mit der Rothaut in einem indianischen Dialekte, den der Detektiv leider nicht verstand. Der Indianer schüttelte lächelnd den Kopf, indem er auf den Baum deutete, der früher einen Eingang bildete, zeigte dann in der Richtung des Felsens, und beide verließen darauf die Lichtung. Der Indianer führte, Miß Morgan folgte.

Als Sharp sie nicht mehr sehen konnte, wollte er dem in der Höhlung verborgenen Waldläufer diese Nachricht zutelegraphieren, aber schon wurde sein Arm berührt, und zu seinem Erstaunen sah er Deadly Dash neben sich liegen, der unterdes herausgekrochen war und sich ihm genähert hatte, ohne daß Sharp mit seinen feinen Sinnen das Geringste davon gemerkt hatte.
Der Waldläufer war ganz mit gelbem Lehm bedeckt; nicht nur sein Anzug, sondern auch Gesicht und Hände trugen Spuren seiner unterirdischen Arbeit.
»Miß Morgan!« flüsterte Sharp. »Was in aller Welt will sie hier? Weiß sie von dem Komplott der Indianer?«
»Es scheint mir, als wäre sie sogar mit daran beteiligt,« gab der Waldläufer zurück. »Sie kann sich mit dem Indianer gut verständigen. Auf ihre Veranlassung hin sollte Miß Petersen von letzteren geraubt werden, also muß sie mit diesen Umgang pflegen.«
»Konntet Ihr verstehen, was sie zusammen sprachen?« fragte Sharp.
»Sie glaubte, dieser Baum bilde den Eingang zur Ruine. Dann aber fiel ihr ein, er gehöre zu denen, die verschüttet worden sind, und ehe sie ihr Kleid schmutzig machte rief sie einen Indianer herbei. Sie muß jedenfalls irgend eine wichtige Rolle spielen. Der Wilde war ihr gegenüber demütig.«
Der Waldläufer wickelte den grünen Draht zusammen und steckte ihn in die Tasche.
»Der Weg zum Innern der Ruine ist frei,« sagte er dann mit tiefer Stimme. »Er ist zwar nur schmal, aber er läßt mich hindurch, und so ist er auch breit genug für Euch. Seid Ihr bereit, mir zu folgen? Es kann ein gefährliches Wagestück werden.«
»Ich bleibe bei Euch, mag kommen was da will! Wie habt Ihr Euch denn aber hindurchgearbeitet? Ihr müßt ja wie ein Maulwurf mit den Händen geschaufelt haben.«
Deadly Dash war schon von Sharps Seite verschwunden, kehrte aber gleich aus einem nicht weit entfernten Dickicht zurück. Er trug einen Beutel in der Hand.
»Er enthält Pemmikan, getrocknetes Fleisch,« sagte er. »Wir müssen uns daraus gefaßt machen, einige Tage unter der Erde zu verbringen. Könnt Ihr Hunger ertragen?«
»Ich glaube ja,« lachte der Detektiv leise. »Es dauert etwas lange, ehe Nick Sharp vor Hunger umfällt.«
Er machte sich bereit, dem Waldläufer zu folgen, schnallte sich den Gürtel enger, versicherte sich, daß ihm das Messer zur Hand war, und folgte dann dem Waldläufer, der schon in der Höhlung des Baumes verschwunden war.
Der Detektiv ließ sich an den Wurzeln des Baumes hinuntergleiten, bis er festen Boden unter den Füßen fühlte.
Unten herrschte natürlich vollkommene Dunkelheit, welche der Waldläufer auch nicht, wie vorhin, erhellte.
»Jetzt haltet Euch immer dicht auf meinen Fersen!« flüsterte dieser. »Fühlt meinen Stiefel, der Weg ist krumm!«
Nick Sharp hörte ein schlürfendes Geräusch, als ob Kleider sich an Steinen rieben, dann war der Waldläufer verschwunden, doch konnte er noch dessen Stiefel fühlen. Also war er in ein Loch gekrochen. Nick Sharp bückte sich und folgte.
Das war ein mühsamer Weg. Man konnte sich nur dadurch fortbewegen, daß man sich mit den Händen an die Seite der Höhlung stemmte und sich so fortschob; an ein Aufrichten war gar nicht zu denken; man mußte glatt auf dem Bauche liegen bleiben.
Dem Detektiven war es unerklärlich, wie sich der Waldläufer hier hatte einwühlen können, dieser Tunnel mußte schon teilweise beim Verschütten der Höhle entstanden sein. Deadly Dash hatte nur etwas nachgeholfen und die Haupthindernisse aus dem Wege und zur Seite geräumt.
Der Weg führte bergauf, was noch hinderlicher war. Sharp wußte nicht, wie weit er so kroch, aber zwanzig Meter schätzte er die Strecke doch. Dann fühlte er den Stiefel nicht mehr, und gleich darauf nahm er wahr, daß sich vor ihm jäh eine Tiefe öffnete.
»Faßt meine Hände!« rief ihm der Waldläufer zu. »So! Nun laßt Euch fallen!«
Sharp schwang sich, von Deadly Dash gestützt, leicht herab und stand auf ebener Erde.
Undurchdringliche Nacht umgab sie, in welcher auch Sharps sonst so scharfe, in der Finsternis sehenden Augen versagten. In einem Raume, in welchen nie die Sonne scheint, kann auch der Mensch oder das Tier, welches sonst während der Nacht im Freien alles sieht, nicht einen Fuß weit sehen. Das Sehvermögen in der Nacht kommt nur daher, daß das Auge empfänglich für Lichtstrahlen ist; bekanntlich saugt jeder Gegenstand das Licht der Sonne am Tage ein und strahlt es in der Nacht wieder aus. Einige Steine tun dies in ganz besonderem Grade, ebenso die Augen einiger Geschöpfe, besonders die der Nachtraubtiere, und diese besitzen dann die erwähnte Eigenschaft.
Hier aber umgab die Männer undurchdringliche Finsternis. Sie konnten die Hand nicht vor den Augen erkennen.
Der Waldläufer hatte sich niedergelegt und das Ohr auf den Boden gedrückt.
»Ich muß es wagen, einmal den Gang zu beleuchten,« sagte er dann, sich aufrichtend, »wir können sonst nicht weiter vordringen, wir verirren uns.«
Noch hatte er den Satz nicht beendet, als plötzlich ein langer, weißer Lichtstrahl von seiner Brust zuckte und den ganzen Gang für einen Moment grell erleuchtete blitzähnlich, aber doch genügend, um alles deutlich erkennen zu lassen.
Sie befanden sich in einem hohen und breiten Gange, dessen Decke hier und da von steinernen Säulen gestützt wurde. Er war schön gebaut, und die Wölbung der Säulen verriet einen kunstsinnigen Baumeister!
Gleichzeitig hatten sie auch gemerkt, daß sich an der Seite des Ganges nicht nur eine Menge von Türen befand, sondern auch eine große Anzahl von ausgemauerten Löchern, wahrscheinlich Eingänge zu anderen Tunneln, aber schmal und niedrig.
»Es gibt Verstecke genug,« flüsterte der Waldläufer, »um uns verbergen zu können. Sind wir in solch einem Gange, so können wir nötigenfalls uns alle Indianer vom Leibe halten, und seien es Tausende. Merkt Euch die Richtung, daß Ihr Euch auch ohne mich nach dem Ausgang zurückfinden könnt. Nun wollen wir die Wanderung beginnen!«
Jetzt brauchten die beiden Männer kein Licht mehr. Schnell, aber vorsichtig schritten sie geradeaus, ohne sich auch nur an die Säulen zu stoßen oder sich einmal in der Richtung zu irren.
Sie wußten, daß sie wenigstens dreihundert Meter gehen mußten, ehe sie dorthin kamen, wo der Gang durch eine Mauer versperrt zu sein schien, und so konnten sie jetzt ohne Zögern geradeaus gehen.
Nick Sharp hörte, wie der Waldläufer leise die Schritte zählte. So war ein Irrtum nicht möglich.
Sie hatten wohl schon zweihundert Meter zurückgelegt, als Deadly Dash plötzlich stehen blieb und den Detektiven am Arme packte. An beider Ohren schlug das Summen von Stimmen, fast wie das Murmeln anzuhören, das von einer aufgeregten Volksmasse erzeugt wird.
Das quadratische Gemach, von ziegelroten Wänden eingefaßt, leuchtete im Scheine eines Feuers blutigrot auf. Dicker Rauch stieg wirbelnd zu der nicht sichtbaren Decke auf, wo er einen Ausweg zu finden schien, und malte an der Wand seltsame Schatten. Rote Lichter zuckten darüber hin, grausige Gestalten spiegelten sich ab, und selbst der Schatten des jungen Indianers, welcher seine Rede mit Gestikulationen der Arme begleitete, veränderte sich fortwährend, bald wachsend, bald wieder fast verschwindend, je nachdem die Flammen hoch emporschlugen oder zwischen die Holzscheite zurücksanken.
Der junge Indianer in dem malerischen Kostüm war Sonnenstrahl, und als ein solcher paßte er nicht in dieses unheimliche Gemach, dem man es sofort ansah, daß es ein altes Grabgewölbe war, ebensowenig, wie Waldblüte hierherein gehörte. Das Mädchen kauerte neben einem Lager aus geflochtenen Binsen und schaute mit unverwandten Augen den Sprecher an, einmal durch leises Kopfneigen ihren Beifall zollend, dann wieder, wenn des Bruders Stimme drohend klang, die Augen mit erschrockenem Ausdruck noch fester als zuvor auf ihn heftend.
Der, zu dem der Indianer sprach, war hier eher am Platze, ja, man hätte ihn für ein Ueberbleibsel der alten Azteken halten können, für eine Mumie, welche hier seit Jahrtausenden schlummerte und noch so lange sich erhielt, bis auch die Balsamierung sie vor dem Zerfall nicht mehr schützte, wenn nicht die glühenden Augen, in denen sich das Feuer spiegelte, Leben verraten hätten.
Dieses Geschöpf hockte auf einem Binsenlager in jener Stellung, wie man sie bei den mexikanischen Mumien gewöhnlich vorfindet; es saß auf den Schenkeln, die Knie waren dicht zusammengerückt, und die Füße spreizten sich nach beiden Seiten, eine für den Ungewohnten sehr unbequeme Stellung.
Es war Arahuaskar, der so regungslos dahockte, den Oberkörper zugleich auf Schenkel und Arme gestützt, den Totenschädel vorgeneigt und mit glühenden Augen den Sprecher betrachtend. Ein leichtes Gewebe umhüllte die ganze Gestalt, aber es war so dünn, daß man jedes Glied darunter erkennen konnte.

Sonst befand sich niemand in dem Gemach, welches weder Tür noch Fenster besaß. Der Raum konnte nur durch künstliches Licht erhellt werden.
Sonnenstrahl suchte so zu sprechen, wie es einem jungen Krieger geziemt, ernst und leidenschaftslos, aber nur zu oft brachen Heftigkeit und Bitterkeit hindurch.
Arahuaskar sprach, ohne eine Miene zu verändern, seine Worte klangen kalt und überlegt.
»Du bist ein Tor, Sonnenstrahl,« sagte der Alte. »Bedenke, was dich in wenigen Tagen, vielleicht morgen schon, erwartet. Tausende von Indianern werden dir zujubeln, man wird dich auf den Schild heben und dich den Weibern und Mädchen mit den Worten zeigen: ›Seht, das ist unser König, er wird die Blaßgesichter aus unseren Jagdgründen vertreiben; sein Tomahawk ist scharf und fehlt nie, seine Hände rauchen von Blut!« Aber das erste, was man von dir verlangt, ist, daß du eine Probe deines Könnens ablegst. So lange du nicht jedem deiner Anhänger zu genügend vielen Skalpen verholfen hast, daß er seinen Gürtel damit zieren kann, darfst du auch nicht auf sie bauen. Zeige es ihnen, mache schon jetzt den Anfang! Es ist dir ein leichtes. Gib deinen Wunsch zu erkennen den alten Vater zu verstehen, und die Bleichgesichter sind in deiner Hand, sie sind wie Schafe im Stalle zusammengepfercht. Dann schicke jenen die Schwester und laß ihnen sagen, die Skalpe der Bleichgesichter gehörten ihnen; das ist der Anfang deiner Laufbahn.«
Finster hatte der junge Indianer zugehört.
»Nimmermehr!« rief er dann heftig. »Waldblüte und ich haben die beiden Mädchen in Schutz genommen und ihnen versprochen, auch über ihre Freunde zu wachen. Soll Sonnenstrahl sein Wort brechen? Nein, er tut es nicht, er müßte sich sonst selbst verachten.«
»Dein Wort gilt nicht mehr, du hast nur noch der Stimme des Volkes zu gehorchen,« unterbrach ihn der. Alte streng. »Ich habe nicht geglaubt, bei dir auf solchen Widerstand zu stoßen. Warum gabst du mir deine Gesinnungen nicht schon früher zu erkennen? Ich hätte Maßregeln getroffen, sie auszurotten.«
»Wir sind nie mit denen zusammengekommen, welche du uns zu hassen gelehrt hast,« warf Waldblüte ein.
»Schweig!« herrschte Arahuaskar sie an, »Ihr brauchtet sie nicht zu sehen. Meine Schilderungen und die des alten Vaters mußten genügen, euch den Haß einzuimpfen, den ihr gegen sie hegen sollt. Doch ich bereue jetzt, nicht anders gehandelt zu haben. Ich hätte mir denken können, daß ihr, klug im Hören, aber unerfahren im Sehen, beim ersten Verkehr mit den Bleichgesichtern einen günstigen Eindruck von ihnen bekommen mußtet. Genau so ging es meinen Vorfahren, und das war der Grund, daß sie unterlagen. Leutselig kamen ihnen die ersten Spanier entgegen, sie versicherten sich ihrer Freundschaft, lehrten sie nützliche Sachen und zeigten ihnen, wie sie ihre Handwerkszeuge besser benutzen konnten und nicht mehr selbst den Pflug zu ziehen brauchten, sondern Pferde davorspannen mußten. Vertrauensvoll nahmen die Indianer die Fremdlinge in ihre Häuser auf, sie glaubten, die Götter wären auf die Erde herabgekommen und bei ihnen eingekehrt. Aber bald zeigte sich, wen sie aufgenommen hatten. Die unersättlichste Gier brach bei den Fremdlingen hervor, sobald sie den Reichtum ihrer Wirte an Gold bemerkten, und als erst einmal diese eine Sucht erregt worden war, kamen noch viele andere der scheußlichsten Art zum Vorschein. Sie begnügten sich nicht damit, durch allerlei unredliche Mittel in den Besitz der Schätze eurer Vorfahren zu kommen, sie raubten dieselben, nahmen sie fort, ohne erst zu fragen, und wurden sie von den Besitzern versteckt, so wurden diese auf die entsetzlichste Art gemartert, bis sie das Versteck angaben. Von wem haben die Indianer die Grausamkeit gelernt? Von den weißen Fremden. Die fremden Gäste haben ihre Weiber und Kinder geschändet, sie haben ...«
Sonnenstrahl machte eine abwehrende Handbewegung.
»Ich weiß es,« sagte er nachlässig, »der alte Vater hat es uns oft genug erzählt. Aber sag', Arahuaskar, wie kommt es, daß der alte Vater und die weiße Frau obgleich sie selbst Weiße sind, die Bleichgesichter hassen und sich auf die Seite der Indianer stellen?«
»Weil sie einsehen, daß diesen Indianern von den Fremden Unrecht geschieht, wie ihnen selbst von ihren eigenen Brüdern und Schwestern Leid zugefügt worden ist. Deshalb stellen sie sich auf unsere Seite, auch sie wollen, daß du als Häuptling die Krieger zum Kampf rufst. Der alte Vater hat dich erzogen, er weiß, daß du befähigt bist, die Indianer zum Siege zu führen. Wie oft hat er nicht gesagt, wir brauchten nur einen Führer, dem alle gehorchten, und wir müssen siegen, oder,« — Arahuaskar dämpfte seine Stimme zu einem Flüstern herab — »oder wir fallen alle.«
»Gut, du sagst also, auch ein Weißer kann sich gegen seinen Bruder erheben,« entgegnete Sonnenstrahl mit Nachdruck, »wenn ihm ein Unrecht zugefügt worden ist, was seine Rache herausfordert. Gibt es nun nicht Indianer, welche Grund haben, ihre Brüder zu hassen, also auf der Seite der Bleichgesichter gegen uns kämpfen?«
»Es kann solche Indianer geben. Falsche Lehrer haben ihnen gesagt, es brächte ihnen Ruhm, wenn sie ihren Brüdern die Skalpe nähmen. Die meisten sind jedoch schon eines Besseren belehrt worden, sie haben, unter sich den Tomahawk begraben und schwingen ihn nur noch gegen die Bleichgesichter.«
»Es kann aber auch noch andere Gründe geben, aus welchen ein Indianer den anderen haßt.«
»Es gibt keine. Sie alle müssen schweigen vor der Rache der Indianer gegen die Fremdlinge.«
»Warum bewacht denn jener Indianer in der Ruine unseren Schmalhand Tag und Nacht, damit er nicht entweicht? Warum spähst du nach einer Gelegenheit, ihn durch deine Diener den Händen jenes entreißen zu lassen? Warum hassest du den fremden Indianer und hast ihm den Tod geschworen?« fragte jetzt Sonnenstrahl direkt.
Arahuaskars Züge verfinsterten sich; seine Augen glühten unheimlich auf.
»Stahlherz ist kein Indianer mehr, er ist ein Verräter, denn er hält zu den Weißen. Sein Ohr ist unempfindlich gegen die Einflüsterungen, die ich ihm zukommen ließ. Er haßt uns, und darum hasse ich auch ihn. Er stirbt als erster unserer Feinde.«
»Warum haßt er uns?« fragte Waldblüte. »Ich habe ihn beobachtet, er gefällt mir.«
»Er muß uns hassen, die Weißen haben ihm Gift in die Adern gespritzt,« war die ausweichende Antwort.
»Er muß Schmalhand kennen, und dieser muß ihm etwas Böses zugefügt haben, sonst würde er ihn nicht so sorgsam pflegen, bis er sich so weit erholt hat, daß er die Marter ertragen kann.«
»Er wird ihn nicht martern,« entgegnete Arahuaskar höhnisch, »noch heute wird Schmalhand ihm entzogen werden. Mag er dann schäumen vor Wut. Auf dem Altar des Huitzilopochtli wird er seinen Feind um Erbarmen anbetteln, denn da er mit den Bleichgesichtern verkehrt, hat er auch verlernt, seinen Tod mit Gelassenheit zu ertragen.«
Eine lange Pause trat ein, jeder der drei war mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt.
»Auch einen unseres Stammes willst du opfern?« fragte dann Sonnenstrahl vorwurfsvoll.
»Stahlherz ist kein Indianer mehr; er schändet diesen Namen,« wiederholte Arahuaskar. »Huitzilopochtli wird wohlgefällig auf uns herabschauen, wenn das Blut dieses Verruchten vergossen wird.«
Die beiden Geschwister mußten schon zur Genüge darauf vorbereitet worden sein, daß in den nächsten Tagen, wahrscheinlich zur Feier ihrer Erhebung, Menschenopfer stattfinden sollten; sie zeigten weder Abscheu noch Schrecken darüber, gleichgültig hörten sie, wie Arahuaskar davon sprach.
»Das wäre erst einer, und du redetest von vielen Opfern; es müßten so viele Weiße geschlachtet werden, wie Häuptlinge hier zusammenkämen, und zwanzig sind schon eingetroffen. Woher willst du die Opfer bekommen? Ich sehe noch keine.«
»Sie werden zur rechten Zeit da sein. Für jeden Häuptling, ja, womöglich für jeden anwesenden Indianer, muß ein Mensch geschlachtet werden, denn das Herz des Opfers gibt ihnen Kraft und Mut, die Brüder der Geschlachteten können nicht einmal den Atem des Mundes ertragen, welcher das Herz gegessen hat.«
»Es mag sein, ich bin damit einverstanden, denn ich sehe ein, daß wir uns Huitzilopochtli günstig stimmen müssen, wollen wir siegen. Aber,« und Sonnenstrahl richtete sich hoch auf, »die Bleichgesichter, welche unsere Mauern bewohnen, bleiben verschont. Ich habe den beiden Mädchen versprochen, ich würde sie beschützen, und ich werde es auch tun. Kein Haar soll ihnen gekrümmt werden.«
»Tor!« rief Arahuaskar. »Sie werden von hier gehen und gegen uns kämpfen. Jetzt sind sie in unserer Hand.«
»Und ich halte mein Wort. Im offenen Kampfe will ich mich mit ihnen messen, so lange sie aber bei uns sind, sind sie meine Freunde. Schwöre mir, Arahuaskar, daß du sie schonen willst!«
»Und wenn ich es nicht tue?«
»Dann sieh dich nach einem anderen Häuptling um! Tritt du selber an die Spitze der Krieger und führe sie an,« lachte Sonnenstrahl höhnisch, »ich kann nicht mehr kämpfen, wenn ich mein Wort gebrochen habe; der Tomahawk ist mir dann zu schwer.«
Ueberlegend blickte Arahuaskar vor sich hin, dann flog ein schlauer Zug über sein runzliges Gesicht, doch unmerklich für Sonnenstrahl, wie für dessen Schwester.
»Es sei,« sagte er, »ich werde sie nicht opfern, aber meine Feinde bleiben sie doch.«
»Schwöre mir bei Huitzilopochtli, daß du sie ihm nicht opfern willst.«
»Ich schwöre beim allmächtigen Huitzilopochtli, ich werde sie nicht auf seinem Altar opfern. Sollte ich es aber doch tun, so will ich ihn niemals schauen, und er soll mich bis in alle Ewigkeit die Schmerzen des Marterpfahls schmecken lassen. Genügt dir dieser Schwur?«
»Er genügt mir,« sagte Sonnenstrahl freudig, und auch Waldblütes Auge leuchtete fröhlich auf. »Diesen Schwur wirst du halten. Wann sollen die Fremden die Ruine verlassen? Waldblüte wird ihrer weißen Freundin die Botschaft bringen, und sie werden ihr gehorchen.«
»Bis morgen abend müssen sie uns verlassen haben und weit genug entfernt sein, daß sie die Ruine nicht mehr sehen können, niemand darf sich mehr in der Nähe derselben aufhalten.«
»Ich werde dafür sorgen,« entgegnete Waldblüte.
»Und tun sie es nicht?« fragte Arahuaskar.
»So werden sie fortgescheucht, aber nicht mit Gewalt,« rief Sonnenstrahl. »Ihr Leben gehört so lange mir, bis der Krieg gegen alles, was weiß ist, begonnen hat.«
»Gut, so lange,« nickte Arahuaskar. »Nun schwöre auch du mir, daß du sofort, wenn du zum Oberhäuptling über alle Stämme erklärt worden bist und der Krieg aus dem Munde der versammelten Häuptlinge gebilligt worden ist, nichts schonen wirst, was feindlich gegen die Indianer gesinnt ist. Nichts soll dich dann mehr hindern, keine Freundschaft, keine Zuneigung, die Weißen zu töten und, wenn es Huitzilopochtli wünscht, sie auf seinem Altar sterben zu lassen.«
»Ich schwöre es bei Huitzilopochtli und bei allen Göttern,« sagte Sonnenstrahl feierlich.
»So werde ich die, welche du jetzt noch Freunde nennen darfst, ziehen lassen, und gehen sie nicht von selbst, sie durch meine Macht unverletzt davonjagen. Doch Stahlherz gehört schon jetzt mir. Ich muß Schmalhand wieder haben, und vermißt Stahlherz diesen, so bleibt er doch in der Ruine und forscht nach ihm. Deshalb werde ich mich seiner schon jetzt bemächtigen.«
»Stahlherz gehört dir.«
Sonnenstrahl nickte seiner Schwester zu.
»Gehe! Verkünde deinen weißen Freunden, daß sie die Ruine verlassen sollen. Ich werde über dir wachen, während du mit ihnen sprichst.«
Er und seine Schwester verbeugten sich tief vor Arahuaskar, aber ohne daß in dieser Bezeugung von Ehrfurcht wirklich solche zu lesen gewesen wäre. Sonnenstrahl legte die Hand an eine Stelle an der Wand. Diese schob sich plötzlich zur Seite und legte sich nach dem Hinausschreiten der beiden wieder in die Fugen, ohne durch eine Spur zu zeigen, daß hier ein Ausgang sei.
Als Arahuaskar allein war, änderte sich plötzlich sein bis jetzt ruhig gewesenes Gesicht. So alt und runzlig die Züge auch waren, noch immer konnten sich Haß und andere Leidenschaften darin abspiegeln. Jetzt verzerrten sie sich vor Haß und Hohn zu einer scheußlichen Fratze.
Er nahm den neben ihm liegenden Stock und fuchtelte damit in der Luft umher, fortwährend unverständliche Worte murmelnd.
Da kam ein schwarzer Gegenstand von irgendwoher geflattert, der zahme Rabe, der sich auf die Schulter des Greises setzen wollte.
»Arahuaskar, Arahuaskar,« krächzte er heiser.
Ein Stockhieb traf ihn.
»Huitzilopochtli,« kreischte er auf und verschwand wieder in der von Rauch verdunkelten Höhe.
»Ja, Huitzilopochtli,« sagte Arahuaskar mit grimmigem Lächeln. »Jetzt wird die Zeit kommen, da dein Name nicht nur beständig von den Raben gerufen wird; überall, wo sich die Zungen nur regen können, wird er bald erklingen, und deine Altäre werden sich von Blut röten. Wenn du die Nase in den aussteigenden Dämpfen des Blutes deiner Feinde vollsaugst, wirst du auch wieder gnädig auf uns herabblicken und unseren Waffen Sieg verleihen. Und meiner, allmächtiger Huitzilopochtli, wirst du dich auch erinnern, denn ich bin es, der deinen Namen wieder zu Ehren bringt. Vergiß mich nicht, Allmächtiger, und deine Altäre sollen von Blut triefen.«
Arahuaskar hatte sich in die Begeisterung hineingeredet. Mit strahlenden Augen blickte er in die Höhe, wo die Flammen blutigrote Bilder malten.
Dann huschte über sein Gesicht ein spöttisches Lächeln, doch die Ehrfurcht vor dem, mit welchem er sprach, unterdrückte es sofort wieder.
»Und auch du, Mexitli, wirst mit deinem Priester zufrieden sein. Auch dein Altar soll reichlich mit Blut besprengt werden, die Körper derer, die du hassest gleich mir, sollen auf deinem Altare im Todeskampfe zucken und sich winden.«
»Ja, das sollen sie,« sagte neben Arahuaskar ein Mann, der durch eine unsichtbare Tür auf der anderen Seite eingetreten war. »Diejenigen, die aus mir friedliebendem Menschen ein Raubtier gemacht haben, die mich vor aller Welt brandmarkten, sollen mein Ohr durch ihr Wehgeschrei ergötzen, daß sich die Götter daran werden können.«
Der alte Vater, wie er hier genannt wurde, war der Sprecher dieser Worte.
Wohl hatte er noch den freundlichen Blick der blauen Augen, der so entsetzlich gegen diese grausamen Worte abstach, aber sein übriges Gesicht drückte nur Haß aus, gepaart mit einer rücksichtslosen Energie, welche alles zu vernichten drohte, was ihn von dem Opfer seiner Rache trennte.
»Es ist gut, daß du kommst,« begrüßte ihn Arahuaskar, eine einladende Bewegung nach der Matte machend, auf welcher er saß. »Ich habe dich erwartet. Ist das weiße Mädchen zurück, von welchem du gesprochen hast?«
»Noch nicht, ich erwarte die Dame stündlich.«
»Dürfen wir ihr auch trauen? Ein Verräter könnte uns fürchterlich werden.«
»Sie ist treu. Auch sie hat Ursache, die zu hassen, welche wir hassen. Sie ist beredt und kennt die Indianer, wir werden von ihr vielen Nutzen haben.«
»Die Indianer, welche sie geworben hatte, werden von den Weißen verfolgt, die hier in der Ruine leben?«
»Nur einige folgen ihnen und auch dem weißen Mädchen, das sich bei jenen befindet.«
»Weißt du, daß alle Weißen bis morgen abend die Ruine verlassen haben müssen?«
»Sonnenstrahl sagte es mir vorhin.«
»Sprach er auch davon, daß er den Grund dazu gab?«
Der Alte zuckte die Achseln.
»Man muß ihnen nachgeben,« entgegnete er vorsichtig. »Es hängt jetzt alles davon ab, daß er die Rolle so spielt, die wir ihm beigebracht haben. Weigert er sich, so kann unser ganzes Bemühen fruchtlos gewesen sein, wir können die Versprechungen nicht halten, die wir den Indianern gegeben haben. Nur Sonnenstrahl ist die geeignete Person, die allen Anforderungen entspricht, jung, stark, kühn, und schier dasselbe gilt von Waldblüte.«
»Darum gab ich ihm nach.«
Der Weißkopf warf dem alten Indianer einen mißtrauischen Blick zu, er schien ihm nicht zu glauben.
»Und Schmalhand?« fragte er dann. »Wir müssen ihn aus den Händen von Stahlherz befreien. Wehe uns, wenn er uns verrät! Es ist schon schlimm genug, daß jener ihn erkannt hat, er bewacht ihn wie seinen Augapfel. Plaudert Schmalhand, so ist alles verloren. Wir können uns wohl retten, weil wir schon genug sind, aber erreichen können wir nichts mehr. Alles wird im Keime erstickt.«
»Schmalhand ist ein Diener Huitzilopochtlis,« entgegnete Arahuaskar stolz, »er kann sterben, ohne gesprochen zu haben. Es war nicht gut, daß du ihn jenem weißen Mädchen zur Verfügung stelltest, er wäre uns nicht verloren gegangen.«
»Es verlangte einen treuen Mann, und ich gab ihm Schmalhand. Dieser ist uns auch noch nicht verloren. Ich weiß sehr wohl, wie nützlich er uns sein kann.«
»Wie gedenkst du, ihn zu befreien?«
»Ich werde nachher den Versuch machen. Stahlherz ist immer allein in jener Kammer, er duldet nicht einmal, daß einer seiner Freunde hineinkommt, mit Ausnahme eines Mannes, seitdem unsere ersten Versuche, ihm Schmalhand abzunehmen, mißglückt sind. Die Diener wollten sich nicht dem Streiche seines Tomahawks aussetzen. Da Gewalt nichts zu nützen scheint, so werde ich nun eine List anwenden. Ich verspreche dir, daß Schmalhand noch heute abend wieder in unserer Mitte ist und,« fügte der Alte leise hinzu, »Stahlherz wahrscheinlich auch.«
Arahuaskars Augen leuchteten auf.
»Bestimmt?«
»Ich will es versuchen.«
Dem alten Indianer mußte viel daran liegen, Schmalhand und Stahlherz in seine Gewalt zu bekommen.
Ein höhnischer Gesichtsausdruck verzerrte seine an sich schon so häßlichen Züge.
»Die Gräber der Azteken sind gefüllt mit Leuten, die alle nicht mehr sprechen können,« sagte er. »Aber es ist noch Platz für mehr darin. Doch nein, Huitzilopochtli wird Wohlgefallen an dem Blute des Abtrünnigen haben.«
»Du willst ihn opfern?«
»Warum nicht?«
»Stahlherz ist ein Indianer.«
»Aber er hat das Herz eines Weißen.«
»Er ist allen Häuptlingen bekannt, die hier zusammenkommen.«
»Er ist von allen gehaßt.«
»Der Indianer achtet auch an dem Mut und Tapferkeit, den er haßt, und Stahlherz besitzt diese Tugenden.«
»So meinst du, Stahlherz sollte nicht geopfert werden?«
»Wenigstens nicht, daß die Häuptlinge darum wissen.«
Arahuaskar lachte höhnisch auf.
»Selbst Sonnenstrahl ist damit einverstanden. Hihihi« kicherte der Alte, »wenn er davon wüßte!«
»Wehe uns dann!« rief der Graukopf erschrocken.
»Sonnenstrahl ist erst halb auf unserer Seite. Er hat oft noch seine eigenen Ansichten, mit denen er durchdringen will, und diese sind nicht nur töricht, sondern oft sogar gefährlich. Ich bin manchmal besorgt.«
Auch der alte Vater blickte nachdenklich vor sich hin.
»Und doch ist er zu der Rolle, die er spielen soll, wie geschaffen.« sagte er dann. »Das erste muß sein, daß er die Macht voll zu spüren bekommt, über welche er verfügt. Eine Schilderung hilft nichts, er kann sie nicht fassen, aber die Wirklichkeit wird ihn berauschen, und dann wird er zu allem fähig sein.«
»Das hoffe auch ich,« entgegnete Arahuaskar, »und im Rausche seines Machtbewußtseins soll er tun, wodurch er nie wieder zurück kann.«
»Was wäre das?«
»Er opfert, wenn er zum Häuptling erhoben worden ist, mit eigener Hand Stahlherz.«
Wieder erschrak der Weiße.
»Und dann?«
»Dann erfährt er, wer Stahlherz gewesen ist.«
»Das kann uns gefährlich werden.«
»Nein, der Jüngling wird dann nichts mehr scheuen, es bleibt ihm dann nichts mehr übrig, als sich ganz dem Gotte hinzugeben und nur dafür zu sorgen, daß das Blut an dessen Altar nie zu stießen aufhört, nicht eher, als bis der letzte Weiße verblutet ist.«
Die Lippen fest zusammengepreßt, stand der alte Gelehrte lange Zeit regungslos da und blickte mit starrem Auge in das zuckende, dem Erlöschen nahe Feuer.
»Ich möchte,« begann er leise wieder, und seine Augen nahmen mit einem Male einen ganz anderen Ausdruck an, »Sonnenstrahl hätte ein weniger edles Herz. Früher habe ich mich darüber gefreut, ich habe versucht, es ihm zu erhalten, aber jetzt sehe ich, daß es uns zum Nachteil ist. Wir hätten gleich jede bessere Regung in ihm ersticken sollen, und vor allen Dingen hätte er nicht in beständiger Gesellschaft von Waldblüte auferzogen werden dürfen.«
»Bis jetzt hat uns dieses edle Herz noch nicht geschadet,« entgegnete Arahuaskar spöttisch, »er wird noch zu lenken sein.«
»Nein!« rief der Weiße und warf auf den Alten einen seltsamen Blick. »Fordert er nicht, daß die Fremden, welche so lange den Tempel Huitzilopochtlis entweiht haben, in Sicherheit abziehen, ehe ihnen durch die Indianer Gefahr droht? Er weiß noch gar nicht, daß es gerade die sind, die er einst rücksichtslos vernichten, jetzt aber schon bis aufs äußerste hassen soll. Er nennt sie Freunde, weil sie Freunde jenes Mädchens sind, welches er hilflos im Walde fand, und welches sein Mitleid gleich so erregte, daß er es in Schutz nahm und mich und dich zum Helfen zwang. Ja, er zwang uns dazu,« fuhr er erregt fort, als Arahuaskar mit dem Kopfe schüttelte. »Du hättest ihm schon damals nicht nachgeben sollen. Ich habe ihm gesagt, es seien jene Feinde, die sein Volk unglücklich gemacht hätten, er aber entgegnete, jetzt seien sie hilfsbedürftig und nicht seine Feinde. Wer hat ihm solche Gedanken eingegeben?«
»Glaubst du, ich?«
»Ich weiß, daß du ihm kein Mitleid beigebracht hast, aber doch bist du hauptsächlich daran schuld, weil du ihm stets nachgabst, und ich mußte mich dann natürlich auch stets fügen. Und die Folge davon ist nun, daß wir diese Fremden ruhig abziehen sehen müssen, während wir sie so sicher hatten. Bedenke, Arahuaskar, wie gnädig Huitzilopochtli unserer Sache sein würde, wenn diese verruchten Fremden, junge, schöne Männer und Mädchen, auf seinem Altar verbluteten.
Arahuaskar stützte sich auf seinen Stock und wandte seinen Kopf langsam dem Sprechenden zu.
»Sie sollen es auch.«
»Wie?« rief der Weiße erstaunt und erfreut zugleich. »Du willst sie opfern? Hast du nicht geschworen?«
»Ich habe geschworen!«
»Ah so, ich verstehe, du meinst, ein anderer soll sie opfern, aber nicht du. Hm, ein gewagtes Spiel! Sonnenstrahl wird damit nicht einverstanden sein.«
»Ich nehme die Verantwortung auf mich.«
»Du willst deinen Schwur brechen? Das darfst du auf keinen Fall.«
»Nein, ich breche ihn auch nicht. Ich habe bei Huitzilopochtli geschworen, die Fremden ihm nicht zu opfern, und das Versprechen muß ich halten. Aber in diesem Tempel standen auch einst die Altäre von Mexitil, des Dieners von Huitzilopochtli, und dieser wird für uns bei seinem Herrn bitten, wenn er eine so reiche Gabe erhält.«
»Wahrhaftig, Arahuaskar, so brichst du deinen Schwur nicht und betrügst Huitzilopochtli doch nicht. Aber,« fügte der Alte langsam hinzu, »Sonnenstrahl? Wird dieser auf diese Täuschung eingehen?«
»Er muß!« rief Arahuaskar mit Nachdruck.
»Er wird, wie immer, damit drohen, nicht auf unsere Pläne einzugehen, wenn seinem Willen nicht gefolgt wird.«
»So greife ich zu einer List.«
»Welcher Art ist diese?«
»Ich gestatte den Fremden den Abzug. Schon haben sie durch Waldblüte den Befehl dazu erhalten. Wollen sie doch nicht gehen, so mußt du selbst versuchen, sie durch Schreck davonzujagen. Dann ist Sonnenstrahl befriedigt. Die übrigen Tage nehmen ihn und Waldblüte mit Vorbereitungen vollkommen in Anspruch, er kann sich nicht um das kümmern, was draußen passiert, und diese Zeit benutze ich, die Fremden zu überwältigen und wieder hierher schleppen zu lassen. Uns stehen jetzt genug Indianer zur Verfügung, so daß dies ein leichtes sein soll. Sie werden einstweilen in Gräbern untergebracht, welche keinen anderen Ausgang haben, als den sichtbaren. Es gibt hier solche, welche noch nicht einmal Sonnenstrahl und Waldblüte kennen. Ihre Zugänge sind verschüttet, aber ich werde sie wieder aufgraben lassen. Ist Sonnenstrahl zum Häuptling erhoben, jubeln ihm alle zu. Hat er schon geopfert, so bemächtigt sich seiner ein wilder Taumel, man fordert noch mehr Opfer von ihm, und sei versichert, dann wird er nicht mehr zögern, die zu schlachten, welche er einst für seine Freunde hielt! Sie werden und müssen unter den Messern der Priester sterben.«
Mit angehaltenem Atem hatte der alte Mann dem Indianer gelauscht.
»Der Plan ist gut überlegt, so wird es gelingen, Sonnenstrahl den letzten Freundschaftsgedanken aus der Brust zu reißen. Hat er einmal das Blut von Weißen vergossen, dann wird er mit Würgen nicht einhalten, so lange er noch die Hand bewegen kann. Doch, was wird Waldblüte dazu sagen?«
»Was wir bei Sonnenstrahl durch Drohungen nicht erreichen konnten, wird uns bei ihr durch solche gelingen. Sie ist ein Weib und bleibt stets unter unserer Aufsicht. Wir sprechen ihr vor, was sie zu sagen hat, und Sonnenstrahl wird sich nicht mehr um sie kümmern, ist er erst Häuptling. Seine Neigungen werden sich dann ändern.«
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.