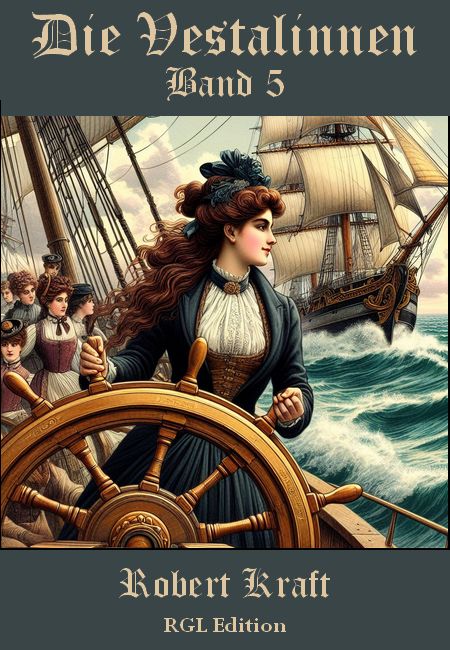
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.
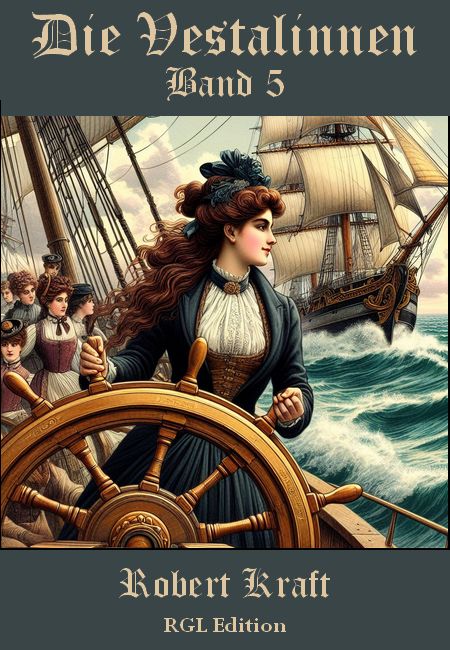
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software


"Die Vestalinnen," Illustierte Ausgabe, 1924

as Schicksal der über die Erde zerstreuten Chinesen gleicht fast dem der Juden. Wie diese, sind auch sie beständigen Verfolgungen und Willkürakten ausgesetzt, vor welchen keine Gesetze sie schützen können, ja, die Obrigkeit erlaubt oft genug, daß sie vom Volke gemißhandelt werden. Die Juden sind verhaßt, weil sie durch unsaubere Geschäfte Geld zu machen verstehen, welches sie anhäufen, den Chinesen verfolgt man, weil er billiger, als jeder andere Mensch arbeitet, ungeheuer sparsam ist und es stets zum Wohlstand bringt, während um ihn herum die zivilisierten Arbeiter durch Faulheit, Trunk, Spiel und andere Laster langsam untergehen oder sich doch nie aus ihrer armseligen Lage heraushelfen können.
Das Volk ist so leicht zu lenken! Ein redebegabter Mensch braucht nur mit Verheißungen um sich zu werfen, die Frage aufzustellen, mit welchem Rechte der Fremdling dem Einheimischen die Arbeit nimmt, und die Brandfackel lodert sofort auf, wenn nicht von anderer Seite Maßregeln getroffen werden, sie zu ersticken.
Was haben die Chinesen in Kalifornien nicht auszustehen gehabt! Fürwahr, die Judenverfolgungen in Rußland weisen nicht solche Greuelszenen auf wie jene Zeiten, da man sich bemühte, die Chinesen in Kalifornien auszurotten. Man hat sie getötet, gemartert, geschändet, ihnen alles, selbst das Hemd weggenommen, aber kaum hatte sich die Wut der kalifornischen Bevölkerung etwas gelegt, so tauchten die bezopften Männer schon wieder auf und begannen mit ungeschwächter Kraft ihre alte Arbeit, und soviel man ihnen auch genommen hatte, flossen ihnen doch aus unbekannten Hilfsquellen reichliche Geldmittel zu, mittels welcher die Nackten sich kleideten, die Hungrigen sich sättigten, und die ihnen die Möglichkeit verschafften, bald wieder wohlhabend zu werden.
So war auch die Bevölkerung von San Francisco, der Hauptstadt Kaliforniens, von einem wahren Wahnsinn befallen worden, der sich gegen alles richtete, was einen Zopf trug und gelbe Hautfarbe und Schlitzaugen hatte.
Ein Straßenjunge hatte die Veranlassung zu dieser Menschenschlächterei gegeben.
Jeden Morgen, noch vor Anbruch des Tages, fuhr ein kleiner Chinesenjunge in San Francisco einen Milchwagen in einem Viertel der Stadt von Haus zu Haus und sorgte dafür, daß die Hausfrau beim Aufstehen stets den gefüllten Milchtopf vor der Tür fand. Als der Chinese einmal, um seine Pflicht zu erfüllen, durch einen langen Hausflur gegangen war, sah er beim Zurückkommen, wie ein Straßenjunge eben mit vollen Zügen aus einer seiner Milchkannen schlürfte.
Das hätte wohl keiner gelitten, ob er Christ oder Heide war, und dem Chinesen war die Milch nicht zu reichlich zugemessen worden. Lief Beschwerde von den Kunden ein, daß sie nicht richtig bedient worden waren, so ward er entlassen.
Er hinderte den Jungen natürlich am Trinken und mochte ihn dabei wohl zu fest am Genick gepackt haben, kurz, der Bengel fühlte sich in seiner Ehre gekränkt, von einem Chinesen tätlich angefaßt zu sein. Der kräftige, kalifornische Junge prügelte den schwächlichen chinesischen Knaben windelweich und warf dann dessen sämtliche Kannen vom Wagen, so daß die Milch in den Rinnstein lief.

Als der Chinese gewahrte, daß der Junge ihm die
Milch wegtrank, packte er denselben im Genick.
Aber die Nemesis ließ nicht lange auf sich warten. Sie kam in Gestalt eines erwachsenen Chinesen, der seinen Landsmann in Schutz nahm und nun seinerseits dem Uebeltäter eine ordentliche Lektion zuteil werden ließ.
Fluchend rannte der zwölfjährige Knabe davon, er wußte, wo er am besten Beschwerde anbringen konnte.
Daß er die ganze Nacht im Freien gelegen, kam nämlich daher, daß sein Vater am Tage die Wohnung hatte verlassen müssen. Derselbe kümmerte sich nicht um sein Kind; als er so alt war, wie dieses, hatte er auch für sich allein sorgen müssen, und um sich von der ihm angetanen Schmach zu erholen und sich ordentlich ausschimpfen zu können, hatte er kurz alles verkauft, was noch begehrenswert war und sich dann in eine Schenke verfügt, wo er das letzte Geld durchbringen wollte.
Dort fand ihn sein Sohn, wo er mit einigen Kameraden eine wilde Orgie feierte.
Der blutende Junge fand anfangs keine große Teilnahme; kaum hatte er aber gesagt, er wäre von einem Chinesen geschlagen worden, so brach der Aufruhr los.
In ganz San Francisco herrschte ein allgemeiner Unwille gegen die Chinesen, und es brauchte nur eines Funkens, so mußte das Pulvermagazin explodieren. Dieser Funke war jetzt gefallen.
Die Nachtschwärmer begannen die Metzelei an den ersten Chinesen, denen sie begegneten, und mit Zauberschnelle fanden sie Anhänger, bis sie zu einer Armee angeschwollen waren, die sengend, mordend, und vor allen Dingen raubend durch die Straßen von San Francisco zog. Alle Wut, die gegen die bezopften Arbeiter schon lange in den Männern gährte, kam nun mit einem Male fürchterlich zum Ausbruch. Wer sonst kein Vorurteil hegte, wurde von der allgemeinen Erregung mit fortgerissen, und Unzählige schwangen nur darum die Brandfackel, um sich der Güter zu bemächtigen, welche, ihrer Meinung nach die Chinesen sich auf unrechtmäßige Weise erworben hatten.
Zündende Reden, Flugblätter, ja selbst die Zeitungen bewirkten, daß diese Wut der Menschenschlächter tagelang andauerte.
In San Francisco gibt es auch recht ansehnliche Geschäfte, die sich in chinesischen Händen befinden, Weltgeschäfte sogar, deren Inhaber Millionäre sind, und gegen diese Häuser wurde der erste Sturm gerichtet, hoffte man doch dort auf die reichste Beute.
Aber wunderbarerweise waren die Besitzer alle schon unter Mitnahme ihrer baren Schätze geflohen. Die Unmenschen fanden nur Waren vor, mit denen sie sich bereichern konnten, die erhofften Geldkisten aber waren verschwunden, ebenso spurlos wie die Eigentümer selbst.
Diese Entdeckung hatte zur Folge, daß man mit den vorgefundenen Chinesen, Dienern, Arbeitern und Kleinkaufleuten um so grausamer verfuhr. Doch die Hoffnung, aus ihnen Schätze herauszupressen, war vergeblich, in ganz San Francisco wurden bei den Chinesen nur wenige Dollar gefunden, und doch befand sich gerade in ihren Händen das meiste Geld der Stadt, um so mehr, als der Chinese das Geld fast nie auf eine Bank trägt, sondern stets bei sich liegen hat.
Die Wut der Geprellten stieg ins Grenzenlose. Doch es half ihnen nichts, man fand kein Geld, und die gemarterten Chinesen konnten nur aussagen, daß man einen Aufstand gefürchtet hätte, daß die großen Kaufleute, ihre Führer, ihnen das Geld abgenommen und sich dann rechtzeitig mit großen Summen gerettet hätten. Jedenfalls sollten alle, die mit dem Leben davonkamen, ihr Vermögen später wieder irgendwo ausbezahlt bekommen. Aber was half dies der Volksmenge jetzt? Gleich, gleich wollte sie genug Geld haben, um sich in Branntwein berauschen zu können.
Wan Li, hieß der Chinese, welcher die Unruhen in San Francisco scharf beobachtet hatte, und welcher so schlau war, daß er, noch ehe die erste Untat vorkam, das Signal zur Flucht gab. Die Chinesen, welche nicht fliehen wollten, waren ebenfalls schon vorbereitet, sie gaben ihre Ersparnisse hauptsächlich ihm.
Im Auslande hängen die Chinesen wie Kletten zusammen, im Falle der Gefahr doppelt fest, und obwohl sie sich sonst nur zu gern betrügen sind sie dann mit einem Male ohne jedes Mißtrauen gegeneinander.
Willig lieferten sie die Gelder an Wan Li aus, und dieser sagte ihnen, wo sie dieselben später wieder erheben könnten.
Wan Li besaß eine große Konfektfabrik, welche ganz Amerika mit Süßigkeiten aller Art versorgte. Der dicke Chinese mit dem schlau lächelnden Gesicht war sowohl ein ausgezeichneter Kaufmann, der sein Geschäft täglich wachsen sah, als auch ein großer Philosoph, der seine Ansichten und Lehren gern in der Welt verbreiten wollte. Jedes seiner Bonbons war in ein Papier gewickelt, auf welchem ein weiser Spruch stand, und vielleicht mochte der menschenfreundliche Chinese schon manches Herz eines seine Bonbons verzehrenden Mannes, Weibes, Mädchens oder Kindes dadurch erfreut und getröstet haben.
Man stürmte noch einmal nach der Fabrik, konnte seine Wut aber nur an unschuldigen Zuckerhüten auslassen, und sich die Taschen mit bunten Bonbons füllen, das Geld war mit Wan Li verschwunden.
Es hieß, Wan Li sei allein geflohen, das heißt, ohne Begleitung von anderen Chinesen, wohl aber habe sich ein Mann, ein Europäer, bei ihm befunden, der vor einigen Wochen in das Haus des Chinesen gekommen und von diesem gastfreundlich aufgenommen worden wäre.
An Verfolgung wurde nicht gedacht, das Volk beruhigte sich ebenso schnell wieder wie es ausgestanden. Vor allen Dingen folgt es dem, der mit mächtiger Beredsamkeit zu ihm spricht, und jetzt eilten von allen Seiten Männer herbei, um es wieder zum Gehorsam zu bringen. — — —
Mitten in der Wildnis hielten zwei Reiter und besprachen sich, welche Richtung sie einschlagen müßten, um in die Nähe von Menschen zu kommen, zugleich aber auch, um größere Ansiedelungen zu vermeiden.
Das Gespräch wurde auf englisch geführt, obgleich der eine von den beiden ein Chinese war, ein kleiner, dicker Mann mit schlau lächelndem Gesicht, in blauer Bluse aus Seide und weiten Beinkleidern aus demselben Stoff. Der lange Zopf war unter der Mütze verborgen. Hätte aber nicht schon die Kleidung den Mann als Chinesen charakterisiert, das ganze eigenartige Gesicht mit den Schlitzaugen mußte es doch tun.
Der Chinese ritt ein Maultier, führte kein Gepäck und keine Waffen, während sein Begleiter, ein Europäer, seinem Rappen einen großen Packen aufgeschnallt hatte, im Gürtel Pistolen trug und außerdem noch an der Seite einen mächtigen Pallasch herabhängen hatte.
Der Säbel sah fast aus wie ein zweihändiges Ritterschwert. Man konnte kaum glauben, daß ein Arm ihn zu regieren vermöchte, aber der Mann war sehr stark gebaut und strotzte von Muskeln.
Wan Li war es und dessen Begleiter, der ihm bei der Flucht behilflich war.
Der Große hatte vor sich auf dem Sattel einen Kompaß liegen, welcher als Wegweiser dienen mußte, denn beide schienen in der Wildnis nicht zu Hause zu sein. Wan Li war Kaufmann; seinen Begleiter konnte man ebensogut für einen Stadtbewohner, vielleicht auch für einen wohlhabenden Bauern halten, aber in den Wald gehörte er jedenfalls nicht, auch seine Haltung zu Pferde zeigte, daß er sich nicht sicher darauf fühlte.
»Mehr rechts, Wan Li,« sagte er jetzt, »wir können nicht mehr weitab sein von der kleinen Ansiedelung, wohin wir empfohlen worden sind, dort wird unsere beschwerliche Wanderung ein Ende haben, dort sind wir in Sicherheit.«
»Wir sind überall in Sicherheit,« entgegnete der Chinese, »oder auch überall in Gefahr. Aus der Stadt, wo wir uns hinter starken Mauern sicher fühlten, sind wir in den Wald geflohen, der uns sonst als ein Schreckensort galt.«
»Wir haben bisher Glück gehabt, der Wald hat uns gastfreundlich aufgenommen.«
»Die Natur ist stets freundlich, die Menschen machen sie erst schrecklich.«
Der Begleiter wollte schon eine Antwort geben, als er plötzlich sein Roß zügelte und, sich weit über den Hals des Tieres vorbeugend, aufmerksam lauschte.
»Schüsse,« flüsterte er dann. »Höre, Wan Li! Kannst du sie vernehmen?«
»Ich höre sie,« war die gleichmütige Antwort. »Es sind keine Jäger, es scheinen Revolver abgeschossen zu werden, und zwar schnell hintereinander.«
Der Große sah nach seinem Pallasch, zog den Stahl etwas hervor und stieß ihn wieder zurück.
»Es findet ein Kampf statt,« sagte er.
»So wollen wir ihn vermeiden. Laß uns einen Umweg machen. Wir haben keinen Grund, uns in andere Angelegenheiten zu mischen, vielmehr alle Ursache, jedem aus dem Wege zu gehen, der Waffen trägt.«
Sie bogen etwas von der Richtung ab und ritten so schnell, als der schlechte Weg es erlaubte. Entweder mußten sie sich direkt von dein Orte entfernen, wo der Kampf stattfand, oder dieser war schon beendet, denn man hörte keine Schüsse mehr.
Da nahm wieder der Chinese das Wort.
»Müssen wir nicht bald jenen Hohlweg erreichen, von dem mein Freund auf der letzten Plantage uns erzählte?« sagte er.
»Ich glaube auch, er kann nicht weit sein. Hast du die Absicht, ihn zu benutzen?«
»Ich möchte ihn erst sehen. Ist er so beschaffen, daß man ihn jederzeit verlassen kann, so würde ich ihn benutzen, damit unsere Tiere ausgreifen können. Ist ein Ausweichen in demselben nicht möglich, so ziehe ich den Weg durch den dichten Wald vor. Noch möchte ich nicht gesehen werden.«
»Ich glaube, deine Vorsicht geht zu weit. Wir sind schon lange in Texas, und dieses ist doch, wie wir oft genug haben erzählen hören, der einzige Staat, in welchem keine Chinesenverfolgungen stattfinden werden.«
»Wohl wahr, doch will ich mich erst überzeugen, ob das auf Wahrheit beruht. Es ist schon lange her, seitdem wir dies gehört haben, und unterdes können Veränderungen eingetreten sein. Laß uns versuchen, den Hohlweg zu finden. Benutzen wir ihn, so werden wir bald zu Ansiedelungen gelangen.«
Schweigend setzten die Reiter ihren Weg fort, jeder mit seinen Gedanken beschäftigt. Der Chinese ließ nur ab und zu die kleinen Schlitzaugen schnell von Baum zu Baum fliegen, wenn er aus seinen Träumereien erwachte, und dann lächelte er stets vergnügt, sein großer Begleiter dagegen blickte mit den blauen Augen stets geradeaus, man wußte nicht, ob er überhaupt wachsam war.
Doch er schien es zu sein, denn plötzlich sagte er:
»Der Wald hört dort auf; wir kommen an eine große Lichtung. Umgehen wir sie?«
Der Chinese blickte scharf geradeaus und schüttelte dann den Kopf.
»Bäume fehlen dort allerdings,« entgegnete er, »aber mich dünkt fast, es öffnete sich vor uns ein jäh abfallendes Tal.«
»Dann könnte es der Hohlweg sein!« rief der Weiße.
Sie ritten so schnell wie möglich dem Orte zu, wo der Wald in dem Boden zu verschwinden schien und sahen, daß der Chinese recht gehabt hatte.
Das Terrain fiel plötzlich ab, bildete eine Art Schlucht, und stieg zehn Meter entfernt wieder empor. So weit man auch blickte, überall tat sich der Abgrund auf, der sich in Krümmungen links und rechts hinzog. Das Tal war unten flach und gestattete ein bequemes Vorwärtskommen, die Tiefe aber war eine ganz beträchtliche, ein Sprung hinab war todbringend, und ebenso war ein Erklettern des Abhanges gar nicht möglich, so glatt fielen die Wände ab.
Der Wald trat bis dicht an den Rand der Schlucht heran und setzte sich auf der anderen Seite derselben wieder fort.
Dies war der Hohlweg, den die beiden gesucht hatten. Er glich wirklich einer ausgetretenen Landstraße. Wer in dergleichen Sachen Erfahrung hatte, sah auf den ersten Blick, daß man das Bett eines Flusses vor sich hatte, der durch irgend ein Spiel des Zufalls ausgetrocknet, oder dessen Wasser einen anderen, bequemeren Weg gefunden hatte, etwa einen unterirdischen, wie man dies so häufig beobachten kann.
Daß hier einst Wasser gerauscht hatte, erkannte man besonders an den runden, abgeschliffenen Steinen, die überall zerstreut umherlagen.
Die Reisenden konnten den Hohlweg noch nicht vollkommen überblicken, das schwarze Roß witterte mit dem feinen Instinkte seiner Rasse eine Tiefe, der sich zu nähern unter Umständen gefährlich werden konnte, es wollte nicht vorwärts, und der Reiter mußte, wollte er den Weg überschauen, absteigen. Er tat es, band das Pferd an einen Baum und schritt dem Abgrunde zu.
Des Chinesen Maultier war weniger furchtsam, es war derartige Wege gewohnt, aber sein Herr war vorsichtig. Wie leicht konnte der mit Moos bewachsene Boden, obwohl fest und sicher aussehend, unter dem schweren Tritte nachgeben und hinabrollen, Tier und Reiter unter sich begrabend. Der Mann allein hatte dagegen nichts derartiges zu befürchten, wenn er sich vorsichtig bewegte.
Also stieg auch er ab und schritt mit dein Begleiter dem Rande der Schlucht zu.
Sie konnten erkennen, wie richtig die Vorsicht des Chinesen war. Drüben auf der anderen Seite hing der gras- und moosbewachsene Boden weit über dem Abgrund vor, jedem eine verderbliche Falle stellend, der sich zu weit vorwagte.
»Wir dürfen nicht weiter,« sagte der Europäer, anscheinend ein Nordländer, vielleicht sogar, seinem Gesichtsausdruck nach, ein Deutscher, »der Boden kann nachgeben und mit uns hinabstürzen.«
Der Chinese hatte sich schon auf die Erde gelegt und brachte aus seiner faltigen Bluse einen Dolch zum Vorschein.
»Ich glaube fast,« sagte er mit pfiffigem Lächeln, »hier befinden wir uns doch auf einem anderen Boden. Sieh, mein Freund, dicht am Rande wachsen sonst keine Bäume, sondern nur leichte Büsche, deren Wurzeln das Erdreich halten. Hier dagegen erhebt sich dicht am Abgrund ein starker Baum. Wäre der Boden unter ihm hohl, so müßte er bald hinabstürzen, meinst du nicht auch?«
»Die Wurzeln können ihn halten,« entgegnete sein Begleiter, den Baum, der wirklich ganz vereinzelt, dicht am Rande stand, mißtrauisch betrachtend.
Der Chinese senkte mehrmals den Dolch in das Erdreich hinab und stieß dabei auf großen Widerstand. Der Boden mußte also steinig oder von vielen Wurzeln durchzogen sein.
»Nun, wenn die Wurzeln den Baum halten können, so werden sie auch uns tragen,« sagte der Chinese wieder und kroch langsam vorwärts, um sich einen Blick in den Hohlweg zu verschaffen.
Sein Begleiter warf sich ebenfalls nieder und bewegte sich an des Chinesen Seite vorwärts. Dicht am Abhange blieben beide liegen und betrachteten nun den Weg, überlegend, ob sie denselben benutzen sollten oder nicht. Der Chinese war nicht gesonnen, ihn zu betreten. Erstens war es schwer, die Pferde hinunterzuschaffen, man mußte vor allen Dingen einen Abstieg suchen, und dann konnte man diesen Hohlweg nicht sofort wieder verlassen, wenn man jemandem ausweichen wollte.
Die Männer lagen noch im Dickicht versteckt, wenn sie sich aber vorbogen, so konnten sie sehen, daß auch der Ort, wo sie lagen, ganz unterhöhlt war. Nur die Wurzeln des Baumes hielten das vorspringende Erdreich fest.
Noch besprachen sie, ob sie einen Abstieg suchen wollten. Der Chinese ließ die Augen eben musternd zur linken Seite hingleiten, als ihn sein Begleiter plötzlich am Arm packte und einen zischenden Warnungslaut ertönen ließ. Mit der anderen Hand griff er nach den Pistolen im Gürtel.
Der Hohlweg machte nicht weit von dem Platze, wo sie versteckt lagen, eine starke Biegung, und soeben tauchten hinter dieser einige Indianer auf. Sie waren zu Fuß, vollständig bewaffnet und traten vorsichtig, aber ohne Scheu zu zeigen, hervor. Jedenfalls hatten sie sich erst auf ihre Weise überzeugt, daß der Weg frei war, denn sie bewegten sich schnell vorwärts, sich dabei immer dicht an der einen Wand haltend.
Es waren vier Indianer im vollen Kriegsschmuck.
»Spione,« flüsterte der Chinese.
Sie zogen die Köpfe noch mehr zurück, um nicht entdeckt zu werden, ließen aber die Indianer nicht aus den Augen.
Diese schritten schnell bis zur nächsten Biegung. Dort warfen sie sich an die Erde, schmiegten sich noch dichter als zuvor an die Wand und krochen nur bis zur Ecke, um welche sie vorsichtig spähten, ob der weitere Weg ihnen keine Gefahr böte.
Dann waren sie verschwunden.
»Was wollen diese?« fragte der Weiße verwundert. »Es sieht fast aus, als würde ihnen ein größerer Trupp bald folgen. Sie benehmen sich mit einer solchen Hast. Entweder werden sie verfolgt, oder sie sind Vorläufer eines starken Zuges.«

»Das letztere ist auch meine Meinung,« stimmte Wan Li bei, »wir wollen noch ein wenig hier liegen bleiben. Sind wir von diesen Spionen unbemerkt geblieben, so werden uns auch die Nachkommenden nicht entdecken. Es ist immer besser, wenn man eine drohende Gefahr im vollen Umfange erkennt, als wenn man sich vor ihr versteckt, ohne sie gesehen zu haben.«
»Aber warum mögen sie sich nur in diesem Hohlweg für so sicher halten?« meinte sein Begleiter.
»Sie bewegten sich nur an der Wand entlang,« antwortete der Chinese, »und dort können sie allerdings nicht gesehen werden. Sie glaubten gewiß, wie wir vorhin wähnten, daß man sich dem Abgrund nicht nähern kann, ohne hinabzustürzen. Wir haben den besten Platz gefunden, wo man sicher den Hohlweg überschauen kann.«
Sie brauchten nicht lange zu warten, so fanden sie ihre Vermutung bestätigt.
Um jene Biegung, hinter welcher vorhin schon die vier Indianer aufgetaucht waren, kamen jetzt noch mehr, ein ganzer Trupp, ganz sorglos, die ersten zu Pferd, zum Vorschein. Ohne besonders scharf voraus oder in die Höhe zu spähen, ritten und gingen die ersten in ziemlich schnellem Tempo voraus, dann kamen andere Männer nach, durch deren Anblick die beiden Beobachte in keine geringe Erregung versetzt wurden.
Es waren Weiße, wenigstens vierzig Mann, welche mit auf den Rücken gebundenen Händen zwischen den Indianern schritten. Die Entfernung war noch eine sehr große, aber schon konnten die beiden Beobachter sehen, daß sie roh behandelt wurden. Die neben ihnen gehenden Indianer versäumten keine Gelegenheit, ihnen Püffe, Stöße, ja, sogar Fußtritte beizubringen. Dann erkannten sie auch, daß unter ihnen einige Weiber waren, aber höchstens vier oder fünf.
»Es sind deine Landsleute,« flüsterte Wan Li, »sie sind von den Indianern gefangen genommen worden.«
Finster zuckte der Angeredete die Achseln.
»Ich kann ihnen nicht helfen und würde es auch nicht tun, wenn ich könnte,« antwortete er, »sehr wahrscheinlich sind die Indianer im Recht, wenn sie die Fremden gefangen genommen haben.«
»Ich kenne deine Ansichten, sie sind andere als die meinen, wir haben oft genug darüber gesprochen und gestritten. So gern ich jenen aber auch helfen möchte, ich darf es nicht tun. Ich bin es meinen Landsleuten schuldig, daß ich in Sicherheit komme. Tausende von Chinesen hoffen, daß ich am Leben bleibe, um ihnen später das wieder zurückzugeben, was sie mir anvertraut haben.«
»Ich weiß,« sagte der Große, denn die Indianer waren noch weit ab, »wir wollen den Trupp ruhig vorüberziehen lassen und uns dann aus dieser Gegend entfernen, wo ein Zusammenstoß zwischen Indianern und Weißen vorgefallen zu sein scheint. Leicht können wir mit Versprengten zusammentreffen und in einen Kampf verwickelt werden.«
Sie fuhren fort, die sich Nähernden mit scharfen Augen zu betrachten. Dem Chinesen fiel zuerst etwas auf, was er in flüsterndem Tone seinem Begleiter mitteilte.
»Was für sonderbare Männer sind das? Einige von ihnen haben langes, hellblondes Haar, sie gleichen eher ... Wahrhaftig,« unterbrach sich Wan Li, »es sind Weiber wie Männer gekleidet. Ist es nicht so?«
Er sah bei diesen Worten den neben ihm Liegenden an. Diesem wich plötzlich alle Farbe aus dem Gesicht, er wurde aschfahl, und hörbar knirschten die Zähne aufeinander.
»Wan Li,« hauchte er mit bebender Stimme, »es ist keine Täuschung, sie sind es, von denen ich dir erzählt habe. Es sind die Engländer von dem ›Amor‹ und die amerikanischen Damen von der ›Vesta‹. Ich weiß, sie halten sich bereits in Amerika auf. Sie sind in die Hände der Indianer geraten.«
Der Chinese legte ihm eine Hand auf den Arm, der eine Bewegung nach den Pistolen im Gürtel machte.
»Wir dürfen keinen Versuch zu ihrer Befreiung machen,« zischte er zwischen den Zähnen hindurch.
Schlaff ließ der andere die Hand sinken.
»Ich wollte dies auch nicht,« murmelte er, »den Indianern sollte meine Kugel nicht gelten.«
Der Chinese sah ihn groß an.
»Das war nicht edel von dir gesprochen,« sagte er vorwurfsvoll, »so hassest du sie noch immer?«
»Ja.«
»Ich glaubte, infolge meiner Lehren hattest du deinen Haß vergessen. Was nutzt er dir?«
»So willst du ihnen helfen?«
»Ich? Nein, ich kann es nicht. Erst muß ich das ausgeführt haben, was mir meine Pflicht vorschreibt. Und auch dann würde ich mir noch überlegen, ob ich etwas zur Rettung jener tun könnte. Es sind hundert Indianer gegen uns zwei Mann. Erst müßten wir versuchen, die Gefangenen zu befreien, und das erfordert viel List.«
»Bah,« murmelte der Weiße verächtlich, »würde ich deinen Ratschlägen nicht folgen, bei Gott, es wäre mir ein leichtes, dieses rothäutige Gesindel zu Paaren zu treiben! Noch habe ich mein altes Handwerk nicht verlernt. Aber ich werde mich hüten, in die Justiz der Indianer einzugreifen, sie könnten im Recht sein.«
Jetzt befand sich der Zug fast unter ihnen. Sie konnten deutlich die Indianer, wie auch die Gefangenen sehen.
Es mußte keinen großen Kampf gekostet haben, sich der letzteren zu bemächtigen, denn weder die Gefangenen, noch die Indianer zeigten Verletzungen, einige unbedeutende Schrammen ausgenommen.
Kaum sah man hier und da Blutflecke. Jedenfalls waren die Weißen durch eine List in einen Hinterhalt gelockt und von der Uebermacht ohne Anwendung von besonderer Gewalt überwältigt worden.
Die Gesichter der Weißen drückten Niedergeschlagenheit aus, besonders die der Mädchen, aber einige von ihnen schritten auch erhobenen Hauptes zwischen ihren Wächtern und nahmen alle Mißhandlungen hin, ohne auch nur eine Miene zu vergehen. Die Männer zeigten fast alle finstere Stirnen und drohende Augen, wären ihre Hände nicht so fest geschnürt gewesen, sie hätten wohl auch ohne Waffen den Kampf gegen die Indianer erneut, sie wären wie Raubtiere mit Zähnen und Nägeln über die Unholde hergefallen.
»Alle?« fragte der Chinese fast unhörbar.
Der andere schüttelte den Kopf.
»Einen vermisse ich bestimmt, den Führer der Männer. Doch mögen außer ihm noch andere fehlen, früher waren es mehr.«
Schnell zog der Trupp vorüber, ohne daß die Anwesenheit der beiden Versteckten gemerkt wurde. Nach zehn Minuten zogen die Indianer um die nächste Felsecke. Die beiden sahen noch, wie ein Mädchen, welches sich einmal umblickte, von dem neben ihr gehenden Indianer hart geschlagen wurde, dann waren sie verschwunden.
Schon wollten sich die beiden erheben, um zu den Pferden zurückzugehen, und die Reise fortzusetzen, als eine neue Erscheinung sie an dem Boden festbannte.
Auf der anderen Seite der Schlucht, ihnen gerade gegenüber, bewegten sich die Zweige, und, dicht auf den Boden geschmiegt, huschte ein Mann hervor. Seine Züge waren verstört, eine tiefe Wunde zog sich über die Stirn hin, und langsam sickerte ein Blutstropfen nach dem anderen über die bleichen Wangen.
In der Hand trug er ein langes, entblößtes Bowiemesser, um dessen Griff sich die Finger krampfhaft spannten, seine einzige Waffe.
Schon hatte er die Büsche verlassen und wollte sich dicht bis an den Abgrund begeben, als der Boden plötzlich unter ihm zu schwanken begann. Schon stürzten losgelöste Erdteile hinab, und es hätte nur noch einer Sekunde bedurft, so hätte der Mann durch sein Gewicht das Erdreich zum Absturz gebracht. Aber ehe dies noch eintrat, hatte er schon seine Lage erkannt und schnellte wie eine Feder zurück.
Dann sah er an der gegenüberliegenden Seite, wie der Boden überall über die Schlucht hervorsprang und so dem unvorsichtigen Fuße eine Falle stellte. Der Mann probierte, ob das Erdreich da, wo er sich jetzt befand, unter ihm hielte, und als er sich davon überzeugt hatte, klammerte er sich mit der Hand an die Zweige eines Busches und beugte seinen Oberkörper so weit als möglich vor, nach der Seite des Hohlweges spähend, von welcher vorhin die Indianer mit den Gefangenen gekommen waren.
Die beiden konnten von ihm nicht gesehen werden, sie lagen hinter den Wurzeln des Baumes.
»Er gehört zu den Weißen,« flüsterte Wan Li, »er ist den Indianern entkommen. Kennst du ihn?«
Der andere schüttelte den Kopf mit den kurzen Locken.
»Es scheint fast, als ob er noch jemanden erwarte,« fuhr der Chinese fort.
»Und zwar, als ob noch andere Gefangene kämen, deren Befreiung er vorhabe,« ergänzte der Begleiter.
»So sieht es fast aus. Einige mögen den Indianern entflohen sein, dieser Mann glaubt oder weiß, daß sie nachträglich gefangen worden sind, sie müssen hier durchkommen, und er will sie nun befreien. Wahrhaftig, das ist edel von ihm. Er besitzt allem Anschein nach nur ein Messer und will er damit die indianischen Wächter angreifen, so verrät dies eine große Kühnheit. Doch komm, mein Freund, wir wollen hier nicht länger liegen! Laß uns vorsichtig aufstehen und zu den Tieren zurückkehren. So gern ich auch des Fremden Handeln weiter zusehen möchte, ich darf es nicht, weil meine Person in Gefahr kommen kann.«
Doch der andere hörte ihn nicht, seine Augen hatten mit einem Male einen seltsamen Ausdruck bekommen. Er zog seine Pistole aus dem Gürtel, legte diese vor sich hin und fügte ihr auch noch einen Revolver bei.
»Was hast du vor?« fragte der Chinese erschrocken.
Der Große nickte mit dem Kopfe nach jener Biegung, wo wieder einige Gestalten zum Vorschein kamen.
»Den will ich retten, der mich dem Leben wiedergegeben hat,« entgegnete er. »Siehst du dort den Mann, der zuerst kommt? Das ist der, von welchem ich dir so viel erzählt habe.«
Die Engländer und die Mädchen, sowie auch die sie begleitenden Trapper waren abermals in die Gewalt von Indianern gefallen. Beim Passieren des Hohlweges stürzten plötzlich von allen Seiten Indianer auf sie ein, man hatte keine Zeit mehr, die Schußwaffen hervorzuziehen, schon waren sie umzingelt, und ein wildes Ringen begann.
Den Indianern mußte weniger daran gelegen sein, die Bleichgesichter zu töten, als vielmehr, sie lebendig in ihre Gewalt zu bekommen, denn sie machten keinen Gebrauch von ihren Waffen. Hätten sie die Tomahawks geschwungen, so wäre es ihnen ein leichtes gewesen, Sieger zu werden, so aber drangen sie nur auf die Ueberraschten ein und versuchten sie zu überwältigen, was ihnen auch schließlich gelang.
Sie waren in der Ueberzahl. Wenn von den Indianern einer fiel, so erstanden für ihn drei andere; immer neue rote Gestalten drangen auf die halb Wehrlosen ein, und einer nach dem anderen wurde zu Boden geworfen und gefesselt, ohne daß ihm die anderen helfen konnten.
Nur dreien gelang es, den sie erwartenden Banden zu entfliehen, hauptsächlich darum, weil sie die größte Kaltblütigkeit besaßen.
Selbst der im Kampfe mit den Indianern geübte Charly mußte unterliegen, ebenso die anderen Trapper; John Davids dagegen war der erste, welcher sich Bahn brach und entkam.
Sofort, als er sah, daß ein Sieg über die Indianer nicht möglich war, dachte er gar nicht mehr an eine Verteidigung, sondern nur noch an eine Flucht, und wirklich gelang ihm diese. Er stellte sich, als sei er von der Kugel eines seiner eigenen Kameraden getroffen worden, stürzte zu Boden und entfloh in dem Moment, als er die Gelegenheit für günstig hielt.
Einige Indianer setzten ihm sofort nach. Keiner der Kämpfenden wußte, ob der Genosse entkam oder nicht.
Auch Lord Harrlington floh und riß Ellen mit sich fort. Diesen Erfolg hatte er hauptsächlich seinem Freunde Hastings zu verdanken. Der riesenstarke Lord hatte keine Patronen mehr für seinen Revolver, sich aber dafür in den Besitz eines Tomahawks gebracht. Mit diesem wütete er nun wie ein Kriegsgott unter den Rothäuten; jeder Schlag zertrümmerte einen Schädel, und schon schien es, als würde dieser riesige Kämpfer ganz allein die Indianer, welche die Waffen nicht gebrauchen wollten, in die Flucht treiben und die Gefangenen befreien, als die List eines Gegners den Lord kampfunfähig machte.
Derselbe holte eben zum mächtigen Schlage aus, welcher den Schädel eines vor ihm stehenden Indianers zerschmettern sollte. Sausend fuhr der Tomahawk herab, aber blitzschnell wich der Indianer aus, und mit solch furchtbarer Gewalt war der Schlag geführt worden, daß Hastings vornüber gerissen wurde.
Er taumelte etwas, und ehe er seine Waffe wieder erheben konnte, war ihn der Indianer zwischen die Beine gefahren und brachte ihn zum Sturze. Im Nu warfen sich ein Dutzend Rothäute auf ihn und überwältigten ihn.
Lord Hastings ward gebunden, aber durch seine Tat war es zwei anderen gelungen, zu entfliehen.
Auch Lord Harrlington wußte sich lange die Angreifer vom Leibe zu halten; er brauchte nicht einmal sein Messer, die Fäuste genügten ihm, und wo diese hintrafen, da wichen die Indianer stöhnend zurück. Blitzschnell teilte er nach allen Seiten Stöße aus. Keiner konnte ihn packen, aber seine Lage war natürlich hoffnungslos.
Er stand mit dem Rücken gegen einen Felsen gelehnt, und ringsum war er von Indianern eingeschlossen.
Da sah er, wie Lord Hastings fiel, die meisten Indianer drängten sich dorthin, um ihn am Aufstehen zu verhindern, dadurch wurde es um ihn etwas freier, eben sah er, wie Ellen noch mit einem Indianer rang, und im Nu stürzte er mit erhobenem Messer durch die Reihen der Indianer und auf Ellen zu.
Ein Stoß befreite sie von ihrem Angreifer, dann faßte Harrlington Ellens Hand und rannte mit Aufgebot aller Kräfte davon. Die Indianer waren im Augenblick verblüfft, dann setzten sie unter wildem Geschrei den Flüchtigen nach.
Harrlington ahnte, daß die Indianer aus irgend einem Grunde ihr Leben schonen und sie lebendig fangen wollten, und so wußte er, daß in der Schnelligkeit ihrer Füße die einzige Hoffnung lag.
Er selbst war ein so vorzüglicher Läufer, daß ihn wohl schwerlich einer der Indianer, obgleich diese bekanntlich auch äußerst schnellfüßig sind, einholen konnte, doch Ellen hinderte ihn, seine ganze Schnelligkeit zu entwickeln. So gewandt auch Ellen in allen körperlichen Künsten war, konnte sie es im Laufen doch nicht mit den Indianern aufnehmen.
Näher und näher erklang das Geschrei der Verfolger, da griff Harrlington zu einer List, welche sie vielleicht retten konnte.
Er verständigte Ellen von seinem Plane, und sie sah die Zweckmäßigkeit des Vorschlages ein.
Sie flohen nicht durch den Hohlweg, sondern den Weg zurück, welchen sie gekommen waren, der den Hohlweg kreuzte. Links und rechts standen Büsche und Bäume, auch große Steine lagen auf dem Boden zerstreut.
Eben wurden die Flüchtigen den Verfolgern durch dichte Büsche entzogen, Harrlington gab Ellens Hand frei, und der Verabredung gemäß bog das Mädchen rechts ab, im Dickicht verschwindend.
Harrlington mäßigte einen Augenblick seinen Lauf und wendete den Kopf, um zu beobachten, ob dieses Manöver bemerkt sei. Es schien nicht der Fall zu sein.
Doch lange durfte er nicht warten, ein schneller Läufer kann in wenigen Sekunden eine beträchtliche Strecke durchmessen, und so floh er in großen Sprüngen weiter, aus tiefster Seele das inbrünstigste Gebet zum Himmel aufsendend, daß Ellen entkommen möge.
Um seine eigene Person war er nicht bange, machten die Verfolger keinen Gebrauch von den Schußwaffen, so wollte er ihnen schon entgehen.
Harrlingtons Unglücksstern wollte aber, daß er den Feinden nicht entkam.
Noch zehn Minuten mochte er gelaufen sein, die Indianer waren schon nicht mehr zu sehen, er hörte nur noch ihr wildes Geschrei, als hinter einigen Baumstämmen plötzlich eine Menge dunkler Gestalten hervorsprangen und sich auf den Flüchtigen warfen.
Einer davon, ein Indianer von riesiger Größe sprang mit solcher Gewalt gegen ihn an, daß Harrlington sowohl, als er zu Boden geschleudert wurden. Wohl war der Lord sofort wieder auf den Füßen, wohl gelang es ihm noch, den ersten der auf ihn Springenden zu Boden zu schlagen, dann aber wurde er von hinten umschlungen, er war überwältigt.
Harrlington achtete nicht auf die Schmähreden und Mißhandlungen, mit welchen ihn die Indianer überhäuften, er dachte in diesem Augenblicke nur daran, daß diese Leute eben die waren, welche vorhin John Davids verfolgt hatten, er erkannte den großen Indianer wieder.
Also war John Davids entkommen, das war wenigstens ein Trost.

Dann fiel ihm Ellen ein, und neue Besorgnis beschlich sein Herz.
Die Indianer, die ihm nachsetzten, waren atemlos angekommen, sie wechselten nur wenige Worte mit ihren Gefährten, dann warfen sie sich ins Gras um sich zu verschnaufen. Jetzt konnten sie noch nicht zu Worte kommen, so heftig arbeitete die Brust nach dem rasenden Laufe.
Die anderen Indianer versicherten sich noch einmal, daß Harrlingtons Hände fest gebunden waren, befestigten an einem Fuße desselben einen Lasso und setzten sich dann ebenfalls hin, um zu warten, bis ihre Genossen sich erholt hatten, damit sie erzählen konnten, was sich auf dem Kampfplatze zugetragen hatte.
Es dauerte auch nicht lange, so waren die Atemlosen dazu fähig.
Harrlington bedauerte, kein Wort ihrer Kehllaute zu verstehen, aber schon wurde er ängstlich, als er sie lachen und nach der Richtung deuten sah, aus der sie gekommen waren.
Sollte Ellen ihnen doch nicht entgangen sein. Sollten einige von ihnen zurückgeblieben sein und das Mädchen ebenso wie ihn gefangen haben? Ellen war schon abgemattet, an Widerstand konnte sie nicht denken, auch nicht an eine erfolgreiche Flucht.
Harrlingtons Herz zog sich bei diesem Gedanken krampfhaft zusammen, schon sah er im Geiste, wie Ellen von den rohen Indianern gepackt wurde.
Dasselbe geschah jetzt mit ihm.
Ein Indianer sagte einige Worte zu ihm, und als er das nicht verstand, erhielt er einen derben Fußtritt, der ihn belehrte, daß er aufstehen und sich zum Rückwege bereit machen sollte.
Mit zusammengebissenen Zähnen erhob sich Harrlington und wurde von den Indianern in die Mitte genommen, die ihn zum schnellen Gehen nötigten.
Es ging wieder nach dem Hohlweg zurück.
Sie waren noch nicht weit gegangen, als Harrlington stehen blieb und mit der Kraft der Verzweiflung an seinen Banden riß. Dort stand Ellen, ebenso gebunden wie er, am Fuße einen Lasso gleich einem Schlachtopfer, von zwei Indianern gehalten, und erwartete ihren Leidensgenossen, dem sie sich auf dem Wege anschließen sollte.
Ach, Harrlington strengte sich vergeblich an, er vermochte nicht die Lederstreifen zu zerreißen. Einige Püffe mit dem Stiele des Tomahawks waren die Belohnung für diese Bemühung, aber er fühlte es nicht, der Schmerz der Seele betäubte den des Körpers.
»Ellen,« rief er in verzweifelndem Tone, »warum müssen wir so gestraft werden!«
Sie antwortete nicht, stumm blickte sie zu Boden und konnte nicht verhindern, daß ihr die Tränen über die Wangen liefen.
Lachend banden die Indianer die beiden Gefangenen zusammen, Arm an Arm, wodurch ein Fluchtversuch ganz unmöglich wurde. Dann wurde ihnen wieder bedeutet, schneller zu gehen, denn die Verfolgung hatte sie ziemlich weit von den Ihrigen entfernt.
»Ellen, sprich wenigstens zu mir, das ist mir schon ein Trost!« bat Harrlington.
Sie wurden nicht am Sprechen gehindert. Die Indianer hatten sich selbst viel zu erzählen, sie schienen überhaupt sorglos zu sein.
Ellen hob das Auge zu dem Geliebten empor.
»Jetzt sind wir vereint,« sagte sie bitter, »unser Ziel ist erreicht, wir können zufrieden sein.«
»Sprich nicht so, noch leben wir und haben Hoffnung auf Befreiung.«
»Unsere Lage ist hoffnungsloser denn je.«
»Davids ist entkommen.«
Erfreut vernahm Ellen diese Worte.
»Und ist uns der Tod beschieden,« fuhr Harrlington fort, »so wollen wir vereint sterben. An deiner Seite soll mir der Tod leicht werden. Ich habe ihn nie gefürchtet, aber stets gewünscht, vor seinem Eintreten noch von dir geliebt zu werden.«
»Armer James,« seufzte das Mädchen, »ich weiß, wie sehr du dich darnach gesehnt hast. Ach, ist mein Wunsch doch auch kein anderer. Jetzt, da wir uns wiedergefunden haben, muß unser Los ein solches sein!?
Nach längerer Zeit unterbrach Harrlington das eingetretene Stillschweigen wieder.
»Kennst du diese Indianer? Es scheint mir fast, als wären es dieselben, welche unter dem weißen Wolf gegen euch schon einmal gekämpft haben. Ich kenne sie aus der Beschreibung der Damen.«
»Es sind wohl Apachen, aber andere,« entgegnete Ellen, »ich verstehe ihre Sprache.«
»Was sagen sie?«
»Ich werde nicht recht klug daraus. Nur so viel ist mir klar geworden, daß alle unsere Freunde und Freundinnen schon gefangen sind mit Ausnahme von John Davids. Der Führer, jener große Indianer dort, wiegelt seine Gefährten eben auf, ihren Genossen gegenüber zu behaupten, sie hätten ihn durch einen Pfeilschuß getötet. In Wirklichkeit ist er ihnen aber doch entflohen.«
»Da haben wir noch eine große Hoffnung. Ellen, verliere den Mut nicht! Davids wird alles aufbieten, uns zu befreien.«
»Er ist aber allein und ohne Waffen,« klagte Ellen.
»Aber er ist treu bis zum Tode, stark, kühn und umsichtig. Ein solcher Mann kann viel erreichen.«
Harrlington brach kurz ab und schritt nachdenkend weiter, es mußte ihm etwas anderes eingefallen sein.
»Ellen,« begann er dann wieder, »wir wollen noch einmal offen zusammen sprechen, es ist zwar töricht, jetzt, kurz vor dem Tode, so etwas zu erwähnen, aber dennoch drängt es mich dazu. Sag' mir, Ellen, wie standest du mit Davids? Nicht wahr, ich hatte mich getäuscht, als ich einst meinte, Davids bemühte sich um deine Gunst?«
Er richtete dabei den Blick fest auf Ellens Gesicht.
Diese wäre, wenn er im Irrtum war, vielleicht unwillig über eine solche Frage geworden, diesmal blieb sie jedoch freundlich, sie lächelte sogar, dabei etwas errötend.
»Wie sprichst du so töricht, James,« entgegnete sie, »Davids war mir stets ein treuer Freund, ich rechnete auf seine Hilfe fast ebenso, wie auf deine.«
»So gab er dir nie zu verstehen, daß du ihm mehr warst als eine Freundin?«
»Nie, auch nicht das geringste Zeichen.«
»Und das Bild, welches er malte, und das du ihm schenktest?«
»War nur ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Er bat darum, und ich ließ es ihm. Daß er es auf seiner Brust trug, ahnte ich nicht, ich hätte es ihm dann nicht gegeben. Aber willst du mich noch mit Eifersucht quälen, James? Das wäre nicht schön. Doch nein,« unterbrach sie sich, »du hattest Grund dazu, mein Benehmen gegen dich war so töricht, daß du zur Eifersucht berechtigt warst. Ich bin dir deswegen nicht böse, im Gegenteil, zeigt es mir doch, wieviel ich dir galt.«
»Das Bild brachte mich auf böse Gedanken, nachdem Miß Morgan mir den verderblichen Samen des Mißtrauens ins Herz gestreut hatte,« murmelte Harrlington.
»Ach, James, erwähne nicht mehr diesen Namen! Diese Teufelin ist hauptsächlich schuld an all unserem Unglück. Jedenfalls steckt sie auch hinter diesem Ueberfall, ist sie doch gesehen worden, wie sie mit Apachen verkehrte.«
»Kannst du nicht aus der Rede der Indianer hören, was unser Los sein soll?«
»Ich entnehme ihrem Gespräch nur, daß wir bis heute abend marschieren müssen, ehe wir — da, ruhig,« unterbrach sich Ellen und horchte. »Sie sprechen vom Tempel Huitzilopochtlis, dorthin sollen wir gebracht werden,« sagte sie dann, »also wieder nach den Ruinen zurück. Wozu sollen wir dorthin, nachdem wir erst von dort vertrieben worden sind?« Harrlington gab ihr den Rat, vorläufig dem Gespräche der Indianer zu lauschen, ihre ganze Aufmerksamkeit auf dieses zu richten, weil sie dadurch leicht etwas erfahren konnten, was ihnen bei einer eventuellen Flucht nützlich war. Auch sollte sie ja nicht verraten, daß sie den Dialekt der Apachen verstände, sonst würden sich die Indianer vielleicht hüten, ihre Geheimnisse vor den Gefangenen hören zu lassen.
Dadurch war es nicht mehr möglich, daß sich die beiden unterhielten, sie sehnten sich auch nach keinem Zwiegespräch, welches unter solchen Verhältnissen nur einen traurigen Inhalt haben konnte. Was half ihnen, wenn sie sich jetzt ihre Liebe zu verstehen gaben? Der Tod trennte sie doch bald, wenigstens für diese Welt.
Sie erreichten den Hohlweg wieder, in welchem der ungleiche Kampf gewütet hatte, zum Nachteil beider Parteien. Die Indianer waren in Uebermacht gewesen, hatten aber keinen Gebrauch von ihren Waffen gemacht, die Weißen waren zwar überwältigt worden, hatten aber erst gar manche der Rothäute in die ewigen Jagdgefilde geschickt.
Dies konnte man deutlich sehen.
Viele Leichen lagen umher, aber kein einziger Weißer war darunter, nur Indianer bedeckten den Boden.
Die Sieger mußten sich mit ihren Gefangenen sofort entfernt haben, denn sie hatten sich nicht einmal Zeit gegönnt, die Toten zu begraben. Wie sie gefallen waren, so lagen sie auch jetzt noch da, ja, einige bluteten noch und wanden sich in ihren Schmerzen.
»Sie haben es sehr eilig gehabt,« flüsterte Harrlington dem Mädchen zu, »die Indianer sollen ihre Toten sonst doch stets begraben und die Verwundeten mitnehmen.«
»Diese hier bestätigen deine Annahmen,« entgegnete Ellen. »Sie schienen den strengen Befehl erhalten zu haben, ohne Verzug nachzukommen. Sie bemitleiden zwar die Verwundeten, aber gib acht, James, auch sie werden weitergehen, ohne sich um dieselben zu bekümmern.«
Die Grausamkeit der Indianer ging aber noch bedeutend weiter.
Wie Ellen weiter erlauschte, hatten die Abziehenden die Verwundeten sogar getötet, aber einige lebten doch noch, weil sie von ihren Genossen für tot gehalten worden und erst später aus ihrer Betäubung erwacht waren.
Schaudernd wandten sich die beiden Gefangenen ab, als sie sahen, wie die Apachen ihren eigenen Kameraden, die erst um Wasser, dann um Erbarmen baten, mit kalter Miene und fester Hand das Messer ins Herz stießen. Ein Verwundeter nach dem anderen sank röchelnd zurück, und als die noch Lebenden sahen, was für ein Los sie erwartete, harrten sie ruhig des Indianers, der ihnen den Todesstoß gab. Es kam oft genug vor, daß die Apachen, wenn sie die Verwundeten nicht mitnehmen konnten, weil diese die übrigen hinderten, alles töteten, was nicht mehr gehen oder reiten konnte. Die Verwundeten faßten dies auch als etwas ganz Selbstverständliches auf, ja, sie verlangten es von den Kameraden, denn fielen sie lebendig in die Hände der Feinde, so warteten ihrer die schrecklichsten Qualen.
Jene, welche jetzt von der Hand der Freunde starben, hatten oft genug selbst so gehandelt, und so ließen sie sich den Stahl in die Brust stoßen, ohne mit der Wimper zu zucken. Ein schwaches Röcheln war alles, was ihnen der Tod auszupressen vermochte.
Schon zogen die Geier in der Luft ihre Kreise — sie hatten Beute gewittert, und bald stritten sie sich mit Schakalen und Füchsen um die Kadaver.
»Merkwürdig!« flüsterte Ellen wieder. »Unser Leben schonen sie, das der Gefährten nicht im geringsten.«
»Ist das ein gutes Zeichen?«
»Ich denke, ein sehr schlimmes.«
»Ein schlimmeres Los als der Marterpfahl kann uns nicht erwarten. Ellen, wenn ich wüßte!«
Harrlington wagte nicht, dem Gedanken weitere Worte zu verleihen.
»Dann würdest du mich gefaßt sterben sehen, James,« entgegnete Ellen ruhig. »Seit ich dich wahrhaftig liebe und dir meine Liebe gestanden habe, hat der Tod für mich keine Schrecken mehr, besonders, wenn ich dich bei mir weiß. Ach, James, wenn du wüßtest, wie gern ich den tausendfachen Tod erdulden möchte, wenn ich dadurch dem Leben erhalten könnte!«
»Laß diese Worte!« bat Harrlington. »Glaubst du, ich dächte anders? Aber es ist umsonst, so zu sprechen. Trösten wir uns damit, daß unser Los das gleiche ist!«
Der große Indianer trat an sie heran und verbot ihnen jetzt mit harten Worten das Sprechen. Ellen verstand die Worte, Harrlington die drohende Gebärde.
Die Indianer mußten einen Grund haben, sich still zu verhalten, auch sie ließen das Sprechen und bewegten sich vorsichtig, aber schnell, innerhalb des Hohlwegs, den schon die anderen Indianer zu ihrem Marsche benützt hatten.
Durch eine Unvorsichtigkeit Harrlingtons wurde der Unwille des Führers erregt, ein neues Unglück schien über sie hereinzubrechen, beide mußten sich neue, unsagbare Demütigungen gefallen lassen, aber dennoch gereichte ihnen alles zum Glück.
Harrlington konnte es nicht unterlassen, noch einmal zu Ellen zu sprechen. Trotzdem er gefesselt war, fühlte er sich doch glücklich an ihrer Seite. Er beugte sich etwas vor, daß die Indianer nicht die Bewegungen seines Mundes sehen konnten, und flüsterte ein Trost- und Kosewort zugleich.
So leise das kurze Wort auch gesprochen worden war, war es dem Ohre des Führers doch nicht entgangen.
Sofort drehte er sich um, riß das Messer aus dem Gürtel, packte den Gefangenen an der Brust und hob drohend das Messer.
Da flammte plötzlich Harrlingtons Mut auf. Was galt es ihm, wenn er schon jetzt endete? Ja, es wäre ihm vielleicht lieber gewesen, denn er hatte wenig Hoffnung auf Rettung, und zu Füßen Ellens eines schnellen Todes zu sterben, wäre ihm nur erwünscht gewesen.
»Stoß zu!« rief er laut und mit blitzenden Augen.
Fast schien es, als wollte der Führer, der bei diesem lauten Ruf erschrocken zusammenfuhr, das Messer in die Brust Harrlingtons senken. Ellen schrie entsetzt auf; aber schnell hatte sich der Indianer besonnen, steckte das Messer ein, murmelte etwas und begab sich nach dem Ende des Zuges, wo er mit einigen Indianern flüsterte.
»Weißt du, was er sagte?« fragte Ellen.
»Er darf mich gewiß nicht töten, aber ich möchte, er hätte es getan,« entgegnete Harrlington.
»Er sagte: jetzt noch nicht, ich darf das Opfer Huitzilopochtlis nicht töten, das hat — —«
Einige Indianer sprangen zu ihnen und machten drohende Bewegungen, um die Sprecher zum Schweigen zu bringen. Dann kam auch der Führer wieder vorgeeilt und machte Miene, die Lederschnuren zu lösen, welche beide Gefangene miteinander vereinigten.
»Sie wollen uns trennen,« schrie Ellen, »wir wollen zusammenbleiben, James.«
Eine Hand schloß ihr den Mund, die Indianer lösten die Verbindungsschnüre, man führte Harrlington nach hinten, und Ellen geriet darüber außer sich.
Sie glaubte nicht anders, als sie sollte jetzt auf immer von Harrlington getrennt werden, und schrie laut auf.
Harrlington, der nun den Schluß des Zuges bilden sollte, damit beide am Sprechen gehindert würden, wandte sich um und sah, wie ein Indianer das schreiende Mädchen grausam schlug. Diesen Anblick konnte der Lord nicht ertragen. Wie ein Raubtier wollte er sich auf den Indianer stürzen, aber er hatte den Lasso am Fuß vergessen. Ein Ruck, und er lag am Boden.
So mußte er noch sehen, wie Ellen, welche zu dem Gefangenen eilen wollte, mit rohen Griffen daran gehindert wurde, und wie ein Indianer sie unbarmherzig mit dem Stiele des Tomahawks stieß.
Harrlington knirschte mit den Zähnen, er wand sich und versuchte mit aller Kraft, die Fesseln zu sprengen — vergebens.
Da geschah etwas Unerwartetes, was die Indianer mit Entsetzen, die beiden Gefangenen aber mit grenzenlosen, Jubel erfüllte, wie ein Wunder kam es vom Himmel.
Plötzlich sauste an der Wand der Schlucht ein Mann herunter, man sah noch den Lasso hängen, an welchem er sich heruntergelassen hatte, da der Mann schon dicht neben Harrlington stand, in der Faust einen riesigen Pallasch, dessen Griff durch ein breites Lederband fest mit seiner Hand verbunden war. Wie ein Blitz sauste der Stahl durch die Luft, und ehe die Indianer noch an den Gebrauch ihrer Waffen denken konnten, fielen die Schläge schon hageldicht auf sie herab, und jeder ließ einen Kopf auf den Boden rollen.
Nur ein Indianer wollte den Tomahawk zum Wurf erheben, aber in demselben Augenblick war auch schon sein Arm vom Rumpfe getrennt. Beim nächsten Streich sank sein Gefährte neben ihm nieder, der dritte Schlag legte einem Indianer den Kopf vor die Füße, und so ging es weiter, bis die ungefähr zwanzig Indianer, weder an Flucht noch an Gegenwehr denkend, sondern nur entsetzt auf diesen Würgengel blickend, innerhalb weniger Minuten bis auf einen einzigen abgeschlachtet worden waren.
Dieser war der Führer.
Er war, als er die Häupter seiner Genossen wie Mohnköpfe unter der Sichel des Schnitters links und rechts fallen sah, schnell zurückgesprungen und hatte Ellen mit sich gerissen.
Der letzte war gesunken, und der Mann mit dem Schwerte wandte sich nun gegen ihn.
Da schlang der Indianer die Hand um das Haar Ellens, riß sie zu Boden und zückte das erhobene Messer auf ihren Busen.
»Komm,« rief er mit wildem Blick dem anstürmenden Kämpfer zu, »du tötest zwei!«
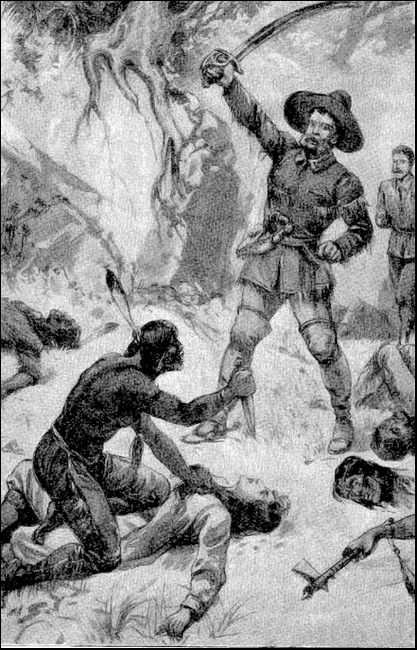
»Komm, du tötest zwei!« rief der auf Ellen kniende Indianer seinem Gegner zu.
Der Mann blieb wie versteinert stehen. Ging er dem Indianer zu Leibe, so erstach dieser die Gefangene, und sein Rettungswerk war umsonst.
Harrlington schrie laut auf, er sah die Geliebte schon dem Tode geweiht.
Da aber sauste abermals von dem Rande der Schlucht, diesmal jedoch von der anderen Seite, ein Gegenstand durch die Luft und stürzte direkt auf den Indianer, schleuderte ihn zu Boden und blieb bewegungslos auf ihm liegen. Es war ein Mann, derselbe, den vorhin der Chinese und sein Begleiter, der eben unter den Indianern gewütet, auf der anderen Seite des Tales gesehen hatten.
Ellen selbst war von dem Springer etwas gestreift worden und durch die Gewalt des Sturzes zur Seite geschleudert worden, aber die Finger des Indianers waren noch immer in ihr Haar gekrallt. Sie glaubte ebenso wie die anderen, der Springer sei durch den Sturz getötet worden und habe dabei auch den Indianer erschlagen, denn beide lagen völlig regungslos aufeinander.
Der Mann mit dem Schwerte wollte schon auf den Indianer zugehen, um ihm noch einen Stich beizubringen, da aber richtete sich der auf diesem Liegende plötzlich auf und stieß ihm sein langes Bowiemesser mehrmals schnell hintereinander ins Herz.
Dann brach er wieder zusammen und rollte über den Indianer hinweg.
Als er sich nochmals aufgerichtet hatte, konnte man sein Gesicht sehen, und jetzt erst erkannten ihn Ellen und Harrlington gleichzeitig.
»John Davids,« riefen beide wie aus einem Munde.
Harrlingtons, wie auch Ellens Fesseln wurden von dem Pallasch zerschnitten, dann stiegen die Befreiten über die Leichen der Indianer und gingen auf Davids zu. Er lag jetzt auf dem Rücken, und ein Blutstrom entquoll seiner Brust.
»Sie sind verwundet!« rief Harrlington und beugte sich über seinen treuen Freund.
Davids versuchte sich aufzurichten.
»Es ist — nicht schlimm,« stöhnte er, wodurch seine Worte Lügen gestraft wurden, »ich bin — ins Messer — gesprungen.«
Sein an sich schon farbloses Gesicht wurde noch blässer, und ein Zittern ging durch seine Glieder.
»Er stirbt!« schrie Ellen auf.
»Nicht so schreien,« ließ sich da eine Stimme von oben vernehmen und zwischen den Büschen des Randes kam das besorgte Gesicht des Chinesen zum Vorschein, »hier sind Stricke, klettert herauf und zieht den Verwundeten nach.«
Dabei warf er noch einen starken Strick herab, dessen anderes Ende an dem Baume oben festgebunden war.
»Er stirbt,« wiederholte auch Harrlington, den Verwundeten liebevoll umschlingend.
»Nein — nein,« murmelte Davids leise, »bringt euch — in Sicherheit, schnell — schnell — die Indianer — könnten zurückkommen — laßt mich — hier liegen.«
»Wir bleiben bei Ihnen.«
»So nehmt — mich mit!«
»Es ist das beste, wir suchen einen sicheren Platz im Walde aus,« sagte der Mann mit dem Schwert, »und stirbt der Engländer, so kann er wenigstens in Ruhe den letzten Seufzer tun. Die Indianer können zurückkehren. Ich muß fort, oben stehen unsere Pferde, dem Verwundeten will ich meins abtreten, wenn Ihr jetzt sofort mit uns kommt.«
Harrlington erhob die Augen und begegnete den Blicken des Sprechers.
Erschrocken sprang er auf, er erblickte den Mann vor sich, den er in China an Bord des amerikanischen Kriegsschiffes mit eigenen Augen am Galgen hatte hängen sehen. Doch jetzt war keine Zeit, sich darüber zu wundern oder gar auszusprechen.
»Clas van Guden!« rief er. »So sind Sie also unser Retter? Dank Euch, Ihr kommt zur rechten Zeit!«
»Ich brauche keinen Dank. Ich habe nur Gleiches mit Gleichem vergolten. Ihr habt mein Leben geschont, als es in Eurer Hand lag, mich zu töten, nachdem Ihr mich besiegt hattet, jetzt rette ich das Eure. Wir sind quitt, Lord!«
Harrlington reichte ihm die Hand, die der Holländer auch ergriff und drückte, ihm fest ins Auge sehend.
»Wir sind nicht quitt, Jonkheer,« sagte Harrlington, »wir sind Freunde, zählt auf mich.«
Der Chinese drängte wieder zum Handeln, und Davids selbst verlangte, daß man ihn von hier fortschaffe.
Harrlington schwang sich an dem Strick nach dem Rande der Schlucht empor; van Guden und Ellen banden den Verwundeten, der bei Bewußtsein war und furchtbare Schmerzen erdulden mußte, aber doch nicht stöhnte, sondern mit zusammengebissenen Zähnen sich alles gefallen ließ, an das Seil, und Harrlington zog ihn zu sich hinauf.
Namenloses Weh bewegte Ellens Brust. In den Zügen Davids' konnte sie lesen, daß ihm der Tod bevorstand. Also hatte Davids sich für sie geopfert, er war in das Messer gesprungen, welches schon zum Stoß für sie erhoben war.
Der Chinese empfing die Ankommenden mit sehr ungnädigem Gesicht, das schlaue Lächeln war daraus verschwunden. Er schien durchaus nicht damit einverstanden, daß sein Begleiter sich in diese fremden Angelegenheiten gemischt hatte, er hatte ihn bis zum letzten Augenblicke daran gehindert, zu schießen, und so hatte van Guden, kurz entschlossen, einen Lasso am Baume befestigt, sich daran heruntergelassen und war mit dem Schwert, in dessen Führung er Meister war, zwischen die Indianer gefahren.
Er hatte seinen alten Namen ›Würgengel‹ wieder bewahrheitet.
Der Holländer band Davids auf sein Pferd und führte dann das Tier am Zügel in den Wald. Die anderen folgten ihm.
An einem sanften Hügelabhange, umgeben von Bäumen und Büschen, erhob sich ein aus rohen Stämmen zusammengefügtes Häuschen. Der Erbauer hatte sehr klug gearbeitet, wenig Holz und wenig Mühe darauf verwendet, indem er nämlich das Häuschen gerade da angelegt hatte, wo der Hügel jäh abfiel, und es an diese schräge Stelle anlehnte, wodurch er eine Wand ersparte.
Die Folge davon war, daß das Dach fast in gleicher Richtung mit dem Rasenboden des oberen Hügels lag, und man konnte also auf dreierlei Weise in das Haus gelangen; entweder durch die unten befindliche Tür, durch das Fenster oder auch durch das Loch, welches oben, dicht über dem Boden lag. Es diente zum Abzug des Rauches, einen Schornstein gab es nicht.
Das Haus war ziemlich hoch. Im Inneren zeigte es zwei Räume, die übereinander lagen. Der untere hatte nur eine grobe Bettstelle mit Decke, einen rohgezimmerten Tisch und einen Stuhl aufzuweisen, außerdem lag noch einiges Kochgeschirr umher. Die Decke bildete ein Gefüge von dünnen Baumstämmen, wodurch oben noch ein Raum entstand, zu welchem eine Leiter hinaufführte.
Der Rauch des Feuers mußte erst durch dieses Loch in den oberen Raum entweichen und gelangte dann durch die Oeffnung dieser Kammer in das Freie. Diese Einrichtung bewies, daß das Haus einst einem Fallensteller gehört hatte, der in dem unteren Teile wohnte und in dem oberen die frischen Felle trocknete, wohl auch Bärenschinken, Hirschkeulen und anderes etwas anräucherte.
Auch dies bestätigte die Vermutung, daß der Besitzer, ein Fallensteller, die Behausung verlassen hatte, weil der an dem Hügel vorbeifließende Bach einst von vielen Bibern bewohnt gewesen war, jetzt aber waren die zahlreichen, kunstvollen Erdbauten am Ufer leer, die Biber waren zumeist gefangen worden und die letzten ausgewandert, und mit ihrer Entfernung war natürlich auch der Fallensteller brotlos geworden, er mußte sich eine andere Stelle aussuchen, wo die Biber mit den teuflischen Fallen der Menschen noch unbekannt waren.
Dennoch war das Haus bewohnt. Zwei Menschen, die gar nicht hineingehörten, hatten davon Besitz genommen, wenn sie sich auch nicht häuslich eingerichtet hatten, sondern nur das benutzten, was von dem bedürfnislosen Fallensteller zurückgelassen worden war.
Im unteren Räume spielte sich eben eine greuliche Szene ab.
Auf dem Bett lag eine ekelerregende Gestalt mit haarlosem Kopf und geschwollenem, mit Geschwüren bedeckten Gesicht und krümmte sich vor Schmerzen, schlug mit den unförmlichen Händen wie wahnsinnig um sich herum und krallte die Finger in die Decke, dabei ein fürchterliches Geheul ausstoßend.
Neben dem Bett stand eine Dame, welche noch viel weniger hierher gehörte, wenn sie sich nicht gerade verirrt hatte. Ein graues Kleid nach modernem Schnitt umschloß ihre volle Gestalt, sie machte den Eindruck, als wäre sie eine reisende Engländerin, die der Neugierde halber einmal hier eingetreten war, um sich einen Waldmenschen anzusehen.
Sie hielt in der Hand einen Becher, den sie mehrere Male an die Lippen des Schreienden und sich Windenden bringen wollte, aber der Mann stieß ihn immer wieder zurück.
In dem Gesicht der Dame war kein Mitleid zu lesen, eher Ekel, sie hütete sich, mit ihrer feinen Hand den Unglücklichen zu berühren, stand weit von ihm entfernt, den Arm ausgestreckt und beobachtete mit mißtrauischem Auge jede seiner Bewegungen.
Kam die Hand mit den dicken, zuckenden Fingern in ihre Nähe, so zog sie ihr Kleid an sich und trat noch etwas mehr zurück, als hätte eine Berührung eine Vergiftung bedeutet.
Die Bewegungen des Leidenden wurden schwächer, das Zucken ließ nach; nur ab und zu kam noch ein schauerlicher Schmerzensschrei über die blauen Lippen, dann ließ er die Arme schlaff fallen und lag mit starren Augen und hochgehender Brust still da.
»Eduard,« sagte das Weib, während es den Becher an seinen Mund führte, »trink' jetzt, es ist das einzige, was nach des alten Mannes Ansicht deinen Schmerz etwas lindern kann. Wenn du aber den Anfall bekommst, bist du wie ein Rasender, du schlägst mir den Becher stets aus der Hand, anstatt den lindernden Trank zu nehmen.
»Wahrhaftig, Eduard, ich verliere bald die Geduld mit dir. Zur Krankenwärterin eigne ich mich nicht.«
»Schieße mir eine Kugel durch den Kopf,« wimmerte der Unglückliche.
»Ach was! Einmal sprichst du so und dann wieder so,« fuhr das herzlose Weib fort. »Ich habe dir schon oft genug den Revolver in die Hand gegeben, du brauchtest nur abzudrücken, aber dann schwatzest du wieder, du müßtest leben, um Rache nehmen zu können, und schleuderst den Revolver von dir, mich verwünschend.«
Eduard richtete seine Augen auf das Weib, seine einstige Geliebte, und teuflischer Hohn blickte daraus hervor.
»Ja, du möchtest wohl, daß ich nicht mehr lebte, Sarah,« kam es zischend zwischen den Lippen hervor, »dir wäre lieb, wenn ich aus der Welt wäre, nicht?«
»Sprich keinen Unsinn, Eduard! Wünschte ich das, wie leicht wäre es mir! Du bist ja hilflos wie ein Kind, ich könnte dich mit der Hand erwürgen.«
»Hahaha,« lachte der Kranke höhnisch, »du wirst dich hüten! Was bist du denn? Glaubst du, du könntest dich als Mutter Marthas legitimieren? Keinen Pfennig bekommst du von alledem, was da ist, dafür habe ich gesorgt. Hier hilft es nichts, Unterschriften zu fälschen. Niemand außer mir weiß, wo mein Geld liegt, und deshalb, Sarah, schonst du mich und pflegst mich sogar, weil du hoffst, ich könnte es dir doch einmal in einer schwachen Stunde mitteilen. Aber nur Geduld, du erfährst es nicht eher, als bis meine Rache befriedigt ist.«
Des Kranken Gesicht nahm wieder einen schrecklichen Ausdruck an.
»Willst du mich töten? Haha! Du Scheusal, was bist du denn, wenn ich sterbe? Die Beweise sind in anderen Händen, welche alles aufdecken! Was bist du denn? Du Scheusal!«
Er schlug mit der Faust nach Miß Morgan, die dem Hiebe auswich, aber ganz gegen ihre sonstige Natur völlig ruhig blieb. Doch biß sie die Zähne so fest auf die Unterlippe, daß Blutstropfen sichtbar wurden.
»Gebärde dich nicht wie ein Narr!« entgegnete sie. »Ich pflege dich nur, weil ich dich einst geliebt habe, weil ich dich wirklich bemitleide. Ich glaube gar nicht an das, was du da immer von angesammelten Schätzen schwatzest, du willst mich nur an dich zu fesseln suchen.«
»Hahaha,« lachte der Kranke wieder gellend, »du weißt recht gut, wie ich meine früheren Spießgesellen immer geprellt habe, du hieltst es mir früher oft genug vor. Natürlich glaubtest du, auch du würdest einmal später davon Nutzen haben, ich nannte dich ja meine Frau, aber hier giebt es keine Anweisung, die man stehlen kann, oder Testamente, nur ich weiß, wo der Schatz liegt, und hilfst du mir bei meiner Rache, so sollst du meine Erbin sein. Was sprichst du mir da von Mitleid? Du hast nie solches gekannt, nicht einmal mit deinem eigenen Kind.«
»Eduard, ich habe dich wirklich geliebt, du dauerst mich, wenn ich dich so leiden sehe.«
»So, und du hast mich hierhergeschafft und läßt mich hier liegen? Warum bringst du mich nicht nach der Ruine, wo du in aller Bequemlichkeit lebst? Hier bläst in der Nacht der Wind herein, der Rauch schlägt mir ins Gesicht, und selbst am Tage fürchte ich mich, Wasser zu schöpfen, weil ich dabei immer mein Gesicht darin erblicke. Warum soll ich nicht nach der Ruine kommen?«
»Nimm Vernunft an!« bat Sarah. »Du weißt, ich brächte dich auch hin. Aber gerade, als dich die Indianer sahen, bekamst du deine Anfälle, und dummerweise glaubten diese, es mit einem vom bösen Geist Befallenen zu tun zu haben. Sie verweigerten deine Aufnahme. Hier bist du ja auch ganz sicher. Niemand kennt dich, selbst wenn er dich früher gesehen hätte, und du wirst von mir mit allem, was du nötig hast, gut versehen.«
»Wie lange soll ich hier bleiben?« klagte Eduard. »Ist die Zeit noch nicht bald gekommen, da sich meine Ohren und Augen an dem Schmerze meiner Feinde weiden können? Dann, glaube mir, Sarah, dann werde ich wieder gesund.«
»Die Zeit ist bald da. Schon jetzt sind sie wahrscheinlich auf dem Wege zur Ruine.«
»Und Hoffmann? Ist auch er von den Indianern gefangen worden? War er überhaupt schon in der Ruine?«
»Gewiß, er hat sich wiederholt in der Ruine gezeigt und liegt bereits an Ketten gefesselt im tiefsten Gewölbe des Gemäuers,« log das Weib, um den Kranken zu beruhigen.

Eduard Flexan richtete sich hastig auf.
»Aber er gehört mir,« rief er.
»Gewiß, du sollst ihn martern.«
»Die Indianer müssen ihn mir überlassen.«
»Ich werde dir Zutritt in die Ruine verschaffen, du sollst dich an seiner Angst weiden.«
Draußen ertönten Hufschläge, das Weib wandte sich dem Fenster zu und schrak zusammen.
Ihr Gesicht bedeckte sich mit Todesblässe, ihre Fäuste ballten sich, und ein Zittern ging durch ihren Körper.
»Harrlington,« stammelte sie, »und Ellen! Sie bringen einen Verwundeten. Also sind sie wieder entkommen.«
Hastig wandte sie sich an Eduard:
»Harrlington, Miß Petersen und noch einige Männer kommen, sie sind den auf sie gehetzten Indianern entgangen und werden wahrscheinlich hier eintreten. Empfange sie, lege dir schnell ein Märchen zurecht, ich muß fliehen, mich kennen sie, dich nicht. Suche sie festzuhalten, bis ich wiederkomme, ich werde sie überwältigen lassen.«
Sie sah sich um, eine Flucht durch die Tür war, ohne gesehen zu werden, nicht mehr möglich. Da fiel ihr Blick auf die Luke. Schnell stieg sie empor und verschwand in dem oberen Raume.
»Es ist die Hütte eines Fallenstellers,« hörte Flexan draußen jemanden sagen, und beim Klange dieser Stimme zuckte er, wie von einer Natter gestochen, zusammen — es war die Stimme seines ärgsten Feindes, seines Nebenbuhlers, die Lord Harrlingtons.
»So werden wir hier einige Stunden ruhen und Mister Davids verbinden können, die Hütte liegt sehr versteckt,« sagte darauf eine andere volle Altstimme.
Wieder zuckte Flexan zusammen. Soeben hatte Ellen gesprochen, das Wesen, welches er liebte, und das ihn verachtete.
Doch gleich hatte er seine Fassung wiedergewonnen, und als jetzt die Tür aufgestoßen wurde, lag er still auf dem Bett, das Gesicht der Wand zugekehrt.
Harrlington, Ellen und der Holländer traten ein, ohne von Flexan beachtet zu werden.
»Guter Mann,« sagte ersterer, »habt Ihr in Eurer Hütte Platz für uns? Wir wollen einen Verwundeten verbinden. Wir hoffen, daß wir dann unsere Reise fortsetzen können.«
Jetzt wandte Flexan den Kopf, und die Anwesenden erschraken über den Anblick, der sich ihnen bot. Wie konnte dieser Mann, der von einer Krankheit völlig zerfressen schien, einsam hier leben? Es schien doch gar keine Kraft mehr in seinen Knochen zu sein, und das Leben im Walde ist beschwerlich.
Doch jetzt war keine Zeit, sich darüber den Kopf zu zerbrechen.
»Kommt herein!« murmelte Flexan in seinem gewöhnlichen, krächzenden Ton.
Er hatte keine Angst, erkannt zu werden, er war diesen Leuten, die er, wie auch den Holländer, kannte, ein völlig Fremder.
Der letztere und Harrlington gingen hinaus, wo der Chinese die Reittiere hielt. Auf des Holländers Pferd lag Davids, noch am Leben, aber dem Tode nahe. Nur wollte sich keiner gestehen, daß es wirklich so schlimm mit ihm stand. Sie konnten es nicht fassen, ihn verlieren zu müssen.
Ellen trat unterdessen zu dem Mann auf dem Bette, der sie starr anblickte.
»Seid Ihr krank?« fragte sie ihn.
Keine Antwort. Eduard verwandte kein Auge von der, die er liebte, die ihn in seiner vollsten Mannesschönheit gesehen hatte und ihn jetzt als ekelhaftesten Krüppel nicht wiedererkannte.
Ellen sah sich im Zimmer um.
Sie fand nichts, was sich zu einem Lager für einen Verwundeten eignete, aber der Bewohner dieser Hütte lag auf einer Menge von Decken, auch Kissen und Polster waren ihm untergebettet — sehr merkwürdig für einen einfachen Fallensteller — und wenn er einige abgab, so hätten sie recht gut ein annehmbares Lager bereiten können. Kurz entschlossen trat sie auf den Mann zu.
»Wir bringen einen Schwerverwundeten mit.« sagte sie, »wir möchten ihn betten, er hat viele Schmerzen auszustehen. Wollt Ihr uns nicht einige Decken und Kissen abgeben, damit ich ihm ein weiches Bett bereiten kann? Gott wird es Euch lohnen.«
Der Mensch antwortete weiter nichts, aber er erhob sich etwas und zog unter seinem Körper einige Decken hervor, die er Ellen hinreichte. Diese griff danach, dabei berührte ihre Hand die des Mannes, und als sie den dicken, geschwollenen, jetzt noch mit Geschwüren bedeckten Fleischklumpen fühlte, konnte sie sich doch nicht beherrschen. Sie schauerte zusammen und zog die Hand unter allen Zeichen des Ekels zurück, die Decken dabei fallen lassend.
Des Mannes Augen blickten mit einem fürchterlichen Ausdruck auf das junge Mädchen, die blauen Lippen verzerrten sich, man wußte nicht, ob in Schmerz oder in Hohn, und ein Grunzen erklang aus dem zahnlosen Mund.
Ellen schämte sich, ihren Abscheu verraten zu haben.
»Verzeiht mir!« murmelte sie, als sie sich bückte, um die Decken aufzuheben.
Der Mann händigte ihr noch mehr Decken und Kissen ein. Er selbst hütete sich zwar, die Hand des Mädchens wieder zu berühren, doch seine Augen ruhten mit einem so seltsamen Ausdruck auf ihr, daß es Ellen grauste. Sie dachte, dieser Mann müßte ein Opfer maßloser Leidenschaften geworden sein, und selbst seine Krankheit könne diese noch nicht dämpfen, so begehrlich blickte er das Mädchen an.
Wäre es nicht unbedingt nötig gewesen, für Davids schnell ein Lager zu bereiten und ihm einen ordentlichen Verband anzulegen, sie wäre unverzüglich aus diesem Hause geflohen.
Unter ihren geschäftigen Händen entstand bald aus Decken und Kissen ein bequemes Lager.
»Bist du fertig, Ellen?« erklang draußen die Stimme Harrlingtons.
»Ja, James, bringe ihn herein!« antwortete das Mädchen.
»James, Ellen?« murmelte Flexan unhörbar, und wieder ballten sich seine Hände.
Der Lord und der Holländer traten herein, Davids auf den Armen tragend, dessen Kopf schwer auf der Schulter seines Freundes lag. Er schlug die Augen matt auf, sein erster Blick fiel auf Ellen, und ein wehmütiges, aber doch zugleich glückliches Lächeln huschte über sein farbloses Antlitz.
Sanft ließen die Träger den Verwundeten auf das Lager gleiten, Harrlington kniete neben ihm nieder und öffnete den Rock, um den Notverband abzunehmen, der zuerst angelegt worden war.
Ellen und der Holländer standen daneben und sahen erwartungsvoll dem Lord zu. Erstere kannte keine Scheu, sie hatte schon vorhin die erste Hilfe geleistet und ihr Taschentuch zum Verband hergegeben.
Jetzt hob Harrlington das Hemd von der Wunde zurück und nahm das Tuch ab. Die Ränder derselben waren geschwollen, es schien bereits zu spät zu sein, besonders, da außer Davids selbst, niemand sich rühmen konnte, etwas von der Heilkunde zu verstehen.
Der Holländer holte Wasser, Ellen wusch das Blut ab. Davids stöhnte, als sie die Wunde berührte.
»Wie geht es?« fragte sie leise. »Haben Sie Schmerzen?«
»Nein,« flüsterte er.
»Sie werden hierbleiben, wir pflegen Sie. Die Hütte liegt versteckt, die Indianer werden uns nicht finden.«
Davids schüttelte schwach den Kopf.
»Ich sterbe,« flüsterte er, »ich bin Arzt — ich weiß — wie es mit mir steht — ein Lungenflügel ist getroffen —«
»Quälen Sie uns nicht mit solchen schwarzen Bildern,« sagte Harrlington wehmutsvoll.
»Wo ist van Guden?« fragte Davids.
Ellen glaubte, er wollte den Holländer sprechen und rief diesen, der sich eben draußen mit dem Chinesen unterhielt, herein. Aber Davids hatte das Gegenteil gemeint.
»Van Guden — lassen Sie — mich mit — dieser Dame — allein,« kam es abgerissen von seinen Lippen. Verwundert sahen sich Ellen und Harrlington an, doch der Holländer nahm schon das Wort:
»Gut, daß Sie gleich davon anfangen,« sagte er, »ich muß Sie nämlich verlassen, so leid es mir tut. Glauben Sie nicht, ich sei feig oder rücksichtslos, doch ein Versprechen bindet mich, den Chinesen zu begleiten. Er bedarf vor allem der Sicherheit. Von seinem Leben hängt das Wohlergehen von Tausenden chinesischer Familien ab, er gehört nicht mehr sich selbst, und hier fühlt er sich nicht sicher. Es ist meine Pflicht, ihn zu begleiten, er will durchaus nicht länger hierbleiben, und so muß ich von hier fort.«
Der Holländer streckte schon die Hand zum Abschied aus.
Bestürzt hatten Harrlington und Ellen ihn angehört, doch dann nahm ersterer seine Hand.
»Wir sind fest überzeugt, daß Sie nur durch die Verhältnisse gezwungen sind, uns zu verlassen, sonst würden Sie uns beistehen. Leben Sie wohl, und sollte ich wohlbehalten aus dieser Lage hervorgehen und meine Heimat erreichen, dann hoffe ich, daß ich noch einmal von Ihnen zu hören bekomme.«
Van Guden zog aus seinem Gürtel eine Pistole und einen Revolver, schnallte die Munitionstasche ab und überreichte alles Harrlington.
»Nehmen Sie!« sagte er. »Sie haben keine Waffen, ich bin genügend damit versehen. Gott sei mit Ihnen, ich kann nicht mehr tun, als diesen Wunsch aussprechen.«
Noch einmal schüttelte er dem Lord die Hand, ging dann an das Lager Davids, reichte auch diesem die Hand, ohne ihm aber ein Trostwort zu sagen, winkte Ellen zu und verließ das Haus.
Der Chinese saß schon im Sattel, der Holländer sprang auf sein Roß, und beide ritten schnell von dannen, ohne sich umzusehen. Wan Li schien über den Aufenthalt ärgerlich zu sein.
Ellen und Harrlington wandten sich wieder zu Davids, der unterdes von seinem Halse die goldene Kette gelöst hatte, an welcher das Medaillon mit dem Bilde Ellens hing.
»Van Guden ist gegangen,« begann Harrlington wieder, neben ihm kniend und sich mit dem Verbande beschäftigend, »er verläßt uns nur, weil er nicht anders kann; er ist ein wackerer Mann, ihm verdanken wir nach Ihnen, Davids, unsere Rettung.«
»Davids,« schluchzte Ellen, kniete ebenfalls nieder und nahm die andere Hand, welche das Medaillon hielt, »Davids, Sie haben sich in das Messer geworfen, welches mich bedrohte, Sie haben den für mich bestimmten Stoß mit Ihrer Brust aufgefangen.«
Wieder lächelte Davids glücklich.
»So habe ich mir den Tod gewünscht,« flüsterte er, »ich bin — zum ersten Mal — glücklich in — der Stunde — des Todes.«
Harrlington hielt mit dem Anlegen des Verbandes inne, er blickte Davids erstaunt an. Dieser drängte die auf seiner Brust liegende Hand zurück.
»Geben Sie sich — keine Mühe — mehr — James,« fuhr Davids fort, »der — Verband — nützt nichts — ich sterbe.«
»Davids, sprich nicht so!«
»Ich muß — lassen Sie — mich sprechen — noch einige — Worte — dann kann — ich ruhig — sterben.«
Aufseufzend warf Harrlington die Leinwand von sich, er durfte sich nicht mehr täuschen — vor ihm lag ein Sterbender. Er faßte die eine Hand des Freundes, die andere wurde von Ellen gehalten.
»So sprechen Sie, Davids!«
»Hier gebe ich — Ihnen das — was mir —heilig war,« Davids reichte ihm die Kette mit dem Medaillon, »wir hätten — uns deswegen — einmal bald — entzweit.«
»Es war Torheit von mir, Davids.«
»Nein — Sie hatten — recht — James.«
»Davids!«
Ellen war es, welche diesen Ruf ausstieß, während Harrlington erschrocken zurückfuhr.

»Ja — ich liebte — Ellen,« fuhr Davids fort, »jetzt kann — ich es gestehen — und — Ellen,« er wendete den Kopf nach der Seite, »höre es — auch du — ich liebte dich — mit aller Kraft — meiner Seele — und — liebe dich — noch jetzt. Wende dich nicht von mir,« fuhr er mit seiner letzten Kraft fort, »entziehe mir deine Hand nicht, Ellen, ich habe dir nie etwas gesagt! Niemand hat etwas geahnt.«
Ellen hatte ihm die Hand nicht entziehen wollen, sie war nur zusammengefahren bei diesem Geständnis.
Davids blickte wieder Harrlington an.
»Zürnst du mir deshalb, James, daß ich Ellen liebte? Ich habe keine Gegenliebe verlangt, ich wollte sie nur glücklich sehen, ich wußte, daß sie dich liebte, und daß sie an deiner Seite glücklich werden konnte; deshalb verschloß ich meine Liebe im Innersten meiner Seele und bot alles auf, um euch zusammenzuführen. Die Welt mag es Torheit nennen, ich konnte nicht anders handeln. Daß ich Ellen glücklich sah, war das Glück, welches ich mir wünschte.«
»Sie sind ein edler Mensch,« flüsterte Harrlington.
Davids wollte fortfahren, aber er bewegte nur die Lippen, und die Hände ließen im Druck nach.
»John!« rief Harrlington schmerzlich, »stirb nicht, bleibe bei uns!«
»Es ist — besser so,« hauchte der Sterbende, »lebe wohl — James — bewahre mir — ein gutes — Andenken — ich war dir — ein treuer — Freund.«
»Ich hatte keinen besseren.«
»Nimm das — Medaillon — es gehört — jetzt dir — Ellen,« wandte er sich an diese, »lebe — wohl.«
Sie schluchzte laut auf und preßte seine Hand.
»Armer, armer Davids,« weinte sie, »was kann ich für dich tun? Du bist für mich gestorben. Jetzt wird es mir erst völlig klar, was ich an dir verliere.«
»Ich sterbe glücklich — aber — Ellen — noch einmal — ehe ich sterbe — mache — meine Todesstunde — zu meiner — schönsten.«
»Was soll ich tun?« drängte Ellen.
Wieder sah der Sterbende Harrlington an.
»Erlaubst du?«
Dem Lord ging eine Ahnung dessen auf, was er meinte. Er nickte.
Mit seiner letzten Kraft zog Davids der Geliebten Hand an sich und preßte seine schon kalten Lippen darauf. Da beugte sich Ellen zu ihm herab und küßte ihn auf den Mund. Er schlang seinen Arm um sie und hielt sie fest.
Da plötzlich sank sein Arm schwer herab. Als Ellen sich aufrichtete, lag Davids, mit einem heiteren Lächeln auf dem Antlitz, tot da — seine Seele war bei dem Kusse Ellens entflohen.
Diese richtete sich auf, aber nur, um sich vor einem Stuhl auf die Knie zu werfen, ihr Gesicht in die Hände vergrabend und still vor sich hinweinend. Harrlington stand mit gesenktem Kopfe vor dem toten Freunde und blickte in dessen Antlitz, das von einem heiteren Lächeln verklärt war, wie man es nur bei Starken, Edlen, Tapferen und Guten finden kann.
Dann trat er zu der Geliebten.
»Ellen,« sagte er und strich sanft über ihr aschblondes Haar, »stehe auf! Er hat recht, er ist eines herrlichen Todes gestorben. Er war besser als ich, er hat zu meinen Gunsten entsagt, weil er sah, daß ich dir mehr war, als er. Fürwahr, eine solche Kraft hätte ich nicht besessen. Er muß schwere Stunden durchgemacht haben, dir nahe zu sein, dich zu lieben und nichts zu sagen, weil er sah, daß du ihm nichts weiter warst, als eine Freundin. Aber nicht genug damit, er ist auch ein Freund dessen, den du liebst, er beschützt den, um den du dich bangst, er ist jederzeit bereit, sich für diesen aufzuopfern, und schließlich stirbt er, um dich zu retten, aber nicht etwa, weil er dich dann besitzen kann, sondern, um dich seinem Freunde zu erhalten. Er war der Edelste aller Edlen, die ich je kannte. Ist er auch tot, in unseren Herzen soll er immer lebendig bleiben und den Ehrenplatz einnehmen.«
Er richtete Ellen auf, die sich an seine Brust warf.
»Ich habe es nie gewußt,« flüsterte sie.
»Ich weiß es nun! Stritt mir doch Davids selbst immer ab, daß er eine Neigung zu dir besäße.«
»Ach, James, daß er sterben mußte!«
»Es war das beste für ihn, er hat genug Qualen auszustehen gehabt, nun hat er ausgelitten. Sag', Ellen, verringert dieses Geständnis des Toten deine Liebe zu mir?«
»O, James,« und Ellen warf sich ihm von neuem an die Brust, »du bist ja mein Ein und Alles auf der Welt. Und würde ich dich nicht mehr haben, würde Davids wieder auferstehen, er könnte mir nichts weiter als ein Freund sein, wenn auch der treueste und beste, aber meine Liebe gehört dir allein und könnte nimmermehr einem anderen zuteil werden. Wenn du stirbst, könnte ich auch nicht mehr leben, die edelste Freundschaft könnte mich nicht für deinen Verlust trösten. Jetzt erst, da mein Herz an deiner Brust erwärmt ist, weiß ich, was Liebe ist.«
»Und nur, wenn ich dich habe, bedeutet das Leben für mich noch Glück; wo du nicht bist, ist für mich der Tod,« sagte Harrlington zärtlich und drückte die Geliebte an sich.
Doch erschrocken blickte er auf, es war ihm, als hätte er es über sich ganz deutlich rascheln hören, ja, es deuchte ihm, als hätte er in der Luke, zu welcher die Leiter führte, ein schönes, aber von Schadenfreude verzerrtes Gesicht gesehen.
Da lachte es heiser hinter ihm auf. Er drehte sich um und sah den kranken Bewohner der Hütte mit herabhängenden Beinen auf dem Bette sitzen. Er schien sich über etwas zu belustigen, aber die Freude entstellte das Gesicht entsetzlich. Alles schien Hohn und teuflische Leidenschaft.
»Ist jemand da oben?« fragte Harrlington.
»Ja, ja,« grinste der Gefragte, »eine Schlange ist da oben, eine giftige Schlange.«
»Könnt Ihr sie nicht vertreiben oder töten?«
Harrlington glaubte erst, der Mensch spräche im Ernst, denn Schlangen, und besonders Klapperschlangen, gehen mit Vorliebe in Häuser und werden dort zur Plage.
»Ich vertreiben?« grinste der Mann wieder. »Warum soll ich sie vertreiben? Es ist ein so gutes, liebes Tierchen. Ja, töten, das wäre etwas anderes, aber das will sie nicht leiden. Sie sticht, wenn man sie anfaßt. Paßt auf, sie wird euch noch beißen, ja ja, ganz besonders euch, sie will nicht haben, daß ihr euch küßt! Sie haßt das. Hahaha!«
»Höre nicht auf ihn,« flüsterte Ellen, »er ist nicht recht klug im Kopfe, glaube ich!«
»Nicht recht klug im Kopfe?« wiederholte der Mann. »Paß auf, mein Täubchen, du wirst noch anders von mir denken lernen! Wenn euch die Schlange da oben gebissen hat, werdet ihr mich schon um Rettung vor dem Tode anbetteln.«
Harrlington kehrte ihm den Rücken; der Mann sprach wirklich irre. Dann fiel ihm aber ein, es könnte doch jemand da oben sein. Wie konnte der kranke Mann überhaupt allein hier leben?
Vorsichtig stieg er die Leiter hinauf und spähte in den dunklen, nur durch das kleine Loch erhellten Raum hinein, konnte aber nichts entdecken.
»Es mag wirklich eine Schlange gewesen sein, die dem Alten Gesellschaft leistet,« sagte er zu Ellen.
»Hat mir allerdings lange Zeit Gesellschaft geleistet,« krächzte es aus dem zahnlosen Munde weiter, »war ein liebes, kleines Tierchen, jetzt aber beißt sie. Möchte auch mich gern beißen, darf es aber nicht. Bei euch wird sie weniger Rücksicht nehmen. Denkt daran, was ich euch sage, ich spreche im Ernst!«
Das Gespräch wurde widerlich. Die beiden verständigten sich durch Zeichen, nichts mehr zu sagen. Sie wollten dem Menschen geben, was sie an Geld bei sich hatten. Nur das eine Gute hatte die Unterhaltung gehabt, daß sie die beiden in die Wirklichkeit zurückgeführt hatte.
Diese sah traurig genug aus.
Die Freunde gefangen, sie selbst noch nicht frei, sondern nur den Wächtern entschlüpft, auf jeden Fall verfolgt, fast ohne Waffen, von dem Holländer verlassen.
Doch jetzt galt es, Davids zu begraben. Mochten sie sich in einer noch so großen Gefahr befinden, diesen Freundschaftsdienst mußten sie dem Toten erweisen. Ein einfaches Grab genügte vorläufig. Die wahrhafte, tiefe Trauer mußte einstweilen alles übrige ersetzen; später war noch Zeit, dem edlen Freunde einen Grabstein zu errichten, wie er ihm gebührte.
»Wir wollen ihn hinaustragen,« sagte Harrlington leise, »wir müssen uns beeilen, die Sonne beginnt zu sinken, und ich möchte die Nacht nicht in dieser Hütte verbringen.«
»Vielleicht bleibt ihr doch hier,« krächzte der Kranke.
Sie bückten sich, um den Toten aufzuheben, auf dessen Gesicht noch immer das Lächeln stand.
Schon hatte Harrlington seine Arme unter den Körper geschoben, als diese plötzlich von hinten gepackt und zusammengepreßt wurden.
Da schrie auch Ellen schon auf und starrte entsetzt nach der Tür.
Einige Indianer hatten sich hereingeschlichen und Harrlington überwältigt, andere standen noch draußen. Aber Ellen beachtete sie nicht, sie sah nur die Gestalt im Türrahmen, ein Weib — Miß Sarah Morgan.
»Faßt diese da!« rief Miß Morgan und deutete auf Ellen.
Diese sprang mit ausgestreckten Armen vorwärts, um ihre Feindin zu greifen, zu erwürgen, aber im Sprunge fingen zwei Indianer sie auf und hielten sie fest.
»Besudele deine Hände nicht durch die Berührung dieser Elenden!« rief Harrlington bitter. »Sie wird ihrem Lohne nicht entgehen. Aber Menschen werden sie wohl schwerlich bestrafen können, sie ist selbst dem Henker zu verächtlich.«
Der Mann auf dem Bette, Eduard Flexan, lachte laut auf.
»Seht ihr wohl, wie die Schlange beißt? Ja, ja, ich habe es euch gesagt, ihr Biß tötet. Paßt auf, wie langsam ihr an dem Gifte sterben werdet!«
»Schweig!« herrschte ihn Miß Morgan an. »Lord Harrlington und Miß Petersen, versucht keinen Widerstand mehr. Laßt euch binden, und folgt den Indianern. Euer Leben ist geschützt, wenn ihr an keine Abwehr denkt.«
»Keine Förmlichkeiten! Tue mit uns, was du willst, nur laß uns nicht zu lange warten,« unterbrach sie Harrlington.
»So kommt!«
Den Gefangenen waren die Hände wieder auf den Rücken geschnürt worden. Doch Harrlington wollte noch nicht gehen.
Er nickte mit dem Kopfe nach der Leiche hinüber.
»Und dieser da?« sagte er. »Soll er als Fraß der Ratten hier liegen bleiben? Er ist ein Sohn des Lord von Montrose. Haben Sie ihn als Mensch gehaßt, so dehnen Sie den Haß wenigstens nicht auf den Toten aus.«
»Mir ist gleichgültig, was er ist,« entgegnete das Weib, doch dann, sich anders bedenkend, fuhr es fort: »Nun ja, ihm soll ein Begräbnis zuteil werden. Ich bin nicht so grausam, Lord Harrlington, wie Sie vielleicht von mir denken.«
Sie gab den Indianern in deren Sprache Befehle; der Leichnam wurde aufgehoben und hinausgetragen, während andere Indianer mit Tomahawks und Messern schon in die Erde gruben.
Harrlington und Ellen schauten mit wehmütigen Blicken zu, an ihr eigenes Leid dachten sie in diesem Augenblicke nicht mehr.
Das Grab war fertig; auf einen Wink Sarahs brachte ein Indianer eine Decke herbei, der Leichnam wurde hineingewickelt und ohne Sang und Klang hinabgesenkt. Die Erde fiel darüber und wurde mit den Füßen festgestampft. Nur eine kleine Erhöhung deutete an, daß hier jemand begraben lag.
»Miß Morgan!«
Das Weib wandte sich um. Lord Harrlington hatte sie gerufen, sie war darüber verwundert.
»Was wünschen Sie?«
»Geben Sie mir die Hände frei! Bei meiner Ehre, ich denke weder an Flucht noch an Gegenwehr.«
»Wozu?«
»Um meinem Freunde noch einen Liebesdienst zu erweisen.«
Miß Morgan schaute erst prüfend den Sprecher an, dann Ellen; sie lächelte leicht, zog ein Messer hervor und durchschnitt seine Fesseln.
Obgleich Harrlington diese Bitte in der Hoffnung gestellt hatte, daß sie ihm erfüllt werden würde, war er doch selbst erstaunt über die schnelle Gewähr. Doch die Indianer standen ja auf dem Sprunge, um ihn zu halten, falls er floh.
Harrlington ging auf einen Indianer zu und forderte dessen Tomahawk. Der Indianer verweigerte ihm denselben natürlich.
»Gib ihm die Waffe!« befahl das Weib.
Harrlington ging nach einem Busche; die Indianer wollten ihn umringen und zurückhalten.
»Laßt ihn gehen!«
Harrlington hieb einige Zweige ab, band mit einem Stricke ein Kreuz zusammen und pflanzte es dann auf das Grab, es durch Schläge mit dem flachen Tomahawk so tief wie möglich hineintreibend.
Dann warf er die Waffe weg und ging auf Sarah Morgan zu.
»Flieh' oder töte mich und dich!« flüsterte ihm Ellen zu.
Miß Morgan lächelte.
Harrlington legte die Hände auf den Rücken und sagte leise:
»Lassen Sie mich binden!«
Wieder wurde er gefesselt. Miß Morgan hinderte die Indianer nicht daran, aber ein eigentümliches Lächeln umspielte ihren Mund. Flexan hatte verwundert dieser merkwürdigen Szene zugeschaut.
»Sind Sie fertig?«
»Wir sind es.«
Die Indianer nahmen die Gefangenen in die Mitte, und der Zug setzte sich in Bewegung, Miß Morgan schloß sich ihm an, und Flexan blieb zurück.
Als sie um den Hügel biegen wollten, blieb Harrlington stehen und wandte sich um, desgleichen Ellen.

»Lebe wohl, John!« rief Harrlington noch einmal
dem Grabe zu, nur mit Mühe die Tränen zurückhaltend.
»Lebe wohl, John!« rief Harrlington noch einmal nach dem Grabe des Freundes hinüber — »Lebe wohl, John« rief auch Ellen.
»Lebe wohl, John, treuer Freund!« rief auch Ellen. »Wir werden dir wohl bald nachfolgen in jenes Reich, wo es weder Trauer noch Klagen gibt. Möchte es mir vergönnt sein, dich da wiederzusehen, wo man sich anders liebt als hier auf Erden, wo man die treue, edle Freundschaft Liebe nennt! Von dort kamst du. Diese Erde war kein Platz für dich, deine Tugenden waren überirdische. Ach, könnte ich dich dort wiedertreffen! Dort dürften wir uns lieben, ohne Eifersucht zu erwecken! Lebe wohl, John, schlummere sanft!«
Ellen brach in Tränen aus, und Harrlington wagte nicht, sie zu trösten. Er bedurfte selbst des Trostes.
Der Zug verschwand hinter dem Hügel.
Die Sonne sank, den Horizont mit einem purpurnen Hauche überziehend; sie durchleuchtete den Wald und färbte die Blätter golden, sie schlich sich durchs Gras, bis sie den kleinen Erdhügel erreichte, den sie mit ihren letzten Strahlen zu erwärmen suchte.
Doch der unter diesem Hügel lag, fühlte ihre Wärme nicht mehr, er brauchte sie auch nicht. Die Sonne ist Leben, ohne sie gibt es kein Leben auf der Erde. Ob es nicht besser wäre, die Sonne hätte nie die Erde mit ihrem belebenden Strahle geküßt?
Was hilft es, darüber zu grübeln? Es ist nun einmal so! Aber der da unten, welchen der Sonnenstrahl nicht mehr traf, wäre nicht froh gewesen, wenn derselbe ihn abermals zum Leben erweckt hätte, denn er wäre nur zu neuen Leiden und Entsagungen erwacht.
Jetzt fühlte er keinen Schmerz mehr. Der Körper wurde wieder zu dem, aus dem er geformt worden war; der Geist aber durchflog den Aether und vereinigte sich in glücklicher Vergessenheit mit der Kraft, von der er ausgegangen war.
Wie schon erwähnt, waren die terassenähnlichen Bauten, welche den Tempel des mexikanischen Gottes einschlossen, hohl. Es verliefen innerhalb der Mauer etagenweise übereinander angebrachte Gänge.
Diese wurden, so weit sie oberhalb der Erde lagen, also in dem Gebäude selbst, durch das Licht erleuchtet, welches durch in der Wand angebrachte Löcher hereinfiel. Aber unter der Erde befanden sich noch Gänge, zu denen das Tageslicht keinen Zutritt fand. Hier mußten brennende Fackeln es ersetzen.
Man konnte in jedem der einzelnen Gänge rund um die Ruinen herumgehen. In dem der Außenwand gegenüberliegenden Gemäuer befanden sich ebenfalls große Löcher, wenigstens in den oberen Räumen. Diese Löcher, in der inneren Gangwand dicht über dem Boden angebracht, waren so groß, daß sich ein erwachsener Mensch gebückt in sie hineinsetzen konnte, und unterzog man sich dieser Mühe, so konnte man in eine Art von Schacht sehen, dessen Boden unter der Erde lag.
Erleuchtet wurde er von dem Licht, welches von beiden Seiten durch die Scharten hereinfiel.
Solche Schächte waren früher als Grabgewölbe benutzt worden, jetzt aber konnte man in ihnen weder Särge noch Mumien erblicken.
Türen zeigten die Schächte nicht, da man aber wohl schwerlich von oben hinunter gelangen konnte, wollte man nicht den Hals riskieren, so mußte unten ein Zugang existieren. Die Türen lagen allerdings unter der Erde und konnten nur mit Hilfe eines Mechanismus' geöffnet werden, denn die alten Azteken, welche die Mumien heilig hielten, wollten fremde Hände von diesen fernhalten, sollte ihr Land doch einmal von Eroberern genommen werden.
Ihre Absicht war vergebens gewesen; kundige Finger hatten den Mechanismus gefunden, die Türen geöffnet, Menschen waren eingedrungen und hatten die Gewölbe zu anderen Zwecken verwandt, nachdem die Mumien entfernt worden waren.
In einem der oberen Gänge wandelte ein Indianer auf und ab. Obgleich der Gang in sich zurücklief, war es doch nicht so leicht, ihn zu finden, denn er zeigte unzählige Winkel, Ecken und Verstecke, manchmal schien sich ein Nebenweg abzuzweigen, der aber blind endete, und so konnte man sich oft verlaufen, ehe man die Runde gemacht hatte.
Doch der Indianer mußte hier bekannt sein; er verirrte sich nie, sondern machte regelmäßig seine Runde.
Ab und zu steckte er seinen Kopf durch eine der inneren Oeffnungen, bog den Oberkörper weit vor und konnte dann immer unten eine Gestalt sitzen, stehen oder auf- und abgehen sehen. Allerdings war der Raum mit drei Schritten durchmessen.
Wohin der Indianer auch blickte, fast jeder Schacht hatte seine Bewohner. Es waren Gefangene.
Männer waren es und Weiber in Männerkleidung, jede Person für sich; nur in einem Schacht befand sich ein junges Weib, welches ein Kind im Arme trug. Die meisten saßen apathisch am Boden, nur einige rannten die wenigen Schritte ununterbrochen auf und ab, wie ein sich nach Freiheit sehnendes wildes Tier in seinem Käfig.
Besonders an dem einen Loche verweilte der Indianer lange, und jedesmal, wenn er hinunterblickte, huschte ein verächtliches Lächeln über seine dunklen, trotzigen Züge. Wenn er sich zurückzog, legte er die Hand wohl auch drohend an den Tomahawk und murmelte etwas, was wie eine Verwünschung klang.
Am Boden jener Kammer, die immer wieder sein Interesse erregte, lag eine andere Gestalt; sie war in einen ledernen Anzug gekleidet und trug auf dem glatt rasierten Kopfe nur eine Skalplocke. Sonst mochte diese wohl mit Adlerfedern geschmückt gewesen sein, jetzt aber war sie deren bar, auch kein Oel machte sie mehr geschmeidig — schlaff und unordentlich hing sie über den Kopf, ganz passend zu dem Manne, der bewegungslos, das Gesicht auf der Erde, am Boden lag.
Ein Indianer, und zwar kein anderer als Stahlherz, wurde hier gefangen gehalten.
Der wachehaltende Indianer bekam manches Schimpfwort zu hören, das gegen die Rothäute geschleudert wurde. Sie stiegen besonders aus den Gemächern empor, welche die Trapper beherbergten, und jedesmal, wenn ein solches Schimpfwort an sein Ohr schlug, zogen sich die Augenbrauen des Wilden drohend zusammen.
Einmal mußte er von einem Manne unten gesehen worden sein, als er sich über die Mauer beugte.
»Verdammte Rothaut,« klang es herauf, »komm herunter, elender Halunke, ich habe ein Wort mit dir zu sprechen. Warte nur, ich will dir schon dein rotes Fell über die Ohren ziehen.«
Es war die Stimme Jokers, der trotz seines lahmen Beines wie ein Rasender auf- und abrannte.
Der Indianer erwiderte nichts; er zog den Kopf zurück und murmelte nur etwas Unverständliches vor sich hin.
Dann hob er den Kopf und lauschte, er hörte Schritte durch den Gang kommen. Er schmiegte sich an die Wand und ging geräuschlos dahin, von wo der Schritt kam.
Vor ihm standen ein Weib in grauem Kleide und ein Indianer.
Der indianische Wächter blickte mit allen Zeichen der Ehrerbietung auf die beiden.
Das Weib sprach etwas zu ihm und wandte sich dann an seinen Begleiter, der mit der Hand nach einer Oeffnung deutete. Dorthin begab sich das Weib, Sarah Morgan, beugte sich nieder und spähte aufmerksam hinunter.
Ihr Blick fiel auf einen Mann, der regungslos am Boden saß und trübe vor sich hinsah. Es war Lord Harrlington.
Dann ging sie einige Schritte weiter, an ein anderes Loch, und sie konnte Miß Petersen betrachten, welche ebenso teilnahmlos am Boden saß. Kein Schal, keine Decke schützte sie vor dem kalten Boden.
Auf des Weibes Gesicht spiegelte sich eine boshafte Schadenfreude, als es dieses Opfer betrachtete.
Die beiden Indianer hatten leise miteinander gesprochen, dann war der erste gegangen und in einem Seitenwege verschwunden, während der Neuangekommene für diesen die Bewachung der Gefangenen übernahm.
Miß Morgan hatte der Besichtigung der Kammern eine Minute geschenkt, jetzt ging sie an dem Wächter vorbei, der ehrerbietig zur Seite trat, und begab sich in ebendenselben Seitengang, den der fortgehende Indianer benutzt hatte.
Dieser Gang mündete in eine terassenartige Treppe, die in vielen Bogen und Winkeln abwärts führte. Der Weg war beschwerlich, die Stufen waren sehr hoch und noch dazu vielfach verschoben. Auch von hier führten wieder Seitengänge ab, und Löcher waren in den Wänden, von denen man nicht wußte, ob sie den Eingang zu neuen Wegen bildeten oder nicht.
Es war ein förmliches Labyrinth.
Miß Morgan war einige Stufen hinabgestiegen oder vielmehr hinabgesprungen, als sie um eine Ecke biegen mußte.
Entsetzt fuhr sie zurück — auf der zweiten Stufe lag lang ausgestreckt der Indianer, welcher soeben abgelöst worden war.
Er lag mit dem Gesicht auf dem Steine, hatte den Tomahawk an der Seite im Gürtel und zeigte, soweit man sehen konnte, keinerlei Verletzung. Ein Arm lag unter ihm, der andere hing an der Stufe herab.
Miß Morgan kam erst auf die seltsame Vermutung, der Mann schlafe. Sie näherte sich ihm vorsichtig und stieß ihn mit dem Fuße. Als er sich aber nicht rührte, erschrak sie fürchterlich.
Was war geschehen?
Doch Miß Morgan kannte das Gefühl der Furcht nicht. Sie zog einen Revolver aus der Tasche und blickte sich nach allen Seiten um, eilte, die Waffe schußbereit haltend, um die nächste Ecke, dann wieder nach der nächsten Biegung, ohne jemanden zu erblicken.
Langsam kehrte sie zu dem Indianer zurück.
»Sollte er bewußtlos geworden sein?« murmelte sie, »Das wäre bei einem Indianer etwas Neues!«
Wieder stieß sie ihn mit dem Fuße in die Seite, immer derber, aber er rührte sich nicht. Dann rollte sie ihn auf den Rücken, der Körper war noch warm, aber völlig leblos. Sarah blieb nicht lange im Zweifel darüber, daß der Indianer wirklich tot war.
Das Weib sah sich nochmals scheu um, ehe es an eine Besichtigung des Toten ging. Dann aber schlitzte es mit dem Messer ohne weiteres das baumwollene Jagdhemd auf, welches die Brust des Wilden umhüllte, und untersuchte diese, ohne irgend eine Wunde zu finden, ebensowenig wie an den Seiten, unter den Armen oder am Rücken.
»Merkwürdig,« dachte sie, »so kann er nur von einem Schlaganfall betroffen worden sein! Seit wann sind denn die Indianer so schwachnervig geworden?«
Sie ließ den Toten liegen und stieg kopfschüttelnd die Treppe hinunter, kreuzte mehrere Gänge, öffnete durch Bewegung von Mechanismen geheimnisvolle Türen oder ließ sich diese durch indianische Posten öffnen und gelangte so endlich in ein Gemach, welches schon unter der Erde lag und von oben beleuchtet wurde.
Dort traf sie auf Arahuaskar und einige Indianer, welche eben zwei gebundene Männer hereintrugen und dem alten Azteken zu Füßen legten.
Der eine von ihnen war förmlich in Stricke eingewickelt, er zeigte durch Blutspuren, daß er sich erst nach langem, heftigen Kampfe hatte binden lassen.
Finster blickte Arahuaskar auf die Gefangenen, welche vor ihm lagen.
Es mußte eben ein Verhör stattgefunden haben. Die Indianer machten sich schon wieder bereit, die beiden hinauszutragen.
»Siebenundzwanzig meiner roten Söhne hast du ermordet,« hörte Sarah den Alten in aufgeregtem Tone rufen, »so sollst du auch einen siebenundzwanzigfachen Tod erleiden.«
Das Weib hatte die beiden sofort erkannt. Es waren der Holländer und der Chinese, die vor einigen Tagen von ihr in der Hütte des Fallenstellers gesehen worden waren, als sie von dem oberen Raume aus die Szene unten betrachtete.
Also waren auch sie in die Hände der Indianer gefallen. Aber es hatte einen schweren Kampf gekostet, sie zu fangen. Siebenundzwanzig Indianer waren dabei getötet worden, jedenfalls von dem Holländer, der mit seinem Schwerte furchtbar gewütet hatte. Miß Morgan war ja selbst einmal Zeuge davon gewesen, wie gewandt der Holländer sein Schwert zu handhaben wußte.
Nun, es war wohl sein letzter Schwertkampf gewesen; an einem der nächsten Tage fand er den Tod zu Ehren des Kriegsgottes. Die Indianer brauchten viele Opfer, denn je mehr Blut floß, um so gnädiger blickte Huitzilopochtli auf sie herab. Die Rothäute, welche früher nur ihrem großen Geiste gehorchten, hatten die neue Lehre, welche den alten Gott predigte, mit offenen Ohren aufgenommen und waren jetzt Feuer und Flamme, Bleichgesichter lebendig zu fangen, um mit ihnen ihren alten Gott, den sie schon lange vergessen hatten, zu versöhnen.
Der Holländer lag mit starren Augen da, er verriet weder Angst noch Zorn, während der Chinese die geschlitzten Augen blitzschnell durch das Gemach von einem zum anderen schweifen ließ und dabei noch immer das schlaue Gesicht zeigte. Nur Aerger konnte dieses verwischen, aber keine Gefahr.
Jetzt wurden sie von den Indianern aufgehoben und hinausgetragen. Auch ihr Aufenthalt war vorläufig die Turmkammer.
Die geheime Oeffnung schloß sich sofort hinter den Trägern, Sarah war mit Arahuaskar allein in dem kleinen Gemach.
Der alte Indianer benahm sich gegen das Weib sehr zuvorkommend, er rückte auf dem Binsenlager etwas zur Seite, deutete auf den leeren Platz und forderte jenes auf, Platz zu nehmen.
»Was hat mir meine weiße Tochter zu sagen? Setze dich, du bist mir stets willkommen!«
Doch Miß Morgan, die hier wie zu Hause zu sein schien, setzte sich nicht, auch ging sie auf kein vertrauliches Gespräch ein. Mit kurzen Worten erzählte sie, wie sie, als sie die oberste Etage verließ, aus der Treppe die Leiche eines Indianers gefunden hätte, der eben erst abgelöst worden wäre. Nichts verriete, daß er sein Leben durch Gewalt verloren habe; sein Körper habe keinen Stich, kein Kugelloch aufzuweisen, sein Schädel sei nicht zerschmettert.
Ungläubig schüttelte der Alte den Kopf.
»Es ist so,« versicherte Sarah.
»Ich habe gehört,« entgegnete Arahuaskar nachdenkend, »ein Mensch kann auch ohne Krankheit sterben. Er fällt plötzlich um und ist tot, ohne vorher noch gesprochen zu haben.«
»Das ist es, was auch ich meine, der Indianer hat einen Schlaganfall gehabt.«
»Noch nie ist dies bis jetzt bei einem Indianer vorgekommen, ich habe es nur von Weißen erzählen hören.«
»Ich werde die Leiche hierherbringen und den alten Vater holen lassen,« sagte Sarah. »Er ist Arzt und kann dir sagen, ob meine Vermutung auf Wahrheit beruht.«
Sie setzte den Mechanismus in Bewegung. Ein Teil der Wand schob sich in das Gemäuer hinein, und schon wollte Sarah durch diesen künstlichen Ausgang in den Gang treten, als einige Indianer herannahten, die den leblosen Kameraden trugen. Sarah warf einen Blick auf den Mann und trat zurück.
»Sie haben ihn schon gefunden,« sagte sie zu Arahuaskar, »nun will ich den alten Vater holen lassen.«
Sie beauftragte einen Indianer damit.
Der Körper wurde niedergelegt.
»Wer ist dieser Krieger?«« fragte Arahuaskar.
Einer der Indianer trat vor.
»Der schwirrende Pfeil. Ich fand ihn auf einer Treppe, tot, doch ohne eine Verletzung. Der große Geist hat ihn gebraucht, denn der schwirrende Pfeil war ein tapferer Krieger.«
Der Indianer hatte schnell eine Erklärung gefunden.
»Wo fandest du ihn?«
»Auf der zweiten Treppe zur rechten Hand von hier. Er lag am Fuße des Blockes, der so gestürzt ist, daß er den Weg versperrt.«
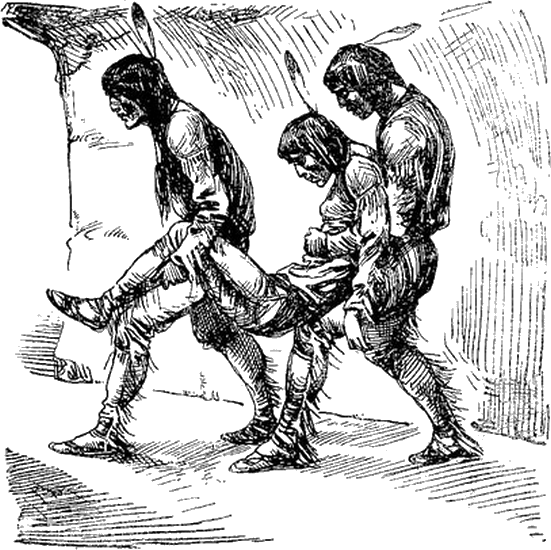
»Wie?« rief Sarah plötzlich. »Dort habt ihr ihn gefunden? Nicht in dem obersten Gange auf der ersten Treppe?«
»Dort waren wir nicht.«
Das Weib beugte sich tief auf den Toten hinab, und sah ihm ins Gesicht. Das Licht war zu schwach, um die Züge desselben deutlich zu erkennen. Indianer, welche nie einen Bart tragen, ähneln sich überhaupt sehr.
Doch da schrie Sarah wieder auf.
»Das Hemd ist auf der Brust nicht zerschnitten!«
Der Indianer zischte verächtlich.
»Ich brauche nicht erst das Hemd zu zerschneiden, will ich sehen, ob ein Messer den Körper getroffen hat. Auch an dem Hemd müßte dann ein Loch zu sehen sein.«
»Wohl, aber ich habe das Hemd zerschnitten.«
Jetzt sahen die Indianer die Sprecherin verwundert an.
»Auf,« fuhr Sarah fort, »folgt mir dahin, wo ich die Leiche fand!«
Sie stürmte hinaus, die Indianer ihr nach, und nach zehn Minuten kehrten sie zurück, einen anderen toten Indianer, denselben, den Sarah vorhin gesehen hatte, tragend.
Der alte, weißhaarige Mann war unterdes zu Arahuaskar gekommen, hatte die Leiche untersucht, zuckte aber nur mit den Achseln und erklärte, er könne nicht sagen, woran der Mann gestorben sei. Weder äußerlich noch innerlich sei etwas verletzt, und von den Schlaganfällen, die er kenne, läge keiner vor.
Die Bestürzung wuchs; sie steigerte sich zum Entsetzen, als noch eine dritte Leiche gebracht wurde. Der Mann war eines ebenso rätselhaften Todes gestorben, wie die anderen.
»Sie müssen an Gift verendet sein,« meinte Sarah.
Das wäre allerdings die einzige Lösung des Rätsels gewesen.
»Gut, ich werde die Magen der Leichen untersuchen,« erklärte der alte Gelehrte, welcher ebenso wie Arahuaskar wenig aus der Fassung kam, ein Zeichen des Alters, welches sich über nichts mehr so leicht wundert, während die jüngeren Indianer schauderten, teils stumpfsinnig die toten Gefährten betrachteten. Was über den Begriff des Indianers geht, das betrachtet er als etwas Uebernatürliches und befaßt sich nicht mehr damit. Darin hat er Aehnlichkeit mit dem Mohammedaner.
Arahuaskar ließ die Leichen hinaustragen, er wollte die beiden Weißen allein sprechen. Der Arzt gab den Indianern den Befehl, eine davon nach dem Raume zu bringen, den er bewohnte. Er wollte untersuchen, ob sie an dem Genusse giftiger Speisen gestorben seien.
»Wie zeigt sich Sonnenstrahl?« fragte Arahuaskar, als sie allein waren.
»Er ist willig,« entgegnete der Alte, »er lauscht mit Begeisterung meinen Erzählungen, er befolgt streng die Vorschriften, welche nötig sind, ihn vorzubereiten, und kann kaum die Zeit erwarten, da er vor die Krieger treten soll.«
Arahuaskar nickte befriedigt.
»Und Waldblüte?«
Der Alte zog ein mißmutiges Gesicht, warf einen Seitenblick auf Sarah und sagte dann:
»Wir haben einen Mißgriff mit ihr getan. Waldblüte paßt nicht gut für unsere Pläne, sie hat zuviele Wenn und Aber.«
»Ich dachte es mir. Seit wann aber war sie nicht mehr mit Sonnenstrahl zusammen?«
»Seit nur sechs Tagen.«
»So entflamme Sonnenstrahl noch mehr, mache ihn vor Stolz und Ehrsucht ganz trunken, dann bringe ihn mit seiner Schwester zusammen, bleibe aber bei ihnen und laß deine Bemühungen, sie willfährig zu stimmen, durch die seinen unterstützen!«
»Ich glaube fest, Waldblüte hat eine Ahnung, daß die, welche sie beschützen wollte, wieder gefangen worden sind.«
»Durch wen sollte sie es erfahren haben? Sie hat ihre Kammer doch nicht einmal verlassen.«
»Nein, dafür habe ich gesorgt. Aber es war falsch von uns, ihr die Löwin zu geben. Sie glaubte mir nicht, als ich ihr erzählte, ihre Freundin hätte sie ihr geschenkt. Ich konnte wohl merken, daß sie sich nur so stellte.«
Arahuaskar runzelte die Stirn.
»So versichere es ihr von neuem! So lange sie nicht völlig unser ist, darf sie nicht erfahren, daß die Weißen wieder hier sind. Hörst du? Nicht das Geringste. Hat Sonnenstrahl Argwohn geschöpft?«
»Er denkt gar nicht mehr an jene, er träumt nur von seinem künftigen Ruhme, Ich glaube, schon jetzt würde er nicht zögern, sie seinem Gotte zu opfern.«
»Sage es ihm noch nicht! Das Herz des Jünglings ist unbeständig. Ist er zum Häuptling erwählt, hat er das erste Blut fließen sehen, so wird er selbst das Opfer verlangen.«
Er wandte sich an Sarah.
»Meine weiße Tochter kennt die beiden Männer, welche meine Krieger vorhin brachten?«
»Ja. Doch sprachst du nicht gestern davon, als du mir ihre Gefangennahme erzähltest, du kenntest den Mann genau, er sei ein Feind der Engländer?«
»Den einen. Er ist ein unversöhnlicher Feind der Engländer gewesen, scheint es aber nicht mehr zu, sein.«
»Schade,« sagte Arahuaskar in bedauerndem Tone, »wir müssen jeden auf unsere Seite zu bringen suchen, der die Engländer haßt.«
»Aber nicht diesen Mann. Er ist von den Indianern mißhandelt worden, und ehe er sich gegen die Engländer wendet, würde er erst seine Rache an den Indianern nehmen. Er ist für uns verloren. Ueberhaupt traue ich ihm nicht mehr, ich habe gesehen, wie er einem Engländer die Hand schüttelte, und gehört, wie er ihn Freund nannte.«
»So muß er sterben! Wer ist der Kleine?«
»Ein Chinese.«
»Ein Fremder in unserem Lande — er stirbt!«
Arahuaskar winkte mit der fleischlosen Hand, doch Sarah bat, noch sprechen zu dürfen. Freundlich wurde ihr dies gestattet.
»Ich habe eine Bitte, an deren Erfüllung mir viel gelegen ist,« begann sie.
»Sprich!« ermunterte Arahuaskar sie, die Augen im Totenschädel mit sichtlichem Wohlgefallen auf der schönen Erscheinung haften lassend.
»Durch mich wurden jene zwei Flüchtlinge wiedergefangen, deren Entkommen vielleicht alles verraten hätte. Ich bitte daher, sie mir zu überlassen.«
»Was willst du mit ihnen beginnen?«
»Sie töten!«
Verwundert über diese kurze Antwort blickte Arahuaskar das Mädchen an.
»Ihr Los ist auch sonst kein anderes,« sagte er dann.
»Das weiß ich, aber sie sind meine Feinde. Ich will sie durch meine eigenen Hände sterben lassen.«
Arahuaskar überlegte, er blickte seinen Gefährten an, und dieser nickte unmerklich.
»So sei es, sie gehören dir!«
»Ich darf mit ihnen tun, was ich will?«
»Was du willst, das heißt, sie müssen sterben.«
»Das sollen sie. Kann ich Zutritt zu ihren Kammern erhalten? Das ist mir die Hauptsache.«
»Ich werde meinen Kriegern Befehl geben, daß sie dich jederzeit einlassen.«
Sarahs Augen leuchteten auf.
»Dann habe ich noch eine Bitte,« hob sie wieder an. »Erinnerst du dich meines Begleiters, welcher bei seinem Eintritt hier von Krämpfen befallen wurde?«
»Was ist mit ihm?«
»Ich möchte ihn bei mir haben.«
»Meine Krieger fürchten sich vor dem bösen Geiste, der in ihm wohnt.«
»Sie sollen ihn nicht zu sehen bekommen. Er kann heimlich bei Nacht hereingeschafft werden und einen versteckten Raum als Aufenthaltsort angewiesen bekommen.«
»Gut! Er darf herein. Doch hüte dich, daß die Indianer ihn in seinem wilden Zustande zu sehen bekommen. Nichts ist gefährlicher, als wenn sie glauben, böse Vorzeichen zu erblicken.«
»Ich werde dafür sorgen.«
Sarah verließ mit dem Alten das Gemach.
Während beide durch den finsteren Gang schritten und der Alte mit einer Blendlaterne den Weg beleuchtete, ergingen sie sich in Vermutungen über den Tod der drei Indianer. Der Gelehrte glaubte an eine Vergiftung, er wollte jetzt die Körper untersuchen, ob in ihnen Spuren eines Giftes zu finden seien.
Man fand innerhalb des Gemäuers noch hie und da Mumien, diese waren mit einer giftigen Substanz einbalsamiert worden, und leicht konnte es ja geschehen sein, daß die Indianer ihre Speisen zufällig mit solch einer Mumie in Berührung gebracht hatten, ohne daß sie es wußten.
»Haben Sie denn nicht daran gedacht,« begann Sarah, »daß unter den Gefangenen zwei Mann fehlen?«
»Doch, ich habe es sofort bemerkt und war darüber bestürzt.«
»Und schöpfte Arahuaskar nicht deswegen Argwohn?«
»Arahuaskar ist schon alt, sein Gedächtnis beginnt ihn zu verlassen, und ich hüte mich, ihn zu erinnern, damit er uns nicht mit neuen Besorgnissen quält.«
»Nun, es ist sehr leicht möglich, daß diese beiden Männer, Waldläufer, sich noch in der Ruine befinden und Spuk treiben.«
Ueberrascht blieb der Greis stehen.
»Glauben Sie das?«
»Es ist nur eine Vermutung.«
»Dann müßten sie die Indianer vergiftet haben,« entgegnete der Alte, den Weg fortsetzend. »Sind diese beiden wirklich entkommen, bleichen ihre Gebeine nicht irgendwo zwischen dem Gemäuer, sondern schlagen sie Lärm, so kann Arahuaskar ein Strich durch die Rechnung gemacht werden.«
Sarah lachte spöttisch, aber leise auf.
»Wir können ja offen miteinander sprechen,« sagte sie, »was uns hier hält, ist ja nur eine Privatsache. Sie interessieren sich für die Sache der Indianer doch ebensowenig wie ich. Ist unsere Rache befriedigt, dann gehen wir unsere eigenen Wege.«
»Was wissen Sie davon?« murmelte der Alte dumpf.
»Verstellen Sie sich nicht, ich weiß es ziemlich bestimmt,« entgegnete Sarah spöttisch. »Arahuaskar ist ja wahnsinnig mit seinen Plänen. Er paßt besser zu einem Narrenfürsten als zum Indianerbeherrscher, doch das gilt mir gleich. Die Gefangennahme dieser Männer und Mädchen hat er gut gemacht, mir ist Gelegenheit geboten, mich an einigen Personen zu rächen, und Sie haben doch auch keine andere Absicht.«
Der Alte murmelte etwas Unverständliches in seinen langen Bart. Daß er nicht widersprach, bezeugte, daß Sarah recht hatte.
»Können Sie Arahuaskar nicht bereden, die Sache schneller zu betreiben?« begann sie wieder.
»Er will warten, bis Vollmond ist. So schreibt es ein Gesetz der Azteken vor. Nie begannen sie einen Kampf eher, wenn sie auf sicheren Erfolg hofften.«
»Torheit!« murrte Sarah. »Bis dahin kann schon alles verraten sein. In vierzehn Tagen, vermute ich, ist das Grenzmilitär hier und hat die Ruine umzingelt.«
»Das habe ich Arahuaskar auch schon gesagt; er glaubt es aber nicht. Seine Antwort ist immer, so lange er Geiseln besitzt, könne ihm niemand etwas anhaben.«
»Ach, mit Geiseln rechnet der schlaue Fuchs also auch schon; da wird es Zeit, daß ich mein Werk beginne, sonst besinnt sich Arahuaskar noch anders und nimmt mir meine Beute wieder aus den Händen. Es gibt also kein Mittel, Arahuaskar zu schnellerem Handeln zu bewegen? Vorstellungen, daß Gefahr vorliegt, wenn er zögert, müssen doch wirken.«
»Ich habe alles versucht. Er wartet bis zum Vollmond.«
»Weshalb haben Sie denn Waldblüte zur Prophetin erzogen? Legen Sie ihr doch ein Orakel in den Mund, daß der Gott diesmal nicht zürnt, wenn der heilige Mondschein nicht abgewartet wird, sondern daß er gerade das Gegenteil wünscht.«
Der Alte lachte bei diesem Vorschlage spöttisch auf.
»Gewiß, das wäre ein Plan. Nur schade, daß Arahuaskar ebensowenig an Waldblütes prophetische Gabe glaubt wie ich.«
»Ach so, das hatte ich vergessen. Nun, machen Sie es ebenso wie ich; warten Sie nicht auf Arahuaskars Einwilligung, sondern gehen Sie allein vor! Ich bedaure, daß Sie betreffs Ihres Schicksals so zurückhaltend sind. Ich interessiere mich für Leute, welche gleich mir Rachegedanken hegen, und deren ganzes Leben in der Aufgabe liegt, dieselben auszuführen. Apropos, eine Frage habe ich doch an Sie. Ihrem Dialekt nach halte ich Sie für einen Holländer. Ist meine Vermutung richtig?«
Der Alte antwortete nicht, sondern tat, als hätte er die Frage völlig überhört. Jetzt bog er links in einen Gang ab. Die Blendlaterne beleuchtete Nischen, Winkel und Löcher in den Wänden.
Sarah wußte, daß sie sich nicht geirrt hatte — Schweigen ist auch eine Bejahung.
»Ich wollte Ihnen nur mitteilen,« fuhr sie fort, »daß jener Mann, der mit dem Schwert so blutig unter den Indianern gehaust hat und der vorhin als Gefangener eingeliefert wurde, ebenfalls ein ...«
Doch sie stieß plötzlich einen lauten Schrei aus, zog die Hand hastig zurück und drängte sich an den Alten. Sie war so erschrocken, daß sie an allen Gliedern zitterte und nicht, wie sonst, daran dachte, nach dem Revolver zu greifen.
»Was war das?« rief sie in entsetztem Tone. »Etwas Nasses berührte meine Hand.«
Der Alte war selbst erschrocken, doch nur über die Heftigkeit seiner Begleiterin. Schnell drehte er die Blendlaterne, und der Lichtstrahl klärte alles auf; er fiel gerade auf einen mächtigen, grauen Bären, der mit gesenktem Kopf vor Sarah stand und deren Füße beschnoberte.
Der Alte lachte sorglos.
»Barzam, alter Kerl,« sagte er und klopfte freundlich das zottige Fell. »Wie kannst du uns so erschrecken! Er hat mit seiner nassen Nase nur untertänig Ihre Hand geküßt, das macht er gern,« fügte er erklärend hinzu.
Sarah hatte vor dem Tiere, welches ihr fast bis an die Hüfte reichte, noch nicht alle Scheu verloren. Der graue Bär, Grislybär oder nur Grisly genannt, ist das fürchterlichste Raubtier Amerikas, vielleicht der ganzen Welt. Er wird von den dortigen Kolonisten mehr gefürchtet als der Löwe von den Kapbauern und der Königstiger von den englischen Koloniesoldaten, denn letztere tötet doch ein sicherer Schuß, der graue Bär dagegen stürzt sich noch mit zwanzig Kugeln im Leibe auf den Jäger und zerfetzt ihn. Seine Stärke, Wildheit und Grausamkeit gegen die Beute, der er lebendig die Glieder abreißt, hat nicht seinesgleichen.
»Der Grisly hat nur eine Tugend — er kann nicht klettern,« sagt der Hinterwälder.
»Es ist ekelhaft, wie diese Tiere hier umherschleichen,« rief Sarah unwillig, »auf Schritt und Tritt begegnet man den unheimlichen Gästen; sie sind hier so heimisch, daß sie selbst die geheimen Eingänge zu finden wissen und einem mitten in der Nacht Besuche abstatten. Ich bin schon oft bis zum Tod erschrocken, wenn ein Bär in meinem Zimmer sein Nachtquartier aufschlug. Und dabei muß man noch höflich gegen sie sein, sonst macht man Bekanntschaft mit ihren Tatzen.«
»O nein, unsere Bären sind alle zahm. Nur wenn sie gehetzt werden, sind sie gefährlich.«
»So? Arahuaskar hat mir selbst gesagt, ich sollte ja zart mit ihnen umgehen.«
»Weil die Bären den Azteken heilig waren, und Arahuaskar befolgt alle alten Gebräuche.«
»Alberne Sitte! Wieviele sind eigentlich hier?«
»Fünf. Drei davon sind mit Sonnenstrahl aufgezogen worden, die anderen sind später dazugekommen und von Arahuaskar selbst gezähmt worden. Er versteht sich auf dergleichen Künste, und Sonnenstrahl hat sie von ihm gelernt. Es gehört dies zu dem arrangierten Mummenspiel; es geht nun einmal die Sage, Sonnenstrahl oder besser der zukünftige Häuptling aller Indianer werde in Gemeinschaft von Bären auferzogen. Sie sagen sogar, er sei von einer Bärin gesäugt worden.«
Der Bär hatte sich unterdes nach Art seines Geschlechtes von einer Vordertatze auf die andere gewiegt, gemütlich gebrummt und des Alten Füße berochen. Er schien sehr guter Laune zu sein.
»Geh jetzt, Barzam,« sagte der Alte, ihm das Fell klopfend, »geh zu deinem Herrn!«
Gehorsam wendete der Bär sich um und entfernte sich in jenem schwerfälligen und doch so fördernden Trab, der diesen Tieren eigen ist. Der Alte ließ ihm den Strahl der Laterne folgen, bis er um eine Ecke gebogen war.
»Ich habe mich an die Tiere gewöhnt,« sagte er schwermütig. »Wenn man so weit kommt, schließlich alle Menschen zu hassen, so bleiben einem nur noch die Tiere als Freunde. Ich kann mich mit Barzam wie mit einem Menschen verständigen; er versteht jedes Wort von mir und ich sein Gebrumm. Selbst aus seinem Augen- und Mienenspiel kann ich seine Wünsche lesen. Sie lachen, weil ich von dem Mienenspiel eines Tieres spreche? Fragen Sie nur jemanden, der sich viel mit Tieren abgiebt, zum Beispiel einen Tierbändiger, noch besser aber den Dresseur von Hunden und Affen, der wird Sie eines Besseren belehren. Was das Mienenspiel des Tieres vor dem des Menschen so wertvoll macht, ist, daß es immer ehrlich ist. Das Tier kann darin nicht lügen, eine Verstellung ist darin ebenso unmöglich wie beim Ausdruck seiner Gefühle; Barzam liebkost den, welchen er liebt, und wen er nicht leiden kann, den knurrt er an. Wahre Aufrichtigkeit ist nur noch bei Tieren zu finden, nicht mehr bei Menschen.«
Er setzte mit seiner Begleiterin den Weg fort.
»Wohin gehen Sie?«
»Ich weiß gar nicht, wo ich mich befinde, ich bin Ihnen einfach gefolgt. Ich wollte nur einen Ausgang gewinnen, der mich ins Freie bringt.«
»Ohne Kenntnis der Gänge sind diese Pforten schwer zu finden. Einer, den der Instinkt nicht wieder zurückleitet, kann sich hier so verirren, daß er sich in einem Labyrinth zu befinden glaubt und nie wieder ans Tageslicht kommt. Der Fall ist schon passiert. Seien Sie deshalb vorsichtig! Kommen Sie mit mir, ich bringe Sie an einen Ausgang!«
Er bog rechts ab in einen anderen Gang.
Sie waren noch nicht lange gegangen, als der Alte sagte:
»Riecht das hier nicht ganz eigentümlich?«
Sarah sog die Luft ein.
»Ich kann nichts bemerken.«
»Es riecht so nach — nach ...«
»Wahrhaftig,« rief das Weib, »es riecht gerade wie in einer Schlächterei.«
Sarah glitt plötzlich aus und stürzte zu Boden. Aergerlich lachend erhob sie sich.
»Gerade ins Wasser gefallen,« sagte sie.
»Ins Wasser? Das ist wohl nicht gut möglich, die Keller sind vollständig trocken, und doch,« unterbrach sich der Alte, welcher auf den Boden geleuchtet hatte, »hier steht Wasser.«
Der ganze Boden des Ganges war mit einer großen Pfütze bedeckt; sie reichte von einer Seite bis zur anderen und floß auch in alle Ecken und Winkel hinein.
»Wie mag dies hierherkommen?« brummte der Alte.
Sarah hatte so ein eigentümliches, klebriges Gefühl an den Fingern. Sie hob dieselben und brachte sie an das Licht der Laterne, wo die Hände eine rote Farbe zeigten.
»Das ist kein Wasser,« schrie sie laut auf, »das ist Blut!«

»Das ist kein Wasser, das ist Blut!« schrie Miß Morgan
auf, als der Lichtschein die große Pfütze beleuchtete.
Der Alte tauchte kopfschüttelnd den Finger in die dunkle Flüssigkeit und betrachtete ihn dann ebenfalls im Licht. Er mußte Sarahs Behauptung bestätigen.
»Blut?« murmelte er in namenlosem Schrecken. »Wie in aller Welt kommt das hierher?«
Die beiden sahen sich lange Zeit sprachlos an, und gleichzeitig entstand in ihren Köpfen der Gedanke, ob dieses Blut mit den gefundenen Leichen im Zusammenhange stände. Die Vermutung lag nahe.
Scheu wurde die Laterne nach allen Richtungen gedreht. Das unsichere Licht machte die vorspringenden Ecken erzittern, verwandelte die Säulen in Gestalten und zauberte in die Nischen unheimliche Wesen mit glühenden Augen und grimmigen Gesichtern. Den beiden grauste es, doch waren sie nicht furchtsam genug, um an die Wahrheit ihrer Phantasiegebilde zu glauben. Der Alte war hier grau geworden, ihn schützte die Erfahrung vor Furcht, Sarah ihr angeborener Mut.
Sie fand auch bald die Sprache wieder.
»Wo so viel Blut geflossen ist,« sagte sie leise, »müssen auch Leichen vorhanden sein.«
»Und Mörder,« ergänzte der Alte.
Doch der Strahl der Laterne ließ weder einen Leichnam, noch ein lebendiges Wesen erkennen, die Blutlache erstreckte sich scharf abgegrenzt zu ihren Füßen, und keine Spur bezeichnete den Weg, den der Mörder mit seinem Opfer genommen.
Der Alte zog eine stählerne Pfeife aus den Falten seines Gewandes. Ein trillernder Pfiff schrillte durch das Gemäuer.
»Was unsere Augen nicht sehen können, wird denen der Indianer nicht verborgen bleiben,« sagte er. »In einigen Minuten sind unsere Diener hier.«
Er ließ die Pfeife in kurzen Zwischenpausen ertönen, um die Indianer zu sich zu leiten.
»Halt,« rief Sarah plötzlich, »wir haben ja Barzam vollständig vergessen. Sollte der Bär ein Tier oder vielleicht auch einen Menschen zerrissen und verschlungen haben?«
»Diese Bären rühren kein Fleisch an,« sagte ihr Begleiter bestimmt. »Arahuaskar hat sie an eine ausschließliche Pflanzenkost gewöhnt.«
»So greifen sie keinen Menschen an?«
»Doch! Auf Befehl ihrer Herren werfen sie sich auf jeden, der ihnen bezeichnet wird, mit der größten Wut und zerfleischen ihn, nie aber fressen sie ihn. Sie haben einen Widerwillen vor Fleisch bekommen. Barzam also hat dieses Blut auf keinen Fall vergossen.«
»Kann er selbst es nicht verloren haben?«
»Dann wäre er wohl nicht so gemütlich gewesen. Und weiter, betrachten Sie nur diese Blutlache! Der stärkste Büffel wäre bei solch einem Blutverlust verendet.«
In der Ferne wurden Lichter sichtbar, Indianer, die ständigen Bewohner der Ruine, kamen herbeigeeilt. Schnell waren sie verständigt, sie überwanden das Entsetzen, das sie bei der Mitteilung befiel, und begannen Nachforschungen zu halten, aber von der Blutlache führte keine Spur ab.
Selbst der Bär konnte sie nicht überschritten haben, sonst hätte man die blutigen Abdrücke seiner Tatzen erkennen müssen; auszuweichen war der Lache nicht, also mußte er vor ihr umgekehrt sein.
Es wurde nichts gefunden. Arahuaskar selbst wurde gerufen, auch er stand vor einem Rätsel.
Durch die zahllosen, unterirdischen und überirdischen Gänge der Ruine streiften Banden von Indianern, bewaffnet und mit Fackeln versehen, keine außergewöhnliche Fußspur, kein Stückchen Zeug, kein verdächtiger Laut wäre ihnen entgangen, aber immer kamen sie mit der Meldung zurück, nichts Verdächtiges gefunden zu haben.
Am nächsten Tage aber wurden die Bewohner der Ruine abermals in den höchsten Schrecken versetzt. Zwei Indianer waren wieder auf eine neue, von der ersten weit entfernten Blutlache gestoßen. Von ihr führten auch unförmliche Spuren ab, man konnte nicht erkennen, ob sie von einem Menschen oder Tiere herrührten, es waren nur runde Flecke, dann aber hörten sie plötzlich ganz auf und blieben verschwunden. Das Blut mußte eben erst geflossen sein, es rauchte noch.
Fehlte unter den gegenwärtigen Indianern in der Ruine einer? Nein, außer den drei Kriegern, deren Leichen gefunden wurden, keiner, und deren Körper enthielten noch alles Blut, aber ebensowenig konnten sie an Gift gestorben sein, der alte Gelehrte hatte sie genau untersucht und keine Spur davon in ihnen gefunden.
Von wem stammte dann das Blut?
Diese Frage hielt die Bewohner der Ruine und deren Gäste in beständiger Aufregung. Man flüsterte leise miteinander. Der Name Huitzilopochtli ward öfter denn je hörbar, und gingen die Indianer an einer mit Riegeln und Schlössern bedeckten, eisernen Tür vorüber, so beschleunigten sie ihren Schritt und drückten sich ängstlich an die Wand. Hinter dieser Tür sollte sich das Standbild des nach Blut dürstenden Kriegsgottes befinden, und in diesem wohnte er selbst.
Hatte er das Blut den Indianern vor Augen gezaubert, um sie daran zu erinnern, daß sie mit dem Schlachten der Opfer nicht mehr lange zögern sollten? Hatten jene Krieger, deren Leichen man gefunden, an seiner Macht gezweifelt, vielleicht gar über ihn gespottet?
Der schlaue Arahuaskar wußte diese ihm selbst rätselhaften Vorkommnisse auszubeuten, er sorgte dafür, daß Huitzilopochtli noch mehr Anhänger fand. Der Kriegsgott hatte deutlich zu seinen roten Kindern gesprochen.
Miß Sarah Morgan hatte wirklich recht gehabt, als sie sagte, die Bären in der Ruine wären lästige Tiere. Sie waren in den Gängen zu Hause; bei Tag und Nacht schlichen sie umher, und es schien ihnen ein ganz besonderes Vergnügen zu bereiten, einen Ahnungslosen bis zum Tode zu erschrecken.
In den unteren Gängen herrschte eigentlich immer Nacht. Nur Fackeln oder Laternen erhellten die Finsternis, und gerade deshalb hielten sich die Bären mit Vorliebe in den Kellern auf. Der einsame Wanderer, der seinen Weg mit der Fackel beleuchtete, konnte sicher darauf rechnen, daß er plötzlich von hinten am Gewand gepackt und festgehalten wurde, oder, daß ihn ein zottiges Fell streifte oder eine nasse Schnauze seine Hand berührte. Da nie das geringste Geräusch solch eine Begegnung ankündigte, so erschrak natürlich der Ueberfallene stets heftig, die Indianer, welche hier fremd waren, am allermeisten, besonders, da sie sich an einem sowieso unheimlichen Orte befanden, von dem die Sage ging, daß es in ihm nicht ganz geheuer sei.
Aber selbst die hier heimischen Indianer erschraken bei solch einer Begegnung oft tödlich. Die Flamme der Fackel malte zitternde Schatten an die Wand, alle Ecken, alle Gegenstände bekamen Leben, und wenn das Gemüt des furchtsamen Indianers aufgeregt worden war, wenn er die Götter und Unholde der alten Azteken vor seinen geistigen Augen in wildem Reigen durch die Gänge tanzen sah, dann umschlangen ihn auch noch unvermutet von hinten ein Paar haarige Pranken, und ein rauher Kopf schmiegte sich an den seinen.
Was Wunder, wenn die Bären mit Scheu betrachtet wurden? Es hätte nicht erst des Befehles von Arahuaskar bedurft, seine Lieblinge vor Mißhandlung zu schützen. Niemand wagte, sich den Bären gegenüber auch nur unwillig zu zeigen, ja, man getraute sich nicht einmal, ihnen in Gedanken zu zürnen, hatten sie ein Unheil angerichtet, aus Furcht, man könnte sich die Ungnade der Tiere zuziehen.
Barzam und seine Genossen konnten aus- und eingehen, wo sie wollten; was sie fanden, gehörte ihnen. Keine Speise lag ihnen versteckt genug; sie kannten alle geheimen Eingänge, alle Mechanismen, und nur zu oft kam es vor, daß ein Indianer neben seinem Lager auf der bloßen Erde schlafen mußte, weil es Meister Petz beliebte, seinen mächtigen Leib auf dem weichen Binsenbett, das mit Decken belegt war, zu dehnen. Als einmal eine Bärin Junge bekommen, waren alle wollenen Hemden, welche die Indianer nicht gerade auf dem Leibe trugen, von den Wänden verschwunden, und nach langem Suchen fand man sie in einem Winkel zu einem bequemen Lager zusammengelegt, auf welchem die Bärin ihre zwei Jungen säugte. Von einer Herausgabe der notwendig gebrauchten Kleider war keine Rede. Die Rothäute dachten auch gar nicht an eine Forderung, sie freuten sich vielmehr über das Tier.
Bis jetzt war Miß Morgan allerdings noch von unliebsamem Besuche verschont geblieben, aber da sie den Teufel an die Wand gemalt hatte, kam er auch. Möglich war es freilich, daß der kluge Barzam ihre Worte verstanden und diese seinen Kameraden mitgeteilt hatte, kurz, das Weib wurde seitdem öfters von einem der Bären in der Behausung aufgesucht.
Es war am Abende nach dem Tage, an welchem die zweite Blutlache entdeckt worden war.
In tiefen Gedanken schritt Miß Morgan den Gang entlang, der sie nach der von ihr bewohnten Kammer brachte. Eine mit Rüböl gespeiste Lampe beleuchtete den unterirdischen Weg, denn auch ihre Kammer lag unterhalb der Erde. Dunkelheit war der einzige Uebelstand, welcher hier herrschte, sonst hatte Sarah nichts zu vermissen.
Die Räume waren alle vollkommen trocken und wurden von oben durch Löcher, welche aber kein Licht einließen, gut ventiliert. In der Ruine mußten Vorräte aller Art aufgespeichert sein, denn Sarah war mit einem ganz behaglichen Bett versehen worden, hergestellt aus Kissen, Decken und Polstern.
Selbst ein Tisch und ein Stuhl befanden sich in dem geräumigen Gemach, und in einer Ecke standen zwei große Koffer, die Effekten des Weibes enthaltend.
Sarah hatte von außen den sehr einfachen Mechanismus in Bewegung gesetzt, und die Tür schob sich in die Wand zurück. Es war einfach eine Schiebetür, welche beiseite gezogen werden konnte. War sie geschlossen, so war sie von dem Korridor aus kaum zu bemerken, nur eine kleine Nische verriet dem Kenner der Geheimnisse dieser Ruine deren Vorhandensein.
Sarah setzte die Lampe auf den Tisch, ging dann nach der Ecke und öffnete einen der Koffer, dem sie eine Anzahl von Briefen und Schriftstücken entnahm. Sie breitete dieselben auf dem Tische aus und begann, auf dem Stuhle Platz nehmend, dieselben zu sortieren.
Bald hatte sie den gefunden, den sie gesucht. Es war eine kräftige, kühne Männerhandschrift, welche sie lange betrachtete, anscheinend, ohne den Inhalt des Briefes selbst zu lesen.
»Ich werde es versuchen,« murmelte sie dann, den Brief beiseite legend und aus einer Tischlade Tinte, Papier und Schreibzeug nehmend. »Bin ich darin auch nicht so geübt, wie andere, so wird es mir schon gelingen. Aufregung, Angst und ganz besonders die Dunkelheit verdecken etwaige Mängel.«
Sie begann ganz langsam auf dem Papier zu malen, abwechselnd den Blick auf den vorliegenden Brief, dann auf die unter ihrer Feder entstehenden Schriftzeichen richtend. Ein Buchstabe reihte sich neben den anderen, bis endlich die Worte ›James Harrlington‹ entstanden waren.
So täuschend die Unterschrift auch der auf dem Brief nachgeahmt war, nach längerem Vergleichen mußte Sarah mit ihrem Werk doch nicht zufrieden sein, sie schüttelte mißbilligend den Kopf und begann die Schreibversuche von neuem.
Das zweite Mal war sie ungeduldiger. Sie schrieb schneller, und die Folge davon war, daß ihre Schrift dem Muster noch weniger ähnlich, als vorher, wurde.
Aergerlich warf sie die Feder hin und zerriß das Papier mit den Schriftproben in kleine Stücke.
»Morgen früh will ich ernstlich damit beginnen,« sagte sie aufstehend. »Heute bin ich zu aufgeregt dazu. Ich muß die alte Regel beherzigen: Das erste Mal muß es gut ausfallen, oder man muß es auf den anderen Tag verschieben; der zweite Versuch mißlingt stets. Ich habe ja noch einige Tage Zeit, unterdes kann ich andere Vorbereitungen treffen. Und schließlich wäre Harrlingtons Brief an Ellen gar nicht nötig. Besser wäre es allerdings, wenn sie getäuscht würde. Schon ihr Schmerz wäre für mich eine Wonne.«
Sie raffte die Schriftstücke zusammen und wandte sich, um sie wieder nach dem Koffer zu bringen, blieb aber mit einem leisen Schreckensschrei stehen.
Vor ihr stand, den Kopf tief auf den Boden gesenkt, mit der Nase umherschnüffelnd und sich auf den Tatzen wiegend, ein Bär, kleiner als Barzam, aber noch immer stattlich genug.
Sarah kannte das Tier wohl, es war die einzige Bärin in der Ruine, Mythra genannt.
Wie das Tier hereingekommen war, wußte sie nicht, sie hatte wenigstens kein Geräusch gehört, und die Tür war noch geschlossen. Doch die Tiere wußten ja, wie man die Türen offnen und zurückschieben konnte, oder es wäre auch möglich gewesen, daß Mythra unter dem erhöhten Bett geschlafen hatte und nun hervorgekrochen war, um den Bewohner des Raumes zu begrüßen.

Miß Morgan hatte den Schrecken überwunden, sie wurde jetzt ungehalten über den frechen Eindringling, der ihr den Weg nach dem Koffer sperrte. Doch Mythra war, wenn auch nur ein weibliches Wesen; doch noch immer ein mächtiger Bär; grob durfte man sie auf keinen Fall behandeln, sondern sehr zuvorkommend.
»Geh!« sagte Sarah und suchte das Tier zurückzudrängen.
Die Bärin schmiegte sich aber noch dichter an das Weib, so daß es sich an dem Tische festhalten mußte, um nicht zu fallen, und stieß ein freundliches Brummen aus.
Sarah streichelte das zottige Fell und kraulte in den dichten Haaren; der Bär brummte noch mehr, wich aber keinen Zoll zurück, er drängte sich noch dichter an sie.
Ein fortgeworfener Papierknäuel hatte gar keinen Zweck, Mythra war nicht spielig, sie wollte es nur gut meinen.
Sarah fuhr fort, den Bären zu streicheln, ihm Kosenamen zu geben, aber — sie konnte nicht an ihren Koffer kommen. Die Papiere in der Hand, stand sie noch immer da und wurde gegen den Tisch gedrängt.
Sarah war halb ärgerlich, halb belustigt über den Bären, der in seinen Gunstbezeugungen so hartnäckig war. Schließlich wurde es ihr aber doch etwas bange, als das Tier sie nicht freiließ. Es zurückzudrängen hatte gar keinen Zweck — der Bär stand wie eine Mauer.
Auf die Gefahr hin, das Tier zu erzürnen und gefährlich zu machen, griff Sarah zu einem anderen Mittel. Sie nahm die trübe brennende Oellampe vom Tisch und näherte sie der Schnauze des Baren, hoffend, daß das Licht und die Wärme der Flamme ihn zurückschrecken würden.
Wirklich, sie hatte sich nicht getäuscht.
Kaum kam die Lampe dem Kopfe des Bären zu nahe, als er mit einem plumpen Satze zur Seite sprang und einen mißtrauischen Blick nach dem Mädchen warf, ohne aber in seinem gemütlichen Brummen einzuhalten.
»Siehst du,« lachte Miß Morgan. »Ich bin doch schlauer als du. Warte, Petz, nun weiß ich, was du nicht vertragen kannst!«
Der Bär schnüffelte im Zimmer umher, während Miß Morgan neben dem Koffer niederkniete, die Lampe hinsetzte und die Papiere wegpackte.
Noch nicht lange war sie so beschäftigt, als der Bär sich schon wieder neben ihr befand und ihr neugierig zusah. Sarah achtete seiner erst nicht, weil er sich ruhig verhielt, als aber seine Tatze plötzlich in den Koffer fuhr und zwischen den Briefen zu wühlen begann, mußte sie abermals daran denken, sich seiner zu entledigen.
Zureden und Drohungen mit Worten halfen nichts; der Bär warf die Papiere umher, kehrte die Kuverts um und tat überhaupt gerade so, als könne er die Schrift lesen.
Sarah klappte den Koffer zu, ein Tatzenschlag öffnete ihn wieder, die ungeheure Pranke wühlte weiter, und als die Besitzerin des Koffers den Versuch wiederholte, den Deckel zuzuschlagen, wobei die Tatze dazwischen geriet, wendete der Bär den Kopf ihr zu und stieß ein so unheimliches Knurren aus, daß sich Sarah schnell erhob und in Sicherheit brachte.
Der Bär verstand keinen Spaß, wenn man ihm nicht seinen Willen ließ. Doch jetzt brummte er schon wieder gemütlich und fuhr fort, die Papiere zu zerstreuen und umzuwenden, gerade als hätte er an ihrem Inhalt Interesse.
Sarah dachte daran, wie sie Mythra schon einmal in die Flucht getrieben hatte; sie war nicht gesonnen, sich den ganzen Koffer um und um wühlen zu lassen. Im übrigen hielt sie den Bären für ein gutes, etwas dummes Geschöpf, das ging ja daraus hervor, wie tölpisch er sich mit den Papieren beschäftigte.
Sie näherte sich vorsichtig dem Koffer, brachte mit einem Griff die Lampe in ihren Besitz und führte diese dem Bären vor die Schnauze.
Der Bär hob die Nase, erschrak aber diesmal nicht wie vorhin; er war doch nicht so dumm, wie Sarah glaubte. Plötzlich herrschte vollkommene Dunkelheit in dem Gemache — der Bär hatte die ihn bedrohende Flamme, vielleicht nur unabsichtlich, durch einen Atemstoß ausgeblasen.
Sarah mußte lachen. Schnell schlug sie auf einem Feuerzeug Licht und entzündete die Lampe wieder. Ihr Strahl fiel auf den Bären, der trotz der Dunkelheit fortgefahren hatte, in den Papieren zu stöbern und jetzt zwischen ihnen schon eine ganz beträchtliche Unordnung angerichtet hatte.
»Vermaledeites Tier,« murmelte Sarah, wagte aber nicht zum zweiten Male, den Bären mit der heißen Lampe zu verscheuchen. Er hätte den Spaß doch einmal übel verstehen können.
Sie ließ dem Tiere seinen Willen, setzte sich auf den Stuhl und betrachtete den Störenfried. Entweder mußte der Bär jetzt, da er nicht mehr gestört wurde, seiner Beschäftigung überdrüssig geworden sein, oder er hatte sich überzeugt, daß in dem Koffer nichts für ihn Wertvolles sei, er ließ ihn in Ruhe, ging nach der Tür und streckte sich dort behaglich aus, den Kopf gerade an die Stelle schmiegend, wo die Tür zurückgeschoben werden konnte.
Schnell schloß Sarah den Koffer, steckte den Schlüssel in die Tasche und begann zu überlegen, wie sie den unverschämten Gast entfernen und auch für spätere Zeit am Zutritt in ihre Kammer ein für allemal hindern könne. Doch wollte sie erst den unliebsamen Gast auf anständige Weise hinauskomplimentieren, und dies glaubte Sarah am besten dadurch zu erreichen, daß sie selbst die Kammer verließ.
Ein Druck öffnete die Tür.
»Komm, Mythra, komm mit mir!«
Willig stand der Bär auf und verließ mit ihr das Gemach, blieb aber wartend draußen stehen, während sie die Tür wieder schloß. Als sie durch den Gang schritt, trabte der Bar hinter ihr her.
»Er wird mir doch nicht folgen wollen?« dachte Sarah. »Erwünscht wäre mir seine Begleitung zu dem Gange, den ich jetzt vorhabe, eben nicht.«
Aber sie hatte sich nicht geirrt, Mythra folgte ihr wirklich auf Schritt und Tritt nach; mochte sie sich wenden, wohin sie wollte und in andere, schmale Gänge einbiegen, immer war der Bär auf ihrer Ferse.
Sarah begegnete einem der ständigen Bewohner der Ruine. Der Indianer schritt, eine brennende Fackel in der Hand, der Behausung Arahuaskars zu.
»Halte den Bären zurück, er soll mir nicht folgen!« befahl Sarah dem Mann.
Sogleich beschäftigte sich der Indianer mit dem Tiere, lockte es und suchte es auch am Fell zurückzuhalten, während Sarah davonging, aber der Bär schien gar nicht zu merken, daß ihn jemand gefaßt hielt.
»Scheuche ihn mit der Fackel zurück!«
Wohl führte der Indianer diesen Befehl aus, er schwang drohend die Fackel vor des Bären Nase, da aber traf ihn ein Tatzenschlag, daß er den Arm mit einem Weheruf sinken ließ, und im nächsten Augenblicke wurde er unter zornigem Geknurr so an die Wand geschleudert, daß ihm alle Knochen krachten.
Der Indianer hatte an dieser Lektion genug, er machte, daß er fortkam, und auch Sarah setzte ihren Weg fort, ohne von dem Bären verlassen zu werden; sie mußte sich seine Begleitung eben gefallen lassen, er trat hier mit dem Rechte des Stärkeren auf.
Eine andere geheime Tür brachte sie ins Freie. Sie versuchte, durchzuhuschen, ohne daß der Bär ihr folgen konnte, denn diesen Mechanismus hätte er allein wohl nicht zu bewegen gewußt, Meister Petz jedoch schmiegte sich immer dicht an sie, und wohl oder übel mußte sie mit ihm auch das Freie betreten.
Sie befand sich zwischen den Trümmern des Säulentempels. Es war Nacht, aber der Mond beschien hell die weißen Säulen, die Zeugen von einstiger Pracht und Herrlichkeit. Der Platz mit den zerstreuten, gestürzten und geborstenen Postamenten und Pfeilern machte den Eindruck eines Leichenfeldes; der bleiche Mondschein erhöhte noch das Grausige der Szenerie.
Sarah schritt zwischen den Steinblöcken hindurch dem nahen Walde zu, immer in Begleitung des Bären, und sie war jetzt froh darüber, das anhängliche und riesenstarke Tier bei sich zu haben. Die unheimliche Stille an diesem schauerlichen Orte, der nur von dem geisterhaften Gekrächz des Käuzchens unterbrochen wurde, ließ ihr Herz doch schneller schlagen; das freundliche Gebrumm des Bären aber beruhigte es wieder.
Sie hielt die eine Hand in dem zottigen Fell desselben versteckt und kraute es. Es hatte etwas Beruhigendes für sie, ein solch starkes Geschöpf in der Nähe zu wissen.
Nur einmal fiel ihr etwas ein, worüber sie sich wunderte. Es war ihr doch, als hätte ihr ein Indianer oder der alte Vater gesagt, die Bären dürften nie in's Freie, täten es auch gar nicht mehr, und Mythra trottelte so sicher zwischen den Steinen herum, als wäre sie hier groß geworden. Möglich, daß dies nur ein verbotener Spaziergang war, dessen sich die Bären vielleicht öfters erfreuten.
Sarah verließ jetzt die Ruine und trat in den Wald, welcher aber, wie schon erwähnt, auch noch von Mauern und kleineren Gebäuden eingenommen wurde. Einem der letzteren, einem noch gut erhaltenen Steinhause, näherte sich Sarah, den Bären noch immer an ihrer Seite.
Als sie die offene Tür des fensterlosen Hauses erreicht hatte, kam ein leises Zischen von ihren Lippen, und sofort zeigte sich, daß diese Priesterwohnung der alten Azteken noch andere Wesen beherbergte, als Kröten, Fledermäuse und Schlangen.
»Sarah, bist du's?« klang eine krächzende Stimme, die so recht in dieses Haus paßte, heraus. »Du bleibst lange.«
»Ich konnte nicht eher kommen. Hast du lange auf mich gewartet?«
»Zwei Stunden schon hocke ich in diesem Loche und lausche dem Quaken der Frösche und dem Rascheln der Schlangen. Aber sie hüten sich, mich zu beißen; sie denken, sie könnten eher sterben als ich, wenn sie mich vergifteten Menschen verletzen.«
»Laß diesen Hohn, wer heißt dich denn überhaupt, dich in dieses Haus zu verkriechen? Du solltest doch nur in der Nähe desselben sein und dich im Gebüsch versteckt halten.«
»Ich fühle mich wohl, wo sich nur Nachttiere aufhalten. Auch ich bin ein lichtscheues Wesen geworden.«
»Es ist Nacht, komme jetzt heraus!«
Sarah war vor der Tür stehen geblieben, der Besitzer der heiseren Stimme aber kam heraus. Es war Eduard Flexan.
Selbst der Bär schien vor dieser ekelhaften Gestalt zu erschrecken; er hob sich auf den Hinterbeinen empor, warf sich dann aber kurz herum und kroch in den Schatten eines Baumes.
»Hahaha,« grinste Flexan, »selbst dein Begleiter hat einen zu ästhetischen Geschmack, um meinen Anblick ertragen zu können. Der schöne Eduard Flexan hätte nicht gedacht, daß bei seinem Anblick einst Mensch und Tier davonlaufen würden. Aber wie steht es nun? Hast du mich hierherbestellt, um mich in die Ruine zu bringen?«
»Ja, Eduard, eben darum! Es hat mir viele Bitten und große Ueberredungskunst gekostet, ehe ich es fertiggebracht habe, aber für dich scheute ich keine Mühe.«
»Hatte es auch satt, draußen in der zugigen und einsamen Hütte zu schlafen. Ich habe noch immer Lust zu leben, Sarah, kannst dich drauf verlassen, wenn ich auch nur noch ein wandelnder Leichnam bin. Aber die Hoffnung, Sarah, hält mich noch am Leben, die Hoffnung, meine Rache befriedigen zu können.«
»Dies kannst du jetzt tun, die Gefangenen sind alle hier, und über die, welche uns beiden besonders angehen, kann ich nach Willkür verfügen. Wir können sie töten oder martern, soviel wir wollen.«
»Wen?«
Sarah wurde über diese Frage unwillig.
»Nun, Harrlington und Ellen natürlich,« rief sie, »wen denn sonst, Törichter!«
»So willst du Ellen martern?«
»Natürlich. Jeden Blutstropfen will ich ihr langsam abzapfen. Oder hattest du es mit der, die dich verschmähte und verachtete, vielleicht anders vor? Ah so — —«
Sarah beugte den Kopf zurück und brach in ein schallendes Gelächter aus, dessen Echo den Wald ertönen machte.
»Was hast du, Weib?« murmelte Eduard bei diesem Ausbruch von Lustigkeit grimmig.
Es dauerte lange, ehe Sarah sich beruhigt hatte.
»Ich verstehe dich,« sagte sie endlich, noch immer manchmal vom Lachen unterbrochen, »du hast noch nicht alle Hoffnung aufgegeben, daß du Ellen für dich gewinnen könntest. Armer Mann, du dauerst mich! Wärest du bei vollem Verstande, so müßtest du die Hoffnungslosigkeit deiner Absichten einsehen.«
Eduard packte das Weib hastig am Arme und schüttelte es, so sehr sich auch Sarah sträubte und sich von dem Griffe, vor dem sie sich ekelte, zu befreien suchte.
»Zweifle wenigstens nicht an meinem Verstand!« donnerte er sie an. »Er ist ebenso gesund wie der deine. Soll ich es dir beweisen, heh?«
»Laß mich los!« flehte Sarah, die vor diesem Manne ihre sonstige Standhaftigkeit und Energie zu verlieren schien.
Eduard ließ sie los.
»Soll ich dir beweisen, daß ich bei klarem Verstande bin?« wiederholte er. »O, ich kenne deine Absichten ebensogut wie die meinen, und die deinigen sind nicht minder wahnsinnig. Auch du hoffst, Harrlington noch besitzen zu können. Ist es nicht so? Sprich!«
»Es ist so.«
»Und denkst du nicht daran, daß Harrlington dich ebenso verachtet, vielleicht noch mehr als Ellen mich?« fuhr Eduard fort. »Welchen Plan hast du ausgesonnen, um seine Liebe zu gewinnen? Du hoffst doch nicht etwa, Ellen bei ihn ausstechen zu können? Mir paßte das schon, aber es geht nicht.«
Sarah antwortete nicht, entweder wußte sie keinen Plan, oder sie wollte ihn nicht verraten.
»Ich weiß sehr wohl, was deine Absicht ist,« begann Flexan wieder. »Du möchtest Harrlington besitzen und Ellen, deine verhaßte Nebenbuhlerin, vernichten; aber bei Himmel und Hölle, krümmst du ihr auch nur ein Haar, so schicke ich dich dahin, wohin du gehörst. Derselbe Befehl, den ich einst gab, gilt auch noch heute. Es war dein Glück, daß statt Ellen damals eine andere am Marterpfahl endete, sonst, bei allen Teufeln, hätte ich dich desselben Todes sterben lassen. Was dir gelingt, gelingt mir erst recht.«
Ruhig hörte Sarah diesen Wutausbruch an, sie dachte an keinen Widerspruch.
»Wenn aber Ellen dich nicht erhört, was gar nicht zu bezweifeln ist?« fragte sie gelassen.
»Warum soll sie mich nicht erhören?«
Sarah lachte auf.
»Sprich nicht so töricht, Eduard! Du verstellst dich ja nur. Ellen ist ein schönes Weib, das muß ihr der Neid lassen, und du bist ihr gegenüber ein — ein —«
»Scheusal,« ergänzte Flexan.
»Gut, da du es selbst sagst, kannst du es als keine Beleidigung betrachten, wenn ich es nachspreche. Hat Ellen dich als schönen Mann verabscheut, wie kannst du verlangen, daß sie dich jetzt als ein Scheusal umarmt?«
Der Mondschein beleuchtete das unförmliche Gesicht Flexans, und schaudernd sah Sarah, wie es sich in teuflischer Schadenfreude verzerrte.
»Dann gibt es nur noch die Rache,« sagte er heiser, »die mir für ihre Liebe Ersatz bieten kann.«
»Das sagte ich ja auch, töte, martere sie! Dann ist mir und dir geholfen.«
»Ich habe eine andere Rache, eine viel fürchterlichere.«
»So wende sie an!«
»Ich töte sie nicht.«
»Nicht? Was denn?«
»Ich lasse sie leben.«
»Das darfst du nicht,« rief Sarah hastig. »So lange Ellen lebt, kann ich nicht auf Harrlington hoffen.«
»Es gibt noch etwas anderes, wodurch sowohl deine, als meine Absicht erreicht würde.«
»Und was wäre das? Spanne mich nicht länger auf die Folter!« rief das Weib ungeduldig.
Langsam griff Flexan in die Tasche und brachte daraus ein Fläschchen zum Vorschein.
»Was ist das?« fragte er.
»Gift?«
Der Mann entfernte den Glasstöpsel und hielt das Fläschchen dem Weibe hin.
»Riech' hinein!«
Sarah nahm einen scharfen, ätzenden Geruch wahr, so heftig, daß sie erschrocken zurückfuhr.
»Schwefelsäure,« stammelte sie, entsetzt die Hand zurückstoßend, welche die gefährliche Flüssigkeit hielt.
»Konzentrierte Schwefelsäure,« grinste Flexan. »Das wird's tun. Meinst du nicht?«
Im Nu hatte Sarah den Plan erfaßt, mit dem sich Flexan trug. Ja, fürwahr, teuflischer konnte er nicht sein, aber auch nicht besser für Eduard und für sich selbst.
»Nun, was sagst du dazu?« grinste Eduard weiter.
»Ich werde noch einmal in aller Form um ihre Hand anhalten, und bekomme ich abermals einen Korb, dann,« Eduards Gesicht nahm einen fürchterlichen Ausdruck an, »dann kannst du deine Rache befriedigen, Sarah, dann kannst du aus Ellen ein Wesen machen, das mit mir an Häßlichkeit wetteifert.«
»Gib mir das Fläschchen!« hauchte Sarah, die Hand nach der furchtbaren Waffe ausstreckend.
»Hier ist es!« Er reichte ihr das Verlangte. »Der Stöpsel schließt gut, du kannst es ruhig einstecken. Aber nicht eher darfst du davon Gebrauch machen, als bis ich es dir heiße.«
»Nicht eher, verlaß dich darauf!« versicherte Sarah.
»Und dann,« fuhr der Mann fort, »dann bist du am doppelten Ziele angelangt und ich desgleichen. Du hast deine Rache befriedigt und brauchst keinen Nebenbuhler mehr zu fürchten. Hahaha, möchte das Gesicht von Harrlington sehen, wenn er seine schöne, mit Schwefelsäure geschminkte Braut zum ersten Male erblickt!«
Sarah antwortete nicht, krampfhaft schlossen sich die Finger um das Fläschchen in der Tasche.
»Jetzt komm! Es ist ein Zimmer für dich in der Ruine bereit,« sagte sie.
»Noch eins, Sarah,« entgegnete er. »Was wir jetzt verhandelt haben, war mir nicht die Hauptsache. Wo ist Hoffmann, dieser Teufel? Ist er sicher gefangen, damit ich ...«
»Rege dich nicht auf!« unterbrach ihn Sarah schnell, die schon wieder einen Ausbruch seiner maßlosen Wut fürchtete, die ihn stets befiel, wenn er auf Hoffmann, den Verschulder seiner Krankheit und Häßlichkeit, zu sprechen kam. Sie mußte ihn in der einmal gefaßten Meinung lassen, daß sich Hoffmann ebenfalls gefangen in der Ruine befände.
»Hoffmann sitzt in seiner Kammer und erwartet dich,« lachte sie. »Er wird sich wundern, wenn er sieht, wie seine Quecksilberkur dich zugerichtet hat.«
»Der Schurke,« zischte Flexan. »Tag und Nacht brüte ich darüber nach, wie ich ihn eines tausendfältigen Todes sterben lassen kann.«
»Frage die Indianer! Sie werden dir nützliche Ratschläge erteilen können. Doch komm jetzt! Der Tau beginnt zu fallen; es wird kalt.«
Beide wandten sich zum Gehen; geräuschlos erhob sich der Bär aus dem Schatten des Baumes und gesellte sich ihnen bei. Mißtrauisch betrachtete ihn Flexan, doch er konnte ich denken, daß das Tier gezähmt war.
»Ist das dein ständiger Begleiter?« fragte er.

Mißtrauisch betrachtete Flexan den Bären und
fragte: »Ist das dein ständiger Begleiter?«
»Seit etwa zwei Stunden, ja,« lachte Sarah. »Er hat an mir ein ganz besonderes Wohlgefallen gefunden.«
Als wolle der Bär die Wahrheit der Worte bezeugen, sprang er an Sarah empor, so daß sie bald gestürzt wäre.
Sie schlüpften durch dieselbe Pforte in das Innere der Terrasse hinein, durch welche Sarah sie vorhin verlassen. Sie versuchte dabei wieder, sich des Tieres zu entledigen, aber mit einer Gewandheit, die man dem plumpen Körper garnicht zugetraut hätte, wußte es mit hineinzuhuschen.
Sarah führte Flexan durch lange, stockfinstere Gänge, der letzte von ihnen war so niedrig, daß sie sich nur gebückt vorwärtsbewegen konnten, und schließlich öffnete sich unter des Weibes kundiger Hand eine ganz versteckte Tür, welche zu Flexans künftigem Aufenthaltsort führte.
Das Gemach mußte Jahre lang, vielleicht Jahrhunderte hindurch völlig unbenutzt dagelegen haben, es war halb zerstört und von geschäftigen Händen schnell aufgeräumt und vom Schutt befreit worden. Im übrigen war es bequem ausgestattet. Sarah schärfte Flexan ein, dieses Gemach nie zu verlassen, selbst wenn er ihr etwas mitzuteilen hätte, ja, selbst wenn er irgend etwas nötig brauche; denn sein Aufenthalt hier müsse ganz geheim gehalten werden, weil die Indianer den häßlichen, ekelerregenden Menschen, der öfters Anfälle von Tobsucht bekäme — Sarah sprach sehr offen — wie einen bösen Gott fürchteten.
Doch brauche er nicht in Sorge zu sein, sie selbst würde jeden Tag einige Male zu ihm kommen, ihm alles zum Leben Nötige bringen und mit ihm sprechen.
Dann verließ sie ihn, ohne ihm den komplizierten Mechanismus der Türe erklärt zu haben. Sie hoffte, es würde ihm nicht glücken, denselben jemals zu finden. Als sie hier eingetreten, war der Bär draußen geblieben; sie fürchtete schon, ihn ihrer wartend zu treffen, sah aber mit Freuden, daß er nicht mehr da war. Sie hatte vor dem Tiere, das sich ihr als steter Begleiter aufzudrängen schien, eine förmliche Angst bekommen, denn tat sie etwas, was seinem Willen entgegenlief oder belästigte, so bekam sie stets das drohende Knurren zu hören.
Daß der Bär keinen Spaß vertrug, hatte die Begegnung vorhin mit dem Indianer gezeigt.
Sarah brannte die Laterne, welche sie an diesem dunklen Orte immer bei sich trug, nicht an, sondern begnügte sich, den unsicheren Weg mit Streichhölzern nur zeitweilig zu erleuchten, um bei der Annäherung des Bären rechtzeitig im Dunklen verschwinden zu können.
Sie hatte auch das Glück, unbelästigt ihr Gemach zu erreichen, der Bär hockte nicht davor, wie sie schon geglaubt hatte.
Ohne Licht anzubrennen, entkleidete sie sich, warf die Sachen über den Stuhl und wollte sich auf das Bett legen, als sie mit einem Schreckensruf zurückfuhr.
Sie war mit einem rauhen, haarigen Körper in Berührung gekommen — Mythra hatte bereits ihr Bett eingenommen, rührte sich nicht und fing jetzt sogar an zu schnarchen.
Sarah hütete sich, den ungeladenen Gast zu wecken, sie bereitete sich aus ihren Kleidern ein Lager an der Erde und beschäftigte sich fast während der ganzen Nacht mit den Gedanken, wie sie Lord Harrlington für sich gewinnen, über Ellen triumphieren, eine furchtbare Rache ausüben und sich Eduard Flexans und dieses aufdringlichen Bären entledigen könnte.
Sir Charles Williams hatte wieder einmal Gelegenheit, zu erproben, ob seine lachende Philosophie, die er sich in langen Jahren gebildet und angeeignet, in jeder Lage Stich hielt. Die letzten Wochen waren nicht dazu geeignet gewesen, denn während dieser hatte er an Bettys Seite in einem Meer von Glück und Seligkeit geschwommen, nun aber waren andere Zeiten über ihn hereingebrochen.
Drei Tage hatte er apathisch dagesessen; er beachtete nicht das Körbchen, welches jeden Tag zweimal von oben an einem Strick herabgelassen wurde und ihm Brot, Fleisch und einen Krug mit Wasser brachte. Am vierten Tage aber wurde es zum ersten Male leer wieder hinaufgezogen; oben erscholl ein spöttisches Lachen, und unten in dem Dämmerlicht saß ein Mann am Boden in der einen Hand ein Stück Brot, in der anderen ein Stück Büffelfleisch, biß abwechselnd hinein und befeuchtete die Speisen mit seinen Tränen.
Der Hungrige und halb Verdurstete hörte nicht eher mit dieser Beschäftigung auf, als bis Brot, Fleisch und Wasser spurlos verschwunden waren, und dann hörten auch die Tränen auf.
»Hätte nicht geglaubt, daß Kummer und Sorgen so vorteilhaft auf den Appetit wirken!« sagte Charles, stand auf und begann sein Gemach mit großen Schritten zu durchmessen, wozu er allerdings nur deren drei bedurfte.
»Werde von jetzt ab regelmäßig essen. Was hilft es, daß ich alle Nahrung verschmähe? Besser wird es dadurch auch nicht, aber ich habe einst sagen hören, mit vollem Magen sterbe es sich leichter, als mit leerem. Nun werde ich mich einmal selbst von der Wahrheit dieser Aussage überzeugen können. Sterben!« unterbrach sich Charles und blieb stehen. »Ist es denn wirklich so schlimm?«
In trüben Gedanken setzte er seinen Weg fort; es schien wirklich nicht anders, als wäre der Tod ihr Los. Warum aber in aller Welt hielt man sie denn gefangen und versorgte sie auch noch mit Essen und Trinken? Das war doch sonst gar nicht die Art von Indianern. Und diese Ruinen, die geheimnisvolle Weise, wie alles vor sich ging, die strenge Abgeschlossenheit, was hatte das nur alles zu bedeuten?
Charles fand keine Lösung des Rätsels.
Um sich selbst war er noch nie besorgt gewesen, war es also auch jetzt nicht; während er aber früher sich auch wenig um das Schicksal anderer gekümmert hatte, brach sein Herz bald vor Schmerz, wenn er an seine Braut, an Betty, dachte.
Wie würde sich das arme Mädchen um ihn ängstigen, weinen und seufzen! Doch schließlich gelang es Charles, sich auch hierüber zu beruhigen.
»Kann ich etwas dafür, daß Betty in eine solche traurige Lage gekommen ist? Nein, nicht im geringsten; im Gegenteil, ich habe ihr hundertmal erklärt, sich von den Freundinnen loszusagen und mit mir auf- und davonzugehen. Hätte sie meinen wohlgemeinten Rat befolgt, so säßen wir jetzt schon lange im Warmen, entweder in einer Stadt Englands und amüsierten uns köstlich, oder in einer Villa auf dem Lande, gingen und führen spazieren und ließen den lieben Gott einen frommen Mann sein.«
Charles blieb stehen und schlug sich vor die Stirn.
»Halt, Williams, du sprichst töricht. Wer weiß, ob uns dort nicht ein noch traurigeres Schicksal erwartet hätte als hier. Charles, du warst immer etwas Fatalist, glaubtest, daß alles, ehe es geschehe, schon vorher vom Schicksal bestimmt worden sei, und der Glaube daran ist ein größerer Trost, als wenn man sich mit Wenn und Aber quält. Und schließlich, wenn uns der Tod beschieden ist, was für ein großes Unglück ist denn dabei? Später oder früher muß man doch einmal sterben, und nur wenigen glückt es, an Altersschwäche zu sterben. Schöner ist es natürlich, im weichen Federbett den letzten Atemzug zu tun, als am Marterpfahl, aber das Ganze läuft auf dasselbe hinaus: Das Ende des Lebens ist ein vollkommenes Fiasko, aus dem nur die Erben Vorteile zu ziehen wissen. Ob man sich sträubt, ob man weint, bittet, fleht — ganz egal, es wird nichts geändert, die Seele entflieht dem Körper, und deswegen fällt kein Stern vom Himmel, die Erde weicht deshalb nicht einen Millimeter aus der ihr vorgeschriebenen Bahn. Ans vollem Herzen sage ich: Gott sei Dank, daß es so ist, daß das innigste Gebet die Seele nicht zurückhalten kann, denn ebensogut könnte man durch ein Gebet ein Naturgesetz umkehren oder etwa einen Planeten aus seiner Bahn lenken. Wie aber, wenn ein frommer Bewohner auf einem anderen Planeten den Einfall bekäme, Gott um einen Beweis seiner Allmacht zu bitten, und zwar, unserer Erde einen anderen Weg vorzuschreiben, wodurch sie am soundsovielten Tage in die Sonne stürzen müßte — denn natürlich glaubt jener fromme Bruder, unsere Erde sei nur ein Stern, eigens für ihn da, um ihm beim Nachhauseweg zu leuchten. Nein, es geht alles, wie es geht, und alles mit Geduld und Gleichmut zu ertragen, das ist die wahre Kunst des Lebens, nach der man streben soll.«
Charles lachte auf.
»Wohin bist du denn da plötzlich gekommen?« fuhr er fort. »Aus diesem dunklen Kellerloche in den Himmel und auf einen anderen Planeten. Nun, der Tod wird dadurch auch nicht abgewendet, aber tröstend sind solche Betrachtungen doch. Hm, ich kenne viele Frauen und Männer, Menschen, vor denen ich Ehrfurcht gehabt habe, nicht, weil sie reich und mächtig waren, sondern weil sie wirkliche Menschen waren, Geschöpfe Gottes, wahr und großherzig, und ich habe sie jahrelang die entsetzlichsten Qualen ausstehen sehen, ehe sie im Grabe Ruhe fanden. Und ich sollte nicht einmal eine Stunde am Marterpfahl dulden können? Bah, Unsinn. Und sehe ich den, den ich liebe, auch unter den größten Schmerzen sterben, bei klarem Gedanken muß ich mir doch sagen, daß es nur zu seinem Vorteil ist, denn er geht seinem Glücke entgegen.«
So sonderbar auch diese Trostgründe waren, bei Charles Williams schlugen sie an, er wurde nicht nur beruhigt, sondern sogar heiter, selbst wenn seine Gedanken bei Betty verweilten. Doch vermied er es, lange an seine Braut zu denken, fürchtend die Traurigkeit könne ihn doch wieder übermannen.
Dagegen führte er sich andere Bilder vor Augen, die ihn erheiterten. So traurig die letzten Tage auch gewesen waren, Charles hatte ihnen doch immer noch eine Lichtseite abzugewinnen gewußt, und einmal, gerade im gefährlichsten Moment, als Tod und Leben auf dem Spiele standen, hatte er laut aufgelacht!
Es war während des Kampfes im Hohlweg gewesen. Die meisten waren sofort überwältigt worden, auch Charles. Nur Hastings, Harrlington und einige andere, auch Mädchen, wehrten sich mit der Kraft der Verzweiflung, während die anderen, schon mit gebundenen Händen, dem unglücklichen Kampfe zusahen.
Unter denen, welche noch nicht überwältigt waren, befand sich auch Mister Youngpig. Der Reporter hatte diesen Umstand etwas ganz Eigentümlichem zu verdanken.
Youngpig war einer der ersten, die sorglos den Hohlweg betraten, und auf ihn war zuerst ein riesenhafter Indianer gesprungen. Jeder andere wäre wohl vor der wilden, roten Erscheinung mit dem wehenden Federschmuck und dem buntbemalten Gesicht entsetzt zurückgefahren, nicht so Mister Youngpig.
Dieser mußte das ganze für einen Spaß halten. Noch ehe der Indianer ihn erreicht, hatte Youngpig seinen Photographenapparat von der Seite gerissen und dem Krieger vorgehalten, der den Kasten für eine ihm unbekannte Schußwaffe von furchtbarer Wirkung halten mochte, denn er blieb wie versteinert stehen und schien jeden Augenblick ein entsetzliches Krachen zu erwarten.
Doch es ward nur ein leises Knacken hörbar.
»Danke, never mind,« sagte der Reporter und hing seinen Kasten wieder um, war aber nun sofort umringt und überwältigt, doch nicht, bevor er einem der nach ihm greifenden Indianer ein paar tüchtige Ohrfeigen verabreicht hatte, wie etwa der Schullehrer einem Kinde.
Als er sah, was sich eigentlich zugetragen hatte, brach Youngpig in ein furchtbares Schimpfen aus und zeigte dabei eine unglaubliche Redegewandtheit, und Charles bekam Worte zu hören, von deren Existenz er vorher noch gar keine Ahnung gehabt hatte.
So ernsthaft die Situation auch war, Charles konnte nicht anders, er mußte lachen. Mister Youngpig, der von seinem Berufe als Reporter so eingenommen war, daß er selbst den ihn angreifenden Indianer photographierte, und dann das ganze Lexikon mit neuen Schimpfwörtern wirkten zu komisch auf ihn.
Wo mag der arme Kerl jetzt sein? dachte Charles. Vielleicht sah er ihn nie wieder oder erst in der Todesstunde. Diesen Mann hatte er gern bei sich gehabt. Charles glaubte, in Gesellschaft mit diesem müsse es sich ganz hübsch leben und selbst sterben lassen.
Der am Boden sitzende, mit dem Rücken an der Wand lehnende Gefangene hatte diesen Wunsch noch nicht zu Ende gedacht, als sich wie durch Zauberei plötzlich ein Loch in der Mauer öffnete und ein Mann hereinstürzte oder aber geworfen wurde, über Charles' ausgespreizte Beine stolperte und zu Boden schlug.
»Guten Morgen, Sir Williams,« rief der Mann, ohne sich zu erheben, »wie geht es Ihnen? Never mind.«
»Mister Youngpig,« sagte Charles erstaunt, »sind Sie das denn wirklich?«
»Gewiß bin ich's. Ich belästige Sie doch nicht?« Mit diesen Worten erhob sich der Reporter und rieb sich die geschundenen Knie. Er trug noch immer die kurzen Hosen, die Joppe und die schottische Mütze, war überhaupt noch ganz der Alte, nur der Kasten und die Mappe fehlten ihm.

»Hat man Sie gezwungen, hierherein zu gehen?«
»Gezwungen? Durchaus nicht, man hat mich nur hereingeworfen. Never mind.«
»Warum denn? Wo sind Sie denn bis jetzt gewesen?«
Der Reporter sah sich um.
»In einem ganz genau solchen Raume wie diesem, ich bin Ihr Nachbar gewesen.«
»Und man hat Sie herausgeholt?«
»Ja. Ich kalkuliere, die Zellen reichen nicht mehr, weil andere Gefangene gekommen sind, und nun werden wir zwei und zwei zusammengesteckt. Mehr kann ich Ihnen aber nicht verraten, weil ich selber nichts weiß. Aus diesem Grunde werde ich alle Fragen, wie zum Beispiel, ob sich die anderen noch am Leben befinden, wie es ihnen geht, ob ich Ihre Braut gesehen habe, ob sie bleich und angegriffen aussieht, was unser Los sein wird, warum nur hier sind, ob wir gehängt, geschlachtet, skalpiert, gemartert oder gefressen werden, und so weiter, unbeantwortet lassen. Ich saß in einem ebensolchen Raum wie dieser, bekam jeden Morgen und Abend genau so einen Korb wie den dort in der Ecke an einem Hanfseil herabgelassen, und mein Krug sah dem da zum Verwechseln ähnlich. Das ist alles, was Sie Neues von mir erfahren können. Never mind.«
Der Reporter schöpfte Atem, und Charles lachte vergnügt.
»Ich habe mich sehr gefreut, einen Gesellschafter zu bekommen,« sagte er, »und nun sehe ich zu meinem tiefsten Bedauern, daß ich mich getäuscht habe.«
»Wieso getäuscht? Paßt Ihnen meine Gesellschaft nicht? Tut mir leid, ich kann aber wirklich nichts dafür.«
»Das ist es nicht. Da Sie aber nicht mit mir sprechen wollen, so kann ich mich ebensogut mit der Wand unterhalten.«
»Oho, da irren Sie,« rief Youngpig. »Ich wollte Ihnen nur von vornherein alle unnütze Fragen abschneiden, die ich nicht beantworten kann. Denken wir, wir säßen in einer Restauration und wollten uns die Zeit vertreiben! Arrangieren wir einstweilen ein Spielchen.«
Der Reporter nahm ein Stück altes Brot, weichte es im Munde auf, knetete es und formte dann mit vielem Geschick zwei Würfel daraus. Die Augen ersetzte er durch Löcher.
»So,« sagte er, »nun kann's losgehen. Wer die meisten Augen wirft, gewinnt. Um was spielen wir?«
»Ich habe nichts einzusetzen.«
»Es wird später ausgezahlt; wir betrachten unser Wort als Ehrenschuld, sobald als möglich einzulösen.«
»Wirklich, Mister Youngpig, ich habe keine Lust zu solchem Spiel, es kommt mir, vielleicht kurz vor dem Tode, überaus kindisch vor.«
Der Reporter warf die Würfel ärgerlich an die Wand, daß sie sich breit drückten und kleben blieben.
»So schlagen Sie etwas anderes vor,« rief er. »Ich habe mich in meiner Zelle nicht im geringsten gelangweilt, bei Ihnen scheint es aber loszugehen.«
»Wir wollen ein vernünftiges Gespräch beginnen, soweit unter uns ein solches möglich ist! Sagen Sie, Mister Youngpig, wie stellen Sie sich Ihr Leben nach dem Tode vor?«
Erstaunt betrachtete ihn der Reporter von der Seite, dann stieß er einen langen Pfiff aus.
»Aha, Sie sind einer von denen, welche andere mit in den Himmel nehmen möchten, weil sie glauben, sie könnten sich dort langweilen?« fragte er mit schlauem Gesicht.
»Leicht möglich, warum nicht?«
»Nun, dann kann ich Ihnen sagen, daß ich ganz genau weiß, wohin meine Seele nach dem Tode kommt.«
»Nun?«
»Eben wieder dahin, woher sie gekommen ist. Wollen wir wetten, Sir Williams?«
»Wissen Sie das bestimmt?«
»Ganz genau, das sagt mir mein gesunder Verstand.«
»Aber woher sind Sie denn gekommen?«
»Ja, wenn ich das wüßte, dann könnte ich Ihnen auch sagen, wohin ich komme. Da das aber bis jetzt niemand hat tun können, ja, da sich sehr kluge Leute nur bis zu ihrem dritten Lebensjahre zurückerinnern können und auch im Alter viele Leute das Bewußtsein völlig verlieren, so ist doch anzunehmen, daß ich nach dem Tode genau dasselbe sein werde, wie vor dem Leben. Mir einzureden, ich soll ewig sein, während ich früher ein Nichts war, ist nicht möglich, daß ich aber ewig war und ewig bleibe, das glaube ich. Das Leben ist nur eine kleine Zwischenstation, für den einen einen längeren, für den anderen einen kürzeren Aufenthalt bedeutend, dann geht es weiter. Geborenwerden und sterben ist ganz dasselbe. Sterben ist auch ein Geborenwerden, sogar ein schöneres, der Tod ist das große Reservoir des Lebens, und wenn wir nur den Taschenspielerkniff begriffen, dann würden wir nach Willkür Leben erzeugen können.«
Der Reporter hatte sich in Eifer geredet.
»Wir sind zwei hartgesottene Sünder,« entgegnete Charles, »denn leider muß ich Ihnen beistimmen. Kurz vor dem Tode ist es aber doch nicht gut, mit so etwas zu spielen. Nicht jeder kann es ertragen.«
»Denken wir noch nicht an den Tod! Vorläufig leben wir ja noch. Sie glauben vielleicht nach dem eben Gesagten, ich sehne den Tod herbei? Gott bewahre! Offen gestanden, mir gefällt es hier auf der Erde ganz gut, und so zufrieden, wie ich, kann jeder sein, der sich ins Leben nur zu schicken weiß. Sehen Sie! Andere würden vielleicht jammern, weil sie eingesperrt sind. Haben wir es aber eigentlich nicht noch ganz gut? Wir bekommen reichlich zu essen und zu trinken und haben uns um nichts zu sorgen.«
»Nun, nun, manches könnte in diesem Hotel aber doch besser sein,« meinte Charles, »von den notwendigsten Bequemlichkeiten gar nicht zu sprechen, der Mangel an jeglichem Waschgeschirr ist mir doch nicht angenehm.«
»Was, waschen!« sagte der Reporter verächtlich. »Ich war als Kind immer ein Feind vom Waschen, weshalb mir mein Bruder den Namen Youngpig beilegte, den ich aus Gewohnheit beibehalten habe.«
»Apropos, Mister Youngpig, so ist Nick Sharp wirklich Ihr Bruder?«
»Mein richtiger Bruder, wie Miß Johanna Lind meine richtige Schwester ist. O, Sir Williams, wir haben eine schöne Jugend gehabt.«
Träumerisch blickte der Reporter vor sich hin.
»Ich kenne wenigstens die Laufbahn Nick Sharps,« nahm Charles wieder das Wort. »Er hat sie einst Lord Harrlington erzählt, und von dem habe ich sie erfahren. Damals wußte aber auch Harrlington noch nicht, daß Miß Lind Sharps Schwester war.«
»Nikolas spricht nicht gern über seine Familienverhältnisse.«
»Leben Ihre Eltern noch?«
»Beide.«
»Sie waren Schauspieler?«
»Ja. Johanna und ich waren noch klein, Nikolas fünfzehn Jahre alt, als meine Mutter sehr krank wurde, was sie bis jetzt geblieben ist. Gleich darauf mußte auch mein Vater seinen Schauspielerberuf aufgeben, es ging ihm wie so vielen Kollegen. Er verlor plötzlich das Gedächtnis und verwechselte die Rollen. Manchmal sprach er wie ein vernünftiger Mensch, dann wieder wie ein kleines Kind. Nikolas war kurz vorher verschwunden. Niemand wußte wohin; wahrscheinlich war er zur See gegangen, dachte man damals, weil dies immer sein Wunsch gewesen. Meine Eltern wären in große Not geraten, wenn sie nicht von Freunden unterstützt worden wären, und als diese Hilfsquelle versagte, kam Nikolas als gemachter Mann wieder und unterstützte seine Eltern reichlich. Johanna und mich brachte er in eine Pension und tat alles an uns, was in seinen Kräften stand.
»Johanna, nur ein Jahr jünger als ich, war damals ein ausgelassenes Mädchen, ich war schon ein wilder Junge, aber ihr konnte ich nicht das Wasser reichen. Wir wohnten nicht weit von New York auf einem herrlichen Landgute. Ich kann nichts weiter sagen, als daß es eben ein wunderschönes Leben war und mein Bruder sorgte, daß es nicht gestört werden konnte.«
»So war Miß Johanna also früher ein wildes Mädchen?« fragte Charles nach einer Weile, als der Reporter nicht weitersprechen wollte. »Das hätte ich nicht gedacht, ich habe sie als ein stilles, sinniges Wesen kennen gelernt.«
»Daß sie dies geworden, daran ist Nikolas schuld, und in diesem Falle hat er sehr unrecht gehandelt, obgleich man ihn nicht davon überzeugen kann. Ich kam, als ich vierzehn Jahre alt war, in eine höhere Schule, aus welcher ich aber weglief — doch davon ein anderes Mal — Johanna kam wieder zu den Eltern, und auch Nikolas verweilte dort längere Zeit zum Besuch. Es war das erstemal, daß der Bruder mit der Schwester anders verkehrte, als mit ihr Dummheiten zu teilen, zu reiten, auf Bäume zu klettern und so weiter, worin Nikolas früher ebenfalls Großes leistete. Er war damals Detektiv und in die Ansicht verrannt, daß dies die entzückendste Beschäftigung wäre. Er war Detektiv mit Leib und Seele, und sein ständiges Bemühen war, auch andere sich hierzu eignende Personen zu gewinnen. In Johanna fand er ein solches Wesen. Sie war tollkühn, dabei aber doch kaltblütig und scharfsinnig, und von ihren Eltern hatte sie vor allen Dingen das Schauspielertalent geerbt, was ich nicht besitze. Nick nahm sie in seine Schule und machte aus ihr eine geschickte Detektivin, mit der er anfangs zusammenarbeitete. Johanna war noch nicht siebzehn Jahre alt, als sie schon auf eigene Faust operierte und Sachen unternahm, vor welchen damals die gewieftesten Detektiven zurückschreckten.«
»Sie fühlte sich glücklich in ihrem gefährlichen Berufe?« fragte Charles den Erzähler.
»Das ist es eben, worauf ich jetzt kommen wollte. Anfangs fand sie wohl Vergnügen an diesem Handwerk, sie verdiente sehr gut dabei und fand Lob und Anerkennung. Dann aber kam sie in Kreise, wo sie gewahr ward, daß man sie verachtete, und von dem Augenblicke an trat in ihrem Wesen eine Umwandlung ein. Sie hatte eine lange Unterredung mit dem Bruder, es ging sehr heftig dabei zu. Nick ging, ließ ein paar Jahre nichts mehr von sich hören, unterstützte auch die Eltern nicht mehr, und Johanna blieb Detektivin, schon aus dem Grunde, um die Eltern ernähren zu können. Aber mit ihrem Frohsinn war es aus; sie wurde immer stiller und ernster. Ihre einzige Freude bestand darin, den Eltern ein behagliches Heim zu schaffen, in dem sie sich erholen konnte. So ist es geblieben bis auf den heutigen Tag, vielleicht aber, daß die Brautschaft mit Hoffmann ihr den alten Frohsinn wiedergegeben hat, um so mehr, da Hoffmann wohl nicht mehr dulden wird, daß sie sich als Detektivin durchs Leben schlägt. Ich habe sie lange Zeit nicht wiedergesehen; in China schon bemerkte ich aber, daß ihr Auge den alten Glanz wiedergewonnen hatte. Das ist die Geschichte Johannas.«
»Und Ihre eigene?«
»Die ist kurz genug. Ich habe es nie lange aushalten können, weder in der Stube bei Muttern noch in einer Gesellschaft noch in der Schule. Ich hatte eben kein Sitzfleisch. Meine größte Lust war, auf Abenteuer auszugehen, und dabei fand ich in Johanna stets eine Gesellschafterin. Diese lernte sehr gut, sie war scharfsinnig, und es machte ihr Lust, sich im Denken zu üben. Ich dagegen war faul und in der Schule dumm, ein Talent aber besaß ich, was den beiden anderen abging. Ich konnte gut erzählen, dichten und fabulieren, eine Mücke in einen Elefanten umwandeln und überhaupt alles, was ich gesehen, gerade ins Gegenteil verwandeln, ohne die eigentliche Wahrheit zu umgehen. Sie verstehen nicht, wie ich das meine? Nun, ich konnte einen Leichenzug so beschreiben, daß sich meine Zuhörer vor Lachen ausschütteten, ich konnte alles nach Willkür drehen und wenden, daß schließlich ein anderer Sinn herauskam. Mich einer Lüge zu überführen, war gar nicht möglich. Ich stand immer so rein wie ein Engel da, und der Anschuldiger bat mich mit Tränen um Verzeihung, während ich kleiner Knirps der größte Spitzbube war, der auf Gottes Erde existierte. Mein Bruder hatte mich deshalb zum Advokaten bestimmt, ich hielt es aber nicht länger aus, die Schulbank zu drücken, und war eines Tages aus der Pension verschwunden unter Mitnahme einer jungen Dame, Miß Nelly Lockhard, welche mir Treue bis in den Tod geschworen hatte und ebenfalls nach Abenteuern dürstete.
»Wie alt waren Sie denn damals?«
»Fünfzehn Jahre, zwei Monate, sieben Tage.«
»Was? Mit fünfzehn Jahren haben Sie eine Dame entführt?« rief Charles staunend.
»Ist dabei etwas so Wunderbares?« entgegnete der Reporter kaltblütig. »Sie müssen bedenken, daß ich Amerikaner bin. ›Amerika ist groß‹, Diesen Ausruf bekommt man in Amerika täglich und bei jeder Gelegenheit zu hören: er soll ausdrücken, daß man sich in Amerika über nichts wundern darf. sagt man, solche Fälle gehören dort zu keinen Seltenheiten. Miß Nelly war Engländerin und wurde auf Veranlassung eines Onkels in New York erzogen. Sie war damals vierzehn Jahre alt, jetzt ist sie seit einigen Monaten meine Frau. Wir flohen also und wurden von meinem Bruder selbst verfolgt, der aber zum ersten Male fortwährend an der Nase herumgeführt wurde. Als wir kein Geld mehr hatten, ließen wir uns fangen, und jetzt wollte Nick aus mir einen Detektiven machen. Um zu Ende zu kommen, ich wurde kein Detektiv, sondern trotz meiner Jugend Reporter beim ›New-York-Herald‹. Nelly ging zu ihrem Onkel nach London zurück, wurde aber von ihm verstoßen und ernährte sich jahrelang durch die Arbeit ihrer Hände, bis es mir möglich war, sie zu erhalten. Weder Nick, noch Johanna hatten davon eine Ahnung, sie glaubten, ich lebte sehr leichtsinnig, weil ich es trotz meiner guten Einkünfte zu nichts brachte. Vor einigen Monaten ist Nelly mein Weib geworden — ich war zuletzt für die Londoner Times tätig — und fressen mich die Indianer nicht auf, so gehe ich von hier aus direkt nach London zurück und werde ein häuslicher Familienvater. Ich habe mir in der Welt die Beine wundgelaufen, ich weiß ganz bestimmt, daß mir jetzt Sitzfleisch gewachsen ist.«
Charles nahm die Hand des Reporters und schüttelte sie herzlich.
»Sie sind ein guter Mensch,« sagte er warm. »Ich wünschte jetzt nicht mehr nur meinet- und meiner Braut wegen, daß wir hier mit heilen Gliedern davonkommen, ich wünsche es auch Nellys wegen.«
»Na, machen Sie sich keine Sorgen,« tröstete Youngpig, »wir sind ja noch nicht verlassen! Mein Bruder ist nicht gefangen worden, und wäre er es, so würde er bald einen Ausgang gefunden haben. So lange er lebt, hoffe ich ganz bestimmt auf Rettung.«
»Er kann aber tot sein,« seufzte Charles.
»Natürlich. Sein Los ist auch schließlich einmal der Tod. Aber doch scheint es manchmal, als trüge Nick einen Talisman bei sich, der ihn schützt. Er hat auch wirklich einen — und es ist seltsam, wie dieser überall ins Leben eingreift.«
Youngpig schaute sinnend vor sich hin.
»Was für ein Talisman soll das sein?« fragte Charles lächelnd, der natürlich an keine geheimen Zaubermittel glaubte.
»Verachtung des Todes,« heißt er. »Nick Sharp geht dem Tode nie aus dem Wege, er sucht ihn vielmehr auf, und es gibt kein größeres Vergnügen für ihn als dieses. Ganz genau so verhält es sich mit dem Glück. Beobachten Sie nur den Spieltisch und die Liebe. Wer das Glück verachtet, dem fliegt es zu. Wem wenig daran gelegen ist, ob er am grünen Tisch verliert oder gewinnt, der streicht große Summen ein; wer dagegen gierig spielt, verliert. Bekanntlich bricht der Frauenverächter die meisten Herzen, und ganz ebenso verhält es sich beim Duell, überhaupt bei jeder Gefahr, in welcher es sich um hohe Einsätze handelt.«
»Es ist etwas Richtiges an Ihrer Theorie,« meinte Charles nachdenkend. »Wer sein Leben liebt, verliert es. Wer sein Leben verachtet, gewinnt es, sagt schon die Bibel, allerdings in anderem Sinne. Wie sprachen Sie aber vorhin? Dem Tode ins Knochengesicht zu sehen, wäre ein Vergnügen? Das bezweifle ich denn doch.«
»Es ist aber doch so,« behauptete der Reporter hartnäckig. »Fragen Sie nur einmal jemanden, der den Augenblick des Todes schon gekostet hat, etwa durch Ertrinken, Erhängen und so weiter. Ich meine nicht die Angst vor dem Tode, sondern den Todeskampf selbst. Sie werden stets die Antwort erhalten, daß ihnen dieser Augenblick scheinbar ewig gewährt hat und daß sie niemals schönere Empfindungen gehabt haben. Nick Sharp ist einmal gehängt worden, wurde aber rechtzeitig abgeschnitten; er gerät in Begeisterung, wenn er davon spricht, wie er den Tod kommen fühlte. Jetzt kann er sich allerdings jederzeit hängen lassen, er weiß durch einen Kniff die Schlinge so zu verschieben, daß sie ihm nicht die Luft raubt, und sein Halswirbel ist stark genug, ohne daß er bricht, den ganzen Körper zu tragen.«
»Ich habe davon gehört. In Südamerika hat er dieses Kunststück einmal öffentlich ausgeführt«
»Er hat es auch von einem Indianerstamme dort gelernt. Sie sind ja ein Engländer. Haben Sie nie von einer Manie gehört, welche in Ihrer Heimat hauptsächlich verbreitet ist.«
»Sie meinen doch nicht etwa jene Gesellschaft, deren Mitglieder sich gegenseitig aufhängen und rechtzeitig, aber im letzten Moment vor Eintritt des Todes, abschneiden? Ich glaube nicht daran!«
»Sie sind lange von England abwesend und haben auch keine Nachrichten erhalten, sonst würden Sie erfahren haben, daß tatsächlich eine solche Gesellschaft existiert hat, welche im Todesschauer den höchsten Genuß fand. Die Leutchen wurden bei einer ihrer Manipulationen gestört; zwei Gehängte konnten nicht abgeschnitten werden, sie starben, und dadurch kam die grausige Geschichte ans Tageslicht. Da diese Manie aber nun einmal Fuß gefaßt hat, ist sie auch nicht wieder auszurotten. Es ist das furchtbarste Laster, das bis jetzt aufgetaucht ist, es wird immer mehr Anhänger finden, und keine Strafe kann es unterdrücken. Denn was fürchtet der, welchem der Tod ein Vergnügen ist? Dieses Laster ist entsetzlicher als Trink-, Spiel- und Opiumsucht, es macht den Menschen für dies Leben vollkommen untauglich, denn um trinken, spielen und Opium rauchen zu können, muß man wenigstens manchmal arbeiten.«
»Hoffen wir, daß es nicht so schlimm ist, wie Sie es sich vorstellen,« entgegnete Charles.
Er hob plötzlich den Kopf und lauschte.
»Hören Sie. Scharrt da draußen nicht etwas an der Wand?«
»Der Wächter wird es sein, der den Mechanismus untersucht. Habe mir schon viel Mühe gegeben, kann ihn aber nicht öffnen. Das hätte übrigens auch gar keinen Zweck, wir würden doch sofort wieder überwältigt werden.«
Das Scharren und Kratzen draußen an der Wand fuhr fort, dann hörte man auch einen Indianer laut sprechen.
»Verstehen Sie, was er sagt?« fragte Youngpig.
Charles schüttelte den Kopf und lauschte weiter; der Indianer schien zornig zu sein.
»Es ist das erstemal, daß hier so eine laute Unterhaltung stattfindet. Sonst verhielten sich die Wächter mäuschenstill.«
Da schob sich die Tür plötzlich zurück, und ein Bär erschien im Rahmen derselben; wahrscheinlich hatte er seine Kunstfertigkeit, die geheimen Mechanismen zu öffnen, auch hier probieren wollen, und es war ihm gelungen, trotzdem der wachehabende Indianer ihn daran zu hindern suchte.
Jetzt trabte er herein; der Indianer packte ihn noch einmal beim Fell, aber ein Tatzenschlag schleuderte ihn zu Boden, als wäre er ein Kind und nicht ein kräftiger Mann gewesen.
Der Indianer mußte sich fügen; der Bär, Mythra, schien mit seinem Willen immer durchzudringen. Der rote Krieger blieb draußen und schob die Tür wieder zu. Knackend sprang eine Feder vor; der Mechanismus war geschlossen.
Charles und Youngpig waren nicht wenig erschrocken, als das große Raubtier plötzlich zu ihnen hereinkam. Sie wußten noch gar nicht, daß hier Bären gezähmt wurden, sie hatten solche bis jetzt nur wild oder auch im Käfig, durch Hunger gezähmt, bei einem Bärenführer gesehen. Dieses Tier aber schien im Besitze seiner vollen Kraft und Wildheit.
In den Köpfen der Gefangenen blitzte gleichzeitig der Gedanke auf, daß dieser Bär das Mittel sein sollte, durch welches sie aus dem Leben in den Tod befördert wurden. Wie römische Christensklaven sollten sie mit bloßen Händen den Kampf gegen das furchtbare Raubtier aufnehmen, während man oben dem Schauspiel zusah.
Der Gedanke war entsetzlich. Das Blut erstarrte den beiden in den Adern; dann sprangen sie gleichzeitig auf und retirierten nach der entgegengesetzten Wand.
Der Bär blieb an der Tür stehen, setzte sich dann wie ein Hund auf die Hinterschenkel und knurrte drohend.
»Unser letztes Stündlein ist gekommen,« flüsterte Charles. »Youngpig, jetzt gibt es einen kurzen Boxerkampf, und dann wandern wir in den Magen dieses gefräßigen Gesellen.«
»Der Bär frißt ebenso gern Brot wie Fleisch,« murmelte der Reporter.
»Ja, wenn er kein solches bekommt.«
»Na, dann gilt's möglichst ruhig sterben. Williams, wir greifen den Bären gleichzeitig an und suchen ihm mit den Fingern die Augen auszustechen, dürfen uns aber nicht umarmen lassen. Haben Sie kein Messer oder sonst etwas Spitzes bei sich?«
»Nichts.«
»Verdammt! Dann mal los!«
Der Reporter zog die Jacke aus und bereitete sich wirklich zum verzweifelten Kampfe vor.
»Halt!« mahnte Charles. »Wir wollen erst sehen, was er beginnt. Vorläufig verhält er sich noch friedfertig.«
»Tote soll er auch nicht anrühren.«
»Es ist zu spät, uns totzustellen.«
Der Bär erhob sich, knurrte und ging langsam auf den Korb und Wasserkrug zu, welche beiden Gegenstände er vorsichtig beschnüffelte. Der Korb war leer, sonst hätte dessen Inhalt den ersten Hunger des Tieres wohl stillen können.
Dann schritt es brummend auf die beiden zu, welche an der Wand standen und sich nicht zu rühren wagten.
Charles seufzte erleichtert auf.
»Es scheint kein blutdürstiges Tier zu sein, es benimmt sich sehr gemütlich und brummt auch nicht drohend,« flüsterte er. »Lassen wir es ruhig gewähren.«
Jetzt hatte der Bär sie erreicht, ging von einem zum anderen und beschnoberte ihre Füße. Als sich die beiden nicht regten, richtete er sich plötzlich an Charles in die Höhe und legte ihm die Tatzen auf die Schultern. Der Druck war so stark, daß Charles in die Knie sank.
Youngpig glaubte nicht anders, als sein Genosse wäre jetzt in Gefahr, zerrissen zu werden, er schrie laut auf und warf sich mit aller Gewalt auf den Bären, die Faust hoch erhoben, um ihn auf die Nase zu boxen. Doch der Bär war trotz seiner plumpen Gestalt wunderbar gewandt, er drehte sich, der Schlag ging fehl. Youngpig stürzte zu Boden, und mit lustigem Sprunge und wohlwollendem Brummen sprang der Bär über ihn hinweg.

Youngpig glaubte nicht anders, als sein
Genosse wäre in Gefahr, zerrissen zu werden.
»Alle Wetter! schrie Charles, »Der Kerl will nur mit uns spielen.«
Der Reporter erhob sich mit verdutztem Gesicht und rieb sich die Hände, auf die er gestürzt war.
»Wahrhaftiger Gott,« murmelte er, »ich glaube es jetzt fast auch.«
Der Bär ließ sie nicht lange im unklaren, ob er nur spielen oder Ernst machen wollte, mit lustigen Sprüngen kam er angesetzt, bald vorwärts springend, bald zurückfahrend, wie es spielende Hunde zu machen pflegen, und ehe Charles noch wußte, daß es wirklich keine Gefahr bedeutete, warf ihn schon ein kräftiger, aber unschuldiger Tatzenschlag zu Boden, und gleich darauf wälzte sich Mister Youngpig neben ihm.
Der Bär aber sprang schon wieder zurück und erwartete einen Angriff seiner Spielgefährten.
Er machte wirklich nur Scherz, und jetzt war das Eis gebrochen. So wenig die beiden eigentlich zum Scherzen aufgelegt waren, die Laune des Bären durften sie auf keinen Fall verderben, und in der noch eben so ruhigen und traurigen Zelle hielt mit einem Male die wilde Jagd Umzug.
Der Bär spielte den Verfolger, die beiden Menschen mußten fliehen, und ließen sie sich fassen, was oft genug vorkam, so wurden sie zu Boden geworfen, zwar nicht gerade sanft, manchmal sogar etwas grob, aber dabei ließ es auch der Bär bewenden. Er machte weder Gebrauch von seinen scharfen Krallen noch von seinem furchtbaren Gebiß.
Er nahm nichts übel. Im Gegenteil, traf einmal ein tüchtiger Puff seinen harten Schädel, so grunzte er noch gemütlicher, und seine Sprünge wurden noch kecker.
Endlich schien er genug bekommen zu haben, er ließ nach. Hochatmend standen die beiden Menschen da, während der Bär nach der Tür ging und mit der Tatze dagegen donnerte und knurrte. Es ward ihm sofort geöffnet. Mythra huschte hinaus, und die Feder schnappte wieder ein.
Erstaunt blickten sich die beiden an. So etwas hatten sie noch nicht erlebt. Der Bär hatte sie eine halbe Stunde wie ein paar Spielkameraden behandelt.
Charles setzte sich, um die erregte Lunge zur Ruhe kommen zu lassen, auf den Boden, dicht neben den Korb. Da bemerkte er plötzlich in demselben einen weißen Streifen liegen, auf dem er trotz der herrschenden Dämmerung Schriftzeichen zu erkennen vermochte.
Ahnungsvoll nahm er ihn, ließ ihn aber sofort in der Hand verschwinden, nötigte Youngpig zum Sprechen und betrachtete heimlich das Zettelchen.
»Mut, Freunde, ihr werdet gerettet!« las Charles, und sein Antlitz übergoß sich mit einer plötzlichen Röte, die Youngpig nicht entging.
Geschickt spielte ihm Charles das Zettelchen in die Hände, denn vielleicht lugten von oben beobachtende Augen herab. Auch des Reporters Hände, welche die Himmelsbotschaft zerknitterten, bebten.
»Das kommt von meinem Bruder,« flüsterte er, »nur er kann es geschrieben haben.«
»Der Bär muß es hier gelassen haben,« entgegnete Charles.
»Er war sein Abgesandter. Nick Sharp bedient sich sonderbarer Hilfsmittel, wenn er jemandem eine geheime Nachricht zukommen lassen will.«
Nicht weit von jener Zelle, welche jetzt von zwei Gefangenen eingenommen wurde, lag die Ellens.
Das vom Schicksal so hart geprüfte Mädchen konnte aber nicht, wie Charles, den Gleichmut wiederfinden. Rastlos wanderte es auf und ab, rang die Hände oder warf sich schluchzend auf den harten Boden, der die zahllosen Tränen nicht aufzufangen vermochte.
So nahe dem Glück und wieder hinab in den bodenlosen Abgrund des Elends gestoßen! Es gab keinen Trost mehr, nur noch Verzweiflung und dann den Tod.
Gab es denn einen Gott? Ach, Ellen begann daran zu zweifeln. Früher hatte sie einmal ein Gedicht gelesen, das sie mit Abscheu erfüllt hatte, weil es die betende Menschheit verspottete.
»Du lebtest noch, so sagen sie und knien
Vor deinem Kreuzesholz, daran in Qual
Du hängst, und küssen deine Füße«
So lautete der erste Vers, und der letzte, nachdem Christi Gottheit bezweifelt wurde:
»Ha! Wärest du's, du rissest von dem Nagel,
Dem martervollen, deinen Fuß — in Staub
Trätest du sie verachtend nieder!«
Jetzt verstand Ellen mit einem Male die empörten Gefühle jenes Dichters. Jeder Mensch hat wenigstens einmal in seinem Leben ähnliche Gedanken. Die Frage: Warum hilft er mir denn nicht, wenn es einen Gott gibt? ist die gefährlichste der Kirche.
Was hatte sie denn nur getan, daß sie so furchtbar schwer bestraft wurde? Hatte sie ihre Schuld nicht schon mehr denn genügend gebüßt? Einem Menschen, der sich an ihr versündigt, hätte sie schon längst verziehen, und wenn er sich noch so sehr vergangen. Diese Qualen machten alles wieder gut. Und der allwissende und allbarmherzige Gott sollte noch immer mehr Kummer auf ihr Haupt häufen, während es doch nur seines allmächtigen Wortes bedurfte, um diese Mauern fallen zu lassen und sie mit James zu vereinen?
Weicht, Gedanken, ihr macht wahnsinnig!
Bereits am zweiten Tage trat in Ellens Gefängnisordnung eine Aenderung ein. Am Morgen erschien nicht mehr, wie am Abend zuvor, das am Strick von oben heruntergelassene Körbchen mit Essen und Wasser — von Ellen allerdings unbeachtet gelassen, sondern die Tür öffnete sich, ein Indianer mit finsteren, grausamen Gesichtszügen trat herein und brachte der Gefangenen Nahrung.
Draußen sah Ellen zwei andere Indianer mit Tomahawks stehen, an Flucht war also nicht zu denken.
Dieser Indianer, scheinbar der Gefängniswärter, begnügte sich nicht, Brot und Wasser hinzustellen, sondern reinigte auch oberflächlich die Zelle. Bei dieser Beschäftigung musterte er, wie Ellen wohl bemerkte, die Gefangene scharf, doch Ellen erwiderte die Blicke nicht. Was hätte das genützt? Wie konnte sie von einem herzlosen Indianer, der sie erst gefangen, Rettung erhoffen?
Der Indianer sang während seiner Arbeit fortwährend vor sich hin, nach jener näselnden, monotonen und traurigen Art, wie unter den Indianern die Sangeskunst gepflegt wird. Die Melodie ruht fast nur auf einem einzigen Ton und wird erst beim Ende höher. Der Text ist abgerissen, ohne Reim, aber sinnvoll. Ebenso gibt es kein Versmaß. Jeder singt eben so, wie ihm die Worte in den Mund kommen.
Am ersten Morgen achtete Ellen nicht dieses Gesanges, es war ein apachischer Dialekt, den sie nur wenig verstand. Am Abend kam derselbe Indianer wieder, Ellen schloß daraus, daß er der Gefängniswärter war, welcher auch ihre Leidensgenossen zu versorgen hatte.

Er machte sich in einer Ecke etwas zu schaffen. Ihr Auge begegnete seinem glänzenden Blick, und plötzlich horchte sie hoch auf; der Mann hatte die Sprache gewechselt, wohlbekannte Laute schlugen an ihr Ohr, die Sprache der Nawagos, eines Stammes, welcher nicht weit von ihrer Besitzung in Louisiana die Wigwams aufgeschlagen hatte.
Mit diesen Indianern hatte sie in freundlichem Verkehr gestanden, mit ihnen geritten, gejagt, und sie hatten einander besucht.
Der Mann sang noch immer näselnd sein Lied, jetzt aber verstand Ellen deutlich den Text. Es mochte eine alte Sage sein, die der Indianer da in Musik gesetzt hatte.
»Die Prärie ist groß, die Prärie ist grün — viel bunte Blumen zieren sie — ein schwarzer Hengst eilt über sie hin — kaum knicken die Hufe die Halme — und doch ist er schwer — denn ein Reiter sitzt auf seinem Rücken — und noch ein anderer — der eine ist lebendig —der andere ist tot — warum halten sie sich so fest umschlungen? — Aus Liebe? —Nein — starke Binsenseile binden sie zusammen — aus des Toten Rücken tröpfelt Blut — eine tiefe Wunde ist darin — sein Leib ist schon verwest —«
Der Indianer bückte sich, um den umgeworfenen Krug aufzurichten. Sein Blick streifte dabei den Ellens.
»— und der andere Reiter hat Hunger,« klang es schauerlich weiter, »— sein Magen ist leer — und vor ihm ist Fleisch.«
Ellen schauderte, sie wußte jetzt, was der Indianer sang. Es war die entsetzliche Strafe eines Mörders, wie sie unter den Indianern Nordamerikas gehandhabt wird.
Man bindet den Mörder mit seinem Opfer zusammen auf ein schnelles, scheues Pferd, ganz eng, Körper an Körper, die Arme des Lebenden sind auf den Rücken geschnürt, und sein Mund berührt das nackte Fleisch dessen, den er meuchlings ermordet. Das Pferd wird auf die Prärie gejagt, und unstet läuft es mit seiner doppelten Bürde umher, weder Rast noch Ruhe kennend.
Der Leichnam beginnt zu verwesen. Der lebendige Reiter wird hungrig, und wenn der Hunger die Eingeweide schmerzlich durchwühlt, dann vergißt er den Ekel. Er sättigt sich an dem Fleische des von ihm Erschlagenen.
Ellen schüttelte sich, wenn sie sich die Szene ausmalte. Sie selbst hatte einmal Gelegenheit gehabt, solch ... Halt, was sang der Indianer jetzt? Ellen lauschte mit angehaltenem Atem.
»— Ein Pferd jagt über die Prärie — es ist eine weiße Stute — ihr Rücken darf keinen Reiter tragen — aber eine weiße Squaw Indianischer Name für Frau.— sie schwingt den Lasso — der Hengst ist zu schnell — sie sendet die noch schnellere Kugel — der schwarze Hengst stürzt — ein Messer durchschneidet Stricke — du bist frei, sagt der weiße Mund — der singende Vogel ist frei — und — wird — der — Squaw — dienen,« schloß der Indianer, den Ton immer höher werden lassend.
Ellen war völlig erstarrt, sie wollte sprechen, aber sie konnte nicht, doch erwiderte sie den Blick, den ihr der Indianer beim Hinausgehen zuwarf.
Jetzt wußte sie, woran sie war.
Viele Jahre waren verflossen, seitdem sie einst einem solchen Opfer der indianischen Justiz begegnet war. Ein schwarzer Hengst trug zwei Menschen auf dem Rücken, beide zusammengebunden, der eine lebendig, der andere schon halb verwest.
Ellen kannte das barbarische Gesetz der Prärie; sie hielt sich für berechtigt, rettend einzugreifen. Des Reiters Züge waren schon verzerrt. Die Zunge lechzte nach der eklen Speise. Der Strafe war genug, und wenn er hundert seines Stammes gemordet hätte!
Ellen schwang den Lasso und trieb ihr Pferd an, konnte das Verfolgte aber nicht erreichen. Der Hengst lief mit der Kraft der Verzweiflung, ihr Roß dagegen scheute sich vor dem Leichengeruch, der bereits die Luft verpestete.
Ihre Büchse tat bessere Wirkung. Eine Kugel brachte das Pferd zum Sturz, und es fiel so glücklich, daß der Gerettete unbeschädigt blieb.
Mit eigener Hand zog Ellen die beiden Körper hervor, sie überwand das Grausen und durchschnitt die Fesseln. Der singende Vogel, so nannte sich der Nawago, küßte ihre Hand und schwor, er sei ungerecht als Mörder seines Bruders angeklagt worden. Ellen glaubte ihm, sie verschaffte ihm ein Pferd und Waffen, und sie sah den singenden Vogel nie wieder.
Jetzt tauchte er abermals auf. In Ellens Herz war ein Hoffnungsstrahl gefallen. Der singende Vogel hatte sie erkannt und war willens, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Er sann auf ihre Rettung. Der Anfang war schon gemacht. Die Verständigung war eingeleitet, und Ellen durfte hoffen.
Kein Auge konnte sie die ganze Nacht schließen, die Stunden wurden ihr zur Ewigkeit, bis die Dämmerung, die nie dem Tage wich, anbrach und den Wächter herbeibrachte.
Ein schneller Blick belehrte sie, daß auf dem Korridor kein anderer Indianer stand, der Wärter war allein.
»Kennt mein roter Bruder mich noch?« flüsterte sie hastig, als der Indianer Brot und Wasser neben sie hinsetzte.
Der Indianer setzte seine Beschäftigung, das Reinigen der Zelle, sehr langsam fort, und in jener monotonen, singenden Weise erklang es von seinen Lippen:
»Der singende Vogel hat die weiße Squaw erkannt — sein Herz blutet — doch kann er nicht helfen.«
Dem Mädchen sank noch nicht der Mut. Etwas anderes war ihr vorläufig die Hauptsache.
»Kommst du auch zu den anderen Gefangenen?« flüsterte sie wieder, ohne den Kopf nach dem Indianer zu wenden. Sie hätten von oben beobachtet werden können.
»Der singende Vogel versorgt alle — er tut für dich, was er kann — das beste Fleisch gibt er dir.«
»Was ist unser Los?«
»Der Tod,« klang es klagend.
Ellen erbebte.
»Mein roter Bruder,« flüsterte sie, sich fassend, »du sagtest, du wolltest dich dankbar erweisen, willst du es noch?«
»Der singende Vogel will tun, was er kann.«
Mit hastigen Worten beschrieb Ellen das Aussehen Harrlingtons.
»Kennst du diesen?«
»Ich kenne ihn — ich gehe zu ihm.«
»So grüße ihn von mir, von seiner Braut, hörst du?«
»Ich werde es tun.«
Der Indianer hatte immer leise vor sich hingesungen und den Kopf nie gehoben, und so hätte selbst ein Beobachter wenig von einer Unterhaltung gemerkt. Gleichgültig ging er schließlich zur Tür und verließ die Zelle, ohne Ellen noch einen Blick zu gönnen.
Aber diese war überglücklich. So sollten also alte, fast vergessene Wohltaten vergolten werden! Sie hatte einen Freund gefunden, der ihr in der Not nicht nur Mitleid bewies, sondern ihr auch helfend zur Seite stand. So etwas ist nicht mit Gold zu bezahlen, nur schade, daß man es erst einsieht, wenn man allein und hilflos dasteht.
Ellen hatte am liebsten laut aufgejubelt, wenn sie sich ausmalte, wie ihr James betrübt in seiner Zelle saß, traurig, an die Geliebte dachte, wie der Wärter zu ihm trat und plötzlich der Gruß der Braut ihm ins Ohr gesungen wurde. In Ellens Phantasie verwandelte sich der singende Vogel in ein wirklich zwitscherndes Vögelchen.
Doch dann ward ihr Antlitz wieder bleich und ernst.
Harrlington verstand keinen der indianischen Dialekte, und sollte der Indianer des Englischen mächtig sein? Schwerlich.
Unruhig wanderte sie auf und ab. Nun mußte sie wieder bis zum Abend warten, ehe sie Auskunft bekam, ob ihr Gruß den Geliebten erreicht habe. Denn es stand zu erwarten, daß der singende Vogel ihre Zelle nur betrat, wenn seine Pflicht ihm das vorschrieb. Ein außergewöhnlicher Besuch hätte Verdacht erregen können.
Ihre Geduld sollte auf keine harte Probe gestellt werden.
Noch war keine Stunde vergangen, als der Wärter wieder ihre Zelle betrat. Am liebsten wäre ihm Ellen entgegengeflogen, aber sie mußte dem Beispiele des Indianers folgen, der gleichgültig, immer singend, den Raum durchschritt und umherspähte, als wolle er sich überzeugen, ob die Gefangene keine Anstalten zur Selbstbefreiung träfe.
Ellens Herz krampfte sich bei den ersten gesungenen Worten zusammen.
»Dein Freund versteht den singenden Vogel nicht — er antwortet nicht — auch achtet er auf sein Gezwitscher nicht — gib acht, ich komme wieder.«
Der Indianer brach kurz ab, er hatte den vollen Krug umgeworfen, das Wasser verbreitete sich über den Fußboden. Der singende Vogel bückte sich, den Krug aufzuheben, und gleichzeitig fiel neben Ellen ein weißes Stück Leder, etwa ein Fuß im Quadrat haltend, und rote Kreide nieder, wie sie die Indianer zum Bemalen der Gesichter verwenden.
Ellen hatte verstanden; wieder füllte sich ihr Herz mit Jubel. Doch schnell versteckte sie Leder und Kreide unter ihrem Kleide.
»Mach' schnell, ich komme wieder,« klang es singend, als der Indianer mit dem leeren Krug den Raum verließ, »Du bist jetzt unbeobachtet!«
Das ließ sich Ellen nicht zweimal sagen; mit zitternden Händen breitete sie das Leder auf dem Boden aus und malte mit der dicken Kreide kleine Buchstaben darauf. Die Schrift wurde undeutlich, aber die Liebe hat scharfe Augen.
Sie brauchte nicht nach Worten zu suchen. Im Nu war das Leder von oben bis unten auf beiden Seiten mit Schrift bedeckt.
»Teuerster James!
»Trau' dem Indianer, er ist ein Freund. Von ihm erhoffe ich Rettung. Und wird sie uns nicht, so sterbe ich mit Freuden, weiß ich mich doch von Dir geliebt. Nicht Tod, nicht Marter soll mich Dir abwendig machen. Es gibt ein anderes Leben, wo Du mich als die Deine wiederfinden wirst. Auf Wiedersehen denn, Heißgeliebter, hier oder dort! Schreib', wenn du kannst!
Deine Ellen.«
Schon kam der singende Vogel wieder. Er setzte den gefüllten Krug hin und begann das Wasser mit einem Lappen aufzuwischen. Der Indianer sang immer, durch diese Gewohnheit hatte er seinen Namen erhalten, es fiel also nicht auf.
»Ist meine weiße Schwester fertig?«
»Ich bin's. Er soll wieder schreiben. Gib ihm auch Leder und Farbe!«
»Wie nennt ihr das — worauf ihr schreibt — mit einem spitzen Stift — der schwarz färbt.«
»Papier und Bleistift,« entgegnete Ellen schnell.
»Dein Freund hat diese Sachen bei sich — ich habe ihn schreiben sehen.«
»So sag' ihm — oder nein, er wird dir ein Papier für mich geben. Willst du es mir bringen?«
»Der singende Vogel tut alles für seine weiße Schwester.«
Der Indianer erhob sich, brachte im Vorbeigehen geschickt das weiße Leder in seinen Besitz, ließ es in seinem auf der Brust offenen Jagdhemd mit der Geschicklichkeit eines Taschenspielers verschwinden und verließ abermals das Gemach.
Diesmal mußte Ellen lange warten, ehe der singende Vogel zurückkam. Er durfte einunddenselben Gefangenen nicht zu oft besuchen, das hätte die Aufmerksamkeit der draußen stehenden Posten erregt.
Es wurde Abend, als der singende Vogel mit dem Essen die Zelle wieder betrat. Der Krug stand an seinem Platz, der Korb daneben. Die Augen Ellens verfolgten mit fieberhafter Spannung jede Bewegung des Mannes, welcher zwar wie gewöhnlich sang, aber nicht im Interesse des Mädchens.
Schon wollte er die Zelle verlassen, schon wollte Ellen, außer sich vor Erwartung, auf ihn zuspringen und ihn zum Sprechen nötigen, als ein Blatt Papier in ihren Schoß flatterte.
Sie war allein. Die heftig zitternden Hände hielten die Antwort des Geliebten; sie wollte lesen, aber es war schon zu dunkel. Sie nahm wohl Schriftzüge wahr, aber diese zu entziffern war unmöglich.
Ellen hatte schon manche schreckliche Nacht schlaflos verbracht, aber so schneckenhaft langsam waren ihr die Stunden noch niemals verstrichen.
Unermüdlich wanderte sie auf und ab. Sie konnte es nicht lassen, die brennenden Augen auf das Blättchen zu heften, welches die Schriftzüge ihres Geliebten trug; es war vergebens, sie konnte nichts sehen, und das einzige, was ihr Linderung verschaffte, war, daß sie wieder und wieder die heißen Lippen auf dasselbe drückte, denn es war ja auch von der Hand des Geliebten berührt worden.
Was würde der morgende Tag offenbaren? Die Ergüsse eines nach Liebe schmachtenden Herzens, Ausrufe der Verzweiflung, Schmähungen gegen das Schicksal, Trostworte oder gar Aufforderungen zum Entsagen?
Ach, bräche doch der Morgen erst an!
Er kam. Ellen kauerte am Boden, hielt das Papier in den ersten, von oben hereinfallenden Lichtstrahl und strengte die Augen an, daß sie ihr zu schmerzen begannen. Sie nahm sich fest vor, dieselben zu schließen und langsam bis dreihundert zu zählen. Es kostete sie unsagbare Anstrengung, dies auszuführen, aber sie zwang sich dazu.
»Dreihundert!« — Ellen öffnete die Augen, es war hell. Sie las nicht, sie verschlang die Schrift mit den Augen, es war die markige, ausgeschriebene Hand von James.
»Geliebte Ellen!
»Was ich Dir mündlich nicht zu sagen wage, gestehe ich Dir schriftlich. Es liegt in meiner Hand, Dich zu retten, es bedarf nur eines Wortes von mir, und Du bist frei. Wenn Du dies liest, habe ich das Wort schon gesprochen, bald wird Dir Deine Freiheit verkündet werden. Folge dem, der Dir die erlösende Botschaft bringt! Nicht Eigennutz ist es, welcher mich dazu nötigt, Deiner zu entsagen, eben die Liebe zu Dir zwingt mich dazu. Auch mein Leben bleibt dadurch zwar erhalten, aber was gilt es mir ohne Dich? Und doch, ich nehme die Hand derer an, welche uns beide retten will. Frage nicht, wer diese Person ist! Du wirst sie kennen. Verstehst Du die Gefühle, die in meiner Brust miteinander kämpfen? Ich entsage, um Dich zu retten; was mit mir geschieht, kommt nicht in Betracht. Doch tausendmal lieber wäre mir, könnte ich Dich durch meinen Tod retten, aber der meinige bedeutet auch den Deinigen. Deshalb bleibe ich leben. Gewohnheit vermag viel, vielleicht gelingt es mir, mich an die zu gewöhnen, welche mich besitzen will. Beurteile sie nicht zu hart, Ellen, ich habe sie jetzt verstanden, sie ist nur aus Liebe zu mir eine Sünderin geworden, an meiner Seite wird sie eine andere werden. Versuche mich zu vergessen, wie ich Dich vergessen muß. Das Schicksal hat uns beständig gezeigt, daß wir einander nicht gehören sollen, wir, und besonders ich, suchten ihm zu trotzen und sind schwer dafür bestraft worden. Jetzt habe ich das Schicksal erkannt, ich gebe ihm nach; meine Bestimmung ist es, die Sünderin zu bessern und dich zu retten. Alle Rücksichten müssen jetzt schweigen. Ich weiß, daß ich mir nicht mehr selbst gehöre. Lebe wohl, Ellen, auf immer! Ich vergesse, was Du mir gewesen bist, vergiß auch Du mich! Du wirst einen anderen finden, der Dich glücklich macht, und der Himmel wird Euch nicht wieder feindlich entgegenstehen. Du siehst mich nicht wieder, suche mich nicht, ich kreuze nie wieder Deine Wege. Gott will es!
»Ich gebe dieses Schreiben heimlich dem singenden Vogel, es ist das letzte Zeichen von mir. Es war mir verboten, Dir zu schreiben, doch ich hielt es für meine Pflicht. Ich werde heute frei, auch Du wirst Deine Zelle verlassen können.
James Harrlington.«
Ellen hatte das Schreiben zu Ende gelesen. Kein Zucken in dem geisterbleichen Gesicht verriet, was in ihr vorging, und das Zittern der Hände hatte schon längst aufgehört.
Ohne einen Seufzer auszustoßen, knitterte sie das Papier zusammen, zerriß es und ließ es fallen.
Dann strich sie wie geistesabwesend mit der Hand über die Stirn, öffnete den Mund, als wolle sie schreien, schwankte und schlug bewußtlos zu Boden.
Hätte sie gewußt, daß er in diesem Augenblick einen ähnlichen Brief von ihr las, den der singende Vogel ihm in die Hände gespielt, sie würde sich die Sache weniger zu Herzen genommen, das ganze Gespinst des Lugs und Trugs durchschaut haben.
Doch eine wohltätige Ohnmacht enthob sie jetzt aller Schmerzen und alles Grübelns.
Sie wußte nicht, wie lange sie bewußtlos dagelegen hatte. Kühles Wasser benetzte ihre Stirn und brachte die entschwundenen Sinne zurück. Als Ellen aber die Augen aufschlug, schloß sie dieselben schnell wieder, denn ihr Blick hatte ein entsetzliches, schaudererregendes Gesicht gestreift. Es gehörte dem Manne, welchen sie schon einmal in der Hütte des Fallenstellers gesehen hatte.
Ellen blieb bewegungslos liegen. Eine angenehme Schwäche hielt ihre Gedanken umfangen und hinderte sie, an ihr letztes Unglück zu denken. Soviel nur wußte sie, daß sie aus diesem Zustande der Lethargie nicht erwachen durfte, wollte sie nicht vom Wahnsinn befallen werden. Dieser Zustand ist der Trost des Kranken; er macht den Schmerz nicht fühlbar, ist aber doch von diesem erzeugt, von körperlichem oder geistigem.
Eine feuchtkalte Hand ergriff die ihrige; sie fühlte den Druck unförmlicher, geschwollener Finger. Die Berührung brachte sie zum Bewußtsein.
»Rühre mich nicht an, Ungeheuer!« schrie Ellen entsetzt, richtete sich halb auf und drückte sich in eine Ecke.
Sie sah, daß sie nicht geträumt hatte.
Vor ihr stand wirklich jene gräßliche Erscheinung mit dem haarlosen Kopfe voller Beulen, dessen Häßlichkeit der Besitzer nicht zu verdecken suchte.
Ihr Blick fiel auf die am Boden zerstreut liegenden Papierstückchen, sie erinnerte sich an das, was passiert war. Doch sie erschrak nicht mehr, entweder war der Schmerz zu groß oder die Nachricht des Geliebten, seine treulose Handlung unter dem Mantel der Liebe vermochte keinen Schreck in ihr zu erzeugen.
Jetzt fürchtete sie sich nur noch vor diesem Manne; sie beobachtete ängstlich jede seiner Bewegungen.
»Nun, Ellen, mein Täubchen!« krächzte es aus dem zahnlosen Munde. »Wie steht es? Ich komme, um dich aus dem dunklen Kerker zu holen.«
»Verlaß mich!« rief Ellen. »Mein Weg aus dieser Zelle führt in den Tod.«
»Du irrst! Ich komme nicht, um dich als Schlachtopfer auszuliefern, ich komme, dich zu befreien. Doch einige Bedingungen knüpfen sich daran.«
»Ich gehe auf nichts ein. Weiche von mir, und laß mich hier in Frieden sterben!«
»Oho,« grinsten die dicken, blauen Lippen. »Denkst du schon ans Sterben? Sieh mich an, erscheine ich dir nicht wie ein lichtstrahlender Engel, der dir, wie seiner Zeit dem gefangenen Petrus, die Pforten des Kerkers öffnet?«
»Du wagst noch, mit deinem Unglück zu spotten, Mensch? Daran erkenne ich, daß Gott dich nicht ungerecht so gestraft hat. Er hat dich gerechterweise mit Krankheit geschlagen. Geh, ich kann dich nicht bedauern, deine Seele gleicht deinem Körper.«
Der Mann zuckte mit den Fingern.
»Weißt du, wer vor dir steht?« krächzte er.
»Ein Ungeheuer an Leib und Seele.«
»Eduard Flexan.«
Ellen hatte nicht mehr die Kraft, spöttisch zu lachen. Mit starren Augen musterte sie die Erscheinung.
»Nicht möglich,« hauchte sie dann.
»Ich bin Eduard Flexan, dein Vetter.«
Ellen wandte den Kopf zur Seite.
»Wenn du nicht wahnsinnig bist, so bist du ein Lügner,« entgegnete sie. »Ich kenne Eduard Flexan und weiß auch, wo er ist. Er ist da, wo es kein Entrinnen mehr gibt.«
»Er ist tot, meinst du?« lachte er heiser. »Nein, er war auf der Felseninsel, auf welcher auch die Vestalinnen mit dir sich einige Wochen aufgehalten haben. Habt ihr die Insel nicht verlassen können? So bin auch ich von dem Eiland gekommen. In Hoffmanns Quecksilberkammer allerdings hat Eduard Flexan seine Schönheit eingebüßt.«
»So gehe hin, woher du gekommen bist! Für uns beide ist der größte Raum zu eng. Hast du mir schon früher jeden Ort durch deine Anwesenheit verleidet, selbst mein eigenes Haus, so verpestest du mir jetzt auch hier die Luft.«
Ellen zweifelte nicht mehr, daß wirklich Eduard Flexan vor ihr stand — es war alles möglich. Sie hatte dies schon oft genug erfahren.
»Du spottest über mich,« fuhr Flexan wütend auf. »Weib, ich kann dich wie eine Kröte zermalmen!«
»Tue es! Ich würde dir dankbar sein.«
»Das möchtest du wohl, doch so schnell geht das nicht. Zu meinen Füßen sollst du noch liegen, diese meine Hand lecken und mich um Erbarmen betteln.«
Jetzt mußte Ellen doch lachen.
»Du glaubst mir nicht? Ich werde es dir zeigen.«
»Nur zu.«
»Hoffst du noch auf Harrlington? O, wenn du wüßtest, wo er jetzt ist.« —
»Im Kerker, wie ich.«
»Er ist frei!«
»Ich glaub's nicht.«
»So höre denn, wo er ist: In diesem Augenblicke liegt er in Miß Morgans Armen!« rief Flexan mit teuflischer Schadenfreude. »Die, welche er schon einmal geliebt, hat er wiedergefunden. Hahaha, es wurde ihm nicht schwer, zwischen Miß Morgan und dem Feuertode zu wählen. Auf der einen Seite sah er die Pfannen mit glühenden Kohlen stehen, auf der anderen Miß Morgan. Er hat nicht lange mit seiner Wahl gezögert.«
Langsam hatte sich Ellen vom Boden erhoben, jetzt lehnte sie mit geballten Fäusten an der Wand. Stürmisch rang der Busen nach Atem; es dauerte lange, ehe sie eine Entgegnung fand.
Sie sprach erst ganz leise, aber immer mehr schwoll ihre Stimme, bis sie wie Donner in Flexans Ohren hallte:
»Meint ihr, ich würde noch länger eueren Lügen glauben? Denkst du, ich wüßte nicht, daß auch jener Brief da, der zerrissen am Boden liegt, gefälscht ist? Lord James Harrlington soll aus Furcht vor dem Tode meiner entsagen? Haha, das erzählt jemand anderem. Ich durchschaue dein und Miß Morgans Lügengewebe vollkommen. Wie kann Harrlington nur eine Sekunde zwischen mir und jener schwanken! Ebensowenig zögert er, in den Tod zu gehen, ehe er mich dadurch rettet, daß er Miß Morgan die Seine nennt. Heuchler ihr, Lügner, Schurken, die ihr nicht wert seid, daß euch die Sonne bescheint, weswegen ihr euch auch wie giftige Schlangen in finstere Winkel versteckt, aus denen hervor ihr euer Gift spritzt! Bei Gott, ekelte ich mich nicht davor, dich zu berühren, ich würde dir Verruchten eine andere Antwort geben. Doch du bist schon als Abschaum der Menschheit gekennzeichnet, ein anderes Mal in deinem Gesicht ist nicht nötig. Verlaß mich, und willst du an mir deine Rache kühlen, so tue es bald, foltere und martere mich, rufe Miß Morgan als Zuschauerin herbei, dann kann ich, während ich sterbe, ihr immer und immer wieder zurufen, daß James mir gehört, und das soll meinen Tod, selbst auf dem Scheiterhaufen, schmerzlos machen und versüßen. Höre und sage es jenem elenden Weibe: Nie wird Harrlington von mir lassen; und würden ihm, ans Kreuz geheftet, alle Schätze und Freuden der Welt geboten, er würde nicht vom Marterpfahl herabsteigen, wenn ich ihm nicht meine Arme entgegenstreckte. Und von mir, von Ellen Petersen, gilt dasselbe; er oder der Tod, eine andere Wahl gibt es nicht. Ich bin die Seine, und Feuer und Wasser, Himmel und Hölle sollen mich nicht von ihm trennen. Gehe hin, Scheusal, von Gott Verfluchter, und sage es!«
Erschöpft sank Ellen zurück. Sie hatte ebensowenig wie der vor Wut bebende Flexan gemerkt, daß sich die Tür geöffnet und eine Gestalt hereingetreten war.

»Sind das die Liebesworte, Eduard, die du mit der Sehnsucht deines Herzens wechseln wolltest?« ließ sich Miß Morgans spöttische Stimme vernehmen.
»Auch das noch!« murmelte Ellen bitter.
»Ja, auch das noch,« fuhr Sarah fort, »ich habe wohl gehört, wie freundlich Sie von mir gesprochen haben. Allein die scharfsinnige Kommandantin der ›Vesta‹ hat sich auch diesmal, wie schon so häufig, getäuscht. Lord Harrlington zieht die Freiheit und mich einer platonischen Liebe vor.«
»Weib, du lügst!« stammelte Ellen.
»Sie werden nachher aus seinem eigenen Munde, verstehen Sie mich recht, aus seinem eigenen Munde vernehmen, daß er mir die Treue, die er mir einst geschworen, zu halten gewillt ist. Haben Sie noch nie gemerkt, daß James wankelmütig ist? Sie haben ihm vorhin zwar ein sehr gutes, aber unwahres Zeugnis ausgestellt. Ich glaube gern, daß er Ihnen oftmals Liebe geschworen hat, besonders in letzter Zeit, aber ich habe ältere Ansprüche auf ihn, als Sie. Wir haben nicht nur Schwüre gewechselt und Küsse getauscht. Liebte ich ihn nicht wirklich, ich hätte doch bereits das Recht, mich Lady Harrlington zu nennen.«
»Dirne!«
»Zische nur! Dein Geifer fällt schadlos zur Erde. Mir kann er nichts anhaben.«
»Und du versuchst vergeblich, mir das Herz zu zerfleischen. Ich zweifle nicht an Lord Harrlington.«
»So? Er wird es dir dann selbst sagen.«
»Ein jedes Wort, ein jeder Hauch aus deinem Munde enthält eine Lüge.«
»Glaubst du auch ihm nicht?«
»Wenn er so zu mir spricht, so ist es nicht James, sondern ein anderer.«
»Wohl!« lachte Miß Morgan, den Sinn der Worte verdrehend. »Lord Harrlington ist durch dein kaltes Wesens deinen Hochmut abgestoßen. Hier aber schlägt ein Herz, an dem er sich erwärmen kann. Seit wir uns ausgesprochen haben, ist er allerdings ein anderer geworden. Noch vor einer Stunde hat er mir selbst gestanden, er könne nicht begreifen, wie er von deiner frostigen Kälte auch nur einen Augenblick angezogen werden konnte, und wir besiegelten unseren Bund von neuem. Ja, starre mich nur entsetzt an, Ellen! Konnte nichts dir geraubt werden, weder Geld und Gut, noch das Leben, deinen Geliebten habe ich dir doch entführt! Weine, Ellen, jammere, raufe dir das Haar! Unglückliche, ich habe den Sieg davongetragen, ich triumphiere über dich!«
Diese Worte waren mit solcher Freudigkeit und so siegesgewiß gerufen worden, daß selbst Ellen an die Wahrheit derselben zu glauben begann. Ihr Antlitz war totenbleich, ihr Körper zitterte wie Espenlaub.
Einer Antwort war sie unfähig.
Jetzt hielt Miß Morgan die Zeit für gekommen, zugunsten Flexans ein Wort zu reden. Dieser spielte eine sehr traurige Rolle, um so mehr, als Miß Morgan, um Ellen noch mehr zur Verzweiflung zu bringen, mit seiner unmenschlichen Häßlichkeit Spott trieb.
»Noch ist Ihr Schicksal nicht so schlimm, wie Sie glauben, Miß Petersen,« nahm sie in ruhigem Tone wieder das Wort. »Ich will offen mit Ihnen sprechen: Ich hasse Sie, mein höchster Wunsch ist, Sie zu töten, und es läge jetzt auch vollkommen in meiner Macht, ihn auszuführen. Ich brauchte nur einige Tage zu warten, denn der Tod ist sowieso Ihr Los. Ich könnte ihn abwenden, tue es aber nicht, weil ich nicht gegen meine Natur handeln kann. Doch hier steht ein Mann, der Ihnen schon oft seine Freundschaft angeboten hat, die Sie aber stets in beleidigender Weise zurückgewiesen haben. Jetzt kommt er noch einmal.«
»Wer ist es?« fragte Ellen.
»Er sagte Ihnen die Wahrheit, er ist Ihr Vetter Eduard Flexan, dessen Gestalt durch Hoffmanns frevelhafte Behandlung etwas gelitten hat. Diesem Teufel aber soll es vergolten werden.«
»Er hat recht gehandelt,« sagte Ellen. »Zu einer häßlichen Seele gehört auch eine abscheuliche Gestalt.«
Flexan wollte auffahren, doch Miß Morgan hielt ihn am Arme zurück.
»Sprechen Sie nicht so von ihm!« fuhr Sarah fort. »Er ist der einzige Freund, den Sie jetzt noch besitzen. Zählen Sie vor allen Dingen nicht mehr auf Lord Harrlington, er gehört mir jetzt mit Leib und Seele, er denkt bereits gar nicht mehr an Sie.«
Ellen bewegte die Lippen, schwieg aber.
»Kurz gefragt: wollen Sie Ihre Freiheit Eduard Flexan zu verdanken haben?«
Fast schien es, als ob Ellen geneigt wäre, auf den Vorschlag einzugehen, sie ließ die Blicke von einem zum andern wandern und antwortete dann:
»Unter welchen Bedingungen?«
»Sie wissen doch, daß Flexan Sie früher geliebt hat.«
»Ich weiß es.«
»Nun, er liebt Sie jetzt noch ebenso stark.«
Ellen zuckte zusammen. So kalt sich Sarah auch stellte, und so sehr sie das höhnische Lächeln verbergen wollte, ihrer Feindin entging es doch nicht.
»Reichen Sie Flexan die Hand,« sagte Miß Morgan weiter, »und er wird Sie aus diesem finsteren Kerker in die Welt, ins Sonnenlicht zurückführen. Sie brauchen kein verächtliches Gesicht zu machen, Miß Petersen; mit dem Handreichen meinte ich nicht gleich den Bund vor dem Altar, sondern nur ein Zeichen der Einwilligung. Wie Sie es später halten wollen, weiß ich nicht, das geht mich auch nichts an, ich will Sie nur für immer von meinen Kreisen fern wissen. Heiraten Sie oder heiraten Sie ihn nicht, wie Sie wollen; ich weiß nicht, wie Mister Flexan darüber denkt.«
Sarah sah den Mann an ihrer Seite an. Flexan blickte mit zusammengekniffenen Augen auf den Boden, er fühlte wohl den Spott, der in ihren Worten lag, zugleich war aber in seinem Herzen ein Hoffnungsstrahl aufgegangen.
»Ich lese aus Flexans Augen,« fuhr Sarah mit bitterer Ironie fort, »daß er anders, als Sie, denkt, und da ich nun einmal begonnen habe, für ihn die Heiratsvermittlerin zu spielen, will ich auch weiter zu seinen Gunsten sprechen. So schön, wie er früher gewesen, ist er nun freilich nicht mehr, aber immerhin ist er doch noch ein Mensch, der sich in Gesellschaft blicken lassen kann, ja, sogar Aufsehen erregen wird. Und vor allen Dingen glaube ich, daß er einen vorzüglichen Ehemann abgeben wird. Frei von Eifersucht dürfen Sie sein, Miß Petersen, es ist schwerlich —«
»Halten Sie ein mit Spott,« unterbrach Ellen die Sprecherin entrüstet, »oder meinen Sie, Sie ergötzen mich mit solchen Worten? Es sieht Ihnen allerdings vollkommen ähnlich, mit einem Unglücklichen Spott zu treiben. Ich kann wohl einen solchen Menschen verabscheuen, nicht aber über ihn spotten.«
»Hörst du, Eduard? Sie verabscheut dich,« wandte sich Miß Morgan an diesen.
»Ich weiß es,« murmelte Flexan, und laut sagte er dann: »Ellen, willst du mir folgen? Ich bringe dich in die Freiheit.«
»Und der Preis dafür?«
»Deine Liebe.«
Ellen konnte nicht anders, sie mußte lachen, aber es war das Lachen der Verzweiflung. Auf solche Weise also konnte sie sich das Leben erkaufen.
»Du lachst,« zischte Flexans heisere Stimme. »Was bleibt dir denn noch übrig? Wähle zwischen mir und dem Tode.«
»Der Tod ist mir tausendmal lieber als du, dessen Charakter noch häßlicher ist als der Körper.«
»Verfluchtes Weib,« knirschte Flexan. »Hüte dich, daß du nicht auch noch so mißgestaltet wirst, wie ich! Es könnte die Zeit kommen, daß sich Harrlington mit Grausen von dir wendet.«
»Nie!« rief Ellen. »Was mit meinem Aeußeren auch geschähe, James liebt meine Seele.«
»Er liebt deine schöne Gestalt.«
»Wohl, ich bin glücklich, daß ich ihm gefalle.«
»Sarah, das Fläschchen,« zischte Flexan, und seine ausgestreckten Hände zitterten.
Miß Morgan trat einen Schritt auf Ellen zu.
»So verschmähst du diesen Mann?«
Ellen lachte.
»Verschmähen? Soll ich ihn etwa lieben? Der barbarischste Neger, der mißgestaltetste Zwerg wäre mir lieber, wenn seine Gesinnung nur eine edle ist. Ich hasse dieses Scheusal, mehr als zuvor.«
»Das Fläschchen, Sarah, das Fläschchen,« wiederholte Flexan, der seine Wut nicht mehr bemeistern konnte.
»Hoffst du noch immer auf Harrlington, Törin?« höhnte Miß Morgan. »Laß dir's doch gesagt sein! Er denkt nicht mehr an dich, und sollten doch Erinnerungen in ihm auftauchen, so sorge ich dafür, daß sie im Keime erstickt werden. Ich gehe jetzt, doch bald komme ich wieder. Von weitem sollst du mich in seinen Armen liegen sehen. Weißt du, was er von mir denkt? Er empfing einen Brief von dir, von mir mit deiner Handschrift abgeschrieben, er glaubt, du seiest mit Scheidewasser begossen worden, ich habe es bestätigt und nicht vergessen, dein von Gift zerfressenes Gesicht recht anschaulich zu beschreiben. Er hat sich entsetzt, er will dich nicht mehr sehen, aber doch werde ich ihn dich erblicken lassen. Adieu, Ellen, mein Gemahl erwartet mich, er schmachtet nach meinen Küssen.«
Lachend wollte sich Sarah umwenden; ihr Vorrat an Gift war verspritzt, es war ihr unmöglich, Ellens Herz noch mehr zu verwunden.
Doch auch mit deren Selbstbeherrschung war es vorüber. Der Glaube an Harrlingtons Treue stand bei ihr wieder felsenfest. Unsagbare Entrüstung gegen diese Geschöpfe überkam sie.
Mit einem Sprunge stand sie vor dem Weibe.
»Elende Dirne, schamlose Lügnerin!«
Auf Sarahs Wange fiel ein klatschender Schlag, der sie an die Wand der engen Zelle warf.
Ein unartikulierter Schrei, dem Gebrüll des verwundeten Wolfes gleich, entrang sich der Kehle der Geschlagenen. Blitzschnell fuhr die Hand in die Tasche. Sie hatte ein entkorktes Fläschchen in der Hand und spritzte dessen Inhalt in Ellens Gesicht.
»Dies für den Schlag!« keuchte sie. »Bleibst du am Leben, so sollst du die Häßlichkeit selber sein. Und ich will dafür sorgen, daß du am Leben bleibst.«
Schon war die Tür auf; sie drängte Flexan hinaus, und der Kerker schloß sich wieder. Drinnen stand Ellen bewegungslos da, die Hände vor dem Gesicht.
»Es ist geschehen,« flüsterte Miß Morgan zu ihrem Begleiter. »Eduard, du bist gerächt, und ich bin die Nebenbuhlerin los, Himmel und Hölle, ich hab's getan und bereue es nicht! Blind und häßlich, von Brandwunden entstellt, hahaha, so weiß sich Sarah Morgan an ihrer Nebenbuhlerin zu rächen.«
Das Weib eilte davon, Flexan stehen lassend.
Doch schon nach wenigen Schritten hemmte sie den Fuß und legte das Ohr an die Wand. Die Mauer ließ ganz schwach den Schall von Schritten durchtönen.
Der Indianer, welcher hier wachte, glaubte, sie wolle die Tür geöffnet haben, er näherte sich ihr, doch sie schüttelte den Kopf, eilte weiter und stieg eine Treppe empor, welche sie in den nächsthöheren Korridor brachte.
An der Innenseite der Mauer befanden sich, wie schon erwähnt, große Scharten, durch welche man in die einzelnen Zellen hinunterspähen konnte. Hier befanden sich die untersten Löcher, aber sie waren noch viel zu hoch, als daß man sie von unten mit der Hand hätte erreichen können.
Durch eine dieser Scharten beugte sich Miß Morgan und blickte hinab in den schwach erleuchteten Raum.
»Lord Harrlington!«
Der unten stehende Mann hob den Kopf und sah, zwei Meter über sich, das Gesicht derer, die er einst im Drange der Leidenschaft umfangen hatte und jetzt verachtete.
Harrlingtons Züge waren ernst, aber durchaus nicht traurig. Eine unbeugsame Energie war darin zu lesen. Wären Sarahs Augen nicht von Liebe verblendet gewesen, sie hätte dies erkennen und wissen müssen, daß hier all ihr Bemühen fruchtlos bleiben würde. Aber sie wollte es nicht glauben, noch hoffte sie, Harrlington zwingen zu können, ihr wieder in Liebe zu begegnen.
»Kommen Sie, um mir neue Lügen zu erzählen? Eitle Bemühungen!« entgegnete der Lord.
»Sie glauben mir nicht, daß Ellen von ihrem alten Liebhaber mit Scheidewasser begossen wurde? Es ist doch so, so leid es mir tut. Ich habe mich eben selbst davon überzeugt. Sie sieht entsetzlich aus.«
Auf Harrlington blieben diese Worte ohne Wirkung.
»Wer war der Verruchte?«
»Der Mann, den Sie in der Hütte des Fallenstellers sahen.«
»Den Gott schon so hart gezüchtigt hat? So möge ihm seine Untat in der Ewigkeit vergolten werden; auf Erden ist er schon gestraft genug! Ein Liebhaber Ellens, sagen Sie? Sie dichten die unglaublichsten Sachen zusammen.«
»Es ist Eduard Flexan, der im Quecksilberlaboratorium von Kapitän Hoffmann Gift in den Körper aufgenommen hat.«
»So? Ich bedauere ihn nicht.«
»Lord Harrlington, Sie haben ein grausames Herz.«
»Durchaus nicht, doch meine Feinde kann ich nicht lieben.«
»So lieben Sie Ihre Freunde!«
Der Lord lachte bitter.
»Wo sind diese?«
»Hier,« sagte Sarah leise.
»Sie?« entgegnete Harrlington verächtlich. »Gerade Sie sind es ja, welche mir die Freunde und die Freude am Leben zu rauben sucht.«
»James,« fuhr Sarah mit bebender Stimme fort, »bei Gott, du irrst dich in mir. Nur aus Liebe zu dir habe ich dies alles getan. Die Liebe ist mächtiger als alle anderen Gefühle, deshalb bin ich zu entschuldigen. Gönne mir nur ein gutes Wort, und die Türen deines Kerkers öffnen sich, du bist frei.«
»Deine Liebe ist unrein, ich verschmähe sie.«
»Ich will nicht dein Weib werden, laß mich nur deine Geliebte sein! Kannst du eine größere Demütigung von mir verlangen?«
»Es gelingt dir nicht, mich zu verführen, Schlange! Ich verachte dich aus tiefstem Grunde meines Herzens.«
»Verachte mich, aber herze mich! Ich will deine Sklavin sein,« flehte Sarah.
»Nimmermehr! Ellen ist die, nach welcher ich mich sehne. Mein Herz gehört nur ihr.«
»Sie liebt dich nichts schon hat sie, um ihr Leben zu retten, sich dem Willen Flexans gefügt.«
»Du lügst! Sie liebt mich doch und stirbt lieber, als daß sie einem anderen folgt.«
»Ellen ist deiner nicht wert. Ich schwöre dir, sie hat dich verleugnet. Flexan hat sie, um sie für eine Beleidigung wegen seiner Häßlichkeit zu züchtigen, mit Scheidewasser Übergossen. Nun ist sie blind und häßlich, entsetzlich entstellt, aber Flexan hat doch sein Ziel erreicht. Ihre Kraft ist gebrochen, sie folgt Flexan, ihm an Häßlichkeit gleich.«
Harrlington stöhnte wie ein verwundetes Raubtier auf.
»Und ist Ellen blind und entstellt, meine Liebe gehört ihr doch für immer. Hörst du's, Teufelin?«
Sarahs Stimme klang nicht mehr demütig, sondern höhnisch und herausfordernd, als sie sagte:
»Du könntest Ellen auch lieben, wenn ihre Augenhöhlen ausgebrannt und ihre Züge von Säure zerfressen wären?«
»Ich würde sie nur um so mehr lieben und keine Sekunde zögern, sie zu meinem Weibe zu machen.«
»Törichter Narr!« lachte Sarah hinab.
Harrlington war klüger, als Ellen; er verschmähte, auf beleidigende Worte Antwort zu geben. Mit verschränkten Armen lehnte er an der Wand.
»Willst du deine Braut mit dem schönen Gesicht sehen?« spottete das Weib weiter.
»Nein.«
Sarah biß sich auf die Lippen. Sie war diesem Manne gegenüber machtlos. Mit Ellen hatte sie leichteres Spiel gehabt.
»James,« begann sie wieder mit schmeichelnder Stimme.
Keine Antwort.
»James, zwinge mich nicht zum Aeußersten!«
»Tue es.«
»Gönne mir ein Wort der Liebe!«
»Dirne!«
Sarah bekam dasselbe Wort zu hören, mit dem Ellen sie benannt. Ihr Blut wallte auf.
»Du verschmähst mich und meine Liebe?« zischte sie. »Wohlan, noch habe ich Mittel, dich zu zwingen! Wir sprechen uns wieder, Lord Harrlington, vergiß das nicht!«
Sarah zog sich zurück; ihr Kopf brannte in Fieberhitze, der wogende Busen wollte das enge Kleid zersprengen.
Lange stand sie so da, nach Ruhe ringend; sie drückte die Hände auf den Busen, sie konnte ihn nicht besänftigen noch Herr der Röte werden, die ihr Gesicht, Nacken und Hals überzog.
Sie hatte sich wie eine Dirne erniedrigt.
Und doch hätte sie, wenn sie gekonnt, alle Schätze der Welt dafür gegeben, um Harrlington zu gewinnen, einmal um seiner selbst willen, und dann, um Ellen demütigen zu können. Als sie dieser vorhin gesagt, sie sollte sie, Sarah, im Arme Harrlingtons sehen, hatte sie zwar nur eine Hoffnung ausgesprochen, aber diese beschäftigte sie Tag und Nacht so stark, daß sie manchmal auf die fixe Idee kam, die Hoffnung wäre schon zur Wirklichkeit geworden oder müsse es bald werden. Hoffen und Harren macht manchen zum Narren, sagt das deutsche Sprichwort.
Jetzt aber wurde es Sarah klar, daß sie nichts erreicht hatte, daß sie noch ebensoweit vom Ziele entfernt war, wie vor einem Jahre. Sie brauchte sich keinen Illusionen hinzugeben, James liebte sie nicht, ja, er verachtete sie sogar.
Sie stampfe heftig mit dem Fuße.
»Und er muß doch mein werden« knirschte sie, »und könnte ich ihn erst sterbend umarmen! Er hat die Todespein noch nicht kennen gelernt, er soll sie kosten, und,« fügte sie langsam mit teuflischem Gesichtsausdruck hinzu, »Ellen sterben sehen, durch seine Schuld. Ja,« schrie sie auf, »er selbst soll sie martern, ohne seinen Willen, aber er soll willenlos die Ursache dazu sein. O, ich kenne diese Mittel, wie man so etwas macht. Flexan, bah! Dieser lebende Tote, dem alles genommen worden ist, nur seine sinnlose Leidenschaft nicht, muß mir dazu behilflich sein.«
Sie erinnerte sich an Ellen, und wie sie die Unglückliche zugerichtet hatte. Die teuflischste Schadenfreude spiegelte sich auf ihrem Antlitz wider.
»Ich will mich wenigstens an ihrer Häßlichkeit ergötzen,« murmelte sie. »Ihr entstelltes Gesicht wird wie Balsam auf meine Wunden wirken.«
Sie eilte durch den Korridor und stieß, als sie um eine Ecke bog, mit Flexan zusammen.
»Du hier?« rief sie erzürnt. »Habe ich dir nicht streng befohlen, dich nie aus den dunklen Räumen zu entfernen, weil du den Indianern Entsetzen einflößest? Du bist daran schuld, wenn auch mir der Aufenthalt innerhalb der Ruine verboten wird.«
Doch plötzlich verstummte sie. Sie kannte Flexans entstelltes Gesicht schon zur Genüge. Dasselbe war des Ausdruckes des Schreckens nicht mehr fähig, aber es war ungeheuer verzerrt. Die blauen Lippen bewegten sich, ohne einen Laut hervorbringen zu können.
»Was gibt's?« rief Sarah besorgt. »Bringst du mir wieder eine Unglücksbotschaft?«
Sie duldete diesmal, daß die unsaubere Hand ihren Arm umfaßte und sie mit fortzog. Dem Benehmen Flexans nach mußte etwas Außergewöhnliches passiert sein, und Sarah vergaß daher den Widerwillen vor Flexan.
Schon nach wenigen Schritten blieb dieser stehen und deutete wortlos auf eine Scharte in der Mauer. Durch sie hatte man einen Einblick in die Zelle, welche Ellen einnahm.
Sarah glaubte nichts anderes, als der Verhaßten sei auf eine wunderbare Weise die Flucht gelungen. Mit angehaltenem Atem beugte sie sich vor.
Doch Ellen befand sich noch in dem Kerker. Sie hob, das Geräusch hörend, ihr Gesicht, und erschrocken fuhr Sarah zurück — Ellens Antlitz strahlte ihr in unveränderter Schönheit entgegen. Kein rotes Fleckchen verriet, daß das Scheidewasser seine Wirkung getan hätte.

Ellens Antlitz strahlte noch in unveränderter Schönheit.
»Ist denn das Weib mit dem Teufel verbündet, daß ihm die Säure nichts schadet?« stammelte Sarah.
»Du hast sie nicht getroffen,« krächzte es aus Flexans Munde.
»Der ganze Inhalt traf ihr Gesicht. Ich sah die Tropfen hängen, wie sie mit den Händen nach den Augen fuhr.«
»Hast du das Fläschchen noch?«
Sarah hatte es bei sich, sie gab es Flexan. Dieser prüfte es und fand, daß es dasselbe Fläschchen war, welches er Sarah eingehändigt hatte. Sie konnte damals den Geruch nicht vertragen, so scharf war die Säure gewesen.
Flexan entfernte den Glasstöpsel und roch lange hinein. Einen immer furchtbareren Ausdruck nahmen seine Züge an.
»Weib,« brüllte er dann, »du steckst mit Ellen unter einer Decke! In diesem Glase war kein Scheidewasser.«
Er ließ den letzten Tropfen des Inhaltes auf die Hand laufen und kostete vorsichtig.
»Wasser,« murmelte er. »Sarah, du hast die Flüssigkeit vertauscht!« schrie er dann wieder und heftete die kleinen blutunterlaufenen Augen mit schrecklichem Ausdruck auf Sarah.
»Bei Gott, Flexan, ich hab's nicht getan.«
»Wer sonst? Ich etwa?«
Flexan war so außer sich über diese Täuschung, daß er Miene machte, sich auf Sarah zu stürzen. Doch schon bei der ersten, dieses Vorhaben verratenden Bewegung blitzte ihm der Lauf eines Revolvers in der Hand des Weibes entgegen.
»Keine Torheit, Flexan!«
Dieser hatte sein Leben doch noch lieb, er blieb wie angewurzelt stehen.
»Ich glaube eher, du hast mir das Fläschchen genommen, die Säure ausgegossen und Wasser hineingefüllt,« fuhr sie fort, »denn du liebtest ja Ellen um ihrer Schönheit willen.«
»Du trugst das Fläschchen bei dir!«
»So hast du es mir aus der Tasche gestohlen. Du kennst derartige Kniffe.«
»Mit diesen Fingern,« hohnlachte Flexan und streckte die geschwollenen Hände vor.
»Du bist es gewesen,« behauptete er.
»Nein, du! Du liebtest Ellen.«
»Gut denn,« sagte Flexan endlich, »ich glaube dir, daß du es nicht gewesen bist, aber auch ich trage keine Schuld daran. Weiß der Himmel, wodurch sich die Säure plötzlich in Wasser verwandelt hat! Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.«
»So ist es recht. Hast du noch mehr von diesem Stoff?« fragte Miß Morgan.
»Nein,« entgegnete Flexan, »ich dachte ...«
»Schon gut, wir können anderen bekommen und zwar sofort. Von diesem Loche aus wollen wir das Experiment erneuern, und hier können wir auch gleich die Folgen beobachten.«
»Kannst du in den Besitz von Scheidewasser kommen? Ich brenne danach, die mir im Aussehen gleichzumachen, die mich wegen meiner Häßlichkeit verspottet hat.«
»Der alte Vater hat ein Laboratorium mit allen Chemikalien. Er wird uns Säure geben.«
»Ah, vortrefflich! Schnell! Laß uns gehen!«
Sarah schritt voran, Flexan folgte ihr.
Plötzlich erscholl hinter der Voranschreitenden ein lautes, spöttisches Lachen, sie wandte sich um.
»Warum lachst du?«
»Ich lachte nicht, du warst es,« entgegnete Flexan. »Warum hast du gelacht?«
Wieder entstand ein Wortwechsel. Keins wollte gelacht haben. Sarah ging zurück und sah um die Ecke, erblickte aber keinen Menschen. Nur ein Bär kam eben dahergetrottelt.
»Ach, Mythra,« rief Sarah erschrocken. »Schnell, daß wir fortkommen! Ich bin froh, daß ich dieses Tier losgeworden bin. Es könnte wieder Geschmack an meiner Gesellschaft finden.«
Doch Mythra schien ihre Freundin vergessen zu haben, oder sie hatte etwas anderes im Sinn, sie trabte in einen Seitengang, ohne sich um die beiden zu kümmern.
»Gott sei Dank,« rief Sarah und eilte weiter.
Da plötzlich erscholl eine furchtbare Detonation. Die Luft wurde von dem Donner erschüttert. Die Mauern bebten, und der Boden zitterte unter den Füßen der Schurken.
Gleichzeitig stürzten beide zu Boden. Sie meinten nichts anderes, als das ganze Gemäuer bräche über ihren Köpfen zusammen. Sie warteten auf den zweiten Donner, aber dieser blieb aus.
Sarah war die erste, welche sich langsam aufrichtete, die Haare aus dem Gesicht strich und sich verwirrt umschaute.
»Was war das?« stammelte sie entsetzt. »Das war nicht jener künstliche Donner, den der alte Vater zu erzeugen versteht.«
»Das klang wie eine Explosion,« meinte der erschrockene Flexan, sich auch aufrichtend.
Auch die übrigen Bewohner der Ruine waren erschrocken. Trotz der dicken Mauern vernahm man ihr Schreien und hastiges Hin- und Herlaufen. Ueberall ward es lebendig, sie mußte eine Unmenge von Menschen beherbergen.
Da stürzte durch den Gang ein weißhaariger Greis im langen, schwarzen Gewand auf die beiden zu — der alte Gelehrte.
»Was ist geschehen?« rief ihm Sarah entgegen.
»Nichts von Bedeutung für euch, aber schrecklich für mich,« erwiderte der Alte, in dessen Gesicht mehr Gram als Schrecken zu lesen war. »Wo ist Arahuaskar?«
»Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich in seinen Räumen. Aber so sprechen Sie doch! Was für eine Explosion war das?«
»Mein Laboratorium ist plötzlich mit allem, was darinnen war, in die Luft geflogen. Ach, meine schönen Instrumente, meine seit Jahren gesammelten Mumien, Reliquien und Schätze — alles, alles dahin.«
Der Alte war in seinem Jammer trostlos.
»Wo ist es geschehen? Nahmen Sie ein Experiment vor?«
»Nein, nichts war vorhanden, was hätte explodieren können, wenigstens meines Wissens. Es müssen sich Gase entzündet haben.«
Dem Gelehrten traten die Tränen in die Augen.
»Alles, alles fort!« jammerte er weiter. »Die Früchte meines emsigen Fleißes von vielen langen Jahren sind dahin. Nun habe ich nichts mehr, was ich auf der Erde liebe.«
Er richtete sich mit einem Male auf, und sein sonst so freundlich blickendes Auge nahm einen unheimlichen Ausdruck an. »Nun habe ich nichts mehr auf dieser Erde zu suchen als die Rache, und die werde ich finden.«
Damit stürzte er fort.
Die beiden Zurückgebliebenen sahen sich groß an.
»Die Säure ward in Wasser verwandelt, und gerade, da wir uns andere holen wollen, fliegt das Laboratorium des alten Gelehrten in die Luft,« sagte Sarah. »Wie soll man sich das erklären?«
»Verdammt!« murmelte Flexan. »Doch bleiben uns noch andere Mittel übrig. Gegen Feuer wird Ellen wohl nicht gefeit sein.«
In einem der Nebengänge erscholl wieder jenes laute, spöttische und unheimliche Lachen.
»Und nun, mein Sohn, gehe hin und wandle deine Bahn mit Kraft und Mut! Bedenke, daß du der letzte Nachkomme der Azteken bist, denn deine Schwester ist nur ein Weib, sie wird dir zwar helfen, aber das Ansehen deines Geschlechtes nicht erhalten. Ihr Kind schon hat kein reines Blut mehr in den Adern, wohl aber das deine und das deiner Kindeskinder. Du hast Weisheit gesammelt, trotz deiner Jugend bist du ein erfahrener Mann. Die besten Krieger unter den Indianern haben dir gezeigt, wie man den Tomahawk schwingt, den Pfeil entsendet und die Lanze wirft, du hast deine Lehrmeister übertroffen. Keiner kann dir mehr standhalten, und so erfüllst du alle Forderungen, die an den mächtigsten Häuptling der Indianer zu stellen sind. Deine Schwester Waldblüte kann in den Gestirnen lesen, den Flug der Vögel deuten und aus den Eingeweiden der Tiere wahrsagen. Morgen nacht wird sie zum ersten Male ihre Kunst an den Eingeweiden von Menschen versuchen. Schaffe dir einen Namen, der in sich die Höhe des Himmels, die Kraft des Sturmes und die Behendigkeit der Schlange, die Klugheit des Bibers und die Festigkeit des Felsens trägt. Vierhundert der angesehensten Indianer sind hier versammelt, um das Kind der Sonne zu ihren Häuptling zu erheben. Noch treffen stündlich neue Krieger ein, welche nur zu winken brauchen, und ihr ganzer Stamm liegt zu deinen Füßen. Sechsundsiebzig Gefangene warten auf der Priester Messer, Huitzilopochtli wird wieder Blut schmecken und dir gnädig sein, sorge du dafür, daß sein Altar nie trocken von Blut wird, dann leuchtet dir sein Antlitz jederzeit. Hasse alle, welche weiße Haut haben, doch schlagen sie dich auf deine Seite, weil sie an Blaßgesichtern Rache nehmen wollen, so nimm sie auf, aber sei schlau wie ich, behalte sie im Auge und entledige dich ihrer, wenn du sie nicht mehr brauchst. Jetzt geht, seit einig, stark und furchtlos, dann werden sich meine alten Augen noch einmal am Glanze eurer Herrlichkeit erfreuen können, ehe sie sich für immer schließen. Ich fühle, die Zeit ist nicht mehr fern.«
Seufzend hatte Arahuaskar die lange Rede geschlossen. Sie war an Sonnenstrahl und Waldblüte gerichtet gewesen, die bewegungslos gelauscht hatten.
Jetzt streckte Arahuaskar den Arm aus, beide verbeugten sich tief mit über der Brust verschränkten Armen, diesmal wirklich Ehrerbietung verratend, und entfernten sich. Ihnen nach schlich sich Mythra, der Liebling Sonnenstrahls. Geschickt wußte der Bär durch die Tür zu schlüpfen, als diese für einen Augenblick geöffnet wurde.
Einige Minuten später betraten Sonnenstrahl und Waldblüte das ihnen angewiesene Gemach. Der Bär war auf dem dunklen Gange verschwunden, dafür aber begrüßte Juno, Ellens Löwin, ihre jetzige Gebieterin mit tollen Sprüngen. Das Tier hatte sich hier schon völlig eingewöhnt und schien seine frühere Herrin gar nicht mehr zu vermissen.
Sonnenstrahl warf sich auf ein am Boden liegendes Fell, stützte sich auf einen Arm, und spielte mit der anderen Hand sinnend in den Haaren des Felles der Löwin. Freundlich konnten die Gedanken nicht sein, welche die hohe, gewölbte Stirn verbarg, aber es mußten befriedigende sein, denn auf dem Gesicht spiegelte sich ein grimmiges und selbstbewußtes Lächeln wieder.
Die Schwester entfachte unterdes auf einer Art von Herd ein Feuer und traf Anstalten, eine Mahlzeit aus Mehl, Mais und Fleisch zu bereiten. Die beiden kamen schon seit langer Zeit mit niemandem mehr in Berührung, als mit Arahuaskar und dem alten Vater, aus deren Munde sie täglich feurige, aufregende Reden anhören mußten, bald beide zusammen, bald allein. Einmal wurde Waldblüte zu dem alten Gelehrten beschieden, dann war Sonnenstrahl wieder stundenlang mit Arahuaskar zusammen, wonach auch Waldblüte dort erscheinen mußte, um den letzten, feurigsten Teil der Rede zu hören.
Von ihren einzelnen Lektionen durften sie nicht untereinander sprechen, obgleich sie nun nur auf sich selbst angewiesen waren. Aus letzterem Grunde mußte auch Waldblüte die Bereitung der Mahlzeiten übernehmen, während sie früher die fertigen Speisen von Indianern geliefert erhielten.
Die Zeit, da sie in den angelernten Rollen auftreten sollten, war nicht mehr fern. »Morgen nacht,« hatte Arahuaskar gesagt und furchtbare Andeutungen gemacht.
Während Waldblüte Holz aufs Feuer warf, den mit Wasser gefüllten Kessel an eine Kette hing und sonstige Küchenarbeiten besorgte, wurde sie von der lange allein gelassenen Juno mit Sprüngen umtobt. Waldblüte hatte genug zu tun, das Tier von sich fernzuhalten, und jedesmal, wenn sie sich deshalb der Löwin zuwenden mußte, streifte ihr besorgter Blick das höhnisch lächelnde Gesicht des Bruders.
Da, wo sich die unsichtbare Tür befand, ertönte ein Scharren und Kratzen.
»Oeffne!« sagte Sonnenstrahl. »Mythra sehnt sich nach uns. Sie hat sich lange nicht mehr blicken lassen.«
Es war merkwürdig für einen Indianer, daß er Englisch sprach. Aber auch späterhin bedienten sich die beiden immer dieser Sprache, ein Zeichen, wie sie in ihr, dank den Bemühungen des alten Lehrers, zu Hause waren. Sie war ihnen schon zur Gewohnheit geworden. Und die englische Sprache ist auch sehr reich an Worten, um wieviel besser konnten sie sich also in ihr ausdrücken als in den armseligen, indianischen Dialekten, welche für viele Begriffe einunddasselbe Wort haben und Gattungsbezeichnungen, wie Vogel, Insekt, Baum, Pflanze und so weiter, gar nicht kennen, sondern jedes Ding nur mit seinem Namen benennen.
Waldblüte erhob sich aus ihrer kauernden Stellung, ging an die Wand, suchte mit der Hand nach dem Mechanismus, und durch die entstehende Oeffnung huschte Mythra herein.
Der Bär schien sich gar nicht so zu freuen, seinen Herrn und Herrin hier zu finden, denn ohne Sonnenstrahl anzusehen, lief er an ihm vorbei auf einige Felle zu, die ihm ein weiches Lager versprachen.
Juno schien Lust zu haben, mit ihm zu spielen, sie sprang auf ihn los, aber ein drohendes Murren gab ihr zu verstehen, daß der Bär nicht zum Spielen aufgelegt war.
Juno ließ den mürrischen Gesellen in Frieden.
Dies war dem Bären eben recht, er drehte sich auf den Fellen mehrmals im Kreise umher, sein Körper bog sich immer mehr zusammen, und zuletzt lag er glatt da, mit der Schnauze den Schwanz berührend.
Hätte man das Gebrumme des Tieres übersetzen können, so würde es vielleicht gelautet haben: Ich gedenke einen langen Schlaf zu tun, denn dieser letzten Tage Qual war groß — obgleich der Grislybär Schillers Dramen wahrscheinlich nicht kannte.

»Mythra ist nicht mehr so freundlich gegen dich wie sonst,« sagte Waldblüte vom Feuer herüber, wo sie sich wieder mit dem Kessel beschäftigte.
Der Bruder antwortete nicht, unverwandt blickte er vor sich nieder.
Die Züge Waldblütes nahmen einen noch besorgteren Ausdruck an als zuvor. Sie war überhaupt in der letzten Zeit sehr still geworden, nur ungern folgte sie dem Befehl, der sie zu Arachuaskar oder dem alten Gelehrten rief, und selbst mit dem Bruder, mit dem sie früher so heiter hatte plaudern können, sprach sie nur noch wenig, weil sie entweder gar keine oder mir kurze, mürrische Antworten erhielt. Die Geschwisterliebe der beiden hatte einen Riß erhalten.
Waldblüte seufzte tief auf ließ das Köpfchen sinken und hob es auch nicht, als das Wasser des Kessels überzulaufen begann und zischend in das Feuer lief.
Erst die Mahnung des Bruders, ihres Amtes zu warten, in nicht gerade sehr freundlichem Tone gerufen, ließ sie ihrer Pflicht nachkommen.
Als der Mais in das brodelnde Wasser geschüttet war, schien sie plötzlich einen Entschluß zu fassen.
Sie stand mit einem Ruck auf, die Löwin, welche glaubte, jetzt ginge das Spielen los, wurde durch einen Blick der strahlenden Augen bis in die entfernteste Ecke des Raumes zurückgescheucht, und dann ging sie lautlosen Schrittes zu dem Bruder hinüber.
Eine weiche Hand legte sich auf die nackte Schulter des Indianers, er blickte auf und sah in das schöne, traurige Antlitz seiner Schwester.
»Was willst du, Waldblüte?« fragte er, diesmal freundlicher als sonst.
»Meinen Bruder.«
Sonnenstrahl lächelte.
»Bin ich nicht bei dir?«
Nein.«
»Nicht?« lachte er. »Wo bin ich denn?«
»Der Körper Sonnenstrahls ist wohl hier, aber die Seele meines Bruders ist ferne.«
Der Indianer ist gewohnt, schnell zu begreifen, Sonnenstrahl hatte verstanden. Er nahm die Hand der Schwester in die seine und drückte sie leise.
»Die Zeit unserer Jugend ist bald vorüber,« sagte er schwermütig. »Wohl bleiben wir Bruder und Schwester, doch können wir nicht mehr zusammen spielen. Unsere Gedanken müssen sich mit ernsteren Dingen beschäftigen.«
»Warum muß das sein?« seufzte Waldblüte.
Der Indianer richtete sich etwas auf und blickte erstaunt die Schwester an.
»Warum?« wiederholte er langsam. »Waldblüte, weißt du denn nicht, um was es sich handelt? Um nichts Geringeres, als um die Freiheit von Tausenden von Indianern, deren Feinde unrechtmäßigerweise alles genommen haben, was sie von ihren Vätern ererbt haben. Waldblüte, hast du die Lehren nicht gehört, welche dir der alte Vater täglich gab?«
»Wohl habe ich sie gehört, aber nicht verstanden. Worte wie Blut, Tod und Rache bekomme ich täglich zu hören, aber ich weiß nicht, warum mein Haß die verfolgen soll, welche ich nicht kenne, und die mir niemals etwas zuleide getan haben. Ich fühle keinen Haß gegen sie in mir.«
Sonnenstrahl hatte sich jetzt völlig aufgerichtet; unwilliges Erstaunen prägte sich in seinen Zügen aus.
»Wie, Waldblüte, also haben die Lehren des alten Vaters gar keinen Erfolg bei dir gehabt? Du mußt sie hassen, die weißen Eindringlinge, denn sie haben unsere Vorfahren gemartert, sie aus dem Lande getrieben, ihnen kleine Bezirke angewiesen, auf denen sie sich nur kümmerlich ernähren konnten, und daher kommt es, daß wir eine elende, verachtete Nation geworden sind! Doch jetzt endlich wird die Zeit kommen, Waldblüte, da Huitzilopochtlis Krieger Tezkatlipocas Tezkatlipoca ist der Schöpfer des Himmels, der Erde und der übrigen Götter, er vergilt Gutes und Böses. Reich aufrichten, damit er wieder Gutes und Böses vergelten kann. Besinne dich, Waldblüte, von dir hängt jetzt vieles ab! Wohl werden mich viele Indianer als Häuptling anerkennen, aber ich bedarf deiner Hilfe, um mich als Sonnensohn behaupten zu können. Bedenke, was auf dem Spiele steht!«
Wieder seufzte Waldblüte tief auf.
»Ich möchte, wir wären geblieben, was wir waren,« sagte sie traurig, »ein liebendes Geschwisterpaar, das im Frieden dieser Ruine und des Waldes die Tage zubringt. Wie schön war es, Sonnenstrahl, wenn wir unter den buschigen Zweigen saßen, das Rehkalb spielte zu unseren Füßen, die zahmen Vögelchen fraßen aus der Hand, und ich wand Blumen zu Kränzen, mit denen ich dich schmückte! Ach, jetzt sind diese Zeiten vorbei! Blut und Mord, Zorn und Haß sollen Herrscher werden. Das zahme Rehkalb fürchtet sich vor dir, es flieht dich, und selbst Mythra läuft achtlos an dir vorüber. Sind das nicht Zeichen, daß sie dich nicht mehr lieben?«
»Sie fürchten mich, wie mich bald alle fürchten werden,« lächelte Sonnenstrahl.
»Ist es nicht schöner, geliebt zu werden, anstatt gehaßt?«
»Ist es nicht schöner,« entgegnete Sonnenstrahl, »bewundert zu werden, anstatt geliebt? Sieh, morgen nacht schwingen vierhundert Indianer die Tomahawks über den Häuptern; sie schwören, für mich sterben zu wollen, und viele unter ihnen sind mächtige Häuptlinge, denen Tausende von tapferen Indianern folgen, und die übrigen sind Krieger, welche in ihrem Stamme Häuptlingsrang einnehmen. Apachen, Nawakos, Cherokees, Irokesen, Choktaws, Seminolen, die unvergleichlichen Chickosaws, sie alle sind bereit, mir unbedingten Gehorsam zu leisten, und die übrigen werden dem Sohne der Sonne zufallen, wenn sein blitzender Tomahawk wie der Wetterstrahl auf die weißen Feinde saust, und wenn die Schwester mit mächtiger Zunge ihm Sieg und Ruhm prophezeit! Ach, Waldblüte, Sieg, Ruhm und Ehre sind mir beschieden! Morgen nacht, wenn das Blut der Schlachtopfer auf dem Altare Huitzilopochtlis raucht, werde ich der Häuptling aller Häuptlinge sein, und du wirst als Priesterin und Prophetin mir zur Seite sitzen und die Huldigung meiner tapferen Krieger empfangen. Ist das nicht herrlich?«
Des jungen Indianers Augen blitzten wunderbar; er hatte die schlanke, muskulöse und doch harmonisch schöne Gestalt noch höher aufgerichtet — man glaubte, eines jener Götterbilder vor sich zu sehen, wie sie nur unter dem Meißel des griechischen Künstlers in unnachahmlicher Vollkommenheit entstehen konnten. Die in ihm lebende Begeisterung mußte sich dem Bewunderer mitteilen, doch Waldblüte wurde nicht mit fortgerissen, ihr Herz trachtete nicht nach Ruhm. Es war das Herz einer Jungfrau, das sich nach etwas Unbestimmtem, Unbekannten sehnt, für welches sie keinen Namen hat, und das doch das Innerste ihrer Seele erfüllt. Es ist jenes Gefühl, welches Fürstinnen zwingt, vom Throne zu steigen und lieber an der Seite des Schäfers die Herde zu bewachen, als ein Volk zu regieren; es ist das innerste Gefühl des edlen Weibes, weshalb viele Staatsmänner dem Weibe durchaus die Fähigkeit abstreiten, an der Regierung teilzunehmen, ja, überhaupt sich in staatliche Angelegenheiten zu mengen.
Ist das Weib, welches lieber herrscht, als in Liebe gehorcht, überhaupt noch ein Weib? Nein, es ist eine Ausgeburt der Natur, denn der Beruf des Weibes ist Liebe, und folgt sie nicht diesem, dann wird sie von unnatürlichen, rasenden Leidenschaften ergriffen, welche Liebe zu nennen, verbrecherischer Hohn ist. Die Geschichte der regierenden Königinnen, besonders die der englischen, zeigt dies deutlich.
Waldblüte trug dieses Gefühl der Liebe in sich, vorläufig erstreckte es sich nur auf den Bruder, aber schon dessen Liebe galt ihr tausendmal mehr als Ruhm und Pracht.
Bei den letzten Worten Sonnenstrahls schauderte sie zusammen.
»Und ich kann es nicht glauben, daß ein Gott sich freuen kann, wenn ihm Menschen geopfert werden,« entgegnete sie. »Hat er sie nicht erst geschaffen, damit sie leben sollen?«
»Er hat das Reh geschaffen, um den Panther ernähren zu können, den Schmetterling, damit der Vogel satt werde, und den Feind, damit Blut fließe, denn der Duft des Blutes ergötzt seine Sinne.«
»Ich kann keinen Menschen opfern,« rief Waldblüte verzweifelnd.
»Ich selbst werde es zuerst tun, du wirst zuschauen und mir Handreichungen leisten, bis du dich daran gewöhnt hast. Kann ich ein Tier opfern, so kann ich auch einen Menschen opfern, beide sind Geschöpfe Gottes. Das Tier ist weniger, als ich, ich habe dieselbe Seele wie das Tier; Gott hat auch die weißen Fremdlinge geschaffen, aber die Azteken liebt er am meisten, denn sie sind Kinder der Sonne, und da er Blut liebt, läßt er sich von diesen opfern, am liebsten Menschen, denn sie zu bilden hat ihm mehr Mühe gemacht als die Tiere.«
»Ich kann's nicht glauben. Sonnenstrahl! Du wirst wohl im Kampfe gegen deinen Feind kämpfen und ihn töten, aber ich glaube nicht, daß du deine Hand mit dem Blute wehrloser Menschen zu beflecken vermagst.«
»Ich kann es,« rief der Indianer bestimmt, »denn Huitzilopochtli fordert es von mir. Höre denn, wie fest ich entschlossen bin, keinen mehr zu schonen, in dessen Adern das Blut der Weißen rinnt und den verachtet, dessen Land er bewohnt, also Huitzilopochtlis spottet. Höre denn: Die Männer und Mädchen, welcher wir uns erst angenommen hatten, sind wieder in der Ruine gefangen.«
»Was?« rief Waldblüte und prallte zurück, die Augen entsetzt auf den Bruder gerichtet. »Du weißt es und hast es nicht gehindert, daß sie gefangen wurden, du, der du dich jetzt den mächtigsten Häuptling nennst, dem alles gehorcht?«
»Ihr Blut wird zuerst unter meinem Messer auf dem Altar des Kriegsgottes fließen,« sagte der Indianer mit tiefer Stimme, die Schwester fest ansehend.
»Sonnenstrahl!«
Es lag ein namenloser Schrecken in diesem Ausruf, zugleich ein Zweifel an der Wahrheit des Gehörten.
»Sprichst du im Ernst? Es ist nicht möglich.«
»Es ist mein Ernst. Ich kenne keine Schonung mehr, ich war im Irrtum, als ich sie für Freunde hielt, weil sie hilfsbedürftig waren. Sie sind Feinde, wie alle anderen, welche sich in unseren Gebieten aufhalten und tun, als gönnten sie uns nur aus Gnade und Barmherzigkeit ein Stück Land, zu klein, um in ihm den Büffel jagen zu können, zu klein sogar, um dem Büffel Gras zum Füttern zu geben. Sie sind meine Feinde; sie müssen sterben.«
Entgeistert starrte Waldblüte in das finstere Gesicht des Bruders, sie konnte keinen Zug des Mitleids darin erkennen, er sprach in völligem Ernst.
»Das also sind die Worte eines Häuptlings,« begann sie langsam und tonlos. »Heute werden sie gesprochen, und morgen sind sie verweht. Du versprachst ihnen Schutz und Treue und versprachst mir, deiner Schwester selbst, du wolltest mit deinem eigenen Leben für ihr Leben stehen, kein Haar sollte auf ihrem Haupte gekrümmt werden, ja, du sagtest, und wenn sie deine ärgsten Feinde gewesen waren, von dem Augenblicke an, da sie meine Freunde würden, sollte ihr Leben auch dir heilig sein! So stark war deine Bruderliebe zu mir! Und nun? Sage es noch einmal, Sonnenstrahl. Hast du sie als Opfer Huitzilopochtlis bestimmt?«
»So ist es, sie sterben!« entgegnete der Indianer trotzig, doch seine Lippen zuckten verräterisch.
Waldblüte antwortete nichts mehr, sie nestelte in dem langen Haar, welches auf dem Kopfe von einem wunderbar gearbeiteten goldenen Reifen, mit Steinen geschmückt, zusammengehalten war. Er glich jenem, den die Priesterinnen der Azteken als Abzeichen ihrer Würde trugen.
Der goldene Ring wurde plötzlich von des Mädchens Hand zu den Füßen Sonnenstrahls geschleudert.
Der Indianer erschrak.
»Was soll das heißen?« stammelte er.
»Du wirst es wissen,« war die kurze Antwort.
»Nein, sprich!« Er hob den Reifen auf und wollte ihn Waldblüte wieder einhändigen. »Du behandelst das Abzeichen der Priesterinnen Huitzilopochtlis unwürdig, und doch ist kein Haupt als das deine wert, es zu tragen!«
Doch Waldblüte nahm ihm den Ring nicht ab.
»Ich bin keine Priesterin Huitzilopochtlis mehr.«
»Sprich keine Torheit, Waldblüte!«
»Ich sage mich von ihm los.«
Sonnenstrahl erschrak noch mehr, er glaubte seinen Ohren nicht trauen zu dürfen.
»Waldblüte!« flehte er. »Liebst du denn deinen Bruder gar nicht mehr?«
»Nein, ich habe keinen Bruder mehr.«
Der Indianer hielt die Augen entsetzt auf die Schwester geheftet; es war das erstemal, daß er das sonst so ruhige, freundliche, fast schüchterne Mädchen so energisch reden hörte.
»Nein, ich habe keinen Bruder mehr,« wiederholte Waldblüte mit bebender Stimme. »Wohl habe ich einst einen Bruder gekannt, aber der war edel und liebte mich, doch du, der du dich meinen Bruder nennen willst, bist grausam, wortbrüchig und hassest mich. Tritt nicht heran, rühre mich nicht an! Schon jetzt sehe ich an deinen Händen das Blut meiner Freunde rauchen, weg von mir, Meuchelmörder, du besudelst mich!«
Waldblüte hatte ihr Gewand eng an sich gezogen, und war zurückgewichen, als Sonnenstrahl mit ausgestreckten Händen auf sie zugehen wollte.
Wieder blieb er entsetzt stehen.
»Wie kannst du nur sagen, Waldblüte, du würdest von mir gehaßt? Ich liebe dich noch immer so wie früher, du bist noch immer meine heißgeliebte Schwester. Waldblüte, du bist das einzige Wesen auf der Erde, von welchem ich geliebt werden möchte, alle anderen sollen mir gehorchen oder mich fürchten.«
»Gehorchen und fürchten? Ach, Sonnenstrahl, siehst du denn gar nicht ein, daß dich Gehorsam und Furcht anderer nie glücklich machen werden?«
»Doch! Als Herrscher über die Indianer, als Wiederaufrichter der alten aztekischen Herrlichkeit, welche die Freiheit aller Indianer, der rechtmäßigen Besitzer Amerikas, mit sich bringt, werde ich glücklich sein, doch nur,« sagte er zärtlich hinzu, »wenn meine Waldblüte den Häuptlingssitz mit mir teilt.«
»Dann wird dir dieses Glück nie zuteil werden, denn nie werde ich mich auf einen Thron setzen, dessen Pfosten von dem Blute meiner von dir hingeschlachteten Freunde befleckt sind.«
»Du wirst noch anders darüber denken lernen, Waldblüte. Die dir gebrachten Huldigungen werden dich berauschen. Nur in Indianern wirst du Freunde erkennen, aber alle Bleichgesichter hassen, wie ich sie schon jetzt hasse. Nimm den Ring an und setze ihn wieder auf dein Haupt.«
Doch sie nahm ihn nicht, sie stand mit auf der Brust gekreuzten Armen vor ihm, und er mußte lange auf eine Antwort warten. Schon hoffte er, die Schwester hätte sich eines Besseren besonnen, als sie leise begann:
»Ich glaube, Sonnenstrahl, Arahuaskar sowohl, als der alte Vater haben uns beiden böses Gift zu trinken gegeben. Immer klarer wurde es mir schon seit langer Zeit, daß man mit uns nur ein frevelhaftes Spiel treibt, jetzt aber sehe ich mit einem Male ganz deutlich, daß wir auf eine furchtbare Weise gemißbraucht werden sollen. Wir dienen als Werkzeug eines Hasses, der sich gegen die Weißen erstreckt. Wir kennen die Grausamkeit der Weißen nur vom Hörensagen, gesehen haben wir sie noch nie, die schauderhaftesten Greueltaten der Indianer aber haben wir mit eigenen Augen gesehen. Man wollte damit unser Mitleid ersticken, bei mir hatte es aber die entgegengesetzte Wirkung. Ich habe einst Arahuaskar und den alten Vater belauscht, sie sprachen untereinander ganz anders als zu uns. Der alte Vater glaubt selbst nicht an das, was er uns sagt; ich weiß, der Feind, dem wir begegnen sollen, ist furchtbar stark. Wir und alle Indianer gehen im Kampfe gegen ihn zugrunde. Der alte Vater hat Arahuaskar gewarnt, ich habe gelauscht, doch Arahuaskar ist alt, sein Kopf gleicht dem eines Kindes, welches blindlings in die Gefahr läuft.«
Scheu blickte sich Sonnenstrahl um.
»Auch diese dicken Kellerwände haben Ohren,« flüsterte er. »Hüte dich, Waldblüte.«
Doch das Mädchen verachtete die Warnung, mit der größten Erregung fuhr es fort:
»Nein, alle Welt kann meinetwegen erfahren, ich rufe laut: Wir beide sind die Opfer von Lug und Trug, wir dienen nur als Werkzeuge persönlicher Rache. Es kommt nur darauf an, recht viele Weiße möglichst grausam abzuschlachten und hinzumorden, dann können wir unter den Messern der Feinde fallen, dann ist Arahuaskars Wunsch erfüllt, und der alte Vater hat sich an seinen Landsleuten gerächt.«
Jetzt richtete sich Sonnenstrahl mit blitzenden Augen hoch auf.
»Und gehen wir unter, gut, so hat es Huitzilopochtli gewollt! Aber leicht soll ihnen der Sieg nicht werden!« rief der junge Krieger mit starker Stimme. »Erst wollen wir wie Boten des Todes über sie herfallen und zwischen ihnen würgen. Was für einen schöneren Tod gibt es als im Kampfe zu sterben? Das war stets mein Wunsch, jetzt kann er vielleicht erfüllt werden. Doch ist es schwer, gegen Sonnenstrahl zu kämpfen, das weißt du, Waldblüte. Ich bin in Gemeinschaft mit Bären auferzogen worden, sie waren meine Spielgefährten, an ihnen übte ich meine Kräfte, und keinen gibt es unter ihnen, den ich nicht schon mit diesen meinen Armen hier zu Boden geworfen hätte.«
Sonnenstrahl streckte die sehnigen Arme aus, an denen die stählernen Muskeln wunderbar anschwollen.
»Und keinen Krieger gibt es, welcher den Schlägen meines Tomahawks widerstehen könnte,« schloß Sonnenstrahl.
Es liegt in der Natur der Indianer, von sich selbst rühmend zu sprechen, eine Eigenschaft aller wilden Völker. Man darf sie deshalb nicht verspotten. Gibt es eine Nation, auch eine solche Europas, welche ihre Soldaten nicht für die tapfersten der Welt hält? Ich glaube nicht.
Doch Waldblüte wies den Bruder zurecht.
»Du kennst die Weißen nur vom Hörensagen. Wohl bist du ein tapferer, starker und in Waffen geübter Mann, doch sie können Krieger haben, welche dir gewachsen sind.«
»Ich bezweifle es,« war die selbstbewußte Antwort.
»Denke an den Weißen, welcher hier gefangen liegt. Zweimal hat er mit seinem Schwerte über zwanzig Indianer, tapfere Krieger, erschlagen. Er würde deinem Tomahawk wohl begegnen können.«
»Sonnenstrahl war nicht unter seinen Gegnern, er hätte den Kampf allein bestanden.«
»Du prahlst.«
»Ich prahle nicht. Es gibt keinen Mann, welcher Brust an Brust mit dem grauen Bären ringen könnte, doch Sonnenstrahl fängt den wilden Bewohner der Felsenhöhlen mit der Hand und zwingt ihn, ihm wie ein Hund zu folgen.«
»Dein Blick ist es, der ihn bezwingt, nicht allein deine Kraft.«
»So wird mein Blick auch den Feind unfähig machen, den Arm gegen mich zu heben.«
Das Gespräch fand eine Unterbrechung, denn die Aufmerksamkeit der beiden Geschwister wurde auf den Bären gelenkt, welcher sich anscheinend an der Unterhaltung beteiligen wollte. Sein Benehmen war ein sehr seltsames.
Er erhob sich brummend und wollte auf seine Herren zugehen, doch sein Weg wurde von Juno gekreuzt.
Die Löwin glaubte nicht anders, als der Bär sei nun eher zum Spielen aufgelegt, als vorhin, da er müde war. Mit einem Satz kam sie aus ihrer dunklen Ecke vorgesprungen und versetzte dem Bären einen Schlag mit ihrer Tatze, dann schnell über ihn hinweg und zur Seite springend.
Der Grislybär ist dem Löwen an Stärke durchaus gewachsen, in einem ernsthaften Kampfe würde er sicher nicht den kürzeren ziehen. Seine Plumpheit ist nur eine scheinbare, man täuscht sich in der dicken, gewaltigen Gestalt. Bekanntlich kann der graue Bär selbst den Reiter einholen; ist ihm das Roß auch an Schnelligkeit überlegen, des Bären nicht zu ermüdender Beharrlichkeit fällt es doch zum Opfer, und mit seinen Tatzen weiß der Grisly furchtbare Schläge auszuteilen.
Das sollte die Löwin zu ihrem Schaden erfahren.
Sie hatte den Boden auf der anderen Seite des Bären noch nicht erreicht, als sie schon von diesem einen Schlag erhielt, der sie sich um und um drehen ließ. Doch gleich war Juno wieder auf und versuchte einen neuen Angriff.
Sie wollte nur spielen, ihr Hieb war sanft gewesen, der Bär dagegen hatte ganz gewaltig zugehauen. Deshalb unternahm sie das neue Manöver von hinten auf den Bären, instinktiv erratend, daß sich der plumpe Gesell nicht so schnell umdrehen konnte, wie sie sprang. Seine Tatzen und das Gebiß hätte sie also nicht zu fürchten gebraucht.
Aber wieder hatte sie die Rechnung ohne den Wirt gemacht.
Mythra konnte ihre Gestalt allerdings nicht schnell genug umwenden, aber plötzlich stand sie auf den Vorderfüßen und schlug mit den hinteren aus, die Löwin so kräftig vor die Brust treffend, daß diese mit einem Jammergeheul an die Wand flog und sich wieder in eine Ecke verkroch. Noch lange erscholl ihr Winseln aus dem Dunkel hervor, sie hatte vollständig genug bekommen, um nicht abermals mit dem groben Bären spielen zu wollen.
Sonnenstrahl und Waldblüte stießen bei diesem seltsamen Manöver Mythras gleichzeitig einen Ruf der Ueberraschung aus. Sie waren doch mit den Bären aufgewachsen, kannten jede ihrer Eigentümlichkeiten, wußten ganz genau, wie sie sich bei jedem feindlichen Angriff verhielten, daß aber ein Bär gleich einem halsstarrigen Pferd oder verdrossenen Esel hinten ausschlug, hatten sie noch niemals bemerkt, das war ihnen neu.
Der Bär mußte mit einem Male überhaupt ganz andere Anschauungen bekommen haben, er richtete sich jetzt auf den Hinterfüßen empor, fuchtelte mit den gewaltigen Pranken in der Luft herum und stieß ein drohendes Gebrüll gegen seinen eigenen Herrn aus.
»Mythra,« rief Sonnenstrahl halb erstaunt, halb unwillig, »was fällt dir ein? Komm hierher und begrüße deinen Herrn, wie es dir ziemt.«
Aber der Bär hatte keine Lust, der Aufforderung zu folgen. Ganz gegen seine sonstige Gewohnheit beharrte er in seiner aufrechten Stellung und brummte weiter.
»Siehst du, er kündigt dir schon den Gehorsam,« rief Waldblüte erschrocken, »Sonnenstrahl folgte er aufs Wort, den nach Blut dürstenden Häuptling kennt er nicht mehr, Tiere sind oft klüger als Menschen, sie wissen, was diese nur ahnen.«
»So werde ich ihn von neuem zum Gehorsam zwingen,« entgegnete der Bruder.
Er ging auf den Bären zu und schaute ihn mit einem Blick an, dessen magnetische Kraft sonst nie seine Wirkung verfehlt hatte. Sonnenstrahl konnte sich sonst auf diese Weise das gefährlichste Raubtier zu Willen machen. Doch diesmal blieb es erfolglos.
Mythra deutete durch nichts an, daß sie den bannenden Blick verspürte.
Sonnenstrahl wurde zornig, die Muskeln an seinen Armen schwollen plötzlich an.
»Du willst nicht?« rief er, den Tomahawk aus dem Gürtel ziehend. »Ich will dich Gehorsam lehren.«
Dabei führte er mit dem Stiele der Waffe einen Schlag nach der Schnauze des Baren, doch gewandt drehte derselbe den Kopf, der Schlag ging ins Leere, aber nicht der, welchen jetzt der Bär dem Indianer zugedachte. Die Tatze traf mit voller Wucht das obere Ende des Tomahawks, und klirrend flog die Waffe auf den Boden.
Erst war der Indianer über diesen tätlichen Angriff des Bären ganz erstaunt, nie hatte er einen solchen von dem Tiere vermutet; dann aber sprang er mit einem Schrei der Entrüstung auf ihn los. Den Bären am Fell packen und ihn emporheben war eins, im nächsten Augenblick wurde er zu Boden geschmettert, daß man förmlich die Knochen krachen hörte.
Eine solche fast übermenschliche Kraft hätte man in dem schlanken Jüngling nimmermehr vermutet.
»Erkennst du nun deinen Gebieter?« rief er. »Kann dich mein Blick nicht mehr zwingen, so vermag dies doch noch mein Arm zu tun!«
Er hatte den Bären niedergedrückt und kniete nun auf ihm.
Allein auch der Bär war ein riesig starker Gegner. Der Angriff des Indianers war nur zu schnell gekommen, daß er nicht hatte daran denken können, ihm zu begegnen, wer weiß, ob er sonst besiegt am Boden gelegen hätte.
Sonnenstrahl, wie auch Waldblüte glaubten sicher, jetzt würde Mythra jeden Widerstand aufgeben. Mit leuchtenden Augen blickte Waldblüte auf den starken Bruder. Allein beide sollten sich getäuscht haben.
Der Bär lag einen Augenblick wie betäubt auf dem Rücken, dann aber kam plötzlich wieder Leben in ihn. Seine Pranken schlangen sich um den Indianer, und ein Ringkampf begann, in welchem einmal der Indianer, das andere Mal der Bär obenauf war.
Waldblüte schrie laut auf. Es war das erstemal, daß ein Bär nicht nur spielend, sondern anscheinend ernstlich sich mit Sonnenstrahl maß. Mythra besaß furchtbare Tatzen und ein scharfes Gebiß, der Bruder trug ein Messer im Gürtel. Doch er griff nicht nach diesem, durch seine Kraft wollte er den Bären zum Gehorsam zurückführen. Wenn derselbe nur auch so edel gesinnt gewesen wäre!
Wahrhaftig, fast schien es so, er machte von seinen Zähnen keinen Gebrauch, desto mehr aber von seinen Armen und blieb doch Sieger, es konnte ja auch nicht anders sein. Wie ein Alp lag er jetzt auf dem Jüngling und drückte ihn in erstickender Umarmung an seine Brust. Da half kein Widerstand, Sonnenstrahl vermochte sich nicht mehr zu rühren.
Der glühendheiße Atem des Bären streifte sein Gesicht, sein Atem stockte, noch einmal versuchte er mit aller Kraft seinen Arm freizumachen, um nach dem Messer greifen zu können, denn jetzt hätte er Gebrauch davon gemacht — allein vergebens, wie Eisenbanden umschlangen ihn die Pranken des Bären.
Waldblüte schaute dieser Szene mit Entsetzen zu. Sie sah, daß das furchtbare Raubtier nicht mehr spielte, sie sah das aschfarbene Gesicht des Bruders, wie sich dessen Augen schlossen, sie hörte das Röcheln, daß seiner Brust entquoll, und sie wußte, daß der Bär sein Opfer nicht eher aus der umstrickenden Umarmung ließ, als bis es tot war.
Der Bär war plötzlich von Tollwut befallen worden, der menschliche Willenseinfluß war wirkungslos.
Doch Waldblüte verlor die Besinnung nicht, sie schrie auch nicht, das hatte den noch immer geliebten Bruder nicht vor dem sicheren Tode gerettet.
Neben ihr am Boden lag der Tomahawk des Bruders, im nächsten Augenblick sauste er in ihrer Hand durch die Luft und schmetterte auf den Schädel des Bären nieder. Es gab einen Klang, als wenn ein irdener Topf zerspränge.
Der Schlag war nicht mit der Schärfe des Beiles geführt worden, sondern mit der hinteren, stumpfen Seite, aber, o Wunder, was für eine seltsame Wirkung hatte dieser Schlag.
Als wäre dem Bären der Kopf nur angeleimt gewesen, so fiel er plötzlich ab und rollte durch das Gemach. Aber es floß kein Blut, es zeigte sich nicht einmal eine blutige Stelle, sondern nur ein großes Loch, und aus diesem schob sich plötzlich der Kopf eines Menschen, eines Bleichgesichtes hervor.
»Danke,« sagte eine lachende Stimme zu dem Mädchen, das seinen Augen nicht trauen wollte. »Sie schlagen eine kräftige Hand, aber vorsichtig müssen Sie sein. Hätte ich meinen Hals nicht schnell genug eingezogen, so rollte mein Kopf jetzt ebenfalls in dem Futteral des Bärenschädels wie eine Kegelkugel herum, und das wäre mir wahrhaftig sehr fatal.«
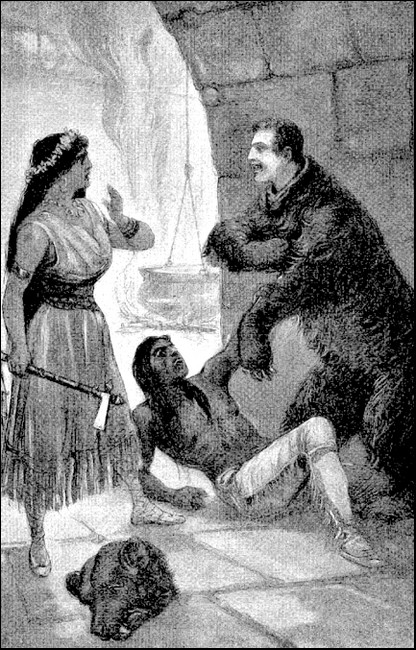
»Danke,« sagte das Bleichgesicht zu
Waldblüte, die ihren Augen nicht traute.
Der Indianer war beim Klang der Stimme wieder zum Bewußtsein gekommen, besonders, weil die Arme in der todbringenden Umstrickung nachließen.
Verblüfft blickte er in das über ihn gebeugte Gesicht des weißen Mannes.
»Nun, Mister Sonnenstrahl,« fuhr der lachende Mund fort, »was meinen Sie denn nun? Gibt es unter Bleichgesichtern Männer, welche es mit Ihnen an Kraft aufnehmen, heh? Allen Respekt, Mister Sonnenstrahl, Sie würden sich recht gut zum Ringkämpfer eignen, mir tun jetzt noch die Knochen im Leibe weh, aber einen Bären werfen Sie ebensowenig wie mich.«
Nach diesen spöttischen Worten erhob er sich, stellte sich aufrecht hin, das Fell sank plötzlich von ihm hernieder, und aus der Umhüllung kam ein Mann zum Vorschein — Nick Sharp.
»Hugh!« rief der Indianer, sprang auf und eilte zu seiner Schwester, sich wie schützend vor sie stellend.
»Nun seid mal nicht bange,« fuhr der Detektiv in gemütlichem Tone fort, das Fell beiseite schleudernd und sich dehnend und streckend, »ich tue euch nichts, Kinder, so lange ihr mir nichts tut. Waldblüte, das Essen scheint fertig zu sein, es riecht schon so appetitlich, ich habe einen ganz ungeheuren Hunger.«
Die beiden wagten nicht, sich zu rühren. Sie waren selbst angelernt worden, anscheinend übernatürliche Sachen auszuführen, mit denen sie den abergläubischen Indianern imponieren sollten, das aber, was sie hier sahen, überstieg ihr Begriffsvermögen.
Wie ein Bär herumzulaufen, sich schlafend zu stellen, zu knurren und brummen, selbst den spielenden Löwen zu täuschen, und dann diese furchtbare Stärke — das konnte kein Mensch sein, sondern einer ihrer Götter, der sich als Bär unter sie gewagt hatte und nun wieder Menschengestalt annahm.
»Wer bist du?« brachte Sonnenstrahl endlich hervor.
»Kein Gott, wie du vielleicht glaubst, sondern ein Mensch wie du, nur daß ich eine weiße Haut habe und noch etwas kräftiger bin als du. Oder soll ich es dir noch einmal beweisen? Jetzt hindert mich das Bärenfell nicht mehr, du wirst staunen, wie ich dich in der Luft herumwirbeln werde.«
»Ich glaube dir! Doch du bist nicht Mythra?«
»Gott bewahre,« lachte der Mann. »Du kommst auf seltsame Gedanken.«
»Wo ist Mythra?«
»Dies Fell dort gehörte ihr allerdings. Ich muß dir aber mitteilen, so leid es mir auch tut, daß ich Mythra getötet habe.«
»Du hast Mythra getötet?«
Sonnenstrahl hatte seine Fassung wiedergewonnen, seine Stimme klang vorwurfsvoll.
»Ja, ich mußte, weil sie mir, so lange sie lebte, ihr Fell nicht borgen wollte, und ich brauchte es unbedingt, um recht gemütlich in der Ruine herumstreifen zu können. Die beiden Blutlachen, die ihr fandet, und die euch so in Aufregung setzten, stammten von Mythra und Barzam, ihrem Herrn Gemahl.«
»So hast du auch Barzam getötet?«
»Ich nicht, sondern mein Freund. Er ist bedeutend stärker als ich, also mußte er auch ein größeres Fell haben.«
»Er steckt in Barzams Fell?«
»Gewiß, auch mein Freund treibt sich als Bär in dem Gemäuer herum und schnüffelt überall hin.«
Die Geschwister sahen sich erstaunt an.
Diesen Mann brauchten sie nicht zu fürchten, das merkten sie, aber was wollten die beiden Fremdlinge hier?
»Es sind die beiden Männer, welche nicht bei den Gefangenen sind,« flüsterte Waldblüte dem Bruder zu, »der alte Vater und das weiße Mädchen sprachen davon und waren deshalb besorgt, ich habe sie belauscht, wie ich dir schon mitteilte.«
»Was willst du hier?« fragte Sonnenstrahl wieder.
»Ich möchte nicht gern, daß meine Freunde und Freundinnen, welche ihr gefangen haltet, getötet werden. Mein Begleiter und ich werden über sie wachen.«
Der Indianer runzelte finster die Stirn, er maß den kühnen Sprecher von oben bis unten mit den Blicken.
»Fremder,« sagte er drohend, »bist du auch stärker als ich, im Kampfe mit den Waffen bist du mir nicht gewachsen.«
»Das kommt darauf an. Ich bin zu jeder Zeit bereit, mit dir zu fechten. Wie wäre es zum Beispiel hiermit? Es macht nicht viel Lärm, trifft aber ganz gut.«
Dabei hielt der Detektiv dem Indianer einen Revolver entgegen.
Schneller konnte der Blitz nicht sein als Sonnenstrahl. Im Nu war er bei dem Gegner und hatte ihn unterlaufen, aber für den Detektiven war er doch noch zu langsam.
Der Indianer griff ins Leere, dafür drückte ihn Nick Sharps eiserne Faust schon gegen die Wand. Den Revolver hielt er nicht mehr, er hatte ihn eingesteckt.
»Mach' keine Torheiten,« lachte er, »du kannst mir doch nichts tun, fange es an, wie du willst.«
Sharp gab den Indianer frei und trat einen Schritt zurück.
Diese Szene hatte sich in einigen Sekunden abgespielt. Die erst wie versteinert dastehende Waldblüte sprang jetzt zu ihrem Bruder, der wieder die Fassung verloren hatte, und schmiegte sich an ihn.
Wahrhaftig, das war kein Mensch. Oder sollten alle Weißen so sein? Dann stand es für die Indianer schlimm.
Diese Gedanken wirbelten in Sonnenstrahls Kopfe herum.
»Nun, wie steht's, hast du nun Vernunft angenommen?« begann Sharp wieder.
Sonnenstrahl atmete tief, er hatte am liebsten in den Boden versinken mögen.
»Freue dich nicht zu früh!« entgegnete er. »Ich gebe zu, daß du mir überlegen bist, aber es bedarf nur eines Zeichens von mir, und von allen Seiten strömen Indianer herbei.«
»Bah, die sitzen und hocken alle oben im Saale auf Fellen, ich kenne das.«
»Doch schnell sind sie von mir gerufen.«
»Doch schneller fliegen sie in die Luft.«
»Was sagst du da?«
Sharp zog wieder den Revolver hervor und richtete ihn in die Höhe.
»Berührt mein Finger den Drücker, so fällt ein Schuß. Ist es nicht so?«
»Wenn er geladen ist, ja.«
»Und gleichzeitig erfolgt eine furchtbare Explosion, alles, was nicht unter der Erde liegt, fliegt in die Luft, und mit dem Mauerwerk zugleich alles Lebendige. Außer den Gefangenen werden nicht viele Menschen am Leben bleiben.«
Der Indianer versuchte bei diesen kaltblütig gesprochenen Worten zu lächeln, aber er konnte damit das Entsetzen, das sich in seinen Zügen abspiegelte, nicht verdecken.
»Wie könnte das sein?«
»Mein Freund steht bereit, auf meinen Schuß hin den ganzen oberen Teil der Ruine in die Luft zu sprengen. Alles ist unterminiert, die Lunte brennt.«
Wieder flüsterte Waldblüte mit dem Bruder.
»So habt ihr schon die Arbeitsräume des alten Vaters zerstört?«
»Wir waren es.«
»Warum tatet ihr es?«
»Weil wir es für gut fanden.«
Der Indianer mußte sich mit dieser Antwort zufrieden geben, der Fremde trat vollkommen als Herr auf.
Doch jetzt nahm Sharp wieder seine alte, gemütliche Sprechweise an.
»Sonnenstrahl, du kannst mich wirklich dauern. Du bist ein so mutiger, kräftiger Krieger, viel zu gut, hier in den Grabgemächern zu vermodern. Aus dir sollte etwas anderes werden.«
Der Indianer fühlte sich geschmeichelt, wie überhaupt alle Rothäute dem Lobe sehr zugänglich sind, um so mehr, wenn es aus dem Munde eines Mannes kommt, vor dem sie Achtung haben.
Und Sonnenstrahl hatte vor diesem Weißen, der ihm in jeder Hinsicht überlegen war, plötzlich die größte Hochachtung bekommen, wenn er sich das auch nicht merken lassen wollte.
Ein Lächeln flog über seine bronzefarbenen Züge.
»Warum aber bedauerst du mich?«
»Weil man dich an der Nase herumführt. Und sehr klug bist du auch eben nicht,« fuhr Sharp ruhig fort.
»Fremder, du kannst mich wohl töten, wenn du mich besiegt hast, darfst mich aber nicht schmähen,« klang es drohend.
»Ich sagte die Wahrheit. Deine Schwester hat mehr Verstand als du, überhaupt mehr, als alle Indianer zusammen, welche sich hier versammelt haben, und das sind nicht wenige.«
»Waldblüte? Wieso?«
»Weil alle anderen dem alten, verrückten Arahuaskar glauben und sich durch den Hokuspokus des sogenannten alten Vaters, dieses Spitzbuben, verblüffen lassen. Waldblüte dagegen hat den wahren Sachverhalt begriffen, wie ich vorhin selbst gehört habe, sie versuchte ihn auch dir klarzumachen. Es war aber wie gewöhnlich, sie predigte tauben Ohren, weil diese einem Narren gehören.«
»Du nennst mich einen Narren?«
»So lange du an Huitzilopochtli glaubst, bist du einer. Dieser Gott hat seine Rolle schon lange ausgespielt. Ihm ist es ganz gleich, ob ihm Menschen geschlachtet werden oder nicht, er schläft schon lange den Schlaf der Ewigkeit. Aber anderen ist es nicht gleichgültig, ob eure Gefangenen geschlachtet werden oder nicht, und zu diesen anderen zählen mein Freund und ich, wir dulden derartiges nicht.«
Sonnenstrahl wurde verlegen. Er war von diesem Manne ein Narr genannt worden, weil er an Huitzilopochtli geglaubt hatte. Dasselbe, nur zarter, hatte ihm vorhin seine Schwester gesagt.
»Sollte es wirklich so sein?« murmelte er bestürzt.
»Es ist so, glaube ihm!« flüsterte ihm die Schwester zu. »Wir können nichts gegen die Blaßgesichter beginnen. Sieh diesen, er ist nur einer; aber furchtlos kommt er zu uns, um seinen Freunden nahe zu sein, er befiehlt uns in unserer eigenen Behausung, und er braucht nur zu wollen, so fliegen alle hier versammelten Indianer als zerfetzte Leichen in die Luft.«
»Ich glaube es nicht,« murmelte Sonnenstrahl.
»Aber ich.«
»Arahuaskar kann keinen Frevel mit mir treiben, er darf es gar nicht wagen.«
»Bah,« mengte sich Sharp wieder dazwischen, »ihr seid eben beide nur die Werkzeuge des ehrsüchtigen Alten. Sonnenstrahl, du denkst doch nicht etwa, du bist ein Kind der Sonne?«
Der Indianer schwieg eine Weile, dann fragte er:
»Wenn ich es nicht wäre, wo ist denn meine Mutter?«
Der Detektiv lachte laut und ungeniert auf.
»Viel Schlauheit verrät diese Frage eben nicht. Ich bin nicht verpflichtet, deine Mutter zu suchen, aber ich wette, Sonnenstrahl, würdest du einige Mühe darauf verwenden, du würdest sie oder deinen Vater finden.«
»Meinst du?« rief Waldblüte.
»Sicherlich. Ich bin fest überzeugt, Arahuaskar wie auch der sogenannte alte Vater, der Gauner, kennen das Geheimnis eurer Abstammung. Ich will gehangen werden, wenn er es nicht offenbart; man muß ihm nur einmal die Kehle etwas zudrücken.«
»O, einen Vater, eine Mutter,« rief Waldblüte, die alles andere plötzlich vergessen zu haben schien, freudig aus, »wie schön wäre es, wenn wir diese hätten! Die Sonne ist zwar auch schön, aber sie ist so sehr, sehr weit von uns entfernt.«
»Nun, Waldblüte, verlaß dich darauf! Wenn du ein Sonnenkind bist, dann will ich ein Mond sein. Nun macht keinen Unsinn mehr, Kinder! Vergeht die Sonne, die niemals hier hereinscheint, vergeht Arahuaskar, Huitzilopochtli und wie die alten Heiden alle heißen, und du, Waldblüte, steckst dein liebliches Näschen einmal dort in den Kochtopf, denn ich kalkuliere, die Suppe ist gar. Ich habe einen ganz verzweifelten Hunger, Ihr habt doch nichts dagegen, wenn ich an Eurer Seite meinen Magen fülle?«
»Dies ist ein heiliger Ort,« entgegnete Sonnenstrahl zögernd, »hier bereiteten sich die Priester vor, wie wir dies ebenfalls tun.«
»Papperlapapp, du sprichst wie ein altes Weib. Nimm es mir nicht übel, Sonnenstrahl, aber es ist wahrhaftig so. Du, ein Kerl, der einen Bären über den Haufen schmeißen kann, solltest dich was schämen, so zu sprechen. Zum Henker mit dem ganzen Theater; Waldblüte, heran mit Schüsseln und Messern, und dann aufgepackt, daß die Steinteller knacken. Herr Gott, habe ich Hunger! Hörtet ihr, wie ich vorhin als Bär immer knurrte? Dafür konnte ich nichts, das war mein Magen, der seit einigen Tagen nichts weiter als eine Handvoll Fleisch und trockenes Brot bekommen hat.«
Waldblüte lachte und folgte der Anweisung. Ehe sie sich um die dampfende Schüssel mit gekochtem Mais und Wildbret setzten, meinte Sonnenstrahl noch:
»Du sprichst zu laut, die Stimme eines Fremden kann erkannt werden, und nur Waldblüte und ich dürfen hier zugegen sein.«
»Es darf auch niemand hereinsehen?«
»Es wäre sein Tod.«
»Desto besser,« lachte Sharp, sich dabei den Mund füllend, »so sagt ihr später, ihr hättet mit Huitzilopochtli gesprochen.«
»Aber deine Stimme?«
»Ist die von Huitzilopochtli. Meinetwegen kann sogar jemand hereinkommen, er soll nur einmal sagen, ich wäre dieser Gott nicht. Mit Donner und Blitz wollte ich ihm antworten, daß ihm Hören und Sehen verginge.«
Die Unterhaltung der neuen Freunde, die sich auf so seltsame Weise zusammengefunden, stockte lange. Die beiden Geschwister, welche wenig aßen, waren mit ihren Gedanken beschäftigt, und Sharp ausnahmslos mit seinem Teller. Er entfaltete wieder einmal seinen Appetit in großartigem Umfange.
Indianer können gewiß etwas im Fr — im Essen leisten, aber selbst die Geschwister staunten, als der weiße Mann wieder und immer wieder seinen Steinteller füllte und schließlich, als der Hunger der Mitspeisenden gestillt war, den Topf vom Feuer nahm und ihn rein auslöffelte.
»Gott sei Dank,« seufzte er endlich auf, »nun könnte ich wieder einige Tage hungern.«
»Du hast lange der Speise entbehrt?« fragte der Indianer lächelnd.
Er, sowie seine Schwester wurden für den fremden Mann, der so ungeniert und selbstbewußt auftrat, immer mehr eingenommen, sie wußten selbst nicht, warum. Er war eigentlich ihr Feind, und doch betrachteten sie ihn als Freund.
Jetzt hatte er übrigens mit ihnen an einem Feuer gegessen, in diesem Gemache war sein Leben ihnen heilig, Sonnenstrahl hätte es mit seinem eigenen schützen müssen.
»O ja, so einige Tage,« entgegnete Sharp auf die Frage des Indianers.
»Und wo ist dein Gefährte?«
»Barzam? Der treibt sich draußen herum.«
»Er wird auch Hunger haben.«
»Ich nehme ihm nachher etwas mit, hier ist ja genug Fleisch.«
»Wo haltet ihr euch versteckt?«
»In einem verfallenen Kellerloche.«
»Und ihr habt die beiden Bären getötet?«
»Ja, sie wollten es sich nicht gefallen lassen, aber sie mußten schließlich doch klein beigeben. Dann zogen wir ihnen die Felle ab und paßten diese uns selbst an.«
»Wo ließet ihr die Kadaver?«
»Die warfen wir in einen alten Brunnen.«
»Die Indianer fanden an den Blutlachen keine abführende Spur.«
»Das glaube ich,« lachte Sharp, der sehr aufgeräumt war, »wir verstehen eben unser Handwerk. Aber ein höllisches Stück Arbeit war es, die schweren Bären fortzubekommen, ohne uns zu verraten.«
Sonnenstrahl betrachtete den Mann an seiner Seite verwundert.
»Und ihr habt auch die drei Indianer getötet?« fragte er dann weiter.
»Ja, wir mußten dies leider tun, weil sie uns sahen. Wir waren damals noch nicht als Bären verkleidet, suchten aber schon die Ruinen zu durchstreifen.«
»Man konnte an ihnen keine Wunde bemerken.«
»Daß ist auch nicht nötig.«
»Du hast sie erdrückt?« sagte Sonnenstrahl, an die furchtbare Umarmung des Bären denkend.
»Mein Freund hat sie getötet, nicht ich, aber er hat sie auch nicht erdrückt.«
»Wie hat er sie sonst getötet?«
»Mein Freund ist ein mächtiger Mann, er hat den Blitz in seiner Hand. Wenn er will, so braucht er seinen Feind nur anzufassen, und auf der Stelle sinkt dieser tot um.«
»Den muß Sonnenstrahl kennen lernen,« rief der Indianer verwundert.
»Du sollst dies auch. Nun aber, Sonnenstrahl, höre zu, was ich dir sage! Was Arahuaskar und der alte Vater euch beiden vorgeschwatzt haben, ist alles Unsinn gewesen.«

Mit diesen Worten begann Nick Sharp einen Vortrag, in welchem er dem Indianer auseinandersetzte, daß ein Aufstand der Rothäute gegen die Weißen von gar keinem Vorteil, wohl aber zum Schaden für erstere sein würde.
Er fing damit an, zu erzählen, welche Macht die Blaßgesichter in den Händen hätten, wie die paar tausend Indianer den Weißen gegenüber einem Wassertropfen im Meere glichen.
Es wäre ihm dennoch schwer geworden, den Jüngling zu überzeugen, wenn er nicht bald in Waldblüte eine Helferin gefunden hätte. Auch diese sprach jetzt auf den Bruder ein.
Ernst hörte Sonnenstrahl zu. Manchmal überflog ein spöttisches Lächeln, manchmal ein grimmiger Zug sein Gesicht, als aber endlich Nick Sharp sich mit Hilfe der Geschwister wieder in das Bärenfell hüllte, war er von dem Betruge, den Arahuaskar mit ihnen vorhatte, wie seine Schwester überzeugt, ebenso glaubte er jetzt an die Ohnmacht Huitzilopochtlis.
Außerdem hatte noch eine lange Unterredung stattgefunden, wie die beiden Geschwister morgen nacht auftreten sollten, wie sie die Gefangenen retten könnten, und Sharp ließ deutlich durch seine Worte klingen, daß der beiden eine ganz andere, glücklichere und ruhmvollere Zukunft warte, wenn sie den Weißen ihr Wort hielten, als wenn sie sich auf die Seite der rohen, dem Untergange geweihten Indianer stellten.
Nick Sharp war ein glänzender Redner, es war ihm ein leichtes, die unerfahrenen, aber doch klugen und scharfsinnigen Kinder der Wildnis für sich zu gewinnen.
Ob es das erstemal war, daß sich der so schlaue Detektiv irrte?
Er irrte sich nämlich insofern ganz ungeheuer, als er glaubte, es nur mit einigen ruhmsüchtigen Indianern zu tun zu haben oder mit solchen, welche glaubten, die Weißen aus ihrem Gebiete treiben zu können.
Wie wäre Sharp erschrocken gewesen, hätte er geahnt, was unterdessen draußen in der Welt vorging, welche drohende Wolken am politischen Horizonte schwebten und wie begehrlich das freie Mexiko die Hand nach jenem Teile Amerikas ausstreckte, der einst ihm, jetzt aber den Vereinigten Staaten angehörte!
Ein mexikanischer Goldsucher war zufällig dahintergekommen, daß die Indianer einen allgemeinen Aufstand planten, besonders in Texas sah es schlimm aus.
Das war etwas für die Spanier im benachbarten Mexiko; jetzt hieß es klug und schnell handeln, die Indianer für sich gewinnen, sie auf die englische Bevölkerung hetzen, indem man ihnen die alten Rechte und Besitzungen verhieß, und waren die Engländer zum Lande hinaus, gab es wieder eine einzige große, freie Republik Mexiko, dann wurde auch den Paar Indianern der Marsch geblasen.
Die armen Roten, wie oft haben sie schon für andere die Kastanien aus dem Feuer holen müssen!
Schon durchstreiften zungengewandte Indianeragenten, meist mexikanische Offiziere als Trapper, Händler oder auch nur als harmlose Reisende verkleidet, die Prärien, Wälder und Gebirge. Unter uralten Bäumen wurden zündende Vorträge gehalten, und überall gruben die roten Krieger mit finsterer, unheilvoller Miene die Tomahawks aus.
Wer den Boten Arahuaskars nicht geglaubt, der traute jetzt den amerikanischen Freiheitsverkündigern, welche es an Geschenken nicht fehlen ließen. Ja, das war etwas anderes. Die vernünftigeren Indianer wußten, daß sie allein gegen die Weißen nichts anfangen, höchstens im Kampfe ruhmvoll sterben könnten, aber vereint mit den Mexikanern durften sie hoffen.
Und dann waren sie frei, dann konnten sie wieder, wie früher ihre Väter, den Büffel auf der Prärie jagen; das ganze Land, soweit das Auge reichte, gehörte ihnen, die Mexikaner wollten sich mit ihrem alten Gebiete begnügen, nur die verhaßten Yankees mußten zum Lande hinaus.
»Indianer, ihr seid unsere Brüder, wir haben euch lieb — Yankees, ihr müßt fort oder sterben,« so scholl es überall, und die Indianer schrien Beifall.
Ihr armen, betörten, leichtgläubigen Indianer, hättet ihr gewußt, wie in der Hauptstadt Mexikos Männer in goldgestickten Uniformen hinter verschlossenen Türen schon besprachen, wie man die siegreichen, roten Scharen am leichtesten vernichten könnte! Aber diese Herren waren noch schlauer, sie wollten sich auch nicht die Finger verbrennen.
Den Vereinigten Staaten offen den Krieg erklären? Um Gottes willen nicht, dann wäre Mexiko bald annektiert worden.
Nein, Freischärler verbanden sich vorläufig mit den Indianern, Unzufriedene, Rachsüchtige, Beutegierige, und hatten sie Erfolge auf ihrer Kampfesbahn, dann erscholl in der Hauptstadt Mexiko ein Kommando, und geschlossene Truppenmassen marschierten den Vorkämpfern zu Hilfe.
Doch einige Offiziere, darunter sogar sehr hohe, konnten schon jetzt nicht mehr die Zeit des Handelns erwarten, schon jetzt machten sie sich bereit, sich mit den Indianern zu verbinden und gegen die Yankees ins Feld zu rücken. Die unter ihrem Kommando stehenden Soldaten hielten zu ihnen, sie hatten ja nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen — es waren gemeine Söldlinge.
Diese Abtrünnigen, welche den Krieg vom Zaune brachen, wurden öffentlich an den Pranger gestellt, die Presse verdammte sie, und hohe Belohnungen standen auf ihren Köpfen, aber im geheimen beglückwünschte man sie, ja beneidete sie sogar, und niemand war da, welcher sich die Belohnung verdienen wollte.
Sie waren noch die Ehrlichsten von der ganzen Sippschaft, sie konnten wenigstens nicht heucheln, den Vereinigten Staaten nicht Freundschaft versichern und dabei die Faust in der Tasche ballen.
So sahen die politischen Verhältnisse in Texas und Mexiko aus, und weder Nick Sharp, noch einer der übrigen hatten davon eine Ahnung, auch nicht die Indianer, denn hierher waren die Aufrührer bis jetzt noch nicht gekommen, aber sie standen schon auf der Grenze zu diesem Gebiet.
Nick Sharp wollte seine Schutzbefohlenen aus den Händen der in der Ruine befindlichen Indianer befreien. Doch schon zog sich ein dichter Kreis von anderen Indianern, verbunden mit spanischen Mexikanern, geschulten Soldaten, um das Gemäuer herum.
Aber eins hatte er erreicht, er hatte den Gefangenen in Sonnenstrahl wieder einen treuen Freund erworben, einen Freund, der in der Not nicht für alle Schätze der Welt aufzuwiegen ist.
Sonnenstrahl war zur Erkenntnis seiner Pflicht zurückgeführt worden, jetzt wußte er wieder, daß ein gegebenes Wort mehr als alles gilt, und wenn darüber auch alle Zukunftsträume vernichtet werden.
Sharp stand auf dem Fell, die Geschwister wollten ihm helfen, dasselbe anzulegen. Der Detektiv streckte Sonnenstrahl die eine, Waldblüte die andere Hand entgegen, und beide wurden erfaßt, rechts kräftig, links zart, aber beide herzlich.
»So willst du meinen Freunden ein Freund sein?«
»Ich will es, treu bis zum Tode.«
»Und ich will ihnen eine Freundin sein, wie ich es immer gewesen bin,« fügte Waldblüte hinzu.
»Mein Geist war umnachtet, ich konnte Freund und Feind nicht voneinander unterscheiden,« sagte Sonnenstrahl entschuldigend.
»Ich weiß es; törichte Reden richten leider oft mehr aus, als kluge. Vergeßt meine Anordnungen nicht, seid schweigsam und schlau, und traut nicht mehr falschen Zungen!«
Die Bärenhülle ward übergezogen, die Tür öffnete sich, und Mythra trabte hinaus.
In der Bibel ist oft von einem Gotte Moloch die Rede, welchem Menschen, besonders Kinder, geopfert werden, und da Moses Götzenopfer immer und immer wieder verbietet und mit den härtesten Strafen, mit den furchtbarsten Flüchen belegt, so müssen solche damals recht verbreitet gewesen sein.
Wunderbar ist es, auf was für Gedanken die Menschen kommen, wollen sie eine erzürnte Gottheit versöhnen. Die eigenen Kinder haben sie schon verbrannt, um sich den Himmel günstig zu stimmen.
Der Moloch war ein Gott der an den Grenzen Palästinas wohnenden Heiden. Sein Standbild glich einem riesigen Ungeheuer, war aus Bronze gefertigt, inwendig hohl und konnte von unten geheizt werden.
Die liebenden Eltern legten nun ihr Kind auf die Arme dieser Gestalt, Priester machten Feuer darunter, und je mehr das langsam röstende Opfer schrie, desto gnädiger schaute Moloch auf die Eltern herab, und desto günstiger wurde er für ihre Bitten gestimmt.
»Du sollst deinen Samen nicht dem Moloch opfern,« sagt Moses wohl hundertmal, aber nicht etwa zu den Heiden, sondern zu seinen Juden, ein Zeichen, daß das von Gott auserwählte Volk auch ganz gern einmal auf solche Weise Menschenopfer brachte.
Wenn ein Gott nur auf die bloße Bitte hin alles schenkt, wie freigebig muß dann erst ein anderer Gott sein, dem zu Ehren man das liebste, was man hat, opfert?
Die Azteken brachten ihren Göttern ähnliche Opfer dar, nur daß man die Gerösteten nicht nur schreien hörte, sondern sie auch in ihren Qualen sich winden sehen konnte.
Sie benutzten keine Backöfen, sondern die Opfer wurden einfach auf Platten gelegt, Feuer unter diesen gemacht und die Unglücklichen dem langsamen Verbrennungstode überliefert.
Der Feuertod auf dem Scheiterhaufen ist gegen diese Marter noch Barmherzigkeit zu nennen, denn offenes Feuer läßt den Gemarterten oft nur wenige Minuten leben. Hitze und Rauch lassen ihn ersticken. Das Blech des Bratherdes dagegen erwärmt sich allmählich, der Gefolterte kann atmen; doch es wird immer heißer, er kann nicht mehr auf der einen Seite liegen, die Luft ist kühl, er dreht sich also herum, doch die andere Seite kommt nur auf um so heißeres Eisen zu liegen.
Dieser Röstofen war eine teuflische Erfindung der aztekischen Priester, aber sie hatten sich mit ihm die eigene Grube gegraben.
Als die goldgierigen, spanischen Soldaten in das Land der Azteken kamen und die ehemals so reichen Tempel nach Gold und Silbersachen durchsuchten, da forderten sie zuerst von den Priestern die heiligen Gefäße. Diese weigerten sich, und so wurde ihnen das Geheimnis der Verstecke auf den Röstherden ausgepreßt.
Die Priester wanden sich in Zuckungen auf denselben Marterinstrumenten, auf denen sie oft Kriegsgefangene zu Ehren Huitzilopochtlis zu Tode gesengt hatten.
Im tiefsten Keller der Ruine stand in einem kleinen Gewölbe solch ein Röstofen, und vier Indianer trafen Vorbereitungen, ihn wieder einmal in Tätigkeit zu setzen, nachdem er Jahrhunderte lang unbenutzt gestanden hatte.
In die Wand gesteckte Pechfackeln leuchteten zu der unheimlichen Arbeit, wie sie Holz unter dem Ofen aufschichteten, dasselbe mit Pech begossen, damit es heller brennen sollte, und noch mehr Holzscheite aufstapelten.
Die Fackeln beleuchteten auch noch zwei andere Gestalten, einen Mann und ein Weib.
Der Mann war Lord Harrlington; er stand oder lehnte vielmehr, an Händen und Füßen gebunden, an der Wand und ließ seine Augen bald auf den arbeitenden Indianern haften, welche anscheinend Anstalten zu seinem Foltertod trafen, bald richtete er sie entschlossen, ohne Zeichen von Angst, auf das vor ihm stehende Weib — Miß Morgan, die zu ihm sprach.
»James, hörst du?« fragte sie jetzt.
»Ich höre.«
»So sprich ein Wort der Liebe zu mir, und du bist frei.«
»Ich hasse dich.«
»Dann stirbst du!«
»Ich weiß es, mir ist schon gesagt worden, daß ich heute nacht sterben soll.«
»Du stirbst eines entsetzlichen Todes.«
»Mir wird das Herz lebendig aus der Brust geschnitten, ich weiß es. Röste mich meinethalben auch auf dem glühenden Ofen, der Schmerz kann auch nicht schlimmer sein.«
»Du meinst, diese Marter hier, welche ich vorbereiten lasse, sei für dich bestimmt?«
»Für wen sonst?«
Sarah lachte höhnisch auf.
»Ellen soll hier vor deinen Augen sterben.«
»Teufelin!« knirschte Harrlington.
»Nun, was sagst du dazu?«
»Ich verfluche dich!«
»Ellen stirbt deinetwegen.«
»Ich bin unschuldig daran.«
»Durchaus nicht! Versprich mir auf dein Ehrenwort — ich weiß, du brichst es nie — daß du mein sein willst, und Ellen ist frei.«
»Ich gehöre Ellen allein. Stirbt sie, so muß auch ich sterben.«
»Nein, liebst du mich nicht, so stirbt sie; es ist also deine Schuld, wenn sie gemartert wird.«
»Weib, mache mich nicht wahnsinnig!« stöhnte Harrlington.
»Gehöre mir, fliehe mit mir!« fuhr Sarah unerbittlich fort, »und bei dem Heiligsten, was ich habe, bei meiner grenzenlosen Liebe zu dir, schwöre ich, Ellen soll frei sein, sie kann hingehen, wohin sie will, und kein Haar soll ihr gekrümmt werden. James, gehe ein auf die Bedingungen, es kostet dich nur ein Wort!«
»Nimmermehr! Auch Ellen wird tausendmal lieber sterben, als mich treulos sehen.«
»Ich werde es einmal versuchen,« lachte das Weib.
Sie winkte; zwei Indianer verließen das Gewölbe und kehrten gleich darauf mit Ellen zurück.
Dieselbe war nur an den Händen gebunden, die Füße waren frei, und ohne die Umgebung, ohne Miß Morgan zu beachten, flog sie mit einem Freudenschrei auf Harrlington zu, lehnte sich an dessen Brust und bedeckte sein Antlitz mit Küssen.
Wie hatte sie diese Gelegenheit ersehnt! Obgleich gefangen, wähnte sie sich doch im Paradies.
»James,« schluchzte sie freudetrunken.
Da stieß eine harte Hand sie zurück. Miß Morgan stellte sich wie schützend vor Harrlington, die Nebenbuhlerin mit wütenden Blicken betrachtend.
»Er gehört mir,« schrie sie.
Ellen bemerkte erst jetzt die Feindin; erschrocken taumelte sie zurück. Auf ein Wort Sarahs wurde sie ergriffen, die Füße wurden ihr gebunden und sie dann ebenfalls gegen die Wand gelehnt.
»Glaube ihr nicht, Ellen, ich hasse dieses Weib!«
Wie eine Himmelsbotschaft klangen diese Worte an Ellens Ohren, während die Indianer ihr Fesseln anlegten.
Jetzt trat Miß Morgan vor sie hin und deutete auf den Feuerherd.
»Weißt du, was das ist?«
Ellen blickte sie geistesabwesend an, die Besinnung drohte ihr zu schwinden, sie war fassungslos, sonst hätte sie ihrer Feindin wohl nicht mehr Rede gestanden.
»Nein.«
»Auf diesem Herde sollst du zu Tode geröstet werden.«
Jetzt begriff Ellen mit einem Male alles; wie Schuppen fiel es ihr von den Augen.
»James!« schrie sie entsetzt.
»Ich sterbe mit dir,« tröstete Harrlington.
»Tröstet dich das, wie?« fragte wieder Miß Morgan höhnisch die Unglückliche. »Sieh, dein Hochzeitsbett wird schon bereitet, die Indianer sorgen, daß es hübsch warm ist. Was meinst du, willst du lieber langsam darauf verbrennen, oder willst du jedes Anrecht auf Harrlington aufgeben? Sprich schnell, ich habe keine Zeit mehr zu verlieren!«
Da richtete sich Ellen plötzlich hoch auf und blickte das Weib mit unsagbarer Verachtung an.
»Ah so, nun verstehe ich dich erst,« sagte sie langsam. »Also du glaubst, durch Folterqualen könntest du mich dazu zwingen, James zu verkaufen? Nimmermehr, tue mit mir, was du willst, aber dein Ziel wirst du niemals erreichen.«
»Wir werden sehen, was du auf dem rotglühenden Blech sagst, und ob du dann nicht deine Meinung änderst,« spottete Sarah.
Der Lord stöhnte tief auf und schloß die Augen, als könne er, wenn er es nicht sähe, das Schicksal Ellens mildern.
»Nun, beharrst du noch bei deinem Entschlusse?«
»Ich tu's.«
»Auf den Ofen mit dem Weibe! Zündet das Holz an!« rief Sarah mit starker Stimme.
Harrlington schrie laut auf, Ellen wurde von drei Indianern gepackt, emporgehoben und auf die Eisenplatte gelegt, während ein anderer schon die Fackel von der Wand nahm.
»Erbarmen!« schrie Harrlington.
»Erbarmen? Für wen?«
»Für Ellen!«
»Hahaha, Erbarmen für diese! Seit Jahren ertrage ich Tag und Nacht Feuerqualen im Herzen, mag sie es nun auch einmal probieren, wie das schmerzt!«
»Um deiner Seligkeit willen, habe Erbarmen,« flehte Harrlington weiter, welcher sah, wie die Fackel schon das Holz berührte, daß es zu knistern begann.
»Hattest du mit mir solches?«
Die Flamme züngelte empor.
»Löscht das Feuer aus,« schrie Harrlington in höchstem Schmerz, »ich — will — alles — tun.«
»Was willst du tun?« fragte Sarah lauernd, dem beim Feuer stehenden Indianer winkend, ihrer Befehle zu achten. »Hast du dir's überlegt, willst du nachgeben?«
Doch Ellen selbst forderte den Geliebten zur Standhaftigkeit auf — allerdings fühlte sie die Hitze des Feuers noch nicht.
»Gib nicht nach, James,« rief sie von der Platte herunter dem Gefangenen zu, »ich ertrage gern die größten Qualen, nur gib diesem Weibe nicht nach! Was gilt mir das Leben ohne dich?«
Stöhnend schloß Harrlington die Augen.
»Mehr Holz nach, schürt die Flammen« befahl Sarah den Indianern und trat dann zu Harrlington.
»Siehst du, wie sie sich schon zu winden beginnt?« raunte sie ihm ins Ohr. »So habe ich mich Tag und Nacht gequält; wie Feuer brannte es mir im Herzen, wie siedendes Blei rollte es durch meine Adern, und daran warst du schuld, Grausamer, du erwidertest meine Liebe nicht, und deshalb mußte ich bei lebendigem Leibe verbrennen. Hörst du sie schon seufzen, James? Die Hitze beginnt zu wirken. Schlage die Augen doch auf, James, besieh dir dein Opfer. O James, liebe mich, und du sollst Ellen den Ofen verlassen sehen.«

»O, James, liebe mich,« beschwor ihn Miß Morgan,
»und du sollst Ellen den Ofen verlassen sehen.«
»Jetzt sofort?«
»Sofort, aber du darfst Ellen nie wiedersehen. Meine Liebe wird dich trösten.«
Wieder stöhnte Harrlington laut auf, doch er öffnete die Augen nicht.
Ellen konnte übrigens die Wärme noch vertragen, ihre Kleider schützten sie auch vorläufig noch vor der unmittelbaren Berührung mit dem Metall.
Ein Schauer durchrieselte Ellens Körper, aber dennoch rief sie laut, ja, fast fröhlich:
»Sei standhaft, James, mir ist der Tod süß, wenn ich mich von dir geliebt weiß!«
»Ellen!«
»Traure nicht um mich! Davids starb für mich, er sagte, die Todesstunde sei seine schönste gewesen, und so sage auch ich jetzt. Glaube dem Weibe nicht, höre nicht auf die Teufelin. Ich habe keine Schmerzen.«
»O, sie werden schon noch kommen!« höhnte Miß Morgan. »Wenn die Kleider erst zu glimmen anfangen, wenn die Haut da, wo sie die Platte berührt, Blasen zieht, dann wirst du dich wie ein Wurm auf dem glühenden Blech krümmen, dann ...«
»Höre auf,« flehte Harrlington.
»Sage ein Wort, und Ellen ist frei.«
»Bleibe standhaft, James; liebe mich und verachte das Weib,« klang es von der Platte herab.
Die Indianer warfen Holz nach, die Flamme schlug höher, und die Platte wurde heißer.
Da stieß Ellen den ersten, gellenden Schrei aus, ihre Hand hatte eine heiße Stelle berührt und eine Brandwunde erhalten. Dieser Schrei des Schmerzes war zu viel für Harrlington, seine Kraft war gebrochen, er konnte Ellen nicht leiden sehen.
»Halte ein, halte ein,« schrie er wie ein Wahnsinniger, »nimm sie herab! Ja, Sarah, so schwöre ich dir denn beim allmächtigen Gott, ich will ...«
Er konnte nicht vollenden.
Plötzlich sprang die Wand auf, und herein trat ein einzelner, junger Indianer. Mit einem Blick seiner leuchtenden Augen hatte er die ganze Situation erfaßt, mit einem Sprunge stand er neben dem Ofen, hielt Ellen in seinen Armen und ließ sie zu Boden gleiten.
Ohnmächtig brach sie zusammen.
»Ich danke dir, Gott, du hast mein Gebet erhört,« stammelte Harrlington.
Miß Morgan stand sprachlos da, sie kannte diesen Indianer nicht, sie hatte ihn noch nie gesehen. Wie konnte er es wagen, so eigenmächtig hier aufzutreten, wo sie das Recht zu befehlen hatte? Diese Gefangenen waren ihr von Arahuaskar überlassen worden.
Doch die vier Indianer schienen den Eingetretenen zu kennen; scheu zogen sie sich von dem Ofen zurück und drückten sich an die Wand — sie mußten kein reines Gewissen haben.
Der junge Indianer ließ seine strahlenden Augen von Miß Morgan auf Harrlington gleiten und heftete sie dann auf eine der vier Rothäute.
»Was soll hier geschehen?« fragte seine klare, feste Stimme. »Wer hat den Befehl gegeben, das Feuer Huitzilopochtlis zu schüren? Arahuaskar? Sprich, Büffelauge!«
Der angeredete Indianer, dessen großes, hervorquellendes Auge ihm den Namen eingebracht haben mochte, deutete stumm auf Sarah.
Der junge Krieger wendete sich an diese.
»Du?« fragte er erstaunt.
Jetzt kam Leben in das Weib, es fand seine Selbstbeherrschung wieder. Dieser Indianer war jedenfalls ein Häuptling oder der Sohn eines solchen, jener Gäste, welche die Ruine beherbergte, und deshalb nur hatten diese Männer Respekt vor ihm.
Nun, mit dem wollte sie fertig werden. Sie trat einen Schritt auf ihn zu.
»Und mit welchem Rechte trittst du in dieses Gemach und störst mich in meinem Treiben?« fragte sie scharf.
»Mir gehört dieser Raum, ich habe hier zu befehlen und niemand anders.«
Diese Antwort war in einem so selbstbewußten Tone gegeben, daß Sarah bestürzt wurde.
Wer mochte das sein?
»Du?« entgegnete sie spöttisch. »Wer bist du denn?«
»Sonnenstrahl.«
Jetzt erschrak Sarah wirklich. Sie hatte den jungen Indianer noch nie gesehen, sondern nur von ihm sprechen hören, und sie hatte sich deshalb ein Bild von ihm gemacht, als wäre er noch ein halbes Kind, zutraulich, weich und lenksam wie ein Lamm.
Nun sah sie einen erwachsenen, starken und unbeugsamen Mann mit flammenden Augen vor sich stehen.
Außerdem wußte Sarah aber auch, daß es Sonnenstrahl streng verboten worden war, sich irgendwo sehen zu lassen, ebenso wie Waldblüte; sie durften ihr Gemach, in welchem sie sich zur Priesterweihe vorbereiten sollten, nur verlassen, wenn Arahuaskar sie rief, weil der alte Mann wegen seines hohen Alters kaum noch gehen konnte.
Sarah sah diesen Befehl übertreten, und daraus schöpfte sie Hoffnung, Sonnenstrahl irrezumachen.
»Du, Sonnenstrahl? Hast du von Arahuaskar nicht den strengen Befehl erhalten, dein Gemach nicht zu verlassen?«
»Was geht das dich an?«
»Sehr viel.«
»So, warum?«
»Weil ich die Freundin Arahuaskars bin. Ich habe Anteil an den Bestrebungen, Huitzilopochtlis Ansehen wiederherzustellen.«
Sonnenstrahl lächelte spöttisch.
»Du bist im Irrtum. Noch einmal, ich bin hier Herr und habe zu befehlen, nicht Arahuaskar.«
»Oho, das wollen wir sehen.«
»Gut, später. Was hast du mit diesen Gefangenen vor?«
»Sie gehören mir!« war Sarahs trotzige Antwort.
»Hast du sie gefangen?«
»Nein.«
»Wer hat sie dir geschenkt?«
»Arahuaskar.«
»Sie gehören nicht ihm, sondern mir. Sie sind Huitzilopochtli als Opfer bestimmt.«
»Aber Arahuaskar hat sie mir geschenkt«
»Arahuaskar hat nichts zu verschenken, nur ich.«
Sarah war klug, sie sah ein, daß sie jetzt nachgeben mußte, denn die Indianer standen natürlich auf der Seite Sonnenstrahls.
»Ich wollte sie auch nur Huitzilopochtli opfern,« entgegnete sie daher.
Ein seltsamer Blick traf sie aus dem Auge Sonnenstrahls.
»Du hast kein Recht an diese Gefangenen, sie gehören mir, und nur ich habe über sie zu verfügen.«
Er ging auf Harrlington zu, zog das Messer und machte Miene, diesem die Fesseln zu durchschneiden.
Da aber sprang Sarah dazwischen.
»Das darfst du nicht,« rief sie heftig.
»Wer wagt, es mir zu verbieten?«
»Ich.«
»Du? In wessen Namen?«
»Im Namen Arahuaskars!«
»Bah.«
»Er wird dir zeigen, daß er dir zu befehlen hat und daß ich seine beste Freundin bin.«
Harrlingtons Fesseln fielen; mit einem Jubelruf stürzte er auf Ellen zu, hob sie vom Boden auf und schloß sie an seine treue Brust. Sarah stand daneben, ihre Augen schillerten wie die einer Schlange.
»Das sollst du büßen!« zischte sie. »Du bist ein Feind der Indianer, du hältst es mit den Weißen!«
»Hüte deine Zunge!« warnte Sonnenstrahl.
»Es ist so, du bist ein Verräter!«
»Genug, ich will dir zeigen, daß ich hier zu befehlen habe,« herrschte er das Weib an.
»Befiehl nur!« höhnte Sarah.
»Du bist meine Gefangene.«
»Haha,« lachte Sarah laut auf, »sehr gut!«
»Bindet sie.«
Ehe noch Sarah wußte, ob der Befehl ernst gemeint war, wurde sie schon von den Indianern umringt und ihr die Hände auf den Rücken gebunden. An Gegenwehr hatte sie gar nicht denken können.
Vor ihr stand Sonnenstrahl mit drohendem Gesicht, hinter ihr ertönten Liebesworte, die Ellen und Harrlington wechselten. Miß Morgan war vor Wut außer sich.
»Das wirst du büßen müssen,« leuchte sie, »eine Freundin Arahuaskars so behandelt zu haben.«
»Du wirst es ihm erzählen?«
»Gewiß,« rief Sarah, in der Hoffnung, Sonnenstrahl empfände jetzt Gewissensbisse.
»Auf den Ofen mit ihr!« klang es kalt. »Du wirst es Arahuaskar nicht sagen können.«
Miß Morgan schrie vor Entsetzen laut auf, vergebens schlug sie mit den Füßen um sich, biß sogar nach den sie packenden Händen, sie wurde emporgehoben und zu dem Ofen getragen.
Die Platte war unterdes rotglühend geworden; schon von weitem fühlte Sarah die intensive, ausstrahlende Hitze, und schon schwebte sie darüber. Die acht Hände brauchten nur loszulassen, und sie wand sich auf der glühenden Platte, bis sie eine schwarze, verkohlte Masse ward.
Die Sprache hatte sie verlassen, Sarah konnte nicht einmal mehr schreien. Mit stieren Augen blickte sie hinunter auf den schrecklichen Ofen.
Doch die Hände hielten sie noch, Sonnenstrahl gab noch nicht den Wink, sie fallen zu lassen.
Da stürzten Harrlington und die von ihm entfesselte Ellen vor.
»Was wollt ihr?« fragte Sonnenstrahl.
»Töte sie nicht! Dieses Ende ist zu entsetzlich,« flehte Harrlington.
»Wenn du ein Herz in der Brust hast, so nimmst du deinen Befehl zurück,« fügte Ellen hinzu.
Sonnenstrahl winkte; die Indianer traten zurück und ließen Sarah zu Boden gleiten.
»Hörst du, deine Feinde bitten für dich! Sie wollen nicht, daß du so enden sollst, wie du es doch ihnen bestimmt hattest.«
Sarah murmelte etwas Unverständliches, der Schreck hatte sie halb tot gemacht.
»Ich hatte gar nicht die Absicht, dich zu töten,« fuhr Sonnenstrahl fort. »Nur zeigen wollte ich dir, daß ich, und kein anderer hier über Leben und Tod zu entscheiden habe. Es ist mir sogar wenig daran gelegen, ob du jetzt zu Arahuaskar gehst und ihm mein Vorhaben dir gegenüber mitteilst oder nicht. Tue es, ich erlaube es dir.«
Dabei durchschnitt er Sarahs Fesseln. Wie ein verwundetes Raubtier sprang sie auf und lief aus dem Gewölbe, ohne sich noch einmal umgesehen zu haben. Erst draußen stieß sie einen heiseren Wutschrei aus.
Verwundert betrachteten Harrlington und Ellen den jungen Indianer. Das war derjenige, von dem sie heute nacht geopfert werden sollten. Sie glaubten nicht mehr daran, neue Hoffnung zog in ihre Herzen ein. Sie kannten ja nun seinen edlen Sinn.
Doch sie schienen sich getäuscht zu haben.
»Ihr seid meine Gefangenen,« wandte sich Sonnenstrahl an sie, »folgt den Indianern, sie bringen euch in eure Zellen zurück!«
Ellen warf sich aus die Knie und umklammerte seine Füße.
»Was ist unser Los? Sage es uns!« bat sie. »Lasse uns nicht länger in der schrecklichsten Ungewißheit!«
Doch Sonnenstrahl zeigte sich durchaus nicht so gnädig, wie die beiden Gefangenen wohl geglaubt hatten; finster schaute er auf Ellen herab.
»Der Tod ist euer aller Los.«
»Warum hast du mich jetzt befreit? Hättest du mich doch lieber sterben lassen!«
»Nicht der Rache dieses Weibes solltest du zum Opfer fallen, Huitzilopochtli wartet auf dein Blut.«
»O, Sonnenstrahl, gedenke des, was du mir versprochen hast, du wolltest mir ein Freund sein!«
»Als Freund schlachte ich dich auf dem Altar, der Gott will es so.«
»Dann nimm dein Messer und stoße es mir ins Herz, aber beende diese Qual!«
»Laß mich los!«
»Ich lasse dich nicht, töte mich und meinen Freund!«
Sonnenstrahl bückte sich, löste mit Gewalt die Hände Ellens und schleuderte sie unsanft von sich. Es hatte einige Zeit gedauert, ehe er sich von ihr befreite.
Ellen erhob sich langsam, strich sich die Haare aus der Stirn und schaute lange in Sonnenstrahls Gesicht, in dem nichts von Mitleid zu lesen war. Dann warf sie sich plötzlich an Harrlingtons Brust, lehnte ihr Antlitz an dessen Wange und schluchzte laut.
Dem Lord wollte das Herz vor Wehmut zergehen, er hatte schon Lust, sich auf den Indianer zu werfen, ihm das Messer zu entreißen und diesen Leiden ein Ende zu machen. Doch was war das? Weinte Ellen oder lachte sie, er konnte es nicht unterscheiden. Doch da schlugen auch Worte an sein Ohr.
»Verstelle dich!« lispelte es deutlich. »Sonnenstrahl hat mir zugeflüstert, er sei unser Freund, er rettet uns, aber nichts merken lassen, James.«
Mehr brauchte Harrlington nicht zu hören. Mit jubelndem Herzen, aber mit weinenden Augen umschlang er Ellen und drückte sie wieder und wieder an die Brust, bis ihn die Indianer aufforderten, ihnen in die Zellen zu folgen.
Sie gehorchten willig, die Kerker hatten ihre Schrecken verloren. Ein sicheres Gefühl sagte ihnen, daß sie in Sonnenstrahl einen aufrichtigen Freund besaßen, doch er mußte seine Rolle weiter spielen, sollten seine Freunde befreit werden.
Noch einen langen, langen Kuß, dann ging Harrlington auf dem Korridor links, Ellen rechts, und die Kerkertüren schlossen sich hinter ihnen.
Die sie begleitenden Indianer hatten nicht gewagt, sie auch nur scheel anzusehen, denn Sonnenstrahl war nicht weit von ihnen, und wie er über die Opfer Huitzilopochtlis dachte, hatten sie soeben gehört; die Gefangenen gehörten ihm, kein Haar durfte ihnen vorher gekrümmt werden, und wehe dem, der hier eigenmächtig handelte — der Röstofen war noch immer glühend, er wartete der Ungehorsamen. —
Als Sonnenstrahl den Teil des Bauwerkes erreichte, von welchem aus sich der Gang nach seinem Gemache abzweigte, sah er in der Ferne das unsichere Leuchten einer Fackel, und er konnte auch drei Gestalten erkennen.
Schon wollte er einen anderen Weg einschlagen, aber gleich darauf umschwebte seine Züge ein flüchtiges, spöttisches Lächeln, und er setzte seinen Weg fort.
Er wußte nämlich, wen er dort treffen sollte, jedenfalls Arahuaskar, den alten Vater und das weiße Mädchen, und man wollte ihn zur Rede setzen. Den ersteren erkannte er schon an dem eigentümlichen Geruche, welcher plötzlich die Kellergewölbe ausfüllte, an jenem ekelhaften Schlangenfett.
Sonnenstrahl wollte ihnen zeigen, wie wenig er sie fürchte, sorglos ging er weiter und traf nicht weit vom Eingange zu seinem Gemach mit ihnen zusammen.
Arahuaskar, jetzt sehr gebückt und schwer am Arme des alten Freundes hängend, blieb stehen und bohrte die Augen fest in die des jungen Indianers, der alte Vater zeigte nichts Außergewöhnliches, er hielt die Fackel, doch Miß Morgan konnte ein triumphierendes, schadenfrohes Lächeln nicht verbergen.
Sie glaubte nicht anders, als jetzt erhielte Sonnenstrahl eine scharfe Rüge erteilt.
Auch Sonnenstrahl mußte stehen bleiben, die drei versperrten vollständig den Gang und schienen ihn nicht vorbeilassen zu wollen.
»Warum bist du nicht in deinem Gemache?« begann Arahuaskar mit leiser Stimme.
»Weil ich es verlassen mußte.«
»Warum? Gab ich dir nicht den Befehl, es nicht zu verlassen?«
Sonnenstrahl war nicht geneigt, hier anders zu sprechen, als vorhin zu Miß Morgan.
»Nicht du gabst mir den Befehl, sondern Huitzilopochtli,« entgegnete er scharf.
»Wohl, Huitzilopochtli sprach durch mich zu dir.«
»Huitzilopochtli sprach aber diesmal selbst zu mir: ›Geh und verlaß das Heiligtum, es sollen zwei Opfer, die mir gehören, getötet werden von frevelnden Händen. Ich will es nicht haben.‹ So sprach Huitzilopochtli zu mir, und ich gehorchte ihm.«
Der alte Indianer erschrak, er war sprachlos, er sah sich plötzlich in seiner eigenen Falle gefangen. Sonnenstrahl war schlauer als er.
Sein Freund konnte ein boshaftes Lächeln nicht unterdrücken.
»Huitzilopochtli spricht nur zu mir, nicht zu dir, weil du noch nicht sein Priester bist,« sagte dann Arahuaskar, sich sammelnd.
»Er sprach zu mir durch Waldblüte.«
»Waldblüte kann ihn nicht verstehen.«
»Wie?« rief Sonnenstrahl jetzt heftig. »Willst du mich der Lüge zeihen? Ich sage, er sprach durch Waldblüte zu mir, er zürnt dir sogar, daß du die beiden Gefangenen diesem Weibe in die Hand gabst, er hatte es dir nicht geheißen. Oder willst du mich etwa glauben lassen, auch Waldblüte könnte ihn nicht verstehen, obwohl sie seine Priesterin ist?«
Arahuaskar sah sich plötzlich von aller Verstandeskraft verlassen, er blickte hilfesuchend in das Gesicht des alten Vaters, sah aber dort nur ein boshaftes Lächeln.
Er hatte bis jetzt geglaubt, Sonnenstrahl verehre Huitzilopochtli wirklich und sei der Meinung, er selbst, Arahuaskar, könne nur mit dem Gott verkehren. Nun sah er ein, daß Sonnenstrahl nicht mehr an diesen Humbug glaube, ebensowenig wie Arahuaskar und der alte Vater selbst.

»Laßt mich vorüber, ich kann nicht länger hier verzögern. Huitzilopochtli will, daß ich mich würdig vorbereite, um heute nacht mein Amt antreten zu können.«
Arahuaskar atmete auf. So war Sonnenstrahl also kein Abtrünniger, wie er erst fürchtete, er wollte noch seine Rolle weiterspielen. Doch mit Arahuaskars Herrschaft war es nun aus. Sonnenstrahl war kein Kind mehr, welches dem Lehrer folgte. Saß er erst auf dem Thron, so duldete er keinen Vormund.
Doch Arahuaskar war befriedigt, er trat zur Seite.
»Ich konnte meiner weißen Tochter nicht recht geben,« sagte Arahuaskar entschuldigend zu Miß Morgan, »wenn Huitzilopochtli es ihm aufgetragen hatte, so mußte er gehorchen.«
Sarah antwortete nichts, mit einem sehr verächtlichen Zug im Gesicht, der mehr als alle Worte sagte, verließ sie die beiden.
»Elende Heuchler,« murmelte sie, als sie nach Flexans Aufenthaltsort eilte, »ihr betrügt einander und euch, selbst, mich aber könnt ihr nicht täuschen. Lächerlich wenn man euch so ernsthaft von euren Göttern sprechen hört, an die ihr selbst nicht glaubt. Es wird die höchste Zeit, daß ich handle, sonst geht mir meine Rache verloren. Ich Törin, daß ich glaubte, in diesen Rothäuten Bundesgenossen zu haben; hätte ich lieber auf eigene Faust gehandelt. Fast scheint es, als könnte Ellen meine Rache nicht mehr treffen, aber,« fügte sie triumphierend hinzu, »ihr Blut werde ich dennoch heute nacht, wenn der erste Morgenstrahl anbricht, fließen sehen.«
Arahuaskar und der alte Vater standen sich lange wortlos in einem Gewölbe gegenüber.
»Was sagt mein weißer Bruder dazu?«
Der alte Gelehrte zuckte mit den Schultern.
»Sonnenstrahl ist unserer Aufsicht entwachsen,« entgegnete er, »wir haben ihm so viel von Ruhm und Macht vorgeschwatzt, bis er auch uns nicht mehr gehorchen zu brauchen glaubt. Doch das macht nichts, unserer Absicht wird er nicht untreu.«
»Meinst du nicht?«
»Auf keinen Fall! Wie kannst du so etwas glauben? Ich kenne Sonnenstrahl; als ich ihn das letztemal sprach, um ihn für einige Tage in seine Kammer zu verweisen, schmachtete er nach dem ihm versprochenen Ruhm, wie der durstige Hirsch nach Wasser. Wie weit sich unterdes diese Sucht in ihm entwickelt hat, haben wir jetzt eben gesehen: er will selbst uns, seinen Lehrern, schon befehlen.«
»Laß ihn, es ist gut so,« entgegnete Arahuaskar, »gern will ich mir von ihm befehlen lassen, wenn er nur nach unseren Sinnen befiehlt.«
»Das tut er sicher,« sagte der alte Gelehrte und verließ das Gemach, um sich nach jener Zelle zu begeben, in welcher der Holländer gefangen saß. Er wollte schon lange mit van Guden sprechen, jetzt war die letzte Gelegenheit dazu, denn in wenigen Stunden schon war keiner der Gefangenen mehr am Leben. —
»Gelungen?« wurde der eintretende Sonnenstrahl von einer Stimme begrüßt.
Diese rührte nicht von Waldblüte her, sondern sie kam aus jener Ecke, wo Mythra behaglich auf Fellen ausgestreckt lag, aber nicht wie ein Bär, sondern eher wie ein Mensch, denn das Tier stützte den Kopf auf eine seiner Tatzen.
»Deine Freunde sind gerettet,« entgegnete Sonnenstrahl und erzählte nun alles, was sich ereignet hatte.
»Famos,« schrie Nick Sharps Stimme aus der Bärenumhüllung, »aber dieses satanische Weib soll noch dafür büßen müssen, oder ich will Zeit meines Lebens als Bär herumlaufen. Aber seid klug. Sonnenstrahl und Waldblüte, noch ist nicht alles gewonnen. Das schwierigste Stück Arbeit habt ihr noch vor euch; verläßt euch der Mut bei der Rolle, die ihr spielen sollt, so sind wir alle verloren und ihr mit.«
Sonnenstrahl lächelte verächtlich.
»Sonnenstrahl hat Mut,« entgegnete er stolz, »er wird nicht mehr mit sich spielen lassen, sondern wie ein Mann nach eigener Ueberlegung handeln.«
»Und Waldblüte wird auch den Mut dazu haben,« fügte die Schwester hinzu, »gilt es doch unsere Freunde zu retten. Gelingt es uns nicht, müssen die Gefangenen sterben, so wird Waldblüte als Freundin mit ihnen zu sterben wissen.«
Im Hafen von Matagorda lagen der ›Blitz‹ und die ›Hoffnung‹, außerdem noch die ›Vesta‹ letztere jedoch im Trockendock. Sie wurde unter der persönlichen Aufsicht von Herrn Anders, Hoffmanns Ingenieur, repariert, und nach etwa acht Tagen konnte sie wieder auf dem Wasser schwimmen, der Schaden, den ihr die Matagorda-Riffe zugefügt, war geheilt.
Die Matrosen der beiden deutschen Schiffe langweilten sich in dem Hafenneste furchtbar. Mit den spanischen Bewohnern war durchaus nichts anzufangen, die verstanden gar keinen Spaß, und ihre Töchter flohen vor den deutschen Seeleuten, als wären diese Menschenfresser und keine artigen, galanten Jungen.
Ingenieur Anders lag fast Tag und Nacht auf dem Dock und leitete die Arbeiten, Steuermann Nagel wartete nur immer auf die Nachricht, daß Kapitän Hoffmann bald in Matagorda ankäme, aber Georg, die Ordonnanz, brachte nie von dem kleinen Postgebäude die Depesche mit, und die einzige Beschäftigung der Matrosen der ›Hoffnung‹ bestand darin, das Schiff von oben bis unten zu scheuern.
»Die Planken werden immer dünner,« brummte Karl, der Bootsmann, »nächstens scheuern wir ein Leck ins Schiff.« Aber auf Geheiß des Steuermanns mußte er doch immer wieder Steine, Sand und Scheuerbesen an die Matrosen austeilen.
Die einzige Abwechslung, brachte der Abend. Dann fanden sich die befreundeten Besatzungen in jener kleinen, spanischen Weinstube zusammen, und es passierte öfters, daß in ganz Matagorda kein Wein mehr aufzutreiben und gleichwohl der Durst noch nicht gelöscht war.
Wenn dann die Tante wieder eine neue Ladung Wein erhielt, so fand zwischen den beiden Besatzungen ein Wettrinken statt, und es schien überhaupt, als solle das Leben in Matagorda in eine einzige, große Sauferei, um gut deutsch zu reden, ausarten.
Darauf gab es eine Unterredung zwischen Steuermann Nagel, der doch auch kein Glas verachtete, und dem Steuermann der ›Hoffnung‹, und es war mit den Trinkgelagen aus — es gab keinen Vorschuß mehr. Die Matrosen fluchten, priemten, spuckten, aber das half alles nichts, es gab kein Geld mehr, und die Tante in der Weinschenke pumpte auch nicht.
Nun fing die Langeweile erst recht an, man verfiel auf allerlei Streiche; einige Stunden erzeugten diese wohl auch Lustigkeit, dann war es aber wieder die alte Geschichte.
Georg, der Spaßmacher, war auf einem wilden Ochsen geritten, hatte eine Gans blau und rot angepinselt, eines Nachts die Schornsteine einer ganzen Straße zugenagelt — es war alles nichts. Die Kapitäne der Schiffe fehlten, ohne sie gab es kein Geld, und Geld muß der Seemann am Lande haben, sonst fühlt er sich nicht als Mensch.
Doch Georg wußte noch Rat, wenigstens für sich und seine Freunde, um die Langeweile zu vertreiben.
Er hatte am Abend eine geheime Unterredung mit einigen seiner Freunde, die auf der ›Hoffnung‹ dienten, darunter auch Bootsmann Karl, und am nächsten Morgen warf er das Lot aus.
Steuermann Nagel stand am Deck und erwartete das Boot, welches Georg von Land an Bord bringen sollte. Georg war wieder auf der Post gewesen, um nach etwaigen Depeschen zu fragen.
Das Boot kam; Georg stand aufrecht darin und schwenkte die Hand, welche ein Papier hielt.
»Endlich,« brummte Nagel in den Bart.
Er öffnete das Telegramm; es rührte aber nicht, wie er erwartet, von Hoffmann her, jedoch von einer Person, die ihn ebensoviel anging.
»STEUERMANN NAGEL. ›BLITZ‹. MATAGORDA — BIN VON GALVESTON ABGEREIST, HOFFMANN AUFZUSUCHEN. HABE MILITÄRISCHE BEDECKUNG BEI MIR. TREFFE ICH HOFFMANN IN AUSTIN NICHT, REISE ICH ZURÜCK NACH MATAGORDA. SO LANGE AUF MICH WARTEN.
JOHANNA LIND.«
»Teufel, muß die aber Sehnsucht nach dem Kapitän haben,« brummte Nagel, »reist das Mädel durch Urwälder, um ihren Bräutigam einmal küssen zu können!«
»Ja, Steuermann, die Liebe, die Liebe,« meinte Georg mit wichtiger Miene.
»Ach was, Liebe, habe auch eine Frau zu Hause, würde ihretwegen aber nicht eine Meile gehen, wenn kein anständiger Weg zu ihr führte. Habe übrigens wieder höllisch lange auf dich warten müssen, Georg. Dummheiten gemacht, Georg, heh?«
»Gott bewahre mich davor, daß ich jemals Dummheiten mache,« rief Georg entrüstet, »ich mußte nur auf Herrn Anders so lange warten. Dieser war nämlich ebenfalls auf der Post, als ich kam, und erhielt von Fräulein Lind aus Galveston die Anfrage, ob der Kapitän schon hier sei. Anders verneinte, Hoffmann würde wohl auch noch nicht gleich zurückkommen, und daraufhin bekam ich von Fräulein Lind diese Depesche für Euch, der Ingenieur aber eine andere, viel längere.«
»So so, daß ist etwas anderes. Verdammt hübsch von dem Mädchen, daß sie mich, als den stellvertretenden Kapitän des ›Blitz‹, von ihrem Vorhaben benachrichtigt. Das Mädel hat Manier im Leibe, das muß man ihr lassen.«
»Ja, der Kapitän hat einen fetten Fisch geangelt,« bestätigte Georg ernsthaft.
»Mir wäre es aber lieber gewesen, sie wäre hierher gekommen und hätte sich ein paar von unseren Jungen mitgenommen.«
»Donner und Doria, Steuermann, ja, das wäre ein Gedanke gewesen, mich und noch ein Dutzend.«
»Militärische Bedeckung? Pah, das ist alles nur spanisches Gesindel, das beim ersten Schuß wegläuft.«
»Wie wär's, Steuermann,« fragte Georg mit listigem Augenblinzeln, »wenn Ihr doch noch ein paar Jungens abschickt?«
»Wohin?«
»Nun, Fräulein Lind entgegen.«
»Unsinn, Georg, ich habe den strengen Befehl, alle Mannschaft zusammenzuhalten. Also Ingenieur Anders hat gesagt, der Kapitän wäre vor einigen Tagen nicht zu erwarten?«
»Wahrhaftig, das hat er gesagt, und der Beamte hat es auf seinem Apparat sogar hinübergeklappert.«
»Verflucht.«
»Ja, es ist verdammt langweilig hier.«
»Hilft nichts.«
»Gar nichts.«
»Na, geh jetzt, Georg, kannst die Kajüte scheuern.«
»Hm.«
»Und die Schränke abwischen. Auf die Glasscheiben kann man wieder einmal Landkarten malen.«
»Hm, hm.«
Der Steuermann blickte Georg an, der unschlüssig dastand, ein Bein nach dem anderen hob und dabei mit den Händen in den Hosentaschen wühlte.
»Nun, hast du noch etwas auf dem Herzen?«
»Ich? Nu ja, ich wollte — hm — ich hatte —«
»Heraus mit der Sprache, was hattest du?«
»Ach so, Steuermann — hm — ich wollte Euch schon immer etwas fragen, aber, aber — hatte immer keinen Mut dazu.«
»Nanu,« lachte Nagel, »seit wann fehlt es dir denn an Mut? Hast du etwas auf dem Gewissen?«
»Durchaus nicht, ich wollte Euch nur fragen, ob Ihr priemen tätet.«
Nagel riß auf diese unverschämt vorgetragene Frage den Mund vor Staunen auf.
»Junge, bist du denn seetoll geworden, im Hafen und bei ruhigem Wetter?« rief er. »Du weißt doch, daß ich schon seit acht Tagen schimpfe und fluche, weil mir mein Priemtabak ausgegangen und der hier käufliche das reine Süßholz ist. Oder aber, Georg, hast du etwa —?« fügte er schmunzelnd hinzu.
»Ja, ich habe,« sagte Georg jetzt schnell und brachte aus seiner endlosen Hosentasche eine kleine Rolle Priemtabak hervor.
»Aber das ist ja deiner! Ich dachte, du hättest hier welchen aufgetrieben. Du hast auch nicht mehr viel.«
»Macht nichts, Steuermann, beißt Euch ruhig ein Endchen davon ab, Euch schmeckt es gerade so gut wie mir.«
Schmunzelnd folgte Nagel dem Geheiß, er biß sich ein Stück von der Rolle ab, und der dunkelbraune Strahl, der gleich darauf von seinen Lippen fünf Meter weit ins Wasser spritzte, bewies, daß es eine gute Sorte war.
»Danke, Georg, der hält einige Stunden vor! Gott, ist das ein Genuß, wieder einmal mit den Zähnen auf etwas Herzhaftes beißen und die braune Sauce so wegspritzen zu können.«
»Ja, Tabak ist etwas Herrliches, besonders, wenn man welchen hat.«
»Na, nun geh, Georg!«
»Hm, hm, Steuermann.«
»Aha, du wolltest mich wohl bestechen, Georg,« lachte Nagel.
»Stechen? Ja nicht. Aeh, hm, ich wollte —«
»Nun, raus damit, Junge.«
»Wollt Ihr noch ein Stückchen?«
Georg hielt ihm die Rolle wieder hin.
» All right, die andere Backe will auch was haben, sonst werde ich einseitig.«
Nagel biß sich noch ein Stück ab.
»Ist er gut?«
»Ausgezeichnet!«
»Dann beißt Euch noch ein Stück ab.«
»Nee, nee,« lachte Nagel abwehrend, »Backbord und Steuerbord hat schon.«
»Dann steckt die Rolle ein!« sagte Georg und gab ihm seinen ganzen Tabak.
»Junge, Junge, du hast etwas im Rohre stecken. Schieß los damit,« ermunterte Nagel, nahm jedoch die Rolle an und ließ sie in der Hosentasche verschwinden.
»Ja, ich habe etwas,« sagte Georg jetzt offen, als hätte ihn die Abnahme des Tabaks erleichtert, »damit Ihr's nur wißt, Urlaub wollen wir haben, ich und noch ein paar andere.«
»Urlaub? Wozu denn?« fragte Nagel verwundert. »Hier gibt's doch nichts zu sehen.«
»Genug. Am Hafen natürlich nicht, aber dort,« Georg deutete auf die sichtbare Grenze des Waldes, »da muß es schön sein.«
»Dann geht doch heute abend einmal hin und spielt Versteckens oder Haschens zwischen den Bäumen.«
»Pah, Steuermann, das ist nichts mehr für unsereins. Gebt uns Flinten, Pistolen und so weiter, noch dazu ein Boot, und dann hurrjeh, dann sollt Ihr es einmal knallen hören, daß die Bäume im Walde umfallen.«
Der Steuermann stand lange Zeit sprachlos vor Staunen da, endlich aber fand er Worte:
»Du bist von Sinnen, Georg, oder die dicke Wirtin hat neuen Wein bekommen, und du hast bei ihr gepumpt.«
»Ich rede im Ernst, Steuermann; wir wollen einen Jagdausflug in den Urwald machen.«
»Hahaha,« lachte Nagel, »ihr wäret mir die rechten Jäger. Was wollt ihr denn schießen? Eidechsen he?«
»Hirsche, Rehe, Bären, Kaimans,« zählte Georg auf.

Nagel wurde wieder ernst.
»Nein, Georg, das geht nicht. Ich habe vom Kapitän den Befehl bekommen, euch nicht von Bord zu lassen, und ich muß gehorchen.«
»Ach, Steuermann, nur ein einziges Mal,« bat Georg betrübt. »Der Kapitän bleibt ja noch einige Tage fort, wie Anders selbst sagt.«
»Es geht nicht, Georg, wahrhaftig nicht.«
»Wir bringen Fleisch in Hülle und Fülle mit, Bärenschinken, meinethalben schon geräuchert.«
»Unsinn.«
»Ihr wißt doch, wir können alle mit Gewehren umgehen.«
Das mußte Nagel allerdings zugeben, Hoffmann hatte seine Leute in den Waffen ausgebildet.
»Na, Steuermann, sagt einmal ein kräftiges Ja.«
»Nein, ich kann es nicht zulassen.«
»Ach, bloß bis morgen abend.«
»Was,« schrie der Steuermann erschrocken, »gleich bis morgen abend? Ich dachte höchstens für einige Stunden.«
»Das hat doch keinen Zweck, wir gehen in den Urwald, um Tiere zu schießen, und hier in der Nähe sind keine mehr.«
»Ihr seid toll, alle samt und sonders verrückt.«
»Steuermann, Bootsmann Karl ist auch mit dabei.«
Das war Georgs letzter Trumpf, den er gegen den Alten ausspielte.
Der Steuermann hielt nämlich sehr viel von dem Bootsmann der ›Hoffnung‹. Sie waren beide als Schiffsjungen und Matrosen zusammen gefahren. Nagel hatte sein Steuermannsexamen gemacht, Karl, der leichtlebige, dagegen nicht. Dennoch schaute Nagel mit einer Art von Bewunderung zu dem Hünen auf, er erkannte offen die Überlegenheit des Freundes als Seemann an und freute sich im stillen, daß Karl noch immer der alte war, trotz seines grauen Haares ein frischer, munterer Geselle, dem es nicht so leicht bunt genug gehen konnte.
Natürlich, Karl war Junggeselle, Nagel dagegen Familienvater, der den Hauptteil seiner großen Heuer stets dem Kapitän überließ, damit dieser die Summe nach der Heimat schicken konnte.
Georg wartete gespannt ab, ob diese Worte Erfolg haben würden. Er zweifelte nicht daran.
»So, so, also Karl will auch Bären schießen gehen,« lächelte der Steuermann.
»Wer ist denn sonst noch bei der Partie?«
Das klang schon wie Erlaubnis. Georgs Hacken und Zehen hoben und senkten sich, er tanzte im stillen einen kleinen Freudenstep.
Er nannte einige Namen von der ›Hoffnung‹ und vom ›Blitz‹.
»So, so, also eine regelrechte Jagdpartie?«
»Kommt Ihr mit, Steuermann?«
»Was, ich? Ich habe es euch ja noch gar nicht erlaubt!«
»Ach, macht doch keine Geschichten, Steuermann! Ich sehe es Euch an, daß Ihr nur gar zu gern selbst mitgingt.«
Nagel seufzte auf. Georg hatte ins Schwarze getroffen. Aber die Pflicht, die Pflicht! Wenn nur die nicht gewesen wäre, und gerade so streng beim Seemann.
»Hm. Will mir es überlegen,« brummte er, »ich kann natürlich nicht mitgehen.«
»Entscheidet Euch jetzt gleich,« bat Georg. »Meine Freunde sitzen unten, gespannt wie die Regenschirme.«
»Erlaubt es denn der Steuermann von der ›Hoffnung‹?« suchte Nagel noch einmal eine Einwendung zu machen. »Das ist ein Mann, der keinen Spaß versteht!«
»Pah, der Bootsmann ist ja selbst mit dabei, und nach dessen Pfeife muß auf der ›Hoffnung‹ ja alles tanzen.«
»Aber Anders? Den mußt du auch noch fragen.«
»Habe ich schon gefragt,« entgegnete Georg mit schlauem Lächeln.
»Und was sagte der?«
»Ich sollte nur noch Eure Erlaubnis holen, er gibt es zu.«
Die ›Hoffnung‹ lag vom ›Blitz‹ ziemlich weit entfernt, das in der Takelage laufende Tauwerk konnte man schon nicht mehr erkennen. Jetzt sah man, wie ein Matrose die Wanten hinaufkletterte, eine Raa entlangrutschte, einen Sprung von dieser machte und dann gleichsam in der Luft hängen blieb.
Er hielt sich mit den Händen eben an einem vom ›Blitz‹ aus unsichtbaren Tau fest, vielleicht an der Flaggenleine.
Schon das Benehmen des Matrosen, der wie ein Affe herumturnte, war seltsam, es sollte aber, für den Steuermann wenigstens, noch rätselhafter werden.
Der in der Luft hängende Mann fing plötzlich mit den Beinen an zu strampeln, stieß sie nach unten und nach den Seiten aus, kurz, machte die unglaublichsten Bewegungen, gerade wie ein am Bindfaden hängender Hampelmann.
»Was soll das bedeuten? Ist der Kerl denn verrückt?« rief Nagel verwundert.
»Nein, auf der ›Hoffnung‹ haben sie die Erlaubnis bekommen, die Jagdpartie zu unternehmen. Steuermann, nun fehlt bloß Ihr noch, dann tanze ich auch da oben in der Luft einen Step.
»Zum Teufel denn, ja, seid aber morgen abend wieder zurück.«
Die letzte Ermahnung hörte Georg schon nicht mehr, wie ein Eichhörnchen lief er die Wanten hinauf, ein Sprung, er hing an einem Tau und führte da oben einen ebensolchen merkwürdigen Tanz aus — das Zeichen, daß auch sie die Erlaubnis erhalten hatten, ein Boot auszurüsten. Daß es jetzt gleich fortging, verstand sich nun ganz von selber.
Die Besatzungen der übrigen, im Hafen liegenden Schiffe, meistenteils Spaniolen und Südamerikaner, zwischen denen eigentlich kein großer Unterschied ist, staunten nicht schlecht über die seltsamen Kapriolen der beiden Matrosen. Doch es waren ja Deutsche, denen konnte man so etwas schon verzeihen.
Wie nämlich wir Deutsche den Engländer gern als spleenig bezeichnen, so halten andere Ausländer, und ganz besonders die Spanier uns Deutsche für verrückt, und besonders deshalb, weil wir bei ihnen samt und sonders für Trunkenbolde gelten.
Georg rutschte wieder herab und begann sofort Vorbereitungen zu der Reise.
Ein Boot wurde zum Rudern ausgerüstet, aber nicht eins von jenen starken, außen mit Blech beschlagenen, an denen hinten eine Schraube eingesetzt werden konnte, sondern ein richtiges, schlankes Seeboot aus Holz. Der ›Blitz‹ besaß auch solche, nur lagen sie nicht zur eigentlichen Benutzung bereit.
Georg wählte seine Freunde aus, acht Mann noch, alles Deutsche; sie empfingen vom lächelnden Steuermann Waffen und Munition: schwere Büchsen, Revolver und starke Bowiemesser. Er ließ sie wie Soldaten in Reih und Glied antreten und unterzog sie einer genauen Musterung.
Man konnte sofort sehen, daß Nagel ein ehemaliger Bootsmannsmaat der Marine gewesen, mit solcher Genauigkeit hielt er die Musterung ab, und genau ebenso machte es jetzt drüben der Bootsmann Karl, auch ein alter Unteroffizier der Marine, der sogar seinen Freund Nagel einst als Rekrut gedrillt hatte.
Zugleich konnte man letzterem aber auch ansehen, wie gern er selbst mit ins Boot gestiegen wäre und an der Partie teilgenommen hätte — doch er durfte seinen Posten nicht verlassen.
Jetzt inspizierte er noch einmal genau das Boot. Es enthielt genügend Hartbrot, kaltes Fleisch und Wasser für drei Tage. Außer den acht langen Riemen lagen noch die gleiche Anzahl von kurzen darin, denn die Fahrt sollte den Koloradofluß hinaufgehen, und nicht immer waren vielleicht die langen Riemen zu gebrauchen, welche eine Strichfläche von zehn Metern einnahmen. Aber der Matrose bedient sich lieber der langen Riemen als der kurzen, sie sind zwar viel schwerer zu handhaben, fördern jedoch die Fahrt bedeutend mehr.
Waffen und Munition lagen wohlverstaut im hinteren Teile des Fahrzeuges.
»Wer ist Bootssteurer?« fragte Nagel.
Georg salutierte stumm mit der Hand an der bewimpelten Mütze.
»Alles in Ordnung?«
»Nein, fehlt noch etwas,« antwortete Georg.
»Was?«
»Kein Boot fährt ohne Flagge.«
Auf des Steuermannes Befehl wurde hinten die Flaggenstange eingesteckt und das schwarz-weiß-rote Tuch zusammengewickelt daran befestigt. Es brauchte nur emporgezogen zu werden, so entfaltete es die Farben.
»Noch etwas?«
Georg vergaß plötzlich seine militärische Haltung, wie vorher fuhr er mit den Händen bis an die Ellenbogen in die Taschen und fing an darin zu wühlen.
»Nun, was gibt's? Priemtabak? Habe keinen.«
»Ne, ne, Steuermann, das ist es nicht.«
»Nun?«
»Seht, es kann einer von uns krank werden,« begann Georg zögernd, »und dann — dann ...«
»Krank? Ich glaube gar.«
»Nun ja, ich meine, bloß so ein bißchen Rheumatismus oder so etwas Aehnliches. Da ist es immer gut, wenn man etwas zum Einreiben bei sich hat.«
»Ich werde euch eine Flasche Arnika mitgeben.«
»Ach nee, Steuermann, Arnika tut's nicht.«
»Nicht? Was denn sonst.«
»So, hier, ein bißchen zum Einreiben,« sagte Georg und rieb sich die Magengegend.
»Ach so,« lachte Nagel, »innerlich einzureiben. Was für Medizin ist denn das? Du meinst doch nicht etwa Rum?«
»Das ist's,« grinste Georg.
Der Koch mußte einige dickbäuchige Flaschen aus dem Proviantraum holen, sie wanderten ins Boot und wurden von den schmunzelnden Matrosen so vorsichtig verpackt, als enthielten sie einen Explosivstoff.
»Aber,« warnte Nagel, »nicht zuviel.«
»Keine Angst, Steuermann, wir fahren unter deutscher Flagge,« entgegnete Georg selbstbewußt.
»Und morgen abend bei Sonnenuntergang zurück sein.«
»Gewiß, Steuermann.«
»Dann ins Boot.«
Im Nu schwangen sich die blauen Jungen über die Bordwand, glitten an Tauen herab und nahmen Platz, die acht Ruderer auf den Bänken, Georg am Steuer.
Letzterer übernahm jetzt das Kommando.
»Klar bei Riemen« — zwölf Hände legten sich auf die Ruder, vier ergriffen zwei Stangen, vorn mit Haken versehen.
»Hoch die Riemen« — sechs Ruder flogen gleichmäßig hoch und standen aufrecht im Boot, die Dollen, in denen die Ruder sich bewegen, wurden in die Löcher gesteckt und die zwei anderen Leute richteten ihre Stangen hoch.
»Setzt ab« — die Stangen wurden ans Boot gesetzt und dasselbe vom Schiff abgestoßen.
»Bug« — die Matrosen vertauschten ihre Stangen mit Rudern und richteten dieselben ebenfalls hoch.
»Laßt fallen — auf Riemen« — beim ersten Kommando fielen die Ruder in die Dollen, ohne daß aber die Blätter dabei das Wasser berührten — das wäre ein sehr grober Verstoß gewesen — und die Blätter wurden schnell ausgerichtet, so daß das Boot mit den langen Riemen wie ein ungeheurer Vogel mit ausgebreiteten Fittichen über dem Wasser schwebte.
»Ruder an« — gleichmäßig, wie von einer Maschine getrieben, fuhren die acht Körper der Matrosen voraus, acht Riemenblätter tauchten ins Wasser, und dann bogen sich die Oberkörper wieder zurück, bis sie fast unter dem Bootsrand verschwanden. Gleichzeitig ging hinten die deutsche Flagge hoch und entfaltete sich.
Diese Kommandos folgten kurz aufeinander, und die Ausführung ging ebenso schnell, Schlag auf Schlag, Hand in Hand, alles wie durch Zauberei. Ein ordentliches Schiff hält darauf, daß jedes Manöver glatt von statten geht, und nun gar im fremden Hafen, wo stets müßige Seeleute zuschauen und kritisieren, da spannt sich jede Muskel, jeder Nerv, und über das kleinste Versehen ärgert man sich tagelang.
Doch die Mannschaft des ›Blitz‹ brauchte derartiges nicht zu fürchten.
Die Riemen bogen sich, aber sie hielten, denn sie waren aus Eschenholz, und beim zweiten Schlag, oder besser gesagt, beim zweiten Durchholen schoß das Boot schon wie ein Pfeil über das Wasser hin, und die deutsche Flagge flatterte, wie vom Sturme gepeitscht, obgleich stilles Wetter war.
Da löste sich auch von der ›Hoffnung‹ ein gleichbesetztes Boot ab, hinten flatterten ebenfalls die schwarz-weiß-roten Farben, und Nagel erkannte am Steuer den Bootsmann Karl.
Wo der Koloradofluß in die Bucht einmündet, trafen beide Boote zusammen und fuhren nebeneinander in den breiten Fluß ein, bis eine Biegung, schon bewaldet, sie den Augen der Nachblickenden entzog.
Steuermann Nagel seufzte tief auf, stieß dann einen kernigen Fluch aus, biß sich noch ein Stück Tabak ab und stellte seine Leute wieder zur Arbeit an.
Eine halbe Stunde später betrat Ingenieur Anders das Deck und wandte sich sofort an den Steuermann.
»Nagel, hat Georg die Erlaubnis von Ihnen erhalten, den Jagdausflug zu unternehmen?« fragte er hastig.
»Gewiß, er ist schon seit einer halben Stunde unterwegs.«
Anders machte ein bestürztes Gesicht.
»So komme ich eine halbe Stunde zu spät.«
»Wollen Sie mich dafür verantwortlich machen?« fragte der Steuermann etwas spitz. »Georg sagte mir, von Ihnen hätte er schon die Erlaubnis, und Georg lügt nie.«
»Ich will Sie durchaus nicht verantwortlich machen,« entgegnete der Ingenieur schnell, »es ist nur ein unglücklicher Zufall.«
»Was ist denn geschehen?«
»Soeben spreche ich einen Herrn auf dem Dock und erfahre, daß allerlei Indianerunruhen vorgekommen sind, gar nicht weit von hier, am Koloradofluß. Englische Niederlassungen sind bereits überfallen worden, aber die Indianer haben dafür gesorgt, daß keine Verräter die Städte erreichen konnten. Daher ist die Sache so lange geheim geblieben.«
»Alle Wetter!«
»Ja, und das Schlimmste ist, auch das benachbarte Mexiko scheint die Hände dabei im Spiele zu haben. Schon wird Texas von Freischärlern durchstreift, welche sich für Mexikaner ausgeben, ja, sogar mexikanische Uniformen, Offiziere, will man unter ihnen gesehen haben. Ganz Matagorda ist plötzlich in der furchtbarsten Aufregung, bald muß ein lichterloher Aufstand losbrechen. Es scheint alles vorbereitet gewesen zu sein; kurz, ehe ich hierherkam, stellten alle spanischen Dockarbeiter wie auf Verabredung die Arbeit ein, und einem der Ingenieure, einem Yankee vom reinsten Wasser, fiel plötzlich ein schweres Stück Holz von oben auf den Kopf. Ein Spanier will es aus Versehen haben fallen lassen. Es liegt wie Gewitterschwüle über Matagorda, und man sagt, schon über ganz Texas.«
»Alle Wetter,« wiederholte Nagel, jetzt völlig erschrocken, »das sieht bös aus! Verflucht, daß sie auch gerade jetzt —«
»Sie meinen unsere Matrosen?«
»Ah pah, die schlagen sich schon durch, wenn es mir auch lieber wäre, sie wären hier. Aber die andere —«
»Miß Lind.«
»Eben die.«
»Es ist zu fatal,« sagte Herr Anders, sehr aufgeregt, »muß sie auch gerade jetzt diese gefährliche Reise antreten, da überall Indianer und spanisch-mexikanische Abenteurer herumstreifen.«
»Wenn nur erst Kapitän Hoffmann und die übrige Gesellschaft zurückwäre, damit wir dieses verdammte Nest verlassen könnten!«
»Nun, wir wollen nicht gleich das Schlimmste fürchten,« tröstete Herr Anders, »jener Mann, zwar auch ein Spanier, aber im Herzen den Vereinigten Staaten anhängend, meinte auch, die Sache würde wohl etwas übertrieben worden sein. Wenn wirklich ein Aufstand zu befürchten wäre, dann würden die in Washington auch schon davon gehört haben und Sorge tragen, daß er im Keime erstickt wird. Onkel Sam Onkel Sam, auf englisch Uncle Sam, ist der Spitzname für die Vereinigten Staaten, entstanden aus U.S., der Abkürzung für Unites States. läßt sich Texas und sein Mexiko nicht so leicht nehmen.«
»Ja, wenn! Ehe die aber etwas davon gemerkt haben, kann es hier schon lustig knallen.«
»Halloh,« unterbrach ihn da Herr Anders plötzlich, »was für ein stattliches Fahrzeug ist das da?«
Der Einfahrt des Hafens strebte eben ein Schiff zu, anscheinend ein Segler. Man konnte vorläufig nur die Takelage sehen, denn eine Mole, jenes Mauerwerk, welches den Hafen abschließt und sich oft weit ins Meer hinausschiebt, verbarg noch den Rumpf.
Auch war die Entfernung noch sehr groß.
»Ist das Schiff nicht bald getakelt wie ein — wie ein ...«
»Wie ein Kriegsschiff,« kam ihm der dann erfahrene Steuermann zu Hilfe, »allerdings, es ist ein Kriegsschiff.«
»Ein Kreuzer.«
»Eine Kreuzerfregatte,« bestätigte Nagel.
»Können Sie noch keine Flaggen erkennen?«
»Nein — doch ja, den Kriegswimpel, also ist es ein ausländisches Schiff.«
In diesem Augenblicke kam die Fregatte hinter der Mole hervorgedampft, am Heck flatterte das Sternenbanner der Vereinigten Staaten.
»Alle Hagel,« rief der Steuermann erstaunt, »ein Nordamerikaner kommt in einen nordamerikanischen Hafen und zeigt den Kriegswimpel! Was soll das bedeuten?«

»Alle Hagel,« rief der Steuermann, »ein Nord-
amerikaner — und zeigt den Kriegswimpel!«
»Ich erkenne sie jetzt,« ließ sich der Ingenieur vernehmen, der das Fernglas zu Hilfe genommen hatte, »es ist die Kreuzerfregatte ›Swift‹, unter dem Kommando des Kapitäns Staunton.«
»Wahrhaftig, Sie haben recht. Aber was will sie denn nur hier mit dem Kriegswimpel?«
Die Fregatte sollte diese Frage bald beantworten.
Langsam fuhr das majestätische Schiff in den Hafen, bog dann aber scharf nach rechts ab, legte sich mit der Querseite von der Stadt ab und ließ sofort, als diese Lage erreicht war, die Anker fallen.
Der lange Kriegswimpel flatterte vom mittelsten Mast, die mit Kanonen gespickte Breitseite schaute direkt auf Matagorda.
Die beiden Männer sahen einander an.
»Merken Sie etwas?« fragte Nagel.
Der Ingenieur nickte nur ernsthaft.
Auf der ›Swift‹ wurde ein Boot ausgesetzt, der Kapitän und zwei andere Offiziere nahmen darin Platz und wurden ans Land gerudert.
»Jetzt gibt es auf dem Stadthaus eine Auseinandersetzung,« meinte der Ingenieur.
»Ja, und der Kriegswimpel auf der ›Swift‹ sagt ein deutliches: Entweder — oder, meine Herren.«
»Sie meinen doch nicht, daß etwa ...?« rief Anders erschrocken.
»Daß etwa eine Blockade stattfinden kann?« ergänzte Nagel. »Ja, das glaube ich. Ich kalkuliere, wir können vielleicht noch die Kanonen des ›Swift‹ zu hören bekommen, und mit Pfefferkuchen werden die Yankees wohl nicht schießen.«
»Dann wäre alles außerordentlich schnell vor sich gegangen.«
»Und ich möchte, meine Leute wären erst wieder an Bord,« fügte Nagel seufzend hinzu, »trau' der Teufel den heißblütigen Spaniolen und den schlagfertigen Yankees!«
Ein kleiner Dampfer kam in den Hafen, und einige Minuten später lief die Nachricht durch ganz Matagorda, von Mund zu Mund, von Schiff zu Schiff, draußen vor dem Leuchtturm kreuzten vier mächtige Panzerkolosse, schwimmende Festungen, am Heck das Sternenbanner, am Mast den Kriegswimpel. Innerhalb vierundzwanzig Stunden konnte die ganze Küste blockiert sein.
Die jagdlustigen Matrosen brauchten nicht die langen Riemen mit den kurzen auszutauschen, der Koloradofluß war überall breit genug, so daß beide Boote sogar nebeneinander fahren konnten, aber obgleich die Matrosen nun schon mehrere Stunden lang kräftig gerudert hatten und sich schon mitten im tropischen Urwald befanden, hatte sich noch kein Wild am Ufer gezeigt.
Sie waren darüber sehr ärgerlich.
»Bleiben wir hier, so können wir bis an die Quelle hinaufrudern,« rief der Bootsmann Karl zum anderen Boot hinüber. »Ich denke, beim nächstem Nebenfluß biegen wir ab. Die Nebenflüsse sind schmäler, dort können wir die Ufer besser beobachten.« —
Der Vorschlag des Bootsmannes fand Beifall.
Man war nämlich schon öfters an solchen Armen vorbeigekommen, und in den nächsten, links oder rechts, wollte man einbiegen und vielleicht auch landen, um das Jagdglück noch einmal zu Lande zu probieren.
Der nächste Arm ging rechts ab. Er war schmal und schien auch seicht zu sein, denn viele Wasserpflanzen bedeckten die Oberfläche.
Karl ließ die kurzen Riemen zur Hand nehmen und steuerte sofort hinein.
»Das ist kein fließendes Wasser,« rief Georg von hinten, »es steht still.«
»Dann ist es eine Bucht, und am Ende derselben werden wir einen guten Anlegeplatz finden,« entgegnete Karl. »Zeit zum Essen ist es überhaupt, und im Boote wollen wir doch nicht essen.
»Bekomme ich keine gebratene Hirschkeule vorgesetzt, rühre ich auch nichts an. Pullt, Jungens, daß wir endlich ans Land kommen und einmal unsere Büchsen knallen hören können.«
Mit kurzen Schlägen, die Riemen noch etwas eingezogen, wurden die Boote über das grüne Wasser fortgetrieben. Es war noch tief genug; ab und zu erprobte man mit der Stange den Grund, brauchte aber noch nicht zu fürchten, aufzulaufen.
Georg hatte recht gehabt, dieses Gewässer war nur eine langgestreckte Bucht. Schon nach einer Viertelstunde erreichte man ihr Ende. Ihre Ufer waren mit Büschen dicht bewachsen und boten gute Landungsstellen, das heißt, wenn die Wassertiefe ausreichte.
Das Steuermannsboot machte zuerst den Versuch, vorsichtig wurde es dem Ufer genähert, doch plötzlich begann der Kiel zu schaben, dann ruckte es ein paarmal, und schließlich saß es fest.
Alles Schieben mit Stangen und Riemen half nichts, das Boot ging weder vor- noch rückwärts. Georg war vorsichtiger gewesen, er war weiter hinten geblieben, und als er des Bootsmannes Unglück gesehen, hatte er sein Boot schnell stoppen lassen.
»Festgerannt!« rief der Bootsmann ärgerlich. »Nun können wir ans Land waten.«
»Erst abwarten,« meinte Georg, »vielleicht kann mein Boot das Ufer erreichen, und dann ziehen wir euch heran.«
Er versuchte es, kam auch wirklich dem Ufer bis auf etwa fünf Meter nahe, dann saß aber auch er fest, und alles Schieben blieb erfolglos.
Die Matrosen lachten.
»Daß die Pest uns hole!« schrie Georg und sprang auf. »Ans Ufer müssen wir doch. Wir können hier nicht warten, bis der Fluß vom nächsten Regen schwillt.«
»Und Tiere werden wohl auch nicht hierher kommen, damit wir sie schießen können!« ließ sich ein anderer hören.
»Wir waten eben ans Ufer.«
Der Bootsmann, wie auch Georg, machten schon Miene, ins Wasser zu steigen, als der Ausruf eines Matrosen sie hemmte. Der Mann deutete nach einer Stelle des Ufers.
Dort konnte man zwischen den Teichlinsen einen dunklen Gegenstand schwimmen sehen, ähnlich einem Stück Holz.
»Es hat sich eben bewegt,« behauptete der Matrose.
»Werden wir gleich sehen,« meinte Georg, griff nach der Büchse, zielte und schoß.
Der Gegenstand verschwand sofort, aber überall am Ufer plätscherte es, die ganze Oberfläche des Wassers kam in Aufruhr, dunkle Gegenstände verschwanden, andere tauchten auf, es klappte und schnappte, und hier und da wurde auch für einen Augenblick ein schuppenbedeckter Leib sichtbar.
»Bombenelement,« rief Georg erschrocken, »das sind ja verhungerte Alligatoren! Nun sitzen wir in einer schönen Falle.«
Auch alle anderen erschraken. Im Boot, daß sich nicht rückwärts noch vorwärts bewegte, und das Wasser von Alligatoren wimmelnd, so daß man ohne Todesgefahr nicht das Ufer erreichen konnte — schlimmer konnte die Lage gar nicht sein.
Georg stand auf, zog sich die Jacke aus und nahm das Ende eines Strickes in die Hand.
»Was hast du vor?« erklang es von allen Seiten.
»Ich wag's!« entgegnete der kecke Bursche. »Mit zwei Sprüngen bin ich am Ufer, und währenddessen wird mich wohl nicht gleich so ein Ungetüm verspeisen.«
»Nimm dich in acht, Georg,« warnte Karl, »die Alligatoren sind flink mit Rachen und Schwanz.«
»Pah, frisch gewagt ist halb gewonnen! Fritz, gib mal die Rumbuttel vor.«
Nach einem kräftigen Schluck erklärte sich Georg bereit, durch das Wasser ans Ufer zu springen.
»Ein Aal,« rief plötzlich der Bootsmann, als er einen solchen Fisch neben seinem Boote ganz langsam und ziemlich an der Oberfläche schwimmen sah.
Er machte Anstalten, das Tier zu greifen.
»Vorsicht, es kann auch eine Wasserschlange sein,« meinte ein anderer Matrose.
»Unsinn, ich kann doch einen Aal von einer Wasserschlange unterscheiden.«
Des Bootsmanns Hand griff zu, fest legten sich die Finger um den schlüpfrigen Leib, jedes Entkommen verhindernd. Das Tier krümmte sich zusammen, aber mit einem Schmerzensschrei zog Karl die Hand zurück, warf sich der Länge nach ins Boot, strampelte mit Armen und Beinen und heulte wie ein Kind.
Der herkulische Mann war plötzlich ganz gebrochen.
»Um Gottes willen, Bootsmann, was ist Euch denn? Seid Ihr gebissen worden?« riefen die Matrosen durcheinander.
»Ja — nein — au, au — ich sterbe, ich sterbe!«
»Seid Ihr von der Schlange gebissen worden?«
»Ja — nein — au — es war keine Schlange, es war ein Aal,« winselte der Bootsmann.
»Halt, ich hab's!« rief ein Matrose. »Es war ein Zitteraal!«
Georg sank auf seinen Sitz zurück.
»Verflucht und zugenäht, Zitteraale gibt's hier also auch,« murmelte er niedergeschlagen
»Was ist das, ein Zitteraal?«
»Das sind Aale, welche, wenn man sie anfaßt, elektrische Schläge austeilen können.«
»Es ist doch nicht gefährlich?«
»Das gerade nicht. Ein kräftiger Zitteraal kann aber schon einen jungen Ochsen betäuben.«
»Dann bin ich ein alter Ochse,« sagte der Bootsmann, sich wieder aufrichtend und die Hand schlenkernd. »War es mir aber doch gerade, als führen mir tausend spitze Nadeln durch den Körper, meine Hand ist jetzt noch ganz lahm.«
»Ihr könnt Gott danken, daß Ihr eine so starke Natur habt, sonst hätten wir eine schöne Bescherung mit Euch gehabt. Greift ein andermal nicht alles an, was im Wasser schwimmt.«
Der Bootsmann ließ sich diese Lehre von dem jungen Matrosen gefallen, etwas Medizin aus der Rumflasche stellte ihn bald wieder völlig her, aber man saß nun immer noch auf derselben Stelle.
»Potz Alligatoren und Zitteraale, ich springe doch,« rief Georg, »ich springe doch. Jungens, nehmt eure Gewehre und schießt einmal alle ins Wasser, das vertreibt das Ungeziefer.«
Eine Salve von achtzehn Schüssen trachte, die Kugeln schlugen ins Wasser und brachten diesmal nicht wieder solchen Aufruhr hervor wie vorhin. Die Alligatoren hatten sich zurückgezogen, aber noch waren die Zitteraale zu fürchten, Georg mußte eben schnell springen.

Er stellte einen Fuß auf den Bootsrand und holte aus, dahin zu springen, wo die Büsche etwas auseinander traten, so daß man das Ufer deutlich erkennen konnte.
Es machte einen festen und guten Eindruck.
Doch Georg kam wieder nicht zum Sprung.
Plötzlich wurden die Zweige auseinandergebogen, und auf die eben erwähnte Stelle kam ein Neger gestürzt, fiel auf die Knie und erhob flehend die Hände gegen die Matrosen.
Er war ohne Waffen und trug einen stark mitgenommenen Leinwandanzug.
»Teufel, wer ist das?«
»Nix schießen,« bat der Schwarze in kläglichem Tone, »nix schießen, Josua tut euch nix.«
»Das glauben wir,« lachte Georg. »Wer bist du, Bursche, und was willst du hier?«
»Josua.«
»Was willst du hier?«
»Nix schießen, ich bin ein armer, unglücklicher Nigger.«
»Unglücklich sieht der nicht aus,« meinte der Bootsmann. »Der Kerl hat Hängebacken, und sein Gesicht strahlt wie der Vollmond.«
»Hast du noch jemanden bei dir?«
»Niemand nix, Josua allein, Gideon fort, Herr fort, alles fort. Aber nix wieder schießen.«
»Gott, hat der Kerl Furcht vorm Schießen,« sagte Georg, »aber gebrauchen können wir ihn dennoch. Hier, fang' das Seil und schlinge es fest um den Baum dort.«
Wunderbarerweise hatte der Neger den Befehl sofort verstanden und führte ihn geschickt aus. Er fing das ihm zugeschleuderte Seil, befestigte es mit doppeltem Knoten an den Baum und trat zurück.
»Ich will hängen, wenn das kein Seemann ist,« rief Georg, der den Schwarzen bei der Arbeit aufmerksam beobachtet hatte. »Doch egal, Jungens, jetzt zieht gleichzeitig.«
»Ahoi — ahoi,« sangen die Matrosen im Boot, zogen taktmäßig an dem Tau, und in einer Minute lag das Boot am Ufer, ohne daß der Kiel besonders stark auf dem Grund gescheuert hätte.
Als die Matrosen ans Land gesprungen waren, schwamm es frei im Wasser.
Auch das andere Boot wurde ans Land angezogen, und bald standen alle wohlbehalten am Ufer, ohne sich die Füße benetzt zu haben.
»Nun zu dir!« wandte sich Georg an den Neger, der sofort wieder auf die Knie sank und den Sprecher entsetzt anblickte. »Wie kommst du ohne Waffen in den Urwald?«
»Josua wollte Panther schießen,« erklang es kläglich.
Ein allgemeines Gelächter war die Folge von dieser Antwort.
»Panther? Du bist wohl nicht recht bei Sinnen. Du sprachst vorhin von Gideon, wer ist das?«
»Ein Nigger, so schwarz wie ich.«
Georg nahm zufälligerweise seine Büchse von der Schulter.
»O, nix schießen. Massa,« bat sofort der Schwarze, »Josua tut euch nichts.«
»Hast du einen Herrn?«
»Ja, einen starken, mutigen, tapferen, kühnen Herrn mit rollenden Augen.«
»Alle Wetter,« lachte Georg, »das muß ja ein banniger Kerl sein. Wo ist er denn jetzt?«
»Weiß nix, Massa.«
»Bist du ihm weggelaufen?«
»Josua niemals nicht weggelaufen.«
»Wie heißt denn dein Herr?«
»Weiß nix, Massa.«
»Warst du mit ihm im Urwald?«
»Weiß nix, Massa.«
»Gott bewahre mich!« lachte Georg. »Den Kerl verläßt mit einem Male vollständig das Gedächtnis. Was wollte dein Herr im Urwalde machen?«
»Weiß nix, Massa.«
»Gib diesem Mister Weißnix einen Tropfen Rum zu trinken,« schlug ein Matrose vor, »nichts hilft dem Gedächtnis mehr auf die Sprünge, als ein Tropfen Rum.«
Georg befolgte den Rat; er ließ den Neger Bekanntschaft mit dem Inhalt der dickbäuchigen Flasche machen.
»He, hallo,« rief er aber, als Josua die mit beiden Händen umklammerte Flasche gar nicht wieder absetzen wollte, »du glaubst wohl, die Flasche enthält bloß einen Tropfen? Mensch, du hast ja einen halben Liter gesoffen.«
Josua leckte behaglich mit der Zunge die wulstigen Lippen ab; der Trunk schien ihm behagt zu haben.
»Nun, Herr Weißnix, bist du nun besser zum Antworten aufgelegt?« fuhr Georg in seinem Verhör fort. »Wie kommst du hierher?«
Der Rum hatte seine Wirkung nicht verfehlt; des Negers Gehirn hatte sich etwas geklärt.
»Mein Herr ist großer, großer Jäger,« begann er zu erzählen, »er hat in Afrika viele, viele Löwen geschossen und ist dann hierhergefahren und hat mich und Gideon mitgenommen, weil er Panther schießen wollte.«
»Aha, dein Herr ist also so ein Sportsmann, der als Jäger herumreist. Wie heißt er denn?«
»Weiß nix, Massa.«
»Sehr gut, kennt der nicht einmal den Namen seines Herrn! Also fahre fort, wie kommst du hierher?«
»Wir hatten vorhin einen Panther beinahe geschossen, da sahen wir viele Soldaten kommen mit einer weißen Lady Missis. Mein Herr freute sich furchtbar, als er sie sah, plötzlich aber sprangen viele rote Menschen und Soldaten aus dem Busch, alle mit Aexten und Messern bewaffnet und dann — dann —«
»Dann wolltet ihr den Ueberfallenen beistehen? Nicht wahr? Denn die Soldaten und die weiße Lady Missis sind doch von Indianern überfallen worden?«
»Ja, Massa, das wollten wir,« bestätigte Josua, »aber da warf plötzlich Gideon sein Gewehr weg und lief davon, und da Gideon klüger ist, als ich, da dachte ich, ich müßte es auch so machen, und da warf ich mein Gewehr auch weg und lief fort. Das war doch ganz klug von mir?«
»Du bist ein verflixt schlauer Schlingel, du wärst wert, daß man dich übers Knie legte und dir fünfundzwanzig aufzählte. Ein schöner Diener, der seinen Herrn in Stich läßt!«
»Ich habe meinen Herrn nie nicht in Stich gelassen.«
»Du bist doch fortgelaufen, während er die weiße Lady zu befreien suchte!«
»Nein, mein Herr ist auch gleich fortgelaufen.«
»Ach, so seid ihr also alle solche tapfere Helden. Und dein Herr hat Löwen und Panther geschossen?«
»Ja, viel, viel.«
»Und läuft weg, wenn er eine Dame in Gefahr sieht?«
»Es waren zu, zu viele rote, nackte Menschen und Soldaten da, welche die weiße Lady Missis haben wollten, und das sah mein Herr auch ein, daß er nichts helfen konnte, und ist fortgelaufen. Ja, wenn die roten Menschen nicht so geschrien hätten! Denn sonst ist mein Herr ganz furchtbar mutig.«
Georg stellte das Verhör ein, es war doch nichts mehr aus dem beschränkten Schwarzen herauszubekommen.
Der Bootsmann meinte, man solle den Kerl morgen mit nach Matagorda nehmen, um die anderen könne man sich nicht kümmern, wenn sie ihnen bei der jetzt vorzunehmenden Jagd nicht zufällig in die Hände liefen.
»Wo haben die roten Menschen, die Indianer, die Dame überfallen?« fragte man ihn noch einmal.
»Weiß nix, Massa.«
»War es weit von hier?«
»Weiß nix, Massa.«
»Wie hast du uns gefunden?«
»Hörte Schüsse und bin leise hierhergekrochen. Ich sah Matrosen, und vor denen brauche ich mich nicht zu fürchten. Josua ist früher auch auf Schiffen gewesen.«
Die Matrosen wurden wieder vom Jagdfieber ergriffen. Man entdeckte einen Hirsch zwischen den Bäumen, doch konnte man leider nicht zum Schuß kommen. Aber es war doch ein Zeichen, daß hier Wild vorhanden war, und dieses dummen Kerls wegen wollte man sich nicht den Jagdausflug verderben lassen.
Vier Matrosen sollten zurückbleiben und für tüchtige Feuer sorgen, Josua konnte Holz schleppen, und die übrigen verteilten sich in Gruppen, um den Wald zu durchstreifen. Durch Schüsse hielten sie sich zusammen, durch Pfiffe konnten sie sich auf weite Entfernung hin trefflich verständigen. Sie brauchten also nicht zu fürchten, sich in dem pfadlosen Walde zu verirren.
Georg verließ in Begleitung des Bootsmannes und eines anderen Kameraden vom ›Blitz‹ den Sammelort. Wohlgemut streiften sie zwischen den Bäumen und Büschen hindurch, nach Jagdbeute ausspähend. Es kam ihnen zwar lange Zeit nichts vor die Mündung der Büchse, aber Schüsse von ihren Genossen bewiesen, daß sie auf Wild getroffen waren.
Nach Verlauf einer halben Stunde hatten sie selber zwei große, truthahnähnliche Vögel geschossen, und gleich daraus stürzte, von Georgs Kugel getroffen, ein stattlicher Rehbock zusammen.
Das Tier wurde, so gut es ging, ausgeweidet.
»Nun, Bootsmann, wie gefällt Euch das Leben im grünen Walde?« fragte Georg, das Messer handhabend.
»Hm, 's ist schon ganz hübsch, so frei herumzustreifen, aber das richtige ist es doch noch nicht.«
»Was fehlt Euch noch?«
»Es kommt mir so läppisch vor, wenn ich starker Kerl von über 6 Fuß Höhe so ein niedliches Tierchen niederschießen soll. Ich weiß nicht, ich schäme mich ordentlich.«
»Ja, Bootsmann, ich passe auch nicht zum Jäger. Aber mich so mit Indianern herumschlagen zu können, das wäre mir schon recht. Das war mein Lieblingsspiel als Junge, und wenn wir dann am Beratungsfeuer zusammenkamen, hatte Georg immer die meisten Skalpe.«
»Skalpe?« lachte der Bootsmann. »Rißt Ihr Euch denn wirklich die Haare vom Kopfe?«
»Das nicht, wenn's auch manchmal toll genug zuging, die Mützen waren die Skalpe, und wen man besiegt hatte, dem nahm man die Mütze weg, also den Skalp. Wir hatten hölzerne Tomahawks, hölzerne Messer, Bogen, Pfeile, Lanzen, Federschmuck, kurz alles, was ein richtiger Indianer haben muß. Auch Namen mußten wir natürlich haben, ich hieß zum Beispiel der brüllende Löwe.«
»Aber Indianer kennen doch gar keinen Löwen,« unterbrach der Bootsmann den Erzähler.
»Das war uns damals ganz gleichgültig, ich hieß eben der brüllende Löwe, weil ich so furchtbar brüllen konnte. Ach, Bootsmann, das war doch eine schöne Zeit! Ihr hättet mich kleinen, zehnjährigen Knirps sehen sollen, wenn ich so am Feuer — denn das durfte natürlich nicht fehlen — aufstand, das Messer schwang und dazu schrie: Der brüllende Löwe ist ein großer Krieger, er verachtet seine Feinde, die Pawnees sind Söhne von Hunden, sie haben gespaltene Zungen, der brüllende Löwe wird sie auffressen!«
Georg hatte sich aufgerichtet, schwang das blutige Messer in der Luft und machte seinem ehemaligen Namen wirklich Ehre, er brüllte wie ein Löwe in den Wald hinein.
»Mach mir nicht bange!« lachte Fritz, sein Freund.
»Da habe ich auch meine erste Pfeife rauchen gelernt,« fuhr Georg in seinen Erinnerungen fort, dabei aber weiter an dem Reh arbeitend, »wir wollten nämlich einmal als Friedenspfeife nicht bloß einen Rohrstengel, sondern eine wirkliche Pfeife rauchen. Ich mauste also meinem Vater die Pfeife, und diese ging nun am Beratungsfeuer im Kreise herum. Es dauerte nicht lange, so verschwand einer der tapferen Krieger nach dem andern vom Feuer und ging hinter einen Baum, dann bleich und mit schlotternden Gliedern wieder vorkommend, und schließlich verschwand auch der brüllende Löwe, um sich hinter einem Busch gründlich auszusprechen. Dieser Tag war überhaupt ein Unglückstag für mich. Ein Förster fing mich, als ich über einen Zaun stieg, und der brüllende Löwe bekam auf den hinteren Teil seines Körpers eine ordentliche Tracht Prügel, und als er dann nach Hause kam, empfing er vom Vater, dem die Pfeife fehlte, die zweite Lage. Ich sage Euch, der mutige Häuptling der Mohikaner, nämlich ich, wollte zwar allen Qualen des Marterpfahles trotzen, damals aber hat er gebrüllt, wie ein — nun, wie eben nur ein Löwe brüllen kann.«
Der Bootsmann lachte, daß ihm die Tränen über die Backen liefen.
»Solche Streiche habe ich nun freilich nicht gemacht,« sagte er, »wir trieben uns mehr auf dem Wasser herum. Uns wurden überhaupt in der Jugend die Köpfe nicht mit solchen Indianergeschichten verdreht, aber dafür möchte ich jetzt einmal in Wirklichkeit erfahren, was das eigentlich für Kerls sind. Ob die wohl stehen bleiben können, wenn ich sie mit der Faust so zwischen die Augen treffe.«
Karl führte einen blinden Boxerhieb nach Georg.
»Ja, wahrhaftig, ich möchte ihnen auch einmal gegenüberstehen. Nun, vielleicht haben wir noch Gelegenheit dazu, diese weiße Lady Missis, wie der Schwarze sagte, soll ja von Indianern — Donnerwetter,« unterbrach sich Georg, hob den Kopf und blickte in die Zweige des Baumes, unter welchem das Reh lag, »was raschelt denn da oben eigentlich immer?«
Fritz mußte auch schon etwas Verdächtiges gemerkt haben, er hatte dem letzten Teil der auf deutsch geführten Unterhaltung schon nicht mehr zugehört, sondern war vorsichtig um den Baum gegangen und hatte in die Zweige gespäht.
Jetzt kam er schnell zu seinen Gefährten.
»Ich glaube, es ist ein großer Affe,« sagte er. »Ich sah vorhin eine Gestalt auf einem Aste hocken, als ich sie aber näher besehen wollte, verschwand sie im Dickicht.«
»Möglich, daß es ein Affe gewesen ist. War die Gestalt sehr groß?«
»Fast so groß, wie ein Mensch.«
Georg schüttelte nachdenklich den Kopf.
»Die Affen Amerikas sind nur klein, also muß es etwas anderes gewesen sein. Laß uns die Gewehre nehmen und um den Baum schleichen. Es mag auch ein großes Raubtier sein.«
»Oder ein Indianer,« flüsterte der Bootsmann.
Sie schlichen um den Baum herum, in einiger Entfernung vom Stamm, die Büchsen schußbereit, und spähten in die Blätter.
Ein Ruf Georgs rief die beiden anderen zu sich, der Matrose deutete auf den untersten Ast des Baumes.
Da sah man ein paar gelbe Stiefeln stehen, bis zu den Knöcheln sichtbar. Das übrige verbarg das dichte Laub des Baumes.
»Ein Affe in Schnürstiefeln,« flüsterte Fritz. »Soll ich schießen? Er ist aus einer Menagerie geflohen.«
»Unsinn,« entgegnete Georg, »ich habe eine Ahnung, wer es ist. Es wird Gideon, der Gefährte des tapferen Josua sein. He, guter Freund,« rief er dann laut, »sei so gut und zeige uns einmal dein liebliches Gesichtchen.«
Es erfolgte keine Antwort, aber der eine Fuß wurde emporgezogen und verschwand somit ebenfalls.
»Du sprichst ja Deutsch,« sagte Karl, »der Nigger wird höchstens englisch verstehen.«
»Ach so,« und Georg fuhr auf englisch fort: »Hörst du, Nigger, wenn du dein anderes Füßchen auch unsichtbar machst, so schieße ich dir eine Kugel in den Bauch. Zeige deine Fratze! Verstanden?«
Damit legte Georg seine Büchse an die Wange.
» Oui, Oui,« erklang es, und zwischen den Blättern erschien ein dickes, angstvolles Gesicht, aber das eines Weißen.
»Nix schießen, Messieurs, ick bin ein harmloser, friedlicher Jäger, verschonen Sie mein Leben.«
»Heiliger Dunstan,« rief Georg, »das ist ja ein Franzose. Und ich will mich hängen, wenn das nicht Josuas Herr ist, der gewaltige Löwen- und Pantherjäger.«
» Oui, das bin ick. Wer sind Sie, sind Sie wirklich keine verkleideten Indianer?«
Die Untenstehenden brachen in ein Gelächter aus, und sofort verzog sich auch das Gesicht des Franzosen zu einem vergnügten Lächeln.
»Komm herab, alter Junge, und zeige dich in deiner vollen Lebensgröße!«
»Ich kann nicht herunterkommen, sonst säße ich schon lange nicht mehr hier oben.«
»Ja, wie bist du denn hinaufgekommen?«
»Ich weiß selber nicht wie, aber allein kam ich auf jeden Fall herauf. Hinunterzukommen ist mir unmöglich, ich kann nicht gut —«
Oben raschelte und krachte es, der Franzose hatte jedenfalls mit den Händen gestikuliert, dabei seinen Halt losgelassen und die Balance verloren und kam nun plötzlich von oben herabgesaust.
Es war ein Glück, daß Bootsmann Karl ein Mann war, der nicht leicht die Besinnung verlor, auch nicht den Kopf einzog, wenn etwas auf ihn stürzte, und auf den man zugleich den Vers des alten Seemannsliedes beziehen konnte:
»Ick heeße Jochen Kast,
Und wat ick anfaß, hol' ick fast.«
Kurz, der Bootsmann griff zu und fing die kleine, dicke, fast kugelrunde Gestalt wie einen Sack auf, sie dann vorsichtig auf den Boden stellend.
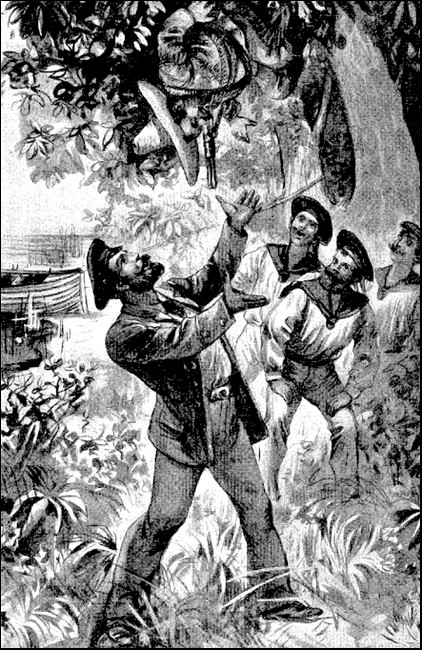
Der Bootsmann griff zu und fing die kleine,
dicke, fast kugelrunde Gestalt wie einen Sack auf.
»Meiner Treu,« schrie Georg, »das ist ja der Franzose aus Afrika, Monsieur — Monsieur —«
»Monsieur Aubert aus Toulon, Hauptmann der freiwilligen Bürgerwehr, meine Herren,« antwortete der Franzose, der den Schreck über den hohen Fall schon vergessen hatte, stolz und trocknete sich das dicke Gesicht mit dem roten Taschentuch.
»O, mein Herr, ich kenne Sie noch recht gut, Sie waren Matrose auf dem schwarzen Segelschiff. Das war ein böser Fall, hätte mir bald das Leben kosten können. Vielen Dank, mein Herr, ich werde mich revanchieren, Sie können auf meine Hilfe in jeder Gefahr zählen.«
Es war noch immer das dicke Kerlchen mit hochrotem Gesicht, das jetzt die Matrosen von allen Seiten bewunderten. Er trug noch genau dieselben drei Flinten, darunter die mächtige Elefantenbüchse, der Gürtel starrte von Pistolen und Dolchen; zwei Riemen mit Patronen schlangen sich um Brust und Rücken, und das einzige Neue war nur, daß Monsieur Aubert statt des damaligen Fez jetzt einen breitrandigen Schlapphut auf dem Kopfe hatte, wodurch er ein banditenartiges Aussehen bekam.
»Sie sind Pantherjäger?« stotterte Karl endlich nach langem Staunen.
»Zu dienen, mein Herr, jetzt Pantherjäger, früher Löwenjäger. Schade, daß Gideon, dieser feige Geselle, fortgelaufenen ist, sonst könnten Sie meine Jagdtrophäen in Gestalt zweier Löwenfelle erblicken, die ich mit dieser meiner Büchse geschossen habe.«
»Monsieur Aubert, wir haben jetzt keine Zeit zum Schwatzen,« unterbrach Georg den redseligen Franzosen, »erzählen Sie uns kurz und bündig, wie Sie auf den Baum gekommen.«
»Sehr einfach! Ich, Josua und Gideon, meine beiden Diener, befanden uns nicht weit von hier, um Panther zu schießen. Nach längerem Suchen sahen wir auch einen, ich hielt ihn für ein kleines Exemplar, schoß, traf natürlich, fand dann aber zu meinem Bedauern, daß es ein Karnickel war.«
»Hören Sie, Monsieur Aubert, das wollen wir alles nicht wissen. Sie flunkern gar zu gern, das wissen wir schon. Wir wollen den Ueberfall der Dame durch Indianer erzählt haben.«
»Ach so, das meinen Sie? Wohlan! Wir standen zwischen Büschen, welche eine Lichtung begrenzten. Da sahen wir etwa zehn Soldaten geritten kommen, welche eine Dame in der Mitte führten, das heißt, freundschaftlich, verstehen Sie. Denken Sie sich mein Erstaunen, als ich in dieser Dame eine liebe Freundin von mir erkenne, mit welcher ich in Afrika manche frohe Stunde verlebt habe, es war Miß Lind, welche —«
»Wer?« schrie Georg.
»Miß Lind. Schon wollte ich —«
»Kurz, kurz,« schrie Georg, »oder ich schlage dir den Schädel ein.!«
Der Franzose erschrak, Georg schien ganz außer sich zu sein, mit rollenden Augen stand er vor ihm.
»Nun ja,« stammelte der Franzose jetzt, »da stürzten plötzlich Indianer hervor, darunter auch einige Soldaten, wahrscheinlich Spanier, und da wollte ich —«
»Was machten die Begleiter der Dame?«
»Gar nichts.«
»Sie wehrten sich nicht?«
»Nein, im Gegenteil. Es schien mir, als ob sie selbst Miß Lind hinderten, von ihrem Revolver Gebrauch zu machen.«
»Und was tatest du?«
»Josua und Gideon warfen die Waffen fort und liefen davon. Ich ihnen nach, um sie zum Stehen zu bringen. Dann wollte ich mit ihnen die Dame befreien.«
»Wo war die Lichtung?«
»Gar nicht weit von hier, ich kann sie wiederfinden.«
»Wann geschah der Ueberfall?«
»Vor etwa zwei Stunden.«
»Fort, fort,« schrie Georg plötzlich und gab dein Monsieur einen Stoß, daß er einige Schritte voraustaumelte. »Auf, Karl und Fritz, wir müssen nach dem Lager eilen, unsere Freunde benachrichtigen und dann die Indianer verfolgen!«
Die anderen hatten ihn verstanden, sie waren ebenso wie er entsetzt, daß Miß Lind, die Braut Hoffmanns, von Indianern überfallen und entführt worden war.
Kostete es, was es wollte, man mußte ihr folgen. Die Boote mußten zurückgelassen werden, sie kamen gar nicht in Betracht, und ebensowenig, daß man an Bord erwartet wurde.
In eiligem Laufe stürmten sie durch den Wald, den bestürzten Franzosen immer vor sich herstoßend. Unterwegs trafen sie andere Trupps Matrosen, denen schnell alles erzählt wurde, und als man das Lager erreichte, war es schon allen bekannt, daß Johanna Lind auf ihrer Reise nach Austin von Indianern überfallen, wahrscheinlich von ihren eigenen Soldaten verraten worden war.
Ebenso fest stand bei allen der Entschluß, den Räubern zu folgen und alles zu tun, die Braut Hoffmanns zu retten. Mochten die Boote hier verfaulen oder gestohlen werden.
Am Lagerfeuer hatte sich unterdes auch schon Gideon eingefunden.
Schnell wurde gegessen, dann brach man nach jener Stelle auf, die der Franzose als den Schauplatz des Ueberfalles bezeichnete.
Texas ist noch von wenigen Eisenbahnen durchkreuzt, nur die größeren Städte sind durch solche untereinander und mit dem größten Hafen verbunden. Im übrigen dient das Pferd noch immer als Verkehrs-, Maulesel und Ochsenwagen als Transportmittel.
Vor einigen Tagen war aus Galveston, in welchem etwas Militär lag, ein kleiner Trupp nach Austin marschiert. Solche Soldaten sind angeworbene Leute, meist spanischer Abkunft, und dienen hauptsächlich dazu, die Indianer im Schach zu halten. Nicht zu verwechseln sind diese spärlichen, überallhin zerstreuten Soldaten mit den Grenzsoldaten. Diese sind nur Yankees und liegen beständig an den Indianergrenzen, wilde, verwegene und trotzige Menschen, in Hautfarbe, Gewohnheiten, Schlauheit und leider auch Grausamkeit ihren Feinden, den Indianern, völlig gleichend. Sie gehen meist aus Trappern, Cowboys und Söhnen von Farmern hervor, welche durch das Versprechen außerordentlich hohen Lohnes ihre Freiheit aufgeben und fernerhin die Büchse nur noch im Interesse der Vereinigten Staaten führen.
Die übrigen sind Söldlinge, welche sich aus der arbeitsscheuen Klasse der Bevölkerung rekrutieren, sind faul, unwissend, diebisch, und die Hälfte von ihnen Verbrecher. Im Kriege dienen sie als Kanonenfutter.
Ein Trupp solcher Soldaten war also von Galveston nach Austin abmarschiert. Sie hatten nicht alles Gepäck mitführen können, und daher waren in dem kleinen Quartier zehn Mann zurückgeblieben, welche unter der Führung eines Leutnants und eines Unteroffiziers die fehlenden Sachen, Lebensmittel und Munition, nachbringen sollten. Die Vorausmarschierten waren zu Fuß, letztere sollten reiten und konnten in etwa drei Tagen wieder zu dem Haupttrupp stoßen.
In einem hübschen, kleinen Zimmer des Quartiers stand der Capitano, der Hauptmann und Kommandeur dieser Garnison, und las einen Brief, während vor ihm auf einem Polsterstuhl eine junge Dame saß, Johanna Lind, in Reisekleidung, blühend wie immer, aber viel heiterer, als früher aussehend, obgleich sie einen Zug von Besorgnis nicht verbergen konnte.
Der Capitano faltete den Brief zusammen, legte ihn auf den Schreibtisch und machte gegen Johanna eine Verbeugung.
»Ich bin jederzeit der Ihre,« sagte er in fließendem Englisch, »der Wunsch des Stadtpräfekten, meines Freundes, ist für mich Befehl.«
Johanna dankte für diese galante Rede mit einem leichten Neigen des Hauptes.
»Sie hätten die Gelegenheit nicht besser treffen können,« fuhr der Capitano fort. »Soeben rüsten sich unten im Hof elf Mann unter Führung eines Leutnants zum Aufbruch nach Austin; eine sicherere Reisebegleitung würden Sie nicht auftreiben können, und ich rate Ihnen, sich derselben anschließen zu wollen, das heißt, wenn es Ihnen paßt, schon in einer Stunde abzureisen. Der Marsch dieser Leute darf keine Verzögerung erleiden, sie müssen innerhalb dreier Tage zu dem Haupttrupp von hundert Mann treffen.«
»Ich nehme Ihren Vorschlag dankbar an,« entgegnete Johannas volltönende Stimme. »Wenn es darauf ankommt, bin ich in zehn Minuten bereit. Mein Pferd steht schon gesattelt im Gasthaus, der Maulesel ist schon gepackt. Doch wie steht es mit Treibern? Können Sie mir einen sicheren Mann empfehlen, Señor?«
»Sie brauchen keinen Treiber, Miß Lind, unsere Soldaten müssen bereits gepackte Maulesel beaufsichtigen, und so kommt es auf einen mehr nicht an.«
Johanna machte ein mißmutiges Gesicht.
»So haben die Soldaten, denen ich mich anschließen darf, Maultiere zu treiben?«
Der Capitano lächelte.
»Sie fürchten, daß dadurch die Schnelligkeit der Reise gehemmt werde? Durchaus nicht, Sie werden sehen, daß Sie Ihr Pferd beständig in Trab halten müssen, es wird ein Eilritt ...«
»Ah, die Soldaten sind beritten,« unterbrach ihn Johanna.
»Allerdings.«
»Ich glaubte, hier lägen nur Infanteristen.«.
»Es sind Infanteristen, aber bei uns kann jeder reiten und ist auch zu Pferd ausgebildet. Unsere Soldaten müssen sehr viel können, vieles, was gar nicht zum Kriegshandwerk gehört, wie eben zum Beispiel das Treiben von Maultieren, ein sehr unritterliches Handwerk, was aber auch gelernt sein will. Sie müssen, wie gesagt, den Haupttrupp einholen und werden deshalb schnell reiten. Der Präfekt schreibt mir, es wäre Ihnen angenehm, die Reise so schnell wie möglich machen zu können, und daher konnten Sie keine bessere Gelegenheit finden.«
Johanna war befriedigt, doch nach einer kleinen Weile fragte sie zögernd.
»Was für Leute sind es? Kann ich ihnen trauen?«
»Vollkommen,« versicherte der Capitano, »wenn Sie sich ans Fenster bemühen wollen, können Sie die Leute sehen. Den Leutnant, einen Kavalier durch und durch, werde ich Ihnen nachher noch speziell vorstellen.«
Johanna trat ans Fenster.
Auf dem Hof herrschte ein reges Leben. Eine Menge Maulesel, kräftige Tiere, wurden von Soldaten in einfacher, dunkler Uniform mit schweren Säcken bepackt. Die Männer zeigten darin großes Geschick. Am anderen Ende des Hofes wieherten und stampften ungeduldig zwölf stattliche Pferde, und ein Offizier beaufsichtigte die Arbeit.
Es war ein blutjunges Bürschchen, wie ein Siebzehnjähriger aussehend. Er stützte sich auf den Degen in lederner Scheide, rauchte nachlässig eine Zigarette und trillerte leise vor sich hin. Sein Gesicht war edel und schön, aber ohne den kleinen, schwarzen Bartanflug hätte es für das eines Mädchens gelten können. Der Arbeit schenkte er wenig Beachtung, vielmehr einem Hündchen, das er mit der Fußspitze neckte.
Dieser junge Mann hätte besser in die phantastisch reiche, mexikanische Uniform gepaßt, als in die dunkle, monotone der Vereinigten Staaten. Es lag etwas Ritterliches in dem schlanken Kerlchen, zugleich aber auch etwas Unvollkommenes.
Johanna überkam ein eigentümliches Gefühl, als sie daran dachte, daß sie diesem unreifen Leutnant während einiger Tage auf einer Reise durch die Wildnis auf Gnade und Ungnade überlassen bleiben sollte.
Der Capitano schien ihre Gedanken zu ahnen.
»Macht der Leutnant keinen günstigen Eindruck auf Sie?« fragte er lächelnd.
»O doch,« entgegnete Johanna ausweichend.
»Ich hoffe, Sie werden mir nicht zutrauen, daß ich Sie dem Schutze eines Mannes überlasse, für den ich nicht in jeder Weise garantieren kann,« sagte der Capitano ernst, »Leutnant Ramos ist ein Kavalier, ein Ehrenmann und ein vorzüglicher Offizier, sonst wäre er nicht trotz seiner Jugend schon Leutnant. Man urteilt falsch, wenn man einen Mann wegen seiner Jugend gering achtet.«
»Sie haben recht,« entgegnete Johanna schnell, »ich denke nicht so. Leutnant Ramos macht einen angenehmen Eindruck auf mich, ich traue ihm.«
»Dann sehen Sie noch dort den alten, graubärtigen Korporal, der so energisch Hand mit anlegt, obgleich er die Leute nur anstellen soll. Es ist Patrick O'Brian, der älteste Soldat in Texas. Ich empfehle Ihnen diesen Mann ganz besonders, nur bitte ich Sie, nicht Anstoß an seiner sonderbaren Sprechweise zu nehmen.«
Johanna erblickte einen alten Soldaten, mit den Abzeichen des Korporals auf dem Jackenärmel, der selbst einen Maulesel belud und dann die übrigen prüfte, ob sie gut gepackt waren.
Das vollbärtige, biedere Gesicht mit den unzähligen Fältchen und Runzeln nahm sie sofort ein. Seinem Namen, Patrick O'Brian nach mußte er ein Irländer sein.
»Wieso?« fragte Johanna auf des Capitanos letzte Bemerkung hin. »Warum soll ich Anstoß an seiner Sprechweise nehmen?«
»Sie werden es bald genug selbst merken, er bedient sich seltsamer Ausdrücke. Doch er ist treu wie Gold.«
»Leutnant Ramos, bitte,« rief der Capitano dann zum Fenster hinunter.
Der Leutnant blickte empor und stand eine Minute später in strammer Haltung vor seinem Kommandeur, ohne vorläufig die Dame beachtet zu haben.
Der Capitano stellte ihm Johanna vor, ihn auch in kurzen Worten mit seiner Mission vertraut machend. Angenehme Ueberraschung spiegelte sich in dem hübschen Antlitz des jungen Mannes wider, es strahlte förmlich vor Entzücken.

»Ah, Señorita, ein angenehmerer Auftrag hätte mir nicht zuteil werden können. Ich schätze mich glücklich, Sie begleiten zu dürfen, und versichere Ihnen, alles, was in meinen Kräften steht, für Ihre Bequemlichkeit und Ihren Schutz zu tun.«
Sein Auge glitt bewundernd über die schöne Gestalt Johannas und blieb nur einen Augenblick länger aus dem blitzenden Goldreif am Finger haften. Er kannte die Bedeutung dieses Ringes.
Auch Johanna war angenehm überrascht. Dies war durchaus kein Knabe, wie sie erst geglaubt, sein Benehmen war wirklich das eines Kavaliers, vollkommen selbstbewußt, aber nicht im geringsten geziert, seine Stimme tief und sicher, und man hörte ihr die Aufrichtigkeit der Gesinnung an.
Sie hatte die leichte Bewegung in seinem Gesicht bemerkt, als sein Auge auf das Verlobungszeichen an ihrer linken Hand gefallen war, und Johanna war als einstige Detektivin Menschenkennerin genug, um das unangenehme Gefühl zu erraten, das in diesem Augenblick die Brust des jungen Mannes durchbebte. Es war jenes Gefühl, welches jeden jungen Mann befällt, wenn er zum ersten Male ein Mädchen sieht, welches ihn sofort einnimmt, das er aber schon für einen anderen bestimmt sieht. Doch selbst in diesem leichten Zucken konnte Johanna entdecken, daß sein Empfinden ein schmerzliches, kein begehrliches war, ein feiner Unterschied, der aber oft von der größten Bedeutung ist.
Jetzt hätte sie sich keinem Manne lieber anvertraut, als diesem blutjungen Offizier.
»So nehmen Sie schon jetzt meinen herzlichen Dank an,« entgegnete sie auf des Leutnants Worte. »In Austin wird mein Bräutigam den seinigen hinzufügen.«
»Ich bin so indiskret, zu erraten, daß Miß Lind die Braut des Mister Hoffmann ist,« nahm der Capitano das Wort, des Kapitäns vom ›Blitz‹, welcher im Hafen von Matagorda liegt. Es wurde mir in dem Briefe mitgeteilt,« fügte er erklärend zu Johanna hinzu.
»Konnte Mister Hoffmann seine Braut nicht selbst nach Austin geleiten?« fragte Ramos lächelnd.
Johanna wurde etwas verlegen.
»Geschäfte halten ihn in Austin, er kann mich unmöglich selbst abholen.«
In Wirklichkeit lag die Sache anders. Johanna glaubte Felix wirklich in Austin, dort hatte er eine Adresse angegeben, aber schon seit langer Zeit waren ihre Depeschen und Briefe unbeantwortet geblieben. Sie kannte keine Sorge um ihren Verlobten, aber daß er nicht mehr in Austin war, war ihr rätselhaft, und da sie sich einmal an der Küste aufhielt, wollte sie, anstatt sich direkt nach dem Ankerplatz des ›Blitz‹ zu begeben, erst nach Austin reisen und dort anfragen. Es waren ja nur wenige Tage bis dahin.
Von Herrn Anders hatte sie erfahren, daß Hoffmann noch nicht zurück war. Ihr langes Getrenntsein und ihre Sehnsucht nach dem Geliebten entschuldigte ihren etwas eilfertigen Entschluß, Felix konnte ihr nicht zürnen. Doch anderen brauchte sie den Grund zu dieser Reise nicht zu erzählen.
Der Kapitän und der Leutnant sprachen etwas Dienstliches zusammen, worauf sich letzterer, schon jetzt die Fürsorge für Johanna übernehmend, an diese wendete:
»Ich höre, Ihr Pferd und Gepäck ist schon bereit. Darf ich meinen Korporal und einige Leute nach Ihrem Hotel senden, um alles holen zu lassen?«
Johanna dankte, fügte aber, sie müsse selbst noch einmal hingehen, um mit dem Wirt zu sprechen.
Als das junge Mädchen ihr Quartier erreichte, fand sie schon den alten Korporal und zwei Soldaten mit ihren Tieren im Hof beschäftigt. Sie beglich die Rechnung und begab sich dann selbst auf den Hof.
Wieder beschlich sie eine angenehme Empfindung, als sie das ehrliche Gesicht des alten Korporals sah; der Anblick der beiden Soldaten dagegen erweckte in ihr Mißbehagen. Sie zeigten dieselben Galgenphysiognomien, welche auch ihre anderen Begleiter, wie überhaupt fast alle diese Söldlinge aus spanischem Geblüt zur Schau trugen.
Doch sie mußte sich dareinfinden, es war nun einmal nicht anders, und die Hauptsache war, daß die Anführer, der Leutnant und der Korporal, sich wie brave Männer benahmen.
Patrick O'Brian zog eben den Sattelgurt ihres Reitpferdes empor. Das Tier hatte viel gefressen, der Gurt drückte es, und es wieherte daher ängstlich auf. Patrick hatte das Mädchen noch nicht gesehen.
»O, mein Tierchen,« sagte er in irischem Dialekt vor sich hin, »nur nicht so zimperlich. Das schmerzt etwas, sagte der Teufel, als er seiner Großmutter einen Zahn auszog.«
Der Gurt saß fest, jetzt wendete Patrick seine Aufmerksamkeit dem Riemen des Steigbügels zu.
»Der ist zu lang, sagte der Teufel, da schnitt er sich ein Stück vom Schwanz ab,« murmelte Patrick und schnallte den Riemen kürzer.
Lächelnd trat Johanna auf ihn zu, legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte:
»Patrick O'Brian, es freut mich, Sie als Reisebegleiter bekommen zu haben. Ich schätze jeden Irländer als einen braven und zuverlässigen Menschen.«
Ueberrascht blickte der alte Mann auf das schöne Mädchen; ein freundlicher Schimmer erhellte seine runzligen Züge, doch gleich legte sich wieder eine finstere Wolke darüber.
»So sind Sie es, Miß, die mit den Soldaten durch den Urwald nach Austin reiten will?« brummte er und beschäftigte sich wieder mit dem Steigbügel.
»Ja, Patrick, ist Ihnen das nicht recht?«
»Das ist mir schon recht, sagte der Teufel, als ihm der Papst in die Hölle gebracht wurde,« war die verdrießliche Antwort.
»Ich entnehme Ihren Worten, daß Sie mich doch nicht gern als Reisebegleiterin haben wollen.«
Patrick erhob sein ehrliches Gesicht und zwinkerte mit dem einen Auge.
»Ich dachte, Sie wären eine alte, häßliche Jungfer, sagte der Teufel, als er zum ersten Male die Jungfrau Maria sah.«
Johanna lachte laut auf.
»Lieben Sie die alten, häßlichen Jungfern so sehr?«
Patrick blickte zu den beiden Soldaten hinüber, welche sich mit dem Maulesel beschäftigten.
»Das nicht, aber das dort ist eine Schwefelbande, sagte der Teufel, als er seine Opfer mit heißem Schwefel begoß.«
Johanna wurde plötzlich ernst, ihr scharfer Verstand hatte die leise Andeutung des Alten sofort verstanden.
»Sie trauen diesen spanischen Soldaten nicht?« flüsterte sie.
»Ich traue keinem Teufel, sagte Luzifer, als ihn sein Bruder um einen Dollar anpumpen wollte.«
»Lassen Sie den Teufel einmal aus dem Spiele, Patrick! Bitte, sprechen Sie deutlicher!«
Der Alte bückte sich, um nach der Schnalle des Gurtes zu sehen. Sein Gesicht nahm plötzlich einen seltsamen Ausdruck an.
»Reisen Sie nicht mit uns!« flüsterte er rasch.
»Warum nicht?«
»Ich traue meinen Begleitern nicht.«
»Auch dem Leutnant nicht?«
»Der ist gut.«
»Und die Soldaten?«
»Haben nichts Gutes im Schilde.«
»Gegen mich?«
»Weiß nicht.«
»Was haben sie vor?«
»Es ist in letzter Zeit ein Gemunkel und Geflüstere unter ihnen, sie stecken die Köpfe zusammen und zischeln.«
»Was beabsichtigen sie?«
»Ich weiß nicht, etwas Gutes keinesfalls.«
»Dem Leutnant ist wirklich zu trauen?«
»Der ist treu wie Gold, treu — wie Patrick.«
Johanna überlegte. Dieser Mann warnte sie vor seinen eigenen Gefährten, dies gab zu denken. Doch er hatte keinen Grund zur Besorgnis, er vermutete nur einen solchen. Johanna hatte ein mutiges Herz, sie mußte eine Gefahr sehen, ehe sie an dieselbe glaubte.
»Reisen Sie nicht mit uns!« flüsterte wieder der alte Korporal, der noch immer gebückt dastand. »Sie können hier genug brave Yankees für Geld als Begleiter bekommen.«
Das stimmte, aber wie lange hätte es gedauert, ehe sie solche Leute zusammenbrachte! Johanna wurde von einer rasenden Sehnsucht nach Austin getrieben. Der Leutnant und der Korporal waren treu, und in drei Tagen war sie in Sicherheit. Pah, sie riskierte das Wagnis.
»Ich gehe mit Ihnen.«
Patrick hob den Kopf.
»Ich kann mit mir machen, was ich will, sagte der Teufel, da brach er sich selbst das Genick ab.«
»Hoffentlich ist der Teufel nun für immer tot,« lachte Johanna, im Begriffe, das Pferd zu besteigen.
»Wer zuletzt lacht, lacht am besten, sagte der Teufel, als er sich seinen Hals wieder zurechtzimmerte,« entgegnete Patrick, hielt die ausgestreckte Hand unter Johannas Fuß und hob sie ritterlich in den Sattel.
Er selbst folgte mit dem Packesel und den beiden spanischen Soldaten nach.
Leutnant Ramos empfing sie bereits zu Pferd, graziös wußte er das tänzelnde Tier zu zügeln. Der Zug ordnete sich, der Leutnant besichtige die Soldaten, von denen jeder neben sich einen Maulesel am kurzen Lasso führte, und dann gab er das Zeichen zum Aufbruch.
Der Capitano reichte Johanna die Hand und schüttelte die ihrige herzlich. Sie sah, wie der Leutnant zögerte und nach ihr blickte, und sofort trieb sie ihr Pferd an seine Seite.
Der Zug setzte sich in Bewegung, an der Spitze Leutnant Ramos und Johanna, dann kam Pferd hinter Pferd, Esel hinter Esel, und den Schluß bildete Patrick, der jedoch fortwährend seinen Platz wechselte, weil er hauptsächlich für die Sicherheit des Gepäckes verantwortlich war und daher immer von einem Tier zum anderen eilte. —
Das erste Nachtlager wurde mitten im Urwalde aufgeschlagen. Die Soldaten packten das Zubehör für die Zelte aus, und bald standen die Leinwandhäuser unter den Bäumen, zwei große für die Mannschaft bestimmt, ein kleineres für den Offizier.
Johanna schaute etwas verlegen diesen Vorbereitungen zu, sie wußte, was jetzt kommen würde.
»Führen Sie unter Ihrem Gepäck ein Zelt mit?« wandte sich der Leutnant an sie.
»Leider nein, doch brauche ich auch keins. Wie ich Ihnen unterwegs erzählte, bin ich schon viel in Wildnissen gereist und habe nur selten die Annehmlichkeit eines Zeltes kennen gelernt. Eine Decke und der Schutz eines Baumes genügen mir vollkommen. Selbst das Feuer kann ich ohne Nachteil entbehren.«
»Ich biete Ihnen mein Zelt an.«
»Und ich kann nicht verlangen, daß Sie meinetwegen mit den Leuten zusammenschlafen. Mir ist es von höchster Wichtigkeit, daß der Respekt erhalten bleibt, und noch viel weniger ...«
»Sie irren,« unterbrach sie der Leutnant höflich, aber entschieden, »ich schlafe weder mit den Soldaten zusammen, noch im Freien, wie Sie vielleicht glauben. Es ist noch ein anderes kleines Zelt unter dem Gepäck. Wenn die Soldaten dann abgegessen haben, werde ich es für mich aufschlagen lassen.«
Johanna mußte sich damit zufrieden geben. Ramos ließ Decken in ihr Zelt tragen; sie sah, wie jedem Soldat eine solche zugeteilt wurde, wie aber in ihrem Zelt deren drei ausgebreitet wurden, zu denen noch die ihrige kam. Sie wunderte sich darüber nicht, es waren jedenfalls genug vorhanden.
Die Nacht brach schnell an, die Feuer flammten auf und die Soldaten bereiteten sich das mitgenommene, getrocknete Fleisch. Scherzend teilten der Leutnant und Johanna ihre Vorräte, Patrick spielte den Diener und kam dabei nicht zu kurz.
»Das schmeckt, sagte der Teufel, als er sich in seine Zunge biß,« meinte er, verzehrte aber mit Wohlbehagen ein Stück gekochte Rindszunge.
Die drei waren bald fertig mit ihrem Abendbrot, die Soldaten aßen noch.
»Es wird kalt,« sagte der Leutnant, ausstehend. »Miß Lind, ich bitte Sie, sich in ihr Zelt zurückziehen zu wollen, die Nachtluft in Texas ist ungesund.«
Johanna erhob sich.
»Doch ich sehe, Ihr Zelt ist noch nicht aufgeschlagen.«
»Die Soldaten müssen erst fertig mit Essen sein, dann schlagen sie mein Zelt auf. Gute Nacht, Señorita!«
Johanna fühlte, daß der Leutnant sie aus irgend einem Grunde ins Zelt verbannen wollte, und sie gehorchte. Sie reichte dem jungen Mann die Hand, welche ehrfurchtsvoll nur mit den Fingerspitzen berührt wurde, wechselte mit Patrick einen derben Händedruck und ging ins Zelt.
Sie war wirklich sehr müde. Den ganzen Tag war scharf im Trab geritten worden, wobei die spanischen Soldaten die bepackten Esel auf dem unebenen Weg in einer wirklich bewundernswerten Weise zu lenken wußten, und so war es kein Wunder, wenn sich alles nach Ruhe sehnte.
Behaglich wickelte sich Johanna in zwei Decken, es war kalt, die anderen boten ihr eine weiche Unterlage, und ein Polster war das Kopfkissen. Sie hörte noch, wie der Leutnant mit klarer Stimme die Nachtposten abteilte, und wollte warten, bis er den Befehl geben würde, das Zelt für ihn aufzuschlagen, schlief aber darüber ein.
Sie hatte keinen erquickenden Schlaf, trotzdem sie müde war. Anfangs nur gaukelte ihr der Traum liebliche Bilder vor, Sie saß in einem duftenden Garten neben ihrem Geliebten und tauschte Koseworte, dann aber mischte sich in den Traum der letzte Gedanke, den sie vor dem Einschlafen gehabt hatte, wie es so oft passiert, und peinigte sie unaufhörlich.
»Johanna, wir wollen ins Zelt gehen!« sagte Felix, träumte sie. »Es wird kalt.«
Ja, aber wo war das Zelt?
»Es hat eben noch hier gestanden,« behauptete Felix und begann zu suchen.
Dann stand es plötzlich neben ihnen, doch die Stricke fehlten daran, man konnte die Leinwand nicht spannen, dann waren die Stricke wieder da, aber sie rissen, und schließlich trug ein Windstoß das ganze Zelt samt der Stange davon.
Darüber erwachte Johanna, sie lächelte über den, komischen Traum und wollte schon wieder einschlafen, als sie sich des Leutnants erinnerte.
»Will doch sehen, ob er sich ein Zelt hat aufschlagen lassen,« dachte sie, erhob sich und schlug die Leinwand zurück.
Sie konnte noch gar nicht so lange geschlafen haben, denn die Feuer brannten noch, wenn sie auch dem Verlöschen nahe waren. Allerdings konnte man auch noch frisches Holz nachgeworfen haben.
Johanna sah einen Posten mit geschultertem Gewehr auf- und abgehen, aber sie erschrak, als sie kein viertes Zelt erblickte. So war also der Leutnant gar nicht im Besitze eines solchen, er hatte dies nur vorgegeben, damit Johanna sein Zelt ohne Zögern annehmen sollte.
Und richtig, an dem noch am hellsten glimmenden Feuer lag ein Mann auf dem Boden, trotz der Kälte der Nacht sogar ohne Decke.
Leise näherte sich ihm das Mädchen; doch der Schläfer war nicht Ramos, sondern Patrick, welcher schnarchte, wie nur ein Irländer schnarchen kann. Er lag auf der bloßen Erde, selbst das Haupt nicht von einem Sattel erhöht, und schlief dennoch sanft; sein Gesicht zeigte in dem glühenden Schimmer des Feuers einen friedlichen Ausdruck.
Warum ruhte er nicht im Zelt bei seinen Gefährten, warum ohne Decke? Fest hielt die braune Hand den Lauf des Gewehres umspannt.
Aber wo vor allen Dingen war Ramos?
Da flackerte an dem anderen Feuer ein Zweig auf, der eben von den Flammen erfaßt wurde, und jetzt erkannte Johanna eine zweite Gestalt.
Schnell war sie neben derselben. Es war der Leutnant. Auch er lag auf dem nackten Boden, und keine Decke hielt die Nachtkälte von ihm ab. Der Degen lag, halb aus der Scheide gezogen, über seiner Brust, und zur Seite der Revolver.
Tiefes Mitleid überkam Johanna; sie fühlte eine mütterliche Besorgnis für den Jüngling, der fast noch ein Kind war. Schnell eilte sie ins Zelt zurück und entnahm ihrem Lager drei Decken.
»Eine für Patrick, zwei für Ramos und eine für mich,« murmelte sie, »mich schützt die Zeltleinwand vor dem Tau, den jungen Mann aber nicht.«
Als sie die Decke sorglich über den schlafenden Irländer breitete, zuckte dieser zusammen, stellte sein Schnarchen ein, griff auch mit der anderen Hand nach dem Gewehr und murmelte etwas, worin Johanna nur das Wort »Teufel« verstehen konnte. Was der Böse diesmal sagte, ging ihr leider verloren.
Der alte Soldat erwachte nicht unter ihrer zärtlichen Fürsorge, er begann sofort in einer anderen Tonart weiterzuschnarchen.
Nun ging Johanna leise zu Ramos hinüber. Er lag noch wie vorher. Das hübsche, kindliche Gesicht verriet durch keinen Zug, daß er irgendwelche Bequemlichkeit vermißte.
Johanna breitete die beiden Decken auseinander und legte sie leise, vorsichtig über den Schläfer. Kaum aber berührte ihre Hand dessen Körper, so schnellte er wie von einer Feder getrieben empor und stand, den Revolver in der Hand, aufrecht vor ihr.
Er erkannte sie sofort.
»Ah, Señorita,« stammelte er verwirrt, »Sie hier?«
»Und das nennen Sie Ihr Zelt?« fragte das Mädchen vorwurfsvoll.
Der junge Offizier wurde verlegen und errötete über und über.
»Verzeihen Sie mir, wenn ich Ihnen vorhin die Unwahrheit sagte,« entgegnete er leise. »Achten Sie meine Worte nicht als Lüge.«
»Antworten Sie mir jetzt die Wahrheit, dann will ich Ihnen verzeihen. Haben Sie noch ein anderes Zelt mit?«
»Nein.«
»Warum schlafen Sie im Freien?«
»Ich kann mit den Soldaten nicht unter einem Zelte kampieren.«
»Warum schläft Patrick nicht dort?«
»Er schläft eigentlich in meinem Zelte.«
»Warum decken Sie sich nicht zu?«
Der Offizier schwieg eine Weile, dann stammelte er:
»Ich habe keine Decke.«
»Ich weiß, Sie und Patrick haben mir die Ihrigen gegeben. Ist es nicht so?«
»Es ist so.« gestand er leise.
»Ist das auch schön, mich glauben machen zu wollen, Sie schliefen in einem Zelt, während sie auf dem nackten, kalten Boden liegen?«
»Señorita, ich bin Soldat und nicht der Knabe, für den Sie mich vielleicht halten. Sie aber sind meine Schutzbefohlene. Ich brauche mich meiner Unwahrheit nicht zu schämen. Zürnen Sie mir noch? Señorita, ich tat es Ihretwegen.«
Es lag etwas so Bittendes in dem Tone, in dem er dies sprach, die schwarzen Augen schauten sie so treuherzig an, daß dem Mädchen das Herz überging. Es streckte dem Jüngling die Hand entgegen und drückte die seine warm.
»Ramos,« sagte Johanna herzlich, »Sie sind ein edler Mann, ja noch mehr, Sie sind ein guter Mensch.«
Sie breitete die Decken am Boden aus.
»Wollen Sie nicht schlafen gehen?« fragte er, als sie mit einem Ast im Feuer stöberte.
»Nein, ich bin nicht müde. Wenn es Ihnen recht ist, so setzen Sie sich neben mich, und wir plaudern ein Stündchen zusammen. Erst aber sorgen Sie dafür, daß das Feuer wieder hell brennt.«
Der Offizier schien nur gar zu gern auf diesen Vorschlag einzugehen; er entfernte sich und kam bald mit einem Arm voll Holz zurück. Beide setzten sich auf die Decken, Ramos in respektvoller Ferne von dem Mädchen, und ließen die angenehme Wärme des Feuers auf sich wirken. Eine Unterhaltung wollte nicht gleich in Fluß kommen.
»Sie sind noch so jung und schon Offizier?« begann Johanna das Gespräch.
»In Amerika ist das Offizierspatent käuflich,« war die gleichgültige Antwort.
»Wohl wahr, aber es sind Kenntnisse und Fähigkeiten nachzuweisen, ehe man es kaufen kann.«
»So werde ich diese wohl besitzen.«
Es lag kein Stolz in der Antwort des jungen Offiziers.
»Dennoch sind Sie noch sehr jung für einen Leutnant, ich schätze Sie siebzehn Jahre.«
»Achtzehn Jahre. Ich erfreue mich der Gunst meiner Vorgesetzten.«
»Sie haben frühzeitig die Offizierskarriere eingeschlagen?«
»Mit meinem vierzehnten Jahre.«
»Gaben Ihre Eltern gleich die Einwilligung zu diesem harten Berufe, oder stießen Sie auf Widerstand?«
»Ich habe nur noch eine Mutter, und ich bin stolz darauf, sie ernähren zu können.«
Des Offiziers Stimme zitterte bei diesen Worten.
»Wie? Sie ernähren Ihre Mutter?« rief Johanna erstaunt. »So sind Ihre Eltern verarmt?«
»Sie waren immer arm.«
»Aber es gehört viel Geld dazu, um das Offizierspatent zu kaufen.«
»Ich schäme mich nicht, zu gestehen, daß mich ein anderer zu dem gemacht hat, was ich bin. Ohne ihn könnte ich meine Mutter nicht so erhalten, wie ich es tue. Gott segne meinen Wohltäter!«
»Erzählen Sie!« bat Johanna.
»Mein Vater war ein armer Bergmann, er arbeitete in einer Silbergrube des nördlichen Mexiko. Das nördliche Mexiko gehört zu den Vereinigten Stauten, das südliche ist eine Republik. Er verunglückte und starb, als ich zehn Jahr alt war. Der Besitzer der Grube erfuhr davon, er verfolgte die Witwe, ließ mir die beste Erziehung angedeihen, und als ich in die Armee einzutreten wünschte, kaufte er mir ein Offizierspatent. Das ist die kleine Geschichte mit großem Inhalt.«
»Wie hieß die Grube, in welcher Ihr Vater arbeitete?«
»Sie gehörte zu den Altascarezgruben.«
»Kennen Sie den Besitzer?«
»Ja, ich habe oft mit ihm verkehrt. Er ist der Mensch, den ich nach meiner Mutter am meisten verehre. Mein Leben gehört ihm.«
»Wie heißt er?«
»Felix Hoffmann.«
Lange Zeit ward kein Wort hörbar, der Offizier blickte träumend ins Feuer, und Johanna saß da, die Hand auf dem wogenden Busen, Tränen im Auge.
Endlich sagte sie leise:
»Ramos, Hoffmann ist der Mann, zu dem ich reise.«
Der Leutnant sprang erschrocken auf.
»Wie?« stammelte er verwirrt. »Sie wären — Felix Hoffmanns — der Silberkönig — wäre —«
»Ich bin die Braut Felix Hoffmanns.«
Johanna erschrak über das Gebaren des jungen Offiziers. Er drehte sich plötzlich um, riß den Degen heraus, stieß ihn bis zur Hälfte in die Erde, ließ die Hand am Griff und blickte starr und mit sich bewegenden Lippen einige Sekunden darauf. Dann stieß er den Degen in die Scheide zurück.
»Ramos, was tun Sie?« rief Johanna.
»Nichts,« entgegnete der Leutnant ruhig und wandte sich wieder zu dem Mädchen, »Es ist bereits zwei Uhr. Nach wenigen Stunden wollen wir schon wieder aufbrechen. Darf ich Sie bitten, sich in Ihrem Zelte schlafen zu legen?«
»Ach, Ramos, ich kann nicht schlafen, während Sie hier frieren.
»Auch nicht, wenn ich Sie bitte?«
»Es ist mir unangenehm, wenn jemand meinetwegen leiden soll,« entgegnete sie zögernd.
Da ergriff der Leutnant plötzlich ihre Hand und führte sie ehrfurchtsvoll an die Lippen. Johanna duldete es, sie merkte, wie er zugleich ihren Verlobungsring küßte und wie sich seine Augen mit Tränen füllten.

Johanna merkte, daß Ramos ihren Verlobungsring
küßte und sich seine Augen mit Tränen füllten.
Er ergoß sich in keinen Wortschwall von Treue und Ergebenheit, er fragte nur einfach mit bebender Stimme:
»Will die Señorita nicht in Ramos' Zelt schlafen?«
Johanna antwortete nicht. Sie drückte noch einmal des Jünglings Hand und verschwand dann hinter dem Zeltvorhang.
Ramos aber ging zu Patrick hinüber.
»Auf, auf, fauler Bär,« sagte er und rüttelte den Schläfer, »nennst du das Wache?«
»Ja, das nenne ich Wache, sagte der Teufel, als man ihn als Posten vor ein Schnapsfaß stellte.«
»Der Teufel soll dich holen, wenn du von Schnapsfässern träumst.«
Doch schon stand Patrick mit klaren Augen vor ihm.
»Halloh, was gibt's denn? Indianer? Oder ist wieder einer der Halunken desertiert?«
»Einen Schatz gibt es zu bewachen.«
Jetzt erst bemerkte Patrick die leuchtenden Augen seines Vorgesetzten.
»Einen Schatz? Nanu! Etwas gefunden? Aha, doch nicht etwa eine Liebschaft angesponnen?«
»Unsinn, Patrick. Auf, auf, nimm dein Gewehr, es wird nicht mehr geschlafen, bis wir in Austin sind.«
Weiter ließ Ramos sich nicht aus, er eilte fort, um die Posten ablösen zu lassen.
»Bis nach Austin nicht mehr schlafen?« brummte Patrick, sich im Haar kratzend. »Das ist ein bißchen lange, sagte der Teufel, als seine Großmutter hundert Jahr im Wochenbett lag.«
Die Posten wurden abgelöst, zwei neue Soldaten übernahmen die Wache und den Rundgang um das Lager, die alten begaben sich in die Zelte.
Nachdem Ramos der Ablösung beigewohnt, legte er sich quer vor Johannas Zelt auf den Boden, schlief aber nicht, sondern schaute hinauf zu den Sternen, welche durch die Zweige des Baumes blickten, bis sie verblichen, und auf sein Geheiß der Weckruf erschallen sollte.
Die abgelösten Posten betraten das Zelt. Sonderbarerweise schliefen ihre Kameraden nicht, sondern erwarteten halb aufgerichtet die beiden Ankömmlinge.
»Nun, Gasparino, etwas erfahren?« fragte einer leise.
»Genug,« klang es triumphierend zurück. »Morgen mittag, wenn ein Schakal sich mit einem Wolf zu beißen scheint — das Signal ist leicht zu erkennen — sind sie in unserer Nähe. Wir suchen unter einem Vorwande an die Führer heranzukommen und machen sie dingfest, wenn die Freunde hervorbrechen.«
»Gut, wer brachte dir die Nachricht?«
»Ein Indianer. Der Kerl sprach ganz gut Spanisch.«
»Also Indianer sind auch mit dabei?«
»Natürlich, die spielen ja die Hauptrolle. Aber es wird ihnen scharf auf die Finger gesehen, sie liegen an der kurzen Leine.«
»Wie fandest du ihn?«
»Ich fand ihn überhaupt nicht, sondern er mich. Ich ging so ganz gemütlich auf und ab und sann darüber nach, auf welche Weise man uns wohl Nachricht zukommen lassen wollte, als mich plötzlich etwas ans Bein faßte. Ich bin doch gewiß nicht ängstlich, das wißt ihr doch alle —«
»Gewiß, Gasparino.«
»Aber ich erschrak doch furchtbar. Da sah ich aber schon einen nackten Schädel mit einem Haarbüschel darauf. Ich verstand sofort, ich schrie nicht. Nun erzählte mir der Indianer, wie wir uns verhalten sollten, und fort war er wieder, ohne daß ich etwas hörte. Hätte nie geglaubt, daß eine Rothaut so unhörbar schleichen kann.«
»Nun, die Sache soll leicht vonstatten gehen. Der Leutnant, das junge Bürschchen, ist wie ein Kind zu überwältigen, und für Patrick sind noch genug von uns übrig.«
»Und die Dame?«
»Die wird natürlich erst recht gefangen genommen. Sie ist eine Amerikanerin, und den Rebellen kommt es ja hauptsächlich darauf an, recht viele Geiseln zu erhalten. Der Proviant bleibt den Indianern überlassen, der Munition werden sich aber diesmal wohl die Rebellen bemächtigen, denn damit sieht es schwach bei ihnen aus.«
»Wird sich die Dame wehren?«
»Bah, die bekommt im Notfalle eins über den Kopf.«
»Halt!« ließ sich da Manuel, der andere abgelöste Posten vernehmen. »Nun will ich euch etwas Interessantes erzählen, über das ihr staunen werdet. Wir haben nämlich ein Goldfischchen gefangen.«
»Das wäre?«
»Die Dame.«
»Ein Weib? Was ist das weiter?«
»Wißt ihr, wer sie ist?«
»Wie sollen wir es wissen? Miß Lind nennt sie sich, und sie mag ja auch die Tochter irgend eines reichen Mannes sein, aber Geisel bleibt doch immer nur Geisel, es müßte denn gerade jemand sehr Vornehmes oder sehr Reiches sein.«
»Das ist sie auch.«
»So sprich doch, Mann!«
»Ihr kennt doch die Altascarezgruben?«
»Natürlich.«
»Auch den Besitzer?«
»Es gibt gar keinen Besitzer, sie gehören einer ganzen Gesellschaft oder doch vielen Nachkommen des Alten.«
»Das ist nicht wahr,« mischte sich ein anderer dazwischen, »sie gehören einem einzigen, das ist der wahre Silberkönig.«
»Stimmt!« sagte Manuel. »Felix Hoffmann heißt er.«
»Ja, es war ein deutscher Name, ich habe ihn auch schon einmal nennen hören.«
»Nun, was hat er mit dem Mädel zu tun? Ist sie seine Tochter? Das wäre allerdings günstig.«
»Nein, sie ist seine Braut; er ist in Austin, und deshalb will sie dorthin.«
»Ah, das wäre allerdings ein brillanter Fang! Weißt du es genau?«
»Ganz genau. Ich habe vorhin mit eigenen Ohren gehört, wie die Dame es dem Leutnant gestand. Und der Leutnant nennt den Silberkönig seinen Wohltäter, für den er sterben will.«
»Das kann er ja tun, ich halte ihn davon nicht ab,« lachte ein Mann leise. »Das Leben der Dame aber muß geschont werden, kein Haar dürfen wir ihr krümmen.«
»Um Gottes willen nicht. Für eine tote Braut wird der Silberkönig wohl nicht viel Lösegeld zahlen.«
»Meinst du, der Anführer behält sie nicht als Geisel, damit wir Sicherheit haben, sollte die Sache schiefgehen?«
»Andere Leute vielleicht, sie aber nicht. Zum Kriegführen gehört nun einmal Geld, und der Silberkönig gibt so leicht eine Million für seine Braut hin, wie ich zehn Cents für ein hübsches Mädchen.«
»Kennt Ihr den Silberkönig?«
»Nein, Ihr?«
»Auch nicht. Es ist aber gut, denke ich, wenn wir ein scharfes Auge auf den jungen Leutnant haben. Er scheint riesig an dein Silberkönig zu hängen, und seitdem er weiß, daß die Dame dessen Braut ist, auch an dieser. Jetzt schläft er schon vor ihrem Zelte wie ein Hund vor der Tür seines Herrn.«
»Wenn es so ist, dann schadet es allerdings nichts, wenn er ins Gras beißt, sollte er uns zu viele Umstände verursachen. Dieses Mädel muß uns erhalten bleiben, es ist nicht mit Gold aufzuwiegen, höchstens mit Perlen und Edelsteinen.«
So wurde in dem Zelte der Soldaten schwarzer Verrat gesponnen, während Johanna friedlich in dem Zelte des Leutnants schlummerte. Sie träumte so süß, sie glaubte sich in den Armen Felix', in diesen starken Armen, wo ihr keine Gefahr etwas anhaben konnte. Sie streichelte ihm das goldige Haar und die hohe Stirn und küßte seine Lippen. Dann stand neben dem Geliebten Leutnant Ramos, bleich wie der Tod, aber mit leuchtenden Augen. Er hatte seinen Degen in die Erde gestoßen und murmelte vor sich hin.
Plötzlich sank er zusammen, die Hand ließ den Griff der Waffe nicht los, daher brach der Stahl ab, und Blut rann von dem Kopfe des Jünglings.
›Ich habe meinen Schwur gehalten,‹ tönte es von seinen Lippen. ›Meine Mutter, meine arme Mutter!‹
Johanna weinte im Traume; doch gleich war sie wieder glücklich, denn Felix umarmte und küßte sie.
›Dein Weg zu mir führte über seine Leiche,‹ sagte er.
Johanna wachte auf, es graute ihr. Doch alles war ja nur ein Traum gewesen, und so schlief sie wieder ein.
»Nur zwei Tage noch,« war ihr letztes Wort.
Der Leutnant lag vor dem Zelteingang und beobachtete die zitternden Sterne. Noch hatte er keine Heldentat vollbracht, aber eine innere Stimme sagte ihm, daß ein treuer Freund mehr als ein Held sei, und deshalb fühlte er sich schon als ein solcher.
Die Reisenden hatten schon wieder das zweite Frühstück hinter sich, welches ohne weitere Vorbereitungen eingenommen worden war. Leutnant Ramos bemühte sich noch mehr als tags zuvor, für die Bequemlichkeit seiner schönen Begleiterin Sorge zu tragen. Er achtete auf jeden ihrer stummen Wünsche, und seine Hand kam jedesmal der ihrigen zuvor.
Dennoch lag in seinem Benehmen keine Spur von Aufdringlichkeit, sondern nur Galanterie, verbunden mit Ehrfurcht. Er unterhielt Johanna noch mehr als gestern, und gern lauschte sie dieser tiefen und doch weichen Stimme, welche mit der Redegewandtheit des Spaniers über alles zu plaudern wußte.
Johanna erschrak immer wieder, wenn sie erst eine Zeitlang den klugen Worten gelauscht hatte und dann, zur Seite blickend, das Antlitz eines Knaben sah, für welches, wenn es nicht so gebräunt gewesen, der Ausdruck ›wie Milch und Blut‹ passend gewesen wäre.
Hier verband sich das Aussehen des Kindes mit dem inneren Wert des Mannes; der Capitano hatte recht gehabt, als er Johanna warnte, den Leutnant wegen seiner Jugend zu unterschätzen.
Der Weg wurde schlechter, es konnte nicht mehr im Trab geritten werden.
»Wir haben auch nicht mehr nötig, so zu eilen,« meinte Ramos zu dem Mädchen. »Unter meinen Leuten sind einige, welche lange als Jäger in der Wildnis gelebt haben und sich auf Spuren verstehen. Ihrer Ansicht nach kann der Haupttrupp noch nicht lange hier marschiert sein. Ich hoffe, wenn wir einige Stunden des Abends zu Hilfe nehmen, können wir die Nacht im Hauptlager verbringen.«
»Dann haben Sie auch nicht mehr nötig, auf der nackten Erde zu schlafen,« lächelte Johanna.
»Nein, mein Zelt wird neben dem Ihren stehen.«
Patrick kam vorgaloppiert. Er hatte, ohne den Zug halten zu lassen, einen Pack aufschnüren lassen und demselben eine Flasche und einen Becher entnommen.
Es war heiß. Dicke Schweißtropfen standen dem Alten unter dem Schild der dunklen Mütze. Er wollte einen erfrischenden Trunk zu sich nehmen, dachte aber erst an den Leutnant und an dessen Schutzbefohlene.
Dankend nahm Johanna ihm den Becher mit schäumender Limonade ab und trank.
»Das kühlt, sagte der Teufel, als er sich auf die heiße Ofenplatte setzte,« schmunzelte Patrick.
Der zweite Becher galt dem Leutnant. Ramos führte den Becher an die Lippen, setzte ihn aber gleich wieder ab.
Im Wald erscholl ein greuliches Geheul; deutlich konnte man das Bellen des Schakals und das Heulen des Wolfes unterscheiden. Dazwischen ertönte ein seltsames Fauchen.
Schon öffnete Patrick den Mund, um den Teufel über diesen Skandal einen Ausspruch tun zu lassen, als hinter ihm ein Schrei ertönte, dem ein Poltern folgte.
Der Pack, welchen Patrick vorher geöffnet, aber wieder sorgsam befestigt hatte, war von dem Maulesel herabgefallen.
Mit einem Fluche sprengte der Korporal zurück.
»Es ist der Pack, den Ihr aufgemacht habt,« rief ihm der Soldat, welcher das Lasttier zu führen hatte, entgegen.
»Ist das eine Entschuldigung? Habe ich ihn nicht selbst wieder befestigt?« herrschte Patrick den Mann an.
»Vielleicht zu fest, ein Strick ist gerissen.«
»Unsinn, flunkere nicht! Wie kann solch ein Strick reißen?«
»Dann seht selbst zu, wie es passiert ist! Ich sah mit eigenen Augen, wie der Strick plötzlich riß,« war die freche Antwort.
Der Pack war bei dem Sturze auf den harten Erdboden aufgeplatzt und ließ Brot, Schinken und Kistchen mit Munition sehen.
Patrick sprang vom Pferde, ebenso einige Soldaten, denn der Pack mußte wieder geschnürt werden. Ramos und Johanna kamen ebenfalls herbei.
Patrick suchte unter der Leinwand nach dem gerissenen Strick, hatte ihn bald gefunden und zog ihn hervor.
»Halloh, Bursche, was ist das?« rief er. »Dieser Strick ist durchschnitten worden.«
Sein Auge begegnete dem listigen Blick des Soldaten.
»Ich habe kein Messer in der Hand gehabt.«
»Der Strick ist aber durchschnitten oder angeschnitten worden.«
»Mag sein, daß ich ihn mit den Sporen gestreift habe.«
»Und das sagst du so gleichgültig, Kerl?« herrschte ihn Leutnant Ramos an.
»Nein, nein, Leutnant, es ist ein Messer daran gewesen, ein Sporn schneidet anders,« behauptete Patrick, den Soldaten, der häßlich lächelte, scharf fixierend.
»Zeigt mir den Strick!« befahl Ramos.
Doch dieser konnte nicht hervorgezogen werden, ohne den Pack völlig in Unordnung zu bringen, Ramos stieg daher vom Pferde und bückte sich.
»Er ist mit einem Messer zerschnitten worden,« entschied er.
»Gut,« grinste der Soldat, »ich habe ihn zerschnitten.«
Patrick und Ramos blickten auf; sie waren erschrocken über diese Frechheit. Das hatte etwas zu bedeuten.
Da erscholl plötzlich ein gellendes Geheul zur Seite des Weges. Wilde, grellbemalte Gestalten sprangen aus den Büschen, und gleichzeitig fühlten sich Patrick und Ramos von hinten umschlungen. Sie konnten nicht mehr nach den Waffen greifen — ihre eigenen Soldaten hatten sie verraten.
Ebenso wurde Johanna plötzlich von fester Hand gepackt und vom Pferde gerissen. Es gelang ihr zwar noch, den Revolver aus der Satteltasche zu ziehen, aber Gebrauch konnte sie nicht von ihm machen, er wurde ihr aus der Hand gerungen.
Bald waren Ramos und Patrick von Lassos umschlungen, Johanna wurden nur die Hände festgehalten.
»Schurken!« knirschte Ramos, als er seine Leute als Verräter erkannte, die mit den Indianern unter einer Decke steckten.
Noch einen unsagbar schmerzlichen Blick warf er auf Johannas bleiches Antlitz, dann ergab er sich in sein Schicksal.

Nicht so Patrick.
»Komm mir nicht zu nahe, sagte der Teufel, da gebrauchte er seinen Pferdefuß,« murmelte Patrick und gab dabei einem ihm nahestehenden Soldaten einen so derben Tritt in den Unterleib, daß der Mann zwischen die Pferde flog und liegen blieb. Er starb noch an demselben Tage.
Die Indianer hatten die Gefangenen umzingelt; doch seltsamerweise hielten sie sich von ihnen entfernt, sie stürzten sich nicht einmal auf das Pack. Nur einer sprach auf spanisch zu einem der Soldaten, es war der Indianer, welcher Gasparino auf den Ueberfall vorbereitet hatte, anscheinend ein Häuptling.
Da plötzlich erweiterten sich Ramos' Augen; seine Nasenflügel zitterten, und ein pfeifender Laut entrang sich seinen Lippen.
Aus dem Gebüsch, welches vorher die Indianer verborgen, traten einige Weiße heraus, alle Spanier, teils in Phantasiekostümen, teils in die reichen Uniformen Mexikos, teils in die einfachen der Vereinigten Staaten gekleidet.
Sie kamen langsam und schwatzend auf die Indianer und Gefangenen zugeschritten.
»Gut gemacht, Gasparino!« rief einer in der Uniform der Vereinigten Staaten. »Auch ihr anderen habt euch klug verhalten. Es soll eurer noch gedacht werden.«
»Leutnant Diaz,« rief Ramos erstaunt.
Der Gerufene, ein junger, schöner Mann mit finsterblickenden Augen, derselbe, welcher eben das Lob erteilt, trat vor Ramos.
»Diaz,« wiederholte dieser, »was soll das bedeuten?«
Finster maß Diaz den Frager.
»Leutnant Ramos, Eure Rolle ist ausgespielt! Ihr seid ein Gefangener Mexikos!«
»Ihr spaßt wohl! Tragt Ihr nicht meine Uniform?«
»Ich muß, weil ich keine andere Kleidung habe, sonst würde ich diese mir verhaßte Uniform in Stücke reißen.«
»Diaz, Ihr seid ein Renegat? Ihr haltet zu Mexiko? Nie hätte ich das von Euch erwartet.«
»Ich bin kein Renegat, ich bin ein Rebell,« war die stolze Antwort. »Ich kämpfte nicht für Mexiko, sondern gegen den Yankee.«
»Euer Los wird der Galgen sein.«
»Oder das Eure.«
»Diaz, Ihr wart mir ein Freund,« bat Ramos. »Nehmt Euch jener Dame an!«
»Das steht außer meiner Macht. Sie ist eine Geisel. Doch Spanier sind höflich gegen Damen.«
Ramos lächelte bitter.
»Ihr seid desertiert?« fragte er dann.
Leutnant Diaz gehörte zu dem Haupttrupp, dem Ramos nacheilen sollte.
»Desertiert?« antwortete der Gefragte spöttisch. »Alle hundert Soldaten waren schon von uns gewonnen.«
Ramos erschrak.
»So war der Abfall schon vorbereitet?«
»Schon längst.«
»Ich habe nie das Geringste davon gemerkt.«
»Das glaube ich. Man hat sich gehütet, Euch einzuweihen, denn man kannte Eure törichte Pflichttreue ebenso, wie die jenes Irländers dort.«
»Und auch der Capitano war ein Rebell?« fragte Ramos schmerzlich. »Ihn wenigstens hätte ich für treu gehalten!«
»Beruhigt Euch! Er wollte sich ganz allein gegen die Rebellen werfen, er fiel von meiner Hand.«
Ramos atmete auf.
»Wohl ihm, so starb er als ein Ehrenmann,« rief er, »Ihr aber seid ein Meineidiger.«
Ein anderer, ein mexikanischer Offizier, eine kleine, krummbeinige Gestalt, trat auf Ramos zu.
»Was hat dieses Bürschchen zu schimpfen? Meineid, he? Weil wir diesen verfluchten Yankees nicht mehr gehorchen wollen? Warte, Knabe, du sollst noch anders pfeifen! Erst aber herunter mit den Dingern.«
Er riß Ramos die Epauletten von den Schultern und schnallte ihm den Degen ab.
Der Gefangene sagte nichts; er wandte den Männern den Rücken und sah nach Johanna.
Diese hatte man unterdes nach Waffen untersucht, sie aber sonst freigelassen.
Jetzt näherte sich der mit Juarez angeredete mexikanische Offizier dem Mädchen; ihre Blicke begegneten sich.
»Ah, Señor Juarez,« rief sie überrascht. »Ich hatte schon einmal das zweifelhafte Vergnügen, Sie in der Nähe von Manila kennen zu lernen. Also bis zum Meuterer haben Sie es doch schon gebracht.«
Der spanische Offizier, welcher seiner Zeit die Negrillos gepeitscht hatte, um in den Besitz der Wertsachen des Marquis Chaushilm zu kommen, und wegen einer Beleidigung von dem Marquis ins Gesicht geschlagen worden war, errötete. Die Begegnung kam ihm unerwartet. Doch gleich hatte er seine Fassung wiedererlangt.
»Das Blatt hat sich gewendet, Señorita. Damals war die Uebermacht auf Ihrer Seite, ich mußte die Beleidigung ruhig hinnehmen, jetzt ist dies etwas anderes. Sind jene Herren vielleicht nicht weit von Ihnen? Dies wäre mir sehr lieb, dann könnte die alte Schuld bald getilgt werden.«
Johanna lachte verächtlich.
»Großprahler, Lügner und Dieb! Laßt Euch nicht von ihnen erblicken, Ihr würdet zum zweiten Male den Boden küssen.«
Da ließ sich neben ihm eine andere Stimme vernehmen.
»Das soll gleich gemacht werden, sagte der Teufel, da hatte er es schon ausgeführt,« und gleichzeitig erhielt Juarez, noch ehe er einen Entschluß fassen konnte, von Patricks Fuß einen Tritt, der ihn zu Boden warf.
Leider hatte Patrick nicht nahe genug gestanden, sonst hätte der Stoß eine nachhaltigere Wirkung gehabt.
So aber erhob sich Juarez mit schäumenden Lippen, riß den Degen heraus und wollte sich auf Patrick stürzen, der schon wieder das lange Bein erhob, aber Diaz fiel ihm in den Arm und hinderte ihn an seinem Vorhaben.
»Halt,« rief dieser Offizier drohend, »die Gefangenen gehören nicht Ihnen, sondern Mexiko, sie sind Geiseln. Wir wollen nicht wie Räuber, sondern wie Soldaten handeln.«
Juarez mußte gehorchen, aber man sah ihm an, daß er seine Rache nur verschob. Patricks Füße wurden gebunden, wobei er noch manchen schmerzenden Tritt austeilte.
Gasparino und Manuel waren zu einem anderen Spanier getreten, welcher zwar keine Uniform trug, aber hier den Anführer zu spielen schien. Die beiden wiesen während ihrer Erzählung öfters auf Johanna, und das Gesicht des Mannes mit dem Knebelbart nahm einen immer erstaunteren Ausdruck an.
»Ah, das ist eine angenehme Nachricht!« rief er endlich. »Dank euch, Burschen.«
Juarez und Diaz wurden zu ihm beordert, sie besprachen such, und der Inhalt ihres Gespräches schien Johanna zu gelten.
»Die Schufte wissen, wer Sie sind,« sagte Ramos zu dem Mädchen. »Die meuternden Soldaten haben es gestern abend von uns selbst zu hören bekommen.«
»Machen Sie sich keine Vorwürfe deswegen,« beruhigte Johanna den jungen Offizier. »Meine Lage gestaltet sich dadurch um so besser. Mein Leben wird ihnen von jetzt ab heilig sein.«
»Das ist mir der einzigste Trost. Doch rechnen Sie noch auf mich, noch lebe ich!«
Die Soldaten lachten bei diesen Worten höhnisch auf; wie prahlerisch sprach dieser Knabe!
Man gedachte, sich zu trennen. Die Soldaten, welche Ramos begleitet hatten, nahmen diesen und Patrick in die Mitte. Letzterem wurden die Füße wieder befreit, aber man hielt sich von ihnen entfernt.
»Wir werden getrennt,« seufzte Ramos, als Johanna fortgeführt wurde.
»Dann hoffen Sie auf ein baldiges Wiedersehen! Adieu, Ramos, zählen Sie auf mich, wie ich auf Sie rechne! Doch ich glaube nicht, daß meine Gefangenschaft lange dauern wird.«
Johanna wußte ja, wie gern Felix alle seine Schätze hingegeben hätte, wenn er sie befreien konnte, und verlangten die Rebellen auch ein noch so hohes Lösegeld, der Silberkönig merkte die Summe kaum in seiner Schatzkammer.
Der alte Spanier erteilte noch Diaz Instruktionen, dann bestiegen er und die anderen Offiziere die erbeuteten Pferde und verschwanden im Wald, Johanna mit sich nehmend.
Auch die Indianer waren mit ihm gegangen, nur drei blieben bei Diaz und den beiden Gefangenen zurück, welche von den neun Soldaten bewacht werden sollten. Der zehnte, von Patricks Fuß getroffen, ward auf einem Pferde mitgeführt.
Diaz wendete sich mit ernster Miene an die Soldaten.
»Diese Gefangenen sind Geiseln der Republik Mexiko, in deren Namen wir hier handeln,« sagte er streng. »Wer sich an ihnen nur im geringsten vergreift, vergeht sich gegen den Staat, dem er Gehorsam geschworen hat. Augenblicklicher Tod von meiner Hand wird die Strafe dafür sein. Merkt euch das, Leute!«
Die Gefangenen waren also vor Mißhandlungen geschützt, auch ihr Leben war vorläufig nicht in Gefahr. Diaz schien auf strenge Manneszucht zu halten, und die Soldaten wußten, daß er nicht mit sich spaßen ließe.
Patrick sah ein, daß man den Offizier, war er auch ein Rebell, achten mußte, er ließ jetzt die Soldaten ruhig an sich herankommen, ohne sie mit Fußtritten zu traktieren.
»Wohin geht die Reise?« fragte Ramos, als Diaz die Soldaten zum Marsch aufstellte.
»Ich weiß nicht, Señor,« war die kurze Antwort, und Ramos fragte nicht wieder nach dem Ziel.
Diese Szene hatte Monsieur Aubert beobachtet.
Diaz wandte sich an einen der drei Indianer; er war ärgerlich, daß man ihm nur so wenige von diesen gelassen hatte, um die Sicherheit des Weges auszukundschaften.
»Ihr werdet ausschwärmen und darauf achten, daß wir von jeder uns drohenden Gefahr rechtzeitig benachrichtigt werden,« sagte er.
Der Apache, dessen Gürtel mit herabhängenden Biberschwänzen verziert war, richtete sich stolz auf.
»Biberschwanz wird Augen und Ohren offenhalten, er riecht die Gefahr und wird seine Freunde warnen. Im Kampf schützt er den Rücken der Bleichgesichter.«
»Schon gut!« unterbrach ihn Diaz ungeduldig. »Wie wollt ihr euch verteilen?«
»Biberschwanz bleibt zurück, Bachstelze flattert voraus, und die schwarze Schlange durchschleicht die Büsche euch zur Seite.«
»So geht!«
Die zwei zuletzt genannten Indianer verschwanden voraus und zur Seite im Walde, Biberschwanz blieb zurück, und ein listiges Lächeln überzog sein Gesicht, als er den Zug sich entfernen sah.
Unverwandt blickte er den Soldaten nach, bis Büsche und Bäume sie seinen Augen entzogen. Dann sah er sich scheu um und ging nach der Stelle zurück, wo vorhin dem Maulesel das Pack entfallen war. Eng daneben stand ein dichter Busch. In diesen kroch Biberschwanz und kam gleich darauf mit einem dickbäuchigen Steinkruge zum Vorschein.
Er begab sich nicht wieder aus die Lichtung hinaus, sondern blieb im Schutze der Bäume, schmiegte sich auch noch dicht an den Busch. Ein zufriedenes Lächeln lag auf seinem dunklen Gesicht, als er mit dem Skalpiermesser den Kork aus der Kruke entfernte.
»Die Weißen wollen nicht, daß die armen Indianer einmal fröhlich sind,« grinste er, »das Gute behalten sie immer für sich, aber Biberschwanz ist schlauer als sie — und schlauer, als seine roten Brüder.«
Er tat einen langen, langen Zug aus der Kruke, und als er sie endlich wieder absetzte, strahlte sein Gesicht, er schnalzte entzückt mit den Fingern.
»Ah, Feuerwasser, sehr, sehr gut, Feuerwasser, macht den Kopf des Indianers hell wie die Sonne, und seine Augen scharf. Feuerwasser macht Biberschwanz jung.«
Er trank wieder.
Da hörte er etwas rascheln, schnell verschwand die Kruke im Gebüsch, noch ehe die Bachstelze vor ihm stand.
»Was tut die Bachstelze hier?« fragte Biberschwanz finster, am Boden hocken bleibend.
»Was tut Biberschwanz hier?«
»Biberschwanz ist treu, er sorgt, daß seinen bleichen Freunden kein Feind in den Rücken fällt. Warum ist Bachstelze nicht vorn und sichert die Brust unserer Freunde?«
Bachstelze hob die Nase und schnüffelte.
»Es riecht hier nach Feuerwasser.«
»Es war solches in den Packen der Maultiere.«
»Biberschwanz' Augen glänzen.«
»Er späht nach Feinden.«
»Biberschwanz hat Feuerwasser getrunken.«
»Die Bachstelze träumt,« entgegnete Biberschwanz ruhig.
Der andere nickte.
»Dann hat die Bachstelze geträumt. Er träumte, ein Pack wäre aufgeplatzt und eine Steinflasche wäre herausgerollt. Niemand sah sie, nur ein Indianer. Als die Buntröcke zusammen sprachen, hob der Indianer die Flasche leise auf und steckte sie in diesen Busch. Der Indianer hieß Biberschwanz.«
»Die Bachstelze hat geträumt.«
»Niemand sah es, nur ein Indianer, und der hieß Bachstelze.«
»Die Bachstelze lügt.«
Mit einem Sprunge war der Apache an dem Busche, griff hinein und hatte die Flasche in seiner Hand.
Biberschwanz war darüber nicht im mindesten aufgebracht, zeigte auch durchaus keine Scham, der Lüge überführt worden zu sein, nur nahm er dem Kameraden, als dieser die Kruke gar nicht wieder vom Mund lassen wollte, die Flasche aus der Hand und vertiefte sich selbst in deren Inhalt.
So wanderte sie hin und her; stumm übergaben die Indianer sie sich gegenseitig, der eine trank, und der andere streckte schon wieder die vor Gier zitternden Hände nach ihr aus.
Plötzlich verschwand sie abermals im Busch, ein Geräusch war gehört worden, und vor ihnen stand die schwarze Schlange.
»Hugh.«
»Was will die schwarze Schlange hier? Glaubt sie, die Feinde unserer Freunde sind hier?«
Es folgten fast dieselben Reden wie vorhin, Behauptung und Ableugnung, bis die schwarze Schlange sich selbst die Flasche hervorholte und mit langen Zügen das nachzuholen suchte, was sie versäumt hatte, und das war nicht wenig.
Die scharfen Sinne der Indianer werden immer gerühmt; warum sollte da die schwarze Schlange nicht gerochen haben, daß sich ihre beiden roten Brüder am Feuerwasser delektierten? Manche Nasen leisten im Aufspüren von Branntwein Unglaubliches. Oder es war auch der schwarzen Schlange nicht entgangen, daß Biberschwanz eine Kruke Feuerwasser beiseite gebracht hatte.
Die drei Indianer tranken lautlos, bis jenes Stadium erreicht war, in welchem das Getränk die Zunge zu lösen beginnt. Nun hat bei vielen Menschen Alkohol, sei er in Schnaps, Bier oder Wein enthalten, die Wirkung, daß er ihnen plötzlich einen ungeheueren Mut einflößt. Schade nur, daß die so erzeugte Courage immer nur auf der Zunge liegt. Die sowieso schon sehr ruhmredigen Indianer erliegen diesem Einfluß des Alkohols immer.
Es war ein liebliches Terzett, welches die drei Apachen nicht zu singen, aber zu sprechen begannen, ein Furchtsamer, der es gehört hätte, wäre schon vor Schrecken gestorben.
»Hugh, Biberschwanz ist ein Krieger.«
»Die Feinde zittern, wenn sie den Flügelschlag der Bachstelze hören.«
»Wenn die schwarze Schlange zischt, fliehen ihre Feinde in Erdlöcher.«
»Biberschwanz hat die Kräfte eines Bären.«
»Bachstelze hat ein stählernes Herz.«
So ging es fort. Sie priesen ihre Kraft, Schlauheit und Treue, ihren Mut, Scharfsinn und so weiter, aber alle diese Eigenschaften bewiesen sie nur dem Feuerwasser gegenüber, die Flasche war schon halb geleert. Ihren Auftrag hatten sie ganz vergessen.
Biberschwanz behauptete, er könne jeden Bären mit einem Schlage seines Tomahawks töten; er hielt es wahrscheinlich für seine Pflicht, dies auch zu beweisen, nahm den Tomahawk aus dem Gürtel und richtete sich auf, schlug aber sofort der Länge nach zu Boden.
Im Fallen ergriff er die Kruke, trank noch einige Züge und schloß dann die Augen zum langen Schlafe.
Seiner matten Hand entglitt die Flasche, sie wäre umgefallen, ihr kostbarer Inhalt hätte den Rasen getränkt, doch mit der größten Geistesgegenwart ergriff Bachstelze sie — er war ja ein großer Krieger — und saugte sofort an ihrem Hals.
Eine Viertelstunde tranken die beiden wackeren Zecher noch, bis das Feuerwasser auch sie besiegt hatte. Sie fielen um und schliefen den Schlaf der Gerechten.
Noch nicht lange war ihr Lobgesang verstummt, als sich die Büsche teilten und ein schwarzes Gesicht mit schwülstigen Lippen sichtbar wurde. Mit der Schnelligkeit des Blitzes fuhr es beim Anblick der drei Indianer zurück. Die Gestalt eines Negers richtete sich auf und rannte, wie von Furien gepeitscht, davon.
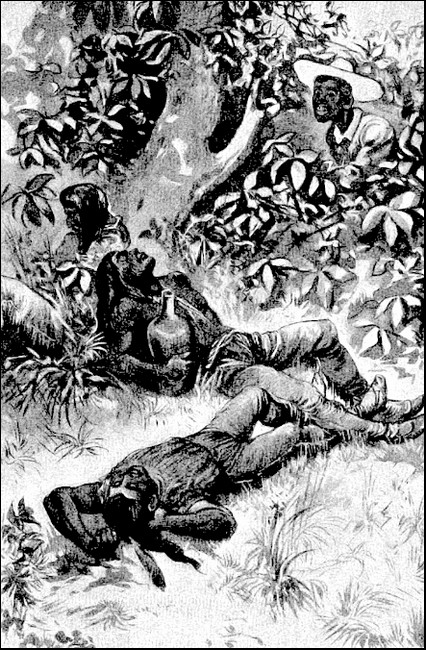
Die Büsche teilten sich, ein schwarzes Gesicht tauchte auf,
verschwand aber sofort wieder beim Anblick der drei Indianer.
Unter einem Baume stand ein Trupp bewaffneter Männer, nach Art der Matrosen gekleidet. Einem derselben, dem größten, warf sich der Neger zu Füßen.
»Nun, was gibt's, Gideon?« fragte ein anderer. »Wer schreit da so laut im Walde?«
»O, Massa, Massa,« heulte der Schwarze, »drei Indianer liegen dort. Sie haben sich alle drei gegenseitig tot gemacht.«
»Donnerwetter, das ist ein Kunststück! Tot sind sie, sagst du, Gideon?«
»Ja, tot! Sie liegen ausgestreckt im Grase.«
Unsere Freunde vom ›Blitz‹ und von der ›Hoffnung‹ sowie Monsieur Aubert, Gideon und Josua, setzten sich in Bewegung, um den Tatbestand zu untersuchen.
Vielleicht kamen sie nun endlich auf eine Spur.
Vorsichtig lugten sie durch das Dickicht, und wahrhaftig, da lagen drei Indianer im Gras, anscheinend leblos.
»Sie sind tot,« flüsterte Josua.
»Ja, aber sie schnarchen,« sagte Georg und begab sich mit seinen Gefährten zu ihnen.
»Die schlafen ganz gemütlich,« rief der Bootsmann erstaunt.
Josua hatte inzwischen schon die Flasche entdeckt, hob sie auf, roch hinein und schmunzelte vergnügt.
»Das riecht gerade wie — wie — will doch mal kosten, was das eigentlich ist.«
»Halt,« sagte aber Georg und riß ihm die Flasche vom Munde, »Whisky ist es, Halunke, und wenn du auch nur einen Schluck davon trinkst, stoße ich dir die Flasche in deinen schwarzen Rachen, daß du acht Tage lang Backzähne spuckst. Dasselbe gilt dir, Gideon, merkt es euch!«
Es wurde festgestellt, daß die drei Indianer vollständig berauscht waren. Da kam der fortgeschlichene Gideon mit der Nachricht zurück, er habe den Platz des Ueberfalles gefunden. Man überzeugte sich sofort von der Wahrheit dieser Angabe.
»Hier viele, viele Soldaten und Indianer gegangen, dort nur wenige. Bei diesen sind die Gefangenen, hier der Fuß der weißen Lady Missis,« erklärte Gideon.
Die Matrosen waren unerfahren im Erklären einer Spur, die beiden Neger wußten etwas davon, aber sie errieten mehr, als sie wirklich schließen konnten. Sie sagten, die Dame befände sich bei dem kleinen Trupp, also bei den anderen Gefangenen und täuschten sich also. Dies kam daher, weil Johanna auf ein Pferd gehoben worden war, und die Neger den kleinen Fuß des Leutnant Ramos für den Johannas hielten.
»Dann wollen wir schnell folgen,« rief Monsieur Aubert begeistert. »Wieviel Mann sind es? Ungefähr zwölf? Pah, die nehme ich ganz allein auf mich.«
»Nur gemach!« entgegnete Georg. »Erst müssen wir diese Indianer unschädlich machen. Wenn sie wieder zu sich kommen, haben wir sie dann auf dem Halse.«
»Wir schneiden ihnen den Hals ab,« schlug der Franzose vor.
»Wenn ich Blutvergießen vermeiden kann, tue ich es.«
Fritz hob die Flasche empor und untersuchte.
»Sechs Liter und über die Hälfte geleert, Donnerwetter, das ist eine Leistung.«
»Wir binden sie einfach,« meinte der Bootsmann.
»Ja, das geht.«
Einer der Indianer murmelte im Schlaf und leckte mit der Zunge die trockenen Lippen.
»Aha, das schmeckte wohl nach mehr,« lachte Georg. »Will doch mal sehen, ob Indianer auch im Schlafe trinken können.«
Er brachte die Kruke an den Mund des Indianers, und dieser begann auch sofort zu schlucken. Unter dem Gelächter der Matrosen ließ Georg ebenso die anderen Schläfer trinken, und er hielt nicht eher an, als bis die Kruke völlig leer war.
»So, das wird wohl einen Tag langen,« lachte Georg. »Jeder Mann zwei Liter, Donner und Doria, da können sie aber gut darnach schlafen.«
»Sie bekommen einen Schlaganfall,« meinte der Franzose.
»So etwas kennen die Indianer nicht; damit sie aber nachher keine Dummheiten machen, wollen wir sie doch lieber an Händen und Füßen binden.«
Georg, der Bootsmann und Fritz drehten die Indianer herum, und im Nu waren deren Glieder mit Stricken umwunden.
»Das wird wohl nicht lange halten,« sagte der Franzose kopfschüttelnd, »die Indianer sind Meister darin, sich einer Bande zu entledigen. Ich habe oft genug davon gelesen, sie können alle Fesseln abstreifen.«
Der Bootsmann klopfte dem Monsieur vertraulich auf die Schulter.
»Ich kalkuliere, daß, wenn wir jemanden binden, derselbe sich nicht selbst befreien kann. Die Knoten sind nicht zu lösen, sie können nur durchschnitten werden.«
Der Franzose kannte nicht den Unterschied zwischen Weber-, Kreuz- und Schlippknoten, er sah unter den Händen der Matrosen einfache Schlingen entstehen und wußte nicht, daß sie sich bei jeder Bewegung enger zusammenziehen mußten.
Georg richtete sich auf.
»So, nun noch einen Knebel!«
Er fuhr mit der Hand in die Tasche, brachte sie aber leer wieder heraus und sah sich mit mißtrauischen Augen im Kreise seiner Kameraden um.
»Hat einer der Gentlemen zufälligerweise ein sogenanntes Schnupftuch bei sich?«
Es begann ein allgemeines Wühlen in den Taschen nach diesem entbehrlichen Gegenstand, und wirklich kamen zwei zum Vorschein. Das eine war ein zierliches Batisttuch, gestickt und mit Spitzen besetzt, das andere war unverkennbar ein Stück aus einem Fenstervorhang.
»Hier,« sagte der Besitzer des ersteren, »es gehört eigentlich einem spanischen Mädchen, ich habe aber in meiner Kiste noch genug solcher Fähnchen.«
Georg stopfte jedem der Indianer eins der zusammengeballten Tücher in den Mund.
»Monsieur, ich bitte um Ihr Taschentuch, dieser Kerl hier braucht es. Sie können es später gewaschen von ihm zurückverlangen.«
Seufzend gab der Franzose sein rotes, ungeheuer großes Taschentuch hin.
»Ein Glück, daß der Kerl ein so großes Maul hat, sonst ginge es gar nicht hinein.
»So, mein Junge, an diesem Priem hast du einige Tage zu kauen.«
Die Indianer wurden in das Gebüsch getragen, und dann besprach man sich, wie die Verfolgung aufzunehmen sei.
Man beschloß, dem Trupp, welcher die Gefangenen mit sich geschleppt, im Laufschritt zu folgen, Gideon und Josua, Neger, welche bekanntlich vom Laufen kein Seitenstechen bekommen, sollten vorauseilen. War es möglich, so konnte man versuchen, die Feinde zu umgehen und zu umzingeln, verboten ungünstiges Terrain oder sonst ein Umstand dieses Manöver, so wollte man die Soldaten einfach mit einem Hurra angreifen.
Der Franzose bekam mit einem Male Bedenken.
»Wir können nicht schießen, sonst treffen wir die Gefangenen,« meinte er vorsichtig.
»Wir gebrauchen die Kolben,« entgegnete der Bootsmann und schwang grimmig die schwere Büchse wie einen Rohrstock um den Kopf.
»Die Soldaten sind aber nicht so außer Atem wie wir, sie können ruhig zielen.«
»Wer fällt, bleibt liegen.«
»Es sind aber reguläre Soldaten.«
»Und wir sind auch keine Strauchdiebe: nicht, Georg?« nickte der Bootsmann dem jungen Matrosen zu.
»Donner und Doria, nein, das sind wir nicht,« rief dieser enthusiastisch. »Was, Fritz, wir haben unter der deutschen Kriegsflagge in Bagamoyo die Palisaden gestürmt, ohne einen Schuß abzugeben, und den Negern die Schädel mit dem Kolben eingeschlagen. Diese lumpigen zehn Spanier? Pah, die laufen bei dem ersten Hurra davon.«
»Ich kann nicht so schnell laufen,« bemerkte der Franzose kleinlaut.
»Dann bleibt zurück.«
Doch Monsieur Aubert wollte aber auch um keinen Preis in der Wildnis, wo Indianer herumstreiften, zurückbleiben.
»Heh, Monsieur, wieviel wiegt Ihr?« fragte ihn Georg.
»Zweiundneunzig Kilo wog ich das letztemal.«
»Paßt auf, zwölf Kilo verliert Ihr bei dem Laufe sicher. Voraus mit euch, Josua und Gideon, eure Namen seien unser Feldgeschrei! Stillgestanden — Gewehr zum Laufschritt — marsch, marsch!« — — — — — —
Hätten Leutnant Diaz und die übrigen Soldaten geahnt, daß die drei Indianer, welche ihnen den Weg sichern sollten, total betrunken, gebunden und geknebelt in einem Busche lagen, sie wären wohl nicht so ruhig durch den Wald marschiert.
Finster schritt Ramos zwischen seinen Wächtern, er öffnete die festgeschlossenen Lippen weder zu einer Frage noch zu einem Seufzer; Johanna, war sein einziger Gedanke, er hatte seinem Wohltäter die Braut nicht sicher zugeführt. Daß er schuldlos an ihrer Gefangenschaft war, konnte ihn nicht trösten.
Patrick dagegen murmelte unaufhörlich vor sich hin; der Teufel und seine Großmutter lagen fortwährend auf seinen Lippen, und immer wurden sie in Verbindung mit den meuternden Soldaten gebracht. Es war gut, daß die Spanier durch den strengen Diaz befehligt wurden. Dieser wunderte sich nicht darüber, daß sich keiner der Indianer sehen ließ; er kannte ihre Gewohnheiten. So lange keine Gefahr vorlag, schlichen sie unbemerkt neben dem Trupp her und spähten nach Feinden.
Einmal vernahm man zur Seite ein lautes Knacken, die Soldaten schraken zusammen, beruhigten sich aber sofort wieder. Einer der Indianer mußte sich ganz gegen die Gewohnheit sehr unvorsichtig benommen haben.
Hätten die Rebellen gewußt, daß dieses Knacken von dem schweren Fuß des Bootsmanns hergerührt hatte, wie entsetzt wären sie gewesen! Die deutschen Matrosen hatten die Feinde bereits umgangen, noch sah ihnen das furchtsame, aber pfiffige Gesicht Josuas aus einem Busch grinsend nach.
Es war schon Nachmittag, als der Trupp eine felsige Gegend erreichte. Auf dem steinigen Grunde standen noch Bäume, sie wurden aber schon seltener, bis sie ganz verschwanden, weil eine Felspartie den Wald unterbrach.
Der Weg führte als Engpaß durch dieses Gebirgsland, links und rechts jäh abstürzende, niedrige Felsen, in der Mitte der schnurgerade Pfad.
Obgleich der Blick weit reichte, konnte man auch hier nichts von den Indianern entdecken, obwohl man sie doch wenigstens in dem langen Wege hätte sehen müssen. Aber es war möglich, daß sie oben auf dem Felsgrate hinliefen, für Indianer war das eine Kleinigkeit, für weiße Soldaten, mit Waffen und Decken bepackt, schon beschwerlicher, und geradezu gefährlich für Menschen mit auf den Rücken gebundenen Händen.
Dort oben konnten sich die Indianer sicher bewegen und eine anrückende Gefahr schnell erkennen.
Leutnant Diaz führte den Trupp in den Engpaß hinein, nach wenigen Minuten schon waren sie von Felsen umgeben.
»Halt,« donnerte da eine mächtige Stimme von oben herab, »nieder mit den Waffen — Arme hoch!«
Einen Blick nur warfen die bis zum Tode erschrockenen Soldaten nach oben, dann ließen sie die Gewehre fallen und streckten die Hände zum Himmel auf. Wohin sie auch sahen, überall begegneten ihre Augen braunen, sogar schwarzen Gesichtern, und neben jedem blitzte ein Büchsenlauf.
Nur Diaz zögerte, die Hände zu heben.
»Arme hoch — sofort! Eins — zwei —« klang es wieder.
Ehe drei gesagt wurde, waren auch des Leutnants Hände oben. Er hielt diese Leute ebenfalls für spanische Wegelagerer, wenn der Anführer auch Englisch sprach. Hier mußte er vorläufig gute Miene zum bösen Spiel machen.
Drei Gestalten glitten von den Felsen herab, eine davon war ein riesiger Mann. Aber sonderbar, sie sahen nicht aus wie Räuber, sondern völlig wie Seeleute. Selbst der blaue Matrosenkragen fehlte ihnen nicht.
»Wer eine Bewegung macht, hat eine Bohne im Leib, die er nicht verdauen kann,« herrschte der Große die Erschrockenen an, »jetzt die Hände auf die Rücken!«
Die Soldaten gehorchten sofort, Diaz bekam aber mit einem Male eine Ahnung, daß er keine gewöhnlichen Wegelagerer vor sich hatte. Er war durchaus kein Feigling, er griff daher nach dem Revolver, um wenigstens wie ein Mann zu sterben, da wurden jedoch seine Hände schon vom Bootsmann gepackt, mit unwiderstehlicher Gewalt zusammengepreßt und auf dem Rücken gebunden.
Diese drei Männer mußten sich im Fesseln ordentlich geübt haben; denn in weniger als einer Minute standen auch die neun Soldaten mit gebundenen Händen da.
Der Engpaß wimmelte plötzlich von Matrosen, unter ihnen ein dicker Mann und zwei Neger.
Georg trat auf Ramos zu, den er an der Uniform als Offizier der Vereinigten Staaten erkannte. Ein Messerschnitt befreite ihn, wie auch Patrick, von den Banden.
»Sie sind gefangen genommen worden?« fragte Georg.
»Ja, von meinen eigenen Soldaten.«
»Ah, also Meuterei! Wartet, Burschen!«
»Es scheint eine völlige Rebellion im Gange zu sein, ich kenne bereits über hundert Soldaten, welche zur Republik Mexiko halten und gegen das Sternenbanner kämpfen wollen. Auch dieser Offizier ist ein Ueberläufer, wie Sie an seiner Uniform erkennen können.
»So, so, na, meine Jungen, dann sollt ihr nachher einmal ein Tauende zu schmecken bekommen. Wie ist Ihr Name?«
»Leutnant Ramos.«
»Also Leutnant, war in Ihrer Begleitung nicht eine junge Dame namens Johanna Lind?«
Aller Augen hingen gespannt an den Lippen des jungen Offiziers, der jetzt zu erzählen begann. Ab und zu mischte sich auch Patrick ein, und bald hatten die Zuhörer alles erfahren, was sie wissen wollten.
»Was!« rief Georg. »Das ist ja eine förmliche Revolution gegen die Vereinigten Staaten! Soldaten, Offiziere, Abenteurer und Indianer, alle verbünden sich, um dem Yankee ein Stück Land wegzunehmen? Hurra, Jungens, wir sind die ersten, welche ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. Ha, Bootsmann, was meinst du, wir verdienen uns hier die Generalstroddel.« »Vergessen Sie nicht die Dame!« warf Ramos ein.
»Natürlich nicht, das ist die Hauptsache. Die befreien wir, und wenn sie auch in dem Hauptquartier der Rebellen gefangen gehalten wird. Sie ist ja die Braut unseres Kapitäns. Leutnant, Sie sind doch der Unsrige?«
Ramos hatte schon dem gefangenen Diaz den Degen abgeschnallt und sich selbst umgegürtet.
»Ich ruhe nicht eher, als bis ich Miß Lind ihrem Bräutigam zugeführt habe,« fügte er einfach.
»Und ich bin auch nicht zu verachten,« fügte Patrick hinzu, Büchse, Revolver und Seitengewehr eines Soldaten ergreifend.
Die Matrosen betrachteten etwas spöttisch den blutjungen Offizier, sie schienen nicht allzu großes Vertrauen in seine Tapferkeit zu setzen. Doch dieser achtete nicht auf sie, mit bleichem Gesicht wandte er sich jetzt an Leutnant Diaz.
»Diaz,« sagte er mit tiefer Stimme, »das Blatt hat sich abermals gewendet!«
»Es ist das Los des Soldaten.«
»Ihr seid kein Soldat mehr.«
»Oho, was sonst?«
»Ihr seid ein Rebell.«
»Aber trotzdem noch ein Soldat. Ich kämpfte für die Freiheit Mexikos gegen die Yankees.«
»Ihr seid mein Gefangener.«
»Ich weiß es, tut mit mir nach Belieben!«
»Dies braucht Ihr mich nicht erst zu heißen. Diaz, Ihr wäret mein Freund, doch jetzt seid Ihr es nicht mehr. Ich bin Offizier der Vereinigten Staaten, Ihr ein Rebell, ich habe das Recht, es ist sogar meine Pflicht, Euch unschädlich zu machen. Die Sicherheit meines Vaterlands erfordert dies.«
»Törichter Knabe,« lächelte Diaz, »Ihr habt noch keine Ahnung, wie weit der Aufstand schon gediehen ist. Ganz Texas steht in Flammen, Mexiko wartet nur auf den ersten Schlag, und seine Truppen rücken auf Befehl der Republik in Texas ein. Falle ich als erstes Opfer, so ist es nur recht. Ueber meinen Leichnam hinweg wird der siegreiche Fuß der Mexikaner stürmen, sie werden mich rächen.«
»Genug,« sagte Ramos mit nachlässiger Handbewegung und zog den Revolver aus dem Gürtel.

Das Lächeln der Matrosen erstarb, sie wußten plötzlich, daß dieser Offizier kein Knabe, sondern ein Mann war. Vielleicht hatte er dem Tod schon öfter ins Auge geblickt als sie. Ein Zug von furchtbarer Entschlossenheit lag auf seinem bleichen Antlitz.
Er setzte die Mündung des Revolvers auf Diaz' Stirn.
»Leutnant Diaz,« fragte er laut, »nennt Ihr Euch einen Offizier der Vereinigten Staaten oder einen Rebellen?«
Diaz zuckte zusammen, sein Gesicht wurde aschfahl. Das hatte er doch nicht erwartet.
»Sprecht.«
Die fest aufeinandergepreßten Lippen öffneten sich nicht.
»Eins — zwei —«
Da richtete sich Diaz empor.
»Ich bin ein Rebell,« sagte er stolz.
Ein Feuerstrom fuhr aus dem Revolver. Mit zerschmetterter Stirn sank Leutnant Diaz zu Boden.
Nicht nur die Soldaten, auch die Matrosen erschraken über dieses furchtbare Gericht, sie hätten dem Leutnant diese Energie nicht zugetraut.
Der Bootsmann trat vor.
»Leutnant,« rief er, »Ihr seid ein Mensch, Ihr dürft einen anderen Menschen nicht wie einen tollen Hund niederschießen. Es sind Gefangene, sie sind wehrlos.«
Ramos blickte den Sprecher fest an.
»Ihr irrt,« entgegnete er kalt, »ich habe das Recht dazu. Ich bin Offizier der Vereinigten Staaten, und ich habe geschworen, einen jeden, der meinem Vaterland gegenüber sich als Rebell zeigt, auf der Stelle zu töten. Ich muß meinen Diensteid halten, diese Leute sind Rebellen. Sie sterben, und wenn mein Bruder unter ihnen wäre.«
Es lag etwas in dem Tone, was dem Bootsmann und dessen Freunden deutlich sagte, nur er, der Leutnant, habe jetzt hier zu befehlen, und unwillkürlich mußte ihm jeder gehorchen.
Der Bootsmann zuckte die Achseln und wandte sich um, einige der Matrosen ließen ein beifälliges Murmeln hören. Meuterei! Entsetzliches Wort — darauf stand auch bei ihnen der Tod.
Ramos wandte sich zu den zitternden Soldaten.
»Ich frage euch nicht erst, zu wem ihr gehört, denn ihr feiges, ehrloses Gesindel würdet mir, um euch zu retten, doch eine Lüge sagen. Ihr seid Meuterer, welche am Galgen sterben müssen. Zum Hängen fehlt hier die Gelegenheit, euch mitzunehmen wage ich nicht, eine Kugel soll euch töten, obgleich ihr keinen Schuß Pulver wert seid. Korporal Patrick O'Brian, ich befehle Euch, in Gemeinschaft mit mir diese neun Meuterer zu erschießen. Die Verantwortung nehme ich auf mich, hier und dort, ihr Blut komm auf mein Haupt, wenn es unschuldig vergossen ist.«
»Zu Befehl, Leutnant!«
Patrick stand schon lange mit schußbereitem Revolver da. Diese drei Worte hatte er in dienstlicher Haltung und Stimme gesagt, jetzt fuhr er vertraulicher fort:
»Macht keine Umstände, Leutnant, ich warte schon lange auf dieses Kommando.«
»Kommt, Kameraden,« sagte der Bootsmann dumpf, »wir dürfen uns hier nicht einmengen, die Gerechtigkeit muß ihren freien Lauf haben.«
Die Matrosen schulterten stumm die Gewehre und marschierten in geschlossener Reihe ab. Niemand sah sich um.
»Wir stoßen wieder zu euch,« rief Ramos hinter ihnen her.
Ein Jammergeheul erscholl, die Gefangenen sahen sich dem Tode nahe. Schuß krachte auf Schuß, immer schwächer wurde das Geschrei, weil jeder Schuß einen Mund zum Schweigen brachte.
»Schrecklich,« flüsterte der Bootsmann.
»Es ist der Krieg,« entgegnete der neben ihm gehende Georg, »da heißt es: Ihr oder wir. Denkt, Bootsmann, wir müssen ebenso unerbittlich handeln, wenn an Bord des Schiffs eine Meuterei ausbricht. Für Meuterei gibt es keine andere Strafe als den Tod; würde Schonung geübt, so würde die Welt aus den Fugen gehen.«
Ob wohl Georg wußte, was für bedeutungsvolle Worte er sprach? Der Stern, welcher seine Bahn verläßt, muß zerschmettern, der Mensch, welcher die Ordnung verletzt, geht zugrunde.
Der letzte Schuß war gefallen, der letzte Schrei verstummt. Die Matrosen schauten rückwärts. Ramos und Patrick zerbrachen die Gewehre und die Säbel, dann eilten sie zu ihnen.
Der Leutnant, den Degen in der Faust, sah nicht mehr bleich aus, sein Gesicht strahlte vor Begeisterung.
»Die Meuterer sind tot!« rief er. »Ich habe von ihnen erfahren, wohin Miß Lind gebracht worden ist. Leute, seid ihr bereit, die Gefangene mit mir zu befreien?«
Ein bejahender Zuruf erscholl aus zwanzig Kehlen.
»Gut! Doch keine Truppe ohne Führer! Wählt einen solchen!«
Die Matrosen, die keinen Knaben mehr vor sich sahen, wählten alle sofort Leutnant Ramos. Er war auch mit den Verhältnissen des Landes am meisten vertraut.
»Ich nehme die Wahl an,« entgegnete Ramos. »Denkt nicht geringschätzig von mir, weil Ihr mich als Gefangenen fandet. Ich wurde von den eigenen Leuten überwältigt, lebendig fällt Leutnant Ramos zum zweiten Male nicht in die Hände der Feinde.«
»Schon gut, führt uns an!« unterbrach ihn Georg.
Der Offizier schwang begeistert den Degen.
»Ich schwöre, den Degen nicht eher in die Scheide zu stoßen, als bis Miß Lind, meine Schutzbefohlene, in Freiheit ist. Felix Hoffmann ist euer Kapitän, mir ist er ein Wohltäter. Es gilt, ihm seine Braut zuzuführen.«
»Ein Schuft, wer anders denkt,« rief Georg, und von Ramos geführt, eilten die Matrosen den Weg zurück, den sie gekommen waren.
Ein Teil des Tempels, äußerlich ebenfalls ein terrassenartiger Aufbau, innen aber ein einziger, großer und hoher Raum, diente in alten Zeiten dazu, dem Huitzilopochtli, dem Gott dieses Tempels, Menschen zu schlachten.
Gegen fünfhundert Indianer füllten gegenwärtig den Saal. Scheu drückten sich die bemalten und mit Federn geschmückten Gestalten an die Wand, sie sollten ein Schauspiel zu sehen bekommen, wie es bei ihren Vorvätern üblich gewesen war.
Hier und da stand ein ungeschmückter Indianer, einer der ständigen Bewohner des Tempels und hielt eine Pechfackel hoch. Unheimliche Bilder beleuchtete das flackernde Licht.
Im Hintergrund erhob sich eine riesige Figur aus Bronze, ein Scheusal, halb Mensch, halb Tier vorstellend. Davor stand ein mächtiger, oben glatter Felsblock, der Altar. Auf ihm war früher so manches Mal Menschenblut geflossen, heute sollte es wieder geschehen, denn Huitzilopochtli, der Götze, fand Wohlgefallen an Menschenopfern.
Eine Menge von vermummten Indianern umringten den Altar, es waren diejenigen, welche dem Opfernden Handreichungen leisten sollten. Doch dieser selbst, Sonnenstrahl, fehlte noch, ebenso Waldblüte.
Neben dem Götterbild kauerten oder standen die Gefangenen, unsere Freunde und Freundinnen, mit bleichen Gesichtern zwar, aber dennoch Hoffnung im Herzen.
Sharp und sein Gefährte waren in der Nähe, sie hatten ihnen unbedingte Rettung versprochen. Sonnenstrahl und Waldblüte seien selbst aus ihrer Seite, und auch der alte Vater würde noch gewonnen werden.
Arahuaskar hockte auf einem niedrigen Schemel. Neben ihm erhob sich ein zweisitziger, thronartiger Stuhl. Er war für Sonnenstrahl und Waldblüte bestimmt.
Van Guden fehlte noch, ebenso Stahlherz, mit dessen Opferung begonnen werden sollte, um den Indianern ein abschreckendes Beispiel zu geben, falls doch einer unter ihnen wäre, welcher den Bleichgesichtern freundlich gesinnt war.
Doch dies war nicht zu fürchten, alle diese Indianer waren die grimmigsten Feinde der Weißen, die rachgierigsten, aber auch die unbesonnensten, sonst hätten sie dem Boten Arahuaskars nicht so leicht Gehör geschenkt. Sie waren von einem Wahn betört worden.
Ebenso fehlten noch der alte Vater und Miß Morgan.
Noch war es Nacht, aber die Zeit nicht mehr fern, da der erste Sonnenstrahl durch die Maueröffnung fiel, und mit dem Aufblitzen desselben mußte die Opferung beginnen — so wollte es Huitzilopochtli haben, er hatte einst seinen Willen dem Gründer des Kultus zu erkennen gegeben.
»Sie sollen kommen,« krächzte Arahuaskar leise einem Diener zu.
Der Diener wußte, wer gemeint war, der alte Vater und der Holländer. Gleichzeitig mit Stahlherz sollte Sonnenstrahl eintreten.
Der Diener, es war Schmalhand, ging nach der Zelle des Holländers, welche der alte Vater zuletzt aufgesucht hatte, fand diese aber zu seinem Erstaunen leer. Er ging, um sich zu überzeugen, daß Stahlherz noch in seiner Zelle war.
Wo aber war Clas van Guden?
In einem entfernten Teile der Ruine befand sich ein kleines Gemach, anscheinend die Stube eines Gelehrten, denn sie war mit Büchern, Pergamenten und Schriftstücken angefüllt. Drei Personen befanden sich in diesem Räume.
Nick Sharp stand an dem Mauerloch und schaute hinaus. Ein am Boden liegendes Bärenfell verriet, daß er als Bär hierhergekommen war.
In einem Lehnstuhl saß tiefgebeugt der alte Gelehrte und hielt die Hände des Holländers in den seinen, welcher vor ihm auf den Knien lag. Der sonst so starke Mann war völlig gebrochen, Tränen liefen ihm über die Wangen, und er schluchzte wie ein Kind.
»Vater, ist es nur möglich?« rief er ein über das andere Mal. »Du lebst wirklich, du hast nicht in England am Galgen geendet?«
Nick Sharp hatte diese Szene herbeigeführt. Die äußere Aehnlichkeit der beiden Männer war ihm nicht entgangen. Außerdem war er einer von denen, welche wußten, daß der des Hochverrats Angeklagte van Guden nicht die Todesstrafe erlitten hatte.
Als Detektiv war ihm so mancher dunkle Punkt bekannt, über den er jedoch reinen Mund halten mußte, wollte er nicht andere ins Unglück stürzen.
»Ich bin es wirklich,« entgegnete der Alte tränenden Auges.
»Ja, aber wie kam denn nur alles? Entsprangst du, oder wurde dir die Freiheit geschenkt?«
»Mir ist das meiste selbst noch ein Rätsel. Mir wurde die Freiheit geschenkt. Auf geheimnisvolle Weise wurde ich forttransportiert, man gab mir die Mittel, mir fortzuhelfen, ich erhielt aber zugleich den strengen Befehl, mich nie wieder in England blicken zu lassen. Als ich im fremden Land den Fuß von Bord setzte, erfuhr ich, der Hochverräter van Guden sei in England öffentlich gehängt worden. Ich galt also für tot, aber mein Haß gegen die ungerechten Richter lebte fort. Ich erfuhr, daß alle Glieder meiner Familie tot oder verschollen seien; auch du seiest tot.«
»So hat man einen anderen statt deiner gehängt,« rief Clas erstaunt. »Seltsam, das war auch mein Schicksal.«
»Ich kann das Rätsel erklären,« ließ sich Sharp am Fenster hören. »Sie waren allerdings schon zum Strange verurteilt, Mynheer, aber einem der Richter war es doch bewußt, daß Sie unschuldig waren. Er gab Ihnen die Freiheit und ließ einen anderen Verbrecher statt Ihrer hängen. Es war allerdings grausam, Sie zeitlebens zu entehren, aber ich kenne grausamere Ungerechtigkeiten.«
»O, es gibt nichts Furchtbareres als einen Menschen leben zu lassen und ihn für tot zu erklären.«
»Doch! Man hätte Sie henken lassen können.«
»Das wäre mir lieber gewesen.«
»Der Richter war nicht so ungerecht, wie Sie meinen. Er hätte Sie auch, fühlte er doch etwas Mitleid, das heißt, wollte er sein Gewissen nicht mit einem Mord beflecken, für immer in einen Kerker verbannen können. Aber er gab Ihnen die Freiheit, Sie konnten wenigstens auf Vergeltung sinnen. Das ist für manche Menschen ein großer Trost.«
»Der Richter war ein Schurke,« entgegnete der Alte heftig, »er hätte, wußte er von meiner Unschuld, mit aller Kraft, ja, mit seinem Leben für seine Ueberzeugung einstehen müssen.«
»Urteilen Sie nicht vorschnell, Mynheer. Das Parlament hatte Ihren Tod beschlossen, bevor ein Mitglied desselben von Ihrer Unschuld erfuhr. Hätte sich das Parlament blamiert, indem es einen schwerwiegenden Irrtum zugab, so wäre dies von den ungeheuersten Folgen gewesen; das Volk selbst wollte Ihren Tod, also mußten Sie sterben.«
»Es ist eine Grausamkeit, wie sie noch nie dagewesen ist,« stöhnte der Alte.
Des Detektiven Stimme klang seltsam weich, als er sagte:
»Mynheer, ich bin kein bibelfester Mann, doch eine Stelle fällt mir ein, weil sie mich in meiner Kindheit oft bis zu Tränen gerührt hat. Ein Mensch stand vor seinem Richter, mit keiner einzigen Sünde befleckt.
»›Kreuzige, kreuzige ihn!‹ schrie das Volk, und der Richter gehorchte. Ich konnte Pilatus nie verdammen, und warum warfen die anderen Menschen keinen Stein auf ihn?«
Der Alte schwieg, dies Beispiel hatte gewirkt.
»Es kommt öfters vor, daß der Richter ein Auge zudrückt, manchmal auch beide, wo eigentlich die Strenge des Gesetzes walten sollte,« fuhr Sharp fort, »so gleicht sich alles in der Welt aus. Fragen Sie Ihren Sohn, er kann ein Beispiel davon erzählen.«
»Wahrhaftig, ich kann's,« rief Clas und erzählte seine Geschichte.
»Dieser Mann da, obgleich ein Detektiv, also ein Diener der Justiz, hat mich gerettet,« schloß er seine Erzählung.
»Nicht ich war es eigentlich,« sagte Sharp, »sondern Kapitän Staunton wünschte, daß Sie dem Leben erhalten blieben. Das Mitleid überwog sein Gerechtigkeitsgefühl, ich sprach ihm dann auch noch zu, denn auch ich hielt Sie sonst für einen ehrenwerten Mann. Außerdem wollte ich mich in die Bande der Verbrecher schleichen, welche hängen sollten, ich suchte den stärksten Mann aus, malte ihn an, daß er Ihnen ungefähr ähnlich sah, und dieser mußte dann an Ihrer Stelle hängen, während Sie auf und davon gingen. Ich selbst gab mich für den Verbrecher aus. Es war allerdings ein gewagtes Spiel, aber es glückte. Die Meuterer erkannten in ihrer Todesangst nicht einmal den eigenen Kollegen.«
»So haben Sie mir also meinen Sohn erhalten!« rief der Alte.
»Gewinne wieder Lebensfreudigkeit!« bat Clas. »Wir sind doch nun wieder zusammen. Wir wollen glücklich sein und das uns zugefügte Unrecht vergessen.«
»Und den Haß,« ergänzte Sharp.
»Das wollen wir tun, mein Sohn, doch,« der Alte schrak zusammen, »wir sind ja nicht allein. Unten harren fünfhundert Indianer der Menschenopfer, und auch du bist dazu bestimmt.«
»Gemach, Mynheer,« sagte Sharp, »und frischen Mut gefaßt. Arahuaskar träumt zwar noch, aber er wird bald erwachen.«
»Ich weiß, daß seine Pläne unausführbar sind, ich bestärkte ihn nur in denselben, weil ich mit Hilfe der Indianer Rache an den Engländern nehmen konnte, dann wollte ich sterben. Nun denke ich anders. Doch wehe, die Opfer werden Arahuaskar nicht entgehen.«
»Eine Stunde fehlt noch bis zum Tagesanbruch.«
»Wie bald ist diese verstrichen! Und dann?«
»Ich kalkuliere, Arahuaskar wird nicht opfern.«
»Er tut es doch!«
»Und Sonnenstrahl?«
»Ich weiß nicht, wie er denkt,« erklang es zögernd.
»Und Waldblüte?«
»Ich glaube fast, sie stimmt am meisten gegen die Menschenopfer.«
»So lassen Sie sich sagen, daß weder Sonnenstrahl noch Waldblüte sich dazu hergeben werden, einen Gefangenen zu schlachten.«
Der Alte lächelte.
»Ich ahnte es fast,« lispelte er. »Verstehen Sie es einzurichten, so können diese beiden alles verhindern.«
»Verlassen Sie sich darauf, sie sind von mir gut instruiert worden. Waldblüte wird nicht die ihr von Arahuaskar in den Mund gelegten Worte wiederholen, sondern die meinigen, und diese laufen denen Arahuaskars entgegen. Die Indianer selbst werden die Gefangenen befreien, Arahuaskar mag heulen, wie er will.«
»Ah, das ist gut,« rief der Alte und sprang mit dem Feuer eines Jünglings empor, »dann ist Hoffnung auf Rettung vorhanden, wenn nichts anderes dazwischenkommt.«
»Hoffen wir das beste. Doch nun eine ernste Frage an Sie, Sie werden nicht mehr zögern, mir offen zu antworten. Wer ist Stahlherz, den Arahuaskar und Schmalhand hassen?«
Verwundert blickte der Alte auf.
»Woher wissen Sie etwas davon?«
»Wer ist Stahlherz?«
»Der Vater von Sonnenstrahl und Waldblüte.«
»Also doch! Wir ahnten es. Nun bitte ich Sie, mir so kurz wie möglich die Geschichte dieser beiden Kinder zu erzählen.«
Der Alte seufzte tief auf, dann begann er:
»Sie irren, wenn Sie meinen, Arahuaskar und Schmalhand hassen Stahlherz. Es ist kein Haß, was die beiden veranlaßt, diesen Indianer aus dem Wege zu räumen, sondern die Furcht vor Rache. Arahuaskar kam auf den wahnsinnigen Einfall, das alte Reich der Azteken wiederherstellen zu wollen. Er hatte lange Zeit in Ruinen gelebt, hauptsächlich in diesen hier, anfangs nur, um nach Schätzen zu suchen, dann aber fing er nach und nach an, sich für die Geschichte der Azteken zu interessieren, er lernte ihre Pergamente lesen und bekam die Idee, die alte Herrlichkeit wieder aufzurichten. Die Einsamkeit, vieles Lesen und die Ueberbleibsel von Götzen, Altären und so weiter erhitzten seine Phantasie, sein Plan wurde zum Entschluß. Er selbst fühlte sich schon zu alt; seinen jungen Begleiter Schmalhand hielt er nicht für fähig, die Rolle eines Priesters und Häuptlings zu spielen, und so sah er sich nach Personen um, womöglich Kindern, welche er in seinem Sinne erziehen wollte. Ein Knabe und ein Mädchen waren dazu nötig.
»Damals lebte im Walde in einer einsamen Hütte ein Indianer mit seiner jungen Frau. Niemand wußte, woher sie stammten und kamen. Es mochten Verstoßene sein. Der Mann, es war Stahlherz, lebte von der Jagd und verkehrte mit niemandem. Das Ehepaar hatte zwei kleine Kinder, einen Sohn von zwei, eine Tochter von einem Jahre. Diese erkor sich Arahuaskar, und Schmalhand mußte den entsetzlichen Plan des Greises ausführen.
»Eines Tages, als Stahlherz abwesend war — wir kannten seinen Namen damals noch gar nicht — schlich sich Schmalhand nach der Hütte. Diese war dicht verhangen, jede Ritze war mit Moos verstopft, dennoch aber drang überall feuchter Qualm heraus. Schmalhand als Indianer konnte sich sofort erklären, was hier vorging. Es wurden Vorbereitungen getroffen, die Kinder zu tätowieren. Dazu wird im Inneren der Hütte ein Feuer angemacht, Steine werden hineingelegt, und sind diese glühend, so gießt man Wasser darauf. Der feuchte Dampf erfüllt die Hütte und macht die Haut der nackten Kinder geschmeidig, so daß die Tätowierung weniger schmerzhaft ist.
»Schmalhand wußte, daß Stahlherz abwesend war. Kurz und gut, er raubte die Kinder, band das Weib und zündete die Hütte an. Der zurückgekehrte Stahlherz fand den verkohlten Leichnam seiner Frau, aber von den Kindern keine Spur. Der scharfsinnige Indianer wußte schon nach der ersten, oberflächlichen Untersuchung, daß hier ein Kindesraub und Gewaltakt vor sich gegangen war, er fand die Spur Schmalhands und sogar diesen selbst, aber der Räuber entwischte ihm mit den Kindern.
»Seitdem ist Stahlherz unermüdlich gewesen, den Räuber seines Glückes wiederzufinden, womöglich auch seine Kinder. Schmalhand und Arahuaskar zitterten bei dem Gedanken, das Vorhaben könnte ihm glücken, denn die Rache des Vaters wäre eine furchtbare. Oft schon haben sie versucht, Stahlherz zu töten, aber es gelang ihnen nie, ihm etwas anzuhaben. Stahlherz ist ein gewaltiger Krieger, er spottet aller Feinde. Dennoch schien es, als ob es ihm nicht gelingen würde, seine Kinder wiederzubekommen. Dann war er längere Zeit mit einem weißen Manne, einem Waldläufer, zusammen, der ihn in seinen Nachforschungen unterstützte.«
Der Detektiv nickte.
»Dieser verschwand, doch jetzt ist er wieder aufgetaucht. Stahlherz wäre nun verloren, aber das Schicksal nimmt eine andere Wendung, er wird seine Kinder wiederfinden und wahrscheinlich leben bleiben.«
»Er weiß bereits, daß Sonnenstrahl und Waldblüte seine Kinder sind,« entgegnete Sharp.
»Wer hat ihm das gesagt?«
»Nicht ich, sondern eben jener Waldläufer, von dem Sie vorhin sprachen. Er befindet sich hier in der Maske eines Bären.«

»Deadly Dash?«
»Deadly Dash,« bestätigte Sharp. »Der Waldläufer hat die Kinder zuerst erkannt und dies Stahlherz mitgeteilt, ihm sie auch gleich zugeführt. Sie sind schon bei ihrem Vater und freuen sich mit ihm.«
Er fragte den alten Mann nicht, inwieweit er an dem Kinderraub mit beteiligt gewesen, unschuldig war er jedenfalls nicht daran. Doch er wollte das Glück der beiden Wiedervereinigten nicht durch Erinnerungen stören.
Vater und Sohn schmiedeten beim Scheine der trübe brennenden Lampe Pläne für die Zukunft, während Sharp an dem Mauerloche stand und in die Nacht hinausblickte.
Wäre es Tag gewesen, so hätte Sharp den Wald sehen können, aber die völlige Finsternis hinderte auch sein scharfes Auge, irgend etwas zu unterscheiden.
Dennoch blickte er, einen eigentümlichen Zug im Gesicht, den Kopf weit vorgestreckt, aufmerksam hinaus, als bemerke er etwas Außergewöhnliches.
»Ruhig!« rief er jetzt den Sprechenden zu.
Diese wurden aufmerksam.
»Was gibt's?« fragte Clas van Guden, zu ihm tretend.
»Ich höre ein seltsames Murmeln,« flüsterte Sharp.
»Es ist der in den Zweigen rauschende Wind,« meinte der Alte.
»Nein, dies Geräusch kenne ich. Es klingt eher wie das Murren einer aufgeregten Volksmasse in der Ferne.«
»Die Indianer im Erdgeschoß rufen nach den Opfern.«
»Es kommt aus dem Walde. Mynheer, Sie sind Astronom. Wann bricht die Morgendämmerung an?«
Der Alte sah nach einer Uhr.
»In zwanzig Minuten muß der erste Strahl der Sonne die Gegend erhellen.«
»Ich bin begierig, was er mir enthüllen wird.« —
Schmalhand, eine Fackel tragend, war nach jener Zelle geeilt, in welcher Stahlherz gefangen lag. Er glaubte natürlich, er wäre allein, denn außer dem alten Vater und Miß Morgan waren alle in dem großen Saale.
Ein bösartiges Lächeln lag auf seinem Gesicht, während er durch die Gange huschte. In wenigen Minuten sollte der geopfert werden, dessen Rache er so sehr fürchtete.
Er stieg eine Treppe hinauf und stieß mit Miß Morgan zusammen, welche sich eben von einem Mauerloche wegwendete. Die Fackel erleuchtete ein von Entsetzen bleiches Antlitz.
»Wo ist Stahlherz?« fragte sie den betroffen aussehenden Indianer sofort.
Er blieb die Antwort schuldig, er konnte sich den Grund zu dieser Frage nicht erklären.
»Sonnenstrahl und Waldblüte sind bei ihm.«
Schmalhand ließ vor Schreck die Fackel fallen.
»Sie nennen ihn Vater.«
Jetzt war es mit dem Indianer völlig aus; wie ein Sterbender lehnte er sich an die Wand.
»Und ich höre noch eine andere Stimme sprechen, es ist die eines Weißen. Wer ist das?«
Schmalhand raffte sich zusammen, verlöschte die Fackel und näherte sich dem Mauerloche, welches zu der Zelle von Stahlherz führte. Schmalhand sah seinen verruchten Streich verraten, er wollte sich aber von der ihm drohenden Gefahr überzeugen.
Er bog sich hinab. Er konnte zwar unten nichts sehen, hörte aber deutlich flüstern:
»Vater, wir befreien dich oder sterben mit dir,« sagte Sonnenstrahl.
»Wir brauchen nicht ans Sterben zu denken. Spielt Waldblüte ihre Rolle gut, so werden wir die Indianer bald auf unserer Seite haben und Arahuaskars Anschläge zuschanden machen. Auch der alte Vater ist der Unsrige, der Holländer ist schon frei. Und mißglückt unser Plan, so wollen wir zeigen, daß wir es auch mit fünfhundert Indianern aufnehmen können.«
Wieder erschrak Schmalhand furchtbar.
Diese Worte hatte kein Indianer gesprochen, es mußte ein Weißer gewesen sein, die Gurgellaute fehlten. Wer konnte sich eingeschlichen haben? Wie war das möglich? Schmalhand entsann sich plötzlich der gefundenen Leichen und der Blutlachen.
Jetzt sprach Stahlherz.
»Nur nach Rache sehne ich mich. Der Mann, welcher mein Weib ermordet hat, muß von meiner Hand fallen, dann will ich sterben. Fluch meinen Brüdern, zu Mördern wurden sie — Stahlherz wird gegen sie kämpfen, er haßt sie alle.«
»Dein Feind ist mein Feind,« sagte Sonnenstrahl, »auch ich werde gegen die kämpfen, welche meine Mutter töteten und mich raubten.«
»Diese Genugtuung soll euch werden,« ließ sich wieder der Weiße vernehmen, »erst aber müssen wir dafür sorgen, die Mordgedanken der Indianer zu unterdrücken, um meine Freunde zu retten, und dazu können uns nur Sonnenstrahl und Waldblüte verhelfen.«
»Ich werde mich so lange beherrschen,« entgegnete Sonnenstrahl.
»Auch ich helfe erst denen, welchen ich Freundschaft versprochen habe,« stimmte Waldblüte bei.
Schmalhand bückte sich, hob die verloschene Fackel auf und zog ein Feuerzeug aus dem Gürtel.
»Was willst du tun?« fragte ihn Miß Morgan leise, welche vor einem anderen Mauerloche stand und ebenfalls lauschte.
»Schmalhand will sich Gewißheit verschaffen, wer der fremde Mann ist,« klang es flüsternd zurück, und selbst der leisen Stimme konnte man das Beben anmerken.
Schmalhand ging etwas abseits, schlug vorsichtig Feuer, entzündete die Fackel und schlich sich, dicht am Boden sich bewegend, damit das Licht sein Vorhaben nicht verriet, wieder dem Loche zu.
Plötzlich fiel die brennende Fackel in die Zelle hinab und ließ deutlich die Personen erkennen.
Schmalhand und Miß Morgan spähten durch die Löcher. Sie sahen unten Stahlherz und Sonnenstrahl und Waldblüte zusammenstehen, daneben legte eben ein großer, starker Mann mit blonden Locken und kurzem Vollbart das Fell eines Bären an.
»Verraten!« schrie dieser Mann, als die Fackel zwischen ihnen auf den Boden fiel.
»Deadly Dash!« gellte Schmalhands Stimme.
»Ja, Deadly Dash; er kommt, dich zur Rechenschaft zu ziehen,« erklang es von unten herauf. Die Fackel war ausgetreten worden, es herrschte wieder Finsternis.
Unten wurde eine Tür zugeworfen.
»Verloren — alles verloren!« schrie Schmalhand und lief davon, die bestürzte Miß Morgan allein zurücklassend.
Wie ein Wahnsinniger stürzte er durch die Gänge, sprang Treppen hinab und hinauf, stieß in der Dunkelheit an Ecken, fiel, ließ sich aber nicht aufhalten, bis er den Saal erreichte, wo Arahuaskar seiner Antwort harrte.
Alle staunten, als der Indianer in den Saal stürzte und auf Arahuaskar zusprang. Er gebärdete sich wie ein Wahnwitziger.
»Was gibt's?« rief der Greis ihm entgegen.
»Wir sind verraten!« keuchte Schmalhand, »Sonnenstrahl hat seinen Vater erkannt — Deadly Dash ist bei ihm — sie wollen uns töten — dich und mich — Sonnenstrahl verstellt sich — er will die Gefangenen befreien.«
Arahuaskar glich jetzt völlig einem Toten, seine Augen verschwanden ganz in den Höhlen.
»Mensch, du rasest!«
»Ich spreche die Wahrheit, ich habe sie belauscht.«
Arahuaskar sah seine Pläne vernichtet. Er hatte es oft gefürchtet, jetzt wußte er, daß Sonnenstrahl anders dachte als er. Hatte Sonnenstrahl den Vater erkannt, so war er verloren — Deadly Dash — die Rache kam!
Arahuaskar richtete sich auf, er hatte sich gefaßt. Er mußte sich sogleich retten, in einer Minute vielleicht schon konnte Stahlherz mit seinem Sohne vor ihm stehen.
Eben brach der erste Strahl der Dämmerung durch die Scharten, jetzt hätte die Opferung beginnen sollen.
»Kinder des großen Geistes!« rief seine schneidende Stimme den lautlos harrenden Indianern zu. »Verrat ist unter uns gesponnen worden, Verrat gegen uns, die Diener Huitzilopochtlis, Verrat von euren eigenen roten Brüdern. Sie wollen nicht, daß die Gefangenen geopfert werden, sie lieben die verfluchten Bleichgesichter, sie wollen die Gefangenen befreien. Auf, tapfere Krieger, erhebet die Waffen gegen sie, schont ihrer nicht, weder Männer, noch Weiber. Folgt meinem Rate, Huitzilopochtli will ihre Häupter, gespalten von euren scharfen Tomahawks, zu seinen Füßen liegen sehen. Auf, auf! Oder zittert ihr vor einem Verräter und vor einem Weibe? Sie hat Huitzilopochtli verhöhnt, sie und ihre Angehörigen, sie alle müssen sterben!«
Unheimlich gellte die Stimme des Alten durch das Gewölbe, er sprach das Todesurteil über Sonnenstrahl und Waldblüte aus. Er hatte sie nicht geliebt, sie waren nur Werkzeuge seiner Pläne gewesen, und jetzt, da sie ihm schädlich zu werden drohten, mußten sie sofort vernichtet werden.
Schmalhand hatte die ihm anvertrauten Indianer, die Bewohner der Ruine, schon benachrichtigt. Diese alle wußten um das Geheimnis, sie kannten die Abstammung der Geschwister, und sofort begriffen sie die ihnen drohende, furchtbare Gefahr.
Sonnenstrahl und Waldblüte, vor allen Dingen aber Stahlherz und auch Deadly Dash mußten sofort unschädlich gemacht werden.
Sie mischten sich unter die übrigen Indianer; es war leicht, die nach Kampf dürstenden Rothäute zu gewinnen. Schon nach einer Minute gellte wildes Kriegsgeschrei durch das Gewölbe, und von Schmalhand geführt, stürzte eine Bande entmenschter Krieger durch die Gänge, der Zelle zu, wo vorhin die Unterredung stattgefunden hatte.
Die Morgendämmerung beleuchtete den Weg der Rasenden.
Da sah Schmalhand drei Gestalten, welche eben um eine Ecke biegen wollten, darunter ein Weib.
»Sie sind es,« schrie Schmalhand, »die Verräter! Greift sie, schont sie nicht!«
Schmalhand glaubte, die Bedrohten würden vor der Uebermacht fliehen; aber er hatte sich geirrt.
Der größere der beiden Männer drehte sich um als die Stimme hinter ihm ertönte, er kannte sie, schon einmal hatte er sie gehört. Sonnenstrahl hatte ihn bewaffnet, in seiner Hand glänzte der Stahl eines Tomahawks.
»Vater,« schrien Sonnenstrahl und Waldblüte gleichzeitig, welche hatten fliehen wollen.
Allein der Ruf seiner Kinder hielt Stahlherz nicht zurück, mit geschwungenem Tomahawk stürzte er den Indianern entgegen, denn dort stand der, den er schon seit fünfzehn Jahren suchte.
Ihm folgte Sonnenstrahl, ebenfalls den Tomahawk in der Hand; er wollte mit dem wiedergefundenen Vater sterben.
Schmalhand sah den anstürmenden Rächer; ein Beben befiel ihn, scheu drückte er sich in die Reihen der roten Kameraden zurück.

Schmalhand sah den anstürmenden Rächer, und scheu
drückte er sich in die Reihen der roten Kameraden zurück.
Da prallte Stahlherz mit den vordersten der Krieger zusammen, die Tomahawks schmetterten gegeneinander, Funken sprühten aus den Schneiden, aber kein Arm konnte dem Schlage des dem Untergange geweihten Indianers widerstehen.
Gelähmt sanken die Arme herab; jeder Hieb zerschmetterte einen Schädel; immer weiter floh Schmalhand, aber immer mehr arbeitete sich der unwiderstehliche Stahlherz in die dichten Reihen hinein, bis er den Mörder seines Weibes erreicht hatte.
Der Tomahawk schmetterte herab, Schmalhands Kopf war bis an den Hals gespalten.
Es schien Stahlherz' letzter Schlag gewesen zu sein, Arme umschlangen ihn von hinten und suchten ihm die Waffe aus der Hand zu winden. Man wollte diesen Würger lebendig haben, aber noch einmal wurde sein Arm befreit.
Sonnenstrahl kam ihm zu Hilfe. Er kämpfte jetzt gegen die, zu deren Herrscher er bestimmt gewesen war, und mit Schrecken sahen die Indianer, welch furchtbaren Feind sie vor sich hatten. Niemand hielt ihm stand, neben seinem Vater hauste er wie der leibhaftige Tod.
Die Männer kannten ihn nicht; sie hatten ihn nie gesehen, und am allerwenigsten dachten sie daran, daß sie den vor sich hatten, den sie noch vor wenigen Minuten als ihren Fürsten erwartet hatten.
Doch so furchtbar Vater und Sohn auch wüteten, ihr Schicksal war besiegelt.
Immer neue feindliche Massen drängten heran, und schließlich lagen beide gefesselt am Boden, von den Indianern halb erdrosselt. Rings um sie her war der Boden mit von ihnen erschlagenen Kriegern bedeckt.
Auch Waldblüte war gefangen genommen worden.
Sie hatte ihr Messer nicht umsonst im Gürtel getragen, es stak im Rücken eines Indianers, der röchelnd am Boden lag. Er war, dem Federschmuck nach zu schließen, ein mächtiger Häuptling gewesen, und seine Krieger blickten grimmig auf das Weib, welches gewagt hatte, die Hand gegen einen Häuptling aufzuheben.
Pantherzahn, der mächtigste Häuptling, war von der Hand eines Weibes gefallen! Die Mörderin durfte nicht einfach sterben, sie mußte einen zehnfachen Tod erleiden.
Die Indianer verschmähen es nicht, auch Weiber den grausamsten Martern auszusetzen.
Die Geschwister standen neben dem Vater und sahen den Feinden entschlossen ins Gesicht. Was konnte ihrer warten? Der Tod? Sie wünschten, er würde sogleich an ihnen vollzogen. Martern? Bah, sie wollten ihrer spotten.
Die Häuptlinge taten ihr möglichstes, ihre Krieger davon abzuhalten, sofort Hand an die Gefangenen zu legen. Kaum gelang es ihnen, die Aufgeregten zu beschwichtigen.
Da erschien auch noch Arahuaskar.
»Keine Schonung, tötet sie,« kreischte er, »es sind Zauberer, sie entschlüpfen euch wieder.«
Wieder wurden die Tomahawks geschwungen, aber wie gelähmt sanken die Arme am Leibe herab, als durch die Mauerlöcher plötzlich Trompetengeschmetter hereintönte und man das taktmäßige Stampfen von Tritten vernahm.
Die Indianer kannten diesen schrecklichen Klang, Militär rückte heran.
Der Erschrockenste war Arahuaskar selbst, er glaubte fast, seine Götter selbst mischten sich jetzt in die Angelegenheit. Er trat vor ein Mauerloch, und so weit sein Auge reichte, sah er Weiße, nicht alle in Uniform, aber doch die meisten.
Die Ruine mußte während der Nacht von ihnen besetzt worden sein, sie begannen sich schon zu verteilen, Männer in mexikanischer Uniform sammelten sich, desgleichen solche in der der Vereinigten Staaten und wieder solche, welche keine Uniform trugen.
Es mochten gegen dreihundert Mann sein, darunter viele Offiziere; was Arahuaskar aber am meisten mit Schrecken erfüllte, war, daß draußen auch gegen sechshundert Indianer lagerten.
Er erkannte alle benachbarten Stamme, hauptsächlich waren die Apachen vertreten. Auch Pferde waren in stattlicher Anzahl vorhanden.
Kamen die Leute in feindlicher Absicht? Doch nein, dort stand Miß Morgan und sprach mit einem spanischen Offizier. Der Mann strich seinen langen Knebelbart und hörte, spöttisch lächelnd, der Erzählung des Weibes zu.
Kein Zweifel, Miß Morgan sprach von ihnen. Sollte sie eine Verräterin sein?
Arahuaskar sollte nicht lange im Zweifel über das bleiben, was hier vorgefallen war.
Eine halbe Stunde später schon hatte seine Herrschaft in der Ruine aufgehört; die Neuangekommenen Indianer mischten sich unter die, welche er für seine Ansichten gewonnen, und er selbst stand, von einem Indianer gestützt, vor dem Offizier mit dem Knebelbart.
Mit gerunzelter Stirn hörte er den Mann an, der ruhig und freundlich sprach, aber vor dem Priester Huitzilopochtlis durchaus keine Ehrfurcht zeigte. Vielmehr ließ er deutlich durchklingen, daß er unbedingten Gehorsam verlange.
»Es freut mich, hier so viele, tapfere Indianer beisammenzufinden,« fuhr der Offizier fort, »welche aber gewillt sind, die Yankees aus dem Lande zu werfen. Dies ist auch meine Absicht und die meiner Leute, wir werden also mit den Indianern zusammen gegen die Verhaßten kämpfen und nicht eher die Waffen ruhen lassen, als bis sie Amerika geräumt haben.«
Der Alte war doch nicht so leichtgläubig, wie der Offizier der Rebellen gemeint hatte.
»Nicht gegen die Yankees allein, gegen alle Bleichgesichter wollen wir kämpfen,« war die unwillige Antwort.
»Warum?«
»Weil wir sie hassen.«
»Warum?« wiederholte der Offizier, der in jeder Weise vorbereitet war.
»Weil sie uns das genommen haben, was uns gehört hat.«
»Richtig, aber nicht wir, sondern die Yankees sind die Räuber. Wir sehen das euch zugefügte Unrecht ein, und wir werden euch beistehen, wieder in den Besitz eures Landes zu kommen. Haben wir das erreicht, so ziehen wir uns zurück und lassen euch schalten und walten, wie ihr wollt.«
Der Offizier, ein Spanier, war an den Unrechten gekommen. Arahuaskar wußte in der Geschichte Amerikas so gut Bescheid, wie er.
»Ihr wollt uns behilflich sein, die Yankees zu vertreiben, damit wir unser Gebiet wieder einnehmen können?« entgegnete Arahuaskar spöttisch. »Du bist ein Spanier, und gerade Spanier sind es gewesen, welche uns —«
»Genug,« unterbrach ihn der Offizier mit einer nachlässigen Handbewegung, »ich werde dir später die urkundlichen Schriften zeigen, nach welchen Mexiko gewillt ist, Texas zu dem zu machen, was es selbst ist, zu einer Republik, aber zu einer indianischen. Die Indianer sollen sich selbst regieren, Mexiko will nicht, daß Texas von Yankees verwaltet wird. Genug, genug! Sprechen wir jetzt nicht mehr davon, später mehr! Ich habe eine andere Frage. Wieviele Gefangene sind in deinen Händen?«
Arahuaskar biß sich auf die Lippen; mit seiner Herrschaft war es aus; seine Pläne waren für immer zerstört. Die Indianer, die ihn vorhin belauscht hatten, jubelten laut, die Neuangekommenen hatten ihm erzählt, was für Versprechungen die Rebellen den Indianern machten, aber es waren keine leeren Worte, sie zeigten ihnen die geschenkten Waffen, Schmuckgegenstände, und unaufhörlich kreiste die Flasche mit Feuerwasser.
Also das weiße Weib, Miß Morgan, hatte ihm auch von den Gefangenen erzählt.
»Es sind einige.«
»Wieviele? Ich muß die Zahl ganz genau wissen.«
»Wozu?« fragte Arahuaskar zögernd.
»Es sind Geiseln.«
»Nein, es sind meine Gefangenen.«
»Sprich keinen Unsinn, schwarze Zeder!« raunte der Offizier ihm drohend zu. »Glaubst du, du könntest deine Rolle hier noch weiterspielen? Tor, der du bist! Halte zu uns, dann erreichst du sicher das Ziel, welches du dir gesteckt hast.«
Arahuaskar wurde mit einem Male gefügig, er nannte die genaue Anzahl der weißen Gefangenen. Die Nennung seines früheren Namens hatte viel zu dieser Sinnesänderung beigetragen.
»Leutnant Alessandro.«
Ein junger Offizier trat zu dem Vorgesetzten.
»Lassen Sie sich von diesem Indianer alle Gefangenen ausliefern, welche die Ruine beherbergt. Suchen Sie sich ein geräumiges Gewölbe aus, wo sie zusammengebracht werden. Sie werden nicht gebunden, aber von Soldaten bewacht. Du, schwarze Zeder, bist mir dafür verantwortlich, daß alle Gefangenen zur Stelle sind. Ich bin neugierig, wen wir zu sehen bekommen, meiner Meinung nach haben wir einen guten Fang gemacht.«
»Es sind Weiße unter uns, welche keine Gefangenen sind,« warf Arahuaskar ein.
»Sie alle kommen in dem Gewölbe zusammen.«
»Auch jene weiße Dame, mit welcher du vorhin sprachst?«
»Auch sie. Und sorge vor allen Dingen dafür, daß jene beiden hinkommen, an welchen die Dame ein besonderes Interesse zu nehmen scheint. Sie wollte zwei Gefangene für sich behalten, doch solche private Rücksichten kennen wir nicht.«
Als sich Arahuaskar mit dem Leutnant entfernte, um den Auftrag auszuführen, stieß er ein heiseres Lachen aus. Es war nicht ein Lachen des Hohnes, welches auf Widerstand deutete, sondern ein Lachen der Verzweiflung.
Arahuaskar sah, daß er gehorchen mußte, weil er nichts mehr zu befehlen hatte. Alle seine Hoffnungen waren fehlgegangen, Schlag auf Schlag wurden sie zerstört.
Ein geräumiges Gewölbe war gewählt worden; Soldaten wurden darin und davor mit geladenen Gewehren postiert und andere ausgeschickt, um in Begleitung von Indianern die Gefangenen aus ihren Verstecken zu holen.
Arahuaskar selbst gab seinen Indianern den Auftrag dazu, er sah, wie einer nach dem anderen eintrat, er bebte vor ohnmächtiger Wut, als sein Freund, der alte Vater, auf des Holländers Arm gestützt, erschien.
Also hatte auch der alte Vater ihn betrogen, er hielt zu den Gefangenen.
Miß Morgan war ebenfalls anwesend. Sie bebte vor Wut, als Ellen und Harrlington sich umschlangen. Sie konnte den Anblick nicht mehr ertragen, sie wollte das Gewölbe verlassen, aber der Leutnant hielt sie zurück und wies gebieterisch mit der Hand auf ihren alten Platz.
Sie mußte gehorchen; vorläufig galt auch sie als Gefangene, bis der Führer der Rebellen über das Schicksal aller entschieden hatte. Diese gingen ganz ordnungsgemäß vor, man merkte, daß es ein wohlgeplanter Aufstand war, an dessen Spitze hohe, geschulte Offiziere standen.
Diese Freudenrufe, diese Umarmungen, als alle Gefangenen zusammen waren! Es gab fast keine Person, welche nicht eine andere gehabt hätte, über deren Wiedersehen sie sich unaussprechlich freute. Einzeln standen nur die Trapper da: sie reckten und streckten die Glieder, fluchten und besprachen, was eigentlich los wäre.
Als die erste Freude des Wiedersehens vorbei war, teilten sie den Liebespaaren, darunter Hannes und Hope, ihre Ansicht mit, und sie hatten sich nicht sehr getäuscht.

Sie befanden sich in den Händen von Rebellen, welche Texas der Republik Mexiko einverleiben wollten. Dies war der Wunsch eines jeden spanischen Mexikaners, vielleicht wurden die Rebellen, Abenteurer, Deserteure und Leute mit revolutionärer Gesinnung, sogar von Mexiko unterstützt, denn es befanden sich auch mexikanische Soldaten unter ihnen, selbst hohe Offiziere, und daß diese so ohne weiteres ihre Fahne und sichere Stelle verließen, um eine Revolution anzuzetteln, war kaum glaublich.
»Wir haben noch Glück im Unglück,« hörte Miß Morgan eine der Vestalinnen sagen, »unser Leben scheint nicht mehr bedroht zu sein. Es wird auf Manneszucht gehalten, wir werden nur als Geiseln dienen.«
»Vom Regen in die Traufe!« höhnte Miß Morgan. »Sie werden es bald genug erfahren.«
Sie glaubte selbst nicht an das, was sie sagte; die Wut gab ihr diese Worte ein. Sie sah ihre Beute entschlüpft, die Befriedigung ihrer Rache war ferner gerückt denn je.
Doch nur Geduld! suchte sie sich immer wieder zu trösten. Noch ist nicht aller Tage Abend.
»Freuen Sie sich nicht,« rief ihr eine der Damen zu. »Ihr Los wird kein besseres als das unsere sein.«
»Sie irren, ich bin Mexikanerin,« entgegnete Miß Morgan, »ich werde nur verhört, dann bin ich frei und kämpfe selbst gegen die Yankees, welche ich hasse. Sie dagegen dienen als Geiseln. Siegt Mexiko, dann werden Sie vielleicht gegen Gefangene ausgetauscht, mißglückt unsere Sache, dann fallen Ihre Köpfe.«
»Lügnerin!« rief Ellen, »Sie gaben sich als Nordamerikanerin aus. Alles an Ihnen ist Lug und Trug.«
Miß Morgan zuckte die Achseln.
»Im Krieg ist alles erlaubt.«
Da nahm Hannes das Wort.
»Miß Morgan! Sind Sie erst frei, dann werden wir wohl ein Hühnchen zusammen rupfen, wenn Sie es nicht vorziehen, sich unsichtbar zu machen.«
»Sie werden Ihre Freiheit wohl schwerlich vor Beendigung des Krieges wiedererlangen,« war die höhnische Antwort. »Sie können sich einstweilen an Brot und Wasser delektieren, Sie nebst Ihrer werten Frau Gemahlin.«
»Haben die Rebellen nur über Brot und Wasser zu verfügen? Dann muß es traurig in ihrer Kriegskasse aussehen.«
»Geiseln werden kurz gehalten.«
»Ich kalkuliere, man wird mich bald auf freien Fuß setzen. Und dann, Miß Morgan, auf Wiedersehen!«
»Meinen Sie?«
»Sicher. Ich bin kein Yankee, ich bin ein Deutscher.«
»Bah. Mitgefangen, mitgehangen.«
»Solche Späße dürften den Rebellen teuer zu stehen kommen.«
»Laß dich mit diesem gemeinen Weibe in kein Gespräch ein,« bat Hope, »ihre Stunde wird auch noch schlagen. Sie ist weder eine Nordamerikanerin noch eine Mexikanerin, sie dient für Geld dem Staate als Spionin, der am meisten bezahlt.«
Miß Morgan konnte keine Antwort mehr geben, denn der spanische Offizier trat herein, welcher die Gefangenen hierher beordert hatte. In seiner Begleitung waren noch zwei andere Offiziere, beide in mexikanischer Uniform, während der Spanier mit dem Knebelbart einfach gekleidet war.
Er war eine angenehme Erscheinung, schon ältlich, mit grauem Haar, aber die Augen über der scharfen Adlernase sprühten in jugendlichem Feuer. Er machte durchaus keinen gemeinen Eindruck, wohl aber war seinen Zügen der Stempel der Abenteuerlust deutlich aufgeprägt.
Ueber die graue Jacke trug er einen ledernen Gurt geschnallt, von welchem ein sehr langer Degen mit einem riesigen Handgefäß herabhing — ein sogenannter Raufdegen.
Er strich sich wiederholt den Schnurrbart, es schien, als wolle er mit der Hand ein Lächeln verbergen, und sein schwarzes Auge wanderte von einem zum anderen. Ueberall begegnete er festen, unerschrockenen Blicken.
»Ladies und Gentlemen,« begann er, »wir haben Sie aus der Gefangenschaft der Indianer befreit, welche Sie ohne Unterschied einem ihrer früheren Götzen schlachten wollten. Sie können von Glück reden, daß wir dazwischen kamen — es war die höchste Zeit. Nun aber sind Sie in unsere Gewalt geraten —«
»Darf ich fragen,« unterbrach Lord Harrlington aufgeregt den Sprecher, dieser aber ließ ihn nicht zu Worte kommen.
»Ich kenne Ihre Frage, ich werde ihr zuvorkommen. Wir handeln nicht im Namen, sondern nur im Interesse der mexikanischen Republik, und dies genügt, daß wir uns für berechtigt halten, einen jeden, der als Untertan den Vereinigten Staaten angehört, gefangen zu nehmen. Mit einem Wort, wir nennen uns Rebellen, mag dies klingen, wie es will.«
Diesmal gelang es Harrlington doch, ihn zu unterbrechen.
»Sie vergessen ganz, wen Sie vor sich haben,« rief er mit Nachdruck. »Indianer konnten uns wohl ohne weiteres gefangen nehmen und uns abschlachten wollen, Ihr Benehmen uns gegenüber könnte aber von weittragenden Folgen sein. Meine Freunde und ich sind keine Amerikaner, wir sind Engländer, und glauben Sie sicher, daß, wenn uns auch nur ein Haar auf dem Haupte gekrümmt wird, Ihre Sache, mag sie gerecht oder ungerecht sein, hoffnungslos verloren ist. Ich bitte Sie, sich erst mit uns bekannt zu machen.«
»Junger Mann,« gab der Spanier lächelnd zurück, »Sie haben mich vorhin wieder nicht aussprechen lassen. Ich bin Offizier, wenn ich auch keine Uniform trage; ich will mir erst eine neue verdienen. Seien Sie versichert, ich bin nicht so kopflos, den ersten besten zum Gefangenen zu machen, der mir in die Hände fällt, noch weniger ihn zu töten oder gar zu mißhandeln. Ich wußte ganz genau, wen ich hier in der Ruine vorfinden würde, und einen besseren Anfang konnte ich für unser Unternehmen gar nicht machen. Ich kenne Sie alle, wenn auch nicht persönlich, so doch dem Namen nach, und diese Dame,« er winkte zu Miß Morgan hinüber, »gab mir wichtige Erläuterungen hierzu. Es fällt mir nicht ein, Sie, Lord Harrlington, oder einen der anderen englischen Herren als Gefangenen zu behalten, Sie sind frei, Sie können hingehen, wohin Sie belieben. Nur das eine wollte ich Ihnen auf den Weg mitgeben, meine Herren: Sie sitzen noch nicht im Parlament, haben also auch nicht über Krieg und Frieden zu entscheiden, sondern Ihre Väter. Und ich bezweifle, daß diese England zum Krieg rüsten lassen, weil ihre Herren Söhne während einer Reise in die Patsche geraten sind.«
Diese selbstbewußten Worte verfehlten nicht ihre Wirkung, die Herren sahen sich mit bestürzten Blicken an.
Lord Harrlington war der erste, der sich wieder sammelte.
»Unterschätzen Sie das Vergehen nicht, wenn Sie sich während einer Revolution an Engländern vergreifen. Ob wir Lords oder Arbeiter sind, England wird für uns Rechenschaft fordern.«
»Ich bedaure, Ihnen abermals widersprechen zu müssen,« klang es lächelnd zurück, »es ist ein großer Unterschied, ob Sie Lords oder Arbeiter sind. Ihretwegen wird schon eher ein Kriegsschiff ausgerüstet und Alarm geblasen.«
»Um so mehr hüten Sie sich, sich mit uns einzulassen.«
»Ich sagte Ihnen ja schon, daß Sie frei sind. Ich will gar nichts mit Ihnen zu tun haben. Leutnant Alessandro, bitte, lesen Sie die Namen der englischen Herren vor, welche nicht als Gefangene zu betrachten sind.«
Dieser Spanier war jedenfalls kein gewöhnlicher Soldat, er verband Witz mit Scharfsinn. Die Engländer fühlten, daß er ihnen augenblicklich überlegen war. Sie bissen sich auf die Lippen, als sie sahen, wie die Soldaten, die Offiziere, Miß Morgan und selbst einige der Trapper spöttisch lächelten.
Leutnant Alessandro zog ein Papier aus der Brusttasche und begann die Namen der Engländer vorzulesen, und es zeigte sich, daß die Rebellen mit deren Personalien vollkommen vertraut waren. Er las stets ihren Namen, dann den des Vaters ab. Die Liste fing an mit Marquis Chaushilm und fuhr fort mit dem im Range nächstfolgenden.
John Davids fehlte unter ihnen, er ruhte ja unter der Erde. Der Spanier konnte dies nur von Miß Morgan erfahren haben, mit welcher er vorhin gesprochen hatte.
Der letzte Name war genannt worden.
»So, meine Herren, Sie sind frei,« sagte der Spanier.
»Und diese Damen?« fragte Harrlington mit vor Erregung bebender Stimme.
»Diese sind als Bürgerinnen der Vereinigten Staaten unsere Gefangenen, sie dienen als Geiseln. Sind sie Untertanen eines anderen Landes, dürfen sie uns verlassen. Miß Morgan wird mir behilflich sein, ihr unparteiisches Urteil mit dem meinen zu verbinden.«
»Herr, es sind unsere Bräute!«
Unter den Herren, wie unter den Damen entstand eine Bewegung. Harrlington hatte ein gewichtiges Wort gesprochen.
»Tut mir leid,« entgegnete der Spanier höflich, aber kalt, »im Krieg kennt man keine dergleichen Rücksichten. Sind diese Damen gewillt, ihren Namen ›Vestalinnen‹ abzulegen, so ist hier ein unrechter Platz dazu.«
»Herr, wahren Sie Ihre Zunge!«
»Fanden Sie eine Beleidigung in meinen Worten, so bin ich bereit, Ihnen Rechenschaft zu geben,« lächelte der Spanier und legte die Hand an das Degengefäß. »Sie sind ein freier Mann, und ich schätze Sie als Kavalier.«
Dem Lord lag jetzt nichts daran, Streit anzufangen, es lag in dem Benehmen des Spaniers überhaupt etwas Gewinnendes.
»Ich versichere Ihnen auf mein Wort als Kavalier,« fuhr er fort, »daß diese Damen anständig behandelt werden sollen.«
Unter den Herren entstand ein Geflüster.
»Wieviel Lösegeld fordern Sie für die Damen?« fragte Harrlington.
Der Spanier spielte erst nachdenklich mit dem Wehrgehäng, dann hob er den Kopf und sagte:
»Ich denke, Sie werden sich nicht weit von unserem Quartier aufhalten?«
»Wir bleiben solange in der Nähe der Ruine, bis diese Damen frei sind.«
»Gut, so werden wir Ihnen die Bestimmungen bald mitteilen, unter denen Ihnen die Geiseln ausgeliefert werden. Dann bemerke ich noch, daß ich Sie vorläufig als neutral erachte, in dem Moment aber, da Sie gegen uns eine Waffe erheben, sind Sie unsere Feinde.«
»So halten Sie uns sofort für solche,« rief Charles Williams aus der Mitte der Herren.
»Ich nehme diese Erklärung dankbar entgegen, ich weiß nun wenigstens, mit wem ich es zu tun habe.«
Die Herren erschraken über diese Aeußerung von Williams, der Spanier merkte es und fuhr schnell fort;
»Fürchten Sie nicht, daß ich Sie nun als Gefangene behandle; ich kämpfe lieber mit Edelleuten, als mit gemeinen Soldaten.«
Die Tür öffnete sich, und herein trat, von einem Offizier begleitet, eine Dame, bei deren Anblick Miß Morgan ein zischender Laut entfuhr, den übrigen Damen und Herren aber ein Ruf der Freude; es war Johanna.
Umarmungen folgten, Johanna erklärte schnell, daß sie auf der Reise nach Austin ebenfalls gefangen genommen worden sei und fügte den Trost hinzu, den Rebellen sei es weniger um Geiseln, als um ein recht hohes Lösegeld zu tun, um die bis jetzt noch fehlenden Mittel zum Führen eines Krieges zu erlangen. Dies sei auch der Grund, warum die englischen Lords freigelassen wurden; sie sollten ihre Geliebten auslösen, denn sie waren ja weder an der Revolution, noch an der Verteidigung der Vereinigten Staaten interessiert. Die übrigen, welche nichts zahlen konnten, würden sicher nicht freigelassen werden.
Doch Johanna täuschte sich. Der Spanier, wahrscheinlich hier unumschränkter Bevollmächtigter einer mexikanischen, revolutionären Partei, wollte nun einmal als Ritter erscheinen.
»Ich beginne bei jenen Männern,« nahm der Spanier wieder das Wort, »welche keinen Staat als Heimat besitzen, deren Vaterland der Wald und die Prärie ist. Ich meine diese Trapper und Waldläufer. Meine Herren, wählen Sie einen Sprecher!«
Ohne Aufforderung trat Charly, der Waldläufer hervor.
»Ihr habt ein gutes Wort gesprochen, wir besitzen zwar kein Vaterland mehr, dem wir unbedingte Treue zu leisten verpflichtet sind, aber im Namen aller dieser Männer, meiner Kameraden und Freunde, erkläre ich, daß wir gegen die Partei fechten werden, die wir im Unrecht erkennen.«
»So ist es,« klang es einstimmig.
»Und welche ist diese?«
»Das müssen wir uns noch überlegen, allem Anschein nach ist das die Eurige, denn es ist ein großes Unrecht, harmlose Reisende, und noch dazu Weiber, als Geiseln festzuhalten und sie den Männern, welche sie lieben, vorzuenthalten.«
»Streiten wir nicht hierüber,« entgegnete der Spanier, »ich erkläre Sie alle für freie Männer. Kämpfen Sie auf unserer Seite, so wird es mich sehr freuen, kämpfen Sie gegen uns, so soll es uns eine Ehre sein, mit solch tüchtigen Männern die Waffen kreuzen zu dürfen. Sie können mit den englischen Herren die Ruine verlassen.«
Das Erstaunen der Männer über den Spanier wuchs immer mehr. Er paßte gut in jene Zeiten, da sich die Ritter knochentiefe Wunden schlugen, nur um ihre Kraft zu prüfen, hinterher sich die Hand schüttelten, sich ihrer Hochachtung versicherten und dann die vollen Humpen leerten. Als Führer einer revolutionären Partei schien er weniger geeignet, doch es waren ja Spanier, die er führte, heißblütige und phantastische Spanier.
»Nun zu den übrigen!« fuhr der Offizier fort, sprach leise mit Miß Morgan und dann mit seinem Adjutanten, Leutnant Alessandro, welcher eine andere Liste hervorzog.
»Mister Hannes Vogel!«
»Deutscher,« sagte Miß Morgan.
»Sie sind frei,« fügte der Spanier hinzu.
»Danke, und dies ist meine Frau,« entgegnete Hannes, Hope zu sich heranziehend.
»Amerikanerin, Bürgerin der Vereinigten Staaten,« rief Miß Morgan boshaft dazwischen.
»Missis Vogel bleibt als Geisel hier.«
Hope brach in Tränen aus, sie warf sich an Hannes' Brust und weinte laut.
»Sei ruhig,« tröstete Hannes sie zärtlich, »die Sache ist nicht so schlimm, wie sie aussieht. Das Ganze kommt mir überhaupt wie ein Spiel mit Bleisoldaten vor. Ich löse dich aus, sobald ich kann.«
»Das kostet viel,« schluchzte Hope.
»Macht nichts, ich gebe gern alles hin.«
»Dann haben wir aber wieder nichts.«
»Wir machen eine andere Erbschaft oder spielen in der Lotterie. Paßt es mir besser, so bezahle ich nichts und rede mit diesen Spaniern ein ernsthaftes Wörtchen.«
»Ach, Hannes, mache dich nicht unglücklich! Lieber bezahle! Was brauche ich Geld, wenn ich dich habe!«
Hannes küßte Hope und ging zu den Engländern hinüber, seine Frau bei den Damen zurücklassend, welche selbst kaum die Tränen zurückzuhalten vermochten und doch das arme Weib zu trösten suchten.
Pueblo und Inez, welche ihr Kind auf dem Arme trug, kamen daran. Sie wurden ohne weiteres entlassen, ebenso van Guden und dessen Vater, da sie als Holländer bezeichnet wurden. Es stand in ihrem Belieben, sich sofort zu entfernen oder noch zu warten. Sie blieben vorläufig.
Denselben Wink erhielt Wan Li, der Chinese, doch der kleine Mann blieb mit zwinkernden Augen vor dem Befehlshaber stehen.
»Du sagst zu mir: ›Geh, es ist gut‹. Aber Wan Li sagt: Es ist nicht gut. Wo sind seine Schätze, die ihm die Indianer abgenommen haben? Sie sind in der Ruine.«
»So holen Sie sich dieselben,« entgegnete der Spanier gelassen.
Der Chinese ließ die Augen herumwandern, er sah das boshafte Lächeln von Miß Morgan und wußte ganz genau, daß die Summe, welche ihm seine Landsleute anvertraut hatten, sich bereits in den Händen dieses Spaniers befand.
»Du hast mein Geld.«
»Wenn du es weißt, so ist es ja gut. Ja, ich habe dein Geld.«
»Es gehört nicht mir, sondern armen Chinesen, welche auf die Zurückerstattung warten.«
»Ich werde es ihnen später mit Zinsen zurückgeben.«
Der Chinese wiegte den Kopf hin und her.
»In meinen Händen ist es sicherer.«
»Durchaus nicht. Wünschest du eine Quittung über den Empfang? Ich will sie dir nachher geben. Ich betrachte die Summe von ungefähr vier Millionen Dollar als eine Anleihe und zahle fünf Prozent Zinsen. Ist das nicht anständig?«
Wan Li wußte recht gut, daß dies nur eine Wortfechterei war. Sein Geld war so gut wie verloren. Dies gab der Spanier auch freimütig genug selbst zu.
»Ich versichere dir auf mein Ehrenwort, fällt der Krieg zu unseren Gunsten aus, so erhältst du die Summe mit fünf Prozent zurück.«
»Und fällt der Krieg nicht zu deinen Gunsten aus?«
Der Spanier zuckte lächelnd die Achseln.
»Wer kann für Unglück? Dann war es eine verfehlte Spekulation, mein lieber himmlischer Sohn, du mußt dich dann eben mit mir trösten. Ich bin ein ehrlicher Kompagnon; wenn ich gewinne, werde ich dich nicht betrügen.«
Des Chinesen Augen blitzten auf, aber seine Stimme klang ruhig, als er sagte:
»Gut, ich gehe, aber ich komme wieder, um abzurechnen. Und fehlt beim Kassenschluß auch nur ein Penny, so bist du ein Betrüger und wirst deine Schuld büßen.«
Die anwesenden Offiziere lachten, als der Chinese zu den Engländern hinüberschritt; nur der Kommandeur blieb ernsthaft.
»Miß Johanna Lind!«
Die Gerufene trat vor.
»Sie sind Amerikanerin?«
»Ich bin eine Deutsche, nur in Amerika geboren.«
»Sie sind aber Bürgerin der Vereinigten Staaten.«
»Allerdings.«
»Dann bleiben Sie als Geisel hier.«
»Wie Sie befehlen.«
»Noch eins, Miß Lind! Sie sind die Braut von Felix Hoffmann?«
»Ich verzichte, Ihnen auf diese Frage zu antworten,« entgegnete Johanna kalt, »sie gehört nicht hierher.«
»Also habe ich recht,« lächelte der Spanier. »Ich schätze mich glücklich, die Braut des Señor Hoffmann beherbergen zu dürfen.«
Lord Harrlington ergriff noch einmal das Wort.
»Señor, Sie kennen alle unsere Namen. Wir bitten um den Ihrigen, damit wir wissen, wem wir unsere Befreiung aus den Händen der Indianer und die neue Störung zu verdanken haben.«
»Mein Name ist Fernando d'Estrella, ich war Kapitän in mexikanischen Diensten, ich habe selbst den Abschied genommen, um den Versuch zu machen, Texas wieder mit meinem Vaterlande zu vereinigen. Möchten die Vereinigten Staaten doch einsehen, daß Nord und Süd nicht zusammenpassen, wieviel Blutvergießen würde dadurch vermieden! Nie kann Texas einem anderen gehören als dem freien Mexiko. Die Natur selbst will es so. Betrachten Sie seine Flora, die Charaktere seiner Bewohner, und Sie müssen mir recht geben.«

Der Offizier wurde unterbrochen; draußen hörte man Rufe schallen, zwei Schüsse fielen, es mußte ein Ringkampf stattfinden. Dann folgte ein Geräusch, als schmetterte ein Büchsenkolben auf menschliche Schädel herab, wieder folgten Schreie, Flüche und Verwünschungen.
Der Lärm war erst weit entfernt gewesen, doch schnell kam er näher, bis er vor der Tür war.
»Fangt ihn lebendig, den Schurken!« rief eine Stimme. Es war die des Leutnants Juarez.
Man hörte hastige Fußtritte; Menschen rannten hin und her. Wieder mußte ein Ringkampf erfolgen, dann wurden die Angreifer jedenfalls zur Seite geschleudert, die Tür öffnete sich und Deadly Dash stürmte ins Gemach, noch in demselben Waldläuferkostüm wie früher, die kurze Büchse im Arm und den breitrandigen Filzhut auf den Locken. Er hatte sich nur insofern geändert, als ihm ein kurzer Vollbart gewachsen war, der ihm ein ganz anderes Aussehen gab.
Sein Eintreten rief Bestürzung hervor. Die Soldaten rissen die Gewehre empor, die Engländer und Mädchen machten erstaunte Gesichter, nur Johanna stürzte ihm mit ausgebreiteten Armen einen Schritt entgegen und blieb dann bewegungslos stehen.
Kurz ehe den englischen Herren die Freiheit verkündet wurde, fanden in einem anderen Teile der Ruine Szenen statt, welche das Vorspiel zu den nachkommenden waren.
Spanische Soldaten, darunter auch Offiziere, standen auf Steinhaufen und schauten nach der Waldgrenze, wo sich einige hundert Indianer versammelt hatten. Sie mußten die Absicht haben, Gefangene zu martern. Drei Pfähle waren in den Boden gerammt, und schon brachte man drei gebundene Gestalten herbei, zwei Männer und ein Weib. Sie wurden einzeln an die Pfähle gebunden, Indianer traten vor sie hin und hielten lange Reden.
Die Gefangenen waren ebenfalls Indianer; mit dem Gleichmut ihrer Rasse ergaben sie sich in ihr Schicksal.
Auf einem etwas abgesonderten Steinhügel standen zwei Offiziere und betrachteten das Schauspiel. Die Entfernung war eine sehr große, man konnte die Gestalten der Indianer nur undeutlich wahrnehmen.
Der eine der Offiziere war Juarez, früher spanischer Kapitän in Manila, jetzt mexikanischer Leutnant, er sprach mit seinem Gefährten, den er Sylvester anredete.
»Jammerschade, daß wir keine Ferngläser haben,« meinte eben Juarez, »ich möchte gar zu gern diese Marterung deutlich sehen. Ich habe einer solchen noch nie beigewohnt.«
»Es ist ein verteufelt hübsches Mädchen dabei,« entgegnete sein Genosse, ein Franzose, »eine richtige indianische Schönheit.«
»Sollten wir denn vermöge einiger Geschenke nicht als Zuschauer zugelassen werden?«
»Schwerlich! Aber selbst wenn es uns die Indianer erlaubten, dürfen wir nicht. Sie wissen, Estrella hat den strengen Befehl gegeben, die Indianer völlig sich selbst zu überlassen. Jede Einmischung hat er auf das schärfste verboten.«
»Aber warum nur?«
»Er will sich die Indianer als Freunde erhalten und sie vor allen Dingen in dem Glauben lassen, sie seien die eigentlichen Herren, er wolle ihnen nur helfen, die Herrschaft zu gewinnen und diese dann zu befestigen.«
»Möchte wissen, wie lange ihm das glückt.«
»O, Estrella versteht es, Indianer zu behandeln, er selbst hat viele Jahre unter den Rothäuten gelebt. Dadurch, daß er ihnen nicht direkt befiehlt, sondern vielmehr tut, als gehorche er ihnen, hat er sie schon halb gewonnen. Geschenke, besonders Feuerwasser, tun das übrige.«
»Ja, diese aber hören einmal auf — da seht, Sylvester, was will der Kerl dort?« unterbrach sich Juarez. »Es ist ein Weißer.«
»Ja, anscheinend ein Waldläufer. Er muß aber mit langer Nase abziehen, obgleich er sehr ehrfurchtsvoll behandelt wird. Auch er darf der Marterung nicht beiwohnen.«
In den die Pfähle umschließenden Kreis von Indianern war ein großer, starkgebauter Mann getreten — man konnte diese Gestalt trotz der großen Entfernung deutlich beobachten — und hatte mit einem federgeschmückten Indianer gesprochen. Nach kurzer Unterredung, während welcher oft auf die Gefangenen gedeutet wurde, drehte der Mann sich wieder um und verschwand im Walde.
»Wer war das?«
»Habe keine Ahnung, wahrscheinlich ein Freund der Gefangenen, der zu ihren Gunsten sprechen wollte.«
»Was haben sie eigentlich verbrochen?«
»Sie haben viele Krieger getötet, darunter einige Häuptlinge. Deshalb sollen sie gemartert werden.«
»Das Weib hat mitgekämpft?«
»Sie soll den vornehmsten Häuptling getötet haben.«
»Teufel,« lachte Juarez, »muß das ein Weib sein!«
»Es ist ein reizendes Mädchen, ich hätte ihr nie eine Heldentat zugetraut, so unschuldig und lieblich, mit ein paar Augen wie Schwarzbeeren. Eine entzückende Erscheinung.«
»Wenn wir nur hingehen könnten,« seufzte Juarez.
»Dürfen nicht.«
»Mir wird die Zeit bald lang. Die Kerle halten ja ungeheuer lange Reden, und ist der eine fertig, tritt immer wieder ein anderer vor und spricht wie ein Volksredner.«
»Ja, wollen Sie hier oben auf die Marterung warten?« fragte Sylvester lachend. »Da können Sie nur gleich Frühstück und Mittagessen hierherbestellen.«
»Wieso denn?«
»Das Martern geht bei den Indianern nicht so schnell, jeder einzelne von ihnen erzählt erst seine Heldentaten, sie schimpfen die Gefangenen; sind alte Weiber vorhanden, so speien diese die Gefangenen an, und oft vergehen Tage, ehe diese gemartert werden.«
»Warum zögert man so?«
»Um die Gefangenen die Todesangst möglichst ausgiebig schmecken zu lassen.«
»Nun, etwas will ich ihnen doch noch zuschauen, aber Stunden warte ich nicht mehr, Kamerad, Sie sind doch im Kriegsrat. Glaubt Estrella wirklich, mit einer Handvoll Leute den Kampf gegen die Yankees aufnehmen zu können?«
»Warum soll er dies nicht tun?« entgegnete der Gefragte, schlau lächelnd.
»Bah, machen Sie mir doch nichts vor! Ich halte Estrella für einen klugen Kopf, er wird sich nicht einer solch törichten Hoffnung hingeben.«
»Nun, Leutnant Juarez, warum haben Sie sich denn als Offizier gemeldet, wenn Sie die Sache für aussichtslos halten?«
»Ich wurde aus den spanischen Diensten entlassen, wegen eines Schurken, dem ich hoffentlich hier noch begegne,« knirschte Juarez. »Ich wandte mich nach Mexiko, es ging mir schlecht, weil ich nichts anderes gelernt habe, als Soldaten drillen, und so nahm ich denn mit Freuden das Angebot an, im Interesse Mexikos gegen die Yankees zu kämpfen. Das ist meine Geschichte.«
»Aehnlich wie die meinige, nur daß ich mehr Vertrauen zu der Sache habe.«
»Das ist nicht Ihr Ernst, Sylvester!«
»Gewiß ist es mein Ernst.«
»Sie glauben wirklich, Estrella könnte mit seinen lumpigen paar hundert Mann und tausend Indianern gegen die Yankees siegreich kämpfen?« lächelte Juarez, »Nun ja, Sie sitzen mit im sogenannten Kriegsrat, und da mag es sein, daß die Pläne des phantastischen und redegewandten Estrella auch Ihnen den Kopf verdreht haben.«
»Spotten Sie nicht,« entgegnete der andere, »Estrella ist ein geborener Feldherr und Diplomat.«
»Das habe ich oft sagen hören. Er konnte es aber in mexikanischen Diensten zu nichts bringen, einmal wegen fortwährender Liebeshändel und Duelle, und dann, weil er nie gehorchen wollte.«
»Stimmt, Estrella ist zum Befehlen geboren.«
»Bah, ich gehorche auch nicht gern.«
»Halten Sie Estrella nicht für einen klugen Kopf.«
»Gewiß, soweit ich ihn kenne. Das befähigt ihn aber noch lange nicht dazu, eine Revolution gegen die Vereinigten Staaten siegreich zu Ende zu führen.«
»Das allerdings nicht. Wissen Sie, was Estrella vor allen Dingen fehlt?«
Juarez überlegte einige Augenblicke.
»Geld,« sagte er lächelnd.
Sylvester nickte.
»Das ist es, und Mexiko kann ihm keins geben, so gern er es auch möchte. Aus mir unbekannten Hilfsquellen erhält er so viele Mittel, um Offiziere und Mannschaften anständig besolden zu können. Glauben Sie mir, wenn Estrella genügend Geld hat, bringt er eine Armee zusammen, schult sie und liefert Schlachten, aus denen er immer als Sieger hervorgeht.«
»Ja, wenn! Natürlich, mit Geld kann man alles erreichen, da will ich auch eine Armee zusammenbringen, und ganz besonders hier in Amerika, wo sich Männer mit Haut und Haaren verkaufen, wenn nur gut bezahlt wird.«
Sylvester nahm einen vertraulichen Ton an, als er jetzt sagte:
»Leutnant Juarez, Sie verstehen Estrellas Pläne ganz und gar nicht. Glauben Sie denn, er will etwa, wie Sie ganz richtig sagten, mit der Handvoll Leute und den betrunkenen Indianern gegen die Yankees vorrücken?«
Juarez machte ein förmlich bestürztes Gesicht.
»Nicht? Was will er denn sonst?«
»Ich werde etwas aus der Schule plaudern, muß aber um unbedingte Verschwiegenheit bitten.«
»Ich plaudere nie.«
»Nun, die Revolution, welche Estrella jetzt angezettelt hat, ist nur Spiegelfechterei, um die Vereinigten Staaten zu täuschen. Mexiko selbst wird gegen die Rebellen vorgehen und sie unschädlich machen, obgleich es im geheimen doch zu ihnen halt, dadurch werden die Yankees in Sicherheit gewiegt, und Mexiko kann mit Ruhe Vorbereitungen zu einem intensiven Schlage treffen, an welchem es sich dann selbst beteiligt.«
»Wie? So sind Estrellas Soldaten, also auch wir, nur einfache Schlachtopfer? Caracho, meine Haut ist mir doch zu lieb, als daß ich sie wegen solch einer Sache zu Markte trage.«
»Bah, Schlachtopfer sind wir deshalb noch nicht, wir haben vielmehr einen großen Zweck zu erfüllen, nämlich den, Geld zu verschaffen. Mexiko hat keins. Niemand borgt ihm, und so hat sich der schlaue Estrella bereit erklärt, welches zu verschaffen. Dafür winkt ihm der Marschallstab, und Estrella ist der Mann, in der kürzesten Zeit die größten Summen aufzutreiben.«
»Hm, möchte wissen, wie er das machen kann, damit ich es von ihm lerne.«
»Estrella ist auf dem besten Wege dazu, er hat seine zwanzig Millionen Dollar schon so gut wie in der Tasche.«
»Wahrhaftig? Wie kam denn das?«
»Leutnant Juarez, allen Respekt vor Ihrer Tapferkeit, im Kampfe mögen Sie der beste Offizier sein, aber zum Diplomaten taugen Sie nicht,« lächelte Sylvester. »Glauben Sie, Estrella ist umsonst nach der Ruine gerückt? Er wußte ganz genau, was hier vorging. Von ihm gemietete Indianer benachrichtigten ihn über alles, und so wußte er auch, was für Gefangene hier waren. Verstehen Sie nun?«
»Nein, noch gar nichts.«
»Immer noch nicht? Das ist doch sehr einfach. Die gefangenen Damen sind jene Vestalinnen, welche eine Reise um die Welt unternommen haben, alles Amerikanerinnen, schwer reich, und die Herren sind englische Herzöge, Lords, Grafen und so weiter. Estrella weiß ganz genau, daß die Damen und Herren sich lieben; letztere läßt er nun laufen, erstere behält er als Gefangene und fordert für sie von den Engländern ein unverschämt hohes Lösegeld. Den Lords kommt es auf einige Millionen nicht an, die merken den Verlust gar nicht in ihrem Geldschranke; die Bräute aber in den Händen von Rebellen zu wissen, darüber sind sie unglücklich. Dies weiß Estrella recht gut, und ich wette meinen Kopf darum, daß er innerhalb einiger Tage eine Summe in der Tasche hat, mit der er alle waffenfähigen Männer Amerikas werben kann. Ob seine jetzigen Soldaten zugrunde gehen, ist ihm ganz gleichgültig; passen Sie aber auf, wie schnell aus ihren Leichen eine Armee wachsen wird, an deren Spitze alle mexikanischen Generäle ohne Ausnahme stehen, und wie schnell die mexikanischen Truppen sich uns anschließen werden. Geldmangel war die Ursache, warum diese Revolution so kläglich anfing, ist er aber erst überwunden, dann ade, Texas, der Yankee bekommt es nimmermehr zurück!«
»Ah, nun habe ich verstanden!« rief Juarez. »Fürwahr, der Plan ist sein gesponnen.«
»Und sicher,« fügte Sylvester hinzu. »Aber reinen Mund halten! Nicht jeder braucht zu erfahren, daß Estrella hinter der Maske eines Rebellen das Gesicht eines Buschkleppers versteckt, der Reisende überfällt und mit deren Geld seine Reisige bezahlt. Lassen Sie uns nach dem Lager gehen! Es ist Zeit zum Frühstück.«
Beide stiegen von dem Trümmerhaufen hinab.
»Es wundert mich, daß Leutnant Diaz noch nicht hier ist,« meinte Sylvester.
»Er mag aufgehalten worden sein.«
»Haben Sie jene Dame gesehen, welche dem Leutnant Ramos durch Estrella abgenommen worden ist?«
»Miß Lind? Ja.«
In Juarez' Gesicht stieg eine Blutwelle. Mit dieser Dame verknüpften sich für ihn unangenehme Erinnerungen.
»Kennen Sie dieselbe?«
»Nur oberflächlich.«
»Wissen Sie, daß sie Braut ist?«
»Auch das.«
»Kennen Sie den Bräutigam?«
»Er heißt Hoffmann.«
»Kennen Sie diesen genauer? Wissen Sie, wer er ist?«
»Ein Schurke ist er,« platzte Juarez mit maßloser Wut heraus, »ein Schurke, den ich zu treffen wünsche, um ihn wie einen Buben zu züchtigen.«
Sylvester lächelte leicht, als sein Blick den kleinen mageren, krummbeinigen Kameraden streifte.
»Warum denn?« klang es spöttisch.
»Er ist der Schuft, welcher mich verdächtigt hat, ebenso wie die Engländer. Wenn sie freikommen, sollen sie meiner Rache nicht entgehen. Ich will mit ihnen Mann für Mann den Degen kreuzen.«
Die beiden erreichten einen einsamen, menschenleeren Ort. Der Weg führte immer zwischen Schutthügeln, aus zusammengefallenen Häusern und Mauern gebildet, hin, und plötzlich kam hinter solch einem Haufen ein Mann hervor und ging, ohne die beiden Offiziere zu beachten, schnellen Schrittes an ihnen vorüber.
Sie erkannten ihn sofort. Es war jener Waldläufer, welcher vorhin von den Indianern zurückgewiesen worden war, es war dieselbe große, starke Gestalt, fast ein Riese. Er trug lange Stiefel, lederne Jagdkleider, darüber den breiten Gurt mit Jagdmesser und Revolver, einen breitrandigen Filzhut und über der Schulter, am Riemen hängend, eine kurze, prachtvoll gearbeitete Büchse.
Juarez war bei seinem Anblick wie vom Blitz getroffen zusammengefahren, er glaubte sich plötzlich in den Orangenhain bei Manila zurückversetzt. Doch nein, jener Mann dort, den er haßte, war ein Gentleman gewesen, dieser war ein armseliger Waldläufer, auch hatte dieser nur einen ganz kurzen Vollbart.
Sie hatten ihn noch nicht gesehen, dennoch mußte er zu den Rebellen gehören, denn die Ruine war ringsum mit einer doppelten Postenkette umgeben, welche nur nach Abgabe der Parole passiert werden konnte. Diese aber war nur Offizieren, einigen angesehenen Indianern und den Posten selbst bekannt.
Auf Verrat des Parolewortes stand sofortiger Tod.
Die Offiziere mußten sich überzeugen, ob ein einfacher Waldläufer die Parole kannte, und wer er war.
Sylvester eilte ihm nach, Juarez folgte.
»Heda, Freund,« rief der Franzose, »wer seid Ihr?«
Der Angerufene drehte sich kurz um.
»Ein Waldläufer,« entgegnete seine tiefe Stimme.
»Wie heißt Ihr?«
»Deadly Dash.«
»Ein gefährlicher Name.«
»Den mir meine Feinde gegeben haben.«
»Gebt die Parole!«
»Freiheit.«
Verwundert und mißtrauisch blickten die beiden den Riesen an, es war ein falsches Wort gewesen.
»›Freiheit‹ lautet die Parole nicht.«
»So heißt sie anders.«
»Gebt die richtige!«
»Ich kenne sie nicht, Mann,« fuhr der Waldläufer fort. »Greift nicht nach dem Revolver! Man nennt mich nicht umsonst den tötenden Schlag. Ehe der Revolver aus dem Futteral ist, schmettert mein Kolben auf Eure Schädel herab. Doch wir wollen Freunde bleiben.«
Die beiden Offiziere fühlten sich nur mutig, wenn sie von ihren Soldaten umringt waren. Jetzt standen sie allein dem riesigen Manne gegenüber, kein anderer Mensch war zu sehen, und sie hatten schon genug von Waldläufern erzählen hören. Sie wagten nicht, energisch aufzutreten; der Mann schien ja friedfertig zu sein, wenn sie es waren.
»Wie kommt Ihr durch die Vorpostenkette?« fragte Sylvester, sich ruhig stellend.
»Ich bin einfach hindurchgegangen.«
»Ohne die Parole zu wissen?«
»Ich kannte sie nicht.«
»Señor, das ist nicht möglich.«
»Warum nicht?«
»Weil die Posten die schärfste Instruktion haben, niemanden ohne Angabe der Parole hindurchzulassen.«
»Mich hat niemand nach derselben gefragt.«
»Dann muß ich Euch für einen Lügner halten.«
Der Waldläufer fühlte sich nicht beleidigt, er lächelte vielmehr.
»Ich will Euch die Wahrheit sagen: Weil ich die Parole nicht kannte, habe ich es so einzurichten gewußt, daß mich niemand nach ihr fragen konnte.«
»Ah,« riefen die beiden Offiziere gleichzeitig, »so habt Ihr Euch durch die Posten geschlichen!«
»Allerdings.«
»Auch das ist nicht gut möglich, die Posten stehen eng zusammen, und die Hälfte davon sind Indianer,« sagte Sylvester.
Wieder lächelte der Waldläufer spöttisch.
»Wenn Deadly Dash nicht gesehen werden will, so sieht ihn auch niemand. Señores, Ihr kennt die Waldläufer nicht, und am allerwenigsten Deadly Dash.«
Sylvester konnte kaum seine Aufregung unterdrücken, nur die Furcht hielt sie noch nieder. Seine unbedingte Pflicht wäre es jetzt gewesen, diesen Mann, der sich ins Lager der Rebellen geschlichen, sofort gefangen zu nehmen, und wehrte er sich, ihn niederzuschießen.
Aber der Waldläufer war ein bärenstarker, in den Waffen geübter Mann, er achtete die beiden Offiziere gleich Kindern. Ja, wenn Soldaten hier gewesen wären, die sie auf ihn hetzen konnten! Doch das ließ sich ja noch nachholen.
»Wohin wollt Ihr gehen?«
»Nach dem Orte, wo die Gefangenen untergebracht sind.«
»Wohlan, so geht! Wir haben jetzt zu tun. Doch nachher werden wir Euch noch für Eure unerlaubte Handlung zur Rechenschaft ziehen.«
»Wollt Ihr mich nicht lieber gleich jetzt zur Rechenschaft ziehen?« entgegnete der Waldläufer mit vielsagendem Lächeln.
»Nein, Ihr habt gehört, wir haben jetzt keine Zeit. Auch ist dies nicht der Ort dazu.«
»Auf Wiedersehen denn, Señores!«
Der Waldläufer drehte sich um und ging. Schnell riß Juarez den Revolver aus dem Gürtel, doch ebenso schnell drückte Sylvester den erhobenen Arm mit der Mordwaffe nieder.
»Seid kein Tor!« raunte er dem hinterlistigen Kameraden zu. »Wir dürfen ihn nicht töten, wenn er keinen Widerstand leistet. Estrella versteht keinen Spaß. Erführe er die Tat, so wäre unser Tod gewiß.«
Die Warnung wäre übrigens gar nicht nötig gewesen; ob es Zufall war, oder ob der Waldläufer den meuchelmörderischen Gedanken des Spaniers geahnt hatte, kurz, er war sofort hinter einem Steinhaufen verschwunden, und die vor Wut funkelnden Augen des Spaniers blickten ins Leere.
»Erreicht dieser anmaßende Kerl, der die Parole nicht kennt, das Quartier der Gefangenen, wo sich eben jetzt Estrella befindet, und dieser erfährt, daß wir ihn nicht festgenommen haben, so blamiert er uns vor der Front, wenn er nicht schlimmer mit uns verfährt,« zischte Juarez.
»Wir holen nach, was wir versäumt haben,« lachte Sylvester. »Kommen Sie! Als freien Mann soll ihn Estrella nicht treffen. Dafür lassen Sie mich sorgen!«
Er zog Juarez mit sich fort. Beide eilten zwischen den Steinhaufen hindurch und hatten schon nach einigen Minuten das gefunden, was sie suchten — einen Trupp Soldaten, die am Boden saßen und Karten spielten.
»Hallo, Kerls,« rief Sylvester zornig, »ihr sitzt hier, spielt und laßt Spione, welche die Parole nicht kennen, im Lager herumschleichen! Auf, greift den Kerl! Wir hatten ihn schon beinahe fest, er ist uns aber entsprungen. Er kann wie der Teufel rennen. Sucht ihn lebendig zu fangen, erst wenn er sich wehrt, schießt ihr ihn nieder.«
Die Soldaten warfen die Karten weg und sprangen auf. Ihre Gewehre hatten sie nicht bei sich, wohl aber Seitengewehre und Revolver. Sie waren für Abenteurer und Rebellen überhaupt sehr gut bewaffnet, nur durch ihre ungleichmäßige Uniform unterschieden sie sich von regulären Soldaten. Ebenso erhielten sie regelmäßige und hohe Löhnung und ausgezeichnete Verpflegung, mußten sich aber dafür die strengste Manneszucht gefallen lassen.
Die kleinste Widersetzlichkeit gegen einen Offizier hatte den Tod zur Folge, ganz gegen spanische Sitten; darauf hielt Estrella mit unnachgiebiger Strenge.
»Kommt, folgt mir,« rief Sylvester, »umzingelt und faßt ihn, er kann noch nicht weit sein.«
Die Soldaten stürmten den vorauseilenden Offizieren nach, welche jetzt, an der Spitze von etwa zwanzig bewaffneten Leuten, wieder einen unglaublichen Mut in sich fühlten.
Der Waldläufer war schnell gegangen; man holte ihn nicht so bald ein, aber man mußte ihn treffen, denn nach jenem Gewölbe führte kein anderer Weg als dieser.
»Lauft, Kerls!« schrie Juarez. »Eben habe ich seine Gestalt gesehen. Dort hinter dem Steinhaufen hat er sich verkrochen.«
»Meint Ihr mich, Señores?« rief eine Stimme, und vor den erschrocken zurückfahrenden Soldaten stand plötzlich der gesuchte Mann.
Sie hatten geglaubt, einen Spion, einen elenden, feigen Wicht zu finden, und jetzt stand plötzlich die herkulische Gestalt eines Waldläufers mit imponierender Ruhe vor ihnen.
Niemand hob eine Hand, die beiden Offiziere fühlten plötzlich wieder, wie das tapfere Herz in die Kniekehlen rutschte.
»Ah, das sind ja die Herren von vorhin,« sagte Deadly Dash, die beiden Offiziere erkennend. »Ist dies vielleicht der geeignete Ort, von mir Rechenschaft zu fordern?«
Sylvester kam zur Besinnung, er fühlte die Lächerlichkeit seines Benehmens. Die Scham gab ihm den Mut zurück.
»Drauf, Leute, fangt den Spion!« schrie er und zog den Degen.
»Mein Name ist Deadly Dash,« entgegnete der Waldläufer, ohne eine Bewegung zur Verteidigung zu machen. »Wer mich anfaßt, wird ihn bestätigt finden. Deadly Dash läßt sich nicht fangen!«
Einige Soldaten beachteten die Warnung nicht. Durch den Offizier ermutigt, sprangen zwei von ihnen mit ausgestreckten Händen vor, um den Mann zu fassen, doch noch ehe sie ihn berührten, stieß der Waldläufer beide Fäuste zugleich vor, sie trafen das Gesicht der Angreifer, und lautlos stürzten beide zu Boden, wie Schlachttiere vom Beile des Metzgers getroffen.
Auch diese Warnung genügte nicht. Mit gezücktem Degen drang Sylvester auf den Riesen ein, und eingedenk des Befehles, zogen die Soldaten die Revolver aus den Gürteln.
Da befand sich die eben noch über der Schulter des Waldläufers hängende Büchse plötzlich mit dem Lauf in dessen Hand. Wie eine Keule wurde sie in der Luft geschwungen und sauste auf Kopf, Schulter und Arme mit schmetterndem Schlag herab.
Nur zwei Revolver knallten, dann sanken die, welche sie abgedrückt hatten, leblos nieder. Aus ihren zerschmetterten Köpfen floß Blut. Sylvester kam nicht zum Stich; der Kolben des Gewehres zerschmetterte seinen Oberarm. Noch einmal kreiste die Büchse um des Waldläufers Kopf, noch einmal stürzten vier Mann, als wären sie gleichzeitig getroffen worden, zu Boden, dann waren die übrigen, wie Spreu im Wind, zerstoben.

Nur zwei Revolver knallten, dann sanken die, welche sie abgedrückt
hatten, leblos nieder. Deadly Dash hatte seinem Namen Ehre gemacht.
Auch Juarez hatte Zuflucht hinter einem Steinhaufen gesucht.
»Besinnt Euch ein anderes Mal besser, ehe Ihr Deadly Dash fangen wollt,« rief der Waldläufer dem stöhnenden Sylvester zu, »Deadly Dash flieht nicht, wenn man Hunde auf ihn hetzt. Die Soldaten mögen für ihre Kameraden sorgen; wer auf mich schießt, mit dem kenne ich kein Mitleid.«
Deadly Dash setzte seinen Weg ruhig fort, ohne sich umzusehen. Er war vollkommen unverletzt.
Doch er sollte sein Ziel nicht unbelästigt erreichen, Juarez war ja entkommen, und dieser konnte ihn hier, mitten im Lager der Rebellen, sicher noch unschädlich machen. Das müßte ja der leibhaftige Satan sein, der einem ganzen Bataillon geschulter Soldaten trotzen wollte.
Die Schüsse im Lager hatten die Leute alarmiert. Von allen Seiten strömten sie herbei. Sie eilten sogar an Deadly Dash vorüber, dessen ruhiges, harmloses Benehmen ihnen nichts von dem Vorgefallenen verriet, als sie auf ihre versprengten und halbtoten Kameraden stießen. Dann gesellte sich ihnen noch Juarez mit schreckensbleichem, von Wut entstelltem Gesicht bei.
Was, ein einzelner, und noch dazu ein Spion, wollte hier so auftreten? Juarez brauchte die Soldaten nicht erst aufzufordern, rasend vor Zorn, stürzten sie dem Waldläufer nach.
»Fangt ihn lebendig, den Schurken!« brüllte Juarez, diesmal aber vorsichtigerweise hinter der Front bleibend.
Lebendig wollten die Soldaten den Spion auf jeden Fall fangen. Niemand zog eine Waffe. Er sollte hängen. Fünfzig Mann gegen einen — er konnte nichts gegen sie machen.
Deadly Dash hatte einen freien Platz erreicht, nur noch wenige Schritte, dann hatte er den Eingang zu jenem Gewölbe erreicht, in welchem sich die Gefangenen befanden. Schon die draußen postierten Soldaten verrieten dies.
Plötzlich sah er sich von einer brüllenden Menge umgeben, hundert Arme streckten, sich nach ihm aus.
Diesmal stieß er nicht erst einen Warnungsruf aus, wieder kreiste seine Büchse um den Kopf und teilte wuchtige Hiebe nach links und rechts, nach vorn und hinten fast gleichzeitig aus, und wen der Kolben traf, der stürzte bewußtlos nieder.
Dann beschleunigte Deadly Dash seinen Schritt. Niemand konnte ihn fassen, nicht einmal berühren, die Büchse bahnte ihm den Weg, und bald hatte er den Eingang des Gewölbes erreicht.
Mit einem Ruck hing er die Büchse über die Schulter, die Posten wurden zur Seite geschleudert, und Deadly Dash stand vor Estrella und den Gefangenen.
Wie schon erwähnt, hatte das Erscheinen Deadly Dashs große Bestürzung hervorgerufen, besonders unter den Gefangenen. Der Waldläufer, den sie während ihrer Gefangenschaft in ihrer Nähe gewußt hatten, mußte doch ein Feind der Rebellen sein, und er wagte sich trotzdem ohne Besorgnis in die Höhle des Löwen. Den Weg hierher hatte er sich mit Gewalt gebahnt. Hinter ihm drängten sich Soldaten und ein Offizier herein, Juarez, und die im Gemach anwesenden Soldaten fällten die Gewehre, die Offiziere, mit Ausnahme Estrellas, zogen die Degen.
In der nächsten Sekunde mußte Deadly Dash entweder tot oder gefangen sein.
Doch das Staunen der Anwesenden wurde durch das Verhalten Johannas noch gesteigert.
Diese war mit ausgebreiteten Armen auf den Waldläufer zugeeilt, wie zweifelnd stehen geblieben und dann wieder auf ihn zugestürzt, hatte ihn umarmt und wieder und wieder geküßt.
»Felix, bist du es denn wirklich?«
»Ich bin's, Johanna,« entgegnete der Waldläufer und zog das Mädchen an seine breite Brust.
Da hallte das donnernde Kommando Estrellas durch den Raum, augenblickliche Stille unter den Soldaten hervorzaubernd.
»Gewehre in Ruh!«
Doch Juarez hatte den Befehl nicht gehört, mit entblößtem Degen stürzte er herein und hob die Waffe, den wehrlosen Fremden zu durchbohren.
Estrellas scharfes Auge erkannte die Situation.
Juarez Handgelenk wurde mit solch eiserner Kraft gepackt, daß die Klinge seiner Hand entfiel.
»Haben Sie mich verstanden, Leutnant?« sagte der Kommandant drohend. »Gewehr in Ruh! Bei Gottes Tod, gehorchen Sie!«
»Er ist ein Spion,« stammelte Juarez.
»So werde ich ihn verhören.«
»Er hat Soldaten getötet.«
»So? Warum haben Sie ihn denn nicht gefangen?«
Das war eine verfängliche Frage.
»Ich habe mein Möglichstes getan.«
»Gut! Wenn Sie darauf bestehen, so werde ich eine Untersuchung einleiten und die Soldaten oder Offiziere, welche sich schlapp betragen haben, geziemend bestrafen lassen. Jetzt stecken Sie den Degen ein und stellen sich dorthin.«
Juarez knirschte leise mit den Zähnen, als er den Degen aufhob. Die Situation gefiel ihm nicht. Schließlich konnte er dieses Kerls wegen, der mit seiner Büchse wie ein Wilder um sich schlug, auch noch mit einer entehrenden Strafe belegt werden.
Als er sich aufrichtete, erschrak er heftig, ein solch furchtbarer Blick traf ihn aus den Adleraugen Estrellas.
Juarez wußte, der Kommandant hatte seine Zähne knirschen gehört, sagte aber nichts. Schweigend gesellte er sich den übrigen Offizieren zu.
Es dauerte lange, ehe sich unsere Freunde und Freundinnen von ihrem namenlosen Staunen erholt hatten. War es denn nur möglich? Dieser Waldläufer, mit dem sie lange Zeit intim verkehrt hatten, war Felix Hoffmann, der Bräutigam Johannas? Und sie hatten ihn nicht erkannt!
Doch ja, Felix Hoffmann hatte früher einen langen Bart getragen, und nichts verändert einen Menschen so sehr, als wenn er plötzlich ohne Bart erscheint. Jetzt, da ihn wieder ein kurzer Vollbart schmückte, hatte er schon mehr Aehnlichkeit mit dem alten Freund. Das heißt, weil sie nun wußten, wer er war. Sonst hätten sie ihn noch nicht erkannt.
Doch der Blick der Liebe ist scharf. Johanna hatte ihn sofort erkannt, sie hätte ihn auch unter Tausenden herausgefunden, wenn er noch unkenntlicher gewesen wäre.
Die beiden flüsterten leise und zärtlich miteinander, Johanna erzählte, wie sie hierher kam.
»Felix, ich habe ein großes Unrecht begangen.«
»Dich trifft keine Schuld, ich mache dir nicht den geringsten Vorwurf wegen deines Verhaltens. Im Gegenteil, ich hätte dich über meinen Verbleib beruhigen sollen, doch es war keine Gelegenheit dazu.«
»Wenn ich nicht gefangen worden, wärest du jetzt hier?«
»Schwerlich. Ich kam, weil ich dich hier wußte.«
»So bist du also durch meine Schuld gefangen worden? Felix, vergib mir meine Unbedachtsamkeit! Nie wieder will ich einen Schritt ohne deine Erlaubnis tun.«
»Aber, Schatz, ich bin ja frei.«
»Doch nicht, wenn du auch nicht gefesselt bist.«
»Nein, ich versichere dir, ich kann sofort wieder gehen, wenn ich will, wahrscheinlich sogar mit dir.«
Johanna hob erstaunt den Kopf.
»Ist das wahr?«
»Wirklich, wie du nachher gleich sehen wirst. Doch nun laß mich erst unsere Freunde begrüßen.«
»Ich brauche mich Ihnen nicht erst vorzustellen,« sagte er zu den Herren und Damen, ohne seine Braut aus den Armen zu lassen, »ich habe lange Zeit unter Ihnen verweilt, ohne daß Sie mich kannten, und ohne daß ich mich Ihnen zu erkennen gab. Verzeihen Sie mir mein doppeltes Spiel. Ich mußte als Deadly Dash auftreten, weil ich als solcher hier Freunde und Einfluß unter Weißen und Rothäuten besitze, als Felix Hoffmann dagegen kennt mich hier niemand.«
»Mister Felix Hoffmann,« sagte hinter ihm leise eine Stimme.
Hoffmann wendete sich um, ließ, als er den Sprecher, Estrella, erblickte, Johanna los und trat einen Schritt vor.
»Fernando de Estrella, sind Sie es wirklich?« rief er erstaunt.

»Ich bin es wirklich.«
Hoffmanns Stimme klang erschüttert, als er sagte:
»Wie, als einen Anführer von Freibeutern treffe ich Sie wieder? Das hätte ich nicht erwartet! Als wir uns vor drei Jahren zum letzten Male sahen, glaubte ich bestimmt, dem Capitano Estrella als General wiederzubegegnen. Sie, Fernando, ein mutiger, scharfsinniger, hochbegabter Mann, zum Offizier wie geboren, Anführer einer Schaar von Freibeutern, um noch einen gemäßigten Ausdruck zu wählen! Ich kann es kaum fassen.«
»Es ist wirklich so. Ich zürne Ihnen sogar nicht, wenn Sie mich einen Räuberhauptmann nennen.«
»Was hat Sie zu dieser Stelle gebracht?«
»Das Schicksal.«
Hoffmann hob die Schultern.
»Das ist die Entschuldigung eines jeden, der sich ohne Gegenwehr zu Boden werfen läßt, weil sein Charakter zu schwach ist, dem Unglück standzuhalten.«
Bis jetzt hatte der sonst so selbstbewußte, fast immer spöttisch lächelnde Capitano sich benommen, wie ein Schuljunge, der vom Lehrer auf verbotener Tat ertappt worden ist. Doch nun richtete er sich wieder auf.
»Mister Hoffmann, Sie sagten vorhin, Sie wären kein Gefangener.«
»Ich glaube kaum, daß Sie es wagen werden, mich als Gefangenen zu betrachten,« erklang es sicher.
Wieder schauten die Damen und Herren verwundert auf. Das klang ja fast, als wäre Hoffmann hier unumschränkter Befehlshaber. Sie wußten nicht, was er in Wirklichkeit war, sie hielten ihn für einen Ingenieur, wohlhabend genug, so daß er sein eigenes Schiff halten konnte. Nur Johanna kannte seine wahren Verhältnisse, da er aber darüber schwieg, sprach auch sie nicht davon.
Das Erstaunen der Anwesenden steigerte sich, je länger Hoffmann und der Spanier, welcher viel von seinem früheren Selbstbewußtsein verloren hatte, sprachen.
»Warum nicht?« fragte Estrella.
Hoffmann lächelte.
»Weil dann Ihre Sache, und hätte sie noch so gute Aussichten, hoffnungslos verloren wäre.«
»Ich sehe das ein,« entgegnete Estrella zögernd, »ich werde mich auch hüten, Sie als Gefangenen hier zu halten, sonst —«
»Sonst würde sich Mexiko wohl schwerlich noch für Ihre Sachen interessieren,« fiel Hoffmann ein.
»Aber,« fuhr der Spanier fort, »ich wünsche, daß Sie mich unterstützen.«
»Nimmermehr,« rief Hoffmann, »ich habe Ihnen oft genug erklärt, und Sie wissen recht gut, daß ich mich nie in politische Verhältnisse mischen werde.«
»Allerdings bin ich davon überzeugt, aber ich glaube doch, Sie werden gezwungen sein, mir zu helfen.«
»Wieso?«
»Sie sind zwar nicht selbst mein Gefangener, wohl aber Miß Lind.«
»Ah, ich beginne zu verstehen.«
»Würden Sie versuchen, auch diese Dame durch Gewalt zu befreien, ebenso, wie Sie sich der Gefangennahme durch jenen Offizier dort entzogen haben?« lächelte der Spanier und stützte sich auf das Gefäß seines langen Degens.
Hoffmann war überrascht.
»In der Tat, nein. Ihr Leben gilt mir mehr als das meinige. Sie möchte ich nicht der Gefahr aussetzen, sich durch die Feinde zu schlagen.«
»Sehen Sie, Miß Lind bleibt also meine Gefangene.«
»Also auf diese Weise wollen Sie meine Unterstützung erzwingen,« lachte Hoffmann, durchaus nicht befangen. »Estrella, Sie sind ein Schlauberger, ich mache Ihnen mein Kompliment. Wieviel fordern Sie Lösegeld?«
»Ich hoffe, Sie bleiben in der Nähe der Ruine. Häuser stehen Ihnen genug zur Verfügung, und auf Wunsch werde ich sie Ihnen auch einrichten lassen, damit Sie und die englischen Lords sich dort häuslich fühlen. Für die nächsten Tage steht keine kriegerische Aktion zu befürchten, morgen werde ich Sie und diese Herren die Höhe des Lösegeldes wissen lassen.«
Jetzt wußten sie mit einem Male alle, was Estrella beabsichtigte. Er wollte weniger Geiseln, als vielmehr Geld haben, ohne welches ein Krieg unmöglich ist.
»Wohlan,« rief Hoffmann und zog Johanna wieder an sich, »beruhige dich, Geliebte, in wenigen Tagen schon wirst du wieder bei mir sein. Der Charakter Estrellas garantiert mir, daß du hier sicher aufgehoben bist, man wird dir mit gebührender Achtung begegnen.«
»Auf mein Ehrenwort,« warf Estrella ein, »die Damen sind nicht meine Gefangenen, sondern meine Gäste.«
Jetzt nahm Lord Harrlington das Wort.
»Capitano,« sagte er, »wir sehen, daß es Ihnen nur darauf ankommt, für diese Damen ein Lösegeld zu erhalten. Wir sind der Meinung, daß dasselbe nicht gering sein wird. Doch dies macht nichts aus, wir sind glücklicherweise so gestellt, es bezahlen zu können, und für diese Damen geben wir gern alles hin. Sie selbst sagten aber vorhin, nur für die nächsten Tage seien keine kriegerischen Aktionen zu befürchten. Nun sind jene Summen, welche Sie verlangen werden, nicht sofort zu beschaffen, wir sind weit entfernt von der Heimat, es vergeht einige Zeit, ehe wir in den Besitz von Geldern gelangen.«
»O, das macht nichts,« lachte Estrella. »Wenden Sie sich an Señor Hoffmann, er kreditiert Ihnen jede Summe, welche Sie nur von ihm wünschen. Nicht wahr, Señor Hoffmann?«
Verwundert schauten alle auf den Ingenieur, der einfach nickte. Sollte dieser Mann wirklich so reich sein, daß ihm Estrella solches Vertrauen schenkte? Sie waren hier in Texas, hier konnte man auf einer Bank nicht durch bloße Ausfüllung eines Wechsels jede beliebige Summe erheben.
»Ich erkläre mich gern bereit,« sagte Hoffmann, »den Herren innerhalb kurzer Frist jede Summe zu verschaffen, welche zur Auslösung der Damen notwendig ist.«
»Natürlich in bar,« schalt Estrella ein, »Papiergeld kann im Kriege wenig nützen.«
»In bar.«
»Auch Silber nehme ich an,« fügte der Spanier lächelnd hinzu.
Die Vestalinnen traten zusammen und flüsterten miteinander. Man glaubte, sie sprächen über Hoffmann, in Wirklichkeit aber unterhielten sie sich über ein anderes Thema.
Nur Hope nahm an der Besprechung nicht teil, sie stand abseits von den Freundinnen und weinte. Auch Hannes hielt sich mit geballten Fäusten von den Herren entfernt und murmelte vor sich hin. Sein Gesicht drückte fast Verzweiflung aus, die man sonst nie bei ihm zu finden gewohnt war. Er wagte nicht, einen Blick nach seiner jungen Frau zu werfen, kein Wort des Trostes, der Hoffnung kam über seine Lippen.
Unter den Anwesenden befanden sich natürlich auch Hannibal und Kasegorus. Ersterer hielt sich in der Nähe seines Herrn und war sich vollkommen bewußt, daß, wenn Harrlington frei war, man auch ihn nicht gefangen halten durfte. Letzterer drückte sich in eine Ecke und machte ein ängstliches Gesicht. Unter diesen vielen Soldaten fühlte er sich nicht wohl.
Jetzt schlich er sich zu Williams, zupfte ihn am Rock und flüsterte ihm etwas zu.
»Gewiß, mein Junge,« sagte dieser lächelnd. »Du kommst mit mir. Dein schwarzes Fell ist doch nichts wert.«
Schon machte der Kleine wieder ein fröhliches Gesicht, als Estrella, dessen Auge diese kleine Szene beobachtet hatte, es abermals in ein erschrockenes verwandelte.
»Sir Williams,« rief er, »ist dieser Ihr Diener?«
»Ja, Señor.«
»Er bleibt als Gefangener hier.«
»Wollen Sie Sklavenhandel treiben?« fragte Williams unwillig, während der Schwarze zu weinen begann.
»Der Neger kann stolz darauf sein, daß für ihn ein hohes Lösegeld gefordert wird, daran, ob es bezahlt wird oder nicht, kann er gleich prüfen, wieviel er von seinem Herrn zu halten hat. Wem gehört jener grauköpfige Neger dort?«
»Er ist mein Diener, Señor,« entgegnete Lord Harrlington.
»So gilt von ihm dasselbe.«
Wie? Hannibal sollte als Geisel hier bleiben? Das war zu viel für das Ehrgefühl des Schwarzen.
Mit der Geste eines Schauspielers, die eine Hand weit vorgestreckt, die andere aus dem Herzen, trat er einen Schritt auf Estrella zu.
»Señor,« rief er in fließendem Spanisch mit tremolierender Stimme, »bedenken Sie, was Sie tun. Wagen Sie nicht, mich von Lord Harrlington zu trennen! Sie würden die furchtbarsten Folgen über Ihr Haupt heraufbeschwören.«
»Auch Sie werde ich nicht wie einen Gefangenen, sondern wie einen Gast behandeln,« unterbrach ihn Estrella lächelnd.
»Trotz alledem! Würden Sie wagen, nur ein Haar auf meinem Haupte zu krümmen —«
»Sie sind ja schon krumm!«
»Man würde Sie zur peinlichsten Rechenschaft ziehen,« fuhr der kraushaarige Hannibal unbeirrt fort. »Ich bin ein Mann, auf den ganz England mit Stolz schaut, die ältesten Gelehrten lauschen meinen Worten mit Ehrfurcht —«
»So werde auch ich mir bei Ihnen etwas Belehrung holen. Genug jetzt, Sie bleiben als Geisel hier! Bitten Sie Ihren Herrn, daß er Sie bald auslöst.«
Hannibal mußte sich erfolglos zurückziehen. Estrella kam es darauf an, Geld zu machen.
Hoffmann sah jetzt zum ersten Male Miß Morgan, welche sich bis jetzt in einer dunklen Ecke gehalten hatte, nun aber sich dem Anführer näherte, um leise mit ihm zu sprechen.
»Trauen Sie diesem Weibe nicht,« rief der Ingenieur beim Anblick der Verräterin zornig. »Alles, was sie spricht, ist Lug und Trug, sie ist das verworfenste Geschöpf unter der Sonne. Selbst meinem Feinde wünsche ich sie nicht als Beraterin.«
Sara warf ihm einen gehässigen Blick zu.
»Ich brauche sie aber,« entgegnete Estrella und besprach sich mit Miß Morgan.
»Ah so,« sagte er dann. »Mister Hoffmann, wo ist Ihr Gefährte, mit welchem Sie sich längere Zeit in der Ruine versteckt gehalten haben?«
»Ich möchte ebenfalls wissen, wo er ist, damit er uns beistehen kann. Doch er wird schon noch zu uns stoßen.«
»Miß Lind, wissen Sie, wo Nicolas Sharp, Ihr Bruder, sich jetzt befindet?«
Johanna lachte laut auf.
»In der Tat, Sie verlangen viel von mir. Aber wenn ich es auch wüßte, ich sagte es Ihnen nicht!«
Estrella sah die Berechtigung dieser Antwort ein, er verschmähte, weiter nach dem verschwundenen Detektiven zu forschen. Uebrigens hielt er ihn nicht für gefährlich. Sharp gab wohl einen guten Spion ab, doch Estrella war es gleichgültig, ob man seine Pläne ausspionieren wollte oder nicht. Er legte sie ja selbst offen dar.
»Dann wäre die Sache erledigt,« meinte er jetzt, sich an die Herren wendend, »Sie können das Lager sofort verlassen, und ich versichere Ihnen nochmals, daß die Damen bis zum Eintreffen des Lösegeldes so behandelt werden, wie sie es von Kavalieren erwarten dürfen.«
»Noch eins,« unterbrach ihn Hoffmann. »Die in Ihren Diensten stehenden Indianer haben drei Gefangene, darunter ein Mädchen, welches sie martern wollen. Können Sie diese mir überlassen? Ich zahle auch für sie Lösegeld.«
Estrella zuckte bedauernd die Schultern.
»Ich darf mich nicht in solche Angelegenheiten mischen. Ich kenne die drei Gefangenen, sie haben angesehene Krieger getötet, und die Indianer dürsten nach Rache. Nicht um alle Schätze der Welt kann ich sie befreien.«
»Ist dies Ihr letztes Wort?«
»Mein letztes.«
»Dann verlassen wir Sie, Ich darf Ihnen kein Glück wünschen, Estrella, ich würde Sie lieber an der Spitze Ihres mexikanischen Bataillons gegen die Yankees ins Feld rücken sehen als so!«
»Das Schicksal will es, und ich bin's zufrieden.«
Hoffmann umarmte seine Braut, die Engländer die Mädchen, denen sie ihre Liebe schon lange gestanden hatten. Wenige gab es unter ihnen, die sich nur mit einem Händedruck begnügen mußten, in welchem aber auch mehr lag, als nur ein einfacher Abschied.
Hannes und Hope sagten nichts. Weinend lag sie an seiner Brust und umklammerte ihn, als wolle sie ihn nicht von sich lassen. Fast mit Gewalt befreite er sich von ihr, denn schon begannen die Männer das Zimmer zu verlassen.
Die Trapper gingen voran.
»Auf Wiedersehen, Capitano!« riefen sie, und der Klang der Stimme verriet, daß sie keine freundliche Begegnung wünschten. So verstand es auch Estrella.
»Auf Wiedersehen auf dem Schlachtfeld, meine Herren! Estrella wird Ihnen zeigen, daß auch er die Kampfesweise der Indianer kennt.«
»Auf Wiedersehen!« rief auch Lord Harrlington, das Gemach verlassend.
»Ich würde mich freuen, Ihnen niemals wieder zu begegnen,« sagte Hoffmann. »Wehe Ihnen aber, sollte es doch der Fall sein! Sie werden keinen Mann vor sich haben, dessen Frau Sie zur Geliebten begehren.«
Estrella, wegen seiner zahllosen Duelle, aus Liebeshändeln entsprungen, bekannt, antwortete nichts. Stumm blickte er der hohen Gestalt des Deutschen nach.
Der letzte, welcher sich dem langen Zuge anschloß, war Hannes. Mit gesenktem Kopfe tat er es.
Das Zimmer war noch gefüllt mit den Damen, Soldaten und Offizieren.
»Hannes, Hannes, verlaß mich nicht — du siehst mich niemals wieder!« gellte es da mit schmerzerfüllter Stimme dem Zuge nach.
Hope lehnte, an allen Gliedern zitternd, an der Wand, Sie wäre zu Boden gestürzt, hätten nicht zwei Mädchen sie schnell gehalten.
Hannes blieb stehen, schaute sich um und trat dicht vor den Kapitän hin, die Fäuste geballt.
»Herr,« sagte er mit zitternder Stimme, »ich bin nicht gewöhnt, zu bitten, diesmal erniedrige ich mich dazu: geben Sie jene Dame dort frei!«
Estrella schüttelte den Kopf.
»Sie sind vermögend, zahlen Sie Lösegeld! Sie ist hier einstweilen gut aufgehoben.«
»Ich liefere Ihnen das Lösegeld später, ich gebe Ihnen alles, was ich besitze.«
»Ein Versprechen allein hat keine Sicherheit für mich. Auch darf ich keine Ausnahmen machen.«
»Auf mein Ehrenwort, Sie erhalten die Summe nachträglich.«
»Ich mache keine Ausnahme.«
Hannes' Stimme bebte noch mehr, als er sagte:
»Sie ist meine Frau.«
»Im Kriege gibt es keine zarten Rücksichten«
»Wir sind wenige Monate verheiratet.«
Das Zwiegespräch war von Hopes leisem Weinen begleitet worden. Auf des jungen Mannes letzte Worte richtete Estrella den Blick nach der gebrochenen Gestalt und verweilte lange auf ihr.
»Señor Estrella, ich möchte Sie allein, ohne Gegenwart dieser Männer sprechen,« bat Hannes leise.
»Was ich höre, dürfen auch meine Leute hören,« entgegnete der Spanier, ohne seinen Blick von Hope zu wenden.
Zwei junge Offiziere raunten sich gegenseitig etwas zu. Ein spöttisches Lächeln kräuselte ihre Lippen, doch ein drohender Blick Estrellas ließ es verschwinden.
Sonderbar! Was mochte im Inneren dieses Mannes vorgehen?
Immer starrer wurde sein Blick, Zoll für Zoll sank die hohe, schlanke Gestalt zusammen, bis sie gebückt vor Hannes stand.
»Sie heißt Hope,« murmelte er dumpf, »das bedeutet die Hoffnung. Auch ich hatte einst ein junges Weib, schön und liebevoll. Sie starb, als sie in der Hoffnung war, mir ein Kind zu schenken. Wäre sie einige Monate später gestorben, hätte sie mir erst das Pfand meiner Liebe geschenkt, ich wäre nicht der geworden, der ich jetzt bin. Zum Teufel denn, Mann,« schrie er plötzlich, sich wieder hochaufrichtend, den jungen Mann an, »nehmen Sie Ihre Hope und machen Sie, daß Sie fortkommen! Ich will kein Lösegeld, hören Sie? Ich mag von Ihnen kein Lösegeld. Aber das verlange ich: Verlassen Sie dieses verfluchte Land und leben Sie Ihrer Frau, damit nicht auch Ihnen die Hoffnung geraubt wird! Verstanden?«
Ein heller Jubelruf ertönte aus Hannes' Munde, er sprang auf Hope zu, nahm sie in die Arme, nein, auf die Arme und eilte mit ihr hinaus, ohne sich noch einmal umzublicken.
Estrella stand an dem Fenster und blickte hinaus auf das Lagerleben mit einer Spannung, als interessiere er sich außerordentlich dafür. Doch der Führer der Rebellen wollte den Untergebenen nur seine nassen Augen nicht sehen lassen.
Draußen wurden Hannes und Hope von den staunenden Engländern umringt.
»Hannes, Sie sind doch ein Glückspilz!«
Der junge Mann setzte Hope vorsichtig auf den Boden.
»Bah,« meinte er, »Sie könnten es auch so haben, Sie hätten nur schnell zugreifen müssen, das heißt, fix heiraten, anstatt so lange den galanten Ritter zu spielen.«
»Leutnant Juarez,« rief drinnen Estrella mit rauher Stimme, um seine Weichheit zu verbergen. »Geleiten Sie diese Leute durch die Postenkette. Sie bürgen mit Ihrem Kopfe dafür, daß dieselben unbelästigt bleiben, bis sie selbst die Waffen gegen uns erheben.«
Es war Mittag. Heiß brannte die südliche Sonne auf die Häupter der drei Gefangenen herab, welche an den Pfählen standen und mit festen Augen den Vorbereitungen zu ihrem Martertode zusahen. In einiger Entfernung brannten Feuer, und junge Indianer waren damit beschäftigt, Holzsplitter zu schneiden.
Diese wurden im Feuer zum Glimmen gebracht und sollten dann den Gefangenen unter die Nägel der Hände und Füße geschoben werden. Jene eisernen Ladestöcke dort wurden glühend den Opfern ins Fleisch gestoßen, bis man endlich Holz rings um sie aufschichtete und ihre Leiber langsam röstete.
Schade, daß unter den Indianern keine Weiber waren. Das weibliche Geschlecht ist in seinen Leidenschaften dem männlichen bedeutend überlegen, gleichviel, ob in Liebe, Haß oder in Eifersucht und Rache. Wären die Mütter, Töchter oder gar die Frauen der Erschlagenen anwesend gewesen, sie hätten noch ganz andere Mittel gefunden, deren Mörder erst zu demütigen und dann zu quälen. Aber einen anderen Erfolg als diese indianischen Männer hätten sie auch nicht gehabt.
Die Indianer heulten die Lobgesänge zu Ehren der Getöteten, welche mit Schmähungen auf die Mörder endeten, vor tauben Ohren. Die Wimpern der Gefangenen zuckten nicht, wenn die jungen Männer ihnen triumphierend die rotglühenden Ladestöcke zeigten.
Keine Spur von Furcht war in den trotzigen Mienen Sonnenstrahls und Stahlherz' zu lesen, und Waldblüte blickte träumerisch und lächelnd drein wie damals, als sie Blumenkränze für den Bruder wand.
Aber wie sah es in ihrem Innern aus!
Der Vater stand neben den wiedergefundenen Kindern — noch heute sollte er sie in den Flammen sterben sehen. Darum also hatte er sie gefunden, um ihrem Tode beizuwohnen! Auch ein Indianer kennt die Vaterliebe, wenn er ihr auch selten Ausdruck gibt. Schmerzender, als später die feurigen Eisen sein konnten, waren die Gedanken, welche sein Herz marterten.
Sonnenstrahl stand vor denen, welchen er ein Fürst, ein die Freiheit bringender Heiland sein sollte. Sie kannten ihn nicht, sie banden ihn an den Pfahl und schürten das Feuer, um seinen Leib verkohlen zu lassen. Sonnenstrahl wußte nicht, daß er das Schicksal vieler Menschen teilen sollte. Im Leben verachtet, nach dem Tode verehrt — seltsam, daß sich die Menschen nie ändern, jedes Jahrhundert zeichnet in das Buch der Weltgeschichte neue Beispiele dieser Kurzsichtigkeit und Undankbarkeit.
Waldblüte hatte gleiche Gedanken wie der Bruder. Ihr Herz krampfte sich beim Anblick dieser armen Verblendeten zusammen.
Aus dem Walde trat ein Mann und schritt auf den Kreis von Indianern zu. Es war Hoffmann, oder wie wir ihn jetzt noch nennen wollen, Deadly Dash. Er war noch in feinem Waldläuferkostüm, aber vollständig ohne Waffen, Er trug weder Büchse noch Messer oder Revolver, wohl aber hingen von seinem Gürtel jene schon früher erwähnten Ledertaschen herab.
Noch ehe er den Kreis erreicht hatte, trat ihm ein Indianer entgegen, derselbe, mit dem sprechend, Deadly Dash von den beiden Offizieren gesehen worden war.
Er wußte, daß die Martern noch nicht begonnen hatten, aber auch, daß sie bald ihren Anfang nehmen würden, denn die Indianer hatten anderes zu tun, als mit dem Quälen von Gefangenen viel Zeit zu vergeuden, ein wie großes Vergnügen ihnen ein solches Schauspiel auch bereitete.
Indianer haben die größte Ehrfurcht vor körperlicher Kraft, dieser hohe, breitschulterige Mann mußte ungeheuer stark sein, und so wies ihn der Indianer nicht sofort barsch zurück, sondern ließ sich in ein Gespräch mit ihm ein. Einige Indianer umstanden beide.
»Was will das Bleichgesicht?«
»Der Marterung beiwohnen,« antwortete Deadly Dash.
»Das Bleichgesicht hörte schon einmal, daß kein Fremder zuschauen darf. Geh,« sagte der weiße Falke.
»Ist der weiße Falke der erste Häuptling am Beratungsfeuer?«
»Nein,« gestand der Indianer offen.
»Ich weiß, der Adlerfeder haben die Häuptlinge zu lauschen. Vorhin war die Adlerfeder nicht da, doch nun habe ich sie gesehen.«
»Der weiße Falke lügt nicht. Ja, Adlerfeder ist jetzt hier.«
»So hat er zu befehlen, nicht du.«
Der Indianer runzelte grimmig die Stirn. Doch er beherrschte sich, er mußte es tun.
»Adlerfeder will nicht, daß ein Bleichgesicht den sterben sieht, der seinen Bruder erschlagen.«
»Rufe Adlerfeder!«
»Adlerfeder wird dem Bleichgesicht eine scharfe Antwort geben.«
»Rufe Adlerfeder,« beharrte der Waldläufer.
»Wie nennt sich das Bleichgesicht?« fragte der Indianer unmutig, weil er sich doch verpflichtet fühlte, den Auftrag auszurichten.

»Ich bin ein weißer Häuptling, welcher am Beratungsfeuer sitzt, wenn die anderen stehen. Nur Adlerfeder nenne ich meinen Namen,« sagte Deadly Dash stolz.
Diese Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Der Indianer ging in den Kreis zurück, während seine Gefährten den Waldläufer umringten.
Bald kam der weiße Falke wieder. In seiner Begleitung befand sich ein schon älterer Indianer, der an seinen Abzeichen als Häuptling erkenntlich war. Die mageren, äußerst sehnigen Arme mußten einst von Muskeln gestrotzt haben. Der Blick war der eines Adlers. Zahlreiche Ketten von Bärenklauen ließen auf Tapferkeit schließen, und der reiche Federschmuck verriet den hohen Rang dieses Häuptlings. Eine Krone aus den Federn des seltenen Seeadlers saß auf dem Haupt, und lang wallte der Schmuck aus denselben Federn über den Rücken des Indianers hinab, bis er den Boden berührte und dort noch nachschleifte. Auch durch die Ohren des Mannes waren Adlerfedern gesteckt.
Diesem Häuptling fiel, als er vor dem Waldläufer stand, sofort auf, daß letzterer kein Gewehr bei sich hatte.
»Wo hat der weiße Mann, welcher vom Wild des Waldes lebt und sich vor Feinden schützen muß, seine Waffen?«
»Er braucht keine.«
»Womit tötet er seine Feinde?«
Deadly Dash streckte eine geballte Hand aus.
»Mit der Faust.«
»Ein starker Mann hat eine starke Faust, doch die Kugel ist schneller als die Hand.«
»Doch nicht als meine.«
Adlerfeder betrachtete den Waldläufer lange, dann fragte er:
»Wie wird das Bleichgesicht genannt?«
»Deadly Dash.
Es bringt dem Indianer Schande, zu erschrecken, und noch mehr, den Schrecken zu zeigen. Bei Nennung dieses Namens jedoch fuhren die den Waldläufer umstehenden Indianer zurück und drängten auf den zweiten Kreis.
Der einzige, welcher sich beherrscht hatte, war Adlerfeder gewesen, aber auch sein Auge ruhte mit unverhohlenem Erstaunen auf dem Mann, der sich Deadly Dash, tötender Schlag, nannte.
»Deadly Dash — Deadly Dash!« pflanzte sich der Ruf von Mund zu Mund fort, und in weniger als einer Minute war der Waldläufer von Hunderten von Indianern umringt. Die Gefangenen wurden nur noch von den Verwandten der Getöteten bewacht.
Alle übrigen wollten den Waldläufer sehen, dessen sagenhafter Name in den Wigwams der einzelnen Stämme nur flüsternd genannt wurde.
Adlerfeder hatte sich gefaßt; nachdenklich schüttelte er den Kopf, daß die Federn schwankten.
»Viel hat Adlerfeder von Deadly Dash sprechen hören, sein Bruder hat ihn selbst gesehen, aber Adlerfeder glaubt nicht, daß Deadly Dash vor ihm steht.«
»Warum nicht?«
»Deadly Dash trägt den Tod in der Hand. Wen er anfaßt, der fällt tot zu Boden.«
Wieder streckte der Waldläufer die Faust aus.
»Wen diese Faust trifft, der steht nicht wieder auf.«
Der Häuptling lächelte.
»Als vor vielen Sommern Adlerfeders Arm noch voll war, warf er jeden Büffel mit einem Schlage nieder. Noch gibt es junge Männer, welche dasselbe können. Das Bleichgesicht lügt, es ist nicht Deadly Dash.«
»So beweist es, ehe du mich einen Lügner nennst.«
»Deadly Dash hat Hände, von denen Strahlen ausgehen, er ist der Blitz ohne Donner.«
»Von meinen Händen gehen Strahlen aus.«
»Adlerfeder sieht sie nicht.«
»Du siehst sie nicht, weil ich nichts anfasse. Fasse ich aber jemanden an, so blitzt es, ohne zu donnern, und der Blitz tötet alles.«
»Beweise es! Dann erst glaubt Adlerfeder, daß du Deadly Dash und kein Lügner bist.«
Eine ungeheuere Erregung bemächtigte sich der Indianer, aber wie Spreu stoben sie auseinander, als der Waldläufer mit ausgestreckten Händen auf sie zutrat.
»Wen soll ich anfassen?«
Auch Adlerfeder fuhr erschrocken zurück, als die todbringenden Hände ihm zu nahe kamen.
»Mußt du den Blitz gerade in einen roten Mann hineinsenden? Da sind Bäume. Deadly Dash konnte sie sofort zerschmettern.«
»Bäume sind tot, ich kann sie nicht brauchen. Wer von den roten Kriegern ist so tapfer, sich von mir anfassen zu lassen, damit sie glauben, daß ich Deadly Dash, der Blitz ohne Donner bin?«
Keiner der Indianer rührte sich; alle standen zur Flucht bereit, falls die todbringenden Hände ihnen zu nahe kommen sollten. Mit so etwas war nicht zu spaßen.
Es schien fast, als ob Deadly Dash keine Probe seiner Kraft ablegen könnte, doch Adlerfeder war schlau, er wußte Rat. Es brauchte ja nicht gerade ein Mensch zu sein, der dem Blitz zum Opfer fallen mußte.
Die Finger seiner schlaff herabhängenden Hand bewegten sich kaum merklich, aber die hinter ihm stehenden Indianer lasen dennoch die Worte ab, welche Adlerfeder in der Zeichensprache schrieb.
Eine Minute später wurde durch den Kreis der Indianer ein schöner Mustang geführt, welcher aber stark hinkte. Auf dem Hinterschenkel hatte er eine tellergroße Wunde, deren Heilung aussichtslos war.
Niemand gewahrte, als sich aller Augen nach dem Pferde richteten, wie Deadly Dash seine Hand etwas in die weiten Aermel seines Jagdhemdes zurückzog, dort etwas zu ergreifen schien und dann die Hände geballt wieder ausstreckte.
»Dies Pferd ist stark,« sagte Adlerfeder. »Bist du Deadly Dash, so berühre es, und es muß sofort tot sein.«
»Wohl, ich werde beweisen, daß ich den Blitz ohne Donner in meiner Hand führe!«
Scheu wichen die Indianer, auch Adlerfeder, vor dem Manne zurück, der jetzt auf das Pferd zuschritt. Schon sein sicheres Auftreten bewies, daß er die Wahrheit gesprochen hatte.
Deadly Dash stand vor dem Kopfe des Pferdes und legte die rechte Faust an dessen eines Ohr. Mit angehaltenem Atem sahen ihm die Indianer zu. Was würde der nächste Augenblick bringen?
Der Waldläufer erhob die linke Faust, näherte sie dem anderen Ohre des Pferdes, und noch hatte sie dasselbe nicht berührt, als unter deutlichem, knisterndem Geräusch ein blauweißer Funke ihr entfuhr. Augenblicklich stürzte das Pferd zusammen, ohne noch einmal gezuckt zu haben — es war tot.
Die Indianer waren außer sich.
»Deadly Dash, der Blitz ohne Donner!« heulten sie und umdrängten den Waldläufer, sich aber hütend, auch nur seine Kleidung zu streifen; ein Blitz hätte ihr entfahren können.
»Du hast die Wahrheit gesprochen. Du bist Deadly Dash,« sagte Adlerfeder ehrfurchtsvoll. »Bist du als Feind oder als Freund zu den Indianern gekommen?«
»Als Freund.« entgegnete Deadly Dash und streckte dem Häuptling die offene Hand entgegen.
Doch dieser zögerte, sie zu ergreifen.
»Dem Freund kann der Blitz nichts schaden,« lächelte Deadly Dash, »nur den Feind und falschen Freund tötet er, oder wenn Deadly Dash es besonders will.«
Adlerfeder durfte keine Furcht zeigen, er ergriff die Hand des Weißen und schüttelte sie.
»Mein weißer Bruder ist willkommen. Was will er von Adlerfeder? Sein Herz gehört ihm, sein Wigwam steht ihm offen.«
»Ich wiederhole meine Bitte: laß mich der Marterung der drei Gefangenen beiwohnen.«
Plötzlich trat lautlose Stille ein. Man ahnte was Deadly Dash beabsichtigte — die Befreiung der Gefangenen.
»Sie haben unsere Krieger, auch Häuptlinge getötet,« sagte Adlerfeder langsam, die Augen durchbohrend auf den Waldläufer, gerichtet. »Hält mein weißer Bruder es für nötig, daß wir sie deshalb am Marterpfahl sterben lassen?«
»Ihr müßt sie martern,« entgegnete Deadly Dash ohne Zögern.
Das war eine seltsame Antwort aus dem Munde des deutschen Ingenieurs, doch er hatte recht.
Sage dem Mohammedaner, Jesus Christus sei Gottes Sohn — die Mohammedaner verehren auch Christus, aber nur als einen untergeordneten Propheten Allahs — sage den christlichen Montenegrinern, die Blutrache sei eine Sünde, sage den Karaiben, Menschenfresserei sei nicht erlaubt, und du wirst jedesmal ein Lügner oder ein Narr genannt werden, das gleiche gilt, sagst du dem Indianer, er dürfe seine Gefangenen nicht martern.
Deadly Dash durfte aber nicht als Narr, noch viel weniger als Lügner erscheinen, wollte er seine Absicht erreichen.
Adlerfeder nickte befriedigt auf die Aeußerung seines neuen Freundes hin. Er war also im Herzen ein Indianer.
»Die Gefangenen sind deine Freunde?«
»Sie sind es.«
»Du willst ihrer Marterung beiwohnen?«
»Ich will sehen, ob Deadly Dashs Freunde dem Tod ohne Furcht ins Auge sehen können.«
»Du willst sie nicht befreien?«
»Nein.«
»Du sendest nicht den Blitz aus deiner Hand, um ihre Fesseln zu sprengen und ihnen einen Weg durch die Reihen meiner Krieger zu bahnen?«
»Deadly Dash sagt nein,« wiederholte der Waldläufer mit Betonung.
»Adlerfeder weiß, wenn Deadly Dashs Mund nein sagt, so sagt sein Herz nicht ja. Mein weißer Bruder ist willkommen, er soll die Gefangenen sterben sehen.«
Der Waldläufer ward zu den Marterpfählen geführt, und bald war der Kreis wieder um dieselben gebildet.
Man konnte den Gefangenen nicht anmerken, ob sie aus der Anwesenheit ihres Freundes Hoffnung schöpften, nicht einmal, ob sie ihn überhaupt sahen. Gleichgültig wie vorher blickten sie geradeaus, kein Aufleuchten der Augen verriet ihre Gedanken.
Die Beredsamkeit der Indianer war erschöpft; sie wußten keine Schimpfnamen mehr; die Probe der Standhaftigkeit sollte die Marter einleiten.
Junge Krieger traten vor, schwangen den Tomahawk um den Kopf und schleuderten ihn dann nach den Gefangenen. Sausend fuhren die Waffen durch die Luft und gruben sich dicht neben dem Arm oder dem Kopf der Gebundenen in das Holz ein, oft ein Stück des Jagdhemdes oder eine Haarlocke abschneidend.
Die Gefangenen zuckten nicht, wenn der Tomahawk oder das Messer auf sie zuzischten. Sie wußten, daß nur die geschicktesten Krieger ihre Kunst im Werfen zeigten, die kleinste Verletzung des Gefangenen hätte den Schleuderer entehrt.
Selbst Waldblüte blickte lächelnd dem auf sie zufliegenden Tomahawk entgegen, obwohl fast jedesmal der scharfe Stahl eine ihrer schwarzen Locken mit fortnahm.
»Deine Freunde sind standhaft,« sagte Adlerfeder zu Deadly Dash. »Wir wollen prüfen, ob sie auch lachen können, wenn glühende Holzpflöcke ihnen unter die Nägel gebohrt werden.«
»Noch nicht,« entgegnete der Waldläufer. »Adlerfeder hat vergessen, dem alten Indianer das Jagdhemd abzunehmen. Betrachte die Figuren, welche daraufgezeichnet sind! Sie enthalten die Medizin, welche ihm ein stählernes Herz geben. Nimmst du sie ihm, so wird er zittern.«
»Wah, Deadly Dash hat einen weisen Mund,« rief Adlerfeder und gab einigen jungen Indianern den Befehl, Stahlherz das Jagdhemd abzureißen.
Es war schon früher erwähnt, daß das Jagdhemd des Stahlherz mit allerlei bunten Figuren bemalt war.
Zwei Indianer sprangen auf ihn zu. Ihre Messer schlitzten das Hemd auf, und im Nu war es abgerissen.
Erschrocken fuhren die beiden zurück und deuteten auf den Gefangenen, welcher sich stolz emporrichtete. Auch die übrigen Indianer brachen in Rufe des Staunens aus.
Auf der Brust des Stahlherz war mit weißer Farbe ein vollständiges Gerippe des Brustkorbes tätowiert, jede Rippe war sichtbar, längs der Arme liefen die weißen Knochen, und jedenfalls zeigte auch der untere Teil des Körpers auf der Haut das Bild des Knochengerüstes.
Grell traten die weißen Malereien zum Vorschein; die dunkle Haut verschwand dagegen, und so glaubte man ein wirkliches Skelett vor sich zusehen, nur daß der Totenschädel fehlte.
»Das Totem der Apalachen[*] — ein Apalache,« erscholl es von allen Seiten.
[* Jeder indianische Stamm führt sein Totem, das heißt, ein Abzeichen.]

»Das Totem der Apalachen!« erscholl es von allen Selten, als die
sonderbare Malerei auf dem Körper Stahlherz' sichtbar ward.
Nur Deadly Dash und Adlerfeder behielten ihre Ruhe bei, alle anderen waren außer sich vor Staunen, als sie das tätowierte Gerippe erblickten. Es war sorgsam gezeichnet, vielleicht hätte kein Mediziner an der Malerei etwas auszusetzen gehabt.
Adlerfeder trat auf Stahlherz zu und schaute ihn mit durchbohrenden Augen an.
»Wer bist du, daß du es wagst, das Totem der Apalachen zu tragen?« fragte er drohend.
»Ein Apalache,« entgegnete Stahlherz stolz.
»Du lügst, es gibt keine Apalachen mehr.«
»Ich bin der letzte Apalache, welcher das Totem trägt. Diese meine Kinder wurden mir geraubt, als ich ihnen das Gerippe eintätowieren wollte.«
»Du lügst!«
»Stahlherz lügt nicht, er spricht die Wahrheit.«
»Wohl. Wie hieß dein Vater?«
»Wannakonda.«
»Wo fiel er?«
»In der Hirschschlucht. Die Kugeln der Bleichgesichter warfen ihn nieder.«
»Wer war sein Sohn?«
»Ein Knabe, der zwölf Sommer gezählt hatte. Mallakonda blieb für tot liegen, eine Kugel saß in seiner Seite.«
»Wer war bei ihm?«
»Ein junger Krieger. Er beugte sich über den toten Knaben. ›Tot,‹ flüsterte er, ›der letzte Apalache ist tot, jetzt bin ich der Häuptling der Apachen, Irokesen und Tschirokesen.‹«
Immer starrer wurden des Häuptlings Augen.
»Wer war der Krieger?«
»Du.«
»Wer bist du, daß du dies weißt?«
»Ich bin Mallakonda. Ich lebte wieder auf, deine Schwester pflegte mich, sie wurde mein Weib. Ich ging nicht wieder zu deinem Stamme zurück, du haßtest deine Schwester, mein Weib, weil sie nicht den Mann nahm, den du ihr bestimmtest. Als Stahlherz lebte ich in der Wildnis, niemand kannte mich.«
»Ich denke nicht mehr an Haß,« sagte Adlerfeder mit tiefer Stimme.
»So töte jetzt den letzten Apalachen, dann ist keiner mehr da, der dir den Häuptlingsrang streitig macht.«
Adlerfeder wandte sich um.
»Krieger der Apachen, Irokesen, Pawnees und Sioux,« rief er dröhnend, »ich bin nicht mehr der Häuptling, dem eure Häuptlinge gehorchen müssen, der Apalache ist wieder auferstanden. Mallakonda, Wannakondas Sohn steht vor euch, und seine Kinder mit ihm. Gehorcht ihm, und er führt euch zum Sieg gegen die Bleichgesichter!«
Ein Schnitt löste Stahlherz' Bande, auch Sonnenstrahl und Waldblüte waren frei.
Ein lauter Jubel brach unter den Indianern aus, sie umringten die Befreiten.
Stumm nahm Stahlherz die Geschwister an der Hand und machte Miene, den Ort zu verlassen.
»Wohin will mein Bruder?« fragte Adlerfeder bestürzt.
Stahlherz blieb stehen und schaute sich stolz um.
»Ich kenne die roten Kinder der Prärie nicht mehr, ihr Herz ist heute so und morgen so. Wannakonda hatte es gut mit ihnen vor, sie schickten ihn dorthin, wo ihn die Kugeln der Feinde trafen. Sie raubten Stahlherz die Kinder, sie martern ihre roten Brüder. Gut, Stahlherz geht zu denen, die ihn lieben und die ihm treu sind.«
Wieder wandte sich Stahlherz zum Gehen.
»Du darfst nicht gehen,« rief Adlerfeder, »Du gehörst zu uns. Es gibt keine Rache mehr, der Apalache hat das Recht, die zu töten, welche die Waffen gegen ihn erheben.«
Stahlherz ließ ein verächtliches Zischen hören.
»Die Stimme der Indianer ist wie der Wind, bald kommt sie von dieser, bald von jener Seite. Ich gehe zu meinen Freunden, welche keinen Wechsel kennen. Wollt ihr es nicht, so haltet mich. Wagt es, die Hand an den letzten Apalachen zu legen! Eurem Schicksal entgeht ihr doch nicht.«
Stahlherz schritt, die Kinder an der Hand dem Kreise zu, und ehrerbietig machten die Indianer ihm Platz. Sie hielten ihn nicht.
»Auch Deadly Dash will gehen?« fragte Adlerfeder traurig, als der Waldläufer den dreien nacheilte.
»Deadly Dash hat Wort gehalten, er hat seine Freunde nicht befreit, du selbst hast ihre Banden zerschnitten. Jetzt geht er zu Stahlherz, er ist sein Freund.«
Deadly Dash erreichte die drei, als sie eben den Wald betraten. Lange Zeit schritt er stumm neben Stahlherz her.
»Was will mein Bruder nun beginnen?« fragte er endlich.
»Stahlherz will sterben.«
»Sterben?« wiederholte Deadly Dash erstaunt. »Nun, da er seine Kinder wieder hat?«
Der Indianer nickte.
»Gestern nacht erschien ihm sein Vater und sagte, zweimal würde er noch die Sonne untergehen sehen, am dritten Tage nicht mehr. Stahlherz sehnt sich, zu seinen Vätern versammelt zu werden.«
»Und deine Kinder?«
»Stahlherz hat den Lehren seines weißen Bruders gern gelauscht, sie waren gut, aber er ist zu alt, als daß er sie behalten konnte. Sonnenstrahl und Waldblüte sind jung. Mein weißer Bruder mache sie zu dem, was er aus Stahlherz machen wollte.«
»Stahlherz,« begann der Waldläufer nach langem Nachdenken, »du bist nur der Hautfarbe, vielleicht auch dem Herzen nach ein Indianer, aber dein Kopf ist der eines Weißen. Du hast eingesehen, daß die Indianer so, wie sie jetzt leben, untergehen müssen.«
»Sie werden es,« entgegnete Stahlherz traurig. »Fallen sie nicht unter den langen Messern, so reiben sie sich selbst auf. Ein roter Mann muß sie retten, doch kein Krieger.«
»Du denkst an Sonnenstrahl und Waldblüte?«
»Möchten sie versuchen, was ich nicht wagte. Erzähle du ihnen, was du mir sagtest, und sei du ihnen der Vater, bin ich tot.«
Stumm drückte ihm Deadly Dash die Hand. Dann schritten sie, ohne ein Wort weiter zu wechseln, dem Teile der Ruine zu, wo sich die Engländer und Trapper aufhielten, und warteten, bis Estrella ihnen den Boten schicken würde, der das Lösegeld für die gefangenen Damen fordern sollte.
Wie schon gesagt, erstreckte sich die Ruine weithin, selbst in den Wald hinein, obgleich die einzelnen Teile nicht zusammenhingen.
Das Gebäude, das die Engländer einnahmen, lag über einen Büchsenschuß von dem eigentlichen Tempel im Walde versteckt. Früher mochten Tempeldiener hier gewohnt haben. Von hier aus konnte man zwischen den Bäumen hindurch die terrassenartigen Bauten sehen, aber von diesen aus nicht die Häuser, weil dieselben im Walde lagen.
Estrella setzte alles daran, den Engländern, wie wir sie kurz nennen wollen, seine Gunst zu zeigen, damit auch diese ihm freundlich gesinnt blieben. Durch seine eigenen Soldaten hatte er die Häuser reinigen lassen. Tische und Stühle wurden aufgestellt, genügend Feldbetten aufgeschlagen und sonstige Bequemlichkeiten angeboten. Ja, er hatte sogar nicht vergessen, für Papier, Tinte und Feder zu sorgen, aus dem einfachen Grunde, weil er dies Schreibmaterial bald von Hoffmann benutzt zu sehen wünschte.
Als Hoffmann am Nachmittag mit Stahlherz und dessen Kindern nach diesem Quartier zurückkam, traf er die Soldaten noch unter der Führung von Leutnant Juarez an.
Dieser beachtete ihn nicht. Mit fest zusammengebissenen Zähnen leitete er die Arbeiten der Soldaten, und sobald diese fertig waren, befahl er den Abmarsch.
Doch er wurde von Hoffmann angeredet. Dieser kannte ihn noch sehr gut, spielte aber nicht auf jene Szene bei Manila an.
»Leutnant,« sagte er, als Juarez seine Soldaten abrücken lassen wollte, »ich habe durch Sie Kapitän Estrella noch etwas mitzuteilen.«
Juarez wandte sich um und erwartete, ohne den Blicken des Ingenieurs zu begegnen, das weitere. Sie wurden von Engländern und Trappern umringt.
»Was ist es?«
»Ich lasse Estrella sagen, daß wir — ich spreche im Namen aller dieser Herren — uns von jetzt ab alle seine Freundschaftsbezeigungen verbitten. Er hat uns hier eingerichtet, das ist nicht mehr, als billig, denn er hält uns hier fest. Im übrigen aber betrachten wir ihn als unseren Feind, dies ist unser Lager, und wer von den Bewohnern der Ruine es betritt, Offizier oder Gemeiner, wird gehenkt.«
»Bravo, das war ein gutes Wort!« rief Joker. »Sie sind doch nur Rebellen, mögen sie sich auch einbilden, was sie wollen.«
»Wer gegen uns die Waffen erhebt, Indianer oder Weißer, wird auf der Stelle niedergeschossen, und wer mit uns sprechen will, ohne daß er sein Leben gefährden will, hat mit einer weißen Flagge zu kommen. Wird er von Estrella geschickt, so muß außerdem dort auf der Terrasse eine weiße Flagge gehißt werden. Ueberläufer nehmen wir nicht auf, sie werden ohne Barmherzigkeit gehenkt oder niedergeschossen. Sagen Sie dies Señor Estrella.«
»Sonst noch etwas?«
»Ja. Ich bitte, daß mir der Mann, welcher die Höhe des Lösegeldes nennt, innerhalb vierundzwanzig Stunden geschickt wird.«
»Darüber hat nur Kapitän Estrella zu entscheiden.«
»Es wird ihm viel daran liegen, ihn mir sobald als möglich zu senden. Jetzt gehen Sie! Nach fünf Minuten schone ich Sie nicht mehr. Dann treten die Kriegsregeln in Kraft.«
Juarez rückte eilends mit seinen Leuten ab.
Der ganze Tag verging unter Gesprächen und Meinungsaustausch. Man riet, wie lange die Rebellen wohl hier unbelästigt liegen blieben, denn sicher mußte die Revolution bald bekannt werden. Truppen wurden aufgeboten und hierhergeworfen, und war Mexiko wirklich dabei im Spiele, so trafen ganz bestimmt auch bald Kriegsschiffe ein, um die mexikanische Küste zu blockieren.
Die Gouvernements der Vereinigten Staaten verstanden keinen Spaß. Die regulären Truppen waren bald zum Abmarsch bereit, aber leider war diesen nicht viel zu trauen. Sie setzten sich aus abenteuerlustigen Subjekten zusammen, die für Geld dienten. Zum Kampf gegen die Indianer waren sie ganz gut zu verwenden, kamen aber zwei Parteien in Streit, dann geschah es nur zu oft, daß die Söldlinge zum Feind übertraten, weil dieser besser bezahlte. Dann griff der freie Bürger zur Wehr und sorgte für die Aufrechterhaltung der Ordnung; aber das ging nicht so schnell. Aus dem Landmann wurde nicht sofort ein Krieger; darüber verstrich immer einige Zeit.
Freilich, standen erst einmal die Bürger unter Waffen, dann wehe denen, welche sich gegen die Ordnung auflehnten. Unter den Klängen des Yankee Doodle schritten die Nordamerikaner noch immer dem Siege entgegen, und Richter Lynch hat lange Beine. Auch im Kriege schwingt er sein Szepter, Pardon gibt es nicht. Der Verwundete wird niedergehauen, der Lebende an den nächsten Baum geknüpft, und wenn ihn sein Bruder abschneidet, so hängt dieser sofort daneben.
Auf die regulären Truppen war also kein Verlaß. Sie setzten sich im Süden der Union hauptsächlich aus Spaniern zusammen, und die kämpften lieber für Mexiko. Ja, wenn Kriegsschiffe hier gewesen wären! Die setzten die blauen Jungen ans Land — das waren Nordamerikaner — und unter einem Hurra wären die lumpigen paar Rebellen bald zersprengt worden, wenn sie sich auch noch so gut in der Ruine versteckten. Leichte Schiffskanonen hätten die Musik gemacht.
Aber die Geiseln, die Mädchen, die Geliebten!
Man mußte gute Miene zum bösen Spiel machen und erst die Mädchen auslösen, dann konnte der Kampf losgehen. Die Kanonenkugeln durften den Tempel vollends zerstören, Huitzilopochtli hatte nichts mehr zu sagen.
Und was begannen dann die Rebellen mit dem Gelde?
Sie warben dafür Truppen, Never mind, dachten die Engländer, wir wollen unsere Bräute haben, dann machen wir, daß wir fort und in die Heimat kommen.
Mit trüben Gedanken legten sich die Herren auf ihre Lager, auch Hoffmann war sorgenvoll. Er hatte vor dem Schlafengehen noch eine lange Unterredung mit Stahlherz und Sonnenstrahl, welcher auch der kleine Chinese beiwohnte. Hoffmann hörte gern den klugen Vorschlägen Wan Lis zu.
Der alte Holländer und sein Sohn saßen Hand in Hand zusammen. Sie schmiedeten Pläne für die Zukunft. Hope und Hannes waren das einzige lustige Paar. Sie freuten sich der wiedergewonnenen Freiheit ebenso, wie dies auch die Trapper taten, nur mit dem Unterschiede, daß diese besprachen, wie sie am besten ihre Freiheit gebrauchen konnten, um den Rebellen das Handwerk zu legen.
Die Nacht senkte sich hernieder und drückte die Augen zu, nur einige Trapper blieben wach, welche das kleine Lager umschritten und wachsam die Dunkelheit durchspähten.
Bereits am nächsten Morgen sah man, wie auf einer der Terrassen eine Fahnenstange errichtet wurde. Estrella beachtete also ihre Weisungen, und noch war die Mittagszeit nicht herangekommen, als schon eine weiße Flagge in die Höhe ging.
»Meine Herren,« sagte Hoffmann, »Estrella schickt uns seinen Boten, mit welchem wir über das Lösegeld verhandeln sollen. Versammeln Sie sich in meinem Hause, ich muß Ihre Meinungen hören!«
Die Herren begaben sich in das betreffende Gebäude, welches Hoffmann mit Stahlherz und Sonnenstrahl teilte. Auf dem Tisch stand das Tintenfaß, die Feder lag zum Schreiben bereit neben dem Papier.
Der Parlamentär kam an, von zwei Trappern begleitet. Es war Leutnant Alessandro, der Adjutant Estrellas. Er trug keine Waffen, eine weiße Fahne war sein ganzer Schutz.
Der junge, einnehmende Mann begrüßte die Herren militärisch kurz und wandte sich sofort an Hoffmann.
»Ich bin im Auftrage des Kapitäns Estrella hier. Hier ist das Verzeichnis des Lösegeldes, welches er für die Freigebung der Damen fordert. Alle sind einzeln angeführt, weil nicht alle gleich hoch geschätzt sind, und damit in der Rechnung kein Fehler hinzukommt,« fügte er lächelnd hinzu und übergab dem Ingenieur eine Papierrolle.
Die Engländer wollten sofort einen Einblick in dieselbe nehmen, doch Hoffmann stellte sich so, daß ihm niemand über die Schultern sehen konnte.
»Gemach, meine Herren, ich werde es Ihnen vorlesen:
»Miß Ellen Petersen, eine Million Dollar.«
»Alle Wetter,« schrie Williams und sprang mit einem Satze von der Fensterbank, auf welcher er saß, herunter, »Estrella versteht es, Preise zu machen.«
Auch die anderen Herren zogen bestürzte Gesichter.
»Weiter,« rief Harrlington, »Miß Ellen scheint die teuerste zu sein.«
»Miß Betty Thomson, eine Million Dollar.«
»Geht das so weiter?«
»Ja,« entgegnete Hoffmann, »zweiundzwanzig Damen sind es, jede zu einer Million Dollar taxiert, macht zustimmen zweiundzwanzig Millionen.«
Die Engländer waren sprachlos.
»Mehr als eine Million Dollar habe ich gar nicht,« brach Edgar Hendricks zuerst das Schweigen, »Williams, da müssen Sie mir etwas borgen.«
»Nehmen Sie es aus der Mitgift Ihrer zukünftigen Gemahlin, ich verborge nichts,« entgegnete dieser.
»Das ist stark,« rief auch Marquis Chaushilm.
»Zweiundzwanzig Damen sind es,« ließ sich wieder Lord Harrlington vernehmen. »Ich dächte doch, es müßten dreiundzwanzig sein.«
»So viele sind es auch. Miß Lind ist besonders angeführt.«
»Warum? Ist sie billiger?«
Alessandro lächelte noch mehr.
»Im Gegenteil,« entgegnete Hoffmann.
»Teurer?«
»Estrella wollte eine runde Summe haben, er fordert für meine Braut acht Millionen.«
Die Herren brachen in Ausrufe der Entrüstung aus.
»Da weiß ich wirklich nicht, woher wir diese Summe nehmen sollen,« sagte Harrlington. »Wir sind zwar reich, aber eine Million Dollar hat man nicht bar daliegen, und wer ist hier, der sie uns leihen könnte?«
»Mister Hoffmann hat sich dazu bereit erklärt,« antwortete Leutnant Alessandro.
Erstaunt blickten alle auf den Deutschen, und das Erstaunen wuchs, als dieser ruhig sagte:
»Das stimmt allerdings. Wann will Kapitän Estrella diese Summe von dreißig Millionen Dollar ausbezahlt haben?«
»Innerhalb zweier Tage.«
»Diese Frist ist zu kurz. Ich kann das Geld höchstens nach Verlauf von drei Tagen hier haben.«
»Das ist nicht nötig. Kapitän Estrella weiß, daß Sie ein Ehrenmann sind. Fertigen Sie eine Anweisung aus und versprechen Sie, die Auszahlung nicht zu hintertreiben. Das ist alles, was Estrella verlangt. Das Geld erhebt er selbst innerhalb von zwei Tagen.«
Die Engländer glaubten ihren Ohren nicht mehr trauen zu dürfen. Wer in aller Welt war denn nur dieser Mann, der über bare dreißig Millionen Dollar so ohne weiteres verfügen konnte? Denn bar wollte sie Estrella natürlich haben.
»Gut, ich werde Ihnen die Anweisungen geben, dieselben aber auf zwei verschiedene Stellen ziehen.«
»Das bleibt sich gleich. Nennen Sie dieselben!«
»Eine in Texas, die andere in Mexiko.«
»In Städten?«
»Nein, beide sind Bureaus von Altascarez-Gruben.«
Altascarez, das Wort war gefallen. War es möglich, daß dieser Mann der sogenannte Silberkönig war? Es konnte nicht anders sein.
Hoffmann griff nach Papier und Feder.
»Noch eins,« fragte Alessandro. »Wie zahlen Sie die Summen aus?«
»Das meiste in Gold, das andere in Silber.«
»In Münzen?«
Hoffmann lächelte.
»Leutnant. Sie scheinen die Verhältnisse nicht zu kennen. So viele Goldmünzen sind in Mexiko und Texas wohl kaum aufzutreiben, desto mehr in wertlosen Papierwischen.«
»Ja, wie zahlen Sie sonst? Estrella wünscht das Lösegeld bar.«
»Ich zahle in Gold- und Silberbarren, die nach dem laufenden Wert berechnet werden.«
»Ach so, ich bitte um Entschuldigung.«
Jetzt wußte man, daß Hoffmann der Besitzer der Altascarez-Gruben war oder doch zu denen gehörte, deren Eigentum sie waren.
Hoffmann setzte sich, doch gleich stand er wieder auf.
»Ja so,« sagte er. »Sind die Herren damit einverstanden, daß ich für sie die Summen bezahle?«
»Wir sind es,« rief Harrlington schnell. »Wir sind dadurch Ihre Schuldner geworden. Aber ich garantiere für meine und noch zwei andere Millionen Dollar. Ich gebe Ihnen den Schuldschein, sobald Sie fertig sind. Es sind einige unter uns, welche die Summe nicht sofort bezahlen können. Wer von den Herren will also außer mir bürgen, daß Mister Hoffmann die Summe von zweiundzwanzig Millionen Dollar erhält, sobald deren Beibringung möglich ist?«
Ungefähr zehn Herren erklärten sich sofort bereit, für die Deckung der Summe Bürgschaft zu leisten.
Hoffmann setzte sich nieder, legte einen Bogen Papier zurecht und begann zu schreiben. Das Datum stand in großen, markigen Zügen da. Das Schreiben aber mußte ihm ziemlich schwer fallen, denn schon legte er wieder die Feder weg und hob den Kopf.
»Falls Estrella die Anweisungen erhält, wann gibt er die Damen frei?«
»Sofort, wenn er das Papier in der Hand hält, werden die Damen hierhergebracht.«
»Ah,« riefen die Herren, erstaunt über die Bündigkeit.
Hoffmann fuhr im Schreiben fort.
Die Trapper waren nicht im Haus, sie standen draußen auf dem Vorplatz umher und machten recht mürrische Gesichter, als wären sie gar nicht mit dem zufrieden, was drinnen ausgemacht wurde.
Hope und Hannes kümmerten sich nicht um die Verhandlung, sie waren mit ihrem Glück beschäftigt. Sie saßen vor dem Fenster und unterhielten sich auf deutsch.
Während Hoffmann schrieb, mußte er unwillkürlich der Unterhaltung der beiden lauschen.
»Dreißig Millionen Dollar. Es ist eine Schande,« hörte er Hannes sagen.
»Riesig viel. Was will er nur damit anfangen?«
»Er wirbt damit Soldaten und laßt diese gegen die Yankees kämpfen.«
»Dann ist es eigentlich eine Sünde, daß man ihm das Geld gibt.«
»Aber sollen die Mädchen denn gefangen bleiben?«
»Wenn ich einmal gefangen wäre, und ich wüßte, mit meinem Lösegeld sollten Soldaten gegen mein Vaterland geworben werden, ich würde rufen: ›Nein, nein und abermals nein, keinen Penny zahlt diesem Halunken!‹ Lieber wollte ich sterben und verderben, als daß ich durch meine Freiheit dem Vaterlande schadete. Und so, wie ich, denkt jede Amerikanerin, am meisten Ellen. Aber sie darf ja nichts sagen, sie muß sich alles ruhig gefallen lassen.«

Hope hatte sehr energisch gesprochen.
Hoffmann hörte auf zu schreiben, nur die Summe mußte er noch ausfüllen.
»Stimmt einer der Herren vielleicht dafür, daß die Dame, welche er, ganz offen gesprochen, liebt, gestrichen wird?« fragte er.
Harrlington trat vor.
»Ich verstehe, was Sie meinen,« sagte er mit bebender Stimme. »Glauben Sie mir, mein Herz blutet, daß ich dem Rebellen Geld geben muß, mit welchem er Söldlinge gegen die Yankees werben kann. Aber ich bin gezwungen, so zu handeln, so lange uns die Damen nicht selbst erklären, Gefangene bleiben zu wollen. Und auch dann noch,« fügte er leise hinzu, »wüßte ich nicht, was ich täte. Ach, es ist so schwer, vom Liebsten, was man hat, immer und immer wieder getrennt zu werden!«
Alessandro zog ein spöttisches Gesicht, als er diese Worte hörte.
Der Ingenieur sah nachdenkend vor sich hin, eben als draußen Joker mit vollen Backen den Yankee-Doodle zu pfeifen begann.
»Wäre ich ein Yankee,« fuhr Harrlington fort, »dann würde ich anders handeln. Keinen Cent bekäme der Rebell. Meine Braut gilt mir viel, aber als Ehrloser wäre ich ihrer Liebe unwürdig. Doch ich bin Engländer, ich verhalte mich neutral.«
Hoffmann antwortete nicht, doch schrieb er auch nicht weiter. Er lauschte dem Gespräch zwischen Hope und Hannes.
»Hope, Hope,« scherzte Hannes, »du warst doch recht froh, als ich dich mitnehmen durfte?«
»Nun, natürlich! Ganz offengestanden, ich wäre im ersten Augenblick auch einverstanden damit gewesen, daß du für mich Lösegeld zahltest, aber dann wären später sicher Vorwürfe gekommen, und dann, Hannes, dann glaube ich ...«
»Was dann, Hope?«
»Ach, es ist ja Torheit, noch davon zu sprechen.«
»Was glaubtest du denn, Hope? Ich will die Antwort wissen.«
»Nun gut denn, du Gestrenger. Ich glaube, dann hatte ich meine Liebe zu dir verloren.«
»Hope!«
»Es ist so. Ich hätte mir dann immer sagen müssen, du hast mich wie eine Sklavin vom Markte gekauft.«
»Ja, sollte ich dich denn gefangen lassen?«
»Nein, du hättest mich mit den Waffen befreien sollen.«
»Ich ganz allein?« lachte Hannes.
»Ach wo! Du mußtest dir Freunde suchen, oder du konntest ja auch von dem Gelde, welches eigentlich zu meiner Befreiung bestimmt war, Soldaten anwerben. O, Hannes, wie hätte ich gejubelt, wenn du an der Spitze deiner Leute angestürmt gekommen wärest und die Rebellen zu Paaren getrieben hättest! Wie wäre ich dir dann entgegengeflogen und hätte in wohliger Freude an deiner Brust gelegen.«
»Wenn ich aber nun verwundet worden wäre?«
»Dann hatte ich dich gepflegt, so gut und lieb, daß du dein Krankenlager nicht wieder zu verlassen wünschtest.«
Hannes lachte.
»Hope, du bist und bleibst doch eine kleine Närrin. Wenn du nun vor meiner Leiche gestanden hattest?«
»O, Hannes, sprich nicht so.«
»Das war aber sehr leicht möglich.«
»Nun, dann, Hannes,« fuhr Hope begeistert fort, »dann wärst du wie ein Held gestorben, dann hätte ich gewußt, daß ich dir mehr galt als eine Sklavin, welche du liebst, weil sie mit dir tändelt, du wärst für meine Freiheit gestorben, weil du mich nicht mit feilem Gelde kaufen wolltest. Ich war dir mehr wert, als alle Schätze der Welt. Ach, Hannes, wie hätte ich dich dann geliebt!«
»Und einen anderen geheiratet.«
»Hannes!«
Hoffmann hatte noch immer nicht weitergeschrieben, auch die übrigen waren in Gedanken versunken. Diejenigen, welche Deutsch verstanden, lauschten dem Gespräch, die übrigen dem Cow-boy, der unermüdlich den Yankee-Doodle pfiff.
Plötzlich fuhren alle erschrocken zusammen.
»Was soll das bedeuten?« schrie plötzlich Leutnant Alessandro laut auf.
Hoffmann hatte mit der gefüllten Feder einen dicken Tintenstrich durch Johannas Namen gezogen.
»Das soll bedeuten,« entgegnete Hoffmann ruhig, »daß Estrella für Miß Lind von mir kein Lösegeld erhält.«
Der Leutnant wurde aschfahl im Gesicht. Diese Antwort benahm ihm fast den Atem, seine Brust rang nach Luft.
»Glauben Sie nicht, daß Kapitän Estrella, weil er früher Ihr Freund war, Ihnen Miß Lind, Ihre Braut, umsonst geben wird!« keuchte er.
»Das weiß ich,« lächelte Hoffmann. »Ich werde mir meine Braut aber doch holen.«
»Sie erhalten sie nicht.«
»Doch, und zwar billiger, als wenn ich sie auslöse. Ich werde das Geld besser anwenden, indem ich zugleich den Vereinigten Staaten einen guten Dienst leiste.«
Alessandro hatte verstanden.
»Ah, Sie wollen Gewalt gebrauchen?«
»Allerdings.«
»Sie werben Soldaten?«
»Nicht direkt! Ich verspreche allen denen, welche mir beistehen wollen, Straßen- und Menschenräuber unschädlich zu machen, eine Belohnung, um sie für den Arbeitsverlust zu entschädigen.«
Alessandro rang hörbar nach Atem.
»Irren Sie sich nicht,« sagte er dann, »Kapitän Estrella läßt nicht mit sich spaßen. Miß Lind ist in seinen Händen.«
»Estrella ist ein Kavalier, er hat bei seinem Ehrenwort versprochen, die Gefangenen anständig zu behandeln.«
»Ja, aber bei einem Kampfe wird er nicht mehr dafür sorgen, daß sich keine Kugel zu den Gefangenen verirrt.«
Hoffmann zuckte die Schultern.
»Es handelt sich ja nur um Miß Lind. Die anderen Damen werden ausgelöst werden, für sie will ich vorschußweise zahlen.«
»Ihre Braut wird Ihnen für Ihre Sparsamkeit dankbar sein,« sagte der Leutnant höhnisch.
Hoffmanns Stirn zog sich in Falten, seine Stimme klang leise, aber drohend, als er sagte:
»Leutnant, Ihr Leben ist mir als das eines Parlamentärs heilig. Sobald Sie aber beleidigend werden, gelten Sie mir nicht mehr als solcher. Haben Sie mich verstanden?«
Alessandro blieb die Antwort schuldig.
Unter den Herren war ein Geflüster entstanden. Der Entschluß Hoffmanns hatte große Aufregung hervorgerufen, ganz besonders bei Charles Williams. Wie ein wildes Tier rannte er im Zimmer auf und ab, die Stirn gerunzelt, die Fäuste geballt.
»Gentlemen, ich zeichne jetzt nur noch für 22 Millionen Dollar,« sagte Hoffmann. »Immer noch eine ganz nette Summe.«
»Halt,« rief Williams, »einen Augenblick!«
Er trat an den Tisch, nahm eine zweite Feder und zog auch durch den Namen der Miß Thomson einen dicken Strich.
»Nun sind es nur noch 21 Millionen. Leutnant Alessandro, Estrellas Aktien fallen.«
»Sie dürfen dies nicht tun, Williams,« rief Harrlington erregt. »Auch wir haben da ein Wort mitzureden.«
»Lord Harrlington,« entgegnete Williams stolz. »Miß Thomson geht von allen Herren mich nur allein an, und ich versichere Ihnen, so wahr ich Miß Thomson meine Braut nennen darf, sie wird meinen Entschluß billigen.«
Wieder entstand ein langes Stillschweigen. Alessandro hatte die Arme über die Brust geschlagen und stierte unverwandt zum Fenster hinaus. Es waren nur noch 21 Millionen, die er Estrella zu bringen hatte, wenn nicht noch mehr —
»Mister Hoffmann, ich ersuche Sie, den Parlamentär sich für wenige Minuten entfernen zu lassen,« sagte Williams.
»Bitte, Leutnant Alessandro, halten Sie sich draußen außer Gehörweite auf, bis ich Sie wieder rufe.«
Er folgte der Aufforderung, doch im Türrahmen wandte er sich noch einmal um.
»Meine Herren, ich warne Sie, unbedacht zu handeln. Lassen Sie sich nicht zu Handlungen hinreißen, welche Sie bitter bereuen würden! Als auslösbare Geiseln sind die Damen bei Estrella sicher aufgehoben, aber nicht als Kriegsgefangene.«
»Sprechen Sie im Namen Estrellas? Können Sie Ihre Aussage verantworten?« fragte Hoffmann.
»Ich stehe hier und spreche für Estrella.«
»Gut, so werden wir uns danach zu richten wissen.«
Alessandro verließ das Gemach und stellte sich weitab neben einen Trümmerhaufen, von wo aus er die weiße Flagge auf der Terrasse sehen konnte. Starr heftete er sein Auge auf sie; seine blutleeren Lippen murmelten unverständliche Worte, seine Hände zitterten. Er hatte schon eine Ahnung, daß ihn Estrella mit fürchterlichen Verwünschungen empfangen würde, weil er als Parlamentär keine Anweisungen, wohl aber einen Fehdehandschuh brachte.
Einmal erweiterten sich die Augen des Leutnants. Die Parlamentärsflagge auf der Terrasse wurde etwas niedergezogen, doch gleich flatterte sie wieder oben an der Spitze der Stange.
»Sie hatten sich geirrt,« murmelte er, »aber doch müssen sie noch heute kommen.«
Eine andere Szene erregte seine Aufmerksamkeit.
Aus dem Walde erscholl Geschrei, und gleich darauf brachte Charly, der Waldläufer, einen Kerl herbeigeschleppt, der in einer abgeschabten, mexikanischen Uniform steckte und ein dummes, aber dennoch pfiffiges Gesicht zur Schau trug.
»Ein Ueberläufer!« rief Charly und war im Nu von seinen Kameraden umringt.
Die Trapper, darunter auch Joker, veranstalteten ein Verhör, ehe sie Hoffmann Anzeige erstatteten.
»Was hast du hier bei uns zu suchen, Bursche, he?« examinierte Charly.
»Ich wollte in euer Lager,« entgegnete der Soldat mit dummdreistem Lächeln.
»Warum?«
»Ihr braucht doch auch Soldaten, und ich habe gehört, dieser Señor Hoffmann soll viel Geld haben. Bei uns gibt's zu viel Speck und Erbsen, und da dachte ich, ich würd's einmal bei den anderen probieren. Hm, hier riecht's recht gut nach Hirschbraten, den bekommen wir nie, wir sehen die Tiere nur im Walde herumlaufen.«
Die Umstehenden lachten, aber Charly rief:
»So ist er also wirklich ein Ueberläufer! Ich dachte vorhin, er wäre nur ein Deserteur. Was meinst du wohl, Bursche, was wir nun mit dir machen?«
»Ihr nehmt mich natürlich als Soldaten an. Ich kann den Schießprügel abdrücken wie nur einer.«
»Gehangen wirst du!«
»Ach, geh, du machst Spaß! Gib mir lieber erst etwas zu essen, mir kollern noch die harten Erbsen im Leibe herum.«
»Am Strick kannst du sie verdauen, Schlingel!«
»So wollt ihr mich wirklich aufhängen?«
»Natürlich, wir hängen jeden Ueberläufer auf. Hat das Estrella nicht den Soldaten gesagt?«
»Freilich hat er das gesagt. Aber ihr hängt mich doch nur unter den Armen auf?«
Die Trapper brachen in ein lautes Gelächter aus. Obgleich es ihnen ernst war, amüsierten sie sich doch über den Burschen und wollten das Gespräch in die Länge ziehen.
»Unter den Armen? Du bist verrückt. Die Schlinge wird dir um den Hals gelegt.«
»Aber da bekomme ich ja keine Luft!«
»Sollst du auch nicht, mein Junge, du sollst sterben.«
»Au, das mag ich nicht. Hätte ich das gewußt, so wäre ich natürlich nicht hierhergekommen. Ich dachte, einen Ueberläufer hängt man hier nur ein Stündchen unter den Armen auf, und dann wird er als Soldat aufgenommen.«
»Da hast du dich gründlich geirrt. Innerhalb fünf Minuten zappelst du an einem Ast.«
»Ich mag aber nicht. Laßt mich wieder zurücklaufen!«
»Nichts da, jeder Ueberläufer wird unerbittlich gehangen. Haltet ihn fest, ich will Hoffmann erst Bescheid sagen!«
Charly trat an das Fenster des Häuschens.
»Señor Hoffmann, ein Ueberläufer hat sich gemeldet, er hat das Kommando Estrellas satt,« rief er hinein.
»Hängt ihn!« war die kurze Antwort.
Sofort lag um des Soldaten Hals die Schlinge eines Lassos, und unter lautem Halloh ward er nach dem nächsten Baume geschleppt.
Alessandro tat nichts, den Soldaten zu retten, er hätte es auch nicht gekonnt. Er kannte ihn gar nicht; solche Individuen trieben sich drüben in der Ruine viele herum.
Der Soldat glaubte noch immer nicht an den Ernst der Situation.
»Treibt den Spaß nicht zu weit!« rief er lachend. »Mir geht die Luft ja schon jetzt aus.«
»Sie wird dir noch mehr ausgehen, sprich dein letztes Gebet. Werft den Lasso über!«
Das Seil flog über einen sehr hoch oben befindlichen Ast und wurde straff gezogen.
»Ich will nicht gehängt werden!« schrie der Soldat.
»Das war dein letztes Wort. Eins — zwei — drei — schubb,« kommandierte Charly, und wie ein Ball flog der Körper des Soldaten in die Höhe.
»Nuu, mein Junge,« lachte Joker hinauf, »bekommst du nun noch Luft?«
Zwar röchelnd, aber dennoch ganz deutlich klang es herab:
»Es geht eben noch, aber lange halte ich es so nicht aus. Länger als eine Stunde auf keinen Fall.«
Erschrocken prallten die Trapper zurück. Sie hatten schon so manchen gehängt, und sie wußten daher ganz genau, daß beim Hängen der Tod weniger darum eintritt, weil die Schlinge die Luft abschneidet, als vielmehr, weil beim Aufziehen des Delinquenten sofort dessen Genick bricht.
So etwas war ihnen noch nicht passiert. Jetzt steckte der Gehängte auch noch die Hand in die Tasche und brachte — den Trappern sträubten sich vor Entsetzen die Haare — ein Schnupftuch zum Vorschein, mit welchem er sich die Nase schnäuzte.

Da steckte der Gehängte auch noch die Hand in die Tasche und
brachte
ein Schnupftuch zum Vorschein, mit welchem er sich die Nase schnäuzte.
»Das ist der Teufel, oder er hat das zähe Leben einer Katze,« brachte endlich Charly hervor. »He, Joker, springe empor und hänge dich an seine Füße.«
Joker sprang, aber schnell zog der Hängende die Beine in die Höhe.
»Nee, nee,« rief er, »ich bin kitzlig an den Beinen. Ich dächte übrigens, nun wäre es genug. Laßt mich herunter, sonst ersticke ich noch.«
Die Trapper antworteten nicht; sprachlos blickten sie auf diesen unheimlichen Menschen, der das Rückgrat eines Büffels und die Luftröhre wie ein Gasrohr haben mußte.
»So, ihr wollt mich wirklich sterben lassen? Ich mag aber nicht sterben, ich habe noch keine Lust dazu. Hilfe, Mörder, Diebe,« gellte es von oben herab, »Señor Hoffmann, mein liebster, bester Hoffmann, sie wollen mich töten, und ich habe gar nichts getan.«
Hoffmann und einige Herren kamen bei diesem Spektakel aus dem Hause gestürzt.
»Was gibt's? Was ist los?«
Die Trapper deuteten auf den Hängenden, und die Herren waren nicht weniger über das Schauspiel erstaunt, als die Trapper.
»Mister Hoffmann, um Gottes willen, schneiden Sie mich ab, die Luft geht mir aus,« schrie der Soldat weiter.
»Herunter mit ihm!« befahl Hoffmann.
»Aber nicht an die Beine fassen, ich bin so kitzlig.«
Der Lasso ward nachgelassen; der Soldat stand vor Hoffmann und lockerte die Schlinge am Halse. Eine tiefe, dunkelrote Furche wurde dabei sichtbar, sonst hatte der Lederriemen keinen Schaden angerichtet. Der Soldat verfügte übrigens über einen recht muskulösen Hals.
»Wer bist du? Was willst du hier?« fragte Hoffmann.
Das dummdreiste Gesicht des Soldaten grinste.
»Ach, gehen Sie doch, Mister Hoffmann, Sie kennen mich recht gut!«
»Ich sollte dich kennen?«
»Natürlich, wir haben doch lange genug zusammen Bären gespielt.«
»Was,« rief Hoffmann bestürzt, »Sie sind doch nicht —«
»Ganz recht,« nickte der Soldat, »mein Name ist Nikolas Sharp, und hier ist ein Papier, welches mir die Damen für Sie und die Engländer mitgaben.«
Damit brachte er aus der Brusttasche seines schmutzigen Waffenrockes ein Papier zum Vorschein und händigte es Hoffmann ein. Dieser zog den Detektiven sofort in das Haus hinein.
»Ich bitte Sie, weitere fünf Minuten zu warten,« rief er dem Leutnant zu.
Alessandro knirschte mit den Zähnen.
»Das war also der Detektiv, den Estrella überall hat suchen lassen und nicht finden konnte,« murmelte er, »mit den Damen hat er auch gesprochen und bringt sogar ein Schreiben von ihnen mit. Die Wachen der Gefangenen sollen dafür büßen. Aber ich fürchte, ich fürchte, unsere Aktien sinken immer mehr.«
Er hatte recht.
Drinnen übergab Hoffmann, nachdem er die wenigen Zeilen überflogen, das Papier Williams, welcher eben lange zu seinen Freunden eindringlich gesprochen hatte. Er stieß einen Freudenschrei aus, als er die von Miß Petersen flüchtig geschriebenen Worte gelesen hatte.
»Sagte ich es nicht?« rief er triumphierend. »Ich habe die Damen richtig taxiert, sie denken nicht anders als ich. Hören Sie, was uns Miß Petersen schreibt:
»Master Sharp erklärt sich bereit, Ihnen diese Zeilen zu überbringen. Ehe Sie für uns ein Lösegeld zahlen, überlegen Sie sich reiflich, was die Rebellen mit diesem beginnen. Glauben Sie, daß die Leute nach Empfang einer großen Summe den Vereinigten Staaten wirklich schädlich werden können, so nehmen Sie keine Rücksicht auf uns. Wir wollen lieber Gefangene bleiben, als durch Auslösung unserem Vaterlande Gefahr bringen. Wir sind Yankees, wir wollen das Sternenbanner unseretwegen nicht erniedrigt sehen. Sie sind Söhne Englands, bereiten Sie seinem Tochterlande keine Schande. Ich schreibe dies im Einverständnis mit allen Vestalinnen, Miß Lind mit einbegriffen.
Ellen Petersen.
»Wir wissen nun, was wir zu tun haben,« schloß Williams mit blitzenden Augen. »Wir wollen uns von den Damen nicht beschämen lassen, Geben sie alle persönlichen Rücksichten auf, wenn es gilt, das Vaterland in Ehren zu halten, so müssen wir sie, wollen wir ihrer Liebe wert sein, dabei unterstützen.«
»Bei Gott, das wollen wir!« stimmten die Herren bei.
Leutnant Alessandro mußte noch einige Minuten warten, ehe er gerufen wurde, um den Beschluß der Herren zu empfangen. Vor ihm wurden zwei Indianer hereingeholt, Stahlherz und Sonnenstrahl, dann erscholl auch sein Name.
Der eintretende Leutnant sah schon an den entschlossenen Gesichtern der Engländer, welcher Bescheid ihn erwartete. Hoffmann übergab ihm nichts weiter, als die Rolle, welche die Namen der Damen trug.
Alessandro öffnete und wurde aschfahl — jeder Name war einzeln durchstrichen.
»Dies die Antwort für Estrella,« sagte Hoffmann, »sie ist deutlich genug.«
»Sie zahlen kein Lösegeld?«
»Keinen roten Cent.«
»Dann werden die Damen die Freiheit nicht eher wiedersehen, als bis Texas die mexikanische Flagge führt.«
»Und wenn dies nicht der Fall ist?«
»Dann wird mit ihrem Lösegeld der Schaden gedeckt.«
»Nun, im Vertrauen zu Ihnen gesagt,« lächelte Hoffmann, »wir werden nicht so lange warten, bis es den Rebellen gefällt, den Damen die Freiheit zu schenken.«
»Oho, Sie drohen mit Gewalt?«
»Sehen Sie diesen Brief? Er geht sofort nach Matagorda an den Stadtpräsidenten ab. Es gibt noch genug Männer, welche nicht dulden, daß das Sternenbanner beschmutzt wird.«
Er händigte Stahlherz einen Brief ein.
»Eilt, Stahlherz und Sonnenstrahl,« sagte er, »hütet euch vor solchen, welche nicht wünschen, daß der Brief die Küste erreicht!«
Stahlherz lächelte finster.
»Stahlherz ist schnellfüßig, er überholt den fliehenden Hirsch, und Sonnenstrahl wird nicht nachbleiben.«
»Wann wirst du dort eintreffen?«
»Noch ehe die Sonne wieder emporsteigt, ist Stahlherz am salzigen Wasser, doch er wird die Sonne nicht wieder untergehen sehen. Sonnenstrahl führt dir die Krieger zu.«
»Ich wünsche Ihnen viel Glück,« lachte Alessandro, »versichere Ihnen aber, daß Sie an der Küste nicht viel Yankees finden werden. Wer Waffen tragen kann, ergreift sie für Mexiko, nicht zum Schutze des Sternenbanners. Zugleich bemerke ich, daß Estrella Sie sofort nach Empfang der abschlägigen Antwort als Feinde betrachten wird. Rechnen Sie nicht mehr auf seinen Schutz.«
»Wir werden uns zu wehren wissen. Geht jetzt, Stahlherz und Sonnenstrahl! Eilt, daß der Sturm hinter euch zurückbleibt!«
Die beiden Indianer schritten der Türe zu, draußen blieben sie jedoch stehen, die Herren fuhren auf, und Alessandro wurde weiß wie die Wand. Dann stürzte alles hinaus.
Im Wald, in noch weiter Entfernung, schmetterten plötzlich Trompeten, sie bliesen keine Signale, es war ein Marsch, der wie elektrisierend auf alle Hörer wirkte.
»Der Yankee-Doodle!« rief Hope und sprang einen Steinhaufen hinauf, aber noch vor ihr erreichte ein Trapper den Gipfel und spähte über die Bäume hinweg in die Ferne.
»Soldaten!« rief er. »Merkwürdig! Sie haben entsetzlich weite Hosen an und Mützen gerade wie kleine Kinder auf.«
»Es sind Matrosen,« fügte Hope hinzu, »da, die blaue Fahne mit den Sternen. Hip hip Hurra, amerikanische Marine kommt. Auch Geschütze bringen sie mit.«
Alles versammelte sich jetzt auf dem Trümmerhaufen, einer hielt sich am anderen fest.
Zwischen den Hügeln hindurch bewegte sich ein langer Zug von amerikanischen Matrosen, bald verschwindend, bald wieder auftauchend. Es mochten gegen fünfhundert Mann sein, dazwischen wurden ab und zu leichte Schiffsgeschütze sichtbar, aber diese waren immer noch schwer genug, denn die sechs Pferde, welche vor jedes einzelne gespannt waren, mußten schonungslos angetrieben werden, so tief sanken die Räder in den Boden ein.
»Wie wird Ihnen nun?« fragte Williams den neben ihm stehenden Leutnant.
Dieser drehte sich mit einem Fluche um und blickte nach der weißen Flagge auf der Terasse, als erwarte er von ihr ein Zeichen.
Da wurde schon ein taktmäßiges Stampfen von Schritten hörbar, und aus dem Walde traten, wahrscheinlich der Vortrupp, in geordneten Reihen die Soldaten heraus, an ihrer Spitze ein junger Seeoffizier in der Uniform eines Korvettenkapitäns.
Mit einem Freudenruf flog ihm Hope entgegen und warf sich an seinen Hals.
»Macdonald,« jubelte sie, »du erscheinst zum zweiten Male als rettender Engel. Woher hast du nur erfahren, daß wir dich jetzt gerade brauchen?«
»O, wir sind gut orientiert,« lachte der Bruder.
Der Korvettenkapitän wurde von den ihn umringenden Herren begrüßt. Kommandos erschollen, die Waffen rasselten, und die etwa hundert Matrosen standen mit Gewehr bei Fuß hinter den Offizieren und Unteroffizieren.
»Kapitän Hoffmann,« wandte sich Staunton an diesen, »ich bringe sechshundert Mann und zehn Schiffskanonen. Ich denke, diese genügen, um den Aufruhr zu ersticken.«
Hoffmann teilte ihm mit, in welcher Lage sie sich befanden, die Gefangennahme der Damen und so weiter, und Stauntons Zorn wuchs immer mehr. Er jubelte, als er erfuhr, daß man das Lösegeld ausgeschlagen habe.
»So komme ich zur rechten Zeit,« rief er. »Vier Kriegsschiffe haben je 150 Mann gestellt, die übrigen Offiziere werde ich Ihnen nachher vorstellen, sie sind unter meinem Kommando. Sie sind der Parlamentär des Rebellenchefs?« wandte er sich an Alessandro. »Was meinen Sie, wird sich Estrella freuen, wenn er meine blauen Jungen anrücken sieht?«
Der Gefragte lachte höhnisch.
»Er wird sie nicht besonders fürchten.«
»Oho, dann muß Estrella ein starkes Selbstvertrauen haben.«
»Wir liegen hinter einer sicheren Schutzwehr.«
»Meine Geschütze sollen sie bald zerstören.«
»Vergessen Sie die Damen nicht, die Kugeln könnten ihnen gefährlich werden.«
»Ah so. Gut, wir brauchen die Kanonen nicht. Diese zwei- oder dreihundert Rebellen jagen wir mit den Kolben davon.«
»Die achthundert Indianer auch?«
»Bah, die werden den Entersäbeln nicht lange standhalten.«
»Nun, wir werden sehen,« höhnte Alessandro. »Sie stellen sich die Sache leichter vor, als sie ist.«
Kapitän Staunton wandte sich ab; er war wütend über diese prahlerische Sprache, ebenso die übrigen Herren, obgleich sie zuvor von dem Leutnant einen günstigen Eindruck gewonnen hatten.
Staunton trat wieder auf Hoffmann zu.
»Betrachten Sie meine Leute!« sagte er lächelnd. »Mich wundert, daß Ihnen noch nichts aufgefallen ist.«
Hoffmanns Blick überflog die jungen Leute mit den wettergebräunten Gesichtern, in den blauen Uniformen mit hellen Kragen, mit offener Brust, kurzen Gewehren und langen Entersäbeln, welche sie aufpflanzten, um gleich dem bestgeschulten Infanteristen Bajonettangriffe machen zu können. Matrosen werden immer auch als Infanteristen ausgebildet, sie lernen den Patrouillendienst und die verschiedensten Gefechtsarten. Die Kriege in den Kolonien machen dies erforderlich.
Aber was war denn das? Dort standen andere Uniformen, es waren schwarze, rote und gelbe Gesichter darunter, Hoffmann kannte sie, es waren seine eigenen Leute, und dort am Flügel, neben dem Steuermann Nagel, stand Ingenieur Anders.
Jetzt eilte dieser auf seinen Kapitän zu.
»Als wir hörten, daß es sich um die Befreiung der Engländer und Damen handelte,« sagte er, »ließen wir uns nicht halten. Wir marschierten mit Kapitän Stauntons Truppen. Wir sind glücklich, daß wir Sie hier finden. Aber ich hätte Sie nicht erkannt, wenn Sie nicht mit Ihrem Namen angeredet worden wären. Dort stehen auch die Matrosen der ›Hoffnung‹; der Kapitän spricht schon mit ihnen.«
Hoffmann begrüßte seine Leute, doch vermißte er einige unter ihnen, besonders Georg. Anders rapportierte, daß diese einen Jagdausflug gemacht hatten und seitdem nicht wieder gesehen worden waren. Es stände zu vermuten, daß daran die Rebellen schuld wären.
Im Wald begann es abermals von Tritten zu hallen, das Buschwerk brach, Peitschen knallten, Pferde wurden angetrieben, und die Matrosen kamen anmarschiert, die Kanonen mit sich führend.
Als sie die Blöße erreichten, setzte die Musik ein; wieder schmetterte der Yankee-Doodle durch den Wald und zeigte den Rebellen in der Ruine an, daß Onkel Sam wachsam und bereit war, das Sternenbanner zu schützen.
»Der Yankee schleicht nicht lautlos an den Feind heran,« lachte Staunton, »diese Klänge haben uns oft zum Siege geführt, sie werden es auch diesmal tun. Die Rebellen mögen zittern, wenn sie unsere Trompeten hören.«
Mit finsteren Augen musterte Alessandro die aufgestellten Matrosen, aber er zeigte keine Besorgnis, viel eher Schadenfreude.
Dann wendete er seine Blicke schnell wieder der weißen Flagge auf der Terrasse zu, und sein Ruf lenkte auch die Aufmerksamkeit der anderen dorthin; sie war verschwunden, statt ihrer flatterte eine blutigrote Fahne im Wind.
»Soll das die Kriegserklärung sein?« fragte Hoffmann.
Statt aller Antwort sprang der Leutnant wieder den Steinhaufen hinauf, spähte mit der Hand über den Augen nach der Ruine und deutete dorthin.
Die Herren sahen der ausgestreckten Hand nach.
Sie erblickten jenseits der Ruine einen langen Zug; es schienen Soldaten zu sein, denn Waffen blitzten im Sonnenschein, Wie eine Schlange wand sich der Zug zwischen Bäumen und Hügeln hin, direkt auf die Ruine zu. Tausend Mann waren es mindestens.
»Die regulären Truppen marschieren schon gegen die Rebellen,« rief Hoffmann. »Leutnant Alessandro, in einer Stunde können Sie dieselben vor sich, und uns im Rücken haben.«
»Sie irren sich abermals,« entgegnete Alessandro, und eine bissige Schadenfreude lag in seinem Ton. »Wohl sind die Leute dort jene Kompagnien, welche von den Gouvernements ausgeschickt wurden, die Rebellen niederzuwerfen. Aber Estrella zahlt besser, alle Soldaten sind bereits übergetreten, sind die Unsrigen. Sie kommen, um sich mit Estrella zu verbinden.«
Einige Herren konnten Rufe des Schreckens nicht unterdrücken.
»Ja ja,« hohnlachte Alessandro. »Ueberlegen Sie sich, ob Sie uns morgen angreifen oder nicht. 1400 Soldaten und 1000 Indianer stehen Ihnen gegenüber.«
»Diese elenden Deserteure,« knirschte Staunton, »aber dennoch, meine Burschen werden ihnen Mores beibringen.«
Alessandro schwang seine weiße Fahne und sprang von dem Hügel hinab. Staunton legte die Hand an den Revolver, aber Hoffmann hinderte ihn, denselben zu ziehen.
»Ist er auch Rebell, er gilt jetzt noch als Parlamentär,« sagte er.
Alessandro blieb auf dem Wege nach der Ruine noch einmal stehen und wandte sich um.
»Ich kann wohl auf ein Wiedersehen für morgen rechnen, meine Herren! Noch einmal, sparen Sie Pulver und Blei, und vor allen Dingen schonen Sie die Geschütze, denn die Damen sind nicht gegen Kugeln gefeit.«
»So greifen wir mit dem Bajonett an,« rief Staunton dem Davoneilenden nach.
Die amerikanischen Matrosen hatten schon Zelte aufgeschlagen, um sich während der Nacht nicht den dem Boden entsteigenden Fieberdünsten auszusetzen. Sie mußten morgen klare Augen haben, der Kopf durfte nicht vom Fieber befangen sein, sonst durften sie auf keinen Erfolg rechnen.
Ueberall erhoben sich zwischen den Bäumen die braunen Segeltuchzelte, Feuer flackerten auf, kurz, es entwickelte sich das vollkommene Bild eines Lagerlebens. Aber schon ging unter den Matrosen ein Geflüster, daß es ihnen nicht vergönnt sei, bis morgen früh unter dem Zelte zu schlafen. Vielleicht mußten sie schon während der Nacht zu den Waffen greifen und zum lautlosen Marsch antreten.
Darüber entschieden die drei, welche dort oben auf dem Dache des Hauses standen. Die übrigen Gebäude waren mit Kanonen besetzt, deren Mündungen nach der Ruine zeigten, ebenso wie das, auf dessen plattem Dache die drei Männer standen.
Es waren Hoffmann, Kapitän Staunton und Stahlherz. Hoffmann lehnte an dem Geschütz und musterte durch ein Fernrohr die Ruine, in der es lebhaft zuging.
Offiziere eilten hin und her, sie schienen Posten auszustellen, denn bald stand überall, wo sich ein Zugang zu der Ruine befand, ein Mann, oft auch deren zwei.
Ob Estrella einen Ueberfall in der Nacht fürchtete oder nicht, jedenfalls sorgte er dafür, daß ein solcher rechtzeitig entdeckt und abgeschlagen werden konnte.
»Ein Glück, daß sie keine Geschütze haben,« meinte Staunton, der ebenfalls ein Fernrohr gebrauchte. »Diese Ruine könnte mit solchen in eine uneinnehmbare Festung verwandelt werden.«
»Es ist so,« bestätigte Hoffmann, »und sehr schlimm ist es, daß unterirdische Gänge zu dem Tempel führen, welche meilenweit laufen sollen. Wer diese kennt, kann jederzeit Boten und Spione aussenden, sich sogar mit Proviant und Munition versorgen. Ein Gang soll etwa zehn Meilen weit führen.«
»Sind diese Gänge den Rebellen bekannt?«
»In der Ruine sind Indianer, welche immer dort gelebt haben. Ich erzählte Ihnen vorhin zum Beispiel von Arahuaskar. Dieser kennt die geheimen Gänge sicherlich, Sonnenstrahl kennt nur die kurzen, die nicht von Bedeutung sind.« —
»Es wird ein blutiger Kampf werden,« begann Hoffmann nach langer Pause wieder.
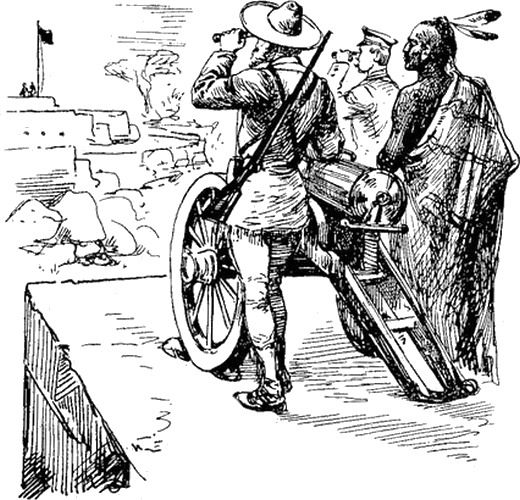
»Ja, und dennoch darf er nicht aufgeschoben werden.
Hätte ich nur die Hälfte meiner Leute bei mir, ich würde sie dennoch gegen den viermal stärkeren Feind führen.«
»Ich gebe Ihnen recht. Es darf unter keinen Umständen gewartet werden, bis Estrella Artillerie erhält, denn dann ist die Ruine wirklich uneinnehmbar. Haben die Rebellen aber einen sicheren Ort, nach welchem sie sich immer zurückziehen können, so haben sie Aussicht auf Erfolg.«
»Könnten wir wenigstens unsere Geschütze anwenden,« seufzte Staunton, »wieviele Menschenleben würden geschont werden!«
»Wir dürfen es nicht wagen. Estrella hat durch Gefangennahme der Damen eine furchtbare Schutzwehr um sich errichtet. Selbst die Gewehre müssen vorsichtig gebraucht werden.«
»Hugh,« rief Stahlherz leise. Er hatte sich bis jetzt nur mit den Indianern beschäftigt, welche dichtgedrängt am rechten Flügel der Ruine lagen.
Die beiden Männer wandten ihre Ferngläser dorthin und erkannten einen Weißen, der von vielen federgeschmückten Indianern, wahrscheinlich Häuptlingen, umringt war und zu diesen sprach.
»Ah, jetzt naht die Entscheidung, wie die Indianer verwendet werden sollen,« rief Staunton. »Wolle Gott, daß die Verteilung so erfolgt, wie wir wünschen.«
»Kann Stahlherz alles deutlich sehen?« fragte Hoffmann den Indianer. »Nimm sonst dieses Glas!«
»Stahlherz braucht das lange Auge nicht,« wehrte dieser ab, »er erkennt Estrella, er spricht zu den Häuptlingen der Stämme.«
»Wahrhaftig,« rief Staunton, »dieser Indianer sieht mit seinen Augen besser, als ich mit dem Fernrohr. Erst jetzt erkenne ich Estrella, da es gesagt worden ist.«
Lange schauten die drei zu den Indianern hinüber, deren Verhalten ihnen von der größten Wichtigkeit war. Je nachdem, wie sich dieselben verteilten, davon hing der Erfolg der morgenden Schlacht ab. Stahlherz sollte noch eine wichtige, vielleicht die wichtigste Rolle spielen.
»Sie scheiden sich in Stämme,« rief Stahlherz.
Die Indianer eilten da und dorthin, es entstand ein Gedränge, bald aber bildeten sich sieben Abteilungen, deren jede sich je um einen Häuptling scharten.
Fünf davon waren nur klein, zwei jedoch sehr groß.
Sie zählten so viele Krieger, wie die anderen fünf zusammen, also etwa vierhundert Mann.
»Es sind dies die Apachen und Cherokesen,« erklärte Hoffmann, »von denen ich vorhin sprach. Bleiben diese zusammen, so haben wir die besten Aussichten.
»Vielleicht legen sie sich gerade hier vor uns her.«
»Mit solchen Hoffnungen wollen wir nicht rechnen.
»Da, Estrella geht nach der Ruine zurück. Die einzelnen Stämme marschieren ab. Jetzt kommt es darauf an, ob die Ausführung unseres Planes möglich ist.«
Die Indianer trennten sich. Vier kleine Stämme zogen um die Ruine herum, der den Amerikanern gegenüberliegenden Seite zu, die zwei großen Stämme, im Verein mit einem kleinen, gingen zwischen der Ruine und dem Lager entlang, sich aber dicht an der Ruine haltend, so daß sie außer Schußweite waren.
»Sie hatten recht,« sagte Staunton, »Estrella benutzt die Indianer als Vorposten. Ist die Verteilung uns günstig?«
»Sehr günstig. Die Apachen und die Cherokesen, deren Häuptling Adlerfeder ist, kommen auf unsere Seite zu liegen. Der kleine Stamm ist der der Seminolen. Wie denkt mein roter Bruder von diesen?« fragte Hoffmann den Indianer.
»Die Seminolen sind Hunde, sie kämpfen, um Feuerwasser zu bekommen, aber nicht für Skalpe.«
»O weh! Nun, sie können ja weitermarschieren, wir wollen die Hoffnung noch nicht sinken lassen.«
Die Sonne sank rasch. In einer Stunde schon konnte vollkommene Dunkelheit herrschen. Die drei Männer verharrten auf dem Dache des Hauses und beobachteten unausgesetzt die marschierenden Indianer.
Auf den anderen Dächern standen die Engländer und amerikanischen Offiziere und sahen ebenfalls den Bewegungen der Indianer zu. Sie wußten, um was es sich handelte.
»Lord Harrlington!« rief Hoffmann.
Der Lord verließ mit Hilfe einer rohgezimmerten Leiter, das Dach, auf dem er stand, und begab sich zu Hoffmann.
»Wir haben Glück,« sagte der Deutsche. »Apachen und Cherokesen legen sich zwischen uns und die Ruine, und wie Stahlherz sagt, werden sie die Tomahawks nicht gegen uns erheben.«
»Ist Stahlherz seiner Sache sicher?«
»Er behauptet es. Bei Nacht wird er den Versuch machen, hinüberzuschleichen.
»Wenn Stahlherz spricht, wird man ihm gehorchen, doch er spricht nicht zu den Seminolen,« sagte der Indianer.
»Die Seminolen sind jener kleine Stamm, welcher vorausmarschiert. Jetzt lagern sich die Apachen und Cherokesen, doch die Seminolen gehen weiter. Ich will Ihnen gleich den Ort zeigen, von welchem aus wir vorbrechen werden, während Kapitän Staunton mit seinen Leuten die Rebellen beschäftigt. Sehen Sie aber nicht zu lange hin, auch wir werden wahrscheinlich beobachtet.«
Hoffmann beschrieb zur linken Seite der Ruine einen mit dichten Büschen bepflanzten Ort, von welchem aus das Gemäuer leicht zu betreten war.
»Hoffentlich lagern sich nicht gerade dort die Seminolen,« schloß Hoffmann, »sonst müssen wir uns einen anderen Platz wählen, und gerade dieser ist ausgezeichnet.«
Doch Hoffmann sah seine Erwartung getäuscht. Gerade an dem von Harrlington bezeichneten Platze machten die Seminolen Halt und lagerten.
»Nun, so nehmen wir einen anderen Ort ein,« tröstete er. »Es gibt noch Verstecke genug, und Sonnenstrahl ist hier zu Hause. Er wird uns beistehen, einen solchen zu finden. Es ist immer besser so, als wenn die Seminolen zwischen Apachen und Cherokesen zu liegen gekommen wären, denn dann wäre Stahlherz' Absicht wohl vereitelt worden.«
In der Dämmerung erkannte man noch, wie sich rings um die Ruine her, der Kreis der Indianer immer enger zusammenzog, bis er vollständig war. Jetzt war sie vollkommen von Indianern eingeschlossen. Dann brach die Dunkelheit an und machte eine fernere Beobachtung unmöglich.
Die Herren verließen die Dächer, um sich nach einem Hause zu begeben, in welchem mit den Offizieren zusammen eine Beratung stattfinden sollte, wie der Kampf morgen zu beginnen und zu führen sei, so weit dies noch nicht besprochen war.
Hoffmann erreichte mit Stahlherz zuletzt den Boden.
»Wann geht mein roter Bruder?«
»Jetzt.«
»Schon jetzt?«
»Ja, Stahlherz hat viel zu vollbringen. Seine Füße müssen schnell wie seine Zunge sein.«
»Versprichst du dir Erfolg?«
»Stahlherz hört sie schon ja sagen. Adlerfeder führt sie, und Adlerfeder achtet das Totem der Apalachen.«
Der Indianer entledigte sich seines Jagdhemdes, hüllte sich aber in eine Decke, so daß das tätowierte Gerippe nicht zu sehen war.
»Stahlherz geht.«
Hoffmann streckte ihm die Hand entgegen.
»So geh, mein Bruder, und bringe uns gute Nachricht!« sagte Hoffmann herzlich.
Stahlherz blieb noch zögernd stehen.
»Deadly Dash sieht Stahlherz nur noch einmal wieder.«
»Wann ist das?«
»Nachher, wenn er spricht: die Apalachen und Cherokesen haben die Stimme eines Häuptlings gehört, sie hassen die, welche Deadly Dash hassen.«
»Und warum sollen wir uns dann nicht wiedersehen? Ich hoffe, morgen werden wir Seite an Seite kämpfen.«
»Vielleicht! Doch Deadly Dash wird morgen auch an der Leiche von Stahlherz stehen.«
Hoffmann kannte den Aberglauben der Indianer, welche viel auf Träume und Anzeichen geben. Er widersprach ihm nicht.
»Dann stirbt Stahlherz als ein Held, sein Vater wird sich freuen, ihn empfangen zu können.«
»Wohl, ein Apalache weiß zu sterben. Doch Stahlherz hat zwei Kinder, die er liebt.«
»Stirbst du, und ich bleibe am Leben, so haben sie noch einen Vater.«
»Sonnenstrahl kann Häuptling der Cherokesen werden.«
»Er soll es werden.«
»Er soll es nicht werden,« entgegnete Stahlherz dumpf, »Sonnenstrahl ist kein Indianer dem Herzen nach; er ist zu gut, für seine roten Brüder zu sterben.«
»Ich verstehe dich,« sagte Hoffmann nach längerer Pause, »auch du bist kein Indianer mehr.«
»Doch, noch zuviel. Deadly Dash soll so zu ihm und Waldblüte sprechen, wie er zu mir sprach. Stahlherz war alt und sehnte sich nach seinen Kindern, er liebte die Lehren, befolgte sie aber nicht. Mögen Waldblüte und Sonnenstrahl sie befolgen.«
»Ich werde mich ihrer annehmen.«
»Dann werden sie die Häuptlinge aller Häuptlinge werden. Stahlherz weiß es, der Wald wird zu klein, die Prärie zu mager und die Büffel verhungern, doch die Indianer sind blind, sie sehen es nicht, bis sie selbst verhungern. Sonnenstrahl soll ihnen Nahrung zeigen.«
Stahlherz verschwand im Dunkel des Waldes, und Hoffmann schritt, in Gedanken versunken, dem Hause zu, in welchem die Beratung stattfinden sollte.
Alle Engländer waren schon dort versammelt, desgleichen die amerikanischen Offiziere. Auf dem Tische brannten einige Wachskerzen. Sie beleuchteten ernste, wohl auch traurige Gesichter, aber keine mutlosen. Es war ja eine ernsthafte Situation, man stand am Vorabend einer Schlacht, in welcher sich ungleiche Streitkräfte gegenüberstehen sollten.
Auf der einen Seite siebenhundert Mann, auf der anderen etwa eintausendvierhundert Soldaten und fast tausend Indianer. Hier der Mut der Verzweiflung, dort das Bewußtsein des Rechtes und — die Liebe.
Die Rebellen würden in der ersten Schlacht gegen die Yankees sicher wie Rasende kämpfen. Das Lösegeld war ihnen verloren gegangen; große Geldmittel konnten ihnen nicht zur Verfügung stehen, und so galt es jetzt, die erste Schlacht zu gewinnen. Nur dann konnte die Revolution fortschreiten.
Wurden sie aber besiegt und versprengt, dann war die Revolution so gut wie vernichtet, den Besiegten schlossen sich keine Freischärler mehr an, noch viel weniger traten, wie bisher, ganze Bataillone zu ihnen über.
Es stand also ein Verzweiflungskampf bevor, eine der Parteien mußte untergehen oder siegen. Dies war auf den Gesichtern zu lesen; den Offizieren winkte für den Sieg Lob und Ehre, den Engländern eine viel schönere Palme, welche in den Händen der Vestalinnen ruhte.
Es wurde nur leise geflüstert, eine eigentliche Beratung war nicht möglich, so lange Stahlherz nicht zurück war und Nachricht brachte, ob man auf die Indianer rechnen dürfe oder nicht.
Schwangen diese die Tomahawks gegen sie, so mußte eben morgen der Sturm auf die Ruine beginnen, indem man die Indianer mit den Geschützen in Schach hielt, kämpften diese auf der Seite der Engländer, so fand schon in der Nacht noch eine Beschleichung der Ruine statt. Die Indianer waren zu gute Vorposten, sie hätten eine solche rechtzeitig bemerkt und vereitelt.
Hoffmann sprach mit Lord Harrlington und Hannes.
»Es bleibt so, wie wir es ausgemacht haben. Kapitän Staunton rückt bei Tagesanbruch mit seinen Mannschaften offen gegen die Ruine vor, während wir, das heißt, Sie, Lord Harrlington und Ihre Freunde, Kapitän Vogel und ich mit unseren Schiffsbesatzungen im Versteck seitlich vom Kampfplatze liegen. Hauptsache ist, daß das Versteck nicht von Indianern besetzt ist. Mit diesen dürfen wir überhaupt nicht in Berührung kommen. Kapitän Staunton muß alles daransetzen, die Rebellen völlig zu beschäftigen, und sollte er Mann für Mann opfern. Ist dies der Fall, ist es den Rebellen nicht möglich, die Ruine selbst zu bewachen, so versuchen wir, gegen hundert Mann stark, vorzuschleichen und ins Innere der Ruine zu dringen. Unsere Hauptaufgabe muß sein, sofort in die Nähe der Gefangenen zu kommen. Dort setzen wir uns fest und eröffnen das Feuer gegen die Rebellen.«
»Aber die Indianer, welche auf der anderen Seite der Ruine liegen?« warf Hannes ein. »Werden diese nicht den Rücken der Rebellen decken?«
»Von den Indianern habe ich noch nicht gesprochen. Gelingt es Stahlherz, die Apachen und Cherokesen für uns zu gewinnen, so beschäftigen diese die uns feindlichen Indianer. Kämpfen sie gegen uns, dann allerdings haben wir eine schwierige Aufgabe. Wir werden uns durch die Indianer durchschlagen müssen. Dennoch zweifle ich nicht an einer glücklichen Lösung, der Name Deadly Dash ist gefürchtet.«
Kapitän Staunton verbrachte ebenso noch einige Stunden im Gespräch mit seinen Offizieren. Mitternacht war nicht mehr fern. Alle sehnten nichts mehr herbei, als das Erscheinen von Stahlherz, als dieser plötzlich in der Mitte des Zimmers stand.
Sein Oberkörper war nicht mehr von der Decke verhüllt. Deutlich trat das tätowierte, weiße Gerippe hervor, die Augen des Häuptlings strahlten in seltsamem Glanze, und an seinem Gürtel hingen zwei noch blutige, indianische Skalpe.
»Endlich, Stahlherz!« rief Hoffmann. »Ist es dir geglückt? Sprich schnell, wir vergehen vor Erwartung.«
Eine triumphierende Freude spiegelte sich auf dem dunklen Antlitz des Gefragten wider.
»Die Apachen und Cherokesen haben ihren Häuptling erkannt. Wann soll ihr Kriegsruf gegen die Rebellen sich mit dem des Stahlherz vermischen?«
»Gott sei Dank!« riefen Hoffmann und Staunton gleichzeitig. »Und die Seminolen?«
»Die Seminolen sind Hunde. Zwei fragten Stahlherz: Was willst du hier? Stahlherz antwortete nichts, er nahm ihnen die Skalpe.«
»Bist du von ihnen erkannt worden?«
»Nur von diesen zweien, doch sie sprechen nicht mehr.«
»Liegen die Seminolen noch an dem Ort, welchen ich dir als unser Versteck bezeichnete?«
»Nein.«
»Nein, wo denn sonst?« rief Hoffmann erschrocken.
»Ein Offizier kam zu den Apachen und sagte: Geht weiter auseinander. Sie taten es, als Stahlherz bei ihnen war. Er fand die Seminolen nicht mehr vor, sie lagen auf der anderen Seite des zerfallenen Gebäudes. Hier liegen nur Apachen und Cherokesen und diese freuen sich, für Stahlherz und Deadly Dash kämpfen zu dürfen. An dem Versteck liegt Adlerfeder, er wird es mit seinen Kriegern verlassen, damit du hineingehen kannst.«
Jubelrufe ertönten. Bessere Nachrichten hätte Stahlherz gar nicht bringen können.
Die Indianer hatten also noch während der Dunkelheit andere Positionen eingenommen. Die vor der Ruine waren vermindert, die auf der anderen Seite vermehrt worden.
»Es ist jetzt kein Zweifel mehr,« erklärte Hoffmann, »Estrella hat erfahren, daß gegen ihn von der anderen Seite reguläre Truppen vorrücken. Uns fürchtet er weniger als jene, darum hat er seine Macht dort verstärkt. Nun, die Hauptsache ist, daß wir jetzt vor uns nur Indianer haben, die uns ergeben sind. Sollten morgen von der anderen Landseite noch Truppen der Vereinigten Staaten angreifen, um so besser für uns. Was sagt mein roter Bruder, will er seine Krieger anführen?«
»Deadly Dash soll befehlen.«
»Wohlan. Liegen die Indianer im Wald oder noch so, wie vorhin, zwischen den Steinhaufen an der Ruine?«
»Nein, diese mußten sie verlassen. Sie sind vielmehr hierhergerückt, eine Kugel fliegt zweimal über sie hinweg.«
»Ah, und sind die Steinhaufen verlassen?«
»Sie sind von Rebellen besetzt.«
»Kapitän Staunton,« wandte sich Hoffmann an diesen, »Sie kennen nun das Terrain. Die Steinhaufen erstrecken sich eine englische Viertelmeile von der Ruine ab dem Walde zu, Sie sind von Rebellen besetzt worden, weil sie wichtige Verteidigungspunkte bilden, welche Estrella den Indianern nicht überlassen wollte. Ehe wir uns den Eingang zur Ruine erzwingen können, müssen wir im Besitz der Steinhaufen sein.«
»So nehmen wir sie.«
»Natürlich, aber wir wollen es so einrichten, daß dies ohne Lärm geschieht, und daß wir bei Tagesanbruch direkt vor der Ruine stehen.«
»Ohne Lärm geht dies wohl nicht ab.«
»Vielleicht doch! Stahlherz, wie sind die Steinhügel besetzt?«
»Nur von Posten.«
»Es sind also nur Sicherheitswachen, welche die Ruine bei einem Ueberfall alarmieren sollen. Kannst du sie mit deinen Kriegern lautlos überwältigen?«
Stahlherz lächelte verächtlich.
»Unhörbar wird Stahlherz über ihre Leichen hinwegschreiten und vor den Mauern der Ruine Halt machen.«
»Meine Herren,« rief Hoffmann und schaute sich mit blitzenden Augen um, »so hören sie meinen Plan! Stahlherz bleibt noch so lange hier, bis die amerikanischen Matrosen bereit sind, ihm zu folgen. Sie tun dies so leise als möglich, die dunkle Nacht begünstigt uns, wir werden nicht gesehen werden. Die Rebellen zwischen den Steinhügeln glauben, die Indianer seien treu, und werden von diesen überrumpelt. Die Matrosen schleichen ihnen nach und setzen sich in Besitz der Steinhügel, aber immer darauf achtend, daß sie sofort, wenn die Ruine alarmiert wird, sich in sicherer Position befinden. Merke auf, Stahlherz! Wird dein Ueberfall entdeckt, so schwenkst du sofort ab und greifst die Indianer auf der anderen Seite an. Hast du sie in die Flucht geschlagen, so gehst du von rückwärts gegen die Ruine im Rücken vor. Die Matrosen beschäftigen, ohne ihr Leben zu sehr der Gefahr auszusetzen, unter Kapitän Stauntons Führung die Rebellen. Zum Sturm mag geschritten werden, wenn es Kapitän Staunton für geeignet findet.
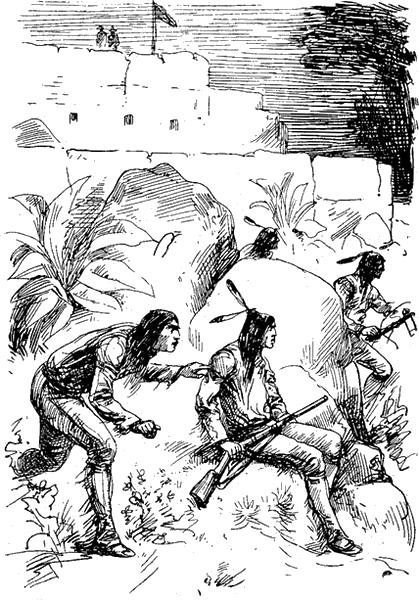
»Wir hundert Mann liegen in dem Ihnen bezeichneten Versteck und brechen hervor, wenn ich es für gut finde, entweder, wenn wir durch einen energischen Angriff von der Flanke aus die Rebellen zum Weichen bringen oder eventuell, Sie wieder festen Fuß fassen lassen können. Sonst warten wir, bis die Rebellen alle ihre Macht konzentriert haben, um Ihrem Angriff standhalten zu können.
»Dann brechen wir hervor und suchen in die Ruine einzudringen, möglichst ungesehen.
»Ich bin der festen Ueberzeugung, daß Estrella um die gefangenen Damen ein Karree bilden läßt. Dieses zu sprengen, soll meine Aufgabe sein, und so Gott will, wird es mir gelingen. Ich vertraue dem Mute meiner Leute; sie gehen für mich durchs Feuer. Kapitän Vogels Matrosen stehen ebenfalls nicht zurück, und diese englischen Herren scheuen den Tod nicht, wenn es gilt, die Damen zu befreien.
»Die Kanonen kommen so lange nicht in Betracht, wie sich der Kampf innerhalb der Ruine bewegt. Wenn Truppen der Rebellen diese verlassen, dann werden sie mit Granaten überschüttet, ebenso feindliche Indianer. Gelingt es diesen, die Apachen zurückzuschlagen und den Rebellen zu Hilfe zu kommen — was jedoch kaum glaublich ist — dann Granaten zwischen sie, so lange sie außerhalb der Ruine sind. Doch kein Kanonenschuß nach den Teilen innerhalb der Mauern, selbst die Gewehre nur vorsichtig angewendet! Sind die Herren mit diesem Plan einverstanden oder hat einer der Herren einen anderen?«
Der Plan Hoffmanns wurde mit Begeisterung aufgenommen. Kapitän Staunton fühlte sich nicht beleidigt, daß nicht er ihn entworfen hatte, er mußte ihn billigen.
»Kapitän Staunton! In welcher Zeit können Ihre Truppen zum Abmarsch bereit sein?«
»Innerhalb einer Stunde.«
»So bleibt Stahlherz bis dahin hier. Wenn er geht, folgen ihm sofort die Matrosen, während wir uns nach den Büschen begeben. Und Sie,« wandte sich Hoffmann an die Engländer, »werden von mir mit Waffen versehen. Glücklicherweise hat Mister Anders nicht vergessen, solche mitzubringen. Was fehlt, wird aus den Vorräten der Amerikaner ergänzt. Auf, es ist keine Zeit mehr zu verlieren. Stahlherz, du bleibst bei mir, ich habe noch mit dir zu sprechen!«
Die Offiziere eilten zu ihren Leuten, um sie vorzubereiten, die Engländer begaben sich mit Hoffmann zu den Wagen, auf welchen Vorräte mitgeführt worden waren, und erhielten dort Gewehre und Degen oder Entersäbel, sowie Revolver.
Nach einer Stunde standen die Matrosen bereit, den Feind anzuschleichen.
»Jetzt geh!« sagte Hoffmann zu Stahlherz und drückte ihm die Hand.
»Wo bleibt Sonnenstrahl?«
»Geht er nicht mit dir?«
»Nein.«
»So geht er mit mir. Er bleibt nicht zurück, wie Waldblüte.«
Stahlherz verschwand, und sofort setzten sich die Truppen in Bewegung, die Offiziere an der Spitze. Kapitän Staunton nahm von Hoffmann und den Herren mit dem Wunsche auf ein Wiedersehen Abschied.
Es herrschte eine sehr ernste Stimmung; es gab wahrscheinlich kein Gefecht, sondern eine Schlacht.
Fünfzig Matrosen blieben zur Bedienung der Geschütze zurück, einige von ihnen mußten ihre Waffen abgeben. Eben schnallte sich der junge van Guden einen Entersäbel um.
»Sie schließen sich den Matrosen an?« fragte ihn Lord Harrlington.
»Nein, ich gehe mit Ihnen. Ich liebe den Kampf mit blanker Waffe.«
Harrlington drückte ihm stumm die Hand.
»Wo ist Mister Vogel?« fragte Hoffmann.
»Er nimmt Abschied,« entgegnete Williams.
»So warten wir noch.«
Hinter einem Haus stand Hannes und hielt seine junge Frau umschlungen. Sie war weder trostlos, noch weinte sie. Sie war im Gegenteile fröhlich, und Hannes schien dies nicht zu gefallen.
»So schickst du mich fort?« fragte er vorwurfsvoll. »Keine Träne hast du für mich? Mit einem Scherzwort läßt du mich in den Kampf gehen?«
»Ich freue mich, weil ich weiß, daß du meine Freundinnen befreist.«
»Wenn ich nun nicht wiederkomme?«
»Doch, du kommst wieder. Ich weiß es ganz bestimmt.«
»Wie willst du das wissen?«
»Weil ich für dich bete,« flüsterte sie ihm ins Ohr.
»Lebe wohl, Hope!«
Sie antwortete nichts, sondern küßte ihn und drängte ihn dann von sich. Hannes ging; es war ihm sonderbar zumute, gar nicht kampfesfreudig. Da hörte er hinter sich einen dumpfen Fall, eine Weiberstimme weinte laut auf.
»Hannes!« schluchzte es in namenlosem Weh.
Der junge Mann blieb stehen, schon wollte er umkehren, doch er setzte seinen Weg fort. Aber seine Augen hatten plötzlich Glanz bekommen.
»Fertig?« empfing ihn Hoffmann.
» All right.«
»Vorwärts denn! In einer Stunde müssen wir das Versteck erreicht haben, in zwei Stunden schon bricht die Morgendämmerung an.«
»Es ist kalt,« sagte Marquis Chaushilm, als sich der lange Zug lautlos durch den Wald bewegte.
»Tanzen macht warm,« entgegnete Nick Sharp an seiner Seite, »ich kalkuliere, der Tanz wird bald beginnen.«
»Horch, wie die Schakale heulen!«
»Sie freuen sich auf den morgenden Tag.«
»Er wird blutig werden.«
»Ja, das wissen die Tiere auch, sie haben einen feinen Instinkt. Der sagt ihnen das, was uns die Vernunft lehrt.«
»Caracho, daß ich mich in die Sache Estrellas eingelassen habe.«
»Bah, die ist nicht hoffnungslos.«
»Ich glaube doch. Wir werden die Beute der Schakale sein.«
»Fürchtest du dich vor den fünfhundert Blaujacken?«
»Es sind sechshundert.«
»Desto schlimmer.«
»Es gibt ein kleines Gemetzel, weiter nichts.«
»Ja, und einige Leichen.«
»Was macht das?«
»Das macht sehr viel aus, wenn ich unter den Leichen bin.«
»Geh, Kamerad, du bist ein Hasenherz!«
Dieses Gespräch führten zwei Soldaten, welche zwischen den Steinhügeln, am nächsten der Tempelmauer, Posten standen. Es herrschte undurchdringliche Finsternis um sie her. Die beiden Soldaten, obgleich dicht zusammenstehend, konnten sich kaum erkennen. Nur das ferne Geheul der Schakale unterbrach die Stille der Nacht, sonst hörte man nichts, nicht einmal mehr die Schritte der Posten, das Stampfen der Kolben, welches vorhin erklungen war.
»Es ist mir unheimlich,« sagte der besorgte Soldat wieder. »Es ist plötzlich so ruhig geworden.«
»Die Posten sind des Umhergehens müde, sie lehnen sich aufs Gewehr oder haben sich sogar gesetzt.«
»Ich werde es auch gleich so machen.«
»Tu's nicht! Wir stehen zu nahe an der Ruine; die Ronde könnte kommen und uns ertappen.«
»Unsinn, daß wir hier stehen,« brummte der andere, »die Indianer wachen ja draußen.«
»Der Teufel traue den Rothäuten; selbst ist der Mann, denkt Estrella. Ich kann schwören, daß er diese Nacht kein Auge zutut, sondern wacht, wie ein gewöhnlicher Soldat.«
»Es ist viel von uns verlangt, zwei Stunden hier zu stehen.«
»Nach einer Stunde werden wir abgelöst.«
»Ja, dann bricht aber der Morgen an, und wir werden auch nicht ans Schlafen denken können.«
»Das ist der Krieg.«
»Und ich wiederhole aus ganzem Herzen: Caracho, daß ich mich in diese faule Sache eingelassen habe!«
»Pst,« warnte der andere, »ich höre Schritte. Der patrouillierende Offizier wird kommen.«
Die Posten wurden aller zwei Stunden abgelöst. Ein Offizier führte jedesmal die Wachtmannschaft an, aber er kam auch nach jeder Stunde allein, um die Posten zu revidieren.
Jetzt näherten sich Schritte. Diese beiden Posten waren die nächsten, sie wurden stets zuerst geprüft.
»Halt, wer da?«
Die Soldaten entsicherten die Gewehre und schlugen sie nach der Richtung hin an, aus der die Schritte ertönten.
Das Geräusch verstummte. Die Gestalt war stehen geblieben.
»Leutnant der Ronde,« erklang eine Stimme.
»Parole?«
»Wut und Feuer.«
Gleichmäßig setzten die Soldaten die Gewehre ab; die Kolben stampften auf den Boden. Man hörte wieder den Schritt, und in der ersten, schwachen Dämmerung, welche die Finsternis verdrängte, tauchte die Gestalt eines einzelnen Offiziers auf.
Doch konnte man sie auch erst erkennen, wenn sie dicht vor einem stand. Es war etwas nebelig.
»Ist alles ruhig?«
»Alles, Leutnant.«
»Wie haben sich die Indianer verhalten?«
»Wir haben nichts von ihnen gehört.«
Der Leutnant stand unbeweglich, er schien zu lauschen.
»Es ist mir zu ruhig,« sagte er dann, »ich höre die Schritte der Posten gar nicht mehr.«
»Sie sind müde, die armen Kerle.«
»Was soll das heißen?«
»Nun, ich meine nur, sie werden sich auf die Gewehre stützen, ohne ihre Wachsamkeit zu vermindern.«
»Ja, das kenne ich, auf das Gewehr stützen, schlafen und träumen, nennen sie wachen. Wehe dem, den ich schlafend finde!«
Der Leutnant schlug den langen Mantel enger um sich und ging, um die nächsten Posten zu kontrollieren, wozu er nur etwa 20 Meter zu gehen hatte.
Die beiden Soldaten schulterten die Gewehre und schritten wieder auf und ab, möglichst geräuschvoll, um ihre Munterkeit zu beweisen.
Der Offizier hatte sein nächstes Ziel noch nicht erreicht, als er plötzlich stehen blieb und mit der Hand unter den Mantel nach dem Degen fuhr. Vor ihm stand die hohe, dunkle Gestalt eines Indianers.
»Hugh, nicht erschrecken, Geierauge ist treu und wachsam,« flüsterte der Indianer schnell in mangelhaftem Spanisch.

»Hugh, nicht erschrecken! Geierauge ist treu und
wachsam,« flüsterte der Indianer dem Offizier zu.
»Wie kommst du hierher?« fragte der Leutnant erschrocken.
Die Indianer sollten diese Steinhügel nicht betreten, die Posten hatten den strengen Befehl, jeden abzuweisen. Etwaige Nachrichten über das Verhalten der Yankees sollten die Indianer den äußeren Posten geben und diese sie in das Quartier bringen.
Der Indianer beantwortete die Frage nicht.
»Deine Feinde liegen nicht still, sie klirren mit den Waffen,« sagte er.
»Wohl! Der Morgen bricht an, sie werden sich zum Kampfe rüsten. Wie kommt aber Geierauge hierher?«
»Auf den Füßen.«
Der Leutnant beherrschte seinen Unmut über diese spöttische Antwort; Indianer sind leicht reizbar.
»Ließen dich die Posten eintreten?« fragte er mißtrauisch.
»Ja.«
»Das ist ja gar nicht möglich, sie haben ...«
Der junge Leutnant konnte nicht weitersprechen, zwei Hände legten sich wie eiserne Klammern von hinten um seinen Hals, er konnte keinen Laut mehr ausstoßen, nicht einmal ein Röcheln. Wohl fuhr seine Hand nach dem Revolver, doch schneller noch blitzte vor ihm Geierauges Messer und grub sich in sein Herz. Der Offizier sank lautlos zu Boden, dennoch ließ der hinter ihm stehende Indianer nicht eher mir dem würgenden Griffe nach als bis ein Zucken durch den Körper des Offiziers ging — er war tot.
Die Morgendämmerung brach an; schon konnte man die Gestalten auf einen Meter Entfernung erkennen.
»Bärenherz war nicht schnell genug,« murrte Geierauge grimmig, »es wird hell.«
»Nur noch zwei.«
»Auch die Bleichgesichter haben Augen.«
»Bärenherz wird sie doch töten.«
»Sie dürfen nicht schreien.«
»Bärenherz wird dafür sorgen, daß sein Messer sie eher trifft, als ihr Mund sprechen kann.«
Die beiden Indianer flüsterten leise zusammen. Sie berieten sich, dann nahm der kleinere, Bärenherz, dem Leutnant den Mantel ab, hing ihn sich um, setzte die Mütze auf die Skalplocke und konnte so wohl für den Leutnant gelten, es war ja sehr nebelig.
»Wenn Geierauge den Arm hebt, legt Bärenherz die Hand ans Messer. Die Soldaten müssen gleichzeitig sterben.«
Mehr zu besprechen, war nicht nötig. Geierauge schlüpfte hinter einen Steinhügel, Bärenherz schritt, als Offizier verkleidet, auf die beiden ahnungslosen Soldaten zu.
Sie schöpften keinen Argwohn, als sie den Leutnant schon wieder auf sich zukommen sahen, er mochte die Ronde schneller beendet haben, als ihm die Pflicht eigentlich vorschrieb.
Bärenherz ging auf den einen Soldaten zu und blieb schweigend vor ihm stehen. Noch brauchte er nicht zu fürchten, erkannt zu werden. Er blickte zu dem anderen Soldaten hinüber, welcher neben einem Steinhügel stand.
Der Soldat wartete auf eine Ansprache des Leutnants, er wunderte sich ebenso wie sein Kamerad über dessen sonderbares Benehmen.
»Leutnant?«
Da erhob sich hinter dem am Hügel stehenden Soldaten eine dunkle Gestalt, und ein Messer grub sich in den Rücken des Ahnungslosen. Er brach zusammen.
»Was war das?« rief der andere und wandte sich um. Doch in demselben Augenblicke fuhr ihm der Stahl des vermeintlichen Leutnants zwischen die Rippen.
»Jesus Maria!« gellte es von den Lippen des tödlich Verwundeten, dann sank auch er leblos zu Boden.
Am Horizont zuckte es blutigrot, auf: die Morgenröte.
»Halloh, was gibt's, wer schreit hier?« ließ sich da eine Stimme vernehmen.
Es war Estrella. Er stand auf der Tempelmauer, welche fast zwei Meter breit war, und spähte, von einigen Soldaten umgeben, in den grauenden Tag.
Er brauchte keine Antwort zu hören, er sah sie. Dort, wo die Posten zwischen den Steinhügeln gestanden, lagen Leichen, so weit sein Auge reichte, wohl dreißig Stück. Eben erblickte er Bärenherz im Mantel des Leutnants, doch Estrella ließ sich nicht täuschen, diese Gestalt schwang triumphierend einen Skalp in der Hand, und dort lag die Leiche des Soldaten ohne Kopfhaut.
»Verrat!« schrie Estrella. Sein Revolver krachte. Bärenherz, der hinter einem Hügel Deckung suchen wollte, machte einen Luftsprung. Er mußte die Verzögerung mit dem Leben büßen. Von allen Seiten eilten bewaffnete Soldaten auf Estrella zu, noch gar nicht wissend, was geschehen war — sie hatten nur den Revolverschuß gehört.
»Verrat! Zu den Waffen!« donnerte Estrella. »Auf die Posten, die Wachen sind überrumpelt!«
Da krachte schon hinter den Hügeln hervor eine Salve, wohl aus fünfhundert Gewehren, die Mauer war plötzlich wie leergefegt. Alle, die eben noch daraufgestanden, wälzten sich in ihrem Blute, nur Estrella war wie durch ein Wunder den Kugeln entgangen.
Salve krachte nun auf Salve. Die Soldaten, welche nicht auf der Verteidigungsstelle waren, fielen im Laufe nach dort. Estrella eilte durch den Kugelregen. Wohl gelang es ihm, die Verteidigung der Ruine zu ordnen, den Matrosen wäre es nicht möglich gewesen, dieselbe im Sturm zu nehmen, die Uebermacht war eine zu starke, aber ehe noch auf Seite der Rebellen ein Schuß gefallen, bedeckten schon Hunderte von ihnen als Leichen den Boden.
Estrella hatte die Situation erkannt.
Die amerikanischen Matrosen lagen hinter den Steinhügeln und überschütteten den vorderen Teil der Ruine mit einem Kugelregen! Wohl hätten sie einen Sturm wagen können, aber er wäre ihnen übel bekommen. Estrella ärgerte sich, daß Macdonald Staunton einsichtsvoll genug war, es nicht zu tun.
Die Ruine bot unzählige Verstecke. Von dort aus wäre gegen die Stürmenden ein vernichtendes Schnellfeuer eröffnet worden.
Das Anschleichen der Yankees hatte einigen hundert Rebellen das Leben gekostet, doch was macht das? Jetzt lagen auch sie hinter den Schutzwehren und erwiderten das Feuer der Yankees. Es gab einen Feuerkampf, der sehr langweilig, aber zum Vorteil für Estrella war. Die Matrosen suchten sich wieder vorwärtszubewegen; sie sprangen von Hügel zu Hügel, und mancher stürzte bei solchem Sprunge getroffen zusammen. Die Rebellen dagegen blieben in ihren Verstecken liegen und suchten die Heranschleichenden zu dezimieren.
Estrella wußte, daß, wenn es den Yankees gelang, in die Ruine zu dringen, Macdonald sofort zum Sturm schreiten ließ. Estrella hätte nur wenige Minuten später zu kommen brauchen, und er hätte die Matrosen schon innerhalb der Tempelmauern gefunden; seine Position wäre verloren gewesen.
Die Indianer waren Verräter. Doch wo waren sie jetzt?
Auf der anderen Seite der Ruine ertönte das Kriegsgeschrei der Indianer; dort wütete ebenfalls ein Kampf.
Indianer kämpften gegen Indianer. Estrella atmete auf. Nur die Apachen und Cherokesen waren abgefallen, Staunton hatte sie gegen die übrigen Indianer rücken lassen.
Jetzt durchschaute er den feindlichen Plan vollkommen.
Die Indianer sollten die ihm Ergebenen zu überwältigen suchen und dann die Ruine von der anderen Seite angreifen. Im Schleichkampf waren die Indianer nicht zu unterschätzen, Estrella hatte in ihnen einen gefährlichen Feind. Einstweilen begnügten sich die Matrosen, mit den Rebellen Kugeln zu wechseln; griffen die Indianer aber erst von hinten an, dann ließ Staunton seine Leute ganz sicher zum Sturm vorgehen.
Nun, vorläufig mußte man abwarten, welchen Erfolg die Apachen und Cherokesen erzielen würden. Doch inzwischen versäumte Estrella nichts, um die Verteidigung der Ruine nach allen Seiten hin zu sichern. Er eilte durch den dichtesten Kugelregen, verteilte seine Leute und stellte sie auf. Starben auch viele auf dem Marsch nach der bezeichneten Stelle, seine Macht blieb immer noch doppelt so stark wie die feindliche.
Die Soldaten lagen so, daß sie die Flanken der Ruine bewachten, bei einem etwaigen Sturm der Matrosen diese aber auch beschießen konnten. Jetzt war ein Sturm gar nicht mehr möglich, nun hieß es, die Yankees in Schach halten und den Erfolg der Indianer abwarten.
Estrella lachte höhnisch auf.
Noch blieben ihm die Gefangenen. Ob die feindlichen Offiziere wohl das Karree beschießen ließen, welches die Damen in sich barg? Nein, aber das Karree würde Tod und Verderben in die Reihen derjenigen speien, welche es mit der blanken Waffe auseinanderzusprengen versuchen wollten.
Neben Estrella stürzte ein Mann zusammen, von der Kugel eines Matrosen getroffen, eine andere durchbohrte Estrellas Mütze. Der Kommandeur ergriff des Gefallenen Gewehr und Patronentasche und warf sich hinter einen Felsblock.
»Spart die Munition!« donnerte seine Stimme der Umgebung zu. »Schießt nur, wenn ihr jemanden seht, dann aber trefft ihn sicher!«
Er sandte Schuß auf Schuß nach den Steinhügeln, ohne den Ueberblick über die ganze Situation zu verlieren. Das Kriegsgeheul der Indianer verriet ihm, wie diese standen. Das der Apachen klang schwach, sie konnten nicht im Vorteil sein.
Von dichtem Gebüsch vollkommen versteckt, lagen fast hundert Mann im Wald und beobachteten den Kampf. Sie setzten sich zusammen aus Hoffmann und seiner Schiffsbesatzung, aus den Matrosen der ›Hoffnung‹, an ihrer Spitze Hannes, aus den Engländern und den anderen, welche sich diesen angeschlossen.
Die Trapper waren nicht unter ihnen, Hoffmann hatte sie ausgeschickt, die Umgegend der Ruine abzuspähen. Bekanntlich liefen von derselben unterirdische Gänge ab, und leicht hätten diese von den Gegnern benützt werden können, um in den Rücken oder in die Seite der Yankees zu kommen.
Ein solcher Versuch sollte von den Trappern dem Kapitän Staunton sofort gemeldet werden, damit dieser ihn vereiteln konnte.
Hoffmann und seine Leute schützten die Matrosen vor einem seitlichen Angriff.
Sharp hatte mit ersterem darüber gesprochen, ob es ihnen nicht gelingen könnte, auf einem solchen Schleichwege ins Innere der Ruine zu gelangen, aber Hoffmann hatte den Plan abgelehnt.
Nach der Aussage von Sonnenstrahl waren alle Gange verschüttet worden; die in der Ruine lebenden Indianer würden aber trotzdem an ihren Mündungen gute Wache halten — dafür sorgte ganz sicher schon Estrella.
Wären Hoffmann und seine Leute dennoch in einen solchen geschlichen, und sie wären entdeckt worden, dann hätte es gewiß ihr Leben gekostet.
Dies Wagnis war zu gefährlich. Ein offener Angriff, und wäre er noch so blutig verlaufen, war immer sicherer als dasselbe.
Der Kampf dauerte schon einige Stunden, und noch immer lagen sie untätig in dem Versteck. Viele waren bereits außer sich über die Verzögerung, sie ließen sich kaum noch abhalten, offen vorzudringen.
Unruhig gingen sie auf und ab. Der dichte Busch verbarg sie vollkommen den Augen der Rebellen. Sie dagegen konnten, spähten sie durch die Zweige, die Soldaten sehen, welche hinter Felsblöcken lagen, die ziemlich freie, nur etwas bewaldete Gegend beobachteten und zugleich nach den Matrosen schossen.
»Wir könnten ganz gut die Kerle dort wegputzen,« sagte Marquis Chaushilm ungeduldig. »Der dort liegt gerade so, daß ich ihm eins an den Kopf brennen kann.«
»Nur Geduld!« beschwichtigte ihn Hoffmann, welcher ruhig im Grase lag, im Arm eine kurze, etwas gebogene Toledoklinge. »Noch ist es nicht Zeit, die Rebellen wissen zu lassen, daß auch hier Feinde versteckt liegen.«
»Sie schießen aber die Amerikaner kreuz und lahm.«
»Dafür werden wir nachher wie ein Wetter über sie herfallen und vernichten. Meine Herren, spielen Sie nicht so mit den Waffen, das Blitzen derselben könnte uns verraten und unseren Plan zu nichte machen.«
Unmutig stießen die Herren ihre Degen und Entersäbel in die Scheiden zurück, sie konnten ihre Kampfbegier kaum noch bemeistern.
»Wann soll denn der Angriff beginnen?« fragte Williams.
»Nicht eher, als bis Kapitän Staunton seine Leute zum Sturm vorgehen läßt.«
»Das kann noch lange dauern.«
»Dann warten wir eben.«
»Die Yankees schmelzen immer mehr zusammen.«
»Die Rebellen nicht minder.«
»Aber es ist fürchterlich, so untätig zu warten, während andere ihr Leben aufs Spiel setzen.«
»Das ist Kriegsbrauch,« lächelte Hoffmann. »Wir müssen auf jeden Fall so lange hier warten, bis Sonnenstrahl uns die Nachricht bringt, wie sich die Indianer gegenüberstehen.«
Zwischen den Schüssen hörte man das Kriegsgeheul der Indianer, doch klang es zu entfernt, um zu schließen, welche der Parteien als Sieger aus dem Kampfe hervorgehen würde.
»Sonnenstrahl wird es vorziehen, seinen roten Brüdern zu Hilfe zu kommen.«
»Er kommt hierher zurück.«
Die Büsche teilten sich, und der Jüngling trat in den Kreis.
»Nun, wie stehen die Apachen und Cherokesen?« fragte Hoffmann denselben.
»Wie Männer, ihre Feinde wanken wie Weiber. Nicht lange dauert es, so laufen sie vor den Tomahawks der Apachen davon.«
»Wo stehen unsere Freunde?«
»Vor der Ruine.«
»Bravo, so ist es ihnen bereits gelungen, sich zwischen die Ruine und die feindlichen Indianer zu stellen. Wer führt sie an?«
»Stahlherz die Cherokesen, Adlerfeder die Apachen. Die Feinde wandten sich schon zur Flucht, als Sonnenstrahl sie sah. Der Kriegsruf der Apachen ist zu schrecklich. Wo sich das Gerippe zeigt, flieht alles. Doch Stahlherz ist ein Mensch, er kann nicht überall sein.«
»Meine Herren,« sagte Hoffmann ernst, den Degenriemen enger schnallend, »die Entscheidung naht. Wenn der Kriegsruf der Apachen in den Ruinen gellt, kommandiert Kapitän Staunton zum Sturm, und wir selbst rücken vor. Von drei Seiten angegriffen, müssen die Rebellen weichen.«
Eine wilde Kampfesfreude bemächtigte sich aller. Sie machten sich bereit, im Sturmschritt, trotz allen Gewehrfeuers, auf die Ruine vorzurücken.
Doch den Apachen mußte der Sieg nicht so leicht werden, ihr Kriegsruf ward noch immer von dem der Feinde beantwortet.
»Horch, was ist das?« rief plötzlich Williams, welcher noch auf dem Boden lag. Er näherte sein Ohr der Erde, die übrigen folgten seinem Beispiel.
»Eine unterirdische Erschütterung,« sagte Hoffmann sofort. »Es wird unter Erde gearbeitet, aber etwas entfernt von hier. Sonnenstrahl, ist hier ein Gang?«
»Ja, er mündete nicht weit von hier im Wald, doch jetzt ist er verschüttet.«
»So graben sie ihn wieder auf.«
»Es war mir, als hörte ich eine schwache Explosion,« flüsterte Williams.
»Leicht möglich,« entgegnete Hoffmann, »die Rebellen suchen ihn benutzbar zu machen, um den Yankees in die Seite zu fallen. Dies müssen wir verhindern.«
»Ha,« rief Sharp plötzlich, »seht dort, die Rebellen verlassen ihre Verstecke auf dieser Seite, sie sammeln sich, sie verschwinden.«
»Das sind die, welche durch den Gang ins Freie gelangen sollen,« entgegnete Hoffmann.
»Eine bessere Gelegenheit, einen Sturm zu wagen, haben wir nicht, als gerade jetzt,« meinte Harrlington. »Die zweihundert Meter, welche uns von der Ruine trennen, können wir im Laufschritt durcheilen, ohne ein Menschenleben beklagen zu müssen.«
»Und doch dürfen wir es nicht tun. Einmal ist dies wider die Verabredung. Kapitän Staunton beginnt den Sturm, nicht wir, und dann die Truppen, welche den Yankees in die Seite fallen sollen? Diese müssen wir unbedingt fernhalten.«
»Dann verraten wir unser Versteck.«
»Wir führen zwei Manöver mit einem Male aus. Haben wir die ankommende Truppe zersprengt, dann bleibt uns allerdings nichts anderes übrig, als sofort gegen die Ruine vorzugehen. Sonnenstrahl, wo liegt die Mündung des Ganges?«
Der Indianer beschrieb den Platz; noch war er aber damit nicht fertig, als auf einen Wink Hoffmanns plötzlich alle lautlos und mit angehaltenem Atem dastanden.
Durch den Wald kamen, hinter den Bäumen Deckung suchend, etwa 200 Rebellen. Ihre Aufgabe war es, den Matrosen in die Seite oder in den Rücken zu fallen. Die Stellung der Yankees wäre dann haltlos gewesen.
»Harrlington, Vogel,« flüsterte Hoffmann, die Anführer je einer Truppe zu sich rufend.
»Wenn diese Rebellen zwischen uns und der Ruine sind, geben wir ihnen zwei Salven, nicht mehr. Dann unter Hurra, auf sie los. Die Stehenbleibenden werden niedergemacht, dann gehts im Sturmschritt weiter gegen die Ruine, unterwegs gilt's wieder zu laden und uns der Ruinenmauern zu bemächtigen. Das übrige wollen wir Gott anheimstellen. Hoffen wir, daß bei unserem Vorgehen auch Kapitän Staunton zum Sturm schreiten läßt und die siegreichen Apachen und Cherokesen erscheinen.«
Die Anführer instruierten ihre Leute, Harrlington seine Freunde; die Waffen wurden bereitgemacht.
Die Rebellen hatten keine Ahnung von dem Hinterhalte. Die beiden führenden Offiziere beachteten den Busch nicht. Ihre Augen waren nur auf die Steinhügel gerichtet, hinter welchen die amerikanischen Matrosen lagen und noch immer auf die Rebellen feuerten.
Wehe ihnen, gelang es diesen zweihundert Mann, in ihre Seite zu kommen! Ihre langausgestreckten Körper boten sichere Zielpunkte, sie waren rettungslos verloren.
»Vorsichtig, Leute!« warnte ein Offizier. »Noch diese Baumgruppe passiert, dann tiefer in den Wald.«
»Feuer!« hallte da ganz in der Nähe ein Kommando, und zugleich mit dem Donner der Salve wälzten sich fast hundert Rebellen in ihrem Blute, eine zweite ließ nur noch wenige verwirrt nach den Waffen greifen.
»Hurra, marsch, marsch!«
Wie der Wind stoben die Angegriffenen auseinander, allein zu spät, sie fielen unter den Hieben der blanken Waffen, welche von den aus dem Busch Stürmenden geschwungen wurden. In raschem Laufe, aber geordnet, ging es weiter, gegen die Ruine vor. Sie waren nun doch verraten, sie brauchten nicht mehr still zu sein.

»Hip, hip, hurra!« erklang es von den Lippen der Engländer.
»Hurra!« riefen die deutschen Matrosen nach.
Die Mauer dort war verlassen, kein Schuß fiel, und ehe Estrella die Gefahr überhaupt bemerkte, lagen die kühnen Stürmer schon hinter der Mauer, und ihre Kugeln bestrichen dieselbe.
Estrella erkennt, daß er seine jetzige Stellung aufgeben muß, will er nicht seine Leute aufreiben lassen. Der Trompeter neben ihm erhebt das Horn. Doch das Signal hat keine Wirkung mehr, denn plötzlich schmettern die Klänge des amerikanischen Sturmmarsches, die Matrosen rücken mit aufgepflanztem Bajonett vor, an ihrer Spitze Kapitän Staunton, den Degen in der Faust.
Noch eine Salve kracht ihnen entgegen, die Matrosen lassen sich nicht aufhalten. Im Nu haben sie die vordersten Reihen der Rebellen erreicht, der Stahl des Entersäbels gräbt sich in die Eingeweide, und die Hintenstehenden empfangen Revolverkugeln.
Die Rebellen können jetzt nicht an Widerstand denken, sie sind im Nachteil, weil sie das Bajonett noch nicht aufgepflanzt haben, das Feuern im Nahkampf ist unmöglich.
Estrella muß seine Leute erst sammeln und ihnen Zeit zur Besinnung geben. Er hält sich noch nicht für verloren, noch immer ist die Uebermacht auf seiner Seite.
Da ertönt indianisches Kriegsgeschrei im Rücken der Ueberraschten. Rote Gestalten schwingen sich über die Mauer, voran das weiße Gerippe der Apalachen.
»Hurra!« ertönt es zur Linken. Hoffmann führt seine Truppe an. Die blanken Waffen blitzen in der Sonne.
Sie werden von einer Salve begrüßt, die letzte, welche die Rebellen auf Kommando feuern können.
Vor Hoffmanns Füßen stürzt ein Matrose, ein zweiter, ein dritter, neben Harrlington sinkt Marquis Chaushilm nieder. Der Lord wirft einen bedauernden Blick auf ihn, dann geht es weiter, er muß über Hendricks springen, der sich stöhnend am Boden windet, weiter, immer weiter.
Alle Ordnung ist aufgelöst. Mann kämpft gegen Mann. Das Gewehr ohne Bajonett ist nutzlos; nur der Revolver knallt, der Degen sticht, und der Entersäbel schlägt. Die ganze Ruine ist ein einziger, großer Schlachtplatz. Am nördlichen Flügel ist es den Rebellen gelungen, sich zu sammeln. Ihre Kugeln begrüßen die anstürmenden Indianer. Wie Halme stürzen sie nieder.
Estrella verliert den Mut nicht.
»Zurück nach dem Plateau!« ruft er mit heiserer Stimme.
Hoffmann versucht vergebens, zu ihm zu gelangen. Selbst seiner Toledoklinge, so furchtbar sie auch wütet, ist es nicht möglich, die dichten Reihen der Rebellen zu durchdringen. Estrellas Raufdegen hält die Matrosen ab, jeder Stich wirft einen nieder.
Hoffmann ahnt den Plan des Gegners, er versucht wie ein Wahnsinniger, durch die Reihen der Feinde zu brechen. Immer mehr Rebellen eilen einem Plateau zu, auf welchem Offiziere sie empfangen und aufstellen, Estrella selbst schlägt sich noch mit einigen hundert Mann gegen die Yankees, er will diese nur aufhalten.
Hoffmann sieht Staunton kämpfen.
»Nach dem Plateau,« ruft Hoffmann ihm zu, »ein Karree soll dort gebildet werden. Wir müssen dem zuvorkommen, sonst sind wir verloren.«
Estrella hat diese Worte vernommen, er lacht höhnisch auf. Er kreuzt die Waffe jetzt mit Kapitän Staunton, eine halbe Minute nur, dann fährt die Spitze seines langen Raufdegens durch Stauntons Hand. Dieser läßt den Degen sinken, er erwartet den tödlichen Stoß, aber Estrella kann denselben nicht ausführen, er wird von seinen eigenen Leuten fortgerissen. Hoffmann dringt ihm nach. Neben ihm fällt sein Ingenieur Anders. Dort sieht er den Holländer rasen. Sein Entersäbel mäht Rebellenköpfe ab.
»Nach dem Plateau!« heult Estrella und bricht sich Bahn.
»Kein Schuß mehr!« ruft Hoffmann. »Nach dem Plateau! Braucht nur die Säbel!«
Auf dem Plateau haben sich Rebellen angesammelt, schon werden sie zum Karree formiert. Es liegt neben einer Felswand, also nur drei Seiten müssen gebildet werden.
In dem Gestein ist eine Oeffnung, und eben sieht Hoffmann, wie die gefangenen Damen herausgeführt werden. Man führt sie in die Mitte des Karrees, ihre Gesichter drücken Verzweiflung aus.
Die Yankees und die Freunde Hoffmanns begreifen, warum dieser so gerufen.
»Kein Schuß mehr!« ertönt es überall, die Besitzer von Degen werfen die Gewehre, sogar die Revolver weg.
Auch Estrella wendet sich, wie die übrigen, zur Flucht, er muß das Karree erreichen, dann kann es sein mörderisches Feuer eröffnen, es selbst darf nicht beschossen werden, die Anwesenheit der Damen verbietet dies. Feuert es jetzt schon, treffen die Kugeln die Rebellen, darum zurück.
»Sie dürfen es nicht eher erreichen als wir,« ruft Hoffmann, mit der Kraft der Verzweiflung vorwärts dringend.
Dem Anführer der Rebellen soll dies auch nicht gelingen, Estrella hat sich am Fuße verwundet, er ist in ein Bajonett getreten, er kann nicht mehr fliehen. Wie ein verwundeter Tiger fährt er herum und — steht vor Hoffmann.
»Ah, Estrella, wir sehen uns doch wieder!«
Jener erwidert nichts. Blitzschnell sticht und schlägt der Raufdegen auf den Gegner ein, allein vergebens. Estrella mag ein ausgezeichneter Fechter sein, Hoffmann ist ihm überlegen. Drei Sekunden lang begegnet der Raufdegen, wie er auch geführt wird, der Toledoklinge, bis sich diese wie eine Schlange um den Degen windet. Er fliegt davon, Estrella vermag ihn nicht zu halten.
»Ergebt Euch!«
»Stecht zu!«
Hoffmann braucht nicht zu überlegen, ob er Pardon geben soll, ein aufgepflanzter Entersäbel dringt in die Eingeweide des Anführers der Rebellen, Estrella sinkt nieder.
»Hol' Euch die Pest!« Mit diesem Fluche entflieht seine Seele. Bajonette haben eine furchtbare Wirkung, beim Rückziehen aus der Wunde werden sie umgedreht.
Vorwärts! Weiter, weiter! Das Karree hat sich gebildet.
Hoffmann ist der Verzweiflung nahe. Er sieht es, das Karree kann nicht mehr erreicht werden, die Flüchtlinge sind eher dort. Schon knallen Salven den Indianern entgegen, an ihrer Spitze steht nicht mehr Stahlherz, sondern Sonnenstrahl.
»Tod oder die Freiheit der Gefangenen!« ruft Hoffmann und stürzt vorwärts. In einer halben Minute müssen die Gewehre krachen.
Doch was ist das? Schickt der Himmel Engel herab, welche für die gerechte Sache streiten sollen?
Aus demselben Gange, aus welchem vorhin die gefangenen Mädchen geführt wurden, stürzt ein Offizier, ein Knabe, hervor, ihm folgen etwa zwanzig Mann. Der Knabe hat einen Degen in der Faust, er springt ins Karree hinein. Seine Leute folgen ihm, sie haben die Büchsen umgedreht und lassen die Kolben auf die Köpfe der Rebellen schmettern.
Hoffmann hat sie erkannt: Es sind die fehlenden Matrosen vom ›Blitz‹ und die der ›Hoffnung‹, er erkennt Georg und den Bootsmann, auch den Jüngling an der Spitze, es ist sein Schützling, Leutnant Ramos, den er erzogen hat. Er vergilt jetzt die ihm erwiesenen Wohltaten.
Das Karree gerät in Unordnung, es hat einen inneren Feind zu bekämpfen. Die Rebellen achten nicht auf die anstürmenden Yankees und Engländer, sie wenden sich gegen die Eindringlinge. Sie schießen und töten ihre eigenen Kameraden.
Doch es gelingt ihnen nicht, die Ordnung wiederherzustellen; ihr Offizier fällt vom Degen des jungen Leutnants. Die Kolben der deutschen Matrosen wüten wie Keulen. Jeder Schlag zerschmettert einen Rebellenschädel.
»Drauf und dran!« donnert Hoffmann, er hat zuerst das Karree erreicht, dann prallen die Engländer gegen die erste Reihe, dann kommen die amerikanischen Matrosen.
Die ferne Musik begleitet den letzten Sturm; er bedeutet die Vernichtung des Karrees. Im Nu ist es auseinandergesprengt, alles löst sich in Flucht auf.
»Pardon, Pardon!« heult es überall.
Es gibt keinen. Den Knienden durchsticht der Degen, den Verwundeten das Bajonett, ein Kolbenschlag wirft den noch Auferstehenden nieder.
Auch die Indianer sind herangekommen. Sie finden keine Arbeit mehr, der Tomahawk wird eingesteckt, das Skalpiermesser hervorgezogen, und eine blutige Kopfhaut nach der anderen reiht sich an ihre Gürtel. Sonnenstrahl ist der einzige Indianer, welcher keine Skalpe nimmt; finster schaut er den roten Brüdern zu.
Die Engländer, Hoffmann an der Spitze, haben die Mädchen erreicht. Mit lauten Freudenrufen stürzen sie auf dieselben zu, sie wollen sie von den Fesseln befreien, aber sie kommen zu spät, die von Ramos angeführten Matrosen haben die Stricke, welche die Hände fesselten, bereits durchschnitten.
Hoffmann steht einen Augenblick erstaunt da. Leutnant Ramos lehnt sich an Johanna, ein Arm umschlingt ihren Hals, die andere Hand hält den abgebrochenen Degen. Das Antlitz des Jünglings ist mit Blut bedeckt, es fließt aus tiefen Kopfwunden herab. Aber sein Blick ist heiter, er lächelt, und auch Johanna hat ihn umschlungen. Man glaubt ein Liebespaar vor sich zu haben.
»Mister Hoffmann,« sagt er freudig, »ich habe meinen Schwur gelöst. Sie sind mein Wohltäter, hier ist Ihre Braut.«
Er läßt seinen Arm sinken, Johanna will sich an die Brust des Geliebten werfen, aber sie kann es nicht, denn zwischen beiden stürzt der junge Leutnant lautlos nieder — er hatte keine Stütze mehr.
Der Kampf war aus. Die Trompete blies zum Sammeln. Die übriggebliebenen Matrosen scharten sich um die noch lebenden Führer.
Die Musterung ergab, daß 230 Matrosen und 17 Offiziere und Unteroffiziere gefallen waren, ein großer Verlust, aber klein im Verhältnis zu dem der Rebellen.
Von diesen waren viele geflohen, und jetzt gab Kapitän Staunton, die Hand mit einem Tuche umwickelt, den Befehl, die Ruine zu besetzen, damit die entflohenen Rebellen keine Gelegenheit hätten, sich unter einem kaltblütigen Offizier zu sammeln und den Kampf von neuem zu beginnen.
Die Indianer mußten die Umgegend absuchen. Staunton brauchte ihnen nicht erst zu befehlen, keinen Pardon zu geben.
An ihm, welcher eben Krankenträger abteilte, flog eine weibliche Gestalt vorbei. Es war Hope.
Sie achtete des Bruders nicht, er lebte ja. Lächelnd blickte dieser der Schwester nach, welche einer Gruppe von drei Männern zueilte.
Diese saßen auf einem Steine. Der eine, Youngpig, der sich redlich am Kampfe beteiligt hatte, zeichnete und schrieb in ein dickes Buch, Nick Sharp saß neben ihm, reinigte mit Hilfe eines Revolverwischers seine kurze Tabakspfeife, schaute dem zeichnenden Bruder zu und erteilte ihm Ratschläge.
Beide waren unverwundet, der dritte beschäftigte sich damit, mit einem Taschentuche das Blut zu trocknen, welches ihm übers Gesicht lief, lachte aber dabei herzlich über die trockenen Witze des Detektiven.
Plötzlich umklammerten diesen dritten zwei Arme.
»Hannes, du blutest, du bist verwundet!« schrie Hope außer sich.
»Ach, Hope, ich hatte dich ganz vergessen, Mister Youngpig malte eben, und da ...«
»Aber du bist verwundet,« klagte Hope.
»Ein bißchen. Das macht nichts weiter. Eine Revolverkugel ist mir durchs Ohr gegangen.«
»Ich will es dir verbinden,« rief das junge Weib, aufjauchzend, weil es seinen Hannes lebend fand.
Sie besichtigte das Ohr. Eine Revolverkugel hatte ein kleines Loch darin zurückgelassen.
»Und sonst hast du keine Wunde?«
»Ich weiß keine andere.«
»Gar keine andere?«
»Wahrhaftig nicht. Das heißt, wir können ja nachher einmal danach suchen.«
»Tut dir nichts weh?«
»Nein, gar nichts.«
Hannes bewegte sich hin und her, Sharp begann zu lachen.
»Ach, das böse Loch,« seufzte Hope, das Blut stillend.
»Wissen Sie was!« lachte Sharp. »Sie machen in das andere Ohr auch noch eins, dann kann Mister Vogel Ohrringe tragen.«
»Gehen Sie, Sie abscheulicher Mensch,« rief Hope unwillig, »Sie haben gar kein Mitgefühl.«
Sie zog Hannes fort, um ihm abseits einen Verband anzulegen.
»Siehst du,« flüsterte sie zärtlich, »mein Gebet hat geholfen.«
»Aber Nick Sharps Entersäbel auch, sonst stände ich nicht mehr hier. Er hat mich einmal herausgehauen, als ich schon umzingelt und verloren war.«
»Dann will ich ihm verzeihen und abbitten. Ich weiß, daß Sharp anders denkt und handelt, als er spricht.«
Auf dem Plateau wurden die Mädchen von den Engländern umringt, aber nicht viele Freudenrufe ertönten, nicht viele Umarmungen erfolgten. Bange Fragen wurden laut.
»Wo ist Marquis Chaushilm?«
»Wo ist Sir Hendricks?«
Noch viele solcher Fragen ertönten, sie fanden keine Beantwortung. Ellen ließ die weitgeöffneten, entsetzten Augen im Kreise herumwandern, sie fanden nicht Lord Harrlington.
»Wo ist James?« erklang es gellend.
Williams, nur unbedeutend verwundet, machte sich aus den Armen von Miß Thomson los.
»Viele von uns sind gefallen,« sagte er wehmütig. »Wir wollen uns den Krankenträgern anschließen und unsere Freunde aufsuchen. Bitten wir Gott, er möge uns gnädig sein, damit wir diesen Sieg nicht allzu schmerzlich empfinden. Eine größere Hoffnung wage ich nicht auszusprechen.«
Paar nach Paar verließ das Plateau, es herrschte keine Freude des Wiedersehens mehr. Einige Mädchen eilten ungeduldig voraus, andere wankten hinterdrein, zuletzt Ellen — sie mußte gestützt werden, und doch wollte sie nicht warten, bis die Krankenträger zurückkamen.
Gebrochen hing sie am Arme Williams' und Miß Thomsons, Trostworte fanden kein Gehör. Der Glanz ihrer Augen war erloschen, aber sie fand keine Tränen.
Auch Sharp und Youngpig suchten unter den Verwundeten. Hannes und Hope begaben sich nach dem Plateau, auf welchem nur Hoffmann und Johanna zurückgeblieben waren.
Beide knieten neben Ramos, welcher bewegungslos am Boden lag. Hoffmann hatte ihn untersucht, sein Tod war unabwendbar, ein Schuß hatte die Lunge durchbohrt.
Johanna entfernte fort und fort das Blut von dem kindlichen und doch männlichen Antlitz, ein Verband war nicht mehr nötig.
Jetzt ging ein Zittern durch den Körper des Sterbenden, er schlug die Augen auf, erkannte die neben ihm Knienden, und ein Lächeln verklärte seine Züge.
Er streckte seine Hände aus, sie wurden beide gefaßt.
»Kapitän Hoffmann — Miß Lind,« lispelten seine bleichen Lippen, »ich sterbe — vergessen Sie — nicht — meine Mutter.«

»Kapitän Hoffmann — Miß Lind,« murmelte der
Sterbende, »vergessen Sie — nicht — meine Mutter!«
Ein doppelter Händedruck war die Antwort auf diese letzte Bitte, der junge Mann nahm die stumme Versicherung, daß er seine Mutter nicht schutzlos zurückließ, mit ins Jenseits hinüber.
Hoffmann drückte ihm die Augen zu, Johanna weinte leise.
»Señor, ein Matrose verlangt nach Ihnen,« erklang hinter ihnen eine Stimme.
Hoffmann erblickte einen alten Soldaten, er trug die amerikanische Korporalsuniform, sein Arm lag in einer Binde. Johanna erkannte in ihm Patrick O'Neill, welcher unter Führung von Ramos gefochten hatte, die Teufel ließ er diesmal aus dem Spiele.
Beide erhoben sich. Johanna drückte dem braven Alten warm die gesunde Hand, während Hoffmanns Adlerblick das Plateau überflog. Engländer lagen hier nicht, ebensowenig amerikanische Matrosen, wohl aber Deutsche, welche das Karree sprengten.
Hoffmann erkannte vier anscheinend Tote, teils vom ›Blitz‹, teils von der ›Hoffnung‹, und außerdem viele Verwundete. Diese warteten entweder auf die Krankenträger oder suchten ihre Wunden selbst zu verbinden. Sie äußerten keinen Schmerz, freudig blickten sie nach der hohen Gestalt Hoffmanns und Hannes', welcher mit Hope neben einem Toten kniete.
»Wir können nicht allen zugleich helfen,« redete Hoffmann sie an. »Ihr sollt jedoch bald die beste Verpflegung erhalten. Für die Angehörigen der Toten wird gesorgt. Wir vergessen nicht, daß ihr für uns gefochten habt.«
»Keine Worte mehr, Kapitän,« rief ein Matrose mit zerschossenem Arme, »wir wissen das allein ohne Eure Versicherung.«
»Wo ist der Matrose, welcher nach mir fragte?« wandte sich Hoffmann an Patrick.
Dieser führte ihn und Johanna hinter einen Steinblock. Dort lag ein Mann am Boden, um ihn eine Blutlache.
»Georg, auch du!« rief Hoffmann schmerzlich.
Der Verwundete hob das bleiche Gesicht.
»O, es ist nichts weiter,« flüsterte er, »ich habe durchaus noch keine Lust zum Sterben. Nur ist mir so eine verdammte Bohne ins Bein gefahren, und da wollte ich nur fragen, ob ...«
Hoffmann hatte die Kleider schon aufgeschnitten, eine Kugel hatte den Schenkel durchbohrt und anscheinend auch den Knochen verletzt. Der Kapitän legte sofort einen Notverband an, um das Blut erst zu stillen.
»Armer Kerl, es wird einige Zeit dauern, ehe du wieder in die Takelage klettern kannst.«
»Also ist es nicht so schlimm?«
»Nein, es wird heilen.«
»Hm, ich kenne auch lahme Matrosen, welche noch wie Affen klettern können. Hm, hm, aber ...«
»Was denn, Georg?«
»Hm, es sind doch nur halbe Menschen.«
»Wie so denn? Ich versichere dir, du wirst kein halber Mensch werden, sondern bleibst ein ganzer, stattlicher, schlanker Bursche.«
»Wohl möglich, wenn ich sitze.«
»Unsinn, Georg, du kannst auch stehen und gehen.«
Des Matrosen Gesicht begann sich aufzuklären.
»Ich werde auch nicht hinken?«
»Nicht im mindesten.«
»Juchhe!« jauchzte Georg plötzlich auf. »Dann kann ich also auch noch tanzen?«
Die beiden mußten trotz des Ernstes der Situation über den Matrosen lächeln.
»Tanzest du denn so sehr gern?«
»Natürlich! Was nützen mir denn die Beine, wenn ich mich mit ihnen nicht manierlich drehen kann?«
»Nun, Georg, du wirst tanzen können, bis dir der Atem ausgeht.«
»Gott sei's getrommelt und gepfiffen,« seufzte Georg erleichtert. »Sehen Sie, Kapitän, ich habe in Bremerhaven so eine kleine, nette, fixe Dirn', Mary heißt sie, brav wie ein aufgetakelter Lotsenschoner mit doppeltem Klüversegel, aber tanzen tut sie nun schrecklich gern. Ich glaube ja, sie würde mich auch noch mit einem Bein lieben, aber verflucht wäre es doch, wenn ich zusehen sollte, wie sie mit einem anderen tanzt, denn tanzen muß sie nun einmal, und ich mit einer verkürzten Bramsteng am Leibe könnte sie doch nicht blamieren. Gott verdamme mich ...«
»Georg,« warnte Johanna.
»Nun ja, ich habe nichts gesagt. Aber schön ist's doch, wenn man so die Beine schlenkern und stampfen kann, daß der Boden wackelt ... au, mein Bein.«
Georg hatte sein Bein bewegen wollen. Der Schmerz erinnerte ihn, daß er noch nicht fähig war, Mary zum Tanz zu führen.
»Still liegen und geduldig warten,« ermahnte ihn Hoffmann, »bis die Krankenträger kommen! Dann die Vorschriften des Arztes genau befolgen, und vor allen Dingen keine alkoholischen Getränke zu dir nehmen, sonst garantiere ich für nichts.«
»O weh, da werden saure Wochen kommen!«
Johanna und Felix gingen, um andere Verwundete zu trösten, doch ein Bild fesselte ihre Schritte.
Dort saßen Hannes und Hope neben dem Körper des alten Bootsmannes, er schien tot zu sein. Hannes hielt ein kleines Bild und ein halb zerfallenes, von Alter vergilbtes Papier in der Hand.
Hope weinte, Hannes standen die Tränen im Auge, während er sprach. Verwundert lauschten die beiden seinen Worten. Seltsam, was er da erzählte, war eine unglückliche Liebesgeschichte, eine von jenen, an deren Spitze das Wort des Dichters stehen kann:
»Es ist eine alte Geschichte, Doch bleibt sie ewig neu, Und wem sie just passieret, Dem bricht das Herz dabei!«
Ein junger Seemann liebt ein Mädchen, es ist verachtet, weil es die Tochter des alten Schäfers ist, welcher im Verdachte der Hexerei steht. Doch daran kehrt sich der Liebende nicht. Er kommt nach langer Reise zurück, mit Brautgeschenken beladen, doch er sieht die Geliebte im Arme eines anderen, mit schönen Kleidern geschmückt, bleich und gebeugt. Der arme Seemann hat verspielt, er kehrt auf das Meer zurück, tobt sich aus, gewinnt seine Freudigkeit wieder, doch das Bild des Gänsemädchens schwindet nicht aus seinem Herzen.
Kurz, es ist die Geschichte des Bootsmannes, wie er sie früher einmal an Bord der ›Kalliope‹ erzählte.
Hannes wendete sich um und hielt Hoffmann das Bild entgegen. Es war eine alte Photographie, schlecht gemacht, halb erloschen, und stellte ein junges Mädchen dar mit unschuldigen, lieblichen Zügen und langen Zöpfen.
»Susanne Vollmer ihrem lieben Karl, Neukirchen 187*, Ostern,« stand darunter mit eckigen Schriftzügen. »Vor 25 Jahren,« murmelte Hoffmann gerührt.
»Karl hielt das Bild in seiner Hand, daneben lag dieser Brief, er muß ihn vor seinem Tode noch einmal gelesen haben.«
Die beiden lasen den Brief, er war fünf Jahre jünger als das Bild. Karl erhielt die Mitteilung von Susanne, daß ihr Mann sich erhängt habe, sie sei mittellos, ohne Kinder, läge im Krankenhaus, die Aerzte hatten sie aufgegeben, jede Stunde könnte der Tod eintreten. Der Brief war von anderer Hand geschrieben, man erkannte eine geübte Schrift, darunter aber standen in zittrigen, mühsamen Buchstaben die Worte:
»Deine Suffy, behalte sie im Andenken, bis Du sie wiedersiehst!«
Dem Brief entfiel ein getrocknetes Blümchen, es war ein kaum noch erkennbares Vergißmeinnicht. Hoffmann hob es auf und legte es wieder sorgfältig in den Brief.
»25 Jahre trägt er das Bild, 20 Jahre den Brief bei sich. Wie oft mag er ihn gelesen haben,« sagte Hoffmann gerührt.
»Und wie oft mag er das Bild geküßt haben,« schluchzte Hope, »nun sieht er sie wieder.«
Hoffmann wandte seine Aufmerksamkeit dem Toten zu, ein Bajonett war ihm in den Unterleib gedrungen.
»Aber er lebt ja!« rief Hoffmann plötzlich.
»Dann ist er noch einmal zu sich gekommen,« entgegnete Hannes, »ein Bajonettstich ist tödlich.«
»Nicht immer; es können Ausnahmen eintreten. Schnell, eilt zu den Krankenträgern; sie haben Verbandzeug bei sich. Vielleicht kann auch der Schiffsarzt abkommen.«
Hannes eilte davon. —
Unterdes spielten sich da, wo der erste Zusammenstoß zwischen den Engländern und Rebellen stattgefunden, andere Szenen ab.
Ein Vermißter nach dem anderen wurde gefunden, und bis jetzt war unter den Engländern kein Toter. Die Rebellen hatten schlecht geschossen und blanke Waffen fast gar nicht gebraucht. Der Angriff jener hundert Menschen war zu bestürzend für sie gewesen, die Engländer waren wie Unholde über sie hergefallen; gegen die Kunstfertigkeit im Fechten half kein Mittel, ebensowenig wie gegen Lord Hastings' Riesenkraft.
Unverwundet schlang er seinen Arm um Miß Murrays schlanke Taille, während sie über das Schlachtfeld schritten.
»Ich habe Richard Löwenherz fechten sehen,« flüsterte sie, »ich habe gesehen, wie er seine Feinde vernichtete. Niemand konnte seinem Arm widerstehen. Du hättest einen Panzer umhaben sollen und auf deinen blonden Locken einen stählernen Helm, dann wären die Zeiten der alten Ritter wiedergekommen. Alle anderen Vestalinnen haben für euch gezittert, ich nicht, ich habe immer leise gesungen:
Du stolzes England, freue dich,
Dein König geht und kämpft für dich.«
»Aber Richard Löwenherz war diesmal kein König,« sagte Hastings bescheiden, »er focht unter den Befehlen Hoffmanns und Harrlingtons, und ihre Taten haben die seinigen übertroffen.«
»O, Harrlington,« rief Jessy erschrocken, »die arme Ellen sucht ihn noch immer vergebens.«
Der erste Engländer war gefunden, welcher zwar ebenfalls nur verwundet, an dessen Tod aber kaum gezweifelt werden konnte. Es war Marquis Chaushilm.
Neben ihm kniete Miß Sargent und gebärdete sich wie eine Wahnsinnige; sie hörte nicht auf Williams' und Bettys Trostworte, sie schrie verzweifelnd auf und fluchte dem Himmel.
»Er darf nicht sterben!« rief sie wieder und wieder. »Ich habe ihm schon einmal das Leben gerettet, ich werde es ihm wieder retten, er darf nicht sterben!«
Die Umstehenden fühlten mehr Mitleid mit dem Mädchen, welches sich die Haare raufte, als mit dem Herzog selbst. Es war nach dem Arzt geschickt worden, doch vergingen einige Minuten, ehe dieser kam.
»Chaushilm ist nicht tot, sonst flösse das Blut nicht mehr,« tröstete Williams.

»Ja, er ist tot,« schrie das Mädchen, sich ausrichtend und mit irren Augen umherblickend. »Wer sagt, daß er nicht tot sei? Haha, wer spricht da, es gäbe einen Gott? Wo ist er? Warum hat er ihn töten lassen? Ich will es wissen!«
Der Arzt kam. Mit sanfter Gewalt mußte das rasende Mädchen abgehalten werden, daß es ihn nicht an der Untersuchung hinderte.
Endlich befreite eine Ohnmacht es von ihrem Schmerz.
»Die Kugel ist dicht am Herzen vorbeigegangen,« erklärte der Arzt, »ich wage nicht, zu behaupten, daß sein Zustand hoffnungslos ist, aber auch nicht das Gegenteil. Die nächste Stunde wird dies entscheiden.«
Chaushilm wurde auf eine Trage gelegt und nach dem Verbandplatze geschafft; auch Miß Sargent mußte fortgetragen werden.
Da stieß Williams einen Freudenruf aus, er hatte unter den Verwundeten seinen Freund entdeckt.
»Hendricks, Gott sei Dank, endlich gefunden! Tot oder lebendig?«
Sir Hendricks lag gar nicht weit entfernt vom Schauplatz der eben erwähnten Szene, auf der Seite, halb aufgerichtet, rief seltsamerweise aber niemanden an, obgleich er völlig bei Besinnung war. Er verhielt sich überhaupt ganz merkwürdig.
»Williams — gut, daß Sie kommen — au, au — verdammtes Pech — au, seien Sie stille! Rufen Sie niemanden, bevor — au — verflucht.«
»Was fehlt Ihnen denn?« rief Williams erstaunt.
»Um Gottes willen — au — machen Sie keinen Lärm!«
Da kam aber auch schon Miß Nikkerson an, und hinter ihr tauchte Nick Sharp auf.
Alle wußten, daß Miß Nikkerson und Sir Hendriks ein Paar bildeten.
Das Mädchen sah ihren Geliebten am Boden liegen, aber er schien nicht ernstlich verwundet zu sein, er lächelte ja sogar — es wer ein verschämtes Lächeln.
»Mein armer Edgar,« rief Klara und kniete neben ihm nieder, seine Hände erfassend.
»Au — Klara, das ist schön, daß du kommst — au — ich bin nicht arm — liebe Klara —«
»Hast du Schmerzen?«
»Ich? Nein, gar nicht — au o — Himmelsakkerment — entschuldige, Klara, daß ich fluche — au — ich tu's nicht mehr — verflucht.«
»Bist du schlimm verwundet?« fragte Klara ängstlich. »Nicht im mindesten.«
Plötzlich stand Hendricks kerzengerade vor ihr, fiel aber gleich wieder mit einem Schmerzensschrei zurück und wälzte sich auf die Seite.
»O — ah — au — das brennt wie Pfeffer!«
»Bist du in die Brust geschossen?«
»Nein, weiter unten — au.«
»In den Leib?«
»Au — noch weiter unten.«
»Ins Bein?«
»Au — au — weiter oben.«
Verwundert schaute Miß Nikkerson ihn und die beiden Männer an.
»Ich verstehe dich nicht, wo bist du denn nur verwundet? Ich will die Wunde untersuchen und verbinden, ich verstehe mich darauf.«
Hendricks zog ein verzweifeltes Gesicht.
»Klara, ich liebe dich — au — du bist so gut — au — du liebst mich — au, o — aber zum Teufel, Klara — Herrgott — das brennt wie spanischer Pfeffer.«
Da sah Miß Nikkerson das spöttische Gesicht von Nick Sharp, und plötzlich ging ihr eine Ahnung auf.
»Auf Wiedersehen, mein lieber Edgar,« sagte sie und küßte ihn, wie eine Purpurrose errötend. »Ich komme dann wieder zu dir und erkundige mich nach deinem Befinden.«
Sie eilte davon.
»Herrgott, Kreuzmillionenschwerenot,« fluchte Hendricks in einem Atem, »so ein verdammtes Pech — auhhh — nun schlag doch Gott den Teufel tot!«
Williams saß auf einem Stein und lachte, daß ihm die Tränen über die Backen rollten.
»Drehen Sie sich herum, edler Sir,« sagte Sharp gutmütig, »ich bin zwar kein Arzt, aber ich weiß, wo Sie der Schuh drückt.«
Gehorsam drehte sich Hendricks herum. Auf dem Bauche liegend, verspürte er keine Schmerzen. Aber er wußte nicht, daß Sharp sein Taschenmesser in der Hand hatte, sonst würde er nicht so willig gewesen sein.
»Sir Williams,« bat Sharp, »bitte, achten Sie darauf, daß keine Damen hierherkommen, sie könnten ohnmächtig werden.«
Williams verbiß das Lachen, ließ seine Augen umherschweifen, vergaß aber auch nicht, die Beschäftigung Sharps zu beobachten, welcher auch einmal als Operateur fungieren wollte.
Erst wurde das Auftrennen von Hosennähten hörbar, Sharp operierte an dem Hinteren und weitesten Teile der Hose.
»Aha, da sitzt eine Kugel im Fleisch. Seien Sie froh, daß Sie solch dicken Speck haben, deshalb ist sie nicht tief in Ihren edelsten Teil eingedrungen. Jetzt beißen Sie die Zähne zusammen.«
Hendricks folgte dem Rate. Doch gleich darauf erschütterte sein Jammergeschrei die Luft, Sharps Messer und Finger wühlten im Fleische.
»Einen Augenblick — da ist sie schon.«
Er hielt dem Verwundeten die Kugel hin.
»Mein lieber Hendricks,« meinte Williams lachend, »reiten werden Sie nun wohl längere Zeit nicht können, Sie müßten sich den Sattel denn polstern lassen. Auch beim Essen werden Sie stehen oder auf dem Bauche liegen müssen.«
»Erst versuchen Sie, ob Sie gehen können.«
Siehe da, Hendricks konnte gehen, ohne besonderen Schmerz zu empfinden.
»So begeben Sie sich nach dem Verbandplatz und lassen Sie sich die Wunde an einem versteckten Orte verbinden.«
»Ich kann doch nicht mit der offenen Hose gehen,« klagte Hendricks, »überall sind ja Damen.«
»Ich stecke sie einstweilen zu,« entgegnete Sharp und besserte den Schaden sofort mit Stecknadeln aus. Dabei zeigte es sich, daß Sharp, als vorsichtiger Mann, der sich immer auf Reisen befand, mit vollständigem Nähzeug ausgerüstet war.
»Sagen Sie nur,« nahm Williams das Wort, »wie bekamen Sie eigentlich die Wunde an jener Stelle? Ein Zeichen von Tapferkeit ist das eben nicht.«
»Ich sah, wie Lord Harrlington plötzlich stürzte, er griff sich nach dem Herzen, rannte noch einige Schritte vorwärts und stürzte in eine Spalte. Ich bückte mich, um ihn herauszuziehen, da fühlte ich einen Schlag oder Puff an jener Stelle. Ich konnte dem Lord nicht helfen, ich wurde fortgerissen, stürmte vorwärts, bis ich plötzlich einen brennenden Schmerz verspürte.«
»So wissen Sie also, wo Lord Harrlington liegt?« fragte Williams hastig.
»Ja, es ist gar nicht weit von mir.«
»Mein Gott, Miß Petersen sucht ihn immer noch vergebens. Schnell dorthin, Miß Petersen verzweifelt fast!«
Hendricks verbiß den Schmerz und eilte so schnell als möglich voraus, es schlossen sich ihnen noch viele an.
Hoffmann sprach unterdes mit dem Matrosen Fritz, einem von jenen, welche unter Leutnant Ramos das Karree gesprengt hatten. Er war nur ganz leicht am Kopfe verwundet worden.
»Nun gib mir die Erklärung, wie ihr ins Innere der Ruine gelangtet!«
»Wir hatten erfahren, daß Miß Lind, welche zu befreien wir geschworen hatten, in die Ruine gebracht worden war. Wir kamen hier an, als eben der Kampf begann. Leutnant Ramos orientierte sich über die Gefechtsstellung und beschloß dann, die Ruine an einer schwachbesetzten Stelle anzugreifen. Plötzlich sahen wir, als wir so im Walde versteckt lagen, wie aus der Höhlung eines Steinhaufens ein Mann nach dem anderen hervorkroch, etwa zweihundert, die sich dann fortschlichen. Ramos meinte, sie wollten die amerikanischen Matrosen in der Flanke angreifen. Wir waren zu schwach, um dies zu verhindern, uns kam es nur darauf an, Miß Lind zu befreien. Wo die Rebellen herauskamen, mußte ein Gang existieren, und den wollte Ramos benützen, um in die Ruine zu gelangen. Der Leutnant war ein tüchtiger Bursche, so jung er auch war, und wenn ich jemanden schlecht von ihm sprechen höre, der bekommt es mit Fritz zu tun. Ich habe vorhin geweint, als ich vor seiner Leiche stand, Gott habe ihn selig! Ein besseres und tapfereres Herz schlug selten in einer Brust. Er ließ uns noch einmal auf seinen Degen schwören, das Mädchen zu befreien oder zu sterben, und dann ging es in den Gang hinein. Nur ein Franzose und zwei Neger, die sich uns anschlossen, blieben zurück — um uns den Rücken zu decken, wie sie sagten.«
Sie hatten also den Gang benutzt, aus welchem jene Rebellen gekommen. Was er nicht gewagt, war ihnen gelungen.
»Wir gelangten ans Ende des Ganges, ohne aufgehalten zu werden. Nur einmal kam uns ein Weib in den Weg, welches aber floh, ohne Lärm zu schlagen.«
»Eine Indianerin?«
»Nein, eine weiße Dame.«
»Eine Gefangene?«
»Nein, das ist nicht gut möglich. Sie war sogar recht elegant angezogen.«
»Aha, ich weiß! Sonderbar!« murmelte Hoffmann.
»Wir erreichten das Freie gerade dort, wo das Karree gebildet werden sollte. Die Tapferkeit Ramos' war unwiderstehlich, und wir, nun wir taten eben auch unser Möglichstes. Das andere wißt Ihr, Kapitän, und ich denke, wir haben dem deutschen Namen keine Schande gemacht.«
»Ihr seid brave Burschen. Verlaß dich darauf, ihr sollt nicht umsonst wie Löwen gefochten haben.«
Da gellte ein Schrei durch die Ruine, so entsetzlich, daß alle zusammenschraken, daß sich selbst die Sterbenden aufzurichten versuchten. Es war ein Schrei, wie ihn nur ein Weib in höchster Verzweiflung auszustoßen vermag.
Alles eilte dorthin, woher er erklungen.
Man hatte Lord Harrlington aus einer Spalte herausgezogen, und über seinem Körper lag Ellen ausgestreckt, tränenlos, selbst einer Toten gleichend.

Mit Mühe gelang es, sie fortzubringen. Mit starren Augen sah sie der Untersuchung des Geliebten zu, man hatte einen Toten vor sich. Die Glieder waren starr und kalt. Leichenblässe bedeckte das Gesicht, das auch noch im Tode schön und ernst war.
Auf dem Rock erblickte man ein kleines Loch, von einer Revolverkugel herrührend; es saß gerade in der Herzgegend. Die Kugel schien die Wunde zu verstopfen, es floß kein Blut.
Der herbeigeholte Arzt schnitt Rock und Hemd auf.
In Ellens Gehirn begannen sich die Gedanken zu verwirren; eine andere Szene kam ihr in die Erinnerung, sie glaubte sich plötzlich nach Malakka versetzt.
»Der Indrargarri ist nicht tot,« flüsterte sie tonlos, »er ist nur scheintot. Wo ist Davids? Er hat es gesagt. Er braucht nur mit seinem Messer eine Ader zu öffnen, dann kommt Blut, und der Tote wird wieder lebendig.
»Wo ist Davids?«
»Armes Weib,« murmelte Williams, welcher dem Arzte half.
»Wo ist Davids?« wiederholte Ellen. »Nur er kann helfen. Sagt doch, wo ist John Davids?«
Der Arzt schnitt jetzt das Hemd Harrlingtons auf, er wunderte sich darüber, daß er noch kein Blut erblickte. Die Brust lag bloß. Bestürzt schauten der Arzt wie auch die Umstehenden auf dieselbe; es war keine Wunde zu sehen.
»Wo ist Davids?« murmelte das Mädchen wieder.
»Ein Wunder,« rief der Arzt plötzlich. »Die Kugel ist gefangen worden.«
Er hob ein goldenes Medaillon auf, welches zur Seite gerutscht war. Es war völlig breitgeschlagen und enthielt die Revolverkugel, als wäre diese in Gold gefaßt worden. Das Medaillon mußte direkt auf dem Herzen gelegen haben, denn dort erkannte man einen blauen Fleck.
»Er ist nicht tot?« fragte Williams atemlos.
»Fast scheint es so. Schnell! Die Herztätigkeit ist gelähmt worden. Lassen Sie uns ihn reiben, reiben, bis das Blut wieder durch die Haut kommt.«
Ellen hatte den Sinn dieser Worte begriffen, hatte verstanden, daß eine Rettung möglich war, und die Besinnung kehrte ihr wieder. Sie wollte mit helfen, folgte dann aber willig der Aufforderung, sich zurückzuziehen. Eine fieberhafte Tätigkeit herrschte um den Gelähmten, aber schon nach einigen Minuten war ihm das Leben zurückgekehrt, nach einer halben Stunde lag er in den Armen Ellens.
Von ihr erfuhr er, daß das Andenken von Davids, das Medaillon, die Kugel aufgefangen. So hatte Davids im Leben Ellen, und im Tode noch Harrlington gerettet. Sein Geist hatte schützend die Liebenden umschwebt.
Keiner der Engländer hatte den Sieg mit dem Leben bezahlt, nur Marquis Chaushilm schwebte am Rande des Grabes. Doch nach der Versicherung des Arztes war seine Lage keine hoffnungslose; bei guter Pflege konnte er vielleicht am Leben erhalten werden, wenn es Gott nicht anders gefiele.
Aber Verwundete gab es genug. Von den sechsundzwanzig Herren waren nur vier vollkommen unverletzt. Die übrigen hatten leichtere oder schwerere Wunden aufzuweisen. Bei einigen konnten Monate vergehen, ehe sie wiederhergestellt waren, sie konnten sich nicht selbst fortbewegen, sondern mußten getragen werden.
Nur einer hatte den Verlust von Gliedmaßen zu beklagen; eine Gewehrkugel hatte Lord Stevenson zwei Finger der linken Hand weggenommen.
Miß Chalmers war darüber trostlos, doch der Lord stillte ihre Tränen mit den Worten, er mache sich nichts daraus, wenn er den Verlobungsring am kleinen Finger trüge.
Desto schlimmer sah es unter den amerikanischen Matrosen und denen des ›Blitz‹ und der ›Hoffnung‹ aus. Als jene zurückkehrten, welche die versprengten Indianer verfolgt hatten, brachten sie einen skalplosen Trapper mit — sein Kopf war von einem Tomahawk zerschmettert worden. Charly, der Waldläufer, schwor bei der Leiche seines Freundes, von jetzt ab würde auch er Skalpe nicht mehr verschmähen, und er wollte nicht eher ruhen, als bis er ihn hundertfach gerächt haben würde. Er wolle nicht mehr Wild, sondern Indianer jagen.
Jene Gewölbe, in welchen einst die Trapper, die Herren und Damen Unterkunft gefunden, verwandelten sich in Lazarette, doch sie sollten nicht lange als solche dienen. Darüber sprach jetzt Hoffmann mit Kapitän Staunton.
»Eine meiner Besitzungen liegt nicht weit entfernt, etwa acht englische Meilen. Ich eile dorthin und sorge für genügende Transportmittel, damit alle Verwundeten dort Pflege finden. Ich nehme nur meinen Ingenieur und Miß Lind mit und kehre mit Wagen zurück, während Herr Anders den Bau von hölzernen Baracken leitet, groß genug, um alle verwundeten Soldaten aufzunehmen, die Ihrigen sowohl, als auch die Rebellen. Erst wollen wir sie pflegen, dann beratschlagen, was wir mit ihnen beginnen.«
»Und ich werde einstweilen die Toten bestatten lassen,« entgegnete Staunton.
Hoffmann bezeichnete die, deren Leichen er innerhalb zweier Tage abholen würde, und hatte dann mit Nick Sharp eine längere Unterredung, worauf sie sich von den übrigen entfernten.
Der Abend brach an. Die Dunkelheit senkte sich hernieder. Nur die amerikanischen Soldaten beschäftigten sich im Freien mit der Bestattung der Toten, alle anderen befanden sich in den Gewölben und richteten die Lager für die Verwundeten her. Die Damen übernahmen die Pflege der Engländer, die unverletzten halfen ihnen dabei im Lichte der Fackeln.
Hoffmann wollte die Reise nach seiner Besitzung mit dem nur wenig verwundeten, jungen Ingenieur erst am anderen Tage antreten. Früh sollte ein feierliches Massenbegräbnis stattfinden, und diesem wollte er noch beiwohnen.
Jetzt schritt er mit Nick Sharp einem Gewölbe zu, von dem sie wußten, daß es einen Zugang zu den unterirdischen Gängen der Ruine bildete. Beide trugen keine sichtbaren Waffen, hatten aber natürlich solche bei sich, ebenso Mittel, um sich Licht zu verschaffen.
Sie nahmen nämlich an, daß auch noch Leben im Innern der Ruine herrschte. Fritz hatte ja erzählt, die Eindringlinge seien einem Weibe begegnet, das vor ihnen geflohen sei.
Sie wollten also die Gänge, Gewölbe, Gemächer und so weiter untersuchen. Sie brauchten keinen Führer, sie hatten sich als Bären vollkommen über den unterirdischen Bau orientiert.
»Arahuaskar fehlt,« flüsterte Hoffmann, als sie den geheimen Zugang im Gewölbe mittels des Mechanismus' öffneten, »ebenso andere Indianer. Ich denke, wir werden noch Lebende finden.«
»Auch Miß Morgan und Flexan haben sich wieder blicken lassen,« entgegnete Sharp. »Sie könnten dem Unglücklichen eine Medizin geben, welche ihn von seinen Leiden befreit.«
»Ja, es wird die höchste Zeit, daß dieses Natterngezücht von der Erde verschwindet. Können sie auch nicht mehr viel schaden, so ist es doch besser, wenn sie nicht mehr leben, denn auch abgebrochene Giftzähne wachsen wieder nach.«
Sie schlüpften durch die engen Oeffnungen, schlossen dieselben wieder sorgfältig und bewegten sich ebenso vorsichtig in dem dunklen Gang wie damals, als sie das erstemal das Labyrinth betraten. Licht brauchten sie nicht, sie konnten schnell vorwärtsdringen, ohne auch nur irgendwo anzustoßen.
Das Knallen der Gewehre, das Schmettern der Trompeten, die Kommandos und das Hurra der stürmenden Matrosen, vermischt mit den Schmerzenslauten der Verwundeten, drangen nur schwach hinab in die unterirdischen Räume der Ruine, aber sie wurden doch von zwei Personen vernommen.
Man konnte sie nicht sehen, sie befanden sich in einem vollkommen dunklen Raum, aber man hörte ihre Unterhaltung. Die Stimmen gehörten Miß Morgan und Flexan an; die heisere, krächzende des letzteren war nicht zu verkennen.
»Unser Spiel wird bald aus sein,« ließ sich die Frauenstimme vernehmen, und ein Hohn lag darin, welcher die Wut verdecken sollte. »Immer deutlicher schlägt der verfluchte Yankee-Doodle an mein Ohr, immer lauter erklingen die feindlichen Hurras, und schon höre ich das Kommando Estrellas nicht mehr.«
»Desto lauter klingt das Hoffmanns,« krächzte Flexan. »Dieser Schurke, daß er mir entgangen ist! Sara, du hast mich betrogen, Hoffmann war gar nicht unter den Gefangenen Arahuaskars.«
»Doch, er war bei ihnen, aber nicht als Gefangener.«
»Warum belogst du mich?«
»Ich denke jetzt an etwas anderes, als daran, dich über diese Notlüge aufzuklären.«
»Woran denkst du?«
»Wie ich diese Engländer mit ihren Bräuten doch noch vernichten kann,« zischte das Weib.
»Sie sind jetzt auf dem besten Wege, die Rebellen samt uns zu vernichten,« lachte Flexan.
»Das letzte Kommando Estrellas war: ›Nach dem Plateau‹. Dort soll wahrscheinlich das Karree gebildet werden, welches die gefangenen Mädchen aufnimmt. So war Estrellas Plan. Doch seine Stimme höre ich nicht mehr.«
»Er wird gefallen sein.«
»Dann haben die Rebellen wenig Aussicht auf Sieg.«
»Kannst du dich nicht überzeugen, wie ihre Sache steht?« fragte Flexan.
»Ich würde nichts Erfreuliches zu sehen bekommen.«
»Doch! Die Engländer sind nicht gegen Kugeln gefeit, und vielleicht schonen die Stürmenden auch nicht die Gefangenen, vielleicht beschießen sie doch das Karree.«
»Gut, ich gehe.«
»Bleibe nicht lange.«
Man hörte, wie eine Tür geöffnet ward. Miß Morgan verließ den Raum, um von einem Mauerloch aus den Kampfplatz zu überschauen.
Flexan brauchte nicht lange auf die Freundin zu warten, schon nach wenigen Minuten kam sie zurück.
»Nun, schon wieder da?«
Sara antwortete nicht, Flexan hörte ihren fliegenden Atem.
»Du bist außer dir! Hast du Schlimmes gesehen?«
»Nichts habe ich gesehen,« keuchte das Weib endlich, »aber den Feinden wäre ich bald in die Hände gelaufen.«
»Nicht möglich! Sie sind im Innern der Ruine?«
»Es scheint so. Sie haben wahrscheinlich einen unterirdischen Gang gefunden, der sie mitten unter die Rebellen bringt. Hahaha, jetzt sind diese verloren. Jener Gang führt gerade auf das Plateau, wo das Karree gebildet werden soll.«
»Bist du gesehen worden?«
»Ich weiß nicht.«
»Schwerlich! Sonst hatten sie dich verfolgt.«
»Unsinn, was kümmern sich diese Männer um ein Weib! Das Karree wollen sie sprengen und die Gefangenen befreien.«
»Aber Sara!« rief Flexan fast laut. »Warum hast du denn nicht Lärm geschlagen und die Rebellen auf die ihnen drohende Gefahr aufmerksam gemacht?«
»Was kümmern mich die Empörer!«
»Aber die Gefangenen können befreit werden. In den Gängen hätten die Angreifer leicht unschädlich gemacht werden können. Du hättest den Ueberfall unbedingt verraten sollen. Geh schnell und tue es, vielleicht ist es noch Zeit.«
»Daß ich eine Närrin wäre!« höhnte Miß Morgan. »Die Rebellen mögen die Suppe, die sie sich selbst einbrockten, allein auslöffeln, ich diene ihnen nicht mehr. Mögen sie besiegt werden.«
»Wo bleibt dann unsere Rache?«
»Die bleibt uns überlassen. Mir ist jetzt die Hauptsache, daß ich hier versteckt bin. Nach der Schlacht wird die Aufregung eine sehr große sein, den siegestrunkenen Engländern, den wonnetaumelnden Damen ist dann leicht beizukommen.«
»Aber wie?«
»Laß nur, ich habe meine Pläne.«
»Ich möchte sie wissen.«
»Du sollst sie noch erfahren. Der Tod soll die Liebenden ereilen, wenn sie einander in den Armen liegen.«
Draußen entstand ein furchtbares Getümmel, die Gewehre schwiegen, nur Revolver knallten noch ab und zu, und Waffen klirrten gegeneinander.
»Das Karree ist nicht gebildet worden, oder es ist gesprengt, noch ehe es feuern konnte. Hörst du das verzweifelte Stöhnen, Flexan? Es ist der Todesschrei der Rebellen!«
»Du meinst, sie sind besiegt?«
»Ich meine, sie werden vernichtet.«
»Pardon, pardon!« vernahmen die beiden zwischen den Siegesrufen der Amerikaner.
»Keinen Pardon, nieder mit den Rebellen,« hörten sie Kapitän Stauntons Stimme den Tumult übertönen. Kolben schmetterten, Degen rasselten, gellende Hilferufe erschollen und brachen kurz ab — es gab keinen Pardon.
»Besiegt, verloren!« stöhnte Flexan.
»Hörst du, das ist Ellens Stimme,« zischte Sara. »Wie sie sich freut. Sie fragt nach Lord Harrlington, sie schreit — aha, Harrlington fehlt unter den Siegern — noch mehrere — ja, ja, der Krieg kostet Menschen, er verschont auch den Geliebten nicht — Gebete halfen nur früher — Hoffmann tröstet —«
»Verdammter Schurke, er lebt also noch.«
»Hope Staunton schreit,« fuhr die lauschende Sara fort, »aha, ihr geliebter Hannes fehlt, nein, da ist er — hahaha, er hat eine Kugel ins Ohr bekommen — armer Hannes, wie Hope um deine verlorene Schönheit trauert!«
So ging es fort. Die beiden im Keller vernahmen jeden Ruf der Freude und der Klage.
»Hah, das ist Nick Sharps Stimme,« rief das Weib plötzlich. »Er ruft seinen Bruder, den Reporter. Wehe uns, Flexan, wenn er daran denkt, uns zu suchen! Wir müssen eilen, wollen wir einen Racheakt herbeiführen. Ich fürchte diesen Detektiven mehr als alle anderen zusammen, er ist mit dem Teufel im Bunde.«
Sie verbrachten einige Stunden in ungeduldigem Warten, bis Sara die Zeit der Dämmerung für gekommen hielt. Sie verließ ihr sicheres Versteck, um draußen zu spionieren, und kehrte mit der Nachricht zurück, daß die Verwundeten in Gewölben untergebracht lägen, und daß die Damen bei ihnen wären.
Sie konnte dem knirschenden Flexan auch von der Wiederbelebung Lord Harrlingtons erzählen, sie hatte ein Gespräch belauscht, ja, den Lord sogar in den Armen Ellens gesehen und beider Küsse gehört.
»Und unsere Rache!« stöhnte Flexan.
»Sie kommt,« entgegnete Sara triumphierend.
»Willst du einen nach dem anderen mit dem Revolver erschießen?«
»Nein.«
»Was sonst?«
»Nicht einen nach dem anderen, sondern alle gleichzeitig.«
»Das wäre ein Kunststück.«
»Welches mir gelingen soll. Habe ich auch nicht die Wollust, sie langsam unter tausend Qualen sterben zu sehen, wie es mein Wunsch war, der Tod aller soll mich auch schon befriedigen.«
»Willst du sie zum Duell fordern?« höhnte Flexan.
»Ich habe einen Plan, der sicher ist.«
»Ich will ihn hören. Ich dürste ebenso nach Rache, wie du.«
»So höre! Die Gewölbe, in dem sich jetzt fast alle befinden, liegen gerade über den Räumen, in welchen früher die Bären hausten. Kennst du sie?«
»Ich kenne die Bärenzwinger.«
»Gut, dorthinein müssen wir und —«
»Aber die Bären?«
»Die sind in alle Winde zerstoben. Sie sind in den Wald geflohen, ich weiß, daß einige von ihnen durch Indianer erlegt worden sind.«
»Und wo ist Arahuaskar?«
»Wer weiß, wo sich dieser versteckt halt. Doch das hat hiermit nichts zu tun.«
»Richtig, die Bärenzwinger, welche unter den Gewölben liegen! Von dort aus willst du deinen Feinden beikommen?«
»Ja. Unter der nicht weit von hier liegenden Munition Estrellas befindet sich auch ein großes Faß mit Pulver, weil viele der Rebellen mit Vorderladern bewaffnet waren.«
»Ah, ich verstehe.«
»Es ist fast noch voll. Dieses wälzen wir in die Bärenzwinger und lassen die Gewölbe in die Luft fliegen.«
»Vortrefflich. Sollen wir losen, wer von uns mit in die Luft gesprengt wird?«
»Es ist nicht nötig, ich habe Zündschnur und Feuerzeug für alle Fälle stets bei mir.«
»Dann bin ich mit dem Plane einverstanden, und fürwahr, die Stunde der Vergeltung ist endlich gekommen,« triumphierte Flexan. »Sind wirklich alle in den Gewölben versammelt?«
»Alle, deren Tod wir wünschen. Wir wollen noch etwas warten, bis es dunkler ist, denn wir müssen einen vom Tageslicht beschienenen Gang passieren!«
Nach einer Stunde erklärte Sara, daß es jetzt Zeit sei.
»Du mußt mir helfen, das Faß zu transportieren, es ist eine Treppe hinauf- und eine hinunterzurollen. Wenn zwei dabei sind, kann besser jedes Geräusch vermieden werden.«
»Du fürchtest Beobachter?«
»Man kann nicht wissen. Haben wir den Gang erreicht, der an dem Bärenzwinger vorbeiführt, werde ich das Faß allein weiterrollen.«
»Und wo bleibe ich?«
»Du begibst dich an jenen Ausgang der Ruine, welcher dem krummgewachsenen Eichbaum gegenüberliegt.«
»Ich kenne ihn.«
»Dort erwartest du mich.«
»Aber komme, bevor das Pulver explodiert.«
»Ich werde wohl nicht so lange warten. Die Zündschnur glimmt eine gute Viertelstunde.«
»Und wenn ich von dem Eingange verscheucht werden sollte, wohin nehme ich meine Zuflucht dann?« fragte der sehr vorsichtig gewordene Flexan weiter.
»Dann nimmst du denselben Weg, den die geflohenen Indianer genommen haben, verbindest dich mit ihnen und wartest, bis auch ich zu ihnen treffe.«
»Dieser Vorschlag gefällt mir nicht, mit Indianern ist nicht gut Kirschen essen.«
»Du bist aber sicher bei ihnen, weil sie dich deines Aussehens wegen fürchten.«
»Nun gut, ich werde zu ihnen gehen, solltest du mich nicht am Ausgange finden.«
Sie schlichen hinaus und begaben sich nach jenem Ort, wo die Rebellen ihre Munition und sonstige Vorräte aufgestapelt hatten. Es fehlte den siegreichen Matrosen vorläufig noch an Zeit, darnach zu suchen.
Miß Morgan brauchte kein Licht, sie führte Flexan dorthin, wo das zwar große, doch nicht besonders schwere Pulverfaß stand, und beiden gelang es, dasselbe von den anderen Fässern herunterzuheben. Dann wurde es weitergerollt.
Wie Sara gesagt hatte, mußten sie eine Treppe hinauf, eine andere hinunter. Sie gaben sich die möglichste Mühe, jedes verräterische Geräusch zu vermeiden, doch ganz gelang ihnen dies nicht.
Sie unterhielten sich während ihrer Arbeit nur flüsternd; hatten aber natürlich keine Ahnung, daß ihr Gespräch belauscht wurde.
»Der Inhalt dieses Fasses wird genügen, die ganze Ruine in die Luft zu sprengen,« meinte Flexan.
»Das hat nichts zu sagen.«
»Arahuaskar soll hier Schätze verborgen haben.«
»Wenn dem so ist, so wird auch der sogenannte alte Vater, dieser verräterische Schurke, das Versteck kennen und die Schätze ans Tageslicht bringen.«
»Wenn das Gemäuer nicht schon vorher zerfällt.«
»Dann werden die Schätze verschüttet, und vielleicht haben wir später das Glück, sie zu finden.«
»Ich werde nicht nach ihnen suchen,« knurrte Flexan.
»Weil du ihrer nicht bedarfst?« fragte das Weib lauernd.
»Mache dir keine Hoffnung, eher etwas von mir zu bekommen, als bis meine Rache gekühlt ist.«
Sara bückte sich zum Fasse hinab.
»In einer Viertelstunde soll dies der Fall sein. Und dann?«
»Dann setze ich dich zu meiner Erbin ein.«
»Wer garantiert mir dafür?«
»Sara, nimm Vernunft an! Ich habe niemanden mehr auf der Welt als dich, selbst mein Kind habe ich verspielt. Ich verlange auch gar nicht mehr nach ihm. Nur du hast dich meiner noch angenommen, und das soll dir vergolten werden.«
»Gut, daß, du es einsiehst,« murmelte Miß Morgan.
Hätten die beiden geahnt, daß hinter ihnen wie Katzen zwei Männer schlichen, Hoffmann und Nick Sharp, bereit, eine neue Freveltat zu verhindern!
Sie sprachen nicht, flüsterten nicht zusammen, ja, der Detektiv schlich sogar mit geschlossenen Augen vorwärts, weil diese die Eigenschaft besaßen, im Dunklen zu leuchten. Manchmal war dies sehr vorteilhaft für ihn, weil er somit befähigt war, auch im Finstern einigermaßen zu sehen, jetzt aber konnten sie zu Verrätern an ihm werden.
Lieber sah er gar nicht, er schloß die Augen, tastete sich vorwärts und hielt sich an Hoffmann.
Jetzt hatten die mit dem Faß Beschäftigten den Gang erreicht, der nach dem Bärenzwinger führte.
»Findest du dich von hier aus zu dem geheimen Ausgang?« fragte Miß Morgan.
»Ja, ich bin hier schon wie zu Hause.«
»Du kannst gleich rechts abbiegen.«
»Den Weg kenne ich allerdings nicht, ich finde mich nur, wenn ich zurückgehe.«
»So kehre so schnell wie möglich zurück und warte auf mich, in zehn Minuten bin ich bei dir.«
Der Mund des Detektiven berührte Hoffmanns Ohr.
»Fassen wir ihn?«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Der kleinste Laut, schon das Aufhören seiner Schritte kann uns verraten.«
» All right. Fangen wir das Weib?«
»Ja, doch jetzt noch nicht.«
»Es wäre aber besser, wenn wir es täten.«
»Nein. Um ihre Rache zu befriedigen, schont sie ihr eigenes Leben nicht. Sie könnte ins Faß schießen.«
Flexan kam näher.
»Schnell neben der Wand auf den Boden!«
Geräuschlos sanken die beiden Männer zusammen.
Jetzt hatte Flexan sie erreicht.
Der Gang war breit, aber der Vertraute Miß Morgans mußte sich jedenfalls an der Wand forttasten, denn er trat auf den Detektiven.
»Halloh, was ist das?«
»Was gibts?« rief Sara leise.
»Hier liegt ein Mensch.«
»Nicht möglich!«
»Doch! Aber sei ruhig, er ist tot. Ich habe ihm ein paarmal mit aller Wucht auf die Hand getreten, er rührt sich nicht.«
»Es wird ein Indianer sein, der hier verreckt ist. Gehe weiter!«
Hoffmann und Sharp trafen sich wieder, als die Schritte verhallt waren.
»Hat er Sie wirklich auf die Hand getreten?« flüsterte, nein, hauchte Hoffmann dem Begleiter zu.
»Ja,« murrte der Detektiv. »Begegne ich ihm wieder, so werde ich ihm auf die Gurgel treten, bis er keine Luft mehr bekommt.«
Miß Morgan hatte das Faß weitergerollt und war dann stehen geblieben. Sie mußte die Wand erreicht haben.
»Ich bin am Ziel, hier sind die Bärenzwinger,« murmelte sie, daß ihre Worte eben noch für die seinen Ohren der Nachschleichenden hörbar waren, »ich gehe in den ersten besten Raum, die Gewölbe liegen oben, und das Pulver reicht hin, um alles in Trümmer zu legen.«
Ein Kratzen verriet, daß sie an der Wand nach dem Mechanismus suchte; doch sie hielt noch einmal an.
»Was war das? Klang das nicht wie leises Stöhnen? Torheit, ich fürchte mich nicht vor Gespenstern. Meine Nerven sind nur äußerst erregt und täuschen mir diese Töne vor.
Sie horchte wieder.
»Es ist alles ruhig.«
Es ward ein Knacken hörbar. Der Mechanismus bewegte sich, die Wand schob sich zurück, und — ein furchtbares Wehgeschrei gellte durch den dunklen Gang, dem ein dumpfes Knurren folgte.
Sharp packte Hoffmanns Arm.
»Ein Bär,« flüsterte er, den Revolver ziehend.
»Das war kein Bär, das war das Fauchen einer Katze.«
»Denken Sie an die Waffe!«
»Ich habe keine nötig. Seien Sie ruhig, wir brauchen kein Raubtier zu fürchten.«
Schauerlich erklang das Stöhnen des Weibes, dann wieder das drohende Knurren. Da flammte ein Licht auf, der Ingenieur hielt eine Glühlampe in der Hand, und das Bild, welches sie beleuchtete, war wirklich entsetzlich.
Miß Morgan lag am Boden, und auf ihrem blutenden Körper stand eine Löwin, das Maul schon von Blut gerötet und mit den Augen gegen das elektrische Licht blinzelnd.
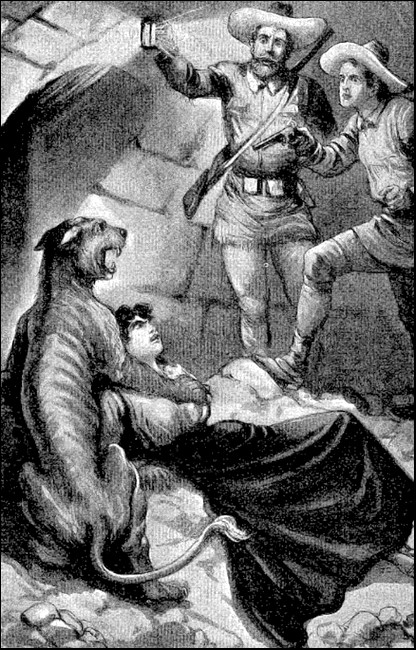
Miß Morgan lag am Boden, und auf ihrem
blutenden Körper stand Juno, Miß Ellens Löwin.
Das Tier war furchtbar abgemagert, es bestand nur noch aus Haut und Knochen, das Fell war struppig, und die Augen funkelten in unzähmbarer Wildheit.
Es war Juno. Sie mochte schon lange hier eingeschlossen gewesen sein, und im Drange der letzten Ereignisse war das Tier vergessen worden. Nach langer Hungerzeit war das verbrecherische Weib seine erste Beute, es war verloren.
Hoffmann wollte vorwärts, doch der Detektiv hielt ihn am Arm zurück
»Hier waltet die Nemesis,« sagte er, »wir wollen ihr nicht entgegentreten, es wäre Sünde.«
»Miß Morgan lebt noch,« sagte Hoffmann erschüttert.
Bisher hatte das Weib nur leise gestöhnt. Es war nicht tödlich verwundet; noch hatte Juno ihr Opfer geschont. Die starke Natur Miß Morgans ließ eine Ohnmacht nicht zu, sie war sich ihrer gefährlichen Situation bewußt.
Sie erkannte die beiden Männer.
»Hilfe, Hilfe,« schrie sie, »um Gottes Barmherzigkeit, helft mir, und ich will ...«
Die Löwin mochte fürchten, das Opfer könnte ihr entgehen. Ein wütender Biß in die Kehle der am Boden Liegenden war die Folge ihres Schreiens, dann riß Juno ein Stück Fleisch nach dem anderen von dem zuckenden Körper und schlang es gierig hinter.
»Zu spät!« murmelte Hoffmann.
»Juno hat gerichtet, ich bedaure das Weib nicht.«
Die Löwin wurde wieder mißtrauisch, sie unterbrach ihr greuliches Mahl und betrachtete die beiden Männer.
»Dem Tier ist nicht mehr zu trauen,« meinte Sharp, »es kennt die Menschen nicht mehr. Es kann selbst uns gefährlich werden.«
Er hob den Revolver.
»Es ist die Löwin von Miß Petersen.«
»Sie ist es, doch sie ist in ihre Wildheit zurückgefallen. Lieber schieße ich sie tot, als daß ich mich von ihr fressen lasse.«
»Ich kann sie schneller töten, als Sie es vermögen.«
»Bitte, überlassen Sie mir den Schuß, ich möchte einmal einen Löwen mit dem Revolver töten. Sollte er doch noch springen, dann empfangen Sie ihn nach Ihrer Weise.«
»Denken Sie an das Pulverfaß.«
»Bah, das liegt ja ganz links.«
Der Detektiv hob den Revolver und drückte los, ohne anscheinend gezielt zu haben. Doch sein Revolver fehlte nie, die Kugel drang ins Auge der Löwin, und ohne nur einen Laut auszustoßen, stürzte dieselbe tot zusammen.
Die Männer eilten vorwärts.
Miß Morgan war tot. Des Tieres Gebiß hatte sie schon furchtbar zugerichtet; die linke Seite war zerfetzt, der dazugehörige Arm vom Rumpf gerissen.
»So, wieder eine Schandtat vereitelt!« meinte Sharp, der keine Gewissensbisse zeigte, weil er nicht früher geschossen. »Sie wird kein Pulverfaß mehr explodieren lassen.«
Hoffmann untersuchte den Zwinger.
»Hier liegen Knochen, sie sind teils zermalmt. Also hat Juno nicht immer hungern müssen.«
»Menschenknochen?«
»Nein, solche von Hunden.«
»Aber Hunde gab es ja gar nicht hier.«
»Doch, einen. Lizzard, die Dogge von Stahlherz, wurde hier gefangen gehalten. Anscheinend sind Lizzard und Juno hier zusammengesperrt worden, und die stärkere Juno hat Lizzard aufgefressen. Schade um das brave Tier!«
Sharp hob den Kopf und sog aufmerksam die Luft ein.
»Riecht das hier nicht sonderbar?«
»Es riecht nach Raubtieren. Doch ja, wahrhaftig, das riecht bald nach jenem Fett, mit dem sich Arahuaskar einrieb.«
Die Lampe leuchtete umher, doch sie beschien nichts Auffälliges, bis Sharp endlich in Kopfeshöhe eine Art von Wandschrank entdeckte. Als er ihn nach einigen Versuchen geöffnet, erblickten sie darin eine Mumie, aber schon der zweite Blick belehrte sie, daß sie keine tausendjährige Mumie, sondern den noch ziemlich frischen Körper Arahnaskars vor sich hatten.
Der phantastisch angelegte Indianer hatte sich hier, als er sein Ende nahen fühlte, selbst eingeschlossen. Das Scheitern aller seiner Pläne konnte er nicht überwinden.
Nach versteckten Schätzen wurde vergeblich gesucht, und die beiden verschoben eine gründliche Untersuchung auf später, denn Flexan fiel ihnen ein, den sie auch noch dingfest machen konnten.
Sie eilten die Gänge zurück, erreichten den beschriebenen Ausgang, fanden aber Flexan dort nicht vor.
Die Nacht war dunkel, und in der Ferne leuchteten Fackeln. Es kamen befreundete Indianer an, ein eigentümliches, wehklagendes Summen ertönte von ihren Lippen.
Der Ingenieur eilte den Indianern entgegen, sie erkannten Deadly Dash und hielten ehrfurchtsvoll still. Auf seine Frage sagten sie aus, sie hätten allerdings einen Mann von dem beschriebenen Aussehen dahin laufen sehen, woher sie kamen. Sie hinderten ihn nicht an der Flucht, denn er sei vom bösen Geist besessen gewesen.
So war Flexan doch durch etwas mißtrauisch gemacht geworden und hatte sich entfernt.
»Wir wollen ihn vorläufig laufen lassen,« meinte Sharp, »seinem Schicksal entgeht er doch nicht.«
Ein junger Indianer trat zu Hoffmann — es war Sonnenstrahl — und führte ihn nach der Mitte des Zuges, wo auf einer Bahre ein verhüllter Körper lag.
Sonnenstrahl schlug die Decke zurück, die Leiche Stahlherz' ward sichtbar.
Hoffmann ergriff die kalte Hand des Toten. Mitleid war nicht nötig, die Indianer bedauern den Kameraden nicht, der auf dem Kampfplatz fällt.
»Er ist eines ehrenvollen Todes gestorben.«
»Ja, und die Feinde haben nicht gewagt, einem Apalachen den Skalp zu nehmen.«
»Er wird in den ewigen Jagdgefilden ein Häuptling über viele Häuptlinge werden,« sagte Adlerfeder.
Hoffmann reichte Sonnenstrahl die Hand.
»Bleibet hier, du und deine Schwester, bis ich wiederkomme. Dann hole ich euch und halte das Versprechen, das ich deinem Vater gab.«
»Ich kenne es. Ich und Waldblüte werden warten.«
Der Zug setzte sich wieder in Bewegung, der Leichnam des Apalachen sollte nach der geheimen Sitte einiger Indianerstämme bei Nacht begraben werden.
Hoffmann und Sharp begaben sich in die Gewölbe zurück, erzählten aber das Erlebte noch nicht, auch nicht die furchtbar drohende Gefahr, der die Freunde entgangen waren. Der Tag hatte schon schreckliche Ereignisse genug gebracht.
Little Rock liegt am Arkansas im gleichnamigen Staate, welcher an Texas grenzt. Es ist ein blühendes Städtchen, stetig im Wachsen begriffen, und nicht lange wird es dauern, so gehören alle kleinen Ortschaften, Dörfer, Ansiedelungen und so weiter, welche sich allerdings auch schon Städte nennen, zu Little Rock.
Bekanntlich belegen sich in Amerika schon drei zusammenstehende Häuser mit dem stolzen Namen › town‹, das heißt Stadt, und so unrecht ist das nicht. Ein Haus enthält die Wirtsstube, im zweiten wohnt der Sheriff, das heißt der Richter, und im dritten der Ortsvorsteher, eingesetzt von Gottes Gnaden.
Solcher › towns‹ liegen gar viele am Arkansas, stromauf und stromab von Little Rock, bis sie, wie gesagt, einst von der wachsenden Stadt verschlungen werden. Doch jetzt befinden sie sich noch in einer Art Urzustand. Es geht wirklich sehr gemütlich zu in solch einer › town‹, und da die Schenkstube das eigentliche Zentrum bildet, den Versammlungsort der nicht arbeitenden Männer, die Ratsstube, den Gerichtssaal und was sonst noch, so verlohnt es sich wohl, einmal in eine solche einzutreten.
Diese › town‹ trägt den Namen San Francisco, nicht zu verwechseln mit der Hauptstadt Kaliforniens. Er war ihr gegeben worden, als ein Mann in ihrer Nähe eine Goldmine entdeckte, worauf die neun Einwohner beschlossen, der kalifornischen Goldstadt Konkurrenz zu machen.
Die Mine war freilich bereits am ersten Tage erschöpft, die Stadt, aus vier Häusern bestehend, behielt aber den Namen San Franzisko weiter, ebenso wie das Schenkhaus den Namen ›zur Goldhütte‹.
Die Einwohner lebten hauptsächlich vom Holzverkauf an die anlegenden Dampfer, wodurch auch der Besitzer der ›Goldhütte‹, ein Ehrenmann, der wegen mehrfacher Körperverletzung fünf Jahre Zuchthaus hinter sich hatte, gute Einnahmen hatte.
Der Richter hieß Bill und schoß in seiner Freizeit, die sich von früh bis abends und von abends bis früh erstreckte, im Walde Wölfe, für welche er in Little Rock Prämiengeld erhielt, einen Dollar für jeden Schwanz.
Das derart erworbene Geld setzte er in der ›Goldhütte‹ in Spirituosen um.
Dick war der Name des Ortsvorstehers. Er fällte Holz, lieber aber saß er in der ›Goldhütte‹ und leistete seinem Freunde Bill Gesellschaft. Er mußte doch dafür sorgen, daß alle seine Schutzbefohlenen zu Wohlstand kamen.
Außerdem wurde die Stadt noch von einem anderen Holzfäller bewohnt, dessen Name der Nachwelt nicht überliefert worden ist. Die übrige Bevölkerung bestand aus Weibern und Kindern.
Die ›Goldhütte‹ war ein sehr schönes Lokal. Es bildete den zweiten Raum des Holzhauses, der erste wurde vom Wirt und Familie, darunter auch eine Ziege, als Wohnzimmer benutzt.
Im Schenkzimmer stand ein Tisch, ein wirklicher, wahrhaftiger Tisch mit vier Beinen, der sogar einmal poliert gewesen war. Er war angeschwemmt worden und diente jetzt als Bar, Likörflaschen und Gläser standen darauf und hatten die Politur weggenommen. Als Trinktisch diente ein Brett, welches auf vier Fässern lag, und andere Fässer vertraten die fehlenden Stühle.
Der Wirt hatte aus Eisenblechen kunstvoll eine Art Kamin gebaut, in dem ein Feuer brannte, weil es Zeit zum Mittagessen war. Eine ganz nette, junge Frau hantierte mit rußigen Pfannen umher, ohne den Säugling vom Arm zu lassen, während ein dreijähriges Mädchen sich am Rocke der Mutter festhielt und sich überall mit hinschleifen ließ. Es hatte viel Aehnlichkeit mit der Mutter, oder bester gesagt, es war ebenso rußig wie diese.
Von der Decke herabhängende Schinken vervollständigten das Inventar der ›Goldhütte‹. Zu erwähnen ist höchstens noch das aus einer Zeitung geschnittene Porträt des derzeitigen Präsidenten der Vereinigten Staaten an der Wand, daneben ein buntes Bild, die Vertreibung Adams und Evas aus dem Paradies — wunderbarerweise hatte der Maler der Eva ein Kind auf den Arm gegeben — und dazwischen eine Kugelbüchse.
In der ›Goldhütte‹ wurde wacker gezecht.
Bill, Dick und der Wirt saßen auf Fässern am Tisch und füllten sich die Gläser aus der Whiskyflasche. Bill, der Richter, war gestern in Little Rock gewesen, wo er zwanzig Wolfsfelle verkauft hatte. Zwanzig Dollar erhielt er Prämie, achtzig für die Bälge, und nun versuchte er seit heute morgen, die hundert Dollar so schnell wie möglich durchzubringen, wobei ihm seine Freunde halfen.
Der Wirt hatte dabei keinen großen Verdienst, Spirituosen wurden hier zum Selbstkostenpreis verschenkt, wenigstens für die Bewohner der Stadt.
Daß es so gut nach Schinken, Speck, Kartoffeln und ranziger Butter roch, daran war ebenfalls Bill schuld. Heute war ihm nichts zu teuer, hatte er schon hundertmal geschworen und dabei mit der Faust stets auf den Tisch geschlagen, daß die Gläser und Flaschen Luftsprünge machten.
Auch Tabak hatte Bill mitgebracht, besonders guten, saftigen Priemtabak, die Unze zu zehn Cents, und der Wirt war wahrlich nicht dumm gewesen, als er heute Wasserstiefel angezogen hatte. Er mußte viel hin- und hergehen, und ohne Wasserstiefel hätte er sich leicht nasse Füße holen können — auf solch schauderhafte Weise spuckten die priemenden Männer. Sie spuckten, wie es eben nur ein amerikanischer Hinterwäldler kann. Der Stubenboden war eine einzige, große Pfütze. Selbst Matrosen, welche doch auch mit Vorliebe nach jedem Worte, das sie gesprochen, einen kleinen Teich vor sich hinsetzen, werden von diesen Leuten bei weitem übertroffen.
Das Gespräch drehte sich hauptsächlich um die bald bevorstehende Präsidentenwahl. Ortsvorsteher, Richter und Wirt waren sich vollkommen bewußt, welchen Einfluß ihre Stimmen dabei ausüben mußten.
»Battleford, Ihr kennt doch Battleford,« nahm der Richter eben das Wort, »nun, Battleford sagte auch zu mir: Bill, sagte er, wählt Corner, oder verdammt sollt ihr sein, wenn ihr nicht Battleford wählt. Und Gott mache mich blind, wenn ich nicht Corner wähle!«
Bill stürzte ein Glas Branntwein hinab.
»Corner hatte früher einen Schnapsladen,« sagte der Wirt.
»Ja, und den Preisboxer vom vorigen Jahre, den Nigger, hat er auch zu Boden geschlagen.
»Und nach Beendigung des Sezessionskrieges hat er mit seinem eigenen Hause ein Freudenfeuer abgebrannt.«
»Ein Teufelskerl, der Corner, den nehmen wir.«
Dies war beschlossen, als das Gespräch eine andere Wendung bekam. Ein Mann trat herein, wie ein Jäger gekleidet, in hohen Stiefeln, mit ledernem Hemd und Hose und einer Mütze aus Fuchspelz. Unter dem Arm trug er eine kurze Doppelbüchse.
Er war schlank und mittelgroß, kräftig gewachsen und sein Gesicht verbrannt. Man konnte ihm ansehen, hauptsächlich seinen Stiefeln, daß er eine lange Fußwanderung hinter sich hatte.
Alle Köpfe wandten sich nach ihm um — es war ein Fremder.
» Good morning, gentlemen!« sagte er. »Wann legt das nächste Passagierboot hier an?«
Der Wirt hielt es für seine Pflicht, zu antworten, tat es aber nur sehr unvollkommen.
»Weiß nicht, Fremder.«
»Seid Ihr der Wirt?«
»Der bin ich.«
»Dann müßt Ihr das doch auch wissen.«
Der Wirt war guter Laune.
»Ich kann's Euch wahrhaftig nicht sagen. Die Boote legen hier nur an, wenn sie Holz brauchen.«
Der Fremde stieß einen Fluch aus.
»So hat man mich in Little Rock belogen.«
»Die lügen, wenn sie nur den Mund auftun.«
»Aber Passagiere werden ausgesetzt?«
»Natürlich, auch aufgenommen. Ich brauche nur einen Lappen auf mein Haus zu stecken, dann setzen sie ein Boot aus. Wollt Ihr mitfahren, Fremder?«
»Nein.«
»Erwartet Ihr jemanden hier?«
»Nein.«
»Hm, Ihr seid kurz angebunden, Fremder,« brummte der Wirt, war aber durchaus nicht unwillig.
In Amerika ist es nun einmal nicht Sitte, einen Fremden auszufragen, will man nicht riskieren, eine ungenügende oder auch gar keine Antwort zu erhalten. Man darf darüber nicht verstimmt sein. Eine sehr schöne Sitte.
Aber es gibt ein Mittel, den Fremden zur Rede zu zwingen, indem man nämlich mit ihm trinkt.
In Amerika spielt die Schenkstube eine wichtige Rolle. Dort werden Geschäfte abgeschlossen, Leute ausbezahlt und angenommen, Kontrakte aufgesetzt und so weiter, kurz, ein ›Schluck‹ muß immer dabei sein, der ist so gut wie der Stempel.
Zwei Leute, die zusammen ein Glas getrunken haben, sind einander nicht mehr fremd, wenn sie sich auch gewohnheitsmäßig noch › strangers‹ nennen.
Der Eingetretene hatte die Büchse an die Wand gelehnt und ohne weiteres auf einem Fasse Platz genommen.
»Wirt, ein Glas Whisky ohne Wasser mit Pfefferminz.«
Jetzt hielt Bill die Zeit für gekommen, das Wort zu nehmen. Der Fremde gefiel ihm.
»Trinkt Ihr ein Glas mit mir?«
» All right.«
Das Glas stand gefüllt vor ihm.
»Ihr kommt weit her, kalkuliere ich.«
»Ja, so ziemlich.«
»Wollt mit dem Schiff fort?«
»Nein.«
»Zu Fuß weiter?«
»Ja, später.«
»Ihr bleibt heute hier?«
»Bis ich mich ausgeruht habe.«
Eine lange Pause erfolgte, jeder beschäftigte sich mit seinem Tabak in der Backe, bis Bill energisch ausspuckte und sagte:
»Ihr seid ein Jäger, was?«
»Ja.«
»Gibt hier nicht mehr viele.«
»Dann gehe ich weiter. Ihr seid auch Jäger?«
»Ja, woran seht Ihr das?«
»An Eurem scharfen Blicke.«
Der Wolfsjäger fühlte sich geschmeichelt. Schon wollte er eine Antwort geben, als der Fremde fortfuhr:
»Ihr habt ein Auge, wie so ein richtiger Sheriff, es dringt einem bis in die Seele.«
Bill schlug donnernd aus den Tisch.
»Gott verdamm' mich, Fremder, ich glaub', Ihr kennt mich.«
»Wie soll ich? Ich bin hier fremd.«
»Ich will's Euch sagen, ich bin wirklich Sheriff, einstimmig gewählter Sheriff von San Francisco in Arkansas.«
»Seht Ihr, ich habe mich nicht getäuscht.«
»Ruhe,« rief da der Wirt, »ein Dampfer kommt!«
Nicht weit von der Ansiedlung, von Bäumen verborgen, floß der Arkansas. Jetzt hörte man ein Rauschen, von den Rädern eines Dampfers herrührend.
»Er fährt nahe am Ufer,« meinte Dick, »vielleicht will er Holz einnehmen.«
»Laßt ihn erst pfeifen!«
Da ertönten schon zwei Pfiffe aus der Dampfpfeife.
»Hurra, er setzt Passagiere ab!« schrie der Wirt und sprang hinaus, um etwa nötig werdende Hilfe zu leisten, während die übrigen ans Fenster traten, auch der Fremde.
Einen schmalen Wasserstreifen des Stromes konnte man sehen, auch noch den Holzbau, an welchem die Dampfer und Boote anlegten, weil das Ufer seicht war. Eben tanzte ein Boot, von vier Rudern getrieben, über die Wasserfläche, ein Passagier saß darin.
»Das ist mal ein Kerlchen,« sagte Dick.
»Ja, er sieht wie ein Zwerg aus, einen Hals hat er gar nicht.«
Das Boot machte eine Wendung, um anlegen zu können.

»Aber dafür einen Buckel.«
»Ah, einen Buckel!« rief Bill. »Ist das große Ding auf dem Rücken ein Buckel? Habe noch nie einen Buckel gesehen. Ich kalkuliere, das bringt uns Glück.«
»Sein Gesicht sieht gerade aus wie ein Reibeisen.«
»Teufel noch einmal, der Kerl hat ja keine Augen!«
»Doch, siehst du nicht die kleinen Schlitze?«
»Wahrhaftig, ich sehe sie,« entgegnete Bill, »möchte aber wissen, wie er mit ihnen sehen kann. Ein Jäger ist er sicher nicht, obgleich sein Gesicht braun genug ist. Beim Kriechen durch die Büsche müßte er mit dem Buckel ja überall hängen bleiben. Oder ob er ihn abschnallen kann?«
»Unsinn, Bill,« lachte Dick, »ebensowenig, wie du deinen Kopf.«
Das Boot lag an dem Vorbau, der Bucklige stieg heraus, der Wirt half ihm dabei, empfing einen kleinen Handkoffer, und dann stieß das Boot wieder ab.
Jetzt kamen die beiden durch den Wald auf das Haus zu.
Plötzlich stieß Bill einen langen Pfiff aus.
»Herrgott, der Kerl ist ja im ganzen Gesicht so rot wie ein Krebs,« rief er erstaunt.
»Ja, scheint eine Brandwunde zu sein. Er muß seine Nase einmal zu dicht ans Feuer gehalten haben.«
»Sieht gerade im Gesicht aus, wie ein skalpierter Indianer auf dem Kopfe. Pfui Teufel!«
Die beiden gingen um das Haus herum und betraten die Wirtsstube. Jetzt zeigten Bill und Dick keine Neugierde mehr, das wäre unter ihrer Würde gewesen. Sie sahen, ebenso wie der Fremde, von ungefähr den neuen Ankömmling, dem der Wirt mit dem Reisekoffer folgte.
Der Fremde war wirklich klein, bucklig, hatte kaum einen Hals, zeigte statt der Augen nur Schlitze, und sein Gesicht war eine einzige rote Brandwunde.
Er war sehr einfach angezogen, ganz gegen die Gewohnheit der Buckligen, welche sich mit Vorliebe elegant kleiden, um das Unschöne ihrer Gestalt durch ein glänzendes Aeußere dem Beschauer angenehm zu machen.
Der Bucklige wandte sich an den Wirt.
»Wann kommt der nächste Dampfer hier vorbei?«
»Dampfer fahren immerfort vorbei.«
»Ich meine das Passagierboot mit dem roten Stern im blauen Schornstein.«
»Ah so. Fährt es stromauf oder stromab?«
»Das stromauf kommende.«
»Da habt Ihr etwa noch zwei Stunden zu warten. Soll hier ein Passagier an Land gesetzt werden?«
»Ja.«
»Hört, Fremder, das Boot mit dem blauen Schornstein ist ein Schnelldampfer, es hat bis nach Little Rock nur noch eine halbe Stunde zu dampfen, und wegen eines Passagiers stoppt es nicht, um ein Ruderboot auszusetzen.«
Der Bucklige machte ein erschrockenes Gesicht.
»Das wäre! So bin ich falsch berichtet worden.«
»Nun, ausgenommen, der Passagier bezahlt gut.«
Der Bucklige atmete erleichtert auf.
»Das tut er.«
»Nun, dann läßt der Kapitän auch stoppen, ein Yankee tut für Geld alles. Aber ein hübsches Stück Geld kostet es.«
» Never mind.«
Der Wirt rieb sich schmunzelnd die Hände, welche so groß waren, daß er sie wohl schwerlich in die Taschen stecken konnte, ohne dieselben der Gefahr auszusetzen, aufzuplatzen.
Er besaß eine hünenhafte Gestalt und verriet durch seinen breiten, gemeinen Dialekt den ehemaligen Flußschiffer. Der Bucklige mit seiner hohen, quäkenden Stimme sprach ein gutes, reines Englisch.
Der Wirt schmunzelte, weil dieser feine Gast einen noch feineren erwartete. Geld hatten sicher beide, und so konnte er auf einen guten Verdienst rechnen.
Bill und Dick hatten dem Gespräch aufmerksam gelauscht; der fremde Jäger verhielt sich gleichgültig, bediente sich aber fleißig der Whiskyflasche, als er jedoch das volle Glas an die Lippen führte, huschte über sein Gesicht ein pfiffiges Lächeln, und unmerklich nickte er mit dem Kopfe.
»Ein delikater Whisky,« sagte er, das Glas hintergießend, »riecht wie nach Blumen.«
Der Bucklige nahm nicht, wie gehofft wurde, an dem Tisch Platz, sondern setzte sich, das Gesicht dem Fenster zukehrend, auf ein niedriges Faß und deutete somit an, daß er sich nicht an dem Gespräch beteiligen wollte.
Der Wirt machte trotzdem einen Versuch, ihn zum Reden zu bringen.
»Wollt Ihr Euch nicht an den Tisch setzen, Fremder? Es sind Gentlemen, angenehme Unterhaltung.«
Ein Blick aus den Schlitzaugen streifte die rohen Gesichter der spuckenden Gentlemen.
»Danke, ich sitze hier gut.«
Diese Nichtachtung sollte ihm noch teuer zu stehen kommen, der Wirt hielt auf Anstand und Gesellschaft.
»Bald so stolz wie damals die beiden durchgegangenen Kassierer, die hier ihr Geld teilten,« flüsterte Dick.
»Hm, du meinst die, welche hier gefaßt wurden?« fragte Bill.
»Dieselben.«
»Ach ja, stimmt, der Detektiv bat uns ja um Beistand, wir taten's und bekamen dafür eine Prämie, daß wir acht Tage lang nicht nüchtern wurden. Wie hieß doch gleich jener Detektiv?«
»Nick Sharp, glaube ich.«
»Richtig, Nick Sharp. Das war ein verfluchter Kerl, der hatte Haare auf den Zähnen.«
Der fremde Jäger schielte nach dem Buckligen; doch dieser hatte das leise Gespräch nicht gehört. Unruhig rutschte er auf dem Fasse hin und her. Der Sitz war ihm nicht bequem.
Jetzt trat der Wirt zu ihm; hinter seinem Rücken lugte das kleine Mädchen hervor.
»Wollt Ihr was trinken, Fremder?«
»Danke, noch nicht.«
»Hm, Ihr seid in der ›Goldhütte‹.«
»Das weiß ich.«
»Die ›Goldhütte‹ ist ein Gasthaus,« sagte der Wirt mit gerunzelter Stirn.
Der Bucklige sah sich scheu in dem Raume um.
»Ach so, ich verstehe. Bitte, ein Glas Zuckerwasser.«
Der Wirt öffnete den Mund vor Staunen.
»Wasser, wozu denn?«
»Zum Trinken.«
»Hier wird kein Wasser getrunken, darin waschen wir uns höchstens. Hier gibt es nur Whisky.«
»Der steigt mir zu sehr in den Kopf.«
Da kam die junge Frau dem Bedrängten zu Hilfe. Sie war mit dem Geschmack feiner Leute schon besser vertraut als ihr Mann, weil sie einst in einem Hotel von Little Rock Teller gewaschen hatte.
Sie trat zu dem verlegenen Gast.
»Zuckerwasser wollt Ihr? All right, Ihr sollt ein Glas bekommen, wie Ihr es besser noch nie getrunken habt. Wünscht Ihr auch etwas zu essen?«
Der Bucklige hatte wirklich Hunger. Er war schon seit der Nacht auf dem Schiffe, hatte aber seitdem nicht einen Bissen über die Lippen gebracht, weil dort für die Speisen Schiffspreise, das heißt, außerordentlich hohe verlangt wurden.
»Sehr gern, was habt Ihr?«
»Schinken, geräucherten Hirschrücken, Käse, Butter und Brot,« erklärte die Wirtin.
»Oder Ihr könnt auch an unserem Mittagessen teilnehmen,« fügte der Gemahl hinzu.
Wieder flog ein argwöhnischer Blick aus den Schlitzaugen durch das Gemach, über die schwarzen Schinken, die rußigen Pfannen und blieb schließlich an den schmutzigen Händen der Frau haften. Der Gast war unschlüssig.
Da sah er neben dem Kamin Eierschalen liegen.
»Habt Ihr Eier?«
»So viel Ihr wollt.«
»Dann bitte ich um einige gekochte Eier, aber mit den Schalen. Ich schäle sie selbst.«
»Das ist ein sonderbarer Kauz,« dachte die junge Frau, als sie zur Bereitung des Zuckerwassers schritt.
Der Wirt rollte inzwischen ein größeres Faß vor den Gast. Auch er mußte sich schon einige Kenntnisse in der feinen Bedienung angeeignet haben, denn er vergaß nicht, den oberen Teil des Fasses abzuwischen, allerdings mit einem entsetzlich schmutzigen Stück Zeug, welches sich beim Auseinanderfalten als eine Art Nachtjacke seiner Frau Gemahlin entpuppte, aber auch als Windel gedient haben konnte.
Der Gast starrte zum Fenster hinaus, er hütete sich, den Vorbereitungen zu seiner Mahlzeit zuzuschauen.
Jetzt kam die Wirtin mit einem großen Glase, eine grünlichgelbe Flüssigkeit enthaltend.
»So, frisches Zuckerwasser,« sagte sie, das Glas auf das Faß setzend.
»Aber das sieht ja grün aus,« rief der Bucklige entsetzt.
»Daran ist der Zucker schuld, wir haben nur braunen im Hause. Bill bringt erst nächstens welchen aus der Stadt mit.«
Der Ekel wurde überwunden und gekostet. Es schmeckte nach Melasse oder Sirup.
In Amerika ist es gebräuchlich, nach Empfang eines Getränks oder einer Speise sofort zu bezahlen, nur in besseren Hotels wird darin Ausnahme gemacht. So war es dem Wirt nicht übelzunehmen, wenn er neben dem Faß stehen blieb.
Der Bucklige legte einen Silberdollar hin.
»Stimmt.«
Mit diesem Wort verschwand das Geldstück in der tiefen Westentasche des Wirtes.
Diesmal war es an dem Buckligen, den Mund vor maßlosem Staunen aufzureißen.
»Wie? Ihr verlangt für dieses kleine Glas Zuckerwasser einen Dollar?«
»Findet Ihr das teuer?«
»Ich finde es unver — sehr teuer.«
»Ich nicht. Als General Jackson bei mir einkehrte, bezahlte er für ein Glas Whisky zehn Dollar.«
»Das ist aber Wasser mit etwas Zucker.«
»Das bleibt sich gleich; bei mir kostet jedes Glas einen Dollar, gleichgiltig, ob Whisky, Milch oder Wasser darin ist. General Jackson saß auf demselben Platz, wo Ihr sitzt: seitdem ist es der Fremdensitz. Wer hier bedient wird, zahlt das doppelte. Am Tisch drüben ist es billiger.«
»Was kostet es dort?«
»Einen halben Dollar. General Jackson trank sein zweites Glas drüben am Tisch und bezahlte mir fünf Dollar.«
»Ich bin aber kein General.«
»Nicht? Das ist schade, Ihr habt eine prachtvolle Figur zu einem General.«
Ein brüllendes Gelächter belohnte den Wirt für diesen Witz. Die Männer, mit Ausnahme des fremden Jägers, welcher ernst blieb, schüttelten sich vor Lachen, und die junge Frau ließ das Fett aus der Pfanne ins Feuer laufen.
Der Bucklige spülte seinen Aerger mit dem grüngelben Zuckerwasser hinunter, aber Schluck für Schluck, denn jeder Schluck kostete ihm fünf Cents. Er murmelte etwas, was jedenfalls keine Schmeichelei enthielt.
Die Frau brachte einen Teller mit Eiern.
»Bitte, setzt es drüben auf den Tisch, es wird mir zu kühl am Fenster,« sagte der Bucklige, stand auf und nahm an dem Tisch, neben dem fremden Jäger Platz.
»Das sind ja zwölf Stück Eier,« rief er erschrocken, »so viel habe ich gar nicht gewollt.«
»Ihr habt nicht gesagt, wieviele Ihr haben wollt,« meinte der Wirt achselzuckend. »Als General Jackson hier war, aß er drei Dutzend.«
Mit einem verzweifelten Gesicht brachte der Bucklige eine Börse zum Vorschein, wandte sich aber ab, damit diese Kerle mit den rohen Gesichtern seine Barschaft nicht sähen.
»Was kosten die Eier?«
»Wollt Ihr Brot dazu?«
»Nein.«
»Das Stück einen Dollar, macht zusammen zwölf Dollar. Weil Ihr so viele nehmt, bekommt Ihr das Salz gratis.«
Der Bucklige ließ vor Schreck die Hand sinken.
»Das Ei einen Dollar?«
»Gewiß, General Jackson bezahlte zwei Dollar und behauptete, er hätte noch nie so billige Eier gegessen; sie sind wunderbar schön.«
»Legen Eure Hühner so wenig Eier?«
»Jeden Monat eins, und außerdem habe ich mir die Hühner aus Kanada kommen lassen, jedes Huhn kostet mich vierzig Dollar Reisegeld. Das macht die Eier so teuer.«
»Ich möchte Euch nicht aller Eier berauben.«
»O, geniert Euch nicht Fremder, ich freue mich, wenn es jemandem schmeckt, mir sind die Eier überhaupt zu teuer, nur wegen der Kinder kommen manchmal welche auf den Tisch.«
Mit saurer Miene verspeiste der Bucklige die kostbaren Eier, bei jedem Biß dachte er an seine verschwundenen Dollars. So rein er die Schalen auch auskratzte, das kleine Mädchen untersuchte sie nochmal, ob nicht Eiweiß dran haften geblieben wäre.
Nun mußte auch Bill sein Gegenüber ›ausholen‹, und er tat dies nach einer Art, die er für die eines Gentleman hielt.
»Wollt Ihr eins mit mir trinken, Fremder?«
»Ich danke, ich trinke keinen Whisky.«
»Warum nicht?«
»Er steigt mir in den Kopf.«
»Unsinn, er fließt doch in den Magen.«
»Ich meine, er berauscht mich.«
»Bah, trinkt Ihr ein Glas mit mir?«
»Ich danke wirklich,« schlug der Bucklige das Anerbieten ab. Er kam sich hier wie in einer Räuberhöhle vor.
Was hatte er aber hier zu tun? Das mußte der Wolfsjäger unbedingt erfahren, denn als Sheriff war er für die Sicherheit der Stadt verantwortlich. Wie ein Räuber sah der kleine Mann allerdings nicht aus, aber Pferde kann man auch stehlen, wenn man einen Buckel hat.
Plötzlich fuhr der Kleine erschrocken von seinem Faß auf, die Faust des Wolfsjägers schlug krachend auf den Tisch, daß die vollen Gläser überflossen und die Eier vom Teller sprangen.
»Wollt Ihr ein Glas mit mir trinken?« klang es zum dritten Male, diesmal aber so drohend, so schrecklich blickten die Augen den Buckligen an, daß dieser nicht anders dachte, als der nächste Fausthieb träfe seinen Kopf.
»Ja, ja,« stammelte er, »mit dem größten Vergnügen, so viele Gläser, wie Ihr wollt.«
Bill war beruhigt, er schenkte ein Glas voll, und jetzt war er berechtigt zu fragen:
»Wohin wollt Ihr, Fremder?«
»Ich warte hier auf einen Freund.«
»Geschäftliche Angelegenheiten?«
»Ja.«
»Ein hübscher Platz dazu hier.«
»O ja, etwas teuer.«
»In Little Rock ist es billiger, aber nicht so gut,« mengte sich der Wirt ein.
»Woher kommt Ihr?«
»Von New-York.«
»Gott ver — das ist ein weiter Weg.«
»Was tut man nicht, um ein gutes Geschäft abzuschließen!«
Der Wolfsjäger ward immer mißtrauischer, und der Bucklige, welcher dies merkte, immer ängstlicher.
»Euer Freund steigt auch hier ab?«
»Ja.«
»Warum trefft Ihr ihn nicht in Little Rock?«
»Er will mich hier sprechen.«
Das mußte dem Frager genügen.
»Pferdehandel?«
»Nein.«
»Kaffee?«
»Nein.«
»Zucker?«
»Beinahe.«
»Was zum Henker ist es denn?«
»Ich will ihm eine Medizin verkaufen.«
»Eine Medizin?« lachte Bill. »So seid Ihr Arzt?«
»Apotheker.«
»Aha.«
»Hört, Fremder,« ließ sich der Wirt vernehmen, »meine Ziege ist krank, sie gibt keine Milch mehr, da könnt Ihr sie gleich kurieren.«
»Ich bedaure, ich habe meine Arzneien nicht bei mir.«
Es trat eine lange Pause ein.
»Hm, hm,« begann dann wieder Bill, die Nase nachdenklich mit dem Finger reibend, »wenn es sich um den Verkauf von einer Medizin handelt, muß es natürlich heimlich zugehen. Dann ist es etwas anderes. Nehmt nichts für ungut, Fremder, daß ich Euch so ausfragte, aber mein Beruf als Sheriff zwingt mich dazu.«
Der Bucklige zeigte wieder große Unruhe, bemühte sich aber, dieselbe zu verbergen.
»Ihr seid Sheriff?« fragte er kleinlaut.
»Ich bin Sheriff,« entgegnete Bill würdevoll.
Auch Dick mußte dem Freunde beistimmen.
»Ihr habt recht, Patente und Geheimmittel muß man ganz heimlich verkaufen, denn überall schnüffeln Spürnasen herum, welche auch gern so ein Mittelchen erfahren wollen, mit dem sie schnell reich werden können. Da wohnte zum Beispiel in Little Rock ein Pelzhändler, der hatte auch einmal eine lange Unterredung mit einem fremden Manne, wozu er sich zwei Tage im Keller einschloß. Was meint Ihr, was für ein Geheimnis er diesem abkaufte?«
»Nun?«
»Aus Fellen von braunen Bären Eisbärenfelle zu machen. Er steckte die Felle in eine stinkige Brühe, sie wurden auch schneeweiß, und der Mann machte auch rasende Geschäfte.«
»Aber?«
»Aber nach einem halben Jahre wurde er von zwei Brüdern gelyncht, die Felle hatten nachgedunkelt, und in der Sonne wurden sie wieder braun.«
»Was für eine Medizin ist denn das, die Ihr verkaufen wollt?« wandte sich Bill wieder an den Buckligen.
»Das kann ich nicht verraten.«
»Nun, ich meine nur, etwas gegen Hühneraugen, gegen die Tollwut oder die Trunksucht?«
»Nein, es ist ein Abführmittel.«
»Abführmittel? Was ist das?«
Der Apotheker erklärte, die Männer lachten, und die junge Frau machte einen Versuch, sich zu schämen.
»Seltsam, an was für Krankheiten die Menschen leiden, wenn sie nichts zu tun haben,« meinte Dick.
»Und dafür bekommt Ihr viel Geld?«
»Hoffentlich sehr viel.«
»Na, ich wünsche Euch viel Glück, und wenn Ihr ein gutes Geschäft macht, dann denkt an uns.«
»Euer Whisky ist mir etwas zu teuer.«
»Hm, wir machen dann einen Ausnahmepreis.«
Der Bucklige saß wie auf glühenden Kohlen, unruhig rutschte er hin und her, blickte immer aus dem Fenster und lauschte auf das geringste Geräusch.
Da, endlich — zwei Pfiffe schallten vom Wasser.
»Euer Freund kommt!« rief der Alte und eilte hinaus.
Der Bucklige sprang ans Fenster, die übrigen blieben sitzen, weil ihnen der viele Whisky schon etwas in die Glieder gefahren war.
Es dauerte nicht lange, so legte ein Boot an, ein Herr sprang heraus, der kein Gepäck bei sich hatte, und das Boot stieß sofort wieder ab. Die Ruderer mußten sich tüchtig in die Riemen legen, um den Schnelldampfer wieder einzuholen, welcher nicht stoppte, das heißt, Gegendampf gab, sondern langsam weiterfuhr.
Kaum lag das Boot längsseit, so entstieg dem Schornstein eine dichte Wolke, und mit voller Fahrt jagte das Schiff wieder davon.
Am Deck sah man mehrere Herren stehen, welche dem Gelandeten zuwinkten, der sich umgedreht hatte und jenen Männern einen Abschiedsgruß mit der Hand nachsandte.
Dann wandte er sich zu dem Wirt, und dieser war ungemein freundlich, denn jetzt hatte er einen wirklichen Gentleman, einen feingekleideten, wohlgewachsenen Herrn vor sich.
»Seid Ihr der Wirt von der ›Goldhütte‹?« fragte der noch junge Herr.

»Seid Ihr der Wirt von der ›Goldhütte‹?«
fragte der wirklich vornehm aussehende Fremde.
»Ihr seid auf der richtigen Fährte.«
»Ist in Eurem Hause ein kleiner Herr?«
»Ja, er hat einen Buckel und ein brandrotes Gesicht. Ist das der, den Ihr sucht?«
»Den meine ich.«
»Er wartet schon zwei Stunden mit seinem Abführmittel auf Euch.«
Der Herr warf einen zweifelnden Blick auf den grinsenden Wirt, als ob er ihn für geistig nicht recht normal hielte, und ging dann, dem Wirt voraus, mit großen Schritten dem Holzhause zu, welches zwischen den Bäumen auftauchte.
»Mister Moore, endlich,« begrüßte der Bucklige den Eintretenden. Eine Zentnerlast schien ihm vom Herzen zu fallen.
»Haben Sie sich die Zeit gut vertrieben, Mister Elias?« fragte der mit Moore Angeredete, sich im Zimmer umschauend.
»Ausgezeichnet, nie habe ich mich so gut unterhalten. Auch Sie werden noch Ihre Freude hier erleben.«
»Bringen Sie gute Nachrichten?«
»Ausgezeichnete.«
»So lassen Sie uns hier am Fenster Platz nehmen und ungeniert sprechen,« sagte Mister Moore.
»Dort ist es etwas teuer, das Glas Zuckerwasser kostet einen Dollar.«
»Macht nichts.«
»Und ein Ei ebensoviel.«
»Ein Straußenei?«
»Nein, ein kanadisches Hühnerei.«
»Gut, so werde ich welche essen.«
»Aber ich bemerke gleich, daß ich nichts verzehren werde.«
»Sie sind und bleiben ein Knicker. Habe ich Sie hierherbestellt, so sind Sie natürlich mein Gast.«
Die beiden setzten sich wieder am Fenster um ein Faß, und Mister Moore wußte so selbstbewußt aufzutreten, einen solchen Kreis von Unnahbarkeit um sich zu ziehen, daß der Wirt viel höflicher wurde als zuvor, und der neue Ankömmling von jeder Neugier seitens des Wirtes und der übrigen Gäste verschont blieb.
Das Gespräch wurde flüsternd geführt, nachdem Mister Moore Getränke bestellt hatte.
»Vor allen Dingen sagen Sie mir,« begann Elias, »warum haben Sie mich in dieses verdammte Loch bestellt und nicht nach Little Rock?«
»Verhältnisse, lieber Elias. Sehen Sie, auf jenem Schiff, dem ich entstieg, befanden sich noch vier Herren von unserer Genossenschaft. Wir wollen in Little Rock zusammentreffen, welches in unserem Zentrum liegt, um eine Beratung abzuhalten. Sie kommen später ebenfalls hinzu, wie zufällig. Es gibt ein kleines Fest, es wird sehr lustig hergehen.«
»Konnten wir nicht dort verhandeln?«
»Nein, wir dürfen nicht tun, als hätten wir schon vorher zusammen gesprochen. Sie wissen, niemand soll wissen, was ich mit Ihnen verhandelt habe. Sie kommen ganz zufällig. Nun aber genug davon, was bringen Sie mir?«
»Gute Nachrichten.«
Ein angenehmes Erstaunen spiegelte sich im Gesicht des jungen Mannes ab.
»Haben Sie das Schreiben dechiffrieren können?«
»Es war mir eine Leichtigkeit.«
»Kannten Sie alle Substanzen?«
»Alle.«
»Können Sie den Stoff selbst herstellen?«
»Natürlich, ich habe ihn schon.«
»Vortrefflich!« rief Mister Moore erfreut. »Und wirkt er gut?«
»Ausgezeichnet.«
»Es ist der richtige?«
»Vollständig.«
»Wirt, was habt Ihr außer diesem verdammten Whisky, der einem die Kehle zerkratzt, im Hause? Wein?«
»Nein, den führe ich nicht. Aber Bier ist noch da.«
»Gut, bringen Sie einige Flaschen, aber schnell, ich verdurste.«
»Das wird Ihnen teuer zu stehen kommen,« brummte Elias. »Bier ist an und für sich schon nicht billig, und nun gar hier.«
»Macht nichts! Der Tag, an dem Sie mir glückliche Nachrichten bringen, muß gefeiert werden.«
»Hätten Sie mir nicht ein anständiges Reisegeld geschickt, ich würde nicht Tag und Nacht gefahren sein, um diese Wildnis zu erreichen.«
»Ich weiß, für Geld tun Sie alles.«
»Muß man auch, um heutzutage vorwärtszukommen.«
»Nun wieder von dem Mittel. Es ist also wirklich dasselbe?«
»Es ist gut, ich habe es selbst probiert.«
»Das versteht sich. Sie dürfen jedoch keinen anderen ins Geheimnis ziehen,« sagte Moore.
»Füllt mir gar nicht ein.«
»Haben Sie das Rezept übersetzt?«
»Hier ist es.«
Elias zog aus seiner Brusttasche eine Briefmappe und entnahm derselben ein Papier.
Moore entfaltete es und schüttelte den Kopf.
»Das kann ich nicht verstehen, es ist lateinisch.«
»Haben Sie schon einmal ein Rezept anders geschrieben gesehen?«
»Nein, allerdings nicht.«
»Aber dies können Sie in jeder Apotheke abgeben oder irgend einem Chemiker, es wird Ihnen sofort bereitet.«
»Es ist also gar kein Geheimnis?«
»Doch, das habe ich hier.«
Elias nahm ein anderes Papier, zog es aber, als Moore danach greifen wollte, schnell wieder zurück.
»Halt, so schnell geht das nicht. Bevor Sie dies erhalten, zahlen Sie mir meinen Lohn.«

Es dauerte lange, ehe Moore einen Entschluß fassen konnte.
»Wer bürgt mir dafür, daß Sie mich nicht hintergehen?« fragte er dann langsam.
»Auf welche Weise soll dies möglich sein?« klang es unschuldig zurück.
»Sie haben mir irgend ein Rezept ausgeschrieben, das richtige aber nicht entziffern können, oder wenn dies gelungen, das Geheimnis für sich behalten.«
»Torheit,« lachte Elias ungezwungen, »ich gebe Ihnen auch das Original, Sie lassen es von einem vereideten Entzifferer übersetzen und vergleichen es mit meiner Uebersetzung.«
»Kann das Geheimnis denn nicht verraten werden?«
»Einmal ist der Entzifferer zur Verschwiegenheit verpflichtet, wenn es sich nicht um ein Verbrechen handelt, und zweitens kann die Substanz nur ein sehr geschickter Chemiker herstellen. Es handelt sich dabei um verschiedene Ingredienzen, die außer mir nur sehr wenige kennen werden; es kommen Ausdrücke vor, die Zubereitung betreffend, die ebenfalls den meisten unbekannt sind.«
»Ich werde mich an keinen Entzifferer wenden, sondern Ihnen trauen,« meinte Moore zögernd.
»Daran tun Sie recht.«
»Nun geben Sie mir das Rezept.«
»Erst bitte ich um eine Anweisung auf die ausgemachte Summe.«
»Sie verlangen Unbilliges. Sie erhalten dieselbe erst, wenn ich festgestellt habe, daß ich die Substanz herstellen kann.«
»Das können Sie niemals, nur ich vermag es.«
»Gut, so werde ich dem Experiment beiwohnen.«
»Sie werden es nicht, so lange ich nicht die Anweisung habe. Hier ist Ihr Original zurück.«
Er reichte dem jungen Manne ein Pergament, das mit seltsamen, mystischen Zeichen bedeckt war. Es wurde mit sichtbar zitternder Hand ergriffen. Ein scheuer Blick aus den Augen des jungen Mannes streifte durch das Zimmer, ehe er es in der Brusttasche verschwinden ließ.
Das Gespräch war nicht mehr so leise geführt worden wie zuerst, besonders der Bucklige hatte laut gesprochen, und die Gäste hatten dieser Geschäftsunterhandlung mit Interesse gelauscht.
»Jetzt geben Sie mir das Geheimnis der Bereitung, und ich zahle Ihnen eine Summe,« nahm Moore wieder das Wort.
»Eine Summe? Welche?«
»Die Hälfte der versprochenen.«
»Und den Rest?«
»Wenn Sie in meiner Gegenwart die Substanz herstellen, und wenn ich sie für gut befunden habe.«
Der Bucklige sann längere Zeit nach.
» All right, ich bin's zufrieden.«
Moore zog einen Papierblock aus der Tasche, ein Tintenfaß und eine Feder und schrieb.
»Ist dies gut so?«
Des Buckligen Augen leuchteten auf.
»Unterschreiben Sie!«
Die Feder kratzte übers Papier, und dasselbe wurde abgelöst.
»Wehe Ihnen, wenn Sie mich betrogen haben!« sagte Moore, als er dem Buckligen die Anweisung auf ein New-Yorker Bankhaus überreichte.
»Hier ist das Rezept der Bereitung,« entgegnete der Chemiker, »es ist englisch geschrieben.«
Der junge Mann überflog das Papier, das seine zitternden Hände hielten, und ein immer größeres Erstaunen malte sich in seinen Zügen.
»Wie, das soll es sein?«
»Es ist das Rezept.«
»Wie ist mir denn, klingt das nicht fast, als ob es sich um die Bereitung einer Medizin handle? Destilliertes Wasser, Latwerge, Chlorkalium ...«
»Es ist ja auch eine Medizin. Ich glaube, Sie werden mit dem Abführmittel gute Geschäfte machen, vielleicht in kurzer Zeit zum reichen Manne werden.«
Moore ließ das Papier sinken, ein furchtbarer Blick traf den Buckligen. Dieser stand schnell auf und ging nach dem Tische, wo sein Glas noch stand.
»Wirt, eine Flasche vom besten Whisky für diese Gentlemen,« rief seine kreischende Stimme. »Meine Herren, das Geschäft ist abgeschlossen, und ich bin ein Mann von Wort.«
»Alles hat seine Richtigkeit,« bestätigte Bill kopfnickend.
»Kinnaird,« keuchte es vom Fenster her.
»Sie wünschen?«
Der Bucklige setzte sich gelassen wieder auf seinen alten Platz, ohne sein Gegenüber aber aus den Augen zu lassen.
»Kinnaird, was soll das bedeuten?«
»Wie kommen Sie zu dieser Frage?«
»Sie haben mich betrogen,« stöhnte Moore.
»Herr, das verbitte ich mir!« versuchte der Bucklige aufzubrausen. »Diese Herren dort sind Zeugen, daß alles ehrlich vor sich gegangen ist.«
»Ja, das ist es,« bestätigte Dick, sein Glas aus der neuen Flasche füllend.
»Und glauben Sie meinen Worten nicht,« fuhr der Bucklige oder Elias Kinnaird, der Chemiker aus New-York, fort, »so lassen Sie die Schrift entziffern. Enthält sie nicht das Rezept eines Abführmittels, dann können Sie mich einen Betrüger nennen, wenn ich Ihnen die Summe nicht bis auf den letzten Cent zurückzahle.«
Moore war völlig außer Fassung; mit starren Augen glotzte er den Buckligen an.
»Ich bin betrogen worden,« konnte er nur stöhnen.
»Von mir nicht.«
»Dann von Flexan.«
»Ah, Flexan ist also auch im Spiele. Ja, der betrügt gern oder vielmehr, betrog gern, denn er ist ja spurlos verschwunden. Hat er Ihnen dieses Rezept verkauft? Es ist ja ein ganz gutes Mittelchen, aber ich glaube, Sie überschätzen es doch.«
»Sprechen Sie nicht so! Sie wissen recht gut, um was es sich handelt,« entgegnete Moore immer noch trostlos.
»Ich? Nicht im geringsten.«
»Flexan selbst hat mit Ihnen unterhandelt.«
»Oft genug, aber nie wegen eines Abführmittels.«
»Um dieses Rezept?«
»Nie!«
»Sie lügen!«
»Ich spreche die Wahrheit. Flexan hat nie wegen eines Abführmittels mit mir gesprochen.«
»Sie wollen mich höhnen,« entgegnete Moore, wieder eisigkalt werdend. »Flexan übergab Ihnen ein Stück jener Substanz, welche man da auf dem Meeresgrunde gefunden, wo die schwimmende Werft des ›Blitz‹ gelegen hatte. Sie konnten die Substanz nicht analysieren, forderten das Rezept, und Flexan versprach, Ihnen dasselbe zu verschaffen.«
Der Bucklige riß die kleinen Augen so weit wie möglich auf.
»Ja, aber was hat dieses Rezept mit alledem zu schaffen?«
»Es ist das, welches Flexan Ihnen bringen wollte.«
Elias Kinnaird bog sich hintenüber und brach in ein schallendes Gelächter aus.
»Köstlich,« rief er, »Mister Kirk — wollte sagen Mister Moore, da sind Sie allerdings furchtbar aufs Eis geführt worden, entweder von Flexan oder von dem, welchem das Rezept ursprünglich gehört hat. O, nun verstehe ich alles. Sie wähnen sich im Besitze jenes Geheimnisses, welches die Sehnsucht Flexans war. Ja, Mister Moore, das tut mir leid, dann haben Sie sich entweder getäuscht oder Sie haben sich betrügen lassen.«
Der junge Mann ward aschfahl im Gesicht und knirschte mit den Zähnen.
Kinnaird, der mit einem Male sehr freigebig geworden, bestellte für die Männer am Tisch eine zweite Flasche und flüsterte dann, sich vorbeugend, seinem Nachbar zu:
»Von wem erhielten Sie das Pergament?«
»Von Flexan.«
»Das glaube ich nicht.«
»Warum nicht?«
»Weil Flexan es sicher nicht aus den Händen gelassen hätte. Er gedachte Millionen daraus zu schlagen.«
»Ich habe ihm aber auch eine ungeheuere Summe dafür bezahlt. Er war damals gerade in Geldverlegenheit.«
»Hm, klingt sehr unwahrscheinlich.«
»Es ist aber so.«
»Wußten Sie, wo das Geheimnis, das sich nun als Abführmittel entpuppt hat, sich befand?«
»Nein, Flexan wußte es; er hat es in seinen Besitz gebracht und mir verkauft.«
»Es befand sich auf der Brust des Besitzers.«
»So?«
»Ja, auf der Brust Hoffmanns.«
»Pst, nicht so laut.«
»Bah, was gilt ein Name in Amerika?« grinste Kinnaird, welcher sich an der furchtbaren Verlegenheit seines Gegenübers weidete. »Wissen Sie, wo Hoffmann jetzt ist?«
»Habe keine Ahnung.«
»Ich auch nicht, er ist verschwunden.«
»Geht mich nichts an.«
»Der Verdacht liegt vor, daß er ermordet worden ist.«
»Was? Sollte Flexan sich so weit vergessen haben, um das Geheimnis des ›Blitz‹ zu erlangen?«
»Allem Anschein nach. Flexan hat nie lange gezögert, galt es einen Fang zu machen.«
»Sprecht nicht so laut!« warnte Moore nochmals. Sein Gesicht war bleich wie das eines Toten, aber die Hand, welche das Glas zum Munde führte, zitterte nicht. Gleichgültig und sicher blickte er den Chemiker an, doch dieser ließ sich nicht täuschen.
»Ich wette, Flexan hat das Geheimnis für sich behalten, um es in seinem Interesse zu verwerten, Ihnen aber ein Falsifikat verkauft, welches ein nutzloses Rezept enthält.«
»Er soll mir dafür büßen, wenn ich ihn wieder treffe.«
»Ich kalkuliere, das wird niemals der Fall sein.«
»Warum nicht?«
»Weil Flexan verschwunden ist.«
»Das war schon mehrmals der Fall.«
»Hm, diesmal aber wird er wohl nicht wieder auftauchen.«
»Wieso glauben Sie das?«
»Nun, es ist nur eine Vermutung. Ich denke nämlich,« Kinnaird beugte sich weit auf und dämpfte seine Stimme noch mehr, »die Vestalinnen werden wieder aufleben und uns den Hals brechen, was sie wahrscheinlich schon mit Flexan getan haben.«
Moore lachte laut auf.
»Bah, die sind versorgt. Im schlimmsten Falle bringe ich mich schleunigst in Sicherheit. Die Welt ist groß, größer als Amerika, in welchem allein man sich schon unsichtbar machen kann.«
»Sie reisen jetzt nach Little Rock?«
»Ja, wir Verbündeten haben eine Unterredung, wahrscheinlich die letzte. Apropos, Kinnaird, wie steht es mit der Summe?«
»Mit welcher Summe?«
»Die ich Ihnen vorhin gab.«
»Nun, die gehört natürlich mir.«
»Das geht nicht, ich bin zu sehr im Verlust. Anstatt mir das gewünschte Geheimnis zu enträtseln, geben Sie mir das Rezept eines wertlosen Abführmittels.«
»Tut mir leid, ich kann nichts dafür. Meines Auftrags habe ich mich entledigt und dabei viel Zeit gebraucht.«
»Sie sind unbillig.«
»Kein Wort mehr darüber! Wirt, wann kann ich an Bord eines Dampfers?«
»Braucht mir's nur zu sagen, und ich hisse die Flagge. Wollt Ihr stromauf oder stromab?«
»Nach Little Rock.«
» All right, wird besorgt.«
»Ich fahre mit,« rief Moore dem hinausgehenden Wirt nach.
»Und ich auch,« sagte der fremde Jäger.
Aller Augen wandten sich diesem zu. Kinnaird und sein Gefährte schienen mißtrauisch zu werden.
»Ihr fahrt mit?« fragte der Bucklige.
»Ja, gefällt Euch das nicht?«
»Mir soll's gleichgültig sein.«
»Es kommt auch noch ein vierter Mann mit,« wendete sich der fremde Jäger zu dem unterdes wieder hereingekommenen Wirt.
»So, wer ist denn das?«
»Er wird jede Minute hier eintreffen.«
Der fremde Jäger gab noch einen Rundtrank aus und bezahlte den Wirt an der Bar. Sie sprachen wenige Worte zusammen, und der letztere zog ein sehr erstauntes Gesicht, wurde aber auf eine Vermahnung hin wieder gleichgültig. Gleich darauf ging er hinaus und nahm die Flagge von seinem Hause wieder herab.
Die beiden hatten ihren Platz am Fenster noch nicht verlassen, sie flüsterten nach wie vor zusammen.
»Flexan ist doch ein wahrer Teufel,« meinte Kinnaird. »Ein Menschenleben zählt bei ihm so viel, wie das einer Fliege.«
»Er ist damit zu unvorsichtig. Sein letztes Unternehmen mit Hoffmann wird ihn ins Unglück gestürzt haben.«
»Aber man hat doch nichts von einem Mord oder einer Verhaftung gehört.«
»Wird schon noch kommen.«
»Wissen Sie,« sagte Kinnaird vertraulich, »daß ich erst glaubte, als Sie mir das Pergament überschickten, Sie hatten Hoffmann ins Jenseits fahren lassen?«
Moore konnte sich nicht genügend beherrschen; erschrocken fuhr er zusammen.
»Wie kommen Sie auf die seltsame Vermutung?«
»Nun, Sie brauchen nicht gleich zu erschrecken,« kicherte Kinnaird, »ich dachte ja nur so. Mit Flexan verkehrte ich sehr intim, er vertraute mir die meisten seiner persönlichen Unternehmungen an, und so erfuhr ich denn von ihm, daß er es auf das Geheimnis des ›Blitz‹ abgesehen hatte. Dann war Flexan plötzlich verschwunden, gleich darauf verlautete, Hoffmann würde vermißt, und einige Tage später schickten Sie mir das Pergament ein. Ich dachte, genau ein solches vermutete Flexan auf der Brust Hoffmanns, seltsam, ich sollte es ihm enträtseln, und nun sendet mir Mister Kirk — wollte sagen Mister Moore eins zu. Nun, ich hatte mich geirrt, das Ihrige war ja nur ein einfaches Abführmittel.«
Kichernd leerte der Bucklige sein Glas. Seinem Genossen schien es furchtbar unbehaglich zu werden; er wich den Blicken des Gegenübers jetzt fortwährend aus.
Ein Rauschen ward hörbar, vom Flusse herkommend, Moore, der dem Fenster den Rücken zukehrte, wendete sich um.
»Ist das ein Dampfer, Wirt?«
»Ein Schnelldampfer, er hält nicht.«
»Wann kommt ein anderer?«
»Wird nicht lange mehr dauern.«
»Ich leiste Ihnen Gesellschaft bis nach Little Rock,« sagte der Kleine. »Dort aber verlasse ich Sie.«
»Wollen Sie unsere Freunde nicht sehen? Es wird ein gemütliches, kleines Fest.«
»Ich danke für diese Gemütlichkeit. Ich reise sofort nach New-York, erhebe die Summe und mache, daß ich fortkomme. Ich hoffe, Sie werden mir keine Schwierigkeiten in den Weg legen?«
Ein teuflischer Blick voller Hohn und Schadenfreude traf dabei den jungen Mann.
»Ich bin froh, wenn sich unsere Wege nicht wieder kreuzen. Suchen Sie ruhig das Weite mit Ihrer mir abgenommenen Beute, ich halte Sie nicht.«
»Und nehmen Sie sich in acht, daß man nicht Recherchen nach Hoffmann anstellt und lebhafte Nachfrage nach Ihnen hält!« zischelte der Bucklige.
»Schweigen Sie! Geben Sie sich nicht mit solch wahnsinnigen Vermutungen ab!« herrschte ihn der andere an.
»Dort kommt schon wieder ein Dampfer,« rief er dann dem Wirt zu. »Warum pfeift er denn nicht? Habt Ihr die Flagge auf Eurem Hause wehen?«
Er wollte sich aus dem Fenster beugen, fuhr aber mit einem Schreckensschrei, bleich wie ein Toter, zurück. Am Fenster erschien ein vollbärtiges Gesicht, die großen, blauen Augen schauten den Erschrockenen fest an.
»Kapitän Hoffmann!« gellte es durch den kleinen Raum. Der junge Mann wankte, er wollte sich an das Faß klammern, die zitternden Hände fanden keinen Halt, er taumelte noch weiter zurück und stürzte in die Arme des fremden Jägers.
»Mister Kirkholm,« donnerte es in seine Ohren, »Sie sind mein Gefangener! Versuchen Sie keinen Widerstand.«
Da huschte es an ihnen wie ein Wiesel vorbei. Der Bucklige war es, er hatte die Situation erkannt. Ihre Anschläge waren verraten. Die aufspringenden Männer wollten ihn fassen, aber wie ein Aal glitt er ihnen unter den Händen hinweg, und es gelang ihm, das Freie zu erreichen.
Draußen jedoch ertönte ein Schrei, und gleich darauf trat eine hohe Gestalt ein, die den buckligen Chemiker am Kragen hereinschleppte.

Eine hohe Gestalt trat ein, die den buckligen Chemiker am Kragen schleppte.
Der Wirt war im Einverständnis mit dem fremden Jäger, er hatte auch Bill und Dick instruiert. Sie halfen, den halbohnmächtigen Mister Moore, in Wirklichkeit Mister Kirkholm, zu binden, und gleich darauf waren auch die Hände des Buckligen auf dessen Rücken festgeschnürt.
»Kapitän Hoffmann!« konnte Kirkholm nur stöhnen.
»Ja, ich bin's,« lachte der neue Ankömmling, vor den Gefangenen hintretend. »Ihre Verbrecherlaufbahn hat ein Ende. Nur so viel will ich Ihnen zum Trost mitteilen, daß es Ihnen damals im Staate Kolorado, auf dem schmalen Felsgrate, nicht gelungen ist, mich zu töten. Der Handlung nach sind Sie kein Mörder, aber dem Gewissen nach. Wegen Mordes können Sie von den Menschen nicht verurteilt werden, aber Ihre Absicht war es, mich zu töten, um sich in den Besitz des Geheimnisses auf meiner Brust zu bringen, und um Sie in Sicherheit zu wiegen und mein Leben gegen Sie zu schützen, ließ ich Sie den Mord im Traume ausführen, denn Ihre Absicht war dies doch.«
Man sah es dem Gefangenen an, daß ihm der Sinn dieser Worte unverständlich war. Entsetzt starrte er den Sprecher an, den er doch mit den eigenen Händen erst erschossen und dann in den bodenlosen Abgrund geschmettert hatte. Er glaubte einen Geist vor sich zu haben, er war völlig gebrochen.
Bei dem Buckligen, dem Chemiker Kinnaird aus New-York, war das vollkommene Gegenteil der Fall. Er hatte seine Fassung behalten.
»Was soll das heißen, Herr?« rief er entrüstet. »Mit welchem Rechte bindet Ihr mich, als wäre ich ein Verbrecher?«
»Das sind Sie auch,« entgegnete Hoffmann ruhig, »Sie sind der Helfershelfer von Wechselfälschern und Falschmünzern, welche sich nicht scheuten, bei Ausführung ihrer Pläne auch Gift anzuwenden. Sie lieferten ihnen sympathetische Tinte, entfernten Schrift und ahmten Kautschukstempel nach.«
»Oho, das soll mir erst bewiesen werden, daß ich unrechte Handlungen begangen habe! Ich habe einfach für Geld gearbeitet, ohne zu fragen, wozu meine Arbeiten dienten. Nach den Gesetzen der Vereinigten Staaten kann ich wohl zur Rechenschaft gezogen, aber nicht bestraft werden, wenn mit meiner Hilfe Unfug getrieben worden ist.«
»Wie kann dieser kleine Vogel entrüstet pfeifen.« lachte Sharp, der als Jäger verkleidete Mann. »Wir werden Euch eines Besseren belehren, für was wir Euch halten.«
»Kopf hoch, Mister Kirkholm!« schrie der Kleine. »Sie können uns nichts anhaben, mir ebensowenig, wie Ihnen. Ihr seid Sheriff,« wandte er sich an Bill, »wollt Ihr dulden, daß einem Bürger der Vereinigten Staaten Gewalt angetan werde?«
Bill war aber anderer Meinung.
»Warum lieft Ihr denn vorhin davon, wenn Ihr ein gutes Gewissen habt?«
»Weil ich an einen räuberischen Ueberfall glaubte.«
Jetzt kam auch Kirkholm wieder zur Besinnung.
»Ich wünsche, dem Gericht ausgeliefert zu werden,« murmelte er dumpf.
»Das könnte Euch wohl passen,« höhnte Nick Sharp, »einige Monate in Untersuchung zu kommen, damit Ihr Zeit zur Flucht habt. Nichts da, Ihr seid unser Gefangener.«
»Diese Männer dürfen es nicht dulden,« schrie Kinnaird.
»Oho, wir sind ganz zufrieden damit,« erklärte Bill, »dieser Gentleman ist der Detektiv Nick Sharp, und was der tut, hat seine Richtigkeit.«
Bei Nennung dieses Namens wurde auch Kinnaird kleinlaut und ergab sich in sein Schicksal. Diese beiden Männer sollten nicht dem Gerichte zur Bestrafung ausgeliefert, sondern ohne weiteres für ihre Verbrechen gezüchtigt werden, ein in Amerika bevorzugtes Verfahren, weil die Beamten häufig bestechlich sind.
»Seid ihr bereit, die beiden Gefangenen unter Führung von Nick Sharp zu begleiten?« wandte sich Hoffmann an Bill und Dick. »Es handelt sich nur um einen kleinen Marsch durch den Wald, eure Zeitversäumnis soll reichlich bezahlt werden.«
Die beiden schmunzelten.
»Natürlich gehen wir mit, und entspringen sollen sie nicht, dafür stehen wir mit unserem Kopf.«
»Wann könnt ihr aufbrechen?«
»Wir sind jederzeit bereit.«
Hoffmann sprach mit Sharp, worauf er und Bill und Dick die beiden Gefangenen zwischen sich nahmen, das Haus verließen und im Walde verschwanden.
Der Deutsche aber wartete auf den nächsten Dampfer, der nach Little Rock fuhr, und benutzte ihn. Den Koffer des Chemikers nahm er mit sich.
Die Ruhe in Texas war wiederhergestellt. Mexiko versicherte, bei dem Aufstande die Hand nicht mit im Spiele gehabt zu haben. Die Namen Estrellas und der übrigen desertierten Offiziere, welche ohne Ausnahme gefallen, waren mit Schimpf und Schande befleckt, und diejenigen Meuterer, die nach und nach noch gefangen genommen wurden, mit schwerstem Kerker belegt.
Kapitän Staunton war auf sein Schiff zurückgekehrt. Das höchste Lob erwartete ihn und seine Mannschaft für ihr energisches Eingreifen, dank dessen die Revolution im Keime erstickt worden war.
Das Nachspiel der Meuterei aber fand auf einer Besitzung statt, nur wenige Meilen von der Ruine entfernt. Dort wurden die Wunden derer geheilt, welche den Kampf mit den Meuterern zu bestehen gehabt hatten.
Rings um den villenartigen Bau erhoben sich Baracken, in denen die verwundeten amerikanischen Matrosen Pflege fanden. Aerzte waren herbeigeholt worden. Männer und Mädchen strömten aus der Umgegend herbei und boten sich freiwillig als Krankenpfleger an, und in der Villa selbst lagen die englischen Herren, welche am meisten in dem Kampfe gelitten hatten.
Sie wurden von den Vestalinnen gepflegt, für die sie das Leben aufs Spiel gesetzt hatten.
Auch diejenigen waren geblieben, deren Abreise nichts entgegenstand, so Miß Petersen und Lord Harrlington, Miß Murray und Lord Hastings, Miß Thomson und Sir Williams, Hope und Hannes und andere.
Sie wollten ihre Freunde und Freundinnen nicht verlassen, sondern mit diesen zusammen die Heimreise antreten. Die ›Vesta‹ und der ›Amor‹ lagen seebereit im Hafen von Matagorda, und nur wenige Wochen noch brauchten zu vergehen, dann waren alle so weit hergestellt, um die Fahrt nach New-York antreten zu können. Den Triumph, mit ihrem eigenen Schiff in New-York wieder anzukommen, wollten sich die Vestalinnen doch nicht entgehen lassen, dann sollte die ›Vesta‹ den guten Mächten, welche sie beschützt, geopfert werden.
Nur Marquis Chaushilm war noch ernstlich krank, obgleich er nach der festen Versicherung des Arztes dem Leben erhalten bleiben würde. Doch auf dem ›Amor‹ konnte er die Reise nicht mit antreten, er mußte entweder hierbleiben und seine Genesung abwarten oder durfte höchstens auf dem Landweg weitertransportiert werden.
Die stille und doch so energische Miß Sargent entschloß sich fürs erstere. Kapitän Hoffmann hatte ihnen alles Nötige zur Verfügung gestellt, besser, als hier, konnten sie es nirgendswo finden.
Miß Sargent erklärte entschieden? den Marquis nicht eher verlassen zu wollen, als bis er wieder gesund sei, er sei die einzige Person auf der Welt, an der noch ihr Leben hänge, und daß sie ihn nach seiner Genesung verließe, stand nicht zu erwarten. In dieser Hoffnung lebte der Verwundete langsam wieder auf, eine bessere, treuere und aufopferndere Pflegerin, als Miß Sargent, konnte er nicht finden. Tag und Nacht saß sie bei dem Kranken, seine heiße, abgezehrte Hand in der ihrigen. Sie schlief neben ihm in dem Lehnstuhl und sprach der Fiebernde von Kasegora, welche ihn auch einst so gepflegt hatte, so lächelte das Mädchen nur. An Eifersucht dachte sie nicht, dieser Mann, dem sie zweimal das Leben gerettet hatte, gehörte ihr.
Mister Hoffmann war in Begleitung von Nick Sharp abgereist, niemand wußte wohin, und Johanna mußte sich damit trösten, daß er ihr eine baldige Rückkehr zugesichert hatte.
Die Verwundeten fühlten sich in ihrer Heilstätte wohl, und die Gesunden waren glücklich. Die Besitzung Hoffmanns war ein kleines Paradies. Stundenlang konnte man durch den Park von tropischen Gewächsen gehen, die Gärten hauchten balsamischen Duft aus, und die Villa lieferte alle Bequemlichkeit; was ausging, wurde schnell wieder ergänzt.
Jeden Morgen brachten Wagen Nahrungsmittel und alles das, was die Verwundeten, Aerzte und Gesunde nötig hatten oder auch nur wünschten.
Der Verwalter durfte auf Befehl Hoffmanns nichts sparen. Der Silberkönig — als solcher war Hoffmann jetzt allen bekannt — hatte das auch wahrlich nicht nötig.
Hannes und Hope saßen auf einer Bank im Schatten eines blühenden Granatapfelbaumes, ließen die Vergangenheit an ihren Augen vorüberziehen und schmiedeten Pläne für die Zukunft.
»Weißt du,« sagte Hope, »ebenso, wie jetzt, saßen wir in Batavia auf der Besitzung des Holländers und machten aus, daß wir später auf einem eigenen Schiff die Welt umsegeln wollten. Nun hat sich alles erfüllt. Welche Umänderungen aber waren nötig, ehe es soweit kam!«
»Ja, und in Batavia, nach jenem Feste, erkannten wir, daß wir uns liebten.«
»Und du warst so trotzig.«
»Ich glaubte, du spottetest über mich.«
»Es war mein Ernst, ich liebte dich.«
»Ich konnte nicht ahnen, daß eine reiche Amerikanerin einen armen Matrosen lieben könnte.«
»Der sich später als Freiherr entpuppte und das reiche Mädchen als armes, verstoßenes —«
»Na, meine Freiherrnwürde hat auch nicht lange gedauert.«
»Aber es hat doch noch alles glücklich geendet.«
»Und ein eigenes Schiff haben wir auch.«
»Hannes,« sagte Hope nach einer Weile seligen Stillschweigens, »ich denke, wir geben das Seereisen auf.«
»Warum denn?« fragte Hannes betrübt.
»Es gefällt mir nicht mehr. Wir sind immer in Gefahr, des Lebens werden wir doch nie froh.«
»Früher dachtest du anders. Dir konnte es nie gefährlich genug werden.«
»Jetzt ist das etwas anderes. Um mich sorge ich mich noch immer nicht, wohl aber um dich. Ich bitte dich, Hannes, wir warten, bis die Kranken genesen sind, bis der allgemeine Aufbruch erfolgt, dann treten auch wir die Heimreise an. Ich gehe mit dir nach deinem Deutschland, dort wollen wir ein fröhliches, ungetrübtes Leben führen.«
»Wie du willst, Hope, ich bin ja nur glücklich, wenn du dich glücklich fühlst.«
»Ich wußte, daß du mir beistimmen würdest. Auch gedenke deiner Eltern, denen zweimal der Sohn entrissen wurde. Du sagtest ihnen beim Wiedersehen zugleich ein Lebewohl; glaube mir, sie sehnen sich doch nach dir.«
»Ach Gott, ich kenne fast keine Liebe zu ihnen mehr. Das Schicksal hat so mit mir gespielt, daß ich fast gar nicht mehr glauben kann, je Eltern gehabt zu haben. Erst der Sohn einer alten Frau, die fremde Kinder aufzog, dann das Kind eines Freiherrn und nun wieder der Sohn von anderen. Von wem soll ich nun glauben, daß sie meine Eltern sind?«
»Weißt du, daß wir dem Namen Schwarzburg schon einmal begegnet sind?«
»Wie meinst du das?«
Hope erzählte von Kora-hissar, was zu deutsch Schwarzburg hieße, von Salim und Sulima, und wie Johanna Lind der Ansicht sei, daß Kora-hissar die Schwester des alten, verstorbenen Freiherrn von Schwarzburg gewesen wäre. Emil von Schwarzburg hätte auf dem Sterbebett gestanden, daß die Schwester durch seine Intrigen unschuldig vom Vater verstoßen worden, und daß sie in der Türkei verschollen sei.
»Ich spreche gerade jetzt davon,« schloß Hope, »weil Johanna die Zeit während ihres Getrenntseins von Hoffmann dazu benutzen will, den Freiherrn Johannes von Schwarzburg, deinen ehemaligen Doppelgänger, über die Verhältnisse schriftlich aufzuklären. Hat Johannes die Absicht, seinen Cousin, allerdings einen Araber, dem Leben in der Wüste zu entziehen, so ist ihm durch Johannas Anweisung die Möglichkeit dazu geboten. Sie sendet ihm auch eine Bibel, welche sie in Kora-hissars Hinterlassenschaft gefunden hat. Johanna selbst will sich nicht mehr mit dieser Sache befassen, sie hat sich als Detektivin genug um fremde Leute gekümmert, nun will sie an der Seite einer geliebten Person das eigene Glück genießen.«
»Hm,« brummte Hannes nachdenkend, »das wäre ein guter Grund, mit der ›Hoffnung‹ noch einen kleinen Abstecher nach Arabien zu machen, uns mit Beduinen zu prügeln und Salim und Sulima im Triumph nach Deutschland zu bringen.«
Hannes hatte bei diesem Vorschlag gelächelt, doch Hope mußte ihn für Ernst nehmen.
»Gehst du wirklich mit solchen Plänen um?« rief sie erschrocken. »Wir haben nun doch wirklich Abenteuer genug überstanden, meine ich, so daß wir uns einmal der Ruhe und des glücklichen Beisammenseins freuen könnten. Und nun gehst du wieder damit um, dich von neuem in Gefahr zu stürzen.«
»Es war mein Ernst nicht,« tröstete Hannes und streichelte zärtlich die Hand seiner jungen Frau, »aber dennoch möchte ich eins erwähnen. Wir beide sind sonderbare Naturen, gleich abenteuerlustig angelegt und keine besonderen Freunde der Ruhe. Siehst du das nicht ein?«
»Wir haben uns die Hörner nun abgelaufen, wie ihr Deutschen sagt.«
»Aber sie werden uns wieder wachsen,« scherzte Hannes. »Gewiß sehne auch ich mich nach Ruhe, ich möchte mit dir allein ein stilles, glückliches Leben führen, fern vom Geräusch der Welt, eines nur auf das andere angewiesen; aber bei klarer Ueberlegung muß ich mir sagen, daß auch einst die Zeit wiederkommen wird, da ich mich nach der Welt zurücksehnen werde. Glaubst du, liebe Hope, daß du es aushalten wirst, bis an dein seliges Ende mit mir Küsse zu tauschen? Wir beide sind von anderem Schlage, als daß uns eine sorglose Untätigkeit befriedigen könnte.«
»Du hast recht,« seufzte Hope, »tief in unserem Inneren steckt ein Drang nach Leben und Tätigkeit. Er kann wohl eingeschläfert werden, aber er erwacht immer wieder. Wer nie hart gearbeitet hat, kennt nicht den Genuß der Ruhe, wer keine Gefahren bestanden hat, weiß nicht, wie köstlich die Sicherheit ist, und insofern hat man eine gewisse Berechtigung, sich freiwillig schwerer Arbeit und drohenden Gefahren zu unterziehen, ohne die Absicht dabei zu haben, die Kräfte und das Selbstbewußtsein zu stärken. Wer aber diese nachfolgenden Genüsse einmal gekostet hat, der sucht, wenn sie entschwinden, immer wieder Arbeit und Gefahr auf, um sich von neuem den Genuß von Ruhe und Sicherheit zu verschaffen. Deshalb glaube ich auch, es wird die Zeit wiederkommen, da ich nach einem anderen Leben verlange, wenn es auch nicht so aufregend zu sein braucht, wie ich es bisher geführt habe.«
»Es gibt Leute, welche ohne Arbeit leben. Sie schlafen, essen und trinken.«
»Nenne das nicht Leben,« rief Hope unwillig, »es ist ein bloßes Vegetieren. Das Pferd, welches den Wagen zieht, steht tausendmal höher in meiner Achtung, als ein solcher Mensch, ja, selbst der Ochse im Stall ist nützlicher, denn man verwertet sein Fleisch. Uebrigens machen sich auch solche Menschen Arbeit, um sich darauf Genuß zu verschaffen, sie gehen spazieren, damit das Essen besser schmeckt und sie schlafen können. Aus diesem Grunde ist auch der Sport entstanden; wir selbst, ich meine die Vestalinnen, haben ebenso, wie die Herren des ›Amor‹, zu diesem Mittel gegriffen. Viel gescheiter wäre es gewesen, hätten wir, statt planlos herumzufahren, eine Ladung Salz nach Afrika gebracht und dafür Elfenbein eingetauscht.«
»Ich will dir etwas gestehen,« begann Hannes nach einer kleinen Pause wieder, »doch ich wünsche nicht, daß du mich für einen gottlosen Menschen hältst.«
»Sprich dich nur offen aus!«
»Es ist etwas ganz Abscheuliches.«
»So etwas traue ich dir nicht zu, ich kenne dich besser.«
»Nun gut. Wir sprachen gerade von Untätigkeit, und die war mir von jeher verhaßt, ohne daß ich wußte, warum. Jetzt weiß ich, ich mußte tätig sein, mußte arbeiten, sonst konnte ich weder essen noch schlafen.«
»Ist das so ein gotteslästerlicher Gedanke?« lachte Hope.
»Der kommt noch. Als der Lehrer mir früher vom Paradiese erzählte, da wollte es mir gar nicht in den Kopf, daß dort wirklich ein so sehr schönes Leben sein sollte. Immer unter den Lebensbäumen liegen, Gott ansehen und dabei den ganzen Tag lang Hallelujah singen? Nein, das gefiel mir nicht, davor grauste mir. Ich habe es nur einmal ausgesprochen, aber nie wieder, denn der Lehrer hat mich so geprügelt, daß ich weder sitzen noch liegen konnte. Nun, warum lachst du nicht, warum schimpfst du mich nicht meiner Torheit wegen aus?«
Aber Hope lachte nicht, ernst blickte sie vor sich hin.
»Weißt du, Hannes, was du jetzt eben gesagt hast?«

»Jedenfalls großen Unsinn.«
»Nein, dasselbe, was ein Landsmann von dir, ein deutscher Dichter und Philosoph gesagt hat.«
»Philosophen kommen in die Hölle, lehren die Pfaffen, aber was sagt er denn?«
»Er sagt: Käme ich in ein Paradies, ich würde bald unzufrieden sein. Ich würde das Paradies in eine Wüste verwandeln und aus dieser mir ein neues Paradies schaffen.«
Plötzlich sprang Hannes mit blitzenden Augen auf.
»Schaffen, das ist das richtige Wort,« rief er enthusiastisch, »Wir wollen uns ein Paradies erst schaffen, Hope! Auf der Erde finden wir doch keins, und wäre dies der Fall, so fühlten wir uns bald nicht mehr glücklich darin, weil wir es nicht haben entstehen sehen. Ja, Hope, mit eigenen Händen wollen wir uns ein Paradies schaffen!«
Hope war eine Natur, die sich leicht zur Begeisterung hinreißen ließ, und so faßte sie den Gedanken von Hannes sofort freudig auf.
»Gut,« rief sie, »laß uns erst von diesen langen Strapazen ausruhen, dann wollen wir daran denken, uns ein Paradies zu bauen. Aber bedenke, vollkommen ist hier nichts auf Erden, etwas bleibt immer zu wünschen übrig.«
»Nach dem Fehlenden zu streben, ist auch schon schön, selbst wenn es nicht erreichbar ist.«
»Unser Leben ist kurz, wir können über der Schöpfung des Paradieses sterben.«
»So arbeiten unsere Kinder und Kindeskinder weiter daran, bis der Bau vollendet ist. Allein der Gedanke daran macht mich schon glücklich.«
»Und wo wollen wir uns das Paradies herrichten?« fragte Hope. »In Deutschland?«
»Ja, wo? Deutschland eignet sich nicht gut dazu.«
»Warum nicht?«
»Wir wollen doch nicht immer allein bleiben.«
»Du willst auch andere mit hereinziehen?«
»Natürlich. Wir sind reich. Das Paradies, welches wir uns schaffen, wollen wir mit anderen teilen.«
»Aha! Du denkst an eine Kolonie!«
»Richtig! Eine Kolonie wollen wir gründen, eine Insel mitten im Weltgetriebe, auf der wir, unbekümmert um die anderen, nach unserem Gutdünken hausen.«
»Dann entsteht Unfrieden.«
»Das ist nicht wahrscheinlich. Wir nehmen Personen nur nach reiflicher Prüfung auf, und wer Unfrieden stiftet, wird einfach für immer ausgewiesen.«
»Warum wollen wir nicht solch ein Unternehmen in Deutschland anfangen?«
»Weil dann jeden Monat die Steuersammler, Polizisten, Gesundheitsinspektoren kämen und herumschnüffelten. Nein, Hope, das ist nichts. Wir beginnen eine Kolonie von Grund auf, wie Robinson, nur daß wir alle Hilfsmittel besitzen. Dazu aber ist nötig, daß wir völlig abgeschlossen sind, sonst ist so etwas nicht möglich.«
»Gut, dann siedeln wir uns auf einer Insel an.«
»Ach, jetzt weiß ich es,« rief Hannes erfreut. »Erinnerst du dich noch, was für Pläne wir in Batavia hatten? Ja, das machen wir. Wir gründen eine Republik —«
»In der du König sein wolltest,« lachte Hope.
»Das war Unsinn von mir. Wir bauen Schiffe und werden die Stammeltern eines neuen Seefahrervolkes.«
»Ach, Hannes, du hast hohe Pläne. Wo bleibt denn dann das Paradies? Es wird ein Jagen nach Gewinn. Reich können wir wohl werden, aber nicht glücklich.«
»Du hast recht,« gab Hannes kleinlaut zu. »Auf die Weise verschaffen wir uns kein Paradies auf Erden.«
»Ich habe einen anderen Plan. Wir suchen uns eine Insel aus; es gibt deren noch genug, die äußerst fruchtbar sind, aber nur von Wilden bewohnt werden. Wir kaufen sie dem Staate ab, dem sie gehört, und legen darauf eine Kolonie an. Wir suchen uns arme, aber würdige Personen aus, welche gern arbeiten möchten, aber keine Arbeit haben, rüsten sie mit allem aus, was sie zum Häuser- und Landbau nötig haben, mit Ackergeräten, Handwerkszeug und so weiter und schaffen sie nach der Insel. Wir selbst fahren mit und leiten ihre Arbeiten. Was meinst du, Hannes, ist das nicht ein herrlicher Plan?«
»Das ginge. Doch wo gibt es wohl noch solche Inseln?«
»Nun, an der Westküste von Afrika liegen zum Beispiel die Juan Fernandez-Inseln, prachtvoll, reich an Blumen, Wiesen und Wasser.«
» All right. Auswanderer finden wir sofort. Wir suchen die aus, die uns gefallen, so ungefähr zwanzig mit Frau und Kind, Bauern und Handwerker, packen sie auf die ›Hoffnung‹ und bringen sie nach der Insel. Wenn wir selbst tüchtig mit Hand anlegen, muß bald aus der Wildnis ein Paradies entstehen.«
»Und Tiere dürfen wir nicht vergessen: Rinder, Schafe, Schweine, Hühner, Enten und Gott weiß was alles.«
»Hm, alles ganz hübsch, wunderbar hübsch, aber das kostet schrecklich viel Geld,« meinte Hannes vorsichtig.
»Wir haben doch sechs Millionen Mark.«
»Ich kalkuliere, die würden bald alle sein.«
»Dann müssen mir Geld aufnehmen.«
»Mit Schulden anfangen ist nicht gut.«
»Fast alle Kolonien haben mit Schulden angefangen, denke an die australischen!«
»Nun, vielleicht gäbe Hoffmann etwas dazu.«
»Richtig, und die englischen Herren und die Vestalinnen auch. Sie dürfen uns dafür auch einmal besuchen.«
»Das sage ich aber gleich, wenn sie Zank anfangen, werden sie sofort 'rausgeworfen.«
»Ich auch?« fragte eine Stimme, und aus dem Gebüsch trat lächelnd Johanna hervor.
»Nun, wenn Sie recht artig sind, dürfen Sie einige Wochen bei uns bleiben,« lachte Hannes. »Aber wenn so zum Beispiel Williams mit seinen Witzen dazwischenkäme, dem würde sofort die Insel für immer verboten werden.«
»Dann zahle ich auch nichts dazu,« klang es links, und Sir Williams mit Miß Thomson kamen herbei. Sie hatten das Gespräch der beiden belauscht.
»Du, Hannes, dann müßten wir eine Ausnahme machen,« sagte Hope lachend.
»Keine Ausnahme,« erklärte Hannes entschieden, »wer Unfrieden stiftet, muß 'raus.«
»Und wenn nun gerad' kein Schiff da ist?«
»Da wird der Betreffende ins Wasser geworfen und muß schwimmen.«
Alle lachten, aber die Pläne wurden weitergesponnen, wobei die drei Neuangekommenen mithalfen. Hannes und Hope nahmen die Sache ernst.
»Das wird herrlich!« rief letztere und klatschte in die Hände. »Wir wollen die Kolonie schon in die Höhe bringen. Aber gearbeitet muß natürlich werden. Faulenzer können wir nicht gebrauchen. Da soll es keine Sorge mehr geben, jeder hat das, was er zum Leben gebraucht.«
»Gewiß,« ergänzte Hannes. »Alle arbeiten für einen, und einer für alle. Was überschüssig ist, wird für später aufgehoben, wenn einmal Not eintreten sollte.«
»Wer wird denn alles aufgenommen?« fragte Williams.
»Vorläufig sind nur die darauf, welche wir mitgenommen haben.«
»Ah so, sonst wollte ich sagen, es würden sich ziemlich viele melden.«
»Wir wollen nur der Welt ein Beispiel geben, wie glücklich man auf Erden leben kann.«
»Also, es wird ein Staat im kleinen?«
»Ja, ein Musterstaat.«
»Hm, alles ganz hübsch. Wenn aber nun Subjekte darunter sind, welche die Eintracht stören, stehlen und so weiter?«
»Sehr einfach! Die bekommen erst tüchtig die Jacke voll, und dann werden sie an die Luft gesetzt.«
»Das läßt sich hören. Auf einer Insel soll die Kolonie gegründet werden?«
»Ja.«
»Wenn diese nun übervölkert wird?«
»Dann werden andere Kolonien angelegt, welche von der ersten mit verwaltet werden.«
»Ah, eine Verwaltung gibt es auch?«
»Nun natürlich, Gesetze, Gerichtsbarkeit, alles ist vorhanden, nur daß diese von den Kolonisten festgesetzt werden.«
»Da gibt es auch so eine Art von Fürsten?«
»Keinen Fürsten.«
»Aber einen Herrn?«
»Ja, der gewählt wird.«
»Ach so, also einen Konsul?«
»Richtig, einen Konsul,« rief Hope. »Und Hannes wird der erste.«
»Das heißt, wenn ich dazu gewählt werde,« fügte Hannes bescheiden hinzu.
»So etwas ließe sich wohl arrangieren,« meinte Williams, »aber dazu gehört im Anfang viel Geld, weil die Insel die Kolonisten nicht gleich ernähren wird.«
»Das ist es ja eben, Sir Williams, wieviel können Sie mir dazu vorschießen?«
»Ich habe augenblicklich nichts bei mir.«
»Jetzt natürlich nicht, später.«
Williams machte mit einem Male ein erstauntes Gesicht.
»Ja, Hannes, ist denn das mit der Inselkolonie Ihr wirklicher Ernst?«
»Unser völliger Ernst,« riefen Hannes und Hope gleichzeitig. »Halten Sie so etwas nicht für möglich?«
»Möglich ist es wohl, warum nicht? Aber das kann nicht mit einem Male aus der Luft gegriffen werden, man muß vorher alles reiflich überlegen, die Kosten ausrechnen, Gesetze ausklügeln, welche später den Kolonisten zur Wahl vorgelegt werden, wenn kein despotischer Staat entstehen soll, und schließlich muß man jeden Fall überlegen, der später einmal eintreten kann, um ihn sofort zu lösen.«
»O, dazu haben wir Zeit. Nach einem Jahr schon können wir damit beginnen.«
»Ferner ist nötig, die Geschichte anderer Kolonien zu studieren, ja, die ganze Weltgeschichte, denn eine Insel ist eine Welt für sich, es kann sich alles auf ihr abspielen.«
»Nein, damit bin ich nicht einverstanden,« rief Hannes, »ich will kein Muster haben, nach dem ich schaffe, nach meinem gesunden Menschenverstand will ich handeln, mehr aber nach meinem Herzen.«
»Hm, das hat auch etwas für sich. Aber Sie werden dabei oft in die Brüche kommen.«
»Tut nichts, durch Schaden wird man klug. Ich kenne keine Kolonie, welche so verwaltet wird, wie ich es von der meinigen wünsche.«
»Doch, es gab welche, aber sie gingen unter, weil sie auf einer zu schwachen Basis standen.«
»So werde ich zeigen, daß sich eine Kolonie nach meinem Sinne halten kann.«
»Dennoch ist es gut, wenn Sie sich nach Mustern richten.«
»Gibt es denn solche?«
»Gewiß, massenhaft.«
»Ich habe nie von solchen gehört, höchstens von den Flibustiern, bei denen es kein persönliches Eigentum gab. Auch der Hinterwäldler holt sich das aus dem Blockhaus seines Nachbarn, was ihm fehlt, aber das sind keine organisierten Gesellschaften.«
»Es gab solche, doch konnten sie sich nie halten,« erklärte der belesene Williams, »weil der menschliche Egoismus dies nicht zuließ. Es traten immer Personen auf, welche herrschsüchtig waren, und schließlich gelang es ihnen immer, ihre Mitmenschen durch Versprechungen so weit zu bringen, daß sie ihnen gehorchten, anfangs ohne, daß sie es wußten. Als ich vorhin von Mustern sprach, meinte ich solche, welche geistvolle und erfahrene Männer schriftlich niedergelegt haben als ein Ideal, das zu verwirklichen es ihnen an Mitteln, Unternehmungsgeist oder auch an Mut fehlte, weil sie wußten, auf welche kolossale Hindernisse sie stoßen würden.«
»Ich weiß, an wen Sie denken,« rief Hope. »Sie meinen Plato.«
»Ja, erstens Plato, dann noch viele andere. Plato ließ einen Staat, in dem es kein Privateigentum gab, auf der Insel Atlanta entstehen, einer riesigen Insel, so groß wie Asien und Afrika zusammen, welche im atlantischen Ozean liegen sollte. Es war natürlich nur eine Phantasie. Ein noch besseres Muster gibt ein Landsmann von mir, Thomas Morus, der Kanzler Heinrichs VIII., welcher ums Jahr 1500 sein berühmtes ›Utopia‹ schrieb.
»Utopia ist ein solcher idealer Staat, auf einer Insel gelegen. Seitdem sind solche Zukunftsstaaten wie Pilze aus der Erde geschossen, das heißt, nur auf dem Papier, alle aber sind mehr oder weniger Nachahmungen des unsterblichen Werkes von Thomas Morus. Verwirklicht ist bis jetzt noch keiner worden.«
»Ich weiß, warum,« sagte Hannes. »Weil man die Suche immer gleich zu groß anfing. Ein ganzes Volk umzubilden, halte ich für unmöglich; nein, klein muß man anfangen und groß aufhören.«
»Sie mögen darin recht haben,« entgegnete Williams, »das Wort ›unmöglich‹ sollte überhaupt keine Geltung mehr haben.«
»Dann muß das neue Utopien unbedingt eine Insel sein. Die Kolonisten dürfen mit anderen Menschen gar nicht in Berührung kommen.«
»Das sah auch schon Utopus, der Gründer von Utopien ein,« fügte William hinzu. »Sein neues Land war zwar keine Insel, sondern nur eine Halbinsel, er ließ aber die Landenge durchstechen. Ich frage Sie nun nochmals, Mister Vogel, ist es Ihnen, einem reichen Mann, der in aller Bequemlichkeit leben kann, wirklich völliger Ernst mit dem Plane, die Gründung einer Kolonie zu versuchen, in der Sie Ihre Ideale verwirklichen wollen?«
»Ich tue es,« rief Hannes enthusiastisch.
»Haben Sie sich auch überlegt, welch ungeheuere Arbeit Sie sich damit aufbürden? Sie gehören dann nicht mehr sich, noch Ihrer Gemahlin, Sie gehören nur noch der Kolonie. Bedenken Sie die Sorgen, den Aerger, die Verzweiflung, die Sie manchmal beim Scheitern von Plänen empfinden werden!«
»Aber das Glück vergessen Sie, welches wir fühlen werden, wenn wir eine Kolonie aus einem Nichts entstehen sehen! Nicht Hope, wir führen es aus?«
Das Gespräch ward wieder heiter. Lord Hastings und seine Braut kamen dazu, und alle halfen jetzt, die künftige Kolonie in Gedanken wenigstens zu gründen. Hannes sah sich schon hinter dem Pflug, Hope freute sich darauf, wenn sie erst als Lehrerin der Kinder fungiere und mit Hannes die Regierungsgeschäfte übernehme. Man baute schon in Gedanken Häuser, Scheunen und Ställe auf, machte Gesetze, stritt sich um sie, schlug andere vor, berechnete die Kosten, kurz, in Gedanken erhob sich auf einer Insel schon eine blühende Kolonie, und als eine Glocke zum gemeinsamen Mittagstisch rief, war sie fix und fertig.
Lachend eilten die Hungrigen zur Tafel, Williams folgte mit Betty langsamer.
»Ein tolles Paar,« lachte Betty, »Pläne haben sie fortwährend, und nie können sie ihnen phantastisch genug sein. Warum bist du so ernst, Charles?«
»Du glaubst, Hannes und Hope geben sich nur mit Träumereien ab?«
»Natürlich, was denn sonst? Sind sie bei klarer Vernunft, so kommen sie auf andere Gedanken. Dann sehen sie ein, was für ein undankbares Geschäft es ist, sein eignes Glück zu opfern, und fremde Menschen glücklich zu machen.«
Williams seufzte tief auf, weswegen Betty ihn verwundert anschaute.
»Du teilst doch nicht etwa gar ihre Ansichten? Möchtest du ihnen helfen, solch eine Kolonie zu gründen?«
»Warum nicht?«
»Ach geh, du spaßest.«
»Ich spaße nicht. Ich möchte ihnen helfen, wenn meiner nicht andere Pflichten warteten. Eins aber weiß ich: wenn alle Menschen so dächten, wie Hannes und Hope, dann sähe es in der Welt anders aus.«
Einige Tage später herrschte auf der Besitzung Hoffmanns eine allgemeine Aufregung. Eines Abends traf Nick Sharp ein in der Begleitung von zwei rauhen Hinterwäldlern, welche einen feingekleideten Herrn gefesselt mit sich führten.
Das Erstaunen wuchs, als Miß Murray in diesem Mann ihren Cousin erkannte. Mitleid fühlte sie nicht mit ihm. Sein Gespräch mit Spurgeon im Walde von Matagorda hatte ihr seinen verbrecherischen Charakter verraten.
»Nummer eins,« sagte Sharp. »Die übrigen wird Mister Hoffmann mitbringen, kalkuliere ich. Das wird eine Freude werden, wenn sie sich hier wiedersehen.«
Kirkholm beachtete nicht die erstaunten und unwilligen Blicke der Damen und Herren; finster schritt er zwischen seinen Wächtern und wurde in ein starkgebautes Häuschen gesperrt, welches wie zum Gefängnis geschaffen war.
Sharp stellte Posten von deutschen Matrosen auf und gab den Befehl, den Gefangenen bei einem etwaigen Fluchtversuch rücksichtslos zu erschießen, so daß Kirkholm diese Weisung hörte, er konnte sich darnach richten.
»Was wollen Sie mit ihm beginnen?« fragte Miß Murray den Detektiven.

»Vor allen Dingen im eigenen Gewahrsam halten, bis der Prozeß gegen ihn eingeleitet wird. Dazu ist nötig, daß wir auch die andere Sippschaft haben, welche unter dem Namen des Meisters unzählige Verbrechen verübt habt: Diebstähle, einfache Morde, Raubmorde und so weiter. Ich kann Ihnen das Treiben der Bande nicht mit kurzen Worten enthüllen, es wird später alles ans Tageslicht kommen. Nur so viel will ich Ihnen sagen, daß Kirkholm zu jenen Schurken gehört, denen es nicht darauf ankam, eine ganze Schiffsbesatzung von Hunderten von Menschen zu vergiften, konnten sie sich dadurch bereichern.«
»Wollen Sie die Sache nicht gleich den Gerichten übergeben?«
»Nein, noch immer können Helfershelfer auftauchen, welche die Genossen befreien. Erst muß ihre ganze Schlechtigkeit enthüllt werden, dann ist es Zeit, sie den Gerichten auszuliefern.«
In einiger Entfernung hatte Ellen gestanden und mit einer Freundin gesprochen, zugleich aber dem Zwiegespräch der beiden gelauscht. Jetzt trat sie auf den Detektiven zu.
»Mister Sharp,« sagte sie lächelnd, »Sie versuchen umsonst, Ihrem Benehmen gegen die Gefangenen oder noch gefangenzunehmenden Personen einen anderen Beweggrund zu geben, als den, den Sie wirklich haben.«
Sharp verbeugte sich.
»Miß Petersen, ich habe nie an Ihrem Scharfsinn gezweifelt.«
»Darf ich Sie überzeugen, daß ich mich nicht getäuscht habe?«
»Bitte! Ich bemerke aber gleich, daß der Grund zu meiner Handlungsweise nicht fern liegt.«
»Allerdings nicht.«
»Nun?«
»Sie wollen die Ehre, das Gewebe der Verbrecherbande aufgedeckt zu haben, einzig für sich allein besitzen. Ich vermute, Sie beginnen mit einem Privatprozeß und endigen mit Anklagen, wie sie die Welt bisher noch nicht zu hören bekommen hat. Die Beweismittel liegen einzig und allein in Ihrer Hand, und Sie werden dafür sorgen, daß sie Ihnen nicht genommen werden.«
»Ihr Scharfsinn hat Sie nicht betrogen, so ist es,« gestand der Detektiv. »Uebergebe ich nämlich die Sache den Gerichten, so trete ich zwar als Hauptzeuge auf und spiele allerdings eine bedeutende Rolle, aber das Hauptverdienst wird mir doch von höhergestellten Personen entrissen. Ich will aber die Ehre für mich ganz allein besitzen, die Verbrecher entlarvt und gefangen zu haben. Diejenigen, welche mir dabei geholfen haben, werde ich natürlich nennen.«
»Lassen Sie nur uns möglichst aus dem Spiele, wir haben genug davon,« lachte Ellen.
»Möglichst, ja, aber ganz werden Sie mir Ihre Aussagen doch nicht vorenthalten.«
»Wenn wir als Zeugen verlangt werden, müssen wir natürlich gehorchen, so unangenehm auch derartige öffentliche Verhöre uns sind.«
»Es soll alles schriftlich abgemacht werden.«
»Ah, das ist schön. Und glauben Sie, aus Ihren Bemühungen Vorteile ziehen zu können?«
»Die allergrößten. Das Privat-Detektiv-Amt von Nikolas Sharp wird weltberühmt werden.«
»Miß Lind wird Ihnen sehr fehlen.«
»Allerdings. Doch gibt es noch genug gute Kräfte. Gern hätte ich Miß Morgan engagiert, allein dieses Weib war zu verdorben.«
»Wie? Selbst aus Verbrechern würden Sie Ihre Beamten rekrutieren?«
»Sogar mit Vorliebe. Gar viele von den Personen, welche einst in verbrecherischer Weise gegen Sie operiert haben, werden mir noch dienen. Ich nehme sie an.«
»Das Detektivgewerbe ist seltsam,« sagte Ellen kopfschüttelnd.
»Und welcher Mittel bedient man sich heutzutage, um sich einen Ruf zu erwerben!« fügte Miß Murray hinzu. »Jahrelang hat sich Mister Sharp damit beschäftigt, die Spuren der Verbrecherbande zu verfolgen, und ich glaube, fast weniger darum, um sie unschädlich zu machen, als vielmehr, um durch ihre Vernichtung sich einen Namen zu machen.«
»Wissen Sie, meine Damen, auf welche Weise die ›Times‹ in London zu ihrer Berühmtheit gekommen sind?«
Mit diesen Worten trat Mister Youngpig zu der Gruppe.
»Durch die Genauigkeit, mit welcher sie ihren Leserkreis über alle Vorkommnisse in der Welt orientiert.«
»Nicht allein dadurch; dazu gehört nur eine Unmenge von Reportern und eine energische, bemittelte Redaktion. Sie verdankt ihre Berühmtheit hauptsächlich einem Geniestreich, der ihr zugleich den Ruf der Allwissenheit eingebracht hat.«
»Erzählen Sie!«
»London wurde einst von einem kolossalen, noch nie dagewesenen Raub bedroht. Es hatte sich eine Diebesbande gebildet, welche beschlossen hatte, in allen Juwelierläden, Banken und so weiter von ganz London gleichzeitig in ein und derselben Nacht einzubrechen. Jahre vergingen mit der Vorbereitung, ein deutscher Schlosser, in großer Not, lieferte ihnen die Nachschlüssel. Es wurde alles mit so großer Vorsicht betrieben, daß selbst die sonst so scharfsichtige Londoner Polizei nicht das geringste ahnte. Die bestimmte Nacht rückte immer näher heran, da die Bande gleichzeitig in die Läden und Banken einbrechen sollte.«
»Aber wie ist das möglich?« unterbrach eine Dame den Erzähler. »Wenn so viele Einbrüche gleichzeitig stattfinden, müssen die Diebe doch Aufsehen erregen und gefaßt werden.«
»Wohl, gnädiges Fräulein. Einige Einbrüche wären sicher vereitelt worden, meinetwegen die Hälfte, aber die anderen? London ist groß, die Polizei kann nicht überall sein, also Erfolg versprach sich der Leiter der Bande auf jeden Fall. Einige Millionen Pfund Sterling hätte er dabei sicher eingeheimst. Wer gefangen wurde, war es eben, wer entkam, war ein reicher Mann. Sie müssen bedenken, daß Einbrecher Leute sind, welche nichts als ihre Freiheit zu verlieren, aber sehr viel zu gewinnen haben. Der Leiter des Unternehmens aber machte sicher ein gutes Geschäft, er stellte sich nicht bloß und kassierte dann den Raub ein.«
»Nun gut, dies ist mir klar.«
»Die Polizei also merkte nichts, wohl aber kam ein Reporter der ›Times‹ eine jener Spürnasen, die in dem Gewerbe der Verbrecher herumschnüffeln, hinter die Pläne. Er erwarb sich das Vertrauen des deutschen Schlossers, weil er sich für ein Mitglied der Bande ausgab. Als er ahnte, um was es sich handelte, ging er nicht zur Polizei und zeigte das Vorhaben an, sondern zum Chefredakteur der ›Times‹. Dieser Redakteur operierte auf eigene Faust weiter. Für eine hohe Summe wurde der Schlosser gewonnen, alles zu verraten, und er tat es gern, denn es wurde ihm Straffreiheit versprochen. Der Mann war übrigens nicht so sehr schuldig, er hätte die Schlüssel nicht geliefert, wenn er gewußt, wozu sie gebraucht wurden, und dann, als er es erfuhr, war es zu spät — er war zum Mitschuldigen gemacht worden. Kurz und gut, der Redakteur der ›Times‹ beschloß, das Verbrechen mit eigenen Mitteln zu vereiteln und die Täter dingfest zu machen, ohne der Polizei etwas davon mitzuteilen, ja, noch mehr, er sorgte auch dafür, daß die Verbrecher ungestört arbeiten konnten und die Polizei in Sicherheit gewiegt wurde. Durch allerlei Kniffe und Schliche gelang ihm dies auch.
»In der betreffenden Nacht hob der Redakteur mit geworbenen Leuten das Räubernest aus, die gefundenen Nachschlüssel wurden in Gewahrsam genommen, und dies alles geschah, ohne daß die Polizei auch nur eine Ahnung davon hatte. Der deutsche Schlosser dampfte noch in derselben Nacht nach Amerika ab — der Redakteur war ein Mann von Wort.
»Am nächsten Morgen brachten die ›Times‹ eine Erzählung, in welche die eben geschilderten Vorgänge verflochten waren, und sehr wohlgefällig schloß der Erzähler mit den Worten: ›So hat die allwissende Redaktion der ›Times‹ über London gewacht. Millionen von Pfunden wären verloren gegangen, die Polizei war ohnmächtig und ahnungslos. Dank der wachsamen Redaktion sind Unzählige vor unermeßlichem Schaden bewahrt worden.‹
»Man hielt dies eben nur für eine Erzählung, der Polizeidirektor nahm sie sogar übel. Nun denken Sie sich das Erstaunen, als ihm die gefangenen Diebe vorgeführt wurden. Sie gestanden alles offen, ihre Aussagen widersprachen sich nicht, es galt einen kolossalen Einbruch auszuführen, und die gefundenen Schlüssel paßten überall da, wo sie dieselben als passend angaben. Seither war der Ruf der ›Times‹ als bestorientiertes, allwissendes Blatt begründet, selbst die Polizei konnte nicht so schnell in Geheimnisse dringen, wie die ›Times‹. Und wer meine Erzählung nicht glaubt, der gehe nach der Redaktion der ›Times‹.
»Dort hängen zwei Tafeln. Die eine erzählt in goldenen Buchstaben kurz die Geschichte; die zweite enthält eine Dankschrift der vereinigten Juweliere und Bankiers von London an die wachsame Redaktion.«
»Was sagte der Polizeidirektor?«
»Der soll sich tüchtig hinter den Ohren gekratzt haben.«
Die Zuhörer lachten, doch Mister Youngpig hatte die ungeschminkte Wahrheit erzählt.
Am folgenden Tage traf wieder ein Transport von Gefangenen ein. Sie wurden von Hoffmann geführt, und ihre Wächter waren Leute, die im Dienste Nick Sharps standen.
Eine unangenehme Stimmung bemächtigte sich der Damen, jene sechs neuen Gefangenen waren nahe und entfernte Verwandte. Sie waren es, denen die Vestalinnen die Widerwärtigkeiten und Angriffe auf der Reise zum Teil verdankten.
Die Gefangenen fühlten sich auch als Verbrecher. Stumm, ohne den Blick zu heben, schritten sie durch die Reihen derer, nach deren Leben und Besitz sie seit Jahren getrachtet hatten. Dasselbe Häuschen, welches schon Kirkholm beherbergte, nahm auch sie auf. Die Wachsamkeit der Matrosen vereitelte jeden Fluchtversuch, und Sharp sorgte dafür, daß sie auch nicht so leicht zum Selbstmord greifen konnten. Sie wurden in einzelne, wohlverwahrte Stuben gebracht, genau durchsucht und ihnen nicht einmal ein Hosenträger gelassen, an dem sie sich hätten aufhängen können.
Hoffmann und Sharp hatten eine Unterredung.
»Wo ist Elias Kinnaird?« fragte Hoffmann.
»Tot,« entgegnete Sharp finster.
»Tot?«
»Ja, er hat sich nur wenige Meilen hinter der ›Goldhütte‹ vergiftet.«
»Hatten Sie ihn nicht durchsucht?«
»Doch, aber ich vergaß, ihm den Ring vom Finger zu nehmen, was ich bei den anderen Gefangenen nicht wieder versäumt habe. Kinnaird trug einen hohlen Goldreifen, in welchem er Gift verborgen hatte. Er nahm es und starb mir nach wenigen Sekunden unter den Händen.«
»Ist es Ihnen ein großer Verlust?«
»Nein, ich besitze seinen Koffer, und dieser enthält alle Papiere, welche beweisen, daß er den Verbrechern Gift, Betäubungsmittel, falsche Stempel und so weiter lieferte.«
»Was ist nun Ihre nächste Aufgabe?«
»Die, zu welcher Sie erst eine Unterredung mit Miß Petersen nötig haben.«
»Ah so. Lord Harrlington wird sie nicht allein reisen lassen.«
»So kommt er mit.«
»Gut, ich werde es ihnen sagen.«
»Auch Hannes und Hope werde ich zum Mitgehen bewegen.«
»Wie Sie wollen! Wann reisen Sie?«
»Vielleicht heute noch, spätestens morgen früh. Geben Sie mir die Vollmacht, daß ich an Bord des ›Blitz‹ den betreffenden Mann abholen kann.«
»Ich werde Ihnen dieselbe ausfertigen.«
»Gelang Ihnen die Gefangennahme in Little Rock sofort, ohne auf Widerstand zu stoßen?«
»Sofort! Die Schurken waren im Saale des Hotels versammelt, und die größte Bestürzung herrschte unter ihnen. Sie hatten eben die Nachricht erhalten, daß die Rebellen niedergeworfen seien; und daß die englischen Lords dem Kapitän Staunton beigestanden hätten. Als sie die Namen der totgeglaubten Damen lasen, stieg ihre Bestürzung aufs höchste. Sie kamen nicht dazu, ihre Verzweiflung auszudrücken oder neue Pläne zu schmieden, denn ich trat mit Ihren Leuten zwischen sie und erklärte sie für meine Gefangenen. Sie waren völlig gebrochen, ließen sich wie Kinder fesseln und dachten nicht einmal daran, Chalmers zu schmähen, der ihre Namen nannte und sie selbst eine Strecke begleitete.«
»Ist Chalmers dann zurückgekehrt?«
»Er ist in Little Rock geblieben.«
»So wollte ich es.«
»Sie behalten Chalmers bei sich?«
»Ja.«
»Auch ich halte ihn jetzt für zuverlässig.«
»Er ist es. Mister Hoffmann, ich danke Ihnen für Ihre Bemühungen.«
»Ich tat es gern, ich vergalt nur Gleiches mit Gleichem.«
»Nun ist nur noch Flexan aufzuspüren, dann sind alle dingfest gemacht.«
»Er wird niemandem mehr viel schaden können.«
Die beiden Männer trennten sich. Hoffmann ging in die Villa, wo ihn Johanna erwartete, und Sharp spazierte in den Anlagen auf und ab.
Es wurde Abend, und da die Jahreszeit kühl war, so befanden sich nur noch wenige Personen im Freien. Die Verwundeten lagen in den Baracken, ihre Freunde waren bei ihnen, und die Herren und Damen hielten sich in der Villa auf, um die letzten Ereignisse zu besprechen. Auch die Kranken beteiligten sich daran.
Nick Sharp traf während seines Spazierganges nur selten einen fremden Gast oder einen zur Besitzung Gehörenden, und je weiter er sich vom Hause entfernte, je tiefer er in den parkähnlichen Wald drang, desto spärlicher wurden die ihm Begegnenden, bis er endlich ganz allein zwischen den Bäumen wandelte.
Der Detektiv zeigte sich ganz anders, als sonst. Er besaß nicht seine gewöhnliche Gelassenheit; denn bald ging er schneller, bald langsamer, er gestikulierte und, was er sonst nie tat, er murmelte sogar, vor sich hin.
»Eine verfluchte Sache! Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sie ist einfach, aber riskant, reinfallen tue ich auf jeden Fall, so oder so. Merkwürdig, mein Verstand sagt nein, und das Herz? Nun, das wird nicht gefragt. Und dennoch will ich. Ich habe die Westenknöpfe gezählt, die Rockknöpfe gezählt, und immer kommt ein Ja heraus. Sollte das mehr als Zufall sein? Nun, noch einmal will ich es probieren, und zwar an den Hosenknöpfen. Sagen sie auch ja, dann ist es beschlossen. Dann, Nick Sharp, dann begehst du die größte Torheit, die du je im Leben begangen hast, aber mit Absicht, und vielleicht — nun wer weiß.«
»Ja — nein — ja — nein,« begann der Detektiv zu zählen und griff dabei an seine Hosenknöpfe, »ja — nein — ja — nein. Nichts ist es, das Schicksal will nicht. Aber halt, da fehlt ein Knopf. Diese Liederlichkeit darf nicht geduldet werden, und die vorige Zählung gilt natürlich nichts.«
Sharp zog sein Nähetui hervor und begann, sich den fehlenden Knopf anzunähen. Der Detektiv mußte sich wie ein Aal krümmen, um dies tun zu können.
»Verdammt saures Geschäft,« brummte er, »ich hätte es aber bald nicht mehr nötig, wenn —. Ja, wenn; nun, das Herumreisen hat ja nun ein Ende.«
Das schwierige Geschäft war beendet, Sharp fing von neuem an, das Schicksal zu befragen; und natürlich mußte er nun ein »Ja« erlangen.
»Das nennt man das Schicksal zwingen,« sagte er befriedigt, »jetzt heißt es: Entweder — oder.«
Er drehte sich um, der Villa zu, als sein scharfes Auge eine weibliche Gestalt wahrnahm, welche durch die Bäume des Waldes auf ihn zueilte.
»Alle Wetter, sollte das ...? Wahrhaftig, es ist Miß Chalmers. Was hat sie hier zu tun?«
Er sollte nicht lange im Zweifel darüber bleiben.
»Endlich,« rief das junge Mädchen, als es den Detektiven erreicht hatte, »ich habe Sie wie eine Stecknadel gesucht, in der Villa, im Garten und im Park. Wer ahnt auch, daß Sie bei Nacht im Walde herumstreifen!«
»Haben Sie sich so nach mir gesehnt?« entgegnete Sharp in seiner gewöhnlichen, ironischen Weise.

»Haben Sie sich so nach mir gesehnt?« fragte Sharp
ironisch die vor ihm stehende Miß Chalmers.
»Gesehnt gerade nicht, aber ich wünschte Sie zu sprechen,« rief Miß Chalmers lächelnd. Doch gleich wurde sie wieder ernst, und dem Detektiven entging es trotz der Dunkelheit nicht, daß ihre Züge sogar einen sehr ernsten Ausdruck annahmen.
Miß Klara Chalmers, die Cousine von Eugen Chalmers, dem Straßenprediger, der sich nachher als Verbrecher entpuppte, war ein munteres, brünettes Mädchen, nicht gerade ausgelassen, aber doch lieber fröhlich, als traurig. Sonst hätte sie auch nicht unter die Vestalinnen gepaßt.
Ihr ernstes Benehmen war daher auffallend.
»Sprechen Sie sich ruhig aus,« sagte Sharp ermutigend, »wenn Sie Hilfe oder Rat brauchen. Einen bereitwilligeren Freund, als mich, finden Sie nirgends.«
»Ich weiß, Sie haben sich unser stets mit der Fürsorge eines Vaters angenommen, ohne darauf zu achten, daß Ihnen Ihre Dienste mit Undank vergolten wurden.«
»Hm, als Vater fühle ich mich eigentlich noch etwas zu jung,« brummte Sharp.
»Es war ja nur ein Vergleich; ein Vater verliert ebenso, wie die Mutter, nicht die Liebe zu den Kindern, wenn diese ihm auch Sorge machen, ja, selbst wenn sie seine Liebe mit Nichtachtung vergelten.«
»In diesem Falle würde ich meinen Kindern den Stock ordentlich zu schmecken geben.«
»Haben Sie Kinder?«
»Ich? Um Gottes willen, Fräulein, ich habe bis jetzt noch nicht einmal Zeit zum Heiraten gehabt.«
»Dann können Sie allerdings nicht wissen, wie es einem Vater zumute ist, dem sein Kind Schande bereitet —«
»Bitte, lassen Sie den Vater aus dem Spiele,« unterbrach sie Sharp, »ich fühle mich noch zu jung, um Vater sein zu können. In der Hinsicht bin ich unschuldig, wie ein Säugling im Wickelbettchen.«
»Aber vielleicht haben Sie schon einmal bittere Erfahrungen an Verwandten gemacht,« fuhr Miß Chalmers fort, »man nimmt doch immer Anteil an deren Ergehen.«
»Hm, wohl möglich, ich war allerdings noch nie in der Lage, meinen Verwandten zürnen zu müssen,« entgegnete Sharp und im stillen dachte er:
»Teufel, wohinaus will sie denn nur? Aha ja, das könnte möglich sein.«
»Unter jenen Menschen, welche auf unrechtmäßige Weise in Besitz unseres Vermögens kommen wollten, befindet sich einer, der meinen Namen trägt.«
»Ah so, ich verstehe. Sie meinen Ihren Cousin. Es tut mir leid, Ihnen gestehen zu müssen, daß er ein Luftikus ersten Ranges ist.«
Es entstand eine lange Pause, das Mädchen schwieg, und Sharp, der zur Seite schielte, sah, wie ihre Lippen fest aufeinandergepreßt waren, und wie in ihren Augen ein Ausdruck von großer Trauer lag.
Sofort bereute Sharp die eben gesprochenen Worte. Er konnte wohl grob, sogar rücksichtslos sein, aber jemanden kränken, lag nicht in seiner Absicht. Jetzt wußte er, daß dieses Mädchen mit ihrem Cousin, der ihren Namen trug, Mitleid fühlte.
»Ich meinte, Mister Chalmers war ein großer Taugenichts,« sagte er daher, »er scheint jetzt einen anderen Weg einschlagen zu wollen, der ihn wieder zum ehrlichen Menschen macht.«
»Das zu hören, freut mich,« rief das Mädchen, und in ihrer Stimme lag wirkliche Freude, »um so mehr, als es mir ein Mann sagt, den ich schätze.«
»So schätzen Sie mich?«
»Ich schätze Sie als ehrlichen, zuverlässigen Mann, dessen Freund zu sein, jedem eine Ehre sein sollte.«
»Obgleich ich ein Detektiv bin?«
»Ich bin über Vorurteile erhaben.«
»Das freut wieder mich. Doch nun zu Mister Chalmers! Haben Sie seinetwegen eine Frage?«
»Ja. Mister Hoffmann erzählte mir vorhin, Sie würden für das Fortkommen meines Cousins sorgen.«
»Das war eigentlich indiskret von Mister Hoffmann.«
»Er sagte es auf meine Bitte hin, weil er weiß, daß mich das Schicksal Chalmers bekümmert. Er ist ja mein Cousin.«
Merkwürdig innige Verwandtenliebe! dachte Nick Sharp und zog seine Pfeife hervor.
»Dann sei's ihm verziehen. Ja, ich interessiere mich für diesen Mann, er ist ein befähigter Kopf. Er ist zum Verbrecher wie geschaffen.«
»O!«
»Oder auch zum Detektiven.«
»Ach so, Sie wollen ihn zu einem solchen ausbilden?«
»Nein, ich habe noch höheres mit ihm vor. Sie wissen, ich will ein Bureau gründen?«
»Mister Hoffmann erzählte mir davon: eine Art von Beobachtungsamt.«
»Noch viel mehr, ich mache der Polizei Konkurrenz, befasse mich aber natürlich nur mit delikaten Angelegenheiten, welche Gewinn einbringen.«
»Und dabei verwenden Sie Mister Chalmers?«
»Ja, wenn er sich gut hält.«
»Als was?«
»Er wird mein Agent in Australien, ich ernenne ihn zum Direktor der Agentur in Sydney.«
»Ist das eine ehrenvolle Stellung?«
»Ist ein Polizeidirektor etwa kein respektabler Mann?«
»Gewiß. Ich hoffe, nein, ich weiß, daß Mister Chalmers ein anderer Mensch werden wird, daß Sie ihm völliges Vertrauen schenken können.«
»Ich zweifle auch nicht daran, doch eine Probezeit muß er, wie jeder, bestehen.«
»Kennen Sie seine Lebensgeschichte?«
»Er hat sie Mister Hoffmann mitgeteilt, und dieser hat sie mir oberflächlich erzählt.«
»Mister Chalmers war als Knabe gut, liebevoll und weichherzig. Sein Vater, ein Ehrenmann, hatte, schon ältlich, den unglücklichen Gedanken, noch einmal zu heiraten. Ich will keinen Stein auf seine zweite Frau werfen, ich kann ihr nichts nachsagen, aber sie stellte vor der Hochzeit die ungerechte Forderung, das Kind ihres Mannes müsse außer dem Hause erzogen werden. So kam Eugen im Alter von vierzehn Jahren in Pension, und er hat das Haus seines Vaters nie wieder betreten, obgleich ihn dieser und später auch die Stiefmutter zurückhaben wollten. Daß ihn sein Vater wegen seiner Frau aus dem Hause unter fremde Leute gestoßen, hat er nie vergessen können. Er kam, da er ohne alle Aufsicht blieb, in schlechte Gesellschaft, wußte sich aber anscheinend wieder emporzuraffen und studierte Theologie. Er trieb sein leichtsinniges Leben unter der Maske eines frommen Mannes weiter und ist zu dem geworden, als was wir ihn kennen gelernt haben. Wäre er zu Hause geblieben, er wäre nimmer so tief gesunken. Eugen besaß eine gute, edle Natur; er ist verdorben worden, weil man ihn unbarmherzig in die Fremde gestoßen hat. Haß gegen die Eltern war die erste Sünde, welche seine Seele befleckte. Es war nicht seine Schuld, ich wage ihn daher nicht zu verdammen.«
»Sie halten sehr viel von Ihrem Cousin.«
»Weil ich ihn von Jugend auf kenne und weiß, daß ein guter Kern in ihm steckt.«
»Sie haben viel mit ihm verkehrt?«
»Wir waren ständige Spielgefährten, er war mein Beschützer in der Jugend.«
Sharp hatte unterdes seine Pfeife gestopft und zündete sie jetzt an.
»Hm,« brummte er, »so würden Sie sich also freuen, wenn Sie fernerhin Gutes von ihm hörten?«
»Außerordentlich.«
»Nun, ich werde mein möglichstes tun, ihn zu einem guten Menschen zu machen. Es sind mir schon verschiedene solche Kuren gelungen.«
Das Mädchen ergriff seine Hand und drückte sie herzlich.
»Nehmen Sie meinen Dank schon im voraus,« rief sie.
Sharp blickte sie verwundert an; er vergaß sogar das Rauchen. Die nimmt ja ein außerordentliches Interesse an dem jungen Taugenichts, dachte er. Nun ja, für Jugendfreunde behält man später immer noch ein Herz.
»Ist die Sache betreffs Chalmers nun erledigt?« fragte er.
»Sie ist es. Gehen Sie nach der Villa?«
»Noch nicht. Würden Sie mit mir noch etwas hier auf- und abgehen? Ich habe mit Ihnen etwas Geschäftliches zu besprechen.«
»Etwas Geschäftliches?« fragte das Mädchen erstaunt.
»Nun ja, wie man's nimmt.«
»Gern, eine Gefälligkeit ist der anderen wert.«
Beide gingen einige Zeit nebeneinander, ohne daß der Detektiv anfing zu sprechen. Er paffte mächtige Wolken vor sich hin, und als eine solche einmal gerade ins Gesicht des jungen Mädchens kam, bekam dieses einen Hustenanfall.
»Gott, was für einen beizenden Tabak rauchen Sie,« lachte sie und wischte sich die Tränen aus den Augen.
»Es ist aber eine teure Sorte.«
»Er riecht nicht gut.«
»Ich finde das Gegenteil.«
»Ich kann den Tabakrauch nicht vertragen.«
»Nicht?«
Sharp war diesmal außerordentlich galant, ganz gegen seine sonstige Gewohnheit. Er drückte das Feuer aus und steckte die Pfeife in die Tasche.
Gleich darauf hörte Miß Chalmers ein leises Knirschen der Zähne, als bisse ihr Begleiter etwas ab.
»Sie kauen Tabak?«
»Ja, etwas muß man doch zu tun haben.«
»O, pfui!«
»Finden Sie Tabakkauen unanständig?«
»Es ist ordinär.«
Sharp spuckte auch das Priemchen aus.
»Ich füge mich ganz Ihrem Willen,« sagte er. »Ihretwegen würde ich mir sogar das Essen abgewöhnen.«
»Das verlange ich nicht,« lachte das Mädchen. »Aber es wird kalt, wir wollen ins Haus gehen.«
»Einen Augenblick noch, ich habe etwas auf dem Herzen.«
»Sprechen Sie sich offen aus!«
»Nun gut! Sehen Sie, Miß Chalmers, ich bin zweiunddreißig Jahre alt.«
»Nicht älter?«
»Sehe ich denn schon so alt aus?«
»Sie machen immer einen verschiedenen Eindruck.«
»Das ist allerdings fatal, daß Sie mich nicht in meiner wirklichen Gestalt kennen. Ich muß mich Ihnen einmal in derselben vorstellen. Dann bin ich ein noch ganz leidlich aussehender Mensch.«
»Das glaube ich Ihnen gern.«
»Nicht wahr? Sehen Sie, ich bin gewillt, mein unstetes Leben aufzugeben, ich will mich in New-York häuslich niederlassen und von dort aus mein Geschäft, welches sich natürlich über die ganze Welt erstrecken soll, leiten.«
»Ich wünsche Ihnen viel Glück dazu.«
»Danke schön. Vorhin nun habe ich die Knöpfe an meiner Weste gezählt — Sie kennen doch das Spiel: ja, nein, ja, nein, um das Schicksal zu befragen?«
»Ich kenne es.«
»Zählen Sie auch Knöpfe?«
»Nein, ich rupfe Blumenblätter aus,« lachte das Mädchen.
»Ich mache dasselbe mit meinen Knöpfen, das heißt, ich rupfe sie nicht ab — das kostete mir nachher die Mühe des Annähens, ich zähle sie. Und sonderbar, ich blieb bei einem Ja stehen.«
»Das kommt öfters vor.«
»Die Geschichte wird noch merkwürdiger. Ich zähle die Knöpfe meines Rockes — ich endige ebenfalls mit einem Ja.«
»Was haben Sie sich denn gewünscht?«
»Davon später! Ich zähle auch noch meine — meine — anderen Knöpfe, und indem ich mir einen schnell annähe, endige ich auch wieder mit einem Ja.«
»Dann geht Ihr Wunsch sicher in Erfüllung,« lachte Miß Chalmers, »obgleich das Annähen des Knopfes nicht vorschriftsmäßig ist. Aber ich reiße auch manchmal zwei Blütenblätter aus, wenn ich die bejahende Antwort erzwingen will.«
»Und trifft es dann ein?«
»Unbedingt.«
»Gut, dann habe ich Hoffnung.«
»Um was handelt es sich denn nur? Sie tun ja schrecklich geheimnisvoll.«
»Die ersten beiden Male hatte ich das Schicksal um Rat gefragt, ohne mir etwas dabei zu wünschen. Das drittemal aber, als ich mir den Knopf annähte, stieg der Gedanke in mir auf, daß es eigentlich doch jämmerlich ist, wenn ein Mann sich seine Knöpfe selbst annähen muß.«
»Lassen Sie es von einem Schneider besorgen.«
»Der ist nicht immer anzutreffen.«
»So von einem Soldaten, die verstehen sich auf derartige Sachen.«
»Soldaten nähen zu grob, denen kommt es gar nicht darauf an, die Haut mit festzunähen.«
Wieder mußte das junge Mädchen laut auflachen, die Unterhaltung mit dem Detektiven gefiel ihm. Es fühlte jetzt nicht mehr die Kälte des Abends.
»Dann kann ich Ihnen nur noch einen Rat geben, heiraten Sie so bald wie möglich!«
»Das war es, um was ich das Schicksal befragte, und Weste, Rock und alles andere antwortete mit einem Ja. Meiner Heirat steht also nichts mehr im Wege.«
»Wie, Sie wollen heiraten? Nicht möglich!« rief Miß Chalmers erstaunt.
Sie hätte eher den Einsturz des Himmels erwartet, als aus des Detektiven eigenem Munde hören zu müssen, daß er heiraten wolle. Dieser energische, kaltblütige Mann war ihr von jeher als der eingefleischteste Junggeselle erschienen. Doch was vermag die Liebe nicht alles zu tun?
»Nicht möglich?« wiederholte Sharp. »Nanu, warum soll ich denn nicht heiraten können?«
»Die Ueberraschung erpreßte mir diese Worte,« sagte das Mädchen beschämt. »Gewiß, ich glaube, Sie geben einen vortrefflichen Ehemann ab.«
»Nicht wahr, das glaube ich auch!« rief Sharp erfreut.
»Haben Sie schon unter den Töchtern des Landes gewählt?«
»Ich habe gewählt.«
»Ah, darf ich fragen, ob sie eine Deutsche ist, da Sie doch von deutscher Abstammung sind?«
»Sie ist eine Amerikanerin.«
»Werden Sie bald heiraten?«
»Sobald ich mit ihr gesprochen habe.«
»Sie haben dies noch gar nicht getan?«
»Nein.«
»Aber sie weiß, daß sie von Ihnen geliebt wird?«
»Ich glaube, nein.«
»Sie sind ein seltsamer Charakter. Lieben Sie denn das Mädchen?«
»Sehr.«
»Schon lange?«
»Ich kenne es nun seit beinahe drei Jahren, lieben tue ich es seit einem halben Jahre.«
»Und haben mit ihm noch nie darüber gesprochen?«
»Noch nie! Sie wissen, ich beobachte gern lange, ehe ich dem Köder zu Leibe gehe. Ich habe die betreffende Person nun seit drei Jahren fortgesetzt beobachtet, seitdem ich sie liebe, noch genauer, und bin nun zu der festen Ueberzeugung gekommen, daß sie oder keine andere die Meine wird.«
»Das ist schön von Ihnen, aber Sie wissen doch, daß das Mädchen Sie liebt?«
»Bis jetzt hat sie's mir noch nicht gesagt.«
»Das ist auch nicht nötig. Ihnen brauche ich doch nicht erst zu sagen, daß die Liebe auch in anderer Weise, als durch Worte angedeutet werden kann.«
»Sie hat mir noch nichts zu verstehen gegeben.«
»Dann ist Ihre Spekulation eine gewagte.«
»Wieso? Ich finde das nicht! Ich weiß, daß das Mädchen keinen anderen liebt, von keinem anderen geliebt wird, und so trete ich als einziger Bewerber auf.«
»Dann haben Sie allerdings Hoffnung. Aber immerhin, die Liebe ist launisch.«
»Bin ich nicht ein ganz ansehnlicher Mensch?«
»Das sind Sie.«
»Ich habe keine Untugenden an mir.«
»Sie dürfen nicht mehr Tabak kauen.«
»Werde es mir abgewöhnen.«
»Und Ihr Tabak riecht beizend.«
»Ich rauche eine leichtere Sorte.«
»Na, dann können Sie Ihr Glück ja probieren. Aber wie ist mir denn?« Miß Chalmers blieb plötzlich stehen. »Sie sind doch die letzten Jahre fast immer in unserer Gesellschaft gewesen. Sie haben doch nicht etwa die Absicht ...«
»Ich werde sie wohl haben,« nickte der Detektiv.
»Eine der Vestalinnen?«
»Allerdings.«
»Da haben Sie sich wohl getäuscht,« sagte Miß Chalmers, den Weg wieder aufnehmend. »Soviel ich weiß, ist die Hand keiner Vestalin mehr frei.«
»O doch!«
»Ich wüßte nicht, welche.«
»Meinem Auge entgeht nichts.«
»So nennen Sie mir den Namen!«
»Darf ich auf Ihre Verschwiegenheit bauen?«
»Ich plaudere nicht.«
»Nun gut, so werde ich Ihnen den Namen nennen. Sie heißt Klara Chalmers.«
Das Mädchen war stehen geblieben. Erst sah es den Detektiven erschrocken an, dann aber wurde sein Gesichtsausdruck ein unwilliger.
»Wenn Sie glauben, mit mir Scherz treiben zu können, so irren Sie sich,« sagte sie leise und langsam. »Ich verstehe in solchen ernsten Sachen keinen Spaß. Ich kenne Ihre bittere Ironie, aber diese an mir probieren zu wollen, verbitte ich mir ein für allemal. Adieu!«
Sie drehte sich kurz um und wollte dem Hause zueilen, doch schon stand Nick Sharp vor ihr und versperrte ihr den Weg.
Seine Stimme klang ganz anders als sonst, es lag etwas Bittendes darin.
»Aber, verehrtes Fräulein, ich mache ja gar keinen Spaß. Wahrhaftig, ich liebe Sie, ich liebe Sie schon lange, und wenn Sie mich glücklich machen wollen, so sagen Sie mir, daß Sie versuchen wollen, mich wieder zu lieben. Mehr kann ich jetzt nicht verlangen, ich weiß, daß ich nicht zum Brautwerber passe, nehmen Sie daher Rücksicht auf mich, verzeihen Sie mir meine sonderbare Einleitung zu der Werbung.«
Plötzlich wußte Miß Chalmers, daß dieser Mann vor ihr wirklich im Ernst sprach. Lange Zeit stand sie bewegungslos vor ihm, sie machte keinen Versuch, ihre Hände aus der seinen zu befreien, aber ein Zittern verriet ihre innere Bewegung.
»Sprechen Sie! Wird es mir gelingen, Ihre Gegenliebe zu gewinnen?« bat Nick Sharp.
»Nein,« klang es leise, aber bestimmt.
»Wie? Nein?«
»Nein, ich empfinde keine Neigung zu Ihnen, frei und offen gesagt.«
»Fassen Sie den Entschluß nicht so schnell, Sie kennen mich noch nicht.«
»Ich war jahrelang mit Ihnen zusammen.«
»Aber ich bin bemüht, mich immer anders zu geben, als ich wirklich bin. Mein Beruf brachte dies mit sich. Jetzt lege ich ihn nieder, ich will mich so geben, wie ich bin, verkehren Sie mit mir, und Sie werden zur Einsicht kommen, daß es sich mit mir recht gut leben lassen wird! Ich bin ein gutmütiger, friedliebender Mensch, ich begehre Sie nicht zur Frau Ihres Reichtums willen, denn ich gebrauche ihn nicht, ich kann Ihnen ein Leben bieten, wie Sie es nur wünschen mögen, ich liebe Sie, Sie ganz allein, verschenken Sie Ihr Vermögen und werden Sie mein. Klara, sagen Sie, Sie wollen versuchen, mich zu lieben, mich wenigstens erst kennen zu lernen, aber sagen Sie nicht einfach ein kaltes Nein!«
»Mein Nein ist nicht kalt, es tut mir weh,« entgegnete Klara mit zitternder Stimme, »und dennoch, ich muß auf Ihre Frage mit einem Nein antworten.«
»So glauben Sie, mich nicht lieben zu können?«
»Nein.«
»Warum nicht? Erscheine ich Ihnen abstoßend?«
»Nein, wir wollen Freunde werden, Sharp.«
Der Detektiv seufzte tief auf.
»Es ist verdammt hart, derjenigen ein Freund zu sein, welche man liebt.«
»Ich bitte Sie, bleiben Sie mir ein Freund, wie ich stets der Ihre sein werde.«
»Warum nur ein Freund?«
»Weil — ich einen anderen liebe,« kam es leise und zögernd über des Mädchens bebende Lippen.
»Ah, das ist etwas anderes. Dann muß ich mich in mein Schicksal fügen. Ich bin zu spät gekommen.«
Sharps Stimme klang traurig, er ließ die Hände des Mädchens frei, doch dieses ergriff die seinigen von neuem.
»Zürnen Sie mir?«
»Wie sollte ich dies? Ich zürne vielmehr mir, daß ich mich habe von meinem Urteil täuschen lassen. Ich schäme mich jetzt, weil ich mit meinem Scharfsinn geprahlt habe.«
»Ach, niemand weiß, daß ich liebe, Sie sind der erste, der es erfährt.«
»So lieben Sie unglücklich?« fragte Sharp teilnahmvoll.
»Ich liebte unglücklich.«
»Sie fanden keine Gegenliebe?«
»Ich weiß nicht.«
»Wie soll ich das verstehen?«
»Meine Liebe war — ein Verbrechen.«
»Das sind Redensarten.«
»Nein, denn sie galt einem Unwürdigen.«
Sharp war zu zartfühlend, um nach dem Namen zu forschen, er wollte ein anderes Gespräch anfangen, doch Klara kam von selbst auf das Thema zurück.

»Bitte!«
»Mister Sharp, lieben Sie mich wirklich?«
»Von ganzem Herzen.«
»Und wollen Sie nach dem, was ich Ihnen gesagt habe, mir ein Freund bleiben?«
»Zählen Sie auf mich im Leben und Sterben, Sie finden keinen treueren Freund als mich.«
»Ich brauche einen Helfer in der Not.«
»Ich stehe meinen Mann.«
»Es gilt ein Menschenleben zu retten.«
»Wie das?« fragte der Detektiv erstaunt.
Regungslos stand Miß Chalmers vor ihm, seine Hände noch immer in den ihren, vor Erregung zitternd.
»Wen soll ich retten?« fragte Sharp nochmals verwundert.
»Eugen Chalmers,« erklang es flüsternd, noch ein Händedruck, und das Mädchen war verschwunden.
Wie vom Donner gerührt stand Nick Sharp da und blickte der Davoneilenden nach. Dann kam ein langer, leiser Pfiff über seine Lippen.
»Also so steht die Sache!« murmelte er. »Nick Sharp, was für ein großer Esel bist du doch! Ein scharfsinniger Detektiv willst du sein, der schon von weitem riecht, wie es in einem menschlichen Herzen aussieht? Ein blinder Maulwurf bist du!«
Er schlug langsam den Weg nach dem Hause ein.
»Aber nein,« fuhr er dann fort, »du brauchst dir keine solchen schweren Vorwürfe zu machen. An dem Rätsel des Frauenherzens sind schon ganz andere Geister gescheitert als du. Wunderbar, wunderbar! Sie liebt den Taugenichts, den Verbrecher. ›Eugen Chalmers,‹ wie schmelzend konnte sie den Namen aussprechen! Herrgott, da könnte einem doch der Verstand stillstehen! Und ich, der ich sie liebe? Ich soll aus ihm einen guten Menschen machen, damit sie ihn heiraten kann! Man könnte sich doch gleich den Kopf am nächsten Baume zerschmettern, aber leider habe ich einen harten Schädel. Was hilft's, ich muß mein Wort halten, umsonst soll sie nicht an meine Freundschaft appelliert haben. Mein Los wird nun wohl sein, Junggeselle zu bleiben, denn zum zweiten Male mag ich mich nicht so furchtbar blamieren. Das war mein erster Irrtum, meine erste verfehlte Spekulation, meine erste Niederlage, eine zweite mag ich nicht wieder erleben, so wahr ich Nick Sharp heiße.«
Die erleuchteten Fenster der Villa tauchten vor ihm auf, heiteres Lachen schlug an seine Ohren.
»Glückliche Menschen, wie sie lachen und scherzen! Nur ich bin unglücklich, ich bin nur als Freund brauchbar. Ich kann meine Knöpfe ewig allein annähen. Verdammte Knöpfe, ihr allein seid an meinem Unglück schuld! Wenn ihr nicht immer mit einem Ja auf meine Frage geantwortet hättet, so wäre ich von der Blamage verschont geblieben. Und daß ich mir den unglückseligen Hosenknopf annähen mußte! Meine Hose war klüger als ich, hätte ich ihr nur gefolgt. Habe ich denn nur gar keinen Trost im Elend? Doch ja, meine Pfeife.«
Er zog die kurze Holzpfeife hervor, schlug Feuer und sog mit Behagen den Rauch ein.
»Ah, das labt!« schmunzelte er. »Wer weiß, ob mir eine leichtere Sorte geschmeckt hätte. Am Ende hätte Miß Chalmers gar von mir verlangt, ich sollte das Rauchen aufgeben, und ich armer, verliebter Narr hätte ihr natürlich gehorcht. Dann hätte ich nur wie ein Schulbube heimlich unter einem Strauche rauchen können. Wahrhaftig, das ist auch ein Trost. Nick Sharp, vielleicht hat es das Schicksal doch ganz gut gemeint, denn ohne Rauchen bin ich nun einmal kein Mensch, dadurch unterscheidet sich der Mensch vom Tier.«
Als wolle er das Versäumte nachholen, begann er zu dampfen, wie eine Lokomotive, und eine dichte Rauchsäule hinter sich lassend, erreichte er das Gebäude.
Er begab sich sofort nach dem Pferdestall.
»Sattle und zäume den Braunen dort!« rief er dem schwarzen Stallknecht zu.
»Wollen Massa noch heute nacht spazieren reiten?«
»Paßt das dir bratwurstlippigem Nigger vielleicht nicht?«
Grinsend zeigte der Neger die Zähne und tat nach dein Geheiße des Detektiven; er machte das bezeichnete Pferd fertig, und Sharp half ihm dabei.
Eine Hand legte sich auf seine Schulter, und sich umblickend, sah er in die erschrockenen Augen von Miß Chalmers.
»Sie wollen fort?«
»Ja.«
»Sie zürnen mir?«
»Nicht im mindesten.«
»Sie wollen wirklich nicht fort, weil — —«
»Weil ich einen Korb bekommen habe? Denke nicht daran, wir bleiben Freunde. Good bye, Miß, auf Wiedersehen in einigen Tagen.«
Sharp setzte den Fuß in den Steigbügel, zog ihn aber noch einmal zurück, denn Williams trat auf ihn zu.
»Sie wollen fort?«
»Ja, eine kleine Reise. Sir Williams, zählen Sie manchmal Knöpfe, um das Schicksal zu befragen? Sie verstehen doch, wie ich es meine.«
»Ich verstehe. Nein, ich tue das nicht. Früher warf ich bei ernsten Fragen ein Geldstück in die Höhe, und je nachdem, wie es fiel, ob Kopf oder Wappen oben war, danach entschied ich. Seit mir aber als jungem Burschen, als mir das Geld noch knapp zugemessen wurde, ein Goldstück durch eine Spalte ins Wasser fiel, habe ich diese Spielerei aufgegeben.«
»Gut denn, so brauche ich Ihnen dies nicht erst zu raten.«
»Was denn?«
»Trauen Sie nie dem Orakel der Knöpfe, und am allerwenigsten denen der Hose, sie lügen immer. Vorsicht, zurückgetreten!«
Sharp war in den Sattel gesprungen. Die Umstehenden wichen zurück, denn der feurige Hengst bäumte sich und schlug mit den Vorderfüßen in der Luft herum.
»Sagen Sie Mister Hoffmann, ich hätte meine Reise schon angetreten. Good bye.«
Der Neger eilte nach dem Tor, um dieses zu öffnen, aber schon flog der Hengst an ihm vorüber und setzte, unter dem Schenkeldruck des Detektiven nebenan über die Fenz hinweg.
Man hörte noch die Galoppsprünge des Pferdes auf dem kiesigen Wege, die anfeuernden Rufe Sharps, dann war der rasige Boden des Parkes erreicht, und Roß und Reiter verschwanden lautlos zwischen den Bäumen.

Kopfschüttelnd kehrten die im Freien Befindlichen ins Haus zurück. Sie konnten sich den Ritt des Detektiven in der Nacht nicht erklären, nur Hoffmann nickte befriedigt mit dem Kopfe, als er davon erfuhr.
Die Umgegend der Besitzung von Miß Petersen bot ein trauriges Bild des Verfalls. Nur wenige Felder waren mit Mais und anderen Körnerfrüchten bestellt, auch die Tabak- und Kaffeeplantagen waren wohlerhalten; dagegen waren die meisten anderen Felder verwüstet und die grünen Halme niedergetreten, als wäre eine Schlacht hier geschlagen worden.
Auf dem Hofe des herrschaftlichen Hauses herrschte im Gegensatze zu diesem Bilde der Verwüstung fröhliches Leben; zahllose Neger tanzten und sprangen umher, schrien und sangen und vertilgten so nebenbei ungeheure Mengen von gebratenem Rindfleisch und leerten ganze Fässer eines wohlschmeckenden Getränkes, das ihre Lustigkeit noch steigerte.
In einiger Entfernung waren für sich die Weißen der Plantage versammelt, ebenfalls zur Feier eines Festes: Aufseher von freien, für Geld arbeitenden Negern, keine Sklaventreiber, ferner Handwerker, Diener und dergleichen, wie sie auf einer Hazienda stets vorhanden sind, und schließlich eine stattliche Anzahl von Cow-boys, denn diese ließen ein Fest niemals ungefeiert vorbeigehen. Sie wußten auch immer die Feststimmung zu erhöhen.
Schon schnallten die abenteuerlichsten Gestalten mit den kupferbraunen, verwitterten Gesichtern, den halbzerfetzten Anzügen, welche sie weder wechseln, noch ausziehen — das Hemd nicht ausgenommen — bis sie vom Leibe fallen, mit den pfundschweren Sporen und dem kostbaren Revolver im Gürtel, an welchen sie all ihren Reichtum verschwenden, schon schnallten diese wilden Gesellen den Leibriemen enger, um im Wettlauf die Schnelligkeit der Füße zu messen. Strecken wurden abgeschritten, damit sich die besten Springer zeigen konnten. Halbwilde Mustangs wurden herbeigeführt, an denen sie ihre Reitkunst zeigen wollten, und, nicht zu vergessen, auch nach Zielen wurde schon gesucht, welche die sichere Revolverkugel treffen sollte.
Abends gab es Tanz. Waren nicht genug weiße Ladies vorhanden, so mußten die schwarzen herhalten, heute war Weib eben Weib, die schwarzen, mit Oel gesalbten Dirnen tanzten auch nicht schlecht, die Cow-boys nahmen sie noch lieber in den Arm, als die weißen, denn mit ihnen konnten sie nach Herzenslust sich drehen und meterhohe Sprünge machen, ohne daß die Tänzerin schrie oder gar in Ohnmacht fiel. Die drei Zoll langen Sporen aus echtem Silber konnten dabei manchmal gefährlich werden, aber was fragten die Cow-boys oder Schwarzen danach? Lustig, lustig! Feste sind auf der Hazienda rar.

Am Abend gab es Tanz, und waren nicht genug weiße
Ladies vorhanden, so mußten die schwarzen herhalten.
Wenn die Fackeln den Hof erleuchteten, dann mischten sich wohl auch die höheren Beamten der Plantage unter die Tanzenden. Jetzt saßen sie nebst ihren Frauen in dem Herrenhause und feierten den großen Tag auf eine stillere und feinere Weise als jene.
Was aber hatten die niedergetretenen Felder mit diesem Feste zu tun?
Die Baumwollenlese war vorüber. Der zarte, flockige Stoff lag, in mächtige Ballen verpackt und schon gewogen, an der Seite des Hauses. Die Schwarzen hatten die Felder der Baumwolle beraubt, daher waren sie zertreten, daher wurde heute eine Art Erntefest gefeiert.
Als die Felder noch in ihrem weißen Schmucke geprangt, hatte ein Händler bereits die Ernte gekauft; heute morgen waren die Ballen gewogen worden, und jetzt zahlte der Kaufmann, der Agent einer Baumwollfirma, dem Haziendero die bedungene Summe aus.
Das Geschäft mußte schon erledigt sein, denn ein Wagen stand vor der Tür und wartete des Agenten, der vor der Abfahrt noch eine Erfrischung zu sich nahm.
Jetzt trat er aus dem Hause. Mister James Flexan begleitete ihn, ein Gruß mit der Hand, und der Wagen rollte davon. Einige Tage später trafen lange Wagenreihen ein und holten die gekaufte Baumwolle ab.
Es war eine brillante Ernte gewesen und der erzielte Preis ein guter, sonst hätte Flexan die Arbeiter nicht so freigebig traktiert.
Die unteren Beamten, die in die Geschäftsgeheimnisse ihres Herrn nicht eingeweiht waren, ergingen sich in Schätzungen. Der eine meinte, die Verkaufssumme betrüge 50 000 Dollar, der andere lachte darüber und sprach von höchstens 30 000, während wieder ein anderer die Baumwolle gar auf 100 000 Dollar taxierte.
Schließlich machte ein Diener dem Streit ein Ende. Er hatte, wie es Diener mit Vorliebe tun, an der Tür des Geschäftszimmers gelauscht und nannte die Summe von 80 000 Dollar, für welche Flexan die Baumwolle an den Händler losgeschlagen habe.
Nun folgte allgemeines Erstaunen; besonders sperrten die unwissenden Cow-boys den Mund auf. Sie konnten die Höhe dieser Summe nicht fassen; sie mußten sich auf eine andere Weise davon einen Begriff machen, ungefähr so, wie es Kinder tun.
Einer der Cow-boys trat zu einem Aufseher, welcher viel mit Schreiben und Zählen beschäftigt war — das heißt, er machte bei jedem vollgepackten Ballen einen Strich ins Buch — und klopfte ihm auf die Schulter.
»Mister Giberne, Ihr könnt doch rechnen?« fragte der verwitterte Geselle.
»Gewiß, Fred, was willst du ausgerechnet haben?« entgegnete der Aufseher würdevoll und zog ein Notizbuch und einen Bleistift aus der Tasche.
»Dann sagt mir 'mal, wieviel Glas Whisky kann ich mir für 80 000 Dollar kaufen!«
»Das Glas zu 5 Cents?«
»Natürlich, der ist der beste.«
»Die Rechnung ist ganz einfach, für einen Dollar bekommst du 20 Glas. Nicht?«
»Stimmt.«
»Nun mache ich bei jedem Glase einen Strich, bis 20 voll sind, dann fange ich wieder von vorn an, und wenn ich 80 000 mal 20 Striche gemacht habe, zähle ich alle zusammen, und dann muß ich gerade so viele Striche erhalten, als man für 80 000 Dollar bekommt.«
»Wahrhaftig, das ist ganz einfach.«
Der rechengewandte Aufseher begann nun, in seinem Notizbuch einen Strich neben dem anderen zu machen, dabei laut zählend. Der Cow-boy sah ihm zu.
»Das erste Hundert. Die Seite ist ziemlich voll, nun drehe ich um und rechne auf der zweiten Seite weiter, damit die Rechnung übersichtlich bleibt. Eins, zwei, drei ...«
»Euer Notizbuch da hat ungefähr 80 Seiten,« sagte da neben ihm der neugierige Diener von vorhin, der zu ihnen getreten war und dem Zählenden mit pfiffiger Miene, die Hände in den Taschen der betreßten Hose, zusah, »folglich könnt Ihr nur 8000 Striche da hineinkritzeln, Mister Giberne, und folglich habt Ihr 200 solcher Notizbücher nötig, ehe Ihr die Whiskys ausgerechnet habt.«
Bestürzt ließ der Rechnende den Bleistift sinken.
»Ist das wirklich wahr?«
»Gewiß ist das wahr.«
»200 Notizbücher sind ein bißchen viel, so viele habe ich nicht.«
»Ihr müßt sie aber haben, wollt Ihr das Rechenexempel nach Eurer Weise lösen.«
»Könnt Ihr es vielleicht kürzer machen?« fragte der Aufseher spitz.
»Ich kann's wohl. Für 80 000 Dollar bekommt Ihr, das Glas zu 5 Cents gerechnet, über 1 ½ Millionen Gläser Whisky, Fred.«
»Dan, o Dan,« schrie dieser einem anderen Cowboy zu, »1 ½ Millionen Gläser können wir dafür trinken.«
Der gerufene Cow-boy kam eiligst herbeigelaufen.
»Nur 1 1/2? Unsinn!«
»1 ½ Millionen, Schafskopf,« lachte der Diener.
»Was ist das, eine Million?«
»Ich weiß auch nicht,« sagte Fred, »es muß aber sehr viel sein.«
»Eine Million ist tausendmal tausend,« belehrte sie der Diener.
»Da wissen wir gerade soviel wie vorher.«
Der Diener deutete nach dem blauen Himmel.
»Seht Ihr die Sterne am Himmel?«
Die beiden blickten nach oben und brachen gleichzeitig in ein Gelächter aus.
»Ihr wollt uns wohl foppen, Jeremy, am Tage stehen doch keine Sterne am Himmel.«
»Aber in der Nacht doch.«
»In der Nacht natürlich, wenn keine Wolken oben sind.«
»Habt Ihr sie schon einmal gezählt?«
»Die Sterne, nee!«
»Ich kann nur bis zehn zählen, dann fange ich immer wieder von vorn an,« gestand Dan freimütig.
»Aber ich habe sie gezählt,« gestand Jeremy ernsthaft.
»So? Verdammt harte Arbeit das! Wieviel sind es denn eigentlich?«
»Es sind 100 000, eigentlich 34 mehr, aber die sind so klein, daß man erst eine Brille aufsetzen muß, ehe man sie sehen kann. Die Kometen zählte ich nicht mit, weil die immer hin- und herfahren.«
Fred musterte nachdenklich den Himmel, an dem jetzt die Sonne strahlte.
»Also 100 000 Sterne hängen da oben,« meinte er, »ja, ja, ich habe mir immer gedacht, daß es ungefähr soviel sein müßten. Und dann wünschte ich mir, es wären lauter Gläser mit Whisky, und ich könnte sie allein aussaufen.«
»Ja, wegen des Whiskys,« fuhr Jeremy fort. »Gesetzt nun den Fall, jeder Stern wäre ein Glas Whisky, so müßtet Ihr jeden Stern 16mal leer trinken, ehe Ihr mit 1 ½ Millionen Glas fertig wäret.«
»Gottsdonnerwetter,« rief Dan und kratzte sich hinter den Ohren. »16mal soviel wie alle Sterne! Das ist ja ungeheuer!«
»Hm, in wieviel Wochen könnte ich das wohl austrinken?« fragte der wißbegierige Fred weiter.
»Das kommt darauf an, wieviel Ihr jeden Tag trinkt.«
»Nun,« schmunzelte der Cow-boy, »ich kann schon eine ganz hübsche Portion Whisky vertilgen, das heißt, Geld muß ich dazu haben.«
Der Diener war in den Zahlen bewandert, er konnte leicht eine kleine Kopfrechnung machen.
»Ich will annehmen, Ihr wollt die 80 000 Dollar innerhalb eines Jahres in Whisky anlegen,« sagte er nach kurzem Ueberlegen, »so wäre dazu nötig, wenn nur einer trinkt, daß er jeden Tag ungefähr 4383 Glas trinkt.«
»4383 Glas? Jeden Tag?« riefen die Cow-boys erstaunt.
»Ja, oder jede Stunde etwa 183 Glas, das heißt, Tag und Nacht, immerfort, ohne Unterbrechung.«
Jetzt kratzte sich auch Fred hinter den Ohren.
»Na, das ist ein bißchen zu stark. Zwanzig Dollar habe ich auch schon mal an einem Tage für Whisky verbraucht, als ich abbezahlt worden war ...«
»Das sind erst 400 Glas,« unterbrach ihn Jeremy.
»Aber da tranken Frauenzimmer mit, die wie die Löcher saufen konnten,« fuhr Fred fort, »und betrogen bin ich auch wenigstens um die Hälfte worden.«
»Was meint Ihr wohl, Dan, wieviel könntet Ihr jeden Tag trinken?«
»Nun, eine ganz hübsche Masse.«
»Hundert am Tag?«
»Das ist schon ziemlich viel.«
»Pah, das sind nur in der Stunde vier.«
»Ach so. Natürlich, die kann ich trinken.«
»Gut, so müßtet Ihr ungefähr 43 Jahre trinken, ehe die 1 ½ Millionen Glas alle wären.«
»Herrgott, da stürbe ich ja, ehe ich fertig wäre.«
»Ich glaube, Dan, Ihr wäret schon nach der ersten Woche tot,« lachte Jeremy laut auf und schritt dem Hause zu, wo er eigentlich Gäste bedienen sollte.
Die Cow-boys konnten sich aber noch lange nicht beruhigen, um so weniger, da sie nun wußten, welch große Summe ihr Herr soeben von dem Agenten erhalten hatte.
Das Beispiel mit den Whiskys und dem Sternenhimmel, den Jahren und Tagen war von dem Diener gut gewählt worden, erst jetzt hatten die Cow-boys einen Begriff, welchen Wert 80 000 Dollar repräsentierten. Anschauungsunterricht nennt man das. Mancher wird über das kindliche Begriffsvermögen dieser Cow-boys lachen, aber geht es uns bei höheren Summen nicht ebenso?
Was sind fünf Milliarden Franken? Man kann sich keinen Begriff davon machen, wenn ihr Wert nicht durch einfache Anschauung vor Augen geführt wird. Hat jemand schon einmal eine Million Mark in Silberstücke aufgestapelt gesehen? Es gibt derartige Schaustücke, natürlich nur aus Pappe oder Holz, mit Silberpapier überzogen, hergestellt. Um eine Million in Markstücken aufzuzählen, würde man ungefähr zweihundert Stunden gebrauchen.
Die Cow-boys berieten noch lange, was sie tun würden, wenn jene Summe ihnen gehörte. Die unglaublichsten Pläne kamen zum Vorschein. Nur auf den Einfall geriet keiner, die Summe auf die Bank zu tragen.
»Kurz und gut,« sagte zuletzt Dan, »wenn ich Mister Flexan wäre, ich würde noch heute nach der Stadt reiten und alles auf den Kopf stellen. Juchhe, das sollte einmal ein Fest werden!«
»Und ich würde meinen Revolver mit Diamanten besetzen lassen,« entgegnete Fred, »wenn ich Geld brauche, dann kann ich einen nach dem anderen verkaufen. Erst aber würde ich mir ein neues Hemd kaufen, meins fängt an wie Zunder zu reißen.«
Die Aufmerksamkeit der Cow-boys wurde auf etwas anderes gelenkt. Der Gruppe näherte sich von dem Fenztor eine Gestalt, deren sonderbares Aussehen den Präriereitern Rufe des Staunens und des Ekels entlockte.
Es war die aufgedunsene, haarlose, entsetzlich aussehende Gestalt von Eduard Flexan.
Die Neger, welche er passieren mußte, wichen scheu vor ihm zurück, die Weiber kreischten laut auf und hielten sich Tücher vors Gesicht, um diese Mißgestalt nicht sehen zu müssen, und ebenso wurden die Kinder versteckt, damit ihnen der böse Blick nicht schade.
Flexan schritt dem Eingang zum Hause zu, mußte aber dabei zwischen den Cow-boys hindurch.
Diese kannten keine Furcht vor dem mißgestaltenen Menschen, im Gegenteil, sie betrachteten sich denselben recht genau und trieben Spott mit ihm.
»Hei, der hat wohl seine Haare irgendwo liegen lassen,« lachte einer.
»Ein reizendes Gesicht,« sagte ein anderer. »Heh, Kitty, möchtest du ihn nicht einmal küssen?«
»Er hat keine Zähne im Mund und hat sich doch so dick gefressen.«
So gab jeder seinen Witz zum besten.
Schon hatte Eduard Flexan die Bande fast hinter sich, als ein Diener einem Cow-boy, Dan, etwas zuflüsterte, worauf dieser sofort vor Flexan trat und ihm den Weg versperrte.
Der Cow-boy mußte das Amt des Dieners übernehmen, weil sich dieser vor der Mißgestalt fürchtete.
»Heh, Fremder, wohin wollt Ihr?«
»Ins Haus, wie Ihr seht,« kam es heiser und krächzend aus Eduards zahnlosem Munde.
»Hahaha, das klingt ja gerade, wie die Vogelknarre auf dem Maisfelde,« lachte es im Chor.
Eduards Augen schossen Blitze auf die Umstehenden, doch sie wurden nicht beachtet.
»Was habt Ihr dort zu tun?« setzte Dan sein Verhör fort.
»Das geht Euch nichts an.«
»Oho. Ich werde Euch gleich zeigen, ob ich das Recht habe, zu fragen oder nicht. Antwort, Bursche! Was habt Ihr im Hause zu suchen?«
Flexan hielt es für geraten, zu antworten.
»Ich will den Herrn sprechen.«
»Den Herrn? Ihr Krüppel? Was habt Ihr denn mit ihm zu unterhandeln?«
Flexan entgegnete nichts; haßerfüllt blickte er den vor ihm Stehenden an.
»Wollt Ihr ihm ein Haarwuchsmittel verkaufen?« höhnte Dan unter dem Gelächter der anderen weiter.
»Das geht Euch nichts an,« wiederholte Flexan.
Dan schien Lust zu haben, dem Fremden eins zu versetzen, er holte bereits mit der Hand zum Schlage aus.
»Greif ihn nicht an, er könnte beißen!« lachte ein Cow-boy. »Sieh, wie er schon das Maul aufsperrt.«
»Laß ihn tanzen!« rief ein anderer.
»Laß ihn tanzen!« klang es von allen Seiten.
Die Cow-boys vertreiben sich, wenn sie nicht der Bewachung von Rinderherden oder dem Bändigen wilder Pferde obliegen, die Zeit mit recht niedlichen Spielen. Ihre Rücksichtslosigkeit kennt dabei keine Grenzen. Besonders, wenn sie nach ihrer Entlohnung das Geld in Städten durchbringen, erlauben sie sich untereinander und selbst Fremden gegenüber die rohesten Scherze. Die Teilnahmlosigkeit des Amerikaners an dem Lose seiner Mitmenschen ist daran mit schuld.
Mit Vorliebe schießt der Cow-boy einem Fremden die Hacken von den Stiefeln; geradezu lebensgefährlich — wenn auch die anderen schon schlimm genug ablaufen können — ist aber der Spaß, den sich der Cow-boy mit dem erlaubt, welchen er für einen »Grünen« hält.
Er tritt vor ihn hin, den Revolver in der Hand, und befiehlt ihm, zu tanzen. Kommt der Betreffende der Aufforderung nicht sofort nach, so streift eine Kugel seine Stiefelspitze. Natürlich hebt er schleunigst sein Bein, aber schon bedroht die Revolvermündung den anderen Fuß, der nun auch gehoben wird. So entsteht ein Tanz, ein fortwährendes Hin- und Herspringen.
»Dance higher, my boy — tanze höher, mein Bursche,« ruft der Cow-boy und sendet eine Kugel nach der anderen aus seinem »Sixshooter« direkt unter die Füße des Tanzenden, weshalb dieser immer höher springt.
Dan sollte also den Mann auf diese Weise tanzen lassen, und sofort hielt er seinen Revolver in der Hand.
»Tanz', tanz'! Lustig! Heute muß gesprungen werden,« rief er und senkte den Revolver.
Flexan lachte heiser auf und blieb ruhig stehen.
»Wie, du willst nicht tanzen? Tanz', sage ich dir!«
Sein Revolver knallte, und eine Kugel streifte die Spitze von Flexans Schuh, ein Stück Leder mit fortnehmend.
Doch Flexan tanzte nicht, wohl aber hatte er mit einem blitzschnellen Griff die den Revolver haltende Hand gepackt, die andere Faust gab dem Cow-boy einen Schlag ins Gesicht, der ihn blutüberströmt und besinnungslos zu Boden warf.
»Dies die Bezahlung für deine Tanzlektion,« rief Flexan und griff nach dem entfallenen Revolver.
Einen Augenblick standen die Cow-boys wie erstarrt über das kecke Auftreten des Fremden, dann aber brach es mit einem Male von allen Seiten los.
Ehe Flexan den Revolver noch ergriffen hatte, wurde er schon gepackt. Diese Männer ekelten sich nicht, ihn anzugreifen. Seine Häßlichkeit war ihm also kein Schutz, im Nu war er überwältigt und sollte sofort dafür bestraft werden, daß er, ein Fremder, den Cow-boy niedergeschlagen hatte.
»Hängt ihn, hängt ihn! An den Baum mit ihm!« brüllte es von allen Seiten, und schon waren wenigstens zehn Lassos bereit, um den Hals des Mannes gelegt zu werden.
Die Freunde des zu Boden geschlagenen Cow-boys wollten kurzen Prozeß machen. In der nächsten Minute schon hätte Flexan an einem Ast zwischen Himmel und Erde geschwebt, wenn ihm nicht Hilfe erschienen wäre.
»Ihr wollt doch den armen Mann nicht aufhängen, was hat er denn getan?« rief ein feines Kinderstimmchen, und durch das rohe Volk drängte sich ein etwa achtjähriges Mädchen, dessen Kleidung verriet, daß es ins Herrenhaus gehörte.
Beim Klange dieser Worte sanken die erhobenen Arme herab, die Schlinge um den Hals des Fremden lockerte sich von selbst wieder, und nur die Hände, welche Flexan festhielten, ließen im eisernen Griffe nicht nach.
»Was hat denn der arme Mann getan?« wiederholte die Kleine, halb entrüstet, halb mitleidig.
Fred übernahm die Rolle des Sprechers.
»Er hat einen von unseren Kameraden niedergeschlagen,« entgegnete er finster und doch unterwürfig. »Seht nur, Miß, wie Dan blutet.«
Der Cow-boy kam wieder zur Besinnung, er hob den Kopf und schaute sich unwirsch um.
»Gottsdonnerwetter,« rief er, »träume oder wache ich? Hat der Kerl, den ich tanzen lassen wollte, mir denn wirklich eins auf die Nase gegeben?«
»Du wolltest ihn tanzen lassen, Dan?« fragte das kleine Mädchen.
»Natürlich, es muß doch lustig hier zugehen.«
»Und hast ihn geschossen?«
»Seine Schuhspitze habe ich nur gestreift.«
Das Mädchen musterte die Füße des Festgehaltenen.
»Dann ist dir recht geschehen, wenn er dich dafür geschlagen hat,« rief sie unwillig. »Und ihr da, laßt den Mann los! Ihr sollt ihm nichts tun, ich will es nicht!«
Die Männer zögerten doch, ihr Opfer ohne weiteres fahren zu lassen. Die Cow-boys waren unabhängig, sie gehorchten niemanden und arbeiteten nach Gutdünken. Nicht einmal ihr eigener Herr durfte ihnen schroff befehlen, wollte er nicht riskieren, daß sie ihn alle gleichzeitig verließen, wodurch er in einer Nacht alle seine halbwilden Rinderherden einbüßen konnte.
Aber so energisch das kleine Mädchen auch auftrat, nahmen sie es ihm doch nicht übel.
»Fred, wenn du den Mann nicht freigibst, so ist es mit unserer Freundschaft aus,« rief das Mädchen wieder mit vor Aufregung gerötetem Gesicht.
Der Cow-boy lachte fröhlich auf.
»Das ist etwas anderes, dieser Gefahr will ich mich nicht aussetzen. Heda, laßt den armen Teufel los! Dan mag dann selbst mit ihm abrechnen.«
»Das wird Dan nicht,« rief aber die Kleine dazwischen. »Nicht wahr, Dan, mir zuliebe wirst du diesen Mann in Frieden lassen?«
»Wie Ihr wünscht, Miß,« lachte der Cow-boy, sich das Blut aus dem Gesicht wischend, »mag er denn zur Hölle fahren. Mich geniert so ein kleiner Puff nicht weiter, die Pferde haben mir manchmal schon anders zugesetzt.«
»So ist es brav gesprochen. Dann sollst du auch etwas haben, was ich dir aus der Stadt mitgebracht habe.«
Flexan wurde freigelassen, die Cow-boys dachten an keine Rache mehr. Ihr Zorn war ebenso schnell wieder verraucht, wie er entstanden war.
Die kleine Herrin wandte sich jetzt an Flexan.
Dieser hatte keine Angst verraten, obgleich sein Leben bedroht gewesen, er hatte seine Augen nur starr auf das zarte, kleine Mädchen geheftet gehabt. Er kannte sie wohl, es war Martha, seine Tochter, mit welcher er und sein Vater, der ihn für seinen Neffen ausgab, ebenfalls verbrecherische Absichten gehabt hatten.
»Wohin wollt Ihr?« fragte Martha, jetzt aber viel scheuer, denn sie fürchtete sich vor der entsetzlich aussehenden Gestalt.
Flexan antwortete nichts; er stierte die zierliche Erscheinung stumm an, und ein immer stärkeres Grinsen prägte sich in seinem Gesicht aus, dieses noch häßlicher machend; entstellt doch ein höhnisches Lächeln selbst das schönste Antlitz.
»Wohin wollt Ihr?« wiederholte Martha, allen ihren Mut zusammenraffend.
Immer erfolgte noch keine Antwort.
»Ist der Mann stumm?« wandte sich das kleine Mädchen an einen Cow-boy.
»Unsinn, vorhin konnte er wie eine Nachteule schnarren, aber man verstand ihn deutlich. Der Schreck wird ihm so in die Glieder gefahren sein, daß er die Sprache verloren hat.«
»Was wollte er denn?«
»Ins Haus hinein, aber wir duldeten es nicht. Wenn nicht einmal wir hineindürfen, so braucht solch ein Bursche es erst recht nicht.«
Martha dachte anders.
»So geht ins Haus, Fremder, wenn Ihr jemanden sprechen wollt. Aber nicht da durch das Hauptportal, geht hinten herum durch die Seitenpforte.«
»Martha, Martha,« rief eine Stimme.
»Ich komme,« entgegnete das Mädchen und lief nach dem Hauptportal, in welchem eine Dame stand, die der Kleinen winkte.
Die Cow-boys kümmerten sich nicht mehr um den Fremden, Weiber brachten Körbe mit Nahrungsmitteln angeschleppt, und diesen wendeten sie jetzt ihre ungeteilte Aufmerksamkeit zu.
Flexan blickte der Kleinen nach, bis sie verschwunden war; vielleicht beschäftigte er sich auch mit der Dame, denn bei ihrem Anblick hatten seine Züge einen eigentümlichen Ausdruck angenommen, und seine Augen schossen Blitze.
Er murmelte etwas Unverständliches und schritt dann um das Haus herum, der ihm von Martha bezeichneten Pforte zu. Er brauchte nicht erst nach dem Wege zu fragen, er kannte sich ja hier aus. Der einstige junge Herr hielt seinen Einzug, unerkannt, mißgestaltet, verachtet, schlimmer als ein Bettler, den er beneidete.
Eduard Flexan hatte um diese Zeit einen ganz anderen Einzug erwartet, er hatte geglaubt, Martha wäre die Besitzerin all dieser Güter, und er, der Vater, würde im Triumph empfangen werden.
Eduard Flexan sollte noch eine zweite Begegnung mit seinem Kinde haben, ehe er das Haus betrat.
Als er durch die Gartenanlagen ging, welche sich vor der Seitentür erstreckten, sah er durch die Blätter einer Laube ein rosafarbenes Kleid schimmern, wie es vorhin Martha getragen hatte.
Eduard mußte, ob er wollte oder nicht, seine Schritte dorthin lenken, vielleicht, daß in seinem versteinerten, von Leidenschaften vergifteten Herzen doch noch ein Funken von Vaterliebe glühte.
Anstatt der Tür zuzugehen, bog er in einen schmalen Weg ab, der ihn zu der Laube führte, und stand mit wenigen Schritten im Eingang derselben.
Martha war allein. Sie spielte mit bunten Steinen auf einer Bank und bemerkte nicht die Gestalt hinter sich. Erst ein Husten veranlaßte sie, sich umzusehen, und als sie den Mann von vorhin erblickte, erschrak sie heftig.
Doch gewöhnt, daß man ihr gehorchte, schrie oder weinte sie nicht, sondern trat gebieterisch auf, wenn sie die Angst auch nicht verbergen konnte.
»Habt Ihr die Tür nicht gefunden?« fragte sie. »Dort ist sie! Geht in die Küche! Sie ist gleich rechts!«
Flexan folgte nicht der Richtung, welche der ausgestreckte Arm andeutete, er blickte nur auf die kleinen, rosigen Fingerchen, auf das hübsche Puppengesicht mit den langen Locken und in die großen, dunklen Augen.
Plötzlich stieg ein anderes Bild vor ihm auf, das sich vor langen, langen Jahren und weit von hier, in seine Seele gegraben hatte. Er sah das Ebenbild der Mutter Marthas vor sich, und diese nannte er damals seine Geliebte.
»Es ist mein Kind,« murmelte er. »Noch bin ich sicher! Wer will mir wehren, daß ich es umarme und küsse? Es ist mein Fleisch und Blut, wer kann es mir streitig machen?«
»Dort ist die Tür! Hört Ihr nicht?« wiederholte die Kleine.
Flexan trat auf sie zu, doch sie zog sich in den entferntesten Winkel der Laube zurück.
»Martha!«
Er streckte die Hände aus, als wolle er das Kind fassen, und jetzt schrie dieses laut auf, es grauste ihm vor einer Berührung durch diese unförmlichen Hände.
»Rühre mich nicht an,« schrie Martha, »du garstiger, häßlicher Mann!«
Doch Flexan kam immer näher.
»Hilfe, Hilfe,« gellte es aus dem kleinen Munde, doch schon hatte Flexan sie umschlungen und küßte die frischen Lippen. Das Kind schrie, es wehrte sich, aber es half ihm nichts.
»Hilfe, er will mich töten,« klang es noch einmal. Schon wand sie sich in Zuckungen auf seinen Knien, sie schien, von namenlosem Entsetzen erfaßt, die Krämpfe zu bekommen.
»Los da!«
Eine kräftige Hand umklammerte Flexans Arm, die andere faßte das Kind, und nach kurzem Ringen war es frei. Mit fliegendem Busen stand eine Dame vor dem Manne, welche Martha an sich preßte.
Flexan zeigte sich weder erschrocken noch verlegen. Mit finsteren Augen musterte er die Dame, und diese wieder den Mann, der hier ohne Scheu wagte, bei lichtem Tage ein Kind zu küssen, wenn er nicht noch etwas Abscheulicheres vorgehabt hatte.
Schon öffnete sie die Lippen, um Dienerschaft zur Hilfe herbeizurufen, aber die Laute erstarben infolge eines Ausrufes des Mannes.
»Halloh, also hier sehen wir uns wieder!«
Die Dame betrachtete den Fremden noch genauer und erkannte ihn auch wieder, obgleich er damals, als sie ihn zuerst gesehen, sehr heruntergekommen gekleidet gewesen, während er jetzt einfach, aber anständig angezogen war.
»Sind Sie nicht der Mann ...?«
»Welchem Sie in Matagorda schon begegneten? Ja, der bin ich,« nickte Flexan grinsend. »Sie wundern sich wohl ungeheuer, mich hier wiederzusehen? Unangenehme Ueberraschung, nicht, meine Gnädige?«
Die Dame nahm eine sehr stolze Miene an.
»Ich wüßte nicht, warum mir dies unangenehm sein sollte, aber wie ...«
»Oho,« unterbrach sie Flexan abermals, »nicht unangenehm? Sie hatten damals in Matagorda einen Besuch auf dem Dampfer abzustatten — ich weiß nicht mehr, wie er heißt — und eine recht lange Unterredung mit den Passagieren, die sich am Tage nicht sehen ließen und erst bei Nacht heimlich das Schiff verließen. Können Sie sich vielleicht erinnern, Gnädige?«
Die Dame hatte bei Beginn der Rede einige Unruhe verraten, doch sofort wußte sie sich wieder zu beherrschen.
»Was geht das Sie an? Wer sind Sie überhaupt?« fragte sie kalt.
»Es galt eine kleine Unterredung mit den englischen Lords, so ein kleines Tete-a-tete. Habe ich richtig erraten, meine Gnädige — ich, wie war doch gleich Ihr werter Name?«
»Komm fort von hier, Tante!« drängte Martha und suchte die Dame fortzuziehen, aber diese blieb stehen.
»Ich weiß nicht, was Sie dies alles angeht, aber meine Pflicht ist es, zu fragen, was Sie hier zu suchen haben, und da Sie mir keine Antwort geben wollen, so werde ich Sie dazu zwingen oder Sie von hier fortbringen lassen, folgen Sie nicht gutwillig, mit Gewalt.«
Die Dame wandte sich zum Gehen, aber mit einem Sprunge, der die ihm noch immer innewohnende Kraft verriet, stand Flexan vor ihr.
»Wie? Sie wagen es, uns den Weg zu sperren?« rief die Dame erzürnt, aber nicht erschrocken. »Ich brauche nur zu rufen, so eilt Hilfe herbei.«
»Nur langsam,« höhnte Flexan, »ich habe nicht die Absicht, Ihnen oder dem kleinen Mädchen, das anscheinend Ihr Zögling ist, wehezutun, aber ich möchte mit Ihnen gern noch ein paar Worte wechseln.«
»Das ist Gewalt, ich rufe um Hilfe.«
»Hätte wenig Zweck. Wissen Sie, daß Sie rechte Aehnlichkeit mit Miß Kenworth, Marthas früherer Gouvernante, haben? Ich hätte Sie bald für dieselbe gehalten, doch jetzt finde ich einen bedeutenden Unterschied zwischen Ihnen und jener.«
Die Dame blieb ruhig, aber eine leichte Blässe bedeckte ihr Antlitz.
»Geben Sie den Weg frei!« herrschte sie ihn an.
»Einen Augenblick noch, Miß — oder soll ich Missis sagen?«
»Das geht Sie nichts an.«
»Nun ja, bei den meisten Gouvernanten ist zwischen Frau und Fräulein auch kein Unterschied zu machen,« bemerkte Flexan mit hämischem Lächeln, »man kann sie anreden wie man will, den falschen Ausdruck brauchen sie nicht übelzunehmen.«
»Wollen Sie den Weg jetzt freigeben?« fragte die Dame drohend.
»Meinetwegen, gehen Sie! Doch sag' mal, mein Kind,« wandte er sich an Martha, »seit wann ist denn deine frühere Gouvernante, Miß Kenworth, fort von hier?«
Martha achtete nicht auf die Frage, sie fing jetzt bitterlich zu weinen an.
»Für was oder wen Sie mich halten, ist mir gleichgültig, für wen ich Sie aber halte, werde ich Ihnen sofort zeigen,« sagte die Dame, »fort nun von hier.«
»Bitte,« rief Flexan, sprang zurück und eilte der Haustür zu. Die Dame wollte ihm nacheilen, um ihm womöglich zuvorzukommen, konnte aber des Kindes wegen nicht schnell genug laufen. Sie blieb zurück. Auf der Hinterseite des Hauses befanden sich keine Leute, und so gelangte Flexan unbelästigt ins Haus.
»Es war eigentlich Unsinn von mir,« murmelte er auf dem kurzen Wege nach dorthin, »so frei mit diesem Weibe zu sprechen. Ist sie eine Verräterin, so kann sie aus meinen Andeutungen Argwohn geschöpft haben. Wer aber, zum Teufel, mag sie nur sein? Wo ist Miß Kenworth? Sollte mein Vater diese fortgeschickt und sie als Gouvernante angenommen haben? Das wäre ein schlimmer Streich von ihm gewesen. Hm, dann könnte ich mir die Verräterei erklären. Aber, nein, damals, als alle unsere Plane verraten wurden, war ja Miß Kenworth bei ihm, und diese ist treu, muß treu sein. Nun, mein Vater wird mich ja in kurzem darüber aufgeklärt haben. Erst aber habe ich etwas anderes mit ihm zu besprechen, der Alte wird sich schön wundern.«
Er eilte ins Haus. Unten war alles leer, und so hielt ihn niemand auf. Oben begegnete ihm ein Diener, welcher einen Präsentierteller mit Gläsern trug. Flexan hätte bald alles umgestoßen.
»Zum Teufel, gebt acht!« schimpfte der Diener, die Augen auf die Gläser gerichtet.
»Wo ist Mister Flexan?«
Der Diener schaute auf, und bei dem Anblick des aufgedunsenen Gesichtes erschrak er so sehr, daß er das Brett fallen ließ. Klirrend zersprangen die Gläser auf dem marmornen Boden.
»Wo ist Mister Flexan? In seinen Zimmern?« herrschte Flexan den tödlich Erschrockenen an und schüttelte ihn auch noch heftig am Arme, weil er nicht sofort Antwort bekam.
»He, wache auf, Bursche! Wo ist Mister Flexan?«
Eduard lag alles daran, zu seinem Vater zu kommen, ehe ihn die Dame von vorhin erreichte. Es wäre ihr ein leichtes gewesen, den fremden, häßlichen und gewöhnlich gekleideten Mann festnehmen zu lassen. Mister Flexan hätte gar nichts von dessen Anwesenheit zu hören bekommen, und dann wäre Eduards Absicht für heute vereitelt gewesen.
Aber heute noch, gerade jetzt mußte er seinen Vater sprechen, oder alles war vielleicht verloren.
»Fort, zeigt mir das Zimmer, in dem sich der Haziendero Mister Flexan befindet — oder —«
Jetzt kam der zitternde Diener zu sich, er merkte, daß mit diesem Manne nicht zu spaßen war. Der Griff am Arme schmerzte derb.
»Mister Flexan ist im Beamtenzimmer,« brachte er stotternd hervor.

»Was tut er dort?«
»Er unterhält sich mit seinen Gästen.«
»Kommt mit — laßt die Gläser liegen.«
Eduard schleppte den Diener durch den Gang, bis er vor einer Tür stehen blieb. Sie führte in den Warteraum vor dem privaten Arbeitszimmer des Plantagenbesitzers.
»Geht schnell zu Mister Flexan — aber schnell, hört Ihr — und sagt ihm, in seinem Arbeitszimmer warte jemand, der ihn unverzüglich zu sprechen wünsche.«
»Wen soll ich melden?« stammelte der Diener.
Eduard öffnete schon die Tür.
»Einen Mann, der ihm eine Nachricht brächte, von der Leben und Tod abhinge.«
Eduard verschwand im Zimmer, und der Diener stürzte davon, als ob ihm der leibhaftige Satan auf den Fersen säße.
»Ist das der Teufel nicht selbst, so hat er ihn in sich. Nie habe ich solch eine Mißgestalt gesehen,« dachte der Diener, eilte noch einige Türen weiter und betrat das Gesellschaftszimmer.
Hier waren die oberen Beamten der Plantage versammelt, und eben ging Mister James Flexan von einem zum anderen, mit jedem einige Worte wechselnd und seine Zufriedenheit über das abgeschlossene Geschäft zu erkennen gebend.
Er hatte in den drei Jahren stark gealtert. Sein Haar, das früher nur wenige weiße Fäden durchzogen, war jetzt schneeweiß, der Vollbart graumeliert, und auch der ganze Gesichtsausdruck der eines müden, abgelebten Greises.
Dies war der Grund, warum der sonst so eitle Haziendero zu keinem Haarfärbemittel griff. Er war klug genug, zu wissen, daß ein Greis mit weißen Haaren noch schön sein kann, während ein Schwarzkopf mit greisenhaften Zügen Widerwillen einflößt.
In diesem Augenblicke verjüngte sein hageres, eingefallenes Gesicht allerdings ein liebenswürdiger Zug, teils durch die Anwesenheit der Gäste, teils durch das gute Geschäft hervorgerufen. Die Wangen zeigten eine hektische Röte, die Augen strahlten in mattem Glanze.
»Was gibt es?« wandte sich jetzt Mister Flexan, das Gespräch mit dem Inspektor abbrechend, an den Diener, der eben ins Zimmer getreten war und nun mit verstörtem Gesicht und zitternden Gliedern vor dem Hausherrn stand.
»Nun, was gibt es?« wiederholte Flexan ungeduldig.
»Ein — ein Mann wünscht Sie — zu sprechen,« kam es bebend von den Lippen des Dieners.
»Ein Mann? Wie heißt er?«
»Er wollte mir keinen Namen nennen.«
»Wo wartet er?«
»Vor Ihrem Arbeitszimmer.«
»Wie? Du hast einen fremden Menschen vor meinem Arbeitszimmer warten lassen? Weißt du denn nicht, daß —«
»Ich ließ ihn gar nicht eintreten,« rief der bestürzte Diener schnell, »er öffnete selbst die Tür zu dem Wartezimmer. Er muß hier bekannt sein.«
»Dummkopf!« brauste Flexan auf und ging schnell hinaus, um den Fremden selbst zu sehen und als frechen Eindringling zur Rechenschaft zu ziehen.
Sein erster Schrecken kam daher, weil er in einem Geldschrank seines Zimmers die eben ausbezahlte Summe verwahrte. Morgen wollte er sie nach der Stadt zu seinem Bankier bringen. 80 000 Dollar sind keine Kleinigkeit, man hebt sie nicht in der Schublade auf, und wenn diese auch noch so feuer- und diebessicher wäre. Der Amerikaner ist kein Freund von totem Geld.
Auf dem Wege nach seinem Arbeitsraum beruhigte sich Flexan wieder. Er besaß keinen Schlüssel zu demselben, es war überhaupt kein Schloß daran, sondern nur ein sehr sinnreicher Mechanismus, der ihm und seinem treuen Verwalter allein bekannt war. Schließlich kann man jedes Schloß öffnen, solch einen Mechanismus aber höchstens vermittels des größten Scharfsinns, verbunden mit endloser Geduld.
Verwundert sah sich der eintretende Flexan in dem Warteraume um, er war leer.
»Hat den Diener ein Hirngespinst geplagt, oder hält mich jemand zum Narren?« murmelte er.
Plötzlich zuckte er, wie von einer Schlange gebissen, zusammen, drinnen in seinem Arbeitszimmer hörte er Schritte, ein Räuspern und dann ein Lied summen, eine Lieblingsmelodie von sich, die er früher bei guter Laune beständig gesungen oder gepfiffen hatte.
Wie ein Rasender stürzte Flexan nach der Tür, sie war geschlossen. Seine zitternde Hand schob an den Knöpfen und Stiften, bis sie die richtige Lage erlangt, ein leiser Druck an einer Erhebung, die Tür sprang auf, und Flexan erblickte die ekelerregende Gestalt des Fremden, welcher mit gekreuzten Armen an einem Tische lehnte und den Eintretenden ruhig anblickte, immer dabei die Melodie summend.
»Was habt Ihr hier zu suchen, wie kommt Ihr überhaupt hier herein?« schrie Flexan, nach dem Revolver an der Wand blickend, vor welcher der Fremde gerade stand.
»Ich habe dich erwartet,« erklang es heiser. »Schließ' die Tür! Schnell, ich muß mit dir sprechen!«
Wie geistesabwesend starrte Flexan den ihm völlig Unbekannten an. Hatte er es vielleicht mit einem Irrsinnigen zu tun? Fast schien es so.
»Wer seid Ihr?«
»Kennst du mich nicht mehr?« lachte der Fremde. »Warum blickst du so nach dem Revolver? Brauchst du ihn, um dich gegen mich zu schützen? Hier,« er nahm den Revolver von der Wand und gab ihn Flexan, der eiligst nach ihm griff, »er scheint geladen zu sein. Nimm ihn und schieß' deinen Sohn nieder, wenn du dich vor ihm fürchtest!«
»Meinen Sohn?« hauchte Flexan.
»Deinen Sohn. Nun schließe die Tür, du hast ja eine Waffe. Ich bin wirklich dein Sohn, Eduard Flexan, und genügt dir nicht schon der Beweis, daß ich die geheime Tür öffnen konnte, so werde ich mich noch besser legitimieren.«
Fast ohne zu wissen, was er tat, zog der Hausherr die Tür hinter sich zu, den Fremden, der sich für seinen Sohn ausgab, aber starr im Auge behaltend.
»Du wärest mein Sohn?« wiederholte er.
»Eduard Flexan.«
»Du lügst oder bist wahnsinnig.«
»Keines von beiden. Setze dich! Ich werde es dir so beweisen, daß du mir glauben mußt.«
»Nimmermehr.«
»Warum nicht?«
»Weil ich meinen Sohn kenne.«
»Bah, was vermag eine kurze Spanne Zeit aus dem schönsten, blühendsten Menschen zu machen! Tod, Krankheit und Schicksalsschläge anderer Art können uns innerhalb einer Sekunde völlig verändern. Setze dich und höre, wie es deinem Sohne ergangen ist. Ich habe nicht viel Zeit zur Erzählung, aber so kurz sie auch sein mag, du wirst dennoch heraushören, daß ich dein Sohn Eduard bin.«
Nach diesen bittergesprochenen Worten war der erste Zweifel des Alten schon etwas geschwunden; er setzte sich und lauschte der Erzählung jenes Mannes, den man einst als seinen schönen Sohn bewundert hatte.
Je länger Eduard sprach, einen desto entsetzteren Ausdruck nahmen die Züge des Vaters an, immer starrer wurden die Augen, und als der heftig sprechende, zahnlose Mund schwieg, da schlug der alte Mann die Hände vors Gesicht und brach in lauten Jammer aus.
»Eduard, Eduard, was ist aus dir geworden!« stöhnte er. »Ich habe nur für dich gearbeitet, für dich mich Tag und Nacht gesorgt, für dich sogar unerlaubte Handlungen begangen. Und nun? Dies sind die Folgen! Dies ist die Strafe unserer gottlosen Pläne!«
Der Sohn machte eine ungeduldige Bewegung.
»Verschone mich mit derartigen Lamentationen, die ändern mein Aussehen nicht. Kurz und bündig, glaubst du nun, daß ich dein Sohn bin?«
»Ich muß es.«
»Das ist nichts! Ja oder nein?«
»Ja.«
»Gut, das ist mir die Hauptsache, So höre denn, lieber Vater; ich brauche Geld, sofort, unbedingt!«
Flexan nahm die Hände vom Gesicht.
»Wozu?«
Ein höhnisches Lachen war die erste Antwort.
»Wozu? Seltsame Frage! Weil man eben heutzutage ohne Geld nicht leben kann, um so weniger, wenn man sich auf der Flucht befindet.«
»Auf der Flucht?«
»Ja, auf der Flucht vor jenen vermaledeiten Mädchen und Männern, mit denen wir uns jahrelang beschäftigt haben. Sie sitzen mir dicht auf den Hacken,« fuhr er schneller und heftiger fort, auf den Vater zutretend, »ich habe keine Zeit zu langen Erklärungen, darum gib mir Geld, schnell, oder meine Flucht wird verhindert! Und du kannst dir denken, daß von meiner Freiheit auch deine Sicherheit abhängt,« schloß Eduard leise mit lauerndem Blick.
Flexan war willig, seinem Sohne mit Geld zu helfen, er erhob sich.
»Wieviel brauchst du?«
»Ich gehe nach Australien. Hier muß ich das Spiel doch völlig aufgeben.«
»Gut, ich werde dafür sorgen, daß du dort ein behagliches Leben führen kannst, hier möchtest du doch einmal erkannt werden. Glaube mir, Eduard, bist du auch verändert, ich liebe dich noch immer!«
»Danke,« grinste der Sohn, »aber nun das Geld.«
»Richtig, wieviel brauchst du zur Reise?«
»80 000 Dollar.«
Wie vom Blitz getroffen sank James Flexan in den Lehnsessel zurück.
»Wieviel?« stammelte er.
»80 000 Dollar.«
»Zur Reise?«
»Unsinn. Glaubst du, ich will späterhin von deiner Großmut leben? Das Gnadenbrot essen? Und wenn du stirbst, was dann? Gib mir die Summe, dann werde ich dir nie wieder zur Last fallen.«
»Ich würde sie dir geben, aber ich habe nicht so viel hier. Es vergehen Tage, bis ...«
»Lüge nicht, dort in jenem Geldschrank liegen 80 000 Dollar, die du vorhin von dem Agenten erhieltest.«
»Woher weißt du das?« stöhnte der Alte.
»Das bleibt sich gleich. Schnell, gib sie mir! Es wird die höchste Zeit, daß ich verschwinde.«
»Sie gehören nicht mir.«
»Wem denn?«
»Ellen.«
»Bah, das bleibt sich gleich.«
»Durchaus nicht.«
»Gleiche die Bücher auf irgend eine Weise aus.«
»Diese Differenz ist zu groß, um sie unbemerkbar zu machen.«
»So laß die Summe stehlen.«
»Stehlen?«
»Stelle dich nicht so dumm. Rufe jemanden ins Zimmer, laß ihn allein, dann kannst du ihn verschwinden lassen, und er hat die Summe eben gestohlen. Sehr einfach, es gibt tausend derartige Wege. Ich empfehle dir dazu Dan, den Cow-boy, der Bursche hat ein Gaunergesicht.«
Der Alte wand und krümmte sich wie ein Aal, doch Eduard ließ mit seinem Drängen nicht nach, er begann sogar zu drohen.
»Du willst mir die 80 000 Dollar nicht geben?«
»Ich kann wahrhaftig nicht.«
»Du mußt, ich brauche sie.«
»Begnüge dich vorläufig mit tausend Dollar.«
»Unsinn.«
»Dann mit 5000, ich schicke dir das fehlende nach und nach zu.«
»80 000 Dollar.«
»Meinetwegen 10 000 Dollar, die kann ich wohl entbehren, ich beschneide dafür die Kaffeernte.«
»Höre, Vater,« sagte Eduard jetzt drohend, »erhebe dich, schließe den Kassenschrank dort auf und gib mir die Summe, oder ich greife zu anderen Mitteln.«
»Zur Gewalt?«
»Nein, solch ein Tor werde ich nicht sein. Ich werde verfolgt. Bin ich gefangen, so bist du durch meine Aussagen verloren. Bedenke das, ich gehe nicht eher von hier, als bis du mir die betreffende Summe bis auf den letzten Dollar ausgezahlt hast, und wenn ich auch darüber gefangen werde. Darum schnell, jede Stunde kann meine Häscher bringen.«
Ueber des Alten Gesicht flog plötzlich ein schlauer Zug, überlegend schaute er den Sprecher an.
»Hm, Eduard, ich glaube doch, du irrst dich, wenn du wähnst, mich durch deine Aussagen verderben zu können.«
»Durchaus nicht. Mitgefangen, mitgehangen, würde es dann bei dir heißen.«
»Weise mir eine strafwürdige Handlung nach!«
»Nur eine?« höhnte Eduard. »Hast du nicht nach Ellens Leben getrachtet?«
»Das war nur eine Vermutung von dir.«
»Dein Erschrecken bestätigte sie.«
»Aber zu beweisen ist mir nichts.«
»Nicht? Gerade ich kann alles beweisen.«
»Du hast das Aussehen und Betragen eines Wahnsinnigen, man wird dich für einen solchen halten, besonders, wenn ich diese Vermutung anrege.«
Eduard achtete nicht auf das höhnische Lächeln.
»Ich habe mächtige Beweismittel in der Hand, dich des beabsichtigten Mordes zu überführen.«
»Welche denn zum Beispiel?«
»Zum Beispiel den Seewolf.«
Die Wirkung dieses Namens war furchtbar. Flexan brach plötzlich in seinem Stuhle zusammen. Dann richtete er sich langsam wieder auf und suchte sein Erschrecken zu bemänteln.
»Nun ja,« stammelte er mit bebenden Lippen, »das war eben auch nur eine Vermutung von dir.«
»Der Seewolf lebt.«
»Das macht nichts.«
»Ich kann ihn dir jederzeit gegenüberstellen.«
»Er kennt mich nicht.«
»Er kennt dich doch, trotzdem du damals in einen langen Mantel gehüllt warst und dein Gesicht mit einer schwarzen Maske verdeckt hattest. Auch das Fehlen deines linken, kleinen Fingers bemerkte er, trotzdem du Handschuhe angezogen hattest. Ja, ja, erschrick nur. Soll ich dir erzählen, wie du überhaupt mit dem Meister in Verbindung kamst? Du suchtest ihn nicht, wohl er aber dich, weil er deine Million Dollar besitzen wollte. Durch ein geheimnisvolles Billett bot er dir seine Dienste an, und du machtest Gebrauch davon. O, dieser Meister kannte deine Absicht, Ellen verschwinden zu lassen, sehr gut, und willst du noch mehr hören, so kann ich dir nur noch sagen, daß ich jederzeit eine Quittung aufzuweisen vermag, welche dir der Unbekannte über die von dir erhaltene Million Dollar ausgestellt, die er aber vorsichtshalber, nachdem er deine Unterschrift erhalten, dir nicht gab.«
Immer entsetzter hatten die Augen des Alten auf dem Sprecher gehaftet.
»Um Gottes willen,« stöhnte er endlich, »Eduard, wer bist du, daß du dies alles so genau weißt?«
»Genug, ich weiß es. Bist du gewillt, mir jetzt die Summe zu geben? Konntest du dem Meister eine Million zahlen, so wirst du auch für deinen Sohn 80 000 Dollar übrig haben, oder ...«
Flexan schloß mit einer drohenden Bewegung.
Völlig gebrochen erhob sich der Vater, schwankte zu dem Geldschrank, schloß ihn auf und übergab seinem Sohne einige Päckchen Banknoten.
Dieser zählte nur den ersten Pack, sah nach den Zahlen der anderen und schob alles mit einem höhnischen Lächeln in die Tasche seines Rockes.
»Danke, werde wohl einige Zeit damit langen.«

»Es ist alles, was ich habe,« murmelte der Alte.
»Bah, deine Kasse füllt sich immer wieder. Finde nur ein Mittel, die Schuld einer Veruntreuung von dir zu wälzen.«
»Nun sage mir aber, woher du alles so genau weißt!« flehte Flexan.
»Sehr einfach, ich selbst war es, der dir das Billett zusteckte und dir eine Unterredung mit dem Seewolf verschaffte.«
Flexan fuhr zurück.
»Wie, du selbst?«
»Gewiß.«
»So bist du es, den man — nein, es ist nicht möglich.«
»Was?«
»Du selbst wärest der Meister?«
»Ja, ich hatte die Ehre, von verschiedenen Verbrecherbanden Meister tituliert zu werden, obgleich sie mich selbst nicht kannten.«
Sprachlos stierte der Alte Eduard an.
»O, wir waren sehr gut organisiert,« fuhr Eduard fort, »wir hätten noch die besten Geschäfte gemacht, denn endlich war die Zeit gekommen, da ich statt fortwährender Auslagen auch einmal Einnahme zu erwarten hatte, da aber tauchte dieser verdammte Nick Sharp, der Detektiv, in Begleitung der Damen und Herren auf, mit deren Verfolgung ich mich beschäftigte, und Zoll für Zoll hat er mir meine Beute entrissen. O, es ist zum Verzweifeln!«
Eduard stampfte wütend den Boden.
»Warum versuchtest du, mich ins Spiel zu ziehen, wenn du schon andere Wege gingest?« fragte Flexan leise. »Warum schicktest du Miß Kenworth hierher?«
»Du bist ein Dummkopf, daß du solche Fragen stellst!« brauste der Sohn auf. »Martha war die von Ellen eingesetzte Erbin, Martha ist aber mein Kind, wie du weißt. Miß Kenworth sollte dafür sorgen, daß alles seinen regelrechten Lauf nahm, sobald die Kunde von Ellens Tod eintraf.«
»Das hätte ich auch getan.«
»Und dann sollte Miß Kenworth hauptsächlich dafür sorgen,« fuhr Eduard fort, »daß du — jetzt kann ich es offen aussprechen, daß du mir nicht zwischen meine Pläne kamst.«
»Eduard, du mißtrautest mir?«
»Nicht dir selbst, aber deiner Dummheit. Du hättest mir leicht alles verderben können. Darum schickte ich Miß Kenworth zu dir, eine treue Freundin von mir, welche in alle meine Pläne eingeweiht war. Durch sie erfuhr ich Marthas und dein Verhalten, wie sie mir auch den Inhalt von Ellens Briefen mitteilte, welche allerdings sehr spärlich eintrafen. Nun sage mir noch, bevor ich gehe, wo ist Miß Kenworth? Wie kommt es, daß Martha eine andere Erzieherin erhalten hat, ohne daß ich davon Mitteilung bekam?«
Eduard ließ seine Augen mit einem drohenden Ausdruck auf den Vater haften, doch dieser schien über die Frage sehr verwundert zu sein.
»Eine andere Gouvernante?«
»Ja, ist sie nicht jene Dame, welche ich vorhin in Begleitung Marthas gesehen habe?«
»Eine Dame?«
»Weiche mir nicht aus! Wer war es, und wo befindet sich Miß Kenworth?«
»Aber Miß Kenworth ist ja noch die Erzieherin Marthas, hier befindet sich gar keine andere Dame.«
Eduard horchte hoch auf.
»Wer war die Dame in blauem Kleid mit schwarzen Schleifen, welche Martha Tante nannte?«
»Eben Miß Kenworth.«
»Das ist nicht wahr,« schrie Eduard auf, »ich kenne Miß Kenworth recht gut, diese war es nicht.«
»Eduard, ich versichere dir, es war Miß Kenworth, welche du mir vor drei Jahren mit deiner eigenen Empfehlung, zur Erziehung Marthas schicktest. Ich besaß die Photographie, sie stimmte.«
Eduard lehnte, die Augen weit aufgerissen, an der Wand und starrte den Vater an.
»Sprichst du die Wahrheit? Das soll Miß Kenworth sein?« stieß er endlich hervor.
»Miß Kenworth ist die einzige Person im Hause, welche den Namen Dame verdient, und hast du sie in Begleitung Marthas gesehen, so ist sie es unbedingt gewesen, denn das Kind kann keine Minute ohne sie sein.«
»Sie ist dieselbe, welche mit einer Empfehlung von mir hier ankam?«
»Dieselbe.«
»Und sie ist seit drei Jahren immer in deinem Hause gewesen?«
»Ja.«
»Als Erzieherin Marthas?«
»Ja.«
»Hast du sie beobachtet?«
»Ich tat's.«
»Das solltest du nicht,« schrie Eduard. »Doch gut, hast du etwas Verdächtiges an ihr bemerkt?«
»Nicht das geringste.«
»Schrieb sie viele Briefe?«
»Einige.«
»An wen?«
»An Freundinnen, ganz harmlose, wie ich mich selbst überzeugt habe.«
»War Miß Kenworth vor einigen Monaten verreist?«
»Ja, für etwa eine Woche. Sie sagte, sie wolle eine Freundin empfangen, welche mit dem Schiff ankäme. Aber was hast du denn, Eduard?«
Dieser begann plötzlich wie ein wildes Tier im Zimmer auf- und abzulaufen, seine Augen rollten, und Schaum stand ihm vor den Lippen.
»Verdammt!« zischte er. »Ueberall betrogen, wohin man sieht. Es ist nicht Miß Kenworth — eine andere — natürlich, die Aehnlichkeit — sie ist Sharps Gehilfin — die richtige hat er auf die Seite gebracht. Ha, nun kann ich mir erklären, woher dieser Halunke, dieser Detektiv so genau über meine Pläne orientiert war. Ich Tor schrieb der vermeintlichen Miß Kenworth alle meine Pläne, Absichten, Handlungen und Bewegungen, und sie, nun sie teilte natürlich alles sofort Nick Sharp mit. Briefe an eine Freundin, hahaha,« gellte es lachend.
»Eduard, wohin willst du?« rief Flexan, als der Rasende die Tür zu öffnen suchte.
»Fort will ich, Dummkopf elender,« brüllte Eduard, »ich möchte dich prügeln, so wütend bin ich, wenn du auch mein Vater bist. Aber ich fühle mich selbst schuld an dem Unheil, welches durch diese vermeintliche Miß Kenworth angerichtet worden ist.«
Er hatte die Tür schon geöffnet, doch Flexan hielt ihn noch am Arm zurück und schloß dieselbe wieder.
»Noch eins, ehe du gehst, dann mache, was du willst und rechne auf meine Hilfe und Unterstützung zu jeder Zeit.«
»Was willst du?«
»Ist meine Lage jetzt gefährlich geworden?« fragte der Alte mit vor Angst bebender Stimme.
Eduard drängte, fortzukommen.
»Nein, nein, nicht im mindesten.«
»Auch durch den Verrat der Gouvernante nicht?«
»Auch nicht. Ich ließ ihr in meinen Briefen nicht merken, daß du ein verbrecherisches Handwerk triebest —«
»Ich bin kein Verbrecher,« wollte sich Flexan verteidigen.
»Schon gut; sie glaubte, du bemühtest dich nur, Martha als Erbin einzusetzen, damit deine und meine Existenz gesichert sei. Das kommt häufig vor. Niemand findet darin eine besondere Sünde.«
»Ist dies wirklich wahr?« atmete Flexan sichtlich erleichtert auf.
»Ja doch, Narr!«
Flexan konnte Eduard nicht mehr halten, derselbe riß die Tür auf und stürzte durch den Korridor.
»Tor du,« zischte er in dem menschenleeren Gange, »wenn du wüßtest, daß alle deine schändlichen Pläne von dieser Gouvernante sicher ebenso verraten worden sind, wie die meinen, du würdest zittern und heulen! Ganz gewiß wird jetzt auch schon die Schlinge um ihn gezogen. Nun aber erst, bevor ich fliehe, zu Miß Kenworth, Ich will probieren, ob ich noch der Meister bin, welcher Verräter durch einen Händedruck töten kann, ohne daß man einen Laut hört. Sie muß sterben, und führte der Weg zu ihr über die Leiche meines Kindes, Rache, nur erst Rache, dann will ich an Flucht denken, und hat bis jetzt niemand den Meister fangen können, so wird er auch diesmal verschwinden, unsichtbar, selbst für den schlauen Nick Sharp. Haha, der Meister versteht noch mehr als der.«
Er rannte weiter, bis er den Korridor verließ und durch leere Zimmer seinen Weg fortsetzte. Waren diese auch von innen verriegelt, so wußte er sie doch stets lautlos zu öffnen.
Als Eduard Martha und deren Gouvernante verlassen hatte, war diese nicht, wie ersterer erwartet hatte, ins Haus geeilt, um Lärm wegen des Betragens des fremden Mannes zu schlagen.
Hatte Miß Kenworth Eduard auch nicht erkannt, so wußte sie doch, welch furchtbare Gefahr ihr durch diesen Mann drohte, Sie kannte das Komplott der beiden, des Vaters und des Sohnes, gegen Ellen, und sie hatte alle Pläne Eduards an Sharp verraten.
Sie riß Martha mit sich fort und begab sich in ihr im ersten Stock gelegenes Zimmer. Sofort verschloß sie die Türen, und dann erst kam sie etwas zur Besinnung.
Dies war der Mann gewesen, den sie in Matagorda gesehen hatte, als sie den ankommenden, englischen Herren die Nachricht brachte, wo sie die Damen finden würden, und wie sie sich verhalten sollten, um die Feinde der Vestalinnen auf eine falsche Spur zu bringen.
Ja, dieser Mann war mit im Bunde der Verbrecher, er hatte sie wiedererkannt, und nun zeigte er dem Hausherrn an, daß sie eine Verräterin sei, die drei Jahre lang gegen ihn, statt für ihn gearbeitet hatte.
Was mochte die Folge sein?
Wieder verlor sie die Besinnung; sie sah sich und das Kind von Feinden umringt. Auch dieses war als ein Opfer von verbrecherischen Plänen ausersehen, und sie hatte das Kind lieber gewonnen als ihr eigenes Leben.
Ohne zu wissen, was sie tat, raffte sie ihre Kleider zusammen und warf alles in die geöffneten Koffer; dann wieder dachte sie daran, daß es eine eilige Flucht galt, sie riß daher alles wieder heraus, um nur die notwendigsten Kleidungsstücke einzupacken.
Waren die Türen auch ordentlich zugeriegelt? Sie überzeugte sich davon, vergaß aber darüber ihren vorigen Entschluß und begann abermals, alles ohne Unterschied in die Koffer hineinzuwerfen.
Auf dem Sofa saß zwischen Paketen und Hutschachteln Martha und schaute verwundert dem Treiben ihrer sonst so ruhigen, jetzt so aufgeregten Gouvernante zu.
»Aber was hast du nur, Tante,« fragte sie nach längerem Schweigen, »willst du denn verreisen?«
»Ja, ja, mein Kind, ich muß fort, schnell fort.«
»Dann komme ich mit dir.«
»Gewiß, du kommst mit mir, du darfst nicht allein hierbleiben.«
»O, das ist herrlich!« rief die Kleine und rannte jauchzend im Zimmer umher. »Wir verreisen, wir verreisen! Wohin denn, Tantchen?«
»St, nicht so laut,« warnte Miß Kenworth erschrocken. »Niemand darf hören, daß wir fort wollen.«
»Ich verstehe dich nicht. Warum soll das niemand erfahren?« rief das Mädchen, lachend die Locken schüttelnd.
»Wir müssen fort. Der Mann, der dich vorhin küssen wollte, ist ein garstiger Mensch, er hat Böses mit uns vor.«
»O der, ich brauche es ja nur Dan zu sagen, der wird ihn gleich fortjagen.«
»Tu's mir zuliebe, Martha, sei still und hilf mir einpacken!«
»Wenn du es willst, so tue ich es gern,« flüsterte Martha jetzt. »Aber nicht wahr, du nimmst mich doch mit?«
»Ganz sicher.«
»Dann will ich schnell meine Kleider holen. Riegele die Tür auf, ich bringe sie herunter.«
»Du darfst nicht hinaus,« sagte die Gouvernante schnell, das Kind zurückhaltend, »draußen steht der böse Mann.«
»Wir haben ihm doch nichts getan.«
»Er haßt mich, er will mir etwas tun.«
»So rufe doch nur zum Fenster hinaus, dort stehen ja Dan und Fred und alle meine Freunde, die mich lieb haben. Ich brauche nur zu rufen, so kommen sie und helfen mir und dir. Die fürchten sich vor niemanden!.«
Zögernd ließ Miß Kenworth die Hände sinken.
Das Kind hatte eigentlich recht. Sie fühlte sich keines Verbrechens bewußt, im Gegenteil, sie hatte nur gute Taten vollbracht und Verbrechen vereitelt. Jene Männer dort, welche tanzten und sangen, waren zwar roh, aber unter ihren ledernen oder baumwollenen Hemden schlugen dennoch ehrliche Herzen. War es nicht richtig, sie begab sich unter den Schutz dieser halbwilden Leute? Martha war der Liebling aller, und auch Miß Kenworth genoß die Achtung der Cow-boys. Sie stritten sich darum, das kleine Mädchen vor sich auf ihr Pferd zu setzen, und Dan hatte ihr ein Reitpferd geliefert, an dessen Dressur er tagelang gearbeitet hatte, während er sonst jeden Tag, den er nicht hinter den Ochsenherden verbrachte, sechs Pferde zuritt, so daß er einen namhaften Schaden erlitten hatte.
Diese Gedanken jagten der Gouvernante blitzschnell durch den Kopf, während sie schon wieder mit fieberhafter Emsigkeit einpackte.
Nein, sie konnte die Dienerschaft nicht zu Hilfe rufen; denn dann war es nötig, eine furchtbare Anklage gegen den Plantagenbesitzer zu erheben. Sie durfte es nicht tun. Ach, wenn nur ihre Freunde hier wären! Jetzt mußte sie fliehen. Aber wie nur?
»Sei ein liebes Kind,« flüsterte sie Martha zu, »ich muß unbedingt verreisen und zwar heimlich. Du kommst mit mir, nicht wahr, Martha?«
»Ich komme mit, ich lass' dich nicht allein gehen. Wen habe ich denn sonst hier als dich, den ich liebe? Der Onkel wird mit jedem Tage garstiger, und Onkel Eduard kommt nicht wieder. Höchstens die Cow-boys haben mich etwas lieb, aber die sind manchmal so sehr roh, sie schlagen die Pferde oft halbtot für gar nichts. Nein, ich komme mit dir. Dann hilfst du mir auch, meine Kleider einpacken, nicht wahr, Tante?«
So schwatzte das Kind weiter, und Miß Kenworth stopfte unterdes alles in den Koffer, was ihr gerade in die Hände kam, während Martha, neben ihr kniend, ihr half.
Ein Gedanke quälte hauptsächlich fort und fort die Gouvernante. Wie sollte sie jetzt, sofort, eine heimliche Flucht möglich machen?
Halt, die Cow-boys! Sie konnte ihnen winken, diese verwegenen Burschen halfen ihr sicher. Sie fragten nicht erst lange, wohin und warum, sie waren gewohnt, nach der augenblicklichen Eingebung zu handeln. Nach ihrer Ansicht war der Mensch frei, wie der Vogel in der Luft, er konnte tun, was ihm gefiel. Niemand durfte ihn zur Rechenschaft ziehen.
Miß Kenworth wollte schon aufstehen, um an das Fenster zu treten und den Cow-boys zu winken, als sie plötzlich etwas sah, was ihr Glieder und Sprache lähmte.
Um des Kindes Hals legte sich plötzlich eine dicke Hand mit geschwollenen Fingern. Martha fiel lautlos zurück. Jetzt wollte Miß Kenworth schreien, aber im selben Augenblick krallten sich von hinten Finger auch um ihren Hals. Mit einem Schwung flog Martha durch die Luft auf's Sofa, gleich darauf wurde auch sie emporgerissen, sie kam auf Martha zu liegen, dann stürzte sich der menschliche Körper mit Wucht auf sie, ohne daß ihr Hals losgelassen wurde, und die der Ohnmacht nahe Dame blickte in das verzerrte Gesicht Eduards, dessen andere Hand unter ihr lag, wahrscheinlich hielt sie noch die Kehle Marthas umklammert, und durch sein schweres Gewicht hinderte der Elende beide an jeder Bewegung.
»Also Sie sind die Dame, welche sich Miß Kenworth nennt,« kam es zischend aus dem zahnlosen, schäumenden Munde. »Verräterin, du mußt sterben! Doch erkenne mich noch vor deinem Tode: ich bin Eduard Flexan, der durch deine Verräterei so scheußlich entstellt worden ist. Fahrt zur Hölle, du und Martha! Ist sie auch mein Fleisch und Blut, ehe ihr Schreien mich verrät, soll sie durch meine eigene Hand sterben!«

»Verräterin, du mußt sterben! Fahrt zur Hölle,
du und Martha!« stieß Eduard Flexan hervor.
Des Weibes Antlitz war schon ganz blau angelaufen; unter dem würgenden Griffe mußte der Tod jeden Augenblick eintreten. Die nach Atem ringende Brust ward schon still, und das Kind hatte wahrscheinlich bereits ausgelitten — von seinem eigenen Vater ermordet.
Da ließ der Griff nach, der Würger hob den Kopf und blickte vorsichtig zum Fenster hinaus.
Unten war lautes Geschrei entstanden, die Neger jauchzten, die Weiber kreischten, und die Cow-boys brüllten und sprangen wie gewöhnlich bei jedem besonderen Ereignis, nach den Pferden. Nur im Sattel fühlt sich der Cow-boy als Mensch.
Auf dem Rücken der Pferde Liegt das Paradies der Erde.
Dieser Lärm veranlaßte Eduard im würgenden Griff nachzulassen, ohne daß er es wußte. Schlaff wurden seine Finger, und seine Augen blickten starr in die Ferne, wo sich unendliche Weideplätze, von Bächen durchzogen, erstreckten.
Dort brausten wilde Reiter über die grüne Fläche. Es waren weder Indianer noch Cow-boys, welche ihre Pferde zur tollsten Karriere antrieben, die höchsten Hecken und Büsche nahmen und über die breitesten Gräben wegfetzten, als waren es Rinnen, es waren Herren in Sportanzügen und Damen in wallenden Reitkostümen.
Nicht alle beteiligten sich an der wilden Jagd. Weiter zurück erkannte man einen Trupp von Reitern, welche ihre Tiere nur im Galopp hielten.
Die Spitze der Jagenden — allem Anschein nach galt es einen Wettritt — bildeten ein Herr und eine Dame. Sie hatten den anderen gegenüber einen großen Vorsprung, sie besaßen die schnellsten Pferde, oder aber sie waren die besten Reiter.
Beide gaben sich nichts nach. Kopf an Kopf, mit vorgestreckten Hälsen brausten die beiden führenden Pferde dahin. Dennoch schien es, als sollte der Herr eher an das Ziel, die Plantage, kommen. Die Dame hatte keine Reitpeitsche, er dagegen bearbeitete sein Tier mit einer solchen und den Sporen zugleich, und zwar immer mehr, je näher sie der den Hof einschließenden Fenz kamen.
Jetzt erkannte man auch, daß der Reiter unterwegs den Sattel verloren haben mußte, er saß auf dem nackten Rücken des Tieres.
Der Mörder in der Stube hatte seine Augen unverwandt auf die beiden Reiter gerichtet, ohne seine Opfer noch zu beachten. Plötzlich erweiterten sich seine Augen, sein Gesicht nahm einen schrecklichen Ausdruck an, und ein pfeifender Laut kam über seine Lippen.
»Verflucht, er ist es! Jetzt, Eduard, flieh, oder es wird zu spät. Halt, diese da muß erst sterben, ein Dolchstich wird sie unschädlich machen.«
Seine Hand fuhr unter den Rock, da aber sprang das Weib, das unterdes wieder zu sich gekommen, mit einem Satz auf und stieß ihn so kräftig zurück, daß er an die Wand taumelte.
»Mörder!« gellte es durch das Haus.
Eduard dachte nicht daran, seine Rache jetzt zu befriedigen, einen wütenden Blick nur warf er auf das Weib, auf das Kind, welches bewegungslos auf dem Sofa lag, dann floh er durch die offene Tür, durch welche er unbemerkt hereingeschlichen war.
Miß Kenworths Hilfegeschrei rief Dienerschaft herbei, aber man dachte jetzt nicht an die Verfolgung des Fremden, sondern beschäftigte sich mit Martha, welche zwar noch lebte, aber halb erstickt war. Es gelang der Gouvernante, sie langsam wieder zum Bewußtsein zu bringen.
»Heisa, das gilt einen Wettritt,« schrien die Cow-boys und schwangen sich auf die Pferde, und wer keins erhaschen konnte, sprang an den Zaun, stieß die Neger zurück und kletterte auf einen Stein oder einen Baum, um über die fast zwei Meter hohe Fenz hinweg dem aufregenden Schauspiele zusehen zu können.
»Der Mann reitet ohne Sattel.«
»Nein, er hat ihn verloren. Das ist ein Gentleman, die reiten nie ohne Sattel.«
»Aber reiten kann er doch.«
»Die Dame reitet besser.«
»Oho.«
»Sie hat eine bessere Faust.«
»Der Mann auf dem braunen Hengst überholt sie doch.«
»Das fragt sich noch. Sie sollte nur peitschen.«
»Aber sie hat keine Peitsche.«
»Sie schont noch.«
»Nein, sie schont nicht, sie bleibt zurück.«
»Sie schont, sage ich. Was gilt die Wette, daß sie gewinnt?«
»Zehn Dollar, daß der Hengst gewinnt.«
»Dreißig Dollar, daß der Falbe siegt,« erscholl es schon von der anderen Seite.
»Fünfzig Dollar für den Falben. Wer hält?« brüllte ein Cow-boy vom Baume herunter, als gälte es, einen Toten aus dem Schlafe zu wecken.
»Wo soll das Ziel sein?«
»Achtung, ihr Nigger!« warnte ein alter, grauhaariger Cow-boy mit einem ledernen Gesicht. »Sie halten gerade auf hier zu. Sie wollen über die Fenz setzen.«
»Hurra, Jungens,« brüllte wieder der Cow-boy auf dem Baume, »sie halten auf die Fenz zu. Fünfzig Dollar für den Falben. Wer hält?«
»Ich, ich, ich,« schrie es von allen Seiten.
Der braune Hengst hatte alle Aussicht zu gewinnen, aber der Cow-boy auf dem Baume hatte nun einmal besondere Vorliebe für das schöne Geschlecht, er schwärmte für jede Reiterin, und so hielt er die Wette für sie. Aber diese kecke Dame auf dem Falben verdiente auch seine Bewunderung, graziöser, als sie, konnte niemand die Büsche und Gräben nehmen.
»Achtung, Jungens,« schrie wieder Ralph, der alte Cowboy, »sie kommen gerade hierher! Die Fenz ist das Ziel, werft euch den Gäulen in die Zügel, wenn sie darüber sind. Weg da, ihr Nigger!«
Die Cow-boys, welche auf den Reiter gewettet hatten, brachen in ein lautes Hallo aus, der braune Hengst schoß jetzt, von Sporen und Peitsche furchtbar bearbeitet, an dem Falben vorbei, einige Sprünge noch, die Neger stoben auseinander, ein Ruck in den Zügeln, der Hengst hob sich und flog in mächtigem Satz über die Fenz hinweg.

Die Cow-boys brachen in ein lautes Hallo aus, denn
der braune Hengst schoß jetzt an dem Falben vorbei.
Eine Viertelsekunde später folgte der Falbe, aber die Reiterin begnügte sich nicht damit, mit dem Tiere den Sprung gemacht zu haben, noch in der Luft hob sie sich im Sattel, und kaum berührte das Roß jenseits der Fenz den Boden, so glitt sie herab und stand aufrecht da, während der Falbe schon weiterjagte.
Staunend hatten die Cow-boys diesem tollkühnen Reiterstückchen zugeschaut. Es war ein Wagnis gewesen, bei welchem die Reiterin ebenso leicht meterweit mit der furchtbarsten Heftigkeit geschleudert oder auch unter dem stürzenden Pferd begraben werden konnte. Die größte Sicherheit, Kaltblütigkeit und Erfassung des rechten Momentes waren nötig gewesen, es gelingen zu lassen.
Dann aber brachen die Cowboys in ein endloses Jubelgeschrei aus und umringten die hochatmende Dame in dem schleppenden Reitkleide, welche es im Reiten mit jedem von ihnen aufnehmen konnte. Sie wartete auf den Reiter, welcher jetzt sein Pferd pariert hatte, umlenkte und zurückritt.
»Gewonnen!« rief er lachend vom dampfenden Pferd herab.
»Durchaus nicht,« entgegnete die Dame, ebenfalls lachend, »ich habe die Wette gewonnen.«
»Oho, alle diese Gentlemen sind Zeugen, daß mein Brauner zuerst in den Hof setzte.«
»So haben wir ja gar nicht gewettet.«
»Nicht? Um was denn sonst?«
»Mister Wood, Sie haben doch sonst ein so gutes Gedächtnis, entsinnen Sie sich nicht mehr auf den Wortlaut der Wette?«
»Wer den Hof innerhalb der Fenz zuerst betritt, soll gewonnen haben.«
»Nun, habe ich ihn nicht zuerst betreten?«
Der Herr brach in Lachen aus.
»Dann muß ich mich allerdings besiegt erklären, und ich tue es gern.«
»Und ich erkläre,« fügte die Dame hinzu, »daß Ihr Brauner allerdings gewonnen hat, es wäre aber nicht der Fall gewesen, wenn ich eine Reitpeitsche besessen hatte.«
»Das geht mich nichts an,« entgegnete der Herr trocken, sprang vom Pferde und bewillkommnete die übrigen Wettreiter, Herren und Damen, welche, da sie die Hoffnung auf den Sieg doch aufgegeben, den Weg nicht über die gefährliche Fenz, sondern durch das Tor genommen hatten.
Die anderen Reiter waren noch weit entfernt.
Als die Dame während des Satzes über die Fenz abgeglitten, war der Falbe also weitergejagt, doch blitzschnell hatten sich ihm von beiden Seiten zwei Cow-boys in die Zügel geworfen und ließen sich, unbekümmert um die drohenden Hufe, schleifen. Noch war das Tier nicht zum Stehen gebracht worden, als der eine Cow-boy auf die Füße zu stehen kam, ein Griff in die Mähne, ein Satz, und der verwegene Gesell war mitten im Laufen auf den Rücken des Pferdes voltigiert.
Es war Ralph, der alte Cow-boy, dessen Glieder durch das Alter noch nichts an Gelenkigkeit eingebüßt hatten.
Mit einem Schenkeldruck, der das Tier tänzeln machte, brachte er es der Herrin zurück, und jetzt fiel der Blick der Dame, die sich bisher lächelnd im Kreise der sie anstaunenden Männer umgesehen hatte, als suche sie nach alten Bekannten, auf ihn.
»Ralph,« rief sie fröhlich und sprang, das Reitkleid zusammenraffend und die freie Hand ausstreckend, an den Cow-boy heran, »Ralph, alter Kerl, kennst du denn deine Freundin nicht mehr?«
Mit offenem Munde starrte der Mann das junge Mädchen an, dessen schon tiefgebräuntes, aber frisches und gesundes Antlitz von dem wilden Ritt noch dunkler geworden war, so daß es an Farbe denen der Cow-boys fast nicht nachstand.
»Ne, Fräulein,« stotterte er befangen, »kann mich nicht entsinnen ...«
»Aber Ralph, kennst du denn das Mädchen nicht mehr, welches du reiten gelehrt hast, das mit dir in kurzen Kleidern wie toll hinter den fliehenden Herden hergejagt ist, sie umritten hat? Nebeneinander haben wir gehalten und sie zum Stehen gebracht. Weißt du nicht mehr, wie du mir den Gebrauch des Lassos zeigtest, wie du dich freutest, als ich das erste Pferd fangen wollte und abgeschleudert wurde, bis ich es ohne deine Hilfe doch fest hatte; weißt du noch, Ralph ...«
Da jauchzte der alte Bursche plötzlich auf und warf sich vom Pferde herab.
»Gottes Tod,« schrie er, »Ellen, wahrhaftig, 's ist unsere Ellen — Miß Petersen, wollte ich sagen,« verbesserte er sich schnell, ergriff aber dennoch ohne alle Scheu die Hand und schüttelte sie, als wolle er den Arm ausrenken. »Verdamm' meine Augen ...«
»Fluchst du immer noch?« lachte Ellen.
»Nein, ich hab's mir abgewöhnt. Verdamm' meine Augen, konnte ich alter Spitzbube mir nicht gleich denken, daß das nur Ellen sein konnte, die vom springenden Pferde aus dem Sattel glitt? Nun bleibt Ihr hier? Hurra, dann geht's wieder hinter den Pferden her. Die Pfeife habe ich auch noch, sie ist nur ein bißchen kürzer geworden. Wie war's auf dem Wasser? Aber das Reiten habt Ihr doch nicht verlernt, Gott verdamme mich — wollte sagen, der Teufel segne mich — nein — na, Ihr wißt schon, was ich sagen wollte.«
Die Worte sprudelten dem Graubart nur so über die Lippen, er war vor Freude schier närrisch.
»Nein, ich weiß nicht, was du für einen Ausdruck gebrauchen wolltest,« lachte Ellen, »aber ich weiß, daß du dich freust, mich wiederzusehen, und ich freue mich ebenso. Ach, da sind ja auch noch Dan und Fred und Bill und Ned, auch den dort kenne ich noch. Wie freut es mich, euch begrüßen zu können, und daß ihr es gerade seid, die mich in der Heimat zuerst bewillkommen.«
Des Begrüßens war kein Ende. Von allen Seiten streckten sich Hände aus, alle wurden erfaßt und geschüttelt, immer neue Freudenrufe erschollen. Die junge Herrin wurde förmlich erdrückt von den wilden, verwitterten Gestalten, man hörte kein ›gnädiges Fräulein‹, nur ›Ellen‹ oder ›Miß Ellen‹, höchstens einmal ›Miß Petersen‹.
»Genug, genug, ich sehe euch ja nachher wieder! So laßt mich doch nur einmal frei, ich habe noch andere Freunde zu begrüßen. Wo ist Martha?«
»Die wird sich riesig freuen, sie ist im Haus; heute ist die Ernte verkauft worden.«
Endlich gelang es Ellen, durchzukommen und sich den Freunden und Freundinnen beizugesellen, welche jetzt alle angekommen waren. Es waren Lord Harrlington, Hastings, Williams und alle diejenigen Damen, welche sich nicht mehr von diesen trennen wollten, Hannes und Hope und noch viele andere. Sie hatten sich nicht zurückhalten lassen, sondern sich der in ihre Heimat reisenden Ellen angeschlossen. Die Kranken weilten noch unter der Pflege ihrer Geliebten auf der Besitzung Hoffmanns, man wollte bald wieder dorthin zurückkehren.
Auch Johanna befand sich unter den Angekommenen, doch Hoffmann fehlte.
Nick Sharp beliebte es, sich wieder einmal Mister Wood nennen zu lassen. Sein Pferd hatte vorhin das von Miß Petersen geschlagen, als sie, von der übermütigen Laune erfaßt, einen Wettritt arrangiert hatte.
Alle waren schon aus dem Sattel gesprungen und hatten die Pferde herbeieilenden Dienern übergeben, unter denen Ellen nur sehr wenige bekannte Gesichter entdeckte.
»Ich grüße dich, meine Heimat!« rief sie jetzt fröhlich. »Einsam und traurig zog ich aus ihr fort, heiter und reich an Freunden kehre ich wieder. Auch arm war ich damals, arm und leer im Herzen, jetzt aber bin ich reich, denn,« sie warf sich an die Brust Harrlingtons, ich bringe dich ja mit, du bist von jetzt ab mein Schatz, mein Reichtum, mein Alles auf Erden. Und hätte ich auch alles, alles auf dem wilden Meere verloren, dich habe ich doch dabei gewonnen.«
Zärtlich umschlang Harrlington die Geliebte, preßte sie an sich und küßte sie.
»Auch ich habe dich gewonnen, Ellen, ich kann eher so sprechen, als du. Wenn man gewinnen will, muß man kämpfen, und ich habe gekämpft und gerungen, bis der Sieg mein war und mir der Preis zufiel.«
»Du glaubst, ich hätte nicht gekämpft? O, wenn du wüßtest, wie. Es war kein offener, nein, ein heimlicher Kampf, und dieser ist doppelt furchtbar. Stolz und Liebe stritten miteinander, mein Herz war eine Walstatt, bis die Liebe siegte. Denn ich habe dich ja vom ersten Augenblick an geliebt, da ich dich gesehen; den Stolz gebändigt zu haben, diese Ehre mußt du mir allein lassen, wenn ich dich und die Schicksalsfügungen mich als Kampfgenossen anerkennen will.«
»Streiten wir uns nicht um die Ehre, sondern teilen wir den Gewinn,« lachte Harrlington und schloß seiner Braut durch einen Kuß den Mund, zwei andere nahmen die Tränen von den Wimpern, obgleich sie nur freudetrunkene Augen verschleiert hatten.
Die beiden Liebenden konnten nicht sofort die innige Umarmung lösen.
»James, du stehst auf deinem eigenen Boden,« flüsterte Ellen.
»Noch nicht,« lächelte der Lord.
»Doch! Was mir gehörte, gehört jetzt dir, ich habe keinen Anspruch mehr darauf.«
»Du verschenkst sehr leichtsinnig.«
»Ich bin überhaupt kein Freund von Geschäften; deshalb ist es Eigennutz, wenn ich dich bitte, schon jetzt die Plantage als dein Eigentum anzusehen.«
»Ich verstehe dich nicht. Sprichst du im Ernst?«
Ellen lachte.
»Gewiß, James! Sieh, wenn man jahrelang abwesend gewesen ist und man kommt endlich wieder, dann erwarten einen fürchterlich viele Geschäfte. Ach, mir graust schon, wenn die Bücher aufgeschlagen werden und ich sie prüfen soll, ich muß es scheinbar tun, man muß sich in Respekt zu halten suchen, die Beamten wollen gewissermaßen mit ihrer Ehrlichkeit prahlen. Eine seltsame Art und Weise, als ehrlicher Mann Lob hören zu wollen, nicht?«
»Ja, die Ehrlichkeit wird rar, wer sie hat, zeigt sie gern, und wer sie nicht besitzt, noch mehr.«
»Und diese Geschäfte könntest du mir doch eigentlich abnehmen,« fuhr Ellen fort.
»Wenn du mir die Vollmacht dazu gibst.«
»Die hast du schon.«
»Oder wir machen es zusammen.«
»O, das geht auch. Dann verfliegt die Zeit schneller, wenn wir zusammen in die Bücher mit den endlosen Zahlenreihen blicken.«
»Nun, wir werden sehen, wie wir dies unangenehme Geschäft am schnellsten und besten erledigen, Mister Wood, was wünschen Sie?«
Diese Frage klang etwas unwirsch. Der Detektiv war aber auch ein zu großer Pechvogel, eben wollte Lord Harrlington wieder etwas von Liebe sagen, und natürlich mußte Sharp dazwischenkommen und ihn stören.
»Sie brauchen mich nicht so grimmig anzublicken,« sagte der unverwüstliche Detektiv kaltblütig, »es tut mir allerdings sehr leid, Sie stören zu müssen, doch ich mußte Sie darauf aufmerksam machen, daß dort Ihr zukünftiger Schwiegerpapa angelaufen kommt, um seine Gäste zu begrüßen. Ich glaube, er wird sich über den unerwarteten Besuch riesig freuen.«
Mit einem Zug des Mißvergnügens wandte Ellen den Kopf dem Hause zu.
Mister James Flexan kam aus dem Hauptportal und eilte der Gruppe von Herren und Damen zu, welche noch immer von Cow-boys und Negern umringt waren.
Hätte man sein Gesicht noch in der Flur selbst beobachten können, so hatte man in seinen Zügen einen namenlosen Schreck gelesen, den Ausdruck der furchtbarsten Angst, jetzt aber drückte es geheuchelte Freude aus.
Er war im Gesellschaftsanzug, hatte schnell einen Zylinder aufgestülpt und lief nun, lächelnd und sich krampfhaft die Hände reibend, auf die Gruppe zu, sie mit den Augen überfliegend und dann sich direkt an Ellen wendend.
Scheu wichen die Neger vor dem Haziendero zurück, der hier die Rolle eines Fürsten spielte.
Ellen ließ zwar die Arme von des Lords Halse, behielt aber seine Hand in der ihren. Mit kalten Augen musterte sie den Ankommenden, ebenso Harrlington. Die übrigen Herren und Damm näherten sich langsam.
»Ellen,« rief der alte Herr und eilte mit vorgestreckten Händen auf sie zu, »endlich, endlich erinnerst du dich, daß du noch ein Vaterhaus besitzest, in dem sich liebende Herzen um dich sorgen und sich nach dir sehnen. Sei mir gegrüßt, meine Tochter, vergiß der vergangenen Zeiten und nenne mich fortan deinen Vater! Nochmals, herzlich willkommen in deiner Heimat.«
»Guten Tag, Mister Flexan,« klang es eisigkalt aus Ellens Munde.
Bestürzt blieb der Haziendero stehen, seine Hände sanken schlaff herab, es war, als hätte ihn plötzlich der Schlag getroffen. Seine Gestalt brach fast zusammen, aber auch nur einen einzigen Augenblick währte diese Bestürzung, ein oberflächlicher Beobachter hätte sie nicht einmal wahrgenommen.
Sofort faßte er nach dem Hut, und mit einem süßlichen Lächeln verneigte er sich gegen Ellens Begleiter.
»Lord Harrlington, habe ich die Ehre? O, ich habe schon so viel von Ihnen erzählen hören — Unglaubliches — und wie mich das freut, Sie an der Seite meiner Tochter zu sehen!«
»Lord Harrlington — Mister Flexan,« stellte Ellen vor.
Der Lord begrüßte ihn höflich, aber ebenfalls eisigkalt, und Flexan wagte nicht, dem Bräutigam seiner Stieftochter die Hand zum Gruß zu bieten, wie es sich gehört hätte.
Ellen stellte weiter vor, Flexan schien überglücklich zu sein, er floß über von Komplimenten und Schmeicheleien, sein ganzes Wesen zerschmolz in Höflichkeit und Ehrerbietung. »Wie mich das freut,« kam wohl hundertmal über seine Lippen, welche beständig leise zuckten.
Auf Seiten der Herren und Damen dagegen nur leichtes Hutabziehen, flüchtiges Nicken, ein kaltes ›Guten Tag‹ und abweisende Blicke.
Diese peinliche Vorstellung war vorüber, unangenehm für die Gäste, geradezu niederschmetternd für den Hausherrn, und dennoch sah man ihm nicht das geringste Mißbehagen an. Alles an ihm war Liebenswürdigkeit und Freude.
»Doch nun bitte ich die Herrschaften, ins Haus zu treten. Dann entschuldigen Sie mich einen Augenblick, damit ich persönlich Fürsorge treffen kann, daß es meinen Gästen an nichts fehlt. Ich wäre unglücklich ...«
»Es sind meine Gäste, Mister Flexan,« warf Ellen ein, Sie beachtete nicht den warnenden Blick, den ihr Nick Sharp, als Mister Wood vorgestellt, zuwarf. Eine lautlose Stille trat ein. Alle fühlten, daß in Ellens Einwurf geradezu eine Beleidigung lag, nur Flexan selbst schien dies nicht zu merken.
»Natürlich, natürlich,« beeilte er sich zu sagen, »es sind eigentlich nicht meine, sondern deine Gäste, liebe Ellen, aber es würde mir unendliches Vergnügen bereiten, den Wirt spielen zu dürfen.«
»Sie werden mit der Baumwollenernte sehr beschäftigt sein.«
»Durchaus nicht, alles schon verpackt.«
»Oder mit dem Verkauf.«
»O, hm hm,« hustete Flexan, »der ist bereits abgeschlossen.«
»Sie haben das Geld schon empfangen?«
Diesmal wunderte sich Flexan wirklich, das sah man ihm an. Er war nicht gewöhnt, daß sich seine Stieftochter um Geschäfte kümmerte. Doch den Schrecken verstand er trefflich zu verbergen, nur nicht vor zwei außerordentlich scharfen, fest auf ihm ruhenden Augen, vor denen des Detektiven.
»Ah, seit wann interessiert sich meine schöne Tochter denn so für Geschäfte?« stellte er sich freudig erstaunt. »Hat sie dies auf der Reise gelernt? Ich dachte ...«
»Ich frage Sie, Mister Flexan, ob Sie das Geld schon empfangen haben,« wiederholte Ellen ungeduldig.
»Gewiß, es sind ...«
»Wir sprechen nachher darüber,« unterbrach ihn Ellen nachlässig, »es ist mir nur lieb, da ich gerade eine größere Summe in bar brauche. Doch nun bitte ich Sie, mir zu folgen,« wandte sie sich an die Freunde, »Sie sind meine Gäste, betrachten Sie mein Haus als das Ihrige, befehlen Sie ohne alle Umstände.«
Sie gingen zusammen nach der Hauptpforte. Flexan schritt neben Ellen, fand aber von dieser gar keine Beachtung. Auf seiner Stirn standen dicke Schweißtropfen, obgleich es gar nicht so besonders heiß war.
Ellen sprach auch nicht zu ihm, sondern zu ihrem Begleiter auf der andern Seite, zu Lord Harrlington, als sie sagte:
»Mich wundert nur, daß Martha mir noch nicht entgegengeeilt ist. Sie hat doch sicher schon von meiner Ankunft gehört. Ueberall wurde ja mein Name gerufen, und sie kennt mich doch, wenigstens meinem Bilde und meinen Briefen nach. Sie wird doch nicht krank sein?«
»O, daß ich das in der Aufregung vergessen habe,« nahm Mister Flexan sofort das Wort und zog ein bekümmertes Gesicht, »in der Tat, liebe Ellen, Martha ist ein kleiner Unfall zugestoßen.«
»Was ist mit ihr?« rief Ellen erschrocken, ihr kaltes Benehmen welches sie dem Stiefvater gegenüber zeigen wollte, vergessend. »Sie ist doch nicht krank?«
»Nein, ein Ueberfall ...«
»Ein Ueberfall?«
Schon war Sharp, der für dergleichen unglaublich feine Ohren hatte, hinter ihm.
»Ja, es hatte nichts zu bedeuten,« fuhr Flexan kurz fort.
»Ein Ueberfall in meinem Hause? Auf Martha? Unmöglich. Wer sollte es wagen ...«
»Ein Fremder —«
Flexan konnte nicht weiter erklären, Ellen ging oder rannte vielmehr dem Hause zu, Harrlington ihr nach, doch beide wurden von Sharp überholt.
Der Haziendero kämpfte seine Unruhe nieder, er wandte sich an die übrigen Gäste, welche langsamer dem Hause zuschritten, und erzählte ihnen, wie ein Mann auf sein Pflegekind und dessen Gouvernante einen räuberischen Anfall gemacht habe, kurz bevor die Herrschaften angekommen wären.
Der Räuber sei an der Ausführung seines Vorhabens gehindert worden und geflohen, Miß Kenworth und ihr Zögling seien völlig außer Gefahr.
Flexan vermied sorgfältig, das Aussehen, des Mannes zu beschreiben, er ahnte fast, daß diese Gäste Eduard Flexan auch in seiner jetzigen Gestalt kannten, er sprach immer nur von einem ›Fremden‹ der sich unter dem Vorwand, ihn zu sprechen, ins Haus geschlichen habe.
Aufgefordert, eine Beschreibung von ihm zu geben, antwortete er mit schön und wichtig klingenden, aber leeren Wortphrasen, wie sie einem jeden nur einigermaßen gewandten Weltmann stets zur Verfügung stehen, und welche bei harmlosen Zuhörern auch keinen Argwohn erwecken.
»Ich sprach den mir völlig unbekannten Mann im Wartezimmer vor meinem Bureau,« schloß Flexan. »Sein Aussehen wie auch sein Benehmen, war ein ganz seltsames, fast das eines Idioten, wenn nicht ein kluger Blick in seinem Auge gelegen hätte, wie man dies häufig bei menschenähnlichen Affen findet. Er bot sich mir als Pferdebändiger an, und es fiel mir auf, daß er eine zwar große, dicke Hand besaß, welche aber wohlgepflegt war, wie man sie bei Cow-boys nicht eben findet. Ich hielt ihn für einen Geistesgestörten und wies ihn kurz ab. Er entfernte sich und hat darauf einen Raubanfall versucht.«
Kopfschüttelnd hatte ihm Sir Williams zugehört.
»Idiot — kluger Blick — menschenähnlicher Affe — wohlgepflegte Hand — Pferdebändiger,« murmelte er, »nein, da werde ein anderer klug daraus, ich kann es nicht.«
Harrlington, Ellen und Sharp fanden die Gouvernante an dem Bette Marthas. Das Mädchen hatte sich erholt, doch sah es von dem überstandenen Schrecken der Todesnot noch bleich und angegriffen aus. Der Hals zeigte dunkelrote Flecken, welche die würgenden Finger zurückgelassen hatten.
Dieselben Zeichen trug auch der Hals von Miß Kenworth. Als die drei eintraten, überzog eine tiefe Röte ihr Antlitz, scheu senkte sie das Auge, doch gleich schlug sie es wieder offen und groß auf. — Es begegnete ruhig dem prüfenden Blick des Detektiven, dieser nickte und gab ihr die Hand wie einer alten Bekannten.
Dann, als sie zu Ellen hinüberschaute, zog eine noch dunklere Blutwelle über ihr Gesicht, doch Ellen achtete ihrer jetzt nicht, sie kniete neben dem Bettchen und hielt die Hand des Kindes.
»Martha, kennst du mich?«
Das Kind nickte nur, es streichelte die Hand des Mädchens, und selige Freude verklärte sein Gesicht. Zum Sprechen war es zu schwach, es bewegte nur die Lippen, und Ellen konnte ihren Namen von ihnen ablesen.
»Armes Kind,« flüsterte Ellen, »nie, nie sollst du erfahren, wer deine ...«
Ellen sprach nicht weiter, sie beugte sich über das Kind und küßte es wiederholt mit tränenden Augen.
»Was kannst du dafür? Wer du auch seiest, ich will deine Schwester sein.«
»Nicht Martha? Soll ich dir keine Schwester sein?«
Das Kind schüttelte das Köpfchen.
»Meine Mutter,« lispelte Martha.
»Ja, deine Mutter!«
Ellen richtete sich auf und strich sich das vorgefallene Haar zurück. Ihr Blick begegnete dem der Miß Kenworth. Ellen trat auf diese zu und ergriff herzlich ihre Hand.

»Ich danke Ihnen, Miß Kenworth,« sagte sie einfach, »ich zähle eine Freundin mehr.«
Miß Kenworth versuchte ihr scheu die Hand zu entziehen, doch Ellen hielt sie fest.
»Ich kenne und nenne Sie nicht anders mehr, denn als meine Freundin,« wiederholte sie.
Da trat Nick Sharp dazwischen.
»Wenn die Begrüßungen vorüber sind, so wollen wir an die Aufnahme des Tatbestandes gehen,« sagte er kurz. »Miß Kenworth, bitte, teilen sie uns mit, wie sich die Sache zugetragen hat!«
Miß Kenworth warf einen Blick auf Martha, winkte dann den dreien und trat ans Fenster. Die Entrüstung über die freche Tat überwog das Staunen der Zuhörer, nur Sharp blieb unverändert.
»Also sein eigenes Kind schont er nicht, wenn es gilt, seine Leidenschaft zu befriedigen. Es ist entsetzlich! Und offen sagte er aus, daß er keine Vaterliebe mehr kennt? Hat Martha gehört, daß er seinen Namen nannte?«
»Nein, ich habe sie deswegen schon ausgeforscht. Sie soll es auch nie erfahren.«
»Nimmermehr, sie soll den Namen Flexan auch nie tragen. Mister Sharp,« wandte sie sich an den sinnend dastehenden Detektiven, »da ist Arbeit für Sie. Warum zögern sie noch? Suchen Sie ihn zu greifen.«
»Erlauben Sie erst, daß ich mir überlege, mit welcher Hand ich ihn greifen soll,« entgegnete Sharp trocken, »übrigens ist mein Name Wood und kein anderer.«
Ellen wurde etwas verlegen.
»So habe ich das nicht gemeint.«
» All right, ich gehe.«
»Schonen Sie ihn nicht, auch wenn sein Tod nicht in die Pläne paßt,« rief Ellen dem Detektiven nach, »er ist ein Raubtier, kein Mensch.«
Ein spöttisches Lachen war die Antwort.
Miß Kenworth blickte dem Hinausgehenden nach und dann auf Ellen. Wieder übergoß ihr Gesicht eine purpurne Röte, ein Zittern ging durch ihren Körper, und plötzlich schlug sie die Hände vors Antlitz, warf sich übers Bett und weinte laut.
Verwundert schaute Harrlington auf Ellen, er kannte diese Dame nicht, noch weniger konnte er sich ihr rätselhaftes Betragen erklären.
»Lieber James, laß uns einen Augenblick allein,« bat Ellen. »Suche deine Freunde auf.«
Der Lord hauchte einen Kuß auf ihre Stirn und verließ das Zimmer.
Ellen beugte sich über die Gouvernante, zog sie empor und nahm ihr die Hände vom Gesicht.
Als Martha die Tante weinen sah, brach auch sie in Tränen aus.
»Nicht weinen, nicht weinen, Tante!« jammerte sie.
»Hören Sie, nicht weinen,« sagte Ellen liebreich und zog sie an ihre Brust, »Martha will es nicht, und ich will es auch nicht.«
»O, Sie sind so gut zu mir, und ich verdiene es nicht,« schluchzte die Unglückliche.
»Warum nicht? Was Sie auch begangen haben mögen, Sie haben es nicht nur gebüßt, sondern es auch wieder gutgemacht, und das ist viel wert. Seien Sie wieder heiter und glücklich, es steht Ihnen nichts im Wege.«
»Ein Gespenst schreckt mich.«
»Welches Gespenst?«
»Meine Vergangenheit. Ach, wenn Sie ahnen könnten, welch martervolle Stunden ich hier verbracht habe. Mein einziges Glück war Martha, in ihrer Gesellschaft floh das Gespenst, aber dann kamen die Nachtstunden, o, diese schrecklichen, einsamen Nachtstunden, dann quälte es mich, daß ich zu sterben wünschte, Nur der Gedanke an Martha hielt mich aufrecht.«
»So sollen Sie ständig in Gesellschaft Marthas bleiben und in der meinen, wir beide wollen das Gespenst bannen, bis es das Wiederkommen vergißt.«
Miß Kenworth schüttelte den Kopf.
»So lange ich hier nicht gekannt wurde, mochte es gehen, aber wer mag mit mir zusammenleben, der mich kennt?«
»Ich,« entgegnete Ellen fest. »Sie leben fortan als Miß Kenworth an meiner Seite, und wer es wagt, Sie zu beleidigen, der beleidigt mich. Ich und Lord Harrlington werden wachen, daß Ihr Friede nicht gestört wird.«
»Wer mich kennt, hat das Recht, auch an meine Vergangenheit zu denken.«
»Wer kennt Sie denn hier? Nur ich. Nicht einmal Harrlington hat eine Ahnung, wer Sie sind. Habe ich es ihm mitgeteilt — was meine unbedingte Pflicht ist — so wird auch er Ihnen als Freund die Hand reichen.«
»Und jener — jener Mister Sharp?« hauchte die Gouvernante.
»Ich denke, er wird sich bald auf Nimmerwiedersehen entfernen. Ich habe ihm früher bitter unrecht getan, ich habe ihn gehaßt und verachtet, doch ich bat's ihm ab. Jetzt steht er hoch in meiner Achtung, wenn ich ihn auch nicht als Gesellschafter wünsche. Er ist etwas rücksichtslos.«
»Rücksichtslos?«
Miß Kenworth schauerte wie im Fieber zusammen.
»Er kann entsetzlich sein,« stöhnte sie dann leise.
Wieder zog Ellen sie an ihre Brust und streichelte sanft das Haar, als hätte sie ein Kind vor sich und nicht eine Dame, welche bedeutend älter war, als sie.
»Ich weiß,« sagte sie zärtlich, »Sharp erzählte mir selbst alles. Kam mir sein Verfahren auch anfangs so barbarisch vor, daß ich ihn fast von neuem zu hassen begann, so habe ich doch später anders denken gelernt. Was er getan, hat er nur in guter Absicht und zu Ihrem Besten getan.«
»Ja, das hat er, aber ich möchte ihn nicht mehr sehen.«
»Dies soll auch nicht geschehen, ich werde dafür Sorge tragen. Wollen Sie also bei mir bleiben und als meine Freundin hier leben?«
Die Gouvernante schaute das junge Mädchen fest an, und ein seliges Lächeln breitete sich über ihr Antlitz.
»Wenn ich darf?« flüsterte sie endlich.
»Nicht dürfen, ich bitte Sie ja darum.«
»Ja. Ach, so sehr gern.«
Ellen zog die Hand der neuen Freundin an sich und schlug mit ihrer anderen Hand kräftig ein.
»So ist unser Bund besiegelt,« rief sie fröhlich. »Wir sind Freundinnen, wollen es bleiben und uns in die Erziehung Marthas teilen. Ihr früherer Name und alles andere ist vergessen, nichts soll von dem über meine oder über eines anderen Lippen kommen. Sie sind von jetzt ab Miß Kenworth. Diesem Namen haben Sie Ehre gemacht. Kümmern Sie sich nicht mehr um Ihre Verwandte, Martha und ich wollen Ihnen alles sein, und hat man Ihnen die Heimat genommen, ich will Ihnen eine andere geben. Sie sind nicht mehr bei fremden Leuten, Sie sind in Ihrer Heimat. Und nun habe ich noch jemanden, der vor Freude jubeln wird, wenn er Sie wiedersieht.«
Ellen sprang auf und eilte hinaus. Miß Kenworth streckte die Arme aus, als wolle sie die neue Freundin zurückhalten, doch diese war schon fort, da stürzte sie auf die Knie und schlug die verklärten Augen zum Himmel auf.
James Flexan hatte sich von den Gästen unter dem Vorwande verabschiedet, persönlich die Einrichtung ihrer Zimmer zu leiten, und ließ sich auch nicht davon zurückhalten, in Wirklichkeit aber wollte er nur seiner Verzweiflung und Angst freien Lauf lassen.
Er verschloß sein Bureau von innen und warf sich dann stöhnend auf das Sofa.
Die schwärzesten Bilder jagten an seinen Augen vorbei.
War er verraten? Nein, das glaubte er nicht. Sein Sohn hatte die Wahrheit gesprochen. Ellen war zwar verletzend kalt gegen ihn, aber so war sie auch früher gewesen, und hätte sie seinen eigentlichen Charakter auch nur geahnt, sie wäre ganz anders aufgetreten. Sie hätte ihm die Anklage direkt ins Gesicht geschleudert.
Ja, das hätte sie unbedingt getan, Flexan kannte seine Stieftochter so genau wie die Schubläden seines Kassenschrankes — so glaubte er wenigstens.
Richtig, der Kassenschrank!
Vor Flexans Augen tauchte plötzlich eine eiserne Schublade auf, und diese war leer, eigentlich aber hatten 80 000 Dollar in Banknoten darin sein müssen.
»Es ist mir lieb, dies zu hören, ich habe gerade eine größere Summe bar nötig, nachher sprechen wir darüber,« hörte Flexan im Geiste Ellen sprechen, und wieder schlugen ihm diese Worte wie Donnerhall ans Ohr.
80 000 Dollar — 320 000 Mark nach deutschem Gelde — sie waren weg, sein Sohn trug sie in der Tasche.
Ellen erfuhr sicher davon, daß diese ihm von den Agenten bar ausgezahlt worden waren, er hatte es ja vorhin selbst seinen Beamten freudestrahlend erzählt.
Sollte er sie alle zusammenrufen und ihnen Schweigen auferlegen? Unsinn, das war zu spät, ganz unmöglich, und dann die Diener!
Sollte er sagen, das Geld wäre schon nach der Stadt geschickt worden? Auch unmöglich, vor kaum zwei Stunden stellte er die Summe ja Ellen zur Verfügung. Und dann bedeutete dies nur einen Aufschub.
Doch weg jetzt mit dem Gelde, dafür ließ sich schon noch eine Entschuldigung finden. Erst wollte Flexan darüber nachgrübeln, was Ellen veranlaßt haben mochte, so plötzlich auf der Plantage zu erscheinen.
So schwarz diese Gedanken auch waren, und so sehr sie Flexan auch aufregten, immer wieder tauchte vor ihm die leere Schublade auf. Das Fehlen der Summe war die erste Gefahr, die ihm furchtbar drohte.
Ausreden? Das konnte man bei jedem anderen machen, aber nicht bei Ellen. Das Mädchen drang immer gleich bis aus den Grund. Wieso — wozu — warum — klar und deutlich — dagegen gab es keine Ausflüchte.
Sich selbst aufhängen?
Hm, das wäre sehr einfach, aber Mister Flexan haßte den Selbstmord. Er schätzte sein Leben übrigens höher. Für 80 000 Dollar hing er sich nicht auf, das war ihm eine zu lumpige Summe.
Gewiß, eine lumpige Summe, aber sie fehlte, und er konnte nicht sagen, wohin sie gekommen war.
Flexan sprang auf und rannte im Zimmer auf und ab, vielleicht brachte ihm diese Bewegung andere Gedanken. Gerade so war vorhin Eduard —
Flexan wollte sagen: Eduard auf- und abgelaufen — aber er vollendete den Gedanken nicht. Was hatte ihm Eduard geraten? Laß die Summe einfach von jemandem stehlen, ich empfehle dir Dan, den Cow-boy.
Sinnend blieb der Haziendero stehen.
Wahrhaftig, das war ein vortrefflicher Plan, so einfach. Warum war er ihm nur nicht früher eingefallen? Dann hatte er sich viel Verzweiflung ersparen können.
Flexan rieb sich vergnügt die Hände.
Aber halt, wer sollte der Dieb sein?
Stempelte er jemanden zum Verbrecher, und der Betreffende wurde gefaßt, so wurde aller Wahrscheinlichkeit nach seine Unschuld doch bald bewiesen.
Aber das schadete nichts, erst einmal Zeit gewinnen, dann konnte man eine andere List ausdenken, die unterdes aufgetriebene Summe gefunden werden oder sonst etwas geschehen.
Doch wer sollte der Dieb sein?
Der stählerne Geldschrank war so gut wie diebessicher, vielleicht hätte ihn ein äußerst geschickter Schlosser öffnen können, aber solche gab es unter dem Dienstpersonal nicht. —
Flexan hob plötzlich den Kopf und blickte mit einem seltsamen Ausdrucke durchs Fenster. Draußen tummelten sich noch immer die Neger und Cow-boys umher und feierten das Fest der Baumwollernte nach ihrer Weise.
Das Gewerbe der Cow-boys ist ungeheuer beschwerlich und gefährlich, aber auch sehr lohnend. Das Jahr hat für sie zwei Saisons oder, englisch ausgedrückt, zwei Seasons, Sprich »ßihsns« — Zeitabschnitte. in denen sie Geld verdienen, welches sie während der vier beschäftigungslosen Monate wieder ausgeben, das heißt, wenn es nicht schon in einigen Tagen verbraucht ist.
In der ersten Saison sind sie bei den Rinderherden, in der zweiten reiten sie die Frischlinge, die jungen Pferde, zu.
Sie bewachen die Rinder vor zwei- und vierbeinigen Räubern, halten sie zusammen, brennen ihnen den Stempel mit dem Zeichen des Besitzers ein, suchen die Verirrten auf und ziehen sie mit den Lassos aus den tiefen Löchern, mit denen die Prärie bedeckt ist und in denen die gestürzten Tiere zugrunde gehen, wenn sie nicht rechtzeitig entdeckt und befreit werden.
Die letzte Arbeit der Cow-boys während der Saison ist das Fangen derjenigen Tiere, welche den Verkaufsstempel tragen. Der unfehlbare Lasso schlingt sich um die Hörner. Das Tier wird aus der Herde gezogen und abseits getrieben. Dann bleiben die Tiere entweder sich selbst überlassen, zu einer Zeit, da sie sich ruhig verhalten, oder sie werden auch in Gehege getrieben, und der Cow-boy wird abbezahlt.
Er bekommt für jedes Stück Schlachtvieh, das er in gutem Zustande abliefert, einen bestimmten Betrag, und die ausgezahlte Summe ist oft von bedeutender Höhe.
Aber auch viele Strapazen und Gefahren sind mit dieser Tätigkeit verbunden.
Bei dem Cow-boy ist der Ausdruck ›Tag und Nacht im Sattel‹ kein leerer, er steigt wirklich von einem müden Pferde auf ein frisches und schläft im Sattel, wenn es die Ruhe seiner Herde gerade erlaubt.
Von den Gefahren, welche dem Cow-boy drohen, seien hier nur zwei erwähnt.
Es ist stockfinstere Nacht. Durch ganz Amerika braust ein Polarsturm, der selbst hier unten im Süden nichts von seiner schneidenden Kälte verloren hat. Die nach Tausenden zählende Rinderherde steht bewegungslos da, dicht aneinandergedrängt, die Köpfe gesenkt. Nur ab und zu hebt ein Stier das mächtige Haupt und blickt nach einer der Gestalten, welche rings um die Herde aufgestellt sind. Es sind berittene Cow-boys, bewegungslos steht das Pferd, den Hals weit vorgestreckt, bewegungslos sitzt der Reiter, bis über die Ohren in seinen Poncho gehüllt, als ob er schliefe; doch er schläft nicht.
Da brüllt ein Stier, dort wieder einer, in die Herde kommt etwas Leben, eine wellenförmige Bewegung entsteht auf der Fläche von Rücken.
»Verdammt,« knurrt der Cow-boy, »werden die blutigen Racker wohl aushalten?«
Die Tiere haben sich wieder beruhigt; einige mögen von einer Maus erschreckt worden sein. Sie blicken nach den stummen Wächtern, denn sie wissen recht gut, daß diese für ihre Sicherheit sorgen.
Wieder ist Todesstille eingetreten, nur das Pfeifen des Sturmes ist hörbar.
Der Cow-boy seufzt tief auf, befriedigt steckt er die Pfeife in den Mund, zündet sie aber nicht an. Warum nicht? Er hat Stahl und Zunder in der Tasche. Doch er wird sich schön hüten, jetzt Feuer zu schlagen.
Da zuckt aus dem mit schwarzen Wolken bedeckten Himmel ein blendender Blitz herab, der Vorbote unzähliger anderer, ein grollender Donner rollt nach, und die Verwirrung, welche dieser Blitz hervorruft, ist nicht zu beschreiben.
Die ruhige Masse der Rinder hat sich in ein wogendes Meer verwandelt, und plötzlich bricht es los. Fort geht es, Kopf an Kopf, die Hufe donnern auf dem harten Boden, unaufhaltsam, von der schrecklichsten Furcht gepeitscht, und der Masse zur Seite fliegen die Rosse der Cow-boys einher.
Die starkknochigen, ausgezeichneten Gäule — keine Luxustiere — haben den Kopf fast auf der Erde, den zahllose Löcher müssen übersprungen werden. Was fällt, das fällt. Der Sturz hat gewöhnlich den Tod des Reiters zur Folge, und dennoch schont er weder Sporen noch Peitsche, denn es gilt, die fliehende Herde zu überholen.
Stundenlang, Hunderte von Meilen geht es so fort, bis sich alle Cow-boys an der Spitze der Herde befinden, noch etwas weiter voraus, dann wird umgekehrt und den Rindern standgehalten. Die Cow-boys schreien, heulen und schießen in die Luft. Immer näher stürmen die wütenden Tiere, aber ihre Wächter weichen nicht. Sie oder die Tiere, entweder die Rinder halten, oder die Cow-boys werden in Atome zerstampft.
Gewöhnlich gelingt es, die Herde zum Stehen zu bringen. Dann müssen die in die Löcher gestürzten Tiere herausgeholt werden, worüber Tage vergehen. Gelingt das Wagnis nicht, trotz aller Energie und Kühnheit, so sind die Cow-boys dem rettungslosen Tode geweiht, und die Herde, und wären es hunderttausend Stück, ist dem Besitzer verloren, sie verschwindet spurlos. Die Tiere laufen Tausende von Meilen weit, bis sie zusammenbrechen und verrecken, sie stürzen in Löcher und sterben Hungers, sie fallen Raubtieren und Indianern zur Beute, und die leben bleiben, mischen sich unter fremde Herden oder unter die wilden Büffel, richtiger Bisons genannt. Der Haziendero hat das Nachsehen.

Mit dem nie sein Ziel fehlenden Lasso fängt
der Cow-boy selbst die störrigsten Stiere.
Aber auch bei Tage droht dem Cow-boy beständige Gefahr.
Die Rinder sind gegen jeden Reiter friedfertig, aber dem Fußgänger verderblich. Bei ihnen hört der Mensch ohne Pferd auf, ein Mensch zu sein, sie kennen eine solche Kreatur nicht, und die allgemeine Wut richtet sich gegen sie. Passiert es einem Cowboy, der sich unter die Rinder gemischt hat, daß sein Pferd stürzt, so ist er sofort der Gefahr ausgesetzt, von den Hörnern aufgespießt oder von den Hufen zermalmt zu werden.
Doch der Cow-boy verliert nicht den Mut. Mit mächtigem Satze springt er auf den Rücken des nächsten Stieres, dann wieder auf einen anderen. Stehen die Rinder eng zusammen, so läuft er über sie wie über eine Brücke hinweg, bis ihm ein Kamerad zu Hilfe kommt und ihn vor sich aufs Pferd nimmt.
In der zweiten Saison beschäftigt sich der Cow-boy mit dem Bändigen und Zureiten junger Pferde, die noch keinen Zaum getragen haben. Wie er dies macht, soll hier nicht geschildert werden. Man liest eine derartige Beschreibung öfter als die des Cow-boy bei Bewachung der Rinderherde. Nur so viel sei erwähnt, daß es nicht wahr ist, wenn behauptet wird, ein bockendes Pferd könne auch den besten Reiter abwerfen. Der Cow-boy verläßt den Sattel nicht, so lange das Tier sich nicht wälzt. Er ist kein eleganter Reiter, seine Haltung ist nachlässig, und sein Aufsteigen auf ein zugerittenes Pferd ist als schlafmützig zu bezeichnen.
Aber man muß ihn sehen, wenn er zureitet. Das nach den Beinen des Reiters beißende Pferd begegnet stets mit dem Maule dem Hiebe der eisernen Faust, es mag bocken oder steigen, wie es will, der Cow-boy sitzt wie angegossen, wälzt oder überschlägt es sich, so steht der Cow-boy neben ihm, und kaum springt es wie eine Feder in die Höhe, so sitzt er auch schon wieder im Sattel. Will es sich den Kopf an einem Baumstamme zerschmettern, so wird es mit einem Tuche oder mit dem Hute geblendet, und gibt es seine Versuche nicht bald auf, so preßt der Cow-boy ihm mit den Schenkeln die Flanken, bis es röchelnd zu Boden sinkt.
Wer einen Pferdebändiger bei seiner Arbeit gesehen, der interessiert sich nicht mehr für die tollkühnsten Kunststücke eines Voltigeurs im Zirkus.

Der Cow-boy bändigt die Tiere im Akkord. Für jedes Pferd erhält er einen gewissen Betrag, und da er in Ausdauer Unglaubliches leistet, so verdient er oft täglich 20 bis 30 Dollar. Die zu schnell zugerittenen Pferde taugen allerdings nichts, sie sind zu grausam behandelt worden, sie fürchten den Reiter, erhalten aber ihre Wildheit sofort wieder, wenn sie merken, daß der neue Reiter sie nicht regieren kann. Außerdem werden sie hartmäulig, sie gehorchen nicht dem Zügel.
Durch diese harte Lebensweise sind die Cow-boys ein ganz besonderer Menschenschlag geworden: roh, jede Bequemlichkeit verachtend, unempfindlich gegen eigene Schmerzen und gegen die anderer, tollkühn. Haben sie Geld, dann wollen sie den Augenblick genießen, das ›morgen‹ kümmert sie nicht. Sinnlos streuen sie ihr sauer erworbenes Geld mit vollen Händen aus, ohne Reue, ohne Befriedigung und ohne Dank. Darin übertreffen sie noch die Matrosen, Trapper, Taucher und so weiter, welche für schwere gefahrvolle Arbeit meist gut bezahlt werden.
Spiel, Weiber und Wein sind es, welche an allen Orten der Welt bereit sind, Leuten solchen Schlages das Geld nicht aus der Tasche zu locken, sondern es heraus zu rauben.
Die Behörden gestatten es, denn sie selbst werden dadurch bereichert, sie leisten dieser Räuberei sogar Vorschub. Ist das Geld aber verschwunden, dann bekommen die Ausgebeuteten, um recht deutlich zu sprechen, einen Tritt, und von den Behörden werden sie oft genug noch eingesteckt.
Ein hervorragender Charakterzug bei dieser Gattung von Menschen ist die Liebe zur Freiheit und Unabhängigkeit. Der Cow-boy tut seine Arbeit, läßt sich aber nicht befehlen; wenn er merkt, daß sein Gobernador, das heißt sein Meister oder Herr, unzufrieden mit ihm ist oder ihm auch nur die kleinste Vorschrift macht, so kehrt er ihm sofort trotzig den Rücken und verläßt ohne Abschiedsgruß die Plantage auf Nimmerwiedersehen. Cow-boys sind immer gesucht. —
Flexan blickte noch immer mit dem seltsamen Gesichtsausdruck zum Fenster hinaus auf die Gruppe der spielenden, trinkenden und johlenden Cow-boys.
Ein alter Cow-boy saß etwas abseits auf einem Fasse und schnitzte an seiner Pfeife herum.
»Ralph, das ist der richtige,« murmelte Flexan, »er ist zwar gut Freund mit Ellen, aber das macht nichts, ich kenne ihren Trotz und werde mich danach zu richten wissen.«
Der Haziendero öffnete das Fenster.
»He, Ralph!«
Der Gerufene hob den Kopf.
»Sir?«
»Kommt in mein Zimmer!«
Der Cow-boy erhob sich und ging breitspurig dem Hauptportal zu.
Schnell schloß Flexan den Kassenschrank auf und entnahm einem Kasten fünf Hundertdollarnoten.
»Die Sache ist es wert, daß ich meine Privatschatulle angreife,« murmelte er, »werde den Schaden schon wieder ersetzen können.«
Er schloß den Schrank wieder, faltete die fünf Banknoten zusammen, preßte sie sorgfältig in einem Buche glatt und steckte sie in seine Westentasche.
Im Vorzimmer ertönten sporenklirrende Schritte. Flexan öffnete die Tür und ließ den Cow-boy eintreten.
»Was gibt's, Herr?«
Ralph stand mitten in der Stube, die Hände an den Hüften, die Beine gespreizt und auf dem Kopfe den breitrandigen Filzhut, den Sombrero, welchen abzunehmen er nicht für nötig hielt.
Seine Beine staken in ungeheuren Stiefeln, die ihm bis übers Knie reichten und oben von der ledernen Hose abstanden. Diese Oeffnung benützte der Cow-boy als Messerscheide, denn an der Innenseite des rechten Stiefels sah man den Horngriff eines Messers hervorragen.
Am breiten Gürtel hing das Revolverfutteral, daneben stak die Pfeife, und rechts hing der Tabaksbeutel. Der Gürtel war mit Patronen gespickt. Oberhalb desselben schlang sich ein Lasso in vielen Windungen um das baumwollene, rote Hemd.
Der Haziendero lehnte am Schreibtisch, die Hände auf dem Rücken.
»Was gibt's Herr?«
»Wart Ihr es nicht, Ralph, der seinerzeit das Gittertor am Garten reparierte, welches das durchgehende Wagenpferd zertrümmerte?«
»Ich tat's.«
Flexan nickte.
»Habt Ihr wieder etwas zu reparieren?«
»Nein, jetzt nicht.«
»Was soll denn die Frage?«
»Woher versteht Ihr derartige Arbeit?«
»Ich kann sie eben.«
»Wart Ihr früher Schlosser?«
Der Cow-boy zögerte einen Augenblick. Doch er war eine offene Natur, er verhehlte niemals die Wahrheit.
»Ja, ich habe als Schlosser gelernt und in meinen jungen Jahren auch in einer Geldschrankfabrik als Geselle gearbeitet. Konnte aber das ruhige Leben nicht aushalten, mußte hinaus und mich austoben, wurde erst Trapper und später Cow-boy. Bin's nun schon dreißig Jahre lang.«
»Hm, Ihr hättet lieber Trapper bleiben sollen.«
»Warum?«
»Das Leben gefiel mir auch nicht, der Cow-boy verdient mehr, und ich bin gern lustig.«
»Oder Ihr hättet Schlosser bleiben sollen. Ein geschickter Schlosser verdient auch viel.«
»Bah, Schlosser. Warum gebt Ihr mir überhaupt solche Ratschläge?«
»Ihr werdet alt.«
»Unsinn, ich reite noch ebensogut, wie damals, als ich mich in meinen besten Jahren befand.«
»So? Dann hättet Ihr eben Schlosser bleiben sollen.«
Der Cow-boy machte große Augen.
»Sir, wollt Ihr mich beleidigen?«
»Ich will niemanden beleidigen.«
»Was sollen denn die Redensarten?« fragte Ralph mit drohend gerunzelter Stirn.
»Wer hat die schwarze Stute zugeritten?«
»Welche?«
»Die mit der weißen Brust und den weißen Fesseln.«
»Ich, und ich denke, der Reiter kann mit dem Tiere zufrieden sein.«
»Das Tier beißt.«
»Das ist nicht wahr.«
»Ich sage, es beißt,« fuhr Flexan auf. »Wollt Ihr mich der Lüge zeihen?«
»Reitet es, und ich will zusehen. Wenn es nur einmal beißt, dann will ich die ganze Saison umsonst gearbeitet haben.«
»Die Saison hat ja eben erst begonnen, da habt Ihr nicht viel zu verlieren.«
Der Cowboy wurde immer unwilliger, er konnte kaum noch seinen Zorn bemeistern, umsoweniger, als er stark angetrunken war.
»Beißt das Pferd, so werde ich die ganze Saison für Euch umsonst arbeiten,« rief er heftig.
»Es beißt, sage ich Euch, es zeigt überhaupt böse Mucken. Ich wollte es Miß Petersen schenken, aber sie mag kein Pferd, welches sich vor dem Wasser scheut. Sie war sehr mißgestimmt über Euch.«
»Ueber mich?« wiederholte der Cow-boy.
»Ja, über Euch. Sie sagte mir vorhin erst, Ihr verderbt die Pferde, weil Ihr sie zu schnell zureitet.«
»Das ist nicht wahr,« keuchte der Cow-boy.
»Doch. Miß Petersen wünscht, daß Dan das Pferd noch einmal zureite.«
»Ihr wollt das Pferd noch einmal jemandem anders geben?«
»Ich tue es auf Miß Petersens Wunsch.«
Ralph schlug donnernd mit der Faust auf den neben ihm stehenden Tisch.
»Was habt Ihr? Wünscht Ihr etwas? fragte der Haziendero gelassen.
»Abbezahlt will ich werden,« schrie der Cow-boy, außer sich vor Wut.
»Wie Ihr wünscht! Ich bin überhaupt nicht mit Euch zufrieden, darum sagte ich schon vorhin, Ihr hättet lieber Schlosser bleiben sollen. Alle von Euch zugerittenen Pferde zeigen Mucken.«
»Spart Eure Worte, Sir, ein jedes, das über Eure Lippen kommt, ist eine verdammte Lüge.«
»Ist's nicht wahr, daß so schnell, wie Ihr, kein anderer Cow-boy die Pferde bändigt?«
»Das ist eben die Kunst.«
»Ihr gebt Euch keine Mühe. Kaum können die Tiere Sattel und Zaum tragen, so liefert Ihr sie schon ab. Eine Woche später sind sie ganz genau wieder so wie früher, wenn man sie nicht von früh bis abends reitet. Das ist's, warum Ihr mir die meisten Pferde abliefert.«
»Nun ist's genug!« schrie Ralph und hieb bei jedem Worte auf den Tisch. »Abbezahlt will ich werden, und damit basta! Mag Eure blutigen Pferde zureiten wer will, Ralph tut's nicht mehr. Ich bin nicht von dieser blutigen Farm abhängig. Wohin ich komme, werde ich gern aufgenommen. Her mit dem blutigen Geld, hört Ihr's?«
»Das sollt Ihr haben,« sagte der Haziendero und nahm von dem Regal ein Buch herunter.
»24 Tage seid Ihr hier erst beschäftigt und habt in der Zeit 31 Pferde abgeliefert. 8 Dollar bekommt Ihr für das Stück, macht zusammen 248 Dollar. Seht hier die Rechnung; stimmt sie?«
Er hielt dem Cow-boy das offene Buch hin, doch dieser blickte nicht hinein.
»Es stimmt,« knurrte er, »aber zieht die 8 Dollar für die schwarze Stute ab, wenn sie Euch nicht gut genug ist.«
»Dann bekämt Ihr gar nichts, denn ich bin mit allen Euren Pferden nicht zufrieden.«
»Herr,« knirschte Ralph, »seht Euch vor, ich lasse mich nicht beleidigen. Reitet mir ein Pferd nach dem anderen vor, und wenn eins untauglich ist, dann will ich keinen blutigen Dollar annehmen.«
»Ich habe keine Zeit dazu, und ich will Euch ja auch die Summe bezahlen.«
»Zieht die Stute ab! Ich hab's nun einmal gesagt, und was Ralph sagt, das hält er.«
»Und ich will von Euch nichts geschenkt haben.«
»Zählt auf!« sagte der Cow-boy nach kurzem Besinnen.
Flexan schloß mit dem kunstvoll gearbeiteten Hauptschlüssel den Geldschrank auf und dann mit einem einfacheren eine Schublade, aus welcher er Gold- und Silberstücke nahm.
Dann trat er vor den Tisch, an welchem der Cow-boy stand, und begann aufzuzählen.
Er mußte noch einige Male in den Kasten greifen, bis zweihundert Dollar auf dem Tische lagen, noch einige Silberstücke dazu, und die Schublade war leer.
Flexan schloß eine andere auf, entnahm ihr eine Hundertdollarnote und hielt sie dem Cow-boy hin.
»Könnt Ihr wechseln?«
Ralph stieß ein spöttisches Lachen aus, er besaß keinen Cent in seinem Vermögen.
»Womit? Mit Patronenhülsen vielleicht? Solch einen Lappen nehme ich überhaupt nicht.«
Der Cow-boy nimmt nur ungern Papiergeld, er will blankes, hartes Geld haben, das ihm schwer in der Tasche liegt und klimpert.
»So muß ich wechseln gehen, wartet einen Augenblick! Hier liegen zweihundert Dollar.«
»Nur keine Angst, ich nehme nichts davon,« höhnte der Cow-boy.
Flexan steckte das übrige Geld in die Tasche, ging an den Geldschrank, verschloß die beiden Schubladen, ließ aber die Haupttür selbst offenstehen. Dann verließ er das Zimmer, um mehr kleines Geld zu holen.
Kaum war er hinaus, so fing der Cow-boy an, mit dröhnenden Schritten im Zimmer hin- und herzugehen und auf eine mordsmäßige Weise zu fluchen.
Er schimpfte auf den Haziendero, auf Ellen, in der er sich getäuscht hätte, auf die Pferde und Rinder, und alles war bei ihm verdammt und blutig.
»Dies blutige Mädel ist auch hochnäsig geworden, habe wohl gesehen, wie schnell sie aus unserer Mitte wollte, um dem verdammten Gentleman an den Hals zu fliegen. Für uns hatte sie gar kein Auge mehr, natürlich, so ein blutiger Hampelmann ist ihr lieber als ein alter, aber ehrlicher Cowboy. Gott mache mich blind, wenn ich die Dirne noch einmal ansehe, und diese blutige Hazienda verlasse ich sofort, oder ich will verdammt sein!«
Sein Selbstgespräch wurde unterbrochen, Flexan trat wieder herein. Ralph befand sich gerade vor dem Kassenschrank, er blieb stehen und drehte sich um.
»Nun?«
»Hier ist Euer Geld.«
Flexan stand am Tisch links neben Ralph, zählte daher mit der linken Hand auf, und der Cow-boy blickte auf die Geldstücke.
Er sah nicht, wie Flexan, der etwas gebückt stand, in seiner Hand kleine, zusammengefaltete, blaue Zettelchen hielt, er merkte auch nicht, wie Flexan dieselben mit der Geschicklichkeit eines Taschenspielers in die weitschäftigen Stiefel des Cow-boys gleiten ließ.
»248 Dollar. Stimmt es?« sagte Flexan und hob den dunkelgeröteten Kopf.
»Stimmt.«
Ralph suchte unter dem Silber, er konnte anscheinend eine Summe nicht zusammenbringen.
»Wechselt mir diese zehn Dollar in Silber.«
Flexan holte Silbergeld aus der Tasche und wechselte dem Cow-boy.
»Hier die 8 Dollar für die Stute,« sagte Ralph und schob das betreffende Geld beiseite.
»Ich will sie nicht haben, sage ich Euch.«
»Nicht?«
»Nein.«
Ralph nahm die 8 Dollar, und schwubb, flogen sie zum Fenster hinaus.
Dann strich er das übrige Geld zusammen, steckte es ein, unterschrieb die Rechnung im Buch mit seinem Namen und verließ sporenklirrend das Zimmer, ohne ein Wort des Abschieds, und ohne den Haziendero noch einmal anzusehen.
Flexan atmete hoch auf, als er allein war.
Er sah durch das Fenster, wie Ralph über den Hof ging, mit den Cow-boys sprach und dann nach den Pferdeställen ging. Bald darauf ritt er durch das Hoftor. Das Pferd, welches der Cow-boy bei seinem Dienstantritt erhält, gehört ihm, er kann es später mit fortnehmen, fällt es und wird unbrauchbar, so bekommt er stets ein anderes.
»Du reitest nach der Stadt,« murmelte Flexan höhnisch. » All right, morgen schon wirst du sinnlos betrunken sein, und dann mußt du sofort wegen Verdachtes des Diebstahls eingezogen werden. Man wird die fünfhundert Dollar bei dir im Stiefel finden, und du kannst nicht sagen, woher du sie hast. Das andere Geld fehlt natürlich, aber was weiß ein Cow-boy von dem, was er in der Trunkenheit tut? Er hat die Banknoten weggeworfen, sie verschenkt oder sich die Pfeife damit angezündet.«
Flexan begab sich zu den Gästen, vermißte unter ihnen aber Ellen und Lord Harrlington.
Er suchte erstere zu sprechen, ward aber mit dem Bescheid abgewiesen, sie würde erst gegen Abend erscheinen.
Er wollte mit Ellen betreffs des Geldes reden, welches sie wünschte, doch sie erklärte ihm, geschäftliche Angelegenheiten würde sie morgen mit ihm abmachen.
Das Erntefest erreichte am Abend seinen Höhepunkt, Alt und jung, vornehm und niedrig, schwarz und weiß tummelte sich auf dem Hofe beim Scheine von Fackellicht. Selbst die Gäste beteiligten sich an dem Treiben.
Nur eine Truppe fehlte unter den Lustigen, die Cow-boys.
Sie waren plötzlich verschwunden, ohne zu sagen, wohin, und als Ellen sie suchen ließ, konnte man sie nirgends finden.
Die fremden Gäste hatten sie sicher nicht verscheucht, sie genierten sich nicht so leicht. Etwas ganz anderes mußte sie bewogen haben, das fröhliche Fest plötzlich zu verlassen. Niemand ahnte den Grund, mit Ausnahme des Hazienderos.
Hannes und seine junge Frau hatten auf der Plantage Hoffmanns bereits von allen denen Abschied genommen, welche diese Reise wegen Krankheit oder wegen ihrer Pflicht als Pfleger nicht hatten beiwohnen können. Ihr Entschluß war, sich in wenigen Tagen nach New-Orleans zu begeben und von dort aus nach Deutschland zu reisen.
Besonders Hope drängte dazu. Sie hörte nicht auf den Vorschlag ihres Mannes, die ›Hoffnung‹ dabei zu benutzen, nein, sie wollte auf den ersten Schnelldampfer, und Hannes mochte Anordnung treffen, wie er wollte, sein Schiff nach Deutschland dirigieren zu lassen.
Uebrigens hatte Hannes nur einmal diesen Vorschlag gemacht, seine Bitte aber nicht wiederholt, denn Hope war in ein nervöses Weinen ausgebrochen.
Hoffmann erklärte sich bereit, für die ›Hoffnung‹ und ihre Besatzung Sorge zu tragen.
Wie gern fügte sich Hannes dem Wunsche seiner Gemahlin! Es tauchten jetzt andere Gefühle in seiner Brust auf, er sehnte sich nicht mehr nach Abenteuern und Gefahren, wohl aber nach einem stillen, trauten Heim.
Er stand am Fenster seines ihm angewiesenen Zimmers, welches eher Anspruch auf den Namen eines Prunkgemaches machen konnte, und blickte auf das sich vor ihm ausbreitende Hüttendorf der Arbeiter.
Es war jetzt leer. Seine schwarzen Bewohner befanden sich auf dem Hofe, von welchem her ihr lauter Jubel an die Ohren des sinnenden Mannes drang.
Alles beteiligte sich an dem Erntefeste, die Alten saßen, nicht wie sonst, gebückt vor den leichten Hütten, selbst die vom Fieber Geplagten hatten ihre Lager im Schatten der Wände verlassen, denn wer sich nicht selbst an dem munteren Treiben der Jungen und Gesunden beteiligen konnte, der wollte ihm doch wenigstens zuschauen. Schon der Anblick von Lust und Frohsinn gibt dem Alter anscheinend seine verlorene Jugend wieder, läßt den Kranken seine Schmerzen vergessen.
Nur vor der Tür einer Hütte war Leben, nur drei Menschen hielten sich von dem lärmenden Jubel fern.
Waren sie so alt, daß sie nicht mehr gehen konnten, oder war ihr Schmerz so groß, daß sie den Frohsinn haßten?
Nein, das dicke, gutmütige Gesicht des jungen Negers war eitel Sonnenschein, es strahlte von Entzücken, und so matt das junge, schwarze Weib neben ihm auch auf der Bank saß, ein so seliger Glanz lag in seinen dunklen Augen, daß man den leidenden Zug im Gesicht nicht mehr wahrnahm.
Warum beteiligten sie sich nicht an dem Feste, warum lachten und freuten sie sich nicht mit ihren schwarzen Brüdern?
Ach, es genügte ihnen, daß der kleine dicke Wollkopf auf dem Schoße der Mutter so herzlich lachte, so, wie es nur ein Kind kann. Die Herzen der Eltern jubelten, wenn er mit den Beinchen strampelte und die Händchen in das kurzhaarige Fell des niedlichen Hündchens krallte, das der glückliche Vater seinem Sprößling hinhielt.

Die Herzen der Eltern jubelten, wenn der Kleine
mit den Beinen strampelte und so herzlich lachte.
Mutterglück, Vaterfreude! Was galt ihnen dort auf dem Hofe das Trinken, Tanzen und Lachen, sie hörten es nicht, ihr Ohr sog mit Wollust die quiekende Stimme des eigenen Kindes ein, ihr Auge weidete sich an dem Strampeln der dicken Gliederchen.
»Die Neger haben keine Seele!« Dies haben in Amerika nicht nur rohe, dumme Menschen gesagt, welche das schwarze Ebenbild Gottes als Lasttier betrachteten, auch von den Kanzeln ist dies gepredigt worden. Leicht war dieses Wort gesprochen, aber eine unauslöschliche Schmach ist damit auf seine Urheber und Verbreiter geworfen worden. Die Weltgeschichte ist eine scharfsichtige Richterin und durch Gold nicht zu bestechen. —
Zu Füßen des Negers lag eine Hündin und säugte Junge. Sie stieß ein winselndes, bittend klingendes Winseln aus und blickte ängstlich nach dem fehlenden Hündchen, das in den Händen des Negers zappelte.
Ob diese Hündin, die für ihr Junges bangte, wohl auch eine Seele besaß?
Auf die Schulter des sinnenden Zuschauers legte sich eine Hand, Hope stand neben ihm.
»Woran denkst du, Hannes?«
»Ich freue mich über dieses Bild,« umging Hannes die Frage.
»Es ist auch schön.«
Beide betrachteten, Arm in Arm, die kleine Szene, jedes mit seinen Gedanken beschäftigt.
»Ob die Hündin ihr Junges wohl ebenso lieb hat wie die Mutter ihr Kind?« fragte Hannes nach langer Pause.
»Gewiß,« nickte Hope.
»Das glaube ich nicht.«
»Warum nicht?«
»Nimmt man ihr das Junge weg, so mag sie sich wohl eine kurze Zeit lang ungebärdig betragen, aber nur eine sehr kurze Zeit — dann hat sie es vergessen.«
»Ebenso ist es bei Menschen.«
»Oho, wir trauern jahrelang um einen Toten.«
»Ein Tag oder ein Jahr, das bleibt sich gleich.«
»Wir können unser ganzes Leben lang um eine geliebte Person trauern.«
»Das findet man auch bei Tieren.«
»Du willst doch nicht etwa sagen, Hope, daß Tiere ein ebenso gefühlvolles Herz besitzen wie wir?« fragte Hannes verwundert.
»Wen meinst du mit dem ›wir‹?«
»Nun, uns Menschen.«
»Welche Menschen?«
»Dich, mich und alle anderen.«
Hope lächelte bitter.
»Man findet sehr wenig gefühlvolle Herzen unter den Menschen,« entgegnete sie, »und, wie ich während meiner Reise gesehen habe, am wenigsten unter den Christen. Kennst du die Religion der Buddhisten?«
»Nur sehr wenig.«
»Ich will dir ein Geschichtchen erzählen, welches meinem Vater passiert ist. Derselbe ging einst durch die Straßen von New-York und war, wie gewöhnlich, sehr einfach gekleidet. Da sprach ihn plötzlich ein indischer Matrose an, im langen, schmutzig-weißen Rocke, Turban und gelben Schuhen. Er mochte meinen Vater für einen armen Mann halten, oder es mochte sich jemand mit ihm und meinem Vater einen Scherz erlauben wollen, kurz, der Inder fragte in schlechtem Englisch, ob mein Vater ihm für gutes Geld einmal New-York zeigen wolle.
»Mein Vater war ein hochangesehener, geachteter Mann, er hatte sich sein Ansehen besonders dadurch zu verschaffen gewußt, daß er viel Armen- und Krankenhäuser gestiftet oder doch begründet hatte. Aus Spaß ging er auf den Vorschlag des Inders ein und spielte den Fremdenführer.
»Natürlich machte er den Orientalen ganz besonders auf die vielen Armenanstalten und Hospitäler New-Yorks aufmerksam und nannte mit Stolz die Summen, welche zu ihrer Erbauung und Instandhaltung nötig gewesen seien, und wie viele Insassen sie beherbergen konnten.
»Der Inder staunte nur immer.
»›Nicht wahr, das ist großartig?‹ fragte mein Vater.
»›In der Tat, diese Gebäude sind prächtig!‹
»Mein Vater erzählte, wieviel in New-York Gutes für Arme und Kranke getan, und was für Elend ohne diese Gebäude herrschen würde. Verwundert hörte ihm der Inder zu, nur schade, daß mein Vater dessen Staunen nicht verstand.
»›Hm,‹ sagte zuletzt der Inder, ›diese Gebäude sind ja großartig, richtige Paläste, in denen Rajahs wohnen könnten, aber sagt, was würden denn nun Eure Kranken und Armen anfangen, wenn sie nicht in solche Gebäude aufgenommen werden könnten?‹
»Einen Augenblick war mein Vater bestürzt, dann sagte er:
»›Dann müßten sie eben umkommen oder doch wenigstens Not leiden.‹
»›Bei mir zu Hause gibt es keine solche Anstalten,‹ entgegnete der Inder kopfschüttelnd, ›aber unsere Kranken und Armen brauchen keine Not zu leiden!‹ Sprach's und ging von dannen. Diesmal war es mein Vater, der vor Staunen den Mund aufriß.
»Mein Vater hatte nämlich keine Ahnung,« schloß Hope, »daß die buddhistische Religion weit menschenfreundlicher ist, als unsere christliche. In Indien wird viel mehr Nächstenliebe geübt, als bei uns, und zwar nicht, um Ehre damit zu erringen. Im stillen, ungesehen gibt man seine Gaben, hilft man Unglücklichen, und ebenso verhält es sich dort mit den Tieren. Als in Europa noch Menschen geschlachtet wurden, gab es in Indien schon großartige Tierhospitäler. Der Priester verurteilt dort den Menschen nicht, Gebete herzumurmeln, sondern dazu, soundsoviel Vögel auf dem Markte zu taufen und fliegen zu lassen, oder aber Schlachttiere zu kaufen und sie bis an ihr Ende zu ernähren, als wären es seine Kinder. Sieht ein Vater, daß sein Bube ein Tier quält, so zieht er ihn am Ohre und sagt: Das bist du, das Tier hat dieselbe Seele wie du ...«
»Das kommt daher, weil die Inder an Seelenwanderung glauben.«
»Gut. Wir aber kennen auch das Sprichwort: Quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz. Wird jedoch bei uns, die wir uns gebildete, hochzivilisierte Menschen nennen, das Tier nicht auf eine ganz abscheuliche Weise gequält? Denke nur an Droschkenpferde, an Singvögel, an Froschschenkel, an gemästete Gänse. Pfui!«
»Mir läuft dabei das Wasser im Munde zusammen.«
»Wenn ich von den gemarterten Droschkenpferden spreche?«
»Nein, aber beim Gedanken an die gemästeten Gänse,« lachte Hannes.
»Du bist prosaisch,« schmollte Hope.
»Und du bist heute wieder einmal ganz besonders verstimmt. Deine gute Laune ist dahin ...«
»Du irrst.«
»Nein, ich sehe dir an, daß du erst vorhin wieder geweint hast.«
»Ach, Hannes,« und Hope fuhr sich mit dem Taschentuche über die wirklich etwas geröteten Augen, »wenn du wüßtest, was ich alles ...«
»Ich weiß alles, aber das ist kein Grund, zu weinen, wenn du mich wirklich lieb hast.«
»Gar nichts weißt du,« unterbrach ihn Hope schmollend. »Da setze dich hin und höre mir zu! Ich will dir etwas Schreckliches erzählen. Wir haben eben von Tierquälerei gesprochen, nun sollst du etwas von Menschenquälerei zu hören bekommen.«
»Hm, bin oft genug selbst gequält worden,« brummte Hannes und setzte sich auf einen Stuhl, während sich Hope auf dem Sofa niederließ.
»Nun, hat Mister Flexan vielleicht einen seiner Schwarzen bis aufs Blut peitschen lassen? Dann soll ihn der Teufel holen, aber ähnlich sieht's ihm.«
»Etwas viel Schlimmeres.«
»Das Fell über die Ohren gezogen?«
»So höre doch, ein Weib ...«
»Potz tausend, ein Weib hat er gemartert? Dann soll er hängen!«
»Unterbrich mich doch nicht mehr. Ich will dir etwas erzählen, was dich wirklich interessieren wird.«
»Gut, ich höre.«
»Vor allen Dingen wisse, daß ich derjenigen, welche mir das folgende erzählt hat, fest versprochen habe, es niemandem wiederzusagen.«
Hannes brach in Lachen aus.
»Sehr gut, und jetzt willst du es mir gleich wieder erzählen? So seid ihr Frauen doch alle!«
»Du hast mir viel zuviel Frauenkenntnis,« schmollte Hope, »und übrigens ist das etwas ganz anderes, wenn ich es dir wiedererzähle. Wir sollen untereinander keine Geheimnisse haben, sonst kann nimmermehr bei uns Einigkeit herrschen.«
»Du hast recht,« begütigte Hannes, »die Frau soll vor dem Manne kein Geheimnis haben und umgekehrt, und was man seiner Ehehälfte verschweigen muß, das darf man gar nicht erst anhören. Also bitte, erzähle und sei versichert, daß dein Geheimnis das meine ist.«
»Erinnerst du dich noch, einmal von mir den Namen Mistreß Forbes gehört zu haben?«
»Nein.«
»Es ist der Name meiner Tante,« fuhr Hope fort, sichtlich befangen.
»Ah, nun erinnere ich mich. Hm, viel Ehre kannst du mit dieser Verwandtschaft eben nicht einlegen. Doch das geht mich ja nichts an.«
»Aber von dieser eben will ich erzählen.«
»So sprich!«
»Du hast doch schon Miß Kenworth gesehen?«
»Wer ist das?«
»Die Erzieherin Marthas, welche hier im Hause weilt und in Korrespondenz ...«
»Mit Nick Sharp stand,« fiel Hannes ein. »Natürlich, ich habe sie mir ordentlich betrachtet, als sie mir vorgestellt wurde, nur der Name fiel mir jetzt nicht gleich ein. Sie ist es ja, durch deren Hilfe Nick Sharp, den ich mit Stolz meinen Freund nenne, dem ganzen Lügengewebe der Halunken auf die Spur gekommen ist.«
»Pst,« warnte Hope erschreckt, »nicht so laut. Du weißt, wo wir uns befinden.«
»In der Höhle des Löwen, richtig, ich muß vorsichtig sein. Diese Miß Kenworth ist eine interessante Dame, sie gefiel mir im ersten Augenblick, doch was hat sie denn mit deiner Tante zu tun?«
»Mistreß Forbes und Mistreß Kenworth sind ein und dieselbe Person,« sagte Hope leise, aber jedes Wort betonend.
Hannes war vor Ueberraschung aufgesprungen.
»Was, das wäre deine Tante?«
»Es ist meine Tante.«
»Dann ist Miß Kenworth ja auch meine Tante,« stammelte Hannes verwirrt.
Hope lächelte, obgleich sie sehr ernst war.
»Gewiß, sie ist auch deine Tante; ich glaubte aber, du würdest zuerst an etwas anderes denken.«
Hannes begann, mit großen Schritten im Zimmer auf- und abzugehen.
»Natürlich, natürlich, ich mußte meine erste Ueberraschung nur durch irgend einen Ausruf zum Ausdruck bringen. Hol' mich der —, ich denke, diese Mistreß Forbes ist ein ganz gottvergessenes Frauenzimmer.«
»War sie auch, Hannes.«
»Und nun entpuppt sie sich als ein Engel der Verfolgten. Na, Hope, dann hast du deine arme Taute entweder furchtbar verkannt oder mir gegenüber furchtbar schlecht gemacht. Eins von beiden ist sicher.«
»Mit nichten, Hannes, meine Tante war früher wirklich so, wie ich sie dir geschildert habe, ich habe sie selbst in ihrem Elend gesehen, und auch Miß Petersen weiß, welchen schändlichen Charakter sie besaß. Doch nun ist aus Mistreß Forbes Miß Kenworth geworden, mit dem alten Namen hat sie auch ihren alten Charakter abgelegt.«
»Aber wie ist denn alles gekommen?«
»Sie ist kuriert worden.«
»Mit was?«
»Erst frage: Durch wen?«
»Nun, durch wen?«
»Durch Nick Sharp.«
»Ist das ein Teufelskerl, dieser Detektiv! Aber so erzähle doch nur, Hope, wenn du alles weißt, wie dies alles gekommen ist. Hat Nick Sharp Bekehrungsversuche mit ihr angestellt?
»Ja, mit der Hundepeitsche.«
»Das sieht ihm ähnlich. Hat sie sich denn das ruhig gefallen lassen?«
»Ich habe dir schon erzählt, wie ich zusammen mit Miß Petersen in Sydney meine Tante besucht und in welchem Zustande ich sie gefunden habe, und ferner, wie Miß Petersens gutgemeinte Absicht, dem wahnsinnigen Weibe das Geld wegzunehmen, durch das Dazwischentreten ihres Geliebten verhindert wurde.«
»Ich entsinne mich noch recht gut, ich weiß sogar noch, daß dieser Geliebte von ihr Jimmy gerufen wurde und daß er beim Fortgange Ellens ihr so merkwürdige Worte zuflüsterte.«
»Ja, er sagte: Raubtiere bändigt man nicht mit guten Worten und Versprechungen, sondern mit der Peitsche, oder so etwas Aehnliches, und nun kannst du dir denken, wer dieser Jimmy war.«
»Nick Sharp?«
»Er war es.«
»Aber wie kam er dorthin? Woher wußte er von deinem Vorhaben?«
»Er spielte die Rolle Jimmys im Interesse von Ellen. Lord Harrlington hatte erfahren, daß Ellen ein Unternehmen vorhabe, welches vielleicht gefährlich ablaufen konnte, denn mit Mistreß Forbes war zuzeiten nicht zu spaßen. Er gab daher Nick Sharp den Auftrag, ihr zu folgen. Dieser erkundigte sich, wer der Geliebte des Weibes sei, suchte ihn auf und bestach ihn durch Geld, daß er sich von dem Schauplätze seiner zukünftigen Taten, womöglich für immer, entferne.«
»Aha, nun nahm Sharp das Aussehen Jimmys an und handelte als dessen Vertreter.«
»So ist es. Du weißt doch ferner, daß dieser Jimmy seiner Geliebten die Banknoten wegnahm, dieselben in die Brusttasche steckte, sie aber dem Weibe gleich zurückgab?«
»Ja. Ich konnte mir diese Handlungsweise nicht erklären.«
»Sharp behielt die richtigen Scheine, ihr aber gab er unechte, und zwar ganz plump nachgeahmte, die kein Kind als echt nahm, doch das erregte Weib merkte den Betrug nicht, es nahm die Banknoten.«
»Ach so, nun verstehe ich.«
»Sharp verließ nun das Weib. Dieses ging allein aus und winde schon nach einer Stunde wegen der falschen Banknoten arretiert. Der Detektiv setzte sich mit der Polizeibehörde in Verbindung, es gelang ihm, sie für seine Pläne zu gewinnen, und nun begann er mit meiner Tante einen regelrechten Erziehungsversuch. Sie kam erst in ein Arbeitshaus, wurde mit der schwersten Arbeit beschäftigt und mag wohl mehr Hiebe, als Essen zu schmecken bekommen haben, dann nahm Sharp sie unter seine Fuchtel, und wie sie mir erzählte, ist er fürchterlich mit ihr umgesprungen. Sie lebte bei ihrem vermeintlichen Aufseher wie eine Prinzessin, versuchte sie aber nur einmal, in ihr früheres Leben zurückzufallen, so hat Sharp sie behandelt wie eine Nonne, welche wegen unsittlichen Lebenswandels bestraft wird. Sie bebt noch jetzt, wenn sie nur daran denkt. Endlich war sie gebrochen, sie wagte nicht mehr, sich ihrem Peiniger zu widersetzen, sie gehorchte ihm aufs Wort, und Sharp muß sich noch anderer Mittel bedient haben, ihren Willen dem seinigen unterzuordnen — wie es ja solche gibt — kurzum, sie war ihm gefügig, er konnte von ihr verlangen, was er wollte, sie war eben nur ein willenloses Werkzeug in seiner Hand.«

»Sharp wußte, daß Eduard Flexan seinem Onkel oder vielmehr seinem Vater eine Gouvernante für Martha »zusenden wollte welche einmal Mister Flexan überwachen und dann auch Martha in strenger Obhut halten sollte, denn Martha war ja zur Erbin Ellens bestimmt. Sie ist die Tochter von Eduard Flexan und Sarah Morgan, das weißt du ja nun.«
»Eine saubere Brut.«
»Sollen die Kinder für die Sünden ihrer Eltern büßen?« fragte Hope vorwurfsvoll.
»Nein, nein, Martha macht überhaupt einen angenehmen Eindruck auf mich.«
»Auch ich hatte sie lieb vom ersten Augenblick, da ich sie gesehen. Doch genug: Miß Kenworth war Sharp persönlich bekannt. Es war dem schlauen Detektiven ein leichtes, die für diese bestimmten Orders abzufangen, Miß Kenworth selbst verschwinden zu lassen und an ihre Stelle meine Tante zu schieben. Eine gewisse Aehnlichkeit begünstigte die Verwechslung, eine Erkennung durch Eduard war nicht zu befürchten, denn dieser mußte sich immer im Auslände aufhalten, weil er hinter den Vestalinnen her war. Miß Kenworth, oder vielmehr meine Tante, hat ihre Aufgaben glänzend gelöst, ohne ihre Hilfe wären wir auf jeden Fall dem Untergange geweiht gewesen, und außerdem hat sie bewiesen, daß sie dank Sharps Erziehungsmethode ein anderes Leben begonnen hat.«
»Ich verstehe nun. Kehrt sie in den Kreis ihrer Verwandten zurück, zu denen auch ich jetzt zähle?«
»Würdest du zögern, sie in deiner Gesellschaft leben zu lassen?«
Hannes lachte kurz auf.
»Ich? Ich wüßte nicht warum. Du solltest doch wissen, daß ich über Vorurteile erhaben bin.«
»Ebenso denkt Ellen. Sie hat meiner Tante ein Asyl in ihrem Hause angeboten, und sie hat es dankbar, mit Freudentränen im Auge, angenommen. Sie fühlt sich wie neugeboren, aber allein will sie bleiben, niemanden mehr sehen, der sie an ihre Vergangenheit erinnert, ausgenommen Ellen. Sie ißt übrigens nicht das Gnadenbrot, sie ist noch immer reich zu nennen.«
»Unter solchen Umständen würden es viele vorziehen, zwar unter anderem Namen zu leben, aber nicht verborgen.«
»Daran erkennt man eben, daß bei meiner armen Tante eine wirkliche Sinnesänderung eingetreten ist. Wohl ihr, daß diese stattgefunden hat! Doch laß dir nicht merken, was du weißt! Tue nicht, als ob sie deine Verwandte wäre! Nenne sie einfach Miß Kenworth und behandle sie wie eine Fremde. Unerkannt fühlt sie sich am wohlsten, wir wollen ihr das schwer errungene Glück nicht wieder rauben.«
Hannes versprach es.
Nach kurzem Klopfen trat Ellen herein.
»Warum so allein hier?« rief sie.
»Wir sind nicht allein.«
»Nun ja,« lächelte Ellen, »Liebende fühlen sich nie einsam, aber Sie werden erwartet. Unsere Freunde sind bereit, sich auf dem Hofe unter die Fröhlichen zu mischen, und Sie dürfen sich nicht ausschließen.«
»Das wollen wir auch nicht! Komm Hope, wir werden uns noch einmal lustig machen, ehe wir Amerika, vielleicht für immer, verlassen, und wenn wir uns unter den Schwarzen drehen, dann wollen wir denken, wir feien in Mgwana, bei jenem Feste, wo wir in der Palmengrotte unsere Flucht verabredeten und das Heiratsprojekt deines Bruders und Miß Petersens zuschanden machten.«
Ellen hielt das lachende Pärchen zurück.
»Noch eins! Wissen Sie, wer die Person war, welche auf Martha und Miß Kenworth einen Raubanfall machte?«
»Ein affenähnlicher Idiot mit klugem Blick, plumpen, aber zarten Händen, der Pferde zureiten wollte,« lachte Hannes.
»Es war Eduard Flexan.«
»Alle Wetter.«
»Ja, er hielt sich hier auf und hatte jedenfalls nichts Gutes im Sinn. Unsere Ankunft hat seine Pläne gestört. Nick Sharp ist bereits hinter ihm her, und wir hoffen, daß der Flüchtling dem Detektiven nicht entgeht. Er ist der letzte, vor dem wir uns in acht zu nehmen haben.«
»Ich möchte mit Ihnen morgen früh Geschäftliches besprechen,« hatte Ellen am Abend nach dem Feste zu Flexan gesagt, als die Gesellschaft sich trennte.
»Ich bin jederzeit für dich zu sprechen, liebe Ellen,« war die von einem süßlichen Lächeln begleitete Antwort gewesen. »Welchen Ort beliebst du zu bestimmen?«
»Ihr Kontor.«
»Und welche Zeit?«
»Zur Erledigung von Geschäften ziehe ich die frühe Morgenstunde vor.«
»Um vier, um fünf bei Sonnenaufgang? Bestimme nur, ich werde dich erwarten, liebe Ellen.«
»Sagen wir um neun Uhr! Gute Nacht!«
Wir wollen uns nicht mit den Gefühlen beschäftigen, welche während einer schlaflosen Nacht Kopf und Herz des alten Hazienderos durchwühlten. Er war nicht so dumm, daß er das kalte Benehmen seiner Stieftochter nicht bemerkte. Sie war noch dieselbe, sie haßte ihn, aber sie trug auch noch eine sichtliche Verachtung zur Schau. Sie sprach mit ihm, als hätte sie einen Diener vor sich, den sie demnächst wegen unordentlichen Benehmens entlassen würde.
Ellen konnte sich nicht verstellen. Wie sie dachte, so sprach sie auch, das glaubte er sicher zu wissen, in etwas hatte er sich aber doch getäuscht.
Schon lange vor der bestimmten Zeit befand sich Mister Flexan in seinem Arbeitszimmer, tat, als ob er in einem Buche rechne, horchte in Wirklichkeit aber mit nervöser Anstrengung auf die Schritte, welche draußen auf dem Korridor ertönten.
Würde wohl jemand vor der Tür stehen bleiben?
Da hob die Uhr zum Schlage aus, um die neunte Stunde zu verkünden, und in demselben Augenblick pochte es gegen die Tür. Da sie diesmal nicht verschlossen war, öffnete sie sich, und Ellen trat herein.
Draußen lag über Feld und Flur heiterer Sonnenschein, doch er spiegelte sich nicht wider im Antlitz Ellens, eine frostige Kälte war darin zu lesen; Flexan dagegen suchte sein Gesicht mit der größten Anstrengung in heitere Falten zu legen.
Doch sie sollten bald verschwinden.
Er sprang auf und eilte ihr entgegen, die Hand zum Morgengruß ausstreckend.
»Guten Morgen, liebe Ellen! Wie frisch und munter du aussiehst! Noch nie habe ich die Morgensonne mit solcher Pracht aufgehen sehen, wie heute.«
Auch diesmal nahm Ellen die dargebotene Hand nicht an, Flexan hatte die erste Abweisung vergessen. Sie nahm auf einem Stuhl Platz und blickte ihren Stiefvater kalt an, der sich an den Schreibtisch lehnte.
»Es ist das erstemal, daß wir uns allein sprechen,« begann sie frostig.
»Ja, leider! Ich wünschte schon lange, dich einmal allein zu sehen; die Anwesenheit der Gäste wirkt bei einem Wiedersehen störend.«
»Für mich nicht. Doch erst etwas anderes, ehe wir von Geschäften sprechen!«
»Bitte, liebe Ellen?«
»Nur die Anwesenheit der Gäste hat mich gehindert, Ihnen schon gestern zu sagen, daß Sie mich nicht ›liebe Ellen‹, überhaupt nicht mit meinem Vornamen zu nennen haben. Ich bin für Sie einfach Miß Petersen.«
Lautlose Stille trat ein. Flexan schwieg, er war aber über diesen Anfang keineswegs bestürzt.
»Ich glaubte, das Recht zu besitzen, Sie so vertraulich anzureden, Miß Petersen,« begann er nach einer Weile höflich. »Ehe Sie nach New-York gingen, nannte ich Sie so, warum sollte ich es jetzt nicht mehr tun? Wollen Sie mir den Grund sagen, warum Sie mir gegenüber diese Kälte zeigen?«
»Ich ziehe vor, den Grund für mich zu behalten. Ich hoffe, Sie werden sich auch so meinem Wunsche fügen.«
»Gewiß,« beeilte sich Flexan zu sagen, »wenn Sie es wünschen. Es schmerzt mich allerdings sehr, daß unser Verhältnis ein so gespanntes geworden ist.«
»Es war nie ein freundliches.«
»O doch, ich war stets höflich und liebenswürdig Ihnen gegenüber. Sie konnten sich nie beklagen über mein Verhalten.«
»Das gute Verhältnis zwischen uns war einseitig. Sie müssen bemerkt haben, daß ich mich stets von Ihnen fernzuhalten gesucht habe.«
»Manchmal schien es mir allerdings so, und vergebens habe ich nach einem Grunde gesucht.«
»Lassen wir das!« entgegnete Ellen mit abwehrender Handbewegung. »Etwas anderes ist es, was ich vor allen Dingen Sie fragen wollte. Wie kommt es, daß sich gestern Abend die Cow-boys plötzlich vom Fest zurückgezogen haben?«
Flexans Herz begann schneller zu schlagen, aber er heuchelte Gleichgültigkeit.
»Habe keine Ahnung.«
»Es muß doch etwas vorgefallen sein.«
»Nicht, daß ich wüßte.«
»Haben Sie die Leute beleidigt?«
Flexan zog ein spöttisches Gesicht.
»Cow-boys kann man nicht so schnell beleidigen. Und überdies, was kümmert's mich, ob die Cow-boys das Fest verlassen oder nicht? Ich nehme keinen Anteil daran.«
»Aber ich,« war die scharfe Antwort. »Es ist mir nicht gleichgültig, ob die Leute, welche ich beschäftige, zufrieden oder unzufrieden sind. Ich mag nicht, daß sie Grund zur Klage haben.«
»Ich werde mich nachher erkundigen, ob die Cow-boys sich durch irgend etwas beleidigt fühlen, Miß Petersen, und Ihnen dann die Meldung zukommen lassen.«
Es lag ein leiser Spott in diesen Worten; Ellen beachtete ihn nicht.
»Bemühen Sie sich nicht, ich werde mich dann selbst darum kümmern,« erwiderte sie. »Ueberhaupt werde ich von jetzt ab die Verwaltung der Plantage in die Hand nehmen.«
»Sie sind großjährig, haben also das Recht dazu. Ich werde Ihnen die Bücher in tadellosem Zustande übergeben. Welchen Tag bestimmen Sie dazu? Natürlich muß ich mir einige Zeit dazu erbitten.«
»Solange meine Gäste hier sind, ist daran überhaupt nicht zu denken. Vielleicht reise ich auch mit ihnen, und erst nach meiner Wiederkunft werde ich die Bücher prüfen, respektive prüfen lassen, da ich die Plantage jedenfalls verkaufen werde.«
»Ah!«
»Ja, denn mit einem Pächter ist es so eine Sache. Ein Gut kann leicht heruntergebracht werden.«
»Dies ist bei mir nicht der Fall gewesen,« sagte Mister Flexan gekränkt.
»Ich meinte nicht Sie, ich betrachte Sie nur als den Verwalter meines Besitztums, seit Sie aufgehört haben, mein Vormund zu sein, was in Amerika übrigens nicht viel zu bedeuten hat.«
Flexan biß sich auf die Lippen. Er bemerkte immer mehr, daß es Ellen darauf abgesehen hatte, ihn zu beleidigen, oder aber ihn aus seinen Illusionen, hier Herr zu sein, zu treiben. Doch das schadete nichts, er hatte sich schon darauf gefaßt gemacht, schlimmeres hören zu müssen, nämlich betreffs Eduards.
»Sie haben gestern die Baumwollenernte verkauft?« fuhr Ellen fort.
Jetzt kam das Erwartete, jetzt galt es, seine Selbstbeherrschung zu wahren.
»Ja, an den Agenten Hayman in New-Orleans, der in den letzten Jahren stets unsere Baumwolle abnahm.«
»In den letzten Jahren? Mir ist nichts davon bewußt.«
»Ich habe Ihnen nicht mitgeteilt, daß ich mit diesem Herrn in Geschäftsverbindung getreten bin, da Sie sich nie für die Einzelheiten interessiert haben.«
»Das ist allerdings wahr, darum will ich nicht weiter darüber sprechen, daß Sie mir dies nicht mitgeteilt haben. Warum aber verkaufen Sie gerade an Hayman?«
»Er bot einen guten Preis.«
So ruhig sich Flexan auch stellte, innerlich erschrak er doch. Hayman war ein Jude, der sich in unsaubere Geschäfte einließ, und Flexan hatte ihm die Baumwolle überlassen, weil durch diesen Handel viel in seine eigene Kasse floß. Die Baumwollenernte war weit größer gewesen, als Flexan angegeben, in den Ueberschuß teilten sich Flexan und Hayman. Daß Ellen aber diesen Mann kannte, davon hatte er keine Ahnung gehabt. Ein gutes Licht warf das nicht auf ihn.
»Hayman wird allgemein für einen Betrüger gehalten. War Ihnen dies nicht bekannt?«
»Mir gegenüber war er stets ehrlich.«
»Hm, nun gut. Es wird das letztemal gewesen sein, daß er seinen Fuß auf meine Plantage gesetzt hat. Zurückgenommen kann der Verkauf nicht mehr werden?«
»Nein, er ist bereits unterzeichnet.«
»Ist das Geld bezahlt?«
»Es liegt bereits hier.«
»80 000 Dollar, nicht wahr?«
»Ja.«
»So bitte ich Sie, mir 50 000 geben zu wollen.«
»Wie Sie wünschen. Wann soll ich Ihnen diese Summe übergeben?«
»Jetzt sofort.«
»Sofort?«
»Wundert Sie das?« fragte Ellen scharf. »Ich will sie jemandem leihen, welcher mich bald verlassen will. Bitte, geben Sie sie mir.«
Hier galt es kein Zögern mehr, Flexan mußte sofort der Aufforderung nachkommen, sonst erregte er Ellens Verdacht.
Gelassen und mit sorglosem Gesicht ging er an den Kassenschrank, zog den Schlüsselbund aus der Tasche und öffnete die Haupttür.
Sollte Ellen schon Verdacht haben? dachte er dabei mit klopfendem Herzen. Nein, das ist unmöglich.
Jetzt wollte er die Schublade öffnen, arbeitete einige Sekunden mit dem Schlüssel am Schloß herum und zog sie auf. Schon vorher hatte er seinem Gesicht einen überraschten Ausdruck zu geben gewußt, jetzt malte sich Schrecken darin.
»Sie ist leer,« stammelte er.
»Leer?« rief Ellen, welche wirklich ahnungslos war. »Leer? Sie haben die Summe in ein anderes Schubfach gelegt. Sehen Sie doch nach, ehe Sie mich so erschrecken!«
Sie war zu ihm hingesprungen.
»Nein, nein, ich lege größere Summen nur hierherein, mir fiel schon auf, daß die Schublade nicht verschlossen war, und ich vergesse nie, sie zuzuschließen.«
»Sehen Sie doch erst nach!« drängte Ellen ungeduldig.
Mit zitternden Händen — er brauchte sich jetzt nicht mehr zu verstellen — schloß Flexan eine Schublade nach der anderen auf, sie enthielten Bücher, Dokumente, Gold- und Silbergeld, auch Banknoten in beträchtlichem Wert, aber eine Etikette zeigte, wozu sie bestimmt, oder wofür sie erhalten waren, doch die gesuchten Scheine waren nicht dabei.
Flexan wandte das kreidebleiche Gesicht Ellen zu und blickte in ein Paar große Augen, die ihn fest ansahen.
»Die Summe ist weg,« stotterte er.
»Ist weg? Was soll das heißen?« fragte Ellen ruhig.
»Sie ist gestohlen worden. In diesem Schubfach hier hat sie gelegen. Ich war sofort bestürzt, als ich merkte, daß der Schlüssel nicht schloß, es ist ein Einbruchsdiebstahl vorgefallen. Schnell, Miß Petersen, weit kann der Dieb nicht sein, wir können ihn noch fassen.«
Er wollte an Ellen vorbei, doch mit einem Schritt stand diese vor ihm und sperrte seinen Weg.
»Wohin?«
»Alles alarmieren — Leute ausschicken — Untersuchungen halten.«
»Nur ruhig Blut, Mister Flexan! Ich bin nicht gewohnt, gleich den Kopf zu verlieren. Dort setzen Sie sich hin und geben mir als derjenigen, welche am meisten von dem Verluste betroffen wird, ruhige und klare Antworten. Dann erst wollen wir sehen, was sich tun läßt!«
Als wäre er von der Entdeckung ganz gebrochen, so sank Flexan mit dem Talent eines Schauspielers in den nächsten Sessel. Vor ihm stand Ellen, ihn scharf fixierend.
»Wann haben Sie das Geld in die Schublade getan?«
»Gestern morgen gegen 11 Uhr,« stöhnte Flexan, der sich verzweifelt gebärdete.
»Und wann haben Sie es zuletzt darin gesehen?«
»Gestern nachmittag gegen 6 Uhr.«
»Als wir schon hier waren?«
»Ja.«
»Warum sahen Sie nach?«
»Ich nahm aus dem Kassenschrank Geld, und eine nervöse Unruhe trieb mich dazu, nach der großen Summe zu sehen.«
»Sie war unberührt darin?«
»Ja, es kann ...«
»Warten Sie! War während der Zeit, da Sie die Summe zuletzt gesehen und heute morgen außer Ihnen jemand in Ihrem Bureau?«
»Nein.«
»Entsinnen Sie sich.«
»Ich kann mich nicht entsinnen.«
»Auch nicht jener Mann, den Sie als einen Idioten bezeichneten?«
Flexan zuckte nicht mit der Wimper vor dem festen Blick Ellens, als er entgegnete:
»Nein, diesen Mann sprach ich im Vorzimmer.«
Ellen überlegte.
»Kannten Sie diesen Mann?«
»Er war mir gänzlich unbekannt.«
Es war fast, als ob Ellen heftig auffahren wollte, doch sie bezwang sich.
»Warum öffneten Sie denn gestern nachmittag gegen 6 Uhr den Kassenschrank?«
Flexan besann sich lange. Plötzlich nahmen seine Züge einen ganz anderen Ausdruck an, er sprang auf und schlug sich vor die Stirn.
»Richtig,« rief er, »das hatte ich ganz vergessen. Natürlich, ich zahlte ja den Cow-boy aus. Halt, wie ist mir denn, das könnte Licht in die Sache bringen.« Ellen ließ sich durch sein aufgeregtes Gebaren nicht irremachen.
»Welchen Cow-boy?«
»Den Ralph.«
»Sie haben Ralph abbezahlt?«
»Ja.«
»Warum denn?«
»Er wollte gehen.«
»Ralph? Der seit 20 Jahren auf unserer Farm tätig war? Unser bester Cow-boy? Der sich so freute, mich wiederzusehen? Mister Flexan, Ralph sollte gerade jetzt plötzlich seine Abbezahlung verlangt haben?«
»Es ist so.«
»Das klingt sehr unwahrscheinlich. Sie müßten ihn denn stark gereizt haben. Nun kann ich mir auch die Unzufriedenheit seiner Kameraden erklären. Was könnte nach Ihren Worten Licht in die Sache bringen?«
»Hören Sie, Miß Petersen! Ralph wollte abbezahlt werden, weil ich ihn wegen eines seiner zugerittenen Pferde tadelte. Er trat sehr schroff auf.«
Ellen schien sich in diesem Augenblick viel mehr für Ralph, als für die Geldsumme zu interessieren. Letztere hatte für sie eigentlich auch nicht viel zu bedeuten, sie konnte ersetzt werden, ihr Freund Ralph aber nicht.
»Sie tadelten ihn, weil er ein Pferd schlecht zugeritten haben soll?«
»Allerdings.«
»Ralph war unser bester Bereiter.«
»So machte er diesmal eine Ausnahme.«
»Welches Pferd ist es?«
»Die schwarze Stute mit weißer Brust und weißen Fesseln. Sie beißt und scheut.«
»Gut, Sie werden mir sie dann zeigen, und ich werde sie selbst versuchen.«
»Aber, Miß Petersen, dies alles bringt uns die fehlende Summe nicht zurück,« erlaubte sich Flexan zu bemerken, der neuen Schwierigkeiten entgegensah. Doch er tröstete sich damit, daß Pferde ihre Mucken haben, sie sind unberechenbar.
»O, die Summe kommt vorläufig nicht in Betracht; ob ich sie eine Viertelstunde eher oder später habe, macht nichts aus. Jetzt interessiere ich mich vor allen Dingen für Ralph. Vergessen Sie nicht, mir dann das Pferd vorführen zu lassen.«
»Ich habe es selbst geritten und gefunden, daß es nichts taugt.«
»Ich habe Sie nie als einen guten Reiter kennen gelernt. Ich weiß, daß Ralph kein Pferd abliefert, welches er nicht für gut findet. Doch das wird sich noch zeigen. Also Sie haben Ralph abgelohnt?«
»Jawohl,« nahm Flexan eifrig das frühere Thema wieder auf, »der Cow-boy kam auf meinen Ruf ins Zimmer.«
»In dieses Zimmer?«
»In mein Kontor, und kaum hatte er meine leise Andeutung gehört, daß ich mit der schwarzen Stute nicht zufrieden sei, so verlangte er sofort seine Abbezahlung. Ich wollte ihn zurückhalten, doch er bestand trotzig darauf und benahm sich überhaupt sehr roh.«
»Nach Art dieser wilden Reiter derb, aber nicht roh,« schaltete Ellen ein.
»Ich zahlte ihn aus, und er bemerkte, daß ich das Geld aus dem Kassenschrank nahm.«
Ellen hob plötzlich den Kopf, und ihre Züge drückten die größte Spannung aus.
»Ich konnte ihm nicht alles in Gold und Silber zahlen, Papier nahm er nicht an, und so mußte ich das Zimmer verlassen, um zu wechseln. Dabei beging ich die Unvorsichtigkeit, die Haupttür des Schrankes offen zu lassen.«
Ellen war aufgesprungen.
»Ah, nun weiß ich, was Sie wollen, Sie bezeichnen Ralph als den Dieb?«
»Es kann nicht anders sein.«
»Fahren Sie fort!« drängte Ellen hastig, und ihre Stirn zog sich drohend zusammen.
»Ich blieb nur fünf Minuten fort. Als ich mit dem gewechselten Gelde wieder eintrat, fand ich Ralph gerade vor dem Geldschrank stehen. Er trat sofort zurück und zeigte ein verlegenes Gesicht.«
»Fiel Ihnen das nicht auf?«
»Nicht im geringsten. Ich wußte bestimmt, daß ich die Schubladen zugeschlossen hatte. In dergleichen Sachen bin ich sehr vorsichtig. Aber jetzt erst fällt mir ein, daß Ralph von Beruf Schlosser ist, er hat hier mehrere Male als solcher gearbeitet und zwar sehr geschickt.«
»In der Tat, Ralph hat in seiner Jugend als Geldschrankschlosser gearbeitet.«
Flexan atmete auf. Ellen mißtraute ihm also nicht, sie faßte selbst Argwohn gegen Ralph.
»Nun kann ich mir alles erklären,« fuhr er fort, »Ralph hat meine Abwesenheit benutzt, den Diebstahl auszuführen. Er hat die erste beste Schublade aufgeschlossen und sich ihren Inhalt angeeignet, eben die 80 000 Dollar. Der Beweis liegt klar auf der Hand, die betreffende Schublade war geöffnet.«
Immer unwilliger schaute Ellen ihn an, Flexan hielt dies für Entrüstung über den frechen Diebstahl Ralphs, doch er hatte sich getäuscht.
»Und das nennen Sie einen Beweis?« kam es schneidend von ihren Lippen.
»Ist es keiner?«
»Für Sie vielleicht, nicht für mich.«
»Es können noch andere gebracht werden.«
»Welche?«
»Nun, Ralph muß einfach festgenommen werden. Ich bin sicher, daß man bei ihm das Geld finden wird mit Ausnahme dessen, was er schon durchgebracht hat. Die größte Eile ist deswegen nötig, denn einem Cow-boy ist es ein leichtes, in einem Tage 80 000 Dollar kleinzumachen.«
Hochaufgerichtet stand Ellen vor ihm und schaute ihn mit flammenden Augen an. Flexan konnte diesen durchdringenden Blick nicht ertragen. Zum ersten Male mußte er das Auge scheu zu Boden senken.

»Was Sie mir da von Ralph erzählt haben,« sagte sie, jedes Wort betonend, »glaube ich nicht eher, als bis Ralph der Schuld überführt worden ist. Man kann leicht erfahren, wo er sich gewöhnlich aufhält, dort wird er auch jetzt zu finden sein. So lange nicht definitiv bewiesen ist, daß er das Geld gestohlen hat, wird ihn auf dieser, meiner Plantage, niemand, hören Sie, niemand als Dieb bezeichnen, selbst dann nicht, wenn er nicht gefunden werden sollte. Uebrigens, Mister Flexan, kommt auch jener Mann mit in Betracht, den Sie gestern gesprochen haben, den Idioten mit dem klugen Blick. Verstehen Sie?«
»Ich empfing ihn im Vorzimmer,« entgegnete Flexan, sich zusammenraffend.
»Gleichgültig! Auch nach ihm muß gefahndet werden, hat er doch einen Raubmord versucht.«
»Ich werde sofort Leute ausschicken, um ihn suchen zu lassen.«
»Ist nicht mehr nötig. Der in meiner Begleitung gewesene Detektiv Nick Sharp, ist bereits auf der Fährte.«
Ellen verließ schnell das Zimmer, und so konnte sie nicht mehr den Eindruck ihrer Worte sehen. Wie vom Blitz getroffen taumelte Flexan zurück.
»Verdammt!« war alles, was er knirschend herausbrachte.
Auf dem Hofe wurde ein Gemurmel laut, es kam immer näher und klang immer deutlicher, bis es dicht unter den Fenstern des Bureaus erscholl.
Flexan blickte durch die Jalousien und sah gegen fünfzig Cow-boys, anscheinend angetrunken, welche zusammen sprachen, die langen Peitschen schwangen und Flüche und Verwünschungen ausstießen.
»Verdammt!« murmelte er nochmals.
Er wußte, was sie wollten: samt und sonders ihre sofortige Entlassung, gerade jetzt am Beginn der Saison, da keine Cow-boys aufzutreiben waren, und da — Flexan preßte die Lippen zusammen, da kam gerade auch noch Ellen aus dem Hauptportal.
Sie stutzte, als sie die versammelten Cow-boys erblickte, aber auch sie ahnte sofort, um was es sich handelte. Die unwilligen Gesichter der Männer sagten es ihr deutlich genug.
Eben wollten die ersten, darunter auch Dan und Ned, das Portal betreten, doch Ellen versperrte ihnen den Weg.
»Was wollt ihr?«
»Unsere Entlassung,« entgegnete Dan kurz und ohne Ehrerbietung.
»Warum?«
»Weil wir wollen.«
»Dan, ich bitte dich, sage mir den Grund, warum ihr mich verlassen wollt, gerade jetzt, da ich euch gebrauche?«
Dan zupfte an seinem Lederhemd und drehte die Reitpeitsche in den Händen.
»Weil Ralph entlassen worden ist, gehen wir auch.«
»Ralph hat seine Abbezahlung gefordert«
»Ja, weil Mister Flexan gesagt hat, er wäre zu alt, um noch Pferde zureiten zu können.«
»Hat er das wirklich gesagt?«
»Ralph erzählte es uns, und er lügt nicht.«
»So, dann will ich euch sagen: nicht Mister Flexan hat hier zu befehlen, sondern ich.«
Es trat eine lautlose Stille unter den Cow-boys ein, alle blickten auf das energische Mädchen.
»Hm, Ihr selbst habt Euch ja über ihn beschwert.« fuhr Dan fort.
»Ich? Das ist nicht wahr.«
Es lag eine solche Bestürzung in diesen Worten, daß Dan aufmerksam wurde.
»Doch, Ralph bekam durch den Herrn zu hören, Ihr hättet gesagt, er tauge nichts und habe sich Euch gegenüber unverschämt betragen.«
»Wer sagte ihm das?«
»Mister Flexan.«
»Das ist eine Lüge,« rief Ellen mit starker Stimme, tiefrot im Gesicht.
»Ralph ist aber entlassen worden, und so gehen wir von selber unserer Wege.«
»Hört, Leute, ich sage euch nochmals, so lange ich hier bin, habe ich zu befehlen, sowie Leute anzustellen und zu entlassen, und kein anderer. Damit ihr seht, daß es mir Ernst ist, hole ich Ralph selbst zurück. Seine Entlassung ist ungültig. Solchen tüchtigen Burschen finde ich niemals wieder. Ich habe gegen Ralph nie etwas gehabt oder gesagt, ich schwör's euch zu. Wohin mag er gegangen sein?«
»Jedenfalls nach Yorkspire, dort hält er sich nach jeder Abbezahlung auf.«
Die Gesichter der Cow-boys klärten sich immer mehr auf, ihr Murren hatte aufgehört.
»Wohlan, ich will euch beweisen, wieviel mir daran gelegen ist, Ralph wieder bei mir zu haben. In einer Stunde soll er zurück sein, und wem es nicht paßt, der mag gehen, ich halte ihn nicht, und wenn es der erste Verwalter ist. Ich reite selbst. Dan, hole mir ein Pferd; dein eigenes und noch eins dazu, ich reite augenblicklich, und ihr, Leute, fort! An eure Arbeit!«
Die Cow-boys waren versöhnt; sie jubelten ihrer jungen Herrin zu. Andere liefen davon, um Pferde zu holen, und zwar ihre eigenen, denn die Cow-boys suchen sich zum Reiten nur die besten Tiere aus.
Ellen sprang die Treppe hinauf, um sich zum Reitausflug zurechtzumachen.
Flexan hatte dem Schluß und Erfolg dieser Unterredung nicht beigewohnt. Kaum ahnte er, wohinaus das Gespräch laufen würde, als er sofort an den Schreibtisch trat, im Stehen einige Zeilen auf ein Papier warf und dasselbe siegelte.
»So,« murmelte er. »Ehe Ellen Ralph findet, soll er schon verhaftet sein. Haha, sie wird wohl zu spät kommen, ihren Schützling zu retten.«
Er verließ das Zimmer eiligst; eine Minute später, als Ellen noch mit den Cow-boys sprach, jagte schon ein Reiter die Landstraße hinab, welche nach Yorkspire führte. Er trug die Mitteilung an den Sheriff in der Tasche, daß Ralph im Verdacht stehe, eine bedeutende Summe Geldes gestohlen zu haben.
Schwerlich befand sich der Cow-boy noch in Yorkspire; denn dieses war nur ein Städtchen, welches keine Vergnügungen bot, aber es besaß eine Telegraphenstation, und so konnten sofort alle größeren Städte benachrichtigt werden, um den vermeintlichen Dieb verhaften zu lassen.
In Amerika wird mit Dieben wenig Federlesens gemacht; daß der Cow-boy die 80 000 Dollar nicht besaß, war gar kein Beweis für seine Unschuld. Man wußte, wie leichtsinnig diese Burschen mit dem Gelde umgehen, aber das Auffinden der fünf Banknoten im Schafte seines Stiefels war ein Argument, das ihm sofort den Hals brach. —
Ellen betrat das Bureau. Sie konnte den komplizierten Mechanismus bewegen, denn sie war ja Herrin im Hause, aber den Gesuchten fand sie nicht mehr vor. Flexan war schon ausgeflogen. Einige Zeit suchte sie ihn noch mit zornsprühenden Augen, um ihn für seine Lügen und Verleumdungen sofort zur Rechenschaft zu ziehen, Flexan hatte sich aber unsichtbar gemacht, und die Diener konnten keine Auskunft über seinen Verbleib geben.
»So laß ihn laufen,« murmelte Ellen, die Treppe nach ihren Gemächern hinaufeilend, »er entgeht seinem Schicksale sowieso nicht.«
Sie hatte es so eilig, daß sie fast einen die Treppe herabkommenden Mann umgerannt hätte, der sie jedoch in den Armen auffing und ungeniert küßte.
»Brennt es?« lachte Lord Harrlington.
»Ja, James, und du sollst mir löschen helfen. Gut, daß du im Reitanzug bist, reite mit mir! Willst du? Natürlich! Schnell, dein Pferd wartet schon auf dich, in fünf Minuten bin ich ebenfalls unten. Sharp noch nicht zurück? Nein? Schade. Laß mich, die Erklärung gebe ich dir unterwegs.«
Und fort war sie wieder, den bestürzten Lord stehen lassend. Er hielt es für das beste, vorläufig den hastigen Befehlen oder Wünschen Ellens zu folgen und die Erklärung abzuwarten, schnallte sich Sporen an, nahm die Reitpeitsche, und als er in den Hof trat, sah er schon Ellen auf einem der beiden tanzenden Pferde sitzen. Während er sich die Sporen angeschnallt, hatte sie sich in ein Reitkleid geworfen. Ellen gehörte nicht zu den Personen des schönen Geschlechts, welche den größten Teil des Tages am liebsten vor dem Toilettenspiegel verbringen.
Im sausenden Fluge ging es fort, denn sie ahnte schon eine Intrige ihres Vaters und wollte dieser zuvorkommen.
Durch den Wald schlängelte sich ein Bach, der zu breit war, als daß ein Pferd darüber wegsetzen konnte, wenn dies nicht das sumpfige, mit Schilf bewachsene Ufer an sich schon unmöglich gemacht hätte. Schnell trug er sein schmutziges Wasser dem Süden zu, an mächtigen Bäumen vorüber, wie sie in Amerika zu finden sind.
An den Wurzeln solch eines Waldriesen festgebunden lag ein Boot im Bach, darin saß ein junger Neger und war damit beschäftigt, zwischen den Wurzeln eine Falle aus Stricken und Zweigen aufzustellen.
Sein Gesicht zeigte einen gutmütigen, stupiden Ausdruck, die dicken Lippen waren zu einem ständigen Lachen verzerrt, als machte ihm seine Arbeit ganz ungeheures Vergnügen.
Außer einer baumwollenen Hose und einem Strohhut mit einem fast einen halben Meter breiten Rande trug er kein Kleidungsstück.
Da knackte es im Gebüsch. Der Neger blickte auf und brach in ein schallendes Gelächter aus. Er sah neben dem Baum am Ufer auf einem schaumbedeckten Pferde einen Reiter halten, dessen Aussehen die leicht erregbare Lachlust des Schwarzen erweckte.
»Hohoho, Massa,« brüllte er aus vollem Halse, » good morning, Massa, how do you do »Guten Morgen, wie geht es Ihnen?«?«
»Danke, mein Bursche, so leidlich,« war die Antwort; »schöner Morgen heute, nicht?«
»Schön für die Hunde, aber nicht für mich,« lachte der Schwarze.
»Wieso?«
»Dachte, meine Fallen wären alle voll, aber keine Ratte hat sich darin gefangen.«
»Ihr fangt Ratten?«
»Hohoho, Ratten? Waschbaren will Ben fangen, aber die Luder sind verdammt schlau.«
»Das sind sie.«
»Hört, Ihr habt wohl Eure Haare vom Kopfe weggeschwitzt?«
»Nein, ich lasse mir nicht nur das Gesicht, sondern auch den Kopf rasieren. Das ist jetzt die neueste Mode. Weißt du das noch nicht?«
Der Schwarze legte sich hintenüber und lachte, daß ihm die Tränen über die Nacken liefen.
»Schöne Mode das, wahrhaftig, das muß ich meiner Chloë erzählen. Aber woher in aller Welt habt Ihr denn nur diese furchtbar dicken Hände?«
»Ich war früher Ziegelstreicher, das ist harte Arbeit.«
»Habt Ihr da auch mit dem Gesicht gestrichen?«
»Warum?«
»Weil das auch so furchtbar geschwollen ist.«
»Ich habe Zahnschmerzen.«
»Zahnschmerzen? Hohoho, habe niemals Zahnschmerzen gehabt.«
»Dann bist du zu beneiden. Und die Schuhe drücken mich auch, daß ich aus der Haut fahren möchte.«
»So zieht sie doch aus!«
»Wollte ich auch hier tun.«
»Wohin wollt Ihr?«
»Nach Mister Rickerts Farm.«
»Das ist noch ein weiter Weg für den, der Zahnschmerzen hat und den die Schuhe drücken, das heißt für einen Fußgänger sieben bis acht Meilen sicherlich.«
»Und wundgeritten habe ich mich auch, ich möchte vor Schmerzen laut brüllen.«
»O je, Ihr seid ja ein richtiges Schmerzenskind.«
»Wie heißt du?«
»Ben.«
»Und fängst Waschbären?«
»Ja, das heißt, wenn ich Zeit habe, sonst fälle ich für gewöhnlich Holz.«
»Verdienst schönes Geld damit, heh?«
»Jawohl, kaum so viel, daß meine Chloë für mich und unsere acht Würmer satt zu essen kochen kann.«
»Frau und acht Kinder, das ist allerdings hart.«
»Verdammt hart,« bestätigte der Neger, lachte aber dabei, als erzähle er etwas Fröhliches.
»Wohnst du stromab oder stromauf?«
»Stromauf steht mein Haus, muß dann das Boot schleppen, die Strömung ist stark. Warum?«
»Ich fragte nur so.«
Der Reiter schien zu überlegen.
»Soll ich Euch übersetzen? Dann braucht Ihr Euch nicht naß zu machen, der Bach ist tief. Möchte gern was verdienen, wenn Ihr zahlen könnt, aber schließlich tue ich es auch umsonst.«
»Hm, du willst etwas verdienen?« meinte der Reiter nach einigem Zögern.
»Am liebsten tausend Dollar,« lachte Ben.

»Willst du dir etwas verdienen?« fragte der Reiter.
»Am liebsten tausend Dollar,« lachte der Schwarze.
»So viel kann ich dir nun freilich nicht geben, habe selbst nicht so viel, aber anständig will ich dich doch für eine Gefälligkeit bezahlen.«
»Für welche?«
»Erst will ich ins Boot kommen; dann besprechen wir das weitere.«
Der Reiter sprang vom Pferde, sank aber mit einem Schmerzensschrei zusammen.
»O — au — ah, die verdammten Schuhe, wie die drücken.«
Er machte Miene, sie auszuziehen, ohne dabei den Zügel des Pferdes loszulassen.
»Nicht am Ufer,« warnte der Neger, »im Schilfe sind oft Schlangen.
»Alle Teufel,« rief der Weiße, der kein anderer als Eduard Flexan war, trat schnell ins Boot und zog das Pferd ins Wasser hinein; das Tier, erhitzt und anscheinend sehr müde, war mit dem erfrischenden Bade einverstanden, es verhielt sich ganz ruhig.
Flexan fiel mit einem Schmerzensschrei auf den Boden des schwankenden Fahrzeuges nieder.
»Verdammt! Au! Nun reiße mir erst einmal die Schuhe von den Füßen, oder ich fahre aus der Haut. Ich muß das Pferd festhalten.«
Der grinsende Schwarze war ihm behilflich.
»Ein paar Staatsdinger,« lachte er, »Jesus Christus, Maria und Joseph, was habt ihr für merkwürdig große Füße. Habt ihr die auch vom Ziegelstreichen?«
»Nein, aber vom Lehmtreten. Nun höre, Bursche, wie du dir einen Dollar verdienen kannst. Ich habe mich so wundgeritten, daß ich mich nicht mehr rühren mag. Kannst du reiten?«
»Das wollte ich meinen,« war die selbstbewußte Antwort.
»So setze dich auf diesen Gaul, reite nach Rickerts Farm und gib ihn mit einem schönen Gruß von mir ab. Willst du das, Freund?«
Der Schwarze zögerte.
»Hm, Ihr habt das Pferd doch nicht gestohlen?«
»Dummkopf,« lachte Flexan, »Rickert ist mein Freund, er hat mir das Pferd geliehen. Stiehlt man etwa ein Pferd und liefert es dann ab?«
Der Neger kratzte sich grinsend hinter den Ohren, er sah die Richtigkeit dieser Bemerkung ein.
»Ich gebe dir ein Zettelchen mit,« fuhr Flexan fort, Bleistift und Notizbuch aus der Tasche nehmend.
»Hm, einen Dollar wollt Ihr mir geben?«
»Ja.«
»Und Ihr seid Ziegelstreicher?«
»Gewesen. Ich habe eine Tongrube gefunden und mein Glück gemacht. Glaubst du etwa, Mister Rickert hat einen Ziegelstreicher zum Freunde oder leiht ihm etwa ein Pferd wie dieses?«
Flexans Pferd war ein sehr schönes Tier, es hatte schon des Negers Verwunderung erregt.
»Da habt Ihr wieder recht, ich bin und bleibe eben ein Esel, wie meine Chloë zehnmal an jedem gesegneten Tage behauptet. Aber, Massa, das ist ein weiter Ritt, eine Stunde habe ich sicher hin, eine andere zurück. Da ist ein Dollar etwas wenig, könntet schon noch eine Kleinigkeit hinzufügen.«
Der Neger hatte des Weißen Schuhe in die Hand genommen, prüfte sie sorgfältig unten und oben und schien Lust zu haben, sie an seine eigenen, ganz respektablen Füße zu probieren.
Flexan merkte es; der Neger kam seinem Wunsche zuvor, aber er hütete sich, des Schwarzen Argwohn zu erregen.
»Ich gebe dir noch einen zweiten Dollar — puh, das will gar nicht zusammenpassen.
»Drei Dollar.«
»Reicht nicht.«
»Ich habe nicht mehr bei mir.«
»Tut mir leid, dann könnt Ihr selber reiten.«
Flexan machte ein klägliches Gesicht und berührte mit der Hand die wundgerittenen Stellen.
»Willst du meine Jacke an Zahlungsstatt annehmen?« fragte er.
Verächtlich musterte der Schwarze die abgetragene Jacke, sein Blick kehrte zu den Stiefeln zurück.
»Ben braucht keine Jacke, aber — aber ...«
»Aber was?«
»Euch drücken diese Schuhe?«
»Ganz entsetzlich.«
»Ob sie mir wohl passen?«
»Probiere sie mal an!«
Im Nu saßen die Schuhe an Bens Füßen, und er stampfte lachend im Fahrzeuge herum, daß es fast umzuschlagen drohte.
»Sie passen, Hurra, sie passen,« brüllte er aus Leibeskräften. »Die ersten Schuhe, die ich je an meine blutigen Füße gekriegt habe, und sie passen gleich! Ist das nicht wunderbar, Massa?«
»Sehr wunderbar.«
»Und euch drücken sie?«
»Drücken? Sie peinigen mich, als säßen meine Füße im Stock.«
Ueber des Schwarzen Gesicht huschte ein schlauer Zug.
»Euch drücken sie, und mir passen sie. Wie wär's, wenn Ihr mir Eure Schuhe gäbt? Dann reite ich Euer Pferd nach Rickerts Farm, aber einen Dollar muß ich extra haben, damit ich einen Schluck trinken kann. Es ist höllisch heiß, ich glaube, wir bekommen Gewitter.«
»Topp,« rief Flexan, »die Sache ist abgemacht. Hier ist der Zettel, dort steht das Pferd. Setze dich darauf und gib dem Gaul meine Stiefelabsätze zu fühlen. Ich wollte mir sowieso andere Schuhe kaufen.«
Der Schwarze ließ Dollar und Zettel in die Hosentasche verschwinden, sein Gesicht strahlte vor Vergnügen.
»Nun müssen wir erst das Boot nach meiner Hütte bringen.«
»Unsinn, ich bleibe hier liegen.«
»Kommt zu meiner Frau, sie soll Euch etwas vorsetzen, Maiskuchen und Speck.«
»Maiskuchen und Speck liebe ich nicht, ebensowenig Frauen; und wenn deine Chloë auch die schönste von allen wäre, ich bleibe lieber hier im Boot und warte auf dich. Weißt du, ich geniere mich vor Frauen etwas wegen meiner Schönheit, ich bin zu verführerisch.«
Ben hielt sich den Bauch vor Lachen; einen häßlicheren und komischeren Mann, als diesen, hatte er noch nie gesehen.
»Na, meinetwegen macht's, wie Ihr wollt,« sagte er endlich, »legt Euch schlafen, wenn Euch die Moskitos schlafen lassen.«
»Der Rauch meiner Pfeife soll sie schon vertreiben.«
»Wie wollt Ihr denn nachher weiterkommen? Barfuß durch den Wald zu laufen ist wohl für einen Schwarzen eine Kleinigkeit, aber nicht für einen Massa.«
»Ich warte eben auf dich, und du bringst mich in diesem Boote nach der nächsten Farm am Bache, wo ich mir Schuhwerk verschaffen werde oder doch ein Stück Leder, um es um die Füße zu wickeln.«
»Die nächste Farm liegt zwei Meilen stromab.«
»Bringst du mich für einen Dollar dorthin?«
»Natürlich.«
»Dann reite los!«
» All right, in zwei Stunden bin ich zurück.«
Ben wollte aufs Pferd steigen, doch Flexan hielt ihn davon zurück.
»Wir wollen mit dem Boote erst ans andere Ufer fahren, dann brauchst du dich nicht naß zu machen.«
»Hoho,« lachte der Schwarze, »das macht mir keinen Schaden, meine Hose trocknet in fünf Minuten, und von meiner Haut läuft das Wasser ab.«
»Es ist aber bequemer, auch könnte das Boot umschlagen, was mir nicht gerade angenehm wäre.«
Flexan mußte es sehr viel darauf ankommen, den Neger erst drüben aufsteigen zu lassen, doch schon saß dieser mit einem kecken Sprunge auf dem Rücken des Pferdes, nahm die Zügel und lenkte es durch das Wasser.
Mit zusammengekniffenen Lippen schaute Flexan zu, wie das Tier das Ufer gewann, wo die Hufe tief in den weichen Boden einsanken. Plötzlich leuchteten seine Augen auf.
»He, Ben!« rief er.
»Was gibt's?« fragte der Neger, ohne den Kopf nach dem Ufer zu wenden.
»Du mußt den Sattelgurt erst fester anziehen.«
»Ist nicht nötig, der Sattel sitzt fest.«
»Der Gaul hat vorhin viel gesoffen, in fünf Minuten schlottert der Sattel hin und her.«
»Teufel, das geht freilich nicht, da heißt es eben, noch einmal abgesessen.«
Der Neger sprang ab, die Stiefel gruben sich tief in den Boden ein, und der Gurt wurde so fest gezogen, daß dem Tiere fast die Luft ausging.
»So, das wird genügen,« meinte Ben, wieder aufsteigend. »In zwei Stunden bin ich zurück, laßt Euch die Zeit nicht lang werden.«
»In zwei Stunden wirst du dein Boot nicht mehr hier finden, Narr,« murmelte Flexan, als der Neger davonsprengte, »wenn man dich während dieser Zeit nicht als Pferdedieb festnimmt und aufhängt; ich aber bin nun so gut wie in Sicherheit. Zwei Stunden, hah, wo kann ich dann schon sein!«
Mit Schadenfreude betrachtete er die tiefen Abdrücke, welche seine Schuhe an des Negers Füßen auf dem jenseitigen Ufer hinterlassen hatten.
»Hüben und drüben ganz dieselben Spuren, der schlaueste Indianer muß irregeführt werden. Wahrhaftig, diesmal wird dem Nick Sharp eine lange Nase gedreht. Flexan, du hast ein Meisterstückchen gemacht. Habe mich zwar seit gestern nachmittag schon ganz wacker gehalten und bin diesem verfluchten Detektiven einige Male geschickt ausgewichen, obgleich er manchmal ganz dicht auf meinen Hacken saß, aber endlich kommt er doch hinter meine Schliche und Kniffe. Na, jetzt sitzt er ganz sicher auf einer falschen Spur, und Flexan wird er wohl nie wieder zu sehen bekommen.«
Er löste das Boot von den Wurzeln, setzte sich zurecht und ergriff das Schaufelruder. Blitzschnell schoß das leichte Fahrzeug den reißenden Bach hinab, Flexan gebrauchte dennoch das Ruder, und zwar so geschickt, daß er jede Biegung glücklich überwand. Bäume und Büsche huschten wie Schatten an ihm vorüber, kein Reiter konnte in diesem Walde mit ihm gleichen Schritt halten.
So fuhr er mehrere Stunden hinab, alle seine Aufmerksamkeit dem gefährlichen Wasserwege widmend, nur ab und zu einen Blick zum Himmel sendend, wo sich schwere, drohende Wolken zusammenballten.
»Es gibt ein Gewitter, jedenfalls einen gewaltigen Regenguß,« murmelte Flexan, »schade, wenn er meine so schlau angelegte, falsche Spur verwischen sollte. Doch nein, laß es regnen, als ob die Erde wegschwimmen wollte, um so sicherer bin ich vor Verfolgung.«
Der Bach machte eine große Biegung, der Ruderer mußte alle seine Kunst aufbieten, um sein Boot in den Wirbeln vor dem Umschlagen zu schützen, bis es mit der Schnelligkeit eines Pfeiles wieder davonschoß.
Zu beiden Seiten des Baches standen Büsche, die Zweige wie eine Laube über das Wasser wölbend.
Plötzlich schlug in der Ferne ein Hund an, Flexan zuckte erschreckt zusammen.
»Da ist er, der Schuft, der Pferdedieb, fangt ihn,« schrie eine Stimme.
Die Büsche brachen, Zweige knackten, als brächen mehrere Männer durch das Unterholz, und eine Meute Hunde heulte wild auf.
Das galt ihm, Flexan. Er hatte gestern, nachdem er seinen Vater verlassen, ein Pferd von einer benachbarten Weide gestohlen, weil er sich gescheut, ein Reittier zu kaufen und so seine leicht erkennbare Gestalt zu zeigen.
Cow-boys oder Farmer hatten Bluthunde auf seine Spur gehetzt; wußte er sich nicht durch List zu retten, so war sein Leben verloren, die Bluthunde rissen ihn in Stücke, Pferdediebe sind in Amerika vogelfrei, sie zu töten ist kein Mord.
Die Rufe ertönten von rechts, schnell lenkte Flexan sein Boot dicht an das linke Ufer und fuhr unter dem Schutze der dichten Zweige dahin. Dann fiel ihm mit einem Male ein, daß die Bluthunde doch gar nicht seine Spur hätten finden können, er befand sich ja schon stundenlang auf dem Wasser. Aber immerhin, vielleicht waren sie durch Zufall wieder auf seine Spur geraten. Sein böses Gewissen stempelte ihn zum Schuldigen.
Er sah die Verfolger nicht, also konnte auch er nicht gesehen werden.
»Fangt ihn, den Pferdedieb!« erklang es von neuem.
Das Boot huschte am Rande des Baches dahin, immer unter dem Schutze der Zweige. Flexan arbeitete mit dem Ruder wie ein Wahnsinniger, er entwickelte alle ihm innewohnende, bedeutende Kraft, die Muskeln waren zum Springen geschwellt.
Die Zweige hingen immer tiefer herab, sie streiften fast schon das Boot, und Flexan mußte sich weit vornüberbeugen, um unter ihnen wegzuschlüpfen. Sie sollten ihm zum Fallstrick werden.
Eben machte er einen gewaltigen Ruderschlag, schon klang das Lärmen entfernter, da fühlte er sich plötzlich im Genick gepackt; blitzschnell schoß das Boot davon, unter ihm weg, und Flexan lag im Wasser, wurde aber von einem unsichtbaren Etwas festgehalten.
Im ersten Schrecken verhielt sich Flexan bewegungslos, er fühlte, wie sein Rock nach oben gezerrt wurde und überzeugte sich dann, daß ein hakenartiger Ast seinen Rock durchbohrt hatte. Er wollte sich befreien, es gelang ihm nicht.
»Laßt euch nicht täuschen, er will uns glauben machen, er wäre ans Land gelangen, er liegt aber am Boden des Bootes,« schrie eine Stimme.

Ah, das war Hoffnung! Das Boot trieb mit der Strömung weiter, seine Verfolger wähnten ihn noch darin.
Doch Flexan sollte sich nicht lange freuen.
»Nein, er ist nicht mehr darin, ich kann es von hier aus sehen,« rief eine andere Stimme, »Er hat sich im Gebüsch versteckt, wahrscheinlich sitzt er auf einem Baumast. Ruft die Hunde zurück, untersucht die Gebüsche!«
Jetzt begann Flexan wie ein Verzweifelter zu arbeiten, er mußte von dem Aste freikommen, er suchte nach dem Messer, um den Rockzipfel abzuschneiden, fand es aber nicht. Wie ein gefangener Biber plätscherte er im Wasser.
Halt, noch gab es ein Mittel, um sich zu befreien, doch gleich mußte es gebraucht werden, denn schon klang das Geschrei der Verfolger wieder näher.
Flexan riß die wenigen Knöpfe der Jacke auf, sein Körper sank tiefer, er tauchte unter, die Arme schlüpften aus den Aermeln, er tauchte wieder auf und war frei.
Mochte die Jacke hängen bleiben und gefunden werden, nur fort, fort. Er fürchtete sich nicht vor den Bluthunden, er verstand die Kunst, sie irrezuleiten, ja sogar, sie sich vom Leibe zu halten.
Mit zwei Stößen war er am Ufer. Vom Dickicht verborgen, kletterte er hinauf, und mit mächtigen Sätzen sprang der Flüchtling durch den Wald, weder von den Verfolgern, noch von den Bluthunden vorläufig entdeckt. —
Die Luft war still, wenigstens unten auf der Erde, in den oberen Regionen dagegen mußte es anders zugehen, denn schwarze Wolken jagten am Himmel einher, wie bizarre Felsmassen anzusehen. Diese ungleiche Beschaffenheit der Atmosphäre ließ darauf schließen, daß bald ein Orkan oder ein gewaltiger Regenguß, vielleicht ein Wolkenbruch die Gegend heimsuchen würde.
Ab und zu kam die Sonne zum Vorschein und sandte ihre Strahlen mit sengender Glut herab. Alle Tiere des Waldes ahnten eine Katastrophe, sie hielten sich versteckt, so daß die Sonne sie nicht sehen konnte, mit Ausnahme eines Wesens, welches recht gemütlich, lang ausgestreckt auf einer kleinen Blöße lag.
Es war ein Mensch, und er mußte einen tiefen Schlaf halten, denn weder weckten ihn die stechenden Sonnenstrahlen, die ihm direkt in das graubärtige, verwitterte Gesicht schienen, noch hatte er gemerkt, wie vor etwa einer Stunde an ihm eine wilde Jagd von Hunden und Reitern vorbeigebraust war.
Wenn nicht schon seine ganze Kleidung den Cow-boy verraten, die pfundschweren Silbersporen und die neben ihm liegende dreifingerdicke Reitpeitsche aus zusammengeflochtenen Lederstreifen hätten dies sicher getan.
War denn der Mann tot, daß er für die Vorgänge um ihn herum keine Empfindung besaß, daß er die stechenden Sonnenstrahlen nicht fühlte?
Nein, denn jetzt öffnete er den Mund, so weit es überhaupt nur möglich war, und gähnte so laut, daß die Vögel in der Umgebung erschreckt davonflatterten. Dann öffnete er auch die Augen, mußte sie aber vor dem Glanze der Sonne schnell wieder schließen, bis eine große Wolke Schatten verbreitete.
Er richtete sich halb auf, stützte sich auf einen Ellenbogen und schaute mit wirren Blicken um sich.
»Wo bin ich denn?« murmelte er verdutzt. »Wie in aller Welt komme ich denn hier in den Wald?«
Sinnend legte er den Zeigefinger an die Nase.
»Mir ist ganz sonderbar zumute in meinem Kopfe, es ist gerade, als wenn darin zweizöllige Hufeisen geschmiedet würden, und einen Geschmack habe ich im Munde, als hätte ich Schwefelsäure verschluckt. Brrrrr!
»Hm,« fuhr er dann fort, sich wieder lang ausstreckend, »es scheint doch, als ob ich noch lebe. Mein Name ist Ralph, daran ist gar kein Zweifel, und ich glaube, Ralph, du bist gestern, vielleicht auch vorgestern mordsmäßig besoffen gewesen. Wie lange mag ich wohl hier so gelegen haben? Ein, zwei oder drei Tage? Quien sabe? Tut auch nichts zur Sache. Faktum ist aber, daß ich keinen Cent mehr in der Tasche habe, oder will jemand mit mir wetten, daß ich noch einen Cent bei mir habe? Ich will mir gar nicht erst die Mühe geben, ich finde doch nichts, sonst wäre ich nicht hier. Die haben schon gesorgt dafür.«
Er seufzte tief auf, wälzte sich um, bis er auf dem Bauch lag, stützte den brummenden Schädel in beide Hände und sah sorgenvoll vor sich hin ins Gras.
»Ralph, du bist doch ein altes Schwein und bleibst ein solches,« fuhr er in seinem moralischen Selbstgespräch fort, »hast dich wieder einmal sinnlos besoffen. Du bist ein richtiger Lump, Ralph, eine Sau und, nicht zu vergessen, der dümmste Hornochse, der auf Gottes Erdboden wiederkäut. Da hast du nun zweihundert und einige Dollar durch die Kehle gejagt, und was hast du davon gehabt? Gar nichts, rein gar nichts, höchstens einen Brummschädel, der mir nächstens auseinanderplatzen wird. Pfui Teufel, anspucken möchte ich mich, wenn es nur ginge. Ohrfeigen könnte ich mich wohl, aber dazu bin ich zu faul, und meine zweihundert Dollar kriege ich dadurch auch nicht wieder.«
Jetzt folgten Reminiszenzen.
»Schön war's ja eigentlich doch. Heisa, wie staunten die Mädels, als Ralph plötzlich, am Anfange der Season, mit vollen Taschen ankam und ihnen Rum und Whisky eintrichterte, bis zuletzt auch noch die Champagnerpfropfen knallten. Aber saufen können die Mädels, Gott bewahre mich. Die Peggy ist wie ein Schwamm, wenn sie voll ist, quetscht man sie einfach aus. Ich habe wohl gesehen, wie sie immer den Finger in den Hals steckte, wenn ihr Magen wie eine Tonne gefüllt war. Donnerwetter, habe ich denn nur gar nichts mehr bei mir, daß ich noch einmal hingehen kann? Die Peggy ist eine ganz famose Dirne, nur schade, daß sie eine breitgequetschte Nase hat, aber das beeinträchtigt ihre Schönheit nicht, und ihren Durst erst recht nicht. Hm, muß doch mal meine Tasche untersuchen, habe auch schon einmal nach solch einem Saufgelage eine Fünfdollarnote darin gefunden.«
Er wühlte in den Hosentaschen, die Untersuchung blieb aber erfolglos.
»Meinen Revolver mag ich nicht verkaufen, meine silbernen Sporen ebensowenig, sonst bin ich kein Cow-boy mehr, sondern nur noch ein altes Weib.«
Nach langer Ueberlegung fuhr er fort:
»Hm, habe auch Cow-boys gekannt, welche nur einen Sporn trugen, warum könnte ich diese Mode nicht mitmachen? Fünf Dollar bekomme ich immer für den Sporen.«
Er betrachtete nachdenklich den fraglichen Gegenstand.
»Brrrr, dieser Geschmack im Munde, und Durst habe ich zum Verrecken. Dort fließt Wasser, das ist ein Faktum, aber hingehen und trinken, dazu bin ich auch wieder zu faul, mir sind die Knochen wie zerschlagen.
»Ja, wenn dort Irish-Whisky flösse, dann wollte ich mit einem Sprunge drin sein, mich baden, das Maul aufreißen und schlucken. Was für ein Jammertal ist doch die Erde, daß das Wasser, welches auf ihr fließt, nicht gebrannt ist. Wäre ich der liebe Gott, dann hätte ich das ganz anders gemacht.«
Ralph vertrieb sich den Durst, indem er Grashalme kaute, endlich aber konnte er es nicht mehr aushalten, er erhob sich und ging mit schleppendem Schritt dem Bache zu.
»Hier gibt es Schlangen, denn dieses Wasser heißt der Schlangenbach. Na, mich wird wohl keine beißen, und tut sie es, so kann ich mir nicht helfen. Einmal muß man doch sterben, je früher, desto besser.«
Ralph hatte eben einen ungeheuren, moralischen Katzenjammer, hauptsächlich deshalb, weil er kein Geld mehr hatte, das lustige Leben von gestern heute mit vollem Glanze zu erneuern.
Auf Händen und Füßen kroch er durch das dichte Gebüsch, bis er den Rand des Wassers erreicht hatte. Schon wollte er sich bücken, als er innehielt und erstaunt einen Gegenstand betrachtete, der ihm fast vor der Nase hing.
»Gottsdonnerwetter, eine Jacke! Hat sich hier jemand ersäuft oder sich gebadet und dann vergessen, die Jacke wieder anzuziehen?«
Er sah sich um.
»Niemand zu sehen, na, dann kann ich ja die Jacke als Fundstück betrachten. Viel wert scheint sie allerdings nicht zu sein, aber ein Glas Whisky muß mir Peggy doch dafür einschenken.«
Er hielt sich an einem Busche fest, bog sich weit vornüber und nahm die Jacke von dem hakenförmigen Aste ab, an dem sie hing.
»Hm, hm, die ist doch schon zu alt, zerrissen ist sie auch und naß dazu. Das beste ist, ich schmeiße sie weg. Aber halt, die feinen Herren haben ja Taschen in den Jacken, richtig, da sind sie, die muß ich doch erst durchstöbern. Vielleicht finde ich einen Dollar.«
Ralph versenkte die Hand in eine Seitentasche, er brachte sie mit einigen Päckchen Papieren wieder heraus, und was für große Augen machte er, als er in ihnen Hundertdollarnoten erkannte.
Er untersuchte die anderen Taschen, wieder fand er Banknoten von demselben Werte, und endlich lag ein ganzer Stapel vor ihm.
Seine Ueberraschung war so groß, daß ihm die Jacke aus den Händen glitt, sie fiel ins Wasser und sank, durch irgend etwas beschwert, sofort unter.
Plötzlich kam Leben in die regungslose Gestalt des Cow-boys, er raffte die Banknoten auf, propfte sie in die Hosentaschen, kroch aus dem Gebüsch und rannte auf der Blöße herum, als hätte er einen Sonnenstich bekommen, blieb stehen, krähte wie ein Hahn und schlug dann wieder Purzelbäume.
»Kikerikikih,« krähte er, »Ralph hat Geld, viel, viel Geld, hurra, ich bin reich!«
Dann aber ward er mit einem Male still, es war ihm ein anderer Gedanke gekommen. Er setzte sich ins Gras und begann die Banknoten zu zählen.
Bis hundert kam er auch, dann gab er das Geschäft auf.
»Das ist zu langweilig, auf 70 — 100 000 Dollar schätze ich aber diese Summe. Herr Gott, Ralph, nun bist du ja plötzlich ein schwerreicher Kerl geworden! Echt sind sie, das ist ein Faktum; auf so etwas verstehe ich mich wie der Apotheker auf seine Schmiersalben. Wie mag die Jacke nur hierherkommen? Und 100 000 Dollar darin? Merkwürdig. Hurra, Ralph, du bist doch ein Glücksschwein!
»Halt,« fuhr er dann nach einer Weile fort, »so schnell geht die Sache denn doch nicht. Das Geld gehört mir, das heißt insofern, als niemand weiß, woher ich es habe, und gestohlen habe ich es nicht. Aber immerhin, Ralph, du bist stets ein ehrlicher Kerl gewesen, dein Haar ist in Ehren grau geworden, und wenn du auch manchmal ein arger Süffel bist, du hast noch niemals gestohlen oder betrogen. Immer ehrlich, wenn's auch schwer fällt, und Gott verdamme mich, wenn ich's nicht bin. Ja, ich zeige es an, wie ich in den Besitz der Summe gekommen bin, nach den Gesetzen gehört der zehnte Teil mir, den nehme ich gleich und bringe ihn durch, aber das andere bleibt unberührt. Will mal sagen, das wären 50 000 Dollar, sehr niedrig taxiert, der zehnte Teil davon wären 5000 Dollar oder 50 Hundertbanknoten. All right, die zähle ich ab und bringe sie auf die Sparkasse, das heißt, zu Peggy. Hurrjeh, werden die aber große Augen machen.«
Er zählte die Scheine ab, steckte diese und die anderen für sich und wollte sich auf den Rückweg machen, als er noch einmal stehen blieb. Dann drehte er sich um und ging wieder an den Bach. So sehr er auch spähte, von der Jacke war nichts mehr zu sehen, ebensowenig auch von den anderen Papieren.
»Fatal,« brummte er in den Bart, »ich hätte sie aufheben sollen. Dann konnte man eher erfahren, wem das Geld eigentlich gehörte. Na, macht nichts.«
Ehe er die Blöße wieder erreichte, passierte es ihm, daß er mit dem linken Fuße in ein Loch trat. Der Sporn hakte sich fest, und er konnte nicht wieder heraus.
»Dann muß ich eben den Stiefel ausziehen,« lachte er ärgerlich, und nach einiger Anstrengung gelang es ihm, den Fuß aus dem Stiefel herauszubekommen.
»Ich glaube, das ist seit einem halben Jahre das erstemal, daß ich den Stiefel ausziehe, wir Cow-boys haben doch ein Hundeleben. Aber was ist denn das?«
Er stülpte den unterdes aus dem Loche befreiten Stiefel um, und einige Papiere flatterten zu Boden.
»Bin ich denn nur heute verhext? Das sind ja schon wieder Hundertdollarnoten. Wahrhaftig, fünf Stück. Schockschwerenot, ich denke, ich habe kein Geld mehr und trage da seit einem halben Jahre schon 500 Dollar mit mir herum. Da muß ich aber schön besoffen gewesen sein, als ich die Banknoten in den Stiefel gesteckt habe. Hatte von jeher einen Widerwillen gegen diese Papierwische. Hurra, heute ist mein Glückstag, der muß tüchtig gefeiert werden. Durst habe ich zwar, aber Wasser? Brrrr, das Zeug schmeckt zu fade. In einer Viertelstunde soll meine Gurgel etwas anderes zu schmecken bekommen.«
Eiligst zog er den Stiefel wieder an und rannte, als ob ihm die Sohlen brennten, davon. Er fühlte jetzt weder Kopfschmerzen noch Mattigkeit, sein Gedanke war nur die Schenke, genannt, ›zur schönen Peggy‹.
Nach kurzer Zeit tauchte vor ihm ein Hügel auf, auf dem sich ein starkgebautes Holzhaus erhob. Es lag nicht weit entfernt von einer Landstraße und hatte infolgedessen starken Zuspruch, hauptsächlich von Fuhrleuten, Cow-boys, fremden Reisenden und ab und zu auch von nach Feuerwasser schmachtenden Indianern.
Es lag wohl noch in einer Wildnis, aber sicher vor Ueberfällen. Nicht weit davon begannen Felder, zu Farmen gehörig, deren Besitzer ab und zu auch bei der schönen Peggy vorsprachen und ein Glas Brandy schlürften. Die Waldschenke auf dem Hügel winkte zu freundlich in die Gegend hinab, man konnte der Einladung nicht widerstehen.

Die schöne Peggy war eine junge Witwe. Sie mochte einst wirklich recht hübsch gewesen sein, ihr Mann aber hatte ihr kurz vor seinem Tode einen Fausthieb ins Gesicht gegeben und ihr somit als Andenken an sich eine eingeschlagene Nase hinterlassen.
Man munkelte, der Mann sei gleich darauf eines recht seltsamen, plötzlichen Todes gestorben, dann habe sich Peggy dem Genusse der Spirituosen hingegeben, und wenn diese zu wirken begännen, so könnte Peggy Sachen erzählen, vor denen man sich graute.
Doch das waren nur Redensarten, zu beweisen war ihr nichts. So viel stand fest, Peggy war eine liebenswürdige Wirtin, trank für zwei mit, konnte einen derben Spaß vertragen, wurde nicht unwillig, wenn sich ein kräftiger Arm um ihre Taille legte, und errötete nicht bei einem zweideutigen Witz.
Die Hauptsache war, daß sie für gute Getränke sorgte, ferner aber auch dafür, daß sich die liebesbedürftigen Cow-boys und übrigen Angestellten der Farmen bei ihr erholen konnten, wozu in ihrem Hause immer einige Küchen- und Schenkmädchen beschäftigt waren. Ja, sogar zwei recht graziöse Verwandte hatte sie im Hause, welche sie Schwägerin und Cousine nannte, doch diese ließen sich nicht in den unteren Räumen sehen, sondern hielten sich nur in den oberen, besser eingerichteten Zimmern auf, so viel aber stand fest, daß wegen dieser beiden Damen, die immer recht elegant gekleidet waren, gemalte Augenbrauen und geschminkte Wangen hatten, gar mancher reiche Farmer vom Pferde stieg und einige Stündchen in den oberen Räumlichkeiten mit der schönen Cousine und der koketten Schwägerin verplauderte.
Es dürfte klar sein, auf welche Weise die schöne Peggy, ein gar listiges Weib, gute Einnahmen erzielte.
Dennoch war ihr Ruf ein guter. Niemandem fiel es ein, auf sie einen Stein zu werfen, ebensowenig wie auf ihr weibliches Dienstpersonal. Im Gegenteil, man hatte Hochachtung vor Peggys Unternehmungsgeist, in dieser menschenbewohnten und doch einsamen Gegend ein so reizendes Etablissement einzurichten.
Gott, man war doch in Amerika, man war auch ein Mensch, andere wollten auch leben, und ob die Damen und Dirnen nun in der nächsten großen Stadt oder hier ihr Gewerbe trieben, das blieb sich doch ganz gleich. Daß Peggy den Cow-boys und anderen Leuten das Geld aus der Tasche lockte, verargte ihr niemand, ausgegeben wurde es doch, und bei Peggy hatte man wenigstens noch etwas Gutes dafür.
Peggy hatte gewissermaßen Macht in der Umgegend, ihr Ausspruch galt etwas, eben, weil sie auf die Idee gekommen war, für Abwechslung in dem eintönigen Leben der Farmer zu sorgen.
Dafür stand sie unter dem Schutze der gesamten Einwohner, ebenso ihre weiblichen Domestiken, und so offen diese auch ihr Handwerk betrieben, auf ihre Ehre ließ man doch nichts kommen.
Erst voriges Jahr hatten sich die Söhne zweier reicher Farmer geschossen, weil der eine behauptet hatte, Peggys schöne Schwägerin habe falsche Zähne.
Augenblicklich war stille Zeit für die Waldschenke. Die Hazienderos hatten mit der Ernte zu tun, ihre Leute natürlich ebenfalls, und die Cow-boys hatten die Saison eben erst begonnen.
Das weibliche Personal erholte sich jetzt, es hielt eine Art von Kur, das heißt, schlief lange, schminkte sich weniger und war nicht jeden Abend betrunken. Die letzten Monate waren die Damen arg mitgenommen worden, jetzt mußten sie sich wieder für die kommende Geschäftszeit stärken.
Gestern hatte Ralph eine kleine Abwechslung gebracht, doch der Bursche war zum Lieben zu alt, er besaß mehr Zuneigung zu der Flasche. Peggy hatte mütterlich dafür gesorgt, daß der Cow-boy nicht eher ihr Haus verließ, als bis er keinen Cent mehr in der Tasche hatte.
Als der Champagner geflossen, hatten es selbst die beiden nobleren Damen nicht verschmäht, sich zu erniedrigen. Sie waren vom Olymp zur ebenen Erde herabgestiegen und hatten die Lippen mit dem schäumenden Naß benetzt.
Schon fielen schwere Tropfen herab, als Ralph mit großen Schritten dem Hause auf dem Hügel zueilte. Er beachtete nicht das heranziehende Unwetter, er dachte nur an das kommende Gelage.
Ehe er seinen Fund in der nächsten Stadt ablieferte, wollte er sich mit den 5000 Dollar noch einmal ›köstlich amüsieren‹ und das übrige Gott anheimstellen.
Bei schönstem Wetter war Ellen mit Lord Harrlington fortgeritten, einige Stunden später hatte sich der Himmel bewölkt, gegen Nachmittag war in den oberen Luftregionen Ruhe eingetreten, aber eine schwere, dunkle Masse bedeckte jetzt das Firmament, und bald öffneten sich die Schleusen des Himmels, es regnete nicht, das Wasser stürzte in Strömen herab.
So blieb es bis zum Abend, mancher Plantagenbesitzer schaute wohl von seinem Zimmer sorgenvoll auf die Felder, deren Saaten vernichtet, weggeschwemmt werden konnten, wenn dieses Gießen nicht bald aufhörte, denn schon vermochte die Erde, so ausgetrocknet sie auch gewesen war, die Wassermengen nicht mehr aufzufangen, es entstanden kleine Seen, aus welchen Bäche dem Süden zuflossen, aus den Bächen wurden Flüsse, und unwillkürlich faltete der Farmer die Hände, dachte er daran, was aus diesen Flüssen vielleicht noch werden konnte.
Vor etwa zehn Jahren hatte einmal eine Ueberschwemmung ganz Texas verwüstet. Sollte Gott über das Treiben der Menschen so zürnen, daß er ihnen abermals eine Sintflut zusendete? An diesem Tage wurde Gott so manche kostbare Weihkerze versprochen, wenn er gnädig sein wolle.
Mister James Flexan gab sich nicht mit solchen Befürchtungen ab. Ihm war es ganz gleichgültig, ob die gesamte Tabaksernte zum Teufel ging oder nicht, ob die Rinder- und Pferdeherden ertranken oder leben blieben, er grübelte darüber nach, was für einen Erfolg Ellen durch ihren hastigen Ritt haben, ob sie Ralph wohl finden und zurückbringen würde.
Doch Ellen kam nicht, ebensowenig Harrlington. Die Sonne sank, der Abend brach an, und er brachte die beiden nicht zurück.
Flexan freute sich im stillen, er betete zu seinem Schutzgeist in der Hölle, daß der Himmel diese verhaßte Ellen spurlos wegschwemmen möchte. Die Gäste dagegen waren in höchster Bestürzung über das lange Fortbleiben der beiden, während dieses Wetters.
Die Herren und Damen waren den ganzen Tag im Salon versammelt und betrachteten in gedrückter Stimmung durch die Fenster die Verwandlung, welche mit der Landschaft vor sich ging. Aus dem Festland wurde nach und nach ein See, und statt daß der Regen nachließ, wurde er immer heftiger.
Die Kerzen der Kronleuchter brannten; draußen war es pechfinstere Nacht, und der Regen prasselte gegen die Fensterscheiben.
In einer Nische, abseits von der Gesellschaft, saßen drei Personen: Williams, Betty und Johanna.
»Fassen Sie Mut, liebes Fräulein,« sagte eben Williams zu der sehr niedergeschlagen aussehenden Johanna, »Mister Hoffmann ist nicht der Mann, der in einem fußhohen Wasser ratlos stecken bleibt. Es ist noch nicht spät, die Finsternis ist nur so schnell angebrochen. Hat er gesagt, er wolle heute kommen, so kommt er auch.«
»Mister Hoffmann hat damals die tosenden Fluten des Oberonsees zu bändigen gewußt, als der Damm brach,« fügte Betty hinzu, »so wird er sich wohl nicht viel aus diesem Regen machen.«
»Was nicht ist, kann noch geschehen,« seufzte Johanna. »Während einer Nacht kann sich diese Gegend in einen tobenden See verwandeln. Aber ich bange mich weniger um Felix, als vielmehr um Ellen. Muß das Unwetter auch gerade jetzt eintreten, wo sie von uns getrennt ist!«
»Lord Harrlington ist bei ihr.«
»Was kann er helfen, wenn sie von dem Wasser überrascht werden? Ihre Pferde werden von den Fluten fortgerissen.«
»So schlimm steht es noch nicht,« tröstete Williams, »und käme es so weit, dann wären wir von keiner geringeren Gefahr bedroht. Diese Besitzung ist tief gelegen.«
»Schon früher soll einmal eine furchtbare Ueberschwemmung hier gewütet haben,« meinte Betty, »und so müssen die Farmer dieser Gegend doch auch wissen, wie sie sich in solch einem Falle zu verhalten haben.«
»Das können wir ja gleich erfahren, dort steht Mister Flexan und scheint nur darauf zu warten, sich an einer Unterhaltung zu beteiligen.«
Der Haziendero wurde vollkommen als eine Null betrachtet. Sprach er, so hörte man nicht auf ihn, näherte er sich einer Gruppe, so wurde ihm der Rücken zugedreht, obgleich es schien, daß dies alles nur zufällig passiere. Flexan mußte natürlich deutlich herausfühlen, wie man seine Gesellschaft vermied, dennoch nahm er keine Notiz davon und suchte sich an jeden heranzudrängen, um ihm zu versichern, wie sehr er wegen des Fortbleibens seiner lieben Stieftochter und ihres Bräutigams bekümmert wäre.
Von dem Fehlen der 80 000 Dollar wußte noch niemand, man hielt den Ritt der beiden einfach für ein Vergnügen, wobei sie den entlassenen Ralph suchen wollten.
Williams rief also den Haziendero, und dieser trat schnell in die Nische. Endlich, endlich sollte er einmal zur Unterhaltung herangezogen werden.
»Was belieben die Herrschaften? Aengstlich wegen der beiden jungen Leutchen? In der Tat sehr, sehr schlimm, ich vergehe vor Angst.«
»O, die werden sich schon durchschlagen, das sind Wasserratten,« unterbrach Betty den händereibenden Farmer, »wir wollten Sie nur fragen, wohin wir uns zurückziehen, wenn das Wasser uns gefährlich werden sollte.«
»Ach, das bißchen Regen schadet nichts, das Wasser verläuft sich schnell. Ich glaube kaum, daß es der Ernte schaden wird, der Boden gleicht einem ausgedorrten Schwamm. Morgen ist alles trocken, auf Ehre.«
»Ich frage, wenn doch vielleicht eine Ueberschwemmung bevorstehen sollte.«
»Wir müssen's abwarten.«
»Bietet dies Haus uns Schutz?«
»Freilich, wenn das Wasser nicht zu hoch steigt.
»Bei diesem Regen? Seien Sie ohne Sorge, es ist nichts. Freilich, den beiden jungen Leutchen kann der Wasserstand gefährlich werden, sie können sich verirren, Wasserlöcher, geschwollene Bäche, die man nicht sieht, fliehende Herden ...«
»War nicht schon einmal hier eine furchtbare Überschwemmung?« unterbrach Williams den redseligen Wirt, der nicht geneigt war, so leicht die einmal begonnene Unterhaltung aufzugeben.
»Vor elf Jahren.«
»Sehen Sie ...«
»Aber das war damals ein Wolkenbruch, das Wasser stand im Nu fünf Meter hoch.«
»Blieben Sie auch hier im Haus?«
»Gott bewahre, das brach zusammen, als wir es kaum verlassen hatten. Aber das war ein Wolkenbruch, bedenken Sie, kein anhaltender Regen.«
»Wohin flohen Sie mit den Leuten?«
»Dahin, wohin sich alle anderen zurückzogen, die um ihr Leben und um ihre Herden bangten; nach Delrocks.«
»Was ist das, Delrocks?«
»So wird eine ganze Gegend genannt, etwa hundert Meilen von hier entfernt. Sie liegt sehr hoch und ist der einzige Punkt, welcher nicht überschwemmt wurde. O, das war eine böse Nacht, durch das Wasser im Galopp geritten. Am nächsten Mittag erreichten wir die Gegend, alle Herden fanden dort Schutz.«
»Hundert Meilen? Das dauert aber lange, ehe man sein Leben in Sicherheit gebracht hat.«
»Ja, ich meine die Herden, und meine erste Hauptaufgabe war, nachdem die Menschen gerettet, das Vieh vor dem Tode zu bewahren.«
»Ach so! Wohin flohen diejenigen, welche nicht mit den Herden beschäftigt waren?«
»Nach einem Hügel, der etwa dreißig Meilen von hier entfernt liegt.«
»So ist also in der Nähe eine hügelige Gegend. Nun, dann ist es ja nicht so schlimm.«
»Es ist nicht hügelig dort, der Hügel erhebt sich ganz jäh aus dem flachen Lande.«
»Das ist sonderbar.«
»Ja, man sagt, es sei kein natürlicher, er soll ein Kunstprodukt der alten Azteken sein.«
»Wahrscheinlich als Schutz gegen Überschwemmungen errichtet.«
»Allerdings. Man sagt, die Azteken haben ihn aufgeschüttet, als sie einmal von einer Überschwemmung, bedroht gewesen sind, bei der sie ihr Hab und Gut einbüßten. Doch das sind nur Sagen. Auch ein Wirtshaus steht darauf.«
»Auch von den Azteken gegründet?« lachte Betty.
»So weit reicht meine Kenntnis nicht,« versuchte Flexan zu scherzen, »aber es ist leicht möglich, daß die Restauration ebenfalls von den Azteken stammt. Jedenfalls wollten sie dafür sorgen, daß sie während ihres unfreiwilligen Aufenthalts auf dem Hügel Zerstreuungen hatten. Jetzt steht das Wirtshaus in keinem guten Rufe, ich kenne es nur dem Aussehen, fast nur dem Namen nach.«
»Nun, wir wollen nicht hoffen, es betreten zu müssen,« sagte Betty.
»Sie paßten schlecht hinein, verehrtes Fräulein. Ich sehe auch keinen Grund zu Befürchtungen. Solche Regengüsse kommen bei uns häufig vor, ohne gefährlich zu werden, ja, selbst ohne den Saaten zu schaden.«
»Regen, Regen, Wasser und Regen, wohin man hört, man hört keine anderen Worte als diese,« sagte Hannes, welcher mit Hope zu der Gruppe trat, »kennen Sie nicht das hübsche Verslein:
»Laßt's regnen, wie es regnen mag,
Es regne seinen Lauf,
Denn, wenn's genug geregnet hat,
Hört's schon von selber auf.«
»Bravo, das nenne ich die Sache humoristisch nehmen, weil sie eben nicht zu ändern ist,« rief Flexan händereibend, »und wahrhaftig, ich glaube, Sie haben eine prophetische Gabe, Mister Vogel, der Regen hört auf.«
Es war in der Tat so, wie man sich am geöffneten Fenster überzeugte. Es rieselte nur noch fein herab, aber das Auge sah eine weite Wasserfläche, vom Monde beschienen, der hinter zerrissenen Wolken auftauchte.
»Steht nur einige Zoll hoch,« meinte Flexan, »in einer Stunde schon hat es sich verlaufen.«
»Dann werden wir vielleicht Miß Petersen und Lord Harrlington heute nacht noch in unserer Mitte sehen,« sagte Hope. »Ich schlage vor, wir bleiben auf und warten auf sie.«
»Natürlich,« erklang es von allen Seiten, »wir können doch nicht schlafen, wir erwarten sie.«
»Es ist aber leicht möglich, daß sie sich auf einer benachbarten Hazienda befinden, um dort die Nacht zu verbringen,« warf Flexan ein.
»Wir warten doch auf sie,« war die Antwort.
Flexan wandte sich ab und murmelte etwas.
Hätten seine Gäste verstehen können, welche Worte er gemurmelt!
»Immer wartet nur, ihr werdet vergeblich warten. Sie werden nie wiederkommen, kalkuliere ich,« hatten sie gelautet.
»Und Mister Hoffmann?« fragte Johanna so leise, daß nur Betty sie hören konnte.
»Hoffen Sie,« ermutigte das Mädchen die Freundin, »auch er kann ja ein Obdach gesucht und gefunden haben.«
»Er wollte heute abend kommen, und er hält sein Wort immer.«
»Es können Verhältnisse eintreten, welche ihn zurückhalten. Ich glaube doch, daß er heute noch kommt.«
»Lord Hastings,« rief Williams den Vorübergehenden an, »sieht das nicht gerade aus, wie damals in Südamerika, als wir auf dem Hügel standen und rings um uns nichts als eine Wasserwüste erblickten?«
»Es ist dasselbe Bild, wir aber befanden uns in anderer Lage. Wir kauten getrocknetes Büffelfleisch oder verzehrten Pferdesteaks, tranken lehmiges Wasser und rauchten den niederträchtigen, indianischen Tabak, der die Zunge zum Reibeisen machte. Auf einer solchen Insel, wie diese hier, könnte ich jahrelang geduldig warten, bis sich das Wasser verlaufen, die Speisen lassen nichts zu wünschen übrig, die Weine sind ausgezeichnet und die Havannas delikat.«
»Sie waren schon einmal in Wassersnot?« fragte Flexan.
Hastings erzählte in kurzen, trockenen Worten die Erlebnisse in Südamerika.
»Die Ueberschwemmungen in Südamerika sind ungefährlich,« fügte Williams hinzu, »weil sie periodisch wiederkommen, man sich also schon vorher darauf einrichtet. Die Indianer, Vaqueros und die sonstigen dort wohnenden Leute würden schön staunen, wenn die Pampas nicht zur bestimmten Zeit überschwemmt wären. Eine Ueberschwemmung hier hat dagegen etwas ganz anderes zu bedeuten.«
»Es wird keine Ueberschwemmung, morgen ist alles wieder trocken,« versicherte Flexan, wenigstens zum hundertsten Male, »und ich wette, daß morgen früh meine schöne Stieftochter in den Hof galoppiert kommt.«
»Eine Ueberschwemmung ist schrecklich, wenn sie durch anhaltenden Regen oder durch einen Wolkenbruch hervorgerufen wird,« nahm Johanna wieder das Wort, »desgleichen, wenn der Damm eines Bassins oder Sees bricht, wie ich es selbst erlebte, aber es gibt eine noch viel schlimmere Wassersnot.«
»Welche ist dies? Meinen Sie die auf offener See, etwa beim Untergange eines Schiffes?«
»Nein, ich meinte, beim anhaltenden Regen sehe ich, wie das Wasser nach und nach wächst, und ich kann ihm rechtzeitig entfliehen. Ich sehe auch, wie sich über mir eine Wolke zusammenballt, wie sie stürzt, ich sehe also die Gefahr, wie sie sich bildet, und habe noch immer Hoffnung auf Rettung durch Flucht. Droht ein Dammdurchbruch, so versuche ich, bin ich mutig, ihn mit aller Kraft zu verhindern, bin ich feig, so fliehe ich. Aber es gibt eine Gefahr, welche größer ist, als alle diese.«
»Ah, Sie meinen, wenn der Dammdurchbruch unerwartet erfolgt, ohne daß man vorher die Katastrophe ahnte, oder wenn eine ganze Gegend von dem geschehenen Unglück unbenachrichtigt geblieben ist? In der Tat, dann kann das Wasser zum Massengrab werden.«
»Ich dachte in diesem Augenblicke an etwas anderes, diesem aber ähnliches,« entgegnete Johanna. »Wer bürgt uns dafür, daß nicht anderswo Wolkenbrüche niedergegangen sind, und daß, während wir hier das Verlaufen des Wassers schon erwarten, nicht bald neue Fluten auf uns einstürmen?«
»Vermutungen, nichts als Vermutungen,« warf Flexan ein.
»Die aber einer Grundlage nicht entbehren,« sagte Williams ernst. »Sahen Sie heute nachmittag im Norden die furchtbar schwarzen Wolken, welche fast auf der Erde zu liegen schienen? Der Wind trieb sie zwar zu uns, hier aber sahen sie gar nicht mehr so sehr gefährlich aus. Wo nun haben sie ihre Wassermenge verloren?«
Flexan lachte gezwungen.
»Weil sie von uns weit entfernt waren, sahen sie so schwarz aus. Sollte wirklich ein Wolkenbruch stattgefunden haben, dann müßte das Wasser schon längst hier sein.«
»Das ist eine Vermutung von Ihnen,« rief Johanna, »das Wasser kann allerdings schon hier sein.«
»Wo denn?«
»Vorläufig in Bächen und Flüssen, die vielleicht stark geschwollen sind.«
»Natürlich; infolge des anhaltenden Regens.«
»Ja, bis sie austreten und alles überschwemmen.«
»Bitte, ich habe eine genügende Erfahrung. Die Bäche und Flüsse in dieser Gegend können eine bedeutende Quantität Wasser aufnehmen. Ich glaube dafür garantieren zu können, daß ein Wolkenbruch, der nicht hier, sondern weiter oberhalb fällt, für uns kaum bemerkbar sein wird.«
Hannes lachte ungeniert auf.
»Ich verzichte darauf, von dieser Garantie Gebrauch zu machen. Höre ich, daß im Gebirge etwa ein Wolkenbruch stattgefunden hat, so werfe ich die Beine über das erste beste Pferd und jage davon, ohne an Ihre Garantie zu denken.«
Die Gesellschaft war zu ernst gestimmt, um lachen zu können. Es bildeten sich wieder andere Gruppen, und Flexan wurde von einigen Herren in die Mitte genommen. Die Erledigung von Fragen, welche nur Flexan beantworten konnte, zwang sie, trotz der Verabredung, sich mit ihm zu beschäftigen.
Nur Betty blieb bei Johanna.
»Auch Ihr Bruder befindet sich möglicherweise ohne jeden Schutz im Freien,« sagte erstere.
Johanna lächelte leicht.
»O, der weiß sich immer zu helfen. Schlimmstenfalls setzt er sich auf einen Baum, bindet sich fest und verschläft die ganze Überschwemmung, als läge er in einem Himmelbett. Natürlich kann auch ihm ein Unfall zustoßen, aber es ist mir nicht möglich, mir Sorge um ihn zu machen, und erführe er es, würde er mich schön auslachen. Mein Bruder behauptete selbst immer im Scherz, er sei gegen Feuer und Wasser gefeit. Nein, Ellen und Lord Harrlington sind es, um welche ich mich sorge.«
Sie fügte nicht einen anderen Namen hinzu, Betty wußte auch so schon, wer gemeint war.
»Daß er gerade heute kommen wollte,« seufzte sie leise.
»Hören Sie da,« sagte Betty plötzlich, »Ihre Ansicht von vorhin hat die Herren besorgt gemacht, sie sind ganz gegen ihre sonstige Gewohnheit sehr vorsichtig.«
Eben erklärte Hastings dem Haziendero, er verlange, daß die Reitpferde bereitgehalten werden sollten, er trat darum so energisch auf, weil Flexan anfangs, als Hastings bittend gesprochen, gelacht hatte.
Flexan zuckte mit den Achseln und verließ mit einem höhnischen Gesichtsausdruck das Zimmer, um dem Verlangen des Lords nachzukommen.
»Ich habe die Schauspielerei herzlich satt,« sagte Hastings, »am liebsten möchte ich ihm ins Gesicht rufen, was ich von ihm denke, und ihn gleich dingfest machen.«
»Wir müssen auf Hoffmann und seinen Begleiter warten,« mahnte Williams. »Was seit Jahren vorbereitet ist, dürfen wir nicht durch unsere Ungeduld zerstören. Freilich, es ist ekelhaft, diesem Schurken gegenüber ein freundliches Gesicht zu machen.«
Flexan trat wieder ein und machte dem Gespräch über ihn ein jähes Ende.
»Die Pferde sind gezäumt und gesattelt, ich habe die besten Schwimmer aussuchen lassen,« sagte er spöttisch.
»Kommt dort nicht ein Reiter?« rief in diesem Augenblicke die durch das Fenster sehende Miß Murray.
»Wirklich. Vielleicht ist es Lord Harrlington.«
»Ohne Ellen?«
Man sah einen Reiter angesprengt kommen. Sein Pferd lief in Karriere, obgleich das Wasser noch fußhoch stand. Bei jedem Sprunge des langbeinigen Tieres spritzte es hoch auf. Mit Windeseile näherte sich der Reiter dem Herrenhause, dessen erleuchtete Fenster ihm als Wegweiser dienten.

Mit Windeseile näherte sich der Reiter dem Herrenhause,
dessen erleuchtete Fenster ihm als Wegweiser dienten.
Jetzt machte er einen Bogen, um auf einen hintengelegenen Hof zu kommen, und Herren und Damen eilten auf die andere Seite des großen Saales.
»Aufgemacht!« klang langgedehnt der Ruf durch die Nacht.
»Wer ist das?«
»Vielleicht ein Cow-boy.«
»Nein, dieser würde nicht erst rufen, daß ihm das Tor geöffnet wird,« erklärte Flexan, der plötzlich bleich wurde, »es muß ein Fremder sein.«
»Aufgemacht!« tönte es von neuem.
Schon sprangen zwei Diener über den mit Wasser bedeckten Hof und öffneten das Tor. Der Reiter sprengte in voller Karriere hindurch und warf, aus dem Sattel gleitend, die Zügel über einen Pfahl.
Man konnte ihn noch nicht richtig erkennen.
»Wo ist der Haziendero?« wiederholte der Reiter barsch.
»Herein mit ihm!« rief Flexan aus dem Fenster. Der eintretende Mann war ohne Zweifel ein Mestize, sein straffes, schwarzes Haar verriet es. Er war mit einem einfachen Reitanzug bekleidet, am linken Oberarm trug er eine Binde mit dem Postzeichen der Vereinigten Staaten daran. Er war wie aus dem Wasser gezogen.
»Schnellpost?« rief Flexan bestürzt.
Der Mestize bejahte.
»Señor Flexan?«
»Das bin ich.«
»Dann setzt Euren Namen hier darunter.«
Er zog aus seinem ledernen Hemd eine Brieftasche aus Wachstuch, öffnete sie und hielt sie dem Haziendero hin. In ihr war ein Schreiben angesiegelt.
Die Gäste drängten sich um den lesenden Flexan, welcher noch bleicher wurde, die den Bleistift haltende Hand zitterte. Das Papier enthielt eine abgeschriebene Depesche und lautete:
AUS TEXARKANA WIRD TELEGRAPHISCH GEMELDET, DAß IM OBEREN ARKANSAS HEUTE NACHMITTAG ZWISCHEN 5 UND 6 ZWEI WOLKENBRÜCHE VORGEKOMMEN SIND. SIE FIELEN AUF DER WASSERSCHEIDE. WEITERE NACHRICHTEN FEHLEN, WEIL DIE VERBINDUNG ZERSTÖRT.
STATION TRINITY.
Einen Augenblick stand alles wie erstarrt da, dann wurden Rufe des Schreckens laut.
»Miß Lind, Ihre Ahnung hat sich erfüllt!«
»Wohin läuft das Wasser ab, nach Norden oder nach Süden?«
»Weiß nicht,« entgegnete der Bote, »bei der nächsten telegraphischen Frage kam schon keine Antwort mehr.«
»Wann seid Ihr von Trinity abgeritten?« fragte Flexan den Mestizen.
»Um 6 Uhr.«
»Was, und Ihr kommt erst um 10 hier an?«
»Beschwerlicher Weg.«
»Unsinn, das bißchen Wasser hindert kein Pferd.«
Der Mestize schüttelte den Kopf, daß das Wasser aus den langen Haaren spritzte.
»Bin achtmal durch das Wasser geschwommen.«
»Achtmal? Ihr übertreibt wohl. Die Bäche mögen wohl von dem Regen stark angeschwollen sein, aber sie sind sonst kaum einen Meter breit, und so muß ein Pferd doch immer noch darüber wegsetzen können.«
»Mein Gaul konnte es nicht.«
»Der Schlangenbach ist das einzige Gewässer, das Euch hätte Schwierigkeiten bereiten können.«
»Schlangenbach? Sagt lieber Schlangenstrom. Er riß mich weg, so daß ich eine Meile weiter unten landen mußte. Eine halbe Stunde habe ich mindestens gegen die Strömung gekämpft.«
Des Hazienderos Augen erweiterten sich.
»So schlimm sind die Bäche geschwollen?« nahm Sir Williams das Wort.
»Kann man ihnen nicht verdenken.«
»Nur vom Regen?«
»Quien sabe?«
»Der Regen hat aufgehört. Bemerktet Ihr, daß die Fluten abnahmen?«
»Auf der Ebene wohl, aber nicht in den Bächen.«
»Sieht es gefährlich aus?«
»Ich kalkuliere, der Schlangenbach wird bald austreten.«
»Meint Ihr, daß der Wolkenbruch nach hier ablaufen wird?«
»Keine Ahnung,« sagte der Mestize, der es eilig zu haben schien, kurz, »die Bäche können vom Regen so geschwollen sein, sie enthalten das von oben kommende Regenwasser, schwellen also immer noch, oder aber der Wolkenbruch füllt sie aus. Señor Flexan, Ihr seid gewarnt, in der nächsten Stunde muß es sich entscheiden, ob das Wasser kommt oder nicht. Jetzt unterschreibt, daß Ihr die Warnung gelesen habt, ich muß noch auf Rickerts Farm.«
Flexan schrieb seinen Namen unter das Papier, welches schon eine Unterschrift trug. Dann verließ der Postbote das Zimmer und ritt weiter.
Die Damen und Herren sahen sich an, ein lähmender Schrecken hatte sie alle gepackt.
»Wir machen uns zu große Sorge,« sagte Flexan, der nicht viel zu verlieren hatte, trotzdem aber ganz außer Fassung war. »Liefe das Wasser nach hier ab, so müßte es ja schon längst da sein.«
Er machte es, wie so viele Menschen, er fand darin Beruhigung, daß er die drohende Gefahr einfach leugnete.
Man besprach, wie die Depesche eigentlich zu verstehen sei. Arkansas ist gebirgig, und zahlreiche Flüsse entspringen in ihm, wovon einige nach Norden, andere nach Süden abfließen. Letztere sind die meisten. War der Wolkenbruch nun gerade auf der Wasserscheide gefallen, so war es fraglich, welchen Weg das Wasser nahm, es konnte entweder Louisiana oder das nördlich gelegene Missouri überschwemmen.
»Auf jeden Fall ergießt sich der größte Teil in den Mississippi,« tröstete Williams, »und dieser Strom kann eine tüchtige Menge Wasser schlucken, ehe er überläuft.«
»Natürlich, natürlich,« stimmte Flexan hastig bei, »und dann sind noch dazwischen der Arkansasstrom, der Kanadian, der Redriver, und wie sie alle heißen. Die wollen sämtlich erst gefüllt sein.«
Aber alle diese Vermutungen halfen nichts, das Wasser nahm seinen Lauf, wie es wollte.
Es war nicht weit von Mitternacht, Flexan hatte alles zur Flucht bereitmachen müssen, er selbst hatte schon das geordnet, was er eventuell mitnehmen würde, desgleichen die Gäste, und man hoffte nur noch, daß Ellen und Lord Harrlington eintrafen, damit man nicht abermals von ihnen getrennt würde.
Johanna sehnte ihren Bräutigam herbei, sie wußte ihn ganz bestimmt in dieser Gegend, und er war mit den örtlichen Verhältnissen hier unbekannt.
Doch das Wasser hatte sich ja schon fast verlaufen. Es begann zu trocknen, ein frischer Wind half dabei, und so schien es, als ob der Himmel es diesmal gnädig mit dem blühenden Staate Louisiana vorhabe.
Einmal wurde wieder Aufregung hervorgebracht, als ein Cow-boy erschien und meldete, die Bäche wüchsen noch immer, wenn auch noch keiner ausgetreten sei. Der Mann hatte keine Ahnung von Wolkenbrüchen, und daß er das Wachsen der Bäche seltsam fand, rief Bestürzung hervor.
»Wie verhalten sich die Rinder?«
»Unruhig.«
»Gebt acht, daß ihr sie halten könnt. Bei einer Flucht würde die Hälfte von ihnen ertrinken. Und hauptsächlich schaut scharf aus, ob ihr einen Reiter seht, der hierher will. Dann zeigt ihm den Weg. Es könnte noch ein Bote von der Station zu erwarten sein,« fügte er, zu den Gästen gewendet, erklärend hinzu.
»Wohl, Sir, wir werden die Augen offen halten,« entgegnete der Cow-boy. »Man kann in der Ferne zwei Lichter auf der Prärie schimmern sehen.«
»Feuer?«
»Das wäre ein Kunststück, jetzt Feuer auf der Prärie anzumachen,« lachte der Cow-boy, »nein, das müssen Laternen sein.«
»Reitet hin und untersucht es.«
»Leicht gesagt! Die Gewässer sind kaum noch zu passieren, und jeder Mann ist auf seinem Posten erforderlich.«
»Was für Lichter mögen es sein?«
»Hm, sie behalten immer den gleichen Abstand voneinander, Wagenlichter etwa, denke ich.«
»Die Lichter eines Wagens?« schrie Johanna auf. »Mein Gott, das könnte Felix sein. Er wollte vielleicht den Wagen benützen, statt der Pferde. Kommt der Wagen nicht näher?«
»Ist es wirklich ein Wagen, dann ist er jedenfalls stecken geblieben,« entgegnete der Cow-boy.
»Wer ist das Felix?« fragte Flexan unruhig. »Erwarten Sie noch jemanden?«
Er wußte nicht, daß man die Ankunft des Mister Hoffmann und eines anderen erwartete.
»Heh, Joe,« fuhr er, zu dem Cow-boy gewendet, fort, »ebensogut, wie du hier bist, kannst du einmal dorthin reiten und dich überzeugen, was für eine Bewandtnis es mit den Lichtern hat.«
Der Cow-boy antwortete nicht, er hob plötzlich den Kopf und lauschte, und sein Gesicht hatte einen so merkwürdigen Ausdruck, daß in dem großen Saal augenblicklich eine unheimliche Stille eintrat.
»Wohin? Was gibts?« rief Flexan dem hinausstürzenden Cow-boy nach.
»Die Herden fliehen,« klang es noch draußen auf dem Korridor.
Da hörten auch schon unsere Freunde ein Geräusch, als ob es in der Ferne donnere. Der Boden erbebte, aber das Geräusch näherte sich ihnen fürchterlich schnell. Die Erde zitterte, daß das Haus im Grunde erbebte, und schon sah man eine endlose, dunkle Masse sich auf dasselbe zu bewegen.
»Die Herden fliehen,« wiederholte Flexan, bleich wie der Tod.
»Sie fliehen vor dem Wasser,« hörte man draußen Stimmen heulen. »Der Bote hat's gesagt, das Wasser kommt.«
Ein furchtbarer Tumult entstand, die Dienerschaft lief hin und her, aber kein Mensch zeigte sich auf dem Hofe.
»Zu den Pferden,« schrie Williams und wollte, Miß Thomson mit sich reißend, hinausstürzen, »schnell, Mister Flexan, treffen Sie Anordnungen!«
»Noch nicht! Fliehen wir jetzt, so sind wir verloren,« stammelte der Haziendero.
»Wieso?«
»Wir werden von der Herde zu Brei gestampft.«
»Die Pferde sind schneller.«
»Ehe wir aufsitzen, sind die Tiere hier.«
Ob Flexan anders dachte, oder ob er das zusammenraffen wollte, was gerettet werden mußte, er sprang aus dem Zimmer, und man hörte ihn eine Treppe hinaufrennen. Wahrscheinlich wollte er in sein Bureau.
»In Ihre Zimmer und das mitgenommen, was Sie retten wollen!« übertönte Williams den Tumult, der im Saale entstanden war. Einige folgten der Weisung, andere blieben ebenso, wie Williams selbst, am Fenster stehen und erwarteten die rasenden Rinderherden.
Man konnte sie nicht übersehen. Die Köpfe tief geneigt, Körper an Körper, so stürmten sie auf das Haus zu, alles niederwerfend, was ihnen im Wege stand.
Nun, das Haus konnten sie wohl nicht über den Haufen rennen, aber was mochte hinter ihnen kommen?
Vor der Herde her brausten die Cow-boys auf schäumenden Pferden, sie dachten jetzt nicht daran, die Tiere aufzuhalten, denn dadurch wären diese und sie selbst dem sicheren Tode überliefert worden.
Sie vergaßen nicht, die Bewohner des Herrenhauses zu warnen.
»Das Wasser, das Wasser kommt,« übertönte ein Schrei aus fünfzig Kehlen das Donnern der Hufe.
Dort, mitten zwischen den Rindern eingekeilt, befanden sich auch unzählige Pferde, wilde Mustangs. Eine neue Gefahr drohte den in der Villa Eingeschlossenen. Die gezähmten Tiere in den Ställen hörten das ängstliche Wiehern ihrer wilden Kameraden, eine furchtbare Angst ergriff sie.
»Zu den Pferden!« schrie auf dem Hofe eine Stimme. »Die Tiere befreien sich.«
Donnernd schlugen die Hufe gegen die hölzernen Scheidewände der Ställe, die Ketten sprangen, als wären sie von Glas, ein wildes Durcheinander entstand, dann sprang die Stalltür auf, und die Tiere, an der Spitze ein mächtiger Hengst, wollten ins Freie stürmen.

Aber man kam ihnen zuvor. Der Hilferuf des Dieners hatte nicht nur seine Kollegen, sondern auch die englischen Herren herbeigerufen. Lord Hastings war der erste, welcher den Tieren entgegensprang. Der große Hengst war sein Pferd. Eine Faust ergriff den Zügel, die Finger der anderen preßten die Nüstern zusammen, und das Tier konnte der gewaltigen Kraft des Lords nicht widerstehen, es gab den Gedanken an Flucht auf. Ebenso schnell waren die anderen Pferde wieder gebändigt.
Jetzt hatte die fliehende Herde das Haus erreicht, sie teilte sich. Links und rechts stürmten die Tiere daneben vorbei, aber die Fenz und ein kleines Bretterhaus verschwanden doch spurlos unter ihren Hufen.
Williams stand auf dem massiven Pferdestall wie auf einer Insel, mitten in der lebenden Masse, die Beamten, die Diener und seine Freunde waren im Stall, die Damen im Haus, wohin sich auch die Bewohner des Negerdorfes gerettet hatten. Dieses selbst war schon längst unter den alles zermalmenden Hufen dem Erdboden gleich gemacht worden.
Zwischen dem Herrenhaus und dem Pferdestall befand sich noch ein freier Raum, und nichts hätte die Rinder gehindert, diesen bei ihrer Flucht zu benutzen, aber die Tiere gehen nun einmal nicht ihren eigenen Weg, sie folgen immer den Fußstapfen der Voranstürmenden.
So konnte der Weg zwischen der Villa und dem Pferdestall gefahrlos von Menschen benützt werden und so eilten nicht nur die in der Villa befindlichen Beamten und Damen dorthin, wohl wissend, daß nach dem Passieren der Rinder ihre Rettung allein auf den Rücken der Pferde lag, sondern auch einzelne Neger wurden von dem Instinkt dazu getrieben. Auch sie begaben sich in den Pferdestall.
Williams sah von seinem erhöhten Standpunkte aus das Ende der Herden noch nicht, und was mochte wohl dahinter kommen? Ein entfesseltes Meer? Doch das war es nicht, was dem sonst so kaltblütigen und unerschrockenen Engländer, der auch in der Gefahr seinen Humor nicht verlor, das Blut plötzlich aus den Wangen jagte. Ein anderer, entsetzlicher Gedanke war in ihm aufgestiegen.
Neben Lord Hastings, welcher seinen mächtigen Hengst am Zügel hielt, sah er einen großen, herkulischen Neger stehen, den riesigen Lord fast noch überragend. Sein brutales Gesicht war von einer furchtbaren Angst entstellt, die blutunterlaufenen Augen schielten unverwandt nach dem Lord und dessen Roß, und seine rechte Hand hatte er unter dem baumwollenen Hemd verborgen.
Ferner sah Williams, wie seine Freunde und die Damen sich weniger mit den Pferden beschäftigten — es waren ihre eigenen — als vielmehr mit den Herden. Die Beamten und Diener der Plantage dagegen hielten sich alle bei den Rossen auf, ihre Hand lag schon am Zügel. Williams erkannte sofort die Gefahr, die seinen unerfahrenen Begleitern, wie ihm selbst, drohte.
Wie gesagt, sie hatten ihre eigenen Pferde mitgebracht, wenn man aber dem Tode unmittelbar ins Auge schaut, hört der Unterschied von Mein und Dein auf, man greift nach dem nächsten, und wenn es auch dabei — fügte Williams mit leisem Schaudern hinzu — über die Leiche des eigentlichen Besitzers hinweggehen sollte.
Außer ihren Pferden enthielt der lange Stall noch über hundert andere, aber sie reichten nicht einmal für alle weißen Diener, um wieviel weniger für diese Neger, welche ihr Heil ebenfalls in der Flucht suchen wollten.
Das mußte einen Kampf um Leben und Tod geben, wenn man nicht gleich von vornherein energisch und rücksichtslos auftrat.
Jeder ist sich selbst der Nächste. Williams sah das tierische Gesicht des großen Negers, war mit einem Sprunge von dem Dach herab, stand neben Lord Hastings und flüsterte ihm etwas zu.
Der Lord erschrak leicht, erfaßte aber die Situation sofort. Ein Gemurmel ging durch die Reihen der englischen Herren, es pflanzte sich fort bis zu den Damen, überall fand es Widerhall, und eine Bewegung trat ein.
Jetzt konnte man die letzten Reihen der Büffel sehen — der Mond befehlen hinter ihnen eine zerstampfte, morastige Ebene, doch kein anstürmendes Wasser.
»Die Damen auf die Pferde!« donnerte Lord Hastings' tiefe Stimme im Kommandotone.
Alles war vorbereitet gewesen, die Damen hatten schon neben ihren Pferden gestanden, welche sich kaum noch halten ließen, über zwanzig Herren bückten sich, zwanzig Hände wurden untergehalten, ohne den Zaum des eigenen Tieres loszulassen, und im Nu saßen alle Damen im Sattel. Die bestgeschulten Kavalleristen hätten nicht gleichmäßiger aufsitzen können.
Das Kommando des Lords hatte aber auch Leben unter den übrigen Männern hervorgezaubert. Plötzlich entstand im Stall und auf dem Hof vor der Tür ein wildes Gedränge, ein Stoßen, Schlagen, Kämpfen, Fluchen und Toben.
Die ersten, welche den Sattel eingenommen hatten, waren die höheren Beamten der Hazienda. Die Diener, diesen zu gehorchen gewohnt, ließen sie unbelästigt; ein heißer Kampf aber entspann sich um die übrigen freien Pferde, wenn es auch vorläufig bei Stößen und Fausthieben blieb.
Auch den englischen Herren sollten die Pferde streitig gemacht werden, als sie nach der den Damen geleisteten Hilfe in die Sättel steigen wollten.
Lord Hastings erblickte, sich wieder aufrichtend, den großen Neger, wie er eben den Fuß in den Steigbügel setzte. Als er das drohende Auge des Lords auf sich gerichtet sah, fuhr seine Hand sofort wieder in den Brustschlitz des Hemdes.
»Heh, guter Freund, den Fuß aus dem Steigbügel,« rief der umdrängte Lord und packte den Neger am Arm.
»Mein Pferd, Massa.«
»Zurück oder —«
Doch der Neger wich nicht zurück, blitzschnell fuhr die Hand aus dem Busen, sie hielt ein langes Bowiemesser, Lord Hastings aber besaß eine schnellere Faust, mit zerschmetterter Kinnlade sank der Neger zu Boden, und der Lord saß im Sattel, neben sich das Pferd seiner Braut am Zügel haltend.
Ebenso wurden einige andere Herren belästigt. Einer der Diener sprang auf den schlanken und schmächtigen Williams zu, ihm den Zügel zu entreißen. Er wagte jedoch nicht, zuzugreifen, denn er blickte in die Mündung eines Revolvers, den ihm Williams mit entschlossenem Gesicht vorhielt.
Das Stampfen und Zittern hatte nachgelassen, die Herde mußte vorbei sein.
»Hinaus und den Revolver in die Hand!« schrie Williams mit heiserer Stimme.
Die berittenen Beamten waren schon draußen, sie jagten schon über die Prärie der Herde nach, und jetzt drängten sich, Pferd an Pferd haltend, die Herren und Damen auf den Hof.
»Hilfe!« gellte Hopes Stimme.
Sie war die letzte, welche den Stall verließ, und neben ihr hielt sich Hannes.
Hope wurde von einem Diener gehalten, der sie, mit allen Zeichen der entsetzlichsten Angst in den verzerrten Zügen, von hinten vom Pferd zu reißen suchte.
Ihr Hilferuf fand sofort Erhörung.
Hannes drehte den bereitgehaltenen Revolver herum und ließ den Kolben auf den Schädel des Verzweifelten herabschmettern, so daß er sofort zusammenbrach.
Dabei entlud sich der Revolver, die Kugel drang in die Decke, und es war als ob der Schuß das Zeichen gewesen wäre, daß jetzt jede Schonung aufhören sollte!
Schüsse krachten, Messer blitzten, und um die noch freien Pferde herum entstand ein mörderisches Schlachten. Die Folge davon war, daß überhaupt niemand in den Sattel gelangte.
Doch unsere Freunde hatten schon das Freie erreicht.
»Sind alle da?«
»Mister Flexan fehlt noch.«
»Was kümmert uns der?«
Kaum hatte Lord Hastings diese Worte gesprochen, als man in der Ferne ein unheimliches Rauschen vernahm und die Strahlen des Mondes sich in einem silbernen Streifen brechen sah, der rasch näherkam.
»Das Wasser!« schrie Hastings. »Fort denn! Wer sich uns entgegenstellt, wird überritten.«
Das letzte galt den Dienern und Negern, welche das Rauschen ebenfalls gehört hatten und nun in ihrer Todesangst noch einmal den Versuch machen wollten, sich der fremden Pferde zu bemächtigen.
Hastings setzte sein Pferd in Galopp, die Hufe warfen einen Neger zu Boden.
Williams hielt die Zügel des Rosses der Miß Thomson, er bildete den Schluß der fliehenden Truppe. Da bemerkte er Johanna, welche zögernd ihr Pferd zurückhielt.
»Kommen Sie!« drängte er hastig. Er sah, wie zwei Männer schon nach dem Tiere sprangen.
»Aber Felix — ich bleibe,« stammelte Johanna.
Da griff ihr schon die Hand eines Kerls in die Zügel und suchte ihr denselben zu entwinden.
»Losgelassen!« donnerte Williams und hielt ihm den Revolver vor die Augen.
Der Verzweifelte hörte nicht; ein Blitz, ein Knall, und mit durchschossenem Kopfe lag er am Boden.
»Es mußte sein,« murmelte Williams, »besser einer, denn viele. Gott wird mir dies einst nicht anrechnen.«
Mit fester Faust ergriff er die Zügel des zurückgehaltenen Pferdes.
»Lassen Sie mich!« flehte Johanna.
Doch Williams riß es mit sich, das Mädchen konnte das Tier, welches die Gefahr witterte, auch nicht mehr halten. Wie der Sturm sausten die drei Zurückgebliebenen den Freunden nach.
Ab und zu brach noch ein Pferd mit einem Reiter aus dem Stalle hervor und floh in mächtigen Sprüngen davon. Die letzten Pferde waren durch Revolverschüsse unbrauchbar gemacht und auf die wenigen guten kam niemand, einer riß den anderen herunter. Kraft und List, verbunden mit der größten Rücksichtslosigkeit, wurden aufgeboten, auf den rettenden Rücken zu gelangen.
Doch sie waren ja noch nicht ganz verloren.
»Das Wasser kommt!«
Näher und näher kam der silberne Streifen; wie eine endlose Welle flutete er heran, und er war auch wirklich eine ungeheure Welle, der unzählige andere folgten.
Heulend stürzten die Männer nach dem Hause, wo sie von dem Zetern der Neger empfangen wurden.
Im Augenblick war die Prärie ein See, doch kein friedlicher mehr, wie vorher der von dem Regen gebildete, sondern ein stürmischer, vom Winde bewegter.
Man konnte wahrnehmen, wie das Wasser jede Minute schwoll. Es stieg fürchterlich schnell, und immer heftiger schlugen die Wellen an das steinerne, aber nicht starkgebaute Haus an. Würde es ihnen standhalten, bis sich das Wasser verlaufen?
Davon hing jetzt Leben und Tod ab.
Die Dämmerung brach schon an, und der Wagen, welcher über die in einen Sumpf verwandelte Prärie fuhr, hatte sein Ziel noch nicht erreicht. Ein schlimmes Stück Arbeit, unter solchen Verhältnissen einen Wagen über die Prärie zu lenken, denn die unbemerkbaren Löcher bieten zahllose Gefahren.
In dem starkgebauten, hölzernen Gefährt saßen zwei Männer, von denen der eine in Decken gehüllt war. Das Fieber mußte ihn plagen, denn ab und zu ging ein Zittern durch seinen Körper.
Jetzt hielt der Kutscher seine beiden Pferde an, denen man ansah, daß sie schon mehrmals aus Sumpflöchern herausgezogen worden waren, und wandte sich auf dem Bocke um.
»Was gibt's?« fragte der Gefährte des Kranken, das verstört aussehende Gesicht des Kutschers bemerkend.
»Es wird Abend, Sir.«
»Das merke ich.«
»Und wir haben die Hazienda noch nicht erreicht.«
»Schlimm genug. Macht zu, daß wir bald das Haus zu Gesicht bekommen.«
»Ist es meine Schuld, daß wir so langsam von der Stelle kommen?«
»Freilich nicht. Wer hätte das auch gedacht! Ich mache euch auch keine Vorwürfe. Nun aber treibt Eure Gäule an, wir wollen die Nacht nicht hier kampieren.«
»Die Pferde stürzen jeden Augenblick in ein anderes Loch.«
»Dann müssen wir sie eben jedesmal wieder herausziehen,« entgegnete der Wageninsasse gleichmütig.
Oft schon mußten sie dieses unangenehme Geschäft verrichtet haben, denn seine, wie des Kutschers Kleidung war durch und durch naß und mit Schlamm bespritzt. Sie sahen nicht viel besser, als die Pferde, aus.
»Fahrt weiter!« drängte der Mann.
»Ich kalkuliere, es ist besser, wenn wir, ich und Ihr, ein Wagenpferd nehmen und vorausreiten.«
»Und mein Diener?«
»Der mag so lange hier bleiben, bis wir ihn abholen.«
»Ich habe Euch schon einmal erklärt, daß ich auf diesen Vorschlag nicht eingehe. Mein Diener ist krank. Ueberdies müßten wir dann doch wieder zurück und ihn abholen, hätten also nur doppelte Arbeit.«
»Ach was, jeder ist sich selbst der Nächste.«
»Ich verlasse meinen Gefährten nicht.«
»So laßt mich allein reiten und bleibt bei ihm. Ich komme mit frischen Pferden zurück.«
»Ich traue Euch nicht, weil bei Euch der Spruch gilt: Jeder ist sich selbst der Nächste.«
Der Kutscher nahm dies nicht übel, er lachte pfiffig.
»Und daß ihn einer von uns vor sich auf's Pferd nimmt, geht auch nicht,« entgegnete er dann. »Die Pferde sind so müde, daß sie kaum einen Reiter tragen können, und Ihr seid beide von starkem Gewicht. In diesem Sumpfe bleiben sie beim ersten Schritte stecken.«
Der Kranke war von hohem, starken Körperbau, sein Gefährte überragte ihn noch. Insofern hatte der Kutscher recht.
»Und schließlich ist es immer noch besser, die Nacht überrascht uns im Wagen, wo wir uns gemütlich einrichten können, bis sich das Wasser verlaufen hat, als daß wir ermüdet vom Pferde herabfallen.«
Der Fremde blickte auf.
»Was soll das heißen? Ah, ich verstehe, Ihr wißt überhaupt nicht mehr, wo Ihr seid.«
»Stimmt,« erwiderte der Kutscher offen, »ich will's Euch jetzt nicht mehr verhehlen. Ich habe schon seit einigen Stunden keine Ahnung mehr, wo ich mich befinde.«
Anstatt in Schelten über den unkundigen Wegeführer auszubrechen, erwiderte der Fremde ruhig:
»Ich kann Euch deswegen nicht zürnen, Freund. Da auch ich in der Prärie zu Hause bin, weiß ich recht gut, daß sich bei einer Überschwemmung der erfahrenste Präriejäger wie ein Neuling verirren kann. Aber das nützt nichts, den Kopf deswegen sinken zu lassen. Treibt die Pferde an und fahrt geradeaus, wir können doch nicht weit von der Hazienda entfernt sein!«
»Nehmt Vernunft an, Sir,« sagte der Kutscher rauh. »Die Nacht bricht an, und wollen wir nicht hier kampieren, so müssen wir beide Pferde nehmen und reiten. Es steht Euch ja frei, dann Euren Diener abzuholen. Dieser Karren hier wird schon nicht gleich wegschwimmen.«
»Ich lasse meinen Gefährten nicht im Stiche. Steckt die Lampen an und fahrt zu. Vielleicht sehen Cow-boys die Lichter und suchen uns auf.«
Der Kranke richtete sich etwas auf.
»Reiten Sie und lassen Sie mich zurück!« sagte er unter hörbarem Zähneklappern. »Ich weiß bestimmt, Mister Hoffmann, daß Sie mich nachholen.«
»Torheit, Snatcher, ich lasse dich nicht im Stiche.«
Der Kranke wollte noch Einwände machen, aber Hoffmann gab seinen Entschluß nicht auf.
Eben war der Kutscher damit beschäftigt, die beiden Lampen zur Seite des Bockes anzuzünden, als Hoffmann plötzlich freudig rief:
»Dort sind Lichter!«
»Wahrhaftig, das sind die erleuchteten Fenster der Hazienda. Hurra, wir sind nicht weit davon ab.«
»Dann gebt den Pferden die Peitsche zu schmecken. Freue dich, Snatcher, heute nacht sind wir unter Dach.«
Snatcher murmelte etwas Unverständliches vor sich hin.
Der Kutscher hatte neuen Mut bekommen. Er ergriff die Zügel. Die Pferde zogen an, und nach einigen Anstrengungen gelang es ihnen, den unterdes tief eingesunkenen Wagen wieder in Bewegung zu setzen. Es ging nur langsam vorwärts, aber Schrittfahren kennt man in der Prärie nicht, auch auf diesem sumpfigen Wege mußten sie in Trab fallen.
Die Entfernung bis zum Hause mochte noch zwei bis drei englische Meilen betragen, doch der Wagen sollte die Hazienda nicht erreichen.
Die Pferde waren noch nicht weit getrabt, als plötzlich das eine aufbäumte, es wollte zurück, das andere zog es vorwärts, und sofort war es spurlos verschwunden. Aber nicht genug damit, es zog auch das zweite Pferd mit in die Wassergrube hinein.
Diese war ganz außergewöhnlich tief. Sonst sahen wenigstens die Köpfe der gestürzten Tiere heraus, diesmal verschwanden beide spurlos unter der Wasserfläche. Die heftig bewegte Oberfläche zeigte an, was für ein Kampf da unten vor sich ging.
Mit einem fürchterlichen Fluche sprang der Kutscher vom Bock herab. Bis an die Knöchel sank er in den Schlamm, ihm nach sprang Hoffmann. Im Nu waren die Stränge gelöst, und beide Männer tauchten die Hände ins Wasser. Sie konnten eben noch die Mähne des obersten Pferdes fassen.
»Schnell,« keuchte der Kutscher, »oder sie ertrinken!«
Trotzdem hatte er keine Hoffnung, die Tiere herauszuziehen. Wer sollte solch ein schweres Pferd am Halse heben? Ratlos stand er da, doch Hoffmann herrschte ihm zu, Hand anzulegen.
Der Kutscher hielt es kaum für möglich, aber seinem herkulischen Fahrgast gelang es doch mit einer riesigen Kraftanstrengung, das erste Tier herauszubringen, fast ohne daß ihm der Eigentümer dabei half.
Es zeigte sich sofort, daß das Tier für sie unbrauchbar war, mit gebrochenem Beine lag es im Schlamme. Das andere herauszuziehen hatte keinen Zweck mehr, das war schon längst ertrunken.
»Himmel und Hölle,« fluchte der Kutscher, »was nun? Zwei Pferde eingebüßt zu haben, ist hart, noch härter aber, daß ich jetzt so in der Patsche stecke. Ich verfluchter Narr, daß ich Eurem verrückten Vorschlage nachgeben mußte, Euch in meinem Wagen über die Prärie zu kutschieren.«
»Still, Mann, Euer Fluchen hilft nichts, es bringt uns nicht weiter,« sagte Hoffmann barsch. »Ihr selbst habt mir übrigens angeboten, mich fahren zu wollen.«
»Schon recht,« war die brummige Antwort, »aber wenn mein Fluchen nichts hilft, was sollte uns sonst helfen?«
»Wir müssen einfach nach der Hazienda marschieren, das ist alles.«

»Durch den Sumpf?«
»Ich möchte, ich wäre von vornherein zu Fuß gegangen, dann hatte ich die Hazienda schon längst erreicht. Oder wollt Ihr allein hierbleiben?«
Der Kutscher warf einen prüfenden Blick über seinen Wagen und dann nach den freundlich blickenden Lichtern in der Ferne, die ihm Bequemlichkeit versprachen.
»Hm, ich ziehe vor, mit Euch zu gehen. Aber was wird aus dem Kranken?«
»Er kommt mit.«
»Er kann nicht so lange durch den Sumpf waten.«
»Dann trage ich ihn.«
»Hm, ein schweres Stück Arbeit. Ich erkläre Euch gleich von vornherein, daß Ihr nicht zu glauben braucht, an mir einen Ablöser zu finden.«
»Ich brauche Euch auch nicht. Möchtet Ihr nie in solch eine Lage kommen, wie diese da; wehe Euch, wenn der Himmel Gleiches mit Gleichem vergilt.«
Hoffmann wandte sich zu Snatcher.
»Hast du gehört, was wir ausgemacht haben?«
»Ja.«
»So komm, ich trage dich!«
»Mister Hoffmann, Sie muten sich zuviel zu, ich bin ein schwerer Mann.«
»Du wirst sehen, daß es mir ein leichtes ist, dich eine Stunde zu tragen.«
Damit hüllte er den fiebernden Snatcher fest in die Decke ein und nahm ihn, wie ein Kind, auf den Arm, während der Kutscher einige Sachen zusammenschnürte, die er mitnehmen wollte.
»So, nun kann die Reise losgehen. Hoffentlich fressen die Schakale bis morgen meinen Wagen nicht auf.«
»Mich wundert's, daß sich keine sehen lassen.«
»Sie werden wegen des Regens in ihre Löcher gekrochen sein.«
»Damit sie ersaufen,« lachte Hoffmann spöttisch; er sah immer mehr ein, welchen Mißgriff er bei der Wahl dieses Mannes als Kutscher durch die Prärie gemacht hatte. Er benahm sich oft wie ein unbeholfenes Kind, das nie die Stube verlassen hat.
»Wo sollten sie denn sonst sein?« entgegnete er jetzt. »Bei solch einem Wetter sucht jedes Tier einen trockenen Schlupfwinkel.«
»Aber nicht der Schakal. Das stets hungrige Raubtier weiß ganz genau, daß ihm nach einem anhaltenden Regen reichliche Beute zufällt.«
»Welche?«
»Ersoffene Ratten und Mäuse, Maulwürfe, Hasen und so weiter.«
»Also schöpft Ihr Argwohn, weil sich die Schakale nicht herumtreiben?«
»Allerdings. Diese Tiere haben Instinkt, der manchmal schärfer sein kann, als unser Verstand.«
Langsam bewegten sich die beiden vorwärts, Hoffmann kam, obgleich er wegen seiner schweren Last auf dem Arm fast bei jedem Schritte bis ans Knie einsank, noch eher von der Stelle als der Kutscher.
Plötzlich blieb er stehen.
»Horch.«
Ein Rollen war hörbar.
»Es donnert,« sagte der Kutscher.
»Nein, das ist kein Donner.«
»Mister Hoffmann, das sind fliehende Büffel oder Rinder,« sagte Snatcher mit schwacher Stimme, »ich kenne das Geräusch, es kann nichts anderes sein.«
»Zurück zum Wagen,« schrie Hoffmann und eilte so schnell nach dem Gefährt, daß ihm der Kutscher nicht folgen konnte. Atemlos gelangte er endlich dort an. Die Lampen brannten noch, Hoffmann hatte den Kranken schon wieder ins Innere gehoben und war selbst eingestiegen.
»Meint Ihr wirklich, das fliehende Büffel hierherkommen?« fragte der Kutscher ängstlich.
Hoffmann nickte nur kurz; die weitere Antwort kam von selbst. Immer näher erscholl das dröhnende Stampfen von zahllosen Hufen, und jetzt konnte man im Mondschein schon die Unmenge der behörnten Köpfe sehen.
»Jesus Christus,« schrie der Kutscher, »wir sind verloren.«
Er blickte sich um und sah in einer Entfernung von etwa einer Meile hinter sich die ersten Bäume eines Waldes stehen.
»Wir müssen nach dem Walde fliehen und uns auf die Bäume retten.«
Er machte schon Miene, vom Wagen herabzuspringen und sein Vorhaben auszuführen, allein Hoffmanns eiserne Faust hielt ihn zurück.
»Ehe Ihr hundert Meter gelaufen, seid Ihr eingeholt und niedergetreten. Hier geblieben.«
Hochaufgerichtet stand er im Wagen und blickte der anstürmenden Herde entgegen. Der Kutscher war in die Knie gesunken.
»Warum fliehen sie?« murmelte Hoffmann. »Kein Gewitter, kein Sturm treibt sie, es ist ganz schönes Wetter, und noch dazu achten sie diesen morastigen Boden nicht. Und wo sind die Schakale? Sonderbar.«
»Mister Hoffmann,« sagte Snatcher an seiner Seite, den im Augenblicke der Gefahr das Fieber verließ, wir sind in keiner so großen Not, wie Sie vielleicht meinen.«
»Ich weiß, ich weiß.«
»Die Herde kann geteilt werden.«
»Und das werde ich tun. Gelingt's, dann sind wir gerettet, wenn nicht, so können wir nur noch ein Notgebet murmeln.«
Sein scharfes Dolchmesser schlitzte eine Matratze auf die im Wagen lag. Er zog das innen befindliche Seegras auseinander und etwas heraus, nahm eine Lampe, löschte sie aus und goß das Oel über die ganze Matratze aus.
»Angefaßt,« rief er dann dem Kutscher zu.
Mechanisch half ihm dieser, die Matratze hinauszuwerfen, Hoffmann schleppte sie noch etwas vom Wagen ab und blieb dann hinter ihr stehen, während der Kutscher eiligst wieder nach dem Wagen zurückkehrte.
Mit ungeheurer Schnelligkeit näherten sich die angsterfüllten Tiere. Ruhig erwartete sie Hoffmann, das Auge fest auf die Reihen gerichtet, welche weder nach links noch nach rechts ein Ende zeigten.
Cow-boys waren hier nicht zu sehen, sie ritten entweder zur Seite oder voraus, aber außer Gesichtsweite.
Jetzt hatten die vordersten Tiere den Mann fast erreicht. Im nächsten Augenblick mußte er zerstampft am Boden liegen, ebenso der Wagen mit seinen Insassen, da aber flammte eine hohe Feuersäule aus der Matratze zum Himmel auf.
Die Tiere stauten sich. Sie erschraken vor dem Feuer.
Mit einem Sprunge stand Hoffmann auf dem Wagen, ergriff eine Decke und schwang sie unter lautem Rufen um den Kopf.
Der nächste Augenblick mußte entscheiden, ob die Tiere ihren Weg fortsetzten oder sich teilten. Fast schien es, als wollten sie das erstere tun, denn die nachfolgenden Tiere drängten zu sehr nach vorn, als eine Explosion die Luft erschütterte — Hoffmann hatte einen Explosivstoff in das Heu geworfen.
Entsetzt prallten die Tiere zurück; dann stürmten sie weiter, teilten sich aber nach links und rechts, und keinem Rind fiel es ein, den einmal gemiedenen Platz zu durchqueren.
Wie auf einer Insel standen die Männer, umringt von unübersehbar vielen Büffeln, und sorgten durch Deckenschwingen noch dafür, daß die Sicherheit ihres Standes nicht erschüttert wurde.
Nach einer halben Stunde war die letzte Reihe vorbei, die Prärie glich jetzt einem Moor.
»Gott sei gedankt,« jubelte der Kutscher aus tiefstem Herzen auf, »wir sind gerettet. Nun aber schnell, daß wir die Hazienda erreichen!«
»Gemach,« entgegnete Hoffmann, »die Rinder sind nicht ohne Ursache geflohen. Snatcher, was meinst du, warum sie dies taten?«
Der Gefragte musterte den Horizont.
»Die Ursachen sind oft ganz verschieden. Ehe die Tiere aber so mutlos werden können, daß sie beim Rascheln eines Blattes die rasende Flucht ergreifen, müssen sie vorher durch irgend etwas erschreckt worden sein, durch Blitz oder Donner oder durch sonst etwas.«
»Ganz meine Ansicht, also durch ein Naturereignis. Vielleicht haben sie ein solches auch nur geahnt.«
Alle drei spähten in die Ferne.
»Ha, der Mond spiegelt sich dort im Wasser,« rief plötzlich Hoffmann.
»Eine Ueberschwemmung!« schrie Snatcher.
Der Kutscher heulte laut auf. Dem Tode erst entronnen, sah er sein Leben abermals in Gefahr. Doch das Wasser ließ sich durch seine Verzweiflungsausbrüche nicht aufhalten, mit reißender Schnelligkeit kam es näher.
»Wir bleiben auf dem Wagen,« entschied Hoffmann, »vielleicht steigt es nicht so sehr hoch und verläuft sich bald. Es muß ein Wolkenbruch stattgefunden haben.«
»Wir ersaufen,« jammerte der Kutscher.
»Nein, der Wagen wird uns tragen.«
»Dann schwimmen wir weg.«
»Höchstens bis an den Wald, dort können wir uns einstweilen festhalten.«
Hoffmann richtete seine Augen weniger auf das ankommende Wasser, als vielmehr auf die Hazienda. Dort wußte er die Damen und Herren, unter ihnen seine Braut. Was mochten sie wohl beginnen? Würden sie auf Pferden fliehen oder im Hause der Ueberschwemmung zu trotzen wagen? Hoffmann wünschte, sie täten das erstere.
Auch Snatcher bangte für jemanden auf der Plantage.
»Wenn er nun ertrinkt?« sagte er leise.
»Dann kommen wir zu spät, er ist schon Gottes Gerechtigkeit verfallen.«
»Ich möchte lieber, er bliebe am Leben! Ach, könnte ich den Augenblick genießen, ihm gegenüberzustehen, ihm, der mir alles geraubt hat!«
Das Wasser war herangekommen. Erst bedeckte es den Boden nur handhoch, da es aber so schnell dahinrollte, daß man ihm mit dem Auge kaum folgen konnte, so konnte man daraus schon schließen, welcher Schwall noch kommen mußte.
Mit rapider Geschwindigkeit stieg es. Nach kaum einer Viertelstunde schon hatte es die Räder des Wagens bedeckt, welcher sich zwar noch nicht hob, aber nicht weit davon sein konnte.
»Wird er uns auch tragen?« fragte der Kutscher ängstlich.
»Sind wir heute nicht schon mehrere Male auf ihm über Flüsse geschwommen?«
»Ja, das war aber Flußwasser.«
Hoffmann mußte über die Dummheit des Kutschers lachen.
»Sollten die Räder nicht so fest im Schlamme stecken, daß er nicht gehoben werden kann?« fragte Snatcher.
»Ich habe vorhin den Wagen ausgehoben und gefunden, daß er nur lose im Schlamme steckt,« war Hoffmanns Antwort, »außerdem weiß ich genau, wie weit das Wasser reichen muß, ehe er schwimmen kann. Sollte er es dann doch nicht tun, so müssen wir eben ins Wasser und ihn freisetzen.«
»Halten Sie unsere Lage für gefährlich?«
»Durchaus nicht. Wir schwimmen eben, wie Noah in seiner Arche, herum, bis wir nach einer hügeligen Gegend getrieben werden, oder bis sich das Wasser verlaufen hat. Unsere Fahrt wird allerdings eine sehr schnelle sein, denn diese Gegend hat ein starkes Gefälle nach der Küste zu, und wir müssen daher vor allen Dingen verhüten, daß der Wagen an einem Baumstamme zerschmettert, dann könnten wir auf dem Baume vielleicht Hungerqualen erdulden. Hier haben wir glücklicherweise Proviant, um uns lange Zeit vor Not zu schützen.«
»Ob die auf der Hazienda wohl geflohen sind?«
»Hoffentlich haben sie sich auf Pferde geworfen, anstatt im Hause dem Wasser zu trotzen.«
»Glauben Sie, daß ein Pferd diesem schnellfließenden Wasser entgehen kann?«
»Gewiß. Ich habe ganz andere Ueberschwemmungen erlebt und bin auch zu Pferd entkommen. Die Tiere leisten, wenn sie das drohende Wasser hinter sich wissen, ganz Unglaubliches, Eine gute Führung ist natürlich nötig, um die tieferen Löcher zu vermeiden.«
Hoffmann beobachtete das steigende Wasser. Ab und zu kam ein Kadaver vorbeigeschwommen, auch die Leiche eines Menschen war einmal darunter.
»Jetzt müßte sich der Wagen heben, und er tut es noch nicht,« murmelte er. »Wir haben keine Zeit zu verlieren, Kutscher, in's Wasser und auf der anderen Seite gehoben.«
Er machte sich bereit, hinabzuspringen, der Kutscher ebenso, und auch Snatcher legte die Decke ab.
»Du bleibst,« sagte Hoffmann.
»Das Fieber ist vorüber.«
»Aber du bist zu schwach.«
»Ich fühle mich stark genug.«
»Wohl, um den Wagen zu heben, aber nicht, um der Strömung zu widerstehen. Du bleibst, ich befehle es dir.«
Snatcher fügte sich scheinbar.
Hoffmann und der Kutscher sprangen in's Wasser — es reichte ersterem bis unter die Arme — und hoben den Wagen. Auf des Deutschen Seite war er sofort frei, nicht aber auf des Kutschers Seite.
»Er ist zu schwer,« ächzte der Mann, dem das Wasser schon bis an den Hals ging.
»Versuch' es noch einmal! ermunterte ihn Hoffmann.
»Es geht nicht.«
Hoffmann hörte ein Plätschern, er wußte sofort, daß Snatcher dem Kutscher zu Hilfe gesprungen war. Da es zum Verhindern zu spät war, so schwieg er.
Jetzt hob sich der Wagen auch auf der anderen Seite und wurde sofort von der Strömung erfaßt.
»Hinauf!« schrie Hoffmann und schwang sich auf den pfeilschnell dahinschießenden Wagen.
Ebenso schnell hatte der Kutscher festen Boden, von Snatcher aber war nichts mehr zu sehen.
Hoffmann bog sich über das Geländer des Wagens, vielleicht hielt er sich noch daran fest, zu schwach, um sich allein ins Innere zu helfen.
»Snatcher — Snatcher!«
Keine Antwort folgte. Niemand war zu sehen. Der Wagen schoß schnell davon, die Unglücksstelle war schon weit entfernt und ringsum nichts als wogende Wasserwüste, aus der kein Kopf auftauchte.
Bis zum Tode erschrocken blickte Hoffmann den stumpfsinnigen Kutscher an, der nicht sonderlich erregt war.
»Er ist eben weggespült worden,« sagte er achselzuckend.
»War er immer bei dir?«
»Bis zuletzt, da ich mich in den Wagen schwang. Die Strömung war ihm zu stark.«
»Konntest du ihn denn nicht halten, als du sahest, daß ihn die Kraft verließ?« schrie Hoffmann außer sich.
»Ich habe ihn ja gar nicht beachtet.«
Hoffmann hätte am liebsten den Kutscher dem Verunglückten nachgeschleudert, doch er bezwang sich. Rettung war nicht möglich, selbst wenn Snatcher in weiter Ferne treiben gesehen worden wäre. Der Wagen folgte steuerlos der Strömung.
»Armer Snatcher,« murmelte Hoffmann, »so nahe deinem längst ersehnten Ziel, hast du es doch nicht erreicht. Doch vielleicht ist es besser so. Seine Familie hat nie einen Vater gehabt, sie wird ihn nicht vermissen, wenn ich für sie sorge. Aber derjenige, der Schuld an seinem Unglück ist, soll seiner Strafe nicht entgehen, wenn nicht ein Mächtigerer, denn ich schwacher Mensch, seine Rache bestimmt hat.«
Der Wagen nahm eine andere Richtung an, als Hoffmann vorhin gedacht hatte. Er wurde nicht dem Walde zugetrieben, sondern schwamm den Waldsaum entlang, und dies war für ihn sehr günstig, so kam er nicht in Gefahr, an einem Baumstamme zerschmettert zu werden.
Während er dahintrieb, machte sich Hoffmann daran, die Deichsel abzunehmen, um aus ihr eine Art Ruder herzustellen. Der Kutscher sollte ihm dabei helfen, aber dieser war so apathisch, daß es erst eines energischen Auftretens Hoffmanns bedurfte, ehe er es für gut befand, hilfreiche Hand anzulegen.

Der Wald trat jetzt mehr hervor, so daß der Wagen vom Wasser, welches schon die Gipfel der niedrigen Bäume berührte, zwischen diese getrieben wurde. Mit Hilfe des improvisierten Ruders war es Hoffmann ein leichtes, dieselben zu vermeiden, denn er wollte noch nicht, daß sein Fahrzeug hängen bliebe.
Das Wasser schien jetzt seinen höchsten Standpunkt erreicht zu haben; es stieg nicht mehr, fiel aber auch nicht. Wenn letzteres eintrat, dann erst wollte Hoffmann den Wagen an einem Baum befestigen, denn dann mußte sich das Wasser wegen des starken Gefälles der Prärie nach Süden hinunter bald verlaufen haben.
Stunde auf Stunde verging. Immer trieb der Wagen zwischen den Wipfeln der Bäume dahin. Manchen Stoß erhielt er von versteckten Aesten, oft auch blieb er sitzen und dann hatte Hoffmann stets die größte Mühe, den schnell um sich drehenden Wagen frei zu bekommen.
Er hatte deswegen nicht Zeit, die Umgegend zu mustern, weil er seine ganze Aufmerksamkeit der Lenkung des Fahrzeuges zuwenden mußte, der Kutscher tat dies so eifrig, als ob er das Nahen eines rettenden Kahnes erwarte.
Einmal berührte er Hoffmanns Arm, als dieser gerade mit der Ruderstange arbeitete.
»Herr, die Prärie brennt,« sagte er schüchtern.
»Unsinn, wo denn?«
»Dort.«
Hoffmann blickte auf und sah in der angegebenen Richtung wirklich einen blutigroten Schein zwischen den Bäumen.
»Wahrhaftig, dort brennt es, die Prärie aber jedenfalls nicht. Es mag ein Haus sein; der untere Teil muß schon unter Wasser stehen, und nur der obere brennt noch. Es sei denn, es steht auf einem Hügel. Wir hätten den Feuerschein schon eher sehen müssen, wenn wir aufgepaßt hätten.«
»Merkwürdig, mitten auf der überschwemmten Prärie ein brennendes Haus.«
»Merkwürdig? Sagt lieber schrecklich! Wehe denen, die vom Feuer im Schlafe überrascht wurden und, ins Freie eilend, dem nassen Element in die Arme liefen.«
Hoffmann hatte den Wagen wieder frei bekommen.
»Stecke die ausgegangene Lampe wieder an!« sagte er zu dem untätigen Kutscher.
»Wozu?«
»Es möchten Menschen umhertreiben, die wir auf den Wagen retten könnten.«
»So laßt sie ersaufen! Ich bin nicht gesonnen, den Wagen so mit Menschen zu überladen, daß er sinkt. Jeder ist sich selbst der Nächste.«
Plötzlich stand Hoffmann mit blitzenden Augen vor dem Erschrockenen.
»Gehorche!« donnerte er ihn an.
»Es ist kein Oel mehr drin,« war die kleinlaute Antwort.
»Du hast welches mit, hast du selbst gesagt.«
»Aber so nehmt doch Vernunft an, wir können doch nicht jeden Schwimmenden aufnehmen!«
»Wenn du innerhalb fünf Minuten die Lampe nicht in Ordnung gebracht hast, fliegst du ins Wasser,« rief Hoffmann drohend.
Der Kutscher wagte nicht, nochmals zu widersprechen. Bald leuchtete vom Bock des Wagens die letzte Lampe in die dunkle Nacht hinaus. Mitternacht mochte nicht mehr fern sein.
Zwar fiel das Wasser noch nicht, aber die Strömung war schon sehr schwach. Welch ungeheuren Schaden mochte die Ueberschwemmung angerichtet haben!
Jetzt trieb der Wagen in einer Gegend, von welcher aus sie die Ursache des Flammenscheines sehen konnten. Das Feuer war im Verglimmen; ab und zu zuckte noch eine Flamme in der Ferne zum Himmel auf.
»Was für ein Haus mag das gewesen sein, hier mitten in der Prärie?« murmelte Hoffmann.
»Jedenfalls ein Holzhaus.«
»Diese Bemerkung war sehr dumm, denn ein Steinhaus kann nicht brennen, dennoch glaube ich nicht, daß es ein Holzhaus gewesen ist. Selbst eine starke Blockhütte und wäre sie noch so klein, müßte vom Wasser fortgespült worden sein. Dieses Gebäude aber muß eine ziemliche Höhe gehabt haben.«
»Halt, vielleicht kann ich Euch eine Erklärung geben. Obgleich ich hier nicht eben zu Hause bin —«
»Was du mir aber gesagt hast, Halunke.«
»Nun ja, was tut man nicht alles wegen des Geldes?«
»Was wolltest du also sagen?«
»Ich habe erzählen hören, daß hier ein großes, steinernes Gebäude stehen soll, das heißt eigentlich kein Gebäude, sondern nur ein viereckiger Steinkasten, ohne Fenster und ohne Türen.«
»Wahrscheinlich ein Grab der alten Azteken.«
»Richtig, so was Aehnliches habe ich sagen hören. Auf diesem Steinbau nun haben pfiffige Menschen eine Blockhütte errichtet, in welcher sie schlafen können, ohne Angst haben zu müssen, von den Schakalen gefressen zu werden.«
»Ist der Steinbau hoch?«
»Ziemlich hoch, aber die Ueberschwemmung hätte ihn doch erreicht.«
»Und breit?«
»O je, die kleine Blockhütte hat eben Platz darauf.«
»Dann ist es der Begräbnisplatz eines Aztekenhäuptlings. Führen Stufen hinauf?«
»Nein, eine einfache Leiter.«
Man verlor das Feuer jetzt außer Sicht; vielleicht war es im Wasser verlöscht.
»Du meinst, daß dieses Haus hier steht?«
»Diese Gegend mag es ungefähr sein.«
»Dann wird auch wahrscheinlich das Blockhaus auf dem Gemäuer gebrannt haben, denn steinerne Häuser mit hölzernem Dachstuhl stehen hier nicht so einsam in der Prärie, man findet sie höchstens auf Plantagen.«
»Hier gibt es nur zwei Plantagen, die von Flexan und die von Rickert. Es muß also schon das Grabgebäude sein, wie Ihr sagt —«
Der Mann wollte in seinen Vermutungen noch fortfahren, aber Hoffmann unterbrach ihn. Schnell zog er die Ruderstange in den Wagen, legte die Hand ans Ohr und lauschte angestrengt in die Nacht hinaus.
»Klang das nicht wie ein Ruf?«
»Der Wind pfeift in den Bäumen.«
»Nein — da, nochmals.«
Jetzt vernahm auch der Kutscher das Rufen, es klang noch weit, weit entfernt, zu sehen war nichts.
»Das ist eine Weiberstimme!« schrie er. »Was aber ruft sie? Das ist kein Hilferuf.«
»Es ist der Ruf des Seemanns, wenn er das rettende Boot sieht,« entgegnete Hoffmann aufgeregt. »Halte den Wagen an den Zweigen des nächsten Baumes fest.«
Der Mann gehorchte, Hoffmann selbst band die Lampe an die Wagendeichsel fest und richtete diese hoch.
Wieder erscholl jener Ruf, mit welchem die Matrosen das Heulen des Sturmes zu übertönen suchen, tief einsetzend, dann immer höher schwellend, bis er mit einem gellenden Ton abreißt. Jetzt erklang es schon viel näher. Ja, es mußte ein Weib sein, ein Mann hätte nicht so hoch, ein Kind nicht so laut rufen können, und Hoffmann wußte auch, daß die Ruferin absichtlich das Schiffersignal benutzte.
Da sahen sie im Mondschein in der Ferne einen dunklen Gegenstand geschwommen kommen, fast wie ein Mastbaum aussehend, wahrscheinlich ein Balken; auf demselben lag ein dunkler Gegenstand, und auf dem hintersten Ende saß rittlings eine Gestalt, den Balken rudernd und lenkend.
»Sie treiben vorbei, und wir können den schweren Wagen nicht dirigieren,« sagte Hoffmann angsterfüllt.
Aber der Balken sollte nicht vorbeitreiben.
Noch einmal erklang lang ausholend der Schifferruf; nur die hinterste Person konnte ihn ausstoßen, denn sie schwang dabei den Arm. Sie also war das Weib, welches den Balken durch die Strömung lenkte, und allem Anschein nach lag darauf eine andere Person bewegungslos. Dann rief die Frauenstimme klar und deutlich.
»Was für ein Licht ist das?«
»Johanna!« schrie Hoffmann auf.
»Nicht Johanna!« tönte es zurück, dann glitt die Gestalt ins Wasser, drehte den Balken und stieß ihn vor sich her, direkt auf den Wagen zu.
Zu den vielen Opfern, welche der furchtbaren Ueberschwemmung nicht entgehen sollten, schien auch jener Reiter zu gehören, der mit Todesangst in den Zügen sein Roß in dem bereits zwei Fuß hoch stehenden Wasser zum schnellsten Laufe antreiben wollte.
Wohl setzte das edle Tier seine ganze Kraft daran, die größte Schnelligkeit zu erreichen, der Reiter hatte es nicht mit Sporen und Peitsche erbarmungslos zu bearbeiten brauchen, aus eigenem Instinkt schon tat es sein möglichstes, doch alles war umsonst.
Vor den Augen des Reiters dehnte sich die unübersehbare Wasserfläche aus. Wenn sie auch nur erst zwei Fuß hoch war, immer mehr kam einhergerollt, und da das Pferd mit ihm nicht mehr gleichen Schritt halten konnte, so stieg es von Minute zu Minute höher an seinen Beinen hinauf.
Schon nach einer halben Stunde befeuchtete das Element die Füße des Reiters, bald mußte das Pferd schwimmen.
»Verfluchtes Geld,« knirschte der Reiter, aber mit zitternden Lippen. »Daß ich mich Narr habe von ihm verführen lassen, nicht sofort mit den übrigen zu fliehen. Die sind nun in Sicherheit, denn die Pferde entkommen dem Wasser doch, wenn sie guten Boden unter den Hufen haben, mit mir aber scheint es dem Ende entgegenzugehen.«
Sein Pferd begann zu schwimmen. Aengstlich spähte es in die vom Mond erhellte Nacht hinaus, es öffnete die Nüstern, als suche es trockenes Land zu wittern.
»Hei, wie die Halunken in dem Hause nach meinem Pferde griffen,« fuhr der Reiter fort, »als ich plötzlich durch die Hintertür an ihnen vorbeisauste. Sie hatten keine Ahnung, daß ich das beste Pferd versteckt hielt. Ich habe ihnen mit dem Revolver zu verstehen gegeben, daß dieses Pferd mir gehört. Aber was hat es mir genützt? Viel besser wäre es gewesen, ich hätte mein Heil ebenfalls im Hause gesucht. Schlimmer als hier konnte es mir dort auch nicht gehen. Doch nur nicht verzagt, Flexan, noch hast du ein Pferd unter dir und lebst. Im schlimmsten Falle rettest du dich auf einen Baum des Waldes, den du bald erreichst, schnürst den Gürtel eng um den knurrenden Magen und wartest das Ende der Ueberschwemmung geduldig ab. Nach der Hazienda zurückzukehren, fällt mir dann natürlich nicht ein, ich habe genug Geld bei mir, auch Schecks, daß ich nicht mehr von dieser verdammten Ellen abhängig bin. Hm, wäre mir nur Eduard nicht mit seiner unverschämten Forderung dazwischengekommen.«
Jetzt geriet er in die stärkste Strömung. Wie ein Kork wurde das Pferd emporgehoben und fortgerissen.
»Vorbei,« stöhnte James Flexan, »das Pferd dient mir nur noch als Schwimmunterlage. Ich werde es bei der ersten Gelegenheit verlassen.«
Lange brauchte er auch nicht darauf zu warten; der Strom war so stark, daß er ihn blitzschnell davontrug. Den Wald, den er eben noch in weiter Entfernung erblickt, hatte er in wenigen Minuten erreicht.
Der erste Baum stand etwas abseits im Walde, eine hohe, knorrige Eiche mit dicken Aesten, und auf diese wurde das Pferd gerade zugetrieben. Ehe sich's Flexan versah, befand er sich unter den grünen Zweigen. Schnell griff er nach einem Aste über sich, hielt sich mit beiden Armen daran fest, und das Pferd trieb unter ihm hinweg.
Doch ein neues Unheil drohte ihm.
Sein um den Leib geschlungener Lasso, der treue Begleiter des Cow-boys, wie des Hazienderos selbst, hatte sich am Sattelknopf gefangen, die Lederschnur spannte sich und das weitertreibende Pferd drohte den in der Luft schwebenden Mann wieder herabzureißen.
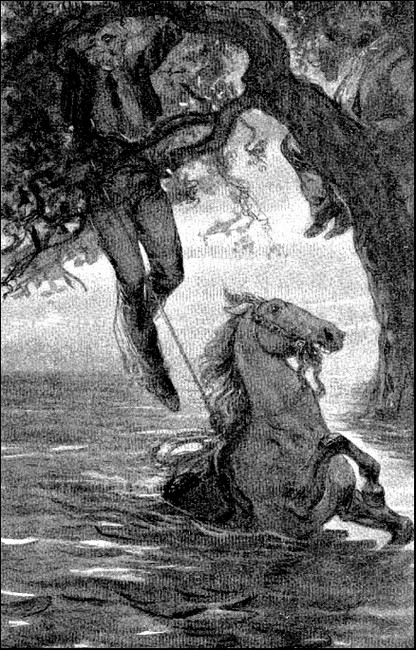
Der Lasso spannte sich, und das Pferd drohte den
in der Luft schwebenden Mann wieder herabzureißen.
Flexan verlor die Besinnung nicht. Schneller als der Blitz ließ er einen Arm los, riß das Messer aus dem Gürtel, durchschnitt den Lasso und griff hastig wieder nach dem Ast, wobei er allerdings sein Messer fallen lassen mußte.
In einem Augenblick war alles geschehen.
Das Pferd wendete noch einmal den Kopf, schaute den Reiter, der es so treulos verließ, traurig an, versuchte umzukehren, drehte sich aber mit dem Strudel und verschwand für immer in der Nacht.
Flexan schwang sich gewandt auf den Ast.
»Gerettet!« jubelte er nach der überstandenen Todesangst freudig auf.
»Aber auf wie lange?« ertönte neben ihm eine Stimme.
Jetzt erst bemerkte Flexan, daß er nicht der einzige war, der auf diesem Baume Zuflucht vor dem nassen Elemente gefunden hatte. Auf demselben Aste, wo er saß, hockte ein anderer Mann, lehnte den Rücken gegen den Stamm und hielt sich mit den Händen an einem Ast fest.
Im ersten Augenblick war Flexan unangenehm überrascht, ja, erschrocken, sein erster Gedanke war, daß sich gewöhnlich ein Kampf um Leben und Tod entspinnt, wenn zwei Menschen in Todesgefahr nach ein und demselben Rettungsmittel greifen, sein zweiter Gedanke galt dem verloren gegangenen Messer. Dann aber besann er sich. Der Baum konnte ja beide zugleich tragen, und er freute sich sogar ungemein, einen Leidensgenossen getroffen zu haben, denn einen Gefährten im Unglück zu besitzen, ist wirklich ein sehr großer Trost.
Vor allen Dingen kam es Flexan darauf an, zu erfahren, wer dieser Mann war. Nicht Neugierde, sondern sein böses Gewissen trieb ihn an.
Leider stand der Mond gerade hinter den dichten Zweigen des Baumes, so daß hier vollkommene Dunkelheit herrschte. Flexans scharfe Augen konnten nur die zusammengekrümmte Gestalt bemerken, aber nicht einmal den Kopf, viel weniger die Züge unterscheiden. Auch vernahm er ein deutliches Zähneklappern, der Mann mußte sehr frieren.
Flexan rückte auf dem Aste vorwärts.
»Wer seid Ihr, Fremder?«
»Ein Unglücklicher,« erklang die Antwort, wieder von Zähneklappern begleitet.
»Ihr könnt von Glück sagen, daß Ihr dem nassen Tode entgangen seid.«
»Ich wollte, ich hatte ihn gefunden.«
»Dazu ist es noch immer Zeit,« lachte Flexan. »Ihr braucht Euch ja nur fallen lassen.«
»Ich darf nicht sterben.«
»Hm, sonderbarer Widerspruch. Ihr wünscht Euch den Tod und wollt nicht sterben.«
»So ist es.«
»Warum?«
»Ich darf nicht eher sterben, als bis meine Rache gekühlt ist.«
»Ach so! Das ist freilich ein Grund, welcher den Menschen oft hindert, freiwillig in den Tod zu gehen, und ihm das zähe Leben einer Katze verleiht. Was habt Ihr zu rächen?«
Der Unbekannte schwieg beharrlich, er wollte also keine Antwort geben. Nur sein Zähneklappern war hörbar.
»Seid Ihr krank?«
»Ich habe Fieber.«
»Schlimme Geschichte das, mit Fieber auf einem Baumast zu sitzen, während unten Wasser ist. Seid Ihr auch zu Pferde von der Überschwemmung überrascht worden?«
»Nein, ich war in einem Wagen.«
»Allein?«
»Ich befand mich bei meinem Herrn.«
»Er ist ertrunken? War der Wagen so leicht, daß er Euch beide nicht trug?«
»Der Wagen stak, nachdem die beiden Pferde in eine Wassergrube gestürzt und ersoffen, so fest im Schlamm, daß ihn das Wasser nicht hob. Mein Herr, der Kutscher und ich sprangen ins Wasser, um nachzuhelfen, und bei diesem Versuche bin ich von der Strömung fortgerissen worden, bis ich mich auf diesen Baum retten konnte.«
»Da habt Ihr freilich Pech gehabt. Verzeiht, Fremder, wenn ich so neugierig frage, doch in dieser Situation brauchen wir keine Rücksichten zu nehmen. Wohin wollte Euer Herr eigentlich, und warum war er nicht beritten?«
»Weil ich mich zu schwach fühlte, um ein Pferd besteigen zu können.«
»Hm, sehr rücksichtsvoll von Eurem Herrn. Und wohin wollte er?«
»Nach der Hazienda der Miß Petersen.«
Flexan horchte hoch auf. Da kam ihm der Gedanke, daß dieser Mann zu jenem Herrn gehören mochte, den seine Gäste heute abend erwartet hatten. Der Diener war nicht gerade red- und vertrauensselig, aber offen. Er wollte ihn aushorchen.
»Ah, also nach der Hazienda der Miß Petersen? Gewiß zum Besuch?«
»Ja.«
»Ich kenne diese Hazienda sehr gut.«
»So, seid Ihr dort bekannt?« fragte der Unbekannte, der kein anderer als Snatcher war, lebhaft.
»Natürlich bin ich dort bekannt,« lachte Flexan, der Grund hatte, sich nicht zu erkennen zu geben, »ich bin lange Jahre dort Inspektor gewesen.«
»Ah, seid Ihr es noch?«
»Gewiß, das heißt, wenn die Überschwemmung von der Hazienda noch etwas übriggelassen hat.«
»So schnell ist der Ackerboden nicht zu vernichten.«
»Kennt Ihr die Hazienda?«
»Nein, ich bin nur mit den hiesigen Bodenverhältnissen bekannt, war früher auch Farmer, wenn auch nicht selbständig. Doch sagt, Sir, ist der Stiefvater von Miß Petersen nicht Mister Flexan?«
Diese Frage war an und für sich harmlos, Flexan hätte nicht zu erschrecken brauchen, aber sie wurde mit einer so eigentümlichen Spannung gestellt, sie klang fast ängstlich, so daß Flexan Argwohn schöpfte und, von einer bösen Ahnung erfaßt, beschloß, auf seiner Hut zu sein.
»Richtig, James Flexan heißt er.«
»James Flexan,« murmelte Snatcher zähneklappernd und fuhr dann fort: »Kennt Ihr ihn persönlich?«
»Wie sollte ich nicht? Mein Beruf brachte mich ja täglich mit ihm zusammen.«
Was will dieser Mann, dachte Flexan dabei, und mit einem Male flüsterte ihm sein böses Gewissen zu, daß derselbe ihn suche. Er sprach vorhin von Rache, und er, Flexan, war derjenige, den die Rache treffen sollte.
»Wie sieht er aus?« forschte Snatcher weiter.
»Er sieht noch sehr jugendlich aus, hat, obgleich er alt ist, noch schwarzes Haar, schwarzen Bart und frische Züge.«
»Gerade wie damals,« flüsterte Snatcher.
»Kennt Ihr ihn?«
»Wehe mir, daß ich ihn kennen gelernt habe, er war ein Teufel in Menschengestalt.«
Flexan zuckte zusammen. Wer konnte dieser Unbekannte sein? Das Herz schlug ihm zum Zerspringen. Leise griff er nach dem Revolver, doch dieser nutzte ihm nichts, mit den sechs Kugeln hatte er sechs Menschen über den Haufen geschossen, die nach seinem fliehenden Pferde gegriffen, und sein Dolchmesser hatte er verloren.
»Was habt Ihr gegen Flexan?«
»Nichts,« hauchte Snatcher.
»Macht mir doch nichts weiß; er ist der Mann, den Eure Rache treffen soll.«
Lange ließ die Antwort auf sich warten, des Fiebernden Zähne klapperten entsetzlich, dann erklang es so schwach, daß sich Flexan vorneigen mußte, um verstehen zu können:
»Ihr seid ein Freund von Flexan?«
»Ich? Um Gottes willen, ich bin sein ärgster Feind,« rief Flexan grimmig.
»Warum?«
»Er hat mir das Schlimmste zugefügt, was mir ein Mensch tun konnte, er hat mir mein Lebensglück geraubt.«
»Ja, er ist eben ein Teufel. Was hat er Euch getan, daß Ihr ihn hassen müßt?«
»Ich besaß eine schöne Tochter, ein unschuldiges Kind; er hat sie mit den teuflischsten Künsten sich zu eigen gemacht und dann die Schuld einem Neger zugeschoben. Die Tochter starb, ohne ein Wort gesprochen zu haben, der Neger wurde sofort gelyncht, ich aber weiß, daß er unschuldig gebüßt hat, Flexan war der Schuldige, doch die Beweise fehlen mir.«
Snatcher glaubte die kecke Lüge.
»So haßt Ihr ihn?«
»Wie den Satan selbst.«
»So will ich Euch etwas sagen, was Euren Haß vermehren soll, ich will Euch Mittel an die Hand geben, Eure Rache zu befriedigen. Ihr sollt als Kläger gegen Flexan auftreten, wenn das Wasser ihn verschont, meine Freunde aber vernichten sollte.«
»Sprecht! Einen größeren Dienst könnt Ihr mir gar nicht erweisen.«
»Ich sterbe!« fuhr Snatcher mit schwacher Stimme fort. »Ich fühle, wie der Tod langsam heranzieht. Darum will ich Euch mein Geheimnis preisgeben. Ich habe zwar Freunde, welche mich rächen und Flexan als Mörder entlarven wollen, aber es könnte auch sein, daß sie alle dem Wasser zum Opfer gefallen sind.«
»Ihr habt Freunde, welche um Euer Geheimnis wissen, und die Euch unterstützen wollen?«
»Sie waren auf Miß Petersens Farm anwesend, als die Ueberschwemmung eintrat, es sind die Damen der ›Vesta‹ und die Herren des ›Amor‹.«
»Ah!«
»Und auch jener Herr, Mister Hoffmann, welcher mich für seinen Diener ausgab, befand sich auf dem Wege dorthin. Nach seinem Eintreffen sollte Flexan festgenommen werden, ich sollte ihn als den Mörder bezeichnen, denn ich bin es, welcher viele Jahre lang unschuldig für Flexan gebüßt hat.«
»Flexan ist ein Mörder, und Ihr seid für ihn bestraft worden, sagt Ihr?« rief der Angeschuldigte, sich gut verstellend, in höchster Aufregung.
»So ist es! Ich fühle meinen Tod kommen, deshalb will ich Euch alles erzählen, damit ich einen Menschen weiß, welcher die Mittel in der Hand hat, Flexan, dieses Ungeheuer, zu entlarven und für die Wiederherstellung meines guten Namens zu sorgen.«
»Ich will tun, was in meinen Kräften steht, verlaßt Euch darauf,« versicherte Flexan mit fester Stimme und versuchte dabei, die Dunkelheit zu durchdringen, um die Züge des Unbekannten zu erforschen. Doch es gelang ihm nicht. Aus dessen Andeutungen wußte er noch nicht, wen er vor sich hatte, denn mehr als ein Mord belastete sein Gewissen, und gar mancher schmachtete für ihn im Zuchthause oder hatte auch für ihn am Galgen geendet. Solch ein Opfer hatte er hier vor sich.
Flexans Züge waren verzerrt. Die Finger umklammerten krampfhaft den ungeladenen Revolver in der Tasche — in der nächsten Minuten mußte er wissen, wer dieser Mann war.
»Ich bin hier geboren, in Louisiana,« begann Snatcher mit schwacher Stimme, als ob er schon im Sterben liege, »wanderte aber schon frühzeitig nach Australien aus, ließ mich in Sydney nieder und fuhr, nachdem ich mich verheiratet hatte, auf einem Küstenschiff, weil ich so mehr als auf dem Lande verdienen konnte.«
»Faßt Euch kürzer, Fremder, ich sehe, es geht mit Euch zu Ende,« drängte Flexan. »Wie heißt Ihr und der, gegen den Ihr als Kläger auftreten wollt, und was hat er an Euch verbrochen?«
»Ihr habt recht, ich muß schneller sprechen, sonst erfahrt Ihr gar nichts. Mein Name ist Snatcher, der, für den ich als Mörder gegolten habe, ist eben James Flexan, früher aber hieß er ...«
Ein sonderbarer Anblick veranlaßte Snatcher, für einen Moment abzubrechen. Der Vollmond war nicht stehen geblieben, er hatte seinen ihm vorgeschriebenen Weg verfolgt und blickte nun eben durch eine Lücke des dichten Gezweiges neugierig auf die beiden Männer, welche da auf einem Ast nebeneinander hockten und sich unterhielten.
Seine bleichen Strahlen beleuchteten scharf das Antlitz Flexans. Snatcher sah verzerrte Züge unter schneeweißem Haar, glühende Augen, wie die eines Raubtieres, drohend auf die gebrochene Gestalt des Unglücksgenossen gerichtet, und ein heiserer Ruf gellte von Snatchers Lippen:
»Jonathan Hemmings, jetzt habe ich dich!«
Verschwunden waren plötzlich Fieber und Schwäche. Der Anblick desjenigen, der ihn und seine Familie ins Unglück gestürzt, der seinen Namen geschändet, gab ihm für eine Minute seine alte Kraft zurück. Wie ein Panther stürzte er mit einem Sprunge auf ihn zu und krallte die Finger um den Hals des Hazienderos.
»Mörder, Mörder!« kreischte er wild auf. »Du hast Nikkerson ermordet, und ich habe für dich achtzehn lange Jahre im Steinbruch gearbeitet, hundertfacher Mörder, du verfluchte Schlange, die ich am Busen genährt, du sollst mir nicht entgehen!«
Flexan war, obgleich er schon längst wußte, wen er vor sich hatte, auf den Angriff nicht vorbereitet gewesen, er wäre bald vom Ast ins Wasser gestürzt. Um dies zu verhüten, mußte er sich mit beiden Händen anklammern, und so war er wehrlos dem würgenden Griff ausgesetzt.
Doch nur einen Augenblick dauerte dies, dann wendete sich das Blatt. Snatchers Kräfte schwanden sofort wieder, doch die Flexans wuchsen in der Todesangst.
Snatcher sollte nicht seine Absicht, im Sterben sich zu rächen, erreichen, sondern eines gewaltsamen Todes, des Todes durch Mörderhand, enden.
Flexan hatte wieder festen Sitz gefaßt, seine Hände waren frei, und sein Revolver schmetterte in das Gesicht des Würgers. Die Hände sanken schlaff herab, und jetzt legten sich Flexans Finger um den Hals des Unglücklichen.
»Snatcher,« hohnlachte der Teufel mit weißen Haaren, »hast du mich wiedererkannt? Ja, ich bin's, bin Jonathan Hemmings, bin's, der Nikkerson ermordet hat, aber mit deinem Dolchmesser, und deswegen wurdest du für den Mörder gehalten. Hahaha, habe ich meine Rolle damals nicht gut gespielt? Du Narr, elender, fahre hinab und grüße Nikkerson und die übrigen, welche durch meine Hände starben. Hinab mit dir!«
Noch ein kurzes Ringen, dann hoben Flexans kräftige Arme den Mann auf und schleuderten ihn vom Aste hinab.
Noch einmal gelang es Snatcher, den Ast mit einer Hand zu fassen, während sein Körper schon im Wasser lag, ein Schlag mit dem Revolver, die zerschmetterten Finger lösten sich, ein gellender Schrei, dann versank der Unglückliche in der gurgelnden Flut.

Flexan war auch noch zum Mörder an dem geworden, der statt seiner für einen von ihm verübten Mord gebüßt hatte.
Der Haziendero kannte keine Gewissensbisse, er wurde vielmehr von einer wilden Fröhlichkeit befallen; war er doch nun eines Anklägers entledigt. Daß noch andere lebten, die um seine Verbrechen wußten, daran dachte er jetzt nicht, er befand sich überhaupt in einer seltsamen Verfassung, seine Lustigkeit war unnatürlich, es war fast, als hätte sich das Fieber seines Opfers auf ihn übertragen.
Wild lachend rutschte er auf dem Ast nach dem Stamme zu, lehnte sich an und machte es sich so bequem wie möglich.
»So ein Tor,« lachte er heiser, »teilt mir mit, daß er Flexan sucht, weil dieser der eigentliche Mörder und er unschuldig ist, und hat den immer vor sich, an dem er sich rächen will. Hahaha, köstlich, habe noch nie so etwas erlebt!«
Immer lachend streckte er beide Beine auf dem Aste aus, der breit genug war, ihm einen Sitz zu gestatten, von dem er nicht so leicht herunterfiel, selbst, wenn er von der Müdigkeit überwältigt worden wäre.
Er konnte sich lange nicht über das Schicksal Snatchers beruhigen, immer wiederholte er dieselben Worte.
»Nein, so ein verfluchter Narr! Sucht Flexan, um sich an ihm zu rächen, und dabei sitzt dieser immer neben ihm, will ihm sogar die Geschichte erzählen, die Flexan nur zu gut kennt. Hahaha, es ist zum Totlachen.«
Dann fuhr er sich mit den Händen nach dem Kopf, der heiß wie glühendes Eisen war.
»Weiß der Teufel,« murmelte er, »ich glaube, ich bekomme auch das Fieber. Ein Wunder wäre das freilich nicht, bei dem schnellen Ritt durch das Wasser, wobei ich keine geringe Angst ausgestanden habe, denn der Tod des Ertrinkens ist der schrecklichste, den ich mir nur denken kann. Dann die aufregende Szene mit diesem dummen Narren, die hat mich auch nicht gerade beruhigt, und überhaupt ist das Klima sehr ungesund, wenn es lange geregnet hat, und durch die Überschwemmung werden die Fiebermiasmen wohl auch nicht getötet. Ach, wie mein Kopf schmerzt, noch niemals, wenn ich Fieber gehabt habe, hat es darin so gewühlt und gehämmert wie jetzt. Verdammt!«
Wieder hielt er den Kopf, er fühlte ordentlich das Klopfen der Pulse. Er mußte sich immer mehr sagen, daß er von einem Fieberanfall heimgesucht wurde.
»Nun, habe ich mit meiner starken Natur schon so manchen Anfall überstanden, so werde ich wohl auch diesen aushalten. Daß ich ins Wasser falle, davor brauche ich keine Angst zu haben, der Ast ist breit genug, selbst wenn ich einschlafen sollte. Ach, könnte ich dies doch, welche Wohltat wäre das, und dann, wenn ich aufwachte, sollte die Prärie wieder trocken sein.«
Es dauerte nicht lange, so fiel Flexan in jenen Zustand, welchen das Fieber stets mit sich bringt. Man weiß nicht, ob man wacht oder träumt, man glaubt eher, zu wachen, sucht sich aber immer einzureden, man träume nur. Dabei zaubert einem die Phantasie die grausigsten Bilder vor. Früher erlebte Szenen wiederholen sich ganz getreulich, und zwar eben diejenigen, an die zu denken man sich sonst scheut, schon längst vergessene Gestalten erscheinen und schrecken den Fiebernden.
Wer das tropische Wechselfieber durchgemacht hat, erinnert sich mit Entsetzen dieses Zustandes.
Auch Flexan träumte so deutlich, als wache und erlebe er alle seine Schandtaten nochmals. Er sagte sich zwar immer und immer wieder, er träume nur, vergebens, er erlebte das, was er verbrochen, zum zweiten Male.
Er mühte sich ab, die Zahl der von ihm getöteten Opfer zu finden, er murmelte Namen. Bald war das Resultat 6, dann wieder 20, und er konnte nicht mit sich einig werden, welche Nummer auf Snatcher fiel. So viel war daraus zu erkennen, daß er das Morden einst als Handwerk betrieben hatte.
Dann kam Nikkerson ihm in den Sinn.
Er befand sich damals in Sydney. Hungernd und obdachlos schleppte er sich durch die Straßen, dem Tode nahe. Eines Nachts fand ihn Snatcher schlafend im Rinnstein liegen. Der eben nach langer Reise zu Weib und Kind heimkehrende Matrose fühlte Mitleid mit dem Unglücklichen, er nahm ihn mit nach Hause, und er und sein Weib pflegten den Halbverhungerten, der sich Jonathan Hemmings nannte.
Der Matrose gab ihm Speise und Kleidung, er beherbergte ihn wochenlang und lief während der freien Zeit umher, um für den Hilfsbedürftigen, der sich langsam erholte, Arbeit zu finden.
Sydney war damals übervölkert, es war schwer, Arbeit zu bekommen, und Snatcher fand keine.
Sobald Hemmings gehen und stehen konnte, nahm er seinem edlen Wohltäter diese Mühe ab, er selbst ging am Tage fort, um Arbeit zu suchen, und erst der Abend brachte ihn in Snatchers Haus zurück.
Aber wie wurde Snatchers Güte vergolten?
Er war ein Freund von ausländischen Waffen. Er sammelte, kaufte oder erwarb solche durch Tausch, wo er nur konnte. Auf seiner letzten Reise hatte er von einem Schiffskameraden ein arabisches Dolchmesser erstanden, dessen Klinge mit Gravierungen und dessen Griff mit eingelegten Gold- und Silberplatten geschmückt war.
Er hatte viel dafür bezahlen müssen, aber er war doch überglücklich, Besitzer dieser wertvollen Waffe zu sein. Er zeigte sie jedem und prahlte mit ihr. Sein Glück wuchs, als ein Waffenkenner in Sydney behauptete, das Messer stamme aus den Zeiten der Osmanen. Er bot Snatcher 100 Dollar dafür; doch dieser hätte, obgleich er nur wenig oder gar keine Ahnung von den arabischen Eroberern besaß, das Messer jetzt nicht für 1000 Dollar und noch mehr verkauft.
Dadurch wurde das Dolchmesser berühmt. In den Zeitungen wurde seiner Erwähnung getan, und so kam es, daß noch andere Sachverständige nach ihm fragten.
Da erlitt Snatcher eine furchtbare Niederlage.
Der erste Waffenkenner war keine Kapazität in seinem Fache gewesen, schon der zweite bewies, daß erstens die Gold- und Silberplatten nicht echt, zweitens, daß das Messer eine sehr plumpe Imitation der alten Osmanischen sei.
Ein Hunderte von Meilen zugereister Antiquitätensammler warf den Dolch beim ersten Blick sofort verächtlich zur Seite und erklärte, solcher Messer würden heutzutage unzählige hergestellt, das Stück zu einem halben Dollar. Es sei ein arabisches Schiffsmesser, weiter nichts.
Der gute Snatcher hatte neben dem Schaden — es hatte ihm zehn Dollar gekostet — noch den Spott, seine Kameraden hänselten ihn, der ›Messerheld‹ wurde in den Zeitungen lächerlich gemacht.
Das konnte Snatcher nicht vertragen, er wollte seine Ehre retten und griff zu einem nicht gerade ehrlichen, aber doch unschuldigen Mittel.
Wehe ihm, daß er, anstatt offen zu sein, zum Betrüger wurde, und obwohl der Betrug ein noch so unschuldiger war, er mußte ihn mit seinem Lebensglück büßen.
Tief, tief in der untersten Schublade der Kommode verbarg er den verhängnisvollen Dolch, und dann trat er hin vor seine ihn verspottenden Kollegen, ihnen erzählend, er habe den Dolch für zwanzig Dollar an einen alten Narren verkauft. Dabei zeigte er die blinkenden Goldstücke vor, und man hielt Snatcher für einen klugen Mann, der sich vor Schaden zu hüten wußte.
Niemand hatte eine Ahnung, daß der Dolch in der Schublade lag, mit Ausnahme Snatchers selbst, seiner Frau und — Hemmings'.
Dieser hatte gesehen, wo das Messer versteckt wurde, doch er war ja ein Gast, der seinem Wohltäter dankbar sein mußte. Er blamierte Snatcher durch seine Aussage sicher nicht.
Gleich darauf verließ Hemmings das Haus seines freundlichen Wirtes, er schloß sich einer Expedition ins Innere des Landes an, wie er sagte, und war auch wirklich bald darauf verschwunden.
Die Sache verhielt sich aber anders.
Hemmings ernährte sich professionsmäßig vom Rauben und Stehlen, wobei es ihm auf einen Mord mehr oder weniger nicht ankam. Es ging ihm schlecht, weil er von seiner Bande, mit der er arbeitete, versprengt worden war — er brauchte zu seinen Unternehmungen stets Helfer, — und hier in Sydney fand er einige alte Bekannte, man brütete neue Verbrechen aus.
Als Opfer wurde ein amerikanischer Wollhändler ausersehen, Mister Nikkerson, welcher jeden Tag in Sydney eintreffen konnte, um Wolle zu kaufen.
Es wurde gelost, wer den Raubmord an dem große Summen bei sich tragenden Mann ausüben sollte, und das Los traf Hemmings.
Nun galt es, einen Plan auszuhecken, daß er den Verdacht der Täterschaft von sich ab auf jemanden anders lenkte, so daß er selbst gar nicht in Betracht kam. Dann galt es nur eine schnelle Flucht, und der Mörder war mit der erbeuteten Summe in Sicherheit.
Hemmings war schlau, o, so schlau! Er wußte nicht nur sofort Rat, sondern konnte sogar auch noch seine Genossen mit einer kleinen Summe abspeisen.
Er hatte wunderbares Glück, das Schicksal kam seinem Plane noch zu Hilfe.
Einige Wochen schon war Hemmings aus Snatchers Hause geschieden, als letzterer eines Abends etwas angetrunken auf der Straße ging und aus Versehen einen elegant gekleideten Herrn unsanft anrempelte.
»Dummkopf, sieh dich vor,« rief Mister Nikkerson — denn dieser war es — ein etwas heftiger Charakter.
Auch Snatcher besaß damals noch junges, feuriges Blut, welches leicht in Wallung geriet. Er fühlte sich in seiner Ehre schwer gekränkt, stellte sich sofort in Boxerpositur und forderte, der Herr solle das Wort Dummkopf zurücknehmen oder einer von beiden müsse Blut lassen.
Lachend zogen ihn seine Freunde davon, und der aufgeregte Snatcher, der gerade sehr kampfeslustig, stieß gegen den Beleidiger Drohungen aus, die, so harmlos sie im Grunde genommen auch waren, doch sehr grimmig klangen.
Am anderen Morgen fiel Mister Nikkerson in einer dunklen Passage durch Mörderhand, die Geldsummen auf der Brust waren geraubt worden, und neben der Leiche lag — das arabische Dolchmesser.
Snatcher selbst gehörte zu denen, welche die Leiche zuerst fanden, und beim Anblick des wohlbekannten Messers erschrak er furchtbar, was dem Späherblick der Polizisten nicht entging.
Er wurde sofort als des Mordes verdächtig eingezogen.
Der arme, ehrliche Matrose war dem schlauen Richter gegenüber furchtbar dumm! Um sich wegen des angeblichen Verkaufs des Messers nicht zu blamieren, log er, um sich zu rechtfertigen, widersprach er und ritt sich immer tiefer ins Unglück.
Zitternd und mit käseweißem Gesicht stand der Unschuldige vor dem Richter. Es war das Spiel der Katze mit der Maus.
»Gehört dies Messer Ihnen?«
»Nein.«
»Lügt nicht! Es ist allgemein bekannt, daß dieses Messer Ihnen gehört.«
»Ich habe es verkauft.«
»An wen?«
Nach langem Besinnen nennt Snatcher einen Namen, stotternd spricht er ihn aus.
»Wie heißt der Mann?«
Jetzt klingt der Name schon anders.
»An den wollen Sie das Messer verkauft haben?«
»Ja.«
»Können Sie dies beschwören?«
»Nein,« ruft Snatcher erschrocken.
Die Zuhörer beginnen schon zu lächeln.
»Warum nicht?«
»Weil ich das Messer gar nicht verkauft habe,« ruft Snatcher, wie von einer Zentnerlast befreit.
»Also war es in Ihrem Besitz?«
»Ja.«
»Warum behaupteten Sie vorhin das Gegenteil?«
»Weil ich mich schämte.«
Nach langem Fragen wird endlich der Grund klar, warum Snatcher das Messer nicht verkauft, sondern in seiner Schublade verborgen gehalten hat.
Der Richter verkündet ihm, daß er beschuldigt ist, Mister Nikkerson ermordet und beraubt zu haben, da aber verschwindet alles Zagen und Bangen, hochaufgerichtet steht Snatcher vor dem Richter und schaut ihn mit flammenden Augen an.
»Das ist nicht wahr,« ruft er mit fester Stimme und hebt die Rechte auf, »meine Hand soll auf der Stelle verdorren, wenn sie dieses Messer mit Blut befleckt hat.«
Doch was gibt der Richter auf solche Ausrufe. Er kann sie täglich noch viel schöner hören.
Das Messer ist das seine, er hat es in der Kommode aufbewahrt und die sofortige Haussuchung hat ergeben, daß es nicht mehr dort ist.
Snatcher und seine Frau beschwören, das Messer nicht herausgenommen zu haben.
Endlose Kreuz- und Querfragen folgen, Snatcher widerspricht sich immer mehr.
»Wer war dabei, als Sie das Messer in der Kommode versteckten?«
»Nur meine Frau.«
»Sonst niemand?«
»Nein.«
»Besinnen Sie sich.«
»Es war niemand anders dabei.«
Kratzend fährt die Feder des Protokollisten über das Papier.
»Halt!« schreit da plötzlich Snatcher auf. »Jonathan Hemmings hat es noch gesehen.«
»Warum sagen Sie das jetzt erst?«
»Ich hatte nicht gleich daran gedacht.«
Snatcher muß erzählen, wie er Hemmings zu sich genommen.
»Sie kannten den Mann nicht?«
»Nein.«
»Waren niemals ein Freund von ihm?«
»Nein.«
»Und haben ihn so mir nichts, dir nichts von der Straße aufgelesen und zu sich ins Haus genommen?«
»Ja.«
»Warum?«
Ja, warum? Das konnte Snatcher auch nicht sagen.
»Ich hatte Mitleid mit ihm.«
»Hm, hm, höchst sonderbar,« brummt der Richter, und auf der Galerie hört man lachen.
Snatcher wird abgeführt, erst nach zwei Tagen steht er wieder vor dem Richter.
»Ihre Aussagen über Hemmings haben sich als richtig erwiesen. Haben Sie sonst noch etwas betreffs dieses Mannes hinzuzufügen?«
»Ich glaube, Hemmings ist der Mörder des Mister Nikkerson,« sagte Snatcher nach langem Zögern leise.
Der Richter machte ein strenges Gesicht.
»Sie sprechen da eine furchtbare Anklage aus. Da Sie es nur glauben, will ich sie lieber gar nicht beachten.«
»Nein, nein,« schrie Snatcher verzweifelt auf, »kein anderer als Hemmings ist der Mörder.«
»Beweise!«
Ja, woher wollte Snatcher Beweise nehmen? Daß Hemmings der Versteckung des Dolches beigewohnt hatte, war die einzige Ursache zur Anklage.
»Geben Sie sich keine Mühe, Hemmings zu verdächtigen,« fuhr der Richter in strengem Tone fort, »es ist schon durch Nachforschung erwiesen, daß Ihre früheren Angaben richtig waren. Bereits 14 Tage vor der blutigen Tat hat dieser Hemmings mit einer Karawane Sydney verlassen. Das angegebene Signalement und der Name stimmen, Hemmings war nicht hier, sondern tief in den Steppen Australiens.«
»Er kann aber zurückgekehrt sein.«
»Niemand ist von dieser Karawane zurückgekehrt oder wird je zurückkehren,« sagte der Richter feierlich, »die Expedition ist bis auf den letzten Mann umgekommen, verschmachtet oder unter den Keulen der Eingeborenen gefallen.«
»Dann suche man nach den Leichen! Dem Hemmings fehlte der kleine Finger an der linken Hand, daran ist seine Leiche sofort zu erkennen.«
Einige der Zuhörer lächelten mitleidig.
Verräterische, eingeborene Führer hatten die mitgenommenen Wassersäcke der Reisenden aufgeschnitten; was nicht verdurstet war, das hatten die Keulen der Schwarzen niedergeschmettert. Wo lagen jetzt wohl ihre Leichen? Außerdem fraßen die verhungerten Dingos, die wilden Hunde Australiens, auch Knochen, die etwa gefundenen Skelette waren also verstümmelt.
Dies teilte der Richter dem Angeklagten mit kurzen Worten mit, Snatcher konnte nichts darauf erwidern.
Dennoch mußte noch einmal Nachforschung geholten werden, doch die Anfragen blieben erfolglos. Jonathan Hemmings konnte trotz der genauesten Angaben nicht gefunden werden, und so wurde denn bestimmt angenommen, daß er bei der Expedition mit zugrunde gegangen sei.
Snatcher riß sich durch sein tölpelhaftes, besser gesagt, unerfahrenes Benehmen immer mehr hinein, aber unter den Richtern befanden sich auch Leute, welche begriffen, daß man ohne einen anderen Grund, als bloß aus reiner Herzensgüte einen armen Menschen von der Straße auflesen und in sein Haus nehmen konnte; diese Braven taten ihr möglichstes, Snatcher zu retten. Gelang es ihnen auch nicht völlig, so konnten sie doch wenigstens die schon verhängte Todesstrafe umändern.
Ein Jahr lang saß Snatcher in Untersuchung, dann wurde über ihn das Urteil gefällt:
»25 Jahre Zwangsarbeit im Steinbruch zu Hughenden.«
In diesem Steinbruch kam Snatcher zu der festen Ueberzeugung, daß Hemmings und kein andrer der Mörder des Mister Nikkerson war, er hörte in der leise gefühlten Unterhaltung der Sträflinge öfters den Namen Jonathan Hemmings, erkundigte sich und erfuhr, daß dieser Mann ein ganz gefährlicher Verbrecher sei, der schon zahllose Raubmorde auf dem Gewissen habe.
Snatcher versuchte nochmals, seine Stimme geltend zu machen, er wollte die Untersuchung von neuem eingeleitet wissen — vergebens! Niemand hörte auf den Sträfling. Man bedeutete ihm vielmehr, daß er in Eisen gelegt würde, wenn er verriete, mit den Sträflingen gesprochen zu haben.
Allerdings war sein Notschrei nicht ungehört verhallt. Man versuchte nochmals, Jonathan Hemmings ausfindig zu machen, aber es gelang nicht.
Ueberdies war Nikkerson ein reicher und angesehener Amerikaner. Sein Tod forderte Sühne, und so mußte eben Snatcher, einmal gefangen, zum Opfer dienen. Er war ja nur ein einfacher Matrose, was war da viel Geschrei zu machen! Noch ganz andere hatten auf einen bloßen Verdacht hin unschuldig gebüßt.
Snatcher erfuhr aber von einem Kameraden, daß Hemmings unter dem Namen James Flexan noch lebe und in Amerika die Rolle eines reichen Hazienderos spiele, nachdem es ihm gelungen war, das Herz der verwitweten Mistreß Petersen zu erobern. —
»Hihihi,« kicherte Flexan auf dem Baumast, während unter ihm das Wasser floß, und murmelte, »Snatcher, Snatcher, du dummer Narr, hast dein Messer gut verborgen, was? O, ich weiß, wo es liegt. Bst, vorsichtig, leise — das Kind schläft — das Fenster steht auf — so, nun durchgestiegen — die Kommode geöffnet — da ist der Dolch — er gehört nicht mir — nein, Gott bewahre — er gehört Snatcher — man wird ihn bei der Leiche finden — Hemmings ist ja ins Innere mit der Expedition — hihihi, alles famos arrangiert.«
Der Fiebernde durchlebte noch einmal die damalige Szene.
»Verfluchter Snatcher, du glaubst, ich sei Nikkersons Mörder? Zum Teufel mit dir, Hund, ins Wasser hinein mit dir! Hei, wie das plätschert! Was, du hältst dich noch fest? Schade, daß ich mein Messer verloren habe, das schöne, arabische Messer. Puff, der Kolbenschlag genügt auch. Hei, wie er plätschert, wie er das Wasser hinunterschluckt, als wäre es Wein! Jetzt taucht er unter, fort ist er. Adieu, Snatcher. Nun, kannst du noch sagen, daß ich Nikkerson gemordet habe?«
»Du hast Nikkerson ermordet, nicht ich,« rief da eine hohle Grabesstimme.
Flexan riß die gläsernen Augen auf, er zupfte sich an der Nasenspitze, kniff sich in die Ohren, aber es half nichts, das Gespenst wich nicht. Vor ihm, zwei Meter von ihm entfernt, saß auf demselben Baumast Snatcher, das Wasser floß ihm aus den Kleidern, und er starrte ihn aus hohlen Augen an. Gerade so hatte er vorhin ausgesehen, als Flexan ihn erkannte, und der Mond beschien ihn auch jetzt.
»Unsinn,« lachte Flexan gellend, »ich träume ja nur, ich habe Fieber! Dieser Kerl da ist eine Ausgeburt meiner erregten Phantasie.«
»So wache doch auf,« ertönte die Grabesstimme zurück, »aber du kannst nicht aufwachen, denn du wachst ja schon. Ja, ja, glotze mich nur an, ich bin wirklich Snatcher.«
»Lügner, ich habe ja Snatcher mit eigenen Augen ertrinken sehen.«

»Das Wasser hat mich nicht behalten, es spie mich wieder aus, damit ich Rache nehmen kann an dem, der mich ins Elend gestürzt hat, denn du bist es, der Mister Nikkerson getötet hat.«
»Hahaha, du bist nur eine Truggestalt.«
»So, meinst du?« hohnlachte das Gespenst, griff in die Tasche und brachte einen Dolch heraus. »Kennst du noch dieses Messer? Ich habe es unten gefunden und mit heraufgebracht.«
Flexan erkannte das Messer, welches er vorhin verloren hatte.
»Und kennst du dieses?«
Das Messer verwandelte sich plötzlich in der Hand des Gespenstes, Flexan sah jetzt das arabische, dessen Griff mit Gold- und Silberplatten ausgelegt war.
»Haha, daran erkenne ich, daß ich träume! Wie könnte sich das Messer sonst verwandeln?«
»Ich bin nicht Snatcher selbst, sondern nur sein Geist und komme, mich zu rächen.«
»Du Narr, es gibt ja gar keine Geister. Ich träume nur, werde aber gleich aufwachen.«
Flexan kniff sich wieder in die Ohren, grub die Nägel ins Fleisch, bis das Blut kam, aber die Gestalt wich nicht.
»Verschwinde, Snatcher, ich bin aufgewacht!« schrie er.
»Erst wenn ich dich gemordet habe! Du glaubst nicht, daß ich der Geist von Snatcher bin?«
»Nein, es gibt keine Gespenster.«
»So will ich es dir beweisen, ich werde dich greifen und würgen.«
Die Gestalt streckte die Hand aus, eine Hand mit zerschmetterten, blutenden Fingern, wie sie Flexan mit dem Kolben des Revolvers zugerichtet hatte, streckte sie krallenartig aus und rutschte langsam auf Flexan zu.
Dieser redete sich nicht mehr ein, daß er nur träume, er schrie vor Entsetzen laut auf, seine Haare sträubten sich, und mit einem Sprunge saß er schon auf dem nächsthöheren Ast.
»Du entkommst mir nicht,« grinste unten das Gespenst. »Rache, Rache, Rache will ich haben! Du hast Nikkerson ermordet, und ich habe für dich gelitten. Mörder, Mörder, Mörder, ich greife und würge dich doch!«
Er schlang seine dürren Arme um den Baumstamm und kletterte nach oben, auf Flexan zu, und dieser retirierte abermals einen Ast höher. Das Dolchmesser kam oftmals ganz bedrohlich in seine Nähe, aber immer wich er einem Stich oder der fürchterlichen Umarmung durch einen schnellen Sprung aus.
Noch mehrmals versuchte Flexan, durch Ausrufe sich aus dem Traum zu wecken. Vergebens! Das Gespenst antwortete stets mit einem neuen Hohngelächter.
Deutlich konnte Flexan die Wassertropfen sehen, welche aus den Kleidern des Gespenstes fielen, die blutende Hand, die Züge des Gesichtes, den Dolch, und schon zweifelte er nicht mehr daran, daß er wirklich von Snatcher verfolgt wurde.
Wie ein Eichhörnchen mußte Flexan von Ast zu Ast, bald nach oben, bald nach unten springen, wollte er sich von dem Gespenst nicht fassen lassen, welches ihm zwar langsam, aber mit unermüdlicher Beharrlichkeit folgte.
»Mörder, Mörder, Mörder!« wimmerte es unaufhörlich in Flexans Ohr. »Immer fliehe, du entgehst meiner Rache doch nicht, du hast Nikkerson ermordet!«
Schrecklich, hinter sich das Gespenst, bald den Dolch zückend, bald die Krallenfinger zum würgenden Griffe ausstreckend, und unter sich die reißende Flut. Auf Flexans Stirn standen dicke Schweißtropfen, von Erschöpfung und Todesangst ausgepreßt, seine Glieder versagten fast den Dienst, und dennoch durfte er in seiner Flucht nicht einhalten.
Er dachte nicht daran, zu erwachen, er hoffte nur noch auf das Morgenrot, denn Gespenster können ja das Tageslicht nicht vertragen, dann mußte es in Nebel zerrinnen.
Endlich, endlich rötete sich der Himmel im Osten. Blutig stieg die Sonne am Horizont auf, aber das Gespenst wich nicht. Nach wie vor rutschte es seinem Opfer nach. »Mörder, Mörder, Mörder!« wimmerte es, und Flexan mußte noch immer von Ast zu Ast springen, denn unter sich erblickte er nichts als eine unübersehbare Wasserfläche, ihm ebenfalls den Tod verheißend.
Ralph hatte sich, als er trotzig von der Plantage fortgeritten, nicht nach Yorkspire begeben, um dort sein ausbezahltes Geld, 240 Dollar, in Saus und Braus zu verjubeln, sondern zur schönen Peggy, für welche er trotz seiner grauen Haare eine kleine Neigung besaß.
Seine Kameraden hatten sich daher geirrt, als sie der fragenden Ellen Yorkspire als den Ort bezeichneten, wo Ralph sein Geld durchbringen würde. Sie hatten eben keine Ahnung davon, daß Ralphs zartfühlendes Herz sich schon längst nach der schönen Peggy sehnte, überdies galt diese Sehnsucht mehr dem ausgezeichneten Whisky, als der jungen Witwe mit der breitgedrückten Nase. Aber sie besaß eine eigentümliche Art, dem Ralph auf die Schulter zu klopfen, wenn sie ihm das Glas kredenzte, das zog den alten Burschen an.
Der Ritt Ellens und Harrlingtons war vergeblich gewesen. Sie fanden den Gesuchten nicht. Dafür bekam Ellen in der nächsten Schenke von dem Wirt, der die junge, reiche Herrin mit Bücklingen empfing, etwas zu hören, das ihr sofort die Zornesröte ins Gesicht trieb.
»Wir haben Ralph vergeblich erwartet. Jammerschade, daß er nicht gekommen ist,« entgegnete der grinsende Wirt auf die erste Frage nach dem Cow-boy.
»Erwartet, wieso?«
»Nun, ganz Yorkspire ist bereit, dafür zu sorgen, daß Ralph festgenommen wird, ehe er Gebrauch von seinem Revolver machen kann.«
»Sprecht deutlicher, ich verstehe Euch nicht,« rief Ellen, obgleich ihr schon eine Ahnung aufging.
»Wißt Ihr nichts davon? Das sollte mich doch wundern,« schmunzelte der Wirt.
»Gar nichts weiß ich.«
»Daß hinter Ralph die Konstabler her sind.«
»Was?«
»Natürlich! Ihr habt doch selbst die Behörde instruiert, daß Ralph wegen Diebstahls sofort festgenommen werden soll.«
Der Wirt blickte so listig, daß anzunehmen war, er glaube selbst nicht an seine Behauptung.
»Ich hätte die Polizei benachrichtigt, daß Ralph zu verhaften sei?« rief Ellen empört.
»Nun oder doch Mister Flexan in Ihrem Namen.«
Ellen wandte sich an Harrlington.
»Was sagst du nun zu dieser neuen Gemeinheit, James? Ich gebe ihm noch deutlich zu verstehen, daß ich Ralph eines Diebstahls nicht für fähig halte, daß ich wünsche, er soll auf meiner Farm bleiben, setze mich selbst aufs Pferd, um ihn zu holen, und während ich mich umziehe, schickt Flexan schnell einen Boten nach Yorkspire, welcher die Polizei auf Ralph hetzen soll, um ihn verhaften zu lassen. Dieser elende Schurke!«
»Ellen,« mahnte Harrlington, mit einem warnenden Blick auf den Wirt.
»Ich bin der Verstellung nun überdrüssig,« entgegnete Ellen ungeduldig, »ärgere mich überhaupt schon lange, mit dem Manne, der mich Stieftochter nennt, nicht so umgesprungen zu sein, wie er es verdient. Doch nun ist es genug, ich zögere jetzt nicht mehr, laut zu sagen, daß Mister Flexan ein Schurke ersten Ranges ist, und wenn dadurch auch Mister Hoffmanns Plan zerstört würde.«
»Ellen, mäßige dich!« bat Harrlington. »Diese Heftigkeit entstellt dich, und dann bedenke, daß alles dies Ralph nicht davor rettet, verhaftet zu werden.«
Ellen brachte das tänzelnde Pferd, welches von der Aufregung seiner Herrin angesteckt worden war, zur Ruhe und sagte freundlicher:
»Da hast du recht, lieber James, wir müssen eben versuchen, Ralph zu finden, ehe die Konstabler zufassen, denn sitzt er einmal hinter Kerkermauern, dann würde es selbst mir schwer fallen, ihn sofort wieder freizubekommen, denn es sind viel Formalitäten dabei notwendig, und ein Tag im Kerker eingeschlossen, bedeutet für den freien Cow-boy ein Jahr. Ich möchte Ralph nicht dieser entsetzlichen Qual ausgesetzt wissen.«
»Wenn wir ihn aber nun treffen, und die Verhaftsbefehle sind schon erlassen?«
»Das schadet nichts weiter.«
»Du kannst sie aufheben?«
»Nicht aufheben, das heißt, nicht widerrufen, aber ungeschehen machen.«
»Das wundert mich,« rief Harrlington erstaunt. »Eine Verhaftung wird doch im Namen der Regierung ausgesprochen.«
»O, lieber James,« lachte Ellen, »wir sind in Amerika und nicht in England. Solange sich nicht die eiserne Tür hinter ihm geschlossen hat, er sich also noch in den Händen der Konstabler befindet, kann ich ihn stets freimachen. Schließlich bin ich ja auch die Bestohlene, nicht Flexan.«
»Dieser muß einen ganz besonderen Grund haben, Ralph als Dieb verhaften zu lassen,« meinte Harrlington nachdenklich, »sollte wirklich ...«
»Lassen wir das,« unterbrach ihn Ellen. »Ich habe dir schon vorhin Andeutungen gemacht, sie bestätigen sich jetzt. Nachher sprechen wir mehr davon. Wirt,« wandte sie sich an den Mann, der in unterwürfiger Haltung vor ihr stand, »wann sind die Konstabler von hier aufgebrochen, um Ralph zu suchen?«
»Vor einer Viertelstunde.«
»Erst? Dann können sie ja noch gar nicht weit sein. Wohin haben sie sich gewendet?«
»Das weiß ich nicht.«
»Wieviele waren es?«
»Drei Konstabler und ein Sergeant.«
»Wann kam der Bote hier an, welcher die Polizei auf Antrag des Mister Flexan alarmierte?«
»Vor einer halben Stunde.«
»So haben sie eine Viertelstunde gebraucht, ehe sie Yorkspire verlassen konnten?«
»Durchaus nicht, Miß. Die amerikanische Polizei ist nicht so langsam. In dieser Viertelstunde haben sie ganz Yorkspire nach dem Diebe durchsucht.«
»Ralph ist kein Dieb,« sagte Ellen streng. »Also sie fanden ihn nicht?«
»Nein.«
»Und wohin sind sie dann geritten?«
»Nach Norden.«
»Das ist sehr unbestimmt. Ihr habt keine Ahnung, wo sie Ralph zu treffen hoffen?«
»Nicht die geringste.«
»Sollten sie nicht zu jemandem gesprochen haben?«
»Weiß nicht. Vielleicht zu dem Boten, welcher das Schreiben von Mister Flexan brachte. Er ist gut Freund mit einem der Konstabler, hat auch mit ihm gesprochen, als sie in meiner Wirtsstube nach Ralph suchten.«
»Das wäre ein Anhalt. Ja, wenn wir wüßten, wo jener Bote jetzt wäre.«
»Das kann ich Ihnen sagen,« lachte der Wirt. »Harry sitzt in der Stube und läßt sich meinen Wein schmecken.«
»Warum sagt Ihr das nicht gleich?« rief Ellen halb erzürnt, halb erfreut.
»Wußte nicht, daß Ihnen so viel an dem Burschen gelegen wäre.«
»So holt ihn schnell!«
Der Wirt ging in das Haus.
»Könntest du nicht auf dem hiesigen Polizeibureau erfahren, wohin sich die Konstabler gewendet haben?« fragte Harrlington das Mädchen. »Sie müssen doch Instruktionen empfangen haben, ehe sie Yorkspire verließen.«
»Hier sieht es traurig mit dem Polizeibureau aus,« lächelte Ellen. »Der Sergeant ist der oberste Beamte, und da er selbst mitgeritten ist, so ist das Bureau geschlossen. Wir brauchen uns gar nicht erst davon zu überzeugen, ich weiß es bestimmt. Uebrigens ist es mit der Polizei in solch kleinen amerikanischen Städten eine eigentümliche Sache. Man operiert auf eigene Faust, und wird geglaubt, daß ein guter Fang zu machen ist, der sich lohnt, wie hier bei Ralph mit seinen vermeintlichen 80 000 Dollar, so ist alles hinter dem Entflohenen her. Dann liefert man in der nächsten Hauptstation per Telegraph einen Rapport ab, bringt eventuell den Gefangenen hin, und die Sache ist in Ordnung.«
Der Wirt trat mit einem bespornten Manne heraus, der die Livree eines Dieners trug. Sein Gesicht machte auf Ellen einen unangenehmen Eindruck, was durch das Schielen noch verstärkt wurde. Man wußte niemals recht, wohin der Mann eigentlich sah.
»Ihr seid der Mann, welchen Mister Flexan nach Yorkspire gesendet hat, um Ralph durch die Polizei verhaften zu lassen?« fragte ihn Ellen.
»Ich bin der Mann, den Mister Flexan nach Yorkspire an die Polizei gesendet hat, wußte aber wahrhaftig nicht, was in dem mitgegebenen Wische stand,« war die nicht weniger als höfliche Antwort.
Ellen musterte den Mann scharf, er mochte sie wohl ansehen, schielte aber dabei nach Lord Harrlington.
»Jetzt wißt Ihr aber, was Ihr ausgerichtet habt?«
»Gewiß, nun ist es mir klar geworden.«
»Seid Ihr Diener bei Mister Flexan?«
»Reitknecht.«
»Ich kenne Euch nicht.«
»Ich Euch auch nicht.«
»Bursche, seid höflicher!« sagte Ellen mit drohend gerunzelter Stirn. »Ich bin Miß Petersen, Mister Flexan ist nur mein Verwalter. Du stehst vor deiner Herrin.«
Das Gesicht des Dieners nahm sofort eine unterwürfige Miene an, die ihm nicht stand.
»Das habe ich nicht gewußt, entschuldigen Sie mich. Ich habe Sie schon auf der Plantage gesehen, gewiß, jetzt entsinne ich mich.«
»Wie lange befindet Ihr Euch auf meiner Plantage?«
»Seid einem Jahre.«
»Es ist gut. Ihr könnt nichts dafür, daß Mister Flexan gegen meinen Willen die Verhaftung Ralphs angeordnet hat, ich sehe es ein, aber Ihr seid hoffentlich willens, dieselbe zu verhüten, wenn ich es wünsche.«
»Gern, wenn ich es kann. Befehlt über mich, Miß.«
»Ihr kanntet einen der Konstabler?«
»Ja.«
»Er hat mit Euch darüber gesprochen, wohin sich der Sergeant wenden will, um Ralph zu finden?«
»Er sagte es mir.«
»Nun, wohin?«
»Der Sergeant wollte erst nach Saint Claude reiten, ich aber wußte, wohin Ralph sofort läuft, wenn er Geld hat. Er ist sicher bei der schönen Peggy,« sagte Harry mit unangenehmem Lächeln.
»Ah, weißt du das bestimmt?«
»Ganz bestimmt; er ging in letzter Zeit immer dorthin, wenn er irgendwo einen Dollar auftreiben konnte, hielt seine Wege aber sehr geheim. Ich bin ihm dort mehrmals begegnet, daher weiß ich es.«
»Das Wirtshaus, welches Ihr meint, steht in keinem guten Rufe.«
»Bei uns in sehr gutem,« grinste der Diener.
»So warst du es also, der die Konstabler auf die richtige Spur gelenkt hat?«
»Konnte ich dafür? Ich glaubte doch, nur meine Pflicht zu tun, wenn ich behilflich bin, den Dieb zu fangen. Da ich aber nun merke, daß ich eine Dummheit begangen habe, weil Sie den Ralph gar nicht fangen lassen wollen, so bin ich gern erbötig, die Sache wieder gutzumachen.«
»Wie das?«
»Der Sergeant benutzt, um zur schönen Peggy zu kommen, wo er manchmal dienstlich vorsprechen muß, die Brücke an der Hirschlecke. Kennen Sie diese?«
»Ich kenne sie.«
»Das ist ein großer Umweg, ich werde Ihnen einen anderen Weg zeigen, der Sie eine Stunde eher zur schönen Peggy bringen wird, und wenn Sie auch noch zwei Stunden hier zögern. Vier bis fünf Stunden haben Sie sowieso scharf zu reiten, es ist ein tüchtiger Weg.«
»Es ist kaum anzunehmen, daß der Sergeant diesmal die Brücke benutzt, denn es gilt, einen Fang zu machen, von welchem er Gewinn erhofft.«
»O, der Sergeant ist kein Mann, der sich zwecklos die Kleider naß macht.«
»Diesmal aber wohl.«
»Nein, denn Ralph bleibt doch so lange da kleben, wo er sich einmal befindet, bis das Geld vertan ist. Außerdem hat mir der Sergeant auch noch gesagt, daß er die Brücke ganz sicher benutzen wird. Ich sollte ihm die Nachricht bringen, falls Ralph schon wo anders festgenommen sein sollte, damit er den weiten Weg nicht umsonst macht.«
»Trotzdem taugt dein Plan nichts,« sagte Ellen und wendete schon das Pferd. »Ich kenne die Gegend hier sehr gut und reite direkt nach der Waldschenke, komme also doch eher an als die Konstabler.«
»Sie müssen dann aber durch den Schlangenbach.«
»Was macht das?«
»Das macht naß.«
»Bah, daran sind wir gewöhnt.«
»Ich kenne einen Weg, wo man ihn trocken überschreiten kann, und dieser führt ebenfalls direkt.«
»Ich danke, ich brauche Eure Hilfe nicht.«
Lord Harrlington drängte sein Pferd neben das Ellens.
»Nimm den Vorschlag des Dieners an,« bat er. »Warum sollen wir unsere Kleider durchnässen, wenn wir es vermeiden können?«
»Ich traue ihm nicht,« flüsterte Ellen ihm schnell zu.
»Ach, was haben wir von ihm zu fürchten?«
»Gut, ich will dir zuliebe nachgeben, obgleich der Himmel überhaupt aussieht, als wolle er uns bald durchnässen. Aber sagt erst,« fuhr sie, zu dem Diener gewendet, fort, »auf welchem Wege wollt Ihr uns trocken über den Schlangenbach bringen? Ich kenne in der Umgebung keine einzige Fähre.«
»Die existiert auch nicht.«
»Eine Brücke also?«
»Etwas Aehnliches.«
»Und die sollte der Sergeant nicht kennen? Das klingt sonderbar.«
»Es ist eine natürliche Brücke, von einem Baumstamm gebildet, welchen der letzte Sturm entwurzelt und gerade über den Bach geworfen hat. Er ist breit genug, daß ein Pferd mit sicherem Schritt darübergehen kann.«
» All right, so sollt Ihr uns als Führer dienen. Aber wie kommt es eigentlich, daß Ihr als Reitknecht so gut Bescheid im Walde wißt?«
»Ich bin erst seit einigen Tagen Reitknecht im Dienste des Mister Flexan.«
»So? Ich denke seit einem Jahre?«
»Früher war ich Cow-boy.«
»Wie? Seit wann gibt ein Cow-boy seinen Beruf auf und wird ein Diener?«
»Ein Pferd hat mich arg geschlagen, seitdem mag ich mit den unbändigen Tieren nichts mehr zu tun haben, ich halte nur noch schon zugerittene in Bewegung.«
»Hm, sonderbar,« murmelte Ellen, während Harry ging, um sein Pferd aus dem Stall zu holen, »das gefällt mir auch nicht an diesem Menschen.«
»Du bist ja heute ungeheuer vorsichtig,« lachte Harrlington, »das ist doch sonst gar nicht deine Art.«
»Ich weiß nicht, was mich gerade heute so vorsichtig stimmt.«
Der Bediente kam mit seinem Pferde an, er ritt eine prachtvolle Stute, die würdig gewesen wäre, einen Fürsten zu tragen.
»Ist das Euer Dienstpferd?« fragte Ellen.
»Nein, es gehört Miß Kenworth, und da sie fast gar nicht reitet, muß ich es tun.«
Die beiden sprengten davon, der Diener voraus, dessen Stute sofort verriet, daß sie den Pferden der Nachfolgenden an Schnelligkeit überlegen war.
»Mich wundert, daß Flexan dieses wertvolle Tier an eine Gouvernante verschenkt hat,« meinte Harrlington, als ein Sprung der vorausgaloppierenden Stute über einen Graben von neuem seine Bewunderung erregte.
Ellen lächelte still vor sich hin.
»Nun, weißt du eine Erklärung dafür?«
»Allerdings. Flexan verfolgte die immer noch ganz hübsche Miß Kenworth mit seinen Liebesanträgen, und da kam es ihm nicht darauf an, als er kein Gehör fand, ihr die Stute zum Präsent zu machen. Daß aber dieser ehemalige Cow-boy sie jetzt reitet, während er einen dienstlichen Weg zu machen hat, hat einen ganz anderen Grund.«
»Schon wieder eine Besorgnis?«
»Diesmal nicht. Harry sollte uns bis Yorkspire einen bedeutenden Vorsprung abgewinnen, deshalb gab ihm Flexan das beste Pferd. Wie hätte er sonst eine halbe Stunde früher eintreffen können als wir, obwohl wir doch immer in Karriere gejagt sind! Ich bin übrigens fest überzeugt, daß er mit Flexan im Bunde steht.«
»Wie kommst du darauf?«
»Er will offenbar verhindern, daß die Verhaftung Ralphs durch uns möglich gemacht wird.«
»Du meinst, er sollte uns irreführen?«
»Das kann er nicht, ich bin hier zu Hause.«
»Oder er weiß dann, daß Ralph nicht bei Peggy ist?«
»Das wäre eher möglich, da er uns aber selbst begleitet, so würde er sich bei seiner Lüge sehr bald fangen. Denn bei Peggy müßten wir dann ja auch die Konstabler treffen. Uebrigens glaube ich selbst bestimmt, daß Ralph in der Waldschenke ist, weil wir ihn in Yorkspire nicht gefunden haben.«
»Aber was sollte uns dieser Kerl da vorn schaden können?«
Ellen zuckte die Schultern.
»Jedenfalls müssen wir ein scharfes Auge auf ihn haben. Bedenke, lieber James, er ist ein Bote von Flexan, und von dem kommt nichts Gutes. Erwünscht wäre es mir, wenn wir bei diesem Ritt gleich den wirklichen Dieb fangen könnten.«
»Du glaubst, daß Eduard Flexan die 80 000 Dollar wirklich gestohlen hat?« fragte Harrlington zweifelnd.
»Sicher, das heißt, wenn sie ihm sein Vater nicht freiwillig gegeben hat, entweder gezwungen, oder weil beide unter einer Decke stecken.«
Zwei Stunden vergingen, ehe die Prärie, der Weideplatz der zu Miß Petersens Farm gehörenden Pferde, passiert war. Dann mußten sie die Ecke eines Waldes durchkreuzen, wobei die Gangart natürlich bedeutend gemäßigt werden mußte. Schon hier machten sie die Bemerkung, daß sich der Himmel mit unheilverkündenden Wolken bedeckt hatte und ein schweres Gewitter oder ein gewaltiger Regenguß zu erwarten war.
Hier stießen sie auch auf den Schlangenbach, und des Dieners Aussage erwies sich als richtig. Ein ungeheuer dicker Baum war entwurzelt worden und lag direkt über dem Gewässer, so eine bequeme Brücke bildend.

Ein ungeheurer Baumstamm bildete eine natürliche Brücke über
den Schlangenbach, der sonst nicht zu passieren gewesen wäre.
Der Diener führte die Pferde hinüber, Ellen und Harrlington schritten zu Fuß über die Brücke. Ohne diese wären sie bis auf die Haut naß geworden, denn der Bach war sehr tief.
»Und doch haben wir noch dieses Schicksal zu erwarten,« meinte Ellen, den Himmel musternd, »bald werden die Wolken Ströme von Wasser herabsenden.«
»Wie weit ist es noch bis zur Waldschenke?«
»In zwei Stunden können wir sie erreicht haben, das heißt, wenn sich die Prärie nicht unterdes in einen Sumpf verwandelt. Dann können wir mit der doppelten Zeit rechnen.«
»Es scheint schon Nacht zu werden.«
Wirklich wurde es plötzlich so dunkel, daß man in dem Wald, in dem die Sonne sowieso nur spärlich Zutritt fand, kaum noch die nächsten Gegenstände erkennen konnte.
»Es ist auch schon sechs Uhr nachmittags,« entgegnete Ellen, »es ist nicht mehr weit bis zum Einbruch der Dämmerung.«
»Dann müssen wir irgendwo übernachten.«
»Gewiß, bei der genannten Peggy. Das Haus steht zwar in keinem besonders guten Ruf, aber ich glaube, es wird keinen Flecken auf meine Ehre werfen, wenn ich eine Nacht dort zugebracht habe,« fügte sie lachend hinzu, »in der Wildnis ist man in dergleichen Sachen nicht so penibel. Die Hauptsache ist, daß wir Ralph dort finden und dem Plane Flexans zuvorkommen.«
Als sie den Wald nach einer halben Stunde verließen, empfing sie schon ein starker Platzregen. Zögernd hielt Ellen ihr Pferd im Schutz eines Baumes zurück.
»Das ist ärgerlich,« rief sie, »nun denken wir, wir sind dem Wasser entronnen, und kommen vom Regen in die Traufe.«
»Wir wollen denken, wir seien in Australien, und Sharp hetzte uns durch den Fluß,« lächelte Harrlington.
»Gut, vorwärts denn!«
In großen Sprüngen jagten die drei Pferde über die Prärie hin. Der Regen ward immer heftiger, und bald glich die Ebene einem See. An schnelles Reiten war jetzt nicht mehr zu denken. Es war fast Nacht geworden, und die sonst so klugen Tiere konnten auch nicht mehr, wie früher, die zahlreichen Löcher erkennen, die das Wasser verhüllte; oft genug versank eins von ihnen und konnte nur durch die Geistesgegenwart des Reiters aus seiner bedrohlichen Lage befreit werden.
»Weißt du was, James?« sagte Ellen. »Wir suchen einstweilen eine Unterkunft. Lange kann dieser furchtbare Regen doch nicht mehr dauern, es gießt ja wie mit Eimern herab, und hat er erst aufgehört, so wird sich das Wasser schnell verlaufen.«
»Können wir hier eine Unterkunft finden?«
»Ich kenne eine, sie ist nicht sehr weit von hier gelegen; die wollen wir aufsuchen.«
Sie rief den vorausreitenden Cow-boy zu sich.
»Steht das indianische Grab noch hier?« fragte Sie.
»Ja.«
»Eben noch so erhalten, wie früher?«
»Ganz genau so.«
»Ich meine, mit dem Bretterhaus und der Leiter?«
»Alles ist noch da.«
»Dann wollen wir dorthin, in zehn Minuten können wir es erreicht haben.«
Sie schwenkten etwas von der Richtung ab.
»Seit wann ist denn meine Ellen so umgewandelt, daß sie vor dem Regen ein Obdach sucht?« lächelte Harrlington. »Früher gab es nicht so leicht etwas, was sie bewogen hätte, ihren Weg zu unterbrechen.«
»Du hast recht, James, ich bin eine andere geworden. Ich fühle nicht mehr die Spannkraft in mir, die ich früher besaß. Die lange Seereise hat mich mehr angegriffen, als ich mir manchmal gestehen will.«
»Arme Ellen, du hast Schweres durchgemacht. Gar mancher starke Mann hätte das nicht ertragen können, was du ertragen hast.«
»Nun sehe ich aber dafür einer glücklicheren Zeit entgegen,« rief Ellen heiter. »Wirklich, ich sehne mich nach Ruhe und Bequemlichkeit, zum ersten Male in meinem ganzen Leben.«
»Und die wirst du bei mir finden.«
»Ich werde wohl das nachzuholen haben, was ich früher versäumt habe.«
»Was wäre das?« fragte Harrlington.
»Ein Weib zu sein,« entgegnete Ellen und gab ihrem Pferde die Sporen, daß es mit weiten Sätzen in die anbrechende Dunkelheit flog und den Cow-boy überholte.
Vor Harrlingtons Blicken tauchte ein graues, gespensterhaft aussehendes Gebäude auf. — — — — —
Mitten auf der Prärie erhob sich ein Gebäude, oder besser gesagt, ein Steinhaufen, denn es waren weder Fenster, noch Türen zu sehen, die Steine waren nicht durch Mörtel verbunden, sondern einfach lose übereinander gesetzt, da das Ganze aber eine quadratische Form zeigte, so sah es von weitem wie ein Haus aus.
Der mächtige Steinwürfel besaß eine Höhe von ungefähr sechs Metern und war ebenso breit und lang. Ob er aus den Zeiten der alten Azteken oder der Indianer früherer Jahrhunderte stammte, wußte man nicht, jedenfalls stand er auf dem Grabe eines Häuptlings, der von seinen Kriegern geehrt worden war, indem man ihm nach seinem Tode eine Art von Denkmal gesetzt hatte.
Zu untersuchen, ob der Bau hohl war und Schmuckgegenstände barg, gelüstete niemanden; die Arbeit, die Steine fortzuschaffen, hätte sich doch nicht gelohnt. Fast alle derartigen Bauwerke aus früherer Zeit zeichnen sich dadurch aus, daß man nur ungeheure Blöcke zur Herstellung benutzt, kleinere Steine aber ganz verschmäht hatte, und so war auch dieses Grabdenkmal aus Blöcken zusammengesetzt, von denen man sich nicht erklären konnte, wie es Menschenkräften möglich gewesen, sie übereinander zu schichten.
Ein pfiffiger Kopf hatte es aber doch verstanden, dieses Andenken früherer Jahrhunderte sich nutzbar zu machen.
Wahrscheinlich war es ein Präriejäger oder aber ein menschenscheuer Einsiedler gewesen, der auf den Gedanken gekommen, sich hier oben ein Blockhaus zu bauen, wo er vor wilden Tieren geschützt war und auch recht gut einen Kampf mit Indianern bestehen konnte.
Auf dem Mauerwerk stand eine recht nette Hütte, fast den ganzen Platz einnehmend, so daß nur ringsherum eine schmale Galerie lief. Sie bestand aus dicken, sehr gut zusammengefügten Baumstämmen, das Dach lief schräg, so daß das Regenwasser abfließen konnte, und die Fenster wie die Tür waren von solider Konstruktion.
Dieses Haus stand schon so lange, wie sich die ältesten Bewohner dieser Gegend erinnern konnten — sehr alt wurde hier allerdings niemand — und trotzdem hatte es sich noch gut erhalten. So ausgetrocknet die Baumstämme von der Hitze auch waren, lagen sie doch noch so dicht zusammen, daß kein Luftzug durchstreichen konnte. Das Dach ließ noch keinen Tropfen Wasser durch. Die Fensterläden schlossen ausgezeichnet. Der Riegel an der Tür funktionierte noch, und das einzige, was etwas gelitten, war die Leiter, welche hinaufführte.
Da der Erbauer des Hauses wahrscheinlich nicht imstande war, die sechs Meter zu seiner Wohnung hinaufzuspringen, so hatte er sich eine Leiter gebaut, auf welcher er bequem auf- und absteigen konnte. Da er sie wahrscheinlich jedesmal, wenn er sich zu Hause befand, emporzog, wie er sie beim Verlassen der Hütte hinablassen mußte, so hatte sie bedeutend gelitten, sie hielt aber noch, wenn sie ab und zu von jemandem benutzt wurde.
Die wie eine Festung vom Berge ins Land hineinschauende Blockhütte wurde öfter besucht.
Jäger schliefen darin, beschäftigungslose Cow-boys quartierten sich gleich monatelang darin ein, und es gab auch wirklich kein bequemeres und sichereres Asyl als diese Hütte.
Man brauchte nur die Leiter emporzuziehen, und weder Mensch, noch Tier konnte die Plattform betreten.
Die Hütte bestand aus zwei Teilen. Durch die Tür trat man in den Raum, welcher als Wohnzimmer diente. Er enthielt einen Tisch und einige Bänke, und neben dem Feuerherd lag stark mitgenommenes Kochgeschirr. Brennholz mußte sich jeder aus dem nahen Walde selbst holen.
Im zweiten Zimmer war nichts weiter vorhanden, als eine dicke Schicht köstlich duftendes Prärieheu, das ein auch an seine Nächsten Denkender hier aufgetürmt hatte. Ein Bedürfnisloser, dem Federbett und Sprungfedermatratzen unbekannte Begriffe sind, hätte sich kein besseres Nachtlager wünschen können. Selbst eine Decke war vorhanden, da sie aber nur aus zusammenhängenden Löchern bestand, so lag die Vermutung nahe, daß der ehemalige Besitzer sie nicht als edles Vermächtnis, sondern als wertloses Objekt zurückgelassen hatte. —
In dem triefenden Regen der Nacht standen die drei Pferde an dem Grabdenkmal und knusperten die Halme ab, welche noch über das den Boden bedeckende Wasser hervorragten. Unruhig patschten die Tiere im Wasser, daß es hoch aufspritzte, und ab und zu stießen sie ein ängstliches Wiehern aus. Ihr Instinkt sagte ihnen, daß dieser Regen das Vorspiel einer nahenden Katastrophe sei. Die Zügel waren an Ringen befestigt, welche in das Gemäuer eingekeilt worden waren.
Die Reiter hatten vor dem Regen Zuflucht in der Hütte gesucht, die Leiter lehnte am Gemäuer, damit auch noch andere sie benützen konnten, wenn sie Schutz suchten.
Um den Tisch saßen Ellen, Harrlington und der Diener und aßen die von ersterer mitgenommenen Vorräte, denn ein Ritt durch die Prärie ist keine Vergnügungspartie, man muß sich darauf gefaßt machen, eine Mahlzeit im Sattel zu halten.
Das Essen verlief schweigend; man sprach höchstens ein Wort über den Regen. Man hoffte, er würde bald nachlassen und das Wasser sich dann schnell verlaufen.
Der Diener schien zu ahnen, daß seine Gegenwart störend wirkte, denn kaum hatte er den letzten Bissen der zwar kleinen, aber gewählten Mahlzeit hintergeschluckt, als er aufstand und der Tür zuschritt, welche ins andere Zimmer führte.
Ellen hielt ihn noch einmal zurück.
»Was meint Ihr, was die Konstabler bei diesem Regen machen werden?«
»Sie machen es ebenso, wie wir.«
»Ihr meint, auch sie hätten ein Obdach gegen den Regen gesucht?«
»Natürlich; der Sergeant scheut das Wasser wie eine Katze.«
»Aber von seiner Schnelligkeit hängt ein lohnender Fang ab.«
»Haha, Ralph entgeht ihm doch nicht. Wo der sitzt, da bleibt er kleben, bis er keinen Cent mehr in der Tasche hat.«
»So könnten wir also unter Umständen hierbleiben, bis der Regen vorüber ist?«
»Bis sich das Wasser verlaufen hat, auf alle Fälle. Sie können ruhig auch die ganze Nacht hierbleiben. Der Sergeant übernachtet jedenfalls auf Rickerts Farm, und vor morgen früh verläßt er sein Bett auf keinen Fall.«
»Dann dürfte ihm der Vogel entgangen sein.«
»Ah bah, ich kenne das besser. In der Waldschenke gibt es hübsche Mädchen, und dem Ralph fällt es gar nicht ein, eine weiche Matratze mit dem Sattel zu vertauschen, selbst wenn er die Konstabler hinter sich wüßte. Ein Cow-boy hat nicht so oft Gelegenheit, allein Mädchen zu karessieren, so etwas nimmt er stets mit. Hahaha.«
Lachend verließ der Bursche das Zimmer, wahrscheinlich mit der Absicht, sich drüben im Heu schlafen zu legen.
»Ein ekelhafter Kerl,« sagte Harrlington, »er hätte uns überhaupt sofort verlassen können, nachdem er uns den gestürzten Baum gezeigt.«
»Was soll ich denn tun?« entgegnete Ellen. »Ich habe ihm deutlich genug zu verstehen gegeben, er könnte nun nach Hause reiten. Er nimmt keine Notiz davon. Es ihm zu befehlen, hat gar keinen Zweck, seit ich weiß, daß er Cow-boy gewesen ist. Diese Burschen lassen sich nichts sagen.«
»Er hat aber nicht das offene Benehmen eines solchen.«
»Aber doch ihre Sitten, auch er läßt sich nichts sagen, wie ich schon bemerkt habe. Uebrigens, James, auf deinen Wunsch hin habe ich ihn mitgenommen, darum mußt du ihn nun auch dulden.«
Beide blickten schweigend zum Fenster hinaus.
»Es läßt nach mit regnen,« meinte der Lord.
»Wie lange kann es aber noch anhalten!«
»Willst du die Nacht hierbleiben?«
»Ich denke ja. Ich sehe die Richtigkeit der Bemerkung des Cow-boy ein. Erreichen wir morgen früh die Waldschenke, so ist immer noch Zeit, Ralph zu retten.«
»Dann will ich wenigstens den Diener hinausweisen, der Kerl scheint schon drüben zu schlafen. Eine Frechheit ist es, ohne uns zu fragen, Besitz von diesem Raum zu ergreifen, der dir gebührt.«
»Laß nur, James, ich bleibe wach!«
»Du kannst drin schlafen, ich und der Diener legen uns hier auf die Bänke.«
Ellen schüttelte schwermütig den Kopf und schlang dann den Arm um des Mannes Nacken.
»Ich bleibe bei dir,« flüsterte sie zärtlich.
»Du willst die ganze Nacht hier sitzen bleiben?«
»Wenn du es ertragen kannst, für mich soll es eine Freude sein.«
»Ich kann es nicht zugeben.«
»Ich bitte dich darum!«
Nach längerem Widerstreben fügte sich Harrlington, den Diener schlafen zu lassen, während sie beide hier wachten.
Es war völlig dunkel in der Stube, Ellen schmiegte sich dicht an ihren Bräutigam.
»Wie naß du bist,« sagte er bedauernd.
»Habe ich schon so viele Tage in nassen Kleidern verbracht, so wird es mir diesmal auch nichts schaden; du bist auch nicht trockener.«
»Ich kann es aber nicht dulden, daß du aufbleibst. Du könntest es dir drüben bequem machen, ich will vor der Tür dein treuer Wächter sein.«
»Sprich nicht mehr davon, ich bitte dich darum! Ich mag nicht allein sein, ich will mit dir wachen.«
Ellens heißer Atem streifte seine Wangen. Sie fühlte, wie ein Zittern durch den Körper des Mannes ging. Er drückte sie noch fester an sich und flüsterte ihr ins Ohr.
»Wenn ich dich nun sehr, sehr bitte, würdest du dich nicht schlafen legen?«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Ich will bei dir bleiben.«
Harrlington wollte sich aus ihrer Umarmung befreien, sie aber hielt ihn fest.
»James, mißdeute meine Antwort nicht,« flüsterte sie hastig, »lege ihr keinen anderen Grund unter! Ich fürchte mich, allein zu sein, bange Ahnungen durchbeben mein Herz, ich weiß selbst nicht warum.«
»Fürchtest du dich vor mir?«
»Nein, James, ich weiß, was du damit sagen willst, und ich weiß auch, du bist ein Ehrenmann, der nicht das mißbraucht, was ihm vielleicht die Gelegenheit bietet. Etwas anderes ist es, was mich mit so trüben Ahnungen erfüllt.«
Harrlington wurde plötzlich ganz still, und Ellen ahnte, was in ihm vorging.
»Nicht lange mehr, nur wenige Monate noch,« flüsterte sie ihm ins Ohr, »und wir sind für immer vereint. Ach, wie sehne ich mich nach der Zeit, da ich dieses wilde Leben hinter mir habe, da ich an deiner Seite in Glück und Ruhe leben kann!«
»Warum aber stürzest du dich immer wieder in neue Abenteuer und Gefahren?«
»Ich vermeide sie jetzt.«
»Nein, dieser Ritt wäre auch nicht notwendig gewesen.«
»Ich konnte nicht anders. Mein Zorn war zu groß, als ich die Verdächtigung Ralphs durch Flexan hörte. Aber ich verspreche dir, es soll das letztemal gewesen sein, daß ich gehandelt habe, ohne dich erst zu fragen. Vergib mir, bedenke, es ist nicht möglich, daß aus einer wilden, trotzigen Natur mit einem Male eine sanfte werden kann, so wie du von mir wünscht, ich bedarf der Erziehung und will mich von jetzt ab dir fügen. Du sollst keinen Anlaß mehr zur Klage haben, ich will dir gehorchen, ich will dir folgen, nicht mehr eigenmächtig handeln, sondern dich handeln lassen und dir dabei helfen. Bist du so mit mir zufrieden?«
»Meine Ellen!«
»Ich weiß wohl,« fuhr das Mädchen fort, »daß dir mein Charakter so, wie er früher war, nicht gefallen hat. Du liebst an einem Mädchen nicht diese wilde, ungestüme Natur, du schiltst sie unweiblich, du willst die, welche du liebst, sanft, zart, nachgiebig haben, sie soll sich nicht auf sich selbst verlassen sondern allein auf ihren Mann. Ist es nicht so?«
»Ja,« hauchte Harrlington.
»Und so sollst du mich finden, wenn wir beide vor den Altar treten. Von dem Tage an sollst du mich völlig verwandelt sehen, und schon jetzt will ich mich bemühen, mich zu ändern, denn deine Liebe zu erwerben, soll mein schönstes Ziel, deine Liebe zu besitzen, mein höchstes Glück sein.«
»Wie kannst du so sprechen, Ellen! Besitzt du nicht schon meine innigste Liebe?«
»Auch deine Zufriedenheit möchte ich haben; nichts darfst du an mir auszusetzen haben. Nur dein Wille soll fortan noch gelten, ich habe keinen mehr.«

Harrlington war glücklich. Er hatte den Sieg davongetragen, seiner Beharrlichkeit war es gelungen, Ellen zu dem zu machen, was sie jetzt war oder was zu werden sie doch gelobte. Sie versprach ihm, eine treue, ergebene Gattin zu sein, ein Weib, welches nicht mehr mit rücksichtsloser Energie alles zu überwinden sucht, was sich ihm hinderlich in den Weg stellte, sondern ein Weib, welches in Demut zu seinem Manne aufschaut und von ihm Hilfe erwartet, solange es Sachen betrifft, welche zu besiegen die Pflicht des Mannes ist.
Wohl gibt es im Menschenleben oftmals Gelegenheit, wo auch die Gattin beweisen kann und muß, daß sie an der Seite des Geliebten jeder Gefahr trotzt, gegen jeden Feind kämpft, aber nach Besiegung der Gefahren und Feinde darf sie nicht den Beifallsruf der Welt erwarten, im Glück der Kinder und im tiefsten Innern des eigenen Herzens muß sie den Lohn für ihren Heldenmut finden. Die Zeiten der Amazonen sind vorüber, nur schwacher Ruhm winkt ihnen, Treue, Liebe, Tugend, Ergebenheit, Gehorsam und Mut und Freudigkeit beim Ertragen von Leiden und Unglück haben unsere heutigen Dichter zu besingen, und fürwahr, diese Tugenden des Weibes sind des Ruhmes wert.
Harrlington kämpfte noch einige Zeit gegen den Schlaf, der sich auf seine müden Augen senken wollte, doch lange konnte er nicht widerstehen. Die letzten Tage waren aufregend gewesen, er hatte in der Nacht vor Liebesseligkeit keine Ruhe finden können, dazu jetzt der anstrengende Ritt, war's ein Wunder, wenn ihm bald der Kopf auf die Brust sank, er sich immer schwerer gegen die Wand lehnte, bis auch er in das Reich der Träume entrückt war?
So fest war der Schlaf der beiden, daß sie nicht merkten, wie die Tür aufging, ein Kopf mit im Dunkeln glühenden Augen hereinsah und dann der Cow-boy völlig hereinschlüpfte.
Gleichzeitig ertönte in der Ferne ein Donnern, welches schnell näherkam. Auch dies vernahmen die Schlafenden nicht; kein Gott warnte sie, und dieser Mann, der die anstürmende Gefahr kannte, die nachfolgende ahnte, erst recht nicht.
»Sie schlafen,« murmelte der Schuft mit schadenfrohem Grinsen, »besser kann ich's nicht treffen, meinen Auftrag auszuführen, und ich denke, Mister Flexan wird mit mir zufrieden sein. Hätte wirklich nicht geglaubt, daß sich mir eine so günstige Gelegenheit bieten würde. Hm, ich bin lange genug bei den Rindern gewesen, um zu wissen, was diese Flucht trotz des sumpfigen Bodens bedeutet, und darum muß ich mich beeilen. Ich muß den Tieren vorauseilen, und ich bin keine Wasserratte.«
Während dieses Selbstgespräches hatte er einen Faden und ein Täschchen hervorgezogen, schlüpfte wieder in den mit Heu angefüllten Raum hinein, kehrte aber sofort wieder zurück.
»Hihihi,« kicherte er, »das wird eine Ueberraschung geben. Good-bye, ihr beiden, euer letztes Stündchen naht.«
Leise öffnete er die Haupttür, kletterte die Leiter hinab und entfernte dann diese selbst von dem Gemäuer.
Ungeduldig stampften und wieherten neben ihm die Pferde. Sie hörten das näherkommende Brausen und wußten, in der Prärie geboren, was es zu bedeuten hatte; die Rinder und Büffel flohen vor dem Tode.
Da löste eine Hand ihre Zügel von den Ringen und, von Todesangst getrieben, jagten sie vor den Rindern einher — nur auf einem der drei Pferde saß ein Reiter. —
Ellen fuhr plötzlich erschrocken auf, sie warf einen Blick durch das Fenster in die vom Mond beschienene Nacht.
»James,« schrie sie entsetzt, »die Rinder fliehen!«
Im Nu war Harrlington wach und trat neben Ellen an das Fenster. So weit das Auge reichte, sah es nichts als eine mit Büffeln bedeckte Ebene, dazwischen höchstens ein Pferd, einen Hirsch, eine Gazelle oder sonst ein freies Tier der Steppe. Wie ein Meer wogte es auf und ab, und die harten Hufe entlockten dem Boden einen dumpfen Donner.
»Daß wir das nicht gehört haben!« rief Harrlington bestürzt.
»Wenn sich nur unsere Pferde in ihrer Angst nicht losgerissen haben, dann ist alles gut.«
Mit diesen Worten eilte Ellen hinaus, bog sich auf dem schmalen Plateau, welches die Hütte noch frei ließ, hinab und — schrie vor Schreck laut auf.
Harrlington gesellte sich ihr bei.
»Die Pferde sind fort!« rief er.
»Und die Leiter auch.«
»Die Tiere haben sie umgeworfen.«
»Dann müssen wir einen hohen Sprung wagen.«
»Er ist nicht gefährlich,« tröstete Harrlington, »der schlammige Boden schützt uns vor Schaden. Aber schlimm sieht es dann mit dem Gehen aus.«
»Ja, das wird ein schweres Stück Arbeit,« entgegnete Ellen, die sich schnell wieder erholte. »Wir dürfen uns keine Hoffnung machen, die Waldschenke vor morgen abend zu erreichen, wenn wir nicht unterwegs auf Hilfe treffen.«
»Warum fliehen die Tiere? Es ist übrigens ein imposanter Anblick.«
»Das Warum ängstigt mich auch; umsonst begeben sich die Tiere auf diesem morastigen Boden nicht auf die Flucht. Wir müssen jetzt abwarten, bis die Herden vorüber sind, lange dauert es nicht mehr, dort sehe ich schon die letzten Reihen.«
Sie gingen in die Hütte zurück.
»Wir haben ja Harry ganz vergessen,« sagte Harrlington plötzlich, »der Kerl hat einen Schlaf wie ein Murmeltier.«
Ellen erwiderte erst nichts, sie wandte sich jäh um und blickte Harrlington mit großen, erschrockenen Augen an.
»James, ich habe eine Ahnung,« stammelte sie dann.
Dieser erbleichte.
»Was? Du glaubst doch nicht etwa ...«
Schon war Ellen an der Verbindungstür, riß sie auf und überflog mit spähenden Blicken das Gemach — es war leer.
»Fort!« murmelte sie.
»Mit unseren Pferden.«
»Natürlich, er ist ein Schurke!«
»Warum hat er uns nicht geweckt?«
»Er ist der Diener meines Stiefvaters, das ist eine genügende Erklärung. Er soll uns vernichten.«
»Ich sehe keine so ungeheure Gefahr.«
»Wer weiß — halt, was ist das?«
Ellen sog die Luft ein, sie erblaßte.
»Riechst du nichts?«
Harrlington prüfte die Luft.
»Nein.«
»Es riecht so süßlich angenehm.«
»Ich merke nichts.«
»So brandig.«
»Angenehm und brandig zugleich?« lächelte Harrlington.
»Ja, etwa wie Räucherpulver.«
»Ach so. Halt, ich weiß es. Wenn viele Pferdehufe den Boden stampfen, so wird ein eigentümlicher, brenzlicher Geruch erzeugt, wie ich schon selbst gefunden habe, und ebenso wird es bei diesen zahllosen Rindern sein.«
»Du hast recht, aber nur, wenn der Boden sehr trocken ist, entsteht dieser Geruch, nicht bei solcher Feuchtigkeit.«
»Was könnte es sonst sein?«
Sie durchstöberten das Heu, fanden aber nichts.
»Riechst du es noch immer?«
»Nein.«
»So wirst du dich vorhin getäuscht haben.«
»Das ist kaum möglich. Ich roch es, als ich hier eintrat, jetzt habe ich mich bereits daran gewöhnt.«
Ellen gab sich zufrieden.
Jetzt erreichten die letzten Reihen der Tiere das Gebäude. Den Kopf tief geneigt, stießen sie mit den mächtigen Hörnern unter ängstlichem Gebrüll die vorderen in die Fleischteile, und da ein jedes dies tat, um das vordere zu schnellerem Laufe anzutreiben, so konnte man sich erklären, warum solch eine fliehende Herde so schwer aufzuhalten ist. Das Tier, welches fällt, wird sofort zerstampft, auch jetzt konnte man hier und da eine formlose, dunkle Masse am Boden liegen sehen.
»Wir müssen den Sprung wagen,« rief Lord Harrlington am Fenster.
Ellen blickte starr der Herde nach.
»Wo sind die Schakale und Wölfe?« flüsterte sie.
»Wie meinst du das?«
»Wo sind die Raubtiere, welche stets in ungeheurer Anzahl jeder fliehenden Herde folgen, um die gestürzten Tiere zu fressen?«
Auch Harrlington wurde ängstlich, Ellen sprach in so sonderbarem, aufgeregten Tone.
»Erblickst du in dem Fehlen dieser Raubtiere eine neue Gefahr für uns?«
Ellen wendete den Kopf der anderen Richtung zu.
»Da kommt sie schon!« rief Ellen gellend. »Siehst du den silbernen Streifen? Das ist Wasser! Eine Ueberschwemmung!«
»Wir müssen fliehen!« schrie Harrlington und schlang den Arm wie schützend um Ellen.
»Zu spät, wir können dem Wasser nicht entgehen, zu Fuß gleich gar nicht.«
»Was ist zu tun?«
»Wir müssen hierbleiben, hier sind wir sicher.«
»Wir haben keinen Proviant bei uns.«
»Diese Gegend fällt stark nach der Küste zu ab. Ich versichere dir, morgen hat sich das Wasser wieder verlaufen, und wäre die Ueberschwemmung auch noch so stark. Ich habe schon einmal eine solche in dieser Gegend durchgemacht. Fürchterlicher, als jene, kann diese auch nicht werden.«
Fünf Minuten später kam die erste Welle an, zehn Minuten darauf befanden sich beide auf einer Insel mitten im wogenden Ozean.
»Wir sind hier sicherer, als wenn wir im Sattel säßen,« sagte Ellen, fast heiter, »unsere Lage ist durchaus nicht schlimm, sie gefällt mir sogar, weil du bei mir bist.«
Ein Händedruck war die Antwort.
»Warum nur mag Harry die Pferde losgekettet haben und ohne uns geflohen sein?« fragte er dann.
»Ja, warum? Wenn nur keine Teufelei dahintersteckt.«
Ellen hob den Kopf und sog abermals prüfend die Luft in die Nase ein.
»James, riechst du nichts?« schrie sie.
»Wahrhaftig, es riecht brandig.«
»Horch, was ist das? Es knistert so.«
Ellen stürzte nach der Tür, riß sie auf und prallte zurück — eine feurige Garbe schlug ihr entgegen, das Heu im Nebenraume stand in Flammen.
Beide stießen Schreie des Entsetzens aus, sie befanden sich auf einer brennenden Insel, unter sich das reißende Wasser, neben sich das verzehrende Feuer.
»Hah, jetzt weiß ich, was ich vorhin roch,« schrie Ellen, »es war eine brennende Zündschnur.«
»Zurück auf das Plateau! Können wir nicht löschen?«
»Wir haben nichts, um Wasser zu schöpfen.«
»Die Balken sind vom Regen durchnäßt, sie werden kein Feuer fangen. Nur das Heu brennt ab.«
»Die Balken sind aber inwendig trocken geblieben. Sieh, dort brennt es schon!«
Ihr Entsetzen wuchs. Das brennende Heu strahlte eine intensive Hitze aus, schon konnten sie es nicht mehr in dem ersten Räume aushalten, sie mußten ins Freie eilen und standen nun zwischen Feuer und Wasser auf einem Platze von kaum einem Meter Breite.
Ellen hatte recht, das Holz fing doch Feuer, weil es inwendig trocken geblieben war, und die äußere Nässe verdunstete schnell. Ehe sie es sich versahen, stand der hintere Teil des Bauwerkes, wo das Heu gelegen, in lichterlohen Flammen. Schon leckte das begehrliche Element das Dach hinauf und versuchte seine verzehrende Kraft am Nebenraume.
Stand auch dieser in Flammen, dann blieb den beiden nichts anderes übrig, als ins Wasser zu springen wenn sie den Verbrennungstod nicht dem des Ertrinkens vorzogen. Doch sie konnten schwimmen, also würden sie letzteres wählen, wenn sie auch keine Hoffnung nähren durften, sich zu retten.
Ihr erstes, maßloses Entsetzen wich bald der Kaltblütigkeit; es war ja nicht das erstemal, daß sie dem Tode ins Auge sahen.
Ellen war wieder ganz die Alte. Vergessen war alles, was sie vorhin ihrem Geliebten versprochen hatte, und jetzt war auch die Zeit, ihre Energie zu zeigen.
»Wir müssen ins Haus zurück und versuchen, Balken loszubrechen, um ein Floß zu bauen, hier außen kann man sie nicht fassen,« rief sie.
Sie drangen abermals in den Raum ein. Die sengende Hitze raubte ihnen fast den Atem; aber sie mußten aushalten.
»Dicht an der äußersten Wand, hier, hier habe ich vorhin eine Ritze entdeckt.«
Sie grub schon ihre Finger in eine Spalte zwischen zwei Stämmen und suchte einen davon durch Rütteln zu lockern. Harrlington sah, wie ein Finger ihrer Hand blutete, auch er folgte ihrem Beispiel.
Beide rüttelten wie wahnsinnig an dem Balken. Ach, hätten sie doch nur eine Axt, eine Brechstange oder nur ein Stück Eisen gehabt!
Immer heißer wurde es. Die Seitenwand fiel, das Feuer kam zu ihnen herein. Sie befanden sich in einem Backofen.
Harrlington strengte seine stählernen Muskeln zum Zersprengen an, er achtete es nicht, daß die Haut am oberen Teile der Hand zerschunden wurde, ebensowenig Ellen, ihre Energie ersetzte die ihr fehlende Kraft. Gleichmäßig zogen und schoben sie hin und her, und die Balken lockerten sich merklich. Aber die Flammen kamen immer näher, die Hitze wurde unerträglich.
»Wir müssen fliehen, oder wir verbrennen,« keuchte Harrlington.
»Nur diesen Balken,« entgegnete Ellen.
»Wir bekommen ihn nicht los.«
»Wir müssen, nur diesen einen, auf ihm können wir uns stundenlang halten.«
Da krachte der Baumstamm unter einer Kraftanstrengung Harrlingtons in den Fugen, er hatte sich gelöst. Harrlington sprang zu Ellen, welche näher an der offenen Tür stand und so frische, kühle Luft bekam, ein Ruck, und auch hier ging der Balken aus den Fugen.
»Hinaus!« schrie Harrlington, sprang zurück und faßte das hintere Ende, während Ellen schon das vordere aufhob.
Sie trugen den Balken hinaus, doch Harrlington stand noch in dem Raume, dessen Dach schon lichterloh brannte.
»Wir werfen ihn hinunter und springen sofort nach,« rief Ellen, »sofort, hörst du?«
»Los!«
Plätschernd stürzte der Baumstamm ins Wasser, schon wollte Ellen nachspringen, da krachte es hinter ihr. Sie sah, wie ein brennender Balken von oben herabfiel und Harrlington zu Boden schlug. Mit einem furchtbaren Schrei sprang sie auf ihn zu, hob ihn auf und schleifte ihn ins Freie.

Im Nu sprang Ellen auf ihn zu, hob ihn auf und schleifte ihn ins Freie.
Sie sah den Balken noch treiben, ohne Besinnung warf sie sich, Harrlington in den Armen haltend, ins Wasser. Sie sank tief, doch Ellen war eine Schwimmerin, welche weder durch ihre Kleidung noch dadurch gehindert wurde, daß sie einen anderen Menschen zu tragen hatte. Mit einigen Stößen des freien Armes erreichte sie wieder die Oberfläche und arbeitete sich dem forttreibenden Balken nach.
Ein Glück war es, daß Harrlington bewußtlos war, denn wäre er nur verletzt, aber bei Besinnung gewesen, so hätte er sich leicht so an das Mädchen klammern können, daß ihm das Schwimmen unmöglich gemacht wurde.
In wenigen Augenblicken hatte Ellen den Balken erreicht. Hochaufatmend hielt sie sich daran fest und betrachtete das Antlitz Harrlingtons.
Sie sah auf den ersten Blick, daß sein Kopf von dem brennenden Sparren getroffen worden war, sein Haar war verbrannt; sonst war er unverletzt, soweit sie es wenigstens beurteilen konnte. Vielleicht war aber auch eines seiner Glieder zerschmettert worden.
Ellens Herz krampfte sich bei diesem Gedanken zusammen.
»James, um Gottes willen, was ist dir? Komm' zu dir, wache auf!«
Harrlington schlug die Augen auf; wirr blickte er um sich.
»Wo bin ich?« stöhnte er und strich sich mit der nassen Hand über die Stirn.
»Bei mir!« jauchzte Ellen förmlich auf. »Fühlst du irgendwo Schmerzen?«
»Nein, nur der Kopf brennt mir.«
Er schloß die Augen wieder, verlor aber nicht von neuem das Bewußtsein, was wohl geschehen wäre, wenn er nicht in dem kalten Wasser gelegen hatte.
Ellen nahm ihn wieder in den einen Arm, schleppte ihn weiter nach vorn und versuchte dort, ihm auf den Balken zu helfen. Da er selbst fast gar nichts dazu tat, so merkte sie, daß der Schlag ein sehr heftiger gewesen sein mußte.
Endlich lag Harrlington auf dem Balken, der stark genug war, beider Last zu tragen, ohne unter die Oberfläche zu sinken.
»Kannst du dich so festhalten?« fragte sie.
»Ja.«
»Ohne herabzufallen?«
»Ich halte mich. — Ellen, wo sind wir?«
»Aus dem Feuer ins Wasser geraten. Jetzt bleibe ruhig liegen, wir werden uns retten!«
Sie glitt nach hinten.
»Du hast mich gerettet, ich weiß es jetzt,« stöhnte Harrlington.
»Wo bist du?« fragte er dann, da er unfähig war, den Kopf zu heben.
»Ich werde den Stamm dem Walde zulenken; halte dich nur gut fest!«
Ellen hatte sich auf den hinteren Teil des Stammes geschwungen und suchte nun durch Bewegungen der Hände und Füße ihm eine solche Richtung zu geben, daß sie nach dem in der Ferne auftauchenden Walde getrieben wurden.
Dort gedachte sie einen breitästigen Baum aufzusuchen, auf dem sie die Ueberschwemmung überstehen wollten. Ohne den Balken wäre ihnen dies auf keinen Fall gelungen, sie wären schon auf dem halben Wege ertrunken, so gute Schwimmer sie auch waren. Ellen rechnete noch zwei Stunden, ehe sie den Saum des Waldes erreichten, und ein guter Schwimmer kann sich zwar auch mit Leichtigkeit so lange über Wasser halten und dabei eine bedeutende Entfernung zurücklegen, wenn er nicht zu gleicher Zeit gegen den Strom schwimmen muß. Dies war aber hier nötig. Der Wald lag weit links ab. Die Strömung hätte sie eine Meile davon entfernt vorbeigetrieben, und Ellen bot nun ihre ganze Kraft auf, dem Stamm eine andere Richtung zu geben, so daß sie das Ziel erreichten.
Harrlington war wieder völlig zu sich gekommen und sprach mit Ellen. Diese bat ihn, ruhig liegen zu bleiben und sich zu schonen. Sie könne den Balken allein lenken. Zu gleicher Zeit hielt sie scharfe Umschau nach etwaiger Hilfe.
»Mir fiel ein brennender Sparren auf den Kopf, ich entsinne mich ganz gut,« flüsterte Harrlington, »ich brach ohnmächtig zusammen. Du mußt mich hervorgezogen haben und mit mir ins Wasser gesprungen sein. Ist es nicht so, Ellen?«
»Es ist so, James,« entgegnete Ellen einfach, aber mit freudigem Herzen. »Was ist weiter dabei? Hättest du es nicht ebenso getan?«
Harrlington glaubte, er hätte sich erholt, richtete sich auf und wollte seine Kraft mit der ihren verbinden. Aber schon bei der ersten Bewegung sank er mit leisem Stöhnen in seine alte Lage zurück.
»Ich kann nicht; mein Kopf schmerzt zu sehr.«
»Du sollst auch nichts, als ruhig liegen bleiben. Halte dich nur fest, das ist deine einzige Aufgabe!«
»Ich kann dich doch nicht so allein arbeiten lassen.«
»Da ich unsere Rettung nun einmal begonnen habe, so laß sie mich auch beenden,« lachte Ellen fröhlich, »du hast mir oft genug beigestanden.«
Ellen fühlte sich so heiter, wie seit längerer Zeit nicht. Obgleich in einer schrecklichen Situation, hätte sie doch aufjubeln mögen, sie wußte selbst nicht warum.
Doch sie waren noch nicht in Sicherheit, vielleicht stand ihnen das Schwerste noch bevor.
Die zweite Stunde war schon vergangen. Ellens Anstrengungen war es gelungen, den Balken dahin zu bringen, wo sie ihn haben wollten; sie trieben jetzt direkt dem Walde zu. Es war ein schweres Stück Arbeit gewesen. Auf Ellens Stirn vermischten sich Wasser- mit Schweißtropfen, aufgelöst hing ihr das nasse Haar um den Kopf, das Zeug klebte am Körper, und die Brust rang nach Atem.
Harrlington hatte sich ruhig verhalten.
»Ellen,« flüsterte er jetzt leise, »stehen Sterne am Himmel?«
»Gewiß, über uns«
»Auch am Horizont?«
»Nein, der ist noch ganz mit dicken Wolken bedeckt.«
»Dort stehen gar keine Sterne?«
»Kein einziger. Warum stellst du diese merkwürdige Frage?«
Harrlington richtete sich etwas auf.
»Sehe ich denn diese Sterne dort nur in meiner Phantasie, oder ist es etwas anderes?«
Er deutete dabei nach einer Richtung des Waldes.
»Das sind keine Sterne, das sind Lichter,« jauchzte Ellen auf, die leuchtenden Punkte zwischen den Bäumen jetzt ebenfalls wahrnehmend, »Freue dich, James, Rettung naht sich!«
»Rettung?« lächelte Harrlington schwach.
Ellen legte die Hände trichterförmig an den Mund.
»Boot ahoi,« gellte ihre Stimme durch die Nacht.
»Du bist auf der Prärie, sie verstehen diesen Schifferruf in Seenot hier nicht.«
»Aber sie hören meine Stimme — Boot ahoi!«
Lang aushaltend tönte der Ruf, fand aber keine Erwiderung.
»Es ist nur ein Licht,« rief Harrlington.
»Und es bewegt sich, also muß es ein Boot, ein Floß oder sonst ein Fahrzeug sein.«
»Vielleicht ein Wagen.«
»Auch möglich — Boot ahoi!«
»Es liegt still, das Licht wird hochgehoben, sie haben uns gehört.«
»Wir treiben vorbei,« rief Harrlington angsterfüllt, und es schien in der Tat so.
Ellen richtete sich hoch auf, schwenkte den Arm und rief:
»Was für ein Licht ist das?«
»Johanna!« ertönte es zurück; Angst und Freude lagen zugleich in diesem Ruf.
»Nicht Johanna,« entgegnete Ellen, ins Wasser gleitend. »Es ist Hoffmann,« fügte sie murmelnd hinzu.
Es war die höchste Zeit, daß dem Balken eine andere Richtung gegeben wurde, sonst trieben sie vorbei, denn das Licht war schon ganz nahe. Glücklicherweise war die Strömung nicht mehr so sehr reißend.

Ellen schwamm und stieß den Balken mit kräftigen Stößen vor sich her, ihm eine andere Richtung gebend, als die Strömung wollte. Immer näher kam das Licht. Sie sah ein Fahrzeug schwimmen, sie erkannte neben Hoffmann einen anderen Menschen. Der Balken stieß an, prallte ab, wurde über sofort von vier Händen gefaßt und herangezogen.
»Miß Petersen,« rief Hoffmann erstaunt, »sind Sie es wirklich? Wer ist Ihr Begleiter?«
Hoffmann dachte schon an Snatcher.
»Lord Harrlington. Nehmen Sie erst ihn ins Boot!«
»Wir sind auf einem Wagen.«
»Der aber jetzt als Boot dient.«
Lord Harrlington war schon wieder so weit hergestellt, daß er sich allein auf den Wagen schwingen konnte. Zitternd vor Anstrengung sanken beide auf die Sitze, die Kleider von Wasser triefend, die Haare vom Feuer versengt.
»Gelobt sei Gott, wir sind gerettet!« seufzte Ellen aus tiefstem Herzen.
»Amen,« fügte Harrlington leise hinzu.
»Woher kommen Sie?« fragte Hoffmann, jetzt erst die Verletzungen bemerkend, welche kein Wasser hatte anrichten können. »Doch nicht aus dem brennenden Gebäude?«
Ellen nickte.
»Vor dem Regen suchten wir Schutz in einer Blockhütte, bis uns das Feuer daraus vertrieb, dann fanden wir Zuflucht im Wasser. Das war eine schreckliche Nacht, und doch schön — James, durch Feuer und Wasser!«
Harrlington drückte innig ihre Hand.
»Heisa, lustig, lustig, Mädels, laßt die Korken knallen und sorgt, daß die Gläser nicht leer stehen! So ein Stück Geld findet man nicht jeden Tag im Wald. Danke, ich trinke kein solches Zeug, es kitzelt mich zu sehr in der Nase und schmeckt zu süß.«
So brüllte Ralph, schlug auf den Tisch und sprach nur die letzten Worte höflich zu seiner schönen Nachbarin, welche ihm Champagner einschenken wollte.
Wenn Ralph seinen bereits annektierten Finderlohn recht bald ausgeben wollte, weil er ihm in der Tasche brannte, so war er hier an die rechte Schmiede gekommen. Hier schmiedete man das Eisen, wenn es warm war, das heißt, man ging dem Manne um den Bart, welcher Geld besaß, und da Ralph mit Papiergeld und den eingewechselten Goldstücken nur immer so um sich warf, so fehlte es an Zärtlichkeiten nicht.
Lucy, Katy, Mary, Anny und andere Mädchen mit auf y endigenden Namen saßen um den Tisch herum, lachten, schrien und johlten und schwiegen nur, wenn sie die Nase in das Champagnerglas vergruben. Links und rechts von Ralph saßen die beiden besseren Bewohner der Waldschenke.
Da die stille Cousine und die kokette Schwägerin erstens Verwandte von Peggy, der Wirtin, waren, und zweitens keine harten Arbeitshände, wie die übrigen Mädchen, besaßen und überhaupt einem besseren Eindruck machten, so mußten sie natürlich volltönendere Namen führen, und so hieß die stille Cousine Magdalen, die kokette Schwägerin hörte auf den Namen Eulalie.
Von einem ›besseren‹ Eindruck der beiden konnte man allerdings eigentlich nur im Gegensatz zu den anderen sprechen. Auch ihre Kleider waren an den Ellenbogen durchgescheuert, an der Taille fehlten Knöpfe, und Stecknadeln verschmähten sie, der Saum des Kleides war franzenartig — Eulalie trug einen buntgestreiften Unterrock, der ihre drallen Waden frei ließ, nur schade, daß die Strümpfe nicht mehr ganz heil waren — und im übrigen steckte ihr Haar in Papierwickeln. Die Mädchen, deren Namen auf y endigten, waren einfach ›lumpig‹ gekleidet. Keins wollte heute abend reizend erscheinen, weil keine Eroberungen zu machen waren.
Die Mädchen waren durchweg hübsch zu nennen; Magdalen, eine Blondine mit unschuldigen, schwärmerischen Kinderaugen, sehr zart gebaut und sehr still, Eulalie, eine üppige Brünette mit tiefschwarzem, blauschimmerndem Haar, voller Büste und junonischen Schultern. Sie war wirklich schön, viel schöner als Magdalen, dennoch sollte diese größere Triumphe feiern, als die kokette Eulalie. Das schüchterne Weibliche hat eben einen eigentümlichen Reiz.
Daß sich Eulalie im Unterrock befand, wurde schon erwähnt. Er verriet den Bau ihrer unteren Gliedmaßen in entzückender Weise. In ihrer burschikosen Weise rauchte sie Zigarren, während die übrigen die Lust mit Zigarettendampf füllten.
Peggy allein war sauber gekleidet und hatte das Haar gescheitelt. Trotz der Anwesenheit der vielen Dienstboten bediente sie selbst; im Augenblick aber saß sie auf Ralphs Schoß und ließ sich in die vollen Arme kneipen.
Hundertmal hatte der grauhaarige Sünder sie heute abend schon gefragt, ob sie ihn liebe. Peggy hatte stets mit einem aufrichtigen Ja geantwortet. Hundertmal wollte er ihr dann einen Kuß geben, aber immer wurde er daran durch irgend etwas verhindert, gewöhnlich, weil ihm ein Mädchen zutrank, und eine Minute später hatte er seinen Vorsatz stets vergessen.
Lucy trat eben wieder ein, warf die umgehängte Mantille ab, daß die nassen Tropfen über die Gesellschaft spritzten, und setzte sich wieder hin.
»Himmel, was für ein Regen,« sagte sie dabei, »alle Pumpen müssen oben in Bewegung sein. Man sieht schon gar kein Land mehr, alles ist Wasser.«
»Wasser, Wasser, sprecht nicht von Wasser,« schrie Ralph, »ich habe vor Wasser einen Abscheu; höchstens waschen tu ich mich drin, aber auch nur sehr selten.«
»Steht das Wasser wirklich schon hoch?« fragte Peggy das Mädchen.
»Wenn man sich hineinlegt, kann man darin ersaufen.«
»Ich mag nicht ersaufen,« schrie Ralph und schlug auf den Tisch.
»Hast du ja auch nicht nötig.«
»Ah, Peggy, bist du auch noch hier? Wahrhaftig, sitzt der kleine Mops noch auf meinem Schoß, und ich denke immer, das ist die Mary. Liebst du mich, Peggy?« »Ach, wenn du wüßtest, wie.«
»Dann gib mir einen Kuß!«
»Prosit Ralph,« rief Eulalie und stieß an sein Glas.
»Prosit,« entgegnete Ralph, trank und hatte den Kuß wieder vergessen.
»Ich denke, wir bekommen Gäste,« meinte Peggy, an Eulalie sich wendend.
»Zum Teufel mit den Gästen, wir schlagen sie tot!« brüllte Ralph.
»Unsinn, bei dem Regen kommt keiner,« entgegnete Eulalie.
»Dann brauchen wir keinen totzuschlagen.«
»Vor dem Regen scheut sich kein Präriemann,« sagte Peggy, »aber wenn der Boden mit Wasser bedeckt ist, schonen sie die Pferde.«
»Es ist gar nicht so schlimm.«
»Doch! Halte nur einmal deine Nase hinein, du wirst keinen Grund finden,« lachte Lucy.
»Dann können wir auch noch Gäste erwarten. Magdalen und Eulalie, zieht euch an!«
Eulalie hatte keine Lust, der Aufforderung der Wirtin nachzukommen, sie machte ein brummiges Gesicht.
»Wenn jemand kommt, hat es immer noch Zeit.«
»Zieht euch an, sage ich euch!« rief Peggy jedoch streng.
Die beiden erhoben sich und verließen brummend das Zimmer, das Wort ›blutig‹ ward einige Male hörbar.
Auch die übrigen Mädchen mußten sich nach und nach anziehen. Es war ihnen nicht recht. Wäre Peggy nicht so von dem weinseligen Cow-boy in Anspruch genommen gewesen, so hätte ihr Ohr die Worte ›verdammte Stülpnase‹ öfters zu hören bekommen.
Aber sie gehorchten doch sofort. So liebenswürdig Peggy auch war, sie konnte zur Furie werden, besonders wenn sie etwas getrunken hatte. Dann war mit ihr nicht gut Kirschen essen, der verwogenste Kerl bekommt manchmal vor dem ewig ›Weiblichen‹ heillosen Respekt.
Nach einer halben Stunde saßen die sechs Dienstmädchen — wie sie wenigstens im Hause genannt wurden — in einfacher, aber ganz hübscher Toilette um den Tisch herum, die Kleider etwas bunt, mit knallroten Bändern geschmückt, die Haare geordnet, die Gesichter gewaschen und etwas geschminkt.
Doch Gäste kamen noch nicht, nur der herkulische Hausknecht trat ab und zu ins Zimmer, um seine Kehle anzufeuchten.
Ralph hatte seine Freude an den Mädchen.
»Wo ist Eul — Eul — Eulalie?« brachte er schließlich mit schwerer Zunge hervor.
Eulalie und Magdalen ziehen sich noch an.«
»Sie sind schon fertig,« warf ein naseweises Mädchen ein.
»Dann sollen sie runterkommen,« schrie Ralph. »Verdammt, ich will sie sehen!«
»Sie können nicht kommen,« suchte Peggy ihn zu besänftigen.
»Warum denn nicht?«
»Das verstehst du nicht, Schatz.«
Der Cow-boy war nicht auf den Kopf gefallen, er lächelte schlau.
»O, ich weiß schon, warum nicht. Solange sie in ihren Lumpen steckten, waren sie gut genug, bei mir zu sitzen und mit mir zu saufen, weil sie aber nun ein bißchen fein angezogen sind, sollen sie oben in den Salons mit den weichen Stühlen bleiben. Aber verdammt will ich sein, wenn ich mir das gefallen lasse!« schrie er plötzlich, sprang auf und schlug donnernd auf den Tisch. »Herunter mit den beiden, her an den Tisch, damit sie weiter mit mir saufen.«
Peggy zog den Aufgeregten auf den Stuhl zurück.
»Du kannst oben mit ihnen trinken, aber nicht hier.«
»So, warum denn nicht?«
»Das ist gegen die Hausordnung.«
»Zum Teufel mit der Hausordnung! Kommen die beiden Mädels herunter oder nicht?«
»Sie dürfen nicht.«
Ralph sprang auf. Sein Rausch schien plötzlich verflogen zu sein. Er schnallte den Gürtel enger und drückte sich mit energischem Gesicht den alten Filzhut fest auf den Kopf.
Doch kam er nicht bis zur Tür, Peggy sprang auf ihn zu und umschlang ihn mit beiden Armen.
»Närrischer Kauz, wohin willst du?«
»Laß mich, fort will ich!«
»Du ersäufst ja draußen,« lachte Peggy.
»Kann ich machen, wie ich will, das geht dich gar nichts an. Das aber sage ich dir,« er machte sich unsanft aus Peggys Armen frei, »ich kann mein Geld verzehren, wo ich will, ich finde noch Plätze, wo ich anständiger behandelt werde, als hier, wo ich mein Geld auch los werden kann, wo man aber nicht die Mädchen hinausschickt, die ich gerade gern habe. Donner und Doria, so eine Gemeinheit! Denkst du, ich bin nur gut genug für sie, wenn sie in Lumpen gehen? Mein Geld ist ebensogut, wie das seiner Leute, mein Gold ist ebenso schwer. Verdamme meine Augen, ich will nach einer anderen Schenke, und wenn ich auch hinschwimmen sollte.«
Er wollte gehen.
»Aber Ralph,« rief Peggy bestürzt, »was fällt dir denn ein? So höre doch nur, ich habe ja etwas ganz anderes mit dir vor, etwas viel Schöneres.«
Sie schlang den Arm um ihn und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Der Cow-boy bog sich hintenüber, brach in ein schallendes Gelächter aus und zog dann ein ungemein pfiffiges Gesicht.
»Peggy, hältst du mich etwa für besoffen?«
»Durchaus nicht.«
»Na, dann will ich dir sagen, was ich denke: du hältst mich nämlich für einen solchen dummen Narren, wie sie hier oft einkehren, aber Ralph ist kein solcher, er hat nicht nur Haare unter der Nase, sondern auch auf den Zähnen. Ralph geht nicht so schnell auf den Leim.«
»Wie meinst du das?« fragte Peggy unschuldig. »Ich habe es doch nur gut mit dir vor.«
»Hahaha,« lachte Ralph aus vollem Halse, »der Teufel danke dir für diese Gutheit, ich tu's nicht. O, ich durchschaue deine Pläne. Wenn wir uns heiraten, bekommst du einen geriebenen Mann, der dir manche Nuß zu knacken geben wird. Du meinst also, ich soll mich mit den beiden Mädchen oben in die Salons setzen, ganz allein, heh? Na, mein Liebchen, das tut der alte Ralph nicht —«
»Mein Gott, was ist denn weiter dabei, du bist doch sonst nicht so zimperlich.«
»Laß doch diese Reden! Du denkst, hier unten kannst du mein Geld nicht schnell genug bekommen, oben aber, da geht es schneller, da zahlt man Salonpreise, für einen Fingerhut Whisky einen Dollar, für einen Kuß fünf Dollar. Na, mein Liebchen, das tun wir nicht, ich bleibe hübsch hier unten und trinke aus großen Gläsern, bis meine 8000 Dollar alle sind. Einige Tage wird es wohl noch dauern, denn tausend habe ich erst spendiert. Und wenn du etwa geglaubt hast, du könntest mir da oben in den Salons mit deinen Mädeln den ganzen Fund, die übrigen 72 000 Dollar, aus der Tasche locken, dann hast du dich geirrt, das merke dir. Ralph ist weder ein verliebter Pudel, noch ein Narr.«
Peggy biß sich auf die Lippen, der schlaue Alte war wirklich nicht auf den Kopf gefallen, er hatte ihre Absicht durchschaut. Doch gleich ward sie wieder freundlich.
»Nun, wie du willst, bleibe unten! Wir sprechen nicht mehr darüber.«
»Oho, so schnell geht das nicht, die Mädel müssen herunter, oder ich gehe doch noch.«
»Sie sind ja schon da,« rief Peggy.
Die Tür öffnete sich, und Magdalen und Eulalie traten ein, sie hatten schon draußen gewartet.
»Ah, großartig,« schrie Ralph, »das sind ja die reinen Wachspuppen. Uebrigens,« wendete er sich an Peggy und klopfte sie auf die Schulter, »ich wäre doch nicht gegangen, wenn sie auch nicht gekommen wären. Draußen ist es mir zu naß, und hier ist es hübsch trocken, ich wäre also sowieso hiergeblieben. Du bist eben reingefallen, Schätzchen.«
Peggy nahm die Sache nicht weiter übel; ihre gute Laune war schnell wiederhergestellt. Einem Cow-boy gegenüber half Schmollen gar nichts. Beide nahmen unter den schadenfroh kichernden Mädchen wieder Platz, ebenso Eulalie und Magdalen.
Ralphs altes Herz begann doch etwas schneller zu schlagen, als er zwischen diese beiden zu sitzen kam; er vergaß Peggy vollständig, und diese war's zufrieden.
Magdalen und Eulalie waren nämlich gekleidet, als wollten sie in große Gesellschaft gehen — doch nein, da hätten sie keinen Einlaß bekommen — etwa wie zu einem Kostümball, auf dem es zum Schluß etwas frei herzugehen pflegt: Die Kleider tief ausgeschnitten, die Arme bloß und das Röckchen nur bis an die Knie reichend. An den Handgelenken, den Fingern und am Hals wie im hochfrisierten Haar blitzte Geschmeide, die Wangen zeigten den rosigen Hauch der Pfirsiche und die Lippen die Röte von Korallen.
Die scheue Magdalen, welche ihre zarte Büste mit einem weißen Flor verhüllt hatte, trug ein blaues Atlaskleid mit roter Schärpe, die stark dekolletierte Eulalie ein rotes Atlaskleid mit blauer Schärpe, und die weiße Haut der letzteren stach wirklich entzückend von dem roten Atlas ab, der sich eng um den vollen Körper schmiegte.
Ralph saß so verblüfft da, daß die Mädchen sich kichernd anstießen und die beiden Bewunderten ihn lächelnd ansahen. Noch nie hatte er derartige Erscheinungen gesehen, trotzdem er ein stürmisches Leben hinter sich hatte, in dem Frauen und Mädchen eine große Rolle gespielt hatten. Eine solche Eleganz hatte er noch nie gesehen. »Donnerwetter, sind denn das nur wirklich die Mädels, welche so saufen können?« brachte er endlich nach langer Pause zögernd hervor.
Ein lautes Gelächter erscholl, und damit war der Bann gebrochen, der den verwegenen Cow-boy fast zum schüchternen Jüngling gemacht hätte.
Ralph fühlte sich sofort zu Magdalen hingezogen, sei es, weil die halbverhüllten Reize der zarten Gestalt seine Sinne entflammten, sei es, weil ihm das stille Wesen der scheuen Cousine mehr gefiel, als die offene, zudringliche Schönheit der anderen.
»Narrenspossen,« rief er, »habt ihr euch auch mit ein paar bunten Lappen behangen, ihr werdet doch nichts süßeres, als ihr gewesen seid. Komm, Magdalen, laß dich umarmen.«
Er wollte seinen Arm um die Taille des Mädchens schlingen, doch dieses entschlüpfte ihm schnell.
»Nicht so schnell, das darfst du nicht.«
»Darf ich nicht? All right, dann bekommst du keinen Champagner mehr. Kannst Regenwasser trinken.«
Magdalen unterhandelte, ein Blick Peggys hatte sie dazu aufgefordert.
»Doch! Du darfst es, aber unter Bedingungen.«
»Was für welche?«
»Daß du dir erst die Hände wäschst.«
Unter dem Gelächter der übrigen betrachtete Ralph verblüfft seine beiden Hände, welche eine braunschwarze Färbung zeigten.
»Warum soll ich sie erst waschen?«
»Weil sie lange nicht mit Seife in Berührung gekommen sind.«
»Seife, Seife,« murmelte Ralph nachdenklich, »richtig, das ist das Zeug, mit dem sich seine Leute einschmieren, damit sie rein werden. Nein, Magda, ich gebrauche prinzipiell keine Seife, ich bin kein solches Vieh, Faktum! Mach keine Geschichten, setz' dich her!«
»Ich lasse mich nicht anfassen, solange du dich nicht gewaschen hast. Faktum!«
»Unsinn, warum nicht?«
»Deine Hände färben ab.«
»Ah so, du denkst, dein Kleid bekommt Flecke?«
»Natürlich. Was meinst du wohl, was so ein Kleid kostet?«
Ralph betrachtete die zierliche Gestalt von oben bis unten, fing bei dem aschblonden, in der Stirn gelockten Haar an und hörte bei den mit silbernen Schnallen besetzten Goldkäferschuhen auf. Er schmunzelte, vielleicht hatte er die Zeichensprache Peggys, welche sich mit Magdalen verständigte, bemerkt, vielleicht auch nicht.
»Nun, wieviel kostet es?«
»Fünfhundert Dollar.«
»Donnerwetter, so viel kostete mein Hemd und meine Hose freilich nicht.«
»Das glaube ich. Und darum will ich mich auch nicht von deinen schmutzigen Händen anfassen lassen. Wasche dich erst!«
»Ich wasche mich um keinen Preis der Welt, ich bin keine Katze.«
»Und ich lasse mich nicht anfassen!«
Bedächtig griff Ralph in seinen Hemdenschlitz und zog zehn Hundertdollarnoten hervor. Sofort saß Magdalen auf ihrem alten Platz neben ihm.
»Das sind tausend Dollar. Stimmt es?«
»Es ist richtig. Fünfhundert kostet das Kleid, das andere ist für mich, nun darfst du mich umarmen.«
»Unsinn,« lachte Ralph, »verschenken will ich nichts.«
Damit griff er nach links und rechts, umschlang je ein Mädchen und zog sie beide auf seine Knie. Eulalie sträubte sich erst ein wenig, ließ es sich dann aber gefallen.
»Dein Kleid ist auch bezahlt, also laß das Zappeln,« meint« Ralph, die beiden Mädchen hin- und herwiegend, »Sieh, Mutter Peggy ist zufrieden, sie streicht schon das Geld ein.«
Ralph bekam bald noch andere Gelüste.

»Was kostet oben im Salon ein Kuß von euch?«
»Fünfzig Dollar,« war die prompte Antwort. »Verdammt, ihr seid teure Mädels. Na, meinetwegen, ich hab's ja.«
Er legte zwanzig Dollar auf den Tisch.
»Von jeder einen Kuß.«
»Dann macht's aber hundert Dollar.«
»Mach keinen Schwindel. Oben ist alles fünfmal teurer, Peggy hat's mir oft genug erzählt. Zwanzig Dollar für zwei Küsse und keinen Cent mehr, basta!«
Die listige Peggy, welche nur fürchtete, daß der kurzangebundene Ralph anderen Sinnes werden könne, steckte das Geld schnell ein. Der Handel war abgeschlossen.
Schon spitzte der verliebt gewordene Cow-boy die Lippen, Eulalie ebenfalls, als etwas geschah, wodurch der Kuß wieder vereitelt wurde.
Draußen erschollen Hufschläge; man hörte, wie ein Mann vom Pferde sprang und nach dem Knecht rief. Dieser kam und nahm dem Reiter das Tier ab.
»Was für ein Haus ist das?«
»Die Waldschenke zur schönen Peggy.«
»Wie? Hier so einsam steht eine Schenke?«
»Ja, warum nicht?«
»So, hm, mag ein sauberes Etablissement sein, wahrscheinlich eine richtige Räuberhöhle.«
Der Schritt näherte sich der Tür.
»Was sagt der Kerl? Das wäre hier eine Räuberhöhle?« sagte Ralph und ließ die beiden Mädchen los, welche schnell ihre Kleider ordneten. »Da soll doch gleich —«
»Still,« flüsterte Peggy, »das ist ein völlig Fremder. Dem Wollen wir einmal zeigen, in was für eine Gesellschaft er kommt. Ihr wißt doch, was ich meine,« wandte sie sich an alle Mädchen.
»Natürlich, natürlich, wie damals bei dem fremden Engländer,« tönte es leise von allen Seiten, noch einmal ein leises Kichern, dann wurden alle Gesichter ernst, man setzte sich ehrbar auf den Stühlen zurecht und schwieg.
»Und du hältst dein Maul,« flüsterte Peggy dem Cow-boy zu, »sonst verdirbst du alles.«
Ralph zog das schlaueste seiner schlauen Gesichter. »O, ich weiß schon, was du willst, ich bin kein solcher Hornochse, wie du denkst.«
»Desto besser für dich. Still jetzt!«
Ein Mann trat herein, noch ziemlich jung, in einen Reitanzug gekleidet, der noch vor kurzem elegant gewesen sein mußte, wie man leicht erkennen konnte, vielleicht noch vor wenigen Stunden; jetzt aber war er an vielen Stellen zerrissen, ja zerfetzt und mit Schlamm bespritzt, der vom Regen etwas wieder abgewaschen worden war. Der Reiter mußte einen schweren Ritt durch dorniges Gestrüpp gemacht haben.
Er blieb an der Tür stehen und betrachtete erstaunt die von der Petroleumlampe erleuchtete, mit Ausnahme Ralphs, nobelgekleidete Gesellschaft, welche aber keine Notiz von ihm nahm.
»Er hat kein besonders schlaues Gesicht,« flüsterte Peggy, »mit dem können wir spielen. Es ist ein Gentleman, der sich wahrscheinlich auf der Jagd verirrte.«
Sie ging auf den regungslos Dastehenden zu und begrüßte ihn mit freundlichen Worten.
»Guten Abend, Sir. Sind Sie auch vom Regen hart mitgenommen worden?«
»Ja, Missis, es ist ein fürchterliches Wetter, man muß sich auf der Prärie nur immer durch Wasserlöcher arbeiten.«
Der Fremde spritzte das Wasser von der Jockeimütze, sein Blick flog dabei argwöhnisch an den Tisch hinüber. Die Wirtin fing den Blick auf; schnell trat sie dicht an ihn heran und flüsterte:
»Stoßen Sie sich ja nicht an der Gesellschaft, Sir. Auf einer Farm, nicht weit von hier, war Kostümball, jener Herr und die beiden Damen dort sind bei der Rückkehr vom Fest hier eingeregnet, ebenso die sechs jungen Mädchen, welche Besuch auf einer benachbarten Farm gemacht haben.«
»Ah so, nun kann ich mir alles erklären,« lachte der Fremde.
»Darf ich Sie, da Sie doch längere Zeit hier verweilen müssen, den Herrschaften vorstellen?« fragte die weltgewandte Peggy. »Not kennt kein Gebot. Lassen wir einmal die gewöhnliche Steifheit fallen —«
»Und denken wir, wir befänden uns, aus Wassersnot gerettet, auf sicherem Felsen,« ergänzte der Fremde lächelnd. »Mein Name ist Paddington.«
Beide traten an den Tisch, die Gesellschaft blickte auf.
»Mister Paddington, ein vor dem Tode des Ertrinkens hier Rettung suchender Gentleman — Mister Adolphs, Missis Adolphs,« stellte Peggy vor. Ralph und Eulalie als ein Ehepaar bezeichnend, »Miß Freeman, Missis Adolphs Schwester,« das war Magdalen.
Steife Verbeugungen auf beiden Seiten folgten. Selbst Ralph machte seine Sache sehr gut. Dann folgte die Vorstellung der übrigen Mädchen als Töchter von Farmern, wenn dies auch nicht gesagt wurde. Die Vorstellung ging glatt vonstatten, die Mädchen besaßen alle so viel Routine, wie sie eben gebrauchten. Dann aber ging's los.
»Hahaha, hohoho,« brüllte Ralph plötzlich heraus, als sich alle wieder gesetzt hatten, und schlug mit der Faust auf den Tisch, »hohoho, ich ersticke!«
Der Fremde sah ihn erstaunt an.
»Mein Mann hat sich auf dem Kostümball so ausgezeichnet amüsiert,« nahm Eulalie schnell das Wort, »die Wirtin hat Ihnen doch schon gesagt —«
»Mein Schwager hat sich als Cow-boy verkleidet,« fiel Magdalen mit einer Geistesgegenwart ein, die man dem unschuldig blickenden Mädchen gar nicht zugetraut hätte, »und einer Wette zufolge will er seine Rolle bis morgen mittag 12 Uhr weiterspielen. Fällt er bis dahin nur einmal aus der Rolle, so habe ich gewonnen. Ist das nicht reizend?«
»In der Tat, das ist reizend,« lächelte der Fremde. »Darf ich fragen, welcher Zeit Ihr Kostüm entspricht?«
»Es ist das Kostüm einer altfränkischen Edeldame.« »Hohoho,« brüllte Ralph weiter, »alte — fränkische — edle — Dame.«
Der Fremde warf eine prüfenden Blick an der altfränkischen Edeldame hinunter, und diese, ahnend, daß Edeldamen eher Schlepp- als Kniekleider tragen, steckte schnell die unbedeckten Beine unter den Tisch.
»Wie unangenehm!« flüsterte sie verschämt. »Liebe Frau Wirtin, sind unsere Umschlagtücher noch nicht trocken? Wir sind in einer fatalen Situation.«
»Ich habe eben erst nachgesehen,« entgegnete Peggy, »aber obgleich sie dicht am Feuer hängen, sind sie doch noch feucht. Soll ich Ihnen einen Mantel von mir bringen?«
Magdalens schüchterner Blick streifte den Fremden.
»Meinetwegen genieren Sie sich ja nicht,« beeilte sich dieser zu sagen, »überdies ist es hier sehr warm. Sie glauben nicht, wie sehr es mich freut, hier so reizende Gesellschaft zu finden.«
»Hohoho,« schrie Ralph, »reizende Gesellschaft das. Jeder Kuß kostet zehn Dollar. Wollt Ihr auch einmal bezahlen?«
»Bernard, übertreibe deine Rolle nicht,« ermahnte ihn seine Frau.
»Verdammt, wenn ich übertreibe. Ihr blutigen Mädels versteht doch, einen bis aufs Blut auszusaugen.«
Dabei stürzte er ein großes Glas Whisky hinunter.
»Ihr Herr Gemahl spielt den Cow-boy sehr getreu,« wandte sich Paddington an dessen Frau.
»Leider ja, er spielt zu natürlich, selbst die Hände hat er schwarzbraun gefärbt. Ich weiß gar nicht, woher er plötzlich so furchtbare Flüche gelernt hat, sonst brachte er nie einen über seine Lippen.«
Der Cow-boy wälzte sich vor Lachen; auch die sechs Dirnen konnten das Lachen kaum noch verbeißen, nur Peggy, die beiden Mädchen und der Fremde blieben ernst.
So ging die Unterhaltung lange Zeit weiter, nur daß Ralph jetzt anfing, bei jedem Wort, das seine Lachlust erregte, den schönen Nachbarinnen derb auf den Fuß zu treten, so daß manchmal schmerzliche Gesichter zu sehen waren, und als er von Eulalie einmal dafür einen heimlichen, aber nichtsdestoweniger derben Rippenstoß bekam, brach auch eine der Damen in Lachen aus.
Verwundert blickte Paddington nach dem Mädchen, das ohne jeden Grund so auflachte, und diese Gelegenheit hielt Ralph für günstig, seine Meinung über den ahnungslosen Fremden zu äußern. Er deutete schnell auf ihn und klopfte dann mit dem Knöchel auf seine Stirn.
Darüber brachen alle sechs Dirnen gleichzeitig in Lachen aus, trotz der drohenden Miene Peggys.
»Ein lustiges Völkchen,« sagte Paddington leise zu Eulalie.
»Ja, etwas übermütig. Sie besitzen nicht den rechten Anstand.«
»Mein Gott, Jugend hat keine Tugend.«
»Sie sind auch zu entschuldigen, es sind Töchter von kleinen Farmern, müssen hart arbeiten und kommen daher viel mit Knechten in Berührung.«
»Sie waren mit auf dem Balle?«
»Wo denken Sie hin? Auf dem Kostümball waren nur die reichsten Familien der Umgegend. Unkostümierte hatten überhaupt keinen Zutritt.«
»Ach so. Ihr Kleid steht Ihnen übrigens vortrefflich.«
»Nicht wahr? Ich habe es auch in New-York anfertigen lassen.«
Da sich das Gespräch jetzt nicht mehr um Anwesende drehte, wurde es wieder lauter.
»Ist Ihr Kleid auch in New-York gefertigt worden?« wandte sich Paddington an Magdalen.
»Gewiß. Es hat schweres Geld gekostet.«
»Das glaube ich. In Blackwels-Island vielleicht?«
Das Lachen und Kichern verstummt plötzlich; eine lautlose Stille trat ein, alle saßen wie versteinert da. Selbst die sonst so kaltblütige Peggy blieb, ein Brett mit Gläsern in der Hand, in der Stube stehen und starrte den Fremden erschrocken an.
»Was sagten Sie da?« brachte Magdalen endlich hervor.
Blackwels-Island ist eine Insel in der Nähe von New-York und in ganz Amerika bekannt, weil sich auf ihr das strengste Zuchthaus für schwere Verbrecher befindet. Daher rührte bei allen das namenlose Entsetzen.
Der Fremde wurde sichtlich verlegen.
»O, entschuldigen Sie, es war eine Dummheit von mir,« entgegnete er. »Eine Ähnlichkeit fiel mir auf, ich fühlte mich plötzlich nach Blackwels-Island versetzt, und deshalb kam mir dieses Wort über die Lippen.«
»Sie waren in Blackwels-Island?« rief Eulalie und schlug die Hände vor Schrecken zusammen.
»Gewiß,« nickte Mister Paddington ernsthaft, »ich war dort im Zuchthaus.«
»Im Zuchthaus?«
»Im Zuchthaus, einige Jahre.«
Die Mädchen schrien auf, Ralph rückte mit mißtrauischer Miene seinen Stuhl fort, und Magdalen verhielt sich ganz sonderbar. Sie setzte das Glas an den Mund, als wolle sie ihr Gesicht verdecken, und ihre Hand zitterte dabei.
»Ihr seid entsprungen?« fragte Ralph.
»Ach wo!«
»Habt also Eure Zeit hinter Euch?«
»Natürlich.«
»Welche Ähnlichkeit fiel Ihnen auf, wie Sie vorhin sagten?« fragte Eulalie, die sehr interessiert schien.
»Hm, ich lernte dort ein junges Mädchen kennen, welches vier Jahre wegen Kindesmords absitzen mußte. Die Strafe dünkt Ihnen für so ein schweres Verbrechen sehr gering, wie ich Ihren erstaunten Mienen entnehme, aber es wurden mildernde Umstände angenommen, besonders deswegen, weil der Vater des Kindes mit unter den Richtern saß. Sie wissen ja, wie es in der Welt zugeht. Ida Cohen war der Name jenes Mädchens, habe oft mit ihr gesprochen, und ich sage Ihnen, ohne Beleidigung, sie sah Ihnen ähnlich, Miß Freeman, wie aus den Augen geschnitten.«
»Was hast du denn, Magda — Schwester!« rief Eulalie erschrocken.
Magdalen hatte sich langsam erhoben und blickte mit den Augen einer Toten auf den Erzähler, der sich in den Stuhl zurückgelehnt hatte, seine Zigarre rauchte und seine Blicke scharf umherfliegen ließ.
»Nichts,« hauchte Magdalen und ließ sich wieder auf den Stuhl fallen, »mir wurde unwohl, ich bin zu fest geschnürt.«
»Und Ihr seid doch ein ganz verdammter Lügner,« rief Ralph und schlug auf den Tisch. »Ich weiß ganz genau, daß die Verbrecher zu Blackwels-Island alle in Einzelzellen sitzen und nie zusammenkommen.«
»Das stimmt, wart Ihr dort?«
»Hütet Eure Zunge, ich bin kein Sträfling gewesen!«
»Ich auch nicht.«
»Ich denke, Ihr wart im Zuchthaus?«
»Na, ja.«
»Dann seid Ihr auch ein Verbrecher.«
»Gott bewahre, ich war als Justizbeamter dort.«
Der vorige Schrecken wiederholte sich. Peggy ließ eine Champagnerflasche fallen, daß der Kork mit einem lauten Knall an die Decke flog. Am meisten entsetzt aber war Eulalie, sie sank fast vom Stuhl.
»Erschrecken Sie doch nicht so, Missis,« lächelte Paddington, »was ist denn weiter dabei, wenn Sie auch in den Tombs Tombs (sprich tuhms), wörtlich übersetzt Gräber, heißen in New-York die Gefängnisse. ein Jahr lang Tauwerk gezupft haben. Damals nannten Sie sich allerdings Julie Morris und hatten ein sehr liebedürftiges Herz, was die Polizei nicht dulden durfte; daß Sie aber an Ralph, den Cow-boy verheiratet sind, habe ich nicht gewußt — ich gratuliere Ihnen noch nachträglich — und daß Ida Cohen Ihre Schwester ist, ebensowenig.«
Einen Augenblick herrschte lähmendes Entsetzen, dann aber war es, als ob eine Granate im Zimmer geplatzt wäre. Alles sprang auf, mit Ausnahme des Sprechers. Magdalen hielt sich zitternd an der Stuhllehne fest, und Eulalie wollte sogar hinauseilen, brach aber, halb ohnmächtig, in einem Lehnstuhl zusammen.
»Donner und Doria!« sagte Ralph endlich leise mit drohenden Augen. »Ich sehe zwar, daß Ihr unser lächerliches Spiel durchschaut habt, wie könnt Ihr aber wagen, solche Anschuldigungen zu erheben?«
»Es sind keine leeren Anschuldigungen, ich spreche die Wahrheit. Ich bin Detektiv, aber,« sagte er schnell, als er neues Entsetzen bemerkte, denn außer Ralph schien hier niemand ein gutes Gewissen zu besitzen, »habt keine Angst, ich stehe nicht mehr in Staatsdiensten. Meinetwegen mögt Ihr noch so viel auf dem Kerbholz haben, ich kümmere mich nicht darum, sonst wäre ich wohl nicht so dumm und würde mich gemütlich als Detektiv zu erkennen geben.«
Jetzt war die Bestürzung schnell vorüber. Alle atmeten erleichtert auf, nur Ralph nicht. Starr blickte er auf Magdalen.
»Was, die, die da,« er deutete auf das Mädchen, »diese mit den unschuldigen Augen, die so still ist, die soll ihr Kind gemordet haben? Sagt es noch einmal!«

»Was? Die da mit den unschuldigen Augen,« rief
Ralph, »die soll ihr Kind gemordet haben?«
Magdalen zeigte plötzlich ein äußerst freches Lachen, der Detektiv zuckte gleichgültig die Achseln.
»Wer einen Stein auf sie werfen kann, der tue es,« sagte er gedämpft, »ich kann es nicht. Vor den Menschen hat sie ihre Schuld abgebüßt, vor einem späteren Richter hat sie sich noch zu verantworten. Doch Gott ist, glaube ich wenigstens, ein gnädigerer Richter, als die irdischen, weil er die Verhältnisse besser durchschaut, als wir blinden Maulwürfe. Drum nochmals: wer einen Stein auf sie werfen will, der tue es, ich tue es nicht, damit ich nicht ins Gericht komme, wenn sie freigesprochen wird.«
Diese Worte, so gleichgültig sie auch gesprochen waren, verfehlten ihren Eindruck nicht. Todesstille herrschte in dem Gemach, in dem sich Dirnen, bestrafte und unbestrafte, aber alle schuldbewußt, befanden, man hörte den Holzwurm in der Wand klopfen.
Magdalens freches Lachen, das ihre Züge entstellt hatte, war verschwunden, sie beugte sich vor und flüsterte:
»Ich danke Euch, Fremder.«
Doch dem Detektiven schien gar nicht viel daran gelegen, eine sentimentale Stimmung hervorzurufen oder gar etwa Bekehrungsversuche zu machen, seine nachfolgenden Worte verwischten sofort den erzielten Eindruck wieder.
»Ich merkte sofort,« fuhr er fort, »was für ein Spiel mit mir getrieben werden sollte. Erstens trügt mein Auge selten, zweitens bin ich hier sehr wohl bekannt. Wenn die schöne Peggy mich genauer betrachtet, könnte sie vielleicht ein bekanntes Gesicht entdecken.«
»Wer seid Ihr denn?« rief Peggy.
»Ein Detektiv. Nur daß ich nicht Paddington heiße.«
»Wie heißt Ihr?«
»Das tut nichts zur Sache. Verlaßt Euch darauf, daß ich viel mit Euch verkehrt habe, und daß Ihr es mir verdankt, wenn Ihr hier die Gäste bedient. Ich habe manches Euretwegen getan, was ich nicht vor meinen Vorgesetzten, wohl aber vor meinem Gewissen verantworten konnte und jetzt noch kann.«
»Mein Gott,« schrie Peggy halb erschrocken, halb erfreut, »ist es möglich, Ihr wäret —«
»Laßt es gut sein, ich bin derjenige, den Ihr wahrscheinlich meint. Ich merkte also, was Ihr mit mir vorhattet, und da ich gerade sehr übel gelaunt war, weil mir ein Plan mißglückt ist, so ging ich auf Euer Spielchen ein, um mich zu erheitern. Und das ist mir gelungen, ich habe meine gute Laune wieder.«
»Was ist Euch denn mißglückt?« fragte Ralph.
»Das ist meine Sache,« entgegnete der Mann kurz. »Und jetzt, Kinder, laßt euch nicht durch Erinnerungen stören, ich hätte gar nicht daran rühren sollen. Man lebt nur einmal in der Welt, darum lustig, laßt es draußen regnen, wir wollen uns schon hier die Langeweile fernhalten!«
»Bei Gottes Tod,« schrie Ralph, »ja, das wollen wir. Mir brennt das Geld sowieso wieder in der Tasche, weil ich vorhin nicht genügend ausgeben konnte. Habe ich aber meine Rolle nicht prachtvoll gespielt, Peggy?«
»Ausgezeichnet,« lachte diese.
Es ging seinen alten Gang, die Gläser wurden gefüllt, und bald erklang wieder Jubeln und Lachen. Der Detektiv war der Tollsten einer, nur manchmal wurde er plötzlich ernst, blickte gerade vor sich hin, aber nur, um dann desto fröhlicher zu werden.
»Zum Teufel mit den dummen Gedanken! Ob man weint oder lacht oder flucht oder sonst etwas tut, das ändert doch nicht, was einmal nicht zu ändern ist.«
Bald verlor man alle Scheu vor dem Detektiven, besonders als er noch einmal versicherte, er sei nicht amtlich hier, stehe überhaupt nicht in Diensten der geheimen Polizei, sondern halte sich in dieser Gegend nur auf, um privatim mit einem Manne ein Hühnchen zu rupfen.
Weiter ließ er sich nicht aus, sondern erklärte nur noch, daß er eben eine große Schlappe erlitten, der Gesuchte sei ihm nämlich entgangen, und er wünsche nun, seine schlechte Laune durch reichliches Trinken und durch lustige Gesellschaft zu verscheuchen.
Man findet oft, daß zwischen Polizei und Verbrechern, so schlimme Feinde sie auch sein müßten, ein harmonisches Verhältnis besteht, in dem Humor eine große Rolle spielt. Zahllose Geschichten erzählen davon, und es ist auch in Wirklichkeit so. Die Polizisten bekommen von den Verbrechern oft genug zu hören, daß sie ohne dieselben brotlos wären, und sie erkennen dies auch an.
So herrschte auch hier völlige Einigkeit, es wurden Schwänke zum besten gegeben, die Mädchen erzählten die haarsträubendsten Dinge aus ihrem vielbewegten Leben, und der Detektiv ergötzte wiederum sie mit seinen Erlebnissen.
Ralph sorgte dafür, daß die Gläser nie leer wurden. Obgleich sich der Detektiv zuerst gewundert hatte, woher der Cow-boy am Anfange der Season so viel Geld besaß, fragte er doch nicht darnach. Was ging es ihm an? Hatte der Mann es gestohlen, so wurde es doch alle gemacht, warum sollte er da nicht mit helfen? Sein Gewissen sprach ihn von der Pflicht frei, nach der Quelle dieses Geldes zu forschen.
Als jedoch die Lustigkeit ihren Höhepunkt erreicht hatte, geschah etwas, was der Unterhaltung eine andere Wendung gab. Der laute Lärm verstummte, die Gesellschaft sollte sich, wie schon vorhin, wieder einmal im stillen amüsieren.
Draußen erscholl eine Stimme, laut nach dem Wirt, Hausknecht oder sonst einem männlichen Wesen rufend.
»Ein neuer Gast, den der Regen zur Einkehr zwingt,« sagte Peggy.
»Wie freundlich und sanft er nach dem Hausknecht ruft,« meinte Eulalie. »Gerade, als wollte er einen widerspenstigen Hund an sich heranlocken.«
»Still,« flüsterte der Detektiv, »ich weiß, wer er ist.«
»Ihr scheint ja jeden in Amerika zu kennen.«
Der Hausknecht war unterdes draußen erschienen.
»Ist dies die Waldschenke, lieber Freund?« hörte man eine weiche, tremolierende Stimme fragen.
»Da seid Ihr auf dem richtigen Wege, Fremder, wenn Ihr die sucht,« entgegnete der Hausknecht.
»Es ist ein anständiges Haus?«
»Verdamm' mich, wenn es das nicht ist, hier verkehren nur feine Gentlemen.«
»Sie dürfen nicht fluchen, mein Bruder, wehe Ihnen, wenn Gott Sie beim Wort nimmt! Jeder Fluch ist ein Gebet zum Teufel. Wußten Sie das noch nicht?«
»Verdamm' mich, nein, das wußte ich noch nicht.«
»So fluchen Sie nicht mehr, um Ihrer Seligkeit willen.«
»Verdamm' mich, ich tu's nicht mehr, wenn Ihr's durchaus wünscht. Wollt Ihr aber da im Regen stehen bleiben? Ihr werdet bald weggespült.«
»Wir sind in Gottes Hand, zu Wasser oder zu Lande, kein Haar wird uns gekrümmt, wenn er es nicht will.«
»Zum Teufel, nun tretet ein.«
In der Hausflur erscholl ein Stampfen.
»Das ist ein Pfaffe,« flüsterte Peggy.
»Brrrr, nun wird es hier heilig,« lachte Eulalie.
»Ihr kennt ihn?«
»Er ist ein Wanderprediger, ein Indianermissionar,« erklärte der Detektiv, während die weiche Stimme draußen dem Hausknecht noch eine Ermahnung wegen seines Fluchens gab, »betreibt seine Mission erst seit Wochen. Ich lernte ihn in St. Louis kennen, wo er allgemein der heilige Elias genannt wurde. Sein Name ist auch Mister Elias, jedenfalls ein angenommener. Ich traf ihn vorhin. Er hatte sich verirrt und fragte nach einer Herberge, wo er übernachten könnte. Er betonte wiederholt, daß er nur in ein ganz anständiges Haus gehen wollte, und so habe ich ihn hierhergewiesen.«
»Da habt Ihr ihm gerade das richtige Haus gezeigt,« lachte Eulalie. »Warum kam er nicht mit Euch?«
»Ich war zu Pferde, er zu Fuß.«
»Ein Indianermissionar?«
»Ja, aber noch ein vollkommener Neuling. Er hoffte sich Lorbeeren zu verdienen, ist überhaupt furchtbar ruhmbegierig und sucht mit jedem Freundschaft zu schließen, der reich ist oder irgend einen Rang einnimmt. Er ist eben ein Streber.«
»Und er ist so bedacht darauf, in ein anständiges Haus zu kommen?«
»Er hält es seiner Priesterwürde für angemessen, sich der größten Sittenreinheit zu befleißigen. Bei dem kleinsten, unlauteren Wort kann er schon erröten und den Fluch Gottes auf das Haupt des Schuldigen rufen. Damit ist er sehr freigebig, er hält sich für einen Heiligen und darum für dazu berechtigt.«
»Er wird schön erschrecken, wenn er uns hier sitzen sieht.«
»Spielt doch das mit ihm, was Ihr mit mir vorhattet.«
»Wahrhaftig, das tun wir.«
»Aber laßt mich möglichst aus dem Spiele, solange ich nicht freiwillig eingreife.«
Jetzt machte der Neuangekommene Anstalten, die Stube zu betreten, zögerte aber noch etwas.
»Es ist also viel Gesellschaft drin?« fragte er.
»So ein Stücker zehn Menschen.«
»Alle anständig?«
»Aeußerst anständig, und nobel angezogen, sage ich Euch, Ihr werdet staunen.«
»Der Mann Gottes ist über Eitelkeit erhaben, er läßt sich nicht von ihr bestechen, sondern verlacht sie. Was tun sie?«
»Sie trinken.«
»Wehe ihnen, sie werden so lange trinken, bis Gott ihnen die Sintflut schickt, in der sie ertrinken.«
»Dann ersauft Ihr aber auch mit, Herr Missionar.« »Gott liebt seine Auserwählten, er wird ihnen die Arche Noah senden und sie retten.«
»Da steige ich mit ein.«
Die Tür öffnete sich, und herein trat ein noch sehr junger Mann, schwarz gekleidet, vollständig durchnäßt, einen triefenden Regenschirm in der einen, eine große Tasche in der anderen Hand und auf dem kurzgeschorenen Haar einen sogenannten Missionarshut. Sein bartloses Gesicht mit der herabhängenden Unterlippe war fleischig, auf der Nase saß eine Brille.
Er stellte die Tasche in eine Ecke, nahm die angelaufene Brille ab, um sie abzuwischen, und erblickte jetzt erst die zahlreiche Gesellschaft, welche sich lautlos verhalten hatte.
Seine Bewegungen hörten plötzlich auf, das Tuch in der Hand, blickte er wie versteinert nach den beiden dekolletierten Damen, eine fürchterliche Ahnung stieg in ihm auf.
Mit theatralischer Armbewegung trat er einen Schritt vor.
»Wehe mir,« rief er, »was erblicken meine Augen, in was für ein Haus bin ich geraten? Sehe ich nicht Töchter der Freude hier zu einem Trinkgelage versammelt, Freudenmädchen? Hah, nun erkenne ich Gottes Walten, die Sintflut bereitet sich vor, diese verdorbenen Geschöpfe zu vernichten, fürwahr, es ist die höchste Zeit, daß die Erde von der Schlangenbrut befreit wird, deren Hauch schon die Luft verpestet.«
»Da sind Sie sehr im Irrtum, Herr Missionar,« entgegnete Peggy, vor ihn hintretend. »Sie finden hier durchaus keine solche Gesellschaft, wie Sie vermuten, das sind höchst anständige Personen, mit denen zu verkehren Ihnen eine Ehre sein müßte.«
»Freudenmädchen? Hat sich selbst hier in der Wildnis dieses höllische Gezücht eingenistet? Ich muß fort von hier, schnell fort« — er griff nach seiner Tasche — »daß ich nicht entheiligt werde und Gott sich mit Verachtung von mir wendet. Wie schreibt Paulus an die Korinther im 1. Briefe 6. Kapitel?«
»Das weiß ich wirklich nicht, weiß überhaupt nicht, was Mister Paulus für ein Gentleman ist. Das sage ich Ihnen aber, Sie sind hier in einer sehr anständigen Gesellschaft, denn ich bin eine ehrbare Witwe, welche keine zweifelhaften Gäste duldet.«
Jetzt wurde der Priester hitzig.
»Ehrbare Witwe?« donnerte er die Wirtin an. »Wissen Sie, was der Apostel über die Witwen sagt — «
»Ist mir ganz egal, was Ihr einfältiger Apostel über die Witwen sagt. Daß Sie mich schlecht machen, dulde ich auf keinen Fall, sonst bekommen Sie es mit mir zu tun! Verstanden?«
Der Priester wurde etwas kleinlaut, setzte die Tasche wieder hin und blickte nach dem Tische.
»Aber ich kann unmöglich hierbleiben,« murmelte er.
»Warum nicht?«
»Mein Ruf, meine Ehre als Gottesmann verbieten es.«
»Unsinn, Sie sind wahrscheinlich noch nie in einer besseren Gesellschaft gewesen. Das sind alles ehrbare Leute, Farmerstöchter mit ihren Gatten, Schwagern und so weiter. Sie kommen nur von einem Kostümball. Verstehen Sie nun?«
Des Pfaffen Gesicht klärte sich auf.
»Ah so, das ist etwas anderes.«
»Und dort sitzt der erste Sheriff von Louisiana« — Peggy machte eine Bewegung nach dem Detektiven hin — »ich glaube, wenn der hier ist, können Sie auch ruhig Platz nehmen.«
»Der erste Sheriff,« sagte der Missionar, und seine Züge nahmen plötzlich den Ausdruck der Ehrfurcht an. »Ah, das ist ja der Gentleman, der vorhin die Güte hatte, mir armem, verirrten Schafe den Weg zu zeigen. Also der erste Sheriff ist er.«
Jetzt trat er unverzagt an den Tisch, und dieselbe Vorstellung und dieselbe Erklärung betreffs Ralphs sonderbaren Benehmens erfolgte wie vorhin.
Der Missionar nahm keinen Anstand mehr, sich zwischen die beiden dekolletierten Damen zu setzen, hielt es aber für gut, seinem geistlichen Stande dadurch Ausdruck zu geben, daß er seine Reden mit biblischen Wendungen durchflocht.
Die Gesellschaft zu schmähen, wagte er nicht mehr, er fühlte sich recht wohl zwischen den beiden hübschen Damen, konnte es aber doch nicht unterlassen, ab und zu leise seinen Tadel anzudeuten.
Das erste war, daß Ralph ihn zum Trinken nötigte. Er schenkte ihm ein großes Glas Wein ein.
»Trinkt, Mann, trinkt, damit Ihr auch inwendig naß werdet. Das hält Herz und Körper zusammen.«
»Ich danke, Herr, meine Lippen haben noch nie einen Tropfen Wein gekostet.«
»Hahaha, sehr gut! Warum denn nicht?«
»Ich halte es mit dem heiligen Paulus, der da sagt zu den Ephesern im 5. Kapitel 18. Vers: Und saufet euch nicht voll Weins, daraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern werdet voll Geistes.«
»Aha, Ihr wollt lieber Whisky trinken! Da ist freilich mehr Geist drin. Peggy, eine neue Flasche Whisky, der Missionar trinkt lieber Geist.«
»Sie verstehen mich falsch, Herr Cow-boy. Es ist der Geist gemeint, der den wahrhaft Gläubigen zuteil wird, nicht geistige Getränke.«
»Ich werde aus Eurem Geschwätz nicht klug —«
»Weil Sie eben vom Geist nicht erleuchtet sind.«
»O, ich bin manchmal ganz hübsch illuminiert, wenn ich eine tüchtige Portion in mir habe.«
»Ich glaube, Sie sind doch etwas zu streng gegen sich selbst,« warf Paddington ein.
»Wachet und betet, daß ihr nicht in Anfechtung fallet; das ist mein Wahlspruch.«
»Sie sehen elend aus.«
»Zerfällt der Körper, so steht der Geist auf,« entgegnete der Priester salbungsvoll.
»Ich halte Sie für magenkrank.«
»Ich mag ihn wohl verdorben haben, weil ich ihn zu mäßig halte, damit ich nicht in Völlerei gerate.«
»Dadurch haben Sie das kränkliche Aussehen bekommen.«
»Besser, krank am Körper, als an der Seele — ich fühle mich wirklich oftmals sehr krank.«
»Sehen Sie, dahin wollte ich Sie haben,« rief Paddington. »Wie sagt Paulus in seinem Briefe an Timotheus?«
Der Schwarzrock blickte erstaunt auf; dies war das erstemal während der drei Wochen, in denen er durch die Wildnis reiste, daß er einen bibelfesten Mann traf.
»In welchem Briefe meinen Sie?« fragte er ausweichend, da er keine andere Antwort wußte.
»Im ersten.«
»Ich weiß augenblicklich nicht ...«
»Er schreibt in dieser Epistel, 5. Kapitel 23. Vers: Trinke nicht mehr Wasser, sondern brauche ein wenig Wein, um deines Magens willen, und da du oft krank bist. Habe ich recht?«
Der Schwarzrock wurde immer verblüffter. Hier solche Bibelkenntnis zu treffen, hatte er nicht erwartet.
»In der Tat, das schreibt er,« entgegnete er kleinlaut.
»Nun, sehen Sie. Ich könnte Ihnen noch eine Menge Stellen anführen, wo geraten wird, Wein zu trinken, da aber Paulus Ihr Lieblingsapostel zu sein scheint, so lasse ich es bei seinem Ausspruch bewenden. Nun trinken Sie getrost den Wein.«
»Meinen Sie, daß er meinem Seelenheil nicht schaden wird?« fragte der Priester, schon nach dem Glase greifend.
»Ich bin vom Gegenteil fest überzeugt. Bedenken Sie doch: Der Wein erfreut des Menschen Herz.«
Der Priester schien kein Neuling im Zechen zu sein, im Nu war der Wein aus dem Glase verschwunden.
Der Bann war gebrochen. Ralph konnte einschenken, so oft er wollte, das Glas blieb nie lange voll. Anfangs bewegte sich das Gespräch noch auf religiösem Gebiet. Da der Regen noch mit unverminderter Heftigkeit an die Fensterscheiben klatschte und draußen alles in einen See verwandelt war, so sprach der Schwarzrock mit Vorliebe von der Sintflut.
Er war der festen Ansicht, daß Gott schon längst wie zu Noahs Zeiten die Menschheit mit einer alles vernichtenden Sintflut heimgesucht hätte, wenn nicht noch Wesen existierten, durch deren Frömmigkeit er sich bewogen fühlte, das tragische Ereignis immer hinauszuschieben.
Mister Elias zögerte durchaus nicht, mit bescheidenen, aber sehr deutlichen Worten zu verstehen zu geben, daß er einer dieser Auserwählten sei.
»Hm, das ist alles recht schön,« brummte Ralph, »aber ich glaube, wenn jetzt so eine Sintflut käme, dann müßtet Ihr auch daran glauben.«
»Gott hat stets Mittel, seine Kinder zu retten.«
»Na, dann müßte er gerade das Wasser um Euch herum in Wein verwandeln, dann glaube ich allerdings, daß Ihr nicht ersaufen würdet.«
Die Mädchen lachten, Ralph spielte darauf an, daß der Schwarzrock ein ganz außergewöhnlicher Zecher vor dem Herrn war; der Wein floß wie Oel seine Kehle hinab.
Die Folgen des starken Trinkens blieben nicht aus. Sein Gesicht rötete sich. Seine Augen strahlten, und schon begann er, Bibelstellen zu Witzen zu benutzen.
Eulalie, als Ralphs Gattin, hatte schon lange bemerkt, daß des Schwarzrocks Augen oft begehrlich über ihre bloßen Reize glitten; er bemühte sich beim Fassen nach dem Glase ihren vollen Arm zu streifen, und in ihrem nach Streichen suchenden Kopfe entstand ein Plan.

»Würden Sie mich mitnehmen, wenn uns die Sintflut überraschte und Ihnen eine Arche zur Verfügung gestellt würde?« fragte sie verführerisch lächelnd den Schwarzrock.
»Mit Ihnen würde ich eine Ausnahme machen, aber nur mit Ihnen,« entgegnete dieser höflich. Er wurde jetzt sehr weltlich gesinnt.
»Mich ganz allein?«
»Sie ganz allein, das heißt,« fügte er mit unsicherem Blicke nach Ralph hinzu, der nicht neben seiner angeblichen Gattin, sondern neben seiner Schwägerin Magdalen saß, »wenn Mister Adolphs damit einverstanden ist.«
»Wie meinen Sie das?«
»Nun, es ist doch anzunehmen, daß Mister Adolphs ebenfalls die Arche benutzen würde.«
»O, Mister Adolphs ist sich seiner Sündhaftigkeit so völlig bewußt, daß er das Angebot, die Arche zu benutzen, abschlagen würde.«
»Dann würde er sicher seine schöne Gemahlin mit in den Tod nehmen.«
»Meine Schwester? Natürlich!« lachte Eulalie.
Die Uebrigen horchten verwundert auf, Eulalie schien Lust zu haben, ihre Rolle abermals zu wechseln. Gewiß wollte sie einen anderen Streich ausführen.
»Ich verstehe Sie nicht, Missis Adolphs,« staunte der Schwarzrock.
»Ah, jetzt wird es mir klar. Sie halten mich für die Gattin Mister Adolphs?«
»Sie wurden mir als solche vorgestellt.«
»Dann haben Sie sich verhört,« lachte Eulalie übermütig. »Meine Schwester ist seine Gattin, ich bin herzlich froh, noch meinen Mädchennamen tragen zu dürfen.«
Das war es also, was Eulalie bezweckt hatte. Jetzt war Magdalen Missis Adolphs, Eulalie zu Miß Freeman geworden.
»Wie, Sie wären Miß Freeman?« rief der Schwarzrock, und eine freudige Ueberraschung spiegelte sich auf seinem geröteten Antlitz wider.
»Gewiß.«
»Wie man sich täuschen kann! Ich habe Sie immer für eine verheiratete Frau gehalten.«
»Sind Sie ärgerlich darüber, daß ich es nicht bin?«
Bis jetzt hatten die anderen den beiden zugehört, plötzlich aber brachten der Detektiv und Magdalen, die Schlauesten am Tische, eine Unterhaltung auf, an welcher sich alle beteiligen mußten, so daß die beiden sich allein überlassen blieben.
Eulalie wußte freilich, daß man dennoch ihrem Gespräche lauschte, der Schwarzrock nicht.
»Sagen Sie doch,« fuhr Eulalie fort, als ihr Nachbar vor Verlegenheit keine Antwort hervorbringen konnte, »ist es Ihnen so unangenehm, hören zu müssen, daß ich nicht die Gattin Mister Adolphs' bin?«
»O nein,« stotterte der Priester, »im Gegenteil.«
Lächelnd drohte ihm Eulalie mit dem Finger.
»Sprechen Sie die Wahrheit! Ich habe wohl gemerkt, mit welchen Blicken Sie meine Schwester immer betrachteten, und nun sind Sie außer sich, daß sie Missis Adolphs ist, während Sie dieselbe immer für Miß Freeman hielten.«
»Aber, Fräulein, ich versichere Ihnen, nichts ist mir lieber zu hören, als daß Ihre Schwester verheiratet ist.«
»Nehmen Sie solchen Anteil an ihr? Ach so, Sie sind Priester, und als solcher müssen Sie die Ehe protegieren.«
»Sie sind vollständig im Irrtum, ich frage den Teufel danach, ob Ihre Schwester verheiratet ist oder nicht.«
»Pfui, wie können Sie fluchen!«
»Pardon. Es verhält sich wirklich so, meinetwegen brauchte Ihre Schwester nicht verheiratet zu sein.«
»Ich glaube doch, Sie beneiden Mister Adolphs!«
»Nicht im geringsten, ich möchte Ihre Schwester um keinen Preis der Welt zur Frau haben.«
»Warum nicht? Ist sie nicht ganz hübsch?«
»O ja, aber — hm.«
»Warum nicht?«
»Weil sie — nicht so hübsch ist wie Sie, Miß Freeman,« platzte der weinselige Priester hervor.
Eulalie verstand es ausgezeichnet, ein beleidigtes und abweisendes Gesicht zu machen, als sie aber bemerkte, daß der Schwarzrock dadurch wieder zur Vernunft kam, änderte sie sofort ihr Benehmen, sie zeigte ein schelmisches Lächeln, welches geradezu berückend auf ihren Nachbar wirkte.
»Mister Elias, Sie sind ein Schalk,« lächelte sie. »Also darum wollten Sie mich in Ihre Arche nehmen, weil Sie mich für die hübschere von uns beiden halten. Sie schmeicheln.«
»Ich schmeichle nicht,« beteuerte der Schwarzrock mit der Hand auf dem Herzen. »Uns Männern Gottes ist die Schmeichelei verhaßt. Bei den Wunden Christi, ich hätte Sie auch in die Arche genommen, wenn Sie nicht die schönste der anwesenden Damen wären. Wahrhaftigen Gott, das hatte ich getan.«
»Ich wüßte keinen Grund hierfür. Sind Sie so sehr um meine Person besorgt?«
»Mehr, als um die meinige.«
Eulalie schüttelte ungläubig lächelnd den Kopf, und dieser Zweifel entflammte den Priester noch mehr.
»Sie glauben mir nicht? Wissen Sie, was in der Bibel steht?«
»Da steht gar manches drin, was heute nicht mehr verantwortet werden kann.«
»Wenn ich allein die Arche bestiegen hätte, so wäre ich bald meines Lebens überdrüssig geworden.«
»So wollen Sie mich also als Zeitvertreiber mitnehmen, Mister Elias?« unterbrach ihn Eulalie. »Dazu fühle ich mich zu gut.«
»Einen Augenblick! Sie verkennen mich. Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei, sagte Gott, und gab Adam die Eva als Lebensgefährtin bei. Jahrtausende sind seitdem verflossen, immer aber hat sich der Spruch wiederholt, es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei. Ein jeder fühlt sich von der Wahrheit desselben durchdrungen und sieht sich nach einer Lebensgefährtin um. Nur ich,« schloß der Priester mit einem schmachtenden Seufzer, »habe bis jetzt nie Gelegenheit gehabt, dem göttlichen Gebote zu folgen.«
Eulalie rückte ihren Stuhl näher an ihn heran und beugte sich vor. Ihr heißer Atem streifte sein Gesicht. Ihr voller Arm lag auf seinem Knie.
»Was hindert Sie denn, dem Beispiele aller andern Männer zu folgen? Wenn Sie noch nicht verheiratet sind, so holen Sie es doch nach. In keinem anderen Lande kann man so schnell Ehen schließen, wie in Amerika.«
Der Schwarzrock seufzte tief auf, er hätte gar zu gern offen gesprochen, wagte es aber noch nicht.
»Oder zählen Sie zu den Männern, welche wie Schmetterlinge von einer Blume zur andern flattern? Ihr Wunsch, mich mit in Ihre Arche zu nehmen, läßt fast darauf schließen.«
»O, werte Miß, wie können Sie mir so etwas zutrauen? Ich bin ein Ehrenmann.«
Eulalie rückte immer näher an ihn heran; jetzt saßen sie dicht nebeneinander, und da war es um den Priester geschehen. Er konnte die Aufmunterung des Mädchens nicht mehr verkennen. Außerdem leitete Eulalie, falls der unbeholfene Priester doch noch zögern sollte, den Antrag selbst ein.
»Wäre es möglich? So hätten Sie eine tiefere Zuneigung zu mir?« flüsterte sie mit glühenden Wangen und verschämtem Augenaufschlag.
Mister Elias drückte enthusiastisch ihre Hand.
»Ja, so sei es gesagt: Fräulein, ich liebe Sie mehr als mein Leben. Glauben Sie, daß Sie für mich Gegenliebe empfinden können?«
Ein Händedruck war die Antwort.
»Fräulein, ich bitte um Ihren Namen.«
»Eulalie,« hauchte das Mädchen.
»Liebe Eulalie, sprich, willst du die Meine werden?«
»Ja,« lispelte sie.
Der Priester war überglücklich. Schnell stürzte er zwei große Gläser Wein hinunter und begann nun, dem Mädchen teils mit biblischen, teils mit weltlichen Worten seine Liebe zu versichern, und nicht lange dauerte es, so lag sein Arm um ihre Taille.
»Aber, Eulalie,« rief da plötzlich Magdalen entrüstet.
Das Mädchen suchte sich loszumachen, doch der Schwarzrock ließ sie nicht frei, mutig hielt er sie fest und erhob sich, das Mädchen mit sich emporziehend.
»Missis Adolphs, Mister Adolphs, Ihre Schwester, respektive Schwägerin ist willens, Ihre Gesellschaft zu verlassen und sich fortan unter meinen Schutz zu begeben. Ich hoffe, daß ich Ihrerseits auf keine Schwierigkeiten stoße.«
»Eulalie,« rief Magdalen mit freudigem Erstaunen und flog ihrer Schwester an den Hals.
Ralph machte keinen Anspruch auf sein Recht als Verwandter, er vergrub sein Gesicht im Weinglas.
»Ist es möglich, ein Brautpaar?« rief Peggy und trat, die Hände an der Schürze abwischend, heran.
Eulalie und der Schwarzrock, der im ganzen Gesicht vor Entzücken strahlte, wurden von allen umringt, und des Händeschüttelns und der Umarmungen war kein Ende.
Als man sich beruhigt hatte und die beiden sich wieder selbst überlassen blieben, dachten sie auch an die Zukunft. Dabei war Eulalie mit Liebesbezeugungen sehr freigebig, der Priester fühlte sich wie im Himmel. Zugleich wuchs sein Stolz, daß sich das schöne und erst so stolze Mädchen ihm so ohne weiteres in vollster Liebe hingab.
»Gibst du nicht deinen Beruf als Missionar auf, da du mich gefunden hast?« schmeichelte sie.
Der Priester zupfte an seiner Krawatte.
»Ein halbes Jahr muß ich noch aushalten, sonst gehe ich meiner späteren Anstellung verlustig, aber wenn du willst, so ...«
»Nein, nein, so meine ich das nicht. Ich bin stolz darauf, einen Priester zu haben, das war immer mein höchster Wunsch. Ich dachte nur, du könntest gleich eine ruhige, sichere Stellung antreten, denn das kannst du doch nicht verlangen, daß ich mit dir unter den Indianern herumziehe.«
»Freilich nicht, ehe ich aber einer Missionsanstalt zugeteilt werde, ist es unbedingt notwendig, daß ich ein halbes Jahr als Wanderprediger tätig war.«
»Ist es denn gar nicht möglich, daß du irgend eine feste Stellung erhältst?«
»Nein, gar keine.«
»Sie braucht nicht einkömmlich zu sein, ich selbst habe Vermögen, so daß wir sorgenfrei leben können.«
»Nun, das heißt, wenn du wünscht, ich soll meinen Beruf aufgeben,« sagte der Schwarzrock, innerlich erfreut, eine wohlhabende Frau zu bekommen, wodurch er des Kampfes um das tägliche Brot enthoben würde.
Doch seine Braut setzte seinem Entzücken schnell einen Dämpfer auf.
»Aber ich setze gerade eine Ehre darein, die Frau eines Priesters zu werden. Das war von jeher mein Ideal, um so mehr, als ich überhaupt sehr religiös bin.«
Magdalen biß sich auf die Lippen.
»Nun gut,« seufzte der Schwarzrock, »dann bleibt mir nichts anderes übrig, als noch ein halbes Jahr auszuhalten, so schwer es mir auch wird.«
Eulalie spielte mit seinen Fingern; ein feuchter Schimmer lag in ihren Augen.
»Das ist freilich sehr schlimm, aber es bleibt uns nichts anderes übrig, als eben zu warten.«
»So heiratet euch doch gleich,« rief Magdalen herüber.
»Gleich?«
»Nun ja, noch heute abend.«
»Ach, wenn das nur so ginge,« meinte Eulalie, »das wäre mir auch am liebsten. Wenn du, Elias, so unter den Indianern bist, wie leicht kannst du mir untreu werden oder mich ganz vergessen. Wenn wir verheiratet wären, dann würde ich dich ruhig ziehen lassen.«
Mister Elias' Augen leuchteten auf.
»Ich bin Priester,« sagte er, »und habe auch das Recht, Ehen zu schließen.«
»Du hast wohl das Recht, aber die von dir geschlossenen Ehen sind ungültig, solange sie nicht registriert sind.«
Elias sah, daß die Mädchen mit den Verhältnissen Bescheid wußten, man konnte ihnen nicht so leicht etwas vormachen.
»Aber da ist ja Mister Paddington,« rief Magdalen, »der darf ja Ehen schließen. Warum haben wir denn nicht gleich daran gedacht?«
»Sie dürfen Ehen schließen?« fragte der Schwarzrock den Detektiven.
»Gewiß, als erster Sheriff.«
»Auch gleich hier?«
»Warum denn nicht? Sie sind wohl noch nicht lange in dieser Gegend?«
»Nein.«
»Das ist hier sehr einfach. Ich setze nur ein Formular auf, welches Sie, Ihre zukünftige Frau und zwei Zeugen unterschreiben, und Sie sind verheiratet.«
»Aber das Registerbuch, das ist doch die Hauptsache!«
»Bah, in das trage ich morgen alles ein.«
Der erste Sheriff hatte alles Nötige bei sich: Tinte, Feder und Papier. In wenigen Minuten war der Schein fertig. Er sprach dem Paare einige Formeln vor, sie sprachen diese nach und unterschrieben, Magdalen und Ralph ebenso, und das Paar war fürs Leben zusammengekuppelt.
Der Priester streckte die Hand nach dem Scheine aus.
»Halt, der gehört Ihrer Frau Gemahlin, das wissen Sie doch, als Priester!«
»Nun ja, da bei mir aber nicht zu befürchten ist, daß ich meiner Frau ausreiße, so kann ich ihn doch bekommen. Ich werde ihn wie einen Talisman aufbewahren.«
»Wer weiß, man darf keinem Manne trauen,« lächelte Eulalie und ließ das Papier in ihren Busen gleiten.
Nun brach wieder der tollste Jubel los. Die Hochzeit mußte natürlich gefeiert werden, und jetzt kam Mister Elias an die Reihe, die Gäste zu traktieren. Der sparsame Priester wurde mit einem Male verschwenderisch, er zögerte nicht, Dollar nach Dollar springen zu lassen. Mit glücklichem Lächeln hielt er seine junge Frau auf dem Schoß, und diese erwiderte seine Liebkosungen äußerst freigebig.
Der Sheriff zeigte eine Tabelle, nach welcher er für seine Mühe vier Dollar zu fordern hatte. Sie wurden ihm sofort gezahlt, aber er steckte sie nicht ein, sondern verwendete sie dazu, eine Flasche auf das Wohl der Neuvermählten zu geben.
Mancher Leser wird sich vielleicht wundern, daß ein gebildeter Mann, wie der Priester war, doch auf solch plumpen Betrug eingehen und ihn glauben konnte.
Die Heiratsverhältnisse in Amerika, wie in England, sind eben ganz andere als die unsrigen; man kann früh aufstehen, ohne einen Gedanken an Heirat zu haben, geht spazieren, macht die Bekanntschaft einer Dame, und nachmittags ist man mit ihr gesetzmäßig verheiratet. In England wird man auf der Registratur nach Namen, Alter und Wohnung gefragt, ferner ob ledig oder Witwer, und da kein einziges Ausweispapier verlangt wird, so kann man irgend eine Angabe machen. Zwei Zeugen sind dazu nötig. Oft genug kommt es vor, daß man auf der Straße angehalten wird, ob man als Trauzeuge fungieren will. Für diese Gefälligkeit gibt es hinterher im Stehen einen ›Trink‹ im nächsten Bierhaus.
Die Folge davon ist, daß die Bigamie in England, aber auch die dreifache, vierfache Ehe und so weiter sehr häufig ist. Die Zeitungsberichte strotzen von solchen Verhandlungen vor Gericht, und geradezu lächerlich sind die einzelnen Tatbestände.
Richter: »Sie sind beschuldigt, eine Doppelehe eingegangen zu sein. Was haben Sie zu sagen?«
Angeklagter: »Ich war vierzehn Tage lang betrunken, ich habe keine Ahnung, daß ich mich zum zweiten Male verheiratet habe.«
Richter zur Frau: »Wußten Sie nicht, daß dieser Mann schon verheiratet war?«
Angeklagte: »Er war so betrunken, daß ich aus seinen Angaben nicht klug werden konnte.«
Richter: »Schämen Sie sich nicht, einen betrunkenen Mann zum Altar zu führen?«
Angeklagte: »Ew. Gnaden, wenn er nicht so betrunken gewesen wäre, dann hätte er mich ja nicht geheiratet.«
Die gefällte Strafe ist wegen mildernder Umstände eine sehr geringe. Die Ehe wird aufgelöst.
Ferner kann man in England die Schwester seiner Frau heiraten, kirchlich oder vor dem Standesamt. Kommt es dann an den Tag, daß es die Schwester der Frau ist, so ist die Ehe sofort aufgelöst, ohne daß der zweifache Ehemann auch nur vor das Gericht geladen werden darf. Die Ehe ist einfach ungültig.
Ebensolche Umstände herrschen in den Vereinigten Staaten von Amerika wie im stolzen, frommen England, womöglich noch schlimmere. In Louisiana zum Beispiel kann jede Ehe ohne Angabe eines Grundes innerhalb von acht Tagen rechtskräftig geschieden werden, beide Gatten müssen nur ihre Zustimmung geben, ist Geld vorhanden, in noch kürzerer Zeit, und ist der Gatte reich, so braucht er gar nicht erst die Zustimmung der Frau. Am nächsten Tage heiratet er eine andere, läßt sich wieder scheiden, und so geht es fort, bis Richter Lynch mit dem liebebedürftigen Manne sich näher befaßt, oder aber, bis sich die betrogenen Frauen und entrüsteten Mädchen verbinden und dem Don Juan mit dem Ochsenziemer für immer die Liebesgedanken austreiben.
Wehe den Don Juans in Amerika, welche den Unwillen des weiblichen Geschlechts auf sich lenken:
Da werden Weiber zu Hyänen —
Mister Elias war also fest überzeugt, daß er mit dem stattlichen Mädchen gesetzlich verheiratet war, und da sie eine bedeutende Summe als ihr Vermögen angegeben hatte, so trug er kein Bedenken, sein seit langen Jahren mühsam Erspartes zu opfern, das heißt, es in die Kehlen der Dirnen und übrigen Gäste zu gießen.
Alles war guter Laune: Peggy über die reichliche Einnahme, der Priester über seine junge Frau, mit welcher er heute in dieser Schenke die Brautnacht zu verbringen gedachte, und die anderen freuten sich über den Streich, den sie an dem heiligen Manne Gottes ausgeübt.
Draußen erklangen wieder Hufschläge.
»Es kommen Gäste, es müssen etwa vier sein,« rief Peggy.
Eulalie erschrak etwas, das konnten Farmer sein, welche sie alle kannten.
»Wir halten unsere Hochzeit geheim,« sagte sie schnell zu dem Schwarzrock.
»Aber warum denn, Schätzchen? Schämst du dich, wenn ich dich mein Weibchen nenne?«
»Das nicht, aber weißt du, ich habe unter den umwohnenden Farmern viele Verehrer, und da könnte es leicht geschehen, daß einer von ihnen auf dich eifersüchtig würde.«
Eulalie kam mit ihrer Ermahnung nicht weiter, die Tür wurde aufgerissen, und vier Mann drangen ins Zimmer. Sie bewegten sich so schnell, daß der erste von ihnen, ein herkulischer Mann, schon vor Ralph stand, ehe man sie noch richtig erkannt hatte. Sofort standen auch zwei andere hinter dem Cow-boy, während der vierte, die Hand in der Tasche, die übrigen Gäste im Auge behielt.
»Seid Ihr Ralph, der Cow-boy von Miß Petersens Farm?«
Ralph starrte den Frager verwundert an.
»Herrgott, Konstabler!« rief er dann und wollte aufspringen, aber sofort drückte ihn der Mann, in der Uniform eines Sergeanten, kräftig zurück.
»Im Namen des Gesetzes, Ihr seid verhaftet!«
Die Mädchen schrien. Ralph wollte nach dem Revolver greifen, aber schon hatte einer der hinter ihm Stehenden ihm diesen mit geschicktem Griff aus dem Gürtel gezogen.
Diese Leute hatten Uebung darin, mit Verbrechern der verwegensten Sorte zu verkehren. Alles Sträuben half dem Cow-boy nichts, nach einer Minute saß er mit gebundenen Händen und Füßen auf dem Stuhl.
»Was fällt Euch ein,« brüllte Ralph jetzt mit heiserer Stimme, »wie könnt Ihr wagen, mich anzufassen? Ich habe nichts begangen, daß Ihr mich verhaftet.«
»Nur gemach,« entgegnete der Sergeant, und brachte schon bei der ersten, oberflächlichen Untersuchung aus den Hosentaschen ein Bündel Banknoten zum Vorschein.
»Aha, dachte ich's doch.«
»Das ist mein Finderlohn.«
»Finderlohn ist sehr gut. Hier, zähle die Banknoten,« wandte er sich an einen Konstabler, »und ihr zieht ihm die Stiefel aus.«
»6178 Dollar,« meldete der Konstabler.
»Gut, und hier im Stiefel sind die anderen, die zu den 80 000 Dollar gehören; einige wird allerdings Peggy in Verwahrung genommen haben, und die übrige Gesellschaft scheint Sorge tragen zu wollen, daß auch das andere Geld bald kleingemacht wird. Gut, daß wir uns so beeilt haben, sonst hätte Mister Flexan das leere Nachsehen gehabt.«
Die Mädchen drückten sich bei diesen Worten scheu zur Seite, auch Peggy, denn jetzt sahen sie, daß Ralph sie von gestohlenem Geld traktiert hatte. Dieser selbst saß ganz fassungslos im Stuhl, er konnte nicht gleich zu einem Entschlüsse kommen. Der Detektiv rauchte ruhig weiter und fixierte dabei den Cow-boy, und nur Mister Elias nahm die eben gesprochenen Worte des Konstablers nicht so geduldig hin.
»Herr, was unterstehen Sie sich zu sagen?« rief er. »Dieser Herr da ist kein gewöhnlicher Cow-boy, wie Sie vielleicht annehmen, er spielt nur die Rolle eines solchen. Sie brauchen sich nicht zu wundern, daß er so viel Geld bei sich hat ...«
Langsam wendete der Sergeant den Kopf nach dem Sprecher.
»Ah, Mister Elias, Sie auch hier?« unterbrach er ihn. »Das hatte ich nicht erwartet! Einen guten Namen macht Ihnen das nicht eben. Was haben Sie zur Verteidigung dieses Cow-boys anzuführen?«
»Er ist kein Cow-boy, er ist mein Schwager.«
»Ihr Schwager? Sie wollen mich wohl foppen?«
»Ich versichere Ihnen, er ist mein Schwager, Mister Adolphs.«
»Hm, dann kennen Sie ihn besser, als ich,« der Sergeant sah sich unter den Menschen um, »und ist Ihre Gemahlin vielleicht auch hier?«
»Bitte, meine Frau.«
Der Schwarzrock faßte Eulalie, welche purpurrot wurde, an der Hand und stellte sie vor. Gleichzeitig brachen alle Konstabler in lautes Lachen aus.
»Diese ist Ihre Frau? Hahaha, seit wann denn?«
»Jener Herr, ein Sheriff, hat sie mir angetraut. Ich bitte Sie, dies nicht lächerlich zu finden. Sie könnten es bereuen, mit einem angestellten Missionar Spott getrieben zu haben.«
Der Sergeant warf dem ihm unbekannten Detektiven einen forschenden Blick zu. Er wußte sofort, daß mit dem Missionar ein Scherz getrieben worden war, freute sich selbst darüber, hielt es aber für seine Pflicht, solche Eingriffe in behördliche Angelegenheiten nicht ungeahndet zu lassen.
»Ich muß Ihnen erklären.« sagte er zu dem Priester, »daß Sie das Opfer eines Betrugs geworden sind, denn dieser Mann, den Sie Ihren Schwager nennen, ist ein Cow-boy, welcher 80 000 Dollar gestohlen hat, dieser, den Sie als ersten Sheriff bezeichnen, hat nicht das Recht, Ehebündnisse zu schließen, und endlich diese Dame, als deren Gatte Sie sich so glücklich schätzen, ist eine bekannte, für Geld käufliche Dirne. Seien Sie froh, daß ich dazwischengekommen bin, sonst hätte man sich mit Ihnen noch andere Späße erlaubt.«

Einen Blick voll des namenlosesten Entsetzens warf der Schwarzrock auf seine Gemahlin und auf den Sheriff, wie gebrochen sank er in einen Stuhl. Das freche Lachen Magdalens, die Verlegenheit Eulalies, die spöttischen Gesichter der Konstabler und des vermeintlichen Sheriffs bestätigten die Aussagen des Sergeanten.
»Mein Gott, mein Gott,« stammelte er leise, »du strafst mich hart! Habe ich denn das wirklich verdient? Meine Ehre, mein Ruf, meine Stellung — alles dahin.«
Jetzt kam auch in Ralph wieder Leben, sein Rausch war verflogen.
»Ich soll ein Dieb sein?« sagte er leise. »Laßt mich los, verdammte Halunken; gefunden habe ich das Geld, und wer das nicht glaubt, den schieße ich wie einen tollen Hund nieder!«
»Ruhe,« donnerte ihn der Sergeant an, »jetzt ist keine Zeit, Eure Unschuld zu beweisen! Könnt Ihr es, so werdet Ihr bald freigelassen werden. Meine Pflicht ist es, Euch als Dieb zu verhaften, und ich habe es getan, Euer Schimpfen hilft also gar nichts, ergebt Euch in Euer Schicksal. Alles übrige wird sich später finden. Hier im Zimmer geblieben,« rief er Eulalie nach, welche sich aus der Tür schleichen wollte, »mit Euch habe ich auch noch ein Wort zu sprechen.«
Eulalie blieb gehorsam stehen.
»Was habt Ihr mit dem Missionar dort vorgehabt?«
»Nichts, Sir,« stotterte Eulalie.
»Es war nur ein harmloser Spaß,« fügte Peggy verlegen hinzu.
»Der Euch teuer zu stehen kommen kann,« fügte der Sergeant, der Lust zu haben schien, nicht nur den Vollstrecker der Polizei, sondern auch den Richter selbst zu spielen. »Mister Elias, Sie sind das Opfer eines schamlosen Betrugs geworden. Ist Ihnen auch ein Trauschein ausgestellt worden, der Sie scheinbar an diese Dirne fesselt?«
»Ja, aber ich habe ihn nicht.«
»Wer hat ihn?«
»Meine Gattin — Eulalie, dieses Mädchen da,« verbesserte sich der Schwarzrock schnell.
»Her damit!«
Eulalie wagte nicht, zu widersprechen oder Ausflüchte zu machen. Subjekte, wie sie, stehen mit der Polizei immer auf etwas gespanntem Fuße. Sie brachte aus dem Busen den ausgestellten Trauschein hervor. Der Sergeant las ihn und konnte ein Lächeln nicht unterdrücken.
»Hm,« schmunzelte er, »hiernach wären Sie allerdings mit Miß Eulalie Freeman ehelich getraut. Ein Glück für Sie, Mister Elias, daß der Stempel fehlt, und daß ich bezeugen kann, daß diese junge Dame einen anderen Namen führt. Schließlich wäre auch noch der Stempel nachgeahmt worden, und dann hätten Sie in einer schönen Patsche gesessen. Der Aussteller dieses Scheines besitzt große Fertigkeit darin, hm, diesen Herrn muß ich mir einmal genau ansehen.«
Er wandte sich an den Detektiven, der noch immer im Stuhl zurückgelehnt saß, gleichmütig seine Zigarre weiterrauchte und mit heimlichem Entzücken die Gruppe beobachtete. Die durchbohrenden Blicke des Sergeanten beachtete er gar nicht. Dieser hielt ihn für einen heruntergekommenen Gentleman, der herumabenteuerte.
»Wer sind Sie? Was ist Ihr Geschäft?« fragte der Sergeant den Mann barsch.
Dieser nahm langsam die Zigarre aus dem Munde und blickte den Frager erstaunt an.
»Wer sind Sie? Was ist Ihr Geschäft?« wiederholte der Sergeant in noch gröberem Tone.
»Was berechtigt Sie zu dieser Frage?« klang es spöttisch zurück.
Der Sergeant ließ sich vorläufig noch nicht einschüchtern.
»Sie haben einen Trauschein ausgestellt, obwohl Sie kein Recht dazu haben.«
»Ist mir nicht eingefallen.«
»Oho, ich habe den Schein in meinen Händen.«
»Nennen Sie dies einen Trauschein? Dann dünkt es mich, als ob Sie als Beamter sehr wenig von der Geschichte verständen. Es ist erstens kein Stempel vorhanden, und ferner sind die Formalitäten ganz und gar nicht eingehalten. Wenn Sie nur ein bißchen Grütze im Kopfe hätten, müßten Sie sofort einsehen, daß hier nur ein sehr harmloser Scherz vorliegt.«
»Herr,« brauste der Sergeant auf, »hüten Sie sich, einen Beamten der Vereinigten Staaten zu beleidigen.«
»Und hüten Sie sich, sich als etwas aufspielen zu wollen, was Sie nicht sind,« entgegnete Paddington und stand auf. »Sie sind, wie ich sehr wohl weiß, dazu kommandiert, den Cow-boy hier wegen Verdachtes des Diebstahls zu verhaften, aber mich zu fragen, was ich bin, und was ich treibe, haben Sie nicht das geringste. Recht. Ich gebe zu, daß Ihnen der falsche Trauschein etwas seltsam erscheint, aber mich zur Rechenschaft deswegen ziehen dürfen Sie nicht.«
»Wollen Sie es mir vielleicht verwehren?« fragte der Sergeant trotzig, aber nicht so sicher, wie vorhin.
»Nicht verwehren, ich lasse es mir einfach nicht gefallen.«
»Das wird sich finden.«
»Hüten Sie sich, über das Maß Ihrer Machtbefugnis hinauszugehen, ich weiß ebensogut, wie Sie, vielleicht noch bester, wie weit diese reicht.«
Jetzt wurde der Sergeant kleinlaut, er schien doch an den Unrechten gekommen zu sein, und als Paddington dies merkte, fuhr er schnell fort:
»Sie dürfen nichts weiter, als mich bitten, Ihnen etwaige Legitimationspapiere zu zeigen, falls Sie meine Tat strafbar finden, damit gegen mich Klage erhoben werden kann. Ich habe nicht einmal nötig, Ihnen zum nächsten Bureau zu folgen, solange Sie mir nicht einen vorschriftsmäßigen Verhaftsbefehl vorweisen können.«
»Dann bitte ich Sie um Ihre Papiere.«
»Sie wollen Klage erheben?« lächelte Paddington. »Sie würden nicht viel damit erreichen.«
»Das weiß ich,« entgegnete der Sergeant unwirsch, »ich möchte nur wissen, mit wem ich es zu tun habe.«
Paddington entnahm seiner Brieftasche einige Papiere und reichte sie dem Sergeanten, der sie las, einen erstaunten Blick auf den Fremden warf und sie ihm, die Hand an die Mütze legend, wieder einhändigte.
»Die Sache ist in Ordnung,« sagte er unterwürfig, »es hat sich nur um einen Spaß gehandelt. Mister Elias, ich glaube, Ihnen ist ganz recht geschehen. Sie haben diese Demütigung verdient. Kokettieren Sie ein andermal nicht mit jedem Mädchen, das Ihnen in den Weg läuft, und seien Sie nicht gar zu vertrauensselig.«
Doch der Schwarzrock konnte sich über die ihm gespielte Posse nicht beruhigen, er hielt sich für ruiniert, den Menschen sowohl, wie Gott gegenüber, sein Jammern nahm kein Ende.
»Und ich,« begann jetzt Ralph wieder mit vor Wut bebender Stimme, »ich soll als Dieb verhaftet werden? Fragt diese Dirnen, ob ich ihnen nicht gleich gesagt habe, wie ich zu dem vielen Gelde gekommen bin.«
»Ergebt Euch vorderhand in Euer Schicksal,« sagte Paddington zu ihm, »ich gebe Euch die Versicherung, daß Ihr, wenn Ihr unschuldig seid, bald genug frei sein werdet. Ihr nanntet Miß Petersen Eure Freundin, nun gut, sie wird Euch beistehen, wenn sie von Eurer Verhaftung erfährt.«
Der Sergeant beschloß, diese Nacht in der Schenke zuzubringen und Ralph unter scharfer Bewachung zu halten. Der Regen hatte zwar aufgehört, aber der Boden der Prärie war noch mit Wasser bedeckt, der Heimritt also unbequem. Paddington sprach lange leise mit dem Sergeanten, das Gespräch drehte sich um den finster dasitzenden Cow-boy, doch der Sergeant machte abwehrende Bewegungen, er wollte um keinen Preis auf den Vorschlag des Detektiven eingehen, Ralph vorläufig freizulassen.
Die Mädchen, auch Peggy, verhielten sich schweigsam. Die Anwesenheit der Konstabler war ihnen ungemütlich, und nur der Schwarzrock machte Lärm. Er bejammerte in einem fort die ihm zugefügte Schmach, rief Gott zum Helfer an und schmähte weidlich auf Paddington und besonders auf Eulalie. Diese konnte nicht unterlassen, eine boshafte Bemerkung zu tun.
»Was meint Ihr, geehrter Herr Missionar,« flüsterte sie ihm zu, »ob wohl Gott jetzt noch zögern würde, auch Euch in der Sintflut zu verderben? Ich glaube kaum, denn Ihr seid doch ein ganz gewaltiger Sünder.«
»Hebe dich weg von mir, Satan!« schrie Elias. »Möge sie kommen, die Sintflut, und euch Schlangengezücht vernichten! Ihr seid reif dazu.«
»Und Ihr mit!«
Dieses Wort war noch nicht aus ihrem Munde, als es plötzlich im Walde lebendig wurde. Es schien eine Reiterschar durchzubrechen, man sah solche über die etwas bewaldete Prärie jagen und dem Hügel zustreben.
»Die haben es eilig,« rief der Sergeant.
»Es sind zwei Farmer aus der Umgegend,« erklärte Peggy am Fenster, »die anderen kenne ich nicht.«
»Es sind auch Damen dazwischen.«
»Sie scheinen zu fliehen.«
»Sie reiten vorbei.«
»Nein, Sie reiten um den Hügel herum, kommen aber herauf, sie kennen die Gegend nicht. Da, jetzt folgen sie den beiden ersten Farmern.«
»Horch, was ist das?«
So klang es in dem Zimmer durcheinander. Der letzte Ausruf bezog sich auf ein seltsames Geräusch, welches man zwischen dem Stampfen der Pferdehufe vernehmen konnte. Es klang wie ein entferntes Rauschen, manchmal auch wie ein Gurgeln.
»Das Wasser,« schrie in diesem Augenblick Paddington, wirklich erschrocken.
»Das Wasser ist hinter uns her,« tönte es da gleich darauf aus dem Munde einiger Reiter, welche jetzt die Anhöhe hinaufgaloppierten.
Die Insassen der Stube schrien vor Schrecken laut auf. Sie wußten, was dieser Ruf, diese Flucht der Reiter zu bedeuten hatte. Alles sprang nach den Fenstern, nur der Schwarzrock sank mit einem dumpfen Stöhnen in die Knie und verbarg das Gesicht in den Händen.
»Mein Gott, mein Gott,« ächzte er, »du bist furchtbar in deinem Grimm gegen die Sünder. Du schickst die Sintflut, ich habe sie heraufbeschworen. Sei gnädig gegen mich armen Sünder, wende dein Gesicht nicht von mir!«
»So schlimm steht es noch nicht mit uns,« sagte Eulalie neben ihm und klopfte ihm auf die Schulter, »Eure Sintflut kommt nicht bis zu uns herauf, und sollte dies auch der Fall sein, ich weiß doch ein Mittel, uns zu retten.«
»Wirklich?«
Ein Hoffnungsschimmer zeigte sich im Gesicht des Priesters.
»Ja, und wenn Ihr mich wirklich lieb habt, so werde ich Euch auch retten.«
»O, ich habe dich so furchtbar lieb, Eulalie.«
»Wollt Ihr mich heiraten?«
»Gewiß, so oft Ihr wollt.«
»Dann betet vorläufig ruhig weiter, schaden tut es auf keinen Fall.«
»Mein Gebet hat seine Kraft verloren, seitdem ich in den Pfuhl der Sünde geraten bin, ich verlasse mich lieber auf dich, meine liebste Eulalie.«
Der Schwarzrock war aber doch so vorsichtig, weiterzubeten, vielleicht auch hatte er nicht mehr die Kraft, sich aus seiner knienden Stellung zu erheben — er blieb liegen.
Die Reiter hatten unterdes ihre Rosse vor der Haustür gezügelt, waren abgesprungen und betraten nun das Wirtszimmer, die Nachricht verbreitend, daß im Koloradogebirge zwei Wolkenbrüche niedergegangen seien und das Wasser ihnen auf dem Fuße folge.
Die Ankömmlinge waren natürlich keine anderen, als die Damen und die englischen Herren, welche von Miß Petersens Farm hierhergeflohen, darunter einige Beamte der Hazienda, auch einige Diener, sogar Neger, denen die Flucht gelungen war.
Wohl war auf dem wilden Ritt manches Pferd gestürzt, da man aber treu zusammenhielt, so war kein Vermißter zu beklagen, es sei denn Miß Petersen und Lord Harrlington, über deren Schicksal man völlig im unklaren war.
Die Ankommenden wunderten sich nicht wenig, hier dekolletierte Damen anzutreffen. Einige geflüsterte Bemerkungen reichten hin, um alle darüber aufzuklären, ebenso betreffs des gefesselten Ralph, und da man im Falle der Gefahr keine Rücksicht kennt, bei einer Feuersbrunst bekanntlich sogar die Frau Bürgermeisterin im Hemd zum Fenster hinausspringt, so wurde darauf weiter keine Obacht gegeben. Man war froh, dem Wassertod entgangen zu sein, und gedachte nur mit schmerzlichem Bedauern der beiden Fehlenden, Johanna insbesondere an ihren Bräutigam, an Hoffmann, der ganz sicher ebenfalls von der Ueberschwemmung überrascht worden war.
Fragen und Antworten wechselten schnell hin und her, besonders wurde Paddington mit Fragen bestürmt, den man im Eifer mit Mister Sharp anredete. Jetzt war keine Zeit dazu, sein Pseudonym zu wahren.
Ehe man sich noch ausgesprochen, war draußen schon eine unendliche See entstanden, nicht mehr mit glattem Spiegel, wie vorhin, sondern der Vollmond beschien eine aufgeregte Wasserfläche, und diese stieg mit rapider Geschwindigkeit. In einer Viertelstunde war die breite Basis des Hügels verschwunden, man befand sich nur noch auf einer kleinen Insel.
»Gott sei uns gnädig!« hauchte mancher bleiche Mund, der Schwarzrock wimmerte zum Herzbrechen.
Nick Sharp wurde gefragt, wie er hierherkäme, antwortete aber so kurz, daß man für gut fand, ihn in Ruhe zu lassen. Man bekümmerte sich jetzt übrigens weniger um das Schicksal von Eduard Flexan, den Sharp wahrscheinlich vergeblich verfolgt hatte, als vielmehr um das von Ellen, Harrlington, Hoffmann und dessen Begleiter.
Sharp war nicht mehr im Zimmer, er befand sich draußen und lief am Wasserspiegel hin und her. Das Wasser wuchs noch immer, würde aber, versicherten die Beamten, welche schon einmal eine Ueberschwemmung durchgemacht hatten, sicher nicht das auf dem Hügel stehende Gebäude erreichen.
Diese Behauptung war zwar tröstlich, ruhte aber auf sehr schwacher Basis. Was noch nicht geschehen, konnte ja jetzt eintreten, die Elemente dulden keine Vorschriften, sie spotten aller menschlichen Berechnung.
Niemand konnte sich daher der Sorge um die Zukunft erwehren, mit Ausnahme vielleicht des Missionars, welcher sich an die Aussage des Beamten anklammerte, wie ein Ertrinkender am Strohhalm. Er verfolgte denselben ständig mit Fragen und konnte nicht oft genug versichert bekommen, daß für sie selbst keine Gefahr vorliege. Eulalie schien nicht besonders um ihr Leben besorgt zu sein, sie ängstigte jedoch den armen Schwarzrock fortwährend durch ihre Vermutungen, versprach aber, ihn zu retten, sollte das Wasser ihnen bis an den Hals steigen, und so schloß sich der Priester in seiner Todesangst eng an das Mädchen, seine gewesene Gattin an.
Endlich entschied Williams, man wolle nicht tatenlos hier harren und die Ueberschwemmung vorübergehen lassen, sondern an andere Unglückliche denken. Es wurde eine Vorrichtung getroffen, auf dem Dache des Hauses ein Feuer anzünden zu können, ohne daß die Balken in Gefahr kamen, anzubrennen. Mit Hilfe von Töpfen und Blechen geschah dies, und bald schlug eine hohe Flamme zum Himmel empor, ein weithin sichtbares Zeichen für alle die, welche sich in Wassersnot befanden. Konnte man ihnen auch nicht beistehen, so wollte man doch den ratlos im Wasser Schwimmenden den Weg zur Insel zeigen. Dann eilte man hinaus, um zu sehen, ob das Feuerzeichen Erfolg haben würde, und jeder hoffte im stillen, daß es auch die Freunde herbeiführen möge.
Der Beamte hatte recht gehabt, das Wasser erreichte bald seinen höchsten Standpunkt, die Strömung ließ nach und begann dann zu sinken, wenn auch sehr langsam.
Welch kolossalen Schaden mochte die Ueberschwemmung angerichtet haben!
Die erwarteten Ernten waren unbedingt vernichtet, das Vieh mochte zum Teil auf dem hügeligen Plateau, welches sich einige Meilen weiter östlich erhob, gerettet worden sein, denn der Instinkt der in der Natur frei aufgewachsenen Tiere ist sehr fein. Der Verlust der Ernte hatte für eine solche große Hazienda, wie die von Miß Petersen, nicht viel zu bedeuten, das nächste Jahr glich den Schaden wieder aus, und zwar dadurch, daß die Ueberschwemmung alles mit einem äußerst fruchtbaren Schlamm bedeckte. Dasselbe war zwar auch bei den kleineren Haziendas der Fall, aber diese Farmer hielten den einmaligen Schaden mit ihren geringen Geldmitteln nicht aus, sie kamen in Schulden, an denen sie jahrelang zu zahlen hatten, während den großen Farmern stets bedeutende Summen zur Verfügung standen.
Und wie viele Menschenleben mochte das Wasser vernichtet haben!
Händeringend stand Johanna im Schatten des Hauses und blickte hinaus auf die trostlose, rauschende und gurgelnde Wasserwüste. Wo mochte Felix jetzt sein?
Da erscholl in der Ferne ein lauter Hilfeschrei, dann noch einer, und auf dem Hügel trat eine atemlose Stille ein. Dort rang ein Mensch mit den Fluten.
Wieder setzten die Rufe ein. Der Unglückliche hatte das Feuer erblickt, aber hatte er auch die Kraft, das trockene Land zu gewinnen? Die Stimme klang von da, woher die Strömung kam, also war zu hoffen, das er angetrieben oder doch dicht vorbeigetrieben wurde.
Nick Sharp tränkte Werg mit Petroleum, band es an einen Stock und zündete die so gebildete Fackel an, sie in weiten Kreisen um den Kopf schwingend.
»Dort treibt er, dort, dort, er schwimmt vorüber!« rief jetzt eine Stimme.
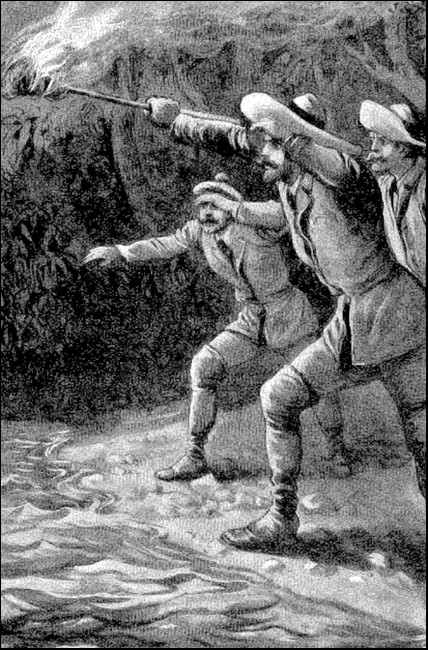
»Dort treibt er! Dort, dort schwimmt er vorüber!« rief eine Stimme.
Man erblickte im Mondschein eine Gestalt, welche verzweifelt mit der Strömung kämpfte, um nach der Insel zu gelangen. Doch bald mußte es mit seiner Kraft vorbei sein, die Bewegungen wurden hastig, aber schwach ausgeführt.
Das Gesicht des Schwimmenden konnte man nicht erkennen, dazu reichte das Mondlicht nicht aus.
»Er sinkt unter, er ertrinkt.«
Der Kopf war unter dem Wasser verschwunden, tauchte noch einmal auf und sank abermals unter, um nicht wieder aufzutauchen.
»Verloren!« ertönte es entsetzt.
»Noch nicht,« rief Sharp, drückte die Fackel dem ihm zunächst Stehenden in die Hand, war mit einem Satz im Wasser und strebte mit langen, kräftigen Stößen der Stelle zu, wo der Kopf zuletzt gesehen worden war.
Mit zwanzig Stößen hatte er sie erreicht, drehte um, tauchte unter und schwamm nun unter dem Wasser so schnell wie möglich mit der Strömung weiter.
Hatte er Glück, so konnte er den Ertrinkenden fassen, denn die Strömung schrieb ihm den Weg genau vor. Aber es kam darauf an, wie weit jener schon gesunken war.
Nach einer halben Minute tauchte Sharp wieder auf, er hatte eine beträchtliche Strecke durchmessen.
»Nichts,« rief er, schöpfte tief Atem und war schon wieder verschwunden, diesmal aber gegen die Strömung schwimmend.
»Er findet ihn doch nur als Leiche,« flüsterte ein Engländer. »Zwei Minuten sind schon seit dem ersten Hilferuf verstrichen.«
Sharp erschien wieder an der Oberfläche, er hatte den Fremden nicht erreicht.
»Lasten Sie ab, es ist zu spät,« rief ihm Williams zu, »Sie strengen sich umsonst an.«
Doch Sharps eiserne Natur kannte weder Ermüdung, noch gab er so leicht einen Vorsatz auf. Wieder tauchte er unter und blieb sehr lange aus, doch diesmal war sein Rettungswerk von Erfolg gekrönt, und mit unveränderter Kraft schwamm Sharp, den Verunglückten in einem Arm, der Insel zu.
Zwanzig Hände streckten sich aus und zogen den Bewegungslosen ans Ufer. Man hatte sicher einen Toten vor sich.
»Hei, den kenne ich,« schrie Williams plötzlich und prallte erschrocken vor der Leiche zurück.
»Eduard Flexan und kein anderer,« riefen die Uebrigen.
Sharp zog ein unbeschreibliches Gesicht.
»Also endlich habe ich ihn doch bekommen,« murmelte er, »den ganzen Tag habe ich den Schuft vergeblich verfolgt, und jetzt ziehe ich ihn aus dem Wasser. Und ich Dummkopf mache mir auch noch die Kleider naß und ertrinke fast dabei. Wahrhaftig, ich möchte lachen, wenn es nicht so traurig wäre.«
Da lag Eduard Flexan, sein Gesicht war noch geschwollener als sonst, er sah entsetzlich aus. Er war in Hemdsärmeln, seine Jacke hatte er auf der Flucht verloren, wie Sharp erzählte.
»Ralph behauptet immer, er habe eine Jacke im Walde gefunden und darin hatten die 80 000 Dollar gesteckt,« meinte Eulalie.
»Das ist allerdings wahr, das hat er gesagt,« entgegnete der Sergeant unwirsch.
»Ich kalkuliere, Ralph hat nicht gelogen, er ist unschuldig,« sagte auch Sharp.
»Und ich behaupte, daß nicht Ralph, sondern dieser Schurke dort, der jetzt endlich von seinem wohlverdienten Lohn erreicht ward, das Geld, mein Geld, gestohlen hat,« sagte da eine Stimme.
»Ellen — Lord Harrlington,« tönte es von allen Seiten, und man umringte das plötzlich wie aus der Erde gewachsene Paar.
»Felix,« erscholl auf der anderen Seite ein Jubelruf und an der breiten Brust des hohen Mannes hing, lachend und weinend zugleich, Johanna.
Der angetriebene Wagen gab Zeugnis davon, wie die Ankömmlinge sich aus der Wassersnot gerettet hatten; mit kurzen Worten schilderten sie ihre Erlebnisse, man beglückwünschte sie und bedauerte den armen Snatcher, welcher sicherlich eine Beute des Wassers geworden war.
Als Ellen den gefesselten Ralph erblickte, überflog eine Wolke ihr Gesicht, der Sergeant mußte ihr alles erklären, und dann war es Ellen ein leichtes, auf ihr Wort hin nicht nur Ralph in Freiheit zu setzen, sondern den Verhaftsbefehl gegen ihn vollkommen zurückzunehmen.
Jetzt zweifelte niemand mehr daran, daß Eduard Flexan die 80 000 Dollar wirklich gestohlen hatte oder daß sie ihm von seinem Vater ausgehändigt worden waren. Ralph beschrieb die Jacke, welche er gefunden hatte, Miß Kenworth, wie auch Martha bestätigten, so hätte das Kleidungsstück des Räubers ausgesehen, und überdies lag der Leichnam Eduards ohne Jacke am Boden.
Williams, Sharp und Hannes hatten sich mit dem Körper beschäftigt, wie man es mit Ertrunkenen zu tun pflegt. Doch alle Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.
»Mausetot,« sagte Hannes, sich aufrichtend, »ich schlage vor, wir werfen ihn wieder ins Wasser.«
Sofort hob ihn Sharp auf und wollte ihn in die Fluten schleudern, wurde aber durch einen Ruf Ellens daran gehindert.
»Halten Sie ein, Mister Sharp! So schlimm uns dieser Mann auch während seines Lebens mitgespielt haben mag, er ist tot, Gott hat ihn vor seinen Richterstuhl gefordert, und wir wollen uns nicht an seinem Leichnam rächen.«
»Rächen?« wiederholte Sharp, den Toten noch immer im Arm haltend. »Werfe ich ihn in das Wasser, so soll dies sicher kein Akt der Rache sein, sondern nur eine einfache Vorsichtsmaßregel. Im Wasser kommt er sicher nicht wieder zum Bewußtsein.«
»Ah, Sie halten ihn also nur für bewußtlos?«
»Nein, das nicht. Ich halte ihn für tot. Aber noch immer geschehen Zeichen und Wunder.«
Ellen bestand auf ihrer Meinung.
»Ich teile Ihre Ansicht nicht, Mister Sharp. Der Tote soll hierbleiben und nach Verlauf der Ueberschwemmung, also jedenfalls schon morgen früh, ein Begräbnis erhalten, wie es sich auch für den tiefstgefallenen Menschen geziemt. Wenn Sie wollen, können Sie dem Toten ja zur Vorsicht Füße und Hände binden.«
Die Stimmung war zu ernst, als daß in Ellens letzten Worten ein Scherz liegen konnte. Sharp murmelte etwas zwischen den Zähnen und warf den schrecklich anzusehenden Leichnam in einen Schuppen des Hauses.
Den letzten Teil der Nacht verbrachte man schlafend, Peggy mußte die Zimmer des geräumigen Hauses zur Verfügung stellen. Nur einige der Herren wachten. Sie unterhielten das Feuer, beobachteten das Sinken des Wassers und besprachen die letzten Ereignisse. Eine Frage beschäftigte sie besonders. Wo war der alte Flexan geblieben? War er vielleicht gar im Jenseits mit dem zusammengetroffen, der schon hier auf Erden Anklage gegen ihn erheben wollte, ihn aber nun vor einem höheren Richter als Mörder bezeichnete?
Die Morgensonne beleuchtete eine trockene Fläche. Die Grashalme lagen zwar noch niedergedrückt am Boden, richteten sich aber schon wieder auf. Ueberall stieg dichter Nebel empor, ein Zeichen, mit welcher Kraft die Sonne ihr Austrocknungswerk betrieb. Man verließ den Hügel und fand, daß der Boden zwar noch weich war, aber den Pferdehufen schon widerstehen konnte. Nach und nach kam einer nach dem anderen aus dem Hause, bis alle draußen versammelt waren und sich an dem Bilde erfreuten, das sich ihnen darbot.
Nach kurzem Beraten beschloß man, sofort den Ritt nach der Hazienda zu beginnen und dort den Wasserschaden zu besichtigen. Hoffentlich hatte das Haus den Anprall der Fluten ausgehalten, hoffentlich lebten die Diener und Neger noch.
»Erst aber wollen wir den Toten begraben, wenn auch ohne besondere Feierlichkeit,« ermahnte Ellen, »möge Gott ihm gnädig sein!«
Ralph war der erste, welcher ohne Aufforderung nach dem Schuppen eilte. Er verschwand darin, und plötzlich hörten die übrigen ihn einen lauten Schrei ausstoßen.
Der Schuppen war leer, der Tote nicht mehr darin.
Der Hausknecht konnte nichts aussagen, er war vor wenigen Minuten erst aufgestanden; ebensowenig die Herren, welche gewacht hatten. Sie wollten den Toten nicht beiseite geschafft haben.
»Wo ist Mister Sharp?« fragte Ellen, sich im Kreise umsehend.
Eben bog der Gesuchte um die Ecke des Hauses und schlenderte gemächlich, die Hände in den Hosentaschen, im Munde die qualmende Pfeife, auf die Gesellschaft zu.
»Hier bin ich,« sagte er, »Guten Morgen, meine Herren und Damen. Schöner Tag heute, nicht? Und alles wunderbar trocken geworden.«
Ellen maß den Sprecher mit finsteren Blicken.
»Wissen Sie, was wir entdeckt haben?«
»Ich wüßte nicht. Ach so, vielleicht, daß Sie Appetit haben?
»Es ist wahr, ich fühle einen riesigen Hunger.«
»Mister Sharp, der Leichnam Flexans ist verschwunden,« sagte Ellen kurz.
»Wahrhaftig? Das ist seltsam, aber wiederum auch leicht erklärlich,« war die gleichmütige Antwort Sharps, dessen Gesicht auch nicht im mindesten einen anderen Ausdruck annahm.
»Finden Sie dies so leicht erklärlich, Mister Sharp?«
»Natürlich, es hat ihn einfach jemand schon begraben.«
»Niemand von uns.«
»Ich auch nicht.«
»So hat ihn jemand ins Wasser zurückgeworfen, obgleich ich so dringend darauf bestanden habe, daß dies nicht geschieht.«
»Von dem Betreffenden, der dies getan, war es wirklich sehr rücksichtslos, Ihre Bitte nicht zu beachten,« entgegnete Sharp.
»Mister Sharp, kein anderer, als Sie, hat den Leichnam, während wir schliefen, ins Wasser geworfen.«
Jetzt machte Sharp ein ganz anderes Gesicht, langsam nahm er die Pfeife aus dem Mund und sah Ellen fest an.
»Ach, so steht die Sache,« sagte er leise. »Also Sie glauben, ich hätte Ihrer Anordnung entgegengehandelt? Warum übrigens, Miß Petersen, sprechen Sie Ihre Vermutungen nicht gleich offen aus?«
»So will ich es jetzt tun,« erwiderte Ellen mit geröteten Wangen, »Mister Sharp, Sie haben den Leichnam Flexans beiseite gebracht!«
»Nein.«
Ellen zuckte die Achseln. Da trat Sharp plötzlich einen Schritt auf sie zu.
»Ich hätte das Recht gehabt, es zu tun, denn Eduard Flexan war ein gefährlicher Verbrecher, dem man am besten eine Kugel durch den Kopf hätte schießen sollen. Aber trotzdem, Miß Petersen, ich habe es nicht getan. Genügt Ihnen diese Aussage?«
Der Detektiv hatte in ganz ungewöhnlich scharfem Ton gesprochen, es schien fast, als müßte ein Streit entstehen. Schnell trat Hoffmann dazwischen.
»Ihre Erklärung genügt,« rief er. »Ich frage die übrigen Anwesenden nochmals: hat einer von Ihnen den Leichnam auf irgend eine Weise beiseite gebracht?«
Alle antworteten verneinend; die Konstabler, der Cow-boy, die Mädchen wurden befragt, überall dieselbe Antwort.
»Mister Sharp, halten Sie es für möglich, daß Flexan wieder zu sich gekommen ist und die Flucht ergriffen hat?«
»Unmöglich ist nichts.«
»So lassen Sie uns den Schuppen untersuchen.«
Ehe Sharp dem Ingenieur folgte, wurde er noch einmal von Ellen zurückgehalten.
»Ich muß mein Benehmen Ihnen gegenüber rechtfertigen. Ich konnte nichts anderes denken, als daß Sie mit dem Leichnam ausgeführt, was Sie schon gestern abend mit ihm zu tun beabsichtigten.«
»Ich tat es nicht.«
»Jetzt glaube ich es.«
»Warum nicht gleich?«
»Ihr seltsames Benehmen bewirkte dies.«
»Wieso seltsam?«
»Wir alle erschraken, als wir Flexan nicht mehr vorfanden, nur Sie blieben bei der Mitteilung ganz kaltblütig. Sollte ich daraus nicht den Schluß ziehen, daß Sie selbst den Körper verschwinden ließen?«
Sharp lächelte.
»Miß Petersen, es wundert mich, daß Sie mich noch immer nicht kennen, Sie müßten doch nun wissen, daß ich mich nicht so leicht ins Bockshorn jagen lasse. Ob ich bei Ihrer Mitteilung nun geweint oder gejammert oder geflucht hätte, davon wäre Flexan, ist er wirklich fort, auch nicht wiedergekommen. Doch jetzt muß ich mit Mister Hoffmann den Schuppen untersuchen.«
»Die Sache ist beigelegt?«
»Vollkommen, hatte überhaupt nichts zu bedeuten.«
Es ergab sich, daß Flexan wirklich verschwunden war. Diese Nachricht verbreitete sichtlichen Schrecken. Eine kleine Pfütze zeigte den Platz an, wo der Körper gelegen hatte, andere Spuren fehlten.
»Sie glauben doch nicht etwa, Flexan sei wieder zu sich gekommen und geflohen?« fragte Ellen mit bebender Stimme. Sie war die Aengstlichste von allen.
»Offengestanden, ich zweifle nicht mehr daran,« entgegnete Sharp, »ich habe mich selbst davon überzeugt, daß Flexan die Lebenszähigkeit einer Katze hat, und Mister Hoffmann kann noch andere Sachen von ihm erzählen.«
»Es ist so,« fügte Hoffmann hinzu. »Wer wochenlang die furchtbarsten Quecksilberdämpfe einatmen kann, ohne eine Gegenmedizin zu nehmen, und wer dann noch eine ungebrochene Rüstigkeit zeigt, ja, wer sogar eine Nacht in einer Quecksilberretorte aushalten kann, ohne zu sterben, den möchte ich fast für befähigt halten, stundenlang unter Wasser ohne Luft zu leben. Meines Erachtens ist Flexan zu sich gekommen und hat das Weite gesucht, ganz schwache Spuren zeugen davon. Ich ersuche Sie jetzt, den Hügel nicht zu verlassen, bis wir unsere Untersuchung vollendet haben.«
Hoffmanns Rat kam zu spät, keine Spur Flexans konnte mehr gefunden werden. Derselbe hatte merkwürdigerweise keine Schuhe angehabt, die ganz schwachen Abdrücke seiner Füße waren daher nicht mehr zu erkennen, um so weniger, als der Boden von den Anwesenden schon völlig zertreten worden war.
Aber man hatte heute früh auch den Hügel schon öfters umgangen, kreuz und quer liefen zahlreiche Spuren, die eines nackten Fußes waren nicht darunter.
Flexan war eben entkommen, alle zogen erschrockene Gesichter, Hoffmann und Sharp schüttelten die Köpfe und besprachen sich oftmals leise.
Da teilte der Hausknecht plötzlich mit, daß ihm seine Schuhe fehlten, nirgends könnte er sie finden. Er verfügte über ein paar ansehnliche Füße, und jetzt entdeckte man plötzlich unter den übrigen Spuren Abdrücke eines sehr großen Stiefels.
Es war kein Zweifel, Flexan hatte des Hausknechts Stiefel gestohlen und in ihnen seine Flucht angetreten. Man konnte die Abdrücke auf dem Hügel erkennen, unten aber hörten sie plötzlich auf.
»Die Sache ist leicht zu erklären,« meinte Hoffmann. »Sir Williams, Sie haben diese Nacht gewacht. Wann fing das Wasser an, sich völlig zu verlaufen?«
»Als die Morgenröte dämmerte, stand es noch fußhoch. Dann verlief es sich schnell.«
»So hat Flexan seine Flucht angetreten, als der Boden noch mit Wasser bedeckt war, denn sicherlich ist er noch bei Nacht geflohen. Er wird bei jeden Schritt zwar tief eingesunken sein, denn der Boden war noch sehr weich, aber deswegen schloß sich die Oeffnung wieder spurlos.«
»Mister Sharp, wollen Sie ihn verfolgen?« fragte Ellen den Detektiven.
»Gewiß,« entgegnete Hoffmann anstatt des Gefragten.
Angsterfüllt blickte Johanna den Geliebten an.
»Wie? Du willst doch nicht etwa auch seine Verfolgung aufnehmen?«
»Es ist von größter Wichtigkeit, daß dieser Schurke endlich dingfest gemacht wird.«
»Ueberlaß dies meinem Bruder,« bat Johanna flehentlich »es ist sein Beruf; du aber bleibe bei mir.«
»Ich zweifle nicht, daß dem Bruder der tüchtigste Detektiv ist, doch Flexan ist schlau; um ihn in der Wildnis zu fangen, muß man Waldläufer sein. Mister Sharp kann bezeugen, welcher Listen sich Flexan bedient.«
Sharp nickte mit zusammengebissenen Lippen.
»So willst du mich wirklich verlassen?« fragte Johanna nochmals.
»Es muß sein.«
»Dann gehe ich mit dir, keine Gewalt auf Erden soll mich je wieder von dir trennen.«
Zweifelnd blickte Hoffmann vor sich nieder, ein innerer Kampf fand statt. Da trat Sharp zu ihm.
»Mister Hoffmann, überlassen Sie die Verfolgung mir. Ich garantiere dafür, daß ich Flexan doch noch fange, und daß er keinen Schaden mehr anstiften soll.«
»Sie haben mir ausführlich Ihre gestrige Verfolgung erzählt. Ohne Sie beleidigen zu wollen, behaupte ich, Sie sind von Flexan irregeführt worden.«
»Wohl, ich gestehe dies offen ein. Mein Fehler war, daß ich Flexan unterschätzte.«
»Sie vermuteten keinen Menschen in ihm, der seine Spur verbergen kann.«
»In der Tat, das glaubte ich nicht.«
»Er wird es zum zweiten Male und noch geschickter tun.«
»Ich versichere Sie, er entgeht mir nicht, und wenn er noch so schlau manövrierte, und wenn er noch so oft seine Stiefel wechselte, verschenkte, Wasserwege benutzte und so weiter, seit ich weiß, daß er in dergleichen Sachen erfahren ist.«
»Gut,« sagte Hoffmann nach längerem Zögern, Johannas Hand ergreifend, »ich stelle die Verfolgung Ihnen allein anheim.«
Jubelnd umarmte ihn Johanna.
»Ich hätte noch ein anderes Mittel gewußt, Sie von Ihrer Braut nicht zu entfernen,« lächelte Sharp.
»Und das wäre?«
»Ich werde Flexan nicht in der Prärie verfolgen.« »Nicht?«
»Nein, ich werde ihm eine Falle stellen.«
»Eine List?«
»Ja, ich fange ihn in der Stadt. Der Plan ist sicher. Mäuse fängt man mit Speck, für den verzweifelten Flexan weiß ich einen anderen Köder.«
»Tuen Sie, was Sie wollen, nur fangen Sie diesen Unhold, seine Zeit ist abgelaufen. Und vor allen Dingen, schonen Sie ihn nicht mehr!«
Man bestieg die Pferde.
Ralph war frei, Ellen hatte den Verhaftsbefehl zurückgenommen. Der Sergeant händigte ihr das vorgefundene Geld ein. Der Cow-boy wollte sich wegen des fehlenden Geldes verantworten, doch Ellen fiel ihm freundlich in die Rede.
»Es ist gut. Ich kenne eure Sitten und weiß daher, daß du den Finderlohn ohne Gewissensbisse behalten durftest. Genug, Ralph, du bist ein ehrlicher Kerl und sollst mein Freund bleiben. Jetzt kehrst du mit mir nach der Hazienda zurück, dort sprechen wir weiter über deinen Finderlohn. Sergeant,« wandte sie sich an den Konstabler, »Sie werden noch von mir hören, Ihre Bereitwilligkeit, mein Eigentum zu retten, soll nicht unbelohnt bleiben.«
In der Schenke waren zwar überflüssige Pferde vorhanden, aber die Konstabler ließen es sich nicht nehmen, ihre guten Reittiere denen anzubieten, welche auf dem schwimmenden Wagen angekommen waren.
Sharp blieb vorläufig in der Schenke zurück, ohne über seine Pläne zu sprechen. Er verabschiedete sich kurz.
Mister Elias ließ sich beim Abreiten der Gesellschaft nicht sehen, sein Schamgefühl hielt ihn zurück, und der übrigen Bewohner der Schenke wurde nicht weiter gedacht. In kurzem Trabe ging es der Plantage Ellens zu, der Schwarzrock sah ihnen aus einem Dachfenster mit sehr gemischten Empfindungen nach.
Eine Hand legte sich auf seine Schulter, und der Prediger sah in das lachende Gesicht Sharps.
»Da reiten die sündigen Menschen hin, die Sintflut hat sie doch verschont,« sagte er.

»Gott war ihnen gnädig,« murmelte der Schwarzrock verlegen, ohne die Augen zu heben.
»Ja, wissen Sie auch, warum?«
»Aus seiner Barmherzigkeit.«
»Vielleicht auch das. Aber sehen Sie, es heißt im 1. Buch Mose, 18. Kapitel, 32. Vers: Ich will sie nicht verderben um der zehn willen — nämlich die Einwohner Sodoms. Wenn nun Gott eine ganze Stadt nicht vernichten will, wenn er zehn Fromme darin findet, so hat er doch auch sicher die paar Sünder verschont, welche diese Nacht hier versammelt waren, weil ein Frommer unter ihnen war.«
Der Schwarzrock blickte auf, ein angenehmes Erstaunen malte sich in seinem blassen Gesicht.
»Ein Frommer? Wen meinen Sie damit?«
»Was glauben Sie?«
»Sie meinen sich selbst damit. In der Tat, nur ein Gerechter kann in der Bibel so bewandert sein, wie Sie es sind.«
»O nein,« lächelte Sharp, »ich gestehe ehrlich ein, daß ich ein großer Sünder vor dem Herrn bin.«
»Aber wen meinen Sie sonst damit?«
»Nun, wen anders als Sie?«
Des Priesters Antlitz wurde plötzlich wie mit Sonnenschein übergossen, fromm verdrehte er die Augen.
»O, Sie überschätzen mich,« stammelte er.
»Durchaus nicht. Ich bin fest überzeugt, daß Ihre Gebete die drohenden Fluten bändigten.«
»Wirklich, ich habe alle Kraft in mein Gebet gelegt.«
»Das merke ich; aber eins wundert mich doch.«
»Was denn? Sie meinen, daß die Sintflut überhaupt gedroht hat?«
»Das nicht. Ich wundere mich, daß Sie in der Ueberschwemmung nicht ersoffen sind.«
Der Schwarzrock hatte eben etwas sagen wollen, jetzt starrte er mit weitaufgerissenem Munde den kalt lächelnden Detektiven an.
»Wie meinen Sie das?« brachte er endlich hervor. »So, wie ich es sagte,« entgegnete Sharp kurz, wandte sich um und ließ den gefoppten Schwarzrock stehen.
Ein weitausgreifender Mustang jagte über den noch weichen Boden der Prärie, und der Reiter auf seinem Rücken war ein Cow-boy, ein alter Bekannter von uns, Fred. Er schonte weder Peitsche noch Sporen, das Pferd in raschester Gangart zu halten; sein Weg führte nach Miß Petersens Plantage.
Nach einiger Zeit verließ er die begrasten Ebenen er kam in kultivierte Gegenden, zu Ellens Besitzungen, gehörend, aber man sah nur noch an dürftigen Spuren, daß hier einst Felder bebaut worden waren.
Die Flut hatte dem gelockerten Boden die Halme samt den Wurzeln entrissen, die Tabaksernte war für dieses Jahr völlig vernichtet, alle Felder glichen frischgepflügten Aeckern.
Fred gab sich keinen trüben Gedanken hin, nicht, weil er persönlich von dem Unheil verschont geblieben war, sondern weil er die Sachlage richtig verstand.
»Ein Glück,« schmunzelte er vergnügt, »daß die Baumwolle und das Getreide schon hereingebracht worden sind; wäre die Ueberschwemmung zwei Wochen eher gekommen, dann hätte sie entsetzlichen Schaden angerichtet; mancher kleine Farmer hätte den Schlag nicht überstehen können. Der Tabak ist freilich hin, na, macht nichts, gut, daß es noch so abgegangen ist. Ach so, die geerntete Baumwolle ist ja auch fortgespült worden, aber die war schon verkauft. Hahaha, möchte das Gesicht des Juden sehen, wenn er seine Baumwolle abholen will — der wird spucken. Hoffentlich gibt Miß Petersen nicht nach, verkauft ist eben verkauft. Die Hauptsache ist doch, daß wir Cow-boys — halloh,« unterbrach sich Fred und richtete sich, das Pferd zügelnd, in den Steigbügeln empor, »sind das Reisende oder Indianer? Doch nein, es werden Einheimische sein, die vor dem Wasser geflohen sind und nun zurückkehren.«
Eine in der Ferne auftauchende Reitertruppe hatte die Aufmerksamkeit des Cow-boy erregt. Er änderte seine Richtung so, daß er sich ihr näherte, ohne zu sehr von seinem Ziele abzuweichen, und nicht lange dauerte es, so stieß er einen freudigen Jubelruf aus.
»Wahrhaftig, das sind ja die Herren und Damen, die Gäste von Miß Petersen. Hoffentlich ist diese selbst dabei. Wird die sich aber freuen, wenn ich ihr die freudige Nachricht bringe.«
Er hielt jetzt direkt auf die Reiter zu, und nach einer Viertelstunde passierte er den Saum eines Waldes, wodurch er zwar die Reiter aus den Augen verlor, dafür aber bald auf sie stoßen mußte.
Diejenigen, welche er gesehen, waren wirklich die Herren vom ›Amor‹ und ihre Damen, nebst Hoffmann und den geflüchteten Beamten. Sie befanden sich auf dem Wege nach der Hazienda. Hoffmanns scharfe Augen entdeckten zuerst den einsamen Präriereiter, und gleich darauf versicherte Ralph, das sei kein anderer als Fred.
»Er will mir Kunde wegen der Rinder bringen, ob sie gerettet oder verloren gegangen sind,« rief Ellen.
Auch sie verließen ihre Richtung und ritten dem Cow-boy entgegen. Sie sahen, wie derselbe den Wald erreichte, vorher die Hand zum Gruße schwenkte und dann zwischen den Bäumen verschwand, um so einen bedeutenden Teil des Weges abzuschneiden.
Die Gesellschaft schonte die Pferde, sie ritt langsam. Minute nach Minute verging, Fred ließ sich nicht am anderen Saume der Waldecke erblicken.
»Das ist ja sonderbar.« meinte Ellen. »Er müßte schon längst bei uns oder wenigstens zu sehen sein.«
»Er wartet wahrscheinlich, bis wir zu ihm kommen,« lachte Williams.
Der Wald war noch weit entfernt, aber als sie ihn erreichten, war Fred noch immer nicht zu sehen.
»Es war gar keiner von meinen Cow-boys,« sagte Ellen, »er wollte auch nicht zu uns.«
»Es war Fred und kein anderer,« behauptete Ralph energisch. »Saht Ihr übrigens nicht, wie er uns winkte?«
Die übrigen mußten das zugeben.
»Ja, was soll das aber bedeuten? Sollte Fred in der letzten Minute noch ein Unglück zugestoßen sein?«
»Das wäre nicht so unmöglich,« nahm Hoffmann das Wort. »Die Prärie ist zwar trocken, weil sie den Strahlen der Sonne direkt ausgesetzt ist, aber vielleicht ist der Boden des Waldes noch sumpfig, und leicht könnte dann ein Reiter so tief einsinken, daß es ihm nicht möglich ist, sich selbst zu befreien.«
Diese Meinung fand Beachtung, man beschloß, den Wald zu untersuchen und nach dem Cow-boy zu forschen. Vielleicht stak er in einem Sumpfe.
Aber warum rief er nicht?
Doch bald zeigte sich, daß sich Hoffmann geirrt hatte. Wohl war der Boden morastig, viel weicher als draußen in der Prärie, aber kein Pferd sank ein, und Löcher gab es im Walde nicht.
Ralph kannte diese Gegend wie seine lederne Hosentasche, versicherte er.
Dennoch sah man den Vermißten nicht, er schien wie verschwunden.
Die Gesellschaft zerstreute sich, um ihn zu suchen.
Da ertönte der Ruf eines Beamten; schnell eilte man auf ihn zu und sah ihn vor einer Leiche halten. Schon wurde allgemein geglaubt, man hätte rätselhafterweise die Leiche des Cow-boy entdeckt, als der zuerst ankommende Hoffmann vom Pferde sprang.
»Snatcher!« rief er in schmerzlichem Tone.
Die Leiche wurde umringt, alle, mit Ausnahme Ralphs und der Beamten, erkannten den Unglücklichen. Er war das erste Opfer der Überschwemmung, welches sie auf ihrem Ritte trafen.
»Er ist ertrunken, nachdem er von meinem Wagen fortgespült worden war. Ich dachte es mir, es konnte nicht anders sein. Krank, wie er war, hatte er nicht mehr die Kraft, sich auf einen Baum zu retten, konnte sich vielleicht nicht einmal mehr über Wasser halten, und gelang es ihm doch, einen Baum zu erreichen, so hat der vom Fieber Geplagte bald seinen Halt verloren, ist ins Wasser gestürzt und ertrunken.«
Hoffmann hatte schon erzählt, wie er Snatcher verloren — jetzt standen sie vor seiner Leiche.
»Wollen wir ihn mitnehmen?« wurde die Frage laut.
Man beriet, was zu tun sei. Ein Grab hier auszuheben, war nicht möglich, das von dem Messer ausgeworfene Erdloch füllte sich sofort mit Wasser, und keiner wollte den Leichnam vor sich aufs Pferd nehmen, ohne Decke. Keiner der Herren bot sich freiwillig dazu an, jeder hatte einen anderen Rat, und Ralph konnte man den Transport nicht zumuten.
Dieser erklärte, er wolle bei dem Leichnam zurückbleiben, die Herren sollten dann Leute mit einer Bahre senden, oder aber er wolle den weitern Weg zu Fuß zurücklegen, er stelle sein Pferd zum Transport des Ertrunkenen zur Verfügung.
Dieser Vorschlag wurde angenommen; Ralph sprang ab und legte hilfsbereit mit Hand an, den Leichnam auf sein Pferd zu heben, wo er mit Lassos festgeschnallt werden sollte.
Der Körper war von Raubtieren noch unberührt gelassen, nicht einmal die Raubvögel, welche nicht nötig gehabt, vor der Ueberschwemmung zu fliehen, hatten ihn gefunden, wahrscheinlich weil auf der freien Prärie genug Aas für sie vorhanden war. Dagegen zeigte die rechte Hand Snatchers Spuren, als wäre sie von einem harten Instrument empfindlich getroffen worden. Hoffmann erklärte nach kurzer Untersuchung, der Mittelfinger sei sogar zerschmettert.
Wie dies geschehen, war ein Rätsel, alles Nachsinnen führte zu keinem Resultat.
Schon sollte der Tote auf den Rücken des Pferdes gehoben werden, als sich ein Reiter durch die Umstehenden drängte. Es war Fred, aber sein Aussehen war derart, daß der Leichnam sofort fallen gelassen wurde.
Freds Gesicht war aschfahl, die Augen spähten scheu umher, und die die Zügel haltenden Hände zitterten. Beim Anblick des Toten erschrak er sichtlich, seine Züge nahmen noch mehr den Ausdruck des Entsetzens an.
»Fred, was ist los?« redete Ellen ihn an.
»Miß Petersen,« wandte er sich sofort an seine Herrin, seine Stimme bebte merklich, »mir ist etwas passiert, Herrgott, mir zittern alle Glieder — so etwas Entsetzliches ...«
Sein erschrockenes Aussehen steckte fast die Gesellschaft an, es mußte dem Manne wirklich etwas Furchtbares begegnet sein, und die Leiche hatte sowieso ein grausiges Gefühl erweckt, besonders bei den Damen.
»Was ist es denn? Sprich doch, Fred!«
»Furchtbar — Miß, die Rinder sind gerettet, fehlen bloß ein paar hundert Stück, alle übrigen sind auf Delrocks — oder die Cow-boys sind mit ihnen schon unterwegs.«
»Gott sei Dank — aber hat denn das deine Furchtsamkeit so erregt? Das ist doch eine fröhliche Nachricht.«
Bei einigen wurde die Lachlust rege, doch es schien, als sei Fred seiner Geisteskräfte nicht mehr ganz mächtig, er brachte alles durcheinander hervor.
»Ja, ja, ein Gespenst — schrecklich anzusehen — mußte Euch erst melden — wegen der Rinder — denn das Gespenst — habe nie zuvor so eins gesehen —«
Ellen wußte, daß die Cow-boys, wie alle verwilderten Menschen, sehr abergläubisch sind; etwas, was über ihre Fassungskraft geht, jagt ihnen oft das namenloseste Entsetzen ein.
»Ein Gespenst? Wo?« fragte Ellen weiter.
»Auf dem Baume — habe die Rinder...«
»Laß die Rinder jetzt aus dem Spiele, sie sind gerettet, ich weiß es nun. Auf welchem Baume?«
»Wo das Gespenst saß.«
»In diesem Walde?«
»Ja, ja.«
»Es wird ein angeschwemmter Leichnam sein,« meinte Williams.
»Kein Leichnam, ein Gespenst,« behauptete Fred, dessen Züge sich wieder zu glätten begannen.
»Es lebte?«
»So wie ich. Es kletterte von Baum zu Baum, glotzte mich an und drohte mir mit der Faust.«
»Du hast geträumt, Fred.«
»Träume ich denn jetzt etwa? Vor kaum fünf Minuten habe ich es gesehen.«
»Und wo hast du bis jetzt gesteckt?«
»Mit aufgerissenem Munde habe ich dagestanden, unfähig, mich zu bewegen.«
»Hat das Gespenst gesprochen?«
»Ja, habe aber nichts verstehen können. Es machte eine Faust und drohte mir, während es immer wie ein Eichhörnchen von Ast zu Ast sprang.
Die Zuhörer sahen sich an.
»Aber so lassen Sie uns das Wunder doch selbst ansehen,« sagte jetzt Hoffmann. »Fred, wo steht der Baum?«
»Ich werde Euch führen.«
Man folgte dem Cow-boy, welcher sich ängstlich zurückhielt, und auch unseren Freunden war es unheimlich zumute.
»Nicht so viele, nicht so viele,« gellte plötzlich eine Stimme durch den Wald. »Ich weiß es jetzt ganz genau, nur sieben habe ich ermordet. Ihr seid zu viele, ich kenne euch nicht. Verflucht, willst du fort!«
»Da ist es,« flüsterte Fred, nach einem alleinstehenden Baume deutend.
Wahrhaftig, er hatte recht gehabt. Dort oben kletterte ein Mann von Ast zu Ast, bald nach oben, bald nach unten, hin- und herspringend oder rutschend. Er sah sich beständig um, als würde er verfolgt, das verzerrte Gesicht blickte angsterfüllt nach unten, dann begann das Springen wieder. Dabei schwatzte er unaufhörlich, bald leise, bald laut, bald schreiend.
»Ja, ich habe Nikkerson ermordet,« rief er wieder, »ich gestehe es, aber verfolge mich nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich falle ins Wasser. Sieben — sieben sind es nur — nicht so viele — was wollt ihr von mir, heh — verfluchter Snatcher, laß mich los, du erwürgst mich!«
Eilends kletterte die Gestalt einen Ast höher. Schrecklich sah sie aus; die Kleider hingen in Fetzen um den skelettartigen Körper, es mußte ein mexikanischer Anzug gewesen sein — zu erkennen war er nicht mehr — das Haar hing wirr um das eingefallene Gesicht, die Augen traten fast aus den Höhlen, der Bart, weiß wie das Kopfhaar, war gleichfalls zerzaust.
Wer mochte es sein? Wie lange kletterte er schon auf dem Baume? Niemand kannte ihn.
Da fiel Ellens Auge auf die linke Hand, welche einen Ast umklammert hielt, der kleine Finger fehlte, am Zeigefinger glänzte ein Diamantring.
»Mein Gott,« schrie sie plötzlich auf, den Mann erkennend, »es ist James Flexan!«
»Das ist nicht wahr,« kreischte der Unglückliche ihr zu, »ich heiße nicht James Flexan, ich heiße Jonathan Hemmings. Ja, ja, lacht nur da unten im Wasser, ich bin Jonathan Hemmings, den sie so sehr gesucht haben. Hahaha, sie konnten mich nicht finden. Ich habe Nikkerson ermordet, nicht Snatcher, ich habe ihm das Messer aus der Schublade gestohlen, dort unten liegt es noch. Seht ihr, wie es im Wasser glitzert? Verflucht, willst du mich noch immer verfolgen?«

»Ich heiße nicht James Flexan,« kreischte der
Unglückliche, »ich heiße Jonathan Hemmings!«
Er sprang auf einen anderen Ast, blickte, sich wild um und glotzte dann wieder auf Ellen herunter, welche erschüttert Harrlington umschlungen hielt.
»James Flexan — mein Stiefvater,« wiederholte sie.
»Ein Wahnsinniger,« fügte Harrlington hinzu, »gestern sahen wir ihn noch als kräftigen Mann, heute ein wahnsinniges Skelett — das ist Gottes Gericht.«
»Ellen, Ellen, ich hasse dich,« gellte es vom Baum herunter, »wärest du nicht im Wasser, ich würde dich erwürgen, wie ich Nikkerson und noch sechs andere getötet habe. Hah, bist du schon wieder da, verdammter Snatcher!«
Wieder ein Satz nach einem anderen Ast.
»Er glaubt sich verfolgt.«
»Ja, von Snatcher.«
»Wie lange mag er schon auf dem Baume sein?« flüsterte Ellen geistesabwesend.
»Etwa vierundzwanzig Stunden.«
»Nicht möglich.«
»Doch, wir sahen ihn noch gestern.«
»Er ist ja aber zum Skelett abgemagert.«
»Die Todesangst, der Wahnsinn haben diese schnelle Veränderung bewirkt.«
Sie umstanden den Baum, hielten sich aber noch in gehöriger Entfernung. Grausen schreckte sie zurück; leicht hätte sich der Wahnsinnige auch auf einen unter ihnen werfen und ihn erwürgen können.
Er schwatzte unaufhörlich weiter, dabei seine Sprünge fortsetzend. Aus seinen Reden vernahm man bald, daß er die Prärie noch unter Wasser, sich selbst von Snatcher verfolgt glaubte. Man vernahm sein Schicksal, wie er Snatcher auf dem Baume getroffen, wie er ihn ins Wasser geschleudert, wie er ihm die Hand mit dem Revolverkolben zerschmettert habe, und wie er nun das Gespenst Snatchers hinter sich zu haben wähnte.
Daß er Nikkersons Mörder war, wußte man schon aus Snatchers früheren Aussagen, Flexan sollte dies selbst gestehen, so war es die Absicht Ellens gewesen. Es war nicht mehr möglich, ihn dazu zu zwingen, auch gar nicht mehr nötig, denn er selbst gab sich als Mörder Nikkersons und noch sechs anderer Personen an.
Dieses Schwatzen und Springen war entsetzlich.
»Wir müssen dem Spiele ein Ende machen,« sagte Ellen, »er muß vom Baum herunter.«
Hoffmann näherte sich dem Stamme.
»Es wird vergeblich sein,« sagte er dabei, bückte sich dann und hob ein Messer auf. »Er hat es verloren, Snatcher besaß kein solches.«
»Es ist Snatchers Messer,« rief der Wahnsinnige sofort, »ich habe es ihm gestohlen und damit Nikkerson ermordet. Hahaha, war das nicht schlau von mir ausgesonnen?«
»Bemüht Euch nicht, Señor,« rief Ralph dem Weitergehenden zu. »So ist die Sache einfacher.«
Gleichzeitig sauste ein Lasso durch die Luft, die Schlinge legte sich um den Wahnsinnigen und schnürte dessen Arme an dem Körper fest.
»Nicht ziehen,« befahl Ellen, von Mitleid erfaßt.
Der Anblick, der sich ihnen jetzt bot, war noch entsetzlicher, als alle früheren.
Flexan glaubte sich wahrscheinlich von dem erwähnten Gespenst gefaßt, wild kreischte er auf. »Laß mich los!« heulte er. »Ich gestehe, ich gestehe, ich gebe dir Gold, Gold, Gold — laß mich los!«
Er verlor den Halt, stürzte vom Ast und wurde von Hoffmann aufgefangen. Dieser legte einen Bewußtlosen zu Boden.
»Es ist vorbei mit ihm, er stirbt.«
Es war so. Die Nacht auf dem Baume, der Wahnsinn hatte die Lebensgeister Flexans auf einmal völlig aufgelöst, er machte noch einige krampfhafte Bewegungen, öffnete den Mund, schloß die Augen und tat den letzten Seufzer.
»Besser so für ihn,« murmelte Hoffmann erschüttert.
Der Leichnam wurde neben den Snatchers gelegt.
Da lagen die beiden. Der eine unschuldig, der andere ein Mörder, und doch hatte der Unschuldige viele, viele lange Jahre für den Schuldigen gebüßt, und schließlich war er auch noch von ihm ermordet worden.
Niemand konnte sich eines Schauers erwehren, niemand für den eben Gestorbenen beten, Gott war mit ihm ins Gericht gegangen, er hatte den Elenden in seinen letzten Stunden furchtbar büßen lassen. Was mochte Flexan zuletzt im Wahne durchgemacht, wie mochten ihn die Geister seiner Opfer noch gefoltert haben!
Ralph erklärte sich bereit, bei den beiden Leichen zu bleiben, bis man sie abholen würde, das heißt, fügte er hinzu, wenn man ihn nicht gar zu lange warten ließe, und im Falle, daß das Haus weggespült worden wäre und alle Diener den Tod in den Fluten gefunden hätten, stände dies zur erwarten.
Ellen versicherte, daß sie ihn in keinem Falle vergeblich hier harren lassen, sondern ihm baldigst Nachricht schicken würde.
Ralph erbat sich einen Beutel mit Tabak, stopfte seine Pfeife und schaute rauchend, an einen Baum gelehnt, den Davonreitenden nach.
Denjenigen, welche zur Zeit der Ueberschwemmung nicht auf der Hazienda gewesen waren, also Ellen, Harrlington und Hoffmann, war schon mitgeteilt worden, wie schwer den übrigen die Flucht geworden wäre, weil die Diener und Neger sich ebenfalls der Pferde bemächtigen wollten.
Ellen meinte, das hätte nichts zu bedeuten. Angesichts des Todes müßte jeder zuerst an sich oder an den denken, den er liebe, das sehe jeder ein, also auch die Diener. Wären sie noch am Leben, so würden sie ihnen sicherlich keinen unfreundlichen Empfang bereiten. Man beklagte die Toten und freute sich, daß man selbst noch lebe.
»Miß Petersen, Mister Hoffmann, ich bitte um ein Wort,« sagte Williams zu den beiden eben Genannten und galoppierte eine Strecke voraus, damit andeutend, daß er die beiden Gerufenen allein sprechen wollte.
Williams' sonst so fröhliches Gesicht sah sehr ernst aus, als er zwischen den beiden ritt.
»Nun, Sir Williams, was veranlaßt Sie, uns heimlich sprechen zu wollen, da wir doch keine Heimlichkeiten voreinander zu haben brauchen?« fragte Ellen lächelnd. »Oder handelt es sich vielleicht wieder ...«
»Sie irren, wenn Sie glauben, ich brütete über einen Streich,« fiel ihr Williams ernst ins Wort. »Es ist jetzt wahrlich keine Zeit dazu, Streiche anzuführen. Etwas anderes veranlaßt mich, Sie und Mister Hoffmann zu sprechen.«
Williams Gesicht wurde ernst, ja fast finster.
»Sie erschrecken mich, was ist es?«
»Ihnen ist die Flucht aus der Hazienda bereits ausführlich erzählt worden, der Kampf, welcher um die Pferde stattfand, und so weiter.«
»Es ist mir alles bekannt, und ich habe schon erklärt, daß die Sache nichts auf sich hat.«
»Alles ist Ihnen doch nicht bekannt.«
»Was ist das?«
»Miß Thomson, Miß Lind und ich waren die letzten, welche die Hazienda verließen, und wozu wir oder vielmehr ich getrieben wurde, um uns die Passage freizumachen, ist den Vorausreitenden unbekannt geblieben, wir drei haben bis jetzt darüber geschwiegen.«
»Sie irren, Sir Williams,« wandte sich Hoffmann freundlich an diesen, »meine Braut hat mir erzählt, was Sie zu tun gezwungen waren, ich betone: gezwungen, und dieser Ihrer Tat verdanke ich einzig und allein, daß ich Johanna noch meine Braut nennen darf.«
»Aber was für eine Tat ist denn das nur? Sie machen mich ganz neugierig,« rief Ellen.
»Ich habe einen Diener niedergeschossen, welcher sich in die Zügel des Pferdes der zögernden Miß Lind gehängt hatte,« entgegnete Charles düster.
Diese Nachricht schien Ellen unangenehm zu sein, eine kleine Pause trat ein.
»Tot?« fragte sie dann.
»Durch den Kopf.«
»Konnten Sie ihn nicht niederschlagen?«
»Nein,« entgegnete Charles fest, »es war ein großer, starker Kerl. Nicht jeder hat eine Riesenkraft wie Lord Hastings, und dann, Miß Petersen, bedenken Sie unsere Situation, das Leben hing von einer Sekunde ab.«
»Ich mache Ihnen auch gar keine Vorwürfe, durchaus nicht. Ich selbst hätte nicht anders handeln können. War es ein Weißer oder ein Neger?«
»Ein Neger.«
»Es ist schlimm, aber nicht zu ändern. Bei dem Versuche, sein Leben zu retten, hat der Mann eben sein Leben lassen müssen. Sir Williams, machen Sie sich keine Vorwürfe.«
»Ich bin derselben Ansicht,« erklärte Hoffmann, »und außerdem, Sir Williams, ich danke Ihnen, zugleich im Namen Miß Linds, für Ihre energische Hilfe. Tod und Leben hing von Ihrer Handlungsweise ab. Ich bin der Ihre, zählen Sie auf meinen Gegendienst.«
»Hoffentlich habe ich nicht nötig, ihn in Anspruch zu nehmen,« seufzte Williams. »Uebrigens mache ich Ihnen nicht das Geständnis, um mein Gewissen zu erleichtern, sondern nur, um zu fragen, ob meine Gewalttat wohl böses Blut gestiftet hat. Sie beide wissen die hiesige Bevölkerung am besten zu beurteilen.«
Ellen zuckte leicht die Achseln.
»Wie gesagt, die Sache kann nicht mehr geändert werden. Fürchten Sie eine Rache?«
Williams richtete sich höher im Sattel empor.
»Fürchten, nein! Ich kann meine Tat verantworten. Aber Miß Thomsons, meiner Braut wegen, wünsche ich jede neue Zwistigkeit zu vermeiden. Mein Leben gehört nicht mehr mir, auch sie hat Anspruch auf mich.«
»Was würden Sie tun, wenn zu befürchten stände, die Verwandten des von Ihnen erschossenen Negers könnten Blutrache ausüben?«
»Ich würde mich noch außer Gesichtsweite der Plantage verabschieden, die Gesellschaft verlassen, natürlich meine Braut mit mir nehmen und mich nach der nächsten Stadt begeben.«
»Und wohin von dort aus?«
»Nach dem nächsten Hafen.«
»Und dann?«
»Direkt nach England.«
»Und dann?«
»Miß Thomson meinem Vater vorstellen, ihn um seinen Segen bitten, den ich vorläufig erst schriftlich habe.«
Williams hatte fröhlich gesprochen, er war wieder der Alte geworden.
»Sie werden begreifen,« fuhr er fort, »daß ich nicht erst nach Ihrer Plantage zurückkehrte, wenn ich wüßte, meine Pläne würden durch einen neuen Unfall zerstört. Sie sprachen vorhin von Blutrache, dieser möchte ich natürlich aus dem Wege gehen.«
»Ich setzte vorhin nur den Fall,« entgegnete Ellen. »Nein, nein, seien Sie unbesorgt, Sir, so tragisch nehmen die Neger den Tod ihres Kameraden nicht. Die hiesigen Schwarzen sind ein stumpfsinniges Volk.«
Hoffmann stimmte dem bei, auch er glaubte an keine nachteiligen Folgen von Williams' Tat.
»Doch wollen wir vorsichtig sein,« sagte Ellen wieder. »Ich werde mich im geheimen erkundigen, wer der Getötete gewesen ist und seine Freunde und Verwandte durch treue Diener beobachten lassen, überhaupt die Neger im Auge behalten. Lassen Sie nur erst die Rinder angekommen sein. Dann werden einige geschlachtet, es gibt ein Fest, und alles ist vergessen.«
»So nehme ich Ihre Einladung an, Miß Petersen, und bleibe auf Ihrer Hazienda, aber höchstens noch einige Tage.«
»Länger bleiben wir alle nicht. Ich muß noch Geschäfte ordnen und einen Verwalter ernennen, dann kehren wir alle nach Mister Hoffmanns Besitzungen zurück, auf welcher die kranken Freunde und Freundinnen unserer warten. Wäre die Ueberschwemmung nicht dazwischengekommen, welche die Telegraphenverbindung zerstört hat, so hätten wir sicher schon wieder eine Depesche von ihnen erhalten. Wolle Gott, wir könnten ein fröhliches Wiedersehen feiern.«
»Und was ist dann die Absicht der Damen und Herren?« fragte Hoffmann.
»Das ist noch unbestimmt. Ich weiß, daß viele der Damen den Wunsch hegen, den Rückweg nach New-York auf der ›Vesta‹ anzutreten.
»Ich habe davon sprechen hören. Ist es möglich, daß sie nach den trüben Erfahrungen ihre Reise noch immer fortsetzen wollen?« rief Charles unwillig.
»Von New-York sind wir abgefahren; bedenken Sie den Triumph, wenn wir nach dreijähriger Abwesenheit das stolze Schiff wieder in den Heimatshafen steuern.«
War Charles Williams auch der Vernünftigste unter allen Herren, er war doch ein Engländer, und als solcher ein Sportsman, und begriff daher den Wunsch der Mädchen.
»Was wird aber Lord Harrlington dazu sagen?« fragte er dann zögernd.
»Er wird meinen Bitten nachgeben. Ich kenne ihn; er liebt mich, ist aber auch stolz, wenn seine Braut die ›Vesta‹ wieder in den Heimatshafen steuert. Und Sie vertrauen uns Johanna an, Mister Hoffmann?«
»Auf keinen Fall,« rief dieser fest. »Johanna hat das Seemannsleben hinter sich. Bald werden Sie Abschied von ihr nehmen müssen, wenn Sie Ihren Vorsatz wirklich ausführen wollen.«
»Sie mißbilligen ihn?«
»Ja,« entgegnete Hoffmann offen und deutete dann nach vorn, »dort taucht ein Haus auf. Ihre Besitzung!«
»Es ist ein vorgeschobenes Gebäude,« rief Ellen; »hat dieses den Fluten standgehalten, so wird auch das Herrenhaus noch stehen. Lassen Sie uns eilen.«
In Galopp sprengte man weiter, die Gebäude mehrten sich, nur wenige hatten Schaden erlitten, und diesen auszubessern waren schon Weiße und Neger beschäftigt.
Wer seine Zuflucht im Herrenhause gesucht, war dem Tode entgangen—unversehrt erhob sich das große, schöne Gebäude, und die Neger waren schon dabei, die Fenz wiederherzustellen und die Zeichen der Zerstörung wegzuräumen.
Die Gesellschaft wurde mit Jubelrufen begrüßt, kein böses oder unwilliges Gesicht war zu sehen, die Neger drückten in kindlichem Frohsinn ihre Freude, die Herren und Damen wiederzusehen, so natürlich und herzlich aus, daß man als sicher annehmen konnte, Williams' Befürchtungen seien unnötig gewesen.
Am Abend dieses Tages trat bald überall Ruhe ein. Die Diener schlichen schlaftrunken umher; die Neger suchten die ihnen angewiesenen Schlafplätze auf, bis ein neues Hüttendorf hergestellt ward, und so zogen sich auch die Gäste Ellens gleich nach dem Abendessen in ihre Gemächer zurück.
Jeder einzelne besaß ein Schlafzimmer für sich, und, wie es in den südlichen Gegenden überall in besseren Kreisen üblich ist, war jedem ein Diener, respektive eine Dienerin zugewiesen worden, welche auf ein Klingelzeichen erschienen und nach den Wünschen des Gastes fragten.
Todmüde betrat Miß Thomson ihr Gemach, nachdem sie auf dem Korridor ihrem Bräutigam noch eine herzliche Gutenacht gesagt hatte. Sie fand eine junge, schwarze Dienerin damit beschäftigt, das Bett zu machen. Kissen, Decken, Matratzen lagen bunt durcheinander auf dem Teppich und auf Stühlen umher.
Betty war unangenehm überrascht. Sie hatte erwartet, sich sofort entkleiden und hinlegen zu können, nun mußte sie sich gedulden, bis das Bett gemacht war. Gern hätte sie dabei geholfen, doch sie fühlte sich so zerschlagen, daß sie sich auf ein Sofa sinken ließ.
Die Negerin war ein junges, hübsches Mädchen. Sie bemerkte das Mißbehagen der Dame und beeilte sich mit ihrer Arbeit; da sie aber dabei zu hastig war, so ging diese nur noch langsamer vonstatten. Die Kissen wollten nicht in die Ueberzüge hinein, statt Schleifen entstanden in den Bändern Knoten, welche die hastigen Finger wieder zu lösen suchten, und nie kamen die Decken glatt zu liegen.
Der Negerin Augen streiften manchmal scheu die auf dem Sofa sitzende Dame, von welcher sie beobachtet wurde. Betty hielt es für das Beste, dem Mädchen freundlich zuzureden, um es zur Ruhe zu bringen.
»Nimm dir Zeit,« sagte sie lächelnd. »Je mehr du dich beeilst, desto länger scheint es zu dauern. Ich würde dir gern helfen, aber ich bin von dem langen Ritt zu erschöpft.«
»Will Missis nicht böse sein, daß das Zimmer noch nicht in Ordnung ist?« entgegnete das Mädchen niedergeschlagen. »Es wird gleich fertig sein.«
»Ich bin durchaus nicht böse darüber.«
»Aber auch nicht der Herrin sagen, sonst bekommt Polly Schelte.«

»Heißt du Polly?«
»Ja.«
»Ich werde nichts sagen,« lächelte Betty.
»Ich war heute krank, o, so sehr krank.«
»Was fehlte dir denn?«
»Mein Kopf schmerzte mich so sehr.«
»Die Anstrengungen der letzten Zeit haben uns alle mehr oder weniger angegriffen. Warst du während der Ueberschwemmung mit in diesem Hause?«
»Ja.«
»Ihr habt wohl große Angst ausgestanden?«
»Ja.«
So versuchte Betty weiterzuplaudern, doch die Negerin gab nur einsilbige Antworten. Sie schien sehr niedergeschlagen, sogar traurig zu sein. Betty schob es dem Kopfschmerz zu, denn Neger werden überhaupt von Krankheiten stets stark mitgenommen.
Endlich war das Bett fertig. Betty erhob sich, und die junge Negerin war ihr beim Entkleiden behilflich. Betty fühlte, als ihr die Taille aufgeknöpft wurde, wie die Finger des Mädchens zitterten.
»Was fehlt dir nur? Du bist so unruhig.«
»Mir ist nicht wohl.«
»So gehe jetzt, ich kann mich allein auskleiden.«
»Nein, nein, Missis würde schimpfen, wenn sie es erfährt.«
»Sie soll es nicht erfahren.«
»Aber die Lampe.«
»Ich lösche sie aus, ehe ich schlafen gehe.«
Doch Polly ging nicht.
»Ach, Missis, ich hätte eine große Bitte an Sie,« begann sie dann zögernd.
»Sprich sie aus, Kind! Kann ich sie erfüllen, so werde ich es tun.«
»Es ist nur eine Frage.«
»Dann stelle sie, fragen kostet nichts.«
»Missis, kennen Sie die Herren alle?«
»Welche Herren?«
»Die als Gäste hier sind.«
»O ja, die kenne ich alle sehr gut.«
»Also auch den mit dem Schnurrbarte?«
»Schnurrbärte haben viele. Kannst du ihn nicht ausführlicher beschreiben?«
»Er ist etwa so groß wie Sie, blond und recht hübsch.«
Betty überlegte, sie wußte wirklich erst nicht, wen das Mädchen meinte, die Beschreibung war zu allgemein.
»Ah, du meinst Sir Williams,« rief sie plötzlich. »Ich weiß nicht, wie er heißt.«
»Warte, ich will ihn dir zeigen.«
»Nicht zeigen, Missis, ich mag ihn nicht sehen,« rief Polly und streckte abwehrend beide Hände aus.
»Ich will ihn auch nicht hierherein führen,« lachte Betty, »nur sein Bild sollst du sehen.«
Sie entnahm einer Innentasche ihrer Taille ein Lederetui, öffnete es und hielt das Bild Williams' dem Mädchen hin.
»Das ist er!« rief Polly.
Da Betty selbst die Photographie ihres Bräutigams teilnehmend betrachtete, so bemerkte sie nicht die Aenderung, welche im Gesicht der Negerin vor sich ging.
Ein wilder Ausdruck war plötzlich darin zu lesen.
»Den meinst du?«
»Ja, das ist er.«
»Gefällt er dir?«
»Sehr, sehr gut. Wie heißt er?«
»Charles Williams.«
»Ist das ein guter Mann?«
»Ein sehr guter.«
»Ich glaube das nicht.«
»Warum nicht?«
»Weil — weil alle Männer böse sind.«
»Wie, Kind, hast du schon trübe Erfahrungen gemacht?« lächelte Betty.
»O nein, ich dachte nur so.«
»Sir Williams ist wirklich ein sehr guter Mann.«
»Warum sagen Sie Sir und nicht Mister, wie hier jeder Gentleman heißt?«
»Williams ist ein englischer Edelmann, ein Baronet, und diese werden nicht einfach mit Mister, sondern mit Sir angeredet,« erklärte Betty nicht ohne Stolz.
»So ist er also ein mächtiger Mann!«
»Nicht gerade mächtig, aber doch sehr angesehen in seiner Heimat. Sein Vater ist Minister der Königin von England.«
»Was ist ein Minister.«
»Ein Berater.«
»Und dieser ist auch Minister der Königin?«
»Er kann es vielleicht noch werden.«
Polly blickte noch immer starr auf das Bild des schönen jungen Mannes.
»Sir Williams ist wohl viel, viel mehr wert als ein armer Nigger?« meinte sie dann nachdenkend.
»Wie meinst du das?« fragte Betty betroffen.
»Nun, ein Nigger ist wohl gar nichts gegen ihn?«
»Ein Nigger ist ebensoviel wert wie ein Weißer. Es kommt nicht auf die Hautfarbe, sondern auf das Herz und die Leistungen eines Menschen an, wonach man ihn schätzt. Ein Schwarzer mit einem guten Herzen ist zehnmal mehr wert, als ein Weißer mit einem schlechten Herzen. Gott sieht nur das Herz an, nicht die äußere Person, nicht Titel, nicht Rang, er verdammt sogar oft die Leistungen, welche wir für gut finden.«
»Ein Schwarzer mit einem guten Herzen,« wiederholte die Negerin träumerisch.
»Bist du Christin?« fragte Betty so nebenbei.
»Ich war es.«
»Wie, nicht mehr?«
»Nein. Erst glaubte ich den Worten des Methodistenpredigers, welcher manchmal unser Negerdorf besucht, dann aber sah ich ein, daß in dem großen Buche, aus dem er immer vorliest, nur Lügen stehen.«
Betty fühlte sich nicht dazu berufen, Bekehrungsversuche zu machen, sie schwieg. Warum interessierte sich diese Negerin nur so für Williams, sollte sie etwa —
»Gefällt er dir?« fragte sie nochmals.
Diesmal schüttelte Polly den Kopf.
»Ich mag ihn nicht leiden.«
»Warum nicht?«
»Ich mag keinen Mann mehr leiden.«
»Nicht mehr?«
»Ach, ich hatte — das ist schon lange her,« brach sie kurz ab, und Betty fragte nicht weiter, um Pollys Herz, welches sicher einen geheimen Kummer hatte, nicht schwer zu machen.
Sie steckte das Bild in die Tasche zurück und fuhr fort, sich zu entkleiden.
»Haben Sie alle Herren in Bildern bei sich?«
»Nein, nur diesen einen.«
»Warum gerade den?«
»Weil — nun, Polly, ich will es dir sagen — weil ich seine Braut bin.«
»Braut?«
»Ja, das heißt, wir werden uns heiraten.«
»Ah, Sie lieben ihn?«
»Ja, sehr, und er liebt mich.«
Betty sah in diesem Augenblicke anderswohin, und so bemerkte sie nicht, wie der Negerin Augen plötzlich ausleuchteten, ein haßerfüllter Blick traf das weiße Mädchen. Hätte Betty es gemerkt, sie wäre erschrocken gewesen.
Polly half ihr weiter, die Sachen abzulegen.
»Sir Williams liebt Sie sehr?« fragte sie dann wieder.
»Ich glaube sicher,« lächelte Betty.
»Sie glauben mir?«
»Nein doch, ich weiß es bestimmt. Warum fragst du so?«
»Ich dachte nur, ob ein Schwarzer wohl auch so lieben kann wie ein Weißer.«
»Natürlich, ebenso.«
»Gerade so heiß?«
»Aber warum denn nur nicht.«
»Auch eine Weiße einen Neger?«
Betty mußte lachen.
»So höre doch: die Hautfarbe macht keinen Unterschied, die Schwarzen sind ebensolche Menschen, wie wir Weißen.«
»Ich habe einmal gesehen, wie eine Weiße an der Leiche ihres Mannes stand. Sie weinte furchtbar, raufte sich die Haare und warf sich immer über den Toten.«
»Es war der Ausdruck ihrer Trauer.«
»Wir Schwarzen können nicht so trauern. Wir gehen still umher und wünschen uns ebenfalls den Tod.«
»Ihr habt eben andere Naturen, euer Schmerz drückt sich anders aus, aber ihr habt ebenso zu leiden wie wir.«
»Auch der weiße Mann trauert, wenn seine Geliebte stirbt?«
»Gewiß.«
»Würde Sir Williams traurig sein, wenn Sie stürben?«
»Er wurde trostlos sein, namenlos trostlos. Doch sprich nicht mehr solches Zeug, wir wollen Gott danken, daß wir noch leben.«
Polly wäre jetzt eigentlich fertig gewesen, sie hatte das Zimmer verlassen können, doch machte sie sich noch allerlei zu schaffen. Betty lag schon im Bett, als sie noch immer etwas zu tun fand, und sie bot ihre Dienste in einer Weise an, daß das gutmütige Mädchen ihre Gefälligkeiten nicht abschlagen konnte, obgleich sie wünschte, nun allein zu bleiben und zu schlafen.
»Darf ich Ihnen noch die Wäsche zurechtlege«?« fragte Polly und war schon bei dem Koffer, welcher Bettys Leibwäsche enthielt.
Betty gab ihr Anweisungen, welche Leibwäsche sie morgen anzuziehen wünschte. Die Negerin ordnete alles auf Stühlen und wollte auch noch ein seines Spitzentuch hinzufügen.
»Nicht dies,« rief Betty, »es wäre schade, ein solch feines Gewebe hier zu brauchen. Gehe hinter in den anderen Koffer, dort liegen welche aus haltbareren Stoffen.«
Die Negerin fand die gewünschten Taschentücher nicht gleich, sie wühlte lange in dem Koffer umher schließlich aber brachte sie eins zum Vorschein, auseinandergefaltet.
»Liegen sie so unordentlich durcheinander?«
»Ja, Missis, dies lag so drin.«
Sie faltete das Tuch wieder zusammen und legte es zu der anderen Wäsche.
Betty war herzlich froh, als die Negerin endlich ging. Zu viel Freundlichkeit kann schließlich lästig werden. Kaum war die Tür hinter der Negerin ins Schloß gefallen, als Bettys Augen sich schon zum festen Schlafe schlossen.
Der nächste Morgen brachte zwei neue Gäste: einen Arzt, welchen seine Reise an Miß Petersens Plantage vorbeiführte, und den Baumwollenagenten, welcher Lamentationen wegen seiner fortgeschwemmten Baumwolle erhob. Ellen hieß den Arzt als ihren Gast willkommen, dem Agenten gegenüber verhielt sie sich kalt, solange er versuchte, den Schaden Ellen aufzuladen oder gar sein Geld zurückzuerlangen, als er aber anders wurde, seiner Verzweiflung über den kolossalen Verlust offen Ausdruck gab, da ließ Ellen erkennen, daß sie nicht abgeneigt sei, einen Teil des Verlustes auch auf ihre Schultern zu nehmen.
Heute sollte auch die Beerdigung Flexans und Snatchers auf dem eine Meile entfernten Friedhof der Hazienda stattfinden. Ellen zeigte keine Lust, mitzugehen, die Verhandlungen mit dem Agenten hielten sie davon ab, und so folgten die wenigsten der Herren und Damen dem Zuge, welcher sich nach dem Begräbnisplatz bewegte. Hoffmann und Johanna hatten sich ihm angeschlossen, sie wollten wenigstens dem armen Snatcher die letzte Ehre erweisen. Auch Doktor Starwed, der angekommene Arzt, beteiligte sich an dem Ritt nach dem Beerdigungsplatz, er schien für Hoffmann sehr eingenommen zu sein und suchte stets dessen Gesellschaft.
Die Zurückgebliebenen saßen in beschaulicher Ruhe auf der Veranda. Es war Sonntag und ein sehr heißer Morgen, dem ein noch heißerer Tag zu folgen versprach. Die Unterhaltung war matt, weniger, weil eine Leichenbestattung jetzt vor sich ging, als vielmehr, weil man noch immer von den Anstrengungen der letzten Tage erschöpft war. Die Herren rauchten, die Damen genossen von den umhergereichten Erfrischungen. Dann kam Ellen, welche den befriedigten Agenten verabschiedet hatte, hinzu und brachte mehr Fluß in die Unterhaltung, doch wurde der Tod Flexans nicht mehr berührt. Flexan sollte völlig vergessen werden, das schien Ellen das beste zu sein.
Miß Thomson lag langausgestreckt auf einem Rohrgeflecht und fächelte sich mit dem Taschentuch Kühlung zu. Sie bemerkte unter den aufwartenden Dienerinnen auch Polly, ihre Kammerzofe. Die Negerin war hübsch gekleidet, wenn auch sehr bunt. Die Schwarzen lieben nun einmal grelle Farben, das Bunte gibt nach ihrer Meinung erst die Eleganz. Die rote, vorn ausgeschnittene Taille saß ihr wie angegossen und zeigte ihre vollen Formen.
Betty glaubte zu bemerken, daß die großen, dunklen Augen der Negerin öfters auf sie gerichtet waren; sogar Williams machte sie darauf aufmerksam, und als sie das Mädchen noch einmal bei solch einem Blicke ertappte, rief sie dasselbe zu sich.
»Polly, willst du etwas von mir?« fragte sie leise.
»Nein, Missis! Limonade gefällig?«
Sie hielt ihr ein Präsentierbrett mit Zitronenlimonade hin.
Betty dankte, sie hatte sich getäuscht, als sie glaubte, das Mädchen hätte einen Wunsch.
Die Sonne stieg, die Hitze nahm zu; Fächer und Taschentücher mußten immer häufiger benutzt werden, um sich Kühlung zuzufächeln, aber man vermochte nicht, damit den ausbrechenden Schweiß fernzuhalten.
Das zweite Frühstück war vorüber, es war auf der Veranda präsentiert, aber kaum angerührt worden, bei dieser Hitze zeigte niemand Appetit.
Ellen unterhielt sich mit dem Beamten, welcher von jetzt ab die Hazienda verwalten sollte, über die vorzunehmenden Arbeiten, um die durch die Ueberschwemmung angerichteten Verwüstungen in kürzester Zeit zu verwischen; Lord Harrlington wurde dabei herangezogen, verhielt sich aber, in der Landwirtschaft ganz unerfahren, passiv. Die übrigen sprachen übers Wasser, klagten über die Hitze, und höchstens hie und da fiel ein Wort über die baldige Abreise und die nächsten Unternehmungen.
Da kam Doktor Starwed durch den Garten galoppiert, welcher jetzt allerdings eher einer öden Sandgrube, besetzt mit Bäumen, glich. Der Reiter hatte auf dem Rücken eine Doppelflinte und zur Seite eine geschossene Trappe hängen.
»Wie, Doktor?« rief Ellen dem auf die Veranda Tretenden, welcher Pferd, Büchse und Wildbret einem Diener übergeben, entgegen. »Sie haben den Sonntagsfrieden durch Schießen gestört?«
»Mein Gott, Miß,« entgegnete der Doktor achselzuckend, »wir Stadtmenschen haben nicht jeden Tag Gelegenheit, uns an Jagd zu ergötzen. Kommen wir einmal ins Freie, dann haben wir sicher die Büchse bei uns, und sehen wir ein Wild, so fragen wir nicht erst den Kalender, ob es ein Sonntag oder ein Alltag ist. Zürnen Sie mir deshalb?«
»Ganz und gar nicht,« lachte Ellen. »Wenn Sie die Störung der Sonntagsruhe vor Ihrem Gewissen verantworten können, ich für meinen Teil gehe nicht mit Ihnen ins Gericht. Aber wir denken alle, Sie sind bei der Beerdigung zugegen, und statt dessen jagen Sie.«
»Ich war auch bei der Beerdigung, hielt es jedoch nicht länger aus, als ich von der Jagdlust ergriffen wurde. Eben sagte der Prediger Amen, da rauschte mit schmetterndem Flügelschlag ein Zug Trappen an uns vorüber, ich saß mit einem Satz auf meinem Pferd, ohne das Amen nachgesprochen zu haben, und fort ging's, hinter den Vögeln her. Eine heiße Jagd war's zwar, bekam sie aber doch zum Schuß. Haben Sie meine Beute gesehen? Ein stattlicher Hahn, nicht?«
»Er soll Ihnen heute zum Abendbrot vorgesetzt werden,« entgegnete Ellen. »Was sagten Sie da aber vorhin von einem Prediger?«
»Ja, er sprach famos.«
»Ein frommer Neger?«
»Neger? Nein, Mister Hoffmann sprach.«
»Ach so.«
»Hatte nicht geglaubt, daß dieser Gentleman eine solche Rednergabe besäße. Er sprach so innig, daß sich die Neger immer die Augen gewischt haben, und die Weiber zum Steinzerbrechen schluchzten.«
»Er sprach am Grabe Mister Flexans?«
»Solange ich da war, nur am Grabe des anderen.«
Alle hatten dem Sprecher zugehört, jetzt richtete sich die allgemeine Aufmerksamkeit auf Miß Thomson. Das Mädchen hatte schon seit einiger Zeit wiederholt die Farbe gewechselt; jetzt war es aschfahl im Gesicht, dicke Schweißtropfen standen ihm auf der Stirn, welche es vergebens mit dem Taschentuch wegzuwischen suchte. Die Hände zitterten dabei heftig.
Williams war der erste, welcher diese Erscheinung bemerkte.
»Was ist dir, Betty?« fragte er ängstlich.
»Nichts, nichts, ich fühle mich nur etwas unwohl,« kam es leise von den bebenden Lippen.
»Schnell ein Glas Wasser!«
Das Wasser tat seine Wirkung nicht, das Mädchen wurde immer bleicher, ihr Auge sonderbar starr.
»Gehen Sie etwas auf und ab,« riet der Arzt, welcher nur auf ein plötzliches Unwohlsein, erzeugt von Hitze und zuviel genossener Limonade, schloß.
Betty antwortete nicht, sie schloß die Augen.
»Wird es bester?« fragte Williams.
»Ja, nein — ich habe keine Schmerzen mehr,« lispelte Betty.
»Wie, du hattest Schmerzen?«
»Schon lange.«
»Und sagtest es uns nicht?«
»Ich glaubte, sie würden vorübergehen.«
Ihre Stimme wurde immer undeutlicher, die Lippen färbten sich bläulich, und das Gesicht war das einer Toten. Entsetzt drängte sich die Gesellschaft um das in Zuckungen liegende Mädchen.
»Wo haben Sie Schmerzen?« mischte sich der Arzt ein.
»Ueberall,« klang es nur noch lallend.
»Im Magen?«
»Nein.«
»In den Gliedern?«
»Ja.«
Gespannt hingen die Augen aller an den Lippen des Arztes, dieser schien verlegen, er fühlte den Puls des Mädchens.
»Es scheint Starrkrampf zu sein.«
»Was tun, was tun?« schrie Williams außer sich.
»Bringen Sie Kognak!«
Dem Mädchen wurde Kognak eingeflößt; teilnahmlos schluckte es. Er hatte gar keinen Erfolg.
»Umschläge mit kaltem Wasser, reiben und kneten!«
Auch das half nichts.
»Mein Gott, sie stirbt!« schrie Williams und sank auf die Knie.

»Es wird vorübergehen,« meinte Doktor Starwed, welcher sich die Erscheinung nicht erklären konnte, die Umstehenden und zugleich sich aber beruhigen wollte.
»Glauben Sie?« fragte Williams.
»Es wird vorübergehen. Ein Hitzschlag, weiter nichts. Nur immer kalte Umschläge und recht viel ...«
Eine gellende Lache unterbrach den Sprecher.
Hinter den Umstehenden stand Polly, die funkelnden Augen auf Williams geheftet.
»Immer macht nur kalte Umschläge,« lachte sie, »reibt und knetet sie! Hahaha, mein Gift ist wirksam.«
»Weib, du hast sie vergiftet!« schrie Williams, stürzte auf die Negerin zu und packte sie am Arm.
»Ich habe sie vergiftet,« war die ruhige Antwort. »Hast du den getötet, den ich liebte, so töte ich die, welche du liebst. Ich vergelte nur Gleiches mit Gleichem. Du hast ihn erschossen, als er sich eines Pferdes bemächtigen wollte, um mich zu retten. Ja, du, du warst es,« herrschte sie Williams an.
Doch gleich hatte dieser sie wieder gepackt.
»Was gabst du ihr ein? Sprich, Weib!«
»Gift.«
»Ich habe schon Brechmittel geholt,« rief der Arzt, welcher nach seinem Zimmer geeilt und wieder zurückgekehrt war.
Der Sterbenden wurde ein Brechmittel eingeflößt, doch es hatte schon keine Wirkung mehr.
»Gegen mein Gift hilft kein Brechmittel mehr,« höhnte die Negerin.
»Was für ein Gift war es?«
»Eins, gegen welches nur ich das Mittel weiß.«
»Gib das Gegenmittel an, oder ich erwürge dich!« schrie Williams verzweifelnd.
»Ich gebe es nicht.«
Betty schien zu sterben. Sie hatte heftige Schmerzen auszustehen, ihre Zuckungen waren fürchterlich.
»Das Gegenmittel, das Gegenmittel!«
Aus der Negerin war jedoch nichts herauszubringen, Bettys Zuckungen ließen nach, sie streckte die Glieder und lag bewegungslos da. Nur das schwache Hämmern der Pulse verriet noch Leben in ihr.
»Helfen Sie, retten Sie!« rief die weinende Ellen und stürzte dem Manne entgegen, welcher eben die Verandastufen betrat. »Sie sind Arzt, Mister Hoffmann, Miß Thomson ist vergiftet, sie stirbt!«
Hoffmann stand vor der Sterbenden, er sah die verzweifelten Gesichter, daß Williams die Negerin gepackt hielt, und wußte, wer der Urheber der Vergiftung war.
Er fragte nicht weiter nach Erklärung.
»Sie stirbt,« sagte er traurig, nach dem Pulse des Mädchens greifend. »Schlug das Brechmittel an?«
»Nein.«
»Lag sie immer so da?«
»Vorhin krümmte sie sich vor Schmerzen.«
»Weib, nenne das Gegenmittel, und ich gebe dir alles, was ich habe,« schrie Williams wieder.
»Ich nenne es nicht, sie muß sterben.«
»Sie stirbt nicht!«
»Sie stirbt so sicher, wie jenes Taschentuch nicht im heißesten Feuer verbrennt.«
Der Sinn dieser Worte blieb allen unverständlich bis auf einen, Hoffmann.
»Tschain,« rief dieser plötzlich.
Er sah neben der Sterbenden ein Taschentuch liegen.
»Gehört dieses Miß Thomson?«
Die Frage wurde bejaht, man verstand den Ausruf Hoffmanns, Tschain, ebensowenig wie die Worte der Negerin, und betrachtete mit gespannter Aufmerksamkeit das Gebaren des ersteren.
Er riß ein Streichholz an und hielt das Tuch in die Flamme, doch das zarte Gewebe blieb unverletzt.
»Tschain,« wiederholte Hoffmann, fast jubelnd.
Da bemerkte man erst, wie die Negerin erschrocken war.
»Ja, es ist Tschain,« sagte sie jetzt. »Wer du auch seiest, du kennst kein Gegenmittel für das Gift der Damaras.«
»Tschain — Damara,« murmelte Harrlington. »Wie ist mir denn, sprach Hannibal nicht einmal von einem furchtbaren Gift, welches von den Damaras unter dem Namen Tschain gebraucht wird? Er sagte, es gäbe kein Gegenmittel dafür.«
»Es gibt auch keins, die Lady muß sterben. Ja, ihr Taschentuch ist von mir mit Tschain getränkt worden,« triumphierte die Negerin schadenfroh.
Plötzlich schoß Hoffmann aus der Tür und kehrte nach einer halben Minute mit einem Fläschchen zurück, welches eine goldgelbe Flüssigkeit enthielt.
»Werden Sie sie retten?« tönte es ihm von allen Seiten entgegen.
»Mit Gottes Hilfe, ja. Mister Starwed, wie ist der Pulsschlag?«
»Kaum noch merklich.«
»Also, sie lebt noch!«
»Ist aber, bewußtlos.«
»Nun denn, in Gottes Namen!«
Hoffmann flößte der Vergifteten einen Löffel von der Flüssigkeit ein und zwang sie zum Schlucken. Dann händigte er das Fläschchen dem Doktor ein und schlitzte den Blusenärmel der Bewußtlosen von oben bis unten auf.
»Doktor, helfen Sie mir, ich lasse sie zur Ader.«
Der Arzt hatte an dem Fläschchen gerochen.
»Das riecht nach Schierling, das ist Gift.«
»Ein Gegengift des Tschain.«
»Was ist Tschain?«
»Jetzt ist keine Zeit zur Erklärung; es ist ein afrikanisches Pflanzengift. Helfen Sie mir!«
Der Arzt trat einen Schritt zurück.
»Ich tue nichts, was ich nicht verantworten kann.«
»Ich kann es verantworten.«
»Aber ich nicht.«
»Ich bitte einen anderen Herrn um Unterstützung.«
Lord Harrlington legte einen Verband an, so daß der Arm bei starkem Blutverlust sofort unterbunden werden konnte.
Hoffmanns feines, haarscharfes Messerchen machte einen tiefen Schnitt in das Fleisch, es kam kein Blut.
»Zu spät,« flüsterte es im Kreise.
»Wir müssen warten, noch kann sich die Wirkung nicht äußern,« sagte Hoffmann leise.
Er flößte der Ohnmächtigen einen Löffel voll Medizin ein.
Da kam ein Blutstropfen zum Vorschein.
»Gerettet,« jubelte Hoffmann auf, »das Gift hat seine schädliche Kraft verloren.«
Die Umstehenden stimmten in den Jubelruf ein Hoffmann sprach mit zu großer Ueberzeugung, als daß man an seiner Behauptung hätte zweifeln können.
»Hörst du?« donnerte Williams die Negerin an. »Dein verruchter Plan ist vereitelt worden! Komm, sieh deine Freveltat zuschanden werden.«
Er schleppte die Negerin in den Mittelpunkt des Kreises, hielt sie aber mit eiserner Kraft fest.
Es war nicht bei dem einen Blutstropfen geblieben, einer nach dem anderen kam hervor, bis ein dünner Blutbach über den blendend weißen Arm floß.
»Sie ist gerettet,« sagte Hoffmann, »Lord Harrlington, unterbinden Sie.«
Der Blutstrom stand, und gleichzeitig öffnete Miß Thomson die Augen. Sie waren nicht mehr starr, wie vorhin, sondern hell, wie sonst; sie schaute verwundert um sich.
Williams stürzte neben ihre auf die Knie und bedeckte ihre Hand mit Küssen.
»Betty, hörst du mich? Wie ist dir? Hast du Schmerzen?«
»Was ist mit mir geschehen?« flüsterte sie.
»Keine solchen Szenen jetzt,« sagte Hoffmann, »sie ist zwar außer Gefahr, bedarf aber der Ruhe, jede Aufregung ist zu vermeiden, soll nicht ein anhaltendes Nervenübel zurückbleiben.«
Miß Thomson wurde hinausgetragen und in einem Zimmer gebettet. Die Damen wollten die Pflege übernehmen, niemand sonst sollte das Zimmer betreten, auch Williams nicht. In ein bis zwei Tagen sei jede nachträgliche Gefahr vorüber, erklärte Hoffmann, wenn die Behandlung nach seiner Vorschrift geschähe. Er würde ihr Arzt sein.
Als Williams die Negerin losgelassen, weil sein Herz ihn in die Nähe der Geliebten trieb, wollte Polly diese Gelegenheit benutzen, zu entschlüpfen, doch schnell hatte wieder Hastings sie gepackt.
»Halt, wir sprechen noch ein Wort zusammen!«
Jetzt, nachdem Miß Thomson entfernt und ihre Pflege übernommen worden war, wandte sich der allgemeine Unwille gegen die Negerin.
Polly war die Geliebte des Negers gewesen, welcher bei der Flucht vor dem Wasser durch Williams erschossen worden war. Man brauchte sie nicht zu fragen, sie hatte schon gestanden, daß sie das Taschentuch Bettys mit Gift getränkt hatte.
Mit finsterem Antlitz trat Hoffmann vor das Mädchen, er begegnete einem unerschrockenen Blick.
»Woher hast du das Gift?«
Keine Antwort.
»Hast du noch mehr davon?«
Wieder keine Antwort.
»Sprich, sonst lasse ich dich in meiner Gegenwart entkleiden und untersuche dich selbst.«
Wortlos griff Polly in den Busenausschnitt und zog ein Fläschchen mit einer dunkelgrünen Flüssigkeit heraus.
»Es ist Tschain,« nickte Hoffmann, nachdem er daran gerochen, und steckte es in die Brusttasche.
Aus der Negerin war keine Antwort zu bringen, mit fest zusammengepreßten Lippen stand sie da, die Augen, glühend, wie die eines Raubtieres, unverwandt auf Williams geheftet.
Dieser war erschüttert.
»Eine Ahnung sagte mir, daß meine Tat furchtbare Folgen haben würde, und doch fühlte und fühle ich mich noch jetzt unschuldig wegen der Tötung jenes Negers.«
»Sie sind es auch,« entgegnete Hoffmann, »Sie konnten nicht anders handeln. Doch bitte ich Sie, Miß Petersen, milde mit dieser Negerin zu verfahren. Sie hat heißes Blut in ihren Adern fließen, wir müssen bei Beurteilung ihrer Handlung den richtigen Maßstab anlegen.«
»Ich werde sie dem Gericht ausliefern.«
»Tun Sie das nicht,« bat Williams. »Daraus entspringen noch andere Unannehmlichkeiten, und das Weib wird wegen Giftmischerei hart bestraft.«
Ellen zögerte.
»Wie lange soll ich sie denn noch halten?« murrte da Lord Hastings.
Ellen wollte die Negerin in ein Gewahrsam bringen lassen, als das Mädchen, welches bei Betty wachte, kam und sagte, die Kranke wünsche dringlich, Polly zu sprechen.
»Miß Thomson hat erfahren, woher ihre Krankheit stammte?« fragte Hoffmann.
»Ich habe ihr alles erzählt.«
»Das hätten Sie nicht tun sollen, sie wird dadurch zu sehr aufgeregt.«
»Miß Thomson ist durchaus bei klarer Vernunft und stellte Fragen, welche ich beantworten mußte. Sie selbst glaubte schon, Polly habe ihr Gift verabreicht, sie ahnte den ganzen Zusammenhang, und ich habe sie dann völlig aufgeklärt.«
»Und jetzt wünscht sie, Polly zu sprechen?«
»Ja.«
»Das möchte ich nicht erlauben.«
»Sie wird darauf bestehen.«
»Nun gut,« sagte Hoffmann nach einigem Zögern, »so mag Polly in das Schlafzimmer gehen. Doch es ist ihr nicht ganz zu trauen, darum, liebe Johanna, gehst du wohl mit und,« fügte er leise hinzu, »behältst die Negerin scharf im Auge.«
Die beiden Damen verließen das Zimmer und begaben sich in die Krankenstube, die Negerin führend. Mit gesenktem Kopfe schritt Polly einher.
Williams trat mit ausgestreckter Hand auf Hoffmann zu.
»Mister Hoffmann, Sie haben mir meine Braut abermals, ich weiß nicht zum wievielten Male gerettet; wie soll ich Ihnen dafür danken —.«
»Keinen Dank,« unterbrach ihn Hoffmann, seine Hand ergreifend, »ich oder vielmehr das Schicksal hat Gleiches mit Gleichem vergolten, und ich war nur sein Werkzeug. Ihre Braut kam in Gefahr des Lebens, weil Sie mir die meinige gerettet hatten, danken Sie Gott, nicht mir, daß er mich noch zur rechten Zeit hierherführte.«
»Nun bitte ich Sie, Mister Hoffmann, mir zu offenbaren,« nahm jetzt der Doktor das Wort, »was für eine Bewandtnis es mit dem geheimnisvollen Gift hat.«
»Es ist kein geheimnisvolles, sondern ein unter den Damaras, einem Negerstamm, allgemein bekanntes Gift, welches aus dem Saft einer Pflanze gewonnen wird. In den Magen gebracht, wirkt es weniger schädlich, als wenn es feucht mit der Hand in Berührung kommt. Starrkrampf, Schmerzen in den Gliedern und bald eintretender Tod sind die Folgen der Vergiftung. Das Tschain ist eine leicht flüchtige Substanz, das Tuch, das damit benetzt wird, trocknet sofort wieder, und in diesem Zustande ist das Gift wirkungslos. Kommt es aber mit der feuchten Haut, etwa mit schweißbedeckter Stirn, oder mit nassen Lippen in Berührung, so beginnt seine furchtbare Wirkung, es tötet.«
»Wie erkannten Sie das Gift?«
»Durch den Ausruf der Negerin: so wenig wie das Tuch dort verbrennt. Das Tschain besitzt die Eigenschaft, daß das Gewebe, welches mit ihm imprägniert ist, unverbrennbar wird. Ein Versuch überzeugte mich sofort davon. Ich war lange Zeit in Afrika und habe ein Gegengift unter meinen Medikamenten.«
»Ich habe gesehen, wie Miß Thomson sich öfters mit dem Tuch die feuchte Stirn gewischt hat,« meinte eine Dame.
»Schon die feuchte Hand genügte, um das Gift wirksam zu machen.«
»Wo ist denn das entsetzliche Tuch jetzt?«
»Ich habe es vorläufig in meine Brusttasche gesteckt und werde es dann vernichten.«
»Wer weiß, ob die Dame noch gerettet werden konnte, wenn die Negerin das Gift nicht selbst verraten hätte,« fügte der Arzt hinzu.
»Daran zweifle auch ich,« gestand Hoffmann.
Die vorige Dame trat wieder ins Zimmer.
»Miß Thomson wünscht, Sir Williams und Mister Hoffmann zu sprechen.«
»Darf ich der Kranken nicht auch einmal einen Besuch abstatten?« fragte Ellen lächelnd.
»Einen Augenblick. Ich glaube, es handelt sich um eine private Unterredung.«
Die beiden Herren fanden Miß Thomson den Verhältnissen angemessen sehr wohl, einige Abspannung abgerechnet. Sie empfing die Freunde mit heiterem Lächeln, bedankte sich bei Hoffmann für seine Hilfe und begrüßte dann ihren Geliebten.
Beide wunderten sich nicht wenig, die Negerin, in Tränen schwimmend, neben Johanna stehen zu sehen. Sie hatte das Gesicht verhüllt und schluchzte heftig.
Betty ergriff ihre Hand und zog sie zu sich.
»Ich weiß jetzt, was sie dazu getrieben hat, so zu handeln. Charles, verzeihe ihr!«
Erst blickte Williams finster auf das weinende Mädchen, dann hellte sich sein Antlitz wieder auf.
»Es sei denn, ich trage ihr nichts nach.«
»Du wirst sie nicht strafen?«
»Wenn du es nicht willst, nein!«
»Du hast ihr verziehen?«
»Völlig.«
»So tue noch ein übriges.«
»Was?«
»Du hast ihr die einzige Seele geraubt, an der sie mit Liebe hing, von der sie geliebt wurde ...«
»Und?« fragte Charles gespannt.
»So ersetze ihr den Geliebten.«
Williams war über diese Zumutung verblüfft, doch Hoffmann lächelte verständnisvoll.
»Wie meinst du das?« brachte er endlich heraus. »Ich meine, wir beide wollen uns dieses Mädchens annehmen, welches durch uns den einzigen verloren hat, an dem es hing. Ja, Charles, wir wollen Polly lieben, und sie wird uns wieder lieben — wir nehmen sie mit.«
Williams trat erschrocken einen Schritt zurück.
»Nimmermehr!«
»Erfülle mir diese Bitte! Ich habe mit ihr gesprochen, sie bereut ihre Tat und verspricht, mir die treueste Dienerin zu werden.«
»Betty, bedenke, was du tust! Sie hat dich zu töten gesucht, weil sie mich haßt.«
»Ich habe alles bedacht und bin sicher, daß wir ein gutes Werk tun. Wir retten ein Geschöpf Gottes vor Schmach, Elend und Verzweiflung. Mister Hoffmann, unterstützen Sie meine Bitte, Sie kennen die Menschen!«
Fragend schaute Charles auf Hoffmann.
»Auch Sie wären der Meinung, daß ich dieses Weib zu mir nehmen darf, ohne in steter Sorge leben zu müssen?«
»Sie dürfen es,« entgegnete Hoffmann, »ich rate Ihnen sogar, es zu tun.«
»Aber der Mordanschlag, der Haß!«
»O, Sir Williams! Sehen Sie denn nicht, sie weint, sie vergießt Tränen der Reue, und diese sind das erste und sicherste Zeichen der Besserung. Willst du, Polly, dieser Dame und diesem Herrn fortan eine treue Dienerin sein?«
Da schlug die Negerin das große, mit Tränen gefüllte Auge voll zu dem weißen Mädchen auf, fiel vor Betty nieder und ergriff deren Hand, sie mit Küssen bedeckend.
»Ich will, ich will, nur vergeben Sie mir, und mein Leben soll von jetzt ab Ihnen gehören!« erklang es schluchzend.

Die Negerin fiel vor dem Bett nieder und rief unter
Tranen: »Mein Leben soll von jetzt ab Ihnen gehören.«
Vor dem Redaktionsgebäude des ›New-York Herald‹, einem Riesenbau, dessen prächtige Architektur New-York zur Zierde gereicht, stand breitbeinig ein Mann, die Hände in den Hosentaschen, eine Kalkpfeife im Munde, und schaute zu den Fenstern empor, hinter welchen zahllose Schreiber die Berichte für die morgende Zeitung zusammenstellten.
Der Mann war recht schäbig, nur mit Hose und einer roten Bluse gekleidet, hatte hohe Stiefel an den Beinen und auf dem struppigen, von der Sonne gebleichten Haar saß ein breitkrempiger Filzhut. Das Gesicht war gebräunt, desgleichen die halbnackte Brust, und die dicke Nase strahlte rot wie ein Karfunkel in der Morgensonne.
Man konnte diesen Mann leicht für einen Miner, das ist ein Goldsucher, halten, die Kleidung war ganz die eines solchen.
Jetzt zog der Mann seine grobe, braune Faust aus der Tasche, kraute sich in dem stoppligen Vollbart und murmelte vor sich hin.
»Hm, da wären wir ja. Ein verdammt feines Haus. Hätte nie geglaubt, daß es so große Gebäude gibt, hätte gedacht, es müßte beim ersten blutigen Sturm über den Haufen fallen. Hm, ganz hübsch, aber wohnen möchte ich nicht drin, hätte immer Angst. Na, alter Junge, gehe mal 'nein, so lange wird es schon halten.«
Er nahm die Pfeife aus dem Munde und steckte dafür ein großes Stück Priemtabak in den Mund, dann schritt er, einige Male energisch ausspuckend, dem Hauptportal des Hauses zu.
Ungehindert stieg er die Marmorstufen hinauf. Niemand der Hin- und Hereilenden beachtete die seltsame Erscheinung, denn hier hatte jeder mit sich selbst zu tun.
Auf dem ersten Korridor blieb der Fremde stehen und sah sich fragend um. Ueberall öffneten und schlossen sich fortwährend Türen, die Personen ein- und ausließen, aber niemand fragte den Fremden nach seinem Begehr.
»Hm, da muß ich wohl selbst fragen, sonst kann ich bis heute abend hier stehen und warten.«
Er spuckte aus und fragte einen Gentleman mit Zylinder, welcher eben ein Zimmer verließ:
»He, guter Freund, wem gehört dieses Haus?«
Der Angesprochene streifte ihn nur mit einem Blick, dann eilte er weiter.
»So ein verdammter Affe,« brummte der Kerl, »möchte ihm einen Tritt geben, aber Beine hat er wie eine Hornpipe.« Langbeinige Spinne.
Der nächste, der an ihm vorüberkam, war ein junger Schreiber, die Feder hinter dem Ohr, unter jedem Arm ein Aktenbündel.
Diesmal wollte sich der Miner nicht so leicht abfertigen lassen, mit einem Schritt stand er vor dem Schreiber und legte ihm beide Hände auf die Schultern.
»Wem gehört dieses Haus, mein Junge?«
Erschrocken starrte ihn der Schreiber an.
»Habe keine Zeit,« murmelte er und wollte sich vorbeidrängen, doch der Kerl ließ ihn nicht los.
»Antwort will ich von dir haben, Schlingel! Wem gehört dieses Haus?«
Dem Schreiber war diese Unterbrechung in seiner monotonen Arbeit schließlich gar nicht so unangenehm, er musterte die seltsame Gestalt von oben bis unten und dachte, mit dem Manne seinen Spaß zu treiben.
»Das ist die Redaktion des ›New-York Herald‹!«
»Das weiß ich. Wem sie gehört, frage ich.«
»Mir nicht.«
»Du Tintenkleckser sähst auch gerade danach aus. Höre, wenn du mir jetzt keine Antwort auf meine Frage gibst, so schlage ich dich zum Krüppel.«
»Ihr wollt den ›New-York Herald‹ wohl kaufen?« lachte der Bursche uneingeschüchtert.
Statt aller Antwort verabreichte der Miner dem Schreiber eine Ohrfeige, daß er sich zwischen seinen zerstreuten Akten am Boden wälzte. Natürlich schrie er laut, und jetzt eilten von allen Seiten Diener und Portiers herbei, den Frevler umringend.
»Was gibt's? Was ist los? Wie könnt Ihr Euch unterstehen, diesen Schreiber zu schlagen?«
Der Miner ließ sich durch diese durcheinanderklingenden, drohenden Rufe nicht beirren, breitbeinig blieb er stehen.
»Weil er mich verhöhnen wollte.«
»Wer seid Ihr denn?«
»Ortsvorsteher von San Francisco.«
Die Umstehenden brachen in ein schallendes Gelächter aus.
»Was, Ihr lacht, wenn ich die Wahrheit spreche?« rief der Miner erbost und holte mit der Hand zum Schlage aus.
»Nein, nein, wir glauben es Euch,« rief schnell ein betreßter Portier, dem der Schalk aus den Augen sah. »Also Herr Ortsvorsteher von San Francisco, was wünscht Ihr?«
»Wem gehört dies Haus?«
»Gar niemandem, hier gibt es nur einen Direktor.«
»Aha, und wo ist der Direktor?«
»Wollt Ihr ihn sprechen?«
»Ja.«
»Gut, er steht vor Euch.«
Der Miner riß die Augen auf.
»Was, du affig angezogener Kerl willst der Direktor sein? Ein Lump bist du!«
Patsch, fuhr dem Portier eine Hand ins Gesicht, daß er sich ebenfalls überkugelte.
Nun war es des Spaßes genug, alle stürzten sich auf den Miner, um ihn zu fassen, doch dieser war ein Boxer ersten Ranges. Blitzschnell fuhren seine Fäuste nach allen Seiten aus, dem in den Magen, diesem in die Seite, jenem ins Gesicht. Laute Schmerzensschreie erfüllten den Korridor, die Angreifer lehnten wimmernd an der Wand.
»Wartet, ich will euch lehren, euch Gesindel, zusammen einen einzelnen zu überfallen.«
»Ruhe da,« donnerte eine Stimme, und vor die Kämpfenden trat ein ernster, hoher Mann.
»Wer macht hier solchen Skandal?«
Der Miner wurde natürlich von allen beschuldigt. Die Geschlagenen waren wütend, zogen sich aber doch vor dem Herrn zurück.
»Wer seid Ihr?« wandte sich dieser an den Miner.
»Ortsvorsteher von San Francisco.«
»Hm, das klingt sehr unwahrscheinlich.«
»So? Und wer seid Ihr?«
»Ich bin hier stellvertretender Direktor.«
»Hm, das klingt sehr unwahrscheinlich,« sagte seinerseits der Miner.
»Ihr zweifelt daran?«
»Ebenso, wie Ihr an meinem Rang zweifelt.«
»Nun gut! Was wünscht Ihr?«
»Den Herrn Direktor zu sprechen.«
»Mister Bennet?«
»Ja, so heißt er wohl.«
»Der ist in Paris.«
»Verdammt. Ist das weit von hier?«
»Eine ziemliche Strecke,« lächelte der Herr.
»Wie lange habe ich da zu gehen?«
»Das schlagt Euch aus dem Sinn. Paris liegt einige tausend Meilen von hier.«
»Dann hilft's nichts, dann muß ich warten. Bleibt er lange fort?«
»Weiß ich nicht. Was wollt Ihr von ihm?«
Der Direktor hätte sich mit dem Miner nicht so lange unterhalten, hätte er nicht geglaubt, dieser Mann hätte die wichtige Entdeckung eines Goldfeldes mitzuteilen. Schon einmal war ein ähnlicher Fall passiert.
»Ich muß ihm etwas mitteilen,« entgegnete der Miner auf die letzte Frage des Herrn.
»Das könnt Ihr mir auch sagen, ich bin der Stellvertreter des Mister Bennet.«
»Das kann jeder sagen.«
»Ich bin's, verlaßt Euch darauf. Was wünscht Ihr?«
»Ich habe etwas gefunden.«
Der Direktor beugte sich etwas vor.
»Gold?« fragte er leise.
Ein Kopfschütteln war die Antwort, und der Direktor zog ein langes Gesicht.
»Ja, was denn sonst?«
»Ein Stück Papier.«
»Von Wert?«
»Von großem Wert.«
»Dann wendet Euch nach dem Fundbureau,« entgegnete der Direktor kurz und wollte gehen, wurde aber zurückgehalten.
»Halt, die Sache ist nicht so einfach. Ich will erst meine 10 000 Dollar haben.«
»Ihr seid wohl verrückt!«
»Na, dann ist das wohl alles erlogen?«
Bedächtig holte der Mann aus seinem Hemde eine alte Zeitung heraus, faltete sie auseinander und las dann vor:
»Verloren im Staate Arkansas, auf dem Wege zwischen Little Rocks und Wollaston, ein Pergamentpapier, bedeckt mit unbekannten Schriftzeichen, darin eingewickelt eine dünne, schwarze, elastische Scheibe. Der Finder erhält bei Ablieferung des Pergaments von dem ›New-York Herald‹ 10 000 Dollar bar ausgezahlt.«
Der Miner faltete das Papier zusammen und blickte sich triumphierend im Kreise um. Ueberall begegnete er erstaunten Gesichtern.
»Kommen Sie hier herein!« sagte der Direktor, plötzlich sehr höflich und führte den Miner in ein kleines Zimmer.

»Einen Augenblick, ich komme gleich wieder.«
Der Mann setzte sich behaglich in einem Lehnstuhl zurecht, spreizte die Beine und wartete, bis der Direktor zurückkam. Als dieser wieder erschien, fand er zu seinem Erstaunen, daß sich das Muster des Teppichs plötzlich geändert hatte. Der Miner hatte hier und da Tabakssaft angebracht, besonders der Kopf eines eingewirkten Tigers war von ihm mit unfehlbarer Sicherheit beschossen worden.
Der Direktor nahm keinen Anstoß daran, dieser Mann war jetzt eine zu wichtige Person.
»Sie haben das fragliche Pergament gefunden?«
» Well, Sir, ich habe es.«
»Sie sind Miner?«
»Ich? Nein, ich bin Ortsvorsteher von San Francisco.«
Der Direktor unterdrückte ein Lächeln.
»Von San Francisco in Kalifornien?«
»Unsinn, San Francisco in Arkansas.«
»Ah so. Das kenne ich gar nicht.«
»Nicht möglich!«
»Große Stadt?«
»O ja, so ziemlich.«
»Wieviel Einwohner?«
»Warten Sie mal. Da ist erstens Dick — das bin ich nämlich — dann Bill, der Sheriff, Bob, zwei Frauen, zwei Kinder, macht zusammen sieben, glaube aber, jetzt sind's acht, bei meiner Abreiße wollte Bobs Frau einen neuen Bürger in die Welt setzen.«
»Ihr seid also Ortsvorsteher dieser Kolonie?«
»Keine Kolonie, San Francisco ist eine Stadt.«
»Ich verstehe. Und Ihr fandet das Pergament?«
» Well, Sir.«
»Wo?«
»Im Wald.«
»Warum kamt Ihr nach New-York?«
»In jeder Zeitung steht doch am Ende, daß der ›New-York Herald‹ in New-York ist, sonst würde er doch auch nicht so heißen.«
»Das ist allerdings wahr. Aber wußtet Ihr nicht, daß wir in jeder größeren Stadt Hauptexpeditionen haben, wo Ihr den Fund abliefern und die Prämie empfangen könnt?«
»Was für Dinger?«
»Hauptexpeditionen. Das sind Niederlagen der Zeitung, von wo aus diese verschickt wird.«
»Das wußte ich allerdings nicht. Der ›New-York Herald‹ ist nämlich die einzige Zeitung, welche in San Francisco gehalten wird.«
»Das zu hören freut mich.«
»Wir bekommen ihn aus Little Rock ...«
»Little Rock in Arkansas?« fragte der Direktor.
»Ja.«
»Dort befindet sich ebenfalls eine Hauptexpedition, wo Ihr das Pergament hättet abliefern können.«
»Hm,« schmunzelte der Mann, »das Haus, wo sie sich befindet, sieht gar nicht danach aus, als ob es gleich 10 000 Dollar bar auf den Tisch hinzählen könnte.«
»O, das wäre einfach hintelegraphiert worden.«
»Geht das schnell?«
»Hätte keine fünf Minuten gedauert.«
»Dann war meine Reise hierher allerdings unnütz.«
»Ja, das Geld ist hinausgeworfen worden.«
»Na, macht nichts. Ihr müßt nämlich wissen, ich bin kein so armer Mann, wie ich vielleicht aussehen mag,« sagte der Miner mit pfiffigem Lächeln.
»Und ich bin kein Mann, der sich durch unscheinbare Kleider täuschen läßt. Gerade in den Taschen der roten Minerhemden sind oft Schätze verborgen.«
»Getroffen, Sir,« lachte Dick.
»Ihr seid also ein Miner?«
»Ja, neuerdings wieder. Früher besaß ich nicht weit von meinem Hause einen Claim, habe aber nicht besonders viel herausgeholt. Als er erschöpft war, fing ich an, Holz zu fällen, bis ich vor einigen Wochen eine kapitale Entdeckung machte. Eines Abends war ich ganz mordsmäßig besoffen — das klingt Euch doch nicht anstößig, Sir?«
»Durchaus nicht, fahrt nur fort!«
»Also ich war besoffen wie ein Generalmajor, aber trotzdem noch ein Gentleman vom Scheitel bis zur Sohle,« fuhr Dick fort, nachdem er den angesammelten braunen Tabakssaft energisch ausgespuckt hatte, »und so war es nicht wunderbar, daß ich mich vom rechten Wege verirrte und — es war Nacht — mich nicht mehr zurechtfand. Ehe ich mich versah, stürzte ich mit einem Male in ein manntiefes Loch, und zwar, wie ich gleich bemerkte, in meinen eigenen Claim. Der Boden war wohl einen Fuß hoch mit Wasser bedeckt.«
»Hatte es geregnet?«
»Freilich, das hatte ich ganz vergessen zu sagen. Es hatte vorher einige Tage lang fürchterlich geregnet, eigens für mich wahrscheinlich. Also in meinem Claim stand Wasser, aber das genierte mich nicht, ich streckte mich lang am Boden aus und schlief die ganze Nacht herrlich.«
»In dem Wasser?«
»Bah, was macht sich ein Hinterwäldler daraus!«
»Aber Ihr müßt gefroren haben.«
»Mit acht Quart Whisky im Leibe friert man nicht. Ich erwachte am frühen Morgen, fand mich zu meinem Erstaunen in meinem eigenen Claim liegen, und, als ich mich umsah, was meint Ihr, was ich da erblickte?«
»Gold.«
»Ja, es blinkte und glänzte alles in der Morgensonne, die Wände waren von dem Regen abgespült worden, und nun lagen einige Goldadern am Tage. Ich großer Esel hätte früher nur noch einige Messerstiche zu machen brauchen, so wäre ich schon damals ein reicher Mann gewesen.«
»Nun, ich gratuliere Euch zu Eurem Glück,« sagte der Direktor, welcher ungeduldig zu werden begann. »Doch nun wieder zum Geschäft. Wollt Ihr mir das Pergament einmal zeigen?«
»Gewiß.«
Der Miner brachte aus seinem Hemd ein schmutziggelbes, zusammengefaltetes Pergamentpapier hervor.
»Die Gummischeibe ist auch darin,« sagte er dabei.
Der Direktor streckte die Hand aus, um es zu nehmen, doch schnell zog Dick das Papier zurück.
»Wollt Ihr es haben?«
»Ja, ich muß prüfen, ob es das richtige ist.«
Dick faltete das Pergament auseinander, nahm die Gummischeibe heraus und hielt es seinem Gegenüber hin, so daß dieser die sonderbaren, krausen Schriftzeichen sehen konnte, ließ es aber nicht aus den Händen.
»Gebt es her!«
»Erst die 10 000 Dollar.«
Der Direktor machte ein erstauntes Gesicht.
»Ah, so steht die Sache — ich merkte es schon. Also Ihr glaubt, wenn Ihr mir den Fund gebt, soll ich Euch sofort die 10 000 Dollar auszahlen?«
»Sicherlich.«
»Nein, Freund, da seid Ihr im Irrtum. Ich muß das Pergament erst prüfen, ob es auch das richtige ist.«
»Könnt Ihr denn das beurteilen?«
»Wenn auch ich nicht, so doch ein anderer.«
»Wer ist der andere?«
»Einer, den der Besitzer dieses Pergaments hierherschicken will, die Echtheit des Fundes zu prüfen.«
»Also er ist noch gar nicht hier?«
»Nein.«
»Dann werde ich so lange warten, bis er ankommt und dann noch einmal vorfragen,« entgegnete Dick ruhig und ließ das Pergament wieder im Hemdenschlitz verschwinden.
Verblüfft schaute der Direktor ihn an.
»Aber, Freund,« brachte er endlich hervor, »macht doch keine solchen Geschichten.«
»Die 10 000 Dollar her, und Ihr habt sofort den Wisch,« war die gelassene Antwort.
»Glaubt Ihr etwa, der ›New-York Herald‹ sei für keine 10 000 Dollar gut?«
»Mag wohl sein; aber ich habe einen harten Kopf und mir hineingesetzt, den Wisch nicht aus den Händen zu geben, bevor die versprochene Belohnung mir ausgezahlt worden ist. Deshalb bin ich auch gleich hierhergereist.«
»Nehmt doch Vernunft an!« bat der Direktor sanft. »Der Besitzer des Dokumentes hat mich ausdrücklich gebeten, das Pergament von seinem Bevollmächtigten prüfen zu lassen, da nicht ausgeschlossen ist, daß eine Fälschung vorliegt ...«
»Haltet Ihr mich für einen Fälscher?«
»Das will ich nicht gesagt haben.«
»Habe auch verdammt wenig Geschick, solche schnörklige Buchstaben nachzumachen. Bin herzlich froh, wenn ich meinen Namen richtig geschrieben habe.«
»Ich sprach nicht davon, daß Ihr das Pergament gefälscht habt, Ihr könnt ein Falsifikat gefunden haben.«
»Unsinn, ich fand es im Walde, zwischen Little Rock und Wollaston. Stimmt das nicht?«
»Allerdings, so lautet die Angabe. Aber dennoch, ich habe die strikte Vorschrift, dem Ablieferer des Fundes die 10 000 Dollar nicht eher auszuhändigen, als bis der Bevollmächtigte Hoffmanns die Richtigkeit des Dokumentes erklärt hat.«
»Wer ist das, Hoffmann?«
»Der Besitzer des Pergamentes.«
»Muß ein wichtiges Geheimnis enthalten.«
»Wahrscheinlich, ich weiß es nicht.«
»Also gebt mir den Finderlohn.«
»Ich kann noch nicht, geduldet Euch.«
»Dann bekommt Ihr auch das Pergament nicht.«
»Warum nicht?«
Dick lächelte schlau.
»Seid einmal offen: Ihr haltet mich für einen Schwindler, der Geld erpressen will, vielleicht für einen ganz geriebenen Gauner, etwa für den Helfershelfer eines Schriftfälschers.«
Nach einigem verlegenen Zögern entgegnete der Direktor:
»Ihr sprecht offen, so kann ich auch offen antworten: Ihr habt nicht so unrecht, man kann heutzutage niemandem mehr trauen.«
»Seht, das wollte ich nur von Euch hören. Haltet Ihr mich also für einen Gauner, so könnt Ihr mir nicht übelnehmen, wenn ich auch Euch für einen Spitzbuben halte, dem nicht zu trauen ist.«
»Wahrt Eure Zunge!« fuhr der Direktor auf. »Mir ist nicht eingefallen, Euch zu beschimpfen.«
»Mir etwa? Ihr habt bei mir wahrscheinlich das Wörtchen ›wenn‹ überhört. Ihr traut mir nicht, gut, so traue ich auch Euch nicht. Gebt mir die 10 000 Dollar, und Ihr habt das Pergament. Damit basta!«
»Das Pergament ist nicht Euer, Ihr habt es nur gefunden, müßt es also abliefern,« suchte der Direktor den Mann jetzt einzuschüchtern.
»Macht mir doch nichts weis. Ich weiß recht gut, was ich tun darf und unterlassen muß, dafür bin ich ja Ortsvorsteher. Ich will Euch aber etwas anderes sagen, ich wohne im Hotel Transatlantik, mein Name ist Dick Burrels, und wenn der Kerl kommt, welcher das Papier prüfen soll, so laßt mich rufen.«
Vergebens ersuchte der Direktor den Miner, das Papier herauszugeben, Dick gab nicht nach, und schließlich mußte jener auf den letzten Vorschlag eingehen.
Dick hatte als Wohnung das beste und teuerste Hotel von New-York angegeben, und als nun der nur mit Hemd und Hose bekleidete Mann auf dem Korridor stand, so daß die Diener, welche er vorhin so gezüchtigt hatte, ihn alle sehen konnten, da schien es ihm in den Sinn zu kommen, sich noch einmal zu brüsten.
»Also vergeßt meinen Namen und meine Wohnung nicht,« rief er in der Tür dem Direktor zu, so laut, daß ihn alle hören konnten. »Dick Burrels, Hotel Transatlantik, ersten Stock, vornheraus, und meinetwegen könnt Ihr vor meine Fenster auch einige Beobachter aufstellen; wegen der lumpigen 10 000 Dollar, die der Wisch wert ist, brenne ich nicht durch.«
Stolz schritt er dann an den Leuten vorüber, ihnen Tabakssaft auf die blankgewichsten Stiefel spuckend. Als er an dem geschlagenen Portier vorbeikam, befiel ihn eine Anwandlung von Großmut, seine Hand senkte sich in die Tasche, und sofort begann das Gesicht des Lakaien, dessen eine Backe dick geschwollen war, zu leuchten.
»Hier, mein Lieber, ein kleines Pflaster für Eure dicke Backe, vernascht es nicht.«
Der Mann glaubte seinen Augen nicht trauen zu dürfen, als er in der geöffneten Hand ein blankes Goldstück erblickte. Nun, dafür hätte er sich auch noch die andere Backe dick schlagen lassen.
» Never mind, Sir, hatte nichts zu sagen,« rief er vergnügt dem breitbeinig Fortgehenden nach.
Dick hatte durchaus nicht gelogen. Den ersten ihm begegnenden freien Mietswagen benutzte er, um sich nach dem angegebenen Hotel fahren zu lassen. Uebrigens wußte er recht gut, daß er von jetzt ab scharf beobachtet würde, schärfer, als es der Polizei möglich gewesen wäre, denn dem ›New-York Herald‹ steht ein ungleich größeres Detektivkorps zur Verfügung als der amerikanischen Kriminalpolizei.
Dick war sehr zufrieden mit sich, er schmunzelte fortwährend vor sich hin und rieb die Hände.
»Der Anfang wäre geglückt, habe meine Sache noch besser gemacht, als ich dachte oder als man mir zutraute. Der Direktor gab sich höllische Mühe, mir das Pergament abzunehmen, aber Dick ging nicht auf den Leim. Was ich bei ihm wollte, wissen nun alle, dafür habe ich gesorgt, denn die Diener plaudern doch, ebenso meinen Namen und meine Wohnung. Nun bin ich begierig, was die nächste Zeit bringt; ich kalkuliere, der Plan ist ganz richtig angelegt worden. Der Direktor wird sich nicht wenig wundern, wenn er hinter den richtigen Sachverhalt kommt, und anfangs wahrscheinlich nicht schlecht pusten, daß mit ihm ein solcher Spaß getrieben worden ist, oder aber, er erfährt überhaupt gar nichts von der Sache.«
Dick murmelte noch weiter vor sich hin, bis der Wagen vor dem Hotel hielt. Der Portier empfing den Aussteigenden mit tiefer Verbeugung. Es war hier nichts Neues, daß schwerreiche Leute in Lumpen ankamen. Amerika ist das Land, wo das Glücksrad in ständiger und rasender Umdrehung ist, heute Miner, morgen Millionär, übermorgen wieder Straßenkehrer — das ist in Amerika nichts Wunderbares.
Schon beim Durchschreiten der Flur entging es dem scharfen Auge des Hinterwäldlers nicht, daß er von einem Herrn beobachtet wurde, welcher sich eben an der Portiersloge ein Zimmer bestellt hatte.
»Werden sich noch mehr einfinden,« dachte Dick. »Nur immer zu, ich habe ein gutes Gewissen.«
Nicht minder höflich wurde der Mieter von seinem Zimmerkellner empfangen, so höflich, als wäre er mindestens ein ausländischer Fürst und hätte einen Troß Diener hinter sich. Dick bewohnte zwei der teuersten Zimmer im Hotel, bezahlte immer bar und gab reichlich Trinkgelder. Das war die Hauptsache, er konnte ruhig in Lumpen gehen.
Dick wartete allerdings vergebens ungeduldig in seinem eleganten Wohnzimmer, dessen weiße Gardinen er mit seiner Pfeife anräucherte. Er empfing weder einen Besuch, noch bekam er sonst eine Nachricht, welche seine Mission betraf — denn eine solche hatte unser Freund, den wir in der ›Goldhütte‹ kennen lernten, sicher auszuführen. Nach einem reichlichen Abendtrunk legte er sich daher zu Bett und schlief, als hätte er den ganzen Tag Holz gefällt.
Am nächsten Morgen, als er noch in den weichen Eiderdaunen vergraben lag, sah er den ersten Erfolg seiner Unterredung mit dem Direktor.
Wie er gewünscht, brachte ihm der Kellner um acht Uhr den ›New-York Herald‹ ins Zimmer, auch heute noch stand in den fettgedruckten Lettern, doppelt unterstrichen, die Ueberschrift ›10 000 Dollar Belohnung‹ darin, aber darunter nicht mehr die Anzeige des Verlustes, sondern die Mitteilung, daß die Sache nun erledigt sei.
»Ganz, wie es ausgemacht worden ist,« murmelte Dick zufrieden, »Nun bin ich bloß begierig, wie mein Unternehmen weiter verläuft.«
Auch in den nächsten Tagen fragte niemand nach Dick Burrels, er schien vergessen zu sein; er verließ seine Zimmer fast gar nicht, bis endlich seine Ausdauer von Erfolg gekrönt wurde.
Eine Akazie beschattete mit ihren mächtigen Zweigen das Grab mitten in der Wildnis. Nicht mehr ein einfacher Erdhügel bedeckte die irdischen Reste von John Davids, fleißige Hände hatten ein bleibendes Zeichen schaffen müssen, dem Wanderer bemerkbar zu machen, daß hier die Gebeine eines edlen Mannes ruhten, der fern von der Heimat sein Leben für seine Freunde gelassen.
Von einem kunstvoll geschmiedeten Eisengitter eingefaßt, erhob sich ein quadratischer Marmorblock, an welchem auf der einen Seite mit vergoldeten Buchstaben die Worte zu lesen waren:
FRANCIS JOHN DAVIDS, HONORABLE.
Zweiter Sohn des Lords von Dumfries.
Gestorben während der Weltumseglung
des ›Amor‹ und der ›Vesta‹.
Dieser Seite gegenüber standen die Worte:
Er ging freiwillig in den Tod, um das
Leben derer zu erhalten, welche er liebte.
Die beiden anderen Seiten des Steines enthielten die Namen der Besatzung des ›Amor‹ und der ›Vesta‹, so wie aller derer, welche bei dem Ueberfall der Indianer, wobei Davids seinen Tod fand, zugegen gewesen, mit dem Versprechen, den edlen Toten in dankbarer Erinnerung zu behalten.

Die kleine Blockhütte, in welcher einst Ellen und Harrlington den mißgestalteten Flexan zuerst wiedersahen, in welcher einst Davids verschieden war, stand noch, aber sie war erweitert und wohnlicher gemacht worden. Charly, der Waldläufer, und einige seiner Freunde hausten jetzt darin, führten von hier aus Jagdausflüge in die Umgegend aus und waren zugleich die Beschützer und Pfleger des Grabes, Ihr Patron war Felix Hoffmann, welcher überhaupt alles, ohne Wissen seiner Freunde, hatte arrangieren lassen; die Trapper hatten nicht nötig, wegen Mangels an Wildbret ihre Behausung zu verlassen, er sorgte für sie, damit sie hierbleiben und jedem Fremden, der das Grab besuchte, die Geschichte des Toten erzählen konnten.
Der Steinblock und das Gitter waren mit Kränzen und mit Sträußen bedeckt, nicht mit kostbaren Blumenbuketts, in den Läden gekauft, sondern sie bestanden aus Blumen des Waldes und der Prärie.
Jeder der das Grab Umstehenden hatte ein Sträußchen niedergelegt, mancher mit einem Abschiedsspruch, aber auch gar mancher stumm, weil der Schmerz nichts anderes als Tränen hervorbringen konnte.
Zu letzteren gehörte auch Ellen.
Weinend legte sie ihr Sträußchen auf den Stein nieder und stürzte dann an die Brust des Geliebten, ihr Gesicht daran verbergend. Niemand ahnte, wie nahe sie dem Toten gestanden. Jeder wußte zwar, daß Davids für sie gestorben war, er sprang ja in das auf Ellens Herz gezückte Messer, aber was Davids in seiner Sterbestunde verraten, hatte niemand außer Ellen und Harrlington erfahren.
»Er ging freiwillig in den Tod, um das Leben derer zu erhalten, welche er liebte,«
las Ellen nochmals mit tränenden Augen.
Auch Hoffmann wußte nicht, wie gut er diesen Satz gesetzt hatte. Unter ›derer‹ und ›welche‹ meinte er alle Freunde und Freundinnen des Gestorbenen, Ellen aber bezog diese Worte nur auf sich, aus der Mehrzahl machte sie die Einzahl, und der Spruch paßte nur auf sie.
Selbst Marquis Chaushilm befand sich unter den Versammelten. Er stützte sich auf den Arm Miß Sargents, seiner Braut, zwar noch bleich und elend aussehend, aber in seinem ganzen Aeußeren, besonders in seiner aufrechten Haltung die baldige Genesung verratend. Selbst daß man am Grabe des teuren Freundes stand, konnte den Zug des Glückes nicht verwischen, der in beider Antlitz zu lesen war.
Endlich riß man sich gewaltsam von dem Grabe los und begab sich nach der Blockhütte zu den Waldläufern, um auch ihnen ein Lebewohl zu sagen.
Charly und Joe, die beiden Waldläufer, sowie der alte Fallensteller, welcher nur unter dem Namen ›Biberratte‹ bekannt war, bewohnten die Blockhütte. Letzterer wurde schon zu alt, um von früh bis abends nach den Fallen sehen zu können, er spielte von jetzt ab die Hausmagd — wie er selbst scherzhaft sagte — der beiden Jäger, sorgte für ihre Bequemlichkeit und bereitete den ermüdet Heimkehrenden das Mahl.
Die Biberratte saß auf einer Bank, mit einer Arbeit beschäftigt, neben ihm standen Charly und einige der Herren und Damen.
Zum Abschiednehmen war noch Zeit, man sprach über die baldige Abreise, und Charly ließ sich ganz genau beschreiben, wie so eine Seereise eigentlich wäre.
Die Biberratte hörte kopfschüttelnd zu; die Augen seines jüngeren Gefährten dagegen leuchteten.
»Donner und Doria, da möchte ich dabei sein,« rief er jetzt, »aber ich glaube, viel zu gebrauchen wäre ich nicht, ich bin nämlich noch nie auf dem Meere gewesen. Doch wenn Ihr es gelernt habt, so auf den Schiffen herumzuklettern, da würde ich's wohl auch noch lernen.«
»Du würdest es nicht lange aushalten,« brummte die Biberratte, »auf dem Meere gibt es keinen Wald, Wasser, Wasser, nichts weiter als Wasser, und das kann man nicht einmal trinken — es brennt wie Feuer in der Kehle, so salzig ist es.«
»Und dennoch möchte ich es einmal versuchen.«
»Dir verdenke ich schließlich den Wunsch gar nicht, du hast nichts weiter zu verlieren, als dich selbst,« entgegnete die Biberratte mit hochgezogenen Augenbrauen, »aber daß diese wieder auf dem Meere herumfahren wollen, das wundert mich doch sehr.«
Er meinte damit natürlich die Herren und Damen.
»Warum wundert Ihr Euch darüber?« fragte Ellen.
»Nun, ich dachte doch, Ihr solltet zufrieden sein, daß Ihr nun mit heilen Knochen davongekommen seid, und hübsch machen, daß Ihr zu Hause anlangt. Der Mensch ist doch keine Lerche, die ziellos in der Luft herumschwärmt.«
»Potztausend,« platzte Charly jetzt heraus, »seit du dich zur Küchenmagd verdungen hast, bist du auch ein richtiges, altes Weib geworden. Du schwatzt da einen Unsinn zusammen, daß man sich schämen muß. Was hast du denn bis vor einigen Wochen gemacht, he? Bist du nicht auch ziellos im Walde herumgestrolcht?«
Der Alte schmunzelte.
»Na ja, aber wenn man älter wird, bekommt man Verstand.«
»Dann hast du ihn wohl mit einem Male über Nacht bekommen?«
»Ich habe ihn auf alle Fälle,« beharrte der Alte, »und ich sehe ein, daß es besser ist, man gibt ein wildes Leben auf, wenn man ein ruhiges haben kann.«
»Dann behalte deine Gedanken wenigstens für dich und mach' nicht noch unternehmungslustige Leute zu alten Waschweibern.«
»Die Jugend soll auf den Rat des Alters hören.«
Hoffmann, welcher dieser Unterredung ebenfalls mit beigewohnt hatte, nahm Johannas Arm und ging stillschweigend fort, über Ellens Gesicht flog eine leichte Röte, und die Herren blickten sehr ernst.
»So geht Ihr wirklich wieder zur See?« fragte die Biberratte Ellen.
»Ja.«
»Wieder allein?«
»Ja.«
»Jeder auf seinem eigenen Schiff?«
»So wie früher.«
»Und was sagen denn die dazu?« schmunzelte der Alte, auf die Herren deutend.
»Wir müssen damit einverstanden sein,« entgegnete Lord Harrlington für alle.
»Wie kannst du so sprechen?« rief Ellen. »Ihr habt eure Einwilligung sofort gegeben!«
»Nicht sofort; wir mußten lange Reden anhören, ehe dies geschah.«
»Aber unsere Gründe leuchteten euch ein!«
Es hatte wirklich einen harten Kampf gekostet, ehe die Absicht den Damen, auf der ›Vesta‹ nach New-York zurückzukehren, von den Herren, welche jetzt ein gewisses Anrecht auf sie besaßen, gebilligt wurde.
Nicht Ellen war es eigentlich gewesen, welche mit diesem Vorschlage angefangen hatte, es waren andere. Heftig war der Kampf um Ja oder Nein entbrannt, doch die Engländer waren ja Sportsmen, der Sieg war zugunsten der Mädchen ausgefallen. Selbst Williams hatte seine Einwilligung dazu gegeben, daß Miß Thomson auf der ›Vesta‹ die Heimreise antrat.
Nur einer war vom Anfang bis zum Ende dagegen gewesen — Mister Hoffmann. Als er sah, wer zuletzt recht behalten würde, schwieg er, aber Johanna war von den Vestalinnen ausgeschlossen.
Die Mädchen wollten also wirklich noch einmal, zum letzten Male ein Schiff mit eigenen Händen bedienen, nichts, auch gar nichts hatte vermocht, sie von ihrem Entschlusse abzubringen, weder die trüben Erfahrungen, noch die jetzigen Warnungen.
Selbst die Herren sahen ein, daß ihr Verlangen, mit der Eisenbahn oder auf einem Passagierdampfer die Reise nach New-York zu machen, ein unbilliges wäre, um so mehr, als die ›Vesta‹ noch existierte und seetüchtig war.
Die ganze Weltumseglung wäre zwecklos, der Triumph wäre auf jeden Fall verloren gewesen. Nein, die Vestalinnen mußten mit ihrem Schiffe in den Hafen von New-York einsegeln. Dann sollte das Spiel aus sein. Was sich zusammengefunden, sollte für immer gebunden werden, dann steuerte jeder sein eigenes Schiff in den sicheren Hafen, in den Hafen der Ehe.
Die Herren ließen die Mädchen natürlich nicht allein segeln, nach wie vor sollte der ›Amor‹ die ›Vesta‹ begleiten, aber, war unter Lachen ausgemacht worden, diesmal sollte die ›Vesta‹ nicht wieder versuchen, dem ›Amor‹ zu entschlüpfen. Einträchtig wollte man zusammen fahren.
Schließlich war keiner unter den Herren, welcher nur zögernd die Planken des ›Amor‹ wieder betrat, denn — doch lauschen wir noch eine Minute dem Gespräch zwischen dem plötzlich vernünftig gewordenen alten Trapper und Ellen, welche für ihre Freundinnen das Wort führte.
»Ich weiß nicht,« brummte der Alte kopfschüttelnd, »mir will es gar nicht in den Schädel, was Ihr jungen Leute da vorhabt. So dumm bin ich doch nicht, ich kann doch auch sehen, daß Ihr Euch lieb habt ...«
»Wer?«
»Nun, Ihr Männer und Mädchen untereinander.«
»Vielleicht,« lachte Ellen.
»Und zu Hause, in New-York, heiratet Ihr Euch doch?«
»Das ist leicht möglich.«
»Wenn ich also in der Haut eines dieser Männer stäke, dann wäre ich doch ein Narr, wenn ich meine Braut auf einem Schiffe fahren ließe, und ich sollte auf einem anderen hinterherfahren.«
»Das versteht Ihr nicht, Biberratte.«
»Oho, das verstehe ich sehr wohl.«
»Ich glaube kaum. Es ist nun einmal ausgemacht worden, daß an Bord der ›Vesta‹ kein Mann sein darf.«
»Ach, davon spreche ich ja gar nicht. Ich meine, ich würde mich und meine Braut doch nicht dem Meere anvertrauen, wenn ich nach der Heimat will, um sie dort zu heiraten. Das Wasser hat keine Balken.«
»Ja, wie würdet Ihr denn sonst von hier nach New-York kommen wollen?«
»Sehr einfach, auf dem Landweg.«
»Richtig, das fiel mir nicht gleich ein. Ihr würdet also die Eisenbahn benutzen?«
»Um Gottes willen,« rief der alte Trapper erschrocken, »lieber gehe ich direkt in die Hölle, als daß ich mich so einem feuerspeienden und pustenden Ungeheuer anvertraue. Einmal bin ich darin gefahren, aber gleich nach der ersten Minute sprang ich wieder hinaus — brach mir fast den Hals dabei. Brrr, mir schütteln noch jetzt die Gedärme im Leibe, wenn ich nur daran denke.«
»Ja, lieber Mann,« lachte Ellen, »wie wollt Ihr denn sonst nach New-York gelangen? Doch nicht zu Pferd?«
»Zu Pferd ginge es schon eher, das richtige ist es aber auch noch nicht. Nein, zu Fuß, das ist natürlich.«
Die Umstehenden lachten.
»Von hier bis nach New-York sind es etwa 1500 Meilen,« erklärte dann Ellen.
»Mag sein.«
»Wolltet Ihr die laufen?«
»Was ist denn weiter dabei?«
»Oho, das ist eine gewaltige Strecke.«
»Die ein guter Fußgänger in 70 Tagen bequem zurücklegen kann,« war die kaltblütige Antwort, »ich aber wette, daß ich sie in 50 Tagen mache.«
Der Trapper warf einen Blick auf seine geflickten Mokassins, die schon so manche Meile mit Schritten abgemessen haben mochten. Er konnte sich das Lachen der Zuhörer nicht erklären.
»Was gibt's da zu lachen? Wißt Ihr, wo ich geboren bin? Ich bin ein Kanadier, meine Wiege stand an der Hudsonbai, und ich bin als Junge von 15 Jahren den Weg hierher, eine Strecke von 2000 Meilen, gelaufen, ohne mich einmal länger als eben nötig auszuruhen.«
»Wir glauben Euch,« lachte Ellen. »Uns dürfte aber diese Fußreise etwas zu lang werden. Wir ziehen die kürzere Seefahrt vor.«
»Also Ihr wollt lieber schnell und gefährlich als langsam, aber sicher reisen? Da habe ich einen anderen Geschmack, ich ziehe letzteres vor.«
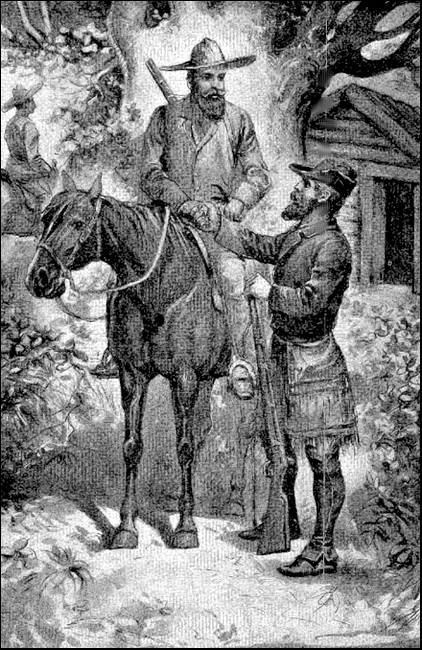
Den Trappern wollte es beim Abschied durchaus nicht in
den Kopf, daß ihre Freunde nicht zu Lande reisen wollten.
»Ich auch. Aber, Biberratte, so überlegt doch, was Ihr sprecht! Ist eine Reise von hier nach New-York zu Fuß nicht sehr gefährlich?«
Der Trapper kraute sich in den Haaren.
»Nun ja, man kommt oft in Gefahr, sein Leben zu verlieren.«
»Wie oft war denn Eures in Gefahr?«
»Während meiner Reise nach hier? Du lieber Gott, unzählige Male: Indianer haben mich verfolgt, betrunkene Cow-boys nach mir geschossen, Räuber lauerten überall auf mich, zwei- und vierbeinige. Aber lieber wollte ich doch noch einmal zu Fuß reisen, als mich der Eisenbahn oder dem Schiffe anvertrauen.«
»Das ist wieder Geschmackssache. So viel laßt Euch gesagt sein, daß die Fußreise zehnmal gefährlicher ist als jede andere, der Tod lauert dabei überall auf einen; auf dem Schiffe dagegen droht einem nur dann der Tod, wenn es untergeht, und wenn das häufig vorkäme, dann würde die Schiffahrt wohl nicht in solcher Blüte stehen. Ueberdies, Biberratte, steht man immer in Gottes Hand, gewöhnlich trifft einen da der Tod, wo man ihn am wenigsten erwartet hat.«
Der Trapper schien das einzusehen, er schwieg verlegen.
»Sie vergessen die Landreise per Eisenbahn,« nahm Miß Sargent das Wort, »diese ist nicht nur sicherer als eine Seereise, sondern geht auch bedeutend schneller vor sich.«
»Letzteres gebe ich zu, was die Sicherheit anbetrifft, so sind Sie im Irrtum,« entgegnete Ellen.
»Wie, die Reise zu Schiff wäre sicherer, als die per Eisenbahn? Sie haben sich wohl versprochen?«
»Nein, ich meinte es wirklich so.«
»Können Sie das beweisen?«
»Ja, allerdings nicht hier, es fehlen mir die Statistiken. Glauben Sie vorläufig meinen Worten: auf den Eisenbahnen kommen mehr ums Leben, als auf Schiffen.«
Ellen hatte diesen Vernunftgrund sich aufgespart, um die Herren zur Erlaubnis zu bewegen, auf der ›Vesta‹ die Heimreise anzutreten, doch sie hatte ihn nicht nötig gehabt.
Die Statistiken weisen wirklich nach, daß durch Eisenbahnunglücke mehr Passagiere ihren Tod finden, als durch Schiffsunfälle, und zwar nicht etwa der allgemeinen Anzahl nach, was daraus erklärlich wäre, daß immer mehr Leute zu Land als zu Wasser reisen, sondern der Prozentzahl nach. Man nehme nur eine Zeitung zur Hand: überall wird man von Eisenbahnzusammenstößen, von Entgleisungen, von Einstürzen der Bahnbrücken und so weiter lesen, von Schiffsuntergängen viel weniger. Geht allerdings einmal ein Passagierdampfer mit Mann und Maus zugrunde, so ist die Anzahl der Verunglückten gleich eine sehr große, und man hört und liest die schreckliche Nachricht überall.
Warum aber fuhren die Damen nicht auf einem Passagierdampfer, sondern auf dem im Vergleich zu einem stählernen Dampfer gebrechlichen, hölzernen Segelschiff? Die rücksichtslose Schnelligkeit, mit dem heutzutage die Passagierdampfer durch das Wasser fahren oder vielmehr schießen, um sich nicht von einem Konkurrenten überflügeln zu lassen, ist schuld an den Untergängen der Schiffe, sie rennen in voller Fahrt zusammen. Nicht die Küsten, noch viel weniger die Stürme haben Schiffskatastrophen zu verantworten.
Wie bequem konnte dagegen die ›Vesta‹ segeln! Bei günstigem Winde fuhr sie mit geschwellten Segeln, bei ungünstigem wartete sie auf besseren, und bei, Sturm ließ sie sich mit eingeraffter Leinwand dahintreiben.
O, die noch immer unternehmungslustigen Mädchen hatten tausend Gründe, den Vorteil zu beweisen, den sie hatten, wenn sie die ›Vesta‹ benutzten.
Bei den Herren hatten sie leichtes Spiel; selbst der kranke Chaushilm bestand darauf, die Fahrt auf dem ›Amor‹ mitzumachen, und wirklich war seine Pflege dort eine bessere und liebevollere als irgendwoanders, die frische Seeluft gab ihm sicher seine alte Kraft zurück.
Die Mädchen hatten es sogar so weit gebracht, Hope und Hannes zu bewegen, sie auf der ›Hoffnung‹ zu begleiten. Beide hatten eingewilligt. Die verwundeten und noch nicht genesenen Matrosen konnten entweder auf Hoffmanns Besitzung zurückbleiben oder als Patienten die Reise mitmachen. Die meisten zogen das letztere vor, sie waren zu treue Freunde von Hannes — mit Ausnahme des Bootsmannes Karl, welcher nach längerer Unterredung mit Hoffmann auf einem Passagierdampfer nach Deutschland zurückkehren wollte. Doch davon später mehr!
Die fehlenden Matrosen der ›Hoffnung‹ wollte Hannes in Matagorda selbst anmustern.
Nur in einem Punkte stießen die Vestalinnen wegen ihrer Absicht auf energischen Widerstand bei Hoffmann, und fast schien es, als sollte in dem guten Verhältnis eine Trübung eintreten.
Hoffmann hatte sich bereit erklärt, die Damen und Herren auf dem ›Blitz‹ nach New-York zu bringen, der sicherste Weg, wie er sagte. Niemand konnte dem widersprechen, aber das war es ja nicht, was die Damen wünschten, sie wollten den Triumph erleben, auf der ›Vesta‹ in New-York einzusegeln. Hoffmanns Anerbieten mußte daher ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden, und Hoffmann, jetzt erst die wahre Absicht der Damen erkennend, riet davon ab — vergebens. Daraufhin gab sich Hoffmann keine Mühe mehr, die Damen zurückzuhalten, schlug aber auch die Bitte ab, die ›Vesta‹ mit dem ›Blitz‹ zu begleiten. Gern hätte er sie nach New-York gebracht, aber begleiten wollte er sie nicht. Er sagte offen aus, daß er nicht die beschützen dürfe, die trotz seiner Warnung und seines Abratens einen von ihm nicht gebilligten Weg einschlügen.
Daher die Spannung. Doch Hoffmanns Liebenswürdigkeit stellte das gute Einverständnis bald wieder her; überdies war ihre Freundschaft schon zu befestigt, als daß sie durch Aussprechen einer Meinung für längere Zeit oder gar für immer erschüttert werden konnte. —
Noch einen Blick auf das Grab des treuen Davids', noch einen mit den Trappern gewechselten Händedruck, dann bestieg man die Pferde und ritt nach Hoffmanns Besitzung zurück. Auch hier fand eine Abschiedsszene statt. Wer wußte, ob man je einen der Matrosen, welche krank zurückblieben, wiedersah!
In einigen Tagen sollte die Abfahrt von Matagorda aus angetreten werden.
Man sah es dem alten Bootsmann an, wie er nur gar zu gern seine Genesung auf der ›Hoffnung‹ abgewartet hätte, Hoffmann und Hannes, wie auch Hope, ließen es nicht zu.
»Zum Teufel mit der Erbschaft,« rief er ein über das andere Mal, »was mache ich mir daraus? Und muß ich nun einmal nach Deutschland, um die Erbschaft anzutreten, dann soll es wenigstens auf der ›Hoffnung‹ geschehen.«
»Wir fahren möglicherweise erst mit nach New-York, dann erst nach Deutschland.«
»Das schadet ja nichts, ob ich eine Woche eher oder später dorthin komme.«
»Nein, nein, mache es nur so, wie wir beschlossen haben. Du fährst, sobald du einigermaßen wiederhergestellt bist, mit einem Passagierdampfer nach Hamburg und von dort aus nach deiner Heimat, wo dich deine alte Erbtante sehnsüchtig erwartet.«
»Möchte nur wissen, was für ein altes Weib das ist,« brummte Karl verdrießlich, »ich habe überhaupt nie eine Ahnung gehabt, daß ich noch Verwandte besitze. Und wenn sie mich so sehnlichst erwartet, dann kommt es auf ein paar Wochen auch nicht an.«
»Sie könnte unterdes sterben.«
»Wäre mir ganz gleichgültig, wenn sie mir nur ihr Geld vermacht.«
»Pfui, Karl, wie könnt Ihr so sprechen,« mischte sich Hope ein. »Die Tante liebt Euch, sie sehnt sich nach Euch, sie vermacht Euch das Geld, und Ihr sprecht so lieblos!«
»Nichts für ungut, es war nicht so gemeint. Wenn ich nur wenigstens wüßte, was für eine Verwandte das ist. Tag und Nacht grübele ich schon darüber nach.«
»Ja, ich weiß auch nichts weiter, der Brief, der an mich, als an den Kapitän der ›Hoffnung‹ gerichtet, war sehr kurz.
»Müller hieß sie.«
»Ja.«
»Müller, Müller?« murmelte der Bootsmann kopfschüttelnd. »Kenne wohl viele, die Müller heißen — das ist ein sehr gewöhnlicher Name, aber daß ich unter den Müllerinnen auch eine Tante besitze, das ist mir vollständig neu.«
»Freut Euch doch!« sagte Hope.
»Natürlich freue ich mich, daß ich zwanzigtausend Taler erbe. Damit kann man schon eine Zeit lustig leben.«
»Müßt Ihr denn das Geld gleich verjuxen?« fragte Hope.
»Wozu ist es denn auf der Welt?«
»Nun, ich glaube, diesmal werdet Ihr wohl vernünftiger damit umgehen.«
»Ich glaube nicht.«
»Aber ich. Und wenn ich mich in meinen Erwartungen nicht täusche, so werdet Ihr heiraten.«
Karl lachte Hope an.
»Heiraten? Ich? Um Gottes willen, wer wird mich alten Krüppel denn noch heiraten?«
»Eine, die zu Euch paßt.«
»Nein, nein,« seufzte Karl, »das ist vorbei. Wenn ich nicht gerade zum heiraten gezwungen werde, freiwillig gehe ich sicher nicht zum Altar.«
»Dann werdet Ihr eben dazu gezwungen,« entgegnete Hannes und verließ mit Hope den Kranken, der sich stöhnend auf die andere Seite wälzte.
Die Villa diente jetzt nur als Lazarett, nicht mehr als Gefängnis, denn die sieben Verbrecher waren schon vor Wochen von Vertrauensmännern Sharps geschlossen weggeführt worden, wohin, wußte niemand, nicht einmal Hoffmann.
Sharps Bruder, mit dem Beinamen Youngpig, hatte schon lange die Gesellschaft verlassen, ohne die Damen und Herren noch einmal gesehen, ja, ohne überhaupt Abschied genommen zu haben. Der Reporter kennt nun einmal keinen Abschied. Er hat keinen Willen mehr, er ist nur eine Maschine, oder, wie der berühmte Afrikareisende Stanley, früher Reporter des ›New-Dork Herald‹, von sich selbst sagte: der reisende Reporter muß dem Auftrage bedingungslos gehorchen, der ihn seinem Schicksal entgegenführt: ob zum Schlachtfeld, ob zum Festgelage, er lautet immer gleich: »Mache dich bereit und gehe!«
Mister Youngpig hatte sich nach Empfang einer geheimnisvollen Depesche nicht einmal erst bereitgemacht, denn er hatte nichts vorzubereiten, er war stehenden Fußes abgereist. Die Depesche bot ihm einen der Redakteurstühle des ›New-York Herald‹ an, jetzt war er auf dem Wege nach London, um seine dortigen Verbindungen zu lösen und sich mit Weib und Kind in New-York anzusiedeln, wo wir ihm noch einmal begegnen werden.
Schade, daß aus seinem geplanten Auskunftsbureau nichts geworden war, er hätte mit seinen Statistiken die Welt gewiß in Staunen gesetzt.
Während der Anwesenheit der Vestalinnen verabschiedeten sich auch van Guden, dessen wiedergefundener Vater und der Chinese. Letzterer hatte die ihm von den Rebellen geraubte Summe, welche ihm von seinen Landsleuten anvertraut worden war, zurückerhalten. Hoffmann hatte nach Erstürmung der Ruine die vier Millionen Dollar unberührt vorgefunden und sie Wan Li sofort ausgehändigt, ehe sie als Kriegsbeute in Beschlag genommen wurden, wodurch sie zwar dem Chinesen nicht verloren gegangen wären, er aber doch viele Unannehmlichkeiten gehabt hätte.
Der Aufstand gegen die Chinesen war so schnell wieder erloschen, wie er entstanden war. Schon saßen die bezopften Gäste wieder auf ihren alten Plätzen, und so kehrte auch Wan Li nach San Francisco zurück, van Guden und dessen Vater mit sich nehmend. Unter anderem Namen begannen beide ein neues Leben.
Auch von Sonnenstrahl und Waldblüte wurde Abschied genommen. Die beiden roten Kinder der Wildnis waren dazu bestimmt gewesen, ihre geknechteten Brüder der Freiheit zuzuführen, und ihr Vormund, Hoffmann, gab diesen Plan auch nicht auf. Doch nicht mit dem Tomahawk in der Rechten, nicht mit dem Kriegsruf auf den Lippen sollte Sonnenstrahl sein Volk beglücken, Waldblüte sollte es nicht durch wahnsinnige Prophezeiungen begeistern, als Evangelisten und Lehrer sollten sie versuchen, ihr Volk auf die hohe, geistige Stufe zurückzuführen, auf welcher es einst gestanden.
Es ist eine Fabel, wenn gesagt wird, die Indianer müßten untergehen, weil sie einer Zivilisation unfähig sind. Werden sie danach behandelt, so entwickeln sie sich zu einem kultivierten Volke, aber unter einer rücksichtslosen Behandlung sinken sie immer tiefer. Als Beispiel mögen nur die Huronen dienen, jene kriegerische Nation, welche in Coopers ›Lederstrumpf‹ eine große Rolle spielt. Jetzt sind die Huronen ein Ackerbau und Industrie treibendes Volk, sie stellen Advokaten, Richter und Gelehrte, vier Huronen sitzen auf akademischen Hochstühlen, und Mister Nasacki, einer der bedeutendsten Chirurgen von New-York, ist ein Hurone, der als zwölfjähriger Knabe an der Seite seines Vaters noch den Bogen gegen die Blaßgesichter gespannt hat.
Des alten van Gubens Bemühungen waren nicht vergeblich gewesen; er hatte Sonnenstrahl und Waldblüte befähigt, ihre roten Brüder zu belehren, wenn sie nur auf die richtige Bahn gelenkt wurden, und dafür wollte Hoffmann sorgen. — — — — — — — — — —
Dicht nebeneinander lagen im Hafen von Matagorda die vier befreundeten Schiffe: Die ›Vesta‹, der ›Amor‹, die ›Hoffnung‹ und der ›Blitz‹. Die Mädchen waren außer sich vor Freude, ihr geliebtes Schiff wieder betreten zu können.
Hoffmann hatte es von den Riffen entfernen, reparieren und wieder vollkommen seefähig machen lassen. Die Mädchen eilten am Deck umher, jeden Mast, jede Raa, jeden Boller wie einen alten Bekannten nach langer Trennung begrüßend, sie fanden ihre Kabinen unverändert, und Hope fühlte sich in ihrem Museum wieder als Vestalin.
Doch nein, diese Zeit war vorüber, dachte sie gleich lächelnd. Natürlich gestattete ihr Ellen, die Gegenstände, welche sie während der Reise gesammelt und liebgewonnen hatte, an Bord der ›Hoffnung‹ schaffen zu lassen; das Krokodil, die Schlange und alle die hundert Andenken wanderten hinüber.
Es mußte noch Proviant eingenommen werden, und so lange hatten sie Zeit, sich dem Abschied zu widmen, denn jetzt galt es ja die Trennung von einem treuen Freunde und einer treuen Freundin, von Hoffmann und Johanna.
Hoffmann blieb mit Johanna in Texas, wenigstens vorläufig, dann zog er sich auf seine anderen Besitzungen zurück, und Johanna war nicht länger mehr nur seine Braut.
Die letzte Stunde nahte.
Sie standen alle auf der steinernen Einfassung des Hafens. Die Mädchen umarmten noch einmal die weinende Johanna und schüttelten noch einmal Hoffmanns Hand, welche so oft den Tod von ihnen abgewendet hatte. Auch die Herren nahmen Abschied, denn die Schiffe lagen seebereit.
»Wir sehen uns wieder,« sagte Johanna zu Ellen, »wenn nicht in New-York, so doch später. Wo gedenken Sie sich anzusiedeln?«
»In England,« entgegnete Lord Harrlington für Ellen.
Ellen gab lächelnd ihre Beistimmung.
»Und wir in Deutschland,« fügte Hope hinzu. »Erst aber machen wir einen Abstecher nach New-York, um dem Empfange der Vestalinnen beizuwohnen. Ein Schimmer des Glanzes wird wohl auch auf uns fallen.«
Man begab sich auf die Schiffe.
Die Ankerwinde des ›Amor‹ rasselte. Wie früher marschierten die Vestalinnen taktmäßig um das Gangspill, und ihr heller Gesang begleitete die rauhen Stimmen der Matrosen auf der ›Hoffnung‹. Beim Ankerhieven muß gesungen werden, sonst hat das Schiff auf seiner Fahrt kein Glück.
»Fest die Brassen, los die Gitane!« tönte es auf allen drei Schiffen gleichzeitig. Die Segel fielen. Ein frischer Wind schwellte sie, und, ohne geschleppt zu werden, nahmen die Schiffe die Fahrt auf.
Die ›Vesta‹ führte, dann kam die ›Hoffnung‹ und in deren Kielwasser der ›Amor‹. Die Besatzungen waren aufgeentert, nur die Kapitäne und die Offiziere standen auf der Kommandobrücke. Zum letzten Male wollten die aristokratischen Seeleute ihr Schiff mit eigenen Händen über den Ozean lenken.
Auf den Rahen wurden Mützen und Tücher geschwenkt, am Strande wurden die Grüße erwidert.
Arm in Arm standen Hoffmann und Johanna und schauten den verschwisterten Schiffen nach. Jetzt erreichten diese das offene Fahrwasser, es mußte gearbeitet werden; undeutlich trug der Wind die Kommandos noch nach dem Lande, wieder flogen die Rahen herum, die Steuerruder wurden gedreht, die Schiffe schwenkten nach Steuerbord und segelten nun mit dem Winde in voller Fahrt.
Kleiner und kleiner wurden sie. Die beiden vorderen Schiffe hatten vor dem ›Amor‹ schon einen großen Vorsprung, bis man nur eben noch erkennen konnte, wie aus dem Schornstein des ›Amor‹ eine Rauchwolke aufstieg.
»Er dampft,« sagte Hoffmann.
Johanna antwortete nicht. Träumerisch blickte sie den verschwindenden Schiffen nach. Dann fühlte Hoffmann seinen Arm gedrückt.
»Felix,« sagte Johanna leise, »warum bist du so hart und folgst ihnen nicht mit dem ›Blitz‹?«
»Weil sie meinen Vorschlag, sie mit dem ›Blitz‹ nach New-York zu bringen, abgelehnt haben,« entgegnete Hoffmann ernst.
»Das konntest du ihnen nicht verdenken.«
»Und sie können mir nicht verdenken, wenn ich sie nicht begleite. Ueberdies, Johanna, weiß ich sehr wohl, daß ihre Bitte nur eine Höflichkeit war, sie würden mich nicht ernstlich ersuchen, sie zu begleiten, um ihnen beizustehen. Sie sind sehr stolz, diese Damen.«
»Also, wenn sie dich ernstlich gebeten hätten, daß du sie begleiten solltest, so hättest du zugesagt?«
»Vielleicht, ja.«
»Nun, Felix, so bitte ich dich recht herzliche laß den ›Blitz‹ seebereit machen und folge ihnen.«
Hoffmann lächelte.
»Mir fehlen Leute.«
»Du hast mir selbst einmal gesagt, du könntest den ›Blitz‹ mit nur einem Hilfsmanne bedienen.«
Eben wollte Hoffmann antworten, als Ingenieur Anders hinzutrat.
»Kapitän,« meldete er, »die neue Kurbel ist eingesetzt, nur die Drähte brauchen noch gelegt zu werden. In einer Stunde kann der ›Blitz‹ abfahren.«
»Wir wollen noch bis zum Abend warten, Mister Anders.«
» Well, die Segelschiffe haben wir doch bald eingeholt.«
Mit frohem Erstaunen hatte Johanna diese kurze Unterhaltung angehört.
»O, du,« sagte sie dann, Hoffmanns Arm zärtlich an sich pressend, »ich habe noch gar nicht gewußt, daß du dich auch verstellen kannst.«
Eine bessere Fahrt hätten sich die drei Schiffe nicht wünschen können, der Wind war immer gut, und so näherten sie sich schnell dem Ziele, New-York.
Schon waren die westindischen und Bahama-Inseln passiert, und noch immer hatten sie sich nicht auch nur ein einziges Mal außer Sicht verloren. Am Tage konnten sie sich stets mit bloßem Auge erkennen, in der Nacht leuchteten ihnen die Schiffslichter.
Nach etwa acht Tagen waren sie nur noch 500 Meilen von New-York entfernt, wie sie sich einander freudig zusignalisierten, und diese Strecke hätten sie bequem in zwei Tagen zurücklegen können, wenn der Wind nicht umgesprungen wäre. Bisher aus Süden, von hinten kommend, blies er eines Morgens von Westen. Es war also immer noch ein guter Wind, aber so schnell, wie bisher, konnten sie doch nicht mehr fahren, die Segel mußten seitwärts stehen und das Steuerruder ganz schräg nach Backbord gestellt werden.
Sie waren jetzt Seeleute genug, um aus allen Anzeichen, Vögeln, Fischen und Temperaturverhältnissen erkennen zu können, daß dieser Wind tagelang, ja vielleicht wochenlang anhielt. Doch das schadete nichts.
Da fuhr die ›Hoffnung‹ näher heran und ließ den Wimpel flattern, zum Zeichen, daß sie eine Unterredung wünsche.
Die beiden anderen Schiffe gaben das Gegensignal.
»Persönlich, Schiff an Schiff,« signalisierte die ›Hoffnung‹ weiter.
Die Herren und Damen wunderten sich nicht wenig darüber, daß Hannes wünschte, die Schiffe sollten nebeneinander zu liegen kommen.
Dazu war viel Arbeit nötig. Alle Segel mußten festgemacht werden, und zwar langsam, eins nach dem anderen, um die Schiffe anzuhalten und zugleich so zu dirigieren, daß sie nebeneinander zu liegen kamen. Die Schiffe wurden vollkommen in der Fahrt gehemmt. Es vergingen Stunden, ehe sie die alte Geschwindigkeit wiedererlangten.
»Warum?« fragten die Engländer noch einmal an, während die ›Vesta‹ schon dem Beispiele der ›Hoffnung‹ folgend, die Segel reffte.
»Ich will Sie persönlich sprechen,« lautete die kurze Antwort.
Auch der ›Amor‹ ließ die Segel reffen, außerdem wurde noch Dampf aufgemacht, um leichter manövrieren zu können.
»Mister Vogel hätte uns in einem Boote besuchen können, wenn er uns ohne Benutzung der Flaggen sprechen will,« meinte Hastings etwas ärgerlich.
»Es muß von Wichtigkeit sein,« entgegnete Harrlington.
»Das macht auch nichts.«
»Nun, wir wollen seinem Wunsche folgen, unnötig wird er uns nicht bemühen.«
Eine Stunde später lag die ›Hoffnung‹ zwischen der ›Vesta‹ und dem ›Amor‹ fest.
Noch war die Verbindung nicht ganz hergestellt, als schon von beiden Seiten die Frage erscholl, was es mit Hannes' Wunsch für eine Bewandtnis habe.
»Wieder ein Abschied.«
»Wie? Abschied?«

»Hope und ich haben unseren Plan geändert,« erklärte Hannes. Mir fahren nicht nach New-York, sondern östlich, nach Deutschland.«
»Aber warum denn nun mit einem Male?«
»Der Wind ist daran schuld. Bei diesem Westwinde können wir in 10 bis 14 Tagen in Deutschland sein.«
»Nein, ich bin schuld daran,« sagte Hope, welche recht niedergeschlagen schien. »Fragen Sie nicht weiter, warum. Kurz und gut, ich bat Hannes, sein Ziel zu ändern, und er gab mir nach. Ich bitte, mir deswegen nicht zu zürnen.«
Hope sagte noch, daß sie zwar anfangs, als sie mit den Vestalinnen immer zusammen war, von deren Unternehmungslust angesteckt worden wäre, während der einsamen Meerfahrt aber hätte sie ihren Entschluß, mit nach New-York zu fahren, bereut. Sie zöge vor, sich direkt in ihre zukünftige Heimat zu begeben.
Dagegen ließ sich nichts machen, es mußte abermals Abschied genommen werden. Dieser geschah in herzlichster Weise, man versprach, wenn es irgend möglich, sich einmal wiederzusehen, auf keinen Fall aber sich ohne gegenseitige Nachricht zu lassen.
Williams mußte seinem Witz noch einmal Luft machen, er nahm seinen ehemaligen Diener zur Seite.
»Lassen Sie sich nicht gar zu sehr unter den Pantoffel bringen,« raunte er ihm zu, »Sie sind auf dem besten Wege dazu.«
So leise die Worte auch gesprochen waren, der nicht weit davon an der Brüstung lehnende Chaushilm hatte sie vernommen und lachte laut auf.
»Wer zuletzt lacht, lacht am besten, Marquis, merken Sie sich das,« rief Hannes. »Sie werden an Miß Sargent eine Nuß zu knacken bekommen. Nichts für ungut,« fuhr er dann lachend fort, dem Marquis herzlich die Hand schüttelnd, »ich habe Ihnen früher manchen bösen Streich gespielt, aber wir scheiden doch als Freunde. Nicht?«
»Und wollen solche auch bleiben. Das Meer soll unsere Freundschaft nicht trennen.«
»Der Ozean oder nur die Nordsee?«
»Nur die Nordsee. Ich oder Miß Sargent machen keine Ausnahme, wir gedenken alle unsere Hochzeit in England zu feiern und dort zu bleiben.«
»Gott gebe, daß Ihnen kein Hindernis mehr in den Weg geschoben wird.«
Die Segel wurden wieder entrollt, der ›Amor‹ manövrierte sich mit Hilfe der Schraube zuerst frei, und dann strebte die ›Hoffnung‹ mit voller Fahrt dem Osten zu; wie ein aufgescheuchter Schwan flog sie über das Wasser dahin, mit dem Winde an Schnelligkeit wetteifernd.
Eng umschlungen standen Hannes und Hope am Heck und erwiderten die Abschiedsgrüße der beiden sich entfernenden Schiffe.
Es war ihnen recht weh ums Herz und doch wieder so fröhlich. Jetzt verließen sie die Freunde und Freundinnen für immer, mit denen sie Freude und Leid geteilt hatten, aber sie segelten ja auch dem friedlichen Glück entgegen; noch wenige Tage, dann konnten sie sich von den Strapazen ausruhen.
»Wo werden wir uns niederlassen?« fragte Hope. »Hast du schon einen bestimmten Platz in Aussicht?«
»Ich habe Eltern und Geschwister, welche mit in Betracht zu ziehen sind. Konnte ich mich ihnen bisher nicht widmen, so soll es von jetzt an geschehen. Die Liebe, mit welcher mich die Mutter in meiner Jugend gepflegt hat, will ich ihr jetzt vergelten, sie soll einen guten Sohn bekommen ...«
»Und an mir eine zärtliche Tochter,« sagte Hope.
»Doch die Stadt, in welcher sie wohnen, soll nicht unsere Heimat werden,« fuhr Hannes fort. »Meine Sehnsucht steht nach einem anderen, stillen Plätzchen. Ehe wir dieses beziehen können, sind Vorbereitungen nötig, und solange diese währen, wollen wir gemeinsam noch ein gutes Werk stiften.«
»Was wäre das?«
»Ich kenne einen Ort in Deutschland, wo ein unglückliches Weib des Geliebten harrt. Lange Jahre hat es in der größten Armut gedarbt, bis ich habe für es sorgen lassen.
»Die Hütte, in welcher es einst eine glückliche Jugend verlebt hat, hat sich auf meine Anordnungen hin in ein stattliches Häuschen verwandelt, und in diesem wollen wir einstweilen wohnen und uns des Glückes freuen, welches durch uns entstanden ist.«
»O, jetzt verstehe ich dich,« rief Hope freudig. »Ach, das wird herrlich werden.«
»Ja, und der Gedanke daran hat mich hauptsächlich bewogen, deiner Bitte, die ›Vesta‹ nicht mehr zu begleiten, sofort nachzugeben. Es muß gewiß schön sein, dem Triumph der einsegelnden Vestalinnen beizuwohnen, aber schöner ist es, sich an dem Glücke zweier Menschen zu erfreuen, welche sich nach langer, langer Trennung vereinigen, und wenn man dann sagt: das haben sie dir zu danken, ohne dich hatten sie sich nimmermehr gefunden.«
Die ›Hoffnung‹ war schon längst am Horizonte verschwunden, sie fuhr ja mit der Schnelligkeit eines Postdampfers dahin. Wieder segelten die beiden Schiffe zusammen den alten Kurs weiter, direkt auf New-York zuhaltend.
Die Sonne sank. Die glühende Scheibe war noch zu sehen, besaß aber fast gar keine Leuchtkraft mehr. Wie ein Schleier hing es vor ihr, und schon wurde es dunkel. Die Umrisse der ›Vesta‹ wurden von den Engländern nur noch undeutlich erblickt.
»In der Atmosphäre liegt etwas wie Nebel, und doch ist solcher nicht zu bemerken,« sagte einer der Herren zu dem Kapitän.
»Die Luft ist mit Wasserdampf gesättigt,« entgegnete Harrlington. »Wir müssen uns auf eine neblige Nacht gefaßt machen. In einer Stunde können wir von einem Maste aus den anderen nicht mehr erkennen. Wir haben schon manchen Nebel durchgemacht, aber von solchen Anzeichen wurde noch keiner eingeleitet.«
Lord Harrlington ließ Dampf aufmachen und näherte sich der ›Vesta‹ bis auf Rufweite, denn diese Nacht galt es, eine weite Distanz einzuhalten.
Ellen bemerkte den Wunsch Harrlingtons und griff zum Sprachrohr, die Unterhaltung beginnend.
»Es wird eine neblige Nacht,« drang es in tiefen, dröhnenden Tönen zum ›Amor‹ hinüber.
»Wir müssen uns trennen.«
»Die Lichter werden nicht zu erkennen sein.«
»Darum bitten wir um Angabe eines Ortes, wo wir uns morgen wiederfinden.«
Die Antwort blieb lange aus, Ellen beriet sich mit ihren Freundinnen, welcher Ort angegeben werden sollte, und dazu war nötig, mit allen Verhältnissen zu rechnen, mit Zeit, Wind, Seegang und so weiter, denn die Manövrierfähigkeit eines Segelschiffes ist ja nur beschränkt.
Dann erfolgte die Bestimmung, den Teil eines Grades angebend, auf welchem sich morgen mittag die ›Vesta‹ befinden wollte. Dort sollte der ›Amor‹ sie aufsuchen.
» All right,« tönte es zurück, »wenn es dem Himmel nicht anders gefällt, so ist der ›Amor‹ morgen dort!«
Ein kurzer Abschiedsgruß noch, bei dem die Schiffer einander schon nicht mehr sehen konnten, dann dampfte der ›Amor‹ zur Seite ab.
»Gute Nacht, James, auf Wiedersehen!« klang es noch einmal leise herüber.
Gute Nacht, Ja, möchte sie gut werden, aber an Schlaf konnte natürlich keiner der Besatzung denken, jetzt galt es, Ohr und Auge bis zum äußersten anzustrengen, jeden Augenblick bereit zu sein, aus einer Katastrophe sein Leben zu retten.
Da drang schon ein schauerlich heulender Ton durch die dicke Finsternis, ein geisterhafter Ton, welcher das Blut des unerfahrenen Passagiers zum Erstarren bringt. Er folgte in kurzen Zwischenräumen mehrmals aufeinander. »Die ›Vesta‹ setzt schon die Nebelhörner in Bewegung, wir wollen mit der Sirene antworten,« sagte Harrlington und drehte den Hebel an einem Rohre, welches aus dem Innern des Schiffes kam und zu einem kleinen Apparat führte, an dessen einer Seite ein Schalltrichter angebracht war.
Ein markerschütternder Ton entfuhr dem Trichter, halb Heulen, halb Pfeifen, und heißer Dampf strömte nach. Der Ton setzte ganz tief ein und endete unglaublich schrill, am besten konnte man ihn mit dem Heulen eines geschlagenen Hundes vergleichen, nur daß er hundertmal stärker war.
Ein im Nebel fahrendes Schiff macht, um einen Zusammenstoß mit einem anderen Schiffe zu vermeiden, so viel Lärm als möglich, denn Signallichter sind im dichten Nebel gar nicht zu sehen.
Auf Segelschiffen bedient man sich der Nebelhörner, einer Art von Trompeten, welche mit großen Blasebälgen zum Tönen gebracht werden, auch setzt man die Schiffsglocke in Bewegung. Dampfer warnen mit ihrer Signalpfeife, wenn sie noch nicht jene Erfindung besitzen, welche vor etwa acht Jahren als Lärmmittel angebracht wurde — die Sirene. Durch zwei aneinanderstehende Scheiben, welche mit vielen Löchern versehen sind, wird mit starkem Druck Dampf geleitet. Die Scheiben fangen an sich zu drehen, und zwar in entgegengesetzter Richtung, und dadurch wird ein heulender Ton erzeugt, der lauteste, den hervorzubringen bis jetzt überhaupt möglich ist.
Der ›Amor‹ konnte die Nebelhörner der ›Vesta‹ schon lange nicht mehr hören, als diese noch immer die fort und fort heulende Sirene vernahm.
»Wenn sie die Sirene immer so heulen lassen,« meinte Ellen, »werden sie bald die Maschine nicht mehr benützen können.«
»Warum denn nicht?«
»Die Sirene verbraucht gewaltig viel Dampf, und ein Schiff hat solchen nie im Ueberfluß vorrätig.«
Das wußte Harrlington auch, er fuhr unter Segel und ließ die Heizer im Maschinenraum nur immer bereit sein, die Schraube in Tätigkeit zu setzen. Somit konnte er die Sirene ununterbrochen ertönen lassen.
Jedem Seemann legt sich der Nebel nicht nur beklemmend auf die Brust, das heißt, läßt ihn nur mühsam Atem holen, sondern er legt sich ihm auch mit drückender Schwere aufs Herz, um so mehr, wenn er sich auf einer Meeresstelle weiß, die von vielen Dampferlinien durchkreuzt wird, und auf einer solchen befanden sich die beiden Schiffe.
In gedrückter Stimmung standen die Engländer an der Bordwand und blickten in den blaugrauen Nebel hinaus, als wollten sie versuchen, ein etwa herannahendes Schiff zu bemerken; aber sie konnten ja kaum die Hand vor den Augen erkennen.
An ein Gespräch war nicht zu denken, der Lärm der Sirene machte jede Unterhaltung unmöglich. Wollte Harrlington den Herren eine Mitteilung machen, so mußte er erst den Apparat abstellen, und auch dann wurden seine Worte kaum vernommen, weil der gellende Tun in den Ohren nachklang. Nichts anderes wurde daher gesprochen, als was unbedingt notwendig war, und dann so kurz wie möglich, um die Sirene nicht zu lange schweigen zu lassen.
Man freute sich fast, wenn dieselbe wieder zu tönen begann, denn so lange der heulende Ton ruhte, kam es den Herren vor, als wären sie im Grabe und in ein Leichentuch gehüllt. Das Licht hatte seine Wirkungskraft vollständig verloren, die menschliche Stimme klang nicht mehr irdisch, sie schien von Geistern zu kommen.
Die Vorbereitungen, welche auf Befehl des Kapitäns getroffen, waren auch nicht geeignet, die Stimmung zu heben.
Alle Boote waren mit Korkgürteln umgeben, und vollständig ausgerüstet: mit Masten, Segeln, Riemen, nautischen Apparaten, Wasserfässern und Proviant. Ja, ein jeder mußte selbst einen Pack mit den nötigsten Kleidungsstücken darin unterbringen. Die Davits, in denen die Boote hingen, waren klar zum Ausschwingen, die Knoten nur ganz lose geschürzt und die Taue lang aufgerollt, so daß sie glatt abliefen. In einer halben Minute wären alle Boote im Wasser gewesen.
Die Herren trugen alle Korkwesten, ja, selbst die Heizer standen und arbeiteten mit solchen vor den Feuern. Alles war vorbereitet, im Augenblick das Schiff verlassen zu können, und ebensolche Vorbereitungen trafen jetzt sicherlich auch die Vestalinnen.
Lord Harrlington ließ nichts außer acht. Er überzeugte sich persönlich davon, daß alle seine Anordnungen ausgeführt worden waren, er prüfte mit eigener Hand die Binden der Korkwesten, er fügte der des noch immer etwas schwächlichen Chaushilm eine zweite hinzu, so daß der Marquis wie ein geschwollener Frosch aussah. Er begab sich in den Heizraum und instruierte die Heizer, wie sie sich bei einem Unglück zu verhalten hätten — sie sollten alles stehen und liegen lassen, an Bord stürzen, aber sich ruhig in die Boote begeben, welche ihnen zugewiesen waren.
Lord Harrlington tat dies nur, um sein Gewissen zu beruhigen, denn im Innern dachte er anders.
Das Schicksal ist nun einmal unberechenbar, und es gefällt sich darin, diese seine Unberechenbarkeit zu zeigen, so oft es kann. Der gleichgültige Spieler gewinnt eher, als der habgierige, den Soldaten, welcher bei jedem Schuß den Kopf einzieht, trifft die Kugel eher, als den mutig Voranstürmenden, denn, »wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren,« sagt schon das Buch der Bücher. Kurz, der Sorglose hat hier auf Erden das meiste Glück, das ist eine Regel, welche durch Ausnahmen wie jede andere Regel nur bestätigt wird.
Daran dachte auch Harrlington, aber er mußte alles tun, für die Sicherheit zu sorgen. Ja, er mußte es, denn er hatte für das Leben seiner Freunde zu bürgen, das seinige kam zuletzt in Betracht.
Lord Harrlington befand sich unten bei den Heizern und gab ihnen Instruktionen. Lord Hastings und Williams, welch letzterer jetzt die Stelle von Davids einnahm, vertraten ihn an Deck. Da plötzlich verstummte der heulende Ton der Sirene, welcher bisher im Heizraum zu vernehmen gewesen war.
Harrlington lauschte. Er glaubte, das Heulen hätte nur ausgesetzt, weil einer der Steuerleute etwas sagte, doch eine Minute wartete er vergebens.
Da stieß ein Heizer einen Ruf der Ueberraschung aus, er deutete auf den Manometer.
»Was gibt's?«
»Kapitän, die Sirene tönt nicht mehr.«
»Sie ist abgestellt worden.«
»Nein, der Dampf geht noch durchs Rohr. Das Ventil ist geöffnet, das Manometer sinkt.«
Mehr hörte Harrlington nicht; mit einigen Sprüngen war er an Deck. Die Herren umstanden die Sirene, Williams rief eben durch das Sprechrohr nach Harrlington, als dieser zu ihm trat.
»Die Sirene funktioniert nicht mehr!«
Dem Schalltrichter entströmte Dampf, man hörte das Rasseln der sich umdrehenden Räder, aber sonst waren sie verstummt.
Der Heizer, welcher als Schlosser mit dem Apparat umzugehen wußte, wurde an Deck gerufen. Während er die Sirene untersuchte, ließ Harrlington Nebelhörner herbeibringen und diese in Bewegung setzen.
Was für ein schwacher Ton gegen den der Sirene!
»Eine Scheibe ist gebrochen,« erklärte der Schlosser, »es muß eine andere eingesetzt werden.«
»Wie lange dauert das?«
»Wenn alles glatt geht, zehn Minuten. Dann muß die Scheibe gestellt werden, bis sie den Ton erzeugt«
Die Arbeit war nicht leicht. Es waren viele Schrauben zu entfernen und das Licht der Blendlaterne durchdrang kaum den Nebel. Jedes Schräubchen mußte sorgsam, als wäre es ein unschätzbarer Diamant, aufgehoben werden, und so verzögerte sich die Arbeit merklich.
Endlich fiel eine Schraube an Deck, ein allgemeines Suchen begann. Selbst die Nebelhörner schwiegen eine Minute, weil ihre Bedienung sich an dem Suchen nach dem unersetzbaren Gegenstand beteiligte.
»Ruhig!« donnerte da plötzlich Harrlington, daß alle erschrocken zusammenfuhren.
In der Ferne hörte man ein Pfeifen. Es erklang immer deutlicher, ein Dampfer näherte sich ihnen.
Von wo kam er? Das konnte man nicht sagen. Der Nebel täuschte über die Richtung. Das Pfeifen klang noch sehr weit entfernt, doch der Nebel gleicht einer dicken Wand, er hält die Schallwellen zurück.
Nicht ohne Grund entfärbten sich einige Herren und sprangen nach den Nebelhörnern, so schnell und so laut als möglich sie ertönen lassend.
Zu sehen war noch nichts, nur das Pfeifen näherte sich dem ›Amor‹ mit rasender Schnelligkeit.
Wenn man nur wenigstens bestimmt hätte sagen können, von wo der Dampfer kam, aber jeder Herr behauptete, das Pfeifen aus einer anderen Richtung zu hören. Alle Grade der Windrose wurden angegeben.
Mit bleichem Gesicht trat Harrlington ans Ruder und nahm die Speichen selbst in die Hand. Die Steuerleute standen am Sprachrohr, seinen Befehl erwartend. Die Schraube arbeitete nicht, aber unten hielt ein Heizer den Griff des Ventils.
»Ein Licht — eine Toplaterne!«
Ein Schimmer tauchte rechts zur Seite auf, ganz nahe schon — die Toplaterne eines großen Dampfers. Die Toplaterne befindet sich in der Mitte des Schiffes. Wo war dann der Bug des mit halber Kraft, aber immer noch 10 Knoten fahrenden Dampfers?
»Volldampf!« schrie Harrlington und ließ das Steuerrad herumwirbeln.
»Stopp — rückwärts,« heulte eine fremde Stimme, die des Kapitäns des fremden Schiffes, durch den Nebel.
Zu spät!
Ein gellender Schrei erscholl, ein furchtbarer Stoß, ein Ruck, alles zu Boden schleudernd, dann ein Splittern, Krachen und Dröhnen — und unbeschädigt, ohne ein Hindernis zu finden, fuhr der fremde Dampfer über eine leere Wasserfläche. Sein scharfer, stählerner Bug hatte den ›Amor‹ in die Seite getroffen und ihn geteilt. — —

Ein gellender Schrei erscholl, ein furchtbarer Stoß, der fremde
Dampfer hatte den ›Amor‹ in die Seite getroffen und ihn geteilt.
Auch die Vestalinnen machten gewaltige Anstrengungen, sich bemerkbar zu machen und so eine Kollision mit einem anderen Schiffe zu vermeiden, sie ließen die Nebelhörner auf allen Seiten ertönen, sie läuteten unausgesetzt die Schiffsglocken, und außerdem saßen auf Anordnung Ellens hin noch auf allen Rahen Mädchen, welche Laternen durch die Luft schwingen und ab und zu Magnesiafeuer abbrennen mußten, deren intensiver Schein die Nebel etwas weiter durchdrang, als die anderen Lichter.
Ein Segelschiff war schon einmal ganz dicht an ihnen vorbeigekommen, so dicht, daß die beiden Besatzungen sich die Hände hätten reichen können. Die Begegnung war schadlos vorübergegangen, denn der Wind hatte sich fast gelegt — sonst wäre dieser dicke Nebel überhaupt nicht möglich gewesen, wenigstens nicht auf die Dauer — und infolgedessen war die See fast völlig glatt.
Dann passierten sie noch einen Dampfer, anscheinend ein sehr großes Passagierschiff, der den Mädchen eine entsetzliche Nachricht brachte.
Die beiden Schiffe sahen oder hörten sich vielmehr rechtzeitig, doch wich der Dampfer dem Segelschiffe nicht sofort aus, sondern näherte sich ihm erst. Von beiden Kommandobrücken herab fand eine Unterhaltung statt, zu welcher das Sprachrohr nicht erst nötig war, so nahe befanden sie sich aneinander.
»Was ist das für ein Schiff?« fragte eine tiefe Männerstimme mit stark amerikanischem Akzent.
»Vollschiff ›Vesta‹, New-York.«
»Wie? Das Damenschiff?« klang es erstaunt.
»Ja.«
»Gott schütze Sie, Miß Petersen! Hier Passagierdampfer ›Troja‹ Kapitän Handsen, New-York. Eine traurige Mitteilung: Wir haben vor zwei Stunden ein Schiff gerammt.«
Einige Mädchen schrien auf. Die Stimme des amerikanischen Kapitäns klang so erschüttert, daß man sofort ahnte, er sprach noch nicht alles aus, er wagte es kaum.
»Nur leckgerammt?« fragte Ellen leise.
»Wir haben es übersegelt.«
»Nichts gerettet?«
»Bis jetzt nichts, wir suchen seitdem und machen jedem uns begegnenden Schiffe die Meldung von dem Unglück, damit sie ebenfalls auslugen. Das Schiff war unvorsichtig, es führte Lichter, gab aber keine Lärmsignale.«
Die Mädchen atmeten auf. Sie hatten alle an den ›Amor‹ gedacht. Doch dieser besaß eine Sirene und auch Nebelhörner, und die Engländer hatten sicher nicht unterlassen, diese fortwährend zu brauchen. Die Mädchen hatten ja selbst die Sirene lange heulen hören.
»War es ein Dampfer?«
»Ja, denn er führte die Toplaterne, und dann hörte ich auch im Moment des Zusammenstoßes das Kommando ›Volldampf‹. Es war das letzte Wort des Kapitäns.«
»Die Unglücklichen! Und keiner ward aufgefischt?«
»Nichts, keine Planke!«
»Es war ein hölzerner Dampfer?«
»Dem Stoße nach ein eiserner oder stählerner. Wir sind mitten hindurchgefahren, wir trafen ihn in der Seite, er barst in zwei Teile und war verschwunden, ehe wir eine Person sehen konnten.«
»Auch nicht den Bau des Schiffes?«
»Nein, es war noch dunkler als jetzt.«
»Keinen Ruf gehört?«
»Nur einen einzigen Verzweiflungsschrei, aus vielen Kehlen kommend.«
»Dann wird wieder ein Schiff spurlos verschwunden sein. Wo befinden wir uns ungefähr?«
»In der Passagierlinie New-York-Kapstadt.«
»Sie bleiben noch hier?«
»Natürlich. Bis morgen früh muß ich die Unglücksstelle absuchen, bis morgen mittag 12 Uhr haben mir die Passagiere Zeit bewilligt.«
»Dann gebe Gott, daß Sie Erfolg haben! Werden Sie von anderen Schiffen unterstützt?«
»Außer Ihrem Segelschiff traf ich noch ein anderes. Es versprach Hilfe, soweit es der Wind erlaubt. Es wendete sofort und fuhr zurück, während ich Bogen machen ließ.«
»Wir wollen tun, soviel wir können. Bei diesem schwachen Winde können wir aber nur langsam manövrieren.«
» Good bye denn, Miß Petersen, glückliche Reise! Die ›Vesta‹ und der ›Amor‹ werden in New-York sehnsüchtig erwartet, glaube ich.«
Die Schiffe trennten sich.
»Armer Mann,« flüsterte Ellen, »ich höre es ihm an, wie bewegt er ist. Es muß ein furchtbares Gefühl sein, ein Schiff übersegelt zu haben ...«
»Kapitän, Kapitän!« riefen drüben auf dem Schiffe, dessen Lichter man noch deutlich sehen konnte, Stimmen. »Was ist denn das dort in aller Welt?«
Ein wunderbares Schauspiel fesselte die Augen aller, es war, als ob plötzlich ein neues, bisher noch nicht dagewesenes Gestirn entstanden wäre.
Am Horizont sah man eine runde, weißleuchtende Scheibe auftauchen, welche sich langsam erhob. Sie war etwa so groß wie die Mondscheibe.
»Der Mond!« wurde auf dem Dampfer gerufen.
»Unsinn!« entgegnete der Kapitän.
Auch die Mädchen sahen die Torheit dieser Annahme sofort ein. Wohl stand der Vollmond jetzt am Himmel, aber seine Leuchtkraft schien erloschen zu sein. Dieser Nebel hätte am Tage selbst die Sonne nicht im geringsten durchkommen lassen, und dann stand der Mond jetzt wo ganz anders, als in der fraglichen Richtung.
Sprachlos vor Staunen standen alle da und blickten auf die Feuerkugel, welche immer höher und höher stieg, bis sie endlich stehen blieb.
Was konnte das sein? Sie war weit, weit entfernt und behielt dennoch, auch noch trotz des Nebels, diese enorme Leuchtkraft. Dort, wo sie sich befand, mußte es lichter Tag sein, und wäre der Nebel auch noch zehnmal dichter gewesen. Der Glanz war so intensiv, daß man nach längerem Hinschauen die Augen schließen mußte.
Es kam noch wunderbarer.
Plötzlich löste sich die riesige Leuchtkugel auf und fiel als feuriger Regen wieder nieder, jetzt noch größere Helligkeit als vorhin verbreitend, welche selbst bis nach den beiden Schiffen drang, so daß sich die Personen erkennen konnten. Und doch befand man sich nach ungefährer Schätzung etwa zwei Meilen ab, wenn der Nebel nicht täuschte.
Dann war es vorbei. Alles ward wieder finster.
»Was für ein Phänomen war das?« fragte der Amerikaner nach der ›Vesta‹ hinüber.
»Ein Wunder, etwas anderes weiß ich nicht zu antworten,« entgegnete Ellen aufgeregt.
»Es war kein Himmelsgestirn.«
»Nein, wenigstens kein bis jetzt bekanntes.«
»Und an ein Nordlicht ist hier nicht zu denken.«
»Es sah auch nicht aus wie ein Nordlicht, eher wie ein riesiger Feuerwerkskörper, etwa wie eine Leuchtkugel.«
»Das müßte eine Leuchtkugel von riesigen Dimensionen gewesen sein. Ich nehme die Richtung nach dort, vielleicht finde ich Aufklärung. Nochmals: good bye, meine Damen, auf Wiedersehen in New-York!«
Der Dampfer verschwand im Nebel.
Die Mädchen unterhielten sich weniger über das in den Grund gerammte Fahrzeug, als über die eben gesehene Erscheinung. Sie war zu wunderbar gewesen.
Uebrigens konnte man nicht daran denken, die Unglücksstelle aufzusuchen, denn gerade von dort kam der Wind. Man wollte soviel wie möglich aussehen, ob man Schwimmende, Leichname oder Trümmer treiben sah. Es war nicht so unmöglich, daß einer oder der andere der Katastrophe entgangen war und sich durch Schwimmen noch am Leben hielt.
Es wurden außenbords Blendlaternen angebracht, aber ihr Licht erreichte kaum die glatte Wasserfläche. Doch man durfte nichts unversucht lassen.
»Der Kapitän meinte, die Feuerkugel schwebe etwa dort, wo er den Dampfer gerammt habe,« sagte Miß Murray zu Ellen.
»Ja, und ich habe auch schon daran gedacht —«
»Daß die Leuchtkugel deshalb in die Höhe gesendet wurde, um das Meer nach Schiffbrüchigen abzusuchen,« fiel Miß Thomson ein.
»Ich habe aber noch nie von solch einer wunderbaren Erfindung auf diesem Gebiet gehört.«
»Wir haben während unserer Reise manches zu sehen bekommen, was uns neu war,« entgegnete Ellen.
»Gewiß,« sagte Jessy, »aber so etwas noch nicht.«
»Es war elektrisches Licht.«
»Wahrscheinlich.«
»Wissen Sie, an wen ich sofort dachte, als ich die elektrische Kugel aufsteigen sah?«
»An Mister Hoffmann,« riefen Miß Murray und Miß Thomson gleichzeitig. »Sollte er —«
»Wer weiß. Er sagte zwar, er wolle uns nicht begleiten, aber mir deucht, er hat seinen Entschluß geändert. Ich werde mich nicht irren: Mister Hoffmann befindet sich mit dem ›Blitz‹ nicht weit von uns entfernt, hat von dem Unglück Kenntnis bekommen und gebraucht nun Elektrizität, um das Meer zu erleuchten und so noch lebende Personen zu retten. Das erstemal wäre es ja nicht, wie uns allen bekannt ist.«
»Wolle Gott, es gelänge ihm auch diesmal!«
Gegen Morgen verzog sich der Nebel, ohne daß man noch einmal eine Lichtquelle oder den vermuteten ›Blitz‹ wahrgenommen hätte. Man sah ihn auch nicht, als die Morgensonne aufging und das Meer mit Purpurröte übergoß.
Der Nebel war völlig gewichen. Ein heller, sonniger Morgen war angebrochen. Er hatte eine frische und günstige Brise mitgebracht.
Nach der aufregenden Nacht folgte eine wohltuende Ruhe, die Wache wurde bis auf wenige reduziert, die übrigen legten sich schlafen.
Ellen berechnete, daß die ›Vesta‹ gegen elf Uhr genau jenen Grad erreichte, der als Zusammenkunftsort mit dem ›Amor‹ ausgemacht war, und gelangte man dorthin, dann sollte alles wieder an Deck erscheinen.
Doch die Schläferinnen wurden noch eher geweckt.
Der Ruf ›eine Leiche‹ drang in die Kabinen und schreckte die Müden auf, sie eilten an Deck und sahen sofort das Opfer des Meeres schwimmen.
Es war nicht nötig, ein Boot auszusetzen, denn die ›Vesta‹ mußte an ihm vorbeikommen, und man konnte den Leichnam dann an Deck hissen, wo er untersucht, nach seinen Personalien durchforscht und dann nach Seemannsweise bestattet werden sollte.
»Ein Schiffbrüchiger; er trägt eine Korkweste,« sagte ein Mädchen.
»Vielleicht einer von dem unbekannten Dampfer.«
»Vielleicht, aber es mögen diese Nacht auch noch andere Schiffe ihren Untergang gefunden haben.«
Jetzt war man längsseits des Leichnams; es wurde eine Schlinge gemacht, und nach einigen mißlungenen Versuchen war der Körper so daran befestigt, daß er an Deck gehißt werden konnte.
Mitleidig umstanden die Mädchen den Verunglückten, der nur mit Hemd, Hose und Strümpfen bekleidet war. Die Korkweste trug er direkt über dem Hemd.
Sein Gesicht konnte man nicht erkennen, es war entsetzlich zerfleischt, die Nase wie abgehackt. Die Verletzungen stammten nicht von gefräßigen Seevögeln oder Fischen her, ein schwerer Gegenstand mußte ihn getroffen haben, denn eine tiefe Wunde, von einem Hiebe herstammend, zog sich von der Stirn bis zum Kinn.
»Wer mag es sein?«
»Ein Matrose.«
»Nein, kein Matrose, ein Heizer,« sagte Ellen.
»Woraus können Sie das schließen?«
»Der Mann hat Strümpfe an, keine Schuhe oder Stiefel, weil die Heizer immer nur in Holzpantoffeln arbeiten. Das Hemd ist auch von Ruß geschwärzt. Er hat in der Nacht mit der Korkweste vor dem Feuer gearbeitet, um bei einem Unglück sofort bereit zu sein. Dieses ist auch eingetreten, er ist zwar nicht im engen Räume stecken geblieben, aber ein Gegenstand, vielleicht ein Stück Maschine hat ihn getroffen oder er ist dagegen geschleudert worden. Ueber Bord kann er nicht gewaschen worden sein, denn es war kein Seegang, wie käme er dann auch zu der Korkweste? Nein, sein Schiff muß untergegangen sein.«
»Könnte man denn nicht ermitteln, wie dasselbe geheißen hat?«
»Wir müssen ihn untersuchen.«
»Ja, und zwar zuerst die Korkweste. Innen steht oft der Name des Schiffes.«

Man wunderte sich, noch nicht auf diesen Einfall gekommen zu sein.
Die noch ziemlich neue, sehr solid gearbeitete Korkweste wurde dem Leichnam abgenommen, Ellen, von allen Mädchen umringt, drehte sie um und — das Entsetzen läßt sich nicht beschreiben.
Da stand in der Mitte eingebrannt:
AMOR, INSEL WIGHT.
Und darunter der Name des Besitzers der Korkweste, ein allen bekannter Name:
THOMAS HACKNEY, HEIZER.
»Thomas Hackney war Heizer auf dem ›Amor‹,« brachte Ellen endlich über die blutleeren Lippen. »Der ›Amor‹ ist untergegangen!«
»Der ›Amor‹ untergegangen!« echote es im Kreise nach, leise, im Tone der Verzweiflung.
Da gellte es furchtbar auf, Ellen stürzte, wie vom Schlage getroffen, zusammen.
Miß Murray fing sie auf.
»Vorbei, vorbei! Der ›Amor‹ ist untergegangen!« jammerte Ellen in namenlosem Schmerze.
Miß Thomson trat zu ihr und faßte ihren Arm. Tränen standen auch ihr im Auge, aber ihre Stimme war fest, als sie sagte:
»Ellen, hören Sie, Ellen, haben Sie Hoffnung!«
»Wie soll ich Hoffnung haben? Dort liegt der Zeuge des völligen Untergangs!«
»Wir können noch Hoffnung haben, nein, ich habe keine Furcht, ich weiß bestimmt, daß wir unnötig erschrecken. Denken Sie an den ›Blitz‹, er ist hier, er muß hier sein.«
Ellen richtete sich auf, strich die Haare aus der Stirn und schaute mit wirren Blicken um sich. Dann jauchzte sie plötzlich auf.
»Ja, ja, Sie haben recht — der ›Blitz‹, der ›Blitz‹. Hoffnung, o, wenn nur wenigstens Hoffnung vorhanden ist!«
Kehren wir zu unserem Freunde Dick zurück, welcher im Hotel Atlantik zwar recht behagliche, aber auch recht langweilige Tage verlebte.
Er hatte die Hälfte des Tages stets wie ein Bär verschlafen, immer für zwei Mann gegessen und getrunken, des Morgens den ›New-York Herald‹ gelesen und die übrige Zeit vom Fenster aus das rege Treiben der Straße gemustert, das ihm ein ganz neues Schauspiel war.
Dick lebte also ganz angenehm, doch eine so riesige Figur wie die seine konnte Müßiggang nicht lange aushalten, besonders wenn es keine Unterhaltung gab, und so war es nicht wunderbar, wenn er sich schon nach den ersten Tagen in ein freundliches Gespräch mit dem Zimmerkellner einließ, viel freundlicher, als es sonst seine Art war. Er klagte ihm seine Langeweile.
»Warum gehen Sie denn nicht spazieren?«
»Ich erwarte jemanden.«
»Deshalb brauchen Sie sich doch nicht wie ein Gefangener im Zimmer einzuschließen.«
»Wenn der nun aber gerade kommt, den ich erwarte, und ich bin nicht zu Hause?«
»So wartet er eben, bis Sie zurückkommen, wenn er Sie so dringend zu sprechen wünscht,« lachte der Kellner.
»Was ich bei mir trage ist von solcher Wichtigkeit, daß ich gar nicht allein auszugehen wage.«
Kurz, Dick fing an zu plaudern, er erzählte von seinem Fund, dem Pergament, von den 10 000 Dollar Belohnung, die ihm in Aussicht ständen, und von dem bald zu erwartenden Bevollmächtigten des Besitzers, welcher das Pergament auf seine Echtheit prüfen und, wenn er solche bestätigt gefunden, ihm wahrscheinlich die Prämie gleich auszahlen würde.
Dick kannte kein Mißtrauen; seine ganze Natur schien Offenherzigkeit zu sein, es fiel ihm auch durchaus nicht auf, daß der bärtige Zimmerkellner mit den listig blinzelnden Augen immer wieder auf dieses Thema zu sprechen kam und recht verfängliche Fragen stellte. Nur in einer Hinsicht war Dick recht hartnäckig, er konnte von dem neugierigen Kellner nie dazu bewegt werden, ihm das Pergament zu zeigen. Bei dieser Bitte kniff der Miner stets die Augen listig zusammen und schüttelte mit pfiffigem Lächeln den Kopf.
Und der Kellner war doch so neugierig!
Dick hatte mit ihm in den paar Tagen schon wirkliche Freundschaft geschlossen und infolgedessen schon manche Flasche Portwein mit ihm ausgestochen. Daher war der Kellner dem Wunsche Dicks sofort nachgekommen, als ihn dieser einmal gebeten hatte, für ihn einige Kleidungsstücke zu kaufen. Der Kellner war mit einem ganzen Paket angekommen und hatte den gutmütigen Miner nicht einmal um einen Cent betrogen.
Obgleich Dick nun niemals das Zimmer verließ, seine neuen Kleider also auch nicht den Straßenstaub auffingen, unterließ der Kellner es doch keinen Abend, die Sachen seines neuen Freundes mit hinauszunehmen, um sie, wie er sagte, von dem Hausknecht ausklopfen zu lassen. Dicks Behauptung, dies wäre unnötig, hielt ihn davon nicht ab, gerade die vorderen Zimmer seien sehr staubig, und so hielten es hier im Hotel alle Gäste, selbst wenn sie monatelang ihr Zimmer nicht verließen.
In Wirklichkeit aber gab der freundliche Kellner die Sachen niemals dem Hausknecht, sondern begnügte sich damit, die Taschen genau zu untersuchen — doch das Pergament fand er nie.
Dick war auch wirklich zu harmlos, so vorsichtig er sich sonst stellen mochte.
So zum Beispiel wachte er einmal aus tiefstem Schlafe auf, weil in seinem Zimmer ein Lehnstuhl mit polterndem Getöse umgefallen war.
»He, wer ist da?« knurrte der Erwachte.
»Ich bin's.«
»Wer ist das ich?«
»Louis,« so war der Name des Kellners, »ich habe gestern Abend meine Schlüssel hier liegen lassen, jetzt werden sie gebraucht, und man macht schon Skandal, daß sie nicht gleich zur Hand sind. Entschuldigen Sie die nächtliche Störung!«
»Macht nichts. Wartet, hier sind Streichhölzchen, ich werde leuchten,« sagte der gutmütige Dick.
»O, bemühen Sie sich nicht.«
In diesem Augenblick klirrte es.
»Da sind sie schon, sie lagen auf dem Boden.«
Wieder klirrte es, und zwar so laut, daß man das Geräusch dabei nicht hörte, welches klang, als wenn die Schublade einer Kommode zugeschoben würde.
»Gute Nacht, Mister Dick.«
»Gute Nacht, Louis,« entgegnete der Miner und wälzte sich auf die andere Seite.
Draußen auf dem Korridor aber murmelte der Kellner:
»Es hilft mir alles nichts, ich finde das Pergament nicht, wahrscheinlich trägt er es am Körper verborgen. Aber eine Natur hat der Kerl! Nach dem, was ich ihm gestern eingeflößt habe, müßte er den ewigen Schlaf tun, und doch ist er aufgewacht. Verdammt, daß ich den Stuhl umwerfen mußte! Na, hatte es wahrscheinlich sowieso nicht gefunden. Ein Glück, daß der Kerl so beschränkt ist.«
Am nächsten Abend erhielt Dick endlich den Besuch, den er so lange erwartet hatte.
Ein junger, nett und einfach gekleideter Mann, dem die Schüchternheit aus den Augen sah, der sich überhaupt recht blöde und befangen benahm, fragte an der Portiersloge nach Mister Dick Burrels und wurde zurechtgewiesen.
Als er auf dem Korridor stand und nach der Zimmernummer suchte, wurde er von dem Zimmerkellner angeredet.
»Sie wünschen?«
»Nummer 41.«
»Mister Burrels?«
»Ja.«
»Ist ausgegangen,« log der Kellner, um den Zweck dieses Besuches zu erfahren.
»O weh, dann muß ich warten. Wird er lange ausbleiben?«
»Je nachdem,« lächelte Louis.
»Wie meinen Sie das?«
»Das kommt darauf an, was Sie von ihm wünschen. Mister Burrels ist nicht für jeden zu sprechen.«
»Also er ist zu Hause?«
»Nicht für jeden.«
»Aber für mich.«
»Hm, sind Sie der Herr, welcher wegen des Pergaments kommt? Diesen vorzulassen hat mich Mister Burrels beauftragt.«
Der junge Mann machte ein erstauntes Gesicht.
»Allerdings, der bin ich.«
»Dann bitte, treten Sie ein.«
»Ein richtiger Grünfink,« dachte Louis, als er die Tür hinter dem Fremden geschlossen hatte, »mir ganz unbegreiflich, daß man solch jungen Bengel bei einer so wichtigen Angelegenheit verwendet. Ich glaube, der ist noch nicht einmal trocken hinter den Ohren. Doch ja, es soll ja so einer sein, der die Echtheit des Pergamentes prüft, also so ein Grübler von Gelehrtem, und die Leute sind gewöhnlich so schüchtern und verlegen, daß sie nicht wissen, wo hinten und vorn ist. Na, dem werden sie die Würmer schnell genug aus der Nase ziehen, denn ein Grünfink ist er doch nur. Schade, daß mir mein Versuch bei Dick nicht gelungen ist, ich muß weiter spionieren, das bringt auch etwas ein.«
Der Grünfink war unterdes von Dick empfangen worden und hatte sich als Mister Stephans vorgestellt.
»So, hm, Stephans, ein hübscher Name,« sagte Dick, den jungen Mann von oben bis unten musternd und dabei ein mißtrauisches Gesicht machend.
»Sind Sie mit mir zufrieden?« fragte der andere lächelnd.
»Weiß noch nicht. Papiere?«
»Habe natürlich keine anderen als die auf meinen Namen.«
»Dachte mir's. Wollen Sie was trinken?«
»Gewiß, bestellen Sie etwas!«
»Portwein?«
»Ich trinke keine Spirituosen.«
»Also Abstinenzler?«
»Ja, ich bin Temperenzler.«
»Vielleicht Limonade?«
»Danke.«
»Selterswasser?«
»Ja, darum bitte ich — mit etwas Kirsch.«
Eine Klingel läutete, welche Louis rufen sollte. Dieser stand auf seinen Kellnerschuhen schon längst vor der Tür und lauschte. Der Beginn der Unterhaltung, dieses Fragen nach Getränken hatte ihn durchaus nicht gewundert, in Amerika beginnen unzählige Geschäftsgespräche auf diese Weise.
Dick sprach, wie gewöhnlich einem Fremden gegenüber, in protzigem Tone, der andere schüchtern.
Daß aber diese Fragen und Antworten der beiden nur Stichworte waren, an denen sie sich erkannten, davon hatte er keine Ahnung, es fiel ihm eben nichts Ungewöhnliches dabei auf.
Er blieb noch eine halbe Minute stehen, schlürfte dann mit den Schuhen und trat ein. Die beiden hatten schon an dem Tisch gegenüber Platz genommen.
»Portwein für mich, Selterswasser und Kirsch für den Herrn,« bestellte Dick.
Louis entfernte sich wieder unter einer Verbeugung und dachte dabei:
»Also Temperenzler ist der Kerl auch. Nun, da haben sie gerade den grünsten aller Grünfinken ausgesucht. Nun heißt es noch, meinen Instruktionen nachzukommen, dann ist das Bürschchen reif, gerupft zu werden.«
Mit den Temperenzlern, das heißt, mit jenen Leuten, welche jeden Genuß irgend eines geistigen Getränks verschmähen, das unschuldigste Glas Dünnbier nicht anrühren, ist es in Amerika und auch in anderen Ländern eine eigentümliche Sache. Sie stehen in keinem guten Rufe, und nicht mit Unrecht.
Temperenzler sind entweder Leute, welche früher Trunkenbolde waren, Trunkenbolde, wie man sie in Deutschland gar nicht kennt, die das Hemd vom Leibe im buchstäblichen Sinne des Wortes vertrinken, oder es sind Scheinheilige, welche sich für Temperenzler ausgeben, im stillen aber destomehr trinken. Zu letzteren gehören Beamte, wie zum Beispiel solche an der Bahn, Post und so weiter, welche versprechen müssen, nie einen Tropfen eines geistigen Getränks zu sich zu nehmen, ferner angesehene Leute, welche den unteren Klassen ein Beispiel der Mäßigkeit geben zu müssen glauben.
Wie gesagt, öffentlich prahlen sie damit, Temperenzler zu sein, und im stillen wird ordentlich gebügelt.
Außer einigen wenigen, welche aus Prinzip oder Gesundheitsrücksichten nichts trinken, sind die früheren Trunkenbolde noch die ehrlichsten. Sie wissen, daß, wenn sie auch nur einen Schluck einer alkoholischen Flüssigkeit getrunken haben, sofort ihr altes Laster sie von neuem ergreift, und zwar mit verdoppelter Heftigkeit. Dann gibt es keine Rettung mehr, sie verkommen in dem Sumpfe, in den sie geraten.
Die Temperenzler stehen noch in dem Rufe, anderen Lastern zu frönen, mit einer Leidenschaft, wie sie der Trinker gar nicht kennt. Das läßt sich auch psychologisch erklären. Einer, welcher früher der Trunksucht stark gefrönt hat, wird, wenn er das Trinken aufgibt, in andere Laster fallen. Wer aus dem bekannten Dreibund, Wein, Weiber und Spiel, den Verderbern so mancher Jugend, den Wein wegläßt, der fällt den beiden anderen Vampiren desto schneller zum Opfer.
Kurz, die Temperenzler sind nicht sehr geachtet, man wittert in ihrem Charakter irgend einen dunklen Punkt.
Louis brachte das Verlangte. Bei seinem Eintritt brach das Gespräch ab. Man beschäftigte sich mit den Getränken, und als Louis dann an der Tür zu lauschen versuchte, konnte er nichts vernehmen — man sprach zu leise.
Die Unterredung zog sich in die Länge. Es war schon um 9 Uhr, und die beiden waren noch nicht fertig.
Einmal bekam Louis, welcher öfters zur Herbeischaffung von frischen Getränken herbeigerufen wurde, auch das Pergament zu Gesicht.
Mister Stephans hatte es vor sich ausgebreitet, hielt eine Lupe vor das Auge und musterte es sorgfältig. Sein Gesicht hatte jetzt nicht mehr einen schüchternen, sondern einen recht klugen, intelligenten Ausdruck.
Louis, einen Auftrag erwartend, blieb lautlos stehen, versuchte aber vergebens, etwas von dem Inhalte zu erfahren. Er sah nur Hieroglyphen, und diese waren für ihn eben Rätsel. Genau so gut hätte er erraten können, was die dünne, schwarze Platte zu bedeuten hatte, welche neben dem geheimnisvollen und so wichtigen Pergament lag.
»Nun, noch immer nicht zufrieden?« fragte Dick endlich.
»Doch, die Sache ist allright,« entgegnete Stephans, »dies Pergament ist das richtige, Sie haben die Prämie verdient.«
Dick schlug auf den Tisch und lachte fröhlich auf, während der junge Mann die Gummischeibe in das Pergament wickelte, beides in eine Ledertasche steckte und diese in eine Innentasche der Weste schob.
Alles das war von dem Kellner scharf beobachtet worden.
»He, Louis,« rief Dick, »noch eine Flasche Portwein, oder halt, eine Flasche Champagner, unser Geschäft muß gefeiert werden. Ihr macht doch einmal eine Ausnahme, Mister Stephans, und trinkt ein Glas Champagner mit?«
»Keine Ausnahme, ich trinke keine alkoholischen Sachen.«
»Ach, macht mir doch nichts weis. Ihr seid doch kein solcher Süffel gewesen, daß Ihr nichts mehr trinken dürft?«
»Das allerdings nicht,« lächelte Stephans, »ich bin Temperenzler durch Erziehung.«
»So habt Ihr überhaupt noch nie ein Glas Wein, getrunken? Schmeckt prachtvoll, sage ich Euch.«
»Einmal habe ich mich allerdings verleiten lassen, einige Glas Wein zu trinken, sie sind mir aber sehr übel bekommen, ich tue es nicht wieder.«
»Uebel bekommen?«
»Ja, oder vielmehr — ich brauche mich ja Ihnen gegenüber nicht zu genieren — ich habe nach dem Genuß jenes Weines Streiche gemacht, welche ich vor meinem Gewissen nicht verantworten konnte.«
Der junge Mann war bei diesem Geständnis errötete. Louis biß sich auf die Lippen, Dick lachte laut.
»Hahaha, sehr gut! Seht Ihr wohl, was Ihr Temperenzler für Tugendhelden seid? Kaum habt Ihr etwas getrunken, so begeht Ihr allerlei Dummheiten!«
»Eben deswegen trinken wir nicht. Jeder Mensch hat seine Fehler, und da ich erfahren habe, daß meine Leidenschaften nach dem Genuß von Alkohol zum Durchbruch kommen, so enthalte ich mich desselben vollständig.«
»Champagner ist kein Alkohol.«
»Er enthält aber solchen.«
»Habt Ihr schon einmal Whisky getrunken?«
»Noch nie an meine Lippen geführt.«
»Auch keinen anderen Branntwein?«
»Nie.«
»So wißt Ihr gar nicht, wie er schmeckt?«
»Nein.«
»Köstlich!« lachte Dick aus vollem Halse. »Von dem solltet Ihr erst einmal ein Quantum trinken, und wenn Ihr dann nicht heute nacht noch New-York auf den Kopf stelltet, dann will ich gehangen werden.«
»Das wäre leicht möglich, und deshalb vermeide ich ihn. Wer den ihm gelegten Schlingen nicht aus dem Wege geht, ist wert, gefangen zu werden. Ich verteidige das Temperenzwesen entschieden, es ist der Anfang eines moralischen Lebens.«
»Ihr sprecht wie ein Buch. Na, laßt's gut sein. Louis, mir eine halbe Flasche Champagner, und was trinkt Ihr, Mister Stephans?«
»Noch Selterswasser und Kirsch. Aber sagen Sie Kellner, woher beziehen Sie die Essenz eigentlich?«
Der Kellner nannte eine Firma.
Ueberall, wo das Temperenzwesen sehr verbreitet ist, wie zum Beispiel in Amerika, Australien, Skandinavien — also überall da, wo die Trunksucht die schlimmsten Auswüchse erzeugt — existieren Firmen, welche sich ausschließlich mit der Fabrikation alkoholfreier Getränke beschäftigen. Brauereien liefern alle Sorten Biere, aus Hopfen bereitet, doch ohne Alkohol, und Destillerien versehen die Temperenzler mit allen nur erdenklichen Arten von Schnaps und Likör, ebenso genannt, aber frei von Spiritus. Man kann sie selbst dem Geschmack nach kaum von wirklichen Branntweinen unterscheiden, aber die betäubende Wirkung bleibt aus.
Dem jungen Mann schmeckte der Kirschlikör nicht, den er zu dem Selterswasser genoß.
»Das ist doch ein Temperenzgetränk?« fragte er.
»Gewiß, diese Firma liefert nur solche.«
»Er regt mich so auf, ich fühle mich so sonderbar. Ich glaube fast, der Kirsch enthält Alkohol.«
»Sie sind der erste Gast, welcher das sagt. Noch, niemand hat sich über ihn beschwert.«
Wirklich, Mister Stephans' Augen glänzten, seine Wangen waren gerötet, was beides vorher nicht an ihm zu bemerken gewesen war.
»Macht keine Dummheiten heute abend,« lachte Dick, »Ihr scheint wieder dazu aufgelegt zu sein.«
»Ich werde mich irren,« fuhr Stephans fort, den Rest seines Glases austrinkend, »die Freude, das verlorene Eigentum meines Herrn wiederzuhaben, jagt mir nur das Blut schneller durch die Adern. Noch eine Selters und Kirsch.«
Als Louis wieder hereinkam, lag vor Dick auf dem Tisch eine stattliche Anzahl von Goldstücken aufgereiht, und Dick unterzeichnete eben eine Quittung, welche Stephans dann einsteckte.
»Also doch,« dachte Louis, die Getränke servierend, »dieser junge Bengel muß ein tüchtiger Mann sein, daß man ihm solche Geschäfte und solche Summen übergibt, oder aber, er genießt bei seinem Herrn unbedingtes Vertrauen. Man findet oft, daß Fromme und Temperenzler untereinander sich das größte Vertrauen erweisen, bis sie einmal hinters Licht geführt werden und ihre Dummheit einsehen. Ich würde solch einem Bruder, der keine drei Glas Wein vertragen kann, keine fünf Dollar anvertrauen.«
Stephans hatte sein Glas ausgetrunken, er erhob sich. Louis räumte zusammen.
»Jetzt muß ich aber fort, ich bin kein Freund von spätem Zubettgehen,« sagte Stephans, Dick die Hand hinhaltend, der das Gold schon eingesteckt hatte.
» Good bye denn, Sir; seht Euch unterwegs vor, fallt nicht in Versuchungen und Stricke.«
»Werde mich hüten! So lange ich bei klarem Verstande bin, ist es nicht so leicht möglich, mich zu fangen. Das müßte ein ganz geriebener Gauner sein.«
»Oder eine Gaunerin.«
» Never Mind! Dank meiner Temperenz, bin ich gegen alle satanischen Künste gefeit.«
Die Männer verabschiedeten sich. Als Stephans durch das Zimmer ging, wäre er beinahe über einen Fußschemel gefallen, er stolperte und sank auf ein Sofa. »O, o, ich bin etwas kurzsichtig. Gute Nacht, Gentlemen, auf Wiedersehen, Mister Burrels.«
Damit erhob er sich und verließ das Zimmer.
Des Kellners Gesicht strahlte, als er mit dem Brett voll Flaschen und Gläser über den Korridor schritt.
»Gelungen,« murmelte er, »der hat seinen Teil weg. Ich möchte zu gern dabei sein, wenn dieser Tugendheld direkt in die Schlingen rennt, die er in seinem Dunkel als gar nicht für ihn existierend wähnt.«
Es war gegen zehn Uhr, als Mister Stephans das Hotel verließ. Der Broadway, in welcher Straße das Hotel liegt, war natürlich noch sehr belebt, doch es herrschte nicht mehr das hastige Treiben des Tages, es waren Spaziergänger, welche sich hier aufhielten, Herren und Damen, paarweise und allein, und man irrt, wenn man eine Dame, welche in Nordamerika des Abends allein auf der Straße geht, für eine der Halbwelt hält.
Die Damen dürfen dort frei auftreten, weil sie unter dem Schutze der Männer stehen. Der Fremde, der solch eine alleingehende Dame anspricht, riskiert, den Regenschirm ins Gesicht zu bekommen, und ist er nicht still, so kann er auch noch die Fäuste der zu Hilfe eilenden Passanten schmecken.
Der junge Mann ging, den langen Rock bis oben zugeknöpft, die Hände in den Taschen, den niedrigen Hut tief in der Stirn, langsam seines Weges, schaute nicht links und rechts, wohl aber einmal einer ihm begegnenden, hübschen Dame in die Augen.
Manche sah weg, manche erwiderte den Blick, einige taten dies sogar in recht zudringlicher Weise.
Der Mann blieb nicht stehen, er schlug oft, wenn der Blick zu feurig gewesen, die Augen nieder und setzte seinen Weg fort.
So erreichte er das Ende des Broadway, wendete sich links in eine noch ziemlich belebte Straße, dann wieder rechts und kam so auf einen Platz, der mit Anlagen verziert war. Diese von eisernen Gittern umschlossenen Anlagen waren jetzt geschlossen, und auf dem Wege längs der Häuser gingen nur sehr wenig Leute. Niemand hatte hier etwas zu tun.
Da erscholl hinter Stephans ein leichter, hastiger Schritt, und ehe der junge Mann wußte, wie ihm geschah, lag ein Arm in dem seinen.
»Herr, schützen Sie mich, ich werde verfolgt!« keuchte eine Mädchenstimme.
Stephans schien sehr überrascht; ehe er die Hilfsbedürftige einer Musterung unterzog, blickte er sich ängstlich um und sah wirklich zwei dunkle Gestalten, welche eben um eine Ecke verschwanden.
»Sie sind weg,« sagte er verlegen.
»Sie werden wiederkommen,« entgegnete die Dame ängstlich, »ich habe wohl bemerkt, daß sie mir schon lange folgen, ich hielt es nur für einen Zufall, sobald ich aber hier einbog, näherten sie sich mir so schnell, daß ich eine Gewalttat fürchtete. Es sind in der letzten Zeit einige Ueberfalle hier vorgekommen. Haben Sie nichts davon gehört?«
»Nein, gar nichts.«
»Damen sind ihres Schmuckes beraubt worden.«
»Dann wäre es besser, Sie nähmen einen Wagen. Ich werde Ihnen einen besorgen.«
»Nicht doch! Die Ueberfalle geschehen fast immer im Wagen. Die Räuber öffnen die Türe, ohne daß es der Kutscher bemerkt, springen hinein und überwältigen ihr Opfer.«
»Das müssen ja freche Menschen sein.«
»Das sind sie. Mir ist bis jetzt noch niemals etwas zugestoßen, ich war immer so keck, aber jetzt ist mir plötzlich aller Mut gesunken. Wenn ich Sie nicht belästige, ersuche ich Sie, mich nach Hause zu begleiten.«
Die Erfüllung einer solchen Bitte darf kein Amerikaner abschlagen, — es sei denn, er befände sich auf dem Wege zu einem Sterbenden.
Mister Stephans hatte im trüben Scheine einer Laterne seine Begleiterin gemustert, allerdings nur scheu von der Seite, und fand in ihr eine nicht mehr allzu junge, aber noch recht hübsche und ansehnliche Dame. Ihre Toilette ließ nichts zu wünschen übrig.

Es war des jungen Mannes Pflicht, die ihn darum bittende Dame nach Hause zu führen, mochte sie sein, was sie wollte. Es gab höchstens einen Ausweg: sie dem Schutze eines Konstablers zu übergeben, doch ein junger Mann tut dies schwerlich.
Ihr Arm lag leicht in dem seinen, die herabhängende Hand, mit gelbem Glacé bekleidet, war klein und zierlich, den runden Knöchel umschloß ein goldenes Armband.
Mister Stephans war sehr einsilbig; man sprach erst vom Wetter, dann von der Unsicherheit New-Yorks, und schließlich erzählte die Dame, wo sie gewesen — in einem Theater, welches frühzeitig schloß. Sie befände sich nun auf dem Wege nach ihrer Wohnung — gar nicht weit von hier.
Stephans fand etwas in diesen Worten, was ihn veranlaßte, die Dame einmal genauer anzusehen, er begegnete ihren feurigen Augen, und gleichzeitig fühlte er seinen Arm gepreßt.
Wäre der junge Mann auch noch so unerfahren gewesen, er hätte doch sofort gewußt, zu welcher Klasse von Damen diese gehörte, die er nach Hause brachte — doch in Amerika gibt es keine solche unerfahrene Menschen.
Er räusperte sich verlegen.
»Hm, hm, Miß, ist es noch weit bis zu Ihrem Hause?«
»Wir sind gleich dort, die nächste Ecke.«
»Dann kann ich mich wohl empfehlen, hier ist die Gegend sicher.«
»O bitte, bringen Sie mich bis vor die Tür!«
»Gut, bis vor die Tür,« sagte Stephans mit Nachdruck.
Nach einigen Minuten blieb er stehen.
»Sie haben sich doch nicht verlaufen?« fragte er.
»Nein, warum denn?«
»Vorhin sagten Sie, die nächste Ecke, und jetzt sind wir schon an einigen vorüber.«
»Ja,« lachte die Dame, »ich bin eben an meinem Hause vorübergegangen.«
Stephans versuchte, seinen Arm freizumachen, er wurde aber festgehalten.
»Ich bedaure, Miß.«
»Was denn?«
»Sie nicht weiter begleiten zu können.«
»O, Sie sind unhöflich.«
»Durchaus nicht, aber Sie täuschen sich in mir.«
»Wieso?«
»Ich bin nicht geneigt, auf Ihren Vorschlag einzugehen.«
»Auf welchen denn?«
»Den Sie mir andeuten.«
»Ich bitte Sie darum.«
»Nein — adieu.«
Die Dame ließ ihn nicht los. Sie hielt ihn fest und sah ihn im Scheine der Gaslaterne mit verführerischem Lächeln an.
»Wenn ich Sie nun aber recht herzlich bitte!«
Der junge Mann senkte die Augen zu Boden.
»Ich bin verheiratet,« brachte er dann schüchtern hervor.
Die Dame brach in ein helles Lachen aus.
»Hier in New-York?«
»In Philadelphia.«
Sie lachte noch lauter.
»O, was für ein Ausbund von Tugend sind Sie! Sie haben gewiß eine sehr strenge Frau.«
»Ja, das ist es eben.«
»Sie ist ja nicht hier.«
»Wenn sie es aber erfährt!«
»O, New-York ist groß. Wirklich, solch ein seltsamer Fall ist mir noch niemals passiert. Kommen Sie, bringen Sie mich nach Hause! Ihre gestrenge Ehegattin wird nichts erfahren.«
»Und ich kann dennoch nicht, so gern ich auch möchte,« seufzte er.
»Warum nicht?«
»Sie sehen mich für etwas anderes an, als ich bin. Ich bin nach hier gereist, weil ich in Philadelphia keine Beschäftigung finden konnte. Meine Geldmittel sind sehr knapp ...«
Die Dame sah ihn scharf an, lächelte dann aber wieder.
»Wissen Sie, Sie gefallen mir.«
»Sehr angenehm ...«
»Ich habe nicht nötig, Ihre Börse in Anspruch zu nehmen.«
Der junge Mann machte eine Bewegung.
»Haben Sie noch nie davon gehört, daß es Mädchen gibt, welche von denen, die sie lieben, kein Geld annehmen?«
»Nein.«
»So erfahren Sie es jetzt.«
Der junge Mann sträubte sich nur noch schwach, er ließ sich fortziehen, dann zog er den Arm seiner Begleiterin enger in den seinen und ging schneller — sein Widerstand war besiegt.
Sie öffnete die Tür eines recht stattlichen Hauses, das Gaslicht beleuchtete Marmortreppen, mit Teppichen belegt, diese Dame mußte also durch Feilbietung ihrer Reize einen ganz hübschen Verdienst haben.
Stephans ließ sich nicht mehr nötigen, er folgte rasch der Voraussteigenden, bis diese einen Korridor erreichte, von welchem aus viele Türen in Privaträume führten, die immer aus drei bis vier Zimmern bestehen mochten.
»Einen Augenblick,« sagte Stephans, als seine Begleiterin eine der Türen aufschloß. »Wohnen Sie allein?«
»Ganz allein.«
»In dieser Wohnung?«
»Sie besteht nur aus zwei Zimmern, einem Wohn- und Schlafzimmer. Es ist die kleinste Wohnung im ganzen Hause, in welchem Künstler und Künstlerinnen, Literaten und wohlhabende Junggesellen hausen.«
»Ich treffe keine Gesellschaft bei Ihnen?«
»Nein doch, Sie Furchtsamer, Sie werden bei mir so einsam wie Adam im Paradies sein.«
Sie schloß auf und trat ein. In diesem Augenblick flammte hinter ihr Licht auf; Stephans hatte eine brennende Wachskerze, in der Hand.
»Sie machen gar nicht den Eindruck eines verheirateten Mannes, viel eher den eines alten Junggesellen,« lachte die Dame; »die haben auch immer Lichter, Bindfaden, Pflaster, Medizinen und so weiter bei sich, um nie in Verlegenheit zu kommen.«
»Ich bin viel gereist, daher diese Angewohnheit. Soll ich das Licht wieder ausblasen?«
»Nein, nein, so war das nicht gemeint. Ganz gut, so kann ich schneller die Lampe finden. So —«
Sie hatte die Lampe angebrannt. Stephans sah sich in einem zierlich eingerichteten Schlafzimmer, zierlich von dem mit Spitzen besetzten, blauen Himmelbett bis zu den Fruchtschalen mit Obst, welche Tische und Kommoden schmückten und einen angenehmen Geruch im Zimmer verbreiteten.
Rosetta, wie sie sich genannt hatte, ließ ihren Begleiter nicht lange in diesem Zimmer Umschau halten.
»Das ist nichts für Ihre profanen Augen, Sie schüchterner, junger Mann,« sagte sie mit verheißendem Lächeln und schob ihn in das Wohnzimmer hinein, welches sehr elegant ausgestattet war. Dichte, schwere Vorhänge verdeckten die Fenster, der grüne Schirm der Lampe warf ein angenehmes Licht auf die kostbaren Samtmöbel. Alles machte den Eindruck der Neuheit, es schien fast, als ob alles soeben erst aus dem Möbelladen gekommen wäre, man meinte noch den Tapeziergeruch wahrzunehmen.
Stephans entdeckte in einer Falte der Fensterportiere ein Zettelchen, er besah es — die Angabe des Verkaufspreises.
»Ist der Zettel noch daran?« lachte Rosetta, seine Untersuchung bemerkend. »Ich habe sie mir heute erst gekauft. Doch nun machen Sie es sich bequem, als wären Sie zu Hause bei Ihrer gestrengen Gattin. Oder ist es Ihnen unangenehm, den Namen Ihrer Frau zu hören? Sie scheinen ja ein wahrer Ausbund von Tugend zu sein! Legen Sie ab, was Sie abzulegen haben. Genieren ist hier am unrechten Platze.«
Stephans hatte sich auf ein Sofa sinken lassen, während Rosetta die Mantille ablegte, die Handschuhe auszog und vor dem großen Spiegel ihr Haar ordnete. Dann nahm sie mit verführerischem Lächeln neben ihm Platz.
»Nun, wie gefalle ich Ihnen, mein Freund? Wenn Sie sich von mir ebenso angezogen fühlen, wie ich mich von Ihnen, so würden wir ein glückliches Paar abgeben.«
Sie ergriff seine Hände und blickte ihm in die Augen. Stephans mußte gestehen, daß seine neue Freundin jetzt noch besser aussah, als vorhin in Mantille und Hut.
»Zu einem guten Verhältnis ist Offenheit nötig,« entgegnete er, eine Hand freimachend, »und so muß ich Ihnen gestehen, daß ich vorhin nicht die Wahrheit gesagt habe.«
»Sie sind gar nicht verheiratet, nicht wahr?«
»Doch, ich bin's.«
»Aber Sie sind nicht das, als was Sie sich ausgaben.«
»Nein.«
»Sie sind kein armer Schlucker, der sich hier nur aufhält, um Arbeit zu suchen. O, ich wußte recht wohl, wen ich vor mir hatte. Nur Ihre Schüchternheit ersann alle diese Ausreden, damit Sie mir entgehen könnten. Jetzt ist es zu spät, Sie sind mein Gefangener, und Sie sollen es nicht bereuen.«
»Sie irren doch noch. Schüchternheit ist kein so großer Fehler, sie ist manchmal recht gut angewendet, aber Dummheit ist eine schädliche Schwäche, und Sie halten mich für etwas dumm.«
»O, mein Freund!«
»Gewiß, Sie tun es, aber ich bin's nicht, bin auch gar nicht so schüchtern, wie Sie glauben. Warum sagen Sie mir eigentlich nicht gleich offen und ehrlich, was Sie von mir wünschen, und gebrauchen solche Schliche?«
»Ich wünsche nichts, als Ihre Liebe.«
»Und dieses Papier.«
Stephans hatte das Pergament herausgezogen und hielt es der Dame hin.
Diese erblaßte. Selbst unter der Schminkeschicht war es zu sehen, sie wurde furchtbar verlegen.
»Was ist das?« brachte sie endlich hervor. »Ich weiß nicht, was Sie damit meinen.«
»Dann will ich's Ihnen sagen.«
Plötzlich hielt Stephans einen Revolver in der Hand und stand vor der bis zum Tode Erschrockenen. Jetzt war die Schüchternheit verschwunden, seine Augen sprühten Feuer, er drückte Rosetta fest auf das Sofa nieder.

Plötzlich hielt Stephans einen Revolver in der Hand und
»Keine Bewegung, keinen Laut!« herrschte er sie an.
»Keine Bewegung, keinen Laut!« herrschte er sie an. »Fürchten Sie nicht für Ihr Leben, ich bin kein Raubmörder und habe diesen Revolver hier nur, um mich gegen Ihre etwaigen Helfershelfer zu wehren. Ein Ruf von mir bringt zahlreiche Hilfe herbei, dies Haus ist bereits umstellt, Ihr Plan ist schon durchschaut, und nun gilt es nur noch, einen Vogel zu fangen. Dazu sollen Sie uns helfen. Wollen Sie? Ja oder nein.«
Die Überfallene war zu erschrocken, um Antwort geben zu können; sie zitterte.
Stephans änderte sein Benehmen, er setzte sich wieder, legte den Revolver vor sich auf den Tisch und hielt nur die Hand der Dame fest.
»Wollen Sie mir Antwort geben?«
»Wer sind Sie?« hauchte Rosetta.
»Kein Detektiv, wie Sie vielleicht meinen.«
Rosetta wollte sich erheben, doch Stephans drückte sie nieder.
»Meinen Sie deshalb nicht, ich hätte nicht das Recht, so aufzutreten,« fuhr er schnell fort, »ich könnte Sie sofort der Polizei übergeben.«
»Ich habe nichts verbrochen.«
»Doch, Sie sind eine Verbrecherin!«
»Sie lügen.«
»Sie sind die Helfershelferin von Verbrechern gewesen und sind es noch.«
»Beweise!«
»Sie sollten mir im Taumel der Leidenschaft dieses Pergament nehmen.«
»Ich kenne es gar nicht —«
»Und es Eduard Flexan bringen.«
Mit einem leisen Schrei sank Rosetta zurück, die Nennung dieses Namens hatte ihren Widerstand völlig gebrochen.
»Sie sehen, ich bin völlig in Ihre Pläne eingeweiht,« fuhr Stephans mit sanfter Stimme fort, »ich bitte Sie, mir offen Rede und Antwort zu stehen. Wollen Sie?«
»Ich will,« hauchte Rosetta, »ich weiß ja, ich bin doch verloren. Wer aber sind Sie, wenn kein Detektiv? Erst beantworten Sie mir diese eine Frage.«
»Ein Mann, welcher Eduard Flexan fangen, nicht aber Sie verderben will. Sagen Sie mir, wo sich Flexan befindet, seien Sie mir behilflich, ihn zu fangen, und Sie sind frei, sollen auch noch die Mittel bekommen, Ihre Freiheit zu behaupte«.«
»Leere Versprechungen, um mich gesprächig zu machen.«
»Nein, denn ich brauchte Ihnen keine Versprechungen zu machen, Sie würden einfach den Händen der Justiz ausgeliefert werden. Doch das will ich vermeiden. Sie sind ein Opfer von Eduard Flexan.«
Rosetta senkte den Kopf.
»Ja, sein letztes.«
»Sie haben keine Genossen mehr?«
»Nein.«
»Wer war der Kellner, welcher mich im Hotel Atlantik belauschte und mir berauschende Getränke vorsetzte?«
»Ich merke, Sie wissen alles.«
»Darum antworten Sie mir. Wer war das?«
»Er war nur von mir bestochen worden.«
»Sie wußten um das Pergament?«
»Ja.«
»Auch der Kellner?«
»Etwas, nicht alles.«
»Sie verkehren mit Flexan direkt?«
»Ja.«
»Und sollten ihm das mir geraubte Pergament bringen?«
»Ja.«
»Wann?«
»Sobald ich konnte, womöglich noch diese Nacht.«
»Erzählen Sie mir, wie der Plan ausgesonnen ist!«
»Flexan suchte mich hier auf und fand mich in großem Elend. Er erzählte mir von einem verloren gegangenen Pergament, welches ein großes Geheimnis enthielte. Besäße er dieses, so wäre er ein reicher Mann. Das Pergament war gefunden worden, der Finder war hier in New-York. Ich ging auf Flexans Pläne ein, er wollte dann seinen Reichtum mit mir teilen. Er brauchte mich, weil er sich nicht auf der Straße sehen lassen darf, man erkennt ihn sofort.«
»Ich weiß, weiter.«
»Zuerst galt es, Dick, den Finder, zu beobachten, denn er hatte das Pergament auf der Redaktion des ›New-York Herald‹ nicht abliefern wollen.«
»Woher wußte das Flexan?«
»Durch mich. Ich mußte mich auf seinen Befehl hin immer auf der Redaktion aufhalten, hörte Dicks Weigerung selbst, seinen Namen, seine Wohnung, und erfuhr auch sehr viel durch die Portiers. Dann bestach ich den Kellner, mit Dick Freundschaft zu schließen und ihn zu beobachten. Flexan stellte mir Geldmittel zur Verfügung, richtete mich auch hier ganz neu ein. Dann kamen Sie. Das übrige wissen Sie selbst — ich habe mich in Ihnen getäuscht. Nun aber, wer sind Sie?«
»Erfahren Sie zunächst, daß Flexan in unsere Falle gegangen ist. Der Verlust und Fund des Pergamentes war nur simuliert ...«
»Aber Sie haben es doch.«
»Ein ganz wertloses Papier. Wir wußten, wie gierig Flexan nach dem Besitze des Originals trachtet.«
»Sie haben triumphiert. Was nun?«
»Nun geben Sie Flexan auf und helfen mir.«
»Wie?«
»Sie zeigen uns Flexans Versteck.«
Rosetta schüttelte den Kopf.
»Gehe ich zugrunde, so soll man mir wenigstens nicht nachsagen, daß ich andere mitgerissen habe.«
»Sie scheinen noch die Gefühlvollste aus der ganzen Bande des Meisters zu sein. Unsinn, ich verrate Sie nicht, wenn Sie die meine sind.«
»Geben Sie mir Sicherheit!«
»Kennen Sie den Namen Nikolas Sharp?«
Rosetta sprang erschrocken auf, sank aber gleich wieder, wie gelähmt, zurück.
»Sie sind ...«
»Nein, der bin ich nicht, aber sein Bruder, Redakteur am ›New-York Herald‹. Sehen Sie, dem Besitzer des ersten Pergaments ist ungeheuer viel daran gelegen, ebenso wie auch anderen, Flexan dingfest zu machen, er hat schon große Summen daran gewendet. Jeder, der ihm dabei behilflich ist, erhält 10 000 Dollar bar, Dick hat sie schon weg, ich bekomme sie noch, und Sie, liebe Miß, erhalten dieselbe Summe, wenn Sie mir sagen, wo Flexan zu finden ist.«
Rosetta sah den jungen Mann lange an.
»Sprechen Sie die Wahrheit?«
»Die lautere Wahrheit. Sehe ich wie ein Lügner aus?«
»Nein.«
»Kommen Sie morgen nach dem ›New-York Herald‹, fragen Sie nach dem Redakteur Mister Lind — das ist mein Name — und Sie erhalten 10 000 Dollar von nur ausgezahlt; das Geld, daß Sie in ein anderes Land reisen können, empfangen Sie von mir extra. Hier meine Hand darauf.«
Rosetta nahm sie.
»Gut, ich will Ihnen das Versteck Flexans mitteilen.«
»Halt, wir können nicht ohne weiteres gehen, wir werden vielleicht beobachtet.«
»Nein, ich bin die letzte, die zu Flexan gehalten hat.«
»Er hat keinen anderen Helfer mehr?«
»Nein.«
»Trotzdem,« sagte Lind — unser alter Freund mit dem Spitznamen Youngpig — nach kurzem Ueberlegen, »Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wir tun, als wäre Ihr Plan geglückt. Hier haben Sie das Pergament, es ist völlig wertlos, Sie gehen, und ich bleibe. Wie hatten Sie es ausgemacht, mit Flexan zusammenzutreffen?«
»Ich sollte ihn einfach in seiner Wohnung, einem erbärmlichen Kellerloch, aufsuchen.«
»Gut, so gehen Sie jetzt! Ich bleibe noch einige Stunden hier und entferne mich dann ruhig, denn dann muß unser Unternehmen schon geglückt sein.«
»Wie das? Soll ich allein Flexan gefangen nehmen? Das kann ich nicht.«
»Nein, das wäre Ihren Kräften auch zuviel zugemutet. Gehen Sie sorglos nach Flexans Wohnung! Sofort, wenn Sie auf die Straße kommen, wird sich Ihnen ein Mann anschließen, der Sie dorthin begleitet und mit Ihnen eintritt.«
»Nur einer?«
»Flexan ist stark, und wenn er wütend wird, besitzt er die Kräfte eines Riesen. Merkt er, daß ich ihn verraten habe, so wird er in Tobsucht fallen.«
»Nun, und?«
»Ein Mann genügt nicht, ihn zu überwältigen.«
»Ihr Begleiter genügt vollkommen.«
»Wer ist es?«
»Mein Bruder, Nikolas Sharp.«
»Der Detektiv? Ah, er ist also auch mit dabei?«
»Ja, ich helfe ihm nur.«
»Gut, ich bin bereit zu gehen. Mister Lind, darf ich Ihnen wirklich vollkommenes Vertrauen schenken?«
»Unbedingtes. Noch eine Frage! Stehen Sie mit der Polizei auf gutem Fuße?«
»Nicht eben.«
»Haben Sie noch etwas auf dem Kerbholz?«
»Nein, nicht mehr.«
»Dann rechnen Sie auf mich, ich werde Ihnen behilflich sein, daß Sie von hier fortkommen, und wenn es Ihnen zusagt, ein neues Leben anfangen können.«
»Was bewegt Sie zu solcher Teilnahme?«
»Ich handle nicht nur nach eigenem Ermessen, sondern auch nach dem meines Bruders. Leicht ist es, Wunden zu schlagen, aber schwer, Wunden zu heilen. Die Justiz soll den Verbrecher nicht bestrafen, um seine Uebeltat zu rächen, sondern um ihn dadurch zu bessern. Doch dazu gibt es noch andere Mittel, als Kerker und Galgen. Auf Wiedersehen morgen, Rosetta!«
»Leben Sie wohl, ich werde Ihrer Worte gedenken,« entgegnete sie mit zitternder Stimme. »Sie geben einer Sklavin die Möglichkeit, sich von ihrem Peiniger zu befreien.«
Zehn Uhr morgens. Mister Youngpig saß auf hohem Schraubstuhl vor seinem Pult und schrieb. Das Privatkontor war mit Aktenregalen und Bücherschränken angefüllt, dazwischen Telephone und Telegraphenapparate, aber nur für den Verkehr mit den übrigen Angestellten des riesigen Hauses bestimmt. Wendete der Schreiber den Kopf, so blickte er durch ein Fenster in einen großen Saal, in welchem wohl hundert Leute hinter Schreibtischen saßen, schrieben, die zahlreichen Telephone bedienten und die eintretenden Reporter anhörten.
Hier wurden dem ›New-York Herald‹ die Tagesereignisse mitgeteilt, und Mister Youngpig, der sich jetzt allerdings Absalom Lind unterschrieb, war Redakteur dieser wichtigen Abteilung.
Ein Herr trat ein — Nikolas Sharp.
»Einen Augenblick Zeit, Herr Redakteur?«
Youngpig rutschte von seinem hohen Sitz herunter.
»Ob ich einen Augenblick Zeit habe! Mensch, ich sitze schon seit heute früh 6 Uhr hier und erwarte dich. Du siehst recht ernst aus.«
»Habe auch keinen Grund zum Lachen.«
»Hast du ihn?«
»Ich habe ihn.«
»Hattest du viel Arbeit mit ihm?«
»Fast gar keine.«
»Ach was? So ließ er sich gleich festnehmen?«
»Er rührte kein Glied dabei.«
»Das wundert mich. Wohin hast du ihn gebracht?«
»Deadstreet Nummer 24.«
»Wohin?«
»Ins Leichenhaus für Unbekannte. Eduard Flexan ist tot. Diesmal aber wirklich.«
»Erzähle, wie alles kam!«
Sharp setzte sich, zündete eine Zigarre an und erzählte.
»Ich bin mit deinem gestrigen Liebchen Rosetta sehr zufrieden gewesen, sie benahm sich wie eine gewiefte Detektivin. Anfangs ließ ich sie allein gehen, nachdem ich ihr ein Zeichen gegeben, daß ich derjenige war, der ihr folgen würde. Dann, als wir in ganz einsame Gassen kamen, machte ich mich an sie heran, tat wie ein verliebter Narr, und so gelang es uns, ein Gespräch zu führen, welches nicht aufgefallen wäre, auch wenn man uns beobachtet hätte. Sie nahm bald meinen Arm und sagte mir, wir hätten keine Beobachtung zu fürchten, sie wäre die letzte, über welche Flexan Macht hätte. Kein anderer stände noch unter dem Befehl des Meisters.«
»Das sagte sie mir auch.«
»Nun gut. Wir gingen kreuz und quer durch Straßen und Gassen, bis wir jenes Viertel erreichten, wo sich die größte Armut niedergelassen hat, welches zu betreten selbst einem Detektiven graut — dicht bei der Chinesenkolonie.
»Endlich hatten wir das halbzerfallene Hans erreicht, wo Flexan wohnen sollte. Eine stumpfsinnige Alte öffnete uns die Tür, Rosetta, welche wie eine Heilige behandelt wurde — weil sie wahrscheinlich mildtätig gewesen — stellte mich als einen Freund vor, und wir traten ein.
»Rosetta begab sich in den Keller hinunter, ich blieb ihr dicht auf den Fersen.
»›Hast du es?‹ krächzte uns eine Stimme entgegen.
»Im Scheine einer Stall-Laterne sah ich Flexan in seiner ganzen Scheußlichkeit, in Lumpen gehüllt, auf einem Strohbett liegen, häßlicher, als je. Aus seinen Augen sprach Irrsinn — es war der Blick des zu Tode gehetzten Wolfes.
»Er erblickte mich und — ich zweifle nicht daran — erkannte mich, wußte, warum ich kam.
»Mit dem Gebrüll eines Raubtieres sprang er nicht auf mich, sondern auf Rosetta los, ich riß das Mädchen zurück und wollte ihn auffangen, aber es war nicht mehr nötig.
»Plötzlich brach er zusammen, und nun kam eine Viertelstunde, ein Schauspiel, welches selbst meine Nerven angegriffen hat.«
Sharp war aufgestanden und ging schweratmend im Zimmer auf und ab.
»Wie? Selbst deine Drahtnerven konnten die Szene nicht ertragen?«
»Kaum. Es war zu furchtbar. Ich habe Leute im Delirium, Wahnsinnige, vom Gewissen Gefolterte, Tobsüchtige sterben sehen, aber Flexans Todesstunde spottet aller Beschreibung, deshalb erlasse sie mir. Doch, ja, einmal habe ich etwas Aehnliches gesehen — als ich eine Hyäne durch den Leib geschossen hatte. Ebenso wand sich Flexan in Zuckungen am Boden. Der Tod hat ihn mit seinen knöchernen Krallen noch in der letzten Stunde für seine Vergehen bestraft.
»Ich untersuchte seine wenigen Halbseligkeiten. Sie enthielten einige Papiere mit Ortsaufzeichnungen, ich vermute dort versteckte Schätze, denn von solchen schwatzte der Sterbende immer. Dann ließ ich ihn ins Leichenhaus schaffen. War Rosetta schon hier?«
»Nein.«
»Dann kommt sie noch. Sie ordnet ihre letzten Angelegenheiten. Ich werde ihr behilflich sein, fortzukommen. Das Mädchen hat bereut — —«
»Hast du Nachricht über die ›Vesta‹und den ›Amor‹?«
»Das sollte ich dich fragen.«
»Ich weiß nichts.«
»Ich auch nicht. Dagegen hat mir Hoffmann depeschiert — das heißt unter uns gesagt — daß er mit dem ›Blitz‹ auf dem Wege nach New-York ist.«
»Dann begleitet er die beiden Schiffe?«
»Jedenfalls, und das ist gut.«
Ein Telephon klingelte, es erschien daran eine Nummer.
»Eine private Mitteilung aus der Abteilung für Schiffsnachrichten,« sagte Youngpig und trat ans Telephon.
Sharp achtete erst nicht auf seinen Bruder, dann hörte er ein leises Stöhnen, und verwundert sah er nun, wie die Hand Youngpigs, welche das Hörstück hielt, heftig zitterte, wie sein Gesicht aschgrau war.
»Was gibt's, Youngpig?«
Dieser klingelte ab, trat vor Sharp hin und legte ihm schwer die Hand auf die Schulter.
»Bruder, eine furchtbare Nachricht!«
»So sprich sie schnell aus!«
»Soeben ist die ›Troja‹ in den Hafen eingelaufen,« sagte der Redakteur mit bebender Stimme, »und bringt die entsetzliche Nachricht mit, daß sie im Nebel ein Schiff in den Grund gerammt hat. Vierzehn Stunden hat sie die Unglücksstätte abgesucht, ohne etwas anderes zu finden, als ein Brett.«
»Allerdings schlimm, es wird ein stählernes Fahrzeug gewesen sein.«

»Und auf dem Brett stand ›Amor, Insel Wight‹.«
Der Detektiv prallte zurück.
»Was?«
»Es ist so — der ›Amor‹ ist untergegangen und mit ihm alle, alle Herren.«
»Die armen Mädchen — wenn sie es erfahren,« sagte Sharp dumpf und wandte sich um. Doch er hätte es nicht nötig gehabt, sein Bruder konnte die Tränen in seinen Augen vor den eigenen nicht sehen. — — — —
Vier Uhr nachmittags. Sharp hatte Rosetta zur Bahn gebracht und befand sich wieder auf seines Bruders Kontor.
Diese beiden Männer gaben sich nicht lange dem Schmerze über ein Unglück hin, das sie nicht mehr ändern konnten, sie sprachen nicht mehr über den ›Amor‹, sondern über Sharps gegenwärtige Absichten.
Eben führte dieser aus, daß er nun die Zeit für gekommen halte, einen Privatprozeß gegen die Verbrecherbande zu beginnen, welche vom Meister, von Eduard Flexan, geleitet worden war — die sechs Hauptmitglieder befanden sich in seinen Händen — als ein Reporter hereingestürzt kam.
»Die ›Vesta‹ kommt!« schrie er atemlos.
Elektrisiert sprangen beide empor.
»Sie ist vom Leuchtturm aus signalisiert.«
Ein nicht endenwollendes Klingeln rief Youngpig ans Telephon, der Chefredakteur begehrte ihn zu sprechen.
»Sofort an den Hafen — Dampfer nehmen — entgegenfahren — Sie selbst,« lautete der Auftrag.
Youngpig stand schon auf dem Sprunge.
»Ich komme mit,« rief Sharp.
»Die Dampfer sind schon alle vermietet und fort, es wurden ungeheure Preise gefordert,« ließ sich der Reporter vernehmen.
»Verdammt!«
»Nur einer ist noch da.«
»Schon vermietet?«
»Ja, durch mich auf eigene Faust für den ›New-York Herald‹.«
»Bravo. Wenn nun höhere Angebote erfolgen?«
»Geht nicht, der ›Herald‹ zahlt stets 100 Dollar mehr als der Höchstbietende.«
»Bravo — Sache gut gemacht!«
Die beiden Brüder stürmten hinaus. Unten fuhr eben ein schnelles Kab vorbei, und Sharp fiel dem Pferd in die Zügel, der Kutscher war starr vor Schrecken, auf offener Straße am hellen Tage überfallen zu werden.
»Nach dem Hafen!«
»Ich fahre eine Dame.«
»Sie ist damit einverstanden.«
Dem Kutscher flog ein Goldstück in den Schoß, er lenkte in eine andere Straße. Sharp sprang seinem Bruder in den Wagen nach, in welchem eine Dame saß. Sie hatte das Gespräch gehört.
»Meine Herren, das ist eine Unverschämtheit,« eiferte sie, »ich fahre zur Hochzeit meiner Tochter.«
»Und wir zu einem Sterbenden.«
»Die Hochzeit findet ohne mich nicht statt.«
»Und er kann ohne uns nicht selig werden — fort Kutscher.«
Die Dame mußte mitfahren, angehalten wurde nicht.
Der Hafen war noch lange nicht erreicht, als der Wagen schon halten mußte. In Hunderten von Reihen standen die Menschen auf dem Quai, um der Ankunft des Damenschiffes beizuwohnen.
»Ich kann nicht weiter,« rief der Kutscher.
»Aussteigen, ich breche Bahn,« sagte Sharp.
»Meine besten Glückwünsche zur Hochzeit Ihrer Tochter,« rief Youngpig in den Wagen zurück.
Wie ein Keil brach Sharp durch die Menge, Youngpig schob nach, doch ging es nur langsam vorwärts. Dann wurde ersterer erkannt, der Name Nick Sharp ging von Mund zu Mund, man wich zurück, so weit man konnte, und jetzt ging's schneller.
Endlich hatte man den kleinen Dampfer erreicht, welcher von Herren umdrängt war, darunter vielen Reportern, als stände ein Weltuntergang in Aussicht, und nur dieser Dampfer könnte der Vernichtung entgehen.
An der Laufbrücke stand der Kapitän und hörte mit unerschütterlicher Ruhe die Preise an, welche man ihm für die Fahrt bot.
»5000 Dollar,« rief eben ein Herr.
»5100,« entgegnete der Kapitän, »wer bietet mehr?«
»6000 Dollar.«
»6100,« versetzte der Kapitän, der eine Auktion zu veranstalten schien.
»Ihr werdet schließlich gar nichts bekommen.«
»Ich glaube doch — da sind sie schon.«
Die Brüder sprangen über die Laufbrücke, sie ging hoch, der Dampfer setzte ab.
»Spart keine Kohlen — hängt euch an die Ventile,« schrie Youngpig in den Heizraum hinab.
Die Schraube peitschte das Wasser, der Dampfer schoß der Flotille nach, welche der ›Vesta‹ entgegenfuhr.
Ganz New-York schien am Hafen versammelt zu sein, nichts als Köpfe, Zylinder, Mützen, Damen- und Herrenhüte, Sonnenschirme waren zu sehen.
Im Hafen lagen nur große, schwere Schiffe, alle übrigen waren vermietet, von kleinen Dampfern und Booten war keine Spur mehr.
Die Liberty, jene im Hafen stehende, riesengroße Statue mit Fackel, die Freiheit darstellend, hatte ein ganz anderes Aussehen bekommen, überall hockten Menschen auf ihr herum, das Fundament war mit Menschen übersät, ebenso die anderen, vor New-York befindlichen Inselchen, auf denen Gefängnisse und Krankenhäuser stehen.
Wurde hier Platzgeld verlangt, so hatten die Institute heute einen gesegneten Tag, und der Amerikaner läßt nie eine Gelegenheit vorüber, wenn er die Kasse füllen kann, gleichgültig ob es seine oder eine ihm nur anvertraute ist.
Der nachjagende Dampfer hatte die Boote bald überholt. Er befand sich zwischen den übrigen Fahrzeugen der Begrüßungsflotille, und nun mußte die Fahrt gemäßigt werden, wollte man nicht Unfälle heraufbeschwören. Kleinere Kollisionen waren schon vorgekommen, ein Dampfer hatte schon in völlig leckem Zustande eine Insel anlaufen müssen.
Dann machte sich auch noch das Meer bemerkbar, der Seegang reichte bis hierher, und die Fahrzeuge begannen zu schaukeln, weshalb eine noch größere Distanz eingehalten werden mußte.
Unser Dampfer befand sich noch nicht an der Spitze der Flotille, aber er suchte diese zu erreichen. Jetzt bog die Spitze um eine Insel, und: »die ›Vesta‹!« erklang es. Der Ruf fand Widerhall. Mit Blitzesschnelle pflanzte er sich fort, von Schiff zu Schiff, von Insel zu Insel, bis er selbst das Land erreichte und dort eine Bewegung, ein dumpfes Murmeln in der nach Hunderttausenden zählenden Menge hervorbrachte.
Ein Schiff nach dem andern kam um die Insel herum, und seine Mannschaft und Passagiere brachen bei dem Anblick der ›Vesta‹ in Jubelrufe und Begrüßungen aus.
»Was rufen die Kerls da vorn immer?« sagte Sharp zum Bruder.
»Ich höre nichts,« sagte der vor Ungeduld fast vergehende Reporter.
»Sie müssen sich über etwas wundern.«
»Einen Augenblick noch, gleich sind wir an der Inselspitze vorüber.«
Der Augenblick schien ihnen eine Ewigkeit, doch endlich bog der Dampfer ab, und vor ihnen lag, wie ein Schwan mit ausgebreiteten Flügeln, die ›Vesta‹ mit vollen Segeln. Am Heck flatterte das Sternenbanner, am Großmast die Flagge mit der vestalischen Priesterin, von der Gaffel flatterte eine Reihe Flaggen herab, ›Vesta New-York‹ ausdrückend.
Das Aussehen des Schiffes war tadellos, alles schneeweiß von der Wasserlinie des Rumpfes an bis hinauf zur Mastspitze, das kupferne Geländer blitzte in der Sonne, die Revolverkanonen warfen blendende Strahlen.
Nur eins paßte nicht zum Aussehen des sauberen Schiffes — das Sternenbanner. Es war zerrissen, die Farben verblichen, die Sterne kaum noch sichtbar. Die Vestalinnen hatten keine neue Flagge aufgezogen, unter dieser hier hatten sie Sturm, Wetter, Wogen und Gefahren getrotzt, diese Flagge gab Zeugnis davon, was sie durchgemacht hatten.
So, wie die Vestalinnen auf dieses Banner, so blickt auch das im Waffenschmuck strahlende Regiment stolz auf die zerfetzte Fahne.
Zum Einsegeln in den Hafen waren des Windes wegen öfters Manöver nötig. Die weißgekleideten Mädchen befanden sich teils auf den Raaen oder hantierten an Deck mit Tauen. Auch die Kommandobrücke war stark besetzt.
Sharp packte des Bruders Arm, der ein Fernglas hielt.
»22 Mädchen sollen es nur sein, und dort sind fast noch einmal so viel. Das ganze Deck steht ja voll.«
»Es sind Männer!«
Sharp riß ihm das Fernglas aus der Hand.
»Wahrhaftig, Männer — Absalom, weißt du, wer es ist — Lord Harrlington, Hastings, Chaushilm, Williams, sie sind es, die Engländer.«
»Zähle sie! Wer fehlt unter ihnen?«
»Keiner,« sagte Sharp nach einer Minute. »Selbst zwei schwarze Gesichter kann ich unterscheiden, das von Hannibal und Kasegorus.«
»Die ›Vesta‹ hat sie gerettet,« jubelte Youngpig.
»Oder das Schiff dort hinten, es ist der ›Blitz‹.«
Sharp deutete auf einen schwarzen Segler, der am Horizont auftauchte. Niemand beachtete ihn vorläufig, aller Augen waren auf die ›Vesta‹ gerichtet, und die Dampfer näherten sich ihr schnell.
Die ersten hatten sie schon fast erreicht. Man traf Anstalten, längsseit beizulegen und sich an Bord zu begeben, um die Damm zu beglückwünschen, als eine neue Wimpelreihe aufgezogen wurde.
»Wir nehmen niemanden an Bord,« lautete das Signal, Ellen lehnte sich über die Kommandobrücke und winkte dem ersten Dampfer mit der Hand ab.
Das war eine niederschlagende Antwort. Man mußte sich damit begnügen, zu rufen und Hüte und Tücher zu schwenken, welche Begrüßungen von der ›Vesta‹ erwidert wurden. Aber an Bord zu kommen, war nicht möglich, außerdem manövrierte die ›Vesta‹ jetzt wieder, und wollten die kleinen Fahrzeuge nicht übersegelt werden, so mußten sie eilends das Weite suchen, denn ein Segler kann keine Rücksicht nehmen.
Die ›Vesta‹ wendete; wie Spreu stoben die Dampfer auseinander, um nicht dem scharfen Bug zum Opfer zu fallen. Im Nu war offenes Fahrwasser geschaffen.
Die Damen arbeiteten mit einer Sicherheit, welche das Auge der ältesten Seeleute entzückte. Mit Zauberschnelle flogen die Raaen herum. Fast im Augenblick gehorchte das Schiff dem Ruder und nahm den neuen Kurs auf. Die Vestalinnen freuten sich, keinen günstigen Wind zu haben, so konnten sie doch ihre erlernte Seemannskunst zeigen.
Die Herren verhielten sich untätig an Deck. Man wußte jetzt, daß es die Engländer des untergegangenen ›Amor‹ waren, die Zurufe und Begrüßungen galten auch ihnen.
Da schoß ein Dampfer aus der Flotille auf die ›Vesta‹ zu, von vorn kommend; kaum entging er einem Zusammenstoß, doch mit sicherer Hand lenkte der grauhaarige Kapitän vorbei, so dicht, daß das schwankende Fahrzeug an dem mächtigen Rumpf zu zerschellen drohte.
Ellen schrie laut eine Warnung, dann war der Dampfer in Sicherheit, er jagte weiter. Da gellte zu Ellen, welche sich über die Bordwand bog, ein Hilferuf empor.— — — — — — — — — — — — —
Begeben wir uns auf die ›Vesta‹.
Die Mädchen sollten nicht lange ihrem Schmerz über den Untergang des ›Amor‹ und den wahrscheinlichen Tod der Besatzung nachhängen, der ›Blitz‹ kam an und brachte die Nachricht, die Engländer seien gerettet an Bord des ›Blitz‹.
Die Mannschaft hatte sich auf der ruhigen Wasserfläche halten können, bis der ›Blitz‹ sie mit Hilfe von elektrischem Licht gefunden. Hoffmann hatte von der ›Troja‹ selbst erfahren, daß diese ein Schiff gerammt hatte. Nur einer wurde vermißt, der Heizer Thomas, welcher zwar noch das Deck erreichte, sich aber schwer am Kopfe verletzt hatte. Doch dies wissen wir schon.
Dieses Wiedersehen war das glücklichste während der ganzen Reise. Nach kurzem Beraten stellten die Vestalinnen von selbst den Antrag, kurz vor New-York die Herren an Bord der ›Vesta‹ zu nehmen und mit ihnen in den Hafen einzusegeln, denn dorthin gehörten sie, nicht auf den ›Blitz‹. Sie hatten jetzt das Recht, neben den Damen auf demselben Schiff zu stehen, sie hatten es sich nach hartem Kampf erworben.
Der Vorschlag wurde natürlich mit Freuden angenommen. So kam es, daß die ›Vesta‹ mit doppelter Besatzung in den Hafen einfuhr. Der ›Blitz‹ hielt sich bescheiden zurück.
O, welche Gefühle bewegten die Herzen der Mädchen, als sie nach über drei Jahren in den Hafen von New-York wieder einliefen! — Sie lassen sich nicht beschreiben. Es war kein Stolz, nein, nur eine unermeßliche, nicht auszusprechende Freude, welche man höchstens in ihren Zügen, in ihren Augen lesen konnte.
Alle diese Tausende und Abertausende von Menschen, welche den Hafen umringten, jeden festen Standort besetzt hielten und sie mit Fahrzeugen umdrängten, führte ja nicht nur allein die Neugier her. Der Jubel, das Tücherschwenken galt den Mädchen ihrer Nation, welche das Sternenbanner über alle Meere und Länder getragen hatten. Mochte es noch so oft in den Staub gezerrt worden sein, die amerikanischen Mädchen hatten es immer wieder aufgerichtet und im Winde flattern lassen.
Hätte Ellen nicht das Verbot aufhissen lassen, sie wären schon hier aus dem Schiffe von Gratulierenden erdrückt worden.
Der kleine Dampfer, welcher so direkt auf die ›Vesta‹ zusteuerte, schien dem Verbot trotzen zu wollen. Die Situation war gefährlich.
»Steuerbord, mehr Steuerbord!« rief Ellen erschrocken dem grauhaarigen Kapitän zu, »wir rammen Euch!«
»Ay, ay,« lachte der alte Seemann, drehte das Ruder und ließ sein Schiffchen vorbeigleiten, aber so dicht, daß sich beide fast berührten.
»Warum fuhr er hier vorbei?« sagte Ellen zu der neben ihr stehenden Miß Thomson. »Es ist genug Fahrwasser offen.«
»Hilfe,« gellte es da herauf, »Hilfe, ich —«
Ein Gurgeln schnitt die weiteren Worte ab.
Entsetzt sahen die Damen und Herren, wie ein Mann mit den Wogen rang. Der Unglückliche konnte nicht schwimmen, der Kopf war schon unter Wasser, nur die Hände sahen noch heraus und griffen krampfhaft um sich.
Er mußte von dem kleinen Dampfer gestürzt sein. Dieser war schon zu weit ab, er konnte keine Hilfe mehr bringen.
»Ruder hart Backbord,« kommandierte Ellen; das Schiff gehorchte, sonst hätte man den Mann übersegelt.
Schnell schoß die ›Vesta‹ weiter, doch schon fiel ein Tau herab, gerade zwischen die Hände des Ertrinkenden. Er bekam es zu fassen, hielt es fest und wurde emporgezogen.

Ein Tau wurde von der Vesta dem Ertrinkenden zugeschleudert.
Er bekam es zu fassen und wurde daran emporgezogen.
Triefend stand ein junger Mann vor den Mädchen.
»Brrr, das war salzig. Habe nur so zum Vergnügen einige Liter Wasser geschluckt. Never mind.«
»Mister Youngpig!« erklang es überall in namenlosem Erstaunen.
»Meine Damen,« fuhr der Reporter mit feierlicher Miene fort, »ich habe die Ehre, Sie als erster im Namen des ›New-York Herald‹ im Heimatshafen zu begrüßen. Vergessen Sie niemals, betone ich, daß Sie den ersten Glückwunsch vom ›New-York Herald‹ empfingen. Ich hoffe zuversichtlich, daß Sie von jetzt ab nur diese Zeitung lesen und neben ihr kein anderes Blatt dulden werden; ein anderes ist auch vollkommen überflüssig. Der ›Herald‹ orientiert seine Leser stets über die politische Lage, er bringt die letzten politischen Ereignisse, alle Neuigkeiten, welche auf der Erde und in umliegenden Dörfern passiert sind; hat der Sultan eine neue Frau genommen, oder tut dem Kaiser von China ein Backzahn weh, Sie erfahren es am nächsten Tage. Spekulieren Sie? Well, der ›Herald‹ bringt die allerletzten Börsenberichte; die besten Schriftsteller der Jetztzeit sorgen für das Feuilleton, jeden Tag —«
»Hören Sie auf,« unterbrachen ihn die Mädchen, »oder wir werfen Sie wieder über Bord.«
»— bringt der ›Herald‹ einen schmackhaften Küchenzettel, er bringt lehrreiche Artikel, wie man Samt wäscht, Flecken entfernt, Modebeschreibungen, Hundedressur, Kindererziehung, Haarfärbemittel, die letzten Pferderennen, Mittel gegen Hühneraugen, die neuesten Frisuren, Biographien berühmter Frauen, Wetterprophezeiungen, Schönheitstinkturen usw. usw. usw. Ich hoffe also, daß von jetzt an die Herren und Damen jedem Blatte verächtlich den Rücken kehren und sich nur noch den ›New-York Herald‹ halten, der Ihnen bis in den entferntesten Winkel der Erde portofrei nachgeschickt wird. Dann ersuche ich die Damen, mich nicht wieder über Bord zu werfen, weil ich gerade etwas an Schnupfen leide, wenigstens nicht eher, als bis Sie mir mitgeteilt haben« — er zog ein in Gummi gewickeltes Notizbuch hervor — »auf welche Weise die Besatzung des am 18. dieses Monats vom Dampfer ›Troja‹ gerammten und untergegangenen ›Amor‹ vom ›Blitz‹ gerettet worden ist.«
»Neufelde, aussteigen!« wandte sich der Schaffner ganz besonders an einen Mann, welcher im Coupé zweiter Klasse saß.
»Das hier soll Neufelde sein? Nicht möglich!« entgegnete erstaunt eine Baßstimme.
»Zeigen Sie Ihr Billett. Ja, bis Neufelde. Wollten Sie weiter?«
»Nein, aber das ist doch nicht Neufelde!«
»Steigen Sie aus, steigen Sie aus!« drängte der Schaffner. »Der Zug setzt sich schon wieder in Bewegung. Hier ist Ihr Schirm.«
Er schob den Mann aus dem Coupé, ein Pfiff, und der Zug brauste davon.
Als wäre er ein Kind, das auf der Reise die Eltern verloren, so stand der vollbärtige, hünenhafte Mann mit dem braunen Gesicht auf dem von vielen Lichtern erhellten Perron und schaute verwundert um sich. Die ausgestiegenen Passagiere stießen ihn, Kofferträger schoben ihn zur Seite, und ein Postkarren fuhr ihm fast über die Füße, aber noch immer stand der Mann da und schaute sich in der großen Bahnhalle um.
Dann schüttelte er den grauhaarigen Kopf.
»Nein, da bin ich einen falschen Kurs gesegelt,« murmelte er. »Wenn das Neufelde ist, dann will ich noch heute nacht selig werden.«
Der Bahnvorsteher hatte den einsamen Mann beobachtet, die letzten Worte vernommen und trat jetzt auf ihn zu.
»Wohin wollen Sie?«
»Nach Neufelde.«
»Dies ist der Bahnhof von Neufelde.«
»Sie wollen mich wohl foppen?«
»Dies ist Neufelde,« lächelte der joviale Beamte, der mit beschränkten Leuten oftmals ähnliche Szenen erlebte.
»Giebt es denn zwei Neufelde?«
»Nein, dies wird schon das richtige sein. Warum glauben Sie, daß Sie an einem falschen Orte sind?«
»Weil Neufelde ganz anders getakelt ist.«
»Sie sind Seemann?«
»Ja.«
»Kennen Sie Neufelde von früher?«
»Es ist mein Heimatsort.«
»Seit wann haben Sie ihn nicht wiedergesehen?«
»Nun, so ein Stücker 25 Jahre mögen wohl darüber vergangen sein.«
»Ja, dann läßt sich das wohl erklären,« lachte der Stationsvorsteher. »Damals war Neufelde noch ein Dorf.«
»Freilich, ein richtiges Kuhdorf.«
»Nun aber ist es eine ganz beträchtliche Stadt.«
»Donnerwetter, wie ist denn das so schnell gekommen? Habe auch manche Städte fix aus dem Boden aufschießen sehen, aber doch nicht in Deutschland.«
»Das macht das Wasser.«
Der Beamte wurde abgerufen.
»Das Wasser, das Wasser?« murmelte der Seemann. »Da werde ein anderer klug daraus.«
Er wandte sich dem Ausgange zu, ohne sein Gepäck zu fordern, und als er den freien Platz betrat, schimmerten ihm zahllose Lichter entgegen — die Gasflammen einer ansehnlichen Stadt.
Der Mann stützte sich auf seinen Regenschirm — Seeleute tragen merkwürdigerweise an Land meist Regenschirme, um zu erklären, warum, müßte man eine ganze Geschichte schreiben — und blickte auf das Getriebe der vom Abenddunkel bedeckten Stadt.
»Gott bewahre mich, das soll Neufelde sein! Und das Wasser hat diese Veränderung bewirkt? Mir unbegreiflich. Was für Wasser? Regenwasser? Salzwasser? Oder vielleicht gebranntes Wasser, welches man auch Schnaps nennt? Früher ein Dorf, dessen Hütten und Häuser man von hier oben aus zählen konnte, und jetzt eine Stadt, und was für eine Stadt! Diese Häuser sind ja die reinen Paläste, die alten Hütten scheinen gar nicht mehr vorhanden zu sein. Dort, wo das mächtige Gebäude steht, lag die Mühle, der Fluß fließt noch, aber seine Ufer sind gemauert, eine schöne Brücke führt darüber. Dort, wo der große Eichbaum ist, war früher ein Teich, jetzt ein Platz mit Anlagen, und dort hinten, dort hinten, wohin ich nicht mehr sehen kann, ja, dort, dort — ach!«
Seufzend fuhr der Mann mit der schwieligen Hand über die Augen, Tränen rollten über die gebräunten Wangen.
Er wurde bald aus seinen Träumen geweckt.
»Droschke gefällig, mein Herr — Gepäck zu tragen — Fremdenführer — Hotelwagen?«
Der Mann sah auf, er war von Schreiern umringt, die ihn für einen Fremden hielten. Und er war ja auch jetzt ein solcher, obgleich er in seiner Heimat weilte.
»Hotelwagen?«
»Hier, hier — Hotel zur goldenen Sonne — Hotel zum weißen Hirsch — Hotel zu den vier Jahreszeiten,« erscholl es durcheinander.
»Wo ist der Wagen für das Hotel zur blauen Nase?«
Keine Antwort, überall grinsende Gesichter.
»Nun, wer fährt zur blauen Nase?«
»Der ist noch aus dem vorigen Jahrhundert,« murmelte ein alter Kerl in Dienstmannskleidung und trat vor.
»Ich bringe Sie in die blaue Nase.«
»Wo ist Euer Wagen?«
»Ich habe keinen, ich bin Dienstmann.«
»Wollt Ihr mich in die blaue Nase bringen?«
»Ja, ich kenne sie. Wo ist Ihr Gepäck?«
»Das bleibt liegen.«
»Ich will es holen.«
»Brauche es nicht.«
»Geben Sie mir etwas zu verdienen.«
»Dann tragt meinen Regenschirm. So. Und Ihr kennt die blaue Nase?«
»Natürlich, ich führe Sie; folgen Sie mir nur!«
Die beiden marschierten ab, die Zurückbleibenden sahen ihnen spöttisch nach.
»Reingefallen; Hotel zur blauen Nase gibt es gar nicht. Wäre übrigens ein guter Name für eine Destillation.«
Der Fremde schritt langsam durch die hellerleuchteten Straßen. Er bewunderte nicht die prächtigen Schaufenster, nicht die palastähnlichen Villen, dagegen konnte er manchmal lange sinnend vor irgend einem unansehnlichen Häuschen stehen, welches bald einzufallen schien.
Dann wendete er sich stets an seinen Begleiter mit einer Frage:
»Wohnt hier der Bäckermeister Fritsch?«
»Nein, der ist schon lange tot. Das Haus wird nächstens abgerissen werden.«
Oder:
»Hier war früher eine Schmiede.«
»Ja, jetzt ist's die Niederlage eines Kaufmanns. Wird auch bald abgebrochen werden.«
Der Fremde seufzte und schritt weiter. Der Führer wurde gesprächiger.
»Sie sind hier geboren?«
»Nein,« war die kurze Antwort des Mannes, der jetzt anders sprach als vorhin.
»Sie sind aber einmal hier gewesen?«
»Ja.«
»Das ist gewiß schon lange her?«
»Ja.«
»Wie lange wohl?«
»Ich weiß nicht.«
Der Fremde schritt träumend weiter. Der Dienstmann fragte nicht mehr, musterte den Fremden aber oft verstohlen von der Seite.
Dann hielt er vor einem prächtigen, glänzend erleuchteten Hause, vor dem Türhüter standen.
»Das ist das Hotel zur blauen Nase.«
Der Fremde blickte verwundert auf und fuhr dann den Begleiter ärgerlich an.
»Ihr wollt mich wohl aufziehen? Da steht ja groß: ›Hotel zum deutschen Reich‹. Das Gasthaus zur blauen Nase war nur ein erbärmliches Häuschen, das immer einzufallen drohte. Mir ist einmal die ganze Stubendecke auf den Kopf gefallen, als sie oben tanzten.«
»Darum ist es auch weggerissen worden. An diesem Platze, wo jetzt das Hotel steht, stand einst das Gasthaus zur blauen Nase. 18 Jahre ist das nun her.«
Der Fremde besah das Haus, die erleuchteten, mit Gardinen geschmückten Fenster, die großen Laternen, die Portiers und Kellner, die ein- und ausgehenden Gäste, die vor dem Tore haltenden Equipagen, dann blickte er um sich, er musterte den Platz mit den Springbrunnen und Anlagen, die umliegenden Häuser und lüftete dann die Schiffermütze.
»Das Gasthaus zur blauen Nase, es stimmt,« sagte er mit einem Anfluge von Feierlichkeit. »Kommt, Maat, wir wollen prüfen, ob wenigstens das Bier dasselbe geblieben ist, oder ob es unter der Dekoration gelitten hat.«
Der Packträger zögerte, der Fremde wollte ihn in die Restauration ziehen.
»Das ist nichts für uns.«
»Nichts für uns?« herrschte ihn der Fremde förmlich an. »Bei Gottes Tod, den möchte ich sehen, der mir hier den Eintritt verweigern will, weil ich keine Handschuhe trage.«
Sie traten ein.
Die dem Eingange Zunächstsitzenden blickten auf, als die beiden den eleganten Salon betraten und an einem Marmortische Platz nahmen. Sie paßten auch wirklich schlecht unter die geputzten Herren und Damen, der Seemann in seinem einfachen, blauen Anzuge, der Dienstmann in seiner abgeschabten Uniform.
Die Kellner zischelten. Keiner wollte das Paar bedienen, aber man durfte ihnen den Aufenthalt nicht verwehren, so lange sie sich anständig benahmen.
Der Seemann rief einen Kellner und bestellte zwei Glas Bier. Der Kellner hielt nicht für nötig, erst zu fragen, was für eine Sorte. Während er es holte, musterte der Seemann den Saal, die Marmortische, die Gesellschaft, die Bilder an den Wänden und das mit Delikatessen besetzte Büffet.
Wieder seufzte er tief auf, schüttelte dann lächelnd den Kopf und griff nach dem vollen Glase.
»Prost, Freund. Wir wollen sehen, ob dieses Bier noch so gut ist, wie seinerzeit in der blauen Nase. Hm,« er wischte sich den Mund, »es war damals süffiger.«
»Kannten Sie das Gasthaus zur blauen Nase?« fragte bescheiden der Packträger, der sich hier unbehaglich fühlte.
»Hoho, und ob ich es kannte. Ich war nahe daran, mir in ihm eine blaue Nase zu holen, und auf seinem Tanzboden habe ich manches Paar Sohlen abgetanzt.«
»Ja, damals waren schöne Zeiten.«
»Wie lange seid Ihr hier?«
»Ich bin hier geboren.«
»Wie heißt Ihr?«
»Gustav Eichert. Ich war früher Fährmann, seitdem die Brücken gebaut sind, ist es damit natürlich aus. Jetzt bin ich ein erbärmlicher Packträger.«
Ueber das verwitterte Gesicht des Seemanns zuckte es wie Freudenschimmer, doch er beherrschte sich.
»Dann könnt Ihr mir auch erzählen, wie das gekommen ist, daß Neufelde so schnell groß geworden ist.«
»Das Wasser ...«
»Potz Tausend, was ist das nur für ein Wasser, das diese Eigenschaft besitzt?«
»Neufelde ist ein Kurort.«
»Was für ein Ort?«
»Ein Badeort.«
»In anderen Städten badet man sich auch.«
»Aber das Wasser hier besitzt eine heilkräftige Wirkung, man badet sich darin und trinkt es.«
»So.«
»Vor etwa zwanzig Jahren fand man, daß die Brunnen von Neufelde sehr eisenhaltig sind und auch noch anderes Zeug enthalten, Magnesium und, Gott weiß, wie das alles heißt. Gleich kamen von allen Seiten Kranke herbeigeeilt, Dicke, Magere, Bleichsüchtige Schiefe, Krumme, Lahme, Bucklige und so weiter, um das Wasser zu trinken.«
»Und davon gesund zu werden,« lachte der Seemann.
»Ja, weil das Wasser Eisen und Magnesium enthält.«
»Hopfen und Malz sind mir lieber darin.«
Der Seemann trank aus und bestellte neues Bier. Sein anfangs düsteres, schwermütiges Gesicht hatte sich aufgeheitert.
»Die Kranken müssen ordentlich bezahlen,« fuhr der Packträger fort, »daher wurden die hiesigen Einwohner wohlhabend; es entstanden Hotels, Villen, Kurhäuser und so weiter, aus dem Dorfe wurde eine Stadt, die mit Blitzesschnelle wuchs.«
»Ich kenne das, in den Goldminen kann man noch etwas anderes erleben. Aber mein Neufelde — nein.«
»Sie waren ehedem hier gut bekannt?«
»O ja — stehen denn gar keine alten Häuser mehr?«
»Einige doch. Sie erkannten diese ja selbst.«
»Und die Bewohner?«
»Sie sind gestorben, ihre Kinder sind jetzt reich, sie kennen unsereins nicht mehr. Ich bin der letzte vom alten Schlag.«

»Steht die alte Kirche noch?«
»Die ist abgebrannt, jetzt ist dort ein Tanzsalon. Aber neue Kirchen ...«
»Das ist mir gleichgültig. Und die Schule?«
»Das ist jetzt ein mächtiges Ding geworden.«
»Ging man daran vorüber, die Landstraße weiter, so kam man an einigen Häusern vorbei.«
»Ja, die Landstraße ist erhalten geblieben, sie liegt noch außerhalb der Stadt, und auch die Häuser stehen noch dort.«
»Sie stehen noch dort?« rief der Seemann und fuhr fast vom Stuhle auf.
»Natürlich sind es neue, schöne, nicht mehr die Meiereien. Jetzt sind es feine Villen, hinten daran Gärten.«
»Ach so,« murmelte der Seemann und sank zurück, »Wie hieß doch gleich der Besitzer des ersten Hofes?«
»Schröder.«
»Und der zweite?«
»Bergmann.«
»Und was für eine Haus kam dann?«
Es klang eine so große Spannung aus den Fragen des Seemanns, er hatte sich über den Tisch gebeugt, seine Augen hingen am Munde des Packträgers. Diesem fiel das Benehmen seines Gegenübers nicht auf, er beschäftigte sich mit der ihm geschenkten Zigarre.
»Und was für ein Haus kam dann?«
»Dann hörten die Häuser auf. Das ist ein vortreffliches Kraut, wo haben Sie die gekauft?«
»In Havanna. Doch, dann kam noch ein Haus.«
»Daß ich nicht wüßte.«
»Besinnt Euch, es war ein ganz kleines.«
»Ach so, richtig. Einige hundert Schritte weiter, da, wo der Teich war und noch jetzt ist, stand eine Hütte.«
»Ja, ja,« hauchte der Seemann.
»Es war ein ganz elendes Ding.«
»Ja. Wer wohnte darin?«
Jetzt wurde der Mann aufmerksam, er fixierte den neugierigen Frager.
»Der Schäfer des Dorfes, Thomas Vollmer,« entgegnete er dann, »er stand in keinem besonderen Rufe und braute Salben und Mixturen. Man wich ihm immer aus, aber nachts wurde er doch viel besucht. Er sollte alle möglichen Krankheiten heilen, die Zukunft wahrsagen, Hexen vertreiben und so weiter können, wenn aber eine Kuh schlechte Milch gab, so war er auch wieder daran schuld. Der arme Mann hat viel an Verfolgungen zu leiden gehabt.«
Der Sprecher blickte nachdenklich den Rauchwölkchen seiner Zigarre nach.
»Besaß er nicht eine Tochter?« fragte nach langer Pause der Seemann mit gedrückter Stimme.
»Die Susanne? Das war ein bildschönes Mädchen, mit goldenen Zöpfen, die ihr fast bis auf die Erde hingen. Das arme Kind! Sie besaß kaum die notdürftigste Kleidung, nicht einmal Strümpfe und Schuhe, denn der Vater war geizig. Deshalb ging sie nie zur Kirche, sie schämte sich, aber die Leute verschrieen sie darum als ein Hexe. Alltags und Sonntags hütete sie am Teiche neben ihrer Hütte die Dorfgänse. Sie wurde gemieden von jedermann, obgleich sich mancher junge Bursche gern mit dem goldhaarigen Mädchen eingelassen hätte. Doch die Weiber des Dorfes machten es unmöglich. Susanne wurde in den Bann getan, nicht weil sie eine Hexe, weil sie arm, sondern weil sie schöner als alle übrigen Mädchen war. Dies konnte die Eifersucht nicht ertragen.«
Der Seemann seufzte tief auf.
»Nur einer machte eine Ausnahme,« fuhr der Erzähler fort, »das war ein hiesiger, junger Bursche, der zur See fuhr.«
»Wie hieß der?«
»Karl Hübner. Ein großer, baumstarker Kerl, wild wie der Teufel, dann wieder sanft wie ein Kind. Der vernarrte sich in die Susanne, allem Geschrei zum Trotz. Eine Zeitlang hielten die beiden ihre Liebschaft geheim, bis Hübner offen damit herauskam. Hier, im Gasthaus zur blauen Nase war es, wo Hübner die Susanne als seine Braut erklärte. Erst rissen die Burschen die Mäuler auf, dann, angestachelt von ihren Mädchen, wurden spöttische Worte laut, aber diese verstummten gar schnell, denn Hübner — ich sehe ihn noch vor mir — zog seinen Rock aus, stellte sich mitten in den Saal und forderte jeden auf, dem seine Verlobung nicht passe oder sie lächerlich finde, zu ihm zu kommen. Gleich darauf flog der Sohn des protzigen Schulzen mit einem kräftigen Schwunge durchs Fenster, und seitdem hatten die beiden Ruhe.«
Der Packträger stärkte sich mit einem Schluck und sah dabei den Seemann eigentümlich an.
»Wenn Sie 25 Jahre jünger wären, ich glaube, Sie müßten Karl Hübner, so wie ich ihn damals kannte, sehr ähnlich sehen. Sie haben ganz genau dieselbe Figur, dieselben Augen, denselben Mund.«
Der Seemann wich dem Blicke aus und schüttelte abwehrend den Kopf.
»Ich kenne ihn nicht.«
»Nun ja, Hübner war auch etwas schlanker, als Sie, sein Gesicht war voller und freundlicher.«
»Heirateten sich beide?«
»Nein. Hübner ging zur See, um seine letzte Reise zu machen. Während seiner Abwesenheit wurde hier die Heilkraft des Wassers entdeckt, Kranke kamen, darunter auch ein steinreicher, alter Herr, der zur Gesellschaft seinen Sohn mitbrachte. Dieser sah Susanne und war sofort bis über die Ohren in sie verliebt. Der alte Herr starb hier, der junge heiratete Susanne.«
»Obgleich sie mit Hübner verlobt war?«
»Denken Sie nicht schlecht von dem Mädchen. Es ist ihr hart zugesetzt worden. Ihr geiziger Vater hat sie bis aufs Blut gepeinigt, endlich, bis zum Tode erschöpft, gab sie nach — sie heiratete den Herrn.«
»Und Hübner?«
»Der kam bald nach der Hochzeit, als sich beide jungen Eheleute gerade hier befanden. Er schritt stumm vorüber mit dem Gesicht eines Toten, Susanne wurde ohnmächtig nach Hause getragen, nur durch ein Wunder blieb sie dem Leben erhalten. Doch besser war's, sie wäre gleich gestorben.«
»Warum?« fragte der Seemann schweratmend. Er hatte die Hand aufs Herz gelegt und die Lippen fest aufeinandergepreßt.
»Ihr Mann war ein Spieler, ein Trinker, und das schlimmste für Susanne, ein brutaler Geselle. Nach fünf Jahren war's alle, er hängte sich. Für Susanne blieb kein roter Pfennig übrig, sie wurde aus dem verschuldeten Hause gejagt und soll dann bald darauf, wie ich erfahren habe, im Armenhospital einer fernen Stadt gestorben sein. Die arme Susanne!«
Eine lange, lange Pause trat ein, der Seemann saß da, die erloschene Zigarre zwischen den Fingern, und blickte starr ins Weite.
»Steht die Hütte noch?« fragte er dann leise.
»Wie sollte sie? Die würde sich komisch zwischen den eleganten Häusern ausnehmen. Sie müssen wissen, die frühere Chaussee ist eine Straße geworden, mit Häusern an beiden Seiten, und zieht sich weit, weit hinaus. Es ist das feinste Viertel von Neufelde, nur reiche Leute haben dort ihre Sommerwohnungen.«
»So ist ein anderes Haus dort gebaut worden?«
»Ja, es ist erst seit kurzem fertig. Den bis vor einem halben Jahre leerstehenden Bauplatz wollte niemand kaufen, und daran war der kleine Teich schuld, der nicht trocken gelegt werden konnte. Die Quelle brach immer wieder durch. Da Sie hier bekannt sind, wissen Sie ja auch, wie dort die Verhältnisse sind. Alles knorrige Bäume mit beindicken Wurzeln, starkes Unterholz, Schilf und so weiter, kurz und gut, ehe man dort einen Garten schaffen könnte, wäre eine Heidenarbeit nötig, der Teich ist im Wege, und da hier jeder unbedingt einen hübschen Garten haben will, so blieb der Bauplatz liegen.«
»Und wie ist das jetzt?«
»Ja, das ist eine eigentümliche Sache. Vor einem halben Jahre begann man mit dem Bau eines Hauses, es wurde wunderschön, eine Villa, wie es hier keine zweite gibt. Wie man dann erfuhr, war der Entwurf dazu auf ein Preisausschreiben eingegangen, und der Baumeister ist wohl aus der Schweiz extra dazu herübergekommen. Jetzt ist die Villa fertig, sie wird sogar schon bewohnt, aber von einem Garten ist keine Spur zu sehen. Alles ist noch ganz genau so geblieben, wie es früher war; der mit den Linsen bedeckte Teich, darum das Schilf, das Stückchen Wald, das Unterholz, das Heidekraut, alles, alles ist stehen gelassen worden, kein Ast durfte abgeschnitten werden, und noch jetzt betritt kein Gärtner dieses Stückchen Land. Es ist eine vollkommene Wildnis.«
Des Seemanns Augen leuchteten auf, das eben Gehörte schien ihm zu gefallen.
»Wer wohnt darin?«
»Eine ganze Familie. Dabei ist übrigens auch etwas Merkwürdiges.«
»Wieso?«
»Vor kaum vierzehn Tagen kamen sie an, ohne jede Einrichtung, sie kauften alles erst hier ganz neu. Nun müßte man doch glauben, das wären reiche, vornehme Leute, aber dem Aussehen nach sind sie's nicht. Ein alter Mann mit harten Arbeitshänden, ein junger Mann, ganz braun gebrannt, dann zwei alte Weiber und einige Kinder, die gar keinen feinen Eindruck machen. Die beste davon scheint noch die Frau des jungen Mannes zu sein, ein sehr schönes Weib, das nächstens ins Kindbett kommen wird. Ich glaube, die jungen Leute sind gar keine Deutschen, sie sprechen eine andere Sprache, wenigstens manchmal.«
»Was für eine?«
»Ja, Herr, das kann ich wirklich nicht verraten. Nur so viel habe ich wegbekommen, daß sie statt nein manchmal no sagen.«
»Dann sprechen sie Englisch oder Italienisch. Wie sehen sie aus?«
»Sehr braun.«
»Auch die Dame?«
»Ja.«
»So sind es Italiener.«
Nach einer Pause begann der vertraulicher gewordene Dienstmann das Gespräch wieder:
»Sie wollen hier Kurbäder benutzen?«
»Ich? Unsinn!«
»Nur einmal sich die alten Plätze besehen? Nicht?«
»Ja, hm. Kennt Ihr hier eine Witwe Müller?«
»Wohnt sie hier, oder ist sie nur ein Kurgast?«
»Weiß ich nicht.«
»Es gibt hier sehr viele Müllers. Wenn Sie mir irgend einen Anhalt geben, so kann ich ja Nachforschungen anstellen.«
»Ist nicht nötig, morgen werde ich es auf dem Gericht erfahren.«
»Auf dem Gericht?«
»Ja; diese Müller ist eine Tante von mir und hat mich zum Erben eingesetzt. Sonst wäre ich wohl nicht wieder nach Neufelde gekommen.«
»Aha, eine reiche Tante!«
»Nun, sie hat mir ein ganz nettes Sümmchen vermacht.«
Der Seemann bezahlte, sein Gegenüber sah einen von Gold strotzenden Beutel. Dieser Mann war also wohlhabend, und nun machte er auch noch eine reiche Erbschaft!
»Wie heißt die Straße jetzt, wo früher die Hütte stand?« fragte der Seemann.
»Sie hat einen ganz vertrackten Namen bekommen, ich glaube, es ist Französisch.«
»Wie denn?«
»Er klingt ungefähr wie — wie — Affenvieh.«
»Affenvieh,« lachte der Fremde, »das ist ja seltsam. Ach so, wohl Avenue?«
»Richtig — Avenue.«
»Ihr könnt mir den Weg nach dort zeigen, ich finde mich in dem Straßengewirr doch nicht mehr zurecht. Es hat sich alles zu sehr verändert, und zu fragen liebe ich nicht.«
Die beiden verließen das Lokal. Nach Passieren einiger Straßen bemerkte der Packträger, daß der Seemann keinen Regenschirm bei sich hatte.
»Sie haben Ihren Regenschirm stehen lassen,« rief er erschrocken.
»So, habe ich ihn? Dann ist es ungefähr der zehnte bis zwölfte, den ich stehen gelassen, seitdem ich am Lande bin.«
»Ich will ihn holen.«
»Unsinn, die Kellner wollen auch eine Freude haben.«
»Aber der schöne Schirm!«
»Ich kaufe mir einfach einen anderen, die Läden sind ja noch offen.«
Der Seemann wurde wieder schweigsam, er versank in tiefes Nachdenken.
»Hier ist die Avenue,« sagte der Dienstmann.
Eine mit Bäumen bepflanzte Häuserstraße zog sich vor ihnen entlang.
»Ach, das sind noch die alten Bäume!«
»Sie sind stehen geblieben. Soll ich Sie nach der Villa führen?«
»Nein, ich finde die Hütte — das Haus jetzt allein.«
»Es ist Nummer —«
»Schon gut. Hier Euren Lohn! Gute Nacht, Gustav Eichert.«
Der Seemann ging mit gesenktem Kopfe weiter, der andere sah ihm lange nach.
»Und ich kann doch schwören, daß es Karl Hübner ist,« murmelte er, ehe er den Rückweg antrat. »Der Mann hat in der Welt sein Glück gemacht — und doch, er ist zu bedauern. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken.«
Der Schiffer schritt weiter, er beachtete nicht die Häuser links und rechts, er sah nicht auf die von den Gaslaternen beschienenen Nummern, er wußte sein Ziel, auch ohne sie zu beachten.
Bald stand er vor einem zierlichen, in schweizerischem Stile erbauten, wunderschönen Häuschen! In der Mitte die Haustür, rechts ein Gittertor, durch welches man die Bäume stehen sehen konnte, welche den ganzen hinteren Teil des Platzes bedeckten. Die übrigen Häuser besaßen wohlgepflegte Gärten, hier schien alles wild zu sein.
Die Vorhänge vor den Fenstern waren zugezogen. Kein Licht, kein Laut verriet die Anwesenheit von Bewohnern, nur die Bäume rauschten.
Mit gekreuzten Armen und trüben Augen stand der Seemann vor der Villa.
»Die Hütte ist verschwunden, Susanne ist tot. Auf Erden geht alles zugrunde, aber aus dem Schutt, aus den sterblichen Resten, soll es in Herrlichkeit wieder auferstehen. ›Behalte mich in gutem Andenken, bis wir uns wiedersehen!‹ So schriebst du mir vor zwanzig Jahren von deinem Sterbebett. Ach, wann endlich wird diese Zeit kommen? Bald? Möchte sie kommen! Dann, Susanne, dann werden wir uns wiedersehen, und du weißt es, ich bin dir treu geblieben, wir werden uns dort vereinigen, wo es keine Trennung mehr gibt.«
Er sah sich um. Alles war still, kein Passant, kein Wächter kam vorüber. Die Leute waren in der Stadt.
Schnell trat er an das Gittertor, es war hoch, und die Stäbe waren spitz, doch ein Seemann ist ein Turner von Profession. Wie ein in dergleichen Dingen gewandter Schulbube schwang sich der alte Mann in die Höhe und stand im Nu drüben.
Leise durchschritt er das Unterholz, welches hier ganz wild wuchs, er erreichte die Bäume.
Jetzt entdeckte er, daß die Bewohner des Hauses doch noch munter waren; an der Hinterfront war im Parterre ein Zimmer erleuchtet, die Fenster standen offen.
Doch der Seemann kümmerte sich nicht darum, es war ihm auch gleichgültig, wenn man ihn als Eindringling fände. Seine Gedanken beschäftigten sich nur mit diesem grünen Platze, jeder Baum, jeder Busch erweckte Erinnerungen.
Ein mit Blattlinsen bedeckter Teich lag vor ihm; dichtes Schilf umrahmte ihn, an einer Seite stand ein Entenhäuschen — gerade so hatte alles vor fünfundzwanzig Jahren ausgesehen.
Es war eine wunderschöne Sommernacht, Am Himmel funkelte Stern an Stern, die Luft war warm und still. Nur die Blätter rauschten leise. Ab und zu quakte ein Frosch.
In der Villa wurden jetzt auf einem Klavier harmonische Akkorde angeschlagen.
Der große, starke, alte Mann lag in dem Schilfe, das Gesicht in beide Hände gelegt, und weinte und schluchzte wie ein Kind.
Gerade solch eine Nacht wie diese war es gewesen, im Sommer vor fünfundzwanzig Jahren, da war er mit Susanne zum ersten Male nicht zufällig zusammengekommen, eben hier am Teiche, sie hatte ihm ein Stelldichein erlaubt, da hatte er sie zum ersten Male in seine Arme geschlossen und ihr ins Ohr geflüstert, wie sehr er sie liebe, da hatten sie sich zum ersten Male geküßt, da hatte das arme, barfüßige Mädchen den armen Matrosen zum reichsten Menschen auf Gottes Erde gemacht, da —
»Aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit
Klingt ein Lied mir immerdar;
O wie liegt so weit, o wie liegt so weit,
Was mein, was mein einst war!«
drang eine jugendliche, süße Frauenstimme aus dem Hause ans Ohr des im Schilfe Liegenden.
Neue Tränen entstürzten seinen Augen. Wie gut paßte das Lied für ihn!
»Was mein, was mein einst war,« jammerte er leise.
Die Frauenstimme sang weiter, das wunderschöne, Rückertsche Lied mit der herzergreifenden Melodie.
»Was die Schwalbe sang, was die Schwalbe sang.«
Der Weinende hob den Kopf. Himmel, diese Stimme! Sie sang Deutsch, ein reines Deutsch, aber mit einem fremdländischen Akzent. Woher kannte er diese Stimme? Es sind ja Italiener — nein, sie sind es nicht. Diese Stimme!
Wie ein Magnet zog ihn das erleuchtete Fenster an, vorsichtig schlich er sich näher, und hell erklang es:
»O du Heimatflur, o du Heimatflur,
Laß zu deinem heil'gen Raum
Mich noch einmal nur, mich noch einmal nur
Entflieh'n im Traum!«
Der Seemann war in der Heimat, er träumte auch, aber von etwas anderem. Er war auf dem Meere, auf dem Schiffe und hörte diese Stimme von der Kommandobrücke herab ihm Befehle zurufen.
Unter dem Fenster stand eine Bank, wenn er hinaufstieg, konnte er ins Zimmer sehen — eine geheime Gewalt trieb ihn, es zu tun, und wenn es ihn das Leben kostete.
»Als ich Abschied nahm, als ich Abschied nahm,
War die Welt mir voll zu sehr;
Als ich wiederkam, als ich wiederkam,
War alles leer.«
Ein paar blaue, scharfe Augen blickten starr ins Zimmer, aber noch niemand bemerkte den Eindringling. An dem großen Tische saß ein junger Mann mit dunkelbraunem Gesicht und setzte eben das Modell eines Segelschiffes zusammen, hier und da noch etwas schnitzend oder knüpfend. Einige Kinder blickten freudestrahlend auf das Kunstwerk, das unter seiner Hand entstand, während ein alter Mann mit andächtig gefalteten Händen auf den jungen Künstler sah. Daneben saßen zwei alte Frauen, von denen die eine, mit prächtigem, schneeweißem Haar, die Hände vor das Gesicht hielt und weinte.
Am Klavier saß eine junge, schöne Frau, sang und spielte, hörte aber jetzt auf den Zuruf des jüngeren Mannes plötzlich auf.
»Singe nicht weiter, ich bitte dich!« sagte er, einen Blick auf die weinende Frau werfend. »Das Lied greift sie zu sehr an. Mach' wieder gut, was du angerichtet hast!«
Die junge Frau sprang auf und eilte zu der Alten, sie mit einem Arme umschlingend.
»O, das wollte ich nicht,« rief sie bedauernd. »Warum bist du so traurig? Du hast doch allen Grund, gerade jetzt fröhlich zu sein.«
Der Eindringling sah jetzt die Sängerin. Bei ihrem Anblicke hatte es in den Augen des jungen Mannes wunderbar aufgeblitzt, aber er beachtete sie jetzt nicht mehr, seine Blicke hingen vielmehr wie gebannt an der alten Frau mit den weißen Haaren.
»Er wird kommen, sicherlich,« fuhr die junge Frau fort.
»Natürlich kommt er, das ist doch so klar wie Kloßbrühe,« sagte der Mann. »Morgen früh gehe ich gleich wieder aufs Gericht und frage nach ihm. Herrgott, das soll aber ein Fest geben!«
»Zu morgen haben sich ja auch Freiherr von Schwarzburg, mein einstiger Nebenbuhler, und Eugenie angemeldet. Kinder, dann wollen wir einmal alle Minen springen lassen; das Schiffchen soll hinten auf dem Ententeiche seine erste Reise machen und auf den Namen ›Hoffnung‹ getauft werden. Mutterchen, besieh's dir doch einmal.«
Die weinende Frau entfernte die Hände von den Augen, es war ein runzliges, aber noch immer hübsches Gesicht, das einst sehr schön gewesen sein mußte.
»Ob wohl Karl ...«
Sie kam nicht weiter, alles sprang erschrocken auf.
Durch das Fenster war eine Gestalt hereingesprungen, lag vor den Füßen der Alten und hielt sie umschlungen.

Durch das Fenster war eine Gestalt gesprungen, lag
vor den Füßen der Alten und hielt sie umschlungen.
»Susanne!«
»Karl!«
Das war ein Wiedersehen nach fünfundzwanzig Jahren, aber nicht im Himmel, sondern noch auf Erden!
Die Ruhe war wiederhergestellt, der erste Schrecken hatte sich gelegt. Der Bootsmann achtete nur wenig auf die ihn Umdrängenden, auf Hannes Vogel, seinen Kapitän, auf Hope, auf die neugierigen Geschwister, er hielt die einstige Geliebte im Arm und tat, als träfe er sie noch als junges, schönes Mädchen. Er hatte keine Ohren für Fragen, er hörte nur auf Susanne, die ihre Leidensgeschichte erzählte, und die übrigen schwiegen bald.
Susanne war nicht gestorben, sie hatte sich wieder erholt, und nun begann für sie ein mühseliges Dasein, welches völlig freudenlos gewesen wäre, wenn sie nicht auf den einstigen Geliebten gewartet hätte. Auch diese Hoffnung schwand, Karls Schiff ging in der spanischen See unter, er blieb seitdem verschollen, war tot.
Sie schleppte sich mit ihrer Hände Arbeit durch ein Leben voller Dornen. Keine Rose stand mehr an ihrem Wege, doch ein gefühlvolles Herz, und noch dazu ein Frauenherz, kann auch auf dem undankbarsten Boden Rosen ziehen, an denen es sich ergötzt. Mitleid und Liebe sind die Gärtner, Unglück und Schmerz der harte Boden, Dankbarkeit und Gegenliebe die entspringenden Rosen. Der Händedruck eines Sterbenden, das Lächeln eines bleichen Kinderantlitzes, ein nur einmaliges Augenaufblitzen belohnt gute Taten manchmal mehr als stummes, totes Geld.
Vor einem halben Jahre war eine Aenderung in den Verhältnissen Susannes eingetreten.
Man suchte sie, sie stellte sich der Behörde, wurde freundlich aufgenommen und vorläufig aufs beste verpflegt. Das war auf Hannes' Anordnung geschehen, welcher nach Auffindung des alten Briefes von Karl auf den Gedanken gekommen war, nach Susannes Verbleib zu forschen.
Sie war nicht gestorben, sie lebte.
Dann holten Hannes und Hope sie ab und bezogen das unterdes gebaute Haus.
Karl begrüßte die Geschwister und Eltern von Hannes. Sein Gesicht strahlte vor Freude, doch lange dauerte diese Begrüßung nicht, dann saß er wieder neben Susanne.
»Teufelskerl,« sagte Hannes, »hast du uns einen Schrecken eingejagt! Weißt du, daß du mir einen Spaß verdorben?«
»Das täte mir sehr leid.«
»Ja. Daß du dich hier auf dem Gericht wegen der Erbschaft von 20 000 Talern melden solltest, war nämlich nur ein Schwindelchen von mir. Ich hatte die Herren auf dem Gericht vorbereitet, dich zu empfangen. Man sollte dich nach deinen Legitimationspapieren fragen, und da die bei dir natürlich niemals, in Ordnung sind, dich einsperren. Ich hätte dich spucken und schnauben sehen mögen. Ich wäre sofort benachrichtigt worden, mit Susanne oder mit der verwitweten Frau Müller hingeeilt, und dann hätte dich deine einstige Geliebte aus dem Kerker befreit.«
»Das wäre herrlich gewesen!« rief Hope entzückt.
»So ist es aber auch ganz hübsch, Kapitän,« schmunzelte der Bootsmann.
»Ach was, ich bin jetzt kein Kapitän mehr, viel eher Passagier.«
Karl lachte.
»Du verstehst mich nicht?«
»Nein.«
»Dein Passagier bin ich.«
»Wie denn?«
»Nun: Hope, meine Eltern, Geschwister und ich sind hier nur Mieter, dieses Haus gehört dir.«
Karl glaubte falsch verstanden zu haben, Susanne dagegen lächelte glücklich.
»Ihr spaßt wohl nur?«
»Durchaus nicht, dies Haus gehört dir, oder, wenn du das lieber hörst, Susanne. Doch das bleibt sich wohl gleich. Wollt ihr euch eigentlich heiraten oder nur zusammen leben?«
Jetzt begriff Karl endlich. Er war glücklich, fand aber keinen Ausdruck für seine Dankbarkeit. Er begnügte sich, die Hand von Hannes zu schütteln.
»Na, mit dem Heiraten — das weiß ich noch nicht,« stammelte er verlegen und blickte Susanne an, welche errötete und lächelnd den Kopf schüttelte.
»Aber, aber,« Karl kratzte sich in den Haaren, »aber das geht doch nicht.«
»Was geht nicht?«
»Das mit dem Hause.«
»Es geht alles, Karl. Hier hat Susannens Hütte gestanden, hier hast du sie wiedergefunden, hier sollt ihr beiden Leutchen bis an euer seliges Ende leben bleiben — damit basta, kein Wort des Dankes mehr! Wir sind Kurgäste, und da erlaubt ihr wohl, daß ich so lange mit meiner Familie hier wohnen bleibe. Im Herbst ziehen wir wieder wie die Schwalben fort und suchen uns ein warmes Nest für den Winter.«
Der Bootsmann konnte nicht widersprechen; in seiner dankbaren Verlegenheit brachte er andere Fragen hervor.
»Kurgast seid Ihr, Kapitän? Um Gottes willen, dann trinkt Ihr wohl auch gar das Wasser mit dem Eisen und dem anderen Dings da?«
»Freilich trinken wir es,« lachte Hope.
»Reines, pures Wasser?« wandte sich Karl erstaunt an Hannes.
»Ach, geht weg!«
»Ja, ja; reines, pures Wasser mit Magnesium und Eisen. Natürlich mische ich zur Hälfte Rum hinein.«
»Und ich Rotwein,« fügte Hope hinzu.
»Bekommt uns großartig.«
Alle lachten, auch Karl und Susanne, und damit war der Bann gebrochen.
Natürlicherweise kam das Gespräch bald auf die Besatzungen der ›Vesta‹ und des ›Amor‹. Karl wußte noch gar nicht, daß der ›Amor‹ untergegangen war, er erfuhr erst jetzt der Engländer Rettung durch den ›Blitz‹, die Ankunft der ›Vesta‹ in New-York und alles andere.
Hope brachte Briefe herbei, die vor einigen Tagen erst aus New-York angekommen waren.
»Und was wird denn nun weiter?«
»Jetzt verkaufen die Damen ihren ganzen Kram in Amerika und fahren mit den Herren nach England,« erklärte Hannes.
»Und dann?«
»Und dann? Komische Frage. Heiraten tun sie sich dann natürlich.«
»Hm, aber ...«
»Was aber?«
»Da müssen einige Damen zwei Männer bekommen.«
»Ach so! Ja, Karl, da hast du recht. Es sind nur 22 Mädels — nein, 21 nur, denn Miß Chalmers geht nicht mit — und 26 Herren. Nun, sehr einfach, die 5 übrigbleibenden Herren werden wohl als Brautführer dienen und dann die Brautjungfern heiraten.«
»Einige werden in England schon sehnsüchtig erwartet,« meinte Hope, »also nur keine Angst ihretwegen.«
»Nun noch andere Mitteilungen, Karl, die dich interessieren werden,« fuhr Hannes fort. »In nächster Zeit wird in einer Holzkiste mit Luftlöchern der kleine Kasegorus hier ankommen. Ich habe Williams gebeten, ihn mir zum Andenken zu schenken, hier seine telegraphische Antwort.«
Er zog ein Telegramm aus der Tasche und las:
»Kasegorus geht heute als Muster ohne Wert von hier ab.
Ihr gehorsamer Diener Williams.«
»Noch eine andere Neuigkeit, Karl,« nahm jetzt Hope das Wort, »ich habe Euch doch von dem Andachtsklub der jungen Damen erzählt, von denen sich jene — jene Abenteurer immer Nachrichten über unser Wohlbefinden holten!«
»Ja, ich entsinne mich sehr gut der frommen Mädchen,« lachte Karl, »ihre Präsidentin hieß Emmy. Habe manchmal darüber gelacht, wenn Ihr davon erzähltet.«
»Die sind jetzt vollständig übergeschnappt,« sagte Hannes.
»Nicht vorgreifen,« rief Hope. »Ja, die haben jetzt einen anderen Klub gegründet, das Beten wurde ihnen zu langweilig. Sie nennen ihren neuen Klub ›Emanzipation‹, kleiden sich wie Herren, tragen Beinkleider, Vorhemdchen, Stöcke, fahren, turnen, fechten, reiten wie Herren, spielen Fußball, Billard und rauchen auf der Straße. Emmy schrieb mir, ihr Ruhm würde bald den der Vestalinnen noch übertreffen, jetzt sind sie dabei, ein weibliches Regiment zu bilden, weibliche Soldaten wären noch bewunderungswürdiger als weibliche Seeleute.«
»Seemädchen,« sagte Hannes.
»Meinetwegen Seejungfern. Was denkt Ihr dazu, Karl?«
»Hm — gar nichts.«
»Ich will sagen, was Karl denkt,« meinte Hannes. »Er denkt: ein Narr macht viele Narren, oder 25 verrückte Mädchen können 25 000 andere verrückt machen.«
»Aber, Hannes, das ist eine Beleidigung!« rief Hope.
»Kann ich denn etwas dafür, wenn Karl das denkt?«
»Ich habe so etwas gar nicht gedacht,« verteidigte sich dieser.«
»Das tut mir leid, daß du es nicht gedacht hast, hättest es aber leicht denken können. Na, Hope, sei einmal offen. Ganz richtig waret ihr vor drei Jahren doch nicht im Oberstübchen, und so viel steht fest, Heiraten ist für überspannte Mädchen die beste Medizin.«
Alle lachten, auch Hope stimmte herzlich mit ein.
»Wir sind wenigstens konsequent geblieben,« sagte dann letztere, »die Vestalinnen sind von jeher emanzipiert gewesen, jene frommen Mädchen dagegen — na, darüber braucht man nichts mehr zu sagen.«
»Konsequent? Ich möchte nur wissen, inwiefern. Eigentlich müßten die Vestalinnen samt und sonders zu Tode geprügelt werden, denn so lauten die Gesetze der ›Vesta‹.«
»Die ›Vesta‹ hat aufgehört zu existieren, somit erlöschen auch die Gesetze.«
»Was machen sie denn mit der Vesta?« fragte Karl.
»Ah so, das hatten wir vergessen, Euch zu erzählen. Die ›Vesta‹ ist bereits für eine enorme Summe an einen pfiffigen Yankee verkauft worden. Der Spekulant zeigt das Schiff erst als Sehenswürdigkeit, dann läßt er aus dem Holz Reliquien anfertigen, nach denen in Amerika eine wahre Jagd veranstaltet wird. Die amerikanischen Dandys machen schon jetzt Bestellungen auf Boote, Stühle, Schränke ...«
»Federhalter, Schnupftabaksdosen, Lineale und so weiter,« fuhr Hannes fort, »ja, sogar Hosenknöpfe werden aus den Planken der ›Vesta‹ gefertigt. Das Geld übergeben die Damen einem Institut für Schiffbrüchige.«
»Wie ist es denn nun eigentlich mit der Wette zwischen den Herren und Damen geworden?«
»Darüber hört man nichts, daran wird wohl nicht mehr gedacht. Eigentlich haben die Damen gewonnen, denn die Engländer haben die ›Vesta‹ in der Tat dreißig Tage lang nicht gesehen — als sie in Südamerika waren — doch die Herren sind in Wirklichkeit Sieger geblieben.«
»Wieso denn?« fragte Hope unschuldig.
»Weil die Engländer die Mädchen geheiratet haben. Nun sind sie ihre Herren.«
»Im Gegenteil, durch die Heirat sind die Damen Siegerinnen geblieben. Sie sind die Herrinnen.«
»Nanu, das ist eine starke Behauptung! Im Namen der ganzen männlichen Bevölkerung der Erde verlange ich Beweise.«
»Die sollst du haben, und zwar unwiderlegbare.« »Karl, steh mir bei, meine Frau zu widerlegen!«
»Der Schein trügt, wenn man glaubt, der Mann sei der Herr der Erde,« begann Hope, »nicht der Mann, das Weib ist es.«
»Redensarten!«
»Laß mich aussprechen! Die Gründer unserer christlichen Religion wußten dies schon sie versuchten die Herrschaft des Weibes zu unterdrücken, indem sie sagten: er soll dein Herr sein. Allein vergebens, es ist ihnen nicht gelungen, das Weib herrscht noch und wird stets herrschen, so lange es nicht durch sklavische Behandlung zum Tier herabsinkt. Doch diese Zeiten sind vorüber. Der Mann hat die Herrschaft nur scheinbar, das Weib in Wirklichkeit in Händen.«
»Aber Beweise.«
»Nur einen! Wenn ich zu dir sage: Hannes, ich befehle dir, gib mir das Buch dort! Was würdest du antworten?«
»Hol's dir selber.«
»Gut. Wenn ich nun sage: Hannes, wir wollen heute abend noch abreisen. Was dann?«
»Ich würde Gründe fordern und erwägen.«
»Schön. Wenn ich aber sage: Mein lieber, guter Hannes, wir wollen heute abend abreisen, frage nicht warum, ich bitte dich aber sehr darum. Würdest du es mir abschlagen?«
Hannes schwieg.
»Hm, ich würde dir allerdings nachgeben,« sagte er dann, »aber bedenke, daß es in anderen Ehen anders zugeht. Es gibt Männer, welche nicht auf die Bitten ihrer Frauen hören, und wenn sie ihnen zu Füßen liegen.«
»O, dann gibt es noch tausend andere diplomatische Mittel, um sie zum Nachgeben zu zwingen. Den einen fängt man durch Schmollen, den anderen durch Tränen dem dritten brennt man das Essen an und so weiter. Ich spreche natürlich nur von klugen Frauen; eine Frau welche durch herrisches Auftreten die Oberhand gewinnen will, ist töricht, sie wird zuletzt doch stets unterliegen. Demut, Gehorsam und List sind die Waffen, mit denen wir kämpfen und siegen werden, und die List — ich spreche nicht von Hinterlist — des Weibes steht unerreichbar da, sie übertrifft die Klugheit des Mannes. Das Weib ist übrigens von der Natur aus bestimmt, zu herrschen, nicht der Mann, und ohne das Weib würde die Welt aufhören zu existieren. So sagen die größten Männer aller Zeiten und Länder, Inder, Chinesen, Araber bis herauf zu uns, begeisterte Dichter singen es, nüchterne, scharfsinnige Philosophen beweisen es. Ein hervorragender deutscher Dichter sagt: ›Die Gunst des Weibes ist die Achse, um welche sich das Weltenrad dreht. Um ihretwillen hat sich die Natur mit ihren leuchtenden Farben geschmückt, um ihretwillen ertönt die Stimme aller Lebendigen in holden Harmonien, und um ihretwillen ist der Riesenkampf entbrannt, der erst erlöschen wird, wenn die Welt zur Ruhe des Eises erstarrt.‹ Dasselbe beweisen Darwin und Häckel, zwei weltberühmte Gelehrte.
»Du selbst kannst dich davon überzeugen. Nimm die Weltgeschichte zur Hand und blättere darin, du wirst finden, daß nicht Männer, sondern Weiber regiert haben. Wo es nicht deutlich ausgedrückt ist, ist es zwischen den Zeilen zu lesen, von der ältesten Geschichte an bis herauf zu den französischen Maitressen, welche Könige am Gängelbande führen, Kriege anzetteln, Gesetze geben.«
»Aber heute ist dies nicht mehr so.«
»Doch. Denke an die französische Kaiserin Eugenie, nannte sie nicht den letzten Krieg ihren kleinen Krieg? Sie wußte, warum sie das offen sagen durfte. Ich verstehe nicht viel von Politik, aber ich bin fest überzeugt, daß die ganze Politik nicht in den Händen von ehrwürdigen Staatsmännern, sondern in denen ihrer klugen Frauen liegt. Ich denke mir das ungefähr so, um nur ein Beispiel anzuführen: Es soll ein neues Gesetz in Vorschlag gebracht werden. ›Das sage ich dir gleich,‹ sagt die Frau zu dem Minister, dessen weisen Worten man immer mit Bewunderung lauscht, ›das neue Gesetz darf nicht durchkommen, denn dann ist die Karriere unseres Sohnes futsch.‹ ›Das neue Gesetz ist aber gut für Volk und Staat.‹ ›Ach was, Volk und Staat, du wirst doch nicht ein Rabenvater sein wollen — erst kommen deine Kinder, dann die übrigen.‹ Das Gesetz fällt durch. Oder der Herr Professor X. soll seiner Verdienste wegen zum Regierungsrat ernannt werden. ›Was?‹ ruft die Frau Minister, ›Professor X.? Das geht nicht, die Frau Professor ist schon so stolz, wie soll es erst werden, wenn sie Regierungsrätin ist?‹ ›Liebe Frau, der Professor hat es verdient, seine Frau kommt dabei nicht in Betracht.‹ ›So, da will ich dir etwas anderes erzählen. Neulich war auf dem Markte nur ein einziges Bund Spargel aufzutreiben, ich stürzte darauf zu, aber Frau Professor X. kam mir zuvor. Frau Professor, rief ich, überlassen Sie mir den Spargel, ich bitte Sie inständigst, mein Mann ißt den Spargel für sein Leben gern. Weißt du, was das Weib mir darauf erwiderte? Mein Mann ißt ihn aber noch lieber.‹ Der edle Gemahl zieht die Stirn kraus und geht — Professor X. erhält nur einen Orden. Und so geht es weiter. Die kommenden Jahrhunderte werden aufdecken, daß unsere heutige Geschichte auch nur von Weibern gelenkt wurde, daß Weiber über Krieg und Frieden entschieden haben. Nun, Hannes, gibst du zu, daß wir Weiber die eigentlichen Herren sind?«
Hannes schüttelte den Kopf und lachte.
»Ich kann mich noch nicht ergeben.«
»Gut, noch einen Beweis. Sieh da unseren alten Bootsmann Karl. Den habe ich nur immer als so einen richtigen Eisenfresser kennen gelernt, als einen Mann, dem es nie zu toll werden konnte. Und nun sitzt er neben seiner Susanne wie ein Turteltäubchen und läßt sich in den Haaren kraulen. Das Weib hat ihn besiegt. Erkennst du nun unsere Herrschaft über euch Männer an?«
»Nein, ich ergebe mich nicht,« lachte Hannes, »aber ich will unterhandeln. Wir wollen uns in die Herrschaft teilen, Hope, wir wollen gleiche Rechte besitzen, wir wollen uns gegenseitig unterstützen, einer auf des anderen Rat hören, kurz, Hand in Hand gehen.«
»So ist es recht,« rief Hope erfreut, »so sollten alle sprechen, dann wäre die Frauenfrage gelöst. Nun noch ein Wort über die Vestalinnen! Ihr Männer sucht uns Weiber durch die Behauptung zu unterdrücken, daß wir euch in jeder Hinsicht nachstehen, an Kraft und Geist, wir besäßen nicht die Fähigkeiten wie ihr, ihr nennt uns das schwache Geschlecht. Oho, ich kenne Frauen, die mit ihren Männern Fangball spielen können; geh nur in den Zirkus, da kannst du Athletinnen sehen, Akrobatinnen und so weiter. Und gibt es nicht etwa Frauen, welche in Wissenschaft und Kunst, in Gelehrsamkeit, in Musik, Malerei, Skulptur, Poesie den Männern den Rang streitig machen? Daß sie nicht so häufig sind, kommt einfach daher, weil das weibliche Geschlecht noch keine Gelegenheit hat, sich vollständig zu entwickeln, und deswegen werden die kommenden Jahrhunderte über die Blindheit der jetzigen Männer lachen. Die Frauen müssen sich durch Emanzipation selbst aus dieser Knechtschaft befreien, sie müssen zeigen, daß sie dasselbe leisten können wie die Männer, und deswegen begrüße ich jedes Weib, welches aus dem Hintergrunde hervortritt und sich der Menge zeigt, gleichgültig, ob es auf dem Seile tanzt, Zentnergewichte hebt, sich auf dem Klavier produziert oder neue chemische Formeln berechnet. Es sind Vorkämpferinnen unseres Geschlechtes, und wir Vestalinnen haben uns ihnen angeschlossen, wir haben gezeigt, daß wir ebenso befähigt sind, ein Schiff übers Meer zu lenken, wie die Männer, und deshalb sind wir nicht in einen Topf zusammenzuwerfen mit jenen albernen Mädchen, welche, nur um die Blicke auf sich zu ziehen, den Männern das Benehmen nachäffen. Das sind unsere größten Feindinnen, sie helfen uns nicht, die Freiheit zu erreichen, sie hindern uns daran, denn sie machen uns lächerlich. Das war alles, was ich zu sagen hatte.«
»Dann sich mal nach, daß die Abendsuppe nicht anbrennt.«
Hope verschloß den Mund des Spötters mit einem Kuß.

Das Abendbrot stand auf dein Tische. Hannes ließ den Pfropfen einer Champagnerflasche zur Decke springen und füllte die spitzen Gläser mit dem schäumenden Wein. Er stand auf und erhob das seine.
»Wollte ich heute abend auf das Wohl jedes einzelnen, dessen wir zu gedenken haben, ein Glas trinken, so würde ich bald unterm Tische liegen, und da dies bei einem Ehemanne nicht mehr vorkommen darf — höchstens wenn die Frau einmal verreist ist — so fasse ich meine Trinksprüche bei dem ersten Glase kurz zusammen. So wollen wir denn anstoßen auf das Wohl der Besatzungen der ›Vesta‹ und des ›Amor‹, mögen sie England gesund erreichen und dort das gesuchte Glück finden! Wir wollen auf das Wohlergehen unseres Freundes Karl und seiner Susanne anstoßen, die sich nach langer Trennung vereint haben, auf das meiner Eltern und Geschwister, und, Hope, auf unser eigenes. Ich gedenke aller derer in Dankbarkeit, die uns auf der Weltreise in Liebe begegnet sind, ob sie weiß oder schwarz, gelb oder braun waren, ich gedenke auch ganz besonders zweier Toten — der Missis Congrave, der ich meine jetzige Stellung verdanke, und des edlen John Davids. Nie soll meine dankbare Erinnerung an sie schwinden. Und schließlich wollen wir anstoßen auf das Wohl aller Menschen, welche ein Herz, keinen Stein, in der Brust tragen, mögen sie Christen oder Juden, Mohammedaner oder Buddhisten, Sonnen- oder Feueranbeter heißen. Prosit!«
»Prosit!« schallte es nach.
»Vorsichtig anstoßen,« warnte Karl, »wir Seeleute sind abergläubisch.«
»Wir Seemädchen nicht,« entgegnete Hope und stieß kräftig an — doch es zerbrach kein Glas.
Die Damen und Herren standen am Hafen von New-York vor der Poststation, in welcher das überseeische Telegraphenkabel endet. Alle waren reisefertig. Der große Passagierdampfer mit flatternden Wimpeln lag unter Dampf. Noch eine Stunde, dann ertönte das erste Signal, und sie wurden an Bord gebracht, zur Reise nach England!
Die Herren begaben sich abwechselnd an den Schalter und besprachen sich mit ihren Angehörigen in England, als wenn sie sich gegenüberständen — allerdings eine sehr kostspielige Unterhaltung.
Besonders Lord Harrlington hatte lange Unterredungen, er gab die Anordnungen zu einem Hochzeitsfeste, wie ein solches in England noch nie stattgefunden hatte, denn auf einem seiner Schlösser sollte die Vereinigung der 21 Paare erfolgen und die Hochzeit gefeiert werden.
Viele Wochen waren vergangen, ehe man die Abreise endlich antreten konnte. Der Verkauf der Besitzungen der Damen war nicht so schnell von statten gegangen, die Herren hatten ihren Bräuten dabei wacker geholfen. Dann hatte man die Hochzeit Johannas und Hoffmanns gefeiert. Die Neuvermählten begaben sich auf dem Landwege nach Mexiko auf eine Besitzung Hoffmanns, die herzlichsten Glückwünsche der anderen begleiteten sie.
Der ›Blitz‹ konnte zur Reise nicht benutzt werden, er war schon lange vorher unter dem Kommando von Anders abgefahren, denn am Tage der Hochzeit sollten die auf freien Fuß gesetzt werden, welche auf der einsamen Felseninsel ein menschenunwürdiges Dasein führten.
Auf Bitten Johannas hin wollte Hoffmann versuchen, sie als Arbeiter in seinen Minen zu beschäftigen und sie wieder zu Menschen zu machen.
Auch Sharp und sein Bruder befanden sich bei der Gesellschaft, sie eilten von Paar zu Paar und vermehrten durch ihren Frohsinn noch die allgemeine Lust. Endlich, endlich war die Zeit gekommen, die Zeit des Glückes. Wenn man die Seereise nur erst hinter sich hätte!
Ein Ausruf von Sharp lenkte die Aufmerksamkeit der Gesellschaft einer Richtung zu. Von dort näherte sich dem Postgebäude ein Mann, welcher erst die Lachlust erregte, dann Erinnerungen wachrief und schließlich von allen Seiten umringt wurde.
Man glaubte einen Waldläufer vor sich zu haben, der sich eben einmal ein neues Jagdkostüm geleistet hatte, nichts fehlte, um den Gefahren der Wildnis Trotz zu bieten. Der lederne Jagdanzug war mit Franzen besetzt, die Mokassins mit Perlen gestickt, im Gürtel staken Skalpiermesser und Tomahawk, über Schultern und Rücken lagen drei Büchsen von verschiedenem Kaliber, und der mächtige, mexikanische Sombrero, der Schlapphut, vervollständigte den Pfadfinder in der amerikanischen Wildnis.
Aber das Gesicht, welches unter dem Sombrero vorblickte, paßte gar nicht zu der kriegerischen Erscheinung, es war so gutmütig und dick, und so war auch der ganze Kerl ebenso dick, wie er groß war — was man bei Waldläufern wohl selten finden wird.
Hinter ihm her troddelte ein verschmitzt aussehender Bursche mit Bausbacken, in ähnlicher Kleidung, aber nur mit einer Büchse bewaffnet.
»Monsieur Pontence,« erklang es wie aus einem Munde, und jubelnd umringte man den kleinen Mann, mit dem man zum dritten Male zusammentraf.
Auch Pontence schien sich über dieses Wiedersehen sehr zu freuen, besonders weil er merkte, wie man ihn mit unverhohlener Verwunderung betrachtete, was seiner Eitelkeit schmeichelte, aber er verbarg seine Freude hinter einer würdevollen Miene.
Dröhnend setzte er die lange Büchse zu Boden, wischte sich mit dem roten Taschentuche den Schweiß vom Gesicht und schaute sich würdevoll im Kreise um.
»Monsieur Pontence, wie kommen Sie denn hierher?« fragte Ellen. »Haben Ihnen die letzten unglücklichen Ereignisse noch nicht den Mut genommen, daß Sie auf neue Abenteuer ausgehen? Ich schließe aus Ihrer Kleidung, Sie beabsichtigen eine neue Jagdexpedition.«
Der Franzose machte eine geringschätzende Handbewegung.
»Den Mut?« entgegnete seine Baßstimme verächtlich. »Hugh, Matatwangara ist ein großer Krieger, sein Herz ist von Stahl und sein Körper von Stein, er sehnt sich nach Gefahren, denn sie bringen ihm Ruhm! Ist es nicht so, Drunkard?«
»Hugh,« entgegnete der Bursche und machte dabei einen Mund, als ob er sich die Ohren wegbeißen wollte.
»Wer ist denn das, Matatwangara? Das ist ja ein indianisches Wort,« forschte Ellen weiter, die bei Nennung dieses Namens ein Lächeln nicht unterdrücken konnte.
»Matatwangara ist ein großer Krieger, die Starken zittern, wenn er niest, und die Tapferen beben, wenn sie ihn sehen. Ist es nicht so, Drunkard?«
»Hugh!«
»So sprechen Sie doch nur, wer ist denn das?«
Der Franzose konnte sich nicht länger beherrschen, er mußte aus der Rolle fallen.
»Das bin ich,« sagte er jetzt, mit dem Finger auf seine Brust deutend.
»Aah,« erklang es von allen Seiten. Man wußte, daß es dem Franzosen beliebte, diesmal den Indianer zu spielen oder doch einen Waldläufer, der indianische Angewohnheiten angenommen hatte, und niemand wollte ihm sein Spiel verderben.
»Bin ich nicht Matatwangara?« fragte er wieder Drunkard.
»Hugh!«
»Na also, habe ich recht oder unrecht?«
»Hugh, du hast recht,« nahm jetzt Sharp das Wort. »Weißt du auch, was Matatwangara heißt?«
»Es ist der Name eines großen Kriegers.«
»Ja, und ich will dir ihn übersetzen. Matatwangara heißt ...«
»Nicht hier, nicht jetzt,« unterbrachen Ellen, Miß Thomson und alle anderen, welche die Bedeutung des Namens wußten, den Erklärer teils unwillig, teils lachend.
»... Matatwangara heißt der Bergadler,« fuhr Sharp fort. »Sieh, großer Häuptling, Mata ist der Berg, Twangara der Adler. Nicht wahr, meine Damen?«
Lachend stimmte man bei.
»Na, habe ich etwa zuviel gesagt?« fragte Pontence stolz. »So nannten mich die Indianer, mit denen ich in Mississippi zusammentraf. Es wäre beinahe zu einem blutigen Kampfe gekommen, ich lockerte schon mein Skalpiermesser in der Scheide und prüfte die Schärfe meines Tomahawks, doch Drunkard hier, ein Waldläufer durch und durch, von dem ich so manches gelernt habe, hinderte mich daran, sonst hätte ich den schuftigen Rothäuten samt und sonders die Skalpe abgenommen. Als ich sie verließ, gaben sie mir den Namen Matatwangara, ich habe ihn mir ehrlich verdient.«
»Hugh!« grinste sein Begleiter.
»Wie? Sie skalpieren auch?« rief eine Dame erschrocken.
»Natürlich, nur keine Schonung mit dem roten Gezücht! Sehen Sie hier ...«
Er griff an seinen Gürtel, wo wirklich ein Stück trockene Haut, mit langen Haaren hing.
»Wahrhaftig, er hat einen Skalp!«
»Erschrecken Sie nicht, meine Herren und Damen,« begütigte Pontence schnell, »diese Kopfhaut habe ich nur zur Uebung einem langhaarigen Affen abgezogen, das heißt hinten vom Rücken. Es ging schon, und es geht von Tag zu Tag besser.«
Mit einem Satze sprang er auf den Burschen zu, warf ihm den Hut vom Kopfe, riß das Messer heraus, packte den Kerl mit der linken Hand in den Haaren und beschrieb mit der Messerspitze einen Kreis um seinen Kopf.
Da der Mann sich alles ruhig gefallen ließ, ohne mit den Augen zu zucken, so sprangen auch nicht die Umstehenden zu, um eine Gewalttat zu verhindern.
»Sehen Sie, so wird's gemacht,« sagte Pontence, wischte das Messer sorgfältig am Knie ab, als wäre es voll Blut, und steckte es in die Scheide.
»Sie sind ein schrecklicher Mann,« meinte Sharp mit ängstlichen Augen. »Den Namen Matatwangara führen Sie mit Recht. Selbst Ihre Gestalt ähnelt der eines Bergadlers.«
»Ohne Anlaß geben die Indianer ihre Namen überhaupt niemals.«
Der Bursche hatte sich Pontence von hinten genähert und machte ihm durch leichte Püffe und Stöße bemerkbar, daß er ihm etwas zu sagen habe. Der Franzose aber besaß ein tüchtiges Fettpolster, er fühlte nichts.
»Ist dies Ihr ständiger Begleiter?« fragte Sharp.
»Hugh!« entgegnete der Bursche für seinen Herrn.
»Drunkard heißt er?«
»Drunkard,« sagte der Franzose. »So haben ihn die Indianer von Missouri genannt, ich glaube, weil er so ungemein schlau ist und jede Spur verfolgen kann.«
»Was es heißt, wissen Sie nicht?«
»Leider noch nicht. Ich werde mir nachher einige Lehrbücher der indianischen Sprache kaufen, damit ich mich mit den Indianern, unter welche ich mich jetzt begeben will, persönlich verständigen kann.«
Pontence konnte nicht völlig Englisch, sonst hätte er wissen müssen, daß drunkard Trunkenbold heißt.
»Das soll ein Waldläufer sein?« fragte Sharp, den Burschen musternd.
»Ja, und zwar ein sehr tüchtiger.«
»Hugh!« stimmte Drunkard bei.
»Er kennt ganz Amerika.«
»Hugh.«
»Von Nord nach Süd, von West nach Ost, alles hat er schon durchwandert.«
»Hugh!«
»Er kennt alle indianischen Sprachen.«
»Hugh.«
»Ist das wahr, daß du alle indianischen Sprachen redest?« fragte nach diesem Duett Ellen den Burschen, der viel eher wie ein Ziegelstreicher als ein Waldläufer aussah.
»Hugh.«
»Alle Sprachen?«
»Hugh — na,« rief jetzt der Bursche, zum ersten Male ein anderes Wort als hugh sagend, und gab dabei dem Franzosen einen tüchtigen Puff in die Seite, »wie steht's nun?«
Er hielt ihm die offene Hand hin, ein nicht mißzuverstehendes Zeichen.
»Gleich, gleich,« entgegnete Pontence, »eine Minute nur noch, mein Lieber. Sind die Herren und Damen gar nicht neugierig, zu erfahren, was mein neuestes Vorhaben ist?«
»Erzählen Sie!«
»Ich gehe jetzt in die nördlichen Staaten von Nordamerika, dort droht ein Indianerkrieg auszubrechen, und da werde ich mich zur schwächeren Partei schlagen und ihr zum Sieg verhelfen. Sie kennen doch die Schwarzfüße?«
»Gewiß, ein sehr tapferer Volksstamm, wird aber bald aufgerieben sein.«
»Die Krähenindianer wollen diese mit Krieg überziehen, weil der hüpfende Büffel — das ist der Häuptling der Schwarzfüße — ihnen keinen Tribut mehr zahlen will. Das finde ich ganz recht, und so bin ich entschlossen, mit dem hüpfenden Büffel gegen die Krähenindianer meinen Tomahawk zu schwingen, ausgegraben ist er schon. O, ich sage Ihnen, meine Herren und Damen, Matatwangara, der Bergadler, wird die Krähen fressen, fressen wird er sie, wie nur je ein Adler Krähen gefressen hat.«
»Da wünsche ich Ihnen guten Appetit,« sagte Williams. »Woher sind Sie denn eigentlich in die indianische Politik so tief eingeweiht? Sie sind doch nicht etwa Gesandter an einem indianischen Hof?«
»O nein, ich bin nichts weiter als ein schlichter Waldläufer, der vom Ertrage seiner Büchse lebt. Drunkard hat es mir hinterbracht.«
»Hugh,« ließ sich Drunkard vernehmen und streckte wieder die Hand seinem Herrn hin, der sie aber nicht zu bemerken schien oder nicht sehen wollte.
»Wie sind Sie zu diesem Manne gekommen?« examinierte Williams weiter. »Ich vermute, Sie haben ihn aus den Händen von Indianern gerettet.«
»Getroffen!« rief Pontence erfreut. »Denken Sie nur, aus welcher Lage ich ihn befreit habe! Eines Abends ging ich am Ufer des Mississippi entlang, um zu sehen, ob ich vielleicht irgendwo Spuren bemerken könnte, denn es sollten sich wieder einmal Indianer gezeigt haben. Richtig, ich fand auch welche. Gerade an einer weichen Stelle war so recht schön ein Mokassin — Sie wissen doch, was ein Mokassin ist, so eine Art von unseren Morgenschuhen — war also ein Mokassin abgedrückt, und mein geübtes Auge erkannte sofort, daß sich der Mann auf der Kriegsfährte befand ...«
»Woran erkannten Sie das?«
»An der Art und Weise, wie er gegangen war. Um Ihnen das begreiflich zu machen, müßte ich Ihnen lange Lektionen geben, unsereins sieht so etwas auf den ersten Blick. Ist es nicht so, Drunkard?«
»Hugh.«
»Vorsichtig schleiche ich der Fährte nach, sie führt in den Wald, aber ich verliere sie nicht, und da plötzlich, wie ich eben einen etwas gebogenen Grashalm mustere, da springt plötzlich eine Rothaut mit gellendem Kriegsgeschrei auf mich los. Herunter mit der Büchse und sie dem Kerl vor die Nase gehalten, war natürlich eins bei mir, und nun denken Sie sich die Verstellungskunst von solch einem Schuft. Blitzschnell sinkt er vor mir nieder und schreit in einem fort: nix schieße, Massa, nix schieße, Massa!«
»Das war ja ein Neger,« lachten die Umstehenden. »Ein Indianer war es, versichere ich Ihnen.«
»Dann war es ein Indianer aus Afrika.«

»Nein, nein, es war ein Indianer, oder glauben Sie, ich könnte einen Indianer nicht von einem Neger unterscheiden? Als der Kerl aber nun sah, daß er an den Unrechten gekommen war, daß ein regelrechter Wald- und Prärieläufer vor ihm stand — ich laufe nämlich immer — da, mögen Sie's glauben oder nicht, da verstellte er sich plötzlich als ein harmloser Neger. Nix schieße, Massa, nix schieße, Massa, wimmerte er fortwährend. Ich ließ mich natürlich nicht täuschen. Was willst du, donnerte ich ihn an und war schon im Begriff, ihm eine Kugel ins rechte Auge zu schießen, ihm das Messer ins Herz zu stoßen und ihm den Kopf zu spalten ...«
»Alles dreies auf einmal?«
»Auf einmal, für mich eine Kleinigkeit! Soll ich es Ihnen vormachen?«
»Bitte, bemühen Sie sich jetzt nicht, ein andermal werden wir das Vergnügen haben,« entgegnete Williams. »Schießen Sie immer durchs rechte Auge?«
»Prinzipiell. Wollen Sie —«
»Nein, nein, nein, ich danke, meinetwegen brauchen Sie niemanden durchs rechte Auge zu schießen. Bitte, fahren Sie in Ihrer interessanten Erzählung fort!«
»Wo war ich stehen geblieben?«
»Als Sie zu gleicher Zeit schossen, stachen und hieben.«
»Sie irren, Sie irren, ich wollte es ja nur tun. Was willst du von mir? donnerte ich also den knienden Indianer an. Und was denken Sie, was die schlaue Rothaut antwortete? Eine Zigarre, Massa, wimmert er. Na, meine Herren, man hat doch auch ein Herz in der Brust, und ich noch dazu ein für Humor ganz empfängliches. Ich ließ also Messer und Tomahawk stecken, zog mein Zigarrenetui hervor und —«
»Erschossen ihn damit? Um Gottes willen!« rief Williams entsetzt.
»O nein, wo denken Sie hin! Ich gab ihm eine Zigarre, ohne ihn aber aus den Augen zu lassen, die eine Hand am Drücker der Büchse, die andere am Tomahawk —«
»Das ist ein Kunststück.«
»Ja, so etwas versteht nur unsereins. War es nicht so, als ich ihm die Zigarre gab, Drunkard?«
»Hugh.«
»Hören Sie es? Und ich sage Ihnen, dieser Mann ist ebenso wahrheitsliebend, wie ich, wie überhaupt jeder schlichte Waldläufer. Unsereinem ist die Lüge verhaßt, wie der Tod am Galgen, das versichere ich Ihnen parole d'honneur.«
»Ja, war denn Drunkard da schon bei Ihnen?« warf Williams dazwischen.
»Nein, ich fand ihn ja erst später in hilflosem Zustande.«
»Hugh.«
»Lüge nicht, Bursche, du warst nicht dabei!«
Die Umstehenden lachten aus vollem Halse.
»Da werde ein anderer klug daraus, ich kann's nicht,« meinte Williams kopfschüttelnd.
»Sie verstehen nicht? Ach so, Sie sind ja mit den indianischen Sprachen unbekannt. Sie müssen nämlich wissen, daß Hugh bei den Indianern sowohl Ja, als auch Nein heißt.«
»Hugh,« stimmte Drunkard bei.
»Dann antworte ich von jetzt ab auch auf jede Frage nur mit einem Hugh,« lachte Williams, »aber bitte, fahren Sie doch fort, wir glauben Ihnen ja alles, auch ohne daß Sie oder Ihr Kompagnon es beteuern.«
»Wo war ich stehen geblieben? Ah so, als ich ihm die Zigarre gab. Nicht wahr?«
»Hugh,« antwortete diesmal Williams.
»Nun gut. Mein lieber Indianer nahm die Zigarre, steckte sie in seine wolligen Haare ...«
»Ein Indianer mit wolligen Haaren?«
»Ja, denken Sie nur, so gut hatte sich der Kerl verstellt — küßte mir die Stiefeln, wollte sagen, meine Mokassins, und schlug sich seitwärts in die Büsche, immer von dem Laufe meiner nie fehlenden Büchse bedroht. Da, denken Sie, meine Herren und Damen,« der Franzose richtete sich so hoch als möglich auf, stützte sich theatralisch aufs Gewehr und blickte sich finster im Kreise um, »du, denken Sie, was mir passiert ist!«
»Nun?« riefen alle, wirklich erwartungsvoll.
»Da hat sich Monsieur Adolphe Guiseppe Léon Jules Pontence, Hauptmann der freiwilligen, scharfschießenden Bürgerwehr zu Toulon, Ehrenmitglied ungezählter Schützengesellschaften, Löwen-, Tiger- und Pantherjäger, jetzt Wald- und Prärieläufer, da hat sich Monsieur Pontence zum ersten Male in seinem Leben übertölpeln lassen!«
Die Herren und Mädchen bissen sich auf die Lippen.
»Hat Ihnen der Indianer mit dem Wollkopf vielleicht beim Nehmen der Zigarre gleich die Uhr gestohlen?« fragte Marquis Chaushilm, in dem eine Erinnerung auftauchte.
»Ein Waldläufer hat keine Uhr, er richtet sich nach Sonne, Mond und Sternen.«
»Oder Ihre drei Gewehre?« fragte Sharp.
»Gehen Sie, Sie wollen mich foppen! Nein, dieser Indianer war doch ein rothäutiger Schuft, er hatte wirklich vor wenigen Minuten erst einen Weißen überfallen, niedergemacht und ihn geplündert. Nur meinem Dazwischenkommen hat jener es zu verdanken, daß er noch seine Skalplocke besitzt und,« fuhr Pontence mit erhobener Stimme fort, »damit Sie nicht etwa glauben, ich lüge — hier steht der Mann, der überfallen wurde, Drunkard. Ist es nicht so?«
»Hugh,« sagte Drunkard und ließ Kopf und Mund hängen.
»Sollte das diesmal Ja oder Nein heißen?« fragte Williams.
»Diesmal Ja. Das Nein wird gegurgelt, ganz hinten in der Luftröhre, das Ja mehr mit dem Gaumen geschnarrt.«
»Ah so, darin werde ich mich noch üben.«
»Ja, ja,« fuhr der Franzose fort, »dieser Mann, ein perfekter Waldläufer, wurde von dem Indianer überrumpelt, und daraus können Sie sehen, was das für ein schlauer Kerl war. Doch ich will nicht vorgreifen. Nachdem der Indianer verschwunden war, drang ich noch etwas tiefer in den Wald ein, um für die Sicherheit der umliegenden Farmen zu sorgen. Plötzlich höre ich ein eigentümliches Geräusch, etwa so, als wenn ein Mensch recht tüchtig schnarcht, aber wie aus wunder Brust kommend, ich untersuche meine Büchse, lockere das Skalpiermesser, prüfe die Schärfe meines Tomahawks und —«
»Mache, daß ich fortkomme,« fiel Sharp ein.
»Herr, wie können Sie sich unterstehen —«
»Ich meinte ja mich, ich muß jetzt gehen,« entgegnete Sharp kaltblütig und ging der Telegraphenstation zu.
»Ach so, das ist etwas anderes! Ich schlich also natürlich der Richtung zu, aus dem die Schmerzenstöne kamen. Was meinen Sie, was ich zuerst fand? Ein Beinkleid, es hing an einem Ast, einige Schritte weiter lagen im Grase ein Paar Hosenträger — Verzeihen Sie mir, meine Damen, nehmen Sie einem schlichten Waldläufer nichts für ungut — dann fand ich eine Jacke, eine Weste, einen Hut, ein Paar Schuhe und schließlich sogar noch, ich wage es kaum auszusprechen, ein Hemd. Wie mir zumute war, ich kann es Ihnen nicht sagen, aber jedenfalls fühlte ich, wie mir die Courage schwoll. Vorsichtig kroch ich immer weiter, erst auf den Knien, dann rutschte ich sogar auf dem Bauche, wollte sagen auf meiner vorderen Seite — und dann sah ich das Opfer des Indianers liegen, so, wie es Gott geschaffen hatte, hier diesen Waldläufer. Er lag auf dem Rücken und stieß jämmerliche Töne aus, wie gesagt, etwa so, als ob jemand schnarche.«
»Er schlief wahrscheinlich wirklich,« ließ sich eine Dame unvorsichtig vernehmen.
»Wo denken Sie hin, Gnädigste, im Urwald und im Urzustande schlafen! Nein, der Indianer hatte ihn eben überfallen und beraubt, bei meinem Anblick hatte er aber den Raub weggeworfen und sich mir gegenüber für einen unschuldigen Neger ausgegeben. Das wußte ich sofort, und außerdem hat es mir Drunkard dann selbst erzählt.«
»War er denn nicht tot?«
»Nein, er schrie ja, und dann steht er auch hier.«
»Wer weiß, heutzutage passieren doch manchmal noch Wunder, besonders bei Ihnen! Kennen Sie übrigens nicht die Redensart: er schnarcht wie ein Toter?«
»Habe nicht die Ehre. Doch nun hören Sie mich an! Nachdem ich mich überzeugt, daß mir kein Hinterhalt gestellt war, näherte ich mich dem Unglücklichen. Das erste, was mir auffiel, war ein penetranter Branntweingeruch ...«
»Aha!« erklang es von allen Seiten.
»So, sollten Sie schon alles ahnen?« fragte der Franzose verwundert. »Das glaube ich kaum. Neben dem Manne lag eine geleerte Flasche, auf welcher Whisky stand.«
»Daher der Name Drunkard,« bemerkte einer.
»Wie meinen Sie?«
»Nun, dieser Gentleman hat sich eben einen tüchtigen Rausch angetrunken und schlief ihn nun aus.«
»Was Sie doch klug sind! Nein, passen Sie nur auf. Der Mann war offenbar bewußtlos, aber selbst in diesem Zustande stieß er noch die eigentümlichen Töne aus. Nach langen Bemühungen, besonders durch Wasserumschläge — in der Nähe floß ein Bach — gelang es mir, ihn zum Leben zurückzurufen. Das schnarrende Schmerzensgestöhn hörte auf, er öffnete die Augen, schaute mit irren Blicken um sich und glotzte mich dann lange verständnislos an. Ich glaubte erst, er habe einen Schlag auf den Kopf erhalten, aber durch die Flasche kam ich auf einen anderen Gedanken, und als ich an den Unglücklichen Fragen stellte, erhielt ich Antworten, die meine Vermutungen bestätigten. Hören Sie, mit welchem Scharfsinn ich dem Sachverhalt auf die Spur kam, hören Sie und staunen Sie! Ich bemerkte, daß der Unglückliche im ersten Augenblick des Indianischen nicht mehr mächtig war, sondern nur ja und nein antworten konnte. ›Sind Sie von einem Indianer überfallen und beraubt worden, armer Mann?‹ fragte ich. Er schwieg lange, starrte mich unverwandt an, dann blitzte es verständnisvoll in seinen Augen auf, und er antwortete mit einem leisen Ja. ›Hat er Sie hinterrücks überfallen?‹ ›Nein.‹ ›Oder sprang er vielleicht auf Sie zu und goß Ihnen den Inhalt dieser Flasche, ins Gesicht?‹ Wieder huschte ein verständnisvolles Lächeln über sein Gesicht, und wieder sagte er ›ja.‹ Kurz und gut, durch meine scharfsinnigen Fragen erfuhr ich, daß dieser Mann hier ein berühmter Waldläufer ist, der aber einmal von einem Indianer, als Neger verkleidet, durch eine List überrumpelt worden war. Der Indianer hatte ihm Branntwein in die Augen gespritzt und dem Geblendeten dann solchen auch noch in den Hals gegossen, bis er völlig bewußtlos war. Mein nächstes ...«
»Nun hören Sie aber endlich auf,« lachten die Zuhörer. »Sie dürfen als alter Freund schon etwas von uns verlangen, aber gar zuviel doch nicht.«
»Was, Sie glauben mir nicht?« rief der Franzose entrüstet. »Fragen Sie doch hier meinen Begleiter, der lügt nie. Drunkard, habe ich die Wahrheit gesagt oder nicht?«
»Hugh,« entgegnete der Bursche und hielt seinem Herrn wieder unter Augenblinzeln die offene Hand hin.
»Diesmal hat er gegurgelt, das heißt nein,« rief Williams.
»Nein, er hat geschnarrt.«
»Na, dann habe ich mich verhört, er soll das nächste Mal deutlicher schnarren und gurgeln.«
Der Franzose wollte den Herren und Mädchen, welche bis zur Abfahrt des Dampfers noch Zeit hatten und sich an dem drolligen Kauz ergötzten — man wußte nie, ob er seine Lügen selbst glaubte oder nicht — noch etwas erzählen, aber Sharp trat heran und reichte ihm ein mit sonderbaren Schriftzeichen bedecktes Telegrammformular hin.
»Nicht wahr, Sie werden von den Indianern Matatwangara genannt?«
»Hugh, ich bin Matatwangara,« entgegnete er stolz.
»Dann ist dies Telegramm auch für Sie bestimmt. Es kam soeben an.«
Pontence nahm das Telegrammformular mit zitternden Händen, er schien ein böses Gewissen zu haben, aber gleich klärte sich sein Gesicht wieder auf.
»Gott sei Dank, es ist kein Französisch,« seufzte er auf, wie von einer Last befreit.
»Können Sie es nicht lesen?«
»Nein.«
»Es ist im Dialekt der Schwarzfuß-Indianer geschrieben, geben Sie her, ich will es Ihnen vorlesen.«
Und ernsthaft las Sharp vor.
»An Matatwangara, New-York, postlagernd. Komm mein weißer Bruder, sagt der hüpfende Büffel, komm, oder die Krähen fressen uns. Will uns der weiße Häuptling seinen Tomahawk nicht leihen?«
»Steht — steht das wirklich da?« stammelte der Franzose nach langer, stummer Pause, und sein Gesicht wurde plötzlich rot wie eine Klatschrose.
»Wer von den Herren oder Damen versteht Schwarzfüßisch?« rief Sharp, die Depesche hochhaltend.
»Hier, ich spreche Schwarzfüßisch wie meine Muttersprache,« sagte Hendricks und drängte sich vor.
»Sie?« fragte Sharp anscheinend mißtrauisch.
»Natürlich, meine Tante, bei der ich erzogen wurde, war ja eine Schwarzfußindianerin, ihre Füße waren so schwarz wie eine Kohle, von der hab' ich's gelernt.«
Er nahm das Papier und las das Telegramm vor. Dann hielt er es Drunkard hin.
»Stimmt's nicht?«
»Hugh.«
»Er hat ja gesagt, er hat geschnarrt,« schrie Williams, »diesmal hab' ich's ganz deutlich gehört. Der Kerl hat wie eine Vogelschnarre geschnarrt.«
Sharp machte ein ganz unterwürfiges Gesicht, als er sich wieder an den Franzosen wendete.
»Verzeihen Sie, Monsieur, wenn ich im ersten Augenblick zweifelte, daß Sie sich in der kurzen Zeit, während welcher wir uns nicht gesehen haben, wirklich zum Waldläufer ausgebildet haben. Wahrhaftig, Sie hatten recht, Ihr Ruf als tapferer Krieger hat sich schon in ganz Amerika verbreitet, er eilt Ihnen voraus, der hüpfende Büffel, der Häuptling der Schwarzfüße, bittet telegraphisch um Ihre sofortige Hilfe. Meine Herren, entblößen Sie das Haupt, meine Damen, machen Sie Ihr Kompliment: Matatwangara, der berühmteste Waldläufer und der gewaltigste Jäger Amerikas steht vor Ihnen.«
Monsieur Pontence war entweder ein Spaßvogel und dabei ein ausgezeichneter Schauspieler — oder aber seine Leichtgläubigkeit, verbunden mit Dummheit, kannte keine Grenzen, und letzteres schien eher der Fall zu sein als das erstere, denn welcher Schauspieler kann nach Willkür erröten und erblassen!
Das Gesicht des Franzosen hatte sich nämlich erst mit Blässe bedeckt, diese aber war wiederum einer glühenden Röte gewichen. Unausgesetzt bearbeitete er das dicke Gesicht mit dem Taschentuch, um die Schweißtropfen zu entfernen.
Dann richtete er seine kleine Figur auf, sie wuchs um einen Zentimeter, stolz schaute er im Kreise umher und sagte mit passender Handbewegung.
»Na, da haben Sie's ja! Was habe ich Ihnen denn gesagt? Glauben Sie's nun endlich? Der hüpfende Büffel braucht mich, oder er ist verloren. Was soll ich da machen? Ich muß eben gehen. Weiß einer der Herren, wann der nächste Zug nach dem Lande der Schwarzfüße fährt?«
»Fragen Sie mal auf der Poststation dort an.«
»Richtig, ich muß sowieso dorthin.«
Er bekam von Drunkard wieder einen Puff in die Seite, blieb stehen und kratzte sich hinter den Ohren.
»Ach so, ja, das ist fatal! Aber ich muß sofort hingehen, sie brauchen mich,« brummte er vor sich hin, »Hm, was ist da zu machen? Habe ich Ihnen schon erzählt, was mich nach New-York führt?«
»Wollten Sie sich nicht mit noch mehr Waffen ausrüsten? Diese drei Flinten dürften kaum genügen.«
»Doch, sie reichen. Nein, das war es nicht. Sehen Sie, ich habe vor einigen Wochen nach Toulon geschrieben, mein Geld ist mir nämlich ausgegangen, und meine Alte — pardon — meine Frau sollte mir telegraphisch Geld nach New-York schicken. Deshalb bin ich hier, hoffentlich ist mein Geld schon da.«
»Wie, Sie sind verheiratet?« rief Miß Thomson.
»Nun, allemal. Warum sollte ich denn nicht? Oder glauben Sie etwa, ein Mann wie ich bekäme keine Frau? Oho, zehn für eine! Als ich in Spanien ...«
»Ich glaube schon, daß Ihnen das Heiraten keine Schwierigkeiten bereitet hat,« unterbrach Betty ihn lachend, wieder eine unendliche Geschichte befürchtend, »aber ich wundere mich, daß Ihre Gattin Sie so in der Welt herumstreichen läßt.«
»Meine Frau, bah, was meinen Sie wohl! Mit meiner Frau halte ich es als Waldläufer, wie die Indianer, sie ist nur meine Squaw, meine Sklavin, die meinen Wigwam in Ordnung zu halten hat, meine Kinder erzieht, solange sie klein sind, und so weiter. Im übrigen aber hat sie keinen Mucks zu sagen, und wagt sie es einmal, aufsässig zu sein, dann — dann ...«
Der hochmütige Sprecher kam nicht weiter. Eine knochige Hand packte ihn hinten am Genick, er fuhr herum und sank vor Schrecken fast in die Knie — vor ihm stand mit zornsprühenden Augen eine große, magere Dame mit einem knöchernen Gesicht und einer Habichtsnase.
»Meine Frau,« ächzte der Franzose.
»Ja, deine Frau,« keifte die schon ältere Dame, und bei jedem Worte nickten die schlanken Strohblumen auf dem koketten Hut, »ja, deine Frau! Nun, Monsieur, was denn? Was denn? Heh, wenn ich nun einmal aufsässig werde, heh?«

»Meine Frau,« ächzte der Franzose —
»Ja, deine Frau,« keifte die ältere Dame, »ja, deine Frau.«
»Aber meine liebe Dorothea, mein herziges Weibchen,« stammelte Pontence ängstlich, »ich bitte dich ...«
»Heh, Monsieur, nun kriecht er wohl zu Kreuze?« fuhr die Gattin unerbittlich fort, und dann, noch böser werdend: »Nun geht mir die Sache aber auch an die Galle! Willst du Landstreicher nun wohl endlich nach Hause kommen, wo Frau und Kinder auf dich warten, du Lump, du infamer? Geld willst du wieder haben, damit du es mit diesen Tunichtsguten da,« die Blumen nickten nach den Herren und Mädchen, »verputzen kannst, heh? Das hättest du wohl nicht erwartet, daß statt der Geldsendung deine Frau selbst käme, heh? Fort mit dir, du Lump infamer, ins Hotel mit mir, das nächste Schiff bringt uns nach Hause. Oder glaubst du, ich sähe es noch länger mit an, wie du unser so sauer verdientes Geld für unsinnige Sachen ausgibst, du Lüdrian du? Man sollte doch gleich ...«
»Aber Frau,« wimmerte Monsieur Pontence, um nur etwas zu sagen, »wir haben das Geld ja nicht verdient, wir haben es ja nur in der Lotterie gewonnen ...«
»So, nur, so? Haben wir damals nicht drei Wochen lang Tag und Nacht beide Daumen gehalten, war das nicht etwa sauer genug? Und du Luftikus schmeißt das Geld nur so zum Fenster hinaus? Ein Skandal ist es, da sollte man dich doch gleich ...«
»Meine einzige, herzigste, beste, allerschönste und liebste Frau,« flehte Pontence in heller Verzweiflung, »so höre doch nur endlich auf, ich will ja gern mit dir nach Hause kommen, höre jetzt nur endlich auf, ich komme ja schon!«
»Das wollte ich auch meinen. Wage nur noch einen Mucks zu sagen, und du sollst mich noch anders als deine gute Frau kennen lernen. Ach, ich armes Weib und die armen Kinder, einen Lump zum Manne und Vater zu haben!«
Die knöcherne Hand packte des Gatten Arm, der sich, völlig geknickt, willenlos fortschleppen ließ, die andere trocknete mit dem Taschentuch die hervorstürzenden Tränen.
Es war ein wunderschönes Bild, wie der dicke, kleine Mann ganz gebrochen am Arme der knochigen, großen Frau hing und sich fortschleppen ließ, die zwei auf dem Rücken hängenden Flinten, die Pistolen und Dolche im Gürtel, der Trapperanzug, die ungeheuer lange Vogelflinte, die er, am Laufe gefaßt, im Staube nachschleifte — ein Bild zum Malen.
Sharp war der einzige, der sich einige Worte erlaubte.
»Aber Monsieur Pontence, wollen Sie denn den hüpfenden Büffel im Stich lassen? Die Schwarzfüße rechnen auf Sie, sonst siegen die Krähen-Indianer.«
Madame Pontence wandte sich um und schüttelte drohend den Sonnenschirm.
»Ich will Sie behüpfen, bebüffeln, beschwärzen und bekrähen. Kommen Sie doch heran, wenn Sie Mut haben!«
»Fällt mir gar nicht ein, Gnädige, weit entfernt ist gut vorm Schuß. Ich fürchte mich nicht so leicht, aber mit Ihnen anzubinden, wage ich doch nicht.«
»Spotten Sie nicht mehr,« raunte Harrlington dem Detektiven zu.
Monsieur Pontence mußte einsehen, welche klägliche Rolle er spielte, und er wollte sich noch einmal den Anschein geben, als wäre er der Herr.
Er wandte sich um, legte die Hand trichterförmig an den Mund, und raunte zurück:
»Lassen Sie mich nur erst mit ihr allein sein, dann will ich ihr schon den Standpunkt klarmachen.«
Bis jetzt war es den Hörern gelungen, ein ernsthaftes Gesicht zu bewahren, bei dieser letzten Bemerkung des großprahlerischen Franzosen aber brach unisono ein Gelächter aus, welches so lange dauerte, bis die drei gefährlichen Flinten und die nickenden Hutblumen hinter der nächsten Ecke verschwunden waren.
»Da geht er hin, und niemals kehrt er wieder,« deklamierte Sharp. »Meine Herren, lassen Sie sich durch dieses Ehepaar nicht abschrecken, segeln Sie deshalb getrost in den Hafen der heiligen Ehe ein.«
Man hatte noch eine halbe Stunde Zeit, ehe man sich an Bord begeben mußte.
Für den wißbegierigen Williams gab es noch eine Frage, welche er beantwortet haben mußte. Er wandte sich deshalb an Ellen:
»Miß Petersen, ist das wirklich ein indianisches Wort: Matatwangara?«
»Gewiß, und zwar scheint es ein internationales zu sein, fast alle Indianer Nordamerikas kennen es.«
»Was heißt es denn?«
»Fragen Sie Ihre Braut, sie kennt es auch.«
»Ist es anstößig?«
»Das nicht gerade! Fragen Sie nur Ihre Braut.«
Williams ging zu Miß Thomson.
»Betty, was bedeutet Matatwangara?«
Betty lachte.
»Das bedeutet, — ich sage es dir nicht.«
»Warum denn nicht?«
»Weil ich nicht mag.«
»Ist es beleidigend für meine Ohren?«
»Für deine eben nicht, aber für meine.«
»Dann kannst du es mir doch auch sagen.«
»Nein, jetzt nicht, vielleicht später einmal. Da steht Mister Sharp, der kennt es auch. Frage ihn.«
Sharp unterhielt sich mit seinem Bruder, als Williams zu ihm trat.
»Mister Sharp, was bedeutet das Wort Matatwangara?«
»Das ist der Name eines Tieres.«
»Ah so, hm, seltsam! Warum wollten es mir die Damen denn nicht nennen? Was für ein Tier heißt so?«
»Ja, nun raten Sie einmal: Matatwangara ist ein Tier, welches nicht existiert, nie existiert hat und nie existieren wird.«
»Sie sprechen in Rätseln. Was für ein sonderbares Tier sollte denn das sein?«
»Ja, raten Sie nur!«
»Das kann ich nicht.«
»Ich will Ihnen wenigstens auf die Sprünge helfen. Wissen Sie, was ein Schwein ist?«
»Dumme Frage!«
»Ich dachte, Sie wüßten es nicht, weil Sie in der Naturkunde nicht eben sehr bewandert zu sein scheinen. Also: gesetzt nun den Fall, ein Schwein verliebte sich in einen Hund, was bis jetzt aber noch nicht vorgekommen ist. Was für ein Tier würde dieser Ehe entspringen?«
Williams schaute den Sprecher groß an.
»Ein Schweinehund,« sagte Youngpig phlegmatisch.
»Das ist es, das bedeutet Matatwangara. Mit diesem Namen schimpfen sich sonderbarerweise fast alle Indianer Nordamerikas, die von der Kultur noch ganz unbeleckten ausgenommen. Indianer haben es dem Franzosen bei irgend einer Gelegenheit nachgerufen, und dieser hat das Wort als einen Ehrentitel angenommen.«
Unterdes hatte Drunkard, der verlassene Waldläufer, der sich dem fürchterlichen Weibe seines Herrn nicht zu nähern gewagt hatte, die Gesichter der Herren studiert und war zu dem alleinstehenden Marquis Chaushilm gekommen.
»Sir,« sagte der Bursche wehmütig, »ich bin ein armer Teufel. Dieser Franzose hat mich als Waldläufer engagiert ...«
»Als Waldläufer engagiert?«
»Ja. Ich war einmal etwas angetrunken ...«
»Das kann vorkommen.«
»... Monsieur Pontence fand mich im Walde liegen, und als ich erwachte, hat er mir so lange vorgeschwatzt, ich wäre ein Waldläufer ...«
»Waldlieger paßte dann eher.«
»... bis ich es fast selbst glaubte. Er versprach mir den Monat zehn Dollar, wenn ich ihn in der Kunst, Spuren zu verfolgen, unterrichten wollte, und schließlich ging ich darauf ein.«
»Versteht Ihr denn, Spuren zu verfolgen?«
»Ich bin von Profession Schuster, etwas verstehe ich mich also auch auf die Abdrücke von Schuhen und Stiefeln. Der Franzose war auch gar zu verrückt, ich mußte eben ein Waldläufer sein. Den ersten Monat bezahlte er mich, den zweiten nicht, weil er selbst kein Geld mehr hatte. Nun sitze ich da in diesem Harlekinsanzug, kein Meister nimmt mich so an ...«
Der Bursche sah Chaushilm so bittend an. Dieser holte eine Zehndollarnote hervor und gab sie ihm.
»Hier ist der rückständige Lohn, vertrinkt das Geld nicht. Heißt Ihr wirklich Drunkard?«
»Ach nein, böse Zungen haben mir den Namen gegeben. Ich bin jetzt Temperenzler geworden, trinke nur Wasser, Limonade ...«
»Schon gut, schon gut. Sie haben jetzt Ihr Geld.«
Die Schiffsglocke läutete.
Arm in Arm begab man sich zu dem Fahrzeug, das sie an Bord bringen sollte. Die letzten Abschiedsgrüße wurden gewechselt.
Miß Chalmers wurde von den Freundinnen tränenden Auges geküßt, sie erwartete die Abfahrt eines anderen Dampfers.
Dann sahen die Zurückbleibenden — der Hafen war stark besetzt — wie sie das Deck betraten, Harrlington und Miß Petersen, Hastings und Miß Murray, Williams und Miß Thomson, der völlig wiederhergestellte Chaushilm und Miß Sargent, alle, wie sie sich zusammengefunden, sie sahen noch ihre glücklichen Gesichter, dann wurden die Anker gelichtet, die Schraube drehte sich und bald war der Ozean-Dampfer am Horizont verschwunden.
»Wann fahren Sie?« wandte sich Sharp an Miß Chalmers.
»Dort liegt mein Dampfer.«
»Dann leben Sie wohl, Miß, vergessen Sie, was ich einmal zu Ihnen gesprochen habe — es kam aus ehrlichem Herzen. Seine Adresse haben Sie, grüßen Sie ihn von mir und — seien Sie ihm ein Schutzengel. Gott segne Sie, Miß Chalmers! Auf Wiedersehen!« —
Das allmächtige Schicksal gebot dem bösen Dämon, welcher die Weltumsegler so oft bedroht und in Gefahr gebracht hatte, Halt, jetzt war es genug, sie sollten England unbelästigt erreichen.
Während der siebentägigen Ozeanfahrt trübte kein Wölkchen den sonnenklaren Himmel, die Winde schwiegen, keine Welle netzte auch nur die Füße der Heimkehrenden. Fürwahr, eine gute Vorbedeutung für künftiges Glück!
Sie erreichten England in Liverpool. Der Empfang war weniger großartig als der in New-York, aber herzlicher, denn die Eltern begrüßten ihre Söhne und umarmten deren Bräute. Die elternlosen Mädchen hatten wieder Mütter bekommen, die sie mit offenen Armen aufnahmen und an die Herzen drückten.
Lange dauerte der Aufenthalt in Liverpool nicht, dann ging es fort nach dem Schlosse Harrlingtons, wo der Traualtar errichtet, die Hochzeitstafel gedeckt und die Säle zum fröhlichen Feste geschmückt waren.
Die Trauung war vorüber, Tafel und Tanz vereinigten die glücklichen Neuvermählten, in Reden und Toasten gedachte man noch einmal aller Erlebnisse, aller treuen Freunde, und manches Paar durchlebte noch einmal die Stunde, in welcher sich die Herzen gefunden.
Der Telegraph war in ständiger Bewegung. Aus aller Herren Ländern liefen zahllose, glückwünschende Depeschen ein, aus Amerika, Afrika, Indien, China und so weiter, und sie mußten erwidert werden.
Stets, wenn Lord Harrlington eine neue Depesche erbrach, war besonders Williams ganz aufmerksam, aber stets schüttelte er mißvergnügt den Kopf. Es wurde Abend, der Tanz begann — die Nacht sollte niemanden als den Hausherrn und seine Gemahlin hier finden — und noch immer wartete man vergebens auf eine Depesche.
Jene Vestalin, welche sich in Batavia verheiratete, hatte von sich hören lassen, eine andere war es, welche den Hochzeitstag ihrer Freundinnen vergessen zu haben schien.
Man bedauerte, daß durch diese Vergeßlichkeit die festliche Stimmung etwas getrübt wurde. Warum telegraphierten denn nur die beiden nicht, an welche man mit solcher Liebe dachte?
Da, mitten im Tanz, bemerkte Harrlington einen Diener mit einem Telegramm. Er verließ seine Tänzerin.
»Aus Deutschland!« rief er.
Die Paare blieben stehen, die Musik verstummte.
Harrlington überflog die Zeilen, lächelte und las mit erhobener Stimme vor:
»HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE ZUR EINUNDZWANZIGFACHEN HOCHZEIT! MEINE VESTALIN BESCHENKTE MICH MIT EINEM KLEINEN AMOR. SIE BEFINDET SICH WOHL. HANNES VOGEL.«
Ein donnernder Jubel brach los, das also hatte den Glückwunsch der beiden verzögert — sie waren entschuldigt.
Dann begann der Tanz wieder.
In einer Nische stand eine Marmorbüste, ein schöner Kopf mit ernsten, edlen Zügen. Die Augen manches Paares streiften beim Vorübertanzen die Büste, und ihre Gesichter verdüsterten sich dann stets. Auch die Augen des Marmors schienen heute abend Leben zu besitzen, sie blickten zwar geradeaus, immer aber waren sie auf Ellen gerichtet, und begegneten sie den ihren, so schienen sie freudig zu glänzen. Tanzte Ellen mit Harrlington, dann senkten sich die steinernen Augen, bis sie auf ein Glaskästchen blickten, welches am Fuß der Büste stand. Darin lag ein von einer Kugel breitgedrücktes Medaillon, das unverletzte Miniaturbild Ellens enthaltend.
Die Augen hoben sich wieder, sie suchten das schönste Paar auf, und über den weißen Marmor flog es wie ein glückliches Lächeln.
Es war Nacht geworden; die Neuvermählten verabschiedeten sich von Ellen und Harrlington. Keine Hochzeitsreise sollte angetreten werden, man sehnte sich nicht mehr danach. Die Schnellzüge brachten die Glücklichen in ihre Heimat, in ihre eigenen Häuser.
Ellen und Harrlington waren allein im erleuchteten Saal, sie hatten sich umschlungen und standen vor der Marmorbüste, vor dem Bilde von John Davids.
»Er hat geweint,« flüsterte Ellen. »Siehst du die Tropfen an seinen Augen hängen?«
»Ich sah, wie vorhin beim Entkorken einer Champagnerflasche Wein in die Nische spritzte, die Büste ist davon benetzt worden.«
Ellen nahm ihr Taschentuch und wischte leise die Tropfen weg.
»Laß mir den Glauben, daß er geweint hat!« bat sie.
»Bist du traurig an unserem Hochzeitsabend?«
Ellen umschlang ihn mit beiden Armen.
»Traurig wohl, James, und doch so sehr, so sehr glücklich!«
»So laß die Toten ruhen, wir aber wollen leben. Es wurde mir schwer, das wilde Täubchen zu fangen, drei Jahre lang, eine Reise um die ganze Erde war dazu nötig, und ich bin müde davon geworden — komm, Liebchen, wir wollen schlafen gehen!«

Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.