
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
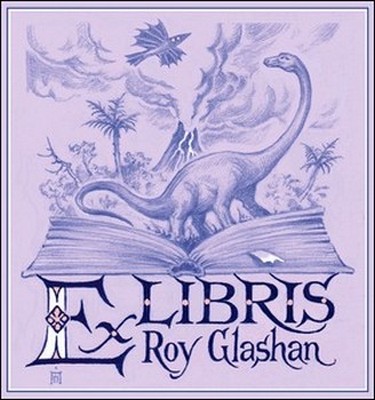

"Um die indische Kaiserkrone," Lieferung 1, 1905

"Um die indische Kaiserkrone," 1905

"Um die indische Kaiserkrone," Band II, 1905
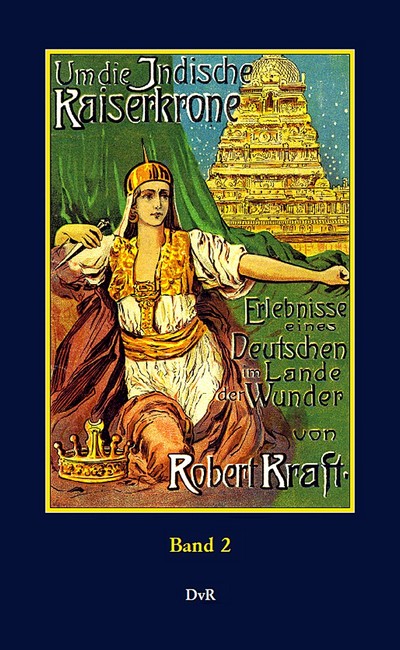
"Um die indische Kaiserkrone," Band 2
Verlag Dieter von Reeken, 2024
Am Rande des lang ausgestreckten Dschungels, wie in Indien die mit Schilf und Rohr bewachsenen Sumpfniederungen genannt werden, entsprang unter einer Sykomore eine Quelle, bildete erst ein Bassin und floss dann dem Süden zu.
Zahlreiche Spuren, große und kleine, bewiesen, dass an diesem Bassin die im Dschungel hausenden Tiere ihren Durst zu löschen pflegten.
Die Nacht war schon angebrochen, hell flimmerten am Himmel die Sterne, und es war also Zeit, dass die nächtlichen Raubtiere, Hyänen, Schakale, Panther und andere, den Dschungel verließen und der Quelle zuschlichen.
Aber sie taten es nicht. Sie heulten nur mit heiserer Stimme, welche den brennenden Durst verriet, jedoch den Dschungel zu verlassen und sich dem Wasser zu nähern, wagten sie nicht.
Daran war der Mann schuld, welcher dort unter der Sykomore saß. Er lehnte seine kleine, korpulente und eine ungeheure Muskelkraft verratende Gestalt an eine Wurzel und lauschte bewegungslos, als wäre er aus Stein gehauen, dem immer näherkommenden Heulen, Wimmern und Fauchen der Raubtiere.
Dieser Mann musste im Dschungel wie zu Hause sein. Er wusste, dass der Durst der Bestien noch nicht so groß war, dass sie sich in grenzenloser Wut auf den Störenfried warfen. Sonst hätte er sich wohl nicht so ruhig verhalten.
Näher und näher kam das entsetzliche Heulen, doch wurde es auch immer leiser. Noch unterlagen die Raubtiere dem mächtigen Einfluss, den ein furchtloser und bewegungsloser Mensch auf sie ausübt.
Da verstummte das Geschrei plötzlich völlig. Der einsame Mensch bekam noch Gesellschaft.
Zwei Reiter näherten sich in scharfem Trabe der Quelle, im Lichte der Sterne glänzten die Läufe ihrer Gewehre und die silberbeschlagenen Pistolenkolben.
Der kleine Mann stand auf und trat aus dem Schatten des Baumes. Jetzt konnte man sein Gesicht erkennen, welches von abschreckender Hässlichkeit war.
Die zwei Reiter zügelten vor ihm ihre Pferde.
»Ich wusste, dass der letzte Spross der Maharattenfürsten Wort hielt«, begann der Kleine mit einem Tone, in dem beißender Spott lag; »aber ich dachte mir auch schon, dass er nicht allein kommen würde. Die Maharatten haben es stets verstanden, ihre Feinde in Überzahl zu überraschen.«
Mit einem heftigen Satz sprang der größere der beiden Reiter aus dem Sattel, eine hohe, imposante Gestalt, nicht mehr jung.
»Nana Sahib, hüte dich, mich noch mehr zu beleidigen«, sagte er drohend, »ich bin gekommen, dir mit jeder Waffe, welche du willst, Rechenschaft zu geben, und damit genug der Worte! Ich brachte diesen treuen und verschwiegenen Diener mit, damit er die Pferde abführt, wenn du mit mir zu Fuß kämpfen willst, und dann, damit er den Ort kennt, wo der Zweikampf stattfindet. Im Übrigen bin ich es, der dich zum Zweikampf auffordert, nicht du mich. Du warst nur eher hier als ich.«
»Du bist sehr vorsichtig gewesen, als du hinterlassen hast wo man deinen Leichnam abholen soll«, höhnte Nana Sahib.
»Spotte nicht! Hast du nicht jemanden zu morgen früh hierher bestellt, im Falle, dass du nicht wieder zurückkehrst?«
»Der Fall kann nicht eintreten!«, war die selbstbewusste Antwort. »Nur du wirst deinen Tod hier finden. Die Pferde sind nicht nötig, ebenso wenig Gewehr und Pistolen. Sieh hier, dies ist meine einzige Waffe.«
Nana Sahib zog einen Yatagan, das ist ein krummes Schwert, unter dem Mantel hervor und ließ den Stahl blitzen.
Ein gleiches Schwert hatte der andere in metallener Scheide an der Seite hängen. Er zog es ebenfalls.
»So soll dies auch meine Waffe sein«, entgegnete er mit düsterem Lächeln. »Nana Sahib, ich glaube, mit solcher Waffe wirst du den Kürzeren ziehen.«
Er mochte nicht ohne Grund so sprechen. Seine hohe, schlanke Gestalt verriet Kraft und Gewandtheit zugleich, sie schien durch Kampf und Jagd gestählt zu sein. Nana Sahib dagegen zeigte nur Muskelkraft, sonst war er plump gebaut, und zum Schwertkampf gehört vor allen Dingen ein gewandter und elastischer Körper.
»Es wird sich finden, wer siegt oder fällt«, sagte Nana Sahib ruhig; »ich glaube, ich werde der Sieger bleiben. Jetzt lass den Diener sich entfernen.«
Der Große übergab seinem Begleiter Gewehr und Dolche, sowie das mantelartige Gewand aus einfacher Baumwolle und deutete nach einer Richtung, in welcher der Inder mit beiden Pferden verschwand.
»Ich bin bereit!«, sagte der Große.
Nana Sahib warf ebenfalls das lange Gewand ab, welches bei ihm aber aus schwerer, indischer Seide bestand. Beide Männer standen sich in enganschließender Kleidung gegenüber, den blanken Yatagan in der Faust.
Der Große stellte sich gleich in Fechtpositur, Nana Sahib nicht. Er legte noch einmal das Schwert zu Boden und wickelte den Mantel um seinen linken Unterarm.
»Wie fechten wir?«, fragte der Große.
»Wir fechten überhaupt nicht!«
»Was?«, rief der andere erstaunt.
»Nein, mache dich bereit, eine andere Art von Zweikampf zu, bestehen. Du rühmtest dich, Sirbhanga, ein Maharatte aus den Bergen zu sein, ein Krieger, dessen Mut um so mehr wächst, je größer die Gefahr ist, du willst der letzte direkte Abkömmling des Maharattenfürsten Sewadschi sein...«
»Zweifelst du, dass ich es bin, wo mich doch selbst Bahadur anerkennt?«, unterbrach ihn der mit Sirbhanga Angeredete finster.
»Wohlan, so beweise, dass du des Sewadschi Nachkomme bist!«
»Was für einen Zweikampf hast du gewählt?«, fragte Sirbhanga stolz. »Ich werde vor nichts zurückschrecken.«
»Auch nicht vor einem Kampf mit einem Königstiger?«
Der Große zuckte doch etwas zusammen.
»Wie, du wolltest es wagen, mit dem Yatagan in der Hand dem Beherrscher des Dschungels gegenüberzutreten?«, fragte er wie scheu.
Nana Sahib lachte höhnisch auf.
»Sieh, wie schnell dein Mut sinkt! Du willst ein Nachkomme des heldenmütigen Sewadschi sein und bebst zurück, wenn du das ausführen sollst, was er getan hat. Denn Sewadschi hat, nur mit dem Dolch bewaffnet, einen Königstiger im Kampf getötet. Nein, Sirbhanga, du bist ein Prahler, und ich hatte recht, als ich mich gestern Abend beleidigt fühlte, als du dich am Tisch näher zu Bahadur als ich setzen wolltest. Mit vollem Recht warf ich dir vor, dass du nichts weiter bist als der Radscha eines armseligen Gebirgsvolkes, so arm, dass du nur Kleider aus Baumwolle tragen und deinen Schwertgriff nur mit buntem Glas schmücken kannst. Ich dagegen bin ein mächtiger, reicher Fürst; Tausende von Kriegern gehorchen mir!«
»Der Neffe von Bahadur bist du, weiter nichts«, unterbrach ihn Sirbhanga heftig, »nur deshalb hast du die Radschawürde und Reichtum erhalten. Mir dagegen gebührt die Herrschaft eines Radschas, ja, die Herrschaft über ganz Indien, denn meine Vorfahren hatten sie in Händen. Und geht nicht durch ganz Indien die Prophezeiung, dass aus meinem Blut einst der Herrscher über Indien entstehen wird, welcher die Faringis vernichten wird? Glaubt nicht Bahadur selbst an diese Prophezeiung?«
»Du irrst, nicht dein Samen, sondern die Tochter Sewadschis, die er in der Nirwana mit der Göttin Kali erzeugt hat, wird die Vernichtung über die Faringis bringen und die alte Herrschaft der Maharatten wieder aufrichten. Dein Sohn soll diese Königin ehelichen, weil es nicht gut ist, dass ein Weib regiert; also nur durch Heirat wird dein Sohn König der Inder werden.«
»Das bleibt sich gleich. Ich bin der Ahne der indischen Könige, du bist nichts weiter als ein Hindu, noch dazu ein mohammedanischer, der durch Verwandtschaft mit dem Großmogul die Radschawürde erlangt hat.«
»Genug davon! Als ich mich weigerte, mich hinter dir an den Tisch zu setzen, entspann sich zwischen uns ein Streit, den zu schlichten Bahadur nicht für seine Pflicht hielt. Statt dich mit mir zu einigen, ergingst du dich in maßlosen Beleidigungen, du nanntest mich einen Emporkömmling, einen Mann, der sich durch Schmeichelei emporgeschwungen hätte, einen Sklaven von Weibern und so weiter. Gibst du zu, dass ich der beleidigte Teil bin?«
»Und du nanntest mich in Gegenwart der übrigen Fürsten einen Bettler, einen anmaßenden Menschen.«
»Wohl; aber begannst du nicht?«
»Ich begann, weil mich der Zorn über deine Anmaßung überwältigte.«
»Also du gestehst wenigstens ein, dass nicht ich, sondern du mit den Beleidigungen begannst?«, fragte Nana Sahib nochmals.
»Nein, schon dass du mir meinen Platz streitig machtest, war für mich eine Beleidigung. Deshalb habe ich dich zum Zweikampf hierher bestellt.«
»So habe ich also auch das Recht, die Art des Zweikampfes zu bestimmen.«
»Du hast es. Der geforderte Teil hat stets dieses Recht.«
»Wohlan, so wollen wir der Tigerin, dessen Junges ich raubte, mit dem Yatagan gegenübertreten. Nimm einen Stein, Sirbhanga, und lass uns nach indischer Weise das Schicksal befragen, wer von uns den Kampf bestehen soll.«
Der Große zögerte.
»Wie, ist das dein Ernst?«
»Hahaha, du wärest ein würdiger Nachfolger des starken Sewadschi«, hohnlachte Nana Sahib; »gleich ihm rühmst auch du dich, dass sich niemand mit dir messen kann. Sewadschi durfte das, denn er hatte seine unübertreffliche Tapferkeit bewiesen, indem er einen Königstiger nur mit dem Dolche tötete. Du aber bist ein Prahler.«
»Niemand kann sich mit mir messen, behaupte ich«, rief Sirbhanga, sich aufrichtend, »und zum Beweise dessen werde ich freiwillig zuerst den Kampf mit der Tigerin beginnen! Töte ich sie aber, dann werde ich dich noch einmal zum Zweikampf auffordern.«
»Nimm erst den Stein, damit du siehst, dass auch ich bereit bin, mit dem furchtbaren Raubtier zu kämpfen. Niemand soll sagen können, dass Nana Sahib ein Feigling ist.«
»Das habe ich auch nicht gesagt. Doch ich befrage nicht erst das Schicksal, ob ich oder du den Kampf beginnst. Ich will dir beweisen, dass ich ein Nachkomme Sewadschis bin. Hast du aber über die Tiere des Dschungels zu befehlen? Kommt auf deinen Wunsch etwa eine Tigerin her, dass ich mit ihr kämpfe?«
»Höre mich an, Sirbhanga, ehe du spottest, und wickle deinen Mantel um den linken Arm, damit du den Feind abhalten kannst. Ja, ich kann eine Tigerin hierher rufen. Vor einigen Tagen fand ich nicht weit von hier den Schlafplatz einer solchen und auf ihr ein Junges. Ich nahm es mit, um es großzuziehen. Jetzt streift die Mutter umher und sucht ihr Kind. Glaubst du nicht, dass sie den Hilfeschrei desselben hören und hierher kommen wird, um es zu befreien, und seine Räuber zu bestrafen?«
Nana Sahib ging an den Baumstamm zurück und kam mit einem Bündel wieder. Als er das Tuch auseinander breitete, sah Sirbhanga eine kleine Tigerkatze daliegen, die Füße gefesselt, die Schnauze mit einem Lappen umwickelt sodass sie keinen Laut von sich geben konnte.
»Rufe mit ihr deine Gegnerin im Kampfe herbei«, sagte Nana Sahib.
Der andere hatte den linken Unterarm mit dem Mantel umwickelt. Mit fest zusammengepressten Lippen, das Schwert in der Hand, bog er sich hinab, die Fesseln der Katze zu durchschneiden. Er war ein Sohn der Wildnis, und wusste, wie er die Mutter, welche ihr letztes Junges suchte, sofort herbeirufen konnte.
Das Heulen des Raubgesindels, das vor Durst ganz heiser geworden, verstummte plötzlich, dafür erscholl ein donnerndes Gebrüll, zwar noch weit entfernt, aber doch schon in unheimlicher Weise.
Sirbhanga hatte sich wieder aufgerichtet.
»Nun? Sinkt dem Nachkommen Sewadschis wieder der Mut?«, spottete Nana Sahib.
»Nein, ich fürchte mich nicht und werde die Tigerin reizen«, entgegnete Sirbhanga. »Sei unbesorgt, dass ich sie auf dich hetze. Doch erst noch ein Wort, Nana Sahib. Du kennst mein Schicksal?«
»Ich kenne es. Was willst du noch?«
»Mein Weib ist verschwunden, ich weiß nicht wohin, nicht, ob es gestorben ist oder noch lebt.«
»Deine Frau musste dem Knaben das Leben in der tiefsten Verborgenheit schenken, nur von zeichenkundigen Brahmanen umgeben.«
»Wo mag der Knabe, mein Sohn, sein?«, fragte Sirbhanga leise, und seine Stimme zitterte.
»Wie soll ich das wissen? Freue dich, Sirbhanga, selbst wenn du in den Tod gehst. Auch ich, dein Feind, muss gestehen, dass du ein glücklicher Mensch bist. Dein Sohn ist bestimmt, dereinst König von Indien zu werden, der Befreier seines Vaterlands.«
»Ich werde seinen Triumph erleben.«
»Vielleicht, vielleicht auch nicht.«
»Und wenn ich sterben sollte, Nana Sahib, willst du ihm sagen, wie sein Vater gestorben ist?«
»Gern will ich deinen Wunsch erfüllen.«
»Dass ich wie ein Held im furchtbaren Zweikampf fiel, so, wie es eines Nachkommens Sedwadschis würdig ist?«
»Ich werde ihm die Wahrheit sagen. Jetzt zögere nicht länger, und fällst du nicht und bist noch stark genug, so verspreche ich dir, noch mit dir Auge in Auge zu kämpfen.«
Schnell entschlossen bückte sich Sirbhanga und löste die Fesseln, wie das Kopftuch der kleinen Katze, welche er dabei mit der linken, umwickelten Faust fest auf den Boden drückte. Das gequälte Tier stieß ein jammerndes, durchdringendes Winseln aus, und sofort erscholl ein donnerndes Gebrüll.
Es raschelte in dem Schilf, am Rande erschien die entsetzenerregende Gestalt eines Königstigers.
Mit glühenden Augen und weitaufgerissenem Rachen stand das furchtbare Raubtier da, ein heiseres Fauchen ausstoßend. Jetzt duckte es sich zum Sprunge zusammen.
Sirbhanga stieß, während Nana Sahib zurücksprang, das kurze Schwert ins Herz der kleinen Katze, ein röchelnder Laut entfuhr dem Tier, dann schleuderte er es der Mutter zu.
Gleichzeitig sprang diese gegen den kühnen Mann an. Wie ein gelber Streifen sauste der Körper der Bestie durch die Luft, verfehlte aber das Ziel.

Sirbhanga war einen Schritt seitwärts getreten, das Schwert zum Stoß erhoben. Doch schneller als der Blitz drehte sich der Tiger um — die beiden standen sich Auge in Auge gegenüber.
Ehe der Tiger sich noch aufrichten konnte, um Gebrauch von den schrecklichen Zähnen und Pranken zu machen, fuhr ihm schon die linke Faust des Inders in den schäumenden Rachen, und gleichzeitig der Yatagan nach der Herzgegend.
Nana Sahib hörte noch ein Malmen und Krachen von Knochen, sah noch eine blutige Masse sich am Boden wälzen, dann floh er in weiten Sprüngen davon, den Gegner dem Raubtier allein überlassend. Wie mochte der Ausgang des Kampfes wohl sein? Nun, das war nicht zweifelhaft. Nana Sahib grübelte nicht darüber nach.
Als er das Ende des Dschungeldickichts erreicht hatte, kam er in eine etwas hügelige Gegend, und als er um eine Ecke bog, sah er die erleuchteten Fenster eines hohen, schlossähnlichen Gebäudes schimmern, wie solche die indischen Fürsten als Jagdschlösser oft in den unwirtlichen Wildnissen besitzen.
Erst in der Nähe des Tores mäßigte Nana Sahib seinen raschen Lauf und sammelte Atem. Als er die niedergelassene Zugbrücke betrat, hatte er sich wieder vollständig beruhigt.
Der Torhüter ließ den Radscha mit einer tiefen Verbeugung eintreten. Das Schloss gehörte Nana Sahib.
Ohne sich aufzuhalten, eilte er in ein Gemach, wo ein alter, herkulisch gebauter Mann in überreicher Kleidung, Haar und Bart weiß und gewellt, und ein kleiner, magerer Mann mit gelben, eingefallenen Gesichtszügen seiner zu warten schienen.
Ersterer war Bahadur, der Großmogul von Indien, welcher sich ebenso wie noch zahlreiche andere Fürsten während eines Jagdvergnügens auf dem Schlosse seines Neffen aufhielt. Bahadur war noch im Vollbesitz aller seiner früheren Rechte und Würden, aber — das wusste er selbst — nur so lange, wie es den Engländern gefiel.
Der kleine Mann war niemand anders als Timur Dhar, der mit Bahadur sehr vertraut zu sprechen schien.
Hochatmend trat der Radscha in das Turmgemach.
»Nana Sahib!«, riefen beide Männer gleichzeitig, als wären sie erstaunt.
»Hattet ihr vielleicht Sirbhanga erwartet?«, war die etwas gereizte Antwort.
»Wir wundern uns, dass du schon jetzt kommst. Hast du unser Ziel erreicht?«
»Es ging alles nach Wunsch, Sirbhanga ist tot, zerrissen von der Tigerin.«
»Hast du dich von seinem Tode selbst überzeugt?«, fragte Timur Dhar.
»Das durfte ich nicht. Der Tigerin war nicht zu trauen. Durch den Mord des Jungen außer sich, durch den Kampf gereizt, hätte sie sich leicht auf mich stürzen können.«
»So hat Sirbhanga das gewagt, was du nicht gewagt hättest?«
Nana Sahib maß den Gaukler mit großen Augen.
»Wie? Du machst mir Vorwürfe, du, der du den Plan zurechtgelegt hast?«, fragte er schneidend.
»Sinkolin hat einen unbesonnenen Ausspruch getan«, mengte sich Bahadur schnell dazwischen, »was wohl sehr, sehr selten vorkommen mag. Sein Rat war wie gewöhnlich der beste, den überhaupt jemand geben konnte. Niemand als Sinkolin wäre auf den Einfall gekommen, durch den wir uns so schnell des gefürchteten, aber seines Stolzes wegen auch so verhassten Sirbhangas entledigen konnten. Er war uns allen ein Dorn im Auge, doch wir mussten ihn achten, denn er ist wirklich ein Nachkomme Sewadschis, und die Krone gebührte ihm, nicht mir. Ich sterbe kinderlos, also würde ich sie ihm gern überlassen, wenn er der Mann gewesen wäre, das ungeheure Volk der Inder zu lenken. Er war es nicht, er war nichts weiter als ein rauher, furchtloser und furchtbarer Kämpfer, ein Anführer, aber kein Lenker einer Nation. Doch aus seinem Blute muss der König Indiens hervorgehen; wir selbst haben dafür gesorgt, dass die Sage immer mehr unter ihnen verbreitet wird. Wohlan, wir sind nicht mehr weit ab vom Ziel! Sirbhanga ist beseitigt. Sinkolin, lass das fremde Mädchen, die Begum von Dschansi, unter Blitz und Donner den abergläubischen Indern erscheinen; erst ihrem Volk allein, dann sorge dafür, dass ihr Erstehen bekannt wird. Auch ihren Gemahl werden wir zu ziehen wissen, schon befindet er sich in unserem Lande. Deiner Klugheit, Sinkolin, wird es ein Leichtes sein, ihn zu dem zu machen, wozu wir ihn haben wollen. Und dir, Nana Sahib«, wandte sich der Fürst an den sich tief verbeugenden Radscha, »dir spreche ich meinen Dank aus für die Ausführung des von Sinkolin angelegten Planes. Ich habe mich jetzt in dir so wenig wie früher getäuscht. Du hast deine Sache meisterhaft gemacht, vom Anfang an, als du den Streit mit Sirbhanga begannst, bis jetzt, da du uns die Nachricht von seinem Tode bringst. Ah, Nana Sahib, wir sind nicht mehr weit entfernt von unserm Ziel, bald werden wir die verfluchten Faringis, welche uns alles geraubt haben, was uns gehörte, welche uns wie Puppen nur mit Flittergold ausstatten, welche uns —«
Der greise Mann, der erst mit diplomatischer Ruhe gesprochen hatte, geriet plötzlich in Wut, und zwar in eine ganz unbeschreiblich maßlose. Seine sonst schönen Gesichtszüge verzerrten sich vor Hass, seine Augen sprühten Flammen.
Bahadur war ein ausgezeichneter Feldherr und Diplomat, der aber eine grenzenlose Leidenschaft besaß, die er nicht zu zügeln vermochte: den Jähzorn, und dieser brach bei ihm stets aus, wenn er von Engländern sprechen musste.
Diejenigen, welche die Geschichte des indischen Aufstandes kennen, wissen, dass Bahadur damals mit Hilfe seiner Verbündeten ganz sicher über die Engländer gesiegt hätte, wenn er seine Siege auszunutzen und das kriegerische Bergvolk der Sikhs für sich zu gewinnen verstanden hätte. In seinem blinden, fanatischen Hass aber verlor er stets die Besinnung und versuchte, anstatt sich schnell in eine gesicherte Stellung zurückzuziehen, den Feind jedes Mal bis auf den letzten Mann zu vernichten.
Sein Wahlspruch war nicht, die Engländer sollten Indien räumen, sondern, alle Engländer sollten in Indien ihren Tod finden.
Dies genügt wohl, um Bahadur, den ersten indischen Fürsten, zu charakterisieren.
Während sich Nana Sahib dem Großmogul gegenüber äußerst demütig verhielt, sich jedes Mal, wenn derselbe von ihm sprach, tief verbeugte, blieb der als Sinkolin angeredete Gaukler völlig gleichgültig. Ja, er wagte sogar, den Großmogul mit einer geringschätzenden Handbewegung zu unterbrechen.
»Ereifere dich nicht, Bahadur, denn damit erreichst du nichts«, sagte er, »unsere Götter wollen keine Worte, sondern Taten. Lass uns alles tun, was in unseren Kräften steht, und die Kali um Hilfe anrufen. Jetzt erst das zunächst Liegende: Nana Sahib, du weißt also nicht, ob Sirbhanga wirklich tot ist?«
»Ich hörte seine Knochen zermalmen, ich sah die Tigerin auf ihm liegen, dann entfernte ich mich.«
»So werde ich mich dann selbst überzeugen, was vorgegangen ist, seine etwaigen Überreste hierher bringen lassen und die Tigerin töten, wenn sie nicht schon tot ist.«
»Das ist wohl kaum möglich«, lächelte Nana Sahib.
»Warum nicht? Sirbhanga war ein Fürst der wilden Berge, als Jäger berühmt. Dass er oftmals den Panther im Einzelkampf getötet hat, das weiß ich.«
»Ein Panther ist kein Königstiger.«
»Nun, ich werde sehen. Getötet muss die Tigerin auf jeden Fall werden.«
»Warum?«, fragte Nana Sahib missmutig.
»Damit Sie nicht an uns zur Verräterin wird. Jetzt erzähle. Nana Sahib, wie der Zweikampf stattfand.«
Nana Sahib erzählte sein Erlebnis in der Dschungel.
»Gut«, sagte Sinkolin dann, welcher hier allein maßgebend zu sein schien, »so gehe du, Bahadur, jetzt mit Nana Sahib zu den Gästen und verkünde ihnen den Ausgang des Zweikampfes, dessen Ursache sie alle kennen. Ich mische mich unter die Diener und beobachte den Eindruck, den die Nachricht vom Tode Sirbhangas auf sie macht.«
Sinkolin verließ das Gemach, ebenso Bahadur und Nana Sahib, diese aber durch eine andere Tür als jener.
Die Letzteren traten nach einer Wanderung durch lange, dunkle Gänge in einen geräumigen Saal, in welchem an einer langen Tafel gegen zwanzig vornehme Inder saßen.
Auch wenn ihre Kleidung nicht so überaus reich gewesen wäre, mit Diamanten besetzt, wo sich diese nur anbringen ließen, ebenso wie die aus dem Gürtel hervorragenden Dolchgriffe und Pistolenkolben von Edelsteinen strotzten — so hätte man doch schon an den stolzen, bronzenen Gesichtern, aus denen Herrsch- und Ehrsucht sprachen, erraten, dass hier nur die Vornehmsten Indiens versammelt waren. Wenn auch nicht alle Radschas oder Fürsten, so war doch keiner darunter, der nicht aus einem altangesehenen Hause gestammt hätte.
Unzählige Diener, zum Teil rot, zum Teil blau gekleidet, eilten hin und her und bedienten die Jagdgäste, welche nicht von Nana Sahib, sondern von Bahadur hierher geladen worden waren.
Man speiste hier von goldenen Schüsseln; ist doch der Reichtum der indischen Fürsten ein geradezu fabelhafter.
Dass auf der Tafel neben den schweren, südländischen Getränken, Likören und so weiter auch Champagner vorhanden, war selbstverständlich. Dieser französische Wein hat die ganze Welt erobert, jeder Chinese oder Inder, der ein großes Haus macht, bewirtet seinen Gast mit Champagner.
Das lebhafte Gespräch verstummte, als Bahadur und Nana Sahib eintraten; aller Augen richteten sich besonders auf letzteren. Die Diener entledigten sich schnell ihrer Schüsseln und Flaschen und traten in dreifacher Reihe hinter die Stühle ihrer Herren, wie üblich rechts die roten, links die blauen.
Bahadur hatte auf einem etwas erhöhten Stuhle Platz genommen, ließ sich ein Glas schäumenden Champagner reichen und trank es langsam aus.
In dem Saale war tiefste Stille eingetreten, man wusste, dass jetzt etwas Wichtiges verkündet werden sollte. Nana Sahib war lange entfernt gewesen.
Bahadur stand auf und streckte beide Arme nach den Seiten aus.
»Geht!«
Sofort verneigten sich ungefähr hundert Diener mit über dem Kopf erhobenen Armen und marschierten hintereinander zum Saale hinaus. Nur einer blieb zurück, der, welcher vorhin mit Bahadur zugleich eingetreten war, ein kleiner; magerer Kerl mit großem, schwarzem Vollbart. Es war der Leibdiener des Großmoguls, sein beständiger Begleiter, der ihn zugleich barbierte, für diesen galt der Befehl nicht, er durfte im Saale bleiben, selbst wenn das Wichtigste und Geheimnisvollste besprochen worden wäre.
Er stand mit über der Brust gekreuzten Armen hinter dem Stuhle Bahadurs und ließ seine kleinen, scharfen Augen über die Gäste schweifen.
»Radschas und Maharadschas Indiens, meine Freunde«, begann Bahadur mit tiefer, dröhnender Stimme, als sich die Tür hinter dem letzten der Diener geschlossen hatte, »ein Stuhl ist leer an unserer Tafel. Es fehlt ein Fürst in unserer Mitte — Sirbhanga, der Radscha von Dschansi mit dem Ehrentitel Brahma, weil aus seiner Familie Brahmanen hervorgehen dürfen. Doch Sirbhanga war kein über Fehden grübelnder Mann, er ist ein Krieger, ein Kampfesheld gewesen —«
»Gewesen?«, rief der Bahadur gegenübersitzende Inder wie erschrocken.
»Gewesen!«, wiederholte Bahadur. »Und du, Abdul Hammed, bist der einzige unter meinen Gästen, der darüber staunt. Da Nana Sahib wieder in unserer Mitte ist, müsstest du wissen, dass Sirbhanga Brahma nicht mehr zu den Lebenden zählt — Sirbhanga ist tot!«
Bahadur machte eine Pause. Unter den Gästen herrschte ein drückendes Schweigen, aus jedem Auge, aus jedem Zug sprach die größte Spannung.
»Wir alle waren gestern Abend Zeuge«, fuhr Bahadur dann fort, »wie sich zwischen Sirbhanga und dem edlen Nana Sahib ein Streit entspann um die Ehre, wer mir zur Linken sitzen solle. Denn den Platz zur Rechten kann niemand dem Maharadscha von Oudh streitig machen. Beide konnten sich nicht einigen, Sirbhanga bestand darauf, weil er ein Nachkomme Sewadschis ist. Nana Sahib, weil er mir verwandtschaftlich näher steht. Da forderte der heißblütige Sirbhanga meinen Neffen auf, den Zweikampf entscheiden zu lassen, wem die Ehre gebühre. Ich konnte nichts weiter tun, als eine Bedenkzeit von vierundzwanzig Stunden zu befehlen, doch auch nach Ablauf dieser Frist hatte sich das Blut noch nicht abgekühlt — heute Abend forderte Sirbhanga abermals Nana Sahib heraus, denn inzwischen waren noch andere Beleidigungen gefallen. Nana Sahib nahm die Forderung natürlich an, und vor einer Stunde ist Sirbhanga im Kampfe gefallen.«
Nana Sahib sah überall fast ungläubige Gesichter, denn Sirbhanga war allgemein als ein nahezu unüberwindlicher Kämpfer bekannt. Auf einen Wink Bahadurs erhob sich ersterer und erzählte, auf welche Weise der Zweikampf stattgefunden hatte.
Jetzt wurden überall Rufe des Erstaunens laut.
»Und seine Leiche?«, rief ein Inder. »Soll der Körper des edlen Maharattenfürsten den Raubtieren zum Fraße dienen?«
»Wir holen ihn selbst«, entgegnete Bahadur. »Nana Sahib wird uns nach dem Orte führen, wo der fürchterliche Kampf stattgefunden hat. Schon werden die Rosse gezäumt und Fackeln bereitgehalten. Wohl niemand wird sich ausschließen, wenn wir die Leiche holen oder sie dem Tiger abjagen! Halt! rief Bahadur, als sich die Gäste erheben wollten. »Erst etwas anderes, noch Wichtigeres! Sirbhanga ist tot — hat niemand etwas zu sagen?«
Ein junger, feuriger Inder sprang auf.
»Sirbhanga ist tot«, rief er, »und das Volk von Dschansi hat keinen Fürsten mehr! Viel habe ich von meinem Vater über ihn erzählen hören, rätselhafte Begebenheiten; und nun, da er tot ist, müssen sich diese Rätsel lösen! Wo ist Sirbhangas Sohn, der vor achtzehn Jahren in einer Höhle geboren sein soll? Wo ist die Mutter, die ihm so geheimnisvoll das Leben gegeben haben soll? Wir kennen ihr Grab nicht. Und wo endlich ist das fremde Mädchen, das nach dem Tode Sirbhangas in Dschansi erscheinen soll, um die Engländer zu vernichten, wie sie selbst die Tochter der Göttin Kali, erzeugt von Sewadschi, sein soll? Noch sehe ich keine Wunder.«
Es lag unverkennbarer Hohn in den Worten des jungen Inders, und Bahadur wie noch manche andere runzelten die Stirn.
»Zweifelst du daran«, fragte Bahadur, »dass die Angaben des alten Brahmanen am See, der das Weib Sirbhangas vor achtzehn Jahren in die Berge führte und sie dort in einer unbekannten Höhle entbunden hat, die Wahrheit enthalten? Hüte dich, des Glaubens der Inder zu spotten! So gewiss Sirbhanga tot ist, so gewiss wird auch das Mädchen aus Nirwana, dem fremden Lande, erscheinen, denn die Göttin Kali hat es uns durch ihre Priester versprochen. Ihre Tochter, die Sewadschi mit ihr gezeugt, wird Indien von den verruchten Eindringlingen reinigen; wie ihre Mutter wird sie nur Vernichtung kennen, und ist Indien frei, dann soll auch Sirbhangas Sohn erscheinen, ein Mensch, kein Gott, und indem er die Vernichterin freit, macht er auch sie zum Menschen, und statt zu vernichten, wird sie von da an in Liebe neben ihrem Gemahl das herrliche, freie Indien regieren —«
Bahadur brach ab und lauschte. Im Hofe klopfte man ans Tor; er hörte Pferdehufe die Steinfliesen stampfen und einen Wortwechsel, der immer lauter wurde.
Doch Bahadur wollte noch zum Schluss kommen. Er hob beide Hände empor und blickte wie begeistert zur hohen Decke des Saales hinauf, die, mit goldenen Sternen verziert, den Nachthimmel darstellte.
»Heilige Kali«, rief er mit unterdrückter Stimme, »schicke uns endlich deine herrliche, siegreiche und furchtbare Tochter; sende sie aus dem fremden Lande, wo sie träumt, zu uns, wir wollen sie mit Jauchzen und Ehren empfangen. Sieh, die Zeit ist erfüllt, Sirbhanga ist tot, und wir sind bereit. Mächtige Kali, vergiss dein Versprechen und dein Volk nicht —«
Wieder musste Bahadur abbrechen, denn drunten wurde mit schmetterndem Schlag gegen das Tor gepocht.
»Aufgemacht! Aufgemacht!«, schrie jetzt eine Stimme auf englisch. »Oder ich haue diese lumpige Tür kurz und klein! Glaubt ihr Halunken denn, ich lasse so einen Kerl, der eine Tigerkatze nur mit dem Schwerte tot sticht, wie einen Hund an der Erde verrecken? Er soll in einem Bett sterben, wenn er auch nur ein Heide ist.«
Gleichzeitig erfolgten wieder heftige Schläge.
»Das sind die Engländer, sie haben Sirbhanga gefunden! Und wenn er noch lebt, dagegen die Tigerin tot ist«, flüsterte der hinter Bahadur stehende Diener seinem Herrn zu, »dann wehe uns!«
Damit eilte er ohne Aufforderung hinaus, Bahadur und die Gäste in Bestürzung zurücklassend.
Erschrocken flatterten die Vögel aus ihrem leichten Schlafe von den Ästen auf, kleine Säugetiere huschten und brachen durch das Unterholz, und mit furchtsamem Geheul zogen sich die vierfüßigen Räuber zurück, wenn sich ihnen die vielen Fackeln näherten, die von durch den Urwald marschierenden Kulis geschwungen wurden.
Sie begleiteten einen Trupp Europäer, der noch zu so später Nachtzeit auf schmalem, unebenem Wege durch den tropischen Wald zog — eine mühsame Wanderung.
Dem Zuge voran schritten zwei Männer, einer groß, der andere klein, mit schweren Büchsen bewaffnet und in einer Kleidung, wie sie von Trappern in den Wildnissen Amerikas getragen wird. Diese beiden Männer waren von keinem Fackelträger begleitet. Sie brauchten kein Licht, um den Weg zu erkennen, denn es waren keine anderen als Dick und Charly, deren Augen die Finsternis durchdringen konnten, und die mit dem Instinkt eines Spürhundes jede Anwesenheit eines unheildrohenden Wesens, sei es Tier oder Mensch, zu wittern vermochten.
In einer Entfernung von etwa zwanzig Schritten folgte, von Fackelträgern umgeben, der eigentliche Trupp, bestehend aus der Gesellschaft, die sich in England zusammengefunden hatte, um den Felsentempel der Göttin Kali aufzusuchen.
Die weiblichen Mitglieder der Expedition saßen auf Maultieren, welche in Indien in stattlicher Größe gezogen werden, alle übrigen waren zu Fuß. Eine Anzahl nachfolgender Maultiere trug das Gepäck.
Es existierten damals in Indien zwar schon viele Eisenbahnen, alle größeren Städte waren durch Schienenwege miteinander verbunden, aber Indien ist groß — oft musste man tagelang zu Fuß oder zu Pferd reisen, war das Ziel einmal ein anderes als eine große Stadt.
Schon seit Wochen zog die Gesellschaft kreuz und quer durch Indien mit Kiong Jang als Führer, doch immer schüttelte der Chinese den Kopf — er hatte noch kein Erinnerungszeichen an den Weg seiner Flucht gefunden.
Oft fanden wichtige Unterredungen zwischen Reihenfels, Hira Singh und Kiong Jang statt, aber zu einem Resultate kam man nicht.
Wie ein steuerloses Schiff trieb die Gesellschaft in dem ungeheuren Lande umher. Jetzt befand sie sich auf dem Wege nach Delhi, der Hauptstadt von Oudh, der Residenz des Großmoguls und überhaupt der bedeutendsten Stadt des Landes.
Die Nacht hatte sie überrascht. Da nach Aussage der hier bekannten Inder, die als Fackelträger engagiert waren, eine in englischem Besitze befindliche Plantage nicht mehr weit entfernt war, hatte Reihenfels beschlossen, diese aufzusuchen, anstatt wieder am Abend ein Lager aufschlagen zu lassen, was schon oft geschehen war.
Alles dazu Nötige führte er auf den Maultieren mit sich.
Reihenfels galt als Haupt der Karawane; willenlos gehorchte man seinem Befehl, mit Ausnahme Augusts, mit dem sich Reihenfels eine Last auferlegt hatte. Dieser Bursche fügte sich nicht ohne weiteres den Anforderungen, die sein Herr an die Mitreisenden stellte, bei Aufbürdung jeder neuen Reisebeschwerde war seines Räsonierens kein Ende.
Die beiden vorausschreitenden Pelzjäger wechselten kein Wort; stumm gingen sie nebeneinander her, ganz in ihre Aufgabe vertieft, eine etwaige Gefahr aufzuspüren.
Nicht so still war es bei dem nachfolgenden Trupp.
Die halbnackten Kulis schwangen fortwährend die lodernden Fackeln kreisförmig durch die Luft und stießen dabei gellende Schreie aus, sodass ein endloses Geheul durch den Wald tönte. Sie taten dies, damit die Raubtiere dadurch erschreckt werden sollten, sodass sie flohen und nicht etwa Lust bekamen, sich einen Menschen aus dem Zuge als Beute zu holen.
Auf diese Weise wird in Indien, wenigstens während der Nacht, jeder Wald passiert; jeder reisende Europäer muss solche Spektakelmacher engagieren.
An ein stilles Träumen war daher nicht zu denken, und um die annehmende Müdigkeit zu verscheuchen, unterhielt man sich. Das Gespräch musste fast schreiend geführt werden, denn vor dem Heulen der Inder verstand man kaum sein eigenes Wort.
Reihenfels hatte eben der erschöpften Lady Carter versichert, dass sie nicht mehr weit von ihrem Ziele entfernt seien. In ein bis zwei Stunden könnten sie die Plantage erreicht haben, wo sie sicher als Landsleute freundliche Aufnahme finden würden.
»Ein bis zwei Stunden«, murrte neben Reibenfels August, »und das nennen Sie nicht mehr weit. Ich danke für Obst und anderes Gemüse, solch einen Weg soll der Teufel holen; an den Wurzeln stößt mau sich die Schienbeine kaputt, und die Dornen zerfetzen die Haut. Meine Füße brennen wie Pfeffer, ich kann, weiß Gott, nicht mehr gehen.«
Reihenfels, welcher sonst bei grundlosen Klagen recht ungeduldig werden konnte, sprang mit seinem Diener, ganz gegen die Gewohnheit, immer recht liebenswürdig um.
»Mein lieber August«, sagte er freundlich, »wir haben kein besseres Los als du. Wir alle sind müde, aber niemand als du allein klagt.«
»Ja, die anderen sind das Rennen gewöhnt, wie zum Beispiel mein Bruder und der andere Kerl da vorn, ich aber nicht. Und die nackten Kulis, na, das sind eben Wilde, keine Menschen.«
»Und Hira Singh und Kiong Jang?«
»Bäh, die bestehen nur aus Haut und Knochen, die haben gar kein Gewicht.«
»Und ich? Glaubst du, mir schmerzen die Füße nicht von dem langen Gehen?«
»Ja, warum haben Sie sich denn in solch ein dummes Unternehmen eingelassen?«, Reihenfels verlor die Geduld noch nicht.
»Wenn es möglich ist, so erwerbe ich auf der Plantage einige Reittiere, und dann werden wir ein bequemes Reisen haben.«
»Jawohl, und reichen sie nicht, dann werde ich wohl wieder derjenige sein, der nebenhertroddeln kann.«
»Du machst mir doch nicht etwa Vorwürfe, weil ich die Maultiere den Damen überlassen habe? Das sähe wohl schön aus, wenn du rittest und Lady Carter ginge zu Fuß nebenher! Es tut mir leid, dass ich, als wir die Station verließen, nur so viel Maulesel auftreiben konnte, wie zum Forschaffen des Gepäcks eben notwendig sind. Die armen Tiere sind sowieso schon überlastet.«
»Dann macht es auch nichts, wenn so ein Vieh einen Zentner mehr trägt.« Reihenfels unterdrückte noch einmal seinen Unwillen über den faulen Diener.
»Solange nicht jemand zum Gehen total unfähig ist«, sagte er ernst, »besteigt niemand ein Maultier, denn dann müsste diesem die Ladung abgenommen und mit ihr die Inder belastet werden. Das habe ich von vornherein gesagt und dabei bleibt es. Füge dich also ins Unvermeidliche!«
Er verließ den mürrischen, brummenden August.
»Kerl, brülle mir nicht so ins Ohr«, schrie dieser jetzt einen Kuli an, der eben wie ein Teufel aufheulte, »oder ich haue dir eine runter, dass du den Himmel für einen Dudelsack anstehst!«
Er holte wirklich zum Schlage aus, und der Schreiende machte sich eiligst aus der Nähe des aufgebrachten Menschen. In diesem Augenblicke blieben die beiden Vorläufer stehen und erwarteten den Trupp. Man befand sich am Rande des Waldes, vor ihnen tauchten Dschungeln auf, welche sich rechts endlos ausbreiteten, links sich zwischen Hügeln verliefen.
Schon jetzt merkte man, dass der Boden weich wurde, und im Sternenlichte konnte man erkennen, dass eine sumpfige Strecke zu überwinden war, wie man schon so manche mit vielen Schwierigkeiten passiert hatte.
»Sumpf«, sagte Dick einfach zu Reihenfels.
»Es scheint so, doch er erstreckt sich nur nach rechts hin. Ist dies nicht die Gegend, wo wir in dieser Richtung abschwenken müssen?«, wandte er sich an einen Fackelträger.
»Ja, Sahib.«
»Wie weit ist es von hier noch nach der Plantage?«
»Wenn die Maultiere nicht zu tief versinken, noch zwei bis drei Stunden, Sahib.«
»Zwei bis drei Stunden!«, schrie August mit verzweifelter Stimme. »Der Weg wird ja immer länger statt kürzer, ihr verdammten Lügner!«
»Ruhe!«, gebot Reihenfels, und fragte dann, sich wieder an den Inder wendend: »Wohin führt der Weg links? Er scheint trocken und viel begangen zu sein.«
»Nach einem Jagdschlosse, Sahib.«
»Wie, nach einem Gebäude? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Wir suchen ja nur eine Unterkunft. Oder ist es nicht bewohnt?«
»Doch, Sahib.«
»Wem gehört es?«
»Dem Großmogul von Indien, Bahadur«, kam es wie zögernd von den Lippen des Inders.
»Es ist nicht leer?«
»Jetzt gerade nicht. Bahadur selbst befindet sich darin und viele, viele vornehme Radschas. Sie wollen in dieser Gegend jagen.«
Reihenfels entging nicht, dass der Kuli mit einer gewissen Scheu sprach. Schnell rief er einen Fackelträger heran, der bis jetzt entfernt gestanden und das Gespräch nicht gehört hatte.
»Wem gehört das Jagdschloss, welches dort links liegt?«, fragte er diesen.
»Nana Sahib, dem Radscha von Berar, Sahib«, war die unverzögerte Antwort.
»Wie, ich denke, es gehört dem Großmogul?«, wandte sich Reihenfels an den ersten Inder.
»So ist es auch.«
»Nein, es gehört Nana Sahib«, sagte der zweite. »Bahadur hat es vor einiger Zeit dem Sohne seines Bruders geschenkt.«
»Befindet sich Nana Sahib auch jetzt dort?«
»Ich glaube so! Alle Radschas sind hier zusammengekommen, um Tiger zu jagen.«
»Ah, nun kann ich mir erklären, warum wir Nana Sahib nicht in Akola trafen. Warum aber wollte dort niemand wissen, wo derselbe sei? Nun, das kann uns gleichgültig sein. Wie weit ist das Jagdschloss von hier entfernt?«
»Biegst du dort um den Hügel, so kannst du es schon liegen sehen.«
»Also nicht weit«, sagte Reihenfels nachdenkend.
»Nein, ganz nahe. Aber du gedenkst doch nicht, das Jagdschloss aufzusuchen? Der Großmogul ist zwar gastfreundlich, doch...«
»Nu, allemal werden wir diesen großmoglichen Herrn besuchen!«, rief August in heller Freude, dass er nicht mehr zwei bis drei Stunden, sondern nur noch eine kurze Strecke, und zwar einen trockenen, keinen sumpfigen Weg zu marschieren hatte. »Denn wenn er uns nicht so empfängt, wie es sich für unsereins geziemt, dann soll ihn doch gleich...«
»Wir wollen die Herren in ihrer Zusammenkunft nicht stören«, entschied Reihenfels, ohne auf seinen Diener zu achten, »wir gehen rechts. Weiter!«
Alle nahmen den Weg, der bald durch einen Sumpf führte, ohne Zögern auf, nur August ließ ein lautes Murren hören.
Ehe man den Sumpf erreichte, fand noch eine Unterbrechung statt, durch Augusts Schlauheit hervorgerufen.
Man hatte noch eine kleine Strecke von äußerst dichtem Unterholz zu durchschreiten, nur mühsam arbeitete man sich vorwärts. Der Boden war schon sumpfig, jeder Schritt erzeugte eine kleine Wasserpfütze.
Plötzlich brach August mit einem lauten Weheruf zusammen und blieb liegen. Reihenfels sprang sofort zu ihm hin.
»Ich habe mir den Fuß gebrochen!«, jammerte August. »Diese verdammten Wurzeln!«, Reihenfels glaubte ihm nicht recht. Er ließ mit Fackeln den angeblich gebrochenen Fuß, der sich aber in ganz richtiger Lage befand, beleuchten und untersuchte ihn.
»Höre, August, ich glaube, du flunkerst uns etwas vor! Wo schmerzt es dich denn?«
August stöhnte unter der tastenden Hand entsetzlich, doch Reihenfels wusste schon, dass ein Bruch des Fußgelenkes nicht vorlag.
»O — au — mein Schienbein!«, jammerte August.
»Nun ist es wieder das Schienbein.«
»Ich bin total unfähig, zu gehen.«
»Versuche einmal aufzustehen.«
»Ich kann nicht — eine innere Verletzung.«
Da plötzlich sprang August mit einem Satze auf beide Füße, aber auch alle anderen bemächtigte sich ein lähmender Schrecken.
Ein donnerndes Gebrüll zerriss die Luft, ein furchtbares Geheul, welches immer wuchs, dann aufhörte und wieder einsetzte, gefolgt von einem schrecklichen Fauchen. Es klang ganz in der Nähe.
»Der Fürst des Dschungels!«, flüsterte ein Inder mit bebenden Lippen.
»Er hat sich auf sein Opfer gestürzt«, ein zweiter.
Atemlos lauschten alle den entsetzlichen Tönen. welche fortdauerten. Alle, welche in Indien bekannt waren, ebenso auch Dick und Charly, wussten, dass hier ein Tiger sich nicht nur auf eine Beute geworfen hatte, sondern dass ein Kampf stattfand.
Mit wem konnte das gewaltige Raubtier, welches keinen Rivalen hat, einen solchen wohl ausfechten?
Das Geheul tönte zwar ganz nahe, aber die Stimme des Königstigers ist mächtig, der Kampf konnte sehr wohl einige hundert Meter weit entfernt stattfinden.
Da gellte ein anderer Schrei durch die Nacht, aus einer menschlichen Kehle stammend, und gleich darauf erscholl ein Laut wie das Todesröcheln des Tigers.
Ohne sich verabredet zu haben, eilten schon Dick und Charly in großen Sprüngen der Richtung zu, wo der ungleiche Kampf zwischen einem Menschen und einem Königstiger stattfinden musste. Reihenfels folgte ihnen ebenso schnell, die Büchse schussbereit in der Hand.
Sie hatten ein äußerst dichtes Gebüsch zu durchdringen, dann standen sie auf einer sumpfigen Lichtung. Doch bald bekam der Bach, welcher sich in der weichen Erde verbreitete, wieder feste Ufer, und da, wo er eine Art Bassin bildete, sahen die drei Anstürmenden im Sternenlicht zwei Körper am Boden liegen.
Furchtlos schritt Dick als erster darauf zu, die Büchse schussfertig im Arm. Er machte keinen Gebrauch von ihr. Der gewaltige Königstiger, welcher dort neben einem Menschen lag, rührte sich nicht.
Es bot sich ihnen ein entsetzliches Bild dar.
Der Körper des Mannes, welcher wahrscheinlich von dem Tiger hier am Rande der Dschungeln überfallen worden, war arg verstümmelt, die Brust zerfleischt, der linke Arm ganz vom Rumpf gerissen. Da der Verletzte jedoch auf dem Armstumpf lag, so war die Blutung nur eine mäßige.
Der Mann, ein Inder, anscheinend von sehr kräftigem Körperbau, hatte sich nicht wehrlos dem Tiger ergeben. Die Faust umklammerte fest den Griff eines Yatagans, und dieser stak bis zur Hälfte im Körper des Tigers, die Spitze hatte das Herz erreicht. Es war nicht der einzige Stich gewesen, der Tiger hatte noch andere aufzuweisen.
Doch ehe sein Tod eingetreten war, hatte er noch seine Wut an dem Überfallenen auslassen können.
Reihenfels setzte eine Pfeife an die Lippen und rief die Fackelträger heran. Auch alle anderen kamen auf diesen Kampfplatz.
»Der Mann ist wie ein Held gestorben«, sagte Dick und beugte sich zu dem anscheinend Toten herab; »es kommt mir fast vor, als hätte er den Tiger überfallen. Wo sind denn seine anderen Waffen? Alle Wetter«, schrie er dann plötzlich, »der lebt ja noch!«
Er hatte die Hand auf die blutige Herzgegend des Verwundeten gelegt und noch schwaches Leben verspürt.
Während die Übrigen in scheuem Schweigen die Unglücksstätte umstanden, die Kulis mit Furcht und Zittern, entlasteten die drei zuerst angekommenen Männer schnell ein Maultier, welches die bei einer solchen Reise unentbehrlichen medizinischen Hilfsmittel trug, nahmen Verbandstoffe zur Hand und beschäftigten sich mit dem Unglücklichen.
Nach Verwendung von sehr viel Watte und Bandagen gelang es ihnen endlich auch, das Fließen des Blutes aufzuhalten, selbst der Armstumpf konnte fest genug verbunden werden.
Der Inder lebte noch, war aber natürlich dem Tode nahe, und wohl schwerlich konnte man ihn am Leben erhalten. Der Blutverlust war schon zu stark gewesen, ringsum war der Boden mit Blut bedeckt, welches selbst das Wasserbassin rötete.
Die beiden Pelzjäger begannen nach ihrer alten Gewohnheit nochmals den Kampfplatz zu untersuchen, um festzustellen, was hier vorgegangen sei.
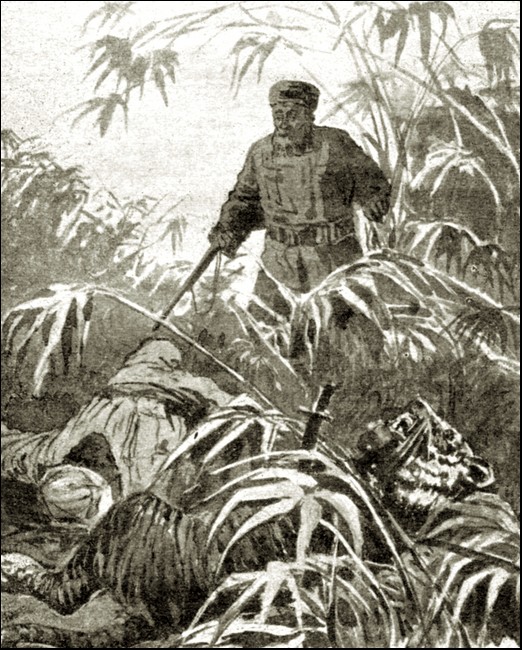
Auch der von den Zähnen des Tigers abgerissene Arm musste noch gefunden werden.
»Hallo, was ist denn das?«, rief August, der auf etwas getreten war, bückte sich und hob einen langen Gegenstand auf. Schnell warf er ihn mit Abscheu wieder von sich, er hatte in Blut gegriffen.
Charly kannte diesen Ekel nicht, er hob den länglichen Gegenstand auf und brachte ihn ins Fackellicht — es war ein muskulöser, nackter Arm, die Hand, um welche Fetzen eines Tuches hingen, vollständig zermalmt.
Auch Reihenfels nahm das Glied in die Hand und betrachtete es prüfend.
Da brachte Dick schon wieder einen anderen Fund, eine kleine, gelbe Tigerkatze, ebenso wie der große Tiger durch einen Stich ins Herz getötet. Da die Tigerin eben erst geworfen haben musste, so war kein Zweifel daran, dass dieses Junge das ihrige war.
Der Inder hatte also erst das Junge und dann auch noch die Mutter getötet. Aber wie in aller Welt konnte ein Mann eine solche Jagd nur mit einem Dolch, wenn er auch schwertartig groß war, unternehmen? Andere Waffen wurden nicht gefunden. Durch das tote Junge war bewiesen, dass der Inder nicht überfallen worden war, sondern dass er die Tigerin erst zur Wut gereizt halte.
Schon wollte Reihenfels den Arm zu dem Halbtoten legen, mit dem sich der Chinese und Hira Singh beschäftigten, als er einen Laut der Überraschung ausstieß und den Arm noch einmal einer Fackel näherte.
Seine Hand fuhr über den Oberarm und wischte das Blut fort.
»Hira Singh, was ist das?«, rief er dann in namenlosem Erstaunen. Der Gerufene trat zu ihm.
»Sanskrit«, sagte dieser, »wahrhaftig, dieselben Zeichen wie damals!«
»Sirbhanga Brahma«, flüsterte Reihenfels wie geistesabwesend.
Emily, die etwas abseits auf ihrem Maultier hielt und die Szene mit heimlichem Grausen beobachtete, sprengte heran.
»Sirbhanga Brahma?«, rief sie. »Dasselbe, was Eugen eintätowiert hat? Nicht möglich! Oder es ist doch nicht etwa...«
Ihre Augen wanderten mit einem entsetzten Ausdruck von Reihenfels nach dem verwundeten Inder.
»Nein, es ist nicht Eugen«, sagte Reihenfels. »Das ist ein großer, starker Inder, Eugen ist mittelgroß und schmächtig. Aber was soll das bedeuten? Nehmen die sich uns entgegenstellenden Rätsel denn gar kein Ende?«
Er beugte sich über den Verwundeten, konnte aber die Gesichtszüge nicht unterscheiden, denn ein Tatzenhieb hatte sie entstellt. Er untersuchte die zerfetzten Kleider oberflächlich und den Yatagan, welcher der starren Faust entwunden worden war, konnte aber keinen näheren Anhaltspunkt finden, wer dieser Mann sei.
»Kennt jemand einen Inder, der den Namen Sirbhanga Brahma führt?«, wandte er sich an die umstehenden Kulis, die vor dem Leblosen plötzlich eine heilige Scheu empfanden.
Alle verbeugten sich schweigend, blieben aber die Antwort schuldig.
»Er steht zu jenem Jüngling, welcher denselben Namen trägt, in einem Verhältnis«, flüsterte der Fakir Reihenfels zu.
»Du schließt das allein aus dem Namen?«
»Es ist dieselbe Tätowierung, es sind die Zeichen der Brahmanen. Ist es nicht wunderbar, dass der Jüngling auch den Arm mit der Tätowierung verloren hätte, wenn wir nicht gekommen wären? Brahmas Ratschlüsse sind unergründlich. Dies ist ein Fingerzeig von ihm.«
Der leblose Körper war noch sorgfältig gewaschen und verbunden worden.
»Der hat das Leben einer Katze«, meinte Charly. »Ich kalkuliere, er wird nicht gleich sterben.«
»Aber der Tod wird nicht zu vermeiden sein«, entgegnete Reihenfels, ihn nochmals untersuchend. »Doch hier können wir denselben nicht abwarten, wir müssen den Verwundeten mit fortnehmen.«
»Drei Stunden hält er es nicht mehr aus, er stirbt unterwegs.«
»Unser Ziel soll jetzt auch ein näheres sein, wir gehen nach dem Jagdschloss.«
»Zu Bahadur?«, riefen einige Kulis.
»Ja, er wird sich wohl nicht weigern, einen todwunden Menschen aufzunehmen, noch dazu einen Inder. Und ich werde mich nicht irren, wenn ich annehme, dass dieser Mann selbst zu der Jagdgesellschaft Bahadurs gehört.«
»Nur ein Radscha wagt es, einen Königstiger zum Kampf zu reizen«, fügte ein Kuli bewundernd hinzu.
Vorsichtig wurde der Verunglückte auf das leergewordene Maultier geladen und befestigt. Zwei Kulis mussten zu beiden Seiten gehen, andere die abgenommenen Packen tragen.
Unterdes hatten Dick und Charly mit zauberhafter Schnelligkeit dem Tiger das Fell abgezogen und dieses auf ein Tier gelegt, ebenso das des Jungen.
Dann schlug man den Weg ein, der nach dem Jagdschloss führte. Diesmal beschlossen Dick und Charly den Zug und hielten sich neben dem Tier auf, welches das auf dem Rücken ausgebreitete Fell trug. Der Maulesel zitterte wie Espenlaub, er fürchtete sich noch vor dem Fell des Raubtieres.
Die beiden Pelzjäger besprachen sich leise, worauf Charly sich zu Reihenfels begab, der den Zug mit anführte.
»Dick will Euch etwas sagen«, flüsterte er ihm zu.
Reihenfels blieb stehen und erwartete den Treiber des letzten Maultieres.
»Nun, was gibt's, Dick?«
»Etwas höchst Sonderbares.«
»Doch nicht schon wieder ein neues Rätsel?«
»Allerdings. Ich habe in meinem Leben schon so manches Raubtier geschossen, Panther, Jaguare, Wölfe, Luchse, wilde Katzen und so weiter, und manches Tier war dabei, dem ein Ohr, ein Auge, der Schwanz oder sonst etwas fehlte, aber dass sich die Tiger in Indien auch tätowieren, das habe ich noch nicht gewusst.«
Was sagst du da, sie tätowieren sich?«, fragte Reihenfels und glaubte, der Pelzjäger erlaube sich mit ihm einen Scherz.
»Es ist so. Dieser Kerl hier hat wahrscheinlich Anfangsbuchstaben seines Namens im Fell gehabt, nicht gerade tätowiert, aber eingebrannt. Da seht selbst! Na, was sagt Ihr nun?«
Dick deutete auf eine Stelle des gelben, wunderbar gestreiften Felles, und Reihenfels glaubte seinen Augen nicht trauen zu dürfen.
Im gelben Untergrunde waren da klar und deutlich zwei schwarze Zeichen zu sehen, wahrscheinlich mit einem Eisen eingebrannt.
»Es sind zwei indische Buchstaben«, sagte Reihenfels ganz verwirrt.
»Wirklich?«, rief Dick erstaunt. »Ich machte vorhin nur Spaß. Aber lesen kann ich sie nicht.«
»Diese beiden Zeichen bedeuten ein N und ein S.«
»Laufen denn die sogenannten Königstiger in Indien alle gestempelt herum?«
Reihenfels blieb lange die Antwort auf diese nur spaßhaft gestellte Frage schuldig, starr waren seine Augen auf die beiden schwarzen Buchstaben geheftet.
»N und S«, murmelte er. »Was soll dies nun wieder bedeuten? Dick, du bist scharfsinnig, kannst du nicht einen Schluss ziehen? Was mag hier vorgefallen sein?«
»Nun, wie denkt Ihr wohl darüber?«, fragte Dick seinerseits »Meine Meinung ist folgende: Der Inder hat die Tigerkatze, die sich bei Abwesenheit der Mutter heimlich aus dem Lager entfernt hat, an der Quelle gefunden und sie aus Übermut getötet. Ihr Schreien rief die Mutter herbei, der Inder sah sie kommen und konnte sich zu einem verzweifelten Kampfe noch vorbereiten.«
»So ungefähr ist auch meine Ansicht«, nickte Dick. »Nur habe ich beim untersuchen des Platzes noch mehr gefunden. Ich habe es bis jetzt für mich behalten; was brauchen es die anderen zu erfahren?«
»Sehr richtig, und was hast du gefunden?«
»Vor allen Dingen waren zwei Männer hier anwesend, der eine hat die Richtung eingeschlagen, die wir jetzt gehen, Also dem Jagdschloss zu, und da er große Sprünge gemacht hat, so muss er geflohen sein, wahrscheinlich, als die Tigerin den Mann überfiel.«
»Das mag sein. Sonst noch etwas?«
Dick zog einige Schnüre und ein Tuch aus der Tasche.
»Dies habe ich auch gefunden, und ich wette, dass damit die Tigerkatze gebunden gewesen war. Hier am Hinterfuß hängt nämlich noch ein Stück Schnur, die von diesem abgeschnitten worden ist. Aber nun sagt mal im Ernst, wie kommt es, dass die Tigerin einen Stempel trägt? Bei uns in Amerika stempelt man wohl Rinder und Pferde, aber doch keine Bestien.«
»Ich weiß nur zwei Erklärungen«, entgegnete Reihenfels sinnend. »Die Tigerin ist entweder früher einmal in Gefangenschaft gewesen und wieder geflohen, oder sie war bis vorhin eine Gefangene und Gezähmte.«
»Gibt es denn solche?«
»Indische Fürsten halten sich oft weibliche Tiger, welche so zahm wie Hunde werden, wenigstens gegen ihre Herren. Nur wenn sie Junge haben, ist mit ihnen nicht zu spaßen. War diese Tigerin säugend?«
»Sie muss erst vor Kurzem geworfen haben, das Junge gehörte jedenfalls ihr.«
Das Gespräch brach ab, denn jetzt tauchte vor den Reisenden ein mächtiges, imposantes Gebäude mit erleuchteten Fenstern auf — das Jagdschloss.
Es war wie eine Burg gebaut, selbst der sich ringsherumziehende Graben mit Zugbrücke fehlte nicht, aber als Festung konnte das Gebäude trotzdem nicht dienen. Schon darum nicht, weil es mitten zwischen Hügeln lag. Reihenfels ließ nicht erst halten, kurz entschlossen führte er die Seinen über die niedergelassene Zugbrücke und erreichte unaufgehalten das starke, eiserne Tor.
Im Schloss ging es lebhaft zu. Fast alle Fenster waren erleuchtet, man hörte lautes Sprechen und sah Schatten hin und her huschen. Doch niemand schien die fremden Gäste zu bemerken, nur einige Hofhunde heulten jetzt lauter als vorhin.
Der Schwerverwundete lebte noch, einmal glaubte man sogar, er würde die Besinnung wiederbekommen. Aber sein Tod war unvermeidlich.
Als Reihenfels weder Klingelzug noch Klopfer fand, pochte er mit dem Revolverkolben laut gegen die Tür. Gespannt warteten alle der Antwort, die sie in dem Schlosse, in dem Bahadur, der erste Fürst Indiens, sich befand, bekommen würden. Die Kulis machten sogar ängstliche Gesichter und schienen gar keine Lust zu haben, eine Nacht zwischen fürstlichen Personen zu verbringen.
Allein niemand kam. Nur die Hunde heulten wütend auf.
»Pochen Sie stärker! Nehmen Sie den Büchsenkolben zu Hilfe, wenn die Leute taub sind!«, riet Mister Woodfield.
Reihenfels zögerte noch, zu so später Nachtzeit in einem fremden, indischen Schlosse solchen Lärm zu verursachen, da aber ließ schon Charly seinen Büchsenkolben gegen die Tür schmettern, dass die Funken aus dem Eisenbeschlag sprühten.
Die Schatten blieben an den Fenstern plötzlich stehen und spähten hinaus, dann kamen Schritte über den Hof, das Gebell der Hunde verstummte, in der Tür wurde eine Klappe zurückgeschlagen, und nachdem ein glühendes Auge die Gesellschaft gemustert hatte, fragte eine Stimme auf indisch:
»Was ist euer Begehr? Dies Schloss gehört einem Inder, kein Faringi hat Zutritt. Entfernt euch!«
»Wir haben einen Inder gefunden, der von einem Tiger überfallen und schrecklich zugerichtet worden ist!«, entgegnete Reihenfels schnell. »Er stirbt, wenn er nicht gebettet und gut behandelt wird!«
»So lass ihn sterben, wie wir einst alle sterben werden!«, war die gelassene Antwort.
»Wüsstest du, wer er ist, du würdest anders sprechen!«
»Wer sollte es sein, der sich so spät in der Nacht noch da herumtreibt, wo der Tiger streift? Entfernt euch oder ich hetze die Hunde auf euch!«
»Das würdest du wohl bleiben lassen!«, entgegnete Reihenfels trocken. »Der Verwundete gehört zu den Gästen Bahadurs.«
Der Mann schwieg eine Minute; jedenfalls war er betroffen über diese Antwort. Dann sagte er in spöttischem Tone:
»Glaubst du, dir durch diese Lüge den Eingang zu erzwingen? Hat dir der Mann, welcher von dem Tiger überfallen worden ist, vielleicht gesagt, wie er heißt, und woher er kommt?«
»Ja«
»So lass ihn doch selbst sprechen!«
»Er ist bewusstlos geworden. Geh jetzt zum Besitzer dieses Schlosses und melde ihm, was ich dir gesagt habe, oder ich werde Mittel finden, mit ihm zu sprechen und mich über dein Betragen zu beschweren.«
Dies wirkte. Der Inder verschwand von dem Türloch, musste aber wahrscheinlich erst eine lange Konferenz mit anderen Dienern haben, denn er kam nicht wieder.
Da stöhnte der Verletzte tief auf und machte mit dem gesunden Arm eine Bewegung. Es mochte wohl sein letztes Erwachen sein.
Reihenfels befahl, ihn von dem Tiere abzuheben und auf ein ausgebreitetes Segeltuch an die Erde zu legen. Dann beugte er sich über ihn und redete ihn an, fragte ihn, wer er sei, erhielt aber keine Antwort.
»Er stirbt!«, sagte Reihenfels. »Ich hätte ihn so gern noch einmal zum Sprechen gebracht.«
Jetzt riss bei Dick die Geduld. Er klopfte mit der schweren Büchse so energisch gegen die eiserne Tür, dass sie in den Angeln erbebte, und rief dabei die im Schlusse des letzten Kapitels erwähnten Worte.
Das half. Nach einer halben Minute schon öffnete sich die Tür, und vor Reihenfels standen drei Männer, von denen zwei vollständig verhüllt waren, indes der dritte, ein kleiner Mann mit schwarzem Vollbarte, ein altes, runzliges Gesicht zeigte. Seine Augen fixierten im Nu jeden einzelnen des Trupps und blieben dann auf dem am Boden Liegenden haften, von dem sie sich auch nicht wieder trennten.
Im Hintergrunde zeigte sich noch eine Anzahl dunkler Gestalten, wahrscheinlich Diener, zu einer etwaigen Hilfe bereit.
Mit kurzen Worten erzählte Reihenfels das Vorgefallene. Schweigend hörten die Inder zu.
»Woher weißt du, dass dieser Mann zu den Jagdgästen dieses Schlosses gehört, wie du dem Torhüter vorhin gesagt hast?«, fragte dann der Kleine.
»Ich habe es nur geraten, weil ich hoffte, dass sich mir dann die Tür schneller öffnen würde.«
»So hast du falsch geraten. Dieser Mann gehört nicht ins Schloss. Doch er ist ein Inder, er soll nicht auf der nackten Erde sterben.«
Der Kleine klatschte in die Hände. Einige Kulis kamen von hinten vor und näherten sich dem Verwundeten.
In demselben Augenblick machte dieser gewaltige Anstrengungen, um sich aufzurichten.
»Nicht — hierher!«, stieß er abgebrochen hervor. »Nana Sahib — ist — ein Schurke — er hat seine —«
Er kam nicht weiter. Mit einem Satz war der kleine Mann bei ihm und schlug das Segeltuch über ihn, sodass seine Worte erstickten.
»Fort!«, befahl er den Dienern. Diese hoben den Körper, vielleicht schon einen Leichnam, auf und trugen ihn in den Schlosshof.
Es war erst, als wollte Reihenfels sie daran hindern, aber gleich beherrschte er sich wieder. Dann trat der Kleine auf ihn zu und sagte mit gewinnender Freundlichkeit, als ob nichts geschehen wäre:
»Ich sehe, ihr kommt von einer langen Reise und seid müde, ist doch schon lange die Sonne in die Nacht hinabgestiegen. Die weiße Dame dort wankt im Sattel. Ich heiße euch im Namen meines Herrn willkommen, die Räume dieses Schlosses, über welches er mich zum Verwalter gesetzt hat, stehen euch offen.«
Er ging voran, und Reihenfels folgte, nachdem er seinen Begleitern, ganz besonders dem Chinesen und Hira Sing, zugenickt hatte, ohne Zögern in den Schlosshof. Die abwehrende Miene des Fakirs schien er nicht bemerken zu wollen. Die Männer halfen den Damen aus den Sätteln; erschöpft lehnten sie sich an die nächste Stütze. Es war die höchste Zeit gewesen, dass sie die Maultiere verließen.
»Erlaubt, dass ich erst meinem Herrn Mitteilung mache und Vorkehrungen für euer bequemes Nachtlager treffe«, wandte sich der Kleine wieder an Reihenfels.
»Wie heißt der Besitzer dieses Schlosses, dessen Tore sich so gastfreundlich jedem öffnen, auch wenn er Indien nicht seine Heimat nennt?«, fragte dieser.
»Es ist ein mächtiger Maharadscha, dem viele Radschas gehorchen, und er liebt die Gastfreundschaft, wie wir alle sie lieben«, war die ausweichende Antwort.
Der Kleine ging mit seinen Gefährten ins Schloss, die Gesellschaft war allein. Schnell traten Kiong Jang und Hira Singh gleichzeitig zu Reihenfels.
»Was tust du, Herr?«, flüsterte ersterer. »Weißt du nicht, in wessen Hause du über Nacht bleiben willst? Oder glaubst du, man weiß nicht, wer wir sind und was wir wollen?«
»Wir sind in der Höhle des Löwen!«, entgegnete Reihenfels so leise, dass kein anderer als diese beiden ihn verstehen konnten.«
»Und wir werden sie lebendig nicht wieder verlassen!«, fügte Hira Singh hinzu.
»Man soll uns kein Haar krümmen, versichere ich euch; dafür lasst mich sorgen! Die Damen konnten kaum noch weiter. Sie fielen fast von den Tieren herab, und außerdem bin ich begierig, zu erfahren, was man hier noch von mir fordern wird. Es ist ihnen höchst unbequem, dass ich den sterbenden Mann gefunden und auch seinen letzten Ausruf gehört habe. Hier ist ein Verbrechen verübt worden, und ich kann mir den Zusammenhang einigermaßen erklären. Sorgt nur dafür, dass die übrigen nicht erfahren, in welcher Gefahr sie sich befinden. Das dürfte ihnen die Nachtruhe stören.«
Reihenfels sprach mit Mister Woodfield, Dick und Charly so lange, bis der Kleine wieder heraustrat.
»Nochmals willkommen im Namen meines Herrn, des mächtigen und gnädigen Großmoguls von Indien!«, sagte er. »Die Gemächer sind für euch bereitet; morgen früh wird sich mein Herr nach dem Ergehen seiner Gäste erkundigen.«
»Wir nehmen seine Gastfreundschaft dankbar an«, erwiderte Reihenfels. »Doch es ist nötig, dass wir vorher einen Boten abschicken!«
»Einen Boten? Wohin?«
»Nach der Plantage von Mister Shaw, den du wohl kennst, denn seine Besitzung liegt nur drei Stunden von hier entfernt!«
»Nicht einmal so weit. Wozu aber das?«
»Wir meldeten ihm, dass wir heute Abend bei ihm eintreffen würden, doch der Weg war zu weit und zu beschwerlich, wir verspäteten uns. Auch könnten wir den Verwundeten nicht dorthin bringen, er wäre unterwegs gestorben und nicht bei seinen Landsleuten. So kamen wir hierher.«
»Wohl, so wird sich Mister Shaw, mein Nachbar, freuen, euch morgen zu sehen, wenn ihr es nicht vorzieht, Bahadurs Gastfreundschaft länger zu genießen.«
»Aber Mister Shaw würde sich ängstigen, wenn er nicht wenigstens die Nachricht erhält, dass wir hier gut aufgehoben sind. Er ist ein Freund jener Lady dort und sorgt sich um sie.«
»Gut, so werde ich einen schnellfüßigen Boten zu ihm senden. Des Pferdes Huf wird durch die sumpfige Erde zu sehr gehindert. Schreibe einen Brief an deinen Freund, ein treuer Diener wird ihn besorgen.«
»Ich werde keinen deiner Diener zu so später Nacht noch belästigen. Hier, mein Gefährte wird das Schreiben überbringen.«
Er gab Dick, der neben ihm stand, ein Stück Papier. Dieser warf sofort die Büchse über die Schulter und wandte sich zum Gehen.
Schnell trat ihm der Kleine in den Weg.
»Das lasse ich nicht zu! Du bist müde, und meine Diener sind ausgeruht!«
Reihenfels übersetzte Dick diese Worte in Englisch.
»Oho, da irrt Ihr Euch, wenn Ihr glaubt, ich könnte müde werden!«, lachte der Jäger. »Lasst mich nur gehen!«
»Ihr seid hier unbekannt!«
»Ich werde mich zurechtfinden!«
»Durch die Wildnis?«
»Durch die Wildnis! Good bye!«
Dick schlüpfte an dem Kleinen vorbei, der ihn auch nicht mehr hinderte, und war im Nu zum Schlosshof hinaus.
Reihenfels entging es nicht, wie unangenehm es dem Kleinen war, dass Dick die Botschaft übernahm. Er wusste überhaupt ganz genau, was in jenem vorging.
Die Gäste wurden ins Schloss geführt, wo sie sich trennen mussten. Emily, Miss Woodfield und Hedwig bekamen Zimmer in einem Seitenflügel angewiesen.
»Fürchten Sie sich nicht!«, flüsterte Reihenfels ersterer beim Gutenachtgruß unbemerkt zu.
»Wir sind hier sicher! Schlafen Sie wohl!«
Dann aber bestand er energisch darauf, dass die Übrigen nicht getrennt würden, auch nicht Hira Singh und Kiong Jang, ebenso, dass sein Gepäck ohne Ausnahme mit nach ihren Zimmern gebracht würde. Der Kleine, der die Rolle eines Schlossvogtes spielte, willigte ohne Bedenken in alles ein.
Niemand außer Reihenfels, Kiong Jang und Hira Singh wusste, in welch gefährlicher Lage sie sich befanden, höchstens der abwesende Dick ahnte dies noch, und ihm war auch bekannt, dass das Leben aller davon abhinge, dass er sich durch List oder Gewalt während seines nächtlichen Weges nicht überrumpeln ließe.
Fiel er in die Hände der Häscher, die jetzt eben in großer Anzahl bis an die Zähne bewaffnet und von Hunden begleitet, deren Mäuler mit Tüchern umwickelt waren, das Schloss verließen, so war das Leben aller verwirkt.
Reihenfels erteilte ruhig einige Instruktionen, wie man sich bei einem etwaigen nächtlichen Besuche der Schlossbewohner — man war ja in einem fremden Lande, unter wegen ihrer gewandten Dieberei bekannten Indern — verhalten sollte, dann suchte jeder den dicken Teppich mit Polster auf, der hier die Stelle des Bettes vertrat.
Etwa hundert Meilen südlich von dem Schloss, in das Bahadur die benachbarten Fürsten, angeblich zur Jagd, eingeladen hatte, befindet sich ein felsiges, mit mächtigen Steinen besetztes Tal, und durch dasselbe zog, von der letzten Abendsonne beschienen, eine lange Karawane.
Den Mittelpunkt des Zuges bildete ein Elefant, auf dessen Rücken sich ein geräumiger Aufbau aus Holz befand. Es musste in diesem eine sehr schwüle Luft herrschen, denn die Tür und die Fenster des Baldachins waren sorgsam mit dichten Tüchern verhängt.
Auf dem Halse des Elefanten, so, dass seine Beine von den gewaltigen Ohren des Dickhäuters bedeckt waren, saß der nackte Mahaut, der Elefantenführer, nur an der Seite am Gurt einen Hammer und ein meißelartiges Eisen tragend.
Neben dem Elefanten ritt auf einem schönen Rappen ein Hindu, schon durch seine reiche Kleidung und die kostbaren Waffen, wie durch sein ganzes, gebieterisches Wesen verratend, dass er der Herr sei.
Bewaffnete Reiter und Fußgänger, Kulis, die bei Nachtreisen Fackeln schwingen und Lärm machen mussten, Kamele, auf deren Rücken in unverhangenen Baldachinen Hindumädchen hockten, vervollständigten die Karawane.
Als Führer diente ein nackter, tiefschwarzer Bursche. Außer einem kleinen Schurz trug er an einem Strick, der sich um die Brust schlang, ein riesiges, bloßes Schwert. Er war also einer jener tollkühnen Männer, welche den Elefanten zu Fuß jagen, sich an das grasende Tier heranschleichen und es durch Zerhauen der Achillessehne zum Sturz bringen.
Alle diese Elefantenjäger müssen fabelhaft schnelle Läufer sein, und so verfügte auch dieser Mann über ein paar stattlich lange Beine.
Das an der rechten Seite herabhängende Horn ließ in ihm den Führer erkennen, ein wichtiges Amt, und selbstbewusst schritt auch der Mann dem Zuge in einer Entfernung von zwanzig Metern voran.
Diese Karawane reiste schon wochenlang, und der vornehme Hindu dachte nicht daran, die Eisenbahn zu benutzen, wenn ihm dazu auch schon oft Gelegenheit geboten worden war. Er wanderte lieber neben dem Schienenstrang her, obgleich die Karawane nur für ihn und die Person ausgerüstet war, die das Innere des Baldachins auf dem Elefanten barg. Vielleicht hasste er, wie manche andere Inder, jede moderne, durch die Engländer getroffene Einrichtung, vielleicht aber hatte es auch einen anderen Grund.
Dem Hindu war nämlich ungeheuer viel daran gelegen, das Inkognito des Wesens zu wahren, welches der Baldachin beherbergte. Auf jeden Fall war es ein Weib, ob aber seine Frau, ob seine Tochter, wie sie aussah, warum sie sich nicht anders als tief verschleiert zeigen durfte, und das nur selten, wusste niemand zu sagen.
Wäre die Eisenbahn benutzt worden, dann hätte der Schleier leicht einmal gelüftet werden können. So war dies fast unmöglich.
Wurde der Baldachin im Lager während der Nacht oder des heißen Mittags zur Ruhe vom Elefanten abgehoben, so durfte das geheimnisvolle Wesen ihn doch nicht verlassen. Selbst die Dienerinnen durften das Häuschen nicht betreten; sie bereiteten die Mahlzeiten, sorgten für das mit Rosenöl vermischte Waschwasser — Hindus peinigen sich förmlich mit Waschungen — sie packten täglich die frischen Unterkleider aus, aber alles wurde von dem vornehmen Hindu selbst hineingetragen, und nach dem Ertönen einer hellen Pfeife wieder herausgeholt.
Daraus hätte man schließen können, dass der Insasse ein Weib war, das jener eifersüchtig vor aller Welt verborgen hielt; aber wiederum behandelte er die Person, wenn er sie nach Aufschlagen des Nachtlagers im Freien auf und ab führte, mit der größten Unterwürfigkeit. Bei diesen Spaziergängen war sie tief verschleiert, nur aus den graziösen Formen und den sicheren Bewegungen konnte man schließen, dass sie ein junges Mädchen war.
Jedenfalls war sie eine sehr vornehme Hindu, die unerkannt reisen wollte, und ihr Begleiter, obwohl scheinbar auch ein Vornehmer, nichts weiter als ihr Diener. Eine Entführung lag auf keinen Fall vor.
Doch die Begleiter der Karawane, männliche und weibliche, zerbrachen sich auch nicht den Kopf darüber, wer die Fremde sein mochte. Sie wurden gut bezahlt, und damit waren sie zufrieden.
Jetzt richtete sich der Hindu in den Steigbügeln auf und spähte, mit der Hand die Augen vor den blendenden Strahlen der Abendsonne schützend, nach vorn. Dem Führer waren einige Männer in schnellem Laufe entgegengekommen, fast wie dieser selbst aussehend, ebenfalls das lange Schwert tragend, also ebenso Elefantenjäger.
Sie wechselten mit dem Führer einige Worte, dieser blieb plötzlich stehen, legte das Horn an den Mund und entlockte demselben einen langgezogenen, tremolierenden Ton.
Unwillkürlich stockte die ganze Karawane, selbst der Elefant blieb stehen, ohne von seinem Führer mittels des langen Stabes dazu aufgefordert worden zu sein.
Nur der Hindu gab seinem Rappen die Sporen und befand ich im Nu neben dem Führer, der von den Elefantenjägern umringt wurde. Sein Hornsignal hatte vor einer drohenden Gefahr gewarnt.
»Was gibt's? Welche Gefahr ist im Anzug?«, fragte der Hindu und griff nach den Pistolen im Halfter.
»Herr, das wandernde Feuer ist in dieser Gegend gesehen worden!«, war die ängstliche Antwort des Führers.
»Das wandernde Feuer? Was ist das?«
»Wie? Du kennst es nicht?«
»Ich habe nie davon gehört.«
»So bist du noch nicht in dieser Gegend gewesen?«
»Nein, sonst brauchte ich dich nicht als Führer! Nun sprich, was ist das für ein wanderndes Feuer, welches dich veranlasst, den Zug ins Stocken zu bringen?«
»Er kennt das wandernde Feuer nicht!«, riefen die Elefantenjäger einstimmig.
»Das wandernde Feuer ist ein Agni, ein Feuergeist«, erklärte jetzt der Führer, »der Brahma verspottet hat und nun zur Strafe auf Erden ohne Ruhe unterwandern muss. Aus Rache tötet er jeden Inder, dem er begegnet.«
»Torheit«, rief der Hindu unwillig, »das ist eine Fabel, in wahnwitzigen Köpfen entstanden!«
Die Elefantenjäger erschraken und schlugen sich mit der rechten Faust wiederholt heftig auf die linke Schulter, was bei den Indern dem sich Bekreuzigen der Katholiken entspricht.
»Ich habe ihn selbst gesehen«, flüsterte der Führer; »Es ist ein alter Mann mit langem, weißem Haupthaar und Bart, statt der Nägel hat er Klauen, und seine Augen glühen wie feurige Kohlen. Er schleicht des Nachts in den Wäldern umher, hat immer einen brennenden Zweig in der Hand und heult wie eine Hyäne.«
»Akam täi, akam täi — so ist es«, riefen die Elefantenjäger und schlugen wieder die Schulter.
»Und eine Keule hat er, die er nach jedem Inder schleudert, und immer kehrt sie wieder in seine Hand zurück«, fügte einer hinzu.
»Er tötet jeden, dem er begegnet?«, fragte der Hindu.
»Jeden; er schlägt ihm mit der Keule den Schädel ein.«
»Und ihr habt ihn selbst gesehen?«
»Wir haben das wandernde Feuer gesehen«, riefen alle.
»So, und doch lebt ihr noch?«, spottete der Hindu. »Warum hat denn seine Keule euch verschont?«
»Wir haben Brahma und die Feuergeister angerufen und Gebete hergesagt. Dann wird das wandernde Feuer blind und sieht uns nicht.«
»Gut, wir werden dasselbe tun. Sollten wir das wandernde Feuer wirklich sehen, was ich aber nicht glaube. Jetzt geht und erzählt euren abergläubigen Unsinn nicht anderen Leuten meiner Karawane, damit sie nicht auch noch davon angesteckt werden. Und du, gib das Zeichen zum Weitermarsch!«
»Herr, ich gehe keinen Schritt weiter«, rief der Führer erschrocken; »diese Leute haben gestern nacht das wandernde Feuer gesehen, es hielt sich in dieser Gegend auf.«
»Gib das Signal, oder ich lasse dir das wandernde Feuer augenblicklich erscheinen.«
Der Hindu zog eine Pistole aus dem Halfter. Da richtete sich der Führer hoch auf und schaute ihn trotzig an.
»Herr, ich bin kein Leibeigener, sondern ein freier Jäger. Wenn ich sage, ich gehe nicht weiter, so tue ich auch keinen Schritt mehr.«
»Ein Feigling bist du, dass du dich vor einem Geist fürchtest, den es nicht gibt.«
»Es gäbe keine Feuergeister?«
»Doch, aber unsere Augen können sie nicht sehen.«
»Meine Augen haben einen gesehen. Ich bin kein Feigling! Oder glaubst du, ein Feigling könnte sich an einen Elefanten schleichen und ihn mit dem Schwert töten? Versuch es einmal. Doch mit Feuergeistern will ich nichts zu tun haben. Ich gehe!«
»Du hast dich mir als Führer verdingt.«
»Ich bin's nicht mehr.«
»Ich habe dich im voraus bezahlt.«
Der Führer knüpfte einen Beutel vom Gürtel los und reichte ihn dem Hindu.
»Hier hast du meinen Lohn, keine Rupie fehlt daran. Ich habe dir drei Wochen umsonst gedient«
Der Hindu nahm den Beutel.
»Hasenherzen. die ihr seid«, donnerte er dann die Männer an, »geht dahin, wohin ihr gehört, an das Küchenfeuer, und lasst euch von alten Weibern Ammenmärchen erzählen! Fort von hier, und wer es wagt, mit einem meiner Leute auch nur ein Wort zu wechseln, den schieße ich auf der Stelle nieder! Ich werde den Weg auch ohne Führer zu finden wissen.«
Schweigend wandten sich die Männer ab und gingen an der noch immer haltenden Karawane vorüber.
Grimmig blickte ihnen der Hindu nach. Er befand sich jetzt in einer ihm völlig fremden, menschenleeren Gegend, und auch keiner seiner Leute war hier bekannt.
Da geschah etwas, was ihn alles andere vergessen ließ.
Als die Jäger an dem Elefanten vorüberkamen, mochte in dem klugen, mit einem ausgezeichneten Gedächtnis begabten Tiere eine Erinnerung auftauchen; vielleicht entsann es sich, wie es einmal vor vielen Jahren, als es noch in zügelloser Freiheit die Grasebenen Indiens durchstreift hatte, von Elefantenjägern gehetzt worden war.
Der Elefant wurde unruhig, als er die Jäger mit den langen Schwertern herankommen sah, er trampelte von einem Bein aufs andere und bewegte den Rüssel hin und her.
Da griff einer der Männer zufällig an sein Schwert, das Funkeln blendete die Augen des Elefanten, im Nu stand sein Rüssel kerzengerade in der Luft, ein furchtbar schmetternder Trompetenton erscholl, und plötzlich jagte das Tier in rasendem Lauf davon.
Wie ein Blitz schoss es an dem Hindu vorbei, dessen Pferd zurückscheute. Dann jagte dieses, von Sporen und Peitschenhieben angetrieben, dem Flüchtling schnell wie ein Pfeil nach.
Der Hindu sah, wie der Mahaut auf dem Halse des Elefanten in der linken Hand den Meißel hielt und die Spitze auf den Nacken des Tieres setzte, wie die rechte Hand mit dem Hammer zum Schlage ausholte.
Die Bewohner des südlichen Asiens, Inder sowohl als Malaien, werden oft ohne jeden Grund von einer noch unaufgeklärten Krankheit befallen, von einer Art Tobsucht, welche als Amok bezeichnet wird. Der Tobsüchtige verliert plötzlich den Verstand und beginnt einen rasenden Lauf, während dessen er alles Lebendige zu töten sucht. Er selbst stirbt, entweder, indem er in einen Abgrund stürzt oder er fällt endlich aus Erschöpfung zu Boden und stirbt am Lungenschlag, wenn er nicht niedergeschossen wird.
Von derselben Krankheit werden auch manchmal die klügeren Tiere befallen, ganz besonders die Elefanten. Auch diese beginnen plötzlich zu rasen, jagen davon und zerschmettern gewöhnlich an einem Felsen oder in einem Abgrund. Dann geht natürlich auch der auf dem Tiere Sitzende mit zugrunde, denn ein Abspringen bringt auf jeden Fall den Tod. Die Möglichkeit, dass der Elefant vor Ermattung zu Boden stürzt, ist kaum vorhanden, weil das Tier den rasenden Lauf fast vierundzwanzig Stunden aushält. Die einzige Rettung besteht darin, es auf der Stelle zu töten.
Aus diesem Grunde besitzt jeder Elefantenführer außer seinem Lenkstabe einen langen Meißel und Hammer. Die Spitze des ersteren wird auf eine bestimmte Stelle im Nacken des Elefanten gesetzt und mit wuchtigem Schlag in den Halswirbel getrieben, wodurch dieser zerschmettert wird und das Tier augenblicklich stürzt. Aber die betreffende Stelle muss sicher gewählt und der Hammerschlag mit furchtbarer Kraft geführt werden, sonst verdoppelt sich nur die Wut des Tieres. Beim Sturze sucht der Führer mit gewandtem Sprung auf die Füße zu kommen.
Die sogenannten Kriegselefanten, welche zum Kampf gegen Menschen abgerichtet werden, können, wie wir später sehen werden, auch künstlich in Tobsucht versetzt werden. Daran erinnert die Kampfwut der alten Deutschen, der sogenannten Berserker, die sich, wenn sie die Schlacht verloren glaubten, nackt in die dichtesten Reihen der Feinde stürzten, um zu siegen oder zu sterben. Sie brachten sich durch entflammende Lieder in Wut, wie die Kriegselefanten durch ein bestimmtes, gellendes Geheul gereizt werden.
Übrigens kann noch heutigentags bei dem sonst so kaltblütigen Deutschen eine Kriegswut ausbrechen, ein Zorn, dessen die heißblütigen Südeuropäer gar nicht fähig sind. —
Der Elefantenführer hob also den Hammer, um den tödlichen Schlag zu führen, denn er glaubte, sein Tier sei vom Amok befallen worden.
Der nachsetzende Hindu dagegen hatte gesehen, wie der Elefant nur vor den Jägern gescheut hatte und einfach floh.

Er sah den Sturz des riesigen Tieres voraus. Der Führer konnte sich wohl retten, aber seine Schutzbefohlene war dann verloren. Der Baldachin musste am Boden zerschmettern, vom Elefanten vielleicht zerdrückt werden, und mit ihm das Weib, welches der Inder wochenlang so sorgsam behütet hatte.
Er schrie laut auf.
»Töte ihn nicht, bringe ihn zum Stehen!«
Der Führer senkte den Hammer. Aber der Elefant, die Hufschläge des Pferdes auf dem steinigen Boden hörend und Verfolger vermutend, vermehrte nur seine Schnelligkeit; der Führer bearbeitete vergebens den vorderen Kopf mit dem Stock, der die Stelle des Zügels vertrat.
Da hob sich abermals der Hammer, der Aufschrei des Hindus blieb unbeachtet, er sauste herab auf den Meißel.
Es hatte nicht den gewünschten Erfolg. Entweder hatte die Spitze die bestimmte Stelle nicht getroffen, oder der Schlag war zu schwach gewesen. Der Elefant stieß einen furchtbaren Ton aus und schnellte so gewaltig in die Höhe, dass der Führer seinen Halt verlor und in großem Bogen zur Erde geschleudert wurde, wo er mit zerschmettertem Schädel liegen blieb.
Der Elefant stürmte weiter, jetzt wirklich zur Wut gereizt, und hinter ihm her auf schäumendem Rappen der verzweifelte Hindu.
Bei dem gewaltigen Satze hatten sich die Vorhänge des Baldachins geöffnet, und das angsterfüllte Gesicht eines jungen Mädchens erschien zwischen ihnen. Ihre erschrockenen, großen Augen waren auf den nachfolgenden Inder geheftet, sie hatte die Hände wie zum Gebet gefaltet.
Wie vom Sturm gepeitscht flatterten die schwarzen Locken um ihr Haupt.
Der Hindu drückte beim Anblick der schönen, reizenden Züge dem Rosse die Sporen in die Weichen, dass das Blut hervorspritzte. In einigen Sätzen war er zur Seite des Elefanten. Doch was vermochte er mit Pistolenkugeln und Dolchen gegen das Ungeheuer auszurichten!
Der nebenhergaloppierende Reiter jagte dem fliehenden Tiere nur noch mehr Furcht ein, immer mehr nahm seine Schnelligkeit zu.
So ging's weiter, der Rappe stets dicht auf den Fersen des Elefanten. Wie Schattenbilder flogen Felsen, Büsche und Bäume vorüber, die Stunden flohen, die Sonne ging unter.
Das Mädchen war nicht mehr an dem geöffneten Baldachin zu sehen. Wahrscheinlich kauerte es in einer Ecke und erwartete geduldig sein Schicksal. Dann erschien abermals ihr Gesicht.
»Ich springe herab«, rief sie.
»Nein, nein«, schrie der Hindu außer sich, »du darfst nicht abspringen, es ist dein Tod!«
Er musste dem Rosse fortwährend die Sporen geben, denn dessen Kräfte ließen nach, kaum konnte es sich noch hinter dem Elefanten halten, während dieser mit unverminderter Schnelligkeit weiterrannte.
Es wurde finster, der Hindu konnte eben noch sehen, wie in der Ferne ein Wald auftauchte.
Die Entfernung zwischen ihm und dem Elefanten hatte sich sehr vergrößert, er war schon außer Rufweite. Beim Anblick des Waldes erfasste den Mann neues Entsetzen. Was mochte geschehen, wenn der Elefant durch den Wald jagte? Er konnte vielleicht unter den Ästen durchschlüpfen; aber das Holzhäuschen musste, wenn nicht daran zerschellen, so doch abgestreift werden, und das Los der darin Befindlichen war der unabwendbare Tod.
Noch einmal versuchte der Hindu das Ross anzutreiben, es gelang ihm aber nicht mehr, den Elefanten zu erreichen. Jetzt wurde er anderen Sinnes.
»Spring, spring jetzt!«, gellte es von seinen Lippen.
Sein Ruf blieb ungehört, die Entfernung war schon eine zu große. Das Mädchen ließ sich nicht einmal mehr blicken, er konnte ihm also auch nicht mehr zuwinken, dass es abspringen solle.
Noch einmal stieß er dem Rosse die Sporen in die Weichen, schon verlor er den Elefanten aus den Augen. Der Rappe bäumte sich mit einem schmerzlichen Wiehern auf, wollte über einen Steinblock setzen, blieb mit den Hinterfüßen hängen, überschlug sich und schleuderte den Reiter ab.
Einen Augenblick blieb der Hindu wie betäubt am Boden liegen, dann sprang er leicht auf, ein Zeichen, dass er unverletzt war.
Dort lag sein Ross bewegungslos, der Elefant war mit dem Baldachin verschwunden, er musste den Wald schon erreicht haben.
Doch der Mann freute sich nicht, dass er den Sturz unversehrt überstanden hatte, er dankte Gott nicht dafür, er warf sich vielmehr abermals an den Boden, zerriss seine reiche Kleidung, raufte sich Kopf- und Barthaar, jammerte, schrie, weinte und verfluchte Gott.
Der von Reihenfels fortgeschickte Dick trabte unterdes in raschförderndem Laufe der Richtung zu, in welcher die Plantage des Mister Shaw liegen sollte. Ob er sie erreichte oder nicht, daran war ihm eben nicht viel gelegen. Hauptsache war nur, dass er sich nicht bei den übrigen im Schlosse befand, und dass er nicht in die Hände der ihm Nachfolgenden fiel. Denn dass er verfolgt würde, darüber war sich Dick nicht im Zweifel. Einmal hatte es ihm Reihenfels fest versichert, und dann sollte er es auch selbst bald merken.
Der Trapper, der seine Lehrzeit in Amerika durchgemacht hatte, bewegte sich hier ebenso schnell und sicher vorwärts, als befände er sich in den Prärien. Hier wie dort dienten ihm Sterne und Mond während der Nacht als Kompass; Furcht vor Raubtieren kannte er nicht, sein ihm angeborener Instinkt, seine im Umgang mit Gefahren ganz unglaublich geschärften Sinne verrieten ihm im voraus, wenn etwas nicht in Ordnung war, sodass er stets noch Zeit zur Umkehr oder zum Umweg hatte. Überdies war Dick schon über zwei Monate in Indien, hatte in Gesellschaft von landeskundigen Männern schon Hunderte von Meilen zu Fuß zurückgelegt, und so waren ihm die Sitten der Bewohner und die Angewohnheiten der Tiere des neuen Landes nicht mehr fremd.
Eine Stunde mochte er so in schnellem Trabe gelaufen sein, ohne dass ihn die schwere Büchse daran gehindert und ohne dass man einmal etwas anderes als ein leichtes Rascheln von Blättern gehört hätte, als er plötzlich wie leblos hinter einem Busche zusammensank.
Kein Laut hatte die Ruhe der Wildnis gestört, Dick aber hatte doch die Anwesenheit von Personen vor sich gewittert.
Schon klang es wie ein Brechen von Zweigen, es kam immer näher, und bald sah Dick im Scheine des unterdes aufgegangenen Mondes zwei Männer auf sich zukommen. Sie führten an Leinen Hunde, welche mit auf die Erde gesenkten Nasen einer Spur folgten.
Dick erkannte in ihnen Kulis und jene großen Hunde, welche zur Jagd auf schnellfüßige Antilopen verwendet werden, aber auch sehr gut die Spur eines Menschen auffinden können. Sie verfolgen eben die Fährte, auf welche sie gesetzt werden.
»Alle Wetter«, dachte Dick, »sie haben Hunde bei sich. Wie zum Teufel aber kommen sie vor mich? Sie müssen einen ganz nahen Weg nach der Plantage kennen und suchen mir denselben abzuschneiden. Denn dass die Hunde meine Spur finden sollen, ist doch ganz sicher. Na, kommt nur heran, vor zwei Kulis und zwei Hunden fürchtet sich Dick noch lange nicht.«
Er wagte nicht, sich in den Busch zu verkriechen. Er blieb so liegen, wie er lag, die Büchse schussbereit vor sich, zog das lange Bowiemesser, nahm es zwischen die Zähne und stemmte dann Hände und Füße so auf den Boden, dass er jeden Augenblick wie eine elastische Feder in die Höhe schnellen konnte.
Er sollte indes zu keinem Kampfe kommen.
Plötzlich schlug einer der Hunde wütend an und zog so stark an dem Riemen, dass der Führer, ein schmächtiger Mann, das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Für das Tier gab es nun kein Halten mehr, die Nase dicht am Boden, jagte es davon, links ab von Dick, und schleifte den Kuli, der die Schlinge nicht schnell genug von der Hand abstreifen konnte, mit sich.
Im Augenblick waren Hund und Mann verschwunden, man hörte nur noch die Hilferufe des Letzteren.
Zwischen dem zweiten Hunde und seinem Führer fand ebenfalls ein Kampf statt, der fast zehn Minuten währte. Der Hund wollte durchaus denselben Weg einschlagen, den sein Kamerad genommen, und der Kuli wollte ihn nicht lassen. Das Tier zog furchtbar an der Leine, es achtete nicht der Schläge, mit welchen es der große, kräftige Mann bedachte, es wollte durchaus irgend einer gefundenen Spur folgen und benahm sich wie wütend.
Da geschah das, was Dick vorausgeahnt hatte. Als keiner der beiden Teile nachgeben wollte, riss die Lederschnur plötzlich mit einem lauten Knall, und fort war der Hund. Der Kuli schickte ihm eine Verwünschung nach.
Plötzlich erscholl ein herzliches Lachen, und vor dem bis zum Tode erschrockenen Kuli stand der kleine, in rotes Leder gehüllte Mann, die gefährliche Büchse gemütlich über der Schulter tragend, überhaupt keine Spur von Besorgnis zeigend.
»Das war ein Spaß!«, lachte er. »Nun lauf nur deinem Hunde nach und fang ihn wieder. Weißt du eigentlich, was für eine Spur das ist, für welche sich das Tier so interessiert?«
Der Kuli fand keine Antwort, vielleicht verstand er auch gar nicht die englischen Worte. Noch immer stierte er den kleinen Roten entsetzt an, als stände ein Gespenst vor ihm.
»Na, du willst mich doch nicht etwa verschlingen, dass du das Maul so weit aufreißt?«, fuhr Dick in gemütlichem Tone fort. »Das sage ich dir gleich, ich bin sehr schwer zu verdauen, alldieweil ich zu wenig Fleisch auf den Knochen sitzen habe. Sieh mal, mein Junge, das ist eine Wolfsfährte, hinter der jeder große Hund wie toll her ist, wenn man ihm nicht von jung auf mit der Peitsche den Geschmack daran verleidet. Der Wolf war ihm lieber als ich, sonst müsste er mich gefunden haben, ich lag nämlich hier hinter diesem Busche. Denn auf mich habt ihr es doch abgesehen, nicht wahr?«
Der Kuli hörte nicht weiter der lehrreichen Auseinandersetzung zu. Plötzlich machte er einen Sprung rückwärts, einen anderen seitwärts, verschwand hinter einem Baumstamm und rannte mit ängstlichem Geschrei davon.
Lachend blickte Dick ihm nach.
»Ihr wäret mir gerade die richtigen Leute, mich zu fangen. Nee, meine Püppchen, da müsst ihr etwas früher aufstehen, wenn ihr Dick im Walde suchen wollt.«
Er wollte seinen Weg in der ersten Richtung fortsetzen, blieb aber gleich wieder stehen und lauschte. In der Ferne erscholl Bellen und Heulen von Hunden. Es kam schnell näher.
»Das sind nicht die zwei von vorhin«, brummte er, »es sind viel mehr, sie kommen hierher, und es soll mich gar nicht wundern, wenn sie auf meiner Spur sind. Also mit Hunden will man mich wie einen Wolf zu Tode hetzen. Na, versucht einmal, ob ihr mich bekommt, aber gnade Gott dem, den ich bekomme.«
Nach diesem Selbstgespräch schulterte er die Büchse und begann wieder seinen Trab anzuschlagen, immer die Richtung einhaltend, die ihn nach der Plantage bringen musste.
Den Hunden konnte er, waren sie wirklich auf seiner Fährte, doch nicht entgehen, und hätte er die Beine eines Hirsches gehabt, denn auch diesen vermochten sie einzuholen.
Dick hörte, wie das Heulen und Bellen näher und näher kam, ließ sich aber durchaus nicht einschüchtern. Ruhig, in gleichmäßigem Tempo rannte er weiter und hielt dabei die Augen weniger auf den Boden, als vielmehr nach dem Laubdach gerichtet, das sich über ihm ausbreitete und durch das an einzelnen Stellen das Mondlicht drang.
Was war aber das dort? Das konnte doch nicht ein zitternder Mondstrahl sein? Ein Licht huschte im Walde umher; bald verschwand es, bald tauchte es wieder auf, flackerte einmal hoch oben, dann wieder fast am Boden.
»O weh«, dachte Dick, »ein Irrlicht! Also ist dort ein Sumpf. Da ist es ratsamer, ich beginne meine überirdische Wanderung gleich jetzt. Will mal probieren, wie weit ich komme; dieser Baum scheint gleich ganz gut für den Anfang zu sein.«
Schon krachte es hinter ihm, und mit weit aus dem Maul hervorhängender Zunge brach ein mächtiger Wolfshund aus dem Gebüsch, auf Dick zu, zwei andere folgten ihm, und entfernt klingendes Geheul verriet, dass noch viele ihresgleichen auf Dicks Fährte saßen.
Mit einem Ruck hing diesem die Büchse auf dem Rücken, ein Sprung, ein Schwung, und Dick saß auf dem hohen Aste eines starken Baumes, weit außer dem Bereiche der Zähne der geifernden Hunde, die mit wütendem Geheul an dem Baumstamm empor sprangen.
»Werft ihn nur nicht um!«, lachte Dick. »Adieu, wir werden uns wohl nicht so bald wiedersehen.«
Schon wollte er höher klettern, als etwas geschah, was ihn veranlasste, auf dem untersten Ast noch einen Moment sitzen zu bleiben.
Aus dem Walde sprang plötzlich die Gestalt eines Mannes, in der einen Hand einen brennenden Zweig, in der anderen einen keulenartigen Stock, und ehe Dick noch Zeit hatte, sich den Mann genauer anzusehen, lagen schon die drei Hunde, ehe sie sich gegen den Angreifer wenden konnten, mit zerschmettertem Schädel am Boden. Drei Keulenhiebe hatten das bewirkt.
Doch der fremde Mann kam noch nicht zur Ruhe, er warf den brennenden Ast weg und fasste die Keule mit beiden Händen, denn eben brach aus dem Gebüsch eine ganze Meute von Hunden, nicht zusammen, sondern hintereinander. Der erste sank, von der Keule getroffen, röchelnd zu Boden, ebenso der zweite; dem dritten wäre es vielleicht gelungen, seine Zähne in den Hals des Mannes einzugraben, da aber sauste ein Büchsenkolben auf seinen Schädel herab.
Neben dem Fremden stand der Trapper und schwang seine mächtige Büchse, jeder Schlag brachte einen Hund zur Strecke. Bald war der Boden ringsum mit leblosen oder noch zuckenden Körpern bedeckt; den letzten Wolfshund ergriff der Fremde, nachdem er die Keule weggeworfen, mit beiden Händen am Halse, denn schon berührten die Zähne des Tieres seine Knie, hob es auf und schmetterte es mit dem Rücken gegen den Stamm des Baumes, sodass es mit gebrochenem Rückgrat zu Boden fiel.
Kein anderer Hund war mehr zu sehen; dieser Gefahr waren beide Männer entgangen, aber wiederum krachte es in den Büschen, und dunkle Gestalten erschienen — die Dick verfolgenden Inder.
Der Jäger dachte nicht mehr an Flucht, er suchte nicht einmal Schutz hinter einem Baum, denn auch der Fremde erwartete die Feinde, die auf jeden Fall auch die seinen waren — hatte er doch ihre Hunde getötet. Der Fremde hatte Keule und den brennenden Zweig wieder ergriffen und schwang letzteren durch die Luft.
Da stockten die heranstürmenden Inder plötzlich, sie prallten zurück, ein Schrei ging von Mund zu Mund, er wiederholte sich unzählige Male, immer aus denselben Worten bestehend, und ehe Dick noch daran dachte, Gebrauch von seiner nie fehlenden Büchse zu machen, waren die Inder schon wieder verschwunden. Man hörte noch ein Brechen und Knacken von Zweigen, als ob sie hastig flohen, dann war alles wieder still.
Jetzt fand Dick zum ersten Male Zeit, sich den Fremden zu betrachten.
Es war ein alter, vielleicht sehr alter Mann, denn seine Haare waren schneeweiß. Alles an ihm zeugte von größter Verwahrlosung. Das Kopfhaar hing ihm in langen Strähnen bis auf den Rücken herab, der ungepflegte Bart bis weit auf die Brust, das Gesicht hatte eine pergamentähnliche Farbe, ebenso die Hände, an denen sich überaus lange Nägel befanden.
Gekleidet war die sonderbare Gestalt in rohe Felle, das Haar nach außen gekehrt, und hatte sich der Mann diese Bekleidung selbst gemacht, so war er weder Gerber noch Schneider.
Der Rock war einfach ein Fell, vorn zusammengenäht, die starkknochigen, muskulösen Arme ganz freilassend. Die ebenso plump gefertigten Hosen reichten nur bis an die Knie und wurden an den Hüften von einem Hanfstrick festgehalten. Die Schuhe aus rohem Fell bedeckten außer den Füßen noch die halben Waden.
Das Gesicht des Mannes mochte sonst Kummer und Leiden ausdrücken, die Augen erloschen erscheinen, als er aber jetzt den brennenden Zweig schwang und damit die Leichen der Hunde beleuchtete, strahlte sein Auge in fanatischer Glut.
Ein anderer als Dick würde sich gefürchtet haben, sich mit solch einer wilden Gestalt allein in der Wildnis zu befinden, er aber war schon an derartige Erscheinungen gewöhnt.
Manche Trapper Nordamerikas setzen einen förmlichen Stolz darein, ihr Äußeres bis ins Unglaubliche zu vernachlässigen. Seife, Kamm, Schere und Rasiermesser kennen sie gar nicht mehr, dagegen wenden sie die größte Sorgfalt dem Aussehen ihrer Waffen zu.
Dick wunderte sich daher lediglich, dass dieser Mann gar keine anderen Waffen hatte als die Keule, auch das kam ihm sonderbar vor, dass der Mann ihn nicht mit einem einzigen Blick beachtete. Er schien ihn gar nicht zu sehen.
»Das war ein Meisterstück«, redete Dick ihn auf englisch an, denn ein Europäer war er unbedingt, »sechzehn Hunde getötet, ohne auch nur einen Schuss abgegeben oder einen Stich gemacht zu haben. Das soll uns ein anderer einmal nachmachen. Ich danke Euch auch, Fremder, Ihr habt mir wacker beigestanden. Vielleicht kommt noch einmal die Gelegenheit, dass ich Euch helfen kann.«
Der Unbekannte schien jedoch ebenso wenig zu hören wie zu sehen. Er trat zu einem toten, sehr großen Hunde, betastete ihn, wie man ein Stück Schlachtvieh befühlt, warf ihn über die Schulter und ging stumm an Dick vorüber, ohne ihn auch jetzt nur eines Blickes zu würdigen.
»Nanu, das ist ja ein merkwürdiger Kauz«, dachte der Jäger, »und allem Anschein nach hat er Lust, sich den Hund zu braten. Gesegnete Mahlzeit!«
Er lief ihm nach und rief laut: »Heda, guter Freund, Ihr habt mir vorhin zwar wacker geholfen, alle Achtung vor Euch, aber etwas höflicher dürft Ihr deswegen doch sein. Und wenn Ihr den Hund braten wollt, so erbitte ich mir ein saftiges Stückchen davon, ich bin auch ein Liebhaber von Hundesteak. Oder wenn Ihr die Sprache verloren habt und stumm seid, dann sagt es wenigstens.«
Ob der Unbekannte den leisen Spott übel nahm oder ob er keine Begleitung wünschte, kurz, er drehte sich schnell um und hob die Keule wie zum Schlage. Dick sprang einen Schritt zurück.
»Oho, Ihr seid ja mit einem Male furchtbar grob geworben. Na, meinetwegen geht zum Teufel.«
Dick sah die Gestalt zwischen den Bäumen verschwinden, war aber nicht dazu geneigt, seine Neugier wer dieser Mann eigentlich sei, und was er treibe, wo er zu Hause sei und so weiter, unbefriedigt zu lassen.
Vorsichtig schlich er ihm nach, und zwar so leise, dass der Voranschreitende nichts davon merkte. Dick konnte ja auch einen gehörigen Abstand einhalten, denn das flackernde Licht zeigte ihm den Weg an.
Endlich blieb er stehen, Dick schlich näher und wurde, von einem Busche verborgen, Zeuge einer seltsamen Szene.
Unter einem Baume lagen zertrümmerte Holzplanken, dazwischen Kissen, Polster, einige Glasscherben, auch Stricke und Ledergurte mit Schnallen.
So seltsam dies im ersten Augenblicke dem Jäger auch schien, seine Aufmerksamkeit wurde von etwas anderem gefesselt.
Neben diesem wüsten und zerstreuten Haufen lag nämlich, den Kopf auf ein Polster gebettet, eine Gestalt im Gras und obgleich Dick sie nicht vollständig sehen konnte, das Gesicht gar nicht, so schloss er doch sofort aus den Locken, welche vom Kopfe hernieder wallten, wie auch aus der für ihn sichtbaren Kleidung, dass dort ein indisches Weib lag.
Der Unbekannte brannte einen neuen, trockenen Zweig an, pflanzte ihn neben sich in den Boden und beschäftigte sich mit der anscheinend Leblosen. Dabei benahm er sich mit einer geradezu mütterlichen Sorgfalt. Indem er ihren Kopf mit der einen seiner rauen Hände sanft und zärtlich streichelte, richtete er ihn mit der anderen hoch, und jetzt sah Dick, dass die Unbekannte um die Stirn einen blutigen Verband trug.
Das Gesicht konnte er noch nicht sehen, weil sich der Arm des Fremden davor befand. Woher der mittellose Fremde, der nicht einmal ein Hemd besaß, das zum Verband benutzte weiße Leinen bekam, wurde Dick bald begreiflich. Er riss einfach von dem weißen Unterkleid des Weibes ein großes Stück ab und band es ihm um den Kopf.
Die Wunde konnte nicht alt sein, denn sie blutete noch. Mit einem anderen Stück Leinen wischte der Alte das hervorsickernde Blut ab.
Dann hob er die Leblose auf, setzte sich selbst auf das Polster, nahm das Weib auf seine Knie und herzte und küsste es, als wäre es seine Geliebte, dabei für Dick unverständliche Worte vor sich hinmurmelnd.
Jetzt konnte dieser das Gericht des Weibes sehen, er erblickte die braunen, lieblichen Züge eines jungen Mädchens, und war vor Erstaunen außer sich.
Wo hatte er dieses Gesicht nur schon einmal gesehen? Es war ihm bekannt, darauf konnte er schwören. Doch wo in aller Welt war er mit dem Mädchen zusammengetroffen?

Der Alte fuhr fort, die Bewusstlose zu liebkosen, und Dick zerbrach sich, während er die Augen starr auf deren Gesicht heftete, fast den Kopf, wo er sie schon einmal gesehen hatte.
Als er zu keinem Resultat kam, grübelte er darüber nach, wie die ihrer Kleidung nach jedenfalls vornehme Inderin hierher zu dem wilden Manne kam, der ihm geistesgestört erschien, was hier überhaupt vorgegangen sei.
Den Trümmerhaufen aus Brettern und Polstern konnte er sich erst nicht erklären, bis er mächtige, tiefe Spuren entdeckte, die auch neben ihm am Boden hinliefen. Er erkannte sie sofort als die Fährte eines Elefanten, welcher in weiten Sprüngen gerannt sein musste, und jetzt konnte er sich auch erklären, was für ein Ganzes jene Trümmer dort gebildet hatten.
Es war ein Baldachin gewesen; die Kissen und Polster hatten zur inneren Bequemlichkeit gedient: mit den Stricken und Ledergurten war er auf dem Elefanten festgeschnallt gewesen, und jene Inderin hatte ihn bewohnt. An dem tiefen Ast dort war der Baldachin vom rennenden Elefanten abgestreift worden, das Mädchen hatte den Sturz mitgemacht, eine Stirnwunde davongetragen, die es bewusstlos machte, und war dann von dem Alten, der jedenfalls wahnsinnig war, gefunden worden.
Aber wer war sie nur? Durfte Dick überhaupt dulden, dass der Alte die Bewusstlose so zärtlich behandelte? In Amerika groß geworden, war es bei ihm eine unauslöschliche Regel, sich Damen gegenüber, ob arm oder reich, ob jung oder alt, mit der größten Höflichkeit und Rücksicht zu benehmen, besonders wenn sie hilflos waren.
Dieser alte, hässliche Mann jedoch tat, als ob das Mädchen seine Braut wäre.
Da machte dieses jedoch einige leichte Bewegungen, stieß einen leisen Seufzer aus und richtete sich dann aus ihrer liegenden Stellung auf.
Sie schien sofort bei Besinnung zu sein, erschrak, schrie halblaut und stemmte beide Hände gegen die Schultern des Mannes. um ihn von sich fernzuhalten. Dieser aber zog sie wieder an sich und bedeckte ihr Gesicht mit immer neuen Küssen. Er benahm sich, als hätte er ein kleines Kind auf dem Schoß, wiegte sie sogar auf den Knien hin und her.
Das Mädchen schrie lauter und sträubte sich aus Leibeskräften, doch der kräftige Mann umschlang es mit dem einen Arm und presste den reizenden Kopf immer wieder an sein haariges Gesicht.
Schon konnte Dick seine Ruhe nicht mehr bewahren, sein ehrliches Blut wallte auf, weil er hier einem Gewaltakte beiwohnte, welchen er zu den größten Erbärmlichkeiten rechnete, da schoss ihm etwas anderes durch den Kopf.
»Herrgott, das ist ja...«, schrie er plötzlich und stürmte, ohne den Satz zu vollenden, dem Mädchen zu Hilfe.
Der Alte sah ihn kommen, ließ die Jungfrau fahren, sprang auf, ergriff seine Keule und warf sich dem Störer entgegen.
Mit zum Schlage erhobener Waffe stand er Dick gegenüber und ließ die Keule mit einem unartikulierten Wutschrei auf ihn herabsausen.
Dick parierte den tödlichen Schlag mit der Büchse, ließ diese dann fallen und packte die Keule, um einen zweiten Schlag zu verhindern. Der Mann hatte ja sonst keine Waffen.
Ebenso schnell jedoch ließ der Alte die Keule fahren und hatte im Nu Dicks Hals mit beiden Händen mit eiserner Kraft umschlungen; wie ein Schraubstock legten sich die harten Finger um ihn.
Des Jägers Tod wäre unvermeidlich gewesen, er hätte ersticken müssen, wenn er nicht im Kampfe mit Indianern aufgewachsen und dadurch im Handgemenge, auch ohne Waffen, ein furchtbarer Gegner geworden wäre.
Schnell wie der Blitz bückte er sich, hob den großen, starkgebauten Mann wie eine Feder empor, drehte sich wie ein Kreisel um sich selbst und schmetterte den Körper des Gegners gegen den nächsten Baum.
Es klang, als ob ein Topf zerberste. Der Alte ließ auch sofort seine Arme schlaff herabsinken und schien betäubt zu sein.
»Kerl, was hast du mit dem Mädchen vor?«, schrie Dick ihn an. »Das ist ja die junge Dame, welche ich im Hause der Lady Carter einmal gesehen habe.«
Der Alte taumelte wie vom Schlage getroffen zurück, blickte Dick mit entsetzten Augen an, schlug dann die Hände vors Gesicht und rannte mit lautem Jammern, das dem höchsten Schmerze entstammen musste, auf und davon.
Erstaunt blickte der Jäger dem im Walde Verschwindenden nach.
»Verrückt, total verrückt!«, murmelte er.
Aber auch das Mädchen war nicht mehr zu sehen.
Dort lag die Keule des Alten, dort stak noch der dem Verlöschen nahe Zweig, dort neben dem Trümmerhaufen war das Polster, aber das Mädchen selbst war nicht mehr zu sehen. Es musste während des Ringkampfes der beiden entflohen sein.
Dick stützte sich auf seine Büchse und überlegte. Was sollte er nun tun?
Es wäre ihm ein leichtes gewesen, die Spuren des Alten oder auch die des Mädchens zu verfolgen, und interessant musste es sein, zu erfahren, wohin die eine oder die andere führte. Aber er erinnerte sich, wie warm ihm Reihenfels ans Herz gelegt hatte, sich in keine unnötige Gefahr zu begeben, sondern nur auf seine eigene Sicherheit bedacht zu sein, denn von seinem Leben, schon von seiner Freiheit hing es ab, ob Reihenfels und seine Begleiter das Schloss Bahadurs lebendig verlassen könnten.
»Der Alte war verrückt«, brummte Dick, »das ist ein Faktum. Wie er in diesen Wald kommt, und was er hier treibt, mag Gott wissen, mir soll's egal sein. Werde Reihenfels davon erzählen. Ist übrigens nicht das erstemal, dass ich solch einen kuriosen Kauz treffe, und das Mädchen? Weiß der liebe Himmel, was mit dem passiert ist. Sie ist schon damals mit ihrem Onkel geflohen, als der gerade gebraucht wurde. Aber vielleicht war sie es gar nicht, sie sah jener — Bega hieß sie wohl — nur ähnlich.
»Das wäre ja zu merkwürdig, wenn ich sie hier mitten im Walde und in der Nacht als die Braut eines Wahnsinnigen antreffen sollte. Na, meinetwegen, ich mache, dass ich fortkomme.«
Nach diesem Selbstgespräch verließ Dick den Platz, ohne sich um die zurückbleibenden Sachen zu kümmern, orientierte sich auf einer Stelle, wo er durch das Laubdach hindurch den Himmel sehen konnte, über den Stand der Sterne und nahm dann mit großen Schritten die Richtung wieder auf, die ihn nach der Plantage des Mister Shaw bringen musste.
Nicht lange dauerte es, so schien es, als ob um den verlassenen Platz ein großes Tier schleiche, das sich aber im Walde nicht geschickt genug zu bewegen wusste, denn die Zweige krachten zu häufig unter seinen Füßen, Ein Raubtier konnte es also nicht sein, denn das hätte sich lautloser bewegt, und ein anderer Vierfüßler schlich nicht während der Nacht durch den Wald.
Da teilten sich die Büsche, ein bärtiges Gesicht mit rollenden Augen kam zum Vorschein, und gleich darauf schlüpfte eine menschliche Gestalt aus dem Dickicht.
Es war das wandernde Feuer, wie die Eingeborenen, die ihn gesehen hatten oder gesehen haben wollten, ihn nannten.
Der unheimliche Mann hob erst die Keule vom Boden auf, schwang dann den nur noch glimmenden Ast so lange durch die Luft, bis er wieder hell brannte, und wendete den Kopf dahin, wo das Mädchen vorhin gelegen hatte.
Als er es nicht mehr sah, begann er die Umgegend abzusuchen und stieß dabei ein markerschütterndes, jammerndes Geheul aus, wie die Tigerin, der ihr Junges geraubt worden ist.
Obgleich die Nacht schon so weit vorgeschritten war, dass sie bald der im Osten über dem Wald auftauchenden Morgenröte weichen musste, hatten doch noch nicht alle in dem Jagdschlosse Befindlichen im Schlafe Ruhe gesucht.
Wieder befanden sich Bahadur, Nana Sahib und der hier mit Sinkolin angeredete Timur Dhar in dem Turmzimmer, das keine Nebenräume besaß, und hörten den Bericht eines Mannes, der vor einer halben Stunde mit vielen Leuten im Schlosse angekommen war. Noch jetzt war sein Gesicht mit Schweiß, seine Kleidung mit Schlamm bedeckt, er sprach mit sichtlichem Zögern, und was er erzählte, musste die Zuhörer mit Unwillen erfüllen, denn dieser war auf ihren Gesichtern ausgeprägt. Nur das des Gauklers hatte seinen gleichmütigen, kalten Ausdruck beibehalten.
»Mit einem Wort«, unterbrach Bahadur den Erzähler ungeduldig, ehe er noch geschlossen hatte, »dieser Mensch ist dir also entgangen, spare dir die lange Schilderung des Agni, wir glauben nicht daran, dass ein Feuergeist in sichtbarem Zustande die Erde betreten darf und die Faringis unterstützt, um seinem Volke, das ihn anbetet, zu schaden.«
»Herr, es ist so! Verflucht will ich in alle Ewigkeit sein, wenn auch nur ein unwahres Wort über meine Lippen kommt!«, rief der Mann mit kläglicher Stimme. »Frage die, welche mich begleiteten, ob auch nur die Aussage des einen der des anderen widerspricht. Es war der Feuergeist, der zum Fluch als Mensch leben muss und das wandernde Feuer genannt wird. Wie wäre es sonst möglich, dass er alle meine Hunde tötete, diese starken Tiere, die selbst den Königstiger zu überwältigen vermögen!«
»Aber auch der, den ihr verfolgen solltet, hat ihn dabei unterstützt.«
»Vielleicht, ich habe es nicht selbst gesehen Einer meiner Diener hat es behauptet.«
»Nun, dieser Mann ist ein Mensch, kein Geist, und verstand es auch, sich die Tiere vom Leibe zu halten.«
»So verlieh ihm die Anwesenheit des Feuergeistes übernatürliche Kraft und Gewandtheit.«
»Geh jetzt!«, sagte Nana Sahib zu dem sich verteidigenden Manne. »Wir haben uns in dir getäuscht. Wir glaubten, du würbest uns die Nachricht von dem Tode dessen bringen, den wir hassen, und du meldest uns, dass er entkommen ist, und erzählst uns Fabeln. Du hast keine Hunde mehr, so bist du auch kein Eschnaib mehr. Geh!«
Der Eschnaib, der Führer der Hundemeute, wie solche die vornehmen Inder zur Hetzjagd benutzen, wollte sich mit demütiger Verbeugung und zerknirschter Miene entfernen, auf ein mahnendes Zeichen Sinkolins jedoch rief Nana Sahib ihn noch einmal zurück.
»Ich will dich deiner Stelle wegen des heutigen Vorfalles doch noch nicht entheben«, sagte er, »Du wirst eine andere Meute bekommen. Nur ziehe sie so, dass sie das nächste Mal auch einen Feuergeist zu packen versteht, den Brahma verflucht hat.«
Als sich der Eschnaib jetzt entfernte, hatte sein Gesicht einen freudigen Ausdruck bekommnen.
Die drei Männer blickten sich lange stumm an.
»Entgangen!«, knirschte Nana Sahib zuerst und stampfte heftig den Boden mit dem Fuße.
»Wäre er tot, so brauchte ich nur hier diesen Hebel«, er griff an eine aus der Wand herausragende Stange, »in Bewegung zu setzen, und für immer wären diese Menschen verschwunden, die wir fürchten müssen, solange wir leben. Der Boden würde sich unter ihnen öffnen, sie stürzten hinab in eine bodenlose Tiefe.«
Nana Sahib musste eine Unbedachtsamkeit gesprochen haben, denn die beiden anderen stießen gleichzeitig ein verächtliches Lachen aus.
»Solange wir leben?«, entgegnete Bahadur geringschätzend. »Da irrst du dich wohl! Wir haben sie nur so lange zu fürchten, wie unsere Pläne noch nicht reif sind. Dann aber kann es uns gleichgültig sein, ob sie uns durchschaut haben oder nicht, denn dann ist ja doch klar erwiesen, auf welches Ziel wir hingearbeitet haben.«
Nana Sahib sah dies ein.
»Und wenn sie schon jetzt Unrat merkten?«
»Es fehlen ihnen die Beweise gegen uns.«
»Dieser Reihenfels scheint viel zu ahnen; er kommt dem langsam, aber sicher näher, was wir vorhaben. Kann er kombinieren, so dürfte er alles erraten haben, denn er hat den letzten Ausruf Sirbhangas gehört, er hat vielleicht dessen noch fehlenden Arm gefunden, und da er Sanskrit versteht, weiß er seinen Namen, weiß vielleicht auch, dass so der Radscha von Dschansi heißt; er hat vielleicht die Zeichen im Fell der Tigerin gefunden und ahnt wenigstens, dass ich im Spiele bin; er ist in alle uns so unangenehmen Vorkommnisse in England eingeweiht; kurz, besitzt er Kombinationsgabe, was ich nach allem Vorangegangenen nicht bezweifle, so kann uns in ihm ein mächtiger. Feind erstehen, der alle unsere Pläne vernichtet, ehe wir sie noch zum Reifen gebracht haben. Soll ich?«
Er ergriff den Hebel, doch Sinkolin packte sein Handgelenk.
»Es darf nicht sein«, raunte er. »Jeder gegen uns erhobene Verdacht würde uns nicht so viel schaden, als wenn man weiß, dass bei uns Faringis, die unter dem Schutze der englischen Regierung stehen, eingekehrt und verschwunden sind. Übrigens ist Reihenfels vorsichtig; ein Glück für uns, dass er zu vorsichtig ist. Er hat allerdings einen Argwohn gegen uns gefasst, aber er sucht erst mehr Beweise, und wenn er diese hat, dann wird es zu spät sein, um sie noch benützen zu können. Dann brauchen wir keine Ankläger mehr zu fürchten.«
»Keine Torheit aus Übereilung!«, warnte auch Bahadur, der sichtlich erschrak, als Nana Sahib den Hebel an der Wand fasste. »Lass sie ruhig das Schloss verlassen. Lange dauert es doch nicht mehr, bis wir am Ziele sind. Basrab muss schon lange unterwegs sein, meiner Berechnung nach kann er gar nicht weit von hier sein, und ich denke, Sinkolin, du kannst dich morgen auf den Weg machen, um die Begum bis an das Endziel ihrer Reise zu begleiten. Bereite sie noch einmal vor, schildere ihr die Zukunft mit den glänzendsten Farben, flöße ihr noch einmal das Gift des Hasses gegen die Engländer ein und umgaukele ihre Phantasie mit mystischer Zauberei, wie nur du es verstehst, Sinkolin...«
»Es wäre nicht mehr nötig«, unterbrach ihn dieser, »denn schon ist die Begum vollständig die unsere. Sie dürstet danach, ihre glänzende Rolle zu beginnen, und sie ist auch die Richtige, sie zu spielen. Ich werde sie trotzdem noch einmal darauf vorbereiten. Vergiss aber auch nicht, Bahadur, dass wir im Sinne des Weibes Nana Sahibs handeln müssen.«
Bahadur wurde über diese Ermahnung etwas aufgebracht.
»Ist diese Frau noch nicht zufrieden mit der Stellung, die ich ihr zugeteilt habe?«
»Die füllt sie nur aus, und zwar zu unserer größten Zufriedenheit, um so weit zu kommen, dass sie ihre Privatrache befriedigen kann.«
»Sollen wir dessentwegen unsere Plane ändern?«
»Nicht im Geringsten. Doch mir müssen ihr Gelegenheit geben, dass sie einst ihren Hass fühlen kann.«
»Sie soll es!«
Die drei Männer schwiegen, jeder mit seinen Gedanken beschäftigt.
»Es ist die höchste Zeit, schlafen zu gehen«, nahm Bahadur dann wieder das Wort. »Ist es auch noch Nacht, so beginnt es im Osten sich doch schon zu lichten, und der kommende Tag verlangt viel von uns.«
»Noch einige Worte«, entgegnete Sinkolin, »ehe ihr den Schlaf sucht, dessen ich nicht bedarf. Was haltet Ihr von dem wandernden Feuer?«
»Ein Hirngespinst, weiter nichts!«
»Das glaube ich nicht. Die Beschreibungen aller, die es gesehen haben wollen, lauten übereinstimmend: ein alter, großer Mann, langes, weißes Kopf- und Barthaar, lange Fingernägel, das Äußere verwahrlost, eine Keule und einen brennenden Zweig in den Händen. Er schleicht in der Nacht umher und hält sich am Tage meist in Wäldern verborgen.«
»Natürlich, weil alle die Schilderung von dem einen haben, in dessen hirnverbranntem Kopfe das Gespenst entstanden ist!«, sagte Nana Sahib.
Sinkolin schüttelte den Kopf.
»Ich selbst glaube fest daran; des Eschnaibs Erzählung war zu überzeugend. Ja, wenn ich wüsste —«
»Was?«, fragte Bahadur den plötzlich abbrechenden Gaukler.
»Nichts, eine Vermutung! Ich werde mich selbst überzeugen, ob dieser Feuergeist wirklich existiert oder nur in der Phantasie der Kulis. Es könnte sein, dass ein wahnsinniger Engländer sich in der Gegend herumtreibt.«
»Hast du Nachricht von den Getreuen erhalten?«, fragte Bahadur. Wie misstrauisch blickten die kleinen Augen den Frager an.
»Nein, schon lange nicht mehr. Mein Weg führt mich nach Dschansi, und dort bin ich nicht weit von ihnen entfernt. Ich werde fragen. Nun noch etwas: Der Bote dieses Reihenfels ist uns also durch die Tölpelhaftigkeit des Eschnaibs entkommen, wir müssen daher die Faringis ruhig abziehen lassen. Wir dürfen nicht einmal wagen, ihr Gedächtnis durch das uns bekannte Mittel zu trüben, denn wo anders sollte es ihnen beigebracht worden sein, als im Jagdschloss Nana Sahibs, in Gegenwart des Großmoguls?«
»Auf keinen Fall!«, riefen die beiden anderen hastig.
»Wie Bahadur schon sagte«, fuhr Sinkolin fort, »ist es unseren Plänen durchaus nicht schädlich, wenn sie leben bleiben, denn sie vermögen nicht früh genug gegen uns aufzutreten. Dennoch aber droht uns eine große Gefahr.«
»Welche wäre das?«
»Wir haben von den Kulis, welche sie begleiten, erfahren, dass sie allem Anschein nach auch Sirbhangas Arm gefunden haben, und ist dieser noch in ihrem Besitze, so kann Reihenfels die Tätowierung lesen, und ebenso besitzen sie das Fell, in welches die Anfangsbuchstaben deines Namens, Nana Sahib, eingebrannt sind.«
»Dies alles haben wir schon erörtert!«, rief Bahadur ungeduldig. »Es genügt indes nicht, uns zu verdächtigen. Bah, sollte ich, der Großmogul, die Anklage dieses Reihenfels, der nicht einmal ein Engländer ist, zu fürchten haben?«
»Dennoch sind es mächtige Beweismittel in seiner Hand, die, wenn auch nicht jetzt, unsere Sache doch stürzen können. Bedenke wohl: Reihenfels könnte aus dem Fund und aus dem letzten Ausruf Sirbhangas den sicheren Schluss ziehen, dass der Radscha nicht im ehrlichen Zweikampf, sondern durch Meuchelmord gefallen ist.«
Diese Worte enthielten eine große Beleidigung für Nana Sahib, doch er schwieg, und sein Schweigen war ein Geständnis. Diesen beiden gegenüber brauchte er sich aber dessen auch nicht zu scheuen.
»Und was dann?«, fragte Bahadur.
»Das Volk von Dschansi ist heißblütig, leicht reizbar, misstrauisch, stolz, oder auch ehrlich, ebenso wie es der Radscha war. Erfährt es, wie es seinen geliebten Fürsten verlor, und durch wen, dann wird es seine Rache zunächst gegen den kehren, der es beleidigt hat, und die neue Königin wird es davon nicht abhalten können. Dies alles kann Reihenfels mit dem erzielen, was er gefunden hat.«
»Du hast recht!«, sagte Bahadur noch langem Nachdenken. »Daher müssen ihm die Beweismittel genommen werden, mit List oder mit Gewalt.«
»Lieber mit List, und ich werde das besorgen. Sinkolin wird die Faringis in tiefen Schlaf wiegen.«
Nach diesen rätselhaften Worten, die aber die beiden ganz gut zu verstehen schienen, verneigte er sich zum ersten Male heute tief vor dem Großmogul, gönnte Nana Sahib ein kurzes Kopfnicken und verließ das Gemach.
Mit finster gerunzelter Stirn und drohenden Augen blickte letzterer dem Hinausgehenden nach.
»Er wird anmaßend, dieser Sinkolin!«, sagte er, als sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte.
Bahadur legte die Hand vertraulich auf die Schulter des Neffen.
»Schmähe ihn nicht, Nana! Benimmt er sich manchmal nicht so, wie du es von jedem anderen verlangen kannst, so denke daran, dass wir ihn nicht entbehren können!«
»Warum nicht?«
»Weil er uns unentbehrlich ist.«
»Das dürfte die Frage sein!«
»Doch nicht. Die ungeheure Macht, die wir jetzt über das indische Volk ausüben, dieser Fanatismus, verbunden mit der größten Verschwiegenheit, der überall unserer guten Sache entgegengebracht wird, haben wir nur Sinkolin zu verdanken. Er ist der eigentliche Leiter; nicht uns selbst, sondern sein geheimnisvolles Wesen, mit dem wir uns nur schmücken, betet das Volk an.«
»Und wenn er nun einmal seine Macht missbraucht?«
»Wie meinst du das?«
»Sinkolin hat es verstanden, sich zu deinem Barbier zu machen, an sich schon ein wichtiges Amt; dem despotischen Herrscher, der du damals warst, lauerte der Meuchelmord überall auf; der Gaukler hat sich bis zum Minister, bis zu deinem Ratgeber aufgeschwungen, auf den du allein hörst...«
»Und mit vollem Recht. Sinkolin steht an Klarheit des Verstandes und Urteiles unerreicht da, aber er unterstützt nicht allein durch den Rat, sondern auch durch die Tat.«
»Und er wird noch höher streben«, fuhr Nana Sahib fort, »bis du ihn fürchten musst!«
Bahadur schüttelte ungläubig lächelnd den Kopf.
»Ich hatte Sinkolin schon lange zu fürchten gehabt«, entgegnete er. »Mein Leben liegt doch täglich in seiner Hand, und er könnte schon jetzt die höchste Stelle einnehmen, wenn er wollte. Ich traue ihm jedoch vollkommen; er ist mir treu ergeben und erstrebt nichts, was ihm nicht gebührt. Er liebt sein Vaterland mehr als jeder andere Inder; es frei zu machen und den auf den Thron zu setzen, dem dieser gebührt, das ist sein glühendster Wunsch. Dies ist die Ursache, dass ich ihn nicht fürchte. Vergiss, dass er einst eine untergeordnete, selbst eine verachtete Stelle eingenommen hat, die eines Gauklers, und nütze klug aus, was wir seiner Schlauheit, Tatkraft und Treue verdanken. Genug davon! Ich kann Sinkolin nicht entbehren, und von dir erwarte ich, dass auch du dich ihm fügst.« —
Der Mann, von dem die beiden eben sprachen, der zugleich die Rolle eines Barbiers, eines Dieners, eines Gauklers und eines Ministers spielte, den einige fürchteten, andere ehrten, dessen Existenz von Unzähligen überhaupt bezweifelt, von den meisten mit einem geheimnisvollen Nimbus umgeben wurde, schlich unterdes geräuschlos durch den winkligen Korridor des zweiten Stockes.
Er hatte einen dichten, langen Vollbart angelegt, der ihn ganz unkenntlich machte. In der Hand trug er einen Apparat, den zwar ein Tuch bedeckte, welches aber doch die Formen erkennen ließ. Es schien ein Destillierkolben zu sein, wie die Chemiker ihn benutzen.
Auf einen Druck öffnete sich eine Wand; Sinkolin verschwand in der Öffnung, befand sich aber nicht in einem Gemache, sondern in einem dunklen, engen Gange. Es zeigte sich, dass die starke, steinerne Wand nicht massiv, sondern hohl war. Sinkolin öffnete in der inneren Seite derselben eine Klappe und bekam so Einsicht in einen Raum, der von der eben beginnenden Morgendämmerung schwach beleuchtet wurde.
Hier schliefen Lady Carter und Miss Woodfield auf erhöht angebrachten Betten; auf einem Teppich an der Tür lag Hedwig. Erstere schliefen sanft; die Anstrengungen der Reise hatten sie äußerst ermüdet, Hedwig dagegen, die getaufte Inderin, bewegte sich unruhig.
Ein höhnisches Lächeln verzerrte die Züge des Gauklers, als er die Schläferinnen sah.
»Ihr würdet nicht so ruhig schlafen«, murmelte er unhörbar, »wenn ihr wüsstet, in wessen Hause ihr übernachtet, oder was der Auftrag der Dienerin ist, der ihr so viel vertraut. Doch es wird hell, ich muss eilen, denn jene Männer, an Beschwerden gewöhnt, werden nicht in den Tag hinein schlafen. Die Morgensonne weckt sie.«
Er verließ den Gang und begab sich in den anderen Flügel des Korridors. Hier verschwand er abermals in der hohlen Wand und ging auch darin fort, um durch drei verschiedene Klappen in ebenso viele Gemächer zu blicken.
Im ersten sah er Mister Reihenfels und Woodfield liegen, im dritten den Fakir und Kiong Jang, Jeremy und August. Alle hatten es sich zur Nachtruhe bequem gemacht und schliefen sorglos.
Finster musterte der Gaukler den jungen Deutschen, dessen Klugheit er erkannt hatte, verächtlich den alten Engländer, mit hasserfüllten Blicken betrachtete er den Fakir und den Chinesen.
»Euch soll euer Lohn zuteil werden, meine Rache soll euch Verräter so furchtbar treffen, wie die Welt es noch nicht gesehen hat. Du, Hira Singh, bist die Schande nicht nur deiner Kaste, sondern ganz Indiens; du verrätst die dir anvertrauten Geheimnisse und hältst es mit den Engländern. Dafür sollen dir die Geier das Fleisch lebendig vom Leibe reißen. Und du, Kiong Jang, hast mich verspottet und willst mich jetzt verraten. Sucht nur, ihr werdet den Felsentempel doch nicht finden! Euer Hiersein ist vergeblich, ihr liefert euch nur selbst meiner Rache aus. Ha, Kiong Jang, wenn du wüsstest, dass ich da bin, den du fürchten musst! Aber ich verstehe die Kunst, mich zu verstellen; und wäre dein Auge auch noch so scharf, du würdest mich nicht erkennen. Du entgehst den heiligen Schlangen der Kali nicht.«
Er zählte die Schläfer.
»Einer fehlt unter ihnen, und es wird so sein, wie ich vermutete; der vorsichtige und kluge Reihenfels hat ihn als Wächter neben den Sachen gelassen. Doch der junge Mann dünkt sich allzu klug, ich werde ihn belehren, dass all seine List vor mir in Nichts zerrinnt.«
Sinkolin öffnete die zum mittelsten Gemach führende Augenklappe und gewahrte einen Haufen von aufgestapelten Ballen, Kisten, Koffern usw. Auf einem der ersteren waren dicht am geöffneten Fenster die beiden Felle des Königstiger, des großen, wie des kleinen, zum Trocknen aufgespannt.
Vor den Waren lag auf einem Teppich, unterm Kopf den Sattel eines Maultieres, Charly, neben sich die Büchse, im Gürtel Revolver und Bowiemesser. Seine tiefen, regelmäßigen Atemzüge verrieten, dass er fest schlief.
»Er ist ein Mann, welcher in Wildnissen großgeworden ist«, murmelte Sinkolin, »er ist gewohnt, auch das leiseste Geräusch selbst im tiefen Schlafe zu vernehmen, denn stets muss solch ein Mann vor Raubtieren und Feinden auf der Hut sein. Ich besitze jedoch ein Mittel, ihn in einen so tiefen Schlaf zu versetzen, dass das Haus über ihm zusammenfallen könnte, ohne dass er es merkt. Nur eine Stunde währt diese Betäubung, dann erwacht er mit freiem Kopfe. Fehlt nachher etwas von dem Gepäck, so haben Kulis es gestohlen, und ich werde sie züchtigen lassen. Dort liegt das Fell, den Arm werde ich finden — beides muss ich besitzen. Wohlan, treuer Wächter, schlafe wohl!«
Mit einem hämischen Lächeln befestigte Sinkolin ein elastisches Instrument an seiner Nase, welches diese vollständig verschloss, wickelte den Apparat aus dem Tuche und brachte die daran befindliche Röhre in die Öffnung. Dann entzündete er ein Lämpchen und hielt die Flamme unter den Kolben.
Sofort ward ein süßlicher Geruch bemerkbar.
Sinkolin öffnete durch Druck auf einen Knopf die Tür und trat lautlos ein. So blieb er eine Minute stehen, teils um noch mehr berauschendes Gas ausströmen zu lassen, das aus dem offenen Fenster nicht schnell genug entweichen konnte, teils um die aufgestapelte Bagage genauer mustern zu können.
Da sah er schon, was er suchte. Neben einem Ballen stand ein großes, längliches Hohlglas, wie man es. zum Aufbewahren von Schlangen benutzt, und in demselben befand sich in einer gelben Flüssigkeit ein nackter, muskulöser Menschenarm — Reihenfels hatte ihn in Spiritus gesetzt.
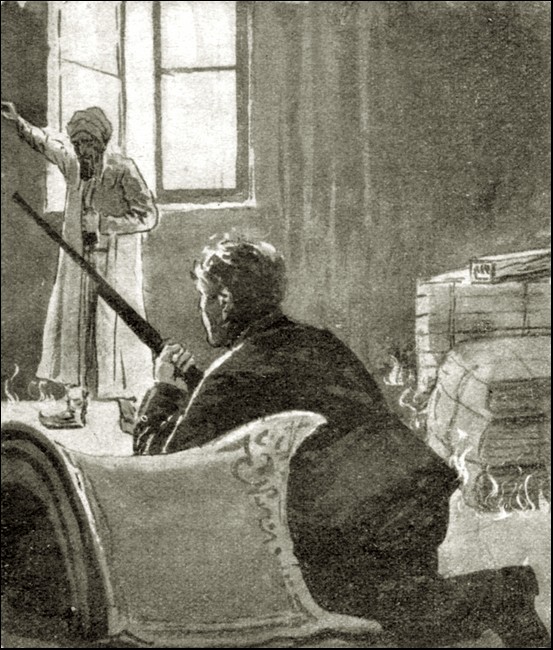
Deutlich konnte Sinkolin die blaue Tätowierung erkennen.
Er eignete sich aber nicht zuerst dieses Glas an, sondern wollte mit dem Schwierigeren beginnen, mit der Abnahme des großen Felles von dem Ballen, für den fingergewandten Gaukler aber auch eine Kleinigkeit; die er ohne das geringste Geräusch ausführen konnte.
Immer den gaserzeugenden Apparat in der Hand, stieg er über den Schlafenden hinweg, der mit keiner Wimper zuckte. Charly hatte keine Ahnung von dem, was um ihn vorging.
Noch einen Schritt, dann hatte Sinkolin das Fell erreicht, mit ausgestreckter Hand tat er ihn und — der schlaue Gaukler sah sich überlistet, dem heimlichen Tun verraten.
Als sein Fuß beim letzten Schritt den Boden berührte, zuckte eine hohe, jedoch nicht heiße Flamme auf, sie pflanzte sich rings um die aufgebauten Stapel fort, begleitet von einem lauten Prasseln und Krachen.
Im selben Moment sprang Charly auf und hatte auch schon den heimlichen Besucher gepackt.
»Was gibt's? Was hast du hier zu suchen?«
Sinkolin hatte nicht eine Viertelsekunde seine Besinnung verloren. Mit blitzähnlicher Schnelligkeit waren Nasenkneifer und Apparat wie auch die Lampe unter dem weiten Mantel verschwunden, noch ehe Charly sie überhaupt gesehen hatte.
Ruhig, verwundert, die Linke auf das Tigerfell gelegt, blickte der Inder den Pelzjäger an, der ihn noch immer gepackt hielt.
»Was hast du hier zu suchen?«, wiederholte Charly barsch.
»Habe ich dich im Schlafe erschreckt? Das tut mir leid!«, war die gelassene Antwort. »Das schöne Fell!«
»Gefällt es dir? Mir auch. Aber Mausen gibt's nicht bei uns, das musst du dir merken.«
»Ich verstehe dich nicht recht. Bitte, lass mich los!«
Charly ließ sich durch diese ruhige Sicherheit doch etwas verblüffen, er gab jenen frei.
»Hast du gut geschlafen?«, fuhr Sinkolin fort.
»O ja, ich danke!«
»Hätte ich gewusst, dass ich dich wecken wurde, so wäre ich nicht hereingekommen, um mir das Fell anzusehen, sondern hätte gewartet. Ich glaube, ich bin auf eine Zündschnur getreten.«
»Allerdings!«
Da kamen auch schon von der einen Seite Reihenfels, von der anderen Kiong Jang hereingestürzt. Die Übrigen, nur halb bekleidet, folgten nach.
»O, wie ich bedaure, euch alle im besten Schlaf gestört zu haben!«, entschuldigte sich Sinkolin, zu Reihenfels gewendet. »Ich konnte nicht ahnen, dass mein unvorsichtiges Benehmen solche Folgen haben würde. Ich wollte mir nur einmal das schöne Fell ansehen, das ich schon gestern Abend bewunderte. Du bist sehr vorsichtig, dass du eine Zündschnur um deine Sachen legst. Es kann sich freilich einmal ein Unschuldiger daran verbrennen, wie es mir bald passiert ist.«
»Man kann nie vorsichtig genug sein.«
»Du fürchtest Diebe?«
»Es könnte der Fall eintreten.«
»O, nicht im Schlosse Bahadurs! Der kleinste Gegenstand, der dir fehlte, müsste ersetzt werden, und wenn sämtliche Kulis von ganz Indien durchgepeitscht werden sollten. Doch so etwas kommt hier nicht vor!«
August hatte die Nase hochgehoben und immer umherschnüffelt.
»Ei, wie richt das hier schön!«, rief er jetzt, als Reihenfels, über diese Dreistigkeit des vermeintlichen Schlossvogts, den er durchschaute, förmlich bestürzt, für einen Augenblick schwieg. »Das riecht hier so süß und lieblich, gerade wie — wie na was denn nu gleich gerade — wie nach Pomeranzen und Zwetschgenwasser, da kriegt man ordentlich Appetit!«
»Auch ich nehme einen süßlichen Geruch wahr!«, meinte Reihenfels.
»Die Blüten der Pflanzen hauchen ihren Duft am stärksten des Morgens aus; der Wind trägt ihn herauf in das Zimmer!«, entgegnete Sinkolin unbefangen. »Es ist nicht gut, bei offenem Fenster zu schlafen!«
»Manchmal aber doch!«, bemerkte August trocken. Sinkolin wendete sich wieder an Reihenfels.
»Ich bitte nochmals um Verzeihung euch im Schlafe gestört zu haben, ich selbst kann es mir nicht verzeihen. Der gestrige Anblick des Felles störte mir fast die Nachtruhe. Ich beschloss, es dir heute Morgen abzukaufen, und konnte keine Ruhe finden, bis ich es nochmals sah.«
»Es tut mir leid, das Fell ist nicht verkäuflich.«
»Warum nicht?«
»Ich möchte es als Andenken behalten. Der Tiger starb durch den Yatagan eines tapferen Mannes, es soll mich stets an diesen erinnern.«
»Nun, wir sprechen nach dem Frühstück noch darüber. Ich hoffe immer noch, mit dir handelseinig zu werden.«
Sinkolin zog sich mit einer Verbeugung zurück, jedoch nicht die geheime Tür benutzend, sondern durch die vorderen Zimmer gehend. Vom Korridor aus gab es zu diesen Gemächern scheinbar keinen Eingang.
»Der hat ja an dem Tigerfell geradezu einen Narren gefressen«, lachte August, als der Gaukler fort war.
Reihenfels warnte ihn mehr durch Blicke als durch Worte, so laut zu sprechen.
»Wie überraschtest du ihn?«, fragte er Charly.
Dieser konnte nicht viel erzählen.
»Du hast nichts Außergewöhnliches bei ihm bemerkt?«
»Nichts.«
»Nicht ein Instrument, einen Apparat oder sonst etwas?«
»Nein.«
»Aber das Betäubungsmittel der Thugs hat er doch angewendet«, sagte Hira Singh, »denn ich kenne alle anderen, deren sich die Fakire und Gaukler bedienen. Nur dieses eine ist mir fremd.«
»Mein Gegenmittel hat nicht versagt«, entgegnete Reihenfels, rückte einen Ballen zur Seite und brachte eine Flasche mit zwei Röhren zum Vorschein, aus denen ganz feine Strahlen der in der Flasche befindlichen hellen Flüssigkeit hervorspritzten, wahrscheinlich infolge eines Luftdrucks.
»Wäre sein Mittel nicht unschädlich gemacht worden, so wäre ihm sein Diebstahl geglückt«, fuhr Reihenfels, der durch eine Drehung des Glasstöpsels die Strahlen zum Versiegen gebracht hatte, fort; »trotzdem muss er eine große Gewandtheit besitzen.«
»Alle Inder sind im Stehlen gewandt«, sagte Hira Singh gleichmütig.
»Dann wundert es mich, dass er nicht auch uns zu betäuben suchte.«
»Er muss sehr, sehr geschickt sein.«
»Ja, wie ein Gaukler.«
Reihenfels sah bei diesen Worten Kiong Jang scharf an.
Dieser schüttelte den Kopf.
»Es ist nicht Timur Dhar, ich kann es nicht glauben. Wie könnte er sich auch vor uns wagen?«
Charly fiel ein, dass er Reihenfels doch noch etwas Merkwürdiges mitzuteilen habe.
»Ha, das hatte ich vergessen, Euch zu sagen. Als ich den Kerl packte, war es gerade, als hätte ich anstatt der Arme ein paar Eisenstangen in der Hand.«
»Er wird harte Muskeln besitzen, was auf große Körperkraft schließen lässt.«
»Es waren keine Muskeln.«
»Warum glaubst du das nicht?«
»Ich bin doch auch nicht weich und zart gebaut; aber seine Arme fühlten sich gerade wie Metall an.«
»Es fiel dir direkt auf?«
»Ja, es war ganz seltsam.«
Reihenfels fragte nicht weiter, er entfernte auch in den beiden anderen Zimmern aus Verstecken zwei ähnliche Flaschen, welche eine stark sauerstoffhaltige Lösung enthielten, und verbarg sie sorgfältig.
Draußen stand Sinkolin, die Fäuste geballt, die Lippen fest zusammengepresst.
Er, der schlaue Gaukler sah sich zum ersten Male von einem Schlaueren überlistet. Zum ersten Male schien er auch in Wut ausbrechen zu wollen, doch es gelang ihm, noch in Ruhe ein im Turm gelegenes Zimmer zu erreichen, das fast wie das Laboratorium eines Chemikers oder auch wie das eines Astronomen ausgestattet war.
Inzwischen hatte er seine Ruhe wiedererlangt. Er zerschmetterte nicht den Apparat, der versagt hatte, am Steinboden, was er in der ersten Wut getan hätte, er untersuchte ihn, atmete die ihm entsteigenden Gase durch die Nase ein und überzeugte sich, dass dieselben ihre Wirkung taten. Er war gegen diese nicht gefeit, auch er fühlte, wie ihm die Besinnung zu schwinden drohte.
»Sie sind mit dem Teufel verbündet«, zischte er endlich, »oder nein, Hira Singh hat ihm auch dieses Geheimnis verraten, und er soll furchtbar dafür büßen. Aber woher kennt Hira Singh denn das Gift? Er kann doch nicht in die Geheimnisse der Thugs eingeweiht sein? Ich kenne übrigens selbst kein Gegenmittel. Sollte jener junge Faringi wirklich mehr — nein, nein, das ist nicht möglich. Der Mann in dem Lederanzug hat eine zu starke Natur; das nächste Mal muss ich ihm etwas eingeben, wonach er nie wieder aufwacht. Aber überlistet hat mich dieser blondhaarige Faringi doch; die Zündschnur war sein Werk, man konnte sie kaum am Boden sehen, so dünn war sie. Nun, auch ich werde ihm einst eine Zündschnur legen.«
Im Schlosse wurde es zwar lebendig, aber nicht laut, denn es war noch eine sehr frühe Morgenstunde, und die Jagdgäste schliefen länger. Nur die Diener eilten hin und her. An unsere Freunde erging durch einen Diener die Einladung, das Frühstück im Saal einzunehmen.
»Wenn dieser Saal unseren Schlafzimmern entspricht«, bemerkte Woodfield zu Reihenfels, »und wenn das Frühstück ebenso dürftig ist wie unser Bett, so beneide ich die Inder nicht um ihr so oft gepriesenes Los. In meinen Schneefeldern habe ich mir ein bequemeres Heim geschaffen, als dieses Schloss ist.«
Reihenfels schloss ganz richtig, das wegen der Anwesenheit so vieler vornehmer Gäste, die ein zahlloses Gefolge mit sich führten, in dem sich wieder Vornehme befanden, die besseren Zimmer alle besetzt waren.
Sinkolin selbst holte die Gesellschaft ab, er hatte die liebenswürdigste Miene aufgesetzt und sagte, dass die Damen sie schon an der Tafel erwarteten.
»Und du, mein Freund?«, wandte er sich an Charly, der ruhig auf seinem Teppich vor dem Gepäck liegen blieb. »Auch für dich ist ein Platz an der Tafel.«
Charly stieß ungeniert einen kräftigen Fluch aus, wälzte sich um und drehte dem Frager den Rücken zu.
»Er leidet an Magenschmerzen«, erklärte Reihenfels.
»O, das ist allerdings schlimm. Wenn er mit mir geht, werde ich ihm einen heilsamen Trunk geben; ich kenne dies Übel, welches alle Fremden in unserem Lande befällt, und besitze ein Gegenmittel. Es ist die Folge des Klimas.«
»Der Teufel segne deine Medizin, ich brauche keine«, knurrte Charly.
Er ließ sich nicht bereden, aufzustehen, und so wurde er zurückgelassen. Nach kurzer Zeit brachte ihm ein Kuli eine Flasche mit der Weisung, den Inhalt zu trinken und sich dann das gleichzeitig mitgebrachte sehr üppige Frühstück schmecken zu lassen.
Als der Inder aber das Zimmer verlassen hatte, goss Charly die Medizin zum Fenster hinaus und ließ die Mahlzeit nachfolgen. Unten balgten sich die Hunde um die Fleischbrocken.
Nach Bewillkommnung der Damen, welche von dem nächtlichen Vorkommnis noch nichts wussten, auch nichts erfahren sollten, nahmen die anderen Platz an der reich ausgestatteten und besetzten Tafel, die Diener an einer besonderen.
Sinkolin selbst war zugegen, denn da er die Stelle des Hausherrn vertrat, musste er nach indischer Sitte wenigstens von jedem Gericht einmal kosten, zwar eine recht patriarchalische Sitte, aber auch andeutend, wie man in Indien, ebenso wie in Arabien, immer darauf bedacht ist, bei dem Gastfreunde den Verdacht fernzuhalten, dass man ihn etwa vergiften wolle. Fast alle orientalischen und indischen Herrscher sterben durch Meuchelmord, Gift oder durch das Rasiermesser ihres Barbiers, meist auf Veranlassung lieber Verwandter. Darum bekleidet im Orient der Barbier eines Fürsten einen Vertrauensposten von nicht geringer Bedeutung.
Bahadur ließ sich durch den angeblichen Schlossvogt entschuldigen. Er sei von der gestrigen, heißen Jagd so ermüdet, dass er seine Gäste nicht selbst begrüßen könne, und diese mussten es schon als eine hohe Gunst betrachten, dass der Großmogul die Gäste überhaupt einer Entschuldigung für würdig erachtete.
Sinkolin verließ mehrere Male den Saal und kam zuletzt in Begleitung einiger Diener wieder herein, welche rotseidene Kissen trugen, von denen ein Funkeln und Flimmern ausging.
»Der allergnädigste Padischah(*) ist nicht gewohnt, die, welche seine Gastfreundschaft genossen haben, ohne Geschenk ziehen zu lassen«, sagte Sinkolin. »Es tut ihm leid, zu hören, dass seine Gäste ihn schon verlassen wollen, er glaubt, sie sind nicht zufrieden mit dem, was er ihnen in diesem einfachen Schlosse, nur für abgehärtete Jäger eingerichtet, bieten kann. Der Padischah hofft aber, dass ihr ihn zu Delhi in seinem Residenzschlosse aufsucht und dort seine königliche Gastfreundschaft kennen lernt, und damit ihr ungehindert, allen anderen Gästen vorgezogen, zu seinem Throne gelangt, sendet er euch diese Gaben als Erkennungszeichen. Sie öffnen euch Tore und Türen seines Palastes.«
(*) Ein anderer Titel für den Großmogul.
Er nahm von den Kissen die wertvollen Geschenke und verteilte sie mit passenden Worten. Die beiden Damen erhielten Halsbänder, Hedwig eine Agraffe zum Zusammenhalten des Busentuchs, alles nur aus in Gold gefassten Diamanten bestehend, die Herren empfingen nach indischem Brauch kostbare Waffen; Reihenfels' Dolch schmückte am Knopf ein Diamant von fast unschätzbarem Werte, die Diener erhielten Waffen und Pfeifenköpfe, zwar unscheinbarer, doch immer noch äußerst wertvoll.
Ist es in Indien auch gebräuchlich, den Gast zum Abschiede zu beschenken, und spielten bei dem Großmogul auch Diamanten keine Rolle, so war es doch immerhin auffallend, dass er so ungeheuer freigebig gegen die ihm völlig fremden Gäste, einfache Privatleute ohne politische Bedeutung, war.
Reihenfels wusste indes schon, was von ihm noch gefordert würde. Vorläufig bedankte er sich im Namen aller seiner Freunde und Begleiter und versicherte, dass sie sich stets Bahadurs als eines edlen und gastfreundlichen Herrschers erinnern würden, würdig, das herrliche Indien zu regieren, das Versprechen des Andenkens sei das einzige Gegengeschenk, das sie dem reichen Padischah bieten könnten und so weiter.
Sinkolin unterbrach diese Dankesbezeugungen.
»Dennoch könnt ihr ihm einen großen Dienst erweisen«, sagte er, »und er bittet euch um die Erfüllung desselben. Euer Mitleid bewog euch gestern Abend, euch eines Inders anzunehmen, welcher von einem Tiger angefallen worden war.«
»Wir taten nur unsere Pflicht«, wehrte Reihenfels ab, »denn wir betrachten jeden Menschen als unseren Nächsten.«
»Sehr edel gesprochen! Wir Buddhisten denken ebenso. Ihr brachtet ihn zu uns...«
»Es war das nächste Haus.«
»Und wir haben ihn gepflegt, so gut wir konnten, doch er starb; es konnte nicht anders sein. Der linke Arm war ihm aus dem Gelenk gerissen, der Blutverlust war schon zu stark gewesen.«

»Ich dachte es mir.«
»Dieser Arm fehlt uns.«
»Auch wir haben ihn nicht gefunden. Schakale werden ihn schon weggeschleppt haben, ehe wir hinzukamen, entgegnete Reihenfels mit der größten Seelenruhe.
Es war eine Lüge, aber er musste sich ihrer bedienen, und niemand wagte es, ihm zu widersprechen. Niemand zeigte besonderes Erstaunen, mit Ausnahme Hedwigs. Doch sie begnügte sich, mit verwunderten Augen nach dem Sprecher zu schauen.
»Ich bedaure, Bahadurs Wunsch nicht erfüllen zu können«, fuhr Reihenfels fort; »er glaubt wahrscheinlich, wir hätten den Arm gefunden und vergessen, ihn abzugeben, damit die Leiche unversehrt bestattet wird. Doch was tut's? Der Körper findet sich in der Nirwana stets wieder und wenn er in hunderttausend Stücke zerschnitten wird, wenn der Geist gut war.«
Sinkolin fand keine Entgegnung, so erstarrt war er über die kecke Ableugnung der Tatsache, dass Reihenfels den Arm in seinem Besitz hatte. Die Fackelträger hatten es ihm auf sein Befragen gesagt; aber waren sich diese Faringis einig, so galt die Aussage der Eingeborenen allerdings nichts. Doch er, Sinkolin, hatte den Arm heute Morgen ja selbst in der Flasche gesehen! Wie konnte Reihenfels wagen, dies zu leugnen?
»Du hast den Arm wirklich nicht gefunden?«, brachte er dann endlich hervor.
»Nein!«
»Aber die Diener sagen es doch.«
»Welche Diener?«
»Die dich mit Fackeln begleiteten.«
»Sie irren. Die Feiglinge wagten kaum den Platz zu betreten, wo der Kampf stattgefunden hatte, sie fürchteten sich sogar noch vor dem toten Tiger, und in ihrer Angst mögen sie geglaubt haben, den abgerissenen Arm zu sehen, der schon nicht mehr vorhanden war.«
Sinkolin schaute sich im Kreise um. Überall begegnete er gleichgültigen, nicht im mindesten verwunderten oder verlegenen Gesichtern. Alle waren von Reihenfels gut instruiert worden, er galt als Führer, und was er sagte, mussten die Übrigen immer gutheißen.
Wenn er zugegeben, er sei im Besitze des Armes, so hätte er ihn unbedingt ausliefern müssen, denn nachdem er hier gastfreundlich aufgenommen und auch noch reichlich beschenkt worden war, wäre eine Weigerung eine tödliche Beleidigung gewesen.
»Ich selbst habe den Arm ja heute Morgen gesehen«, begann Sinkolin nochmals. Reihenfels schüttelte ungläubig den Kopf.
»Wo?«
»In dem Gemache, in dem du die Waren aufgehoben hattest.«
»Ich weiß nichts davon. Was hätte das überhaupt für einen Zweck, dass ich den blutigen Arm des mir gänzlich fremden Mannes mitnehmen sollte?«
»Er war in einer Flasche.«
»In einer Flasche?«
»Ja, sie stand links neben einem Ballen.«
»Ah so, ich weiß, was du meinst«, entgegnete Reihenfels, sich zu einem Lächeln zwingend; »dieser Arm ist in Spiritus aufgehoben, wodurch er vor Verwesung geschützt wird. Aber es ist nicht der des mir Unbekannten, sondern er gehört einem Inder, dem einst, vor langer Zeit, der Arm in England abgenommen wurde. Diese Reliquie ist mir sehr wichtig, sie ist der Anlass, dass wir uns der mühsamen Reise durch Indien ohne Murren unterziehen.«
Sinkolin sah ein, dass er auf diese Weise seinen Zweck nicht erreichen konnte, wusste aber auch keinen anderen Rat, wenigstens vorläufig nicht. Die Gäste der Lüge zeihen durfte er auf keinen Fall.
»Was willst du mit dem Arme erreichen?«, fragte er anscheinend neugierig.
Reihenfels zog die Schultern in die Höhe.
»Ein Geheimnis erforschen. Weißt du eigentlich, wer der Mann war, den wir gefunden haben?«
»Nein, er starb, ohne noch einmal gesprochen zu haben. Jedenfalls ist er ein Jäger gewesen, der im Übermut eine Tigerkatze getötet und dadurch die Wut der Tigerin gereizt hat.«
»Das ist auch meine Meinung. Also einer von den Jagdgästen war es nicht?«
»Auf keinen Fall. Nur Radschas sind hier versammelt, und ihre Diener sind vollzählig.«
»Siehst du? So kann ich dir beweisen, dass der Arm, den ich schon lange in Spiritus aufbewahre, nicht der des in dieser Nacht verstorbenen Mannes sein kann. Kennst du einen Inder namens Sirbhanga?«
Fest ruhte Reihenfels Auge auf dem Schlossvogt, doch dieser zeigte keine anderen Mienen, als sie den Verhältnissen entsprachen.
»Sirbhanga ist ein gewöhnlicher Name.«
»Der Arm, den ich habe, trägt den Namen Sirbhanga Brahma eintätowiert.«
»So entstammte ja sein Besitzer einem Geschlechte, aus dem Brahmanen hervorgehen«, rief Sinkolin wie erstaunt; »vielleicht war er selbst ein Brahmane! Kanntest du ihn persönlich?«
»Ja. Weißt du, wer den Namen Sirbhanga Brahma tragen darf?«
Sinkolin überlegte lange und schüttelte dann den Kopf.
»Es gibt in Indien zu viele Geschlechter, aus denen Brahmanen hervorgehen dürfen; die meisten sind fürstlich, und Fürsten besitzt Indien unzählige. Ich kenne sie nicht alle. Doch in Delhi kannst du dich genau erkundigen, ob ein Fürst so heißt; vielleicht könnte auch Bahadur es wissen.«
»Ich weiß, wo ich mich zu erkundigen habe«, sagte Reihenfels, stand auf und gab somit den übrigen das Zeichen, sich ebenfalls zu erheben.
Sinkolin machte nicht mehr den Versuch, in den Besitz des Armes zu kommen, er erwähnte auch gar nicht einmal des Felles, welches er erst so gern hatte haben wollen. Er hatte erkannt, dass Reihenfels ihn durchschaut hatte, und so wollte er alles vermeiden, was dessen Argwohn noch mehren konnte. Aber schwarze Gedanken entstanden dabei in seinem Herzen. Durch Bitten oder List hatte er nichts erreichen können, so musste er also zur Gewalt greifen, wenn auch nicht gerade jetzt. Aufgeschoben war nicht aufgehoben.
Die Gesellschaft verabschiedete sich schnell unter Danksagungen, sie wollte weiterziehen. Auf Befragen Sinkolins nach dem Reiseziel gab Reihenfels keins an, da sie, wie er sagte, ganz unbestimmt hin und her zögen.
Reihenfels fand die Waren in unberührtem Zustande, vor ihnen lag noch immer Charly, neben sich die leeren Schüsseln, und kaute an einem Schinkenknochen, den er den eigenen Vorräten entnommen hatte.
Er erklärte sich vollständig von seinem Magenleiden befreit, dank der Medizin — die er zum Fenster hinausgegossen hatte — und half mit beim Hinabtragen der Sachen in den Schlosshof.
Eben als die Maultiere beladen wurden, bat ein Reiter, ein Europäer, höflich um Einlass. Er stellte sich als Mister Shaw vor, begrüßte die Gesellschaft, besonders Lady Carter, herzlich und lud sie zu sich auf seine Plantage ein. Wenigstens sollte sie beim Vorüberreiten einmal unter seinem Dache einkehren.
Er sagte auch, wie besorgt er gestern Abend gewesen, als die Gesellschaft trotz ihrer vorherigen Anmeldung nicht gekommen wäre. Doch der Abgesandte von Reihenfels hätte ihn beruhigt und ihm gesagt, wo er sie finden würde. Sonst ließ er sich über nichts weiter aus.
Reihenfels wusste also, dass Dick den Verfolgern entkommen war, und dass er den Engländer gut instruiert hatte. Den Mister Shaw kannte nämlich niemand persönlich; es war nur bekannt, dass er in der Umgegend eine Plantage besaß. Die Angabe, ihn vorher von der Ankunft der Reisegesellschaft benachrichtigt zu haben, war nur eine Erfindung von Reihenfels gewesen, um Dick als Boten abschicken zu können.
Unterwegs machte Oskar auch die nähere Bekanntschaft des Pflanzers. Mister Shaw kannte, wie jeder Engländer, das Schicksal Lady Carters, sowie die näheren, neueren Umstände und fragte daher nicht weiter nach dem Zweck der Reise, nicht einmal, warum Dick ihn so geheimnisvoll ausgefordert hatte, selbst nach dem Schlosse zu reiten und die Gesellschaft abzuholen.
»Wann kam mein Bote zu Ihnen?«, fragte Reihenfels den dienstbereiten Herrn.
»Heute Morgen mit Tagesanbruch, in anscheinend erschöpftem Zustand.«
»Ist er noch dort?«
»Nein. Er schlief einige Stunden wie ein Toter und machte sich dann wieder auf den Weg, Ihnen hinterlassend, dass er in Delhi wieder zu Ihnen stoßen wolle.«
»So wartet er nicht auf uns?«
»Er ist schon fort.«
»Wie soll ich mir das erklären?«
»Ich kann Ihnen auch keinen Aufschluss geben. Er scheint überhaupt sehr selbständig zu sein, dieser Mann.«
Reihenfels musste sich damit begnügen. Das nächste Ziel sollte Delhi sein. Noch heute mussten sie eine Bahnstation erreichen, und mit Benutzung der Eisenbahn konnten sie in wenigen Stunden in die Stadt gelangen.
Dort also wollte Dick, der geradeso tat, als wäre er in Indien zu Hause, erst wieder zu ihnen stoßen. Die Erklärung würde er dann wohl selbst geben.
Warum er erst so spät auf Mister Shaws Plantage ankam, was er unterwegs erlebt, konnte der Herr selbst nicht angeben, denn Dick hatte sich nur schnell seines Auftrags entledigt und dann wie ein Murmeltier auf der ersten besten Bank geschlafen. Nach dem Erwachen war er wieder abmarschiert. Warten sollte man auf ihn keinesfalls.
Am Turmfenster des Jagdschlosses stand der Gaukler und schaute mit unheilverkündender Miene dem im Walde verschwindenden Zuge nach. Nicht, weil sie Faringis und seinen Plänen gefährlich waren, sondern weil sie ihn überlistet hatten, stand ihr Tod bei ihm unerschütterlich fest.
Delhi ist zwar noch jetzt die Hauptstadt Indiens und für die Eingeborenen wegen ihrer Tempel die wichtigste, jedoch längst nicht mehr die größte. Die Hafenstädte haben sie in dieser Beziehung bei Weitem überflügelt. Aber sie ist noch die schönste und interessanteste Stadt der ganzen Halbinsel.
Damals zählte sie nur etwa 150 000 Einwohner, früher dagegen zwei Millionen, und so ist leicht einzusehen, dass über die Hälfte der Stadt nur ein Trümmerfeld ist.
Doch aus diesem ragen noch immer guterhaltene, imposante Gebäude hervor; der Zahn der Zeit vermochte sie wohl zu benagen, sie aber noch nicht ihrer Schönheit zu berauben. Natürlich sind sie unbewohnt. So zum Beispiel der Palast Schahlimar, Monumente, das Grabgebäude des Großmoguls Humayun — alles dem Verfall geweiht, ebenso wie die kolossale Wasserleitung, welche einst die zwei Millionen Menschen mit Wasser versorgte.
Der liebe Leser verstehe unter solch einer indischen Wasserleitung nicht unser heutiges Röhrensystem. Das Wasser floss aus der durch Delhi gehenden Dschamma, einem Strom, durch mehrere Filterwerke hindurch und trat in mannshohe Kanäle, welche sich unterirdisch nach allen Richtungen hin erstreckten. Überall konnte das gereinigte Wasser durch Pumpen ans Tageslicht befördert werden.
Auch diese Wasserleitung ist zum Teil verfallen, die Filter sind verstopft, die Engländer haben Röhren gelegt, welche jedoch nur die Häuser der Reichen mit Wasser versehen, während sich die Armen das ihre weit herholen müssen.
Alles, was in Delhi aus früherer Zeit stammt, ist von einer solchen Solidität und Pracht, dass man fast nicht mehr daran zweifelt, wenn die Inder erzählen, die Straßen Delhis seien zur Zeit der Pandus, der Sonnenkinder, mit Gold gepflastert und die Fußwege mit Edelsteinen abgesteckt gewesen. Als dann Zwistigkeiten unter den Häuptlingen ausbrachen, hätte sich jeder von ihnen so viel wie möglich von diesen Schätzen angeeignet.
Man glaubt diese Sage umso mehr, als in einigen fürstlichen Häusern Delhis noch heute fabelhafte Reichtümer aufgespeichert sind; die öffentlichen Tempel strotzten damals von Diamanten und Juwelen, und die Fußböden waren wirklich mit Gold ausgelegt.
Delhis Einwohnerschaft besteht zur einen Hälfte aus Buddhisten, zur anderen aus Mohammedanern, der kleinste Teil sind Christen, also Europäer, meist Engländer. Jede Sekte bewohnt einen Stadtteil für sich, das Viertel der Europäer ist das kleinste, natürlich aber auch das modernste, und wirklich schön zu nennen.
Die vornehmste Straße darin ist die Tschandri-Tschak, breit, mit Trottoirs versehen und zu beiden Seiten Villen, Prunkhäuser von reichen Engländern, Konsulate und andere öffentliche Gebäude, so z. B. der Palast des General-Gouverneurs von Indien.
Da, wo das indische Viertel an das europäische stößt, steht ein Haus, noch in der Hauptstraße gelegen, welches so recht den Übergang bildet. Es ist in indischem Stil, dem bekannten maurischen ähnlich, erbaut, zeigt aber die Fenster, Schornsteine und anderes der englischen Baukunst.
Ein alter Lord hatte es einst ausführen lassen, der die Sitten und Gewohnheiten der Eingeborenen hatte annehmen wollen, die Bequemlichkeiten der Häuser seines Heimatlandes aber auch nicht entbehren konnte.
Nachdem es lange Zeit leergestanden hatte wurde es von einer Dame bezogen, die mit einer Kammerzofe, einer reizenden, jungen Südländerin, und einigen indischen Dienern und Dienerinnen in Delhi eintraf, das Haus kaufte und es glänzend einrichten ließ.
Die Dame nannte sich Signora Rosa Bellani, war also eine Italienerin, und gab an, dass sie sich schon seit Jahren zum Vergnügen in Indien aufhielte. Niemand hatte sie schon gesehen, ihre Worte fanden indes vollkommen Glauben.
Ob sie selbst vielleicht einmal eine Äußerung getan, oder ob das Kammerkätzchen geplaudert hatte, kurz, bald ging die Sage durch das europäische Viertel, Signora Bellani trüge nicht ihren wahren Namen, sie hätte das Recht, den Herzogstitel zu führen. Sie sei die Gemahlin eines italienischen Marchese, von dem sie nach kurzer, unglücklicher Ehe schon seit langen Jahren getrennt lebe und nun planlos in der Welt umherfahre — böse Zungen sagten: abenteuere. Infolge dessen wurde sie, wenn man von ihr sprach, nur die Duchesse genannt, und sie trat auch wie eine solche auf. Die Goldquelle, aus der sie schöpfte, war anscheinend unversiegbar.
Die Duchesse hatte es verstanden, ihr Haus, so abseits es auch gelegen war, bald zum Mittelpunkt des europäischen Viertels zu machen. Schon nach den ersten Wochen versammelte sich an den Abenden, an denen sie empfing, die ganze jeunesse dorée in ihren Räumen, Kaufleute, Beamte und Offiziere; es war allgemein bekannt, dass sie Letztere bevorzugte, und die, denen der Eintritt dort zu jeder Zeit gestattet war, wurden beneidet. Zu letzteren zählten besonders die Offiziere der in Delhi oder in der Umgegend liegenden englischen Bataillone.
Man konnte der Duchesse zwar nicht gerade Sittenlosigkeit nachsagen; aber man durfte ihr, dem Kinde des heißen Italiens, auch nicht den Vorwurf der Tugend machen.
Böse Männer behaupteten, sie hielte ihre Leidenschaften nur deshalb im Zaume, weil sie ihr Netz nach einem in englischen Diensten stehenden Inder geworfen hätte, einem Leutnant Dollamore — der Name wurde schon einmal erwähnt — und dieser Leutnant sei weniger eifersüchtig als vielmehr sehr sittenstreng im Übrigen aber maßlos in die Duchesse verliebt.
Einmal kam eine böse Zeit über deren Haus.
Es wurde gemunkelt, das englische Gouvernement habe Argwohn gegen sie gefasst, und sie werde beobachtet; die meisten lachten allerdings über diese Behauptung; eines schönen Tages aber erschienen englische Beamte und legten im Namen der Königin in dem Hause der schönen Strohwitwe Siegel an — es fand eine Haussuchung statt.
Eine Woche verging, das damals erst gelegte telegrafische Kabel spielte nach England, Frankreich und Italien und zurück. Während dieser Woche war der Jubel in dem sonst so lebhaften Hause verstummt; die Duchesse war angeblich maßlos darüber aufgebracht, als eine Spionin Frankreichs gegen England verdächtigt zu werden; aber ihre Entrüstung half ihr nichts, sie wurde fortan von Europäern gemieden, höchstens noch von Indern besucht. Am schmerzlichsten musste sie berühren, dass sich auch Leutnant Dollamore verächtlich von ihr wendete.
Dann kam wieder eine Zeit des Glückes.
Der Verdacht wurde als unbegründet bezeichnet. Lord Canning, der Generalgouverneur von Indien, entschuldigte sich zwar nicht wegen seines energischen Vorgehens, denn er hatte nur über die englischen Interessen gewacht, aber er lud sich selbst eines Abends bei der schönen Italienerin zu Gaste, und mit ihm kam der ganze Schwarm der früheren Verehrer wieder, auch der stolze indische Leutnant; ja, Dollamore sollte die Duchesse unter Tränen um Verzeihung gebeten haben.
Dass die Bellani so viel mit vornehmen Indern und deren Weibern verkehrte, erregte fortan keinen Verdacht mehr. Sie war ja selbst fast eine Inderin geworden, hatte die indische Lebensweise angenommen und sprach verschiedene indische Dialekte mit der größten Reinheit. Ebenso wenig verargte man ihr, dass sie auch oft Besuche von Franzosen empfing. Italiener und Franzosen harmonieren überhaupt in ihren Anschauungen.
Nachdem der liebe Leser so die öffentliche Meinung über die Duchesse erfahren hat, soll er selbst bei ihr eingeführt und mit ihrem wahren Charakter bekannt werden.
Das Boudoir, in dem sich die Duchesse befand, war ganz mit dunkelrotem Samt ausgeschlagen, alles Andersfarbige mit einem rötlichen Hauch übergießend. Statt der hölzernen Flügel verschlossen schwere Portieren von derselben Farbe die drei Eingänge des Zimmers. Die Möbel waren von Ebenholz und bestanden aus einigen Fauteuils, niederen Sesseln, Tischen und zwei üppig schwellenden Diwans, welche sich an den Wänden entlangzogen.
Rechterhand vom Fenster stand ein Damenschreibtisch mit kunstvollen Schnitzarbeiten. In den offenen Fächern lagen Stöße von Briefen, welche alle die Adresse Signora Rosa Bellani trugen und dem Stempel nach meist aus Indien und Frankreich, nur zum geringen Teil dagegen aus Italien und England stammten.
In den freien Ecken des Gemachs erhoben sich lebensgroße Marmorstatuen aus den Ateliers berühmter Meister, eine die Nachbildung der Venus von Medici, die andere den Botschaft bringenden Hermes auf beflügelten Sohlen darstellend. Der von den Wänden ausgehende rote Schein übergoss die weißen Gestalten und schien ihnen Leben einzuhauchen.
Wie es diesen Marmorfiguren vollständig an Kleidung mangelte, so auch den Gestalten der fünf Wandgemälde.
Es waren alles bekannte oder vielmehr berühmte Bilder. Leda, das schöne, nackte Weib, wie es den Schwan liebkosend an sich schmiegt; eine Kopie des berüchtigtsten Bildes aus der Gemäldegalerie zu Neapel, der Stier und die Frau; ferner ein Bild mit nackten Figuren in der herrlichen Fleischzeichnung von Rubens, ein viertes mit badenden Männern und Frauen, und schließlich eines, auf welchem eine Orgie von Bacchantinnen und Faunen dargestellt war, zwar sehr schön ausgeführt, doch von solch einer Realistik, dass es der Maler weniger aus Kunstsinn, als viel mehr aus Frivolität gemalt haben musste.
Denkt man sich nun noch die Wände mit Sachen bedeckt, welche eine Art von Pfeifen- und Waffensammlung bildeten, von der Kalkpfeife des Holländers bis hinauf zum juwelenbesetzten Tschibuk der Türken, von der alten, kostbaren Pistole der Inder bis hinab zum modernen englischen Revolver, denkt man sich noch an der Wand einen Gewehrständer, mit der zölligen Elefantenbüchse sowohl auch mit der zierlichen Damenflinte, vor dem einen Diwan ein Rauchtischchen mit Aschenbecher, Zigaretten und Zigarren in silbernen Schalen, vor dem anderen Diwan ein Tischchen mit französischen schlüpfrigen Romanen, so glaubte man, in dem Kabinett eines französischen Wüstlings sich zu befinden, der europäischen Kunstsinn mit orientalischem Raffinement verband, aber nicht in dem Boudoir einer Dame, die noch dazu auf guten Ruf hielt. Und doch war es so.
Bei der Duchesse waren dies alles auch nicht nur Schaustücke; mit jener mächtigen Büchse dort hatte sie einen Elefanten erlegt, mit jener Vogelflinte war sie in hohen Kniestiefeln und kurzem Röckchen durch sumpfige Dschungeln gewatet und hatte Reiher geschossen.
Auch das Rauchtischchen war nicht nur zur Bequemlichkeit männlicher Besucher vorhanden. Die Asche in dem silbernen Becher rauchte noch, und neben dem starken Duft von Vanillewasser zog auch das süßliche Aroma von Zigaretten durchs Zimmer.
Die Bewohnerin selbst saß vor dem Schreibtisch und hatte eben einen längeren Brief beendet, faltete ein Stück Papier, das mit länglichen Ausschnitten versehen war, zusammen, brannte erst ein Streichholz, an diesem darauf das Papier an und entzündete an dessen Flamme eine Zigarette.
Als sie nach dieser griff und sie zwischen die roten, schwellenden Lippen führte, stahl sich der feine, schön geformte Arm aus dem offenen Ärmel des weiten, dunkelroten Hausrockes bis fast zur Schulter hervor. Die Hand war sorgsam gepflegt, im richtigen Verhältnis zu dem kleinen, zierlichen Fuß, an dessen äußerster Spitze ein goldledernes Pantöffelchen hing.
Alles, Fuß, Hand und der wunderschöne Arm, schien einem siebzehnjährigen, vollentwickelten Mädchen anzugehören, doch ein Blick in das Antlitz der Dame lehrte, dass sie über die erste Jugend hinaus war.
Es war schön, dieses Antlitz, wunderbar schön, doch von einer gefährlichen Schönheit. Die Nase war feingeschnitten, die Brauen waren kühn gewölbt, die Augen groß und feurig und verrieten, welch ein leidenschaftlicher Charakter in diesem Weibe schlummerte. Der kleine Mund mit den schwellenden Lippen, hinter denen beim Sprechen die Zähne wie Milchperlen hervorschimmerten, gab dem Gesicht einen sinnlichen Ausdruck. Stolz wurde der Kopf, den das reiche Haar in einer antiken Frisur krönte, auf einem schlanken biegsamen Hals getragen, dessen Beweglichkeit an den des Schwanes erinnerte — oder an den der Schlange. Das Alter der Duchesse konnte man nicht schätzen; sie mochte fünfundzwanzig bis dreißig Jahre alt sein, jedenfalls befand sie sich in der Lebensperiode, in welcher das Weib aller Leidenschaften am heftigsten fähig ist, in welcher es gleichzeitig glühend lieben und glühend hassen kann und in der Befriedigung seiner Leidenschaften keine Grenzen kennt.
Das war der Eindruck, den man von Signora Bellani gewann, wie sie jetzt, in der rechten Hand die Zigarette, in der linken das brennende Papier, mit funkelndem Auge dem Verbrennen des letzteren zusah.
Sie wartete, bis die Flamme fast ihre rosigen Fingernägel erreicht hatte, dann schob sie mit einer hastigen Bewegung den Stuhl zurück, stand auf und warf das Papier hoch in die Luft, sodass es vollständig verbrannt war, ehe es den Smyrnateppich erreicht hatte.
Nicht zufrieden mit dieser Vernichtung stampfte das Weib noch so lange mit den Pantöffelchen auf die Asche, bis sie spurlos verschwunden war.
Mit einem triumphierenden Ausdruck trat sie darauf an den Tisch, kuvertierte und siegelte den Brief im Stehen.
Jetzt konnte man ihre königliche Gestalt bewundern Sie trug, wie schon erwähnt, ein weites, bequemes Hauskleid aus dunkelrotem Brokat, von einem goldenen Schuppengürtel zusammengehalten.
An diesem hing ein kleiner Damendolch mit ziselierter Scheide und Griff, beide reich mit Edelsteinen besetzt. Es war dies nicht nur eine Spielerei oder ein Schmuck. Erst vor einigen Tagen hatte sie den Stahl einem kecken Offizier, der sich im Weinrausche eine allzu freie Berührung erlaubt hatte, durch die Hand gestoßen. Das heißt, man flüsterte nur so etwas, die, welche dabeigewesen waren, plauderten nicht darüber. Jedenfalls musste der Offizier mit verbundener Hand das Zimmer hüten und gab eine Selbstverwundung vor.
Über dem Gürtel war das Kleid vorn kreuzweise mit goldenen Schnüren besetzt, zwischen denen stellenweise das feine seidene Hemd sichtbar ward, das sich eng an den hochgewölbten Busen schmiegte, der von keinem Korsett gehalten wurde.
Alles an ihr, von dem durch das hochfrisierte Haar gesteckten goldenen Pfeil bis herab zu den zierlichen Pantöffelchen, war gewählt und elegant wie jede ihrer Bewegungen, die zugleich die in ihr wohnende Elastizität verrieten.
Jetzt tippte sie mit den Fingerspitzen auf eine Glocke und trat, bis der silberne Ton den Gewünschten herbeirief, an das Fenster. Durch das Muster der durchbrochenen Gardinen konnte sie links den Palast des Generalgouverneurs sehen, rechts in weiter Ferne den mächtigen, imposanten Bau der Residenz des Padischahs und dahinter die Kaserne der englischen und indischen Truppen in welcher sich die Kommandantur befand.
Die Aufmerksamkeit der Duchesse wendete sich einer ihr gerade gegenüberliegenden Villa zu. Dieselbe hatte auch dem verstorbenen Lord gehört, war aber ganz nach europäischem Geschmack eingerichtet und noch jetzt mit vollständigem, fast neuem Mobiliar versehen.
Es musste bald jemand in das Gebäude einziehen wollen, denn es wurden darin von indischen Weibern Reinigungsarbeiten verrichtet. Die Duchesse schien sich lebhaft dafür zu interessieren, wer ihr vis-à-vis wohl werden würde. Bis jetzt hatte sie es trotz aller Fragen nicht erfahren können.
Die Portiere an der rechten Wand wurde etwas zurückgeschlagen, und ein junges Mädchen trat ein.
Man bekam einen flüchtigen Blick in das angrenzende Gemach. Es zeigte helle Wände mit badenden Nymphen in bunter Malerei, umgaukelt unter neckischem Scherzen von kleinen, nackten Knaben, ferner ein marmornes Bassin. Es war also das Badezimmer der Duchesse.
Das eintretende Mädchen war die Kammerzofe und passte in ihrer phantastischen Erscheinung ganz zur originellen Ausstattung des Hauses.
Sie war recht hübsch, üppig gebaut und besaß listige, zugleich aber auch etwas frech blickende Augen. Offenbar war sie eine Italienerin, doch dunkler als ihre Herrin, und hätte sich selbst für ein Hindumädchen ausgeben können.
Das rote Röckchen reichte ihr nur bis zu den Knien und ließ die drallen, mit bunten Strümpfen bekleideten Waden sehen, an denen sich die ledernen Riemen der gelben Schuhe bis an die Knie hinaufwanden. Aus dem schwarzen Mieder quoll das weiße Hemd, das den oberen Teil von Brust und Nacken freigab. Das lange, schwarze Haar fiel in unbändiger Fülle offen auf den Rücken herab und war mit Goldmünzen geschmückt.
Die Duchesse liebte es, sich von phantastisch gekleideten Gestalten bedienen zu lassen. Ein Mädchen im Hauskleid und in weißer Schürze hätte ihr Auge in diesem geschmackvollen Boudoir beleidigt.
Diese Neigung trug auch viel mit dazu bei, die Gesellschaften in ihrem Hause so anziehend zu machen. Eine Rivalin hatte sie in der Kammerzofe nicht zu fürchten, neben der schönen Herrin sank diese zu einem Schatten herab.
Mit leichten, tänzelnden Schritten, sich in den breiten Hüften wiegend, näherte sich das Mädchen der Duchesse. Man kam fast auf die Vermutung, eine professionsmäßige Tänzerin vor sich zu haben. Doch der Gang der Frauen Südeuropas steht an Grazie ja überhaupt unerreichbar da.
»Du hast lange auf dich warten lassen, Mirzi«, sagte die Duchesse ungnädig, sich der englischen Sprache bedienend. »Nimm diesen Brief! Babur soll ihn sofort besorgen, sofort, sonst nimmt die nächste Post ihn nicht mehr mit. Beeile dich und komme dann noch einmal zu mir!«
Die Zofe entfernte sich mit dem Schreiben und kehrte nach einer Minute bereits zurück. Die Duchesse stand wieder am Fenster und schaute einem jungen Engländer nach, der im militärischen Tropenanzug, die Ordonnanztasche unter dem Arme, eben das Gouvernementsgebäude verließ und den Weg nach der Kommandantur einschlug.
Hastig winkte die Herrin die Zofe herbei.
»Das ist der, von dem ich sprach. Suche seine Bekanntschaft anzuknüpfen und mache ihn dir gefügig. Setze alles daran, ich will es dir lohnen. Es wird dir nicht schwerfallen, etwaige Rivalinnen aus dem Felde zu schlagen. In etwa acht Tagen aber musst du schon so weit sein, dass du alles von ihm verlangen kannst. Die nötige Zeit gebe ich dir.«
Mit schlauem Lächeln und selbstbewusst blickte die Zofe dem hübschen, jungen Soldaten nach, der, seiner verantwortlichen Stelle als Ordonnanz bewusst, stolz und mit gehobener Brust die Straße dahinschritt.
»Ich kann ihn bereits um den Finger wickeln«, lächelte Mirzi.
»Wie? So hast du dich schon mit ihm befreundet?«
»Mehr als das. Er hat schon Feuer gefangen und sucht mich; ich gehe ihm aber noch aus dem Wege, um seine Neigung noch mehr zu entflammen.«
»Recht so! Wo hast du ihn kennen gelernt?«
»Vorgestern Abend auf dem Ball, den das Bataillon zur Feier des Geburtstages von Captain Atkins abhielt.«
»Ich liebe es nicht, dass du diese Bälle der englischen Soldaten besuchst!«, sagte die Duchesse, missbilligend den Kopf schüttelnd.
»Bitte, warum nicht?«
»Nun ja, es schadet an sich zwar weiter nichts, aber du hast dem Soldaten doch nicht gesagt, wessen Dienerin du bist?«
»Gott bewahre! Ich gab mich für das Dienstmädchen eines Engländers aus. Delhi ist groß, er wird mich nicht finden noch erkennen, wenn ich nicht will!«
»Er darf es auch nicht, wenigstens soll er nicht wissen, dass du meine Kammerzofe bist!«, sagte die Duchesse ängstlich.
Das Mädchen schaute die Herrin aufmerksam an.
»Warum nicht?«, fragte sie.
»Weil — weil — den Grund sage ich dir später, wenn es Zeit dazu ist, dass du seine Liebe ausnutzt. Jetzt erzähle, wie du dich ihm nähertest.«

»Sehr einfach. Er fand mich anziehend, engagierte mich und wir tanzten öfter zusammen. Er gab mir deutlich zu verstehen, dass er mich liebe, und ich, eingedenk Ihres Wunsches, kam ihm entgegen, natürlich nur durch Händedruck und Blicke. Gern hätte ich ihn einmal an einem versteckten Orte gesprochen, um ihn noch mehr auf das vorzubereiten, was ich mit ihm vorhabe, doch ein Trommeljunge folgte ihm wie sein Schatten, zum Ärger von Green selbst.«
»Green heißt der Mann?«
»Jim Green, gnädige Frau.«
»Auf keinen Fall darfst du ihm also verraten, wer du bist, und in wessen Diensten du stehst! Wenn er dich nur nicht einmal erkennt!«
»Ohne Sorge, gnädige Frau! Wie ein Dienstmädchen gekleidet, das Haar in einen Knoten geschlungen und glatt aus der Stirn gestrichen, dazu eine recht unschuldige, zimperliche Miene aufgesetzt, sah ich so verändert aus, dass ich mich selbst kaum im Spiegel wiedererkannte, jedoch«, fügte sie kokett hinzu, »sah ich trotzdem noch immer recht hübsch aus.«
»Also du glaubst, er liebt dich?«
»Sicherlich ist er Feuer und Flamme. Das nächste Mal schon könnte ich von ihm verlangen, was ich wollte.«
»Noch nicht. Ich sage dir, wenn du den vollen Angriff auf ihn eröffnen sollst. Es hat noch acht Tage Zeit. Dann aber, Mirzi, musst du ihn dir zu Willen machen, du musst, Mirzi, und solltest du auch seinem Verlangen nachgeben, obgleich du es nicht gern tust.«
»Ich verstehe«, entgegnete Mirzi mit frivolem Lächeln, »und ich werde mich nicht mit Widerwillen dazu zwingen; Jim Green ist ein hübscher, schmucker Bursche. Darf ich aber nicht schon jetzt erfahren, was ich von ihm erreichen soll? Ich könnte ihn vielleicht bereits etwas darauf vorbereiten oder mir meinen Plan zurechtlegen.«
Die Duchesse sah ihre Zofe lange an. Sie brauchte vor ihr eigentlich keine Geheimnisse zu haben; dass sie zögerte, ihr die Mitteilung zu machen, bewies, wie wichtig und gefährlich sie war.
»Gut, es ist besser, wenn du schon jetzt erfährst, um was es sich handelt«, sagte die Signora dann langsam. »Dieser Jim Green ist Ordonnanz, er trägt die Briefe zwischen dem Gouvernement und der Kommandantur hin und her.«
»Ach so, ich soll ihm ein Geheimnis entlocken, das auf den Büros bekannt ist, aber nicht in die Öffentlichkeit kommt. O, das soll mir eine Kleinigkeit sein!«
»Das ist es nicht. Deiner harrt eine schwere Aufgabe. Du sollst dich an einem bestimmten Tage zu einer bestimmten Stunde der Brieftasche der Ordonnanz bemächtigen und den Mann so lange aufhalten, bis wir von den Briefen Abschriften genommen haben. Wenn er es hinterher erfährt, schadet es auch nichts weiter, dann ist er eben einer der Unsrigen geworden. Diese Gelegenheit uns zu verschaffen, dazu müssen uns deine Verführungskünste verhelfen, du musst es erreichen, Mirzi, und du sollst reichlich dafür belohnt werden.«
Die Kammerzofe schien zu erschrecken.
»Gnädige Frau, das ist ein gefährlicher Auftrag!«, stammelte sie.
»Du wirst ihn ausführen. Du bist schön, und der junge Soldat wird deinen Lockungen nicht lange standhalten. Überlege dir, wie du die Sache anfängst, ich werde dir mit meinem Rate beistehen, außerdem stelle ich dir alles zur Verfügung, was du brauchst: Zeit und Geld. Schreckst du davor zurück?«
Mirzi hatte sich besonnen.
»Ich werde die Briefe bringen!«, entgegnete sie mit siegesbewusstem Lächeln. »Und wenn der junge Engländer ein Herz von Stein hätte, ich würde es doch in Flammen setzen!«
»Hast du nun erfahren, wer in die gegenüberliegende Villa einziehen wird?«, fragte darauf die Duchesse.
»Noch nicht. Ich werde dann mit Ihrer Erlaubnis ausgehen, mich danach erkundigen und zugleich versuchen, mit der Ordonnanz ein Rendezvous für heute Abend zu arrangieren.«
»Tue das! Nur hüte dich, ihm schon Freiheiten zu gewähren, welche seine Neigung zu dir erkalten lassen, statt sie mehr zu entflammen!«
Die Zofe ging.
Es lag wie ein Zug des Ekels um den Mund der schönen Frau, als sie an das Fenster trat und wieder den Arbeiterinnen in der Villa zusah.
»Einst wurde ich selbst zu solchen Verführungen benutzt, man verlangte es wenigstens von mir!«, flüsterte sie. »Jetzt bin ich schon so weit gekommen, dass ich mir dazu meine Leute halte. O, ich bin avanciert und kann es noch weit bringen! Doch was macht's«, der Zug des Ekels verschwand, ein gehässiger und zugleich triumphierender Ausdruck trat an seine Stelle, »doch was macht's, gern will ich mich erniedrigen, komme ich doch dadurch meinem Ziele, der Erfüllung meiner Rache, immer näher!«
Draußen erscholl ein heller Gongton. Die Duchesse erwiderte ihn auf ihrer Klingel, und durch die Portiere links trat mit tiefer Verbeugung ein indischer Diener ein, ein athletisch gebauter Mann mit brutalem Gesicht, ebenfalls in einem bunten, phantastischen Kostüm.
»Nun, Babur«, redete die Duchesse den Diener an, »wieder Besuch? Ich nehme heute Vormittag niemanden an, mit Ausnahme des Leutnants Dollamore!«
»Zwei Frauen sind angekommen, welche dich, o, Herrin, zu sprechen begehren. Die eine ist gekleidet und vermummt wie eine Araberin und in Begleitung eines Arabers, die andere trägt die Kleidung einer Bäuerin und zeigt ihr Gesicht ebenfalls nicht. Sie reitet auf einem dürren Esel, der sich kaum auf den Beinen halten kann und von einem Bauer getrieben wird. Der Araber gab mit der Hand das zweite Zeichen, doch nicht er, sondern seine Begleiterin will dich, o, Herrin, sprechen.«
»So muss ich sie empfangen. Was für ein Zeichen gab dir die andere?«
»Gar keins. Sie spricht mit verstellter Stimme und will so schnell wie möglich hierher geführt werden.«
»Sie mag warten! Führe die Araberin herein!«
Der Diener entfernte sich, doch alsbald wurde die Portiere wieder zurückgeschlagen, und die mittelgroße Gestalt einer Frau trat ein, welche ganz in weiße Gewänder gehüllt war.
Schon der Gesichtsschleier deutete an, dass es eine Araberin war oder sich wenigstens als solche gekleidet hatte.
Er wurde zurückgeworfen. Die Duchesse erblickte die pikanten Züge einer europäischen Dame von mittleren Jahren. In anderer Kleidung musste sie bedeutend jünger erscheinen als in diesem faltigen Gewande.
Die Duchesse suchte sich vergebens zu entsinnen, wo sie dieses Gesicht, welches einen fast schwermütigen Ausdruck zeigte, schon einmal gesehen hatte.
»Kennen Sie mich nicht, Signora Bellani?«, fragte die Fremde.
»Ich weiß nur, dass Sie das zweite Zeichen geben können, also in unsere Sache ziemlich eingeweiht sind, und dass Sie sich als Araberin verkleidet haben, um nicht erkannt zu werden.«
»Ich könnte auch das erste Zeichen geben!«
»Das wäre! Und ich sollte Sie nicht kennen? Kaum möglich. Mit wem habe ich die Ehre?«
»Ich nenne mich vorläufig noch so wie früher: Madame Phoebe Dubois.«
Einen Augenblick fand die Duchesse keine Worte; mit flammenden Augen betrachtete sie das Weib; keine Freude war in ihrem Gesicht zu lesen viel eher aufsteigender Hass, als stände sie einer Rivalin gegenüber.
Ebenso schnell aber wechselte dieser Ausdruck mit dem der Freude; mit ausgestreckter Hand ging Bellani der falschen Araberin entgegen.
»Willkommen, willkommen in meinem Hause!«, sagte sie mit herzlich klingender Stimme, »Endlich wird mir die Freude zuteil, die kennen zu lernen, welche so uneigennützig für unsere Sache kämpft und schon so viel erreicht hat. Sie kommen aus Bengalen, wo Monsieur Francoeur für uns wirkt? Sind Sie auf der Durchreise? Können Sie mir wichtige Nachrichten geben? Doch nebenbei, ich habe Sie mir der Beschreibung nach heiter und lebenslustig vorgestellt, und Sie machen ein so ernstes, ja, sogar trauriges Gesicht. Doch nichts Schlimmes? Sie wissen, ich darf alles erfahren, selbst wenn Ihnen sonst Schweigen auferlegt worden wäre.«
Sie hatte Phoebe neben sich auf den Diwan gezogen und schaute ihr mit gespanntester Aufmerksamkeit in die Augen.
»Ich möchte erst fragen, wie ich Sie anreden darf«, entgegnete Phoebe. »Sie nennen sich Signora Rosa Bellani, werden aber gewöhnlich Duchesse angeredet.«
»Wissen Sie, wer ich eigentlich bin?«
»Ja.«
»Nennen Sie mich einfach Rosa, wie ich Sie Phoebe nennen werde, liebe Freundin!«
»Nein, auch ich werde Sie Duchesse nennen.«
»O, warum denn?«, lachte das Weib. »Ich bin keine Herzogin. Ein besonderer Umstand veranlasst mich, mich für die getrennt lebende Gattin eines italienischen Herzogs auszugeben, ohne Verrat oder Argwohn fürchten zu müssen.«
»Ich werde Sie dennoch Duchesse nennen, denn nicht lange wird es dauern, so werden Sie einen noch höheren Titel führen.«
»Welcher wäre das?«
»Padischahin, erste Frau des Padischah!«
Die Duchesse — wie wir sie vorläufig noch nennen wollen — wurde etwas verlegen.
»Sie denken an eine ferne Zukunft!«, entgegnete sie. »Bahadur ist zwar schon alt, aber noch rüstig, und nicht Nana Sahib ist sein Nachfolger, sondern ein Weib. Doch nun sprechen Sie, was führt Sie zu mir?«
»Ich reise als Botin der Agitationspartei in Bengalen durch ganz Indien!«, sagte Phoebe dumpf, sodass die andere sie betroffen ansah. »Wohin ich komme, erblicke ich hoffnungsvolle Gesichter, und gehe ich, haben sie sich in trostlose verwandelt.«
»Die Agitation in Bengalen hat nichts erreicht?«
»So viel.«
Phoebe schnippste mit den Fingern.
Die Duchesse war aufgesprungen und ging aufgeregt in dem Gemach auf und ab. Dann blieb sie vor Phoebe stehen.
»Was ist daran schuld, dass unsere Bemühungen dort erfolglos sind, während doch sonst alle Inder unseren Einflüsterungen zugänglich sind?«
»Die freien Bengalen haben den Druck der Sklavenkette noch nicht gefühlt.«
»Sie wird ihnen noch aufgelegt werden. England annektiert Bengalen, und das in kurzer Zeit.«
»Das haben wir ihnen gesagt; sie wollen es nicht glauben.«
»Es ist aber so.«
»Sie wissen es ganz bestimmt?«
»Aus sicherer Quelle.«
»Beweisen Sie es den Radschas von Bengalen, dann können wir sie vielleicht aus ihrer Lethargie noch rechtzeitig aufrütteln.«
»Ich kann die Beweise bringen.«
Phoebe schaute die Sprecherin ungläubig an.
»Sie könnten...?«
»Ja. Ich weiß, dass die Ausarbeitung der Annektion bereits in den Händen des Generalgouverneurs ist«, sagte die Duchesse und ließ sich wieder auf dem Diwan nieder; »schon finden mit der Kommandantur Unterhandlungen statt, welche Aushebung von Rekruten in Bengalen stattfinden soll. Ich weiß genau Tag und Stunde, wann dieses Schreiben und noch andere durch eine Ordonnanz nach der Kommandantur General Havelocks geschickt werden; man benachrichtigt mich davon, und an demselben Tage«, das Weib dämpfte ihre Stimme zu einem Flüstern herab, »werden diese Schreiben in meiner Hand sein. Nun, was werden die Radschas von Bengalen sagen, wenn sie lesen, dass sie in kurzer Zeit Spielpuppen der Engländer werden?«
»Ganz Bengalen wird sich wie ein Mann erheben«, rief Phoebe begeistert, »nur muss dies zeitig genug geschehen, dass sie noch vor dem Aufstand heimliche Rüstungen treffen können.«
»In acht Tagen ist es noch Zeit. Ich versichere Sie«, sagte die Duchesse mit Nachdruck, »Sie haben eine schlimme Botschaft unnötig verbreitet, und kraft der mir von Bahadur verliehenen Vollmacht, enthebe ich Sie Ihres Auftrages, der in kleinlichen Herzen nur bangen Zweifel erzeugt.«
Phoebe verneigte sich zustimmend.
»Ich gehorche der geheimen Führerin unseres Unternehmens; der große Bahadur könnte keine bessere gewählt haben.«
»Es ist kein Befehl, sondern eine Bitte«, lächelte die andere, fuhr dann aber stirnrunzelnd fort, »und überschätzen Sie meine Stellung nicht! Ich habe nur eine scheinbare Macht, auch ich muss gehorchen, und noch dazu einem Menschen, einem Emporkömmling, den man wie einen Gott anbetet, Bahadur nicht ausgeschlossen — nun, Sie wissen, wen ich meine, selbst seinen Namen darf man kaum aussprechen. Sonst noch etwas Neues, liebe Freundin?«
»Ja, leider.«
»Leider?«
»Meine Unglücksbotschaften haben sich noch nicht erschöpft, alles wendet sich jetzt gegen uns.«
»Spannen Sie mich nicht auf die Folter!«
»Es ist etwas, was ganz besonders Sie angeht. auch der zweite Gefangene ist aus dem Felsentempel geflohen.«
Wie gelähmt saß Rosa Bellani da. Dann sprang sie mit geballten Fäusten auf.
»Geflohen, sagen Sie?«, kam es dann zischend von ihren Lippen.
»Geflohen und spurlos verschwunden.«
»Von wem haben Sie es erfahren?«
»Von Tipperah selbst. Als er den Tempel wieder betrat, war sein Gefangener schon seit Wochen fort.«
»Auf welche Weise...?«
»Er ist auf ebenso rätselhafte Weise verschwunden, wie der Chinese, der jetzt gemütlich in Indien herumzieht, die Herren und die Damen, meine früheren Gutsnachbarn, führt, und den Tempel der Kali sucht, um sich seinen Zopf wiederzuholen. Sie haben wohl erfahren, dass jene in Indien sind? Ich möchte ihnen nicht begegnen.«
Die Duchesse hatte die Frage überhört. Es dauerte lange, ehe sie sich wieder gefasst hatte; sie murmelte unverständliche Worte vor sich hin. Phoebe hörte sie einmal sagen. »Ich werde ihn, wenn er noch lebt, zu finden wissen.«
»Haben Sie noch eine Botschaft?«, fragte sie dann, ohne sich wieder zu setzen, als könne sie einen neuen Schlag im Stehen besser aushalten.
»Basrab ist in Mirat eingetroffen, ich bin ihm dort begegnet und habe mit ihm gesprochen.«
»Ah, das ist ja eine freudige Nachricht und keine schlechte! So ist er nicht mehr weit von seinem Ziele entfernt. Auch Sinkolin ist schon auf dem Wege nach dort, um das Mädchen seinem Volke vorzustellen. Es wird die höchste Zeit; denn in sechs Tagen muss es wieder hier sein, damit das zum Feste Sivas zusammengeströmte Volk ihm huldigt. Das soll ein Leben werden. Was sagte Basrab? Haben Sie die Begum gesprochen? Sie durften sie natürlich sehen.«
»Ich habe sie nicht gesehen, und Basrab war der Verzweiflung nahe.«
»Was? Warum?«
»Basrab war allein in Mirat, die Begum ist verschwunden.«
»Nicht möglich!«, hauchte die Duchesse erbleichend.
»In der Nähe von Mirat wurde der Elefant, der den Baldachin des Mädchens trug, vom Amok befallen, er rannte davon; dem Mahaut gelang es nicht, das Tier zu töten, der Mann wurde abgeschleudert und brach den Hals. Basrab setzte dem Durchgänger bis zum Abend nach, bis sein Tier stürzte; am anderen Morgen fand er in einem Walde wohl die Trümmer des Baldachins, die Begum aber war verschwunden, und bis jetzt fehlt noch jede Spur von ihr.«
Bei dieser Mitteilung verlor die Duchesse vollständig ihre Fassung, sie vergaß sich.
»Damned«, erklang es rau von ihren schönen Lippen.
Ein Zwischenfall brachte sie jedoch bald wieder zu sich selbst. Im Nebenzimmer war mehrmals das Gong ertönt, und als die Klingel im Boudoir nicht antwortete, erschien das brutale Gesicht des Dieners zwischen der Spalte der Portiere. Es sah ängstlich aus.
»Was gibt's, Babur?«, herrschte die Duchesse ihn an.
»Sei nicht ungnädig, o, Herrin, du hörtest mein Zeichen nicht!«
»Schon gut! Nun?«
»Jenes Weib, die verhüllte Bäuerin will nicht mehr warten, sie verlangt zu dir.«
»Kann sie kein Zeichen geben?«
»Nein.«
»Nennt sie ihren Namen, oder sagt sie, was sie von mir will?«
»Nein.«
»So kann sie auch warten. Störe mich nicht wieder!«
Der Kopf des Inders verschwand.
Die Duchesse wandte sich abermals an Phoebe.
»Also sie ist verschwunden!«
»Vorläufig, ja. Es ist natürlich Hoffnung vorhanden, dass sie wieder auftaucht.«
»Wenn aber nicht zur rechten Zeit?«
»Das wäre fatal! Dann müsste eben etwas ausgesonnen werden, die Verzögerung als etwas Selbstverständliches, als etwas von den Göttern Gewolltes hinzustellen, wie es schon so manchmal geschah. Sie sind darüber besser orientiert als ich.«
»In diesem Falle nicht, Sie waren ja Erzieherin der Begum. Falls sie nun nicht wieder auftaucht, könnte sie nicht durch eine andere ersetzt werden?«
»Unmöglich!«
»Ich meine, nicht gerade zur bestimmten Frist! Die Vorstellung, unser ganzes Ziel müsste eben etwas verschoben werden.«
»Unmöglich!«, wiederholte Phoebe bestimmt. »Wir würden auf der ganzen Erde kein anderes Weib finden, das so wie Bega befähigt ist, die ihr zugeteilte Rolle zu spielen. Ich habe Bega erzogen, ich kenne sie, und unsere Erziehung ist nach langer Mühe vollständig geglückt. Das in ihr Herz gegossene Gift hat gewirkt; sie hasst die Engländer, die ihren Vater und ihre Mutter unglücklich gemacht haben, sie brennt danach, Rache zu nehmen, sie will Indien befreien und die Faringis vernichten, sie ist geistig und körperlich dazu geschaffen, die Kaiserin eines Landes zu sein. Passen Sie auf, die Inder werden dem schönen Mädchen in maßlosem Jubel zujauchzen; es wird ihnen eine Wonne sein, für die junge Königin zu sterben. Bega nimmt ihre Sache mit einem geradezu erschreckenden Ernst auf, sie ist sich ihrer Stellung vollständig bewusst, und, das kann ich Ihnen schon jetzt versichern, sie wird keinen Rivalen neben sich dulden, wenn er etwas anderes will als Glück Indiens.«
»Hm, sie ist sehr selbständig?«, Phoebe lachte leise auf.
»Bega besitzt kleine, zierliche Hände, was sie aber mit ihnen einmal gefasst hat, das lässt sie nicht wieder los. Ich sage Ihnen, sollte man etwa mit dem Gedanken umgehen, etwa jener Geheimnisvolle, das Mädchen auf den Thron zu setzen und dann, wenn der Zweck erfüllt ist, sie wieder herabzustoßen, so wird man sich bitter täuschen.«
»Das meinte ich nicht«, wich die Duchesse aus, »als ich von ihrer Selbständigkeit sprach. Ich meinte: Würde sie, falls sie sich noch am Leben befindet, eine uns bekannte Person finden, ohne ihr Inkognito zu lüften?«
»Ah, ich hatte im Eifer ganz vergessen, zu erzählen, was ich von Basrab erfuhr. Bega hat die Instruktion bekommen, wenn sie einmal verlassen dastehen sollte, sich unverzüglich an Ihre Adresse zu wenden. Sie ist im Besitze bedeutender Mittel; es würde ihr also nicht schwerfallen, sich unerkannt bis zu Ihnen durchzufinden.«
»So kennt sie meine Namen?«
»Nein, nur Ihr Haus.«
»Sie kann sich durch einen Händedruck legitimieren?«
»Nein, auch diese Zeichen kennt sie nicht.«
»Es ist eine Unvorsichtigkeit, dass man sie noch nicht eingeweiht hat.«
»Sie vergessen, dass Bega vieles nicht erfahren darf, was mit den geheimen Zeichen zusammenhängt. Sie ist eine edle Natur, es würde sie empören, wenn sie wüsste, dass unsere treuesten und stärksten Verbündeten die Thugs sind.«
»Richtig, Sie haben recht! So konnte ich sie also noch erwarten.«
»Hoffentlich erscheint sie noch zur rechten Zeit.«
»Das werden schwere Stunden des Wartens für mich sein, gerade jetzt, da ich mich mit vielen anderen Plänen beschäftigen muss. Dieses Warten auf sie wird alle meine Gedanken einnehmen, und schließlich kommt sie nicht einmal. Man stürzt nicht schadlos von einem jagenden Elefanten herab. Hätte sie aber den Tod gefunden, so müsste man doch ihre Leiche oder wenigstens die Überreste einer solchen gefunden haben.«
Die beiden Damen hingen eine Zeitlang ihren eigenen Gedanken nach. Dann merkte Phoebe, wie die Duchesse sie von der Seite her scharf fixierte.
»Wissen Sie nicht, von welcher Abstammung Bega eigentlich ist?«, begann die Duchesse wieder.
»Das weiß wohl nur einer in Indien. Der Geheimnisvolle. Ich glaube kaum, dass auch Bahadur eingeweiht ist.«
»Auch Sie nicht?«
»Wie sollte ich? Sie gilt als die Tochter des alten Tipperah. Meiner Schwester Kind ist sie jedenfalls nicht, denn ich habe nie eine Schwester besessen«, fügte Phoebe lachend hinzu.
»Ich habe Bega noch nie gesehen und brenne vor Verlangen, sie kennen zu lernen; hoffentlich ist es noch möglich. Es soll ein ganz außergewöhnliches Mädchen sein.«
»Das ist sie.«
»Eine Engländerin?«
»Ich weiß nicht. Ihr Typus ist kein englischer.«
Wieder fixierte die Duchesse Phoebe.
»Sie wissen wirklich nicht, wer Bega ist?«
»Duchesse, Sie verlangen Unmögliches von mir. Ich weiß es nicht.«
Signora Bellani zuckte die vollen Schultern und begab sich ans Fenster. Von der Straße war soeben der taktmäßige Schritt von Soldaten erschollen. Ein Bataillon war vorübermarschiert. Jetzt kamen auch die Offiziere vom Exerzierplatze.
Die Duchesse rief Phoebe zu sich; beide Damen spähten durch die offenen, aber mit Gardinen verhängten Fenster auf die Straße.
»Sehen Sie nur«, lachte erstere, »wie die armen Herren Offiziere auf dem Exerzierplatz mitgenommen worden sind. Ihr Zeug klebt schweißtriefend am Körper wie die Haare am Kopfe, die Gesichter ähneln Klatschrosen, obgleich sie mit einer Schicht Staub dick bedeckt sind. Ja, ja, meine Herren, der neue Kommandeur, Captain Atkins, versteht keinen Spaß. Die Offiziere voran! ist sein Wahlspruch. Da kommt er selbst, der Eisenfresser, wie gewöhnlich an jedem Arme eine Geliebte.«
Unter den Offizieren, welche teils zu Fuß, teils zu Pferd ihren Garnisonen zuschritten, befand sich auch Captain Atkins. Der noch immer junge Mann ging auf dem Trottoir, ein Reitknecht führte sein Pferd auf der Straße. Er hatte sich ebenso wenig geschont wie seine Offiziere, sondern war ihnen mit gutem Beispiel vorangegangen.
Sporenklirrend ging der Eisenfresser auf dem Trottoir, am rechten Arme seine Gattin, Clarence, die Tochter des Generals Havelock, unterm linken Arme den mächtigen Pallasch tragend.
Das waren die beiden Geliebten, von denen die Duchesse gesprochen hatte.
Die Frau mit dem schelmischen, fröhlichen Gesicht führte an der Hand ihr zehnjähriges Töchterchen, ein Junge von acht Jahren trug stolz das untere Ende von des Vaters Pallasch.
So zog die glückliche Familie jeden Tag zur bestimmten Stunde vorbei; immer holten Frau und Kinder den Vater vom Exerzierplatz ab, und mochte der Captain noch so müde sein, stets ließ er sein Pferd neben sich herführen.
»Wunderbar!«, murmelte die Duchesse. »Ich habe wohl geglaubt, dass dieser junge Leutnant einst ein guter, zufriedener Familienvater würde, aber nie, dass er sich zu einem Offizier entwickeln werde, dem sein Dienst noch mehr als seine Familie gilt. Nun, wir werden ja sehen, wie er und die von ihm geschulten Truppen sich im Kampfe bewähren.«
Viele der Offiziere blickten zu den Fenstern des Hauses hinauf, da sie aber niemanden dort sahen, zogen sie ohne Gruß vorüber. Hätte die Duchesse am offenen Fenster gestanden, so wäre des Grüßens kein Ende gewesen.
Plötzlich erscholl ein schmetternder Marsch, und gleichzeitig übergoss sich das Antlitz der Duchesse mit purpurner Röte. Sie brach von einem Rosenstock die schönste Blüte ab und schob die Gardinen ein wenig zur Seite.
»Ich brauche nicht um Ihre Diskretion zu bitten«, sagte sie zu Phoebe. »Was ich jetzt tue, ist ein stadtbekanntes Geheimnis. Es wiederholt sich täglich.«
In scharfem Trabe kam, von eigener Musik begleitet, eine Schwadron stahlgepanzerter, indischer Kavallerie die Straße herauf. Es waren Gurkhas, ausgerüstet mit langer Lanze, Pallasch, Karabiner und Halfterpistolen, die Brust mit einem Schuppenpanzer, Oberarm und Schenkel mit Schienen aus bestem, poliertem Stahl bedeckt.
Die Gurkhas sind die Elitetruppen der englisch-indischen Armee und setzen sich nur aus Bergstämmen zusammen. Es ist eine Ehre, unter ihnen zu dienen, die Soldaten erhalten doppelte Löhnung, die Offiziere nehmen doppelt so hohen Rang als die in anderen Regimentern ein, bekommen aber kein Gehalt, weshalb nur Reiche eine solche Stelle bekleiden können.
Eigentlich sind die Gurkhas ein verwegenes Reitervolk im Norden Indiens, und da die Truppe zuerst aus diesen starken, großen, schöngebauten Leuten rekrutiert wurde, erhielt sie den Namen, obgleich später auch andere Inder in sie eingestellt wurden. Allerdings müssen sie kräftig und schön gewachsen sein; der Offiziersrang ist nicht durch Geld zu erwerben.
Es war ein herrlicher Anblick, diese stahlgepanzerten Reiter auf den ausgesucht schönen Rossen zu sehen. Das Auge konnte das Gleißen der Panzer und Waffen kaum ertragen. Voran ritt der Kriegsgott Mars in eigener Gestalt, das leibhaftige Modell eines Achilles, wie er in stählerner Rüstung, auf wildem Streitross sitzend, gegen den Feind zieht.
Es war der Führer der Schwadron, ein Leutnant, aber im Range eines Captains stehend. Seine Figur überschritt bei weitem die gewöhnliche Menschengröße, er konnte für einen Riesen gelten, doch war er nicht im mindesten auffällig, weil alles an ihm harmonisch gebaut war. Zu ihm passte das mächtige Ross, welches schäumend an dem Gebiss kaute, und aus dessen Augen wildes Feuer glühte, und das doch so willig der starken Faust des jungen Riesen gehorchte.
Der goldene Helm mit wehendem Haarbusch saß auf einem imposanten Haupte, um welches schwarze Locken in unbändiger Fülle flatterten; das bronzene Antlitz mit dem lang herabhängenden Schnurrbart und der edlen Römernase drückten Kampfesmut, Wildheit und Treuherzigkeit zugleich aus. Wie angegossen saß der Panzer an der hochgewölbten Brust, welche gar keines Schutzes bedurft hätte, denn sie war selbst wie aus Erz geformt.
Ob der flammende Blick des Offiziers die dichten Gardinen durchdringen konnte? Vor dem Fenster, hinter welchem die beiden Frauen standen, bäumte sich das Ross unter dem gewaltigen Schenkeldrucke seines Herrn, und grüßend schwenkte dieser die schwere Lanze, doppelt so schwer wie jede andere, als wäre sie ein leichtes Bambusrohr.
Da flog von oben eine rote Rosenknospe herab. Ohne sein Pferd im raschen Lauf zu hemmen, senkte der Held die Lanzenspitze bis zur Erde, ein Schwung, die Rose wurde emporgeschleudert und von der freien Hand aufgefangen.
Noch ein Neigen des lockenumflatterten Hauptes, ein Wink, ein Blick, und die ritterliche Erscheinung, welche der Sagenwelt zu entstammen schien, war verschwunden, mit ihm der reisige Tross.
»Leutnant Dollamore!«, sagte die Duchesse einfach sich zur Gleichgültigkeit zwingend.
»Wie, Dollamore?«, rief Phoebe. »Ist das nicht der Sohn des indischen Nabobs, der kühne Mann, welcher, in seiner Verblendung treu zu England haltend, einst einen Aufstand mit rasch um sich gesammelten Leuten im Keime erstickt hat, worauf ihm die Königin eigenhändig einen Anerkennungsbrief geschrieben und ihn zum Leutnant ihrer indischen Garde ernannt hat?«
»Derselbe.«
Die Erregung der Duchesse beim Anblick Dollamores war Phoebe nicht entgangen.
»Darf ich mir eine indiskrete Frage erlauben, Duchesse?«
»Ich weiß, was Sie wissen wollen — ob mein Interesse für Dollamore auf Neigung oder auf Rücksicht für unsere Sache beruht.«
»Ja, das ist es.«
»Nehmen Sie beides an.«
Die Damen blickten einige Minuten schweigend auf die zu dieser Zeit besonders von Militär stark belebte Hauptstraße.
Wie die Duchesse, so beschäftigte sich auch Phoebe noch mit der ritterlichen Erscheinung, die wie ein Phantom an ihnen vorbeigejagt war.
»Wirklich ein schöner Mann, ein geborener Held!«, murmelte Phoebe. »Wie schade, dass er zu den Engländern hält! Wenn der und seine Stahlreiter auf unserer Seite wären!«
»Dies zu erreichen ist meine Aufgabe. Tritt Dollamore über, so folgen ihm auch seine Scharen. Sie schwören zwar zur englischen Fahne, doch im Herzen nur zu ihrem Führer. Er ist ihr Gott.«
»Dollamore soll treu wie Gold sein, sagt man.«
»Und verliebt wie kein zweiter«, ergänzte die Duchesse spöttisch. »Ich bin nicht zweifelhaft, ob die Liebe oder das Pflichtgefühl im entscheidenden Moment über ihn den Sieg davonträgt.«
»Ein schöner Mann«, murmelte Phoebe nochmals, in Gedanken versunken, »er wäre zum Kaiser von Indien wie geschaffen.«
»Zum Kaiser von Indien«, murmelte die Duchesse träumerisch, »ja, er oder ein anderer. Doch das ist zu spät, zu spät.«
Es lag fast wie Schwermut in den letzten Worten des sonst so leichtfertigen Weibes. An wen mochte sie wohl denken? Jedes Mal, wenn sie Dollamore erblickte, stieg vor ihren Augen gleichzeitig ein Schatten aus längst vergangenen Zeiten auf, auch ein hoher, starker Mann mit schwarzen, feurigen Augen, aus denen Lebenslust und Kampfesmut blitzten.
Seufzend fuhr sich die Duchesse mit der Hand über die Stirn, als wolle sie trübe Gedanken verbannen.
»Nein, die Stelle, die Sie so freundlich Leutnant Dollamore zudachten«, fuhr sie dann spöttisch fort, eine komische Verbeugung nach der Straße und eine vorstellende Handbewegung machend, »diese Stelle ist schon vergeben. Ich erlaube mir, Ihnen vorzustellen Leutnant Eugen Carter, ein Bastard von unbekannter Herkunft, Adoptivsohn von Lady Carter, Seine Majestät der zukünftige Kaiser von Indien.«
Phoebe stimmte nicht in den Spott ein; mit Interesse musterte sie den jungen, schlanken Offizier, dessen gute Nachbarin sie in England gewesen war.
Eugen hatte keinen Blick für die Fenster der Duchesse, wie er überhaupt noch niemals — zum Ärger derselben — das Haus der schönen Frau aufgesucht hatte.
Jetzt blieb er vor der gegenüberliegenden Villa stehen und sprach mit einem der reinmachenden Weiber, zur größten Verwunderung der Duchesse.
»Wer mag nur drüben einziehen wollen?«, dachte sie.
Eine Equipage kam die Straße herauf, darin ein alter Herr und ein junges Mädchen von etwa achtzehn Jahren. Der große Strohhut auf dem blonden Haar, das in zwei lange Zöpfe geflochten war, beschattete ein frisches, unschuldiges Mädchenantlitz mit treuherzigen, blauen Augen.
»Wer ist denn der alte Herr?«, fragte Phoebe. »Mir ist, als müsste ich ihn kennen.«
»Seinen Sohn sicherlich, und dieser sieht dem Vater sehr ähnlich. Es ist Friedrich Reihenfels, ein deutscher Gelehrter, der es hier zu etwas gebracht hat. Sehen Sie nur, wie er von allen Seiten gegrüßt wird. Er könnte den Hut gleich in der Hand behalten.«
»Und das Mädchen?«
»Seine älteste Tochter, Franziska, ein naiver Backfisch. Dem Alten ist eine Professur in Oxford angeboten worden, er will sie in etwa einem halben Jahre antreten; wenn er aber Indien nicht bald verlässt, dürfte er England überhaupt nicht wiedersehen. Ha, was ist denn das nun wieder?«
Auch diese Equipage hielt vor der unbewohnten Villa. Eugen sprach mit den Insassen, dann stieg das Mädchen aus, ließ sich von dem Diener einige Pakete reichen und ging in das Haus.
Die Equipage rollte weiter, Eugen setzte seinen Weg fort.
Die Duchesse wurde plötzlich so erregt, dass sie einige Gänge durchs Zimmer machen musste.
»Jetzt weiß ich, wer mein Nachbar werden wird«, sagte sie dann, und ihr Aussehen war plötzlich ein seltsames geworden. »Dies Haus bezieht niemand anders als jene Gesellschaft, über deren Aufenthalt in Indien sich einige der Unsrigen ganz unnötig ängstigen. Ihre Ankunft in Mirat ist mir gemeldet worden und ebenso ihre Absicht, nach Delhi zu gehen, vielleicht sind sie schon hier. Köstlich, herrlich! Eine bessere Wohnung hätten sie sich nicht aussuchen können.«
Zum Erstaunen Phoebes begann die exzentrische Duchesse plötzlich händeklatschend im Zimmer umherzulaufen, warf sich lachend auf den Diwan und sprang wieder auf.
»Herrlich, herrlich!«, rief sie ein über das andere mal, »Lady Carter zieht in das Haus drüben, und wenn es auch nur einen Tag, eine Nacht ist, wie freue ich mich darauf!«
Phoebe wusste, welche Gesellschaft die Duchesse meinte, und sie kannte auch die Vergangenheit dieses Weibes.
»Aber warum freuen Sie sich denn so, wenn Ihre Schwe...«
Das Weib blieb vor der Sprecherin stehen und schnitt ihr mit einer Handbewegung das Wort ab.
»Nennen Sie Lady Carter nicht meine Schwester; ich will es nicht!«, rief sie heftig. »Und warum ich mich freue? Wenn sie auch nur eine Nacht drüben wohnt, so will ich doch diese wenigen Stunden nach Möglichkeit ausnützen. Ich will sie quälen, martern, ich will mit vergifteten Nadeln in ihrem Herzen wühlen. Oh, wenn sie doch länger drüben wohnen bliebe!«
»Aber ich verstehe Sie nicht.«
»Sie wissen nicht, warum ich Emily hasse?«
»Mir ist nur bewusst, dass Sie sie hassen, über das Warum zirkulieren verschiedene Gerüchte. Aber ich verstehe nicht, auf welche Weise Sie die Dame Ihren Hass besonders fühlen lassen können, wenn sie Ihnen gegenüber wohnt. Wollen Sie sich ihr am Fenster zeigen und in ihr dadurch unangenehme Erinnerungen wachrufen?«
»Sie soll mich nicht zu sehen bekommen — nur im Traum.«
Weiter ließ sich das Weib nicht aus, und Phoebe konnte ihren letzten Worten gar nichts entnehmen, sie waren ihr vollkommen unverständlich.
Die Duchesse war wieder ans Fenster getreten und beobachtete die Villa.
Franziska, Oskar Reihenfels älteste Schwester, leitete jetzt die Arbeit der Weiber, bestieg selbst eine Bockleiter und steckte Gardinen auf.
»Das ist ja seltsam«, sagte Phoebe. »Hat man je so etwas in Indien gesehen? Das Mädchen, eine junge Dame, geniert sich nicht am offenen Fenster Dienerarbeiten zu verrichten.«
»Sie ist eine Deutsche«, entgegnete die Duchesse geringschätzend, »dies erklärt alles. Aber es ist kein Zweifel mehr, sie richtet das Haus für die Gesellschaft ein, welche unter der Führung des jungen Reihenfels reist. Hahaha, diese Toren, sie begehen einen absonderlichen Streich über den anderen. Schon ihre Hoffnungen sind Hirngespinste, ihr Hiersein ist völlig zwecklos, mir aber recht. Wenn sie nur länger hier wohnen blieben!«
Die Duchesse konnte sich nicht mehr der neuen Freundin widmen, sie hatte auch kein Auge für die Straße mehr, ihre Gedanken verweilten nur bei ihren zukünftigen Nachbarn, und der triumphierende Zug in ihrem Gesicht verriet, dass ihr diese Nachbarschaft sehr willkommen war. Phoebe konnte sich allerdings nicht erklären, inwiefern die Duchesse dadurch ihren Plänen näherkäme.
Schließlich vermochte Phoebe doch, der anderen Aufmerksamkeit wieder auf die Straße zu lenken.
»Der Generalgouverneur!«, rief sie, und mit einem Sprunge stand die Duchesse am Fenster.
»Wissen Sie, was zwischen uns beiden einmal vorgefallen ist?«
»Der Generalgouverneur hatte einst einen Verdacht auf Sie, er glaubte, Sie wären eine französische Spionin.«
»Ja, er ließ eine Haussuchung bei mir vornehmen, fand natürlich nichts, und ich stellte mich äußerst beleidigt. Seitdem ist er die Höflichkeit selbst gegen mich. Passen Sie auf, mit welcher Ehrfurcht Lord Canning zu mir heraufgrüßt; ich glaube fast, in seinem Gruße liegt mehr als Höflichkeit. Bitte, treten Sie etwas zurück, man braucht Sie nicht zu sehen.«
Die Duchesse zog die Vorhänge zurück und lehnte sich halb aus dem Fenster.
In einem Wagen fuhr Lord Canning, der Generalgouverneur von Indien vorbei, Stellvertreter der Königin.
Die Zeit war fast spurlos an ihm vorübergegangen, das Gesicht war noch immer das ernste, männlich schöne von früher, die Augen blickten noch immer so klar und forschend, nur die Stirn war etwas höher geworden. Man sah ihm nicht an, dass er schon zweiundvierzig Jahre alt war, er hätte den Vergleich mit jedem jungen Manne ausgehalten.
Die Passanten blieben stehen und grüßten ehrfurchtsvoll den Stellvertreter der Königin; freundlich erwiderte Lord Canning die Grüße, gleichgültig, ob es ein Offizier oder ein sich bis zur Erde verneigender, nackter Eingeborener war; Bekannten oder Freunden dagegen winkte er nur mit der Hand.
Eben passierte die Equipage das Haus der Duchesse.
Lord Canning grüßte nach der anderen Seite hinüber, aber er vergaß ganz, sich auch nach dem Hause der Duchesse zu wenden. Fortwährend winkte er anscheinend der Herrengruppe zu, seine Blicke flogen jedoch über diese weg und dahin, wo ein junges Mädchen, bis an die Schläfe mit Purpurröte übergossen, auf einer Bockleiter stand und eine Gardinenstange in der Hand hielt.
Der Wagen war vorüber. Heftig riss die Duchesse die Gardinen wieder zusammen, dem verschwindenden Wagen noch einen gehässigen Blick nachwerfend. Durch ihre vorherige Äußerung war das Verhalten Lord Cannings, der das stolze Weib, das sich seinetwegen am Fenster gezeigt, gar nicht beachtet hatte, für sie eine Blamage geworden.
Natürlich hielt Phoebe jede Bemerkung oder Frage darüber zurück, sie tat, als wäre ihr gar nichts aufgefallen, und die Duchesse gebrauchte schnell eine diplomatische List, die Zeugin ihrer Niederlage auf andere Gedanken zu bringen.
Die Menschen sind Egoisten, am liebsten sprechen und denken sie von sich selbst.
Rosa Bellani schlang den Arm um Phoebe.
»Nun seien Sie ehrlich mir gegenüber, ich bitte Sie. Ich lese in Ihren trübe blickenden Augen und in Ihren leidenden Zügen, dass ein geheimer Schmerz an Ihrem Herzen nagt. Wollen Sie sich mir anvertrauen? Vielleicht kann ich ihn lindern, sonst ist auch schon geteiltes Leid halbes Leid.«
Das schlaue Weib hatte das Richtige getroffen. Phoebe seufzte tief auf und schien ein Geständnis machen zu wollen, kam aber nicht dazu.
Im Zimmer links wurden zwei Stimmen laut, eine raue, männliche, die von Babur, und eine helle, aber zornige Weiberstimme. Dann musste es drüben zu Handgreiflichkeiten kommen, es wurde ein Stuhl umgestoßen.
»Zurück, oder ich breche dir die Knochen entzwei, kleine Hexe!«, rief Babur gedämpft.
»Ich muss zu ihr, versuche nicht, mich zurückzuhalten! Da, du Tölpel.« entgegnete das Weib zornig, und gleichzeitig flog ein schwerer Körper gegen einen Schrank.
Schnell schob die Duchesse Phoebe in das Badezimmer und schlug die Portiere des anderen Gemachs zurück, entrüstet über diese Ruhestörung.
Eine schlanke weibliche Gestalt, in das ärmliche Gewand einer indischen Bäuerin gehüllt, auch das Gesicht bedeckt, stand mit ausgestreckten Armen vor Babur, der an einem Schranke lehnte, sich den Kopf mit beiden Händen hielt und scheu auf das Weib blickte.
Der starke Mann hatte eben eine Probe von der Kraft dieser Bäuerin erhalten.
Die Duchesse kam nicht dazu, ihren Mund zur zornigen Frage zu öffnen, schnell schlüpfte die Gestalt an ihr vorbei und stand alsbald hochaufgerichtet in dem Boudoir vor ihr.
Das Tuch wurde zurückgeschlagen, die Duchesse sah das schöne, braune Gesicht eines jungen Mädchens. Herrische Augen blitzten ihr entgegen.
Einen Augenblick stand die Duchesse wie versteinert da, dann taumelte sie wie von einem Schlage getroffen mit einem Aufschrei zurück und stürzte wieder auf das Mädchen zu. Doch dessen Blick war gleich dem eines Tierbändigers, er scheuchte das maßlos aufgeregte Weib zurück.

»Wer — wer bist du?«, stammelte die Duchesse.
»Die Begum von Dschansi«, entgegnete das Mädchen stolz, »und wenn du das Weib Nana Sahibs bist, so bin ich deine Gebieterin.«
In diesem Augenblick kam Phoebe hinter der Portiere hervor. Das Mädchen änderte ihre gebieterische Stellung und sprang mit einem Jubelrufe auf die Eintretende zu.
Die stolze Duchesse aber verneigte sich tief nach indischer Sitte, die Augen dabei schließend, als wolle sie deren dämonischen Ausdruck nicht sehen lassen und murmelte unterwürfig:
»Sei mir gegrüßt, Begum; du befindest dich im Hause deiner Dienerin; lass ihr deine Gnade leuchten!«
Die Reisegesellschaft war von Mirat aus mit der Bahn in Delhi eingetroffen, und an der Station wurde sie schon, zur nicht geringen Verwunderung aller, von Dick empfangen.
Ihre erste Absicht war gewesen, wie in allen Städten, die sie schon passiert, so auch in Delhi, Erkundigungen einzuziehen, die sie vielleicht auf eine Spur nach dem Felsentempel gebracht hätten, also die Behörden und besonders zu England haltende Inder zu befragen, ferner sich Geleitbriefe geben zu lassen; doch eine lange Erzählung Dicks, welche im Hause des alten Reihenfels stattfand, brachte zuerst die größte Aufregung, besonders bei Lady Carter, dann eine vollständige Umänderung der bisher gefassten Pläne hervor.
Dick erzählte dabei nur seine Erlebnisse, die wir erfahren werden, soweit wir sie noch nicht kennen. Kiong Jang fügte einige Erklärungen hinzu, und die Folge war, dass eine Teilung der Gesellschaft stattfand.
Mister Woodfield, seine Schwester, Kiong Jang und Dick wollten nach einigen Rasttagen weiterziehen, um, wie bisher, ziemlich planlos nach einem Anhaltepunkte zu suchen, wo der Felsentempel der Thugs liegen könnte, in dem Nancy gefangengehalten wurde. Kiong Jang versicherte fest, er würde den Weg schon noch finden. Nur einen Baum, einen Strauch oder einen Felsen müsse er sehen, der seine Erinnerung wecke, dann würde er direkt den Weg zurücklegen, den er damals bei seiner Flucht genommen, und dieser würde ihn nach dem Felsentempel führen.
Lady Carter, Reihenfels, Hira Singh, Jeremy, Charly, August und Hedwig dagegen wollten in Delhi bleiben, aus einem Grunde, dessen Erklärung im Laufe der Erzählung stattfinden wird.
Nach kurzem Aufenthalte im Hause Reihenfels' sollte nunmehr die Übersiedelung des zurückbleibenden Teils nach einer unbewohnten aber möblierten Villa erfolgen, die dem englischen Gouvernement gehörte.
Lord Canning selbst hatte Reihenfels dieses Haus sofort zur Verfügung gestellt, Lady Carter seiner Teilnahme versichert und seinen baldigen Besuch versprochen.
Auch der Teil der Gesellschaft, welcher weiterreiste, wollte die Rasttage in dieser geräumigen Villa verbringen.
Ferner hatte Lord Canning darauf bestanden, dass Lady Carter nicht ohne Schutz zurückbleibe, wenn Reihenfels und seine Begleiter abwesend waren — was oft in Aussicht stand — eine Ordonnanz in Person von Jim Green war nach der Kommandantur abgegangen, und gleichzeitig, als unsere Freunde in der Villa einzogen, nahm auf Befehl des Kommandanten auch Eugen mit seinen beiden Burschen und noch zwei anderen treuen, eingeborenen Dienern — jeder Offizier hält sich in Indien einige Diener — dort Quartier.
Für Eugen hatte dieser Befehl natürlich nichts Unangenehmes enthalten, mit jubelnder Freude hatte er ihn begrüßt, und zwischen Mutter und Pflegesohn hatte das herzlichste Wiedersehen stattgefunden. Emily vergaß für eine Stunde ihr Leid, das sowieso schon der frohesten Hoffnung zu weichen begann.
Die freundliche Franziska, Oskars älteste Schwester, hatte es sich nicht nehmen lassen, an der Einrichtung der lange leerstehenden Villa selbst die letzte Hand anzulegen, und als die Gesellschaft mit ihrem wenigen Gepäck einzog, fand sie ein gemütliches Heim vor.
Am glücklichsten war August, dass er nicht weiterzureisen brauchte, sondern hier verweilen konnte. Eine herrliche, bequeme Zeit stand ihm in Aussicht, er gedachte sie zu genießen und Delhi und ganz besonders die sich bietenden Vergnügungen recht gründlich kennen zu lernen.
Außerdem war mit ihm noch eine Wandlung vorgegangen. August hatte plötzlich begriffen, welche wichtige Rolle er eigentlich spiele, ja, vielleicht die wichtigste, er ließ sein mürrisches Wesen fahren — er brauchte sich auch nicht mehr über Reisestrapazen zu ärgern — und trug seine Nase noch einmal so hoch. Seit ihm die Augen aufgegangen waren, wie unentbehrlich er Reihenfels war, gab er sich nur noch nach langem Bitten zu einer Dienstleistung her, er wollte selbst den Herrn spielen. Höchstens Reihenfels gegenüber benahm er sich etwas unterwürfig, aber auch noch vertraulich genug, und dieser ließ sich von dem in seinem Brote stehenden Diener viel bieten.
Jetzt war für August wieder eine Gelegenheit da, zu zeigen, dass er kein Diener, sondern ein wichtiges Mitglied der Gesellschaft sei.
Die Villa war bis auf wenige Personen verlassen. Mister Woodfield war mit seinen beiden Gefährten nach dem Gouvernementsgebäude gegangen, um sich Geleitsbriefe ausstellen zulassen, Eugen und alle seine Diener und Burschen, auch Jeremy, räumten in der alten Wohnung zusammen, und so befand sich nur noch eine dienende Person im Hause, Hedwig, die aber schon von Emily gebraucht wurde.
Miss Woodfield machte als fürsorgliche Schwester die Koffer des Bruders zur baldigen Reise zurecht.
Miss Woodfield brauchte also Hilfe, Hedwig war von Emily engagiert, an Reihenfels, der einen Plan zeichnete, durfte sie nicht denken, und so blieb nur August übrig.
Sie suchte diesen und fand ihn in seinem elegant ausgestatteten Dienerzimmer in einem Lehnstuhl sitzend, beide Beine auf den Tisch gelegt und damit beschäftigt, die Anfangsgründe des Zigarettendrehens zu erlernen. Einige unförmliche Wülste, wie geborstene Würste aussehend, lagen schon vor ihm auf dem Tisch.
Erst blieb Miss Woodfield, über seine sonderbare Haltung überrascht, mitten in der Stube stehen.
»Aber, August, wo haben Sie denn das gelernt? Das tut doch kein anständiger Mensch!«
»Zigaretten drehen? Dann ist Ihr Herr Bruder auch ein unanständiger Mensch, denn der dreht sich seine Zigaretten auch selbst.«
»Ich meine, dass Sie beide Beine auf den Tisch legen.«
»Ach so! Das ist dem Tisch ganz egal, der geniert sich deshalb nicht, wie mein Bruder sagt.«
»Aber es ist unästhetisch, unanständig!«
»Ich hab's in England, in Ihrer Heimat gelernt. Da setzen sie sich oft so hin.«
»Nur Menschen, die gar keinen Anstand haben. Ich hielt Sie für einen gut erzogenen Mann.«
»Danke sehr, Miss! Mache mir aber nicht viel aus dieser Schmeichelei. Wo ich das gelernt habe, da verkehrten nur die feinsten Herren Londons und die feinsten Damen, und sogar diese legten manchmal beide Beine auf den Tisch — es war in der Alhambra.«
»Schweigen Sie.« rief Rachel empört, denn ihre Ohren waren sehr empfindlich. »Kommen Sie, Sie müssen mir helfen, den Koffer Mister Woodfields zu packen.«
Die alte Dame hatte eine etwas knurrende Stimme, ihre Aufforderung klang daher wie das Kommando eines Offiziers.
August rührte sich nicht.
»Das hat sich jetzt bei mir ausgemusst«, entgegnete er gleichgültig. »Packen Sie die dreckige Wäsche nur selber zusammen, ich mache meine Finger nicht schmutzig.«
Dabei blieb er. Rachel konnte ihm zürnen, befehlen oder ihn bitten, August weigerte sich, hilfreiche Hand anzulegen. Er fuhr ruhig fort, wurstähnliche Zigaretten zu fabrizieren.
Mit dem Schritt eines Dragoneroffiziers verließ die alte Dame das Zimmer und kehrte gleich darauf in Begleitung von Reihenfels zurück. Dieser blieb im Türrahmen stehen.
»August, du hast nichts für mich zu tun«, sagte er ruhig, »du kannst deshalb Miss Woodfield beim Einpacken behilflich sein.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, begab sich der junge Gelehrte darauf in sein Arbeitszimmer zurück. August aber sprang mit einem Satze auf und pflanzte sich vor die alte Dame hin.
»Also klatschen können Sie auch!«, rief er erbost. »Das hätte ich Ihnen, weiß Gott, nicht zugetraut. Denken Sie ja nicht, ich helfe Ihnen, weil Mister Reihenfels es mir befiehlt, befehlen lasse ich mir überhaupt nichts. Ich will ihm seine Bitte nur nicht abschlagen, weil er mir einen Gegendienst tun soll. Na, also mal los, fix, nur immer fix! Wir hätten schon längst fertig sein können.«

Der Gegendienst, den August von seinem Herrn noch heute zu fordern gedachte, war die Zahlung eines Vorschusses, denn sein Geldbeutel war erschöpft, und auch in Delhi bekommt man nichts ohne Geld. Dies war der Grund, warum August seinen Herrn nicht erzürnen wollte.
Die alte Dame kämpfte ihre Entrüstung über den groben, faulen Diener nieder, indem sie schnell einige Bibelsprüche murmelte, welche christliche Geduld lehren, und dann begann die Arbeit.
Bald jedoch bereute Rachel, August zur Hilfeleistung aufgefordert zu haben. Er fasste alles mit den Fingerspitzen an, wusste alles besser, und seines Räsonierens war kein Ende.
»Ein Paar Unterhosen«, schrie er, als wäre er wütend, warf sie hinter sich und der Dame gerade ins Gesicht.
Jetzt verlor diese aber auch die Geduld.
»Betragen Sie sich nicht so flegelhaft, Sie — Sie — Unmensch!«
»Ich bin weder ein Flegel noch ein Unmensch, das möchte ich mir stark verbitten!«
»Sie haben es mir ins Gesicht geworfen!«
»Ich habe hinten keine Augen.«
»Drehen Sie sich gefälligst um, die Sachen waren schmutzig.«
»Warum hat Ihr Herr Bruder sie denn schmutzig gemacht?«
Rachel murmelte etwas wie ›Unverschämtheit‹, August etwas wie ›alte Schachtel‹, dann wickelte er ein anderes Paar desselben Bekleidungsgegenstandes zusammen, fasste das Bündel mit den äußersten Fingerspitzen und reichte es Rachel mit einer tiefen Verbeugung hin.
»Ein zweites Paar Unterhosen, welches schmutzig zu machen Ihr Herr Bruder die Güte gehabt hat«, sagte er dabei.
»Sie sind ein ganz impertinenter Mensch!«, fuhr Rachel auf. »Bedienen Sie sich wenigstens in meiner Gegenwart keiner unanständigen Worte. Das kann ich verlangen.«
»Nanu, was habe ich denn nun wieder verbrochen? Ich war doch die Höflichkeit selbst.«
»Das sind Unterpantalons, höchstens Unterbeinkleider, verstehen Sie?«
August erwiderte nichts. Er faltete ein Hemd auseinander, besah es aufmerksam von allen Seiten und reichte es ihr dann mit der Bemerkung:
»Ich habe die Ehre, Ihnen einen Unterrock Ihres Herrn Bruders geben zu dürfen. Er hatte die Freiheit, ihn etwas lange zu tragen. Hier noch ein Unterrock. Wie viele Unterröcke trägt eigentlich Ihr Herr Bruder? Wohl ein halbes Dutzend?«
So ging es weiter, bis Rachel ihn bat, sich zu entfernen, wozu jetzt aber August keine Lust zeigte. Endlich kamen Mister Woodfield und seine beiden Gefährten, worauf er sich schleunigst zurückzog. Seine Stelle nahm der höflichere, weit phlegmatischere Charly ein. Dick nahm erst seine Pelzmütze, die er auch im heißen Indien trug, ab, wischte sich mit einem Nachthemd den roten, haarlosen Kopf und suchte dann seinen Bruder auf.
Er fand ihn, wie er am Fenster stand und einem phantastisch geputzten Mädchen Kusshändchen zuwarf, das vom Fenster des gegenüberliegenden Hauses aus die Villa musterte.
Das Mädchen — es war Mirzy — lachte und schnippste dem neuen rothaarigen Verehrer mit den Fingern zu.
»Ein verdammt hübsches Kätzchen«, sagte August zu Dick; »angezogen ist sie gerade wie so ein Ding, das im Zirkus auf dem Pferde Faxen macht. Ob da drüben wohl solche Vagabunden wohnen? Werde heute Abend mal spionieren.«
Er warf wieder Kusshändchen hinüber, das Mädchen wollte sich vor Lachen ausschütten.
»Lass jetzt den Firlefanz«, knurrte Dick, »ich habe mit dir etwas zu besprechen.«
»Gleich, gleich! Die kleine Hexe hat's mir, weiß Gott angetan. Ich hatte nämlich früher einmal, als ich in der Alhambra den Fakir markierte, eine Liebste, die war auch so niedlich angezogen, und überhaupt, gleich, als ich dieses Mädchen sah, musste ich an meine alte Flamme denken. Herrgott, wenn sie es wäre — nee, es ist ja gar nicht möglich. Na, werde mich heute Abend einmal an sie ranschlängeln.«
»Du scheinst ja ein ganz verliebter Schlingel zu sein.«
»Was ist das Leben ohne Liebe?«, deklamierte August.
»Es kommt aber nichts dabei heraus.«
»Manchmal doch, wenn das Mädchen nämlich Geld hat. Ich sage dir, Richard, ich habe einmal eine schöne Gelegenheit versäumt, ich hätte jetzt ein sehr reicher Mann sein können.«
»Durch eine Heirat?«
»Ja, das Mädchen war schön zum Ablecken, und der Vater war Kommerzienrat.«
»Kommerzienrat? Was ist denn das?«
»Das ist ein Mann, der so viel Geld hat, dass er nicht weiß, wo er's hintun soll.«
»So, so, das habe ich noch nicht gewusst; und du hättest seine Tochter heiraten können? Kerl, ich glaube, du flunkerst mir etwas vor.«
»Ich hätte sie heiraten können«, versicherte August, »ich liebte sie wahnsinnig. Aber die Sache hatte einen Haken.«
»War sie krank?«
»Kerngesund.«
»Die Eltern wollten wohl keinen Roten zum Schwiegersohn haben?«
»Die Eltern wurden gar nicht gefragt, das Mädchen hatte seinen freien Willen. Nein, es war etwas anderes. Rate nur.«
»Du warst noch zu jung?«
»Ich war alt genug.«
»Habt ihr euch gezankt?«
»Niemals.«
»Na, warum hast du sie dann nicht geheiratet?«
»Weil mich das Mädchen nicht wollte, das war der Haken. Sonst stand unserer Heirat nichts im Wege«, platzte August lachend heraus.
Dick packte ihn am Kragen, schleppte ihn in die Dienerstube und drückte ihn auf einen Stuhl nieder.
»Nun habe ich deine Albereien satt. Hier bleibst du sitzen und hörst mir zu.«
Er setzte sich ebenfalls am Tische nieder, und seine Miene ließ schließen, dass jetzt etwas Wichtiges kommen musste.
»Wir reisen schon übermorgen von hier weg«, begann er.
»Gott sei Dank!«, seufzte August.
»Freust du dich, dass wir uns trennen?«
»Ganz und gar nicht, nur Miss Woodfield behagt mir nicht. Und dann habe ich auch meine Ruhe wieder.«
»Wer weiß, August, ob wir uns noch einmal wiedersehen, und da dachte ich, August, wir könnten erst noch einmal zusammen an die Mutter schreiben. Sie weiß nur, dass wir nach Indien gegangen sind; es war damals ein sehr kurzes Schreiben, das Reihenfels aufgesetzt hatte.«
»Ich hätte es länger gemacht.«
»Kannst du denn schreiben?«
»Aber natürlich«, sagte August gekränkt; »im Briefe schreiben nimmt's niemand so leicht mit mir auf, und was das Richtigschreiben anbetrifft, da bin ich in der Schule immer einer der ersten gewesen. Kannst du's denn nicht?«
Dick betrachtete wehmütig seine klobigen Finger.
»Ich getraue mir gar nicht mehr, so einen Schreibstift in die Hand zu nehmen, von wegen der Blamage. Warum hast du denn damals nicht selbst geschrieben und Reihenfels darum gebeten?«
»Ich hatte etwas anderes zu tun. Also, wir wollen zusammen an die Mutter schreiben? Können wir machen!«
August stand eilfertig auf, um die nötigen Sachen zu besorgen. Dick hielt ihn noch einmal zurück.
»Es ist darum, wir könnten uns doch schließlich nicht mehr sehen, die Sache mit dem Felsentempel ist nicht so einfach, wie ich erst dachte. Aber wie ist es denn mit dem Zusammenschreiben? Da müssen wir beide mit dem Schreibestift schreiben?«
»Dummheit, ich schreibe in unser beider Namen. Nun sollst du erst einmal sehen, was ich kann. Im Schreiben und der sogenannten Orthografie bin ich ein Haupthahn, da kann mir niemand etwas vormachen.«
August begab sich ins Arbeitszimmer von Reihenfels und kehrte mit Tinte, Papier und Federhalter zurück.
»Es ist freilich nur Kopiertinte, sagte Mister Reihenfels, aber mit der könnte man auch Briefe schreiben. Also nun mal los!«
August setzte sich in Positur, Dick stellte sich hinter den Stuhl des Bruders und schaute ehrfurchtsvoll auf das Papier, auf dem die Feder, mit Tinte gefüllt, schon schreibgerecht ruhte.
Drei Minuten vergingen im tiefsten Schweigen, die Feder kam noch nicht in Tätigkeit.
»Los!«, sagte Dick und gab dem Bruder einen Stoß in die Seite.
August wandte den Kopf.
»Weißt du keinen Anfang, so ein bisschen elegant?«
»Da ist ja einer.«
»Allerdings, ein großer Klecks.«
Fluchend über den Bruder, dessen Puff den Klecks verursacht hatte, sprang August auf und holte sich von Reihenfels einen neuen Briefbogen.
»Er gab mir gleich ein halbes Dutzend«, sagte er, als er zurückkam, »zur Vorsicht, meinte er.«
Als Dick keinen Rat zu geben wusste, wie der Brief anzufangen sei, machte August einige Gänge durchs Zimmer.
»Der Anfang ist beim Brief das allerschwerste«, erklärte er; »da gibt es noch ganz andere Männer als ich, die müssen sich erst auf den Kopf stellen und mit den Beinen Freiübungen machen, ehe sie den Anfang gefunden haben. Habe ich ihn einmal, dann ist das andere ganz leicht, dann quellen mir die Worte nur immer so aus der Feder.«
»Dann stelle dich erst einmal auf den Kopf«, riet Dick, »ich halte dich, dass du nicht umfällst. Oder hilft's dann nicht?«
»Nicht mehr nötig, hat ihm schon«, entgegnete August triumphierend und begann zu schreiben.
Liebe Mutter und Geschwister!
»So, das nennt man die Überschrift, nun kommt das allerschwerste, der richtige Anfang. Weißt du nichts, Dick?«
»Nee, mein Junge. Oder warte mal, wie wäre es denn...«
»Halt, ich hab's«, schrie August, die Augen auf die Tintenflasche geheftet, »so wird's gemacht.«
Konnten wir bisher nicht den deutschen Dialekt wiedergeben, den August sprach, so soll dieser Brief es tun. Einmal im Zuge, ging das Schreiben schnell vonstatten. Dick schaute dem Schreiber ehrfurchtsvoll über die Schulter hinweg.
Liebe Mutter und Geschwister!, kratzte die Feder in steifbeinigen Buchstaben aufs Papier.
Ich und Richard, der hier aber Dick heist, sind nun seit zwei Monaten in Indjen und es geht uns sehr gut und ich werde immer dicker, Dick aber nicht, wenn er auch so heist und Hare bekomt er auch nicht wider auf den Kopf, den die Indjaners in Amerika abskalbirt haben und sein Kopf...
»Das brauchtest du alles nicht zu schreiben«, sagte Dick missbilligend, »das ist Unsinn!«
»Die vier Seiten müssen aber voll werden«, entschuldigte sich August und fuhr fort. Bei dieser Unterbrechung hatte er die letzten Buchstaben ausgewischt.
... und sein Kopf is gerade noch so rot wie früher. Das auswischen müsst ihr entschuldigen, weil es hir in Indjen nämlichst nur Gobirtinte gibt...
»Kopiertinte«, unterbrach Dick ihn mit Nachdruck.
August blickte den Bruder erstaunt an. »Nanu, willst du's vielleicht besser wissen?«
»Der Name steht ja an der Flasche: Kopiertinte und nicht Gobir.«
August las und schüttelte den Kopf.
»Dann ist's da falsch gedruckt, mir kann doch niemand was in der Geografie weismachen.«
»Meinetwegen, also gobire weiter!«
... nur Gobirtinte gibt die auswischen muss, weil sie sonst nichts taugt, wie Herr Reihenfels sagt. Herr Reihenfels lässt euch auch schönstens grüßen unbekannterweiße, er ist ser zufrieden mit mich und kann ohne mir nichts mehr machen weil ich so viel kann. Sonstens geht es uns alle zwei ser gut was wir auch von euch hoffen. Indjen ist ein ser, ser schönes Land man glaubt immer man ist in einem Blumengarten und Abfelsinen tut's hir geben so groß wie eine Kegelkugel aber sie sind dabei ganz weich. Na und dann diese Kerle und Weibsbilder, ihr würdet Maul und Nase aufreisen wenn ihr so was sehn tun tätet...
»Tun tätet ist aber nicht richtig!«, schalt Dick ein.
»Warum denn nicht?«
»Das klingt ja nicht.«
»So was verstehst du nicht, das sind ja eben die Feinheiten beim Briefschreiben. Lern du mir doch so etwas nicht kennen.« Dick schwieg beschämt.
... tun tätet, würdet ihr Maul und Nase sperrangelweit aufreisen...
»Das hast du schon einmal geschrieben.«
»Das ist egal.«
... hier laufen sie manchmal ganz nackgt herum, höchstens mit einer Badehose sogar die Frauen und Mädchens aber Emma braucht nicht zu denken das ich da hinsehe wo ich ihr doch versprochen habe ihr egal treu zu bleiben...
»Was ist denn das für eine Emma?«
»Kennst du die denn nicht? Das ist die Tochter vom Böttchermeister nebenan.«
»Was geht das mich an!«
»Dich nichts, aber mich desto mehr. Wir sind zusammen verlobt.«
... und passt nur gut auf das Emma keine Fissemadentchen macht und sagt ihr, ich haute ihr die Augen blau und braun, wenn sie mir nicht treu bleiben tun täte.
Den Ring habe ich auch noch von ihr und küsse ihn jeden Abend wenn ich ins Bett gehn tue, und dann träume ich egal von sie...
»Welchen Ring denn?«
»Meinen Ring, den Emma mir gab.«
»Du hast ja gar keinen.«
»Natürlich habe ich einen.«
»Wo denn?«
»Ich habe ihn einstweilen in London zum Aufheben gegeben, damit er sich nicht abnutzt. Das braucht aber Emma nicht zu erfahren.«
»Ach so, du hast ihn verkauft?«
»Gott bewahre mich, ich werde den Verlobungsring verkaufen! Versetzt habe ich ihn! Also nun weiter!«
Sonstens geht es uns aber gut, fuhr der Brief fort, und das Essen schmeckt uns beiden hir ser gut. Mit dem Schlafen ist es freilich mau, diweil es hir keine Betten gibt sondern nur Tebbiche, auf die man sich wie die jungen Hunde hinlegt und dann schläft. Aber das Eßen is hir ser gut, Reis gibts fast alle Tage und immer wieder anders einmal mit Rosinen und dann wider mit Babrika oder mit Ingwer und immer wider anders und ihr wisst doch das Reis immer meine Leibspeise gewesen is und auch Klöße die es aber hir gar nicht gibt und Fleisch is hir auch in Hülle und Fülle da weil die dummen Kulis (so heißen nämlichst die Kerle mit den Badehosen) gar kein Fleisch nich essen tun und Hüh ner auch und Tauben und so und Schweine und Schafe und andere Vögel.
Sonstens geht es uns aber gut...
»Das hast du schon ein paarmal geschrieben.«
»Das muss man auch.«
»Und vom Essen brauchst du auch nichts mehr zu erwähnen.«
»Essen ist und bleibt aber die Hauptsache im menschlichen Leben, und das Trinken und Schlafen dazu!«
»Na, dann schreibe meinetwegen weiter!«
... und was das trinken anbetrifft kann man sich auch nich beklagen d. h. (das heißt) nur wenn man nich in einer Stadt ist denn wenn man durch die Wälder und die Schunkeln marschirt was oft passirt gibt es nischt anders als schmutziges Pfützenwasser was einen Beigeschmack nach Schlangen und Fröschen hat und Grogodile gibt's hir zehn Ellen lang und eine Riesenschlange habe ich auch schon tot gemacht. Die war gerade so lang wie eure Waschleine aber natürlich viel dicker fast ebenso dick wie sie lang war und daderbei hatte sie das Maul voller Giftzähne und stinken tat sie tun — fui Deibel...
»Nun hör endlich auf und komm zur Hauptsache.«
»Was soll ich denn anderes erzählen, als was wir hier erlebt haben?«
»Von unserer Trennung; sowie dass ich weiter reise und du hier in Delhi bleibst.«
»Ach so! Warte mal, da muss ich erst einen sogenannten Übergangspunkt finden. Halt, ich weiß schon!«
... sonstens geht es uns hir aber ser gut, und wir sind beide ser zufrieden, auch mit unseren Herren, die ganz gut sind nur muss man sie manchmal den Daumen aufs Auge drücken, sonstens hauen sie übern Strang und verlangen zu viel von ein. Nun muss ich euch noch etwas ser, ser trauriges mitteilen, nämlich von Dick der will mit Mister Woodfield und seiner alten Schachtel von Schwester von den ich euch schon geschrieben habe noch weiterreisen weil sie das was sie suchen was ich nich verraten darf noch nich gefunden haben und ich bleibe hir mit meinem Herrn in Delhi und so kommen wir auseinander, was ser traurig ist und worüber ich mir ser härme. Hir in Delhi gibt es viel Buden wo sie Rum und Gonjak und anderen Schnaps...
»Ist das etwa der sogenannte Übergangspunkt?«
»Natürlich, das wirst du gleich sehen. Lass mich nur machen, so etwas verstehe ich schon.«
... und anderen Schnaps verkaufen tun und auch hiesige sogenannte Ligöre wie z. B. (zum Beispiel heißt das) sogenannten Sorbet und so. Aber ihr wisst ja das ich nischt mehr trinken tue seit ich in der Heilsarmee gewesen bin und da halte ich's...
»So, du trinkst nichts mehr?«, sagte Dick. »Du riechst ja jetzt schon wieder nach Kümmel!«
»Das können aber doch die drüben nicht riechen«, schmunzelte August.
... halte ichs jetzt nur noch mit dem Essen und trinke Wasser dazu. Als wir nun heute Morgen bei das Eßen saßen...
»Bei dem Essen saßen, heißt es!«, bemerkte Dick.
»Mit deinen ewigen Unterbrechungen!«, rief August entrüstet. »Du willst mir doch keine Geografie lernen!«
»Es heißt: bei dem Essen, und dabei bleibe ich.«
»So? Wie sagst du denn? Der Hund geht bei das Essen, oder der Hund geht bei dem Essen?«
»August, du magst mir sonst wohl manches weismachen können, weil ich in derartigen Sachen nicht gerade sehr bewandert bin, aber dass es heißt: der Hund geht bei dem Essen, weiß ich ganz bestimmt, und wenn es nicht so ist, dann sollen auf meinem Kopfe augenblicklich grüne Haare wachsen.«
»Das können wir gleich erfahren«, meinte August und stand auf. »Ich werde Reihenfels fragen! Der ist so ein Federfuchser und weiß ganz genau Bescheid. Komm mit, sonst glaubst du es nicht, wenn ich es dir dann sage!«
Dick war's zufrieden. Beide gingen nach dem Zimmer des jungen Gelehrten, August klopfte an und steckte den Kopf durch die Türspalte.
»Herr Reihenfels, Dick will nicht glauben, dass es heißt: der Hund geht bei das Essen!«
»Was sagt er denn?«, fragte dieser lächelnd.
»Der Hund geht bei dem Essen! Wie heißt es?«
»Es ist alles beides nicht richtig. Es könnte höchstens heißen: der Hund geht an das Fressen, aber schön klingt das auch nicht.«
August machte die Tür zu und wandte sich mit triumphierender Miene an Dick.
»Na, habe ich's nicht gesagt? Es muss ›das‹ und nicht ›dem‹ geschrieben werden!«
»Mach keine faulen Ausreden«, knurrte Dick, »wir hatten beide unrecht! Aber was Reihenfels sagt, gilt bei mir auch noch nicht als ein Faktum!«
»Ich schreibe eben, wie es richtig ist«, sagte August und schrieb dann im Zimmer, nachdem er die letzten Worte ausgestrichen hatte, weiter:
... Als wir nun heute Morgen an das Fressen saßen...
»Kerl, du bist verrückt!«, schrie Dick.
»Mister Reihenfels hat's gesagt, so heißt es!«
»Aber bei mir vom Fressen zu sprechen, verbitte ich mir!«
»Na na, Richard«, sagte August mit pfiffigem Augenblinzeln, »wenn wir bei das Essen sitzen, schlagen wir beide eine ganz gute Klinge. Vom Essen lässt sich da manchmal gar nicht mehr sprechen. Noch einmal ausstreichen tu ich auf keinen Fall.«
So ging es weiter, sowohl in dem Briefstil, als auch mit Dicks Unterbrechungen, bis endlich August mit einem tiefen Seufzer schloss, »weil er nun nichts mehr zu schreiben wisse.«
Der Brief hatte ja schließlich den Hauptzweck erfüllt, dass nämlich die in der Heimat wussten, wie August vorläufig in Delhi blieb, Dick dagegen mit seinem Herrn weiter in das nördliche, gebirgige Indien zog.
Als der letzte Punkt gemacht worden war, fragte Dick mit höhnisch lächelnder Miene, wie viele Fehler der Brief wohl enthalten möge, was Augusts höchste Entrüstung hervorrief.
»Fehler? Meinst du geografische oder andere?«
»Was sind denn eigentlich geografische Fehler?«
»Das sind solche, wo ein Wort falsch geschrieben ist, und die anderen, wo die Worte nicht richtig stehen, heißen — heißen — warte mal — ja, die heißen Stengelfehler. Es gibt noch andere Ausdrücke für Fehler, die kenne ich aber nicht, weil ich sie nie mache.«
»Und wie viele hast du denn von den ersten beiden Sorten gemacht?«
»Richard, du willst mich ärgern. Ich sage dir, wenn in dem ganzen Briefe auch nur ein einziger Fehler ist, dann will ich heute Abend noch gehangen werden, anstatt drüben mit dem kleinen Kammerkätzchen Bekanntschaft anzuknüpfen.«
Damit nahm er den Brief und ging zu Reihenfels, fragend, ob in dem Briefe ein einziger geografischer Fehler sei. Dick bezweifele seine Kenntnis der deutschen Sprache.
Lächelnd las Reihenfels den Brief.
»Nein, ein geografischer Fehler ist nicht drin«, sagte er dann.
»Na, habe ich's nicht gleich gesagt? Und ist ein Stengelfehler drin?«
»Was ist das, Stengelfehler?«
»Wie, Sie wissen das nicht?«, Reihenfels besann sich.
»Ach so du meinst Stilfehler.«
»Das ist ja ganz egal, Stengelfehler oder Stilfehler. Finden Sie einen?«
»Hm, weißt du, was eine doppelte Verneinung ist?«
»Nein«, entgegnete August nach einiger Überlegung offen.
»Du hast die doppelte Verneinung oft genug angewandt.«
»Was ist denn das?«
»Ich habe jetzt keine Zeit dir dies ausführlich auseinanderzusetzen. Eine doppelte Verneinung bedeutet eine Bejahung. Verstehst du das?«
»Nein.«
»Ich werde es dir später einmal erklären. Betreffs deines Briefes also kann ich dir sagen, dass ich darin keine Fehler nicht gefunden habe.«
»Keinen einzigen nicht?«
»Keinen einzigen nicht.«
Damit war August abgefertigt, und er war stolz auf Reihenfels Gutachten, das er falsch auslegte. Da er aber stehen blieb, musste er noch etwas auf dem Herzen haben.
»Nun, was gibt's noch?«
»Herr Reihenfels, ich habe kein Geld mehr.«
»Das tut mir leid, ich bin dir nichts schuldig.«
»Ich bitte um einen kleinen Vorschuss.«
»Wozu brauchst du Geld?«
»In Delhi bekommt man nichts umsonst.«
»Aber was willst du dir kaufen?«
»Ich möchte heute Abend ausgehen.«
»Das erlaube ich dir nicht!«, sagte Reihenfels bestimmt. »Ich bin für dich verantwortlich und gestatte auf keinen Fall, dass du dich während der Nacht in der Stadt umhertreibst. In Delhi ist es nicht sicher, es beherbergt allerlei zweifelhafte Elemente, Europäer sowohl als Eingeborene, die das Tageslicht scheuen und erst in der Nacht auf den Straßen und in Spelunken erscheinen. Am Tage magst du wohl einmal allein ausgehen, in der Nacht aber auf keinen Fall, höchstens, wenn die Notwendigkeit es erfordert, in Begleitung eines verständigen, des Landes kundigen Mannes. Du wirst also nicht gehen!«
August verlor den Mut noch nicht.
»Ich hatte aber etwas vor, was für Sie von höchster Wichtigkeit ist. Sie wissen schon, was!«
Reihenfels blickte überrascht auf. Versuchte dieser August mit dem dummen und doch wieder so schlauen Gesicht ihn etwa zu übertölpeln, oder machte er Ernst?
»Was denn?«
»Ich weiß doch jetzt, warum ich Sie eigentlich begleiten muss. Denken Sie nur, vorhin steht dort drüben ein Mädchen, aufgeputzt wie eine Theaterpuppe, und ich glaube, mich soll das Mäuschen beißen — die leibhaftige Mirzy, gerade wie damals in der Alhambra.
Es war August allerdings gelungen, Reihenfels' höchste Aufmerksamkeit zu erregen, aber von seinem Ziele entfernte er sich trotzdem.
Reihenfels war vor Überraschung aufgestanden und sah nach dem Hause hinüber, dessen sämtliche Fenster dicht verhangen waren.
»Dort drüben?«, stieß er aufgeregt hervor.
»Jawohl, in der ersten Etage, am fünften Fenster von links. Es stand vorhin offen.«
»Sie war es wirklich?«
»Ich glaube es wenigstens, sie sah der Mirzy verdammt ähnlich.«
Reihenfels sank wieder auf den Stuhl.
»Warum glaubst du das?«
»Sie war auch mit allerlei Flitterkram aufgeputzt, und das Gesicht kam mir fast genau so vor, als ob es Mirzy gehöre. Die Entfernung ist freilich ein bisschen groß, ich konnte die Züge nicht deutlich erkennen. Wenn Sie mir aber ein paar Groschen geben und mir heute Abend das Ausgehen erlauben, dann, dann —«
»Was dann?«
»Dann kann ich ja einmal mich dort herumtreiben und ein bisschen spionieren.«
Reihenfels sah den Diener scharf an. Er durchschaute ihn und glaubte, er suche nur einen Vorwand, sich entfernen zu können.
»Nein, August, du bleibst! Bedenke doch, wenn es wirklich das Mädchen ist — was ich aber kaum glaube — so darf es dich nicht sehen, auf keinen Fall aber darf es merken, dass uns daran gelegen ist, mit ihm in Verbindung zu treten. Du weißt doch, warum!«
»Ach so, das ist wahr!«, sagte August und kratzte sich verlegen hinter den Ohren. Seine List war missglückt.
Eben wollte er den Mund zu einer neuen Frage öffnen, als drüben in dem Hause eine helle, schöne Mädchenstimme das italienische Lied zu singen begann.
»O, mia Venezia bella.«
August war bei den ersten Tönen zusammengezuckt.
»Das ist sie, das ist Mirzy!«, rief er dann. »Dieses Lied sang sie gern, ich habe es oft von ihr gehört. Sie war einmal in Venedig engagiert, und da hat sie es gelernt.«
Er sprach so überzeugt, dass Reihenfels nicht an seinen Worten zweifelte. Schnell ging er ans Fenster und zog die Gardinen zu.
»Es ist gut, August, ich danke dir, dass du deinen Dienst so ernst nimmst!«, sagte er dann mit tiefer Stimme. »Hat sie dich schon gesehen?«
»Vorhin einmal.«
»Wird sie dich erkannt haben?«
»Ich glaube kaum. Ich warf ihr sogenannte Kusshändchen hinüber, da ist ja nichts weiter dabei.«
»Und sie?«
»Sie lachte und machte es mit den Fingern gerade, als ob sie meine Kusshändchen wegschnippsen wollte.«
»Sie wird dich erkannt haben.«
»Ach wo, Herr Reihenfels, so eine kennt mehr Männer, als ich Haare auf dem Kopfe habe! Was meinen Sie wohl, eine Tänzerin aus der Alhambra! Wenn sie mich wirklich erkannt hätte, dann würde sie sich ganz anders benommen haben, wenigstens etwas erstaunt gewesen sein.«
»Nun, wenn sie dich oder mich auch erkannt hätte, das wäre nicht mehr zu ändern. Jedenfalls befehle ich dir hiermit, dich niemals mehr um dieses Mädchen zu kümmern; sieh gar nicht mehr hinüber, und triffst du sie, so gehe an ihr vorüber, ohne sie auch nur anzublicken. Dasselbe werde ich tun. Es muss aussehen, als ob sie uns ganz gleichgültig wäre.«
»Schön, Herr Reihenfels — aber, nicht wahr?«
»Was denn?«
»Nun erlauben Sie auch, dass ich heute Abend ein bisschen ausgehe? Delhi ist so schön, ach, so sehr schön, und ich glaube, bei Nacht muss es noch viel schöner sein.«
»Nein, heute Abend nicht! Alle anderen haben im Hause zu tun, da die Abreise von Mister Woodfield bevorsteht, du kannst keine Begleitung bekommen; sonst würde ich dich wohl gehen lassen. Ein anderes Mal!«
August ging mit mürrischem Gesicht hinaus, aber nicht lange dauerte es, so hellte es sich auf. Er suchte Mister Woodfield und fand ihn allein in einem Zimmer.
»Mister Woodfield, wissen Sie, was eine doppelte Verneinung ist?«, fragte August.
Der alte Mann sah verwundert auf. Im Englischen gilt in dieser Hinsicht dieselbe Regel wie im Deutschen.
»Ja. Warum denn?«
»Nur so. Ich lerne gern, besonders wenn's nichts kostet. Ist das z. B. eine doppelte Verneinung, wenn ich sage. ich habe keinen Fehler nicht gemacht?«
»Ja, das ist eine, und das heißt dann soviel als du hast einen Fehler gemacht.«
»Ach so, dachte ich mir doch so etwas Ähnliches!«
»Und eine dreifache Verneinung ist wieder eine richtige einfache Verneinung!«, fuhr Woodfield in seiner Belehrung fort.
August ließ plötzlich wieder den Kopf hängen.
»Wenn aber nun viermal verneint wird?«, fragte er dann mit einem pfiffigen Gesicht.
»Das ist wiederum eine Bejahung, aber so etwas kann wohl überhaupt nicht vorkommen.«
»So, so! Sagt man also viermal nein, so heißt das auch ja!«, murmelte August, als er ging, um eine Erkenntnis reicher.
Er fand Charly, wie dieser eben einen Beutel auf dem Tisch liegen hatte und Geld zählte. Es war August ein leichtes, sich von dem gutmütigen Pelzjäger einige Silberstücke zu borgen, ohne dass er das feste Versprechen einer Rückzahlung zu geben nötig hatte.
Der Abend brach schon an, als August abermals an die Zimmertür seines noch arbeitenden Herrn anpochte. Reihenfels glaubte, August müsse ihn sprechen, und fragte freundlich nach seinem Begehren.
»Herr Reihenfels, erlauben Sie, dass ich heute Abend ausgehe?«, fragte August.
»Nein!«, rief der in seiner Arbeit Gestörte unwillig. »Das ist mein letztes Wort. Belästige mich nun nicht mehr!«
August verschwand und bereitete sich trotz des Verbotes zum Ausgehen vor.
»Er hat viermal nein gesagt, das bedeutet ja!«, murmelte er dabei vergnügt. »Wollen kann er also gar nichts, sonst sage ich ihm, er soll besser Deutsch lernen. Ja, ja, es geht doch nichts über Bildung — und Schlauheit!«, setzte er hinzu.
Ohne dass jemand etwas wusste, verließ er nach Anbruch der Dunkelheit die Villa und war, als man schlafen ging, noch nicht zurück. Dass er sich heimlich, trotz des Verbotes von Reihenfels, entfernt hatte, wurde bald allen klar. Letzterer war natürlich sehr unwillig darüber. Man wartete von Stunde zu Stunde, als August aber nicht kam, sagte sein Herr, man solle sich nicht mehr um ihn sorgen. Er sei jedenfalls in Gesellschaft geraten, in der es ihm gefiel, und benutze seine selbstgenommene Freiheit gründlich.
Sei er bis zum nächsten Morgen nicht zurück, so wolle man ihn durch die Polizei suchen lassen; doch stände zu erwarten, dass er morgen in seinem Bett liege, wahrscheinlich mit schwerem Kopf. Die Haustür konnte ihm durch einen indischen Diener auf sein Klopfen immer geöffnet werden.
Der Morgen kam, und August war noch immer nicht da. Dick schwor, an seinem jüngeren Bruder noch ein Exempel zu statuieren. Reihenfels sah ein, dass Zürnen jetzt zwecklos sei, und überlegte, wie er am schnellsten seinen verlorengegangenen Diener wiederfinden könne, entweder durch Benachrichtigung der Polizei, oder, indem er einige Kulis, welche jeden Schlupfwinkel Delhis kannten, auf die Suche schickte.
Er beschloss ersteres und war schon bereit, noch vor dem gemeinsamen Frühstück fortzugehen, als ihm Jeremy meldete, dass Lady Carter ihn unverzüglich zu sprechen wünsche.
Reihenfels erschrak, als er Emily erblickte. Mit einem leichten Morgenrock bekleidet, lehnte sie müde, als wäre sie vollständig erschöpft, im Lehnstuhl; ihr Antlitz war geisterhaft bleich, und ihre Augen blickten hohl.
»Um Gottes willen, Lady, Sie sind krank?«, rief Reihenfels erschrocken und ergriff die matt herabhängende Hand, nach dem Puls fühlend.
Er glaubte, mit allen in Indien heimischen Krankheiten vollständig vertraut, das gelbe Fieber mache sich bei ihr geltend.
»Ich bin krank«, entgegnete Emily mit schwacher Stimme. »Ich werde mich sofort erholen, wenn Sie mir die Erklärung geben können, dass ich die erste Nacht in diesem Hause nur geträumt habe.«
»Ein Traum hat Sie geängstigt?«
»Ich möchte, es wäre nur ein Traum gewesen, aber es war keiner. So deutlich, wie ich Sie jetzt vor mir stehen sehe, stand diese Nacht Isabel an meinem Bett, und so deutlich, wie ich Sie jetzt sprechen höre, sprach sie zu mir.«
Reihenfels wurde immer besorgter. Er wäre froh gewesen, wenn er Fieber hätte konstatieren können, aber Emily fieberte nicht im Geringsten.
»Sie haben einen einer Vision ähnlichen Traum gehabt?«
»Es war Tatsache, Isabel war bei mir. Ich habe mit ihr gesprochen. Ich wollte mir einreden, ich spräche nur im Traum, heute Morgen erkannte ich indes, dass ich mich nicht getäuscht habe.«
»Wie sah sie aus?«, fragte Reihenfels, hoffend, in Emilys Angaben eine Unmöglichkeit nachzuweisen.
»So wie früher, nur etwas voller. Sie trug dasselbe Kleid, wie damals auf dem Ball, als der Bruch zwischen uns erfolgte. Sie wiederholte dieselben Flüche, sie schilderte mir, wie diese in Erfüllung gegangen wären, und versicherte, das Schicksal würde nicht eher ruhen, als bis sich auch ihr letzter Fluch erfüllt hätte.«

»Mylady, ich bitte Sie, reden Sie sich fest ein, dass Sie nur geträumt haben!«, rief Reihenfels flehend. »Des Menschen Willenskraft vermag Unmögliches zu leisten, sie kann seelische, wie körperliche Krankheiten heilen, und werden Sie von bösen Phantomen geplagt, so müssen Sie, eine Europäerin, in Indien krank werden.«
»Nun denn, so gebe ich zu, dass ich geträumt habe!«, lächelte Emily schwach, aber das Lächeln nahm sich wie ein krankhafter, leidender Zug in ihrem Gesicht aus. »So träumte ich denn auch, Isabel legte mir zum Abschied, damit ich nicht an ihrem wirklichen Besuch zweifle, einen Fächer auf mein Bett, jenen Fächer, den sie damals auf dem Balle trug, und welcher in ihrer Hand zersplitterte, als sich Sir Carter verächtlich von der ungetreuen Braut abwendete, ja, ich träumte, sie legte mir diesen Fächer auf mein Bett, und heute Morgen, als ich aus dem Traume erwachte, da«, sie nahm vom Seitentischchen einen Gegenstand, »da lag er noch da.«
Jetzt war die Reihe des Erschreckens an dem jungen Gelehrten. Emilys Hand hielt ihm einen kostbaren Elfenbeinfächer hin, dessen Stäbe zersplittert waren.
Er kannte jede Einzelheit aus Emilys vergangenem Leben, beide hatten so oft über das geringste Vorkommnis in demselben gesprochen, damit Reihenfels völlige Klarheit bekam, dass er diesen Fächer sofort erkannt hätte, wenn Emily ihm auch nicht erzählt, von wem sie ihn bekommen haben wollte.
Was für ein Geist war das, der ein sichtbares Zeichen seines Daseins zurücklassen durfte? Noch hatte Reihenfels keine Antwort gefunden, als draußen auf dem Korridor hastiges Laufen erscholl, Türen wurden geworfen, er hörte Dicks zürnende Stimme, seinen Namen rufen, und dann stürzte August in das Boudoir Emilys, warf sich, ohne sich um die Anwesenden zu kümmern, in den neben Emily stehenden Lehnstuhl, streckte beide Beine von sich, ließ die Arme hängen und lehnte den rothaarigen Kopf ungeniert an Emilys Schulter.
Reihenfels war über dieses Auftreten seines Dieners einen Augenblick starr, Emily wusste nicht, was sie denken sollte.
Himmel, wie sah dieser Kerl aus!
Seine Schuhe waren mit einer dicken Lehmschicht bedeckt, die Kleider schienen zu verraten, dass ihr Besitzer diese Nacht in einer Kalkgrube geschlafen hatte, und das Gesicht war das eines Mannes, der einen sinnlosen Rausch hinter sich hat und noch nicht wieder zum Bewusstsein gekommen ist. Das Haar stand struppig zu Berge, ein Hut war nicht mehr vorhanden.
Reihenfels glaubte, August sei noch betrunken und simuliere einen Entschuldigungsgrund.
»August«, rief er streng, »du bist betrunken! Was ist das für ein Benehmen? Entferne dich sofort und geh schlafen. Später werden wir uns weitersprechen!«
»Herr — Herr Reihenfels«, stotterte August, »ich — ich — habe ein — Gespenst — gesehen!«
»Am lichten Tage?«
»Nein — nein — in der Nacht!«
Jetzt fiel Reihenfels doch das entsetzt starrende Auge des Mannes auf. Ihm musste wirklich etwas Ungewöhnliches passiert sein.
»Wo bist du diese Nacht gewesen?«
»Auf dem — Friedhof — von — Hum — Hum — Huma —«
»Im Grabgebäude des Humayun?«
»Ja — ja — aber daneben — unter lauter — Leichen.«
»Was hast du da gesehen?«
»Es!«, ächzte August.
»Was für ein es?«
»Ihn!«
»Sprich deutlicher! Erhole dich erst etwas. Denke aber nicht daran, uns etwas aufbinden zu wollen.«
»Ich habe es gesehen«, stöhnte August.
»Was denn nur?«
»Das, was wir suchen — den auch Dick gesehen hat — wie er leibt und lebt — im Grabgewölbe des Hum — Hum — das wandernde Feuer — o Jesses — geben Sie mir ein Glas Kognak, aber nicht zu klein, oder ich sterbe!«
August schloss die Augen und öffnete den Mund, als erwarte er, dass ihm jetzt die gewünschte Medizin eingeflößt würde. Reihenfels und Emily sahen sich beide erschrocken an. Sie glaubten der Aussage des Dieners.
Ein herzlicher Empfang war unseren Freunden zuteil geworden, als sie unter Führung von Reihenfels unvermutet im Hause seiner Eltern eintrafen. Teilnehmend erkundigte man sich nach dem bisherigen Schicksal, von dem man nicht schon erfahren hatte, bedauerte, dass bis jetzt so wenig Erfolg zu verzeichnen wäre und hoffte zuversichtlich, Gott würde noch alles zum Besten lenken.
Wie schon erzählt, half Franziska nach besten Kräften, den Gästen den Umzug nach der Villa zu erleichtern, und während sie dort für Traulichkeit sorgte, half das fünfzehnjährige Käthchen, die jüngste Tochter und das vorletzte Kind der Familie, beim Einpacken in der Wohnung.
An ein ruhiges Aussprechen zwischen dem nach so langer Abwesenheit wieder angekommenen Sohne und den Eltern und Geschwistern war daher nicht zu denken, die Gäste fühlten, wie ein solches herbeigesehnt wurde, und als Franziska am Nachmittag wieder zurückkam, fand der Auszug sofort statt. Nur Oskar blieb noch für eine Stunde im Hause seiner Eltern.
Seine letzten Erlebnisse hatte er dem Vater schon mitgeteilt, auch über seine Tätigkeit in London berichtet, und jetzt saß die ganze Familie — mit Ausnahme des jüngsten Sohnes — in der nach deutschem Geschmacke eingerichteten, heimischen Wohnstube am gemütlichen Kaffeetisch und sprach, alles Geschäftliche ausschließend, über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Es wurde jener Zeiten gedacht, da der damals noch junge Vater in dem Dachkämmerchen saß und um das tägliche Brot Übersetzungen lieferte, wie die kranke Mutter mit freudigem Blick dem Arbeitenden zusah, wie ihr Händedruck, Liebe und Dank ausdrückend, dem Ermüdeten immer wieder neue Kraft einflößte, wie der blondlockige Oskar an ihrem Bette saß und ihr buchstabierend deutsche Märchen vorlas, worauf die glückliche Mutter, welche den Strickstrumpf nicht aus der Hand legte, erzählen musste, wie Oskar beharrlich Domröschen statt Dornröschen vorlas, wie dazu der Zeisig über dem Fenster jubilierte.
Dann wurde des Besuches des Direktors vom britischen Museum erwähnt, wie man sich damals mit großen Hoffnungen trug, die sich aber nicht erfüllten, weil der alte, wohlwollende Herr starb und sein Nachfolger Reihenfels vernachlässigte. Es gab damals wohl Zeiten, in denen das Herz des Gelehrten mit Bitterkeit erfüllt wurde, doch im Kreise der Seinen fand er immer wieder das Glück der Zufriedenheit.
»Denn diese, Gesundheit und ein reines Gewissen sind die einzige, feste Basis, auf welche sich im menschlichen Leben das Glück sicher aufbaut, jeder andere Grund hält das Gebäude nicht, wenn die Stürme des Lebens es umbrausen, und der goldene Grund ist einer der schwächsten«, sagte der alte Reihenfels, und seine Kinder merkten es sich, denn er sprach aus Erfahrung.
Man dachte jener Zeit, als Oskar hinaus ins Leben musste, um sich sein Brot selbst zu verdienen, wie Franziska, da sie als vierzehnjähriges Mädchen die Schule verlassen, in ein Putzmachergeschäft als Lernende eintrat, damit sie sobald wie möglich den Eltern nicht mehr zur Last fiele, und wie dann plötzlich der große Umschwung im Schicksal kam.
Von der Eröffnung des Grabes Timur Dhars, wodurch doch diese Wendung bewirkt ward, sprach man nur flüchtig, denn dadurch konnten unangenehme Erinnerungen berührt werden, dagegen versenkte man sich mit Behagen in die Gegenwart und malte sich die Zukunft aus.
Wie glücklich war alles gekommen! Jetzt besaß die Familie ein trautes Heim, nach deutschem Geschmack eingerichtet und einfach, obwohl Reihenfels Mittel erlaubt hätten, die glänzendste Wohnung zu beziehen.
Der indischen Sitte entgegengesetzt, hielt er nur die notwendigsten Dienstboten, denn wo Frau und erwachsene Töchter im Hause sind, bringt es dem Hause Schande, unnötige Dienstleute zu halten, und je mehr Diener, desto mehr Lasten. Und hätte Reihenfels das erste Palais Delhis besessen, die Achtung, die ihm von allen Seiten entgegengebracht wurde, hätte nicht größer sein können als jetzt.
Mit heimlichem Stolz, der aber durch seine Worte klang, erzählte er, wie selbst der Generalgouverneur ihn mit Aufmerksamkeiten überschütte, wie er ihm bei jeder Zusammenkunft so respektvoll entgegenkäme, als wäre er der erste Beamte Indiens und Lord Canning sein Untergebener.
»Du warst doch sonst nicht so für Gunstbezeugungen empfänglich?«, lächelte Oskar.
»Es kommt darauf an, von wem sie mir zuteil werden«, entgegnete der Vater. »Die Höflichkeit eines Fremden, der nur nach dem Beispiel anderer handelt, würde mich kalt lassen, und wäre er der mächtigste Mann der Erde; doch das Benehmen Lord Cannings mir gegenüber ehrt mich, weil auch ich ihn verehre. Lord Canning ist ein Mann, der es durch seine Tüchtigkeit weit gebracht hat, und jene Behauptung, er hätte seine Stellung nur der Gunst der Königin zu verdanken, weise ich offen als eine schamlose Beleidigung zurück.«
Die Mutter sah nach der tickenden, altdeutschen Wanduhr, die auf vier wies, und sagte zu Franziska, sie solle noch ein Kaffeegedeck auftragen.
Franziska vertrat die Hausfrau, sie besorgte das Einschenken der Tassen und beaufsichtigte den zischenden Kaffeekessel.
»Kommt noch Besuch?«, fragte sie die Mutter, als sie aufstand.
»Ich traf heute Morgen Herrn Neubert und habe ihn gebeten, nach Schluss des Büros zu einer Tasse Kaffee zu uns zu kommen.«
Franziskas Gesicht übergoss sich mit einer flammenden Röte, ihre Hand suchte unsicher die Klinke, als sie das Zimmer verließ, das Gewünschte zu holen. Lächelnd blickte ihr die Mutter nach.
»Ludwig Neubert ist Schreiber auf dem deutschen Konsulat«, erklärte die Mutter Oskar, »ein sehr ehrenwerter, strebsamer, junger Mann. Er und Franziska lernten sich bei einem Ausfluge kennen, den die Beamten des deutschen Konsulats veranstalteten, nun, und die jungen Leute haben aneinander Gefallen gefunden. Warum sollte man nicht manchmal eine Vermittelung zwischen ihnen herstellen?«
Oskar blickte nach dem Vater, in dessen Gesicht er jedoch nichts erkennen konnte. Dagegen ließ sich Käthchen vernehmen.
»Ich glaube, Mutter, du täuschst dich in Franziska«, warf sie vorwitzig ein, ihr als fünfzehnjährigem Mädchen verzeihlich. »Franziska hat nie zu erkennen gegeben, dass sie für Neubert Neigung besitzt. Es scheint mir eher, als fühle sie für den unbeholfenen jungen Mann nur Mitleid.«
»Ach, wie die Mädchen jetzt schon zeitig klug werden«, lächelte die Mutter, »selbst in dergleichen Sachen wollen sie einen schärferen Blick besitzen, als die Eltern! Liebes Käthchen, lenke dein Augenmerk lieber auf deinen Strickstrumpf als anderswohin, denn wie ich schon von hier aus sehe, hast du wieder ein halbes Dutzend Maschen fallen lassen.«
Käthchen wollte ihre Behauptung verteidigen, doch ein ernster Blick des Vaters machte ihr verständlich, dass sie ihre Meinung über dergleichen Dinge nicht aussprechen durfte.
Das Eintreten Franziskas machte dem Gespräch überhaupt ein Ende.
Auch der Geladene ließ nicht lange auf sich warten. Ludwig Neubert war ein junger, gutgewachsener Mann von nüchternem, nichtssagendem Äußeren. Nicht ein Härchen des schlichten, semmelblonden Haares hatte sich eigenwillig verschoben, um den Eindruck des alltäglichen Gewohnheitsmenschen zu zerstören. Alles an ihm deutete auf Schüchternheit und Unsicherheit, was durch das Tragen einer stählernen Brille noch verstärkt wurde.
Nur wer dem Manne in das blaue, treue, seelenvolle Auge sah, und nur wer darin zu lesen verstand, ohne dabei vom Äußeren des Menschen beeinflusst zu werden, konnte ahnen, dass dieser so gewöhnlich aussehende Mann ein ungewöhnliches Herz besaß.
Neubert fühlte mit unabweisbarer Notwendigkeit die Verpflichtung, dass er ein Gespräch beginnen müsse, und so erzählte er, während er das Gebäck mit zitternden Fingern in tausend Stückchen zerbrach, dass eine russische Fürstin zum Besuch in Delhi angekommen sei, und dass der Generalgouverneur ihr zu Ehren am Abend im Palmengarten ein Konzert veranstalten würde. Lord Canning hätte das Programm selbst aufgesetzt, und es sei ganz merkwürdig, wie er nur klassische Musik gewählt habe, während doch allgemein bekannt sei, dass die Fürstin, eine ausgesprochene Freundin von leichten Weisen, für Klassiker gar kein Verständnis habe.
Dies alles war in unsicheren, abgebrochenen Worten erzählt worden, als gelte es ein schamloses Vergehen zu beichten.
»Haben Sie das Programm gelesen?«, fragte die Mutter.
»Ja, es ist herrlich«, rief Neubert lauter als nötig, und seine Augen begannen plötzlich zu strahlen.
»Sind Sie musikalisch?«
»Ach nein, leider nicht, ich liebe nur die Musik, und da ich weiß, dass — Sie — Sie auch gern — gute Musik hören«, er wühlte in der Brusttasche und brachte eine Menge Kuverts zum Vorschein, unter denen er suchte, »so wollte ich mir die Frage erlauben, ob Sie vielleicht geneigt sind, Gebrauch von diesen beiden Billetts zu machen.«
Er reichte Frau Reihenfels ein Kuvert hin, und diese griff danach. Da mochte Neubert der Gedanke kommen, dass es doch eigentlich passender wäre, dem Hausherrn die Billetts zur Verfügung zu stellen.
Schnell zog er das Kuvert aus dem Bereiche der ausgestreckten Hand und hielt es dem alten Reihenfels hin. Auch dieser wollte es nehmen, wurde aber ebenfalls getäuscht.
Neubert hatte sich ja furchtbar tölpelhaft benommen, das musste er wieder gutmachen.
Der Hausherr griff in die Luft, Neubert hatte das Kuvert wieder weggezogen und jetzt glücklich Frau Reihenfels ausgehändigt.
Dieses unglückliche Manöver war von allen beobachtet, doch mit feinem Takt anscheinend übersehen worden.
Nur das mutwillige Käthchen konnte ihre Lachlust nicht beherrschen; schnell ließ sie den Strickstrumpf fallen, bückte sich, und ihr Kopf blieb eine halbe Minute unter dem Tische verborgen. Als er wieder erschien, war er purpurrot vor Anstrengung, fast ebenso rot wie der Neuberts, welcher nichts sehnlicher wünschte, als dass sich hier eine Versenkung befände, in welcher er sich wie des alten Hamlets Geist auf der Bühne unsichtbar machen könnte. In seiner Verlegenheit griff er in die Zuckerdose und füllte sich die Tasse mit Zucker, bis der Kaffee überlief.
Frau Reihenfels hatte dem Kuvert zwei Billetts entnommen, zum neuen Schrecken Neuberts aber auch noch einen beschriebenen Zettel. Derselbe enthielt die Ausgabenrechnung des laufenden Monats; Frau Reihenfels erkannte trotz eines nur flüchtigen Blickes darauf, wie viel die Billetts gekostet hatten — für einen Schreiber eine fabelhafte Summe als Ausgabe an einem Tage.
»Das hat sich wohl in das Kuvert verirrt«, sagte sie, ihm den Zettel gebend. »Ja, wir nehmen Ihre Einladung dankbar an, doch müssen Sie verzeihen, wenn weder mein Mann noch ich davon Gebrauch machen.«
»Die Nachtluft bekommt uns alten Leuten nicht mehr gut«, schaltete Reihenfels ein.
Die Mutter hatte den einzigen, scheuen Blick Neuberts bemerkt, der Franziska gestreift, aber es hätte dessen nicht bedurft, um herauszufinden, wem die Einladung in Wirklichkeit galt.
»Meine Töchter lieben Musik und pflegen sie selbst«, fuhr sie fort. »Wenn es Ihnen angenehm ist, so werden Franziska und Käthchen Sie heute Abend begleiten.«
Neubert stammelte etwas, als wäre er darüber ganz niedergeschlagen, Käthchen verstand es, vor Freude aufzujauchzen, Franziska dagegen senkte den Kopf, nahm befangen ihr Billett und zerknitterte es zwischen den Fingern. Für Neubert hatte sie nur ein dankbares Kopfneigen.
Da stürmte Otto, der jüngste, zehnjährige Sohn, in die Stube, in der Hand einen großen Rosenstrauß, auf dem Rücken den Schulranzen.
Wenn Engländer Kolonien anlegen, so lassen sie es sich immer angelegen sein, sie mit allem auszurüsten, was den Aufenthalt der ganzen Familie ermöglicht, also auch mit englischen Schulen.
Otto hatte keine Zeit, die Anwesenden zu begrüßen, er hielt den prachtvollen, aber einfach mit einem Bindfaden gebundenen Strauß vor sich hin und rief.
»Ein Rosenstrauß, wie viel ist er wert?«
»Rosen sind in Indien billig, er wird nicht viel kosten«, sagte Oskar.
»Ich frage nicht, wie viel er kostet, sondern wie viel er wert ist.«
»Rosen sind fast wertlos.«
»Aber diese sind kostbar! Hier«, er hielt den Strauß Franziska hin, »hundert Rupien zum ersten.«
»Du verstehst Preise zu machen«, lachte diese.
»Ich könnte noch einmal so viel fordern, und mancher würde es zahlen. Diese Rosen hat Lord Canning mit eigenen Händen gebrochen und gebunden.«
Der aufgeweckte Knabe hatte sich nicht getäuscht, jetzt wurde der Strauß mit ganz anderen Augen betrachtet als zuvor. Otto musste erzählen, wie er zu dem Geschenk käme.
»Als ich am Garten des Gouvernements-Palastes vorbeikam«, erzählte er mit der größten Offenheit, »sah ich dicht am Gitter einen Apfel liegen — von den Bäumen, die sich Lord Canning aus Tirol hat kommen lassen. Ich nahm einen Stock und angelte danach, denn so etwas ist hier selten...«
»Das war nicht schön von dir«, sagte der Vater.
»Er hatte schon Flecken«, entschuldigte sich Otto. Ich konnte ihn bald mit der Hand erreichen, als zu meinem Schrecken plötzlich Lord Canning herankam. Glücklicherweise lag neben dem Apfel eine Rose, und nun tat ich, als angelte ich nach dieser. Aber ich glaube, er durchschaute mich, denn er lächelte so merkwürdig. Dann fragte er mich, ob ich Rosen gern hätte, ich musste natürlich ja sagen — obgleich mir an den Dingern gar nichts liegt — und da pflückte er diese hier ab und band sie selbst zusammen. Ich sollte sie mit einem Gruß nach Hause bringen und dann — ich habe mich ganz furchtbar geschämt — gab er mir den abgefallenen Apfel und noch einige andere. Da sind die Rosen, die Äpfel habe ich natürlich nicht mehr, die sind schon sicher aufgehoben.«
»Wie aufmerksam!«, sagte Frau Reihenfels und roch an dem Strauß. »Lord Canning hat mich schon einmal mit einem Strauß bedacht, und zwar mit den ersten Blumen, die nach der Regenzeit in seinem Garten blühten. Hier, Franziska, steck ihn in eine Vase und setz ihn auf meinen Nähtisch.«
Allem Anschein nach schien Frau Reihenfels überzeugt, dass der Strauß nur für sie gebrochen sei.
Dadurch kam das Gespräch wieder auf den Generalgouverneur.
»Wer führt in Delhi eigentlich den Namen Duchesse?«, fragte Oskar einmal dazwischen. »Den wahren Namen habe ich gar nicht zu hören bekommen.«
Als wäre ein Misston erschollen, so verstummte das lebhafte Gespräch plötzlich.
»Diesen Beinamen führt eine Italienerin, eine gewisse Signora Rosa Bellani, vielleicht mit Recht. Sie wohnt deiner neuen Behausung vis-à-vis«, entgegnete der Vater; »es wird in unserer Familie vermieden, von ihr zu sprechen, Oskar.«
Dieser machte ein erstauntes Gesicht.
»Wie, sie genießt keinen guten Ruf?«
»Keinen besonderen wenigstens. Junge Leute brauchen sich nicht gerade zu schämen, in ihrem Hause zu verkehren, doch nach unseren soliden, deutschen Ansichten würde ich mir wahrscheinlich ihren Besuch verbitten.«
»Das finde ich sonderbar. Ich erneuerte am Bahnhof die Bekanntschaft mit zwei mir befreundeten Herren, und als die Equipage des Generalgouverneurs vorüberfuhr, tauschten sie unter sich die Bemerkung aus, dass Lord Canning jedenfalls der Duchesse einen Besuch abstatten wolle. Er interessiere sich sehr für sie, er hätte vielleicht Absichten...«
Oskar brach ab. Aller Augen waren wie erschreckt auf ihn geheftet, es war plötzlich so unheimlich still geworden. Mit einem Male stand Franziska auf, ihr Gesicht war blass, aber ihre Augen sprühten Feuer.
»Das ist eine schamlose Behauptung!«, rief sie mit starker Stimme. »Ich bitte dich um die Namen dieser beiden Herren, Oskar, damit sie zur Rechenschaft gezogen werden können.«
»Aber, Franziska«, begütigte die Mutter die Aufgeregte, »was veranlasst dich denn, so Partei für Lord Canning zu nehmen?«
»Sie hat recht«, nahm aber da auch der Vater für seine Tochter das Wort; »für eine ehrenwerte Person muss man stets, wenn sie abwesend ist, mit aller Kraft eintreten, gilt es ihre Ehre gegen Verleumdung zu wahren, gleichgültig, ob es Freund oder Feind ist, um wie viel mehr, wenn es sich um Lord Canning handelt! Doch beruhige dich, die Sache läuft jedenfalls auf einen Irrtum hinaus.«
Er klärte Oskar darüber auf, dass auf Veranlassung des Gouverneurs bei der Duchesse einst Haussuchung vorgenommen wurde, weil er sie für eine französische Spionin hielt. Als sich der Verdacht als unbegründet erwies, war er ihr zur Rechtfertigung einen Besuch schuldig, und er konnte es nicht bei dem einen bewenden lassen, sondern musste von Zeit zu Zeit wieder vorsprechen.
Damit war die Sache beigelegt.
»Übrigens ist allgemein bekannt«, sagte dann noch Frau Reihenfels, »dass Lord Canning mit der Schwester des Captain Atkins so gut wie verlobt ist; wir erwarten jeden Tag die Publikation. Die Susan musst du kennen lernen Oskar, es ist ein reizendes Mädchen. Sie ist eine Freundin Franziskas und kommt häufig zu uns. Merkwürdig ist nur, mit welcher Entschiedenheit sie ihr Verhältnis zu Lord Canning leugnet; als ich einmal eine kleine Anspielung machte, wurde sie förmlich entrüstet. Nun, sie will uns jedenfalls eine Überraschung bereiten, aber uns alte Frauen kann sie doch nicht täuschen.«
Plötzlich brach Otto in lautes Lachen aus und begann in der Stube herumzutanzen.
»O, was seid ihr doch alle klug«, lachte er; »wenn ihr das alles wüsstet, was ich weiß!«
»Wenn du nur in der Schule etwas mehr wüsstest«, brachte ihn die Mutter zum Schweigen, die seinen Worten keine andere Bedeutung unterschob, als eben die, sich bedeutend zu machen.
Nachdem Oskar sich entfernt hatte, suchte auch Herr Neubert schnell einen Grund zum Abschied, denn als einziger junger Mann zwischen drei Damen fühlte er sich wie von Gott verlassen.
Wie beim Eintritt, so reichte er auch jetzt jedem schüchtern die Hand, bedankte sich bei jedem Einzelnen und schaute ihn wie abbittend an, nur bei Franziska, die ihn doch bedient hatte, fand er kein Wort des Dankes und senkte vor ihr das Auge.
Am Abend also sollte er Franziska und Käthchen zum Konzert abholen.
Als Neubert schon die Treppe erreicht haben musste, entdeckte Otto seinen stehengebliebenen Stock. Schnell wollte er ihm damit nacheilen, doch schneller noch nahm ihn Franziska dem Bruder aus der Hand und lief hinaus.
Käthchen sah die Mutter mit einem Ausdruck an, dessen nur ein junges Mädchen fähig ist, die Mutter wieder lächelte und warf dem Vater einen bedeutsamen Blick zu, der aber von diesem unbeachtet blieb.
»Das ist eigentlich unpassend«, sagte dann Käthchen feierlich.
»Ja, dass du immer klüger sein willst als ich, und dass du noch nicht daran denkst, das Kaffeegeschirr hinauszuräumen«, entgegnete die Mutter, »und dass du vorhin über Herrn Neubert lachtest, war auch nicht eben passend.«
»Es war aber auch zu komisch.«
Dem Vorfall wurde jedoch ein ganz falscher Grund untergeschoben.
Franziska erreichte Neubert auf der obersten Treppenstufe. Seine Verlegenheit stieg wieder auf, als ihm Franziska den Stock gab, sie wuchs, als Franziska vor ihm stehen blieb und ihm die Hand reichte.
»Herr Neubert«, sagte sie mit gedrückter Stimme, »ich möchte Sie nicht kränken!«
»O, Fräulein.«
»Verzeihen Sie mir, wenn ich heute Abend keinen Gebrauch von Ihrer freundlichen Einladung mache. Ich danke Ihnen trotzdem von ganzem Herzen für dieselbe.«
Neubert erschrak, wunderte sich aber nicht; er fühlte nur den Druck der kleinen kräftigen Hand.
»Es soll mir sehr angenehm sein, wenn Sie nicht kommen«, murmelte er in seiner Unbeholfenheit und ging.
Franziska lachte nicht über diese sonderbaren Worte, die eigentlich eine Beleidigung enthielten, wehmutsvoll schaute sie dem Davongehenden nach. Sie hatte keinen Grund dazu, denn Neubert schmerzte ihre Absage nicht, weil diese ihm gar nicht zum Bewusstsein gekommen war; er fühlte nur den warmen Druck ihrer Hand.
In einem Nebenzimmer hatte dann Franziska eine leise Unterredung mit Otto. Der kleine Bruder verzog zwar erst schmollend den Mund, doch Franziska flüsterte ihm etwas ins Ohr, und gleich hellte sich sein Gesicht wieder auf.
»Na ja«, sagte er, »aber gleich zum Major machen, sonst tu ich's nicht.«
»Du willst zu hoch hinaus«, lächelte Franziska, »Oberleutnant ist auch genug.«
»Leutnant mag ich nicht werden.«
»Warum denn nicht?«
»Dann muss ich doch schreiben. Otto Reihenfels, Leutnant, und bei dem Wort Leutnant verschreib' ich mich allemal.«
Franziska ging in ihr Schlafzimmer, Otto sprang zur Mutter.
»Nimm mich heute Abend mit ins Konzert«, bat er.
»Ach, was verstehst du denn davon?«
»Jedenfalls ebensoviel wie mancher andere. Die meisten gehen doch nur hin, um die russische Fürstin zu sehen.«
Der Vater, der diese Worte seines Sohnes gehört hatte, lachte auf.
»Und um ihre neuen Toiletten zu zeigen«, fügte er hinzu.
»Du kannst die Musik auch hier hören«, sagte die Mutter.
»Aber in der Nähe klingt es lauter.«
»Nein, du gehst nicht. Was denkst du wohl, ein Billett kostet fünf Rupien!«
»Die Franziska kann doch nicht gehen, sie ist ja krank.«
»Krank?«, rief die Mutter erschrocken.
»Natürlich! Hast du ihr denn das vorhin nicht angesehen? Ich dachte jeden Augenblick, der Kopf müsste ihr auseinanderplatzen. Ich glaube, sie liegt schon auf dem Bett.«
Die besorgte Mutter eilte in das Zimmer der Tochter und fand dieselbe, wie sie sich eben einen nassen Umschlag um den Kopf machte. Es war gut, dass Franziska das Kommen der Mutter gehört hatte, so konnte noch schnell ihr Mund, der eben ein fröhliches Liedchen geträllert hatte, verstummen.
»Du bist krank, Kind?«
»Kopfweh, Mutter!«, seufzte Franziska.
»Wenn es nur bis zum Abend aufgehört hat, die laute Musik —«
»Ich hoffe so.«
»Herr Neubert hat sich so auf deine Gesellschaft gefreut, er hat die Billetts nur deinetwegen gekauft.«
»Ich bedaure, dass er sich meinetwegen nun einschränken muss.«
»Herr Neubert ist ein guter Mensch.«
»Ein sehr, sehr guter Mensch. Aber, Mutter«, Franziska trat schnell vor die alte Frau, ergriff ihre beiden Hände und sah sie bittend an, »du bist in einem falschen Glauben.«
»Wieso denn, Kind?«
»Du glaubst, ich liebe ihn. Das ist nicht der Fall, und ich bitte dich nur um das eine: Mach diesem Mann, den ich hochachte, keine Hoffnungen, die sich nie erfüllen werden. Ich liebe ihn nicht.«
Die gute Frau Reihenfels ließ sich jetzt nicht weiter mit der kranken Tochter in ein Gespräch ein; aber ihr Lächeln, als sie die Stube verließ, sagte so viel wie: Was nicht ist, kann ja noch werden, lernt euch nur erst näher kennen. Ich weiß das alles aus eigener Erfahrung, habe es selbst durchgemacht. Wenn ich dem schüchternen Neubert nur etwas mehr Courage beibringen könnte!
Dass ihre Tochter einen anderen liebe, darauf kam die gute Mutter gar nicht. Wen sollte Franziska liebgewonnen haben, ohne dass es den scharfen Augen der Mutter entgangen wäre, Franziska, die den offenen Charakter des Vaters besaß!
Am Abend kam Neubert pünktlich; mit teilnahmsvoller Miene vernahm er von Franziskas Kopfschmerzen, und er hinterließ beim Fortgehen so viele Wünsche zur Besserung, dass es Franziska hinterher ordentlich leid tat, die Krankheit simuliert zu haben.
Er, Käthchen und Otto begaben sich nach dem Palmengarten, einem nicht weit abgelegenen öffentlichen Garten, in welchem auf Befehl des Generalgouverneurs ein Konzert zu Ehren einer russischen Fürstin, zur kaiserlichen Familie gehörig, stattfand.
Friedrich Reihenfels war ein Frühaufsteher und ging infolgedessen auch zeitig zu Bett, und da nach seinen Gewohnheiten das ganze Hauswesen geregelt wurde, so musste zu einer bestimmten, frühen Stunde die tiefste Ruhe herrschen, das heißt, alles musste zu Bett gehen.
Nur ein alter indischer Diener blieb auf, den spät Heimkehrenden die Tür zu öffnen, und mit ihm wachte seine Frau.
Alles war still, nur ein Heimchen zirpte seine eintönige und doch so trauliche Weise. Die Lichter waren verlöscht bis auf das des wachenden Inders. Der alte Mann hockte in seinem Stübchen auf einem Teppich, ein dickes Buch vor sich, und ließ den Finger langsam über die krausen Buchstaben gleiten. Er las die alten Traditionen und Prophezeiungen seines Volkes, wie aus Indien alle Menschen stammen und wie die Inder einst noch die Erde beherrschen werden.
Ersteres ist wahr, letzteres ist die Ansicht hervorragender Gelehrter, Männer, welche die Weltgeschichte studiert haben und aus ihr Schlüsse ziehen können.
Sein Weib war nicht im Zimmer, es hockte auf dem Korridor und blickte in das Dunkel.
Da kam ein geräuschloser Schritt die Treppe herab; vor der sich erhebenden Alten stand eine schlanke, in dunkle, indische Gewänder gehüllte Mädchengestalt. Unter dem Kopftuch fielen goldene Zöpfe auf den Rücken herab, das einzige Leuchtende in der Finsternis.
»Bist du's, Zaline?«, flüsterte die Mädchenstimme kaum hörbar.
»Ich bin's und bin bereit.«
»Du verrätst mich nicht, nicht wahr?«
»Meine Augen sollen die morgende Sonne nicht wiedersehen, wenn ich nicht das tue, was du wünschest, denn ich liebe dich.«
Ein kurzer Gang durch den Korridor, ein Schlüssel wurde unhörbar ins Schloss gesteckt, eine Hintertür öffnete sich, und das Mädchen stand im Freien. Zaline schloss wieder die Tür.
Es war eine wundervolle Nacht, eine Nacht, wie nur Indien sie zu zaubern vermag, eine Nacht, von der Natur geschaffen zum Kosen und Küssen.
Augenblicklich war es völlig finster, denn der hochstehende Vollmond wurde von einer Wolke bedeckt; nur Leuchtkäfer verbreiteten an einigen Stellen ein schwaches, phosphoreszierendes Licht. Sie wiegten sich auf Blumen und krochen durch die Büsche des Gartens, der ringsum die Villa umgab.
Kein Lufthauch regte sich, allüberall herrschte die tiefste Stille, der göttlichste Frieden. Unbeweglich stand das Mädchen da, die Hand auf den Busen gepresst, und lauschte. Ihr Ohr vernahm keinen Laut.
Da ertönten in weiter Ferne die leisen, und doch so mächtigen Klänge eines Orchesters; wie eine Musik aus dem himmlischen Jenseits drangen sie herüber, wunderbare, tiefe, ergreifende Töne, das Herz mit Wehmut und Jauchzen zugleich erfüllend.
Es war der Brautmarsch von Mozart, er gab der regungslosen Gestalt das Leben wieder. Mit flüchtigem Schritt, der Wege und Stege dieses Gartens auch bei Nacht fand, eilte sie einer Laube zu, aus der eine hohe, dunkle Gestalt trat.
»Jonny!«(*), flüsterte das Mädchen leise mit unterdrücktem Jauchzen.
(*) Jonny ist der Kosename für John, auf deutsch Johannes.
»Franziska!«, erklang es ebenso zurück.
Dicht aneinandergeschmiegt, dicht verschlungen verschwanden beide in der Laube, und kein Wort ward weiter gehört, nur ein Geräusch, als würden Küsse gewechselt, die beste Verständigung zwischen zwei Liebenden.

Eine Viertelstunde verging, und noch immer ertönte kein Wort. Die Musik, bald leise und süß wie Engelsstimmen, bald weinend und dann wieder tröstend, bald mächtig wie rollender Donner, in dem Gott zürnt, begleitete das Schweigen. Es waren gottbegnadete Meister gewesen, welche diese Töne für die Ewigkeit geschaffen hatten.
Schließlich wurde selbst der gute, treue Mond, der so manches sieht, was zwischen liebenden Paaren vorgeht, und doch immer schweigt, auch er wurde neugierig und guckte hinter der Wolke hervor; seine Strahlen fanden den Weg durch das Blätterdach, sie beleuchteten zwei sitzende, eng verschlungene Gestalten, die sich von Mund zu Mund Leben einzuhauchen schienen, reines, neues Leben, verschmolzen in einem Körper, nicht aber die Glut leidenschaftlicher Liebe.
Deshalb fuhren sie auch nicht erschrocken auseinander, als müsste sich ihre Liebe des Lichtes schämen, sondern sie benutzten das Licht, um sich glückselig lächelnd anzusehen. Zwischen zwei sich innig Liebenden findet eine Sympathie der Seelen statt, die wirklich erklärt, was sonst kein menschliches Gehirn kann. Der eine denkt, der andere hört zu, und findet das Denken Worte, so kann das Gespräch da fortgesetzt werden, wo das Denken aufgehört hat, ohne Störung, ohne Frage.
»Ich bedaure ihn so sehr«, flüsterte das Mädchen.
»Sprich offen mit ihm, ich bitte dich«, entgegnete die tiefe, wohltönende Männerstimme.
»Ich kann nicht, jetzt noch nicht.«
Wieder trat eine lange Pause ein, die beiden lauschten der Musik.
»Das ist schön«, sagte das Mädchen.
»Es ist für dich, nur für dich.«
»Sie wird dich vermissen.«
»Mag sie es, ich bin bei dir.«
»Wie gelangtest du in den Garten, Jonny? Ach, ich hatte solche Angst, dass du nicht kämst! Seit einmal Eingeborene hier übernachtet haben, überzeugt sich Vater jeden Abend selbst, ob die Gartentür geschlossen ist, und den Gitterstab hat er heute auch einsetzen lassen. Wie kamst du herein?«
Der Mann lachte leise.
»Wie der Dieb in der Nacht bin ich hereingestiegen, ich nahm meinen Weg über das Gitter.«
»Über das hohe, spitze Gitter? Jonny, wenn dir dabei etwas zugestoßen wäre!«
»Und wenn es himmelhoch wäre, und wenn seine Spitzen glühend wären, ich würde es doch erklimmen und den Weg zu dir finden, Franziska.«
Er zog sie an sich. Dabei klirrte es leise.
»Was war das?«
»Mein Degen.«
»Du bist in Uniform?«
»Sogar in großer.«
»O, lass mich dich so einmal in der Nähe sehen!«
Der Mann stand auf. Der Mond wurde noch neugieriger, er leuchtete noch stärker und beschien mit vollem Glanz den Mann in Schlapphut und langem, grauem Mantel.
»Wird Franzys Liebe nicht an Zärtlichkeit verlieren, wenn sie mich anders sieht als sonst?«
»Nicht mehr, jetzt freue ich mich an deinem Glanz.«
Hut und Mantel fielen; vor dem Mädchen stand ein schöner, hoheitsvoller Mann in der glänzenden Generalsuniform der englischen Gardedragoner, an der Seite den schweren Pallasch, die Brust mit Orden bedeckt, um den Hals eine goldene Kette.
Wohl war das Mädchen stumm vor Staunen, doch nur freudige Bewunderung, keine Scheu sprach aus ihren Augen. Dann stand sie auf und legte beide Hände auf seine Schultern, wozu sie sich emporrecken musste.
»Bist du denn wirklich mein Geliebter?«
»Ich bin's und werde es immer bleiben!«
»Und ich?«
»Meine Geliebte, jetzt und immerdar, als Braut und als Weib.«
»Weißt du, was der Vater sagte? Er ist klug und weitsichtig.«
»Ich weiß es und höre deshalb gern auf ihn. Was sagte er?«
»In absehbarer Zeit würde die Königin von England die Macht der ostindischen Kompanie beschränken und sich selbst zur Kaiserin von Indien ernennen.«
»Diese Zeit liegt nicht mehr fern.«
»Dann gibt es keinen Gouverneur mehr, der für Englands Interessen wacht.«
»Nein, ein Vizekönig muss ernannt werden.«
»Und dieser würdest du.«
»Wenn ich noch lebe und Gott nicht anders will, werde ich es sein.«
»Und ich?«, erklang es abermals, aber ängstlich.
»Du würdest den Thron mit mir teilen!«
»Um Gott, Jonny, ich — ich könnte es nicht!«
Der Offizier griff nach Hut und Mantel.
»Ich fürchtete es, du bist ein Mensch, und lässt dich von Gold und Ehre verblenden.«
Er konnte sich nicht den Mantel umlegen, denn das Mädchen hinderte ihn daran.
»Nein, nein, Jonny, das waren törichte Worte. Ersteigst du den Thron, so werde ich dir folgen, und solltest du die armseligste Hütte beziehen, so werde ich mit dir einziehen und sie dir zum Palast machen.«
Sie setzte sich und zog ihn auf die Bank.
»Sag, Jonny, bist du wirklich 42 Jahre alt?«
»Nur meinem Geburtsschein nach.«
»Wie meinst du das?«
»Im Herzen bin ich noch ein Jüngling, und deine Liebe macht mich immer jünger. Dies ist der Unterschied der reinen und der anderen Liebe. Verstehst du das?«
»Ich glaube.«
»Würde ich wohl sonst das Gitter übersteigen, ich, dem sich alle Türen öffnen?«
»Sie ist so schön, die heimliche Liebe!«
Er presste sie an sich.
»Die Orden drücken mich!«
»Auch mich manchmal.«
Sie nahm die goldene Kette in die Hand.
»Man sagt, diese Ehrenzeichen seien trotz ihres Wertes oft Sklavenketten und schwer zu tragen.«
»Auch diese ist das Zeichen meiner Sklaverei, doch sie fesselt mich an meine Königin.«
»Du liebtest sie?«
»Ich liebte sie und liebe sie noch immer. Ich liebte sie als Kind, ich liebte sie als Weib, und jetzt liebe ich sie als meine Königin. Weißt du, was ich damit sagen will, Franzy?«
»In deiner Nähe verstehe ich alles.«
»Und fragst nicht mehr?«
»Nein, denn du liebst mich, wie ich dich liebe.«
Sie spielte mit dem Pallasch und versuchte vergebens, den Stahl aus der Scheide zu ziehen.
»Der ist eingerostet.«
»Weil Friede ist.«
»Das darf doch nicht sein, auch nicht im Frieden.«
»Wenn der Friede bedroht ist, wird auch der Stahl nicht mehr verrostet sein, sondern funkeln!«
Lächelnd zog er ihn ohne jede Anstrengung aus der Scheide; blitzend wurden die Mondstrahlen von der Waffe reflektiert.
»Du bist so stark! Ist dieses Schwert dein Eigentum?«
»Es gehört der Königin, wie alles, was ich habe. Sie gab es mir, für ihr Recht damit zu kämpfen, ich ziehe es nur für sie — und für dich!«
Sie betrachtete und betastete mit der harmlosen Neugier eines Kindes die glänzenden Orden an der Brust.
»Ist dies der höchste Orden, der mit den vielen Brillanten?«
»Nein. Ich kenne jemanden, den ich verachte, und er besitzt ihn auch.«
»Welches ist der höchste?«
Der Offizier machte einen ganz kleinen ab, der den anderen gegenüber verschwand, und ließ ihn in seiner Hand im Mondlicht glänzen.
»Dies ist der höchste Orden.«
»Wie, das kleine, unscheinbare Ding?«
»Er ist der höchste Orden.«
»Wofür hast du ihn erhalten? Von welchem Lande oder Fürsten? Ich kann gar nicht glauben, dass dies der wertvollste deiner Orden sein soll.«
Sinnend ruhten die Augen des Mannes auf dem kleinen Silberstück.
»Höre mich an, Franzy, ich will dir einen Traum erzählen, den ich träumte, als ich vor einem halben Jahre aus England zurückkam, als ich dich noch nicht kannte«, begann er dann, während die ferne Musik eine Symphonie spielte, weiche Töne, dann wieder himmelanschwellend. »Ich kehrte zurück, reich mit Ehren beladen, mit Auszeichnungen und Orden überhäuft. Ja, Franzy, ich war stolz, denn ich wusste, ich hatte alles meinen Verdiensten und meiner Treue zu verdanken. Da träumte mir eines Nachts, ich wäre gestorben. Donnerndes Sturmgebraus erscholl, es fasste mich, und mit unwiderstehlicher Gewalt wurde ich durch das Weltall geschleudert. Dann sah ich mich auf einer weiten, weiten Flur stehen, überfüllt mit Millionen von Menschen; Heulen und Jammergeschrei ertönten; aber mächtiger noch ließ sich eine dröhnende, furchtbare Stimme vernehmen, die aus einer zusammengeballten Wolke erscholl. Die ganze Atmosphäre war im Kampf, der Sturm heulte, aus der Wolke zuckten Blitze, und der Donner war Gottes Stimme. O, Franzy, es war schrecklich, es war das jüngste Gericht!«
Ängstlich hielt das Mädchen die Hand des Sprechers umklammert und wagte kaum zu atmen.
»Vor der donnernden Wolke, deren Stimme ich nicht verstand, stand ein Erzengel mit flammendem Schwert und schied die heranziehende Menge in zwei Hälften, links zogen die Verdammten, deren Jammergeschrei die Luft erfüllte, in einen endlosen Raum, aus denen gelbe Schwefelflammen ihnen entgegenschlugen, rechts verschwanden die Gottseligen hinter einer weißen Wolke, hinter welcher himmlische Engelsmusik ertönte. Ach, Franzy, es waren sehr, sehr wenige, die rechts vorbeizogen, und meist waren es solche, die auf Erden verachtet wurden: In Lumpen gehüllt, verhungert, mit ekelhaften Krankheiten geschlagen. Jetzt aber jubilierte ihr Mund!«
Der Mann schwieg wieder, von der Erinnerung überwältigt. Seine Hand war plötzlich ganz kalt geworden
»Und du?«, fragte das Mädchen leise.
»Ich? Ich war so wohlgemut, ich fürchtete mich nicht, ich wusste, dass mein Weg rechts gehen würde. Hatte ich doch Gott jeden Morgen und jeden Abend gebeten, mich sein Kind zu nennen, und war ich mir doch keiner verdammenswerten Sünde bewusst. Da plötzlich stand ich vor dem Erzengel, so wie ich jetzt bin, in Generalsuniform, den Pallasch an der Seite, auf dem Kopf den goldenen Helm mit fliegendem Drachen und die Brust voll Orden. Selbstbewusst blickte ich den Erzengel an. Da verstand ich mit einem Male die Donnerstimme in der Wolke.
›Wer bist du?‹, fragte sie.
›Ein Mensch, der dich angebetet und deine Gebote befolgt hat.‹
›Ich kenne dich nicht, fort in die ewige Verdammnis!‹, zürnte der Donner.
Da vernahm ich in der Wolke eine andere, weiche, milde Stimme, und sie bat für mich um Erbarmen, um seines für mich vergossenen Blutes willen. Ich sollte mich wenigstens verteidigen können.
›Was hast du auf Erden getan und nicht getan?‹, fragte der Donner noch einmal.
Ich richtete mich stolz auf und begann:
Ich habe keine Sünde begangen, die des Verdammens wert ist. Ich habe deine Gebote gehalten, dich als einzigen Gott verehrt, nie betrogen, nie gestohlen, keinen Menschen getötet. Darum war ich auf Erden hochgeehrt, man überschüttete mich mit Anerkennungen. Sieh, diese Orden, sieh, diese Kette, ich erhielt sie von meiner Königin, weil sie auf meine Treue bauen konnte; sie wusste, dass sie über mein Schwert befehlen könne, nur für sie hätte ich es gezogen, und wäre auch die ganze Welt gegen mich zum Kampf angestürmt, ich...
›Du Narr‹, unterbrach mich die Donnerstimme, ›du aufgeblasener Narr, und du willst nicht gemordet haben?‹
›Nein.‹
›Ich habe euch gesagt, ihr sollt nicht töten, auch nicht eure Feinde, sondern selbst diese lieben, und um euch das ans Herz zu legen, habe ich meinen eigenen Sohn geopfert. Du Narr aber brüstest dich noch damit, für deine Königin gegen Feinde zu ziehen, mit dem Schwert die zu töten, die ich geschaffen habe? Schweig! Dass du es nicht getan hast, gilt nichts, du hättest es getan, es fehlte dir nur an Gelegenheit, der Wille gilt. Hast du nicht selbst Todesurteile unterschrieben? Und du willst nicht getötet, gemordet haben? Habe ich euch nicht durch meinen Sohn klar und deutlich gesagt, dass ihr nicht töten sollt?‹
Franzy, ich kam mir mit einem Male in meiner Generalsuniform so unendlich erbärmlich vor. Ja, ich war ein Mörder. Da hörte ich wieder die sanfte Stimme des Sohnes, er bat nochmals für mich um Gnade, er wollte für mich eintreten. In der Wolke sah ich eine feurige Waage, links in der Schale ein ungeheurer Stapel, meine Sünden, in der rechten einige wenige gute Werke, etwas Elternliebe, einige Almosen — sehr wenig. Hoch flatterte die rechte Schale in der Luft. Es kam noch das Blut des Erlösers, für mich vergossen, hinzu; es vermochte das Gleichgewicht nicht herzustellen.
›Gewogen und zu leicht befunden!‹, rollte der Donner. ›Fort in die Verdammnis!‹
Der Erzengel hauchte mich mit glühendem Atem an, plötzlich flogen alle meine Orden, meine goldenen Tressen, alles, alles fort, meine Kleidung verwandelte sich in Fetzen. Da deutete der Erzengel erstaunt auf meine Brust, ich blickte hin und sah noch diesen kleinen, unscheinbaren Orden daran heften; er hatte dem Gluthauch widerstanden. Bescheiden wollte ich ihn entfernen.
›Was ist das?‹, fragte die Stimme.
›O, nichts, Herr‹, entgegnete ich.
›Lege ihn in die Schale.‹
»Ich tat's, und, Franziska, die Schale der guten Taten sank, die der Sünden wurde empor geschnellt. Da zerriss der himmlische Vorhang, ein Mädchen mit Engelsflügeln erschien und winkte mir, einzugehen zu den himmlischen Freuden.«
Beide sprachen lange kein Wort. Der Offizier stützte den Arm auf das Schwertgefäß und bedeckte sein Gesicht mit der freien Hand.
»Was für ein Orden ist das nun?«, fragte sie dann.
Sie wiederholte dieselbe Frage nochmals vergeblich.
»Wie, Jonny, du weinst?«
»Ist dies eine Schande? Ja, ich weine; die Erinnerung hat mich überwältigt, und ich freue mich, dass ich noch weinen kann. So besitze ich noch ein Herz in der Brust.«
»Willst du mir nicht sagen, was der kleine Orden zu bedeuten hat?«
»Es ist eine Rettungsmedaille; so unscheinbar sie ist, ist sie doch der höchste Orden, am schwersten zu erwerben und der einzige, der auch im Himmel gilt.«
»So hast du einen Menschen gerettet?«
»Ja, aus Todesnot.«
»Erzähle, bitte!«
Sie umklammerte seinen Arm, und er begann:
»Es war am Ganges in einer kleinen Stadt. Wochenlang hatte es geregnet, die Bäche stürzten als Ströme herab und hatten den Fluss in ein flutendes Meer verwandelt. Ich, damals Gouverneur von Oudh, befand mich auf einer Inspektionsreise dort. Am Nachmittag entstand ein Gewitter, begleitet von einem furchtbaren Sturm, und der meilenbreite Ganges warf Wellen wie das Meer auf. Ein Blitz schlug in die Stadt; die hölzernen Häuser standen bald an allen Ecken in hellen Flammen. Dicht am Ufer, von den Fluten fast schon berührt, erhob sich ein Häuschen. Es fing auch Feuer. Da kam eine neue Windsbraut angebraust, hob das brennende Holzhäuschen auf und warf es in den Strom.
Im Nu trugen Sturm und Wogen es in die Mitte des Stromes. Auf dem Dache sah man ein Mädchen verzweifelt die Hände ringen. Es war verloren; unter ihr Feuer, neben ihr Wogen, aus denen sich überall hungrige Krokodilsköpfe reckten und mit offenem Rachen ihr Opfer erwarteten. Am Ufer rannte jammernd ein Mann auf und ab, mit Käppchen und Kaftan angetan, rief den Gott seiner Väter an, zerriss den schmutzigen Rock und versprach dem alle seine zusammengeschacherten Schätze, der seine Tochter rette, er versprach sich ihm selbst, sein Leben. Niemand trat vor, den kleinen Nachen zu besteigen. Es war wohl leicht, das brennende, schwimmende Haus zu erreichen, aber das Ufer wiederzuerlangen schien unmöglich. Ja, wäre der Vater ein Mensch gewesen, aber er war Jude, ein schmutziger, geiziger Jude, und seine Tochter eine verachtete Jüdin. So wagte ich es denn in Gottes Namen, und es gelang. Ich steuerte das Boot an das Haus, entriss das Mädchen dem Feuer, dem Wasser und den Zähnen der Krokodile. Gott war mir gnädig, er gebot dem Sturme Einhalt, ich gelangte ans Ufer zurück, allerdings erst nach vielen, vielen Stunden, fast an der Mündung des Ganges, und das Mädchen und ich waren gerettet.«
»Wurdest du nicht im Triumph empfangen?«
»Nein, die Stelle, wo ich landete, war einsam. Ich brachte das Mädchen zu Menschen und entzog mich dem Danke.«
»Du warst doch erkannt worden?«
»Nur von einem einzigen Menschen, einem Engländer. Er berichtete es nach Hause, und ein halbes Jahr später empfing ich aus der Hand der Königin diese Medaille.«
»Der Vater und die Tochter wissen nicht, wer der Retter ist?«
»Nein, ich habe sie nie wiedergesehen und sie mich nicht.«
»Hast du wenigstens den Namen des Juden erfahren?«
»Er hieß Sedrack.«
»Und seine Tochter?«
»Mirja.«
Franziska schmiegte sich an ihn und küsste ihn.
»Du schöner, edler, starker Mann, du hättest noch ganz anders belohnt werden sollen.«
»Noch mehr?«
»Ja, man hätte dich jauchzend auf die Schultern heben und dich triumphierend dem Volk zeigen sollen, rufend: Seht, das ist der Mann, der sein Leben wagte, einen Menschen zu retten, den ihr als solchen nicht anerkennen wollt. Nehmt ihn euch zum Beispiel!«
»Ich bin auch noch viel mehr belohnt worden.«
»Wodurch?«
»Durch dich, mein Lieb!«
Der rücksichtsvolle Mond hielt es für schicklich, sich jetzt wieder hinter einer Wolke zu verstecken, seine Anwesenheit hätte die beiden Liebenden doch etwas stören können.
Er wartete lange, ob sich ihre Stimmen vielleicht wieder vernehmen ließen; als er aber innerhalb einer halben Stunde gar nichts hörte als nur die klassischen Weisen des Orchesters, begann es ihm langweilig zu werden, und er beschloss, gar nicht mehr zu erscheinen.
Auch die beiden in der Laube lauschten, nachdem sie ihre Liebe in Küssen ausgedrückt hatten, der Musik.
Plötzlich zuckte das Mädchen zusammen.
»Was erschrickst du?«
»Die russische Fürstin wird dich vermissen.«
»Ich habe mich wegen dringender Geschäfte entschuldigt. Mein Helm und die Sporen liegen in einem Zimmer neben dem Konzertsaal, kurz vor dem Ende rüste ich mich wieder und gebe dann der Fürstin das Geleit.«
»O, du Heuchler!«
»Wieso? Ist es mir nicht wichtiger, bei dir, meine Liebe, zu sein, als dem faden Geschwätz der Russin zuzuhören, womit sie mir auch noch das Konzert verdirbt?«
»Du gabst es ihretwegen?«
»Dem Scheine nach, in Wirklichkeit erklingen diese Melodien nur für dich.«
»Ich kann deine Liebe zu mir gar nicht begreifen, ich, die ich schon für das tägliche Brot gearbeitet habe.«
»Wir alle arbeiten für das tägliche Brot.«
»Aber immerhin, du vernachlässigst eine Fürstin, um bei mir zu sein.«
»Sollte ich nicht gerade heute kommen, da ich morgen verreise?«
»Ach, wärest du nur erst zurück!«
»Es sind nur einige Tage, und ich stehe in Gottes Hand.«
»Das Reisen in Indien ist so gefährlich!«
»In England findet der oft seinen Tod auf der Eisenbahn, der alle Gefahren der Dschungeln überstanden hat.«
»Auch wir gehen bald nach London.«
»Alle Ozeane der Welt sollen unsere Liebe nicht trennen. Doch vor eurer Abreise spreche ich mit deinem Vater; erst will ich seinen Segen haben, ehe ich dich ziehen lasse.«
»Tu das, ich bitte dich! Ach, Jonny, der arme Neubert!«
»Sprich mit ihm, es ist das beste!«
»Ich wage es nicht; ich glaube, ich gebe ihm den Todesstoß. Seine Liebe zu mir ist so rührend, so heilig.«
»Es muss sein, er oder ich!«
»Jonny, wie kannst du so sprechen? Du, nur du bist es, den ich liebe! Ich fühle mich zu Neubert hingezogen, seine Liebe soll mir immer heilig bleiben. Verstehst du mich?«
»Ich weiß, es ist sehr traurig! Was wird er sagen, wenn er erfährt, dass du mich liebst?«
»Er wird sich freuen, wenn er weiß, dass du mich wiederliebst, und dass ich in deiner Liebe glücklich bin.«
»Das ist der wahre Edelmut eines Mannes: Sich selbst beherrschen, wenn es das Glück eines anderen gilt. Führe mich Gott nicht in Versuchung, dass ich meine Charakterstärke darin selbst probieren muss.«
»Nicht durch mich. Ich bin die Deine und bleibe es ewig. Ach, Jonny, man hat dich wieder verleumdet.«
»Wegen der Duchesse?«
»Ja.«
»Was sagtest du?«
»Ich trat für dich ein, und der Vater stimmte mir bei. Dadurch fiel es nicht auf. Aber nicht wahr, Jonny, du gehst nicht mehr zu diesem Weibe?«
»Es war mir stets unangenehm, sie zu besuchen, doch ich musste es tun, ich war es ihr schuldig. Aber nun ist meine Pflicht erfüllt, ich werde nicht mehr hingehen, außer, wenn ich unbedingt muss.«
»Es erfüllte mich mit unermesslichem Jubel, als du heute Mittag an ihrem Hause vorüberfuhrst und keinen Blick für sie hattest. Sie hatte sich eigens an das offene Fenster gestellt und wartete auf deinen Gruß.«
»So, tat sie das? Ich hatte nur Augen für dich. Ich malte mir aus, wie du einst so in meinem Heim für mich schalten und walten wirst.«
»Und weißt du, alle, ganz besonders meine Mutter, behaupten steif und fest, du seist mit Susan heimlich verlobt.«
»Die Gute! Weil ich oft mit ihr zusammenkomme, um ihr Briefchen für dich zu geben, gerät sie in solch bösen Verdacht. Und was macht Otto, unser kleiner Verbündeter?«
»Er hält treu zur Fahne. Heute Mittag brachte er deinen Rosenstrauß. Mutter beanspruchte ihn natürlich für sich.«
»Er war für dich bestimmt.«
»Eine Bitte musst du mir erfüllen«, sagte das Mädchen schalkhaft.
»Wenn es möglich ist.«
»Neubert lud mich heute Abend zum Konzert ein. Ich musste dich vor deiner Abreise doch noch einmal sprechen, und so überredete ich Otto, für mich einzutreten. Er sagte auch zu, obgleich er sich aus Musik gar nichts macht, aber nur unter einer Bedingung.«
»Unter welcher?«
»Dass ihn mein Bräutigam, der Generalgouverneur von Indien, nach seiner Entlassung aus der Schule gleich zum Major macht.«
Der Offizier lachte leise auf.
»Gleich zum Major? Warum nicht erst zum Leutnant?«
»Weil er dieses Wort nicht schreiben kann — horch, was war das?«, fuhr das Mädchen erschrocken auf.
Beide lauschten, kein Ton war zu hören.
»Es war nichts, vielleicht ein Nachttier«, sagte der Offizier.
Da spielte das Orchester eine herrliche, jauchzende Melodie, das Finale aus Fidelio:
Wer ein holdes Weib errungen,
Stimm in unsern Jubel ein —
»Das letzte Stück des Programms; mein trauter, süßer Schatz, ich muss gehen. Ich kann mit einstimmen in den endlosen Jubel aller derer, denen es gelungen ist, sich ein holdes Wesen zu erringen.«
Noch eine lange Umarmung, noch ein langer, langer Kuss, dann legte der Offizier den Mantel um.
»Gute Nacht, Jonny. Gott sei mit dir auf der Reise. Ich will für dich beten.«
»Gute Nacht, mein Lieb, schlaf wohl und träume von dem, dem du alles bist auf Erden!«
Franziska sah die hohe Gestalt zwischen den Büschen verschwinden und eilte nach Hause.
Es wurde die höchste Zeit, das Konzert näherte sich dem Schluss, bald mussten Käthchen und Otto heimkommen, und erstere durfte noch nichts von der heimlichen, so süßen Liebe der Schwester merken.
Zur Verwunderung Franziskas war die Tür nur angelehnt. Sie öffnete und trat ein. Ihr Fuß stieß an einen Körper. Es war Zaline, welche eingeschlafen war.
»Zaline«, flüsterte Franziska, »es ist Zeit. Steh auf und schließe die Tür!«, Doch das alte Weib schlief fest.

»Zaline, wach auf, wach auf! Du arme Frau bist so müde und musst für mich wachen.«
Sie rüttelte die Schlafende an der Schulter. Seltsam, sie ließ sich so willenlos bewegen, sie erwachte nicht, Franziska mochte rütteln wie sie wollte!
Eine entsetzliche Ahnung begann in Franziska aufzudämmern. Das Weib war alt, ihr Tod konnte jeden Tag eintreten.
Das Mädchen legte angsterfüllt die Hand auf die Herzgegend — kein Heben und Senken, kein Pulsschlag.
Aber was war das?
Ihre Hand lag ja auf einem ganz nassen Tuch. Und da, da, ihre Füße wurden plötzlich feucht, die Steinfliesen waren ganz nass.
Franziskas Hilferuf gellte durch das schlafende Haus.
Zaline lag in einer Lache Blut, es floss aus einer Wunde in der Herzgegend, sie war tot — ermordet.
Trotzdem sich die Duchesse so außerordentlich für ihre neuen Nachbarn interessierte, spähte sie doch nicht durchs Fenster und nährte ihren Hass am Anblick der Schwester, als der Einzug in die Villa erfolgte, denn eine Person war erschienen, deren Erzählung die Aufmerksamkeit der beiden Damen aufs Höchste fesselte. Das als Bäuerin verkleidete Mädchen, Bega, lag bequem auf dem Diwan ausgestreckt, sie war von einer langen Reise ermüdet, die Duchesse und Phoebe saßen auf Schemeln zu ihren Füßen. Bega war die Herrin, die beiden anderen die Dienerinnen.
Das Mädchen wurde hier nicht mehr mit dem Namen Bega, sondern mit dem Titel Begum, was so viel wie Königin bedeutet, angeredet.
Sie schilderte eben ihr Zusammentreffen mit dem wilden Waldmenschen, wie sie sich beim Erwachen aus ihrem bewusstlosen Zustand auf seinen Knien liegend fand, konnte aber nur angeben, dass er sie zu liebkosen versuchte, die gemurmelten Worte habe sie nicht verstehen können.
Dann fand ein Ringkampf zwischen ihm und einem anderen Manne statt, den sie ebenso wenig kannte. Er war in rohes, rotes Leder gekleidet und trug eine lange, schwere Büchse, auf dem Kopfe eine rote Pelzmütze. Während dieses Ringkampfes sei sie geflohen. Mehr könne sie nicht angeben; das alles wäre ihr hinterher wie ein Traum erschienen, doch es war keiner, sie hatte ja noch den Verband, den ihr der alte, unheimliche Mann umgelegt hatte, getragen.
Kopfschüttelnd hörten ihr die beiden Damen zu. Sie waren geneigt zu glauben, dass das Mädchen nur geträumt habe.
»Ein Mann, in rohes, rotes Leder gekleidet, eine Pelzmütze auf dem Kopfe in Indien«, murmelte die Duchesse. »Begum, hast du dich auch nicht getäuscht? Du bist durch den Sturz vom Elefanten herab betäubt gewesen; leicht kannst du diese merkwürdigen Gestalten, die du schilderst, nur im Traume gesehen haben.«
»Ich sah sie in Wirklichkeit«, versicherte das Mädchen.
Phoebe hatte überlegend einen Gang durchs Zimmer gemacht und wusste plötzlich, dass das Mädchen wahr sprach.
Dort unten stand der Mann in rotem Lederanzug und Pelzmütze, er half den neuen Bewohnern, die Phoebe sehr gut kannte, beim Einzug in die Villa. Jetzt wusste sie, wer er war. In Wanstead hatte sie ihn nicht gesehen, nur einmal flüchtig von ihm sprechen hören, und jetzt fiel ihr auch ein, dass er als Diener Mister Woodfields bezeichnet worden war.
Phoebe behielt ihre Entdeckung vorläufig für sich; Bega sollte nicht erfahren, wen sie hier in allernächster Nähe wiederfand.
Plötzlich wandte die Frau sich schnell um und unterdrückte mit Mühe einen Ausruf des Erstaunens über Begas Erzählung.
»Ich kann unmöglich geträumt haben«, hatte das Mädchen gesagt, »ich entsinne mich der seltsamen Erscheinung noch ganz genau. Ich könnte sie malen. Er hatte einen langen, graumelierten, struppigen Bart, ebensolche Haare, alles ohne jede Pflege, selbst die Fingernägel hatten eine ganz ungeheure Länge erreicht. Richtig, eines seiner gemurmelten Worte entsinne ich mich dennoch, es war ein Name, Eugenie, und er wiederholte ihn öfters, als wolle er mich so nennen.«
Die beiden Damen wechselten einen erschrockenen Blick, heimlich, bedeutsam, doch er war den scharfen Augen des Mädchens nicht entgangen.
Es richtete sich aus seiner liegenden Stellung empor.
»Ihr wisst, von wem ich spreche und verheimlicht es mir«, rief sie, und ihre geschwungenen Augenbrauen näherten sich einander. »Aus welchem Grunde stellt ihr euch mir gegenüber unwissend? Sprecht, ich will es wissen.«
Die Duchesse bezwang die aufsteigende, verlegene Röte.
»Du hast recht, Begum, jetzt, da du uns eine genaue Schilderung dieses Waldmenschen gibst, wissen wir, wer er ist. Wir wollten deine Ohren mit der Vermutung verschonen, die in der Gegend von Mirat und besonders weiter nördlich unter abergläubischen Indern Wurzel geschlagen hat. Dort soll während der Nacht ein Agni durch den Wald streifen, einen brennenden Zweig in der Luft schwingend und mit seiner Wurfkeule jeden tötend, der ihm begegnet. Man nennt ihn das wandernde Feuer, es soll ein Feuergeist sein, der von Brahma aus der Nirwana verstoßen worden ist und nun zur Strafe wegen eines Vergehens auf unserer mit Unglück geschlagenen Erde ruhelos umherwandern muss. Deine Schilderung macht uns glauben, dass du dieser Erscheinung begegnet bist.«
»Ja, jetzt entsinne ich mich«, entgegnete die Begum erstaunt. »Neben mir stak ein brennender Zweig im Boden, und die wilde Gestalt schwang, als sie auf den Roten einsprang, eine Keule in der Hand. Obwohl ich nun an Feuergeister glaube, welche im Dienste Shivas und seiner Gattin Kali das Feuer schüren und dämpfen, beides, das erzeugende Feuer das die Pflanzen auf der Erde treibt, wie das verderbliche, das vernichtet, so glaube ich doch nicht dass der allgütige Brahma einem Agni erlaubt, seinen Kindern zu schaden.«
»Dies ist auch meine Ansicht!«, sagte die Duchesse lächelnd. »Und du, Begum, kannst um so weniger an diese Fabel glauben, als du selbst die Tochter der Kali bist und also über die Feuergeister...«
Die Duchesse verstummte plötzlich, denn sie bemerkte im Antlitz des Mädchens einen unwilligen Zug, der andeutete, dass sie von sich auf solche Weise nicht sprechen zu hören wünsche.
Die beiden waren wahrscheinlich wie noch viele andere instruiert worden, diesem Mädchen nicht nur aufs Wort, sondern auch auf einen Blick zu gehorchen; die Begum sollte mit der untertänigsten Ehrfurcht behandelt werden.
»Die Namen Siva und Kali erinnern mich daran«, sagte das Mädchen, stand auf und dehnte die schlanke Gestalt, »welche nächste Aufgabe ich zu erfüllen habe. Zwei Tage Verspätung habe ich erlitten, sie müssen nachgeholt werden. Mach alles bereit, dass ich sofort abreisen kann!«
»Wie, schon jetzt? Du musst doch furchtbar erschöpft sein!«
»Ich muss nach Dschansi, wo ich erwartet werde, und werde in acht Tagen wieder hier sein. Du weißt, warum.«
Die Duchesse verneigte sich und verließ das Gemach, um Anordnungen zu treffen. Sie sprach mit Babur und musterte auch den Bauern, der die Begum gebracht hatte, und der jetzt, die Schuhe neben sich, mit bloßen Füßen auf den Fliesen der Vorhalle kniete und geduldig wartete.
»In zwei Stunden wird eine Karawane zusammengebracht sein«, sagte sie bei ihrer Rückkunft zu dem Mädchen, »welche dich, o, Begum, begleiten wird. Schnellfüßige Kulis sind schon unterwegs, Pferde, Leute und einen Elefanten für dich zu mieten. Wer aber wird das Amt Basrabs übernehmen, dich sicherer als er nach Dschansi bringen und verhüten, dass du erkannt wirst? Wer soll dies tun?«
»Ich«, sagte eine hohe Stimme, und ohne dass ihn jemand hatte eintreten sehen, wie aus dem Boden gewachsen, stand mitten im Gemach ein kleiner Inder mit faltigem, schlauem Gesicht.
»Timur Dhar«, flüsterten die beiden Frauen erschrocken und zogen sich scheu zurück, während das Mädchen mit ausgestreckter Hand auf ihn zuging.
»Timur Dhar«, sagte auch sie, »zu einer besseren Zeit hättest du nicht kommen können! Wusstest du denn, wie ich dich herbeisehnte? Ich hoffe, du wirst mein Begleiter!«
Der Gaukler ergriff die Hand nicht; der sonst so herrisch auftretende, geheimnisvolle Mann verbeugte sich tief und führte die Hand dann nur leicht an die Lippen.
»Ich wusste, dass meine Herrin ihren Diener braucht, ich flog hierher, der Königin meine Dienste anzubieten. Befiehl, und dein Diener gehorcht. Ja, ich werde dich begleiten und dich wie meinen Augapfel hüten. Fürchte nicht, dass bei mir etwas Ähnliches passiert, wie bei dem sorglosen Basrab.«
»Ich weiß, dass du allmächtig bist, bindest du doch die Geister an deinen Ring.«
»Sie gehorchen nicht mehr mir, sondern dir!«
»Wann wollen wir reisen?«
»Nicht heute, erst morgen früh! Ruhe dich aus, o, Begum, die Reise ist lang!«
»Und wir kommen nicht zu spät?«
»Wir kommen zur rechten Zeit.«
»Ich habe Babur schon beauftragt, eine Karawane zusammenzubringen«, warf die Duchesse ein.
Des Gauklers Unterwürfigkeit war verschwunden, als er sich an das Weib wendete.
»Dein Befehl ist widerrufen!«
»Von wem?«
»Von mir!«
»Das ist nicht möglich.«
Timur Dhar ließ ein kurzes Lachen hören.
»Was ist Timur nicht möglich?«
»Dass du den Befehl widerrufen hast. Du bist eben erst gekommen; Babur aber ist schon seit einigen Minuten fort.«
Statt aller Antwort berührte der Gaukler, als wäre er der Herr im Hause, die Klingel, und zur Verwunderung der Duchesse trat Babur ins Zimmer, den sie unterwegs wähnte.
»Ertönt die Klingel zum zweiten Male, so führst du den Bauer herein, der draußen wartet«, sagte er, und der Diener ging.
»Kali hat dich beschützt«, wandte sich der Gaukler, sich um die anderen gar nicht kümmernd, wieder demütig an das Mädchen, »die Göttin wollte nicht, dass ihre Tochter Schaden erleidet. Hat dich der Bauer unerkannt hierher geführt?«
Timur Dhar wusste also schon, was die beiden Frauen eben erst erfahren hatten, und noch mehr. Aber seine Frage war doch ein Gegensatz zu seiner Behauptung, dass er allwissend sei.
»Am Morgen nach jener für mich schrecklichen Nacht«, entgegnete das Mädchen, »war er der erste, den ich erblickte, als ich aus dem Walde trat. Er war allein und mit Pflügen beschäftigt. Ich verhüllte mein Gesicht, sprach den Erschrockenen an und verlangte von ihm gegen reichliche Belohnung, er solle mich während des Tages verborgen halten, mich in der Nacht nach Delhi bringen und nicht nach dem Warum fragen. Der Mann war dienstbereit; das Vorzeigen einiger Goldstücke trug vielleicht viel dazu bei. Nachdem ich ihm noch eingeschärft hatte, zu niemandem von seiner Begegnung mit mir zu sprechen, versteckte ich mich im Felde, der Bauer brachte mir sein Essen und am Abend eine reichliche Mahlzeit, Kleidung und einen Esel und führte mich während der Nacht nach Delhi, wo ich vorhin eintraf. Es dauerte aber lange, ehe ich vorgelassen wurde?«
»Verzeihe!«, entschuldigte sich die Duchesse. »Wie konnte ich ahnen, wen dieses Gewand der Bäuerin verbarg.«
»Hat der Bauer das Antlitz der Begum gesehen?«, fragte Timur.
»Nein, ich war immer verhüllt.«
»Wird er nicht geplaudert haben?«
»Ich glaube nicht, er schien Angst zu empfinden. Überdies hat er mich gar nicht gesehen, konnte mich und meine hilflose Lage auch nicht verraten.«
»So soll er belohnt werden.«
Im Nebenzimmer, wo sich das Bad befand, ertönte Wasserrauschen. Ohne dass die Duchesse es gewusst hatte, war dort ein Bad bereitet worden.
»Bediene die Begum!«, sagte der Gaukler zu Phoebe. Diese und das Mädchen, ihre einstige Pflegetochter, verschwanden hinter der Portiere.
»Bewirtet den Mann gut und belohnt ihn reichlich; er hat es verdient«, rief Bega noch einmal zurück.
»Es wird geschehen«, entgegnete Timur Dhar.
Der Gaukler wechselte einige leise Worte mit der Duchesse, dann wurde auf sein Klingelzeichen der Bauer hereingeführt, ein unansehnlicher Inder mit ängstlichem Gesicht; die Pracht des Hauses war ihm fremd, er trug seine Schuhe in der Hand und blickte zaghaft nach der stolzen, schönen Frau, scheu nach der kleinen Gestalt des Gauklers, der sein Gesicht noch vor dem Eintritte des Bauern verhüllt hatte.
»Du bist der Mann, der das Mädchen, das dich um Hilfe ansprach, diese Nacht auf deinem Esel nach Delhi geleitet hat?«, begann die Duchesse das Verhör.
Der Inder stotterte eine Bejahung.
»Wie sah das Mädchen aus?«
»Ich weiß es nicht.«
»Du musst sie doch gesehen haben!«
»Sie trug das Gesicht immer verhüllt.«
»Wem hast du von ihr erzählt?«
»Niemandem, sie verbot es mir.«
»Wie? Du musst doch wenigstens deinem Weibe erzählt haben dass du eine nächtliche Reise nach Delhi machtest.«
»Ja, ich sagte ihr, ich wollte Getreide nach Delhi schaffen.«
»Und wem hast du sonst noch deine Begegnung mit dem Mädchen erzählt?«
»Ich habe ja gar nicht und zu niemand von ihr gesprochen.« rief der Bauer kläglich. »Ich habe nichts zu gestehen!«
Der verhüllte Gaukler nickte leicht, die Duchesse stellte das Verhör ein.
»Es ist gut«, sagte sie sehr laut, »du hast den Befehl richtig ausgeführt und sollst dafür reich belohnt werden. Babur«, ihr Klingeln hatte den Diener herbeigerufen, »verpflege den Mann gut, ehe er wieder abreist; sorge für seine Bequemlichkeit!«
Ein widerliches Grinsen verzerrte das Gesicht des Dieners, als er den schüchternen Bauern hinausführte.
Jetzt schlug der Gaukler das Tuch vom Gesicht zurück, kreuzte die Arme über der Brust und schaute die Duchesse scharf an.
»Und du?«, fragte er.
»Ich habe bis jetzt getan, was mir aufgetragen wurde.«
»Wie weit bist du mit Dollamore?«
»Er gehört mir.«
»Schon jetzt?«
»Nein, noch nicht, aber er ist schon so gut wie der Unsrige.«
»In acht Tagen muss Dollamore die Fahne Englands verlassen haben und mit ihm alle Gurkhas. Dort drüben«, er deutete nach der gegenüberliegenden Villa, »harrt deiner die Belohnung. Kennst du dieses Haus?«
Die Duchesse nickte, und ihre Augen blitzten triumphierend auf.
»So benutze die Geheimnisse des Hauses, doch hüte dich, dass du sie durch Unvorsichtigkeit oder gar selbst in die Hände deiner Feinde, an denen du dich rächen willst, führst. Deine Feinde sind nicht zu unterschätzen, hüte dich besonders vor ihrem Führer, jenem Reihenfels, er ist schlau.«
»Wohl ein scharfsinniger Gelehrter, doch kein besonders schlauer Mensch«, entgegnete das Weib geringschätzend.
»Du irrst, er ist schlau.«
»Kennst du ihn, Timur Dhar?«
»Ich traf mit ihm zusammen, wir maßen einander an List, und er hat mich überlistet.«
Die Duchesse war über dieses offene Geständnis ganz erstarrt. Wie konnte der Gaukler, der sich mit einem Nimbus umgab, als wäre er fast ein Gott, allwissend und allmächtig, als gehorchten ihm die Geister, wie konnte er solch ein Geständnis machen?
Als der Gaukler ihre Überraschung bemerkte, lächelte er verächtlich. Er erriet die Gedanken des Weibes.
»Glaubst du, er hätte mich überlisten können? Ich ließ mich von ihm mit Absicht überlisten, damit er in seiner Ansicht bestärkt würde, dass er äußerst schlau sei. Von jetzt ab wird er mich in meiner Gestalt, die ich damals trug, nicht mehr fürchten. Verstehst du, wie ich das meine?«
Die Duchesse bejahte, durchschaute aber auch zugleich diesen Mann. Irgend ein Plan war ihm von Reihenfels vereitelt, er war durch diesen überlistet worden. Wenn dies bekannt wurde, war er, der allmächtige und allwissende Gaukler blamiert, und so gab er sich den Anschein, als hätte er sich mit Absicht hinters Licht führen lassen.
Das Weib hatte zwar recht, wusste aber doch nicht alles. Der Gaukler war ihr bedeutend überlegen.
»Wenn morgen das Gerücht entsteht«, fuhr er fort, »dass eine geheimnisvolle Tat in Delhi ausgeführt worden ist, so wisse, dass Timur Dhar sie vollbrachte, und der davon Betroffene ist kein anderer als jener Reihenfels. Der junge Mann dünkt sich zu klug; Timur Dhar wird ihn noch heute Nacht demütigen. Und nun, Ayda, vergiss nicht, dass die Briefe in deine Hand fallen müssen. Du hast deine Dienerin dazu ausersehen, es ist gut, sie eignet sich dazu, und es wird ihr gelingen.«
Er deutete noch einmal nach der Villa und verließ dann ohne Gruß das Boudoir. —
Babur führte den Bauern durch einige Gänge, stieg eine Treppe hinunter, kam in das Erdgeschoss und gelangte nach nochmaliger Benutzung einer schon dunklen Treppe in einen Kellergang, welcher nur schwach durch ein Oberlicht beleuchtet wurde.
Auf dem Wege unterhielt sieh Babur mit dem ihm Anvertrauten.
»Du hast gewiss rechten Hunger, armer Mann?«
Der Kuli verneinte, er hätte genügend Brot bei sich gehabt.
»Bah, Brot, bei uns gibt es etwas Besseres. Nur noch ein paar Schritte, dann sind wir in der Küche. Sie liegt im Keller, da halten sich die Sachen besser. Isst du gebratene Tauben gern?«
Der Bauer leckte mit der Zunge die Lippen.
»Hier ist es recht dunkel«, sagte er dann ängstlich.
»Es wird gleich wieder hell«, tröstete Babur, nahm größere Schritte und ging schneller, sodass er sich von dem Nachfolgenden etwas entfernte.
Hier war der düstere Gang nur einen halben Meter breit.
Da ertönte hinter Babur ein leises Knacken; blitzschnell drehte er sich um und sah eben noch, wie der Bauer, ohne einen Laut von sich geben zu können, in einem plötzlich im Boden entstandenen Loche verschwand.
Sofort schloss sich dieses wieder selbsttätig mit einem Deckel, der nur heruntergeklappt war.
Babur drehte an einem Hebel in der Wand.
»Eine höllische Erfindung«, murmelte er grinsend. »der erste geht darüber, der zweite stürzt hinunter. Da, mein Bursche, lass dir da unten in der Schleuse die gebratenen Tauben gut schmecken.«
Als wäre nichts geschehen und als verschlösse der dünne Deckel nicht eine gähnende Tiefe, die eben einen schuldlos Hingemordeten aufgenommen, schritt Babur darüber und begab sich oben in ein Zimmer, wo Timur Dhar seiner wartete. Auch jetzt hatte er sein Gesicht verhüllt.
»Ist er fort?«
»Er ist stumm.«
»Gut, Babur! Halte dich heute Abend bereit, ich brauche dich. Wenn die Sonne untergeht, bin ich hier.«
»Mit Waffen?«
»Nein, du brauchst keine. Lege alles ab, was dich beim schnellen Laufen stören könnte. Du sollst nichts weiter tun, als einige Gegenstände tragen.«
Babur schien zu wissen, wer der Mann war, der vor ihm stand. Demütig vernahm er die Befehle, und die Neugier trieb ihn auch nicht dazu, zu fragen, was mit der nächtlichen Partie bezweckt werden solle.
Delhi besitzt elf Tore. Sieben davon führen nach Landstraßen hinaus, durch vier andere gelangt man auf Kanälen in die an Delhi dicht vorbeifließende Dschamma.
Es war am anderen Morgen, als ein hochgebautes, zwölfruderiges Boot, in dem sich im Hinterteile ein Häuschen erhob, ein solches Wassertor passierte. Zwölf kräftige Kulis handhabten die schweren, unbehilflichen Ruder, am Steuer lehnte die wie aus Erz gegossene Gestalt eines Inders, und in der Nähe des Häuschens saß auf einer Bank in weißem Burnus den unteren Teil des Gesichts verhüllt, mit arabischen Dolchen und Pistolen im Gürtel, ein Mann — also jedenfalls ein Araber, wie sich solche in Delhi massenhaft aufhalten; ist doch überhaupt, wie schon erwähnt, die Hälfte der Stadt mohammedanisch.
»Halt, beilegen!«, erklang es da im Kommandoton vom Brückenbogen aus. Der Befehl fand keine Beachtung.
»Das Boot soll beilegen«, erscholl es nochmals, diesmal aber auf arabisch.
Der Steuerer blickte nach dem Araber, der sich nicht rührte.
Da traten aus dem Wächterhause am Kai einige Leute, darunter auch zwei uniformierte, ein englischer und ein indischer Polizist.
»Auf Befehl des Gouverneur, das Boot legt bei oder darf heute nicht mehr passieren!«, rief der Engländer wieder.
Der Araber winkte, der Steuerer drehte das Ruder, und als sich das Boot dem Lande etwas genähert hatte, fiel eine Laufbrücke, über welche die beiden Polizisten und noch einige Inder das Boot betraten.
Finster musterte der Araber die Ankömmlinge, ohne sich zu erheben. Es war sonst nicht Sitte, dass die Boote angehalten wurden, Zoll oder Steuer gab es nicht. Es musste also ein besonderer Grund zu der außerordentlichen Maßnahme vorliegen.
Der englische Polizist fragte den Araber nach dem Namen, nach dem Reiseziel, und wo er die letzte Nacht zugebracht habe.
»Das Boot passiert das Tor nicht eher, als bis du diese Fragen beantwortet hast«, fügte der Beamte hinzu, als der Araber, der keinen Herrn über sich erkannte, nicht mit der Sprache herauswollte.
Die letzte Bemerkung veranlasste ihn, zu antworten.
Der Beamte notierte die Aussagen, übergab dem indischen Diener das Papier, und dieser entfernte sich.
»Eine halbe Stunde musst du dich noch gedulden«, sagte der Beamte zum Araber; »mein Diener wird bald wiederkommen und mir Bescheid bringen, ob deine Aussagen stimmen.«
Der Araber fügte sich ins Unvermeidliche. Sich zu erkundigen, was dies bedeute, hielt er unter seiner Würde.
Die beiden Beamten gingen unterdes durch das Boot, musterten alles, sahen sich jeden Mann genau an und tauschten leise Bemerkungen aus.
Vor dem Häuschen blieben sie stehen und klinkten an der Tür. Sie war verschlossen.
»Wer ist hier drin?«
»Meine Frauen!«, brummte der Araber unwillig.
»Öffne!«
»Ich bin Mohammedaner!«
»Öffne auf Befehl des Gouverneurs! Du wirst Delhi nicht eher verlassen können!«
Das wirkte. Der Araber zog einen Schlüssel hervor und öffnete.
Am Boden des mit Teppichen ausgelegten Gemaches hockten zwei vollständig vermummte Weiber, die Frauen des Arabers.
Jetzt kam der Polizeibeamte wieder einmal in eine schwierige Lage. Er sollte kein Boot passieren lassen, ohne dasselbe untersucht und jede Person gesehen zu haben. Streng genommen musste er verlangen, dass die Weiber ihre Gesichter enthüllten, eine heikle Sache, denn nach dem mohammedanischen Glauben ist es bekanntlich ein abscheuliches Verbrechen, wenn ein anderer als ihr gestrenger Gatte das Antlitz der Frauen sieht. Aber wiederum hatten die Beamten auch die scharfe Weisung, nichts zu tun oder zu verlangen, wodurch die Sitten der Eingeborenen beleidigt würden.
Nun, er konnte es ja einmal probieren, dann hatte er es wenigstens versucht, seine Pflicht treu zu erfüllen.
»Lüfte ein wenig den Schleier, Schönste der Schönen, dass sich mein Auge an deiner Schönheit erfreut«, sagte der redegewandte englische Beamte im blumenreichen Stil der arabischen Sprache zu dem Weibe.
Die Antwort, die er erhielt, war weniger blumenreich.
Wütend, mit geballten Fäusten, fuhr das Weib auf den Sprecher ein, hinter dem Schleier drang eine schreiende, quäkende Frauenstimme hervor und überschüttete den Beamten mit Schmähungen, wie sie nur ein altes, arabisches Weib mit größter Zungengeläufigkeit hervorstoßen kann. Ausdrücke wie: Sohn einer Hündin, aasfressender Rabe, verseuchter Wolf, waren noch die besten, die anderen kann man nicht wiedergeben.
Durch, ihre wütenden Bewegungen musste sich der Schleier gelöst haben, er fiel von selbst herab, und die beiden Beamten erblickten ein altes, hässliches, runzliges Gesicht, vor dem Munde Geifer.
Dadurch, dass ihr Gesicht, das die Araberinnen eher verhüllen als den Busen, sich den Augen der fremden Männer offen darbot, wurde die Wut der Frau nur noch mehr entfacht. Sie dachte im Augenblick nicht daran, sich wieder zu verhüllen, mit gekrümmten Fingern sprang sie auf den Engländer zu, wahrscheinlich, um ihm mit den Nägeln in die Augen zu fahren. Pfffftsch ging es, ein Strahl Speichel entfuhr ihren Lippen, und nur durch eine glückliche Kopfbiegung entging der Beamte dem ekelhaften Schleudergeschoss.
Erschrocken nahmen die beiden Beamten Reißaus, mit solch einem Weibe war nicht zu spaßen, eher mit einer Hyäne.
Hinter dem Engländer hatte der Araber gestanden, und das Schicksal wollte es, dass ihn das Geschoss mitten ins Gesicht traf.
Gleichmütig wischte er den Speichel seiner teuren Ehehälfte ab — wahrscheinlich war ihm eine solche Auszeichnung schon öfters zuteil geworden — und verschloss die Tür.
Während die beiden Beamten unter Führung des Steuermannes den unter Deck gelegenen Teil des tiefgehenden Bootes untersuchten, tauschten sie Bemerkungen über das soeben Erlebte aus.
»Wenn man in meiner Heimat von solch einer arabischen Suleika erzählen hört«, sagte der Engländer, »denkt man sich stets ein junges, schönes, unschuldiges Wesen, das ganz Hingabe ist, mit schmachtenden, mandelförmigen Augen und Korallenlippen. Jawohl, kommt nur hin! Das Weib war übrigens schon sehr alt für den Mann.«

»Wahrscheinlich reich«, entgegnete der indische Beamte, ein aufgeklärter, junger Mann. »Geld verjüngt und verschönt die Weiber.«
»Gerade wie bei uns. Ob die andere wohl zahmer war?«
»Zahm vielleicht, auf keinen Fall aber war sie jung oder schön.«
»Warum nicht?«
»Der Mann würde beide nicht in einem Raume lassen, denn sonst entstände Mord und Totschlag. Haben Sie schon gehört, wie neulich ein Tiger einen mit Frauen reisenden Araber überfallen haben soll, und wie der Ausgang der Affäre war?«
»Nein.«
»Ein Araber reiste durch die Dschungeln, er auf einem Elefanten, und seine drei Frauen in einem verhangenen Baldachin auf einem anderen. Plötzlich springt ein Königstiger hervor und verschwindet in dem Baldachin. Im Innern erscholl Zetergeschrei und Geheul. Der Araber soll nicht nach der Büchse gegriffen haben, um seinen Weibern beizustehen. Vielleicht wäre er dem Tiger sehr dankbar gewesen, wenn er sie verschlungen hätte. Aber es kam anders. Mit einem Male erschien das Raubtier auf der anderen Seite des Baldachins wieder und suchte mühsam die sicheren Dschungeln zu gewinnen; es war blutig, blind und ohne Schwanz. Die Weiber hatten ihm die Augen aus dem Kopfe gekratzt und auch noch den Schwanz ausgerissen. Seitdem soll es den Tigern nie mehr einfallen, eine Karawane anzugreifen, bei der sich arabische Frauen befinden.«
Der Engländer lachte herzlich über die Erzählung seines humoristischen Kollegen. Wenn sie natürlich auch nicht auf Wahrheit beruhte, so war sie doch gut erfunden.
Nebenbei bemerkt: Keine andere als die arabische Poesie beschäftigt sich so viel mit dem Reiz schöner Frauen, aber die arabischen Weisen warnen auch am meisten vor alten Weibern.
Die Untersuchung des Bootes hatte nichts Verdächtiges ergeben. Eben als die beiden Beamten das Deck wieder betraten, traf der ausgeschickte Diener ein. Der Engländer hörte eine kurze Meldung an und nickte.
»Deine Angaben beruhen auf Wahrheit!«, sagte er zu dem Araber. »Der Weg ist frei!«
Die Beamten verließen das Boot, das die unterbrochene Fahrt wieder aufnahm.
»Der Weg ist frei!«, sagte drinnen in dem Häuschen auch die Gefährtin des alten Weibes und entblößte ein schönes, braunes Mädchenantlitz. »Was hatte diese Untersuchung wohl zu bedeuten, Timur Dhar?«
Timur Dhar war also dieses alte Weib, und er hatte seine Rolle meisterhaft gespielt.
»Es wird diese Nacht etwas gestohlen worden sein, und die Boote werden deshalb visitiert!«, entgegnete er gleichmütig.
»Wenn jene aber auch mich gezwungen hätten, mein Gesicht zu enthüllen?«
Der Gaukler lächelte geringschätzend.
»Sie würden es nicht gewagt haben, und wenn, dann hätte ich sie eher erwürgt, als dass ich es duldete. Durch ihre Flucht entzogen sie sich dem Tode.«
Das große Boot war noch nicht außer Sicht, als ein kleines vierriemiges, scharfgebautes Polizeiboot herangeschossen kam. An dem Wächterhause legte es einen Augenblick an, weil der englische Polizist es herangewinkt hatte.
»Noch nichts gefunden, Kollege?«, fragte er den Steuerer.
»Natürlich nicht«, entgegnete dieser. »Es ist überhaupt ein merkwürdiger Fall. Der Bestohlene verweigert jede Auskunft, welche Sachen ihm eigentlich gestohlen worden sind. Wir wissen gar nicht, warum jemand bei ihm eingedrungen ist und dabei die Frau ermordet hat. Es ist alles ganz komisch. Geld kann nicht geraubt worden sein. Ich glaube fast, das Mädchen, die Tochter, steckt mit dahinter, ich habe so ein paar Worte, wie heimliche Liebschaft, unanständig, von der zornigen Mutter gehört. Da es sich aber um den alten Reihenfels handelt, dürfen wir nicht weiter forschen und müssen uns mit dem begnügen, was er uns angibt. Haben Sie schon Boote visitiert?«
»Ein einziges, eben jetzt, da fährt's noch.«
»Mein Gott«, seufzte der Steuerer und wischte sich den Schweiß von der Stirn, »wer kann hier auch alle Morde verhüten oder den Täter finden! Man weiß ja überhaupt niemals, ob ein Mord oder ein Selbstmord vorliegt. Die verrückten Inder stoßen sich ja oft nur zum Zeitvertreib den Dolch ins Herz, und wenn sie einmal träumen, Brahma habe ihnen befohlen, sich von den Krokodilen verspeisen zu lassen, schwubb, springen sie ins Wasser. Erst vorhin habe ich wieder einen Kerl schwimmen sehen, um den sich die Bestien balgten. Er war wie ein Bauer gekleidet.«
»Ja, diese fanatischen Buddhisten! Wohin geht's denn jetzt?«
»Ich soll den jungen Reihenfels holen. Es kommt mir fast vor, als ob dieser den Verlust zu tragen hätte, denn der Vater scheint sich vor der Ankunft des Sohnes zu fürchten. Good bye, ich muss schnell machen!«
Das Boot setzte ab und flog unter den kräftigen Ruderschlägen pfeilgeschwind den Kanal hinauf. An der Steintreppe hielt es, der Steuerer sprang heraus, hinterließ eine Weisung und erreichte durch eine Gasse die Hauptstraße. Er stieß gerade auf die neu bezogene Villa, die er betrat.
Reihenfels war eben zu der Überzeugung gekommen, dass Lady Carter wirklich einen geheimnisvollen nächtlichen Besuch empfangen hatte, vielleicht Isabel selbst. Er hatte dazu von August gehört, dass dieser das wandernde Feuer, den Mann, dessen man jetzt zuerst habhaft werden musste, in der Umgebung eines zerfallenen Grabmonumentes erblickt habe, als ein Inder eintrat und meldete, ein Herr wünsche Reihenfels unverzüglich zu sprechen.
Noch halb betäubt von dem eben Gehörten, das er in seinem Kopfe noch nicht ordnen konnte, betrat der Gelehrte ein Zimmer, wo er eine neue beunruhigende Nachricht empfing.
Der ihn Erwartende sagte, er sei englischer Polizist; Herr Friedrich Reihenfels verlange ihn, den Sohn, sofort in seinem Hause zu sprechen.
»Es ist jemand in dieser Nacht ermordet worden...«
»Um Gottes willen. Wer?«, rief Oskar tödlich erschrocken und umklammerte die Stuhllehne.
»Eine alte, indische Dienerin, Zalina heißt sie«, fuhr der Beamte schnell fort, »und anscheinend ist etwas im Hause geraubt worden, was, weiß ich nicht. Ihr Herr Vater wünscht Sie jedenfalls zu sprechen.«
Zehn Minuten später stand Oskar vor seinem Vater, der den Sohn unruhig, mit nervöser Ungeduld erwartet hatte.
»Ich weiß alles«, sagte Oskar leise und schnell, ehe jener zu Worte kam. »Man hat eingebrochen und die Sachen, die ich dir zur Aufbewahrung gab, entwendet.«
»So ist es. Mache mich nicht dafür verantwortlich. Sie waren gut versteckt und verpackt, du selbst hast es ja besorgt; doch man hat darum gewusst und sie geraubt. Meine alte, treue Zalina ist den Dieben zum Opfer gefallen — sie ist tot.«
Hatte der Vater geglaubt, Oskar würde über die Nachricht bestürzt sein, so hatte er sich getäuscht. Derselbe blieb ruhig.
»So ist eben meine List missglückt«, sagte er einfach. »Ich übergab dir die mir sehr wertvollen Sachen in dem Glauben, dass etwaige Diebe sie nur bei mir suchen würden. Ich nahm die Umhüllungen, mit etwas anderem gefüllt, mit mir, sodass es den Anschein hatte, als hätte kein Verlust mich betroffen. Was sie für mich bedeuten, habe ich dir erzählt, wenn ich auch wenig Glauben bei dir fand. Aber seltsam«, sagte er mehr zu sich selbst, »niemand außer uns beiden wusste, dass die Sachen hier waren, niemand war zugegen, als wir sie umpackten und versteckten, und doch wussten sie die Betreffenden ohne Mühe, ohne Lärm, ohne Licht zu finden. Hier muss es einen Verräter geben. Gleichgültig, sie sind eben fort. Bedauerlich ist nur, dass Zalina ihren Tod dabei gefunden hat. Wie ist es eigentlich gekommen?«
Der alte Mann ging erst mit allen Zeichen heftiger Erregung im Zimmer auf und ab, dann nahmen seine Züge einen mehr schwermütigen Ausdruck an.
»Wir wurden gestern Abend gegen 10 Uhr durch Hilferufe Franziskas geweckt. Sie stand unten vor der Leiche Zalinas, die vor der nur angelehnten Gartentür lag, tot, im Herzen einen Messerstich. Er musste von kundiger Hand geführt worden sein, Zalina hatte keinen Laut mehr von sich gegeben. Dann kamen Otto und Käthchen aus einem Konzert und stimmten in Franziskas Zetergeschrei ein. Ich untersuchte erst oberflächlich, ob ein Einbruch erfolgt sei, es fehlte nichts. Dann fielen mir deine Sachen ein, ich sah nach und fand sie nicht mehr vor. Die Eindringlinge hatten es also nur auf sie abgesehen gehabt.«
»Zalina lag vor der nur angelehnten Gartentür?«
»Ja.«
»Sieht das nicht fast aus, als hätte sie die Diebe eingelassen und dann zur Belohnung den Messerstich bekommen, damit sie nichts ausplaudern konnte?«
»Nein«, entgegnete der Vater finster, »Zalina war treu wie Gold. Dies alles hat Franziska auf dem Gewissen!«
»Franziska?«, rief Oskar erschrocken.
»Es hat sich erst jetzt herausgestellt, dass Franziska schon seit langer Zeit eine Liebschaft unterhält. Sie hat dies nun offen gestanden, doch sie weigert sich hartnäckig, den Namen des Mannes zu nennen. Ihre Zusammenkünfte fanden nachts im Garten statt, Zalina war ihre Verbündete. Die an Franziska hängende Dienerin schloss ihr auf und wachte an der Tür, bis sie zurückkam. Entweder hat der Räuber nun gewusst, dass diese Tür offen stand und sie sofort benutzt oder er hat sie zufällig offen gefunden. Jedenfalls hat der Räuber Zalina stumm gemacht.«
Oskars Gedanken weilten nicht mehr bei den ihm wertvollen Sachen, er dachte an die Schwester.
»Die arme Franziska!«, sagte er. »Ich kann mir denken, welche Empfindungen sie bewegen.«
»Ja, sie ist sehr unglücklich, und ich kann sie nicht einmal bedauern oder trösten.«
»Warum nicht, Vater?«
»Sie hat uns, ihre Eltern, getäuscht. Sie benahm sich uns gegenüber unbefangen, während sie ein heimliches Liebesverhältnis hatte, sie hat also geheuchelt. Jedem Vergehen muss aber eine Strafe folgen, sie muss, und diese erleidet Franziska jetzt.«
»Du zürnst ihr?«
»Nicht mehr. Im ersten Augenblick war ich zwar entrüstet, doch ich bezwang mich schnell. Ich bin kein Mann, der ein Mädchenherz studiert hat, ich bezweifle überhaupt, dass ein Mann ein solches beurteilen kann, und so hielt ich mich nicht für kompetent, ihr gegenüber als Richter aufzutreten. Das musste die Mutter tun, und ich fürchte fast, sie ist in ihrem Eifer zu weit gegangen.«
»Was sagte sie?«
Ich glaube, sie hat ein böses Wort fallen lassen«, entgegnete der alte Mann düster, »ohne dass es nötig gewesen wäre — denn Franziska fühlt von selbst eine schwere Schuld auf sich lasten — sie hat dem armen Mädchen vorgeworfen, dass ohne ihr heimliches Ausgehen Zalina den Tod nicht gefunden hätte. Wohin willst du, Oskar?«
»Franziska sagen, dass sie unschuldig ist, oder ich will die Schuld mit ihr tragen und mich mit ihr verantworten«, rief Oskar und verließ das Zimmer.
Er fand die Schwester in Tränen aufgelöst, die Mutter war soeben von ihr gegangen, wahrscheinlich nicht im Guten.
Beim Eintritt des Bruders erhob sie sich; die Tränen versiegten; neben dem Ausdruck des Schmerzes prägte sich der des Stolzes in ihren sonst so sanften Zügen aus.
»Kommst auch du, Oscar, mir Vorwürfe zu machen? Ich dächte, es wäre genug!«
Er ergriff ihre beiden Hände und schaute ihr warm ins Auge.
»Franziska, du beurteilst mich ganz falsch. Ich komme nicht als Ankläger, sondern als Tröster.«
Das Mädchen brach von neuem in Tränen aus.
»Ich brauche auch Trost«, meinte sie.
»Und ich will ihn dir bringen. Was dir die Mutter auch im ersten Zorn gesagt haben mag, sie wird es bald bereuen und ihr Unrecht einsehe, denn das hat sie.«
»Nein, sie hat recht«, schluchzte Franziska, »ich bin schuld daran, dass Zalina ihren Tod gefunden hat. Wer konnte das aber auch ahnen!«
»Ja, wer konnte das ahnen! Angenommen, ich bestelle einen Freund, den ich liebe, meinen Vater oder dich an eine Stelle zur Zusammenkunft, und komme ich hin, so finde ich dich tot, von Mörderhand gefallen — hätte ich einen Grund, mein Gewissen wegen deines Todes anzuklagen?«
Überrascht hob Franziska den Kopf. Ja, das war ein Trost, dieses Beispiel leuchtete ein.
»Und habe ich nicht ebensoviel Schuld wie du, ja, eine noch viel größere als du?«, fuhr Oskar fort. »Ich gab die Veranlassung dazu, dass der Räuber in das Haus einbrach und, als er einer Person begegnete, die ihm lästig war, diese niedermachte. Ich wusste, dass die Sachen, die ich dem Vater zum Aufheben gab, für gewisse Personen von großem Werte waren, dass sie einen Mord nicht scheuten, um in ihren Besitz zu kommen. Glaubst du, mein Gewissen klagt mich an? Nicht im mindesten! Ebenso wenig, wie wenn ich einem Bankier eine Summe übergebe und er dieses meines Geldes wegen ermordet wird. Lass deine Selbstvorwürfe also!«
»Ich danke dir, Oskar«, murmelte Franziska; »aber immerhin, meinetwegen ließ Zalina die Tür offen. So bin ich doch schuld daran, dass dir die Sachen gestohlen worden sind, auf die du soviel Wert legst.«
»Oh, Franzy, da bist du im größten Irrtum. Diejenigen, welche eindringen wollten, hätten den Weg auch in einen zugemauerten Turm gefunden. Die offene Tür begünstigte nur ihren Eintritt, nichts weiter.«
Franziskas Gesicht hellte sich immer mehr auf.
»Und die Mutter«, sagte sie noch einmal ängstlich, »ist so entrüstet, sie dringt in mich, ich soll gestehen, wer — was — und der Vater lässt sich gar nicht sehen, er zürnt mir auch.«
»Er zürnt dir nicht, versichere ich dir. Höre meine Ansicht; folge dem Weg, den du für den besten hältst, folge deinem Herzen, und dass meine Franzy ein gutes Herz hat und nicht leichtsinnig ist, das weiß ich.«
Noch einen warmen Händedruck wechselte Oskar mit der Schwester, dann eilte er hinaus, fest überzeugt, eine gute Tat vollbracht zu haben. Er hatte noch eine Unterredung mit der Mutter, und es gelang ihm, auch diese für Franziska umzustimmen. Nur dass die Tochter hinter ihrem Rücken eine Liebelei angesponnen, konnte sie nicht so leicht verzeihen, und dass sich Franziska beharrlich weigerte, den Namen des Liebhabers zu nennen, erzürnte sie.
Oskar durchschaute die Mutter; diese fühlte sich in ihrer Ehre gekränkt, weil sie sich für eine scharfsinnige Frau gehalten hatte, der nichts entgehen konnte, was ihre Kinder anbetraf, und nun sah sie plötzlich. dass sie ganz blind gewesen war.
Oskar begab sich nach der Villa zurück.
»So haben sie das Fell und den Arm doch wiedererlangt«, dachte er unterwegs; »wie viel muss ihnen also daran gelegen sein! Kein Zweifel, ich habe eine Person um mich, die mich und meine Pläne an sie verrät. Wer mag das sein? Ich werde von jetzt ab auf Hedwig ein scharfes Auge haben.«
Zwischen Reis-, Baumwolle- und Teefeldern, umgeben von Orangenhainen und kleinen Dattelwäldern, lag idyllisch ein großes Dorf, oder vielmehr eine kleine Stadt, denn der Ortsvorsteher führte den stolzen Namen Mankdrallah, was so viel wie Bürgermeister bedeutet.
Die Niederlassung machte aber doch ganz den Eindruck eines Dorfes, die Hütten bestanden aus Lehm, durch Bambusrohre zusammengehalten und mit Schilf gedeckt, nur das Haus des Ortsvorstehers bestand ganz aus Bambusrohr, ebenso wie das ihm gegenüberliegende, und wenn wir hören, dass es noch größer war als das seinige und nur aus zwei großen Räumen bestand, mit Teppichen belegt, aber sonst unbewohnt war, ferner, dass an dem Orte eine Landstraße vorüberging, so ist leicht der Schluss zu ziehen, dass dieses leere Haus die Karawanserei war, die unentgeltliche Herberge für Wanderer, in welcher der Reisende auch mit Essen versorgt wird, ohne den Beutel ziehen zu müssen.
Es war gegen Abend. Die fleißigen Feldarbeiter, männliche und weibliche, kehrten heim, die Kinder liefen ihnen entgegen, bald flammten vor den Hütten Feuer auf, nicht um Licht zu verbreiten, denn es war noch völlig hell, sondern um das Abendessen, die Hauptmahlzeit des Tages, zu bereiten.
Da verstummte das fröhliche Geschwätz in der Dorfgasse, die Weiber vergaßen den Löffel im Gemüse zu rühren, die Männer reckten die Hälse und warfen sich bedeutsame Blicke zu, und die Kinder steckten die Finger in den Mund und rissen die Augen auf.
Durch die Dorfgasse nämlich kam in einem sogenannten Hundetrab eine wichtige Person gerannt — ein in englischen Diensten stehender Beamter. Dieser Mann trug zwar keine Uniform, sondern nur einen kleinen Schurz um die Lenden, aber die Binde mit den englischen Farben um den linken Arm, stempelte ihn zum Beamten, und die lange Bambusstange auf der rechten Schulter, an jedem Ende ein Paket so tragend, dass die Stange das Gleichgewicht hielt, ließ ihn als Postboten erkennen.
Mit langsamen, aber weiten Sätzen eilte der braune, nackte Kuli dahin, das Rohr auf den Schultern machte starke Schwingungen, ohne ihn im Lauf zu stören.
Dieser Briefbote war keine seltene Erscheinung, jeden Morgen und jeden Abend rannte er durch das Dorf, aber immer schaute man ihm mit gleicher Hochachtung nach, denn er war ja trotz seiner Nacktheit ein Beamter.
Einen Brief gab er hier niemals ab, höchstens ein- oder zweimal im Jahre einen an den Ortsvorsteher, einen amtlichen Befehl, sonst rannte er schlank hindurch, der nächsten großen Stadt zu.
Heute aber wurde die Bewunderung zum Staunen. Der Briefbote fiel vor dem Hause des Mankdrallah in Schritt und verschwand in demselben.
Was hatte das zu bedeuten? Ein Brief für den Ortsvorsteher? Ah so, vor einer Stunde war durch das Dorf ein einfach gekleideter Engländer, auf einem kräftigen Pferde sitzend und nur begleitet von einem einzigen Diener, gekommen und hatte im Hause des Ortsvorstehers Quartier genommen.
Vielleicht war der Brief für ihn.
Die guten Leute täuschten sich, der Postbote hatte gar keinen Brief abzugeben.
Der Mankdrallah, ein kleiner, untersetzter Mann mit aufgedunsenem Gesicht und hervorquellenden Augen, stürzte dem Läufer atemlos mit ausgestreckter Hand entgegen; an einer Türspalte erschienen einige neugierige Frauen- und Mädchengesichter.
Der Postbote schüttelte den Kopf.
»Nichts«, sagte er, »aber etwas anderes, eine wichtige, wichtige Nachricht.«
»Was denn?«
»Hast du ein besseres Kleid als dieses?«
»Ja, warum denn?«
»Der Gouverneur, der große Gouverneur muss heute noch hier durchkommen.«
Der dicke Inder sank vor Schreck fast in die Knie.
»Der große Gouverneur, der richtige große?«, stammelte er.
»Der richtige große.«
»Wo — woher weißt du das?«
»Ich weiß es; wer es mir sagte, darf ich nicht verraten, ich darf überhaupt nichts verraten, denn ich bin Beamter.«
Damit rannte der Kuli in noch längeren Schritten davon, um die versäumte Zeit nachzuholen. Seitenstechen und Atemlosigkeit sind diesen Kulis unbekannte Begriffe.
»Der Gouverneur, der große Gouverneur kommt heute noch hier durch«, murmelte der Mankdrallah, ohne sich von der Stelle bewegen zu können, denn der Schreck war ihm in die Glieder gefahren.
Also der Generalgouverneur von Indien sollte heute dieses Dorf passieren, der Briefbote hatte es gesagt, und der musste es ja ganz genau wissen.
Endlich kam wieder Bewegung in den Dicken. Zur Verzweiflung der weiblichen Familienmitglieder begab er sich nicht erst zu ihnen, um ihnen mitzuteilen, was ihm der Postbote ins Ohr geflüstert hatte, sondern ging zu dem vor einer Stunde angekommenen reisenden Engländer.
In dem Gemach war ein Feldtisch aufgeschlagen, desgleichen ein Stuhl und ein Bett, welche durch den Reisenden auf einem Maultier transportiert worden waren. Der Fremde, ein Mann von mittleren Jahren, in grauem Tropenanzug, hatte auf dem Tisch ein Mikroskop aufgestellt und betrachtete durch dasselbe den Kopf eines eben gefangenen Käfers. Sein eingeborener Diener leistete ihm dabei Handreichungen.
Der Mankdrallah hatte vor diesem Faringi keinen allzu großen Respekt, denn er war ja nur zu Pferd, mit einem ebenfalls berittenen Diener und einem beladenen Maultier angekommen, und so einfach reist in Indien selten ein Engländer. Es war jedenfalls ein ganz unbedeutender Mensch, dachte der Mankdrallah, nur so ein armer Kerl, wenigstens den anderen Faringis gegenüber, aber er war doch immerhin ein Engländer und konnte dem Mankdrallah einen Rat geben.
»Der Gouverneur, der große Gouverneur kommt heute hier durch«, stürzte er ins Zimmer. Verwundert schaute der Fremde von seinem Mikroskop auf.
»So? Woher weißt du denn das?«
»Der Briefbote hat es gesagt.«
»Wann soll er denn kommen?«
»Bald, sehr bald!«
»Hast du ihn schon einmal gesehen?«, fuhr der Fremde lächelnd fort.
»Ich? Nein. Der ist ja immer in seinem mächtigen Palast zu Delhi und erteilt Befehle.«
»Soso, also er soll heute hier durchreisen! Na, da empfange ihn nur gut, damit er sich freut und dir etwas schenkt.«
»Vielleicht schläft er hier.«
»Das glaube ich kaum. Weißt du, solche große Herren reisen lieber etwas länger, damit sie in einer Stadt über Nacht bleiben können. Da gibt es bessere Häuser.«
»Ach so, das ist wahr.«
Der Ortsvorsteher kratzte sich in den dichten Haaren.
»Was mache ich denn nun, wenn er kommt, Sahib?«, fragte er dann kleinlaut.
»Gar nichts.«
»Aber der große Gouverneur.«
»Er soll keine Empfangsbegrüßungen lieben.«
»Das sagst du nur, weil du ihn gar nicht kennst, Sahib. Nein, nein, ich muss ihn begrüßen.«
»Dann tue es. Er wird jedoch wohl nicht kommen.«
»Er kommt, ich weiß es ganz bestimmt.«
Da sich der Mankdrallah von dem ungefälligen Sahib keinen Rat holen konnte, wie er den großen Gouverneur empfangen könne, so handelte er nach eigenem Gutdünken.
Fünf Minuten später durchzog ein Inder, eine weiße Binde um den Kopf, das Dorf, machte durch Zusammenschlagen zweier Becken einen Höllenlärm, und verkündete in den Zwischenpausen mit weitschallender Stimme, alle Bewohner, Männlein, Weiblein und Kinder, sollten sofort jede Arbeit stehen und liegen lassen, die Kochtöpfe vom Feuer nehmen und das beste anziehen und anhängen, was ihre Hütte berge, denn der große Gouverneur von Indien käme noch heute Abend durch das Dorf, der große Gouverneur, der dem Padischah zu befehlen hätte, den die Maharadschas bei Tisch bedienen müssten, dem die Radschas die Füße küssten, der die Mörder und Diebe mit eigener Hand aufhänge, der dafür sorge, dass in Indien abwechselnd die Sonne scheine und es wieder regne, damit die Früchte auf dem Feld gediehen und die Kulis etwas zu essen hätten und so weiter und so weiter, alles Worte, die der Mankdrallah dem Ausschreier in der Eile in den Mund gegeben hatte, und welche den Generalgouverneur mindestens zum lieben Gott von Indien machten.
Es war sehr bezeichnend, dass gar nicht der Reichtum des erwarteten Mannes erwähnt wurde, sondern nur seine Macht. Andere ungebildete Völker preisen immer den Reichtum und den Glanz der fremden Gäste, die Inder aber sind diesen durch die einheimischen Fürsten im größten Maße gewöhnt, ihnen imponiert nur die Macht und Herrschaft, die jemand ausübt.
Ein Leben und Hasten begann, wie das Dorf es noch gar nicht gesehen hatte. Die Feuer wurden gelöscht, die Kochtöpfe umgeworfen — denn man brauchte sie jetzt leer — in den Hütten wurden Kleider aus Bambuskörben gerissen, die Haare gesalbt; die Weiber und Mädchen schmückten sich mit Messingketten und Spangen, mit Ohrringen von zehn Zentimeter Länge, wertlos, aber glitzernd; wer kein gutes Kleid hatte, borgte sich eins vom Nachbar, die sonst nackten Kinder wurden in rote Tücher gewickelt, wie überhaupt Rot eine große Rolle spielte.
Als der Mankdrallah vor der Tür seines Hauses erschien, erregte er das größte Erstaunen; so nobel hatte er sich noch nie gezeigt. Die funkelnagelneuen, weißen Hosen saßen stramm wie Trikots an den dicken Beinchen, der lange Rock war scharlachrot, ebenso der ungeheure Turban. Gravitätisch, einen Stock mit goldenem Knopf unterm Arm, schritt er auf und ab, aber sein Herz pochte zum Zerspringen vor heimlicher Angst.
Endlich huschten kleine, nur mit einem Hemd bekleidete Gestalten, über die Straße, jede hatte wenigstens noch was Buntes auf dem Leibe, und wenn es auch nur ein Busentuch oder ein Gürtel war, alles spähte, die Hand vor den Augen, gegen die untergehende Sonne, denn von da sollte der mächtige Mann kommen.
Handbereit lagen Töpfe, Schüsseln, Löffel und andere — nicht etwa Essgerätschaften — Musikinstrumente da und ferner Gegenstände, welche aus Därmen gefertigt zu sein schienen und zu irgendeinem noch unbekannten Zwecke dienen mussten. Vorläufig wurden sie an dem Brunnen vor der Karawanserei mit Wasser gefüllt.
»Wird er kommen, oder wird er nicht kommen?«
Diese Frage lag mit Zentnerschwere auf aller Herzen, man vergaß darüber ganz den Hunger. Die armen Leute hatten ja ihr Abendessen eingebüßt.
Die Kinder wollten vorauslaufen und kundschaften, ob er käme, aber der strenge Befehl des Mankdrallah hielt sie zurück. Ein etwaiger Empfang sollte mit intensiver Heftigkeit erfolgen, was den Pomp vergrößerte.
Der Ortsvorsteher raffte sich auf, er bekämpfte seine heimliche Angst und teilte seine Untergebenen auf. Er war natürlich der erste, der dem hohen Herrscher entgegenkam, dann aber folgte ein ganz gewöhnlicher Feldarbeiter, der nur den Vorzug besaß, eine ungeheure Stimme zu besitzen. Er konnte wie ein Tiger brüllen und noch etwas lauter.
Da der Mann nur ein Hemd besaß, hatte der Ortsvorsteher ihn mit seinen eigenen Sachen ausstaffiert, und zwar bunt wie einen Pfauhahn.
»Wenn ich den Stock hebe«, sagte er zu ihm, »fängst du an zu schreien, so laut, dass die Hütten einfallen, und wenn auch deine Lunge platzt; und ihr«, wandte er sich an die umstehenden Männer, »ihr brüllt mit und macht Musik, so schön und laut wie möglich. Immer hübsch zusammen, eins, zwei, und immer gut brüllen.«
Nun instruierte er seine dicke Ehehälfte, die wie ein bunter Schmetterling aussah, nur nicht so graziös, und an der Spitze der Frauen und Mädchen des Dorfes stand. Sie und die Töchter des Mankdrallah trugen so viel Messing an Hals, Armen und in den Ohren, wie alle übrigen Weiber zusammen, wenigstens ein Kilogramm.
»Er kommt!«, schrie ein Junge vom Baume herab. Ja, er kam.
Eine Staubwolke wirbelte in der Ferne auf der Landstraße empor, dann erschien zuerst ein mächtiger Elefant, später tauchten zur Seite und hinten Reiter und Läufer auf.
Der Elefant trug einen offenen Baldachin, in dem ein Mann saß — es konnte niemand anders sein als der große Gouverneur.
Noch verharrte die Menge bewegungslos und lautlos, doch schon hatte der Schreier den Mund so weit aufgerissen, dass eine Taube darin Platz gehabt hätte.
Da hob der Mankdrallah den Stock, fort stürzte der kleine, dicke Mann, wie eine Kugel rollte er die Landstraße hin, dem Zuge entgegen, und hinter ihm her die Männer, Frauen und Kinder, nicht mehr ruhig, sondern mit einem ohrenzerreißenden Lärm.
Die Kochtöpfe prasselten zusammen, die Löffel und Messer rasselten auf den Blechschüsseln und Tellern, und dazu schrie, brüllte, gellte und heulte es, als ob alle Teufel der Hölle entfesselt wären.
Man hatte den Elefanten erreicht. Man umtobte ihn, schlüpfte ihm zwischen den Beinen hindurch und schwang die Konzertinstrumente hinauf; nie vergaß man aber dabei, sie zu rühren, das Geheul währte fort, und der Schreier brüllte wie ein angeschossener Tiger.

Der Mann in dem Baldachin, der Gouverneur, kannte natürlich die Sitten der Eingeborenen und schaute gleichgültig wie seine Diener auf die Menge herab. Es war eben ein indischer, ehrenvoller Empfang, wie jeder Reisende ihn erhält, der mit großem Gefolge ein Dorf passiert, weiter nichts.
Dann aber hatte er die Vorsicht, sein Gesicht mit einem Tuche zu bedecken, und das war gut, denn jetzt hatten auch die Weiber und Kinder den Zug erreicht, und plötzlich schossen aus den seltsamen Gerätschaften aus Schafsdärmen, durch einen Druck der Hand hervorgetrieben, unerschöpfliche Wasserstrahlen, überschütteten den Elefanten, und reichten auch hinauf bis zum Reiter im Baldachin, ihn bald vollkommen durchnässend.
Dem Elefanten schien das Duschbad nach der langen Reise sehr angenehm zu sein, er schwenkte den Rüssel und grunzte behaglich. Der Engländer ließ die Strahlen geduldig über sich ergehen, das Gesicht war durch das Tuch vor ihnen geschützt. Es ist nun einmal in Indien Sitte, den Reisenden, den man ehrenvoll empfangen will, mit Wasser zu bespritzen, wie wieder andere Völker, z. B. die Orientalen, dem Gast die Füße waschen. Es hat ja auch nichts weiter zu sagen. Der Reisende wechselt seine Kleidung sowieso mehrmals des Tages, und täte er dies auch nicht, so hätte die heiße Sonne sie in fünf Minuten doch wieder getrocknet.
Schließlich ist so ein Duschbad nach staubigem Marsche auch ganz erfrischend.
Umgeben von der tobenden und spritzenden Menge zog die Karawane in das Dorf ein, und dem Mankdrallah fiel das Herz wieder in die Kniekehlen, als der Elefant vom Mahaut, dem Führer, nach der Karawanserei gelenkt wurde und dort hielt.
Der Generalgouverneur wollte doch nicht etwa...
Wahrhaftig, dem Führer wurde ein Brett gereicht, er legte es vom Baldachin aus nach dem Dach der Karawanserei und darüber hinweg schritt der Gouverneur, dann die Leiter herabsteigend.
Er wollte also wirklich hier übernachten; schon sprangen die berittenen Eingeborenen ab, die anderen beschäftigten sich mit dem Gepäck.
Scheu wichen die Umstehenden vor dem mächtigsten Manne in Indien zurück, eine lautlose Stille trat ein.
Der Mankdrallah hatte Lust, sich hinter seiner Ehehälfte zu verkriechen, diese jedoch, eine energische Dame, gab ihm einen Puff in die Seite, der ihn in den Kreis schleuderte, in welchem der Gouverneur stand und sich umschaute, da er den Ortsvorsteher erwartete.
Jetzt war dieser vor ihm. Der dicke, kleine Mann, der den Stock verloren hatte, machte nur eine einzige Verbeugung, das heißt, er knickte rechtwinklig zusammen und blieb so stehen, und da er kurze Beinchen, aber lange Arme besaß, die er herabhängen ließ, so sah es gerade aus, als ob er auf allen vieren stände.
Er sah sich genötigt, den hohen Herrn zu begrüßen, und murmelte daher ohne Unterbrechung unverständliche Worte hervor.
»Bist du der Mankdrallah?«, fragte der Gouverneur.
Der Mann stieß ein vollkommen unverständliches Grunzen aus.
»Gut, ich werde diese Nacht bei dir bleiben. Weise mir zwei Zimmer in deinem Hause an, eins für mich, das andere für meinen Diener. Die Übrigen bleiben in der Karawanserei.«
Der Mankdrallah warf sich unbehilflich herum und lief ins Haus. Da er sich auch beim Gehen nicht aus seiner gebückten Stellung emporrichtete und dabei mit den langen Armen, deren Hände so ziemlich den Boden berührten, taktmäßig schlenkerte, so sah es fast aus, als liefe ein großer Affe auf allen vieren davon.
Der Engländer sandte ihm einen verwunderten Blick nach und wendete sich dann an einen vom Pferde gesprungenen Inder mit einem scheuen und zugleich finsteren Gesicht.
»Aleen«, sagte der Herr zu ihm, »sorge, dass zuerst mein Gepäck ins Zimmer kommt, und richte es ein. Lass die Kulis sich um das andere kümmern. Hier scheint noch gar kein reisender Engländer durchgekommen zu sein«, fügte er leiser hinzu, »die Leute empfangen mich ja gerade, als wäre ich der Herr des Landes.«
»Es scheint so Sahib«, entgegnete der Inder und machte sich mit dem Gepäck zu schaffen.
Der Engländer ging ins Haus; an der Tür empfing ihn wieder der seltsame, vierbeinige Mensch und lief ihm voran nach einem Zimmer, wo er stehen blieb.
Lächelnd betrachtete der Reisende den Mann.
»Bist du der Mankdrallah?«, fragte er nochmals.
Das Tier hob das rechte Vorderbein und senkte den Kopf zur Bejahung.
»Bist du so krumm gewachsen?«
Der Ortsvorsteher hatte vorhin von seiner Frau etwas Mut eingeflößt bekommen, er fand die Sprache wieder.
»Nein...«, entgegnete er, das Nein deutlich aussprechend, das folgende Wort aber zerfloss in einem Murmeln.
»Wie nennst du mich?«
Wieder ein unverständliches Grunzen.
»Es ist schön, dass du einem Fremden gegenüber höflich bist, doch so höflich, dass du auf allen vieren herumkriechst, brauchst du nicht zu sein. Es ist gut, du kannst gehen.«
Das Tier warf sich auf den Hinterbeinen herum und trabte hinaus.
Der mit Aleen angeredete Diener kam herein und brachte die Bettstelle seines Herrn.
»Was hat dieser unterwürfige Empfang nur zu bedeuten?«, fragte ihn sein Herr. Über die finsteren Züge des Inders flog ein leichtes Lächeln.
»Hast du nicht gehört, Sahib, was die Leute dir vorhin beim Entgegenkommen zuriefen?«
»Ich hörte nichts weiter als ein wütendes Gebrüll.«
»Es waren Worte.«
»Was riefen sie?«
»Sie glauben, du seiest der große Gouverneur, der Generalgouverneur von Indien.«
»Das wäre!«
»Ich werde mich noch einmal heimlich erkundigen.«
Als er wieder, mit dem übrigen Gepäck beladen, hereinkam, bestätigte er seine vorige Aussage.
»Der Postbote hatte die Nachricht verbreitet, der Generalgouverneur käme heute noch durchs Dorf: und nun halten sie dich, Sahib, für denselben.«
»Ah, nun kann ich mir die übergroße Höflichkeit erklären. Es ist Torheit, ich weiß bestimmt, dass Lord Canning nach Berar gereist ist.«
»Aber nicht nur die Dorfbewohner, auch die von dir gemieteten Diener glauben plötzlich, du seiest wirklich der Generalgouverneur, und behandeln sogar mich, als deinen Diener, mit der größten Ehrfurcht«, fuhr der Inder lächelnd fort.
Während Aleen einen Tisch, Stühle und das Bett für die Nacht aufschlug, saß der Herr sinnend am Fenster und stützte den Kopf in die Hand.
Seltsam, dieser Empfang! Er war nicht abergläubisch, er wollte es wenigstens nicht sein, aber dennoch...
Der liebe Leser wird schon gewusst haben, als der Engländer den Diener Aleen rief, dass es niemand anders als Edgar Westerly war, jetzt Lord Westerly, dem zufällig solche Ehren erwiesen wurden.
Hatte er dies nicht schon einmal geträumt? Zuerst träumte er, er befände sich im Hause seiner Eltern als Herr, als Lord, und der Traum war buchstäblich in Erfüllung gegangen. Dann hatte er geträumt, man empfinge ihn in Indien mit Auszeichnung, er würde zum Generalgouverneur, ja, selbst zum König ausgerufen. Sollte auch dies in Erfüllung gehen? War dies schon ein Anfang, eine Einleitung?
Lächelnd wollte er die Gedanken abschütteln.
»Du schweigst!«, sagte er zu Aleen.
»Mankdrallah!«, rief er dann.
Sofort trollte der Kleine in seiner gebückten Stellung herein, die Hände immer auf dem Boden. Sein Kopf war vor Anstrengung ganz rot geworden.
»Weißt du, wer ich bin?«, fragte ihn Westerly.
Das rechte Vorderbein ward über den Kopf gehoben.
»Nun wer?«
Nur ein Grunzen erfolgte.
Westerly trat vor den seltsamen Kauz hin, der sich schleunigst zurückzog, bis sein Hinterteil die Wand berührte.
»Richte dich einmal auf und benimm dich wie ein Mensch. Mir tut schon das Kreuz weh, wenn ich dich nur ansehe. Hier, nimm, mach ein Loch durch und hänge es deiner Frau an die Nase.«
Er reichte dem Manne ein großes Silberstück, für den Inder ein Vermögen bedeutend. Jetzt endlich richtete er sich auf und machte dabei ein Gesicht, das deutlich verriet, wie ihn der Rücken schmerzte.
»Hast du die Sprache wiederbekommen?«
»Ja, Sahib.«
»Nun, wer bin ich?«
»Der Gouverneur.«
»Der Gouverneur?«
»Ja, der große, große Gouverneur von Indien, dem alles gehört, was in Indien ist, dem alle gehorchen müssen, Radschas und Hindus und der Großmogul und alle Kulis, und der so mächtig ist, dass sie alle...«
»Schon gut, schon gut! Du scheinst ein treuer Diener zu sein und treu an England zu hängen.«
»Sahib, es gibt in ganz Indien keinen treueren Diener und niemanden, der dich mehr liebt als ich.«
»Ich danke sehr für deine Liebe, sie macht mich glücklich. Damit du siehst, dass der Generalgouverneur auch freigebig sein kann, will ich heute ein Fest veranstalten.«
Des Dicken Augen leuchteten auf. Der Löwenanteil musste bei so etwas immer ihm und seinem Hause, das den Gast beherbergte, zufallen.
»Habt ihr Schlachtvieh da?«
»Ziegen, Schafe, Gänse, Enten Hühner«, zählte der glückliche Bürgermeister auf.
»So schlachtet so viel davon, wie ihr essen könnt, und verbraucht, was ihr euch für schwere Zeiten gespart habt. Ich werde es morgen bezahlen. Halt«, rief er dem Hinauslaufenden noch einmal zurück, »ist heute schon ein Fremder durchs Dorf gereist?«
»Nein, Sahib, es ist aber noch einer hier.«
»Ein Faringi?«
»Ja, Sahib.«
Unangenehme Überraschung malte sich im Gesicht Westerlys.
»Warum hast du mir das nicht eher gesagt?«
»Du fragtest nicht danach.«
»Wo ist denn sein Gefolge?«
»Er hat nur einen Diener mit sich, der in seinem Zimmer mit ihm schläft.«
»In der Karawanserei?«
»Nein, in diesem Hause.«
»Wo?«
»Auf der anderen Seite.«
»Sprach er Indisch?«
»So gut wie ich.«
»Was ist er?«
»Ich weiß nicht, Sahib, aber ich glaube, es ist eben so ein Mann, wie schon früher einmal einer hier war.«
»Was war das für ein Mann?«
»Er hatte Gläser vor den Augen und guckte den ganzen Tag draußen auf dem Felde durch ein langes Rohr, das auf drei Beinen stand, schrieb, rollte eine lange Leine immer auf und ab, und war er hier im Hause, so malte er auf einem großen Tische.«
»Ach so, ein Geometer! Der Faringi ist auch ein Geometer?«
»Er kam erst vor zwei Stunden an und packte auch gleich so eine goldene Röhre aus, durch die er guckt, und schreibt in einem Buche.«
»Es wird ein Geometer sein. Es ist gut, ich will ihn nicht kennen lernen. Besorge den Auftrag!«
In Gedanken versunken, ging Westerly im Zimmer auf und ab. Man drängte ihm die Rolle des Generalgouverneurs auf, und Westerly hatte keinen Grund, diese Leute vom Gegenteil zu überzeugen. Das hätte überdies wahrscheinlich unsagbare Mühe gekostet, wäre jedenfalls ganz unmöglich gewesen.
Westerly beschloss also, sich ganz ruhig weiter Generalgouverneur titulieren zu lassen. Niemand hatte einen Nachteil davon.
Die Ehre, die ihm hier in dem kleinen Dörfchen von unwissenden, indischen Bauern widerfuhr, war überhaupt äußerst gering. Und dennoch, der ehrsüchtige Westerly fühlte sich geschmeichelt; er, der über jeden Aberglauben spöttelte, musste fortwährend an seinen Traum denken, von dem sich schon ein Teil erfüllt hatte.
Während er im Zimmer auf und ab schritt, bereitete ihm Aleen auf einer Spiritusmaschine aus Konserven ein delikates Abendbrot.
Auf der Dorfstraße, noch immer vom Abendsonnenschein erleuchtet, erschollen jauchzende Jubelrufe, die Bauern hatten die fettesten Ziegen und Schafe aus ihren Herden gewählt und trieben sie vorüber, der Schlachtbank zu.
Die Frucht auf den Feldern war ihr Brot, die Herden ihr Vermögen, und dieses griffen sie nicht an. Zinsen genossen sie wenig davon, die fraßen gewöhnlich die Tiger, Panther, Schakale und andere Raubtiere, das übrige rafften Seuchen dahin. Nur bei Hochzeiten oder anderen Festen spendierte ein Reicher einmal ein mageres Tier.
Heute durften sie schlachten, denn morgen wollte ja der Gouverneur zahlen, und bares Geld war auch ihnen am liebsten.
Die Kochtöpfe, welche dem Empfangskonzert nicht zum Opfer gefallen waren, hingen bald über flackernden Feuern, und an anderen wurden saftige Keulen an Spießen gedreht.
Unbewusst nahm Westerly die ihm von Aleen aufgetragene Abendmahlzeit ein, seine Gedanken verweilten noch immer bei dem Traum. Nur eines fehlte ihm noch, dann war auch das alles erfüllt; wo waren die...
»Sahib«, sagte Aleen am Fenster, »der Mankdrallah lässt die Mädchen des Dorfes vorbeiziehen.«
Westerly schrak zusammen, obgleich er keinen Grund dazu hatte. Er trat mit geringschätzendem Lächeln ans Fenster und blickte hinaus.
Unten zogen die jungen Mädchen des Dorfes vorbei, festlich geschmückt, wie der Mankdrallah es befohlen hatte und wie sie es aus eigenem Antriebe getan, um dem hohen Gast zu gefallen.
Wie die Ziegen und Schafe waren auch sie Schlachtopfer.
Der Mankdrallah stand neben seiner Frau und kommandierte:
»Kopf höher«, rief er der einen zu, »halte dich gerader«, einer anderen. Die Mädchen gehorchten, sie gaben sich die möglichste Mühe, einen guten Eindruck zu machen, gekleidet waren sie so, dass ihre Reize sichtbar waren, und wo ein Tuch noch etwas verhüllte, zog die Frau Ortsvorsteherin es zur Seite.
Vor dem Hause blieben sie stehen. Die meisten schauten gleichgültig geradeaus, nur wenige senkten den Blick beschämt zu Boden, und nur zwei, welche schon in einer größeren Stadt gewesen waren, kokettierten zum Fenster hinauf. Alle wünschten, der anwesende Faringi mochte recht bald seine Wahl treffen, damit die Übrigen sich auch noch an den Vorbereitungen des Festes beteiligen könnten.
Es ist eine Sitte oder eine Unsitte, wie man es nimmt, die man in den südlichen Ländern überall antrifft, dass dem reisenden Gast im Nachtquartier Mädchen angeboten werden. In den Tagebüchern der Afrikareisenden findet man immer die Notiz, wenn sie von einem schwarzen Häuptling gastlich aufgenommen wurden: er schenkte mir einige Sklavinnen, oder, er stellte mir einige seiner Weiber zur Verfügung. Ebenso ist es in dem zivilisierten Orient, ganz besonders in Ägypten. Auch da werden dem Gast vor dem Schlafengehen in jedem Dorfe Mädchen vorgeführt, nicht nur dem reisenden Scheich oder englischen Offizier, sondern oft genug auch dem armen europäischen Handwerksburschen. Es gehört dies eben zur Gastfreundschaft; ländlich — sittlich.
So ist es auch in Indien, von dem malaiischen Archipel gar nicht zu reden, wo das holländische Militär eine geradezu schreckliche Sittenlosigkeit eingeführt hat. Bekanntlich werden der holländischen Fremdenlegion von der Regierung aus unentgeltlich malaiische Weiber geliefert, die Soldaten müssen sogar heiraten, und die Kinder gehören der Regierung, sie werden wieder zu Soldaten erzogen.
Das Schiff nun, welches einen Hafen in Holländisch-Indien anläuft, wird gleich von Soldaten erstürmt, die ihre Frauen den Matrosen für eine Kleinigkeit, für einen Groschen, zum Kauf anbieten.
Auf dem indischen Kontinent haben besonders die Beamten der ostindischen Kompanie viel gefrevelt. Diese Herren waren allmächtig, ein reisender Kommis war der liebe Herrgott selbst; wohin er kam, mussten sich ihm alle Türen öffnen, und damit der Mankdrallah des Dorfes nicht erst grob angefahren wurde, ließ er gleich alle Weiber und Mädchen des Dorfes zusammenholen und stellte sie dem Beamten zur Auswahl vor.
Westerly schaute geringschätzend auf die Dorfschönen herab, für ihn war das nichts Neues. Er konnte diesen indischen Mädchen keinen Geschmack abgewinnen.
Es war eine Form der Höflichkeit, des ›guten Anstandes‹, die man dem hohen Gast schuldig war, weiter nichts.
Der Mankdrallah kroch wieder in seiner alten, gebückten Stellung herein.
»Sie sind versammelt, großer Gouverneur«, murmelte er, »die Schönsten, die dein Diener dir bieten kann. Lass dein Auge gnädig auf ihnen ruhen und suche die aus, welche würdig ist, in deiner Nähe weilen zu dürfen.
»Führe sie wieder fort!«, sagte Westerly gleichgültig. »Sie sollen an dem Feste teilnehmen.«
Die Mädchen marschierten wieder ab; jetzt vermischten sie ihr Jauchzen mit dem der übrigen Dorfbewohner.
Westerly blickte noch immer in den Abend hinaus. Auch seine eingeborenen Diener beteiligten sich an den Vorbereitungen der Schmauserei; sie hatten vor der Karawanserei Feuer entzündet, und häuteten die Schlachttiere ab, welche an der Bambuswand hingen.
Der Brunnen vor der Karawanserei war von Mädchen dicht umringt. Sie ließen an der langen Hebelstange den tönernen Krug hinab, brachten ihn gefüllt wieder herauf, setzten ihn auf den Kopf und balancierten ihn so mit sicherem Tritt nach ihrer Kochstätte.
Die zuletzt Kommenden stellten sich hinten an und warteten, bis die Reihe an sie kam. Ein junger Kuli bediente den Hebel und füllte den Mädchen unter Späßen und humoristischen Worten den Krug, setzte ihn auch jeder auf den Kopf und sorgte dafür, dass er überlief und sich das Wasser über Brust und Nacken des Mädchens ergoss, was stets ein kreischendes Gelächter hervorrief.
Da bemerkte Westerly ein Mädchen, welches in ganz auffallender Weise zurückgesetzt wurde. Zuerst stand sie immer hinten, die Neuankommenden stellten sieh immer wieder vor sie hin, dann rückte auch sie durch Zufall einmal langsam vor, aber wieder drängten sich andere vor ihr in die Reihe. Endlich, nach langem, langem Warten, hatte sie den Brunnen erreicht, sie hielt ihren Krug dem Burschen hin, dieser griff erst danach, zog aber die Hand schnell wieder zurück und sagte kopfschüttelnd etwas, worüber die anderen in ein lautes Gelächter ausbrachen.
Das Mädchen wurde sichtlich verachtet. Die Krüge aller anderen wurden gefüllt, sie hielt den ihren vergebens hin, bis sie ihn endlich auf den Rand des Brunnens setzte und geduldig wartete. Sie musste wahrscheinlich harren, bis alle mit Wasser versehen waren.
Westerlys Augen betrachteten entzückt dieses verachtete Mädchen. Ja, das war etwas anderes als die indischen Weiber, und sie war nicht unter denen gewesen, welche vorhin zur Schau gestellt wurden.
Es war etwas ganz Fremdländisches an ihr. Ihre Gestalt war klein und zierlich, aber herrlich entwickelt. Das Gesicht zeigte nicht den Typus der indischen Mädchen. Die Augen waren nicht etwas schiefliegend, sondern groß und rund; dichte, schwarze Brauen wölbten sich darüber, die Nase war leicht gebogen, der Mund sehr klein, der Teint nicht schwarzbraun wie der der Inder, sondern mehr ins Gelbliche spielend.
Auch ihre Kleidung war eine ganz andere, an die der Araberinnen erinnernd. Sie trug ein blaues Jäckchen, mit großen, blanken Knöpfen besetzt; den trotz ihrer zierlichen Figur vollen Busen bedeckte ein rotes, baumwollenes Hemd, welches jedoch in der Mitte nur ganz wenig offen war.
Ein blauer Rock reichte bis weit über die Knie, unter ihm aber sahen noch die roten, weiten Pantalons hervor, welche über einem plumpen, mit starken Sohlen versehenen Schuh am zarten Knöchel fest zusammengeschnürt waren.

Um den Kopf trug sie ein rotes Tuch geschlungen, unter dem blauschwarzes Haar hervorquoll. Obgleich die Entfernung ziemlich groß war, konnte Westerly doch das ausdrucksvolle Spiel der herrlichen, großen Augen bemerken und bewundern. Sie blickten schüchtern und ängstlich, als sich immer wieder andere Mädchen vor ihr eindrängten, und bittend, als sie dem Burschen den Krug zum Füllen hinhielt, und gleichgültig und stolz, zugleich aber auch wehmütig, als sie wartend dastand.
Und wie graziös lehnte sie sich an den Brunnenrand, die eine Hand auf den Krug gelegt, die andere leicht in die breite Hüfte gestützt, wobei der geschlitzte Ärmel auseinanderfiel und den vollen, runden, gelbbraunen Arm zeigte! Ihre Stellung drückte eine nachlässige Gleichgültigkeit aus, als läge ihr gar nichts daran, ob sie jetzt oder zuletzt daran käme; denselben Ausdruck versuchte sie auch dem Gesicht zu geben, aber es gelang ihr nicht. Sie sah so traurig aus.
Westerly konnte seine Augen nicht von der schönen Gestalt wenden.
»Mankdrallah!«, rief er.
Wie ein Wiesel schlüpfte der Gerufene sofort herein.
»Wer ist jenes Mädchen in dem blauen Kleide?«
»Nur eine Jüdin, Sahib«, war die verächtliche Antwort.
»Sie war vorhin nicht unter denen, welche du mir vorführtest.«
»Sie ist heute Nachmittag in Begleitung eines alten Juden zugereist gekommen. Beide schlafen in der Karawanserei.«
»Die Karawanserei muss jetzt doch ganz voll von meinen Dienern sein.«
»Das ist sie.«
»Und das Mädchen muss unter den Männern schlafen?«
»Ja, die Inder murren schon, dass sie mit der Jüdin unter einem Dache schlafen müssen«, entgegnete der Ortsvorsteher, Westerlys Frage einen anderen Grund gebend.
»Ist der Jude ihr Vater oder ihr Mann?«
»Ihr Vater; er ist alt und hässlich. Er ritt einen mageren Esel, sie ging zu Fuß nebenher. Ich hätte sie nicht in die Karawanserei gelassen, doch dein Befehl, Sahib, will es so.«
Die Karawansereien standen für jeden offen, es durfte niemand vom Zutritt ausgeschlossen werden.
»Warum gibt ihr der Bursche kein Wasser?«
»Sahib, sie ist ja eine Jüdin, muss also warten, bis alle anderen Wasser haben. Dann kann sie ihren Krug selbst füllen.«
»So geh du hin und fülle ihr den Krug.«
Der Mankdrallah glaubte falsch verstanden zu haben.
»Ich, Sahib?«, rief er erschrocken. »Ich soll die Jüdin bedienen?«
»Ja, du selbst.«
»Sahib, es ist ja ein Judenmädchen!«
»Hund, willst du gehorchen?«, rief Westerly, ergriff vom Tische eine Reitpeitsche und holte zum Schlage aus.
Blitzschnell war der kleine Mann verschwunden.
Gleich darauf sah Westerly ihn mit gravitätischen Schritten, aber weinerlichem Gesicht, zum Brunnen gehen. Die Mädchen, die dem Dorfschulzen nicht respektvoll auswichen, weil sie ihn nicht sahen, stieß er unsanft beiseite und sprach zu dem Burschen. Als dieser ihn erstaunt ansah, empfing er sofort eine Ohrfeige, dass er bald in den Brunnen gefallen wäre.
»Du Lump, du Hundesohn!«, brüllte ihn der entrüstet tuende Mankdrallah an. »Glaubst du etwa, weil das Mädchen eine Jüdin, eine schmutzige Jüdin ist, brauchst du ihr kein Wasser zu geben? Du bist ja selbst nichts weiter als ein räudiger Hund! Schnell, gib ihr Wasser, zu allererst und immer wieder zuerst, wenn sie wiederkommt. Und du?«, fuhr er ein anderes Mädchen an. »Was hast du den Mund vor Staunen aufzureißen?«
Patsch, klatschte seine Hand an ihren Kopf.
Der Bursche fragte nicht erst lange, was den Mankdrallah plötzlich so für die verachtete Jüdin einnahm; schnell griff er nach dem Kruge, da aber ließ sich Westerlys Stimme am Fenster vernehmen:
»Mankdrallah, du selbst sollst des Mädchens Krug füllen, sofort! Hörst du?«
Der Ortsvorsteher ließ sich das nicht zum zweiten Male von dem Gouverneur heißen; demütig schöpfte er Wasser, während die Jüdin erstaunt nach dem Manne am Fenster blickte, der ihr nicht nur so wohl wollte, sondern ihr sogar eine solche Auszeichnung zuteil werden ließ.
Westerly sah ihr nach, wie sie mit graziösem Schritt, sich in den breiten Hüften wiegend, dabei den Krug sicher auf dem Kopfe oder vielmehr auf der Stirn balancierend, der Karawanserei zuschritt und darin verschwand.
»Großer Gouverneur, ich habe deinem Befehl mit Freuden gehorcht, zürne mir nicht länger!«
Mit diesen Worten trat der Dicke wieder in das Zimmer, sich nicht mehr aus seiner Verbeugung aufrichtend.
»Lass dir gesagt sein, ich will nicht, dass diese Juden zurückgesetzt werden. Es geht auch nicht, dass dieses Mädchen in der von Männern gefüllten Karawanserei schläft. Hast du noch in deinem Hause ein Zimmer leer?«
Der Inder wagte nicht, den Gouverneur noch einmal daran zu erinnern, dass das Mädchen eine Jüdin sei, deren Aufenthalt in seinem Hause dasselbe verunreinige.
Im Zimmer rechts richtete sich eben Aleen ein, das Zimmer links war frei, und Westerly bestimmte es als Aufenthalt der Jüdin für die Nacht.
»Geh hinüber und bitte sie mit freundlichen Worten, in deinem Hause zu schlafen.«
»Sahib, sie wird es mir nicht glauben.«
»Warum nicht? Hole sie herüber, ich befehle es dir.«
»Auch den Juden?«
»Nein, der mag in der Karawanserei bleiben. Stelle ihm einige Mädchen zur Verfügung, dass er seine Tochter bei der Bereitung des Abendessens nicht vermisst.«
Der Mankdrallah hatte Einwendungen nur gemacht, um sich unwissend zu stellen, denn er wusste ganz genau, was der Faringi beabsichtigte.
Ob das Mädchen einwilligte, oder ob es sich weigerte, der Einladung Folge zu leisten? Nur an so etwas zu denken, war schon Torheit.
Der Inder der unteren Klassen war an sich willenlos, und noch mehr die Juden, obgleich diese durch ihr zusammengeschachertes Geld auch eine gewisse Macht ausübten, allerdings nur indirekt.
Westerly hielt den Inder noch einmal zurück.
»Du verstehst mich doch recht? Das Mädchen soll hier schlafen, weil die Karawanserei mit Männern überfüllt ist. Deute ihr meine Einladung nicht anders.«
Der Mankdrallah nickte schlau und ging. Die Karawanserei war wirklich bis auf den letzten Platz mit Teppichen belegt, auf denen später die jetzt draußen Schmausenden schlafen wollten. Es waren auch einheimische, berauschende Getränke ausgeteilt worden, die Diener führten selbst welche mit, und obgleich die Inder im Trinken mäßig sind, so war doch zu erwarten, dass es in der Karawanserei heute nacht noch manche Szene geben würde.
In einer Ecke hockten zwei Gestalten, das vorhin beschriebene Mädchen und ein alter Mann mit weißem Bart, in einem schmierigen Kaftan, und auf dem Kopfe ein Käppchen.
Zwischen sich hatten sie zwei Näpfchen stehen; in dem einen war Hartbrot in Wasser aufgeweicht, das andere enthielt einige Oliven.
Er nahm abwechselnd ein Stück Brot und eine Olive, doch das Mädchen biss von den Dingerchen ab, als könne sie eine ganze Frucht gar nicht in den Mund bringen, um dem Vater die Zukost zu überlassen. Das war ihre armselige Mahlzeit, die sie mit einem Trunk Wasser aus dem nebenstehenden Kruge würzte.
»Iss, Mirja«, nötigte der Alte das Mädchen, »iss nur Oliven und denke nicht immer an mich. Sind sie auch nicht billig, der Gott meiner Väter wird doch sorgen dafür, dass es dem alten Sedrack nicht fehlen wird daran.«
Das Mädchen schob die Schälchen dem Vater hin.
»Ich bin satt«, sagte es mit sanfter, etwas tiefer Stimme. »Ach, Vater, wären wir doch nicht hier eingekehrt. Die vielen Männer! Sie werden uns, wenn sie hereinkommen, belästigen und verhöhnen, wenn nicht gar hinausweisen.«
»Hat nicht der große Gouverneur von Indien dich genommen in seinen Schutz? Er wird die tausendfältig schlagen, die uns schlagen.«
»Er erbarmte sich meiner nur, weil er mich so lange warten sah. Jetzt wird er nicht mehr an uns denken.«
»Der große Gouverneur von Indien ist ein weiser Herrscher, wie Salomo, und gerecht, er wird auch noch weiter für uns sorgen, dass uns kein Leid widerfährt. Ich habe gehört, er nimmt sich auch der Auserwählten Gottes an, und Gott wird ihn nicht verdammen, wenn er die Christenhunde in den feurigen Pfuhl wirft, er wird ihn zu den Juden schicken.«
»Lass uns lieber die Karawanserei verlassen und im Freien schlafen«, bat das Mädchen.
»Wir bleiben!«, entgegnete der Vater mit Betonung.
»Der Sahib wird nicht an uns denken, man wird uns misshandeln!«
»Gott ließ vor Davids Höhle die Spinne ein Netz weben, fester denn eine Burgmauer; er wird auch uns eine unsichtbare Mauer bauen.«
Das Mädchen konnte dieser Glaube nicht beruhigen, ängstlich lauschte es dem johlenden Treiben.
Da kam der Mankdrallah herein, feierlich, mit wichtiger Miene; ihm folgten einige Mädchen mit Schüsseln voll dampfendem Fleisch und Gemüse.
Des Juden Augen erweiterten sich, er ahnte, dass auf Befehl des fremden Gastes auch seiner gedacht worden war. Er durfte das Fleisch essen, denn die Inder stechen die Tiere auch; und murmelte er einige Sprüche darüber, so war es für ihn koscher.
Der Mankdrallah blieb vor ihm stehen und berührte mit dem Stock seine Schulter.
»Der große Gouverneur, der mich beehrt hat, in meinem Hause zu wohnen, hat geruht, dir dieses Fleisch und Gemüse zu schicken, Jude. Er will nicht, dass deine Tochter in der Karawanserei unter den Männern schläft, sie soll in meinem Hause ein Zimmer für sich bekommen.«
Der Jude verneigte sich mit ausgebreiteten Armen und verzückten Augen.
»Sagte ich dir nicht, Mirja, der Gouverneur ist weise und gerecht wie Salomo? Er ist wert, ein Jude zu sein. Iss, Mirja, und geh mit dem Mankdrallah, der vor dem Herrn ist wie ein Wurm im Staube!«
Der Ortsvorsteher warf dem Juden, der plötzlich so keck wurde, da er einen Beschützer hatte, einen bösen Blick zu, schluckte aber seinen Zorn hinter.
»Das Mädchen mag gleich mitkommen«, sagte er, »für sie steht eine andere Mahlzeit bereit.«
Mirja war unschuldig; doch böse Erfahrungen hatten ihren Verstand gewitzigt, sie war misstrauisch.
»Ich, eine Jüdin, soll in deinem Hause schlafen?«, fragte sie argwöhnisch.
»Der gnädige Gouverneur will es so. Bei ihm gelten alle Menschen gleich.«
»Ja, ich gehe, wenn mein Vater mitkommt.
»Der bleibt hier!«, fiel der Inder hastig ein.
»Dann bleibe auch ich!«
Der Alte schüttelte missbilligend den Kopf. Seine Augen funkelten schon vor Begier, über das Fleisch herfallen zu dürfen, doch die Mädchen hatten die Schüsseln noch nicht hingesetzt.
»Warum zauderst du, Mirja?«, sagte er. »Fürchtest du dich? Warum? Hat dich der Gott Israels nicht schon in tausend Gefahren beschützt? Bist du dort sicherer als hier?«
»Du warst immer bei mir!«, murmelte sie leise.
»Und könnte ich dich schützen? Nur Gott kann es, und er wird auch dort bei dir sein! Ich bin alt und werde dich bald verlassen müssen. Geh, Mirja, unser Gott wird bei dir sein! Ich weiß, der große Gouverneur ist ein edler Mann und wird nicht missbrauchen die Hilflosigkeit eines armen Mädchens, das auch noch eine Jüdin ist. Geh, Mirja!«
Das Mädchen sah sich verlassen. Was blieb ihm nun übrig? Die Juden waren, wie die Kulis, nur Spielzeuge in der Hand der Europäer und Hindus, und in wie vielen Gefahren war Mirja schon gewesen, in welchen sie ihre Ehre verloren haben würde, wenn nicht Gottes Hand sie immer wunderbar beschirmt hätte. Diese Gefahr lauerte überall auf sie, auf der Landstraße, in der Herberge, an jedem Ort und in jeder Minute. Schließlich war es auch sicherer, sich dem Edelmut des Mannes anzuvertrauen, von dessen ernstem, sittlich strengem Charakter sie schon gehört hatte. Gesehen hatte sie ihn vorhin am Fenster zum ersten Male, und er hatte ihr gefallen. Wie hatte er sich gleich des verachteten Mädchens angenommen! Er hatte sogar den hochmütigen Inder vor ihr gedemütigt, und das weiß ein Weib zu schätzen.
In der Karawanserei wäre sie heute Nacht auf alle Fälle einem Angriff ausgesetzt gewesen; schlief sie im Freien, nicht minder. Ihr ganzes Leben war nur ein Kampf zur Wahrung ihrer Ehre. Nur einen verborgenen Ort wusste sie, wo sie bis jetzt wenigstens sicher gewesen war. Doch sie musste den Vater ja immer auf seinen Handelsreisen begleiten.
Das arme, schöne Judenmädchen erhob sich mit einem Seufzer, nahm sein Bündel und folgte dem vorausgehenden Mankdrallah. Als es sich in der Tür noch einmal umblickte, sah es noch, wie ihr Vater die Fleischstücke heißhungrig hinunterschlang.
Ach, auch Mirja hatte Hunger. Sie konnte sich kaum noch entsinnen, jemals satt gewesen zu sein. Und musste sie denn hungern? Ja, denn der Vater weinte bei jeder Kupfermünze, die er dem Geldbeutel entnehmen musste.
Sie ging dem führenden Mankdrallah ins Haus nach.
Westerly war allein in dem Gemach. Auf dem Tische brannte ein Licht, denn es war schon dunkel. Es beleuchtete ein von Aleen bereitetes Abendessen, bestehend in Konserven.
Jetzt hörte er draußen Schritte; zwei Personen betraten das leerstehende Zimmer nebenan —der Mankdrallah und seine Schutzbefohlene. Sie hatte also der Einladung Folge geleistet. Natürlich!
Der Inder ging noch mehrmals aus und ein, wahrscheinlich brachte er Teppiche und Matten zum Nachtlager, dann kam er nicht wieder. Drüben raschelte es noch einige Male, dann wurde es still.
Das Essen wurde kalt, der menschenfreundliche Westerly durfte nicht länger zögern, das Mädchen einzuladen, wenn dasselbe für sie bestimmt war.
Er ergriff die Kerze und ging hinüber. Das Mädchen kauerte in einer Ecke auf dem Teppich und blickte den Eintretenden mit großen, scheuen Augen, die vom Licht nicht geblendet wurden, an, doch Furcht drückten sie nicht aus.
»Bist du das Mädchen, dem man verweigerte, am Brunnen Wasser zu geben?«
»Ja, Herr, und ich danke dir, dass du dich einer armen Jüdin angenommen hast«, antwortete ihre melodische Stimme. »Gott wird es dir vergelten!«
»Warum betonst du so, dass du eine Jüdin bist?«
»Weil wir verachtet sind!«
»Ich verachte euch nicht.«
»So bist du edel!«
»Bei mir sind Juden Menschen wie andere, und ich will es dir noch mehr beweisen. Wie heißt du?«
»Mirja!«
»So komm, Mirja, ich habe für dich ein Abendbrot bereiten lassen. Iss von meinen Schüsseln und trink aus meinem Becher!«
Westerly verstand es meisterhaft, die Begierde, die ihn beim Anblick des schönen, reizvollen Mädchens, das ihm jetzt ganz überlassen war, befiel, zu verbergen. Mirja, fortwährend mit fremden Menschen verkehrend, hatte zwar keine Furcht, zögerte aber doch, ihm in das Nebenzimmer zu folgen.
»Du bist ein mächtiger Mann, und ich bin eine verachtete Jüdin! Es passt sich nicht, dass ich an deinem Tische esse!«
»Und noch weniger passt es sich, dass du in der Karawanserei zwischen rohen Männern schläfst. Deshalb habe ich dir hier ein Zimmer einrichten lassen. Du dauerst mich, Mirja. Komm jetzt, oder soll ich dir das Mahl herüberbringen?«
»Gott verhüte, dass du mich bedienst!«, rief das Mädchen, stand auf und ging mit ihm hinüber.
Westerly setzte sich auf das Bett und schaute der Essenden schweigend zu. Entzückt hing sein Auge an den reizenden Formen, an dem Spiel der vollen Arme, die sich bei jeder Bewegung entblößten. Und dieses wunderbar schöne Gesicht, dieser fremdartige Reiz darin! Wie musste dieser kleine Mund küssen können! Die Augen verrieten die Glut, die in dem Mädchen wohnte, und die leicht zum Ausbruch zu bringen war.
Üppige Bilder umgaukelten Westerlys Phantasie, doch noch beherrschte er sich, er wollte das Mädchen während des Essens nicht stören.
Mirja hatte allerdings Hunger, doch sie brauchte nur wenig, um ihn zu stillen. Sie verschmähte Messer und Gabel und führte alles mit der Hand zum Munde, aber mit solcher Grazie, dass man sich nichts Zierlicheres vorstellen konnte. Den vorgesetzten Wein berührte sie nicht.
»Trink, Mirja«, sagte Westerly, als sie anscheinend gesättigt war, »er flößt dir neues Leben ein und verbannt trübe Gedanken.«
»Ich danke, Herr! Noch nie ist über meine Lippen Wein gekommen; er würde meine Sinne verwirren.«
Sie stand auf und warf einen Blick durchs Zimmer. Die Fenster waren mit Teppichen verhängt, die Kerze verbreitete nur ein schwaches Licht und musste bald niedergebrannt sein.
Da bemerkte Mirja, wie Westerlys Auge mit so seltsam glänzendem Ausdruck auf ihr ruhte, und sofort wusste die schon so oft verfolgte Jüdin, was ihr bevorstand. Doch sie zeigte weder Verlegenheit noch Furcht; was hätte ihr das auch genützt? Sie dachte nicht einmal an Flucht, denn wohin hätte sie fliehen sollen?
»Ich danke dir, Herr!«, sagte sie nochmals. »Erlaube deiner Dienerin, dass sie nun schlafen geht, denn sie hat heute einen weiten Weg gemacht.«
Sie verneigte sich gegen Westerly und wollte in ihr Zimmer gehen, doch er sprang auf und vertrat ihr den Weg.
»Du willst mich schon verlassen, Mirja? Bleib noch etwas bei mir und leiste mir Gesellschaft.«
»Herr, ich bin müde!«
»So ruhe dich in meinen Armen aus«, rief Westerly, umschlang ihre Taille und zog das Mädchen neben sich nieder.
Mirja sträubte sich nur schwach, aber Schamröte übergoss ihr Gesicht.
»So ist es recht, Mädchen!«, scherzte er. »Sei nicht blöde. Komm, schlinge die Arme um mich!«
Als sie seiner Aufforderung nicht nachkam, umarmte er sie und suchte sie zu küssen, doch noch vermochte ihn das Mädchen von sich abzuhalten.
Ihr Gesicht war plötzlich bleich geworden, ihre Augen seltsam starr, und ihre Stimme klang hart und fest, als sie sagte:
»Herr, ich bin deine Dienerin, du hast mir zu befehlen, und ich werde auch gehorchen; hast du aber Böses mit mir vor, so werde ich mich wehren. Du kannst mich wohl töten, doch nicht bezwingen!«
Westerly lachte laut auf.
»Man erschrickt ja ordentlich, wenn du so sprichst! Ich will dir ja nichts Böses tun, kleine Hexe!«
Er umschlang sie wieder, presste sie an sich, und da er natürlich bedeutend kräftiger war als sie, so half ihr Stemmen und Sträuben nichts, er drückte sie immer fester an sich, und endlich gelang es ihm, seine Lippen auf ihre Wangen zu pressen.
Da verwandelte sich sein Lachen plötzlich in einen Schmerzensschrei, er fuhr zurück und griff an sein Ohr. Mirja hatte mit ihren scharfen Zähnchen hineingebissen.
Der Schmerz vermochte aber weder des Mannes kochendes Blut abzukühlen noch seine Laune zu verderben.
Mirja hatte den Moment benutzen und aufspringen wollen, doch Westerly ergriff sie noch zur rechten Zeit an beiden Armen und drückte sie auf das Bett zurück.
»Du willst dich also wirklich wehren?«, lachte er.
»Ja, Herr, ich werde mich wehren«, stöhnte sie, »ich bitte dich aber, verschone mich! Ich bin nicht das, für was du mich hältst.«
Ihr Gesicht war dunkel gerötet, Westerlys Blicke ruhten mit gesteigertem Verlangen auf der schönen Jüdin.
»Desto besser, wenn du's nicht bist! Nimm Vernunft an, Mädchen, sträube dich nicht länger! Du bist mein!«
»Nur tot werde ich es sein!«
»Das sind Redensarten, ich kenne euch Mädchen.«
»Ich bitte dich, Herr, verschone mich!«
»Willst du dich nicht gutwillig fügen?«
»Nein, nimmermehr!«
»So brauche ich Gewalt!«, stieß Westerly atemlos hervor, und wieder fand zwischen beiden ein Kampf statt.
Er riss Mirja das Gewand von den Schultern, und nun entflammte sich seine Begier erst recht.
Dem Mädchen schwanden die Kräfte. Schon konnte eine Hand von ihm ihre beiden Arme halten, gebrochen lag sie da.
Doch wieder fuhr er mit einem Wutschrei zurück, diesmal floss Blut über sein Gesicht. Mirja hatte ihn in die Backe gebissen.
Da verlor er vollkommen die Herrschaft über sich, er sank zum Tier herab. Den Kopf des Mädchens, das sich erheben und fliehen wollte, traf ein Faustschlag; mit einem Hilferuf sank es halbbetäubt zurück; doch nicht genug damit, Westerly hob die Faust zum zweiten Schlag, der das Mädchen widerstandslos machen sollte.
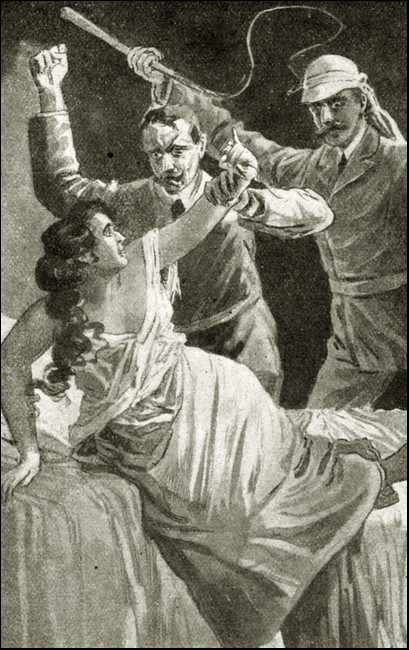
Da pfiff es durch die Luft, ein klatschender Schlag, und Westerlys Hand sank von einem schweren Hieb getroffen, nieder.
Mit einem Wutschrei fuhr er herum und stand einem Manne in grauem Reiseanzug gegenüber, in der Hand Westerlys Reitpeitsche. Es war der andere Gast des Dorfes.
Der Getroffene stand wie versteinert da, ihm gegenüber, drohend, mit finsterem Gesicht, der andere.
»So lange ich in Indien zu befehlen habe, soll kein Mädchen ungestraft in seiner Ehre beleidigt werden, und wenn Sie nicht — ah, Mister Westerly!«, unterbrach sich der Fremde erstaunt. Jener hatte den Störenfried eher erkannt, als dieser ihn; schnell gesammelt, richtete er sich auf.
»Lord Westerly, bitte!«, sagte er, als wäre nichts geschehen.
»Richtig, Sie hatten den Verlust Ihres Bruders und seiner ganzen Familie zu beklagen. — Mankdrallah!«
Der Gerufene musste draußen an der Tür gelauscht haben, er war sofort im Zimmer, machte aber ein sehr ängstliches Gesicht, denn er sah, was der Generalgouverneur vorgehabt hatte, und nun war der Fremde auch im Zimmer.
»Bringe dies Mädchen«, der Fremde deutete nach Mirja, »zu deinen Töchtern und lass es bis morgen bei ihnen. Wird ihm auch nur ein Haar gekrümmt, so wirst du mich kennen lernen.«
Die Worte waren in einem solchen Tone gesprochen, dass der Inder eiligst gehorchte, ohne auch nur einen Blick auf den vermeintlichen Generalgouverneur zu werfen.
Seine Töchter kamen und trugen Mirja hinaus, welche übrigens nicht betäubt war, sondern mit offenen Augen dalag. Aber sie schien wie leblos zu sein, sie hatte nur Interesse für den Fremden. Wie gebannt hingen ihre Blicke an ihm.
Bis zum letzten Augenblick hielt sie ihre Augen auf ihn gerichtet.
»Wer ist das? Wie heißt dieser Mann?«, flüsterte sie.
Sie erhielt keine Antwort.
Der Fremde wollte auch sofort das Zimmer wieder verlassen, ohne Westerly zu berücksichtigen, doch dieser vertrat ihm den Weg.
»Ich darf Sie wohl ersuchen, Mylord«, sagte er, die mit einer blutunterlaufenen Schwiele bedeckte rechte Hand ausstreckend, »dass Sie mich um Entschuldigung bitten.«
»Warum?«
»Nun, Sie haben mich vorhin versehentlich mit der Reitpeitsche auf die Hand geschlagen.«
»Sie irren!«
»Wie? Sie hätten nicht geschlagen?«
»Doch, aber nicht versehentlich!«
»Wie meinen Mylord?«
»Der Schlag war mit Absicht geführt«, erklärte der Fremde ruhig; »einen Augenblick kämpfte ich sogar mit mir, ob ich Ihnen die Reitpeitsche nicht lieber ins Gesicht schlagen sollte.«
Ein zischender Laut kam über Westerlys Lippen.
»Das war eine tödliche Beleidigung«, keuchte er.
»Ich wüsste nicht!«
»Sie beschmutzen meine Ehre, das fordert Sühne.«
»Ich beschmutze Ihre Ehre?«, fuhr der Fremde auf. »Sie selbst taten dies! Wer sich als etwas ausgibt, was er nicht ist, Herr Generalgouverneur, und wer ein unschuldiges Mädchen zu vergewaltigen sucht, Lord Westerly, der hat in meinen Augen keine Ehre. Nehmen Sie den Schlag von mir als eine wohlverdiente Züchtigung für einen Bubenstreich an.«
Ohne sich umzublicken, schritt der hohe, breitschultrige Fremde hinaus. Mit geballten Fäusten und knirschenden Zähnen sah Westerly ihm nach. Er war geschlagen worden, er, Lord Westerly.
»Wir werden uns darüber noch einmal auseinandersetzen, verlass dich darauf!«, murmelte er mit schäumenden Lippen.
Da wurde die Seitentür lautlos geöffnet, und auf der Schwelle erschien Aleen, wie zum Sprunge zusammengeduckt, mit dem Blicke eines Tigers und in der Hand den furchtbaren Dolch, dessen Berührung schon tötete.
»Wer — wer war das?«, flüsterte er.
Mit einem Sprung stand Westerly vor ihm und umklammerte sein Handgelenk.
»Mensch, was willst du?«, raunte er ihm zu und nahm ihm den Dolch ab.
»Den will ich, der eben mit dir sprach.«
»Warum?«
»Damit ich ihn mit dem Dolch kitzeln kann.«
»So kennst du ihn?«
»Ja, und er oder ich muss sterben.«
Ein düsteres Lächeln überflog Westerlys Antlitz.
»Ich will dir Gelegenheit verschaffen, ihn unschädlich zu machen, wenn du ihn fürchten musst...«
»Ich fürchte ihn nicht, ich hasse ihn aber so, dass ich es nicht aussprechen kann«, hauchte der Inder.
»Du sollst deine Rache befriedigen können. Jetzt rufe die Leute zusammen, wende die Peitsche an, wenn sie zögern — wir reisen sofort ab, es gibt einen Nachtmarsch. Besorge alles Nötige.«
Eine Stunde später, mitten in der Nacht, bestieg Westerly seinen Elefanten; mit mürrischen und schläfrigen Gesichtern ordneten sich die mit Fackeln versehenen Kulis zum nächtlichen Marsch.
Da drängte sich der Mankdrallah hervor.
»Sahib«, rief er mit weinerlicher Stimme, »du hast vergessen, die geschlachteten Tiere zu bezahlen, sie sind nun schon gegessen und...«
»Und hier ist dein Nachtisch«, unterbrach ihn Westerly und schlug ihn mit der Faust ins Gesicht, dass der Mann zu Boden stürzte, »lass ihn dir gut schmecken, die Kosten trägst du!«
Am andern Morgen rötete die Sonne kaum den Horizont, als der Ortsvorsteher von dem Diener zu dem fremden Herrn beschieden wurde. Der arme Mann hatte noch kein Auge zugetan, sondern sich bis jetzt die zerschlagene Nase mit Umschlägen gekühlt.
Mit verbundenem Gesicht erschien er vor dem Faringi, der schon reisefertig war. Alles, bis auf den Tisch und einen Stuhl, war schon zusammengepackt.
»Nenne mir deinen Namen und den des Dorfes«, sagte der Mann, der an dem Tisch vor Papieren saß.
Er notierte die genannten Namen.
»Weißt du als Mankdrallah nicht, dass es auf Befehl des Generalgouverneurs verboten ist, über Nacht bleibenden Gästen Mädchen anzubieten?«
Der Inder wurde ängstlich, verbarg aber seine Angst hinter einem dummdreisten Lächeln.
»Verboten ist es wohl, aber es wird doch überall gemacht. Der große Gouverneur hat ja selbst...«
»Schon gut! Kennst du die Strafe, die darauf steht, wenn jemand Mädchen feilbietet, ohne dass sie es wollen, sich allein auf seine Macht stützend?«
»Ja — nein«, stotterte der Inder.
»Es sind fünfundzwanzig Stockhiebe. Hat dir der Sahib, welcher gestern Nacht noch abreiste, die geschlachteten Tiere bezahlt?«
»Nein.«
»So sollst du die Kosten tragen, ich werde dafür sorgen. Einmal hast du den Befehl übertreten, du hast Mädchen vorgeführt, wie es früher Sitte gewesen sein mag, und dann warst du behilflich, eine Jungfrau zu überwältigen.«
»Sahib, das ist nicht wahr.«
»Du hättest es verhüten müssen und hast es nicht getan, hast sogar Posten gestanden. Hier, nimm dies«, er übergab ihm ein Kuvert, »in acht Stunden kannst du in Delhi sein und wirst auf der ersten besten Polizeistation dies abgeben. Es ist eine Anweisung.«
»Auf Geld?«, fragte der Inder unsicher.
»Nein, auf fünfundzwanzig Stockhiebe. Kommst du nicht, so wirst du geholt und bist nicht mehr Mankdrallah dieses Dorfes. Geh, und mache dich reisefertig.«
Niedergeschmettert schlich der Ortsvorsteher hinaus, bestellte sein Haus und machte sich gleich auf den Weg.
Als er eine halbe Stunde später von dem fremden Reiter und dessen Diener auf der Landstraße überholt wurde, warf er sich auf den Boden und küsste den Staub.
»Ach, ich Esel«, seufzte er dann, »ach, ich dummer Esel. Der Faringi, der mich auf die Nase geschlagen hat, ist gar nicht der große Gouverneur gewesen, aber der da, der mir die Stockhiebe geben lässt, das ist er! Was soll ich nun tun? Ich muss hingehen. Brahma schenke mir Geduld und ein hartes Fell.«
Der Jude schlief noch in der Karawanserei, unter dem Kopfe ein Bündel, das er auch noch mit beiden Händen krampfhaft umklammert hielt, als er gerüttelt wurde.
Mit einem Angstschrei fuhr er empor und presste das Bündel an sich.
»Ich habe nichts, nichts, ich bin ein armer Jude«, murmelte er.
Doch es war nur seine Tochter, die vor ihm stand. Ihr Gesicht war seltsam verklärt.
»Vater, ich habe ihn gesehen, ihn sprechen hören«, flüsterte sie.
»Wen?«
»Ihn, der mich aus Feuer und Wasser und aus den Rachen der Krokodile gerettet hat.« Des Alten Hand zitterte, als sie in dem Bündel wühlte.
»Wo ist er, dass ich ihm geben kann eine Belohnung?«
»Er ist fort.«
»Fort? Das ist schade! Ich würde ihm gern haben gegeben etwas, das ihn hätte gemacht glücklich. Weißt du nun, wie er heißt?«
»Nein«, sagte Mirja, und ihr Gesicht hatte sich bei den Worten des Vaters verfinstert, »ich konnte seinen Namen nicht erfahren.«
»So schenke ihm der Gott unserer Väter ein langes Leben, was ich nicht kann, und das ist besser als Gold und Edelstein, was der arme Sedrack nicht hat, aber beten will ich für ihn.«
Sie sattelten den mageren Esel, der alte Jude setzte sich darauf, nahm die Bündel vor sich, und dann trieb Mirja mit einem Stecken das müde Tier vor sich her.
Sie erzählte nicht, wie es ihr in der Nacht ergangen war, nicht, wie sie von dem Manne, der sie schon einmal gerettet hatte, zum zweiten Male gerettet worden war, finster blickte sie auf den Vater, dessen Lippen Zahlen murmelten; dann aber verklärte sich wieder ihr schönes Antlitz zu einem glücklichen Lächeln. So zogen die beiden auf Delhi zu.
Draußen herrschte ein schreckliches Regenwetter; klatschend schlugen die schweren Tropfen gegen die Scheiben; dies trug aber nur dazu bei, die Gemütlichkeit des roten Boudoirs der Duchesse zu erhöhen.
Die Teemaschine summte, der aromatische Duft des heimatlichen Getränkes durchzog das Zimmer, und das durch einen Schirm gedämpfte Licht der Lampe übergoss alles mit einem traulichen Schein.
Eine gemütliche Stimmung hatte sich ausnahmsweise auch einmal des ränkevollen Weibes bemächtigt; die Duchesse wollte für eine halbe Stunde ihre ehr- und rachsüchtigen Pläne vergessen und mit ihrer neuen Freundin Phoebe, die bei ihr wohnte, ein Familiengespräch beginnen.
Letztere hatte sich geändert. Sie war nicht mehr das eitle, kokette und abenteuerlustige Weib, das wir in ihr am Anfang kennen lernten, in ihren Zügen war eine gewisse Traurigkeit oder Melancholie ausgeprägt, die sie früher nie gezeigt, und so hatten sich auch ihre Sprache, ihr ganzes Benehmen geändert.
Die Duchesse fragte sich oft, ob dies denn dasselbe Weib sei, welches ihr vor ihrer persönlichen Bekanntschaft oft geschildert worden war, und dann, ob sich Phoebe wirklich zur Ausführung der geplanten Intrigen eigne.
Vielleicht war das Klima an dem Wechsel schuld, und damit muss man stets rechnen, will man nicht große Fehler begehen. Der im Norden energischste Mensch wird im Süden oft ganz willensschwach; eines anderen Charakter wächst oft wieder im Süden, man bekommt jedenfalls ganz andere Neigungen, Empfindungen und Gedanken. Deshalb ist es auch ganz richtig, wenn die Kolonien eigene Gerichtsbarkeit verlangen und wenn ein Mensch, der im Süden eine strafbare Tat begangen hat, das über ihn in seiner nördlichen Heimat gefällte Urteil nicht anerkennen will, weil er die Richter nicht für kompetent hält.
Doch bald erfuhr die Duchesse, dass Phoebes Stimmungswechsel eine andere Ursache hatte. Freilich war es auch noch zu keiner ausführlichen Aussprache über diesen Punkt gekommen.
Jetzt war Zeit zum Erzählen.
»Es ist mir nie gelungen«, sagte die Duchesse, ihre Freundin mit Tee bedienend, »das Ende Ihrer abenteuerlichen Laufbahn in England zu hören, und ich glaube, darin liegt der Schlüssel Ihrer Traurigkeit. Hatten Sie sich Pläne für die Zukunft gemacht und sind diese gescheitert?«
»Allerdings«, sagte Phoebe, »vollständig gescheitert. Meine Pläne waren dieselben, wie jetzt noch, aber ich hoffte, die Früchte meiner Bemühungen an der Seite eines Mannes genießen zu können, den ich liebte. Ich bin frei; sobald wir unser Ziel erreicht haben, dann kann mich auch Francoeur nicht mehr halten. Um meine schönste Hoffnung bin ich aber betrogen worden.«
»Ihr bisheriges Leben kenne ich ja, bis Sie aus England fliehen mussten. Sie ließen Ihre frühere, dort wiedergefundene Liebe zurück, einen Herzogssohn, der es bis zum Räuber gebracht hatte; allerdings eine pikante Liebe! Doch ich weiß selbst, dass das Frauenherz keine Rücksichten kennt, wenn es liebt. So weit also habe ich von Ihnen alles erfahren. Habe ich nun recht, wenn ich glaube, dass Ihre Verstimmung mit jenem Alphons de Lacoste zusammenhängt?«
»Ja.«
»Ist er Ihnen untreu geworden? Warum folgt er Ihnen nicht in das Land, was zur Liebe geschaffen ist, und beteiligt sich an unseren Unternehmungen?«
»Weil er nicht kann.«
»Es fehlt ihm an Mitteln? Kleinigkeit!«
»Er ist tot!«
»Ah, das ist etwas Anderes! Meine arme, liebe Freundin, da müssen Sie sich mit der Zeit zu trösten suchen. Der Tod ist nun einmal das Los eines jeden Menschen. Er ist doch nicht etwa wieder gefangen worden und dann...«
Die Duchesse machte eine Bewegung nach dem Halse.
»Er hat sich selbst getötet — ertränkt!«
»Wie? Das sieht dem Charakter Ihres Freundes, wie Sie ihn mir geschildert haben, allerdings gar nicht ähnlich. Ich denke, er war immer heiter, selbst in der größten Gefahr, und besaß einen ausgeprägten Humor?«
»Ja, so war er, und ich glaube nimmermehr, dass sich Alphons selbst ertränkt hat — überdies ein schweres Kunststück — nein, er ist von unbekannter Hand ermordet worden.«
»Ermordet? Man soll den Räuber heimlich ermordet haben?«, rief die Duchesse erstaunt.
»Vielleicht aus Gründen, die unsere Sache angehen. Ich habe Ihnen schon erzählt, dass Alphons durch Zufall Einblick in unsere Pläne bekam, aber nur ganz wenig, er hätte uns nicht schaden können, was er übrigens nie getan haben würde; denn seine Absicht war, in unseren Bund zu treten. Meine Meinung nun ist, dass Alphons entweder von einem der Unsrigen ermordet wurde, weil er unser Geheimnis bei ihm nicht treu verwahrt glaubte, oder aber von einem Vertrauten des Vaters. Letzteres glaube ich, weil plötzlich, als das Gerücht auftauchte, in der Leiche des angeblich durch freiwilliges Ertränken Getöteten sei Gift gefunden worden, die Sache niedergeschlagen wurde. Der Vater hat es vorgezogen, seinen Sohn als einen Selbstmörder gelten zu lassen, der in der Erkenntnis seines verfehlten Lebens freiwillig daraus schied.«
»Hm, ein seltsames Motiv! Wollen Sie mir nicht den näheren Sachverhalt erzählen?«
»Dass Alphons gefangen genommen wurde und seinen Häschern sofort wieder entsprang, wissen Sie schon. Ich las dies auch alles erst hier, teils schon auf der Reise in Zeitungen. Einige Tage darauf wurde an einer Sandbank in der Themse ein Leichnam angetrieben, in dem man bald Alphons erkannte. Es wurde Selbstmord angenommen, er sollte die Energie besessen haben, sich selbst, ohne Gewicht an Hals oder Füße zu binden, zu ertränken. Den Tod beim Durchschwimmen in der Themse gefunden zu haben, schien kaum glaublich; denn Brücken gibt es in London genug, und Verfolger waren ihm nie auf den Fersen gewesen. Die Leichenschau ergab Erstickungstod durch Ertrinken. Da machte ein junger Arzt auf eine brandige Stelle im Nacken des Toten aufmerksam und wies mit einer Lupe nach, dass in der Mitte dieser Stelle ein winziger Stich vorhanden war. Der Arzt war in Indien gewesen und erklärte, dort gäbe es eine seltsame, furchtbar giftige Pflanze mit Dornen, ein leichtes Ritzen an diesen führe sofort den Tod herbei, und die verletzte Stelle bekäme nach einigen Stunden genau dasselbe Aussehen wie die vorliegende. Daraufhin wurde die Leiche untersucht, und man konstatierte im Blute wirklich ein noch unbekanntes Gift. Dann aber beschäftigten sich alle Zeitungen nicht mehr damit, den Redakteuren schien der Mund gestopft worden zu sein, sie berichteten nur noch einmal, dass Alphons de Lacoste, genannt die schwarze Maske, sein Leben durch Selbstmord geendet habe. Ist das nicht sonderbar?«
»Allerdings. Und was schließen Sie daraus?«
»Alphons ist wirklich ermordet worden, und zwar hat man ihn mit einem Instrument in den Nacken gestochen, welches mit jenem uns unbekannten Gift imprägniert war, und ihn dann ins Wasser geworfen. Der Vater hielt einen Selbstmord für besser und ließ die Resultate der Leichenschau unterdrücken.«
Die beiden Damen wurden wieder unterbrochen, Mirzy trat ein und überreichte ihrer Herrin eine Karte, die keinen Namen enthielt, sondern nur ein mit Bleistift daraufgemaltes Zeichen.
Die Duchesse sprang vor Überraschung auf.
»Wie, schon heute Abend? Ich hatte ihn erst für morgen bestellt. Ist er selbst da, Mirzy? Doch ja, er muss es ja sein, es ist das ihm gegebene Zeichen. Sage ihm, Mirzy, er möchte sich eine Viertelstunde gedulden, ich hätte noch eine Unterredung zu erledigen.«
»Wissen Sie, wer mich besucht?«, wandte sie sich dann an Phoebe.
»Einer aus unserem Bunde?«
»Ein Schüler, ein Lehrling, auf den wir einst große Hoffnungen setzten, die sich aber nur zum Teil erfüllt haben, nicht durch seine Schuld. Vielleicht lässt er sich noch verwerten, nun vielleicht. Es ist niemand anders als Edgar Westerly, jetzt Seine Herrlichkeit der Lord von Leicaster.«
»Wie, Westerly ist hier?«, sagte Phoebe erstaunt.
»Wir ließen ihm die Aufforderung zukommen, morgen zu einer bestimmten Stunde hier zu erscheinen, sonst... Sie wissen, wie wir ihn zu allem zwingen können, wir haben ihn vollständig in unseren Händen, und ganz besonders ich, wie ich Ihnen schon erzählt habe.«
»Und wie gedenken Sie ihn zu verwenden?«
»Ich weiß noch nicht, jedenfalls als Spion. Schade, dass er nicht mehr in der diplomatischen Karriere ist! Doch er hat noch Verbindungen, und die müssen wir ausnützen. Sollen wir ihn etwa seine neuerlangte Würde in England mit Ruhe genießen lassen, während wir uns abquälen? Mitnichten, er soll auch mit arbeiten. Ich verlasse Sie auf zehn Minuten, um ein Schauspiel vorzubereiten, dem Sie als Zuschauer beiwohnen dürfen. Es soll Ihnen eine Episode aus meinem Leben vorgeführt werden.«
»Noch eine Frage: Weiß Westerly, wer Sie in Wirklichkeit sind?«
»Nein, er soll jetzt daran erinnert werden, dass ich es bin, die ihn in der Tasche hat. Vorläufig kennt er mich nur als Signora Bellani mit dem Beinamen Duchesse, gesehen hat er mich als solche noch nicht.«
Noch vor Verlauf der zehn Minuten kam die Duchesse zurück, nicht mehr als Dame in französischem Geschmack gekleidet, sondern wie ein indisches Haremsweib in weiße, weite Gewänder gehüllt.
»Dies ist mein Kostüm zu der Komödie. Bitte, ziehen Sie sich in dieses Gemach zurück und beobachten Sie mein Auftreten; aber enthalten Sie sich aller Beifalls- oder Missgunstbezeugungen.«
Als Phoebe hinter der Portiere Platz genommen hatte, schraubte die Duchesse die Lampe ganz niedrig, sodass nur ein schwaches Dämmerlicht im Zimmer herrschte und ließ sich in der dunkelsten, der Tür entferntesten Ecke in einem tiefen Fauteuil nieder.
Westerly saß unterdes in dem eleganten Wartezimmer und harrte der Aufforderung, die ihn zu der Person rief, welche ihn durch ein befehlerisches Schreiben, das bei seinem Nichtkommen mit allerlei Enthüllungen drohte, von England hierher bestellt hatte.
Er wusste nur, dass hier eine Duchesse Bellani wohne; aber dass diese zum Bunde der Verschwörer gehörte, unterlag für ihn keinem Zweifel.
Die Aufforderung hatte zwar erst auf morgen Abend gelautet, doch er kam schon heute, denn er brannte vor Verlangen, sich mit den Verschwörern zu vereinigen.
Die verbundene Hand, auf der die Schwiele wie Feuer brannte, war schuld daran, dass er nicht mehr bereute, sein Heimatland verlassen zu haben. Er hätte allerdings überhaupt gehorchen müssen, jetzt aber tat er es gern.
Rache wollte er an dem nehmen, der ihn geschlagen hatte, furchtbare, blutige Rache.
Da meldete Babur, die Duchesse wünsche ihn zu sprechen. Westerly erhob sich und folgte dem Diener durch einige nur schwach erleuchtete Gänge. Plötzlich fühlte er sich von hinten von kräftigen Armen umschlungen, Gestalten sprangen auf ihn ein, und ehe er noch an Abwehr denken konnte, waren ihm schon die Hände auf den Rücken gebunden.
»Bin ich hier in eine Räuberhöhle geraten?«, knirschte Westerly. »Was hat man mit mir vor?«
»Still!«, raunte ihm Babur mit zorniger Miene zu. »Du hast meine Herrin beleidigt und wirst ihr jetzt ausgeliefert! Möge sie gnädig gestimmt sein, sonst ist dein Tod unvermeidlich!«
»Aber ich kenne sie ja gar nicht! Wie soll ich sie da beleidigt haben? Wer ist denn deine Herrin?«
Halb betäubt von dem eben Geschehenen, das er sich nicht im geringsten erklären konnte, wurde Westerly fortgeschoben, eine Portiere flog zurück, und plötzlich stand er in einem rotausgeschlagenen Boudoir, in dem nur so viel Licht war, um die nächsten Gegenstände erkennen zu lassen.
Westerly kam alles wie im Traume vor. Hatte er nicht schon einmal etwas Ähnliches erlebt? Vor langen, langen Jahren, als...
Wahrhaftig, da erhob sich aus einer Ecke abermals eine weiße, verschleierte Gestalt, schwebte auf ihn zu und blieb vor ihm stehen.
Westerly sank von einer Erinnerung überwältigt, in die Knie.
»Ayda!«, flüsterte er wie geistesabwesend.
Die Gestalt schlug den Schleier zurück; der Kniende erblickte ein Gesicht, das ihm bekannt war. Es war etwas verändert, aber es waren dieselben Augen, dieselben Züge.
»Ja, ich bin's, Ayda! Und wo bist du, Treuloser, der du mir ewige Liebe schworst, so lange gewesen?«
Westerly brachte keine Antwort hervor. Es erschien ihm alles wie im Traum, er glaubte sich achtzehn Jahre zurückversetzt.

Da blitzte in der Hand des Weibes ein Dolch, er war auf Westerlys Brust gezückt. Angesichts der Todesgefahr erhielt er sein Bewusstsein wieder, er richtete sich auf.
»Ayda, bist du es wirklich? Ich habe nichts getan, was deinen Zorn erregen könnte. Du aber hast mich ins Unglück gestürzt.«
Das Weib lachte leise, trat hinter den Gefangenen und zerschnitt seine Fesseln.
»Genug des Possenspiels, Lord Westerly!«, sagte sie lachend, jetzt auf Englisch mit veränderter Stimme, und schraubte die Lampe höher. »Ich sehe, Sie haben ein sehr gutes Gedächtnis. Es wäre wohl gar nicht erst nötig gewesen, Ihre Erinnerung, vor wem Sie stehen, wachzurufen. Eine Erklärung hätte schon genügt! Bitte, setzen Sie sich, Mylord!«
Mechanisch nahm Westerly Platz, das Weib ihm gegenüber.
»So sind Sie wirklich jene — jene Haremsdame, die mir schon damals einen Possen spielte?«
»Ja, ich bin jene Haremsdame, doch einen Possen habe ich Ihnen nicht gespielt, vielmehr Sie mir!«
»Es sind für mich unangenehme Erinnerungen«, sagte Westerly zögernd.
»Sie meinen, weil Sie sich am Morgen des anderen Tages in den Armen einer Bajadere wiederfanden, und weil ich darum weiß? Ah, Sie waren damals noch sehr jung; jungen Leuten verzeiht man solche Torheiten!«
»Sie hatten mich betrogen!«
»Bitte, ich hatte nicht Sie, sondern Lord Canning gebeten, mir die langweiligen Stunden zu verkürzen. Sie hatten mein Billett unterschlagen, das erforderte Sühne!«
Westerly war bei Nennung dieses Namens zusammengezuckt.
»Aber Sie taten zuerst, als nähmen Sie mich gern als Ersatz an«, sagte er.
»Ich hatte eine Absicht dabei. Es galt, zu erfahren, wer der Überbringer der geheimen Order sei, die durch Indien zirkulieren sollte. Ich brauche Sie wohl nicht erst daran zu erinnern, Mylord, was ihr Inhalt war. Machen Sie sich keine Vorwürfe, dass Sie das Geheimnis mir verraten haben. Lord Canning hätte meinen Verführungskünsten ebenso wenig widerstanden!«
Durch dieses schamlose Geständnis war man auf das eigentliche Thema gekommen.
»Ich wünschte, ich hätte damals keinen Gebrauch von der Einladung gemacht«, murmelte Westerly. »Es wäre alles anders gekommen!«
»Vielleicht, vielleicht auch nicht! Über uns Menschen waltet ein Verhängnis, dem man nicht entrinnen kann. Sie geben also doch zu, dass Sie sich in meiner Macht befinden?«
»Hätte ich Ihrer Aufforderung, hierher zu kommen, sonst wohl so unverzüglich Folge geleistet? Ich verließ mein eben erst angetretenes Besitztum, ein ehrenvolles Leben, und vertauschte es mit dem Aufenthalt in dem heißen, ungesunden Indien — weil Sie es wünschten!«
»Merkwürdig, was das kleine Medaillon, das ich damals zum Andenken an Sie behielt, für eine Anziehungskraft auf Sie ausübt!«, lächelte die Duchesse.
»Behalten Sie es. Ich vermache es Ihnen, wenn Sie an dem Bildnis meines Vaters solchen Gefallen finden. Mich fesseln noch stärkere Bande an die Verschwörer Englands als dieses mir geraubte Medaillon.«
Westerly war erregt aufgestanden.
»Sie haben recht, Sie haben sich schon zu weit mit uns eingelassen, Monsieur Francoeur hat Sie bereits zu einem der Unsrigen gemacht.«
»Wäre ich es noch nicht, ich würde es jetzt freiwillig werden, ja, ich würde mich freiwillig Ihnen und den Ihrigen anschließen.«
»Das ist schön! Sie sehen also ein, dass unsere Sache Zukunft hat und wollen sich für spätere Zeiten einen Posten sichern! Wir haben alle dasselbe Bestreben. Bitte, setzen Sie sich wieder, wir wollen in Ruhe überlegen, wie Sie verwendet werden können!«
»Nein, ich arbeite nicht für einen Posten, den ich, wenn Indien Frankreich gehört — denn weiter ist es doch nichts — einnehmen soll. Ich will für meine Rache arbeiten!«
»Ah! Also auch Sie verfolgen Privatinteressen!«
»Von jetzt ab erst!«
Westerly setzte sch nieder und versank in finsteres Brüten.
»Darf ich das Nähere erfahren?«, begann die Duchesse, als er nicht von selbst das Wort nahm.
»Erst möchte ich mir eine Frage erlauben: Sie nannten sich früher Ayda, jetzt Duchesse Rosa Bellani, damals erschienen Sie mir wie ein Haremsweib, diesen Eindruck machen Sie mir jetzt gar nicht. Wollen wir in nähere Verbindung treten, so ist es nötig, dass ich über Ihren wahren Charakter aufgeklärt werde.«
Erst hatte die Duchesse eine scharfe Antwort auf der Zunge; sie wollte ihm kurz erklären, dass nur sie zu fragen, er zu antworten habe, denn sie sei die Herrin, er der Knecht, doch sie änderte schnell ihren Sinn.
Sie ergriff, ihm freundlich ins Auge sehend, seine Hand.
»Betrachten Sie mich als Ihre Freundin, und lassen Sie sich daran vorläufig genügen, als Ihre Freundin, die in der Verschwörung so ziemlich den wichtigsten Rang einnimmt. Und zeigen Sie sich mir als Freund, so... was ist Ihnen, Lord?«
Sie hatte die Hand erfasst, die am oberen Teil verbunden war, und diese bei den letzten Worten etwas gedrückt. Westerly war schmerzhaft zusammengefahren.
»Sind Sie verwundet?«
»Mir brennt meine Hand«, sagte er mit unheimlich glühenden Augen, »und das Feuer pflanzt sich fort bis in mein Herz! Sehen Sie hier!«
Er nahm den Verband ab; auf dem Handrücken zog sich eine blutrünstige Schwiele hin.
»Was ist das?«
»Das, was meine Rache erheischt!«
»Es sieht aus wie ein Hieb!«
»Lord Canning hat ihn geführt!«, zischte er.
Der Duchesse ging plötzlich ein Verständnis auf.
»Ja, er hat mich geschlagen«, fuhr Westerly fort, »geschlagen wie einen Hund, und mir die Möglichkeit genommen, Rechenschaft zu fordern. Wie sollte ich auch? Das Duell ist bei uns Engländern verpönt, Lord Canning ist Herrscher in Indien, er gibt die Gesetze, hat also das Recht auf seiner Seite. Nur eine Abbitte könnte mich versöhnen; er hat sie mir ausdrücklich verweigert, und so bleibt mir nur ein Weg offen — mich an ihm zu rächen!«
Das Weib forschte nicht, was die Veranlassung zu dem entehrenden Schlage gebildet hatte, ihre Gedanken erfassten sofort nur einen Punkt. Jetzt wusste sie, wozu Westerly zu gebrauchen war, sie kannte seine schwache Seite, und diese musste sie bis aufs Äußerste ausnutzen.
Sie war eine perfekte Schauspielerin, doch sie brauchte sich im Moment nicht einmal besonders zu verstellen. Auch ihre Augen funkelten plötzlich auf. Sie war aufgesprungen.
»Sie hassen Lord Canning?«, stieß sie hervor.
»Wie die Pest.«
»Und wissen Sie, was er mir getan hat?«
»Nein.«
»Sie selbst haben den Hass mir ins Herz gesät. Hat er nicht meine Einladung, die ihm galt, mit schnöden Worten abgewiesen und über mich als ein sentimentales Weib gelacht?«
»So ist es, wir können uns gegen ihn verbünden.«
»Und wir wollen es tun, wir wollen uns in den Hass teilen. Aber Lord Canning ist Generalgouverneur.«
»Das entrückt ihn nicht meiner Rache.«
»Auch meiner nicht. Ich meine nur, er steht uns allen im Wege, denn er ist scharfsinnig und gewandt; wäre er nicht mehr, so hätten wir leichtes Spiel.«
Das war eine deutliche Anspielung, doch Westerly bebte nicht zurück; als hätte er nur darauf gelauert, so ergriff er sofort den Gedanken und führte ihn weiter aus.
»Sie sprechen von seinem Tod«, flüsterte er und richtete sich hoch auf; »wohlan, ich bin der Mann, ihn zur Seite zu schaffen, zum Nutzen der Verschwörer gegen England, ohne eine Belohnung zu fordern; denn es gilt nur, diesen entehrenden Schlag mit der Reitpeitsche zu rächen.«
So leicht hatte sich die Duchesse das Spiel doch nicht gedacht, sie hätte aufjubeln mögen. War aber Westerly auch der Mann, eine solche Tat auszuführen? In ganz Indien gab es keinen Menschen, der gewagt hätte, gegen den zugleich gefürchteten und geliebten Generalgouverneur die Waffe zu erheben. Schon mehrere Versuche, Mörder zu werben, waren erfolglos gewesen.
»Sie selbst würden es wagen?«, fragte das Weib wie erstaunt.
»Ich oder ein anderer.«
»Wer ist der andere?«
»Mein Diener namens Aleen. Aus einem mir unbekannten Grunde hasst er Canning glühend.«
»Hm, also ein Inder. Auf diese ist kein Verlass. Weiß er, dass Canning der Herrscher Indiens ist?«
»Nein.«
»Dann ist er nicht brauchbar.«
»Aleens Hass überwiegt die Ehrfurcht, scheint mir.«
»Nein, kein Inder darf es sein. Fällt er durch die Hand eines solchen, dann ist bewiesen, dass ein Aufstand vorbereitet wird.«
»Nun«, stieß Westerly hervor, »so bin ich bereit, die Tat auszuführen.«
»Sie? Wissen Sie auch, mit welch einem Gegner Sie es aufnehmen wollen? Lord Canning ist einer der stärksten und gewandtesten Männer, die ich je gesehen habe; man hört nur nicht viel von seinen ritterlichen Eigenschaften, weil er sie bloß im Geheimen übt. Ich war einst Zeuge, wie er über eine zwei Meter hohe Mauer sprang. Wir hatten schon einmal einen Meuchelmörder gedungen, einen Spanier, ihm das Stilett von hinten ins Herz zu stoßen; die Waffe berührte nur seinen Rock oder ritzte ihm vielleicht auch die Haut, da drehte er sich blitzschnell um und packte den Mörder. Diesem gelang es noch einmal, zu entkommen; er schlüpfte mit seiner schmächtigen Gestalt durch ein Mauerloch, Lord Canning aber sprang darüber, packte ihn und übergab ihn herbeieilenden Polizisten.«
»Ist er auch gegen Gift gefeit?«, fragte Westerly höhnisch.
»Es gibt kein Gift, welches augenblicklich wirkt. Lord Canning würde doch den Mann noch fassen und ausliefern, und das darf nicht geschehen. Schon hat man gegen uns in gewissen Kreisen Argwohn gefasst. Wird Lord Canning ermordet gefunden, so forscht man nach dem Grunde, und man wird sich zuerst an uns wenden. Auch ich hasse den Gouverneur, denn er hat mich verhöhnt, ich hasse ihn auch als Feindin Englands, und viel wäre uns geholfen, wäre er beseitigt, doch unauffällig muss sein Tod herbeigeführt werden. Wären Sie der Mann dazu?«
Mit einem furchtbaren Gesichtsausdruck zog Westerly aus der Brusttasche einen kostbaren Dolch hervor und entblößte den Stahl.
»Ja, ich kann es tun!«, hauchte er. »Dieser Dolch ist das Mittel, ihn in die Ewigkeit hinüberschlummern zu lassen.«
»Er ist vergiftet?«
»Mit einem furchtbaren Gift.«
»Aber es wirkt auch nicht sofort.«
Westerly trat einen Schritt näher an das Weib heran.
»Es wirkt sofort, auf der Stelle. Ich brauche die Spitze nur jemandem auf den Nacken zu setzen, nur einen Stich zu machen, hundertmal kleiner als den, den eine Nadelspitze hinterlässt, und wie vom Blitz getroffen sinkt der Mann zusammen, keinen Laut kann er mehr ausstoßen, und nichts verrät, dass er kein natürliches Ende genommen hat — was war das? Sind wir nicht allein?«
Hinter der Portiere hatte es geraschelt.
Die Duchesse schlug diese schnell zurück und lud Phoebe ein, hereinzukommen.
»Sie kennen sich schon, eine Vorstellung ist nicht nötig. Madame Dubois, Sie haben gehört, um was es sich handelt. Gut, Mylord, Sie sollen der Auserwählte sein! Dieses Edelwild darf nicht durch die Hand eines Kulis fallen, sondern durch die Ihre, und Ihre Belohnung soll königlich sein.«
»Ich tue es umsonst«, sagte Westerly grimmig; »denn es handelt sich dabei nur um meine Rache.«
Die sehr aufgeregte Duchesse verließ das Boudoir. Westerly war so von dem gegenwärtigen Plan eingenommen, dass er die anwesende Phoebe gar nicht beachtete, nicht einmal begrüßte.
Diese sah geisterhaft bleich aus, ihre Augen glänzten unheimlich, als sie dem im Zimmer auf und ab Wandernden folgten. Endlich zwang sie sich wieder zu einem harmlosen Aussehen.
»Ich hatte nicht erwartet, Mylord, Sie in Indien, wiederzusehen!«, begann sie.
»Ich musste hierher kommen, Sie wissen es.«
»Wann verließen Sie England?«
»Etwa vor sechs Wochen.«
»Darf ich nicht das genaue Datum erfahren?«
»Ist Ihnen daran so viel gelegen?«
»Ja, ich möchte Sie dann über etwas fragen.«
Westerly nannte das Datum.
»Nein, dann waren Sie schon fort«, entgegnete Phoebe, sich zur Gleichgültigkeit zwingend. Nach einer Pause fragte sie wieder.
»Ist der Dolch wirklich mit einem furchtbaren Gift imprägniert?«
»Ja, es tötet sofort«, entgegnete Westerly zerstreut.
»Und hinterlässt keine äußeren Kennzeichen einer Vergiftung?«
»Ein kaum sichtbares. Etwa zwölf Stunden später wird die gestochene Stelle etwas brandig, aber kaum bemerkbar.«
Phoebe musste mit aller Macht kämpfen, ihrer Aufregung Herr zu werden.
»Sie haben es selbst schon probiert?«, fragte sie leise, um das Beben ihrer Stimme zu verbergen.
»Ja.«
»Wen haben Sie damit getötet?«
»Keinen Menschen«, lachte Westerly; »ich stellte meinen Versuch mit einem Hunde an, dessen Haar ich an einer Stelle abrasieren ließ.«
Westerly war selbst zu erregt, als dass er das seltsame Benehmen Phoebes bemerkt hätte, wie sie nach Selbstbeherrschung rang, wie sie beständig die Farbe wechselte, und dabei den auf und ab Gehenden stier anblickte.
Die Duchesse trat wieder ein. Alles an ihr drückte eine nervöse Hast aus, ihre Augen strahlten in triumphierendem Feuer.
»Jetzt ist die passende Zeit dazu, Mylord«, flüsterte sie.
»Wozu?«
»Lord Canning zur Seite zu räumen.«
Westerly erschrak doch, so nahe hatte er sich der Ausführung seines Entschlusses nicht gewähnt.
»Schon jetzt?«
»Ja, je eher, desto besser. Die Gelegenheit ist günstig.«
»Wo befindet er sich?«
»In seiner Wohnung.«
»Im Gouvernements-Palast?«
»Ja, er ist von einer Reise zurückgekehrt und hat sich bereits um zehn Uhr zur Ruhe begeben. Jetzt liegt er schon im tiefsten Schlafe.«
Westerly war doch erschüttert.
»Nun, zögern Sie etwa?«, fragte sie schneidend. Er richtete sich auf, seine Hand brannte ihm.
»Nein. Woher aber wissen Sie, dass er schläft?«
»Ich habe es soeben erfahren.«
»Durch wen? Sie waren nur fünf Minuten entfernt.«
»Ich stehe mit einem Getreuen im Gouvernements-Palast durch eine unterirdische Sprachleitung in Verbindung und weiß alles, was im Palast vorgeht. Genügt Ihnen das?«
»Also im Bett soll er sterben?«
»Es ist das Unauffälligste.«
»Aber ich muss deshalb in den Palast, in sein Schlafzimmer eindringen!«, sagte Westerly bestürzt.
»Es hat dies keine Gefahr auf sich, ich selbst begleite Sie und wohne der Handlung bei. Lord Canning liebt keine Diener um sich; nur ein Inder oder vielmehr ein Halbblut schläft im Nebenzimmer. Dieser wird von meinen Getreuen zur bestimmten Zeit, wenn wir dort erscheinen, unter einem Vorwand entfernt werden. Lord Canning schläft bei unverschlossener Tür, nichts steht uns im Wege, und sollte uns doch jemand hindern, nun, so muss er zur Seite geräumt werden. Dann gilt es nur noch den Mord des Verhassten.«
»Aber ich begreife nicht, wie Sie in den Palast gelangen wollen!«, murmelte Westerly. »Wir müssen doch das Tor passieren.«
»Das lassen Sie meine Sache sein. Ich garantiere Ihnen mit meinem Leben, dass alles glückt, denn ich begleite Sie ja bis ans Bett Cannings. Wenn Sie nur sicher sind, dass das Gift auf der Stelle, ohne Todeskampf, tötet, denn auch noch sterbend muss Lord Canning ein furchtbarer Gegner sein.«
»Ein Ritz in den Nacken vernichtet das Leben sofort«, sagte Westerly unbewusst; »ich selbst war schon Zeuge davon. Doch könnte nicht mein Diener Aleen der Lord Canning ebenfalls —«
»Ha, wollen Sie sich so drücken?«, unterbrach ihn das Weib spöttisch. »Mit Ihrem Dolche würde ich es ohne Zögern allein wagen, doch es fehlt mir die Kraft, den Mechanismus einer geheimen Falltür in Bewegung zu setzen. Natürlich, prahlen konnten Sie mit Ihrem Rachedurst uns gegenüber, aber den zu töten, der Sie wie einen Sklaven geschlagen, dazu fehlt Ihnen der Mut, wenn es darauf ankommt.«
»Genug!«, rief Westerly mit zuckenden Lippen und umklammerte mit der verwundeten Hand den Dolch. »Führen Sie mich, wohin Sie wollen, meinetwegen direkt in die Hölle, wenn ich nur Lord Canning dort finde!«
»So kommen Sie! In einer Stunde spätestens sind wir wieder hier«, wandte sie sich im Hinausgehen noch einmal an Phoebe, »und der, den wir von unseren Gegnern am meisten zu fürchten haben, ohne den die englische Partei in Indien keine Stütze mehr hat, wird bei unserer Rückkehr nicht mehr am Leben sein.«
Phoebe wartete, bis die Portiere hinter ihnen gefallen war und hob dann drohend die Faust.
»Jetzt weiß ich, woran und durch wen Alphons gestorben ist« flüsterte sie. »Wohlan, Lord Westerly, du wirst es furchtbar büßen müssen, mich meines Geliebten beraubt zu haben. Geh hin und werde nochmals zum Mörder; leugnest du auch einen göttlichen Richter, so sollst du doch einen irdischen in mir kennen lernen. Hoffentlich verfällst du nicht zu früh der Justiz, damit ich noch Zeit habe, Beweise zu sammeln, unter deren Last du gestehen musst.« —
Westerly wurde angewiesen, sich seiner modernen Kleidung zu entledigen und dieselbe mit einem indischen Gewande zu vertauschen. Der Gürtel enthielt außer dem Dolch noch ein Paar dicker Filzschuhe.
Als die Duchesse wieder zu ihm kam, hatte auch sie sich verändert, auch sie trug indische Männerkleidung, welche sich eng an ihre vollen Formen anschloss. Doch hätte Westerly jetzt auch Sinn dafür gehabt, ihre deutlich erkennbaren Reize zu bewundern, er hätte es nicht lange gekonnt, denn das Weib erklärte ihm sofort, ihm die Augen verbinden zu müssen.
»Wozu diese Vorsicht?«, fragte er. »Gehöre ich nicht zu Ihrem Bunde, dass Sie mir den Weg verhehlen wollen?«
»Niemand kennt diesen Weg, als ich allein, und ich werde ihn nicht einmal meinem bewährtesten Freunde zeigen. Überdies, Lord, noch sind Sie jetzt nicht ganz der Unsrige, sondern erst, wenn Sie die Tat ausgeführt haben.«
»Schon der Wille sollte mich dazu machen.«
»Wir begnügen uns nicht mit dem Vorsatz, wir brauchen Taten.«
Sie band ihm ein schwarzes Tuch fest um die Augen, nahm ihn an der Hand, und die Wanderung begann.
»Es dauert nicht lange, so dürfen Sie wieder sehen«, flüsterte sie; »halten Sie sich immer zu mir, sollte uns doch etwas Ungewöhnliches in den Weg treten. Aber wir haben nichts Derartiges zu fürchten, unser Weg ist einsam und daher sicher.«
Westerly wurde durch mehrere Zimmer und Korridore geführt, dann eine Treppe hinunter, dann noch eine und schließlich eine dritte. Eine kühle, fast kalte Luft umgab ihn, er musste sich in einem Keller befinden.
Nach Zurücklegung eines geraden Weges hielt die Führerin. Westerly vernahm ein schwaches Geräusch, wie ein Knacken und Rasseln; wahrscheinlich öffnete sich eine Falltür.
»Jetzt gehen Sie vorsichtig, nur jetzt, damit Sie nicht fallen!«, flüsterte das Weib und dirigierte ihn mit Worten so, bis sein Fuß die Sprosse einer Leiter fand. Nach einem ziemlich langen Abstieg in die Tiefe fand er den Boden; seine Stiefel plätscherten im Wasser.
Nachdem er einige Meter im Zickzack und im Bogen geführt worden war, wurde ihm der Verband abgenommen. Neben ihm stand das Weib in Männerkleidung, in der Hand eine brennende Kerze, welche einen mannshohen, gemauerten Gang beleuchtete.
Die Wände waren trocken und mit zahllosen Spinnweben bedeckt, der Boden aber feucht; an einigen Stellen stand sogar Wasser.
»Ich weiß«, begann Westerly, brach aber erschrocken ab, denn wie Donnerhall schallten die Worte, obgleich nur leise gesprochen, in dem Gewölbe wider.
»Sie dürfen getrost laut sprechen!«, sagte die Duchesse. »Hier hört uns niemand, und an den Widerhall werden Sie sich bald gewöhnen. Was wissen Sie?«
»Ich weiß, wo ich mich befinde!«, flüsterte Westerly trotzdem kaum hörbar.
»Nun?«
»In der alten Wasserleitung.«
»Richtig, in der von Pandus angelegten Wasserleitung.«
»Sie ist doch von den Engländern untersucht und die Gänge sind von ihnen vollständig verschüttet worden?«
»Ja, vor langer Zeit!«, lachte die Duchesse. »Übrigens haben sie nur die äußeren Gänge untersucht, die inneren kennen sie gar nicht. Auch ist noch ein Geheimnis dabei, welches ich Ihnen nicht verraten darf. Würden Sie sich von hier aus nach meinem Hause zurückfinden können?«
»Wenn ich lange genug suchte, vielleicht. Aber die Leiter ist doch wieder hinaufgezogen worden.«
»Und wenn Sie bis in alle Ewigkeit suchten, würden Sie den Weg doch nicht wiederfinden können. Sie befinden sich in einem Labyrinth, gegen welches das des Minotauros noch ein Promenadengang war. Wer hier hereingerät, ist unrettbar verloren. Kommen Sie jetzt, wir haben einen nassen Weg, doch zuletzt wird er besser. Sprechen Sie nicht mehr zu mir, ich muss genau die Schritte zählen, sonst könnte auch ich mich verirren und nie mehr das Tageslicht erblicken.«
Schweigend schritten sie nebeneinanderher, die Duchesse zählte leise. Fortwährend zweigten sich links und rechts andere Gänge ab, und schlug sie einen solchen ein, so begann sie wieder von eins an zu zählen.
Die Gänge waren sich alle gleich, gemauert, oben gewölbt, gut erhalten, und der Boden schlammig oder mit Wasser bedeckt. Auch hier hatte sich Leben eingebürgert. Spinnen krochen an den Wänden und machten auf schwarze Käfer Jagd, und hier und da huschte eine Eidechse vorbei.
Westerlys Herz erfüllte sich mit Grausen, während er diese öden, kalten Mauern betrachtete und dabei das flüsternde Zählen vernahm.
Ein Schauer rann über seinen Rücken herab, wenn er sich ausmalte, wie beide ziellos zwischen den nackten Mauern umherirrten, wie sie endlich vor Hunger erschöpft zu Boden sinken würden, ein Fraß für die Spinnen und Käfer...
Westerly verscheuchte diese schrecklichen Gedanken, indem er an sein Vorhaben dachte, und wie er mit der schmerzenden Hand den Dolch umklammerte, gelang ihm dies auch. Die Furcht wurde von der Hoffnung auf Rache vertrieben.
Da blieb die Duchesse stehen.
»Haben Sie sich verirrt?«, rief er erschrocken.
»Nein, wir sind gleich am Ziel«, entgegnete sie, »wir müssen nur Vorbereitungen zu einem Schleichweg treffen...«
Beide setzten sich auf den hier völlig trockenen Boden und vertauschten die durchnässten Stiefel mit den Filzschuhen. Dann gingen sie unhörbar noch einige Schritte weiter, und das Weib deutete auf eine nach oben führende Steintreppe.
»Wir befinden uns unter dem Gouvernements-Palast«, flüsterte sie; »diese Treppe bringt uns in seinen Keller.«
»Und niemandem ist dieser unterirdische Gang bekannt?«
»Auch der, welcher uns die Keller- und anderen Türen öffnet, kennt diese Treppe, aber nicht den Weg nach meinem Hause. Er würde nicht wagen, den Gang zu betreten.«
Die Treppe war breit genug, dass beide sie nebeneinander passieren konnten. In der Decke des Gewölbes war ein Loch, in diesem verschwand die Treppe, und wie in einem Tunnel stiegen die beiden empor.
Als die Stufen endeten, verlöschte die Duchesse das Licht, einige Augenblicke vergingen, sie tastete mit den Fingern an der Wand umher, dann erklang ein ganz geringes Geräusch, als ob sich etwas in Angeln drehe, und in der Decke war eine Öffnung entstanden.
Jetzt stießen sie auf kein Hindernis mehr, welches beseitigt werden musste. Als die Duchesse also sagte, ihre Kraft reiche nicht, den Mechanismus zu bewegen, hatte sie gelogen.
Die Wanderung ging durch einige Kellergewölbe, Treppen hinauf, einige Türen wurden passiert, dann kamen Gänge des Erdgeschosses, und Westerly hörte durch ein offenes Fenster das Rauschen der Blätter.
Draußen war finstere Nacht, auch hier leuchtete kein Licht, nur aus einem anderen Gange drang ein schwacher Schein zu ihnen.
Die Duchesse betrachtete das Fenster, an dessen Riegel ein weißes Bändchen hing, jedenfalls ein Zeichen.
»Wir sind sicher, der Weg ist offen«, flüsterte sie Westerly ins Ohr, ergriff seine Hand und zog ihn um eine Ecke.
Der Lord erschrak doch, als er sich plötzlich auf einem fürstlich ausgestatteten, mit Teppichen belegten Korridor sah. Er befand sich im Innern des Gouvernements-Palastes.
Doch die Führerin ließ ihm nicht lange Zeit zum Überlegen; von ihr geführt, huschte er über den Korridor, wie durch Zauberei öffnete sich eine Tapetentür und schloss sich wieder hinter ihnen.
Sorglos brannte die Duchesse ein Wachskerzchen an und leuchtete beim Besteigen einer Wendeltreppe. Keine Stufe knackte, vollkommen lautlos erreichten sie ihr Ende.
Hier blieb das Weib stehen und lauschte — Totenstille umgab sie.
»Wir sind am Ziel«, flüsterte sie Westerly wieder ins Ohr, »nur mutig und kaltblütig, wir riskieren nichts dabei! Dies ist das Zimmer des Dieners, er ist abwesend. Wir gehen beide hindurch in das des Gouverneurs.«
»Und wenn wir getrennt werden? Ich finde den Rückweg nicht.«
»Wir werden nicht getrennt.«
Unter dem Druck ihrer Hand öffnete sich abermals völlig geräuschlos eine Tapetentür, ein gedämpftes Licht fiel ihnen aus dem Gemach entgegen.
Aber was war das? Beide blieben mit stockendem Atem stehen — dort an dem Tisch stand ein Inder. Er drehte ihnen den Rücken, er sah oder hörte nicht, was hinter ihm vorging.
Nur einen Moment währte der Schrecken des Weibes, dann drückte sie die Hand des Gefährten und deutete auf jenen Mann.
Westerly hatte verstanden. Der Weg nach dem Schlafgemach des Gouverneurs ging über die Leiche dieses Dieners, und er zögerte nicht.
Die Lippen fest zusammengepresst, in der erhobenen Hand den Dolch, schlich er vorwärts, ihm zur Seite die Duchesse. Er hatte ja schon gesehen, wie es gemacht werden musste. Jetzt wollte er seine Erfahrung verwerten.
Er stand dicht hinter dem völlig Ahnungslosen, der Dolch senkte sich, die Spitze berührte den bloßen Hals des Inders, und plötzlich, wie vom Herzschlag getroffen, ließ der Mann beide Arme schlaff herabfallen und neigte sich zur Seite.

Er wäre geräuschvoll zu Boden gestürzt, hätte ihn das Weib nicht in den Armen aufgefangen und den Körper langsam niedergleiten lassen.
Sofort deutete sie nach der Tür, und Westerly zögerte nicht, sein Hauptwerk zu verrichten. Fest umklammerte er den Griff des Dolches.
Ehe er zur Tür schlich, warf er noch einen Blick auf sein Opfer und — plötzlich taumelte er zurück, stieß einen markerschütternden Schrei aus und brach fast selbst zusammen.
»Was geht da vor, Abel?«, rief im Zimmer nebenan eine tiefe Stimme; es erfolgte ein Sprung, und gleichzeitig erklang ein Ton wie das Knacken eines Pistolenhahnes.
Fort stürzte Westerly, der Tapetentür zu, verfehlte die Stufen und schlug hinunter, doch schon war die Duchesse neben ihm, fasste seine Hand und zog den Halbbetäubten mit sich, durch Gänge und Keller, bis sich die Falltür wieder hinter ihnen schloss. Sie hörten noch eine Glocke schallen, dann standen sie wieder im Gange der Wasserleitung.
Wütend entzündete die Duchesse ihre Kerze und leuchtete dem Begleiter ins Gesicht. Sie erblickte plötzlich ganz fremde Züge, sie waren von einer entsetzlichen Angst entstellt. Beim Fall von der Treppe hatte sich Westerly ein tiefes, dreieckiges Loch an der Stirn zugezogen, aus dem das Blut über das Gesicht lief. Dabei zitterte er wie Espenlaub am ganzen Körper; klirrend entfiel seiner Hand der Dolch, den er bisher umklammert gehalten hatte. Schnell eignete die Duchesse sich ihn an.
»Sie wären wert, dass ich diese Waffe jetzt gegen Sie richtete!«, stieß sie endlich mühsam hervor. »Ganz nahe dem Ziele, befällt Sie die Angst, und Sie machen diese Dummheit. Lord Canning besitzt zwar einen sehr leichten Schlaf, er hätte uns aber doch nicht eintreten hören. Nun ist alles verdorben.«
Westerly vernahm die Vorwürfe gar nicht. Sein Zittern nahm immer mehr zu, er musste sich an die Wand lehnen, und dabei griff er fortwährend wie tastend an der Stirn herum, seine Hand mit Blut befleckend und diese dann entsetzt betrachtend.
»Mensch, was haben Sie denn nur?«, herrschte ihn das Weib an. »Sind Sie solch ein Schwächling? Wischen Sie sich wenigstens das Blut aus dem Gesicht.«
»Abel, Abel!«, stammelte Westerly, und konnte auch nichts weiter hervorbringen.
»Na ja, so ist der Diener Lord Cannings getauft, er ist von Missionaren erzogen worden. Hätten Sie nur mir den Dolch gegeben, ich würde Lord Canning doch noch entgegengetreten sein.«
»Abel — Abel!«, wimmerte Westerly.
»Sie tun gerade, als wären Sie Kain, der seinen Bruder Abel ermordet hat.«
Westerly sank bei diesen Worten fast in die Knie, die Duchesse trat einen Schritt zurück und hob zu ihrem Schutz den Dolch, denn sie glaubte es mit einem Irrsinnigen zu tun zu haben, ein so entsetzlicher Ausdruck lag in seinen Augen.
»Abel — Kain!«, ächzte er. »Sehen — auch Sie schon das Mal auf meiner Stirn?«
»Sie sind von der Treppe gestürzt.«
»Ich habe meinen Bruder ermordet!«, schrie er gellend. Das Weib erschrak doch etwas.
»Unsinn, Sie träumen!«
»Haben Sie nicht gesehen — die Narbe an seiner Wange — es war Abel — mein Bruder — der Sohn meiner Mutter — und ich habe ihn ermordet — das Mal — das Mal an meiner Stirn!«
Plötzlich wurde sein Blick noch starrer, er stierte in die Ferne, dann stieß er ein gellendes Geschrei aus.
»Da — da kommt er schon, der Rächer mit dem flammenden Schwert.«
Er stürzte davon. Die Duchesse wollte ihn rufen, zur Besinnung bringen, aber das Wort erstarb ihr auf den Lippen. Gleichzeitig erscholl ein klagender, wimmernder Ton, wie der eines Sterbenden, nur hundertmal lauter.
Von dort, wohin er gedeutet hatte, näherte sich ihr ein flackerndes Licht, es schien durch die Luft geschwungen zu werden, schnell kam es näher, und da erkannte sie auch schon eine geisterhafte Gestalt, welche der Unterwelt entstiegen sein musste.
Welcher Mensch kann sich rühmen, nie von Gespensterfurcht befallen zu werden? Prahler, welche es spöttisch bestreiten, hört man oft, aber gerade ihnen sträubt sich das Haar am leichtesten auf dem Kopfe.
Auch der Duchesse, sonst ein furchtloses Weib, sank plötzlich der Mut bis auf ein Minimum zusammen; angesteckt von dem Entsetzen ihres Begleiters, jagte sie davon, ihm nach, ohne sich um die Richtung zu kümmern.
Nur ihm nach, nur nicht allein hierbleiben, und hinter beiden her jagte eine wilde Gestalt, einen brennenden Zweig in der Luft schwingend, und dabei erfüllte ein unnatürliches, heulendes und wimmern des Geschrei die Gewölbe mit einem tausendfachen Echo.
Obgleich die Exerzierstunden der anglo-indischen Truppen auf den frühen Vormittag verlegt waren, mussten die Soldaten doch ganz gewaltig schwitzen, die Gemeinen wie die Offiziere, und nicht einer war darunter, der nicht von ganzem Herzen gewünscht hätte, die Uhr sei elf und der Exerzierdienst somit für heute zu Ende.
Captain Atkins war beliebt, weil er gerecht war und allen mit gutem Beispiel voranging; aber im Dienst ließ er nicht mit sich spaßen. Die Soldaten, Offiziere und Gemeine, welche ihm zugeteilt waren, murrten anfangs ganz gewaltig über sein scharfes Kommando, das sie von seinem Vorgänger nicht gewohnt gewesen, doch als sie sahen, wie er sich selbst nicht im geringsten schonte und dafür nach dem Dienst die Disziplin fast bis zur Gemütlichkeit lockerte, da verstummte ihr Murren.
Captain Atkins war eben ein Bataillonsführer comme il faut, er verstand es, seine Leute zu behandeln und zu tüchtigen Soldaten zu machen.
Heute war es aber fast zu arg. Die neu angekommenen Soldaten, die meist in England nur eine notdürftige Ausbildung erhalten hatten, mussten in feldmarschmäßiger Ausrüstung Dauerlauf üben, und nie fiel dieser zur Zufriedenheit des Captains aus.
Den Soldaten lief der Schweiß in Strömen vom Gesicht, aber es war nicht roter als das ihres Leutnants, Eugens, dem, obgleich er ruhig zu Pferde saß, die Stirn noch nasser war, vor heimlichem Unmut über die Rügen, die er eben erhalten hatte.
Es war ja gar nicht mehr zu verlangen, dass die Leute elastisch auf den Fußzehen wie Balletteusen springen konnten, nachdem sie sich vorher in Einzelmärschen erschöpft hatten.
Die etwa hundert Mann starke Abteilung übte nach den Klängen der Trommeln und Pfeifen der vier Trommeljungen, und diese hatten vielleicht das schwerste Los. Sie trugen zwar kein Gepäck und keine Waffen, dafür aber mussten sie die Trommel rühren oder die Pfeife handhaben, immer vorn an der Spitze der rennenden Abteilung.
Wurde nun ›Kehrt‹ kommandiert, so mussten sie geschlossen um den Zug herumlaufen und sich wieder an die Spitze stellen, bekamen also fast niemals Ruhe.
Einer von ihnen, ein junges, hübsches, zartgebautes Kerlchen, schien die Geschichte herzlich satt zu haben; die Wut, die in ihm kochte, konnte man ihm am Gesicht ablesen. Wer nicht selbst Soldat und nicht selbst gedrillt worden ist, kennt diese furchtbare Wut gar nicht, die mit Mordgedanken umgeht; nur merkwürdig, dass sie sofort verraucht ist, wenn man das Seitengewehr nach dem Dienst abschnallt. Ja, ein ganz unbeschreibliches Wohlbehagen befällt einen.
»Abteilung kehrt, marsch marsch!«, kommandierte Eugen jetzt wohl schon zum zwanzigsten Male.
Da geschah etwas, was der Exerzierplatz zu Delhi noch nie zu sehen bekommen hatte. Jener kleine Trommeljunge riss plötzlich seine Trommel ab, warf sie heftig zu Boden, schleuderte sie mit dem Fuße fort, rannte hinterher und gab ihr wieder einen Fußtritt — kurz, er spielte mit ihr Fußball, das beliebte englische Ballspiel.
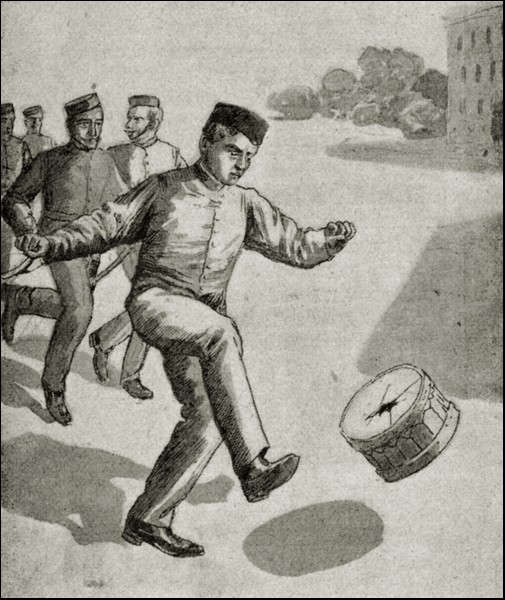
Die Abteilung hielt ohne Befehl, man glaubte seinen Augen nicht trauen zu dürfen; Eugen saß sprachlos im Sattel.
»Der Junge ist verrückt geworden!«, rief er dann. »Bob, was fällt dir ein!«
Bob, der Trommeljunge, hörte aber nicht, denn er war verrückt geworden. Wie hätte er sonst auch solch einen unglaublichen Streich begehen können! Ruhig spielte er mit der Trommel weiter Fußball und entfernte sich immer mehr von der Truppe.
Da kam schon der Captain herangesprengt.
»Er ist verrückt geworden«, rief Eugen nochmals, »fangt ihn, Leute!«
Jetzt war der Bann gebrochen, die Abteilung löste sich auf und jagte hinter dem Bengel her, ihn zu fangen.
Das war aber leichter gesagt als getan. Bob war schnellfüßiger als eine Gazelle, immer entwischte er wieder den nach ihm ausgestreckten Händen, dabei aber trieb er die Trommel noch durch Fußtritte vor sich her.
Endlich hatte der langbeinige Corporal ihn erwischt und hielt ihn am Genick fest. Captain Atkins und Eugen sprengten heran und sprangen von den Pferden, um den Fall näher zu untersuchen.
»Er hat einen Sonnenstich wegbekommen!«, keuchte der Corporal atemlos.
Das schien aber gar nicht der Fall zu sein, oder der Sonnenstich war von einer bis jetzt unbekannten Art.
Bob steckte die Hände in die Hosentaschen und schaute die beiden Offiziere mit grimmigem Gesicht an.
»Was ist dir denn eingefallen, Bursche?«, fragte Atkins. »Bist du verrückt geworden?«
»Verrückt? Unsinn!«, schrie der Knirps wütend. »Aber satt habe ich Eure Quälerei. Oder glaubt Ihr, ich lasse mich wie ein Esel geduldig schinden?«
Die umstehenden Soldaten waren starr wie Eugen selbst, nur Captain Atkins behielt seine Fassung bei solch einer unerhörten Subordination.
Er bestieg wieder sein Pferd.
»Leutnant Carter, lassen Sie die Leute antreten, bringen Sie den Jungen zur Vernunft und nehmen Sie im Schatten Gewehrübungen vor. Vor dem Appell spreche ich mit Ihnen über den Jungen.«
Das sollte so viel heißen wie, Eugen sollte den Aufsässigen im Guten zum Gehorsam bringen, falls er nicht wirklich durch die Hitze Schaden erlitten hatte. Seine Strafe war eine geringere, wenn er sich schnell wieder fügte; bestraft musste er freilich werden.
Eugen ließ die Leute sich ordnen und beschäftigte sich abseits mit Bob. Doch er hatte einen schweren Stand.
»Bob, fühlst du dich krank?«
»Nicht im Geringsten«, war die gleichmütige Antwort, und der Junge hielt es nicht einmal für nötig, die Hände aus den Hosentaschen zu nehmen.
»Bist du nicht klar im Kopfe?«
»Klar wie unsere dünne Suppe, Herr Leutnant.«
»Dann mach keine Torheiten, Bob, stell dich ins Glied!«
»Fällt mir nicht ein.«
»Was? Du weigerst dich?«
»Ich habe die Soldatenspielerei nun satt.«
Eugen wusste nicht, was er sagen sollte, so etwas war noch nie vorgekommen.
»Bob, nimm Vernunft an. Du kommst mit einer kleinen Strafe davon, mit ein paar Tagen Arrest, wenn du dich wieder ordentlich beträgst. Wenn du dich aber noch weigerst, dann sind dir Stockprügel sicher.«
Bob zog eine Hand aus der Tasche und hielt sie dem Leutnant hin.
»Wetten wir, dass ich keine Stockprügel bekomme?«
»Mensch, du bist verrückt. Du bist Soldat, verstehst du? Du hast dich auf zwölf Jahre verpflichtet, und wenn du...«
»Hahaha, auf zwölf Jahre!«, lachte Bob. »Keine Minute bleibe ich mehr hier; Eure Schinderei hängt mir zum Halse heraus.«
»Ich kann dich sofort in Eisen legen lassen, du kommst vors Kriegsgericht, und wenn du milde Richter hast, so erhältst du eine Tracht Prügel und wirst mit Schimpf und Schande aus der Armee gestoßen.«
»Hahaha!«, lachte der freche Bursche und hielt sich die Seiten. »Ich vors Kriegsgericht! Ich eine Tracht Prügel! Um wie viel wetten wir, dass ich nichts bekomme? Um hundert Pfund?«
»Du kannst auch deine zwölf Jahre hinter Festungsmauern absitzen.«
Das vermehrte nur Bobs Lachen.
Dem Leutnant ging die Geduld aus. Auch die Leute verzogen schon den Mund, und wollte er sich nicht den Respekt vergeben, so musste er den Aufsässigen abführen lassen.
Noch einmal redete er ihm im guten zu, das letzte Mal, dann würde er abgeführt werden. Bob wurde plötzlich nachdenklich, er hörte den Leutnant wenigstens ruhig an.
»Wo komme ich denn vor das Kriegsgericht?«, fragte er dann. »Hier oder in England?«
»Du gehst mit dem ersten Schiff nach England, und nun denke dir, wenn du an Händen und Füßen geschlossen durch die Straßen geführt wirst! Was werden deine Kameraden denken, die jetzt glauben, du seist schon bald Corporal.«
»Na, meinetwegen«, sagte Bob und hängte seine durchlöcherte Trommel wieder an den Gürtel, »da will ich noch ein bisschen Soldatens spielen, aber das sage ich gleich, nur so lange, wie es mir gefällt.«
Damit stellte er sich wieder in die Reihe.
Vor dem Mittagsappell machte Eugen dem Captain Meldung, er durfte nichts verschweigen, und der Bataillonsführer war sehr aufgebracht.
»Ich wollte den Jungen nur mit Arrest bestrafen«, sagte er, »weil er eben noch ein Kind ist und noch nicht recht begreifen kann, was für ein schweres Verbrechen Ungehorsam im Dienst ist; aber diese Frechheit geht über alle Grenzen. Ist er schon vom Arzt untersucht?«
»Zu Befehl, Herr Captain.«
»Was sagte der Arzt?«
»Eine Gehirnstörung liegt nicht vor.«
»Dann muss ein Exempel statuiert werden, schon der anderen Trommeljungen wegen. Bob erhält sechs Stockschläge, die mildeste Strafe für ein derartiges Vergehen.«
»Herr Captain, Bob ist noch sehr jung und zart und sonst gut im Dienst«, ergriff Eugen seine Partei.
»Es bleibt dabei. Hätte er wenigstens den Streich im ersten Unmut begangen und ihn dann sofort bereut; aber hinterher noch diese Frechheit, diese Antworten — nein, es geht nicht. Er erhält sechs Stockschläge, die ersten, die ich diktiere, und hoffentlich die letzten.«
Wie bei den Schiffsjungen in der deutschen Marine, so wird auch bei den englischen Trommeljungen die Prügelstrafe noch angewendet. Überdies werden in England auch rückfällige Verbrecher geprügelt.
Die Abteilung stand zum Appell angetreten, jeder Corporalschaftsführer, darunter auch Jim Green, meldete die Anzahl seiner Leute, dann wurde der Tagesbefehl vorgelesen und zum Schluss die Strafen verkündet.
Bob musste sich vor die Front stellen, der Feldwebel verlas seine Strafe, sechs Stockschläge wegen groben Vergehens gegen die Subordination, zu empfangen nachmittags vier Uhr vor versammelter Mannschaft.
Bob zuckte mit keiner Wimper, er zog vielmehr ein höhnisches Gesicht und schielte dabei nach Jim Green, der dem kleinen Burschen wiederum mit den Augen zuzwinkerte und allerhand heimliche Grimassen schnitt, um den Delinquenten zum Lachen zu bringen.
Der Trommeljunge gehörte zu seiner Corporalschaft, und Jim Green, als Ordonnanz vom schweren Dienst befreit, betrachtete das ganze Soldatenleben nur als eine Spielerei, mit der man sich soviel wie möglich amüsieren müsste.
»Wegtreten!«, erscholl das Kommando; die Soldaten marschierten nach der Küche, holten das Mittagessen und verfügten sich in ihre Reviere.
Wie in allen anderen Stuben, so wurde auch in der Jim Greens sonst gewöhnlich während des Mittagessens diskutiert und politisiert; der eine schimpfte über den Bataillonsführer, der andere über die Königin von England, dieser meinte, wäre er Kriegsminister, er würde die Sache ganz anders machen, jener tadelte das neueste Kolonialunternehmen Englands, wenn man nur auf seinen Rat hören wolle und so weiter.
Heute herrschte ein anderes Thema; unbarmherziger Hohn wurde ausgeschüttet.
»Du, Tom«, rief ein Soldat, »welche Stöcke ziehen denn besser, die von Akazie oder von Haselnuss?«
»Hast du noch etwas Öl und Heftpflaster?«
»Stopf dir nur den Rock gut aus, mein Junge!«
»Jawohl, hat sich was auszustopfen«, lachte ein alter Soldat den Rekruten aus, »er muss den Buckel nackt hinhalten, das ganze Hemd muss er ausziehen. Na, Bob«, wandte er sich an diesen, »brauchst doch deshalb nicht gleich rot zu werden wie ein Mädchen, bist doch ein Junge. Und was die entehrende Strafe anbetrifft, na, Bob, darum brauchst du dir auch keine grauen Haare wachsen zu lassen. Bei dem früheren Captain war es ganz anders, der diktierte bei jeder Kleinigkeit Stockhiebe, und wenn ich alle die zusammenzählen wollte, die ich bekommen habe, da würden einige hundert voll. Bin ich deswegen entehrt, he? Unsinn, das sind Redensarten. Beiß die Lippen zusammen und halte aus! Damit fertig!«
Bob ließ den Spott ruhig über sich ergehen; anfangs hatte er immer behauptet, er bekäme doch keine Stockhiebe, und sogar Wetten angeboten.
Doch die Soldaten lachten nur über seine Prahlerei — und so schwieg er schließlich. Überdies hatten die Soldaten nichts zu verwetten, ihre hohe Löhnung wurde am Zahlungstage sofort verjubelt. Von Bob war bekannt, dass er sein Geld in Kandiszucker anlegte, zur Verwunderung aller, die sich eine solche Vorliebe gar nicht erklären konnten.
War der Spott manchmal zu unbarmherzig, so kam dies daher, weil der Exekution alle Mann im Hofe beiwohnen mussten, die Leute büßten also eine Freistunde ein.
Bei den Worten des letzten, etwas tröstenden Sprechers, hob Bob trotzig den Kopf.
»Und ich bekomme doch keine Stockschläge«, wiederholte er, »ich lasse es mir nicht gefallen!«
Ein allgemeines Gelächter folgte dieser behaupteten Unmöglichkeit.
»Herrgott«, sagte jetzt auch Jim Green »was ist denn da weiter dabei? Sechs Hiebe kann jeder aushalten. Schaden tut's dir überhaupt nicht, Bob, du hast immer ein freches Maul!«
»Ich bekomme aber keine Stockhiebe!«
»Werden's ja sehen! Ach, Bob, das wird herrlich, wenn du so dein Hemdchen ablegst, dich krumm hinstellst, festgeschnallt wirst, und nun geht's los: au — o — hih!«
Jim machte mit seinem Messer die Bewegung des hauenden Stockes nach und heulte dazu. Doch gleich fiel's ihm ein, dass er dem Jungen gar zu sehr mitspielte.
»Heule nur nicht, Bob«, begütigte er, »so schlimm wird's schon nicht. Der Stockmeister ist mein Freund, und wenn ich mit ihm spreche und eine Bulle Whisky spendiere, dann wird er schon ein bisschen sanft zuhauen. Aber den Whisky musst du zahlen, Bob.«
»Er wird mich überhaupt nicht schlagen«, behauptete der Junge abermals, und dabei blieb er, ohne den Grund für seinen so festen Glauben, der ja auf einer Unmöglichkeit beruhte, anzugeben.
Aber er sollte doch schließlich recht behalten.
Während sich die übrigen Soldaten zur Nachmittagsruhe aufs Bett legten, wanderte Bob in der Stube auf und ab, und, ob sein Trotz vielleicht abnahm, je mehr sich die Stunde der Exekution näherte, oder ob er nun einsah, dass er der Prügelstrafe doch nicht entging, der zuversichtliche Gesichtsausdruck verschwand immer mehr, und machte einem traurigen, niedergeschlagenen Ausdruck Platz.
Wenn er an dem schlafenden Jim vorbeikam, betrachtete er stets das frische, kecke Gesicht mit dem kleinen Flaum, und dann konnte er nie einen Seufzer unterdrücken.
Jetzt blieb der Junge stehen, er schien einen Entschluss gefasst zu haben.
»Nein, ich führe es doch durch«, murmelte er; »aber schlagen lasse ich mich auf keinen Fall. Das Schlagen ginge schließlich noch, aber das andere, wo er dabei ist, nein...«
Der rastlose, pflichtgetreue Captain saß noch in seinem Privatbüro und ließ sich vom Feldwebel die laufenden Schriftstücke zur Einsicht und Unterschrift reichen, als kurz an die Tür geklopft wurde und, ohne das Herein abzuwarten, ein Trommeljunge eintrat, der sich nicht einmal in militärischer Haltung rechts neben der Tür aufbaute, sondern sich mit gesenktem Kopf und zerknirschter Miene, die Mütze in der Hand drehend, hinstellte.
Der Feldwebel machte ein Gesicht, als erwarte er jetzt den Weltuntergang. Dass ein anderer als der Herr Captain selbst diese Tür benutzte, war ihm einfach eine Unmöglichkeit. Der Weg in dieses Zimmer führte durch das Büro nach vorheriger Anmeldung und erteilter Erlaubnis.
Es sollte noch besser kommen.
Der Captain wendete den Kopf und schien ebenfalls erstaunt zu sein.
»Wie, ist das nicht der Trommeljunge von heute Morgen?«
»Es ist Bob«, staunte der Feldwebel.
»Wie kannst du hier ohne Weiteres eintreten? Marsch, hinaus!«
Bob ließ sich nicht einschüchtern.
»Herr Captain, ich muss Sie sprechen! Bitte, bitte, hören Sie mich nur für fünf Minuten an!«
Das war ganz unmilitärisch. Der Feldwebel machte Miene, den Burschen hinauszuwerfen und als einen Hochverräter zu behandeln, doch ein Wink des Captains hielt ihn zurück. Atkins war willens, den Jungen anzuhören, denn in Bobs Kopfe musste doch eine Schraube locker geworden sein.
»Willst du Einspruch gegen deine Strafe erheben? Das geht nicht. Die sechs Stockschläge werden dir sehr gut tun.«
»Herr Captain, ich muss Sie sprechen«, wiederholte Bob weinerlich.
»So sprich, fasse dich kurz! Die Strafe wird aber nicht aufgehoben.«
»Unter vier Augen!«
»Was?«
Das war ja unerhört. Der Feldwebel riss den Mund vor Staunen auf.
»Ich muss Sie allein sprechen, schicken Sie den Feldwebel hinaus.«
Atkins betrachtete den Jungen mit einer förmlichen Neugier, wie der Naturforscher etwa eine ihm noch unbekannte Pflanze.
»Feldwebel, gehen Sie hinaus!«, sagte er dann, und der Mann verließ das Zimmer, indem er seinen Kopf befühlte. Er glaubte das alles nur im Traume zu erleben.
Da lag plötzlich Bob vor den Füßen des Captains auf den Knien und hob flehend die Hände.
»Herr Captain, lassen Sie mich nicht schlagen! Bitte, Herr Captain, ändern Sie die Strafe!«
»Steh auf!«, befahl Atkins streng. »Du bist Soldat, Bob! Schon dieses weibische Betragen ist strafwürdig!«
»Ich stehe nicht eher auf, als bis Sie die Strafe umgeändert haben!«
»Ich lasse dich sofort arretieren und abführen!«
»Lassen Sie mich nicht schlagen!«, flehte Bob unbeirrt weiter.
»Du willst nicht gehorchen?«, rief Atkins entrüstet.
»Nein, denn ich bin...«
»Was bist du?«
»Ich bin entehrt, wenn ich geschlagen werde!«
Der Captain fühlte Mitleid mit dem Knaben. Er sah doch ein, dass er in Bob eine ganz andere Person vor sich hatte als einen jener meist sehr verwilderten Trommeljungen, der zwischen rohen Soldaten aufwächst, ohne Eltern und Geschwister.
Er wollte ihm wenigstens Mut einflößen.
»Du hast gegen die Disziplin, ohne welche sich das Militär in eine Horde zügelloser Wilde verwandeln würde, arg gefrevelt, und dann auch noch den Respekt verletzt. Das muss bestraft werden, und jede Strafe ist entehrend, sie kommt in dein Führungsbuch und bleibt darin stehen. Nur durch gute Führung kannst du deine Ehre wiederherstellen. Ob du Arrest bekommst oder Stockhiebe, ist ganz gleichgültig, beides ist entehrend.«
»Geben Sie mir Arrest, Herr Captain«, flehte der Junge, »so viel Sie wollen, ein halbes Jahr, aber nur keine Prügel!«
»Der Befehl ist bekannt gemacht worden, ich kann ihn nicht zurücknehmen!«
»Ich will mein ganzes Leben ohne Löhnung dienen!«
»Du erhältst die Strafe! Steh auf!«
Bob stand auch auf, aber mit blitzenden Augen.
»Ich will nicht geschlagen sein, und man wird mich auch nicht schlagen!«, sagte er mit Betonung.
Atkins betrachtete den Jungen noch einmal prüfend. Er schien Energie zu besitzen, und der Fall war nicht ausgeschlossen, dass er aus Furcht vor der entehrenden Strafe selbst Hand an sich legte. Was sollte Atkins tun? Eine Umänderung der Strafe durfte er sich auf keinen Fall abtrotzen lassen; aber konnte sein Gewissen nicht mit einer furchtbaren Anklage belastet werden?
Bob mochte ahnen, was im Innern des Captains vorging; er warf sich wieder vor ihm nieder und umklammerte sogar seine Knie.
»Herr Captain, lassen Sie mich nicht schlagen, geben Sie mir sonst die härteste Strafe!«, winselte er mit herzzerbrechender Stimme.
Atkins wurde förmlich verlegen. In einer solchen Lage hatte er sich noch nie befunden.
»Warum fürchtest du dich nur so sehr vor dem Stock? Du, ein Soldat, solltest doch nicht solche Angst vor Schmerzen haben!«
»Nicht die Schmerzen, die Schande fürchte ich!«
»Jede Strafe hat diese im Gefolge!«
»Ich muss mich entkleiden — in Gegenwart — aller Soldaten!«, schluchzte Bob.
Das war ja ganz seltsam.
»Verletzt denn das dein Schamgefühl?«, fragte Atkins erstaunt.
»Ja — und ich tu's nicht, ich mache sonst etwas!«
»Keine Drohung!«, rief Atkins streng. »Sie würde dir am allerwenigsten nützen! Jetzt steh auf und betrage dich so, wie es sich für einen englischen Soldaten geziemt! Ich will diesmal das Unmögliche tun! Du bist noch ein Kind und eignest dich nicht besonders zum Militär, dies bewegt mich, deine Strafe umzuändern. Statt der sechs Stockhiebe erhältst du ebenso viele Tage strengen Arrest. Nach deiner Entlassung werde ich dafür Sorge tragen, dass du wegen Unbrauchbarkeit verabschiedet wirst. Ich hoffe, es wird dir recht sein!«
Bob hatte das letztere überhört; er vernahm nur, dass er keine Prügel bekommen sollte, und wie er seinen Dank in jubelnder Weise ausdrückte, überstieg alle Grenzen der militärischen Ordnung. Es hätte nicht viel gefehlt, so wäre er dem gestrengen Herrn Bataillonsführer um den Hals gefallen und hätte ihn geküsst.
»Der Bursche taugt nicht unter die Trommeljungen!«, dachte Atkins, als der glückliche Bob ihn verlassen hatte. »Er besitzt einen weibischen Charakter, ist eigenwillig und launisch. Bleibt er beim Militär, so würde er sich noch unglücklich machen. Ich werde Gründe suchen, ihn zu entlassen und nach England zu schicken. Wie ich aus seinem Buche sehe, hat er bedeutende Anlagen zur Musik, er hat sich die Technik aller Instrumente in der kürzesten Zeit angeeignet. Ich will sehen, dass ich ihn ausbilden lassen kann; hier würde er nur verkommen, und außerdem will ich sorgen, dass er in seinem strengen Arrest mit besonderer Milde behandelt wird. Es soll ihm nichts abgehen!«
Die Soldaten wunderten sich, dass sie nicht zusammengerufen wurden, um der Prügelexekution beizuwohnen, man vermisste auch Bob; dann lief erst das Gerücht durch die Stuben, dieser sei in Arrest abgeführt worden, und schließlich bestätigte es sich. Der Junge war schon vor einer Stunde von einem Gefreiten nach dem Arrestlokal gebracht worden; der Captain hatte die Strafe in sechs Tage strengen Arrest verwandelt.
Die Verwunderung war natürlich eine sehr große, umso mehr, als es Bob vorausgesagt hatte.
»Weiß der Teufel, wie der Junge es fertiggebracht hat, den Captain rumzukriegen«, brummte Jim Green, als er sich seine Ordonnanztasche umhing, »der lässt doch sonst nicht mit sich spielen! Na, da bin ich ihn einmal für sechs Tage los. Möchte nur wissen, warum der Bengel an mir einen solchen Narren gefressen hat; er hängt sich an mich wie eine Klette und verfolgt mich auf Schritt und Tritt. Habe mich oft genug darüber geärgert, der Kerl hat mich schon manchmal gestört. Na, heute Abend habe ich vor ihm Ruhe, und das ist gut. Nun will ich mit dem niedlichen Mädchen einmal intimere Bekanntschaft machen.«
Bob saß schon in seiner Zelle.
Der aufgeweckte Junge merkte sofort, dass der Schließer besondere Instruktionen empfangen hatte; denn obgleich es im strengen Arrest eigentlich finster sein sollte, so wurde doch die Fensterklappe nicht geschlossen, der Wärter schien es vergessen zu haben. Auch brachte ihm der Mann brummend mehrere Decken; im strengen Arrest, wo man auf der Holzpritsche schlafen musste, ein unbekannter Luxus.
Atkins hatte recht gehabt, als er Bob als weibisch und launenhaft bezeichnete.
Vor kurzem in Tränen aufgelöst, war er jetzt die Fröhlichkeit selber. Während sonst der verurteilte Soldat die enge, dumpfige Zelle, in der in Indien natürlich immer eine Atmosphäre zum Ersticken herrscht, niedergeschlagen betritt und sich in dumpfem Brüten auf die Pritsche setzt, war das erste, was Bob tat, als der schwere Riegel vorgeschoben wurde, dass er einen polternden Step tanzte und dazu mit heller Stimme Gassenhauer sang, einen immer zweideutiger als den anderen, englische Lieder von der gemeinsten Sorte.
Solchen Lärm durfte der Schließer natürlich nicht dulden, er öffnete die Klappe in der Tür.
»Willst du wohl ruhig sein, Kerl?«, herrschte er Bob an. »Ich lasse dich krummschließen, wenn du noch Spektakel machst!«
Bob antwortete mit einem neuen Gassenhauer und bearbeitete dabei den Boden taktmäßig mit Hacken und Spitzen seiner Kommissschuhe. Sonderbarerweise begnügte sich der sonst so strenge Schließer mit seiner einmaligen Drohung. Als sie nichts fruchtete, kümmerte er sich nicht mehr um Bob, er mochte es noch so arg treiben.
Zum Vesper erhielt der Gefangene nicht das vorschriftsmäßige trockene Brot und Wasser, sondern Kasernenkost, bestehend aus Weißbrot, Butter, Käse und Kaffee, und jetzt wusste Bob, dass sein Arrest nur scheinbar streng war.
Nach dem Vesper kamen neue Verbrecher an, sie wurden verteilt, und dann begann die Unterhaltung. Die Soldaten standen an den Fenstern auf der Pritsche und sprachen miteinander, ohne sich sehen zu können. Erst nannten sie ihre Namen, erzählten dann ihre Streiche und brüsteten sich damit. In welchem Tone diese Unterhaltung geführt wurde, kann man sich denken, und Bob suchte die anderen noch darin zu übertreffen.
Der Schließer konnte nichts gegen diesen Unfug tun; verstummte bei seinem Nahen das Gespräch auf dem einen Flügel, so begann es wieder auf dem anderen, und die aufgestellten Posten der Arrestwache hatten nur aufzupassen, dass keiner der Gefangenen ausbrach, wozu übrigens gar kein Grund vorlag, was auch noch nie vorgekommen war. Die Arrestwache ist ja nur eine Förmlichkeit.
Gegen Abend ließ das Gespräch nach, denn die Gefangenen mussten das Licht noch benutzen, mit Hilfe ihrer Kleidungsstücke sich ein Bett auf der Pritsche herzustellen. Auch Bob machte sich aus den Decken ein solches, und zwar ein sehr bequemes.
Nur zwei Soldaten schwatzten weiter und konnten nicht aufhören, wahrscheinlich, weil sie auf ein interessantes Thema gekommen waren, nämlich auf das der weiblichen Bevölkerung Delhis.
Sie gaben ihre Liebesabenteuer zum besten, rissen Zoten und besprachen ihre neuen, zukünftigen Unternehmungen.
Da wurde Bob plötzlich aufmerksam, er hörte ihnen zu, denn ein ihm bekannter Name war gefallen.
»Ich möchte, ich steckte heute Abend in Jim Greens Haut«, sagte der eine Soldat.
»Warum denn?«
»Der schnappt heute noch einen fetten Bissen. Er hat's mir erzählt.«
»Na, die paar Tage vergehen schon, dann blüht unser Weizen auch wieder.«
»Ja, aber Jim hat ein unverschämtes Glück. Hast du das Mädel schon gesehen?«
»Nein, noch nicht. Ich denke, sie tut spröde, die Kleine? Jim sagte so etwas.«
»Bis jetzt war sie's freilich! Vorhin aber, ehe ich abgeführt wurde, hat's mir Jim erzählt. Sie hat sich mit ihm heute Abend bestellt, zum ersten Male, na, und da weißt du doch, was kommen wird. So sind die Mädchen alle.«
»Ist sie denn hübsch?«
»Sehr hübsch. Es muss eine Italienerin oder so etwas sein. Ein Paar Augen hat sie im Kopfe, ah!«
»Also sie hat auch endlich angebissen. Wo wollen sie sich denn treffen?«
»Das wusste Jim selbst noch nicht. Um neun Uhr muss er mit geheimen Depeschen gehen, um zehn kommt er erst von der Kommandantur.«
»So spät noch?«
»Es muss jetzt dort etwas ganz Wichtiges gearbeitet werden, sie schreiben immer bis in die Nacht, sagte Jim, und oft muss er noch ganz spät Briefe hin und her tragen. Daher hat er ja auch eine Passkarte für die ganze Nacht.«
»Hahaha«, lachte der Soldat, »für die ganze Nacht! Der Jim ist doch ein Glückspilz!«
»Und das Mädchen solltest du sehen! Ich kann mir denken, wie Jim wünscht, es wäre erst zehn. Ich glaube, sie wollen sich im Palmengarten treffen, den Jim immer passieren muss. Aber genau wusste er's auch nicht, oder er wollte's nicht sagen.«
»Mir soll's gleich sein, ich habe doch nichts davon. Gute Nacht, Kamerad, drücke deine Pritsche breit und lasse dich nicht von den kleinen Tierchen auffressen!«
Damit verstummte das Gespräch.
Sonderbar, was für eine Erregung es bei Bob hervorgerufen hatte!
Der Junge wechselte beständig die Farbe; bald wurde sein Gesicht blass, bald glühend rot, seine geballten Hände zitterten wie sein ganzer Körper.
Mit einem Sprunge stand er wieder auf der Pritsche am Fenster und rüttelte an den Eisenstäben, als wollte er sie aus der Mauer brechen. Sie spotteten natürlich seiner Anstrengung.
Dachte der so mild behandelte Arrestant etwa an einen Fluchtversuch? Er beschäftigte sich sogar ernstlich mit einem solchen, und zwar mit einer Schlauheit wie ein alter, gewiefter Ein- und Ausbrecher.
Das Arresthaus war ein zweistöckiges Gebäude, von einer drei Meter hohen Mauer umgeben, die hinten einen Hof umschloss. Die Wache befand sich vorn, auf dem Hofe patrouillierte nur ein einziger Posten mit scharfgeladenem Gewehr, und er hatte auch die Instruktion auf jeden Flüchtling zu schießen, doch dieser Fall lag fast außer dem Bereiche der Möglichkeit.
Hier saßen nur die Soldaten, welche einen dummen Streich oder einen Ungehorsam begangen hatten; die Verbrecher und die in Untersuchungshaft Befindlichen wurden im sogenannten Turm gefangengehalten, einem alten Gebäude, das außerhalb Delhis auf einem Hügel lag. Sie brauchten nie lange dort zu schmachten; das erste abgehende Kriegsschiff nach England brachte sie dorthin zum Gericht.
Wenn Bob nun wirklich eine Flucht gelänge und der Posten entdeckte ihn, würde er wohl auf ihn schließen? Bob bezweifelte es. Aber er würde auch die Flucht auf die Gefahr hin riskiert haben, erschossen zu werden.
Der Junge hatte von schon bestraften Soldaten oft gehört, wie leicht es sei, aus dem Arrest zu entweichen, wenn man es wolle. Aber wie schon gesagt, an so etwas dachte niemand. Man saß die paar Tage ruhig ab, es lag kein Grund zur Flucht vor. Selbstbefreiung ist ein schlimmes Vergehen, der Flüchtige wäre sofort in den Turm und vors Kriegsgericht gekommen.
Das alles wusste Bob, er war darüber instruiert worden und dennoch dachte er an Selbstbefreiung. Sein einfacher Plan war schnell gefasst, er führte das aus, was seine Kameraden im Scherz besprochen hatten.
Den Schließer rief bei Anbruch der Dunkelheit ein starkes Pochen an die Tür von Bobs Zelle. Der Junge hatte sich wieder auf die Pritsche geworfen und wand sich, als würde er von den unerträglichsten Leibschmerzen gepeinigt.
Der Mann erschrak. Es war nicht das erstemal, dass ein Arrestant plötzlich vom gelben Fieber oder von der Cholera befallen wurde und gestorben war, ehe sein Schmerzensruf das Ohr des Schließers erreichte.
Unverzüglich öffnete er die Tür und begab sich in die Zelle, um erst zu fragen und sich zu orientieren und dann den Arzt des Arresthauses zu holen.
Kaum aber stand er neben der Pritsche, als Bob wie eine Feder empor schnellte und schon die Tür hinter sich zugeworfen hatte, ehe der Schließer noch zur Besinnung gekommen war.
Bob stand aus dem Korridor im ersten Stock, dessen Fenster nach dem Hof hinausführten. Der Korridorposten befand sich eben in dem anderen Flügel. Ein Sprung zum Fenster hinaus wäre zu gewagt gewesen; der Junge musste auch noch den Posten täuschen, denn an ihm musste er vorbei, wollte er dort an den Blitzableiter gelangen, den er von hier aus erblicken konnte. Eine andere Flucht war nicht denkbar.
Bobs Plan war wohlüberlegt, im Nu wurde er ausgeführt, noch ehe das Hilfegeschrei des gefangenen Schließers ertönte.
Als Bob um die Ecke des Korridors bog, begegnete ihm der Posten mit entblößtem Seitengewehr. Der Soldat wunderte sich nicht, einem Arrestanten zu begegnen. Er war eben ausgetreten, und der bequeme Schließer hatte es, wie gewöhnlich, unterlassen, ihn zu begleiten.
»Nun, Bob, hast du dir eine weiche Pritsche ausgesucht?«, fragte ihn der Posten, trotz des Verbotes, mit den Arrestanten zu sprechen.
»Weich, wie ein Federbett, und...«
In diesem Augenblick wurde die Stimme des Schließers laut, er schrie Zeter und Mord und stieß mit den Füßen gegen die Tür. Er konnte sie mit seinem Schlüssel nicht öffnen, weil Bob von außen den Riegel vorgeschoben hatte.
»Was ist denn das?«, fragte der Posten erstaunt.
»Da wird einer rebellisch«, lachte Bob, »bringe ihn zur Räson. Das ist deine Pflicht.«
Der Posten eilte davon, Bob stand mit einigen Sprüngen an einem Fenster, neben welchem der Blitzableiter herablief, ein Blick nach dem unten auf der anderen Seite des Hofes stehenden Posten, und der Trommeljunge rutschte an dem Blitzableiter hinab.
Da bemerkte ihn der Posten. Erst stand er ganz erstaunt da, sich wie vorher auf das Gewehr stützend, dann sprang er auf Bob zu, ihn festzuhalten. An eine Benutzung seiner Waffe dachte er nicht, er hob sie nur, um mit ihr dem Flüchtling den Weg zu versperren.
Doch schon war Bob mit einem Satz auf einem an der Mauer stehenden Fass, ein anderer Satz, er saß rittlings auf der Mauer und war jenseits verschwunden.
Wenn deine Mutter selbst nicht begreifen kann, warum die ihr seit nun zwanzig Jahren regelmäßig aus England zugehende Pension plötzlich ausbleibt«, sagte Lord Canning zu seinem treuen Diener Abel, während er einige Kuverts mit Blaustift adressierte, »so muss doch angenommen werden, dass sie im Besitze eines Kontraktes ist, nach welchem ihr eine bestimmte Summe jährlich von einer gewissen Person bezahlt werden muss. Kannst du denn nicht erfahren, wer es ist?«
»Nein«, entgegnete Abel, ein christlich getaufter junger Inder mit intelligentem, hellfarbigem Gesicht; »meine Mutter weigert sich, den Namen zu nennen, und ich glaube, sie hat einen Grund dazu.«
»Ah, ich verstehe! Der Kontrakt würde wahrscheinlich erlöschen, wenn sie den Namen ihres Wohltäters veröffentlichte. Weißt du auch nicht, in welcher Beziehung sie zu der Person stand?«
Abel wurde sichtlich verlegen.
»Ich kann's mir schon denken, du brauchst dich deshalb nicht zu schämen«, fuhr Canning fort, »es ist ja in Indien nichts Außergewöhnliches, dass ein reicher Engländer sich in eine schöne Eingeborene verliebt, von ihr ein Pfand seiner Liebe erhält und sich nun verpflichtet fühlt, der Mutter Zeit ihres Lebens eine sichere Existenz zu geben. Wie nun aber, wenn der Mann gestorben ist?«
»Die Mutter sagt, er wäre schon längst tot, die Pension hat sie aber noch bis vor einem halben Jahre regelmäßig erhalten und müsste sie auch bis an ihr Lebensende bekommen. Sie dürfe sie beanspruchen.«
»Wenn sie jedoch den Namen nicht nennen will, ist es schwer, etwas zu erforschen. Nun, schicke deine Mutter morgen oder übermorgen hierher, ich will versuchen, im Geheimen Recherchen anzustellen, um zu einem Resultat zu kommen. Schließlich wäre es ja auch möglich, dass die ganze Familie ausgestorben ist, oder aber, dass die Erbschaft in Hände gekommen ist, wo die Testamentsbedingungen nicht befolgt werden. Ja, ich hatte schon einmal...«
Lord Canning spielte mit dem Blaustift, räusperte sich und sah dann den Inder mit durchdringenden Augen scharf an. Abel besaß ein gutes Gewissen, er konnte den Blick ertragen.
»Kanntest du den Mann von gestern Abend«, fragte Canning, »der die ihm aufgedrungene Rolle als Generalgouverneur wirklich zu spielen versuchte, »und in dessen Handlungen mich zu mischen, mir meine Ehre befahl?«
Der Inder, dem Verstellungskunst unbekannt, wurde abermals sehr verlegen, und mit Verwunderung sah dies Canning.
»Ah, du kennst ihn also? Es wäre ja wunderbar, wenn meine Ahnung begründet ist.«
»Ich weiß nicht, was du meinst, Sahib. Ich kenne den Mann nicht, aber...«
»Was, aber? Sprich offen, Abel!«
»Bei seinem Anblick fiel mir gleich etwas ein — ein Bild...«
»Welches Bild?«
»Das ich einst zufällig in einem Kasten meiner Mutter fand.«
»Es stellte diesen Mann dar?«
»Nein, sondern einen alten Herrn, und der Mann von gestern Abend sah diesem ähnlich; es fiel mir gleich auf.«
»Es ist gut, Abel, ich werde mit deiner Mutter sprechen und ihr Recht zu verschaffen suchen. Den ihr geschenkten Bungalow soll sie auf keinen Fall verlassen, wenn auch alle ihre indischen Nachbarn Ansprüche darauf erheben. Im schlimmsten Falle werde ich ihn kaufen und ihr vermachen. Rufe jetzt die Ordonnanz herein!«
Jim Green trat ein, im Ordonnanzanzug, links am Gurt das breite und lange, schwertähnliche Seitengewehr, rechts im Lederfutteral den englischen Armeerevolver.
»Sechs Briefe«, sagte Canning, »nach der Kommandantur, General Havelock selbst abzugeben und um seine Quittung bitten.«
Die Vertrauensordonnanz verglich die Nummern der Briefe mit denen in seinem Quittungsbuche, quittierte und steckte die sechs Briefe und ein anderes Quittungsbuch in seine Ledertasche. Dann stellte er sich stramm hin, noch etwaige Befehle abwartend.
»Welchen Weg gehst du nach der Kommandantur?«, fragte der Gouverneur.
»Am Tage den näheren durch den Palmengarten, abends durch die Tschandri-Tschack und dann am Kanal entlang.«
»Recht so, dort ist es des Abends lebhafter als im Palmengarten. Du wirst den Straßenweg auch heute Abend benutzen.«
»Zu Befehl, Exzellenz!«
»Es ist gut, geh, und bringe mir die Quittung noch heute, zu jeder Stunde in der Nachtzeit. Ich erwarte dich!«
Jim machte kehrt; Canning rief ihn noch einmal zurück.
»Ordonnanz, ich kann mich auf dich verlassen?«
»Zu Befehl, Excellenz!«
Lord Canning musterte das frische, ehrliche Gesicht mit den treuherzigen Augen, die kräftige Gestalt des jungen Mannes, der in tadelloser Haltung vor ihm stand, und er nickte befriedigt.
»So geh, halte dich nicht auf und komm unverzüglich zurück!«
Jim ging.
Eine seltsame, ängstliche Spannung malte sich in den Zügen des Gouverneurs, als er, den Kopf vorgeneigt, den sich entfernenden Schritten auf dem Korridor lauschte.
Plötzlich schellte er die Glocke, so hastig, dass Abel erschrocken hereingestürzt kam.
»Rufe die Ordonnanz zurück, sie soll eine Patrouille zur Begleitung mitbekommen — doch nein, nein«, unterbrach sich Canning selbst schnell wieder, »es ist besser so. Niemand ahnt ja, was die Brieftasche birgt, und Vorsichtsmaßregeln könnten nur Verdacht erregen.«
Jim schritt schon die Tschandri-Tschack, die Hauptstraße entlang, welche am kühlen Abend stark belebt war.
»Was hat denn der Alte heute nur?«, dachte er unterwegs. »Er ist ja heute furchtbar vorsichtig und misstrauisch. Es mag etwas Geheimes sein, obgleich kein Brief mit ›Geheim‹ bezeichnet ist. Na, mir soll wohl niemand etwas abnehmen, ich würde ihn ordentlich mit dem Eisen kitzeln. Verflucht, dass der Alte mir auch gerade heute sagen muss, ich soll nicht durch den Palmengarten gehen, heute zum ersten Male, wo ich doch heute durch muss. Ja, ich muss, denn sonst verpasse ich Angela, und dann weiß ich nicht, wo ich sie später treffen soll.«
Er hatte nicht den Weg durch den Palmengarten eingeschlagen, kam aber, als er die Hauptstraße hinter sich hatte, an ihm vorbei. Bog er durch eins der Gittertore ein, so durchschnitt er eine Ecke des Gartens, ein kurzer Weg von etwa zehn Minuten, und dann befand er sich wieder in einer belebten Straße.
Hier sollte er Angela, das Mädchen, dem er schon seit einiger Zeit vergebens nachstellte, treffen, hier wollte sie ihm sagen, wo er sie nach Beendigung seines Dienstes zu einem Rendezvous finden würde.
Jim standen einige herrliche Stunden in Aussicht; verpasste er das Mädchen jetzt, so gingen sie ihm verloren, denn Angela war eigensinnig und launisch.
Er war nicht lange im Zweifel, was er tun sollte. Er befolgte den Befehl nicht direkt, das heißt, er vermied den Palmengarten nicht vollständig, aber er handelte dem Befehle auch nicht direkt entgegen. Was war denn weiter dabei, wenn er das Eckchen Garten durchquerte und mit der reizenden Angela das Stelldichein ausmachte?
Kurz entschlossen bog er von der Straße ab und schritt zwischen den Palmbäumen und anderen herrlichen, exotischen Gewächsen dahin. Der Weg war vollständig finster und anscheinend menschenleer, doch ein Geflüster ab und zu verriet, dass die Bänke zur Seite des Weges mit Liebespaaren besetzt waren.
Jim hatte die Brieftasche unter dem rechten Arme, die linke Hand auf den Griff des Seitengewehres gelegt und einen festen, strammen Gang angenommen. Dabei pfiff er leise eine Melodie, welche er mit Angela als Erkennungszeichen ausgemacht hatte.
Da huschte eine Gestalt auf ihn zu und legte sofort ihren Arm in den seinen. Jim wollte nur einen Augenblick stehen bleiben.
»Bist du's, Angela?«, flüsterte er.
»Ja, ich bin's, deine Angela. Ach, Jim, ich warte schon so lange auf dich!«
Die Mädchenstimme klang recht ängstlich.
»Ich muss gleich wieder fort. Sage mir schnell, wo wir uns in einer Stunde treffen wollen. Du hättest es mir überhaupt schon eher sagen können.«
»Ich kann nicht, Jim.«
»Was, du willst mich wieder zum Narren haben, Mädchen?«, rief Jim entrüstet und presste dabei die schlanke, warme Gestalt an sich.
»Nicht so laut!«, bat das Mädchen. »Komm mit, ich will dir etwas zeigen, und dann wirst du begreifen, dass ich mich heute Abend nicht mit dir treffen kann. Komm nur mit, es ist gar nicht weit von hier.«
Sie legte den Arm um seine Hüfte und zog den sich nur schwach Sträubenden mit fort, aber nicht den Weg entlang, sondern in die Gebüsche.
»Aber was ist denn nur passiert?«
»Ich will es dir zeigen, wir sind gleich da.«
Jim glaubte einige Minuten riskieren zu können. Dass das Mädchen irgend eine andere Absicht mit ihm habe, daran dachte er gar nicht; er ließ sich von ihr fortziehen und wunderte sich nur, wie Angela hier in den dunklen Gebüschen, wo er allein jeden Augenblick an einen Baum gerannt wäre, den freien Weg zu finden wusste.
Er hielt Angela wirklich, wie sie ihm gesagt hatte, für das Dienstmädchen einer englischen Herrschaft. Sie war sehr hübsch, sogar schön und begehrenswert, aber nach Jims Meinung etwas dumm und verstand sich gar nicht ein bisschen hübsch zu kleiden. Am liebsten trug sie ein schmuckloses Kattunkleid und die Haare einfach hintergekämmt, was ihr gar nicht stand; er versuchte vergebens, ihr einen anderen Geschmack beizubringen, damit er sich mit ihr sehen lassen konnte.
Mit dem ›Sehen lassen‹ hatte es übrigens etwas auf sich; Angela hatte sich bis jetzt nämlich geweigert, mit ihm auszugehen, und das fand der stramme, hübsche Soldat sehr dumm von dem Dienstmädchen.
Angela sprach ziemlich gut Englisch, mischte aber immer italienische Brocken dazwischen. So erzählte sie auch jetzt in einem fort etwas, bald Englisch, bald Italienisch, es sei etwas passiert, was sie heute Abend zu kommen abhielte, und wenn Jim glaubte, er erführe den Grund, dann begann sie wieder Italienisch zu sprechen. Sie redete schnell und leise und führte dabei Jim immer mit sanfter Gewalt fort.
Dieser dachte an nichts Böses. Die Ordonnanztasche fest unterm Arm, ließ er sich führen; einige Minuten konnte er schon opfern, das Mädchen behauptete ja, sie wären gleich da.
Ein Licht leuchtete in der Ferne auf.
»Was ist das?«, fragte Jim.
»Weißt du das nicht? Das Gärtnerhaus.«
»Du gehst ja gerade darauf zu.«
»Ich will hinein.«
»Wie? Da darf ich nicht mit. Der Gärtner ist ein englischer Beamter, er darf mich hier nicht sehen.«
Jim wollte stehen bleiben, das Mädchen zog ihn aber unter leisem Lachen wieder fort.
»Torheit, Jim, der Gärtner ist ja mein Verwandter, seine Frau ist meine richtige Tante.«
»Du wohnst wohl dort?«
»Natürlich.«
»Ah, nun weiß ich endlich, wo du zu Hause bist.«
»Komm nur, Jim, du musst mit mir hineingehen, nur einen Augenblick, dann lasse ich dich wieder frei. Nur die Tante ist da, sie weiß, dass du kommst.«
Jim versuchte noch einmal, Widerstand zu leisten.
»Höre, Mädchen, du hast doch nicht etwa lose Streiche vor? Jetzt bin ich noch im Dienst, da geht so etwas nicht. Erst wenn ich das Seitengewehr abgeschnallt habe, bin ich wieder ein Mensch.«
Angela fand abermals Gründe, ihn zum Weitergehen zu bewegen, und jetzt beschleunigte Jim selbst den Schritt, um so bald wie möglich das Ziel erreicht und hinter sich zu haben. Auf eine Viertelstunde kam's ihm auch gar nicht an; auf der Kommandantur musste er immer eine halbe Stunde und noch länger warten, ehe er ins Büro gerufen wurde.
Das einstöckige Haus, dessen Gemüsegarten sie durch eine Hinterpforte jetzt betraten, gehörte dem Verwalter des Palmengartens, einem alten, pensionierten Engländer, der mit seiner Frau das Parterre bewohnte. Jim wusste, dass die erste Etage leer stand und dass der Gärtner sie zu vermieten suchte, was ihm aber noch nicht gelungen war, weil das Haus nach arabischem Stil erbaut war, wenigstens oben also keine Fenster besaß, sondern nur Oberlicht. Europäern sagte das am Tage herrschende Halbdunkel nicht zu, reiche Inder wollten mit dem englischen Beamten nicht unter einem Dache wohnen.
Eine alte, indische Frau öffnete die Hintertür.
»Komm herein«, flüsterte das Mädchen, »schnell und leise, es braucht niemand sonst etwas davon zu merken, dass du hier bist.«
Jim sah im Scheine der Flurlaterne, dass das Mädchen vollständig verhüllt war. Doch Angela war es, er kannte ihre Stimme ganz genau. Ehe er noch zögern konnte, schob sie ihn schon die Treppe hinauf.
»Ja, wohnst du denn hier oben?«, fragte er verwundert.
»Natürlich, meine Herrschaft ist ja gestern in das Haus meines Onkels eingezogen. Sie ist heute aus, ich bin allein. Hier hinein! Lege ab und setze dich; ich bin in einem Augenblicke wieder bei dir.«
Jim stand allein in einem fensterlosen, durch eine Hängelampe schwacherleuchteten Gemach, welches sehr luxuriös, halb nach indischem, halb nach europäischem Geschmack eingerichtet war. Allem Anscheine nach war es das Boudoir einer Dame, denn dort stand ein Toilettentisch — nein, das Schlafzimmer, die blauen Vorhänge verhüllten ja ein Bett.
Die Tasche fest unter den Arm geklemmt, stand Jim in sprachloser Überraschung da und schaute sich verwundert um, wobei in ihm ein banges Gefühl aufstieg, als er sich von hinten von unsichtbaren Armen umschlungen fühlte; er sah nur zwei über seine Brust gefaltete, zarte, mit Ringen geschmückte Damenhände, dann wurde er rücklings auf den nächsten Diwan gezogen und gleichzeitig ließ sich neben ihm eine weibliche Gestalt nieder.
Jim war vor Staunen außer sich. Er blickte in ein lachendes Mädchengesicht, in ein Paar strahlende Augen, und alles das gehörte niemandem anders, als seiner Angela. Verschwunden aber war ihr so einfaches Kattunkleid; sie trug eine Toilette, in welcher sie sich auf dem feinsten Ball hätte sehen lassen können, am Busen und Nacken tief ausgeschnitten, über den Schultern nur schmale, mit Schleifen gezierte Bänder, sodass die wohlgeformten Arme, ja fast der ganze obere Teil der Brust sich den Blicken darboten.
War das wirklich Angela? Wie kam sie in dieses Kostüm? Halt, Jim hatte schon in England einmal etwas Ähnliches erlebt; als er ein Dienstmädchen während der Abwesenheit der Herrschaft besuchte, empfing sie ihn im Kleide der Herrin und wollte diese selbst spielen.
Doch dieses Mädchen machte auch den Eindruck einer Dame, ihre Hände waren zart, keine Spur von harter Arbeit...
Das Mädchen machte seinem Zweifel ein Ende, vermehrte aber nur seine Verwirrung. Sie legte die runden Arme um Jims Hals, drückte seinen Kopf zurück und presste ihm unter verführerischem Lachen einen langen, glühenden Kuss auf den Mund.
»Nun, du erkennst wohl deine Angela gar nicht wieder?«, scherzte sie. »Erst hast du immer eine solche Stunde herbeigesehnt, und nun, da ich sie dir gewähre, benimmst du dich so kalt.«
Jim stotterte verlegen eine Entschuldigung, scheu blickte er auf den Boden, eine flammende Röte überzog ihm Stirn und Wangen. Schon begann er schwer zu atmen, seine Hände, welche die Brieftasche umklammerten, fingen an zu zittern.
»Ist es denn nur möglich? Du, Angela?«
»Ich bin's, erkennst du mich denn nur nicht? Verstellt es mich denn so sehr, weil meine Haare frisiert sind und ich ein etwas geschmackvolles Kleid angelegt habe? Du hast es ja immer gewünscht, dir zuliebe habe ich's getan.«
»Aber — aber — du — ein Dienstmädchen.«
»Ich ein Dienstmädchen?«, lachte sie. »O, Jim, du bist nicht besonders scharfsinnig. Hast du denn nicht gleich gemerkt, dass ich etwas ganz anderes bin? Hier in diesem Hause habe ich zu befehlen.«
»Du? Nicht möglich!«
»Ich bin die Herrin hier, und dich, Jim, möchte ich zu meinem Geliebten haben. Begreifst du denn gar nicht?«
Jims Sinne drohten wirklich zu schwinden. Er fühlte nur die weichen Arme um seinen Hals, er sah das Heben und Senken des vollen Busens.
Noch einmal wollte er versuchen, den Gedanken abzuschütteln, dass er wirklich ein solch ausgesuchter Glückspilz wäre, der Geliebte einer vornehmen Dame zu sein.
»Du warst auf dem Ball der Unteroffiziere.«
»Aus Lust zu Abenteuern; ich ging mit Zagen hin, wie ein Dienstmädchen gekleidet. Es war riskant, es konnte mich jemand erkennen, mich verraten, aber es geschah nicht, und ich fand mein Glück — dich. Ich konnte mich dir nicht gleich hingeben, ich hatte viele Bedenken zu überwinden, doch ich überwand sie, jetzt will ich dir ganz gehören. Viel gebe ich deinetwegen auf.«
Sie drückte ihn an sich und küsste ihn wieder, sie legte sogar ihren kleinen, mit einem niedlichen, ausgeschnittenen Schuh bekleideten Fuß über den seinen.
»Aber wer bist — wer sind Sie denn nur?«
»Das darf ich dir nicht verraten«, flüsterte sie ihm mit glühendem Atem ins Ohr; »nimm mich so, wie ich bin! Ich will jetzt ganz dir gehören. Hier fühlst du, wie mein Herz schlägt? Es schlägt nur für dich allein.«
Sie nahm seinen Arm und legte sich ihn selbst um ihre Hüfte, sodass seine Hand auf ihrem Busen ruhte. Er fühlte die weichen, üppigen Formen, und je mehr seine Aufregung wuchs, desto mehr sank sein Mut.
Dem Dienstmädchen gegenüber wäre er wohl keck und unverzagt aufgetreten, seit er aber wusste, dass das schöne Weib eine vornehme Dame war, fühlte er sich unsäglich befangen.
An seine Pflicht dachte er im Augenblicke nicht mehr; nicht, dass er leichtsinnig und pflichtvergessen war, er war eben in eine Schlinge gefallen, deren Stricke auch die energischsten und erfahrensten Männer nicht zerreißen können. Und er war ein junger, heißblütiger, lebenskräftiger Mann.
»Warum so scheu, Jim? Liebe mich, ich begehre deine Liebe, ich habe schon lange vergebens danach geschmachtet, ich will sie genießen. Hier, trink, es gibt dir Mut.«
Sie schenkte, ohne ihren Arm von ihm zu lösen, auf einem Seitentischchen ein Glas Portwein ein, nippte davon und reichte es ihm. Er nahm es und trank es begierig da aus, wo sie ihre Lippen angesetzt hatte.
Das Weib sah ihr Opfer gefangen, es gehörte ihr. Doch auch ihre Augen begannen in wildem Feuer zu funkeln, ihr eigenes südländisches Blut wallte auf, ihre Nüstern erweiterten sich; aber obgleich sie selbst dem Triebe erlag, den sie in dem jungen Soldaten entfacht, verlor sie dennoch keinen Augenblick die Herrschaft über sich, ihres Zieles war sie sich noch bewusst.
»Liebe mich, Jim!«, wiederholte sie. »Du kennst uns Italienerinnen nicht, der muss uns lieben, den wir lieben, oder wir töten ihn, wie er uns tötet. Lege die Tasche weg, sie hindert dich.«
Die Tasche! Dem jungen Manne fiel seine Pflichtversäumnis ein, er musste die Briefe gegen Quittung abgeben, der Generalgouverneur wartete auf seine Rückkunft.
Er wollte sich erheben, konnte sich aber nicht aus der Umschlingung des Weibes befreien.
»Lass mich, ich muss gehen!«, stöhnte er, die Tasche umklammernd.
»Ich lasse dich nicht!«, flüsterte sie und bedeckte sein Gesicht mit Küssen.
»Ich muss gehen — nachher, Angela...«
»Nein, jetzt, jetzt, ich kann nicht mehr warten!«
»Ich komme — wieder.«
»Jetzt, Jim oder niemals. Lege wenigstens deine Waffen ab, sie drücken mich.«
Sie hatte ihn so fest umschlungen, dass er sich nicht rühren konnte, sie lag fast auf ihm. Er sah nicht, was um ihn vorging, denn sein Kopf war zurückgebeugt, sodass er nur die Decke mit dem Oberlicht erblicken konnte.
Das Weib löste den Gurt mit den Waffen und warf ihn auf den Tisch.
»Du bleibst!«
»Ich darf nicht! Ich muss fort!«
»Ich lasse dich nicht! Nur eine Viertelstunde, zehn, fünf Minuten schenke mir!«
»Fort — lass mich!«
Es entstand fast ein Ringkampf; es gelang Jim wenigstens, sie zur Seite zu drücken. Sein Gesicht war dunkel gerötet, seine Pulse flogen, aber dennoch dachte er an die Folgen, wenn er hier bliebe und die Briefe heute nicht an die Kommandantur gelangten.
»Die Briefe, Angela!«, ächzte er.
»Welche?«
»Hier in der Tasche!«
»Gib sie her!«
»Nimmermehr!«
»Ich schicke sie hin — wohin?«
»Du Närrin, ich muss sie selbst hinbringen, oder...«
»Oder was?«
»Oder ich bin verloren.«
»Verloren? Torheit! Du bleibst bei mir. Liebe mich, umarme mich!«
Um Jim war es geschehen. Hätte er auch noch etwas sehen können, wer weiß, ob er es beachtet haben würde.
Seine Hand hielt nicht mehr die ihm anvertraute Brieftasche umklammert; er presste das Weib an sieh, er bedeckte Angelas Busen, Hals und Gesicht mit heißen Küssen, er keuchte; entnervt lag der sonst so kräftige Soldat da.
»Wie du glühst, Jim!«, flüsterte ihm das Weib zu, selbst bis zum Exzess aufgeregt. »Kann ich dir mehr bieten als mich selbst? Küsse mich, nimm mich hin, es gehört alles dir!«
»Mach ein Ende«, hauchte Jim, »ich ersticke!«
Er merkte nicht, wie das berechnende Weib, während es ihn küsste und an sich drückte, das Band von seinem Halse löste, an dem ein kleiner Schlüssel hing, mit ihm die Ordonnanztasche aufschloss und in dieselbe hineingriff; er sah auch nicht, wie sich hinter dem Diwan die Portiere teilte und in der Spalte ein scharfmarkiertes Gesicht mit einem Schnurrbart erschien. Ein teuflischer Hohn lag in den Zügen.

»Die Briefe!«, flüsterte der Mann, für Jim unhörbar. »Halte ihn nur eine Viertelstunde auf, verweigere ihm nichts, nur fessele ihn, dass er nichts merkt!«
»Jim, Jim«, rief das Weib in rasender Lust, »liebst du mich? Liebe mich, liebe mich, oder ich töte dich!«
Sie drückte mit der einen Hand sein Gesicht an ihre Brust, die andere reichte dem fremden Manne die geraubten Briefe hin, er fasste danach, da — — —
Ein Prasseln erscholl, ein Klirren von zerbrochenen Fenstern, Stücke von Glasscheiben fielen von der Decke herab, ein ganzes Fensterkreuz stürzte auf den Tisch, und diesem nach folgte ein Mensch, ein Junge in englischer Uniform. Mit einem wilden Sprunge stand er neben dem Weibe, packte die Hand mit den Briefen, riss sie zurück, sodass die Briefe zerstreut in der Stube umherflatterten, riss das Weib selbst von dem Soldaten herab lang auf den Diwan, und ehe die bis zum Tode Erschrockene auch nur einen Laut von sich geben konnte, fielen die Schläge, von einer kräftigen Faust geführt, hageldicht auf sie herab.
Das Weib stieß ein gellendes Zetergeschrei aus — doch niemand kam zu Hilfe. Vergebens suchte sie sich mit den Händen zu schützen, die Faust des Jungen wusste immer eine empfindliche Stelle zu treffen, die Nase, die Augen, und bald lag das Opfer blutüberströmt da, ihr Körper war ein blauer Fleck und schon begann das Zetergeschrei nachzulassen.
Aber nicht genug damit, der wütende Bursche riss sie an den Haaren von den Polstern herab auf den Boden, trat sie mit Füßen, wohin es auch kam, kniete dann auf ihr und begann von neuem ihr Geicht zu bearbeiten. Dabei war er nicht still, jeden Faustschlag begleitete er taktmäßig mit einem Wort.
»Italienische Liebe!«, schrie er mit durchdringender Stimme. »Nun — lerne — einmal — irische — Hiebe — kennen — du — schamloses — Weibs — bild — du — wie — schmeckt — dir — das — denn —«
Und nun folgten eine Unzahl von jenen schauderhaften Flüchen und Schimpfworten, in denen die Irländer, und besonders die irischen Weiber, ganz Unglaubliches leisten können, und jedes Wort erhielt durch einen Faustschlag, oder vielmehr durch einen kernigen Boxerhieb, Nachdruck.
Dem Mädchen war schon die Besinnung geschwunden; es hätte vielleicht unter den Händen des Wütenden das Leben lassen müssen, wenn nicht endlich Hilfe gekommen wäre.
Einige Inder, die Gesichter verhüllt, drangen ins Zimmer. Schnell wie der Blitz sprang der Bursche von seinem Opfer auf, an den Tisch, riss Jims Revolver aus dem Futteral und hielt ihn den Gegnern entgegen.
Ebenso schnell waren dieselben auch wieder hinter der Portiere verschwunden, kein drohender Laut erscholl.
Jim hatte unterdes ganz mechanisch, wie im Traum gehandelt. Alles dies kam ihm nur wie eine Erscheinung vor.
Jener Junge dort war Bob, der Trommeljunge. War denn der nicht im Arrest? Wie kam er hierher? Was hatte er mit dem Weibe zu tun? Was lagen da für Briefe umher? Das waren ja seine Briefe aus der Tasche, an welcher der Schlüssel steckte!
Langsam, ohne sich um die Szene neben sich zu kümmern, sammelte er die Briefe auf, steckte sie in die Tasche, zog den Schlüssel ab und sah verwirrt um sich.
In diesem Augenblicke kamen die Inder, im nächsten jagte Bobs Revolver sie zurück, dann sprang der Trommeljunge zu dem verstört blickenden Soldaten und händigte ihm Seitengewehr und Revolver ein.
»Schnall um«, drängte er, »schnell, schnell, wir müssen fort! Hast du die Briefe?«
»Ja.« murmelte Jim.
»Alle?«
»Ja.«
»Dann fort, fort von hier!«
Er zog den verwirrten Jim mit hinaus und die Treppe hinunter. Sie stießen auf keinen Widerstand, niemand begegnete ihnen.
Im Garten blieben beide noch einmal stehen, Bob sah den Soldaten mit großen, vorwurfsvollen Augen an.
Da ging durch Jims Körper plötzlich ein Zittern, er musste sich an das Gitter lehnen und sich festhalten. Dann strich er die wirren Haare aus der Stirn, fasste die Brieftasche mit beiden Händen und stöhnte tief auf.
»Was habe ich getan!«, ächzte er.
»Nichts, was nicht wieder gutzumachen geht«, sagte Bob leise, hob die Hand und deutete nach einer Richtung. Verständnislos stierte Jim ihn an.
»Nach der Kommandantur«, flüsterte Bob; »ich habe dich nicht gesehen und du mich nicht. Gehab dich wohl!«
Jim drehte sich wortlos um ging die ersten Schritte mit gesenktem Kopfe, richtete sich dann aber gerade auf und suchte im Gehen seinen Anzug in Ordnung zu bringen.
Der Junge sah ihm nach, bis er seinen Blicken entschwunden war. Dann wollte er in der entgegengesetzten Richtung davongehen, als er lauschend wieder stehen blieb. In der Ferne tönten Trompetensignale, es wurde kleiner Alarm geblasen. Plötzlich stieß Bob einen jauchzenden Ruf aus und eilte der Richtung zu, aus welcher die Signale erklangen, und dort lag das Arrestlokal. —
Oben in dem Hause, dessen unterer Teil heute verlassen schien, beschäftigte sich der Mann, dessen Kopf vorhin hinter der Portiere erschien, mit dem Weibe. Angela hatte ihre Verführungskunst bald mit dem Leben büßen müssen.
Sie sah schrecklich aus. Die Augen konnte sie wohl wochenlang nicht öffnen, so waren sie angeschwollen, dabei schon jetzt blau umrändert; wenn das Nasenbein noch heil war, so konnte sie von Glück sagen; das ganze Gesicht war mit Blut bedeckt und keine Stelle der Brust, die nicht blau und geschwollen gewesen wäre. Nicht besser mochte der übrige Körper aussehen, denn der Junge hatte mit Fußtritten nicht gespart.
Der Mann hob die Bewusstlose auf den Diwan. Wir kennen ihn bereits, es ist Monsieur Francoeur.
Er bedauerte in diesem Augenblicke nicht die Gemisshandelte, grübelte auch nicht darüber nach, wie der Junge auf das Dach des Hauses gelangt war, wie er von dem erfahren hatte, was hier vorging oder was hier vorgehen sollte, seine Gedanken waren mit dem Misslingen seiner Absicht beschäftigt.
»Es ist schändlich!«, murmelte er, die Bewusstlose vom Boden aufhebend. »Wir waren schon ziemlich am Ziel, Mirzy hatte so geschickt operiert, da musste die Störung kommen. Innerhalb zehn Minuten hätte ich die Briefe erbrochen, kopiert und wieder so geschlossen gehabt, als wären sie nie offen gewesen. Dann hätte der Soldat gehen können, Mirzy würde ihm schon einen Entschuldigungsgrund für sein längeres ausbleiben gegeben haben; niemand hätte von unserer Kenntnis der Briefe eine Ahnung gehabt — nein, da muss es wieder missglücken. Nun, verloren sind uns die Briefe nicht, sie kommen auf jeden Fall in unsere Hände, aber die Ordonnanz muss dabei ihr Leben lassen, und man weiß dann bestimmt, dass eine Meuterei im Gange ist. Gleichgültig, wir müssen sie haben, übrigens ist der Befehl schon gegeben, ich könnte es nicht mehr ändern.«
Er rief eine alte Inderin herein, das Weib brach beim Anblick des Mädchens in Jammern aus.
»Lass dein Heulen«, fuhr Francoeur sie barsch an, »kleide sie an, wenn sie auch nicht erst zum Bewusstsein kommt, packe alles ein, auch deine Sachen. In fünfzehn Minuten verlassen wir das Haus und kehren nicht wieder zurück.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, ging er hinaus und erstieg die zum Dach führende Treppe. Es war platt und zum Aufenthalt eingerichtet, wie gewöhnlich bei indischen und arabischen Häusern.
Der Mann untersuchte auch jetzt nicht, wie der Trommeljunge das Dach hatte erreichen können, aufmerksam lauschte er in die Nacht hinaus.
»Jetzt müsste er dort sein«, murmelte er, »und noch ertönt kein ausfälliges Geräusch. Pest noch mal, wenn er an der Ruine einen weiten Umweg machte, oder wenn meine Leute nicht am Platze wären! Dann gilt es einen offenen Mord, der alles verraten kann. Aber unser müssen diese Briefe werden.«
Etwa fünfzig Meter von diesem Hause entfernt lag eine uralte, völlig zerfallene Ruine, nur klein, gar nicht mehr erkennen lassend, was für ein Gebäude es eigentlich früher gewesen sei. Altertumsforscher behaupten, sie stamme aus der Zeit der Pandus und sei nur ein Turm gewesen, in welchem das Wasser in der Leitung gemessen wurde. Jetzt stand kein Stein mehr auf dem anderen, alles war mit Gras und Moos überwuchert, und nur selten wagte sich ein spielendes Kind an das unheimliche Gemäuer.
Die Inder scheuten sich, es zu betreten, weil ihnen alles, was von den Pandus stammt, heilig ist, die Europäer, weil hier einmal ein entsetzlicher Raubmord begangen worden war.
Ein breiter Weg führte unweit davon vorüber. Dorthin lenkte Francoeur seine Aufmerksamkeit, und er sollte nicht lange zu warten brauchen.
»Zu Hilfe!«, erscholl der Ruf durch die Nacht, von derselben Stimme ausgestoßen, die vorhin unter dem halbnackten Mädchen gestöhnt hatte. Beim zweiten Hilferuf versagte sie.
»Gelungen!«, flüsterte Francoeur triumphierend.
Da aber erschollen andere Rufe, die ihn mit Bestürzung erfüllten.
»Zurück, Canaillen!«, ertönte gleich nach dem Hilferuf eine raue, tiefe Männerstimme.
»Hand weg von der Ordonnanztasche! Willst du brauner Schuft mit einem alten Lancierkorporal fechten? Da, verdaue den, wenn du kannst — zu Hilfe, England, Meuterei!«
Ein heftiger Kampf musste stattfinden, Waffen wurden gekreuzt, ein Revolver knallte mehrmals hintereinander.
Die furchtsamen Spaziergänger des Parks entflohen, die Weiber kreischten, die unerschrockenen Männer wurden herangezogen. Von allen Seiten eilten dunkle Gestalten herbei, unter ihnen erkannte Francoeur einen uniformierten Offizier.
Noch einen Augenblick verweilte der Lauscher auf dem Dach.
»Er ist von Indern überfallen worden«, hörte er sagen, »ist er tot?«
»Nur betäubt durch einen Schlag vor den Kopf und einen Stich durch die Schulter«, entgegnete die raue Stimme; »es ist eine Ordonnanz, Herr Leutnant.«
»Her die Tasche! Wo ist das Quittungsbuch?«
»Hier!«
»Stimmt, es fehlen keine Briefe. Wie viele Angreifer waren es?«
»Vier.«
»Aber so viele liegen ja hier am Boden.«
»Dann werde ich sie wohl alle niedergemacht haben«, lachte die raue Stimme.
»Ihr allein?«, erklang es erstaunt.
»Ich allein.«
»Wer seid Ihr?«
»Jeremy Huxley, Lanciercorporal beim ersten roten Dragonerregiment.«
»Ich werde Eurer gedenken. Jetzt die Kerls erst untersucht, ob einer noch lebt, damit er Geständnisse machen kann.«
Mit einem Fluche sprang Francoeur die Treppe hinab. Unten kam ihm ein Kuli entgegen.
»Alles bereit?«
»Alles fertig, Sahib!«
»Dann fort, wir müssen spurlos verschwinden. Das Mädchen nehmen wir mit. Eilt, sonst dürften wir nicht mehr entkommen.«
Im nördlichen Teile Delhis liegt ein zerfallener Bau, nur noch an einigen Stellen seine frühere Schönheit zeigend. Er ist niemals bewohnt gewesen, nur ein Toter hat einmal vor vielen Jahrhunderten darin Einzug gehalten — der Großmogul Humayun, welcher hier begraben liegt und dem zu Ehren das riesige Monument gebaut wurde.
Man hat seinen Sarg niemals gefunden, er mag von herabstürzenden Steinen zerschmettert und zerstreut worden sein, ebenso wie das Gerippe des mächtigen Herrschers.
Sein Grabmonument blieb jedoch nicht als einziges Zeichen der Sterblichkeit in diesem Stadtteile stehen; die vornehmen Hindus, welche dem Großmogul gedient hatten, bestimmten schon bei ihren Lebzeiten, dass sie einst in der Nähe ihres geliebten Fürsten begraben wurden, später bestattete man dort auch andere, und so entstand nach und nach ein allgemeiner Friedhof, auf dem die Reichen und Vornehmen in metallenen, die Wohlhabenden in steinernen Särgen und die Armen schließlich in schmucklosen Holzsärgen beigesetzt wurden.
Den Mittelpunkt des Friedhofes bildete immer das weithin sichtbare Monument Humayuns.
Jetzt werden dort keine Toten mehr bestattet, und bei einem Gange über den Friedhof kommen einem die Worte der Bibel ins Gedächtnis. Die Gräber geben ihre Toten wieder.
Überall liegen Knochen zerstreut, überall grinsen gebleichte Totenschädel, kein Gerippe ist mehr vollständig, man müsste sich denn die Mühe machen und einen Sargdeckel abnehmen.
Die Holzsärge sind natürlich schon längst zu Staub zerfallen, die Metallsärge sind völlig verschwunden, wahrscheinlich von einwandernden Völkern, welche die Toten nicht ehrten, zur Herstellung nützlicher Gegenstände verwendet worden, den silbernen Sarg hat man vielleicht eingeschmolzen und daraus Brautgeschmeide gefertigt, und nur die steinernen Särge sind stehen geblieben. aber auch ihre Deckel hat man abgehoben oder verschoben, um nach Geschmeide zu spähen, welches man den Toten mit ins Grab gab, oder auch ein Samenkorn hat sich in einen Spalt verirrt, hat Wurzel geschlagen und die allmächtige Naturkraft, in Form des treibenden Saftes im Baumstamme, hat den schweren Deckel Millimeter nach Millimeter gelüftet, bis er eines Tages polternd herabfiel.
So hatte sich auch ein Fliederbaum, trotz seines zarten Markes, Bahn gebrochen und den ihn hindernden Deckel zur Seite geworfen. Zerschmettert lag er neben der Öffnung, in der sich ein noch ziemlich gut erhaltenes Gerippe zeigte.
Vor diesem Grabe standen im Scheine der schon tief am Horizont stehenden Sonne drei Männer und lauschten der Erzählung eines vierten, der mit lebhaften Gestikulationen vortrug.
»Von dort kam es zuerst heran«, sagte er eben und deutete nach dem in einiger Entfernung stehenden, großen Grabmonument; »ich sah natürlich im Anfang nur ein Licht, es ging auf und nieder, hüpfte hin und her, bewegte sich immer im Zickzack, kam aber auch wieder näher zu mir. Dann verschwand es plötzlich, bis es mit einem Male ganz dicht in meiner Nähe auftauchte, und da, Herrgott, ich denke, mich soll...«
»Hast du dich denn nicht schon vorher gewundert und darüber nachgedacht, was für ein Licht das gewesen sein mag?«, unterbrach ihn ein junger Mann.
»Ich glaubte erst, es wäre ein Stern, Mister Reihenfels.«
»Nanu, August, ein Stern, der so auf der Erde herumhüpft?«
»Sie vergessen immer, Mister Reihenfels, dass ich ganz mordsmäßig besoffen war«, sagte August verschämt; »ich glaubte ja, ich läge in meinem Bett, und ich lag auf dem Moderstaub da so recht hübsch weich. Und dann dachte ich, ich sähe zum Fenster hinaus den Sternenhimmel, na, und der drehte sich wieder einmal wie ein Karussell. August, sagte ich zu mir selbst, August, schämst du dich denn nur gar nicht? Du bist doch wieder besoffen wie eine Radehacke, die Sterne tanzen bei dir Polka, und der da, der große, der führt nun gar einen Solotanz auf. August, wenn das nun aber noch ein einziges Mal passiert, dann haue ich dir eine runter, dass...«
»Schon gut«, unterbrach ihn Reihenfels abermals, »spare dir deinen Monolog. Also du glaubtest, das flackernde Feuer sei ein umherirrender Stern.«
»Ja, ich dachte, einer von uns beiden muss besoffen sein, entweder ich oder der Stern. Dann war er mit einem Male fort, und dann kam er dort, wo der große Baum steht, wieder zum Vorschein. Aber Jesus Christus, mir gab's einen Hexenschuss durchs ganze Rückgrat, da sah ich erst, was das für ein Stern war. Der Kerl ist's, wie ihn auch Dick gesehen hat, ganz genau so, ich konnte von hier aus ganz deutlich die meterlangen Fingernägel sehen...«
»Meterlange?«, fragte der mitanwesende Jeremy.
»Nu, ein bisschen kleiner mögen sie gewesen sein. Aber der Kerl war's, das sogenannte wandernde Feuer. Er hüpfte herum, als wäre er närrisch im Kopfe, immer über die Gräber und Löcher weg, fuchtelte mit der Fackel in der Luft herum, und dabei schrie er, dass es mir durch Mark und Bein ging. Geradeso, als wenn man einem Hunde auf den Schwanz tritt.«
»Hast du kein Wort verstanden?«
»Es war ein ganz wortloses Schreien, ohne Sinn und Verstand.«
»Nun, und weiter?«
»Ich kniff mir immer ins Ohr und in die Nase, um aufzuwachen, denn ich glaubte ja, ich träume nur, aber's war nischt, ich wachte eben. Dann aber bin ich vor Schreck bewusstlos geworden, das heißt, ich schlief ein.«
»Wenn du nur das nicht alles geträumt hast!«
»Ich will auf der Stelle blind werden, wenn ich nicht die lautere Wahrheit gesagt habe.«
»Das mag schon sein, aber du kannst in deinem Delirium eine Vision gehabt haben, hervorgerufen durch Dicks Erzählung.«
»Mister Reihenfels, ich habe noch nie das Delirium gehabt«, sagte August gekränkt, »so weit ist's mit mir noch nicht. Ich halte es nur mit dem Grundsatze: Wer niemals einen Rausch gehabt, der ist kein braver Mann.«
»Schon gut! Wann kamst du wieder zu dir?«
»Da stand die Sonne schon ziemlich hoch am Himmel. Und nun denken Sie sich meinen Schreck, wie ich aufwache und ich liege hier in diesem Grabe, habe das Gerippe liebevoll umschlungen, so recht hübsch Kopf an Kopf, Brust an Brust! Na, ich weiß nur, dass ich mit einem Satze heraus war und gleich wieder in die Knie sank. Dann fiel mir sofort der Kerl mit der Fackel ein; mein erstes war, dass ich Reißaus nehmen wollte, aber nun bewundern Sie meine große Geistesgegenwart. Mir fiel auch gleich ein, dass Ihnen an dem Kerl mit der Fackel so viel gelegen ist, seinetwegen bleiben Sie ja nur in Delhi, und so guckte ich mich erst ordentlich um, merkte mir, wo ich gelegen hatte, und dann, hallo, dann ging's fort, was die Beine langten. Ich hörte hinter mir immer Gerippe klappern, bis ich endlich wegkriegte, dass es nur mein Absatzeisen war. Den ersten Mann, den ich traf, fragte ich, wie die Gegend hier heißt, und dann ging's weiter. Nun können Sie sich doch erklären, warum ich so erschrocken bei Ihnen ankam. Ich hatte mich immer noch nicht beruhigt.«
Es war sehr zweifelhaft, ob der Erzählung Augusts Glauben zu schenken war. Er konnte ebenso gut alles nur geträumt haben. Doch Reihenfels musste wenigstens prüfen.
Noch bevor die Dunkelheit anbrach, verteilte er seine Begleiter, Charly und Jeremy, so, dass das Grabmonument, wo das Feuer zuerst erschienen sein sollte, von allen Seiten beobachtet werden konnte. August blieb bei Reihenfels, der sich hinter den Fliederbaum postierte.
Wie man sich zu verhalten hatte, wenn das wandernde Feuer wirklich erschiene, darüber waren alle instruiert. Es konnte unter Umständen ein schweres, gefährliches Unternehmen werden.
Stunde nach Stunde verging; vollständige Finsternis herrschte, und nichts regte sich auf dem weiten Leichenfelde, kein Lichtschimmer war zu sehen.
Reihenfels forschte seinen Diener nochmals aus, ob er nicht nur geträumt habe, aber August blieb bei der Behauptung, das wandernde Feuer wirklich gesehen zu haben.
»Sie müssen bedenken, dass ich nicht schon des Abends in meinem Rausche hierher gekommen bin«, fügte er hinzu, »es war weit über Mitternacht, und ich mag auch einige Zeit mit offenen Augen dagelegen haben, ehe ich es erblickte.«
»Mitternacht ist auch jetzt längst vorüber.«
»Dann wird es schon noch kommen, wenn es sich — da — da ist es schon!«
Wirklich, dort, dicht am Grabmonument huschte ein Licht hin und her und entfernte sich dann, es schien sich wie hüpfend über das Trümmerfeld zu bewegen. Gleichzeitig erscholl ein leises, klagendes Geheul.
»Alle guten Geister loben Gott, den Meister!«, murmelte August.
»Du weißt, was du zu tun hast!«, flüsterte ihm Reihenfels zu. »Du bleibst hier und erwartest unsere Rückkehr. Solltest du merken, dass diese aus irgend einem Grunde unmöglich ist, so ist dein erster Gang zu Hira Singh, dem du so klar wie möglich das erzählst, was du gesehen hast.«
Reihenfels schnallte den Ledergurt, von dem nur einige Stricke herabhingen, über seinen Rock und bewegte sich dann vorsichtig, jedes Grab und jeden Stein als Deckung benutzend, auf das irrende Feuer zu.
Anfangs näherte es sich ihm, dann aber vergrößerte sich der Abstand wieder, weil das Feuer dieselbe Richtung nahm wie er, und zwar schneller; Reihenfels suchte keine Deckung mehr, er rannte jetzt, und nicht lange dauerte es, so konnte er den Träger des Lichtes auch erkennen.
Es war wirklich jene Gestalt, wie erst Dick und dann auch August sie beschrieben hatten. Sie war in rohe Felle gehüllt, Haar und Bart weiß und lang, ganz verwahrlost. In der Hand hatte der Mensch einen großen, brennenden Baumast, den er gewöhnlich dicht über dem Erdboden hielt und mit dem er in jedes offene Grab leuchtete, als suche er etwas. Dann schwang er ihn durch die Luft, sodass er wieder hoch aufflammte, und stieß dabei ein markerschütterndes, jammerndes Geschrei aus.
Ziellos sprang er umher, bald hierhin, bald dorthin, kein Grab unberücksichtigt lassend. Die Keule, von welcher Dick erzählt hatte, führte er nicht mehr bei sich.
Reihenfels blieb einige Sekunden stehen und legte die Hand aufs Herz, denn er fühlte, wie sich dieses schmerzhaft zusammenkrampfte. Dann suchte er sich dem Manne wieder zu nähern.
Da ertönte ein kurzer Pfiff; schnell erwiderte ihn Reihenfels, gleichzeitig sprang hinter einem Grabe Charly hervor und warf sich auf die unheimliche Gestalt. Von der anderen Seite eilten Jeremy und Reihenfels hinzu.
Einen Augenblick stand die Gestalt wie betroffen da, die Fackel in der erhobenen Hand, das Geschrei war verstummt. Da hatte Charly den Mann erreicht; der gewandte Pelzjäger wollte ihn unterlaufen, er bückte sich, doch da schmetterte der brennende Ast auf seinen Kopf herab.

Charly stieß einen Schmerzensschrei aus, griff nach den Augen und brach zusammen.
Die Gestalt wandte sich um, floh mit weiten Sprüngen, die Fackel wie eine Waffe schwingend, und jetzt stieß sie ein wütendes Geheul aus. Sie bewegte sich direkt auf Jeremy zu. Dieser stand auf einem Erdhügel, hatte ein breites Seitengewehr schützend über dem Kopf erhoben und erwartete den Rasenden furchtlos.
»Keine Waffe gebrauchen!«, schrie Reihenfels, und als wäre er selbst in Todesgefahr, so flog er wie eine Sprungfeder über die Gräber und Steine dahin, überholte die wilde Gestalt noch und stellte sich neben Jeremy auf.
Der Mann schien die beiden Gegner nicht zu sehen oder sie nicht zu fürchten, er rannte mit geschwungenem Ast auf sie zu.
»Sir Frank Carter!«, rief da Reihenfels, das Wutgeheul noch übertönend. »Ihre Tochter Eugenie ist gefunden, sie ist bei uns!«
Diese Worte brachten keinen Eindruck hervor, der Mann rannte weiter, auf seine vermeintlichen Feinde zu.
Da fühlte Reihenfels unter sich plötzlich eine Erschütterung, der Boden wich unter seinen Füßen, und ehe der Mann ihn noch erreicht, stürzte er in eine Tiefe.
Er wusste nicht, wie tief er gefallen war, denn ein Schlag auf den Kopf hatte ihn schon unterwegs betäubt. Als er wieder zu sich kam, war es vollkommen Nacht um ihn, nicht nur so finster, wie es im Freien zu sein pflegt, und er fühlte, wie zwei Hände seinen Körper rieben.
»Bist du's, Jeremy?«, fragte er, sofort wieder bei vollem Bewusstsein.
»Ja, Sir, es ist Jeremy. Ich habe die Fahrt in die Tiefe mitgemacht. Wir standen auf einem Grabhügel, und unter uns ist der Boden hohl gewesen. Er konnte uns nicht tragen, wir sind hinabgerutscht. Seid Ihr verletzt?«
Reihenfels konnte sich ohne alle Anstrengung erheben und seine Glieder leicht bewegen, nur der Kopf schmerzte ihm etwas, und einige Stellen im Gesicht und an den Händen brannten infolge von Hautschürfungen.
»Ich bin vollkommen unverletzt, und du?«
»Mir tut nichts weh; ich habe mich nur mit meinem Seitengewehr etwas in den Finger geschnitten. Ich dachte schon, ich hätte Euch aufgespießt. Wir können von Glück sagen.«
»Wurdest du bewusstlos?«
»Nicht im geringsten. Gleich nach unserem Sturz, den ich so etwa zehn Meter tief schätze, sah ich das Feuer über uns wegspringen. Mister Reihenfels, wir sitzen in einem Loch, und es scheint mir, als könnten wir uns allein nicht wieder heraushelfen.«
Der junge Gelehrte hatte für alle Fälle Feuerzeug und einige Wachskerzen eingesteckt. Er machte Licht und sah sich um.
Sie saßen allerdings in einem Loch mit steilen Wänden, von denen noch immer Erde abbröckelte. An ein Erklimmen war nicht zu denken, aber das Loch besaß einen Aus- oder Eingang, eine etwa einen Meter hohe und breite, finstere Öffnung. Als er hineinleuchtete, war er erstaunt, ein niedriges, gemauertes Gewölbe zu finden.
»Was ist das? Eine Art Erdbegräbnis? Hier liegen Menschenknochen herum.«
»Die werden wohl mit uns herabgestürzt sein«, meinte Jeremy.
»Du hast recht, sonst lägen sie wohl nicht obenauf. Ehe wir nun sehen, ob wir den Gang benutzen können, wollen wir versuchen, unsere Begleiter herbeizurufen.«
»Mit Charly sah es schlimm aus. Wenn er nur nicht geblendet worden ist, er griff gleich so nach den Augen.«
»Dann bleibt uns nur noch August übrig. Hoffentlich aber steht es mit jenem auch nicht so schlimm.«
Reihenfels gab auf der Pfeife lange, gellende Signale, er wartete, pfiff wieder und immer wieder, bis er einsah, dass sie von ihren Begleitern vorläufig keine Hilfe zu erwarten hatten.
»So lass uns allein den Gang untersuchen«, sagte er zuletzt und kroch, das brennende Licht vor sich haltend, voran.
Jeremy folgte.
Der Gang war überall gut gemauert und noch vollkommen erhalten. Sie waren einige hundert Schritt so in gebückter Stellung gekrochen, zur größten Verwunderung von Reihenfels, der sich die Bedeutung dieses Tunnels gar nicht erklären konnte, als er sich so erhöhte und erweiterte, dass sie nebeneinander und aufrecht gehen konnten.
Ein Ende des Ganges war nicht zu sehen, so weit das Licht der Kerze reichte. Doch der Kreis, den dieses warf, war in der dunstigen Atmosphäre auch nur klein; als sich der Gang noch mehr verbreiterte, erreichte er nicht einmal die Wände.
Erstaunt blieb Reihenfels stehen.
»Wohin in aller Welt mögen wir nur geraten sein?«
»Wisst Ihr denn das nicht?«, fragte Jeremy.
Reihenfels sah ihn überrascht an.
»Weißt du es denn?«
»Natürlich, das ist die Wasserleitung, welche die alten Inder angelegt haben. Die Engländer wollten sie auch einmal benutzen, aber es ging nicht, weil sie schon ganz zerfallen war.«
»Du irrst«, sagte Reihenfels kopfschüttelnd, »dies ist kein Gang jener Wasserleitung. Ich weiß ganz genau, wie ihre Kanäle unter Delhi hinlaufen; in die Gegend dieses Friedhofes kommen sie gar nicht; außerdem sind sie auch vollkommen verschüttet, dieser Gang dagegen ist sehr gut erhalten wie kein einziger der alten Wasserleitung, und schließlich liegt die Gewölbedecke derselben immer nur zwei Meter unter der Erde, während wir schon gegen zwanzig Meter hinabgestürzt sind.«
»Höchstens zehn.«
»Ich glaube das doppelte. Blickt man aus einer tiefen Grube in die Höhe, so taxiert der Sachkundige die Tiefe fast immer nur auf die Hälfte, geradeso, wie er ein hohes Gebäude, einen Kirchturm viel zu niedrig schätzt.«
»Aber was soll es denn sonst sein, wenn nicht die Wasserleitung?«
»Ich denke mir, eine Art von Massenbegräbnisplatz.«
»Ich sehe weder Särge noch Knochen.«
»Wir wollen den Gang noch etwas weiter verfolgen, dann werden wir schon auf solche stoßen, vielleicht erst am Ende.«
Sie gingen noch lange geradeaus und erreichten doch das Ende nicht.
»Mister Reihenfels, hier zweigt ein anderer Gang ab!«, rief Jeremy, der sich der Wand einmal genähert hatte, und wie Donnerhall erklangen seine Worte in unzähligen Echos.
Ein anderer Gang — ein anderer Gang — ein anderer Gang! wiederholte es sich wohl hundertmal, bis es nach und nach verklang.
Es war so; ein Kanal mündete ein, ebenso hoch und breit wie der Hauptgang.
»Und hier ist wieder einer!«, rief Reihenfels an der anderen Wand.
Wieder einer — wieder einer! spottete das Echo nach.
Reihenfels leuchtete an der Wand hin und fand alle zehn Meter auf der rechten Seite sowohl, als auf der linken, einen neuen Gang, dem ersten immer ganz ähnlich.
Sein Erstaunen darüber war grenzenlos. Was hatte dieser unterirdische Bau, der sich so weit verzweigte, zu bedeuten? Er glaubte noch immer an einen Begräbnisraum.
»Wir wollen diesen Gang hinaufgehen«, schlug Jeremy vor; »erreichen wir da kein Ende, versuchen wir's mit einem anderen.«
»Und dann?«, fragte Reihenfels.
»Wieder mit einem anderen. Irgendwo müssen wir doch ein Ende, hoffentlich einen Ausgang finden.«
»Und wenn nicht, was dann?«
Diese Fragen klangen so eigentümlich, dass der alte Soldat den jungen Mann im Scheine der nur ganz kleinen Wachskerze betroffen ansah.
»Was meint Ihr damit, Mister Reihenfels?«
»Offenen Weg in einem Labyrinth zu finden ist leicht, aber den Rückweg, das ist schwer. Lass uns lieber zurückgehen, Jeremy, wir werden schon aus dem Loche an die Oberfläche der Erde kommen.«
Reihenfels wollte den Lichtstummel noch benutzen, den Rückweg zu beleuchten; ein Ruf Jeremys hielt. ihn zurück.
»Wohin geht Ihr denn? Hier heraus kommen wir, das war ja der linke Gang.«
Es klang fast wie ein Ächzen, als Reihenfels das Licht sinken ließ. Er schloss die Augen.
»Da haben wir es schon. Wir sind zweierlei Meinung«, seufzte er.
Wo ist Nord, wo ist Süd, wenn man sich in einem vollständig geschlossenen Gemache befindet? Wo rechts, wo links nach geografischer Bestimmung? Kein Mensch kann es mehr sagen, da verlässt auch den scharfsinnigsten Inder der Instinkt, mit dem er sonst den wochenlangen Weg durch die Wildnis nach einem bestimmten Ziele mit der größten Genauigkeit findet.
»Wir kamen hier heraus, versichere ich Euch«, sagte Jeremy.
»Meiner Meinung nach benutzten wir diesen Gang«, entgegnete Reihenfels mit erhobener Hand.
»Aber, Mister Reihenfels, was ist Euch denn? Eben deutetet Ihr nach links und jetzt nach rechts.«
»Weißt du das ganz bestimmt?«
»Ganz bestimmt. Ihr hattet die Augen geschlossen und Euch etwas zu mir herumgedreht. Daher mochte es kommen. Ihr seht aber, dass Ihr im Zweifel seid, nicht ich.«
»Gott gebe es. Wohlan, wir wollen diesen Tunnel gehen!«
Er schritt voran, mit bangen Ahnungen erfüllt.
»Jetzt rechts!«, rief Jeremy hinter ihm.
Rechts — rechts — rechts! spottete das Echo in zahllosen Wiederholungen.
»Wir sind ja vorhin immer geradeausgegangen.«
»Ach so, richtig, Ihr habt recht.«
Es schien fast, als hätte Jeremy den richtigen Weg eingeschlagen. Sie erreichten eine Wand, von der nur ein meterhoher Gang abführte. Es musste der vorige zuerst benutzte sein.
Reihenfels hätte bald aufgejubelt, als er mit einem neuen Lichte in gebückter Stellung weiterkroch.
Doch schon nach wenigen Schritten stieß er einen Ruf der Enttäuschung aus — er konnte sich wieder aufrichten. Vor ihm dehnte sich abermals ein hoher und breiter Gang mit vielen Abzweigungen aus.
Die beiden Männer sahen sich an, Jeremy bestürzt, Reihenfels resigniert.
»Verdammt, ich habe mich geirrt!«, murmelte ersterer. »Wir müssen zurück!«
Sie gingen zurück und wieder vermeintlich geradeaus, sie gingen links, sie gingen rechts, sie gingen aufs Geratewohl, immer hoffend, den ersten niedrigen Gang zu finden, sie gingen wieder zurück und wieder einen anderen Tunnel. —
Wir überspringen einen Zeitraum von zwanzig Stunden und finden die beiden mit brennenden Füßen und knurrendem Magen am Boden eines Ganges sitzen, vollständig erschöpft von der Wanderung und nicht minder von der Aussicht, nie wieder das Tageslicht zu erblicken.
Reihenfels besaß zwar noch eine Wachskerze, aber schon seit fast achtzehn Stunden hatten sie sich nur noch die Mauern entlang getastet, mit Ausnahme einiger schweigsamer Ruhepausen.
Sie hatten keinen Proviant bei sich — oder doch, ja, ihre Stiefel waren von Leder, das zwar schwer verdaulich, aber doch den Magen füllte, an einigen Stellen stand etwas vermodertes Wasser, und schließlich, war nicht noch immer ein Begleiter von Fleisch und Blut da?
Jene Zeiten sind noch nicht vorüber, da in einer Gesellschaft gelost wird, wer von den Anwesenden das nächste Mal zum Stillen des Hungers der übrigen dienen soll, noch immer kommen solche schreckliche Szenen vor, bei Schiffbrüchigen im Boote, bei verschütteten Bergleuten, bei eingeschneiten Jägern und so weiter.
Doch bei unseren beiden Freunden wären solche Gräuelszenen wohl nicht vorgekommen, beide besaßen einen Charakter, welcher durch eine Begierde nicht unter das Niveau der Menschlichkeit gedrückt werden konnte.
Gefasst sahen sie dem Tode ins Auge, ja, dem unvermeidlichen Tode — es gab für sie keine Rettung mehr durch eigene Kraft, nur der Allmächtige konnte ihnen noch helfen.
Reihenfels lehnte sitzend mit dem Rücken an der Mauer, Jeremy lag langausgestreckt am Boden, mit dem Kopfe die Wand berührend.
»Mein lieber Jeremy«, begann ersterer nach langer Pause mit leiser, aber fester Stimme, »wir müssen uns aufs Sterben gefasst machen, ich sehe keine Rettung mehr. Was hilft es uns, wenn wir noch einige Stunden im Dunkeln umhertasten, oder auch noch das Licht verbrauchen? Es ist besser, wir sammeln uns vorher, um den Tod ruhig wie Männer ertragen zu können.«

»Wir werden des Hungers sterben«, entgegnete Jeremy gleichmütig, »denn eine Wasserpfütze ist hier neben mir. Sprecht mir keinen Mut ein, Mister Reihenfels, es ist wahrlich nicht nötig. Ich hätte mir freilich einen angenehmeren Tod gewünscht; was aber nicht zu ändern ist, muss man erdulden. Ihr sollt mich wie einen Mann sterben sehen, ohne Fluch und ohne Seufzen, verlasst Euch darauf.«
»Leidest du schon Hunger?«
»Offen gestanden, ja, ganz ungeheuer. Mein Magen dreht sich immer rundum. Merkwürdig, was mir immer für Bilder erscheinen, wenn ich halb einschlafe. Ich sehe einen gedeckten Tisch mit köstlichen Sachen darauf, ich esse und esse und mein Hunger nimmt doch immer zu.«
Reihenfels wusste, dass dies auch eine Art Delirium war. Es geht dem Hungertode voraus. Dem Verdurstenden dagegen zeigt sich immer ein Bach, aus dem er mit vollen Zügen trinkt, wodurch sein Durst sich nur steigert, als wäre es Salzwasser. Er selbst hatte noch nicht stark vom Hunger zu leiden, vielmehr quälten ihn vorläufig nur trübe Gedanken.
»Mir ist überhaupt nicht viel an meinem Leben gelegen«, begann da wieder Jeremy, »ich sterbe ganz gern, um so mehr als ich den Tod beim Suchen meines Herrn finde, den ich über alles liebte. Ihr aber tut mir leid, Mister Reihenfels, Ihr habt viel auf Erden zu verlassen.«
»Darnach fragt der Tod nicht; er pflückt sich die Blume, die ihm gefällt, und lässt sich durch nichts bestechen. Es ist sehr gut, dass es so ist. Stehst du denn ganz allein da, Jeremy?«
»Ganz allein, ich habe niemanden auf der Welt.«
»Du warst nicht verheiratet?«
»Was man so verheiratet nennt, das war ich nicht. Ich hatte auch einmal eine — doch das ist schon lange her. Gute Nacht, Mister Reihenfels, auf ein Wiedersehen in einem besseren Leben!«
Der alte Soldat hatte etwas erzählen wollen, vielleicht eine Geschichte, wie auch ihm einst das Liebesglück gelacht hatte, doch er brach ab, legte sich auf die Seite und sprach nicht mehr.
Reihenfels saß wohl eine halbe Stunde schweigend, in Gedanken versunken, da, als sich Jeremy wieder aufrichtete.
»Sprecht Ihr zu mir?«, fragte er.
»Nein, Jeremy.«
»Seltsam. Ich sah wieder den gedeckten Tisch stehen, hörte aber auch ganz deutlich, wie Ihr mich zum Zulangen nötigtet.«
»Du träumtest es, ich sagte nichts.«
Jeremy legte sich wieder hin, nach einer Minute schon hob er abermals den Kopf.
»Was sprecht Ihr denn da immer?«
»Ich spreche nicht!«
»Natürlich, aber ein ganz seltsames Kauderwelsch. Nur einiges kann ich verstehen.«
»Was soll ich denn gesagt haben?«
»Ihr nanntet eben einige englische Käsesorten: Stilton und Chester.«
»Du hast geträumt, Jeremy!«
Der alte Soldat legte sich brummend hin. Reihenfels fühlte tiefes Mitleid mit ihm. Er musste schon stark vom Hunger gepeinigt werden, dass er selbst Worte deutlich in seinen Ohren vernahm.
Plötzlich sprang Jeremy auf.
»Hol mich der Teufel!«, rief er fast heftig. »Wollt Ihr mich denn foppen? Ihr erzählt mir da eine ganze Speisekarte, und ich vergehe vor Hunger!«
Reihenfels erschrak. Dieses Delirium bekam einen bösartigen Charakter.
»Ich sagte nichts, Jeremy!«, begütigte er. »Du träumst nur, armer Kerl!«
»Wie soll ich denn träumen? Ich höre immer Worte, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Es muss aber etwas zu essen sein, denn es kommen Worte vor, die ich kenne. Dass ich das Schnattern, Schwatzen und Lachen durcheinander nur träume, will ich gern zugeben, aber diese fremden Namen —«
»Was denn zum Beispiel für welche?«
»Nun, was ist denn das: Fromage de Brie?«
»Hast du das noch nie gehört?«
»Nein!«
»Ein französischer Käse.«
»Und Roquefort?«
»Auch.«
»Seht Ihr! Ich habe diese Worte noch nie gehört, und das geht immer untereinander: Stilton, Roquefort, Manchester und Fromage de Brie, und dazwischen schwatzt es und lacht es...«
Reihenfels wurde plötzlich aufmerksam.
Wie? Jeremy träumte von Speisen, die er nicht kannte, und hörte Worte, die ihm unbekannt waren?
»Wie lagst du vorhin, Jeremy?«
»Hier, mit dem Kopfe an der Wand!«
Reihenfels legte sich ebenso und drückte das Ohr an die Wand. Er stieß einen Ruf des Erstaunens aus.
Deutlich vernahm er ein Lärmen, Lachen und Schwatzen. Worte schwirrten hin und her, Witze, Zoten wurden gerissen, dazwischen erklang eine längere Rede, die immer unterbrochen wurde, dann brach wieder ein allgemeines Gelächter aus. Es wurde nur Französisch gesprochen.
»... französische Käse? Bah, taugen nichts!«, sagte eine fette Männerstimme. »Wie lange hält sich denn der Fromage de Brie? Der Chesterkäse, ja, das ist etwas Solides, der hält sich das ganze Jahr hindurch und schmeckt immer frisch. Dabei bleibe ich. Danke, danke, Madame, ich bin noch versorgt —«
»Wollen Sie nicht Trüffelsauce dazu nehmen?«, fragte eine Weiberstimme. »Es sind echte Perigords, frisch angekommen, extra für Sie, Conte, ein anderer versteht so etwas doch nicht zu würdigen!«
»Der Conte platzt, der Conte platzt!«, lachte eine Mädchenstimme. »Er muss schon die Weste aufknöpfen!«
Ein Kreischen erfolgte, Teller zerbrachen.
»Das vergesse ich Ihnen nie, Montpassier, Sie haben mir ein Loch in den Strumpf gebrannt!«
»Mädchen, willst du vom Tisch?«, rief die fette Stimme.
»Ich will Cancan tanzen! Ziehen Sie die Nase zurück, sonst bekommt sie einen Stüber!«
»Willst du vom Tisch?«
»Nein, versprechen Sie mir das blaue Kleid in der Tschandri-Dschock, dann dürfen Sie mir mein Strumpfband lösen!«
»Das habe ich billiger! Hexe, du trittst ja in die Kotelettes!«
»Salmis aux Truffes gefällig, meine Herren und Damen?«
»Damen, hahaha, sehr gut!«
»Ich lasse mir nächstens eine Tonsur stehen!«
»Trilby will Hochzeit machen. Hoch lebe das ewig Jungfräuliche an ihr!«
»Hoch lebe die Begum von Dschansi! Sie macht uns alle reich und uns Taugenichtse wenigstens zu Generälen!«
»Ich werde ihre Kammerjungfer!«
»Und ich heirate sie!«
»Sie ist schon vergeben!«
»So werde ich ihr Hausfreund!«
»Bah, ich heirate sie doch, wenn ich will!«
»Wo ist die Mirzi?«
»Die ist für heute engagiert!«
»Heute, heute, heute, meine Herren! Heute ist der große Tag, da Bengalen an England fallen soll, aber an Frankreich fällt.«
»Still, die Wände können Ohren haben!«
»Montpassier, das kostet zehn Rupien Strafe!«
»Und ich wette, dass die Begum von Dschansi in drei Monaten meine Geliebte ist! Einen Korb Champagner!«
»Kannst du auch bezahlen, mein süßer Junge?«
»Francoeur pumpt, die Begum bezahlt meine Schulden. Champagner, Madame, morgen geht das Puppenspiel los!«
»Punsch heizt besser!«
»Ich ziehe Kotelettes à la Soubise vor.«
»Sie sind ungezogen, Monsieur!«
So schwirrten die Worte toll durcheinander, scheinbar ganz unzusammenhängend, weil gleichzeitig mehrere Gespräche geführt wurden.
Dort wurde eine Orgie der tollsten Art gefeiert. Unter den Männern und Mädchen herrschte die größte Zügellosigkeit; wer am gemeinsten war, war der Witzigste. Einer der Herren schien sich nur fürs Essen zu interessieren.
Aber wo war das Lokal? Ebenfalls unter der Erde? Wie weit von hier entfernt?
Die Mauern, gute Tonleiter, konnten den Schall vielleicht meilenweit tragen, und selbst wenn es den Verirrten gelungen wäre, den Ort der Orgie zu erreichen, konnten sie vielleicht unter Leute fallen, denen an ihrem Tode viel gelegen war.
Reihenfels hatte genug gehört, er wusste, dass es so war.
Wenn er nur wenigstens geahnt hätte, wo dieses Lokal lag! Er wusste, dass es in Delhi mehrere solcher Etablissements gab, äußerlich Spelunken, innen glänzend eingerichtet, in denen besonders Franzosen zusammenkamen, mit Mädchen zuchtlose Orgien feierten und hoch spielten. Nur Eingeweihte hatten Zutritt.
Noch überlegte Reihenfels, als plötzlich laute Stimmen durch das Gewölbe hallten. Es war nicht nötig, das Ohr an die Wand zu legen. Auch Jeremy vernahm sie.
»Verzähle dich nicht!«, sagte eine Stimme im indischen Dialekt der niederen Klassen.
»Verirren wir uns, so finden wir nimmermehr den Ausgang!«
»So störe mich nicht!«
Schnell hatte Reihenfels den Mund an Jeremys Ohr gelegt.
»Das ist ein Zeichen von Gott, er will uns retten!«, flüsterte er. »Wir ziehen die Stiefel aus, schnell, und folgen diesem Schall, bis wir auf die Menschen selbst stoßen. Was wir zu sprechen haben, flüstern wir einander nur ins Ohr.«
Jeremy hatte sofort verstanden. Wie Reihenfels, so zog auch er schnell seine Stiefel aus und folgte ersterem.
Deutlich hörte man ein Gemurmel, es waren die Worte des die Schritte Zählenden, und Reihenfels wurde es nicht schwer, die Richtung zu finden, von wo das Murmeln erklang.
Je schneller sie gingen, desto lauter wurde es; sie näherten sich also den Menschen, die sich gleich ihnen hier unter der Erde befanden. Schritte vernahm man nicht — die Kulis — denn solche waren es dem Gespräch nach — gingen barfuß oder auf Sandalen.
Jetzt verstummte das Murmeln.
»Sind wir schon da?«, fragte eine Stimme.
»Gleich! Noch um die Ecke, fünfundsiebzig Schritte geradeaus und den Gang rechts, dann sind wir an der Wand, die uns von der Ruine trennt!«
»Und du kannst die Tür öffnen?«, fragte eine andere, dritte Stimme.
»Ja, auch im Finstern. Mir ist es oft gezeigt worden.«
Das Zählen begann wieder; deutlich vernahmen die Nachschleichenden jede einzelne Zahl. Bei fünfundsiebzig verstummte es.
So leise und schnell wie möglich eilten die beiden dorthin, wo sie das letzte Murmeln vernommen hatten, und so nahe waren sie den Unbekannten jetzt, dass sie selbst die Schritte der nackten Sohlen vernehmen konnten und wie sie manchmal an die Wand stießen.
Aber auch jene mussten infolge der vorzüglichen Akustik des Gewölbes ein Geräusch gehört haben.
»Was war das?«, fragte einer ganz in der Nähe.
»Was soll das gewesen sein? Eine Eidechse.«
»Mir war es, als folge jemand uns.«
»Torheit, wer soll hierher kommen?«
Reihenfels hatte leise den Revolver gezogen, ebenso Jeremy. Sie brauchten ihn nicht anzuwenden.
Allem Anschein nach hatten die Männer, wahrscheinlich vier, ihr Ziel erreicht, denn dem Geräusch nach ließen sie sich auf dem Boden nieder.
Reihenfels zog Jeremy neben sich an die Wand.
»Nur diese Ecke, vor der wir uns jetzt befinden, trennt uns von ihnen, flüsterte er ihm ins Ohr, dort muss ein Ausgang sein, aber die Männer haben noch etwas anderes vor, als nur diese Gänge zu verlassen. Ruhig, sie unterhalten sich.«
»Alles in Ordnung!«, sagte einer der Kulis. »Der Stein bewegt sich, sobald ich an die Stelle drücke. Wisst ihr, wo ihr seid?«
Drei Stimmen verneinten.
»Wir sind dicht an der Ruine im Palmengarten. Ihr braucht nicht zu erschrecken, es sind keine Geister dort, sondern ein Mann, der uns das Zeichen gibt. Klopft er mit seinem Dolchgriff an die Mauer, so ist der Faringi in der Nähe, wir kriechen heraus, verstecken uns in der Ruine und stürzen uns, wenn der Faringi vorübergeht, gleichzeitig auf ihn. Ihr drei macht ihn sofort stumm, womöglich ohne Blut zu vergießen, hebt ihn auf und tragt ihn in den Gang. Er soll spurlos verschwinden. Kobad, der jetzt schon draußen lauert, wirft den Stein wieder hinter uns in die Fugen, denn das ist das Schlimme, dass man den Stein von innen nicht wieder einsetzen kann.«
»Und was machst du?«
Ich nehme nur die Brieftasche mit den Briefen.«
»Was mag denn wohl in diesen stehen?«
»Jedenfalls etwas sehr Wichtiges, was die weiße Missis wissen muss. Der Faringi geht immer zwischen dem Palast des großen Gouverneurs und der Kommandantur mit Briefen hin und her, die sollen wir ihm heute abnehmen.«
Jeremy näherte seinen Mund dem Ohre Reihenfels'.
»Teufel, sie wollen die Ordonnanz des Gouverneurs töten und ihr die Briefe rauben.«
»Wir müssen und können es verhüten«, erwiderte Reihenfels ebenso leise.
»Natürlich tun wir es; und sollte ich hier verhungern, ich gehe nicht eher von der Stelle, als bis ich den teuflischen Plan vereitelt habe. Ich fühle übrigens schon gar keinen Hunger mehr.«
»Wir werden das Klopfen des Wächters ebenfalls hören; in dem Augenblick müssen wir uns so nahe wie möglich heranschleichen, und dringen sie vor, so schlüpfen wir sofort nach ihnen hinaus; nicht zu spät, dass wir die Tat nicht noch vereiteln können, und nicht zu zeitig, dass wir vorher entdeckt werden; sonst könnte man den Stein wieder vorsetzen, und wir wären gefangen. Oder hast du einen anderen Plan?«
»Es gibt keinen anderen — da — was ist das?«
Beide sahen in der Ferne erst einen Lichtschein, dann ein flackerndes Feuer, welches sich schnell durch den Gang bewegte, den sie voll und ganz übersehen konnten. Den vier Männern musste es verborgen bleiben.
»Da ist es wieder, das wandernde Feuer. Jeremy, ich muss ihm nach, ich muss, und sollte ich mich abermals verirren«, flüsterte Reihenfels, des Dieners Hand drückend.
»Ihr seid verloren!«
»Gleichgültig, ich muss; es ist die Aufgabe, die ich mir gestellt habe. Kommst du mit?«
»Sir, ich bin Engländer, und jene Inder wollen englische, amtliche Briefe rauben«, entgegnete Jeremy finster, »ich bleibe hier.«
»So bleib! Auf Wiedersehen!«
Damit war Reihenfels schon unhörbar im Finstern verschwunden.
Jeremy sah das Feuer immer näherkommen, es war nicht mehr hell, sondern wie dem Verlöschen nahe. Dann war es ihm, als sehe er noch eine Gestalt durch den Gang huschen, das war Reihenfels, doch nein, es waren ja mehrere, zwei oder drei, und es war fast, als würden sie von dem Fackelträger verfolgt.
Einen Augenblick schwankte Jeremy, ob er nicht seinem Begleiter beistehen sollte. Da erscholl das Klopfen, das Zeichen des draußen postierten Wächters, und Jeremy blieb.
Unsern Blicken zeigt sich ein fensterloser Salon, der durch zwei Kronleuchter erhellt ist, deren Licht überall von schief an den Wänden angebrachten Kristallspiegeln zurückgeworfen wird. Selbst an der Decke ist ein großer Spiegel befestigt.
Nicht nur der Boden, auch die Wände sind mit dicken, weichen Teppichen belegt, sodass der Salon, ohne Fenster und Türen, das Aussehen eines ausgepolsterten Kastens hat. Nur in der Mitte, wo der lange Tisch steht, ist der Teppich ausgeschnitten, ebenso ein Stück rechts neben dem Büfett.
An einer Wand ist der schwere Vorhang etwas zurückgeschlagen, und es zeigt sich ein üppig ausgestattetes Boudoir mit einem breiten, ganz von Spiegeln umgebenen Himmelbett, von rotem Ampellicht matt erleuchtet, das zugleich zarten Wohlgeruch ausströmt.
Solcher Boudoirs liegen noch mehrere zu beiden Seiten, man braucht nur die Teppiche zur Seite zu schlagen.
Das ist eines jener Lokale, von deren Existenz Reihenfels nur gehört hatte.
Sie waren immer stark frequentiert; hier wurden die raffiniertesten Orgien gefeiert, denen sich ein Spielchen anschloss, das erst mit dem grauenden Morgen und noch später endigte. Geheimnisvoll, wie sie gekommen, entfernten sich die Teilnehmer wieder. Jeder hatte Zutritt, er musste aber eingeführt werden, und der Einführende bürgte für den neuen Gast. Die Gesellschaft eines solchen Lokals wechselte also fortwährend, meistenteils waren es Fremde und Reisende, die sich hier, um sich zu amüsieren, einführen ließen und nach ihrer Plünderung keine Lust mehr hatten, das Lokal zum zweiten Male zu betreten.
Diesen Salon aber, der eben beschrieben wurde, besuchte schon seit einiger Zeit nur eine geschlossene Gesellschaft; jeden Abend kamen dieselben Gestalten, und erschien doch einmal ein Neuer, so geschah es nur mit Vorwissen und Willen der anderen.
Madame Chevaulet — so hieß die Wirtin — hatte strengen Befehl, keine den Herren unbekannte Person, und wäre es früher ihr bester Kunde gewesen, einzulassen, mit Ausnahme — weiblicher Personen, denn der Salon war eine von jenen Höhlen, in welchen es für Mädchen wohl einen Eingang aber keinen Ausgang gibt:
Wunderbar war, dass die jetzigen, ständigen Gäste gar nicht über so große Barmittel verfügten, um ihre kostspieligen Vergnügungen bezahlen zu können, und dass Madame Chevaulet ihnen so willig kreditierte.
Auch heute Abend wurde von der Gesellschaft eine Orgie gefeiert.
Um die mit den feinen Leckerbissen besetzte Tafel saßen in weichen Lehnstühlen acht Herren zwischen ebenso vielen Mädchen. Erstere schienen fast ohne Ausnahme Franzosen zu sein und machten alle, ob jung oder alt, den Eindruck verkrachter Existenzen. Der ehemalige Offizier zeichnete sich durch seine kurze, mit Schlagwörtern und Flüchen gewürzte Sprache aus, der frühere Student durch sein burschikoses Wesen; der Alte mit dem schönen Sünderkopf war jedenfalls seinen lebhaften Gesten nach ein gewesener Schauspieler, ein anderer mit feurigen Augen und langen Locken ein Maler.
Die Mädchen waren durchweg pikant und hübsch, keins über zwanzig Jahre alt. Ihre Kleidung, bei allen gleich, war die denkbar einfachste, keusch und doch wieder verführerisch; sie bestand aus einem einzigen langen, gefältelten, losen Gewand, welches den Körper vom Hals bis zu den Fußknöcheln verhüllte und doch wieder die Formen markierte.
Madame Chevaulet, eine schöne Frau in mittleren Jahren, stand hinter dem Büfett, die Mädchen bedienten selbst ihre Herren.
Der Wein floss in Strömen, die Champagnerpfropfen knallten, und eben bereitete die Wirtin in einer ungeheuren, silbernen Terrine heißen Punsch.
Das Souper neigte sich dem Ende zu, die Stimmung war die animierteste, und schon litt es die Gäste nicht mehr auf den Stühlen, am allerwenigsten die Mädchen. Die mutwilligsten Scherze wurden ausgeführt, begleitet von Witzen und Zoten, und da dies der Ort ist, von welchem Reihenfels Teile des Gesprächs erlauschte, so wissen wir, dass ein mutwilliges Mädchen, Trilby genannt, sich eben angeschickt hatte, mitten auf dem Tisch zwischen Schüsseln, Tellern, Flaschen und Gläsern einen Cancan zu tanzen.
Das erste war, dass sie in eine Schüssel mit Fleischpasteten trat, was aber nur ein ungeheures Gelächter hervorrief.
Nur einer war darüber empört, Monsieur Montpassier, ein zur Fettleibigkeit neigender Kavalier, der sich mehr für das Essen als für weibliche Schönheit interessierte.
Trilbys Tollheit steckte die Übrigen an; nur wenige Herren blieben noch sitzen und unterhielten sich, die meisten sprangen auf, es begann ein Jagen mit den Mädchen, man jubelte, lachte, wälzte sich auf dem weichen Teppich; ein Mädchen begann einen jener lüsternen Chansons zu singen, wie man sie in den Tingeltangels der Boulevards zu Paris zu hören bekommt; jubelnd stimmte man in den Chorus ein — alle bösen Dämonen schienen entfesselt zu sein.
Da ertönte eine Glocke; wie festgewurzelt blieben alle stehen und schauten nach der schönen Wirtin.
Diese lächelte, nahm einen silbernen Teller, auf welchem acht Papierröllchen lagen, und trat unter die Gesellschaft.
»Acht Damen zu halten, ist mir erlaubt«, sagte sie; »ich weiß, dass sich manche ihre Freiheit wünscht, und so soll heute das Los entscheiden, welche derselben zurückgegeben wird.«
»Ich befinde mich hier ganz wohl«, warf Trilby dazwischen, »ich mag gar nicht gehen.«
»Ich auch, ich auch!«, riefen andere.
»Eine muss mich aber doch verlassen.«
»Aber warum denn? Kommt eine neue?«
»Eine neue!«, bestätigte die Chevaulet. »Mein Agent lässt mir eine ganz neue zugehen, Sie verstehen...«
»Ah, das ist herrlich! Wo ist sie? Wer ist sie?«
»Das Kind einer Inderin und eines Engländers.«
»Bah, ein schläfriges Hindumädchen!«, sagte eine verächtlich.
»Haben Sie sie schon gesehen?«, fragte ein Herr.
»Nein, aber es soll etwas ganz Exquisites sein: schön, jung und unberührt.«
»Lassen Sie sie erscheinen!«
»Erst losen.«
Jedes Mädchen nahm ein Röllchen, Trilby war die Begünstigte, welche den Salon für immer verlassen durfte, sich jedoch auch sofort nach Frankreich begeben musste.
»Und ich mag nicht gehen. Wer will mit mir tauschen?«
Ein etwas schüchternes Mädchen, welches sich hier nicht wohl fühlte, nahm gern das Anerbieten an.
»Und wir Herren? Auch wir müssen losen.«
Sie losten, und das Los siel auf Montpassier.
»Montpassier, bravo, bravo!«, rief es durcheinander. »Die Weiberfeinde haben doch das größte Glück!«
»Wenn sie mir zu widerspenstig ist, verkaufe ich das Glück!«, entgegnete der Dicke phlegmatisch. »Ist sie gezähmt, Madame?«
»Ich kenne sie noch gar nicht.«
»Eine Sklavin?«
»Eine Freie. Der Vater raucht gern Opium, und da es ihm an Geld fehlte, hat er seine Tochter verkauft.«
»An wen?«
»An mich.«
»Sie geben sich direkt mit solchen Geschäften ab?«
»Werde mich hüten, mir die Finger zu verbrennen!«, lachte die Chevaulet. »Ich habe meine Zwischenhändler.«
»Wer war es in diesem Falle?«
»Ich habe Gründe, das zu verschweigen.«
»Das Mädchen, das Mädchen!«, riefen die neugierigen Herren und Weiber. »Lassen Sie es erscheinen!«
»Einen Augenblick Geduld! Es ist eben angekommen und wird jetzt angekleidet.«
»Von wem haben Sie es gekauft?«, fragte Montpassier nochmals. »Wir brauchen doch keine Geheimnisse voreinander zu haben, schöne Frau.«
»Da haben Sie recht! Von Sedrack, dem Juden.«
»Wie viel haben Sie für sie gezahlt?«
»Auch das sollen Sie noch erfahren: tausend Rupien.«
»Alle Wetter, muss der Kerl Geld verdienen! Er hat höchstens zehn Rupien an den Opiumsüchtigen bezahlt.«
»Montpassier will Sklavenhändler werden«, lachte Trilby, »darum interessiert er sich so dafür.«
Der Dicke rieb sich nachdenklich die Nase, als ginge er wirklich mit derartigen Gedanken um.
Die Glocke ertönte wieder.
»Auf die Plätze, auf die Plätze, und zuerst möglichst einen guten Eindruck auf sie machen.«
Alle eilten auf ihre Plätze.
Die kleine, offene Stelle vor dem Büfett verschwand plötzlich, sie versank, dann tauchte in der Versenkung ein Kopf auf, und im Salon stand die hohe, imposante Gestalt eines Weibes. Das schöne Gesicht mit den großen, dunklen Augen zeigte einen sentimentalen, schwermütigen und zugleich gleichgültigen Zug, wie man ihn bei Orientalinnen oder auch bei indischen Mischlingen oftmals findet.
Ein gewisses Etwas verriet die Keuschheit. Die Schöne aber erschrak nicht, als die schwermütigen Augen die Versammlung überflogen, deren Charakter ihr bei der freien Haltung der Herren und Mädchen nicht verborgen bleiben konnte.
Sie wusste ganz genau, was ihr bevorstand, sie kannte ihr Los, und mit dem Phlegma ihres Landes nahm sie geduldig das Unabwendbare hin. Es war ja das Schicksal von Hunderttausenden ihrer Schwestern.
»Parbleu, ein göttliches Weib!«, murmelte ein Herr, der, wie die andere Gesellschaft, die schöne Erscheinung ungeniert anstarrte.
»Wunderbar gebaut!«, ein anderer.
»Montpassier, ich beneide dich.«
»Montpassier, was willst du für sie haben?«
»Bah, schön, aber kein Feuer!«, sagte ein Mädchen verächtlich. »Es ist eine Steinfigur.«
»So will ich ihr Leben geben!«, rief ein junger Mann mit schwarzem Knebelbart, Duplessis angeredet, sprang auf und wollte auf die Schöne zueilen; Madame Chevaulet vertrat ihm jedoch den Weg.
»Der Würfel ist gefallen, sie ist vergeben. Handeln Sie mit dem Conte über sie.«
Gleichgültig und ohne Zeichen von Scham oder Verlegenheit hatte das Mädchen die französischen Bemerkungen, die sie verstand, angehört; sie glich wirklich einer Statue. Was war auch weiter dabei?
Ihr Vater, ein pensionierter englischer Soldat, war dem Opium über alles ergeben, und ihr Schicksal hatte sie vorausgesehen, sobald ihre Mutter tot war. Gestern war sie gestorben, heute wurde die Tochter für einige Rupien an einen Juden verkauft — das Schicksal nahm eben seinen Lauf.
Die Frau führte sie Montpassier zu, der sie mit gnädigem Lächeln wie ein hübsches Geschenk empfing und zum Setzen neben sich einlud.
Ein Scherz zauberte wieder die alte Tollheit hervor, man beachtete nicht weiter das Mädchen, welches sich vorläufig noch ungeschickt benahm, mit Ausnahme einiger weniger, die sich für die Liebeswerbung des Dicken interessierten.
Wäre das Mädchen lebhaft, froh und zudringlich gewesen, so hätte der Dicke sie nicht für sich passend gefunden, ihre phlegmatische Ruhe aber war nach seinem Geschmack.
Er machte ihr auf die einzige Weise den Hof, die in solcher Gesellschaft am Platze war, er sagte ihr zudringliche Schmeicheleien und nötigte sie zum Essen und Trinken, was sich das Mädchen, in Armut aufgewachsen, nicht zweimal heißen ließ. Sie langte ohne Zögern zu nahm den ihr gereichten Champagnerkelch, hatte aber für ihren dicken Nachbar nur wenig Beachtung, seine Fragen beantwortete sie einsilbig.
Als sie sich gesättigt in den Stuhl zurücklehnte, duldete sie wohl seine Zärtlichkeiten, ließ sich auch ohne Widerstreben auf seinen Schoß ziehen, doch zum Erwidern solcher Liebkosungen konnte sie nicht bewegt werden. Es war eben ein Wesen, wie man es in den Harems findet: schön, aber träge, kalt und gleichgültig.
Wie leicht war es diesen Wüstlingen, die Stimmung eines solchen Mädchens zu ändern! Montpassier brauchte nicht erst durch verdeckte Ausrufe und Trinksprüche darauf aufmerksam gemacht zu werden, er kannte das Mittel schon.
»Schöne Wirtin«, wandte er sich an die Chevaulet, »Ihr Champagner und Punsch vermag meiner Pikarde nicht den Nimbus zu geben, ohne welchen sie sich in meiner Gesellschaft nicht wohl befindet. Versuchen wir es mit einem Glas jener Rebe, die in der Lavaglut Neapels gezeugt ist.«
Er wendete den Kopf etwas und flüsterte ein Wort, welches fast wie Diavolina klang. Lachend entfernte sich die Wirtin und kehrte mit einem Kristallglas zurück, in dem purpurner Wein funkelte.
Montpassier selbst kredenzte es dem Mädchen auf seinem Schoß, sie nahm es gleichgültig dankend und trank auf sein Zureden davon, allerdings nicht ohne Zögern.
»Trink aus, trink aus!«, ermunterte der Wüstling. »Wenn dieser Wein in deine Adern kommt, wirst du selbst jenen Leuten gleich, in deren Land er gewachsen ist. Das Leben verliert seine Schwermut, alles erscheint in sonnigem Lichte.«
Das Mädchen trank das Glas leer.
Als wäre jetzt etwas Besonderes zu erwarten, so sammelten sich die Herren und Mädchen um den Tisch, die Fremde beobachtend, ohne das Gespräch fortzusetzen. Neugier, Schadenfreude und teuflische Lust malte sich auf allen Gesichtern; boshaft lächelnd stand die Wirtin hinter dem Stuhl des Opfers und wechselte mit den Gästen bedeutsame Blicke.
Mit dem Mädchen ging in der Tat eine seltsame Veränderung vor. Ihre großen Augen verloren den träumerischen Ausdruck; unruhig suchten sie im Kreise umher, eine leise Röte stieg langsam auf und begann Stirn und Wangen zu färben, der schwellende Busen hob und senkte sich schneller, und das Mädchen selbst machte auf den Knien des Mannes unruhige Bewegungen. Dunkler und dunkler ward das Rot, immer glänzender, sehnsüchtiger blickten die Augen.
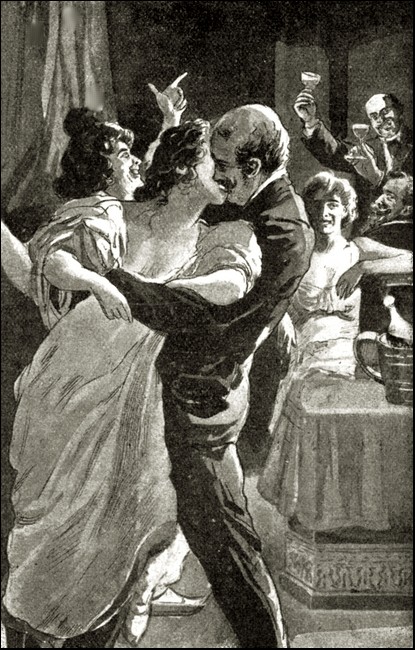
Plötzlich schlang sie heftig beide Arme um den Hals des ihr völlig Fremden und schmiegte sich an seine Brust.
»O, wie wird mir plötzlich!«, seufzte sie. »Was geht mit mir vor? — Mich durchschauert es — ich möchte sterben — in dir —«
Ein wildes Gelächter brach überall los; als wäre die Gesellschaft plötzlich vom Teufel befallen, so begann es zu toben; die Mädchen sprangen auf, klatschten in die Hände, tanzten, die Herren jubelten.
»Bravo, bravo, Montpassier!«, klang es durcheinander. »Hoch lebe Diavolina, sie macht die Erde zum Paradies — hoch lebe Montpassier, der Jungfernbändiger —«
Das Mädchen wusste nicht, was um sie vorging, sie sah nichts, sie hörte nichts, sie schmiegte sich nur an den Mann, der sie in seine Arme gezogen hatte.
Die Augen der Wirtin wiesen Montpassier den Weg nach einem Boudoir, er verschwand mit seiner schönen Last, die er noch in den Armen trug; die Portiere schloss sich; ein leiser, seufzender Schrei, dann wirbelten unter den Fingern Trilbys die rauschenden Töne eines Walzers durch den Saal.
»Beim heiligen Nabel des Papstes«, rief der vorhin mit Duplessis angeredete junge Mann mit dem schwarzen Knebelbart, als sich der Lärm etwas gelegt und die Gesellschaft sich zum Teil wieder um den Tisch versammelt hatte, »Montpassier hat einen seltsamen Geschmack! Ich könnte mich an keinem Weibe ergötzen, in dem ich die Leidenschaft durch künstliche Mittel erweckt habe, und das sich dem ersten besten Manne an den Hals hängt, gleichgültig, wie er aussieht.«
»Glauben Sie, Duplessis, ein jedes Mädchen müsse sich in Sie sofort verlieben?«, fragte die gelbhäutige Inez.
»Ich glaube es nicht, ich weiß es«, war die selbstbewusste Antwort.
»Oho, nach meinem Geschmack wären Sie zum Beispiel keineswegs!«
»Bah, das hatte die Mirzi auch gesagt, und nach acht Tagen hing sie an mir wie eine Klette.«
»Ich behaupte nochmals, in Sie könnte ich mich nie verlieben!«
»Was frage ich sie nach Ihrer Liebe? Wenn Sie mir begehrenswert erschienen, müssten Sie mich eben lieben!«
»Sie würden mich zwingen wollen?«, fragte Inez, in deren Adern spanisches Blut rollte, mit gerunzelter Stirn.
»Gewiss! Nichts ist schöner, als wenn man ein Mädchen zur Liebe zwingt. Je mehr es sich sträubt, desto besser.«
»Das wäre der Tod desjenigen, der es bei mir versuchte.«
»Bei meiner Jungfernschaft«, lachte Trilby, »man glaubt förmlich, Inez sei eine Heilige, wenn man sie jetzt reden hört.«
»Zwingen lasse ich mich nicht; ich kam zwar freiwillig hierher, doch nicht, um jedem anzugehören.«
»He, Duplessis«, rief ein Herr, »du vergisst ganz deine Wette von vorhin. Wie steht es mit der Begum von Dschansi? In drei Monaten wolltest du sie zu deiner Geliebten machen. Hier kannst du deine Unwiderstehlichkeit gleich beweisen.«
»In vier Wochen, behaupte ich sogar. Was gilt die Wette? Wer hält sie?«
»Vorsicht, meine Herren!«, rief die Wirtin. »Der Tisch muss für einen Augenblick verschwinden.«
»Was gibt's? Ein neues Gericht? Mein Bauch ist schon voll zum Platzen.«
»Nur noch den Nachtisch!«
Die Chevaulet zog an einem Handgriff in der Wand, die Gäste lehnten sich zurück, und der Tisch versank plötzlich vor ihnen in die Tiefe.
»Es wird bald Zeit, dass ich zu meinen Auslagen komme«, meinte die Wirtin, während unten der Tisch neu gedeckt wurde.
»Keine Angst, jeden Tag kann der Tanz losgehen, und dann werden unsere Schulden mit Zinsen und Zinseszinsen bezahlt. Oder zweifeln Sie daran?«
»Zweifeln? Dann würde ich Ihnen wohl nicht so lange borgen. Doch lieber wäre mir, die Geschichte nähme schon morgen ihren Anfang.«
»Sie nimmt morgen ihren Anfang«, ertönte eine Männerstimme von unten herauf, »morgen Abend schon geht der Tanz los.«
Ein Knarren zeigte an, dass sich der Tisch wieder in Bewegung setzte, und mit ihm erhob sich aus der Tiefe ein Mann, neben ihm eine vermummte, weibliche Gestalt. Der Mann sprang zur rechten Zeit vom Tisch in den Saal, das Weib mit sich ziehend.
»Hektor«, erklang es von allen Seiten bestürzt, »wen bringst du da mit?«
»Ein junges, unschuldiges Mädchen, welches verfolgt wurde oder sich doch verfolgt glaubte und, um Schutz bittend, sich an mich wendete. Sie soll das nicht vergebens getan haben, ich bringe sie hierher in Sicherheit.«
»Hektor, du bist toll.«
Es schien alle unangenehm zu berühren, dass der Mann ein fremdes Mädchen mit hereinbrachte. Wer hierher kam, durfte das Lokal nicht wieder verlassen, jetzt umso weniger, als allerlei heimliche Gespräche geführt wurden, die beim Verrat alle Anwesenden an den Galgen gebracht haben würden. War die Neuangekommene aber ein Mädchen aus guter Familie, so war es sehr gefährlich, am meisten für die Wirtin, wenn man sie mit Gewalt hier festhielt.
Nur Inez, die stark angetrunken war, machte sich keine Sorge.
»Hektor, mein süßer Junge«, rief sie und warf sich dem Mann an die Brust, »Gottlob, dass du kommst! Ich verschmachte vor Sehnsucht nach dir.«
»Still, Inez, es ist ein anständiges Mädchen, die ich heute hier einführe.«
»Anständig, hahaha, so eine muss ich mir ansehen. Wie sieht denn so ein anständiges Mädchen eigentlich aus? Herunter mit dem Lappen!«
Sie riss der Verhüllten den Schleier vom Gesicht.
Es war ein noch sehr junges Mädchen mit schönen, liebreizenden Zügen, von schwarzen Locken umrahmt. Fast hatte sie Ähnlichkeit mit jener, mit der sich Montpassier in das Boudoir zurückgezogen hatte, also war auch sie wahrscheinlich ein Mischling, wenn nicht eine Südeuropäerin. Doch sie besaß nicht den schwermütigen Ausdruck, die träumerischen Augen wie jene, vielmehr lag in ihrem Gesicht ein kühner und edler Zug, und in ihren Augen schien ein verhaltenes Feuer zu blitzen, das nur die Gelegenheit erwartete, um mit verzehrender Glut hervorzubrechen.
Ohne Verlegenheit stand sie hochaufgerichtet da, den Arm noch in dem des Begleiters, und im Nu hatte ihr Auge jeden Anwesenden scharf gemustert.
Auch das freche Betragen Inez' vermochte sie nicht einzuschüchtern, wohl aber traf ein funkelnder Blick die Frevlerin.
Im Moment beschäftigte etwas anderes die meisten Herren. Die Wirtin wollte den neuen Ankömmling in ein Boudoir ziehen und die Herren ihr folgen, doch Hektor widersetzte sich.
»Hektor, Sie sind toll!«, flüsterte die Chevaulet ihm zu. »Es ist gewagt, eine uns Unbekannte hier hereinzubringen.«
»Nichts ist gewagt, wir brauchen keine Heimlichkeiten mehr!«, rief aber Hektor. »Habt ihr nicht gehört, was ich sagte, als ich der Unterwelt entstieg? Freunde und Freundinnen, morgen Abend geht der Tanz los, übermorgen sind wir Generäle!«
»Wahrhaftig? Woher weißt du's?«
»Ich habe es aus ganz sicherer Quelle. Ob wir die Briefe heute Abend bekommen oder nicht, es geht doch morgen los. Die Begum von Dschansi wird sich morgen im Triumph dem Volke zeigen, sie selbst fährt den Götterwagen.«
Ein unermesslicher Jubel brach los.
»Hoch lebe die Königin von Dschansi!«, erscholl es auf der anderen Seite.
»Wir kennen sie zwar nicht, aber es muss doch ein perfektes Weib sein. Ich liebe sie!«
»Und ich heirate sie doch, und wäre sie hässlich wie die Nacht«, lachte Duplessis, »und das wird wohl der Fall sein, sonst würde sie wenigstens einmal ihr Gesicht zeigen.«
»Morgen tut sie's.«
»Nein, sie tut's nicht, sie fährt vermummt und verschleiert auf dem Wagen der Kali. Ich hab's schon gehört.«
Die Fremde verhielt sich ganz ruhig, während der Jubel über die frohe Nachricht um sie her tobte. Nur ihre Augen wanderten fast wie mit einem drohenden Ausdruck von einem zum anderen.
»So wollen wir diese Nacht noch einmal voll und ganz genießen und den Becher der Freude bis auf die Neige leeren«, rief Duplessis. »Komm, schönes, unschuldiges, verfolgtes Mädchen! Lerne durch mich die Liebe kennen; morgen darfst du plaudern, denn morgen sind wir die Herren Indiens!«
Mit diesen pathetisch gesprochenen Worten wollte er das Mädchen umarmen, doch Hektor hielt ihn zurück.
»Nichts da, das ist meine Beute! Meine Herren und Damen, ich erlaube mir, Ihnen eine Unschuld von Delhi vorzustellen, deren Jungfräulichkeit in Gefahr war, weswegen sie sich in meinen Schutz begab. Ihr Name ist Diavolina...«
»Diavolina, Diavolina!«, kreischten die Mädchen händeklatschend auf, und die Herren sahen sich bedeutungsvoll an.
»Das heißt, diesen Namen habe ich ihr gegeben«, fuhr Hektor fort, »weil sie mir den ihren nicht nennen wollte. Sonst habe ich nur noch von ihr erfahren können, dass sie Kellnerin bei der kleinen Balliot gewesen und jetzt ohne Stellung ist...«
Wieder unterbrach den Vorstellenden ein lautes Hallo. Madame Balliot hielt eine Weinstube, in der viele Franzosen verkehrten, und die dort angestellten Kellnerinnen standen im übelsten Ruf.
Als sich der Lärm gelegt hatte, schloss Hektor:
»So bitte ich Sie also, sich der jungen Dame anzunehmen und hauptsächlich ihre jungfräuliche Ehre zu wahren. Dann habe ich noch zu bemerken, dass sie, als ich im Laufe des Gespräches bemerkte, ich ginge zu Madame Chevaulet, dass diese junge Dame da erwiderte, dies sei ihr gerade recht angenehm. Sie ist eine Südfranzösin. Also bitte, meine schöne Diavolina!«
Unter dem Jubel der Übrigen über diese zynische Vorstellung wollte Hektor das Mädchen nach dem Diwan führen, doch Inez ließ es nicht zu.
»Nichts da, Hektor! Heute gehörst du mir, du hast es mir versprochen. Lass das Mädchen zum Teufel gehen!«
Vergebens versuchte sich der Mann der Spanierin zu erwehren, sie erdrückte ihn bald.
»Zum Teufel, Duplessis, so nimm du sie denn!«, lachte er endlich. »Ich rechne auf Gegendienst.«
»Halt, ich protestiere!«, rief ein anderer. »Duplessis hat gewettet, innerhalb vier Wochen der Geliebte der Begum von Dschansi, unserer Gebieterin, zu sein, und so hat er keine Zeit zu anderen Liebeleien.«
»Ich bin ein Genie, ich kann mehrere Liebschaften zu gleicher Zeit haben und vollenden«, entgegnete Duplessis und führte das Mädchen nach dem Diwan.
Sie folgte auch ohne Zögern und Sträuben, stolz, mit aufrechtem Gang und elastischem Schritt.
»Liebe Diavolina, mach dir's bequem und tu, als wäre dies dein Haus, in dem du die Herrin bist und ich dein untertänigster Diener. Erlaube, schönes Mädchen, dass ich auf diesem Schemel Platz nehme und erst deine kleinen, reizenden Füßchen in Ehrfurcht küsse.«
Das Mädchen tat wirklich, als fühle sie sich in solcher Gesellschaft ganz heimisch. Doch sie duldete nicht, dass sich der junge Mann ihr zu Füßen setzte, sie zog ihn vielmehr neben sich auf den Diwan und rückte dann etwas von ihm ab.
»Entziehe dich nicht meiner Nähe«, bat er und haschte ihre kleine Hand. »Du machst mich unglücklich durch diese Kälte!«
»Sie unglücklich zu machen, wäre das letzte, was ich täte«, scherzte sie; »doch ehe wir vertraulicher verkehren, ist es nötig, dass wir uns vorstellen. Mit wem habe ich die Ehre?«
»Sie sehen in mir, schöne Dame«, entgegnete Duplessis mit komischem Ernst und Verbeugung, »einen Mann, dem der Marschallstab für die nächsten Tage in Aussicht steht. Stoßen Sie sich nicht an meinen einfachen Namen Duplessis; infolge meiner militärischen Fähigkeiten werde ich es bald bis zum höchsten Rang in der indischen, nicht in der englisch-indischen Armee gebracht haben. Es sind dies dieselben Fähigkeiten, mittels deren ich mich früher schlicht und recht als Straßenräuber ernährte; doch ich soll ja auch jetzt nur ein General von Straßenräubern werden. Darf ich nun um Ihre Vorstellung bitten, gnädiges Fräulein?«
»Ich vermute, Sie treiben nur Scherz...«
»Durchaus nicht, es ist mein völliger Ernst!«
»Nun, von mir sollen Sie die Wahrheit zu hören bekommen. Es wundert mich, dass wir uns noch nicht kennen, denn ich war bis vor kurzer Zeit...«
»Kellnerin bei der kleinen Balliot«, fiel Duplessis ein.
»Allerdings! Finden Sie darin etwas Anstößiges?«
»Aber bitte, Mademoiselle, ganz das Gegenteil! Darf ich Sie nun flüchtig mit den anderen Herren bekannt machen? In diesem Augenblicke sind es noch, ganz offen gestanden, weiter nichts als Halunken, Spitzbuben und Taugenichtse, größtenteils wegen Dummheiten aus der französischen Armee gestoßen, ebenso wie ich. Da sie aber ebenfalls militärische Kenntnisse besitzen, können sie es im göttlichen Indien noch weit bringen, denn hier hat jeder französische Soldat und wäre er das verkommenste Subjekt, den Feldherrnstab im Tornister; man braucht nämlich Offiziere für Soldaten. Doch lassen wir das, wir wollen von Liebe sprechen, schöne, herrliche Diavolina!«
Er wollte sie an sich ziehen, aber sie entwich ihm.
»Ich möchte gerade davon mehr erfahren; Sie haben mich durch Ihre Andeutungen neugierig gemacht.«
In diesem Augenblick näherten sich den beiden zwei der Herren, denen der Wein schon sehr zu Kopfe gestiegen war.
»Wir lassen die Sache nicht ruhen, Duplessis«, rief der eine. »Wie steht es mit der Wette?«
»Aber ich bitte! In meiner jetzigen Situation! Später sprechen wir davon!«
»Nein, jetzt«, sagte der eine, »oder wir erklären dich für einen Prahlhans. War das vorhin dein Ernst?«
»Mein völliger!«
»Wohlan, also du erklärst, innerhalb von vier Wochen der Geliebte der Begum von Dschansi zu sein?«
»Ja, ich nehme mein Wort nicht zurück.«
»Und wenn sie nun ein altes, hässliches Weib ist?«
»Auch dann«, lachte Duplessis und strich unternehmend den langen Knebelbart; »aber sie ist es nicht.«
»Du kennst sie?«
»Nein.«
»Dann wollen wir dich jetzt verschonen. Wann arrangieren wir die Wette?«
»Heute Abend noch, verspreche ich euch. Ihr seht, ich habe jetzt Wichtigeres zu tun. Ihr kennt doch das Sprichwort von dem Sperling in der Hand und der Taube auf dem Dache, obgleich mir letztere auch schon so gut wie sicher ist. Hahaha!«
Lachend entfernten sich die beiden Genossen, und Duplessis wandte sich wieder dem Mädchen an seiner Seite zu.
»Nun, meine schöne Diavolina — aber was hast du denn? Du blickst mich ja gerade an wie die Meduse den Diomedes!«
Die Augen des Mädchens waren wirklich unheimlich starr geworden, sie schienen fast die Eigenschaft zu besitzen, alles Lebendige in Stein zu verwandeln.
»Nichts, nichts!«, sagte sie, gleich wieder lebhaft werdend. »Was ist das eigentlich mit der Begum von Dschansi? Ich habe diesen Namen hier innerhalb weniger Minuten schon einige Male gehört.«
»Und du wirst ihn noch unzählige Male zu hören bekommen. Hast du Eltern oder Verwandte in Indien?«
»Nein, niemanden. Wozu diese Frage?«
»Na, dann kannst du ohne Sorge sein, für dich selbst brauchst du nichts zu fürchten, ich nehme dich unter meinen Schutz.«
»Aber wieso denn?«
»Du hast wohl keine Ahnung, was die nächsten Tage für Delhi und ganz Indien bringen werden?«
»Morgen ist Shivas Götterfest, das weiß ich.«
Duplessis stand auf und nahm eine theatralische Stellung ein.
»Und morgen wird den Engländern die Herrschaft über dieses Land genommen, ganz Indien erhebt sich wie ein Mann, und die, welche die wilden Krieger im Kampfe mit weisem Verstande und Rat leiten, das sind wir, die Offiziere der französischen Nation.«
Duplessis machte eine Handbewegung nach seinen Freunden hin. Das Mädchen schien zu erschrecken.
»Ach, Sie treiben nur Scherz!«
»Es wird ein furchtbar blutiger Scherz; die Inder werden sich in dem Blute der Tyrannen baden.«
»Es ist wirklich wahr?«
»Sie werden selbst sehen.«
»Mein Gott, da muss man ja fliehen!«
»Wohin? Es wäre zu spät! Du könntest nicht mehr aus Indien kommen. Bleibe hier! Unter meinem Schutz bist du sicher; man respektiert mich, denn ich werde eine wichtige Rolle in dem Aufstande spielen.«
»Also wieder ein Aufstand!«, seufzte sie. »Ach, ich habe schon so Schreckliches davon erzählen hören!«
»Ja, es wird schrecklich werden. Doch nun, schöne Diavolina, erlaube mir, dass ich schon jetzt deinen Dank in Empfang nehme für meinen Schutz.«
Er rückte wieder an sie heran, und wollte sie umarmen; doch das Mädchen hinderte ihn nochmals mit kräftiger Hand daran.
»Wie, du wehrst dich?«, lachte er. »Das gefällt mir. Immer sträube dich, schöne Kleine!«
Sie hatte seine Hand gefasst, und plötzlich sank er mit einem Fluch und einem Schmerzensschrei zurück und schüttelte den Arm.
»Verflucht, Mädchen! Du hast ja Kräfte wie ein Bär! Himmeldonnerwetter, ich glaube, meine Knochen sind gebrochen.«
»Sie sehen, ich kann mich wehren«, lächelte das Mädchen.
»Aber woher hast du denn diese Kräfte?«
»Ich war früher Athletin in einem Zirkus, das ist die Erklärung.«
»Also spieltest du einst mit Zentnergewichten? Nun, es soll mich nicht entmutigen, ich werde dich doch besiegen.«
»Geben Sie sich keine Mühe; Sie können mich nicht zwingen, und wenn Sie alle Ihre Freunde zu Hilfe riefen.«
»Du willst die Spröde spielen?«
»Ich habe das Gelübde der Keuschheit abgelegt.«
»Hahaha, und du warst Kellnerin bei der kleinen Balliot! Auf wie lange bindet dich denn dein Gelübde?«
»Für heute nur.«
»Das ist köstlich; also heute weigerst du dich, mir anzugehören?«
»Ganz entschieden. Doch um zwölf Uhr bricht der morgige Tag an.«
»Ach so, ich verstehe. Es ist jetzt elf, also in einer Stunde gibst du deine Sprödigkeit auf.«
»Ja, ich verspreche es Ihnen, und ich bitte Sie, mir während dieser Stunde noch etwas über den Aufstand zu erzählen, ich interessiere mich lebhaft dafür.«
»Mit dem größten Vergnügen. Nebenbei werde ich versuchen, dich noch innerhalb dieser Stunde zu zähmen.«
»Es wird Ihnen nicht gelingen. Wer leitet den Aufstand eigentlich?«
»Der Großmogul Bahadur. Trinkst du Wein?«
»Ich danke, in einer Stunde erst. Und wer noch?«
»Nana Sahib, sein Neffe. He, Madame Chevaulet! Ein Glas jenes Weines, der den Namen meiner schönen Gesellschafterin führt.«
Die Gerufene brachte denselben Wein, welcher vorhin die Umwandlung des Mädchens bewirkt hatte. Die Neue aber weigerte sich entschieden, auch nur davon zu kosten.
»In einer Stunde, Punkt zwölf Uhr, ist mein Gelübde beendet, dann sollen Sie in mir die Fröhlichste aller Fröhlichen kennen lernen. Sie sprachen von einer Begum von Dschansi. Wer ist das eigentlich?«
Da Duplessis jetzt nicht zu seinem Ziele kommen konnte, war er willens, seine Kenntnis der Sachlage zu zeigen. Der Ton, in dem er sprach, war geringschätzend.
»Dass die Inder, und am allermeisten die eingeborenen Fürsten, mit der englischen Oberhoheit nicht zufrieden sind, ist ja leicht begreiflich. Nun wird schon seit langer Zeit von oben herab die Prophezeiung unter dem Volke verbreitet, natürlich ganz im geheimen, diese Fremdherrschaft würde nur hundert Jahre dauern. Die Inder sind sehr abergläubisch; einem tüchtigen Feldherrn, der aufträte und sagte: ›Kommt her, seid einig und folgt mir, ich will die Engländer aus Indien vertreiben!‹, würden sie nicht viel zutrauen, es muss dabei etwas Übernatürliches im Spiele sein. Das wussten die Herren da oben, der Großmogul und so weiter, und sie haben daher die Sage verbreiten lassen, nach diesen hundert Jahren würde Brahma ihnen ein Mädchen senden, welches Sewadschi mit der Göttin Kali im Nirwana gezeugt hat. Weißt du, was diese Namen bedeuten?«
»Die Kali ist die Göttin der Vernichtung, Nirwana so eine Art von indischem Himmelreich. Diese beiden Namen hört man oft. Was ist das dritte?«
»Sewadschi war ein indischer Abenteurer, der das Reich der Maharatten gründete und zuletzt ganz Indien unter seinem Zepter vereinigte. Die Tochter Sewadschis und der Kali also soll die Befreierin Indiens werden; die Inder hoffen, dass sie bald erscheine, und morgen wird sie denn auch kommen.«
»Wirklich? Wie ist denn das möglich?«
»Es ist natürlich alles nur Humbug«, lachte Duplessis. »Man hat einfach ein Mädchen so erzogen, dass es sich für die Rolle dieser Begum von Dschansi eignet.«
»So gibt es also schon eine?«
»Freilich.«
»Haben Sie sie schon gesehen?«
»Nein, noch niemand. Vielleicht Francoeur und seine Geliebte, die sie erzogen haben sollen! Ich habe einst Gelegenheit gehabt, sie zu sehen, aber ich interessierte mich damals noch nicht für das indische Unternehmen, ich trat erst später in französisch-indische Dienste.«
»Wer ist dieser Francoeur?«
»Ein Franzose, der schon lange, lange Jahre für Indien arbeitet und sofort beim Beginn des Aufstandes das Kommando der Artillerie übernehmen wird.«
»Also Sie haben die Begum auch noch nicht gesehen? Sagten Sie nicht vorhin, Sie wollten ihr Geliebter werden?«
»Ich habe gewettet, dass dies mir innerhalb vier Wochen möglich ist, und ich werde gewinnen.«
»Gott, warum auch nicht! Sie ist ja auch nur ein Weib.«
»Du darfst aber nicht vergessen, dass die Begum von den Indern als ein göttliches Wesen betrachtet wird, und dass auch wir, die wir doch gar nicht an den Unsinn glauben, sie als solches behandeln müssen. Wir haben den strengen Befehl dazu bekommen.«
»Von wem?«
»Von Bahadur, dem Großmogul selbst. Auch dieser tut anscheinend, als ob er das Mädchen, irgend einen unbekannten Bastard, als seine Gebieterin verehre, desgleichen Nana Sahib und alle anderen Fürsten. Nun, ich werde doch den Beweis liefern, dass auch sie nur ein Weib von Fleisch und Blut ist; in vier Wochen soll sie mein williges Spielzeug sein — Mädchen, was blickst du mich so höhnisch an?«
Diavolinas Augen hatten wirklich einen ganz seltsamen, verächtlichen Ausdruck angenommen.
»Ihr Herren der Schöpfung seid manchmal sehr siegesgewiss«, sagte sie.
»Wir haben nach unserer Erfahrung Ursache dazu. Oder zweifelst du, dass es mir gelingen würde?«
»Erst müssten Sie den Beweis an mir erbringen.«
»Sofort!«
Mit einer schnellen Bewegung umschlang er sie; das Mädchen aber entwand sich ihm wie ein Aal, stieß ihn zurück und hielt seine beiden Hände so fest, dass sie ihm schmerzten, obgleich sie gar nicht einmal drückte.
»Donnerwetter, meine Knochen knacken ja ordentlich!«, lachte er ärgerlich. »Lass mich los, Mädchen!«
»Unter der Bedingung, dass Sie keinen Angriff auf mich mehr machen. Um zwölf Uhr kapituliere ich freiwillig.«
»Gut, so warte ich, bis sich die Festung mir ergibt.«
Er blies auf die rotangelaufenen Hände.
»Musst du aber Muskeln besitzen! Übrigens, hast du denn eigentlich einen Panzer an? Deine Brust fühlt sich hart wie Eisen an.«
»Es ist ein Korsett mit vielen Stahlstäben, das gibt eine hübsche Figur. Also Sie wollen der Geliebte der Begum werden?«
»Ja. Bist du eifersüchtig?«
»Durchaus nicht! Wenn sie aber nun nicht will?«
»Dann zwinge ich sie.«
»Mit Gewalt wie mich? Gehen Sie!«
»O, es gibt noch andere Gewaltmittel als nur die rohe Kraft, mit denen man jedes Weib zwingen kann. Trink Wein, Diavolina!«
»Danke, in einer halben Stunde erst.«
»Kennst du den Wein, der deinen Namen führt?«
»Ich kenne ihn nicht, habe seinen Namen noch nie gehört.«
»So koste ihn wenigstens!«
»Jetzt noch nicht, nachher, und dabei bleibe ich. Nun erzählen Sie mir noch etwas von dem künftigen Aufstand. Was für eine Rolle soll denn die Begum von Dschansi dabei spielen?«

»Die Hauptrolle. Sie soll die Königin sein, welche die Inder wie eine Göttin anbeten. Verstehst du, wie man sie benutzen wird? Sie ist so eine Art von Messias; wer sie ansieht, der wird gesund und stark; wo sie ist, da muss gesiegt werden und so weiter.«
»Also tätlich beteiligt sie sich nicht an dem Aufstand?«
»Ich glaube kaum, sie wird wohl keine Jungfrau von Orleans sein. Sie ist eben nur eine Puppe, die sofort beiseite geschoben wird, sobald sie ihren Zweck erfüllt hat. Im Anfang müssen Bahadur und die übrigen Radschas ihr natürlich gehorchen, weil das Volk mehr an dem Mädchen als an ihnen hängen wird; sind die Engländer aber erst zum Lande hinaus, na, dann wird das Götterweib einfach als unbrauchbar zur Seite geworfen, und dann lässt dies das Volk auch ruhig zu, denn das Ziel ist ja erreicht worden. Ist dir unwohl, Mädchen?«
»Ja — nein — die schwüle Luft hier, ich bin etwas eng geschnürt!«
»So lass mich dir behilflich sein.«
»Um zwölf; so lange kann ich es noch aushalten. Wenn nun die Begum nicht geneigt ist, sich nur als Puppe behandeln zu lassen? Wenn sie nun energisch auftritt und unbedingten Gehorsam von allen verlangt, wie man ihn ihr im Anfang entgegengebracht hat?«
»Im Anfang ist das ja auch ganz gut; Bahadur wird ihr selbst wie ein Diener gehorchen.«
»Ja, aber später, wenn, wie Sie sagen, das Ziel erreicht ist und die Begum will allein und selbständig herrschen. Was dann?«
»Hahaha, dann sucht Bahadur einfach einen Grund und lässt sie einen Kopf kürzer machen. Das ist alles nur Humbug, ebenso wie — aber was ist dir nur? Du wirst ja mit einem Male ganz blass! Du siehst so verstört aus!«
»Nichts, nichts — ebenso wie was? Was wollten Sie sagen? Bitte, klären Sie mich in der Politik etwas auf!«
»Ich meinte, ebenso wie das mit uns Franzosen ja nur Humbug ist.«
»Wieso?«
»Nun, sehr einfach! Die Inder suchen Franzosen, ehemalige Militärs, für ihre Sache zu gewinnen, besonders solche, welche bei der Artillerie und bei den Pionieren gestanden haben, denn mit den indischen Offizieren sieht es schlecht aus, und ebenso haben sie von der Belagerungskunst und der Verteidigungstaktik einer Festung keine Ahnung. Aus der französischen Armee dürfen sie sich natürlich keine Offiziere kommen lassen, denn zur Annahme eines solchen Postens gehört ein etwas weites Gewissen. Aber sie haben doch welche bekommen, wie du an uns hier sehen kannst. Man verspricht uns, wenn Indien frei ist, für unsere Dienste Radschawürde, große Besitzungen und so weiter; aber glaubst du, mein Mädchen, wir wären damit zufrieden?«
»Was verlangen Sie sonst?«
»Gar nichts! Hahaha, dass wir Narren wären und so lange warteten, bis es dem Großmogul gefiele, uns aufhängen zu lassen, damit er seine Geschenke wieder einziehen kann. Nein, wir haben dann nichts Eiligeres zu tun, als das freie Indien in die Hände Frankreichs zu spielen. Du weißt doch, es ist der Rivale Englands in Indien, die Franzosen halten sich für die rechtmäßigen Besitzer, sie nennen die Engländer Usurpatoren, und meiner Meinung nach mit vollem Recht! Frankreich wartet nur auf die Gelegenheit, Besitz von Indien ergreifen zu können; schon stehen wir mit bedeutenden Staatsmännern in Verbindung, die unsere Pläne kennen, sie gutheißen und uns unterstützen — zum Teufel, Mädchen, was hast du für Augen im Kopf! Die können ja ordentlich Blitze schießen!«
»Also Sie wollen dann Indien an Frankreich verraten?«
»Natürlich!«, war die offene Antwort. »Wir französischen Offiziere sind über die Stärke der Inder, über ihre Stellungen und so weiter orientiert. Wir brauchen nur zu rufen, so wirft Frankreich seine Truppen ins Land. Anscheinend kämpfen wir anfangs gegen sie, in Wirklichkeit aber liefern wir ihnen alles in die Hände, und dann, Mädchen, dann werden wir eine große Rolle in der Weltgeschichte spielen, dann winken uns Belohnungen und Ehrenposten. Bist du denn schon einmal hier gewesen, Diavolina?«
»Ich? Nein, es ist heute das erste Mal.«
»Warum blickst du immer da hinauf?«
»Es ist nur zufällig. Warum? Ist da etwas Besonderes?«
»Ja, dort ist nämlich das einzige Loch in der Mauer.«
»Man sieht doch gar keins!«
»Der Teppich ist darüber, aber er ist dort ganz dünn, damit die Luft durchdringen kann. Weil du immer hinaufblicktest, glaubte ich, du wärest hier schon bekannt.«
»Nein, ich sah nur, wie sich der Teppich etwas bewegte, das machte mich aufmerksam.«
»Es ist der Luftzug. Trink, schönes Weib! Nur noch zehn Minuten bis zwölf Uhr!«
»Sagen Sie, Monsieur, wie ist Ihr werter Name?«
»Ich habe schon verschiedene Namen geführt. Jetzt heiße ich Duplessis, und das ist mein richtiger.«
»Also, Monsieur Duplessis, Sie erzählen mir diese geheimsten Pläne so ruhig, wie die Begum von Dschansi nur eine Puppe sein soll, wie Sie Indien dann an Frankreich verraten wollen und so fort. Fürchten Sie denn gar nicht, dass ich das alles verraten könnte?«
»Bah, du, eine Französin! Du musst doch sowieso mit uns gleiche Sache machen!«
»So, muss ich? Wenn ich nun hinauseile und anzeige, dass morgen schon ein Aufstand losbrechen soll?«
»Eile nur hinaus, wenn du kannst!«, lachte Duplessis. »Bis morgen bist du meine Gefangene, auf Gnade und Ungnade; doch ich will erstere walten lassen, wenn du zärtlich gegen mich bist. Noch vier Minuten! Umarme mich schon jetzt!«
»Noch vier Minuten, und ich will diese zu einer Frage ausnutzen: Sie sagten vorhin, ein gewisser Monsieur Francoeur sei der höchste der französischen Offiziere in indischen Diensten?«
»Wenigstens einer der ersten mit.«
»Auch er will Indien an Frankreich ausliefern?«
»Wahrscheinlich! Doch funkle mich nicht so mit deinen Augen an, Mädchen, das kann dir doch ganz gleichgültig sein.«
»Natürlich, es ist nur Neugier! Hat er es nicht gesagt?«
»Nein, er gibt sich für einen treuen Freund Indiens aus — aber, aber, Francoeur ist ein Fuchs, er lässt sich nicht in die Karten sehen!«
»Sie sprachen auch von seiner Geliebten. Wer ist das?«
»Eine gewisse Madame Phoebe Dubois, ein kokettes und verführerisches Weib, trotzdem sie nicht mehr ganz jung ist.«
»Seine Geliebte?«, erklang es erstaunt.
»Natürlich, wenn er sie auch für seine Schwester ausgibt. Kennst du sie denn überhaupt?«
»So oberflächlich. Sie beide haben die Begum erzogen?«
»Ich glaube so, und eben deshalb tut Francoeur, als erstrebe er nichts weiter als nur die Freiheit Indiens, und lässt sich auch uns gegenüber nicht im Mindesten anders aus. Wir müssen uns sogar hüten, dass er von unseren ferneren Plänen erfährt, er könnte kurzen Prozess mit uns machen; aber dass er im Herzen ebenso denkt wie wir, davon bin ich völlig überzeugt!«
»Sie sind sehr leichtsinnig, dass Sie mir das alles so ausführlich erzählen.«
Diese Worte waren in einem ganz sonderbaren Tone, halb flüsternd, halb drohend gesprochen, doch Duplessis fiel es nicht auf. Er ergriff das Glas.
»Hoch lebe der Leichtsinn! Noch zwei Minuten, Mädchen, dann gehen wir ein in das Paradies der Liebe! Trink diesen Wein, er zeigt dir den Weg!«
Die Augen fest auf jenen Punkt der Wand gerichtet, wo sich das Ventilationsloch befinden sollte, die rechte Hand auf Duplessis Schulter gelegt, nahm das Mädchen das Glas und wollte es an die Lippen führen.
Da ertönte ein heftiges Klingeln, einmal, zweimal. Alle erschraken und sahen sich an, der Dicke kam halbangekleidet aus dem Boudoir gestürzt.
»Wer mag das sein?«, flüsterte es.
Noch einmal ein heftiges Klingeln, die kleine Versenkung sauste von selbst hinab, sie hob sich wieder, und im nächsten Augenblick stand ein bärtiger Mann mit verstörten Gesichtszügen in dem Saal.
»Francoeur!«, erklang es wie erleichtert von allen Seiten.
»Wo ist Madame Chevaulet?«, rief dieser.
»Hier, hier! Was gibt es denn?«
»Ist hier etwas Besonderes vorgefallen?«
»Nicht das Geringste!«
»Ihr Haus ist umzingelt; bewaffnete Inder halten es förmlich belagert.«
»Was? Ich weiß nicht, warum. Ließ man Sie denn passieren?«
»Ja, und das ist eben das Merkwürdigste. Sollte uns etwa durch Verrat eine Falle gestellt worden sein?«
»Ohne Sorge, es droht Ihnen keine Gefahr!«, sagte da das fremde Mädchen und trat in den Kreis. »Es sind meine Leute, die meines Rufes harren.«
Francoeur hatte nur einen Blick auf das Mädchen geworfen, dann war er, wie von einer Natter gebissen, bis an die Wand zurückgetaumelt und musste sich an einer Stuhllehne festhalten. Seine Augen drängten sich aus den Höhlen.
»Was — was — du — du hier — in dieser — Höhle?« stammelte er entsetzt hervor. Schnell trat das Mädchen noch mehr in den Kreis der Umstehenden, die es jetzt halb erstaunt, halb furchtsam betrachteten, und sagte lächelnd:
»Verzeihung, meine Herren, wenn ich Sie vorhin über meine Person getäuscht habe. Ich bin keine Kellnerin, was Sie mir übrigens hätten ansehen können. Ich bin eine Französin und bekleide in der Verschwörung gegen England selbst einen wichtigen, hervorragenden Posten. Im Übrigen habe ich dieselben Ansichten und Pläne wie Sie, Verrat Ihrer geheimsten Absichten brauchen Sie also nicht zu fürchten. Nun, Monsieur Francoeur, mein treuer Verbündeter, was bringen Sie uns für eine Nachricht? Gut oder schlimm?«
Während dieser Worte hatte das Mädchen ihren durchdringenden Blick unabgewendet auf Francoeur ruhen lassen, der sich wie gebrochen und mit entsetztem Gesicht an der Stuhllehne festklammerte; aber als ob dieser Blick magnetisch gewesen wäre, so richtete der Mann sich Ruck für Ruck wieder auf, und als das Mädchen die direkte Frage an ihn richtete, hatte er sich wieder vollkommen gesammelt.
»Schlimm, sehr schlimm!«, entgegnete er. »Die Briefe, welche die bengalischen Sachen behandeln, sind uns entgangen.«
Auch unter den Herren rief dies Bestürzung hervor, nur das Mädchen blieb ruhig.
»Wie kam das? Ich glaubte, Sie hätten den Faden so fein eingefädelt? Sie zweifelten nicht im Geringsten an dem Gelingen Ihres Planes.«
»Er ist aber nicht gelungen. Beim Überfall auf die Ordonnanz brach plötzlich hinter den Leuten ein alter Mann, den ich sogar kenne, hervor, gut bewaffnet, und es gelang ihm, die Angreifer, alle vier, auf der Stelle niederzumachen. Das Seltsamste ist, dass er sich da versteckt gehalten haben muss, wo die gedungenen Mörder lagen.«
Das Mädchen runzelte die Stirn.
»Allerdings sehr seltsam! Und die Leute? Leben sie noch? Erzählen Sie!«
»Der Mann war ein alter Lancierkorporal und hatte scharf geschossen und gehauen; alle vier haben augenblicklich ihr Leben aufgegeben, wie ich auf dem Wege nach hier erfuhr.«
»Wohlan, so müssen wir uns vorläufig ohne Bengalen behelfen, aber es wird uns hoffentlich nicht im Stiche lassen. Meine Herren«, die Stimme des Mädchens nahm einen befehlenden Ton an, »brechen Sie Ihr Fest ab! Es gibt Arbeit für Sie, nehmen Sie Ihre vom Wein schwankend gemachte Besinnung zusammen. Morgen beginnt das schwere Werk; es gibt noch Vorbereitungen. Monsieur Francoeur, erteilen Sie die Befehle. Madame Chevaulet, ermöglichen Sie uns den Ausgang.«
Francoeur sprach schnell und hastig mit einigen der von diesen Befehlen des Mädchens ganz betroffenen Herren, anderen gab er Papiere, während das Mädchen an das Tischchen ging und mit einem Zug den Wein ausleerte, der ihr vorhin von Duplessis präsentiert und mit dem Namen Diavolina bezeichnet worden war. Sie wusste nicht, welch höllischen Stoff das Glas enthielt.
»Was ist das für ein Weib?«, flüsterte ein Herr Duplessis zu.
»Die Geliebte von Francoeur, denke ich.«
»Madame Dubois? Nein, die kenne ich, die ist es nicht. Aber wer mag es sein? Jedenfalls eine, die eine wichtige Rolle spielt — und sie hat die Diavolina getrunken, die Wirkung möchte ich noch sehen, am liebsten an mir selbst probieren.«
»Auf den Tisch, meine Herren!«, rief die Chevaulet. »Es ist alles bereit.«
Der Tisch senkte sich, bis die Platte mit dem Fußboden in gleicher Höhe war. Das fremde Mädchen trat noch einmal aus Duplessis zu.
»Und Sie, mein Herr«, sagte sie lächelnd, aber es war ein wildes, höhnisches Lächeln, das dem reizenden Gesicht gar nicht stand, »Sie muss ich noch um Entschuldigung bitten, dass ich mein Wort breche. Es tut mir selbst sehr leid.«
»Pardon, ich hatte Sie verkannt!«, murmelte Duplessis.
»Aber seien Sie versichert«, fuhr sie fort, »ich werde Ihnen noch ein Rendezvous gewähren! Verlassen Sie sich darauf, Sie sollen eins haben. Es liegt mir selbst sehr viel daran.«
»Darf ich Sie jetzt begleiten?«
»Nein, meine Leute erwarten mich. Erinnern Sie sich nur meiner Worte: ich werde Ihnen noch ein Rendezvous gewähren. Und dann vergessen Sie die Begum von Dschansi nicht!«
»O, Mademoiselle, ich denke nicht mehr an sie, seitdem ich Sie gesehen habe.«
»Aber ich möchte, dass Sie die Wette gewinnen.«
»Wie, Sie wünschten es?«
»Allerdings! Oder sinkt Ihnen jetzt, da Sie nüchtern werden, der Mut, mit der zukünftigen Königin von Indien anzubinden?«
»Nicht im Geringsten. Wenn Sie wünschen, dass ich einen Triumph feiern soll, so werde ich Ihnen Gelegenheit geben, ihm beizuwohnen. Sie werden sehen, dass die Begum in vier Wochen besiegt zu meinen Füßen liegt und um meine Liebe bettelt.«
»Gut, wir werden sehen! Ich bin gespannt.«
Man trat auf den Tisch, der Hebel wurde von der Wirtin in Bewegung gesetzt.
»Wie ihre Augen schon lüstern funkeln!«, dachte Duplessis, während er in die Tiefe fuhr.
»Die Diavolina beginnt bereits ihre Wirkung. Schade, dass ich nicht bei ihr bleiben kann! Nun, so ist eben ein anderer als ich der Glückliche. Aber wer mag es nur sein?«
Wir verließen die Duchesse und Westerly, als beide vor einem Gespenst flohen, das, einen Feuerbrand durch die Luft schwingend, hinter ihnen herjagte.
Westerly, der Brudermörder, dem schon ein blutendes Mal auf die Stirn gedrückt worden war, glaubte nicht anders in seiner wahnsinnigen Angst, als der Himmel schicke ihm schon jetzt den rächenden Geist, der ihn bis in alle Ewigkeit verfolgen solle. Unaufhaltsam stürmte er weiter, ohne sich um seine Begleiterin zu kümmern.
Der Duchesse Furcht hatte sich bald gelegt; einen Revolver in der Hand, blieb sie einmal stehen und wandte sich um; kaum aber hatte sie die in Felle gehüllte Gestalt mit wallendem Bart und Haar, mit einem Wort, das wandernde Feuer, gesehen, als sie entsetzt mit verdoppelter Eile davonrannte, hinter Westerly her.
Dies war der Mann, an dessen Elend sie schuld war; jetzt glaubte sie sich verfolgt von dem Rächer, der sie zur Verantwortung ziehen wolle.
Nur fort, immer fort! An ihre furchtbare Waffe, an den vergifteten Dolch, dachte sie gar nicht.
Ziellos stürmten sie so dahin, bald geradeaus, bald links, bald rechts, ohne an ein Ende zu kommen — auch sie hatten sich verirrt. Den Weg beleuchtete das ihnen folgende Licht, aber dies ward schwächer und schwächer, bis es ganz verlöschte; die tiefste Dunkelheit umgab beide.
Dennoch raste Westerly weiter, von dem Weibe gefolgt, bis er wuchtig an eine Mauer rannte und stöhnend zu Boden fiel.
Die Duchesse sah sich um. Kein Licht war mehr zu sehen, kein Fußtritt mehr zu hören, und auch das entsetzliche, wimmernde Geschrei war verstummt.
»Mister Westerly«, flüsterte sie und rüttelte den Daliegenden heftig, »leben Sie noch?«
Ein abermaliges Stöhnen bewies, dass der Angerufene sich den Kopf nicht an der Mauer zerschellt hatte.
Das Weib wartete lange, dann schlug es Licht und entzündete eine Kerze. Am Boden lag Westerly, den Kopf mit Blut bedeckt und das Gesicht mit beiden Händen verhüllt.
Nach vielen, vielen Bemühungen gelang es der Duchesse, den Mann wieder zur Besinnung, das heißt zur Vernunft zu bringen, besonders durch die Drohung, sie wolle ihn allein hier zurücklassen, was seinen unrettbaren Tod bedeutet hätte.
In Westerly war noch nicht aller Lebensmut erloschen; nach und nach erholte er sich völlig, und konnte sogar so weit gebracht werden, dass er sich in einer Wasserpfütze das Blut vom Gesicht wusch und sich einen Verband anlegen ließ, ohne in neues Jammern über den Brudermord auszubrechen. Die Duchesse war ihm in allem behilflich.
Während sich beide im Scheine der Kerze beschäftigten, ahnten sie nicht, dass in der Nähe jemand war, der sie beobachtete.
»Und nun«, sagte Westerly, als das Blut gestillt war und er wieder einem Menschen glich, »nun haben wir uns verirrt und sind dem Tode geweiht.«
»Noch nicht; brechen Sie nicht wieder in neues Klagen aus. Ich will zu Ihrer Beruhigung gleich eine Erklärung geben. Der Mensch, welcher uns verfolgte, wird von den Eingeborenen das wandernde Feuer genannt; ich habe ihn der Beschreibung nach erkannt. Er hielt sich bis vor Kurzem in der Nähe von Mirat auf, jetzt scheint er seinen Wohnsitz nach Delhi verlegt zu haben. Weiß der Himmel, wie dieser verwilderte Waldmensch — weiter ist es nichts — sich in diese unterirdischen Gänge verirrt hat. Es wäre mir ein Leichtes gewesen, ihn unschädlich zu machen, Sie aber flohen ja immer weiter. Ich konnte Sie nicht allein lassen, sonst hätten Sie sich verirrt.«
»Wissen Sie denn, wo wir sind?«
»Der Zufall hat uns nach einer Stelle geführt, wo ich bekannt bin. Sie allein wären natürlich verloren. Ich wüsste den Weg von hier auch nach meinem Hause zu finden, doch ich mag nicht riskieren, Ihnen diesen geheimen Weg zu zeigen; ich ziehe vor, mit Ihnen einen anderen Ausgang zu nehmen.«
»Führen Sie mich, wohin Sie wollen, nur fort aus diesen schrecklichen Gängen! Überall, wohin ich sehe, erblicke ich die Leiche meines Bruders. Entsetzlich! Ich habe ihn getötet!«
»Mensch, nun hören Sie endlich auf! Er war ja nur Ihr Halbbruder, noch dazu ein lumpiger Inder! Nehmen Sie nur die Sache nicht gar so tragisch. Lord Canning härmt sich über den Tod seines Dieners Abel auch nicht gleich zu Tode. Hier sind wir schon am Ziel; in fünf Minuten sind Sie auf der Straße. Dann machen Sie, dass Sie nach Hause kommen. Können Sie unbemerkt hinein?«
»Ja«
»So ist alles gut.«
Die Kerze beleuchtete einen Ring an der Wand, den das Weib mit beiden Händen erfasste.
»Wir kommen in ein Haus, dessen Bewohner Sie gut kennen!«, sagte sie dabei. »Haben Sie wohl eine Ahnung, wer es sein mag?«
»Wie sollte ich.«
»Kennen Sie einen Oskar Reihenfels?«
»Was, er wohnte hier?«, rief Westerly bestürzt.
»Direkt hier über uns. Kennen Sie vielleicht eine gewisse Lady Carter? Sie wohnt mit hier; ihrem Hause wollen wir einen Besuch abstatten.«
»Wenn wir aber entdeckt werden!«
»Ohne Sorge, ich kenne mich in dem Hause meiner — von Lady Carter sehr gut aus; ich werde Ihnen sofort den Ausgang zeigen, falls ich noch etwas länger darin verweilen sollte. Die Filzschuhe machen unsere Schritte unhörbar.«
Sie zog kräftig an dem Ring; wie eine Tür drehte sich ein Stein in Angeln, und beide schlüpften durch die Öffnung, welche zu einer Treppe führte. Nachdem die Duchesse den Stein wieder hinter sich herangezogen hatte, begann der Aufstieg, und als am Ende desselben eine Falltür geöffnet worden war, befanden sie sich in einem richtigen Keller, wie sie in den Häusern Delhis zur Aufbewahrung der Lebensmittel angebracht sind.
Hier wusste die Duchesse den Weg auch im Finstern zu finden; sie verlöschte das Licht und zog Westerly mit sich fort. Einmal blieb sie erschrocken stehen; es war ihr gewesen, als hätte sie hinter sich einen leichten Schritt gehört. Sie lauschte, doch alles war still.
»Eine Ratte, nichts weiter!«, flüsterte sie und setzte den Weg fort.
Nach einigen Minuten hatten sie durch Ersteigen einer Treppe einen matt erleuchteten Korridor erreicht.
»Wir sind im Hause Ihrer einstigen Braut«, raunte die Duchesse Westerly zu, »dort ist das Schlafzimmer der Lady. Haben Sie keine Lust, ihr eine Visite abzustatten?«
»Lassen Sie mich hinaus! Nur fort von hier!«
»So werde ich vielleicht an Ihrer Stelle gehen.«
Es war totenstill im Hause; die Wandlampe verbreitete auf dem Korridor nur ein schwaches Dämmerlicht.
Die Duchesse führte ihren Begleiter einige breite, mit Teppichen belegte Stufen hinab, drehte vorsichtig den Schlüssel, der im Haustor steckte, und öffnete es geräuschlos.
»Ihr Besuch war mir sehr angenehm, beehren Sie mich bald wieder!«, sagte sie spöttisch, als wäre sie hier heimisch, und Westerly eilte hinaus.
Die Duchesse hatte noch nicht die Absicht, das Haus zu verlassen, sie wollte wahrscheinlich auch einen anderen Rückweg nehmen, umso mehr, als sie sich ja noch in Männerkleidung befand.
Sie ging auf den Korridor zurück und betrat ohne Zögern ein abseits gelegenes Zimmer, in dem vollkommene Dunkelheit herrschte. Ohne erst zu tasten und ohne irgendwo anzustoßen, bewegte sie sich sicher vorwärts, bis sie an ein Bett kam und einen Arm berührte.
Der Schläfer, oder vielmehr die Schläferin — denn eine solche war es — fuhr auf und hatte den nächtlichen Eindringling trotz der Dunkelheit sofort erkannt.
»Missis«, flüsterte sie, »was befiehlst du?«
»Steh schnell auf, Hedwig, und gib mir einige von deinen Kleidern. Was ist heute Abend hier vorgefallen? Sind die zwei Männer endlich wieder zurück?«
»Noch nicht, Missis!«, entgegnete Hedwig, die eilig der Aufforderung Folge geleistet, ein Licht angezündet hatte und nun der Duchesse beim Aus und Ankleiden behilflich war, ohne zu fragen, wie diese eigentlich in die Männerkleidung kam, oder ohne sich auch nur darüber zu wundern.
»Immer noch nicht? So wäre Reihenfels verschwunden?«
»Bis jetzt wenigstens. Dass Charly halb geblendet worden ist, weißt du. Er erholt sich aber schnell, er hat keine Gefahr zu fürchten, sagte der Arzt.«
»Das ist schade. Was tut er jetzt?«
»Er wird schlafen; Hira Singh ist bei ihm und macht ihm Umschläge.«
»Also er wacht; da muss ich vorsichtig sein.«
»Du darfst die Lady nicht besuchen.«
»Gerade heute nicht, da das ganze Haus fast leer ist?«
»Auch die Lady schläft nicht; sie wartet und hofft, dass es endlich gelungen ist, die beiden zu finden.«
»Wo sucht man sie?«
»Auf dem Friedhof des Humayun.«
»Sie mögen in eins jener tiefen Grabgewölbe gestürzt sein, welche sich dort befinden. Es ist gut, Hedwig! Ich benutze die Tür, nicht den Gang, sonst hätte ich mich nicht erst umzukleiden brauchen; ich habe heute Nacht noch viel vor. Halte nur die Augen offen, Hedwig, die Zeit ist nahe.«
»Und du gehst nicht mehr in das Zimmer der Lady?«
»Wenn sie schläft! Ich muss mich wenigstens erst an ihrem Anblick weiden. Das gibt meinem Hass neue Nahrung.«
Wie eine einfache, indische Frau jetzt gekleidet, den Schleier zurückgeschlagen, schlich sie durch den Korridor, lauschte an einer Tür und legte die Hand auf die Klinke. In der anderen Hand hielt sie den Dolch in der Scheide.
Leise klinkte sie auf.
»Isabel, Ayda, Nana Sahibs Weib, Kindesräuberin!«, donnerte hinter ihr eine Stimme.
Wie vom Blitz getroffen wandte die Duchesse sich um und stand einem Manne gegenüber, der ihr den Revolver entgegenhielt.
Sie erkannte in ihm Reihenfels, den Vermissten.
»Einen Schritt, eine Bewegung, und du bist eine Leiche!«, herrschte er sie an, wohl wissend, mit welch gefährlicher Person, die den Dolch in der Hand zu gebrauchen wusste, er es zu tun hatte.
Da erklang ein Klirren von zerbrechendem Glas, und augenblicklich war es auf dem Korridor dunkel. Die Lampe war zerschlagen worden.
Reihenfels stürzte auf die Stelle zu, wo er das Weib noch eben hatte stehen sehen. Er griff ins Leere, aber er hörte einen laufenden Schritt, wendete sich schnell um und jagte hinterher, der Haustür zu, die eben schmetternd ins Schloss gefallen war. Nur der Dunkelheit hatte er es zu verdanken, dass er dem Stich des vergifteten Dolches entgangen war.

Im Nu hatte er die Haustür erreicht und war im Freien. Dort sah er das Weib laufen, und sofort setzte er ihm mit Aufbietung aller seiner durch die lange Wanderung und die Schlaflosigkeit erschöpften Kräfte nach. Er lief schneller als sie, bald musste er sie eingeholt haben, und er wollte sie nicht wieder entkommen lassen; lebendig aber wollte er sie haben, sonst hätte er sie niederschießen können.
Die Duchesse eilte nicht ihrem gegenüberliegenden Hause zu, was sie ganz sicher verraten hätte; in ihrem Kopfe war sofort ein teuflischer Plan fertig.
Jetzt hatte sie die erste Ecke erreicht. Sie rannte nicht weiter, sondern blieb plötzlich stehen, schmiegte sich dicht an die Wand, hob den vergifteten Dolch und erwartete mit funkelnden Augen den Verfolger, der in jedem Augenblick um die Ecke biegen musste und dann sofort tot zusammengebrochen wäre.
Doch Reihenfels ging nicht in diese Falle; er machte um die Ecke einen großen Bogen und sah das Weib.
»Steh, oder ich schieße!«, rief er. »Du bist erkannt, Isabel, Nana Sahibs Weib!«
Wieder wandte sie sich zur Flucht und rannte zurück; Reihenfels hinter ihr her, den Revolver nur für den äußersten Notfall zum Selbstschutz erhoben.
Isabel fürchtete sich, sich ihm mit dem Dolch gegenüberzustellen; der Revolver bedrohte ihr Leben.
Da hemmte den Straßenweg ein Trupp Menschen, der Kleidung nach Europäer. Isabel zögerte einen Augenblick; doch bald erkannte sie einige der Leute, und eine triumphierende Freude befiel sie. Ohne Überlegen eilte sie auf den Trupp zu. Reihenfels glaubte Engländer vor sich zu haben, die ihm beistehen mussten.
»Haltet sie!«, schrie er. »Es ist Nana Sahibs, des Verräters, Weib!«
Er sah die Duchesse verschwinden und glaubte sie festgenommen. Er hatte den Trupp erreicht und mischte sich unter die Leute, das Weib suchend. Da erhielt er von hinten einen Schlag auf den Kopf, der ihn bewusstlos zu Boden warf.
Als er wieder zu sich kam, war es Nacht um ihn. Er fühlte sich auf feuchtem, vermodertem Stroh liegen, und als er die Hand ausstreckte, berührte sie eine nasskalte Wand.
Zunächst konnte er sich nur unklar entsinnen, was mit ihm eigentlich vorgegangen sei; erst nach und nach wurde es klarer in seinem Kopf, so sehr dieser ihm auch schmerzte.
Er hatte geglaubt, jene Leute wären Engländer, sie würden ihm beistehen und jene festnehmen, die er als die Feindin Englands bezeichnet. Aber er hatte sich getäuscht, es waren Franzosen gewesen, wie er noch an einem Ausruf vernommen, und immer deutlicher kam es Reihenfels zum Bewusstsein, was in Delhi, vielleicht in ganz Indien vor sich ging.
Diese Franzosen machten mit den Indern gemeinsame Sache; es wurde ein abermaliger Aufstand geplant, und Isabel, die Schwester Emilys, der er hier zum ersten Male begegnet war, spielte dabei eine wichtige Rolle.
Isabel hieß als Nana Sahibs Weib Ayda, dieser war unter dem Namen Sirbhanga als Spion in England gewesen, Sirbhanga war...
Reihenfels' Sinne drohten wieder zu schwinden; seine Gedanken vermengten sich wenigstens; sie zauberten ihm unklare Bilder vor, riefen ihm fortwährend allerhand Namen ins Ohr, es drehte sich alles in seinem Kopfe und vor seinen Augen — Isabel, Ayda, Emily, Sirbhanga Brahma, Bahadur, Eugen, Bega, die Duchesse, Lord Canning, Sir Carter, das wandernde Feuer — alles jagte und tanzte an ihm in toller Reihe vorüber; suchte er einen Namen zu haschen und festzuhalten, so wurde dieser von einem anderen verdrängt.
Stöhnend schloss Reihenfels die Augen. Er konnte sich nur noch gestehen, dass das heftigste Fieber in seinen Adern tobte, und dass er dem Hungertode nahe war. Seit vierzig Stunden schon hatte er nicht mehr geschlafen, seit ungefähr dreißig Stunden keine Nahrung mehr zu sich genommen.
Er versuchte, die Zahl der Stunden genau festzustellen, er rechnete und rechnete, die Summen häuften sich zu ungeheuren Zahlen an, weil sie sich verschoben, sie sprangen durcheinander, und doch musste er immer wieder mit dem Rechnen von vorn anfangen.
Er befand sich eben im Zustand des heftigsten Fiebers, und nur der, welcher einen solchen durchgemacht hat, kann wissen, was es heißt, sich Ruhe, todähnliche Ruhe als einzige Linderung herbeizusehnen und doch immer denken und grübeln zu müssen.
Plötzlich wurde Reihenfels von einem entsetzlichen Gefühl gepackt; in seinen Ohren brauste es wie Donnerhall; er glaubte, die Mauern stürzten über ihm zusammen; er wollte aufspringen. Da fühlte er, dass seine Füße mit Ketten an die Wand gefesselt waren.
Ächzend brach er wieder zusammen und verlor abermals das Bewusstsein.
In dem schon mehrmals erwähnten roten Boudoir der Duchesse befanden sich drei Personen. Die Duchesse, also Isabel selbst, Francoeur, und in der kleinen Gestalt mit dem faltigen, gleichgültigen Gesicht erkennen wir das eigentliche Haupt der Verschwörung, Timur Dhar.
Erstere saß auf dem Diwan, sichtlich erschöpft, Francoeur ihr gegenüber; Timur Dhar stand wie gewöhnlich mit übereinander geschlagenen Armen mitten in dem Gemach.
Das Weib hatte eben seine Abenteuer erzählt, sich dabei eines indischen Dialektes bedienend.
Bei dem misslungenen Mordversuch auf Lord Canning, bei der Schilderung von Westerlys ungeschicktem Benehmen hatte Francoeur Zeichen des Ärgers von sich gegeben, Timur war gleichgültig geblieben. Dann folgte ihr letztes Abenteuer mit Reihenfels.
Die beiden Männer waren dabei gewesen, wie der junge Mann in die Hände der von der Orgie kommenden Franzosen gefallen war, Francoeur selbst hatte den Schlag aus den Kopf Reihenfels' geführt.
»Der Bursche weiß mehr, als uns dienlich ist«, murmelte Francoeur.
»Er weiß alles«, rief Isabel heftig; »aber woher? Wie kann er wissen, dass ich Nana Sahibs Weib bin?«
»Ja, woher? Er hat es eben erfahren. Ein Glück, dass uns seine Kenntnis nichts mehr schaden kann. Und hätte er alles erraten und würde es verraten, es käme doch zu spät. Wo ist er jetzt?«
»Ich habe ihn in ein Kellerverlies schaffen und anschließen lassen.«
»Warum nicht gleich getötet?«
»Ich möchte gern noch einmal mit ihm sprechen. Ich bin wirklich neugierig, zu erfahren, woher er seine Kenntnis geschöpft hat.«
»Töte ihn!«, sagte Timur Dhar kurz. Das Weib verneigte sich leicht.
»Wie du befiehlst.«
Sie wollte gehen, doch Timur Dhar hielt sie zurück.
»Weißt du, wie die Begum mit dem jungen Manne steht?«
»Nein.«
»Sie haben sich einst geliebt!«, sagte Francoeur.
»Ah! Dann ist umso mehr Anlass vorhanden, ihn sofort zu töten! Das habe ich noch gar nicht gewusst. Der Verkehr hat doch keine Folgen gehabt?«
»Ich habe zeitig genug dafür gesorgt«, sagte Francoeur, »dass sich die Liebe Begas in Verachtung gegen ihn verwandelt hat.«
»Wer ist Bega?«, fragte der Gaukler scharf.
»Ich meinte die Begum. Darf ich fragen, Timur Dhar, warum sie sich heute Abend unerkannt unter die französischen Offiziere mischte?«
»Nein!«
Das war so kurz gesprochen, dass es jede zweite Frage unmöglich machte. Francoeur biss sich auf die Lippen und wechselte mit Isabel einen Blick, der aber, so flüchtig er auch gewesen, dem scharfen Auge des Gauklers doch nicht entgangen war.
»Die Begum wünschte, die Männer kennen zu lernen, welche unter ihr kämpfen sollen«, fügte Timur Dhar hinzu, vielleicht einsehend, dass sein kurzes Nein einer Entschuldigung bedürfe. »Ich brachte sie selbst hin und wachte über ihre Sicherheit, ohne zu fragen, was sie dort wolle, denn was die Begum will, müssen wir tun, wir haben keinen eigenen Willen mehr. Ayda, bleibe hier! Ich selbst werde des Mannes Tod anordnen.«
Er verließ das Boudoir.
Isabel und Francoeur sahen sich an; Zorn und Entrüstung spiegelte sich in beider Gesichter wider.
Ehe sie jedoch sprachen, traten sie dicht voreinander hin und redeten auch dann nur im leisesten Flüsterton.
»Nun, was meinen Sie zu dem eben Gehörten?«, fragte Francoeur.
»Wir sind die Puppen, die nach der Pfeife tanzen müssen«, stieß Isabel aufgeregt hervor, »und nicht etwa Bega. Wir haben uns ganz gewaltig getäuscht, als wir glaubten, sie würde nur so als ein Popanz für die Engländer aufgestellt werden. Dieser Timur Dhar, dieser elende Barbiergeselle, ist ein Phantast und ein Fanatiker, in dessen Kopfe es von indischen Göttern, Geistern und Kobolden spukt, und ich vermute fast, er selbst glaubt jetzt an Begas göttliche Abstammung. Hahaha, es ist zum Tollwerden!«
»Nicht so laut!«, warnte Francoeur. »Freilich, es ist schlimm, dass wir uns wie dumme Kinder oder wie willenlose Sklaven behandeln lassen müssen, denen nach unsäglichen Mühen nichts weiter als Ruhe und Essen in Aussicht gestellt wird. Aber was sollen wir machen? Vorläufig wenigstens müssen wir aushalten.«
»Ja, und ich werde auch aushalten, denn mir steht noch eine andere Belohnung in Aussicht: die Befriedigung meiner Rache.«
»Aber unsere Aktien fallen. Bega wurde sicherlich von Timur Dhar in die Spelunke der Chevaulet geschickt, um die geheimen Gedanken der französischen Offiziere auszuhorchen, und, obgleich ich noch nicht mit ihnen gesprochen habe, weiß ich doch schon jetzt ganz bestimmt, dass sie in ihrem gewöhnlichen Leichtsinn alles ausgeplaudert haben.«
»Was gehen mich diese Pläne an? Ich habe nichts mit ihnen zu tun; meinetwegen mag Indien frei bleiben oder an Frankreich fallen, wenn ich mich nur gründlich rächen kann.«
»Mich gehen sie desto mehr an. Ich halte es freilich nicht mit den übrigen Offizieren, aber ein Schatten des Verdachtes fällt auch auf mich.«
»Sie sagen, dass Sie anderer Meinung sind als die Übrigen, aber ich glaube Ihnen nicht.«
»Duchesse!«
»Bah, machen Sie mir nichts vor! Ich will Ihnen aber im Vertrauen sagen, dass Sie, dies ist Ihr geheimer Wunsch, dass Sie dennoch in dem Kampfe gegen England eine hervorragende Rolle auf indischer Seite spielen werden, Sie ebenso wie die anderen französischen Offiziere.«
»Und dann?«
»Komische Frage! Sobald Sie nicht mehr gebraucht werden, wird man Sie zur Seite werfen, und ahnt man, dass Sie einen Verrat vorhaben, so heißt es sofort: Kopf ab!«
»So, glaube ich, denken die indischen Fürsten auch ungefähr von der fremden Königin.«
»Natürlich! Bega ist nur das Mittel, durch welches die Radschas Indien befreien wollen; sind sie aber so weit, dann wird man sie schnell beseitigen. Doch Timur Dhar ist der mächtige Fels, an dem die Absicht dieser Radschas scheitern kann, wenn er sich mit Bega verbindet. Nie habe ich einen solchen Mann gesehen wie Timur Dhar; alles gilt ihm nichts, wenn es sich um seine Götter und die Freiheit Indiens handelt, ich habe ihn erst in letzter Zeit richtig kennen gelernt. Sehen Sie, das ist der Unterschied: Bahadur, Nana Sahib und alle anderen Radschas wünschen nur die Freiheit Indiens, um ihre alte Macht zurückzuerlangen, und ist Indien frei, dann fällt der, der sie in ihrer Macht beeinträchtigt, und das wäre eine Königin. Wodurch ist Sewadschi gestürzt worden? Durch die Hinterlist der Radschas, weil jeder selbst ein Souverän, und wäre er noch so klein, sein will. Timur Dhar dagegen ist ein Mann des Volkes, er will nichts weiter, als die Unterdrücker vernichten, Indien frei sehen, und wer dies bewirkt, der ist sein Gott, den betet er an. Bega hat er als befähigt dafür erkannt; sie ist sein Ideal, er hat sich so fest eingeredet, dass sie die Tochter Sewadschis und der Kali sei, dass er selbst an diesen Unsinn glaubt, und nun sagt er Bahadur den Gehorsam auf; Bega allein hat ihm noch zu befehlen. Timur aber hat über das Volk eine Macht, von der Bahadur sich nicht träumen lässt; vielleicht kennt er sie selbst noch nicht einmal völlig. Passen Sie auf! Diese Bega ist das verzogene Kind, dessen kleinster Befehl, und wäre er noch so töricht, vollzogen werden muss, weil die Eltern zu schwach sind, ihm zu widersprechen.«
Als Timur Dhar das Boudoir verlassen, trat ihm sofort eine Gestalt entgegen und wies gebieterisch mit der Hand nach einem entfernten Gemach.
Der Gaukler begab sich ohne Zögern dorthin, und vor ihm stand jenes Mädchen, das wir zuletzt so befehlend im Kreise der französischen Offiziere haben auftreten sehen — es war Bega.
Ihre Augen glühten in loderndem Feuer, eine gewaltige Aufregung schien sich ihrer bemächtigt zu haben. Keinen Augenblick konnte sie sich zur Ruhe zwingen; ihr Busen flog unter dem dünnen, schwarzen Brusttuch.
»Wohin, Timur Dhar?«, fragte sie mit bebender, nervöser Stimme. »Wohin? Ich will es wissen!«, wiederholte sie heftig, als der Gaukler nicht gleich antwortete. »Du willst zu dem Mann, der bei Aydas Verfolgung von den Franzosen niedergeschlagen wurde.«
»Du sagst es.«
»Was willst du von ihm?«
»Er ist unser Feind.«
»Das heißt, du willst ihm die Möglichkeit nehmen, dass er uns verraten kann?«
»Ja.«
»Du willst ihn töten?«
»Er muss sterben!«
»Und ich will es nicht, er soll frei sein. Führe mich zu ihm!«
»Begum, weißt du nicht, wer er ist?«
»Doch, ich kenne ihn, und ich will seinen Tod nicht, er soll, er darf nicht sterben!«
»Er hat deine Ehre beleidigt!«
Das Mädchen wandte sich ab; ein innerer Kampf erschütterte die schlanke Gestalt. Dieser Gaukler wusste alles, was früher geschehen war, und er machte von seiner Kenntnis Gebrauch.
Aber bald drehte sie sich wieder heftig um und schaute ihn mit blitzenden Augen an.
»Und er soll nicht sterben! Führe mich zu ihm!«
»Begum, du bist krank! Aus deinen Augen wie aus deinen Worten spricht das Fieber.«
»Ist dies ein Grund, mir nicht zu gehorchen? Bei wem hast du geschworen, mir unbedingt zu willfahren?«
Der Gaukler verneigte sich.
»Ich gehorche.«
»So führe mich! Ist er gefesselt?«
»Ja.«
»Gib mir die Mittel, ihn zu befreien.«
Der Gaukler händigte ihr einen Schlüssel ein.
»Schwöre mir, sein Leben zu schonen, bis er dir selbst als Feind entgegentritt.«
»Ich schwöre es dir!«, sagte der Gaukler feierlich.
Das Mädchen folgte dem Vorangehenden, der sie in den Kellergang führte. Dort setzte er eine kleine Laterne in Brand, gab sie dem Mädchen und deutete auf eine Tür.
»Dort liegt er. Tu, was du willst! Doch vergiss nicht, dass noch ein Tag uns von dem Anfang trennt!«
Zögernd blieb das Mädchen stehen.
»Gib ihm dies zu trinken«, fuhr der Gaukler fort, ihr ein Fläschchen hinhaltend, »und er wird uns nicht verraten!«
»Gift?«
»Ich werde dem kein Gift geben, den meine Herrin liebt!«
Mit einem Sprunge stand sie wieder vor dem Alten.
»Ich liebe ihn nicht, es ist nicht wahr!«, rief sie heftig. »Ich habe ihn auch nie geliebt, ich hasse ihn, aber er soll nicht sterben, jetzt noch nicht!«
»So geh, ich bleibe hier.«
»Warte draußen, du sollst ihn führen und schützen. Gib den Trank!«, Timur Dhar gehorchte.
Es war Reihenfels, als ob seine brennenden Augen ein Lichtschein träfe; er öffnete sie, er sah eine Gestalt neben sich stehen, doch gleich war es wieder finster. Er glaubte nur im Fiebertraum eine Vision gehabt zu haben.
Doch nein, da fühlte er, wie eine Hand seine Füße berührte, Ketten klirrten, es wurde geschlossen, und dann rasselten abermals die schweren Fesseln.
»Steh auf, wenn du kannst!«, flüsterte eine unterdrückte Stimme.
Reihenfels besaß eine widerstandsfähige Natur, er hatte noch Kraft genug, sich zu erheben. Er glaubte aber nicht anders, als jetzt kämen seine Henker.
»Faringi«, flüsterte wieder neben ihm die ihm unbekannte Stimme, »du bist in den Händen deiner Feinde, du sollst getötet werden, aber ich will dich befreien.«
»Wer bist du?«, fragte er.
»Jemand, der dich hasst!«
»Und du willst mich befreien?«
Es erfolgte keine Antwort. Ein Tuch ward ihm vor die Augen gebunden.
»Du zitterst, du hast Fieber«, flüsterte wieder die Stimme, die ebenso gut einem Manne wie einem Weibe angehören konnte, »trink dies, es wird das Fieber vertreiben.«
Er fühlte eine weithalsige Flasche an seine Lippen gesetzt.
»Es ist Gift, du willst mich töten«, zögerte er.
»Hätte ich dir da erst die Augen verbunden?«
Mit lechzender Zunge trank Reihenfels das kühle, angenehm schmeckende Naß aus; er fühlte förmlich wie seine Kräfte wiederkehrten.
»Jetzt komm!«
Eine Hand fasste die seine. Diese fremde Hand war klein und weich, dabei zitterte sie selbst wie im Fieber und war glühend heiß. Es musste eine Frauenhand sein.
Er wurde einige Schritte geführt, dann blieb die Begleiterin wieder stehen, er fühlte, wie durch ihren Körper ein Schauer ging. Plötzlich schlangen sich zwei weiche Arme um seinen Hals, mit einer solchen Heftigkeit, dass er das Gleichgewicht verlor. Doch er fiel nicht zu Boden, sondern sank nur auf einen bankähnlichen Gegenstand, vielleicht auf eine Kiste.
Ehe er noch wusste, wie ihm geschah, brannten zwei heiße Lippen auf den seinen; wieder und immer wieder küssten sie ihn, er drohte zu ersticken; dabei schmiegte sich ein zarter, zitternder Mädchenleib an den seinen.
Halb betäubt lag Reihenfels da, das Mädchen erdrückte ihn fast mit Liebkosungen. Dann riss sie ihn empor und wollte ihn fortführen, warf sich jedoch abermals an seine Brust und küsste ihn mit leidenschaftlicher Glut und konnte nicht von ihm lassen.

Endlich aber raffte sie sich auf; die eben noch weiche Hand wurde plötzlich hart und Reihenfels wurde mehr fortgerissen als geführt. Kein Wort hatte er vernommen, höchstens ein schwaches Seufzen.
»Führe ihn!«, flüsterte dieselbe Stimme von vorhin.
Eine andere, größere Hand fasste die seine; er wurde weitergeführt, eine lange Strecke. Da erklang hinter ihm ein leiser Schrei.
»Oskar, bleibe bei mir!«, ertönte es, wie aus den tiefsten Tiefen eines sehnsüchtigen Herzens kommend.
Doch mit eiserner Kraft legten sich Finger um die Hand des jungen Mannes, der Zögernde wurde schnell fortgezogen, und der Ruf wiederholte sich nicht wieder.
Jetzt blieb der Führer stehen.
»Du weißt, wo du bist«, sagte eine Männerstimme, »du wirst dein Haus finden, du bist nicht weit davon entfernt. Geh, verfluchter Faringi, und hüte dich, dass deine Wege noch einmal die meinigen kreuzen, es wäre dein Tod!«
Die Binde wurde ihm abgerissen. Reihenfels drehte sich schnell um, doch niemand war mehr zu sehen. Er stand allein in einer ihm bekannten Straße. Es war zwar noch finster, doch die Finsternis begann sich bereits zu lichten, schon ließ sich hier und da das schüchterne Piepsen eines zu früh erwachten Vögelchens vernehmen.
Mit wankenden Schritten eilte Reihenfels davon, seinem Hause zu. Wie Feuer brannte es auf seinen Lippen, er schmeckte noch die Küsse! Ach, er kannte sie ja, die sie ihm gegeben! Aber war das alles nicht nur ein Traum gewesen? Nein, nein, sie hatte ihn ja noch gerufen, und wie sehnsüchtig hatte der Ruf geklungen!
»Ja, Bega, ich komme wieder, und dann bleibe ich bei dir!«, jubelte er auf, und als ob dies ein Signal gewesen sei, so brach überall plötzlich das jubelnde Vogelgezwitscher hervor, welches den anbrechenden Tag begrüßte.
Mit unsagbarer Freude wurde Reihenfels in seinem Hause empfangen; man bestürmte ihn mit Fragen, er wollte erzählen, er sah Jeremy und Charly, dessen Augen rot unterlaufen waren, aber die Kraft versagte ihm, er sank in einen Stuhl und verlangte zu essen.
»Ich muss zum Gouverneur, sofort, nur etwas essen«, wiederholte er immerzu und hörte nicht darauf, dass man ihm sagte, heute sei Shivas Fest, der Gouverneur habe die fremden Radschas zu empfangen und daher keine Zeit für andere.
»Ich muss zu ihm, ich muss ihn sprechen, will nur erst einige Bissen essen«, wiederholte er. Er hörte auch, dass Lord Cannings Diener Abel gestern Nacht plötzlich gestorben sei; man glaube an eine Vergiftung, und seltsam war es, als Reihenfels antwortete.
»Ich weiß, ich weiß, er ist von seinem Bruder ermordet worden, und der Mörder ist auch hier im Hause gewesen.«
Alles ward von der größten Besorgnis ergriffen. Reihenfels war augenscheinlich sehr erkrankt. Seine Augen glänzten unheimlich, seine Pulse flogen, bald starrte er vor sich hin, bald jubelte er wieder auf, und dabei schlang er hastig das Essen hinab.
Als er einmal allein gelassen wurde und man wieder zurückkehrte, lag er schlafend zurückgelehnt im Stuhl, das Messer war der müden Hand entfallen.
Aus Jeremys Erzählung wusste man, welche Strapazen der junge Mann durchgemacht hatte, sodass die übergroße Müdigkeit leicht begreiflich war. Doch Hira Singh schüttelte den Kopf und blieb bei seiner Behauptung, es sei ihm ein narkotisches Mittel, ein Schlaftrunk eingegeben worden.
Man holte den Arzt. Dieser sagte, es sei nur der wohltuende Schlaf, welcher bei einer starken Natur der Überanstrengung folge; die Brust ginge ja regelmäßig; als aber der Fakir bewies, dass der Schlafende selbst gegen tiefe Nadelstiche ganz unempfindlich war, glaubte auch der Doktor an eine Narkose.
Höher und höher stieg die Sonne, und Reihenfels schlief noch immer; seine Züge verklärte ein glückliches Lächeln. Er vernahm nichts von dem Jubel und Jauchzen draußen auf der Straße. Heute wurde ja Shivas Fest, die Neuverjüngung der Erde, von den Indern gefeiert.
Die Sonne neigte sich wieder zur Küste, und noch hatte der Schlafende keine Bewegung gemacht.
Es war gegen Abend, als er endlich mit dem Namen Bega auf den Lippen erwachte. Mit klaren Augen schaute er um sich, verwundert sah er die sein Bett Umstehenden.
»Ich muss zum Gouverneur, jetzt sofort!«, rief er, dieselben Worte, mit denen er eingeschlafen war.
Jede Bitte, sich zu schonen, nützte nichts, Reihenfels bestand darauf.
»Wo ist Hedwig?«, war seine zweite Frage.
»Sie ist diese Nacht aus dem Hause verschwunden.«
»Ich dachte es mir, und nun weiß ich alles.«
»Captain Atkins feiert im Fort Oliver, wo er steht, seinen Geburtstag«, sagte Lady Carter; »er hat uns heute Morgen zur Teilnahme eingeladen. Auch Ihre Familie werden wir dort treffen.«
»Gehen Sie, Lady; mein nächster Weg ist in den Gouvernementspalast zu Lord Canning.«
»Auch dieser findet sich heute Abend bei Atkins ein.«
»So gehe ich mit dorthin. Wo ist Eugen?«
»Er kommandiert die Wache im Turm.«
»Schade, ich hätte ihn als Zeugen gebraucht! Also nach Fort Oliver, es wird die höchste Zeit, dass ich meine Meldung erstatte.«
Ein Wagen brachte Lady Carter und Reihenfels nach dem außerhalb der Mauern Delhis liegenden Fort Oliver, während Charly, August und Hira Singh als Wächter des Hauses zurückblieben.
Sie sollten sich nicht so bald wiedersehen, eine lange, lange Trennung, ausgefüllt mit schrecklichen Tagen stand ihnen bevor.
Shiva ist eine der höchsten Gottheiten der Inder. Der Tag war angebrochen, an dem sein Fest gefeiert werden sollte. Nicht wie sonst durchzogen beim Scheine des Morgenrots nur die Milchträger und die Frucht- und Gemüsehändler der Umgegend die Straßen Delhis, um sich auf dem Marktplatze zum Feilbieten ihrer Waren aufzustellen; heute flutete schon in der ersten Frühstunde eine unzählbare Volksmenge durch die Riesenstadt.
Alles war festlich geschmückt. Jeder, ob Mann, ob Frau oder Kind, hatte wenigstens ein Körbchen mit Blumen am Arm, und wer noch keins hatte, der beeilte sich, seinen Korb von den Wagen zu füllen, die mit Blumen aus der Umgegend in die Stadt gekommen waren.
Heute war ja das Auferstehungsfest der Erde, heute verjüngte sie sich durch ihre eigene, immer wiederkehrende Kraft; der Tag war der Gottheit Shiva geheiligt, alle Ehre galt ihr allein, die schönsten Gaben der Erde, die Blumen, mussten ihr gespendet werden.
Shiva ist nach Brahma und Vischnu der vornehmste Gott der Inder. Er ist der Gott des Feuers, und da dieser im Innern der Erde wie auch in der Sonne die schaffende Kraft ist, ohne welche nichts Lebendiges denkbar ist, so gilt er als der Erhalter der Erde. Aber das Feuer hat auch eine verderbliche Wirkung; entfesselt, kann es alles vernichten, und so besitzt Shiva nach der tiefsinnigen Religion der Inder eine Gattin, welche dem verderbenden Feuer gebietet. Sie heißt Kali, die Zerstörerin, oder Thug, die Tochter des Berges, weil ihr Kultus besonders von den Bewohnern des nördlichen, gebirgigen Teiles Indiens gepflegt wird, oder auch Durga, die Unnahbare.
Shiva bedeutet der Glückliche, aber man weiß eigentlich nicht, warum er diesen Namen führt, denn er lebt mit seiner Gattin in unglücklicher Ehe. Er erzeugt, sie vernichtet, und außerdem besitzt Shiva noch die Eigenschaft, dass er kein Weib nötig hat, denn er ist ein Mannweib, das aus sich selbst ohne fremde Hilfe erzeugt.
Nur in seiner Liebe, mit der er die Erde und alles Lebende umfasst, ist er glücklich; Kali dagegen hasst sein Werk und sucht es zu zerstören.
Als sich Brahma einst in glücklicher Stimmung befand, schuf sein Wort Tilottama, das schönste Weib der Erde. Bei einer Versammlung der Götter ging diese um sie herum, Shiva schaute ihr voll Verwunderung nach, musste also immer den Kopf wenden, und da er dadurch unaufmerksam war, gab ihm Brahma flugs vier Gesichter, sodass er den Kopf nicht mehr zu wenden brauchte.
Deshalb wird Shiva mit vier Gesichtern dargestellt, und zwar mit weißen, während die Kali nur zwei besitzt, entweder schwarz oder rot dargestellt. Ferner besitzt Shiva drei Arme, in jedem Gesicht drei Augen, und sein Symbol ist der Dreizack.
Die fanatischen Inder sterben nicht nur zur Ehre ihrer Götter, um sich dadurch die wahre Seligkeit zu erwerben, sondern sie geben sich auch freiwillig den Tod, damit die Götter sie als ein Opfer annehmen und die übrige Menschheit segnen.
Dieses Opfern für die bösen Dämonen findet man bei allen Religionssekten und Völkern, auch bei den Christen.
Shiva ist der Gott des Feuers; er muss manchmal auch seine verderbende Kraft offenbaren; damit er aber seine Gattin mit dem vernichtenden Feuer möglichst streng im Zaume hält, geben sich die Inder, wenn sie vom Fanatismus befallen werden, selbst den Tod. Sie stoßen sich vor seinem Bilde den Dolch ins Herz, oder lassen sich von den Rädern seines Wagens zermalmen.
So war vorauszusehen, dass sich auch heute in den Straßen Delhis noch manches blutige Schauspiel abspielen würde. Mancher dieser jetzt lachenden und scherzenden braunen Männer war nach wenigen Stunden vielleicht zu Brei zermalmt, ja, selbst die vornehmen, mit Juwelen geschmückten Weiber, welche auf den Dächern der Häuser das Schauspiel erwarteten, stürzten sich von oben herab, und die massiv steinernen Räder des Götterwagens zermalmen die Knochen und die Diamanten zu Staub.
So kam es, dass an diesem Tage im Jahre eine gewisse schwermütige Stimmung herrschte. Hier und da lehnte eine Gestalt an der Häusermauer, brütete vor sich hin oder murmelte unter Verzückungen Gebete.
Auch hagere, oft zu Gerippen ausgetrocknete Fakire, in Lumpen gekleidet, mit Gebrechen behaftet, drängten sich durch die Menge, flüsterten mit diesem und jenem, ermahnten wahrscheinlich zum Gebet oder zum freiwilligen Opfertod.
Folgen wir einmal solch einer unheimlichen Gestalt und beobachten sie.
Der Mann hat als Kleid nur einen Sack an; in den knöchernen Fingern schüttelt er einen großen Beutel mit kleinen Glasperlen. Blickt man hinein, so sieht man nur weiße, höchst selten einmal eine schwarze. Der Sack mag Hunderttausende solcher Perlen enthalten.
»Wen betest du heute an?«, flüstert er einem fröhlich blickenden Manne zu.
»Wen anders dürfte ich heute verehren, als Shiva?«, antwortet der Gefragte laut.
»Wohl dir, er wird dir gnädig sein, wenn du für ihn stirbst«, entgegnet der Fakir und wendet ihm den Rücken.
»Wen betest du heute an?«, fragt er einen anderen, einen unter der Last des Alters gebückten Mann.
»Kalis Tochter«, ist die ebenso leise Antwort.
»Hast du schon gewählt?«
Der Greis verneint. Der Fakir ruft:
»So wähle jetzt.«
Der Greis zieht eine weiße Kugel.
Dann tritt der Fakir auf einen Jüngling zu. Der Alte hält diesem den offenen Beutel vor.
Der Jüngling zögert, hineinzugreifen, als enthielte der Beutel sein Todeslos, und so war es ja auch.
»Wie viel?«, fragt der Jüngling gedrückt.
»Auf fünftausend weiße eine schwarze.«
Jetzt greift er schnell hinein und nimmt eine Perle — es ist eine schwarze. Der Jüngling entfärbt sich, seine hohe Gestalt sinkt zusammen.
»Ich will nicht sterben«, murmelt er.
»Du musst!«, herrscht der Fakir ihn mit gedämpfter Stimme an.
»Ja, auf dem Schlachtfelde, doch nicht unter den Rädern. Ich will kämpfen.«
»Du musst dich opfern, oder sei verflucht in alle Ewigkeit! Die Weiber sollen dir ins Gesicht speien und die Mädchen Indiens dich, den elenden Feigling, den Hunden zum Fraß vorwerfen.«
Jener Greis mit der weißen Perle ist dem Fakir gefolgt und hat, wenn er auch keins der geflüsterten Worte verstanden, so doch aus dem Schrecken des Jünglings gesehen, dass dieser eine schwarze Perle gezogen hat und nun über sein Los unglücklich ist. Er stellt sich zwischen beide.
»Kalis Tochter braucht junge, starke Männer«, sagt er; »sieh, mein Nacken ist vor Alter gekrümmt, meine welken Arme sind schwach, und meine Knie zittern. Lass uns tauschen, heiliger Mann.«
Der Fakir willigt sofort ein, der Jüngling empfängt vom Alten die weiße, dieser von ihm die schwarze Perle, und er geht erhobenen Hauptes davon.
»Was teilst du da aus?«, fragt den Fakir ein indischer Polizist mit strenger Amtsmiene.
»Ich teile Perlen aus, wie du siehst.«
Er zeigt ihm den Inhalt des Beutels.
»Du teilst Todeslose aus, das ist nicht erlaubt.«
»Deine Zunge spricht Lügen, es findet eine Volkszählung statt. Wo siehst du andere als weiße Perlen?«
Der Polizist wühlt in dem Beutel, kann aber wirklich keine andersfarbige Perle sehen. Er muss sich zufrieden geben.
Der Fakir entfernt sich schnell; sofort aber schließt sich ein anderer Mann dem Polizisten an, beobachtet ihn unausgesetzt und gibt geheime Fingerzeichen nach rechts und links.
Auf einem niedrigen Balkon sitzt eine ganze indische Familie, reich gekleidet, die Frauen und Mädchen mit kostbarem Schmuck überreichlich behängt. Der Vater beschäftigt auf den Feldern Tausende von ihm willenlos ergebenen Kulis, und wie ein Sklaventreiber sieht er aus — ein starres, hartes Gesicht mit buschigen Augenbrauen und finsterem Blick. Wie lieblich und reizend ist dagegen seine jüngste Tochter, ein Mädchen von vierzehn Jahren! Zu ihrem festlichen Kleide passt das Gesicht, es strahlt vor Erwartung der kommenden Dinge; der Glanz ihrer schwarzen Augen verdunkelt den Diamantschmuck, der den biegsamen, bräunlichen Hals umschließt.
»Wen betet Ihr heute an?«, klingt es leise von unten herauf. Das Familienoberhaupt neigt sich über die Brüstung.
»Kalis Tochter!«, tönt es ebenso leise zurück. »Gib mir den Beutel!«
Er lässt sein Weib, seine starken Söhne und schönen Töchter selbst die Perlen ziehen. Die jüngste erhält eine schwarze.
»Vater!«, kommt es klagend über ihre Lippen. sie will die Perle wieder hineinwerfen, die bittenden Blicke der Mutter und Geschwister unterstützen ihren Wunsch, doch schon hat der Vater der Beutel zurückgegeben.
»Geh zu den Mädchen und lasse dich mit dem Besten schmücken, was du hast, sagt er hart. Tränen entstürzen den Augen der eben noch so fröhlichen Tochter, aber sie gehorcht, sie lässt sich wie eine Braut kleiden, um dann unter den Rädern des Götterwagens zermalmt zu werden.
So fand in Delhi, welches heute über drei Millionen von überallher zusammengeströmten Menschen fasste, ein geheimes Treiben statt, das man nicht nur den Augen der Polizei, sondern auch derer zu verbergen wusste, welche nicht das Stichwort geben konnten, und dieses hieß: ›Kalis Tochter bete ich an.‹
Aber nur wenige waren es, welche es nicht wussten, und das waren meistenteils Frauen und Kinder.
Trotz allem herrschte neben der fröhlichen Stimmung gar nicht zugleich jene gedrückte derjenigen, welche ihren Opfertod beschlossen hatten, das unheimliche Murmeln von zahllosen Gebeten fehlte ganz, alles war Jauchzen und Jubeln.
Das fiel auch Lord Canning auf, der auf dem Dach eines Seitengebäudes des Gouvernements-Palastes stand, umgeben von einigen höheren Offizieren und Beamten, und einem aus Europa zum ersten Male hier anwesenden Gast den Grund und die Eigentümlichkeiten von Shivas Fest erklärte.
»Ich habe schon so mancher derartigen Feier beigewohnt«, sagte er, »aber solche Vorbereitungen noch nie bemerkt. Ich glaube, meilenweit um Delhi steht keine einzige Blume mehr. Und auch die Stimmung ist heute eine ganz auffällige, die Todesahnung herrscht gar nicht vor. Es muss etwas ganz Besonderes vorliegen.«
»Vielleicht so eine Art von tausend- oder hundertjähriger Wiederholungsfeier?«, fragte der Gast.
»Dass ich nicht wüsste! Ich bin in der indischen Mythologie bewandert wie ein Brahmane, aber mir ist dergleichen nicht bekannt. Ja«, fügte er leiser hinzu, »wenn diese Inder wüssten, was heute für ein Tag ist, sie würden wohl nicht so fröhlich sein.«
»Was meinen Sie?«
»Heute vor hundert Jahren war die Schlacht bei Plassy, die Engländer siegten und hatten damit in Indien festen Fuß gefasst.«
»Und das sollten die Eingeborenen nicht wissen?«
»Die Erfahrenen wohl, doch sie denken in der Feststimmung nicht daran. In der Tat, ein großartiges Fest, schon diese Vorbereitungen allein! Wie das duftet, diese Blumenpracht, dieses Funkeln der Diamanten, aber, aber — auch diese tragischen Szenen!«
»Wenn sich dann die Einzelnen unter die Räder werfen?«
»Einzelne? Um Gottes willen, Tausende, ganze Reihen gleichzeitig, ganze Familien springen von den Balkons herab, und über sie alle hinweg gehen unbarmherzig die steinernen Räder. Die Gräben an den Seiten der Straßen sind mit Blut gefüllt, es dampft zum Himmel, und ein Geruch herrscht wie in einer Fleischerei. Haben Sie starke Nerven?«
»Wenn es mir zu schlimm wird, entferne ich mich.«
»Es wäre schade, wenn Sie den Anblick nicht ertragen könnten. Hinter Shivas Wagen nämlich folgen die Maharadschas und Radschas Indiens, an der Spitze der Großmogul, und eine solche Pracht bekommen Sie in ihrem ganzen Leben nicht wieder zu sehen. Die Fürsten tragen Rüstungen, die aus Diamanten zusammengesetzt sind, Kopfreife, an denen sich Edelsteine so groß wie Hühner- und Enteneier befinden und selbst die Pferde sind ganz mit Juwelen bedeckt. Das Auge kann den Anblick gar nicht ertragen, wenn die Sonne darauf scheint. Ein solch kleiner Radscha trägt manchmal an seinem Körper mehr Schmuck, als alle europäischen Fürsten zusammen in ihren Schatzkammern haben.«
»Ich denke, auch der Wagen Kalis wird vorbeigefahren?«
»Der kommt erst hinter den Radschas, ihm schließen sich die Brahmanen und Fakire an, sie bilden den Schluss des Zuges. Die Kali wird nicht besonders geachtet, wenigstens heute nicht, denn es opfern sich ja so viele selbst ihrem Gatten, dem Shiva, und der ist der Herr im Hause, ihm gilt heute die Ehre.«
»Wer ist denn dort dieses phantastisch gekleidete Mädchen?«, fragte der Gast. »Es ist eine reizende Erscheinung, dieses unschuldige Gesicht. Aber sie scheint keine festliche Stimmung zu haben, sie sieht so niedergeschlagen aus.«
An einem Steinpfeiler lehnte die Bezeichnete und hörte einem Fakir zu, der eindringlich auf sie einsprach. Sie war phantastisch kostümiert, trug überhaupt keinen Rock, sondern nur weite, blauseidene Pantalons und ein schwarzes Mieder, unter dem das rote Hemd die Brust verhüllte, die Arme aber frei ließ. Das lange, schwarze Haar war mit vielen Goldmünzen behangen, ebenso der Busen, und um Hand- und Fußgelenke trug sie viele dünne Spangen aus edlem Metall.
»Es ist eine Bajadere«, sagte Lord Canning.
»Wie? Dies unschuldige, kindliche Gesicht soll einem solchen gesunkenen Geschöpf angehören?«
»O, nicht doch! Bajadere und Bajadere ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die eigentlichen Bajaderen sind die Tempeltänzerinnen, sie sind selbst Priesterinnen, müssen die Töchter unbescholtener Familien, fehlerlos gebaut sein und das Gelübde der Keuschheit für Zeit ihres Lebens ablegen. Jetzt rekrutieren sie sich nur noch aus den vornehmsten Familien, viele sind Radschastöchter. Ihr einsames, asketisches Leben macht sie scheu und ernst wie Nonnen; nur beim Tanzen bricht ihre südliche Glut mit unbändiger Wildheit durch, aber diesen zu schauen ist unserem Auge nur in Ausnahmefällen gestattet. Die Markttänzerinnen, feile Dirnen, haben nur den Namen Bajadere akzeptiert, oder vielmehr, wir Europäer nennen sie so, mit jenen sind sie gar nicht zu verwechseln. Diese dort ist auf jeden Fall eine Tempeltänzerin, einmal ihrem Wesen nach, außerdem spricht ein heiliger Fakir mit ihr, und dann sehen Sie auch, wie sich das Volk ehrerbietig von ihr zurückhält. Solch eine Bajadere genießt große Hochachtung; kommt sie aber auch nur in den Verdacht, ihr Gelübde gebrochen zu haben, dann wartet ihrer ein entsetzliches Los. Doch die Menge drängt zur Seite, der Zug muss bald kommen.«
Es verging noch eine Stunde. Dann kam eine Bewegung in das Volk, es stieß sich und drängte sich an die Häuserwand, sodass die Straße frei wurde. »Er kommt!«, ging es von Mund zu Mund. In der Ferne vernahm man schon Schreien und Jauchzen.
Jetzt bog um die Ecke ein Elefant, ihm zur Seite ein zweiter, dann noch ein Paar, das Volk begann zu schreien und zu jubeln, die Hände wurden geschwenkt, man griff in die gefüllten Blumenkörbe.
Von vier mächtigen Elefanten an Stahlketten gezogen, kam um die Ecke ein riesiger Wagen, auf steinernen Rädern von etwa vier Meter Breite ruhend. Auf ihm stand die Kolossalstatue Shivas mit seinen vier Gesichtern, zwölf Augen und drei Armen. Die Züge waren schön, aber Ohren, Nase und Mund zu groß. Die Figur war von Brahmanen umringt. Die nachfolgenden Radschas, von denen Lord Canning gesprochen, konnte man noch nicht sehen.
Es ging heute überhaupt ganz anders zu als sonst bei diesem Feste.
Zwischen dem letzten Paare der Elefanten und den Wagenrädern war eine Entfernung von zehn Metern. Sonst warfen sich die Inder massenweise unter die Räder und ließen sich ohne Schmerzensschrei zermalmen, heute nicht. Wohl waren die Räder schon von Blut gerötet und zeigten daran klebende Fleischteile, aber das war nichts gegen sonst, wo die Räder eine breiige Spur zurückließen, aus der das Blut nach beiden Seiten der Straße abfloss.
Ab und zu wurde wohl ein Inder vom Fanatismus erfasst und stürzte sich unter die Räder, wohl warf sich auch jemand vom Balkon eines Hauses herab, aber was waren diese Einzelnen gegen die sonstigen Massen?
Und merkwürdig verhielt sich die Menge!
Sie jauchzte zwar, als würde sie dazu gezwungen, sie winkte der Statue zu, doch sie übergoss sie nicht, wie sonst, mit einem Blumenregen. Nur wenige Hände voll Blüten fielen auf sie herab, die Körbe blieben noch bis zum Rande gefüllt.
»Merkwürdig, äußerst merkwürdig!«, sagte Lord Canning zu seinem Gaste, nachdem er schon mit seinen Beamten verwunderte Worte gewechselt hatte. »Ich kann mir diese Teilnahmslosigkeit gar nicht erklären. Es scheint fast, als würde heute nicht das Fest Shivas, sondern das eines anderen Gottes gefeiert, und doch ist es sein Tag. Man spart die Blumen und Menschenopfer offenbar für etwas anderes auf.«
»Vielleicht für die Kali?«
»Möglich! Auch sie fährt auf einem schweren Wagen; aber es wäre das erste Mal, dass ihr am Tage Menschenopfer freiwillig in größerem Maße dargebracht würden. Nein, nein, es muss ein ganz besonderer Grund vorliegen.«
»Können Sie als Generalgouverneur ihn denn nicht erfahren?«
»Heute besitze ich fast gar keine Macht, heute ist der armseligste Fakir gegen mich ein König zu nennen. Überdies habe ich meine indischen Beamten, die mich benachrichtigen, wenn das Besondere beunruhigend für die Sicherheit sein sollte. Aber wo in aller Welt bleibt nur der prächtige Reiterzug der Radschas?«
Sie kamen nicht; dem Wagen Shivas schlossen sich vielmehr armgekleidete Brahmanen und dürftige Gestalten von Fakiren an. Überdies erfolgten, wie schon erwähnt, doch ab und zu freiwillige Menschenopfer, und mit Schaudern und Entsetzen sah der Gast, wie über die zuckenden Glieder die schweren Räder gingen.
Es waren meist alte Männer oder Weiber, die sich opferten, was Lord Canning wieder als sehr merkwürdig erklärte. Ganz wunderbar sei es, dass die Fakire sich so zurückhielten, die sich sonst scharenweise unter die Räder würfen.
Der Gast sah, wie sich von einem Balkon aus der Mitte ihrer Familie ein junges, schönes Mädchen herabwarf, bräutlich geschmückt, mit Juwelengeschmeide behangen. Er schloss die Augen, um das Mädchen nicht sterben zu sehen. Der Vater sah dem Tode seiner Tochter mit kalter, unbeweglicher Miene zu.
Da ereignete sich eine aufregende Szene.
Eine Bajadere hatte bis jetzt mit dem Fakir gesprochen. Derselbe deutete nach dem Wagen, und mit gesenktem Kopfe stellte sich das phantastisch geschmückte Mädchen mitten auf die Straße, den Wagen erwartend.
Links und rechts schritten die Elefanten an ihr vorüber, näher und näher rollten die von Blut tropfenden Räder heran. Das Mädchen hob den Kopf, ihre Züge drückten Verzweiflung aus.
Jetzt berührten die Räder ihr Gewand, im nächsten Augenblicke mussten sie über das Mädchen hinweggehen.
Da stieß die Bajadere einen gellenden Schrei aus, in dem Angst und Verzweiflung lagen, und flüchtete im letzten Augenblicke aus dem Bereiche der Räder.

Doch sofort hatte der Fakir sie gepackt und schleuderte sie wieder mit kräftigem Ruck vor die Räder. Sie kam zum Stürzen, sie war verloren. Ein furchtbarer Schrei durchzitterte die Luft.
»O weh, das arme Kind stirbt nicht freiwillig! Sie wird von ihrem Priesterorden geopfert!«, rief Lord Canning schmerzerfüllt und wollte sich abwenden, um ihren Tod nicht zu sehen.
Aber es kam anders.
Von dem hohen Balkon eines Hauses herab sauste eine dunkle Gestalt, ein Mann; er stand dicht vor den Rädern, ein Griff, ein Sprung, und er war außer dem Bereich des zermalmenden Wagens, die Bajadere in seinen Armen haltend. Der Mann, ein reich gekleideter Inder, war von riesigem, herkulischem Wuchse, das Mädchen auf seinen Armen nahm sich ihm gegenüber wie eine Puppe aus.
Keine Beifallsrufe lohnten diese kühne Rettungstat, ausgeführt mit der größten Kraft, Gewandtheit und Todesverachtung, ein Sturm der Entrüstung brach vielmehr gegen den Inder los, der es gewagt hatte, Shiva ein Opfer zu entreißen.
Mit wütendem Geschrei drang der Fakir auf ihn ein, ihm nach die nächsten Umstehenden.
»Zurück, wenn euch euer Leben lieb ist!«, donnerte des Riesen mächtige Stimme.
Man achtete jedoch nicht auf seine Drohung, man wollte die Bajadere wiederhaben und sie sterben sehen.
Da schleuderte er den Fakir gegen die auf ihn Eindrängenden; im Nu flogen ein halb Dutzend Menschen von seinem einen Arm durch die Luft, einer immer gegen den anderen; er brach sich Bahn und verschwand mit seiner schönen Bürde in dem Hause, von dessen Balkon er gesprungen war.
Allem Anschein nach wollte die Volksmenge dieses sofort stürmen, die Bajadere zurückholen und den Frevler an der Religion bestrafen, doch in diesem Augenblick ertönte in der Ferne ein unendliches, donnerndes Jubelgeschrei, und sofort hatte man alles andere vergessen. Aller Blicke richteten sich die Straße hinauf, von wo das Getöse erscholl und sich immer weiter und weiter fortpflanzte.
Lord Cannings Gast aber beschäftigte sich noch mit der eben gesehenen Szene, die ihn mächtig ergriffen hatte.
»Wer war dieser heldenmütige Mann? Kennen Sie ihn, Mylord?«
»Sogar sehr gut! Wenn die wackere Tat nur nicht schlimme Folgen für ihn hat«, entgegnete Canning besorgt. »Es war Leutnant Dollamore, einer der ersten Stützen der englischen Herrschaft in Indien, obgleich er sich dessen wohl selbst kaum bewusst ist. Es schadet dies auch gar nichts. Einmal ist sein Vater ein indischer Nabob, dessen ungeheurer Reichtum eine kolossale Macht bildet, und dann ist er selbst der Befehlshaber über die Gurkhas, das heißt nicht der Captain, sondern er ist nur Leutnant; doch käme es darauf an, so würden die Gurkhas nur seinem Befehle gehorchen, denn Dollamore ist der Abgott dieser tollkühnen Stahlreiter.«
»Aber wie kommt es, dass er, ein Inder, den religiösen Kultus verletzt? Ist er kein Buddhist?«
»Er ist zwar ein gläubiger Buddhist, doch den niedrigen Aberglauben, den Fanatismus verachtet er. Er kann sich durch sein heutiges Eingreifen viele schlimme Feinde erworben haben; die Macht der Fakire ist nicht zu unterschätzen. Sie wissen doch, wie behutsam auch wir die Inder in allem behandeln müssen, was ihre Religion betrifft. Sehen Sie nur den Fakir, wie er um das Haus hinkt und welch wütende Blicke er hinauf sendet!«
Sie mussten das Gespräch abbrechen, denn der Jubel der Menge verstieg sich jetzt bis zum unglaublichsten Geheul. Die Ehre galt also heute nicht Shiva, sondern seiner Gattin, der Kali. Aber warum nur?
Eben bog der Zug um die Ecke: Seltsam! Was war den Indern heute eingefallen? Lord Canning und alle anderen Engländer, die schon diesem Feste beigewohnt hatten und seinen Verlauf kannten, glaubten ihren Augen nicht mehr trauen zu dürfen.
Um die Ecke bog nicht der erwartete Wagen, sondern wurde eine große Bahre getragen, auf der eine mit Tüchern verhüllte Figur von Menschengröße stand. Die Bahre ruhte auf riesig langen Stangen, welche von fünfzig bis sechzig Männern getragen wurde, und sonderbar war es, dass ihre Last äußerst schwer zu sein schien. Selbst wenn die Figur aus Bronze und die Platte aus Eisen war, konnte beides für diese sechzig Männer doch nicht so schwer sein.
Der Bahre voran schritt ein alter Mann mit weißem Bart- und Kopfhaar, dürftig wie ein Bettler gekleidet, ohne Kopfbedeckung und Schuhe. Schon von Weitem konnte man sehen, dass sich um seinen Körper ein Seil schlang, welches wie ein Zügel bis hinauf zu der Figur führte.
Es gab keinen Zweifel mehr, der unermessliche Jubel, die Zurufe galten der verhüllten Figur; ein wahrer Blumenregen strömte ununterbrochen auf sie herab; aber nicht nur das, die auf den Balkonen und Dächern sitzenden Inderinnen rissen ihr Juwelengeschmeide von Hals und Brust, aus den Ohren und von den Gelenken und warfen es auf die Bahre. Jetzt konnte man auch schon erkennen, wodurch die Bahre so ungeheuer schwer ward, dass die Träger unter ihr keuchten. Um sie herum zog sich ein Drahtgitter und durch dasselbe bis hinauf zum Rand konnte man Unmassen von Diamanten und anderen Edelsteinen liegen sehen, teils lose, teils gefasst, teils Griffe von Schwertern und Dolchen, ja, ganze Rüstungen, und immer mehr Geschmeide wurde hinzu geworfen, und immer höher häufte sich der Schatz, in dem schon der Wert von Milliarden steckte.
»Wenn Indien selbstständig einen Krieg führen wollte«, meinte der Gast, »eine unerschöpfliche Kriegskasse wäre vorhanden.«
Lord Canning betrachtete kopfschüttelnd den sich vorbeibewegenden Zug.
»Hilf, Himmel«, rief er plötzlich in namenlosem Erstaunen, »der alte Mann da vorn in Lumpen ist ja niemand anders als Bahadur, der Großmogul, selbst! Er lässt sich wie ein Sklave an der Kette führen! Und diese Träger, es sind die Radschas Indiens, wie Bettler angezogen, der erste vorn an der linken Stange ist der stolze Nana Sahib. Meine Herren, wer kann das Rätsel lösen?«
Niemand vermochte es. Auf der Plattform des Daches befanden sich einige indische Beamte in englischen Diensten, auch sie waren vor Staunen sprachlos.
Der Großmogul, die Maharadschas und die Radschas, sonst maßlos stolz, zogen in der dürftigsten Kleidung und barfuß durch den Staub der Straße; sie trugen selbst das Standbild der Göttin, während sie sonst in prächtigen Rüstungen hoch zu Ross nachfolgten und die Huldigungen der Menge gnädig dankend empfingen.
Bahadur, der stolze Bahadur, ging wie ein Zugtier am Zügel voran. Dieser endete und verschwand da in den Gewändern der Figur, wo sich die Hände befinden mussten.
»Ich stellte mir die Figur viel größer vor«, meinte der Gast, »und ich glaubte auch, sie würde offen gezeigt.«
»Das wird sie sonst auch. Es ist ein Weib von riesigen Dimensionen und muss gefahren werden. Sonst achtet man sie auch am heutigen Tage wenig, heute aber gilt alle Ehre ihr. Shiva ist ebenso wenig beachtet worden wie die Radschas.
»Es ist keine Bronzefigur«, rief ein Herr, »es muss ein Mensch sein! Ich habe sie sich bewegen sehen.«
»Die Kali sollte von einem Menschen dargestellt werden? Nicht möglich«, erklang es überall erstaunt, »die Bahre schwankte, Sie haben sich getäuscht!«
»Ich habe mich nicht getäuscht. Ich sah deutlich, wie sich da, wo sich die Hände befinden müssen, das Tuch bewegte. Es war, als griffen Hände nach dem entfallenden Zügel.«
»Das Ansehen der Kali würde entehrt, wenn man einen Menschen an ihrer Stelle zeigte«, meinte Lord Canning. »Aber wiederum, warum nimmt man eine kleinere Figur, als sonst, gerade heute zum Feste? Und warum wird sie nicht offen gezeigt?«
Er wendete sich wieder an seinen Gast.
»Ich erwarte die Radschas nach dem Mittagsmahl, welches sie im Palast des Großmoguls einnehmen, bei mir; denn es ist Sitte, dass sie heute, da sie ihre Götter verehren, durch mich auch der Königin von England ihre Ehrfurcht bezeugen. Konnten Sie die Radschas also jetzt nicht in ihrer ganzen Herrlichkeit bewundern, so werden Sie nachher Gelegenheit dazu haben, denn im Gouvernementspalast werden sie sicher nicht als Bettler erscheinen. Diese Herren prunken uns gegenüber gern mit ihrem Reichtum; es ist ja auch das einzige, was man ihnen gelassen hat.«
Die Bahre mit der Figur, auf welche es noch immer Blumen- und Juwelenschmuck herabregnete, war vorüber, gefolgt von einer Anzahl Brahmanen und Fakire. Die Herren wollten sich ins Innere des Hauses begeben, als eine andere Szene ihre Aufmerksamkeit fesselte.
Es schien, als solle die Rettung der Bajadere vor den Rädern des Götterwagens noch ein tragisches Nachspiel haben.
Eine große, dichtgedrängte Volksmenge hielt das Haus umlagert, in dem sich Dollamore mit dem Mädchen aufhielt, und forderte unter wütendem Geschrei und Drohungen die Herausgabe der Tänzerin.
Es blieb nicht allein bei Drohungen. Als sich das Haustor nicht öffnete, traf man alle Vorbereitungen zum Sturm. Das Tor war massiv eisern, aber dem herbei geschleppten, mächtigen Balken konnte es, wenn er wie ein Sturmwidder von hundert Händen geschwungen wurde, wohl nicht lange standhalten. Dann ergoss sich der aufgeregte Schwarm ins Innere, holte sich das Mädchen mit Gewalt heraus, und es stand zu erwarten, dass dabei das Blut der Bewohner des Hauses floss.
Das Gebäude war groß und nach europäischem Stile gebaut; an jedem Fenster befand sich ein Balkon, und die vier Flügel umschlossen einen geräumigen Hof mit Pferdeställen und Wagenremisen.
Es gehörte einem Engländer, dessen schon einmal Erwähnung getan wurde. Er war jener Mann, der Westerly als Geschenk den vergifteten Dolch geschickt, er hatte die Schwester Dollamores geheiratet, und dieser hatte jetzt seinen Schwager, Mister Morny, und alle Bewohner des Hauses in eine äußerst unangenehme Lage gebracht.
Der heißblütige Inder war nicht gewillt, die dem Tode geweihte Bajadere der Menge auszuliefern, denn sie wäre noch jetzt unter die Räder des Götterwagens geworfen worden. Und auch alle Übrigen, die ein gefühlvolles Herz in der Brust hatten, konnten sich nicht entschließen, ihm zum Nachgeben zuzureden, um so weniger, als das Mädchen selbst den schrecklichen Tod fürchtete.
Sie saß in eine Ecke gekauert und ließ die großen Augen angstvoll von einem zum andern wandern; besonders lange blieben sie dann an der herkulischen Figur Dollamores hängen. Alles an ihr drückte Furcht aus.
»Nicht wahr, du wolltest nicht freiwillig sterben, du bist nur dazu gezwungen worden?«, fragte Dollamores Schwester, eine schöne, junonische Inderin, die Bajadere.
»Ich musste sterben, ich hatte das Los gezogen!«, entgegnete ihre klangvolle, jetzt so klagende Stimme, und dabei ruhten ihre glänzenden Augen mit unsagbar traurigem Ausdruck auf ihrem Retter.
»Sie wollen stürmen, sie bringen einen Sturmbock herbei!«, rief Mister Morny am Fenster. Im Hause entstand hastiges Laufen, Angstrufe erschollen. Die indischen Diener begehrten schon, hinausgelassen zu werden. Auch Mister Morny und seine Gattin konnten ihre Besorgnis nicht länger verbergen, sie blickten nach Dollamore.
Dieser war der einzige, der vollkommen sorglos blieb. Durch die Vorhänge musterte er die schreiende und tobende Menge.
»Ja, es muss etwas geschehen«, sagte er ruhig, »oder es würde durch meine Schuld hier Blut fließen! Ich will sie erst beruhigen.«
Ehe jemand ihn daran hindern konnte, hatte er die Glastür geöffnet und stand auf dem Balkon.
Heulen und wütende Rufe empfingen den Frevler.
»Die Bajadere, die Bajadere heraus«, heulte es durcheinander, »oder wir stürmen das Haus und zünden es an! Das vergossene Blut komme dann auf dein Haupt, Verfluchter, Verräter an deinem Volk! Die Bajadere heraus, sie ist dem Shiva geweiht!«
Unbeweglich stand Dollamore auf dem Balkon. Er versuchte vergebens, sich Gehör zu verschaffen. Seine Stimme verklang.
Er wandte sich etwas zurück, rief seinen Reitknecht, einen Gurkha, heran und sprach leise mit ihm. Über das bronzefarbene Gesicht des wilden Kriegers flog ein düsteres Lächeln, er nickte und ging in das Nebenzimmer, wo seine und seines Herrn Waffen und Panzerrüstungen lagen.
Einem der Inder unten, der den Anführer zu spielen schien, war es gelungen, das Volk etwas zur Ruhe zu bringen.
»Willst du uns die Bajadere ausliefern oder nicht?«, rief er hinauf.
»Meine Brüder!«, begann Dollamore. »Auch ich glaube an Brahma wie ihr, auch ich verehre Shiva und...«
»Kein Wort mehr!«, unterbrach der Sprecher ihn sofort. »Willst du uns die Bajadere herausgeben oder nicht? Antworte ja oder nein, alles andere ist unnütz!«
»Gut denn, ich werde sie euch selbst bringen! Versprecht ihr, dieses Haus dann zu schonen?«
»Was haben wir denn da drinnen zu tun? Wir zählen zehnmal bis sechzig, ist die Bajadere dann nicht in unserer Mitte, so zerbricht dieser Balken das Tor!«
»Gut! In zehn Minuten soll die Bajadere unter euch sein!«
Ohne seinen Angehörigen erst zu sagen, was er vorhabe, ging er schnell in das Nebenzimmer und kam nach einer Minute wieder heraus, mit Brustpanzer, Arm- und Beinschienen angetan, auf dem Haupte den goldenen Helm mit dem geflügelten Ungeheuer, an der Seite das mächtige Schwert. Ebenso war schon sein Reitknecht gerüstet, doch dieser trug noch in seinen Armen einen mit Tüchern verhüllten Gegenstand, der Form und Größe nach ein Mensch.
»Entschuldige, Schwester«, wandte Dollamore sich lächelnd an diese; »ich habe einige deiner Kleider genommen, natürlich die ersten besten, die ich fand, und aus ihnen dieses Bündel geformt. Kann es nicht für diese vermummte Bajadere durchgehen?«
»Was hast du vor?«, fragte die Schwester angstvoll.
»Mein Plan ist sehr einfach. Ich besteige mein Pferd und nehme das Bündel in den Arm. Wenn die Inder die Vorbereitungen zum Sturm treffen, sprenge ich hinaus und schlage mich durch. Sie halten natürlich dieses Bündel für das Mädchen und werden mich verfolgen. Inzwischen schlüpft mein Reitknecht mit der Bajadere zur Hintertür hinaus und bringt sie in Sicherheit. Ich selbst nehme sie nicht, weil die Inder schießen könnten. Mich schützt der Panzer vor den Kugeln ihrer elenden Pistolen.«
Der Plan war gut, aber kühn.
»Sie werden dich töten!«, klagte die Schwester, die den Charakter des Bruders kannte und ihm deswegen gar nicht erst abredete.
»Ach was!«, lachte Dollamore sorglos. »Es wird spielend gelingen! Wenn das Tor aufgeht, setze ich schon über die ersten Reihen hinweg! Wer nicht weicht, der muss fallen, und ehe sie sich umdrehen, habe ich schon freie Bahn. Ihr bleibt hier oben und seht vom geschlossenen Fenster aus zu, wie leicht mir das Stückchen gelingt.«
»Wohin lässt du die Bajadere bringen?«, fragte Mister Morny.
»In die Kaserne der Gurkhas. Den möchte ich sehen, der sie von dort zu holen wagt!«
»Sollte sich nach dem Gelingen deines kecken Planes der Unwille der Menge nicht doch noch gegen unser Haus wenden?«
»Bald sind die Gurkhas unter meiner Führung hier und säubern die Straße!«
Die Menge unten war still geworden, man hörte nur das laute Zählen des Mannes. Er war erst bei der dritten Minute angelangt. Jetzt hörte auch das Zählen auf, ein Wortwechsel fand statt.
»Dollamore, ein Brief an dich! Öffne das Fenster!«, erklang es unten.
Ohne sich in seiner Rüstung sehen zu lassen, tat er so, wie ihm geheißen, und geschickt wurde ein Brief durch das Fenster geworfen. Dollamore erbrach ihn und überflog die Zeilen.
Sei heute Abend acht Uhr bei mir!«, lauteten sie. »Unbedingt! Ich erwarte Dich
sehnsüchtig! Was Du auch vorhast, gib es auf, Du sollst es nicht bereuen! Soeben
erfahre ich von Deiner Tat und ihren Folgen. Liefere die Bajadere aus. Es droht
Dir Gefahr, und ich will Dich nicht in einer solchen wissen! Nur heute nicht! Ich
zittere, dass Du nicht kommen könntest. Liefere sie aus, ich flehe Dich an, um
meiner Liebe willen, und dann vergiss nicht — ich bin eifersüchtig!
Dollamore kannte die Handschrift des nicht unterzeichneten Schreibens — es war die der Duchesse, seiner Geliebten.
»Du hast keinen Grund, eifersüchtig zu sein«, murmelte er, den Brief in die Halsöffnung des Panzers schiebend. »Was ist mir diese Bajadere, dieses Kind! Ich hatte Atkins versprochen, heute Abend zu ihm zu kommen, aber ich kann nicht, die Liebe zu ihr ist mächtiger. Endlich vielleicht — komm, Mädchen«, wandte er sich laut an die Bajadere und nahm ihre Hand, »ich will dich, armes Kind, retten. Lebt wohl, ihr alle, auf Wiedersehen! Brahmas Hand sei über euch und mir. Er ist ein allgütiger Gott und kann nimmermehr wollen, dass die ihm untergebenen Götter Menschenopfer verlangen dürfen.«
Unter Segenswünschen verließ er das Zimmer, die Bajadere an der Hand führend, und wartete in dem Flur, bis der Reitknecht ihm das riesige Schlachtross gesattelt hatte.
Der Zähler draußen war erst bei der sechsten Minute, Dollamore schritt einstweilen in dem Flur auf und ab, ohne die Bajadere weiter zu beachten.
Ihre Augen verfolgten ängstlich den Wandernden, und plötzlich trat sie vor ihn hin.
»Herr, was willst du tun?«, fragte sie mit bebender Stimme.
»Dich retten.«
»Es ist dein Tod.«
»Ich glaube nicht, ich schlage mich durch.«
»So fällst du später den Fakiren zum Opfer.«
»Und wenn ich es bestimmt wüsste, ich würde nicht zögern, dich zu retten, denn du willst nicht sterben. Wessen Bajadere bist du?«
»Ich tanze im Tempel Vishnus.«
»Vishnus? Wie kommt es denn, dass du für Shiva sterben solltest?«
»Der Priester wollte es, ich zog das Los.«
»Armes Kind«, sagte Dollamore mit tiefem Bedauern, »ich werde dich retten!«
»Du kannst es nicht. Ich falle doch den Fakiren wieder in die Hände, und dann sterbe ich unter Martern.«
Dollamore wurde aufmerksam.
»Und wenn ich dich jetzt ausliefere?«
»So werde ich vor die Räder geworfen, und fährt der Wagen nicht mehr, so verbrennt man mich auf dem Scheiterhaufen.«
»Warum?«
»Weil ich mich dem Shiva entzogen habe, und dieser ist der Feuergott.«
»So werde ich dafür sorgen, dass du vollkommen in Sicherheit kommst. Du bleibst einstweilen unter meinem Schutz; später sende ich dich, wenn du willst, in ein fernes Land.«
Das Mädchen kauerte sich wieder in die Ecke, Dollamore nahm seine Wanderung abermals auf. Draußen wurde an der siebenten Minute gezählt; die Menge wurde ungeduldig.
Da vertrat das Mädchen dem Helden abermals den Weg, in ihren Augen glänzten Tränen.
»Lass mich hinaus«, flüsterte sie.
»Aber warum denn?«
»Ich will sterben.«
»Wie, du verachtest dein Leben?«, versuchte er zu lächeln. »Es ist doch so schön.«
»Das Leben ist so schön!«, wiederholte sie träumerisch. »Doch ich habe es nie kennen gelernt!«
»So lerne es noch kennen.«
»Ich bin eine Bajadere, in den Tempel zum Tanzen verbannt. Herr, ich bitte dich, lass mich hinaus!«
»Auf keinen Fall! Ich bringe dich in Sicherheit.«
»Herr, du bist verloren!«
»Durchaus nicht, wir sehen uns bald wieder.«
»Du bist verloren!«, sagte sie abermals.
»Du wirst zu hören bekommen, wie leicht ich mich durchschlug.«
»Du bist verloren, dein Tod ist unabwendbar!«, wiederholte sie zum dritten Male, und in ihrer Stimme lag eine unsägliche Angst.
Dollamore sah ihr in das kindliche, unschuldige, schöne Antlitz; die Augen, in denen Tränen standen, blickten ihn so traurig an.
»Dein Tod ist gewiss«, flüsterte sie, »und ich —möchte dich so gern retten. Herr, wen betest du heute an?«
»Seltsame Frage!«
»Wen anders als Shiva, den Glücklichen? Und dass ihm Menschen sich selbst opfern, ist eine Unsitte.«
»So bist du dem Tode geweiht, und ich kann dich nicht retten«, hauchte sie.
»Mädchen, was sprichst du da? Du mich retten?«
Die Bajadere sah sich scheu um.
»Doch, ja, ich kann dich retten«, flüsterte sie, sich immer scheu umschauend, »du darfst heute nicht Shiva anbeten, du musst — nein, nein, es ist schon zu spät!«
Weinend warf sie sich ihm zu Füßen.
»Lass mich hinaus und sterben, ich kann deinen Tod nicht ansehen«, jammerte sie.
Er hob sie auf.
»Ich verstehe dich nicht, Kind. Du kannst mich nicht retten und brauchst es auch nicht, denn mein Leben ist nicht in Gefahr. Geh hinter diese Ecke, du darfst nicht gesehen werden, wenn das Tor geöffnet wird. Mein Diener bringt schon das Pferd.«
Die neunte Minute war zu Ende, als der Reitknecht das Ross vorführte. Dollamore setzte den Fuß in den Steigbügel. Da fasste das Mädchen noch einmal die Hand des edlen Mannes; ihre Tränen waren getrocknet; hochaufgerichtet stand sie neben ihm.
»Ich bin kein Hindumädchen«, sagte sie mit blitzenden Augen, »ich bin eine Parse und stamme aus Beludschistan.«
Dollamore zögerte noch einen Augenblick.
»Es geht die Sage, die Parsenmädchen von Beludschistan sterben, wenn sie lieben und ihre Liebe nicht erwidert wird. Ich weiß nicht, was du damit sagen willst, Mädchen; zieh dich zurück in deine Ecke. Gib mir das Bündel und entferne dich mit dem Diener. Ihr dürft auf keinen Fall gesehen werden, Sobald man mich verfolgt, wirfst du dich mit ihr aufs Pferd und jagst zur Hintertür hinaus. Wir treffen später wieder zusammen. Hat sich das Mädchen versteckt?«
Sie war nicht mehr zu sehen.
»So öffne das Tor!«
Mit einem Satze war Dollamore im Sattel, das Bündel, wie eine weibliche Gestalt geformt, vor sich im Arm. Der kühne Ritt konnte beginnen. Das feurige Ross stampfte die Steinfliesen.
»Auf!«
Der Reitknecht schob den Riegel zurück und öffnete den Torflügel; Dollamore setzte die Sporen ein.
Da flog eine bunte Gestalt an ihm vorüber, dem Tore zu. Es war die Bajadere.
»Ich sterbe, denn ich liebe dich!«, erklang es durch die Halle, und verschwunden war das Mädchen in der laut aufheulenden, jubelnden Menge.
Dollamore stieß dem Rosse die Sporen in die Weichen, er wollte ihr nachsetzen, sie aus der Menge herausholen, doch schnell schloss der Diener das Tor.
»Du kannst sie nicht mehr retten, Herr, spare dein Blut!«
Jeder Blutstropfen war aus Dollamores Antlitz gewichen, stier blickte er das geschlossene Tor an. Dann sprang er mit einem dumpfen Ächzen aus dem Sattel.
Lord Canning hatte sich getäuscht, als er glaubte, seinem Gaste heute noch die Radschas in aller ihrer Pracht zeigen zu können. Die ungefähr sechzig Fürsten, so ziemlich alle Indiens, an der Spitze Bahadur, erschienen am Nachmittag im Gouvernements-Palaste, ganz einfach, ohne jeden Schmuck gekleidet. Lord Canning empfing sie im großen Saale, auf dessen Galerie sich zahlreiche Zuschauer befanden.
Es wurden Höflichkeitsphrasen gewechselt; mit kalter, gleichgültiger Miene versicherten die Radschas wie gewöhnlich ihre Ergebenheit gegenüber der englischen Königin und dass sie sich unter der Herrschaft der Engländer äußerst wohlfühlten, denn diese wollten ja nur ihr Bestes. Die Engländer verständen das Land viel besser auszunutzen als die trägen, unwissenden Kulis, mit wachsamen Augen sorgten sie dafür, dass nicht etwa das habgierige Frankreich oder das barbarische Russland mit roher Hand von dem schönen Indien Besitz ergreifen könnten, die Engländer seien gerecht und human; glücklicher als unter ihrer Herrschaft könnte Indien gar nicht sein, oder es wäre ja überhaupt gar keine Herrschaft, sondern nur ein Protektorat; man wünsche nur, dass es immer so bliebe und nicht wieder aufrührerische Elemente unter dem Volke Gift verbreiteten, und so weiter, und so weiter.
Ebenso wenig, wie die Radschas selbst, glaubte natürlich Lord Canning, oder irgend einer der Zuhörer an die Wahrheit dieser schönen Worte.
Tee und Kaffee wurden serviert, und vor jedem wurde ein Nargileh, eine Wasserpfeife von gewaltigem Umfang, aufgestellt.
Außer Lord Canning waren noch einige Kabinettsmitglieder und höhere Offiziere zugegen, unter letzteren General Broke, welcher zur Zeit in Delhi den abwesenden Höchstkommandierenden, den General Havelock, vertrat.
Canning schnitt so bald wie möglich die Komplimente und Ehrerbietungsbezeugungen ab und fragte, warum der Festzug heute ganz anders stattgefunden habe als sonst.
»Shiva wollte es so«, antwortete Bahadur einfach.
»Es waren unter meinen Begleitern viele Inder, welche Shiva hoch verehren und in seinen Kultus tief eingeweiht sind. Auch sie wunderten sich, dass die Kali nicht gefahren, sondern getragen wurde, und noch dazu von den Radschas selbst. Übrigens gilt doch sonst das Fest Shiva, nicht der Kali.«
»Sie konnten es nicht wissen, wenn sie bei dir waren«, entgegnete Bahadur gleichgültig, »wir selbst erfuhren Shivas Willen erst in der letzten Minute, als Kalis Wagen schon bereitstand. Ein Oberbrahmane trat unter uns und sagte: ›Shiva will nicht, dass er heute verehrt wird; sein Weib Kali soll angebetet werden, damit er sich mit ihr versöhnt. Ihr seid stolz, Radschas, Kali zürnt euch. Werft euren Schmuck ihr zu Füßen und tragt sie selbst, geht wie Bettler im Staube!‹ Sieh, das ist der Grund, dass wir heute so einfach bei dir erscheinen; wir haben nichts mehr, und im Panzer können wir doch nicht zu dir kommen. Wir hatten eben noch Zeit, die Kunde durch Fakire unter dem Volke verbreiten zu lassen.«
»Es haben sich heute wenig Menschen geopfert.«
»Shiva war zufrieden, dass wir uns vor ihm demütigten, er ist sehr mit uns zufrieden, er hat es uns sagen lassen.«
»Das Götterbild war diesmal sehr klein.«
»Natürlich, wir werden doch nicht das schwerste tragen.«
»War es nicht ein Mensch?«
»Es war ein Bild.«
»Man sagt, es hätte sich mehrfach bewegt.«
»Aber warum sollte sich denn eine Göttin nicht bewegen können?«, fragte Bahadur wie erstaunt.
Gegen eine solche Naivität, die natürlich nur geheuchelt war, war man wehrlos.
Canning kam auf etwas anderes zu sprechen, was ihm übrigens als Generalgouverneur sehr viel anging.
»Ich habe gehört, das Land Dschansi habe seinen Fürsten verloren.«
»Ja, Nana Sahib hat ihn im Zweikampf getötet.«
»Er beleidigte mich«, erklärte Nana Sahib selbst, »und wir losten, wer mit dem Yatagan gegen den Tiger kämpfen sollte. Ihn traf das Los; er fiel neben der Leiche des Tigers.«
»Ein kühner Zweikampf«, sagte Lord Canning, »würdig eines Radschas, und zugleich der Menschheit Nutzen bringend, denn dadurch wurde sie von einem Raubtier befreit. Ich vermisse jedoch noch immer die Nachricht, dass der Thron von Dschansi nicht mehr leer ist.«
»Dschansi ist weit von hier, und die Leute liebten ihren Fürsten; sie trauern noch um seinen Tod.«
»Wer wird ihn besetzen? Sirbhanga hat keine Kinder; als sein Weib eines Kindes genesen sollte, wurde es in die Berge geführt und nie wieder gesehen.«
Canning ließ durchblicken, dass er sehr wohl über die Vorkommnisse auch in den fernsten Teilen des Landes orientiert war. Bahadur war diese Wendung des Gesprächs unangenehm, und er fand sofort einen Grund, sich entfernen zu können.
»Brahma wollte es so. Doch erlaube, Sahib, dass deine Freunde Abschied nehmen, denn viel haben sie heute noch zu beraten. Der Thron von Dschansi ist leer, und so müssen wir wählen, wer würdig ist, ihn zu besetzen.«
Canning lag nichts daran, die Fürsten zu halten. Auf sein Zeichen brachten Diener Gläser und Champagner herein.
Es war bei jeder Zusammenkunft Sitte, dass wenigstens am Schluss der Königin von England mit einem Hoch gedacht wurde, und selbst Nana Sahib, dem als Mohammedaner der Weingenuss doch untersagt war, hatte stets seinen Kelch auf ihr Wohl geleert.
Heute stieß Canning auf unbesiegbaren Widerstand.
»Shiva will nicht, dass wir heute Wein trinken«, sagte Bahadur einfach.
Canning wurde etwas verlegen, das Blut stieg ihm in den Kopf. Dies war eine direkte Weigerung, geschickt verborgen. Sollte er denn mit den Kaffeetassen anstoßen lassen?
Er brachte stehend das Hoch auf die Königin aus; phlegmatisch erhoben sich die Fürsten, sagten das Hoch wie eine vorgesprochene Formel gleichgültig nach und entfernten sich nach langen Höflichkeitsphrasen und Versicherungen ihrer Treue und Ergebenheit schnell, als ob ihnen der Boden unter den Füßen brenne.
Am Nachmittag ritten sie durch die Straßen und zeigten sich dem Volke, aber nicht wie gewöhnlich in glänzenden, mit Juwelen geschmückten Kostümen, sondern in ihren phantastischen Kriegsrüstungen. Es war eine Ausstellung der Erzeugnisse der kunstfertigen, indischen Waffenschmiede; zoll-dicke Brustpanzer bis zu den dünnen Schuppenhemden, welche sich wie Leinwand an den Leib schmiegen, vielfach gehärtet, sodass sie Ersteren an Festigkeit nicht nachstehen; die aus den Gebirgen stammenden Radschas waren angetan mit Kettenpanzern, Rüstungen, welche aus lauter kleinen Ringen zusammengesetzt sind, die Helme waren in jeder nur möglichen Form vertreten, von der Sturmkappe bis zu solchen mit meterhohem Aufbau, meist Ungeheuer vorstellend, Schwerter, so krumm, dass man nicht wusste, ob sie überhaupt aus der Scheide gingen, das Yatagan, das Flammenschwert, das zweihändige Schlachtschwert, alles war vertreten.
Das Volk jauchzte seinen Herrschern zu; auch sie wurden mit Blumen überschüttet.
Als der Abend anbrach, zogen sich die Fremden, welche nur zur Teilnahme am Feste gekommen waren, außerhalb der Mauern Delhis zurück, wo Baracken für sie aufgeschlagen waren, oder sie quartierten sich zwischen den Trümmern ein, die ihnen gute Unterkunft boten.
Die Straßen waren schon still, als Lord Canning mit einigen Fremden nach Fort Oliver hinausfuhr, um den Geburtstag des Captains Atkins mitzufeiern.
In Delhi lagen zur Zeit 6000 Soldaten, die meisten davon waren Sepoys, und ihr Aufenthalt war nicht direkt Delhi selbst, sondern die in der Nähe liegenden Forts.
Fort Oliver verdiente allerdings nicht den Namen eines Forts, vor allen Dingen stelle man sich keine Festung darunter vor. Früher war es ein stark gebauter Bungalow gewesen, welches einem indischen Fürsten gehört hatte, jetzt lag darin eine Besatzung von hundert Mann, und es diente zugleich zum Aufenthalt eines Captains, unter dessen Kommando oder vielmehr Aufsicht auch die übrigen Forts standen. Er war der Inspektor und wohnte im Fort Oliver. Im Falle eines Krieges wäre dieses sofort geräumt worden, denn die wenigen Kanonen sollten dem Gebäude nur einen kriegerischen Anstrich geben. Jedenfalls war es die angenehmste Wohnung, die sich der Fortinspektor in der Umgebung hätte aussuchen können.
Lord Canning traf schon eine fröhliche Herren- und Damengesellschaft an. Fast alle Offiziere Delhis, welche nicht durch Wachtdienst gebunden, waren vertreten, ebenso die höheren Verwaltungsbeamten, und sie alle hatten ihre Frauen und die erwachsenen Kinder mitgebracht.
Auch die Familie Reihenfels war eingeladen worden, weil Atkins durch seine Schwester Susan mit ihr eng befreundet war; ebenso war Otto mitgekommen und fand gleichaltrige Gespielen. Dass Leutnant Dollamore in der letzten Minute noch eine Absage geschickt hatte, wurde lebhaft bedauert, denn der von Leben und Humor übersprudelnde Inder war der beliebteste Gesellschafter. Als seine Karte angekommen, hatten die jüngeren Offiziere flüsternd die Köpfe zusammengesteckt oder sich doch bedeutsame und lächelnde Blicke zugeworfen. Man wusste allgemein, welches ihm der liebste Platz in Delhi war.
Lord Canning war noch nicht lange da, als ihm auch hierher eine amtliche Mitteilung folgte. Der Betriebsingenieur meldete ihm, dass der Eisenbahnzug von Mirat ausgeblieben sei und dass, als er depeschieren wollte, der Telegraf versagt habe. Die Leitung müsse gestört sein. Canning konnte natürlich nichts weiter tun, als durch seine Unterschrift bezeugen, dass er Kenntnis von der Mitteilung genommen habe.
Die Feststimmung in dem mit Girlanden, Blumen und Lampions geschmückten Salon war schon die fröhlichste geworden, als endlich auch noch die bis jetzt Fehlenden erschienen, Lady Carter und Oskar Reihenfels.
Man machte sofort die Bemerkung, dass letzterer recht leidend und angegriffen aussehe; er erklärte aber, besonders den Eltern und Geschwistern gegenüber, dass er sich wohlfühle und ihm auch nichts zugestoßen sei. Nur wenige wussten, dass er mehrere Abenteuer bestanden hatte, denn die Rettung der Ordonnanz durch Jeremy war ja bekannt geworden. Doch man vermied in Gegenwart der Damen ernste Gespräche.
Der Mittelpunkt des Salons war nach Captain Atkins, dem Festgeber und Geburtstagskind, selbstverständlich Lord Canning als im höchsten Range stehend, und Reihenfels versuchte lange vergebens, ihn einmal allein zu sprechen.
Endlich, als man schon zur Tafel schritt, gelang ihm dies.
»Ich bitte um einige Worte unter vier Augen, Exzellenz!«
»Ich stehe Ihnen zur Verfügung.«
»Nicht hier, wir dürfen nicht gehört werden.«
»Muss es denn noch vor der Tafel sein?«, fragte Lord Canning, und sein Blick suchte dabei Franziska, die sich lachend weigerte, den ihr von Susan angewiesenen Platz einzunehmen.
»Es muss sein, denn ich habe Ihnen Mitteilungen von der größten Wichtigkeit zu machen.«
Canning führte Reihenfels in ein Nebenzimmer, und fast eine Viertelstunde musste die Gesellschaft ungeduldig warten, bis beide wieder erschienen. Sie sahen ernst, fast ärgerlich aus. Man bemerkte, wie Lord Canning, als er, in Gedanken versunken, nach seinem Platze schritt, mehrmals wie zweifelnd die Schultern hob.
Es bedurfte einiger Zeit, ehe er die Feststimmung wiedererlangt hatte. Reihenfels blieb den ganzen Abend ernst.
Man erging sich in scherzhafter Unterhaltung, Neckereien, auch einmal kleine Reibereien fanden statt, die von launigen Toasten unterbrochen wurden.
Reihenfels unterhielt sich zerstreut, ja, er konnte sogar manchmal übelnehmerisch werden.
»Mister Reihenfels«, redete ihn ein gegenübersitzender junger Offizier an, »Sie sind doch Engländer?«
»Ich bin in England geboren und besitze dort das Heimatrecht. Erzogen bin ich als Deutscher!«
»Das bleibt sich ja gleich. Warum treten Sie nicht in die englische Armee ein?«
»Aus welchem Grunde sollte ich dies tun?«
»Da könnten Sie es doch zu etwas bringen!«
Reihenfels ließ Messer und Gabel sinken.
»Muss man denn gerade Offizier sein, um es zu etwas bringen zu können?«, fragte er scharf. »Meiner Meinung nach ist der Offizier nur ein notwendiges Übel, das besser nicht wäre; denn direkten Nutzen bringt er den Menschen nicht, und Achtung kann er sich nur dadurch erringe, dass er sich im Frieden so unbemerkbar wie möglich macht, im Kriege aber alle seine Kräfte daransetzt, ihn zu beenden.«
Mit wenigen Ausnahmen stieß Reihenfels mit dieser Ansicht natürlich auf lebhafte Opposition, und nicht zum mindesten bei den jüngeren Damen. Der sich in seiner Ehre verletzt glaubende Offizier hielt eine glänzende Verteidigungs- oder vielmehr Lobrede auf seinen Stand, und es ward ihm sehr leicht, Reihenfels zu schlagen, wenigstens insofern, als ihm fast alle beistimmten. Es ist ja bekannt, dass Tapferkeit in dieser Welt das größte Ansehen genießt, und ganz besonders bei den Damen. Mut verdunkelt jede andere Tugend — leider, und man kann es auch ganz leicht erklären, schon daraus, dass die Folgen des Mutes sofort sichtbar sind, die der anderen Tugenden aber erst nach und nach erscheinen oder überhaupt nicht direkt zu bemerken sind.
Reihenfels fühlte bald, dass er mit seiner Ansicht nicht durchdringen könnte, und schwieg; da aber geschah das Unerwartete, dass nach Schluss des Wortgefechtes der greise General Broke ruhig erklärte, er müsse der Meinung des jungen Reihenfels vollkommen beistimmen.
Dennoch konnte der Eindruck nicht verwischt werden, als hätte Reihenfels gestanden, dass er nicht Offizier werden möchte, weil es ihm an dem dazu erforderlichen Mut gebräche.
»By Jove(*), rief ein Offizier, »in so später Stunde noch Abendrot!«
(*) Beim Zeus — beliebter englischer Ausruf.
»Was, Abendrot?«, lachte man. »Es ist ja schon über zehn Uhr!«
Man blickte durch das Fenster und sah wirklich am Horizonte einen rötlichen Schein, der schnell zunahm und immer höher wuchs.
»Es brennt!«, rief Lord Canning. »Und zwar in der Gegend von Mirat!«
»Horcht, es donnert!«
Man vernahm in der Tat Donnerschläge in weiter Ferne.
»Aber man sieht ja keine Blitze!«
»Das Gewitter wird tief stehen, und zwischen hier und Mirat liegt ein mächtiger Wald. Jetzt blitzte es auf!«
Die Röte stieg nicht mehr höher, sondern sank. Mirat lag sechs Meilen von Delhi entfernt, und es musste ein gewaltiges Feuer sein, wenn man seinen Schein hier sah. Helfen konnte man nicht, und es war schade, dass die Telegrafenverbindung zerstört war.
Aus dem Hofe herauf ertönte das Jubeln der Soldaten, denen Atkins englisches Bier gespendet hatte, und diese Lustigkeit vertrieb auch bald wieder die ernste Stimmung im Salon.
Neben Lord Canning saß Susan, Atkins Schwester, neben dieser Franziska. Vorhin nun wollte Susan, dass diese ihren jetzigen Platz einnahm, sie aber hatte es entschieden abgelehnt.
Wie schon erwähnt, wurde allgemein geglaubt, dass zwischen Canning und Susan ein Verhältnis bestände, und da er sich heute Abend fast ausschließlich mit seiner Nachbarin beschäftigte, gern flüsternd mit ihr sprach, wenn niemand es bemerkte, so fand man die Vermutung bestätigt.
Als Lord Canning jetzt aufgefordert wurde, einen Trinkspruch zum besten zu geben, er aber erst einige Minuten sinnend vor sich hinblickte und dann leise mit Atkins sprach, war man fast der Meinung, dieses Fest würde noch mit einer ganz besonderen, frohen Verkündigung schließen.
Man hatte sich getäuscht.
Atkins stand auf und gab das in Indien gebräuchliche Zeichen, dass sich die Diener entfernen sollten. Er streckte beide Hände aus.
»Geht!«
Die vierzehn Inder, welche die Gäste an der Tafel bedienten, verneigten sich und verließen, hintereinander gehend, das Zimmer.
Lord Canning klopfte an sein Glas und erhob sich. Atkins selbst füllte die Champagnerkelche.
»Meine Herren und Damen! Es war zwar unter uns ausgemacht worden, an dem heutigen frohen Feste, das uns zum Geburtstag unseres lieben Freundes Atkins vereinigt, nichts zu berühren, was unsere Feststimmung trüben könnte. Nun aber haben wir bisher versäumt, einer Person zu gedenken, der wir alles schulden, was wir sind — unserer allergnädigsten Königin. Ehe wir ihr die schuldige Hochachtung erweisen, möchte ich mit kurzen Worten erwähnen, wie es kommt, das wir hier im fremden Lande im Namen der Königin die Interessen Englands wahren. Heute kehrt zum hundertsten Male der Tag wieder, an welchem der Grundstein des mächtigen, britischen Reiches in Ostindien gelegt wurde. Heute vor hundert Jahren fand in der Nähe von Plassy, auf dem linken Ufer des Hugli, die denkwürdige Schlacht statt, in welcher Suradscha Daulah, damaliger Subadar von Indien, von Lord Clive blutig aufs Haupt geschlagen wurde. Damit war die kriegerische Macht der Inder gebrochen. Sir Jaffier wurde zum Padischah gewählt, und dieser edle, verständige Mann, wohl voraussehend, dass Indien dem Ruin entgegenging durch die fortwährenden inneren Kriege, hervorgerufen durch die Streit- und Herrschsucht der Radschas, leistete der Königin von England den ersten Treueschwur...«
»Schade, dass Lord Clive, der Enkel des berühmten Mannes, in Mirat ist!«, flüsterte jemand dem Nachbar zu.
Lord Canning ergriff sein Glas und fuhr fort:
»Heute vor hundert Jahren also erscholl in Indien der erste Treueschwur für unsere Königin; wir brauchen keinen Treueschwur zu leisten, denn die Ergebenheit zu ihr und unserem Vaterlande ist uns zu tief, unauslöschlich ins Herz gegraben, aber wünschen wollen wir, dass es keinen Engländer gibt, der anders denkt als wir, wünschen, dass das Panier Englands stets unantastbar über Indien schwebt, uns zur Ehre, den Indern zum Segen; nimmermehr soll es sich beugen, hoch soll es flattern, von uns gehalten, und darauf erhebe ich mein Glas und rufe: Hoch lebe unsere allergnädigste Majestät die Königin von England, hoch...«
Ein Schuss knallte, die Fensterscheibe klirrte; zersplittert fiel das Glas aus des Redners erhobener Hand; in den Türpfosten schlug eine Kugel.
Erschrocken sprang alles auf.
»Hoch!«
Da wurde die Tür aufgerissen, das Hoch erstickte in den Kehlen. Eine blutige Gestalt stürzte herein, in englischer Offiziersuniform. Der Mann stützte sich schwer auf ein Gewehr mit aufgepflanztem Bajonett.
»Lord Clive!«, erklang es entsetzt.
»Verrat — Meuterei!«, keuchte der junge Offizier mühsam. »Mirat ist — in den Händen — der Rebellen — alles tot — über dreihundert — Frauen und Kinder — niedergemetzelt — ich bin — Delhi ist —«
Das Wort erstarb ihm aus den Lippen — er neigte sich zur Seite und stürzte röchelnd zu Boden.
Ein furchtbarer Tumult entstand, die Weiber schrien, die Männer sprangen nach ihren Waffen; in der Tür zeigten sich die angsterfüllten Gesichter von Soldaten. Gleichzeitig ertönte eine Gewehrsalve, sie musste in Delhi abgefeuert worden sein, unzählige andere folgten, vermischt mit Kanonendonner.
»Was ist das?«, schrie ein Offizier am Fenster. »Die ganze Gegend starrt von Waffen, wir sind umzingelt!«
Ein neuer Tumult entstand.
»Ruhe!«, donnerte General Broke, der sich den Degen umschnallte. »Captain Atkins, übernehmen Sie die Verteidigung des Forts, wenn eine solche nötig ist.«
»Ein Parlamentär!«, riefen die Soldaten draußen, und schon trat ein Inder, waffenlos, ein weißes Tuch in der Hand, in den Saal.
»Erkennt man mich als Parlamentär an?«
»Ja. Was geht vor? Was willst du?«, fragte Broke.
»Ergebt euch! Ihr seid gefangen! Widerstand ist nutzlos.«
Eine Todesstille entstand nach diesen Worten. Dann trat der alte General mit sprühenden Augen auf den Mann zu.
»Was wagst du uns zu sagen?«, lachte er wild auf. »Wir uns ergeben? Hinaus, du Hund, oder ich renne dir den Degen durch den Leib!«
Wie schützend hielt der Inder das weiße Tuch vor sich hin.
»Ihr seid schon gefangen. Fünftausend Inder halten das Haus belagert, darunter zweitausend Sepoys.«
»Sepoys?«
»Unsere Leute, nur in englischen Uniformen. Hörst du die Salven in Delhi? Es sind Sepoys, welche die Engländer beschießen. Hörst du die Kanonen der Festung donnern? Sie sind in unseren Händen, sie werden von Sepoys, die ihr ausgebildet habt, bedient. Ergebt euch!«
»Atkins, lasst die Kanonen laden«, schrie Broke, »die Soldaten bewaffnen! Du lügst, Schurke! Die Sepoys sind nicht übergetreten!«
»Jeder Inder kämpft für Indien.«
»Es sind Sepoys, sie rücken heran«, riefen die Offiziere am Fenster. Lord Canning trat vor den Parlamentär.
»Wie lange haben wir Bedenkzeit?«, fragte er.
»Fünfzehn Minuten.«
»In wessen Namen stehst du hier und redest?«
»Im Namen der Begum von Dschansi«, war die stolze Antwort.
»Wer ist das?«
»Die Königin von Indien.«
»Ich kenne keine Königin von Indien.«
»So wirst du sie noch kennen lernen.«
»Wer führt die Meuterer?«
»Wir sind keine Meuterer, wir sind freie Inder, welche keinen fremden Herrn haben wollen.«
»Wer führt euch an?«
»Die Begum von Dschansi.«

Cannings Augen begegneten denen Reihenfels'.
»Was für Bedingungen stellt sie?«, fragte er dann weiter.
»Alle im Hause befindlichen Inder haben freien Abzug, desgleichen Frauen und Kinder, wenn ihr euch gefangen gebt.«
»Auf Gnade und Ungnade?«
»Als Geiseln. Räumt England Indien und verspricht, es nicht wieder zu betreten, so seid ihr frei, sonst sterbt ihr.«
»Hahaha«, brach Cannings Zorn jetzt los, »bist du wahnsinnig, uns solche Bedingungen zu überbringen? Wir sollen euch Weiber und Kinder übergeben, wenn wir gesonnen sind, uns zu verteidigen?«
»Ja, sie stehen unter dem Schutze der Begum von Dschansi. Sie kämpft mit Männern, nicht mit Weibern.«
»Wer bürgt uns für die Sicherheit der Frauen?«
»Die Begum von Dschansi.«
»Womit?«
»Mit ihrem Worte.«
»Befiehlt sie nur diesen Truppen?«
»Ganz Indien ist aufgestanden; vier Millionen wohlbewaffnete Inder sind bereit, euch zu vernichten, und allen befiehlt nur die Begum von Dschansi.«
»So war die Überrumpelung Mirats auch ihr Werk?«
»Sie geschah auf ihren Befehl.«
»Und da wagst du mir zu sagen, Schurke, diese Begum wolle für unsere Frauen und Kinder bürgen?«, rief Canning entrüstet. »Sind in Mirat nicht alle Frauen und Kinder niedergemetzelt worden?«
Der Parlamentär warf einen zögernden Blick nach Lord Clive, der blutüberströmt auf einen Diwan gebettet worden war.
»Der Befehl der Begum, Weiber und Kinder zu schonen, kam zu spät«, sagte er dann; »es ist geschehen und wird nicht wieder vorkommen.«
»So viel für eure Bürgschaft und euer Wort!«, rief Broke verächtlich. »Ihr habt den Treueschwur gebrochen, ihr werdet auch jeden anderen brechen. Hinaus mit dir! Greift an! Töten könnt ihr uns, doch nicht gefangen nehmen.«
Der Inder wandte sich zum Gehen. In der Tür blieb er noch einmal stehen.
»Ich möchte euch raten, gebt den Widerstand auf. Wir müssen euch gefangen nehmen, um euch als Geiseln zu haben. Spart das Blutvergießen, die Begum will es. Bedenkt, wie Mirat und Delhi, so sind schon alle anderen Städte in unseren Händen, die Arsenale bewaffnen unsere Leute, die Bengalen eilen zu unserer Hilfe herbei, die Gurkhas...«
»Die Gurkhas?«, fuhren Broke und Canning zugleich auf.
»Kämpfen auf unsrer Seite.«
»Du lügst, Dollamore ist kein Treuloser.«
»Dollamore ist ein Inder, er kämpft für Indien.«
»Hinaus, kein Wort weiter! Greift an!«
Der Inder verschwand.
»Die Leute sind verteilt!«, rief der von Soldaten begleitet eintretende Atkins und ließ Gewehre und Munition verteilen.
Jeder Mann nahm ein Gewehr, denn beim Sturm kam es jetzt darauf an, so viele Gegner wie möglich zu töten. Jeder musste seinen Mann stellen. Auch Broke ergriff ein Gewehr.
»Ladet die Kanonen mit gehacktem Blei, keine Schonung!«, sagte er. »Die Mauern sollen eher über uns zusammenstürzen, als dass wir uns ergeben. Noch eins: die Rebellen versprechen Frauen und Kindern freien Abzug.«
Als Antwort erschollen Verzweiflungsrufe, man kannte die Inder aus früheren Aufständen.
Am verzweifeltsten gebärdete sich Franziska. Plötzlich stürzte sie auf Canning zu und warf sich an seine Brust.
»Ich bleibe bei dir«, schluchzte sie, »ich will mit dir sterben, John!«
Canning machte sich sanft von ihr frei.
»Es war ja auch nur eine Frage, ob sich jemand der Gnade der Inder überliefern wolle. Natürlich tut es niemand.«
Nur ein kurzes Staunen zeigte sich über die Vertraulichkeit der beiden; es war keine Zeit zum Staunen.
»Die Frauen und Kinder in das Kellergeschoss!«, kommandierte Broke. »Sind alle Männer bewaffnet?«
Ein herzzerreißender Abschied folgte, dann wurden die Frauen, Mädchen und Kinder von einem Corporal hinausgeführt. Otto weigerte sich als erster, er wollte bleiben und mit kämpfen. Sofort schlossen sich ihm alle Knaben an, durch sein Beispiel angefeuert.
»So lasst sie bleiben und gebt ihnen Gewehre!«, entschied Broke. »Es gilt einen Verzweiflungskampf; jeder, der ein Gewehr abdrücken kann, ist kostbar.«
Einige Inder mit Bündeln unterm Arm traten schüchtern zu Atkins.
»Sahib, wir haben freien Abzug.«
»Hinaus mit euch, Schufte! Kämpft gegen uns!«
»Das wollen wir nicht, wir haben dich lieb...«
»Schon gut, fort mit euch!«
»Halt!«, rief Lord Canning, und die Inder schraken zusammen. »Ist keiner darunter, der treu ist?«
»Kein einziger, alle sind Halunken! Warum?«
»Wenn wir nicht mit dem Leben davonkommen, soll man doch erfahren, wie wir gestorben sind. Was wäre das wert, wenn wir einen treuen Mann hätten, der unbehelligt hinauskäme! Ich habe schon das Schreiben fertig.«
»Es wäre allerdings ausgezeichnet, wenn wir eine Nachricht hinausgelangen lassen könnten, aber es geht nicht. Oder wäre einer der Offiziere bereit...?«
Die Männer sahen sich an und zuckten die Achseln.
»Als Inder verkleidet?«
Wer sollte das wagen? Kämpfen wollten sie alle bis zum letzten Blutstropfen; aber verkleidet durch die dichten Reihen der Feinde schleichen, die das Haus wie eine Mauer umgaben, dazu gehörte mehr als Mut. Und wer sprach auch so gut Indisch, wer konnte sich so benehmen, dass er nicht entdeckt wurde? Keiner!
»Es geht nicht, Mylord!«
Draußen erscholl eine Stimme.
»Noch fünf Minuten! Wollen die Inder mit uns kämpfen?«
»Fort, hinaus mit euch braunen Schuften!«
Eilends schlüpften die Eingeborenen hinaus.
»Nun, wollen Sie kein Gewehr nehmen?«, fragte ein Offizier Reihenfels, der sinnend die Inder betrachtete, welche eben hinausmarschierten.
»Nein!«, entgegnete Reihenfels kurz und verließ das Zimmer.
»Eins — zwei — drei — vier«, erklang es draußen.
»Aha, sie zählen die Diener«, rief Atkins, »und werden sie wahrscheinlich untersuchen. Sehen Sie, Mylord, wie vorsichtig sie sind!«
Das Zählen ging in Zwischenpausen weiter.
»Elf — zwölf — dreizehn —«
Eine lange Pause folgte.
»Es fehlt noch einer!«, erklang die Stimme.
»Wie gut die Kerls orientiert sind!«, flüsterte Atkins. »Ich habe vierzehn Diener.«
»Wo ist der vierzehnte?«, erscholl es wieder.
»Ja, wo steckt denn der Kerl? Hat er sich vor Angst verkrochen?«
Da trat der Vermisste herein und ging sofort auf Lord Canning zu.
»Geben Sie mir den Brief!«, sagte er hastig. »Ich bringe ihn durch und dahin, wo er seinen Zweck erfüllt.«
»Was, du, Halet?«, rief Atkins erstaunt. »Du Schlingel wärst gerade der Richtige. Pack dich zum Teufel, hinaus zu deiner Sippschaft!«
»Ich habe Halet gebunden, er liegt draußen«, entgegnete der junge Inder zum maßlosen Erstaunen aller; »ich bin's, Oskar Reihenfels, als Inder verkleidet! Schnell«, fuhr er hastig fort, »geben Sie mir das Schreiben, das Ausbleiben des Inders erweckt Misstrauen!«
»Sie kommen nicht durch!«, rief Atkins.
»Doch, mit Gottes Hilfe wird es mir gelingen!«
»Die Sprache — Sie werden durchsucht!«
»Ich spreche jeden indischen Dialekt; niemand kann mich von einem Eingeborenen unterscheiden, und ich besitze ein Mittel, meine Durchsuchung zu verhindern. Ich selbst bin ein Spion, ein Fakir. Den Brief!«
Lord Canning gab ihn dem Wagemutigen.
»Haben Sie sonst noch einen Auftrag?«
»Geben Sie das Schreiben dem ersten, der Stellung gefasst hat, womöglich General Wilson oder Havelock! Gehen Sie mit Gott!«
»Wo ist der vierzehnte? Kommt er nicht?«, erklang es draußen.
Reihenfels eilte hinaus. In der Tür hielt ihn noch einmal jener Offizier zurück, mit welchem er die Debatte gehabt hatte. Er drückte Reihenfels die Hand.
»Ich bitte Sie um Verzeihung. Sie wagen etwas, wozu ich nicht den Mut hätte!«
Die Besatzung des Hauses sah, wie der junge Gelehrte von Indern umringt wurde und dann in der Dunkelheit verschwand.
Einige Minuten verstrichen. Draußen herrschte die tiefste Stille, in Delhi dagegen rollten unaufhörlich Gewehrsalven und Kanonendonner. Doch auch hier sah man Waffen blitzen und dunkle Gestalten überall, wohin man nur blicken konnte.
Jetzt erscholl wieder die Stimme:
»Die fünfzehn Minuten sind verstrichen. Wollt ihr euch ergeben?«
»Geben Sie ihm die Antwort, die ihm gebührt!«, flüsterte Broke Atkins zu.
»Feuer!«, kommandierte dieser, und die Gewehre der an den Fenstern postierten Soldaten krachten.
Ein Jammer- und Wutgeheul erscholl; plötzlich wimmelte die Umgegend von Menschen, die Schwerter, Beile und Keulen schwangen und auf das Haus zustürmten.
Schuss krachte auf Schuss; die Inder erwiderten keinen; nur ihr Geheul erfüllte die Luft. Sie wollten das Haus mit blanker Waffe stürmen, und es musste ihnen gelingen, denn wo einer fiel, da standen zwei andere für ihn auf.
Schon hatten die Stürmenden die niedere Hofmauer erreicht. Noch gelang es, das Übersteigen derselben zu verhindern. Ununterbrochen knallten die Gewehre; der Salon, in dem noch die gedeckte Festtafel stand, war schon mit undurchdringlichem Pulverrauch gefüllt.
Wie mochte den Frauen und Kindern unten im Keller zumute sein? Sie hörten die Schüsse, das Wutgeheul, und wussten nicht, wie die Sache stand, wussten nicht, ob nicht schon der, den sie liebten, mit durchschossener Brust am Boden lag.
Alle Männer und Knaben ohne Ausnahme handhabten das Gewehr, General Broke ebenso gut wie Otto Reihenfels. Nur Atkins eilte manchmal nach den Stuben der anderen Seiten, wo ebenfalls Soldaten postiert waren. Auch hier gelang es vorläufig noch, die Stürmenden vom Betreten des Hofes abzuhalten. Aber wie viele Minuten, wie viele Sekunden mochte es noch dauern, und der Kampf Brust gegen Brust begann.
Einigen war es schon gelungen, in den Hof zu gelangen, sie fielen unter den Kugeln der Verteidiger. Da plötzlich erscholl ein Signal; die Stürmenden hielten inne. Gleichzeitig vernahm man ein fernes Donnern, wie von unzähligen Pferdehufen herrührend, und aus der Richtung von Delhi her sah man gleich einer Gewitterwolke in voller Karriere eine Reiterschwadron heranstürmen.
»Die Gurkhas!«, knirschte Broke. »Fertig zum Feuern! Den ersten da vorn nehme ich aufs Korn — es ist Dollamore!«
Schon sah man die Stahlpanzer glänzen; der Reiterschar voran stürmte ein mächtiges, schwarzes Pferd, auf ihm ein Riese, in den Steigbügeln stehend, den geschwungenen Pallasch in der Hand. Broke hatte sein Gewehr auf ihn angeschlagen. Würde der Stahlpanzer der Spitzkugel wohl widerstehen?
Da ertönte die dröhnende Stimme des Führers der Gurkhas durch die Nacht.
»Hurra für England, nieder mit den Rebellen!«
Wie ein Unwetter sprengte die Schar zwischen die Empörer. Was nicht unter den Hieben der Schwerter fiel, wurde überritten. Im Nu war die nächste Umgebung des Hauses gesäubert, und schon stürmte eine andere Schwadron der Reiter heran.
»Gerettet!«, jubelten die Belagerten auf; die Soldaten ordneten sich mit aufgepflanztem Bajonett zum Ausfall.
»Erst die Frauen benachrichtigen!«, rief Atkins und stürzte hinaus; die Offiziere ohne Ausnahme stellten sich an die Spitze der Leute.
Da kam Atkins wieder; das Haar sträubte sich ihm auf dem Kopfe, er war vor Schrecken erst sprachlos.
»Was gibt's, Atkin?«, rief man ihm bestürzt entgegen.
»Der Keller ist leer«, stammelte der Captain mit gelähmter Zunge, »Frauen und Kinder — alle sind verschwunden!«
Bob, der Trommeljunge, hatte sich selbst der ersten ihm begegnenden Patrouille ausgeliefert, die den kleinen, kecken Ausreißer suchen sollte. Der führende Unteroffizier glaubte nicht anders, als Bob habe für diesen Abend ein Vergnügen vorgehabt und, um sich dieses nicht entgehen zu lassen, sich einfach durch Selbstbefreiung dem Arrest entzogen. Nun war er nicht wenig erstaunt, als er plötzlich gefragt wurde, ob er den Trommeljungen Bob suche.
Der Unteroffizier fühlte Mitleid mit dem kleinen Kerl, denn er kannte das traurige Los, das ihm jetzt bevorstand; aber ändern konnte er daran nichts. Die Suppe, die Bob sich eingebrockt, musste er nun auch auslöffeln.
Er wurde wieder nach dem Arrestlokal gebracht, wo ihn der wachhabende Offizier mit unheilverkündendem Gesicht empfing. Ein Protokoll wurde an Ort und Stelle aufgenommen, dann kam Bob sofort, noch diese Nacht, nach dem Turm in Untersuchungshaft.
Aber der Offizier hatte einen schweren Stand, einen so halsstarrigen Sünder hatte er noch nie vor sich gehabt.
Der Schließer erzählte zuerst, wie er Bob, durch dessen Klopfen und Schreien herbeigerufen, sich anscheinend in Krämpfen oder furchtbaren Schmerzen auf der Pritsche hätte wälzen sehen. Er habe geglaubt, der Gefangene wäre heftig erkrankt, habe die Zelle betreten, um die erste Hilfe dem Kranken angedeihen zu lassen, da aber sei Bob aufgesprungen, hinausgeeilt, hätte die Tür zugeworfen und auch noch den Riegel vorgeschoben.
Der Korridorposten erzählt seine harmlose Begegnung mit dem Flüchtling, der Posten auf dem Hofe, wie der Junge am Blitzableiter herabgerutscht, an ihm vorbeigeschlüpft und dann mit Benutzung des Fasses über die Mauer gesetzt sei.
Dieser Soldat sah einer Bestrafung entgegen, weil er auf den Flüchtling nicht geschossen hatte. Dieses Vergehen war ein sehr schweres.
Bob waren ebenso einige Jahre Festung gewiss, es sei denn, der Junge besaß Schlauheit und wusste einen triftigen Grund anzuführen, weswegen er die Selbstbefreiung begangen hatte.
»Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?«, wandte sich der Offizier an Bob.
»Nichts.«
»Es verhält sich also alles, wie der Schließer und die Wachthabenden angaben?«
»Ganz genau so.«
»Warum hast du es getan?«
Hier war die Klippe, an der alles scheiterte. Bob schwieg von jetzt an beharrlich, er erklärte sogar, dass er diese Frage nicht beantworten würde.
Der Offizier konnte fragen, wie er wollte, in Sanftmut oder in Zorn, er konnte dem Schuldigen mit seinen Fragen noch so entgegenkommen, Bob öffnete nicht mehr den Mund. Schon sollte er durch eine Patrouille nach dem Turm abgeführt werden, als ein dem Wachthabenden befreundeter Offizier atemlos und mit allen Zeichen von Aufregung hereinkam.
»Haben Sie schon gehört, die Ordonnanz des Gouverneurs ist im Palmengarten von vier Indern überfallen worden; man hat versucht ihn zu töten, ihm die Briefe zu entreißen.«
»Was Sie sagen! Ich entnehme Ihren Worten, dass der Plan nicht gelungen ist.«
»Gott sei Dank, nein! Ein alter, gedienter Soldat namens Jeremy kam aus demselben Versteck hervor, wo die Mörder lagen; er hatte ihren Plan belauscht, und der alte Haudegen hat die vier Mann auf der Stelle niedergemacht.«
»Und die Ordonnanz?«
»Die hat einen Schlag auf den Kopf und einen Stich durch die linke Schulter bekommen. Ich kam hinzu und fand den jungen Mann bewusstlos zwischen den vier Leichen liegen. Er hatte nur noch Zeit gehabt, den Revolver zu ziehen, die Brieftasche hielt er fest umklammert. Ich überzeugte mich erst, dass die eingetragenen Briefe alle vorhanden waren, ließ dann den Bewusstlosen, der starken Blutverlust erlitten hatte, nach dem Lazarett schaffen, und brachte die Briefe gleich selbst nach der Kommandantur. General Havelock nahm sie mir ab, er schien auf sie gewartet zu haben. Als ich ihm von dem Überfall erzählte, wurde er aschfahl. Sie können sich wohl denken, was die Briefe enthielten.«
»So ziemlich! Sie müssen sehr wichtig gewesen sein. Es wundert mich, dass die Ordonnanz allein geschickt wurde.«
»Mich auch. Dann begab ich mich zu Lord Canning und erstattete Meldung« — der Erzähler näherte den Mund dem Ohre des Kameraden, und seine Stimme sank zu einem Flüstern herab, »und es schien mir, als ob er sich einen Augenblick die ärgsten Vorwürfe machte. ›Ich hätte es mir denken können‹, hörte ich murmeln, ,Gottlob, dass es noch so abgelaufen ist!!‹ Lord Canning ging selbst mit mir nach dem Lazarett, um nach dem Verwundeten zu sehen«, fuhr der Offizier dann laut fort, »und er empfahl ihn der besonderen Obhut der barmherzigen Schwester, die ihn selbst einmal gepflegt hat.«
Der Offizier wollte den Kameraden nicht länger aufhalten und entfernte sich.
Aufmerksam hatten die Soldaten der Mitteilung gelauscht. Sie war auch für ihre Ohren bestimmt gewesen, denn in den Kolonien müssen die Engländer zusammenhalten wie Schiffbrüchige auf einer Insel. Die Subordination ist weniger streng, und am aufmerksamsten war Bob gewesen.
Fahle Blässe überzog sein hübsches Gesicht, als er noch nicht wusste, ob Jim Green nur verwundet oder tot sei; dann aber hellte es sich wieder auf; ein schelmischer Zug kam zum Vorschein; fröhlich leuchteten die Augen wieder, und ein Seufzer der Erleichterung kam aus dem tiefsten Herzen.
»Nun, hast du dir überlegt«, wandte sich der Offizier an ihn, »ob du mir ein Geständnis machen willst?«
»Ja, Herr Leutnant.«
»Das ist gut. Aus welchem Grunde hast du dich also aus dem Arrest entfernt?«
»Aus keinem anderen Grunde, als weil es mir darin nicht gefiel. Draußen war es so schön, und da dachte ich, es könnte mir nichts schaden, wenn ich einen kleinen Spaziergang unternähme.«
Die alte Tollheit des Burschen brach wieder durch. Er behauptete, keinen anderen Grund dazu gehabt zu haben, und schließlich musste der Offizier seine Aussage protokollieren, so lächerlich diese auch war.
Eine Patrouille wurde beordert, Bob in den Turm zu bringen.
»Hast du noch etwas zu sagen?«
»Ja, Herr Leutnant. Ich wollte noch fragen, ob es möglich wäre, dass ich meine Zeit unter den Krankenwärtern abdiene.«
»Hinaus mit ihm, sonst wird er noch völlig verrückt.«
»Oder als barmherzige Schwester!«
»Hinter den Festungsmauern kannst du dich auf deinen neuen Beruf vorbereiten.«
Bob wurde von der Patrouille in die Mitte genommen; sie marschierten ab.
Schon eine Stunde später saß der Junge im Turm in einer engen Zelle, diesmal aber in grauleinenem Arrestanzug. Seine Nachbarn waren Aufwiegler, Diebe und sogar Verbrecher, die mit dem nächsten Schiffe nach England zur Verurteilung kamen. Auch Bobs Los war kein anderes. Vor dem Transport wurde er noch einmal vernommen und die Art seines Vergehens festgestellt.
An Flucht war hier gar nicht zu denken. Wie schon erwähnt, lag der hohe Turm auf einem Hügel außerhalb der Stadt, aber noch innerhalb der Mauern Delhis. Die Bewachung war eine sehr scharfe; unter Aufsicht eines Leutnants lagen hier immer dreißig Mann in voller Kriegsausrüstung; denn einst hatten Inder versucht, einen gefangenen Kameraden mit Waffengewalt zu befreien, und die Wache hatte den Turm wie eine Festung verteidigen müssen.
Ob man dem kecken Jungen vielleicht doch einen Fluchtversuch zutraute, kurz, man wies ihm die höchste Zelle des Turmes an.
Bob war durchaus nicht niedergeschlagen, im Gegenteil, er war sehr fröhlich aufgelegt und bedauerte nur, dass er, wenn er zum Fenster hinaus rief, von keiner menschlichen Seele Antwort bekam.
Am anderen Tage konnte er von seiner luftigen Höhe aus die Festlichkeiten zu Ehren Shivas bewundern, und er amüsierte sich dabei vortrefflich. Den ganzen Tag stand er am Fenster, er sah, wie sich die in Delhi fremden Inder gegen Abend entweder in ihre Baracken zurückzogen oder die Trümmerfelder aufsuchten. Jetzt erwartete er, bei diesen fremden Gästen, die er wohl auf hunderttausend und noch mehr schätzte, sich ein lebhaftes Lagerleben entwickeln zu sehen, aber er hatte sich geirrt. Nur hier und da flammte in der Nacht ein Feuer auf, sonst herrschten vollkommene Finsternis und Ruhe. Die Leute mochten alle müde sein; waren sie doch auch den ganzen Tag auf den Füßen gewesen.
Bob verzehrte mit dem besten Appetit sein Abendbrot, nicht das trockene Brot des Arrestanten, sondern Kasernenkost, wie die Gefangenen sie erhalten, und stellte sich dann wieder ans Fenster, um die kühle Nachtluft zu genießen und das schlafende Delhi von hier oben aus noch etwas zu betrachten.
In der Wachtstube des Turmes lagen sechsundzwanzig Soldaten schlafend auf den Pritschen, vier Mann umschritten als Posten, die geladenen Gewehre über den Schultern, in taktmäßigem Schritt das massive Gebäude. Neben dem Tore lehnte eine Gestalt im grauen Offiziersmantel, es war Eugen, der heute diese Wache kommandierte; ihm zur Seite stand ein alter Hornist, der als solcher sein ganzes Leben in Indien gedient hatte.
Zu dieser Wache ward kein Trommeljunge verwendet, man nahm alte, gediente Hornisten.
Der Hügel war nicht hoch genug, um über die Häuser hinwegsehen zu können, und während beide in die Mündungen der finsteren, von keinen Lampen erhellten Straßen blickten, tauschten sie Bemerkungen über das heutige Fest aus. Der alte Hornist, der schon unzähligen solchen Götterfesten beigewohnt hatte, wunderte sich über die Wagen mit Blumen, und am allermeisten darüber, dass diese gar nicht alle verbraucht worden waren.
»Die Wagen wurden immer noch halbvoll beiseite gefahren, weiß der Teufel wohin, und es kam mir fast vor, als wären sie für eine Blumenladung viel zu schwer. Einen Wagen sah ich, dessen Räder zolltief in den Boden einsanken.«
»Die Wagen sind an sich schon sehr schwer«, entgegnete Eugen, »manche wiegen allein viele Zentner.«
»Trotzdem hätte man nachsehen sollen, was unter den Blumen noch steckte.«
»Ihr seid misstrauisch?«
»Hier in Indien muss man es immer sein; der Teufel traue den braunen Halunken, ich nicht!«
»Wie, Ihr denkt an einen Aufstand, obwohl die vollste Ruhe in Indien herrscht?«
»Nicht gerade an einen Aufstand, denn so etwas wittert man immer im Voraus. Glücklicherweise können sich die heißblütigen Inder nicht verstellen — aber eine Spitzbüberei steckte doch unter den Blumen.«
»Vielleicht brauchen sie sie noch morgen.«
»Ich wüsste nicht, wozu. Morgen rücken die Zugewanderten wieder mit Sack und Pack ab, und es wundert mich auch, dass heute alles so still ist. Sonst enden solche Feste mit großen Schmausereien; die ganze Nacht geht es lebhaft zu.«
»Sie haben am Tage genug gebrüllt und gesprungen, sie müssen müde sein. Oder schöpft Ihr aus dieser Stille wirklich Argwohn? Man kann nicht vorsichtig genug sein, ich würde sofort Meldung machen lassen.«
»Nicht auf meine Veranlassung hin, Herr Leutnant; es ist streng verboten, unnötigen Verdacht zu erregen, weil die Inder dadurch sich gleich in ihrer Ehre verletzt fühlen — diese Spitzbuben. Aber wer, wie ich, schon einige Aufstände durchgemacht hat, der wird leicht misstrauisch.«
»Die Aufstände wurden immer rechtzeitig entdeckt, um ihnen kräftig begegnen zu können.«
»Freilich, sonst stände es auch schlimm mit uns, denn wir sind viel zu wenig Engländer in Indien. Was sind diese 6000 in Delhi? Die werden einfach erdrückt.«
»Ihr sollt im letzten Aufstand in schlimmer Lage gewesen sein.«
»Das war ich, Herr Leutnant. Ich begleitete damals mit einigen Soldaten einen Offizier auf einer Forschungsexpedition, und wir waren wochenlang von jedem Verkehr abgeschnitten; daher hatten wir auch keine Ahnung, dass ein Aufstand in Aussicht war, und dass schon Vorbereitungen getroffen wurden, ihn abzuwehren. Wir glaubten uns im sichersten Frieden, aber die uns begleitenden Inder wussten recht gut, wann es losgehen sollte; sie hatten es von einem Fakir erfahren, der uns begegnete. In der Nacht, als der Aufstand losbrach, schlichen sie sich leise an uns heran; ein Glück, dass ich nicht schlief, sonst wäre kein einziger von uns ihnen entgangen. Dreien haben sie doch den Hals durchgeschnitten, darunter auch dem Offizier, und keinen Ton hörte man dabei. Dann aber waren wir auf und fielen über die Teufel her. Sehen Sie, Herr Leutnant, im kleinen können die Inder wohl ihre Absicht verbergen.«
»Aber einen ganzen Aufstand bis zur letzten Minute zu verheimlichen ist ihnen doch nicht möglich. Das war wohl damals, als der Aufstand mit der Schlacht bei Nursingpur endete?«
»Ja. Es stand schlecht mit uns. Hätte damals Leutnant Carter, dessen Namen Sie tragen, nicht den kecken Reiterangriff gemacht, kein Engländer hätte die Heimat je wieder gesehen. Der arme Sir Carter, ich gäbe mein Leben hin, wenn ich... Himmel und Hölle, was ist das?«
Beide waren zusammengefahren; die patrouillierenden Posten blieben wie auf Kommando stehen und entsicherten die Gewehre, die Soldaten in der Wachtstube sprangen wie elektrisiert von den Pritschen auf und griffen schlaftrunken nach den Waffen.
Ein Trompetensignal schmetterte durch die Nacht. Aber woher kam es? Es musste ganz in der Nähe des Turmes gegeben worden sein, hoch oben in der Luft. Die beiden Männer blickten nach dem Turm hinauf, als müsse der Trompeter oben stehen, denn von dort herab erklang es.
»Das große Alarmsignal!«, flüsterte Eugen. »Höre ich denn wirklich recht oder träume ich nur?«
Dieses Signal hätte für den Wachthabenden den Befehl enthalten, die Soldaten in Reih und Glied unter Waffen antreten zu lassen, die Gefangenen sofort in Freiheit zu setzen, sie zu bewaffnen und die Gewehre der Waffenkammer, welche dann noch übrig blieben, durch Herausnahme einiger Schlossschrauben unbrauchbar zu machen.
Aber nein, es musste eine Täuschung sein. Wer war der Hornist, der dieses Zeichen gab, wer besaß hier außer dem Hornisten eine Trompete?
Doch das Signal klang weiter; tief setzte es ein, in kurzen Absätzen schwollen die Töne und endeten wieder tief; aber nicht genug damit, hinterher erscholl ein schriller, tremolierender Ton, der sich in Schwingungen wiederholte — es war das Zeichen des Stabshornisten, der auf Befehl des Höchstkommandierenden oder des Lenkers der Schlacht das Signal gibt, und jeder Hornist, der es hört, muss es sofort wiederholen.
Schon stürzten die Soldaten aus der Wachtstube. Eugen wusste noch nicht, was er denken sollte. Der Hornist riss die Trompete von der Schulter und setzte sie an die Lippen.
»Soll ich?«
»Noch nicht, es ist ja gar nicht möglich«, flüsterte Eugen.
Durfte er den Weckruf ertönen lassen, der ganz Delhi in Kriegszustand brachte?
Sein Zögern nützte nichts. Das Signal war von anderen Wachen gehört worden, dort in der Ferne erscholl das große Alarmsignal, dort wieder, es ertönte auch mehrmals auf der Festung im südlichen Teile Delhis, deren mächtige Umrisse man von hier aus nur undeutlich erkennen konnte, Lichter huschten darauf hin und her.
»Wiederholt es!«, rief jetzt auch Eugen, und hell und scharf entquollen der Trompete des alten Soldaten die Töne des großen Alarmsignales.
Im Turm ward es lebendig; die Schließer eilten hin und her und öffneten die Türen der Zellen.
»Auf, hinunter mit euch! Bewaffnet euch! Ihr kämpft für euer Leben!«, erklang es.
Die Gefangenen, plötzlich befreit, stürzten hinunter und empfingen Bajonette, Gewehre und Patronen, sie ordneten sich neben der Wache; einträchtig standen die uniformierten Soldaten und die Gefangenen in leinenen Sträflingskleidern nebeneinander.
Eugen bekam schon die Schrauben der überflüssigen Gewehre ausgehändigt, er steckte sie zu sich. Noch wusste er nicht, ob dies denn alles Ernst sei.
»Wer hat das Zeichen des Alarms gegeben?«, fragte er, von einer Ahnung erfasst.
»Ich Herr Leutnant«, schrie ein Junge im Sträflingsanzug und schob eine Patrone in das Gewehr, das ebenso lang war wie er.
»Was! Bob, du hättest...«
Das Wort erstarb ihm auf den Lippen.
Ein furchtbares Geheul erscholl, eine dunkle Masse stürmte aus den Straßen dem Hügel zu, blanke Waffen blitzten.
Jetzt wusste Eugen, woran er war.
»Rechts aufmarschiert — Feuer!«, übertönte sein Kommando das Geheul, und die erste Salve in Delhi krachte den meuterischen Indern entgegen.
Das Schmerzgeschrei der Getroffenen vermischte sich mit dem Gewehrknattern, das plötzlich überall in der Stadt erklang. Am lautesten ging es auf der Festung zu; unaufhörlich rollten dort die Gewehrsalven.
Da, ein Blitz, ein leuchtender Schein — der erste Kanonenschuss, dem der Donner nachfolgte, und in dem Flammenmeer sah man, wie auf dem einen Weg zur Festung die englischen Soldaten mit Indern im Verzweiflungskampfe rangen, während auf dem anderen, der dicht mit Indern besetzt war, der Kanonenschuss Tod und Verwirrung verbreitete.
Der Kampf in Delhi hatte begonnen, eine Stunde zu früh, sonst wäre nicht ein einziger Engländer mit dem Leben davongekommen.
Zur bestimmten Zeit hatte sich Leutnant Dollamore bei der Duchesse anmelden lassen, aber die Geduld des nicht ans Warten gewöhnten Inders wurde auf eine harte Probe gestellt. Fast eine Stunde musste er im Vorzimmer harren. Die Duchesse mache Toilette, hieß es immer, so oft er auch fragte.
Ruhelos wanderte er auf und ab, warf sich bald auf einen Stuhl und blätterte in einem Album, bald musterte er die Bilder an der Wand, doch immer nahm er seine Wanderung schnell wieder auf, als wolle er dadurch sein heißes Blut beruhigen.
Die hier hängenden Bilder gaben denen im roten Boudoir an Lüsternheit nichts nach, und das Album zeigte dem heißblütigen Inder die Herrin des Hauses in Stellungen, welche antiken, klassischen Statuen entnommen waren. Als Juno, wo sie den Pfau liebkosend streichelt, als Diana, wie sie, den Oberkörper vorgebeugt, den Pfeil dem Bogen entsendet, oder zurückgeneigt den Jagdruf ertönen lässt, sie zeigte sich, wie sie zum Bad das Kleid schürzt und so weiter.
Diese Darstellungen, welche, ganz dem antiken Stil nachgeahmt, die Schönheit und Grazie der Körperformen erkennen ließen, erhitzten das Blut des Inders immer mehr, immer wieder warf er das Album weg, und doch griff er immer wieder danach.
Derartige Bilder sind nichts Seltenes, man findet sie besonders in Italien auf dem Tisch im Empfangszimmer liegen, ohne dass daran Anstoß genommen wird, dass ein Fremder die Formen der Hausdame fast unverhüllt bewundern kann. Ländlich, sittlich — nirgends ist das Baden beiderlei Geschlechts untereinander so unschuldig, wie an den Küsten Italiens, so zum Beispiel auf der Badeinsel Lido in der Nähe von Venedig.
Endlich, endlich kündigte ein indisches Mädchen dem der Verzweiflung Nahen an, die Duchesse sei bereit, ihn zu empfangen.
Ein süßer Duft, zusammengesetzt aus allen Wohlgerüchen Indiens, strömte ihm schon aus der geöffneten Tür entgegen.
Schnell wollte er das ihm so wohlvertraute rote Boudoir betreten, sich seiner Herrin zu Füßen werfen, da ertönte ein Schrei, und wie geblendet blieb er im Türrahmen stehen.
Was er vorhin auf Bildern gesehen, das zeigte ihm jetzt die Wirklichkeit: einen Busen und Schultern wie von weißem Marmor, eine schwellende Hüfte und ein Bein, an dessen Schönheit das der Diana nicht reichen konnte.
Nur einen Augenblick durften Dollamores Augen dies schauen, dann warf die Kammerzofe der Duchesse einen langen Mantel um die Schultern, und diese sank auf den Diwan.
»Habe ich dir nicht gesagt, du solltest warten, bis ich zum zweiten Male klingele?«, zürnte sie der Dienerin, die Dollamore gerufen hatte.
Das Mädchen murmelte eine Entschuldigung, während das andere der Herrin behilflich war, ihr auf dem Diwan eine bequeme Lage zu geben. Den schönen Leib verhüllte der weite, dicke Mantel aus rauer und doch weicher Wolle, der Kopf lehnte auf dem Polster, aufgelöst hing das feucht-glänzende, blauschwarze Haar herab, und jetzt richtete sich das schöne, lächelnde Antlitz nach dem noch immer an der Tür Harrenden. Es zeigte einen müden, erschöpften und doch frischen Ausdruck — die Duchesse war eben dem Bade entstiegen.
Sie schickte die beiden Mädchen hinaus, unter denen sich heute Mirzi nicht befand, dann rief sie Dollamore heran.
Der junge Mann ließ sich auf einem niedrigen Sessel am Kopfende ihres Lagers nieder; lächelnd ruhte ihr Blick aus seinem schönen Antlitz, auf dem sichtlich Freude mit Verwirrung kämpfte. Dollamore war feurig, er besaß sogar einen wilden Charakter, doch dieser wurde von Sittlichkeit beherrscht. Aber wehe, wenn diese der Leidenschaft erlag!
Aus den Falten des Mantels huschte eine kleine, feuchte Hand und streckte sich ihm entgegen.
»Du hast mich erschreckt, mein Freund!«, lispelte die Duchesse matt. »Du kamst einige Minuten zu früh und hast gesehen, was du nicht sehen durftest.«
Er führte die warme Hand an seine Lippen und presste einen langen, heißen Kuss darauf, sie aber wickelte sich noch fester in den Mantel, was nur den Erfolg hatte, dass er sich enger an ihre vollen Formen schmiegte.
Dollamore wollte einige Entschuldigungen murmeln.
»Sprich nicht Englisch!«, unterbrach sie ihn sofort. »Bediene dich des Indischen! Ich mag das Englisch nicht hören, und aus deinem Munde klingt es geradezu unnatürlich!«
»Es ist die Sprache derer, die mir zu befehlen haben, und die ich liebe!«, entgegnete Dollamore.
»Du liebst deine Unterdrücker?«, fragte das Weib mit einem leichten Anflug von Hohn.
»Es sind nicht meine Unterdrücker!«, entgegnete der Inder rasch. »Es sind meine und unser aller Wohltäter. Schlimm sähe es in Indien aus, wäre es der Willkür der Radschas preisgegeben!«
Die Duchesse bereute sofort, schon jetzt einen Gegenstand berührt zu haben, der das Thema für den späten Abend bilden sollte; schnell wusste sie dem Gespräch eine andere Richtung zu geben.
»Du sagst, du liebst die Engländer. Auch die Engländerinnen?«, fragte sie scherzhaft, ohne seine Hand freizugeben.
»Wie kannst du so sprechen? Meine Liebe gehört nur dir!«
Er bedeckte ihre Hand mit Küssen.
»Warum bist du so kalt heute, Dollamore?«
»Ich, kalt? Zu dir?«
»Begnügst du dich sonst damit, nur meine Hand zu küssen?«
Er kniete vor ihr, umschlang sie und küsste sie feurig auf die Lippen. Es war dies nicht das erste Zusammenkommen unter vier Augen, er kannte diese Küsse, die sie so heiß erwiderte; Tag und Nacht sehnte er diese Minuten herbei, aber noch nie hatte er den warmen Körper so gefühlt wie heute.
Das Weib drohte zu ersticken; lachend drängte es schließlich den Ungestümen zurück.
»So hatte ich doch unrecht, mich mit Argwohn zu quälen!«, sagte es. »Deine Liebe ist noch dieselbe wie früher!«
»Mit welchem Argwohn?«
»Die Bajadere!«
»O, Rosa, wie kränkst du mich!«, rief Dollamore, und eine dunkle Wolke überschattete sein eben noch vor Seligkeit strahlendes Antlitz.
»Sie ist tot!«, fügte er leise hinzu.
»Wohl ihr, sie ist für Shiva gestorben! Die Nirwana steht ihr offen!«
»Sie starb nicht freiwillig, sie wurde dazu gezwungen, mit roher Gewalt.«
»Mein Gott«, entgegnete die Duchesse achselzuckend, »freiwillig stirbt schließlich niemand. Hättest du keine Lust, dich unter die Räder zu werfen?«, fügte sie lächelnd hinzu.
»Wenn du es gewünscht hättest, würde ich nicht gezögert haben. Zu deinen Füßen oder auf deinen Wunsch zu sterben, bin ich jederzeit bereit!«
»Nein, nein, nicht tot, lebend will ich dich, meinen Geliebten, haben!«
Zwei weiße Arme schlüpften unter dem Mantel hervor und legten sich warm und weich um den Hals des schönen, hünenhaften Mannes.
Wäre Dollamore nicht selbst zu erregt gewesen, so hätte er bemerken müssen, wie die Erregung des Weibes fast unnatürlich schnell wuchs. Ihre Augen, vorher noch matt blickend, nahmen an Lebhaftigkeit mit rapider Geschwindigkeit zu, sie strahlten in einem verzehrenden Feuer, und noch immer vergrößerten sich ihre Pupillen. Auf den vor wenigen Minuten noch blassen Wangen entstanden scharf abgegrenzte rote Stellen, und von dort aus verbreitete sich eine frische Röte über das ganze Gesicht, über Stirn und Hals.
Dollamore fühlte die weichen Arme, die sich liebkosend um ihn schmiegten, und jener Zustand trat bei ihm ein, von dem man wünscht, dass er ewig währen möge, eine selige Vergessenheit, die man nicht durch Worte unterbricht.
Beide schwiegen, sie wollten nur zusammen sein, doch ein nervöses Beben verriet, dass noch immer die Erregung des Weibes wuchs. Er schrieb es der Liebe zu ihm zu, und er war glücklich darüber.
»Was sind das hier für rote Punkte?«, unterbrach Dollamore einmal das Schweigen.
Er hatte an Rosas linkem Unterarm, nahe am Gelenk, kleine Stiche bemerkt, die etwas geschwollen waren. Wäre die Haut nicht so weiß und glatt gewesen, man hätte die Wunden nicht gesehen.
Hastig zog die Duchesse den linken Arm zurück, dass ihn der Mantel wieder verhüllte. Dafür stützte sie sich in malerischer Lage auf den anderen Arm, sodass der deckende Mantel halb von der Schulter herab glitt.
»Nichts von Bedeutung«, entgegnete sie nachlässig. »Gestern Abend war ich so unvorsichtig, bei meiner Ausfahrt im Wagen eine ärmellose Taille anzuziehen. Die Mücken haben mich für meinen Leichtsinn bestraft. Wie aber kann dir jetzt so etwas auffallen? Ich glaube fast, du unterziehst das, was zu sehen dir vergönnt ist, einer genauen Prüfung.«
»Es wäre mir nicht aufgefallen, knüpfte sich nicht an den Anblick jener roten Mückenstiche eine alte Erinnerung.«
»Welche?«
»Es ist schon lange her, ich war ein Knabe, als ich von der asiatischen Augenkrankheit befallen wurde und in ein Hospital kam. Es war ein indisches und für Inder bestimmt, doch bemerkte ich unter den Kranken auch einen Europäer, wahrscheinlich einen Franzosen, der vergebens bei allen europäischen Ärzten Hilfe gesucht hatte und sie nun durch die einfache, natürliche Behandlung der indischen Priester zu finden hoffte.«
»Er kam aus Europa nach Indien, um sich heilen zu lassen? Sonderbar!«
»Nicht doch, er hielt sich immer in Indien auf, ich kannte ihn auch schon vorher sehr gut, doch nur dem Ansehen nach. Er fiel jedem auf durch seine schön gewachsene Gestalt, durch die Gewandtheit, mit welcher er seine Rede beherrschte, und vor allem durch die Grazie seiner Bewegungen. Jeder Fürst musste ihn darum beneiden.«
»Es mag ein Hofmann oder ein Schauspieler gewesen sein. Doch was hat dieser Mann mit den Mückenstichen zu tun? An welcher Krankheit litt er?«
»Dies blieb mir lange ein Rätsel. Ich traf ihn im Hospital wieder und fand in ihm eine ebenso schöne, rüstige und liebenswürdige Erscheinung wie früher. Das einzige war, dass er sehr aufgeregt war; an keinem Platz hielt er es lange aus, meistenteils unterhielt er sich lebhaft; er schien es zu müssen. Manchmal aber, besonders in der Nacht, hörte ich ihn furchtbar schreien, so entsetzlich, wie ich es noch nie gehört hatte. Dann wurde er stets von den Ärzten und Gehilfen umringt und nach einem besonderen Zimmer gebracht. Einmal habe ich ihn auch in einem solchen Zustande gesehen, und ich glaubte, plötzlich einen alten, hinfälligen Mann zu sehen. Alles an ihm war verändert, die Züge und Augen eingefallen — er glich einem Sterbenden. Einige Minuten später kam er wieder heraus, und er war vollkommen der Frühere, schön und rüstig.«
»Was für eine Krankheit mag das gewesen sein?«, murmelte die Duchesse, deren sich eine immer größere Unruhe bemächtigte.
»Auf meine Bitten durfte ich einmal der Prozedur in dem geheimen Zimmer beiwohnen. Der Schreiende, von vier Dienern gehalten, wurde mit Gewalt auf einen Tisch gelegt und ihm der linke Arm entblößt. Da sah ich nahe am Gelenk rote Punkte, unzählig viele, fast ebenso aussehend wie diese Mückenstiche. Der Arzt hatte eine kleine Spritze in der Hand, er stach mit der Spitze unter die Haut des Armes und entleerte sie. Sofort ließ das Schreien nach, und einige Minuten später sprang der Kranke wieder gesund und fröhlich auf.«
»Hast du nicht erfahren, was das war?«
»Ja, der Arzt erklärte es mir später, als der Mann tot war. Der Kranke hatte durch Ausschweifungen aller Art seine Lebenskraft erschöpft und gebrauchte ein unnatürliches Mittel, sie, wenn er ihrer bedurfte, wieder aufzufrischen. Er spritzte jeden Tag in sein Blut ein Gift, das aus dem Mohne unseres Landes genommen wird...«
»Opium?«
»Nein. Es wird wieder aus dem Opium gewonnen und wirkt noch zehnmal aufregender als dieses. Es heißt Morphium.«
Scheu wanderten die Augen des Weibes hin und her, sie wichen den Blicken Dollamores aus.
»Und der Mann starb an diesem Gift?«, fragte sie dann leise.
»Er wäre vielleicht durch die Behandlung der Ärzte gerettet worden, aber er fügte sich ihnen nicht. Das Morphium führte ihn dem sicheren Tode entgegen; schon konnte er nicht mehr schlafen, spritzte er es nicht in seine Adern. Tat er dies gar nicht mehr, so wäre er unter den entsetzlichsten Qualen gestorben. Die Ärzte entzogen ihm das Gift also nicht, sie machten nur immer größere Pausen zwischen den Einspritzungen, und furchtbar müssen die Schmerzen gewesen sein, die den Kranken quälten, wenn er das Morphium zum Leben brauchte und es nicht erhielt. Er versuchte die unglaublichsten Listen, um in den Besitz der Spritze und des Morphiums zu kommen. Eines Nachts gelang ihm dies auch, und er spritzte sich so viel ein, dass er einschlief, um nicht wieder zu erwachen. Ich glaube, der Arzt hatte es absichtlich geschehen lassen, denn es gab doch keine Rettung für ihn. Wer sich des Morphiums bedient, kann von dieser Sucht nicht wieder geheilt werden, eher noch der Opiumraucher.«
Die Duchesse sprang auf und wanderte mit heftigen Schritten im Zimmer auf und ab.
»Warum erzählst du mir so etwas?«, stöhnte sie. »Meine Nerven können derartige Hospitalgeschichten nicht vertragen!«
»Verzeihe mir, ich mache mir schon Vorwürfe! Ich bin ja auch nicht hierher gekommen, um von so etwas zu sprechen. Die Mückenstiche waren schuld daran! Komm, Geliebte, lass mich dir sagen, wie sehr ich dich liebe!«
Er zog sie neben sich auf den Diwan, auf den auch er sich jetzt gesetzt hatte. Sie duldete nur seine Liebkosungen, denn sie rang nach Fassung. »Du bist so kalt!«, klagte er einmal.
»Ich? Kalt?«, lächelte sie und umschlang ihn.
»Du bist nicht so, wie ein liebendes Weib sein sollte!«
»Und du bist anders als andere Männer.«
»Ja, ich bin's. Sieh, Rosa, ich liebe dich, und du wärst jetzt in meiner Gewalt.«
»Dollamore!«
»Ich mache keinen Gebrauch davon. Ich will, dass du mich liebst.«
»Ich liebe dich!«
»So beweise es!«
Er warf sich vor sie hin und umklammerte ihre Knie.
»Noch nicht! Du kennst die Bedingung.«
»Ach, du hältst mich von einem Tag zum anderen hin. Wann endlich bist du frei?«
»Jeden Tag kann ich die Nachricht erhalten.«
»Das sagst du schon lange!«
»So gedulde dich noch kurze Zeit!«
»Ich kann nicht mehr, Rosa, ich kann nicht mehr! Du verlangst Unmögliches von mir, von einem Inder!«
Glühend vor Verlangen presste er sie an sich. Funkelnd verschlangen seine Augen ihre junonische Gestalt, deren Formen der Mantel nicht unkenntlich machen konnte.
Lächelnd streichelte sie sein lockiges Haar.
»So hast du mich also wirklich unermesslich lieb?«
»Wie kannst du so fragen, Rosa!«
»Du liebst mich mehr als alles andere?«
»Hundertmal mehr!«
»Auch mehr als die Engländer?«
»Was willst du damit sagen?«, fragte er erstaunt.
»Du sagtest vorhin, du liebtest die Engländer.«
»Dies ist doch, wie du weißt, bei uns Indern nur ein Ausdruck. Wie kann man meine Liebe zu dir vergleichen mit der Hochachtung vor den Engländern?«
»So achtest du sie also hoch?«
»Ja, das tue ich, und du weißt es.«
Das Weib nahm seinen Kopf in beide Hände und drückte ihn an ihre Brust.
»Würdest du den lieben können, den ich hasse?«, flüsterte sie ihm ins Ohr.
»Er wäre mein Feind!«
»Du würdest ihn fernerhin verachten?«
»Nein. Ich kann meinen Feind wohl hassen, aber nicht verachten, wenn er es nicht wirklich verdient.«
Des Weibes Augen leuchteten auf.
»Dollamore«, flüsterte sie, »so höre denn: Ich hasse die Engländer!«
Der Inder wollte auffahren; doch das Weib umschlang ihn noch fester und hielt ihn niedergedrückt, sie presste sein Gesicht noch inniger an ihren Busen; sie fühlte, wie sein Blut kochte, wie seine Schläfen hämmerten.
»Ja, Dollamore, ich hasse die Engländer glühend, denn sie haben mir unsägliche Schmach zugefügt!«, fuhr sie hastig und leise fort. »Du aber bist ein Freund der Engländer, und dies ist der Grund, dass ich mich dir nicht hingebe. Schon lange hätte ich's getan, mich hindert nichts daran, ich kenne keine Rücksichten, wenn ich liebe, und ich liebe dich, Dollamore; aber ich kann keinem Freunde der Engländer angehören, ich darf nicht, ein Schwur hindert mich daran, und sollte ich aus unbefriedigter Liebe sterben, ich tue es nicht. Sag, Dollamore, bist du noch ein Freund der Engländer, da ich sie hasse? Sage nein, und ich gehöre dir, schon heute, jetzt und immer.«
Mit einem Ruck gelang es dem Manne, sich zu befreien. Er fasste beide Arme des Weibes, hielt es von sich ab und schaute es mit glühenden Augen an.
Die Duchesse erschrak. War sie zu weit gegangen? War schon jetzt alles verloren?
»Rosa«, stieß Dollamore mit rauer Stimme hervor, »du wurdest einst für eine Spionin Frankreichs gehalten. Hatte man recht?«
Das Weib wusste den Mann sofort richtig zu nehmen, sie blickte in sein Innerstes.
»Nein, Dollamore, es war ein falscher Verdacht.«
»Wahrhaftig?«
»Wahrhaftig, ich schwöre es bei meiner Liebe zu dir.«
Im Nu verwandelte sich das Aussehen des Inders; heller Jubel strahlte plötzlich aus seinen Augen.
»So hasst du nur die Engländer?«
»Ja«
»Aus welchem Grunde?«
»Dazu gehört eine lange Erzählung. Ich...«
»Nicht jetzt, nicht jetzt!«, jubelte Dollamore auf und riss die Geliebte an seine Brust. »Dein Feind soll mein Feind sein. Rosa, von jetzt ab bin ich nicht mehr Leutnant der Gurkhas, denn ich liebe dich; nur eine Spionin oder Verräterin könnte ich nicht lieben.«
Stürmisch umarmte und küsste er sie immer wieder, und Rosa beantwortete seine Liebkosungen mit gleichem Feuer. Sie sah sich schon so gut wie am Ziel, doch einen Trumpf musste sie noch ausspielen, und deshalb wusste sie Dollamores Begier in Schranken zu halten.
Sie vermied, noch weiter von ihrem Hasse gegen die Engländer zu sprechen; sie fragte auch nicht, ob er gegen diese kämpfen würde, denn sie war ihrer Sache jetzt sicher. Sie sprach nur von Liebe, und die Phantasie des Inders malte sich sofort die Zukunft in den buntesten Farben aus.
Schon morgen wollte er den Engländern mit kurzen Worten den Dienst kündigen und ohne Abschied die Gurkhas verlassen; denn jetzt habe er jemanden, dem sich seine ganze Neigung zuwende, eine Person, für die er nur noch lebe und da diese den Engländern nicht günstig gesinnt sei, so wolle auch er jeden Verkehr mit ihnen abbrechen.
Das Weib stimmte ihm bei und entfachte immer mehr seine Begierde, ohne diese zu befriedigen. Sie vertröstete ihn von Stunde zu Stunde.
Einmal lauschte Dollamore mit angehaltenem Atem.
»Was war das? Es klang gerade, als rasselte im Nebenzimmer ein Panzer, ich fühle mich plötzlich nach der Kaserne der Gurkhas versetzt.«
»Du weißt doch! An der Wand hängen indische Stahlschilde, und die Diener werden sie reinigen.«
»So spät noch in der Nacht?«
»Vorkehrungen zur Hochzeit, lächelte sie, »dürfen nicht aufgeschoben werden.«
»Zur Hochzeit« stöhnte Dollamore und presste die Gestalt an sich.
Mit Mühe konnte sich die Duchesse seiner erwehren, sie bereute, so leichtgekleidet bei ihm zu sein. Da erscholl draußen ein Signal, dem andere folgten. Überall in der Stadt ertönten sie. Nicht nur Dollamore, auch das Weib fuhr erschrocken zusammen.
»Großer Alarm!«, flüsterte er lauschend. »Was hat das zu bedeuten?«
Er wollte aufstehen, doch sie umschlang ihn und hielt ihn mit Aufbietung aller ihrer Kräfte fest.
»Ich muss gehen, das Signal ruft mich nach der Kaserne.«
»Es wird eine Übung sein, weiter nichts.«
»Ich muss dich verlassen, die Pflicht...«
»In unserer Hochzeitsnacht?«
»Ich komme wieder...«
»Nein, du bleibst. Dollamore, du hast meine Glut entfacht, du bleibst, ich lasse dich nicht.«
Der Mantel fiel ihr von den Schultern und Dollamore blieb.
Plötzlich knatterte eine Gewehrsalve, und unzählige folgten nach. Geheul erscholl, Waffengeklirr, ein Kanonenschuss —
Da schleuderte er das Weib von sich und sprang auf; im Nu jedoch hing sie wieder an seinem Hals; sie rangen miteinander.
»Dollamore, du bleibst, du musst bleiben!«, keuchte sie. »Was hast du mir versprochen?«
»Nichts, nichts! Ein Kampf — es ist Aufruhr — die Gurkhas warten auf ihren Führer.«
»Du dienst nicht mehr den Engländern.«
»Nein, doch wenn sie in Gefahr sind — —«
»Was dann?«
»Dann muss ich ihnen beistehen.«
»Es sind deine Feinde.«
»Ich habe ihnen Treue geschworen.«
»So hast du mich vorhin belogen.«
»Nein, ich tat's nicht. Sie sollen meine Feinde sein; doch ich stehe auch meinen Feinden bei, wenn sie durch Verrat bedroht sind.«
Unten wuchs der Lärm, das Geheul, die Salven, oben rangen die beiden, der Mann und das Weib miteinander. Da kam donnernder Hufschlag die Straße herauf; Panzer und Waffen klirrten zusammen.
»Die Gurkhas, sie wollen ihren Führer, mich!«, rief Dollamore und warf das Weib mit letzter Anstrengung auf den Diwan zurück.
Wieder sprang sie auf und hing sich an ihn.
»Ja, es sind die Gurkhas, und sie wollen nur unter deiner Führung kämpfen. So führe sie an; im Nebenzimmer liegt schon deine Rüstung, ich habe sie holen lassen, ich selbst will dich wappnen — gegen die Engländer, unsre Feinde.«
Der Reitertrupp hielt vor dem Hause. Wie erstarrt stand Dollamore vor dem dämonisch schönen Weibe.
»Nun, zauderst du? Ist dir meine Liebe nichts mehr wert? Komm, ich will dich rüsten. Höre deine Leute! Sie rufen dich; du sollst sie zum Kampf gegen die Engländer führen; Indien ist für England verloren, du bist sein Befreier, kein anderer, und ich möchte an deiner Seite deinen Triumph teilen. Auf, Dollamore, du bist ein Kriegsheld, würdig, der König von Indien genannt zu werden!«
Im Hause erscholl ein schneller, sporenklirrender Schritt, er näherte sich, die Tür ward aufgerissen, und ein gepanzerter Gurkha, ein Corporal, stürzte herein.

»Wappne dich, Leutnant!«, schrie er. »Die Sepoys meutern; das Volk steht ihnen bei, an der Spitze kämpfen Bahadur und Nana Sahib; die Festung ist in ihren Händen; die Engländer sind dem Verderben nahe, nur schwach noch ist ihr Widerstand, ganz Indien steht in Flammen der Empörung. Der Aufstand ist lange vorbereitet gewesen, das Zeichen ist heute gegeben worden.«
»Und wir haben nichts davon gewusst?«, brachte Dollamore, dessen Augen einen schrecklichen Ausdruck angenommen hatten, endlich hervor.
»Man traute uns nicht. Führe uns an, wir folgen dir.«
»Gegen wen soll ich euch führen?«
»Gegen wen?«, lachte das Weib schrill. »Gegen deine und meine Feinde natürlich! Auf, Dollamore, zaudere nicht länger! Deine Leute verlangen nach dir. Sie wollen am Tode ihrer Unterdrücker Anteil nehmen. Dort liegt die Rüstung! Ich ließ sie holen, um dich mit ihr wappnen zu können, zum Kampf gegen die Engländer.«
»So wusstest du um den Aufstand?«
»Gewiss wusste ich darum; ich half ihn mit vorbereiten, jetzt führe du ihn zu Ende, stelle dich an die Spitze.«
»Du wusstest darum!«, wiederholte Dollamore ganz leise.
Plötzlich warf er sich mit einem Satz auf das erschrockene Weib, schleuderte es auf den Diwan und presste ihm mit einer Hand die Kehle zu, die andere riss dem Gurkha den Dolch aus dem Gürtel und zückte ihn auf ihre Brust.
»Schlange«, knirschte er mit maßloser Wut, »du hast mit mir gespielt — du wusstest alles — du wolltest mich zum Meineidigen machen — Verräterin! — Spionin! — Erst stirbst du, ehe die Gurkhas die Meuterer in den Staub treten.«
Das Weib keuchte, es war dem Erstickungstode nahe. Vor ihren Augen flimmerte der zum Stoß erhobene Dolch.
»Leutnant, mach's kurz mit dem Weibsbild«, knurrte der Gurkha. »Hör, wie die Leute nach dir rufen. Führ uns an, wir wollen folgen.«
Dollamore schleuderte den Dolch von sich und richtete sich auf.
»Gegen wen?«
»Gegen wen du willst.«
»Ich helfe den Engländern.«
»Los denn, führe uns!«
Sie stürzten beide hinaus.
Noch einige Augenblicke blieb die Duchesse wie bewusstlos liegen. Dann sprang sie mit einem Wutschrei auf, schlang den Mantel um die Schulter, sodass der rechte Arm frei blieb, riss eine schwere Büchse von der Wand und stand am Fenster, den Lauf erhoben, den Kolben an der Wange.
Unten ertönte durch den Lärm des Aufruhrs das donnernde Kommando Dollamores; schon saß er auf seinem mächtigen Rappen, das Weib wunderte sich nicht, wie er sich in den wenigen Augenblicken vollständig waffnen und rüsten gekonnt hatte, sie zielte nach dem von keinem Stahl bedeckten Nacken.
»Vorwärts! Hurra für England! Nieder mit den meineidigen Rebellen!«
Die wilde Reiterschar setzte sich in Bewegung, an ihrer Spitze Dollamore, zum Kampf gegen ihre Landsleute, treu ihrem Schwur.
Der Führer war dem Tode geweiht; jetzt hatte das Visier der Büchse den tödlichen Punkt am Halse gefunden, und die Hand des Weibes zitterte nicht.
Da wurde der Lauf der Waffe hochgeschlagen, eine andere Hand drückte den Kolben mit eherner Kraft nieder.
Mit einem Wutschrei fuhr das Weib herum und stand einem Mädchen gegenüber, in einer noch dichteren Stahlumhüllung als die Gukghas sie trugen. Ein Schuppenpanzer bedeckte Arme, Brust und Rücken, er machte jede Bewegung des schlanken Körpers mit, ja, er folgte den Atemzügen des jungfräulichen Busens. Ebenso erblickte man unter dem bis zu den Knien reichenden, weißen Rock Stahlschienen; vom Kopf, auf dem der Helm mit ungeheuerlichem Schmuck saß, bis herab zu den Füßen war das kriegerische Weib in Stahl gehüllt; selbst die Hände wurden von ihm geschützt.

Sie stützte sich mit der einen Hand auf das lange, entblößte Schwert, die andere drückte noch das Gewehr nieder.
Die beiden sahen sich einen Augenblick fest in die Augen; aus denen der Duchesse sprachen Hass und Wut.
»Die Begum!«, murmelte sie. »Was hinderst du mich, den zu töten, den ich hasse?«
»So war deine Liebe nur Heuchelei?«, erklang es scharf.
»Ich liebe ihn nicht mehr. Lass mich, noch kann ihn meine Kugel erreichen!«
»Warum willst du ihn töten?«
»Er ist unser Feind.«
»So wollen wir mit ihm kämpfen.«
»Er führt die Gurkhas gegen uns an.«
»So ist er treu. Herunter mit dem Gewehr; er ist mehr wert, als durch die Kugel eines hinterlistigen Weibes heimtückisch ermordet zu werden. Kämpfe mit ihm, wenn du ihn hasst, sieh ihm dabei ins Auge, wie ich es tun werde.«
Das Weib schien plötzlich alle Kraft zu verlassen, es knickte wie gebrochen zusammen und glitt auf den Teppich. Es sah nicht mehr, wie das kriegerische Mädchen hinauseilte.
»Ich — muss mich — mit meiner Rache — beeilen«, hauchte die am Boden Liegende, welche plötzlich die Züge und Haltung, das ganze Aussehen einer Greisin angenommen hatte, »sonst kommt sie — zu spät. Dollamore hat sich — gerächt, ohne dass er es — wusste. Er hat mir eine — furchtbare — Prophezeiung hinterlassen.«
Während draußen unter Gewehrsalven und Kanonendonner der heftigste Kampf tobte, schrie das auf dem Teppich liegende Weib unausgesetzt nach Mirzi, unfähig, sich selbst zu erheben, und ebenso auch geistig kraftlos, denn sie wusste nicht einmal, dass die Dienerin nicht im Hause war.
Es dauerte lange, ehe ein anderes Mädchen erschien und der Herrin das Verlangte brachte, und während dieser Zeit glaubte das Weib sterben zu müssen.
Es sei nur kurz erwähnt, dass es den englischen in Delhi liegenden Truppen gelungen war, sich mit Hilfe einiger weniger Sepoys, die treu geblieben, und ganz besonders infolge der energischen Unterstützung der Gurkhas sich durch die Feinde zu schlagen und die Stadt zu verlassen. Denn nur draußen lag für sie Rettung, die Stadt glich einer Mördergrube.
Die Verluste waren natürlich sehr groß gewesen. An Zahl betrugen die übrig gebliebenen Engländer und Sepoys einschließlich der Gurkhas etwa 4000 Mann, angeschlossen hatten sich ihnen Privatleute mit Weibern und Kindern; die nicht das Freie erlangten, erlitten zwischen den Mauern unrettbar den Tod, wenigstens im Anfang; später wurden sie geschont, gefangen genommen und herdenweise durch die Straßen getrieben.
Die Geretteten waren, mit Ausnahme der Gurkhas, in der ganzen Umgegend zerstreut und hielten sich wie wilde Tiere in den Dschungeln, Sümpfen, Schluchten und Wäldern versteckt. Wohin sie blickten, sahen sie die Feuer der Rebellion auflodern, und lieber suchten sie Schutz bei Panthern und Tigern, als bei den ihre Ketten abschüttelnden Indern.
Vorläufig wurden die Flüchtlinge nur von besonders Blutdürstigen verfolgt, deren sie sich noch erwehren konnten; aber schon berieten die Radschas in der Stadt mit aller Ruhe, wie man auf die durch Zufall Entkommenen eine erfolgreiche Treibjagd abhalten wolle.
Schon jetzt sei gesagt, dass diese auch wirklich stattfand. Vergebens versuchten sich die Zerstreuten zum vereinigten Widerstand zu sammeln, es gelang ihnen erst nach drei Wochen, als General Nicholson, sich selbst aufopfernd, mit 13 000 Mann, meist schlecht bewaffneten Indern, den Bedrängten zu Hilfe eilte, waren doch unter den wie Raubtiere Gejagten die höchsten Offiziere, ja, der Generalgouverneur selbst.
Doch auch dann noch war das Ganze nichts weiter als ein verzweifelter Ringkampf, bei dem jede List und Hinterlist erlaubt war. Es galt, sein Leben zu retten und das der Familie, wenn diese nicht schon ermordet war. —
Während die blutdürstigen Horden durch die Straßen Delhis zogen, nicht an Plünderung denkend, sondern nur nach Europäern suchend und diese dann, erkannte man in ihnen Engländer, mordend, fand in einer weiten Halle des halbzerfallenen Palastes Schahlimar eine Versammlung der Häuptlinge statt.
Fackeln beleuchteten die wilden Gestalten mit den bronzenen Gesichtern und lang herabhängenden Schnurrbärten, alle bis an die Zähne bewaffnet, meistenteils in Stahl gehüllt. Rüstungen, die Waffen starrten von Blut; auch die Anführer hatten ihr Leben nicht geschont, um sich im Blute der Tyrannen baden zu können.
In der Mitte des Kreises der Krieger stützte sich die Begum von Dschansi auf einen Tisch, auf dem ein großes Stück weißes Leder lag mit der in groben Strichen gezeichneten Karte von Indien. Zur anderen Seite des Tisches lehnten Bahadur und Nana Sahib; hinter der Begum stand die vollständig verhüllte Gestalt eines kleinen Mannes, dessen Augen man nur wie glühende Kohlen rastlos im Kreise herumwandern sah.
Man lauschte dem Berichte eines Mannes, seinem Schmuck nach ein Radscha, der in Mirat den Aufstand der Sepoys geleitet hatte. Er selbst war Kommandeur derselben gewesen; er hatte die Macht, die ihm die arglosen Engländer noch gelassen, in furchtbarer Weise missbraucht.
Wild und freudig leuchteten die Augen der Zuhörer auf, als der Erzähler damit schloss, dass kein einziger Engländer dem Schwert der Inder entgangen sei.
Der Mann schwieg, und aller Augen richteten sich nicht nach dem Großmogul, dem höchsten Fürsten Indiens, sondern nach dem geharnischten Mädchen, diesem hatte auch offenbar der Bericht gegolten.
»Wohin hast du die Frauen und Kinder bringen lassen?«, fragte das Mädchen jetzt.
Der Mann blickte die Fragerin verwundert an und zuckte leicht die Achseln, schwieg aber.
»Wo sind die Weiber und Kinder?«, erklang es abermals, diesmal eindringlicher.
Es erfolgte keine Antwort. Wie höhnisch blickte der Gefragte im Kreise umher; überall begegnete er spöttischen Gesichtern, und so sahen auch Bahadur und Nana Sahib aus.
»Hast du meinen Befehl erhalten?«, fragte die Begum weiter.
»Ich habe ihn erhalten.«
»Noch ehe der Aufstand losbrach?«
»Ja, noch ehe ich den Befehl dazu gab.«
»Gut! Ich hieß dich, die Frauen und Kinder zu schonen, sie unter deinen besonderen Schutz zu nehmen. Also frage ich dich nochmals, zum letzten Male. Wo sind die Frauen und Kinder, dass sie uns als Geiseln dienen?«
Dröhnend fiel die stahlgepanzerte Hand des Mädchens auf den Tisch, dass alle erschrocken zusammenfuhren.
Der Radscha aus Mirat war am bestürztesten. Nochmals wanderte sein Blick im Kreise umher; doch als er überall leises Kopfnicken sah, richtete er sich wieder auf. Er nahm eine trotzige Miene an.
»Wozu brauchen wir Geiseln?«, fragte er gleichgültig.
»Das habe ich zu bestimmen, nicht du. Wo sind die, welche ich unter deinen Schutz stellte?«
»Begum«, antwortete der Radscha, den Blick auf Bahadur gerichtet, »ich konnte deinem Befehl nicht nachkommen. Die Inder forderten Rache, sie wollten Blut sehen. Wie ich schon sagte, kein einziger Engländer entkam dem Tode.«
»Nun ja, aber ihre Frauen, ihre Kinder?«
»So will ich es dir sagen«, fuhr der Mann, hochaufgerichtet, trotzig fort, »die Inder forderten auch das Blut der Frauen und Kinder, nachdem ich diese schon in Sicherheit gebracht hatte, und da haben sie dieselben auf einen Platz getrieben und sind mit Schwertern und Dolchen über sie hergefallen, und ihr Jammern und Zetergeschrei war Musik für mein Ohr, wie für das jedes Inders.«
Eine lange Pause trat ein; die Begum blickte mit gesenkten Augen vor sich hin, ihr Busen arbeitete heftig.
»So hast du meinem Befehle nicht gehorcht«, sagte sie dann leise.
»Es tut mir leid, wenn ich dadurch deinen Zorn erregt habe«, entgegnete der Radscha achselzuckend. »Ich konnte meine Leute nicht davon abhalten; sie zwangen mich förmlich dazu, selbst an dem Gemetzel teilzunehmen, und, bei der Kali, der wir dienen, es hat mich ergötzt.«
»Du kannst deine Leute nicht im Zaume halten?«, sagte das Mädchen mit schneidender Stimme. »Du lässt dich von ihnen zu etwas zwingen, was gegen meinen Willen ist? Du suchst deinen Ungehorsam mit so etwas zu entschuldigen?«
»Begum, wir kämpfen für die Freiheit Indiens, nicht für dich«, rief der Radscha stolz.
»Nimm deinen Häuptlingsschmuck vom Helm, ich enthebe dich hiermit deiner Stelle als Anführer.«
Eine Bewegung entstand unter den Zuhörern; der Radscha aber lachte wild auf und trat, die Hand am Schwertgriff, einen Schritt auf das Mädchen zu.
»Du? Mich?«, rief er höhnisch.
Diese zwei Worte waren noch nicht im weiten Saale verschollen, als schneller, als das Auge ihr folgen konnte, die hinter dem Mädchen stehende kleine Gestalt hervorsprang; wie ein Blitzstrahl sauste ein kleines, krummes Schwert durch die Luft, und Rumpf und Kopf des Radschas fielen blutend als zwei Teile zu Boden.
Todesstille herrschte im Saale; niemand wagte zu atmen. Ruhig ging der Kleine an seinen Platz zurück, das Schwert in seiner Hand verschwand spurlos, wie es erschienen war, und ebenso gleichgültig wie vorhin kreuzte er die Arme über der Brust, als ob nichts geschehen wäre.
Bahadur war der erste, der Leben und Sprache wieder fand.
»So geschehe jedem, welcher sich der Begum von Indien ungehorsam zeigt!«, rief er und gab dem kopflosen Leichnam einen verächtlichen Stoß mit dem Fuß.
Auf seinen Wink kamen Kulis und trugen die Leiche hinaus.
»Hast du schon gesorgt, dass Frauen und Kinder in Delhi verschont werden?«, wandte sich das Mädchen an Bahadur.
»Ich habe es befohlen, und wehe dem, der diesen Befehl übertritt«, war die demütige Antwort.
»Ich sah mit meinen Augen, wie manche Weiber unter den Schwertern der Inder starben.«
»So werden die Ungehorsamen desselben Todes sterben. Was hat die Begum uns sonst noch zu befehlen?«
»Wie hat man die Kranken in dem großen, roten Hause behandelt?«
Ein anderer Heerführer trat vor.
»So, wie du befohlen. Ich habe sie vorläufig schonen lassen. Im Dach des Hauses entstand Brand, ich ließ ihn löschen.«
»Gut, sie werden darin bleiben und von den englischen Mädchen weiter gepflegt werden.«
»Bedenke, Begum, es sind Männer, meist englische Soldaten!«
»Haben die Engländer nicht den Ärmsten unserer braunen Brüder in jenes Haus aufgenommen und ihn unentgeltlich gepflegt?«
»Es ist wahr.«
»So wollen wir uns nicht durch sie beschämen lassen. Sie bleiben, bis sie gesund sind.«
»Und dann?«
»Dann mögen sie gehen und gegen uns kämpfen. Wehe dem, der einem der Kranken ein Haar krümmt, der sich einer der englischen Krankenpflegerinnen gegenüber als Herr aufspielt.«
»So willst du, dass wir die verwundeten Engländer auch noch liebevoll pflegen?«, fragte Nana Sahib scharf.
»Ich habe vorhin gesehen, wie die Inder dafür sorgen, dass auch die Verwundeten nicht am Leben bleiben. Was willst du mehr?«
Neue Anführer kamen herein, mit Blut und Schmutz bedeckt, viele zeigten klaffende oder schlecht verbundene Wunden.
»Radscha Madhava«, rief die Begum lebhaft, »du kommst vom Fort Oliver! Was hast du ausgerichtet?«
»Sehr wenig«, entgegnete der Anführer, der sich kaum noch aufrecht halten konnte, niedergeschlagen, »die Häuptlinge der Engländer sind uns entgangen.«
Ein unwilliges Murmeln entstand; nur das Mädchen behielt seine Ruhe.
»Vorläufig! Sie fallen uns doch noch in die Hände. Was macht das uns? Keine Entmutigung deswegen! Erzähle! Wie kam es, dass sie euch entgingen?«
»Die Gurkhas, Dollamore!«, rief ein anderer; ein Wink der Begum gebot ihm Schweigen.
»Sie wollten sich uns, wie du erwartet hast, nicht ergeben. Wir durften noch nicht angreifen, denn das Signal war noch nicht gegeben. Dann kam es eher, als wir dachten.«
»Ich weiß es. Weiter!«
»Wir stürmten. In fünf Minuten wären sie unser gewesen, da aber führte der verräterische Hund Dollamore seine Gurkhas gegen uns. Wie eine Wetterwolke kamen sie angebraust, und da wir nur wenige Gewehre besaßen, wurden wir im Nu überritten. Die Engländer im Fort fielen aus, und sie entgingen uns...«
»Wie? Ihr vielen Tausende konntet nichts gegen sie ausrichten? Wie eine Herde Schafe ließt ihr euch zurücktreiben?«
»Ja, wenn Dollamore weiter vorgedrungen wäre, dann hätten wir sie zermalmt. Aber er war schlau, er begnügte sich damit, das Fort befreit zu haben und deckte mit seinen Leuten ihren Rückzug. Folgen konnten wir ihnen nicht; nur wenn wir sie umzingelt hätten, konnten wir sie überwältigen, doch Sümpfe und Dschungel hinderten uns daran, und zum Fernkampf fehlten uns Gewehre. Wir haben schwere Verluste gehabt, die der Gurkhas sind nur klein.«
»Wir wollen für die Freiheit sterben, nicht im freien Indien leben. Wer fiel von den Engländern?«
»Wir fanden keine einzige Leiche, da wir mit blanken Waffen angegriffen hatten, wie du befahlst, sie dagegen schossen.«
»Die Frauen und Kinder?«
»Sind in unserer Gewalt.«
»Ah, wie kam das?«
»Ein unterirdischer Weg wurde uns verraten, der in den Keller führte. Im letzten Augenblick, als die Gurkhas kamen, benutzten wir ihn und fanden im Keller die Frauen und Mädchen.«
»Die Knaben?«
»Sie hatten mit gekämpft und sind ebenfalls geflohen.«
»Wo sind die Gefangenen?«
»Auf dem Wege hierher.«
»Ich will sie sehen.«
»Nur ein Weib ist uns im Anfang entflohen. Sie war nicht gefesselt; in einer leeren Straße wandte sie sich zur Flucht und war so schnellfüßig, dass sie entkam. Was hilft es ihr? Sie kann nicht heraus aus Delhi und wird doch wieder gefangen, wenn nicht getötet.«
»Wer war sie?«
»Wie soll ich sie kennen?«
»Ein Weib oder ein Mädchen?«
»Ein junges Mädchen noch.«
Die Anführerin blickte eine Weile sinnend vor sich hin, fuhr träumerisch mit der Hand über die Augen und fragte dann weiter:
»Trugst du den Engländern in meinem Namen an, dass Frauen und Kinder freien Abzug hätten?«
»Ja; man glaubte mir nicht, man verspottete mich sogar deshalb.«
»Warum?«, fragte sie mit gerunzelter Stirn.
»Von Mirat war ein englischer Offizier entkommen, er schlich sich durch unsere Reihen, eine ihm nachgeschickte Kugel ging fehl, sie schlug dem Gouverneur das Glas aus der Hand; der Bote gelangte ins Haus und teilte jenen mit, dass in Mirat Frauen und Kinder niedergemetzelt seien.«
Das Mädchen stampfte zornig mit dem Fuße die Erde.
»Und die indischen Diener?«, forschte sie weiter.
»Sie benutzten natürlich den gebotenen freien Abzug und...«
»Sind sie durchsucht worden?«
»Ja, bis auf einen, und nun wollte ich auf diesen einen zu sprechen kommen. Du unterbrachst mich.«
»So sprich.«
»Es dauerte lange, ehe der letzte, der vierzehnte, das Haus verließ, und als wir ihn untersuchen wollten, weigerte er sich. Er sei ein Brahmane.«
»Was?«, rief die Begum erstaunt, und Zeichen des Erstaunens machten sich auch unter den anderen Zuhörern bemerkbar.
»Er sei ein Brahmane«, wiederholte der Erzähler, »aber wir glaubten ihm nicht; wir wollten Gewalt anwenden, da jedoch kam ein alter, uns bekannter, ehrwürdiger Brahmane hinzu; er forschte den für einen Brahmanen noch sehr, sehr jungen Mann aus und musste dessen Aussagen bestätigen.«
Aus dem Kreis trat ein alter Mann mit weißem Bart und Haar, sehr ärmlich gekleidet, und näherte sich ohne Ehrfurchtsbezeugung dem Mädchen; dagegen machten die Umstehenden ihm ehrfurchtsvoll Platz.
»Er sprach die Wahrheit«, begann der Alte mit ruhiger, tiefer Stimme, »und ein Tor ist, wer das nicht für Wahrheit hält, was Buddha uns lehrt. Urteile nicht nach dem Aussehen, noch nach dem Alter, du würdest dich immer wieder täuschen; denn die unscheinbarste Schale enthält den süßesten Kern, und würde er mit dem Alter immer besser, so gäbe es keine hohlen Nüsse. Verstehst du, meine Tochter, was Buddha mit diesem sagen will?«
»Ich verstehe es. Gibt es doch auch Kinder mit dem Geist eines Alten und Alte mit kindischem Geist. Ist dieser junge Brahmane hier?«
»Du kannst ihn sehen, doch ehe du ihn siehst, höre meine Worte, damit du glaubst, dass er ein Brahmane ist.«
»Woraus hast du dies geschlossen?«
»Weil er das weiß, was nur ein Brahmane wissen darf und kann; denn wem stehen die Bücher offen? Wer als die Weisen gibt sich die Mühe, sie zu lesen und dazu erst viele, viele Sprachen zu lernen? Dieser Mann aber wusste viel mehr als ich, ich bin ihm gegenüber an Wissen ein Kind. Er antwortete mir im reinsten Sanskrit, wie Buddha es nicht besser gesprochen haben kann; er kannte die heiligen Formeln, er kannte die Entstehung der Welt, ihre Vernichtung und ihre Wiedergeburt, er zitierte alle Stellen der Veden, des Oupnekhats, des Foe-Kueki und alle anderen heiligen Bücher und Schriftsteller, nicht nur der buddhistischen, die ich von ihm zu wissen begehrte, immer wörtlich im Urtext, ja, er kann den ganzen Daraschakoh auf persisch auswendig und die Stellen richtig auslegen. Ist dies kein Brahmane? Wer darf es wagen, ihn anzutasten?«
»Wie aber kommt ein Brahmane nach Fort Oliver? Was hat er dort zu suchen?«
»Er war als Diener dort.«
»Nicht möglich.«
»Er sagte es, und ich muss es ihm glauben. Brahma gibt uns seinen Willen in der Anschauung zu erkennen, und wir gehorchen. Sagt er: ›Erniedrige dich und diene‹, so tun wir es; denn niemand ist so hochgestellt, dass er nicht dienen muss.«
»Du kennst ihn nicht?«
»Wer kennt alle Brahmanen, die in der Einsamkeit leben und nur zuzeiten sich sehen lassen?«
»Wie alt schätzt du ihn?«
»Nach menschlichen Begriffen höchstens fünfundzwanzig Jahre, doch wer Brahma sehen kann, der bleibt ewig jung.«
»Wie, fünfundzwanzig Jahre? Den muss ich kennen lernen.«
Der Kreis teilte sich, und ein junger Inder, ärmlich gekleidet, trat langsam hervor. Er achtete nicht der Umstehenden, seine Augen hingen unverwandt an dem Mädchen.
Dieses musterte ihn mit Interesse; aber plötzlich drückte sich in ihren Zügen erst namenloses Erstaunen aus, welches darauf in Verwirrung überging. Um dieses zu verbergen, wandte sie sich an Bahadur und flüsterte mit ihm.
Dieser, der selbst zum Brahmanen bestimmt gewesen war, nickte.
Als sich das Mädchen dem jungen Inder wieder zukehrte, war ihr Antlitz kalt wie zuerst.
»Du bist Brahmane?«, forschte sie.
»Du sagst es.«
»Und warst Diener bei Captain Atkins? Das ist seltsam!«
»Brahma wollte es so.«
»Wie heißt du?«
»Bodhisatwa.«
»Bodhisattva? Fürwahr, ein stolzer Name. So hieß Buddha, ehe er ein Weiser(*) wurde.«
(*) Buddha = Weiser.
»Ich bin nicht weit davon entfernt, ein Buddha zu werden.«
Das war eine anmaßende Behauptung und rief Aufsehen unter den Umstehenden hervor. Mit diesen Worten erklärte der junge Inder, dass er bald Anbetung verlangen könne.
»Du bist sehr stolz«, fuhr Begum fort.
»Ich habe Grund dazu.«
»Weißt du, dass ich befohlen habe, jeden der abziehenden Diener nach etwaigen Schreiben zu durchsuchen?«
»Was kümmert mich dein Befehl! Wer will's wagen, einen Brahmanen zu durchsuchen?«

»Oho! Weißt du, wer ich bin?«
»Ein erbärmlicher, aus Erde gemachter Mensch, der nichts ist, wenn er nicht Brahmas Wesen erkannt.«
»Du irrst, ich bin kein gewöhnlicher Mensch. Ich bin die Tochter Sewadschis und der Kali.«
Ein beifälliges Murmeln ward laut, der Inder dagegen stieß ein verächtliches Lachen aus.
»So bist du also das fremde Mädchen, von dem ich schon gehört habe? O, Inder, Inder, welche Torheit, dies zu glauben! Wie kann Sewadschi, ein Mensch, mit einer Göttin ein Kind im Nirwana zeugen, obwohl doch eben das Nirwana jener Zustand ist, wo man die Gefühle der verlangenden Liebe nicht kennt, der stets Schmerzen folgen müssen. Bist du wirklich dieses Kind, dann gibt es auch kein Nirwana, behaupte ich, dann ist auch dieses Lug und Trug.«
Glaubte der junge Weise, durch diese Worte die Radschas aus einem Wahn zu reißen, so hatte er sich getäuscht; ein Sturm der Entrüstung brach vielmehr los, und das Leben des Brahmanen hing an einem Haar.
»Hund, das wagst du zu sagen?«, schrie Nana Sahib, riss das Schwert aus der Scheide und stürzte auf den Brahmanen zu.
Da warf sich zwischen beide die Begum, sie wollte den heiligen Brahmanen mit dem eigenen Leib decken; denn das Schwert zu ziehen, um den herabsausenden Schlag abzunehmen, war nicht mehr möglich.
Doch das Schwert berührte nicht einmal ihre Helmspitze, es fiel auf den Arm des kleinen, vermummten Mannes, und als wäre es ein Glasrohr gewesen, so fiel es zersplittert zu Boden; Nana Sahib behielt nur das Heft in der Hand.
»Verflucht sei, wer einem Brahmanen auch nur ein Haar krümmt!«, zürnte der Kleine den erschrockenen Radscha an, der darüber aufs Höchste bestürzt war, dass sein Schwert, welches sonst jeden Panzer durchdrang, am Arm dieses Mannes zersplittern konnte.
Die Ruhe war bald wiederhergestellt. Aller Augen folgten scheu und ehrfurchtsvoll der kleinen Gestalt, die gelassen an ihren alten Platz zurückging. Ebenso gleichmütig stand der junge Inder vor dem Mädchen.
»Du bist Brahmane, ich glaube es, besonders infolge der Aussage des Alten«, begann Begum dann, »und so darf man dich allerdings nicht untersuchen. Willst du uns nicht selbst das Zeichen sehen lassen, welches du am linken Arm tragen musst?«
»Nein!«
»Hast du Briefschaften bei dir, die dir vielleicht vom Captain Atkins oder vom General Broke oder von dem General-Gouverneur als ganz unschuldig gegeben wurden?«
»Ich verweigere jede Auskunft. Ihr alle habt nicht einmal das Recht, mich zu fragen.«
»Nun gut, wenn wir dieses nicht haben, so haben wir doch das Recht, dich in Gewahrsam zu halten, damit du, wenn dir Papiere anvertraut sind, sie nicht in unrechte Hände gelangen lassen kannst. Es ist dem Brahmanen ja ganz gleich, wo er sich befindet, wenn er sich nur in stille Beschauungen versenken kann!«
»Du sagst es; im Kerker würde mir ebenso wohl wie im freien Walde sein, jedenfalls bin ich dort lieber als in der Gesellschaft dieser Menschen, die von Blut starren.«
»So bist du mein Gefangener.«
Der Brahmane wurde nicht gefesselt, auch nicht bewacht, denn ein Fluchtversuch wäre seiner ganz unwürdig gewesen, so etwas hielt gar niemand für möglich, und außerdem wäre es sehr leicht gewesen, ihn wieder zu fangen.
Ein anderer Krieger kam und meldete, die im Fort Oliver gefangenen Frauen ständen vor der Tür.
Alle begaben sich hinaus, auch der Brahmane.
Da standen dreizehn Frauen und Mädchen und schauten mit entsetzten Blicken die blutigen Gestalten an; auch der Anblick des in Stahl gehüllten Mädchens, das hier zu befehlen hatte, konnte sie nicht trösten. Unter diesem Panzer konnte kein gefühlvolles Herz schlagen.
Besonders eine, eine schöne Frau von vielleicht fünfunddreißig Jahren, betrachtete mit mehr Erstaunen als Furcht die Begum, und ebenso ließ diese lange ihre Augen auf ihr ruhen.
Darauf wendete sie langsam den Kopf und blickte fest den jungen Brahmanen an, der, wie es schien, ein gleichgültiges Gesicht aufzusetzen suchte, was ihm indes kaum gelang. Überraschung und Schrecken spiegelten sich darin wider.
Um sein Gesicht verbergen zu können, trat er zu einem Pferd, welches neben der Tür angebunden war, und streichelte liebkosend den schlanken, edel gebogenen Hals.
Es war ein herrliches Tier, ein Falbe, so zierlich gebaut wie ein Windspiel, die Fesseln dünn zum Umspannen, aber doch wie aus Stahldraht. Der kleinste Muskel trat wie gemeißelt aus dem schlanken Körper hervor, die eingefallenen Weichen konnten die Schönheit des Tieres nicht entstellen.
Das Tier wendete den klugen Kopf nach der Begum, als der fremde Mann ihm den Hals klopfte, und plötzlich stand diese neben dem Brahmanen. Sie beschäftigte sich mit dem prachtvollen Sattel, es war fast, als zöge sie unter der Purpurdecke einen Gegenstand hervor und steckte ihn zu sich.
»Merkwürdig«, murmelte sie dabei, für den Brahmanen bestimmt, »dein Name ist Bodhisattva, und mein Pferd habe ich Kantakana genannt. Wie sagt Bodhisattva, als er zum letzten Male sein Pferd satteln lässt, um aus der väterlichen Residenz in die Wüste zu fliehen?«
»Ich sehe, auch du bist in den Büchern des Foe-Kueki bewandert«, entgegnete der Brahmane. »Bodhisattva sagte: nur diesmal noch, o, Kantakana, trage mich von hinnen, und wenn ich werde Buddha geworden sein, werde ich deiner nicht vergessen!«
Das Mädchen streichelte noch einmal das Tier und ging dann zu den Genossen zurück, den Brahmanen beim Pferd lassend.
Durch die Straßen zogen nicht mehr die die Häuser absuchenden Inder; überall erklangen Hornsignale und sammelten die Krieger, denn beim ersten Morgengrauen sollte die Treibjagd auf die Entkommenen beginnen. Die Straßen waren daher nicht mehr mit Menschen überfüllt.
»Welches Tor hast du für die Boten bestimmt, Nana Sahib?«, fragte die Begum.
»Das vierte Tor.«
»Wie ist dort das Losungswort?«
»Upanischad.«
Das Mädchen hielt die Hand über die Augen und spähte in die Ferne.
»Seht ihr den roten Schein am Horizont? In welcher Gegend mag es brennen?«
Alle schauten dienstbeflissen nach der bezeichneten Richtung.
In diesem Augenblick erscholl hinter ihnen ein leichter, flüchtiger Hufschlag; blitzschnell wandten sie sich um und konnten eben noch sehen, dass der Falbe wie ein Pfeil davon schoss, und der im Sattel saß, war niemand anderes als der junge Brahmane.
Aber nicht allein, dass er entfloh — als er an den gefangenen Frauen vorbeikam, bückte er sich, ein Ruck, und die ihm Zunächststehende lag vor ihm im Sattel.
Nana Sahib war der einzige, welcher die Geistesgegenwart nicht verlor. Er riss sein Pistol aus dem Gürtel und hob es, den Reiter herabzuschießen.
Wieder aber wurde ihm die Waffe von dem Arm des kleinen Mannes in die Höhe geschlagen, der Schuss ging in die Luft.
»O, meine schöne Falbe, meine treue Kantakana, er hat sie geraubt!«, brach das Mädchen in Jammern aus.
»Was hinderst du mich, den Räuber vom Pferd zu schießen?«, fuhr Nana Sahib auf.
»Er ist ein Brahmane«, entgegnete der Kleine. »Ich möchte deine Hand von seinem Blute reinhalten.«
»Ein Schurke, ein Spion war er, kein Brahmane!«
»So? Und wie kommt es, dass ihn dieses Tier nicht abwirft? Du selbst, der du dich als den besten Reiter Indiens rühmst, kannst Kantakana nicht reiten, weil sie keinen anderen als ihre Herrin auf ihrem empfindlichen Rücken duldet. Doch willig folgt sie dem Brahmanen, sie fühlt an seiner Hand, dass er der Herr alles Lebendigen ist.«
»Aber meine Kantakana«, rief die Begum, »sie ist mir verlorengegangen, und wie finde ich ein solches Ross wieder?«
Da trat der Verhüllte zu ihr.
»Begum, du kannst mich nicht täuschen«, raunte er ihr zu, »nicht du allein, auch ich habe diesen jungen Brahmanen wieder erkannt. Verlange nicht das Unmögliche von mir.«
Der Zug der gefangenen Frauen, zu denen noch andere hinzugekommen waren, musste sich ordnen und wurde von der Begum selbst begleitet.
Kaum waren sie fort, als sich durch die Reihen der immer mehr anwachsenden Anführer ein alter Mann durchdrängte, schwatzend und gestikulierend; und überall machte man ihm halb mit Ärger, halb mit Abscheu Platz.
»Wo ist der Mann«, rief der Alte mit der größten Zungengeläufigkeit, »der allwissend ist wie der Gott meiner Väter, der Blitze schleudern kann, und dem keine Waffe etwas schadet, als wäre sein Körper von Stahl und Eisen zusammengeschweißt, der die Stärke eines Simson besitzt, vor dem sich die Mächtigsten beugen, und der doch manchmal den alten Sedrack besucht, um mit ihm zu sprechen heimlich im Vertrauen...«
»Suchst du mich«, redete ihn der kleine Vermummte schnell an, »so schweige, oder ich stopfe dir den Mund. Was willst du, Jude?«
Dieser flüsterte ihm etwas zu, und sofort wurde er abseits geführt. Aufmerksam hörte ihm der Kleine zu.
»So liegt er noch in deinem Hause?«, fragte er dann.
»Werde ich doch nicht ausstoßen, solch einen schönen, jungen Mann, weiß ich doch auch, was wert ist euch sein Leben, und wird man mir doch auch bezahlen meine Pflege.«
»Schwer verwundet?«
»Der alte Sedrack würde daran sterben, dem jungen Blut schadet's so viel, als wenn ich mich ritze mit einer Stecknadel. Lass ihn nur pflegen durch Mirja, in drei Tagen ist er gesund wie ein Fisch und wird wieder nehmen das Schwert, abzuschlagen den Indern die braunen Köpfe.«
Der Kleine brachte ein Pergamentpapier zum Vorschein und drückte darauf in der hohlen Hand einen Stempel.
»Hier hast du Sicherheit für dein Haus. Aber wehe dir, Jude, wenn du mich belogen hast und du unseren Feind nur beherbergst, um Geld von mir zu erpressen.«
»Beim Gott meiner Väter, ich spreche die Wahrheit, und du weißt, Mächtigster der Mächtigen, der alte Sedrack ist nicht geldgierig, sonst wäre er nicht so arm und...«
»Geh! Ich selbst komme dann, mich zu überzeugen, und finde ich einen anderen vor als den Betreffenden, so lasse ich dir dein Haus überm Kopf anzünden.«
»Und ich sollte mit ihm verbrennen?«
»Ja. Es würde dir auch nichts nützen, wolltest du dich in deinem selbst gegrabenen Keller verstecken.«
Der Jude sank vor Schreck bald in die Knie, raffte sich jedoch alsbald auf und floh, wie von Furien gepeitscht, davon.
Der Kleine rief Bahadur und Nana Sahib zu sich, alle drei entfernten sich weit von den anderen.
Die beiden Anführer horchten hoch auf, als ihnen der Kleine mit kurzen Worten etwas erzählte.
»So muss die Begum sofort hin«, riefen beide wie aus einem Munde.
Abwehrend hob der Kleine die Hand.
»Zu spät!«, sagte er. »Dafür ist die Begum verloren.«
»Wie, sie ginge nicht mehr darauf ein?«
»Nein. Ihr könnt die Frauen nur so weit beurteilen, wie ihr sie in euren Harems kennen lernt, doch es gibt auch andere. Die Begum wird sich nicht zu der Rolle hergeben, für die wir sie bestimmt haben.«
»Aber was dann?«, riefen beide bestürzt.
»Ich wüsste einen Rat«, entgegnete der Kleine sinnend; »ich kenne ein Mädchen, eine Bajadere, welche — hm — Bahadur, du bist der Schutzherr von Vishnus Tempel.«
»Ich bin's.«
»Wie heißt das Mischblut, jene Bajadere von unbekannter Herkunft?«
»Kalidasa.«
»Richtig, Kalidasa.«
»Kalidasa, wahrhaftig«, rief Nana Sahib lebhaft. »Sinkolin, ich durchschaue deinen Plan, er ist gut und wird zum Ziele führen. Ich kenne sie, sie sieht der Begum zum Verwechseln ähnlich.«
»Zu spät«, sagte Bahadur, »Kalidasa wird beim Anbruch der Morgenröte auf Shivas Scheiterhaufen geopfert worden sein.«
»Du irrst!«, rief Sinkolin. »Du meinst Sakuntala, die sich weigerte, unter den Rädern des Götterwagens zu sterben.«
»Nein, ich meine Kalidasa; sie stirbt in Gemeinschaft mit Sakuntala, ich selbst habe das von den Priestern mir vorgelegte Todesurteil unterschrieben. Sakuntala war einstweilen gefangen gesetzt worden, und da hat Kalidasa versucht, die Freundin zu befreien. Sie wurde dabei ertappt, und nun sterben beide Freundinnen gemeinsam auf dem Scheiterhaufen. Wohin, Sinkolin?«
»Kalidasas Tod vereiteln, wenn es noch möglich ist.«
»Du kannst es nicht, du beleidigst die Priester.«
»Und sollte ich sie dazu zwingen, sie müssen Kalidasa freigeben, ich brauche sie!«
»So nimm wenigstens meine Vollmacht mit!«
»Es dauert mir zu lange, jede Minute ist kostbar!«
Der Vermummte eilte davon, die beiden Zurückbleibenden schauten ihm nach.
»Gelingt es ihm, das Mädchen zu befreien«, sagte Nana Sahib leise, »so haben wir von nun an zwei Begums statt einer. Hahaha, es wird immer besser!«
»Diese neue haben wir nicht zu fürchten, desto mehr die andere«, entgegnete Bahadur.
»Auf, Nana Sahib, stelle die Anführer an zur Jagd auf die Entkommenen, es soll ein lustiges Treiben werden!«
Am stillsten während dieser Schreckensnacht ging es im mohammedanischen Viertel Delhis zu. Die meisten Bewohner desselben hatten sich allerdings dem Aufstande angeschlossen, sie waren ja auch Söhne Indiens und hassten die Unterdrücker des Vaterlandes, da sie aber Mohammedaner waren, so sorgten sie nach der Lehre ihrer Religion dafür, dass ihre Weiber möglichst wenig davon zu hören bekamen. Nana Sahib, selbst Mohammedaner, hatte den Befehl gegeben, möglichst die Straßen des mohammedanischen Viertels zu verschonen, und man war ihm nachgekommen.
Nur ab und zu streifte eine Bande bewaffneter Inder durch die Straßen, nach Flüchtlingen spähend. Ein Durchsuchen der Häuser fand nicht statt, einmal, weil die Haremsweiber dadurch beleidigt worden wären, und dann, weil in diese Häuser Fremde überhaupt keinen Einlass fanden, und wären sie auch in noch so großer Gefahr gewesen — dafür sorgten schon die Eunuchen, die Haremswächter, oder die alten Weiber, unter deren Aufsicht die jüngeren Frauen und Töchter standen.
In schnellem Lauf eilte ein Mann durch diese stillen Straßen; der wacklige, unbeholfene Schritt verriet sein hohes Alter.
Eine Patrouille begegnete ihm, er wurde angehalten.
»Zeig dein Gesicht, ob du nicht ein verfluchter Engländer bist!«, rief ein Inder und hielt ihm die Fackel unter die Nase.
»Waih geschrien, was hat dir getan der alte Sedrack, dass du ihm verbrennst den grauen Bart!«, jammerte der Alte.
»Der alte Sedrack!«, lachte einer. »Lasst den Juden laufen!«
»Nein«, rief ein anderer, »oder begleitet ihn in sein Haus und durchsucht es! Bekommt er es bezahlt, so nimmt er auch seinen ärgsten Feind auf, denn er ist ein Jude!«
»Es ist nicht nötig; Sedrack nimmt nicht einmal seinen Freund auf, und bezahlte er noch so viel; denn er fürchtet, das Versteck könnte aufgespürt werden, wo seine Schätze liegen.«
»Der alte Sedrack ist ein armer Jüd«, jammerte der Alte; »er braucht keine Verstecke, denn er hat nichts zu verstecken!«
»Lasst ihn laufen!«
Die Patrouille zog weiter, und Sedrack eilte mit beschleunigtem Schritt davon. Doch schon an der nächsten Ecke traf er abermals mit einem Trupp Männer zusammen, die keine Inder waren. Sie trugen französische Offiziersuniformen, phantastisch aufgeputzt, mit Schärpen und Schnüren, sprachen Französisch, sangen, lachten und schienen überhaupt in rosiger, etwas angetrunkener Stimmung zu sein.
Der Jude hatte eben einem kleinen, baufälligen Häuschen zustreben wollen, aus dessen vergitterten Erkerfenstern schwaches Lampenlicht strahlte. Beim Anblick der Männer verbarg er indes seine Absicht, dieses Häuschen betreten zu wollen, und versuchte an der Truppe vorbeizuhuschen.
Ein Mann hatte ihn bemerkt und gepackt.
»Hallo, wen haben wir hier? Qui vive, England oder Indien?«
»Soll doch Indien leben hoch bis in die allerhöchste Höhe und soll doch England fahren in den allertiefsten Pfuhl, wo da ist ein Feuermeer von brennendem Schwefel!«, schrie Sedrack.
»Ein Jude«, lachten die ihn Umringenden. »Also selbst diese Kerle sind heute patriotisch!«
»Lassen Sie mich gehen, meine Herren, oder ich werde machen einen Radau, wie die Kriegsposaunen, von deren Klang umfielen die Mauern Jerichos.«
»Immer blase zu, heute kann ganz Delhi einfallen.«
»Hallo, das ist ja der alte Sedrack!«, rief einer.
»Der alte Sedrack? Bravo, das ist ein kapitaler Fang. Los, alter Sünder, wo ist dein Haus?«
»Hurra, zeig es uns! Der Jude hat Säcke voll Gold in seinem Hause versteckt!«
»Er hat Schätze!«
»Und eine schöne Tochter dazu!«
»Die Mirja, jawohl, die können wir diese Nacht gerade gut gebrauchen. Hund, willst du uns nach deinem Hause führen, oder wir schneiden dir Ohren und Nase ab!«
»Wir stehen ja vor seinem Hause; hier, dies alte Gerümpel ist es; er hatte ein böses Gewissen, er wollte daran vorüber!«
»Jude, öffne die Tür und gib uns die Mirja; das Mädchen ist nichts für einen krummbeinigen Judenjungen!«
»Und dein Gold teilen wir ehrlich!«
Der Jude verlor, ganz gegen seine sonstige Gewohnheit, bei dieser gefährlichen Situation den Mut nicht, triumphierend hob er ein Papier in die Höhe, und endlich gelang es ihm, den Lärm zu übertönen.
»So, meine Herren, wer wagt es wohl, das Haus des alten Sedrack zu betreten und die Mirja zu nehmen bei der Hand? Nu, will keiner dran?«
»Was für ein Wisch ist das?«, rief einer und riss ihn dem Juden aus der Hand. »Bah, in Sedracks Haus habe niemand Zutritt, darunter ein Stempel, Ti — Tim — weiß der Teufel, was es heißt! Unsinn ist das, öffne dein Haus, Jude!«
»Halt, meine Herren«, rief eine tiefe Stimme, und ein Mann händigte dem Juden das Papier wieder ein; »dieser Zettel erklärt das Haus des Juden für geheiligt, und entweihen wir es, so lässt uns der, der den Stempel darunter gesetzt hat, samt und sonders hängen. Kommen Sie, ich will es Ihnen erklären.«
Schreiend und fluchend entfernte sich die Bande, und schmunzelnd klopfte Sedrack an die Tür des Häuschens. Sie öffnete sich, ein Lichtschimmer fiel ihm entgegen, schnell schlüpfte er hinein und warf die Tür hinter sich ins Schloss. Vor ihm stand ein Mädchen, die uns bekannte Mirja, die mit ihren großen, schönen Augen den Vater ängstlich anblickte.
»O, Vater, ich hatte solche Furcht, ich hörte, wie man in unser Haus dringen wollte, um... «
»Brauchst nichts zu fürchten, Tochterleben«, sagte der Jude und hielt ihr das Pergament hin; »hier ist das Osterlammblut, mit dem die Juden in Ägypten die Pfosten der Türen bestrichen, und der Würgengel ging an ihrem Haus vorüber. Er wird auch an uns vorübergehen. Nimm es, und zeige es, wenn jemand das Haus betreten will.«
»Du willst mich wieder verlassen?«
»Ich will gehen in die Erde und arbeiten, arbeiten bis morgen früh; dann wird Sedrack sein Werk vollendet haben, und die Heiden werden nichts finden, wenn sie kommen zu suchen Schätze bei dem alten Sedrack.«
»O, Vater, bleibe bei mir! Ganz Delhi weiß doch, dass du nicht arm bist.«
»Aber finden werden sie nichts!«
»Die Inder begehren deine Schätze gar nicht. Hast du nicht gesehen gestern den Wagen mit den Diamanten? Sie haben mehr als du, sie werfen die Schätze weg.«
»Ja, wenn ich sie nur hätte! Jetzt leuchte hierher!«, sagte der Alte rau.
Mirja leuchtete mit der Kerze in einen Winkel unter der Treppe, der Jude kniete nieder und begann vorsichtig die Dielen aufzureißen.
»Was macht das junge Blut?«, fragte er bei dieser Beschäftigung.
»Er schläft und träumt viel.«
»Es ist das Wundfieber. Gib ihm nur regelmäßig die Medizin. Was sagt er im Fieber?«
»Er denkt immer, er sei noch im Turm und kommandiert die Wache, er befiehlt den Soldaten, zu schießen, und ruft dann Bob zu, er solle Alarm blasen.«
»Er ist es«, nickte der Alte; »denn ich weiß, dass er hatte die Turmwache gestern. Nun geh und bleibe bei ihm, und, Mirja, wenn du hörst, dass jemand auf der Straße verfolgt wird, so lasse ihn ein, doch nur, wenn du glaubst, er kann später«, der Alte machte die Gebärde des Geldzählens, »du verstehst mich, so besonders Weiber, nicht in Lumpen gekleidet. Hahaha!«
»Aber die Inder?«
»Denen zeigst du den Zettel, und sie werden sich verbeugen, als wärest du die Frau des Padischah, und ziehen davon. Geh hinein, ich mache das Loch von innen zu, und wenn sich gefangen hat jemand bei mir, so wirst du klopfen mit dem Fuß hier unten, und ich werde kommen und mir lassen geben eine Bescheinigung für meine Mühe. Hahaha.«
Er verschwand in dem durch Aufreißen der Diele entstandenen Loch, Mirja ging die Treppe hinauf.
In dem äußerst ärmlichen Gemach lag auf einem harten Bett ein junger Inder, den man am rotgestreiften Beinkleid als englischen Offizier erkennen konnte. Rock und Weste waren abgenommen, das Hemd aufgeschnitten worden, und die rechte Brust war wie die rechte Schulter mit nassen Tüchern bedeckt. Der schöngeformte Arm an der linken Seite hing schlaff herab und zeigte am oberen Teil auf der braunen Haut eine tiefblaue Tätowierung in einer indischen Schrift.
Es war Eugen, der während des Straßenkampfes einen Säbelhieb über Brust und Schulter empfangen und dann noch so viel Besinnung hatte, sich in eine offene Haustür zu werfen, ehe er von den Hufen der Pferde zerstampft wurde.
Hier wurde er von dem alten Juden nach Beendigung des Kampfes gefunden, und der sonst so geizige Alte mochte Grund gehabt haben, diesen Verwundeten, den er erkannte, durch Bezahlen einer bedeutenden Summe an Glaubensgenossen, welche die Toten plünderten, in sein Haus schaffen zu lassen. Der alte Jude schien überhaupt tief in die Pläne der indischen Anführer des Aufstandes eingeweiht zu sein.
Eugen wusste nicht, wo er war, hatte das Bewusstsein noch nicht wiedererlangt. Er lag im heftigsten Wundfieber und phantasierte, bald leise, bald laut.
Das jüdische Mädchen entfernte den blutigen Verband, wusch die Wunde vorsichtig aus, bedeckte sie von neuem mit in Karbol getränkter Scharpie und legte auf die entzündeten Ränder nasse Tücher. Dann nahm sie vom Seitentischchen ein Glas und führte es an die Lippen des Kranken.
Er hatte eben nur unverständlich gemurmelt, nachdem er den kühlen Trunk aber mit gierigen Zügen geleert hatte, wurden seine Worte lauter, er ergriff die Hand der Pflegerin und umklammerte sie krampfhaft.
»Bleibe bei mir, Bega!«, sagte er deutlich mit flehender Stimme. »Geh nicht wieder fort von mir; du kommst nicht wieder, wie damals. Ach, Bega, kannst du mir denn nur gar nicht verzeihen? Habe ich dich denn so unversöhnlich gekränkt, als ich dir meine Liebe erklärte? O, Bega, bleibe bei mir, du sollst mich nicht mehr lieben, habe mich nur lieb, wie du damals wolltest, und ich will zufrieden sein, zufrieden für mein ganzes Leben...«
Die Worte sanken wieder zu einem Flüstern herab.
Die Jüdin blieb am Bette des Verwundeten stehen, ließ ihm ihre Hand und blickte mitleidig in das fahle Gesicht. Zum ersten Male vielleicht nahmen ihre schönen Züge einen anderen Ausdruck an, sonst waren sie entweder starr oder kalt oder stolz, meist resigniert und niedergeschlagen, war sie doch die Tochter des verachteten, heimatlosen Volkes, fortwährend Hohn und Verfolgung ausgesetzt, jetzt zum ersten Male vielleicht in ihrem ganzen Leben drückte sich darin Mitleid aus.
»Er liebt«, murmelte sie, »und das Mädchen heißt Bega. Wer mag das wohl sein? Gewiss eine schöne, vornehme Dame; der Name klingt indisch. Er liebt sie, und sie scheint ihn nicht wiederzulieben. Ach, Liebe!«
Der Verwundete war eingeschlafen. Leise entzog sie ihm ihre Hand, setzte sich auf einen Stuhl neben dem Bett, stützte den Kopf in beide Hände und schaute träumerisch in das ruhig brennende Licht der Kerze.
Sie träumte und träumte, und zu ihren Gedanken passte die schwermütige Melodie, die sie leise vor sich hin summte.
Auch dieses Judenmädchen besaß ein Herz, das sich nach Liebe gesehnt und nie welche gefunden hatte, nicht einmal als Kind. Die Mutter kannte sie nicht, den Vater hatte sie versucht zu lieben, aber bald war ihre Liebe zu ihm erkaltet, als sie merkte, dass er das Gold mehr liebe als seine Tochter.
Ob sie denn wirklich ein Herz besaß? Es war so öde und leer in ihr, so kalt rings um sie her. Sie konnte sich nicht besinnen, dass sie jemals geweint hatte. Doch, einmal, als sie zur Erkenntnis kam, dass sie eine Jüdin war und keine Gemeinschaft mit anderen Menschen hatte, dass ihrer nichts anderes als Spott, Hohn und Verachtung wartete. Wohl dem, der sich etwas schaffen kann, an das er sein Herz hängt, wie ihre Glaubensgenossen das Gold — sie konnte es nicht. Seitdem hatte sie nie wieder Tränen vergossen, nicht einmal da, als sie eine mächtige Liebe in ihrem Herzen. auflodern fühlte und ihr vollkommene Gleichgültigkeit entgegengebracht wurde.
Sie war ja das verachtete Judenmädchen, wie konnte sie verlangen, dass sich der schöne, edle, starke Mann nach ihr erkundigte, sie nach ihrem Namen fragte? Resignation war das Heilmittel ihres Herzens, ließ es aber auch zu Eis erstarren.
Mirja kannte noch nicht das andere Gegenmittel, welches das Herz aus der Todesstarre wieder zum Leben mit verzehrender Glut erwecken kann — den Hass. Liebe und Hass, zwei entgegengesetzte Pole, und doch ähneln sie sich in ihren Äußerungen.
Sie wusste noch nicht, was Hass ist. — — — —
Plötzlich schrak sie zusammen und lauschte. Auf der Straße erscholl wüstes Geschrei, schnell kam es näher, laufende Schritte erklangen.
»Jetzt haben wir sie«, riefen raue Stimmen frohlockend, »jetzt kann sie uns nicht entgehen. Sie ist in einer Sackgasse.«
Vorsichtig spähte Mirja durch die Gardinen des Fensters hinaus. Dort rannte mit Aufbietung aller Kräfte ein Weib, ein junges Mädchen, das weiße Kleid, jedenfalls für eine Festlichkeit bestimmt gewesen, hoch aufgerafft, um den dunkelgeröteten Kopf flatterte wild das aufgelöste, flachsblonde Haar. Zehn Schritte hinter ihr her stürmten die Verfolger, Inder, die Waffen im Gürtel; denn sie wollten die Flüchtige lebendig fangen.
Die Fliehende hatte die Rufe gehört, sie zauderte, sie sah sich nun doch verloren.
»Hier herein, hier bist du gerettet!«
Das Mädchen sah eine geöffnete Haustür und darin eine weibliche Gestalt stehen, sie raffte sich noch einmal zusammen, entschlüpfte der schon nach ihr ausgestreckten Hand und war in dem Flur.
»Die Treppe hinauf, du bist sicher«, sagte Mirja und erwartete die Inder.
Ein Wutschrei entrang sich den Lippen der Verfolger, jetzt blitzten Waffen in ihren Händen. Aber sie stutzten, als sie das braune Mädchen furchtlos in der Türe stehen sahen; einen Mann hätten sie sofort niedergemacht, doch dieses Weib musste einen sicheren Halt hinter sich wissen.
»Zurück«, rief Mirja, »kein Inder darf dieses Haus betreten!«
»Hei, ist das nicht die Judendirne, die Tochter des alten Sedrack?«, rief ein keuchender, schweißbedeckter Mann. »Was fällt dir ein? Heraus mit der Faringi, weg da, oder es geht über deinen Leichnam!«
Mirja hielt ihnen ein Stück Pergament hin.
»Wer dieses Haus ohne meine Erlaubnis betritt, ist des Todes!«
Kaum hatten die Inder den scharfmarkierten Stempel gesehen, als sie sich scheu und flüsternd zurückzogen. Mirja aber warf sofort die Tür zu und begab sich hinauf in das Gemach.
Das gerettete Mädchen lag auf den Knien, das Gesicht in den Kissen am Fußende des Bettes vergraben, die Brust rang nach dem hastigen Lauf heftig nach Atem.
Mirja besichtigte noch einmal den Verband des Verwundeten, die Blutung hatte aufgehört, und so erneuerte sie nur die kalten Umschläge. Dann setzte sie sich wieder auf den Stuhl, stützte den Kopf in die Hände und betrachtete das fremde Mädchen ohne große Teilnahme. Es konnte ja von Glück sagen, dass es gerettet worden war, vielleicht konnte es sogar der Gefangenschaft entgehen. Den Vater zu rufen, zögerte Mirja noch.
Jetzt richtete das blonde Mädchen den Kopf auf, sah die Jüdin, stürzte vor ihr auf die Knie und brach in krampfhaftes Schluchzen aus. Der seit langen Stunden aufgespeicherte Schmerz brach sich mit einem Male Bahn.
Die Jüdin wartete, bis das Weinen aufhörte; träumerisch ließ sie die langen, blonden Flechten der Fremden durch ihre braunen Finger gleiten.
»Du hast mich gerettet«, rief diese endlich, »ich müsste dir danken, doch ich kann es nicht. Ach, hätte ich mich doch lieber auch töten lassen!«
»Wo bist du gewesen, als der Kampf begann?«, fragte Mirja.
»Im Fort Oliver.«
»Du bist geflohen?«
»Wir sind gefangen fortgeführt worden, ich benutzte eine Gelegenheit zur Flucht. Hätte ich es doch nicht getan! Wäre ich lieber mit meiner Schwester und meiner Mutter gestorben!«
»Sind diese auch gefangen worden?«
»Ja, alle Frauen und Mädchen! Man fand unser Versteck im Keller und führte uns davon.«
»Dann sei unbesorgt, die Frauen sind nicht getötet worden, sie werden als Geiseln behalten.«

»Wirklich?«, rief das Mädchen, und seine Augen glänzten unter den Tränen vor Freude auf.
»Ich weiß es ganz bestimmt, mein Vater sagte es mir, und er weiß alles, was vorgegangen ist und noch vorgeht.«
»O, dann lass mich hinaus, ich will bei ihnen sein.«
»Du freust dich gleich zu viel. Mein Vater glaubt, die Geiseln werden doch noch getötet, weil die Inder mit ihnen nichts erlangen.«
Das Mädchen brach wieder zusammen.
»Das war ein Stich ins Herz«, murmelte sie. »Alles, alles tot! Ich will auch sterben!«
»Kanntest du die Männer, die im Fort Oliver kämpften?«, fragte Mirja nach längerer Pause.
»Ach, ich kannte sie, es waren mein Vater und meine Geschwister und — auch sie sind tot.«
»Nein, sie sind gerettet worden, kein einziger ist von ihnen getötet worden.«
»Kein einziger?«, rief die Fremde, von neuer Hoffnung beseelt.
»Die Gurkhas haben sie in Sicherheit gebracht, sie halten sich jetzt im Dschungel auf.«
Das Mädchen fand vor Freude über diese Nachricht keine Antwort, verklärt blickte es zum Himmel. Mirja betrachtete es mehr aufmerksam, als mitleidig; eine Frage drängte sich auf ihre Lippen.
»Du liebst Vater und Geschwister wohl recht sehr?«
»Wie kannst du so fragen!«
»Liebst du sonst noch jemanden außer diesen?«
Das Mädchen sprang auf und breitete die Arme aus, als wolle sie den umfangen, an den sie dachte.
»Ja, ich liebe noch jemanden«, rief sie begeistert, »und wenn du die Wahrheit sprichst, so befindet er sich mit unter den Geretteten, unter den Lebenden!«
Mirja stand auf.
»Ich will meinen Vater rufen. Er kann dich in Sicherheit, vielleicht sogar zu denen bringen, die du liebst.«
Das Mädchen hielt sie noch einmal zurück.
»Und wer bist du? Wem habe ich meine Rettung zu danken?«
»Siehst du das nicht? Ich bin eine arme, verachtete Jüdin, weiter nichts.«
»O, sprich nicht so, du besitzt ein teilnehmendes, liebevolles Herz, denn du nimmst dich der Verfolgten an, du und dein Vater.«
Um Mirjas Lippen schwebte ein geringschätziges, spöttisches Lächeln, als sie fragte:
»Hast du Geld bei dir?«
»Ich? Nein«, war die erstaunte Antwort.
»Keine Juwelen, kein Geschmeide?«
»Nichts. Wozu denn nur?«
»Hast du Verwandte in deiner Heimat, die reich sind?«
Immer erstaunter wurde das Gesicht der Gefragten.
»Nicht, dass ich wüsste!«
»Einen Gatten?«
»Ich bin unverheiratet.«
»Armes Mädchen, dann sieht es schlimm mit dir aus. Nun, ich will meinen Vater rufen.«
Da plötzlich ging dem Mädchen das Verständnis auf, und angstvoll hielt es Mirja abermals zurück.
»Jetzt verstehe ich erst, was du meinst. Ihr wollt bezahlt werden, wenn ihr mich rettet?«
»So ist es.«
»O, wie habe ich euren Edelmut verkannt!«
»Edelmut? Wir sind Juden. Ist man etwa gegen uns edelmütig?«
Die Fremde trat vor Mirja hin und legte ihr beide Hände auf die Schultern.
»Bist du auch eine Jüdin, so hast du doch ein Herz«, stieß sie hervor, »und hast du keins, so will ich es in dir erwecken. Mädchen, hast du nie die Liebe gekannt?«
»Liebe? Nein«, seufzte die Jüdin.
»Oh, so lerne sie kennen; du wirst sie noch kennen lernen. Sieh, unter denen, welche aus Fort Oliver geflohen sind, befindet sich mein Geliebter. Bringe mich zu ihm, ich flehe dich an darum, ich weiß auch, du hast die Macht dazu, du besitzt einen Talisman, der dich gegen die Waffen der Inder schützt; bringe mich zu ihm, zu meinem Geliebten, und sollte es uns nicht möglich sein, dir mit Geld zu lohnen, so sollst du von uns etwas viel Schöneres, Wertvolleres zum Lohn erhalten. Du nennst dich arm, verachtet, du sollst es nicht mehr sein, wir wollen dir unsere Liebe schenken, wir wollen dich Schwester nennen, dich auf den Händen tragen. Bringe mich zu ihm, und sein, wie mein Dank soll keine Grenzen kennen; und bringst du mich tot zu meinem Geliebten, so wird er dir dennoch zu deinen Füßen danken.«
In immer wachsender Erregung hatte sie gesprochen, und immer glänzen-der waren Mirjas Augen geworden.
»Hast du diesen Mann so sehr lieb?«, fragte sie leise.
»Über alles in der Welt, tausendmal lieber als mich selbst.«
»Und er liebt dich ebenso, wie du ihn?«
»Hätte er tausend Leben, er würde sie alle einzeln für mich hingeben.«
Mirja schüttelte wie ungläubig den Kopf.
»Glaubst du das nicht?«
»Ach, ich kann nicht glauben, dass man so geliebt werden kann.«
»Könntest du nicht so lieben?«
»Ich? O ja, ich könnte es«, sagte sie schwärmerisch; »aber mich?«, setzte sie seufzend hinzu. »Mich liebt nicht einmal — mein eigener Vater.«
»Armes Kind, ich möchte, ich könnte dir von unserer Liebe mitteilen! Führe mich zu meinem Geliebten, und du sollst die Dritte in unserem Bunde sein.«
»Ich will den Vater rufen.«
»Nein, tu es nicht!«, sagte das blonde Mädchen ängstlich. »Er will Geld, und ich habe keins, kann auch keine Bürgschaft stellen, denn...«
»Sei ohne Sorge«, sagte Mirja warm, »ausliefern soll dich mein Vater nicht. Wenn du ihn nicht zufrieden stellen kannst, dann werde ich selbst dich retten.«
Nach einigen Minuten kehrte sie mit dem alten Juden zurück, der sich noch den Lehm von den Händen rieb. Freundlich grinsend begrüßte er das Mädchen, das ihn ängstlich betrachtete, und war sofort ganz Geschäftsmann.
»Mirja hat mir erzahlt, alles erzählt. Hm, ja, ja, wäre schade um ein solch junges Täubchen, jammerschade; denn der Hals umgedreht würde ihm doch! Na, der alte Sedrack ist ein ehrlicher Mann, hat das Herz auf dem rechten Flecke; wollen sehen, was sich machen lässt, kostet freilich etwas Geld, dich durchzubringen, und der alte Sedrack hat nichts, gar nichts, ist bettelarm; na, wollen sehen, wollen sehen. Setz dich, so, und sei nicht so traurig!«
Nach dieser Einleitung musste sich das Mädchen setzen, Sedrack holte aus einem Wandschrank Tinte und Papier, legte es auf den Tisch und hockte sich auf den Bettrand, während Mirja sich nach orientalischer Sitte in einer Ecke niederkauerte.
»So, mein Täubchen, nun sei recht freundlich! Du bist hier sicher wie in Abrahams Schoß. Weiß, im Fort Oliver alles gerettet, nur die Frauen nicht, bist entflohen, weiß schon alles. Nun, mein Täubchen, bist wohl die Tochter eines der Offiziere, die sind gerettet worden durch die Gurkhas und sich jetzt befinden in Sicherheit, dass sie entgehen werden den Schwertern der ruchlosen Feinde und dafür werden spalten die Köpfe der Inder?«
Besser als mit ›mein Täubchen‹ konnte er das Mädchen nicht anreden; denn wie ein Vögelchen mit gebrochenen Flügeln lehnte das Mädchen im Stuhl, während der Alte mit den runden Augen und der großen, gebogenen Nase ganz einem Geier glich.
Die Fremde raffte ihren ganzen Mut zusammen.
»Nein, mein Name ist Franziska Reihenfels, und ich bin die Tochter des von der englischen Universität Oxford nach Indien gesandten Gelehrten Friedrich Reihenfels.«
»Sooo?«, sagte der Jude gedehnt und warf wie enttäuscht die Feder hin. »Da steht's freilich faul mit dir, Täubchen. Der Reihenfels ist ein Narr, der gibt sein schönes Geld für Mumien und Papier, für die zahlt kein ehrlicher Jüd einen Pfennig, und was er behält, schleudert er fort an Arme, die haben mehr als er. Der Mann ist meschugge, durch und durch meschugge. Na«, fuhr er fort, als er sah, wie Franziska trostlos zusammensank, »wollen nochmals sehen. Du bist Engländerin?«
»Ja.«
»Hast du noch Verwandte drüben?«
»Nein.«
»Hm, ich weiß, ich weiß, seid alle hier. Hast keinen Schatz, der dir schneidet die Cour und hat geworfen sein Auge auf dich?«
Franziskas bleiches Gesicht rötete sich vor Entrüstung.
»Ja«, hauchte sie dann.
»Hm, wollen sehen. Wie tut er heißen?«
»Das — werde ich nicht sagen.«
»Unsinn, mein Täubchen«, kicherte der Alte, »werd's nicht erzählen, dass man's ausposaunt. Hat er Geld?«
»Ich weiß nicht.«
»Wie heißt er? Sag mir's ins Ohr.«
Der Jude neigte den Kopf über den Tisch, doch Franziska ekelte sich vor dem schmutzigen Gesicht in ihrer dichten Nähe, sie lehnte sich zurück.
»Nun, willst du's nicht sagen dem alten Sedrack?«
»Lord John Canning.«
Wie von einer Tarantel gestochen, fuhr der Jude empor.
»Lord Canning, der Oberstatthalter?«
»Ja, Lord Canning, der Generalgouverneur von Indien, ist es; ich bin seine Braut«, sagte Franziska feierlich.
Ein Schrei erklang in der Ecke, auch Mirja war aufgefahren.
»Der große Gouverneur!«, rief sie.
Doch gleich sank sie bewegungslos zusammen, ihre Augen nahmen einen seltsam stechenden, gehässigen Ausdruck an, als sie Franziska betrachtete.
Der alte Jude begann rastlos im Zimmer auf und ab zu wandern, dass die Schöße seines langen Kaftans wie die Flügel einer Fledermaus auseinander flatterten.
»Lord Canning, Oberstatthalter von Indien«, murmelte er, bald für Franziska, bald nur für sich bestimmt, »so so, also du bist seine Braut — ein edler, ein schöner Mann, hat eine schöne Braut, wird sie nicht vergessen — Lord Canning, hm, ist ein schwerreicher Mann, ist Lord von Windsor, weiß es wohl — hm, er ist sicher, brauchst keine Angst um ihn zu haben, mein Täubchen, die Gurkhas haben gebaut eine eherne Mauer um ihn, und wie lange wird's dauern, so sitzt er wieder oben — ein edler Mann, Lord Canning — ist Generalgouverneur — seine Braut...«
Mit einem Ruck blieb er vor dem Mädchen stehen.
»Er liebt dich?«
»Gewiss, wir sind schon lange verlobt.«
»Wer weiß das?«
»Noch niemand.«
»Aha, ich verstehe, der alte Sedrack ist nicht so dumm — desto besser, heimliche Liebe, das freut den alten Sedrack. Hm, mein Täubchen, würde dein Schatz mir wohl geben wieder die Auslagen, die ich hätte, wollte ich dich bringen zu ihm?«
»Alles«, rief Franziska überzeugt, »jede Summe, die du verlangtest als Belohnung.«
»Jede Summe!«, wollte der Jude entzückt rufen, unterdrückte aber schnell die Worte.
»Nichts, nichts von Belohnung«, sagte er und setzte sich wieder. »Der alte Sedrack ist ein ehrlicher Mann, er will nur haben das, was er hat ausgelegt, und eine kleine Entschädigung für Zeit und Mühe. Freilich — hm, es ist nicht so billig.«
»Das schadet nichts, wenn ich nur mit ihm vereint werde, so bald wie möglich!«, rief Franziska jubelnd.
»Sollst's werden, sollst's werden, mein Täubchen. Aber da sind die Wachen des Tores, die müssen werden bestochen, die Führer der Banden, welche durchstreifen die Straßen, und dann die großen Kosten, überall offene Hände — —«
So ging es fort, der Jude zählte alle wahrscheinlichen Schwierigkeiten auf und nannte dann auch die nötige Summe, um sie zu überwinden.
»Tausend Pfund würde es kosten, so wahr ich ein ehrlicher Mann bin und dabei nichts verdienen will«, schloss er seine langen Auseinandersetzungen, denen Franziska ungeduldig und kaum ihrer achtend zugehört hatte.
»Und wenn es hundertmal mehr kostete, bringe mich zu ihm, und du wirst bezahlt werden.«
»Hm, mein Täubchen, Geschäft bleibt Geschäft, ich muss auch haben Sicherheit. Kann ich nicht sonst zusetzen alles, was ich mir erst muss leihen, und bin dann ein geschlagener, ein ruinierter Mann?«
»Ich kann dir keine Sicherheit geben«, seufzte das Mädchen.
»Kannst du nicht? Gib mir was Schriftliches von deiner Hand, dass ich dich habe gerettet aus den Händen der Inder und dich will bringen zu deinem Schatz, und ich habe die Sicherheit.«
»Wie soll ich das tun?«
»Schreib ihm so und so, du bist beim alten Sedrack, der dich hat gerettet, dich aufgehoben, und wenn er will zahlen 1000 Pfund Sterling in englischem Gold, wird Sedrack dich bringen dahin, wo er dich will haben.«
Schnell war jedes Bedenken des Mädchens besiegt; mit zitternden Händen schrieb es unter Anweisung des Juden den Brief.
»Wenn aber nun Lord Canning selbst in großer Gefahr ist?«
»Er ist nicht in großer Gefahr, sage ich dir, und kann ich dich nicht bringen zu ihm, bringe ich dich anderswohin, wohin er dich haben will, wenn er wird bezahlen die Auslagen.«
»Und wann führst du mich zu ihm?«
»Sobald sein wird die Luft rein, mein Täubchen, vielleicht schon morgen! Bleibe hier bei Mirja, ist ein gutes Töchterchen, und dir soll es an nichts mangeln, will dich halten wie mein eigenes Kind.«
Der Jude faltete das Papier zusammen und verbarg es in der geheimsten Falte seines Kaftans. Als er das Zimmer verließ, um wieder an seine unterirdische Arbeit zu gehen, schwebte ein triumphierendes Lächeln um seine bärtigen Lippen.
Franziska wusste noch nicht, ob sie sich freuen oder bangen Gedanken Raum geben sollte. Fragend wendete sie den Kopf nach Mirja und bemerkte noch eben einen seltsamen, höhnischen Ausdruck in deren Augen.
Die Jüdin erhob sich schnell, legte dem Verwundeten nasse Umschläge auf und trat dann zu dem Mädchen. Ihre Züge waren wieder so starr wie früher geworden. Mit verschränkten Armen blieb sie vor Franziska stehen.
»Armes Mädchen«, sagte sie, »also Lord Canning, der Generalgouverneur von Indien ist der Mann, den du so sehr liebst, und der dich auch liebt?«
»Ja, du weißt nun, wer er ist. Wird dein Vater mich wirklich zu ihm bringen?«, Mirja zuckte die Schultern.
»Was? Nicht?«, schrie Franziska entsetzt.
»Nicht doch, er wird dich wohl hinbringen, wenn — er es kann.«
»Was willst du damit sagen? O, sprich die Wahrheit, verhehle mir nichts, ich flehe dich darum an!«
»Mein Vater hat dir vorhin nicht die Wahrheit gesagt. Lord Canning ist nicht in Sicherheit; er wie alle übrigen, die aus Fort Oliver entkommen sind, werden von den Indern wie die wilden Tiere und noch schlimmer durch die Dschungel und Sümpfe gehetzt.«
Erschrocken war Franziska aufgesprungen.
»Warum aber«, stammelte sie, »erzählt er mir das Entgegengesetzte?«
»Um dich gefügig zu machen, den Brief zu schreiben, der so gut wie eine Anweisung ist. Mein Vater wird an die Zahl sicherlich noch eine Null hängen.«
»Das schadet nichts, wenn er mich nur zu ihm bringt.«
»Nimmermehr wird er das tun«, rief Mirja mit starker Stimme, »er wird dich gefangenhalten und dich nur als Mittel benutzen, Summe um Summe aus Lord Canning zu locken, und wenn dies nicht möglich ist, wird er, wahrscheinlich sofort, seine Unterschrift zu erlangen suchen.«
»O, mein Gott«, schrie Franziska auf, »jetzt erst wird mir alles klar. Mirja, erbarme dich meiner! Du bist ein Kind Indiens, kannst du mich nicht zu ihm führen? Und ist er in noch so bedrängter, gefahrvoller Lage, ich will sie mit ihm teilen, nur bei ihm muss ich sein! Mirja, kannst du mich nicht zu ihm bringen?«
»Ich kann es.«
Franziska fiel der Jüdin zu Füßen und umklammerte ihre Knie. Sie sah nicht, wie höhnisch Mirja auf das gebildete, angesehene Mädchen herabblickte.
»So tue es!«, rief Franziska leidenschaftlich.
»Ich will nicht!«
»Wie, du willst nicht?«
»Nein!«, schrie jetzt Mirja plötzlich und schleuderte die Kniende mit einer gewaltsamen Anstrengung von sich. »Nein, ich will nicht, weil ich Lord Canning, deinen Bräutigam — weil ich ihn hasse!«
Franziska hatte sich bestürzt aufgerafft. Bei diesen letzten Worten taumelte sie zurück.
»Was, du hasst ihn?«, brachte sie hervor. »Warum?«
In der so schüchternen, resignierten Jüdin brach mit einem Male eine dämonische Wut hervor; sie blitzte aus ihren Augen. Wie eine Rachegöttin stand sie vor dem bis zum Tode erschrockenen Mädchen.
»Weil ich ihn hasse!«, wiederholte sie zischend, mit immer wachsender Leidenschaft. »Und ich will dir sagen, warum, ich will dir erzählen, was für ein Mann dein so genannter Bräutigam ist, hahaha, dein Geliebter! Ein Schurke ist er, ein elender Wollüstling, der...«
»Du lügst!«, fuhr sie Franziska an; der Zorn, ihren Geliebten schmähen zu hören, verdrängte jedes andere Gefühl.
»Ich lüge? So? Lass dir erzählen! Ich traf einst mit ihm in einem Dorfe zusammen, ich wurde wie gewöhnlich geschmäht, verachtet, zurückgesetzt; aber der große Generalgouverneur war da, er duldete nicht, dass man die arme Jüdin verachtete, er war so freundlich gegen sie, er ließ ihr den Wassereimer zu allererst füllen, alle anderen mussten warten, so edel war Lord Canning. Aber nicht genug damit, er wollte auch nicht, dass das arme, schutzlose Judenmädchen in der Karawanserei allein unter den rohen Männern schliefe, er hatte Mitleid mit ihrer Jungfräulichkeit, er ließ neben seinem Zimmer eines für sie bereiten, er ließ sie zu sich kommen, setzte ihr Essen und Wein vor, sprach so schön von seiner Menschenfreundlichkeit mit ihr, dass er, Lord Canning, auch die Juden als Mitmenschen achte, und dann, dann hat er dies wehrlose Judenmädchen auf sein Bett geworfen, und als es sich wehrte, hat er es mit Fausthieben auf den Kopf zu betäuben versucht —«
Wie eine Rasende sprang Franziska auf sie ein.
»Halt ein, schamlose Verleumderin! Ein jedes Wort, das aus deinem Munde kommt, ist eine Lüge!«
Drohend hielt ihr das Mädchen die Hand entgegen.
»Verflucht will ich auf der Stelle sein, wenn ich ein Wort der Lüge spreche. Ich, ich war jene Judendirne, die der Gouverneur, dein Bräutigam, mit roher Gewalt zu überwältigen suchte, und wäre nicht ein edler Mann dazwischengekommen, so wäre die Schurkerei gelungen. Sieh«, fuhr sie zu der Erstarrten fort, »ich wollte dich retten, und zwar ohne Hilfe meines Vaters, denn ich weiß, dass er ein Seelenverkäufer ist und dich nur gefangenhalten will bis aus Lord Canning nichts mehr herauszupressen ist; ich wollte dich deinem Geliebten zuführen, denn ich, die ich selbst nie Liebe zu kosten bekommen habe, wollte wenigstens dazu beitragen, zwei Menschen auf der Welt glücklich zu machen. Aber nun, da ich weiß, welch erbärmlicher Wicht dein Geliebter ist, ändere ich meine Absicht. Er ist es nicht wert, dass ihm sein Wunsch, seine Braut zu besitzen, in Erfüllung geht, und selbst mein Mitleid zu dir reiße ich aus dem Herzen, um ihm die Nachricht bringen zu können, dass seine Braut unter den Messern der Inder das Leben ausgehaucht hat, und die ihm diese Nachricht bringt, ist das verachtete Judenmädchen, das er überwältigen wollte. Ja, so versteht sich die Judendirne zu rächen.«
Grell lachend eilte Mirja die Treppe hinab.
Halb betäubt stand Franziska da, sie griff sich an den Kopf, sie glaubte zu träumen, doch wie Donnergetöse hallten ihr die eben gehörten Worte in den Ohren wider, und so aufrichtig und überzeugend hatte Mirja gesprochen, dass sie selbst an die Wahrheit glaubte.
Auf der Straße erklangen Waffenlärm und Schritte.
»Hierher! Hier hält sich eine Faringi versteckt!«, hörte sie Mirja unten rufen.
Schritte kamen heraufgestürmt; Inder stürzten ins Zimmer, allen voran Mirja, wie eine Teufelin anzusehen.
»Dort steht sie, nehmt sie, gebt gut acht auf sie, sie ist schon einmal entflohen.«
Franziska wurde unter stürmischem Jubel von rohen Fäusten ergriffen. Das war zuletzt noch eine gute Beute. Ein Inder packte sie an dem vorn etwas ausgeschnittenen Kleid und riss ihr dabei die Taille auf.
Ein blinkender Gegenstand fiel herab, man merkte es nicht. Was galt jetzt Geld, was Gold? — Lebende Faringis wollte man haben!
Das Mädchen warf noch einen schmerzlichen Blick auf die Verräterin, dann wurde es hinabgerissen.
Drinnen stand Mirja mit keuchender Brust, beide Hände vor den Augen. Als sie die Hände sinken ließ, zeigten ihre Züge einen befriedigten Ausdruck. Ja, die verachtete Judendirne hatte sich zu rächen verstanden, und eine Rache, die größte vielleicht, harrte ihrer noch.
Ruhig, als wäre nichts geschehen, erneuerte sie den nassen Umschlag auf der Brust des Verwundeten, der, durch den Lärm aus dem Schlafe gestört, zu neuen Fieberträumen erwachte.
Ihre Augen fielen auf einen kleinen, glänzenden Gegenstand, der dort in der Ecke lag. Was war das? Mechanisch hob sie es auf, eine kleine, goldene Kapsel, ein Medaillon, das Mirja sofort öffnete.
Ah, die eine Seite der Kapsel zeigte das Bildnis der Faringi, welche sie eben den Häschern ausgeliefert hatte, und die andere Seite der Kapsel enthielt —
Heiliger Gott, das waren seine Züge, diese ernsten männlich schönen Züge, sie gehörten dem Manne an, dessen Bild die Gedanken der armen Jüdin Tag und Nacht beschäftigte. Das war der Mann, der sie einst aus dem Wasser, aus dem Feuer und aus dem Rachen der Krokodile zugleich gerettet hatte, der sie erst vor wenigen Tagen aus den Händen jenes Bösewichtes befreite, der den höchsten Posten in Indien bekleidete und seine Macht dazu missbrauchte, wehrlose Mädchen zu sich zu locken. Das war er, er, den Mirja seit Jahren gesucht, um sich ihm zu Füßen zu werfen und ihm ihr Leben als Sklavin anzubieten, und dem sie, als sie ihm wieder begegnete, doch nicht danken konnte, weil sie, von ihm abermals gerettet, halb bewusstlos von den Schlägen auf den Kopf gewesen war.
Doch sie wollte ihn noch zu finden wissen. Jetzt, da sie wusste, dass sie ein Herz im Busen besaß, der Rache fähig, wollte sie es auch auf Liebe probieren, und liebte er sie nicht, weil er schon einer anderen gehörte, so wollte sie ihm als Magd dienen, ja, selbst der, welche er liebte. Sie wollte sich nicht selbst, ihr Leben sollte ihm gehören.
Aber wer war er? Wie hieß er? Und vor allen Dingen, wie kam dieses Mädchen, das eben noch hier gewesen, und das sie als Braut jenes Schurken hasste, neben sein Bild?
Mirja hatte Lust, es herauszureißen und mit Füßen zu treten. Aber die Spur, welche sie hier gefunden, und durch die sie vielleicht auch seinen Namen erfahren konnte, beschäftigte sie zu sehr.
Der Kranke stöhnte, er öffnete die Augen.
»Wo bin ich?«, fragte er.
Mit einem Sprunge war Mirja bei ihm.
»In guten Händen! Du bist gerettet! Hier, trink! Das gibt dir das Bewusstsein völlig wieder.«
Eugen trank.
»Wo sind — die Engländer — die Sepoys — gerettet?«, stammelte er mit schwacher Zunge.
»Ja, sie sind gerettet, in Sicherheit, sie sammeln sich zum neuen Kampf. Doch sieh, dieses Bild, wen stellt es vor? Kennst du ihn?«
Der Verwundete ließ seine matten Augen lange auf dem Bilde ruhen, ein flüchtiges Lächeln huschte über sein blasses Gesicht.
»Ob ich ihn kenne? Es ist der Stellvertreter — der Königin — der ich — Treue geschworen —«
»Wer, wer? Den Namen«, drängte Mirja.
»Es ist — Lord Canning.«
»Wer?«, schrie Mirja und packte den Arm des Kranken, dass dieser schmerzhaft zusammenzuckte.
»Der Generalgouverneur — von Indien.«
Das Medaillon entfiel Mirjas Hand; entsetzt starrte sie den Sprecher an.
»Du phantasierst noch!«, keuchte sie. »Aus dir spricht das Fieber.«
»Ich bin — bei Bewusstsein — ach — dass ich's nicht wäre!«
Schnell hob sie das Medaillon wieder auf und hielt's ihm nochmals hin.
»Wer soll das sein?«
»Der Generalgouverneur — Lord Canning — quäle mich — doch nicht — länger!«
»Aber das andere Bild!«
»Das ist — ja — das ist — Franziska Reihenfels.«
»Die Braut Lord Cannings?«
Eugen war so überrascht von dieser Frage, dass er sich, seine Schmerzen vergessend, etwas aufrichtete.
»Woher weißt du das? Captain Atkins hat es mir unter dem Siegel der strengsten Verschwiegenheit mitgeteilt, und du — o, wie das brennt«, stöhnend sank er zurück, »wie das brennt! Ach, wäre ich doch tot — mit den anderen — die ich fallen sah — tot, tot — alles tot — die Sepoys — blase Alarm«, rief er plötzlich laut, wieder in Phantasien verfallend, »die Sepoys meutern — Feuer —«
Das Mädchen hörte nicht mehr seine Worte; mit entsetzten Augen betrachtete es die beiden Bilder.
»Lord Canning — seine Braut! O, ich Unglückliche, was habe ich getan!«
Heftig warf sie sich vor dem Stuhl auf die Erde, raufte sich die Haare und brach in Jammern, Weinen und Schluchzen aus.

Die Tränen, die sie früher nicht gekannt, jetzt kamen sie plötzlich.
Leiser und leiser wurde ihr krampfhaftes Schluchzen, und dann lag sie lange so da, das Gesicht mit den Händen verhüllt.
Ein Schritt kam die Treppe herauf, und Mirja erhob sich. Die Tränen waren versiegt, ihr Antlitz war wie von Stein. Eine furchtbare Entschlossenheit war darin zu lesen.
»Der Kranke fiebert«, sagte der eintretende Vater, »du musst ihm geben die Medizin. Nun, Mirjaleben, wo ist das Täubchen, die vornehme Braut?«
»Vater«, entgegnete Mirja leise, »weißt du, wer der Mann ist, welcher mich am Ganges gerettet hat?«
»Wie soll ich ihn kennen? Hat er sich doch nicht bei mir gemeldet, abzuholen seine Belohnung. Wo ist denn mein Täubchen?«
»Hast du den Generalgouverneur von Indien, Lord Canning, schon einmal gesehen? Kennst du ihn? Weißt du, wie er aussieht?«
»Haben ihn meine Augen doch noch niemals geschaut, wie soll ich wissen, wie er aussieht? Wo ist sie denn? So so, in deiner Kammer! Das ist recht!«
Er humpelte nach der Holzwand und öffnete den Verschlag. Mirja wühlte in einem Blechkasten und entnahm ihm ein Kopftuch.
»Gott Jakobs und Isaaks, wo ist denn das Täubchen hingeflogen? Sie ist doch nicht fort?«, rief der Jude erschrocken.
»Sie ist fort!«, war die gleichgültige Antwort.
»Was? Wohin?«
»Ich habe sie den Indern ausgeliefert.«
»Mirja, du bist meschugge!«
»Nein, Vater, ich bin es nicht, ich werde sie aber suchen.«
Sie band sich das Tuch um den Kopf.
»Mirja, wo willst du hin? Du darfst jetzt nicht gehen auf die Straße. Und hast du sie gelassen hinaus, oder hat sie gewittert Unrat, so schadet ja das nichts. Das Papierchen habe ich mit der Zahl, und mache ich eine Null dahinter, werde ich haben zehnmal soviel, und werde ich sagen dem großen Gouverneur — Mirja, wo willst du hin?«
»Fort!«
»Tochterleben, was fällt dir ein?«
Mirja trat vor den Alten hin, zum Fortgehen bereit.
»Vater«, sagte sie mit dumpfer Stimme, »tue, was du willst. Ich weiß, du bist ein Menschenverkäufer und handelst mit Seelen, und ich weiß, was ich zu tun habe. Das aber will ich dir sagen. Gehst du hin zu Lord Canning und sagst ihm, seine Braut sei bei dir in Sicherheit, und du wolltest sie ihm zuführen, wenn er dich bezahlen kann, so sollst du zehnmal das zu fühlen bekommen, was du mir bisher angetan hast. Sprich nicht, verteidige dich nicht, ein jedes Wort wäre umsonst! Mir ist ein Licht aufgegangen, ich habe es leuchten sehen, und wie Schuppen ist es mir von den Augen gefallen. Vater, Sklavenhändler, bete zum Gott deiner Väter dass ich nicht einst berufen werde, von dir Rechenschaft zu verlangen! Lass mich, folge mir nicht, ich kenne den Weg, den ich zu gehen habe, und, Vater«, langsam, drohend hob sie die geballte Hand, »kreuzen sich unsere Wege, dann —«
Sie drehte sich kurz um und ging die Treppe hinunter.
Wie vom Donner gerührt stand der Alte da. War denn das seine Tochter, die stille, schüchterne, zum Leiden und Dulden geborene Mirja ohne eigenen Willen?
»Mirja, Tochterleben«, schrie er und stürzte ihr nach, »du bist meschugge! Gott der Gerechte, du bist vom Teufel besessen. Mirja, Mirja, ich bin ja dein Vater, dein guter Vater, der dich liebt mehr als alle Schätze in der Welt!«
Er stand in der leeren Tür.
»Fort«, murmelte er und kraulte sich in den langen Locken, »fort! Der Teufel, der Beelzebub, der gepeinigt hat den Kranken, ist gefahren in sie und hat ihr verwirrt die Sinne. Mirja, Mirja«, schrie er noch einmal laut in die Nacht hinaus, »komm zurück zu deinem alten Vater, der dich liebt wie seinen Augapfel!«
»Was schreist du so, verfluchter Jude?«, erklang es zurück und vor dem Alten standen zwei kleine durch Tücher unkenntlich gemachte Gestalten.
Sedrack trat zurück und verneigte sich so tief, dass sein Bart fast den Boden berührte.
»Meine Tochter ist gegangen von mir im Zorn, o, Mächtigster der Mächtigen.«
»Ich bringe dir eine andere Tochter. Wie geht es dem Kranken?«
»Er fiebert stark.«
»Führe uns hinauf!«
Der Jude schien seine Tochter plötzlich ganz vergessen zu haben, er war die Unterwürfigkeit selbst.
Im Lichte der Kerze konnte man erkennen, dass der eine Sinkolin war. Die andere Gestalt war schlanker, die Bewegungen abgerundeter, sie gehörte offenbar einem Mädchen an.
Eugen fieberte stark, er sprach laut, rief nach Bega und beschwor sie, nicht von ihm zu gehen und ihm seine Liebe zu ihr zu verzeihen.
»Das Mädchen bleibt vorläufig bei dir, Jude!«, redete Sinkolin den Alten an. »Behandele sie, als wäre sie meine Schwester. Dein Kopf fällt, wenn sie sich einmal beschwert. Hinaus mit dir!«
Der Jude verbeugte sich und verschwand.
Jetzt wandte sich Sinkolin an das Mädchen, welches den Schleier noch nicht gelüftet hatte.
»Dort liegt er!«, sagte er, nach dem Verwundeten deutend. »Bist du noch gesonnen, das auszuführen, was ich dir aufgetragen?«
»Ich bin's, Herr«, entgegnete eine melodische Mädchenstimme.
»Ich warne dich, einen anderen Plan selbständig zu fassen. Merke ich dies, so überliefere ich dich wieder dem Scheiterhaufen, dem ich dich entrissen habe, und deine Freundin Sakuntala stirbt mit dir.«
»Herr, ich selbst fürchte den Feuertod nicht, doch um Sakuntalas willen tue ich alles, und verlangtest du das Unmöglichste.«
»Ich verlange nicht viel und komme täglich, dir zu raten. Du bist in der Krankenpflege bewandert. Gebrauche nur die Medizin, die ich dir gab.«
»Bega, Bega«, phantasierte der Verwundete, »ich sterbe, wenn du fern bleibst von mir! Nur deine Hand gib mir, und ich werde gesund!«
Schnell trat das Mädchen zu ihm; eine kleine, zarte Hand schlüpfte unter dem Tuche hervor und ergriff die Eugens. Ein glückliches Lächeln legte sich sofort über seine Züge.
Der Gouvernements-Palast zu Delhi war nicht mehr die Stätte ruhiger, ernster Arbeit; nicht mehr dachten erfahrene Männer dort darüber nach, wie man den Indern begreiflich machen könne, dass man sie nicht nur ausnutzen wolle, und wie man der ostindischen Handelskompanie eine Schranke setze, dass sie das Land nicht allein für ihr Interesse aussauge.
Jetzt herrschte in dem prächtigen, majestätischen Gebäude Tag und Nacht ein aufgeregtes Leben. Die Anführer der Rebellen, welche in Delhi weilten, hatten von den Zimmern Besitz ergriffen, und da ein Radscha stets von Dienern umschwärmt sein will, die ihm die Wünsche an den Augen ablesen, so wimmelte es in dem Palast von Eingeborenen. Auch Bahadur und Nana Sahib hielten sich fast den ganzen Tag hier auf und berieten sich, wobei oft in den sechzig Minuten der Stunde ebensoviel Vorschläge gemacht wurden, einer immer toller als der andere, um den Engländern mit einem Schlage das Lebenslicht auszublasen.
So zum Beispiel wurde der Vorschlag, erst die Engländer in Indien niederzumetzeln und dann in Prauen nach ihrer Heimat zu fahren und ihnen dort den Garaus zu machen, mit wildem Jubel begrüßt, denn dann war es mit ihnen ein für allemal vorbei.
Ein so fanatischer Feind Englands aber Bahadur auch war, diesen Vorschlag verwarf er doch.
Mit den Engländern sah es übrigens sehr traurig aus. Sie hatten jetzt in Indien noch 20 000 Mann auf ihrer Seite stehen, und diese waren über einem Länderkomplex zerstreut, der 180 Millionen Seelen zählte. Man merkte überhaupt gar nichts mehr von englischen Soldaten.
Aber auch die indischen Fürsten hatten sich getäuscht. Sie hatten geglaubt, das indische Volk wäre genügend vorbereitet, wie ein Mann würde es aufstehen und nach der Waffe greifen; aber es kam anders. Das Volk verhielt sich indifferent; es hatte mit der Zeit einen zu großen Respekt vor den Engländern bekommen. Nur an den Metzeleien und Plünderungen nahmen alle redlich Teil, zur offenen Schlacht waren sie nicht zu bewegen, höchstens ab und zu einem heimlichen Überfall.
Die abgefallenen 80 000 Sepoys dagegen waren den Engländern furchtbare Feinde, hatten sie doch von ihnen militärische Schulung genossen. Nun, standen die übrigen Inder den Rebellen nur hier und da bei, so ging alles gut; Hauptsache war, dass sie nicht etwa, durch ihre Radschas dazu aufgefordert, gegen die Sepoys die Waffen ergriffen, denn mit diesen hätten sich auch die Bauern gut geschlagen, weil sie vor ihren eigenen Landsleuten keine Scheu hatten.
Wie Delhi, so waren auch gleichzeitig oder etwas später alle Städte in den Nordwestprovinzen: Benares, Asinghar, Allahabad, Agra, Kanpur, Lucknow und andere mehr in die Hände der Rebellen gefallen. Man begnügte sich vorläufig damit, diese Städte in Festungen zu verwandeln und, waren bei der ersten Metzelei Engländer entkommen, auf diese in der Umgegend Treibjagden abzuhalten. Offenen Widerstand fanden die Inder vorläufig nirgends.
In Delhi zum Beispiel hatten die Meuterer außer einem Staatsschatz von zwei Millionen Pfund Sterling in Gold, das sind also 40 Millionen Mark, noch unermessliche Kriegsvorräte vorgefunden, darunter 150 neue Kanonen, und mit diesen wurde das ummauerte Delhi in eine stattliche Festung verwandelt.
Kommandeur dieser Artillerie war ein geschulter französischer Artillerist, welcher in unserem Roman vorläufig noch den Namen Francoeur führt. Unter ihm standen andere ehemalige französische Offiziere.
Auch Francoeur wohnte im Gouvernements-Palast und hatte sich die besten Zimmer ausgesucht, in denen er sich recht behaglich fühlte.
Eben befand er sich, bekleidet mit einer phantastisch herausgeputzten Generalsuniform, in seinem luxuriösen Arbeitszimmer und stritt sich mit einigen Radschas herum, welche sich beleidigt fühlten, dass ihnen die französischen Offiziere die neu aufgeführten Festungswerke nicht zeigen wollten, als ihm eine Dame gemeldet wurde.
Schnell komplimentierte er die Gekränkten hinaus und empfing die eintretende Phoebe, die gekleidet war wie eine Pariser Modedame.
»Gott sei Dank, endlich eine Unterbrechung in diesen ekligen Geschäften!«, rief Francoeur erleichtert, bewillkommte seine Geliebte, oder vielmehr seine ehemalige Maitresse, und bot ihr einen Stuhl an. »Nun, was führt meine schöne Phoebe zu mir, dem vielgeplagten Mann?«
»Du siehst nicht eben aus, als ob du dich überanstrengtest«, lächelte sie, streifte die bis an die Ellbogen reichenden Glacéhandschuhe ab und bediente sich sofort aus der neben ihr stehenden Zigarettenbüchse. »Seit wir uns nicht gesehen haben, bist du sichtlich dicker geworden.«
»Das heiße indische Klima bekommt mir gut.«
»Und die Küche des Gouvernements-Palastes wohl nicht minder?«
»Besonders der Keller ist ganz vorzüglich bestellt«, lachte Francoeur; »aber, weiß Gott, wenn ich nicht den Schlüssel zu diesem hätte und die Radschas Freunde von englischem Porter und Ale und französischen Weinen wären, ich würde mein Quartier wechseln. Es geht zu unruhig hier her; ein jeder will den Herrn spielen und befehlen.«
»Also du erstreckst deinen Hass nicht auch auf die englischen Getränke, wie die Inder?«
»Durchaus nicht, ich verstehe auch die guten Seiten meiner Feinde zu achten.«
»Und die französischen Rotweine?«
»Diese zu hassen habe ich noch weniger Ursache.«
»Wahrscheinlich eine geheime Sympathie mit Frankreich...«
»Still«, warnte Francoeur, »keine solchen Reden!«
»Bah, wir sind unter uns! Vor mir brauchst du deine Gedanken nicht zu verbergen, du hast oft genug mit mir unverhohlen darüber gesprochen.«
»Aber trotzdem bitte ich dich, zu schweigen. Wie gefällt es dir im Hause der Duchesse?«
Phoebe zuckte die Schultern und blies Rauchwölkchen vor sich hin, sie dann mit dem Fächer verscheuchend.
»Das Weib ist launisch«, entgegnete sie, »heute so, morgen so.«
»Wie spricht sie über die Sachlage?«
»Gar nicht, sie denkt nur an ihre Privatinteressen.«
»Lächerlich, diese Rachegedanken! Es wird nicht mehr lange dauern, und sie wird jetzt, da man sie nicht braucht, beiseite gestellt.«
»Das ist ihr gleich; sie ist ja bald so weit, wie sie will. Jetzt geht sie Nana Sahib um den Bart; sie will eine Gefangene ausgeliefert haben. Du weißt, wen.«
»Lady Carter? So so«, sagte Francoeur nachdenkend.
»Ja, um sie zu demütigen. Sie veranstaltet ein förmliches Fest dazu.«
»Und Nana Sahib will natürlich nicht.«
»Es scheint doch fast so, er möchte ihr wenigstens gern den Gefallen tun. Wenn mich der Schein nicht trügt, so hat Nana Sahib plötzlich wieder bemerkt, dass seine ehemalige Lieblingsfrau doch eigentlich immer noch recht hübsch ist.«
»Ah«, lachte Francoeur, »das nennt man Renaissance in der Liebe, und ich muss gestehen, dass auch ich ein Freund der Renaissance bin.«
Er hatte schon lange mit begehrlichen Blicken die schlanke und doch volle Figur seiner ehemaligen Maitresse gemustert und gefunden, dass sie sich während ihres Aufenthaltes in Indien nur zu ihrem Vorteil geändert hatte. Früher war ihre Farbe, wenn sie ungeschminkt, immer etwas grau gewesen, jetzt zeigte sie eine samtartige, gesunde Bräune.
Ferner erinnerte er sich, dass ihre Augen, als er sie zum letzten Male gesehen, einen matten, schwermütigen Ausdruck gehabt hatten, jetzt strahlten sie in jugendlichem Feuer. Offenbar hatte der Aufenthalt in Indien sie verjüngt.
Phoebe hatte seine Anspielung nur zu gut verstanden. Lächelnd fächelte sie ihm Kühlung zu.
»Francoeur, du bist aus den Jünglingsjahren heraus.«
»Nur den Jahren, nicht dem Herzen nach.«
»Als Kommandeur der Festung solltest du dich mit deinen Kanonen beschäftigen, nicht mit anderem.«
»Ich möchte gern eine kleine Vorübung unternehmen und probieren, ob ich die Gabe habe, eine Schanze zu erstürmen.«
»Scherz beiseite! Ich bitte dich, dich jetzt nicht mit Liebe zu beschäftigen.«
»Aber Phoebe, mit solch ernsten Dingen scherze ich niemals.«
Ärgerlich schnippste Phoebe die Asche ihrer Zigarette ab. Diese Wendung war ihr unangenehm, die unangenehmste, die das Gespräch ihr hätte bringen können.
»Ich ersuche dich, mich wenigstens jetzt mit Anträgen in Ruhe zu lassen«, sagte sie, »du weißt, ich bin nicht mehr völlig von dir abhängig. Bist du aber gefällig, so bin ich auch gern zu Gegendiensten bereit.«
»Hm, du führst eine sonderbare Sprache. Was ist dein Begehr?«
»Erst eine Frage: wie steht es mit den aus Delhi Entkommenen?«
»Das solltest du ebenso gut wissen wie ich. Im Hause der Duchesse wird mehr darüber geredet als hier.«
»Ich habe in letzter Zeit wenig darüber zu hören bekommen, die Duchesse ist ganz mit ihrer Rache beschäftigt.«
»Nun, die Engländer und Sepoys sind total versprengt, und gelingt es ihnen einmal, sich zu sammeln, so sind die Unserigen sofort zur Stelle und jagen sie wieder auseinander. Jedes solches Scharmützel liefert zahlreiche Tote, besonders auf der gegnerischen Seite, und nicht lange wird es dauern, so lebt in den Dschungeln und Wäldern kein einziger der Geflüchteten mehr.«
»Und die Gurkhas?«
»Die halten treu zu den Engländern, doch täglich findet man die Leichen mehrerer von ihnen. Sie sind gegen die Kugeln nicht mehr gefeit, denn in den Sümpfen können sie die schweren Rüstungen nicht tragen. Sie haben dieselben für später versteckt; hoffentlich gelingt uns recht bald, dieses Versteck zu finden. Ihre Pferde haben sie in den Sümpfen auch schon längst eingebüßt.«
»Hat man schon Offiziere gefangen?«
»Nicht einen einzigen«, sagte Francoeur ärgerlich, »die Gurkhas und alle anderen bewachen dieselben wie die Kettenhunde, sie opfern ihr Leben täglich für sie. Auf ihre Gefangennahme stehen hohe Belohnungen. Wer Lord Canning lebendig einliefert, erhält von Bahadur sogar Radschaswürde.«
»Und die will sich der Diener Lord Westerlys wohl verdienen?«
»Ah, sieh mal an! Du bist doch nicht schlecht orientiert!«
»Ich habe nur gehört, dass sich der Diener Lord Westerlys erboten hat, den Gouverneur zu fangen, wenn man ihm dabei behilflich ist.«
»Es ist so. Allem Anschein nach hasst der Bursche Lord Canning glühend — so sagte auch Westerly — und ferner muss er auf einen oder einige der Getreuen Cannings, vielleicht auf Gurkhas, Einfluss haben, denn er ist seiner Sache sehr sicher. Er verspricht, den Generalgouverneur lebendig einzuliefern, wenn ihm ein Boot zur Verfügung steht, bemannt mit Bewaffneten, die den Gefangenen sofort nach Delhi bringen. Denn erfahren die übrigen Versprengten von der Festnahme des Gouverneurs, so kann ein verzweifelter Kampf entstehen.«
»Und das Boot wird ihm gestellt?«
»Natürlich! Der Diener Westerlys ist schon seit einigen Tagen hinaus in den Dschungel.«
»Und sein Herr selbst folgt ihm mit dem Boot?«
»Du weißt ja ebenso viel wie ich!«
»Nicht doch. Ich habe nur gehört, dass Westerly eine Mission bekommen hat, er soll auf dem Wasserwege in den Dschungel fahren, und aus deinen Erklärungen kombiniere ich, dass er die Gefangennahme Lord Cannings unterstützen soll.«
»Das ist doch nicht so ganz, wie du denkst. Westerly hat versäumt, sich den Engländern anzuschließen, was ich ihm gar nicht verdenken kann; denn die Flucht damals aus Delhi war lebensgefährlich. Das Versäumte soll er jetzt nachholen; er soll sich zu den Engländern begeben, natürlich als unser Spion; denn er gehört uns mit Haut und Haar. Er begleitet das Boot nur als Passagier, steigt, wenn es sich im Dschungel befindet, irgendwo unbemerkt aus, markiert den Verfolgten, der aus Delhi geflohen ist und sich bisher versteckt gehalten hat. Auf diese Weise gelangt er unverdächtig zu den Engländern und kann uns über ihre Bewegungen und Pläne unterrichten.«
Nachdenklich wedelte sich Phoebe mit dem Fächer Kühlung zu.
»Hm, der Plan ist gut, aber gefährlich.«
»Bah, was fragen wir danach? Westerly muss gehorchen, wir haben ihn in der Tasche.«
»Ist der Führer des Bootes schon gewählt?«
»Natürlich, ein zuverlässiger Inder, der außerdem die Wasserläufe der Dschamna durchaus kennt.«
»Schade, sonst hättest du mich vorschlagen können.«
»Du passtest sehr gut dazu! Ein Weib!«, lachte Francoeur.
»Warum nicht? Ist doch auch der Höchstkommandierende ein Weib, und zwar eins, das es mit jedem Manne aufnimmt.«
»Nun, mit unserer Pflegetochter kannst du dich wohl nicht vergleichen.«
»Allen Ernstes, ich hege den Wunsch, an dieser Expedition mit dem Boot teilzunehmen.«
Francoeur sah sie erstaunt an, dann brach er in lautes Lachen aus.
»Bricht bei dir schon wieder die Abenteuerlust durch? Ich dächte doch, diese Jahre müsstest du nun hinter dir haben.«
»Ich bitte dich, meinen Wunsch nicht lächerlich aufzufassen. Ich habe die Absicht, die Gegend kennen zu lernen, womöglich die Engländer selbst einmal zu beobachten, und bist du nicht geneigt, meinen Plan zu unterstützen, so wende ich mich an eine andere Seite.«
Francoeur ging einige Male im Zimmer auf und ab und blieb dann vor Phoebe stehen.
»Es ist wirklich dein ernster Wunsch, diese Expedition auf dem Boot, die einen gefährlichen Verlauf nehmen kann, mitzumachen?«
»Ich bleibe fest dabei.«
»Aus welchem Grunde?«
»Den habe ich dir schon mitgeteilt.«
»Bah, mir kannst du nicht weismachen, dass dich nur die Abenteuerlust dazu treibt. Ich wette, du gehst als Spionin für Westerly mit.«
»Vielleicht.«
»Willst du mir keinen reinen Wein einschenken?«
»Ich darf nicht.«
»Hm, solltest auch du ein Freund der Renaissance in der Liebe sein? Solltest du mit Westerly früher — doch nein, das ist nicht möglich. Ah«, fuhr er plötzlich rasch fort, »ich durchschaue dich oder vielmehr deinen Auftrag. Du bist von der Duchesse geworben.«
»Vielleicht!«
»Dass Westerly Lady Carter liebt, weiß ich, und mir ist zu Ohren gekommen, dass er sie als Preis für seine Bemühungen verlangt. Sie ist ihm versprochen worden; das ist aber der Duchesse sehr unangenehm; denn sie will ihre Schwester für sich behalten, um ihre Rache an ihr zu kühlen, und nun hat sie jemanden geworben, der dafür sorgt, dass Westerly...«
»Francoeur«, unterbrach Phoebe ihn heftig, aber leise, »ich bin keine Mörderin!«
»Es gibt noch andere Mittel als nur den Mord. Doch gut, wir Franzosen müssen durchaus zusammenhalten und jedem gefällig sein, der Feind der Engländer wie der Inder ist — und du sollst mitfahren können.«
Francoeur glaubte mit seiner Vermutung das Richtige getroffen zu haben, weil Phoebe ihm nicht widersprach, hatte sich aber sehr geirrt.
Mitten im Dschungel befand sich ein Platz, wo die langen Schilfstängel mit den scharfen Blättern und die Bambusstangen dicht über dem Boden abgeschnitten waren. Auf diese Weise war eine Lichtung entstanden, aber sie konnte auch mit einer Insel verglichen werden, denn ringsherum wurde sie von einem unpassierbaren Sumpfe eingeschlossen.
Den Weg zu dieser trockenen Stelle hatte sonst die Königstigerin nur betreten, wenn sie Junge werfen wollte, jetzt lagen auf dieser Insel zwölf junge Männer in sichtlich erschöpftem Zustande; wurden doch auch sie wie Raubtiere gejagt.
Alle waren von ganz außergewöhnlicher Körpergröße und sonst wohl auch von der entsprechenden Kraft; doch aus ihren Augen und eingefallenen Zügen sprachen die furchtbaren Strapazen, Hunger und Fieber. Keine Decke, kein Mantel schützte sie; sie durchstreiften die Wildnisse wie die Raubtiere, schliefen auf der nackten Erde und aßen das erbeutete Wild meist roh, um durch den Feuerschein keinen Verfolger anzulocken.
Bewaffnet waren sie mit Schwertern, Dolchen und Karabinern, welche sie mit ihren auseinandergefalteten Schärpen sorgsam umwickelt hatten; doch schon lange besaßen sie keine Patrone mehr, das Wild mussten sie in Schlingen fangen.
Es waren verfolgte Gurkhas. Träge lagen sie umher, stierten gedankenlos vor sich hin, oder unterhielten sich auch leise in flüsterndem Tone miteinander, wobei ihre Blicke manchmal scheu den zwölften Mann streiften, der etwas abseits von den Übrigen lag.
Dieser war, wenn auch seine jetzige Hautfarbe den Indern an Bräune nichts nachgab, offenbar ein Europäer, denn er hatte schlichtes, blondes Haar und die Gesichtsbildung der kaukasischen Rasse. An Größe gab er den Gurkhas etwas nach, aber seine breitschultrige Gestalt verriet eine bedeutende Kraft, ja, nicht einmal das Hungerleben in den Fiebersümpfen hatte sie zu beugen vermocht.
Lord Canning, der Oberstatthalter von Indien, dem in jeder Stadt ein Palast zur Verfügung stand, lag hier wie ein gehetztes Wild, an der Stelle, wo sonst die Tigerin ihre Jungen zur Welt brachte.
Bei der Flucht aus Fort Oliver war er von den übrigen Geretteten versprengt worden, nur diese elf Gurkhas hatte der Zufall ihm gelassen, und sie machten nun Tag für Tag, selbst die Hälfte der Nacht, die gewaltigsten Märsche, um sich mit den anderen Engländern und den getreuen Sepoys zu vereinigen. Canning wusste noch nicht, dass auch diese, in kleine Trupps versprengt, umherirrten.
Finster und immer finsterer wurden die Gesichter seiner elf Leute, die schon längst ihre schweren Panzer fortgeworfen hatten, weil sie sonst, nachdem die Pferde schon versunken waren, in dem weichen Boden stecken geblieben wären. Was Lord Cannings eiserne Natur ertragen konnte, das konnte die ihrige nicht aushalten.
Schließlich gab er nach; er bestimmte den morgigen Tag als Rasttag; aber wo war ein Platz, auf welchem man sich ruhig hinlegen konnte, ohne von den Bluthunden sofort wieder aufgestöbert und gejagt zu werden?
Da trafen sie am Abend auf einen Inder, anscheinend ein Jäger. Sie wollten ihn zuerst niedermachen, denn jeder Unbekannte musste als ein Feind angesehen werden, aber der Jäger gab Zeichen des Friedens, und es fand eine Verständigung statt.
Er sagte, seine Hütte, in der er Felle aufbewahre, läge nicht weit von hier, doch dahin könne er sie nicht führen, denn täglich kämen Inder und untersuchten sie nach Engländern. Er selbst mische sich nicht in den Streit, er wäre auf keiner Seite an dem Aufstand beteiligt, sondern er wünsche nur, dieser sei erst vorüber, damit er wieder sorglos seinem Jagdgewerbe nachgehen könne.
Wenn er, Lord Canning, ihm seine glänzende Kette als Halsschmuck gäbe, wäre er gern erbötig, den Verfolgten ein sicheres Versteck zu zeigen.
Derartige Jäger sind in Indien nichts Seltenes. Die Inder haben eine eigenartige Lebensanschauung, wie man an den zahlreichen Fakiren merkt, und dass sich Eingeborene ganz in die Wälder zurückziehen und nur von der Jagd leben, unbekümmert um die andere Welt, findet man häufig.
Lord Canning hätte der Ehrlichkeit des Burschen gern vollkommen getraut, wenn dieser nicht so scheue Augen besessen hätte, die unstet umherwanderten. Doch was sollte er tun? Seine Leute bedurften unbedingt der Ruhe. Er gab dem Jäger die goldene Uhrkette, nachdem er davon ein Medaillon abgelöst hatte, und der Mann brachte die Müden in einen Schlupfwinkel.
Der Jäger sorgte sofort für Wildbret, und hier durfte auch Feuer angemacht werden. Die Feuerstelle in der Mitte des Platzes, sowie umher liegende Knochen einer Antilope bewiesen, dass man bereits eine Mahlzeit hinter sich hatte. Doch diese war schon am Abend zuvor abgehalten worden, und der Jäger war wieder unterwegs, um für neue Nahrung zu sorgen.
Lord Canning bedauerte, dass die Patronen der Jagdflinte nicht in die Karabiner seiner Leute passten, denn so waren sie in einem Kampfe nur auf ihre blanken Waffen angewiesen.
Die Sonne stand schon hoch am Himmel, als die Schilfstängel knackten. Aller Köpfe wendeten sich einer Richtung zu, wo ein geheimer Weg durch den Sumpf führte; der Inder trat heraus, mit einem ledernen Sack schwer bepackt.
Er keuchte, es war heiß und der Sack schwer, aber er setzte ihn nicht gleich ab, sondern trug ihn bis in die Mitte der im Kreise lagernden Gurkhas.
»Woher bekamst du mit einem Male diesen Sack?«, fragte Canning, der aufgestanden und hinzugetreten war, erstaunt.
»Ich war in meiner Hütte, Sahib, und habe ihn mir geholt.«
»Deshalb bliebst du auch so lange aus. Wir haben dich sehnsüchtig erwartet.«
»Das Wild ist auch nicht mehr leicht zu schießen, Sahib, es wird durch den Lärm scheu. Weit musste ich gehen, ehe ich eine Antilope zum Schuss bekam, und der Schleichweg führte mich in meine Hütte.«
Der Mann sah Lord Canning eigentümlich an, machte eine Handbewegung und entfernte sich abseits. Lord Canning, glaubend, er habe ihm eine wichtige Mitteilung zu machen, folgte ihm; aber nicht genug damit, der Jäger zog ihn auch am Arm und richtete es so ein, dass Cannings Gesicht den Gurkhas abgewendet war.
»Nun, was hast du?«
»Sst, nicht so laut!«, warnte der Jäger, die Gurkhas dabei von der Seite beobachtend. »Sie dürfen es nicht hören.«
»Was hast du mir mitzuteilen?«
»Ich habe etwas gesehen.«
»Uns feindliche Inder?«
»Einen Faschni.«
Lord Canning konnte über die Wichtigkeit dieser Mitteilung kaum ein Lächeln unterdrücken, er hatte etwas ganz anderes erwartet.
Wie die Agnis die Feuergeister, so sind die Faschnis die Wassergeister, denn, wie schon erwähnt, bevölkern die abergläubischen Inder alles mit Geistern, mit Kobolden, Nixen und so weiter. Die im Dschungel häufigen Irrlichter halten sie für Agnis, und die zusammengeballten Nebel, welche oft über sumpfigen Gewässern schweben, beten sie als Faschnis an. Dass phantastische Köpfe oft auch richtige Gestalten dabei sehen wollen, ist natürlich.
Das wusste auch Canning und, weit davon entfernt, den Mann über seinen Aberglauben aufzuklären, empfahl er ihm, darüber zu schweigen, denn leicht konnte es sein, dass, wenn ein Gurkha die Anwesenheit eines Faschnis in der Nähe erfuhr, auf und davon lief, und dass die anderen ihm folgten.
Während sich Lord Canning mit dem Jäger besprach, bemerkte er nicht, was hinter ihm vorging. Die Gurkhas blinzelten dem nach ihnen sehenden Jäger zu, nahmen aus dem Sack eine obenaufliegende, kleine Antilope, griffen tiefer hinein und brachten eine Menge teils blauer, teils weißer Pakete zum Vorschein, die sie schnell unter sich verteilten.
Canning hätte sofort gewusst, was sie enthielten, denn sie entstammten den englischen Munitionskammern Delhis; die blauen enthielten Patronen für die Karabiner, die weißen für die Revolver der Gurkhas.
Als sich der Jäger endlich zufrieden gab, und Canning sich umdrehte, waren seine Leute schon ruhig mit Häuten und Zerlegen der Antilope und mit Vorrichtungen zum Braten derselben beschäftigt.
Er ahnte nicht, als er sich zum gemeinsamen Essen setzte, dass er seine Mahlzeit mit lauter Verrätern teilte, die seine Gefangennahme beabsichtigten.
Die anderen aßen noch, als sich der Jäger schon wieder entfernte, um, wie er sagte, für die Sicherheit seiner Schützlinge zu sorgen. Die Gurkhas lagerten sich im Kreis, der Ruhe zu pflegen, und Lord Canning streckte sich abseits nieder.
Lange betrachtete er das geöffnete, kleine Medaillon in seiner Hand, ein gleiches, wie Franziska besaß, trübe ruhte sein Auge auf den lieblichen Zügen seiner Braut, und trübe waren seine Gedanken.
Was war aus denen wohl geworden, welche auf eine so rätselhafte Weise aus dem Keller des Fort Oliver verschwunden waren? Gewiss hatten die Inder einen unterirdischen Weg gekannt, ihn benutzt und die Frauen entführt. Dann war der Tod ihr sicheres Los, und, ach, unter ihnen war auch jene, welche Canning liebte!
Gern hätte er sein Leben darangesetzt, um in die Stadt zu kommen und Nachforschungen nach Franziska anzustellen; aber sein Leben gehörte nicht ihm allein, es gehörte auch England. Alle Engländer warteten jetzt auf den Generalgouverneur, damit er Maßregeln ergriffe, und er lag hier im Dschungel, nur eine Handvoll Getreuer um sich.
Wenn nun auch diese ihm die Treue kündigten? Sie machten schon so mürrische Gesichter. Natürlich, sie hätten nur zum Feind überzutreten brauchen, und das beste Leben wartete ihrer, hier dagegen führten sie ein Dasein wie die Raubtiere. Es brauchte nur jemand zu kommen und ihnen verlockende Angebote zu machen, so war zehn gegen eins zu wetten, dass sie zum Feind überliefen, natürlich, nachdem sie vorher das Haupt der Engländer, ihn, getötet hätten. Ja, wenn Dollamore bei Canning gewesen wäre! Für den verhungerten die Gurkhas mit Freuden.
Wenn nun jener Jäger doch ein Verräter war?
Es war Lord Canning gleich im Anfang gewesen, da er den Jäger erblickte, als hätte er das Gesicht schon früher einmal gesehen, und noch manchmal passierte ihm dies, und jedes mal überschlich ihn dabei ein unangenehmes Gefühl.
Nun, er musste sich eben auf die Treue der elf Gurkhas verlassen; Tag und Nacht für seine Sicherheit wachen konnte er nicht, der Schlaf forderte gebieterisch seine Rechte.
Noch einmal küsste der Generalgouverneur das Bildnis seiner Braut, dann verwahrte er es sorgsam an der Brust und war bald eingeschlafen.
Nicht so die Gurkhas; der Schlaf floh ihre Augen, denn der Jäger, ein schon ältlicher, erfahrener Mann, zauberte den Ermüdeten verlockende Bilder vor, die sie wach hielten.
»Einen Stich ihm beibringen, ja, das könnte ich wohl«, sagte einer, der Stärkste von allen; »aber ihn fangen und gebunden fortführen, nein, ich bring's nicht fertig.«
»Warum nicht?«, fragte der Jäger.
»Ich — könnte ihm nicht ins Auge schauen.«
»So lässt du es eben bleiben!«, lachte der Jäger leise. »Lebendig muss er nach Delhi gebracht werden, sonst dürft ihr auf Gnade nicht hoffen. Alle anderen Inder, selbst die Sepoys, welche den Engländern beigestanden haben, erhalten sofort Verzeihung, wenn sie wieder zu uns übertreten, nur die Gurkhas nicht, denn sie sind daran schuld, dass uns die verfluchten Faringis entgangen sind, sie haben ihnen den Weg zur Flucht gebahnt. Nur euch elf Mann wird die besondere Vergünstigung gewährt, doch diesen da müsst ihr fangen.«
»Aber Dollamore...«, bemerkte der Große noch einmal zögernd.
»Bah, der ist schon längst von einer Kugel gefallen. Und wenn er noch lebte, was wäre dabei? Liebst du denn dieses Hungerleben in den Sümpfen so sehr, oder was hast du von den Engländern, deinen natürlichen Feinden, dass du sie nur ungern verlässt? In Delhi erwartet dich das schönste Leben; übermorgen werden alle gefangenen Weiber und Kinder niedergemetzelt, und dazu lässt Bahadur über tausend Ochsen und unzählige Schafe schlachten.«
»Wir wollen es tun«, sagten einige und standen entschlossen auf. Auch der letzte gab sein Zögern auf.
»Aber kein Schuss, kein Stich, kein Schlag!«, warnte der Jäger und verteilte Stricke.
»Lebendig und unverletzt muss ich ihn haben. Bedenkt, was ich euch sagte, wer ich bin, werdet ihr erst in Delhi erfahren. Alles ist bereit, euch sofort dorthin zu bringen.«
Die Männer verteilten sich und schlichen auf den Schlafenden zu.
Plötzlich fühlte sich Lord Canning von vielen starken Armen umschlungen; schwere Körper lagen auf dem seinen, seine Hände wurden gepackt. Dennoch gelang es ihm noch einmal, sich halb empor zurichten; die linke Hand vermochte sich noch einmal loszureißen; er zog dem nächsten den Dolch aus dem Gürtel, und tödlich getroffen sanken zwei der Verräter nieder.
Aber all seine Kraft half nichts gegen die Übermacht; bald waren ihm die Hände auf dem Rücken gebunden.
»Verräter!«, keuchte er. »Elende, erbärmliche Feiglinge!«
Er sah, wie befehlend jetzt plötzlich der fremde Inder auftrat, und er wusste, wer seine Leute gegen ihn aufgewiegelt hatte. Geduldig ergab er sich in sein Schicksal, er kannte das Los, das seiner harrte — Gefangenhaltung als Kriegsgeisel.
Der Jäger umschlang die Arme des starken Mannes nochmals mit doppelten Stricken, dann wurde Canning in die Mitte genommen und auf dem schmalen Wege durch den Sumpf geführt.
Nach einem Marsch von einer halben Stunde kam man an das schilfige Ufer eines Nebenflusses der Dschamna, der durch sein öfteres Übertreten diese Sumpfregion geschaffen hatte.
Es war eine vollkommene Wildnis. Die Bäume waren mit Schlingpflanzen überwuchert, gefallene Stämme lagen kreuz und quer im Wege und düngten den Boden wieder durch ihren Verfall, sodass das Sumpfschilf üppig treiben konnte.
Der Jäger befahl Halt und ließ Canning an den schlanken Stamm einer Palme fesseln. Er selbst prüfte sorgfältig die Bande, denn er hatte vor der Kraft des Gefangenen Respekt bekommen.
»Ihr geht diesen Fluss entlang«, wandte er sich dann an seine neuen Genossen, »haltet euch immer längs desselben, und wenn ihr ein großes Boot seht, so gebt Zeichen, und ihr werdet von ihm aufgenommen. Sagt, dass ich mit dem Gefangenen hier bin, es wird herauffahren und uns abholen.«
»Warum kommst du nicht gleich selbst mit?«, fragte einer misstrauisch.
»Weil ich mit ihm erst allein sein will. Geht!«
Die Gurkhas gehorchten; sie entfernten sich, und der Jäger sah ihnen so lange nach, bis der letzte hinter den Schlingpflanzen verschwunden war.
Lord Canning ahnte, dass dieser Mann ihn unter vier Augen sprechen wollte.
»Was hast du mit mir vor?«, fragte er.
Der Inder antwortete nicht. Langsam, bedächtig legte er sein Gewehr und seine Munitionstasche nieder, nestelte sein baumwollenes Hemd auf und zog es aus.
Da bemerkte Lord Canning plötzlich, dass des Mannes Rücken mit langen, tiefen Narben durchfurcht war, selbst über Schultern und Achseln zogen sie sich hin. Offenbar rührten sie von Peitschenhieben her, wie die indischen Verbrecher sie erhalten, ehe sie der Strafanstalt überwiesen werden.
Als der Mann sich wieder aufrichtete, sah er schrecklich aus, sein ganzes Wesen hatte sich verändert. Seine Züge waren von einer wilden Leidenschaft entstellt, seine Augen glühten in unheimlichem Feuer.
Selbst Lord Cannings furchtloses Herz erbebte, als die halbnackte Gestalt, im Gürtel ein langes, blankes Messer, mit über der Brust verschränkten Armen vor ihn hintrat. Lange betrachtete der Inder den Gefangenen; immer entsetzlicher wurde der Ausdruck seines Gesichtes.
»Erkennst du mich jetzt?«, fragte er dann leise mit vor verhaltener Wut bebender Stimme. Da plötzlich zerriss der Schleier vor Cannings geistigen Augen. Ja, jetzt erkannte er diesen Mann, und er wusste, dass er von ihm kein Mitleid zu erhoffen hatte.
»Mudrara — du!«
»Ja, ich bin Mudrara«, zischte der Inder, »und du, Hund, bist der, welcher mich zu dem gemacht hat, was ich bin, zu einem Mörder, einem Sträfling, der gepeitscht wurde, einem Menschen, der sein Vaterland nicht wieder betreten darf, weil er dort zu Tode gesteinigt wird. Du, du bist an allem schuld.«
Lord Canning hatte seine Ruhe wiedergefunden.
»Ich kenne dich, Mudrara. Du warst in Kanpur einst mein Diener, ich züchtigte dich einmal, weil du mir Geld entwendet hattest...«
»Es war mein Geld«, fuhr der Inder hastig auf.
»Du irrst, es war das meine, und ich war dir deinen Lohn nicht schuldig.«
»Es war mein Geld; ihr Engländer habt es aus dem Schweiße der Inder erpresst und bezahltet damit eure Diener. Hatte ich, ein Inder, nicht das Recht, es zu nehmen?«
Lord Canning antwortete auf solche Beweisführungen nichts.
»Ich brauchte es, denn meine Tochter stand auf dem Sklavenmarkt, ich hatte sie gesehen und wollte sie kaufen, sie befreien, und dazu musste ich Geld haben...«
»Hättest du mir das gesagt, so hätte ich sie gekauft.«
»Hahaha«, lachte der Inder höhnisch, »nicht wahr, damit du sie besitzen konntest!«
»Mudrara, ich beschwöre dich...«
»Nein, nein, ich kenne euch Engländer, ihr seid alle gleich. Du schlugst mich, als du mich fandest, wie ich das Geld nehmen wollte.«
»Du hobst das Messer gegen mich; ich kam dir nur zuvor, als ich dich zu Boden schlug. Ich wollte wissen, warum du mir die große Summe entwenden wolltest, du aber schwiegst verstockt.«
»Weil du mir doch nicht geglaubt hättest, dass ich damit meine Tochter einlösen wollte. O, ich hatte schon manche Erfahrung gemacht. Du verziehst mir, wie du sagtest, aber du schicktest mich fort, und als ich auf den Sklavenmarkt kam, war das Kind eben unter dem Hammer.«
»Du hättest es der englischen Behörde anzeigen sollen. Der Markt wäre sofort aufgehoben worden und deine Tochter befreit gewesen.«
»Der englischen Behörde?«, hohnlachte der Mann. »Engländer waren ja die Käufer; der Gouverneur von Kanpur selbst kaufte meine Tochter. Wo sollte ich da Recht suchen?«
»Und du warst es, der diesen Gouverneur ermordete.«
»Ich war's, und meine Tochter ermordete ich mit, als sie in seinen Armen lag. Und wer war es, der den flüchtigen Mörder einholte, ihn abermals zu Boden schlug und ihn der englischen Polizei auslieferte?«
Lord Canning erschrak.
»Es war deine Tochter?«
»Meine Tochter! Ich wollte nicht, dass sie zum Spielzeug der Faringis diente, die ich hasste. Lieber tötete ich sie selbst.«
»Du hattest es nicht gesagt, ich wusste das nicht. Hätte ich gewusst, dass es deine Tochter war, bei Gott, ich hätte meine Pflicht vergessen und hätte dir beigestanden.«
»Hahaha!«, lachte der Inder höhnisch. »Gedenkst du, mich zu rühren? Sprich, wer war es, der mich gefangen nahm und der Polizei auslieferte?«
Canning wusste, dass das steinerne, hasserfüllte Herz dieses Mannes nicht umzustimmen war.
»Ich, und dir ist recht geschehen. Meine Pflicht war es damals sogar, deiner Exekution beizuwohnen, und ich gab dem Vollzieher die Weisung, deinen Rücken nicht zu schonen.
»Hund«, knirschte der Inder bei diesem offenen Geständnis und erhob die geballte Faust, »du allein bist an allem schuld, du gabst den Anfang zu meinem Unglück, und Schlag für Schlag, den ich empfangen habe, will ich dir vergelten, ehe ich dich den Radschas ausliefere.«
Er führte mit der Faust den ersten Schlag nach Cannings Kopfe, an die Schläfe.
Canning schrie auf; wie ein Verzweifelter riss er an den Stricken.
»Herr, gib mir nur einen Arm frei!«, stöhnte er auf.
Der zweite Schlag sauste an seinen Kopf; mit schäumenden Lippen stand der Inder vor ihm, er wollte seine Wut an dem Wehrlosen auslassen.
Zum dritten Male holte er zum Schlage aus; da riss es hinter Cannings Rücken, der rechte Arm hatte sich losgesprengt, und von kräftiger Faust in die Seite getroffen, taumelte der Inder zu Boden.

Doch im Nu sprang er auf, riss das Messer aus dem Gürtel und stürzte, die Wichtigkeit Lord Cannings als Gefangenen vergessend, auf ihn zu, ihm den Todesstoß zu geben.
Der Generalgouverneur sah sich verloren, er erwartete seinen Tod mit kaltem Auge. Da blitzte es zwischen dem Schilf auf, der scharfe Schuss eines Revolvers krachte; der Inder brach zusammen, rollte im Todeskampf zwischen die Binsen des Uferrandes, und Dollamore stürzte hervor.
»Gerettet!«, jubelte er. »Ich kam zur rechten Zeit. Es war meine letzte Kugel.«
Sein scharfes Messer sägte und schnitt an den Banden des Gefangenen.
»Ein starker Trupp der Unseren hat sich vereinigt«, sagte er während seiner Arbeit hastig, »jetzt können wir uns durchschlagen — nach Süden zu — General Nicholson ist schon mit Hilfe unterwegs — ein Boot kommt den Fluss herunter — wir greifen es an und nehmen es — wir werden Munition finden und uns nicht mehr jagen lassen.«
Lord Canning war frei. Er drückte wortlos Dollamores Hand. Aus dem Gebüsch brachen wohl hundert Mann, Engländer, Gurkhas und Sepoys. Canning wurde bewaffnet.
»Halt, noch einen Augenblick! Ich bin von verräterischen Gurkhas überwältigt worden, es sind neun Mann, auch sie erwarten das Boot, um sich dessen Mannschaft anzuschließen. Es sollte wahrscheinlich noch Gefangene nach Delhi bringen.«
»Der Teufel soll sie holen, wenn ich sie finde.« rief Dollamore heftig.
Dem Trupp voran stürmte er durch den Dschungel; nach wenigen Minuten erblickten sie die neun Gurkhas, und diese sanken vor Schreck in die Knie, als ihr Führer plötzlich vor ihnen stand.
»Schurken«, donnerte Dollamore sie an, »Verräter, Hunde!«
Er hatte keine Zeit, jetzt ein Gericht abzuhalten, er sah nur ihre gefüllten Patronentaschen, die Munition wurde verteilt, und dann ging es weiter, vorsichtig, leise, jedes Geräusch vermeidend; denn man wollte das erwartete Boot überraschen.
Die neun Gurkhas schlossen sich dem Trupp an, sie hatten ja wieder ihren Führer vor sich.
Eine halbe Stunde währte der Schleichmarsch dann erblickten sie das Boot.
Es war ein großes, plumpes Fahrzeug mit einem Häuschen darauf und so hoch gebaut, dass es ein Zwischendeck enthalten musste. Die Ruderer saßen auf dem schanzenlosen Verdeck und bewegten träge die schweren Riemen. Sonst standen noch etwa zwanzig wohl bewaffnete Inder umher. Das Fahrzeug war ganz flach, ohne Kiel gebaut, konnte also eine beträchtliche Last tragen und doch seichte Stellen befahren.
Aber das unangenehmste war für die heimlichen Beobachter, dass es auf der anderen Seite des Flusses fuhr, und wohin man auch blickte, überall starrte das Wasser von beschuppten Krokodilsköpfen.
Arglos fuhren die Leute dahin.
Da erklang ein Kommando; am Uferrand krachte eine Salve, und fast alle an Deck Stehenden brachen unter Schmerzensschreien zusammen.
»Mir nach!«, donnerte Dollamore und war mit einem Satz im Wasser, dass die Fluten hoch aufspritzten.
Die Gurkhas verließen ihren Führer nicht, sie folgten ihm, und erschreckt über diesen Aufruhr, suchten die sonst so furchtbaren Krokodile das Weite.
Es war das erste Mal, dass die aus Delhi Geflohenen den Feinden nicht aus dem Wege gingen, sondern sie angriffen, und die Mannschaft des Bootes ließ sich auch nicht erst auf einen Kampf ein.
»Dollamore! Die Gurkhas!«, schrien die Überlebenden; sie warfen die Waffen weg und sprangen vom Bordrand an das nahe Ufer, und plötzlich entleerte sich das Zwischendeck wie auch das Häuschen seines Inhaltes, wohl vierzig Inder stürzten daraus hervor an das Ufer und verschwanden in rasender Flucht zwischen dem Schilf.
Es war Dollamore, als hätte er unter den Fliehenden auch ein Weib gesehen; dann hatte er das Boot erreicht; an dem Steuerruder kletterte er hinauf und warf Taue für die Nachfolgenden hinab.
Keine Menschenseele war mehr zu erblicken, ausgenommen die Toten und Verwundeten.
Man nahm ihnen die Waffen und warf sie selbst über Bord, den Krokodilen, die sich bald wieder einstellten, zum Fraß. Weder Dollamore noch Canning dachten an eine Verfolgung der Entkommenen. Sie waren im Besitz von Waffen und Munition, mit diesen konnten sie sich durchschlagen, bis sie auf Nicholson stießen, der schon nach Delhi unterwegs war.
Im Hause der Duchesse ging ein angstvolles Flüstern von Mund zu Mund; die eingeborenen Diener und Dienerinnen getrauten sich kaum am Tage, viel weniger des Nachts die unteren Räumlichkeiten zu betreten, und wurde einer in den Keller geschickt, etwas zu holen, so musste erst eine Begleitgarde beordert werden, denn um keinen Preis der Welt ging einer allein hinunter.
Aber auch diese ganze Truppe kam jedes mal so schnell wie möglich und mit gesträubten Haaren wieder ans Tageslicht, behauptend, sie hätten ,ihn‹ wimmern hören oder sogar den Schein seines Feuers gesehen.
Es hieß nämlich, ein Agni, ein Feuergeist, habe im Keller dieses Hauses sein Domizil aufgeschlagen und käme ab und zu zum Vorschein. Gesehen hatte ihn freilich noch niemand in Wirklichkeit; aber das Gerücht war einmal entstanden, und jetzt behaupteten einige, sie hätten ihn tatsächlich erblickt.
Die Duchesse konnte tun und spotten, so viel sie wollte, sie vermochte das Gerücht nicht zu unterdrücken, und sonderbarerweise fürchtete sie sich selbst vor diesem Hausgespenst. Doch sie war praktisch, sie wollte den Geist unschädlich machen.
Eines Tages, als Vorbereitungen zu einem Gastmahl getroffen wurden, wahrscheinlich zu Ehren des anwesenden Nana Sahib, ließ sie Babur zu sich kommen.
»Für was hältst du das?«, fragte sie den Inder und deutete auf einige große, seltsame Gestelle aus Eisenstäben.
»Es sind Fallen, wie die Faringis sie zum Fangen der großen Raubtiere verwenden.«
»So wollen wir einmal versuchen, ob sich in einer derselben euer Agni fängt.«
Sie ließ den Inder die Fallen auf die Schulter laden und ging ihm voran.
Als er merkte, dass sie in den Keller wollte, blieb er zaghaft stehen.
»Fürchtest du dich, mir zu folgen, Hasenherz?«, zürnte sie ihm.
»Herrin, ich — ich gehe nicht — da hinunter«, stotterte Babur.
»Warum nicht?«
»Dort unten haust der Feuergeist.«
»Hast du ihn gesehen?«
»Ja, Herrin.«
Die Duchesse blickte sich scheu um und trat nahe an den Inder heran.
»Wie sah er aus?«, fragte sie ihn leise
»Er war nur in Felle gekleidet, hatte einen langen, weißen Bart, ebensolches Haar und statt der Nägel Krallen; in der Hand trug er einen brennenden Ast.«
»Hast du von dem Feuergeist gehört, der sich einmal in der Nähe von Mirat umher trieb?«
»Nein, Herrin.«
»Wo hast du diesen Agni gesehen?«
»Im tiefsten Keller.«
»Was machte er?«
»Er flog in der Luft herum und heulte; mehr sah ich nicht, denn ich floh schnell.«
Der Mann hatte jedenfalls den angeblichen Geist gar nicht gesehen; aber woher bekam er diese Schilderung? Oder hatte er ihn doch erblickt?
Als die Duchesse wiederholt das Gerücht von der Anwesenheit eines Feuergeistes im Hause gehört hatte, war eine Vermutung in ihr aufgestiegen. Sie hatte an der hintersten Stelle im tiefsten Keller, da, wo eine geheime Falltür tief hinab in die geheimen Gänge führte, mit eigenen Händen weißen Sand gestreut, und als sie am anderen Tage wieder nachgesehen, hatte sie zu ihrem Schrecken deutliche Fußspuren bemerkt. Sie kamen von da heraus, wo sich die Falltür befand, gingen über den Sand und liefen wieder zurück. Es war ein Männerfuß und kein Zweifel, dass sein Besitzer die Falltür benutzt hatte, um ins Haus und wieder hinaus zu gelangen.
Ein kaltes Entsetzen war bei dieser Entdeckung über des Weibes Rücken gelaufen, und immer wieder befiel es sie, so oft sie von dem Feuergeiste reden hörte. Diesen ungebetenen Besuchen wollte sie aber nun ein für allemal ein Ende bereiten.
Ihrem Zureden gelang es endlich, Babur zum Weitergehen zu bewegen, und schließlich stellte er auch an der engsten Stelle des Ganges, wo ein Mensch eben durch konnte, die Fallen auf und befestigte sie.
Wie von dem Feuergeist schon verfolgt, so floh Babur darauf wieder die Treppen hinauf; die Duchesse aber überzeugte sich erst, ob der Mechanismus funktioniere, welcher die Versenkung in Bewegung setzte.
Dann begab auch sie sich hinauf und machte Toilette, bei welcher Beschäftigung sie durch Nana Sahibs Eintritt unterbrochen wurde.
Sie hatte ihn nicht gleich bemerkt; er betrachtete unterdes mit lüsternen Augen die schöne Gestalt — sein Weib, von dem er seit Langem getrennt gewesen.
Die Kammerzofe sah den Radscha zuerst, sie machte ihre Herrin auf den unangemeldeten Besuch aufmerksam.
Die Duchesse zog erst ein ungnädiges Gesicht.
»Hast du meinen Wunsch erfüllt?«, fragte sie dann.
»Es wurde mir schwer; aber sie ist da.«
Des Weibes Augen leuchteten in triumphierender Freude auf. Sie schickte die Kammerzofe hinaus, und der grimmige Nana Sahib vertrat deren Stelle. —
Die Tafel im Speisesaal war festlich gedeckt, doch nur für vier Personen. Trotzdem war nichts unterlassen, den Reichtum des Hauses zu zeigen. Teller, Schüsseln und Bestecke waren von Silber, desgleichen die mit Früchten gefüllten Aufsätze.
Noch fehlten die Gäste; denn das in raue, schmutzige Leinwand gekleidete Weib, welches dort an der Wand kniete, gehörte sicher nicht zu den Geladenen.
Es war eine Gefangene; mit Ketten war sie an einen Ring geschlossen, der, wie es schien, frisch in die Wand eingemauert worden war, und die, welche die Ketten um die Handgelenke trug, hatte einst den stolzen Namen Lady Carter, Baronesse von Nottingham, geführt.
Ja, es war Emily, aus deren Zügen unsägliches Elend und harte Entbehrung sprachen. Sechs Tage war sie mit ihren Schicksalsgenossen, nur Frauen und Kindern, in einem dumpfen Gewölbe eingesperrt gewesen. Am ersten Tage war ihnen reichliche Nahrung gebracht worden, und man hatte für Ventilation gesorgt, die anderen fünf Tage dagegen hatten sie kaum Brot gehabt, und die Luft wurde nach und nach so verpestet, dass man kaum noch atmen konnte. Schon waren viele Kinder gestorben, viele Erwachsene rangen mit dem Tode, und noch immer wurden neue Gefangene in das Gewölbe hineingetrieben.
Sie kamen aus anderen Städten und brachten schreckliche Kunde mit.
Sie hatten gesehen, wie die rebellischen Inder die wehrlosen Gefangenen in Stücke hieben, von Pferden zerreißen ließen, verbrannten oder vielmehr langsam verkohlen ließen, ihnen die Hände abschlugen, die Ohren mit Zangen abrissen, den Weibern die Brüste abschnitten und andere Gräueltaten mehr verübten.
Warum diese plötzlich eingestellt worden waren, wusste niemand; jedenfalls, meinten die neu hinzugekommenen Gefangenen, um in noch schrecklicherem Maße an ihnen hier in Delhi fortgesetzt zu werden.
Schon der Aufenthalt in diesem Gewölbe war eine entsetzliche Qual, und je mehr starben, desto furchtbarer wurde die Lage, denn an das Fortschaffen der Leichen dachten die Wächter nicht.
Was für Szenen hatte Emily dort gesehen! Sie wünschte sich jede Stunde hundertmal den Tod, und das Zusammensein mit Klärchen, der Schwester Reihenfels', war ihr einziger Trost. Es war wahrhaftig für das Mädchen kein freudiges Ereignis gewesen, als die Mutter von dem jungen Brahmanen bei seiner Flucht aufs Pferd gehoben wurde. Wer wusste, ob diese nicht ein ebensolches Los erwartete?
Heute Morgen war Emily plötzlich mit rauen Worten aufgefordert worden, sich zu erheben und mitzukommen. Sie verließ das Gewölbe mit gebrochenem Herzen, nicht, weil sie nun ihrem Tode entgegenzugehen wähnte — der war ihr nur erwünscht — sondern weil sie Klärchen in todkrankem Zustand zurückließ.
Emily wurde in einer Sänfte fort getragen, wohin, wusste sie nicht; es war ihr alles gleichgültig geworden, sie achtete nicht auf ihre Umgebung, so oft sie auch ein- und wieder aussteigen musste, solange sie auch Aufenthalt hatte, und endlich wurde sie hierher gebracht und von den Indern an diesen Ring gekettet.
Nach und nach kam sie wieder zu klarem Bewusstsein, besonders, weil ein schrecklicher Hunger in ihrem Innern wühlte.
Sie sah sich in einem prächtig ausgestatteten Saal, gegen welchen der Festsaal in Nottingham ein schmuckloses Stübchen zu nennen war. An Pracht konnte er sich mit dem Prunksaal im königlichen Palais zu Richmond messen, wenn auch nicht an Größe.

Vor ihr stand eine gedeckte Tafel, mit Früchten, Konfitüren und Backwerk besetzt.
Beim Anblick des herrlichen Obstes vergaß Emily plötzlich alles andere, jetzt merkte sie erst, welch furchtbarer Hunger sie marterte, sie streckte die Hand aus, eine Frucht zu nehmen — aber ach, die Kette war einen Zentimeter zu kurz.
Vielleicht gelang es, wenn sie sich auf die Seite stellte und sich dann weit vorbog, so, noch etwas mehr —
»Gib dir keine Mühe, liebe Schwester, die Ketten reichen nicht«, erklang es da; eine Portiere wurde zurückgeschlagen, und die Duchesse, in einem tief ausgeschnittenen, weißen Atlaskleid, mit Juwelen behangen und bedeckt, wo sich nur solche anbringen ließen, rauschte herein.
»Isabel!«
Wie ein Schmerzensschrei klang dieser Ruf; Emily sank in die Knie und bedeckte das Gesicht mit den Händen. Hunger, Leid, alles war vergessen, nur ein Abend, jener Ballabend, trat ihr mit furchtbarer Klarheit vor Augen, und das eben hatte Isabel gewollt. Sie trug ein Kleid von derselben Art wie an jenem Abend, die Anordnung des Schmuckes war ebenso, nichts hatte sie vergessen, ja, selbst ein spitzenbesetzter Elfenbeinfächer fehlte nicht.
»Ja, es ist Isabel, deine liebe Schwester«, sagte das Weib und trat dicht vor Emily hin, jedoch nicht so nahe, dass sie im Bereiche der Ketten war. »Du scheinst Hunger zu haben, liebe Schwester.«
Emily antwortete nicht, sie sah nicht auf, sie hatte auch keine Tränen.
»Emily«, fuhr Isabel mit leiser, unheimlicher Stimme fort, »gedenkst du noch meines Fluches an jenem Abend, als du mir den raubtest, den ich immer noch liebte, trotzdem mich das Schicksal an die Seite eines anderen gefesselt hatte? Weißt du noch, wie du mich schmähtest? Weißt du noch, wie ich dir fluchte? Soll ich dir den Fluch wiederholen? Er ist herrlich in Erfüllung gegangen. Lange, lange Jahre habe ich daran gearbeitet, ich habe nichts gescheut, ich habe mich selbst erniedrigt; aber ich habe es mit Freuden getan, denn ich hatte ein Ziel vor Augen, und dieses ist jetzt erreicht. O, Emily, als ich dich vorhin dich abmühen sah, jene Orange dort zu erreichen, das allein hat mich schon entschädigt für das, was ich zu tragen hatte. Verflucht solltest du sein«, fuhr sie mit erhobener Stimme fort, »du, dein Mann, deine Kinder! Bastarde von unbekannter Herkunft solltest du auf den Armen wiegen und sie für deine Kinder halten, während dir diese entrissen wurden. Du solltest von deinem Manne getrennt werden, und schließlich solltet ihr alle in Armut und Schande zugrunde gehen; als Bettlerin solltest du an meinem reichen Tische sitzen, und ich wollte dir nicht das geben, was ich den Hunden gönne. Nun, hat sich nicht alles erfüllt?«
Emily antwortete nicht. Es brauste ihr in den Ohren, und doch musste sie jedes Wort deutlich vernehmen.
»Gott, mach ein Ende mit mir!«, stöhnte sie.
»Das möchtest du wohl!«, lachte das teuflische Weib. »Aber ich will dich noch am Leben erhalten, damit ich dich noch recht lange quälen kann. Wie mein Fluch in Erfüllung gegangen ist, weißt du selbst; ich habe es dir auch drüben in jenem Hause erzählt, als ich dich des Nachts besuchte und du zu träumen glaubtest. O, jene Qual soll noch gar nichts sein gegen die, welche dir noch bevorsteht. Hungern sollst du und doch immer die köstlichsten Speisen vor Augen haben, du sollst Wasser zu trinken bekommen, das deinen Durst nicht zu löschen vermag, und immer von Neuem sollst du von mir hören, Tag für Tag. du hast an deiner Brust ein fremdes Kind großgezogen, einen Jüngling, welcher in englischen Diensten steht und die Pläne der Engländer für indisches Gold an die Feinde verrät...«
Emily blickte zum ersten Male auf.
»Eugen?«
»Ja, Eugen heißt der Verräter an seinen Wohltätern, und wenn man ihn ertappt, dann wird man mit Fingern auf ihn deuten und sagen: Seht, das ist der Mann, den Lady Carter großgezogen hat; aber man darf sich darüber nicht wundern, war doch auch ihr Gatte ein Hochverräter...«
»Das ist nicht wahr!«, schrie Emily auf. Isabel vermied es, weiter darauf einzugehen.
»Dein Gatte, der schöne Sir Carter, ist ein blödsinniger Greis, der gleich dir in Ketten schmachtet.«
»Auch das ist nicht war; mein unglücklicher Gatte befindet sich wenigstens in Freiheit.«
»Was du nicht sagst!«, hohnlachte das Weib. »Allerdings lebte er bis vor kurzer Zeit wie ein wildes Tier im Walde, aber jetzt befindet er sich in einem Käfig bei mir.«
»O, zeig ihn mir, lass mich zu ihm!«
»Du sollst ihn sehen, wie er in seinem Käfig tobt, du sollst ihn brüllen hören, wenn ich ihn mit der Eisenstange necke, aber zu ihm darfst du nicht, er könnte dich zerreißen, und ich will dich noch lebend haben. Und dein Kind...?«
»Meine Tochter?«
»Von ihr wirst du erst später erfahren, wenn ihre Schande vollkommen offenbar geworden ist«, triumphierte Isabel, heimlich bedauernd, auf keinen Fall schon jetzt die Wahrheit sagen zu dürfen, »und dann wirst du dir fluchen, ein Kind geboren zu haben, ein Scheusal, eine Hyäne in Menschgestalt du wirst dir die Haare raufen und wünschen, du hättest das Kind bei der Geburt erstickt, und man wird auf dich deuten und rufen: Seht, das ist das Weib, welches dieses Scheusal zur Welt gebracht hat.«
Isabel bedauerte, dass sie ihre Trümpfe so schnell ausgespielt hatte, am meisten aber, dass sich Emily so teilnahmslos verhielt.
»Nun soll der letzte Teil des Fluches in Erfüllung gehen, hungrig wirst du an meinem Tische sitzen, und ich will dir nicht das geben, was ich den Hunden gönne.«
Sie rauschte nach der Tür und führte Nana Sahib, Westerly und Phoebe herein zu dem Tisch. Ersterem folgten zwei mächtige Hunde.
Der Inder wollte das gefesselte Weib, welches er hierher hatte bringen lassen, jedenfalls nicht sehen, die beiden anderen bemerkten es nicht eher, als bis die Duchesse mit höhnischer Stimme sagte:
»Madame Phoebe Dubois, Lord Westerly, Nana Sahib, Radscha von Berar, Maharadscha von Bitur — Lady Carter, Baronesse von Nottingham.«
Als jetzt Westerly das an der Erde kniende gefesselte Weib erblickte, färbte sich sein Gesicht dunkelrot, das Phoebes dagegen nahm einen Zug der Entrüstung an.
Emily hob ihren Kopf und zeigte den sie Ansehenden ein leidendes, ergebenes Antlitz. Fest begegnete sie den Blicken. Auch sie hatte Nana Sahib erkannt; das war der Mann, der unter dem Namen Sirbhanga um ihre Schwester geworben.
»Duchesse« sagte Phoebe mit verhaltenem Unwillen, »ich finde, Sie treiben die Sache etwas zu weit. Ich bin ein Mensch und besitze noch ein Herz.«
Ein böser Blitz traf sie aus den Augen der Hausherrin.
»Ich bitte Sie, nicht sentimental zu werden, Sentimentalität ist während eines indischen Aufstand gar nicht am Platze, und Sie haben redlich mitgeholfen ihn zu entflammen.«
Sie setzten sich, Nana Sahib neben sein Weib, Westerly neben Phoebe. Isabel saß nun Emily am nächsten; ihr Ruf lockte die beiden Hunde neben sie, und während der von Dienern aufgetragenen Mahlzeit beschäftigte sie sich am meisten mit den Tieren, warf ihnen die ausgesuchtesten Leckerbissen hin und überschüttete sie mit Liebkosungen.
Zu ihrem Ärger verhielt sich Emily völlig teilnahmslos, sie verhüllte nicht einmal mehr das Gesicht, starr blickte sie ins Leere und schien weder zu sehen noch zu hören.
Westerlys Augen ruhten wiederholt von der Seite auf seiner einstigen Braut, und immer mehr sagte er sich, dass er sich Illusionen gemacht hatte, als er sich diese Gefangene als seine Beute erbeten hatte. Wie war sie so mager geworden! Ihre frühere Schönheil war erloschen, und dann dieser hässliche Sackanzug! Mitleid kannte er ja nicht mehr, sein Herz war schon zu einem Stein geworden.
Es war allen, Isabel ausgenommen, als ob ein böser Dämon als Gast am Tische säße, oder eine Person, deren Anwesenheit störend wirke, es kam kein Gespräch in Fluss, bis endlich Nana Sahib von der zu unternehmenden Expedition in den Dschungel begann, an welcher Westerly teilnahm. Es war auch schon bekannt geworden, dass Phoebe die Erlaubnis erhalten hatte, sich ihm anzuschließen, und man wunderte sich über ihre Absicht.
Das interessierte selbst Isabel so, dass sie einige Minuten das Spiel mit den Hunden und Emily vergaß und ihre Aufmerksamkeit den Gästen zuwendete.
Auch Phoebe raffte sich gewaltsam auf und wendete von jetzt an alle ihr zu Gebote stehende Liebenswürdigkeit Westerly zu.
Sie nahm den Dienern die Schüsseln ab und bediente ihn mit der größten Aufmerksamkeit, füllte sein Glas, stieß mit ihm an und scherzte mit ihm.
»Warum ich an der Bootsfahrt teilnehmen möchte?«, sagte sie. »Mein Gott, die Mauern Delhis werden mir zu eng, ich sehne mich einmal hinaus ins Freie.«
»Die Expedition kann unter Umständen nicht ohne Kampf ablaufen«, meinte Nana Sahib, »auch steigen gerade jetzt giftige Fieberdünste auf.«
»Mylord, und auf gute Freundschaft während unserer Reise! Sie sind doch nicht ungehalten darüber, dass ich Sie begleite? Bedenken Sie, wir sind die beiden einzigen Europäer im Boot; wir müssen gute Kameradschaft halten.«
Erstaunt sah Westerly sie an, als sie mit ihm anstieß. Wie Schuppen fiel es ihm plötzlich von den Augen. Es war kein Zweifel, dieses Weib interessierte sich für ihn.
Schnell warf er einen Blick auf Emily, einen anderen auf Phoebe und hatte im Nu einen Vergleich zwischen beiden angestellt. Von jetzt an wurde er gesprächig, er wandte seine ganze Aufmerksamkeit seiner Nachbarin zu und überhäufte sie mit Schmeicheleien.
Wenn Emily es gehört hätte, so würde sie jetzt den wahren Charakter dieses Menschen kennen gelernt haben.
»Wenn Sie wüssten, gnädigste Frau«, sagte er zum Beispiel, »welchen Eindruck Sie damals in Wanstead auf mich gemacht haben.«
»Wirklich? Ich habe damals nichts davon gemerkt«, lächelte Phoebe, »und Sie hatten doch oft genug Gelegenheit, mir das zu verstehen zu geben.«
»Ich hätte es tun können, und ich hätte es auch zu gern getan, aber Sie wissen, es lagen damals besondere Verhältnisse vor, und diese brachten mich bald zur Verzweiflung. Ich hatte einer Person mein Wort gegeben, und das musste ich ihr halten. Ein Glück, dass dieses Verhältnis ein so jähes Ende nahm; ich war ein freier Mann, da aber waren wieder Sie plötzlich verschwunden.«
Phoebe ermunterte ihn, in seinen versteckten Werbungen fortzufahren; hätte er freilich geahnt, wie es in ihrem Herzen aussah, er wäre tödlich erschrocken. So spielt die Katze mit der Maus, bevor sie sie verschlingt.
»Sie waren mit Lady Carter verlobt?«, fragte Isabel.
»Leider ja. Einige Worte der Freundschaft oder vielmehr des Mitleids mit dem ihres Mannes beraubten Weibe waren von ihr falsch aufgefasst worden, und Sie kennen doch die englischen Gesetze. Nicht umsonst haben wir eine Königin auf dem Throne; mit dem Gesetze über das Heiratsversprechen(*), hat sie den Weibern eine furchtbare Waffe gegen uns in die Hand gegeben. Ich hätte damals mein Vermögen verloren.«
(*) Nach den englischen Gesetzen muss man selbst das Heiratsversprechen, das man
unbedacht oder im Scherz gemacht hat, einlösen oder an die Betreffende eine Entschä
digung je nach Verhältnissen zahlen, die aber selten unter 1000 Mark beträgt.
»So hat sie also versucht, Sie zu fangen?«, sagte Isabel. »Ja, das sieht ihr ähnlich, sie besitzt darin Übung. Es mochte ihr nicht angenehm sein, den Namen eines als Hochverräter bekannten Mannes zu tragen.«
Plötzlich richtete sich Emily hoch auf, zum ersten Male öffnete sie ihre Lippen.
»Verspottet mich, verhöhnt, verachtet mich«, rief sie mit starker Stimme, »redet mir nach, was nicht wahr ist, geduldig will ich es tragen und euch nicht dereinst anklagen, ich will euch schon jetzt vergeben; denn so befiehlt es mir der, an den ich glaube, und welcher uns durch sein geheiligtes Leben ein Beispiel hinterlassen hat. Aber dass ihr anderen Übles nachredet, was nicht wahr ist, dulde ich nicht, da will ich meine Stimme erheben, so laut und solange ich kann. Sir Carter hat die Treue, die er seinem Vaterland geschworen, nicht wie andere Leute gebrochen. Wahrt euch, dass er nicht noch einmal komme und euch für eure Verleumdungen zur Rechenschaft ziehe!«
Als hätte diese Rede sie vollständig erschöpft, so sank Emily wieder zusammen.
Ihre Worte waren nicht ohne Eindruck geblieben, nur bei Isabel brachten sie keinen hervor.
Sie warf den Hunden einige Brocken zu, streichelte sie und sagte leichthin:
»Es ist eine bekannte Tatsache, dass es von der Buhlerin bis zur Betschwester nur ein kleiner Schritt ist. Übrigens werden wir diesen ehrenwerten Sir Carter selbst fragen können, ob er damals die geheime Order nicht ausgeliefert habe; denn wie ihm meine liebe Schwester damals eine Falle gestellt hat, so habe auch ich ihm jetzt eine gestellt, nur eine etwas weniger zärtlicher Art...«
Plötzlich sprangen alle erschrocken auf. Die Diener standen wie vom Donner gerührt da, mit gesträubten Haaren, einer ließ prasselnd das Präsentierbrett mit Tellern und Schüsseln aus den Händen fallen.
Ein Geheul, ein Gebrüll wie das eines wilden Tieres durchscholl das Haus, markerschütternd, nervenzerstörend.
»Der Agni, der Agni kommt!«, schrien die Diener, warfen weg, was sie in den Händen hielten, und flüchteten sich in die Verstecke, die ihnen der Saal bot.
Selbst die beiden mächtigen Bluthunde wurden von dem Entsetzen angesteckt, winselnd krochen sie unter den Diwan.
Bei Isabel währte dieser Schrecken nur einen Moment, dann verwandelte er sich in das Gegenteil.
»Gefangen!«, rief sie in triumphierender Freude. »Emily, liebe Schwester, jetzt werde ich dir auch deinen Herrn Gemahl wieder zuführen, er hat sich in der Tigerfalle gefangen.
Da erscholl nochmals dieses unheimliche Geheul, jetzt aber erklang es noch viel lauter, näher, und eingeborene Diener und Dienerinnen kamen in wahnsinniger Furcht hereingestürzt.
»Er kommt, der Agni kommt«, schrien sie, »er ist dicht hinter uns her.«
Sie stürzten nach der Tür auf der anderen Seite des Saales und rissen die Gäste mit sich. Selbst Isabel folgte ihnen einige Schritte, sie versuchte vergeblich, Ruhe herzustellen.
Doch da war es auch mit ihr vorbei.
In den Saal trat oder stürmte vielmehr die schon mehrfach beschriebene Gestalt des wandernden Feuers, auch jetzt trug dieselbe einen brennenden Ast und stieß unartikulierte Töne aus, aber diesmal klirrten um seinen Fuß zwei große, verbogene Eisenstangen — er hatte sich aus der Falle losgerissen, welche selbst der Kraft des Königstigers spottete.

In wilder Flucht ging es davon, in das nächste Zimmer und von da weiter, Isabel mit eingeschlossen, nur hatte letztere noch so viel Besinnung, die Türen innen hinter sich zuzuschmettern und zu verriegeln.
Endlich konnten sie nicht weiter, sie hätten dann den Korridor betreten müssen, und das wollte niemand um keinen Preis.
Alle Türen waren verschlossen, ängstlich drängten sich die Diener um die Faringis und um Nana Sahib, der aber von derselben furchtbaren Angst wie die anderen befallen war.
Man lauschte mit angehaltenem Atem. Würde der Furchtbare ihnen auch hierher folgen? Jetzt war er mit dem gefesselten Weibe und den beiden Hunden allein im Saale.
Die Duchesse zog einen Revolver hervor, Westerly folgte ihrem Beispiel.
Drüben ertönte ein Geräusch, als würden Steine aus den Mauern gebrochen, man hörte Emily schreien, dann erklang Hundegeheul.
»Die Hunde fürchten nur den König der Dschungeln, sonst nichts«, flüsterte Nana Sahib.
»Dann werden sie auch diesen Geist angreifen und ihn überwältigen.«
Das Hundegeheul verwandelte sich in ein jammerndes Winseln. Dann wurde eine Tür geworfen, schwere Schritte erklangen auf dem Korridor. Sie entfernten sich.
Mit entschlossenem Gesicht ging Isabel nach der Tür, öffnete sie und trat hinaus. Zu sehen war nichts. Schnell eilte sie nach einem verlassenen Gemach, aus dessen einer Wand ein eiserner Handgriff hervorragte. Sie zog daran, eine Stange schob sich heraus.
Lauschend blieb sie stehen.
Wieder erscholl ein Gebrüll, eine Weiberstimme schrie, ein gellender Ruf, und alles war still.
»Es ist vorbei«, flüsterte Isabel und begab sich zu den Versammelten zurück, die ihrer furchtsam harrten.
»Es ist vorbei«, sagte sie nochmals mit geisterbleichem Gesicht, »der Agni, wie die Inder sagen, oder das wandernde Feuer oder Sir Frank Carter lebt nicht mehr.«
»Sie hätten ihn getötet?«
»Kommen Sie mit!«
Es war nicht leicht, die drei zum Mitkommen zu bewegen, am allerwenigsten Nana Sahib, aber schließlich gelang es doch.
Isabel führte sie in den untersten Keller, entzündete ein Licht und leuchtete. Im schmalsten Gange blieb sie stehen und deutete auf ein Loch, das vor ihr sich im Erdboden öffnete. Eine Klappe war heruntergeschlagen.
»Ich will Ihnen ein Geheimnis dieses Hauses verraten, um Sie hier zu beruhigen. Die Klappe besitzt einen Mechanismus, welcher oben in einem Handgriff endet. Ziehe ich daran, so fällt sie noch nicht, aber der, welcher darauf tritt, stürzt hinab. Der Feuergeist ist bei seinem Rückzuge in dieses Loch gefallen und wird nicht wiederkommen.«
Alle schauderten, als sie in die schwarzgähnende Tiefe blickten.
»Wohin geht das Loch?«, fragte Phoebe leise.
»In eine Schleuse. Schwillt die Dschamna, so füllt sie es mit Wasser, beim Rücktritt spült es die Leiche mit sich fort, den Krokodilen zum Fraß.«
»So hat schon mancher hier geendet?«
Isabel zuckte die Achseln.
»Mit meinem Wissen und Willen nicht, dies war mein erstes Opfer, und ich bereue es nicht.«
»Aber wohin wollte sich denn der Mann wenden?«, fragte Phoebe weiter. »Der Gang endet ja hier.«
»Das lassen Sie mein Geheimnis sein und bleiben!«
Man fragte nicht weiter, doch Westerly wusste plötzlich, wo sich der Zugang zu den unterirdischen Gängen befand, den er damals unter Führung der Duchesse mit verbundenen Augen benutzt hatte.
»Nun in den Saal zurück! Wir wollen sehen, was das wandernde Feuer eigentlich dort zu suchen gehabt und wie es sich seiner Frau Gemahlin gegenüber benommen hat. Ich fürchte nur, er hat sie erwürgt; aber wiederum freut es mich dann, dass sie wenigstens vor ihrem Tode ihren Gatten noch einmal in seinem schrecklichen Zustande gesehen hat.«
Zagend folgten die anderen Isabel in den Saal, am meisten furchtsam war diesmal Westerly. Krampfhaft hielt er den Revolver umklammert.
Seine Angst war nicht nötig; das wandernde Feuer war nicht mehr da. Beide Hunde lagen am Boden, anscheinend erwürgt. Aber wo war Emily?
Mit einem heiseren Wutschrei stürzte Isabel nach der Stelle, wo sie angefesselt gewesen war. Der Ring war mit furchtbarer Kraft aus dem Mauerwerk gerissen worden — das wandernde Feuer hatte Emily mit sich genommen.
Entsetzt sahen sich die vier an.
»Sie haben auch Ihre Schwester gemordet!«, sagte Phoebe. »Carter hat seine Gattin wahrscheinlich erkannt, befreit, mitgenommen, und nun ist sie mit ihm in die Tiefe gestürzt.«
Wütend fuhr Isabel auf.
»Gemordet habe ich sie?«, schrie sie. »Ha, ich möchte, ich hätte sie vorher ermordet, dann hätte ich mich wenigstens an ihren Qualen lechzen können; denn leicht würde ich ihr den Tod sicherlich nicht gemacht haben. Doch nun ist sie für mich auf ewig verloren, sie ist meiner letzten Rache entgangen, ich konnte nicht einmal mehr Zeuge sein, wie sie starb.«
Das war ihr einziger Kummer. Hätte sie den Leichnam der verhassten Schwester noch erlangen können, sie würde ihren Hass auch noch an diesem ausgelassen haben.
An eine Fortsetzung des Gastmahls war jetzt natürlich nicht mehr zu denken.
Westerly und Phoebe entfernten sich, sie hatten noch viele Vorbereitungen zur gemeinschaftlichen Reise zu treffen.
Es gelang Isabel nach vielen Bemühungen, die Diener zum Bleiben zu bewegen, besonders durch die Versicherung, nun habe der Geist sich das Opfer geholt, wegen dessen er ihr Haus aufgesucht hätte — jenes gefangene Weib.
»Sind schon welche davongelaufen?«, fragte sie den ältesten Diener.
»Nein, wir sind gern bei dir, Herrin.«
»Doch, Nedra ist nicht mehr da«, sagte eine Dienerin.
»Sie war auch vorhin nicht bei uns, als wir uns vor dem Agni in dem Zimmer eingeschlossen hatten«, sagte eine andere; »sie kam zu spät.«
»So wird sie die Haustür zur Flucht benutzt haben und wiederkommen. Ich befehle euch, nicht von dem zu sprechen, was heute hier vorgegangen ist.«
Die Diener gehorchten; aber die vermisste Nedra kam nicht wieder. Sie mochte wahrscheinlich nicht mehr das Haus betreten, in dem es spukte.
Niemand hätte in dem Manne mit dem zerzausten Kopf- und Barthaar, mit dem zerlumpten und zerfetzten, mit getrocknetem Schlamm förmlich überzogenen Anzug, den sonst so eitlen Lord Westerly erkannt, und doch war er es.
Er saß in dem Häuschen des Bootes, welches eben in einen Seitenarm der Dschamna einbog, neben einem Weibe, in welchem wir Phoebe wieder erkennen.
Westerly hatte ihr eben seinen Plan, oder vielmehr seinen ihm gegebenen Befehl, auseinandergesetzt, wie er an einer passenden Stelle das Boot verlassen und sich dann mit den verfolgten Engländern und Sepoys in Verbindung setzen wolle. Dann solle diesen Zeit gelassen werden sich zu sammeln, und sei dies geschehen, dann werde er, Westerly, ihren Aufenthaltsort verraten, sie sollten umzingelt und bis auf die niedergemacht werden, an deren Gefangenschaft den Rebellen viel gelegen war.
Dafür, dass Lord Canning den Feinden in die Hände fiel, bevor die Metzelei begann, war schon gesorgt, denn seine Person musste unbedingt geschont werden. Das Boot hatte ja den Zweck, ihn abzuholen.
Westerly tat natürlich, als handle er ganz nach eigenem Gutdünken und aus eigenem Antriebe, weil er eben auf Seite der Inder stände, und Phoebe widersprach ihm nicht.
Dann aber nahm das Gespräch eine ganz andere, für Westerly verblüffende Wendung.
»Wenn ich Sie nun bäte«, sagte Phoebe lächelnd, »Sie sollten mich als Gehilfin bei Ihrem gefahrvollen Unternehmen verwenden, würden Sie mir diese Bitte abschlagen?«
»Sie scherzen!«
»Es ist mein Ernst. Ich möchte Sie begleiten!«, Erstaunt sah Westerly sie an.
»Aber aus welchem Grunde denn nur?«
»Nehmen Sie an, nur meine bekannte Lust an Abenteuern triebe mich dazu.«
Westerly warf ihr einen misstrauischen Blick zu.
»Ich bitte Sie, Mylord«, fuhr Phoebe schnell fort, »glauben Sie ja nicht, ich sei Ihnen als Spionin, als Aufpasserin zugesellt worden.«
»Wirklich nicht?«
»Ich schwöre es Ihnen. Ich würde Ihnen dann nicht so offen das Geständnis machen, und glauben Sie etwa, man würde zu solch einem Posten ein Weib erwählen?«
»Das ist allerdings wahr. Aber warum wollen Sie mich begleiten?«
»Eben, um bei dieser abenteuerlichen Fahrt zugegen zu sein. Ich möchte — ich will es offen bekennen — mich gern in Ihrer Nähe befinden.«
Westerly fühlte sich geschmeichelt, er ergriff ihre Hand.
»Dennoch, liebe Phoebe«, sagte er, sie zum ersten Male so vertraut anredend, »es kann nicht sein! Bedenken Sie auch, dass die Reise durch Dschungeln, Sümpfe und dichte Wälder geht?«
»Ich habe es bedacht.«
»Dass ich tagelang herumstreifen, Hunger und Durst leiden muss, ehe ich die Engländer treffe, beständig den Angriffen wilder Tiere ausgesetzt bin?«
»Gern will ich alles ertragen — in Ihrer Gesellschaft.«
»Hm, sehr liebenswürdig! Es wäre schön, wenn wir so einige Tage zusammen lebten, vielleicht beeilte ich mich gar nicht so sehr, die Verfolgten zu finden, sondern suchte mir erst ein idyllisches Plätzchen unter Palmen. Aber wirklich, Phoebe, es geht nicht, ich kann's nicht zulassen.«
»Warum nicht?«
»Ihre Haarfrisur, Ihre Tracht...«
»O, wenn's weiter nichts ist«, lachte Phoebe, »in einer halben Stunde will ich so aussehen, als ob ich mich tagelang in den Dschungeln umher getrieben hätte, ich will gar keinem Menschen mehr ähnlich sehen. Wir würden ein schönes Paar abgeben. So, wie wir jetzt sind, passen wir auch gar nicht zusammen.«
»Sie wissen alle Widersprüche zu beseitigen, nur meinen letzten nicht.«
»Welcher ist das?«
»Sie sind als offener Feind Englands bekannt, man könnte Sie erkennen. Mich dagegen, wenn ich mich in meinem jetzigen Zustand sehen lasse, hält man unbedingt für einen aus Delhi unter Todesgefahr Entkommenen, aber Ihre Begleitung könnte mir verderblich sein.«
»Auch auf diesen Widerspruch war ich gefasst. Sie irren nämlich ganz gewaltig, mich kennt niemand.«
»Oho, da bin ich anderer Meinung!«
»Nun, wer sollte mich denn kennen?«
»So zum Beispiel, zum Beispiel...«
Westerly zerbrach sich förmlich den Kopf.
»Vielleicht Leutnant Carter?«, kam sie ihm zu Hilfe.
»Richtig, Eugen! Der kennt Sie von Wanstead aus.«
»Der liegt verwundet in Delhi.«
»Und wenn er genesen ist?«
»So wird er getötet, falls er nicht zu den Indern übertritt, was er jedenfalls tut. Nein, nein, mit so etwas können Sie mir nicht kommen. Und wenn wirklich jemand wüsste, dass ich mit den Rebellen harmoniere, so würde dies doch nichts schaden, denn ich werde mich ganz unkenntlich machen. Überdies liegen bei Ihnen auch Verdachtsgründe vor.«
»Bei mir, dem Lord Westerly?«
»Denken Sie an Reihenfels!«
»Bah, wer weiß, wo er steckt! Ich fürchte ihn nicht; er sollte nur wagen, gegen mich aufzutreten.«
»Denken Sie an Charly!«
»Wer ist das?«
»Der Diener Mister Woodfields. Er ist in Delhi geblieben.«
»Hahaha, was kümmern mich solche Burschen? Die sind überhaupt alle tot. Torheit, vor denen fürchte ich mich nicht!«
»Eine ebensolche Torheit wäre es, wenn ich ein Erkanntwerden fürchtete. Haben Sie nicht gemerkt, dass ich den Spieß nur herumgedreht hatte? Ich komme mit Ihnen.«
»Nein, Sie dürfen es nicht«, sagte Westerly entschieden. »So angenehm mir Ihre Gesellschaft auch sonst ist, in diesem Falle muss ich auf sie verzichten. Sie wären mir nur hinderlich.«
Ruhig stand Phoebe auf und trat vor ihn hin.
»Und ich sage Ihnen, ich gehe doch mit!«, sagte sie fest.
»Wollen Sie mich zur Mitnahme zwingen?«, lächelte Westerly.
»Zwingen nicht. Ich verlasse einfach das Boot, wenn Sie es verlassen, und gehe dahin, wohin Sie gehen.«
»Dann müsste ich eben Anordnungen treffen, dass Sie mit Gewalt an Bord zurückgehalten würden.«
»Bei wem würden Sie dies veranlassen?«, fragte sie spöttisch.
»Bei dem Bootsführer; er ist Captain der Sepoys.«
»Mein gnädiger Lord, Sie haben diesem Captain gar nichts zu befehlen!«
»Er wird die Zweckmäßigkeit meiner Wünsche einsehen und Sie zurückhalten.«
»Auch dafür habe ich schon gesorgt. Wenn Sie den Captain fragen wollen, so werden Sie zu Ihrem Staunen erfahren, dass er die strenge Weisung erhalten hat, sich nicht im Mindesten um mein Tun und Lassen zu kümmern. Ich bin hier vollkommen Herrin meines Willens, viel eher stehen Sie, geehrter Lord, unter dem Befehle des Bootsführers.«
Westerly wurde verblüfft.
»Wenn es freilich so ist!«, murmelte er.
»Es ist so, und Sie können nichts daran ändern. Aber, Mylord«, Phoebe legte ihm die Hände auf die Schultern und schaute ihm lächelnd ins Auge, »ich möchte Ihnen meine Begleitung durchaus nicht aufdrängen, vielmehr bitte ich Sie nochmals recht herzlich, mich mitzunehmen.«
»Da ich Ihnen die Begleitung nicht verweigern kann, so soll sie mir sehr angenehm sein. Wirklich, schöne Phoebe, ich freue mich äußerst darauf, mit Ihnen allein durch den Dschungel zu streifen. Ich kalkuliere, es werden für mich einige herrliche Tage, und ich will dafür sorgen, dass es uns an nichts gebricht. Nur um eins möchte ich Sie fast bitten.«
»Und das wäre?«
»In dieser Toilette zu bleiben.«
»Das geht auf keinen Fall!«, lachte Phoebe. »Die Engländer würden schön staunen, mich mitten in der Wildnis in einem frisch gewaschenen Tropenkleid zu finden. Ich eile, mich umzuziehen, Ihrem Anzuge entsprechend. Sie wissen: Gleich und gleich gesellt sich gern!«
»Doch nicht zu Ihrem Nachteil!«, rief Westerly ihr nach.
»Sie sollen zufrieden mit mir sein!«
Dieses Gespräch ward in der Morgenstunde geführt, als das Boot schon eine ganze Nacht unausgesetzt unterwegs gewesen war. Man befand sich bereits mitten zwischen Wäldern, Dschungeln und sumpfigen Niederungen. Nur einmal war man auf einen Trupp Inder gestoßen, von Bluthunden begleitet, die auf die Versteckten Jagd machten.
Als Phoebe wieder erschien, hätte Westerly sie kaum erkannt. Sie hatte das Aussehen einer zerlumpten, mit Schmuck behangenen Zigeunerin angenommen, welche einst das Ballkleid einer vornehmen Dame geschenkt bekommen hatte und dieses nun so lange trug, bis es in Fetzen vom Leibe fiel. Die Schmucksachen waren übrigens echt. Da sie das Haar, welches jetzt lose herabhing, sonst hoch frisiert hatte, so war schon dadurch ihr Aussehen ein ganz anderes geworden.
»Sie müssen verzeihen, wenn ich Ihnen an Originalität noch nicht ähnele!«, lachte sie. »An der ersten Sumpflache, auf die wir stoßen, werde ich dies ergänzen.«
»Und für wen wollen Sie sich ausgeben?«
»Sie sagen ja, Sie seien auf der von einer englischen Familie arrangierten Festlichkeit gewesen. Nun, so war ich eben auch mit dort, und es gelang mir durch Ihre kräftige Unterstützung, zu entkommen. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie Sie mit einem Schuss sechs Inder töteten, einem das Schwert entrissen und mit diesem auf einen Hieb drei Indern die Köpfe spalteten. Wie soll ich mich nennen? Schlagen Sie einen eleganten Namen vor.«
»Auf jeden Fall müssen Sie eine Engländerin sein. Sie sprechen ja auch das Englische perfekt. Sagen wir also: Miss Evelyn Padders.«
»Padders klingt hässlich, Dorington schlage ich vor. Dann nenne ich mich lieber Missis, mein heißgeliebter Mann ist auch getötet worden, ich sah, wie ihn die Inder vom Dache des Hauses stürzten, wie sein Kopf auf dem Straßenpflaster zerschmetterte.«
»Gut, also Missis Evelyn Dorington!«
Der Bootsführer trat zu ihnen und sagte, das Boot nähere sich jetzt der Stelle, wo Aleen, Westerlys Diener, den Generalgouverneur gefangen auszuliefern versprochen hatte. In einer Stunde würden sie dort sein.
»Ich bin begierig zu erfahren«, meinte Westerly, »ob der Bursche sein Versprechen hält. Es scheint mir fast unglaublich, doch er schien seiner Sache ganz sicher zu sein.«
»Wie lange ist Aleen schon Ihr Diener?«, fragte Phoebe.
»Schon lange Jahre! Er ist treu und zuverlässig.«
»Er hat ein seltsames, scheues Wesen. Mit einem Fremden lässt er sich gar nicht ins Gespräch ein.«
Phoebe hatte schon wiederholt versucht, mit dem fremden Diener Westerlys Bekanntschaft anzuknüpfen, aber alle ihre Versuche, sein Vertrauen zu gewinnen, waren an seiner Einsilbigkeit und seinem Misstrauen gescheitert, und Phoebe hütete sich, merken zu lassen, dass ihr an seiner Freundschaft etwas gelegen war.
»Ja, er scheint eine böse Tat auf dem Gewissen zu haben!«, entgegnete Westerly. »Doch was kümmert mich das? Wenn er mir nur ergeben ist! Ich glaube, ich könnte von ihm verlangen, was ich wollte, er würde es ohne Zögern tun.«
»Sie kennen sein Vergehen?«
»Nein.«
»Aber Sie haben ihn merken lassen, dass Sie darum wissen?«
Westerly sah sie überrascht an.
»Woher vermuten Sie das?«
»Sehr einfach, weil ich es auch so machen würde. Es ist sehr gut, wenn man einen Menschen an sich gekettet hat, von dem man ein Geheimnis weiß, oder dem man doch glauben macht, man wisse darum, d. h. man darf sich dabei nicht der Gefahr aussetzen...«
Das Gespräch fand eine jähe Unterbrechung.
Eine Salve knatterte, an Deck fielen die Ruderer von den Bänken, die indischen Krieger brachen zusammen. Wehrufe erschollen auf dem Boot, am Ufer dagegen Kommandos und Kampfgeschrei.
»Wir werden überfallen!«, rief der Bootsführer, stürzte hinaus und brach sofort von einer Kugel getroffen, zusammen.
Die Bootsmannschaft war auf einen Kampf nicht im Mindesten vorbereitet. Man sah das Ufer von Gewehren starren, man erkannte Engländer und Gurkhas, darunter Dollamore, der sich eben, das blanke Schwert in der Faust, ins Wasser warf, und in panischem Schreck dachte jeder nur an Flucht.
Das Boot fuhr dicht am Ufer, ein Sprung, und sie waren drüben und verschwanden im Schilf — der Anblick Dollamores wirkte auf alle wie ein Schreckgespenst.
Einen Augenblick zauderten Westerly und Phoebe. Da sahen sie unter den Angreifern auch Lord Canning, und ohne an das Mitnehmen einer Waffe zu denken, schlossen sie sich den Flüchtlingen an.
Phoebe folgte ihrem Gefährten; mit Aufbietung aller ihrer Kräfte gelang ihr der Sprung ans Ufer. Sie hätte ihn sonst nicht fertiggebracht, aber der Gedanke, dass sie Westerly verlieren könne, gab ihr die Schnellkraft einer Gazelle.
In wüstem Durcheinander brachen die feigen Inder durch die Binsen- und Bambusrohre, nicht anders glaubend, als einige hundert Feinde säßen ihnen dicht auf den Fersen.
Dann zerstreuten sie sich. Der eine lief schneller als der andere, der eine drang links, der andere rechts vor, einige stürzten oder verwickelten sich in Schlingpflanzen.
Zu letzteren gehörte auch Phoebe. Sie sah Westerly, an dessen Seite sie sich bis jetzt gehalten, sich weiter und weiter entfernen. Sie wagte nicht, ihn beim Namen zu rufen, so viel Geistesgegenwart besaß sie doch, aber wie eine Verzweifelte riss sie an den grünen, zähen Strängen, wodurch sie sich nur immer fester verwickelte.
Ein Messer besaß sie nicht, um sich losschneiden zu können; wie Westerly, so war auch sie in der ersten Bestürzung ohne Mitnahme einer Waffe geflohen.
Schließlich sah sie sich allein und verlassen. Das Brechen in dem Bambusrohr war verklungen, hinter ihr erschollen Ruderkommandos; das Boot war also besetzt worden und nahm seine Fahrt wieder auf.
Als Phoebe jetzt mit Ruhe versuchte, sich aus den Banden der Schlingpflanzen zu befreien, gelang ihr dies sofort. Sie dachte nicht daran, zurückzugehen und sich der neuen Bootsbesatzung als ebenfalls Verfolgte auszugeben. Sie beschloss vielmehr sofort, mit aller Energie den Versuch zu machen, Westerly wieder aufzufinden.
Wie sie, die in der Wildnis ganz Unerfahrene, dies eigentlich bewerkstelligen könne, wusste sie allerdings nicht.
Ziellos begann sie umherzuwandern, und es war ein mühseliger Weg. Die Dornen hielten sie am Kleide fest und zerrissen das schon absichtlich zerfetzte noch mehr. Oft sank sie bis an die Knie in Morast ein; nur mit aller Anstrengung gewann sie durch Rückwärtsgehen wieder festen Boden, und nicht lange dauerte es, so war ihre Kleidung wirklich so mit Schmutz bedeckt, wie sie es im Scherz hatte machen wollen.
Keiner der mit ihr Geflohenen kam ihr wieder zu Gesicht, ebenso wenig Westerly. Die Inder waren in ihrem Heimatland und wussten schon den Weg nach Delhi zu finden, sich überhaupt zu helfen. Aber was stand Phoebe bevor, wenn sie keinen Ausweg aus dieser Wildnis fand?
Durst litt sie nicht, Wasser, wenn auch natürlich schales und ungesundes, war genug vorhanden, doch bald musste sich der Hunger einstellen. Zwar wuchsen an Büschen und Sträuchern genug Beeren und größere Früchte, doch Phoebe kannte sie nicht und fürchtete, sich mit ihnen zu vergiften.
Endlich fand sie eine Kaktushecke mit reifen, birnengroßen Früchten bedeckt. Ehe sie diese jedoch essen konnte, mussten sie von ihrer stachligen Umhüllung befreit werden, und Phoebe gab bald den Versuch auf, denn die Stacheln dieser Früchte sind hundertmal spitzer als Nähnadeln und auch noch mit Wiederhäkchen versehen.
Als sie eine kreischende, langbeschwänzte Affenschar sich um große, rote Strauchfrüchte streiten sah, durfte sie von diesen ohne Misstrauen essen.
Übrigens belästigte sie der Hunger noch nicht, vielmehr nur eine große Müdigkeit. Doch sie wagte nicht zu ruhen, sie wollte immer weiter, sie wollte auf Menschen stoßen, und waren es auch Engländer. Dann hätte sie eben die Rolle gespielt, die sie mit Westerly ausgemacht hatte.
Wo mochte dieser jetzt wohl sein? Sie dachte nur noch wenig an ihn, eine heimliche Angst schnürte ihr das Herz zu. Sprang ein Hirsch oder eine Gazelle vor ihr auf, so dachte sie gleich an den Überfall eines Raubtieres, und wie lange würde es noch dauern, so fiel sie einem solchen zur Beute! Schon einmal hatte sie das bunte Fell eines Panthers durch die Zweige schimmern sehen und sich schnell und leise, immer rückwärts gehend, entfernt.
Phoebe wusste auch, dass sich auf dieser Seite des Flusses gar keine Flüchtlinge aufhielten. Sie befanden sich alle jenseits desselben. Ja, wenn Phoebe drüben gewesen wäre, dann hätte sie schon Menschen getroffen — Engländer oder Inder, sie wollte sich beiden Teilen als Freund legitimieren.
Vielleicht hätte sie es gewagt, den Fluss zu durchqueren, aber diese schauderhaften Krokodile!
Plötzlich vernahm Phoebe Stimmen. Sie blieb stehen, lauschte und konnte deutlich englische Worte vernehmen.
»Jetzt vorsichtig, dass die Rinde am unteren Ende nicht splittert«, sagte eine tiefe Stimme in warnendem Tone.
Ein Krachen erfolgte, als würde ein starker Ast abgebrochen.
»Es ist gut gegangen, dem können wir uns anvertrauen«, fuhr dieselbe Stimme fort.
»Na, na, wenn wir nur nicht mit dem Dinge umkippen«, sagte jemand anders; »das musst du mir erst einmal vormachen, wie man darauf hinüberrutscht!«
»Wir steigen alle beide darauf.«
»Um des Himmels willen, auf diese zerbrechliche Nussschale? Nee, ich habe keine Lust, den Krokodilen mit meinem Fleisch den Magen vollzupfropfen.«
»Wenn ich mich hineinsetze, wirst du sehen, dass dieses Boot noch viel mehr tragen kann als zwei Mann. Denkst du, ich mache zum ersten Male solch ein Rindenboot? Da sollst du erst nach Kanada kommen, dort fahren wir in solchen Nussschalen, wie du sagst, Wasserfälle hinunter, und sie halten doch.«
»Aber in Kanada gibt es keine Krokodile!«
Phoebe brauchte nur einige Schritte zu machen, so stand sie am Flussufer, und wie sie sich etwas vorbeugte, konnte sie zwei Männer sehen, die eben ein selbstgefertigtes Boot in das Wasser hinabließen.
Es bestand aus der abgeschälten Rinde eines weidenähnlichen Baumes und sah allerdings sehr zerbrechlich aus.
Sie kannte beide Männer, den einen sogar von Wanstead aus. Es waren Charly und August, die auf dem Rindenboot über den Fluss setzen wollten. Beide sahen durchaus nicht strapaziert aus, im Gegenteil, wohlgenährt und frisch und schienen ganz guter Laune zu sein.
Wohin sie zu gehen beabsichtigten, wusste Phoebe natürlich nicht. Sie hütete sich, von ihnen gesehen zu werden, denn sie hatte erfahren, was für ein scharfes Auge diese Pelzjäger besaßen. Waren sie doch seinerzeit der Spur der schwarzen Maske vom Steinbruch bis zum Hause Francoeurs gefolgt und hatten die schwarze Maske, obgleich sie sie noch nie gesehen, doch sofort als den erkannt, der den Mordanschlag auf Woodfield gemacht hatte.
Augenblicklich waren diese beiden für Phoebe die schlimmsten Feinde; denn dass sie mit den Engländern in Verbindung standen, wahrscheinlich für sie Späherdienste verrichteten, war kein Zweifel.
Als sich Charly zuerst in das Fahrzeug setzte, sah es allerdings ganz gefährlich aus. Die eine Seite sank tief unter, und es lief auch viel Wasser ein.
Sonderbarerweise brauchte es bei August nicht erst langes Zureden, ein Kraftwort ausstoßend, betrat er das andere Ende des Bootes, und mit Hilfe zweier breiten Äste, die als Ruder dienten, hatte es bald das jenseitige Ufer erreicht, ohne dass die Krokodile auch nur die Köpfe gehoben hätten.
Die zwei Männer stiegen aus, ließen das Boot einfach am Ufer liegen und verschwanden im Walde.
Phoebe wartete einige Zeit. Als die Schritte schon lange verklungen waren, schlich sie sich am Ufer entlang, bis sie an das Boot kam, das vom Strom wieder herübergetrieben war, und benutzte es so, wie sie es vorhin gesehen hatte.
Wie Phoebe, so hatte sich auch Westerly vollständig in der Wildnis verirrt. Er konnte aus dem Stande der Sonne nur ungefähr beurteilen, wo Delhi lag, und er beschloss die Richtung dorthin einzuschlagen. Traf er unterwegs auf Engländer, umso besser.
Er sah sich ebenfalls nach einer Gelegenheit um, den Fluss zu passieren, und fand nach langem Suchen auch eine solche. Zwei Bäume standen sich gegenüber, streckten je einen Ast über das Wasser, so, dass sie sich hoch oben in der Luft berührten.

Bei einiger Gewandtheit konnte man diese schwebende Brücke wohl benutzen, und da Westerly einst ein guter Turner gewesen war, so zögerte er nicht, die Kletterpartie zu unternehmen.
Das Herz schlug ihm doch ängstlich in der Brust, als er hoch oben auf dem schwankenden Aste saß und unter sich im Wasser die Krokodilsköpfe sah, die gierig nach der seltenen Beute äugten. Doch er gelangte glücklich auf den anderen Ast und rutschte am Stamm hinunter aufs jenseitige Ufer. Nun wollte er längs des Flusses weiterwandern, er musste ihn nach Delhi bringen. Wo er sich gegenwärtig befand, davon hatte er keine Ahnung.
Die Sonne stand hoch; sie ließ giftige Dünste aus dem Morast steigen, und Westerlys Glieder drohten, ihm den Dienst zu versagen.
Plötzlich machte er einen weiten Satz vom Flusse ab, denn neben ihm war ein merkwürdiges Klappern ertönt. Er kannte dies Klappern, es waren
die Kiefer der Krokodile, wenn diese eine Beute im Auge haben und vor Begierde erbeben.
Er sah auch einige der scheußlichen Ungetüme sich bewegen; schwerfällig krochen sie an das Ufer heraus.
Aber das Krokodil fühlt sich auf dem Lande nicht sicher; beim Anblick des Menschen sucht es, wenn es mit dessen Feuerrohr schon Bekanntschaft gemacht hat, sofort wieder das Wasser zu gewinnen. So drehten sich auch diese mit einer Schnelligkeit, die man den plumpen Leibern gar nicht zugetraut, um und eilten dem Wasser zu, wo sie verschwanden. Wer sich aber jetzt dem Wasser näherte, der erhielt sicher einen Schlag von dem Schwanz eines Krokodils, wurde herabgeschleudert und von dem Rachen des Tieres aufgefangen.
Westerly blieb stehen; denn er sah zwischen den Büschen einen braunen, nur mit einer Hose bekleideten Menschen liegen, anscheinend tot.
Er ging etwas näher hinzu und erkannte in dem Toten zu seinem Erstaunen Aleen. Eine Kugel war ihm durch die rechte Brust gedrungen, er hatte viel Blut verloren und lag bewegungslos da. Der Spaziergang der Krokodile hatte seinem Leichnam gegolten.
Westerly fühlte nicht den geringsten Schmerz, als er vor der Leiche seines Dieners stand, im Gegenteil, er empfand eine Erleichterung. Als er sich umblickte, sah er an einem Palmbaum Stricke hängen, daneben ein Hemd und Waffen liegen, und schloss ganz richtig, dass hier der Platz war, wo Lord Cannings Gefangennahme erfolgt war; er hatte sich aber wieder befreit und Aleen dabei seinen Tod gefunden.
Gott sei Dank, dass dieser tot war! So hatte Westerly den Mitwisser einer geheimen Schandtat verloren.
Ohne sich noch einmal umzublicken, ließ er die Leiche hinter sich liegen. Mochten die Krokodile sich an ihr delektieren.
Die in ihrer Absicht schon einmal gestörten Tiere warteten lange, ehe sie sich der Beute wieder näherten, doch kaum erscholl das Geheul eines Schakals, ein Zeichen, dass auch ein anderer hungriger Gast Witterung von der Leiche bekommen hatte, als sie eilends das Wasser verließen und dem Toten zustrebten.
Aber nochmals wurden sie verscheucht, denn wieder knackte es in dem Bambusrohr, und ein menschliches Wesen trat heraus. Diesmal war es ein Weib — Phoebe.
Auch sie sah den Leichnam, die Krokodile, und erschrocken wollte sie den Rückzug antreten. Aber wie gebannt blieb sie stehen.
Jener Inder dort war kein Toter, er bewegte den Arm; unwillkürlich machte Phoebe einen Schritt vorwärts, und schleunigst ergriffen die Ungeheuer die Flucht, dem sicheren Wasser zu.
Ja, der Mann lebte, er bewegte sich und stöhnte. Als Phoebe sah, dass ihr von den Krokodilen hier auf dem Lande keine Gefahr drohte, eilte sie zu dem Verwundeten, von einem momentanen Gefühl dazu getrieben, und auch sie erkannte zu ihrer Bestürzung Aleen.
Er öffnete die Augen; stier blickte er geradeaus, er sah Phoebe noch nicht.
»Wasser!«, hauchten seine bleichen Lippen. »Nur einen Tropfen Wasser!«
»Bist du nicht Aleen, Westerlys Diener?«, fragte Phoebe.
»Wasser!«, war die einzige Antwort.
Wohl lagen vom hohen Fall zersprengte Kokosnussschalen umher. Phoebe hätte mit einer solchen Wasser schöpfen können, aber sie kannte die Gefährlichkeit dieses Wasserschöpfens.
Wagt doch nicht einmal das Wild, nicht der in der Stadt aufgewachsene Hund in jenen Gegenden ohne weiteres am freien Flusse seinen Durst zu löschen. Vorsichtig nähert er sich dem heimtückischen Gewässer, starr beobachtet er die Oberfläche, den Kopf weit vorgestreckt, die Vorderfüße nach vorn gestemmt, zum Sprunge bereit, so trinkt er, und das Wasser braucht sich nur etwas zu kräuseln, so flieht er schon mit mächtigen Sprüngen davon.
Die aus Europa eingeführten Hunde, welche diese Gefahr nicht kennen, fallen in Indien beim Wassertrinken den Krokodilen regelmäßig zur Beute, ebenso wie auch am oberen Nil. Nur die Alligatoren Amerikas sind weniger zu fürchten.
Glücklicherweise zweigte sich von dem Flusse eine seichte Wasserrinne ab, hier konnte Phoebe ohne Gefahr die Kokosnussschale füllen.
Zum ersten Male verloren Aleens Augen den scheuen Ausdruck, als er in langen Zügen aus Phoebes Hand den Trank schlürfte; mit dankbarem Blicke ruhten sie auf der Samariterin.
»Du hast Lord Canning nicht gefangen?«
»Ich hatte ihn — Dollamore schoss mich nieder«, ächzte Aleen, der vor kurzer Zeit aus langer Bewusstlosigkeit erwacht war und jenen scheinbar kräftigen Zustand erlangt hatte, der dem Tode gewöhnlich vorausgeht.
Phoebe vergaß alles andere, sie wollte von dem Manne noch etwas zu erfahren suchen.
»Aleen, du bist deinem Tode nahe«, sagte sie hastig.
»Vielleicht — bleibe ich am Leben«, ächzte der Mann. »Ich habe eine — zähe Natur — es ist mir gleichgültig — Lord Canning ist mir entgangen — Westerly, der Hund —«
Phoebe horchte hoch auf.
»Was hast du gegen deinen Herrn?«
»Er ist vorhin — vorbeigegangen — er sah mich liegen. er stand hier — ich sah ihn — sah die Krokodile — und konnte mich nicht rühren.«
Schnell holte Phoebe in einigen Schalen Wasser, gab ihm nochmals zu trinken und wusch seine Wunde. Sie wagte nicht, ihn umzudrehen, da aber das Blut auch aus dem Rücken floss, so nahm sie an, dass die Kugel durch und durch gegangen war.
Sie wollte ihn wenigstens noch für kurze Zeit am Leben und bei Bewusstsein erhalten. An seine Rettung konnte sie nicht glauben.
»Aleen, kanntest du einen Mann, der den Namen ›die schwarze Maske‹ führte?«, fragte sie bei ihrer Beschäftigung.
»Nein — o, wie das kühlt! Warum hilfst du mir?«
»Ich habe Mitleid mit dir. Oder einen Mann namens Alphons de Lacoste?«
»Nein«, stöhnte Aleen.
»Aleen, ich will dich noch etwas fragen«, sagte Phoebe mit zitternder Stimme. »Schwöre mir bei dem, was dir heilig ist, dass du mir die Wahrheit auf meine Frage sagen willst.«
»Mir ist nichts heilig — doch ich will dir die Wahrheit antworten — du bist mitleidig gegen mich gewesen.«
»Hat dein Herr einmal einen Menschen ermordet?«
»Ich — weiß es nicht.«
»Vielleicht mit einem vergifteten Dolch, dessen leisester Stich schon genügte, den Getroffenen auf der Stelle zu töten?«
Des Inders Pupillen erweiterten sich, stier blickte er die Fragerin an.
»Nein«, hauchte er dann.
»Nein?«, rief Phoebe enttäuscht. »Du weißt es nur nicht.«
Jetzt begann Aleen selbst zu fragen.
»Hatte dieser Mann — einen schwarzen Vollbart — eine Narbe über dem Auge?«
»Ja, ja, er ist es, es ist Alphons de Lacoste.«
»Ich — will es gestehen«, ächzte der Verwundete, »ich fühle doch — meinen Tod kommen — ich, ich habe diesen Mann — mit einem vergifteten Dolche — ermordet — und ihn — in die Themse — geworfen.«
»Du?!«
Phoebe schleuderte die Hand, die sie hielt, von sich.
»Westerly — hat mich erst — dazu aufgefordert«, fuhr er fort. »Gib mir — Wasser!«
Sie gab ihm zu trinken.
»Direkt aufgefordert? Warum?«
»Nicht aufgefordert — jetzt weiß ich alles — Westerly ist ein — Schurke — er tat, als wüsste er — von...«
»Er tat, als wüsste er ein Geheimnis von dir, und hat dich somit gezwungen, ihn zu töten?«
»Ja«
»Er sagte, der Mann wüsste ebenfalls von deinem Geheimnis, von deiner Schuld?«
»Ja, woher weißt...«
»Ich kann mir alles denken. Er gab also die Veranlassung, dass du ihn tötetest?«
»Ja.«
»Westerly war dabei?«
»Ja.«
»Du warfst ihn auch auf seinen Befehl in die Themse?«
»Ja — er versprach mir — zu schweigen...«
»O, ich kann mir alles erklären. Was wollte der Mann von ihm?«
»Geld.«
»Er trat drohend auf?«
»Ja.«
»Es ist genug, jetzt weiß ich alles. Nur eins wiederhole nochmals: Westerly war dabei, als du den Mann ermordetest, und du tatest es auf seine Veranlassung?«
»Ja.«
Aleen schien sterben zu wollen. Phoebe würde sonst etwas darum gegeben haben, hätte sie ihn am Leben erhalten können. Sie zürnte ihm nicht, denn sie wusste ganz genau, dass er nur das Werkzeug Westerlys gewesen war. Sie konnte sich auch erklären, wie alles gekommen war. Wenn dieser Mann am Leben bliebe, welche Waffe wäre er für sie gegen Westerly, umso mehr, als er ihn jetzt hasste, ihr dagegen wahrscheinlich ergeben sein würde!
Der Sterbende wollte sprechen, er bewegte die Lippen. Phoebe neigte ihr Ohr hinab.
»Ich möchte noch — etwas gestehen«, flüsterte Aleen, »ich habe viele — Morde ausgeführt — aber das ist — noch nicht das — allerungeheuerste — es büßt ein — anderer Mann für mich — denn ich war es — der aus Hass gegen die Engländer...«
Seine Lippen flüsterten nur noch unverständliche Worte, Phoebe konnte nichts unterscheiden.
»Was hast du getan, Aleen?«
Sie bekam keine Antwort mehr, doch das Leben war noch nicht entflohen.
Da plötzlich sah sich Phoebe von Indern umringt, die mit drohenden Augen das Weib vor dem Sterbenden betrachteten, denn sie glaubten natürlich, es sei eine der entflohenen Engländerinnen.
Es war Phoebe ein leichtes, sich als Freundin auszugeben, schon die Nennung einiger Namen, eine Anspielung auf die Wichtigkeit ihrer Rolle überzeugten die Inder von der Wahrheit ihrer Angaben.
Ein Mann kniete vor Aleen nieder und untersuchte ihn.
»Vielleicht stirbt er nicht«, sagte er, »wenn er danach behandelt wird. Aber was sollen wir mit ihm hier anfangen?«
»Ihr müsst ihn nach Delhi zurücktragen.«
»Das ist eine schwere Arbeit, durch die Wildnis.«
»Ihr wisst, dieser Mann darf hier nicht umkommen.«
Nach kurzer Besprechung machten sich die Inder daran, aus Zweigen eine Tragbahre herzustellen, auf welche Aleen nach sorgfältigem Verbinden der Wunde gelegt wurde.
Noch am Abend desselben Tages kam Phoebe wieder in Delhi an. Viele Inder waren unterdessen eingetroffen, die vom Boot entflohen waren, doch nicht Westerly. Es schien, als sei es ihm geglückt, sich mit den Engländern zu vereinigen.
In nächtlicher Stille lag die Riesenstadt da, um sie herum dagegen ging es lebhaft zu. Der Aasgeruch hatte die Tiere des Waldes angelockt; nicht nur Schakale, selbst größere Raubtiere näherten sich der Stadt und fanden einen reichlichen Schmaus, denn die in Delhi Hingemordeten und im Kampfe Gefallenen waren einfach vor die Stadttore geworfen worden.
Die zerfleischten, zerrissenen und umhergestreuten Leichen boten einen scheußlichen Anblick. Der Trupp Männer, der ein Tor Delhis verlassen hatte und die Landstraße benützte, beschleunigte seine Schritte fast zum Laufen, nicht aus Furcht vor den Raubtieren, denn diese ließen sich gar nicht stören, sondern nur, um außer Bereich dieser blutigen Szenerie zu kommen. Sie waren stark bewaffnet und standen offenbar unter dem Kommando eines Führers.
Ein einsamer Wanderer begegnete ihnen, und seltsam stach dessen Benehmen gegen die aus Furcht erzeugte Eilfertigkeit der Soldaten ab.
Die mit einem sackartigen Gewand bekleidete Gestalt ging langsam, Schritt für Schritt, die Arme über der Brust gekreuzt, ohne den Kopf nach links oder nach rechts zu wenden, und ohne auch nur irgendwie zu zögern oder zusammenzuschrecken, wenn neben ihm plötzlich das Geheul eines Panthers erscholl, der von dem einsamen Wanderer eine Störung besorgte und ihn warnte.
»Fürchtest du nicht, heiliger Mann, dass dich die Raubtiere anfallen könnten?«, rief der Führer des Trupps ihm zu, denn er wusste schon aus dem gelassenen Wesen dieses Mannes, dass es entweder ein Fakir oder vielleicht sogar ein Brahmane war, der über jede Leidenschaft, über Schreck, Staunen und Furcht erhaben ist und in allem nur das Wirken Brahmas in der Natur sieht.
»Tat-wam-asi, das bin ich selbst«, entgegnete die sonore Stimme des Gefragten. »Warum sollte ich mich vor mir selbst fürchten?«
Die Soldaten konnten diese Weisheit nicht einsehen, schleunigst machten sie, dass sie weiterkamen, und auch der Wanderer setzte seinen Weg nach Delhi fort.
Nicht lange dauerte es, so tauchten vor ihm die Stadtmauern auf, die Straße musste ihn direkt auf ein Tor führen, und er kannte das Losungswort. Waren die Wächter mit seiner Person zufrieden, so durfte er passieren. Vielleicht ließen sie diesen heiligen Mann aber auch ohne Losungswort ein, wenn er ihnen einige Sprüche aus den Veden aufschrieb, die sie gegen Wunden, Krankheit und bösen Blick schützten.
Doch der furchtlose Wanderer sollte das Tor nicht unbehelligt erreichen, denn wie die Raubtiere, so gab es auch Menschen, die ihn nicht als Heiligen achteten.
Eben passierte er ein kleines Gebüsch, als sich ihm plötzlich von hinten zwei Hände wie eiserne Zangen um den Hals legten und er zu Boden gerissen werden sollte.
Da aber zeigte sich, dass dieser Mann des Friedens weder ein Schwächling, noch geneigt war, sich willenlos in sein Schicksal zu ergeben. Er zog keine Waffe, weil er wahrscheinlich keine besaß, sondern griff blitzschnell hinter sich, packte den hinterlistigen Gegner, hob ihn auf, schmetterte ihn wieder herab, kurz, suchte ihn zu Fall zu bringen und bemühte sich mit den ungeheuersten Anstrengungen, sich umdrehen und dem Feinde die Brust zuwenden zu können. Lange hätte der Kampf nicht dauern können, denn die Hände des Angreifers drohten ihn zu ersticken.
Der unbekannte Gegner sah ein, dass er unterliegen würde, wenn er seine Hände nicht gebrauchte, ließ den Hals los, umschlang den Überfallenen, und sofort merkte dieser, wie eine Schlinge über ihn fiel, die ihm die Arme an den Leib schnürte.
Trotzdem wehrte er sich noch mit dem größten Erfolg; sonderbar war nur, dass er, obgleich seiner Stimme wieder mächtig, nicht schrie.
Da wurde ihm ein Bein gestellt, er fiel, und auf ihm kniete eine dunkle Gestalt, in der Finsternis nicht erkennbar.
»Hätte in meinem ganzen Leben nicht geglaubt, dass jemand sich so gegen mich wehren kann«, murmelte der Unbekannte, sich der englischen Sprache bedienend. »Es hätte nicht viel gefehlt, so hätte mich dieses schmächtige Kerlchen untergekriegt. Hm, wenn ich nur wüsste, wie ich ihn jetzt ausfragen soll, denn Englisch kann er doch nicht sprechen.«
»Vielleicht kann ich's doch, Dick Red!«, entgegnete der unter ihm Liegende.
Dick, denn dieser war der Hinterlistige, war vor Staunen sprachlos, von dem Inder mit seinem Namen angeredet zu werden.
»Seid so gut und erhebt Euch«, fuhr der Liegende, nach Luft schnappend, fort. »Ihr drückt mir mit Euern eckigen Kniescheiben den Brustkasten ein.«
»Wer in aller Welt ist denn das?«, staunte Dick.
»Oskar Reihenfels, zu dienen!«, ächzte der Liegende.
»Nicht möglich!«
»Ja doch, nun lasst mich aber aufstehen! Wollt Ihr noch Beweise? Euer richtiger Name ist Richard Hefter, Ihr seid der Bruder von August, meinem Diener, der Gefährte Mister Woodfields...«
Dick war schon aufgesprungen, löste die Lederschlinge und half dem Liegenden auf.

»Teufel noch einmal, ich hätte Euren Worten schon eher geglaubt, ich erkannte ja auch gleich Eure Stimme; aber ich konnte nur nicht begreifen, woher Ihr, wenn Ihr Mister Reihenfels seid, diese Kraft und Gewandtheit bekommt, dass Ihr Euch so lange gegen mich wehren konntet, wo ich doch von hinten kam und schon manchmal den stärksten Indianer auf der Stelle niedergeworfen habe.«
Reihenfels reckte seine Glieder.
»Ein andermal wollen wir über dieses Thema weitersprechen, jetzt ist keine Zeit dazu! Wie kommt Ihr hierher, Dick? Ich denke, Ihr streift in den Vorgebirgen des Himalaja herum?«
»Von dort komme ich auch. Mein Herr, seine Schwester und Kiong Jang sind noch dort. Es ist aber besser, wenn wir unser Gespräch an einem versteckten Platze fortsetzen.«
Dick verließ die Straße und zog sich in das Gebüsch zurück, Reihenfels folgte ihm. Der Trapper hatte hier auch seine lange, schwere Büchse versteckt.
»Nun erklärt mir, warum Ihr hier ganz gemütlich als Inder auf der Landstraße spazieren geht! Kein Teufel hätte Euch für Mister Reihenfels gehalten«, begann Dick.
»Davon später, wenn es an die Reihe kommt. Erst sagt, was Ihr hier zu suchen habt! Ihr seid also allein?«
»Ja, ich bin allein. Mister Woodfield, seine Schwester und Kiong Jang haben sich einstweilen in den Hütten eines Gebirgsvolkes da oben häuslich eingerichtet. Von dem Aufstand ist dort glücklicherweise noch nicht viel zu merken, Aufwiegler gibt es zwar genug, aber der Boden ist für ihren Samen nicht gut.«
»Gefunden habt Ihr noch nichts?«
»Von dem heiligen Felsentempel? Noch keine Spur. Na ja, eine Spur wohl, das heißt, Kiong Jang behauptete einmal, diese Gegend habe er passiert, und zwar gleich zu Anfang seiner Flucht. Wir sind Tag für Tag kreuz und quer zwischen Bergen umhergewandert, durch Schluchten gekrochen und haben jede Höhle untersucht, aber Kiong Jang schüttelte immer wieder seinen Totenschädel und mag ihn noch jetzt schütteln. Zu uns drang natürlich auch die Kunde von dem Aufstand hier unten, von den scheußlichen Metzeleien, in denen die braunen Schufte die wildesten Indianer noch übertroffen haben, und dann erfuhren wir durch Zufall, dass der Festungskommandeur von Delhi ein gewisser Monsieur Francoeur sein soll. Stimmt das?«
»Derselbe, der in Wanstead unser Nachbar war, und an dessen Festnahme Mister Woodfield so viel lag«, bestätigte Reihenfels.
»Seht, das ist eine Person, an die wir uns halten können. Wenn der uns nicht sagt, wo wir den Felsentempel zu suchen haben, so gebe ich die Hoffnung auf, oder er kann uns wenigstens eine Adresse geben, an die wir uns zu wenden haben, so zum Beispiel die des Radscha Tipperah. Als Woodfield erfuhr, dass Francoeur hier war, wollte er durchaus mit mir gehen, es gelang mir jedoch, ihn zurückzuhalten, denn er wäre mir doch nur hinderlich gewesen, und so machte ich mich allein auf den Weg. Jetzt bin ich hier und habe die Absicht, Monsieur Francoeur einen Besuch abzustatten!«
»Auf Eurem Wege müsst Ihr doch immer durch aufständische Gebiete gekommen sein.«
»Ich war immer mitten drin, überall wurde geschossen und gestochen, und wohin man sah, da brannte es lichterloh. Das Herz hat mir oft geblutet, wenn ich die Frauen und Kinder hinschlachten sah, aber allein konnte ich nicht viel ausrichten, und dann durfte ich mich nicht lange aufhalten. Es war ein weiter Weg.«
»Ihr wart so, wie Ihr jetzt seid? Ohne Verkleidung?«
»Wozu denn eine Verkleidung?«
»Ihr seid wirklich unversehrt bis hierher gelangt?«, staunte Reihenfels.
»Natürlich! Warum denn nicht?«
»Das kann ich nicht begreifen. Selbst ich, als Inder verkleidet und mit der Rolle eines geheiligten, unverletzlichen Brahmanen vollständig vertraut, schwebe beständig in Gefahr, entlarvt und den Messern der Inder überliefert zu werden.«
»Bah, ich hab's ganz anders gemacht! Wer mich anhielt, dem habe ich den Schädel eingeschlagen; musste ich fliehen, so tat ich's hübsch langsam und schoss einen der Verfolger nach dem anderen nieder. Manchmal waren sie mir dicht auf den Fersen, wenn sie aber glaubten, jetzt haben wir ihn, da war Dick schon immer ganz wo anders. Nun aber erzählen Sie, Mister Reihenfels! Wie steht es hier?«
Der junge Mann, dem wir schon einmal als Brahmanen verkleidet begegneten, erzählte so kurz wie möglich, wie der Aufstand in Delhi losbrach. Es sei ihm gelungen, in seiner Verkleidung unbelästigt die Reihen der Feinde zu passieren; als er einmal fliehen musste, habe er die in seiner Nähe befindliche Mutter aufs Pferd gehoben und sie in Sicherheit gebracht. Dann sei er nach Süden vorgedrungen, auf General Nicholson gestoßen, welcher mit Aufbietung einer fabelhaften Energie versprengte Engländer und Sepoys um sich sammelte, und als er von Reihenfels erfuhr, wie nötig die aus Delhi Vertriebenen Hilfe brauchten, habe er sich sofort auf dem Marsche dorthin gemacht.
Reihenfels' Erzählung hatte eine düstere Färbung, und so klang auch seine Stimme.
»Ihr seid dem Zuge Nicholsons als Spion vorausgeeilt?«, fragte Dick.
»Als Spion? Ich habe keinen Anteil an diesem Krieg. Nein, es sind Gefangene in Delhi, welche ich liebe, darunter meine beiden Schwestern, und ich will versuchen, ob ich sie nicht befreien kann. Es ist ein verzweifeltes Unternehmen, doch ich baue auf Gottes Hilfe.«
»Und meine könnt Ihr dazurechnen. Wisst Ihr nicht, wo sich Charly und August befinden, ob unter den Toten oder unter den Lebenden?«
»Sie sind geflohen und befinden sich ebenfalls in den Sümpfen. Ich traf auf Engländer und erfuhr, dass Charly sogar mit August aufgebrochen sei, um einen Weg aus den von den Indern vollständig umstellten Sümpfen zu finden und Hilfe herbeizuholen. Es wäre nicht mehr nötig gewesen.«
»Na, dann steht's ja noch nicht so schlimm«, sagte Dick aus vollem Herzen; »nun wollen wir versuchen, in Delhi einzudringen und dort unser Möglichstes zu tun.«
»Ich kann wohl hineingelangen, aber Ihr?«
»Sagt mir einen Ort, wo ich mich versteckt halten, wohin ich mich im Falle der höchsten Gefahr zurückziehen kann, und sollte ich mich auch bis dahin Schritt für Schritt durchschlagen, so soll es mir ein leichtes Spiel sein.«
Einen solchen Ort konnte ihm Reihenfels allerdings angeben, und zwar genügte dem Trapper nur eine Beschreibung. Reihenfels sollte jetzt erst kennen lernen, was für einen Begleiter er in Dick bei dem bevorstehenden, überaus gefährlichen Abenteuer besaß.
»Wie gedachtet Ihr denn überhaupt in die Stadt zu gelangen? Das ist mir unerklärlich.«
»Anfangs wollte ich über die Mauer«, entgegnete Dick.
»Die ist auch an der niedrigsten Stelle noch über drei Meter hoch.«
»O, das macht nichts, ich werde schon hinüberkommen, aber freilich, das Herauskommen wäre schwer gewesen, weil ich keinen Unterschlupf wusste, und man würde mich wohl in den Straßen zu Tode gehetzt haben. Darum änderte ich meinen Plan. Ich wollte einen Mann überwältigen, den ich im Besitz des Losungswortes hielt, damit ich erst einmal in Gemütsruhe in Delhi herumspionieren und mir einen sicheren Schlupfwinkel suchen konnte. Freilich spreche ich nicht Indisch, hätte ich den Mann aber etwas mit dem Messer gekitzelt, so würde er meine Frage schließlich schon verstanden haben.«
»Und dieser Mann war ich?«
»Ja. Ihr gingt so ruhig dahin, und da dachte ich, der weiß ganz sicher, wie man in die Stadt hineinkommt, und kann mir vielleicht sonst noch manchen guten Ratschlag geben.«
»Was hättet Ihr denn mit dem Mann gemacht?«
»Ihm einfach die Kehle durchgeschnitten, damit er nicht plaudern konnte. Jetzt kommt es in Indien auf einen Toten mehr oder weniger auch nicht an.«
»Diesem Lose wäre ich also glücklich entgangen.«
Die beiden Männer berieten sich hierauf eine kurze Zeit. Noch war der Morgen weit entfernt, noch herrschte vollkommene Dunkelheit, als der junge Brahmane wieder dem Tore zuschritt, während der kleine Trapper sich vom Wege entfernte und unbemerkt die Stadtmauer zu erreichen suchte. Wohin er sich zu wenden hatte, wusste er nun aus Reihenfels' Beschreibung ganz genau.
Es war am l8. Juni l857, als zwei Männer in langen, grauen Offiziersmänteln jenes dunkle Haus, in dessen unteren Räumen Madame Chevaulet rauschende Festlichkeiten für Lebemänner arrangiert hatte und noch immer arrangierte, verließen.
Nicht lange konnte es mehr dauern, so musste der Morgen anbrechen; müde und abgespannt waren auch die Bewegungen der beiden. Sie konnten sich nicht einmal dazu aufraffen, ein Gespräch anzuknüpfen, langsam schlichen sie auf der wie ausgestorbenen Straße einher.
Als sie um eine Ecke bogen, stießen sie mit einem anderen Manne zusammen, ebenfalls in einen grauen Offiziersmantel gehüllt.
»Verdammt will ich sein, wenn das nicht der dicke Montpassier ist!«, sagte er, stehen bleibend.
»Bitte, Conte Montpassier, Captain der indischen Artillerie, wenn Sie nichts dagegen haben, Monsieur Duplessis«, sagte der eine der Männer spöttisch, und diesen Herrn kennen Sie wohl auch, Leutnant Francois. Wir haben Sie heute vermisst, Monsieur Duplessis; wo haben Sie gesteckt?«
»Francoeur hatte mich auf das Grabmal des Humayun postiert, und ich wette, an Sie kommt auch bald die Reihe, dort 24 Stunden Wache zu halten.«
»Bei den Brieftauben? Was in aller Welt haben wir denn dort zu suchen? Ich verstehe nichts von Taubenzucht; nur gebraten habe ich diese Tierchen gern, besonders mit einer etwas scharfen Sauce. Ah, Duplessis, Sie hätten heute bei der Chevaulet sein sollen, ein Menü hatte sie zusammengestellt, ich sage Ihnen «
»Hören Sie auf, jetzt von so etwas zu sprechen, die Zeit ist zu ernst dazu. Es wird wohl überhaupt das letzte Mal gewesen sein, dass Sie bei der Chevaulet gewesen sind.«
»Unsinn, wir sitzen hier ja ganz gemütlich und warm!«
»Das ist vorbei, es geht los.«
»Es ist schon lange losgegangen.«
»Ja, aber nur von indischer Seite aus. Gute Nacht, meine Herren! Ich muss zu Madame Dubois; Francoeur, der selbst auf dem Grabgebäude ist, schickt mich mit geheimer Depesche zu ihr.«
»Was, ist endlich eine Taube angekommen?«, riefen beide Herren, den Forteilenden zurückhaltend.
»Die erste, sie bringt schlechte Nachricht, und von jetzt an sind weitere zu erwarten.«
»Teilen Sie uns die Botschaft mit.«
»Kein Mensch darf sie erfahren; sie wirkt auf die Inder entmutigend. Sie wissen, morgen soll zu Ehren der Abreise Nana Sahibs, der nach Fatehpur geht, ein Fest gefeiert werden, und das darf nicht gestört werden.«
»Bah, was Madame Dubois erfahren darf, dürfen auch wir hören. Wir sind doch keine Inder.«
Duplessis schien es weder so eilig zu haben noch es so sehr genau mit seinen Dienstgeheimnissen zu nehmen, gebrauchte aber doch die Vorsicht, die Neuigkeit den beiden ganz leise zuzuflüstern.
»Himmel und Hölle«, fuhren diese erschrocken heraus, »so kann er bald hier sein.«
»Nicht vor Ende Juni, wenn er auf Befehl Cannings nicht gar erst gegen Lahore vorgeht. General Nicholson ist jedenfalls der erste Gegner, gegen den wir zu kämpfen haben. Hallo, wer ist das! Was hast du hier zu lauschen, Bursche?«
Mit diesen Worten fuhr Duplessis einen Inder an, der schon längere Zeit unbemerkt zur Seite gestanden hatte. Auch die beiden anderen griffen erschrocken nach verborgenen Waffen, als wollten sie den auf der Stelle niedermachen, der ihr Gespräch belauscht hatte.
Der Inder zuckte mit keiner Wimper, ruhig stand er da.
»Wenn das kein Heiliger ist, will ich hängen«, sagte Montpassier; »solchen Gleichmut haben nur die Fakire und ähnliche Kerls. Was hast du hier zu suchen?«, fragte er auf indisch, während die drei bis jetzt Französisch gesprochen hatten.
»Darf ich nicht hier stehen?«, war die ruhige Antwort.
»Pack dich, oder deine Kali soll dich bei lebendigem Leibe auffressen.«
Der Inder wandte sich und ging.
»Der spricht doch kein Französisch«, meinte Duplessis; »ich habe unter diesen Heiligen noch keinen getroffen, der Französisch versteht; sie pfropfen sich den Kopf mit ihren heidnischen, uralten Sprachen voll. Gute Nacht, meine Herren, oder vielmehr guten Morgen! Wir sehen uns doch beim Fest wieder?«
»Natürlich! Apropos, Duplessis, wie steht es mit Ihrer Wette, Ihrer Eroberung?«
»Mit der Begum? Hahaha, ich habe sie ja noch gar nicht zu Gesicht bekommen!«
»Sie geht auch bald von Delhi weg, es wird Zeit.«
»Morgen werde ich den Anfang machen, ich habe noch acht Tage Zeit, und das genügt mir.«
Die drei trennten sich.
»He, Duplessis«, rief Montpassier ihm noch einmal nach, »Sie wissen wohl, die Dubois wohnt seit ihrer Rückkunft nicht mehr im Hause der Duchesse.«
»Ich weiß es«, klang es aus der Dunkelheit zurück.
Duplessis setzte seinen Weg fort, ohne zu bemerken, dass ihm eine dunkle Gestalt heimlich folgte. Es war der Inder, welcher vorhin neben den drei Männern gestanden hatte.
Vorsichtig folgte er ihm, er blieb hinter jeder Ecke stehen, wartete, bis der Offizier hinter der nächsten verschwunden war und setzte ihm erst dann schnell nach.
Schließlich hatte Duplessis vor einem orientalischen Hause, hoch und schön gebaut, sein Ziel erreicht, setzte den eisernen Klopfer in Bewegung und ward eingelassen.
Während er drinnen berichtete, dass General Nicholson sich mit den aus Delhi Entkommenen, etwa 4000 Mann, vereinigt habe und am 17. Juni, also gestern, die Meuterer von Silkut vollständig vernichtet habe, im Besitz dieser befestigten Stadt sei, dass es den Engländern also zum ersten Male gelungen sei, in Indien wieder festen Fuß zu fassen, und dass man diese Nachricht dem verräterischen Lord Westerly verdanke, der sich jetzt bei den Engländern befinde, lehnte draußen der junge Inder an der Häusermauer und sah zu den Fenstern hinauf, welche eben noch finster, plötzlich erhellt waren.
Dort wohnte also Madame Dubois, die Maitresse Monsieur Francoeurs, des Kommandanten von Delhi, denn Duplessis hatte ja ihr die Nachricht bringen wollen.
Der Offizier hatte es eilig; er hielt sich nicht lange bei der Geliebten seines Vorgesetzten auf. Bald öffnete sich die Haustür wieder, er trat heraus und entfernte sich schnell, ohne den Inder bemerkt zu haben.
Dieser schien einen kurzen Kampf mit sich selbst auszufechten, dann ging er entschlossen auf die Haustür zu und ließ ebenfalls den Klopfer ertönen.
Es ward ihm schneller geöffnet als vorhin dem Offizier, wahrscheinlich weil der Wächter noch in der Nähe der Tür war.
Misstrauisch musterte der alte Inder im Scheine der Blendlaterne den noch jungen Mann, der bewegungslos, die Arme über der Brust gekreuzt, vor ihm stand.
»Nun, was willst du?«, fragte er kurz.
»Zu deiner Herrin.«
Der Alte wurde etwas höflicher, denn er glaubte nicht anders, denn ein als einfacher Mann verkleideter Radscha wollte seine Herrin sprechen, da diese mit den Anführern viel im Verkehr stand.
»Nenne mir deinen Namen, Herr, und ich will sie fragen, ob du sie sprechen kannst.«
»Mein Name ist Niemand, doch nicht lange wird es dauern, so wirst du mich Buddha nennen.«
Der Alte verneigte sich, vor ihm stand ein Brahmane. Denn dass sich ein anderer Inder, selbst einer aus höheren Kreisen, für einen Brahmanen ausgeben könnte, ist ganz ausgeschlossen. Alles würde ihn verraten, ein jedes Wort aus seinem Munde. Den Brahmanen wird die höchste Ehrfurcht entgegengebracht, jede Tür, jeder Weg steht ihnen offen.
»Was befiehlst du deinem Diener?«
»Führe mich zu deiner Herrin!«
»Nur du bist mein Herr, niemand anders«, entgegnete der Alte und lief schon voran, ohne daran zu denken, die Tür wieder zu schließen.
Im ersten Stock blieb er stehen und deutete auf den Eingang zu einem kleinen Gemach.
»Die Dame ist hier, sie pflegt einen Kranken, den sie nicht sterben lassen will. Auch ein heiliger Arzt ist bei ihm, doch was ist er gegen dich, der du ein Buddha bist! Lege ihm die Hände auf, und er ist gesund.«
Der junge Brahmane schlug ohne Zögern die Portiere zurück und trat ein.
Ein scharfer Karbolgeruch drang ihm entgegen; er befand sich in einem Zimmer, das nichts enthielt als ein Bett und alles das, was man in einem Krankenzimmer findet: einen Tisch mit Schüsseln, Becken, ausgebreiteten Tüchern, Schwämmen und so weiter.
Auf dem Bett lag ein Mann, der schwach stöhnte. Ein Greis, einfach dunkel gekleidet, legte ihm eben einen Verband an, am Kopfende stand eine Dame im Nachtgewand und sah mit fragender Teilnahme den geschickten Händen zu.
Der Greis war nach dem weißen Band, welches er um die Stirn trug, ein Priester Vishnus, und da dieser der Erhalter, nicht wie Shiva der Schöpfer, alles Lebendigen ist, so sind seine Diener zugleich auch Ärzte.
»Wird er sterben?«, flüsterte die Dame.
»Noch ist die Stunde nicht gekommen, da das Fieber den stärksten Grad erreicht. Übersteht er diese, so ist er gerettet; ich will wachen und alles tun, ihm sie zu erleichtern, und Vishnu erhöre mein schwaches Gebet.«
»Und Brahma wird das meine erhören, denn er liebt mich«, erklang es hinter den beiden, im Gegensatz zu den zweifelnden Worten des Priesters bestimmt.
Die Dame fuhr erschrocken herum, der Priester sah nur verwundert auf.
»Wie kommst du hier herein? Was suchst du hier?«
»Dich!«
»Es ist ein Brahmane«, sagte der Priester. »Segne diesen Kranken, und er wird gesunden.«
Er trat ehrfurchtsvoll zurück, obgleich der Brahmane, den er sofort als solchen erkannt hatte, ihm gegenüber ein Kind zu nennen war. Der Brahmane ging langsam ans Bett, legte dem Kranken beide Hände auf den Kopf und murmelte einige Sprüche, welche der Greis als zum Sanskrit gehörig erkannte.
»Dich möchte ich sprechen«, wandte er sich dann wieder an die Dame — Phoebe — und bediente sich dabei zu deren Erstaunen des reinsten Französisch. »Gib mir einige Minuten, und du sollst viel zu hören bekommen.«
Nur einen Augenblick musterte sie den Sprecher misstrauisch; sie kannte die Sitten, wie die Religion der Inder sehr genau und wunderte sich, dass dieser junge Mann ein Brahmane sein sollte. Doch der Priester selbst hatte es ja gesagt. Was wollte er von ihr? Sie führte ihn ohne Zögern in ihr Schlafzimmer, das so schwach erleuchtet war, dass man den Lichtschimmer von draußen nicht wahrnehmen konnte.
Nachdem sie die Lampe höher geschraubt hatte, wandte sie sich dem Manne zu, der mitten im Zimmer stehen geblieben war und sich auch auf ihre Aufforderung nicht setzen wollte, ebenso wenig wie er einen Blick für seine Umgebung hatte.
»Du bist ein Brahmane?«, begann Phoebe, sich setzend und den armselig gekleideten Mann neugierig betrachtend, der infolge seiner religiösen Stellung eine so außerordentliche Macht über das Volk besaß.
»Du sagst die Wahrheit, ich bin's.«
»Und sprichst Französisch?«
»Wem Brahma sich offenbart, der redet in der Sprache, in welcher er am besten verstanden wird.«
»Nun, ich spreche eigentlich lieber Italienisch«, lächelte Phoebe, welche natürlich an den Kultus der Inder nicht glaubte.
»So bediene dich dieser Sprache«, sagte der Brahmane auf italienisch.
Jetzt staunte Phoebe doch, immer neugieriger betrachtete sie den jungen Mann.
»Ich glaube wirklich, dass du ein Abgesandter Brahmas bist.«
»Ich bin's, und er spricht durch mich zu dir.«
»Ah, also ein Prophet. Nun, was lässt mir der indische Brahma denn sagen?«
»Er sagt, dass du ein Mensch bist, dem er Vernunft gegeben hat, zu unterscheiden das Böse und das Gute, und je nachdem du von dieser Befähigung Gebrauch machst, wird er auch dich behandeln, schon hier auf Erden und später, wenn du ihn schauen wirst.«
»Ach, wenn doch jeder Mensch nur Gutes tun wollte, wie es jede Religion vorschreibt, wie schön wäre es auf der Erde!«, entgegnete Phoebe nicht ohne Spott. »Gewiss, ich besitze kein böses Herz und möchte gern Notleidenden helfen.«
Phoebe wusste, dass diese Brahmanen sich um Politik gar nicht kümmerten. Der junge Mann hatte wahrscheinlich im Traum den Befehl bekommen, ihr eine Strafpredigt zu halten, und sie war geduldig genug, diese anhören zu wollen.
Zu ihrem namenlosen Erstaunen aber fuhr der Brahmane fort:
»Du besitzt kein gutes Herz, würdest du sonst dulden, dass die in qualvoller Gefangenschaft gehalten werden, die dir immer in Freundschaft und Liebe begegnet sind? Was haben sie dir getan, dass du mit bei dem fluchwürdigen Unternehmen geholfen hast, sie in Ketten zu legen?«
»Von wem sprichst du denn?«
»Von der unglücklichen Gattin und Mutter, welche dir, als du in England warst, in Liebe begegnete, und von ihren Freundinnen. Du hast die Macht dazu, befreie sie, vereine sie mit denen, welche um ihr Los trauern und jammern.«
Phoebe erhob sich in sprachlosem Erstaunen. Sofort wusste sie, dass dieser Mann ein Abgesandter ihrer Feinde war und an ihr im Grunde genommen gutmütiges Herz appellieren sollte. Aber ein Brahmane? Nicht möglich.
»Du verlangst, ich soll meine Hand dazu leihen, um Gefangene zu befreien?«
»Du sagst es.«
»Was sollte mich dazu veranlassen?«
»Dein Herz, wenn es wirklich gut ist, die Bitten derer, die dir nie etwas zuleide getan haben, und dann die Aussicht auf die Belohnung, die jeder guten Tat folgt.«
»Ich begreife gar nicht, wie solch ein Anerbieten mir gestellt werden kann. Wer gab dir diesen Auftrag?«
»Ein Mann namens Oskar Reihenfels. Seine beiden Schwestern schmachten in Gefangenschaft als Geiseln, desgleichen die Mutter des Mädchens, welches du erzogen hast. O, treibe dein frevelhaftes Spiel nicht weiter, kehre um, versuche das wieder gutzumachen, was du gesündigt hast.«
Mit weit aufgerissenen Augen starrte Phoebe den Sprecher an.
»Was?«, rief sie endlich. »Seid ihr Brahmanen wirklich allwissend?«
Der Mann trat auf sie zu und ergriff ihre Hand.
»Ich beschwöre dich«, sagte er warm, »bei allem, was dir heilig ist, sei mir behilflich, diese drei aus der Gefangenschaft zu befreien, und verlange von mir einen Gegendienst, so hoch er auch ist, ich will ihn dir leisten. Du selbst bist eine Gefangene, bist mit Ketten an Francoeur geschmiedet, und nur widerwillig trägst du sie. Ich will auch dir die Mittel geben, frei zu werden.«
»Ha, jetzt beginne ich zu verstehen. Du bist kein Unterhändler, du selbst bist einer unserer Feinde. Aber ein Brahmane? Das kann ich wieder nicht verstehen.«
»Du irrst, ich bin überhaupt kein Inder. Vor dir steht Oskar Reihenfels, und er weiß, dass er dich nicht mehr als Feindin zu fürchten hat, die ihn verrät.«
Es dauerte lange, ehe Phoebe an diese Wahrheit glaubte, und dann war sie vor Staunen außer sich.
»Und Sie wagen es, mich in meiner Wohnung, im Hause des Kommandanten von Delhi, aufzusuchen?«, flüsterte sie, sich jetzt des Englischen bedienend. »Sie sind verloren, wenn ich Lärm schlage und Sie verrate.«
»Ich aber weiß, dass Sie dies nicht tun werden, ich richte nicht einmal eine Waffe auf Sie und sage: Verraten Sie mich, so ist es Ihr Tod; denn Sie werden mich nicht verraten.«
»Woher wissen Sie das so bestimmt?«
»Sie können mich nicht täuschen, Sie sind nicht hartherzig; nur widerwillig verrichten Sie die knechtischen, unsauberen Dienste, die man von Ihnen verlangt «
»Herr, Sie führen eine freie Sprache!«
»Nur eine offene. Helfen Sie mir, und ich will Ihnen Mittel geben, diesen Kreis zu verlassen, der Ihrer gar nicht würdig ist.«
Aufgeregt schritt Phoebe im Zimmer auf und ab. Reihenfels hatte das Richtige getroffen, seine Worte hatten einen wunden Punkt berührt und verfehlten die beabsichtigte Wirkung nicht.
Sie blieb vor dem jungen Manne stehen.
»Was verlangen Sie von mir?«
»Ihre Hilfe, Lady Carter und meine beiden Schwestern zu befreien, womöglich auch alle anderen Gefangenen. Ich weiß, auf Befehl der Begum wird zwar ihr Leben noch geschont, doch sie geht bald nach Osten, den offenen Kampf mit den Engländern zu beginnen; Bahadur bleibt hier, und ich kenne dessen Charakter; er wird die Wehrlosen sicherlich hinmorden.«
»Sie haben recht, ich würde Ihnen auch helfen«, sagte Phoebe mit gepresster Stimme, »aber — ich kann nicht mehr.«
»Sie können nicht? Warum nicht? Sie bekleiden hier eine einflussreiche Stellung, Sie unterstützen mich und meinen Gefährten, der sich in Delhi versteckt hält, und mit Gottes Hilfe, wird es unserem Mut und Scharfsinn gelingen, einen Weg zur Befreiung zu finden.«
»Die Gefangenen sind nicht mehr in Delhi.«
»Nicht?«, fragte Reihenfels erschrocken.
»Nein, Sie sind gestern auf Wunsch Bahadurs und mit Einwilligung der Begum nach Norden transportiert worden, wahrscheinlich sollen sie in einem Schlupfwinkel der Berge verborgen gehalten werden.«
»Oder dort vielmehr ohne Wissen der edelmütigen Begum niedergemetzelt werden, ich kenne das. So eile ich ihnen nach.«
»Vielleicht haben Sie recht. Noch eins erfahren Sie. Lady Carter befindet sich nicht unter diesen Gefangenen.«
Sie erzählte den Vorfall, wie das wandernde Feuer Lady Carter schon befreit hatte, dann aber durch die List Isabels in das Loch gestürzt war. Der Tod beider war sicher.
Stöhnend sank Reihenfels auf einen Stuhl und bedeckte das Gesicht mit den Händen.
»Dieses schändliche Weib!«, knirschte er dann. »Wehe ihr, wenn das Gericht über sie kommt! Also tot, tot! Nun, wohl ihr! Sie ist von ihrem traurigen Schicksal erlöst und hat den Tod in den Armen ihres Gatten gefunden. Sie wissen, dass das wandernde Feuer der aus dem Felsentempel der Kali entsprungene Sir Carter war?«
»Ich weiß es. Vielleicht war es sogar besser, dass sie sich nicht lebend in der Gewalt des wandernden Feuers befindet, denn es ist sehr die Frage, ob der offenbar wahnsinnige, tobsüchtige Mann seine Gattin erkannt hat. Was zwischen beiden im Saale vorgegangen ist, vermag niemand zu sagen.«
Eine lange Pause trat ein; Reihenfels war von dieser Nachricht überwältigt.
»Haben Sie meine Schwester gesehen?«, fragte er dann leise.
»Nein, ich habe die Gefangenen überhaupt nie zu Gesicht bekommen.«
»Wissen Sie, wohin sie geführt werden?«
»Nein, und ich glaube kaum, dass ich dies erfahren werde, selbst wenn ich mir noch so große Mühe gebe. Sie können sich denken, dass man uns Ausländern nicht völliges Vertrauen schenkt.«
»Dann bitte ich Sie wenigstens um Beantwortung einiger Fragen.«
»Ich will es tun, wenn es in meiner Macht steht, sogar, wenn es zum Nutzen der Engländer ist. Fragen Sie!«
»Ein unglücklicher, alter Mann sucht seine Tochter, die ihm vor langen, langen Jahren geraubt worden ist. Sie befindet sich im Felsentempel der Göttin Kali als Gefangene. Wo ist dieser?«
Es war fast, als ob Phoebe plötzlich den Entschluss gefasst hätte, mit ihrem bisherigen Leben und jetzigen Freunden zu brechen.
»Monsieur Francoeur war dieser Kindesräuber«, sagte sie mit fester Stimme, »er nannte sich damals Janvier. Mister Woodfield hatte sich also nicht geirrt, ebenso wenig wie Kiong Jang, seine Erzählung beruhte auf Wahrheit; aber ich kann Ihnen nicht den geringsten Anhalt geben, wo sich dieser Felsentempel befindet, auch Francoeur nicht, denn nur die, die zum Bunde der Thugs gehören, kennen ihn. Es tut mir leid...«
»Und Radscha Tipperah?«
»Ist ein Cham, das heißt ein Priester der Thugs. Er kennt das Geheimnis des Tempels; aber was nützt das? Weiß doch nicht einmal ich, wo er sich jetzt aufhält.«
Wieder ließ Reihenfels den Kopf sinken.
»Dann noch eins«, begann er wieder, »diesmal gilt es meine eigene Person. Madame ich beschwöre Sie, sprechen Sie die Wahrheit.«
»Sie sollen sie erfahren.«
»Wer war der junge Offizier, der Sie vorhin besuchte?«
»Captain Duplessis.«
»Er nannte sich früher Giraud, und er war das Werkzeug Francoeurs, durch welches er mir Begas Liebe raubte?«
Phoebe wurde noch ernster als zuvor. Sie trat auf Reihenfels zu, legte ihm ihre Hand auf die Schulter und sah ihn mitleidig an.
»Armer, junger Mann«, sagte sie weich, »ich bedauere Sie aufrichtig. Sie sind ebenso um Ihre Liebe betrogen worden wie ich, und dies eben veranlasst mich ohne Zögern, ein offenes Geständnis abzulegen. Ich weiß, was Sie noch fragen wollen. Ja, jenes unheilvolle Rendezvous in Olympia mit der maltesischen Tänzerin war von Francoeur herbeigeführt worden. Giraud hatte es arrangiert, und zum Dank erhielt er hier später die Stelle eines Offiziers. Ich selbst war mit im Bündnis, mein Auftrag war es, Sie bei Bega zu verdächtigen; ich tat es, es gelang, und — ach, Mister Reihenfels, ich bin hart dafür bestraft worden.«
Eine lange Pause trat ein.
»Sie meinen, ich habe Begas Liebe für immer verloren?«, fragte dann Reihenfels.
»Ich kenne ihren Charakter; ich glaube, es ist so.«
»Nein, es ist nicht so.«
»Nicht?«
»Nein — doch lassen wir das! Ich hatte Mirzi hier wiedergefunden, jetzt habe ich sie natürlich verloren...«
»Sie büßt einen Verführungsversuch, den sie abermals an einem Unschuldigen ausübte, auf dem Schmerzenslager. Sie wird ihre Schönheit für immer verloren haben, und das ist die härteste Strafe für ein Weib, wenn es eitel wie Mirzi ist. Sie wollen sie als Zeugin haben?«
»Ja.«
»Rechnen Sie am meisten auf mich. Ich werde mich bemühen, Bega über den wahren Sachverhalt aufzuklären.«
Stürmisch ergriff Reihenfels Phoebes Hände und führte sie an seine Lippen.
»O, wie soll ich Ihnen danken! Einen Stern sehe ich in der Nacht aufgehen, er verheißt mir Freude und Glück nach dunkeln Tagen. Was kann ich für Sie tun? Sprechen Sie, verlangen Sie!«
»Auch Sie können mir einen großen Dienst erweisen, doch davon später! Erst muss ich noch Wochen, vielleicht noch Monate hier bleiben, bis ein Mann gesund ist, an dessen Leben mir ungeheuer viel liegt. Auch ich brauche nämlich einen Zeugen und Ankläger gegen den, der mein Glück vernichtet hat. Jetzt wollen wir von Ihnen sprechen. Wagten Sie, Bega als Oskar Reihenfels gegenüberzutreten?«
Reihenfels zögerte mit der Antwort.
»Tun Sie es nicht, solange sie nicht von dem Unrecht weiß, das an Ihnen ausgeübt worden ist«, fuhr Phoebe fort. »Sobald mir Gelegenheit geboten ist, werde ich mit Bega sprechen, denn sie ist der festen Meinung, dass ich die einzige Person auf Erden bin, die es aufrichtig mit ihr meint. Bega hängt wirklich an mir.«
»Verschaffen Sie mir wenigstens eine Gelegenheit, sie einmal zu sehen!«, bat Reihenfels.
»Das ist nicht so leicht, die Begum zeigt sich vorläufig nur wenig in der Öffentlichkeit. Doch, morgen zum Beispiel, würde es gehen.«
»Morgen soll ein Fest gefeiert werden zu Ehren Nana Sahibs, welcher Delhi verlässt.«
»Woher wissen Sie das?«
»Ich belauschte sich unterhaltende Offiziere, darunter Duplessis.«
»Es ist kein anderes Fest, als wie es hier jeden Tag stattfindet. Die indischen Anführer denken noch gar nicht daran, dass es in Indien bald ganz anders aussehen wird, sie halten es gar nicht für möglich, dass sich die Engländer ernstlich zum Kampfe aufraffen können, und so vertreiben sie sich noch jetzt jeden Tag die Zeit durch Vergnügungen und Schaustellungen aller Art. Morgen findet nur insofern eine Abwechslung statt, als auch die französischen Offiziere dazu einmal Zutritt haben, ebenso wie die andern Gäste. Ich könnte Sie einführen.«
»Ich werde erkannt werden«, bemerkte Reihenfels zögernd.
»Ich glaube kaum. Sie sind ganz unkenntlich. Besonders, wenn Sie sprechen, hält man Sie unbedingt für einen Brahmanen, weil sie das reinste Indisch beherrschen, das ich jemals gehört habe.«
»Ein Brahmane — auf einem Fest?«
»Ah, Sie haben recht, das geht nicht.« Phoebe ergriff die Lampe und leuchtete ihm ins Gesicht.
»Übrigens, bei Lichte gesehen, tauchen doch die Züge von Mister Reihenfels vor mir auf.«
»Ich habe mich auch nicht weiter unkenntlich gemacht als durch Schwarzfärben der Haare.«
»Ja, so geht es nicht, Bega hat scharfe Augen, umso mehr, als das Mädchen Sie geliebt hat — sie könnte Sie erkennen. Doch ich war einst beim Theater, mir soll es ein leichtes sein, Sie vollständig unkenntlich zu machen. Seien Sie versichert, Sie sollen morgen Bega sehen und sprechen, selbst in ihrer Nähe sein. Glücklicherweise ist es mir eben jetzt möglich, Sie einzuführen. Einige Stunden Instruktion sind dazu allerdings nötig, denn Sie müssen ihre Rolle fehlerfrei spielen können. Sie sprechen die Sprache der Puharris?«
»Des Volkes an den waldigen Grenzen Bengalens? Ich beherrsche sie vollkommen.«
»Dann steht unserem Unternehmen kein Hindernis im Wege.«
Eine Terrasse des ungeheuren Residenzschlosses war hergerichtet worden, zahlreiche Gäste zu empfangen. Einheimische Gewächse schlossen das weite Plateau ein. Im Norden erblickte man durch die freigelassenen Aussichtsstellen die schneebedeckten Gipfel des Himalajagebirges, im Scheine der Abendsonne erglänzend, im Osten überschaute das Auge, beugte man sich über die Balustrade, das liebliche Tal der Dschamna, und im Süden konnte der Blick auf blühenden Feldern und Fluren weilen, nur schade, dass er dabei auf so viele rauchende Trümmerhaufen traf. Schon neigte sich das reife Korn schwer zur Seite, ohne dass es fleißige Schnitter gab; denn in Indien wütete der Krieg. Wie lange würde es noch dauern, so war das Getreide niedergestampft!
Links erhob sich die massive Wand eines Schlossflügels und schützte vor der Sonne.
In weitem Kreise waren auf der Terrasse Stühle aufgestellt oder dicke Polsterkissen niedergelegt worden, und schon saßen oder lagen auf denselben die Gäste, welche nicht zur direkten Umgebung Bahadurs gehörten und nicht im Schlosse selbst wohnten. Die eingeladenen französischen Offiziere nahmen die Stühle, die indischen Anführer die Kissen ein.
Von der Schlossmauer am weitesten entfernt erhob sich ein meterhoher Aufbau, wie zur Aufnahme eines Thrones bestimmt, links und rechts grenzten ebenfalls Erhöhungen an, welche jedoch schon mit weichen Kissen belegt waren.
Die schon anwesenden Gäste befanden sich diesem Platze gegenüber, unter ihnen auch Madame Dubois.
Während die Offiziere leise miteinander flüsterten, scherzten, lachten und der kommenden Schaustellung neugierig harrten, lagen die Inder schweigend und in echt orientalischem Gleichmut da, als gebe es für sie überhaupt nichts Überraschendes mehr, und diese Männer, deren Juwelenschmuck schon ihren Reichtum verriet, waren wirklich mit allem übersättigt, was das Leben ihnen bieten konnte. Eine solche Vorstellung war ihnen gar nichts mehr.
Nur einer der Inder zeigte sich gesprächig.
Neben der auf einem Diwan sitzenden Phoebe lag in bequemer Stellung ein noch junger Mann und unterhielt sich leise mit ihr. Schon sein ganzes Äußeres war von dem der übrigen verschieden. Sein schwarzes Haar fiel nicht in langen Locken auf die Schultern, sondern war kurz geschoren, auf dem Haupte saß kein großer Turban, sondern nur ein kleines rotes Käppchen auf dem Hinterkopf, das weite Gewand aus dunkelblauer Seide umfloss in malerischen Falten den schlanken Körper und ließ im Gegensatz zu den anderen Indern den rechten, sehnigen Arm frei.
Dieses Gewand ward in den Hüften von einem Schuppengürtel zusammengehalten, in welchem außer den gewöhnlichen Dolchen und Pistolen noch eine sonderbare Waffe steckte, welche den Mann allein schon als Bengalesen kenntlich machte.
Es war eine Waffe, halb Beil, halb Hackemesser, etwa zwei Fuß lang, vorn konvexer Form, mit kurzem, leichtem Griff, der Stahl von hinten nach vorn immer breiter und breiter werdend, sodass der Schwerpunkt in der Spitze liegen musste. Diese Waffe, Dschambea genannt, ist nur den Bengalesen eigentümlich, und wird in der Hand eines Mannes, der sie zu führen versteht, ein furchtbares Werkzeug.
Im Ganzen war der Mann einfacher gekleidet als seine Landsleute, machte aber den günstigsten Eindruck. Das Auge blickte freundlich und kühn zugleich, die hohe Stirn, die dunklen, hochgeschwungenen Augenbrauen, der wohlgepflegte, tiefschwarze Vollbart, diese Sicherheit der kleinsten Bewegung — kurz, es war eine auffallende, angenehme Erscheinung, und nicht nur die Offiziere schauten oft bewundernd nach ihm hin, selbst die phlegmatischen Inder taten dies ab und zu, und es war für sie wirklich ein Grund zur Neugier vorhanden.
Bengalen hatte sich bisher neutral verhalten, nur die Sepoys, welche von dort aus sich für englische Dienste hatten werben lassen, meuterten ebenfalls. Dies aber war auch wieder der Grund, dass nicht alle Sepoys von den Engländern abfielen, zum Beispiel nicht die aus den Himalaja-Gegenden, denn diese, darunter die Gurkhas und die Sikhs, haßten die Bengali-Sepoys glühend.
Der fremde Gast nun war ein Bengalese, und es stand zu erwarten, dass er mit Bahadur Unterhandlung pflegen wollte.
Madame Dubois, welche in Bengalen mehr zu Hause war als in diesem Teile Indiens, hatte ihn als Penab Ran, als den Sohn eines indischen Nabobs, vorgestellt, ihn auch schon mit dem Großmogul zusammengebracht, doch Bahadur hatte ihn nicht besonders beachtet, weil er sich jetzt mit den Bengalesen nicht mehr einlassen wollte. Der Fremde war sein Gast, damit genug.
Es herrscht die Meinung, ein indischer Nabob sei einfach ein reicher Mann, das ist jedoch nicht richtig, denn unter Umständen kann ein Nabob auch verarmen und bleibt dennoch ein Nabob. Er ist kein Fürst, sondern nur ein Mann mit ungeheurem Grundbesitz, die Feldarbeiter sind seine Leibeigenen, er steht jedoch in Abhängigkeit von dem Radscha des Landes. Da der Nabob aber meist reich ist, reicher als dieser, so besitzt er indirekt eine größere Macht als derselbe.
Indien ist groß. Es gibt darin eine Menge Nabobs, deren Namen man kaum kennt, wie in Russland mancher Krösus lebt, dessen Namen die Welt nie erfährt.
Als den Sohn eines solchen Nabobs hatte Phoebe Penab Ran vorgestellt, doch die anwesenden Inder hielten nicht viel von ihm, er war ihnen nicht reich genug gekleidet. Nur sein gefälliges Äußeres mussten sie neidisch bewundern.
Das Schmettern eines unsichtbaren Trompetenorchesters erklang; die Gäste standen auf; das Tor in der Schlossmauer öffnete sich; ein langer Zug betrat die Terrasse.
Zuerst kamen pomphaft gekleidete Diener, lange Stäbe mit goldenen Knöpfen in der Hand tragend, die Zeremonienmeister, andere schwangen Weihrauchbecken, andere wieder trugen Wasserpfeifen.
Auf den Schultern von acht Männern lagen die goldenen Tragestangen einer verhüllten Sänfte; diesem schlossen sich die zu Fuß gehenden, mit Schmuck überladenen Fürsten an, voran Bahadur und Nana Sahib.
Die beiden letzteren wussten nicht, dass diese Zusammenkunft die letzte sein sollte, an der alle Fürsten einträchtig teilnahmen; denn kaum hatten die Engländer etwas Waffenglück, so standen Bahadur und Nana Sahib allein da — die meisten ihrer jetzigen Freunde ließen sie jämmerlich im Stich.
Die Anwesenden verbeugten sich tief, mit einer Ehrfurcht, als hielte die Sänfte einen Gott verborgen.
Sie ward auf die Erhöhung gestellt, links und rechts nahmen die Fürsten nach ihrem Range Platz, stufenweise absteigend, bis die unbedeutenderen Radschas zu ebener Erde saßen, während Bahadur und Nana Sahib dicht neben dem Baldachin auf Kissen ruhten. Hinter dem Kreis waren die Diener postiert.
Plötzlich flogen die Vorhänge des Baldachins zur Seite, ein goldener Thronsessel ward sichtbar, und auf diesem saß die Begum in strahlender, jungfräulicher Schönheit.
Sie hätte sich nicht zu schmücken brauchen, um sich ein königliches Aussehen zu geben, ihre Erscheinung selbst war eine königliche.
Ernst blickte ihr dunkles Auge kurz im Kreise umher. Sie neigte nur leise dankend ihr Haupt, als sich alle, diesmal auch die Fürsten, erhoben und dadurch ihre Ehrfurcht bezeugten. Dann lehnte sie sich zurück, stützte den schönen Kopf leicht auf den Arm und wohnte mit unveränderlichem Ernst, ohne Staunen oder Aufregung zu zeigen, der Vorstellung bei.
In dem weißen Gewand aber, welches mit blitzenden Diamanten übersät war, glich sie nicht der Tochter der schrecklichen Kali, sondern vielmehr der Göttin des reinen, keuschen Lichtes selbst.
Auf jeden Gast trat ein Diener zu, stellte eine kristallene, mit Rosenwasser gefüllte Hukah(*) vor ihn hin, legte glühende Holzkohlen auf den herrlich duftenden Tabak von Schiras und schob das mit Rubinen bedeckte Mundstück zwischen die Lippen des Gastes.
(*) Wasserpfeife, bei den Türken Nargile, bei den Arabern Ischah genannt.
Auch die anwesenden europäischen Damen rauchten, denn wenn sie zu der Festlichkeit zugelassen wurden, durften sie auch keine Gabe der Gastfreundschaft abschlagen.
Andere Diener gingen hin und her und präsentierten Schalen mit Konfekt, unter dem besonders verzuckerte Früchte, Kokosnussschnitte und Rosenblätter eine Rolle spielten. Diese kandierten Rosenblätter sind eine Spezialität Indiens, sie dürfen in keinem Harem fehlen.
Ohne dass eine weitere Vorstellung stattfand, trat der erste Zeremonienmeister vor, ließ geschickt und elegant den goldenen Stab um seinen Kopf wirbeln, dass er das Aussehen eines glänzenden Rades bekam, und verkündete den Anfang, die erste Nummer der Vorstellung.
Ein hässlich gewachsener, hochschultriger Mann mit verzerrten, aber sehr beweglichen Zügen, in denen es beständig zuckte, begab sich in den Kreis und ließ sich vor dem Thronsessel auf einem Teppich nieder. Es war der Spaßmacher und Märchenerzähler des Hofes, und bald zeigte sich, dass in diesem Manne ein außergewöhnliches Schauspieltalent steckte.
Er erzählte eine uralte indische Sage. Ein Jüngling liebt ein Mädchen, entgegen dem Verbote beider Elternpaare. Alle Geister und Kobolde, Nixen und Feen, gute wie böse, greifen in das Schicksal der Liebenden ein, bald für sie, bald gegen sie Partei nehmend, bis am Schlusse das Gute siegt, das heißt, sie bekommen sich zuletzt.
Der Mann verstand ausgezeichnet zu erzählen. Er konnte seiner Stimme einen Schmelz verleihen, wie man es ihm nie zugetraut hätte; in solchen Momenten verschönte sich selbst sein Gesicht. Dann wieder keifte er wie die alte Mutter, seine Züge wurden hässlich, er krächzte wie der böse Dämon, er sang lieblich wie die bittende Fee; sprach dieser, so klang seine Rede kurz, abgerissen, sprach jene, so nahm seine Stimme einen singenden Ton an, dann bediente er sich improvisierter Verse. Ließ er vier Geister sich unterhalten, so glaubte man diese vier wirklich sprechen zu hören, jeder sprach völlig anders, ja, man meinte oft, sie sprächen alle vier zugleich, und einen heftigen Zank wusste er in einer köstlich humoristischen Weise wiederzugeben.
Die Inder hörten aufmerksam zu, sie lachten bei den drastischen Stellen, klatschten in die Hände und warfen dem Erzähler Geldstücke zu, was diesen immer mehr anfeuerte, seine Kunst zu entfalten.
Die Franzosen dagegen langweilten sich äußerst bei dieser langen Erzählung. Des Indischen nur durch die Konversation mächtig, verstanden sie den Sprecher höchstens, wenn er einmal recht feierlich erzählte, alles andere entging ihnen, besonders, weil der Dialekt oft wechselte. Deshalb beschäftigten sich die Herren anstatt mit dem Zuhören mit der Begum.
»Ein prächtiges Weib«, flüsterte Montpassier seinem Nachbar Duplessis zu, »aber ernst, stolz und kalt! Nun, wie steht's, wollen Sie nicht den Versuch machen? Acht Tage noch, dann haben Sie den Korb Champagner verloren.«
»Ein herrliches Weib!«, seufzte Duplessis nach. »Aber wie soll ich das beginnen? Sie scheint unnahbar zu sein.«
»Mut, Kamerad! Ich sollte Ihnen doch wahrhaftig keinen zusprechen müssen. Weiß der Teufel, mir kommt es überhaupt manchmal vor, als ob die Begum Ihnen recht lange Blicke zuwürfe.«
»Wie, haben Sie das auch schon bemerkt? Ich dachte, ich hätte mich getäuscht.«
»Los, ziehen Sie vom Leder! Sie sind ein Glückspilz! Schmachten Sie, kokettieren Sie, vielleicht fängt sie Feuer!«
»Es kann gefährlich werden.«
»Bah, sie ist ein Weib, und Sie sind ein verteufelt hübscher Kerl. Werfen Sie mit schmachtenden Blicken um sich, seufzen Sie, legen Sie die Hand aufs Herz, als hätten Sie Schmerzen darin!«
»Ja, wenn ich allein ihr gegenüber säße, oder wenigstens nicht so verdammt weit entfernt von ihr.«
Wieder traf den jungen Offizier ein langer Blick aus den dunklen Augen der Begum, so feurig, ja, geradezu so auffordernd, dass er erst förmlich verwirrt wurde, dann aber schleunigst seine Manöver begann, wenn auch so heimlich wie möglich.
Er hatte nicht viel Erfolg, wenigstens jetzt noch nicht; denn die Blicke des Mädchens richteten sich nicht mehr so oft nach ihm hin, sondern hatten sich jetzt ein anderes Ziel gesucht.
Bahadur hatte der Begum mehrere Male etwas zugeflüstert und dadurch ihre Augen auf den jungen, fremden Inder gelenkt. Sie zuckte die Achseln, schüttelte geringschätzend den Kopf und beschäftigte sich wieder mit Duplessis, mit dem sie wirklich ein heimliches Augenspiel begann. Wenigstens beobachtete sie den Franzosen und musste seinen schmachtenden Augenaufschlag und seine Gebärden auch verstehen.
Es war ein gewagtes Spiel, das Duplessis begann.
Endlich aber warf die Begum wieder einen Blick nach dem jungen Bengalesen, noch einen; länger und länger ruhten ihre Augen auf seiner schönen Erscheinung, und plötzlich schien es fast, als ob ihr Auge, ihr Gesicht einen furchtbar drohenden Ausdruck annähme.
Doch gleich wurde es wieder ernst und kalt wie gewöhnlich, sie lehnte sich zurück und wandte sich an Bahadur:
»Er soll nicht sagen können, die Begum habe ihn geringschätzend behandelt. Rufe ihn an meine Seite, ich will ihn auszeichnen.«
Während der Spaßmacher noch erzählte, verließ der Zeremonienmeister seinen Platz hinter Bahadur, durchmaß mit majestätischem Schritt den Kreis, blieb vor dem Bengalesen stehen, berührte mit dem Stockknopf die Schulter des jungen Mannes und sagte etwas zu ihm.
Er erhob sich ohne Zögern und folgte dem Diener; sonderbar war es nur, dass sich bei diesem Vorgang im Antlitz Phoebes, seiner Nachbarin, etwas wie namenloser Schrecken ausdrückte, ja, es schien fast, als wollte sie den Bengalesen zurückhalten — und der Begum war diese kleine Szene nicht entgangen.
Der Bengalese stand vor dem Thron und verneigte sich tief. Ein Wink der Begum und ihr zur Rechten ward ein Kissen niedergelegt, nach welchem sie eine einladende Handbewegung machte.
»Setze dich mir zur Seite, Penab Ran, Sohn des Penab Tsarin«, sagte sie langsam, jedes Wort betonend, und ihn dabei mit durchbohrenden Blicken musternd. »Bist du auch kein Feind der Faringis, wie ich höre, so bist du doch auch nicht unser Feind; setze dich neben mich und merke, dass die Begum von Dschansi gerecht ist.«
»Ich bin nicht wert, dass ich deinen Platz teile, der noch über den des Padischas ragt, nur deiner Gnade habe ich diese Gunst zu danken«, entgegnete der Inder, ohne die Augen vor dem feurigen Blick niederzuschlagen, bestieg den Thron und ließ sich neben dem Mädchen auf dem Kissen nieder.
In diesem Augenblick verstummte der Erzähler, rauschender Beifall lohnte ihm, auch klingender in Goldstücken, doch er wäre noch reichlicher ausgefallen, hätte sich nicht die allgemeine Aufmerksamkeit auf den begünstigten Bengalesen gewendet.
Ein Flüstern ging von Mund zu Mund; man sah die beiden sprechen, fortgesetzt ruhten des Mädchens Augen durchbohrend auf ihrem Nachbar, der sich nicht im mindesten befangen zeigte.
»Bahadur wird rot wie ein Truthahn«, sagte Montpassier, »und Nana Sahib noch mehr. Dass ein Fremder so bevorzugt wird, passt den beiden gar nicht.«
»Ich möchte, ich säße da oben«, entgegnete Duplessis, »dann wollte ich das Vögelchen bald kirre gemacht haben.«
Der Zeremonienmeister gab das zweite Zeichen.
Eine Gesellschaft von Jongleuren und Zauberern betrat den Kreis, bestehend aus einem starken, hünenhaften Inder, einem kleinen, schmächtigen Chinesen, einer noch jungen Frau und einem Knaben von etwa acht Jahren. Die Männer trugen nur kurze, enganschließende Kniehosen und einen Gürtel, die Frau ein weißes, weites Gewand, das lange Haar fiel ihr offen und lose herab. Während der Zaubervorstellung hielt sie sich von den sich produzierenden Männern weit entfernt, sodass die Möglichkeit, ihr Gewand diene als Versteck, ausgeschlossen war. Nur einmal trat sie mit auf.
Die Frau breitete eine dünne Bastmatte aus und legte auf einem Korb einige Decken, Waffen von fürchterlichem Aussehen, Messer, Kugeln, Stäbe, ein Fischernetz und andere Sachen darauf. Dann zog sie sich zurück.
Der Chinese trat vor, begrüßte die Herrschaften mit einem Wortschwall und schloss mit den Worten:
»Mit der gnädigen Genehmigung Timur Dhars, des Königs der Gaukler, meines Herrn und Meisters, gegen den ich ein Stümper, ein Nichts bin, beginne ich die Vorstellung.«
Er bot die ausgebreiteten Gegenstände zur Besichtigung an, der Knabe trug sie umher, doch nur die Franzosen prüften sie, ohne etwas Auffälliges an ihnen zu bemerken, höchstens, dass die Waffen von einer fürchterlichen Schärfe waren.
Der Gaukler hatte übrigens keinen Grund, sich Timur Dhar gegenüber so klein zu machen, seine Geschicklichkeit war Staunen erregend, desgleichen die seiner Genossen.
Es wird noch einmal darauf aufmerksam gemacht, dass solche Kunststücke, wie einige jetzt beschrieben werden sollen, nicht etwa Gebilde der Phantasie sind. Erst seit einigen Jahren treten auch in Europa sogenannte Prästidigitateurs und Magier auf; ein wunderbarer Taschenspieler war z. B. Bosco, später ein gewisser Pinetti, ein Houdini imponierte durch seine unglaubliche Gewandtheit, ein Hermann durch seine haarsträubende Geschicklichkeit im Spiele mit scharfen Waffen, jetzt zeigen sich auch ab und zu indische Taschenspieler auf der europäischen Bühne, aber den wirklichen Gaukler kann man nur in Indien und China sehen, selbst der arabische reicht ihm nicht das Wasser; Indien ist das Heimatland des Gauklers, er verlässt es nicht, und alle anderen Schaustellungen bieten nur einen schwachen Abglanz von den Wunderdingen, die man dort schauen kann.
Die Vorstellung begann damit, dass der Chinese eine etwa acht Meter lange Bambusstange, oben mit einer blanken Stahlspitze versehen, aufrecht auf den Boden setzte und an ihr hinaufkletterte, als wäre sie festgewurzelt oder als würde sie von unsichtbaren Händen gehalten. Oben angelangt, legte er sich mit dem Bauch auf die Spitze, bog die Füße zurück, fasste diese mit den Händen und drehte plötzlich den Leib gleich einer Scheibe blitzschnell um sich selbst, dass die Augen der Zuschauer seinen Bewegungen nicht mehr folgen konnten.

Aber nicht genug damit, während dieses Herumwirbelns schraubte sich der Chinese an der Stange abwechselnd hinunter und wieder hinauf, sodass die Spitze oft einen Meter aus dem Körper des Mannes herauszuragen schien, als habe sie ihn durchbohrt.
Die Inder blickten gleichgültig auf dieses Schauspiel; die Franzosen dagegen staunten. Hatten sie auch schon oft genug Gaukler gesehen, so doch eine solche Geschicklichkeit noch nie. Derartige Künstler produzierten sich nur vor Leuten, von denen sie ihren Lohn in Gold empfingen, nicht auf der Straße.
Schließlich rutschte der Chinese pfeilschnell herab, kam auf die Füße zu stehen und schleuderte die Stange, ohne die Hände zu gebrauchen, dem Knaben zu, der sie auffing. Während sich der Chinese unter den Beifallsbezeugungen der Zuschauer nach allen Seiten hin lächelnd verbeugte, näherte sich ihm von hinten der große Kuli mit wütendem Gesicht, ein langes Messer in der Hand, und bohrte es dem Ahnungslosen in den Rücken.
Man sah die Spitze aus der Brust des Getreuen herausdringen, ein Blutstrahl spritzte vorn und hinten hervor; der Kuli stieß mehrmals zu, aber ruhig fuhr der Chinese fort, sich zu verbeugen.
Achselzuckend warf der Inder schließlich das Messer fort, während ein neues Beifallsklatschen, besonders von den Offizieren, dieses auf Täuschung beruhende Kunststück des anscheinend unverwundbaren Gauklers belohnte.
Jetzt kam der Inder an die Reihe.
Er zeigte, dass der etwa einen Meter lange und einen halben Meter hohe und breite Korb aus Rohrgeflecht leer war, und setzte ihn auf die Matte. Dann wurde er von dem Chinesen an Händen und Füßen gebunden und vollständig in das Fischnetz gewickelt. Der baumlange Mann krümmte sich wie ein Aal zusammen, der Chinese warf ihn in den Korb, und er ging wohl hinein, aber an ein Schließen des Deckels war nicht zu denken, er stand weit offen. Der Chinese versuchte es trotzdem, er klemmte den Deckel zu, trat mit Füßen darauf, und siehe da, mehr und mehr senkte sich der Deckel, bis er endlich schloss.
Wie der große, starke Mann in dem kleinen Korbe Platz fand, war allen unerklärlich, und die phlegmatischen Inder suchten auch nach keiner Erklärung.
Die Kunststücke wurden nicht stillschweigend ausgeführt, sondern waren von scherzhaften Zwiegesprächen begleitet. So versicherte der Chinese dem Knaben jetzt, der Gefangene, sein Vater, wäre ein arger Verbrecher und müsse sterben, was der Knabe nach einigem Widersprechen zugab und dann die Messer wetzte.
Bevor der Chinese mit dem Gefangenen im Korbe weiterexperimentierte, nahm er zehn schwere Metallkugeln und erklärte, es seien Sterne, die er einst bei einem Ausflug nach dem Monde vom Himmel herabgeholt habe. Jetzt wolle er sie wieder oben befestigen.
Er warf die Kugeln, eine nach der anderen, in die Luft, man sah sie fliegen, sie verschwanden im dunkelblauen Äther und — keine kehrte zurück.
»Jetzt sind sie am Himmel, heute Abend werden die Herrschaften zehn Sterne mehr sehen. So, nun wollen wir den Kerl totmachen!«
Er nahm ein haarscharfes Schwert und hieb auf den Korb, tief drang es in das Geflecht, und ein Strom Blut quoll heraus. Ebenso bohrte der Knabe den langen Dolch an verschiedenen Stellen in den Korb, und immer drang Blut heraus.
»Wehe euch, ihr habt mich unschuldig ermordet!«, erklang eine Stimme, und unwillkürlich richteten sich aller Augen nach oben, denn aus der Luft musste der Ruf kommen.
»Ist es deine Seele, die spricht?«, rief der Chinese hinauf.
»Meine Seele ist es.«
»Wo bist du jetzt?«
»Zwischen den Sternen.«
»Sind die zehn Sterne oben?«
»Sie sind oben. Soll ich sie dir wiederbringen?«
»Ja, wenn du das könntest! Komm, wir wollen seinen Leichnam begraben.«
Er öffnete den Korb, und wie eine Feder sprang der große Inder lebendig, unversehrt und fessellos heraus. Die Stricke, mit denen er gebunden, lagen zusammengerollt in einer Ecke, in der anderen aufgewickelt das Fischernetz. Er streckte sofort die Hände vor und zeigte die zehn Kugeln, die nicht wieder zur Erde gefallen waren.
Es folgten noch unzählige andere Kunststücke, die durch die fabelhafte Geschicklichkeit, die dazu erforderlich war, oder durch ihre Gefährlichkeit manchmal das Staunen selbst der Inder hervorriefen. Nur eine Person gab es, welcher das Schauspiel kein Interesse abgewinnen konnte — Phoebe. Sie wendete ihre ganze Aufmerksamkeit dem Baldachin zu; mit ängstlicher Spannung betrachtete sie unausgesetzt die Begum und den Bengalen, die beide zwar zuschauten, sich aber auch oft unterhielten, und es entging ihr nicht, wie erstere ihre Augen oft lange und durchdringend auf dem Gesicht ihres Nachbars ruhen ließ.
Die Gauklergesellschaft führte auch ein Kunststück aus, welches dem Leser vielleicht unglaublich erscheint, aber er braucht nur eine Person zu fragen, die schon in Indien gewesen ist, auch nur in indischen Hafenstädten, und er wird die Wahrheit bestätigt bekommen.
Der Korb wird erst über einen Menschen gedeckt. Hebt ihn der Gaukler dann, so ist der Mensch darunter verschwunden, an seiner Stelle erscheint vielleicht ein äußerst magerer Hund, dann ist derselbe plötzlich kugelrund, beim nächsten Male steht ein Schwein da, dann liegt dieses mit durchschnittener Kehle am Boden, und schließlich bleibt wieder derselbe Mensch übrig.
Dass dies alles nur auf Täuschung beruht, ist natürlich, aber wie diese erzielt wird, kann sich kein Uneingeweihter erklären, und der Gaukler verrät sein Geheimnis nicht um alles Gold der Welt. Es vererbt sich vom Vater auf den Sohn und bleibt immer in der Kaste der Gaukler.
Diese Produktion fand hier noch einen überraschenden Schluss.
Als der Gaukler den Korb zum vorletzten Male hob, war der Knabe darunter, als er ihn zum letzten Male aufdeckte, war an seiner Stelle ein lebender Pfauhahn, jedoch schien es, als passe das nicht in das Programm des Chinesen, denn er machte ein erstauntes Gesicht, sah seine Begleiter fragend an und schüttelte den Kopf.
Schnell deckte er den Korb wieder darüber, murmelte seinen Spruch, hob auf, doch der Pfauhahn war noch da. So oft der Chinese den Versuch auch wiederholte, der Pfau machte keinem anderen Wesen Platz.
Jetzt begann der Inder Streit, er wollte von dem Chinesen seinen Sohn wiederhaben. Diese Gelegenheit benutzte der Vogel, um auszureißen. Er flog auf die Balustrade und flatterte schreiend auf den Hof hinunter.
»Meinen Sohn, meinen Sohn will ich wiederhaben!«, schrie der Inder, und das Weib, jedenfalls seine Frau, stand ihm bei. Sie fuhren den Chinesen, der sich ganz verzweifelt gebärdete, wütend an und wollten durchaus ihren verzauberten Sohn wieder haben.
Das Publikum wusste wirklich nicht, ob dies Ernst oder nur Scherz sei.
Da, als es dem Chinesen bald an den Kragen ging, erscholl hoch oben ein fröhliches Gelächter, und aus einem Fenster im zweiten Stockwerk des Schlosses blickte der Junge heraus. Das Staunen der Zuschauer ohne Ausnahme verwandelte sich aber in wirkliches Entsetzen, als der Junge auf die Fensterbank sprang und sich von da oben, den Kopf voran, hinabstürzte.
Er musste auf den Steinfliesen der Terrasse zerschellen; hier half keine Geschicklichkeit mehr.
Blitzschnell jedoch hatte die Frau ihren weiten Ärmel zurückgeschlagen, sie streckte den nackten Arm aus, und im nächsten Augenblick hing der Junge wie ein Bündel Wäsche daran.
Noch ein anderes Kunststück sei erwähnt, das man oft von gewöhnlichen Straßengauklern zu sehen bekommt. Ein Gaukler wünscht von einem anderen rasiert zu werden, er wird zeremoniell behandelt, eingeseift, das Rasiermesser schabt, und der Vollbart fällt. Der Barbier wischt mit einem Tuche die Seife ab, und entfernt er das Tuch — sofort steht der Bart wieder da. Der Mann kann den Kunden rasieren so oft er will, der Bart scheint immer wieder nachzuwachsen, und ebenso geht es mit dem Kopfhaar.
Nachdem sich der Knabe noch in unnatürlichen Gliederverrenkungen und im Kugelspiel produziert, das Weib mit haarscharfen Schwertern und Dolchen gespielt hatte, als wären es Kochlöffel, wurde auch dies eben erwähnte Kunststück ausgeführt.
Die Frau beklagte sich, dass ihr das lange Haar bei dieser Hitze den Kopf zu warm mache.
Der Chinese wusste schnell Rat, er ließ die Frau sich hinsetzen, nahm ein Beil und hackte ihr damit mit mörderischen Streichen auf dem Kopf herum, nicht ohne spaßige Zwischenfragen, ob die Schere gut schneide, ob er eine leichte Hand habe und so weiter.
Es sah schrecklich aus, umso mehr, als das Blut bald in Strömen zu fließen begann und die Frau Zeter und Mord schrie. Eine Flechte fiel nach der anderen, der Gaukler entschuldigte sich wegen seiner kleinen Unvorsichtigkeiten und wischte ihr das Blut mit einem Tuche ab. Plötzlich quoll unter diesem — niemand wusste, wie es geschah — langes, dunkles Haar hervor, wie vorher hing es vom Kopfe herab.
Erschrocken prallten der Barbier und sein Gehilfe zurück, sie begannen die Prozedur abermals, sie rissen Flechte für Flechte mit verzweifelter Kraftanstrengung heraus — vergeblich, das Haar entstand ihnen immer wieder unter den Händen.
»Ist der Korb schon voll von den vielen Haaren?«, rief der Chinese kläglich. Der Junge steckte den Kopf tief in den Korb.
»Ja«, sagte er, hob den Kopf — und von seinem Kinn floss ein langer Bart herab.
Der kleine Kerl mit dem langen Barte sah über aus köstlich aus. Er wurde barbiert — ebenfalls vergeblich, der Bart wuchs nach, immer neue Haare wanderten in den Korb. Der Vater nahm den Jungen an den Beinen, der Chinese fasste ihn an der Bartspitze, beide rissen, aber der Bart saß fest, der Inder hob den Jungen daran hoch empor und schwang ihn sausend durch die Luft.
Schließlich verschwand er ebenso geheimnisvoll wieder, wie er gekommen war, aber der Korb war doch bis zum Rande mit festgestampften Haaren gefüllt.
»Die stopfen wir in die Kissen«, meinte die Frau, in dem Korbe wühlend.
»Was soll das sein?«, fragte der Chinese.
»Nun, was denn anderes, als Haare.«
»Haare? Unsinn, das sind doch Schlangen!«
»Dann müsste ich ja Schlangen auf dem Kopfe gehabt haben.«
Der Chinese stülpte den Korb um, und in scheußlichem Gewimmel lag auf der Matte ein Haufen zischender und sich windender Schlangen, an dem geschwellten Halse, der wie ein Schild aufgebläht werden konnte, an den schwarzen Ringen um die in grünem Feuer funkelnden Augen und an der lohgelben Farbe als die gefährlichsten aller Schlangen erkenntlich, als Brillenschlangen.
Der Schlangentanz begann, das Beschwören der giftigen Reptilien durch Klänge einer Pfeife und faszinierende Blicke.
Die Kunstfertigkeit der indischen Schlangenbeschwörer ist schon zu oft geschildert worden, als dass es hier nötig wäre.
Gleichgültig blickten die Inder nach dem ekelerregenden Schauspiel, es war ihnen etwas ganz Alltägliches. Sie wussten bestimmt, dass diesen Schlangen die Giftzähne nicht ausgebrochen waren, denn der Gaukler würde sich geschämt haben, mit harmlosen Schlangen zu experimentieren.
Wie schon einmal erwähnt, wurde erst im Jahre 1895 von einem französischen Gelehrten bewiesen, dass in Indien wirklich eine Pflanze wächst, deren Saft die Wirkung des Schlangengiftes aufhebt. Bei Bissen von anderen Schlangen ist es wohl noch möglich, dieses Medikament in das Blut zu spritzen; wenn man jedoch von einer Kobra gebissen wird, so tritt der Tod fast augenblicklich ein, beim stärksten Menschen in höchstens einer Minute.
Dieser Saft besitzt aber auch noch eine andere Eigenschaft. Alle Schlangen, auch die Kobra, ekeln sich vor ihm ungemein. Nie, und wären sie noch so gereizt, werden sie in einen Gegenstand beißen, der mit ihm bestrichen ist.
Nun könnte sich ja jeder in Indien Lebende einfach mit diesem Saft bestreichen, und er brauchte Giftschlangen nicht mehr zu fürchten; aber einmal ist die Pflanze sehr selten, die Schlangengaukler nehmen sie für sich in Beschlag, und dann ätzt der Saft auch die Haut in bedenklicher Weise.
Die Begum hatte inzwischen mit dem von ihr begünstigten Bengalesen ab und zu einige Worte gewechselt, ihn über seine Heimat befragt und höfliche und klare Antworten erhalten. Einmal hatte sie sogar eine scherzhafte Bemerkung gemacht.
Als der Inder den Jungen an dem künstlichen Bart durch die Luft schwenkte, wendete sie sich lächelnd an den Bengalen mit der Frage:
»Würde dein Bart, Penab Ran, wohl ausreißen, wenn man so daran zöge?«
»Nur an meiner Leiche könnte man solch eine Misshandlung ausüben!«, war die Antwort, und das Mädchen schwieg.
»Hol mich der Teufel«, flüsterte auf der anderen Seite Duplessis, »die Geschichte hier wird mir bald langweilig. Die beiden dort oben scheinen eine Liebelei anzuknüpfen; vorhin hat sie ihm so huldvoll zugelächelt, und ich überschütte sie vergeblich mit schmachtenden Blicken.«
»Urteile nicht so vorschnell!«, entgegnete Montpassier. »Sieh doch, du Adonis, jetzt wendet sie sich von dem Negerknaben an ihrer Seite ab und wirft wieder dir zündende Blicke zu!«
Es war so; die Augen der Begum suchten den Franzosen und ruhten lange und freundlich auf ihm. Dann rief sie den Zeremonienmeister zu sich und sprach mit ihm.
Den Stab um den Kopf wirbelnd schritt dieser über den freien Platz, die Nähe der Schlangen aber sorgsam meidend.
»Pass auf, jetzt holt er dich!«, flüsterte Montpassier seinem Gefährten zu, der eben seufzte, die Augen nach oben verdrehte und wie traurig das Haupt auf den Arm lehnte.
Duplessis selbst aber glaubte nicht eher an eine solche Möglichkeit, als bis der Inder plötzlich vor ihm stand und ihn mit dem Stocke an der Schulter berührte.
»Die allergnädigste Begum von Dschansi, die Kaiserin von Indien, deren Macht reicht vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang, deren Fußstapfen zu küssen den mächtigen Maharadschas die größte Ehre ist, geruht, dich aus dem Staube zu ihrer Höhe emporzuziehen, damit du dich an ihrem strahlenden Lichte ergötzest und jung werdest. Folge mir!«
Ganz bestürzt erhob sich Duplessis; erst auf dem Wege nach dem Throne sammelte er sich wieder, denn er sah ein, dass er jetzt seiner ganzen Überlegung bedurfte, wollte er sein Ziel erreichen. Selbst seinen gewöhnlichen Übermut fand er wieder. Die Begum sollte kennen lernen, was es heißt, einen Kavalier aus der französischen Schule zum Gesellschafter zu haben.
Schon war links neben ihr ein Sitz, kein Lager, aus Kissen hergerichtet, ein Wink rief Duplessis herauf; der gewandte Weltmann verbeugte sich graziös und nahm Platz.
Die Begum wendete sich ihm voll und ganz zu und schaute ihm lächelnd ins Gesicht.
»Warum siehst du mich immer an?«
»Blickt man nicht lieber nach dem Schönen, als nach dem Hässlichen? Soll ich nach den Schlangen sehen, da ich deinen Anblick genießen kann?«
»Du findest mich also schön?«
Der Franzose war über diese naive Frage entzückt. Er hatte sich das junge Mädchen, das er bisher nur aus der Ferne gesehen, ganz anders vorgestellt, stolz, hochmütig, und nun war sie so zuvorkommend. Ihre Naivität hielt er nicht für natürlich. Duplessis gehörte überhaupt zu jenen Männern, die das Weib nur von der schlechten Seite kennen; er glaubte jetzt, dass mit ihr leicht anzuknüpfen sei, sie kam ihm entgegen, indem sie sich naiv stellte.
»Ob du schön bist? Wie kannst du so fragen? Ich habe schöne Mädchen in meinem Heimatlande gesehen, das deswegen berühmt ist, aber vor dir, Begum, verblassen sie. Du bist lieblich wie eine — eine — wie eine...«
Das Mädchen lachte hell auf.
»Du sprichst schlecht Indisch, und die blumenreichen Wendungen suchst du vergeblich. Du bist ein Franke?«
»Ja, doch ich bedaure, dass ich kein Inder bin.«
»Warum das?«
»Dann könnte ich dir sagen, mit was du zu vergleichen bist.«
»So sprechen wir Französisch!«, fuhr die Begum in dieser Sprache fort.
»Wie? Sie sprechen Französisch?«
»Wie Sie hören! Wir können uns unterhalten, ohne fürchten zu müssen, von dem Fremden neben mir verstanden zu werden. Welchen Rang bekleiden Sie?«
»Den eines Artilleriekapitäns, mir verliehen durch die Gnade der schönen Begum von Dschansi.«
»Pst, so dürfen Sie nicht sprechen, wenigstens nicht auf Französisch, nur auf Indisch.«
»Aber warum denn nicht?«
»Das müssen Sie doch verstehen. Im Indischen ist dies eine Höflichkeit, im Französischen eine Schmeichelei!«
»Man kann Ihnen keine Schmeichelei, sondern nur die Wahrheit sagen!«
»Aber nicht, wenn Hörer zugegen sind. Unter vier Augen ist so etwas eher erlaubt.«
»Unter vier Augen!«, seufzte Duplessis schwärmerisch, im Innern entzückt.
»Sind Sie nicht jener Offizier«, fuhr das Mädchen fort, »der die zweite Batterie vor der Mauer befehligt?«
»Das ist mein Posten!«
»So waren Sie es also auch, dem gestern das Unglück passierte, mit dem Erdreich samt dem Geschütz von der Bastion hinabzurutschen?«
»Es war kein Unfall von Bedeutung! Es ging gut ab; das Kanonenrohr kam über mich zu liegen, ich selbst in eine Höhlung. Sonst freilich wäre ich zu Brei zerquetscht worden.«
»Schrecklich!«, seufzte das Mädchen. »Ich stand am Fenster und beobachtete Sie. Ich schrie vor Entsetzen laut auf, als ich Sie mit dem Geschütz im Graben verschwinden sah.«
Duplessis Entzücken wuchs; sie beobachtete ihn also heimlich.
»Nun«, fuhr sie fort, »wenn es Ihnen nichts geschadet hat, so waren Sie gewiss noch an demselben Abend bei Madame Chevaulet und amüsierten sich.«
Diese Bemerkung wäre sehr frei gewesen, wenn nicht eine Inderin sie gemacht hätte. In diesem Lande ist nicht nur eine Anspielung, sondern eine offene, sogar sehr offene Sprache erlaubt.
»Ich war nicht dort!«
»So hatten Sie Dienst?«
»Allerdings, aber...«
»Also gehen Sie heute Abend hin?«
Wie sie ihn doch genau beobachtet hatte!
»Ich schwöre Ihnen, ich gehe nie wieder dorthin.«
»Warum denn nicht? Es soll ja sehr hübsch dort sein.«
»Es könnte mir nie mehr dort gefallen, nachdem ich Sie gesehen und kennen gelernt habe.«
»Schweigen Sie! Sie werden zu deutlich. So etwas dürfen Sie nur auf Indisch sagen«, flüsterte die Begum befangen und warf scheue Blicke um sich.
»Werden Sie beobachtet?«
»Wer sollte das wagen?«, entgegnete sie stolz.
»Sie scheinen aber Lauscher zu fürchten.«
»Ich bin frei.«
»O, so möchte ich Ihnen gern so viel noch sagen.«
»Wirklich?«, lächelte sie. »Dienstgeheimnisse?«
»Geheimnisse wohl, doch nicht den Dienst betreffend, oder doch, nämlich den Dienst, dem ich mich von jetzt an weihen will.«
»In diesem Falle dürfen Sie deutlicher sprechen. Sie wollen sich meinem Dienste weihen, und das muss ich sogar von Ihnen verlangen, denn ich bin Ihre Gebieterin.«
»Nun denn, so weihe ich mich Ihnen — als Ritter.«
Es war, als ob das Mädchen zusammenzuckte, zur tiefsten Genugtuung von Duplessis.
»Und Sie gehen wirklich nicht mehr zur Chevaulet?«, flüsterte sie dann.
»Bei meiner Ehre, nein!«
Die Begum bewog ihn, seine Aufmerksamkeit den Gauklern zuzuwenden.
Der Schlangentanz war beendet; eine Scheibe wurde aufgestellt, nach welcher das Weib mit unfehlbarer Sicherheit Messer schleuderte. Dann nahm den Platz vor der Scheibe ihr Sohn ein, sie warf ihm die haarscharfen Messer zwischen die Finger, durchspießte eine auf seinen Kopf gelegte Apfelsine und vollbrachte ähnliche gefährliche Übungen mehr, alles auf eine Entfernung von etwa zwanzig Metern.
Die Begum wendete sich wieder dem Bengalesen zu, den sie so lange vollkommen vernachlässigt hatte. Sie blickte in ein Paar starre, mit seltsamem Ausdruck auf sie gerichtete Augen.
»Nun, Monsieur, Monsieur — wie war doch gleich Ihr Name? — Ach so, entschuldige, du sprichst kein Französisch. Richtig, Penab Ran. Du führst eine gefährliche Waffe im Gürtel, die Dschambea, und ich habe gehört, die Puharris, zu denen du gehörst, sollen Meister in der Führung dieser Waffe sein.«
»Wir wissen uns damit zu verteidigen und das zu schützen, was uns gehört, o, Begum.«
»Diese Waffe wird auch geworfen.«
»Sie ist dazu eingerichtet, der Schwerpunkt liegt vorn.«
»Dann ist dies leichter als das Schleudern mit Messern. Ich hegte schon lange den Wunsch, die Dschambea werfen zu sehen; du wirst es mir zeigen.«
Das klang wie ein Befehl.
»Ich bin ein Krieger, Begum, und ergreife die Waffe nur, wenn es nötig ist.«
»Das wäre ein schöner Krieger, der sich in seinen Waffen nicht übt und sie nicht zu gebrauchen versteht«, spottete das Mädchen. »Wozu trägst du denn die Dschambea im Gürtel?«
Bahadur hatte dies Zwiegespräch gehört. Er fasste es als etwas ganz Selbstverständliches auf, dass dem Wunsche der Begum unbedingt Folge geleistet wurde.
»Sobald diese Vorstellung beendet ist«, sagte er, »wird Penab Ran, dir, o, Begum, zeigen, wie die Puharris mit der Dschambea das ferne Ziel zu treffen wissen. Sind die Jäger dieses Landes doch auch dafür berühmt, dass sie mit dieser Waffe dem Panther mit einem Schlage den Kopf spalten.«
Der Inder schwieg; es gab für ihn keine Weigerung mehr.
Als sich die Gauklerfamilie nach einem Goldregen entfernt hatte, trat der Zeremonienmeister vor und verkündete mit lauter Stimme, dass Penab Ran, Sohn des Nabobs Penab Tfarin, zeigen würde, wie die Männer seines Landes mit der Dschambea ein zwanzig Meter entferntes Ziel mit unfehlbarer Sicherheit zu treffen wüssten.
Lautes Bravorufen erscholl; die vornehmen Inder bewundern körperliche Tüchtigkeit, sind aber meist selbst zu bequem, um sich darin zu üben, sie sehen lieber darin ausgebildeten Sklaven zu. Wer von ihnen aber in ritterlichen Übungen Meister ist, dem zollen sie die größte Hochachtung.
Nur eine Person erschrak bei dieser Verkündigung sichtlich, es war wieder Phoebe. Angstvoll blickte sie nach dem Bengalesen, der gelassen aufstand, die Dschambea aus dem Gürtel zog und nach der Mitte des Kreises schritt, die Waffe geschickt auf einem Finger balancierend.
In diesem Augenblick wurde der Torflügel aufgerissen, und in vollem Laufe wurde ein Käfig auf Rädern hereingeschoben. Die dabei beschäftigten Diener kannten das veränderte Programm nicht.
Der Zeremonienmeister ließ schon die Scheibe aufstellen, er wollte den Käfig zurückfahren lassen; doch schnell erhob sich die Begum und traf selbst die Anordnungen.
»Gut denn, lass den Pantherkampf beginnen!«, rief sie. »Aber das Tier soll nicht getötet werden. Penab Ran wird dann den Käfig betreten und dem Panther den Kopf spalten, was den Puharris ja ein Leichtes sein soll. Penab Ran, setze dich wieder neben mich.«
»Du wirst den Kampf mit dem Raubtier zuletzt ausfechten«, empfing sie den Zurückkehrenden.
Der Bengalese verneigte sich schweigend zum Zeichen der Zustimmung und setzte sich.
»Würden Sie zögern, einem Panther nur mit dem Schwert in der Hand gegenüberzutreten?«, wendete sie sich dann an Duplessis.
»Ich würde mich hüten«, entgegnete der Franzose.
»Wie? Sie gestehen ganz offen ihre Mutlosigkeit ein?«
»Es ist nur ein Zeichen von Vernunft, wenn ich mich nicht unnötig in Gefahr begebe.«
»Dennoch finde ich dieses Geständnis nicht schön. Sehen Sie diesen Bengalesen; ich fordere ihn auf, dann den Käfig zu betreten und mit dem Panther Auge in Auge zu kämpfen, und ohne Zögern sagt er zu.«
»Ja, das ist auch etwas ganz Anderes! Sie haben es von ihm verlangt.«
»Also würden Sie es auch tun, wenn ich es von Ihnen verlangte?«
»Aber natürlich! Sie brauchten nur zu wünschen, und ich würde noch etwas ganz anderes tun, um Ihren Willen zu erfüllen. Für Sie zu sterben, sollte mir die größte Wonne sein.«
Der Käfig war in die Mitte des Kreises gefahren worden. Er bestand aus einem Gitter von Bambusstäben, ungefähr acht Meter hoch, oben offen. Neben dem sehr geräumigen Käfig stand noch ein viel kleinerer, mit dem ersten durch eine jetzt noch geschlossene Tür verbunden, und in diesem befand sich ein gefleckter Panther, der fauchend die Zuschauer begrüßte.
Es war ein Tier von außergewöhnlicher Größe, Stärke und Wildheit, erst vor einigen Tagen im Dschungel gefangen.
In dem großen Raume stand schon der professionelle Pantherkämpfer, ein schlank gebauter Mann, behänd wie eine Katze, aber mit Muskeln wie von Stahl. Er war nur mit einer kurzen Hose bekleidet, in der rechten Hand trug er ein kleines, breites Schwert, in der linken einen Schild, etwa anderthalb Meter lang, auf der einen Seite spitz, auf der anderen flach und etwa einen Meter breit.
Jubelnde Beifallsrufe empfingen den Pantherkämpfer, dieses non plus ultra von Gewandtheit, Kraft und Verwegenheit.
Sein Körper, Arme und Beine zeigten tiefe, schreckliche Narben, aber diese rührten nicht etwa von schon überstandenen Kämpfen mit wilden Panthern her, sondern noch aus seinen Lehrjahren. Denn gelang es solch einem wilden Tiere, ihm nur einen einzigen Tatzenschlag beizubringen, so war der Mann unrettbar verloren; der zweite streckte ihn zu Boden, ein blitzähnlicher Biss zermalmte ihm das Genick. Die Narben stammten aus früheren Jahren, als er unter der Leitung von Lehrmeistern sich mit gezähmten Pantherweibchen übte. Manchen Tatzenschlag mochte er bekommen haben, oft mochte er unter den Bestien am Boden gelegen haben, aber die gezähmten Tiere durften ihr Gebiss nicht an dem Besiegten probieren.
Graziös verneigte sich der Mann nach allen Seiten, nahm Positur, die Tür ward zurückgeschoben, der Panther stieß ein entsetzliches Gebrüll aus und warf sich in gewaltigem, bogenartigem Sprunge auf den Mann.
Es gelang dem Tiere nicht, seine Pranken in das Fleisch des Gegners zu schlagen; es kam auf den schnell erhobenen Schild zu sitzen. Einen Augenblick war das Tier anscheinend selbst verblüfft, dann sprang es herunter, wieder auf den Mann los, doch immer war der Schild vor oder unter ihm. Schoß er am Boden nach den Beinen des Inders hin, so stand der Schild senkrecht auf der Erde, sprang er, so schlug er dagegen. Blitzähnlich waren die Bewegungen des Tieres, doch der Arm des Bedrohten war ebenso schnell.
Da änderte der Panther seine Kampfweise. Er sprang auf den erhobenen Schild und versuchte den Arm oder den Kopf des Mannes mit Tatzenschlägen zu erreichen, aber vergebens, es gelang ihm nicht, der Inder neckte ihn sogar noch mit dem Schwert.
Es war ein grausiges Schauspiel, und doch zugleich schön, weil der Kämpfer seiner Kraft und Gewandtheit so sicher war, weil er mit dem Raubtiere nur zu spielen schien wie ein Kind mit einem Kätzchen.
Ob der Panther den Mann zu ermüden trachtete, indem er so lange auf dem Schilde sitzen blieb? Wie lange konnte der erhobene Arm wohl diese Zentnerlast noch tragen? Minute nach Minute verstrich, doch der wie aus Marmor gemeißelte, von Muskeln strotzende Arm senkte sich auch nicht einen Millimeter.
»Genug!«, rief da Bahadur.
Der Arm schnellte wie eine Feder vor, und der Panther ward von dem Schilde direkt in den kleinen Käfig geschleudert, und dessen Tür schnell geschlossen.
Dankend nahm der Mann den Beifallssturm und die reichen Geschenke in Empfang, die Begum löste eine Diamantnadel vom Busen und ließ sie ihm reichen. Dann wedelten ihm Diener mit Fächern Kühlung zu.
»Nun, wie gefällt Ihnen dieses Schauspiel?«, fragte das Mädchen Duplessis.
»Herrlich! Noch nie habe ich etwas Ähnliches gesehen. Welche Kraft, welche Gewandtheit und Sicherheit! Eins aber wundert mich doch. Als das Tier vorhin in den Käfig geschleudert wurde, bogen sich die Stäbe wie Papier. Wenn sie nun einmal brechen?«
»Sie brechen nicht, die Erfahrung lehrt es. Der stärkste Panther ist nicht imstande, solche Bambusstäbe zu durchbrechen.«
»Ich finde aber den Käfig auch gar nicht hoch genug, oder er sollte wenigstens oben ebenfalls geschlossen sein.«
»Er ist hoch genug, verlassen Sie sich darauf. Diese Pantherkämpfer kennen die Sprungkraft des Tieres ganz genau. Oder glauben Sie, alle diese Zuschauer würden sonst so ruhig dasitzen?«
»Das ist allerdings wahr. Aber es wäre fürchterlich, wenn der Panther die Freiheit erlangte, auf dieser Terrasse, wo es keinen anderen Ausgang gibt, als die eine Tür.«
»Die Männer sind ja alle bewaffnet. Sie werden sich doch nicht von einem einzigen Panther in die Flucht schlagen lassen. Was würden Sie denn tun, wenn derselbe herausspränge und gerade auf mich zukäme?«
»Ich? Selbstverständlich würde ich mich schützend vor Sie stellen. Ich hoffe, Sie zweifeln nicht an meinen Worten.«
»Nach dem, was Sie vorhin gesagt haben, nicht im Geringsten«, lächelte das Mädchen.
»Ah, das freut mich, dass Sie mich erkannt haben! Wie wird der Kampf eigentlich fortgesetzt?«
»Es findet noch ein zweiter Gang statt, zu dessen Schluss der Kämpfer den Panther mit einem einzigen Stich töten müsste, da aber mein anderer Herr Nachbar bereit ist, sich mit dem Tiere zu messen, so werden wir noch ein sehr interessantes Schauspiel haben.«
Sie wandte sich an den Bengalesen.
»Penab Ran, hat dich die Größe und die Wildheit des Panthers nicht eingeschüchtert? Hast du noch den Mut, den Käfig zu betreten und dem Tiere den Todesstoß zu geben?«
»Wie du befiehlst, Begum«, entgegnete der Bengalese gleichmütig, »nur sorge, dass das Tier vorher nicht zu sehr erschöpft wird, sonst habe ich ein zu leichtes Spiel.«
Es war, als ob eine Wolke des Unwillens über das Antlitz des Mädchens flöge; hastig gab es das Zeichen zum Fortsetzen des Kampfspieles.
Diesmal sollte dasselbe noch viel gefährlicher werden, als zuvor.
Der Pantherkämpfer wandte dem kleinen Käfig den Rücken und verbeugte sich noch vor den Zuschauern, als ein Diener schon die Zwischentür öffnete.
Dicht an den Boden geschmiegt, jede Muskel zum Sprunge gespannt, die Zunge etwas aus dem von Zähnen starrenden Rachen gestreckt, lag der Panther da und hatte die von Mordlust und Wut glühenden Augen auf den ihm noch immer den Rücken Kehrenden geheftet.
Plötzlich schnellte er empor, auf den anscheinend Ahnungslosen zu. Die Europäer stießen einen gellenden Schreckensschrei aus; sie glaubten, das Öffnen sei zu zeitig geschehen, und hielten den Mann für verloren.
Aber schneller als ihm die Augen der Zuschauer folgen konnten, hatte er sich umgedreht, und der vor Enttäuschung aufbrüllende Panther saß abermals auf dem schützenden Schilde.
Er wurde zurückgeschleudert; kaltblütig drehte ihm der Mann wieder den Rücken, und doch fing er ihn abermals auf dem Schilde auf, und immer wieder, obgleich er ihn gar nicht mehr zu beachten schien.
Nicht genug damit, er sprang sogar rückwärts über den auf ihn zuschleichenden Panther hinweg, und dieser schien förmlich zu fühlen, wie er gefoppt wurde, seine Angriffe, wurden immer schwächer, er duckte sich scheu am Gitter.
»Genug!«, rief da die Begum. »Demütige das Tier nicht zu sehr, dass es nicht seine ganze Wildheit verliert! Penab Ran wird jetzt den Käfig betreten. Scheuche den Panther in denselben zurück.«
Bravorufe und Händeklatschen begrüßten diese Ankündigung. Aller Augen richteten sich nach dem jungen Bengalesen.
Dieser war aufgestanden und hatte die Dschambea gezogen. Sein Gesicht war plötzlich bleich geworden; doch trotzig funkelte sein Auge. Sein Blick begegnete dem der Begum; in dem ein seltsames Gemisch von Spannung, Teilnahme und Stolz zu lesen war.
»Du wirst kämpfen?«, fragte sie, und es erklang wie erstaunt.
»Zweifelst du daran? Lerne jetzt den Mannesmut kennen und wisse, dass...«
Er brach ab und wollte in den Kreis hinabsteigen.
Da geschah das Fürchterliche, das Duplessis geahnt hatte.
Der Pantherkämpfer hatte noch einmal seine ganze Kraft und Sicherheit zeigen wollen, er hatte die Bestie zum letzten Sprunge gereizt, das Tier saß auf dem Schilde, aber ein unglücklicher Zufall wollte, dass der Mann den Panther anstatt in die Ecke, wo das kleine Verlies war, in die Höhe schleuderte. Gleichzeitig hatte der Panther springen wollen. Infolge der durch diese doppelte Bewegung erzeugten Kraft wurde er hoch in die Luft geschleudert, schnellte über das Gitter hinaus und — war in Freiheit.
Die Verwirrung, die auf der Terrasse entstand, als das furchtbare Raubtier mit peitschendem Schweif frei in der Mitte des Kreises stand, lässt sich nicht beschreiben.
Die Hukahs wurden umgestürzt; die dem Tore zunächst Sitzenden flohen diesem zu, die, welche dabei an dem Panther vorbei gemusst hätten, retirierten schreiend in die äußerste Ecke der Terrasse oder flüchteten hinter den Thronsessel; an den Gebrauch einer Waffe dachte niemand.
Die Begum war aufgesprungen, sie sah, wie Duplessis mit einem Satze das Weite suchte, und glaubte sich verlassen.
Die Augen des Panthers waren auf sie gerichtet, mit einem donnernden Gebrüll stürzte er auf sie zu.
Das Mädchen hatte ein Kissen ergriffen, als wollte sie damit das Raubtier abwehren. Jetzt hatte es sie erreicht, sie fühlte schon den glühenden Atem.
Da sauste wie ein blendender Blitz der Stahl der Dschambea durch die Luft, und Kopf und Körper des Panthers rollten als zwei Teile vor die Füße des Mädchens.
Neben dem Mädchen stand der Bengalese. Beide blickten nicht nach dem erlegten Raubtier, sondern sahen sich an. Wie Wetterleuchten flammte es drohend in den Augen des Mannes auf, und plötzlich senkte die Begum errötend die ihrigen.
Die Aufregung war schon längst vorüber, die Spur des blutigen Zwischenfalles beseitigt und die Ordnung und Ruhe wiederhergestellt. Die Begum saß allein auf ihrem Thron zwischen Bahadur und Nana Sahib, der Bengalese hatte, wie zuerst, neben Phoebe Platz genommen und das Mädchen ihn nicht wieder an ihre Seite gerufen.
Seine erst schmucklose Kleidung hatte sich verändert; überall waren Diamantagraffen, Broschen, Spangen und andere Schmucksachen angeheftet, seine Finger waren mit Edelsteinen und Gold förmlich gepanzert. Die Fürsten und übrigen Gäste mussten diesen Mann als ihren Lebensretter anerkennen, sie taten dies auch offenherzig und gaben ihrer Dankbarkeit dadurch Ausdruck, dass jeder von seinen Kleinodien eines ablöste und ihm dasselbe persönlich übergab.
Bei den Orientalen ist das Schenken überhaupt Sitte. Wer für eine Person eine besondere Teilnahme empfindet, der zieht einen Ring vom Finger und gibt ihr denselben mit einigen passenden Worten. Bei einer anderen Gelegenheit wird dieser Ring wieder weiterverschenkt, ohne dass daran Anstoß genommen wird, auch nicht von dem ersten Geber.
Nur die Begum selbst, deren Leben am meisten bedroht gewesen, hatte weder für ihren Retter ein Geschenk übrig noch ein Wort des Dankes, noch ließ sie ihn zurückrufen; ebenso wenig aber auch Duplessis, wenigstens vorläufig nicht.
Der Franzose hatte sich dem Mädchen, gleich, als der Panther tot am Boden lag, genähert, den gespannten Revolver in der Hand.
»Ich komme zu spät. Welch unglücklicher Zufall, dass ein anderer rascher war als ich!«, sagte er. »Ich stand hinter dem Thronsessel und hatte das Raubtier schon aufs Korn genommen, als der tödliche Schlag fiel.«
Das blasse Gesicht, die zitternde Hand und die bebende Stimme straften die prahlerischen Worte des Franzosen Lügen. Der Bengalese wendete sich verächtlich von ihm ab, nicht so die Begum.
»Ich danke Ihnen für Ihren Schutz, der mir leider nicht zuteil werden konnte«, sagte sie zwar kalt, aber weder höhnisch noch geringschätzend.
Da Duplessis nicht aufgefordert wurde, sich wieder neben der Begum niederzulassen, musste er seinen alten Platz neben Montpassier aufsuchen, der ihn im Herzen bedauerte, denn sein Freund hatte eine klägliche Rolle gespielt.
Die Inder kannten Scham über ihre Feigheit nicht; ihnen ist doch alles vom Schicksal vorherbestimmt. Ruhig nahmen sie die Plätze wieder ein und erwarteten die Fortsetzung der Schaustellung, die jetzt erst ihren Glanzpunkt erreichen musste, denn bisher hatten die Bajaderen gefehlt, und ein Fest ohne diese Tänzerinnen ist keins.
Es war unterdes dunkel geworden. Drähte mit unzähligen Lampions wurden gezogen, und bald erstrahlte die Terrasse in tausendfachem, buntfarbigem Lichte.
Da flatterten aus dem Tore etwa dreißig schöne, reizend kostümierte Bajaderen und ordneten sich unter einer Anführerin zum Reigen und Einzeltanz.
Es wurde schon einmal gesagt, was von den indischen Bajaderen zu halten ist. Will man sie einfach als käufliche Mädchen bezeichnen, so ist es eigentlich falsch, denn sie sind dies nur insofern, als sie dem gehören, der sie für lange Zeit, fürs ganze Leben bezahlen kann, also entweder Reichen und Vornehmen oder Tempeln.
Stehen sie im Dienste der Letzteren, so müssen sie das Gelübde der Keuschheit ablegen, und dann tanzen sie zu Ehren des Gottes, dem sie dienen müssen, und verherrlichen dessen Feste auch öffentlich auf der Straße durch Tanz.
Die vornehmen Inder halten sich eigene Bajaderen, sie gleichen den Almeen der türkischen Harems. Die niedrigste Klasse vermietet sich zeitweise an Vergnügungsorte oder an herumziehende Unternehmer, und diese Bajaderen sind die eigentlichen öffentlichen Tänzerinnen, welche dem Gott der Liebe speziell dienen und den Ruf ihrer Schwestern so schwer geschädigt haben.
Auch Bahadur hielt sich in seinem Schlosse eine Schar Bajaderen, über deren Leib und Seele er zu befehlen hatte, es waren seine Sklavinnen, nicht etwa seine Weiber, nicht einmal seine Maitressen.
Randschid Singh, ein berühmter indischer Fürst, besaß sogar eine Leibwache aus Bajaderen gleich dem König von Dahomey, und die Mädchen waren trefflich in den Waffen geübt. Nach dem Tode ihres Gebieters zerstreuten sie sich.
Es waren durchweg schöne Mädchen, welche sich nach den Klängen zweier Pfeifen und einer Trommel im rhythmischen Schritt um die Anführerin bewegten, die den Reigen mit einem schellenbesetzten Tamburin begleitete. Die Gazegewänder verhüllten zwar züchtig den Körper, durch die vielen Lichter jedoch erschienen sie durchsichtig und ließen den Gliederbau deutlich erkennen. Es war nur ein schwebendes, anmutiges Gehen, die Grazie der Bewegung gab den Ausschlag.
Dann fanden die Einzeltänze statt, und zwar begann die Anführerin damit, ein junges Mädchen von wunderbarer Schönheit, ein wahrhaftiges Ideal. Das Sanfte und Melancholische des indischen Charakters verband sich in ihr mit einem unendlichen Liebreiz.
Das Gesicht war von zarter, ovaler Form und besaß jenen klaren, goldartigen Teint, der durchsichtig zu sein scheint. Die Nase war fein geformt wie die Ohren und die kleinen Hände, und die nackten, mit Goldspangen geschmückten Füßchen, der schwellende Mund mit den Purpurlippen wie geschaffen zum Küssen.
Das üppige, tiefschwarze Haar, das in schweren Flechten auf den Rücken lag und auch über die Brust herabhing, war mit Korallenketten durchflochten und mit Goldschmuck behangen — der Lohn ihres Tanzes.
Makalli, die Mandelblüte — so hieß diese Vortänzerin — war in faltige, blaue Gaze gehüllt, unter der nur manchmal der kleine, nackte Fuß sich hervorstahl, so lange sie nicht tanzte. Ein rosafarbenes Gewebe, wie es von solcher Zartheit nur in Tibet hergestellt wird, bedeckte Brust und Rücken, ohne die schwellenden Formen und zarten Linien verbergen zu können.
Auf dem Scheitel trug sie einen phantastischen Aufputz, aus smaragdgrünen, in Gold schimmernden Kolibris zusammengesetzt, und Diamanten und Rubinen erhöhten noch die Farbenpracht.
Sie war die einzige, die ihr Gesicht nicht durch Striche mit Ocker und Antimon entstellt hatte, Letzteres hatte sie nur benutzt, um ihren schon wunderbaren Brauen einen noch kühneren Schwung und noch tiefere Schwärze zu geben.
Sie hätte die Augen nicht erst zu verschönen brauchen, denn diese strahlten schon in einem feuchten, schwärmerischen Glanze, wie man ihn bei Orientalen findet, doch es war fast auffällig, wie melancholisch sie blickten.
Während sich die Tänzerinnen um sie drehten, hatte Makalli nicht wie die übrigen Mädchen die Zuschauer mit zudringlichen Blicken gemustert; ängstlich waren ihre Augen im Kreise umhergewandert, und als sie endlich den fremden Bengalesen gefunden, kehrten ihre Blicke immer wieder zu diesem zurück.
Ihr Solotanz begann.
Langsam erklangen Pfeife und Trommel, langsam drehte sich die Tänzerin, ganz einfache Bewegungen und Schrittchen machend, immer auf einer Stelle bleibend. Sie hob die Arme über dem Kopf, schlug einmal das Tamburin und bog den Oberkörper vorwärts, rückwärts und zur Seite. So einfach auch alles war, konnte man doch nicht genug die Grazie und diese Geschmeidigkeit des schlanken Körpers bewundern.
Nach und nach begann sich ihr Gesicht zu röten, sofort wurde die Musik schneller, und jetzt glichen die Linien, die ihr Körper beschrieb, den Windungen einer Schlange. Makalli blieb nicht mehr stehen, sondern glitt geräuschlos, ohne dass man die Füße sehen konnte, an den Zuschauern vorüber, beugte sich auch über den und jenen und glitt wieder zurück.
Schon wurden ihr hier und da Geldspenden zugeworfen, die sie geschickt, aber achtlos, ohne den Tanz zu unterbrechen, im Tamburin auffing.
Phoebe hatte wenig Auge für die Bajadere, sie beobachtete mehr die Begum, welche sich viel mit Bahadur unterhielt, und es kam Phoebe vor, als ob des Maharadschas Blick oft den neben ihr sitzenden Bengalesen streife, und zwar mit wohlgefälligem Ausdruck.
Da näherte sich die Tänzerin auch ihr, beugte sich über den Bengalesen, und plötzlich vernahm Phoebe die leisen, aber für ihr Ohr noch ganz deutlichen Worte:
»Beschenke und bewundere mich, Fremdling, lobe mich, lobe mich!«
Phoebe kannte die Sitten an den Fürstenhöfen ganz genau. Seit wann durften Bajaderen es wagen, sich selbst einen Begünstigten auszusuchen, sich selbst ihm anzupreisen? Die Bajadere war ein willenloser Gegenstand, den der Besitzer dem für einige Zeit verlieh, den er auszeichnen wollte.
Lauter und wilder erklang die Musik, immer heftiger und üppiger wurden die Bewegungen der Bajadere. Bald drehte sie sich wie ein Kreisel um sich selbst, bald glich ihr Leib einer Linie von zuckenden Blitzen; sie kokettierte mit scheu zurückgebogenem Oberkörper, bog ihn in schmachtendem Verlangen vor und schien mit den Armen ein Phantom umfangen zu wollen.
So raste sie durch den Kreis, auch jetzt noch ab und zu sich einem der Zuschauer nähernd. Als sie zum zweiten Male sich über den Bengalesen beugte, hörte Phoebe abermals deutlich die geflüsterten Worte.
»Lobe mich, Fremdling, beschenke mich!«
Was sollte das heißen? Kein Zweifel, diese Tänzerin war ehrsüchtig und geldgierig; diese Worte flüsterte sie jedem zu.
Von allen Seiten flogen ihr Goldstücke zu, von denen sie so viel wie möglich zu fangen suchte, ohne jedoch im Tanze einzuhalten.
Jetzt erreichte sie den Bengalesen zum dritten Male.
»Bei dem Gott, den du am meisten verehrst, beschenke mich, ich flehe dich darum an«, erklang es leise in herzzerreißendem Tone.
Der Bengalese warf ihr ein Goldstück zu. Sofort eilte die Bajadere tanzend zurück, die Musik brach ab, und sie kniete in einer reizenden, bittenden Stellung, die Augen noch immer vor sinnlicher Lust erglühend, vor Bahadur, ihrem Herrn, nieder.
Als das rasende Beifallsklatschen verklungen war und die Bajadere sich erhoben hatte, jedoch noch vor Bahadur wartend stehen blieb, durchschritt der Zeremonienmeister den Kreis und berührte mit seinem Stock des Bengalesen Schulter.
»Folge mir!«
Penab Ran schritt nach dem Throne.
»Das ist eine infame Falle!«, murmelte Phoebe mit angsterfülltem Gesicht. Es geschah, wie sie erwartet hatte.
Bahadur hatte seinen Sitz verlassen, war zu der Bajadere getreten und legte ihre Hand in die des angekommenen Bengalesen.
»Der tapfere Puharri, der den Panther mit einem Streich zu töten versteht, ist kein Fremder mehr in Delhi, er ist Bahadurs Gast. Ich sah deine Augen, Penab Ran, freundlich auf Makalli ruhen, du beschenktest sie auch, die Begum selbst machte mich darauf aufmerksam. Mit dem Willen der gnädigen Begum ist Makalli dein Eigentum, solange du in den Mauern meines Schlosses weilst. Möge dir die Mandelblüte Freude bereiten.«
Damit legte er über die geschlossenen Hände beider ein weißes Tuch, das Zeichen, dass sie ein Lager teilen sollten.
Die Augen der Bajadere leuchteten in hellem Jubel auf, über das Gesicht des Bengalesen ergoss sich eine dunkle Blutwelle, ein unbeschreiblicher Blick traf die lächelnde Begum.
Lächerlich! In Indien erhält jeder Gast, wenn er geehrt werden soll, vom Festgeber ein Mädchen, die Hausherrin selbst teilt ihm ein solches zu, will sie ihn ganz besonders ehren. Eine Prüderie in derartigen Sachen ist völlig unbekannt.
Nein, der Bengalese errötete vor Freude über dieses Geschenk, es konnte nicht anders sein. War doch Makalli die schönste der Bajaderen, vielleicht die schönste aller Inderinnen.
Das Mädchen zog sich einstweilen zurück, der Bengalese verbeugte sich dankend und begab sich wieder auf seinen früheren Platz.
»Durchschaust du das feine Gespinst?«, flüsterte ihm Phoebe unbemerklich zu.
Ein leises Seufzen war die Antwort.
»Ärmster, du darfst dich nicht weigern. Beklagt sich die Bajadere wegen deiner Gleichgültigkeit ihr gegenüber, so wäre das dein Tod. Bahadur ist furchtbar, wenn er in seiner Gastfreundschaft gekränkt wird.«
Über des Bengalesen Lippen kam ein zischender Laut, der Phoebe zum Schweigen brachte. Die übrigen Bajaderen traten auch noch auf, einige allein, die meisten in Gruppen. Nach der Beendigung jedes Tanzes wurden sie an die Gäste Bahadurs verteilt, meist wurde das Verhältnis schon während des Tanzes durch Blicke, Zurufe und Geschenke angeknüpft.
Nur einmal wurde eine Ausnahme gemacht.
Die Begum ließ Duplessis wieder zu sich rufen und unterhielt sich lange liebenswürdig mit ihm. Der Franzose war über die Tänze entzückt, jedoch nicht über die Bajaderen. Er gab deutlich zu verstehen, dass die Begum alle an Schönheit übertreffe.
»Aber bitte, vergleichen Sie mich doch nicht mit einer Bajadere!«
»Betreffs der Schönheit ist jeder Vergleich erlaubt.«
»Nun, mit dieser, welche jetzt tanzt, würde ich den Vergleich wohl nicht aushalten können.«
Eben tanzte ein schönes Mädchen, welches es mit Makalli hätte aufnehmen dürfen, wenn nicht ihre Körperformen das erlaubte Maß der Fülle etwas überschritten hätten. Doch der Geschmack an Schönheit ist verschieden, Duplessis' Augen hingen schon lange mit verstohlenem Entzücken an dieser leidenschaftlichen, glutäugigen Tänzerin. Doch er wollte die Begum nicht beleidigen.
»Sie ist schön, gewiss«, sagte er; »aber wäre sie noch zehnmal schöner als Sie, für mich wären Sie doch die Schönste.«
»Wie soll ich das verstehen?«
»Sie bleiben doch immer die Schönste für mich, weil — darf ich das französisch sagen, was im Indischen zu sagen erlaubt ist?«
»Sprechen Sie!«
»Weil ich Sie liebe, schöne Begum!«
Duplessis erhielt eine seltsame Erwiderung auf diese ungeschminkte Liebeserklärung.
Der Tanz war eben aus, die Bajadere kniete vor Bahadur nieder. Doch die Begum entriss sie einem auf sie schon spekulierenden Fürsten, indem sie die Bajadere zu sich rief und sie mit Duplessis durch das Tuch verband.
»Ein Geschenk von mir«, sagte sie dabei lächelnd.
Einen Augenblick war Duplessis doch verblüfft, von dem Mädchen, dem er soeben eine Liebeserklärung gemacht hatte, ein anderes Geschenk für die Nacht zu erhalten. Doch schnell besann er sich. Die Begum war ja eine Inderin, dazu noch eine vornehme, also über Skrupel anderer Nationen erhaben. Nur weil sie mit ihm im modernsten Französisch sprach, war es ihm so verblüffend vorgekommen.
Aber immerhin, es war ein seltsamer Fall, nach dem, was er sich vorgenommen hatte, und er sah auch, wie der dicke Montpassier das Taschentuch vors Gesicht hielt, um das Lachen zu ersticken.
Hingegen machte Duplessis diese improvisierte Heirat wirklich Freude, das sah die Begum ihm nur zu deutlich an. Sie entließ ihn schnell, ehe er seinen Dank für diese Gnade hervorstammeln konnte.
Die Bajaderen verschwanden von der Terrasse, nachdem sie Schüsseln voll Konfekt erhalten hatten, den Gästen wurde nach den vielen Süßigkeiten noch ein kompakteres Mahl vorgesetzt, bestehend aus Reis mit zerlassener Butter, gebratenem Lammfleisch und aus verschiedene Art zubereitetem Geflügel. Die Inder tranken dazu Jagory, ein berauschendes Getränk aus gegorenem Palmensaft, den Europäern wurde griechischer Rotwein vorgesetzt, der wegen seines Spritgehaltes bekannt ist.
Die Franzosen waren äußerst unmutig über diese frugale Mahlzeit, am meisten über den erbärmlichen, den Gaumen beizenden Wein.
Sie hatten geglaubt, mit den feinsten und raffiniertesten Delikatessen sowie Champagner bewirtet zu werden, und jetzt zeigte sich der sonst so luxuriös lebende Bahadur geizig wie ein Filz.
Niemand wusste, dass Bahadur zu dieser Einfachheit durch die Anwesenheit eines Gastes gezwungen wurde.
Jener ältliche Mann dort mit dem herkulischen Körperbau und den riesigen Fäusten, der die Lammfleischstücke nicht aß, sondern hinunterschlang, war daran schuld. Er hockte zwar bescheiden an der Erde, genoss aber von allen Seiten große Ehrerbietung. Man nannte ihn Radscha Gholab, er war ein Fürst ohne Land und durch seine einfachen Sitten bekannt.
Warum man sich bei dem Feste nach diesem nur durch seinen Körperbau, sein hässliches Gesicht und seine blutunterlaufenen Augen sich auszeichnenden Mann richtete, werden wir noch später erfahren. Er liebte keine Verschwendung beim Essen, noch weniger beim Trinken, und das gab den Ausschlag.
Er war es auch gewesen, der die korpulente Bajadere für sich bestimmt hatte, und als die Begum durch Eingreifen seine Absicht zunichte gemacht hatte, traf ein böser Blick aus seinen geröteten Augen das Mädchen. Bahadur war fast erschrocken gewesen, aber die Begum beachtete es nicht.
Bahadur reichte die Schüssel mit Wasser zuerst der Begum, dann nahm er die seine, die Gäste wuschen sich, und damit war das Zeichen zum Ende der Festlichkeit gegeben.
Die Diener begannen sofort ihr Amt, die Gäste nach den ihnen angewiesenen Zimmern zu führen, war es doch schon sehr spät geworden.
Auf den Bengalesen schritt der Zeremonienmeister selbst zu, um ihn nach seinem Zimmer zu führen, das er heute zum ersten Male im Schlosse Bahadurs einnehmen sollte.
Vergebens versuchte Phoebe, noch einmal mit ihm zu sprechen, die Ankunft des Dieners verhinderte es.
»Weigere dich nicht, du darfst es nicht!«, gelang es ihr, ihm noch unbemerkt zuzuflüstern. Hintereinander zogen die Gäste an dem Thronsessel vorüber, auf welchem Bahadur und die Begum noch saßen, und verneigten sich ehrfurchtsvoll. Ersterer nickte dem Bengalesen freundlich zu, letztere hatte für ihren Lebensretter keinen Blick.
Dann strebten die Gäste teils dem Ausgange zu, teils verloren sie sich unter Führung der Diener in den weitläufigen Flügeln des riesigen Schlosses, oder besser gesagt, in den Straßen dieser Schlossstadt, denn es bildete ein ganzes Viertel für sich.
Der Bengalese wurde von seinem gravitätisch einherschreitenden Führer, dem noch ein Diener mit der Lampe vorausging, kreuz und quer durch winkelige Gänge geleitet, man konnte kaum begreifen, wie sich hier jemand zurechtfinden konnte.
Endlich blieb er stehen, ein anderer Diener gesellte sich noch zu ihnen.
»Schlafe wohl, tapferer Sirdar(*)«, sagte der Zeremonienmeister feierlich; »mögest du unter Brahmas Schutz so sicher ruhen, wie du unter dem des mächtigen Padischah bist. Kama, der Gott der Liebe, sei dir gnädig, bis Surya(**) erwacht.«
(*) Häuptling.
(**) Sonne, auch Gott der Sonne.
Er entfernte sich hierauf mit einer Verbeugung, der Lampenträger begleitete ihn.
Der neue Diener, ein hässlicher, alter Kerl, reichte dem Bengalesen eine mit duftendem Öl gefüllte Lampe und öffnete demütig die Tür.
Der Bengalese befand sich in einem luxuriös ausgestatteten Gemach, jedenfalls nur als Wohnzimmer dienend; denn die schmalen Diwane waren sicher nicht für den vornehmen Gast zum Schlafen bestimmt.
Eine andere Tür gab es allerdings nicht, wohl aber hing an der einen Wand ein zweiteiliger Teppich, der zum Schlafzimmer führte.

Ehe Penab Ran dieses betrat, stellte er die Lampe auf den Tisch und ließ sich nieder. Lange saß er brütend da, bis ihn ein leises Räuspern aus seinen Träumen weckte.
Er erinnerte sich, was seiner noch wartete, ergriff wieder die Lampe und ging in das Schlafzimmer hinüber.
Wirklich, dort auf dem bequemen, breiten Diwan, dessen Vorhänge zurückgeschlagen waren, lag im weißen, leichten Nachtgewand — dort lag Makalli, die ihm als Gastgeschenk gegebene Bajadere, seiner wartend. Sie hatte die Füße unter dem leichten Gewand dicht an den Körper gezogen, und es entging dem Bengalesen nicht, dass sie zitterte. Ihre großen Augen ruhten mit einem gespannten und ängstlichen Ausdruck auf dem Manne, dem sie jetzt willenlos angehörte.
Über das Gesicht Penab Rans flog es fast wie ein Zug der Freude — natürlich. Er setzte die Lampe auf den Tisch und trat vor das Mädchen hin. Sonderbar, was er sagte.
»Das Wort Bahadurs gibt mir unbedingte Macht über dich, Mädchen, er hat dich mir geschenkt, und ich darf dich nicht ausschlagen, will ich mir nicht seinen Zorn zuziehen. So ist es auch in meiner Heimat Sitte. Doch bist du mit der Wahl des Mannes nicht zufrieden, weigerst du dich, mir zu gehören, so darfst du dies sagen, und dann ist es mir erlaubt, dich zu entlassen, dann bist du frei.«
»Aber ich will dir gehören!«, sagte das Mädchen laut. »Du bist ein tapferer und schöner Mann, der Liebe wert, du gefällst mir und musst mit mir das Lager teilen!«
Plötzlich legte das Mädchen die Finger auf die Lippen und sah den vor ihr Stehenden bedeutungsvoll an.
»Lösche das Licht der Lampe!«, flüsterte sie kaum hörbar. »Ziehe dich aus und lege dich neben mich, dass mein Mund dein Ohr berührt. Ich habe dir Wichtiges zu sagen!«
Der Bengalese besaß eine leichte Fassungsgabe. Augenblicklich wusste er, dass des Mädchens erste Worte nur zum Schein gesprochen waren. Hier lag etwas anderes als ein Liebesabenteuer vor, die Bajadere wollte ihm ein Geheimnis mitteilen.
»Kama sei Dank, dass meine Liebe erwidert wird«, entgegnete er ebenso laut; »denn nimmermehr würde ich ein solch schönes Geschöpf, wie du bist, zur Liebe zwingen!«
Er warf klirrend die Dschambea auf den Tisch, Pistolen und Dolch daneben und entledigte sich langsam seiner Tschoga, des Oberkleides, welches er über den Sessel legte, aus welchem schon die dunklen, einfachen Kleider der Bajadere lagen.
Dann blies er die Lampe aus und streckte sich neben dem Mädchen auf den Diwan nieder.
»Komme näher«, flüsterte Makalli, »immer näher, noch näher! Das leiseste Wort, das aus diesem Zimmer in die Ohren des Lauschers dringt, bedeutet unser beider Tod!«
Ihre weichen Arme umschlangen den Mann und zogen ihn dicht an sich heran. Er fühlte ihre warmen, elastischen Glieder, wie sie sich an die seinen schmiegten.
»So, nun sage mir Liebesworte!«, flüsterte sie weiter. »Laut! Man muss es draußen verstehen können. Kaschin horcht wie gewöhnlich; aber nicht zu laut, dass es nicht Verdacht erregt. Küsse mich, dass es schallt! Während du von Liebe sprichst, will ich zu dir flüstern, und wenn ich laut mein Glück preise, solch einen Mann zugeteilt bekommen zu haben, flüsterst du. Kama wird uns vergeben, dass wir ihn betrügen.«
»Tapferer Mann, edler Puharri«, fuhr sie plötzlich laut fort, »wie soll ich der Göttin der Liebe danken, dass du dein Auge auf mich geworfen hast. Du bist stark, wie der Fürst des Dschungels, und kühn, wie der Falke, der auf den Reiher stößt. Du warst der einzige, der vor dem Panther nicht die Flucht ergriff, dein Dschambea war wie der Blitz, der vom Himmel fährt und alles vernichtet, wohin er auch trifft. So, nun sprich du laut!«, flüsterte sie wieder.
Wenn auch Penab Ran ein noch so großer, auf Liebesabenteuer ausgehender Don Juan gewesen wäre, in eine ähnliche Lage wäre er wohl nie wieder gekommen. Hier ruhte er neben dem himmlisch schönen Mädchen, er fühlte ihren Körper, sie legte seine Arme um ihren Leib, sie zog und presste ihn an sich, und doch war dies alles nur, wie jedes gewechselte Liebeswort, ein Vorwand, um sich flüsternd Mitteilungen machen zu können.
Unwillkürlich gehorchte der Bengalese und befolgte genau die Weisung. Der eine sprach laut, während der andere flüsterte, laut sprachen sie von Liebe, leise die furchtbarsten Sachen, die tiefsten Geheimnisse Indiens, und Penab Ran fiel nicht aus der Rolle, obgleich ihm das Blut immer heißer zu wallen begann, hätte er doch sonst kein Mann sein müssen.
Während er ihr zärtliche Worte sagte, flüsterte sie ihm ins Ohr.
»Bist du ein Feind der Faringis?«
Es musste jedes Mal eine lange Pause erfolgen, ehe die Antwort kam, denn der begonnene, laute Satz konnte nicht gleich abgebrochen werden, doch der Bengale zögerte diesmal sichtlich mit der Antwort.
»Wohl mir, ich weiß jetzt, du bist ein Freund der Faringis.«
»Weder ihr Freund, noch ihr Feind.«
»Du bist ein mutiger Mann und stehst dem bei, der in Not und Gefahr ist. Ich habe gesehen, wie alle großprahlerischen Radschas und Faringis die Flucht vor dem Panther ergriffen. Du aber gingst nicht von der Seite der bedrohten Begum, sondern rettetest sie. Da dachte ich, dieser und kein anderer ist es, welcher seinen Beistand Makalli angedeihen lassen wird, steht Edelmut doch schon in deinen Zügen geschrieben. Nicht wahr, du wirst mir beistehen?«
»Ich weiß noch gar nicht, um was es sich handelt. Was trägst du hier um deinen Leib?«
»Es ist aufgewickeltes Garn, welches wir brauchen müssen, wenn du mir beistehst. Höre mich an, Fremdling mit dem schönen und edlen Antlitz. Dich schickt mir Vishnu, der Erhalter, Ehre sei seinem Namen. Ich bin im Begriff, den heiligsten Eid zu brechen, den ich der mächtigsten Göttin geschworen habe; bevor ich das tue, muss ich bestimmt wissen, dass der, dem ich alle die mir anvertrauten Geheimnisse verrate und zeige, sie auch nicht wieder verrät, damit die Meinen nicht unglücklich werden. Was mich betrifft, so werde ich durch Brechen meines Eides gezwungen, zehntausend Jahre auf Erden in allerlei Tiergestalten zu leben, aber gern will ich dies leiden, denn es gilt, den Mann zu befreien, den ich ins Unglück gestürzt habe, und den ich doch liebe. Schwöre mir, dass du schweigen wirst!«
»Nein, ich schwöre nicht, bevor ich nicht weiß, zu welchem Zweck!«, entgegnete der Bengalese fest.
»Schwöre, schwöre!«, flüsterte die Bajadere, warf sich über den Mann und drohte ihn mit ihren Liebkosungen zu ersticken. »Still, sprich jetzt nicht, ich kitzele dich, lache, schreie, sieh, ich zupfe dich am Bart! Schwöre, du musst mir helfen, nur du kannst es, nur du hast Mut zum Schrecklichen, es gilt eine gute Tat. Bedenke, dass ich zehntausend Jahre als Tier Wandlungen durchzumachen habe; doch ich verzage nicht!«
Die Bajadere schrie leise auf. Sie hatte den Mann am Bart gezupft, und plötzlich hielt sie diesen in der Hand, hatte ihn abgerissen.
Der Bengale wollte sich freimachen, doch Makalli hielt ihn fest.
»Nein, nein, ich lasse dich nicht, jetzt weiß ich, du bist ein Feind der Rebellen, du hältst es mit den Faringis. Um so besser, auch ich tue es. Sei nicht stumm, liebkose mich, scherze, jubele, lache, wir müssen den Wächter draußen täuschen. Nicht wahr, du hast dich nur als Spion unter die Radschas gemischt?«
»Ich will dir noch mehr sagen; ich selbst bin ein Faringi, nur als Inder verkleidet.«
Das Mädchen erschrak nicht, es wunderte sich nur.
»Aber woher sprichst du ein so reines Indisch? Ich kann es kaum glauben.«
»Ich bin unter den Faringis ein Gelehrter, der Indien studiert. Ich spreche alle Sprachen, die hier geredet werden.«
Wenn der liebe Leser noch nicht erraten hätte, dass dieser Bengalese der verkleidete Reihenfels ist, so weiß er es jetzt.
»So verstehst du auch die Ramasyana?«
»Ramasyana? Nein, was ist denn das?«
»Du sollst es noch erklärt bekommen, noch viel mehr. Um so besser, wenn du ein Faringi bist, du bist dennoch ein starker, mutiger und edler Mann. Jetzt wirst du mir helfen; der, den wir befreien wollen, ist ein Offizier der Faringis.«
»Ein Engländer?«
»Ja. Schwöre mir bei deinem Christengott, dass du mich nicht verrätst, wenn es uns gelingt und du mir später einmal wieder begegnest.«
»Nun denn, ich schwöre bei dem heiligen Gott, an den ich glaube, und bei dem Blute dessen, der für mich gestorben ist, dass ich dich nicht verraten werde, dass ich dir vielmehr treu beistehen werde im Leben und Sterben.«
Wieder umschlang ihn die Bajadere und erdrückte ihn fast mit Liebkosungen, als wolle sie ihm dadurch ihre Dankbarkeit bezeugen. Dann aber drängte sie ihn von sich.
»Weißt du, Faringi, neben wem du liegst?«
»Neben Makalli, der schönsten Bajadere.«
»Nein, neben Makalli, der Sutha. Weißt du, der alles in Indien kennen will, was eine Sutha ist?«
»Nein.«
Der Bajadere Stimme nahm plötzlich einen unheimlichen Ton an, als sie flüsterte.
»So erfahre es denn, du hast geschworen, du musst jetzt schweigen. Das Lager, auf dem du liegst, kann sich sofort in dein Totenbett verwandeln. Ich bin — erschrick nicht, Fremdling — — eine Sutha, das heißt ein Weib, welches durch ihre Reize Männer anlockt und diese dann in die Hände der Thugs liefert.«
Hatte Reihenfels doch Liebesgedanken bekommen, so verrauchten sie im Nu. Er fühlte, wie sein Blut förmlich erstarrte. Jetzt wusste er auch, was Ramasyana bedeutete. Er hatte diese Sprache von Hira Singh Ramasi nennen hören, ein anderer Ausdruck dafür; sie war die geheime Sprache der Thugs, der furchtbaren Würgerbande. Sutha bedeutet so viel wie Verlockerin oder auch Spionin.
Er wollte hastig aufspringen, um nach seinen Waffen zu greifen, doch lachend warf sich das Mädchen über ihn und hielt ihn fest.
»Ich beschwöre dich bei deinem Christengott, sei besonnen, oder wir sind beide verloren«, flüsterte sie unter dem Lachen. »Von mir hast du ja nichts zu fürchten, ich bin an dich durch das Brechen meines Eides — ich habe ihn schon gebrochen — mit furchtbaren Banden gefesselt. Habe Mitleid mit Makalli, die sich selbst zu zehntausend Jahren Strafe verdammt hat, um den Geliebten zu retten. In meiner Nähe ist dein Leben immer sicher, wenn du mich nicht verrätst.«
Reihenfels sah das ein. Er konnte sich wieder dazu aufraffen, Liebesworte laut zu sprechen und dann wieder zu flüstern.
»Ja, ich bin eine Sutha; schon Hunderte habe ich verführt und den Würgern überliefert. Schaudere nicht, ich büße meine Vergehen durch den Eidbruch schrecklich. Daher eben verrät der gefangene Thug selbst unter den entsetzlichsten Qualen sein Geheimnis nicht, weil er die Strafe dafür mehr fürchtet als den Martertod. Ich verrate es aus Liebe zu einem Manne. Hast du, Faringi, den Radscha gesehen, den großen, starken Mann mit den blutunterlaufenen Augen?«
»Radscha Gholab?«
»Ja. Es ist der Oberguru, der Oberpriester der Buthotes(*), welche mit der Phansi(**) oder mit dem Devy(***) das Opfer ersticken. Ich war vierzehn Jahre alt, Bajadere im Tempel Shivas, keusch, rein, als dieser Mann kam, die Bajaderen musterte, mich besonders lange betrachtete, mit einem Priester sprach und mich dann fortführte. Die Göttin Kali brauchte Dienerinnen, ich wurde gezwungen, in ihre Dienste zu treten. Damals hatte ich noch keine Ahnung von den Thugs, ich wurde eingeweiht und wegen meiner Schönheit zur Sutha bestimmt. Anfangs empörte sich mein Herz gegen die scheußlichen Bluttaten; aber an unbedingten Gehorsam von Kindheit an gewöhnt, gehorchte ich auch jetzt, und schließlich stumpfte sich mein Gefühl ab; ich konnte mit einem Manne scherzen und kosen, konnte sehen, wie der Würger von hinten kam, ihm die Schlinge um den Hals warf, und wie der Lugha ihn dann in das unterdes schon bereitete Grab legte. Du weißt vielleicht nicht, Fremdling, dass das Grab dessen, welcher getötet werden soll, schon fertig sein muss, ehe er tot ist, es sei denn, er soll der Kali geopfert werden, oder wenn ihm die heiligen Schlangen die Augen ausfressen dürfen.«
(*) Erdrosseler.
(**) Schlinge.
(***) Seidentuch.
Reihenfels schauderte zusammen. So hatte Kiong Jang doch nichts als die Wahrheit erzählt, er war nicht irrsinnig, wie so viele behaupteten.
Ehe wir der Erzählung der Bajadere weiter lauschen, seien einige Erklärungen über die Thugs erlaubt.
Wunderbar ist es, dass das Bestehen dieser Mördergesellschaft bis zum Jahre l820 in das Reich der Fabeln verwiesen wurde. Erwähnung tut ihrer schon der alte Geschichtsschreiber Herodot, als er den Kriegszug des Xerxes schildert; sie bestehen gewiss schon so lange wie die indische Religion, reichen also bis in uralte Zeiten zurück.
Die Thugs, nach anderer Schreibweise Dugghs, sich selbst Phansigars, das heißt Schlingenwerfer, nennend, sind Anbeter der Kali, der Göttin der Vernichtung, und werden als solche auch von den Anbetern Vishnus, Shivas und so weiter anerkannt, aber zugleich verfolgt, eben weil diese Götter der Entstehung und Erhaltung sind, jene die Göttin der Vernichtung ist.
Über die Entstehung dieser furchtbaren Mörderbande ist zu bemerken, dass nach der religiösen Anschauung der Inder (Buddhisten) seit Schaffung der Welt das Prinzip des Bösen dem des Guten widerstrebte. Die Göttin Kali, als Prinzip des Bösen, kämpfte gegen den Schöpfer und gründete zu diesem Zwecke die Sekte der Thugs, deren Mitglieder sie selbst in der Kunst des Würgens unterwies. Sie beschützte die Thugs in jeder Weise und vertilgte die Spuren der von ihnen verübten Verbrechen. Doch neugierige Würger beobachteten sie einst, wie sie die ermordeten Opfer verschwinden ließ, und dafür mussten sie büßen, indem sie seitdem die Spuren selbst verdecken und die Toten auch selbst beerdigen müssen.
Die Aufnahme in die Sekte ist mit allerlei Zeremonien verknüpft, die vom Guru, dem Chef der Bande, unterstützt durch Chams (Priester) ausgeführt werden.
Die Engländer in ihrem stolzen Hochmut bestritten das Bestehen dieser Sekte, nur wenige geben es zu. Die vielen Menschen, Europäer und Eingeborene, die in Indien verschwanden, hielt man für Opfer der Raubtiere, Schlangen und Straßenräuber.
Von 1808—1810 verschwanden eine unglaubliche Anzahl von Menschen, besonders von eingeborenen Soldaten, und man begann doch ernstliche Nachforschung zu halten, ohne etwas zu finden — Leichen wurden nicht entdeckt.
Im Jahre 1821 wurde dem Colonel Sleemann während der Nacht auf der Straße eine Schlinge von hinten um den Hals geworfen. Es gelang dem herkulischen Engländer, sich zu befreien, die ihn plötzlich Umringenden niederzuschlagen und den Schlingenwerfer selbst zu fassen.
Der Inder, ein Mann namens Faringhea, räumte offen ein, ein Thug zu sein, und prahlte damit, schon 779 Menschen mit der Schlinge getötet zu haben. Man hielt das für Prahlerei und glaubte ihm nicht. Der Mann bezeichnete aber genau die Stellen, wo er seine Opfer verscharrt habe, man suchte dort nach und fand, über ganz Indien zerstreut, über 600 Gerippe und Leichen.
Lord Bentink, damals Generalgouverneur von Indien, organisierte sofort unter Colonel Sleemann eine Gesellschaft von verwegenen Männern, um gegen die Thugs zu operieren. Diese Männer ließen sich anscheinend von den Thugs in Fallen locken und fingen dann diese selbst. In kurzer Zeit lieferte Sleemann, nach amtlichen Berichten, 3266 Thugs in die Hände der Justiz; diejenigen, welche im Kampfe ihren Tod gefunden hatten, waren gar nicht zu zählen.
Nach Angabe dieser Gefangenen suchte man die Gräber der Opfer auf und scharrte über zehntausend Leichen aus. Über die Geheimnisse ihres Kultus waren die Gefangenen jedoch nicht zum Sprechen zu bringen, davon erfuhr man erst nach dem letzten indischen Aufstand.
Nach diesem tatkräftigen Vernichtungszug hatte man einige Jahre vor den Thugs Ruhe, sie erholten sich aber nach und nach wieder, und kurz vor dem indischen Aufstand betrieben sie ihr Geschäft wieder im vollsten Schwunge.
Die Mitglieder, namentlich die Chams oder Priester und die Gurus oder Häupter, leben oft jahrelang in der bürgerlichen Gesellschaft als dies oder jenes, suchen inzwischen ihre Opfer aus und studieren deren Gewohnheiten.(*)
(*) So lebte 1829 Hurry Singh, ein Guru, als reicher Seidenhändler unbelästigt in Hingoly.
Die Sutha, die Verlockerin, meist ein schönes Mädchen, lockt das Opfer nach einem verborgenen Platze, und inzwischen gräbt der Lugha schon das Grab. Während das Opfer in den Armen der Sutha liegt, wirft der Buthote die Schlinge, erdrosselt den Unglücklichen, der Leichnam wird beraubt und mit solchem Geschick verscharrt, dass von der Begräbnisstelle nicht die Spur zu merken ist. Man durchsticht den Körper vorher sogar mit Stäben, damit er von den Zersetzungsgasen nicht aufgebläht wird und das Erdreich heben kann.
Entgeht den Thugs ein Opfer, so müssen sie unter sich losen, wer von ihnen getötet werden und das schon fertige Grab ausfüllen soll, damit die Göttin nicht betrogen wird.
Braucht die Kali lebendige Opfer oder müssen die Schlangen mit lebenden Menschen gefüttert werden, so bedient man sich des Devy, des Seidentuches, das man dem Manne über den Kopf wirft. Tötet die Schlinge nicht sofort, so verfällt das Opfer den Schlangen. Derartige Personen dürfen nicht beraubt werden, alles an ihnen gehört der Kali.
Die Thugs suchen sich nicht etwa nur Faringis als Opfer aus, sondern im Gegenteil am liebsten vornehme Inder, womöglich Diamantenhändler. Nur zur Klasse der Thugs dürfen sie nicht gehören.
Vor dem Schlafgemache des angeblichen Bengalesen stand der Kaschin genannte Diener und lauschte. Er hörte Lachen, leise Schreie, Scherze, Küsse, Liebes- und Koseworte und ahnte nicht, dass Makalli eben einem Faringi die Geheimnisse des Bundes verriet; denn Kaschin war ebenfalls ein Thug.
»Zum Feste des Shiva, das aber eigentlich seiner Gattin, der Kali, galt«, fuhr die Bajadere flüsternd fort, ohne den Mann aus den Armen zu lassen, »wurde uns Suthas und allen Bajaderen, die sich in Delhi befanden und sich wegen ihrer Schönheit auszeichneten, befohlen, so viele englische Offiziere wie möglich an uns zu locken, damit sie nicht ihre Leute gegen die Rebellen anführen konnten. Einigen gelang es, darunter auch mir. Ach, wäre es mir doch nicht geglückt. Den, welchen ich verraten sollte, liebte ich wirklich, und auch er glaubte, von mir geliebt zu werden. Als Bajadere hatte ich mich ihm schon lange vorher auf Befehl des Obergurus genähert, ich sollte ihn in meine Schlingen ziehen, wie ich es schon mit so vielen Männern getan hatte, aber da geschah es, dass mein Herz in Liebe entbrannte zu ihm, das erste Mal. An jenem Abend bestellte ich ihn zu mir in mein Haus, ich betete zu allen Göttern, dass er nicht kommen möchte, denn ich kannte sein Los, und ihn zu warnen wagte ich damals nicht; denn die Strafe, die darauf steht, ist entsetzlich. Der Unglückliche kam, ich koste mit ihm, er lag an meiner Brust, als von hinten der Buthote kam und ihm den Devy überwarf. Ich sah es und konnte ihm nicht helfen. Er wurde gefesselt, geknebelt und fortgeführt. Den Blick, den er mir, der Verräterin zuwarf, kann ich nie vergessen.«
Ein Schauer ging durch den Körper des Mädchens, doch es vergaß nicht, den jungen Mann aufzufordern, nicht mit lauten Liebesworten zu sparen.
»Und was ward aus ihm?«, fragte dieser dann. Die Bajadere zuckte zusammen.
»Ja, das ist die Hauptsache. Er ist nicht, wie so viele andere, wie die meisten der gefangenen Offiziere, getötet worden, der Oberguru schützte ihn vor dem Blutdurste Bahadurs und Nana Sahibs, welche den Bund der Thugs zwar gut kennen, aber nicht zu ihm gehören. Morgen Nacht findet ein Fest der Kali statt, alle Thugs finden sich dazu ein, und dann wird auch mein Freund mit den übrigen Gefangenen geopfert werden. Wir müssen ihn retten, du hast geschworen.«
»Mit welchen Übrigen?«
»Die vorgestern fortgeführt worden sind.«
Ein furchtbares Gefühl schnürte plötzlich Reihenfels das Herz zusammen.
»Die gefangenen Frauen?«
»Ja.«
»Alle?«
»Alle ohne Ausnahme. Der Oberguru hat darauf bestanden, dass sie der Kali zu Ehren geopfert werden, und Bahadur hat endlich nachgegeben.«
»Wo findet die Opferung statt?«
»In der Burg der Thugs.«
»Wo ist diese?«
»Weit, weit von hier, doch ich kenne den Weg. Wir fliehen noch diese Nacht aus dem Schlosse, Pferde stehen zur Verfügung; ich teile dir noch unterwegs die Geheimnisse der Thugs mit, du bist als Inder unkenntlich, unter männlicher Begleitung habe auch ich Zutritt zum Feste, sonst nicht, und ich weiß, wie es uns gelingen wird, meinen Freund zu befreien.«
»Wie heißt er?«
»Mac Sulivan.«
Reihenfels kannte ihn, es war ein Schotte, ein junger Leutnant.
»Aber ich bin nicht vertraut mit den Gebräuchen der Thugs, ich würde mich verraten.«
»Ich teile dir die Zeichen und den Händedruck mit, weiter brauchst du nichts. Hast du Furcht?«
»Bei Gott, ich schrecke vor nichts zurück. So werden alle Gefangenen geopfert?«
»Alle, alle.«
»In ein und demselben Tempel?«
»In demselben Tempel, in welchem sich Sulivan befindet.«
»Wenn wir zu spät kommen?«
»Unmöglich! Erst müssen die indischen Gefangenen geschlachtet werden, dann kommen die Faringis daran, ganz zuletzt.«
»Du hast einen Plan zur Rettung?«
»Einen ganz sicheren. Ich bin in dem Tempel, welcher in den Grundfesten der Burg liegt, wie zu Hause, ich kenne alle seine Geheimnisse und werde sie benutzen.«
»So bin ich der Deine, Mädchen, ich komme mit und werde dich unterstützen.«
»Und auf mich kannst du dich verlassen, denn stirbst du, so ist es auch mein Tod.«
»Noch eins. Werde ich auch die anderen Gefangenen sehen?«
»Ah, auch du willst welche befreien?«
»Gewiss; deshalb wagte ich mich in dieser Verkleidung nach Delhi.«
Das Mädchen schien zu zaudern.
»Wenn du außer meinem Freunde noch jemanden befreien willst, müssen wir auch noch einen Begleiter haben«, sagte sie dann.
»Den habe ich, er hält sich in Delhi versteckt.«
Er begann Dick Red zu schildern, und zwar so, dass die Bajadere von dessen Tüchtigkeit eingenommen wurde.
»Spricht er so gut Indisch wie du?«
»Ach so, das hatte ich vergessen, er spricht gar kein Indisch.«
»Das würde nichts schaden. Die Thugs legen oft das Gelübde ab, taubstumm zu erscheinen. Jetzt vorsichtig, Faringi, wir müssen uns ankleiden und das Schloss heimlich verlassen.«
»Erst noch eine Frage: Weiß die Begum, dass die Gefangenen der Kali geschlachtet werden sollen?«
»Nein, sie weiß überhaupt nur wenig von der Verbindung der Thugs, sie wird absichtlich darüber in Unkenntnis gehalten, und uns ist streng befohlen worden, uns vor ihr zu hüten.«
»Alle die Gefangenen standen doch unter ihrem Schutze?«
»Die Begum glaubt, sie werden in ein Versteck nach dem Gebirge gebracht, man hat sie getäuscht. Doch jetzt vorwärts, mein Getreuer, wir müssen eilen, denn wir müssen dem Oberguru zuvorkommen, der ebenfalls nach der Burg reist. Es ist ein weiter Weg, wir dürfen nicht ruhen, wollen wir morgen Abend dort sein. Auch müssen wir erst deinen Freund aufsuchen und ihn vorbereiten.«
Die Bajadere erhob sich, trat zu der Portiere und schlug sie zurück.
»Kaschin, frisches Wasser«, sagte sie laut. Keine Antwort, nichts regte sich.
»Er ist fort oder schläft. Kleide dich leise an, wie ich es tue.«
Einige Minuten später verließen beide das Gemach durch eine geheime Wandtür. Reihenfels' Herz klopfte zum Zerspringen, so kalt und entschlossen er auch äußerlich war.
Er sollte die Geheimnisse der Thugs kennen lernen, seine gefangene Schwester sehen und Gelegenheit haben, sie zu befreien, sowie vielleicht alle anderen Gefangenen.
Vielleicht konnte er auch etwas über das Schicksal der Tochter Mister Woodfields erfahren und sie dem Vater wieder zuführen. Die Bajadere wollte er noch nicht über sie fragen, damit Makalli nicht über seine Kenntnis dieser Dinge misstrauisch würde.
Eine vermummte Gestalt huschte durch die winkligen Gänge des Schlosses, mit einem Lämpchen leuchtend. Es war totenstill in den finsteren Räumen, kein menschlicher Laut durchdrang die dicken Wände, auch die Liebespärchen hatten zu scherzen aufgehört.
Als die Gestalt eine Tür erreichte, blieb sie stehen und lauschte. Da bewegte es sich neben ihr, ein Mann mit verschlafenen Augen trat auf sie zu.
»Halt«, sagte er leise, »kein Unberufener hat Zutritt zu diesem Gemach, in welchem dem Gotte Kama geopfert wird. Nur Bahadur dürfte seinen Gast besuchen.«
»Auch ich nicht?«
Die Gestalt schlug das Kopftuch zurück, der Eingeborene verneigte sich tief, denn vor ihm stand die Begum von Dschansi.
»Dir, o Herrin, stehen selbst die Türen offen, die für Bahadur verschlossen sind; hast du mich, deinen treuen Kaschin, doch selbst als Wächter hierhergestellt.«
»Du hast geschlafen, Kaschin.«
»Nur einen Augenblick, die Augen fielen mir zu vor Müdigkeit. Habe ich aber nicht deinen leisen Schritt sofort vernommen?«
»Du hast recht. Was machen der Bengalese und die Bajadere?«
»Sie schlafen unter dem Schutze Kamas. Ein schöneres Paar haben meine Augen noch nie geschaut, sie sind füreinander geschaffen.«
Da der Diener demütig gebückt dastand, so sah er nicht, wie in den Augen der Begum wilde Glut aufloderte.
»Wie verhielten sie sich?«
»Bis vor kurzer Zeit noch scherzten und lachten sie, ich hörte ihre Küsse und Liebesworte, jetzt...«
Der Diener wurde plötzlich von einer kräftigen Faust an der Schulter gepackt und gerüttelt.
»Du lügst, Kaschin, das ist nicht wahr!«
»Ich soll lügen?«, rief der bestürzte Inder erschrocken. »Ich habe es doch bis hier heraus gehört. Und was sollen sie denn auch anders machen? Mit tausend Worten haben beide ihr Glück und ihre Liebe beteuert. Da, höre selbst.«
Drinnen erklang ein Stimmengemurmel.
»Öffne die Tür«, flüsterte die Begum.
Sie trat ein, näherte sich der Portiere und spähte hindurch.
Dort lagen eng umschlungen der Bengalese, halb entkleidet, und die Bajadere. Der Mann beteuerte ihr mit süßen Worten seine Liebe, das Mädchen lag mit dem Munde an seinem Ohr.
Wie vom Blitz getroffen taumelte die Begum zurück, mit keuchendem Busen, die Zähne zusammengepresst, die Finger ineinandergekrallt, dass die Nägel ins Fleisch drangen, stand sie lange da. Nach und nach nahm ihr Gesicht einen furchtbaren Ausdruck an, starr, wie das Antlitz der Meduse.

Geräuschlos, wie sie gekommen, entfernte sie sich wieder.
»Du wartest hier, bis ich zurückkomme«, flüsterte sie draußen dem Wächter zu, »gibst kein Zeichen deiner Anwesenheit, lässt aber niemanden hinaus.«
»Nur ich kann diese Tür verschließen und öffnen, sie ist auch nicht von innen aufzumachen.«
»Desto besser!«
Die Begum eilte fort.
Während ihrer kurzen Abwesenheit war es, dass Makalli nach Wasser rief, aber eingedenk seines Befehles antwortete Kaschin nicht. Die Bajadere wusste auch, dass die Tür nicht zu öffnen war, deshalb rief sie nur in das Vorzimmer hinein. Dann trafen beide ihre Vorkehrung zur heimlichen Flucht.
Bald kehrte die Begum zurück, hinter ihr gingen zwei athletisch gebaute Inder.
»Öffne! Aber vorsichtig, dass wir nicht gehört werden!«, Sie trat ein, die beiden Inder mit.
»Wenn ich euch rufe«, flüsterte sie, »so seid schnell zur Hand und werft euch auf den Bengalesen.«
Sie schlug den Vorhang auseinander und betrat das Schlafgemach. Die Lampe stand noch auf dem Tisch, aber der Diwan war leer, auch die Kleider, welche vorhin auf dem Schemel gelegen hatten, waren verschwunden.
Die Begum ergriff mit zitternder Hand die Lampe, und leuchtete — alles leer, niemand zu sehen. Hatte sie denn geträumt? Nein, der weiche, bett-ähnliche Diwan zeigte noch die Abdrücke zweier Personen, welche dicht nebeneinander darauf gelegen hatten.
»Kaschin«, schrie das Mädchen, »Fluch auf dein Haupt, du hast sie entkommen lassen!«
Der Diener beteuerte, es hätte niemand die Tür passiert.
»So gibt es noch eine andere geheime Tür.«
Kaschin wusste nichts davon.
Das Antlitz der Begum sah schrecklich aus, nichts von der früheren Lieblichkeit war noch darin zu finden.
»Du schaffst mir die beiden wieder!«, donnerte sie den Erschrockenen
an. ».Rufe den Schlossvogt, er soll mir eine Erklärung geben. Nimm diese Männer mit! Eilt, alarmiert das Schloss! Sie dürfen nicht entkommen, wenn sie fliehen wollen. Gefangen will ich sie vor mir sehen, sonst wehe euch!«
Im Schloss ward es schon lebendig, als die Begum wieder durch die Gänge nach einem anderen Flügel eilte. Hier waren die Korridore erleuchtet. Auf einem derselben stieß sie mit Phoebe zusammen.
»Endlich finde ich dich«, rief diese. »Ich habe nach dir gefragt und selbst nach dir gesucht, konnte dich aber nicht finden. Ja, was ist denn mit dir?«
Das Mädchen war in Tränen ausgebrochen und hatte sich der einstigen Pflegemutter an die Brust geworfen.
Phoebe sah sich scheu um, ob nicht Inder diesen Gefühlsausbruch des Mädchens beobachtet hätten, denn das musste unbedingt vermieden werden, und zog sie schnell in ihr nahe befindliches Gemach.
»Was ist dir, Bega? Ich habe dich gesucht, ich muss dich sprechen. Ach, Bega, ich habe dir ein Geständnis zu machen. Jetzt gleich, schnell, kannst du mich anhören? Wir haben keine Zeit zu verlieren, du wirst auch von Bahadur gesucht.«
Schnell waren des Mädchens Tränen getrocknet. Sie blickte auf, doch das war nicht mehr das frühere Antlitz.
»Ich muss mich beeilen!«, fuhr Phoebe hastig fort. »Du bist das Opfer eines Betrugs geworden. Ich fasse mich kurz: Reihenfels...«
Die Begum stieß die Sprecherin von sich und richtete sich hoch auf.
»Ich weiß, dass ich betrogen worden bin und noch immer betrogen werde!«, rief sie mit starrer Stimme und flammenden Augen. »Schweig, rede nicht, ich will nichts mehr hören, auch von dir nicht. Schweig, sage ich dir, auch du hast mich betrogen. Wo ist Bahadur?«
»Aber, Begum —«, stammelte Phoebe bestürzt.
In diesem Augenblick stürzte der Maharadscha, der noch nicht geschlafen hatte, ins Zimmer.
»Was geht hier vor?«, rief er. »Wer hat das ganze Schloss zur Mitternacht in Alarm gesetzt?«
»Ich«, entgegnete die Begum, »ich habe es getan. Wecke die faulen Schläfer!«, fuhr sie, immer heftiger werdend, fort. »Wo sind die Radschas? Her mit ihnen! Sie sollen sich hier versammeln. Ist es jetzt Zeit, dass sie mit Bajaderen tändeln? Großsprecher sind es, feige Hunde, welche die Knute verdienen. Man schwört mir Treue und umgibt mich mit Verrätern. Wer war jener Bengalese, dem du Makalli zuteiltest? Sprich, Bahadur, er war dein Gast!«
Er fand keine Antwort, er starrte auf die Begum. Er glaubte, das Mädchen sei plötzlich rasend geworden, so stürmte es im Zimmer auf und ab.
»Begum, ich bitte dich, höre mich zuerst an!«, flehte Phoebe.
»Schweig«, fuhr das Mädchen sie abermals an, »auch du gehörst zu den Verrätern, du standest mit Reihenfels im Bunde. O, ich durchschaue dich und euch alle.«
Das Zimmer füllte sich immer mehr mit Männern, welche von erschrockenen Dienern aus dem Schlafe gerissen worden waren. Das Schloss glich plötzlich einem aufgestocherten Bienenkorb.
»Nana Sahib, du noch hier?«, redete das Mädchen diesen zornig an. »Ich denke, du bist schon auf dem Wege nach Fatehpur.«
Finster blickte der Radscha die Angeredete an.
»Hat dies nicht noch bis morgen Zeit?«
»Nein; denn du hast mir gesagt, du wolltest gestern Abend nach dem Fest schon abrücken.«
»Ich habe die Zeit eben verschoben.«
»Als ich es billigte, war es mein Befehl!«
»Begum, mäßige dich!«
»Ich mich mäßigen? Vor wem? Vor euch? Glaubt ihr, ich lasse noch länger mit mir spielen? Ihr habt mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin — zu eurer Gebieterin, und nun verlange ich Gehorsam! Wo ist der dicke Radscha mit dem Ochsenkopf?«
Jemand sagte, Radscha Gholab hätte keine Lust, sein Lager zu verlassen.
»Bei Brahmas Haupt, steht er in einer Minute nicht vor mir, so hängt er in der nächsten an der höchsten Spitze des Schlosses.«
Der Betreffende erschien sofort, seine Augen waren von Blut noch röter als sonst.
»Was gibt's, was soll's?«, rief er rau, das Mädchen geringschätzend musternd.
»Du weigerst dich, meiner Aufforderung zu folgen?«
»Begum, bedenke, du hast Männer vor dir, keine Kinder!«, sagte der Dicke drohend.
»Männer? Hahaha!«, lachte die Begum hell auf. »Feiglinge und Memmen, die ihr seid! Wie junge Hunde mit eingekniffenem Schwanz lieft ihr davon, als der Panther plötzlich vor euch stand. Eure Gürtel waren mit Waffen gespickt; aber die Milchflasche gehörte hinein, denn Waffen wisst ihr nicht zu gebrauchen. Nur einer stand mir bei, der, den ihr verachtet. Doch wo ist dieser, wo ist der Bengalese? Er ist entwichen, er hält sich verborgen, vielleicht ist er schon aus dem Schloss, er und seine Bajadere. Auf, sucht ihn, fangt ihn, bringt ihn vor mich! Ich will mein Mitleid aus dem Herzen reißen, und sollte dieses selbst in Stücke gehen. Wo sind die Gefangenen?«
»Du weißt, sie werden nach den Bergen gebracht.«
»Zurück mit ihnen! Ich kenne kein Mitleid mehr, wie man auch mit mir keins gekannt hat. Sie sollen das Los der übrigen Gefangenen teilen. Nun, Nana Sahib, warum bist du noch nicht fort?«
Der Radscha stand noch in der Tür und betrachtete finster das so herrisch auftretende Mädchen.
Drohend hob die Begum die Hand gegen ihn auf.
»Ihr habt den Geist beschworen, nun steht er vor euch, und ihr werdet vergebens versuchen, ihn wieder zu bannen. Hüte dich, Nana Sahib, ich durchschaue dich und euch alle! Ihr alle habt euch gewaltig in mir geirrt. Glaubt ihr etwa, ihr seiet die Befehlshaber in diesem Aufstand? Die Ausführer meiner Befehle seid ihr, weiter nichts. Geht doch hin und seht zu, ob das Volk euch gehorchen wird! Mir folgen die Sepoys, nicht euch, und stehe ich nicht mehr an der Spitze, so wird euer so gut ausgeführter Bau zusammenbrechen. Ihr habt ein paar Engländer hinmorden lassen und glaubt nun, ihr seid Herren in Indien, jetzt dürft ihr befehlen, schlemmen und prassen. Hahaha, ihr Narren! Während ihr hier schlaft, sammeln sich schon die Engländer, und ihr werdet noch darüber getäuscht. Aber ich lasse mich nicht mehr täuschen, ich werde euch aufrütteln. Ihr wisst noch nicht, dass General Nicholson bereits die Meuterer von Silkut vollständig geschlagen hat. Schon befindet er sich auf dem Wege nach Lahore. Schon hat General Havelock Besitz von Allahabad genommen und zieht gegen Kanpur. Ja, das ist nichts, sagt ihr, aber es wird anders kommen. Fort, Nana Sahib, lass deine Leute sich rüsten! Wo sind die französischen Offiziere? Holt sie her, weckt sie, zündet ihnen das Haus über den Köpfen an, wenn sie zu schläfrig sind!«
Sie besann sich einen Augenblick und verließ dann schnell das Zimmer, als hätte sie etwas Neues gefunden, an dem sie ihren Zorn auslassen konnte.
»Das lasst ihr euch von diesem Weibe bieten?«, knurrte Radscha Gholab.
»Warum nicht?«, sagte eine schrille Stimme. »Ihr habt es ja nicht anders haben wollen!«
Die meisten wichen scheu vor der kleinen, vermummten Gestalt zurück, die plötzlich mitten unter ihnen stand, ohne dass jemand sie vorher bemerkt hätte.
Wie erleichtert eilte Bahadur auf sie zu.
»Gut, dass du da bist, Sinkolin! Hast du es gehört?«
»Es wird noch ganz anders kommen, und es ist gut so. Ihr selbst habt es heraufbeschworen!«
»Sie fragte nach den Gefangenen.«
»Nun?«
»Was sollen wir sagen?«
»Ich selbst werde ihr sagen, unter wessen Händen sie gestorben sind, und glaubt mir, sie wird es gutheißen. Die Begum ist eine andere geworden, zu unserem Vorteil.«
Ja, sie war eine andere geworden, und das sollten in dieser Nacht noch einige schwer empfinden müssen.
Jetzt lehnte sie draußen, den Kopf an die Wand gestützt, und verhüllte das Gesicht mit beiden Händen. Es war, als erschüttere ein innerer Kampf den ganzen Körper. Doch bald raffte sie sich auf und ging den Korridor entlang.
»Noch diesen einen will ich fühlen lassen, wer ich bin«, murmelte sie. »Ohne dass er es wusste, hat er mich gedemütigt, oder ich Törin fasste es als eine Demütigung auf, jetzt aber will ich ihm den Hochmut vertreiben!«
Auf ihren Wink eilte ein Diener herbei und öffnete die Tür.
Duplessis zog sich eben schlaftrunken an, die korpulente Bajadere ebenfalls — beide waren durch den Lärm aus dem besten Schlafe gerüttelt — als die Begum vor ihm stand. Mit aller Gewalt war es ihr gelungen, ihr Gesicht in freundliche Falten zu legen.
Bestürzt ordnete Duplessis seinen Anzug, die Bajadere hatte es weniger eilig.
»Gut geschlafen?«, begann das Mädchen freundlich.
Der Franzose konnte nur eine Entschuldigung stammeln. Ihr gebieterischer Wink wies die Bajadere hinaus, dann nahm sie auf einem Schemel Platz und tat ganz harmlos.
»Sie sind frühzeitig gestört worden«, fuhr sie fort, »es ist eben Mitternacht vorüber.«
»Aus welchem Grunde ist solcher Lärm gemacht worden?«, fragte Duplessis und zog seine Stiefel an.
»Nana Sahib rückt ab, es wird mobil gemacht, wie Sie sagen würden. Auch die anderen französischen Offiziere sind schon oben versammelt. Sie sollten geholt werden, und da habe ich mich erboten, dies zu besorgen.«
»Sehr freundlich von Ihnen, ich weiß nicht, wie ich — hm, fatale Situation — müssen Sie nicht dabei sein?«
»Wobei?«
»Nun, bei dem Kriegsrat.«
»Ich als Weib habe dabei nichts zu sagen, ich bin nur so, verstehen Sie, so eine Art von Anstandsdame oder Respektsperson. Freilich, anfangs glaubte ich auch, man verehre mich wie eine Göttin, jetzt habe ich aber eingesehen, dass dies alles nur Schein war, und ich gebe mich damit auch völlig zufrieden. In der Öffentlichkeit bezeugt man mir die größte Ehrfurcht, sonst kümmert man sich nicht viel um mich.«
»Merkwürdiges Frauenzimmer!«, dachte Duplessis, legte die letzte Hand an die Toilette, und sagte laut:
»Aber ich verstehe Sie nicht! Sie sprechen das alles so unverhohlen aus?«
»Natürlich nur Ihnen gegenüber, Sie sind ja ein Franzose, und ich appelliere an Sie als Kavalier, dass Sie nichts ausplaudern.«
»Natürlich nicht. Sie sind wirklich Inderin?«
»Gewiss. Warum nicht?«
»Es kommt mir oft vor, als befände ich mich einer Dame gegenüber, die Paris nie verlassen hat.«
»Erziehung, nichts als Erziehung! Ich kenne weder Frankreich noch sonst ein anderes Land außer Indien. Man kann ja hier sehr gute Lehrer bekommen. Doch weiter darf ich nichts über mein vergangenes Leben verraten, darüber muss ein geheimnisvoller Schleier schweben. Sie verstehen, warum.«
»Ich weiß«, lachte Duplessis und stand auf.
»Ach, bleiben Sie doch noch etwas!«
»Wenn ich gewünscht werde...«
»Wenn Sie bei mir sind, sind Sie entschuldigt.«
Duplessis setzte sich neben sie, er war zwar gar nicht zu neuen Liebesabenteuern aufgelegt, wollte aber diese Gelegenheit doch nicht unbenutzt vorübergehen lassen. Es handelte sich ja auch um den Gewinn seiner Wette.
Es war doch ein sonderbares Mädchen, das da neben ihm saß. Na ja, eine Inderin, im Lande der freiesten Sitten aufgewachsen und in französischer Bildung erzogen.
»Wie denken denn nun Ihre Herren Kameraden über mich?«, fragte sie im Plaudertone weiter.
»Sie werden von ihnen angebetet mit einer Ehrfurcht, welche der der Inder nicht im Mindesten nachsteht. Nur schade, dass Sie sich so selten zeigen.«
»Als Göttin beten sie mich an?«, lachte die Begum.
»Als Göttin der Schönheit, jedoch als ein irdisches Wesen, und der eifrigste Diener dieses Kultus bin ich«, entgegnete Duplessis, kühner werdend.
»Sie? Nun, wir haben uns ja schon darüber ausgesprochen. Mir ist etwas von Ihren Kameraden zu Ohren gekommen, worüber ich von Ihnen gern Aufklärung haben möchte.«
»Mit dem größten Vergnügen, wenn es möglich ist.«
»Es betrifft Sie selbst.«
»Mich?«
»Ja, ich hörte aus einem heimlich belauschten Zwiegespräch — Sie müssen verzeihen, ich lausche gern — dass Sie eine Wette gemacht, in vier Wochen... ja, was nun in vier Wochen, das habe ich nicht verstanden und möchte es von Ihnen erfahren. Ich bin so sehr neugierig.«
Duplessis drehte an seinem Knebelbart und tat, als ob er überlege. Er wusste ganz gut, welche Wette gemeint war.
»Ich kann mich wirklich nicht recht besinnen...«
»Erst gestern fand das Zwiegespräch statt — der dicke Herr war dabei — und es wurde gesagt, sie hätten nur noch sechs Tage Zeit.«
»Dass ich nicht wüsste!«
Das Mädchen drohte ihm lächelnd mit dem Finger.
»Verstellen Sie sich doch nicht! Es handelte sich um eine Wette, die Sie im Keller der Madame Chevaulet gemacht haben, und so viel habe ich auch erlauscht, dass ein weibliches Wesen mit im Spiele ist; wer dieses weibliche Wesen nun ist, das möchte ich gern noch erfahren. Nehmen Sie es mir nicht übel, ich bin so neugierig, weil ich wirklich ein sehr langweiliges Leben zu führen gezwungen bin.«
Duplessis räusperte sich verlegen. Eben war er daran, irgendein Märchen aufzutischen, als die Begum fortfuhr:
»Ich interessiere mich nämlich deshalb hauptsächlich so für das weibliche Wesen, weil dasselbe anscheinend mit ganz seltsamen Namen benannt wurde. Einmal hieß sie die Puppe, dann das Spielzeug, die Königin, die Dingsda, die Prinzessin und was weiß ich noch alles. Nun müssen Sie doch wissen, wer damit gemeint ist.«
Duplessis tat noch immer, als könne er sich nicht besinnen.
»Zum Teufel«, dachte er, »sie wird doch nicht etwa Lunte gerochen haben? Oder vielleicht wäre das gerade recht gut, sie scheint mir entgegenkommen zu wollen.«
»Das sind alles recht hübsche Schmeichelnamen für eine Dame«, entgegnete er; »aber ich kann mich wirklich nicht besinnen...«
»Soll ich Ihnen noch mehr auf die Sprünge helfen? Ich habe es zwar nicht gehört, aber ich ahne, dass es sich um eine weibliche Person handelt, welche in vier Wochen zu erobern Sie gewettet haben; jetzt haben Sie nur noch sechs Tage Zeit, und wenn Sie Ihr Ziel erreichen wollen, so müssen Sie sich allerdings beeilen.«
Lächelnd schaute sie ihn an, und Duplessis nahm schnell einen Anlauf, die förmliche Liebeserklärung zu machen, denn er glaubte, das Mädchen fordere ihn selbst direkt dazu auf. Doch seine Freude wurde wieder gedämpft.
»Schmeichelnamen waren es übrigens nicht, die ich zu hören bekam«, fuhr sie fort, »ich habe nur die besseren, die auch nur spöttisch genannt wurden, wiedergegeben, sonst fielen auch noch solche wie — wie Gänschen und so weiter.«
»Verdammt, dass meine Freunde sich so ungeniert über sie unterhalten haben!«, dachte er.
»Nun, besinnen Sie sich, ich werde mir dann erlauben, Sie noch einmal um den Namen dieser Person zu fragen«, sagte die Begum und stand auf. »Ich bin sehr neugierig, was das für ein Wesen ist, das Sie in sechs Tagen zu erobern gedenken. Monsieur Duplessis«, sie drohte ihm schalkhaft mit dem Finger, »Sie scheinen mir ein Mädchenjäger zu sein.«
In der Tür blieb sie noch einmal stehen.
»Also vergessen Sie es nicht, ich frage Sie dann wieder. Besinnen Sie sich einstweilen!«
Es blieb Duplessis nicht viel Zeit zum Nachdenken, ein Inder kam und holte ihn.
»Sind die Offiziere schon da?«
»Ja, Sahib.«
»Wer hat die Versammlung zu solch später Nachtzeit anbefohlen?«
»Die Begum.«
»Das arme Mädchen muss seinen Namen zu allem hergeben und hat dabei gar nichts zu sagen«, dachte Duplessis; »aber ich glaube doch, ich habe viel Vorteil davon, wenn ich mich hinter sie stelle. Schaden kann's auf keinen Fall, und wenn mir das Glück nur einigermaßen günstig ist, so bin ich in sechs Tagen am Ziel; wird es etwas später, schadet's auch nichts. Duplessis, für dich beginnt eine neue Ära, dein Name kommt vielleicht noch einmal in die Weltgeschichte.«
Mit solchen hoffnungsvollen Gedanken betrat er den Saal, in welchem schon sieben Offiziere versammelt waren. Sie alle hatten die Aufgabe, die Schanzarbeiten zu leiten und die indischen Soldaten an den Geschützen exerzieren zu lassen, also eine Artillerie zu schulen, die Delhi im Falle einer Belagerung verteidigen konnte, denn die Sepoys, welche früher die Geschütze aus der Festung bedient hatten, waren den Engländern treu geblieben, zum Teil gefallen, zum Teil mit entflohen.
Es wäre nicht so leicht gewesen, diese Franzosen, auch einige Italiener, zusammenzubringen, wenn die ausgeschickten Boten nicht gewusst hätten, wo sie zu finden waren. Der Keller der Madame Chevaulet und die Weinstube der kleinen Balliot wurden noch immer stark frequentiert, die Besitzerinnen machten gerade jetzt gute Geschäfte, und dort hatten die Boten die meisten der Herren gefunden, wie sie sich nach dem frugalen Mahl auf dem Schlosse stärkten, die wenigsten waren aus den Betten geholt worden.
»Sie sind hier geblieben«, empfing Montpassier den Freund. »Sie müssen doch wissen, was eigentlich los ist.«
»Natürlich weiß ich es, die Begum hat es mir selbst gesagt!«
»Teufel, die Begum? So sind Sie schon so vertraut mit ihr? Sie haben doch nicht etwa...?«
Duplessis drehte siegesbewusst den Knebelbart.
»Nana Sahib rückt heute nacht noch mit 5000 Sepoys nach Fatehpur ab, Nicholson entgegen«, erwiderte er, »und es werden noch andere Befehle ausgegeben.«
»Hat Ihnen das die Begum selbst gesagt?«
»Gewiss, ich habe mich ja die ganze Nacht mit ihr unterhalten.«
»Sie Tausendsasa, darf man schon gratulieren?«
»Noch nicht, ich habe noch sechs Tage Zeit, wie sie wissen.«
»Die Begum war so unhöflich, uns aus der besten Gesellschaft zu reißen!«
»Bah, die Begum! Sie selbst ist ärgerlich, gerade die angenehmste Gesellschaft verlassen zu müssen.«
»Aber die Order erging auf ihren Befehl an uns.«
»Na ja, wir haben doch oft genug schon darüber gesprochen. Jetzt sehe ich klar, wir haben sie ganz richtig taxiert. Sie ist eben ein Weib, um das ein göttlicher Nimbus mit schlauer Absicht gewoben worden ist, denn die Inder müssen etwas haben, was sie anbeten können. Die Radschas machen sich nicht viel aus ihr, am allerwenigsten natürlich Bahadur und Nana Sahib, und uns gegenüber wird sie sich wohl nie als Herrin zeigen. Im Übrigen ist sie ein sehr liebebedürftiges Mädchen — nun, ich bin der richtige Mann, der...«
Der dozierende Duplessis brach schnell ab, denn eben schritt die Begum an den Offizieren vorüber, welche ihren Kameraden umringt hatten.
Sie schien die Herren gar nicht zu bemerken, keinen Blick hatte sie für dieselben, erwiderte auch nicht ihre Grüße und Verbeugungen.
Duplessis hielt es für passend, nach dem, was er eben gesagt, auch zu zeigen, wie er mit ihr stand. Er eilte auf sie zu.
»Hat auch Ihnen, gnädigste Begum, der harte Befehl des Großmoguls den Schlummer geraubt?«, begann er, fuhr aber nicht fort, denn das Mädchen blieb nicht stehen, ihn anzuhören, sondern ging, ohne den Kopf zu wenden, weiter und verschwand durch die nächste Tür.
»Das nennt man abgeblitzt!«, lachte Montpassier leise. »Ich glaube, Sie haben uns nur etwas aufgebunden.«
»Unsinn! Sie darf sich jetzt nur nichts vergeben. Es war auch Torheit von mir, so offen zu zeigen, auf welch vertraulichem Fuße wir zusammen stehen. Den äußeren Schein muss sie doch immer wahren.«
»Leutnant François!«, rief ein Radscha, in die Tür tretend und dort stehen bleibend.
Der Gerufene ging in das Nebenzimmer, blieb dort etwa fünf Minuten und kam wieder heraus. Das Gesicht des sonst so fröhlichen jungen Leutnants war plötzlich merkwürdig ernst geworden, er beantwortete keine Frage der Kameraden, sondern verließ sofort den Saal auf der entgegengesetzten Seite.
Der zweite Offizier wurde gerufen. Als er wieder heraustrat, steckte er ein Papier zu sich, aber auch er ließ sich mit seinen Kameraden nicht in das kleinste Gespräch ein. So ging es mit allen bis auf zwei, sie entfernten sich stets mit ernsten oder niedergeschlagenen Gesichtern.
Zuletzt erging die Aufforderung auch an Duplessis und Montpassier, und zwar an beide zugleich. Mit einer bösen Vorahnung leisteten sie dem Rufe Folge und waren zuerst nicht wenig erstaunt, außer der Begum und einem am Boden hockenden Schreiber, der als Schreibunterlage nach indischer Sitte nur die Handfläche benutzte, das Gemach mit Bajaderen gefüllt zu sehen.
Es waren dieselben, welche am Abend zuvor getanzt hatten, also etwa dreißig an der Zahl, und sie mussten eben erst hereingerufen worden sein, denn die letzten drängten sich noch durch die gegenüberliegende Tür. Alle zeigten verschlafene Gesichter und eine Toilette, welche verriet, dass sie jäh von ihrem Lager aufgescheucht worden waren.
Ein Blick überzeugte Duplessis, dass die Unterredung keinen günstigen Verlauf nehmen konnte. Der freundliche und liebenswürdige Zug war aus der Begum Antlitz verschwunden, ein unheimlicher Ernst stand darin ausgeprägt, und drohend musterten ihre Augen die beiden Männer, welche immer mehr ihr Selbstbewusstsein verloren.
»Wem habt ihr bei eurem Gott Gehorsam und Treue geschworen?«, begann das Mädchen mit tiefer Stimme, sich des indischen Dialektes bedienend.
»Dir, Begum!«, entgegneten beide gleichzeitig.
»Es ist mir zu Ohren gekommen, dass man meine Befehle nicht achtet oder sie nur nachlässig und unpünktlich vollzieht. Man gehorcht Bahadur und anderen Fürsten mehr als mir, man glaubt, sie seien die, welche zu befehlen hätten, und sie bedienten sich nur eines Weibes, um das Volk, das an mir hängt, williger zu stimmen. Es ist dem anders. Ich bin die einzige Person, welche zu befehlen hat, mein Wille gilt, kein anderer. Ich habe euch auf den Posten beobachtet, die ich euch anvertraut habe, und euch nachlässig gefunden. Ihr glaubt, die euch unterstellten Kulis und Sepoys kommandieren und wie Sklaven behandeln zu dürfen, während ihr umherschlendert, Zigaretten raucht und Scherz treibt. Dies wird von jetzt ab anders. Wenn ihr die euch schriftlich versprochene Belohnung erhoffen wollt, so erwarte ich anderen Eifer. Bedenkt, ihr steht unter den von mir aufgestellten Kriegsgesetzen, ich kann über Leben und Tod entscheiden, ich allein! Duplessis, in wie vielen Tagen könnte die Batterie fertig sein, an welcher du schon vierzehn Tage arbeiten lässt, ohne dass ich einen Forschritt bemerke?«
Duplessis hatte gedacht, in drei Wochen würde das der Fall sein, jetzt änderte er schnell seine Ansicht.
»In drei bis vier Tagen, Begum.«
Das Mädchen nahm vom Schreiber ein Papier und gab es Montpassier.
»Du, Montpassier, übernimmst die Fertigstellung dieser Batterie, denn für Duplessis habe ich einen anderen Posten. Es ist zwei Uhr, in 48 Stunden wirst du die schriftliche Meldung einreichen, dass die Batterie fertig und in tadellosem Zustand ist, oder du gibst dieses Schreiben ab. Es ist eine Art Wechsel. Lies es laut vor!«
Montpassier faltete das Papier auseinander, überflog es erst und erbleichte.
»Lies laut!«, befahl die Begum.
Der Offizier las mit bebender Stimme sein eigenes Todesurteil vor, welches nach Ablauf von 48 Stunden an ihm vollzogen werden würde.
»Eines von beiden wirst du abgeben, entweder deine Meldung, oder dein Todesurteil; eins darfst du behalten, du wie die übrigen Offiziere.«
Bisher hatte die Begum in ruhigem, leidenschaftslosem Tone gesprochen, jetzt begannen ihre feinen Nasenflügel zu zittern; mit einer heftigen Bewegung trat sie vor die beiden hin.
»Und nun noch eins, ehe du, Montpassier an dein Werk gehst. Es ist unter euch beiden eine Wette abgeschlossen worden, nach welcher Duplessis in vier Wochen, von jetzt ab in sechs Tagen, ein Weib gedemütigt haben und zu seinen Füßen sehen will. Wie ist der Name dieses Weibes? Sprich, Montpassier, bei deinem Leben, sprich!«
Das Herz sank den Franzosen bis in die Kniekehlen, hier gab es keine Ausrede mehr. Die Begum hatte davon erfahren, sie wusste, dass sich die Wette um sie selbst handelte, und sie wollte es nur aus dem Munde der Vorwitzigen selbst hören.
»Verzeihung gnädige Begum!«, begann Montpassier mit bebender, flehender Stimme. »In einer großen Unbesonnenheit, die wir jetzt nicht mehr begreifen können, angeheitert vom Wein, begingen wir die Torheit...«
»Wer ist dieses Weib?«, rief das Mädchen heftig. »Sag du es, Duplessis.«
Es half alles nichts, es musste heraus. Duplessis sah ein, dass er sich in diesem Mädchen ganz und gar verrechnet hatte. Er war es gewesen, mit dem gespielt worden war.
»Sei nicht unbarmherzig in deinem Zorn!«, stammelte er. »Sofort, als ich dich persönlich kennen lernte, bereute ich unsäglich, in meiner Vermessenheit dich zum Gegenstand der Wette gemacht zu haben. Verlange, was du willst, ich will meinen Frevelmut büßen.«
»Dieses offene Geständnis rettet dein Leben. Montpassier entferne dich und teile deine Zeit ein, denn jede Minute, die du vergeudest, bringt dich deinem Tode näher.«
Der Offizier ging zerknirscht und mit gesenktem Kopf hinaus; wie die Kameraden trug auch er sein schon ausgefülltes Todesurteil bei sich, und nur durch äußersten Fleiß und Energie konnte er es ungültig machen.
»Nun zu dir, Duplessis«, wandte sich die Begum wieder an diesen, »du bist also der Mann, der gewettet hat, ein jedes Weib, selbst ein solches, welches du noch gar nicht kennst, dir zu willenlosem Gehorsam zu zwingen. Schweige jetzt, ich will keine Verteidigung oder Entschuldigung hören. Sechs Tage hättest du noch Zeit, mich dir gefügig zu machen — schweige Mann — aber du siehst wohl ein, dass bei mir deine Mühe vergeblich wäre. Dennoch bin ich selbst neugierig, ob du nur geprahlt hast, oder ob du wirklich solch eine außerordentliche Macht über die Weiber besitzt, und ich will dir Gelegenheit geben, zu beweisen, dass du nicht nur geprahlt hast.«
Sie drehte sich um und deutete nach den im Halbkreis stehenden Tänzerinnen, welche ebenso wenig wie Duplessis wussten, was jetzt kommen sollte.
»Sieh diese Bajaderen, es sind zweiunddreißig. Ich enthebe dich hiermit deiner Stelle als Kommandeur einer Batterie und gebe dir, weil du solch ein Freund von Weibern bist, den Oberbefehl über diese Mädchen. Zeige, ob du sie durch deine dir angemaßte Macht zähmen und beherrschen kannst. Innerhalb von sechs Tagen wirst du sie wie die Sepoys nach englischem Kommando einexerziert haben, nach diesen sechs Tagen wirst du sie mir vorführen. Du sollst sie wie Rekruten ausbilden, und wehe dir, Duplessis, wenn ich unzufrieden mit ihren Leistungen bin. Dann bist du ein Prahlhans gewesen und dein ganzes Leben lang sollst du als Weib unter Weibern leben.«
Die Begum wandte sich kurz um und verließ das Gemach.
Wie vom Donner gerührt stand Duplessis da; im ersten Augenblick kam ihm die Sache spaßhaft vor.
Er, der französische Kavalier, als Exerziermeister von indischen Bajaderen!
Die Mädchen hatten schnell erfasst, um was es sich handelte. Plötzlich brachen sie gleichzeitig in ein schallendes, endloses Gelächter aus; sie umringten den Mann und begannen, wirbelnd um ihn herum zu tanzen, sie ergriffen ihn, rissen ihn mit sich und stießen ihn von allen Seiten.
Es hätte nicht viel gefehlt, so wäre er zu Boden gestürzt. Die Hölle schien alle Teufel losgelassen zu haben, er wusste nicht mehr, wo ihm der Kopf stand, so setzten ihm die tollgewordenen Mädchen zu.
Da erschollen Peitschenknalle, ein Eunuch mengte sich in den Kreis, links und rechts scharfe Hiebe mit einer großen Peitsche austeilend, gleichgültig, wohin sie fielen.
Aufkreischend, aber doch noch lachend, stoben die Bajaderen auseinander, aber kaum waren sie außer dem Bereiche der Peitsche, so begannen sie ihr tolles Spiel von Neuem und suchten den Franzosen in ihre Mitte zu ziehen.
Der Eunuch drückte ihm die Peitsche in die Hand.
»Keine Schonung, Franke«, schrie er ihm in dem Lärm zu, »schlage die Weiber, schlage zu, oder sie werden dich schlagen. Halt die Peitsche fest, sonst nehmen sie sie dir weg!«
Als wäre er in einem Käfig mit wilden Tieren, so huschte der Mann, jetzt ohne Peitsche, schnell zur Tür hinaus, und Duplessis war mit der kreischenden Mädchenbande allein.
Er sollte jetzt erst kennen lernen, was es heißt, sich in der Gesellschaft zügelloser Bajaderen zu befinden, wenn sich diese nicht auf Befehl ihres Herrn der Liebe hingeben müssen. Duplessis hatte eine Aufgabe bekommen, die einer ewigen Pein in der Hölle glich. Vorläufig war er sich seiner Lage noch nicht völlig bewusst, nur die Worte der Begum: ,Wehe dir, wenn ich unzufrieden mit ihren Leistungen bin; dein ganzes Leben lang sollst du dann als Weib unter Weibern leben!‹, klangen ihm noch sehr unangenehm in den Ohren und erweckten in ihm ein unheimliches Angstgefühl.
Doch er musste sich beeilen, wollte er diese teuflische Mädchenschar bändigen. Sechs Tage hatte er nur Zeit, dann sollten sie als Soldaten einexerziert sein.
Es war Dick, der von früher Jugend auf zwischen Indianern und in beständigem Kampfe mit diesen gelebt hatte, sehr leicht geworden, einen Weg über die hohe Stadtmauer zu finden, ohne dabei von einem Menschen erblickt zu werden, und ebenso sicher und unbemerkt erreichte er den ihm von Reihenfels beschriebenen Ort.
Der das Grabgebäude des Humayun umgebende Friedhof wurde von den abergläubischen Indern, wie schon erwähnt, auf das Ängstlichste gemieden, und seitdem das Gerücht aufgetaucht war, ein Agni triebe dort sein Wesen, man hätte das irrende Feuer dort erblickt, noch mehr als früher.
Dick hatte von Reihenfels die Weisung erhalten, falls er einmal in Gefahr kommen sollte, zum Gespensterspielen seine Zuflucht zu nehmen, und der pfiffige Trapper brauchte keine lange Auseinandersetzung, um das Nützliche dieses Ratschlages einzusehen.
Er fand schnell das Loch, in dem einst Reihenfels mit Jeremy versunken war. Ersterer hatte ihn gewarnt, sich in die Gänge zu begeben, denn auch der sonst außerordentlich scharfsinnige Trapper konnte sich in ihnen verirren. Nur in der Not sollte er Gebrauch von diesem Versteck machen.
Als er mitten in der Nacht das beschriebene Loch erreichte, versuchte er dennoch erst den Boden desselben zu betreten.
Seine in der Dunkelheit sehenden Augen erkannten den Grund, und er schätzte die Tiefe ganz richtig auf zwanzig Meter.
Da nahm er von seinem Gürtel eine zusammengewickelte Lederschnur, rollte diese auf und hielt in der Hand ein langes Lasso, wie es in Amerika zum Fangen von Pferden, Rindern und auch der Feinde gebraucht wird. Nachdem Dick die Schlinge an dem nächsten Baumstamm befestigt hatte, warf er das andere Ende in das Loch, glitt an der Lederschnur hinunter und erreichte auch glücklich den Boden.
Er tastete an den Wänden herum und fand das von Reihenfels beschriebene meterhohe Loch, durch das man in die unterirdischen Gänge gelangte. Schon wollte er wieder hinaufklettern, vorläufig mit dem Ergebnis seiner Untersuchung zufrieden, als er lauschend stehen blieb.
Aus dem Loch an der Erde schlugen Töne an sein Ohr, es klang wie das Murmeln von Stimmen.
Dick legte das Ohr an die Erde und horchte. Deutlich konnte er menschliche Stimmen vernehmen, aber nicht die Worte selbst.
Ohne Zögern beschloss er, trotz der Warnung von Reihenfels, sich in die Gänge zu wagen, und führte seinen Vorsatz sofort aus.
Ein Licht besaß er nicht, musste seine Wanderung also in vollständiger Finsternis antreten. Er tastete sich immer an der rechten Wand entlang und merkte sich genau, wenn er abschwenkte; so war es ihm allerdings möglich, sich zurückzufinden, aber es war sehr die Frage, ob dieser Weg ihn auch dahin führte, wo die Stimmen erklangen.
Er gelangte richtig in den hohen Gang, in dem er sich aufrichten konnte, hier aber hörte er nicht mehr das Murmeln, er wartete lange, ohne dasselbe wieder zu vernehmen.
Etwas Anderes war es, was nun seine Aufmerksamkeit fesselte.
In einem Winkel stieß sein Fuß an etwas Weiches, als er es befühlte, fand er einige übereinandergeschichtete Decken, ferner, als er herumtastete, ein irdenes Trinkgefäß, einen Krug, ein haariges Fell und einige starke Äste.
Es war, als hätte sich hier jemand ein Lager hergerichtet, auf dem er die Stunden der Ruhe zubrachte.
Mehr konnte Dick nicht erforschen, und da das Stimmengemurmel nicht wieder erklang, Dicks Aufgabe auch eine ganz andere war, als sich mit dieser neuen Entdeckung zu beschäftigen, so machte er sich auf den Rückweg und gelangte sicher wieder an den Ausgangspunkt zurück.
Gewandt kletterte er an der Lederschnur empor, löste sie vom Baum, ergriff seine Büchse und begab sich dann nach dem nächsten steinernen Grab, in das er sich legte, ohne dass ihm die menschlichen Knochenüberreste darin Grausen einzuflößen vermochten.
Hier sollte er warten, bis Reihenfels kam, wenigstens drei Tage, falls derselbe so lange abgehalten wurde.
Dick hatte Proviant bei sich, überdies machte er sich nicht viel aus dem Hunger. Sein Magen war daran gewöhnt, tagelang ohne Nahrung und Wasser zu sein.
Er entzündete seine Pfeife, ohne den Schein des Feuers zu verbergen, schlug laut mit dem Stahl gegen den Feuerstein — jedes außergewöhnliche Geräusch und jedes Licht vermehrte ja nur die Angst der etwa anwesenden Inder — und schlief endlich über dem Rauchen ein.
Die Morgensonne erst weckte ihn, und Dick sah sich die Umgegend genauer an.
Vor ihm erhob sich das imposante Monument, das noch nicht ganz zerfallen, aber dem Verfall geweiht war. Das Gebäude musste betreten werden können, wenigstens führten Türen ins Innere, auch Öffnungen wie Fenster gab es, vielleicht waren sogar richtige Zimmer darin.
Nach oben wurden diese Öffnungen immer kleiner, und durch die obersten flatterten zahlreiche Tauben ein und aus. Sie mussten also in dem alten Gemäuer nisten, und zwar sicher, denn Dick nahm an, dass sie hier vor Menschen Ruhe hatten und auch vor den Falken und anderen Stoßvögeln Schutz fanden, die hoch in der Luft ihre Kreise zogen.
Aber was war das? Erschien dort oben an einem Fenster nicht ein menschliches Gesicht? Dicks Augen trogen nie, es war wirklich der Kopf eines Mannes, und zwar eines Inders. Was hatte der dort zu suchen?
Am meisten wunderte sich der erfahrene Trapper, dass die Tauben sorglos durch das Loch huschten, an dem der Mann stand; sie fürchteten die Anwesenheit eines Menschen also nicht.
»Das ist ja seltsam«, murmelte er in den roten Bart. »Es ist nicht anders möglich, als dass dort ein Taubenschlag eingerichtet ist, in dem die Tierchen gepflegt werden. Habe damals nicht gehört, dass in diesem Grabmonument so etwas ist, und wüsste Reihenfels, dass da drinnen Menschern sind oder manchmal hineinkommen, um nach den Tauben zu sehen, so hätte er es mir gesagt, damit ich mich vor ihnen hüte.«
Er beobachtete den Mann, der nicht vom Fenster wich, und er hätte darauf schwören können, dass dessen Augen unausgesetzt dahin gerichtet waren, wo er, Dick, lag. Doch gesehen konnte er nicht werden, dafür sorgte er schon.
Die einzige Möglichkeit war die, dass der Inder in der Nacht das Blitzen von Dicks Feuerzeug gesehen hatte und sich nun überzeugen wollte, ob das vermeintliche Gespenst, der Feuergeist, auch noch am hellen lichten Tage sichtbar wäre.
Endlich verschwand der Kopf wieder.
Dick wartete bis Mittag, ohne dass Reihenfels gekommen wäre.
Um diese Zeit hörte er Schritte, aber sie waren auch nur für das scharfe Ohr des Trappers hörbar, denn jener Kuli dort, der sich schnell zwischen den Steinsärgen hin dem Grabmonument zu bewegte und sich dabei fortwährend furchtsam umsah, schlich auf den Zehen. Der Mann wurde offenbar von Gespensterfurcht geplagt und ging, wenn auch schnell, doch so leise wie möglich, um die am Tage schlafenden Geister nicht zu wecken.
Dick hütete sich, ein Lebenszeichen von sich zu geben oder sich sehen zu lassen. Der Mann verschwand in dem Monument, und gleich darauf kamen an demselben hohen Mauerloche zwei Köpfe zum Vorschein. Beide Männer sprachen eifrig zusammen, und eine Hand deutete wiederholt dahin, wo Dick lag.
»Jetzt erzählt der erste dem zweiten von dem Licht, das er in der Nacht gesehen hat«, brummte der Rote. »Und nun rutscht dem zweiten das Herz noch vollends in die Hosen, das heißt, wenn der Kerl unter dem Frauenrock überhaupt eine Hose anhat!«
Das Gespräch oben wurde fortgesetzt, die beiden machten ängstliche Gesichter, während der unsichtbare Dick über die Bekleidung der Inder Betrachtungen anstellte. Er zog einen Vergleich zwischen ihnen und den Delawaren, einem Indianerstamme, dessen Männer ebenfalls Weiberröcke, aber ein männliches, furchtloses Herz im Busen tragen.
Dann änderte sich das Benehmen der Inder; sie blickten scharf in die Ferne, als musterten sie den Himmel, schrien dann lebhaft und schwenkten Tücher zum Fenster hinaus.
Dick sah ebenfalls nach oben, konnte aber nichts Anderes erblicken als eine Taube, hinter welcher ein Sperber her war. Sonderbarerweise benutzte die Taube nicht ihre Schnelligkeit — die Tauben sind die am schnellsten fliegenden Vögel — um dem Räuber der Lüfte zu entgehen. Angstvoll flatterte sie hin und her oder beschrieb große Bogen, ohne dem sicheren Taubenschlag zuzustreben.
Der Sperber näherte sich ihr mehr und mehr, er wartete die Gelegenheit ab, bis er mit sicherem Stoß auf sie schießen konnte.
Warum aber floh die Taube nicht und verhielt sich so sinnlos, sodass sie in die Klauen des Würgers kommen musste?
Dick hatte bald die Ursache ihres Verhaltens gefunden. Noch ein anderer Raubvogel, mehr in der Nähe des Monuments, schwebte mit ausgebreiteten Flügeln in der Luft, und wäre die Taube direkt auf ihr Ziel zugeflogen, so wäre sie diesem zweiten Feinde in die Fänge geraten.
Deshalb flatterte sie teils im Bogen, teils im Zickzack hin und her, senkte sich dabei und suchte so den Boden, um dort ein Versteck zu erreichen.
Dies wussten auch die beiden Raubvögel, und so weit wollten sie die Taube nicht kommen lassen, denn ihr Element war die Luft, nicht die Erde.
Plötzlich, als sie den Moment für gekommen hielten, weil die Taube mit ausgebreiteten Flügeln einen Augenblick ruhig schwebte, stießen sie herab und erreichten das Opfer gleichzeitig.
Dick sah ein wirres Knäuel in der Luft, Federn stoben umher, dann stürzte die Taube flügellahm herab, während die beiden Rivalen krächzend und sich zankend in die Luft emporstiegen. Jetzt waren sie selbst aneinandergeraten. Einer der Räuber ließ seine Wut über die entgangene Beute am anderen aus.
Die Taube aber stürzte zufällig gerade in das Grab, in welchem Dick lag.
Der Trapper nahm das Tierchen, aus dessen Rücken Blut floss, und untersuchte es.
Das Herz Dicks war durch das raue Leben noch nicht verhärtet worden, er fühlte Mitleid mit dem unschuldigen Geschöpf, welches in seiner Hand zitterte und angstvoll die Augen verdrehte.
Ein Schnabelhieb hatte ihm eine tiefe Wunde beigebracht, an der es sowieso sterben musste, die Fänge der Raubvögel hatten auch die Flügel zerfleischt und gebrochen.
»Ich kann dir nicht wieder aufhelfen«, murmelte Dick; »aber einen Liebesdienst will ich dir doch erweisen.«
Damit drehte er dem Vogel den Hals um — er brauchte wenigstens nicht mehr zu leiden.
»Was mögen die beiden Kerls dort nur mit dem Vogel zu tun haben?«, dachte er dann weiter. »Sie wollten erst in ihrer Dummheit die beiden Stößer durch Schreien und Tuchwedeln verscheuchen, und nun sehen sie in einem fort hierher und deuten nach mir, oder vielmehr dahin, wohin die Taube gestürzt ist. Denn mich können sie doch nicht sehen, sonst würden sie sich wohl anders verhalten. Hm, die Taube muss für sie doch etwas mehr sein, als nur ein eierlegender und verspeisbarer Vogel.«
Er hob das vorhin achtlos fortgeworfene Tier wieder auf, und wie er es so aufmerksam betrachtete und in der Hand hin und her drehte, entdeckte er plötzlich eine weiße Schwanzfeder, auf welche ein seltsames Muster gezeichnet war.

Doch nein, das war kein Spiel der Natur, das waren künstlich mit Farbe oder Tinte aufgetragene Zeichen, Punkte und Striche, symmetrisch geordnet und sich oft wiederholend. Kein Zweifel, diese Feder trug Schriftzeichen, waren doch die übrigen Schwanzfedern völlig weiß und fleckenlos!
Dick konnte die Schrift nicht lesen, er hielt sie auch nicht für Indisch. Aber eine Taube, welche beschriebene Schwanzfedern hatte?
Dick richtete die Augen nach dem Grabmonument, aus dessen Fenster die beiden Inder noch immer nach seinem Versteck sahen, und plötzlich schlug er sich vor die Stirn, eine Ahnung ging in ihm auf.
Wahrhaftig, das war eine Brieftaube, von denen er schon hatte erzählen hören. Der aus dem Schlage entnommenen Taube wird entweder ein Briefchen um den Hals gebunden, oder man schreibt ihr gleich, was sicherer ist, die Nachricht auf eine Feder, lässt sie fliegen, und das freigelassene Tier findet mit Hilfe seines unglaublichen Orientierungssinnes immer wieder seinen Schlag, und wenn es auch tagelang oder Hunderte von Meilen weit davon entfernt ist. Die Brieftaube wird da benützt, wo es keine andere Verbindung gibt; so nehmen zum Beispiel Nordpolfahrer, durch die Wildnis Reisende und Luftschiffer solche geflügelte Postboten mit, aber man verwendet sie auch im Kriege. Briefe und Depeschen können abgefangen werden, wenn die Verbindung nicht überhaupt schon gestört ist; die schnell-fliegende Taube ist schon sehr schwer zu schießen, und man weiß doch auch gar nicht, ob sie eine Nachricht expediert. Raubvögel können die Taube wohl erbeuten, doch wie selten mag dieser Fall einmal eintreten. So ist die Brieftaubenpost im Kriege die sicherste und nach dem Telegrafieren die schnellste.
Dick war darüber zwar nicht besonders genau orientiert, er hatte nur schon von Brieftauben gehört, doch sein scharfer Verstand sagte ihm, dass hier eine Kriegsdepesche vorlag, in einer Geheimschrift geschrieben.
Nun konnte er sich auch das Benehmen der beiden Inder dort erklären.
Sie hatten die von den Sperbern verfolgte Taube als eine der ihrigen erkannt; vielleicht erwarteten sie eine Depesche; naiv suchten sie die Raubvögel durch Schreien zu verscheuchen, sie sahen die Taube herabstürzen, wussten, wo sie lag, wagten aber in ihrer Gespensterfurcht nicht, den berüchtigten Friedhof zu betreten und die wichtige Taube zu holen.
»Wenn Reihenfels kommt, werde ich ihm die Feder zeigen«, dachte der Trapper, riss sie aus und steckte sie zu sich, »der ist so ein Tausendkünstler und kann dergleichen enträtseln, wie mir Charly erzählt hat. Dieser Krieg geht mich eigentlich nichts an, meinetwegen mögen sie sich gegenseitig abschlachten; aber vielleicht steht doch etwas Wichtiges auf der Feder. Also das dort ist eine sogenannte Brieftaubenstation! Hm, jedenfalls von den Franzosen eingerichtet. Wenn nur Reihenfels erst käme!«
Aber der Erwartete kam nicht. Es wurde Abend, und er war nicht da. Doch Dick hatte Warten gelernt; ruhig blieb er liegen und beobachtete die Umgegend. Die beiden Inder entfernten sich nicht, sie spähten immer mit angstvollen Gesichtern bald nach Dicks Versteck, bald nach einer anderen Richtung in die Ferne.
Da kam von dieser Seite her ein Mann gegangen, in einen europäischen Tropenanzug gekleidet, und Dick kauerte sich plötzlich, die Büchse in der Hand, wie zum Sprunge zusammen, denn jener Mann dort war Monsieur Francoeur, dessentwegen Dick die gefährlich e Expedition gemacht hatte. Diesen Mann wollte und musste er über verschiedenes befragen.

Francoeur ging geradeswegs auf das Monument zu. Dick sah ihn hineingehen, und bald erschien er oben am Fenster, wo er heftig auf die beiden Männer einsprach.
Diese entschuldigten sich anscheinend, deuteten nach dem Grabe, in das die Taube hineingestürzt war, und bekreuzigten sich dann, indem sie sich an die Schulter schlugen.
Der Franzose musste sie aufgefordert haben, ihn zu begleiten, sie weigerten sich aber. Schließlich ging er allein, trat aus dem Monument und schritt auf das steinerne Grab zu.
Sofort war Dicks Plan fertig.
Die Taube ließ er liegen, er selbst kroch auf Händen und Füßen aus dem Sarg und versteckte sich hinter dem nächsten Baum. Gesehen worden konnte er dabei nicht sein, denn Francoeur ging arglos weiter.
Jetzt hatte er das Grab erreicht. Mit einem Freudenruf sprang er hinein und hob die Taube auf.
»Gott sei gelobt«, jubelte er förmlich auf, »ich habe sie!«
»Die Taube wohl, aber die beschriebene Schwanzfeder habt Ihr nicht!«, rief eine spöttische Stimme in nächster Nähe.
Erschrockener war Francoeur wohl niemals gewesen als in diesem Augenblick, da diese Worte an sein Ohr schlugen und er aufblickend die rote Gestalt, die Büchse auf ihn anschlagend, hinter dem Baume stehen sah.
Er erkannte diesen Mann sofort wieder. Es war jener Pelzjäger, der ihm schon einmal solch eine glänzende Probe seiner Schlauheit gegeben hatte, der Genosse Mister Woodfields.
Francoeurs erste Bewegung war nach dem Revolver im Gürtel gewesen.
»Keine Bewegung, keinen Griff, am allerwenigsten nach einer Waffe, oder es war Eure letzte Stunde, und Ihr füllt das Grab aus, in dem Ihr jetzt steht.«
Diese Worte genügten. Francoeur stand bewegungslos da.
»Nun, Monsieur Francoeur, oder Monsieur Janvier, wie Ihr Euch früher zu nennen beliebtet«, fuhr Dick gemächlich fort, »seid Ihr geneigt, eine kleine Konversation mit mir in Frieden abzuhalten?«
Des Franzosen Gedanken wurden augenblicklich von etwas Anderem beschäftigt. Er warf einen Blick auf die tote Taube in seiner Hand, er sah sofort, dass die betreffende Schwanzfeder fehlte, und er erbleichte noch mehr.
»Wo ist die Feder?«, stammelte er.
»Die habe ich.«
»Gebt sie her, sie hat für Euch keinen Wert.«
»Da mögt Ihr allerdings recht haben, aber da ich jetzt sehe, welchen Wert sie für Euch hat, so bekommt Ihr sie gerade nicht.«
»Mann, gebt mir die Feder, Ihr dürft für sie verlangen was Ihr wollt.«
»Und wenn Ihr sie mir in Gold aufwiegen würdet«, lachte Dick, »Ihr bekämt sie nicht, weil das nämlich nicht viel Gold wäre.«
»Stellt einen Preis.«
»Gut, das werde ich gleich tun. Erst sagt mir, was darauf steht — pst, rührt Euch nicht, mein Finger liegt am Drücker, und ich kenne keine Schonung, am allerwenigsten bei solch einem Menschen, wie Ihr seid.«
»Sagt Eure Forderung!«
»Was steht auf der Feder?«
»Eine Kriegsdepesche.«
»Hm, das glaube ich Euch nicht. Ich glaube vielmehr, da steht etwas für Euch Verfängliches darauf.«
Der Franzose knirschte mit den Zähnen. Dick hatte allerdings das Richtige erraten.
»Sagt mal, Monsieur«, fuhr Dick gemütlich fort, »kennt Ihr mich eigentlich noch?«
»Nein.«
»Ach, macht doch keine Geschichten! Ich stellte mich Euch schon einmal in Wanstead vor. Na, Ihr habt eben ein schwaches Gedächtnis, ich glaube, Ihr leidet an Gehirnschwindsucht. Wisst Ihr, Ihr zogt die Stiefelettchen von dem Straßenräuber, der schwarzen Maske, an, aber sie waren Euch wohl etwas zu eng, denn Ihr machtet ein ganz verzweifeltes Gesicht. Drückt Euch jetzt wieder ein Hühnerauge? Habt Ihr wieder fremde Stiefel angezogen? Ihr beißt Euch auf die Lippen, als wolltet Ihr vor Schmerz aus der Haut fahren. Geniert Euch nicht, fahrt nur zu — pst, aber nicht rühren, sonst knalle ich Euch eins aufs Fell, so leid mir es auch tun sollte.«
»Macht ein Ende, Bursche!«, zischte Francoeur. »Ich sehe, ich bin in die Hände eines Wegelagerers gefallen.«
»Nanu, das ist merkwürdig! Was ich von Euch will? Die Feder will ich Euch wiedergeben, weil Euch so erschrecklich viel daran gelegen ist.«
»So gebt sie her!«
»Und was gebt Ihr mir dafür?«
»Was Ihr verlangt!«
»Ich bitte höflichst um Beantwortung einiger Fragen.«
»Hol Euch der Geier! Behaltet denn die Feder!«
Francoeur ahnte ungefähr, welche Fragen der Mann stellen würde, und diese zu beantworten hatte er wenig Lust. Geld hätte er gern so viel gegeben, wie gefordert wurde, er hätte selbst zur Befreiung von Gefangenen verholfen, aber verfängliche Fragen an diesen schlauen Burschen beantworten — nein.
Doch Dick ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, er war seiner Sache sicher.
»Oho, Ihr denkt wohl, weil es eine Geheimschrift ist, wäre sie für unsereinen wertlos?«
»Denkt und glaubt, was Ihr wollt!«
»Ich werde sie Mister Reihenfels zum Buchstabieren geben, und der wird bald heraushaben, was sie enthält. Wenn es dann Bahadur oder sonst so ein großmoglicher Herr erfährt, dann häng man Euch vielleicht an den Galgen.«
Dick entging nicht, wie der Franzose zusammenzuckte. Er hatte also wiederum das Richtige getroffen.
»Nun, seid Ihr geneigt, mir zu antworten?«
»Was wollt Ihr wissen?«
»Wo ist der Felsentempel, in welchem die Thugs Menschen schlachten, und wo Nancy gefangengehalten wird. Ihr wisst doch, jenes Mädchen, welches Ihr oben in Nordamerika entführtet.«
Francoeur stierte finster vor sich hin in seinem Innern ging ein Kampf vor sich. Er sollte dieses Geheimnis preisgeben. Kam sein Verrat heraus, so war er geliefert, aber anderseits musste er unbedingt in den Besitz der Feder kommen.
»Nun, wollt Ihr es mir nicht sagen?«
»Gut, Ihr sollt es erfahren. Gebt jedoch erst die Feder her!«
Dick brach in ein lautes Lachen aus.
»Dass Ihr mich auf solch plumpe Weise nicht übertölpeln könnt, muss Euch doch Euer Verstand sagen, und wenn Ihr auch noch so wenig habt. Wo ist der Tempel der Kali?«
Francoeur zögerte eine Weile, dann sagte er mit gepresster Stimme.
»Ich will es Euch beschreiben. Dieser Felsentempel liegt nordöstlich von hier in den Ausläufern des Himalaja. Habt Ihr von der Stadt Jalenaut gehört?«
»Die kenne ich sogar sehr genau.«
»Woher?«
»Das geht Euch nichts an. Weiter!«
»Verlasst Ihr diese Stadt und wendet Euch nach Norden, so kommt Ihr in ein Hügelland, welches schnell immer gebirgiger wird. Erreicht Ihr den Fluss Himat, so fragt nach dem Dorfe Eskandera. Auf dem Wege dahin erblickt Ihr schon einen außergewöhnlich hohen Berg, dessen Gipfel noch ein mächtiger Felsen krönt. In diesen Berg ist der Felsentempel der Kali eingehauen. Wie Ihr hineinkommt, kann ich Euch nicht sagen, denn ich selbst habe keinen Zutritt, wüsste mir auch keinen zu verschaffen. Ich bin ehrlich und offen gewesen, nun seid auch Ihr's — gebt mir die Feder!«
Der Franzose hatte Dicks Gesicht nicht beobachtet, sonst hätte er bemerken müssen, dass sich darin während der Beschreibung das größte Erstaunen widergespiegelt hatte.
Er kannte die geschilderte Gegend sehr gut; denn eben dort, hatte Kiong Jang behauptet, sei er gleich im Anfang seiner Flucht durchgekommen, er wollte gewisse Felsen und Bäume wiedererkennen, dann aber wurde er manchmal vollständig irre an sich selbst.
Vor allen Dingen konnte er die Schlucht nicht wiederfinden, wo er zuerst wieder das Tageslicht erblickt hatte; aber bei der Behauptung blieb der Chinese, dass sich der Felsentempel ganz in der Nähe befinden müsse. Im Dorfe Eskandera befanden sich auch die Zurückgebliebenen.
Sollte Francoeur also doch das Geheimnis verraten haben? Nein und abermals nein, daran konnte Dick unmöglich glauben. Dieser Franzose war schlau, er gab das Geheimnis sicher nicht eher preis, als bis er im Besitz der Feder war, oder bis er eine Garantie hatte, sie zu bekommen.
»Nein, Monsieur, ich glaube Euch nicht. Frag nicht erst, warum. Entfernt Euch, wenn Ihr nicht mit einem Stück Blei nähere Bekanntschaft machen wollt. Ihr wisst, ich zaudere nicht. Entfernt Euch eins — zwei —«
»Halt«, rief Francoeur, »ich will Euch etwas Anderes sagen.«
»Aha, Ihr habt also gelogen.«
»Nein, ich habe nicht gelogen.«
»Der Tempel befände sich wirklich dort?«
»Der Tempel befindet sich wirklich dort, aber er ist leer, durch Sprengungen sind die Zugänge verschüttet worden, das Aussehen der ganzen Umgegend hat sich verändert.«
»Also eine Art von Umzug.«
»Ja, das Heiligtum der Thugs befindet sich jetzt wo anders.«
»Wo?«
»Ich will es Euch sagen, wenn Ihr mir die Feder gebt.«
»Und Euch will ich nun meine Bedingungen stellen, unter denen Ihr die Feder bekommt. Ich weiß, wie ungeheuer wichtig dieselbe für Euch ist, ich schwöre Euch aber, Ihr sollt sie nicht eher bekommen, als bis ich sehe, dass Ihr mich nicht getäuscht habt. Beschreibt mir den Ort, wo sich der Felsentempel befindet, in dem Nancy ist, und, bei meinem Wort als ehrlicher Mann, ich werde Euch die Feder einhändigen.«
»Also erst dort, wo sich der Tempel befindet?«
»Nicht eher.«
»Dann müsste ich Euch begleiten.«
»Tut das, führt mich selbst!«
»Das kann ich nicht.«
»So gebt mir einen treuen Mann mit!«
»Ich weiß keinen.«
»Das ist freilich schlimm. Doch hört, Monsieur. Ihr habt da oben genug Tauben, die den Weg wieder nach ihrem Schlage zurückfinden. Gebt mir eine solche mit, und wenn ich Eure Aussage bewahrheitet finde, so schwöre ich Euch, die Feder der Taube unterzubinden und sie fliegen zu lassen. Nun, seid Ihr damit einverstanden?«
Francoeur zögerte lange mit einer Antwort.
»Wenn Ihr aber nicht Wort haltet?«
»Monsieur, schließt nicht von Euch auf andere! Nicht jeder ist solch ein Schuft wie Ihr.«
»Oder wenn die Taube nicht ankommt?«
»Dafür kann ich nicht. Also los, antwortet; entweder — oder! Wenn Ihr auf meinen Vorschlag nicht eingeht, so bekommt die Feder noch heute jemand, der sich mit der Schrift beschäftigen wird, und dann, ich weiß es wohl, dann seid Ihr geliefert.«
»Wohlan, ich will Euch trauen!«
»Danke sehr! Also wo ist der Aufenthaltsort von Nancy?«
»Ich gehe erst die Taube zu holen. Schießt mich nicht von hinten nieder.«
»Hahaha, könnte ich das nicht schon jetzt tun? Verdient hättet Ihr es eigentlich.«
Francoeur ging in das Monument zurück und kam bald mit einem kleinen Holzkäfig wieder, in dem sich eine Taube befand.
»Also Ihr versprecht, mir die Feder zu schicken, wenn Ihr seht, dass ich die Wahrheit gesprochen habe?«
»Bei meinem Ehrenwort. In dem Augenblick, da ich weiß, dass Ihr mich nicht betrogen habt, binde ich die Feder der Taube an den Schwanz und lass sie fliegen. Setzt das Bauer hin.«
Francoeur hatte doch Vertrauen zu der Ehrenhaftigkeit dieses Mannes, er glaubte ihm.
»Wo ist nun dieser Felsentempel?«
»Nur etwa vier Meilen von Eskandera entfernt«, entgegnete Francoeur, dessen Unentschlossenheit besiegt war, »liegt eine Burg, welche dem Sirdar Akkallah, einem seines Reichtums wegen bekannten Häuptling, gehört...«
»Ah, das ist die neuerbaute Burg, mehr schon eine kleine Festung.«
»Ja, sie ist erst vor zwei Jahren fertig geworden. Dieser Akkallah, obgleich man ihn für einen Freund der Engländer hält, ist selbst ein Thug, und er hat die Burg auf dem Felsen bauen lassen, in welchem sich der große Tempel der Kali befindet. Seit aus dem früheren Tempel Gefangene entflohen sind, haben die Thugs ihr Heiligtum wieder nach dem alten Tempel verlegt. Er befindet sich unter der Burg Malangher.«
Dick musterte den Sprecher scharf. Jetzt glaubte er, dass dieser die Wahrheit gesagt hatte, denn er brachte die Worte nur scheu und zögernd heraus.
»Gut! Und wie gelange ich in die Burg?«
»Zu der Burg hat jeder Freund der Engländer Zutritt.«
»Richtig, Akkallah gibt sich ja selbst für einen aus. Aber wie gelange ich in den Tempel?«
»Ich glaube, ein jeder, der diese Burg betritt und kein Thug ist, macht Bekanntschaft mit dem Innern des Berges.«
»Das heißt, er wird ein Opfer der Thugs?«
»So ist es.«
»Hm, das ist freilich schlimm. Ich nehme an, Ihr verratet, dass ich nun um dieses Geheimnis weiß.«
»Was fällt Euch ein! Dann gebe ich mich ja selbst als Verräter an und habe die Rache der Thugs zu fürchten.«
»So beruht unser Schweigen auf Gegenseitigkeit. Ich werde Euch nicht verraten und Ihr mich nicht. Jetzt, Francoeur, entfernt Euch und wagt keinen Versuch, mich stumm zu machen; denn es würde Euch nicht gelingen. Ich könnte Euch jetzt, da Ihr das Geheimnis verraten habt, niederschießen, doch ich tu's nicht, weil auch Mister Woodfield noch ein Wort mit Euch zu sprechen hat. Wäre es möglich, ich würde Euch selbst gefangen mitnehmen, aber es geht nicht, ich gehe allein. Merkt Euch also. Habt Ihr mich betrogen, so soll die Feder zum Ankläger gegen Euch werden, und ich vermute, dann habt Ihr Eure Rolle hier ausgespielt. Im anderen Falle werde ich mein Wort halten. Entfernt Euch und hütet Euch, mir noch einmal zu Gesicht zu kommen. Das andere macht mit Mister Woodfield aus.«
Francoeur drehte sich langsam um und ging. Als er hinter sich ein Geräusch hörte, legte er schnell die Hand an den Revolver und wendete den Kopf.
Dick war allerdings hinter dem Baume vorgetreten und bückte sich, um das Vogelbauer aufzuheben, aber sein Revolver war auf Francoeur gerichtet, ebenso wie seine Augen.
»Gebt Euch keine Mühe, mich zu hintergehen. Es gelingt Euch doch nicht.«
Noch einmal versuchte der Franzose den Mann, dem er ein so großes Geheimnis verraten hatte, zu töten. Er stand oben am Mauerloch des Monuments, ein Gewehr in der Hand, den Kolben an der Wange und beobachtete den Trapper, wie dieser gleich einem Wiesel von Stein zu Stein schlüpfte, mit schnellem Sprung über eine Blöße setzte und hinter jeder Deckung Schutz suchte, denn auch er wusste, dass Francoeur ihm nur gar zu gern einen Todesboten nachgesandt hätte.
Da knallte es, und neben Dick, der eben über einen freien Platz gesprungen war, schlug klatschend ein Stück Blei an einen steinernen Sarg.
Im nächsten Augenblick vernahm Francoeur einen peitschenähnlichen Knall, und gleichzeitig ward ihm sein Gewehr wie von einer unsichtbaren Gewalt aus der Hand gerissen. In weitem Bogen flog es durch die Luft; unten sah er es mit total verbogenem Laufe liegen. Die nie fehlende Kugel aus der Büchse des Trappers hatte es getroffen.
»Monsieur Francoeur!«, klang Dicks drohende Stimme aus weiter Ferne. »Ich hätte Euch töten können, aber ich schonte Euch, weil Mister Woodfield Euch noch einmal als Monsieur Janvier sprechen will.«
Dann sah der Franzose den Trapper nicht mehr, und er traf auch keine Anstalten, den Freund der Engländer in den Mauern Delhis festzuhalten.
Es war schon Mitternacht vorüber, als sich der Erdversenkung zwei Gestalten näherten, von denen die eine ein Mann, die andere offenbar ein Weib war.
Letzteres schmiegte sich ängstlich an seinen Begleiter.
»Hätte ich gewusst«, flüsterte eine Mädchenstimme, »du würdest mich hierher führen, ich wäre dir nicht gefolgt.«
»Sei ruhig, Makalli! Nur böse Menschen haben Gespenster zu fürchten, die Gespenster ihres Gewissens. Dir aber, die du eine gute Tat vorhast, werden sie nichts anhaben können.«
»Ein Agni soll hier umgehen.«
»Er ist umgegangen, er tut's nicht mehr«, sagte Makallis Begleiter, Reihenfels, und wie ein schmerzlicher Seufzer klangen seine Worte.
Sie umgingen die Versenkung, suchten die nächsten Gräber ab, warteten auch lange Zeit, aber von Dick, den Reihenfels hier zu treffen gehofft, war weder etwas zu sehen noch zu hören.
Der Bajadere Vorhaben duldete keine Verzögerung, und so musste Reihenfels den Friedhof mit schwerem Herzen wieder verlassen, ohne von Dicks Schicksal etwas zu wissen.
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.