
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software

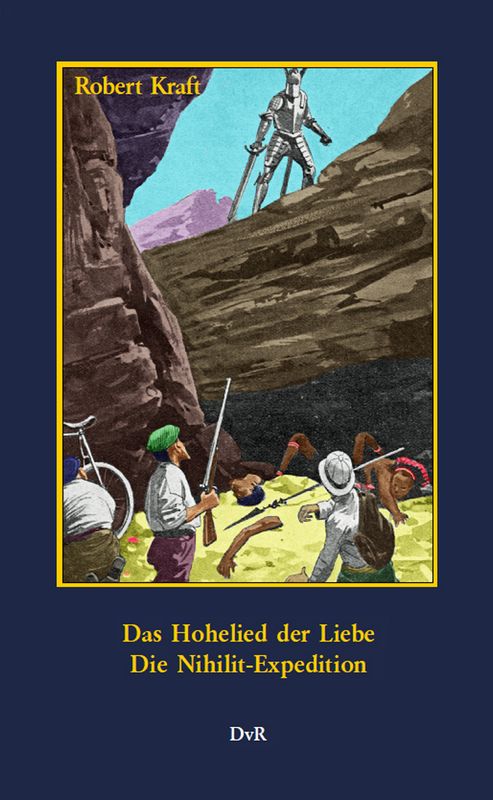
Verlag Dieter von Reeken, 2024
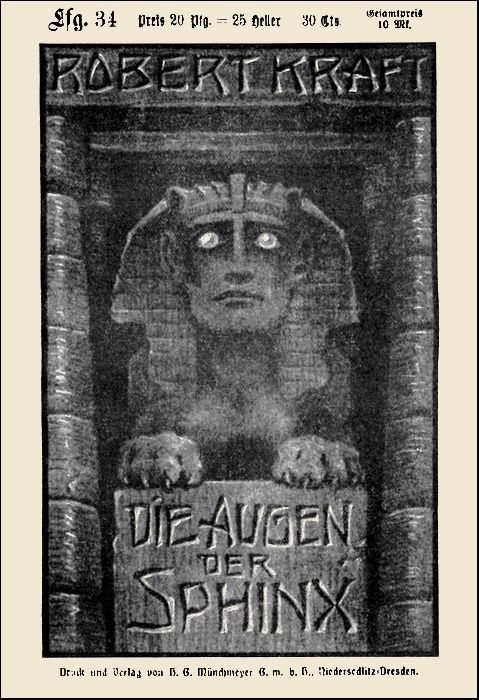
Das Hohelied der Liebe. Roman von Robert Kraft.
In: Robert Kraft: Die Augen der Sphinx.
Niedersedlitz-Dresden: H.G. Münchmeyer G.m.b.H.
o.J. [1909], Lieferung 34, Umschlagseite 1.
Die vorliegende Neuausgabe enthält den ungekürzten Text des von Robert Kraft (1869—1916) verfassten Romans, die erstmals 1909 in 9 Lieferungen erschienen ist, unter Verwendung folgender Ausgabe:
Das Hohelied der Liebe. Roman von Robert Kraft. In: Robert Kraft: Gesammel te Reise- und AbenteuerRomane. Sechste Serie: Die Augen der Sphinx. Fünfter Band. Niedersedlitz-Dresden: H.G. Münchmeyer G.m.b.H. o.J. [1910]. 424 S. mit 17 Illustrationen von Adolf Wald.
Zu Robert Krafts Leben und Werk verweise ich auf die umfassende reich farbig illustrierte Bibliografie von Thomas Braatz(1), die ebenfalls farbig illustrierte Biografie von Walter Henle und Peter Richter(2), ein umfangreiches Buch von Arnulf Meifert (3) und auf die Tagungsbände zu den Robert-Kraft-Symposien (4).
(1) Thomas Braatz: Robert Kraft — Farbig illustrierte Bibliographie zum 100. Todestag. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer, 3., erweiterte Aufl. 2016. — 1032 S. mit über 1000 farbigen Abb.
(2) Walter Henle, Peter Richter: Unter den Augen der Sphinx. Leben und Werk Robert Krafts zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer 2005. — Das Buch ist vergriffen; eine Neuausgabe ist für 2025 geplant.
(3) Arnulf Meifert: Robert Kraft. Avanturier und Selbstsucher. Eine Annäherung. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer 2018.
(4) Robert Kraft 1869—1916. 1. Robert-Kraft-Symposium. 15.—16.10.2016. Mit Beiträgen von Thomas Braatz, Arnulf Meifert, Achim Schnurrer sowie historischen Texten von Dr. S. Friedlaender und Robert Kraft. Leipzig: Thomas Braatz im Rahmen des Freundeskreises Science Fiction Leipzig 2016; Wenn ich König wäre! Robert Kraft zum 150. Geburtstag. 3. Robert-Kraft-Symposium. 12.—13.10.2018. Mit Beiträgen von Jakob Bleymehl, Gerhard W. Bleymehl, Thomas Braatz, Matthias Käther, Walter Mayrhofer, Arnulf Meifert, Karlheinz Steinmüller und Hans Wollschläger. A.a. O. 2019; 4. Robert-KraftSymposium. 16.04.2022. Serienheld Nobody. 100 Jahre KraftFilm von Thomas Braatz, u. a. mit Beiträgen von Michael Bauer, Aurel Lupastean und Franziska Meifert. A.a.O. 2022.
Offensichtliche Rechtschreibfehler und überholte Schreibweisen sind stillschweigend berichtigt worden, z. B. ›Boller‹ in ›Poller‹, ›der Gehalt‹ in ›das Gehalt‹, ›paddeln‹ in ›buddeln‹, ›pulen‹ in ›pullen‹, ›Indier‹ in ›Inder‹, ›Sennor/Sennora/Sennorita/Don/Donna‹ in (spanisch) ›Señor/Señora/Señorita/Doña‹ bzw. (portugiesisch-brasilianisch) ›Senhor/Senhora/Senhorita/Dom/Dona‹, ›Wage‹ in ›Waage‹ usw.
Fußnoten mit Sternchen (*) stehen so auch im Originaltext, solche mit Zahlen in runden Klammern (1) sind vom Herausgeber eingefügt worden.
Die Wiedergabequalität der Abbildungen war abhängig von der jeweiligen Druckqualität der Vorlagen. Da die den Lagen vorangestellten ganzseitigen Abbildungen in der vorliegenden Neuausgabe dem Fließtext räumlich zugeordnet werden konnten, ist auf die fast textgleichen Bildunterschriften verzichtet worden.
Für freundliche Unterstützung durch den Originaltext der Erstausgabe, für Bilder, Hinweise und die bibliografischen Anmerkungen bedanke ich mich bei Thomas Braatz, für die die Korrektur bei Ellen Radszat.

Das Hohelied der Liebe. Roman von Robert Kraft.
Dresden-Niedersedlitz: H.G. Münchmeyer G.m.b.H. o.J. [1924],
Deckelbild und Schutzumschlag, gezeichnet von Georg Hertting
In Amsterdam war Weltausstellung. Ein Böllerschuss machte das Publikum aufmerksam, dass Buffalo Bill sogleich seinen Wilden Westen vorführen würde.
Hei, wie die schäumenden Prärierosse über die grasige Fläche jagen — wie sie sich zwischen den eisernen Schenkeln der Cowboys bäumen und sich wälzen — — gellendes Indianergeheul — die halbnackten Rothäute überfallen eine Ansiedlung — unaufhörlich knattern die Gewehre und Revolver, die Pfeile zischen, die Lassos schwirren durch die Luft — alles geht drunter und drüber — einer sucht den anderen an Tollkühnheit und Reitkunst zu übertreffen.
Seitwärts von dem Getümmel thront Buffalo Bill im Sattel, Ross und Reiter wie aus Erz gegossen. Keine Bewegung, und dennoch lenkt er die weißen und roten Horden, das wilde Schauspiel nur durch den Blick seiner Augen.
Er wird alt, Buffalo Bill, der Held der Prärie und der Ausstellungen. Weiß geworden sind die Locken, die ihm noch vor zwei Jahren kastanienbraun auf die Schultern fielen. Wenn er sich auch noch immer wie ein Jüngling auf seinen prachtvollen Schimmel schwingt — so mitmachen kann er doch nicht mehr.
Jener in Leder gehüllte junge Mann dort, welcher die Cowboys im Kampfe anführt, das ist jetzt seine rechte Hand. Das erkennt man auch gleich an dem edlen Pferde, welches Texas Jack reitet. Wer diese Rappstute besteigen kann, dem zahlt Buffalo Bill 10 000 Gulden für jeden einzelnen Fall. Aber es kommt niemand in den Sattel, nur Texas Jack.
Es gibt auf der ganzen Erde keinen einzigen Menschen, welcher zugleich von Männern und Frauen so vergöttert worden ist wie Buffalo Bill. Dieser Texas Jack ist sein Nachfolger. Wenn der wollte, der könnte furchtbares Unheil unter Frauenherzen anrichten. Mag er auch nur ein Cowboy sein — auf deutsch: ein Kuhjunge — gleichgültig, er ist ein bildschöner, ritterlicher Mann vom Scheitel bis zur Sohle. — —
Der bequeme Mijnheer van Hyden hatte mit seiner Tochter keinen Sitzplatz mehr gefunden, dafür aber einen ausgezeichneten Stehplatz dicht an der Barriere.
»Donnerwetter, das sind doch tüchtige Kerls!!«, flüsterte Mijnheer ganz begeistert. »Sieh nur, Mariechen — na, sieh nur — sieh nur — wie dieser Texas Jack gleichzeitig mit den drei Indianern umspringt!!«
Mariechen. sein holdes Töchterchen von neunzehn Lenzen, eine echte, mollige Holländerin mit flachsblonden Haaren, zwei Grübchen in den roten Bäckchen und einem Grübchen im Kinn, machte gar nicht mehr den Mund zu, dass man immer die reizenden Zähnchen blitzen sah.
Es war windig, und plötzlich flog ihr lose angesteckter Schleier davon; das weiße Spitzengewebe flatterte lustig über den Rasen dahin.
Da kam auf seinem Rappen wie ein Wirbelsturm Texas Jack angesaust, die langen, schwarzen Locken peitschten die Luft. Im Ernstfalle hätte jetzt sein letztes Stündlein geschlagen. Er mochte die Patronen verschossen haben, und der rote Fuchs war hinter ihm her, der Häuptling der Apachen, der beste Lassowerfer, und schon entschwirrte der Hand die nie fehlende Schlinge, um den Verfolgten vom Pferde zu reißen.
Aber im selben Augenblicke, als das Lasso über seinem Kopfe schwebte, senkte Texas Jack mit Blitzesschnelle seinen Oberkörper, seine ausgestreckte Hand berührte den Boden, gerade dort, wo jetzt der weiße Schleier lag — und gleichzeitig den Rappen herumgerissen — ein Griff — der Cowboy saß wieder aufrecht, aber der Indianer war wie ein Phantom verschwunden, dort galoppierte sein lediges Pferd — der Apachenhäuptling lag plötzlich als Gefangener quer auf dem Rücken des Rappen Texas Jacks — — und da jagte dieser auch schon wieder dicht an der Barriere vorbei — und der schöne, wilde Sohn der Prärie beugte sich seitwärts im Sattel und überreichte im Vorbeisausen der jungen Dame den entführten Schleier — — und dann war er mit dem gefangenen Indianer schon wieder wie ein Schatten verschwunden.

Wie er eigentlich dem Lassowurfe entgangen war und gleichzeitig den Indianer vom Pferde gerissen hatte, das hatte man gar nicht sehen können, so schnell war alles gegangen. Und dabei hatte er noch Zeit gehabt, den Schleier aufzuheben, sich dabei etwas zu verbeugen, höflich zu lächeln — und schließlich auch noch der jungen Dame mit seinen großen, nachtschwarzen, wunderbar schönen Augen tief in die ihren zu blicken — — alles fast in einem einzigen Momente! Ganz abgesehen davon, woher er denn überhaupt wusste, wem der vom Winde getriebene Schleier gehöre!
Die sonst so phlegmatischen Holländer tobten vor Jubel über dieses doppelte Bravourstückchen der Reitkunst und der galanten Ritterlichkeit.
»Bravo!! Bravo!!!«, jubelte auch Mijnheer van Hyden. »Ein famoser Bursche! Mariechen, den möchte ich einmal zu mir einladen! Aber freilich, es ist immer nur ein roher Cowboy, ein Pferdebändiger und Kuhhirt — ich will's lieber doch nicht tun.«
Mariechen sagte nichts. Aber ihr reizendes Gesichtchen war sehr rot geworden, und der Vater wusste nicht, dass sie nur den halben Schleier zurückerhalten hatte. Er war beim Überreichen im sausenden Fluge mittendurch gerissen, und die eine Hälfte war in Texas Jacks Hand geblieben. — —
Es sind vierzehn Tage vergangen.
In seiner palastähnlichen Villa saß Mijnheer van Hyden in dem Zimmer, welches er sein Arbeitszimmer nannte. Aber tätig war er darin niemals. Der ehemalige javanische Kaffeehändler hatte in seinem Leben genug gearbeitet und sich nun auf seiner Million zur Ruhe gesetzt. Wie gewöhnlich um diese Zeit, dachte er in seinem Arbeitszimmer angestrengt darüber nach, wie er den angefangenen Tag mit seiner Tochter recht angenehm ohne Aufregung verbringen könne.
Ein Diener mit rundem Vollmondgesicht trat ein und überreichte gravitätisch seinem Herrn auf silbernem Teller eine Visitenkarte.
»Johannes Dankwart«, las van Hyden. »Kenne ich nicht. Ist ein deutscher Name. Hm. Wie sieht der Herr aus?«
»Nu, hässlich ist er gerade nicht«, kam es faul über des Dieners dicke Lippen.
»Ist es denn ein feiner Mann?«
»Nu, zerlumpt ist er gerade nicht.«
»Klaus, du bist und bleibst ein Dummkopf. Ehe aus dir etwas herauszukriegen ist, sehe ich mir den Herrn lieber gleich selbst an. Führe ihn hier herein!«
Gleich darauf trat der Fremde ein. Alle Wetter!!! Mijnheer vergaß vor Staunen und Schreck das Aufstehen. Er dachte nämlich im Augenblick nichts Anderes, als Ihre Majestät die holländische Königin schicke ihren Adjutanten, um den reichen Kaufmann zu einer Hoffestlichkeit einzuladen, was ihn zwar sehr geehrt hätte, ihm aber noch viel mehr unangenehm gewesen wäre.
Denn solche hohe, schöne Männer liebt Ihre Majestät als Adjutanten um sich, und ein Hofmann war das, das sah man gleich, wie er eintrat, und ein Offizier war das ebenfalls, mit seinem dunkelgebrannten Antlitz.
Nur die Länge der schwarzen Locken fiel dem Mijnheer auf, das war jetzt doch gar nicht Mode — — und diese großen, herrlichen Augen — — Herrgott, wo hatte er diesen Kavalier denn nur schon einmal gesehen? — —
Sie saßen sich bereits gegenüber, und van Hyden bat den Herrn immer noch, doch Platz nehmen zu wollen, so verwirrt machte ihn die vornehme, schöne Erscheinung des jungen Mannet, und dabei immer noch der Gedanke: Gott, wo hast du den nur schon einmal gesehen?
»Es ist wohl das Beste, wenn man sich in einer wichtigen Angelegenheit möglichst kurz fasst«, begann der Fremde mit einer tiefen, prächtigen Stimme, die wie Musik klang. »Ich hatte die Ehre, Ihr Fräulein Tochter kennen zu lernen. Ich liebe Fräulein Marie, und Fräulein Marie liebt mich — — Mijnheer van Hyden, ich bitte Sie um die Hand Ihrer Tochter.«
Das war der erste Brautwerber. Einmal hätte doch einer kommen müssen; aber van Hyden wurde vorläufig nur von der imponierenden Erscheinung des Fremden beherrscht, er konnte in seiner Hilflosigkeit nur unsicher lächeln.
»Das ist mir sehr angenehm — — — das — das ehrt mich ja sehr — — aber — aber — Herr — Herr — Herr Graf, nicht wahr...?
»Johannes Dankwart ist mein Name«, klang wieder die herrliche Stimme an des Vaters Ohr, »bekannter aber dürfte ich Ihnen unter dem Namen Texas Jack sein.«
Ach du allmächtiger Himmel!!! Der alte Millionär knickte gleich in seinem Lehnstuhl zusammen. Der Texas Jack bat um die Hand seiner Tochter! Dieser verwegene Pferdebändiger wollte sein zartes Mariechen zur Frau haben!!
Ja, aber da half alles nichts, ob Kuhjunge oder sonst was — — dieser hier, der vor ihm saß, blieb derselbe bildschöne, stolze, vornehme Mann, und van Hyden fühlte durch die Erkenntnis, dass er einen ganz gewöhnlichen Pferdeknecht vor sich hatte, seine sonstige Kaltblütigkeit nicht zurückkehren.
»Aber — aber — aber erlauben Sie, Herr — Herr Texas Jack — — das kommt mir etwas zu unerwartet. Sie kennen meine Tochter doch gar nicht.«
»O doch«, lächelte der schöne, bronzefarbene Mann, dass die prachtvollen Zähne blitzten, »ich hatte doch das Vergnügen, vor vierzehn Tagen Ihrem Fräulein Tochter den vom Winde entführten Schleier zurückbringen zu dürfen...«
»Na ja — na ja — — ich danke Ihnen auch noch vielmals für diese Aufmerksamkeit — — aber — aber — — aber das ist doch eigentlich noch keine Liebe. Wie?«
»Wir trafen noch mehrmals zusammen, dann täglich...«
Jetzt freilich horchte der Papa hoch auf.
»Sie — trafen — sich — mit — meiner — Tochter — täglich? Bitte, wo?«
»Im Pferdestall...«
Mijnheer reckte seinen dicken Hals wie einen Gummischlauch heraus.
»Im — — Pferdestall?«
»In unserem Pferdestall in der Ausstellung. Ihre Tochter interessiert sich sehr für Pferde, ich war mehrmals ihr Erklärer im Pferdestall, sie kam täglich, wir lernten uns kennen, und gestern endlich...«
Der Papa hörte nichts mehr. Er knickte zum zweiten Male zusammen. Seine Tochter im Pferdestall!! Darum also war sie jeden Tag in die Ausstellung gegangen, um im Pferdestall... Vor den Augen des unglücklichen Vaters tanzten lauter Heubündel, sie hatten alle Gesichter und grinsten ihm höhnisch zu.
»Mijnheer van Hyden, ich bin ein Ehrenmann«, fuhr da die prächtige Stimme fort, und jetzt konnte der Vater auch wieder hören. »Ja, wir lieben uns. Das ist Fügung. Wir liebten uns von dem Augenblicke an, da wir uns zum ersten Male sahen, da ich ihr im Vorbeijagen den Schleier zurückgab. Sie wusste, dass ich sie liebte, und ich wusste, dass sie meinetwegen jeden Tag die Pferde besichtigte. Gestern kam es zwischen uns zur Aussprache. Von diesem Augenblicke an war ich von Marie geschieden — — vorläufig! Verstehen Sie? Ich sagte ihr, dass ich morgen, also heute, zu ihrem Vater kommen würde, zu Ihnen...«
»Wirklich, das sagten Sie?«, unterbrach der Vater den Sprecher, und ein grenzenloses Staunen lag in diesen Worten.
»Ich sagte Ihnen doch: Ich bin ein Ehrenmann. Das muss Ihnen zur Erklärung meines Verhaltens genügen. — Ja, Mijnheer, ich verstehe, wenn Sie mir etwas misstrauen. Ich bin für Sie ein Präriejäger, ein Pferdebändiger, ein Abenteurer. Die Prärie war auch meine Heimat, das Jagen und Pferdebändigen mein Beruf, und jetzt verdiene ich mir mein tägliches Brot als Schausteller. Darin werden Sie aber doch nichts Unehrenhaftes finden, und ich will mir Ihre Achtung auch in anderer Weise erringen. Mariechen und ich, wir sind beide noch jung. Wir können warten. Darüber haben wir schon gestern gesprochen. Geben Sie mir ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre — — stellen Sie mich in einem Geschäft an, wo Sie wollen, und wenn ich mir nicht durch Fleiß, Ausdauer und Treue die Achtung meiner Vorgesetzten erringe, will ich auch Ihrer Achtung nicht wert sein. Mariechens Liebe ist mir sicher, das weiß ich; aber mir liegt auch an der Achtung des Vaters, den sie innig liebt. Sonst wäre mein Glück nur ein halbes. Bitte, geben Sie mir eine Frist, in der ich beweise, dass ich Ihrer Tochter würdig bin. Am liebsten allerdings würde ich, etwa hier in Amsterdam, ein Reitinstitut eröffnen. Das verstehe ich. Oder ein großes Landgut würde ich auch verwalten können. Denn arbeiten muss ich. Untätig kann ich nicht sein. Hierbei möchte ich noch eins bemerken, und ich hoffe nicht, dass es Sie beleidigt. Sie sind reich, und Reichtum ist eine schöne Sache, aber darauf spekuliere ich nicht. Ich will Ihre Tochter glücklich machen — weil ich sie liebe. Mijnheer, ich bitte Sie um die Hand Ihrer Tochter.«
Der Vater hatte sich wieder gesammelt. Er lauschte.
Was für herrliche Worte waren das trotz ihrer Schlichtheit!
Er hatte schon manchmal an die Verheiratung seines einzigen Kindes gedacht, sich sogar schon den Freiersmann vorgestellt, natürlich ein feines, patentes Kerlchen, wie das dann hier auf dem Stuhle saß und Worte drechselte und Süßholz raspelte, wie er die geliebte Tochter bis in alle Ewigkeit auf den Händen tragen wollte, usw. usw. — — und die Hauptsache waren natürlich doch immer die Milliönchen, und das kann man auch gar keinem Menschen verdenken, und je mehr jemand sagt, der Geldsack wäre ihm ganz Nebensache, desto mehr ist er ihm die Hauptsache.
Aber hier, hier!! Wie schlicht und ehrlich das alles geklungen hatte! Und mit dieser zum Herzen gehenden Stimme gesagt! Und diese Augen, diese großen, prächtigen, treuen Augen!!
Dem Papa van Hyden war ganz weich ums Herz. Er empfand es dann als ein großes Glück, dass sich Texas Jack selbst schnell verabschiedete.
»Selbstverständlich müssen Sie sich erst bedenken, Sie haben wohl die Güte, mir zu schreiben, wann ich mir den Bescheid holen darf. Mijnheer van Hyden, ich empfehle mich Ihrem Wohlwollen.«
Der Vater war allein, und da war es ihm, als ob ein Bann von ihm wiche.
»Nee!«, schrie er. »Er kriegt sie nicht!! Der verlangt schließlich doch noch, dass mein armes Mariechen wilde Pferde bändigen und Indianer mit dem Lasso fangen soll. Nee, is nicht, gibt's nicht!!«
Und dann schlug er gleich mit der ganzen Faust auf die silberne Tischklingel.
»Meine Tochter!!!«
Mariechen kam, gar nicht so ängstlich, vielmehr mit lächelnder Siegesgewissheit. Aber der Papa lächelte nicht, der fing gleich zu brüllen an.
»Hierher!! — — Hierher kommst du!! — — Sieh mich an!! — — — Was — hast — du — jeden — Tag — im Weltausstellungspferdestalle zu suchen gehabt?«
Die Tochter machte die Sache sehr einfach, sie legte dem alten Manne, den sie doch kannte, die Arme um den Hals und sagte:
»Papachen, ich liebe ihn!«
Aber Papachen war doch nicht gleich so bereit.
»Wen? Ihn? Den Weltausstellungspferdestall?«
»Meinen Texas Jack!«
Der Vater liebte sein einziges Kind und wollte es glücklich wissen.
Er wusste die Sache noch hinzuhalten und zog Erkundigungen ein.
Wer ist denn zunächst dieser Buffalo Bill?
Da bekam er allerdings etwas zu hören, was er nicht erwartet hatte, und er hatte sich bisher um so etwas nicht gekümmert, weil es ganz außerhalb des Bereiches seiner Interessen lag. Wenn man die Sachen mit anderen Augen betrachtet, dann sehen sie oftmals anders aus.
Erstens, William Cody, genannt Buffalo Bill, ist nach und nach durch seine Schaustellungen und andere Spekulationen ein schwerreicher Mann geworden. Bei New York hat er eine ganze Insel, sein Eigentum, mit Villen und Palästen, mit einer elektrischen Eisenbahn, nur für ihn, in seinem eigenen Hafen liegt sein eigener Dampfer. Aber er hat keine Ruhe, hat kein Sitzfleisch. Ab und zu muss er immer wieder eine Bande um sich sammeln und in die Welt hinaus, und dabei macht er Geld, und das eben ist es, was den alten Mann immer noch so jung erhält. Nun muss man ihn näher kennen lernen, was für ein feiner, gebildeter Mann das ist, wie höflich der einen Kellnerjungen um die Zeitung bittet.
Zweitens, William Cody ist Colonel, Oberst in der nordamerikanischen Armee, Kommandeur eines Grenzregiments; in jedem europäischen Offizierskasino wird er als Kamerad aufgenommen.
Drittens, Buffalo Bill hat als Gast an fast sämtlichen Fürstentafeln gesessen. Kaiser und Könige haben ihm freundschaftlich die Hand geschüttelt, tun es noch heute. Das ist eben ein Mann, welcher imponiert. — — — —
Nun zu Texas Jack! Über den berichteten Zeitungen und Broschüren, und was da drin stand, beruhte auf Wahrheit. Da war ja auch gar nichts Außerordentliches dabei. Buffalo Bill hatte einst in einem im Kampfe genommenen Apachenlager einen sechsjährigen Jungen entdeckt, einen kleinen Indianer, der aber schon wie ein kleiner Teufel stach, fauchte und spuckte, hatte dann ein Bleichgesicht in ihm erkannt. Das war einfach das Kind von europäischen Ansiedlern, welche wahrscheinlich niedergemacht worden waren. Darüber war nichts mehr zu erfahren, und so etwas kommt dort ja vor. Der Junge wäre vollkommen zu einem Indianer geworden. Buffalo Bill übergab ihn zur ersten Erziehung einem deutschen Farmer namens Dankwart, der taufte den kleinen Wilden, der zuerst immer wieder durchbrennen wollte, Johannes, und später begleitete dieser als Texas Jack den Buffalo Bill auf seinen Fahrten und Abenteuern, schließlich auch als Schausteller mit in die Welt hinaus, wohnte, wie alle Anführer der Truppe, mit auf der Insel.
Und was für eine Rolle spielte er jetzt?
Erstens, er erhielt ein festes Gehalt von jährlich 2000 Dollar, das sind 8000 Mark, freies Hotel, eine eigene Equipage mit Kutscher, Diener und zwei Reitknechten. Bei seinen Vorstellungen konnte er natürlich nicht im roten Frack und Zylinder zu Pferde sitzen.
Zweitens, Johannes Dankwart war Captain, das ist Hauptmann, im vierten Grenzregiment, auch ihm stand jedes Offizierskasino offen.
Drittens, erst gestern hatte der Kuhjunge mit Buffalo Bill an der Tafel Ihrer Majestät der holländischen Königin Wilhelmina gespeist. — — — —
Nachdem Mijnheer van Hyden alles dies vernommen hatte, da kratzte er sich hinter den Ohren, und er erfuhr so nebenbei auch noch andere Dinge. Konnte der unbekannte Vater von Texas Jack nicht vielleicht ein Graf gewesen sein?
I, was machte sich denn dieser Texas Jack aus so etwas!!
Da hatte sich die Truppe voriges Jahr in Petersburg produziert, und da hatte sich eine FürstinWitwe, verwandt mit dem kaiserlichen Hofe, sterblich in den schönen Cowboy verliebt, wollte ihn heiraten, bloß ein Wink von ihr, und er wäre noch etwas ganz Anderes gewesen als nur ein Graf — — aber Texas Jack hatte eben nicht gewollt.
Ob der auf das Geld des Schwiegervaters spekulierte? Wenn Texas Jack das glänzendste Reitinstitut aufmachte, so brauchte er keinen einzigen Pfennig dazu, der hatte Kredit, so viel er nur haben wollte. — Der hatte noch mehr Kredit als der Mijnheer mit seinen Millionen.
Papa van Hyden kratzte sich noch mehrmals hinter den Ohren. Da war es ja geradezu eine Ehre, wenn der verwegene Pferdebändiger die Hand seiner Tochter begehrte!
Ja, jetzt liebten sie sich! Würde das aber auch auf die Dauer eine glückliche Ehe werden? Würde es dieser Sohn der Prärie, der außerdem schon in der ganzen Welt herumgekommen war, trotz aller Beschäftigung auch in einer Häuslichkeit aushalten?
Dass er dann nicht etwa das zarte Mariechen mit auf seinen wilden Reisen herumschleppte!
Als der Vater noch so überlegte, stellte sich ihm eines Tages Colonel William Cody vor. Er zerstreute die letzten Bedenken.
»Wenn Sie Ihre Tochter dauernd glücklich machen wollen, soweit das in der Macht des Menschen liegt, und wenn Sie sich einen Schwiegersohn wünschen, an dem Sie selbst bis zu Ihrem Tode Stolz und Freude haben — dann geben Sie Ihre Tochter diesem Manne! Wir haben in unserem Leben Gelegenheit genug, den Charakter eines Menschen kennen zu lernen, und ich habe Jacks Charakter kennen gelernt. Ich würde ihm blindlings mein Teuerstes anvertrauen — meine Ehre. Mehr brauche ich nicht zu sagen. Nur noch eins: Wir kommen in der Welt herum; wir erleben Manches, was man nicht erzählen kann; Texas Jack hätte schon manchmal heiraten können. Freilich meist emanzipierte Damen. Nun ist aber Jack im Grunde genommen gar kein abenteuerlicher, unruhiger Charakter, ich kenne ihn, und ich weiß, dass ihm dieses wilde Leben stets zuwider gewesen ist, er hat sich immer nach einem traulichen Heim mit einer stillen, sanften Frau gesehnt, in deren Liebe er aufgeht, wie sie in der seinen — Mijnheer, verscherzen Sie nicht das Glück Ihres einzigen Kindes. Den größten Schaden habe ich dabei.«
Kurze Zeit darauf legte Mijnheer van Hyden die Hände der beiden zusammen.
»Kinder, da habt ihr euch! Werdet glücklich! Amen.«
Und dann reckte er sich, obgleich er auch ziemlich groß war, auf den Fußspitzen empor, um dem hünenhaften Schwiegersohne einen Kuss geben zu können, und nachdem dies geschehen war und er noch einige Tränen vergossen hatte, sagte er weiter:
»Na, Kinder, dehnt die Verlobungszeit nicht gar zu lange aus. Es hat keinen Zweck. Ich bin keinem Menschen Rücksicht schuldig, und wenn ihr nicht zu warten braucht — heiratet euch bald. Weiß doch, ich bin auch einmal jung gewesen. Und macht keine Hochzeitsreise. Jack hat genug von der Welt gesehen und du auch, Mariechen. Ihr geht nach unserer hübschen Villa im Haag. Vielleicht nehmt ihr mich mit. Und da stelle ich auf den Korridor einen Mann, der muss immer sch — sch — sch — sch machen, und dann pfeift er und ruft manchmal Stationen aus, dann denkt ihr, ihr sitzt auf der Eisenbahn, und wenn ihr schöne Landschaften sehen wollt, dann geht ihr ins Panorama. Und über das Reitinstitut oder über das Landgut sprechen wir noch später, das läuft nicht davon, und ich denke, Jack, die ersten Wochen wirst du es wohl auch ohne Arbeit aushalten können.«
So sprach Mijnheer van Hyden, und einen besseren Schwiegervater hätte Jack nicht finden können.
Noch bevor die Hochzeit in kleinem Kreise stattfand, verabschiedete sich Buffalo Bill von den beiden. Er wollte nach New York zurück, hatte große Pläne zu einer neuen Spekulation.
»Ich bringe mein Hochzeitsgeschenk«, wandte er sich in letzter Stunde an die Braut seines jungen Kampfgenossen, der ihn nun verlassen hatte. »Es ist kein Geschmeide, nur eine Kleinigkeit, eine Spielerei, aber auch ein Heiligtum, auf jeden Fall eine sehr große Seltenheit — Fräulein van Hyden, sind Sie abergläubisch?«
Mariechen verneinte lächelnd.
»Ich bin's auch nicht. Aber in manchen Fällen soll man einen frommen Kinderglauben haben, der nicht nach dem Warum forscht. Ich habe in meinem Leben manche Rarität gesammelt — das Schönste davon soll die Braut meines Freundes bekommen. Kennen Sie vielleicht die Rose von Jericho, eine Blume...«
»Sie ist ganz vertrocknet, und wenn man sie ins Wasser legt, blüht sie nach einigen Minuten auf, schrumpft wieder zusammen, entfaltet sich von Neuem, und so kann man das Spiel immer wiederholen.«
»Jawohl, die meine ich.«
»Auf der Ausstellung waren sie massenhaft zu verkaufen.«
»So eine will ich Ihnen auch nicht schenken«, lachte Colonel Cody, fuhr aber gleich wieder ernst fort: »Im Felsengebirge soll an unzugänglichen Stellen eine kleine rote Blume wachsen, die Lebensblume. Getrocknet sieht sie wie eine zusammengeschrumpfte Erbse aus. Wenn man sie anhaucht, nur kurze Zeit, und denkt dabei an eine ferne Person, welche man liebt, so wird das Blümchen sofort aufblühen, vorausgesetzt, dass die Person, an welche man in Liebe denkt, auch noch am Leben ist. Ist die Person tot, dann öffnet sich die Blume nicht, und dann darf man die Orakelblume auch nicht — sozusagen narren, dass man an eine Person denkt, von welcher man bestimmt weiß, dass sie schon tot ist. Dann narrt die Zauberblume den Fragenden auch, und dadurch verliert sie bald ihre Kraft. Mit gläubigem Gemüt befragt, antwortet die Wunderblume also sonst der Wahrheit gemäß, ob der oder die ferne Geliebte noch lebt oder nicht. — So geht die Sage unter den Indianern. In keinem botanischen Buche steht etwas von dieser Blume. Ich habe Tausende von Indianern gesprochen, welche alle von dieser Blume erzählen können, aber noch keiner hat eine gesehen. Es gibt auch schon genug mehr von der Kultur beleckte Rothäute, welche diese ganze Geschichte Schwindel nennen. Im Felsengebirge wächst gar keine solche Blume. — Und ich besitze eine, ich habe zufällig eine gefunden.«
Buffalo Bill griff vorn etwas unter den Kragen und zog über den Kopf weg eine dünne Lederschnur, an welcher ein großer Kirschkern befestigt war. Schon dieser allein war ein kleines Kunstwerk. Bill schraubte an dem Kirschkern und trennte ihn in zwei Teile, schüttete aus der einen Höhlung etwas in seine flache Hand, das Mädchen glaubte, wie gesagt, eine kleine, grüne, zusammengetrocknete Erbse zu sehen, mit einem Stängelchen daran, dass man es eben fassen konnte.
»Nehmen Sie die Blume, hauchen Sie daran und denken Sie dabei an eine Person, welche Sie lieben! Aber nicht an eine, von der Sie schon wissen, dass sie nicht mehr lebt! Das nimmt Ihnen die Blume übel, dann wird sie sich einmal rächen, wenn es darauf ankommt.«
Marie nahm das vertrocknete Ding, hielt es vor den Mund, hauchte mehrmals kräftig...
»Übertreibe es nur nicht, du willst wohl gleich einen ganzen Baum draus machen!«, lachte Jack.
Verwundert entfernte Marie die Blume vom Munde, dass sie dieselbe sehen konnte. Sie hatte ja eben erst mit den Wiederlebungsversuchen angefangen.
»Ach, das ist ja reizend!«, rief sie entzückt.
Plötzlich hatte sich die zusammengeschrumpfte Erbse in ein kleines, rotes Röschen verwandelt. Die Feuchtigkeit der wenigen Atemhauche hatte genügt, die vertrocknete Blume wieder aufleben zu lassen, vielleicht kam noch die ausgeatmete Kohlensäure dazu.
»An welche geliebte Person haben Sie denn nun gedacht, von der Sie nicht wissen, ob sie noch lebt oder nicht?«, fragte der Colonel.
»Ach je«, sagte das Mädchen in allerliebster Verlegenheit. »Das freilich hätte ich auch wissen können, dass der noch lebt — an Jack hier.«
»Sehen Sie, und die Wunderblume hat ganz richtig geantwortet«, scherzte Buffalo Bill mit leiser Ironie. »Na, lassen Sie es gut sein, glauben Sie daran, und missbrauchen Sie die Blume nie, ich bitte Sie darum. Der Glaube macht selig, und wohl dem, der glauben kann! Ein starker, fester Glaube wirkt wahrhaftig Wunder. — Und hier haben Sie zum Glauben auch noch die Hoffnung, versinnbildlicht durch diesen Kirschkern. Das kleine Kind einer Indianerin hatte ihn in die Luftröhre bekommen, es rang mit dem Tode. Ich konnte den Kern noch zur rechten Zeit herausholen. Das Kind war gerettet. Ich behielt den großen Kirschkern, und an müßigen Winterabenden schnitzte ich daraus diese kleine Büchse. Vier Jahre später fiel ich einem feindlichen Indianerstamme in die Hände. Keine Rettung mehr! Ich hatte mit dem Leben abgeschlossen. Morgen war ich ein toter Mann. Da sah ich im Lager eine Indianerin. Es war die Mutter jenes Kindes. Sie verriet mit keinem Blick, dass sie mich noch kannte; aber in meinem Herzen blitzte die Hoffnung auf, und sie trog mich nicht. In der Nacht durchschnitt eine unsichtbare Hand meine Fesseln. Ich war gerettet. — Und zum Glauben und zur Hoffnung gehört noch die Liebe. Ich gebe Ihnen dafür das Sinnbild der Treue. Die Treue ist manchmal mehr wert als die Liebe. Es gibt Liebe ohne Treue, aber es gibt keine Treue ohne Liebe. Hier, dieses Lederschnürchen ist aus der Haut des treuesten aller treuen Hunde geschnitten. Jack, du kanntest ihn. — So, nun nehmen Sie dieses einfache Geschenk. Perlen und Diamanten würden es verunzieren, und von diesem Zeuge haben Sie wohl genug...«
Ehe sich noch die Braut für das Geschenk bedanken konnte, welches man nicht beim Hofjuwelier kaufen kann, hatte sich der greise Held der Prärie und zahlloser Jugendschriften an den jüngeren Gefährten seiner Abenteuer gewandt.
»Und dir, Jack«, sagte er mit unsicherer Stimme, jenem die Hand schüttelnd, »dir will ich zweierlei schenken, was du aber nicht auf den Hochzeitstisch legen kannst: meine Rappstute und meine unwandelbare Freundschaft.«
* Die Hochzeit war vorüber. Gerade drei Wochen währte das selige Glück. Dann griff des neidischen Schicksals raue Faust dazwischen.
»Wo nur Mariechen so lange bleibt?«
Mit diesen Worten fing es an.
Zum ersten Male hatten sich die Neuvermählten Adieu gesagt und — gleich für immer.
Mariechen hatte am Nachmittag in der Stadt eine Freundin besuchen wollen, auch jung verheiratet, aber schon ein halbes Jahr länger, die Freundin musste einmal hin — na, und solche junge Frauen haben sich doch etwas zu erzählen, da kann der Mann nicht mit. Außerdem empfing Mijnheer van Hyden am Nachmittag den Besuch von ein paar guten Freunden; deshalb eben hatte Marie die Gelegenheit mit voller Genehmigung des Papas gleich benutzt. Die alten Sünder wollten auch einmal unter sich sein, aber da gehörte jetzt der Schwiegersohn mit dazu, der musste doch auch etwas erzählen können.
Es war also die allererste Trennung. Ein furchtbares Ereignis! Sie wohnten zwanzig Minuten mit der Eisenbahn von Amsterdam entfernt in einem schönen Villenstädtchen. Jack brachte sein Kostbarstes auf den kleinen Bahnhof, drei Minuten von ihrer Wohnung entfernt, nur quer über die Straße. Wenn sie nach zwanzig Minuten auf dem Bahnhof in Amsterdam ausstieg, konnte sie beim besten Willen keinen Wagen benutzen, denn sie ging nur durch einen Durchgang, dann war sie im Hause ihrer Freundin. Um sechs Uhr wollte sie spätestens zurück sein, drei Stunden vor Anbruch der Dunkelheit, und da hatte sie inzwischen drei Stunden Zeit, mit ihrer Freundin Geheimnisse auszutauschen.
Als sie auf den. Bahnhofe standen und Jack immer wieder so kläglich fragte, ob er sie denn nicht lieber begleiten oder sie wenigstens abholen sollte, da hatte die kleine, immer heitere Frau diesen Abschied auch noch ins Komische gezogen. Angesichts des kommenden Zuges, der sie entführen sollte, hatte sie mit theatralischem Pathos zu deklamieren begonnen:
»Nun lebe wohl, mein teurer Jack! Wer weiß, ob wir uns jemals wiedersehen. — Wirst du meiner auch immer in Liebe gedenken? — Wirst du mir auch immer treu bleiben? — Den letzten Kuss, der Zug ist da — ich reise nach Amerika!«
Zuletzt hatte auch Jack gelacht. Es war ja wirklich lächerlich. Aber als Mariechen dann im Coupé saß und der Zug davonbrauste, da hatten die Adleraugen des Präriejägers doch noch wahrgenommen, wie sie in ihrer Ecke plötzlich in Tränen ausgebrochen war.
Es war eben die erste Trennung zwischen Turteltauben, und das ist immerhin ein Ereignis! —
Mit dem Sechsuhrzug war sie nicht zurückgekommen, wie sie eigentlich versprochen hatte. Jack wagte nichts zu sagen. Es ging fidel unter den alten Herren zu, und man hätte den verliebten Ehejüngling mit seiner Besorgnis doch nur ausgelacht.
Eine halbe Stunde später kam von Amsterdam der nächste Zug, er brachte die junge Frau auch noch nicht zurück. Und Jack sagte noch immer nichts.
Der nächste Zug kam erst um acht, und jetzt ließ sich Jack nicht halten, er ging wenigstens auf den Bahnhof hinüber. Wieder nicht da.
Jack begab sich kurzerhand nach dem Postamt und telegrafierte an die ihm bekannte Adresse der Freundin: Ist meine Frau noch dort?
Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Marie um fünf von hier auf den Bahnhof.
Jetzt allerdings wurde auch der Vater besorgt, obwohl er es sich noch immer nicht merken lassen wollte. Was sollte denn passiert sein! Mariechen war doch kein Kind mehr! Sie hatte schon ganz andere Reisen allein gemacht!
Das half aber alles nichts, solche Beruhigungen brachten Mariechen nicht zurück, und als die späte Nacht des Sommertages anbrach, da sattelte Jack seine Rappstute und jagte nach Amsterdam, einen Bummelzug noch überholend.
In jenem Hause konnte man nicht viel mehr erzählen, als was schon das Telegramm gesagt hatte. Gegen fünf Uhr hatte Marie die Freundin verlassen, um wieder zurückzufahren. Nun aber kam doch etwas Neues hinzu: Es wäre doch möglich, dass sie nicht sofort die wenigen Schritte nach dem Bahnhofe gegangen sei, denn sie hätte noch eine Viertelstunde bis zum Abgange des nächsten Zuges Zeit gehabt, und sie hatte die Absicht geäußert, erst noch einmal durch die Hauptstraße zu gehen, um sich wohl ein großes Schaufenster mit Kostümen zu besehen.
In derselben Nacht noch wurde die ganze Polizei von Amsterdam alarmiert, der Telegraf spielte nach allen Richtungen, am nächsten Tage interessierte sich ganz Holland für die verschwundene junge Frau. —
Wir überspringen gleich acht Tage. Die Schilderungen der Einzelheiten, was man alles tat, ist ja zwecklos. Mariechen war und blieb verschwunden, man entdeckte auch nicht die geringste Spur ihres Verbleibs. Die Polizei konnte sich immer noch eine große Prämie verdienen, man suchte nur noch in — den Gräben und Kloaken nach der Leiche einer jungen Frau.
Wenn man durchaus eine Erklärung für dieses Verschwinden haben wollte, so musste man einfach einen Raubmord annehmen, der in einer großen Stadt auch schon am helllichten Tage vorgekommen ist. Die elegante Dame hatte Schmuck an sich gehabt — ein dunkler, einsamer Durchgang — ein Schlag auf den Kopf — ein Kellerloch — und nach vielen Jahren findet man zufällig einmal ein Gerippe.
Der arme Vater und der um sein Glück betrogene Gatte trugen diesen Schicksalsschlag wie Männer. Sie brauchten einander nicht zu trösten. Wenn sie zusammen waren, hatten sie nicht einmal eine Träne, sprachen gelassen über andere Dinge. Wie sich jeder sonst benahm, wenn er für sich allein war, das ließ eben keiner den anderen merken.
Es war am achten Tage, als Jack mit leisem Schritt das Zimmer seines Schwiegervaters betrat.
Der schon ältliche Mann saß am Fenster, den Kopf in die Hand gestützt.
»Vater«, sagte die tiefe, sonore Stimme, welche so unendlich weich klingen konnte, und ebenso sanft wurde ihm die Hand auf die Schulter gelegt, welche auch eisern sein konnte.
Der Angeredete machte eine hastige Bewegung nach den Augen und wandte jenen. das Gesicht zu.
»Was willst du, mein Jack?«
Der Vater wusste, wenn auch noch keine Gelegenheit gewesen war, es zu beweisen — er wusste, dass er an dem Gatten seiner Tochter nicht nur einen Schwiegersohn, sondern einen wirklichen Sohn gefunden hatte, und das Fehlen der Tochter und Gattin würde daran nichts ändern.
Jack holte einen Stuhl und setzte sich dem Alten gegenüber, und es lag etwas Feierliches darin, wie er dies so schweigend tat.
»Vater, ich muss dich einmal sprechen«, begann er mit gedämpfter Stimme. »Ich habe vielleicht ein Mittel, um sofort erfahren zu können, ob Mariechen noch lebt oder nicht, und, wenn sie noch am Leben ist, wo sie sich aufhält.«
Es ist begreiflich, wie der Vater empor fuhr.
»Und das sagst du mir erst jetzt?!«
»Ja. Ich habe auch nicht gleich daran gedacht. Es ist auch etwas ganz Besonderes, was mir eben jetzt erst wieder einfällt. Es ist ein Mensch, welcher mir dies sagen kann, ich habe ihn das letzte Mal vor zwei Jahren gesehen, schwach und krank, und ich weiß gar nicht, ob er noch lebt. Das kann ich aber sehr schnell erfahren. — Vater, glaubst du an ein zweites Gesicht?«
Der Gefragte sah den Sprecher groß an.
»Dass es Menschen gibt, welche entfernte Personen und Geister sehen, welche in der Nacht einen Leichenzug erblicken und daraus sagen können, dass jemand stirbt? In Schottland soll diese Gabe sehr verbreitet sein.(*) Meinst du das?«
(*) Diese Gabe des ›zweiten Gesichts‹ ist nicht Aberglaube, sondern Tatsache und wird von verschiedenen Gelehrten anerkannt. Volle Klarheit über die Art, wie dieses ›Fernsehen‹ möglich ist, konnte jedoch noch nicht geschaffen werden.
»Jawohl, ganz richtig, besonders in einzelnen schottischen Bauernfamilien soll diese Gabe erblich sein. In meinem Falle spreche ich jedoch nicht von Geistersehen, von Wahrsagen und dergleichen, sondern ich meine einfaches Fernsehen. Es sieht jemand mit seinen geistigen Augen eine entfernte Person, ganz gleichgültig, wo diese ist, und kann alles sagen, was die Person in diesem Augenblicke tut. — Glaubst du an so etwas?«
»Nein, an so etwas kann ich nicht glauben, es geht gegen meine Überzeugung«, erwiderte Mijnheer van Hvden kopfschüttelnd.
»Nun, auch ich habe früher nicht daran geglaubt, habe über solche Märchen gelacht; aber ich bin gezwungen worden, daran zu glauben. Lass dir erzählen! Es sind Tatsachen, die ich berichte. — Tief im Innern Schottlands, einige Meilen westlich von der Stadt Dunkeld, liegt das winzige Dörfchen Killey. Dort lebt in einer einsamen Hütte eine arme Holzfällerfamilie. Die Frau hat schon viele Kinder gehabt, welche aber stets bald nach der Geburt gestorben sind. Als sie wieder einmal guter Hoffnung ist, vielleicht im sechsten Monat, wird der Mann schwerverletzt nach Hause gebracht. Ein fallender Baumstamm hat ihn getroffen, der linke Arm ist ab, hängt aber noch mit Sehnen und Fleischfasern am Körper; erst in der Hütte wird dem Manne die Jacke ausgezogen, und die schwangere Frau muss das alles sehen. Sie fällt in Krämpfe, hat einen Monat lang jeden Tag einen Krampfanfall, und das Kind kommt schon im siebenten Monat. Es ist ein Mädchen, sehr schwach, aber normal gebaut, auch der linke Arm ist wohlgestaltet — doch es ist kein Leben darin, er ist wie tot. — Glaubst du, Vater, dass so etwas möglich ist?«
»Ganz gewiss!! Da sind bei schwangeren Frauen durch Schreck noch ganz andere Fälle vorgekommen!«
»Nun«, fuhr der Erzähler fort, »gerade dieses schwächliche Kind blieb am Leben. Evangeline wuchs, der linke Arm wuchs mit, aber er blieb schlaff herabhängen, er blieb tot. Mit der Zeit, als sie größer wurde, fiel den Eltern manchmal etwas an dem Kinde auf. Meistenteils liegt es im Bett, steht aber doch auch manchmal auf, kann gehen, sitzt beim Essen mit am Tisch. Da konnte es passieren, wenn Eva eben noch gesprochen hatte, dass sie plötzlich mit geschlossenen Augen in den Stuhl zurücksank und so regungslos liegen blieb, bis sie nach einiger Zeit wieder zu sich kam, ohne etwas von dem Geschehnis zu wissen. Diese Anfälle bekam sie auch im Bett. Ihre Länge war ganz verschieden. Sie dauerten fünf Minuten bis zu einer Stunde, und weil sich die Eltern doch mit der Bewusstlosen beschäftigten, merkten sie mit einem Male, dass bei diesen Anfällen sich immer der tote Arm erwärmte; ja, es schien, als ob Evangeline ihn dann auch bewegen könne, sie empfand Schmerz darin und zog die sonst gelähmte Hand zurück.
Eines Tages sitzt sie aufrecht im Bett und spielt mit Federchen, welche eine Gans verloren hat. Sie hat die linke, kalte Hand mit Hilfe der rechten vor sich hingelegt und zählt da die Federchen hinein, schließt mit der rechten Hand die toten Fingerchen um die Federn herum, erzählt sich etwas dabei. Weil sie mit einem Male still wird, blickt die Mutter nach ihr hin und sieht, dass Eva wieder ihren Anfall hat. Sie liegt mit geschlossenen Augen in den Kissen und hat die Finger der linken Hand noch geballt. Was der Mutter auffällt, ist, dass Eva so glücklich vor sich hinlächelt. Denn sonst ist sie eben immer bewusstlos.
›Worüber lachst du denn, Eva?‹, fragt die Mutter.
›Ich sehe unsere Gans, es sieht so komisch aus, wie sie immer die Hühner von ihrem Futternapf jagt‹, entgegnete das Kind.
Die Mutter glaubt, es sei kein Ohnmachtsanfall, weil Eva doch sprechen kann, sie macht eben nur die Augen zu. Aber wie will sie denn da die Gans sehen, welche auf dem Hofe ist? Und die Mutter sieht durch das Fenster, wie die Gans wirklich die Hühner immer fortjagt. Und das Kind kann unmöglich hinaussehen, und jetzt wird auch noch bemerkt, dass die tote Hand, wie stets bei einem Anfalle, lebendig geworden ist.
Der Vater, welcher am Leben geblieben, ist gerade zu Hause. Nun ist ja unter den Schotten die Sage vom zweiten Gesicht sehr stark verbreitet, man sieht darin gar nichts Außerordentliches, es ist eine besondere Begabung einzelner Personen. Der Vater kam also gleich auf eine Idee.
›Was tut die Gaus jetzt?‹ — ›Sie putzt ihre Flügel.‹ — ›Und jetzt?‹ — ›Sie läuft.‹ — ›Und jetzt?‹ — ›Sie breitet die Flügel aus.‹
Alles stimmte. Nun war es erwiesen: das Kind besaß die Gabe des zweiten Gesichtes...«
»Erlaube, dass ich dich unterbreche«, sagte Mijnheer van Hyden. »Hast du das Kind gesehen? Hast du es daraufhin geprüft? Das ist für mich die Hauptsache.«
»Gleich hätte ich hiervon begonnen. Vor zwei Jahren begleitete ich Buffalo Bill nach Schottland. Wir wollten Ponys kaufen. Wir kamen auch nach Dunkeld und hörten da zufällig von diesem hellsehenden Kinde. Das mussten wir uns einmal ansehen. Richtig, wir fanden die Hütte, darin den einarmigen Vater und im Bettchen die damals zehnjährige Evangeline, ein reizendes Kind, aber nur ein Hauch. Wir überzeugten uns von der Tatsache ihres Hellsehens. Ich will ganz kurz die Hauptsachen anführen. Jeden Tag einmal fällt sie in diesen Zustand. Wann, ist ganz unbestimmt. Es kann auch mitten im Schlaf geschehen. Sobald ihre tote Hand warm wird, wird Evangeline hellsehend. Sie sieht mit ihren geistigen Augen den Menschen oder auch das Tier, von dem sie etwas in der lebendig gewordenen Hand hält. Das darf kein beliebiger Gegenstand sein, etwa ein Kleidungsstück, welches die Person lange Zeit getragen hat, das bleibt ganz unwirksam — es muss etwas von der Person selbst sein, die sie sehen soll, es muss an der Person gewachsen sein — also eine Haarlocke, schon das allerkleinste Stückchen des abgeschnittenen Fingernagels genügt, in die Hand gelegt, die Person dem Mädchen augenblicklich vor Augen zu führen. Die Entfernung spielt dabei gar keine Rolle. Sie steht die betreffende Person, sieht, wie sie gekleidet ist, sieht jede ihrer Bewegungen und sieht auch alles, was diese Person sieht. Nichts weiter. Mitfühlen und mithören kann sie nicht. Eine Ausnahme — oder vielleicht auch keine — ist, wenn sich die Person etwa in einem dunklen Zimmer befindet. Dann sieht Evangeline die Person auch nicht, kann nicht ihre Kleidung beschreiben, weiß aber doch bestimmt, dass die Person, von der das stammt, was sie in der Hand hält, sich dort befindet. In diesem Zustande antwortet sie auf jede Frage, fragt wohl selbst, wundert sich über etwas, erwacht aber erinnerungslos. Der Mensch oder das Tier, dessen Haar sie in der Hand hält, muss leben. Sonst fasst sie es gar nicht an. Gibt man ihr das Haar eines verstorbenen Menschen in die Hand oder etwa Federn eines geschlachteten Huhnes — mit Abscheu und Zeichen des Entsetzens schleudert sie so etwas sofort von sich.
Du darfst mir wohl glauben«, fuhr Jack fort, »dass wir beide das kleine Mädchen auf die Echtheit ihres Hellsehens zu prüfen verstanden. Wir haben doch immer allerlei kleine Andenken bei uns. Denke nur an die Schnur aus der Hundehaut! Da gibt ihr Colonel Cody auch eine Haarlocke in die Hand, und plötzlich sieht das kleine Mädchen in der schottischen Waldhütte einen Indianerhäuptling im fernen, fernen Westen Amerikas auf der Büffeljagd; sie beschreibt ihn, und alles mit einer Genauigkeit, wie niemand das beschreiben kann, und wenn er auch noch so viel Indianergeschichten gelesen hat. Evangeline hatte aber überhaupt noch niemals etwas von Indianern gehört! Sie kann etwas lesen, nicht schreiben, kennt aber gar kein anderes Buch als die Bibel. Doch kann sie sehr hübsch zeichnen, es ist eine Begabung, und da malt das Kind mit geschlossenen Augen auf ein Stück Papier die Tätowierung hin, welche der rotbraune Mann auf der Brust hat! Gedankenübertragung? Wir allerdings kannten die Tätowierung des heulenden Wolfes, und sie konnte das vielleicht aus unserem Gehirn ablesen und abzeichnen. Daran dachten auch wir. Da aber sagte sie, dass dieser Indianer nur ein einziges Ohr hat, nur das linke. Wir kannten den heulenden Wolf nur mit zwei Ohren, wollten es auch gar nicht recht glauben. Ein halbes Jahr später sehen wir den heulenden Wolf wieder — richtig, er hatte unterdessen das rechte Ohr verloren. — Nun, Vater, was sagst du dazu?«
Mijnheer van Hyden hatte sich erhoben, langsam zog er die Schultern hoch.
»Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, von denen sich unsere Schulweisheit nichts träumen lässt — mehr kann ich nicht sagen.«
»Und ebenso sorgfältig vergewisserten wir uns, dass sie in diesem halbwachen Zustande nichts in die tote Hand nehmen kann, was von einen. toten Menschen oder Tiere herrührt. Wir machten ganz komplizierte Experimente. Sie bekam die Federn eines Huhnes; mit diesem ging ich weit, weit hinaus — plötzlich tötete ich das Tier. Derartiges haben wir nicht wieder getan, sie bekam die Krämpfe.«
Langsam wandte sich van Hyden seinem Schwiegersohne zu, sah ihn mit großen Augen an.
»Ja, Jack, haben wir nicht etwas von Mariechen...«
»Ich habe eine Locke von ihr.«
»Sollten wir — ja, weißt du, ob das Mädchen, welches so schwach war, auch noch lebt...?«
»Das ist es eben. Und dann ist es immer die Frage, ob sie die Gabe des zweiten Gesichts auch noch besitzt.«
»Da sollten wir gleich einmal schreiben...«
»Schreiben?«
Auch Texas Jack war aufgestanden. Er zog seine Uhr.
»In zwei Stunden geht der Schnelldampfer nach Harwich mit Anschluss nach London — — in achtunddreißig Stunden bin ich in der Hütte von Killey!!«
Der Vater kam mit. Er konnte nicht allein in dem für ihn verödeten Hause bleiben, und auch er wollte schnellstens Gewissheit haben. Nur Gewissheit!! Es war ein Hausverwalter da, ein intelligenter, zuverlässiger Mann, mit dem konnte man, wenn es nötig war, von Dunkeld aus immer in brieflicher oder selbst telegrafischer Verbindung bleiben, falls die Polizei etwas Neues zu berichten hatte.
Wenn aber Mijnheer auf Reisen ging, dann musste auch der Klaus mit, sein Leibdiener. Papa van Hyden konnte sich nämlich nicht selbst rasieren, und er musste immer glatt rasiert sein, sonst fühlte er sich als ein Pavian, aber nicht als ein Mensch, und Papa van Hyden wäre trotz seines Bäuchleins lieber gegen eine feuerspeiende Batterie angestürmt, als dass er seine Physiognomie einem fremden Rasiermesser anvertraut hätte. Er hatte eine Heidenangst davor. Nur einem einzigen Menschen hatte er sich einmal anvertraut, sich an ihn gewöhnt — und der hieß Klaus Klausen.
Ja, barbieren konnte Klaus, sonst aber auch weiter gar nichts. Er war nicht gerade beschränkt, aber — gesetzt den Fall, das Pulver wäre noch nicht erfunden gewesen — dieser Klaus hätte es jedenfalls nicht erfunden, nicht einmal das rauchlose Insektenpulver. Sein Hauptfehler lag in seiner Religion. Nach dieser hatte Gott nur einen einzigen Propheten in die Welt geschickt — und der hieß: Mijnheer Peter van Hyden. Was der sagte, das musste wahr sein.
»Klaus«, hatte da einmal Mijnheer gesagt, als er sich wieder über die grenzenlose Dummheit seines Leibbarbiers geärgert, »ich glaube, du kannst mit deinem Kopfe durch eine Wand rennen. Probier's einmal!«
Bald darauf erscholl ein donnernder Krach, dann noch einer, dass das ganze Haus wackelte und es in den Wänden rieselte.
»Wer hat da geschossen?«, schrie Mijnheer zur Tür hinaus. »Das waren Böllerschüsse!«
Klaus erschien wieder. Sein Vollmondgesicht war ganz Betrübnis, und den Kopf hielt er sich mit beiden Händen.
»Ach nein, Mijnheer«, sagte er kläglich, »es geht nicht — zweimal hab' ich's probiert — mit vollem Anlauf — aber ich bin nicht durchgekommen — nur der ganz Kalk ist von der Decke gefallen.«
Dieses Beispiel genüge. Wir werden uns später noch oft mit diesem Klaus und seiner Geisteskraft zu beschäftigen haben. — — —
Acht Stunden später befanden sich die drei auf der Liverpool Street Station zu London. Sie hatten auf den Abgang des Nordexpresszuges noch eine Stunde zu warten, Jack wollte dem kleinen Mädchen — falls dieses noch lebte — etwas mitbringen, er bat den Schwiegervater, ihn zu begleiten, nur über die Straße.
Er betrat einen Spielwarenladen, verlangte eine Puppe, und dem Vater stieg etwas siedend heiß zum Herzen und bis in die Augen hinauf, als er zusah, wie dieser hünenhafte, bronzefarbene Mann ein Kinderpüppchen kaufte, wie sorgfältig er seine Auswahl traf, wie er sich immer wieder andere vorlegen ließ, er wollte nichts Kostbares haben, ganz im Gegenteil, ganz einfach, aber gut, und sie musste sich richtig aus- und anziehen lassen, sie musste ganz richtige Wäsche haben — und dieselbe Hand, die das wildeste Pferd niederzwang und den Indianerhäuptling aus dem Sattel riss, dieselbe Hand prüfte die Puppenwäsche, darauf Bedacht nehmend, dass jenes arme Kind nur mit einer Hand knüpfen und hefteln konnte — und als sie den Laden wieder verließen, der Präriejäger das Paket mit dem Püppchen wie einen Schatz gegen seine Brust gedrückt, da rannen dem alten Vater die hellen Zähren über die Wangen.
Aber das war noch nicht alles. Nicht allein, dass er so sorgfältig eingekauft hatte! Da war noch vielerlei daran, was nicht richtig war; solche dumme Schuhe trägt kein Mensch, die halten ja beim Gehen gar nicht an den Füßen, das musste alles richtig werden —und im Coupé erster Klasse, angesichts einiger Herren und Damen, fing der vornehme Kavalier an, die Puppenwäsche mit Nadel und Zwirn zu bearbeiten. Und der verstand zu nähen!
Das zwölfjährige Kind saß aufrecht in dem Bettchen, welches in einer sonnigen Ecke der kleinen Waldhütte stand. Arm mochten ihre Bewohner sein, aber Not litten sie nicht, das sah man überall, und hier waltete eine fleißige, saubere Frau.
Jack hatte recht — — es war nur ein Hauch von einem kleinen Menschenleben. So durchsichtig wie die Hand war das blasse Gesichtchen, von einem unbeschreiblichen Liebreiz, eingerahmt von blonden Locken. Doch leidend sah sie eigentlich nicht aus. Die großen, blauen Augen strahlten immer von innerem Glück, zum glücklichen Lächeln war der Mund mit den bleichen Lippen geschaffen. Es war alles Geist an ihr, der jeden Augenblick verfliegen konnte, schmerzlos den ihn hindernden Körper verlassend.
Die Hand des linken Armes lag unter der Bettdecke, die rechte Hand dirigierte zwei Tücher, jedes oben mit einem Knoten, und diese beiden Tücher führten als Menschen durch den Mund des Kindes ein tiefernstes Zwiegespräch.
»Nein, nein, auf so etwas kann ich mich nicht einlassen, Herr Fitzroy. Ich bestelle bei Ihnen ein großes Haus. Sagen Sie mir bestimmt, ob es bis heute Abend fertig gebaut sein kann, sonst muss ich mich mit meiner Frau nach einer anderen Wohnung umsehen.«
Das andere Tuch hob nachdenklich den Knotenkopf.
»Ja, mein bester Herr, das kann ich Ihnen nicht so genau versprechen. Das muss ich erst einmal mit meiner Frau bereden. Wir haben nämlich heute gerade Kindtaufe zu Hause, meine Frau backt Kuchen, und da muss ich die Rosinen auslesen...«
Ein Hund schlug an. Schritte erklangen. Die Hand ließ die Puppen fallen, sie wurde nach der Türe ausgestreckt, erst etwas Staunen, dann wurde das liebliche Engelsgesichtchen von eitel Seligkeit verklärt.
»Jack — — — das ist ja mein Jack!«, jauchzte das dünne Kinderstimmchen dem Eintretenden entgegen.
»Wie? Du kennst mich noch, Evangeline?«
»Ach, ich habe ja fortwährend an dich gedacht! Und denke dir, gerade jetzt lasse ich ein Haus bauen, wo wir beide drin wohnen wollen! Aber«, setzte sie mit einem schelmischen und zugleich verlegenen Lächeln hinzu, »aber das ist natürlich gar nicht wahr, das tue ich bloß so.«
Jack war vor dem Bettchen niedergekniet, und wieder traten dem still zur Seite stehenden Holländer die Tränen in die Augen, wie jener das zarte Geschöpfchen liebkoste und wie dieses das gesunde Ärmchen um ihn schlang, wie sich der große, starke Mann mit diesem Kinde zu unterhalten verstand. Die beiden mussten schon früher gute Freundschaft geschlossen haben.
»Nun sieh erst mal, was ich dir mitgebracht habe.«
Und er packte die Puppe mit mehreren Kleidchen und viel Wäsche aus.
Ach, dieses Entzücken des armen Kindes! Aber kein lauter Jubel. Es lag nur in dem verklärten Lächeln und in den seligen Augen, und wie sie den schwarzlockigen Kopf des Mannes, der neben ihr kniete, immer wieder an ihre kleine Brust drückte.
»... und hier sind sechs Hemdchen zum Wechseln — — — und hier drei Unterröcke — — — und hier noch ein Paar Schuhchen, ganz richtig zum Anziehen...«
»Kann ich das alles wirklich auch waschen?«, fragte sie ganz zaghaft, ob solches Glück denn auch möglich sei.
»Freilich kannst du alles, alles waschen, du kannst die Puppe auch baden.«
»Ach, Jack, warum bleibst du nicht für immer bei mir! Sieh, ich wasche die Hemdchen, und du hängst sie immer zum Trocknen auf. Gelt? Und du kannst hier wohnen, wir haben jetzt so viel Platz, seitdem der Vater tot ist...«
»Dein Vater ist tot?«, rief Jack erschrocken.
»Schon seit einem Jahre, er starb ganz plötzlich«, sagte sie ruhig, und das war erklärlich, als sie dann hinzufügte, wie es eben nur ein Kind sagen kann. »Er ist nun im Himmel. — — O, Jack, wir haben es jetzt gut! Vater war doch Waldhüter, und da bekommt Mutter in der Stadt jeden Monat viel Geld, o, wir sind jetzt fein heraus und brauchen gar nicht mehr zu arbeiten, wir sind reich, wir können jeden Tag für zwei Groschen Hafergrütze essen, jawohl — — — Wer ist denn der Herr dort?«
Mijnheer van Hyden trat heran.
»Das ist mein — — mein Schwiegervater«, erklärte Jack.
»Dein — Schwiegervater?«, wiederholte sie sinnend, darüber ganz die Begrüßung vergessend. »Ja, Jack, bist du denn...«
»Jawohl, ich bin verheiratet.«
Wieder das verklärte Lächeln.
»Ach, Jack, das ist aber schön! Und du hast deine Frau nicht mitgebracht? Ich möchte sie so gerne einmal sehen!«
»Deshalb kommen wir ja eben zu dir«, sagte Jack niedergeschlagen. »Denke dir, Eva, erst seit drei Wochen sind wir verheiratet, und mit einem Male ist sie verschwunden, und wir wissen nicht, wohin, wissen nicht, ob sie überhaupt noch lebt.«
Das sensitive Kind sing sofort heftig zu weinen an. Es brauchte nicht viele Worte, es hörte sofort am Tone des Sprechers, wie dieser erschüttert war. Diesem unschuldigen Kinde gegenüber konnte er sich nicht verstellen.
Während Evangeline noch schluchzte, kam die Mutter, eine alte, freundliche Frau. Auch sie erkannte Texas Jack gleich wieder, sie freute sich, man weihte sie schnell ein, weshalb die beiden gekommen.
»Ja, es ist noch ebenso mit der Hand«, erklärte sie auf die leise gestellten Fragen, und dann blickte sie nach der schlichten Wanduhr. »Es ist gleich um vier — da kommen die Herren eben zur rechten Zeit. In zehn Minuten fällt sie in Halbschlaf.«
»Woher wissen Sie denn das im Voraus?«, fragte Jack erstaunt. »Das war doch früher niemals bekannt.«
»Aber jetzt wissen wir es immer schon. Sie ist einmal abends allein zu Hause gewesen, sie war auf, ging mit einem brennenden Lichte durch die Stube — da bekommt sie den Anfall, sinkt um und lässt das Licht fallen. Die ganze Hütte wäre bald abgebrannt. Das hat sie sich furchtbar zu Herzen genommen, da ist etwas in ihr vorgegangen, seitdem sagt sie stets zuletzt, bevor sie aufwacht, wann sie das nächste Mal in Halbschlaf fällt. Dort nach der Uhr richtet sie sich, und es stimmt auf die Minute. Jetzt wird sie zehn Minuten nach vier einschlafen.«
Evangeline hatte sich wieder beruhigt, sie wollte mehr wissen, wie Jacks Frau verschwunden sei, und über dem Erzählen verging die Zeit, ohne dass die Uhr beobachtet wurde.
»Mein armer Jack! Maria heißt sie? Gerade wie die Mutter unseres Heilandes. Nicht wahr, du hast doch immer zum lieben Gott gebetet, dass sie nicht tot...«
Mitten im Wort sank das Mädchen plötzlich mit geschlossenen Augen in die Kissen zurück, und die Uhr zeigte genau auf zehn Minuten nach vier Uhr.
Jack holte das linke Händchen unter der Decke hervor, auch van Hyden nahm es einmal in die Hand — es war kalt und schlaff, wie das dünne Ärmchen. Schon nach wenigen Augenblicken aber glaubte er einige Wärme und einen Pulsschlag zu fühlen.
»Jetzt — jetzt — — jetzt ist es da!«
Er entnahm einem goldenen Medaillon eine blonde Locke, und bevor er sie in die kleine Hand legte, sah er den alten Mann an.
»Vater«, sagte er mit zitternder Stimme, »im nächsten Augenblick hat es sich entschieden, ob sie die Locke wegwirft oder in der Hand behält — — — Vater, bete zu Gott, dem Allgütigen!!«
Er war furchtbar erregt, und der Vater faltete unwillkürlich die Hände. Beide glaubten ja gar nicht mehr daran, dass Mariechen noch am Leben sein könne, hier aber erhielten sie wenigstens die Gewissheit von ihrem Tode! So sagte Jack. Der Vater hatte unterwegs noch viele Stunden des Zweifels gehabt. Es ging über seinen Verstand, woher das Mädchen sofort fühlen sollte, ob das Haar einem Lebendigen oder einem Toten angehöre.
Das Händchen lag offen auf der Bettdecke, Jack holte tief Atem, es klang wie ein Röcheln, schnell legte er die Locke hinein, klappte die Fingerchen darüber, trat zurück...
Im nächsten Angeublicke lag er auf den Knien, die Arme zum Himmel aufgehoben.
»O Gott, o Gott, ich danke dir!!«, rief er jauchzend aus überströmenden. Herzen. »Vater, sie lebt noch! Unser Mariechen lebt noch!!«
Es lag eine solch gewaltige Überzeugungskraft in diesen Worten, dass Mijnheer van Hyden im Augenblick ganz vergaß, wie es ja nichts weiter war, als dass die Hand die Locke so behielt, wie sie hineingelegt worden war.
»Mariechen lebt!!«, jubelte überzeugungstreu auch der Vater, und heiße Dankestränen gegen den Allmächtigen entstürzten seinen Augen.
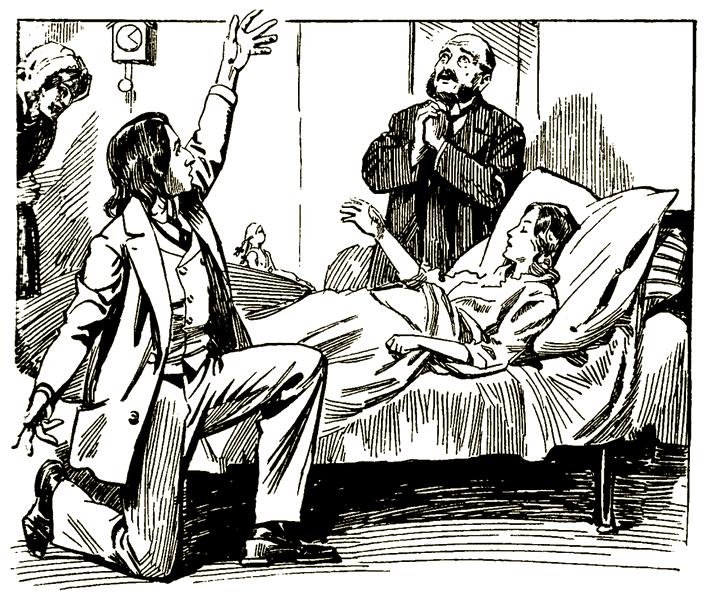
Schnell hatte Jack sich wieder erhoben. Es war keine Zeit zu verlieren. Er setzte sich neben das Bettchen und nahm die andere, die gesunde Hand des Kindes zwischen seine beiden.
»Was siehst du, Evangeline?«
Eine qualvolle Pause verstrich. Das Kind lag regungslos mit geschlossenen Augen da. Jack wiederholte seine Frage. Da endlich begann es zu flüstern:
»Ich sehe — — — — — — nichts.«
»Ist die Person da?«
»Ja, ja«, hauchten die weißen Lippen, »aber — — — es ist ganz finster — — — ich kann noch nichts sehen.«
Wieder ließ Jack das Kind eine lange Zeit in Ruhe. Aber dabei wurde er immer besorgter, eine heimliche Angst schnürte ihm das Herz zusammen, denn in dem seinen Gesichtchen prägte sich eine immer größere Furcht aus, die sich bis zum Entsetzen steigerte.
»Hu, hu — — es ist so finster — — ich fürchte mich«, begann da Evangeline von selbst, und sie zitterte am ganzen Körper, »und — — — und ich kann mich gar nicht regen — — ich — — ich liege in einem Sarge — — hu, sie liegt in einem Sarge!!«
»Sie ist tot!!«, schrie der Vater jammernd.
»Nein, Mariechen ist nicht tot, sonst würde dieses Kind nicht die Haarflechte in der Hand behalten — sie lebt!!«, rief Jack mit derselben felsenfesten Überzeugung. »Oder ist es nicht so, Mutter?«
Die alte Frau bestätigte es mit der größten Gewissheit. Wenn Eva die Locke nicht sofort von sich schleudere, dann müsse die betreffende Person auch noch am Leben sein.
»Evangeline«, wandte sich Jack wieder an das Kind, »sieh doch einmal aufmerksam hin. Vielleicht liegt sie nur in einen. finsteren Zimmer.«
»Nein — nein«, flüsterte die Seherin angstvoll, »es ist ein Sarg — — es ist so finster — — hu, hu, nehmt sie doch nur aus dem Sarge...«
Dabei blieb Eva, mehr war von ihr nicht zu erfahren, und der unglückliche Vater kam wieder zu seiner Ansicht, dass das Kind höchstens eine Tote im Sarge sehen oder richtiger fühlen könnte. Da kam ihm eine Idee.
»Kann man die Locke aus der Hand nehmen und ihr eine andere geben? Sieht sie dann die andere Person?«
»Gewiss, das kann man.«
Mijnheer van Hyden öffnete ein an seiner Uhrkette hängendes Medaillon und entnahm diesem eine kleine schwarze Haarflechte.
»Ich habe in Paris eine Schwester leben, hier ist eine Locke von ihr. Sage mir, Eva, was jetzt meine Schwester macht. Es ist eine alte Dame.«
»Das hättest du gar nicht sagen sollen«, flüsterte Jack. »Sie kann alles hören — ich zweifle nicht daran, aber du hättest dich besser von ihrer Sehergabe überzeugen können.«
Van Hyden antwortete nicht, er nahm Maries Haar aus des Kindes Hand, welche sich jetzt willig von selbst öffnete, es war Leben darin, er legte die schwarze Locke hinein...
Mit einem gellenden Schrei hatte das kleine Mädchen die Haarflechte sofort von sich geschleudert.
»Was ist das?«, rief Jack erschrocken. »Vater, deine Schwester in Paris ist tot!! Sie muss plötzlich gestorben sein.«
Der Holländer aber war seltsamerweise nicht erschrocken. Er faltete die Hände und blickte zum Himmel empor.
»Jetzt glaube ich an die Sehergabe dieses Kindes«, sagte er feierlich. »Ich sprach absichtlich mit so lauter Stimme eine Unwahrheit, um es zu prüfen — — es ist eine Locke von meiner seligen Frau!«
Die Sicherheit des Unterscheidens zwischen Toten und Lebenden war somit erwiesen. Mariechen lebte! Nun war aber das Rätsel mit dem Sarge aufzuklären.
Jack gab ihr die Locke seiner jungen Frau von neuem in die Hand, und er beobachtete, dass diesmal Evas Züge keinen Ausdruck des Grausens zeigten, als sie murmelte:
»Morgen Mittag achtzehn Minuten vor eins falle ich wieder in Halbschlaf.«
Für heute war es zu spät. Die warm gewordene Hand erkaltete schnell wieder, Eva schlug die Augen auf, war gleich bei Besinnung.
»Was habe ich gesagt?«, war ihr erstes Wort.
Es wurde ihr erzählt. Das Kind selbst konnte keine Erklärung geben, zumal, da es aus dem Halbschlafe immer völlig besinnungslos erwachte. Aber die Person, deren Haar sie in der Hand behalten, lebte, lebte bestimmt!!
Nun kam allerdings ein eigentümlicher Fall in Betracht.
Vor einigen Tagen, als die Mutter nicht zu Hause gewesen, waren zwei Männer gekommen und hatten einen Sarg gebracht, sagten, die Mutter hätte den Sarg bestellt, er sei hier abzugeben. Der Irrtum hatte sich schnell aufgeklärt, aber Eva war doch sehr erschrocken gewesen; der Sarg kam ihr jede Nacht im Traume vor.
Das musste in Betracht gezogen werden, und Eva wurde selbst etwas kleinlaut.
Dass die betreffende Person gerade in einem Sarge lag, konnte sie nämlich überhaupt nicht wissen. Wenn die Person z. B. schlief, so sah Eva nichts, dann aber trat anstatt des Sehens ein Mitfühlen ein. Dasselbe galt, wenn sich die Person in einem finsteren Zimmer befand. Ob die Person schlief oder nur in einem finsteren Zimmer lag, konnte sie auch nicht recht unterscheiden. Im Allgemeinen fühlte sie sich, mit einem Schlafenden in Verbindung gesetzt, stets sehr wohl. War die Person aber etwa zu eng geschnürt, trug sie unbequeme Kleider, das fühlte sie sofort. Sie wusste sogar immer ganz genau, ob der finstere Raum, in dem sich die Person befand, sehr groß oder sehr eng war. Denn dieses Gefühl der Unterscheidung besitzt wohl jeder Mensch.
Etwas war also schon daran. Aber dass Marie gerade in einem Sarge lag, das konnte sie nicht behaupten. Da spielte offenbar der Sarg eine Rolle, über den sie erschrocken war. Doch in einem sehr, sehr engen Raum musste sich Marie auf alle Fälle befunden haben, und zwar liegend.
Nun, wir werden später noch sehen, wie außerordentlich fein das Gefühl des Kindes gewesen, wie nahe es der Wahrheit gekommen war.
Es musste bis nächsten Mittag gewartet werden. Am besten war, man blieb gleich hier. Durch des Vaters Tod war Platz in der Hütte geworden. Das Gepäck befand sich in Dunkeld unter Aufsicht von Klaus, und da noch mehrere Tage vergehen konnten ehe Aufklärung geschaffen, wurde ein Mann nach der Stadt geschickt, welcher auch den Diener mit dem notwendigsten Gepäck herbeiholte.
Die drei Männer richteten sich in der Nebenkammer ein, so gut es ging, sie spielten mit dem Kinde, auch am Morgen des anderen Tages. Jack trug es in den Wald; sie pflückten Beeren und kochten für das Püppchen eine Suppe; die neuen Hemdchen waren zu steif, die mussten erst gewaschen werden, Eva wusch, Jack wrang aus, Mijnheer van Hyden hing sie auf, und Klaus setzte sich als Plätteisen darauf.
»Du darfst sie aber nicht verbrennen«, sagte Eva einmal.
Erschrocken sprang Klaus auf, roch erst an das Kinderhemdchen, auf dem er gesessen, ob es versengt röche, dann griff er an sein natürliches Plätteisen.
»Nein, o o o nein, es ist ja gar nicht so sehr heiß.«
Auf diese Weise verging der Vormittag. Die Zeit rückte heran. Eva lag wieder im Bett; achtzehn Minuten vor eins sank sie plötzlich mit geschlossenen Augen in die Kissen zurück. Jack gab ihr die Locke in das warm werdende Händchen.
»Was siehst du, mein liebes Kind?«
Evangeline benahm sich von vornherein ganz anders als gestern; sie lächelte gleich so heiter.
»Ich sehe — — ach, das sieht aber hübsch aus! — — wie die angezogen ist! — — Ganz, ganz bunt! — — — So etwas habe ich noch niemals gesehen! — — Und die schöne, bunte Krone, die sie auf dem Kopfe hat...«
»Bitte, Eva, beschreibe alles ganz genau, was du stehst«, sagte Jack, dessen Herz schon wieder zu pochen begann, weil er abermals ein Rätsel kommen sah, das nicht zu deuten war, und er sah auch das schon wieder misstrauische Gesicht des Schwiegervaters.
»Steht sie, liegt sie?«
»Sie liegt — — worauf, das kann ich nicht sehen — — sie liegt ganz still — — nein, wie komisch sie nur aussieht! — — und schön! — — Sie hat ein kurzes Kleidchen an — — nur bis an die Knie — — ganz, ganz bunt — — blau und rot und gelb und grün — — ja, jetzt sehe ich es ganz genau — — das ganze Kleid ist aus lauter kleinen Federn zusammengesetzt...«
Vater und Schwiegersohn sahen sich an, beide schüttelten den Kopf.
»... und was für merkwürdige Schuhe sie anhat«, fuhr das hellsehende Kind fort, »es sind gar keine richtigen Schuhe — — und dann gehen rote Stricke um den Fuß und um das ganze Bein herauf...«
»Sandalen«, schaltete Jack ein und gebot dem Mijnheer, der etwas sagen wollte, durch eine Handbewegung Stillschweigen. »Was siehst du weiter, mein Kind? Wie ist sie oben gekleidet?«
»O, wunder, wunderschön! Um die Hüften hat sie einen goldenen Gürtel — — und das Oberkleid, das ist auch aus lauter solchen kleinen, bunten Federn zusammengesetzt — — und auf dem Kopfe hat sie eine Krone, auch aus bunten Federn, aber aus ganz langen...«
»Die beschreibt ja gerade das Bild, das sie neulich vom Krämer geschenkt bekommen hat«, meinte die Mutter erstaunt.
»Was für ein Bild?«, fragte Mijnheer schnell. »Vielleicht von einem Zigarrenkistendeckel?«
Das konnte die Mutter nicht so genau sagen, sie ging, das Bild in den Kommodenfächern zu suchen, fand es aber nicht gleich.
»Wie sieht denn ihr Haar aus?«, fragte Jack.
»Das Haar ist lang — lang und schwarz.«
»Schwarz?!«, riefen die beiden Männer gleichzeitig mit der größten Enttäuschung.
»Ganz, ganz schwarz — so schwarz wie ihr Gesicht...«
»Was, ihr Gesicht ist schwarz?!«
»Alles ist schwarz — die ganze Haut — die Hände und die nackten Arme, die Füße — es ist alles schwarz — oder — so dunkelbraun...«
»Nein, das ertrage ich nicht länger, ich muss Gewissheit haben, wie weit die Visionen dieses Kindes zuverlässig sind!«, rief Mijnheer und winkte Jack zu sich.
»Hier, Jack«, flüsterte er dann, entfernt vom Bett, »schneide mir einige Haare vom Kopfe, ich gehe hinaus, außer Gesichtsweite, gib dem Kinde mein Haar in die Hand, lass dir erzählen, was ich Auffallendes tue.«
»Gut, das können wir schnell einmal machen. Ich werde dem Kinde auch einen Bleistift in die Hand geben, male du etwas in dein Notizbuch, du kannst auch schreiben, aber in großen, gedruckten Buchstaben. Die kann sie nachmalen. Das ist der überzeugendste Beweis für ihr Hellsehen.«
Die Haare waren abgeschnitten. Van Hyden ging schnell hinaus, schritt den Weg in den Wald hinein, blieb stehen, wartete etwas, drang in das Gebüsch, setzte sich auf einen Baumstumpf — von der Hütte aus konnte er nicht gesehen werden — zog sein Taschentuch, nahm den Hut ab, wischte sich die Stirn, legte den Hut an den Boden, zog langsam Notizbuch und Bleistift, besann sich und schrieb in großen Buchstaben: KALEIDOSKOP.
So, dieses Wort sollte das Kind einmal erraten!
Er hielt das Buch noch eine kurze Zeit vor sich hin — diese Rücksicht war er dem hellsehenden Kinde schuldig — dann steckte er es ein, stand auf und ging schnellen Schrittes in die Hütte zurück.
»Nun, was habe ich getan?«
»Du gehst in den Wald«, entgegnete Jack, »bleibst stehen, verlässt den Weg, gehst tiefer in den Wald, du setzest dich auf einen Baumstumpf, ziehst dein Taschentuch, nimmst den Hut ab, trocknest dir die Stirn, legst den Hut an den Boden, holst aus der Tasche erst ein Buch, dann einen Bleistift und schreibst...«
Das noch schlafende Kind hielt in der rechten Hand einen Bleistift, vor ihm auf der Bettdecke lag ein Blatt Papier. Jack nahm es und hielt es seinem Schwiegervater hin, und da stand, von einer Kinderhand mit großen Buchstaben hingemalt: KALEIDOSKOP.
Mijnheer van Hyden breitete die Arme aus und blickte zum Himmel empor.
»Ja, jetzt muss ich wirklich glauben! — Aber was ist nun das mit der Indianerin? Das kann doch unmöglich unser Mariechen sein?«
Evangeline erhielt wieder Mariechens blonde Locke in die Hand — allein da sah sie abermals nur das schwarzhaarige Mädchen mit der dunkelbraunen Haut in dem seltsamen, bunten Federkleid. Doch jetzt begann sie auch noch etwas anders zu sehen.
»... sie hebt den Kopf — ach, was für ein schönes Zimmer! — sie blickt sich um — sie richtet sich auf — jetzt sieht sie einen Mann — sie springt auf...«
»Wer springt auf?«, fragte Jack noch einmal zur Vorsicht, vielleicht, dass sie jetzt eine andere Person sah.
»Das Mädchen, dessen Haar ich in der Hand habe...«
»Ja, aber wie sieht dieses Mädchen aus?«
»Ganz schwarz, das Gesicht, die Hände, die Füße — alles ist ganz schwarz — ein schönes, buntes Kleid aus lauter bunten Federn...«
Es nützte nichts!
»Der Mann geht auf sie zu...«
»Wie sieht der Mann aus?«
Evangeline antwortete nicht gleich, und dann sagte sie mit veränderter Stimme:
»Morgen Abend halb sieben schlafe ich wieder ein.«
Es war wieder vorbei, sie erwachte, und diesmal musste man lange warten, ehe man etwas Neues erfahren konnte.
»Hier habe ich das Bild«, sagte die Mutter, ein buntes Papier in die Höhe hebend.
Der ihr zunächst stehende van Hyden nahm es, und seine Zweifel waren immer noch nicht besiegt.
»Natürlich, es ist so ein Bild von einer Zigarrenkiste, ein rauchendes Mädchen in einem Federkleid mit Federkrone darstellend, halb Indianerin, halb Afrikanerin, halb Inderin, wie es so etwas gar nicht gibt. Dass Evangeline Mariechen wirklich sieht und alles, was sie tut, daran allerdings kann ich jetzt nicht mehr zweifeln. Aber in ihr Hellsehen mischt sich doch viel aus ihrer Erinnerung mit. Sieh, mein Kind, du hast dieses Bild...«
»Halt!«, fiel Jack ein und nahm ihm das Bild, welches er dem Mädchen zeigen wollte, schnell aus der Hand. »Evangeline, hast du vom Krämer ein schönes, buntes Bild geschenkt bekommen?«
»Ja, vorige Woche«, lächelte das erwachte Kind. »Es ist ein Mädchen in einem bunten Federkleid, es raucht eine Zigarre...«
»Was für Schuhe hat es denn an?«, unterbrach sie Jack.
»Gar keine, sie hat so Riemen um die Beine gewickelt...«
»Wie sehen diese Riemen denn aus? Schwarz, nicht wahr?«
»Nein, grün sind sie, ich kann mich noch ganz genau entsinnen.«
Jack blickte den Schwiegervater an.
»Siehst du? Auf dem Bilde sind die Sandalenriemen wirklich grün, vorhin aber hat sie rot gesehen. — Kannst du dich sonst noch entsinnen, wie das Mädchen auf dem Bilde aussieht, mein Kind?«
Evangeline besaß ein gutes Gedächtnis und hatte das Bild, ehe die Mutter es weglegte, oft und lange genug betrachtet, und während sie jetzt keine Idee mehr von dem hatte, was sie vorhin im Halbschlafe gesehen, beschrieb sie dieses Bild, welches Jack vor ihren Augen verborgen hielt, ganz genau in allen Kleinigkeiten und immer ganz richtig. Ja, es war wohl eine große Ähnlichkeit vorhanden, das Federkleid, die Federkrone und noch vieles andere, aber dann war manches auch wieder ganz anders. So hatte das Mädchen auf dem Bilde keinen goldenen Schuppengürtel um die Hüften, und davon wusste Evangeline jetzt auch nichts zu erzählen.
Trotzdem, van Hyden wurde seine Zweifel nicht los, ob das Kind nicht dennoch Wirklichkeit mit Phantasie vermische, wie solle Mariechen denn plötzlich eine Negerin geworden sein und in solch ein Kleid kommen — und wie er sich so äußerte, brach Evangeline plötzlich in Tränen aus.
»Warum weinst du denn, mein Kind?«, fragte Jack erschrocken.
»Weil ihr mir nicht glauben wollt, dass ich wirklich richtig sehe«, schluchzte Evangeline herzzerreißend, »und ich kann doch nichts dafür, wenn es nicht so ist, wie ihr es euch gerade vorstellt!«
»Nein, nein, mein Kind, ich glaube dir alles«, tröstete Jack die Weinende, und dann wandte er sich sehr ernst an den Schwiegervater. »Hast du es gehört?! Dieses Kind hat soeben eine tiefe Weisheit gesagt! Weil die Schilderung dieses Mädchens nicht in unseren Ideenkreis passt, deshalb dürfen wir uns noch lange nicht einbilden, dass so etwas ganz und gar unmöglich wäre! In dieser Welt ist überhaupt gar nichts unmöglich! Evangeline hat uns bewiesen, dass sie hellsieht und sich nicht irrt, und deshalb müssen wir von jetzt an alles, was sie uns sagt, mit vollem Glauben hinnehmen — oder wir werden fehlgehen. Aber dann ist das Beste, wir reisen gleich ab und überlassen alles der Amsterdamer Polizei. — Wenn nur mein guter Jagdhund sagt, dass der Grizzlybär, der nicht klettern kann, oben auf dem Baume sitzt, so glaube ich diesem Jagdhunde mehr als hundert Professoren, welche erklären, dass ein Grizzlybär gar nicht klettern kann, und obgleich ich selbst nicht zu fassen vermag, wie dieser Bär da auf den Baum gekommen sein soll.«
Der Präriejäger hatte sehr ernst und bestimmt gesprochen. Mijnheer van Hyden wurde plötzlich ganz kleinlaut. Er sollte überhaupt noch merken, wie dieser Mann, der die Welt doch gesehen hatte, manches so gläubig hinnahm, geradezu kindlichleichtgläubig — aber eben deshalb, weil er die Welt gesehen hatte, weil er wusste, dass Manches auf der Erde passiert, was man dem großen Publikum gar nicht erzählen kann, weil niemand es glauben würde.
»Ja, aber, wie soll denn Mariechen...«, begann der alte Mann nochmals zaghaft.
»Vater, wenn ich dreimal zweifle, so ist der beste Jagdhund für immer verdorben, er traut sich selbst nicht mehr«, unterbrach ihn der Jäger wiederum. »Wie Mariechen in den Sarg gekommen ist, in das bunte Federkleid, warum sie schwarzes Haar und eine schwarze Haut hat, darüber jetzt Erwägungen anzustellen, hat absolut keinen Zweck. Wir müssen sagen: Es ist! Und damit basta! Wir haben jetzt unseren Scharfsinn in ganz anderer Weise anzustrengen, wir müssen die allergeringste Kleinigkeit beobachten, welche uns das Kind erzählt. Lass du mich immer fragen, ich bin in so etwas bewandert, wir müssen erst herausbekommen, in welchem Erdteil sich Mariechen aufhält...«
»Erdteil? Ich denke doch, sie wird noch in Holland sein!«
»Ja, lieber Vater, was gilt denn aber dein Denken! Wir dürfen nicht mit der Hausnummer anfangen. Die kommt zuletzt daran. — Mariechen lebt. Auf der Erde ist sie noch. Nun müssen wir große Kreise ziehen und immer enger gehen, bis ins Zentrum hinein, dann sind wir am sicheren Ziele. Erst in welchem Erdteil. Dann in welchem Lande. Dann in welcher Stadt. Dann in welcher Straße. Und dann die Hausnummer, und da gehen wir direkt hinein und werden Mariechen finden. Aber wenn wir den umgekehrten Weg nehmen, so werden wir immer planlos herumtasten«
Auf solche Auseinandersetzungen wusste Mijnheer van Hyden nichts zu erwidern.
Aber der erfahrene Fährtensucher war auch weitsichtig. Er zog schon die Möglichkeit in Betracht, das hellsehende Kind von hier mit fortzunehmen. Wenn der Aufenthalt der Vermissten mit Sicherheit bestimmt worden war, was aber vielleicht noch lange dauern konnte, so musste man wahrscheinlich gleich Polizei requirieren, das dauerte von hier aus lange Zeit, und dann musste alles schnell gehen. Dann konnte man vielleicht aus den Aussagen der Hellseherin zuerst nur das Land erkennen, in welchem Mariechen verborgen gehalten wurde, und es war doch immer besser, wenn die Hellseherin immer gleich an Ort und Stelle war, um nach ihren täglichen Beobachtungen weiterforschen zu können.
Aber die Mitnahme des schwächlichen Kindes bot natürlich viele Schwierigkeiten. Als Buffalo Bill von der Hellseherin gehört, hatte er beabsichtigt, sie zu engagieren, sie mit auf die Reise zu nehmen. Doch einmal hätte das der Vater nicht zugegeben, vielleicht eher die Mutter; dann war damals die Zeit noch völlig unbestimmt, wann der Halbschlaf eintrat, das ging also nicht gut bei einer öffentlichen Schaustellung, und schließlich brauchte Colonel Cody dieses Kind nur zu sehen, um solch einen Gedanken sogleich aufzugeben. Es war ja nur ein Hauch von einem Menschlein. Das wäre ja eine Barbarei sondergleichen gewesen, dieses arme Kind auf anstrengenden Reisen mit herumzuschleppen. — —
Hierüber unterhielten sich die beiden am Abend desselben Tages in der Wohnstube der Hütte. Die Mutter war ausgegangen, Evangeline war in einen natürlichen Schlaf gefallen.
»Wenigstens nach London!«, flüsterte Jack. »Dort haben wir alles zur Hand; in fünf Stunden kann einer von uns, wenn es nötig ist, in Amsterdam sein. Ich trage das Kind immer in Betten. In London engagieren wir gleich eine Krankenpflegerin. Und wenn unser Vorhaben auch ein eigennütziges ist, so ist doch keine Gewinnsucht dabei. Das können wir vor unserem Gewissen verantworten. Mit der Mutter, glaube ich, werde ich bald fertig, die vertraut mir, und Evangeline...«
Der Sprecher brach ab. Evangeline hatte trotz des Flüsterns alles gehört.
»Ich gehe mit dir, Jack! Ach, bitte, nimm mich doch mit!«, bat sie mit Tränen in den Augen. »Ich kann überall mit hin, ich bin kräftig, o, so kräftig. Wenn du nur deine Frau wiederfindest!«
Als die Mutter kam, hatte Jack das Kind auf dem Schoße, es wurde ihr der Plan vorgelegt, Evangeline bat am allermeisten, und nach einigem weinenden Zögern hatte die Mutter nichts mehr dagegen einzuwenden, dass ihr einziges Kind mit nach London ginge, sie wüsste es in guten Händen, und da waren keine egoistischen Absichten dabei, denn von einer Entschädigung und dergleichen wollte die arme Schottländerin durchaus nichts wissen.
Doch bis zum nächsten Abend wollte man noch warten, was für Enthüllungen dieses Sehen bringen würde, es mussten ja auch noch Vorbereitungen zur Reise getroffen werden, und wenn diese Mutter ein paar gestopfte Strümpfchen und Röckchen unter leisem Weinen in ein Bündel schnürte, so geschah das mit derselben Sorgfalt, als wenn eine andere einige große Koffer für das abreisende Kind zusammenpackte, und keinem der beiden Männer fiel ein, etwa zu sagen, dass dies ja überflüssig sei, da könne man doch Besseres in der nächsten Stadt kaufen.
Der andere Abend und die angezeigte Stunde kamen.
»Was siehst du, mein Kind?«
»Ich sehe — — — sie! Sie steht und spricht mit einem Manne...«
»Wie sieht sie aus?«
»Sie hat ein schönes, weißes Kleid an, die Ärmel sind ganz weit...«
»Ihr Haar?«
»Ihr Haar ist ganz hellblond, ihre Haut ist fast so weiß wie ihr Kleid — — — ach, wie komisch! — — wie hübsch das aussieht! — — — aber das habe ich noch bei keinem Menschen gesehen — — — sie hat auf jeder Wange ein kleines Löchelchen — — — und auch im Kinn...«
»Mariechen! Endlich!! Sie ist's!!«, schrie der alte Vater jubelnd auf, während Jack nur ein glückliches Lächeln hatte.
»Sie spricht mit einem Manne«, fuhr die Seherin fort, »sie bewegt immer die Arme...«
»Wie sieht der Mann aus? Beschreibe ihn doch ganz genau!«
»Er ist groß und mager, er hat schwarzes Haar und in der Mitte einen weißen Strich...«
»Ist in der Mitte gescheitelt«, erklärte Jack schnell mit einer abwehrenden Handbewegung, weil van Hyden eine Frage stellen zu wollen schien.
»... ein schwarzer Vollbart, unten ganz spitz — — — jetzt verbeugt sich der Mann — — — er ist sehr schön angezogen — — — aber ganz schwarz — — — nur mit einem hohen, weißen Kragen — — — und seine Brust ist weiß — — — und aus seinen Ärmeln sieht etwas Weißes hervor — — — und, ach, seine Schuhe glänzen wie Spiegel...«
»Oberhemd, Lackschuhe — — ein Gentleman.«
»... auf dem Leibe hat er eine gelbe Kette hängen...«
»Goldene Uhrkette. Hängt an dieser Uhrkette irgend etwas?«
»Ja, ich wollte es gerade sagen — — da hängt — — — jetzt ist es wieder weg — — — es sah aus, als ob es große Zähne gewesen wären.«
Denn das Kind sah nur immer das, worauf das Auge der betreffenden Person gerichtet war. Doch die Erinnerung an das, was einmal gesehen war, blieb für immer, wenigstens während des Halbschlafes. Wenn Marie die Stiefel des Mannes überhaupt noch gar nicht beachtet hätte, so würde das Kind auch keine Stiefel gesehen haben.
»Der Mann verbeugt sich — — spricht — — verbeugt sich wieder — — — geht nach der Tür — — — dreht sich um ——— verbeugt sich wieder sehr tief — — — er ist hinausgegangen...«
»Was tut Mariechen?«
»Sie steht in der Mitte des Zimmers, hat die Hände gefaltet...«
»Wie sieht sie aus? Ihr Gesicht?«
»Sie sieht traurig aus. Jetzt hebt sie die Hand — — — sie zittert — — — sie greift sich an den Hals — — — sie zieht an etwas — — — ja, ich sehe eine Schnur — — — sie zieht etwas aus der Brust — — — ja, eine lange Schnur — — es hängt etwas Kleines daran — — — es sieht fast wie ein Kern aus...«
Der Vater unterdrückte alle Worte, er legte nur den Arm auf des Schwiegersohnes Schulter, dieser suchte leise seine Hand und presste sie. Es sagte auch mehr, als Worte tun können.
»... ich glaube, sie hat das kleine Ding aufgemacht — — — sie hält etwas zwischen den Fingerspitzen — — wie — — wie — — wie eine trockene Erbse sieht es aus...«
»Wie scharf sie sieht«, raunte Jack dem Vater zu, »und sie hatte doch keine Ahnung von Bills Geschenk!«
»... jetzt hält sie die kleine Erbse vor den Mund...«
Evangeline machte eine längere Pause, und die konnte erwartet werden. Dafür aber lächelte sie immer glücklicher.
»Ach, wie reizend!!«, jubelte sie dann auf. »Jetzt ist plötzlich aus der alten Erbse ein kleines, rotes Blümchen geworden! Wie ist denn das nur möglich?«
»Was tut sie jetzt?«, machte Jack das Kind, welches auch in diesem Zustande staunen und fragen konnte, schnell wieder auf die Hauptsache aufmerksam.
»Sie hebt die Arme, blickt nach oben, schlägt die Hände zusammen, faltet sie, küsst die kleine Blume — — jetzt liegt sie auf den Knien, sie spricht, sie betet — — sie weint — — aber dabei lacht sie...«
Und die beiden Männer weinten gleichfalls und lachten dabei voll Glück, dass sie ihr Liebstes wiedergefunden hatten — wenigstens wiedersahen.
Aber eben deshalb, weil dies ja nur das Bild einer Fernseherin war, verlor Jack nicht die Hauptsache aus den Augen, und er schonte auch nicht die Ruhe der Betenden.
»Wohin blickt sie beim Beten?«
»Nach dem Himmel.«
Siehst du nicht eine Decke?«
»Ja, sie blickt nach der Decke.«
»Wie sieht diese Decke aus?«
»Schön — sehr schön — sie ist rot und gelb — ach, und es sind auch Vögel dran — — und sogar Engel...!«
Hiermit fingen die Schwierigkeiten an. Jack wollte sich so gern die Möbel und manches Andere beschreiben lassen, und das konnte das zwölfjährige Kind nicht. Evangeline kannte nichts weiter als ihre Hütte und den Wald und dann noch einiges Andere, was sie vielleicht auf Bildern gesehen, in der Bibel gelesen hatte. Aber sie war noch nicht einmal in der nächsten Stadt gewesen, hatte eigentlich noch nicht einmal ein richtiges Haus gesehen.
Nun sah sie hier etwa ein Sofa. Sie wusste aber gar nicht, was ein Sofa ist, und da ist so etwas schwer zu beschreiben. Dann sprach sie ganz richtig von einem großen, sehr breiten Stuhle, wurde aber schon wieder durch die Polsterung irre, welche sie nicht kannte. Man musste bei ihren Beschreibungen sehr aufpassen, sonst konnte man leicht auf ganz falsche Schlüsse kommen. Das hatte sich ja auch schon vorher bei anderen Fällen gezeigt. Der Mann sollte in der Mitte seines Haars einen weißen Strich gehabt haben. Das Kind hatte in seiner einfachen Umgebung eben noch nie einen solchen scharfen Scheitel in der Mitte gesehen. Was wusste das Kind von Lackschuhen! Nicht einmal ein Oberhemd und Manschetten kannte es. Wohl aber wusste das Mädchen auch in diesem halbwachen Zustande, dass jener Herr — van Hyden — ebenfalls solche Wäsche trug.
Aber wenn Evangeline die Gegenstände, welche sie mit Maries Augen sah, schwer beschreiben konnte, so besaß sie dafür eine andere Gabe, um sich deutlich auszudrücken.
»Jetzt steht sie auf — — das Blümchen ist wieder ganz zusammengetrocknet — — sie steckt es wieder in den Kern und in die Brust — — sie streicht die Haare aus den Schläfen — — sie tritt ans Fenster...«
»Was siehst du aus dem Fenster?«
»Bäume — — und was für komische Bäume! — — Solche gibt es hier nicht! — — Alle ganz verschieden, und doch alle so ähnlich — — und so furchtbar große Blätter...«
»Evangeline, kannst du nicht solch einen Baum hinzeichnen?«
Sie hatte den Bleistift in der Hand, vor ihr lag noch das Papier, und — — eins, zwei, drei — stand ein Baum da.
»Das ist eine Fächerpalme!«, rief van Hyden sofort.
»Nein«, sagte aber Jack, »das ist eine junge Dattelpalme.«
So deutlich war der mit drei Strichen hingeworfene Baum zu erkennen, dass der weitgereiste Jack sofort sagen konnte, welcher bestimmten Art der Palmbaum angehörte. Das hatte das Kind nicht gelernt, das war eine angeborene Gabe.
»Steht die Palme in einem großen Topfe?«
»Nein, sie wächst in der Erde«, sagte Evangeline und malte weiter, noch mehr Palmen, aber wieder andere Arten, und jetzt zeichnete sie auch den Grund, aber keine großen Töpfe — — — »Jetzt dreht sie sich um, ich sehe die Bäume nicht mehr...«
»Palmen?«, fragte van Hyden staunend. »Sie wachsen in der Erde? Wo mag denn Marie da nur sein?«
»Halt, nicht irremachen lassen! Sie ist offenbar in einem vornehmen Hause. Das kann ein Gewächshaus, ein Wintergarten gewesen sein. — Was tut sie jetzt, Evangeline?«
Marie ging an einen Schreibtisch, setzte sich, nahm aus einer Schublade Papierbogen und begann zu schreiben.
»Kann Eva denn wirklich nicht Geschriebenes lesen?«, fragte van Hyden kleinlaut.
Ja, das allerdings wäre jetzt vortrefflich gewesen! Aber das Kind konnte weder schreiben, noch Geschriebenes lesen. Es wurde versucht, ob Eva die Schriftzüge nachmalen könne; aber es ging nicht.
Man wurde nicht klug aus den nachgemalten Zeichen. Das ist sehr schwer. Marie hatte auch eine sehr kleine, kritzelige Handschrift.
»Das Schreiben werde ich ihr mit der Zeit beibringen, wie noch manches Andere«, flüsterte Jack, »sie muss es nach Maries Handschrift lernen, ich habe einen Brief von ihr mit, dann kann Eva alles nachschreiben, es braucht auch kein Englisch zu sein.«
Das klang für den Vater sehr wenig tröstlich, denn das sah ja doch aus, als ob der Schwiegersohn glaube, die Verschwundene nicht so bald wiederzuerlangen.
Ach, die beiden ahnten nicht, wie lange es noch dauern würde und was sie alles noch durchmachen sollten, ehe sie die Tochter und Gattin wieder in ihre Arme schließen durften!!
Diesmal währte der schlafwache Zustand des Kindes sehr lange.
Die Schreiberin löschte den Brief ab und klingelte, ein reich livrierter Diener kam — und das war wieder ein Schwarzer. Jetzt beschrieb Evangeline aber ganz richtig einen echten Neger.
Der elegante Herr mit dem schwarzen Barte erschien wieder. Marie wollte ihm den Brief zeigen, seinen Handbewegungen nach lehnte er diese Aufforderung höflich ab...
»Ihre Korrespondenz soll nicht kontrolliert werden«, erklärte Jack.
Der Brief wurde von Marie kuvertiert und adressiert, der Herr steckte ihn mit einer Versicherung — jedenfalls, ihn zu besorgen — in seine Tasche, fragte etwas, bot Marie den Arm, immer mit vollendetster Höflichkeit — jetzt waren es zwei schwarze Diener, welche die Flügeltüren aufrissen — sie begaben sich in das Nebenzimmer. Hier war nach des Kindes Beschreibung eine überaus glänzende Tafel gedeckt, mit Silbergeschirr, Palmen und den prächtigsten Blumen, der Herr fragte etwas, verbeugte sich, verschwand. Diener brachten die rauchenden Schüsseln; Mariechen schien allein zu speisen.
»Jetzt aufgepasst, was für Gerichte es gibt, daraus können wir Schlüsse ziehen, wo sie sich befindet«, flüsterte Jack wieder.
Allein da war es wieder sehr schwer, von dem Kinde etwas zu erfahren. Nur über zweierlei konnte sich Jack vergewissern, der allerdings Fragen zu stellen wusste, auf welche der alte Vater niemals gekommen wäre, obgleich van Hyden doch auch nicht dumm war.
Erstens: Zum Fisch wurde kein Messer serviert. Zweitens: Es gab ein Fleischgericht, welches sich in einem gebackenen Teige befand.
»Sie ist in einem vornehmen englischen Hause«, erklärte Jack auf das Bestimmteste. »Auf nach London!«
Der Abschied zwischen Mutter und Kind erfolgte. Die beiden Männer weinten mit. Dann nahm Jack die kleine Evangeline auf den Arm, und er brauchte der Mutter keinen Schwur zu leisten, sie wie seinen Augapfel zu behüten. Er trug sie bis nach Dunkeld und ließ sie während der Fahrt von zwei Tagen und einer Nacht nicht aus seinen Armen, nicht von seinem Schoße, das Kind schlief an seiner Brust.
Während dieser langen Fahrt fiel Eva zweimal in Halbschlaf. Sie konnte nichts Neues erzählen. Es war immer dasselbe. Marie wurde mit der vorzüglichsten Höflichkeit behandelt. Ein anderer Herr als der mit dem schwarzen Vollbarte war noch nicht gesehen worden. Zu der Dienerschaft war jedoch noch eine junge Negerin hinzugekommen, welche nur immer in Maries Gesellschaft war — ihre Zofe.
Die beiden Männer hatten jetzt auch Zeit, Erwägungen anzustellen. Weshalb war Mariechen entführt worden? Es konnte sich doch höchstens um eine Gelderpressung von modernen Mädchenräubern handeln. Aber in Holland war noch kein Brief angekommen, das konnte man telegrafisch ermitteln. Und an wen hatte denn Mariechen geschrieben? Von ihr kam ebenfalls kein Brief an. Und sah denn diese Behausung aus, als ob Menschenräuber darin wohnten?
Mijnheer van Hyden dachte auch noch an etwas Anderes.
»Jack«, begann er einst zögernd, »ich muss einmal offen mit dir sprechen. Nimm es mir nicht übel. Aber hier muss sich doch eine Erklärung finden lassen. Du bist ja weit in der Welt herumgekommen —und — du hast auch viel in Damenkreisen verkehrt — — du bist — — auch viel geliebt worden...«
»Ich weiß, Vater, was du sagen willst«, kam Jack dem Verlegenen zu Hilfe, und dann hob er feierlich die Hand wie zum Schwure empor. »Bei Gott, ich weiß keinen Menschen auf der Erde, der Mariechen mir geraubt haben könnte, um sich an mir zu rächen, um mir heimtückisch ein Leid zuzufügen. Feinde habe ich, Feinde genug! — Aber das sind alles Männer, welche sich mit mir im offenen Kampfe messen möchten. — Ja, ich bin auch viel von Frauen verfolgt worden, ich habe sie durch Abweisung manchmal furchtbar beleidigt — — aber zuletzt bin ich noch mit jeder versöhnt auseinander gekommen, dadurch, dass ich immer offen und ehrlich war. Eine Mexikanerin, welche einst bei unserer Truppe engagiert war, hat mir einmal einen Stich beigebracht. Aber sie hat mich auch auf dem Krankenbett gepflegt, und dann ist sie weinend von mir gegangen, versöhnt, ins Kloster — oder vielleicht auch in die Wildnis. Bei Gott, Vater, ich weiß auf der Erde keinen einzigen Menschen, der mir übel will!«
Dann war und blieb Mariechens Entführung ein unergründliches Rätsel. Es war aber auch noch vieles andere Geheimnisvolle dabei. So zum Beispiel zeigte die Gefangene gar keinen übergroßen Schmerz. Freilich, sie wusste jedenfalls schon, warum sie entführt worden war, und es mochte gar nichts so Schreckliches dabei sein. Was konnte man der alles erzählt haben!
In London bezogen sie ein Hotel, und das erste, was Jack tat, war, dass er eine Krankenpflegerin suchte, wozu er in einer geeigneten Zeitung annoncierte. Dann erst setzte er sich mit der Polizei in Verbindung. Aber die Londoner Polizei konnte absolut nichts machen. Die kannten ja auch schon den Fall. Die hätten sich gern die Prämie verdient. Aus der schwarzen Bedienung war gar nichts zu schließen.
Die ist zwar in England sehr beliebt, die gibt es aber anderswo in vornehmen Häusern auch. Immerhin, man wollte jetzt speziell in London die Augen aufhalten.
Da meldete sich eine junge Dame als Krankenpflegerin. Das war zuerst sehr auffallend; denn die Annonce war in der Zeitung noch gar nicht erschienen, erklärte sich aber bald, als die Dame erzählte, bei jener Zeitung sei eine Freundin angestellt, die habe ihr, da sie gerade eine neue Stelle suchte, einen Wink gegeben.
Sie hieß Margot Linley, war jahrelang bei einer alten Dame als Pflegerin, hatte dann längere Zeit privatisiert. Es war ein bildschönes Mädchen, schwarz wie die Nacht, mit wie glühende Kohlen funkelnden Augen, mit einem stolzen Näschen. Sie sah also gar nicht aus wie eine Krankenpflegerin, welche doch vor allen Dingen, zart, sanft und geduldig sein muss, und sie schien sehr leicht aufbrausen zu können. Aber da kann man sich auch sehr irren. Erstens hatte sie brillante Zeugnisse, und zweitens bewies sie gleich dem Kinde gegenüber, dass sie dennoch als Wärterin passe. Das war gleich eine Liebe und eine Herzlichkeit mit dem Kinde, sie war ganz weg in Evangeline, und sie sagte gleich, wenn sie nur bei diesem Engel bleiben dürfe, dann wolle sie gar nichts für ihre Dienste haben.
Sie wurde angenommen, und schon in einem Tage erkannte man, welch glücklichen Griff man mit dem schönen Mädchen getan hatte. Man kann sich eben täuschen. Margot war die aufmerksamste, zarteste und liebenswürdigste Pflegerin; man musste ihr verbieten, dass sie des Nachts neben des Kindes Bett im Stuhle schlief, und Evangeline vergalt ihr mit gleicher Liebe.
Es ließ sich nicht vermeiden, die Pflegerin musste in alles eingeweiht werden. Margot war außer sich vor Staunen, sie vergoss Tränen, und dann erklärte sie feierlichst, das arme Kind niemals verlassen zu wollen, als bis in die Sache Klarheit gebracht worden wäre.
Evangeline hatte die anstrengende Reise gut überstanden, dank Jacks Aufopferung, und sie versicherte immer wieder, wie wohl ihr das täte, wenn sie im Halbschlafe so befragt würde, und deshalb wurde lieber kein Arzt wegen ihres Zustandes zu Rate gezogen, es war besser, wenn von dem hellsehenden Kinde gar nichts in die Öffentlichkeit kam. Hierüber mussten auch Margot wie Klaus Stillschweigen geloben.
Während also Evangeline im Hellsehen nichts Neues berichten konnte, kam Jack auf den Gedanken, sie zu fragen, ob sie das auch immer schon vorher wisse.
»Wann wirst du morgen einschlafen, Evangeline?«, fragte er also gleich im Beginne.
»Morgen Nachmittag drei Uhr fünfundzwanzig Minuten nach deiner Uhr.«
»Und weißt du schon, wann du übermorgen einschlafen wirst?«
»Übermorgen früh fünf Uhr, vielleicht eine halbe Minute später.«
Jack ließ sich die Zeiten für einen ganzen Monat voraussagen und schrieb sie sorgfältig auf. Es sollte sich zeigen, dass Evangeline sie für den ganzen Monat richtig angegeben hatte.
Das sind Kleinigkeiten, aber der geneigte Leser wird gebeten, darauf zu achten, da dies später noch von der höchsten Wichtigkeit werden soll.
Eines Tages erzählte Evangeline im Halbschlafe, jetzt käme zu Marie wieder der schwarzbärtige Herr herein; er brachte ihr eine Zeitung. Marie nahm sie, lächelte glücklich; es war englisch, was sie las, und jetzt konnte das hellsehende Kind durch die Augen Maries mitlesen:
Liebe Marie! Deinen Brief erhalten. Bin mit allem einverstanden. da es nicht zu
ändern ist. Harre die drei Jahre aus in Mut und Geduld, wie ich bleibe in dieser
Zeit dein dich innig liebender und treuer Gatte Jack Dankwart.
Mijnheer van Hyden traute wieder einmal seinen Ohren nicht; wie vom Donner gerührt saß er da. Jack dagegen sprang wie von einer Natter gestochen empor.
»Vermaledeite Intrige!!«, schrie er. »Jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen! — Was für eine Zeitung ist das? Was steht darüber?«, setzte er hastig hinzu.
Zu spät, Evangeline war schon erwacht. Und wenn Marie nicht gerade nach der Überschrift sah, konnte das Kind auch nichts wissen.
»Vater«, wandte sich Jack an diesen, »verstehst du jetzt, warum Mariechen immer noch so guten Mutes ist?«
Nein, der Vater verstand ganz und gar nicht.
»Hast du denn so etwas in eine Zeitung setzen lassen?«, fragte er in seinem Staunen auch noch.
»I bewahre!«, lachte der schwarzlockige Mann grollend. »wer weiß, wie lange ich schon mit Mariechen in Korrespondenz stehe! Ahnst du wirklich nicht, wie die das machen? Na, ganz einfach — Mariechen schreibt mir immer Briefe, die natürlich von diesen Halunken unterschlagen werden, und meine Antwort setzen sie dann in eine Zeitung. — Aber es ist gar nicht nötig, dass wir auskundschaften, welche Zeitung sie dabei benutzen. So dumm sind die nicht, an eine Redaktion zu schreiben, das habe ich nun schon gemerkt; die sind mit allen Hunden gehetzt! Nein, die präparieren zu meiner Antwort einfach eine englische Zeitung, wahrscheinlich mit einer Handpresse hergestellt.«
Jack musste nähere Erklärung geben, van Hyden verstand immer noch nicht.
Die englischen Zeitungen sehen ganz anders aus als die deutschen. Auf den bedruckten Seiten ist manchmal ein großer freier Raum. Teils werden hier die letzten Depeschen eingetragen, oder es annonciert jemand, nimmt einen großen Raum und setzt nur wenige Worte hinein oder auch gar nichts, um vielleicht auf die spätere Annonce aufmerksam zu machen. Jedenfalls ist in den englischen Zeitungen immer hier und da ein freier Raum, mitten im Text, und mit diesem ist schon mancher Unfug getrieben worden.
Jack hatte schon gesagt, wie die Unbekannten es auf alle Fälle machten. Marie schrieb an ihren Gatten und an den Vater Briefe; höflich lehnte ihr Gefangenwärter ab, diese zu lesen, er wollte sie der Post übergeben — und dann erbrach er heimlich die Briefe und schrieb die Antwort selbst. Direkt schreiben durften ihre Angehörigen natürlich nicht, dann hätten sie doch ihre Adresse wissen müssen. Die Antwort sollte durch eine Zeitung ihr zugehen. Diese Vorsicht genügte den Vorsichtigen aber immer noch nicht, sie druckten die vermeintliche Antwort nur in ein einziges Exemplar, wahrscheinlich mit einer kleinen Handpresse, und ein anderes bekam die Gefangene doch nicht zu sehen.
Das war ganz einfach — — aber eigentlich so raffiniert, dass die meisten Menschen, selbst erfahrene, nicht auf so etwas gekommen wären, und bewundernswert war nur, wie dieser Präriejäger im Augenblick das auf alle Fälle Richtige erkannt hatte.
Und hier hatte man nur zufällig einmal einen einzigen Fall mitgelesen. Wer wusste denn, was Jack und der Vater der Gefangenen alles schon durch die Zeitung geschrieben haben sollten? Das wusste nur Gott — — und der Teufel, von dem dies alles ausging.
Also Mariechen sollte ruhig drei Jahre in der Gefangenschaft aushalten, der treue Ehegatte war ganz damit einverstanden, natürlich auch der Vater.
»Es — ist — doch — niederträchtig!!«, lachte Jack, aber es klang etwas heiser. »Weiß Gott, da kann man wirklich darüber lachen, das wird wahrhaftig humoristisch.«
Aber wozu nur dies alles? Warum sollte Mariechen drei Jahre gefangengehalten werden?
Von wem ging das alles aus? Es schien ein unlösbares Geheimnis bleiben zu sollen.
»Nein«, sagte aber Jack, »ich werde das Geheimnis lösen — ich! Oder, Vater, wollen wir die drei Jahre ruhig zusehen?«
Er wartete keine Antwort ab, er lachte noch einmal, und diesmal klang es noch etwas heiserer. — —
Hatte Evangeline in letzter Zeit nur wenig Neues berichten können, so sollte es bald Schlag auf Schlag gehen — — — und es sollten fürchterliche Schläge dabei sein, welche den noch vor kurzer Zeit so glücklichen Mann zu Boden schmetterten.
Es war später Abend, bald zehn Uhr.
»Evangeline ist in Halbschlaf gefallen«, meldete Margot.
Jack kam aus dem Nebenzimmer, blickte nach seiner Uhr und sah in seinem Notizbuch nach.
»Vierzehn Minuten vor zehn Uhr. Stimmt! Das hat sie acht Tage vorausgesagt.«
Er trat an das Bett, nahm die Haarlocke aus dem Medaillon und legte sie in das Händchen des wie schlafend daliegenden Kindes.
»Was siehst du, Evangeline?«
»Ich sehe — — — sie. Sie steht am Fenster und blickt in den Garten. Es ist derselbe Garten. Sie sieht den Vögelchen zu — — — jetzt hat sie Brot in der Hand — — — sie brockt ab — — — sie streut die Brocken hinaus — — — — die Vögelchen kommen — — — sie freut sich...«
Auf dem bronzefarbenen Antlitz des Mannes prägte sich Staunen aus. Und da plötzlich sprang auch van Hyden von seinem Stuhle auf.
»Das ist gar nicht möglich«, rief er, »es ist doch jetzt...«
Eine gebieterische Handbewegung Jacks schnitt ihm das Wort ab.
»Ist es denn hell im Garten?«, fragte er dann.
»Gewiss, es ist ganz hell.«
Jack hob nur den Finger gegen den Schwiegervater und machte dabei ein ganz eigentümliches Gesicht.
»Kannst du im Garten einen Schatten sehen? Werfen die Bäume Schatten?«
»Jawohl, ich sehe auch die Sonne, aber es muss bald Abend werden, sie steht dicht über den Bäumen.«
Und hier war es Nacht!
Ehe Jack, der von einer furchtbaren Unruhe befallen wurde, eine weitere Frage zur Aufklärung dieses Rätsels stellen konnte, fuhr Eva von selbst fort:
»Jetzt zieht sie ihre kleine Uhr aus dem Gürtel...«
»Welche Zeit ist es?«, rief Jack in der größten Hast, seine Uhr ans der Tasche reißend.
»Sie sieht — — — — ein Viertel vor fünf Uhr...«
»Ganz, ganz genau?«
»Eine Idee darüber, eine Minute — — — jetzt hebt sie den Kopf — — — sie sieht eine große Turmuhr in der Ferne...«
»Und wie steht der Zeiger auf dieser?«, rief Jack abermals so hastig, er begann vor Spannung zu zittern.
»Ganz genau so — — — vierzehn Minuten vor fünf Uhr.«
In van Hydens Kopfe begann etwas zu dämmern, er erkannte wenigstens die Wichtigkeit, welche dieser Zeitunterschied haben konnte, wenn er auch noch nicht im Geringsten wusste, wie man das verwerten könnte.
Jack aber hatte bereits sein Notizbuch herausgerissen, er begann zu rechnen.
»Hier ist es achtzehn Minuten vor zehn, das ist der Unterschied von — — — — — — 296 Minuten oder — — — — — 4 Stunden und 56 Minuten — — — — — die Sonne rückt von Osten nach Westen in vier Minuten einen Längengrad vor — — — — — also 296 dividiert durch 4 — — — — — ist 74 — — — — — wo kann der 74. westliche Längengrad sein? — — — — —«
Er hob die Arme zum Himmel empor, und jauchzend kam es aus seinem Munde:
»O Gott, wir danken dir, du hast uns um einen Riesenschritt der Erkenntnis näher geführt! — — — — Vater, Mariechen kann sich nur auf dem amerikanischen Kontinent befinden, oder es ist nicht wahr, dass die Sonne für unsere Augen im Osten aufgeht und im Westen untergeht!«
Ehe der grenzenlos erstaunte Vater etwas sagen konnte — es wären wieder Worte des Zweifels gewesen — nahm schon Jack abermals hastig das Wort:
»Keine Frage jetzt — — einen Atlas, einen Atlas! Durch welche Stadt in Amerika geht der 74. Längengrad? Schnell, Vater, es muss doch im Hotel ein Atlas aufzutreiben sein — oder wenn es auch nur ein Konversationslexikon mit Tafeln ist!«
Margot kam dem alten Manne zuvor und flog hinaus. Sie blieb ziemlich lange aus. Dann brachte sie einen großen Atlas. Jack schlug die Karte von Amerika auf.
»Da ist's, da ist's — — New York! New York liegt genau auf dem 74. Längengrade! Wir wollen vorsichtig sein, es kommt der ganze amerikanische Kontinent in Betracht, Nordamerika, wie Südamerika. Nein, von New York an geht der 74. Grad durchs Wasser, tritt erst in Südamerika wieder auf festes Land — — — und da käme höchstens Santa Fé in Kolumbien in Betracht. Nein, dort unter dem Äquator ist sie nicht, dort würde sie einen ganz anderen Garten sehen, vor allen Dingen auch immer prächtige Schmetterlinge und Kolibris, und davon hat uns Eva niemals etwas erzählt. — Mariechen befindet sich in New York!!«
Gewiss, in Amerika musste sich Mariechen auf alle Fälle befinden. Wer so zu rechnen versteht, der kann sich nicht irren. Zum Beispiel Bombay in Indien liegt auch auf dem 74. Grade, aber östlicher Länge, doch weil es jetzt dort nachts halb drei war, wartete man dort auf den Aufgang der Sonne, während sie für New York bald unterging.
»Sofort nach New York!!«, rief Jack.
Da fiel sein Blick auf Evangeline, welche unterdessen erwacht war.
»Ach, mein armes Kind«, sagte er, sich über sie beugend, »nein, diese Reise kann ich dir nimmermehr zumuten! Und du hast auch schon genug für uns getan.«
»Du musst jetzt nach Amerika?«, fragte das dünne Kinderstimmchen. »Nicht wahr, da geht es über ein großes Meer? Und dort soll deine Frau sein, Jack?«
Er musste erzählen, zu welcher Entdeckung ihr Fernsehen geführt hatte.
»Ach, mein lieber Jack, nimm mich doch mit!«, flehte das Kind. »Ich bin ja stark genug, und ich will dich nicht eher verlassen, als bis du deine arme Frau wiedergefunden hast — ich will nicht! — und die Mutter ist mit allem zufrieden, was du tust...«
So bat und schmeichelte das Kind weiter, und es war kein Eigennutz dabei, als Jack schließlich dem kleinen Mädchen versprach, es mitnehmen zu wollen.
Aber das ›Sofort‹ musste etwas gemäßigt werden. So gut die Fahrverbindung nach New York auch ist — immer liegen die Dampfer denn doch nicht zur Abfahrt bereit, und dann kommt auch sehr in Betracht, mit welchem man fährt. Der nächste Schnelldampfer ging von Liverpool aus, eher noch, als ein deutscher in Southampton Passagiere aufnahm. Unterdessen konnte man auch nach Amsterdam reisen und von dort einen holländischen Dampfer benutzen, einen sehr schnellen, und dann hatte man in Amsterdam noch immer drei Stunden Zeit, sein Haus zu bestellen, und schließlich — die Hauptsache, welche den Ausschlag gab — man konnte während dieser kurzen Fahrt auf dem Wasser erkennen, ob das schwache Kind eine lange Seereise aushalten würde. Das Wetter war nicht stürmisch, aber die See musste jetzt doch ziemlich hoch gehen, und vertrug Eva diese wenigen Stunden nicht, dann musste sie unbedingt zurückgelassen werden.
Schließlich hatte Jack noch einen anderen Grund, sich erst noch einmal nach Amsterdam zu begeben.
»Und ich nehme auch die Nachtmär mit.«
»Was willst du denn mit deiner Rappstute in New York?«, fragte van Hyden erstaunt.
»Wer weiß...«, war die ausweichende Antwort, »vielleicht kann ich sie noch einmal in Amerika gebrauchen — wir haben mit keinen gewöhnlichen Feinden zu kämpfen. Ich nehme die Nachtmär mit; das edle Tier ist in Amsterdam nicht in den richtigen Händen, es sehnt sich nach mir, und an Bord dieser Dampfer sind gepolsterte Ställe, es hat auch schon Seereisen gemacht.«
Zu dieser Tour musste aber wirklich sofort aufgebrochen werden. Die befragte Pflegerin fand es ganz selbstverständlich. dass sie mitkäme; sie hätte doch versprochen, das arme Kind nicht eher zu verlassen, als bis es wieder unter dem Schutze der Mutter sei.
Also die Sachen wurden in die Koffer gestampft, bezahlt, Jack nahm Evangeline auf den Arm, in eine Droschke, wieder nach der Liverpool Street Station, der sogenannte Kontinentalzug stand schon bereit, fort ging es nach Harwich. Im Coupé schrieb Jack mit Bleistift an die Mutter einen Brief, den er in Harwich in den Kasten steckte; dann an Bord des kleinen Schnelldampfers, ein mehrmaliges Heulen der Pfeife — — und eine Viertelstunde später tanzte das Schiff auf den Wogen des englischen Kanals wie ein toller Hase — aber die Passagiere tanzten nicht mit, durch das ganze Schiff ging ein Wimmern und Stöhnen und Spucken, und der liebe Gott wurde in allen Tonarten gebeten, die Seele aus diesem Jammertale doch zu sich nehmen zu wollen, und weil er das nicht tat, da spuckten sie selbst ihre ganze grüne Seele aus dem gepeinigten Leibe.
Evangeline war an Land auf Jacks Arme eingeschlafen, an Bord wurde sie auf ein Sofa gelegt, mitten auf hoher See wachte sie auf — und freute sich über dieses Schaukeln, wunderte sich, warum denn so viele Menschen plötzlich so krank seien.
Doch dies war kein außerordentlicher Fall. Es ist eine bekannte Tatsache, dass gerade die allerstärksten, robustesten, gesündesten Männer am leichtesten und häufigsten von der Seekrankheit heimgesucht werden, während die schwächlichsten Personen oftmals ganz verschont bleiben — besonders Damen, welche sehr eng geschnürt sind.
An Bord dieses Schiffes sollte Jack auch der Wahrheit wieder einen Schritt näher kommen, diesmal freilich ohne Nutzen.
Er hatte holländische Schiffszeitungen gelesen, als er zu dem Schwiegervater geeilt kam.
»Ich hab's, das Rätsel ist gelöst!«, rief er, in der Schiffsliste auf eine Stelle deutend. »Einen Tag nach Maries Verschwinden ist der holländische Passagierdampfer ›Kuiper‹ von Amsterdam nach New York gegangen. Als Passagier befand sich ein Signor Fratelli mit seinem Wachsfigurenkabinett darauf. Hier steht es. Begreifst du nun, Vater?«
Nein. Ganz verständnislos blickte van Hyden den Schwiegersohn an.
»Freiwillig ist Mariechen keinesfalls mit nach New York gereist. Sie ist überfallen und mit irgend etwas betäubt worden, man hat sie schwarz angemalt und als solch eine phantastische Indianerin oder Afrikanerin angekleidet — Mariechen hat die lange Seereise nach New York in einer engen Kiste als Wachsfigur mitgemacht!«
Es war etwas ganz Ungeheuerliches, was Jack da behauptete. Und doch, es hatte alles Hand und Fuß! Hiermit war auch der Sarg erklärt, in welchem das Kind Marie hatte liegen sehen. Da war die Geraubte unterwegs auf der Reise gewesen, am letzten Tage, und am anderen hatte man sie aus der Kiste genommen und auf das Erwachen der Bewusstlosen gewartet. Die Reise nach New York dauert acht Tage, und während dieser Zeit hatte der Wachsfigurenhändler oder ein anderer der Betäubten ja manchmal Nahrung einflößen können.
»So ist es, so muss es sein, dadurch wird alles erklärt«, sagte Jack, »und du siehst nun, Vater, mit welch raffinierten Feinden wir es zu tun haben.«
Das ›Warum‹ wurde hierdurch freilich noch nicht im Geringsten erklärt.
Mit Sonnenaufgang erreichten sie Amsterdam und hatten bis zum Abgang des Schiffes noch drei Stunden Zeit. Es war kein Brief angekommen, die Polizei hatte nichts zu melden. Mijnheer begab sich zu seinem Bankier und ließ sich Kreditbriefe geben, Jack hatte hauptsächlich mit seinem Pferde zu tun. —
Nun müssen wir uns wieder einmal mit dem treuen Klaus beschäftigen, welcher in Amsterdam ebenfalls noch etwas zu tun hatte, nämlich Abschied zu nehmen von seiner Braut. Denn Klaus war schon seit einem halben Jahre glücklicher Bräutigam. Wenn er manchmal seine Braut besuchen wollte, so hatte er es nicht weit, denn sie wohnte mit ihm in demselben Hause — es war nämlich Mijnheer van Hydens Köchin. Die Hochzeit sollte in nächster Zeit stattfinden, und dass die beiden auch als Ehegatten im Hause bleiben würden, das war selbstverständlich, weil doch Mijnheer keine andere Hand als die seines Leibbarbiers in seinem Gesichte duldete, und Fatje — dies der Name der Braut — war ihm schier ebenso unentbehrlich geworden, weil sie ganz vorzüglich kochte. Das sah man besonders an ihrem Bräutigam, denn umsonst wurde Klaus doch nicht so unheimlich dick, besonders seitdem er in Liebe gefallen war zu der Köchin. Während aber dem Mijnheer das gute Essen in den Bauch ging, ging es dem Klaus mehr in die Backen und in — in — auch in den Bauch, aber diesen Bauch hatte er hinten. Es war überhaupt ein strammer Bengel, dieser Klaus; ein paar Waden hatte dieser Mensch, wie — wie — eben ein paar kolossale Waden. Aber seine Fatje war auch ein nettes Frauenzimmerchen. Sie war sehr klein, sehr dick und setzte die Füße einwärts. Außerdem hatte Klaus seinem Herrn beim Barbieren einmal im Vertrauen erzählt, dass Fatje auch krumme Beine habe — und damals waren die beiden noch nicht einmal verlobt gewesen. Mijnheer war über diese Allwissenheit seines Dieners nicht eben sehr erfreut gewesen, und dann hatte er gemeint, die beiden sollten sich doch lieber heiraten, anstatt anatomische Studien zu treiben — vorausgesetzt, dass beide in seinem Hause blieben. Und so hatten sich die beiden verlobt, und nächstens sollte die Hochzeit sein.
Nun musste aber erst noch einmal Abschied genommen werden. Fatje, welche dem Geliebten an Geisteskraft ein ganz klein bisschen überlegen war, gab ihm gute Ratschläge, er solle sich nicht von den Negern auffressen lassen usw., und dabei heulte sie dermaßen, dass sich von ihrem Haupte eine lange Flechte ihres braunen Haares löste.
»Na, da adjé, meine Fatje«, schluchzte Klaus.
»Na, da adjé, mein Klaus«, weinte Fatje.
»Wirst du mir auch immer lieben und immer an mir denken? Wirst du mich auch immer treu bleiben?«
»Nu allemal, mein Klaus.«
Während sie sich so umarmt hielten und ihre Tränen zusammenflossen, bekam Klaus zufällig die aufgelöste Haarflechte in die Hand, und da blitzte zum allerersten Male ein genialer Gedanke durch seinen dicken Schädel.
Selbst seiner Braut hatte er nichts von der Wundergabe des kleinen Mädchens erzählt, sein Herr hatte es ja verboten, aber... er hatte da ein Mittel in der Hand, um immer zu wissen, was seine Fatje in seiner Abwesenheit trieb, ob sie ihm auch treu blieb usw.
Messer und Scheren hatte der Barbier immer in der Tasche, also heimlich ein Scherchen herausgeholt und unbemerkt, mit zarter Hand — schwubb — ab, und ebenso unbemerkt in die Tasche gesteckt — nicht nur ein kleines Löckchen, sondern gleich den ganzen Pferdeschwanz.
Mit diesen Haaren seiner Geliebten begab sich Klaus an Bord und fuhr nach Amerika. Seinem Herrn wagte er nichts zu sagen, und deshalb schien es für ihn schwer zu werden, die Gabe des hellsehenden Kindes einmal zu eigenem Zwecke zu benutzen, denn wenn Evangeline ihren Anfall bekam, waren doch immer die Herren bei ihr.
Aber er sollte bald Gelegenheit genug finden, durch das Kind seine Braut in der Ferne sehen zu können.
Armer Klaus! Hättest du deiner Braut die Haarsträhne doch lieber nicht abgeschnitten! Es war dein erster genialer Gedanke gewesen, und er sollte dir Kummer über Kummer bereiten. Denn was du noch alles von deiner Braut zu sehen bekommst, von deiner unschuldigen Fatje — das hat wahrhaftig noch kein einziger Mensch auf der Erde erlebt, und wenn du ein Chinese mit einem langen Zopfe gewesen wärst, so hätte sich dieser lange Zopf vor Staunen manchmal kerzengerade in die Luft empor gerichtet, und das will doch gewiss etwas heißen. —
Als Evangeline an Bord des Dampfers zum ersten Male in Halbschlaf fiel, am Vormittag, war es in New York noch sehr früher Morgen, Marie schlief noch, deshalb konnte auch das Kind nichts weiter sehen.
Der nächste Anfall sollte am nächsten Tage kurz nach drei Uhr stattfinden. Es sei hierbei bemerkt, dass der schlafwache Zustand des Kindes immer länger anhielt, ja, es schien fast, dass man ihn stundenlang ausdehnen könne, man musste ihr nur die Locke in der Hand lassen. Nahm man ihr diese, so wachte sie sofort auf. Und sie behauptete immer wieder, dass diese lange Dauer sie durchaus nicht anstrenge, im Gegenteil, je länger der tote Arm lebendig gewesen sei, desto wohler fühle sie sich hinterher. Doch nicht immer konnte man ihr Hellsehen nach Belieben ausdehnen, nur manchmal. Jedenfalls aber änderte sich ihr Zustand nach und nach, eben weil man ihn so häufig benutzte, und für die Beobachter wurde er immer günstiger, sie sah auch immer schärfer. Außerdem gab sich Jack ständig mit dem Kinde ab, lehrte es schreiben, erklärte immer alles, was Eva Neues sah; die Pflegerin, an welcher gar nichts auszusetzen war, musste mithelfen bei diesem Unterricht. Eva las auch sehr gern, und das nur in der Ausbildung zurückgebliebene, aber sonst sehr ausgeweckte Kind lernte fabelhaft schnell.
Der nächste Tag und die angekündigte Stunde kam.
»Was siehst du, mein Kind?«
»Ich sehe — — — sie«, begann sie wie immer, aber sie hatte nichts Außerordentliches zu erzählen.
»Jetzt kommt der schwarzbärtige Herr«, fuhr sie dann fort, »er spricht mit ihr — — er entschuldigt sich — — nein — aber er benimmt sich ganz anders als sonst — er sieht auch so traurig aus — — jetzt holt er aus der Brusttasche eine Zeitung...«
»Aha, jetzt kommt wieder einmal eine Zeitung daran!«
»Er faltet sie auseinander, er will sie Marie nicht geben — Marie will sie haben — — sie sieht so erschrocken aus — — ganz anders — — es muss etwas Schreckliches sein — — sie liest...«
Und die Hellseherin las mit:
Aus Amsterdam wird uns telegrafisch gemeldet, dass der bekannte Texas Jack, über dessen Heirat in Amsterdam mit einer Millionärstochter wir kürzlich berichteten, in einem übelberüchtigten Hause seinen Tod gefunden hat. Ein Frauenzimmer, mit dem er in Streit geriet, hat ihn erstochen...
Ein heiseres Zischen erklang, dann ein Zähneknirschen, Jack war aufgesprungen, er zitterte an allen Gliedern.
»Weiter, weiter!«, stieß er ächzend hervor.
»... sie hat das Zeitungsblatt fallen lassen, sie streckt abwehrend beide Hände aus, sie scheint etwas zu schreien... Ihr lügt, ihr Schurken, es ist nicht wahr, es ist nicht wahr!! — Das ist es, was sie ruft!... Jetzt greift sie schnell in ihren Busen — sie zieht den kleinen Kirschkern hervor, öffnet ihn, hat die vertrocknete Blume in der Hand, führt sie vor den Mund, sie haucht — sie haucht — sie besieht die Blume — — sie haucht wieder — — sie haucht immer noch — — sie besieht wieder die Erbse —«
»Die Blume ist doch erblüht!!«
»Nein, nein — — sie ist immer noch vertrocknet — — sie haucht — — sie haucht immer wieder — diesmal kommt keine Blüte...«
»O Gott, o Gott, sei gnädig, lass das Blümlein erblühen!«, erklang es stöhnend in der kleinen Kabine, und der starke Mann musste sich festhalten.
»... sie besieht sich die zusammengeschrumpfte Erbse noch einmal — lässt sie fallen — öffnet den Mund — — ich glaube, sie schreit — hebt die Hände — schlägt sie vor das Gesicht — — sie schlägt rückwärts zu Boden... ich sehe nichts mehr, es ist ganz finster.«
Und ganz still war es in dem kleinen Raume. Aber mit Angst blickte der Vater auf den schönen, schwarzlockigen Mann, mit noch mehr Angst blickte die Pflegerin auf ihn, obgleich er doch ganz ruhig war, auch sein Gesicht. Aber ein Ausdruck lag darin — ein Ausdruck, welcher jedem Beobachter Entsetzen einflößen musste.
Endlich kam Leben in die regungslose Gestalt, langsam hob er die Hand.
»Ich werde noch einmal furchtbar zu Gerichte sitzen«, sagte er, weiter nichts, es hatte auch nichts in seiner Stimme gelegen, aber die Worte hatten zu dem Ausdruck seines Gesichts gepasst, und dann verließ er die Kabine.
Als van Hyden ihn später wiedersah und von dem Erlebnis beginnen wollte, bat ihn Jack, das sein zu lassen, es hätte doch auch gar keinen Zweck. Dann setzte er nur noch hinzu:
»Allerdings muss Mariechen mich jetzt für tot halten, denn sie denkt doch, das steht in allen Zeitungen, und wer weiß denn, was man ihr sonst noch alles über mich zu lesen gibt, alles in freien Zeitungsstellen fettgedruckt. Das stimmt also, sie muss mich jetzt für tot halten. Aber eins wird diesen Schurken niemals gelingen: mich in Mariechens Augen als ihrer unwürdig hinzustellen. Da kennt Mariechen mich besser, und ich kenne mein Mariechen. — Nun kein Wort mehr davon, bevor ich sie überzeugt habe, dass ich noch am Leben bin. Und diese Halunken — die sollen mich noch schrecklich lebendig finden.«
Als er dann wieder zu Evangeline kam, musste diese unterdessen wohl von anderer Seite alles erfahren haben, denn sie fragte ja stets nach dem Erwachen, was sie erzählt hätte, und es war ihr doch schwer zu verheimlichen. Aber das Kind selbst besaß Takt genug, keine neugierigen Fragen zu stellen, es weinte nur heftig, als es Jack sah, und schlang das Ärmchen um seinen Hals.
»Mein armer, armer Jack«, schluchzte es an seiner Brust, und da allerdings brach auch der starke Mann in Tränen aus.
Der dritte Tag der Seereise kam. Jack holte wieder die hellblonde Locke aus dem Medaillon, das er aber jetzt an einer Lederschnur um den Hals trug.
»Was siehst du, mein liebes Kind?«
»Ich sehe — — — sie. Der schwarzbärtige Mann ist bei ihr, spricht auf Mariechen ein, sie scheint ihn abzuwehren, als ob sie nichts von ihm hören wolle, er wird immer dringlicher, ergreift ihre Hand, sie reißt sich los, jetzt liegt er vor ihr auf den Knien...«
»Was? Wer?«, keuchte Jack schon wieder. Alles lauschte atemlos.
»Der schwarzbärtige Herr mit dem Scheitel in der Mitte, es ist immer derselbe. Er liegt vor ihr auf den Knien und hebt die rechte Hand empor. Mariechen will fliehen, sie kann nicht, er umklammert ihre Knie...«
Ein nicht wiederzugebender Laut durchdrang die Kabine, das Röcheln eines sterbenden Tigers.
»... er richtet sich empor, sich immer an ihr festhaltend, sie will ihn von sich stoßen, sie kann nicht, er zieht sie auf das Sofa, setzt sich neben sie... nein, jetzt hat er sie auf seinem Schoße, er küsst sie — — — er küsst sie immer wieder...«
»Es ist nicht wahr, es ist nicht wahr!!«, schrie Jack plötzlich auf. »Und was tut Mariechen?!«
»... jetzt legt sie ihre Arme um seinen Hals und küsst den Herrn ebenfalls...«
Ein heiseres Brüllen, und Jack war hinausgestürzt.
Wie gelähmt saß der Vater da. Er war ganz fest überzeugt, dass er dies alles nur träume.
Was aber war das mit Margot? Ihr schönes Gesicht strahlte plötzlich vor Triumph, und sie schien sich doch die möglichste Mühe zu geben, ihre Freude zu bändigen.
Das Kind lag mit geschlossenen Augen da, es erzählte nie, wenn es nicht hin und wieder gefragt wurde, und so war kaum eine halbe Minute vergangen, seitdem Jack hinausgestürzt war, als er schon wieder hereinkam, ganz ruhig, zu ruhig, seine Züge waren wie von Stein.
Er trat gleich wieder zu Evangeline.
»Und was macht Marie jetzt?«, fragte er, ebenfalls mit ganz ruhiger Stimme.
Das Kind antwortete nicht gleich.

»Ich wundere mich schon immer«, sagte es dann. »Was tut denn der Mann nur mit ihr? Sie will ihm die Hände festhalten, sie weint immer, und er tut es doch...«
Jetzt fuhr der alte Mann mit einem Schrei des Entsetzens empor.
»Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, das ist nicht mein Mariechen!!«, schrie er.
Jack dagegen war regungslos geblieben. Nichts schien mehr Eindruck auf ihn zu machen, er war wie von Eisen.
»Ruhe«, sagte er herrisch. »Warum soll sie es denn nicht sein? Zweifelst du schon wieder? Ich nicht. Marie ist entschuldbar. Sie ist in der Macht dieses Mannes, und er nutzt ihre Hilflosigkeit aus, doppelt hilflos dadurch, dass sie mich jetzt tot glaubt. Dass sie die Arme um ihn geschlungen und ihn geküsst hat, glaube ich nicht. Sie hat sich ja immer gewehrt. Da kann sich das Kind allerdings geirrt haben. Er wird ihre Arme mit Gewalt um seinen Hals gelegt und sie nach wie vor geküsst haben, und sie duldete es aus Furcht. Was weiß denn das Kind von solch einem Unterschied! Und dann... ja, was soll sie denn dagegen nur tun?! Sie befindet sich vollkommen in der Gewalt dieses Mannes. Ihn töten? Dazu muss sie erst einmal eine Waffe haben, und dann liegt so etwas eben nicht in Mariens sanfter Natur. Sie kann nur weinen und sich sträuben, das ist alles, und das hilft ihr auf die Dauer doch nichts. — — Selbstmord? Hat in meinen Augen auch keinen Zweck, und wenn sie klug ist, tut sie es nicht, sondern...«
Er sprach ruhig und kühl, wie ein alles erwägender Kaufmann. Das war freilich sehr unnatürlich.
Als er abbrach, blickte er nach dem Kinde, welches still dalag, noch die Locke in der Hand. Dann wandte er sich wieder an die anderen, auch Klaus befand sich in der Kabine, und erhob warnend die Hand.
»Das Kind darf nichts davon erfahren«, sagte er gebieterisch wie zuvor. » Verstanden? Dass mich meine Frau für tot hält, das ist ihr erzählt worden, das ist nun nicht mehr zu ändern, und dabei mag es bleiben. Aber ihr nichts von diesem hier sagen! Verstanden? Gut!«
Er ging an das Schwebebett, nahm, obgleich sich Eva noch in jenem Zustande befand und er sie also noch hätte befragen können, die Locke aus der Hand, barg sie und verließ wortlos die Kabine.
Van Hyden wollte ihm nacheilen — er konnte es nicht, die Glieder versagten ihm den Dienst.
Mit erhobenem Haupt schritt Jack über Deck und begab sich zu seinem Pferde. Als er den ausgepolsterten Stall betrat, in welchem das kostbare Tier bei unruhiger See festgeschnallt wurde, sang er sogar, und wenn es auch ein melancholisches Lied war, so klang es doch nicht eben traurig aus seinem Munde:
Ich träumte in einer Maiennacht,
Von Liebe und von Glück,
Und als am Morgen ich erwacht,
Blieb nur der Traum zurück.
Das edle Ross wendete den schönen Kopf und wieherte freudig. Er trat hin und liebkoste es.
»Nun hast du deinen Herrn wieder ganz allein, und nun habe auch ich niemand mehr als dich allein, meine Nachtmär«, sagte er wehmütig, und da übermannte es ihn, er schlang die Arme um den stolzen Hals des Pferdes und weinte bitterlich, und das kluge Tier schien ihn zu verstehen. Es rieb seinen Kopf an Jacks Körper, aber es schien sich zu freuen, dass es nun die Liebe seines Herrn mit niemand mehr zu teilen brauchte.
Jack raffte sich wieder auf, und als er hinter das Pferd ging und den gestutzten Schweif in die Hand nahm, blitzte es unheimlich in seinen Augen auf.
»Gestern habe ich dir das letzte Mal den Schweif geschnitten. Hätte ich es doch lieber nicht getan. Mach zu, dass er wieder wächst — — dass ich jemand daranbinden kann — — und dann sollst du dich auf der Prärie wieder einmal austoben können.«
Er verließ den Stall wieder. Kein Passagier merkte dem schönen, ernsten Manne etwas davon an, wie es in seinem Innern aussah, nicht einmal die feinfühlige Evangeline, mit welcher er liebevoll wie immer sprach. Aber dem Schwiegervater ging er sorgfältig aus dem Wege, sie sahen sich nur bei der gemeinschaftlichen Tafel, und dann erst wieder am anderen Tage, also am vierten der Seereise, in der gemeinschaftlichen Wohnkabine, als die Stunde der Hellseherin kam.
Jack gab ihr die Locke in die Hand.
Es ging überraschend schnell mit den beiden. Was das Kind beschrieb, war nichts Anderes als eine private Trauung. Sie fand in einem Zimmer statt, in welchem Marie schon oft gesehen worden war, man hatte es zu dem Akte nur etwas dekoriert, einen Altar hergerichtet. Ein Priester im schwarzen Ornat vollzog die Trauung, als Zeugen waren ein älterer Herr und eine ältere Dame anwesend. Jack ließ sich deren Äußeres, Gesichtszüge, Haar usw. möglichst genau beschreiben, notierte sich aber nichts, er würde sich seinem Gedächtnis schon alles einprägen!
Marie sollte sehr bleich aussehen und sich niedergedrückt zeigen, sich oftmals die Augen trocknen.
Dann kam ein wichtiger Moment. Die Zeugen unterschrieben. Eva bekam Bleistift und Papier.
»Möglichst genau! Bitte, Eva, gib dir rechte Mühe, male die Buchstaben recht genau nach!«
Eva hatte schon recht hübsch schreiben gelernt. In Bezug auf Marie hatte das aber bisher noch keinen Zweck gehabt, sie war während des Briefschreibens noch nicht wieder beobachtet worden. Das schloss natürlich nicht aus, dass sie inzwischen schon viele Briefe an Jack und an den Vater geschrieben hatte — welche also stets unterschlagen wurden.
Jetzt also malte sie nach: Henry P. Gibson — dann nahm die Dame die Feder, und Eva malte in vollständig anderer Schrift: Jane Maud Doring.
Das waren echte Unterschriften, Eva hatte selbst einen ganz eigentümlichen Schwung des Mannes getreulich nachgeahmt.
»Und nun die Getrauten. Unterschreiben die nicht?«
Nein, die unterschrieben nicht. Das mochte schon vorher geschehen sein.
»Das ist wenigstens ein Gentleman«, sagte Jack mit bitterer Ironie, als er das Papier mit den beiden Namenszügen in seiner Brieftasche barg, »der heiratet doch die Verführte.«
»Das ist ja alles Lug und Trug«, brachte der Vater nur mühsam hervor, »das braucht doch gar kein Priester zu sein.«
»Ich weiß, ich weiß. Aber was kümmert das mich? Was für einen Unterschied macht das für mich aus, ob diese Ehe später ungültig erklärt werden kann oder nicht?«
Jack hatte nur zu recht!
Evangeline beschrieb weiter, was sie sah. Der Priester klebte eine Stempelmarke auf das Papier, machte sie durch seinen daraufgeschriebenen Namen ungültig, faltete den Trauschein zusammen, hielt ihn der jungen Frau hin. Der schwarzbärtige Mann wollte ihn nehmen. Der Priester zog die Hand schnell zurück, alle lachten. Marie musste das Papier nehmen — alles ganz richtig. In England und Amerika bekommt die Frau den Trauschein zur Aufbewahrung, das ist ihre einzige Legitimation, die Frau allein trägt auch beide Ringe, Verlobungs- wie Trauring, und zwar an der linken Hand, der Mann gar keinen — der Gatte umarmte die ihm Angetraute, gab ihr den Arm, sie durchschritten einige glänzend eingerichtete Zimmer, dann sah Eva mit Maries Augen viele gepackte Koffer und Kisten und Hutschachteln stehen — dann wachte das Kind auf, und es hatte diesmal auch außergewöhnlich lange gedauert.
»Carajo«(1), murmelte Jack zwischen den Zähnen, »jetzt gehen sie auf die Hochzeitsreise! Wohin? Ich werde es erfahren und...«
(1) Spanischer Fluch mit der Aussprache ›karacho‹.
Er beschäftigte sich einige Zeit liebevoll mit dem Kinde, erzählte, Eva habe geschildert, wie Marie gerade mit einem schönen, bunten Papagei gespielt habe, den sie natürlich seinen Namen sprechen lehre, dann richtete er sich auf und winkte dem Schwiegervater, ihm zu folgen.
Er ging in seine eigene Kabine, ließ den ihm Folgenden eintreten und schloss hinter ihm die Tür.
»Mijnheer van Hyden, ich habe mit Ihnen zu sprechen. Bitte, wollen Sie Platz nehmen?«
Der alte Mann zuckte bei dieser förmlichen Anrede zusammen, dann entstürzten Tränen seinen Augen.
»Jack, Jack, was habe ich denn getan, dass du so zu mir sprichst?«, weinte er, ein förmliches Wimmern. »Kann ich denn etwas dafür? Wir wollen doch unser Leid zusammen tragen, so wird es etwas weniger fühlbar. Jetzt habe ich keine Tochter mehr — und — und — es war mein einziges Kind — ich habe es für immer verloren — — so verlass du mich doch wenigstens nicht!!«
Da plötzlich verwandelte sich Jack.
»Nein, Vater, nein«, rief er außer sich, stürmisch des Alten Hand ergreifend, »bei Gott, so war es nicht gemeint! Aber ich erschrecke über dich! Was sagst du? Du hättest keine Tochter mehr? Was hat denn Mariechen verbrochen? Sie hat gehandelt, wie sie nicht anders handeln konnte, denn sie ist ein irdischer Mensch. Was in aller Welt soll sie denn nur tun? Sie hält mich für tot und ist willenlos in der Gewalt eines Bösewichtes. Nein, Vater, nein!! Ich wollte etwas zu dir sagen, und dazu brauchte ich eine förmliche Anrede. Deine Tochter ist entschuldbar, ich verzeihe ihr. Ich habe ihr gar nichts zu verzeihen. Du hast noch deine Tochter, du musst sie nach wie vor lieben, du darfst sie nicht verstoßen, du hast kein Recht dazu — — — — ich aber habe meine Frau verloren. Verstehst du den Unterschied, Vater?«
Gleich im Anfange waren des alten Mannes Tränen versiegt vor Staunen. Mit grenzenloser Überraschung blickte er den Schwiegersohn an.
»So sprichst du?!!«
»So spreche ich! Ich bin ein Mann! Soll ich alles noch einmal wiederholen? Marie ist für mich entschuldbar — genug. Aber als Frau ist sie für mich unwiderruflich verloren. Du sollst deine Tochter wiederhaben, dafür werde ich sorgen, und dann sollst du sie zärtlich in deine Arme schließen, als wäre nichts geschehen, das verlange ich, oder — — wir sind getrennt. Bist du damit einverstanden, Vater?«
Ob dieser es war! Es war ja doch seine Tochter, sein einziges Kind! Und als er dann nochmals von grenzenlosem Jammer übermannt wurde, war es nicht über sein eigenes Unglück oder über das der Tochter, sondern er jammerte über das verlorene Glück dieses bedauernswerten Mannes, der sich dabei auch noch in so über alle Begriffe hochedler Weise zeigte.
Ja, sie trugen das Leid gemeinschaftlich, sie weinten sich aus, einer an des anderen Brust.
Und während die beiden Männer hier so sprachen und weinten, schlich sich die schöne Pflegerin in ihre eigene Kabine, verriegelte die Tür und zog aus ihrem Busen eine Fotografie, die sie erst mit glücklichem und triumphierendem Lächeln betrachtete und dann mit glühenden Küssen bedeckte.
»Das erste ist erreicht, nun noch das zweite, dann bist du mein, du schöner, stolzer Mann«, flüsterte Margot, das Bild immer wieder an ihre heißen Lippen pressend.
Es war eine Fotografie von Texas Jack, wie man sie überall zu kaufen bekam, wo sich Buffalo Bill mit seiner Truppe produzierte, ihn als verwegenen Cowboy in seinem Präriekostüm darstellend. — —
Am anderen Tage, noch zwei Tage von New York entfernt, sah Eva Marie am Arme des schwarzbärtigen Herrn in einer ganz anderen Umgebung. Sie beschrieb diese, und Jack erkannte, dass es die Abfahrtshalle von Schiffen war.
So beschrieb das Kind immer weiter, wie sie sich mit ihrem Gepäck beschäftigten, wie sie noch etwas kauften, sie waren von Menschen dicht umgeben, sie überschritten eine Brücke, sie befanden sich ohne Zweifel an Bord eines Schiffes.
Jack wollte eine Frage stellen, Eva kam ihm zuvor, oder eigentlich vielmehr Marie, es war ein Zufall.
»... ich sehe einen großen Ring — so einen Rettungsgürtel, wie sie auch hier überall hängen — auf diesem steht das Wort: E—s—p—e—r—a—n—c—e.«
Eva hatte das fremde Wort Espérance, auf deutsch Hoffnung, buchstabiert, das war der Schiffsname, und das hatte Jack wissen wollen. Eva sah mit Maries Augen diesen Namen auch noch mehrmals an verschiedenen Gegenständen.
Sonst war nichts Neues zu erzählen; die beiden blieben eben an Bord, sie begaben sich in eine Kabine, der Beschreibung nach eine erstklassige, aber eine solche für zwei Personen.
Jack ging in die Kajüte, brauchte nicht selbst die Schiffspapiere zu studieren, ein Schiffsoffizier konnte ihm genaue Auskunft geben.
Alles stimmte. Die Passagierschiffe gehen sehr pünktlich ab, mit der Minute. In New York lag jetzt der französische Schnelldampfer ›Espérance‹, in einer Stunde stach er in See, ging nach Marseille.
Zu spät! Die Verfolger befanden sich noch nicht einmal in New York — und Mariechen wurde inzwischen schon wieder nach Europa geschleppt.
»Bitte, wie ist die nächste Fahrgelegenheit nach Marseille, sobald ich in New York ankomme?«
Diese Route wird nur von französischen Dampfern befahren — im Passagierverkehr — und da hatte er in New York zwei Tage zu warten. Er konnte aber auch sofort einen englischen Dampfer benutzen, welcher Le Havre anlief. Das liegt aber im Norden Frankreichs. Er musste den Schnellzug nach Paris, dann den Blitzzug nach Marseille benutzen, wodurch er nach menschlicher Berechnung, das heißt, nach dem Kursbuche, noch acht Stunden eher in Marseille eintraf als jener Dampfer — nicht aber etwa eher als die ›Espérance‹! Die war dann schon seit drei Tagen in Marseille, war schon wieder nach New York unterwegs.
Jack suchte den Schwiegervater auf und teilte ihm das Gehörte sowie seinen Entschluss mit.
»Ich benutze den französischen Dampfer. Das ist für das kranke Kind viel bequemer als die lange Eisenbahnfahrt quer durch Frankreich, und die acht Stunden nützen uns doch nichts. Ich habe in New York auch noch etwas zu tun. — — Nur Mut, Vater! Du bekommst deine Tochter wieder! Die Erde ist nicht groß genug, als dass der Räuber meines Glückes seine Beute vor mir verbergen könnte!« —
Den nächsten Anfall des Hellsehens bekam Evangeline nachts gegen elf Uhr, noch 26 Stunden von New York entfernt.
»Was siehst du, mein liebes Kind?«
»Ich sehe — — — sie. Es ist ein schönes Zimmer — nein, es ist so eine kleine Schiffskajüte wie hier. Elektrisches Licht. Ein breites Hängebett. Der Mann ist bei ihr. Jetzt zieht er seinen Rock aus. Er küsst sie. Sie...«
»Klaus — Fräulein Margot — verlassen Sie das Zimmer — — auch du, Vater!«, stieß Jack mit heiserer Stimme hervor.
Sie gingen hinaus, der unglückliche Mann war allein, und jetzt wollte er mehr hören, und er konnte mit den Augen des Kindes, welches nach dem Erwachen nichts mehr davon wusste, alles sehen, was er nur sehen wollte. Und er hörte zu, und er schien dabei ganz ruhig zu sein — — da zersplitterte plötzlich die Stuhllehne, auf welcher seine Hand gelegen hatte, mit solch furchtbarem Griffe hatte er sie umklammert gehabt, und das sagt wohl mehr, als es Worte vermögen, was in seinem Innern vor sich ging, während das unschuldige Kind in seiner Bewusstlosigkeit mit unbefangenen Worten Szenen sündiger Liebe schilderte.
Evangeline wurde immer unruhiger, doch aus einem besonderen Grunde, wie sich gleich zeigen sollte. Für das Kind hatten sich die beiden ja nur lieb, der fremde Herr war so gut zu Mariechen.
»Aber was ist das nur?«, sagte sie ängstlich.
»Mariechen liegt doch im Bett — — und sie kommt immer näher und näher — — und so furchtbar schnell — — als wenn sie flöge — — jetzt ist sie schon dicht bei mir — dort ist sie ja...«
An Deck ging etwas vor sich, Schritte rannten hin und her. Jack wandte den Kopf nach dem kleinen Kajütenfenster, er sah viele Lichterchen, eine schreckliche Ahnung ging ihm auf — schrecklich für ihn! — er nahm dem Kinde schnell die Locke aus der Hand und eilte an Deck.
Dort rauschte es heran mit Pfeilesschnelle, ein Ungetüm mit Hunderten von glühenden Augen, ein Steinwurf konnte es erreichen. Jetzt wurden auch an Deck Feuer abgebrannt, hinten und vorn und in der Mitte, grüne und weiße und rote, die beiden sich begegnenden Dampfer signalisierten einander ihre Namen zu.
»Was für ein Dampfer ist das?«, fragte in der Nähe von Jack jemand einen Steuermann.
»Das ist die ›Espérance‹ von Marseille.«
Das Stöhnen eines Tigers entrang sich der Brust des an der Bordwand stehenden Mannes, und wie ein Tiger duckte er sich auch zum Sprunge zusammen.
Dort — dort — noch nicht einen Steinwurf seitwärts von ihn. entfernt — da fuhr sie an ihm vorüber — sein Mariechen — und sie lag in den Armen eines anderen — und hier stand der Gatte — und keine Möglichkeit, hinüber zu gelangen — er konnte nur die geballte Faust schütteln und ein Wort rufen:
»Rache!!!«
»Die Rache ist mein, spricht der Herr«, sagte hinter ihm eine sanfte Männerstimme.
Der Dampfer war vorüber, langsam wandte sich Jack um.
Hinter ihm stand ein noch junger Mann im schwarzen Talar, mit sanften, einnehmenden Zügen. Jack kannte ihn, es war sein Tischnachbar, ein Missionar.
»Die Rache ist mein, spricht der Herr?«, wieder holte Jack langsam in fragendem Tone und wie erstaunt.
Und plötzlich brach er mit furchtbarer Wildheit los, dass der Missionar entsetzt zurücktaumelte.

»Mein ist die Rache, mein!!«, schrie er donnernd, sich mit der Faust vor die Brust schlagend. »Diesmal ist sie mein!!«
Sie bezogen in New York ein Hotel, in dem sie zwei Tage verbleiben konnten. Van Hyden wollte die Hilfe der Polizei in Anspruch nehmen, den Entführer seiner Tochter in Marseille verhaften lassen, aber Jack wollte von so etwas durchaus nichts wissen. Erstens ging das gar nicht so leicht an, dann hatte man es doch jedenfalls mit einem Manne zu tun, der auch mit allen Hunden gehetzt war, und schließlich wurde man hierdurch nur aufgehalten, vielleicht absichtlich, es entstanden Verzögerungen, die gar nicht wieder gutzumachen waren. Nein, selbst ist der Mann!
Der vielgereiste und erfahrene Jack hatte schon in Amsterdam und selbst während der Fahrt von London nach Harwich für alles gesorgt. Zuerst begab er sich nach einem Bankhause, welches für ihn alle Postsachen empfing.
Nach einer Stunde kam er zurück. Van Hyden hatte sich gerade einmal aus dem Zimmer entfernt, in welchem das Kind in gesundem Schlafe lag, wovon sich Jack erst überzeugte, ehe er mit leiser und erschütterter Stimme an Margot das Wort richtete.
»Mein Londoner Vertrauensmann hat mir eine traurige Mitteilung depeschiert; vor vier Tagen ist Evas Mutter plötzlich am Herzschlag verschieden.«
»Ach, das arme, arme Kind!«, rief Margot erschrocken mit erhobenen Händen.
»St!«, warnte Jack. »Wozu soll Eva es erfahren? Ich will also nicht, dass das Kind es zu wissen bekommt. Sagen Sie das auch Herrn van Hyden; denn wenn er nicht bald wiederkommt, kann ich nicht mehr auf ihn warten, ich habe etwas zu tun.«
Er trat an das Bett und blickte lange Zeit auf die kleine Schläferin hinab.
»Ich möchte Evangeline an Kindes statt annehmen«, sagte er dann leise. »Fräulein Margot, ich glaube, auch Sie haben das Kind sehr lieb, würden Sie...«
Er brach ab und blickte nach dem schönen Mädchen, und dessen Augen begannen plötzlich zu leuchten.
»Und ich werde dem Kinde eine treue Mutter sein!«, rief Margot hastig.
»Wollen Sie wirklich bei ihm bleiben?«, fragte Jack freudig. »Ich werde Sie gut bezahlen.«
»Nein, nein«, wehrte Margot energisch ab. »So ist es nicht gemeint. Das Kind hängt an mir, und ich liebe das Kind — und eine solche Liebe kann niemals bezahlt werden.«
»Margot, Sie sind ein gutes Mädchen — — verzeihen Sie, es kam aus dem Herzen«, sagte Jack bewegt, jener die Hände hinhaltend. »So wollen wir beide uns des Kindes annehmen, Sie als Mutter und ich als Vater. Wollen wir diesen Bund zusammen eingehen?«
Mit einer stürmischen Bewegung ergriff Margot die dargebotene Hand, und es sah fast aus, als ob sie dieselbe an ihre Lippen führen wollte. Aber sie beherrschte sich noch rechtzeitig.
Dem scharfsichtigen Jack war diese Bewegung nicht entgangen. Doch er wusste, dass in der schönen Pflegerin ein gut Teil Leidenschaft steckte, sie war ganz Gefühl — — er machte nur den Fehler, dass er diesen Ausbruch der Leidenschaft der Teilnahme zuschrieb, welche sie für das arme, kranke Kind hatte, das jetzt auch noch ganz allein in der Welt dastand.
»Abgemacht!«, sagte er freudig, ihre Hand drückend, und dann, diese loslassend, fuhr er in geschäftlichem Tone fort: »Ich reise jetzt nach Buffalo Bills Insel, ich will einmal mit ihm sprechen. Spätestens morgen früh bin ich zurück. Das Kind brauche ich Ihnen also nicht erst ans Herz zu legen. Auf Wiedersehen, mein liebes Fräulein!«
Er war gegangen. Margot befand sich allein im Zimmer. Sie schlich an das Bett und beugte sich mit verklärtem Lächeln über das schlafende Kind, küsste es sacht.
»Ich will dir wirklich eine treue, liebevolle Mutter werden«, flüsterte sie zärtlich, »denn du bist es, die mich dem Herzen des geliebten Mannes näher gebracht hat, und durch dich will ich den Bund der Liebe für immer mit ihm schließen.«
Das Kind nochmals küssend, richtete sie sich auf, und ihre noch eben von Seligkeit verklärten Züge wurden plötzlich traurig.
»Ach, noch bin ich ja weit entfernt von dem ersehnten Ziele«, flüsterte sie, »noch lässt er ja nicht ab von jener, der er Treue geschworen hat. Er verzeiht ihr ja, er sagt, er habe ihr nichts zu vergeben, er entschuldigt alles, weil sie sich in einem falschen Glauben befände, und wenn er sie auch für sich verloren hält, treu bleibt er ihr doch...«
Sie faltete die Hände und blickte freudvoll und leidvoll zugleich zum Himmel empor.
»O, selig, wer das Herz solch eines Mannes sein eigen nennen darf!«
Plötzlich aber nahmen ihre Züge immer mehr den Ausdruck des Schreckens an, der sich zum Entsetzen steigerte.
»Was hat er gesagt?«, stieß sie hervor. »Mein ist die Rache, diesmal ist sie mein!! — — Und wie er das gerufen hat! Mir zittern noch die Nerven! Wehe! Dieser Mann ist unter wilden Indianern aufgewachsen, und er hat nicht nur deren Grausamkeit geerbt, wenn es Rache auszuüben gilt, sondern auch ihren feinen Spürsinn, und er wird nicht rasten noch ruhen, als bis er den Vernichter seines Glückes gepackt hat, um ihn unter Folterqualen sterben zu lassen — und mich — und mich...«
Stöhnend und am ganzen Körper zitternd sank das schöne Weib auf einen Stuhl nieder.
Als Hyden, der sich nur Zigarren gekauft hatte, zurückkam fand er die Pflegerin wieder ganz ruhig.
Sie teilte ihm mit, was Mister Dankwart ihr aufgetragen hatte. Hyden war sehr erschrocken, konnte aber nichts daran ändern und fand Jacks Anordnung sehr vernünftig.
»Mijnheer verzeihen — unsere Abreise von London wie von Amsterdam ist so plötzlich erfolgt — ich muss notwendig einige Einkäufe besorgen.«
»Selbstverständlich! Brauchen Sie Geld?«
Margot zögerte — dann ließ sie sich zehn Dollar geben, das genügte.
»Sagen Sie doch, was Sie haben wollen. Sie gehören doch mit zur Familie. — Wann fällt Eva heute in Halbschlaf?«
»Heute Nachmittag kurz vor zwei Uhr. Bis dahin bin ich längst zurück.«
»Das ist ja nicht nötig! Ich bin doch da! Nehmen Sie sich nur Zeit, bleiben Sie bis heute Abend, Sie müssen doch auch einmal etwas Anderes haben.«
Margot versicherte aber, dass sie um zwei Uhr wieder zurück sei, und machte Toilette zum Ausgehen. Doch sie blieb auch auf der Straße die Krankenpflegerin und barmherzige Schwester, also ganz einfach gekleidet, statt des Hutes ein weißes Mützchen auf dem Haare.
Das Hotel lag in einer Hauptstraße mit vielen Läden, sie machte gleich hier verschiedene Einkäufe und barg die Paketchen unter dem Mantel.
Das schöne Mädchen zog viele bewundernde und begehrende Blicke auf sich, namentlich, da es auch noch als barmherzige Schwester gekennzeichnet war — — das hat noch einen ganz besonderen Reiz.
Zwei höchst elegante Herren kamen des Weges daher. Der eine blieb gleich stehen, drehte sich um und blickte ihr nach.
»Donnerwetter, wo habe ich denn dieses bildschöne Mädchen schon einmal gesehen?!«, sagte er erstaunt. »Aber nicht als barmherzige Schwester — — in ganz anderer Umgebung — — in einem Salon — — in prachtvoller Balltoilette — — vor meinen Augen tauchen Diener und Pagen auf...«
Er brach ab und schlug sich vor die Stirn.
»Ach, jetzt weiß ich!«, lachte er. »Beim Jubiläumsball im königlichen Palais zu Windsor — ich dachte an die Lady Esther, Tochter des Herzogs von Yorkshire, die erste Ehrendame der Königin. Nein, die läuft nicht in New York als barmherzige Schwester herum. Aber eine merkwürdige Ähnlichkeit!«
Margot, welche bald so verkannt worden wäre, schien hier nicht alles zu bekommen, was sie wünschte. Sie nahm einen Wagen und fuhr in ein anderes Stadtviertel, das auch noch sehr belebt war.
Hier musterte sie die Schaufenster, blickte oftmals oben nach der Hausnummer und schien die gesuchte zu finden, es war ein Wäschegeschäft. Sie sah nach ihrer Uhr und blieb vor diesem Schaufenster stehen, betrachtete die ausgestellten Sachen, blickte aber auch manchmal die Straße hinauf und hinab, als erwarte sie jemand.
Ein Mietwagen kam langsam gefahren, die Fenster mit blauen Gardinen dicht verhangen.
»Ist der Wagen frei?«, rief ein Herr.
»Ist bestellt«, sagte der Kutscher kopfschüttelnd.
Er wurde auf der belebten Straße noch zweimal angerufen — — die Droschke war bestellt, wenn sich der Kutscher auch Zeit nahm.
Jetzt fuhr er langsam an dem Wäschegeschäft vorbei.
Die barmherzige Schwester drehte sich um und trat auf die Seite des Trottoirs.
»Bitte, ist der Wagen besetzt?«
»Nein, Miss, er ist frei.«
Der Kutscher sprang vom Bock, öffnete den Schlag, Margot stieg sehr schnell ein, und ebenso schnell machte der Kutscher die Tür wieder zu und fuhr im Trabe davon. Margot aber hatte nicht einmal angegeben, wohin er denn fahren sollte.
Das musste also doch alles Verabredung sein.
In dem Innern der Kutsche herrschte Halbdunkel. Wer beim Öffnen der Tür zufällig hineingeblickt hätte, der würde wohl schwerlich die dunkle Männergestalt gesehen haben, welche sich in eine Ecke schmiegte. Jetzt richtete sie sich auf, ein vornehmer Herr mittleren Alters mit Lackschuhen und Zylinder.
Margot war nicht im Mindesten überrascht. Eine ganz seltsame Begrüßung und Vorstellung erfolgte.
»Speck und...?«, sagte Margot, die Augen forschend auf das glattrasierte Gesicht des Herrn geheftet.
»Zum Speck gehören eigentlich Erbsen oder Eier«, lachte dieser, »da aber hierauf sehr leicht auch ein Uneingeweihter kommen kann, so will ich lieber sagen: Speck und Hyazinthen.«
»Sie sind es.«
Ohne weitere Umstände begann Margot zu erzählen, und das war sehr viel.
Dem Herrn war das Lächeln schon längst vergangen.
»Alle Teufel!«, zischte er zwischen den Zähnen hervor. »So hat dieser Narr also noch immer nicht genug, wenn er seine Frau in den Armen eines anderen liegen sieht? Hm!«
Eine lange Pause trat ein, während der Wagen über schlechtes Pflaster rumpelte. Margot hatte nichts mehr hinzuzufügen, der Mann wusste alles, was sie ihm hätte mitteilen können.
»Das Allereinfachste wäre«, nahm er dann bedächtig wieder das Wort, »wenn wir dieses vielgeliebte Mariechen für immer aus der Welt schafften — nein, o nein, Sie brauchen nicht zu erschrecken«, unterbrach er sich schnell, als Margot zurückfuhr, und er streckte seine weißen, wohlgepflegten Hände aus. »Sehen Sie meine Hände. Rein, nicht wahr? Und so rein müssen unsere Hände auch bleiben. Kein Blut darf daran kommen, o nein, keine Spur von Blut! Wegen alles Anderen wollen wir uns schon später rechtfertigen. Alles, alles geht zu schieben und zu drehen und zu wenden — — nur kein Blut, kein Mord, kein Verbrechen — — das ist eine faule Geschichte. — Nein, in Marseille wird dieses liebe Mariechen einfach sofort in eine Kiste gesteckt, ob sie will oder nicht, sie wird betäubt, das können wir verantworten, denn sie hat einmal A gesagt, nun muss sie auch B sagen, und da wird sie als Frachtgut irgendwohin geschickt, nach Sydney, nach Honolulu oder sonst wohin, ins Innere von Afrika, hähähähä. Wenn sie in der Kiste ist, kann das Kind sie doch nicht sehen. Nicht wahr? Na also! Da weiß Texas Jack doch auch niemals, wo sie wieder herauskommt, wo sie sich zur Zeit aufhält, und findet er sie doch wieder, in Sydney oder in Honolulu oder in Zentralafrika — — well, da wird sie immer wieder in der Kiste fortgeschickt, immer rund um die Erde, hähähähä. Aber nur kein Blut, kein Blut, das hat so eine garstige rote Farbe und klebt so an den Fingern.«
Und grinsend rieb sich der Ehrenmann die feinen, weißen Hände.
»Aber wozu in aller Welt nur dies alles?«, staunte Margot.
Sie steckte also mit den Feinden unter einer Decke und wusste selbst noch nicht, was diese beabsichtigten.
»Geheimnis, liebes Fräulein, Geheimnis«, kicherte der Gefragte. »Na, das glauben Sie uns wohl, dass wir das alles nicht nur so zu unserem Privatvergnügen machen. Das kostet nämlich schweres Geld. Was meinen Sie denn, was für einen kolossalen Apparat wir in Bewegung setzen, damit dieser Texas Jack sein Mariechen nicht wieder zu sehen bekommt? Hähähähä!«
»Mit dieser Holländerin ist ein Geheimnis verknüpft?«
»Na und ob, und was für eins! Nun habe ich aber schon zu viel gesagt. Hier, geehrtes Fräulein, ist Ihr erstes Honorar.«
Er zog aus der Brusttasche eine schon bereitgehaltene Tausenddollarnote und überreichte sie der Dame. Mit sichtlichem Widerstreben nahm diese das Geld, sie musste einen Abscheu niederkämpfen, obgleich es ein ganz neuer Schein war.
Darauf sah sie nach der Uhr und erklärte, sie hätte keine Zeit mehr, denn um zwei Uhr, wenn das Kind wieder in Halbschlaf fiele, wolle sie zurück sein, das dürfe sie nicht versäumen.
»So ist es recht, Fräulein!«, lobte der Herr. »Denken Sie immer an Ihre Pflicht, und Sie werden es nicht bereuen, wir sind freigebig — — und den vielgeliebten Texas Jack geben wir Ihnen obendrein noch zu — hähähähä!«
Das schöne Antlitz der barmherzigen Schwester wurde weiß wie das einer Leiche, sie presste die Lippen zusammen.
»Ich muss aussteigen. Wo bin ich hier?«, fragte sie dann hastig.
Der Herr erklärte ihr, wo sie sei, wie sie dann zu fahren habe. Margot stand auf.
»Apropos, nennen Sie mir doch in New York eine wohltätige Anstalt für Waisen oder Witwen, der man vertrauensvoll Geld schicken kann.«
»Das SeemannsWaisenhaus, das hat es auch am allernötigsten. Sie wollen ihm doch nicht etwa Ihr Honorar anweisen?«
Margot blieb die Antwort schuldig. Der Wagen hielt schon auf einem stillen Platze, sie sprang ohne Abschied hinaus, der Wagen fuhr mit dem Herrn weiter.
Die barmherzige Schwester fragte einen Constabler nach dem nächsten Postamt, kaufte sich unterwegs Briefbogen und Kuvert, ging in das Postamt und schrieb: »Von einem Weibe, welches aus Liebe sündigt.«
Diese Zeilen legte sie der Tausenddollarnote bei und schickte das Geld im eingeschriebenen Brief an das Waisenhaus für Seemannskinder.
Hierauf nahm sie einen anderen Wagen und beorderte ihn nach ihrem Hotel. Sie konnte gerade noch zur rechten Zeit zurückkommen. Aber eine Zugbrücke über einen Fluss war hochgezogen, der Wagen musste warten, bis ein kleiner Dampfer passiert war, und dieser manövrierte falsch und blieb eine Viertelstunde unter der Brücke hängen, und als er endlich durch war, da funktionierte diese nicht, und als der Wagen darauf wenden wollte, da ging das auch nicht, eine ungeheuere Menge von Fuhrwerk hatte sich angestaut, zwischen dem kein Mensch lebendig herausgekommen wäre — — höchstens ein New Yorker Zeitungsjunge.
So kam es, dass Margot sich um zwei Stunden verspätete.
Das Essen war in diesem amerikanischen Hotel wirklich ausgezeichnet, der Portwein nicht minder. Mijnheer van Hyden hatte von beiden Gottesgaben reichlich genossen und war dann aus seinem Zimmer im Lehnstuhl etwas eingenickt.
Klaus verstand zwar die Gottesgaben nicht weniger zu würdigen, und auch er hätte gern ein Nickerchen gemacht, aber die Pflegerin war noch nicht zurückgekommen, er musste über das Kind wachen, und wie er so mit Eva spielte, schloss diese plötzlich die Augen und fiel in die Kissen zurück.
Klaus blickte nach der Uhr — richtig, zur bestimmten Minute. Sollte er Mijnheer wecken? Der sägte mit der Nase einen Baumast durch.
Haaa!! Nein, Klaus weckte ihn nicht, er brauchte es auch nicht! Jetzt endlich war einmal eine Gelegenheit gekommen!
Klaus zog also aus seiner verborgensten Tasche den Pferdeschwanz, den er seiner Fatje beim Abschied vom Kopfe geschnitten hatte, blickte erst nach dem Kinde, dann nach seinem schnarchenden Herrn — alles war in Ordnung — er trat vor den Wandspiegel, ob Kragen und Schlips auch ordentlich saßen, beguckte sich von hinten und von vorn, ob an ihm auch alles tadellos sei — und als er an sich nichts auszusetzen hatte, schlich er an das Bett des Kindes.
Er ballte den Zopf etwas zusammen, legte ihn in das warm werdende Händchen und schloss die Finger darüber — er hatte ja oft genug gesehen, wie es gemacht wurde.
»Was siehst du, mein liebes Kind?«, flötete er mit der süßesten Stimme.
»Ich sehe — — sie!«
Verklärt himmelte Klaus nach der Decke.
»Sie! Sie sieht sie!«, hauchte er und schlenkerte mit dem rechten Beine. »Wie sieht sie denn aus, mein liebes Kind?«
»Schön, o, wunderwunderschön!«
»Schöööhn, o, wunderwunderwunderschöööhn!!«. echote Klaus verzückt und schlenkerte mit dem linken Beine. »Was macht sie denn? Ist sie in der Küche?«
»Ich sehe — — ein sehr schönes Zimmer...«
»Dann ist Fatje jedenfalls in der guten Stube — — das Luder — — wenn sie nur mit ihren dreckgen Latschen nicht auf meinen Teppichen herumtrampelt.«
»O«, fuhr das Kind fort, »was für ein schönes Kleid sie an hat — — alles Gold — — ein goldenes Kleid — — — mit Puffärmeln...«
Klausens Vollmondgesicht zog sich plötzlich in die Länge, als wäre es aus Kautschuk.
»Mit PuffPuffPuffPuffärmeln?«, stotterte er. »I, wo hat sie denn das goldge Kleid mit Puffärmeln hergekriegt?!«
»Ich sehe — — einen Mann...«
»In der guten Stube bei Fatje einen Mann?!«, stieß Klaus misstrauisch hervor. »Wo zum Deibel hat sie nur das goldge Kleid her?«
»O, ist dieser Mann schön gekleidet — ganz bunt — — und an der Seite hat er ein großes Schwert!«
»Das ist ein Soldat! Und bei Fatje in der guten Stube? Himmelbombenelement! Eva, meine liebe Eva, frage sie doch einmal, wo sie das goldge Kleid her hat.«
»Der Mann mit dem Schwerte hat rote Pumphosen an — —«
»Ein Soldat mit roten Pumphosen?«
Jetzt fing der eifersüchtige Klaus mit beiden Beinen an zu schlenkern.
»Das ist ein Franzose! Und was will denn der in der guten Stube bei Fatje?!«
»Und jetzt kommen noch viele andere solche Männer, alle mit Schwertern und — o, so schön, so schön gekleidet! — Und jetzt kommen andere, ganz in Stahl gehüllt, das sind Ritter...«
»Ritter? Ritter? Wie kommen denn die Ritter in unsere gute Stube? Eva, frage sie doch mal.«
»Und jetzt kommen viele schöne Knaben — o, sind die schön gekleidet! — — Der erste trägt ein Kissen, darauf liegt eine große, goldene Krone...«
»Eine goldge Krone? In unserer guten Stube? Nanu!«
»... und jetzt kommt ein Mann mit einem langen Barte — in einem schwarzen Mantel — auf dem Kopfe eine hohe, spitze Mütze...«
»Eine spitze Mütze?«
»... und jetzt kommen andere Edelknaben, sie tragen einen goldenen Stuhl — — ach, es ist ein Thron! — — sie setzen ihn hin — — der Priester nimmt die goldene Krone — — sie kniet nieder — er setzt ihr die goldene Krone aufs Haupt...«
Klaus sperrte Maul und Nase auf.
»Wem setzt er die goldge Krone auf? Meiner Fatje?«
»Ja, ja, der, deren Haar ich in der Hand habe — — jetzt steht sie auf — — sie setzt sich auf den goldenen Thron — — jetzt kommen lauter schöne Damen, verneigen sich vor ihr und küssen ihr die Hand — — ach, jetzt weiß ich«, rief das Kind fröhlich, »sie ist Königin geworden!«
Klans knickte zusammen, als ob er einen Hexenschuss bekommen hätte.
»Fatje — ist — in — der — guten — Stube Königin geworden! Meine Fatje ist jetzt Königin!! Ei du griene Neine!!«
Da räusperte sich sein Herr, gleichzeitig wachte das Kind auf. Schnell nahm Klaus die Haarflechte aus der Hand und steckte sie ein, das war aber auch die einzige Handlung, deren er fähig war, dann stand er wie ein begossener Pudel da.
»Was ist denn mit dir los, Klaus?«, fragte gleich sein Herr. »Was machst du denn für Grimassen?«
Dass er die Sehergabe des Kindes benutzt hatte, das wagte Klaus nimmermehr zu gestehen, aber er wusste, wie jämmerlich er aussah, eine Entschuldigung musste er doch haben, und so hielt und rieb er sich mit beiden Händen den Leib und sagte in kläglichstem Tone:
»Ach — Mijnheer — Mijnheer — — ich habe solches Bauchkneipen.«
»Siehst du, Kerl, du hast wieder zu viel gefressen. Hol mir mal die Rizinuspulle her!«
Van Hyden hielt nämlich Rizinusöl für ein Universalmittel, das er immer bei sich führte, und eben weil Klaus schon übel wurde, wenn er dieses Zeug nur sah, so wurde er niemals krank. Er hatte sich einmal den Fuß verrenkt gehabt, hatte es aber fertig gebracht, sich gar nichts davon merken zu lassen, aus Furcht, sein Herr würde den verrenkten Fuß auch mit Rizinusöl kurieren.
Jetzt half aber alles nichts, und wenn die Magenschmerzen vorüber waren, so konnten sie doch wiederkommen, Klaus hatte sich eben den Magen überladen — Klaus musste die Rizinuspulle und einen großen Suppenlöffel holen und trotz aller Grimassen das Zeug schlucken! Sein Herr quetschte ihm dabei die Nase zu.
Dann ging Klaus an einen stillen Ort, steckte erst den Finger in den Hals, und dann setzte er sich.
»Meine Fatje ist Königin geworden!«, seufzte er dabei. »I der Deiwel, sie ist doch meine Braut, bin ich da nicht eigentlich König?«
Denn Klaus zweifelte nicht im Geringsten daran, dass seine Fatje wirklich zur Königin gekrönt worden war! Es war allerdings etwas wunderbar — das stimmt! — Aber was Evangeline sah, das war richtig, daran durfte nicht mehr gezweifelt werden. Da hatte sogar schon sein unfehlbarer Herr vom Texas Jack eine lange Nase bekommen, und das Haar war von Fatje gewesen, und was war denn in der Welt noch unmöglich? Wenn des Mijnheern Tochter als Wachsfigur in einer Kiste nach New York verschickt wurde, dann konnte auch des Mijnheern krummbeinige Köchin zur Königin gekrönt worden sein. Alles beides fängt mit K an.
Kurz und gut, Klaus wies jeden Zweifel von sich, und während er so auf seinem stillen Örtchen saß, was bei ihm immer mindestens eine halbe Stunde dauerte, wusste er nur noch nicht recht, ob er sich freuen oder weinen sollte. Bald schwoll ihm vor Stolz das Herz — seine Fatje Königin! — Bald war er zu Tode betrübt — und dabei stöhnte er wie eine ungeschmierte Dampfpumpe.
Dann war sein Entschluss gefasst. Klaus war ein Kavalier. Zuerst musste er gratulieren. In einer unbeschäftigten Stunde griff er also zur Feder und schrieb einen Brief, oder er malte vielmehr, als wäre der dünne Federhalter ein Schippenstiel, und dabei tropfte von seiner Stirn immer der Schweiß auf den Briefbogen.
Libe Fatje!
Ich habbe Gehöhrt, Du pisst Köhnichin gehworrn und Ich freuhe mich söhre drühber und nune mus Ich dihsen brif sliehsen diweil Ich nich möhr zu sreihben weihs, Womihd Ich förbleihbe Dein getreuhör und filgelihbichtör Preuhdüchamm Klaus Klausen.
So, der Gratulationsbrief war fertig. Das war wirklich fein gemacht. Er hatte der Höflichkeit genügt, hatte aber dabei auch durchblicken lassen, dass er noch auf sein Recht als Bräutigam Anspruch mache. Klaus war sehr zufrieden mit sich. Es hatte ihm aber auch Schweiß genug gekostet, das sah man dem Briefbogen an.
Nun bereitete ihm nur noch die Adresse Kopfschmerzen. Von welchem Lande war sie denn eigentlich Königin geworden? Na, das musste eben wiederum so fein gemacht werden, so halb und halb: An Fräulein Fatje Dickmichel, Königin und Köchin bei Mijnheer van Hyden usw.
Der Brief ging ab. Sein Herr erfuhr nichts davon, niemand.
Nun sei aber gleich bemerkt, dass Evangeline ganz richtig gesehen hatte, wirklich die Krönung einer Königin. Der scharfsinnige Leser errät vielleicht schon, was für eine Bewandtnis es mit Fatjes Haarflechte hatte.
Das war aber erst die Einleitung. Klaus sollte noch ganz andere Sachen zu sehen bekommen, haarsträubende!
Am anderen Morgen kehrte Jack zurück. »Vater, komm mit, setze den Hut auf, wir haben eine kleine Fahrt zu machen.«
»Wohin?«
»Bitte, frage jetzt nicht. Ich müsste dir eine lange Erklärung geben, die nicht nötig ist, weil du Augenzeuge von allem werden wirst. Es wird dich sehr interessieren, es handelt sich um eine kleine Überraschung.«
Sie nahmen einen Wagen, fuhren eine Viertelstunde und stiegen vor einem sehr großen Hotel aus. Jack hatte seine langen Locken unter den Hut gesteckt.
»Doktor Higgins zu sprechen?«, fragte er an der Porliersloge. »Bach ist mein Name.«
»Ja, die Herren werden erwartet.«
Sie benutzten den elektrischen Aufzug. Oben wurden sie von einem anderen Portier in Empfang genommen und in ein Zimmer geleitet. Niemand befand sich darin. Jack legte warnend den Finger auf die Lippen.
»Kein Wort, keinen Laut, was du auch zu hören und zu sehen bekommst«, flüsterte er.
Die Tür, die in das Nebenzimmer führte, war nur mit einer dicken Portiere verhangen. Dorthin schlich Jack, dem Vater winkend, ihm zu folgen, schaffte sich in der Portiere eine Spalte, durch die er in das Nebenzimmer blicken konnte, und eine zweite für den Vater.
Dieser sah drüben einen elegant gekleideten Herrn auf und ab gehen, eine vornehme Erscheinung, und dieser schien zu wissen, dass jetzt jemand an der Portiere stand, oder er erwartete Jack; jedenfalls war dieser mit dem Herrn im Einverständnis.
»All right«, flüsterte Jack, als der Mann an der Portiere vorbeikam, und dieser senkte nur etwas den Kopf, unbekümmert seinen Spaziergang fortsetzend.
Das war alles ganz merkwürdig. Mijnheer van Hyden hatte nicht die leiseste Idee, wo das eigentlich hinaus sollte. Außerdem sah er drüben noch einen sehr großen Koffer stehen.
So vergingen einige Minuten. Da klopfte es an der Zimmertür. Der Herr, der doch jedenfalls Doktor Higgins war, blieb in der Mitte des Raumes stehen.
»Come in!«
Der Eingetretene war ein eleganter Herr mit einem schwarzen Knebelbart, offenbar ein Südländer.
»Habe ich die Ehre, Doktor Higgins zu sprechen?«
»Bin ich. Signor Fratelli, nicht wahr?«
Wo hatte van Hyden denn nur schon einmal diesen italienischen Namen gehört?!
»Das ist mein Name. Der Herr Doktor interessieren sich also für das Krebspräparat? Das ist auch ein wundervoll gearbeitetes Modell. Was würden der Herr Doktor mir dafür bieten?«
Der alte Holländer kam immer noch nicht auf die Spur, was das alles eigentlich zu bedeuten habe. Krebspräparat? Modell?
»Hm. Was wollen Sie dafür haben?«
»Unter zweihundert Dollar kann ich Ihnen das unmöglich lassen.«
»Hm. Zweihundert Dollar ist mir etwas... Apropos, da fällt mir gerade ein — — ich war nämlich auf der Amsterdamer Weltausstellung, und da sah ich in Ihrem Panoptikum eine reizende Wachsfigur, die ich aber hier noch nicht gesehen habe, es war — so eine Phantasiefigur — — eine Afrikanerin — — oder Indianerin — — — im bunten Federkleid — — mit roten Sandalen — — — —«
Doktor Higgins hatte den Bleistift, mit dem er gespielt, fallen lassen, er bückte sich.
Aaaaah, jetzt mit einem Male wusste van Hyden alles!!
Aber wie geschickt das alles auf der Bühne und hinter den Kulissen gemacht wurde, das wusste er denn doch nicht, und Jack gab sich später auch nicht erst die Mühe, den Schwiegervater in alle Kniffe einzuweihen. Jede Bewegung war hierbei nämlich berechnet.
Der Italiener war doch nicht zum Setzen aufgefordert worden. Nun hatte sich Doktor Higgins während des Sprechens ohne Auffälligkeit so herumgedreht, dass der Italiener gerade so stand, wie er ihn haben wollte, nämlich, dass der versteckte Jack ganz deutlich sein Gesicht beobachten konnte, und wie Doktor Higgins gerade das sagte, was den Mann, wenn er schuldig war, am meisten erschrecken musste, ließ er den Bleistift fallen und bückte sich, wandte auch noch etwas den Kopf ab, und hätte der Italiener sich sonst, wenn der Frager ihn direkt angesehen, auch vollkommen beherrscht, so war dies jetzt eine Gelegenheit, wo er einmal seine Gesichtsmuskeln spielen lassen durfte.
Und wie Higgins sich noch bückte, gab Jack ein leises Zischen von sich, das eben noch das Ohr des Eingeweihten erreichte. Man hatte sich nämlich nicht geirrt. In dem Moment, als er sich unbeobachtet glaubte, hatte Signor Fratelli einen ganz anderen Gesichtsausdruck bekommen, sogar den Mund aufgemacht. Das hatte sogar Papa van Hyden beobachtet. Aber wäre das nicht alles so schlau arrangiert worden, so hätte Jack nicht das Geringste gesehen. Denn dieser italienische Schausteller war doch ein gerissener Weltmann, der sich sonst durch so etwas nicht ins Bockshorn jagen ließ.
»Wie meinen Herr Doktor?«, fragte er denn jetzt auch mit dem unschuldigsten Staunen, als sich der andere wieder aufgerichtet hatte. »Eine Wachsfigur, die eine Ind...«
Da war es aber zu spät. Higgins war auf ihn zugetreten.
»Na, nu machen Sie mal keine Geschichten«, sagte er ganz ruhig. »Erzählen Sie mal alles offen, wie Sie die junge Dame als Wachsfigur nach New York geschmuggelt haben.«
In höchster sittlicher Entrüstung, gemengt mit immer größerem Staunen, fuhr der Italiener empor.
»Mein Herr, was sprechen Sie da eigentlich...«
Higgins hob warnend die Hand.
»Gestehen Sie lieber!«
»Mein Herr, Sie sind... nicht bei Sinnen! Ich verlasse sofort...«
Aber jetzt war alles zu spät. Higgins schien den Italiener hinausgehen lassen zu wollen, wenigstens stand er ganz ruhig da. Doch auch die erhobene Hand war ein Zeichen gewesen. Plötzlich sah van Hyden unter dem Sofa eine schwarze Menschengestalt wie eine Schlange sich hervorwinden. Dicht hinter dem Italiener stand ein herkulischer Neger mit grinsendem Gesicht, und Fratelli hatte noch keinen Schritt nach der Tür gemacht, als sich ganz sachte schwarze Finger um seinen Hals legten, ein Ruck, er lag auf dem Sofa, ein leises Gurgeln, dann stand er wieder auf den Beinen, hatte aber den Mund ganz weit offen, weil nämlich ein großes Tuch drin steckte, und von hinten wurden seine Hände von dem grinsenden Neger gehalten. Das alles war mit Zauberschnelle vor sich gegangen.
»Na, nun mal los!«, sagte Doktor Higgins gutmütig, der noch ebenso breitbeinig dastand wie vorhin. »Wollen Sie alles beichten, was Sie von der lebendigen Wachsfigur wissen? Dann nicken Sie. Nee? Sie wollen nicht? Das tut mir leid. Sehen Sie sich mal dort den großen Koffer an. Da ist nichts drin. Aber da kommen Sie hinein. Denn hier im Hotel kann ich Ihnen nichts tun, da stört Ihr Schreien. Ich lasse Sie erst nach einem Plätzchen transportieren, wo Sie ungeniert brüllen können, und nun sehen Sie sich einmal dieses niedliche Dingelchen an...«
Higgins brachte aus seinem Hosenbein eine dicke lange Peitsche zum Vorschein, hielt sie erst dem Italiener unter die Nase und ließ sie dann pfeifend durch die Luft sausen.
Das brünette Gesicht des Italieners sah grau aus wie die Lava des Vesuvs. Eben der humoristische Ton, in dem jener sprach, bewirkte, dass er den furchtbaren Ernst erkannte. Er nickte heftig.
»Sie wollen sprechen? Gut! Jupiter, nimm den Knebel heraus! Aber beim ersten Quieken wird Ihnen die Luft abgeschnitten, und dann werden Sie unwiderruflich dort in den Koffer gepresst und verlassen das Hotel als schmutzige Wäsche, welche aber nur ausgeklopft wird.«
Der Neger nahm das Tuch aus dem Munde, in demselben Augenblick umspannten auch schon wieder die schwarzen Finger den Hals, jeden Augenblick bereit, wieder die Luft abzuschnüren. Es war nicht nötig, auch kein weiteres Drohmittel — wie Honigseim floss dem Italiener die Beichte über die Lippen.
An dem Abend, als er auf der Ausstellung das Einpacken der Wachsfiguren beaufsichtigte, waren zwei Herren zu ihm gekommen, Engländer oder Yankees, und hatten ihm den Antrag gestellt, ein betäubtes Mädchen als Wachsfigur mit nach New York zu nehmen. Das war natürlich nicht so schnell gegangen, wie hier erzählt wird, aber das Resultat der Verhandlung war: Signor Fratelli ging für tausend Dollar darauf ein, das bezahlte gerade seine Reisespesen. Das Mädchen war mit irgend etwas betäubt worden, aber nicht mit Chloroform. Es wurde in eine Kiste gepackt und nach der Niederlage getragen, in welcher der Aussteller seine Puppen aufbewahrte, er hatte noch das Kostüm einer ehemaligen, schon längst in Stücke gegangenen Wachsfigur, einer schönen Indianerin, als solche wurde die Bewusstlose ausstaffiert, wozu sie auch angemalt werden musste. Dies alles geschah noch an demselben Tage, an welchem Marie verschwunden war, freilich in später Nacht.
Am anderen Tage wurden die Kisten mit den Wachsfiguren auf das Schiff verladen, die mit der lebendigen Puppe kam im Packraum obenauf.
Nahrung hatte Mariechen während der Überfahrt nicht zu sich genommen, da sie dauernd bewusstlos blieb.
Der Italiener hatte nicht mehr viel zu berichten. Es kam nur noch darauf an, gerade diese Kiste bei der Landung der Zollrevision zu entziehen. Das war sehr einfach. Die Kiste mit der lebendigen Puppe wurde etwas mehr nach unten gepackt. Alle Kisten brauchen doch nicht geöffnet zu werden. Der Schausteller war den Zollbeamten auch schon bekannt, er kam glatt durch. Dann nahm der Herr die Kiste in Empfang, ließ sie auf einen Wagen laden und fuhr davon. Der Schausteller hatte seine tausend Dollar erhalten, und damit genug.
Dass er nicht wusste, wohin nun das Mädchen gebracht wurde, das war doch selbstverständlich, ebenso, dass die beiden Herren falsche Namen genannt hatten.
»Genug!«, sagte Jack hinter der Portiere vernehmlich, aber ohne sich zu zeigen.
Um den Hals des Italieners spannten sich noch immer die schwarzen Finger.
»Na«, sagte Doktor Higgins in seinem trockenen Tone und immer gutmütig, »weil Sie alles so offen gestanden haben, will ich Gnade für Recht ergehen lassen. Ich hatte Ihnen nämlich für diesen Schurkenstreich drei Dutzend Peitschenhiebe zugedacht. Aber weil Sie geständig waren, so sollen Sie nur fünfunddreißig und einen halben bekommen. —«
Im Nu wurde dem Italiener von hinten eine Kappe über den Kopf gestülpt, in demselben Augenblick klappte der Mann wie ein leerer Mehlsack zusammen. Higgins schlug den Deckel des großen Koffers zurück, der Neger schleppte den Betäubten herbei und packte ihn in den Koffer.

Mehr sah van Hyden nicht. Jack hatte ihm auf die Schulter geklopft.
»Komm, Vater, wir sind nicht mehr nötig, und wir haben keine Zeit zu vergeuden.«
Sie verließen das Hotel und bestiegen wieder einen Wagen.
»Ja, was war denn das?«, staunte Papa Hyden, als er dann saß. »Der wird ja doch noch in den Koffer gepackt!«
»Natürlich, der muss jetzt erst noch seine Tracht Prügel bekommen. Im Hotel geht das nicht gut. Higgins sucht sich jetzt ein stilles, idyllisches Plätzchen in der Umgegend aus, und da zählt er diesem edlen Italiener fünfunddreißig und einen halben auf. Ich hätte ja das alles selbst tun können, aber so war es doch besser. Ich muss mich hier zwei Tage aufhalten und will keine Unannehmlichkeiten haben, wenn auch gar nicht daran zu denken ist, dass sich der Italiener etwa bei der Polizei beklagt. Ich war nämlich in dieser Nacht schon auf Buffalo Bills Insel, eine weite Reise. Dass dieser Fratelli seine Schaubude jetzt hier aufgeschlagen hat, das wusste ich, und ich sprach mit Buffalo Bill darüber, wie das zu arrangieren sei. Das hörte Doktor Higgins, das ist nämlich unser Pferdedoktor auf der Insel, ein famoser Kerl, und der sagte gleich: Ach, Jack, das lass mich doch machen, das macht mir Spaß. — Na, wie alles gekommen ist, das hast du nun gesehen.«
»Er wird sich rächen!«
»I wo, Vater! Der kauft sich für fünf Groschen Zinksalbe, legt sich acht Tage auf den Bauch und lässt sich von seiner Frau einreiben.«
Van Hyden konnte sich nicht helfen, er musste laut auflachen.
»Ihr seid Teufelskerle«, brummte er kopfschüttelnd.
Es war Abend geworden, und die neunte Stunde nahte heran, in welcher laut der Vorhersage das Kind in Schlafwachen fallen musste. Diesmal aber sollte Evangeline etwas erzählen, was das ganze Programm über den Haufen warf, es trat ein Fall ein, den auch der weitsichtige Jack ganz vergessen zu haben schien, und es sollte eine fürchterliche Nacht werden.
Evangeline schlief gerade zu dieser Zeit, und als die bestimmte Minute heranrückte, nahm Jack ihre tote Hand in die seine, und als er das Leben mit dem Pulsschlag kommen fühlte, gab er ihr die Locke in die Hand.
»Was siehst du, mein liebes Kind?«
»Ich sehe — — sie. Nein, ich sehe sie nicht — oder nur ganz, ganz undeutlich...«
»Sie befindet sich in einem ganz dunklen Zimmer.«
»Nein, sie geht — — um ihre Hüfte schlingt sich ein Arn. — — im Freien muss sie sein — — — sie blickt nach oben — — keine Sterne — — alles ganz finster.«
»Sie befindet sich mit ihrem Begleiter also an Deck, und es ist eine sehr finstere Nacht«, erklärte Jack. »Bei denen ist es aber jetzt nicht erst um neun, sondern schon viel später, vielleicht schon um elf, denn jetzt dreht sich die Sache um, jetzt sind wir im Westen und die im Osten. — — Was bemerkst du sonst noch, mein Kind?«
»Sie gehen — — jetzt bleibt sie stehen — — Marie lehnt sich an etwas — sie blickt hinab — o, wie schön das aussieht, wie das braust und schäumt in feurigem Lichte!«
»Sie steht am Heck des Schiffes und blickt in das leuchtende Kielwasser. Wird das Schiff stark bewegt?«
»Es rüttelt sehr und geht immer auf und nieder. — Aber daran habe ich mich schon ge...«
Mit einem Male stieß Evangeline einen gellenden Schrei aus und fuhr mit der rechten Hand nach ihrem Halse.
»Hilfe — zu Hilfe!«, schrie sie mit vor Todesangst verzerrtem Gesichte. »Er würgt mich! Er würgt mich! Hilfe, Hilfe, ich bin im Wasser, ich ertrinke!!«
»Allmächtiger Gott, er hat sie über Bord geschleudert!«, schrie Jack.
Es war nur zu wahr! Mariechen rang mit den Meereswogen um ihr Leben, und das hellsehende Kind mit ihr, denn bei solchen besonderen Gelegenheiten, wenn die Seele im höchsten Maße angespannt wurde, trat bei dem sensitiven Kinde anstatt des Sehens ein Mitfühlen ein.
Evangeline wälzte sich hilfeschreiend im Bett, sie sprang im Liegen förmlich empor, sie machte die Bewegungen der Wellen mit, sie gurgelte — und das währte viele Stunden lang, die ganze Nacht hindurch.
Es war entsetzlich! Solange das Kind sich so gebärdete und die Locke noch in der Hand behielt, war Mariechen ja auch noch nicht tot, aber dieser mitgefühlte Todeskampf des Kindes war nicht mehr zu ertragen.
Jack wollte ihr also die Locke aus der Hand nehmen — — vergebens, er hätte die dünnen Fingerchen geradezu abbrechen müssen. Und so währte dieser schreckliche Zustand die ganze Nacht hindurch.
Der alte Vater gebärdete sich und schrie wie ein Wahnsinniger, Margot hatte sich in einen Winkel verkrochen und hielt sich die Ohren zu, Jacks bronzefarbenes Gesicht war aschgrau geworden, und als er einmal trank, klapperte das Glas zwischen seinen Zähnen.
Endlich, gegen zwei Uhr in der Nacht, also nach fünf Stunden, wurden die Bewegungen des Kindes schnell schwächer und schwächer. Fünf Stunden hatte sich Mariechen, welche sehr gut schwimmen konnte, im Wasser gehalten, jetzt wurde sie schnell von ihren Kräften verlassen. Doch das darf man nicht wörtlich nehmen. Im hohen Meere ist es ganz gleichgültig, ob man gut schwimmen kann oder sich nur eben über Wasser zu halten versteht, und nicht einmal das ist nötig. Die Wogen schleudern den Körper, wie sie wollen, und gehen sie sehr hoch, so ertrinkt man nicht, sondern man wird von der kolossalen Wasserlast erschlagen.
Marie hatte es eben fünf Stunden lang ausgehalten, jetzt ging es mit ihr zu Ende, jetzt kam endlich der barmherzige Tod.
Da streckte sich das wie in Schweiß gebadete Kind lang aus, öffnete das linke Händchen, die blonde Locke fiel zu Boden.
»Tot!!«, schrie der Vater, der es gesehen hatte. »Jetzt ist sie ertrunken! Mein Mariechen ist tot!!!«
Jack, für den seine Frau bereits seit langem tot gewesen war, erschrak zunächst über das Kind, denn er glaubte nicht anders, als auch dieses habe nach den furchtbaren Anstrengungen seinen Geist aufgegeben.
Er hatte ihre Hand ergriffen, diese war eiskalt — — aber die andere war noch warm — und da konnte auch noch gehofft werden.
»Mut, Vater!«, rief er. »Noch ist nicht gesagt, dass Marie tot ist, Eva hat die Locke nicht fortgeschleudert, sondern sie nur fallen lassen, weil sie plötzlich aus dem schlafwachen Zustande in einen natürlichen Zustand gesunken ist.«
Es war ein schlechter Trost. Welches Schicksal sollte denn die mitten im Ozean über Bord Geschleuderte noch erwarten, nachdem sie schon fünf Stunden lang mit dem Tode gerungen hatte?
Das Schrecklichste war dabei, dass man jetzt wieder den Tag über warten musste, ehe man Gewissheit haben konnte, denn der nächste Anfall war erst für heute Abend vorausgesagt.
Es waren schreckliche Stunden, welche langsam dahinschlichen. Der alte Mann glaubte sie nicht überleben zu können. Es war ja ganz selbstverständlich, dass Mariechen jetzt bereits tot war, und dennoch wagte der Vater noch zu hoffen.
»Gewissheit, nur Gewissheit will ich haben!«, stöhnte er immer wieder.
Jack saß während der ganzen Zeit am Tische, den Kopf in die Hand gestützt, und brütete finster vor sich hin.
Jetzt sah er alles ganz klar, da war gar kein Rätsel mehr vorhanden, es war eine höchst einfache Geschichte.
Ein reicher, junger Amerikaner fährt zur Weltausstellung nach Amsterdam, da sieht er ein hübsches Mädchen oder eine junge Frau — — wer sie ist, wessen Frau, wessen Tochter — — ist ihm alles ganz egal, der Lüstling will dieses Weib eben besitzen. An demselben Tage noch findet er die Mittel und Wege dazu, sie mit sich nach Amerika zu schleppen. Das Romantische und dass er sie nicht sofort umarmen kann, das alles vermehrt nur den Reiz für den sonst schon entnervten Lüstling, selbst die Gefahr gehört mit dazu.
Zuerst ist er sehr höflich, schwatzt ihr irgend etwas Abenteuerliches vor, gewinnt ihr Vertrauen, ihr Mann muss tot sein, die Trauung wird arrangiert, natürlich alles nur dem Scheine nach — —und nun genießt er mit diabolischer Freude das Vergnügen, dass sie ihn als ihren richtigen Mann mit Liebe umarmt — — oder doch jedenfalls freiwillig, nicht durch rohe Gewalt — — während ihr anderer Mann, den sie tatsächlich noch liebt und dem sie sonst niemals untreu geworden wäre, noch am Leben ist.
Diesem Schurkenstreiche liegt ein Raffinement zugrunde, welches harmlosen Menschen vielleicht unverständlich ist. Wohl ihnen — denn ihrer ist das Himmelreich.
Nun hat er ja, was er wollte. Das macht ihm aber nur ein paar Tage Spaß, dann hat er dieses Weib schon wieder satt. Er will es doch nicht etwa immer mit sich herumschleppen. — Da schmeißt er es eben einfach ins Wasser. Dann schreit er: ›Mann über Bord — es war meine geliebte Frau — — es war mein Teuerstes auf Erden!!‹ — Und dann ist er tief, tief unglücklich, rauft sich die Haare, muss festgehalten werden, weil er ihr durchaus nachspringen will, wie sich das alles so gehört — — und sobald er an Land ist, ist er unter anderem Namen ein neuer Mensch und sucht neue Amüsements, und seinen Millionen und seiner lüsternen Spitzfindigkeit ist fast gar nichts unmöglich.
Also eine sehr einfache Geschichte. So wenigstens glaubte Jack.
Wir aber haben bereits gehört, dass es nicht so einfach war. Es steckte noch ein ganz besonderes Geheimnis dahinter. Und auch Jack sollte bald erkennen, wie sehr er sich irrte, und der geneigte Leser wird einsehen, wie die feindliche Partei aus Versehen eine Unvorsichtigkeit begangen hatte, die sie sehr bereute, die auch gar nicht in ihrer Absicht gelegen hatte.
Jetzt aber grübelte Jack nur nach, wie er des Räubers seines Glückes habhaft werden könnte. Das war nun eine schwierige Sache geworden. Jeder Anhalt fehlte, und die Erde ist groß. Aber er würde den Elenden doch noch bekommen und furchtbare Rechenschaft von ihm fordern. Das sollte von jetzt an seine einzige Lebensaufgabe sein.
Wie gewöhnlich erwachte Evangeline gegen sechs Uhr morgens, nachdem sie vier Stunden in einem gesunden, tiefen Schlafe gelegen hatte. Die furchtbare Aufregung schien ihr nichts weiter geschadet zu haben.
»Ich bin wohl eingeschlafen? Was habe ich denn gestern Abend von Mariechen erzählt?«
Man konnte es ihr nicht verheimlichen, denn sie sah diese Gesichter, sie erschrak, sie drängte, sie wollte alles wissen.
»Denke dir, Mariechen ist mitten im Meere über Bord gefallen.«
Das Kind brach in Tränen aus.
»Ist sie denn ertrunken? Habe ich die Locke denn fortgeschleudert?«, fragte sie weinend.
Man musste ihr erzählen, wie man den Schluss der Tragödie nicht kannte, weil sie darüber eingeschlafen war.
Mehr als Mariechens Schicksal schien dem Kinde jetzt das ans Herz zu gehen, dass es seine Freunde in solch fürchterlicher Ungewissheit sah. Das Kind fühlte sich sogar gewissermaßen schuldig.
»Jack«, rief Eva plötzlich, »lege mir doch einmal Mariechens Locke in die Hand, ich will doch sehen, ob es auch gleich so geht — — ich will sie sehen, ich will!«
Man musste dem Wunsche des Kindes nachgeben.
Jack legte die Locke in die tote Hand und schloss die kalten Fingerchen darüber.
Und wahrhaftig, da geschah es! Mochte es sein, dass Evangeline durch die häufige Benutzung ihrer Wundergabe immer sensitiver wurde, oder war es ihr fester Vorsatz, weil sie den unglücklichen Freunden helfen wollte, waren es die Folgen dieser aufregenden Nacht — — kurz, zum ersten Male überkam der seltsame Zustand sie wie auf Kommando. Sie schloss die Augen, fiel zurück, und plötzlich fühlte Jack in der leblosen Hand den Pulsschlag und die Blutwärme kommen.
Und zum allerersten Male begann sie auch ohne Fragen von allein zu sprechen.
»Ich sehe — — — — — sie!«
»Gnädiger Gott im Himmel!!«, schrie der Vater und lag schon auf den Knien. »Aber, ob das auch das richtige zweite Gesicht ist, dass sie Mariechen auch wirklich sieht?«, setzte er etwas ängstlich hinzu.
»Still, still doch!«, keuchte Jack. »Wo befindet sie sich, Evangeline?«
In einem ganz engen Zimmerchen, in einem ganz schmalen Bett, und zwar auf hoher See, denn es ging immer auf und nieder, soeben brachte ihr ein Mann, der sich beim Gehen überall festhielt, einen Topf mit etwas Rauchendem, jedenfalls Kaffee oder Tee, denn sie warf Zucker hinein — — — Mariechen befand sich an Bord eines Schiffes, die Ertrinkende war in letzter Minute aufgefischt worden!!
Es sei nun etwas summarisch erzählt, was auch schon Evas Zustand erfordert. Seit dieser Zeit nämlich trat ihre Krankheit oder ihre Gabe in ein ganz neues Stadium. Von jetzt an konnte ihr Mariechens Locke jederzeit in die Hand gegeben werden, und so war man jederzeit imstande, Marie zu beobachten, wenn es dort nur hell war, und Eva hätte, wenn sie befragt wurde, Tag und Nacht erzählen können, ohne dass dies sie erschöpft hätte, sie wusste gar nichts davon, sie schlief dabei.
Dadurch war man nicht mehr von der Zeit abhängig. Marie befand sich an Bord eines kleinen, spanischen Segelschiffes, einer Brigg. Sie wurde freundlich behandelt. Das Essen auf solch einem kleinen Segler ist freilich sehr einfach, immer Salzfleisch, Hülsenfrüchte und Hartbrot. Die Fahrt ging mit gutem Winde nach Süden. Das Schiff musste sich in der Nähe der afrikanischen Küste befinden, im Ozean, nicht im Mittelmeer, und zwar hatte es die Kanarischen Inseln schon weit hinter sich.
Dies alles hatte Jack so nach und nach herausgebracht. Das war auch gar nicht schwer. Braune Gesichter, der Anzug, der beim Essen nie fehlende Wein in Korbflaschen — das konnte nur ein spanisches Schiff sein. Nun musste man aufpassen, wenn Marie an Deck kam, was sie da sah, wo die Sonne stand, sie sah zu, wie die Rahen gerichtet wurden, sie blickte einmal nach der Uhr — — alles gab neue Anhaltspunkte. Nur den Namen des Schiffes zu erfahren, das wollte durchaus nicht gelingen.
So waren schon acht Tage vergangen. Die fast immer vor dem Winde segelnde Brigg musste sich bald aus dem zehnten Breitengrade befinden, etwa in der Nähe der Pfefferküste, und hier half alles nichts, man musste ruhig abwarten, welchen Hafen das Schiff anlief, dann erst konnte gesagt werden, was zu tun sei.
Am neunten Tage ging auf dem Schiffe etwas Besonderes vor sich. Die Matrosen benahmen sich anders als sonst. Alle spähten in die Ferne, der Kapitän, ein kleiner, krummbeiniger Patron, deutete dorthin, Marie blickte nach dieser Richtung, aber Eva sah nichts, so konnte jene wohl auch nichts sehen. Ein Schiff war es nicht, das hätte keine solche Aufregung hervorgerufen.
Unterdessen aber brach dort die Nacht an, wenn hier auch noch die Sonne schien. Die Brigg segelte weiter. Da tauchte erst ein Licht auf, dann noch eins, immer mehr, bis es eine ganze Reihe war. Die Matrosen mussten tüchtig arbeiten.
»Land!«, sagte Jack. »Die Brigg geht vor einem Hafen auf Reede.«
Er zog seinen Notizblock, schrieb etwas, riss das Blatt ab und gab es Klaus.
»Hier, Klaus, besorge das Telegramm!«
Klaus trollte sich. Der Vater hatte es sich abgewöhnt, immer neugierig zu fragen, wenn der Schwiegersohn dies und jenes tat. Es hatte alles einen Zweck, dessen Erfolg er dann stets selbst sah.
Vorläufig war nichts mehr zu machen. Mariechen blieb noch sehr lange an Deck, besah sich die Lichtchen, und dann ging sie schlafen.
Die Männer und Margot legten sich, um rechtzeitig munter zu sein, angezogen etwas hin, wenn es hier auch erst früher Abend war.
Gegen Mitternacht klopfte es an die Tür. Ein alter Mann mit langem, weißem Barte, gut gekleidet, aber nicht eben einen sehr angenehmen Eindruck machend, erschien. Besonders die blinzelnden Augen waren voller Hinterlist.
»Hier, mein Freund Ibrahim«, stellte Jack vor, dem Alten vertraulich auf die Schulter klopfend, »früher Ebenholzhändler, jetzt auf Buffalo Bills Insel angestellt, kennt die ganze westafrikanische Küste wie seine Tasche. Der wird uns morgen gleich sagen können, wo sich Marie befindet, wenn sie das Land sieht.«
Der Alte grinste und stieß dem jungen Mann in die Rippen.
»Ebenholzhändler — — so ein Spaßvogel — — hihihi«, kicherte er.
Van Hyden wusste, dass der Mann ein Sklavenhändler war.
Geneigter Leser, und du, schöne Leserin; glaube niemand, der dir sagt, heutzutage gäbe es keine Sklaverei mehr. Ach, du lieber Gott! Ein Sklavenschiff wird gefangen, neunundneunzig rutschen durch. Männliche Sklaven kommen jetzt weniger in Betracht, das stimmt — — weil die weißen Arbeiter billiger sind, die erfordern kein Kapital und brauchen bei Krankheit nicht erhalten zu werden. Aber weibliche Sklaven!! Was steckt in den zahllosen Harems von Marokko, Tunis, Algier, Tripolis und vom europäischen Konstantinopel mit Umgegend? Das sind alles Sklavinnen. Und nicht etwa nur schwarze und braune! Der jetzige Sultan der Türkei ist ja der Enkel einer deutschen Sklavin. Mache von Algier aus eine Segelpartie die Küste entlang, und du verschwindest so sicher auf Nimmerwiedersehen, wie in der Kirche nach der Predigt das Amen kommt. Oder du kannst dich auch zu Hause als Sklavin in fremde Länder verkaufen. In Zeitungen werden doch hin und wieder Kellnerinnen, Dienstmädchen, Gouvernanten und dergleichen nach Brasilien, Argentinien, Peru gesucht, für vornehme Herrschaften natürlich. Melde dich, und sobald du an Bord gehst, bist du verloren, der Agent verkauft dich mit Leib und Seele, du musst springen und tanzen, und weigerst du dich, wirst du gepeitscht, und wenn du die südamerikanische Polizei anrufst, so lacht sie dich auch noch aus. —
Jetzt musste dort an der afrikanischen Küste der Morgen dämmern. Das schlafende Kind bekam die Locke in die Hand.
»Was siehst du, mein Kind?«
Marie blickte durch das Fensterchen, sah aber nur das Meer. Sie kleidete sich rasch an, eilte an Deck und — — Eva beschrieb eine afrikanische Küstenlandschaft, besonders charakterisiert durch Kokos- und Dattelpalmen, übergossen vom Morgensonnenschein. Der Alte stellte Fragen. So sah Eva ein Boot mit schwarzen Ruderern kommen, und schnell fragte Ibrahim, ob die Neger einen besonderen Kopfputz hätten, ob die Frauen ihre Brust verhüllt trügen — — und aus den Antworten kam er der Sache immer näher.
»Es ist entweder die Küste von Senegambien, oder die Goldküste oder die Sklavenküste.«
An einer Flussmündung lag auch ein Dörfchen, nach Evas Beschreibung freilich ein sehr elendes Nest. So etwas aber wird auf der Karte von Afrika schon als Stadt angegeben.
»Ach!«, rief da Eva erstaunt. »Was für Frauen sind denn das? Eine ganze Menge! Große, starke Frauen, alle mit Schwertern und Lanzen bewaffnet, Helme mit Hörnern auf dem Kopfe...«
»Dahomeyweiber!«, rief Ibrahim. »Es ist die Sklavenküste. Wehen von den Helmen rote oder blaue Schleier?«
»Blaue.«
»Es ist Port José. Die rote DahomeyFrauengarde hat einen anderen Hafen. Siehst du nicht auf einem Hügel einen kleinen roten Turm?«
Ja, das stimmte.
»Hängt der Turm nicht etwas nach rechts über? Ich meine, ist er nicht schief?«
»Jawohl, er steht ganz schief.«
»Es ist Port José an der Sklavenküste.«
»Was für ein Hafen ist Port José?«, fragte Jack.
»Portugiesisch. Handelt mit den gewöhnlichen Erzeugnissen der ostafrikanischen Küste. Kein Gold, kein Elfenbein — — aber Ebenholz! Port José ist der Sklavenmarkt für Timbuktu.«
So wollte das spanische Schiff gegen seine Ladung, jedenfalls Tuch und Zeuge, Kokosnüsse, Datteln, Durra und dergleichen eintauschen.
»Ich sehe einen Mann«, fuhr Eva fort. »Er ist alt, er ist ganz weiß gekleidet, sehr fein, auf dem Kopfe hat er eine rote Mütze mit einer blauer Trottel — — jetzt zieht er aus der Tasche eine große Hornbrille. Er betrachtet Mariechen, er lacht, er gibt ihr die Hand, er streichelt ihr die Wange...«
Ibrahim fuhr wie von einer Natter gestochen empor.
»Hat der alte Herr auf der Nase eine große Warze?«
»Ja, ich sehe mitten zwischen den Augen eine große Warze.«
»Allah, lasse ihm Steine wachsen im Bauche!!«, schrie der ehemalige Sklavenhändler plötzlich im höchsten Grimm. »Das ist der Elende, der mich ruiniert hat, das ist Mufta, der Malteser, der Sklavenagent für Timbuktu.«
Und dann wandte sich der Alte an Jack.
»Ist das Mädchen — Ihre Frau, wollte ich sagen — ist sie recht hübsch?«
»Ja, sie ist sehr hübsch«, entgegnete Jack.
»Blond? Weiße Haut?«
»Ja, auch das — eine Holländerin. Was soll es denn?«
»Dann eilen Sie. Dann kauft Mufta sie für den Harem des Sultans von Timbuktu — — er hat sie schon gekauft — — er ist mit dem spanischen Kapitän schon handelseinig — — — hat schon ihre Wangen geklopft... ich kenne doch Mufta, den Malteser...«
Jack war bereits hinausgestürzt.
Der alte Araber oder Türke sprach zu Mijnheer, doch dieser hörte nichts. Er war wie betäubt. Sein Mariechen in einem afrikanischen Harem! Nach Timbuktu!!
Nach drei Minuten kam Jack schon wieder hereingestürzt.
»In einer Stunde geht von hier ein Schnelldampfer nach Sierra Leone!! Keine Minute ist zu verlieren. Die Plätze sind schon telefonisch bestellt!«
Diesmal waren alle Koffer vollständig gepackt, darauf wurde jetzt immer gehalten. Eine Stunde später dampfte die ganze Gesellschaft der afrikanischen Sklavenküste zu.
Bis zuletzt hatte Ibrahim, welcher die Freunde nach dem Schiffe begleitet, Ratschläge erteilt.
Die Karawanen marschieren von Port José nach Timbuktu je nach dem Wetter acht bis zehn Wochen — — das ist nämlich eine kolossale Strecke — und da durften sie nicht durch feindliche Überfälle aufgehalten werden. Deshalb waren solche Karawanen auch immer kriegsmäßig ausgerüstet, wurden von einigen Hunderten bis an die Zähne bewaffneten Kriegern begleitet, abgesehen von den ebenfalls bewaffneten Lastträgern. Nun ging solch eine Karawane auch nicht wegen einer einzelnen Sklavin ab. Da mussten erst genug andere Sklaven kommen — vor allen Dingen zusammen sein, ehe eine Karawane gebildet wurde und abrückte. Der Schnelldampfer fuhr nach Sierra Leone elf Tage, und wenn es das Unglück nicht anders wollte, so konnten die Befreier in Port José sein, ehe die Karawane abrückte, und dann war Marie sofort gerettet. Denn wenn man sie sonst nicht befreien konnte — — so viel, wie der Sultan von Timbuktu, zahlte der holländische Millionär für seine Tochter auch.
Hierüber konnte man sich noch genügend an Bord orientieren, da waren jedenfalls afrikanische Kaufleute, welche diese Verhältnisse ebenfalls kannten. Das Wertvollste waren die Adressen von den Vertrauenspersonen und guten Führern, welche Ibrahim zuletzt noch gegeben hatte.
Nun war aber noch ein wunder Punkt bei der Sache. Dieser Dampfer ging nach Kapstadt! In Sierra Leone gab er nur schnell seine Post ab und nahm solche in Empfang, da konnten wohl auch im Vorbeifahren Passagiere an Land gesetzt werden — aber Freetown, der Hafen von Sierra Leone, ist noch gute tausend englische Meilen von Port José entfernt, dieses liegt ostwärts tief in der Bucht von Guinea. Der Dampfer steuerte dann einen ganz anderen Kurs, direkt nach Süden, und wer wusste, wie lange man da auf eine Fahrgelegenheit von Freetown nach Port José zu warten hatte! Da musste man jedenfalls einen kleinen Faktoreidampfer mieten, und fünf Tage brauchte der zu den tausend Meilen immer! Und was konnte in diesen fünf Tagen nicht alles geschehen!
Ja, wenn es gelänge, den Kapitän dieses Schnelldampfers zu bewegen, den Kurs zu ändern, in Port José anzulegen! Der machte mit seinen achtzehn Knoten in der Stunde diese tausend Meilen in zwei Tagen! Und der Vater wollte alles bezahlen.
»Jetzt hat der Kapitän noch keine Zeit zu so etwas, er steht auf der Kommandobrücke«, sagte Jack, nachdem er sein Pferd untergebracht hatte, »ich will ihn später sprechen und mich sonst erkundigen — mehr kann ich nicht tun.«
Wir versetzen uns schnell einmal an Bord der Espérance. »Gustave de Fleury aus St. Louis, nebst Frau.« So hatte der stattliche, schwarzbärtige Herr in das Kajütenbuch eingetragen.
Die erste Kajüte war stark besetzt, das junge Ehepaar war nicht im Geringsten beachtet worden, umso weniger, als es keine Bekanntschaft suchte.
Es war am fünften Tage der Seereise morgens etwa nach vier Uhr, kurz nach Sonnenaufgang, als die auf der Brücke befindlichen Offiziere sahen, wie dieser de Fleury als erster Passagier an Deck erschien.
Das musste ja später alles zu Protokoll genommen und in das Logbuch eingetragen werden.
Der Herr ging um das ganze Schiff herum, begab sich wieder unter Deck, erschien wieder oben, er musste jemand suchen.
»Haben Sie nicht meine Frau gesehen?«, fragte er schließlich den Bootsmann, der das Deckscheuern leitete.
Der Bootsmann konnte nichts Anderes sagen, als dass er heute früh überhaupt noch keinen Passagier gesehen habe. Die Madame de Fleury kannte er gar nicht.
Der Herr suchte wieder auf und im ganzen Schiff, bis er eine halbe Stunde später Lärm schlug.
»Wo ist meine Frau? Meine Frau ist verschwunden!«
Jetzt wurde der Sache Aufmerksamkeit geschenkt. Die beiden schliefen in einer Salonkabine in zwei Hängebetten. Gestern Abend waren sie gegen elf Uhr schlafen gegangen. Fleury wachte gegen vier Uhr auf, sah das Bett seiner Frau leer, dachte, sie mache schon an Deck eine Morgenpromenade. Er zog sich also leicht an, ging hinauf — — fand seine Frau nicht.
Wenn Eva richtig gesehen hatte, wenn er Marie also über Bord geworfen hatte, so war das alles sehr geschickt von ihm gemacht worden. Allerdings ist an Bord so etwas sehr leicht möglich. Wenn das Wetter nicht gerade sehr schön ist, so ist das Deck selbst solch eines großen Passagierdampfers in der Nacht wie ausgestorben. Auf der Brücke zwei Offiziere, nur die Augen, nicht einmal die Nasenspitze über die Schutzleinwand hebend, der Mann am Steuerruder, welches sich aber ebenfalls mittschiffs auf der Brücke befindet, dann noch vorn auf der Back oder im Mastkorb ein Matrose als Ausguck — — sonst ist kein Mensch an Deck — und diese blicken immer angestrengt nach vorn. Die Wachmannschaft darf sich während der Nacht unter der geschützten Back aufhalten und wird nur herausgepfiffen, wenn es nötig ist.
So hatte Fleury seine Gattin ganz unbemerkt am Heck über Bord schleudern können. Niemand wusste, dass er gestern Abend gegen elf Uhr selbst noch einmal an Deck gewesen war.
Das ganze Schiff wurde nach der Vermissten durchsucht. Als die Espérance in die Straße von Gibraltar dampfte, konnte es keinen Zweifel mehr geben. An einen Selbstmord konnte der unglückliche Gatte nicht glauben, es wäre gar kein Grund vorhanden — — also ein Unfall — — über Bord gestürzt. Das ist nicht das erste Mal gewesen.
Der Gatte benahm sich so, wie Jack es vorausgesehen hatte. Nur einen Selbstmord simulierte er nicht. Er hatte einen Verzweiflungsausbruch, dann ward er nicht mehr gesehen; er gab sich in seiner einsamen Kabine seinem Jammer hin, verschmähte alle Speisen.
Der Dampfer kam in Marseille an. Da erscheint immer gleich auch Polizei an Bord. Es wurde also nochmals ein Protokoll ausgenommen, gleich an Bord, der Mann legitimierte sich mit Papieren — amerikanischer Bürger französischer Abstammung, ehemaliger Pflanzer in Kentucky, zuletzt wohnhaft in St. Louis, getraut mit der und der vor zehn Tagen in New York, alles war in Ordnung — — ja, was sollte man denn tun? Man konnte den armen Mann nur bedauern.
Dieser ließ sein weniges Gepäck und das seiner unglücklichen Frau an Land bringen, nahm einen Wagen und fuhr nach einem Hotel ersten Ranges.
Als er hier ankam, war er natürlich noch immer tiefgebeugt.
»Logiert hier ein Mr. Dorington?«, fragte er den Portier.
Jawohl, der logierte hier seit einigen Tagen, ein alter Herr, ein sehr einfacher Mann, sah sogar etwas schäbig aus, er hatte eins der billigsten Hinterzimmer genommen. Es war wohl ein Geschäftsreisender, der hier auf eine Instruktion von seiner New Yorker Firma wartete, er bekam sehr viele Telegramme.
Fleury stieg die vier Treppen empor, klopfte an die Tür des ihm genannten Zimmers und öffnete nach der gegebenen Aufforderung. Und da war er nicht mehr tiefgebeugt, sondern hochaufgerichtet, und mit einem triumphierenden Gesicht trat er ein.
»Wissen Sie schon?«, begann er sofort im leisesten Flüstertone. »Uns ist ein wunderbarer Zufall zu Hilfe gekommen. Haben Sie es schon gehört? Denn Sie könnten bereits eine Ahnung haben, dass die Locke in der Hand des Kindes nicht mehr funktioniert.«
Der alte Mann stand in der Mitte des Zimmers. Ja, er schien schon etwas davon zu wissen. Und Fleury stutzte. Das glattrasierte Gesicht des alten Mannes zeigte nämlich einen wahrhaft entsetzten Ausdruck, und jetzt streckte er abwehrend beide Arme gegen Fleury aus.
»Unglücklicher, was haben Sie getan!«, hauchte er.
»Na, was denn?«, fragte Fleury ganz harmlos. »Sie ist über Bord gestürzt. Kann ich etwas dafür? Aber sehr gut, dass es so gekommen ist. Nun sind wir dieses lästige Frauenzimmer gleich für immer los.«
Mr. Dorington streckte die Hände nur noch entsetzter gegen den Anderen aus.
»Sie sind an ihr zum Mörder geworden!«, hauchte er wie vorhin im leisesten Tone.
»Weiß Gott nicht«, beteuerte Fleury mit der Hand auf den. Herzen, aber es klang so leichtfertig, fast ironisch. »Der Verdacht liegt allerdings sehr nahe, dass ich's getan habe — aber, weiß Gott, ich bin unschuldig wie ein Embryo im Mutterleibe. Sie ist von ganz allein über Bord gepurzelt.«
»Sie schwören falsch — Unglücklicher! — Was haben Sie getan — — — Das haben wir nicht gewollt — — das — hellsehende — Kind — hat — alles — beobachtet!! Waren Sie denn nur wahnsinnig, zur Ausführung Ihres Vorhabens gerade eine Zeit zu wählen, in welcher das Kind hellsehend ist?!«
Der alte Mann war außer sich, und jetzt fuhr auch Fleury mit einem furchtbaren Schrecken empor, sein gesundfarbenes Gesicht wurde weiß wie eine Kalkwand.
»Sie sind verrückt!«, hauchte er jetzt mit bebenden Lippen.
Der Alte zog aus der Brusttasche ein Telegramm, Fleury nahm und las es, und immer mehr zitterten seine Hände.
Die lange Depesche enthielt nur unzusammenhängende Worte, und wenn nun jedes Wort eine besondere Bedeutung hat, vielleicht einem ganzen Satz entspricht, also eine Geheimschrift, die mehrere Personen unter sich ausmachen, so kann man sich durch solch ein Telegramm lange Geschichten erzählen. Und Fleury verstand es zu entziffern, und er wurde womöglich noch bleicher.
»Nicht möglich!«, keuchte er mühsam hervor. »Das Hellsehen trat doch an jenem Tage in der Nacht um eins ein...«
»Um elf!«
»Um eins!«
»Um elf!«
Beide zogen ihre Notizbücher und verglichen Zahlen.
Hier nun zeigte sich der schändliche Verrat, der hinter Jacks Rücken getrieben wurde.
Er hatte doch damals in London gemerkt, dass Evangeline die bestimmte Stunde und Minute, wenn der Anfall kam, schon für viele Tage voraussagen konnte, und er hatte sich diese Zeiten für einen ganzen Monat voraussagen lassen und sie aufgeschrieben.
Dieselben Zeiten hatten die beiden in ihren Notizbüchern. Nur Evas Pflegerin konnte auch hier die Verräterin gewesen sein.
Ja, der sonst so scharfsinnige Jack hätte eigentlich über etwas stutzig werden müssen. Damals, als der schlafwache Zustand noch zu einer bestimmten Zeit eintrat, hatte Evangeline immer etwas sehr Wichtiges gesehen. Abgesehen davon, dass sie gerade beobachtet, wie Marie die gefälschte Nachricht von Jack zu lesen bekommt, sie soll nur ruhig die drei Jahre ausharren, wie ihr dann weiter die Zeitung gezeigt wird, welche Jacks Tod meldet, wie in Maries Hand die Lebensblume versagt, wie ihr der Herr die erste Liebeserklärung macht, wie die beiden getraut werden, usw. usw.
Das war doch ein merkwürdiger Zufall, wie das immer so gerade zusammentraf.
Aber wie konnte denn Jack ahnen, dass hinter seinem Rücken solch eine raffinierte Verräterei getrieben wurde! Er hielt es eben für Zufall.
Jetzt indessen hatte das Schicksal einmal diesen Intriganten einen bösen Streich gespielt!
Fleury hatte eine einzige Zahl falsch abgeschrieben, in seinem Buche stand eine Eins, während es eine Elf sein musste — und zufällig hatte er gerade an diesem Zeitpunkte, an dem er sich unbeobachtet glaubte, das Verbrechen begangen!
Hier half kein Streiten mehr, das Telegramm bewies, dass die Verfolger alles wissen mussten — und wie gebrochen sank Fleury auf einen Stuhl nieder.
»Ihre Handlung ist einfach unverzeihlich!«, sagte der alte Mann, noch immer außer sich. »Wie oft habe ich nicht betont: In dieser Affäre darf kein Blut fließen! Nichts darf geschehen, was uns dereinst vor Gericht bringen könnte! Und Sie brandmarken sich als Mörder, stürzen uns alle ins Unglück!«
»Es war so einfach, sie auf diese Weise für immer zu beseitigen«, murmelte der Schuldige gedrückt. »Die Gelegenheit war so günstig, keine Schuld konnte auf mich kommen...«
Er stand auf, er hatte sich gefasst.
»Na, Dorington, Sie haben gar nichts damit zu tun. Habe ich die Tat begangen, so nehme ich auch die Schuld auf mich. Die Hauptsache ist, dass dieses lästige Frauenzimmer jetzt tot ist...«
»Soooo?«, unterbrach ihn der Alte langgedehnt mit einem furchtbaren Hohne. »Woher wissen Sie denn das so genau? Wenn Sie nun einmal so etwas vorhatten, dann hätten Sie es wenigstens ordentlich tun müssen und nicht nur halb! Das Beste kommt nämlich jetzt erst: Das Weib ist gar nicht tot! Es ist gerettet worden! Es befindet sich an Bord einer spanischen Brigg!«
Das war erst ein furchtbarer Schlag! Der saß! Fleury beugte sich weit vor, seine Augen drohten die Höhlen zu verlassen.
»Es — ist — nicht — wahr!«
Er bekam ein anderes Telegramm zu lesen. Man wusste hier alles. Wohin das spanische Schiff segelte, konnte freilich auch hier nicht bekannt sein.
Als sich Fleury von der Wahrheit überzeugt hatte, verwandelte sich sein Schreck in Galgenhumor.
»Himmelbombenelement!!«, lachte er schallend. »Jetzt wird die Sache aber lustig!«
»Sie haben einen nichtswürdigen Streich begangen, der gar nicht wieder gut zu machen ist, auch ich bin gebrandmarkt!«, begann der Alte jetzt zu jammern.
Da trat Fleury zu ihm hin und klopfte ihm auf die Schulter. Er war plötzlich eisern geworden.
»Na, na, nur Ruhe, mein alter Freund! Sie bleiben ganz aus dem Spiele. Ich bin's, der die Suppe eingebrockt hat, und ich werde sie auch ganz allein auslöffeln. Die Gefahr ist gar nicht so groß. Ich kenne doch Texas Jack, und ich weiß, dass er nichts der Polizei übergibt. Das ist die Hauptsache. Jetzt freilich habe ich den Weg einmal betreten, jetzt muss ich ihn auch weitergehen. Jetzt muss dieses Weib von der Erde verschwinden. Texas Jack darf es auf keinen Fall wiedersehen — auf keinen Fall! Dafür werde ich sorgen, ich!! Diese Geschäftsspekulation soll uns dennoch glücken!« — —
Also keine Liebe, kein Hass, keine Rache war die Triebfeder aller dieser seltsamen Handlungen — nur eine Geschäftsspekulation!
Was hatte man denn nur mit Texas Jack und seiner Frau vor?
Und wer war denn der alte Mann?
Das war nicht etwa das Oberhaupt einer internationalen Verbrecherbande. Er wollte ja durchaus nichts von einem Morde oder auch nur von einer strafwürdigen Handlung wissen.
Hätten der Hotelier und die Kellner geahnt, wer der alte Mann mit dem schäbigen Zylinder im vierten Stockwerk gewesen, sie wären ihm zu Füßen gekrochen!
Es war kein König, kein Fürst — — — oder doch ein Fürst, nämlich ein Fürst des Geldes und der Börse. Es war ein wohlbekannter amerikanischer Milliardär, der überall, wo es schön ist auf der Erde, seine Schlösser und Paläste hat — — und hier in Marseille hielt er sich einmal inkognito auf. Der hatte eine Geschäftsspekulation vor, aber was für eine, das war das Geheimnis dieser beiden, und der andere, der Hauptmacher, der sich Fleury nannte, das konnte auch kein professioneller Gauner sein, er nannte den sonst unnahbaren amerikanischen Krösus doch ›mein alter Freund‹. — — —
Im Hafen von Marseille lag eine Dampfjacht von etwa tausend Tonnen zum Verkauf, vollständig eingerichtet. Sie gehörte einem französischen Millionär, welcher diesen kostspieligen Sport aufgeben wollte.
Was kostet eigentlich solch eine Jacht oder überhaupt ein modernes, aus Stahl gebautes Schiff? Die Tonne zu bauen, kostet im Durchschnitt 600 Mark. Demnach kostete dieses kleine Schiff schon 600 000 Mark. Dafür hat man aber erst die zusammengenieteten Eisenplatten. Was da nun alles drum und dran hängt! Und wie solch eine Jacht eingerichtet ist!!
Der Pariser Sportsman hatte den Spaß satt, er wollte das Spielzeug um einen Spottpreis losschlagen, er verlangte nur über zwei Millionen Francs dafür.
Und am anderen Tage, nachdem die Espérance angekommen war, vermittelte ein Agent das Geschäft und gab einen Scheck über zwei Millionen Francs auf ein Pariser Bankhaus.
Eine Woche verging, da bekam der Alte in dem schäbigen Rock abermals ein geheimnisvolles Telegramm, und eine Viertelstunde später jagte die kleine Jacht schneller als der schnellste Schnelldampfer nach Port José an der Sklavenküste — — — und der neue Besitzer der Jacht war ein großer, magerer Mann, mit spitzem, schwarzem Vollbart und in der Mitte gescheiteltem Haar.
Jetzt wurde Evangeline fast ununterbrochen im schlafwachen Zustande gehalten, und sie sah Folgendes:
Der alte Mann mit dem roten Fes, von Ibrahim Mufta ›der Malteser‹ genannt, hatte also freundlich mit Mariechen gesprochen, ihr väterlich die Backe geklopft; er deutete mehrmals nach dem Lande, und Mariechen schien sehr fröhlichen Mutes zu sein, mit sichtlicher Dankbarkeit gab sie dem Sklavenhändler die Hand.
Natürlich! Wer wusste denn, was für Märchen der jungen Frau vorgeschwatzt wurden!
Es vergingen zwei Stunden, während welcher Mufta nicht zu sehen war. Der schloss jedenfalls mit dem spanischen Kapitän, der nebenbei auch so manchmal einen kleinen Menschenhandel machte, das Geschäft ab.
Dann erschien Mufta abermals vor Mariechens Augen, wieder wurden freundliche Worte gewechselt, dann stiegen die beiden in ein Boot, welches von zwei Negern an Land gerudert wurde.
Marie folgte dem Sklavenhändler freiwillig. Sie glaubte doch sicherlich, sie hätte einen Menschenfreund gefunden, vielleicht einen Konsul, in dessen komfortablen Hause sie einstweilen untergebracht würde, bis sich eine Gelegenheit zur Heimreise bot.
Auf dem Wege durch das elende Dörfchen schaute sich Marie mit interessierten Augen um, Evangeline sah mit, und was sie erzählte, erfüllte Jack mit der größten Besorgnis.
In dem kleinen Dörfchen ging es außerordentlich lebhaft zu, wie auf einem lustigen Jahrmarkt. Es war mit Negern überfüllt, welche sich alle lustig gebärdeten, soweit sie nicht betrunken waren. Den Mittelpunkt des Treibens bildete eine große, rote Fahne mit weißem Halbmond; ein Tisch war dort aufgestellt, weiße und schwarze Schreiber saßen daran, die Neger kamen heran oder wurden halb mit Gewalt herbeigeführt, sogar getragen, wenn sie zu sehr betrunken waren, bekamen die Feder in die Hand, mussten etwas auf Papier malen, sehr viele, sogar ganz nackte Kerle, besaßen einen Kautschukstempel, fabriziert in London, denn der spekulative Engländer versorgt heutzutage jeden Wilden im fernsten Erdteile mit einem Kautschukstempel, und dann bekam solch ein Neger stets eine kleine Flasche — natürlich Schnaps — und ein schönes buntes Tuch.
Kein Zweifel, hier wurden schon die Leute für die Karawane geworben, und sobald diese vollständig ist, geht sie im Eilmarsch ab, damit die Geworbenen nicht erst auf andere Gedanken kommen.
Abseits des Hüttendorfes betrat Mufta ein modernes Häuschen, er klopfte Mariechen noch einmal wohlwollend auf die Schulter.
In einem Zimmer ward für Evangeline ein pechschwarzer Neger sichtbar, aber sehr reich in ein orientalisches Kostüm gekleidet. Der war auch wieder sehr freundlich, sogar unterwürfig gegen die junge, weiße Dame, und Mariechen ahnte noch nichts. Sie wurde allein gelassen, und dann brach dort die Nacht an. Licht war nicht im Zimmer, und so konnte Evangeline auch nichts sehen. Marie schlief.
Evangeline behielt die Locke in der Hand. Ganz still lag sie da. Jack brauchte nicht ab und zu zu fragen, nun erkannte er schon aus gewissen Anzeichen, wenn das Kind wieder etwas zu sehen bekam.
Es war dort an der afrikanischen Küste nachts gegen zwei Uhr, als Eva zusammenschrak und von selbst zu sprechen begann.
Marie war vor Schreck aus dem Schlafe erwacht, sie sprang aus dem Bett und an das Fenster, und nach dem, was das Kind schilderte, musste es in dem Dorfe allerdings laut genug zugehen, um selbst einen Toten zu erwecken!
Im Scheine von Fackellicht sah Eva viele, viele Neger. Genauer befragt erklärte sie, dass es wohl vier- bis sechshundert sein konnten. Teils trugen sie auf den Schultern Lasten, teils waren sie bis an die Zähne bewaffnet. Eine rote Fahne ward vorangetragen, sie brüllten und lachten und gebärdeten sich wie die Wahnsinnigen, die Krieger schossen unaufhörlich ihre Gewehre ab.
Ganz richtig, so bricht stets eine Karawane auf, und immer in der Nacht.
In das Zimmer kamen Personen: Mufta, der Malteser, jener reichgekleidete Neger, zwei andere, herkulisch gebaute Schwarze und ein schwarzes Weib.
Jetzt musste in Mariechen eine Ahnung aufgehen, welches Schicksal ihrer wartete, jetzt musste sie wohl alles wissen — denn plötzlich warf sie sich vor Mufta auf die Knie nieder, umklammerte diese, rang die Hände und gebärdete sich auch sonst wie eine Verzweifelte.
Dass dies alles nicht half, ist selbstverständlich. Erst schien Mufta tröstend auf sie einzusprechen. Wer weiß, was er ihr vorschwatzte, und als das nichts half, wurde sie kurzerhand von den beiden Negern gepackt, jedoch anscheinend nicht unsanft, es war ja eine kostbare Ware, und hinausgetragen.
Sie kam in eine geschlossene Sänfte und war für die Augen der Hellseherin verschwunden.
Evangeline konnte nur noch sagen, dass sie sich in schaukelnder Bewegung befand und unausgesetzt die Hände rang, jetzt konnte das sensitive Kind auch ihren Jammer mitfühlen. Fort ging es nach Timbuktu!
Und der unglückliche Vater und der unglückliche Gatte fühlten gleichfalls mit.
Wir brauchen kaum vier Wochen zurückzublicken. Da sehen wir das zarte, sanfte Mädchen in Amsterdam, umgeben von allem Luxus, wie ein Augapfel behütet von dem sie abgöttisch liebenden Vater — dann sehen wir sie als die glücklichste junge Frau an der Seite des Mannes, den sie sich aus reiner Liebe erwählt hat, und da war kein Kampf, keine Intrige dazwischen gewesen, vor ihr lag das Leben wie ein einziger, sonniger Frühlingstag — und vier Wochen später befindet sie sich aus dem Wege nach Timbuktu im Innersten von Zentralafrika, um an einen barbarischen Negerhäuptling als Sklavin verkauft zu werden — sie ist schon verkauft!! — — —
Während der Reise konnten Mariechen und die ganze Karawane täglich und stündlich beobachtet werden.
Solch eine Handelskarawane in Afrika reist etwas anders, als man sich wohl vorstellt und auch oft genug zu lesen bekommt, nämlich beschrieben von Leuten, die noch nicht in Afrika gewesen sind.
Die Hauptkarawane bricht nachts punkt zwei Uhr aus jedem Lager auf, unter Gesang und Hörnerklang, und früh um acht Uhr ist schon wieder Feierabend, da wird schon wieder das Nachtlager aufgeschlagen.
Das erscheint sehr wenig. So aber kommt die Karawane eben am schnellsten vorwärts, das hat die Erfahrung während Hunderten von Jahren gelehrt. Und diese sechs Stunden Marschierens mit einer Last von vierundsechzig Pfund sind auch genug, früh um acht fallen alle wie die Fliegen um, dafür aber haben sie auch schon zwanzig englische oder fünf deutsche Meilen zurückgelegt. Der Vortrab und der Nachtrab freilich halten wieder andere Zeiten ein. Ersterer ist eine Tagereise voraus, späht nach dem Feind, ebnet vor allen Dingen den Weg, sorgt für die Flussübergänge usw.
Marie war natürlich beim sicheren Haupttrupp. Sie schien die einzige Sklavin bei der Karawane zu sein.
Ihre Behandlung ließ nichts zu wünschen übrig, sie wurde immer in der Sänfte getragen, ehrerbietig behandelt, bekam von dem mitgenommenen Proviant und später von der Jagdbeute stets das Beste vorgesetzt.
Sie schien sich in ihr Schicksal ergeben zu haben, wenn auch verzweiflungsvoll. Während des ganzen Tages saß sie immer in ihrem besonderen kleinen Zelt, still vor sich hinbrütend, oder sie durfte sich auch innerhalb des Lagers bewegen, und dann saß sie ebenso melancholisch unter irgendeinem Baume.
So befand sich die Karawane schon hundert Meilen von der Küste entfernt, mitten in einem Urwalde, als wieder etwas völlig Rätselhaftes geschah, was alle Theorien, die man über die Ursache ihrer Entführung aufstellte, über den Haufen warf.

Marie befand sich in ihrem Zelt. Da kam Mufta, der Malteser, zu ihr, jetzt aber nicht mehr im modernen Anzug, sondern wie ein Araber gekleidet. Bei solchen Gelegenheiten, wenn sie diesen Mann sah, brach bei der Unglücklichen der Jammer allerdings stets hervor, immer wieder warf sie sich vor dem Manne händeringend zu Boden, flehte und weinte, als dächte sie, mit Bitten das Herz solch eines Sklavenhändlers, der ein gutes Geschäft mit ihr machen wollte, rühren zu können.
Allerdings lag eine Hoffnung sehr nahe. Sie konnte doch zu dem Manne sagen: »Ich habe einen reichen Vater, der dir zehnmal, hundertmal so viel gibt, wie dir der Scheik von Timbuktu für mich bezahlt!«
Ganz gewiss, dies würde Mariechen versuchen. Aber ebenso gewiss würde der Sklavenhändler nicht darauf eingehen. Der Sklavenhandel ist nicht erlaubt, und dann ist solch einem Manne der Sperling in der Hand lieber als die Taube auf dem Dache! Und weiter, wenn der Scheik von Timbuktu erfuhr, dass sein Agent ein schönes, schon für ihn bestimmtes Mädchen anderweitig verkauft hatte, wurde Mufta vielleicht einen Kopf kürzer gemacht, als Geschäftsmann war er jedenfalls hier für immer ruiniert.
Ungerührt ging also der Malteser wieder hinaus, und Marie erhob sich, um sich von Neuem einem dumpfen Brüten hinzugeben.
Schon wollte Jack dem Kinde die Locke aus der Hand nehmen, als Marie wieder Leben zeigte, und jetzt sollte sie seltsame Handlungen ausführen.
Marie stand auf, bückte sich, hatte etwas Schwarzes in der Hand, trat dicht an die Zeltwand und begann auf das weiße Tuch große, lateinische Buchstaben zu malen.
Evangeline begann zu buchstabieren — und Jack, die Buchstaben aneinanderreihend, schnellte plötzlich empor.
»Was — was soll sie da schreiben?!!«, rief er außer sich.
Evangeline bekam Papier und Bleistift, sie malte mit, und als Marie von der Zeltwand zurücktrat, war auch das Kind fertig, und da stand in großen, lateinischen Buchstaben zu lesen:
JACK, MEIN LIEBER JACK!! MAN HAT MICH BETROGEN! JETZT WEIß ICH, DASS DU NOCH LEBST!!! RETTE MICH!!! ICH WERDE VON PORT JOSÉ AN DER SKLAVENKÜSTE ALS SKLAVIN NACH TIMBUKTU GESCHLEPPT!! MARIE.
Mit grenzenlosem Staunen blickten Vater und Schwiegersohn einander an.
Es konnte gar nicht anders sein, nur der alte Sklavenhändler hatte ihr jetzt erzählt, dass ihr Gatte noch lebte, ihr auf den Fersen sei und ein hellsehendes Kind bei sich habe, durch welches er sie und alles, was sie schrieb, immer sehen könnte.
Aber... lag hier nicht ein unergründliches Rätsel vor?
Woher wusste dies denn der alte Sklavenhändler? Und das, was er wusste, sollte er der Sklavin mitteilen, damit diese zu ihrer Befreiung Gebrauch davon machte?!!
Genug!! Marie tat es!! Es hatte nämlich absolut keinen Zweck, auf die Grübeleien einzugehen, welche dann später Jack und der Vater anstellten; denn sie ergingen sich in ganz falschen Vermutungen.
Die richtige Erklärung wurde Jack erst zuteil, wenn er Marie selbst wiedergefunden hatte, wenn er mit ihr sprechen konnte, und dann wird auch der geneigte Leser erkennen, dass mit dieser ganzen Entführung ein Geheimnis zusammenhängt, welches sich auch die kühnste Phantasie nicht zusammenträumt!!
»Jetzt tritt sie zurück«, flüsterte das Kind im Halbschlaf, »sie deutet auf das Geschriebene, jetzt kniet sie nieder, sie blickt hierher zu mir, sie hebt bittend die Hände empor, jetzt schlägt sie, stehend wie ein Kind, die Hände zusammen...«
Mit so anschaulicher Deutlichkeit hatte das Kind noch nie geschildert. Jetzt änderte sich ja alles, alles! Jetzt wusste Marie ja, dass sie hier beobachtet wurde, sie blickte sozusagen hierher, es fehlte nur noch, dass man sich durch das hellsehende Kind auch noch wie durch ein Telefon unterhalten konnte...
Und da sprang Texas Jack empor und streckte die Arme sehnsüchtig nach Südosten aus, dorthin, wo die Sklaveuküste lag.
»Ja, armes Weib«, rief er leidenschaftlich, »ich will dich retten! Ich habe dir die Treue versprochen — und die Treue will ich dir halten!«
Er war in Tränen ausgebrochen, und der alte Vater weinte mit ihm. Auf Margots schönem Antlitz aber paarte sich der Schreck mit der Verzweiflung.
Diese Korrespondenz währte jetzt fort und fort. Marie hatte auch Papier gefunden, Packpapier gab es ja genug bei der Karawane, welche die mitgenommenen Vorräte verbrauchte, und immer wieder schrieb sie etwas Anderes, stets in großen, lateinischen Buchstaben, es konnten auch immer nur einzelne, kurze Sätze sein.
Jack, befreie mich!! — — Mein einzigst geliebter Jack, verzeihe mir, ich bin ein Op
fer des Betrugs, ich habe unschuldig gesündigt. — Du kannst mich nicht mehr
lieben, aber befreie mich nur aus den Händen dieser Neger, und ich will zeit mei
nes Lebens deine Sklavin sein, die du mit Füßen treten kannst.
So hatte sie immer wieder etwas anderes zu schreiben, und stets kniete sie dann nieder und hob nach der westlichen Himmelsgegend bittend ihre Hände empor.
Die Papiere ließ sie darauf den ganzen Tag über offen liegen, und hiermit war doch eigentlich auch wieder ein Rätsel verbunden!
Mufta kam oftmals zu ihr ins Zelt, und sie verbarg das Geschriebene nicht vor ihm, er las es. Und er wusste, dass die Sklavin befreit werden sollte, dass es in der Ferne Personen gab, welche dies lesen konnten, und er lachte nur über die weiße Närrin und schüttelte belustigt den Kopf.
Seltsam, ganz seltsam!
Aber wie gesagt, es hat jetzt keinen Zweck, über diese Widersprüche Betrachtungen anzustellen, denn es sollte eben alles ganz, ganz anders kommen, als jemand auch nur geahnt hatte.
Ebenso wenig hätte es einen Zweck, dabei zu verweilen, welche Pläne Jack entwarf, wie die Karawane zu erreichen und Marie zurückzukaufen sei. Denn die Pläne wurden nie ausgeführt, weil eben auch hier alles ganz anders kam.
Jack hatte mit dem Kapitän gesprochen. »Ich habe ihm alles erzählt, und aus reinem Mitleid und Interesse für unser Unglück will er seinen Kurs ändern und an der Sklavenküste vorbeisteuern. Dadurch aber erleidet er zwei Tage Verspätung, und das, Vater, würde dich 5000 Dollar kosten. Glaube ja nicht, dass sich der Kapitän dieses Geld in seine Tasche macht, keinen Cent davon, danach sieht er auch gar nicht aus, er ist ein Ehrenmann. Er hat mir vorgerechnet, was dies die Gesellschaft selbst kostet, und was meinst du wohl, was für Kohlen solch ein Schnelldampfer frisst! Und auch der Kapitän ist schließlich nur ein Dividendensklave, er hat vor allen Dingen die Interessen der Kompanie zu wahren, in deren Brot und Lohn er steht. Das hat er nur alles ganz offen gesagt. Ein Schiff zu chartern, das heißt zu mieten, kostet pro Tonne und Tag durchschnittlich einen halben Dollar, das weiß ich nämlich auch, Buffalo Bill hat schon manches Schiff gechartert, und da dieser Schnelldampfer 10 000 Tonnen hat, würde das eigentlich für die zwei Tage 10 000 Dollar kosten. Der Kapitän will es auf seine Verantwortung für die Hälfte machen. Bist du damit einverstanden, Vater? Dann schreibe einen Scheck aus!«
Und ob der Vater damit einverstanden war!
»Nun ist aber noch etwas Anderes dabei«, fuhr Jack fort. »Dieser mächtige Dampfer kann sich jener flachen Küste auf höchstens zwei englische Meilen nähern. Der Kapitän übernimmt auch nicht die geringste Garantie dafür, dass wir wirklich von Bord kommen. Das kann er nicht. Er will stoppen, aber... wenn nun ein so hoher Seegang ist, dass kein Boot ausgesetzt werden kann? Der Kapitän kann nicht tagelang warten, nicht einmal einige Stunden, was in einem solchen Falle ja auch gar keinen Zweck hätte. Kurz, Vater... wir müssen uns trennen.«
»Trennen?!!«, schrak der alte Holländer empor.
»Ja, es geht nicht anders. Es ist auch das beste. Die Karawane marschiert jeden Tag zwanzig englische Meilen, und ehe wir in Port José ankommen, ist sie schon zweihundertfünfzig Meilen von der Küste entfernt. Da muss ich Tag und Nacht eilen, um sie einzuholen, ehe sie in Gebiete kommt, die mir verschlossen sind. Dass ihr mich dabei begleiten könnt, mit dem kranken Kinde, das ist ganz ausgeschlossen. Und was wollt ihr in Port José? Das sieht jetzt ganz anders aus, als Eva es uns vor Aufbruch der Karawane geschildert hat, das ist jetzt öde und verlassen, nur das schlimmste Gesindel treibt sich noch darin herum, zu schlecht selbst zum Marsche durch die Wildnis, dort seid ihr keine Minute eures Lebens sicher. — Nein, Vater, ihr verlasst den Dampfer in Freetown und bleibt dort, das ist eine ansehnliche Stadt, und der Kapitän hat mir schon einen Empfehlungsbrief an einen Agenten seiner Kompanie gegeben, der mit seiner Familie dort wohnt, ein komfortables Haus, eine angenehme Familie, sie soll glücklich sein, euch bewirten zu können...«
Jack sprach noch weiter, und er wusste jedes Bedenken zu beseitigen.
»Und ich weiß inzwischen gar nicht, wie es dir geht, ich ängstige mich um dich!«, klagte der Vater nur noch.
»Nicht?«, lächelte Jack aber. »Na, ich gebe dir einfach eine Locke von meinen Haaren, außerdem machen wir noch für jeden Tag eine bestimmte Zeit aus, da schreibe ich alles, was ich dir zu sagen habe, und Eva kann es doch dann lesen!«
Wahrhaftig, das ging!
»Außerdem«, fuhr Jack fort, »das ist nun einmal keine Vergnügungsreise, da muss man eben etwas Angst und Sorge mit in Kauf nehmen. Ja, in Freetown kannst du mir auch viel nützlicher sein. Ich werde dir schon immer Instruktionen durch das hellsehende Kind zukommen lassen. Denn gesetzt den Fall, du musst mir mit bewaffneten Leuten, mit einer großen Karawane zu Hilfe kommen — eine solche jetzt in Port José anzumustern, das ist ganz ausgeschlossen, während du in Sierra Leone so viele zuverlässige Leute bekommen kannst, wie du nur haben willst, und dass der Weg etwas weiter ist, das schadet dann auch nichts — was lange währt, wird gut.«
Für den Schwiegervater gab es nur noch ein einziges Bedenken.
»Wenn du aber nun wegen schlechten Wetters nicht von Bord kannst, dann musst du erst mit nach Kapstadt.«
Abermals lächelnd klopfte Jack dem Schwiegervater auf die Schulter.
»Ohne Sorge um mich! Texas Jack kommt schon vom Schiff herunter; Texas Jack kommt auch an Land; und Texas Jack führt dir auch deine Tochter wieder zu — — — — wenn Gottes Ratschluss es nicht anders will«, setzte er dann noch mit feierlichem Ernste hinzu.
Am elften Tage ging der Dampfer auf der Reede von Freetown vor Anker.
»Ich möchte dir lieber Maries Locke gar nicht geben«, meinte Jack zögernd.
»Warum denn nicht?«, stutzte der Vater. »Du kannst doch auch keinen Gebrauch davon machen.«
»Ja, das ist es eben — — — es ist nicht gut, wenn der Mensch in die Ferne sehen kann und machtlos alles geschehen lassen muss. Es würde dir nur Kummer erspart bleiben. Aber, Vater, da wir einmal das Mittel besitzen, durch welches du dein Kind auch in der Ferne beobachten kannst, darf ich es dir doch nicht vorenthalten.«
Als Jack zuerst so gesprochen hatte, war es gewesen, als ob Margot eine hastige Einwendung machen wollte. Ihre Züge drückten Angst aus.
Jetzt aber, als Jack das Medaillon hervorzog, um dem Vater Maries Locke einzuhändigen, funkelten die dunklen Augen des schönen Mädchens in triumphierender Freude auf.
Hatte Jack denn keinen Engel, der ihn warnte?
Ja, er hatte einen Engel — — oder, besseres noch als einen Engel — er hatte einen klugen, erfahrenen Kopf.
»Hier, Vater, das genügt ja — — man muss immer mit allen Möglichkeiten rechnen.«
Er hatte die Haarlocke geteilt, gab die eine Hälfte dem Vater, die andere Hälfte barg er im Medaillon wieder auf seiner eigenen Brust.
Und die schöne, barmherzige Schwester, die eben noch vor erwartungsvoller Freude gestrahlt, sah plötzlich aus, als hätte sie einen Eimer kaltes Wasser über den Kopf bekommen.
»Und nun schneide auch mir eine Skalplocke ab. Hast du eine Schere? Sonst nimm...«
»Hier, hier!!«, rief Margot hastig, und sie war es, welche dem schönen Manne eine blauschwarze Locke abschnitt, und dann war sie es, welche diese Locke in Verwahrung nahm, sie durfte sie auf dem Busen tragen, da hatte sie doch wenigstens eine Freude.
Ein kleiner Dampfer legte bei. Es ging an das Abschiednehmen.
»Und nun du, mein liebes Kind«, sagte Jack, und die hellen Zähren rannen ihm über die Wangen, als er die kleine Evangeline küssend gegen seine Brust drückte, »wir werden uns wiedersehen!«
»Gewiss, mein Jack«, entgegnete das Kind, gar nicht traurig, sondern nur ernsthaft, als es ihm die Locken aus der Stirn streichelte, »sehen kann ich dich doch immer, und du wirst auch wiederkommen, denn ich werde ja immer für dich beten.«
»Dann bin ich in sicherer Hut.«
»Und du wirst auch dein Mariechen wiederfinden, ich weiß es ganz bestimmte
Der unglückliche Mann konnte nicht mehr, er gab das Kind schnell der Pflegerin und wandte sich ab, suchte die Einsamkeit auf.
Erst als van Hyden schon auf dem kleinen Dampfer war, fiel ihm noch etwas ein, woran er gar nicht gedacht hatte — schließlich nur eine neugierige Frage.
»Jack! — Jack!! — — Was wird denn aber aus deinem Pferde?«
Allein Jack war nicht mehr sichtbar.
Er hatte wohl bestimmt, dass es nach Kapstadt mitgenommen und dort untergebracht würde. Diese Frage hatte Hyden mit seinem Schwiegersohne noch gar nicht erörtert. Denn das Pferd mit im Boot ans Land zu nehmen, daran war gar nicht zu denken, nicht bei der ruhigsten See. Ein Pferd geht nicht in ein Seeboot; man kann sich gar nicht vorstellen, wie das ermöglicht werden soll. — — —
Der Dampfer hatte einen anderen Kurs gesteuert. Zwei Tage später, etwas nach Mitternacht, tauchten in der westlichen Ferne Lichterchen auf. Das war die Sklavenküste.
An Deck drängten sich trotz der späten Nachtzeit noch die Passagiere. Man wusste, dass der allgemein bekannte Texas Jack bald von Bord gehen würde, man wusste zum größten Teile auch warum, alle wollten Zeuge davon werden.
»Wie kommt er denn eigentlich an Land?«, hieß es fragend. »Hat er denn ein Boot?«
»Natürlich, er kann doch nicht hinschwimmen!«, lachte ein Offizier. »Er hat ja für diesen Spaß fünftausend Dollar bezahlt, und dafür muss ihm natürlich auch ein Boot zur Verfügung gestellt werden.«
»Und da rudert er selbst hin?«
»Eigentlich müsste er das. Aber da kommt ein Zufall zu Hilfe. Wir haben zwei Matrosen an Bord, welche nach der Anmusterung in New York davongelaufen waren, die Polizei brachte sie zurück, und nun müssen sie die ganze Reise ohne Bezahlung mitmachen, aber dabei immer tüchtig arbeiten! Das hat freilich keinen Zweck, das ist nur einmal so Usus. Die Burschen arbeiten ja doch nicht und treiben bloß Allotria. Der Kapitän will sie los sein, und die sind mit Freuden bereit, das Boot an Land zu bringen.«
Es war noch nicht so weit, die Passagiere betrachteten einstweilen die Wasserfläche und tauschten Bemerkungen aus.
Die See war nicht gerade hoch, aber doch sehr bewegt, ein Boot tanzte schon anständig, und nun weder Mond noch Sterne, also eine stockfinstere Nacht, welche hier unter dem Äquator oder doch gerade in dieser Gegend im Gegensatz zu dem glühendheißen Tage immer bitterkalt ist, und nun schließlich noch... überall in dem schäumenden Wasser phosphoreszierende Scheine, welche das Schiff umschwärmten — — — die Hyänen des Meeres — — Haifische!!
Nein, es war kein einziger unter den Passagieren, der Neigung verspürt hätte, sich jetzt in einem Boote, einer Nussschale, dort nach der weit, weit entfernten Küste rudern zu lassen — — — und die allermeisten bekamen bei diesem Gedanken schon eine Gänsehaut.
Der Kapitän erschien an Deck.
»Ist Mr. Dankwart vorbereitet, dass er bald das Schiff verlässt?«, wandte er sich an seinen Offizier.
»Ja, er weiß es, er ist jetzt beim Schiffszimmermann; ich glaube, er macht sich eine lange Lanze zurecht, mit der will er sich wohl die DahomeyWeiber vom Leibe halten.«
Wenn das ein Witz gewesen sein sollte, so lachte niemand darüber.
Jack schritt nach hinten über Deck. Er war reisefertig — — — fertig, ein von vier- und zweibeinigen Räubern wimmelndes Land zu betreten.
Er trug ein ledernes Jagdkostüm, aber nicht das eines Sonntagsjägers; es hatte schon manche Strapaze mit durchgemacht, im Gürtel ein Scheidemesser und zwei mächtige Revolver, über der Schulter ein langläufiges Gewehr, um Brust und Rücken schlang sich das aufgerollte Lasso, und außerdem trug Jack in der Hand noch eine lange Lanze, die er sich soeben aus einem Bambusrohr und einem spitzen Messer selbst gefertigt hatte.
»Na, Texas Jack, nun machen Sie einmal den schwarzbraunen DahomeyDamen ihre Kunststückchen vor«, sagte scherzhaft ein Offizier zu dem Vorbeigehenden.
»Ich denke, ja, ich werde ihnen einmal etwas vormachen, was sie noch nicht gesehen haben — — vorausgesetzt, dass die Damen es zu sehen wünschen. Sie wissen doch, ich renommiere nicht gern.«
»Sind Sie fertig, Mr. Dankwart?«, rief der Kapitän ihm nach. »In zwei Minuten stoppt die Maschine.«
»Ich werde fertig sein«, entgegnete Jack und verschwand noch einmal hinten im Schiff.
Ein Boot wurde ausgeschwenkt, d. h. die Davits, die eisernen Arme, in denen das Boot hängt, wurden herumgedreht, sodass es über dem Wasser schwebte. Die beiden Matrosen saßen schon drin, nun brauchte bloß noch Jack hineinzusteigen, erst dann wurde das Boot hinabgelassen, und sobald es das Wasser berührte, wurde das Tau gelöst.
Plötzlich trat eine Todesstille ein. Die Schraube stoppte nämlich. Ein ganz eigentümliches, unheimliches Gefühl! Wenn man sich einmal an dieses Zittern und Rütteln gewöhnt hat und es hört plötzlich auf, da legt es sich jedem sogleich wie ein Alp aufs Herz.
»Mr. Dankwart!!!«
»Was wird denn nun eigentlich aus seinem Pferde?«, fiel es jetzt dem Kapitän ein zu fragen.
Da kam es donnernd über das hohle Deck. Ängstlich wichen die zusammengedrängten Passagiere vor dem mächtigen Rappen zurück, der von Jack geleitet wurde.
»Ja, was wollen Sie denn mit dem Pferde?!«, rief der Kapitän in grenzenlosem Staunen.
»Es mitnehmen.«
»Das geht aber nicht!«
»Warum denn nicht?«
»Na, wie wollen Sie denn nur das große Tier dort in das kleine Boot bringen?«
»In welches Boot?«
Erst jetzt bekam Jack zu hören, dass ihm ein Boot und zwei Matrosen zur Verfügung gestellt wurden.
»Sie sind äußerst liebenswürdig, aber ich kann leider keinen Gebrauch davon machen. Von meinem Pferde trenne ich mich natürlich nicht, zumal ich es dort in jenem Lande recht gut brauchen kann.«
Und mit einem Sprunge saß der ritterliche Mann im Sattel.
»Wahnsinniger, was haben Sie vor?!!«, schrie er, stürzte auf das Pferd zu und packte es am Zügel. »Sie wollen doch nicht etwa an Land schwimmen?«
»Gewiss will ich das!«
»Das sind zwei Seemeilen!«
»Also eine Stunde zu schwimmen — — — eine Kleinigkeit für meine Nachtmär.«
»Sie denken lebendig an Land zu kommen?!! Da sehen Sie einmal überall die phosphoreszierenden Scheine im Wasser! Das sind lauter hungrige Haifische!«
»Gegen diese werde ich mich zu wehren wissen«, entgegnete Jack, die lange Lanze schüttelnd. »Wir beide sind schon durch andere Haifische glücklich hindurch gekommen.«
»Ich lasse Sie auf keinen Fall von Bord!«, schrie der Kapitän, sich in die Zügel hängend. »Ich halte Sie mit Gewalt von solch einer Torheit zurück! Hierher, Leute...«
»Dann muss mein Abschied etwas kurz erfolgen — — good bye!«
Jack hatte es gerufen, der Kapitän wusste dann später nicht mehr, auf welche Weise ihm so plötzlich die Zügel aus der Hand gewunden worden waren — — im nächsten Augenblick donnerten auf dem hohlen Deck wieder die Hufe — — und dann war das Pferd plötzlich verschwunden — — man hörte es außenbords ins Wasser klatschen, man sah dieses aufspritzen — der verwegene Präriejäger war mit dem Rappen über die hohe Bordwand gesetzt.
Einen Moment war alles vor Entsetzen wie gelähmt. Man glaubte, einen seltsamen Traum zu haben. Dann stürzten alle schreiend an die Bordwand und blickten hinab.
Es war ein sehr tiefer Sprung gewesen. Wenigstens fünfzehn Sekunden dauerte es, ehe erst der Kopf des Reiters und dann der des Pferdes wieder auftauchte.
Und da waren Ross und Reiter schon von den heißhungrigen Haifischen umschwärmt, und die Passagiere schrien vor Angst, als wären sie selbst in Todesgefahr; sehr viele Damen wurden ohnmächtig, andere konnten nicht mehr hinsehen.
Es ist wohl bekannt, wie der Haifisch seine Beute fasst. Er muss wegen der Beschaffenheit seines Rachens von unten kommen und sich dabei auch noch auf den Rücken legen. Das ist doch eine überaus weise Einrichtung in der Natur! Wenn der Hai so auf seine Beute losschießen und sie sofort verschlingen könnte, wie etwa der Hecht es kann, so gäbe es ja gar keine Seeleute oder aber, die Schiffe müssten extra wegen der Haifische anders eingerichtet werden, der Schiffsbau hätte sich ganz anders entwickelt. Denn wo ist der Matrose, der nicht erzählen kann, dass er schon einmal über Bord gefallen ist! Allerdings nicht während der Fahrt auf offener See, da ist das doch eine seltene Ausnahme, da sieht sich jeder vor — aber im Hafen, beim Farbewaschen außenbords — da vergeht fast kein Tag, an welchem nicht ein Mann ins Wasser stürzt. Und in den südlichen Gegenden wimmelt es auch im Hafen immer von Haifischen, die sind durch nichts zu vertreiben, so z. B. im Roten Meere an der arabischen Küste, dort sind ihre Tummelplätze, dort scheinen sie am allerunverschämtesten zu sein — und sobald etwas über Bord fällt, sind sie auch da, sie sind überhaupt immer da, und solch ein Mann, der mitten zwischen die Haie stürzt, wäre ja rettungslos verloren — wenn eben der Hai nicht erst solche Vorbereitungen zum Fassen der Beute brauchte, und unter tausend Fällen passiert es doch nur einmal, dass sich der Mann nicht noch rechtzeitig mittels eines Taues in Sicherheit bringen kann. Außerdem geht der Haifisch nicht gern an lebhaft zappelnde Gegenstände, oder es fällt ihm eben schwer, diese zu fassen, und hier waren die Objekte, welche er einzig und allein fassen konnte, vier heftig arbeitende Pferdebeine, und die eisenbeschlagenen Hufe teilen keine zarten Tritte aus.
Aber versucht wurde es, ob solch ein zappelndes Pferdebein nicht zu fassen sei, und das sofort!
Wieder schrien die Passagiere auf vor Angst.
Ganz, ganz deutlich konnte man in beträchtlicher Tiefe sehen, wie sich solch ein Ungeheuer auf den Rücken legte und sich so von unten mit weitgeöffnetem Rachen dem Pferdeleib näherte. Dass die Haifische in der Nacht solch ein phosphoreszierendes Licht ausstrahlen, das ist wieder ein Schutz, welchen die Natur den Menschen und allen, die unter den Haifischen zu leiden haben, gegen die Hyänen des Meeres gibt.
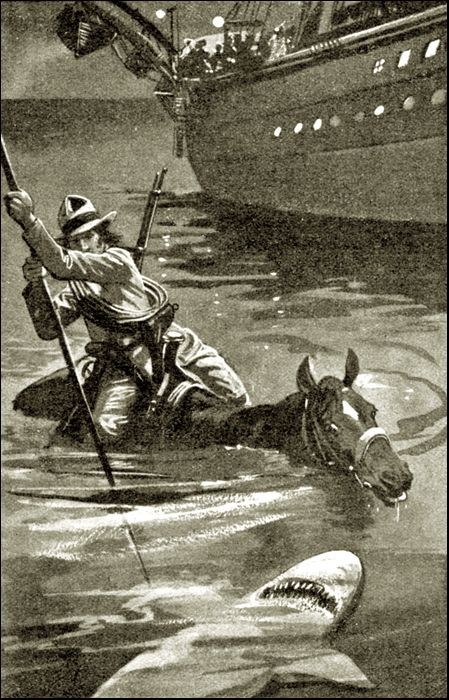
Und Jack hatte wohl Acht! Er stieß mit der Lanze zu, es war keine Harpune, sondern ein glattes Messer — und wie ein Lichtstrahl schoss der getroffene Hai davon, und wenn Jack so fortfuhr, konnte er sich vielleicht nach und nach aller seiner aufdringlichen Begleiter entledigen.
Inzwischen schwamm das starke Pferd wacker, der Dampfer selbst befand sich noch in Fahrt, schnell hatte man den Schwimmer weit hinter sich.
Die beiden Matrosen waren aus dem Boote gestiegen.
»So geht doch ins Boot!«, schrie der Kapitän. »Ihr fahrt wenigstens zur Sicherheit mit!«
Aber die beiden Matrosen, die leise geflüstert hatten, wollten plötzlich nicht mehr, sie hätten es sich anders überlegt, und der Mann sei ja schon außer Sicht, vielleicht fänden sie ihn in der stockfinsteren Nacht gar nicht mehr. Und was könnten sie ihm denn helfen? Der wüsste sich allein zu schützen.
Ja, was sollte der Kapitän tun? Die Aktionäre interessieren sich nicht für Haifische und dergleichen — die Aktionäre wollen die Dividenden haben. Dividenden!
»Der gnädige Gott sei mit dem kühnen Manne! Volldampf voraus!«
Port José ist eine portugiesische Festung(1). So steht es in den Büchern. Diese Festung ist ein Lehmturm, der jeden Tag umfallen kann, er neigt sich schon ganz bedenklich nach der einen Seite. Oben sind die Wohnräume für Offiziere und Mannschaften, unten ist ein Ziegenstall. Verteidigt wird diese Festung von drei Kanonen. Die eine liegt im Ziegenstall unter dem Miste, in der zweiten sorgt ein Karnickelehepaar für Nachkommenschaft, die dritte Kanone aber ist in tadellosem Zustande — in der hebt nämlich die Frau Kommandeuse Brot, Eier, Käse und dergleichen schöne Sachen auf.
(1) Eine portugiesische Festung oder Niederlassung ›Port José‹ konnte im fraglichen geografischen Bereich nicht gefunden werden.
Bedient werden diese drei Kanonen von drei Offizieren und zwei Unteroffizieren. Gemeine Soldaten gibt es gar nicht, dazu ist diese portugiesische Festung ersten Ranges viel zu vornehm. Der höchste ist natürlich der Kommandant, Rodrigo Fernando Bonaventura heißt er, Inhaber mehrerer hoher Orden, ein Kriegsheld vom Scheitel bis zur Sohle, und wenn er nicht schläft, dann ist er bes... betrunken.
Seine beiden Offiziere spielen den ganzen Tag Karten. Wenn sie anfangen, so nennen sie sich gegenseitig Fidalgo und Cavalheresco(2) und geben sich andere ehrenhafte Schmeichelnamen, und dann später nennen sie einander Gauner und Lausejungen, und da haben sie auch ganz recht, denn sie begaunern sich beim Spiele alle beide, und Läuse haben sie auch alle beide. Von den zwei Unteroffizieren ist nichts weiter zu melden, als dass sie beide keine Stiefel haben.
(2) Die von Kraft verwendeten spanischen Bezeichnungen (hier ›Hidalgo‹, richtig ‹Fidalgo‹, und ›Cavalleresko‹, richtig ›Cavalleresco‹) sind hier und weiter durch die portugiesischen Bezeichnungen ersetzt worden.
So, nun soll jemand nur eine Feindseligkeit gegen den Freihafen planen — — Port José steht unter portugiesischem Schutze!!
Wir lassen die Männer ganz aus dem Spiele, sie kommen für uns gar nicht in Betracht, und beschäftigen uns nur mit der Gattin des Kommandeurs.
Senhora Inez Bonaventura ist eine kleine, magere Frau von etwa fünfunddreißig Jahren, mit schwarzen Funkelaugen; sie hat sich gut gehalten, sie ist wirklich noch ganz hübsch. Sie ist in Port José die einzige weiße Frau, und deshalb kann sie mit Recht sagen, dass sie die Schönste im ganzen Lande ist. Und dass ihr dies hin und wieder gesagt wird, darauf hält sie, das will sie, das verlangt sie, und wehe dem, der das nicht tut! Den tyrannisiert sie. Dazu hat sie die Macht. Und sie tyrannisiert überhaupt gern; denn sie ist in Wirklichkeit die Kommandeuse. Ihr Gatte ist doch immer betrunken, wenn er nicht schläft.
Dass ein Offizier ihn vertritt, das geht nicht, das lässt sie auch nicht zu, also führt sie das Regiment und das Kommando. Viele Regierungsgeschäfte sind ja nicht gerade zu erledigen, und das ist eben sehr schade, desto mehr wird dann eine Gelegenheit ausgenutzt, wenn sie einmal regieren kann. — — — —
Es war um die zehnte Morgenstunde. Die Kommandeuse brannte sich die Locken. Das Zimmer, in dem sie diese wichtige Beschäftigung vornahm, schien das Büro ihres Gatten zu sein, also die Kommandantur, denn es gab da einen Tisch, auf dem einige Papiere lagen, es konnte aber vielleicht auch die Speisekammer sein, jetzt war es also das Frisierzimmer, und ebenso liederlich sah die Kommandeuse selbst aus.
Da stürzte eine Negerin herein.
»O Golly, es kommt ein weißer Mann geritten!!«
»Ein Fremder?«, fragte die Kommandeuse gleich erregt.
»Ja, ein Fremder, er hat schon gefragt, wo er sich hier zu melden hat, er muss gleich hier sein — — und, Missus — ich habe ihn schon gesehen — ist das ein schöner Mann — ein wunder, wunderschöner Mann!!«
Das war die schwächste Seite der Kommandeuse. Man konnte es der einsamen Frau in diesem afrikanischen jämmerlichen Neste auch nicht übel nehmen, wenn sie sich mit Verzweiflung einmal nach einer anderen Gesellschaft, nach einer Abwechslung sehnte.
»Wo ist mein Mann? Ist das Schwein wieder besoffen? Schnell, hilf mir, dass ich fertig werde — meine neuen Lackschuhe — — die blauseidene Bluse — — wirf den Buttertopf unter das Sofa...«
Hals über Kopf wurde Toilette gemacht und nebenbei das Zimmer aufgeräumt, d. h., alles, was das Auge beleidigen konnte, wurde irgendwo versteckt.
Jack war durch das wie ausgestorbene Dörfchen geritten; endlich sah er einen Neger, den er erst auf englisch, dann auf spanisch anredete. Er fragte nach dem Ortsvorsteher oder dem Kommandeur dieses Ortes, bei dem sich ein Fremder zu melden hätte, der Neger verwies ihn nach dem Festungsturm. Jack erfuhr sofort, dass der gnädige Herr Kommandeur jedenfalls betrunken sei und dass der Fremde von dessen Gattin empfangen werde — — der Neger gehörte zufällig zur Dienerschaft der Festung, er meldete also durch seine schwarze Kollegin die Ankunft des Fremden, nahm dann diesem das Pferd ab, brachte es in den Stall und schüttete ihm Mais vor.
Nachdem Jack hierbei geholfen hatte, machte er selbst erst etwas Toilette. Nass war er nicht mehr, aber er hatte heute schon einen weiten Ritt hinter sich. Seine Schwimmtour hatte wenig über eine Stunde gedauert, er hatte sich ja auch immer nach den Lichtern an der Küste richten können, doch war er von einer starken Strömung weit nach Norden hinaufgetrieben worden, und dann, als er das Land erreicht hatte, war sein Pferd natürlich äußerst erschöpft gewesen, er hatte ihm einige Stunden Ruhe gönnen müssen, er selbst hatte unter freiem Himmel geschlafen, und so kam er also erst in der zehnten Morgenstunde hier an.
Die Negerin erschien und meldete, die gnädige Kommandeuse erwarte den fremden Herrn. Jack hatte schon die beiden Offiziere bemerkt, welche manchmal vorsichtig aus einem Fenster nach ihm lugten, und er ahnte gleich das Regiment, welches hier herrschte; diese Offiziere hätten den fremden Herrn wohl gern begrüßt, aber sie durften es nicht, erst kam er vor den Höchstkommandierenden, und das war hier eine Frau.
Jack lehnte Gewehr und Lanze an die Krippe, aus der sein Pferd fraß, schnallte den Revolvergürtel ab und hing ihn gleichfalls an die Krippe. Denn bewaffnet vor einer Dame zu erscheinen beim Empfangsbesuche, das ist doch nicht gut angängig.
»Mein Pferd ist nun versorgt«, sagte er zu dem Neger. »Es ist ein sonderbares Tier, durchaus nicht bösartig, es hat sich doch auch von dir anfassen lassen, aber nur, weil ich dabei war. Greife es nicht mehr an, es würde beißen und ausschlagen, und erst recht würde es den beißen, der meine Waffen anfassen wollte. Hast du mich verstanden?«
Der Neger bejahte mit einem scheuen Seitenblicke nach dem dressierten Tiere.
»Gut! Also schließe den Stall oder bleibe hier und sorge sonst dafür, dass kein Mensch meinem Pferde zu nahe kommt, ich habe gewarnt, ich trage für nichts irgendwelche Verantwortung.«
Er folgte der Dienerin eine Treppe hinauf, eine Tür öffnete sich, er stand dem weiblichen Kommandeur von Port José gegenüber.
Es wurden zuerst höfliche Begrüßungsworte gewechselt. Jack sah eine hübsche Frau, etwas kokett geputzt — — — was war da Außergewöhnliches dabei? Und verlegen wurde der welterfahrene Mann vor keiner Dame. Er war äußerlich sehr höflich und innerlich sehr kühl, jedes Wort erwägend.
Die Kommandeuse aber wusste dann später sicherlich nicht mehr, was sie zuerst gesprochen hatte. Sie hatte den fremden Herrn mit gnädiger Amtsmiene empfangen wollen, so hatte es ausgesehen, so hatte sie im Zimmer gestanden — und sofort, als Jack eintrat, war sie die Verlegenheit selbst, konnte nicht sprechen, stammelte Entschuldigungen, zupfte an ihrem Kleide herum, hilfesuchend irrten ihre Augen umher.
Endlich raffte sie sich zusammen.
»Aber bitte, setzen Sie sich doch, Senhor«, sagte sie mit glühendem Gesicht. »Das ist ja schrecklich, was Sie mir da erzählen! Ihre Frau ist als Sklavin nach Timbuktu verkauft worden? Hier? Sie befindet sich bei Muftas Karawane? Nicht möglich!!«
Also, es stimmte alles. Evangeline hatte immer ganz richtig gesehen. Doch es war ganz selbstverständlich, dass die Kommandeuse von dem Verkaufe einer weißen Frau durchaus nichts wissen wollte. Es gibt doch auch gar keinen Sklavenhandel mehr!
Jetzt interessierte sie sich vor allen Dingen für das hellsehende Kind, und Jack hatte gar viel zu erzählen, immer von ihren Rufen des Staunens unterbrochen.
Unterdessen hatte sie Zeit, sich zu sammeln, ihre Verlegenheit schwand, umso bewundernder ruhten jetzt ihre funkelnden Augen auf dem bildschönen, schwarzlockigen Mann, sie machte aus ihrer Bewunderung gar kein Hehl.
»Nun«, sagte sie dann, »ich kann nicht mehr daran zweifeln, dass dieses Kind wirklich die wunderbare Gabe des Fernsehens besitzt, und da es alles so genau gesehen hat, wie es hier tatsächlich zugegangen ist, so muss Mufta, der Malteser, wohl wirklich eine weiße Frau mitgeschleppt haben. Unerhört!! Wenn ich davon eine Ahnung gehabt hätte! Aber das muss alles sehr schnell und sehr heimlich vor sich gegangen sein. Na, in einem halben Jahre kommt Mufta zurück, und wehe ihm, da will ich schrecklich über ihn zu Gericht sitzen!! Also, Ihre Frau ist es! Grässlich! Sie Ärmster! Ja, es stimmt, hier lag eine spanische Brigg, die ›Pendula‹. Und noch in derselben Nacht rückte Mufta mit sechshundert Mann ab. Eine so riesige Karawane hat er noch niemals zusammengebracht. Das kostet ihn furchtbares Geld, und das Risiko ist kolossal. Ich würde in jetziger Zeit keine Karawane abgehen lassen. Das ist jetzt gerade vierzehn Tage her. Also, Ihre Frau war das!! Ach, Sie Allerärmster!! — Ja, was ist da nun zu tun?«
»Hierüber, gnädige Frau, möchte ich eben um Ihren erfahrenen Rat bitten.«
»Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung«, entgegnete Madame mit ihrem verführerischsten Lächeln, den schönen Mann mit begehrlichen Augen verschlingend. »Lassen Sie sehen, was hier zu machen ist. War Ihre Frau denn sehr hübsch?«
»Ja, der Sklavenhändler dürfte einen ansehnlichen Preis für sie erzielen.«
»Lieben Sie denn Ihre Frau sehr?«
»Nun, ich liebe sie genug, um eine Stunde lang mit den Haifischen um die Wette zu schwimmen«, entgegnete Jack auf diese dummdreiste Frage.
»Was, mit den Haifischen um die Wette zu schwimmen?«
Jetzt musste Jack erst ausführlich erzählen, wie er eigentlich hierher gekommen war, und ihr Staunen war natürlich grenzenlos.
»Nein, nein, müssen Sie aber Ihre Frau lieben!!«, rief sie ein Mal übers andere. »Ach, wenn mich mein Mann so liebte! Und vielleicht ist Ihre Frau solch einer starken Liebe gar nicht wert!«
Es war Jack nicht anzumerken, was in ihm vorging. Am allerliebsten hätte er der gnädigen Kommandeuse ein paar heruntergeknallt. Die hatte sich hier in der Einsamkeit als unnahbare Herrscherin ganz selbstständig entwickelt, die war auch sozusagen etwas zu einem rücksichtslosen Übermenschen geworden.
»Ja, da wird schwer etwas zu machen sein«, war dann das Resultat ihrer Hilfeversicherungen. »Sie wollen also Ihre Frau zurückkaufen, vorausgesetzt, dass Mufta sie Ihnen ablässt, was ich sehr bezweifle, wenn er sich einmal geäußert hat, dass er die weiße Frau für den Sultan von Timbuktu bestimmt hat. Da müssen Sie also mit einer Karawane in Eilmärschen nachrücken. Sie kommen aber zur allerungünstigsten Zeit. Es sind während dieser letzten Zeit hier schon zwei Karawanen abgegangen. Port José ist wie ausgestorben. Die Magazine sind leer. Keine Stecknadel ist mehr zu haben. Und Sie können doch nicht so viel Gold und Silber bei sich führen.«
»Papiergeld und mein Scheckbuch.«
»Nützt jetzt gar nichts. Alle Wechsler sind unterwegs.«
»In Abomey soll es mehrere Araber und Juden geben, welche Schecks nehmen.«
»Ja, aber ich bezweifle, dass jetzt dort so viel gemünztes Gold und Silber ist, wie Sie zur Ausrüstung einer nur ganz bescheidenen Karawane brauchen. Und woher wollen Sie die Stoffe und die Perlen und den Messingdraht bekommen? Nicht in Abomey. Und hinter den Akandabergen hört der Geldverkehr auf.«
Jack, durchaus nicht niedergeschlagen, immer gelassen, blickte seitwärts zum Fenster hinaus. Er sah auf den Hafen, in welchem neben mehreren kleinen einheimischen Segelbooten auch eine stattliche Jacht lag.
»Bitte, wem gehört diese große Dampfjacht?«
»Einem Monsieur Alexander Dubois aus Paris. Das ist eben der Herr, welcher vor vier Tagen die zweite Karawane ausgerüstet hat, und der hat alles aufgekauft und hat den letzten Mann mitgenommen. Es sollte eine Forschungsexpedition sein, aber mir kam das gar nicht so vor, der Herr hatte es so außerordentlich eilig. Das allerdings erklärt sich durch seine Absicht, Muftas Karawane einzuholen und sich mit ihr zu vereinigen, und wenn ihm das unterdessen nicht schon gelungen ist, dann dürfte es ihm bereits schlecht ergangen sein, denn lebendig kommt er mit seiner kleinen Karawane nicht durch die Akandaberge. Zirkona fängt ihn ab und massakriert ihn und seine Leute.«
»Monsieur Alexander Dubois?«, meinte Jack. »Der Name kommt mir bekannt vor. Bitte, ist das nicht ein kleiner Herr mit einem großen, roten Vollbarte?«
»Ganz im Gegenteil — ein großer, hagerer, aber stattlicher Herr mit spitzem, schwarzem Vollbart.«
»So«, sagte Jack trocken. »Richtig, jetzt komme ich darauf. Ich kenne ihn doch. Nicht wahr, er hat sein Haar in der Mitte gescheitelt?«
Die Dame bestätigte es, sie bestätigte noch Anderes — — jawohl, es war der Entführer seiner Frau!
Jack aber zuckte mit keiner Wimper. Er wunderte sich über den seltsamen Zufall, dass dieser ihm bekannte Herr hier vor vier Tagen mit einer Karawane ins Innere abgerückt war, und Jack horchte vorsichtig aus, was aus der Kommandeuse auszuhorchen war.
»Wer ist diese Zirkona, welche ihn vielleicht massakrieren soll?«
»Das wissen Sie nicht?«, rief die Senhora erstaunt. »Da wissen Sie wohl auch gar nicht, wie es jetzt am Hofe von Abomey aussieht? Die Roten sind vertrieben, vernichtet! Mehr als tausend sind auf der Elefantenjagd von den Blauen niedergemetzelt worden, Zirkona ist mit dem Rest in die Akandaberge geflüchtet. Aber sie wird sich schon rächen! Und das wissen Sie noch nicht?«
Woher in aller Welt sollte Jack denn das wissen? Aber er interessierte sich sehr dafür, und es war ja auch interessant, außerdem für sein Unternehmen höchst wichtig.
Jede der beiden Parteien der weiblichen Leibgarde hat ihre Vortänzerin oder Vorkämpferin, welche sich gegenseitig hassen, wie sich nur zwei Nebenbuhlerinnen hassen können.
Zirkona war vor etwa drei Jahren mit noch einigen Anderen ihrer Partei in königliche Ungnade gefallen, sie waren geflüchtet, achtzehn Weiber waren zwei Jahre verschwunden gewesen. Vor einem Jahre waren sie wieder zurückgekommen, die Verhältnisse hatten sich unterdessen geändert, sie wurden wieder in Gnaden aufgenommen. Wo waren die achtzehn Mädchen unterdessen gewesen? Die hatten sich die ganze Welt besehen. Sie waren in Sierra Leone von einem Unternehmer engagiert worden, hatten sich in allen größeren Städten Europas mit ihren Tänzen und Kampfspielen produziert.
Nun kamen sie also zurück, sie hatten etwas gesehen, konnten etwas erzählen — Zirkona wurde bald die Anführerin der roten Partei. Sie hatte auch neue Ansichten mitgebracht, sie gebrauchte ihre Macht, um Neuerungen einzuführen.
Vor sechs Wochen war die furchtbare Katastrophe gekommen. Sambone hieß die Anführerin der blauen Partei, und die hatte schon immer ihr Möglichstes getan, die verhasste Rivalin zu stürzen, die Neuerungsversuche gaben ja auch genug Grund zu Verdächtigungen, und endlich war es geglückt.
Der König gab die Erlaubnis. Während eines großen Jagdausfluges wurden die staatsgefährlichen Roten in eine Falle gelockt, die Blauen fielen über die Unbewaffneten her, sie sollten alle niedergemacht werden, doch die Hälfte entkam, sie pressten sich eben heraus.
Auch Zirkona war dem Tode entgangen, sie hatte sich mit dem Reste ihrer Partei, vielleicht immer noch achthundert Weiber, in die wilden Akandaberge geflüchtet, welche die Nordgrenze des Reiches von Dahomey bilden.
Verfolgt konnte sie dort nicht werden. Man musste warten, bis sie zum offenen Rachekampfe herauskam. Dazu brauchte sie erst Waffen, und diese konnte sie sich nur dadurch verschaffen, dass sie Karawanen überfiel, soweit das ihre jetzige Waffenkraft erlaubte. Das war auch gleich ihre erste Rache, sie konnte den ganzen Handel ins Innere lahm legen. Bisher war noch nichts geschehen. Muftas Karawane war die erste, welche die Akandaberge passieren wollte, bald würde man ja erfahren, ob es ihm gelungen sei oder nicht.
Das war der Grund, warum Mufta diesmal eine so ungeheuer starke Karawane angemustert hatte, und wenn Monsieur Dubois ihn nicht noch vor den Akandabergen einholte, so durfte er mit seinen siebzig Negern nicht wagen, diese zu betreten.
»Es bleibt Ihnen nichts Anderes übrig«, schloss die Kommandense, »als sich erst nach Freetown zu begeben und dort eine starke Karawane auszurüsten. Ehe Sie aber mit der von hier abrücken können, ist Mufta bereits in Timbuktu eingetroffen.«
Das hieß also mit anderen Worten: Machen Sie sich gar keine Hoffnung mehr, Ihre Frau ist für Sie unwiderruflich verloren!
»Wie weit sind die Akandaberge von hier?«, fragte Jack ganz ruhig.
»Fünfzehn Karawanenmärsche, das sind dreihundert englische Meilen. Morgen muss es sich entscheiden, ob Mufta der Zirkona entkommt oder nicht.«
»Was ist das Los der Männer, wenn die Karawane besiegt werden sollte?«
»Was nicht niedergemetzelt wird, kommt natürlich in die Sklaverei.«
»Wohin werden da die Sklaven verkauft?«
Die Kommandeuse lächelte eigentümlich.
»Hm, ich denke, die Dahomeyweiber werden die Sklaven wohl für sich selber behalten. Die achthundert Frauen können die Männer wohl recht gut gebrauchen. Oder meinen Sie nicht?«
»Ich kenne die hiesigen Verhältnisse nicht«, entgegnete Jack auf diese verfängliche Frage trocken, wenn auch immer höflich. »Und was würde das Los der befreiten weißen Frau sein?«
»Befreit? Die können die Weiber natürlich nicht gebrauchen, die behalten sie nicht, die wird an den ersten besten Negerhäuptling verkauft.«
Es wurde immer deutlicher sichtbar, dass es diese Frau direkt darauf abgesehen hatte, dem Manne jede Hoffnung auszutreiben, dass er seine Frau jemals wiedererlangen könne.
Jack überlegte.
»Also dreihundert englische Meilen«, meinte er dann. »Gut. Die legt mein Pferd in vier Tagen zurück. Während dieser Zeit rückt die Handelskarawane wieder achtzig Meilen vor. Also werde ich sie spätestens am sechsten Tage eingeholt haben oder doch das Schicksal meiner Frau wissen.«
Erst stutzte die Kommandeuse, schien sogar zu erschrecken, dann lächelte sie mitleidig, beugte sich vor und legte ihre Hand auf Jacks Knie.
»O, mein Freund, mein lieber Freund! In welchen Illusionen bewegen Sie sich! Sie denken, sich so ohne Weiteres aufs Pferd setzen und der Karawane nachreiten zu können? Ganz allein? O, nein lieber Freund, geben Sie sich doch nicht solchen Illusionen hin!!«
»Und warum soll denn das so unmöglich sein?«
»Ja, wenn Sie so etwas für möglich halten, dann kann ich Ihnen auch nicht erklären, warum so etwas unmöglich ist, Sie würden mich gar nicht verstehen, Sie kennen eben nicht im Geringsten die Verhältnisse. Sie kommen ja nicht einmal bis Abomey, keinen Tagemarsch weit, Sie werden sofort festgenommen und als Gefangener behandelt, werden, da Sie keine Erlaubnis haben, wegen Landfriedensbruches bestraft, und darauf steht der Martertod...«
»Gnädige Frau, ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Warnung, Sie meinen es gut — — aber mein Entschluss ist gefasst. Ich werde sogar sofort aufbrechen.«
Jack wollte aufstehen, die Kommandeuse hinderte ihn daran, jetzt ergriff sie gleich seine beiden Hände und blickte ihn zärtlich an.
»Nein, nein, mein teurer Freund, ich lasse Sie nicht fort, auf keinen Fall, das kann ich gar nicht verantworten, denn ich würde Sie in den unvermeidlichen Tod gehen lassen. Aber ich will einmal offen mit Ihnen sprechen. Wissen Sie, warum es ganz unmöglich ist, dass Sie unangefochten durch dieses Land kommen können?«
»Bitte, sagen Sie es mir.«
»Weil hier Weiber herrschen«, lächelte Madame Inês.
»Was für ein besonderer Hinderungsgrund ist das?«
Die hübsche Frau lächelte noch koketter, als sie flüsterte:
»Weil Sie ein viel zu schöner Mann sind. Verstehen Sie es nun? Unsichtbar können Sie sich doch nicht machen, und sobald eine Dahomey Sie sieht, werden Sie von ihr mit Beschlag belegt, dann wird die Sambone von Ihnen hören, und die Sambone ist jetzt allmächtig — und die lässt Sie nicht wieder laufen — die macht Sie zu ihrem Leibsklaven — — und sollten Sie wirklich unbemerkt über Abomey hinauskommen, so fallen Sie mit absoluter Gewissheit der Zirkona in die Hände, und da ist es genau dieselbe Geschichte.«
Jack lächelte nicht, er blickte die Sprecherin starr an.
»Ich will Ihnen aber doch einen guten Rat geben«, fuhr die Kommandeuse fort. »Sie können Ihre Absicht auf andere Weise erreichen. Ich weiß einen Mann, einen schnellen Waldläufer, dem geben Sie schriftlich alles mit, was Sie mit Mufta verhandeln wollen, der eilt der Karawane nach...«
»Und wo bleibe ich einstweilen?«, unterbrach Jack die Sprecherin.
»Nun, Sie bleiben einstweilen hier bei mir«, sagte Inês mit ihrem verführerischsten Lächeln, seine Hände noch fester haltend.
Aber mit einem kleinen Ruck hatte Jack sich frei gemacht und war aufgestanden. Wenn er vielleicht noch etwas im Zweifel gewesen war — jetzt wusste er ganz bestimmt, was dieses Weib beabsichtigte.
Aber auch die Kommandeuse wusste sofort, was er wollte, hatte er doch auch selbst gesagt, dass er auf der Stelle seinen Ritt antreten würde.
Mit katzenähnlichem Sprunge war sie an der Tür.
»Ich lasse Sie nicht fort, das kann ich nicht verantworten!!«, rief sie, und hinaus war sie — — und Jack hörte, wie sie draußen den Schlüssel umdrehte.
Sie eilte behänd die Treppe hinab, wahrscheinlich wollte sie noch andere Vorkehrungen treffen, um den tollkühnen Mann, der es ihr gleich so angetan hatte, mit Gewalt an der Ausführung seines Vorhabens zu hindern.
In dem Hausflur blieb sie mit ihrem Kleide an einem Nagel hängen, und zwar so fest, dass das Tuch nicht riss, sie musste sich von dem Nagel befreien. Einige Sekunden hatte das doch gedauert, und als sie dann ihren schnellen Weg fortsetzte und das Freie erreichte, da erstarrte sie zur Statue, sie traute ihren Augen nicht, glaubte eine seltsame Vision zu haben.
Da sieht sie den Mann, den sie soeben oben in der ersten Etage eingeschlossen hat, auf seinem Rappen zum Stalle herausreiten, über der Achsel das Gewehr, in der Hand die lange Lanze.
Er wandte sich noch einmal im Sattel.
»Es tut mir sehr leid, dass ich aus dem Fenster Abschied nehmen musste, aber ich bin nicht gewohnt, eingeschlossen zu werden«, rief er zurück und sprengte die Dorfstraße entlang, und ehe die Kommandeuse sich so weit erholt hatte, um ihre ›Armee‹ zusammenzurufen, war er schon verschwunden.
Die in den hiesigen Verhältnissen sonst erfahrene Frau hatte recht gehabt. Gesetzt den Fall, in Deutschland, in Berlin produzieren sich DahomeyWeiber. Sie haben irgendwas begangen und werden deswegen von der hochwohllöblichen Polizei hinter Schloss und Riegel gesetzt. Das kommt zu den Ohren ihrer in Freiheit dressierten Schwestern nach Dahomey, diese beschließen, ihre Freundinnen mit Waffengewalt zu befreien, sie fahren nach Hamburg, rücken in Schlachtlinie auf Berlin los.
Das heißt, so stellen sie es sich in ihren Köpfen vor, weil sie eben die fremden Verhältnisse gar nicht kennen. Dass die nicht weit kommen würden, das braucht doch weiter keiner Erwähnung.
Und ganz in derselben Lage befand sich Jack, nur im entgegengesetzten Sinne. Allerdings hatte er als gebildeter Kulturmensch, der von Afrika mehr weiß als ein Afrikaner von Europa, doch einige Vorteile auf seiner Seite, und dann war Jack eben ein Mann, der sich zu helfen wusste.
Wegen des Weges würde er wohl niemals viel zu fragen brauchen. Es gab hier nur einen einzigen ausgetretenen Weg, und der führte nach Abomey, und die Spuren der Karawane musste auch jeder andere Mensch mit Leichtigkeit verfolgen können.
Zuerst führte die Heerstraße durch eine sandige Steppe, wie sie die Küste von ganz Afrika charakterisiert.
Jack war erst eine Stunde in scharfem Trabe geritten und sann über die Wasserfrage nach, die er in einem vor ihm auftauchenden Walde lösen zu können hoffte, als er schon sein Verhängnis kommen sah.
Plötzlich tauchte hinter den Bäumen ein großer Trupp Reiter auf, denen eine noch viel größere Anzahl Männer zu Fuß folgte. Es waren Neger, Jack sah in der Sonne Waffen aller Art blitzen — — Soldaten!
Was tun? Dass er der Truppe nach links oder nach rechts ausweichen könne, daran zweifelte Jack nicht. Seine Rappstute wurde von keinem hiesigen Pferde eingeholt, und die Musketenflinten fürchtete er so wenig wie die Bogen und Pfeile, welche er schon unterscheiden konnte.
An solch einer Vorstellung aber lag ihm nichts. Er wollte sich nicht gleich als verfolgten Flüchtling im Lande fühlen, vielleicht konnte die Sache auch noch anders arrangiert werden, gesehen war er nun doch einmal, und sein Entschluss war gefasst — er sprengte frisch weiter.
An der Spitze des Zuges ritt ein alter Neger, über den von hinten ein mächtiger Sonnenschirm gehalten wurde. Es war jedenfalls ein Offizier oder sonst ein Würdenträger; er war mit goldenen und silbernen Schmucksachen behangen, sein Schwertgriff war, wie die ganze Scheide, mit blitzenden Edelsteinen besetzt. Aber auch die anderen Reiter um ihn her mussten Offiziere oder Häuptlinge sein, die meisten trugen silberne und gar goldene oder doch vergoldete Schuppenpanzer.
Jedenfalls war das eine ganz, ganz vornehme Negergesellschaft, die da angerückt kam.
Und Jack ritt direkt auf sie los. Dicht vor dem Alten brachte er mit einem Ruck sein Pferd zum Stehen.
»Wer bist du?!«, fragte er jenen in ziemlich herrischem Tone.
Die Neger hatten den einzelnen, bis an die Zähne bewaffneten Reiter schon von Weitem gesehen, hatten Bemerkungen ausgetauscht, plötzlich war dieser in gestrecktem Galopp auf sie losgesprengt gekommen, wohl hatten sie hastig nach den Waffen gegriffen... es lässt sich gar nicht beschreiben, wie alles kam, es ging alles so schnell — — plötzlich hält der fremde, weiße Mann dicht vor dem allerhöchsten Anführer und fragt ihn in gröbstem Tone, wer er sei.
Es war einfach alles baff, einer machte immer ein dümmeres Gesicht als der andere.
»Na, wer bist du denn?!«, fing jetzt aber Jack wirklich an zu schnauzen. »Weißt du das nicht? Kannst du nicht sprechen? Oder hast du deinen Namen vergessen?«
Das Gesicht des alten Negers ward immer dümmer und immer dümmer.
»Ich — ich — ich — — — bin bin bin bin«, brachte er endlich heraus, »ich bin der Gao von Dahomey.«
»Aha, du bist der Chef der Armee, der sogenannte Generalfeldmarschall von Dahomey! Das ist ausgezeichnet, du kommst mir wie gerufen! Hier — — lies mal!«
Und Jack griff in seinen langen Stiefelschaft, zog ein Papier hervor, faltete es auseinander und hielt es dem Generalfeldmarschall unter die Nase.
»Weißt du, was das ist?! Lies mal laut vor!«
Der Höchstkommandierende von Dahomey sah ein buntes, sehr hübsch ausgeführtes Plakat, es war mit Schrift ausgefüllt, Jack hatte vielleicht geglaubt, der schwarze General könnte nicht Englisch lesen, aber er konnte es doch, und der Alte las mit stockender, ängstlicher Stimme vor:
»Hotel Terminus, New York. Speisekarte. Schildkrötensuppe mit Madeira, 75 Cent. Karpfen blau, l00 Cent. Schnitzel à la Holstein, 75 Cent. Schweinsrouladen mit Sauerkraut...«
Es war dem verwegenen Mann nicht gerade angenehm, dass der Generalfeldmarschall die Speisekarte des New Yorker Hotels, in dem Jack logiert hatte, wirklich lesen konnte, aber er bemerkte sofort, dass der Neger den Sinn entweder nicht verstand oder einfach ganz perplex war, jedenfalls war es nun einmal geschehen, nun wollte er das kühne Spiel auch durchführen.
»Könnt ihr Heiducken nicht Ehrfurcht bezeugen, wenn der Gao euch meine Legitimation vorliest?!«, schnauzte Jack die umstehenden Offiziere wieder aufs Grimmigste an.
Sofort senkten diese sämtlich das Haupt und legten die eine Hand vor die Augen.
»Lies weiter vor!«
»Schweins — Schweins — Schweinsrouladen mit Sauerkraut und Erbsenbrei, 60 Cent«, las der Generalfeldmarschall mit weinerlicher Stimme vor.
»Allah ist Allah, und Mohammed ist sein Prophet!«, erklang es murmelnd im Chor.
»Rindszunge mit grünen Bohnen, 75 Cent.«
»Allah ist Allah, und Mohammed ist sein Prophet.«
»Hammelrippchen mit sauren Linsen, 60 Cent.«
»Allah ist Allah, und Mohammed ist sein Prophet.«
»Kalbsgekröse nach deutscher Art, 80 Cent.«
»Allah ist Allah, und Mohammed ist sein Prophet.«
Und so wurde das ganze Menu abgebetet, bis zuletzt:
»Fromage de Brie, 30 Cent.«
»Allah ist Allah, und Mohammed ist sein Prophet!«, sang der Chor mit der Hand vor den Augen.
»Schweizerkäse mit Butter und Brot, 40 Cent.«
»Allah ist Allah, und Mohammed ist sein Prophet.«
»Amen«, sagte Jack, nahm dem Alten die Speisekarte aus der Hand und deutete auf einen großen Saucefleck, der unten das Papier zierte.
»Und das ist der Stempel!! Verstanden? Und hierher schreibst du jetzt deinen Namen und drückst dein Siegel darunter! Vorwärts!«
Gehorsam brachte der Alte ein Futteral zum Vorschein, entnahm ihm ein gespaltenes Bambusrohr, auf der anderen Seite der hölzernen Büchse befand sich angeriebene Tusche, er spuckte noch einmal hinein und malte auf die bezeichnete Stelle einige Krähenfüße.
»Und nun dein Siegel! Du hast es doch hoffentlich bei dir?«
Jawohl, der Generalfeldmarschall hatte einen regelrechten Kautschukstempel bei sich, sogar mit sehr wertvollem Griff, und Jack ließ seine visierte und bestätigte Speisekarte wieder im Stiefelschaft verschwinden.
Dann sah er sich im Kreise der Offiziere um, doch alles ging blitzschnell, ohne jeden Aufenthalt.
»Eins — zwei — drei — vier — fünf —sechs«, zählte er ab, jedes Mal eine gepanzerte Brust berührend. »Ich erwähle euch zu meinen Begleitern. Kommt mit! Marsch!!«
Und Texas Jack ritt in schlankem Trabe davon, er passierte noch eine stattliche Reihe von Kavallerie und noch mehr Infanterie — — und gehorsam folgten ihm die sechs ausgewählten Offiziere.
Das war keine Zauberei. Sie waren düpiert, es gibt gar keinen anderen Ausdruck dafür.
Jack blickte sich nicht noch einmal um, das gehörte sich nicht für die Rolle, welche er spielte, aber er war fest überzeugt, dass jetzt noch alle wie die Salzsäulen dastanden, glaubend, sie hätten nur einen Traum gehabt.
Und was dann?
»Hm, hm, hm«, brummte Jack vor sich hin, »durchkommen werde ich auf diese Weise, dem Kühnen gehört die Welt, und zur Welt gehört auch Dahomey.
Aber wie dann wieder zurück? Das weiß der liebe Gott — — — ich nicht. Und doch, so ist es das allerbeste, so komme ich am schnellsten vorwärts.«
Nun wollen wir erst einmal eine Frage aufwerfen.
In welcher Sprache hatte er sich denn mit dem Gao unterhalten? Dieser hatte allerdings Englisch lesen können, aber hatten auch alle andern Neger Englisch verstehen können?
Dieser Texas Jack war in gewisser Hinsicht ein verschlossener und ganz kurioser Mensch.
Er hatte sich während der letzten Stunde in New York von dem alten Ibrahim über die Zustände in Dahomey erzählen lassen — — er hatte jeden Menschen um Rat gefragt — — natürlich, er kam ja in ein ganz fremdes Land, war überhaupt noch nie in Afrika gewesen — — — — und jetzt mit einem Male sprach er geläufig das reinste Dahomey.
Nicht, dass er dies überhaupt konnte — das war das Seltsame nicht. Das hatte er eben gelernt. Er war ein ganzes Jahr lang mit DahomeyWeibern auf dem europäischen Kontinent gereist, Buffalo Bill hatte sie engagiert gehabt, und Jack interessierte sich für fremde Sprachen, er lernte sie spielend leicht in der täglichen Unterhaltung, und er wusste noch manches andere, wie es in Dahomey aussieht und was da Sitte ist und was nicht, wie man einen Bauern begrüßt und wie man sich benimmt, wenn man vor den König kommt.
Nein, das Merkwürdige dabei war, dass Jack von alledem kein Wort verlauten ließ. Er hatte auf dem Dampfer Manches zu hören bekommen, was er für falsch hielt, er wusste es wirklich besser, aber weshalb den Betreffenden korrigieren? Dann fühlte sich dieser doch nur beleidigt und konnte sagen: »Na, wenn Sie es besser wissen, dann brauchen die mich ja nicht erst zu fragen«, — — und Jack konnte unter Falschem doch auch vielleicht wertvolles Richtiges zu hören bekommen. Aber nicht einmal seinem Schwiegervater gegenüber hatte er ein Wort davon verlauten lassen, dass er die Sprache und die Sitten und Gebräuche des Landes kenne. Warum nicht? Er hielt es eben nicht für nötig. Er renommierte nicht. Wenn das jemand bei Gelegenheit erfuhr, wenn es darauf ankam, so war das ja immer noch zeitig genug.
Es gibt schon noch andere Menschen, welche dieselbe Eigentümlichkeit besitzen, und das sind gewöhnlich solche, welche etwas gelernt haben, etwas können und es im Leben zu etwas bringen. — — —
So war er nach seiner Erfahrung jetzt fest überzeugt, durch dieses verwegene Spiel unangefochten durch das ganze Reich zu kommen.
Die Hauptstadt durfte er allerdings nicht passieren, da hätte er sich Förmlichkeiten unterwerfen müssen, bei denen er nicht mit seiner Speisekarte imponieren konnte. Abomey musste eben umgangen werden. Aber sonst wollte er durch jede Stadt kommen, kraft des Ansehens der sechs jedenfalls hohen Offiziere, die er hinter sich hatte, und die musste er in geistiger Knechtschaft halten, darauf kam es an, und das verstand Jack wie noch manches Andere.
Er war der unnahbare Gebieter. Er fragte sie nicht etwa nach dem Namen, was für einen Rang sie bekleideten — die sechs Negerhäuptlinge in silbernen und goldenen Panzern waren für ihn einfach Luft. Er wollte sich eine Zigarre anbrennen, er winkte nur mit dem Finger — — und sofort sprangen sie gehorsam zu ihm hin, sie lasen ihm die Wünsche an den Augen ab. Was sie dabei dachten, das war ihm ganz egal, die Hauptsache war, dass sie gerade so waren, wie er sie haben wollte.
Wie das nur möglich ist? Du lieber Gott, wir haben doch in unseren modernen Kulturstaaten ganzgenau dieselben Beispiele, jeden Tag kann man in der Zeitung davon lesen.
Da kommt ein feiner Herr, er lebt wochenlang, monatelang im teuersten Hotel, nichts ist ihm fein genug, er lässt sich goldene Uhren und Juwelen vorlegen, er wird gebeten, sie doch nur zu nehmen, Bezahlung ja ganz Nebensache — — — und dann stellt sich heraus, dass der Schwindler überhaupt keinen Pfennig in der Tasche hat. Und woher das Entgegenkommen? Na einfach, weil der Mann seinen Zylinder und seine Glacéhandschuhe zu tragen weiß!!
Oder wie ist denn das mit dem Falle Humbert in Paris? Eine einfache Frau vom Lande behauptet zwanzig Jahre lang, in ihrem Geldschranke hundert Millionen Franken liegen zu haben, das wird ihr zwanzig Jahre lang geglaubt, und daraufhin weiß sich diese Frau von den größten und solidesten Bankhäusern nach und nach fünfzig Millionen Francs zu erschwindeln!!!
Wenn ein Schriftsteller so etwas in einem Romane erfinden wollte, so würde ihm das kein Mensch glauben, kein Mensch, und der Verlagsbuchhändler hätte ganz recht, wenn er die Arbeit mit der Bemerkung zurückschickte: »Du bist verrückt, mein Kind!«
Und in der Wirklichkeit passiert es!
Deshalb soll man den erfahrenen Weltleuten glauben, welche immer wieder versichern, dass in der Wirklichkeit noch ganz, ganz andere Geschichten passieren, als die kühnste Phantasie eines Romanschreibers ersinnen kann! — —
Hier lag ein ähnlicher Fall vor, nur in Bezug auf afrikanische Verhältnisse.
Jack hatte die ganze vornehme Gesellschaft durch die so schön gemalte Speisekarte und mehr noch durch sein dreistes Auftreten düpiert, und er verstand, die sechs mitgeschleppten Häuptlinge nicht wieder aus ihrer Düpiertheit herauskommen zu lassen. Aber Jack dachte nicht daran, diese sechs Neger etwa die ganze Reise mitmachen zu lassen! Sein Rassepferd konnte jeden Tag achtzig englische Meilen zurücklegen; die schlechten Pferde von der westafrikanischen Küste dagegen sind jedem Pferdehändler bekannt, die hier konnten schon nach der ersten Stunde mit der Rappstute nicht mehr gleichen Schritt halten im einfachen Trab, und nicht minder schwitzten die gepanzerten Reiter bereits Blut. Außerdem hätte dies bei längerem Beisammensein doch einmal ein böses Ende nehmen müssen.
Aber da gab es noch ein besseres Mittel.
»Halt! Absteigen!«, kommandierte Jack auf einer Waldblöße, auf der ein großer Stein lag, den Jack gerade als Tisch gebrauchen konnte. »Ich werde mich beim Mehu über euch beschweren, oder der Goa soll euch bessere Pferde geben, ihr kommt nicht mit. Jetzt stellt ihr mir einen Pass aus, und jeder einzelne von euch haftet für meine Sicherheit mit seinem Kopfe. Verstanden?!«
Verstanden hatten die Häuptlinge, sie besprachen sich, was sie schreiben sollten, machten dem ›Großen Unbekannten‹ Vorschläge, bis dieser zufrieden war, auch sie hatten Schreibgerät und Stempel bei sich, der platte Stein diente als Tisch, der Passepartout ward auf der Speisekarte ausgestellt, sodass also auch des Generalfeldmarschalls Name und Stempel darunter stand, und fünf Minuten später jagte der intelligente Jack schon wieder mit verhängten Zügeln durch den Urwald, im Stiefelschaft jetzt einen richtigen Pass, der ihm nichts weiter gekostet hatte als im Ganzen zehn Minuten und einige grobe Worte, während er sonst ebenso viele Tage und — nach deutschem Gelde gerechnet — gegen 10 000 Mark gebraucht haben würde, um nur die Erlaubnis zu erhalten, durch das Land reisen zu dürfen.
Das Richtige war dies freilich noch lange nicht, und jetzt hieß es auch die Beine unter die Arme nehmen!
Denn der schwarze Heerführer war doch jedenfalls nach Port José geritten. Dort sprach er doch natürlich die verliebte Kommandeuse. Und die würde ihm selbstverständlich über den einsamen Reiter reinen Wein einschenken. Na, und da würde dieser Generalfeldmarschall nicht schlecht spucken!
Das aber schadete gar nichts. Mochte hinter Jacks Rücken nur immer lustig gespuckt werden. Die Hauptsache war, dass er von keiner Botschaft überholt wurde!
Und wie sollte das möglich sein? Von einem eingeborenen Pferde konnte er nicht überholt werden, dafür wollte er schon sorgen, und noch weniger von einem menschlichen Renner. Das einzige, was hier in Betracht kam, und was ihm an Schnelligkeit überlegen war, das war der Schall, benutzt bei der bei allen Negervölkern verbreiteten sogenannten Batusprache. Das ist ein Telegrafieren mittels großer Trommeln. Oder man kann auch einen hohlen Baumstamm dazu benutzen. Die Trommel wird taktmäßig geschlagen, jeder Takt ist ein Buchstabe, und wer es hört, der gibt das Telegramm weiter, sodass dieses in wenigen Minuten im ganzen Reiche verbreitet sein kann.
Doch so einfach ist das schließlich nicht. Da müssen bei besonderen Gelegenheiten, wie in Kriegsfällen, eben erst solche Telegrafenlinien gebildet werden.
Kurz, Jack glaubte, das Beste getan zu haben, was er hatte tun können, so verwegen auch alles gewesen war, und mit verhängten Zügeln sprengte er weiter dem Westen zu, in die Wildnis hinein, um womöglich schon am fünften Tage seine Aufgabe gelöst zu haben.
Aber der Mensch denkt, und Gott lenkt!
Es sind drei Tage vergangen. An dem Saume eines Waldes hält ein Reiter und wird Zeuge eines ebenso furchtbaren wie schönen Schauspieles, das sich auf der weiten Steppe vor ihm abspielt.
Ein mächtiger Elefant mit kolossalen Stoßzähnen ist mit Trompetengebrüll hinter einem Menschen her, hinter einem Weibe.
Es ist eine noch junge Frau. Der ihr noch nicht bis an die Knie reichende Rock hindert sie nicht im Laufen, sie ist von wahrhaft herkulischem Körperbau, und sie rennt mit gewaltigen Sätzen schnell wie der Wind, dass ihre langen, schwarzen Haare wie vom Sturme gepeitscht flattern.
Doch einem Elefanten kann sie nicht entgehen, der soll ja das schnellste Pferd einholen. Er scheint nicht verwundet zu sein. Man sieht es gleich seiner Größe an, dass er ein sogenannter Einsiedler ist, ein von der Herde verstoßenes männliches Tier, welches einsam in der Wildnis umherirrt und beim Anblick irgendeines lebenden Wesens gleich in Tobsucht gerät, es unter seine Füße stampfen will, während sonst der Elefant doch sehr friedliebend ist.
Die Frau ist bewaffnet gewesen. Am Boden liegt ein gewaltiges Schwert, die Klinge ist wohl zwei Meter lang und entsprechend lang der hölzerne Griff, also mehr eine Art gerader Sense. Die DahomeyKriegerinnen werden denn auch nach diesem ihrem Schwerte, der Hauptwaffe, von den benachbarten Völkern ›Mäherinnen‹ genannt.
Die Dahomey kommt immer wieder dicht an der Stelle vorbei, wo das Schwert liegt, denn sie schlägt beständig Haken, um dem schnelleren Elefanten zu entgehen, der stets etwas über das Ziel hinausschießt, aber sie muss von dem lang ausgestreckten Rüssel schließlich doch noch erfasst und in die Luft geschleudert werden, denn das Viereck, das sie auf diese Weise beschreibt, wird immer kleiner und kleiner.
Könnte sie den Wald gewinnen, so wäre sie vielleicht gerettet, aber das weiß der kluge Elefant auch, und sie muss ja überhaupt immer Haken schlagen, wodurch sie ihr schreckliches Ende doch nur etwas verzögert.
Das Schwert hebt sie nicht auf, sie kommt nicht dazu, es hätte auch gar keinen Zweck.
Die furchtbare Todesangst ist ihr im Gesicht zu lesen, und der am Waldessaum haltende Jack beobachtet alles.
»Es ist eine DahomeyKriegerin«, kalkuliert er kaltblütig. »Sie trägt am linken Arme nicht nur silberne Spangen, sondern sogar goldene, also ist sie eine Anführerin, jedenfalls eine sehr hohe. Retten werde ich sie selbstverständlich. Vorläufig hält sie es noch aus. Dann lasse ich mir im Augenblicke ihrer höchsten Dankbarkeit dafür, dass ich sie vom sicheren Tode gerettet habe, einen Pass geben, und habe ich Glück, dass es wirklich eine sehr hohe Anführerin ist, vielleicht gar die Sambone, so kann es ein solcher Pass sein, der mich gleich aller Sorge entledigt, der sogar vom König und allen seinen Ministern respektiert wird, denn diese Weiber spielen hier doch die erste Geige. Und ehe die schwarze Dame auf irgendwelche andere Gedanken kommen könnte, auf welche Möglichkeit mich Donha Inês vorbereitet hat, würde ich schon wieder mit meinem kostbaren Passe spurlos verschwunden sein. — Ich könnte den tollen Elefanten gleich von hier aus wie eine Ratte totschießen; aber es will wohlüberlegt sein, ob das von Vorteil ist. Man muss einer Dame immer zu imponieren suchen, ganz egal, ob sie eine weiße oder eine gelbe oder eine braune oder eine schwarze oder eine rote oder eine grüne Haut hat. Eine Frau ist immer eine Frau. Einen viel größeren Eindruck macht es jedenfalls, wenn ich mich erst tollkühn dazwischenwerfe, sozusagen erst mein eigenes Leben riskiere. Das imponiert stets — besonders einer Dame. Denn ich kalkuliere, dass der verrückte Elefant dann mich verfolgen wird. Und ob er das tut oder nicht, jedenfalls kann ich ihn noch immer rechtzeitig abtun, und ich habe mich erst in Lebensgefahr gestürzt. Hm, wird gemacht!«
Es war ein ziemlich langes Selbstgespräch, welches Texas Jack in aller Seelenruhe führte, während dort das arme Weib mit vor Todesangst verzerrtem Gesicht um sein Leben rannte.
Während dieser kaltblütigen Spekulation hielt er allerdings immer sein Gewehr im Anschlag. Aber er war noch immer nicht fertig mit seinem Selbstgespräch.
»Außerdem möchte ich doch einmal sehen, wie sich Nachtmär benimmt und ob der Elefant wirklich jedes Pferd einholen kann. — Hussaaah!!«
Hiermit aber war nun das Selbstgespräch beendet. Wie ein Pfeil schoss die Rappstute zwischen den Bäumen hervor. Sie gehorchte dem Zügel, sie wusste, dass sie in der Faust ihres Reiters am sichersten war. Nur einen Meter vor der Rüsselspitze schoss sie vorbei — und richtig, der Elefant ließ ab von dem Weibe, überschlug sich fast, und dann hinter Ross und Reiter her, immer unter furchtbarem Trompetengeschmetter.
Jack jagte geradeaus, blickte sich um, ließ das Pferd Bogen schlagen, mäßigte sogar seinen Lauf.
»Keine Ahnung!«, brummte er. »Auf ebenem Boden kann kein Elefant ein nur einigermaßen gutes Pferd einholen. Wenn freilich die Jagd lange währt und es kommt einmal recht dichtes Gras, oder gar Unterholz... ei, verflucht!!«
Er hatte wieder einmal hinter sich geblickt, und da sah er, wie die Dahomey, das Sensenschwert hochgeschwungen, seitwärts auf den Elefanten einsprang und einen furchtbaren Hieb nach dem einen Hinterbeine führte. Augenblicklich stürzte das riesige Tier und wälzte sich unter einem schrecklichen Schmerzensgebrüll am Boden, unfähig, sich wieder zu erheben; die Achillessehne war ihm durchschlagen.

»Ei verflucht!«, sagte Jack noch einmal. »Ein tüchtiges Frauenzimmer, das muss man ihr lassen, aber das hätte nicht kommen sollen, das war in meiner Spekulation nicht vorgesehen. Jetzt muss ich dem Tiere wenigstens noch schnell den Garaus... ach, und nun auch noch das Unglück!!«
Er war zurückgesprengt, das Gewehr schon in der einen Hand erhoben, als die Dahomey nochmals zum furchtbaren Hiebe nach dem Kopfe des Elefanten ausholte, und aus der massigen Schläfe des Tieres spritzte das Blut meterhoch, die Schlagader war ihm geöffnet, augenblicklich lag es ganz still.
»Na, gerettet habe ich sie doch, meinen Pass muss sie mir trotzdem geben«, tröstete sich Jack, als er vollends heranritt und vom Pferde sprang.
Entweder war die Dahomey wirklich jeder Anstrengung gewachsen oder sie hatte sich beim Anblick eines fremden Mannes sofort wieder vollkommen in der Gewalt. Von der überstandenen Todesangst war keine Spur mehr in ihrem Antlitz zu lesen, und sie lehnte sich wohl gegen das tote Tier, doch kaum, dass ihr Busen nach diesem wahnsinnigen Laufe um Tod und Leben etwas höher ging.
Es war also ein noch junges, wahrhaft herkulisch gebautes Weib, mit riesiger Muskulatur, dabei hochgewachsen, ohne plump zu erscheinen. Es war eine pechschwarze Negerin, und schön konnte man dieses Gesicht durchaus nicht nennen. Es waren wulstige Lippen, eine breitgedrückte Nase und kleine, funkelnde Augen. Aber Stolz und Trotz lagen darin!
»Du hast mich gerettet, und ich habe dich gerettet — — — wir sind quitt!«, sagte sie in tiefen Gutturallauten.
Wenn Jack bei dieser Begrüßung kein verdutztes Gesicht machte, so war er doch innerlich sehr verblüfft.
»O! Gefällt hast du den Elefanten allerdings, aber mich vor ihm gerettet? Ich habe mit dem Tiere nur etwas spielen wollen, ich hätte es abgetan, wenn ich Lust dazu hatte.«
»Und ich habe dich dennoch gerettet — wir sind quitt«, beharrte das Weib.
»Und ich bestreite es! Du zweifelst, dass ich den Elefanten hätte töten können? Ich hätte ihn jederzeit ins Auge treffen können, denn meine Kugel ist unfehlbar. Sieh hier!«
Gemächlich bückte sich Jack, hob mit der rechten Hand einen Stein auf, zeigte ihn, schleuderte ihn hoch in die Luft, nahm das Gewehr in die rechte Hand, legte es aber nicht an die Wange, ein Feuerstrom entfuhr dem Lauf, und gerade als der haselnussgroße Stein seine höchste Höhe erreicht hatte, wurde er von einer unsichtbaren Gewalt in Atome zersplittert.
»So wäre ich auch mit dem Elefanten umgegangen, auch vom galoppierenden Pferde aus, in meiner Büchse lauert der unfehlbare Tod.«
Die Dahomey hatte alles scharf beobachtet, ihre Bestürzung war ersichtlich, diese paarte sich sogar mit Schreck. Aber schnell beherrschte sie sich wieder.
»Und ich habe dich dennoch gerettet«, wiederholte sie zum dritten Male, »nicht vor den Stoßzähnen dieses Elefanten, sondern vor dem Henker von Abomey. Verstehst du mich nun?«
Das war danach angetan, dass Jack stutzte und seine Gedanken eine ganz andere Richtung bekamen.
»Was? Vor dem Henker von Abomey? Was habe ich denn mit dem zu tun? Ich bin ein friedlicher Reisender.«
Jetzt trat auf dem rabenschwarzen Gesichte des Riesenweibes ein Lächeln hervor, ein ganz eigentümliches Lächeln, halb war es Grausamkeit, halb Lüsternheit, und derselbe Ausdruck stand in den kleinen, funkelnden Augen, welche den schönen Mann fast verschlingen wollten.
»Bist du nicht der Mann, welcher vor drei Tagen dem Goa die Unterschrift und das Siegel erpresste?«, fragte sie mit leiser Stimme, in der ein furchtbarer Spott lag.
»Himmelbombenelement!!«, dachte Jack, legte schnell die Hand auf den Rücken und schnalzte mit den Fingern, er lockte sein Pferd, welches sich das Gras schmecken ließ.
»Was für ein Goa ist das?«, fragte er unschuldig.
»Bist du nicht der Mann«, fuhr die Dahomey, ohne die Frage zu beantworten, mit denselben Hohne fort, »der sich dann von sechs unserer ersten Häuptlinge einen Pass ausstellen ließ?«
Jetzt hatte Jack sein Pferd neben sich, mit einem Sprunge wäre er im Sattel und fort gewesen, aber er wollte es nicht, er hatte es sich anders überlegt. Vor allen Dingen musste er jetzt wissen, wie es möglich war, dass dieses Weib alles erfahren hatte, er wollte lieber ganz offen sein, schaden konnte ihm das Weib doch nicht, er ließ es dann einfach schnell hinter sich.
»Ach so — — der Goa — — der hat meinen Pass visiert!«
»Zeige nur mal deinen Pass!«, sagte die Dahomey mit ausgestreckter Hand.
Dazu aber hatte Jack diesmal keine Lust.
»Zeige mir erst einmal deine Legitimation, wer du eigentlich bist, dass du es wagst, mir meinen Pass abzufordern.«
Die riesige Dahomey hatte sich zu ihrer vollen Höhe emporgerichtet.
»Faringi! Halte deine Zunge im Zaum!«, rief sie in furchtbar drohendem Tone. »Du sprichst mit der, welche in diesem Lande gebietet! Ich bin Sambone, vor deren Namen sich vier Millionen Menschen beugen! Und mich belüge nicht! Ich weiß alles! — — Halt! Wage keine Flucht! Du wärest verloren! Du gingest in deinen unvermeidlichen Tod! Die Tauben waren schneller als dein Pferd, und die Batutrommel hat das ganze Land alarmiert! Du bist ein löwenkühner Mann, du bist bei Nacht zwischen den Haifischen an unsere Küste geschwommen und bist ohne Erlaubnis in unserem Lande schon so weit gekommen, wie ich es niemals für möglich halten würde, wenn ich dich jetzt nicht mit eigenen Augen sähe. Aber weiter kommst du nicht! Alle Wege, die du nur betreten könntest, sind dir verlegt, und du kennst nicht die Waffen und Listen, welche wir zu gebrauchen verstehen, um dem Feinde die Wege zu verlegen. Überall lauern im Hinterhalte versteckte Soldaten mit vergifteten Pfeilen auf dich, und dein Pferd ist lahm, denn wo es hintritt, da hat es einen dreizackigen Dorn im Huf, und springst du aus dem Sattel, so stürzt du in eine mit vergifteten Lanzen gespickte Fallgrube. — — Faringi, gib jeden Gedanken an Flucht auf, vertraue dich lieber mir an, ich rate dir gut!«
Ja, wenn es so stand, dann verzichtete Jack lieber auf einen Fluchtversuch. Jetzt war es heraus, jetzt musste er andere Mittel und Wege finden, um schnellstens weiterzukommen.
Also hier hatte man schon eine Taubenpost! Richtig! Jetzt entsann er sich, dass er zwischen den schwarzen Soldaten einen großen Kasten gesehen hatte. Aber dass darin Tauben zur Beförderung von Nachrichten sein konnten, auf die Vermutung war er freilich nicht gekommen. Und hier, wo man noch keine Eisenbahn und keinen Telegraf kannte, war man wahrscheinlich mit der Taubenpost schon viel weiter. Wir haben diese Art von Briefbeförderung ja erst von wilden Völkern gelernt.
»Du hast mein Leben gerettet, ich habe dein Leben gerettet — — wir sind quitt«, wiederholte Sambone immer noch einmal. »Aber ich meine eigentlich, ich werde dein Leben noch retten. Doch indem ich — ich, Sambone — dies sage, bist du schon gerettet. Nein, du kühner Mann sollst nicht von feigen Sklaven zerrissen werden. — Komm, folge mir, und sei getrost, du stehst unter meinem Schutze!«
Sie winkte, wandte sich um und ging mit weit ausgreifenden Schritten dem Walde zu. Jack folgte ihr zu Fuß, sein Pferd wieder ihm wie ein Hund.
»Was werde ich...«, begann er einmal unterwegs.
»Schweig!«, unterbrach sie ihn sofort. »Vertraue dich mir an, der du mir das Leben gerettet hast.«
Er versuchte noch einmal eine Frage zu stellen und wurde wieder abgewiesen. Da verzichtete er auf einen weiteren Versuch.
In persönlicher Sicherheit fühlte er sich. Er wusste, wie ernst und heilig es gerade bei wilden Völkern mit dem Lebensretter genommen wird, welche Pflichten der Gerettete übernehmen muss. Eine andere Sorge als die um sein eigenes Leben erfüllte ihn. Aber jetzt war es zu spät. Die Kommandeuse hatte recht gehabt: Es war unmöglich, ohne Erlaubnis durch dieses Land zu kommen. Die Taubenpost hatte alles verdorben.
Hinter dem Walde befand sich ein großes Lager, vornehmlich von Frauen erfüllt, als blaue Partei gekennzeichnet.
Sambone war unnahbar wie eine Königin. Bedient aber wurde sie nur von Männern.
»Gib deine Waffen ab!«
»Habe ich dich vom Tode gerettet, damit du mich als Gefangenen behandelst?«
»Nicht als Gefangener wirst du behandelt, sondern als Angeklagter. Erst kommt die Gerechtigkeit, unter welcher auch ich stehe. Gib deine Waffen ab und vertraue dich mir an!«
In diesem großen Lager war keine Aussicht auf ein Entkommen mehr vorhanden. Jede Gegenwehr wäre Selbstmord gewesen. Aber um sich befreien zu können, dazu muss man sich dem Leben erhalten. Jack gab seine Waffen ab, sein Scheckbuch, seine Speisekarte, alles. Dann streichelte er sein Pferd, flüsterte ihm etwas ins Ohr, und es ließ sich fortführen.
Jack hatte die Hauptstadt schon weit hinter sich gehabt, er war nach Abomey zurücktransportiert worden, seit acht Tagen befand er sich als Gefangener in einem Raume, ans dem es kein Entweichen gab.
Es war ein geräumiges Gemach, die Wände aus massiven Quadersteinen, Licht und Luft drangen von oben herein, und die Decke war unerreichbar hoch.
Jedenfalls befand er sich in einem Zimmer des königlichen Palastes, und Abomey ist nicht etwa ein elendes Hüttendorf!
Der Gefangene hatte kaum etwas Anderes zu wünschen als die Freiheit. Nach modernem Geschmack war das Gemach freilich nicht möbliert, aber nach dahomeyischen Begriffen jedenfalls sehr komfortabel. Das Hauptmöbel war das Bett, aus vier Holzpfählen bestehend, mit dünnem Rohr überspannt, aber mit den kostbarsten Stoffen aus Wolle, Samt und Seide belegt, und so verband sich hier überall die größte Einfachheit mit dem höchsten Luxus — ein plumper Reichtum!
Einen Menschen hatte Jack während der acht Tage noch nicht zu sehen bekommen. Zu gewissen Zeiten schob sich ein Quaderstein in der Mauer zurück, in dem dunklen Loche fand er die Schüsseln mit frisch bereiteten Speisen, immer das Beste, was das Land bieten konnte. Er schrie einmal hinein, ob er nicht Tabak und Pfeife haben könne, bald darauf schob sich der Stein wieder zurück, und er fand in dem Loche ein großes Paket amerikanischen ›Overwater‹, eine in England fabrizierte Pfeife und schwedische Zündhölzer ›utan svafel ok phosphor‹. Er schrie in das Loch, ob er nicht einen Kamm bekommen könnte, und das Zauberloch spendete einen englischen Gummikamm ›made in Germany‹.
Texas Jack war unter Indianern aufgewachsen, und das merkte man ihm an. Mit Appetit leerte er immer sämtliche Schüsseln, mit Gleichmut lag er rauchend auf der seidenbedeckten Pritsche, dann machte er sich durch Hin- und Hergehen neuen Appetit und fing mit den Schüsseln wieder an.
Was sollte er auch anderes tun? Sollte er weinen und die Hände ringen? Das bringt keinen Stein aus den Fugen.
Was er dabei dachte, das ist eine andere Sache!
Am neunten Tage, als Jack wieder so rauchend auf der Pritsche lag, rasselte es an der Wand. Diesmal entstand eine größere Öffnung, drei beturbante Männer erschienen, die zwei hinteren, welche an der Tür als Wächter stehen blieben, mit furchtbaren Schwertern bewaffnet, der dritte, welcher auf Jack zuging, mit schweren Ketten in der Hand, die er einladend ausstreckte.
»Lass dich fesseln, Faringi!«
Jack gähnte erst einmal, sich dabei anständig die Hand vor den Mund haltend, richtete sich auf und klopfte sorgsam die Pfeife an der Stiefelhacke aus.
Dabei überlegte er, wie es wäre, wenn er jetzt dem Kettenmann einen Tritt in den Bauch gab, vorsprang, die beiden Schwertträger beim Kripse(1) packte, sie mit den Köpfen zusammenschmetterte — und dann mit ihren Waffen hinaus an die frische Luft!
(1) Heute würden wir sagen ›beim Kragen packen‹.
Nein, er verwarf diesen Plan. Wer wusste, ob außerhalb jenes Mauerloches die Luft wirklich so frisch war? Nein, das war keine gute Idee. Vorläufig musste er auf Sambones Wort bauen, das war jetzt unbedingt das Allerreellste.
Er streckte also die Hände aus.
Der Neger legte ihm zwar schnell die Ketten an, doch er schien zu stutzen.
»Weißt du, was deiner wartet, Faringi?«
»Nein, keine Ahnung.«
»Dir wird jetzt der Kopf abgeschlagen.«
»Sooo? Das ist mir sehr unangenehm. Ich bin doch aber noch gar nicht vor einen Richter gekommen.«
»Das ist nicht nötig. Du bist schuldig befunden und zum Tode durch des Henkerschwert verurteilt worden.«
»In meiner Abwesenheit? Ich kann dieses Gerichtsverfahren durchaus nicht billigen.«
»Faringi, und du nimmst das so ruhig hin?«, staunte der Neger.
»Ja, was soll ich denn dagegen tun?«
»Hoffe nicht etwa auf Gnade. Das Henkerschwert wartet schon auf dich.«
»So tu deine Pflicht!«
Er wurde von den dreien in die Mitte genommen und hinausgeführt.
Das war ungefähr so, wie in den achtziger Jahren der Siouxhäuptling Sitting Bull wegen hundertfachen Mordes zum Tode durch den Strang verurteilt wurde.
Die Hinrichtung fand in Washington statt, in Gegenwart aller roten Verwandten, neben dem Galgen stand schon der Sarg, und die Verwandten lobten sehr den schönen Sarg, und Sitting Bull legte sich erst einmal probeweise hinein und meinte unzufrieden, der Sarg sei doch etwas zu klein, da könne er sich nicht bequem genug ausstrecken. —
Auf seinem letzten Gange erkannte Jack, dass eine verzweifelte Flucht nicht geglückt wäre. Es ging durch mehrere Tunnels treppauf und treppab, jedenfalls immer unter der Erde.
Dann hörte er ein Gemurmel, plötzlich blendete ein helles Licht seine Augen, und als er sich daran gewöhnt hatte, erblickte er sich in einem zirkusähnlichen Bau, nur oben offen, also ein Zirkus, wie ihn die alten Griechen und Römer hatten.
Der innere Raum war von amphitheatralischen Sitzen umgeben, auf denen sich das schwarze Volk Kopf an Kopf drängte, viele, viele Tausende, es wogte und murrte wie ein brandendes Meer, und der innere Raum war — die Richtstätte!
Den Ehrenplatz nahm der König ein. Er saß auf einem goldenen Throne unter rotseidenem Baldachin, zu beiden Seiten standen einige Hundert der weiblichen Garde, die auserlesensten Frauen, alle bewaffnet und aufs Prächtigste gekleidet wie die weiter seitwärts stehenden höchsten Würdeträger, unter denen der Kambode hervorzuheben ist, der Zeremonienmeister, welcher mit einer goldenen Glocke läutet, wenn der König sprechen will, und desgleichen, wenn der König hustet oder niest, worauf sich alles Volk zur Erde werfen muss, wie der König überhaupt an die strengste Etikette gebunden ist, wie noch gleich gezeigt werden soll.
Jack hatte die Beschreibung des englischen Reisenden Walter Wallon gelesen, welcher lange Zeit am Hofe von Abomey gelebt hat, und er fand alles bestätigt. Alle Anzüge schimmern von Gold, Edelsteinen und den kostbarsten Stoffen, und die ritterlichen Uniformen der weiblichen Garde sind von einer phantastischen Pracht, mit der sich keine militärische Equipierung Europas vergleichen kann. Vor dem König befindet sich ein mit Kauris verzierter Platz, von zwölf prächtigen Sonnenschirmen beschattet, unter denen zahllose farbige Gläser stehen, deren jedes eine Tugend des Königs vorstellen soll. Es sind also seine Insignien.
Der König selbst aber ist unsichtbar. Er sitzt auf seinem Throne unter einem schwarzseidenen Sacke, schon mehr eine Kiste aus steifem Zeuge. Noch niemand hat den König von Dahomey gesehen. Er darf nicht gesehen werden. Wer ihn sieht, der ist des Todes. Das sind eben Zeremonien. Wenn ihn einmal jemand essen sehen sollte, so muss ganz Dahomey zugrunde gehen. Ja, wenn er spricht, muss sich sogar alles die Ohren zuhalten. Dafür freilich donnert er auch aus seinem Kasten heraus durch ein Sprachrohr. Betont aber muss werden, dass der König deswegen keine göttliche Verehrung genießt, er gilt nicht etwa für unsterblich, die Thronfolge geht auf den ersten Sohn über — es sind eben alles nur Zeremonien. Dieser Unterschied ist nämlich sehr wichtig.
Da plötzlich entrang sich Jacks Brust ein heiseres Stöhnen, und er duckte sich wie ein Tiger zum Sprunge zusammen — dort oben in einer Art von Loge, wo sich hohe Beamte nur als Zuschauer befanden, da stand auch ein weißer Mann — — Jack hatte ihn noch nie gesehen, und er kannte ihn doch! — — den großen, hageren, eleganten Mann mit dem spitzen, schwarzen Vollbarte und dem scharfen Scheitel in der Mitte! — — der Entführer seines Mariechens und der Vernichter seines Lebensglückes!! — — und er sah keine Möglichkeit, zu ihm zu gelangen, um ihn mit seinen Händen langsam zu erdrosseln, ihm wenigstens die schwere Kette auf das verfluchte Haupt zu schmettern — — — er war rings umstellt von Wächtern, die wegen der Nähe des Königs jede seiner Bewegungen bewachten, die ihn sofort niedergestoßen hätten — — und dort starrte erst recht alles von Lanzen und Schwertern und Dolchen...
Und der weiße Mann hatte nur darauf gewartet, dass Jack ihn erblickte, und jetzt hob der Bösewicht mit einer Handbewegung auch noch die Achseln, als wollte er sagen:
»Armer Kerl, es tut mir sehr leid, aber ich kann dir nicht helfen!«
Noch ein Stöhnen, noch ein Zähneknirschen, und Jack wandte sich von seinem Todfeinde ab.
Nein, er musste am Leben bleiben, um dereinst noch an jenem furchtbare Rache nehmen zu können.
Aber die Hoffnung auf Rettung schwand immer mehr. Es ging schnell. Der weiße Landfriedensbrecher war der letzte Delinquent, auf den man nur gewartet hatte.
Dort, wo sich im antiken Zirkus und im modernen Theater die Bühne befindet, befand sich hier die Richtstätte, schließlich auch eine Art von Bühne, sehr, sehr hoch angebracht, viele steinerne Stufen führten auf das Forum, auf welchem neben dem Richtblock der harlekinartig gekleidete Scharfrichter, jedenfalls zugleich Zauberer und Regenmacher, mit einem mächtigen Schwerte stand. Den ersten, welcher von den beiden Henkersknechten hinaufgeführt wurde, erkannte Jack gleich wieder. Es war der Gao, der sein Vergehen, dass er sich von einer Speisekarte hatte narren lassen, mit seinem Haupte büßen musste.
Ohne Gewissensbisse schaute Jack zu. Das war nicht sein Opfer. Dem Manne geschah ganz recht.
Die Henkersknechte drückten ihn hinter dem Steine auf die Knie nieder, sie gingen wieder, der Scharfrichter hatte den Delinquenten bei den Haaren erfasst und drückte den Kopf so auf den Richtblock nieder, nur mit der einen Hand schwang er das krumme Schwert, es sauste herab, ein Blutstrahl spritzte empor, der Henker zeigte einen Augenblick das abgeschlagene Haupt, es an den Haaren haltend, in seiner erhobenen Hand, dann warf er es hinter den Stein, und gleichzeitig war es, als ob dort oben auch der kopflose Rumpf verschwände. Es musste dort hinter dem Richtsteine eine Falltür angebracht sein, welche sich bei einer Bewegung des Henkers öffnete und Haupt und Rumpf verschlang, damit diese dann nicht im Wege waren.
Und da war schon wieder einer oben. Den kannte Jack auch. Das war einer der Offiziere, die ihm den Pass ausgestellt hatten. Und sie kamen alle, alle daran, sowohl die beiden Dorfschulzen, die ihn respektvoll beherbergt hatten, wie das arme, schwarze Bäuerlein, welches ihm für sein Pferd Mais gegeben hatte.
Und es ging schnell! Dieser schwarze Harlekin hatte im Kopfabhacken eine fabelhafte Fertigkeit. Das machte die viele Übung. Es ging wie das Schweinestechen. Auf die Knie nieder, bei den Haaren gepackt, ein Hieb, ein Blutstrahl, den Kopf bei den Haaren in die Höhe gehalten, weg damit, ein anderer her!!
Und leerer und leerer ward es um Jack herum.
Und dann stand er allein zwischen seinen beiden Wächtern.
»Komm, Faringi!«
Zwei eiserne Fäuste packten seine Arme und rissen ihn nach der steinernen Treppe.
Und auch Jack war ein Mensch! Er hatte doch bis vorhin noch Hoffnung gehabt! Ja, er hatte auf Sambone ganz bestimmt gehofft!! Und dort stand sie neben dem Throne, vermied ihn anzublicken. Und kein heimliches Wort traf sein Ohr.
Und auch Jack war ein Mensch! Sein gesundes Antlitz hatte sich aschgrau gefärbt. Es kam ihm etwas in den Sinn, er hatte es einmal gelesen oder gehört, das sind eben solche Augenblicke, da man besondere Einfälle bekommt:
»So sterb' ich im Purpur, wie mir geweissagt worden ist«, flüsterte er mit bebenden Lippen. Dann aber erstieg er festen Schrittes die hohe Treppe. Es half ja alles nichts. Einmal muss der Mensch doch sterben. Und wie ein Mann wollte er wenigstens sterben!
Er wurde oben in nächster Nähe noch Zeuge, wie sein Vorgänger enthauptet wurde, und mit Interesse schaute er zu, mit wirklichem Interesse, wenn es auch sehr unnatürlich war — — so unnatürlich wie jede Henkersmahlzeit.
Bei den Haaren gepackt, herunter mit ihm, das Schwert sauste durch die Lust, schubb — — da war der Kopf mit dem blutigen Strunk — — hatte dieser schwarze Scharfrichter es aber heraus!! — und da lag der Rumpf — — und richtig, jetzt schob sich eine Steinfliese zurück, der Rumpf stürzte in ein Loch, der Henker warf den Kopf nach, die Falltür schloss sich wieder...
»Her!«
Jack ließ sich nicht mit Gewalt niederdrücken, er kniete von selbst hinter dem Steine hin, eine Faust wickelte sich um sein langes Haar — — und da rieselte über den Körper des Unglücklichen ein Schauer des Entsetzens — — von dem Steine herab ergoss sich über ihn das noch ganz heiße Blut seines Vorgängers, und Blut war es, in welches sein Gesicht gepresst wurde.
Und wie er so den Todesstreich erwartete, der ihm das Haupt vom Rumpfe trennte, da spann er in einem einzigen Moment, aber für ihn ein Ewigkeit, wieder einen langen Gedanken aus...
Ja, nun wusste er, was er vorhin mit dem Purpur gemeint hatte. Er hatte es einmal in seiner Jugend erzählen hören — — einem jungen Edelmanne wird von einer Wahrsagerin prophezeit, dass er dereinst im Purpur sterben werde — also als König — — — aber es kommt ganz anders — — er kommt aufs Schafott!! — — und wie der Henker ihm den roten Mantel umhängt, da sagt er:
»So sterb' ich im Purpur, wie mir geweissagt worden ist!«
»Lebe wohl, mein Mariechen, ich konnte dir nicht helfen, Gott, sei mir...«
Das furchtbare Schwert sauste herab, ein Blutstrahl spritzte in die Höhe, der Scharfrichter hob den Arm, in seiner Hand an dem langen, schwarzen Haare zeigte er den Kopf des weißen Faringis, der sich gegen die Gesetze des Landes vergangen hatte.
In der Loge stand Fleury, er sah den schönen, jetzt so bleichen Kopf mit dem schwarzen Haar, er sah das Blut noch unten hervorfließen, und Fleurys Gesicht selbst ward blass wie der Tod, seine Finger zuckten.
»Es wäre nicht nötig gewesen«, murmelte er. »Wirklich schade um ihn! Das habe ich nicht direkt gewollt. Mir hatte er nichts zuleide getan. — — Na, nun ist er weg. Und schließlich ist es doch besser so. Nun habe ich meine Ruhe wieder und kann getrost nach Hause fahren, brauche mich weder um das hellsehende Kind, noch um jene Frau zu kümmern.«
Diesmal hielt der Henker das abgeschlagene Haupt länger in die Höhe, denn es war das letzte, bis aus dem Seidenkasten, unter dem der König saß, eine schmetternde Stimme verkündete, dass der Gerechtigkeit Genüge geschehen sei — — — da ward auch Jacks Haupt seinem Rumpfe nachgeworfen.
Wir wollen uns einmal zu Mijnheer van Hyden und seinen Begleitern begeben. Sie waren in dem Hause und in der Familie des Agenten so freundlich aufgenommen worden, wie es ihnen vorausgesagt worden war.
Freetown an der SierraLeoneKüste ist eine Stadt von 40 000 Einwohnern, und wenn die Weißen im Verhältnis zu der schwarzen Bevölkerung auch gar nicht in Betracht kommen, so ist es doch immerhin eine große Stadt, und vor allen Dingen ist es eine englische Stadt mit einem englischen Gouverneur und mit englischen Beamten, und wo die hinkommen, da bringen sie auch immer den ganzen Komfort mit, und wo irgendwo in der Welt drei englische Familien wohnen, da müssen sie ihre englische Kirche und ihre englische Schule und ihr englisches Kasino haben, sonst bleiben sie eben dort nicht wohnen, und wenn es Beamte sind, die von ihrer Regierung dorthin geschickt werden, so verlangen sie das alles eben von ihrer Regierung, sonst machen sie nicht mehr mit, und der englische Soldat verlangt in Indien oder in Afrika oder in Persien geradeso gut täglich sein tellergroßes Beefsteak mit Bratkartoffeln und Mixedpickles und hinterher Pudding, wie in seiner Kaserne zu Hause, und wenn er das nicht bekommt, dann schmeißt er eben sein Gewehr in den Dreck — — na, da schießt doch selber, ich spiele nicht mehr mit Soldatens!! — — — —
Durch das Kind wusste Mijnheer immer alles, was sich mit Mariechen und mit Jack ereignete. Doch wir wollen hierbei jetzt nicht verweilen, da wir zum Teil selbst dabei gewesen sind, zum Teil noch alles erfahren werden, und uns wieder einmal mit Klaus und der Haarflechte seiner Angebeteten beschäftigen.
Es kommt nämlich ein seltsames Zusammentreffen von Ereignissen in Betracht.
Klaus hatte sich nach und nach an den Gedanken gewöhnt, dass seine Fatje jetzt eine wirkliche Königin war. Er hätte nur gern gewusst, von welchem Lande eigentlich, ob sie dabei noch immer im Hause des Mijnheers für die Dienerschaft kochte, ob er da vielleicht auch Anspruch auf den Königsthron habe, und so quälten noch einige Fragen seinen dicken Schädel. Antwort auf sein ausführliches Schreiben konnte er noch nicht haben, und seinem Herrn oder einem anderen Menschen etwas davon zu erzählen, das wagte er auf keinen Fall.
So wartete er immer auf eine Gelegenheit, wenn er wieder einmal mit Evangeline allein wäre.
Und diese Gelegenheit kam! Margot war einmal fortgegangen, etwas zu besorgen, Mijnheer hatte sich einmal nebenan ins Hotel begeben, Klaus als treuer Wächter war genügend, und — die Hauptsache für Klaus — Eva schlief auch gerade!
Er blickte sich also vorsichtig um, knöpfte seine Jacke auf, knöpfte seine Weste auf, knöpfte noch eine andere Weste auf, knöpfte seine Hose auf, knöpfte noch eine andere Hose auf, nun griff er tief, tief hinein ins innerste rechte Hosenbein, und aus dieser versteckten Schatzkammer zog er den Pferdeschwanz seiner Geliebten hervor.
Nachdem er die ganze Knöpferei wieder in Ordnung gebracht hatte, trat er vor den großen Wandspiegel, reckte den Bauch heraus, zog den Bauch wieder ein, betrachtete sich von hinten und von vorn, zupfte die Manschetten zurecht, zupfte den Schlips zurecht, und nachdem er an seiner äußeren Erscheinung absolut nichts mehr auszusetzen hatte, war er zu der feierlichen Zeremonie bereit.
Auf den Zehenspitzen schlich er sich an das Bett und legte die zusammengewickelte Haarflechte in das tote Händchen des schlafenden Kindes. Bald kam das Leben.
»Was siehst du, mein liebes Kind?«, flötete Klaus.
»Ich sehe — — — — sie!«
»Sieeeeh!«, himmelte Klaus zurück. »Hat sie eine Krone auf dem Koppe?«
»Ja, sie hat auf dem Haupte eine goldene Krone.«
»Enne goldge Krone!!«, himmelte Klaus, mit beiden Beinen zappelnd. »Sie ist eine richtige Königin mit einer goldgen Krone!! — Was hat sie denn sonst noch an?«
»Ich sehe — — nichts weiter!«
»Sie hat gar nichts weiter auf dem Leibe als wie nur die goldige Krone? Ach nee, ach nee! Oder sie sitzt wohl in der Badewanne?«
»Ah, es wird wieder hell. Es war plötzlich ganz finster. Jetzt sehe ich wieder! Es sind viele schön gekleidete Herren um sie herum.«
»Na ja — na ja«, sagte Klaus kläglich, »aber — aber — — hat denn meine Fatje — — — hat denn die Königin gar nischt weiter an, als nur die goldge Krone auf dem Koppe? Gar kein Kleid? Nicht einmal ein Hemd?«
»O doch, o doch, sie hat ein wunderschönes Kleid an ——— ach, und der Mantel! Ganz weiß — mit lauter schwarzen Flecken — — und rot eingefasst.«
»Jawohl, das ist ein Hermelinmantel«, erklärte der Diener, der hierin etwas Erfahrung hatte, »den muss jede Königin haben, sonst taugt sie nischt. Aber Fatje...? Du, Eva, frage sie doch einmal, wo sie den Hermelinmantel gestohlen hat.«
»Sie bewegt immer heftig die Hände, alle sprechen auf sie ein, alle deuten auf sie, sie legt die Hände aufs Herz, als wollte sie sagen, dass sie unschuldig ist, jetzt breitet sie beide Arme aus, die Krone fällt ihr vom Haupte — — der weiße Mantel gleitet ihr von den Schultern — — sie beugt sich zurück — sie schreit — — — — sie ist rücklings zu Boden gefallen...«
»Nanu«, sagte Klaus, »sie ist umgefallen? Du, Evangeline, frage sie doch einmal, warum sie umgefallen ist.«
»Ich sehe sie nicht mehr, es ist ganz finster... Da, jetzt sehe ich sie wieder! Sie sitzt auf einem...«
Zwischen dieser Prozedur und dem Umfallen der Köchin waren aber nur fünf Sekunden vergangen.
»Ahaaa!«, machte Klaus. »Ja, das ist auf einen Schreck immer gut. Mit der Krone?«
»Mit der Krone.«
»Hm«, brummte Klaus. »Ich hätte gar nicht gedacht, dass eine Königin auch bei so etwas immer die Krone aufbehält. Aber das muss wohl so Vorschrift sein. Und was macht sie nun?«
Ja, nun kam eine lange Schilderung und etwas ganz Merkwürdiges.
Zunächst war die Königin natürlich aufgestanden. Dann befand sie sich in einem Gange, sah einen Arbeiter in Hemdsärmeln, der eben aus einer Schnapsflasche trank. Sie klopfte dem Manne freundlich auf die Schulter, sie sprachen zusammen, der Mann schien erst nicht zu wollen, dann einigten sich die beiden doch, sie gab dem Arbeiter einen Kuss, darauf trank auch sie aus der Schnapsflasche...
»Mit der Krone? Mit der goldgen Krone?«
»Immer mit der goldenen Krone.«
»Mit der goldgen Krone gibt sie dem hemdsärmlichen Vagabunden einen Kuss, und dann trinkt sie aus seiner Schnapspulle? Nee, nee, was doch nicht alles an Fürstenhöfen passiert, und unsereens weeß gar nischt davon!! Aber, jawohl, so ist es schon!! Immer fein, immer nobel, immer eine Krone auf dem Koppe — — — und wenn man einmal nicht hinsieht, da setzen sie sich allemal gleich auf den... und küssen sich und trinken Schnaps dabei. —
Na, was macht sie denn nun weiter?«
Jetzt begab sich diese edle Königin in ein anderes ›Gemach‹, welches nach des Kindes Beschreibung eine elende Kammer sein musste, hier legte sie nicht nur Krone und Hermelin, sondern noch manches andere ab, dafür zog sie eine graue Kutte an, hierauf besah sie sich in einem Spiegel und pinselte sich im Gesicht herum...
»Sie pudert sich, sie schminkt sich«, erklärte Klaus. »I, der Deiwel, ist meine Fatje aber ein feines Luder geworden!!«
Dann verließ sie die Kammer, wurde von zwei Kerlen in Empfang genommen, ihre Hände wurden gefesselt, sie wurde fortgeführt, sie sah einen großen Block, der nichts anderes sein konnte als ein Richtblock, Chorknaben mit brennenden Kerzen gingen vor ihr her, sie kniete noch einmal nieder, erst rang sie die Hände, dann betete sie, dann wurden ihr die Augen verbunden, sie kniete vor dem Blocke nieder, der Henker schwang das Beil...
»Der Mann hat ihr den Kopf abgeschlagen, der Mann hat ihr den Kopf abgeschlagen!! Er hält ihren Kopf hoch in der Hand und zeigt ihn allen!«
So jammerte das Kind, und Klaus hatte die Maulsperre bekommen und zitterte an allen Gliedern.
Da näherten sich Schritte der Tür, das war sein Herr, und seine eigene Sicherheit überwog den Kummer über die enthauptete Fatje, schnell nahm er dem Kinde die Haarflechte aus der Hand und steckte sie in die Tasche.
Aber sein Gesicht konnte er doch nicht so schnell wieder in andere Falten legen.
»Klaus, was ist denn dir widerfahren? Was für ein trübes Gesicht machst du denn?«, fragte Hyden erschrocken.
»Ach, Mijnheer — Mijnheer, ich habe — solche — solche — Schmerzen —«
Klaus hatte die Hand auf den Bauch gelegt.
Da fiel ihm die schreckliche Rizinuspulle ein, erschrocken zog er also die Hand vom Bauche zurück und legte sie auf die Backe.
»... ich habe solche furchtbare Zahnschmerzen — — aaaooouuuhh«, heulte Klaus wie ein angeschossener Kettenhund.
»Hast du einen hohlen Zahn?«
»Jaaaaaooooouuuuhhhh.«
»Komm mal hierher ans Licht! Mach mal den Mund auf!«
Klaus musste also das Maul aufmachen, Mijnheer steckte seine Nase hinein. Und Klaus hatte ein tadelloses Wolfsgebiss, wusste gar nicht, was Zahnschmerzen sind.
»Ich sehe doch gar keinen hohlen Zahn?«
»Der hier — der hier — aaaaoooouuuuhhh.«
»Der große Backenzahn hier?«
»Jaaaaoooouuuuhhl«, heulte Klaus.
Margot kam.
»Fräulein, ich möchte mit Klaus einmal hinüber zum Zahnarzt gehen, er klagt so über...«
Ach du großer Schreck!!
»Mijnheer — Mijnheer — — es ist doch schon wieder vorbei!!«, jubelte Klaus mit lachendem Gesicht.
»Nenenenene, dieser Geschichte traue ich nicht recht. Es ist besser, ein Zahn, der schon etwas zu faulen angefangen hat, wird gleich herausgeruppt, als dass er dann alle anderen ansteckt. Komm mal mit zum Zahnarzt.«
Es half nichts, der unglückliche Klaus musste mit geknickten Beinen mit, musste sich auf den Schmerzensstuhl platzieren. Der Zahnkünstler war ein Neger, jetzt steckte der seinen schwarzen Nasenkolben in Klausens Rachen.
»Welcher? Der hier?«
»Nein, der daneben«, erklärte Mijnheer, »ja, der da.«
»Jawohl, der muss unbedingt heraus«, versicherte der schwarze Zahnarzt.
Er sah zwar, dass der Zahn kerngesund war, aber der arme Schlucker wollte sich doch gern die paar Groschen verdienen.
»Mijnheer — Mijnheer — aaaaoooouuuuhhhh«, fing jetzt Klaus vor Angst zu heulen an, als er den Neger mit einer kleinen Feuerzange ankommen sah.
»Siehst du, da fangen die Schmerzen schon wieder an«, sagte Mijnheer. »Na, Klaus, sei ein Mann. Heraus muss der kranke Zahn nun doch einmal, und das tut noch lange nicht so weh, als wenn man geköpft wird.«
Da kam es dem armen Klaus mit furchtbarer Deutlichkeit zum Bewusstsein, warum eigentlich ihm jetzt ein ganz gesunder Backzahn herausgerissen werden sollte!
»O, Fatje, Fatje, wärest du doch nicht Königin geworden!!«, jammerte er innerlich. »Dann hättest du jetzt deinen Kopp noch, und ich brauchte mir keinen Backenzahn herausruppen zu lassen!!«
Dieser Wunsch nützte aber jetzt nichts mehr, der schwarze Zahnkünstler setzte schon seine Feuerzange an, und nachdem er genügend lange gezogen und der im Stuhle festgeschnallte Klaus genügend laut gebrüllt hatte, gab es einen Knall, als wenn ein Champagnerpfropfen aus der Flasche schösse. Der schwarze Dentist verlor die Balance und prallte gleich gegen die Wand, hielt aber mit beiden Händen krampfhaft die Zange gepackt, und zwischen deren Kiefern befand sich ein prachtvoller Backenzahn.

Es gibt einen alten Volksaberglauben — besonders in England findet man ihn weitverbreitet: Wenn eine junge Frau zum ersten Male in gesegnete Umstände kommt und ihr Mann wird während dieser Zeit krank, fühlt sich einmal unwohl, oder er braucht nur — und dies ganz besonders — Zahnschmerzen zu haben, so sagen die klugen Leute: Der junge Mann hilft seiner Frau mittragen.
Das heißt, das soll nicht etwa ein schlechter Witz sein. Ganz im Gegenteil, das wird mit feierlichem Ernste gesagt! Hinter dieser Wechselbeziehung ahnt man nämlich eine tiefe Mysterie, welche der Mensch nie begreifen wird. Das hängt eng mit dem Sündenfall im Paradiese zusammen.
Nun, hier bei unserem Klaus steckte ebenfalls eine tiefe, unergründliche Mysterie dahinter: Seine geliebte Fatje hatte keinen Kopf mehr — Klaus hatte einen Backenzahn weniger. — — —
Nach diesem schmerzensreichen Gange erwartete den armen Klaus zu Hause eine große Freude. Die Post hatte ihm einen Brief von seiner Fatje gebracht.
Das erkannte er gleich an dem Kuvert, weniger aus der Handschrift — oder schließlich doch aus der Handschrift, allerdings nicht aus der geschriebenen Adresse, sondern weil Fatje auf dem Kuvert ihre fünf fettigen Küchenfinger abgedrückt hatte, und dieses Zeichen war dem Bräutigam wohlbekannt.
Noch ehe er den Brief öffnet, wollen wir gleich verraten, dass es die Antwort auf Klausens Schreiben war, in dem er ihr dazu gratulierte, dass sie Königin geworden war.
Diese Antwort konnte schon hier sein. Freilich wäre es nicht möglich gewesen, wenn der Brief erst nach New York gegangen wäre; aber der im Reisen erfahrene Jack hatte für alles gesorgt, und van Hyden war genau instruiert gewesen, was er in Jacks Abwesenheit zu tun hatte, um mit der Heimat in schnellster Verbindung zu bleiben.
Jack hatte vor der Abreise aus New York telegrafiert, ihnen bis auf Weiteres alle Postsachen an eine gewisse Adresse nach Lissabon zu schicken, und von Freetown, welches telegrafisch mit Europa verbunden ist, hatte van Hyden sofort seine jetzige Adresse nach Lissabon, der großen Postschiffsstation, gekabelt. Auf diese Weise hatte die Postverbindung fast gar keine Unterbrechung erlitten.
Und was antwortete nun Fatje auf des Bräutigams Gratulationsbrief zu ihrer Königinwürde?
Da müssen wir erst wissen, was Fatje dachte, als sie diesen Brief las.
Fatje quirlte gerade die Kartoffelsuppe für das übrige Dienstpersonal, als sie das Schreiben erhielt. Was sie beim Lesen dachte?
»Der Kerl ist plötzlich verrückt geworden!«
Doch nein, so hoch verstieg sich Fatjes Gedankenflug gar nicht.
»Ich habbe Gehöhrt, du pisst Köhnichin gehworrn und Ich freuhe mir söhre drühber...«
Fatje warf in die schon genügend gesalzene Suppe noch eine tüchtige Hand voll Salz und raunte zu ihrer Muhme, welche während van Hydens Abwesenheit im Hause Quartier mit voller Pension genommen hatte.
»Muhme, denke dir nur, ich bin Königin geworden! Hier, der Klaus schreibt's aus Amerika, und da muss es doch wahr sein!«
Also jauchzte die treue Fatje freudestrahlend.
Zum Glück war die alte Muhme eine gar kluge Frau, die erkannte Fatjes Würde nicht an, wusste vielmehr gleich, was hier vorlag.
Es war ja ganz einfach. In Amerika ist es doch so heiß, dass alle Menschen schwarz sind und nackt herumlaufen, und da hatte sich der arme Klaus eben einen Sonnenstich geholt, oder er war auf irgendeine andere Weise verrückt geworden. Verrückt war er auf alle Fälle. Die ›Amerikanersch‹ sind ja alle mehr oder minder verrückt.
Nun wusste die kluge Muhme auch, was hier einzig und allein zu tun war. Einem Wahnsinnigen muss man immer zu Willen sein, darf ihm niemals widersprechen, sonst wird's noch schlimmer. Geht man aber auf seine Ideen ein, so kann er vielleicht wieder geheilt werden.
In diesem Sinne musste der Brief beantwortet werden. Schreiben konnte die Muhme nicht, aber Fatje konnte es, und so setzte sie den großen Schreibebrief auf, und da sie aus einer anderen Gegend Hollands stammte als ihr Bräutigam, so schrieb sie auch eine andere Orthografie.
Jetzt hatte Klaus diesen Brief in der Hand. Der Bräutigam wusste natürlich schon, dass Fatje immer die Doppellaute verdrehte, was er sogar sehr vornehm fand, und so bot ihm das Entziffern der Krähenfüße keine besondere Schwierigkeiten.
Feilgeleibter Kluas ich frue mir uach sehr seil ich nanu bin Kenügün tun sien seilgeleibter Kluas ich leibe dir ser un sleise heirmid diene geleibte un truehe Fatje.
Kann man von einem Liebesbriefe mehr verlangen? Noch dazu von den. Liebesbriefe einer Königin?
Also doch! Sie war wirklich Königin geworden! Hier schrieb sie's ja selbst, schwarz auf weiß.
Wenn Klaus nur gewusst hätte, von welchem Lande oder welcher Stadt oder...
Ach, was für einen Zweck hatte denn das, darüber nachzudenken?
Der arme Klaus musste dennoch darüber nachdenken, über die Nichtigkeit dieses ganzen Daseins, wobei er schwermütig das Haupt in beide Hände gestützt hatte, und dann schüttelte er dieses sorgenschwere Haupt und seufzte in kläglichstem Tone:
»Was nützt ihr denn nun die gold'ge Krone, wenn sie keinen Kopp mehr hat, wo sie sie draufsetzen kann? Ach, Fatje, Fatje. wärest du doch lieber in der Küche geblieben, dann hättest du noch deinen Kopp und ich noch meinen schönen Backenzahn!«
Dann ermannte er sich. Nicht nur die Liebe, auch schon der Anstand erforderte es, dass er seiner Fatje ein Beileidsschreiben schickte. Und er setzte es unter vielen Schweißtropfen auf. Sein Stil war so ziemlich immer derselbe.
Libe Fatje! Ich habbe Gehöhrt dir habben Sie den kopp Abkehakkt. Was Mich söhre Leid tuhn tuht und nune mus Ich dihsen brif sliehsen diweili ich nich möhr zu sreihben weihs Womihd Ich förbleihbe Dein getreuhör und filgelihbich tör Preuhdüchamm Klaus Klausen!
So, das war getan, nun noch einige Tränen der Wehmut über die Tote vergossen und bloß noch auf das Kuvert die Adresse gesetzt, welche ihm diesmal viel weniger Kopfschmerzen machte, weil er sich dieselbe doch schon einmal ausgegrübelt hatte.
An Fräulein Fatje Dickmichel, Königin und Köchin bei Mijnheer van Hyden usw.
Der an die tote Braut gerichtete Brief ging ab, van Hyden erfuhr wiederum nichts davon. — — —
Mijnheer van Hyden war also stets über die Schicksale seiner Tochter unterrichtet, wie über alle Abenteuer, welche Jack zu bestehen hatte.
Denn, wie schon erwähnt, ob Evangeline wachte oder schlief, man brauchte ihr nur die Locke in die Hand zu geben, so wurde sie sofort hellsehend.
Dem alten Manne widerstrebte es nur, die Gabe des kranken, so überaus schwächlichen Kindes gar zu sehr auszunutzen, obschon Eva ihm immer wieder versicherte, dass sie sich gerade jedes Mal nach diesem Schlafwachen wunderbar gekräftigt fühlte.
Er konnte das nicht glauben. Es war ihm noch zu neu und kam ihm zu unnatürlich vor. Er meinte eben, das Kind wolle sich nur ohne Schonung für die gute Sache opfern.
Übrigens genügte es ja auch, wenn das künstliche Hellsehen täglich mehrmals erzeugt wurde.
Über Mariechen konnte Eva nicht viel berichten. Es war eine eintönige Karawanenreise, auf welcher das weiße Mädchen nicht anders als jede andere schöne Sklavin behandelt wurde, welche einen ansehnlichen Wert repräsentiert und mit der man noch ein gutes Geschäft zu machen gedenkt.
Dem alten Vater schnitt es nur ins Herz, wie seine Tochter ihren Gatten durch auf Papier gemalte Worte und durch flehende Gesten immer wieder um Verzeihung bat und um Hilfe anrief. Woher sie aber eigentlich wusste, dass Jack zur Verfolgung der Räuber aufgebrochen war, dass sie sich ihm überhaupt auf solch eine Weise verständlich machen konnte, das war und blieb ein unlösbares Rätsel.
Durch des Kindes Augen sahen die Zurückgebliebenen alles mit, was Jack erlebte. Aus Evas Beschreibung konnten sie sogar deutlich sein kühnes Manöver mit der Speisekarte erkennen.
Dann kam sein Abenteuer mit dem von dem Elefanten verfolgten Dahomeyweibe, welches durch später eingezogene Erkundigungen, die man in Freetown haben konnte, als die Anführerin der blauen Partei erkannt wurde — und dann war Jack ein Gefangener!
Um Wiederholungen zu vermeiden, war nicht schon früher erwähnt worden, was Jack in diesem Gefängnis tat, um die Zurückgebliebenen über sein Schicksal zu beruhigen. Auch er besaß ja die Möglichkeit, jenen eine Nachricht von sich zukommen zu lassen.
Bisher hatte er hiervon nicht ein einziges Mal Gebrauch gemacht. Der Schwiegervater konnte ihn ja beobachten, in Freetown sah man also, wie er alle Hindernisse zu überwinden wusste und immer schneller vorwärts kam, und das hielt er wohl für genügend, er war eben kein Freund vom Briefschreiben.
In seinem Gefängnis wandte er aber das Rezept an, um die Zurückgebliebenen über sein Schicksal zu beruhigen. Bleistift und Papier hatte er bei sich, und so schrieb er mit möglichst großen Buchstaben:
Ich bin in Abomey gefangen. Doch seid unverzagt wie ich! Ich habe die Sambone
gerettet, sie wird mich retten. Ich weiß es! Dann nehme ich die Verfolgung wieder
auf. Jack. So! Mehr schrieb er nicht. Diese Angaben hielt der amerikanische Fährtensucher, der niemals viele Worte machte, für genügend, und er irrte sich ja auch nicht.
Während er rauchend auf der Pritsche lag, hatte er diesen Zettel zu den gewissen Zeiten, welche ausgemacht worden waren, vor sich, die Augen darauf gerichtet, und wiederum irrte er sich nicht — das hellsehende Kind las die Worte mit.
Am dritten Tage kam noch etwas Anderes hinzu:
Rüstet für alle Fälle eine Karawane aus! Reiche Geschenke! Aber bleibt in Free
town, bis ich weitere Nachricht gebe!
Etwas Neues kam nicht mehr hinzu.
Jetzt hatte Mijnheer van Hyden alle Hände voll zu tun. Im Grunde genommen aber hatte er leichte Arbeit. Sein freundlicher Wirt, der ins Vertrauen gezogen wurde, war mit allen Verhältnissen bekannt. Die Hauptsache war, dass ein guter Karawanenführer gefunden wurde. Mit dessen Hilfe kaufte man die nötigen Waren und Geschenke ein, alles in Freetown zu haben, und ebenso konnten hier zu jeder Zeit genügend Träger angeworben werden.
Dies schob man aber noch auf, bis man von Jack die Aufforderung zum Abmarsch der Karawane erhalten haben würde. Dadurch sparte man große Kosten und machte sich dennoch keiner Fahrlässigkeit schuldig. Wenn am Nachmittag die Karawane angemustert wurde, konnte sie nach Mitternacht schon aufbrechen.
Unterdessen wurde Jack unausgesetzt mit des Kindes Augen beobachtet. Jetzt ließ van Hyden einmal seine Rücksicht fallen, denn keine Minute sollte versäumt werden, wenn Jack seine Aufforderung gab.
Aus diesem Grunde wurde die Karawane, bei welcher sich Mariechen befand, längere Zeit nicht beobachtet, und das sollte einen schweren Missstand herbeiführen.
Des alten Mannes Besorgnis wuchs. Acht Tage lang war Jack nun schon gefangen, und noch hatte sich nichts geändert. Seine eigene scheinbare Sorglosigkeit, mit der er sich in seine Gefangenschaft fügte, diente nicht zur Beruhigung des Schwiegervaters.
»Wir wollen doch wieder einmal Ihr Fräulein Tochter beobachten«, meinte Margot am Morgen des achten Tages. »Zuletzt befand sich Muftas Karawane schon in einer hügeligen Gegend, jetzt muss sie bereits in den Akandabergen sein, und dort soll doch die Zirkona ihr Wesen treiben.«
Es geschah. In des Kindes Hand wurde Jacks schwarze Locke mit Mariechens hellblonder ausgetauscht.
»Was siehst du, mein Kind?«
»Ich sehe — — sie!«
»Gelobt sei Gott!«, sagte der Vater jedes Mal, wenn er nur hörte, dass seine Tochter noch am Leben war. »Und was sieht Mariechen?«
»Sie sieht... einen Manu mit einem schwarzen Gesicht... in einem weißen Mantel... und eine Frau... noch eine Frau... viele, viele Frauen...«
Die Zuhörer wunderten sich. Bei Muftas Karawane hatte es ja gar keine anderen Frauen gegeben.
»Was für Frauen sind das? Beschreibe sie!«
Es konnte ja sein, dass die Karawane soeben bei einem Negerdorfe lagerte und Weiber Nahrungsmittel brachten.
»Es sind... gerade solche Frauen, wie Jack immer gesehen hat... mit langen Schwertern... wie Sensen... sie haben Helme auf... an einigen sind rote Schleier...«
Margot war die erste, welche die Wendung der Situation erfasste.
»Dahomeys!«, rief sie. »Muftas Karawane ist von der Zirkona überfallen und überwältigt worden!«
So war es. Evas weitere Schilderungen bestätigten es. Muftas Karawane existierte nicht mehr, alle seine Soldaten und Lastträger befanden sich als Gefangene in den Händen von Dahomeyweibern der roten Partei, wenigstens ein Teil davon, denn man musste doch annehmen, dass ein Kampf vorausgegangen war und dass es auch Tote und Verwundete gegeben hatte.
Der Überfall konnte nicht eben erst stattgefunden haben. Die Dahomeys mussten sich von dem Orte, wo der Kampf getobt hatte, schon weit entfernt haben. Dies alles hatte man zu beobachten versäumt.
Dort, wo sie sich jetzt befanden, wurde, obgleich mitten in einem wilden Gebirge, offenbar ein Sklavenmarkt abgehalten. Die Käufer der gefangenen Neger waren Männer, die sich hier zahlreich eingefunden hatten, zwar ebenfalls Neger, aber in weiße oder braune Burnusse gekleidet. Sie unterschieden sich überhaupt sehr von eigentlichen Negern. Sie hatten Zelte aufgeschlagen. Eva sah sehr viele Kamele. und gegen die gefangenen Neger gaben sie den Weibern hauptsächlich Pferde.
Mr. King, van Hydens Wirt, ward gerufen und konnte nähere Auskunft geben, was für Leute das seien. Er ließ sich die Kleidung, mehr noch die Bewaffnung genau beschreiben. Am auffälligsten waren dabei zwei dolchartige Messer, welche jeder Mann trug, aber nicht im Gürtel, sondern von diesem an langen Stricken herabhängend, mit ganz eigentümlichen Griffen. Diese erinnerten sehr an die arabischen Steigbügel, man konnte in einer Höhlung die ganze Hand verbergen.
»Tuaregs!«, rief Mr. King sofort.
»Ein Negervolk?«
»Nein, die Tuaregs sind keine echten Neger, sondern gehören mehr zu den Beduinen, wenn sie auch eine ganz schwarze Haut haben.«
»Was ist das Los der Gefangenen?«
Der Gefragte hob bedauernd die Schultern.
»Sklaverei.«
»Auch nach Timbuktu?«
»Auf keinen Fall. Es ist ja die nach Timbuktu bestimmte und dort schon erwartete Karawane, die sie erbeutet haben. Tuaregs dürfen überhaupt nicht nach Timbuktu kommen.«
»Wohin werden die Sklaven denn sonst gebracht?«
»Das ist es eben! Das weiß man nicht! Viel besser wäre es gewesen, die junge Dame hätte direkt Timbuktu erreicht, dann wüsste man doch wenigstens bestimmt, wo sie zu finden ist. Aber die Tuaregs haben keine Heimat, keinen festen Wohnsitz — die Tuaregs sind die Zigeuner der afrikanischen Wüsten.«
Bei dieser Erklärung schlug der alte Holländer jammernd seine Hände vor die Augen.
»O Gott, o Gott, was habe ich denn nur getan, dass du mein armes Mariechen so furchtbar büßen lässt!?«
Der Vater konnte also schon nicht mehr glauben, dass seine Tochter dieses Schicksal durch eigene Schuld verdient habe.
Doch sein erfahrener Wirt wusste einen Trost.
»Vielleicht ist es sogar ein Glück, dass es so gekommen ist«, sagte er. »Die wandernden Tuaregs sind, weil sie niemals aus der Wüste herausgehen und immer nur mit dem allernotwendigsten Proviant für sich selbst versehen sind, nicht imstande, die Sklaven für längere Zeit bei sich zu behalten. Sie werden diese an die erste ihnen begegnende Karawane weiterverkaufen. Nun gibt es aber von uns aus keine weitere Karawanenstraße, als bis höchstens nach Timbuktu. Weiter ins Innere entführt werden die Sklaven also auf keinen Fall, wohl aber können sie an ein viel näheres Ziel gebracht werden. Ja, im günstigsten Falle werden sie von einer Karawane gekauft, welche sie wieder nach der Küste zurückbringt.«
Der erfahrene Mann hatte richtig prophezeit, aber... nur in Bezug auf die männlichen Sklaven. Bei der weißen Sklavin trat gerade das Gegenteil ein.
Doch hiervon war jetzt noch nichts zu bemerken. Der Austausch der Pferde gegen Sklaven ging sehr umständlich vonstatten, es wurde dabei nach arabischer Art gefeilscht, wenigstens seitens der Tuaregs.
Schon stundenlang hatte Evangeline so beobachtet und geschildert, als plötzlich etwas geschah, nämlich hier in Freetown mit Bezug auf die kleine Hellseherin, was man bei ihr noch nie beobachtet hatte und was ihre wunderbare Gabe wieder in einem ganz anderen Lichte zeigte.
Das Kind zeigte plötzlich eine merkwürdige Unruhe, sprach unzusammenhängend, warf sich hin und her. Das mochte daher kommen, dass es schon stundenlang im Schlafwachen gelegen hatte, also infolge der Überanstrengung, obgleich Eva dies durchaus nicht zugeben wollte, und weil sich jetzt gerade ein Tuareg mit der weißen Sklavin beschäftigte, zögerte van Hyden noch, ihr die Locke aus der Hand zu nehmen.
Da aber wurden auch die Bilder vor den geistigen Augen des Kindes immer unklarer, es klagte, dass es nichts mehr sähe, es wurde überhaupt immer unruhiger, und mit einem Male ließ es selbst Mariechens Haarflechte aus der Hand fallen, hatte sie weggeworfen — — etwas, was Eva noch nie, niemals getan hatte.
Doch anstatt jetzt entweder zum vollen Bewusstsein zu erwachen oder aber in einen natürlichen Schlaf zu sinken, begann sie zu sprechen, ohne die Augen zu öffnen, und da sich nun auch noch ihr Händchen warm anfühlte, musste sie sich auf alle Fälle noch in hellsehendem Zustande befinden.
»Gebt mir Jacks Locke — ich will Jacks Locke — ich muss sie haben!«, rief sie wiederholt mit immer wachsender Heftigkeit.
Man hatte jetzt keine Zeit, über diesem neue Verhalten des hellsehenden Kindes zu staunen, man ahnte nur, dass hier ein ganz intensiver Fall einer unerklärlichen Sympathie vorliegen müsse.
Jacks Locke ward ihr denn in das Händchen gegeben, und unverkennbar war der wohltuende, beruhigende Einfluss, den dieses Haar sofort auf sie ausübte.
Freilich sollte dies nicht lange währen, dann trat gerade das Gegenteil ein.
»Ich sehe... ihn!«
Das hatte sie noch mit verklärtem Lächeln gesagt, dann aber wich dieses einem Ausdrucke des furchtbarsten Entsetzens.
»Was siehst du, mein Kind?«, fragte van Hyden, von den schlimmsten Ahnungen erfasst, als Eva von allein nicht weitersprechen wollte.
»Blut — — Blut — — warum schlägt der bunte Mann den armen Leuten die Köpfe ab?!«
Es gelang den Herren, die eigene Aufregung niederzukämpfen und das Kind zu ausführlichem Sprechen zu bringen.
Es war nichts Anderes als die Hinrichtungsszene in Abomey, welche Eva schilderte. Ein schwarzes Haupt nach dem anderen fiel, und jetzt, wie häufig, wenn es vom Schrecken gepackt wurde, begann das sensitive Kind nicht nur mitzusehen, sondern auch mitzufühlen, mit zu empfinden, Eva wurde zur Gedankenleserin.
»Jetzt packen mich die Henkersknechte... jetzt werde ich zur Richtstätte hinaufgeführt... so sterb' ich im Purpur, wie mir geweissagt worden ist... ich knie nieder... mein Gesicht wird auf den Stein gedrückt... in Blut... eine Faust umschlingt mein Haar... lebe wohl, Mariechen, ich konnte dir nicht helfen — Gott sei mir...«
Ein gellender Schrei, Eva sank in die Kissen zurück — und Jacks Haarlocke lag mitten in der Stube.
Der Schrei war von einem anderen Munde aufgenommen worden. Margot begann plötzlich wie eine Wahnsinnige in dem Zimmer herumzurennen, dabei unaufhörlich schreiend, bis daraus ein schrilles Gelächter wurde, und dann wälzte sie sich in Krämpfen am Boden.
Jack war tot! Er hatte seine Kühnheit mit seinem Haupte büßen müssen. —
Wir überspringen eine halbe Stunde.
Klaus saß als Wächter neben dem Bett des schlafenden Kindes und betastete immer seinen Kopf.
In einem anderen Zimmer lag Margot in unzurechnungsfähigem Zustande, das Fieber hatte sie gepackt, Mijnheer war fortgegangen.
Als wegen Margots ein Arzt geholt worden war, hatte Klaus gehört, wie sein Herr unter anderem zu diesem gesagt hatte:
»Ich habe ganz den Kopf verloren.«
Das war es, worüber der brave Klaus jetzt nachdachte und weswegen er immer seinen Kopf betastete, während ihm die dicken Tränen über die feisten Wangen purzelten.
Endlich konnte er seine Gedanken auch in Worte kleiden.
»Nu hat Fatje keinen Kopp mehr, Jack hat auch keinen Kopp mehr, und nu läuft auch noch mein Herr ohne Kopp herum — — habe ich denn eigentlich noch einen Kopp auf dem Halse sitzen?«
Er tastete und rüttelte und schüttelte und kam schließlich zu der Überzeugung, dass sein Denkerhaupt wirklich noch ganz fest auf dem Halse saß, worüber er sich aber gar nicht freute, sondern nur staunte.
Dann kamen dem einsamen Wächter andere Gedanken, und zwar diesmal gar keine so dummen.
Alles, was mit Evas Hellsehen zusammenhing, war ihm aufs Genaueste bekannt. Also auch, dass Eva nichts anfasste, was von einem Toten herrührte. Wurde ihr so etwas während ihres Schlafes in die erwärmte Hand gegeben, so schleuderte sie es mit Abscheu von sich. So hatte sie doch auch vorhin Jacks Locke in dem Augenblicke, da sein Haupt vom Rumpfe geschlagen wurde, von sich geworfen.
Wie war es denn aber bei seiner Fatje gewesen, als der das Haupt vom Rumpfe getrennt wurde? Da hatte Eva die lange Haarflechte durchaus nicht von sich geschleudert, sie nicht einmal aus der Hand fallen lassen, sondern Klaus hatte sich die Flechte ganz hübsch selbst herausnehmen müssen.
»I, da muss ich doch noch einmal...«
Mit diesen Worten griff Klaus in die Hosentaschen und brachte daraus den Pferdeschwanz seiner Geliebten zum Vorschein. Denn vorhin war er doch von seinem Herrn überrascht worden, und er hatte bisher noch keine Gelegenheit gehabt, dieses Heiligtum wieder im intimsten Versteck zu verbergen.
Klaus zweifelte ja nicht im Geringsten daran, dass Fatje wirklich ihren Kopf verloren hatte. Der Henker hatte doch sogar das blutende Haupt den Zuschauern gezeigt, aber... Klaus war ein sehr ordnungsliebender Mensch, und wenn seine Fatje tot war, dann gehörte auch mit dazu, dass das hellsehende Kind die Haarflechte von sich schleuderte. Das musste der Ordnung wegen unbedingt nachgeholt werden.
Er schob das schlaffe Händchen der Schläferin zurecht, legte die Haarflechte hinein — schon stutzte er — er schloss auch noch die Fingerchen darüber und...
Es ist eben gar nichts unmöglich in der Welt! Fatje war tot, und Eva schleuderte die Haarflechte dennoch nicht von sich.
Ganz mechanisch stellte Klaus die erste gewöhnliche Frage, wenn er sie in seiner Erregung auch micht ganz glatt herausbrachte.
»Wa—wa—wa—wa—wa—wa—was stehst du, mein liebes Kind?«
»Ich sehe... sie!«
»A—a—a—a—a—a—ach nee!«
»Sie liegt...«
»Im Sarge?«
»Nein, auf dem Sofa. Jetzt richtet sie sich auf...«
»Wer hebt sie denn auf?«
»Niemand, sie richtet sich von alleine auf.«
»Ga—ga—ga—ganz alleine?«
»Ja, von ganz alleine.«
»Nu, da lebt sie wohl noch?«
»Gewiss lebt sie.«
Da breitete Klaus beide Arme aus und schaute mit verklärtem Lächeln zur Decke empor.
»Sie hat keinen Kopp mehr und lebt doch noch! Nee, so was lebt ja gar nicht!«
»Jetzt nimmt sie vom Tische ein Weinglas.«
»Nu sicher, sicher, sie lebt noch!«
»Sie trinkt...«
»Trinkt?«, stutzte Klaus. »Ohne Kopp?«
»Jetzt nimmt sie einen Apfel, sie isst ihn...«
»Isst ihn?«, stutzte Klaus immer mehr, und sein Staunen war ganz berechtigt. »Ohne Kopp? Wo steckt sie denn den Apfel hin beim Essen?«
»Nun, in den Mund!«
Jetzt blieb Klausens Verstand vollends stehen.
»A—a—a—a—a—aber wenn sie gar keinen Kopp mehr hat?! Wo hat sie denn da eigentlich ihren Mund?«
Diese Frage blieb unbeantwortet.
»Jetzt sitzt ein Herr neben ihr auf dem Sofa«, fuhr das Kind im Schildern fort.
»Ein Herr? Hat der wenigstens noch einen Kopp?«, fragte Klaus in gerechtem Zweifel.
»Der Herr küsst sie...«
»Küsst sie? Wen?«
»Deren Haar ich in der Hand habe.«
»Meine Fatje? Aber wenn sie keinen Kopp mehr hat? Wo küsst er sie denn hin?«
»Auf den Mund.«
»A—a—a—a—aber wenn sie keinen Kopp mehr hat?«, konnte Klaus nur immer wieder hervorstammeln.
»Jetzt fasst er ihren Kopf mit beiden Händen...«
Aha, jetzt endlich fand Klaus auch die Lösung dieses Rätsels!
»Wo hat sie denn ihren Kopp? Wo liegt denn ihr Kopp? Auf dem Tische, nicht wahr? Auf einem Teller?«
»Er küsst sie wieder, sie ihn...«
Nein, das konnte nicht so weitergehen, da musste er erst Gewissheit haben.
»Eva, meine liebe Eva, sage mir doch nur erst, wo sie ihren Kopp eigentlich hat.«
»Nun, auf den Schultern.«
»Au—au—au—au—auf den Schultern?«
»Ja, wo denn sonst?«, konnte das Kind auch in diesem Zustande belustigt lachen.
»Und darauf sitzt er ganz fest?«
»Natürlich sitzt er ganz fest!«, lachte wiederum das Kind.
Da kam dem braven Klaus die Erkenntnis, und wiederum himmelte er mit ausgebreiteten Armen die Decke an.
»Fatje lebt noch!«, jubelte er aus tiefinnerster Brust, allerdings ganz leise. »Sie lebt noch und hat sogar ihren Kopp wieder!! — Am Ende...«
Klaus wurde von einem anderen genialen Gedanken gepackt, er brach ab, machte sein respektables Maul auf, griff schnell hinein...
Nein, mit dem genialen Gedanken war es nichts gewesen. Wohl hatte Fatje ihren abgeschlagenen Kopf wiederbekommen, Klaus aber nicht seinen herausgezogenen Backenzahn!
Doch er hatte keine Zeit mehr, über das Verhältnis zwischen seinem Backenzahn und dem Kopfe seiner Geliebten Vergleiche zu suchen, er musste sich beeilen, die Haarflechte dem Kinde aus der Hand zu nehmen und sie wieder zu verbergen, denn schon hörte er seinen Herrn kommen.
Mit heiserer Stimme erkundigte sich dieser nach des Kindes und nach Margots Befinden. Während Klaus eine beruhigende Auskunft gab, jagten ihm wiederum die Gedanken wild durch den Kopf.
Er hatte offenbar eine wichtige Entdeckung gemacht, er musste beichten, da half alles nichts, aber er durfte dabei sein eigenes Geheimnis nicht verraten.
»Mijnheer.«
Van Hyden, der sich in Margots Zimmer hatte begeben wollen, blieb auf der Türschwelle stehen.
»Was willst du, Klaus?«
»I—i—i—i—ich — — weiß nicht, aber...«
»Du bist recht aufgeregt, Klaus. Was ist geschehen?«
»Meine Großmutter hat immer gesagt, dass es auch Menschen gibt, welche ohne Kopf herumlaufen können«, platzte Klaus jetzt mit voller Lungenkraft heraus.
Klaus führte sehr gern seine verstorbene Großmutter als Beispiel aller Weisheit an, aber das war denn doch etwas zu toll, was er da zu faseln begann.
Besorgt trat van Hyden auf den Diener zu.
»Ist es dir recht heiß im Kopfe, Klaus? Gib mir mal die Hand, ich will deinen Puls fühlen.«
»Nein, ach nein... na ja, Mijnheer sagten doch auch vorhin, Sie hätten den Kopf verloren, und Sie tun doch auch noch leben.«
»Wirklich, er hat etwas Fieber«, murmelte Mijnheer. »Nun wird der auch noch krank.«
»Ach — ach nein... ich denke, der Mister Dankwart ist gar nicht tot, wenn er auch keinen Kopp mehr hat.«
»Erst einmal eine kalte Dusche, die ist immer gut«, murmelte der alte Holländer wieder.
»A—a—a—ach nein, bitte nicht, Mijnheer!«, begann der wasserscheue Klaus zu wimmern. »Ich hab's ja nur geträumt, dass Jack noch leben könnte. Eva hat die Locke doch eigentlich gar nicht so herausgeschleudert, wie sie's hätte tun müssen!«
Van Hyden stutzte. Nicht etwa, dass er auf die wirren Reden des Dieners etwas gab — nein, der hatte eben das Fieber bekommen, es war schon etwas Delirium eingetreten — aber durch diese wirren Reden war ihm doch eingefallen, dass man sich eigentlich von Jacks Tode noch gar nicht richtig überzeugt hatte. Das heißt, man hätte dem Kinde doch noch einmal die Locke in die Hand geben können, was nicht getan worden war.
Nun, das konnte ja schnell geschehen. Das heißt, der alte Mann zweifelte nicht im Geringsten daran, dass Jack enthauptet worden war, es handelte sich nur um ein Experiment mit der Hellseherin, zu welchem der alte Mann die Vorbereitungen mit den betrübtesten Empfindungen traf.
Er hatte die fortgeworfene Locke vorhin aufgehoben und wieder zu sich gesteckt, das letzte Andenken an seinen unglücklichen Schwiegersohn, Eva schlief, alle Bedingungen waren vorhanden.
Die Locke wurde ihr in das Händchen gegeben, die Finger darüber gelegt — — merkwürdig, van Hyden fühlte in dem toten Ärmchen das warme Blut kommen, er fühlte den Pulsschlag an der Hand, und diesmal wurde das Haar eines Toten nicht mit Abscheu fortgeschleudert!
Zunächst nahm van Hyden, ohne besondere Gedanken zu haben, Jacks Locke noch einmal aus der Hand und legte dafür die seiner verstorbenen Frau hinein... wollte es tun, er kam gar nicht dazu.
Mit einer heftigen Bewegung und schmerzhaft verzogenem Gesicht hatte das schlafende Kind ihm das Händchen entzogen. Bei einem zweiten Versuch, wobei van Hyden Gewalt anwendete, um die Locke zwischen die Finger zu zwängen, wurde die Flechte wirklich mit Widerwillen fortgeschleudert!
Was sollte Mijnheer davon denken? Jetzt nahm er wieder Jacks Haar, und willig ließ es sich Eva zwischen die Fingerchen klemmen, die willige Freudigkeit prägte sich auch gleich in ihrem Antlitz aus.
Da allerdings befiel den alten Mann plötzlich eine furchtbare Erregung, er konnte sich kaum aufrecht halten.
»Was siehst du, mein Kind?«, brachte er mühsam hervor.
»Ich sehe... ihn.«
»Allmächtiger Gott!«, hauchte der Mijnheer, und er konnte es ja doch nicht glauben. »Wen siehst du, mein Kind?«
»Ihn... Jack.«
»Jack, sagst du? Du siehst Jack?!!«, stieß van Hyden außer sich hervor.
»Ja, meinen Jack«, wiederholte das Kind mit liebreizendem, glücklichem Lächeln. »Er steht aufrecht vor einer gepanzerten Frau, spricht mit ihr...«
»Margot, Margot, Jack lebt noch, unser Jack lebt noch, unser Jack lebt noch! Gelobt sei Gott der Allgütige!!!«
Während die Gerufene, von der das Fieber beim Verkünden dieser Himmelsbotschaft im Nu gewichen war, herausgestürzt kam, um sich von der Tatsache zu überzeugen, stand Klaus daneben, sprach kein Wort, aber eine Handbewegung hatte er gemacht, welche noch mehr ausdrückte, als Worte können...
»Na, ihr Schuster, habe ich's nicht gleich gesagt?« — — — —
Wir wollen nicht dabeisein, wenn Evangeline berichtet, aber etwas Anderes sei noch erwähnt.
Eine Stunde später perlten von Klausens Nasenspitze abermals die Schweißtropfen auf einen Brief, und dieser Brief, den er mit dem Federhalter in der Faust malte, lautete:
Libe Fatje.
Ich habbe Gehöhrt das Du Deihnen Kopp wühder behkomen hast und Ich freuhe mir söhre drühber und nune mus Ich dihfen brif sliehfen diweili Ich nich möhr zu sreihben weihs Womihd Ich förbleihbe Dein getreuhör und filgelihbichtor Preuhdüchamm Klaus Klausen.
Als Jack wieder zur Besinnung kam, konnte er sich durchaus nicht erinnern, wie und aus welchem Grunde er eigentlich das Bewusstsein verloren gehabt hatte.
War er denn enthauptet worden? Der Henker hatte sein Gesicht auf den blutigen Stein gedrückt, Jack empfand ein Todesgrausen, es kam ihm. vor, als wenn er durch die Luft flöge, das hielt er für ein Todesempfinden... und dann war es aus mit ihm gewesen, er wusste nichts mehr von sich.
Jack war natürlich nicht der Mann, der sich erst an den Kopf griff, um sich zu überzeugen, ob er ihn auch wirklich noch zwischen den Schultern sitzen habe. Er hätte dies auch nicht getan, hätte er gewusst, dass der Henker den Zuschauern sein blutiges, schwarzlockiges Haupt gezeigt hatte.
Der Leser wird natürlich sofort wissen, dass es sich hier um einen Taschenspielerkniff gehandelt hatte. Aber Jack hatte ja von alledem keine Ahnung!
Er lebte! Sofort, als er sich das sagte, tastete er um sich, bekam in die Hand etwas Rundes, Nasses, mit Haaren daran... einen menschlichen Kopf! Sein zweiter Griff berührte einen menschlichen Körper, aber die Hand tastete nur an einem feuchten Halsstummel ohne Kopf...
Wir wollen diese grässliche Beschreibung nicht weiter ausdehnen.
Wenn aber nun Jack jetzt, da ihm zur Erkenntnis kam, wo er sich befand, vor Entsetzen nicht nochmals in Ohnmacht fiel, wenn er vielmehr mit nüchternem Verstande die Tatsache konstatierte, dass er sich in dem Raume befand, in welchem der Henker immer die Leichname und die abgeschlagenen Köpfe hatte fallen lassen — — so zeigt das doch klar, dass dieser Mann nicht etwa vor Schreck oder aus Todesfurcht das Bewusstsein verloren hatte, als er sich sagen musste: Im nächsten Augenblick trennt dir das Schwert den Kopf vom Rumpfe.
Nein, Jack hatte schon am Marterpfahl gestanden, nicht nur einmal; Jack hatte sich auch schon in noch ganz anderer Gesellschaft befunden als hier zwischen kopflosen Rümpfen und rumpflosen Köpfen. Wenn in einem vollbesetzten Schützengraben eine Granate krepiert, das gibt auch ein hübsches Ragout!
Aber seine Bewusstlosigkeit musste doch irgendeinen Grund haben, und sehr schnell hatte er ihn gefunden. Sein schmerzender Kopf brachte ihn darauf. Er war einfach bei dem Sturze in die Leichenkammer mit der Stirn heftig aufgeschlagen, das hatte ihn betäubt.
»Sambone hat ihr Wort gehalten, mit meiner Enthauptung ist dem Publikum eine Komödie vorgeführt worden.«
Nachdem er sich das gesagt hatte, konstatierte er mit Zufriedenheit, dass es hier unten zwar nicht gerade angenehm roch, aber dass die Luft doch zu atmen war.
Sollte er jetzt nach einem Ausgange suchen? Nein, das hatte keinen Zweck. Man würde ihn schon abholen.
Hatte er Streichhölzer bei sich? Ja. Das heißt, eine schwedische Zündholzschachtel, und in dieser klapperte nur noch ein einziges Hölzchen.
»Hätte ich gewusst, dass es so kommen würde, dann hätte ich mich besser vorgesehen«, brummte er, als er in seinen anderen Taschen suchte. »Dieses einzige Streichholz muss aber ausgenutzt werden, ein Glück nur, dass ich auch den Tabak einstecken habe, und wir wollen hoffen, dass der Phosphor auch noch fängt.«
Und er begann von dem schwarzen Plattentabak, in ganz Amerika, Afrika und Australien ›Overwater‹ genannt, mit dem Messer kleine Scheibchen abzuschneiden, diese wurden zwischen den flachen Händen kunstgerecht zerrieben — das muss nämlich alles erst gelernt werden — die Krümel wurden in die Pfeife gestopft — so, und jetzt mit kolossaler Vorsicht das letzte Streichholz riskiert.
Gott sei Dank, der ›utan svafel ok phosphor‹ fing an der Reibfläche Feuer und setzte auch das Hölzchen in Brand!
Jack benutzte erst einmal die Flamme, um sich seine Umgebung anzusehen — viel sah er nicht, das Lichtchen wurde von einem Dunstkreis umgeben, ein paar Köpfe und ein paar Beine, alles voll Blut, weiter nichts — dann hielt sich Jack dazu, dass er mit der Flamme seine Pfeife in Brand bekam.
Aaahh!! Jetzt aber aufgepasst, dass die Pfeife nicht ausging. Ziehen, immer ziehen, feste ziehen!! Es ist ein köstliches Kraut, dieser Overwater. Drei müssen ziehen, sechs müssen schieben, und zehn schmeißt er um.
So verging eine Viertelstunde mit kräftigem Ziehen, und die Pfeife begann zu schnarchen. Jetzt wiederholte sich die Manipulation mit dem Schneiden und Zerreiben des Tabaks, dabei aber noch die brennende Pfeife zwischen den Zähnen, und als alles fertig zum Laden war, wurde mit gewissenhaftester Sorgfalt die trockenste Stelle am Steinboden ausgesucht, auf dieser die Pfeife ausgeklopft, nun so schnell wie möglich sie mit dem bereitgehaltenen Tabak wieder gestopft, sich gebückt und an dem glühenden Aschenrest frisches Feuer gefangen.
Das ewige Lämpchen war gerettet.
Da erscholl ein knarrender Ton. Jack vergewisserte sich, dass von dem Feuer seiner Pfeife nichts zu sehen war, und blieb still sitzen, lauschte.
Das Knarren wiederholte sich nicht, wohl aber raschelte es einmal leise. Jack konnte es nicht bestimmt sagen, glaubte aber, das Atmen eines Menschen zu vernehmen.
»Faringi!«, wurde da geflüstert.
Eine Weiberstimme! Er kannte sie bereits. Wer anders sollte es auch sein?
Es näherte sich ihm etwas.
»Wer ist da?«
»Die, welche dich zu retten versprach.«
»Sambone!«
»Du sagst es. Wo bist du? Reiche mir die Hand, dass ich dich führen kann.«
Sie raschelte absichtlich, dass er wusste, wo sie in der Finsternis nach ihm tastete.
Jack wusste ein einfacheres Mittel.
»Siehst du das glühende Lichtchen? Hier bin ich.«
Sie schien eine Bemerkung zu unterdrücken, dann hatten sich ihre Hände gefunden.
Jack wurde fortgeleitet. Er stieg über die Leichen und merkte, dass sich auch seine Führerin an der Wand entlang tastete. Wohl passierten sie eine Tür, welche sich knarrend hinter ihnen wieder schloss, es musste ein in der Mauer beweglicher Stein sein, aber an das Tageslicht kamen sie noch nicht, sondern befanden sich noch immer in einem stockfinstern Gange.
Es ging immer weiter, manchmal auch treppauf und treppab, ohne dass seine Führerin ein Wort gesprochen hätte, und Jack war damit beschäftigt, seine möglichst gleichmäßigen Schritte zu zählen und jede Wendung zu berechnen und sich zu merken.
Endlich blieb Sambone stehen; ein Geräusch zeigte an, dass sie einen eisernen Schlüssel in ein Schloss steckte, eine Tür ging auf, helles Licht flutete ihnen entgegen.
Die Dahomey zog Jack herein, blieb aber selbst in der Tür stehen.
»Du findest alles, was du brauchst. Der Brunnen spendet Wasser. Die dort liegenden Gewänder sind für dich bestimmt. Kleide dich an und warte, bis ich zurückkomme.«
So sprach die Negerin, und hinter ihr fiel wieder die Tür ins Schloss, draußen wurde der Schlüssel umgedreht.
Zunächst sah sich Jack näher um. Es waren drei geräumige Kammern, die Wände aus mächtigen Quadern bestehend, welche sich unterhalb eines Lichtschachtes im Kreise gruppierten, sodass sie im Hintergrunde viel breiter waren als unter dem Lichtschacht, wo man also auch von einer Kammer in die andere gelangen konnte.
In der Mitte, direkt unter dem Lichtschacht, war im Boden ein Loch, aus welchem es finster hervorgähnte. Ein daneben liegendes Seil, an welchem eine unten mit Blei beschwerte Kürbisflasche befestigt war, ließ über den Zweck dieses Loches nicht im Unklaren. Es war ein Brunnen.
Wenn man sich daneben stellte, konnte man in den Lichtschacht blicken. Er hielt etwa zwei Meter im Durchmesser, senkrecht stiegen die Wände empor, hatten aber auch hier und da Öffnungen, die Höhe schätzte Jack auf vielleicht dreißig Meter, oben konnte er den blauen Himmel sehen.
Nur im Gegensatz zu der Finsternis, in der er sich zuvor so lange aufgehalten hatte, war es zuerst für ihn ein blendend helles Licht gewesen. In Wirklichkeit herrschte hier eine Dämmerung, welche im Hintergrunde der Kammern natürlich zunahm, während man direkt unter dem Lichtschachte recht wohl lesen konnte.
Die drei Kammern waren nach afrikanischen Begriffen mit der höchsten Bequemlichkeit ausgestaltet, allerdings ohne Luxus. Was Jack in der einen nicht sah, fand er in der anderen. Die eine, in welcher sich wieder ein solches Rohrbett als Hauptsache befand, sollte das Schlafzimmer vorstellen, die Kammer nebenan war zum Toiletten- und Waschraum eingerichtet, in der dritten fand Jack so ziemlich alles, was zu einem ›besseren‹ Negerhaushalte gehört.
Ohne Weiteres ging Jack an seine Toilette, was er sehr notig hatte, denn nicht nur sein Anzug starrte von geronnenem Blute — und zwar von Menschenblut! Aber der Negergewänder, welche auf dem Bette lagen, bediente er sich nicht. Er begnügte sich damit, sich selbst zu waschen und dann seinen Lederanzug mit einem nassen Lappen abzureiben, wodurch sich leicht alle Blutspuren entfernen ließen. Das Leder nahm dabei keine Feuchtigkeit an.
Der Brunnen spendete klares, frisches Wasser, und sehr angenehm war es, dass in der Waschkammer auch ein Ausguss vorhanden war, das heißt, ein Loch im Boden, dessen Bestimmung man ihm gleich ansah. Das ausgegossene Wasser fand irgendwo seinen Abfluss, nur sicher nicht zurück in den klaren Brunnen.
Soeben hatte Jack die letzte Hand an seine Toilette gelegt, als draußen wieder der Schlüssel ins Schloss gesteckt wurde, Sambone trat ein, hinter sich wieder zuschließend, den großen Schlüssel, wie die schwere Eisentür ein Erzeugnis einheimischer Schmiedekunst, dann im Busen verschwinden lassend.
Jack hatte diesem Schlüssel seine größte Aufmerksamkeit gewidmet. Das war ihm viel wichtiger, als dass die Dahomey jetzt ein viel weniger kriegerisches Aussehen hatte als vorher. Offenbar hatte sie mit Absicht ein kokettes Kostüm gewählt, bei welchem schreiende Farben bevorzugt wurden, auch war sie reichlich mit Schmuck behangen, und durch ihr aufgelöstes Haar war eine prachtvolle Korallenschnur geflochten.
Mit flammenden Augen wandte sich das Riesenweib Jack zu.
»Mann mit dem löwenkühnen Herzen«, begann sie, »ich habe dir das Leben gerettet.«
»Ja, jetzt hast du mir es wirklich gerettet, und ich danke dir«, entgegnete Jack. »Erzähle, auf welche Weise du dies fertiggebracht hast! Wissen noch mehr als nur der Henker darum?«
Aber die Dahomey ging gar nicht auf eine Erklärung ein, jetzt nicht und später nicht. Ihre funkelnden Augen schienen den schönen, ritterlichen Mann verschlingen zu wollen, und ihr Busen arbeitete schwer.
»Kennst du die Gesetze von Dahomey?«, fuhr sie fort.
»Sehr wenig.«
»Ich habe dein Leben gerettet — es gehört mir.«
»Und ich habe das deine gerettet — wir sind quitt und brauchen einander nicht mehr zu danken.«
»Und du hast das meine gerettet«, bestätigte sie, »also gehöre ich auch dir — wir gehören zusammen.«
Jack hatte es kommen sehen, er wusste auch, was weiter passieren würde, aber er durfte scheinbar nichts wissen.
»Wenn wir einander nichts mehr zu danken haben«, sagte er, »so kannst du dir meinen Dank noch verdienen, denn dein Werk, Sambone, ist erst halb vollendet. Noch bin ich nicht frei. Wird es dir auch gelingen, mich unbemerkt aus Abomey wieder herauszubringen, dass ich meine Reise fortsetzen kann?«
»Wozu?«
»Du weißt wahrscheinlich noch nicht, weswegen ich die gefährliche Reise durch dieses Land, in welchem du als Lieblingsweib des Königs herrschst, unternahm. Ich habe eine Frau...«
Eine heftige Handbewegung schnitt ihm das Wort ab. Sambones Nüstern blähten sich, ihre Züge nahmen einen drohenden Ausdruck an.
»Schweig!«, schrie sie in befehlendem Tone. »Ich weiß alles. Das Mädchen, welches du deine Frau nennst, ist für dich verloren. Du aber gehörst mir! Verstehst du, was das heißt?«
Jack hielt es für das Beste, die Sache möglichst abzukürzen, nicht mehr den Ahnungslosen zu spielen.
»Was hast du mit mir vor?«
»Du gehörst mir!«, wiederholte sie immer wieder.
»Du willst mich wohl hier festhalten?«
»Du sagst es.«
»Als deinen Sklaven?«
»Als den Mann, welchen ich liebe!«
»Du liebst mich?«
»Du wirst mein Geliebter sein!«
»Ich habe bereits ein Weib, welches ich liebe...«
»Du liebst mich nicht?«
»Nein.«
»Das ist mir gleichgültig, aber ich liebe dich...«
O! Solch einem Charakter durfte man alles zutrauen.
Kaltblütig berechnete Jack schon den Sprung, mit dem er das Riesenweib unterlaufen würde, schon schaute er sich nach geeigneten Stricken und nach einem Knebel um.
Dieses Umschauen aber musste er bemänteln, auch musste er sich erst vergewissern, ob sie hier nicht beobachtet würden, ob jemand vorhanden wäre, der auf des Weibes Hilferufe herbeieilen würde; er dachte auch an sein Pferd...
Es sollte alles ganz anders kommen. Das ans Befehlen gewöhnte Weib machte äußerst kurzen Prozess, um ihren Zweck zu erreichen.
»Du sinnst auf Flucht, aber ich...«
Mit einem katzenähnlichen Satze sprang sie plötzlich auf Jack los und hatte ihn um den Leib gepackt. Der gewaltigste Kampf zwischen einem Manne und einem Weibe ist im Nibelungenliede geschildert, wie Siegfried an Gunters Stelle mit Brunhilde um das Recht der Brautnacht ringt.
Nicht anders war es hier, und an Gewaltigkeit mochte dieser Kampf jenem nicht nachstehen, denn auch hier war es ein riesenstarkes und in allen Künsten des Nahkampfes und Ringens geübtes Weib, welches einen kraftvollen Mann bezwingen wollte.
Bald wäre Jack, obwohl er nicht gänzlich überrascht wurde, auf das Bett geschleudert worden. Im letzten Augenblicke noch entging er durch eine blitzschnelle Wendung dieser Lage, in der er schon so gut wie bezwungen gewesen wäre, die Dahomey aber war so gewandt, dass sie ihrerseits nicht auf das Bett gefallen war.
Hin und her wogte der Ringkampf, und alles, was nicht niet- und nagelfest war, ging in Trümmer, als erstes das Bettgestell. Sie blieben auch nicht nur in der einen Kammer, sie jagten in wildem Tanze aus einer in die andere, und ein Wunder des Zufalls war es nur, dass sie dabei nicht einmal in den Brunnen stürzten.

Gar kein Zweifel, an Gewandtheit kam die Negerin dem im Kampfe mit geschmeidigen Indianern aufgewachsenen Präriejäger gleich, und an Kraft war das herkulische Weib ihm sogar bedeutend überlegen. Aber Jack hatte zwei Vorteile für sich; eigentlich spielte die Dahomey nur mit ihm. Anstatt zu schreien, flüsterte sie ihm auch noch während dieses Ringens mit heißem Atem glühende Liebesworte ins Ohr —— und Jack dachte daran, was ihm dann geschehen würde, wenn dieses liebestolle Weib ihn überwältigt hatte — und er dachte daran, dass diese Szene und alles Andere, was noch kommen könnte, mit den hellsehenden Augen eines Kindes zu beobachten war — und das war es, die Scham, schon mehr eine Art von Verzweiflung, was ihm Riesenkräfte verlieh, das Bewusstsein, dass er nur siegen oder sterben könne — und was ihn auch als Sieger aus dem Kampfe hervorgehen ließ.
Jetzt hatte er die günstige Gelegenheit erspäht — hoch schwebte die Negerin in der Luft — ein schmetternder Krach, sie war zu Boden geschleudert worden und auf ihr kniete Jack.
Der Sturz, der ihr alle Knochen im Leibe zerbrochen haben konnte, hatte ihr das Bewusstsein geraubt, nur für eine Viertelminute, aber diese hatte für den Präriejäger schon genügt, sie mit dem Hanfseile, welches neben dem Brunnen gelegen hatte, an Händen und Füßen zu fesseln und ihr ein großes Tuch in den Mund zu pfropfen. Als er sich von dieser Arbeit aufrichtete, war Sambone schon wieder bei Besinnung. Verstört blickte sie um sich, wollte aufspringen — da erst merkte sie, dass sie die Besiegte war, sie ließ sich zurückfallen und heuchelte den gewöhnlichen Stumpfsinn der Negerrasse. Aber Jack sah bereits, wie sich ihre riesigen Armmuskeln anspannten, sie prüfte die Bande auf ihre Festigkeit.
Nein, dieses noch ganz neue Hanfseil war durch keine menschliche Kraft zu zerreißen, und Jack schlug erst noch einige Knoten hinein, stopfte den Knebel erst noch etwas nach, ehe er innehielt, um zu lauschen, ob der Lärm dieser Kampfszene einen anderen Menschen herbeiführen könne.
Es schien nicht so. Nichts regte sich. Gott wusste, wo sie sich hier befanden. Jedenfalls unter der Erde in einem massiven Kellergewölbe. Von dem Weibe etwas zu erfahren, darauf verzichtete Jack von vornherein. Jetzt wenigstens hielt er es noch nicht für geraten, ihr die Sprache wiederzugeben. Die Augen, die ihn vorhin so lüstern und zärtlich betrachtet hatten, waren jetzt mit einem furchtbar gehässigen Ausdruck auf ihn gerichtet.
Vor allen Dingen suchte er den Schlüssel, den sie auf der Brust verborgen hatte. Obgleich sie schon stark dekolletiert war, musste er auch noch das obere Gewand öffnen, und plötzlich bäumte sich Sambone wie eine Schlange auf, suchte seine Hand mit den Zähnen zu packen, was ihr freilich wegen des Knebels überhaupt nicht gelungen wäre, und dabei veränderte sich wiederum ihr Gesicht, das war kein Hass mehr, sondern rohe Sinnlichkeit prägte sich in den wilden Zügen aus.
Er hatte den großen, seltsam geformten Schlüssel gefunden. Ein geschweiftes Loch in der Tür war vorhanden, der Schlüssel ging leicht hinein — aber Jack konnte ihn so oft herumdrehen, wie er wollte, der Schlüsselbart stieß auf keinen Widerstand, wodurch ein Riegel zurückgeschoben worden wäre — er vermochte die Tür eben nicht aufzuschließen.
Wohl fünf Minuten probierte er so vergebens. Als er sich dann umwandte, sah er die Augen der Dahomey in höhnischem Triumphe auf sich gerichtet, auch stieß sie jetzt gurgelnde Laute aus.
Noch einmal versuchte Jack sein Glück, probierte es selbst mit einem großen, krummen Nagel — das Vexierschloss spottete aller Geduld und allem Scharfsinn, und doch hatte das Weib es vorhin so schnell und leicht auf- und wieder zugeschlossen.
Nach kurzem Besinnen begab sich Jack zu der Negerin, kniete neben ihr nieder, legte die rechte Hand auf ihre Kehle, die andere entfernte den Knebel aus dem Munde.
»Ein einziger Schrei, und ich schnüre dir die Kehle zusammen, was dein Tod sein kann.«
Sie antwortete mit einem Kopfschütteln, und sie schrie auch wirklich nicht, als der Knebel entfernt war.
»Gib dir keine Mühe, Faringi«, sagte sie höhnisch, »du wirst die Tür niemals offen bekommen.«
»Das werden wir sehen. Mich freut nur, dass dein Wahnsinn verraucht zu sein scheint. Willst du mir antworten?«
»Frage, aber lebendig kommst du nicht wieder hier heraus.«
»Wo befinde ich mich?«
»An einem Orte, wo keines Menschen Stimme vernommen wird, und könnte er auch wie ein Löwe brüllen. Deshalb kannst du ruhig deine Hand von meinem Halse nehmen, mein Rufen würde nichts nützen.«
»Weib, was hast du mit mir vor?«
»Jetzt nur noch, mit dir hier zu sterben. Wir werden beide verschmachten. Oder du kannst mich auch zuvor töten. Aber dein Tod ist ebenfalls gewiss.«
Jack beschloss, einzulenken. Not kennt kein Gebot.
»Sambone, warum stürztest du dich auch so ohne Weiteres auf mich? Solche Liebeserklärungen mögen hier Sitte sein, bei mir zulande kennt man so etwas nicht. Es wäre nicht nötig gewesen, dass es zwischen uns zum Kampfe kam. Aber ich musste mich doch wehren.«
»Du hast gewonnen, ich habe verloren.«
»Wenn ich dich nun freigebe, was würdest du dann tun?«
»Dich lieben!«
Dies war kurz und bündig genug.
»Aber du würdest diesen Raum wieder verlassen?«
»Das muss ich doch, sonst würden wir beide ja hier verhungern.«
»Und ich?«
»Du bleibst hier.«
»Du würdest mich nur zeitweilig besuchen?«
»Selbstverständlich.«
»Also ich soll dein Gefangener sein und bleiben?«
»Mein Gefangener! Du darfst dich doch oben überhaupt nie wieder sehen lassen, du bist ja tot.«
Jack überlegte, ob er auf diese Gefangenschaft nicht scheinbar eingehen solle. Dann hatte er doch Gelegenheit, die Negerin bei ihrem Eintritt, wenn sie die Tür noch nicht wieder geschlossen hatte, zu überwältigen. Freilich würde dieses schlaue Weib da wohl noch andere Sicherheitsmaßregeln getroffen haben, und wer wusste denn...
Erschrocken brach Jack in seinem Gedankengange ab, und nicht minder fuhr Sambone empor, soweit das ihre Fesseln gestatteten.
Hinter Jack hatte sich nämlich ein Geräusch hören lassen, sich schnell wiederholend. Ein harter Gegenstand schlug mehrmals auf die Steinplatten auf, und die beiden waren doch allein in diesen Räumen, dreißig Meter unter der Erdoberfläche.
Jack brauchte nur den Kopf zu wenden, so sah er die Ursache dieses seltsamen Geräusches, das geradezu unheimlich wirken musste.
Über dem Brunnenloch hing plötzlich ein starkes Seil, aus dem Schacht herauskommend. Unten war ein großer, hölzerner Eimer befestigt, er hatte schon die Brunnenöffnung erreicht, da aber das Seil stark hin und her pendelte, schlug der Eimer immer auf den Rand, was oben wohl bemerkt wurde.
Die Negerin stieß mit funkelnden Augen ein grimmiges Zischen aus, dem sie auch gleich Worte folgen ließ.
»Welcher Frevler wagt da, aus diesem heiligen Brunnen Wasser zu schöpfen?!«
Texas Jack hatte genug gehört. Blitzähnlich schoss ihm die ganze Erklärung durch den Kopf. Dies hier war also ein geheiligter Brunnen, vielleicht ein verzauberter, vielleicht hatte erst die Anführerin der Blauen solch einen Zauber zustande gebracht, um sich hier unten für alle Fälle eine versteckte Wohnung einzurichten — jedenfalls durfte dieser Brunnen, auch ohne dass er zugedeckt wurde, nicht benutzt werden — aber selbst unter dem abergläubischsten Negervolke mag es Freigeister geben. Ein Durstiger, der dort unten klares Wasser wusste, hatte eben doch einmal einen Eimer hinabgelassen...
Zu diesem Gedankengange hatte Jack nur einen Moment gebraucht. Die Hauptsache war, dass er in diesem Eimer oder vielmehr in diesem starken Seile, seine Rettung sah — mit einem Satze war er an dem Brunnenloche und hatte das Seil gepackt.
Oben an der Schachtöffnung erkannte er eine menschliche Figur, die jetzt hinabspähte, um den Grund zu erkennen, weshalb sich das Seil nicht wieder heraufziehen ließ, der Widerstand musste sofort zu bemerken sein — aber dass Jack selbst gesehen werden konnte, das war ganz ausgeschlossen. Für den dort oben war der Schacht stockfinster.
Doch dass dieses Seil für ihn die Befreiung bedeute, das war nur ein blitzähnlicher Gedanke beim ersten Anblick desselben gewesen. Loslassen durfte er es hier unten nicht; aber wenn die dort oben das Seil hinabfallen ließen, dann war Jack gerade so weit wie zuvor, höchstens dass solch ein langes Seil überhaupt schon einigen Wert hatte.
Zunächst wurde noch versucht, den unbekannten Widerstand zu besiegen; es mussten mehrere sein, die dort oben mit aller Kraft zogen, vielleicht auch hatten sie eine Winde, denn bald ward Jack selbst mit in die Höhe gezogen, und da hat doch jede menschliche Kraft ein Ende.
Schon aber hatte Jack in der nahen Wand einen eisernen Ring erspäht, der dort eingelassen war. Schnell fasste er den Eimer und schlang das unsere Ende des Seiles um diesen Ring, schlug einige Knoten — so, nun konnten die dort oben das Seil nur noch abreißen oder fallen lassen. Das war nun abzuwarten.
»Wie können die Hunde wagen, aus diesem heiligen Brunnen Wasser zu schöpfen!«, wiederholte Sambone.
Ohne den Brunnenschacht aus den Augen zu lassen, wandte sich Jack zunächst wieder seiner Gefangenen zu.
»Wieso ist dieser Brunnen heilig?«, fragte er, in der Hoffnung, dass sie ihm eine nähere Erklärung geben würde, und er sollte sich auch nicht getäuscht haben.
Vielleicht war etwas Eitelkeit dabei, dass sie so offen zu ihm sprach — die Eitelkeit des Besserwissens.
»Weil in diesem Brunnen Sangla wohnt.«
»Wer ist das, Sangla?«
»Der Wassergott, der alle Brunnen fließen lässt.«
Jack erfuhr noch mehr. Die Hauptstadt Abomey hat oft unter Wassermangel zu leiden, so auch jetzt wieder. Die tief in den Felsen gebohrten Brunnen liefern wohl immer Wasser, aber zur Zeit der Dürre wird es salzig. Nur dieser Brunnen hier enthielt ständig gutes Wasser, und wie man es nun bei so vielen Völkern findet, wie es auch bei den Jehova anbetenden Juden war, dass sie ihrem Gott oder ihren Göttern immer das Beste opfern, was die Erde hervorbringt oder was sie sonst besitzen, so war auch dieser immer gefüllte Brunnen spezielles Eigentum Sanglas, des Wassergottes, er durfte von Menschen nicht benutzt werden. Mit Ausnahme, wenn es bei sehr großem Mangel einmal der König erlaubte, wozu aber auch erst diesem Gotte einige Hundert Menschen geopfert werden mussten.
»Nun, dann hat es eben der König einmal erlaubt.«
»Wie kann er es wagen, ohne mich erst zu Rate zu ziehen! Und sind etwa schon Menschen geopfert worden?«
»Nun, ich dächte doch, gerade genug. Und das waren doch alles Personen, von denen jede einige Dutzend aufwiegt.«
»Der König darf es nicht ohne meine Erlaubnis! Wehe ihm, wenn ich wieder vor ihn hintrete!«
Das war also für sie die Hauptsache. Der König, der in der Hand der Vorkämpferin, die zurzeit die Herrschaft hatte, nur eine willenlose Puppe war, hatte ohne ihre Ermächtigung gehandelt. Das konnte sie ihm nicht verzeihen.
»Du selbst aber bist wohl nicht so von der Heiligkeit dieses Wassergottes überzeugt, dass du hier unten eine Fuchswohnung eingerichtet hast?«
Sie ließ nur ein verächtliches Zischen hören, und es sagte genug.
Da kam den Schacht ein Lichtschein herab. Es war eine brennende Öllampe an einem dünneren Seile.
Jack trat nur zurück, sonst ignorierte er die Lampe. Da er die Kürbisflasche mit dem kurzen Seil bereits zur Seite genommen hatte, lag am Brunnenrande nichts mehr, was denen dort oben hätte Misstrauen einflößen können, und außerdem war der Ring mit dem angebundenen Tau außerhalb ihres Beobachtungsfeldes.
Die Lampe ging wieder hinauf, und bald kam ein zweites Seil mit einem Eimer herab. Man hatte sicher auch eine andere Winde herbeigeschafft, denn an der, die ursprünglich am Brunnenmunde angebracht gewesen war, hing doch das von Jack festgebundene Seil. Sie war also nicht mehr beweglich. Jedenfalls nahm man an, durch das starke Pendeln, dessen man sich bewusst war, habe sich der Eimer hier unten irgendwo festgehakt, so vermied man jetzt jedes Pendeln, und infolgedessen gelangte denn auch der unten stark beschwerte Eimer direkt in das Brunnenloch, tauchte ins Wasser, ging voll in die Höhe, ward abermals leer herabgelassen, und so ging das stundenlang fort, ohne dass man sich noch um das erste, festgehakte Seil kümmerte.
Die gefangene Negerin verwünschte immer noch die Frevler, welche ohne ihre Einwilligung Wasser aus diesem geweihten Brunnen zu schöpfen wagten. Der König mochte ja seine Erlaubnis dazu gegeben haben, aber Sambone fühlte sich doch als Hauptperson.
»Ist denn schon einmal ein Mensch in diesen Brunnen herabgestiegen?«, fragte Jack das Weib, welches immer so bereit zur Antwort war.
»Wehe dem, der das wagte!«
»Ist es schon einmal passiert?«
»Solange Abomey besteht noch nicht.«
Das zu hören war unserem Freunde sehr lieb. Nun hätte er auch noch gern erfahren, ob es ausgeschlossen sei, dass man das festgehakte Seil oben abschneiden und herabfallen lassen könne, da wollte er aber mit jener Schlauheit, die der sonst so offenherzige Mann schon oft genug bewiesen hatte, doch lieber auf Umwegen fragen.
»Also auch dem Sangla werden Menschenopfer gebracht?«
»Alljährlich an seinem ihm geweihten Tage, und stets, wenn wegen Wassermangels dieser Brunnen einmal benutzt wird.«
»Dann werden diese Menschen hier in den Brunnen geworfen?«
»In diesen Brunnen? Wo denkst du hin! Das würde das Wasser doch verpesten.«
»Was wird denn sonst in den Brunnen geworfen?«
»In den Brunnen geworfen?«
»Ich habe gehört, dass manchmal etwas in die Brunnen geworfen wird.«
»In diesen darf nichts geworfen werden, kein einziges Steinchen, das würde den Brunnen entheiligen.«
Die Dahomey mochte nun selbst fühlen, dass es doch nicht angebracht war, sich mit dem Manne, der sie besiegt hatte, so gemütlich zu unterhalten, sie wandte sich zur Seite, drehte ihm den Rücken zu — und Jack hatte auch schon genug gehört.
Unaufhörlich ging der Eimer hin und her. Erst nach vielen Stunden kam er nicht wieder herunter, und da drang durch den Brunnenschacht schon kein Lichtschein mehr, der Abend war angebrochen. Durch den Schacht konnte Jack die Sterne flimmern sehen, und dabei blieb es. Die Öffnung ward nicht zugedeckt.
Hier unten herrschte schon längst vollkommene Finsternis. Jack hatte in einem der Räume eine Lampe stehen sehen, er hätte sie finden können, aber er wollte doch lieber kein Licht machen, und er hatte es auch nicht nötig.
Die Negerin hatte bisher regungslos dagelegen. Jetzt ließ sie einmal wieder ihre raue Stimme vernehmen.
»Du gedenkst doch nicht etwa, an dem Seile in die Höhe zu klettern?«, erklang es höhnisch aus der Finsternis.
»Das will und werde ich allerdings tun.«
»Hahaha! Und wo bist du dann?«
»In der Freiheit.«
»Wenn du wüsstest, wo du dann bist!«
»Nun?«
»Erst recht eingeschlossen! Wohl bist du in einem Hof, aber über diese Mauern kommst du nicht hinweg, und der Hof liegt mitten im königlichen Schlosse.«
Ja, dass er dann noch immer nicht ganz frei war, hatte Jack schon in den Bereich seiner Betrachtungen gezogen. Vielleicht aber machte dieses Weib die Sache schlimmer, als sie wirklich war, um ihn einzuschüchtern, dass er diesen Brunnenschacht gar nicht erst verließ.
Daran war natürlich nicht zu denken. Hinauf musste er. Wenn er nur gewusst hätte, wo sich sein Pferd befand, wo er sich dieses verschaffen konnte!
»Wo ist mein Pferd untergebracht?«, versuchte er es doch einmal.
»Ja, da frage mich nur!«, wurde spöttisch gelacht, und Jack gab seine Bemühungen auf. Lieber überzeugte er sich, dass die Fesseln der Gefangenen noch in Ordnung waren, und dabei entging er nur durch einem Zufall ihren Zähnen, die sich in seine Hand zu schlagen versucht hatten. Nun aber war er gewarnt, nun konnte ihm nicht mehr passieren, dass sie ihn biss, ob aus Liebe oder Hass.
Noch zwei Stunden, dann beschloss Jack, seine Kletterpartie anzutreten. Woher er, ohne eine Uhr bei sich zu haben, so genau wusste, dass seit Sonnenuntergang zwei Stunden vergangen waren?
General Sheridan rühmt in einem Bericht an das Kriegsministerium dem seinem Zuge gegen aufrührerische Indianer als Führer dienenden Buffalo Bill nach, dass er jederzeit, wann er auch gefragt wurde, antworten konnte, wo man sich befände, wie weit man schon seit dem Verlassen des letzten Lagers wieder geritten sei, was immer bis auf hundert Meter gestimmt habe, und fabelhaft seien seine Schätzungen der Ortszeit, ohne dass er zur Orientierung Sonne und Sterne nötig hatte, gerade, als habe er in seinem Kopfe einen Chronometer.
Das sind eben Gaben des Instinkts, welche man von einem Führer und Indianerscout verlangt. Ohne diese Gaben eignet er sich gar nicht dazu.
Nun, und Texas Jack nahm es in dieser Hinsicht mit seinem Meister auf. Selbst wenn er aus dem festesten Schlafe erwachte, konnte er fast bis zur Minute die Uhrzeit angeben. Das hatte er eben im Gefühl. Sonst lässt sich das ebenso wenig erklären, wie dass es Menschen gibt, welche auch im finsteren, geschlossenen Raume ganz genau die Himmelsrichtungen bezeichnen können.
Dahomey liegt ziemlich unter dem Äquator. Und unter diesem geht die Sonne regelmäßig, ganz unabhängig von den Jahreszeiten, um sechs Uhr auf und um sechs Uhr unter, direkt unter der Linie mit dem Punkt.
So war es jetzt etwas nach acht Uhr. Das war eigentlich noch keine Nacht. Einmal aber richten sich diese Negervölker doch nach der Sonne, wie die Hühner, wie alle Tagestiere, und wenn die Burgbewohner genügend für Wache sorgten, so bot die Nacht auch keinen besonderen Vorteil für den Fluchtversuch.
Ja, die Zeit wurde sogar immer ungünstiger. Der Brunnenschacht begann sich bereits wieder zu erhellen. Es war nämlich gerade Vollmond. Hoch konnte er noch nicht stehen, und da war es doch besser, den Fluchtplan ins Werk zu setzen, ehe das Himmelslicht die ganze Umgebung noch mehr erhellte.
Als Waffe schob sich Jack eins der Holzbeine des zusammengebrochenen Bettes in den Gürtel, und er war fertig zum Aufstieg. Um das gebundene Weib, welches er hilflos zurückließ, konnte er sich nicht kümmern, wenn es auch hier unten verhungerte oder verschmachtete. Das war der Krieg, der rücksichtslose, in dem dieser Mann, der sonst wiederum ein so zartfühlendes Herz zeigen konnte, groß geworden war.
Übrigens würde die sich schon zu helfen wissen, die war doch ebenfalls mit allen Listen des Kampfes vertraut. Es gibt ja gar keine Fesseln, deren man sich nicht schließlich doch entledigen könnte, wenn man nur ungestört daran arbeiten kann.
Hätte Texas Jack mit seiner Vorsicht wirklich eine gänzliche Gefühllosigkeit verbunden, so hätte er dieses Weib zuvor getötet. Er hätte auch ein Recht dazu gehabt. Es war doch seine Feindin, die selbst zu allem gegen ihn fähig war, und das wäre das Sicherste gewesen.
So aber begnügte er sich, noch einmal ihre Fesseln zu prüfen, die Knoten fester zu schürzen, wobei sie ihn wiederum zu beißen suchte — und dann stellte er auch noch die mit Wasser gefüllte Kürbisflasche und eine Portion Durrabrot vor sie hin, das er in der Proviantkammer gesehen hatte.
»So — deinen Tod will ich nicht, mehr aber kann ich nicht für dich tun, will dir nicht einmal deinen Schlüssel nehmen und werde oben auch nicht das Seil abschneiden. Sieh zu, wie du dich befreien kannst, und bis dahin hoffe ich auf meinem Pferde vor dir schon in Sicherheit zu sein.«
Er wandte sich dem Brunnenschacht zu, ein spöttisches Lachen scholl ihm nach.
Jack begann die Klettertour. Es waren mindestens dreißig Meter, und die wollen an einem glatten, nicht allzu starken Taue erklommen sein. Doch dieser Mann verstand das Klettern. Hand über Hand ging es hinauf, die Beine wurden nur ausnahmsweise zu Hilfe genommen, und diese stählernen Muskeln wollten nicht erlahmen — — nach kaum drei Minuten hätte Jack den Kopf über den Brunnenrand hinausstecken können.
Noch zögerte er. Über der Schachtöffnung lag eine Welle, an der das Seil befestigt war. Die Hilfswinde hatte man wieder fortgenommen. Das konnte ihn nicht hindern, war ihm nur behilflich beim schnellen Herausspringen. Aber er vernahm Stimmen — Weiberstimmen, wenn sie auch rau und tief genug klangen, bis auf einige, die jüngeren Personen angehören mochten.
Sie unterhielten sich über die heutige Hinrichtung, über den kühnen Fremdling, dass auch dieser seinen Tod finden musste, über Zirkona, über Sambone, wo die wohl jetzt schon seit so langer Zeit sein mochte, weshalb sie hier eigentlich Wache halten sollten und über anderes.
Texas Jack glaubte nur vier verschiedene Stimmen unterscheiden zu können. Aber lange durfte er hier nicht lauschen. In dieser hängenden Lage verschwendete er nur unnötig seine Kraft. Es musste gewagt werden, wie es auch kommen mochte. Er baute auf den Zufall — und auf seine Tatkraft und Erfahrung. Er hatte sich schon in schlimmeren Lagen befunden und war immer glücklich herausgekommen. Im schlimmsten Falle kehrte er in den Brunnen zurück, wo er sich dann eben verteidigen musste.
Also vorwärts! Mit einem Schwunge stand er auf dem erhöhten Brunnenrande, die hölzerne Kriegskeule schon in der Hand.
Was er im hellen Mondlicht erblickte, hätte ihn bestürzt machen können. Er hatte vier Stimmen unterschieden — er wollte vier andere zugeben, die sich des Schweigens befleißigt hatten — — und jetzt erblickte er mindestens ein halbes Hundert Dahomeyweiber, welche, alle bis an die Zähne bewaffnet, in engem Kreise den Brunnenschacht umlagerten.
Doch die Menge hatte ja gar nichts zu sagen. Ein Hieb von einem einzigen dieser Sensenschwerter konnte dasselbe tun wie ein halbes Hundert.
Texas Jack hätte bestürzt sein können. Er war es aber gar nicht, hatte gar keine Zeit dazu.
Wohl jedoch waren die Weiber bestürzt — entsetzt! Und obgleich es lauter solche robuste, herkulische oder doch athletische Personen mit Männerstimmen und obgleich sie bis an die Zähne bewaffnet waren und diese Waffen zu gebrauchen wussten, entstand doch im Augenblick ein Gekreische, welches einem Mädchenpensionat beim Anblick einer Maus alle Ehre gemacht hätte.
Es war ja auch begreiflich genug. Sie alle kannten doch schon den Mann, der da plötzlich zwischen ihnen auf der Brunnenrüstung stand. Und sie hatten doch heute früh gesehen, wie der Henker ihm das Haupt abgeschlagen hatte. Der blutige Kopf war ihnen gezeigt worden. Und jetzt stand dieser Mann zwischen ihnen, hatte wieder seinen Kopf auf den Schultern, und nun kam er noch dazu aus diesem Geisterbrunnen.
Also da nützte keine Kriegserklärung und keine gepanzerte Brust. Kreischen und Aufspringen, als wäre der steinerne Boden plötzlich glühend heiß geworden, war eins.
»Der geköpfte Fremde!! Die Toten werden wieder lebendig!! Sangla hat ihn wieder lebendig gemacht!!!«
So und anders erklang es im Tone des furchtbarsten Entsetzens, und dabei blieben sie nicht stehen, sondern flohen Hals über Kopf davon, und manche ließ ihr Sensenschwert oder eine andere Waffe fallen.
Jack hatte im Moment erkannt, dass er jetzt einen Vorteil für sich hatte, den er ausbeuten musste, nicht allein, weil die Kriegsweiber überhaupt flohen.
Es war ein Hof, von einer unübersteigbaren Mauer umringt, nirgends zeigte sich ein bemerkbares Tor — — die Weiber flohen aber nicht planlos davon, sondern sie strebten alle ein und derselben Richtung zu. Dort würden sie sicher einen Ausgang haben, und den musste auch Jack benutzen, solange er noch offen war. Wie er dann wieder zu seinem Pferde und womöglich auch zu seinen Waffen kam, das blieb der Zukunft überlassen. Wenn er selbst nur erst einmal außerhalb der Stadt war, womöglich im Wald, dann wollte er die Sache schon anders anfassen, dann würde er wahrscheinlich mit auszulösenden Geiseln operieren.
Also den immer noch kreischenden Weibern nachgestürmt! Richtig, da war plötzlich in der Mauer eine schmale Spalte entstanden, in die sich die ersten hineinquetschten. Hinter ihnen entstand ein furchtbares Gedränge, schon ging es um Leben und Tod. Wie das enden würde, war noch gar nicht abzusehen. Aber es sollte immer noch ganz anders kommen.
Da plötzlich war es, als ob die ersten, denen es schon geglückt war, sich hineinzudrängen, wie von einer unsichtbaren Macht wieder herausgeschleudert würden — und es war auch wirklich so. Plötzlich wurden Sensenschwerter geschwungen, welche die blaubebänderten Köpfe wie die Ähren abmähten — und plötzlich waren da auch rotbebänderte Dahomeyweiber — und in das noch immer anhaltende Kreischen und Zetergeschrei mischte sich jetzt noch ein ganz anderes Geheul, welches Jack schon recht gut kannte, nämlich in den Vorstellungen hatte er es vor einigen Jahren oft genug gehört, von seinen eigenen Leuten — — der Kriegsruf der Dahomey-Amazonen. Ja, hier wurde eine wirkliche Schlacht geliefert. Oder es war vielmehr ein Schlachten.

Jack brauchte natürlich nicht erst darüber nachzugrübeln, was hier eigentlich vorlag. Er sah die rotbewimpelten Weiber, welche den Blauen die Köpfe abmähten.
Zirkona war mit ihrer Schar aus den Bergen zurückgekehrt, hatte sich in die Stadt geschlichen, die königliche Burg überfallen, in aller Stille; aber sie war jedenfalls schon vollständig in ihrer Gewalt, und jetzt wurden die letzten der blauen Rivalinnen niedergemacht, wobei es ohne lauten Waffenlärm nicht mehr abging.
Und schon war es geschehen. Die letzte der Blauen, die an dem Brunnen hatte Wache halten müssen, lag verblutend am Boden. Die Eindringenden hatten ein sehr leichtes Spiel gehabt, sie hatten sich höchstens durch die eigenen Waffen leichte Wunden zuziehen können. Der Überfall, das Eindringen der Roten in diesen mitten in der Stadt und im königlichen Schlosse liegenden Burghof war gar zu überraschend gekommen, und außerdem hatten diese Wächterinnen hier ja noch vollkommen unter dem Einflusse des aus dem Brunnen steigenden Gespenstes gestanden.
Erst jetzt entdeckten die Siegerinnen den fremden Mann, und seine Anwesenheit hier rief, wenn nicht Bestürzung, so doch Staunen hervor. Sie wussten im ersten Augenblick offenbar gar nicht, wie sie sich seine Anwesenheit erklären sollten.
Jack ließ sie nicht lange staunen.
Schnell trat er auf eine der Kriegerinnen zu, die durch goldene Armspangen und anderen Schmuck als Vorkämpferin ausgezeichnet war, und als solche hatte sie sich mit ihrem Sensenschwert auch bewiesen — gleichfalls ein großes, mit Riesenkräften ausgestattetes Weib, aber doch wieder so ganz anders als Sambone, nicht so plumpherkulisch gebaut, sondern schlank gewachsen mit athletischer Gliederpracht, und dann vor allen Dingen die dunklen Züge edel und wirklich schön.
Auf diese war Jack sofort zugetreten, mit allen Zeichen der Freude.
»Matawenna!!«, rief er mit ausgestreckter Hand, und es klang wie heller Jubel. »Ahnte ich doch gleich, dass diese Zirkona keine andere sei als meine Freundin Matawenna!!«
Erkannte er das kriegerische Weib im wilden Afrika gleich wieder, so doch dieses nicht ihn — oder sie wollte es nicht glauben — traumverloren fuhr sie mit der Hand über die Stirn, diesen Mann jetzt ebenfalls wie ein Gespenst anstarrend.
Da stürzten andere rotgeschmückte Kriegerinnen auf ihn zu, um seine Hand zu ergreifen.
»Jack, Texas Jack!!«, erklang es im Chor. Jetzt suchten zunächst diese Amazonen seine Hand zu ergreifen, und Jack konnte sie, während er einer nach der anderen die Hand schüttelte, alle beim Namen nennen, wenn es vielleicht auch nicht ihre wirklichen waren.
Da kehrte auch bei Zirkona, die er Matawenna genannt, die Erinnerung zurück.
»Ist es möglich?«, rief sie, sich der englischen Sprache bedienend. »Texas Jack, mein Texas Jack!!«
Das hünenhafte Weib fiel ihm gleich um den Hals, und diese zärtliche Begrüßung duldete der sonst so spröde Mann; er erwiderte sie sogar, denn das war etwas ganz anderes, das war wirklich eine gute Freundin, die er hier in Dahomey wiederfand.
Jack befand sich in einem Gemache, welches seiner überaus luxuriösen, wenn auch afrikanischen Einrichtung nach für gewöhnlich dem König oder doch einem seiner höchsten Würdenträger zum Aufenthalt zu dienen schien. Wie die beiden Ampeln mit wohlriechendem Öl, welche ein helles Licht verbreiteten, so waren fast alle anderen Gerätschaften aus Gold und Elfenbein.
Er hatte hier die Dahomeyweiber wiedergefunden, mit denen er einst unter Buffalo Bills Führung eine Rundreise durch Europa gemacht hatte.
Jack hatte von vornherein damit gerechnet oder doch bestimmt darauf gehofft, mit jenen achtzehn Weibern oder doch mit einigen von ihnen hier wieder zusammenzutreffen, zu seinem Vorteil, denn die afrikanischen Kriegerinnen waren damals, als sie in aller Freundschaft die Truppe verlassen hatten, wieder in ihre Heimat zurückgekehrt, das hatte Jack ganz bestimmt gewusst, und wenn auch die die Anderen führende Kriegerin niemals etwas davon erwähnt hatte, welche Rolle sie am Hofe des Königs von Dahomey gespielt hatte — die achtzehn Frauen waren erst durch eine Zwischenperson zu Buffalo Bills Truppe gekommen — so hatte Jack doch schon immer geahnt, dass diese Matawenna keine andere als die Vorkämpferin der roten Partei sei, in Wirklichkeit Zirkona heißend.
Texas Jack aber war eben ein ganz eigentümlicher Mensch. Er hatte viel von dem Charakter der nordamerikanischen Indianer an sich, zu denen er ja auch gehört, wenn ihn nicht Buffalo Bill entdeckt hätte. Er war, wie schon öfter erwähnt, in gewissem Sinne ebenso verschlossen wie in anderem Sinne wieder offenherzig. Er hatte andere Personen immer über das Land der Dahomeys ausgefragt, ohne seinem Schwiegervater auch nur eine Andeutung zu geben, wie gut er schon mit allen Sitten der Bewohner vertraut war, wie er ihre Sprache vollständig beherrschte, und da hatte er also auch nicht von seinen früheren schwarzen Freundinnen erzählt.
Ja, Texas Jack, die rechte Hand Buffalo Bills, hatte damals recht gute Freundschaft mit den achtzehn Dahomeyweibern geschlossen. Sie waren Kriegerinnen, und es war auch wirklich etwas Ritterliches an jeder einzelnen. Zu einem anderen Verhältnis als zu einem freundschaftlichen war es nie gekommen. Matawenna, die Anführerin, hielt ihre schwarze Bande in gar strenger Zucht, und sie selbst war trotz ihrer schwarzen Haut ein edles, sogar ideal veranlagtes Weib, und außerdem zu Zeiten sehr melancholisch.
Sie hatte besonders Englisch lernen wollen, und Texas Jack war ihr Lehrmeister gewesen. Dafür hatte sie ihm von ihrer Heimat und deren Bevölkerung erzählt. Nur darüber hatte sie nie sprechen wollen, weshalb sie mit ihren Freundinnen aus der Heimat geflohen war, und Jack war nicht der Mann, der da noch lange Fragen stellte. Sie hatte zur roten Partei gehört, fortwährende Intrigen seitens der blauen, Zwistigkeiten — sie war mit ihren besten Freundinnen freiwillig in die Verbannung gegangen.
Nun hatte Jack sie hier wiedergefunden, richtig, wie er erwartet hatte, als die Vorkämpferin der roten Partei, und er hatte nicht erst nötig, sie in den Akandabergen aufzusuchen, um von ihr Hilfe zur Verfolgung von Muftas Karawane zu erbitten, wie er von Anfang an geplant hatte.
Denn dass ihm diese Matawenna oder Zirkona jegliche Hilfe gewähren würde, die sie ihm leisten konnte, das hatte er ebenfalls von allem Anfang an gewusst. Das war eine ganz andere als Sambone, ihren Charakter hatte er schon zur Genüge kennen gelernt.
Zunächst war er schnell hierher gebracht worden, in ein Gemach der königlichen Burg, nicht einmal von ihr selbst, sondern von zwei anderen Kriegerinnen, die er auch noch nicht von früher her kannte. Diese standen jetzt draußen Wache. Zirkona hatte kaum ein weiteres Wort mit ihm gewechselt, sie war mit ihrer Schar wieder davongestürmt, ihre Aufgabe war noch nicht vollendet. Wie alles gekommen war, musste Jack erst noch von ihr erfahren. Eben eine Überrumpelung der Burg, der ganzen Stadt, womöglich die Vernichtung aller Blauen.
Dass Jack hierbei nicht viel helfen konnte, fand er selbstverständlich. Jedenfalls mussten jetzt alle Schlupfwinkel nach den Gegnerinnen durchsucht werden, die sich versteckt hatten.
Noch einmal ein kriegerischer Lärm mit Waffengeklirr und dem Schlachtruf der Dahomeygarde. Es schien noch ein Widerstand gestürmt zu werden. Dann herrschte wieder Ruhe, und gleich darauf trat Zirkona ein. Jack hatte kaum eine Viertelstunde zu warten brauchen, die er mit dem stoischen Gleichmut eines Indianers verbrachte.
Die Eintretende hatte eine Doppelbüchse in der Hand, an einem Riemen zwei Revolver in Futteralen, ein Jagdmesser und andere Gegenstände, in denen Jack mit Freude sein Eigentum erkannte.
Die Fortsetzung des Wiedersehens zwischen den beiden fand nicht salonmäßig statt, sondern zwei solchen Personen, deren Heimat die weite Wildnis, deren Beruf der Kampf ist, entsprechend.
»Sind das deine Waffen?«
»Ja.«
»Ich erfuhr, wo sie aufbewahrt wurden, alles, was man dir abgenommen hat, und deine Büchse kannte ich ja noch.«
Wenn es ohne jedes Zeremoniell abging, immer nur die Hauptsache gesprochen wurde, so hatte sie es doch mit einem glücklichen Lächeln gesagt, während ihr noch das Blut aus einer tiefen Wunde am linken Oberarm floss.
»Du blutest, Matawenna.«
»Zirkona«, verbesserte sie. »Gewaschen ist die Wunde schon.«
Sie riss von dem Schleier, der ihr vom Helm wallte, ein Stück ab, versuchte sich die Bandage selbst anzulegen — Jack besorgte es, legte um den von Muskeln strotzenden Oberarm zugleich einen Knebel, und alsbald stand das Blut.
»Du kannst das noch so gut wie früher«, sagte sie mit ernstem Lächeln. »Weißt du noch, als dem Indianer die Ader sprang, und keiner eurer Ärzte konnte das Blut stillen?«
»Hast du etwas über mein Pferd gehört?«
»Es steht im königlichen Stall, wohlversorgt, und ich habe ihm soeben noch einmal Mais vorgeschüttet.«
»Dank dir!«
»Es ist die Nachtmär.«
»Du hast sie wiedererkannt?!«
»Und sie mich. Es war Buffalo Bills bestes Ross.«
»Er hat es mir geschenkt.«
»Und wie kommst du nach Dahomey?«
»Du wusstest noch nicht, dass ich hier bin und wozu?«
»Nein. Ich glaubte einen Geist zu sehen, als ich dich erblickte.«
»Wie kommst du hierher? Erlaube, dass ich erst Dich so frage.«
Zirkona erzählte von den Streitigkeiten zwischen den Roten und den Blauen, wie ihre Partei von der gegnerischen verräterischerweise bis auf 800 niedergemacht worden sei, mit denen sie in die Akandaberge geflohen war.
So sehr es Jack auch drängte, etwas anderes zu erfahren, hörte er doch ganz ruhig zu, und die Erzählerin fasste sich kurz genug.
»Wir brauchten vor allen Dingen Waffen, und noch nötiger Pferde. Da nahte eine große Karawane, auf die wir schon längst gewartet...«
»Mufta, der Malteser!«
»Du kennst ihn? Ja. Mufta wollte mir Waffen und Pferde nicht als Tribut zahlen, den ich zu fordern hatte, weil er ohne meine Erlaubnis durch mein Land zog — er spottete meiner — er pochte auf seine Macht und unterschätzte die meine — er forderte mich zum Kampfe heraus... wir haben seine Karawane aufgerieben, alle Überlebenden als Sklaven verkauft, Mufta selbst mit.«
»Und war da nicht auch eine weiße Frau dabei?«, fragte Jack atemlos.
»Ja.«
»Es war meine Frau!«
»Was?!«, rief Zirkona, große Augen machend.
»Meine Frau, sie ist mir entführt, an diesen Mufta als Sklavin verkauft worden, der sie ins Innere schleppte.«
Mit fliegender Eile teilte Jack der schwarzen Freundin alles mit, was sie unbedingt wissen musste. Von dem hellsehenden Kinde zu berichten, das war jetzt gar nicht nötig.
Zirkona schlug sich vor die Stirn.
»O, hätte ich das gewusst!«
»Ist dir denn das gar nicht gesagt worden?«
»Von wem?«
»Von Mufta.«
»Der hatte nur mit sich selbst zu tun, der elende Wicht.«
»Nicht von der weißen Frau?«
»Ich habe gar nicht mit ihr gesprochen.«
»Weshalb nicht?«
»Weil... ich sie eben gar nicht erst hören wollte. Wohl verlangte sie mich durchaus zu sprechen, aber was hätte ich mir erst vorjammern lassen sollen? Sind diese weißen Frauen besser als wir schwarzen, die wir noch heute als Sklavinnen in alle Weltteile verkauft werden, obgleich die Sklaverei abgeschafft sein soll? Es kamen Tuaregs — ich habe sie wie alle die anderen Gefangenen an diese verkauft.
O, hätte ich das gewusst — — o, warum habe ich dem Flehen der weißen Frau, mit mir sprechen zu dürfen, kein Gehör geschenkt!«
Zirkona war außer sich, Jack hingegen, der allerdings anfangs auch ganz niedergeschmettert gewesen war, hatte sich schnell wieder aufgerafft.
»An Tuaregs hast du sie verkauft? Was für ein Stamm war es?«
»Ein Stamm? Die Tuaregs sind nicht in Stämme geteilt, ein Tuareg ist immer ein Tuareg.«
»O doch, es gibt verschiedene Stämme mit verschiedenen Namen...«
»Ich weiß — diese Namen aber haben sich die Europäer, welche die Tuaregs erforschen wollten, ganz willkürlich gemacht. Die, welche sie im Lande Hogar fanden, haben sie Hogaris genannt, die im Gebirgsland Kilowi nannten sie Kilowais...«
»Nein, diese Tuaregs nannten sich immer selbst so.«
»Ja, solange sie in dem betreffenden Lande wohnen. Ziehen sie aber in ein anderes, so nennen sie sich wieder nach diesem. Doch ob in Algier oder im Kaplande — ein Tuareg ist immer ein Tuareg, der nie eine andere Sprache oder andere Gewohnheiten annimmt. Diese Tuaregs sind die afrikanischen Zigeuner. Und kannst du etwa einen ungarischen oder einen spanischen Zigeuner von einem unterscheiden, den du in Amerika triffst? Ein Zigeuner bleibt immer ein Zigeuner.«
Da hatte diese Negerin, die schon Europa und Amerika gesehen und sich immer über alles orientiert hatte, vollständig recht. Man hat sogar versucht, den rätselhaften Ursprung unserer Zigeuner von diesen Tuaregs abzuleiten. Körperbau und Gesichtsform sind bei beiden sehr ähnliche, aber die afrikanischen Tuaregs haben doch wieder ganz andere Sitten als alle Zigeuner.
»Wohin zogen jene Tuaregs?«
»Wohin? Frage einen Zigeunerstamm, wohin er zieht. Dorthin, wo die Sonne scheint, wo er stehlen und wahrsagen und Igel fangen kann. Ja, bis morgen kann dir der Zigeuner die Richtung angeben — aber in einer Stunde hat er sie vielleicht schon wieder geändert.«
»Die Tuaregs werden die Sklaven wieder verkaufen?«
»Gewiss, an den ersten Sklavenhändler, der ihnen begegnet und ihnen mehr dafür bietet, als sie uns gegeben haben, oder an einen anderen Familienstamm der Tuaregs...«
»Wann hast du Muftas Karawane überfallen?«
»Heute vor... vier Tagen.«
»Dann muss ich ihnen nach. Die Spuren werden sich noch verfolgen lassen.«
»Und ich begleite dich«, fügte Zirkona sofort hinzu.
Jack hatte etwas Ähnliches gehofft, hätte wenigstens um Begleitung gebeten — und jetzt war er doch sehr überrascht.
»Du selbst wirst mich begleiten?«
»Ich selbst. Höre mich an!«
Mit kurzen Worten schilderte sie, wie dieser Überfall zustande gekommen war. Es war schon alles von langer Hand vorbereitet worden. Das ganze Land, und besonders die Bevölkerung der Hauptstadt seufzte längst unter der strengen Hand der herrschsüchtigen Sambone. Die in die Berge Vertriebenen hatten in heimlicher Verbindung mit den Anführern der männlichen Krieger gestanden, es hatte nur noch Zirkona und ihre weibliche Macht gefehlt, um gegen die blaue Partei vorzugehen. So waren die Burg und die ganze Stadt schon in den Händen von Zirkonas Kriegerinnen gewesen, ehe die Blauen nur etwas von ihrer Rückkehr geahnt hatten.
»Alle Anhängerinnen Sambones sind niedergemacht worden?«
»Nur wenige sind in die waldige Umgebung entkommen, meine Kriegerinnen sind schon hinter ihnen her.«
»Und Sambone selbst?«
Jack wollte nur erst einmal hören. Da zeigte zu seinem Staunen Zirkona ihren langen Dolch, an dem noch frische Blutspuren zu sehen waren.
»Das ist das Blut der Verräterin.«
Jack glaubte nicht recht zu verstehen. Oder Zirkona hatte in der Dunkelheit eine andere für ihre Todfeindin gehalten.
»Du hast sie getötet?«
»Ja.«
»Wo?«
»In ihren versteckten Kammern, die sie sich in Sanglas heiligem Brunnen angelegt hatte.«
Also das war der Rivalin bekannt. Dann war Zirkona jedenfalls durch die auch ihr bekannten Türen dort eingedrungen.
»Sie war gebunden?«, fragte er nur noch.
»Gebunden?«, wiederholte Zirkona verwundert. »Wer sollte sie denn gebunden haben? Sie erwartete dort unten jedenfalls wieder einen Liebhaber, den sie festhält, bis sie ihn tötet, wie sie es schon so oft getan hat. Freilich, nur ich weiß um dieses Geheimnis. Ehe sie sich zur Wehr setzen konnte, hatte mein Dolch ihr falsches Herz durchbohrt.«
Jack hielt es nicht für angebracht, jetzt seinerseits lange Erklärungen zu geben, da war erst noch vieles Andere zu erledigen.
»Und du kannst mich auf der Verfolgung begleiten, jetzt, da du hier die Hauptperson bist?«
Zirkona erklärte sich ihm. Sie hatte schon immer beschlossen gehabt, ihre Rolle einer Vorkämpferin, falls sie die Macht wiedererlangte, einer Freundin freiwillig abzutreten. Sie war der immerwährenden Innenkämpfe und Intrigen überdrüssig, schon längst, sie hatte in Europa eben ein anderes Leben kennen gelernt. Nur noch Rache hatte sie nehmen wollen, und das war jetzt geschehen. Den König wollte sie gar nicht erst wiedersehen.
»Sieben Frauen und Mädchen, also Kriegerinnen, wollen mich begleiten. Fünf davon kennst du schon, zwei werden dir neu sein.«
»Und wohin willst du dich da wenden?«
»Irgendwohin. Mir eine neue Heimat suchen. Die Welt ist groß, und ich habe sie schon etwas kennen gelernt. Jetzt aber helfe ich dir erst, deine Frau wiederzuerlangen... du liebst sie?«
»Würde ich sonst ihr um die ganze Erde nachjagen?«
»Ich und meine Kriegerinnen gehen mit dir. So komm!«
Sie war auf der Stelle fix und fertig zum Aufbruch. Jack aber dachte erst an eine innerliche Stärkung, die ihm sofort gebracht wurde.
»Hast du noch von einer zweiten Karawane gehört welche dieselbe Richtung eingeschlagen hat, heute früh sich aber noch in Abomey befand?«
»Eine Karawane von siebzig Negern, die unter der Leitung eines Franzosen stand?«
»Ja.«
»Sie ist heute Mittag von hier wieder nach der Küste zurückgegangen.«
Jack konnte sich zwar nicht recht erklären, weshalb der Entführer seiner Frau die Verfolgung so plötzlich aufgegeben hatte, doch er grübelte nicht weiter darüber nach — — und wir wissen, dass es Monsieur Dubois, wie sich jener als Besitzer der Jacht genannt hatte, genügte, das Haupt von Mariechens Gatten unter dem Henkerbeil fallen gesehen zu haben.
Freudig begrüßte Nachtmär ihren Herrn, und gleich hier im Stall, ehe er sich in den Sattel schwang, um sofort zur Verfolgung aufzubrechen, erledigte Jack noch etwas Anderes.
Es war gerade die Stunde, wo Evangeline seine Locke in der Hand hatte — obgleich Jack voraussetzte, dass sie jetzt viel öfter ihre hellsehenden Augen auf ihn gerichtet hielt — und so nahm er ein großes Stück weißgegerbtes Leder und schrieb im hellen Scheine einiger Laternen mit Kohle in großen Buchstaben Folgendes darauf:
BIN FREI. NEHME IM SICHEREN GELEIT EINIGER DAHOMEYWEIBER DIE VERFOLGUNG WEITER AUF. HALTET ALLES ZUR AUSRÜSTUNG EINER KARAWANE NOTWENDIGE NOCH IMMER BEREIT, ABER NOCH KEINE TRÄGER ANWERBEN.
Dass dies Mijnheer van Hyden auch noch nicht getan hatte, setzte Jack als ganz selbstverständlich voraus. Träger waren in dem stark bevölkerten Freetown immer massenhaft zu haben, höchstens hätte es einmal bei Ausrüstung mehrerer Karawanen an Tauschartikeln fehlen können, und dass da van Hyden auf den Rat Erfahrener hörte, war doch ebenfalls ganz selbstverständlich.
So wenden wir uns nach Freetown zurück und beobachten Jacks und seiner Begleiterinnen ganzen Ritt quer durch Afrika nur mit Evangelines hellsehenden Augen.
Ja, quer durch ganz Afrika sollte es gehen — und da hatte Jack sein Ziel immer noch nicht erreicht!
Wollten wir ihn nun persönlich begleiten und alles erzählen, was er dabei erlebte, so würde dies allein ein dickes Buch füllen. So geben wir alles nur ganz summarisch wieder, und durch die kleine Hellseherin können wir zugleich auch immer die Entführte im Auge behalten.
Es geschah, wie Zirkona vorausgesagt hatte. Die sämtlichen in Sklaverei gefallenen Karawanenträger waren von den Tuaregs schnell wieder an andere verkauft worden, ebenso die weiße Frau. Immer und immer wiederholte sich solch ein Tauschgeschäft. Bald war der neue Herr ein Araber, der eine Karawane führte, oft schon mit gefesselten Sklaven, dann war es wieder ein anderer Stamm Tuaregs.
Die schwarzen Sklaven wurden immer mehr voneinander getrennt, Evas Augen konnten ja stets nur bei Mariechen bleiben, deren Haar sie in der Hand hielt, und zuletzt war diese ganz allein, und noch immer wanderte sie weiter aus einer Hand in die andere, und zwar immer dem Nordosten zu.
Das ging nun schon zwei Wochen so fort, drei Wochen, es wurden vier daraus, und nichts wollte sich ändern. Wüste, Wüste, nichts als Wüste, dazwischen einmal eine Oase, dann wieder viele Tagereisen durch Steppen oder Urwald; dann traf die Karawane, welche Mariechen mit sich schleppte, auf eine andere, und wieder ging es weiter, immer dem Nordosten zu.
Mariechen bediente sich schon längst der seltsamen Fernschrift nicht mehr. Sie hatte alle Hoffnung ausgegeben, glaubte gar nicht mehr daran, dass sie noch durch das hellsehende Kind beobachtet würde. Stumpf saß sie den ganzen Tag auf dem schaukelnden Kamel, welches schon seit längerer Zeit das Pferd als Reittier verdrängt hatte, bis sie im Schleier der Nacht für Evangeline verschwand.
Das Unglück des armen Vaters lässt sich denken.
Seit vier Wochen nun schon wurde seine zarte Tochter im Innern Afrikas umhergeschleppt. Das Schlimmste vielleicht war, dass man jetzt überhaupt nicht mehr wusste, wo sie sich befand. Wohl sah Eva alles, worauf Mariechen die Augen richtete, aber einmal war das ganz undeutlich, weil ohne jedes Interesse, und dann fehlten auch alle besonderen Merkmale. Wüste, Steppe, Urwald — schwarze oder braune Menschen — daraus konnten die Sachverständigen, die zu Rate gezogen wurden und welche manchmal tagelang neben des Kindes Bett saßen, nichts schließen, auch wenn sie selbst schon Afrika in dieser Richtung durchquert hatten.
Und dasselbe galt in Bezug auf Jack. Der war mit seinen schwarzen Begleiterinnen immer hinterher, verlor nie die Spur, das konnte selbst die kleine Hellseherin beurteilen. Er teilte das auch durch Fernschrift mit, sich jetzt mehr weißer Felle als des Papiers bedienend; oft malte er die Buchstaben auch nur in den Sand.
Dann teilte er oft mit, besonders wenn er mit Eingeborenen zusammengestoßen war, friedlich oder feindlich, wo er sich befand. Er nannte Namen. Ja, diese standen aber auf keiner Landkarte, selbst auf solchen Gebieten nicht, die schon für völlig erforscht galten.
Mit dieser Erforschung von fremden Ländern ist es ja überhaupt eine eigentümliche Geschichte, worauf immer wieder aufmerksam gemacht werden möchte. Ein Reisender kann doch stets nur einen Kilometer links und einen Kilometer rechts übersehen. Was er davon erzählt, was jenseits dieser Grenze liegt, kann er bloß auf Treu und Glauben den Eingeborenen nacherzählen, und die kennen gewöhnlich auch nichts weiter als ihren gewohnten Weg und die enge Umgebung ihrer Heimat.
Den Jägern, welche etwas weiter herumkommen, darf man gleich gar nicht trauen. Die Zunge aller Jäger scheint förmlich mit einem Fluch belastet zu sein. Der nordsibirische Pelzjäger ist wegen seiner übertreibenden Aufschneiderei unter seinen Landsleuten genau so bekannt wie der von der Jagd lebende Hottentotte unter den seinen.
Und ziehen dann noch weitere fünf Forschungsreisende durch dieses aufzuklärende Gebiet, so können sie eben — vorausgesetzt auch noch, dass nicht einer den Weg des anderen einschlägt — sechs solche zwei Kilometer breite Wegstreifen beschreiben, können sagen: Da und dort haben wir ein Gebirge, einen See erblickt — — aber alles andere, was jenseits dieser sechs Streifen liegt, ist noch in vollkommenes Dunkel gehüllt.
So ist es noch heute mit Zentralafrika, mit Australien und selbst mit Südamerika. Das Innere Brasiliens ist für uns vorläufig noch ein versiegeltes Geheimnis. Jeden Tag können in den brasilianischen Urwäldern noch Indianerstämme gefunden werden, die noch nie ein Blassgesicht gesehen haben.
Kurz, man hatte keine Ahnung, wo sich die beiden Trupps befanden, wie weit sie voneinander entfernt waren.
Die trostlose Hauptsache aber war die, dass es Jack nicht gelang, die Entführte einzuholen.
Dass die Nachfolgenden bedeutend schneller ritten als die Tuaregs oder wer nun sonst die weiße Frau in der Gewalt hatte, konnte sogar Evangeline beurteilen. Während die Vorausmarschierenden aber allüberall ganz unangefochten durchkamen, hatten die Dahomeys fast täglich Kämpfe mit Eingeborenen zu bestehen, überall waren ihnen Hinterhalte gelegt, die erst sorgsam ausgekundschaftet werden mussten, und immer kam es zum Kampf, und wenn dieser auch ständig zugunsten von Jacks Truppe ausfiel, war das doch sehr zeitraubend.
Ob diese Hinterhalte nun erst von der vorausziehenden Karawane angelegt wurden oder nicht, das war dabei ganz gleichgültig. Jack konnte die Entführte eben nicht erreichen, und auf telepathischem Wege vermochte er denen in Freetown nur immer den Trost zukommen zu lassen: Mut, Mut, ich befreie Mariechen, wenn sie noch am Leben ist, doch!
Ja, sie konnten es sich vorstellen; Jack wusste ja nicht einmal, ob sich Mariechen bei jener Karawane, deren Spur er verfolgte, auch noch befand!
Es waren schreckliche Wochen für den gequälten Vater, und es sollte nur immer schlimmer werden.
In einem Kampfe war schon eine Dahomey getötet worden, Eva beschrieb, wie sie im Wüstensand ein Begräbnis fand. Das empfindsame Kind weinte mit, weil Jack leise weinte — und zwei Tage später ward eine andere der schwarzen Kriegerinnen schwer verwundet. Eine Beratung fand statt, Eva konnte ja alles schildern. Die Verwundete solle in einem Negerdorf zurückbleiben, unter dem Schutze einiger Kameradinnen. Sie wollte nicht, ließ sich auf ihrem Pferde festbinden. Und auf diesem Pferde, mitten im vollen Galopp, sah Evangeline sie sterben.
Am Ende der vierten Woche aber passierte das letzte, was nur noch gefehlt hatte.
»Ich sehe eine Steppe«, begann Evangeline zu schildern, »Jack steigt vom Pferde — ach, sie haben ein Reh geschossen, das wollen sie braten — er sucht wie die Anderen Feuerholz zusammen — es sind auch Büsche da — jetzt nimmt Jack... aaaaahhh!«
Das Kind hatte einen gellenden Schmerzensschrei ausgestoßen. Und nun kannte man doch schon alle Erscheinungen, welche mit diesem Hell- und Fernsehen verbunden waren, zur Genüge, bei allen besonderen Gelegenheiten wurde Evangeline auch mitfühlend.
»Eine Schlange, eine Schlange, ich bin von einer Schlange in den Daumen gebissen worden, ich...«
Evangeline wurde bewusstlos. Dass es jetzt aber auch Jack war, konnte man daraus noch nicht schließen. Jedenfalls lässt sich der Schreck der an dem Bettchen Sitzenden denken.
Doch sehr schnell kam sie wieder zu sich, schilderte ganz ruhig weiter.
»Die starke, schwarze Frau, mit der er am meisten spricht, hat seine Hand im Mund — oder — seinen Daumen — ach ja, sie saugt ihm die Wunde aus, wie man ja tun soll, wenn man von einer giftigen Schlange gebissen worden ist. Ach Gott, Jack sieht ja ganz blau und ganz dick im Gesicht aus...«
»Er ist von einer Giftschlange gebissen, er stirbt!!«, schrie van Hyden verzweifelt und noch verzweifelter Margot.
Aber das Kind selbst blieb ganz ruhig, und das war eigentlich das sicherste Zeichen, dass es doch nicht so schlimm mit Jack stehen konnte.
»Nein, er steht ja aufrecht«, fuhr sie fort. »Und die fünf anderen Frauen graben jetzt schnell ein Loch in die Erde — nur mit den Händen — aber wie die arbeiten! — wie die Maulwürfe. Es wird immer tiefer — wie ein Grab — und jetzt... ja, was machen denn die? Die wollen Jack doch nicht begraben? Er ist ja noch ganz lebendig.«
Jack wurde in das mannestiefe Loch gestellt, aufrecht, und dieses dann wieder zugeschüttet, sodass er nur noch mit dem Kopfe hervorsah, rings um ihn die Erde wieder festgetreten.
Für van Hyden, der die Welt gesehen hatte, war das nichts Unerklärliches. Überall auf der Erde halten es die Eingeborenen für das beste Mittel, nachdem sie die anderen ihnen speziell zugänglichen angewendet haben, einen von einer Giftschlange Gebissenen lebendig zu begraben, d. h., ihn in die Erde einzupacken, und zwar so, dass die Erde einen starken Druck auf ihn ausübt, also ihn einfach in ein Erdloch zu stecken und die Erde um ihn herum dann möglichst wieder festzustampfen.
Da hierbei keine Überlieferung von Erdteil zu Erdteil vorliegt, die Eingeborenen also immer von selbst auf dieses Mittel gekommen sind, so muss dem wohl etwas Wahres zugrunde liegen, wie ja auch die Erfahrung bestätigt. Dabei wird überall Tonboden jedem anderen vorgezogen, und es ist doch ganz merkwürdig, dass wir hochkultivierten Europäer jetzt langsam dieses Heilmittel der mehr oder weniger wilden Völkerschaften nachzuahmen anfangen, meist aber in dem Glauben, da hätten wir eine ganz selbstständige Erfindung gemacht. Schon gibt es Naturheilkundige, welche nun — Extreme berühren sich, es artet immer gleich aus — gleich jede Krankheit mit ›Muttererde‹ kurieren wollen, man soll womöglich auf nacktem Erdboden schlafen — aber bekanntlich verordnen seit einiger Zeit auch die Ärzte gegen Wunden immer essigsaure Tonerde.
Jedenfalls gibt so etwas zu denken. Der Weiterblickende wird bei Prüfung erkennen, dass sich alles und jedes rund um den Erdteil herumzieht, ob nun die Anwendung eines Heilmittels oder ein revolutionärer Gedanke auf dem Gebiete der Politik oder der Kunst oder der Wissenschaft, wobei aber immer jeder Mensch oder jede Menschengruppe glaubt, sie ganz allein habe diesen neuen Gedanken aus sich selbst geschöpft.
Ein historisch beglaubigtes Beispiel hierfür ist die Erfindung der Galvanoplastik, die im Jahre 1839 gleichzeitig in Petersburg von Jakobi und in London von Spencer und Jordan gemacht wurde, ohne dass beide Parteien das Geringste voneinander gewusst haben. Ihre Veröffentlichungen hierüber kreuzten sich sozusagen, und dabei darf man nicht vergessen, dass die Ägypter die Galvanoplastik schon vor viertausend Jahren gekannt und ausgeübt haben. Aber die Herstellung dieser Bronzestatuen ist viertausend Jahre lang der Menschheit ein Rätsel gewesen, bis eben wieder Jakobi und Spencer kommen mussten.
Doch um zu unserem eigentlichen Thema zurückzukehren: In diesem Falle darf die von den Schlangenzähnen herrührende Wunde nicht ausgebrannt werden, wodurch sie verschlossen wird, man erweitert sie lieber noch. Ob die umgebende Erde dann saugend oder drückend wirkt, weiß man nicht. Eigentümlich ist es doch, dass sich fast nur Ton dazu eignet; da müssen also wohl noch andere Heilfaktoren in Betracht kommen. Bei dem Bisse der Brillenschlange und anderer sehr giftiger Reptilien nützt dieses Mittel allerdings auch nicht viel.
Eva verspürte im ganzen Körper ein starkes Brennen; wie siedendes Blei rollte das Blut durch die Adern; sie empfand, wie bei allen außerordentlichen Gelegenheiten, wieder mit, aber sonst blieb sie bei klarem Bewusstsein, also musste dies auch bei Jack der Fall sein.
Zirkona musste ihm das weiße Leder geben, auf das er jetzt immer schrieb, die Schrift bei jeder Wassergelegenheit wieder abwaschend, und er malte mit Kohle in großen Buchstaben darauf:
WENN IHR MICH JETZT BEOBACHTET HABT —; BIN VON EINER SCHLANGE GEBISSEN. DOCH GAR KEINE GEFAHR VORHANDEN, WERDE IN ZWEI TAGEN WIEDER HERGESTELLT SEIN. ACHTUNG, NOCH MEHR!!
Er drehte das Leder herum und schrieb auf die andere Seite:
BIN NUR NOCH VIERZEHN TAGERITTE VON KÜSTE ENTFERNT. KARAWANE AUFLÖSEN, SOFORT NACH ALEXANDRIEN EINSCHIFFEN. DORT WEITERE BOTSCHAFT ERWARTEN, WO WIR WIEDER ZUSAMMENTREFFEN.
Das Fell war vollgeschrieben. Von Mariechen hatte er gar nichts mehr erwähnt.
Was sollte van Hyden tun? Sich der Verzweiflung hinzugeben, hatte keinen Zweck. Gehorchen! So veräußerte er die eingekauften Tauschartikel wieder, nicht einmal zu seinem Nachteil, und mit dem nächsten Dampfer, der nach Alexandrien ging, oder doch Anschluss nach Ägypten hatte, schiffte er sich ein.
Wir begeben uns zu Jack zurück, um eine Szene mitzuerleben, welche Evangeline nicht beobachtet hatte.
Er lag, wie seine Begleiterinnen und wie auch die gelehrigen Pferde, platt in dem gar nicht so hohen Steppengrase und ließ über sich die Kugeln und Pfeile weggehen, welche Feinde, deren Art man noch nicht kannte, ihnen aus einem nahen Gebüsch zuschickten.
Noch rechtzeitig war der Hinterhalt entdeckt worden. Zu umgehen war er nicht, denn er versperrte den Weg durch einen sonst unpassierbaren Sumpf.
Nun, Jacks Kriegsplan war schnell fertig. Er würde mit diesen Negern oder Arabern so schnell wie immer fertig werden. Denn das waren keine nordamerikanischen Indianer.
Er wollte den Hinterhalt umschleichen, um jenen in den Rücken zu kommen. Aber das konnte nur er allein ausführen. So geübt in jeder Art von Krieg diese Dahomeyweiber auch sonst waren — durch dieses kurze Gras konnten sie nicht unbemerkt schleichen, dazu musste sich der Mensch in eine wirkliche Schlange verwandeln.
Noch einige Worte mit Zirkona gewechselt, und plötzlich war Jack aus der Mitte der Weiber verschwunden. Sie selbst hätten fast an Zauberei glauben mögen, wenn sie die Fähigkeiten dieses Jägers und Kriegers nicht oft zu bewundern Gelegenheit gehabt hätten.
Wie eine Schlange glitt der nordamerikanische Jäger durch das Steppengras, das knapp seinen platt auf den Boden gedrückten Körper überragte, und doch brachte er die Gräser kaum zum Erzittern, denn sonst wäre ihm das ganze Manöver nicht geglückt, und die dort lagen und die Feinde aufs Schärfste beobachteten, waren doch ebenfalls geübte Jäger.
Aber es gelang eben, sie zu täuschen. Jack hatte auch gar nicht nötig, sie ganz zu umschleichen, er brauchte nur seitwärts von ihnen zu sein, so sah er schon die schwarzen und braunen Gesichter, ihre ganzen Gestalten, wie sie sich in Schützenlage an den Boden schmiegten, die besten Zielscheiben abgebend.
Jack eröffnete ein mörderisches Schnellfeuer aus seinem Magazingewehr, und er verschoss keine Patrone umsonst, dazu ein ununterbrochenes ›Hipp hipp hurra!‹ in den verschiedensten Tonarten, und der Erfolg war derselbe wie immer, wenn Jack seine Feinde derartig umschlich.
Sie glaubten nicht anders, als ein ganzes Bataillon dieser weißen Teufelssöhne rücke gegen sie an. Aufspringen und davonlaufen war eins, ohne sich nur einmal umzusehen — der Weg war frei, und wie immer fand man dann in dem Hinterhalt noch einige Waffen und vor allen Dingen stets erwünschte Munition, welche man, wenn sie nicht direkt für die eigenen Gewehre passte, doch leicht für die messingnen Patronenhülsen umändern konnte.
Um den Sieg ganz auszunutzen, dass sich die Feinde, die Schwäche des Gegners erkennend, nicht noch einmal besannen, wurden sie auch stets eine kleine Strecke verfolgt, immer noch einige niedergeschossen.
An dieser Verfolgung beteiligten sich natürlich auch die Dahomeyweiber, dabei einen möglichst großen Skandal machend.
Doch nur fünf Minuten, dann gab Jack durch Pfeifen das Signal zum Sammeln.
»Wo ist Zirkona?«
Da lag sie, und neben ihr kniete schon eine andere, die ihr das aus der Mitte der Brust quellende Blut zu stillen suchte.
Die Fliehenden hatten zuletzt doch noch einige Schüsse abgegeben, und einer hatte die dritte der acht Dahomeykriegerinnen gefordert.
Hoffnungslos! Sie verschied unter Jacks Händen. Aber es war ein leichter Tod, wenn nicht ein glücklicher.
»Weißt du, Jack«, flüsterten die blassen Lippen in dem schwarzen, edlen Gesicht, »warum ich... nicht mehr die... Vorkämpferin in... Abomey bleiben... wollte? Weißt du, Jack... wohin ich mich... begeben wollte?«
Jack blieb die Antwort schuldig; er suchte ihre letzte Lebenskraft zurückzuhalten, und sie blickte ihn an, und sie erkannte schon in seinem Gesicht, dass er es bereits wusste, und sie lächelte noch glücklicher.
»Ich wollte... zu dir!«
Es war ihr letztes Wort gewesen. Aus ihrem schwarzen Körper löste sich eine weiße Seele, auch reingewaschen von allem Blut, das sie je vergossen — reingewaschen durch eine Liebe, welche nichts von Eigennutz gewusst hatte.
Trotzdem sie ihn liebte, war sie sofort bereit gewesen, behilflich zu sein, ihm die wiederzugeben, die er mehr liebte.
Genug!
Drei Tage lang hatte Evangeline an Bord des Dampfers in heftigem Fieber gelegen — so lange hatte Jack in dem Erdloch gesteckt — doch umsonst hatten ihre Beschützer um ihr Leben gebangt, sie erholte sich ebenso schnell wie Jack, und als sie zum ersten Male wieder seine Locke in die Hand nahm, sah sie ihn wohlbehalten im Sattel seiner Nachtmär.
Auch Mariechen setzte noch ihre Wanderung durch die Wüste fort. Jetzt aber waren ihre Begleiter keine Tuaregs mehr, sondern Beduinen, die von jenen wohl zu unterscheiden sind, und dabei war jetzt sogar, sicher als Herr der Karawane, ein Mann dabei, der einen europäischen, ganz weißen Anzug und einen Strohhut trug.
Als der Dampfer auf der Höhe von Algier war, nur noch drei Tage von Alexandrien entfernt, passierte diese kleine Karawane nach Evas Beschreibung eine höchst fruchtbare, sorgfältigst angebaute Gegend, auf beiden Seiten von einem Gebirgszug begrenzt, und zwar waren alle beide zu erblicken, also ein Tal, wenn auch einige Kilometer breit und ganz flach, durch seine Mitte floss ein breiter Strom, von dem aus nach allen Seiten Wasseräderchen abgingen — der Nil — und aus den nahen Gebirgszügen musste man auf Oberägypten schließen.
An Bord des Dampfers befand sich ein deutscher Herr, der gleichfalls nach Alexandrien wollte. Bei Gelegenheit hatte es sich gezeigt, dass er als Landvermesser viele Jahre lang in Ägypten nivelliert hatte, das ganze Land durchaus kannte, und van Hyden hatte ihn eingeweiht, so weit es nötig war.
Die kleine Karawane, welche wahrscheinlich — bestimmt konnte das aber nicht angegeben werden — nur Mariechen als fremden Bestandteil mit sich führte, sonst waren viele Kamele bepackt — diese Karawane also hatte in dem Niltal keinen Rasttag gehalten, was man eigentlich erwartete, sie hatte sich nur verproviantiert, und erst in dem anderen Grenzgebirge wurde neben einer Zisterne oder wohl richtiger einem Brunnen halt gemacht.
Als nun Evangeline durch die Augen Mariechens an den Granitwänden, die stark mit roten Adern durchzogen waren, sehr viele eingehauene Hieroglyphen sah, erklärte Herr Beyer sofort, dass es die Karawanenstraße nach Kosseir sei, einem Hafenstädtchen am Roten Meer, außer Suakin das einzige von Bedeutung, jetzt besonders als Quarantänehafen vor dem Passieren des Suezkanals.
»Ist Kosseir ein Sklavenmarkt?«, fragte van Hyden.
Der erfahrene Manu zuckte skeptisch die Achseln.
»Was heißt Sklavenmarkt? Noch heutzutage können einige Dutzend hübscher Mädchen mitten in Berlin neben dem Polizeipräsidium als Sklavinnen verkauft werden, nach Argentinien oder direkt in einen türkischen Harem — allerdings, ohne dass sie es vorläufig wissen. Ja, Mijnheer, wenn ich offen sein soll — ich habe es Ihnen schon einmal gesagt — wie Sie nur Ihre Tochter beschreiben... die wird in einen orientalischen Harem verkauft.«
»Lässt sich denn nur gar nichts dagegen machen?«, jammerte der unglückliche Vater.
»Gar nichts«, lautete der trockene Bescheid. »Wenn Sie auch Alexandrien noch rechtzeitig erreichen — da nützt kein Telegramm. Die ägyptische Polizei versagt Ihnen einfach die Hilfe — oder will sie Schritte tun, nimmt sie die Sache in die Hand, dann ist das nur umso schlimmer für Sie, denn dann wird im Geheimen gegen Sie operiert.
Übrigens, geehrter Herr, lassen Sie mich ganz offen sprechen — nennen Sie mich meinetwegen rücksichtslos... es ist doch ganz gut, wenn Ihre Tochter in einen orientalischen Harem verkauft wird. Jedenfalls doch viel besser, als wenn sie in Zentralafrika in die Lehmhütte eines Negerhäuptlings gekommen wäre. Sie haben es durch dieses Kind in der Hand, ihren zukünftigen Aufenthalt zu erfahren, und schließlich lässt sich aus jedem Harem auch das schönste Weib herauskaufen — oder durch List entführen.«
Nein, zürnen konnte Mijnheer van Hyden dem offenen Deutschen ob dieser Erklärung nicht — aber ein Trost war das auch nicht für ihn.
Nun muss noch bemerkt werden, dass in Evas Zustand wiederum eine Änderung eingetreten war oder vielmehr, ihr neuester Zustand hatte sich geregelt.
Damals, als Jack auf der Richtstätte gestanden, hatte sie in wachem Zustande, von jenem unbestimmten Gefühle getrieben, welches wir Sympathie nennen, plötzlich Jacks Locke in die Hand zu nehmen begehrt, worauf sie sofort in einen merkwürdigen Halbschlaf — Trance würden die Okkultisten sagen — gefallen war. Also eine ganz neue Erscheinung. Und seitdem fiel sie immer in Trance, sobald man ihr Jacks Locke in das kalte Händchen gab, sah sie dann ihren geliebten Jack.
Wechselte man Jacks Haar mit dem von Mariechen aus, so erblickte sie auch diese. Aber sie fiel nicht in Trance, wenn man ihr in wachem Zustande Mariechens Locke gab. Die von Jack musste ihr Hellsehen erst einleiten. Und das fand auch nur einige Male statt.
Mit Jack blieb es dasselbe. Sobald sie eine Locke in die linke Hand nahm, wurde ihr abgestorbener Arm lebendig, und sie erblickte Jack. Gab man ihr dann aber dafür Mariechens Locke zwischen die Fingerchen, so sah sie diese nicht und erwachte wie gewöhnlich nach einiger Zeit.
Als der hierüber beim ersten Male höchst bestürzte van Hyden fragte, was das zu bedeuten habe, gab sie als Antwort für den nächsten Tag Stunde und Minute an, wann sie auch Mariechen wiedersehen könnte, konnte dies auch gleich auf Monate hinaus tun.
Als der Dampfer noch einen Tag von Alexandrien entfernt war, wurde die Karawane noch in der Wüste gesehen, und Jack passierte soeben das Niltal. Diesen konnte man nun noch weiter beobachten, und man sah, wie er Erkundigungen einzog und wie er sich dann von den fünf übrig gebliebenen Dahomeyweibern trennte, um mit verhängten Zügeln durch das Grenzgebirge in die Wüste hineinzujagen, dem Osten zu, und da hätten ihm die Pferde seiner Begleiterinnen auch gar nicht folgen können. Die Nachtmär war doch ein ganz anderes Ross. Sie allein hatte auch die ganze Tour durch Afrika ausgehalten, während die Frauen ihre Pferde bei jeder Gelegenheit gewechselt hatten.
Man behielt ihn durch Evangeline weiter im Auge. Die ziemlich gerade Karawanenstraße vom Niltal nach Kosseir hat eine Länge von ungefähr fünfzehn geografischen Meilen, und diese sah man das schwarze Ross in nicht einmal ganz vier Stunden durchjagen. Dabei hielt sich Jack auch noch mehrmals auf, ihm begegnende Karawanen befragend, dann freilich die Rappstute zu noch größerer Eile antreibend.
Die schwarze Nachtmär war schneeweiß geworden, als er Kosseir in früher Abendstunde erreichte.
Diese Erwartung nun an Bord des Dampfers, der soeben den Hafen von Alexandrien in Sicht bekam! Jetzt, jetzt kam es darauf an!!
Man sah, wie Jack, nachdem er sein Pferd eingestellt hatte, überall Erkundigungen einzog, erst in einem Hotel. Dann ging es stracks in ein vornehmes arabisches Haus. Das dritte gehörte sicher einem europäischen Konsul an. Dann kroch Jack in eine elende Hütte. Ein alter, einäugiger Araber machte fortwährend Bücklinge und grinste dabei — plötzlich knallte Jack ihm ein paar Ohrseigen herunter, und das hatte wohl Erfolg, er begab sich sofort wieder in jenes vornehme orientalische Haus, riss hier, wie Evangeline alles ganz genau sehen und beschreiben konnte, einen Klingelzug ab, dann wieder eine Unterredung mit einem reich gekleideten Araber, der immer die Achseln zuckte, aber keine Ohrfeigen dafür bekam, Jack schien ihn ziemlich höflich zu behandeln — und schließlich begann Jack noch in diesem Hause auf einen großen Bogen Papier zu schreiben:
Sofort nach Siut! Elefantine absteigen Komme selbst hin!
Margot stieß als erste einen Jubelruf aus, und van Hyden stimmte mit ein.
Endlich doch ein Wiedersehen, wenigstens mit Jack, der ihm ja schon nicht minder ans Herz gewachsen war als die eigene Tochter.
Unterdessen war die Stunde und Minute herangekommen, da Eva auch Mariechen wieder beobachten konnte.
Das Kind sah sie in einem ganz engen Raume in einer Schiffskabine, in stark schaukelnder Bewegung
Fünf Stunden waren noch vergangen, ehe der Dampfer in den Hafen laufen und anlegen konnte Dann hatte man noch zwei Stunden auf den nächsten abgehenden Zug zu warten. Er braucht bis nach Siut, der Endstation der ägyptischen Eisenbahn, 16 bis 18 Stunden.
Endlich war Siut erreicht, eine ganz ansehnliche Stadt, von der aus die Vergnügungsreisenden die uralten Bauwerke auf der Nilinsel Elefantine besuchen.
Es ging sofort ins Hotel. Die Zimmer waren ihnen noch nicht angewiesen worden, die vier Personen befanden sich noch staubbedeckt, wie sie waren, alle gemeinschaftlich in ein und demselben, die ganz erschöpfte Eva war soeben erst auf dem Sofa gebettet worden, als sie mit einem Freudenschrei in die Höhe fuhr.
»Da kommt er! Mein Jack kommt!!«, jauchzte sie auf.
Ja, man hörte auf dem Gange einen schnellen Schritt, aber...
»Nein, mein Kind, das kann er noch nicht sein, da müsste seine Rappstute geradezu Flügel besitzen, vor morgen früh dürfen wir ihn nicht...«
Da wurde die Tür aufgerissen, und... ebenfalls mit einem Freudenschrei lag der alte Mijnheer an der Brust eines Mannes, der mit noch einem ganz anderen Staub bedeckt war als sie selber, obwohl man schon auf der ägyptischen Eisenbahn erleben kann, was Staub und Flugsand heißt.
»Jack, endlich, endlich — — oder ist es nicht nur dein mit einer Sandschicht umkrusteter Geist, den ich an mein Herz drücke?!«
Jack schob seinen Schwiegervater fast etwas grob beiseite. Er selbst hatte sich durchaus nicht in Mijnheers Arme stürzen wollen, dieser hatte sich gleich an des Eintretenden Brust geworfen, und auch Margot machte gleich so eine verdächtige Bewegung, während Klaus vor dem Sandmann wie ein Taschenmesser zusammengeklappt war.
Also Jack hatte seinen Schwiegervater rücksichtslos beiseite geschoben — und dann lag er vor dem Sofa auf den Knien, umschlang das Kind und... weinte selbst wie ein Kind.
Mijnheer van Hyden hatte ja schon oft darüber nachgedacht, was er in seinen alten Tagen noch alles durchmachen musste, manche Nacht hatte er unter Seufzen verbracht, manchmal war ihm auch an der Table d'hôte eine Träne in die Suppe oder aufs Beefsteak gepurzelt... jetzt aber drängte sich einmal sein ganzes, ganzes Unglück in einen einzigen Moment zusammen, als er den starken Mann so über den. Kinde weinen sah. Er schluchzte laut auf — und da fing auch Margot an — und da hielt sich der brave Klaus für verpflichtet, wie ein angeschlossener Kettenhund in der Mondnacht zu heulen.
Nur Eva weinte seltsamerweise nicht. Sie streichelte die Locken ihres Freundes.
»Weine nicht, mein Jack, sie lebt ja noch, du wirst sie schon noch wiederbekommen.«
Jack hatte sich denn auch schnell genug wieder gefasst. Übrigens hatte man seinen Schmerz wohl auch ganz missverstanden. Er hatte im Augenblick viel mehr diesem Kinde gegolten, das seinetwegen so durch die ganze Welt geschleppt wurde. Denn die Tochter van Hydens, die er einst seine Frau genannt hatte, war und blieb für ihn verloren. An diesen Gedanken hatte er sich schon gewöhnt.
»Ja, nun erzählt nur erst, was ihr mir über Marie zu berichten habt — oder vor allen Dingen, wo Eva sie zuletzt gesehen hat — doch zu allererst erlaube, dass ich hier gleich aus der Wasserflasche trinke — — so — aaah — — und hier steht auch noch eine — — — na, nun trinke ich hier auch gleich noch das Waschbecken aus.«
Er hatte in zwei Zügen zwei große Wasserkaraffen geleert, dann nach dem auf dem Waschtisch stehenden Wasserkrug gegriffen, aber dieser war schon in das Waschbecken geleert worden — so nahm er gleich das ganze Waschbecken her, setzte es an und trank es aus.
»Aaaahhh — — wenn ich in nur einmal eine poetische Ader entdeckte, dann dichte ich nicht über Wein und Pokal, sondern über Wasser und Waschbecken. Nun, wie und wo habt ihr Marie zuletzt gesehen?«
»Wie kannst du schon hier sein?«
»Lass das jetzt! Hoffentlich geht meine Nachtmär nicht durch diesen Ritt kaputt. Wie und wo habt ihr zuletzt Marie gesehen?«
Van Hyden erzählte, Jack drängte zur Kürze, und doch erfuhr er alles.
Inzwischen rief er auch schon einen Kellner, bestellte ein möglichst großes Gefäß mit Trinkwasser und für einen gesunden Mann, der seit achtundvierzig Stunden nichts über die Lippen gebracht, irgendwelches Essen, wenn es nur recht schnell gebracht würde.
»Stimmt!«, sagte er dann. »Sie ist auf einen kleinen Dampfer gekommen, der in Kosseir lag, eine Lustjacht, führt aber auch die türkische Kriegsflagge, denn ihr Eigentümer ist Brunum Ogli Pascha, der Statthalter des Paschaliks Edschme, das von der Halbinsel Sinai gebildet wird, und dieser Brunum Ogli selbst hat die weiße Frau, die er zufällig gesehen hat — oder vielleicht wurde sie ihm auch gleich angeboten — als Sklavin gekauft.«
»Für seinen Harem?«
»Vater, frage mich nicht zu viel. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß, was ich in Kosseir in aller Eile erfahren konnte. Denn natürlich drängte es mich doch vor allen Dingen, euch wiederzusehen, meine kleine Eva, die mir doch über Marie auch viel mehr erzählen kann als ich euch. Also Eva kann jetzt jederzeit hellsehen?«
»Nur dich, nicht Mariechen.«
»Wie kommt das?«
Dieser neue Zustand wurde ihm näher erklärt, soweit das möglich war.
»Wann fällt Evangeline wieder in Trance, dass sie auch Marie sehen kann?«
»Heute Nacht kurz nach elf Uhr.«
»Dann haben wir noch fünf Stunden Zeit, und bis dahin ist nichts zu machen. Ich aber habe noch gar viel zu besorgen.«
Vor allen Dingen kümmerte er sich um sein Pferd, welches den furchtbaren Ritt glücklich überstanden zu haben schien, dann aß er, und nach einer Viertelstunde konnte er dabei auch von seinen eigenen Abenteuern erzählen.
»Wo sind denn die Dahomeyweiber?«
Erst in Kosseir hatte Jack ja richtig erfahren, dass Mariechen wirklich noch lebe, dass sie auf einen Dampfer eingeschifft worden war, der nach Norden hinauffuhr, da hatte er sofort jene telepathische Botschaft an van Hyden gelangen lassen, darauf den nachkommenden Dahomeys einen Boten, mehrere Boten entgegengeschickt. Sie sollten ihm nicht weiter folgen, sondern sich ins Niltal zurückbegeben und den Nil entlang bis nach Siut reiten, dort würde er sie erwarten.
Das war das Beste für diese Frauen. Hier in dieser lybischen Wüste hätten sie verhungern können, während der Reisende im Niltal selbst kein Geld braucht, überall wird er gastfreundlich aufgenommen — d. h., nicht im Hotel, wenn er kein Geld hat. Vor dem anderen Morgen früh aber konnte man die Weiber nicht erwarten, und da durften sie ihren Pferden während der Nacht nicht viel Ruhe gönnen.
»Bis morgen früh hier warten?«, fragte van Hyden verzagt.
»Wir müssen sogar zwei Tage hier liegen bleiben«, sagte Jack mit Entschiedenheit. »Du hast dich ausgeruht, das sieht man dir an — nun aber betrachte meine Nachtmär, der bin ich wohl zwei Rasttage schuldig. Ich aber bin doch auch nur ein Mensch. Und dieses arme Kind?«
Kleinlaut versicherte der alte Papa, dass er das ja vorhin gar nicht so gemeint habe. Natürlich würde man hier zwei Tage warten, drei Tage — so lange Jack bestimme.
Jack hatte jene Worte in durchaus keinem unfreundlichen Tone gesagt, aber van Hyden hatte doch etwas Besonderes herausgehört — dasselbe, was ihm schon jener Herr Beyer, der nicht nur so hieß, sondern auch wirklich ein echter, bis zur Grobheit offenherziger Bayer war, ganz deutlich gesagt hatte.
Es gibt im Menschenleben Augenblicke, oder Tage, in denen die ganze ›sittliche Moral‹ in die Brüche geht, d. h. die Ansichten über diese Sache der Erziehung, wo man erkennt, dass die Hauptsache vom ganzen menschlichen Leben doch eigentlich das Leben selbst ist. Faktisch, man muss vom Schicksal einmal tüchtig geschüttelt werden, um zu dieser ebenso naiven wie tiefen Weisheit zu kommen. Nur darf man nicht durch eigene Schuld andere unglücklich machen — dann aber ist auch alles, alles entschuldbar, und das meiste sogar, worauf sich fast unsere ganze Literatur aufbaut, sind geradezu lächerliche Kleinigkeiten.
Mit anderen, für diesen unseren Fall gültigen Worten: Van Hyden sollte sich als Vater, wenn er seine Tochter wirklich liebte, glücklich schätzen, dass sie die furchtbaren Strapazen hinter sich hatte und nun in einen bequemen Harem kam, anstatt anderswohin, in eine Negerhütte oder in eine Räuberhöhle als gemeinsames Gut oder in einen Sarg. Denn ein gepolstertes Zimmer mit lebendiger Schande ist noch immer viel besser als ein nackter Sarg mit toter Unschuld — nur darf man eben die Schande nicht selbst verschuldet haben.
Das galt für den Vater. Wie Jack als Gatte darüber dachte, das war seine Sache.
Fast schien es, als habe er nur Evas wegen die Kräfte seines Pferdes bis zum Zusammenbruch angestrengt, nur um dieses Kind so schnell wie möglich wiederzusehen. Bloß während des Essens hatte er über sich selbst berichtet, dann setzte er sich gleich neben Evas Bett, spielte mit ihr, plauderte mit ihr — nur nicht über Mariechen — alles, was damit zusammenhing, wusste er geschickt zu vermeiden.
Das von der langen Eisenbahnfahrt erschöpfte Kind schlief bald ein. Jack sah noch einmal nach seinem Pferd, dann nahm er ein Bad, nahm auch gleich seinen unverwüstlichen Lederanzug mit in die Wanne hinein, freilich nicht am Leibe.
Hierauf, nachdem er auch sonst sein Äußeres wiederhergestellt hatte, hielt er unter den Hotelgästen Umschau. Vom Schwiegervater gefragt, ob er denn gar keines Schlafes bedürfe, meinte er, er habe sich während des letzten Wüstenrittes ausgeschlafen.
Nun, wenn so ein alter, echter Bootsmann auf dem schaukelnden und hüpfenden Deck während des Hin- und Hergehens schlafen kann — eine Tatsache, die jeder Seemann, jeder Marineoffizier bezeugen wird — dann wird wohl auch ein echter Reitersmann im Sattel des galoppierenden Pferdes sein Nickerchen machen können. Sonst wären ja gar nicht solche Touren möglich, wie sie der professionelle Expressreiter Walter Taylor ausführte, der während des Baues der südlichen Pacific eine Depesche von Little Rock nach Prescott brachte, eine Strecke von zweihundertsechzig deutschen Meilen, nur in der Luftlinie gemessen, die er mit achtzehnmaligem Pferdewechsel in zweiundneunzig Stunden zurücklegte.
Das vornehme Hotel war stark mit Vergnügungsreisenden besetzt, besonders Engländer und Amerikaner, und Mijnheer van Hyden bekam wieder einmal zu merken, was für einen ›berühmten‹ Schwiegersohn er doch hatte.
Kaum tauchte der schöne, ritterliche Mann mit seinen langen, schwarzen Locken in dem abgeschabten und dennoch zierlichen Lederkostüm auf, als alle Sehenswürdigkeiten von Luxor und Elefantine und alles andere Interessante vergessen waren.
»Kennen Sie den? Das ist Texas Jack — Sie wissen, die erste Kraft von Buffalo Bills ›Wild West‹, er soll ja eine Holländerin geheiratet haben, aber...«
Und so weiter. Es waren eben fast nur Engländer und Amerikaner mit ihren Damen, und bei diesen spielt der Sport und was damit zusammenhängt, noch eine ganz andere Rolle als in Deutschland. Dort verkehrte Buffalo Bill als Colonel Cody ja nur in Offizierskreisen, aber man muss gesehen haben, wie dieser Mann als Chef der Kundschafterabteilung und überhaupt eben als Buffalo Bill nebst den Hauptpersonen seiner Truppe in England vergöttert wurde.
Als Blücher nach der Schlacht bei Waterloo London besuchte, ist er in seinem Hotel von englischen Lords bedient worden — denen er dann, nebenbei bemerkt, da der alte Marschall Vorwärts ein leidenschaftlicher und immer glücklicher Hasardspieler war, das ganze Geld abgenommen hat — und bei seinen Spazierfahrten durch die Stadt hat er bekanntlich, um den ewigen Handküssen zu entgehen, zum Wagenfenster seinen ausgestopften Handschuh herausgehängt. Dem Buffalo Bill aber haben bei seinem Londoner Aufenthalt im Jahre 1903, als er einmal durch die Straßen ritt, einige aristokratische Damen mit bekannten Namen, schnell aus ihrer Equipage springend, die Stiefel ausgezogen, um diese dann als Trinkgefäße zu benutzen, und nicht minder verrückt waren die Männer.
Und nun muss man das Leben in diesen ägyptischen Hotels kennen, wie diese Amerikaner und Engländer mit ihren Frauen und Töchtern auftreten! Entweder wie die Zigeuner, oder richtiger wie die Bauernknechte und Bauernmägde, mit schweißigen Flanellsachen und Kitteln und Schuhen, die der ewige Jude zu seinen rastlosen Wanderungen recht gut hätte brauchen können, oder aber in ›full dress‹.
Beim Anblick des Speisesaales eines Hotels, das mitten in der Wüste liegt, zu dessen Erreichung viele Stunden Kamelreitens nötig sind, denkt man nicht anders, als man kommt zu einer glänzenden Hoffestlichkeit. ›Smoking‹ gibt es für die Herren gar nicht, nur Frack, oder aber schneeweiß, und nun gar die Damen, alle in prachtvollster Toilette, tief dekolletiert, mit drei Meter langen Schleppen, alles funkelnd von Juwelen, und diese Toiletten müssen immer wieder gewechselt werden, sonst kann man da eben nicht mitmachen. Ein lumpiger Millionär kann es auch nicht, auch keiner in Dollars, der könnte noch nicht einmal auf die Dauer die ungeheuren Gepäckkosten bestreiten.
So sah es auch hier in diesem Hotel aus. Und nun wendete sich all dieses glänzende und gleißende Geschmeiß dem abgeschabten Lederkostüm zu...
»Das ist Texas Jack...«
Aber es waren eben fast nur Engländer und Amerikaner. Nur einige bewundernde und feurige Blicke, nur ein leises Raunen, dann beherrschte man sich meist wieder. Viele kannten ihn persönlich, hatten schon mit ihm gesprochen, aber so ohne Weiteres war eine Wiederannäherung nicht möglich, dazu mussten erst umfangreiche Vorbereitungen getroffen werden.
Nur einer von der Gesellschaft machte eine Ausnahme.
»Hallo, Mr. Dankwart!«
»Hallo, Mr. Bobsnob!«
Und freudig wurden die Hände geschüttelt, auch Jack strahlte plötzlich im ganzen Gesichte.
Dieser Mann bildete auch wirklich eine Ausnahme von der ganzen menschlichen Gesellschaft, sein Äußeres und sein Charakter müssen näher beschrieben werden.
Es war ein Riese Goliath von mindestens drei Zentnern, aber der Schmerbauch fiel nicht auf, weil die ganze Gestalt so kolossal war — und auf dieser hohen Fleischmasse nun ein kleines Köpfchen mit einem fröhlichen Kindergesichtchen, mit hübschen roten Pausbäckchen, das kurzgeschorene Haar schon ergraut; er hatte die fünfzig auch schon hinter sich, und nun, um trotzdem das Knabenhafte voll zu machen, auch noch einen Knabenanzug, nämlich Pumphosen und auch so ein kurzes Jäckchen — kurz und gut, so ein strammer zehnjähriger Junge, der einst ein dicker Riese zu werden verspricht, unterm Vergrößerungsglas betrachtet, schon mehr unterm Mikroskop — und das Beste dabei war, dass dieser ungeheuere Fleischkoloss auch noch ein helles Kinderstimmchen hatte!

Schon sein Name war eine Merkwürdigkeit. Er hieß Snob. Das ist doch schon etwas ganz Ungewöhnliches. Sein Vorname war Robert, das ist englisch Bob — und nun war daraus Mr. Bobsnob geworden. Die meisten dachten, er hieße wirklich so, er vielleicht bereits selbst, denn weil einmal ein Bankhaus einen Wechsel von ihm nicht angenommen hatte, weil er sich nur Snob unterschrieben hatte, wo er doch Bobsnob hieße, so unterzeichnete er seitdem nur noch Bobsnob.
Mr. Bobsnob war in ganz England und in ganz Amerika bekannt, soweit diese reisen. Und das Paradies des reisenden Engländers und Amerikaners ist Ägypten geworden. Kairo, das afrikanische Paris, ist ihr RendezvousOrt, und das ganze übrige Ägypten mit noch einem Teil des weiteren Afrikas und des angrenzenden Asiens gehört mit zur ›Umgebung‹.
Und Mr. Bobsnob lebte schon seit einem halben Menschenalter ganz in Ägypten, kam gar nicht mehr heraus. Weshalb, das wusste man nicht recht. Er fühlte sich hier eben behaglich. Oder er sagte es ja selbst: weil es hier das beste Beefsteak gab.
Das wirklich ganz eigenartige ägyptische Rindfleisch ist nicht nach jedermanns Geschmack, es ist sehr trocken, aber Mr. Bobsnob schwärmte eben für diese Trockenheit. Über dieses hiesige Rindfleisch konnte Mr. Bobsnob stundenlange Vorträge halten. Wenn jemand darauf einging, da packte ihn die Begeisterung.
Und dann noch über Eier. Jaaa, die ägyptischen Eier!! Klein, aber fein!
Mr. Bobsnob hatte überhaupt für nichts weiter Interesse als für die... nun, sprechen wir es nur getrost aus: als für die Fresserei.
Beefsteaks und Eier waren aber auch so ziemlich das Einzige, was er von ägyptischen Produkten verbrauchte. Alles, alles andere bezog er direkt aus seiner Heimat, aus England, seinen Porter und Whisky bis zum letzten Streichholz, dessen er für seinen englischen Tabak bedurfte, und waren seine Hemdenknöpfchen den Weg aller Hemdenknöpfchen gegangen, so ließ er sich aus London eine ganze Kiste Hemdenknöpfchen schicken.
Er war nicht gerade ein angenehmer Gesellschafter. Nicht nur, dass er, seinem Kindergesicht entsprechend, jedem mit kindlicher Naivität die Wahrheit ins Gesicht sagte, sondern er konnte mit seinem hellen Kinderstimmchen auch ganz mörderlich fluchen, hatte schändliche Ausdrücke, und da war es ihm ganz egal, wer mit am Tische saß und wie lang die Schleppen waren. Trotzdem war er überall gern gelitten. Er war eben eine Ausnahme von der ganzen Menschheit. Man konnte ihm gar nicht gram sein, ihm nichts übel nehmen.
Ja, mit diesem Manne war auch ein Geheimnis verbunden. Wenn der sich noch einen Beruf wählen müsste, hätte er Heilmagnetiseur werden sollen. Es ging von ihm wie eine Kraft der Gesundheit aus. In seiner Nähe musste alle üble Laune weichen. Und ganz besonders, wenn jemand an Magenverstimmung litt oder sich überhaupt ohne Appetit zu Tisch setzte, so brauchte er nur Mr. Bobsnob zu beobachten, wie der fr... aß, dann bekam der Betreffende gleich einen Wolfshunger.
Man behauptete sogar, Mr. Bobsnob habe in ganz Ägypten und weiterer Umgegend freies Hotel, er diene als ReklameEsser. Das war aber durchaus nicht der Fall. Er hatte sich seine Millionen ehrlich verdient, und nicht etwa durch Viehhandel en gros, sondern mit Glühstrümpfen — faktisch, dieser Riese Goliath von drei Zentnern hatte solche duftige Dingerchen gemacht, die man kaum anblasen darf! Zu einer Zeit, als diese Glühstrümpfe noch etwas ganz Neues gewesen waren, hatte er für England das erste Patent gehabt, und da waren die Millionen nur so geflossen gekommen.
Ist der Herr einer so ausführlichen Beschreibung gewürdigt worden, verdient auch sein Diener wenigstens einiger Worte. Er hieß Amyanth und war das ganze Gegenstück von seinem Herrn, dem er, wenn er sich nur etwas bückte, zwischen den Beinen durchlaufen konnte, und dazu nun ganz dürr, ganz zart, nur ein Hauch von einem Menschlein, dabei aber, während sein kolossaler Herr lebhaft wie Quecksilber war, immer tiefernst, würdevoll bis in die zarten Fingerspitzen, und nun das majestätische Gesicht mit zwei mächtigen Bartkoteletten geschmückt. Dabei trotz dieser ruhigen Majestät gewandt und elegant und graziös wie — wie — wie ein Tanzmeister, der er denn früher auch wirklich gewesen war. Nicht vergessen werden darf, dass er immer tadellos schwarz ging, mit weißer Halsbinde und weißen Handschuhen, und nun ließ sich gar kein possierlicherer Gegensatz denken, als wenn dieses kleine, dürre, elegante Kerlchen mit dem großen Vollbart so steif und würdevoll hinter seinem mächtigen, immer lebhaft gestikulierenden Herrn stand, der immer bloß seine Pumphosen und sein Kinderjäckchen trug.
Vor zwei Jahren war Mr. Bobsnob ein einziges Mal in London gewesen, ein Bankgeschäft hatte es unbedingt erfordert, Buffalo Bill hatte in London gerade seinen ›Wilden Westen‹ vorgeführt, da hatte Mr. Bobsnob die ziemlich intime Bekanntschaft von Texas Jack gemacht.
Jetzt wurde sie erneuert. Wenn Mr. Bobsnob schon etwas von der ganzen Affäre, weswegen Texas Jack hier war, wusste, so fragte er deswegen doch noch nicht, obgleich er sonst also keine Rücksichten nahm. Es war noch Zeit bis zur Abendtafel, Mr. Bobsnob wollte sich erst noch etwas Bewegung machen, lud seinen Freund dazu ein — so promenierten die beiden auf der palmengeschmückten Veranda, die um das ganze Hotel ging, der patente Amyanth immer hinter seinen. Herrn einherstolzierend.
»Sie kennen doch Ägypten, Mr. Bobsnob!«, eröffnete Jack das Gespräch.
»Wie meine Hose, wie meine Hose!«, schrie das helle Kinderstimmchen, dass jede Dame, die diesen Gentleman noch nicht kannte und ihm alles nachsah, ein ›shocking!‹ ausstieß und sich errötend abwandte.
»Fragen Sie mich über Ägypten, was Sie wollen, ich kenne alles, jeden Menschen.«
»Auch die Halbinsel Sinai?«
»Das Paschalik Edschme? Ei gewiss, ei gewiss!! Ich bin oben auf dem Dschebel Musa gewesen, Sie wissen, wo Moses die sieben Gebote bekam.«
»Es waren zehn Gebote«, korrigierte Jack lächelnd.
»Zehne? So? Auch möglich. Ach so, sieben Bitten sind's. Na, das ist ja schließlich ganz egal — ich möchte nur wissen, wie Moses da hinaufgekommen ist. Ei, so eine gottverdammte Kraxelei! Da muss man sich anseilen lassen. Für mich musste ein Drahtseil mitgenommen werden. Da oben, wo er die sieben Gebote bekam — oder zehne sind's also gewesen — steht eine Zypresse, die schon damals dort gestanden haben soll. Aber ich glaube nicht. Das ist für mich auch ganz Nebensache. So weit gehen die Pilger gar nicht. Als eigentliches Heiligtum gilt das Sankt Katharinenkloster, das noch eine Stunde weiter unten steht, da drin beten Mohammedaner und Juden und Christen zusammen. Und da möchte ich noch einmal hin. Diese Mönche haben nämlich eine Hühnerzucht — und Eier, sage ich Ihnen, Eier!! — einen ganz feinen, merkwürdigen Geschmack, so zwischen L 5 und M 2.«
Für diesen Epikuräer war ein frisches Hühnerei also nicht nur ein frisches Hühnerei, sondern zur Nuancierung des Geschmackes genügte ihm nicht einmal das Alphabet, er setzte auch noch Nummern hinzu.
»Kennen Sie da zufällig den Brunum Ogli Pascha?«, fragte Jack schnell, ehe jener sich noch tiefer in die Eierkunde verirrte und von da ganz sicher aufs Rindfleisch gekommen wäre.
Der bepumphoste Riese blieb stehen und fuchtelte mit den fleischigen, aber auffallend kleinen Händen in der Luft herum.
»Ob ich den kenne? Den Statthalter von Edschme? Das ist ein Lump. Das ist ein großer Lump. Der soll mir nicht noch einmal in die Quere kommen. Mit dem habe ich einmal etwas gehabt. Und da habe ich ihm etwas gesagt. Wenn der mich erblickt — Sie sollten sehen, wie der gleich vor mir zu Kreuze kriecht.«
Dass Mr. Bobsnob ein Renommist und Prahlhans war, hatte Jack eigentlich noch nicht bemerkt, auch noch nie etwas davon gehört. Trotz seines Kindergesichtes und seiner Kinderstimme machte er einen sehr männlichen Eindruck, wurde auch von allen als ein ganzer Mann respektiert.
Jetzt erzählte Jack seine ganze Geschichte und wie es der Pascha von Edschme war, der die Entführte zuletzt gekauft hatte — für dreihundert Pfund Sterling, auch das hatte Jack in Kosseir erfahren. So viel war die wenn nicht schöne, so doch sehr hübsche, reizvolle Holländerin dem türkischen General wert gewesen.
Mister Bobsnob hatte den Erzähler nicht allzu oft unterbrochen. Sehr viel schien ihm davon schon bekannt zu sein, wenigstens das Hauptthema, die ganze Entführungsgeschichte, und von dem hellsehenden Kinde berichteten jetzt bereits die Zeitungen.
»Er war in Kosseir mit einem Kriegskutter, einer Dampfjacht«, schloss Jack seinen Bericht, »und diese hat sich vier Stunden vor meiner Ankunft in Kosseir wieder nordwestlich gewandt, also jedenfalls nach Kabel el Tor zurück, wo dieser Pascha doch seine Residenz hat.«
»Da müssen wir sofort hin!«, rief jetzt der quecksilberne Riese lebhaft. »Da gehe ich nämlich mit! Sonst kriegen Sie Ihre Frau nicht wieder — von dem nicht! Herr, sehen Sie mich an!«
Jack folgte dieser Aufforderung, und der dicke Riese Goliath riss seine freundlichen Kinderäuglein möglichst weit auf, während er ein recht böses Gesicht zu machen versuchte, was ihm freilich schlecht gelang. Es war doch ein sonderbarer Kauz.
»Herr, sehe ich etwa aus wie ein Renommist?«, fing er jetzt auch noch an.
Jack hätte beinahe mit einem freimütigen ›Ja‹ geantwortet. Oder wenn er nicht so aussah, so hielt ihn jetzt doch Jack für einen solchen. Er verbiss sich dieses ›Ja‹.
»Wie ein Renommist? O nein, Mister Bobsnob«, entgegnete er statt dessen.
»Ich habe in meinem ganzen Leben bewusst noch keine Lüge gesagt, oder ich habe sie sofort eingestanden, wenn ich mich einmal bei einer kleinen Unwahrheit ertappte, und so sage ich Ihnen: Von diesem Ogli Pascha bekommen Sie Ihre Frau nicht wieder! Wenigstens nicht durch Rückkauf. Nicht für alles Geld in der Welt.«
»Ja, weshalb denn aber nicht?«, wurde Jack etwas ungeduldig.
»Nu, weil der selbst Geld genug hat. Dabei aber ist er gar nicht geldgierig. Da macht er als türkischer Statthalter einmal eine merkwürdige Ausnahme. Überhaupt ein merkwürdiger Mensch! Ich kenne doch den Brunum Ogli. Dass der jetzt die weiße Frau gekauft hat, die durch ganz Afrika geschleppt worden ist — das ist so etwas für den, der gibt diese seine Sklavin nicht für alle Schätze der Welt wieder heraus.«
Jack wurde immer pikierter. Von dieser Seite hatte er den kindlichen Riesen damals in London wirklich nicht kennen gelernt, da war er wohl außerhalb seiner Atmosphäre gewesen.
»Nun, wenn man sich da gleich an die richtige Quelle wendet, nach Konstantinopel — die Pforte dürfte da wohl ein Machtwort sprechen.«
»Bei dem? Nee. Der hat als Statthalter von Edschme mehr zu sagen als der Sultan. Als Statthalter von Edschme, verstehen Sie recht. Der ist unentbehrlich. Denn das ist der einzige, der diese gottverdammte Luderbande von Drusen in Schach halten kann. Verstehen Sie?«
Nein, Jack verstand ganz und gar nicht. Mister Bobsnob ward ihm vielmehr immer unverständlicher. Dieser Riese schien in seinem kleinen Köpfchen Gehirnerweichung bekommen zu haben.
»Kennen Sie Kabel el Tor?«, fragte er jetzt zunächst.
»Nein, hatte noch gar nichts davon gehört, habe es erst vorhin auf der Karte aufgesucht.«
Mister Snob schilderte es näher, und jetzt sprach er ganz vernünftig.
Auch Kabel el Tor, zu deutsch die Bucht der Seufzer, ist ein Quarantänehafen für die von Süden nach Norden durch den Suezkanal gehenden Schiffe, ebenso wie Kosseir, aber von ganz besonderer Bedeutung. Er ist nur für die Pilgerschiffe bestimmt, welche von Konstantinopel aus die mohammedanischen Wallfahrer aufnehmen, die sich zu gewissen Zeiten an der ägyptischen und kleinasiatischen Küste versammeln, in Karawanen tief aus dem Innern Afrikas und Asiens kommend, natürlich auch schon mit europäischen Mohammedanern besetzt, diese dann nach Dschidda bringen, dem Hafen von Mekka und Medina.
Wie es auf diesen Pilgerschiffen zugeht, welche alle unter englischer Flagge fahren, besetzt aber mit arabischen und jetzt sehr viel auch mit japanischen Matrosen, Europäer kommen da nicht an oder halten es gar nicht aus — der Schreiber dieses ist jedoch ein halbes Jahr auf solch einem Pilgerschiff als Matrose gefahren — wie es also auf solch einem Schiffe zugeht, vom Oberdeck an bis zum Kielraum mit einigen tausend Männern, Frauen und neugeborenen Kindern vollgepfropft, das spottet jeder Beschreibung. Beschreiben könnte man es wohl, aber niemand würde es glauben, der es nicht mit eigenen Augen gesehen hat.
Auf der Rückfahrt nun müssen diese Pilgerschiffe, ehe sie durch den Suezkanal dürfen, in Kabel el Tor in Quarantäne gehen, mindestens vierzehn Tage. Es ist die strengste Quarantäne der Welt. Die Pilger werden gegen ihr eigenes schweres Geld in Zelten untergebracht, also am Lande, in der Wüste, jedes Schiff in einem besonderen Lager, das von Soldaten bewacht wird, und zeigt einer von den tausend bis fünftausend Lagerbewohnern irgendeine ansteckende Krankheit, so wird die Quarantäne immer wieder um vierzehn Tage verlängert.
Auf diese Weise würde die Quarantänehaft nie erlöschen. Die sechshundert türkischen Soldaten, die in Kabel el Tor liegen, dienen mehr als Totengräber, denn als Wachtposten. Noch mehr müssen die Aasgeier besorgen. Da hilft nur die türkische Bestechlichkeit. Nach einigen Wochen, nachdem der Pascha von Kabel el Tor die Pilger so viel wie möglich ausgesaugt, die Leichen geplündert hat, kommen sie doch wieder aufs Schiff. Dieses würde jetzt ein Herd der Cholera, Ruhr, Pest und anderer scheußlicher Krankheiten sein. Aber diese Schiffe sterben regelmäßig aus. Man möchte fast annehmen, dass die mitgehenden Schiffsagenten, die Leiter dieser Fahrten, sogar ›von oben‹ dazu angewiesen sind, der schnellen Sterblichkeit eventuell durch Gift nachzuhelfen. Was dann noch übrig bleibt — wie auf der ›Malakka‹ im Jahre 1890 von 1105 Passagieren nur noch elf, von 87 Mann Besatzung noch 23 — das wird wie das ganze Schiff tüchtig ausgeräuchert, und die Sache ist »all right‹.
Nur auf diese Weise kann verhindert werden, dass von Dschidda resp. von Kabel el Tor aus ganz Europa verseucht wird. Für die Mohammedaner hat dieser Massentod und Massenmord nichts zu sagen, die schätzen sich sogar glücklich; der Tod der geliebtesten Familienangehörigen und Verwandten wird von den Überlebenden gepriesen, denn wer während solch einer Pilgerfahrt nach dem heiligen Grabe stirbt, kommt ja direkt ins Paradies, gleich in den siebenten Himmel. Dann gibt es doch auch noch Pilgerkarawanen über Land, noch viel, viel stärker frequentiert, die werden nicht so kontrolliert, aber die dürfen gar nicht nach Europa hinein, kommen auch nur aus Afrika oder Asien, mit denen hat unser Erdteil also gar nichts zu schaffen.
»So, nun wissen Sie, wie es dort aussteht. Sie wollen nach Kabel el Tor?«
»Selbstverständlich muss ich hin.«
»Es ist zwar jetzt keine Pilgersaison, in Kabel el Tor ist jetzt nichts als die Besatzung zu finden, trotzdem wird die Kontrolle noch ebenso streng aufrecht gehalten. Nach Kabel el Tor kommt kein Fremder. Weder zu Lande noch zu Wasser. Dort haben sich im Laufe der Jahrhunderte gar zu fürchterliche Schrecknisse und Geheimnisse aufgehäuft. Ihre Gattin ist Ihnen dort genau so unnahbar, als wenn sie im Innern Afrikas verborgen gehalten würde.«
»Wir wollen doch sehen, ob ich nicht hineinkomme.«
»Mister Dankwart, ich kenne Sie und weiß, was Sie leisten können. Ja, Sie sind ein verwegener Teufel. Aber es gibt noch ganz andere Teufel auf der Erde. Ja, ich glaube Ihnen, dass Sie nach Kabel el Tor kommen, Sie werden sich überall durchschleichen, werden offen jeden Widerstand besiegen, durch Kraft und Kühnheit oder List. Aber da kommt so ein Halunke, spricht ganz freundlich mit Ihnen, schlägt sie einmal wohlwollend auf die Schulter — und morgen sind Sie mit Pestbeulen bedeckt, übermorgen scharrt man Ihre Leiche ein. Der Kerl hat Sie infiziert. Na, was sagen Sie nun?«
Jack erschrak. An so etwas hatte er freilich nicht gedacht.
»Das ist möglich?!«
»Kommen Sie nur hin! Die dort können noch etwas ganz Anderes. Die haben direkt in der Hölle studiert. Nun aber sage ich Ihnen etwas Anderes: Ich gehe mit Ihnen; wir fahren von Suez aus mit irgendeinem Dampfer, der nach Süden geht. Der Kurs führt durch das gefährliche rote Meer, das man nur im Zickzack durchkreuzen kann, sowieso ziemlich nahe an Kabel el Tor vorbei; wir haben unser eigenes Boot mitgenommen, lassen den Dampfer einmal stoppen, setzen an Land. Weiter ist gar nichts nötig.«
»Und Sie selbst dürfen diese so streng abgeschlossene Stadt betreten? Ihnen droht keine der geschilderten Gefahren? Der allmächtige Pascha wird Ihnen die Sklavin ausliefern?«
»Herr, sehen Sie mich an«, forderte der dicke Riese noch einmal auf. »Das habe ich schon einmal zu Ihnen gesagt. Sie halten mich nämlich noch immer für einen Prahlhans. Schweigen Sie, es ist so, und ich kann es Ihnen auch gar nicht verübeln. Nun hören Sie aber: Wenn etwa ein Offizier mit einem ganzen Bataillon angerückt kommt, um uns das Betreten des Landes zu verwehren, dann trete ich ihm in den Bauch, und das ganze Bataillon wird vor mir präsentieren; und dann gehe ich direkt in das Haus des Paschas und winke nur mit dem Finger — sehen Sie, so, so werde ich winken — und da wird der allmächtige Brunum Ogli Pascha mit krummem Buckel gekrochen kommen und nach meinem Begehr fragen — und dann werde ich sagen: Heraus mit der weißen Sklavin, du Hund!! — und dann wird er sie sofort bringen — und dann werde ich zu dem allmächtigen Pascha sagen: Lecke mir meine Stiefel ab, du gottverdammter Schuft! — und da wird er mir die Stiefel ablecken — — und wenn das alles nicht buchstäblich in Erfüllung geht, dann sollen Sie dies der ganzen Welt verkünden — und dann bin ich doch als ein Lügner und Aufschneider blamiert, ich, Mister Bobsnob, den alle Welt als einen Ehrenmann kennt, wenigstens soweit sie etwas von Ägypten weiß. Na, glauben Sie nur nun endlich?«
Ja, da mit einem Male sah Jack den Riesen mit dem Kindergesicht mit ganz anderen Augen an. Trotz der Kinderstimme, die er jetzt dämpfte, hatte er mit unwiderstehlicher Überzeugungskraft gesprochen. Und wie hätte er denn überhaupt so sprechen können, wenn es nicht auf Wahrheit beruhte!?
»Mann, wer sind Sie denn, dass Sie solch eine Macht auf einen Pascha ausüben können, der sonst für allmächtig gilt?«, konnte Jack nur staunend fragen.
»Ich habe ihn eben in der Tasche, kenne ein Geheimnis von ihm. Es ist allerdings noch etwas Anderes dabei. Aber ich spreche nicht davon. Ich bin kein Renommist. Ihnen, Ihnen allein will ich es sagen.«
Der Riese sah sich vorsichtig um, sie waren allein, der Diener zählte wohl nicht mit, und der Riese dämpfte seine helle Stimme noch mehr.
»Wer ich bin? Ein Glühstrumpffabrikant. Ich lebe hier in Ägypten seit nun bald einem Vierteljahrhundert, weil nur die Beefsteaks und die Eier so schmecken. Nicht wahr, so sagt man allgemein? Ich bin ein Bummler, ein Tunichtgut, wenigstens in den Augen jedes wirklich tüchtigen Mannes, nicht wahr?
Aber niemand außer meinem Diener weiß, was für ein... strebsamer Mensch ich in Wirklichkeit bin.
Ich habe nicht umsonst ein Vierteljahrhundert in Ägypten gelebt. Ich habe in meinem Kopfe mühsam vielleicht mehr Kenntnisse zusammengehäuft, als alle diese gelehrten Ägyptologen zusammen. Ich bin in Ägypten in Löcher gekrochen, in die noch kein europäischer Professor gekrochen ist. Haben Sie von dem verstorbenen Derwisch Abu dal Nazi gehört? Nicht? Tut nichts zur Sache. Der war mein Lehrmeister. Ich bin in alle Mysterien aller Derwischorden eingeweiht, kenne alle geheimen Erkennungszeichen und alles, alles, alles. Nun fragen Sie einen ägyptologischen Professor, was das zu bedeuten hat. Aber sprechen Sie nicht von mir. Das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, bleibt unter uns. Ich will unbekannt bleiben, mir mein Essen schmecken lassen. Nun kommen Sie zur Tafel!«
Die elfte Stunde nahte, da Evangeline mit Mariechens Haar in der Hand diese sehen würde. Man musste sich aber darauf gefasst machen, dass sie die Entführte dennoch nicht erblicken konnte, weil es Nacht war, Mariechen sich in einem finsteren Raume befand.
Jack hatte Mr. Snob seinem Schwiegervater vorgestellt; die beiden hatten schnell Freundschaft geschlossen, und das umso mehr, weil sich im Laufe des Gespräches ergab, dass die beiden ihr Vermögen auf ein und derselben Bank hatten. Die Hauptsache bildete natürlich die Entführungsgeschichte, die jetzt Mr. Snob ganz ausführlich erfuhr. Dass er nun an der Sitzung teilnahm, war selbstverständlich.
»Sind Sie krank, Miss?«, hatte Jack noch vorher die Pflegerin gefragt.
Margot hatte schon immer in den letzten Tagen ein äußerst unruhiges Wesen gezeigt, den beiden phlegmatischen Holländern, van Hyden und seinem Diener, war es nur nicht ausgefallen. Jack merkte es sofort, und jetzt zitterten ihr sogar die Hände, als sie der kleinen Schatulle die schon so oft gebrauchte Locke entnahm.
Margot wollte von nichts wissen, und jetzt war keine Zeit, deswegen weiter zu fragen.
Evangeline fiel in Trance. Die Befürchtung traf nicht zu. Mariechen befand sich in einem erleuchteten Zimmer, das orientalisch eingerichtet war, und zwar äußerst luxuriös, und ebenso prachtvoll war sie selbst gekleidet, wenn auch wohl schon für die Nacht.
»Sind noch andere Personen in dem Zimmer?«
»Ich sehe keine — ja — jetzt — ein alter Mann — in einem weißen Kaftan — mit Gold — und Purpurstreifen — er spricht mit Mariechen...«
»Kannst du mir den Mann näher beschreiben?«, fragte Mr. Snob.
»Er hat einen sehr langen, weißen Bart... und eine lange, krumme Nase... «
»So eine Hakennase, nicht wahr?«
»Ja, wie der Schnabel eines Raubvogels.«
»Es ist Brunum Ogli Pascha! Siehst du etwas auf seiner rechten Backe, dicht unter dem Auge?«
»Eine große Warze, mit einem Haarbüschel darauf.«
»Es ist Ogli Pascha!«, wiederholte Mr. Snob. »Nun können Sie denken, Sie hätten Ihre Frau schon wieder. Denn der lässt sich nichts wieder nehmen, was er einmal zwischen seinen Geierkrallen hat — mit Ausnahme, wenn Mr. Bobsnob kommt. Also ich meine: Sie brauchen nicht zu fürchten, dass Ihnen die Gattin von dort vorher noch einmal entführt wird, wir brauchen uns also gar nicht besonders zu beeilen.«
Sonst konnte Eva nicht viel erzählen. Jene beiden sprachen lange zusammen, der alte Mann streichelte ihr das blonde Haar, griff ihr unters Kinn, Mariechen nahm seine Hand und küsste sie inbrünstig — nichts weiter.
»Sie küsst ihm die Hand?«, fragten van Hyden und Jack gleichzeitig.
»Ja, lange, lange, und dabei lächelt sie, so recht dankbar...«
»Wie ist das möglich?!«, stieß der Vater grimmig hervor.
»Teufel noch einmal!«, ließ sich da Mr. Snob vernehmen. »Soll sie ihm nicht dankbar sein, wenn sie endlich eine gute Behandlung und ein weiches Bett und etwas Gutes zu essen bekommt, sie, die in acht Wochen durch ganz Afrika geschleppt worden ist?«
Der Riese hatte vollkommen recht, er verstand den menschlichen Charakter viel besser zu beurteilen als der alte Holländer.
Das Kind erwachte.
»Vater, ich möchte dich einmal unter vier Augen sprechen.«
Mijnheer van Hyden knickte bei diesen Worten Jacks gleich zusammen. Wie betäubt folgte er ihm in ein anderes Zimmer. So saß er ganz gebrochen auf einem Stuhle, während Jack mit starken Schritten auf und ab wanderte.
»Die Entscheidung naht«, begann Jack nach einer Pause, ohne seine Wanderung einzustellen.
»Ja«, hauchte van Hyden.
»Wir werden Mariechen wiederbekommen.«
Van Hyden blickte schnell einmal auf. Seit langer, langer Zeit war es das erste Mal, dass Jack wieder ›Mariechen‹ sagte. Er hatte sich sonst immer eines kurzen ›Marie‹ befleißigt, wenn er ihren Namen nicht ganz zu umgehen suchte.
»Ja«, hauchte er dann abermals.
»Selbstverständlich... hm... selbstverständlich...«
»Ja«, erklang es zum dritten Male flüsternd, ergebungsvoll.
Mit einem Ruck blieb Jack da vor ihm stehen.
»Was findest du selbstverständlich?«
»Dass du deine... dass du sie nicht wiedersehen willst.«
Lange Zeit blickte Jack auf den unglücklichen Mann herab, der in der letzten Zeit wirklich sehr, sehr gealtert war.
»Das findest du so ganz selbstverständlich, dass ich sie nicht wiedersehen will?«, fragte er dann leise.
»Ja.«
»Ich glaube, ich habe es selbst früher einmal gesagt.«
»Ja.«
»Was habe ich da gesagt?«
»Dass du mir meine Tochter nur wieder zuführen würdest — aber deine Frau könnte sie nicht mehr sein.«
»Ja, das habe ich allerdings gesagt. Und das findest du selbstverständlich?«
»Ja.«
»Weshalb?«
»Weil ich dich kenne, Jack, und... ich könnte nicht anders handeln.«
»Hm. Was hat Mariechen eigentlich verbrochen oder überhaupt nur getan?«
Da hob der alte Vater beide Arme zum Himmel empor.
»Was sie getan hat?«, rief er in jammerndem Tone. »Nichts, gar nichts, sie selbst ist ja ganz unschuldig!«
»Das denke ich auch«, entgegnete Jack, noch immer mit harter Stimme, wie er das Gespräch begonnen hatte, aber diese begann doch jetzt etwas zu zittern. »Sie selbst ist ja ganz unschuldig. Man hat ihr vorgespiegelt, ich sei tot, nachdem man mich bei ihr schon vorher schlecht zu machen versucht hatte, was sie aber wohl nie geglaubt haben wird — bei dem Versagen der Lebensblume musste sie wohl auch an meinen Tod glauben, selbst, wenn sie sonst gar nicht abergläubisch gewesen wäre — der Mensch ist nun einmal so — dann wurde sie jedenfalls gezwungen, jenen Halunken zu heiraten — es blieb ihr ja gar nichts Anderes übrig — später versuchte der Kerl sie während der Hochzeitsreise zu ermorden...«
»Weshalb nur das alles?«, unterbrach jammernd der Vater.
»Das Weshalb ist jetzt ganz gleichgültig«, sagte der wieder auf und ab gehende Jack. »Es ist so! Um das Weshalb werde ich mich schon später kümmern. Ja, was hat Mariechen eigentlich verschuldet? Absolut nichts. Dass in meinem Herzen nun etwas erstorben ist, das ist selbstverständlich. Das ist das einzige Selbstverständliche. Ja, in meinem Herzen ist etwas getötet worden.«
Tief und schwer holte Jack Atem, als er fortfuhr:
»Niemand kann mir verargen, wenn ich meine Frau nicht wiedersehen will, mich von ihr scheiden lasse. Ich bin sogar geradezu verpflichtet dazu, sonst hätte ich keinen Charakter. Jawohl, das nennt man ja Charakter. Charakter, hahahaha! Haben diese Leutchen eine Ahnung, was Charakter ist! Ja, man wird mich sogar bewundern, denn ich werde dabei ja den größten Teil der sogenannten Mitgift verlieren, einige Millionen, und man wird mich wiederum einen Narren schelten, wenn ich auf diese sogenannte Mitgift überhaupt ganz verzichte...«
»Jack, ich bitte dich...«
»Lass mich aussprechen!«, unterbrach der Auf- und Abwandernde die flehende Stimme rau. »In den Augen der meisten Menschen wäre ich ein Narr. Nur einige wenige würden mich für einen edlen, für einen wirklich charaktervollen Mann halten. Doch was geht mich überhaupt an, was die Menschen von mir denken? Ich selbst weiß, was ich zu tun habe. Vater, hörst du? Ich weiß, was ich tun werde!«
»Nun, was willst du tun?«, fragte Mijnheer van Hyden ganz kleinlaut.
Jack blieb wieder vor ihm stehen.
»Ich werde vor sie hintreten, so wie jetzt vor dich, und ich werde zu ihr sprechen: Mariechen, für alles das konntest du nichts, du bist ein Opfer von... oder ich werde überhaupt gar nichts sprechen, sondern ich werde handeln, dazu vielleicht nur ein einziges Wort... Vergessen, vergessen!... zu vergeben habe ich dir ja nichts, nur vergessen, vergessen!!«
Und plötzlich beugte sich der große, starke Mann herab, schloss den Schwiegervater in seine Arme, küsste ihn wieder und immer wieder, und dabei weinte und schluchzte er wie ein Kind.
Das hatte van Hyden nicht erwartet. Aber er begriff schnell genug.
»Jack, mein Jack, das könntest du tun?«
Und ihre Tränen flossen zusammen. Sonst kann solch eine Szene nicht weiter beschrieben werden.
Es war auch keine Szene, sondern es war ein Lied — ein Lied mit der Begleitung von Engelsstimmen — — es war das Hohelied der Liebe.
Und hinter der Portiere, welche den Türeingang verschloss, stand ein Weib, das schöne Antlitz bleich wie der Tod, den Tod in den erloschenen Augen, die Hand auf das stillstehende Herz gepresst, und ihre Zähne schlugen zusammen, dass es ein Wunder war, wie es die Männer nicht vernahmen.
Dann hörte sie Jack wieder sprechen, und im Gegensatz zu vorhin klang seine Stimme jetzt so sanft, so sanft, und jedes seiner Worte schnitt wie ein Messer in das Herz der Lauscherin.
»Meine Liebe war ja auch nie ganz erstorben«, hörte sie dann ihn sagen, und noch immer war es eine Stimme wie aus dem Jenseits, mit Harfenbegleitung, »nur verwelkt war sie, vertrocknet — unter dem Tau eines neuen Lebens wird sie wieder aufblühen — Mitleid habe ich ja stets für die Ärmste empfunden — ach, was für ein Mitleid! — und was ist denn Mitleid anderes als Liebe — aber noch eine ganz andere Liebe als die, welche jedes Tier empfindet. Doch«, — und mit einmal klang seine Stimme ganz anders, rau, fast wild, — »auch eine andere Pflicht habe ich noch zu erfüllen, als nur die des Vergessens. Etwas Anderes nicht zu vergessen, das ist jetzt meine Pflicht. Eine unverzeihbare Schuld. Rache, Rache an denen, die mein erstes Glück vernichtet, die Unglück über Unglück über mich und über dich und über ein schuldloses Weib gehäuft haben! Rache, Rache!!
Was willst du, Vater? Willst du etwa davon sprechen, dass die Rache des Herrn sei? Nein, mein ist sie, mein!!! Ich kann vergessen, manche Schuld auch verzeihen, aber... ich muss als ganz, ganz kleines Kind in Indianerhände gefallen sein, ich habe noch an der Brust einer Indianerin gelegen...«
Die Lauscherin fürchtete, dass jetzt ihr Zähneklappern gehört werden möchte, sie zog sich zurück.
Wie Margot in den finsteren Hotelpark gekommen war, wusste sie nicht. Sie lehnte ihre Stirn an den Stamm einer Palme, musste sich daran festklammern, um nicht umzusinken.
»Alles, alles war vergeblich«, ächzte sie, »und seine Liebe zu diesem Mädchen ist durch nichts zu besiegen — umsonst war alles, alles...«
»Nichts war umsonst, du Närrin!!«, zischte da eine Stimme, und Margots Arm ward von einer Hand hart gepackt.
Zum Tode erschrocken wollte sich Margot losreißen, sie konnte es nicht.«
»Wer sind Sie?!«, stieß sie hervor.
»Still! Derselbe Mann, den Sie schon in New York gesprochen. O, Sie dachten wohl, wir hätten unser Ziel schon aufgegeben? Hahaha, wenn Sie wüssten, wer wir sind und über was für Machtmittel wir verfügen!«
»Wenn Sie gehört hätten, was ich soeben gehört habe...«
»Ich weiß es, auch wenn ich es nicht mit eigenen Ohren gehört habe. Ich kenne doch diesen Narren von Texas Jack mit seinem Kinderherzen! Hahaha! Nein, gerade jetzt stehen unsere Chancen günstiger denn je, und Sie sollen dennoch den Lohn für Ihre uns geleistete Hilfe bekommen...«
»Ich soll...«, fuhr das Weib empor, wohl ihren Ohren nicht trauend.
»Doch noch diesen Texas Jack bekommen. Hören Sie, wie sich die Sache weiterentwickeln wird.«
Und der in der Stockdunkelheit gar nicht sichtbare Mann flüsterte noch lange.
Am anderen Morgen trafen wohlbehalten die fünf DahomeyWeiber ein, von den Einheimischen wie von den Fremden als Erscheinungen aus dem Jenseits angestaunt.
Jack hatte sie schon durch ausgeschickte Kundschafter erwarten lassen, sie wurden im Hotel untergebracht. Über ihre Zukunft zu reden, dazu war schon genug Zeit vorhanden gewesen. Drei von ihnen waren damals bei Buffalo Bills Truppe gewesen, sie wollten nach Amerika, um sich jenem wiederum anzuschließen. Auf seiner Insel wie auch auf seiner riesigen Farm ›Big Horn‹ im NebraskaTerritorium, wo er Pferdezucht treibt, in welchem Staate er auch Sitz in der Legislatur hat, also den Ehrennamen ›Honorable‹ führt, hält er ja das ganze tote wie lebendige Material für seine Schaureisen immer beisammen.
Dorthin also wollten sich alle fünf Frauen begeben, Jack würde für ihr Weiterkommen sorgen.
Ferner konnte er seinem Schwiegervater eine fröhliche Mitteilung machen. Seine Nachtmär hatte sich schnellstens wieder erholt, noch heute konnte die Reise nach Kabel el Tor angetreten werden. Hierbei setzte er allerdings voraus, dass dann Evangeline zurückblieb, unter dem Schutze Margots, der er vollkommen vertraute.
Von solch einer Trennung wollte aber das Kind durchaus nichts wissen, es wurde ganz unglücklich, als es so etwas hörte, es versicherte, vollständig gesund zu sein, Eva zeigte, wie sie im Zimmer herumspringen konnte — — und Jack war es ja nur umso lieber, wenn er sie mitnehmen konnte. Er hatte noch niemals davon gesprochen, wie leicht dieses hellsehende Kind einmal entführt werden konnte. Es war gar nicht nötig, dass der Plan hierzu von seinen geheimnisvollen Feinden ausging — aber gedacht daran hatte er oft genug.
Um nach Kabel el Tor zu gelangen, gab es keinen anderen Weg, als erst nach Kairo zu fahren, von dort weiter mit der Eisenbahn nach Suez, von dort per Dampfer. Auf der Karte sieht das freilich einfach genug aus. Man brauchte ja nur die kurze Strecke durch die Wüste zurückzulegen und dann über das Rote Meer zu setzen, nur ein ganz schmaler Wasserstreifen. In Wirklichkeit sieht aber eben alles ganz anders aus. Die Wüstenwanderung hätte schon so lange gedauert wie die Fahrt nach Suez, und dort an der wüsten Küste gab es auch nicht ein einziges Fischerdorf, wo sie ein Boot bekommen konnten, und außerdem hat es doch etwas auf sich, das Rote Meer mit einem Boote überfahren zu wollen.
Mit dem nächsten Zuge wurde die Reise angetreten, und zwei Tage später sehen wir unseren Helden dasselbe Manöver wiederholen, welches er schon bei Port José ausgeführt: Er sprang mit seinem Pferde vom Deck des ganz langsam fahrenden Schiffes in die Fluten hinab, hier aber stieß gleichzeitig ein ausgesetztes Boot ab, in dem sich schon außer den vier anderen Hauptpersonen unserer Erzählung, zu denen doch auch Klaus gehörte, Mr. Snob und sein Diener befanden, die ziemlich viel Gepäck mitgenommen hatten.
Gerudert wurde das Boot von vier Matrosen, welche man schon für diesen Zweck und auch sonst als Diener in Suez angeworben hatte.
Wir wollen nicht noch einmal schildern, was für eine Sensation das unter den Passagieren hervorrief, als Texas Jack mit seinem Pferde ins Meer hineinsprang, und zwar wiederum mit einer Lanze, um sich der Haifische zu erwehren, die im Roten Meere ja ganz besonders gut gedeihen — — wir wollen auch nicht die Angst seiner Begleiter schildern, die neben dem schwimmenden Pferde im Boote ruderten, nicht den Enthusiasmus Mr. Bobsnobs.
Das Wagnis gelang wiederum. Jack versicherte, während er mit seinem Spieß um sich stach, dass es überhaupt gar kein Wagnis sei. Nur etwas aufpassen müsse man, nichts weiter. Ein einmal angestochener Hai käme nicht wieder, und einmal müsste sich ihre Zahl doch erschöpfen, was auch wirklich der Fall war. Zuletzt war gar keine der Hyänen mehr vorhanden. Die Hauptsache sei, dass die ruhige See solch eine Schwimmtour überhaupt gestatte.
O, diese Szenerie an jener Küste der Halbinsel Sinai!!
Sie unterscheidet sich ja von anderen Küstengegenden, wo ein Küstengebirge bis ans Meer tritt, nicht viel. An der Nordküste Afrikas ist sie sogar vielleicht noch imposanter, weil hier das himmelhohe Gebirge direkt jäh ins Meer hinabfällt, und wie dieses hier nun brandet, wie es gewaschen hat, wie das in den Grotten schäumt!
Hier in der Gegend von Kabel el Tor und die ganze Küste entlang, so weit das Sinaigebirge reicht, kommt erst ein kilometerbreiter, ganz flacher Wüstenstreifen, dann erst steigt das Felsengebirge ganz steil in die Höhe, fast nicht anders, als wie sich ein Haus erhebt, aber nun ebenfalls bis in die Wolken hinein, und dann zerrissen, zerklüftet, oben wie eine bizarre Wolkenwand aussehend.
Aber nun die historischen Erinnerungen, welche sich mit diesem Gebirge verknüpfen! Diese sind es, welche den denkenden und fühlenden Menschen beim Anblick dieses Felsenberges überwältigen.
Dort oben im Norden sind die Juden durch das Rote Meer gezogen — eine historische Tatsache, von der alle alten Schriftsteller und Chronisten berichten, es muss sich um ein sonderbares Naturphänomen gehandelt haben, und vor allen Dingen wissen auch alle Chronisten zu erzählen, dass nachsetzende ägyptische Reiter, welche den Juden die gestohlenen Tempelgerätschaften wieder abnehmen wollten, von den zurückkehrenden Fluten verschlungen worden sind — dann sind die Juden südlich im Zickzack durch die Wüste gezogen, auch diese Küste entlang, dort durch jene Schlucht sind sie eingedrungen, und dort oben auf jenem Berge, den man allerdings von der Küste aus nicht sehen kann, der aber doch mit zu diesem Gebirge gehört, hat Moses den Juden und der ganzen christlichen Menschheit die zehn Gebote gegeben, die für unsere, die Welt beherrschende Religion grundlegend sind. Und wer das nicht glaubt, der versteht überhaupt nichts von der gewaltigen Bedeutung der christlichen Religion, und deshalb braucht man kein regelmäßiger Kirchengänger zu sein.
Die noch auf oder im Wasser Befindlichen erblickten eine Ansiedlung von weißen orientalischen Häusern, die sich an die Felswand schmiegten und sich auch etwas nach der Küste zu in die Wüste hineinzogen, aber nicht allzu weit. Hier und da zeigte sich eine Palme, das einzige Grüne. Von Zelten, welche sonst den ganzen Wüstenstreifen bedecken, war jetzt nichts zu sehen. In der Ferne blitzte es manchmal auf, Reiter tummelten in geschlossenen Reihen ihre Pferde, dazu ein kriegerischer Marsch — die türkischen Soldaten exerzierten, und zwar hätte man in der Nähe gesehen, dass sie recht gut exerzierten.
Darin ist das türkische Militär heute nicht mehr zu verachten, und als Soldat, als Krieger ist der Türke überhaupt niemals zu verachten gewesen, davon können doch auch wir Mitteleuropäer ein Liedchen singen.
Auch dicht am Ufer der Bucht standen einige kleine und große Gebäude, zwischen denen man Soldaten herumlungern sah. Bis hierher läuft auch längs der Küste die für die Quarantänestation unentbehrliche Telegrafenlinie, von Suez kommend. Jetzt sammelten sie sich, sie waren auf das Boot aufmerksam geworden, welches dem Ufer zustrebte. Schon konnte man erkennen, welches Staunen unter ihnen herrschte.
Das Boot hielt direkt auf die Küste zu, es konnte an einem kleinen Kai beilegen. Aber noch ehe dies geschehen war, löste sich von den Soldaten, die in Reih und Glied angetreten waren, ein einzelner ab, offenbar ein Offizier, in kleidsamer Uniform, durchaus nicht so ein ›dreckiger Türke‹, wie man ihn sich gewöhnlich vorstellt, er machte einen ganz schneidigen Eindruck, hatte sogar einen Klemmer auf der Nase.
»Inschallah!«, rief er erstaunt. »Wer seid denn ihr?! Was wollt ihr denn hier?! Wisst ihr denn nicht, was für eine Küste das ist? Das ist Kabel el Tor! Hier darf niemand landen!«
Jetzt aber hatte das Boot schon die Landungsmauer berührt, und mit einer Leichtfüßigkeit und Elastizität, die man dem dreizentnerigen Riesen nimmermehr zugetraut hätte, war Mr. Snob schon an Land gesprungen.
Dem Offizier, der die Strandwache hatte, war so etwas noch gar nicht passiert, er schien es gar nicht begreifen zu können, bis er endlich wieder Worte fand.
»Beim Barte des Propheten, solch eine Unverschämtheit...«
Er gab ein Kommando. Im Eilschrift rückten drei Dutzend Soldaten vor. Der Offizier selbst ging mit ausgestreckter Hand auf Mr. Snob zu, setzte ihm diese vor die Brust, oder vielmehr auf den Bauch, höher langte der Mann, obgleich er eine ganz normale Größe hatte, nicht hinauf, wollte ihn zurückdrängen, ihn gleich von der Mauer herab wieder ins Wasser werfen.
Da erfolgte eine stumme Pantomime. Zurückdrängen ließ sich der Riese nun freilich überhaupt nicht, und während der Offizier noch die Hand auf seinen Bauch gelegt hatte, hob er das rechte Knie, setzte seinen gelben Schnürstiefel jenem gegen den Leib, streckte das Bein... und der Offizier machte einen Purzelbaum durch die Luft und lag in guter Entfernung im Sande.

Aber, wohlverstanden, es war nicht eigentlich ein Fußtritt gewesen! Das war alles so ganz langsam, ganz gemütlich vor sich gegangen. Deshalb haben wir es auch eine stumme Pantomime genannt, welchen Ausdruck man doch sonst bei einem Fußtritt nicht gebrauchen kann.
Mit einem Wutschrei sprang der Offizier, der nur seinen Kneifer verloren hatte, wieder auf. Ein Kommando. Die Soldaten rückten im Eilschritt und gleichfalls unter einem Wutgeheul vor... da übertönte Mr. Snobs durchdringende Stimme den ganzen Lärm, und zwar bediente er sich einer Sprache, welche Jack nicht verstand, es war weder Türkisch noch Arabisch, nur wenige Worte, aber sie machten auf den Offizier einen furchtbaren Eindruck.
»O, Chawaike, warum hast du das nicht gleich gesagt, dass ich dein Diener bin?«
Dann wieder ein Kommando, und die Soldaten, plötzlich wie die Statuen stehend, kehrten gleichmäßig ihre Gewehre um, den Lauf senkend — sie präsentierten nach englischer Weise — dazu ein langanhaltender Trommelwirbel, und auch die in dem Wachthaus zurückgebliebenen Soldaten traten unters Gewehr.
»Na, habe ich's nicht gesagt?«, wandte sich der kindliche Riese an Jack, der soeben aus dem Wasser gekommen war und zur eventuellen Verteidigung neben seinem Freunde hielt. »So wollen diese türkischen Lumpen behandelt sein — auch die Offiziere — und wenn sie sogar Kneifer tragen.«
»Sie haben einen Ferman des Sultans«, sagte Jack, »anders ist es nicht möglich.«
»Jetzt haben Sie's erraten.«
Ferman ist ein Befehl des Sultans, oder auch ein Pass, im Namen des Sultans selbst ausgestellt. Es gibt ganz verschiedene Grade solcher Fermane, vom gewöhnlichen Reisepass an, mit dem es in der Türkei sehr genau genommen wird, bis zur Vollmacht, die den Besitzer des Fermans als Stellvertreter des Sultans legitimiert, ja, ihn zu diesem selbst macht.
Der Inhaber eines gewöhnlichen Fermans, eines Passes, darf natürlich einen türkischen Offizier noch lange nicht in den Bauch treten, eine Erklärung war das also noch nicht. Dieser Mr. Snob musste eine kolossale Vollmacht besitzen.
»Sie brauchen den Ferman gar nicht vorzuzeigen?«
»Eigentlich müsste ich es tun, aber der Offizier fordert es nicht.«
»Warum fordert er es nicht?«
»Weil er es nicht wagt. Wer einen türkischen Offizier vor der Front seiner Soldaten in den Bauch tritt, muss doch unbedingt einen Promoferman besitzen, eine absolute Vollmacht des Sultans.«
»Dann könnte aber doch schließlich jeder so auftreten.«
»Ja, probieren Sie's nur einmal!«
Nun, Texas Jack hätte etwas Ähnliches vielleicht dennoch fertiggebracht. Sein Wagestückchen mit der Speisekarte war noch etwas ganz Anderes gewesen.
Unterdessen hatten auch die Anderen das Land betreten, und Mr. Snob wandte sich an den stramm dastehenden Offizier, der bei jeder neuen Anrede salutierte.
»Ist Brunum Ogli Pascha in seiner Residenz?«
»Zu Befehl, Chawaike.«
»Er ist wohl erst vor Kurzem von einer Reise zurückgekehrt?«
»Er hat eine Fahrt nach Sansibar gemacht.«
»Wann ist er zurückgekommen?«
»Vor drei — vor vier Tagen.«
»Wo befindet sich denn die Kriegsjacht, die er benutzt hat?«
In der Bucht lag nämlich auch nicht ein einziges Boot.
»Die ist mit Orders nach Konstantinopel gegangen.«
»Hat Ogli Pascha von seiner Reise nicht eine neue Sklavin für seinen Harem mitgebracht?«
Der Offizier zögerte mit der Antwort. Er wurde da etwas gefragt, was er eigentlich gar nicht wissen durfte. Aber diesem Manne, der ihn so in den Bauch getreten hatte, wagte er sich nicht zu widersetzen.
»Er hat drei Weiber mitgebracht.«
»Darunter auch eine weiße Frau, nicht wahr?«
»Es war Nacht, als sie ausgeschifft wurden, und sie waren tief verschleiert.«
»Na nun heraus mit der Sprache, du Hundesohn!!«, fuhr ihn da die helle Kinderstimme an. »Es ist ganz selbstverständlich, dass ihr Sandhüpfer über so etwas sprecht, was habt ihr denn Anderes zu tun!«
»Ja, es war ein weißes Mädchen dabei.«
»Gut! Melde mich dem Pascha an! Mr. Bobsnob, seinen alten Freund!«
Der Offizier eilte selbst davon, die anderen folgten etwas langsamer nach, nur die vier Matrosen blieben zurück.
Es lässt sich denken, von was für Gefühlen die Nachfolgenden beherrscht wurden, etwa mit Ausnahme Mr. Snobs und seines Dieners. Selbst der phlegmatische Klaus fühlte die Bedeutung der kommenden nächsten Minuten, war ganz aus dem Häuschen. Nicht minder erregt war Evangeline, am allermeisten aber wohl Margot, so sehr sie auch rang, dies zu verbergen.
Es wurde nur gesagt, dass sie langsamer folgten, weil nämlich der Offizier, den Säbel in die Hand nehmend, gleich einen Dauerlauf angeschlagen hatte. Sonst war auch des dicken Mijnheers van Hydens Gang über die Wüstenstreifen schon mehr ein Rennen, und dennoch blieb er manchmal wie unentschlossen stehen und trocknete sich die Schweißtropfen von der Stirn.
»O, Jack, Jack, jetzt kommt es — jetzt kommt es!!«
»Nun, ist das nicht ein glücklicher Moment?«
»Wenn du es sagst — ja — vorwärts!«
Sie waren alle so mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt, dass sie nicht viel davon gewahr wurden, wie es inmitten des Häuserviertels aussah.
Mr. Snob lenkte seine Schritte einem stattlichen Hause zu, arabisch gebaut, also außen keine Fenster, als Ausnahme aber auch außerhalb einen Garten besitzend, der sich bis an die Felswand erstreckte, der einzige in ganz Kabel el Tor, der einzige Fleck überhaupt, der Vegetation zeigte, und zwar eine außerordentlich üppige. Durch diesen Garten ging der Bach, der sich in einem Sturz von dem hohen Felsen herab ergießt und allein Kabel el Tor mit Wasser versorgt, es überhaupt erst für Menschen bewohnbar macht. Er füllt die Reservoirs, speist die bei allen Orientalen so beliebten Springbrunnen und verliert sich dann bald wieder im Sande. Die Erde zu diesem Garten musste von weither bezogen worden sein.
Die Ankommenden wurden von tief sich verneigenden Dienern empfangen und von ihnen durch einen düsteren Gang in den geräumigen Hof geleitet, nach dem alle Fenster des großen, viereckigen Hauses gingen und der selbst ein paradiesischer Garten mit Wasserkünsten aller Art war.
Hier kam ihnen und besonders dem vorausgehenden Mr. Snob ein alter, weißbärtigcr Mann entgegen, in kostbare, seidene Gewänder gehüllt, als Zeichen seiner Würde einen krummen Säbel umgeschnallt, dessen Scheide aus gediegenem Gold bestand und wie der Griff überreich mit Diamanten und anderen Edelsteinen besetzt war.
Mr. Snob hatte nicht zu viel behauptet. Der Greis, kein anderer als der Pascha selbst, überschüttete den dicken Riesen mit einer Fülle der blumenreichsten orientalischen Begrüßungsschmeicheleien, versicherte wieder und wieder, dass sein Haus nicht wert sei, von solch einem Besuche geehrt zu werden, und dabei komplimentierte er in einer Weise, dass es wirklich aussah, als wolle er jenem vor den Füßen kriechen.
»Na, glauben Sie nun, dass mich dieser Pascha schon etwas kennt?«, wandte sich Mr. Snob, der nur einen kurzen arabischen Gruß gehabt hatte, erst noch an seinen Begleiter.
»Ich, ich zweifle an nichts mehr, aber dass er Ihnen die Füße küsst oder gar die Stiefel ableckt, das, bitte, erlassen Sie ihm wohl.«
»Wenn Sie es wünschen, sonst aber...«
»Ich bitte darum.«
Zunächst wurden die Besucher, ohne dass sie vorgestellt waren, in ein zur ebenen Erde liegendes Zimmer komplimentiert, dessen glänzende Einrichtung dem bekannten Reichtum dieses Paschas entsprach, der die lebendigen wie die toten Pilger, die sich zwangsweise in seine Obhut begeben mussten, zu plündern verstand. Auf seinen Wink herbeieilende Diener brachten Wasserpfeifen und Tischchen mit Erfrischungen und Konfekt.
Mr. Snob aber ließ sich auf weiter keine orientalischen Förmlichkeiten ein, es genügte ihm, dass er als erster seine Bratwurstbeine auf einem goldgestickten Atlaskissen untergeschlagen hatte.
»Brunum Ogli Pascha«, begann er, als jener wie der andere Besuch noch stand, »du hast neulich, vor drei oder vier Tagen, in Kosseir eine weiße Sklavin gekauft.«
Der Pascha musste ja schon von dem Offizier über alles benachrichtigt worden sein, so machte diese Frage keinen besonderen Eindruck auf ihn, er war und blieb die Unterwürfigkeit selbst.
»Ich hoffe, hochedler Chawaike, der du die Sonne des Orientes bist, in dessen Schatten die Gläubigen wie die Ungläubigen...«
»Lass nun endlich deine Komplimente«, wurde er von der hellen Kinderstimme barsch unterbrochen. »Antworte kurz: Hast du neulich, als du mit deiner Jacht in Kosseir warst, eine weiße Sklavin gekauft?«
»Eju«, bejahte der Pascha jetzt gehorsam so kurz, wie es von ihm gefordert wurde.
»Hat sie dir ihren Namen genannt?«
»Ja.«
»Nun, wie heißt sie?«
»Maria.«
Die anderen hatten ja nicht mehr daran gezweifelt, dass sie sie hier finden würden, und doch war es natürlich, dass sie wiederum von der größten Erregung befallen wurden, von der diesmal auch nicht der sonst so stoische Jack frei blieb.
Jetzt, jetzt kam die Entscheidung, und nachdem die Jagd hinter der Entschwundenen durch vier Erdteile gegangen war — von Europa nach Amerika, durch ganz Afrika bis nach Asien — sollte hier eine so ganz einfache Lösung erfolgen.
So musste wenigstens geglaubt werden. Aber es sollte alles ganz, ganz anders kommen.
»Maria ist nur ein christlicher Vorname«, fuhr Mr. Snob fort. »Hat sie nicht noch einen anderen Namen genannt?«
»Ich glaube mich zu entsinnen.«
»Nun, welchen?«
»Maria de Fleury«, sprach der Pascha mit geläufiger Zunge aus.
Es machte auf van Hyden wie auf Johannes Dankwart einen furchtbar niederschmetternden Eindruck, als sie einen anderen Namen hörten als ihren eigenen. So hatte Maria demnach als ihren Familiennamen den des Mannes angegeben, dem sie gezwungen angetraut worden war.
»Hat sie denn nicht gesagt, dass sie eigentlich die Gattin...«
»Machen Sie es kurz, machen Sie es kurz!!«, stöhnten van Hyden und Jack gleichzeitig wie aus verwundeter Brust.
»Wohl denn — diese weiße Frau, welche du als deine Sklavin gekauft hast, ist die Tochter dieses alten und die Gattin dieses jungen Herrn. Du hast, wie ich schon erfahren habe, für sie dreihundert Pfund Sterling bezahlt, nicht wahr?«
»So ist es.«
»Gegen Zurückerstattung dieser Summe wirst du deine Sklavin wohl ohne Weiteres wieder herausgeben.«
Der Pascha, der sich noch immer nicht gesetzt hatte, wollte sich in Versicherungen erschöpfen, dass er diese weiße Frau ja niemals als seine Sklavin betrachtet habe, wenn er gewusst... Mr. Snob schnitt ihm das Wort ab und bedeutete ihm, diese Sklavin sofort zu holen.
»Wie du befiehlst, edler Chawaike, ich gehe selbst, um dir Fatime, wie sie hier genannt wurde, zuzuführen.«
Er entfernte sich. Die Zurückbleibenden wagten kein Wort zu wechseln. Nur Mr. Snobs Wasserpfeife, die er sich von einem Diener in Brand hatte setzen lassen, gurgelte.
»Jack, Jack«, brachte einmal van Hvden mit gepresster Stimme hervor, »sei gut zu ihr — ach, sei gut zu ihr!!«
»Darüber, denke ich, haben wir doch schon gesprochen«, entgegnete Jack.
»Ach, wie ich mich freue, sie endlich wieder an mein Herz drücken zu können!«, rief jetzt der Vater in ganz anderem Tone, mit unterdrücktem Jauchzen.
»Und ich mich nicht minder«, erklang es von Jacks Lippen ebenso herzlich.
Gedämpfte Schritte kamen. Schon breitete der Vater beide Arme aus — zunächst aber trat der Pascha allein wieder ein, und zwar mit einem unverkennbar bestürzten Gesicht.
»Fatime weigert sich, zu kommen.«
»Was Fatime!«, rief Mr. Snob sofort und ungeduldig. »Marie Dankwart wollen wir haben — die weiße Frau, die du neulich für dreihundert Pfund einer Karawane abgekauft hast.«
»Ja, ja — sie weigert sich, ihren Vater und ihren Gatten wiederzusehen.«
»Sie — weigert sich?!«, konnte van Hyden nur ächzen.
»Sie scheint sich zu schämen, sie ist ganz außer sich.«
Was der Vater und Jack hierbei dachten, wollen wir nicht schildern. Mr. Snob war mit jugendlicher Elastizität von seinem niedrigen Sitze aufgeschnellt. Er wusste sofort, was hier vorlag. Ein Grund zu einer gewissen Scham konnte ja auch wirklich vorhanden sein.
»Ach, Unsinn! So wollen wir selbst zu ihr, was braucht die sich zu schämen!«
Und schon streckte er die Hand aus, um die Portiere zurückzuschlagen, welche die Tür verschloss, durch die der Pascha aus- und eingegangen war.
Da aber vertrat ihm dieser schnell den Weg, wenn auch immer noch die Demütigkeit selbst.
»Hochedler Chawaike, wenn ich auch dein gehorsamer Diener bin, so wirst du doch deine Macht nicht missbrauchen!«
»Missbrauchen? Was soll das heißen?«
»Du kennst unsere mohammedanischen Hausgesetze.«
»Die kenne ich allerdings.«
»Dann wirst du dir nicht den Eintritt in einen Harem erzwingen wollen.«
»So bringe sie in einen anderen Raum — vorwärts, bringe sie hier herein — mit Gewalt, wenn es sein muss!!«
Der Pascha entfernte sich abermals. Die Diener hatten das Zimmer schon vorher verlassen. Die Zurückbleibenden blickten einander schweigend an, d. h. van Hyden und Jack. Schade, dass sie nicht daran dachten, einmal nach Margot zu sehen, die sich ganz in eine Ecke geschmiegt hatte. Ihr ganzer Gesichtsausdruck hätte sie sofort stutzig machen müssen. Eine furchtbare Angst prägte sich in ihren Mienen aus.
Da trat durch die zurückgeschlagene Portiere wieder der Pascha ein, und nach sich an der Hand zog er eine vermummte Frauengestalt.
Weder der Vater noch Jack wollten auf sie zueilen, schon deshalb nicht, weil diese Frauengestalt ebenso unbeweglich und halb abgewendet vor der Portiere stand.
Es war von ihr nichts weiter zu sehen als die Fingerspitzen der halb ausgestreckten, sonst von einem weiten Ärmel verborgenen Hand, und unter dem Kopftuch, welches das ganze Gesicht verhüllte, stahlen sich einige goldblonde Haarflechten hervor.
Wohl eine Minute verstrich in regungslosem Schweigen, und diese Minute hatte bei solch einer Situation eine kleine Ewigkeit zu bedeuten.
»Marie — Mariechen!«, kam es da in furchtbar gepresstem Ton aus van Hydens Brust.
Keine Antwort! Die weibliche Gestalt wendete sich nur noch mehr ab, wie schon wieder zur Flucht durch die Tür bereit.
»Meine Tochter!!«
»Ich bin es«, klang es dumpf hinter dem dichten Gesichtsschleier zurück, und dennoch hatten sie beide nur zu deutlich Mariechens Stimme erkannt.
»Was soll das?«, ächzte der Vater.
»Ich — kann nicht!«
»Was kannst du nicht?«
»Euch ins Auge schauen.«
»Mariechen, du bist doch ganz unschuldig!«
»Nein!«
Wie von einer Natter gestochen fuhr Jack empor, und nicht anders der Vater.
»Nicht?!«
»Nein — ich bin nicht — schuldlos.«
»Weshalb nicht?«
»Jack — Jack — erst muss dieser — Herr gehen«, kam es wieder stöhnend hinter dem Kopftuch hervor.
»Weshalb bist du nicht schuldlos?«, beharrte der Vater, der mit einen. Male eine ganz außerordentliche Energie zeigte.
»Weil ich — ihn liebe.«
»Wen, ihn?«
»Den Mann, dem ich — angetraut wurde — wenn auch unrechtmäßig, wie ich dann erfuhr — Monsieur Fleury... ach, mein Gustave, mein Gustave!!«, erklang es dann in herzzerreißendem Ton hinter dem Schleier, und sehnsüchtig breitete sie die Arme nach einem unsichtbaren Phantom aus.
Da brach der Vater plötzlich fast zusammen. Jack stand schon seit Langem wie eine Statue, im Gesicht aber kaum noch erkenntlich.
»Es ist das Haar und die Stimme meiner Tochter«, murmelte van Hyden dann. »Ja, sie ist es — und doch möchte ich fast glauben, dass sie es nicht ist.«
»Evangeline ist in Schlaf gefallen«, meldete da Klaus leise.
Um das Kind hatte sich bisher niemand gekümmert. Jetzt war Eva plötzlich mit geschlossenen Augen in die Kissen zurückgesunken. Ob das die Stunde war, die sie gestern für heute angemeldet hatte, wusste im Augenblick niemand zu sagen. Aber da sie ihren sonst leblosen Arm etwas bewegte, konnte es kein natürlicher Schlaf sein.
Bei diesem Anblick zuckte Jack aus seiner Erstarrung empor.
»Nur noch eine Prüfung, dann ist jede Täuschung ausgeschlossen«, murmelte er und begab sich mit schleppendem Gang hin zu dem Kinde.
»Miss Margot, die Locke, bitte.«
Die Gerufene näherte sich aus ihrer Ecke dem Lager des Kindes, immer noch mit solch einem ganz unbeschreiblichen Gesicht, in dem eine furchtbare Angst mit einem heimlichen Triumph kämpfte.
Sie hatte die Locke stets in Verwahrung gehabt, d. h. nur noch die halbe, seitdem Jack damals, als er sich von den anderen getrennt, zur Vorsicht die andere Hälfte mitgenommen hatte, was auf Margot einen so merkwürdigen Eindruck gemacht hatte.
So zog sie jetzt aus dem Busen die kleine, an einem Kettchen hängende Kapsel, entnahm ihr die Locke, Jack legte sie in Evas linkes, schon wieder warm gewordenes Händchen, schloss die Fingerchen darüber.
»Was siehst du, mein Kind?«
»Ich sehe... sie.«
»Mariechen?«
»,Ja — aber — sie hat das Gesicht verhüllt — ich sehe nur etwas von ihrem Haar.«
»Wo ist sie denn?«
Eva lächelte belustigt in ihrem halbwachen Schlafe.
»Du musst sie doch selbst sehen, sie steht doch gleich hier.«
Jack blickte nach der Verhüllten, und in diesem Moment hob sie die Hand, um mit den Fingerspitzen ihr unter dem Kopftuch hervorquellendes Haar zurückzustreichen.
»Was tut sie jetzt?«, fragte Jack schnell.
»Sie hebt die Hand, streicht das Haar zurück — jetzt zieht sie an ihrem Schleier — jetzt lässt sie die Hand wieder sinken.«
Es stimmt. Nun war, wie Jack gesagt, wirklich jede Täuschung ausgeschlossen. Eva lag nämlich so, dass sie Mariechen gar nicht sehen konnte, auch wenn sie die Augen offen gehabt hätte.
Aber immer noch nicht genug — jetzt zog Jack die andere, in seinem Besitz befindliche Hälfte der kleinen Haarflechte hervor, gab sie dem Kinde statt jener in die Hand.
»Wen siehst du, Eva?«
»Wie du nur so fragen kannst!«, lautete der verwunderte Bescheid des Kindes. »Das ist doch immer wieder Mariechen, die hier im Zimmer steht — jetzt fasst sie die Portiere an, sie will wohl gehen.«
So schien es. Während sich Jack mit einem ächzenden Stöhnen aufrichtete, trat Mijnheer van Hyden mit einem Schritt schnell auf seine Tochter zu, die sich schon zum Gehen gewandt hatte.
»Mariechen, wenn du meine Tochter bist — beim Andenken deiner Mutter beschwöre ich dich...«
Aber ihre abwehrende Handbewegung genügte, um ihm das Wort abzuschneiden.
»Lass mich, Vater!«, erklang es dumpf. »Nenne mich nicht mehr deine Tochter — ich bin für euch verloren — tot — lebt wohl auf Nimmerwiedersehn...«
Ein sporenklirrender Schritt ging durch das Zimmer. Es war Jack, der sich der Ausgangstür zuwendete.
»Komm, Vater«, stieß er rau hervor, »wir haben hier nichts mehr zu suchen — wir Narren sind umsonst durch die ganze Welt gejagt!«
So ohne Weiteres konnten sie ja nicht gehen, mussten doch wenigstens das schlafende Kind mitnehmen. Aber Jacks Verhalten war ganz der Situation entsprechend. Er hatte alle Hoffnung aufgegeben. Und so wandte sich auch van Hyden mit einem qualvollen Seufzer der Tür zu, um jenem zu folgen, der ihn noch immer Vater nannte.
Alle blickten den Davongehenden nach, und jetzt drückte Margots schönes Gesicht eitel Triumph, eine selige Freude aus. Auch Mariechen war noch vor der Portiere stehen geblieben, blickte jenen ebenfalls nach. Jack hatte die offene Tür erreicht. In dieser stockte sein Fuß, plötzlich richtete er mit einem Ruck seine tief gebeugt gewesene Gestalt hoch auf, er breitete beide Arme aus, aber dem anderen noch immer den Rücken wendend.
»Und es ist nicht wahr!!!«, schrie er plötzlich mit ganz unnatürlich gellender Stimme. »Das kann nicht Mariechen sein, die in meinen Armen gelegen — das ist ein Trug der Hölle — mit Teufelskünsten ist sie behext — und diesen Zauber will ich lösen...!«
Und da plötzlich, mitten im Satz machte er einen riesenhaften Sprung nach rückwärts, den wohl kein Panther fertiggebracht hätte, stand in demselben Moment vor der Vermummten und hatte ihr auch gleich das Kopftuch vom Gesicht gerissen.
Diese wie die nachfolgende Szene sind nicht zu beschreiben. Es kann nur versucht werden, sonst lässt sich so etwas nur theatralisch wiedergeben. Es geschah ja alles viel zu schnell, blitzähnlich, und so kam auch Effekt auf Effekt. Die Vermummte hatte sich gar nicht wehren können. Urplötzlich stand Jack vor ihr und hatte ihr auch schon den Schleier abgerissen. Sie schien es noch gar nicht zu fassen. Sie starrte den vor ihr Stehenden wie ein Gespenst an, ebenso starrte Jack sie an, und im ganzen Zimmer war ein allgemeines Starren.

Dann endlich fand Jack auch Worte.
»Das — ist — ja — gar nicht — Mariechen!!«
»Das — ist — ja — gar nicht — meine Tochter!!«, brachte der Vater in ganz demselben Tonfall hervor.
Nein, das war Mariechen nicht.
Wohl dasselbe goldblonde Haar und dieselben blauen Augen, dieselben weichen, hübschen Züge — im Kinn und in den Backen sogar dieselben Grübchen — — das war aber auch die einzige Ähnlichkeit zwischen Mariechen und dieser Person, sonst war es ein ganz, ganz anderes Gesicht.
Van Hyden und Jack hatten jene Worte in einem Tonfall gesagt, als ob sie es selbst noch nicht glauben könnten, statt Mariechens Gesicht hier ein anderes zu sehen, sie staunten noch immer.
»Nee aber, wie sich unser Mariechen verändert hat!!«, musste sich da auch noch Klaus vernehmen lassen.
Da erst erkannte das Weib, was eigentlich geschehen war. Mit einem gellenden Schrei schlug es die Hände vors Gesicht und wollte durch die Portiere entfliehen. Aber mit blitzschnellem Griff hatte Jack sie gepackt, riss sie ins Zinnner zurück. Sie wollte sich befreien, doch eigentlich, ohne dass sie gegen Jack Gewalt anwendete. Ihr Gesicht mit den Händen zu bedecken und durch die Tür zu entfliehen, das war ihr einziges Streben, und dennoch kam es dabei zwischen den beiden zu einem förmlichen Ringkampf. Sie gebärdete sich wie eine Wahnsinnige, wie eine Tobsüchtige, dabei immer ein schrilles Zetergeschrei ausstoßend, das gar nichts Menschliches mehr an sich hatte.
Und dieses entsetzliche Schrillen fand noch von anderer Seite ein Echo. Margot stieß, aus ihrer ersten Erstarrung erwachend, einen ebensolchen langen, schrillen Schrei aus, und so war sie zur Tür hinaus gerannt. Aber davon hatte niemand etwas gemerkt, alle starrten ja nur nach dem Kampf, und zwar mit entsetzten Blicken, denn es sah wirklich fürchterlich aus, wie Jack mit dem Weibe kämpfte, dass alle die seidenen Gewänder in Fetzen gingen.
Lange freilich konnte das Ringen zwischen den beiden nicht währen, mochte das Weib in seiner Tobsucht auch mit Riesenkräften ausgestattet sein. Aber mit einfachem Festhalten oder nur mit sanfter Gewalt war da gar nichts zu machen. Jack bekam sie gar nicht zu packen, sie drehte sich wie ein Aal, ihm immer nur seidene Fetzen in den Händen lassend. Endlich aber hatte er sie doch richtig zu fassen bekommen, und dennoch konnte er gar nicht anders, er schleuderte sie mit Wucht auf den Boden, der zum Glück mit einem dicken Teppich bedeckt war. Und sie blieb nicht liegen, sie sprang wie ein Gummiball wieder auf, um nach der Tür zu fliehen, doch schon hatte Jack sie wieder gepackt, schleuderte sie abermals zu Boden, und diesmal sorgte er dafür, dass sie nicht wieder aufschnellen konnte, was wirklich etwas Hexenartiges an sich hatte. Er warf sich über sie, setzte ihr das Knie auf die Brust und drückte sie nieder, und schon hatte er einige Riemen zwischen den Zähnen — in der nächsten Minute war sie an Händen und Füßen gebunden!
Keuchend richtete sich Jack wieder auf. Später erklärte er selbst, das Bändigen dieses Weibes habe ihn mehr angestrengt, als da er einmal seinen stärksten Gegner, einen riesenhaften Indianer, im Ringkampf besiegen musste. Freilich kam hier auch noch die seelische Anstrengung hinzu.
Wimmernd lag die Unbekannte da. Es waren schreckliche Töne, die sie unausgesetzt ausstieß. Als würde sie von furchtbaren Schmerzen gemartert. Wie etwa ein zum Tode verbrühter Mensch fortwährend wimmernde Laute hören lässt. So war auch ihr ganzes Gesicht verzerrt und vor dem Munde stand Schaum.
Die anderen waren noch immer ganz starr vor Staunen oder mehr noch vor Entsetzen. Es war eben eine geradezu scheußliche Szene gewesen. Auch Mr. Snob, der noch beweisen sollte, was für ein eiserner Mann er war, führte ganz automatisch noch immer den Schlauch der Wasserpfeife an den Mund.
Von Eva sei nur noch erwähnt, dass ihr Hellschlaf in einen natürlichen übergegangen war, in dem sie durch nichts gestört werden konnte.
»Wie bist du zu diesem Weibe gekommen?«, wandte sich jetzt Jack an den Pascha, der nicht minder fassungslos dastand.
»Ich — ich — habe sie in Kosseir gekauft...«
»Von einer Karawane, die aus dem Inneren Afrikas kam?«
»Ja — ja — ich weiß es nicht anders...«
»Gnade, Erbarmen!«, erklang es da winselnd, »Ich will ja alles gestehen — nur schont mich — ach, was ich schon alles euretwegen durchmachen musste!«
Das Aussehen des gefesselten Weibes hatte sich geändert, ihr Gesicht war wieder normal geworden, das grässliche Wimmern hatte nachgelassen, dafür brach sie jetzt in ein krampfhaftes Weinen aus.
Jack tat wohl das Richtigste, wenn er nicht erst den Pascha lange fragte, sondern sich ausschließlich mit der Unbekannten beschäftigte.
Es gelang ihm, sie zu beruhigen, bis sie, von ihren Banden befreit, ein ausführliches Geständnis ablegte. Das geschah freilich nicht so zusammenhängend, wie wir es hier wiedergeben. Fortwährend bejammerte sie dazwischen ihr eigenes Schicksal und verwünschte die, welche an all ihrem Unglück schuld waren.
Sie hieß Lydia Thorbeck, war eine geborene Holländerin, aber mit ihren Eltern, ein Schauspielerpaar, früh nach Amerika gekommen. Auch sie war Schauspielerin geworden und bis zuletzt gewesen. Nichts Bedeutendes. Die Truppe, die beständig durch die nordamerikanischen Staaten reiste, in den kleinsten Städten und selbst in Ansiedlungen gastierend, welche nur aus Zelten bestanden, würde man in Deutschland eine ›Schmiere‹ nennen. In Amerika verdienen solche Truppen, deren Mitglieder wegen ihrer weiten Wanderungen selbst durch Wildnisse halbe Waldläufer sein müssen, allerdings ganz anderes Geld, da wird an der Kasse oft genug mit Waschgold bezahlt, ein Cowboy gibt als Eintrittgeld seinen silbernen Sporn, und im Chambre séparée lässt ein zerlumpter Kerl den Champagner in Strömen fließen, und er kann auch so spendabel sein, denn die vielen Goldstücke, mit denen er um sich wirft, haben ihm nur einen Schuss gekostet, und ehe er an den Galgen kommt, muss doch die Beute durchgebracht sein.
Das schließt nicht aus, dass solche Truppen auch einmal in großen Städten auftreten, die sie von Zeit zu Zeit aufsuchen müssen, um sich neu zu equipieren, und sie wollen doch auch einmal ein wirkliches Leben genießen.
So gastierte diese Truppe vor einem halben Jahre auch einmal in New York, in einer verrufenen Vorstadt, in einer Spelunke. Solche Lokale werden mit Absicht gemietet. In einem besseren Hause könnte man den anderen Theatern keine Konkurrenz machen. Man reflektiert auf ganz besondere Theaterbesucher, auf Rowdies, welche die Schauspieler mit Geld bewerfen, dessen Ursprung sehr dunkel ist — nicht minder aber auch auf bessere und allerbeste ›Gentlemen‹, die sich einmal austoben wollen. Denn da geht es nicht nur hinter den Kulissen, sondern gleich auf offener Bühne hahnebüchen zu, und eben wegen der eleganten Zuschauer kann die Polizei gar nicht einschreiten.
Miss Thorbeck mit dem biblischen Vornamen Lydia machte im Laufe der Erzählung gar kein Hehl daraus, welchen Lebenswandel sie geführt hatte. Ihre Glanznummern waren Entkleidungsszenen gewesen. Bei jenem Gastspiel in New York nun war sie eines Nachts nach der Vorstellung von zwei Gentlemen zum Souper eingeladen worden. Der eine hatte sich schon damals Gustave de Fleury genannt.
»Und wie hieß der andere?«
»Fleury nannte ihn Sabade oder auch George, aber ganz selbstverständlich waren das falsche Namen.«
»Woher wissen Sie das?«
»Es waren wirklich feine Gentlemen, und es ist doch ganz selbstverständlich, dass die sich bei solchen Abenteuern falsche Namen zulegen.«
»Haben sie sich nicht einmal mit anderen Namen angeredet?«
»Niemals, und ich passte sehr wohl auf, denn — denn...«
»Denn da wird versucht, aus solchen Bekanntschaften Vorteil zu ziehen, es geht bis zur Erpressung, nicht wahr?«
Die Schauspielerin gab es ganz freimütig zu.
»Nun fahren Sie fort.«
Die beiden Gentlemen rückten nach und nach heraus, dass dieses Souper im Chambre séparée einen ganz anderen Zweck habe als den gewöhnlichen. Ob die talentvolle Bühnenkünstlerin bereit sei, einmal nicht nur auf der Bühne, sondern im wirklichen Leben die Rolle einer anderen Person zu spielen, der sie außerordentlich ähnlich sehe, und ein wunderbarer Zufall sei, dass sie selbst noch dazu eine Holländerin wäre, Holländisch sprechen könnte.
Lydia Thorbeck wusste lange nicht, was die beiden eigentlich von ihr wollten. Höchstens, dachte sie, es handle sich um irgendeine unsaubere Geschichte, sie solle die Rolle einer Frau spielen, von der der Mann geschieden sein wolle, oder etwas Ähnliches.
Doch sie sagte ohne Weiteres zu, nachdem ihr ein bestimmter Schmuck, ein neues Kostüm. ein neuer Hut und Anderes versprochen worden war. Im Übrigen waren die Herren etwas knauserig, was sich später ändern sollte. An barem Gelde ließen sie sich vorläufig nicht mehr als zwanzig Dollar herauslocken.
»Kommen Sie nur erst mit, dann sollen Sie schon mit uns zufrieden sein.«
Gut, Lydia war bereit, sofort mitzugehen. Wenn sie aber längere Zeit fortbleiben sollte, dann musste erst der Kontrakt gelöst werden, das koste hundert Dollar. Jawohl, Mr. Fleury gab dem Direktor eine Hundertdollarnote.
Mit einiger Garderobe versehen, folgte die Schauspielerin den beiden Herren auf die Straße. Dort fuhr ein Wagen hin und her, alle drei stiegen ein. Etwas anders aber wurde der Abenteuerlustigen doch zumute, als ihr sofort eine Kappe über den Kopf gestreift wurde.
»Sie dürfen nicht wissen, wohin wir fahren. Doch haben Sie keine Angst, es geschieht Ihnen nichts, fügen Sie sich in alles, und Sie erhalten in einigen Tagen 10 000 Dollar.«
Die Hoffnung auf die 10 000 Dollar besiegte alle Furcht. Es war ja eine Schauspielerin aus dem wilden Westen.
Als ihr die Kappe abgenommen wurde, befand sie sich in einem komfortablen Hause. Später erfuhr sie auch, in welchem: Regalia Street Nummer 13. Aber wer der Besitzer war, das wusste sie heute noch nicht. Während ihres mehrtägigen Aufenthaltes durfte sie es mit keinem Schritt verlassen. Die Diener waren ihr gegenüber stumm. Ja, Mr. Gustave de Fleury nannte sich der Bewohner.
Noch in derselben Nacht setzte er ihr alles auseinander. Man habe in Holland eine Dame entführt, die hier gefangengehalten würde und auch gefangen bleiben musste. Ihre Anverwandten, darunter auch der Gatte, der bekannte Texas Jack, setzten natürlich Himmel und Hölle in Bewegung, wenigstens zu erfahren, ob die Verschwundene überhaupt noch am Leben sei. Das sei ihnen denn auch gelungen, indem sie die wunderbare Hellsehergabe eines Kindes benutzten, das sie in Schottland entdeckt hätten. Durch dieses Kind könnten sie die Entführte immer beobachten und alles das, was diese selbst erblickte.
Nun sollte folgendes arrangiert werden: Das Kind fiel nur zu ganz bestimmten Zeiten in Trance. Diese Zeiten sagte es schon auf Monate im Voraus an. Diese bestimmten Zeiten, wann Eva in hellsehenden Zustand kam, waren auch jenen in New York bekannt...
Hier müssen wir doch erst einmal abbrechen.
Es lässt sich denken, wie Jack und van Hyden zumute war, als ihnen jetzt dieses Weib beichtete. Schildern lässt sich die Verfassung gar nicht, in der sie sich befanden.
Jack hatte möglichst wenig unterbrochen. Jetzt konnte er sich einmal nicht mehr halten.
»Sie wussten es, sie wussten es!«, rief er. »O, mein Gott, mein Gott, welch ein fürchterliches Spiel hat man mit uns getrieben! Aber woher konnten sie denn diese Zeitangaben erfahren haben?!«
»Sie sind verraten worden!«
»Ja, aber durch wen denn?!«
»Sie hatten doch in London für das kranke Kind eine Pflegerin engagiert.«
»Maaargot!«, ächzte Papa van Hyden und schlug die Hände über dem Kopfe zusammen.
Sein Schwiegersohn aber, der hünenhafte Mann, schien plötzlich von aller Kraft verlassen zu werden. Er warf einen Blick nach jener Ecke, in der Margot vorhin immer gestanden hatte, und dann sank er, als trügen ihn die Füße nicht mehr, auf ein Kissen nieder.
»Margot!«, stöhnte auch er. »Margot eine Verräterin!«
»Ja, diese Pflegerin war dazu engagiert, alles nach New York zu depeschieren, was uns wissenswert sein musste«, bestätigte die Schauspielerin. »Und dann musste sie die Locken vertauschen.«
Jack hatte es trotz seiner großen Erregung gehört, und mit einem Male war er wieder ganz kalt.
»Die Locken vertauschen!«, wiederholte er. »Also das war eine Flechte von Ihrem Haar, welche die Pflegerin mit der von meiner Frau vertauschen musste?«
»Selbstverständlich«, entgegnete die Schauspielerin mit ungenierter Offenheit, und sie hatte schließlich auch ganz recht.
»Und das waren dann Sie, die sich mit jenem Mr. Fleury trauen ließ?«
»Ja, aber das war nur eine Scheintrauung.«
»O, das glaube ich schon!«, konnte Jack sogar noch lächeln, freilich sehr bitter. »War das der erste Fall, wo Sie sich für meine Frau ausgeben mussten?«
»O nein, da waren schon viele Sitzungen, wie wir sie immer nannten, vorausgegangen!«
»Welche war da die erste? Können Sie sich noch entsinnen?«
»O, gewiss!«, meinte die Schauspielerin, und das Frauenzimmer, das sich langsam erholt hatte, schien jetzt auf seine ›Kunst‹ ordentlich stolz zu werden. »Ich musste vorher einige Tage das Benehmen der Dame studieren, um alle ihre Bewegungen genau nachahmen zu können — bei meinem Talent eine Kleinigkeit — besonders musste ich sie beobachten, wenn sie die kleine Lebensblume anhauchte, was sie des Tages mehrmals tat. Ist es denn wirklich wahr, dass der Mann, an den man dabei denkt, noch lebt, wenn sie aufblüht?«
Diese Frage einer weiblichen Neugier fand jetzt keine Beantwortung.
»Und sie blühte in ihrer Hand immer auf?«, fragte Jack.
»In der Hand der Mrs. Dankwart? Immer!«
»Und als die Blume versagte, das waren Sie.«
»Natürlich, da hatte ich einfach eine alte Erbse bekommen.«
Sie hatte dieselbe noch bei sich, in einem winzigen Futteral, also einfach eine vertrocknete Erbse, an der sich noch ein Stielchen befand. Näheres hatte das hellsehende Kind ja nicht unterscheiden können.
»O, dieses Raffinement, diese Teufelslist!«, stöhnte van Hyden.
Jack aber machte mit einem Male ein recht glückliches Gesicht.
»Da ging aber doch erst die Szene voraus, wie meiner Frau das Zeitungsblatt mit meinem Tode in einem verrufenen Lokale gezeigt wurde.«
»Gewiss, hiermit wurde diese Szene eingeleitet.«
»Meiner Frau wurde dieses Blatt nicht gezeigt?«
»Ganz im Gegenteil.«
»Wieso ganz im Gegenteil?«
»Der hat man gerade immer gesagt, sie solle nur in guter Hoffnung sein, sie würde mit ihrem Gatten, mit Ihnen, bald wieder vereinigt werden.«
Zunächst drängte sich dem so schwer geprüften Manne eine andere Frage auf, ehe er hierüber weiter forschte.
»Und wie die beiden auf dem Sofa fassen, die Liebesszene, die immer pikanter wurde...«
»Das war ebenfalls ich«, gestand die Schauspielerin und versuchte errötend zur Seite zu blicken. Der verschämte Seitenblick gelang ihr, nicht aber das Erröten — so weit hatte sie es in der ›Kunst‹ trotz allen Talentes denn doch noch nicht gebracht.
Und auch Jack hatte einen Blick — aber einen verklärten... nämlich zum Himmel empor.
»So ist sie überhaupt nie tätlich beleidigt worden?«
»O nein, die wurde nur mit Handschuhen angegriffen.«
»Vater!«
»Mein Jack!«
Die beiden hatten sich verstanden. Es waren Rufe des Jubels gewesen.
»Ja, weshalb aber ist sie dann überhaupt entführt worden?«
»Das weiß ich auch nicht. Das blieb das Geheimnis jenes Herrn, der sich Fleury nannte. Nur einmal machte er eine Andeutung.«
»Was für eine?«
»Als ich ihn scherzhaft fragte, warum er denn die Scheintrauung nicht lieber mit der hübschen Frau vollziehen lasse anstatt mit mir.«
»Und da sagte er?«
»O nein, diese Dame sei ein gar kostbares Objekt, der dürfe kein Haar gekrümmt werden, der dürfe man mit keinem unrechten Worte nahen, damit man sich dann womöglich auch mit ihrem Gatten, also mit Ihnen, wieder aussöhnen könne.«
»Ja, aber wozu denn erst die Entführung in der Wachsfigurenkiste?«, fragte van Hyden nochmals.
»Ich glaube, da fragen Sie lieber die falsche barmherzige Schwester, die weiß wahrscheinlich mehr als ich.«
Da zuckte Jack zusammen, er blickte sich im Zimmer um.
»Wo ist Margot?«, fragte er mit plötzlich unheilvoll sprühenden Augen.
Niemand hatte gemerkt, wie jene unter einem schrillen Schreien vorhin aus dem Zimmer gerannt war, niemand konnte also eine Auskunft geben. Margot war eben nicht zu sehen.
»Wo mag das Weib sein, Pascha?«, fragte Mr. Snob diesen.
Der wusste ebenfalls nichts. Er rief Diener herbei, und einige hatten gesehen, wie sie aus dem Zimmer gestürzt war, durch den Hof und zum Hause hinaus, dort in die Schlucht hinein, welche in das Gebirge führte, immer schrill schreiend.
»Wie eine Lokomotive«, setzte einer der Araber noch hinzu, stolz darauf, dass er schon eine Lokomotive gesehen und pfeifen hören hatte.
Weshalb sie so sinnlos geflohen war, das war ja nur allzu klar. Gefolgt war ihr niemand, dazu hätten die arabischen Diener erst einen Befehl bekommen müssen.
Jack eilte hinaus. Er sah im Sande die Spur ihres kleinen Fußes, verfolgte sie bis an die Schlucht, in der es fürchterlich wild aussah. Die Spur führte noch weiter.
Hier aber besann er sich. Er hatte erst noch mehr zu erfahren, das war ihm denn doch wichtiger. So rief er die nächsten Diener, befahl ihnen, die Spur zu verfolgen — weit konnte Margot ja noch nicht sein, und die Flüchtige zurückzubringen, wenn es sein musste, mit Gewalt. Dann kehrte er zurück.
»O, so ein Weib! Wer hätte der das zugetraut!«, rief van Hyden.
»Ja, ich auch nicht«, meinte Jack, schon wieder ganz gelassen.
»Also verderben wollte sie uns!«
»Uns verderben? Ach, nee«, ließ sich da Klaus vernehmen.
»Was sagst du?«
»Uns nicht. Jetzt aber weiß ich alles.«
»Was weißt du?«, fragte Mijnheer fast bestürzt, als er seinen Diener plötzlich so reden hörte. Wurde der Kerl auch noch geistreich!
»Nu, die hat doch den Mr. Dankwart geliebt.«
»Was, mich geliebt?«, fuhr Jack förmlich entsetzt herum.
»Nu ja, die hat doch egal Ihre Haare abgeknutscht.«
»Meine Haare abgeknutscht?«, wiederholte Jack verständnislos.
»Ihre Locke, die sie Ihnen damals abschnitt, die hat sie doch egal beim Wickel gehabt und hat sie abgeknutscht.«
»Wie hat sie denn das gemacht?«, fragte Mr. Snob trocken.«
»Nu, geküsst hat sie sie — ich habe sie oft genug dabei belauscht — ganz heimlich — und dann hat sie gestöhnt, auch einmal im Schlafe.«
»Gestöhnt hat sie?«
»Na und wie — und gequiekt — wie so'n Ferkel, wenn's angestochen wird — oder eben wie so'n Fraunzimmer, wenn's verliebt ist und wenn's von ihrem Mannsen träumen tut. Uiiii, hat se gemacht — mein Texas Jack, mein lieber Jack, aaah, uuuhhh uuiii uuuiii, hat se gemacht — aaah, pft pft pft uuniiiii, hat se gemacht...«
Klaus schien gar nicht wieder aufhören zu wollen mit seinem Stöhnen und Quieken. Das pft pft pft sollten wohl Küsse bedeuten.
»Gewiss! Diese Miss Margot Linley war in Mr. Dankwart verliebt, rasend verliebt«, bestätigte da auch noch die Schauspielerin, »und das war ja auch der Preis für ihre Verräterei — oder sie musste sich diesen durch eigene Kraft erringen — sie sollte also dafür sorgen, dass Mr. Dankwart glauben musste, seine Gattin sei für ihn verloren. — Das erreichte sie zunächst durch den geschickten Austausch der Locken — die Rolle von Mrs. Dankwart spielte ich, und ich glaube, ich habe meine Sache gut gemacht — sonst musste sie ihn selbst durch ihre Liebe zu fesseln suchen.«
Jack war bei dieser offenen Erklärung ganz erstarrt. Mijnheer von Hyden aber fuhr, einem Einfalle nachgebend, wütend seinen Diener an:
»Und du Halunke hast gewusst, dass dieses Frauenzimmer unseren Jack liebt und ihn sogar im Traum küsst und anstöhnt, und du hast uns kein Wort davon gesagt?!!«
Der arme Klaus knickte ganz zusammen und zupfte schnell seine blumige Weste zurecht.
»A—a—a—aber es war ja nur im Traum«, stotterte er.
»Schlimm genug, gerade im Traume!«, donnerte sein Herr ihn weiter an.
»A—a—a—ach es soll ja nicht wieder vorkommen, u—u—und wenn's noch einmal passiert, dadadadann klatsche ich ihr gleich mit einem nassen Lappen aufs Maul.«
»Lass es gut sein, Vater«, beruhigte Jack den Aufgebrachten, der ja auch nur einmal seiner Erregung Luft machen musste und dazu als Blitzableiter den armen Klaus benutzte. »Auf mir ruht ein Verhängnis — eitle Menschen mögen es als ein Glück betrachten und stolz darauf sein, für mich ist es ein Fluch. Nun fahren Sie fort, Miss.«
Nach der Trauung wurde gleich die Hochzeitsreise inszeniert, aber die Hauptsache dabei musste sich immer zu der Stunde und Minute abspielen, wo man wusste, dass jetzt die Verfolger die Gegner durch das hellsehende Kind beobachten ließen, und Gemütsrohheit — denn etwas anderes war es nicht — ging so weit, dass man den Gatten sogar in die Hochzeitsnacht blicken ließ. Dass sich die beiden Schiffe dabei gerade begegneten, das war allerdings nur ein Zufall gewesen.
Bis hierher hatte die Schauspielerin in heiterem, renommierendem, oft genug sogar in frivolem Tone erzählt, wie es ihr damals zumute gewesen war. Aber dieser Übermut sollte ein Ende mit Schrecken nehmen, und so begann sie jetzt auch zu erzählen, manchmal weinend wie ein Kind — oder eben wie ein hysterisches Weib, das sie jedenfalls war — manchmal noch in der Erinnerung von Entsetzen gepackt. Alle diese Ausbrüche aber waren nichts weiter als die sicheren Zeichen eines starken, herzlosen Egoismus; alle Menschen, die immer ihr eigenes Schicksal bejammern, haben das wenigste Mitleid mit fremden Menschen.
Die ›Hochzeitsreise‹ sollte nach Frankreich gehen. Dort sollte die Schauspielerin abgelohnt werden. Auf hoher See schleuderte der zärtliche PseudoGatte sie in der Nacht über Bord.
Er hatte sich der Helfershelferin und Mitwisserin all seiner Geheimnisse, die schon vorher an direkte Verbrechen gegrenzt hatten, einfach entledigen wollen. Dann war ja auch gleich alles Andere erledigt. Das Kind würde die Locke aus der Hand schleudern — die gewesene Frau Marie Dankwart und jetzige Madame de Fleury war einfach tot.
Nun muss bemerkt werden, um nichts zu vergessen, dass Jack sofort nicht begreifen konnte, wie man diesen Mordanschlag zu einer Zeit, bis zur Minute ausgerechnet, vorgenommen hatte, da das hellsehende Kind gerade in Trance lag, was man also dort doch wusste. Aber Jack war auch scharfsinnig genug, um gleich einzusehen, dass dies unmöglich mit Absicht geschehen sein konnte. Entweder lag hier ein Zufall vor oder aber... Jack dachte auch schon an eine Zeitverwechslung und hatte damit die Wahrheit gefunden.
Im Übrigen war das jetzt ganz Nebensache, er dachte nicht weiter daran.
Die Schauspielerin, an der sich der Fluch der bösen Tat erfüllte, sollte dem Tode entgehen — aber ihr durchaus nicht zum Segen. Eigentlich hätte es schon genügt. Ihr Schaudern war ganz ungekünstelt, als sie erzählte, wie sie, eine gute Schwimmerin, viele, viele Stunden lang mit den tobenden Wogen gerungen hatte. Und diese Strafe erachtete der Himmel noch immer nicht als genügend für ihre Freveltaten. Denn dass es noch ganz andere Freveltaten gibt, als einen Raubmord zu begehen, das ist doch gewiss. Möchte doch bald die Zeit kommen, da aller Wucher und besonders auch alles Ehrabschneiden mehr in geistigem Sinne aufgefasst und danach bestraft wird, ist doch die Sünde wider den heiligen Geist das einzige Vergehen, welches nach Christi Lehre, nach dem Ausspruch des Meisters der alles vergebenden Liebe, das auch vom allgütigen Gott nicht verziehen werden kann — und der heilige Geist ist nichts anderes als die Wahrheit.
Die Sünderin musste leben bleiben, um noch weiter zu büßen. Was sie während des Marsches quer durch Afrika ausgestanden hatte, immer von einer Hand in die andere gehend, das hatte man durch die Augen des hellsehenden Kindes nicht beobachten können. Vergewaltigt und geprügelt war sie allerdings nicht worden. Aber diese furchtbaren Strapazen! Wie sie wimmernd davon berichtete, oder es doch versuchend — dieses Wimmern erzählte mehr als alles Andere. Und nun diese Hoffnungslosigkeit, das mochte das Allerentsetzlichste dabei gewesen sein.
Jetzt erklärte sich auch ohne Weiteres, wie das vermeintliche Mariechen plötzlich von dem hellsehenden Kinde wissen konnte und sich so auf telepathischem Wege hilfeflehend an Jack wendete. Die Schauspielerin hoffte eben, dass man sie noch immer beobachtete, und dass sie nun wieder ›ihren Jack‹ liebte, ihn um Befreiung anflehte, das konnte man ihr nicht verdenken, da durfte man von keiner raffinierten Schlauheit sprechen, wie Mijnheer van Hyden es im ersten Unmut tun wollte.
Als sie dann immer tiefer ins Innere des dunklen Erdteils geschleppt wurde, gab sie auch diese letzte Hoffnung auf, sie signalisierte nicht mehr. Resigniert fügte sie sich in ihr Schicksal, so auch einen Selbstmord vergessend.
Endlich kam sie nach Kosseir. Wieder kaufte sie ein neuer Herr — es war ihr alles gleichgültig, ihr Stumpfsinn begann sich schon in Blödsinn zu verwandeln. Aber gleich die Behandlung, die sie an Bord der Jacht erhielt, das gute Essen, ließ sie wieder aufleben. Sie kam sich in der kleinen Kabine, in dem weichen Bett wie im Paradiese vor. Ach, wenn es doch immer so bliebe!
Sie kam nach Kabel el Tor in den Harem des Paschas, der sich aber seine Weiber und vielen Sklavinnen nur noch so aus platonischer Liebhaberei hielt, so wie ein anderer Mensch Briefmarken sammelt und die seltenen und schönen Exemplare doch ebenfalls zärtlich liebt, sie sogar liebkosen kann — oder wie ein Hundejockel seine edlen Köter liebt, und denen gibt er dann doch auch gut und reichlich zu fressen.
Kurz, war für die abstrapazierte und verhungerte Schauspielerin schon die Jachtkabine das Paradies gewesen, so kam sie hier gleich in den siebenten Himmel. Das ist doch immer so: variatio delectat vitam — die Abwechslung ergötzt das Leben — manche Menschen erstrecken das auch auf die Ehe — und beim Anfange heißt es eben stets: Ach, wenn es doch immer so bliebe! Sogar der erfahrene Zuchthäusler sagt's, wenn er aus kaltem Wintergraus wieder in die behagliche Zelle kommt.
Da, als sie noch in den ersten Paradiesesfreuden schwelgte, sah sie eine Gesellschaft sich nahen. Schon das Kind musste ihr sagen, wer das war. Sie hörte auch etwas von dem Offizier.
Die Rache nahte! Schnell war der Plan der Schauspielerin gefasst. Es wurde eben weiter geschauspielert. Vater und Gatte mussten ein für allemal abgewiesen werden. Und es wäre ihr gelungen, wenn nicht Jack im letzten Augenblick jenen Satz nach rückwärts gemacht hätte.
Die Beichte war beendet, und es war eine vollständige gewesen.
»Ach, was ich alles durchgemacht, was ich gelitten habe!«, fing das Weib wieder zu heulen an. »O Gott, o Gott, hast du mich fürchterlich bestraft!«
In Jacks Augen hatte es während ihres Erzählens, besonders im Anfang, oft genug grimmig aufgeblitzt — jetzt legte er sanft seine Hand auf das Haupt der Weinenden.
»Gott ist nicht fürchterlich, sondern nur gerecht, und ich verzeihe Ihnen hiermit alles, alles.«
Im Nu blickte die Schauspielerin auf, und zwar tränenlos.
»Na«, sagte sie in leichtfertigem Tone, »was ich aber auch ausgestanden habe — und schließlich doch nur Ihretwegen. Habe ich doch nicht einmal meine Prämie bekommen und werde sie nun auch nie kriegen — da werden Sie sich doch nicht etwa auch noch rächen wollen!«
Wieder zuckte es in Jacks Zügen unheilvoll auf. Aber er beherrschte sich. Er wollte seine Tat der Verzeihung, die ihn selbst befriedigte, nicht wieder beschmutzen.
Anders dachte Mister Snob, der noch immer auf seinem Kissen saß; er schnellte empor, dabei das Spazierstöckchen, das er mitgebracht hatte, aufhebend.
»So eine nichtswürdige Gemeinheit von diesem infamen Sauluder — da hört doch alles auf — nein, da protestiere ich, die muss erst einmal tüchtig... aoouuschhh!!!«
Unter diesem Schmerzensschrei griff er an seine dicke Wade und rieb sich dieselbe mit schmerzverzerrtem Gesicht. Er hatte nämlich mit dem Spazierstöckchen während seiner erbosten Worte in der Luft herumgefuchtelt und sich dabei auch einmal an die Wade geschlagen, gar nicht so derb.
Es war ein zierliches Spazierstöckchen, kaum so stark wie der Zeigefinger eines kräftigen Mannes, und gerade deshalb auffallend und einen koketten Eindruck machend, weil damals als Spazierstöcke möglichst dicke Knüttel Mode waren. Es war auch sonst ziemlich auffallend, ein rotbrauner Stock, der, gegen das Licht gehalten, durchsichtig erschien, unterhalb der rundgebogenen Krücke reich mit Goldringen besetzt.
Wir hätten diesem Stöckchen, das sich in der Hand des Riesen Goliath doppelt kindlich ausnahm, während es doch hinwiederum so zu seinem kindlichen Gesicht und auch zu seinen kleinen Händen passte, natürlich nicht solch eine nähere Beschreibung gewidmet, wenn dieser Stock nicht noch eine besondere Rolle spielen würde.
Da er sich also gar nicht so derb auf die Wade geschlagen hatte, musste der ungeschlachte Riese eine äußerst empfindliche Natur besitzen, was ihm nicht gerade ein gutes Zeugnis ausstellte.
»Sehen Sie, da sind Sie schon für Ihre Rachegelüste gestraft«, lachte Jack, besonders über das schmerzverzerrte, pausbäckige Kindergesicht.
Mister Snob, sich noch immer die unverschämt dicke Wade reibend, lachte selbst mit, wenn auch ärgerlich.
»Aber diese saubere Pflegerin wenigstens würde ich doch nicht so laufen lassen.«
»Ja, wo ist Margot?«, fragte Jack mit schnellumdüstertem Gesicht.
Von den ausgesandten Verfolgern war noch keiner wieder zurück, und so kümmerte sich Jack vorläufig noch nicht darum.
»Sind Sie mit dieser Miss Linley persönlich zusammengekommen?«, wandte er sich dann wieder an die Schauspielerin.
»Nein.«
»Sie kennen sie gar nicht?«
»Absolut nicht.«
»Haben Sie nicht sonst etwas über sie gehört?«
»Nichts weiter, als dass eine gewandte Weltdame engagiert wurde, die sich Margot Linley nennen sollte — das ist also gar nicht ihr eigentlicher Name — die sich als Pflegerin des kranken Kindes bei Ihnen erschleichen und dann die Verräterin zu spielen hatte. Mehr kann ich nicht sagen, und da ist es wohl das Beste, Sie fragen diese Dame selbst.«
»Das werde ich allerdings besorgen. Diese Angelegenheit ist erledigt. Und auch über den Zweck, weshalb meine Frau mir entführt worden ist und gefangen gehalten wird, können Sie mir nichts mitteilen?«
»Gar nichts.«
»Sie wird in New York gefangen gehalten?«
»Zuletzt war sie in der Regalia Street Nummer 13, mehr kann ich mit gutem Gewissen wiederum nicht behaupten.«
»Aber Sie wissen, dass sie gut behandelt wird?«
»Ganz sicher. Wie ein rohes Ei.«
»Und ihre Entführung hat nichts mit — mit —Liebe zu tun?«
»Das kann ich auch ganz bestimmt behaupten. Ein anderer Zweck liegt doch sehr nahe.«
»Eine Erpressung!«
»Natürlich, weiter ist es doch nichts. Man wird Ihnen schon noch kommen, wenn Sie nur erst eingesehen haben, dass Sie Ihre Frau nicht durch eigene Kraft wiedergewinnen können. Es ist eben der Texas Jack, den man erst mürbe machen will.«
»Vater!«
Mit diesem einen Worte hatte sich Jack dem alten Herrn zugewandt, es hatte jauchzend geklungen, und so sah auch sein Gesicht aus, strahlend vor seligem Glück.
Und der Alte hatte verstanden.
»Jack, mein Jack!!«
Das Glück war zu groß, als dass sie es mit Worten hätten ausdrücken können.
Dann aber hatte Jack sofort einen anderen Gedanken.
»Ich denke nicht daran, so lange zu warten, bis es jenen Schurken beliebt, mir meine Frau freiwillig wieder auszuliefern. Jetzt kommt es zunächst darauf an, zu erfahren, ob sich Mariechen wirklich in Amerika befindet. Wir müssen also ganz von vorn anfangen.«
»Ob die treulose Pflegerin noch Mariechens echte Locke besitzt?«
»Das wird sie uns selbst sagen müssen. Fast aber möchte ich es bezweifeln. Sie wird sie wohl vernichtet haben. Dann allerdings dürfen wir nicht mehr auf die hellseherische Gabe dieses Kindes bauen, dann müssen wir uns ganz auf die eigene Kraft verlassen.«
»Oder wir hätten doch noch etwas von Mariechen«, entgegnete der Vater.
»Was?«, fuhr Jack empor. »Du hast noch etwas, was von Mariechens Körper herstammt?«
Der Leser entsinnt sich, dass die Locke von Jack abgeschnitten worden war, schon als Bräutigam, und wie der Vater damals vergebens nachgesonnen hatte, ob er nichts Wirksames von seiner Tochter besitze.
»Ja, mir ist es erst später eingefallen — ich habe noch gar nicht davon gesprochen — meine Frau trug an einem Armband einen in Gold gefassten Milchzahn unseres einzigen Kindes, und dieses Armband muss sich noch unter den anderen Schmucksachen meiner seligen Frau befinden.«
»Das weißt du ganz bestimmt?!«, stieß Jack in freudiger Erregung hervor.
»Das kann ich wohl ganz bestimmt behaupten. Die Schmucksachen liegen links im untersten Fache meines Schreibsekretärs, in meinem Arbeitszimmer — übrigens gar nicht sehr viel, ich kann sie aufzählen, meine Dorothee war eine sehr einfache Frau, wollte gar nichts von Schmuck wissen — das goldene Kettenarmband ist wohl das wertvollste Stück...«
»Und du hast diesen Milchzahn noch gesehen?«
»Gewiss. Wann ich einmal nachgesehen habe, weiß ich freilich nicht mehr, aber da war er noch vorhanden, das weiß ich ganz bestimmt, und ich wüsste gar nicht, wohin er gekommen sein sollte.«
»Dann haben wir auch noch die Möglichkeit, Mariechens Aufenthalt fernerhin durch dieses Kind zu erfahren und sie immer zu beobachten«, jubelte Jack, »und das ist doch etwas ganz anderes, als wenn wir uns auf unseren eigenen Scharfsinn verlassen müssten.«
»Ob aber auch solch ein Milchzahn zuverlässig wirkt?«
»Selbstverständlich. Das Schnitzelchen von einem Fingernagel genügte.«
»Ich meine, weil es ein Milchzahn ist, von Mariechen als kleines Kind verloren, doch vor schon mehr als fünfzehn Jahren.«
»Das ist ganz gleichgültig. Ich kenne alle Eigentümlichkeiten bei Evas Hellsehen, und ich weiß, dass auch dieser Milchzahn wirksam ist. Nur muss er wirklich von Mariechen stammen.«
»Na, das wird doch wohl die Mutter gewusst haben!«
»Du hast recht. Dieser Milchzahn befindet sich aber in Holland. Wie bekommen wir den hierher? Und erst wollen wir doch die Pflegerin wegen der entwendeten Locke befragen. Ich habe ja auch sonst eine kleine Auseinandersetzung mit dieser Dame.«
Gerade kehrten die arabischen Diener von ihrer Verfolgung zurück. Sehr aufgeregt berichteten sie, die Spur sei durch die Schlucht gegangen, aber auf einem steinigen Plateau habe sie plötzlich aufgehört.
Während die Diener noch aufs Geratewohl die abzweigenden Schluchten durchsucht hatten, ohne die Frau oder eine Fortsetzung der Spur finden zu können, seien Araber aufgetaucht, Drusen, welche die Diener gebieterisch zur Umkehr und zum Verlassen des heiligen Gebirges aufgefordert hätten.
»Es war Ibn ben Seba selbst, der uns bedrohte«, schloss der, welcher den Sprecher machte, seinen blütenreichen Bericht, und er zitterte noch an allen Gliedern.
Nicht minder erregt aber wurde plötzlich der Pascha.
»Was? Dieser Hundesohn hat euch zu drohen gewagt?!«
»Wenn wir nicht sofort umkehrten seien wir des Todes, und auch dir, o Pascha, sollten wir sagen, dass fernerhin keiner deiner Leute und Soldaten noch wagen sollte, das heilige Gebirge zu betreten. Dir gehöre nur die flache Küste, das wolle man respektieren, um den Vertrag nicht zu brechen, dem Scheich der Drusen aber gehöre das heilige Gebirge.«
Der Pascha schimpfte und fluchte und rühmte sich seiner Macht — eine schnellere Erklärung erhielt Jack von Mister Snob, wenn auch vorläufig nur eine ganz kurze.
Die Drusen, eine religiöse Sekte, über die wir später ausführlicher sprechen müssen, sind über ganz Kleinasien verbreitet; am meisten sind sie am Libanon angesiedelt, vielleicht 50 000 Köpfe — ihre heilige Stätte aber haben sie auf dem Sinai, und sie allein wollen das Grab Mosis kennen.
Dieses aber wird auch von christlichen, jüdischen wie mohammedanischen Wallfahrern noch heute stark besucht. Denn auch die Mohammedaner verehren ja Moses ebenso wie Christus als einen hohen Propheten, wenn auch nach Mohammed stehend. Die Pilgerkarawanen nehmen denselben Weg, den einst die Juden durch die Wüste genommen haben, betreten das Gebirge von Norden her, werden dann von Drusen auf geheimen und sogar geheimnisvollen Wegen, durch endlose Tunnel und unter vielem Hokuspokus nach dem Grabe Mosis geführt.
Das ist der Verdienst dieser Drusen, davon leben sie. Indirekter Raub. Sie sind die Beduinen des Sinaigebirges. Wenn ihnen eine Pilgerkarawane keinen Tribut zahlt, wird sie angegriffen und geplündert. Aber das kommt gar nicht vor. Die Pilger sind eben gezwungen, den Tribut zu entrichten, ohne Führer kommen sie gar nicht an ihr Ziel, an das aller übrigen Welt unbekannte Grab Mosis.
So sind diese Drusen die unbeschränkten Herren der Halbinsel Sinai, soweit diese gebirgig ist. Sie haben schon oftmals eine politische Macht bedeutet, haben der Türkei und anderen Mächten viel zu schaffen gemacht — — schließlich sind sie doch immer wieder besiegt worden, bis auf die, die im Sinai hausen. Denen ist in ihren Schlupfwinkeln gar nichts anzuhaben. Wohl sind sie türkische Untertanen, aber das steht nur auf dem Papier, und als mohammedanischen Papst erkennen sie den Sultan ja überhaupt nicht an.
Die Drusen glauben an die ausgeprägteste Seelenwanderung, der Mensch wird immer wieder geboren. Der erste Scheich der Drusen und überhaupt der Stifter dieser Geheimsekte war der erste Mensch, Adam. Adam inkarnierte oder verkörperte sich wieder als Abraham, der ebenfalls Scheich der Drusen war. Abraham inkarnierte sich wieder als David, dem Äußeren nach ein berühmter König der Juden, in Wirklichkeit ein noch viel größerer Häuptling der Drusen. Jesus Christus hat die nach ihm genannte Religion geschaffen — der Heiland der christlichen Welt war Scheich der Drusen. Er inkarnierte sich wieder als Mohammed. Und so ging das immer weiter. Der jetzige Scheich, der über die auserlesenen Heiligen im Sinaigebirge herrschte, hieß Ibn ben Seba, der große Sohn der Löwen, und dieser war unter anderem auch schon Mohammed, Christus, David, Abraham und Adam gewesen. Er führte die frommen Pilger gewissermaßen immer an sein eigenes Grab. Buddha und Zoroaster haben die Drusen wohl nur vergessen.
»Na, was will man denn gegen solch eine Religion machen?«, schloss Mr. Snob seinen Bericht. »Den Juden wurde durch ihren Gott Jehova das Land Kanaan zugesprochen, also hielten sie die damaligen Einwohner dieses Landes für unrechtmäßige Eindringlinge und vernichteten sie mit gutem Gewissen durch Feuer und Schwert, ihrem Gott zu Ehren. Den Kaffern gehört nach ihrem frommen Glauben alles Rindvieh auf der Erde, und daher wird man einen Kaffer nimmermehr vom Viehdiebstahl kurieren können. Er nimmt nur sein Eigentum. Wir Engländer sind die Nachfolger des auserwählten Volkes Gottes, uns ist die ganze Erde zugesprochen worden — — also herunter von unserem Erdball, ihr fremden Haiducken, ihr habt gar nichts darauf zu suchen Sie glauben's nicht — Ich will Ihnen mit etwa zweihundert Bibelstellen beweisen, dass wir Engländer jetzt das Volk Jehovas sind. Sehen Sie, und so sind die Drusen die eigentlichen Menschen. Alle, die etwas Großes geleistet haben, sind ihre Scheichs gewesen — und nun beweisen Sie ihnen einmal das Gegenteil.«
»Leben sie denn mit der türkischen Garnison hier in Frieden?«
»Ja, bisher haben sie sich immer vertragen. Höchstens manchmal kleine Reibereien, nichts weiter. Brunum Pascha hat einen großen Einfluss auf die Drusen, und ich weiß auch, warum. Never mind. Ibn ben Seba, ein ganz neuer Scheich, der sich seiner früheren Erdengänge nicht mehr recht erinnern mag, scheint ihm jetzt aber den Fehdehandschuh hinwerfen zu wollen. Übrigens hat er auch ganz recht. Laut einem Vertrag darf das Sinaigebirge von dieser Seite aus gar nicht betreten werden.«
»So ist die Dame von den Drusen gefangen genommen worden?«, wandte sich Jack an den arabischen Berichterstatter.
Niemand wusste das zu sagen. Sie hatten nicht erst Zeit gehabt, den schrecklichen Drusenscheich deshalb zu fragen, sondern waren schleunigst dem Befehl, das Gebirge zu verlassen, nachgekommen.
»Dann wird sie wohl gefangen genommen worden sein«, sagte Jack wieder zu van Hyden. »Ich kann ihr nicht helfen, sie trägt ihre eigene Schuld. Was ich später tun werde, weiß ich jetzt noch nicht, da muss ich mich erst näher über die Drusen erkundigen, und dazu ist jetzt keine Zeit. Mariechen ist wohlbehalten, das ist für mich die Hauptsache. Wir haben die Möglichkeit, sie zu beobachten. Der Milchzahn muss herbei. Wie bekommen wir ihn nur her? Oder wollen wir alle zusammen nach Holland?«
Darüber wurde jetzt beraten, bis man es für das Beste hielt, dass van Hyden allein nach Amsterdam fuhr — d. h. in Begleitung seines Dieners, ohne den er ja nicht existieren konnte. Denn dem Kinde konnte man solch eine weite Reise, bei der drei Tage lang die Eisenbahn benutzt werden musste, nicht zumuten. Evas Erschöpfung war zu ersichtlich, so sehr sie auch das Gegenteil versicherte. So wollte Jack mit ihr gleich hierbleiben, weil gerade hier, wenn nicht Pilgerkarawanen ihre Krankenlager aufgeschlagen haben, eine äußerst gesunde Gegend ist. Telegrafisch konnte man sich ja immer verständigen. In vierzehn Tagen spätestens würde Mijnheer van Hyden wieder hier sein, außerdem konnte Jack ihm mit Eva auch entgegenkommen, bis nach Genua, mindestens bis nach Suez.
»Ich bleibe schon deshalb hier, weil ich mich doch etwas darum kümmern muss, was aus Miss Linley geworden ist. Übrigens kannst du ja auch eine Locke von deinem Haar zurücklassen, so wissen wir immer, was du treibst, und machen wir die bestimmten Stunden aus, kannst du uns auch auf telepathischem Wege schreiben.«
»Ja — ja — das kann ich ja tun«, meinte der alte van Hyden etwas unwirsch, nämlich weil er dabei über seinen Schädel strich, auf dem man vergeblich nach einer ›Locke‹ suchen würde.
»Nun, schon ein einziges Härchen tut es ja«, lächelte Jack. »Was meinst du, könntest du nicht auch eine Locke von deiner Fatje oder sonst einem deiner zurückgebliebenen Diener... was ist denn los, Klaus?«
Klaus hatte beim Nennen des Namens seiner Braut einen kleinen Hexenschuss bekommen. Jetzt fiel ihm wieder einmal aufs Gewissen, wie er doch so ungerecht gehandelt hatte, dass er immer die hellseherische Fähigkeit des Kindes missbraucht hatte. Denn dass er davon niemals seinem Herrn etwas mitgeteilt hatte, fiel ihm manchmal schwer aufs Gewissen.
Und jetzt schien die Entdeckung zu kommen. Daher das so erschrockene Gesicht.
»Na, was ist denn los, Klaus? Nun heraus damit!«
»Ich — ich — o — o — o...«
»Klaus, du hast etwas auf dem Gewissen!«
»Es ist wegen der Locke von — von — Fatje...«
»Du hast wohl eine von ihr? Dir eine zum Andenken mitgenommen?«
»Ei, das wäre ja vortrefflich!«, rief van Hyden erfreut. »Dann wüsste ich ja immer, wie es bei mir zu Hause aussieht!«
Jetzt sah sich Klaus gefangen. Und schon hatte, wie von einer fremden Gewalt dazu getrieben, der ehrliche Klaus zwischen Hemd und Hosenbund gegriffen.
»Du hast eine Locke von Fatje?«
»Ja — ja — das heißt...«
O Gott, o Gott, jetzt kam es heraus, wie Fatje unterdessen Königin geworden war und alles andere, was eben des Dieners Gewissen so sehr beschwerte! Aber schon brachte er den Pferdeschwanz heraus.
Über dessen Länge herrschte, da die Haarflechte beim Herausziehen so gar kein Ende nehmen wollte, erst ein allgemeines Staunen, auch etwas über den Ort, wo Klaus dieses Andenken an seine Braut aufbewahrte.
»Kerl, diesen ganzen Zopf hast du der Köchin abgeschnitten?«, rief Jack lachend.
»Nu ja — nu ja — beim Abschied — als ich sie noch einmal umarmte.«
»Hat sie denn das gewusst?«
»Nein — ach, nein — ganz heimlich habe ich ihr das Löckchen abgeschnitten.«
»Na, ich danke, dieses Löckchen!«, lachte Jack immer belustigter.
»Und du Kerl hast uns gar nichts davon gesagt?!«, rief van Hyden mit scheinbarem Zorn.
Da machte Mr. Snob darauf aufmerksam, dass das schlafende Kind den toten Arm bewege. So war jetzt eine Gelegenheit, die Locke der dicken Köchin im fernen Amsterdam gleich zu prüfen.
Wir wollen nicht zu schildern versuchen, wie es Klaus zumute war, als jetzt die Vorbereitungen zu dem Experiment getroffen wurden.
Jetzt erfahren die, dass meine Fatje Königin geworden ist — und dann muss ich gestehen, dass ich das schon vorher gewusst habe — und dass sie einmal keinen Kopp mehr gehabt hat... mehr dachte er nicht.
Die Haarflechte brachte eine Wirkung hervor. Das erkannte man gleich daran, dass sich der ganze Arm schnell erwärmte.
»Was siehst du, mein liebes Kind?«, begann Jack das Examen.
»Ich sehe... sie«, flüsterte Evangeline, das Experiment wie immer einleitend.
»Wen siehst du?«
»Die Person, deren Haar ich hier in der Hand halte.«
»Kennst du diese Person nicht?«
»Nein.«
Evangeline hatte bei ihrer Anwesenheit in van Hydens Hause zwar die Köchin gesehen, aber das war doch nur eine sehr flüchtige Begegnung gewesen.
»Wo befindet sie sich?«
»In einem Walde.«
»In einem Walde?«, wiederholte Papa Hyden mit gerunzelter Stirn. »Was hat die denn im Walde zu tun? Bei mir im Garten ist doch gar kein Wald. Sie pflückt wohl Gemüse?«
»Nein, sie — sie — kriecht jetzt in einen hohlen Baum.«
»Was tut sie? Sie kriecht in einen hohlen Baum? Nu, was hat die denn in hohlen Bäumen rumzukriechen, jetzt, nachmittags um drei? Da hat sie doch aufzuwaschen!«
»Du vergisst wohl, Vater, dass in Amsterdam jetzt eine ganz andere Uhrzeit ist.«
»Na ja, aber... in hohlen Bäumen herumzukriechen! Und ich habe in meinem Garten doch überhaupt gar keinen hohlen Baum. Wie sieht denn der Garten aus, meine liebe Eva?«
»Es ist ein Wald, ein ganz wilder Wald mit furchtbar dicken Bäumen.«
»Nu, da hört aber doch alles auf. Ich habe in meinem Garten, weiß Gott, keine furchtbar dicken Bäume, das weißt du selber, Jack.«
»Lass doch, Vater, sie mag wohl anderswo sein...«
»Da ist sie höchstens spazieren gegangen, jetzt am helllichten Tage. Was für ein Kleid hat sie denn an?«
»Ein ganz merkwürdiges Kleid — braun — ganz einfach — wie ein Sack — und oben eine Kapuze — und um den Leib einen Strick... ach, jetzt weiß ich — es ist eine Nonne!«
Jetzt freilich glaubte auch Jack diesem Hellsehen nicht mehr recht, wenigstens nicht in Bezug auf seines Schwiegervaters dicke Köchin.
»Eine Nonne ist sie? Hast du schon einmal eine Nonne gesehen, mein Kind?«
»Ja, ich weiß doch, was eine Nonne ist, und sie hat auch so ein großes Kreuz auf der Brust hängen — und jetzt kniet sie nieder, sie betet.«
»Dann ist das auch nicht meine Köchin«, entschied van Hyden.
Klaus aber wunderte sich über nichts. Erst Königin, dann geköpft — warum sollte seine Fatje jetzt nicht auch einmal Nonne geworden sein?
»Ach, und jetzt — jetzt — — jetzt ist die Kutte plötzlich verschwunden — — o, wie schön, wie schön!«
»Was ist schön, mein Kind?«
»Wie schön sie jetzt plötzlich angezogen ist! Nein, es war gar keine Nonne, es war ein Mönch!«
Na, nun wurde es aber bald zu bunt!
»Und jetzt ist es kein Mönch mehr?«
»Nein, jetzt ist sie ein Prinz.«
»Was, ein Prinz?!«
»Ja, sie ist wie ein Prinz angezogen.«
»Wie ist sie denn angezogen?«
»Sie hat eine wunderschöne Jacke an — mit lauter Gold und Silber gestickt und mit lauter Spitzen — — und ein Barett mit Federn — und — und — aber Hosen hat der Prinz nicht an!«
»Was, meine Köchin hat keine Hosen an?«, staunte van Hyden, der ganz kopflos wurde, wie auch Jack vorläufig seinen Kopf noch vergeblich zur Lösung dieses Rätsels anstrengte. »Was, meine Fatje ist ein Prinz geworden und hat nicht einmal Hosen an?! Was hat sie denn sonst an?«
»An den Beinen gar nichts.«
»Auch keinen Rock?«
»Nein, ihre Beine sind ganz nackt — oder — die Beine sind aber doch ganz blau — — sie muss doch wohl etwas drüber haben.«
»Es sind Trikots«, sagte Jack. »Das sieht ja fast gerade aus, als ob Fatje Theater spiele und in der Rolle eines Prinzen auftrete — eine Verwandlungsrolle — aus einer Nonne oder einem Mönche wurde sie ein Prinz. Ist die Person, die du siehst, sehr dick?«
»O nein, sie ist ganz schlank!«
»Hat sie — — nun was für besondere Kennzeichen hat denn Fatje? — — Klaus, das musst du doch am besten wissen.«
»Hat sie krumme Beine — furchtbar krumme Beine?«, fragte dieser prompt.
»Krumme Beine? Nein, davon kann ich nichts sehen. Die Beine sind ganz gerade — und sehr dünn.«
»Dann ist es auch meine Fatje nicht«, entschied der hierin allwissende Klaus.
»Ach, was ist denn das?«, fuhr die kleine Hellseherin staunend fort. »Jetzt ist da ein Baum umgefallen.«
»Was, ein ganzer Baum ist umgefallen?«, musste wieder van Hyden staunen.
»Ja, mit einem Male fiel er um — ein ganz, ganz dicker Bann. — es sah aber so komisch aus — als wäre er nur von Pappe... ja, und der Prinz hebt ihn schnell auf — da steht er schon wieder. Und der Prinz hat lachen wollen, hat es sich aber verbissen.«
»Kein Zweifel, die steht auf der Bühne, spielt Theater«, sagte Jack, »aber das ist auch gar nicht unsere Fatje, sondern...«
Das Kind erwachte.
»Klaus, woher hast du diesen Haarschwanz?«
»Den habe ich der Fatje abgeschnitten«, entgegnete der Gefragte weinerlich.
»Ganz gewiss?«
Klaus konnte es mit den feierlichsten Schwüren versichern.
»Kann dir dieses Haar nicht ebenfalls vertauscht worden sein?«
Ganz ausgeschlossen — wo Klaus dieses Haar seiner Geliebten auch aufbewahrte!
»Na, dann hat Fatje ganz einfach einen falschen Zopf. Weißt du denn davon nichts, Klaus, da du doch mit der Köchin schon so intim gewesen bist?«
Nein, bis auf die Echtheit ihres Haares hatte er seine anatomischen Studien nicht getrieben.
»So ist es! Fatje trägt einen falschen Zopf, es ist ursprünglich das Haar einer Schauspielerin, welche noch lebt und jetzt noch auftritt. Nun erblickt Eva diese Schauspielerin. Also wir haben es gleich mit zwei Schauspielerinnen zu tun.«
»Ach, da ist am Ende meine Fatje auch gar keine Königin geworden!«, platzte Klaus heraus.
»Was sagst du da?«
Klaus erschrak nicht schlecht, aber nun war es zu spät, er musste beichten, und er erzählte von der geköpften Königin und von allem Anderen in seiner drastischen Weise, was wir nicht noch einmal wiederzugeben brauchen.
Der brave Klaus brauchte nicht zu fürchten, dass er wegen der heimlichen Benutzung von Evas Sehergabe Vorwürfe zu hören bekam. Die Zuhörer lachten, wie sie wohl noch nie gelacht hatten, und ganz besonders fürchtete Mr. Snob für seinen Bauch.
Am anderen Tage kam ein Dampfer, welcher von Konstantinopel für die Garnison Proviant brachte. Er fuhr noch am selben Tage wieder ab, und Mijnheer van Hyden benutzte ihn mit seinem Diener, um so wenigstens bis nach Suez zu gelangen, von wo es immer die schnellste Verbindung nach Genua oder noch besser nur nach Brindisi gibt. Von dort ging es dann weiter mit der Eisenbahn durch Italien über die Alpen.
Eva war unterdessen noch einmal in Trance versetzt worden, einfach dadurch, dass man ihr Jacks Locke in die Hand gab, worauf sie immer reagierte, und in diesem Zustande hatte sie Angaben gemacht, zu welchen Zeiten sie in den ferneren Tagen in Halbschlaf fallen würde. Auf diese Weise konnte sich der zurückbleibende Jack immer über seinen Schwiegervater orientieren, indem dieser einige der kostbaren Haare seines Kahlkopfes zurücklassen musste, und zur Vorsicht musste auch Klaus einige Büschel von seinem Schädel hergeben, obgleich ihm das gar nicht recht zu sein schien.
Von Margot ward nichts mehr gesehen und gehört. Erst am zweiten Tage kam Jack auf einen Gedanken, auf den er, wie er selbst sagte, eigentlich hätte früher kommen können.
So sehr sich die Weltreisenden auch mit Garderobe und Wäsche beschränkten, so hatten sie doch einige Koffer bei sich gehabt. Van Hyden und Klaus hatten die ihren natürlich wieder mitgenommen, der große und der kleine Koffer der Pflegerin befanden sich noch in dem Hause des Paschas, der die Fremden wie auch die vier Matrosen mit der unterwürfigsten Gastfreundschaft aufgenommen hatte.
Sollte sich denn in diesen Koffern nicht etwas befinden, was direkt von dem Körper der Pflegerin stammte? Es war doch nur ein einziges Haar nötig, und wenn nicht am Kamm, den sie gebrauchte, so würde sich doch sonst irgendwo ein verlorenes Haar finden lassen.
Gedacht, getan! Ohne Zögern erbrach Jack die verschlossene Handtasche, in der er das Toilettennecessaire vermutete, fand es richtig, und in demselben auch gleich eine ganze Menge von Haaren, wie es ohne solche eben beim Kämmen nicht abgeht.
Zunächst erbrach Jack nun auch gleich noch den großen Koffer, suchte nach Papieren und anderem, was über die Person dieser verräterischen Pflegerin hätte Aufschluss geben können, fand aber absolut nichts.
Die Zeit, dass Evangeline an diesem Tage unfreiwillig in Trance fallen würde, trat erst in vier Stunden ein. Sie forderte aber, dass man den Versuch sofort mache, ob sie so wie bei Jacks Locke nicht sofort hellsehend würde.
Eva zeigte überhaupt ein seltsames Verhalten gegenüber der Pflegerin. Man hatte ihr ja alles erzählen müssen, konnte ihr nichts verheimlichen. Zuerst hatte Eva allerdings heftig geweint, aber als sie sich wieder beruhigt hatte, stellte sich heraus, dass sie nur dadurch so schmerzlich berührt war, weil Margot ohne Abschied von ihr gegangen und nun vielleicht in die Hände grausamer Drusen gefallen war.
Kurz, der Verrat der Pflegerin selbst machte eigentlich gar keinen Eindruck auf sie, sie glaubte überhaupt gar nicht an einen solchen.
»Nein, nein, meine Margot war gar nicht so schlecht, dazu hat sie ja dich und mich viel zu lieb gehabt.«
Dabei blieb sie, ohne natürlich diese Liebe zu dem verheirateten Jack näher erklären zu können. Jedenfalls hatte sie für die Verräterin noch immer die größte Sympathie, wie sie sie immer gehabt hatte, und deshalb eben glaubte sie, dass sie nur ein Haar von ihr in die Hand zu nehmen brauche, um sie sofort im Hellsehen zu erblicken, gerade weil sich jene in großer Gefahr befände.
Mr. Snob, der sonst ein so materieller Mensch war, zeigte für dieses Hellsehen das allergrößte Interesse, und zwar nicht nur aus Neugier, er hatte überhaupt niemals daran gezweifelt, dass es so etwas gebe, dass er sich etwa erst davon hätte überzeugen müssen. Wir wissen ja auch, dass dieser Mann sich dem Studium der orientalischen Geheimwissenschaft gewidmet hatte. Er war eben im Grunde genommen ein ganz anderer Charakter, als er sich gab.
So bat also besonders Mr. Snob, hier einmal ein ganz ausführliches Experiment zu machen, wie weit diese Sympathie für eine Person auf das Hellsehen Einfluss habe.
Zunächst bekam Eva die Locke der Schauspielerin, welche sich noch im Hause aufhielt, in die Hand. Eva wollte nicht in Trance fallen. Sobald sie hingegen Jacks Locke in die Hand bekam, wurde sie hellsehend, erwachte aber wieder, als man diese mit der von Miss Thorbeck vertauschte.
Daraus musste man schließen, dass sie für diese Schauspielerin gar keine Sympathie besessen hatte, d. h. nicht während ihres schlafwachen Zustandes. Im wirklichen Wachen hingegen hatte sie ja fest geglaubt, es sei wirklich die Gattin ihres vielgeliebten Jacks, da hatte sie für die Entführte Mitleid genug empfunden.
Während sie in Trance lag, konnte sie eben nicht getäuscht werden, aber diese Ahnung war nur eine unvollkommene, welche sie auch niemand anders mitteilen konnte. Als sie dagegen hinter Jacks Locke nur ein einziges Härchen von Margot in die Hand bekam, blieb sie hellsehend, und sie fiel von allein in Trance — ein Zeichen, welche Sympathie sie für das treulose Weib trotz alledem besaß. Und sollte das unschuldige Kind mit seiner wunderbaren Sympathie nicht vielleicht richtig fühlen?
Doch die Hauptsache war, dass sie Margot überhaupt sah.
Die Pflegerin befand sich in Gesellschaft von einem Dutzend Beduinen, welche sich in einer zerklüfteten Felsenwildnis aufhielten. Sie war nicht gefesselt, offenbar auch sonst ganz frei, unterhielt sich zwanglos mit einigen der Araber.
Obgleich Eva so lange in Trance blieb wie sie das Haar in dem Händchen hielt, geradeso wie bei Jacks Locke, wollte sich dieses Bild doch nicht ändern, und das Kind stundenlang in dem unnatürlichen Schlafe liegen zu lassen, das widersprach Jacks Gefühlen.
Im Laufe des Tages wurde das Experiment mehrmals wiederholt. Margot befand sich mit den Beduinen auf der Wanderung, selbst zu Pferd, auch schon beduinenhaft gekleidet. Lagerpausen, Mahlzeiten usw. Dann ward Margot von dem Kinde in einem orientalisch ausgestatteten Zimmer gesehen. Sie verließ es wohl, Eva erblickte wilde Felspartien, immer wieder Araber, andere Räume — aber wo sie sich befand, das konnte niemand sagen, und daran wollte sich auch nichts ändern.
»Sie wird sich schon in dem Eliaskloster befinden, in dem unzugänglichen Schlupfwinkel der Drusen, von ihnen el Schommar genannt, eigentlich eine Burg«, erklärte Mr. Snob.
Von diesem erfuhr Jack noch mehr über die Drusen, und der Engländer konnte auch viel mehr von ihnen erzählen, obgleich diese Geheimsekte die einzige war, wie er selbst gestand, in die er nicht eingeweiht sei.
Von dem Wiedergeburtsglauben der Drusen haben wir schon gesprochen. Über alles Andere, besonders über ihre blutigen Kriege mit den Türken wie auch mit den Ägyptern unter Ibrahim Pascha, mit Franzosen und Engländern, kann man ja in jedem Konversationslexikon nachlesen.
Also, wohl sind sie schließlich besiegt worden, aber sie werden in Kleinasien geduldet und sogar als gleichberechtigte türkische Untertanen anerkannt, und dazu ist man geradezu gezwungen, weil sie die Herren des Sinaigebirges sind und wegen der dortigen heiligen Stätten, die als Wallfahrtsorte dienen. Kommt Religion mit ins Spiel, da lässt sich nichts machen, man könnte die zahlreichen Pilgerkarawanen der Christen, Juden und Mohammedaner gar nicht verbieten.
Was für eine Religion die Drusen eigentlich haben, das weiß man nicht. Unter den Mohammedanern gelten sie als Teufelsanbeter, als Zauberer und Schwarzkünstler. Sie sollen heilige Bücher besitzen, in denen ihre ganze Religion niedergelegt ist, aber von denen ist noch nichts in die Öffentlichkeit gekommen. Alles wird von ihnen geheim gehalten, sie selbst erkennen sich nur an geheimen Zeichen, also weiß man nicht einmal, wer überhaupt ein Druse ist.
Ihr eigentlicher Stifter ist jedenfalls ein Mohammed ben Ismael el Durzi, ein Magier, der nach dem Volksglauben mit allen Teufeln und Geistern in Verbindung stand, um das Jahr 1000 nach Christi lebend. Bis dahin lässt sich die Geschichte der Drusen wenigstens zurückverfolgen.
In früheren Zeiten haben im Sinaigebirge auch christliche Mönche Klöster gehabt. Ein solches ist auch das Eliaskloster gewesen. 8500 Fuß über dem Meere liegend, wie ein Adlernest an die Felsen geklebt, zu dem kein sichtbarer Weg hinaufführt. Dass dort oben wirklich einmal christliche Mönche gehaust haben, ist zweifellos. Nun erzählt die Legende, dass diese Mönche einmal den göttlichen Befehl erhalten haben, dieses Kloster für einige Jahre zu verlassen, jedenfalls wurden sie durch Wassermangel dazu gezwungen, und als sie ihre alte Behausung wieder beziehen wollten, fanden sie nicht mehr den Aufstieg, die Wege waren durch Gottes Hand — wahrscheinlich durch ein Erdbeben — verrückt, verschoben worden.
So soll ein Jahrhundert lang dieses Kloster leer gestanden haben, unerreichbar von jedem Menschen. Plötzlich aber war es wieder bewohnt. Es war von Drusen eingenommen worden. Und seitdem ist es die Schommar, die Hochburg der Drusen, von wo aus ihr Scheich seine Befehle diktiert, unerreichbar jeder menschlichen Macht.
»Dort oben wird Miss Linley gefangengehalten, gar kein Zweifel«, erklärte Mr. Snob; »denn eine andere Behausung haben die Drusen in diesem Gebirge gar nicht; sonst halten sie sich höchstens in Zeltlagern oder in Höhlen auf. Wollen wir den Drusen einmal einen Besuch abstatten?«
Aber Jack hatte keine Lust dazu. Er wollte bei dem Kinde bleiben, welches bei solch einer Gebirgstour doch nicht mitgenommen werden konnte, und das Schicksal der Pflegerin, ob glücklich oder unglücklich, kümmerte ihn wenig. Durch das hellsehende Kind konnte er ja immer ihren Aufenthaltsort erfahren, und brauchte er sie, so wollte er noch immer ihrer Person habhaft werden.
Die Tage vergingen unter Beobachtung der Pflegerin und mehr noch des Schwiegervaters. Am sechsten Tage nach seiner Abreise traf dieser in Amsterdam ein, begab sich nach seiner Villa im Haag. Jack konnte durch Eva beobachten, wie er seinen Schreibsekretär aufschloss und Schmuckgegenstände in die Hand nahm. Noch an demselben Tage traf in Kabel el Tor das Telegramm ein, dass der Milchzahn gefunden worden sei und dass van Hyden noch an demselben Tage die Rückreise antrete.
Aber aus einem Entgegenfahren wurde nichts. Eva erkrankte an Wechselfieber. Es war an sich bedeutungslos, doch an eine Reise war nicht zu denken. So telegrafierte Jack zurück, dass die beiden nur nach Kabel el Tor zurückkommen sollten, und wich nicht von dem Bettchen der phantasierenden Eva.
Wieder fünf Tage später meldete van Hyden telegrafisch aus Suez, dass er dort eingetroffen sei, weiter anfragend, ob er in Suez warten oder sich nach Kabel el Tor begeben solle.
Eva hatte sich unterdessen sichtlich erholt. Vor allen Dingen wollte sie auch wieder an der Beobachtung teilnehmen, und bei dem Schwiegervater ihres geliebten Jacks brauchte sie keine besonderen Zeiten einzuhalten. Aber ihre Gesundheit war doch noch eine sehr zarte. Das an sich schon so schwache Kind schien immer mehr nur ein Hauch von einem zarten Menschenleben zu werden, wenn auch nicht direkt mit Schmerzen verbundene Kränklichkeit dabei war — das Gesichtchen wurde förmlich kleiner, die Händchen wurden immer durchsichtiger — kurz, Jack hielt eine wenn auch noch so kurze Reise jetzt für ganz ausgeschlossen, gerade weil das Kind hier in der Gebirgsluft so schnell das Fieber überstanden hatte — und ferner kam auch noch dazu, dass van Hyden ja viel besser Gelegenheit hatte, von Suez nach Kabel el Tor zu kommen als Jack von hier nach dort.
Dementsprechend telegrafierte er nach Suez zurück. Dann konnte er mit Hilfe von Evas Augen seinen Schwiegervater beobachten. Das Kind verlangte direkt, dass er es täte.
So sah Jack am Nachmittage desselben Tages, wie sein Schwiegervater mit Klaus einen Dampfer betrat und mit dem Kapitän verhandelte. Aber es musste schon alles in Ordnung sein, denn bald darauf, als der Dampfer bereits abgegangen war, erhielt Jack die Depesche, dass die beiden gegen Mitternacht an der Küste von Kabel el Tor abgesetzt würden.
Und nun sollte für Jack noch eine Zeit gar langer Unruhe beginnen. In sieben Stunden würde van Hyden mit Mariechens Milchzahn hier sein — was würde man dann durch des hellsehenden Kindes Augen erblicken?
Es war gleichgültig, wie sich Jack in seiner Ungeduld die Stunden vertrieb, ob und was er bangte oder hoffte — das Räderwerk der Zeit ging unbekümmert um der Menschheit Qual oder Freude gleichmäßig weiter. Schlimm war es nur, dass ein auskommender Sturm die erst so ruhige See immer mehr aufwühlte.
Zwei Stunden vor Mitternacht begab sich Jack an den Strand. Die dort stehenden Gebäude waren hell erleuchtet, ihre Fenster dienten an der flachen Küste als Leuchtfeuer, nach denen sich die vorüberfahrenden Schiffe tatsächlich richteten.
In der Ferne erblickte man denn auch genug Feuer von Dampfern, hin und wieder auch die farbigen Laternen eines Seglers, und an der Küste rollte und brauste die Brandung.
»Wird der Dampfer denn auch bei dieser See ein Boot aussetzen, und wird dieses hier landen können?«, fragte Jack verzagt, der wohl schon viele Seereisen gemacht hatte, aber doch kein Seemann war.
Die erfahrenen Küstenwächter konnten ihn beruhigen. Die See sei gar nicht so unbändig, da könne noch jedes Boot ausgesetzt werden und herankommen. Er brauche auch hier nicht zu warten. Der betreffende Dampfer würde sich schon durch Feuersignale bemerkbar machen, seine Absicht anzeigend, und dann würde man den Chawaiken sofort benachrichtigen.
Jack arbeitete sich durch den Sturm zurück. Eva schlief, und es hatte ja gar keinen Zweck, ihre Sehergabe zu benutzen. Bis kurz vor Mitternacht unterhielt sich Jack mit Mr. Snob. Da kam ein Bote angelaufen, ein Dampfer signalisiere, er wolle ein Boot mit Passagieren an die Küste bringen.
Jack und Mr. Snob eilten nach dem Strand. Der Sturm hatte sich etwas gelegt, desto erregter war unterdessen das Meer geworden. Aber die Sache ging besser, als Jack zu hoffen gewagt hatte. Aus der finsteren Nacht tanzte ein großes Boot heran, ein zehnriemiger Kutter. Licht hatte es nicht halten können, aber der Bootssteuerer und die englischen Matrosen hatten es tadellos in der Gewalt. An ein richtiges Landen oder gar Anlegen an dem Kai war natürlich nicht zu denken. Plötzlich kamen mit einer rollenden Woge zwei Menschen angeschwommen, denen beiden durch ihre Körperfülle das Schwimmen auch sehr leicht fallen musste. Es wurden ihnen noch einige Koffer nachgeschleudert, dann ging der Kutter schon wieder zurück nach dem illuminierten Dampfer, der in noch bedeutender Entfernung auf den Wogen schaukelte.
»Nein, dass mir in meinen alten Tagen noch so etwas passieren muss, so einfach ins Wasser geschmissen zu werden, wo ich nicht einmal schwimmen kann!«
So jammerte Papa van Hyden, und Klaus stimmte ihm redlich bei.
»Hast du den Milchzahn?«, drängte Jack, nur von diesem einen Gedanken beherrscht.
»Den habe ich.«
»Zeig ihn mir, gib ihn mir!«
Im Lichte der Wachtstube brachte van Hyden den winzigen, in Gold gefassten Milchzahn aus sicherstem Gewahrsam zum Vorschein. Jack aber hielt es wohl für noch sicherer, wenn er ihn gleich in der Hand behielt. So rannte er spornstreichs nach dem Hause des Paschas zurück.
Ja, er hatte Grund, so furchtbar erregt zu sein! Fast ein halbes Jahr war er seiner ihm geraubten Gattin durch alle Welt nachgejagt, nicht um sie wiederzugewinnen, sondern nur, um sie den Händen von Bösewichtern zu entreißen, nur um dem Vater das Kind wiederzugeben — so wenigstens war doch sein ursprünglicher Entschluss gewesen — und als er sie endlich erreicht hatte, da musste er erkennen, dass er ein halbes Jahr lang durch alle Welt nur einem betrügerischen Phantom nachgejagt war!
Jetzt aber, jetzt — wie hatte sich doch alles so geändert!
Mit einem Jauchzen stürzte Jack in den inneren Hof, der ziemlich hell erleuchtet war, weil doch alle Zimmerfenster nach ihm hinausgingen, und an Petroleum wurde hier nicht gespart.
Weiler stürzte Jack in das Zimmer, in welchem er vorhin das Kind schlafend verlassen hatte. Erst im letzten Augenblick zügelte er seine ungestüme Ungeduld. Eva lag noch immer auf den Kissen, von einer Decke vollkommen verhüllt, wie sie es beim Schlafen liebte; selbst das Gesicht musste zugedeckt sein.
Sie durfte nicht gleich aus dem Schlaf geschreckt werden.
Mit vor Aufregung zitternden Händen näherte sich Jack der kleinen Schläferin, vorsichtig fasste er die kostbare Decke an, vorsichtig zog er sie von dem Gesicht hinweg...
Ja, was war das? Da lag nur ein Kissen!
Jack zog die Decke vollends fort... nichts weiter als Kissen, welche die Gestalt des Kindes ungefähr markiert hatten.
Ganz verwirrt blickte sich Jack um. Gewiss, das war dasselbe Zimmer, in dem Eva vorhin gelegen hatte. Das war auch dieselbe Decke...
Da sah er einen arabischen Diener stehen, und jetzt, wohl schon von einer Ahnung erfasst, fuhr er auf diesen los.
»Wo ist Evangeline?! Wo ist das Kind?«

»Arbussa hat es doch holen müssen«, stammelte der erschrockene Diener, der speziell dem Kinde beigesellt gewesen war.
»Arbussa? Wer ist Arbussa?«, donnerte Jack ihn weiter an.
»Der Pferdewärter.«
»Der hat das Kind holen müssen?!«
»Du hast ihn doch selbst beauftragt.«
»Ich? Ich?!«
»Vor zehn Minuten. Du hast ihn doch beauftragt, das Kind gleich nach dem Strande zu bringen.«
»Evangeline ist geraubt!!«
Van Hyden und Mr. Snob waren unterdessen ebenfalls eingetroffen. Sie hatten den Ruf gehört, und auch Mr. Snob war entsetzt zurückgeprallt, nicht vor dem Inhalt dieser Worte, sondern vor dem furchtbaren Tone, in dem sie gerufen worden.
Van Hyden hatte gesehen, wie sich sein Schwiegersohn gebärdete, als ihm damals die geliebte Gattin entführt worden war, als es für ihn keinen Zweifel mehr geben konnte, dass sie ihm von verbrecherischer Hand geraubt worden war. Eigentlich aber hatte sich Jack doch damals gar nicht ›gebärdet‹. Er hatte den Fall ganz kühl aufgefasst, wenigstens ein ganz kühles Wesen gezeigt, so kühl, wie ein Jäger sein muss, der sich zur Verfolgung der Fährte eines Wildes anschickt.
Und was er sonst auch noch alles erfahren, durch die Augen des hellsehenden Kindes beobachtet hatte — scheinbar hatte es ihn doch eigentlich gar nicht außer Fassung bringen können. Hier aber bekam van Hyden einmal zu sehen, welch furchtbarer Leidenschaft, welch wilder Gefühlsausbrüche sein Schwiegersohn fähig war.
Dass ihm jetzt auch noch dieses zarte Kind geraubt worden war, das war es, was ihm zu Herzen ging. Da zeigte sich, wie Evangeline ihm ans Herz gewachsen war.
Jack schrie und gebärdete sich wie ein Wahnsinniger, und dann jagte er auf seiner Rappstute in die finstere Nacht hinaus — niemand wusste, wohin.
Die Sonne eines neuen Tages war über Kabel el Tor aufgegangen, ohne dass sich etwas an der Sachlage geändert hätte. Jack hatte umsonst mit den fürchterlichsten Schwüren gegen sich, gegen Gott und gegen alle Welt getobt — die kleine Evangeline kehrte nicht von allein wieder, und er selbst brachte sie, als er bei Tagesanbruch auf schaumbedecktem Rosse zurückkehrte, ebenfalls nicht zurück.
»Wer ist dieser Arbussa?«, war seine erste Frage die er finster stellte.
Man gab ihm Auskunft. Die anderen hatten unterdessen ja selbst welche eingezogen. Der Stallmeister des Paschas, der dessen eigene Pferde unter sich hatte, war bisher ein durchaus treuer, zuverlässiger Mensch gewesen.
Kaum waren Jack und Mr. Snob von dem Boten des Wachthauses geholt worden, als Arbussa jenes Zimmer betreten hatte, in welchem ein arabischer Diener Wache hielt.
»Der Chawaike befiehlt mir, ich soll das Kind gleich mit an den Strand bringen.«
Arbussa sprach's, hüllte das schlafende Kind in eine mitgebrachte Decke und verließ mit ihm Zimmer und Haus, um sich nicht wieder blicken zu lassen. Dass er kein Pferd mitgenommen hatte, das war das einzige, worüber sich Jack noch selbst orientiert hatte, ehe er davongejagt war.
»Im Hause und in der weiteren Umgebung hält er sich nicht verborgen«, sagte Mr. Snob. »Da haben wir unterdessen schon genaue Untersuchungen angestellt. Haben Sie denn Spuren gefunden?«
»Bei diesem Sturme Spuren in dem losen Sand, hahaha!«, lachte Jack grimmig.
»Ja, weshalb nur mag Evangeline geraubt worden sein? Haben Ihre Gegner gewusst, dass jetzt ein anderes Mittel kommt... «
»Weshalb? Weshalb?«, unterbrach Jack den Sprecher, immer grimmiger werdend. »Was geht mich das Weshalb an? Was kümmert mich jetzt noch meine Frau? Das Kind, meine kleine Evangeline will ich wiederhaben! Und wenn auch Teufel diesen Engel mit in ihre Hölle genommen hätten — ich hole ihn von dort zurück! Meine Eva, ach, meine kleine Evangeline!«
Tränen entstürzten bei diesem letzten Ausruf seinen Augen.
Er hatte es ja auch schon gesagt: es handelte sich jetzt für ihn nicht darum, dass er durch des Kindes Raub das Mittel verloren hatte, seine Frau wiederzufinden oder doch sie beobachten zu können, sondern allein der Verlust des Kindes warf den starken Mann plötzlich ganz nieder
Aber wer wusste denn auch, wo er während der ganzen Nacht oder doch während der letzten sechs Stunden überall umhergejagt war, ganz planlos, eine Beute der furchtbarsten Empfindungen.
»Meine Eva, das schwache, kranke Kind vielleicht von räuberischen Beduinen fortgeschleppt!«, wiederholte er in klagendem Tone, seine Tränen nicht zu stillen versuchend.
»Aus der Schlucht kommt ein Beduine geritten!«, erklang da der Ruf der Diener, und der zusammengebrochene Mann schnellte empor, als wisse er schon ganz bestimmt, dass da wirklich die Erklärung käme.
Es war ein vermummter Beduine, der langsam aus der Schlucht aus das Haus zuritt und dort gemächlich von seinem prächtigen Rosse abstieg. Der Pascha und die anderen hatten ihn schon vor dem Hause erwartet.
»Brunum Ogli Pascha?«, wandte sich der Vermummte an diesen, nachdem er den Zügel über die in den Sand gestoßene Lanze geworfen hatte.
»Ein Druse«, flüsterte Mr. Snob zu Jack, »sonst hätte er den mohammedanischen Gruß gehabt.«
»Ich bin es«, entgegnete der Pascha. »Was willst du? Wer bist du?«
»Kennst du mich nicht?«
Der Vermummte hatte das Kopftuch zurückgeschlagen. Das weißbärtige Gesicht eines sehr alten Greises zeigte sich.
»Scheich Hassan el Schommar, was habe ich mit dir zu schaffen?«
»Auch ein Scheich der Drusen«, konnte Mr. Snob wiederum belehren, »aber unter Ibn ben Seba stehend — der Befehlshaber der Hochburg.«
»Was du mit nur zu schaffen hast? Ist das eine Begrüßung?«
»Für dich ja«, war die hochtrabende Antwort des Paschas.
»Wo du mich erwartet hast?«
»Ich dich?«
»Dann diese dort.«
Und dabei hatte der Scheich eine leichte Handbewegung dorthin gemacht, wo Snob und Jack standen.
Da war schon Jack mit einem großen Schritte auf ihn zugetreten.
»Dann bist du es, der heute Nacht das Kind entführt hat oder es entführen ließ!«
»Ja.«
Dieses einfache Ja wirkte nicht anders als ein Donnerschlag aus heiterem Himmel. Jack hingegen ward mit einem Male eisern.
»Und warum?«
»Willst du mich als Fremden hier draußen stehen lassen?«
»Pascha, lade ihn als deinen Gast ein.«
Der Scheich folgte in den Gartenhof, der alle Bequemlichkeiten eines Zimmers enthielt; die unvermeidlichen Tschibuks und Wasserpfeifen und Erfrischungen wurden gebracht.
»Weshalb hast du das Kind rauben lassen?«
»Weil es eine Tochter der Alleingläubigen ist.«
»Der Drusen?«
»Du sagst es. So nennen die Ungläubigen uns ja wohl.«
»Wo befindet sich das Kind jetzt?«
»In el Schommar, in unserer heiligen Hochburg.«
»Aus welchem Grunde hast du es geraubt und dorthin gebracht?«
»Aus demselben Grunde, aus dem du das Kind durch alle Welt geschleppt hast.«
»Was weißt du davon?«
»Die Frankin, eine Anglisi, die bisher immer bei dir war, hat mir davon erzählt.«
Also auch darin war Margot zur Verräterin geworden! Doch jetzt hatte Jack nur mit diesem alten Araber zu tun, er blickte ihm lange in die runzligen Züge. Ja, es war ein edles Gesicht, wie fast alle Orientalen es haben, aber der Menschenkenner wird darin auch immer einen Zug von Fuchsschlauheit entdecken. Und Jack kannte diese Orientalen.
»Du weißt, dass das Kind hellsehend ist?«
»Ich weiß, dass Evangeline jede Person sieht, sobald sie von ihr etwas in der kalten Hand hält, was an dem Körper dieser Person gewachsen ist, und keine Entfernung kann sie an diesem Sehen hindern.«
Jacks unheilvolles Zähneknirschen war für keinen anderen hörbar, und ebenso wusste er auch seine Augen zu beherrschen.
»Nun wollt ihr mit der Gabe dieses Kindes Hokuspokus treiben.«
»Hokuspokus?«
»Zauberei.«
»Nenne du es Zauberei. Wir bedürfen dieses Kindes genau so wie du.«
»Ist das Kind dir etwa freiwillig gefolgt?«
»Ist es dir freiwillig durch alle Welt gefolgt?«
»Allerdings.«
»Wohl, so bleibt es unfreiwillig bei uns.«
»Scheich, Scheich, du wagst eine freie Sprache!«, sagte Jack mit nur wenig erhobener Stimme, aber man konnte schon etwas heraushören.
»Mich schützt die Gastfreundschaft.«
»Ist es wahr, Pascha, schützt ihn schon deine Gastfreundschaft?«
»Nein, er hat noch kein Brot und Salz gegessen.«
»Das haben wir Drusen auch nicht nötig, wir sind keine Mohammedaner.«
Wenn der Scheich solch eine freie Sprache wagte, so musste er doch irgendeinen Rückhalt haben, dass er sich so sicher fühlte. Noch ehe Jack ihn deshalb vorsichtig auszuforschen begann, nahm er selbst wieder das Wort:
»Es steht im Buche des Schicksals verzeichnet, dass dieses hellsehende Kind fernerhin den Drusen gehört.«
»Besitzt ihr Drusen vielleicht dieses Buch des Schicksals?«, spottete Jack.
»Allerdings, wir besitzen es — wir allein.«
»Ah, so! Dann dürfte aber doch verschiedenes Falsches in diesem Buche des Schicksals verzeichnet sein.«
»O nein. Und ich habe noch Anderes im Buche des Schicksals gelesen.«
»Nun? Halte nicht zurück mit deiner Weisheit.«
»Du bist Texas Jack.«
»Sogar das steht in deinem Schicksalsbuche?!«, lachte Jack, aber es klang immer gefährlicher.
»Doch dein eigentlicher Name ist Johannes Dankwart.«
»Wunderbar, woher du das alles weißt! Aber das gehört doch eigentlich nicht in das Buch der Zukunft.«
»Es ist nicht das Buch der Zukunft, sondern das Buch des Schicksals, welchem die Drusen all ihre Macht verdanken, und dieses umfasst die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und da steht weiter drin, dass du der stärkste und der kühnste Mann der Erde bist.«
»Ich danke dir für dieses Kompliment, edler Scheich, aber verfangen tut so etwas bei mir nicht, und dass ich nun gerade der stärkste Mann der Erde bin, das dürfte z. B. gleich nicht stimmen. Ich habe schon viel stärkere Männer kennen gelernt.«
»Aber du bist nicht zu besiegen. Du bist der größte Held der Erde.«
»Nun, Scheich, lass endlich diese Schwätzerei«, wurde Jack jetzt ungeduldig. »Was willst du eigentlich von mir?«
»Dir dein zukünftiges Schicksal offenbaren.«
»Dann fasse dich kurz.«
»Du hast doch von unserem Oberscheich gehört, von Ibn ben Seba?«
»Ja.«
»Er ist der Löwe des Sinais, der erste, unbesiegbare Krieger der Drusen.«
»Ich dachte, der erste, unbesiegbare Krieger wäre ich?«
»Der Erde, Ibn ben Seba ist nur der gewaltigste Krieger der Drusen.«
Jack hatte doch etwas Besonderes herausgehört. Er wollte dieses Gespräch lieber noch nicht abbrechen. Und er war gewohnt, mit einem Indianerhäuptling, der ihm die wichtigste Mitteilung zu machen hatte, erst schweigend ein Dutzend Pfeifen zu rauchen, ehe jener mit der Sprache herausrückte.
Es musste doch auch ein ganz bestimmter Grund zu dieser absonderlichen Behauptung vorliegen. Warum wurde ihm denn hier von einem hohen Scheich der Drusen, die sich selbst für die bevorzugtesten Menschen hielten, so geschmeichelt?
»Soll ich etwa mit diesem Löwen des Sinais kämpfen? Vielleicht um das Kind?«
»Das hätte doch gar keinen Zweck.«
»Wieso nicht?«
»Es ist doch ganz selbstverständlich, dass du ihn sofort besiegst.«
»Nun, was ist sonst mit diesem Ibn ben Seba?«
»Du denkst, er ist der Oberscheich der Drusen.«
»Ich habe so gehört. Ist er es nicht?«
»Nein, er ist nur ein Stellvertreter für den Oberscheich, bis wir den richtigen gefunden haben. Und jetzt haben wir ihn gefunden.«
»Nun, wer ist es denn?«, fragte Jack, noch völlig ahnungslos.
»Der Oberscheich der Drusen bist du.«
Jack glaubte nicht richtig gehört zu haben, und das sagten auch die Gesichter aller anderen Anwesenden.
»Ja«, fuhr der Scheich mit jetzt feierlicher Stimme fort, »das Buch des Schicksals spricht nicht immer, es ist für uns Akkals, die Wissenden, nicht immer lesbar, jetzt aber hat es gesprochen, und es hat gesagt: Vor einem halben Menschenalter wurde in jenem fernen Lande, das dort liegt, wo die Sonne untergeht, und welches die Franken Amerika nennen, ein Mann geboren, welcher vor sechstausend Jahren der erste Mensch gewesen ist, der mit Eva alle anderen Menschen gezeugt und auch schon den Orden der Drusen als den der vollkommensten Menschen gegründet hat — und dieser Adam wurde dann Noah — und Noah wurde Abraham — und Abraham wurde David — und David wurde Jesus Christus — und Christus wurde Mohammed — und Mohammed wurde Mohammed ben Ismael — und Ismael wurde Hakim, welcher der letzte Großemir der Drusen gewesen ist — und Hakim wurde du, der du dich Johannes Dankwart oder Texas Jack nennst — und so begrüße ich in dir als erster den neuen Großemir des auserwählten Volkes Gottes, und hunderttausendmal hundert Millionen Drusen warten auf dich, um dich als Großemir und Stellvertreter Gottes anzubeten.«
Mit auf der Brust verschränkten Armen verneigte sich der Alte demütig vor dem ›Stellvertreter Gottes‹, bis er sogar den Boden küsste.

Jack war keines Wortes fähig. Nicht nur vor Staunen ob solch ihm angedichteter Ehre, sondern er zermarterte noch sein Hirn, was das alles zu bedeuten habe, ob ihm da nicht eine Falle gestellt würde.
»Sapperlot«, unterbrach da Mr. Snob als erster das allgemeine Schweigen, »haben Sie aber schon eine glänzende Karriere hinter sich — ich gratuliere!«
Jack hatte sich von seiner ersten Überraschung schnell wieder erholt.
»Nun gut. Gesetzt den Fall, ich nehme diesen Rang eines Großemirs an...«
»Du musst.«
»Wieso muss ich? Willst du mich etwa dazu zwingen?«
»Es steht im Buche des Schicksals verzeichnet, dass du der Oberscheich der Drusen wirst, also hängt es gar nicht von deinem Willen ab.«
»Ah so, ihr glaubt an ein Fatum. Nun gut, wenn ich diese Ehre annehme — was dann?«
»So bist du eben der Großemir, der erste Scheich aller Drusen.«
»Ich bin ein Christ.«
»Du wirst ein Anhänger des allein richtigen Glaubens werden.«
»Man wird mir Lehrer geben?«
»Gewiss.«
»Ich komme nach el Schommar?«
»Wohin sonst?«
»Ich werde allgemein anerkannt?«
»Es ist bereits in dieser Nacht alles beschlossen worden, und nur in el Schommar können solche Beschlüsse gefasst werden.«
»Und ich kann diese Burg auch jederzeit wieder verlassen?«
»Warum nicht? Bist du nicht der allmächtige Emir der Drusen? Wer will deinem Befehl widerstehen?«
»Jetzt sofort willst du mich nach el Schommar bringen?«
»Jetzt sofort. Alles ist zu deinem Empfange bereit.«
»Hört«, ließ sich da Mr. Snob auf Deutsch vernehmen, »Ihr wollt doch nicht etwa auf so etwas eingehen?«
»Das habe ich allerdings vor.«
»Man stellt Euch eine Falle, man will ganz einfach auch Euch gefangen nehmen.«
»Aus welchem Grunde?«
»Die werden schon einen Grund haben, und wenn es auch nur irgendeine Weissagung ist, dass man sich gerade Eurer Person bemächtigen soll. Diese Drusen sind ja ganz verseucht von Aberglauben. Vielleicht aber hängt es auch mit dem Kinde zusammen, das ohne Euch nicht hellsehen will.«
»Lasst es gut sein, ich weiß schon, was ich tue, und vorher spreche ich auch noch einmal mit Euch. — Weißt du, Scheich«, wandte sich Jack auf Arabisch wieder an diesen, »weshalb ich hierher gekommen bin?«
»Du suchst deine dir geraubte Frau.«
»Ich habe sie nicht gefunden.«
»Du bist betrogen worden, ich weiß es!«
»Woher weißt du das?«
»Die Frankin, die sich im Gebirge verirrte, erzählte es uns, aber es wäre nicht nötig gewesen, jetzt haben wir es auch im Buche des Schicksals gelesen.«
»Ich bin nicht willens, die Verfolgung meiner Frau aufzugeben.«
»So nimm sie doch zu dir.«
»Nach el Schommar?«
»Gewiss.«
»Dann muss ich sie erst haben.«
»So holen wir sie dir.«
»Du? Ihr Drusen?«
»Zweifelst du daran? Ha, lerne erst die Macht der Drusen kennen! Die Erde ist zu klein, als dass sich irgend jemand vor uns verbergen könnte.«
»Also jetzt sofort bringst du mich nach el Schommar?«
»Jetzt sofort.«
»Hast du Begleitung bei dir?«
»Ich bin allein.«
»Wie weit ist es bis nach el Schommar?«
»Nur zwei Stunden.«
»Nicht weiter?«
»Dann können wir es auf der Höhe erblicken.«
»Gut, ich bin bereit, dir zu folgen, ich sattle nur mein Pferd.«
Jack erhob sich und begab sich hinaus. Mit starrem Staunen wurde ihm nachgeblickt. Dann eilte Mr. Snob ihm nach, fand ihn im Pferdestall, wirklich schon seine Nachtmär sattelnd.
»Es ist nicht möglich!«
»Was ist nicht möglich? Sprechen Sie Deutsch! Das wird hier wohl niemand verstehen. Was halten Sie für unmöglich?«
»Dass Sie wirklich auf solch eine plumpe List hereinfallen.«
»Sie meinen, es handelte sich nur darum, mich gefangen zu nehmen?«
So befragt, äußerte Mr. Snob, der die Drusen auch genug kannte, doch eine andere Meinung. Ja, es konnte sein, dass die Drusen, wenn Ibn ben Seba wirklich nur ein einstweiliger Oberemir war, tatsächlich diesen ihnen sonst ganz fremden Mann, von dem sie nur soeben erst durch Margot gehört haben konnten, zu ihrem ersten Fürsten zu machen wünschten.
Dies kommt daher, dass die Drusen überhaupt alles von den Sternen, von Orakelsprüchen und von anderen abergläubischen Handlungen abhängig machen. So etwas steht ja nicht etwa einzig da in der Weltgeschichte, auch nicht solch eine Fürstenerwählung. Man denke nur daran, was die alten Griechen und Römer alles von den delphischen Orakelsprüchen forderten, wie oft sie davon die Wahl eines Herrschers abhängig machten, und der Bescheid des Orakels konnte auf einen bisher gänzlich unbekannten Mann fallen. So haben es auch die alten Ägypter gehalten; von den alten Deutschen wird nichts Anderes erzählt. Wir haben in Deutschland eine religiöse Sekte, von hier aus sich über die ganze Welt verbreitend, von der der Schreiber dieses im Allgemeinen sehr hoch denkt. Es ist die Brüdergemeinde der Herrnhuter. Diese haben ein sogenanntes Losungsbuch, ein gedrucktes Buch, in welchem die sinnreichsten Bibelsprüche zusammengestellt sind, jeder ist mit einer Nummer versehen, es werden eben so viele Lose gemacht, und in jedem wichtigen Falle, wo es ein Ja oder ein Nein gilt, wird das Los gezogen, der betreffende Bibelvers entscheidet als das Wort Gottes — bei einer Heirat, ob der oder jener neu als Priester zu wählen ist, ob man in einem fernen Erdteil eine neue Mission gründen soll, die Hunderttausende kostet, und so bei Allem und Jedem.
Man mag hierüber denken, wie man will — aber jedenfalls, wenn im zivilisiertesten, aufgeklärtesten Lande eine Gemeinschaft von Menschen, die gar kluge Köpfe zu den Ihren zählt, alle ihre Entschlüsse, die kleinsten wie die größten, von solchen Orakelsprüchen abhängig macht, dann kann man glauben und es ihr nicht verargen, wenn auch eine halbwilde, fanatische Religionssekte dasselbe tut.
»Durch das Kind, welches gewissermaßen zu Ihnen gehört, ist man darauf gekommen, Ihnen das Horoskop zu stellen oder mit Ihrer Person sonst irgendeinen Hoskupokus zu treiben, und da hat das Orakel gesagt, dass Sie die fleischliche Wiedergeburt von Adam, Noah, Abraham et cetera pp. sind, also auch der jetzige Fürst der Drusen, und nun kommen diese naiven Menschen ganz einfach, um Sie zu holen.«
»Ja, ja, ich verstehe schon«, sagte Jack, die letzte Schnalle am Sattel festziehend.
»Aber Sie werden doch nicht auf so etwas eingehen!«
»Und wenn ich's nun zu tun gewillt bin?«
»Na, wenn man Sie einmal dort oben hat, dann lässt man Sie auch nicht gleich wieder so laufen. Darauf können Sie Gift nehmen. Dann betrachtet man Sie gewissermaßen als Talisman, von dem Glück und Unglück der Drusengesellschaft abhängig ist.«
»Ja, ja, ich verstehe schon«, wiederholte Jack gleichmütig. »Für mich aber kommt hier nur eins in Betracht.«
»Und das ist?«
»Sie kennen diese Hochburg der Drusen?«
»Nur von außen.«
»Sie ist nicht ersteigbar?«
»Da sind geheime Zugänge, und die kennen nur die Eingeweihtesten dieser Kerls.«
»Aber ich werde hineinkommen.«
»Ja, um Sie nicht wieder herauszulassen.«
»Für mich aber ist das der kürzeste Weg, um wieder mit meiner Evangeline vereint zu werden, und das gibt für mich den Ausschlag — ich gehe mit dem Scheich!«
Jack hätte noch mehr sagen können, er tat es nicht, und für den dicken Engländer mit dem Kindergesicht war es auch nicht nötig.
»Ja, ja, ich verstehe«, sagte Mr. Snob. »Dort in diesem geheimnisvollen Felsennest ist Ihnen das Kind wie jede andere Person wirklich unerreichbar...«
»So aber habe ich Hoffnung, dass ich Evangeline noch heute sehe. Und ich denke: Wo ich hineinkomme, da werde ich auch wieder herauskommen.«
»So habe auch ich stets gedacht, habe mich ebenfalls niemals einsperren lassen, und deshalb erlauben Sie wohl, dass ich Sie begleite.«
Mit freudigem Erstaunen fuhr Jack gegen jenen herum.
»Wie? Sie würden mich begleiten?!«
»Weshalb nicht? Ich suche mir jetzt nur ein Pferd aus, das meine drei Zentner tragen kann.«
»Aber die Gefahr, welche...«
»Die kenne ich vielleicht besser als Sie. Und sehe ich etwa aus wie ein Mann, der sich vor irgend etwas fürchtet?«
Nur ein Handschlag, und der Freundschaftsbund auf Tod und Leben war zwischen den beiden besiegelt.
Sie hätten erst erwägen sollen, ob der Scheich den Anderen auch mitnehmen wollte, ihm dann nicht wenigstens den Eintritt in das Allerheiligste verbieten könnte, aber bei einem solchen Bunde auf Tod und Leben, auch wenn dabei keine schwülstigen Worte gemacht worden sind, ist ja Derartiges gar nicht nötig. Wohin der eine nicht kommt, geht eben auch nicht der Andere.
Als Jack sein Pferd hinausführte, kam van Hyden an, der erst jetzt alles richtig erfasst hatte.
»Jack, was willst du tun?!«
Mit seinem Schwiegervater wurde Jack sehr schnell fertig, brauchte ihm all seine Pläne gar nicht erst zu offenbaren.
»Ich bringe Evangeline zurück, Mr. Snob begleitet mich. Ihr bleibt unterdessen hier, auch Mr. Snobs Diener, könnt euch aber zu jeder Zeit zum Aufbruch bereithalten.«
Da kam Mr. Snob schon beritten an. Er hatte in dem Stalle der türkischen Kavallerie wirklich ein Pferd gefunden, das diese Fleischlast von drei Zentnern auf die Dauer tragen konnte. Trotz seiner Mächtigkeit machte es dabei einen ganz gelenkigen Eindruck.
»In der Wüste ist es ein Vogel, im Gebirge verwandelt es sich zur Gämse — und Gott weiß, was sein Besitzer, ein alter Wachtmeister, mir sonst noch alles von seinem Gaule vorgeschwärmt hat. Ja, Prachtrosse haben sie hier, das muss man ihnen lassen. Erst aber frühstücken wir doch wohl und nehmen zur Vorsicht gleichzeitig ein doppeltes Mittagsmahl ein.«
Der Scheich sah die beiden Reiter kommen, welche wieder abstiegen.
»Dieser Mann ist mein unzertrennlicher Freund, er wird mich begleiten.«
»Wie du befiehlst, Emir«, entgegnete der Scheich, sich verbeugend.
»Er kommt mit nach el Schommar.«
»Wie du befiehlst, Emir«, wiederholte der Scheich immer wieder so demütig.
»Wenn ich Großemir der Drusen sein werde...«
»Du bist es schon, indem du schon deine Zusage gegeben hast.«
»So wird dieser mein Freund meine rechte Hand sein.«
»Der lebendige Berg des Sinais soll dein Ratgeber sein, wenn du es befiehlst, Emir.«
Diese Angelegenheit war also erledigt, ohne dass die beiden noch daran gedacht hätten, dass sie hierbei auf Schwierigkeiten stoßen könnten.
Die schon bestellte Mahlzeit wurde eingenommen, an der auch der Scheich teilnahm, und wenn er nicht viel zulangte, so kam dies wohl nur daher, weil er immer staunend beobachten musste, was für einen Appetit der englische Riese, dem er schon den Namen eines lebenden Berges gegeben hatte, entwickelte.
Dann ein nur kurzer Abschied, und die drei stiegen in den Sattel. Außer seinen gewöhnlichen Waffen nahm Jack auch die solide Bambuslanze mit, welche er sich zum Kampfe gegen die Haifische gefertigt hatte.
»Nun, und Sie, Mr. Snob«, fragte er diesen, dessen Sattel nicht einmal Pistolenhalfter hatte, »nehmen Sie keine Waffe mit?«
»Ist das nicht Waffe genug?«, entgegnete der dicke Engländer, mit seinen Pumphosen zu Pferde erst recht merkwürdig aussehend, und fuchtelte mit seinem dünnen Spazierstöckchen in der Luft herum.
»Wenn Sie meinen!«, lachte Jack, und der kleine Reitertrupp setzte sich in Bewegung.
Es war die trostloseste Felsenwildnis. Kaum ein Grashälmchen konnte der Blick hin und wieder entdecken. Aber einen imposanten Eindruck machten diese öden, wildzerrissenen Felsmassen doch, deren steile Wände oft bis zum Himmel emporstiegen.
Von der ersten Schlucht, die von Kabel el Tor aus ins Gebirge geführt hatte, zweigten sich überall Nebenschluchten ab, es war ein vollständiges Labyrinth von Gängen, und merkwürdigerweise war kaum ein Ansteigen zu bemerken, ihr Boden lag mit der Küste in einer Fläche. Es sind richtige Einschnitte, die das Sinaigebirge kreuz und quer durchziehen.
»Könnten Sie sich hier zurückfinden?«, fragte Mr. Snob, nachdem er schon immer über dies und jenes geplaudert hatte, sich dabei des Deutschen bedienend.
»Ob ich es könnte?«, wiederholte Jack erstaunt. »Es wäre ja schlimm, wenn ich das nicht könnte!«
»Na, ich könnte es nicht. Ich bin zweimal nach dem Katharinenkloster gepilgert und habe dabei auch stets el Schommar erblickt, aber nie von Kabel el Tor aus, sondern von Norden her, und da ist es eine fast schnurgerade Schlucht, die man fünf Stunden lang durchwandern muss. Mir kommt es überhaupt fast vor, als ob uns der Scheich im Zickzack führe.«
»Im Zickzack wohl, aber er sucht doch immer den kürzesten Weg zu nehmen. Umwege machen wir keinesfalls.«
»Das können Sie beurteilen?«
»Ganz sicher.«
»Wie machen Sie denn das?«
»Das sagt mir der Instinkt.«
»Und dieser würde Sie auch wieder aus diesem Labyrinth herausleiten?«
»O nein, da kämen meine Sinne, meine Augen in Betracht. Es sind doch bemerkenswerte Felsbildungen genug vorhanden, auch die glatteste Felswand sieht anders aus als eine andere, das heftet sich unauslöschlich meinem Gedächtnis ein, dass ich den Weg, den ich einmal gegangen bin, immer wiederfinde.«
»Das könnte ich von mir nicht sagen, da wäre ich verloren wie eine tote Ratte, und da würden mir auch alle meine Geheimwissenschaften nichts helfen«, gestand Mister Snob.
»Das glaube ich schon«, lächelte Jack, »da müssten Sie eben wie ich im Wald und in der Prärie großgezogen sein, und besonders die eintönige Prärie hat ja noch viel weniger Unterscheidungsmerkmale als solch ein Felsengebirge, und doch finden wir unseren Weg mit unerschütterlicher Sicherheit zurück.«
»Auch bei Nacht würden Sie sich hier zurückfinden?«
»Nein, bei Nacht hört mein Unterscheidungsvermögen auf, lässt sich wenigstens nicht mit dem während des Tages vergleichen. Da nützt mir auch mein Instinkt nichts, wohl aber können wir uns auf den unserer Pferde verlassen. Die würden sich nach der Küste zurückfinden, in schnellster Karriere, ohne sich in der größten Finsternis den Kopf an einer Mauer zu zerschellen. Auf meine Nachtmär wenigstens kann ich mich verlassen, sie führt diesen Namen nicht umsonst, und deshalb also, Mister Snob, dürfen wir uns niemals von unseren Pferden trennen, wir sind eben Zentauren.«
Sie besprachen noch weiter, wie sie sich verhalten wollten.
Schweigend ritt der vermummte Scheich voraus, sich nicht um seine beiden Begleiter kümmernd, und kein anderer Mensch zeigte sich.
So waren bald zwei Stunden vergangen, als Jack mit ausgestreckter Hand nach oben deutete.
»Sollte das nicht die Hochburg der Drusen sein?«
»Gewiss, das ist el Schommar. Ich sehe sie nur zum ersten Male von dieser Seite.«
Jacks Augen und Mister Snobs Erfahrung hatten dazu gehört, um in dem winzigen Dinge, welches dort oben in einer Höhe von mindestens zweihundert Metern platt an der Felswand klebte, eine menschliche Wohnung zu erkennen. Es glich wirklich mehr einem Adlernest, von dem man nur den äußeren Rand erblickte.
»Es ist ja auch nichts weiter als die äußere Wallmauer«, erklärte der Engländer, »sonst ist das ganze ehemalige Kloster, die jetzige Burg, in den Felsen hineingehauen. Das heißt, so sagt die Fama. Dort hinaufgekommen ist niemand, der nicht zu den Drusen gehört, und von diesen dürfen auch nur die Eingeweihtesten dort oben hausen oder die Burg bei besonderen Gelegenheiten betreten.«
»Ja, das glaube ich, dass dort hinauf kein Weg führt«, meinte Jack.
»Wenigstens nicht von außen. Alles unterirdisch, im Innern des Felsenberges soll ein Weg hinauf führen.«
»Ob da aber auch Pferde mit hinauf können?«
»Ja, denn dass früher die Mönche, welche doch auch so halbe Wüstenmenschen waren, ihre Pferde mit dort oben gehabt haben, das weiß man bestimmt.«
»Desto besser für unsere Absichten.«
Der Scheich streckte die Hand aus und drehte den Kopf zurück, zum ersten Male seine Begleiter eines Wortes würdigend.
»El Schommar!«
»Wir wissen es, Scheich.«
Der Führer lenkte sein Ross seitwärts in eine engere Schlucht, gleich darauf in eine andere und immer wieder in eine andere.
»Jetzt führt er uns mit Absicht im Zickzack, das merke ich deutlich«, flüsterte Jack nach einer Weile. »Er sucht uns irrezuführen.«
»Und Sie können sich noch immer zurückfinden?«, fragte Mister Snob.
»Bei Tage ich, bei Nacht mein Pferd.«
»Kann denn das jedes Pferd?«
»Das bezweifle ich. Meine Nachtmär kann es.«
Immer wilder ward die Gegend. Kaum konnten sich die Pferde mit ihren Reitern noch zwischen den steilen Seitenwänden durchdrängen, bis wieder ein steiler Kessel kam.
Hier hielt der Scheich und wandte sich halb gegen seine Begleiter.
»Wir sind bald am Ziel, beim Aufstieg zur Burg. Ihr gestattet wohl, dass ich euch jetzt die Augen verbinde.«
Das hatten unsere beiden Freunde allerdings nicht erwartet.
»Die Augen verbinden? Nee, so was gibt's nicht bei mir«, fuhr zuerst der dicke Engländer empor.
»Mir, den du schon den Großemir der Drusen nennst, die Augen verbinden?!«, stimmte Jack ihm ebenso energisch bei. »Wie reimt sich das zusammen?«
»Verzeihe«, entgegnete der Scheich demütig, »es ist nicht etwa, dass ich dir oder deinem Begleiter misstraue...«
»Was, misstrauen!«, unterbrach Jack ihn schroff, denn er wusste, dass es jetzt darauf ankam, die persönliche Autorität zu wahren. »Hast du mich nicht schon den Großemir der Drusen genannt?
»Du bist es.«
»Ich bin der anerkannte Großemir?«
»Ja.«
»Und du wagst, mir die Augen verbinden zu wollen?!«
»Es ist eine heilige Zeremonie der Drusen. Wer zum ersten Male das Tor des Geheimnisses passiert, der muss es mit verbundenen Augen tun...«
»Und dieser Zeremonie soll auch der erste Fürst der Drusen unterworfen sein?«
»Wenn er zum ersten Male diesen zu unserem Heiligtum führenden Aufstieg betritt, ja.«
»Wer hat diese Zeremonie erst geschaffen?«
»Der Stifter unseres Ordens.«
»Und wer war dieser Stifter?«
»Adam.«
»Und ich selbst war Adam, bin es noch heute — hiermit hebe ich diese Zeremonie wieder auf!«
»Bravo!«, lachte Mister Snob leise.
Aber der Scheich, der unter seinem Burnus schon zwei Tücher zum Vorschein gebracht hatte, zögerte noch immer.
»Vorwärts, führe uns!«, herrschte Jack ihn da an. »Ich befehle es dir als dein Großemir!«
Mr. Snob meinte, wie er dann auch erzählte, dass Texas Jack jetzt doch etwas zu energisch vorging, er setzte zu viel aufs Spiel; das wäre noch nicht nötig gewesen, und er sah auch, wie über das gelbe, runzlige Gesicht des Arabers ein tückisches Lächeln huschte.
»Die Fürsten der Drusen«, meinte er, »sind die einzigen Bevorzugten des Menschengeschlechtes, welche sich ihrer früheren Lebensläufe erinnern können, bis zu Adam hinauf, und da du also schon oft genug zu el Schommar hinaufgeritten bist, wenn nicht in diesem, so doch in deinem früheren Leben, so musst du den Weg ja selbst finden können.«
Da war es! Mr. Snob hatte es schon gefürchtet.
In den Kessel, so klein er auch war, mündeten nämlich nicht weniger als sieben Schluchten, eine dicht neben der anderen, aber sternförmig von allen Seiten einlaufend, und wenn die anderen Schluchteingänge so beschaffen waren, wie der Weg, den sie bisher genommen, so war das hier das reine Spinnennetz, wobei jeder passierbare Weg einen Faden bedeutete, und es war absolut nicht zu erkennen, dass einer dieser Wege besonders häufig oder überhaupt benutzt würde.
Doch Jack ließ sich durchaus nicht aus der Fassung bringen.
»Glaubst du denn, du Narr«, herrschte er den alten Scheich nach wie vorn an, »ich wüsste nicht, wie du uns schon immer im Zickzack auf falschen Wegen geführt hast? Hier heraus hätten wir in diesen Kessel kommen sollen, und hier diese Schlucht, fast die entgegengesetzte Richtung zurück, müssen wir weiter. Vorwärts, jetzt mache ich den Führer!«
Und ohne Weiteres lenkte Jack sein Ross in eine der Schluchten ein. Mr. Snob sah den Scheich ein ganz fahles Gesicht bekommen, und er folgte; der Scheich schloss sich ihnen an.
»Alle Wetter, woher kommt Ihnen denn plötzlich diese Kenntnis?!«, rief der Engländer, als Jack ohne Zögern immer wieder in eine abführende Schlucht abbog, einmal links, einmal rechts, aber durchaus nicht immer in die nächste, oft genug übersprang er mehrere Abzweigungen.
»Ich folge einfach den Spuren«, lachte Jack, »die sich nur auf dem Zickzackwege zeigen, den ich jetzt nehme, während in den anderen Schluchten keine Spuren von solchen Fährten sichtbar sind.«
»Spuren?«, fragte Mr. Snob, den felsigen Boden unier sich musternd. »Ich kann nichts davon merken.«
»Das glaube ich schon; auch diese Araber werden es nicht für möglich halten, dass ihre unbeschlagenen Pferde selbst im Laufe der Jahrhunderte in diesen Granit Spuren eingetreten haben, aber solch einen alten Fährtensucher wie mich, der auch im Felsengebirge zu Hause ist, kann man doch nicht täuschen.«
»Ja, sehen Sie denn nur wirklich etwas?«, staunte der Engländer immer mehr.
»Überall, wohin ich auch blicke. Wenn Sie neben mir reiten könnten, würde ich es Ihnen zeigen. Direkte Hufabdrücke kann ich allerdings nicht erkennen. Hier aber ist auf einem weißen Stein ein schwarzer Strich, nur wie ein Haar. Er sagt mir, dass es hier dennoch beschlagene Pferde gibt. Hier liegt gleich ganz offen ein langes Pferdehaar. Hier an der Seite in Pferdekopfhöhe ist wieder solch ein glänzender Strich, und zwar glänzt er silbern — ein Pferd hat ihn mit seinem silbernen Gebiss hinterlassen — und hier liegt ein winziger Überrest von jener gelben Frucht, welche Pferde für gewöhnlich von Zeit zu Zeit massenhaft fallen lassen. Im Übrigen sind derartige Spuren äußerst vorsichtig beseitigt worden, für mich genügen aber doch die letzten Überreste, welche noch den Beduinenaugen entgangen sind. In dieser Hinsicht, wenn es sich um das Erkennen von Spuren handelt, können sich die Beduinen, so falkenäugig sie auch sonst sein mögen, doch nicht mit den amerikanischen Rothäuten messen.«
Eine Schlucht zeigte einmal eine ziemlich lange, gerade Strecke, und da bogen um die jenseitige Ecke einige arabische Reiter.
»Aufgepasst!«, rief Jack, sich immer des Deutscheu bedienend, wenn er mit Mr. Snob sprach. »Jetzt bin und bleibe ich der schon anerkannte Emir der Drusen, der hier allein zu befehlen hat.«
Und es zeigte sich, dass der fremde Mann, den man aber schon an seiner Kleidung erkennen konnte, wenn man ihn kennen wollte, hier tatsächlich erwartet wurde, und zwar nicht als Fremder.
Kaum erblickten die Araber die ihnen Entgegenkommenden, als sie ihre Rosse etwas zurückdrängten und in die nächste Seitenschlucht einlenkten. Denn alle diese Gänge des steinernen Spinnennetzes waren so eng, dass sich zwei Reiter nicht ausweichen konnten.
Der erste von den fünf senkte seine Lanze, als Jack ankam, und dieser hielt für eine halbe Minute.
»Wie heißt du?«, redete er ihn an.
»Mansor ben Habid.«
»Wohin reitet ihr?«
»Nach Hakir.«
»Wozu?«
»Wir sollen Datteln holen.«
»Wie weit ist Hakir?«
»Drei Stunden.«
»Weißt du, wer ich bin?«
Der Angeredete senkte seine Lanze, mit der er diesen Engpass gegen ein ganzes Bataillon hätte verteidigen können, noch tiefer.
»Du bist der löwenkühne Franke, den wir als unseren Emir erwarten«, war die demütige, aber mit flammenden Augen gegebene Antwort, als sei er schon stolz auf solch einen Scheich.
»Wie weit ist es noch bis zum Aufstieg nach cl Schommar?«
»Er beginnt gleich dort hinter der Ecke. Scheich Hassan el Schommar, welcher der Burg befiehlt, wird dich ja führen.«
»Danach frage ich dich nicht. Ist alles zu meinem Empfang vorbereitet?«
»O, Emir, wie kannst du noch fragen! Hofften wir doch gewiss, dass Scheich Hassan dich bringen würde.«
»Befindet sich das Kind oben in der Burg?«
»Es wird sich freuen, dich wiederzusehen!«
»Ganz oben in der Burg?«
»Ganz oben.«
»Mr. Snob, weiter!«
Und Jack trieb sein Pferd an. Der ihm folgende Engländer wusste gar nicht mehr, was er von alledem denken sollte.
»Hört, Jack«, flüsterte er, als er sich noch einmal umgeblickt hatte, »der Scheich spricht mit den Leuten!«
»Daran ist nichts zu ändern. Weiter, vorwärts, vorwärts! — Wir müssen das Eisen schmieden, solange es warm ist.«
»Bei Gottes Tod«, rief der Engländer staunend, »jetzt ahne ich, was Sie vorhaben! — Das ist wohl die kühnste Überrumpelung, welche in der Weltgeschichte jemals passiert ist!«
Auch er setzte sein Riesenpferd in Trab, den mit den Beduinen sprechenden Scheich zurücklassend.
Jetzt wollte also Jack ganz auf eigene Faust vorgehen, in das Heiligtum eindringen. Es war ein tollkühnes Unternehmen, aber es gab kein anderes Mittel, um zum Ziele zu gelangen, nachdem der Scheich ihn einmal so weit gebracht hatte.
Als Jack um die nächste Ecke bog, sah er vor sich einen großen Torbogen, in die Steinwand eingehauen. Verschiedene Araber standen herum, neben ihren Pferden, einige auch noch beritten.
Das Tor führte in ein Gewölbe, schwach erhellt, und im Hintergrunde erblickte Jack eine breite Steintreppe mit niedrigen und so breiten Stufen, dass sie auch von einem Pferde begangen werden konnte, und soeben kam ein Reiter diese Treppe herab.
Ohne Zögern ritt Jack an den ihn anstarrenden Arabern vorbei, und jetzt konnte sich ihm sein Begleiter zur Seite halten.
»Der Scheich eilt uns nach.«
»Mag er. Wir lassen uns durch nichts aufhalten und durch nichts aus dem Sattel bringen. Verstanden?«
»Na, wie dieses Abenteuer noch ausgeht, darauf bin ich doch gespannt«, meinte der Engländer kaltblütig.
Der Scheich hatte die beiden eingeholt, drängte sich an Jacks Seite.
»Was machst du, Anglisi?«
»Nun, ich halte meinen Einzug in meine Burg.«
»Du musst dich unseren Gebräuchen unterwerfen!«
Also noch immer keinen direkten Widerstand gegen dieses willkürliche Eindringen, und Jack blieb bei seiner Haltung. Er war der unumschränkte Herrscher — so wie damals, als er den Dahomey die Speisekarte hatte vorlesen lassen.
»Euren Gebräuchen? Willst du mich die Gebräuche der Drusen kennen lehren?«
Unterdessen begannen schon die drei Rosse die rampenähnliche Treppe zu erklimmen, welche durch Öffnungen in der Felswand schwach, aber genügend erleuchtet wurde.
»Es sind heilige Zeremonien.«
»Eben weil sie heilig sind, kenne ich sie am allerbesten.«
»So musst du doch wissen, dass kein Pferd diese Treppe ersteigen darf.«
»Narr, lass dich nicht auslachen! Kam uns vorhin nicht ein Reiter entgegen? Sitzt du nicht selbst auf einem Ross?«
»Ja, diese Pferde sind schon geweiht, das deinige und das deines Freundes müssen erst noch geweiht werden.«
»Jedes Pferd, auf dem ich sitze, ist nicht nur geweiht, sondern schon geheiligt, und dasselbe gilt von dem Pferde meines Freundes. Weshalb? Weil ich es will!! Oder hast du da etwas zu widersprechen?«
Jack schien vor Übermut der Kamm immer mehr zu schwellen. Aber wir haben schon früher einmal des Längeren davon gesprochen, was es heißt, einen Menschen zu düpieren. Wer das am besten versteht, dem gehört die Welt.
Und dieser Scheich ließ sich düpieren. Es konnte ja auch gar nicht anders sein. So etwas war ihm eben in seinem ganzen Leben noch nicht passiert. Widersprüche hatte er allerdings noch immer.
Mit Erleichterung konstatierte Jack zunächst, dass es hier keine Türen zu geben schien. Sie waren schon ziemlich hoch hinauf, und er hatte noch kein Tor gesehen, welches die Treppe verschlossen hätte.
Diese führte in großen Bogen und im Zickzack hinauf, immer von außen her Licht erhaltend. Ohne dieses zufällige Zusammentreffen aller Umstände hätte er freilich auf eigene Faust niemals hier eindringen können. Noch immer konnte an jedem Vorsprung ein einzelner Mann nur mit einer Lanze ein ganzes Bataillon aufhalten, und Menschen gab es hier genug, und keiner der Araber hatte sein Gesicht verhüllt, sodass es Jack auch nicht unter der Maske eines Beduinen hätte wagen können. Oder wagen hätte er es schon können, aber geglückt wäre es ihm niemals.
Jetzt kamen sie an einem großen Nebenraum vorbei, alles aus dem Felsen herausgemeißelt, in welchem sehr viele Pferde standen, und oberhalb dieser Stallung sah man keinen Reiter mehr auf der Treppe, die hier auch viel steiler wurde, eine richtige Treppe, nicht mehr so rampenartig.
Der Scheich fasste, obgleich er sich von seiner Düpiertheit noch immer nicht erholt hatte, leise Jacks Arm.
»Hier aber musst du vom Pferde steigen, edler Chawaike.«
»Wie wagst du mich zu nennen?!«, donnerte Jack ihn wie ein Jupiter an.
»Hier musst du von deinem heiligen Rosse steigen, hochedler Emir, der du die Sonne der Welt bist.«
»Weshalb denn?«
»Hierherauf darf auch kein geweihtes Pferd.«
»Mit Ausnahme des meinen und des meines Begleiters. Du glaubst es nicht? Ich will es dir zeigen, ich führe hier ganz neue Gesetze ein.«
Schon begann seine Rappstute die Treppe zu erklimmen, und zu seiner Genugtuung sah Jack, dass auch seines Begleiters Riesengaul die steilen Stufen vorsichtig, aber ohne Beschwerde nahm.
»Wenn es nur so gut weitergeht«, meinte Mr. Snob, »dass wir schließlich nicht doch absteigen müssen, weil's zu niedrig wird.«
»In diesem Falle steigt nur einer von uns ab, der andere bleibt bei den Pferden.«
»Wer soll das sein?«
»Wie es die Gelegenheit ergibt. Vorwärts, vorwärts, wer die Sekunden ausnutzt, der ist Herr der Situation!«
Da war der Scheich, der zurückgeblieben, wieder neben Jack, jetzt zu Fuß, und er fasste jene Lanze.
»Aber keine Waffe, keine Waffe!!«, rief er mit fast flehender Stimme.
»Weshalb keine Waffe?«
»Diesen heiligen Ort darf man mit keiner Waffe betreten.«
»Von jetzt ab ist das anders, ich bestimme es hiermit. Das heißt«, setzte Jack schnell hinzu, »nur der Großemir macht von jetzt an darin eine Ausnahme. Das bestimme ich hiermit, basta!«
Mr. Snob genierte sich nicht, in ein Gelächter auszubrechen. Wenn man die ganze Situation richtig betrachtete, war es auch wirklich ein tolles Komödienspiel — Jack freilich mochte es weniger humoristisch zumute sein. In seinem Innern war jetzt jedenfalls jeder Nerv bis zum Zerspringen angespannt.
Die Treppe war zu Ende. Eine ganze Flucht von hallenartigen Räumen, alle in den Stein gehauen, öffnete sich vor ihnen.
Wir sehen nur mit Jacks Augen, und der hatte nicht viel Zeit und Interesse, sich erst lange umzublicken.
Da waren Kanonen, alte, mächtige Dinger, da waren vollständig nach orientalischer Weise eingerichtete Zimmer, da lag ein großer Haufen Datteln...
Die Hauptsache war für Jack, dass er auch hier keine Tür sah und dass die Räume selbst für seines Begleiters mächtige Reitergestalt hoch genug waren.
»Wo ist das geraubte Kind?«, herrschte er den Scheich an.
Da gewahrte er, dass der alte Araber plötzlich ein ganz anderes Gesicht machte. Er schien nach und nach zur Besinnung zu kommen.
»Was willst du mit dem Kinde?«
»Antworte!! Wo ist das Kind?«
»Was fragst du zuerst nach dem Kinde?«, erklang es noch misstrauischer zurück.
»Du willst mir nicht antworten?«
»Nein, und du scheinst deine Stellung denn doch zu überschätzen...«
Jack hörte nicht weiter darauf, was der Scheich sonst noch sagte, er wollte es zunächst einmal auf andere Weise probieren.
»Eva, Evangeline!!!«, ließ er seine Stimme mit Macht erschallen.
Die Wirkung des Rufes war eine ganz überraschende. Nicht, dass das Kind geantwortet hätte, aber ein gellender Schrei ertönte, der aus der Kehle einer erwachsenen weiblichen Person kommen musste, und gleichzeitig sah Jack, zwei weite Räume von sich entfernt, an der offenen Tür ein Weib vorüberjagen das in den Armen etwas wie ein Bündel hielt.
Das Weib hatte arabische Gewänder getragen, Jack hatte ihr Gesicht, obgleich dieses unverhüllt sein mochte, nicht gesehen, nur die schwarzen, nachflatternden Haare; aber wenn er Evas Pflegerin nicht schon an dem Schrei erkannt hätte, so sagte ihm doch eine ganz bestimmte Ahnung, wer dies nur sein könne und was sie da in eine Decke gehüllt getragen hatte.
Und schon spornte er seine Rappstute an, donnernd schlugen die stahlbeschlagenen Hufe auf die Teppiche, welche diese Wucht nicht dämpfen konnten. Mit zwei Sätzen hatte das Ross die beiden Räume durchmessen — — dort floh Margot durch einen vierten Raum — der Reiter ihr nach, beim Nehmen der Türen auf dem Pferdehals liegend — quer in dem dritten Zimmer stand ein Diwan mit hoher Lehne, Nachtmär im Sprunge darüber hinweg — — und so ging die wilde Jagd hoch zu Ross weiter aus einem Zimmer ins andere, über Diwane und Tische und andere Möbel hinweg, hinter dem Weibe her.
Margot war zu Fuß in dieser endlosen Zimmerreihe im Vorteil. Aus einem Zimmer ins andere, die Türen in scharfen Ecken genommen, immer um die Sofas und Tische herum, hinter sich Stühle geworfen, und der wilde Zimmerreiter immer hinterher.
Sie währte nur kurz, diese tolle Parforcejagd, wie wohl noch kein Zirkusreiter eine solche ausgeheckt hat, um dem Publikum wieder einmal etwas ganz Neues zu bieten.
Mitten im Sprunge über einen Tisch hatte er die gellend Schreiende bei den fliegenden Haaren gepackt, mit dem nächsten Griff hatte er ihr das Bündel ans den Armen gerissen — ja, das Tuch verhüllte eine kleine, menschliche Gestalt, die sich selbst von der Decke zu befreien suchte. Rasch half Jack nach — — Evangeline kam zum Vorschein.
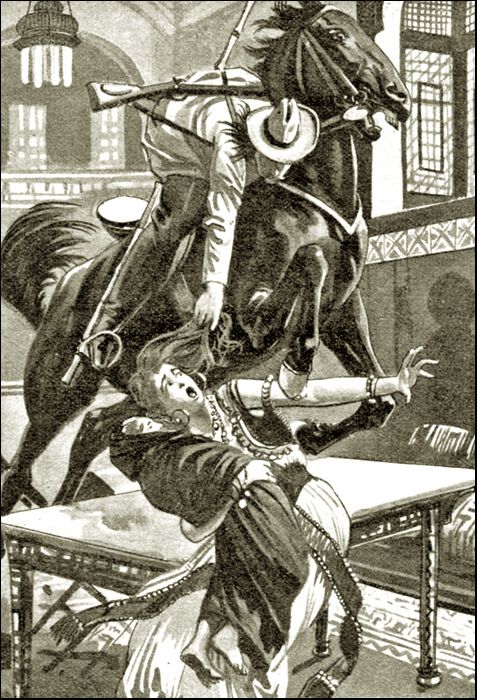
»Jack, mein lieber Jack!!«, erklang es jauchzend, und ein Ärmchen schlang sich um seinen Hals.
Und der wilde Reiter, der bei der tollen Jagd durch die für solch einen Ritt doch immerhin engen Zimmer nicht einmal seine lange Lanze hatte fahren lassen, hatte das Weib vergessen, jubelnd drückte er das wiedergefundene Kind an seine Brust, in der die Treue wohnte, küsste es immer und immer wieder... aber mitten in diesen Liebkosungen erstarrte er, um sein Ross von Neuem anzuspornen.
Das war Kampfgetobe! Zeternde und brüllende Araber. Aber so viel Lärm sie auch machten, sie wurden von des Engländers durchdringender Stimme übertönt, und sie klang höchst erbost.
»Was? Ihr wollt mich vom Pferde ziehen, ihr Lumpengesindel — ihr winzigen Pygmäen? — Hier, lernt mal mein Spazierstöckchen kennen — das ist ein echt senegambischer Schambock — da, nimm das — verdaue den — und das — und das, du Vieh!«
Jack wusste bereits, mit welch furchtbarer Waffe sein Begleiter versehen war. So ganz ohne Waffen hätte er Mr. Snob doch nicht mitgenommen, er hatte doch gelacht, als ihm jener als seine einzige Waffe das dünne Spazierstöckchen zeigte. Gerade als Pferdebändiger und Schausteller, der auch viel mit wilden Tieren zu tun bekam, wusste Jack recht gut, was für eine Bewandtnis es mit dem rotbraunen, glasartig durchsichtigen Stöckchen hatte, und er wünschte nur, solch ein Spazierstöckchen, welches einige hundert Mark kostet, wenn es überhaupt zu haben ist, ebenfalls zu besitzen.
Wir müssen einmal etwas Physik treiben. Es gibt physikalische Gesetze des Falles, des Druckes, des Zuges, des Stoßes usw. Alle diese mechanischen Resultate einer wirkenden Kraft sind von dem Physiker schon genau studiert und in mathematische Formeln gekleidet worden, alles lässt sich mit Zahlen berechnen. Nun gibt es aber in der Natur auch mechanische Erscheinungen, Kraftresultate, welche von den Physikern noch nicht in Regeln gezwängt werden konnten.
Eine solche Kraft ist der Schlag und seine Wirkung. Man braucht kein Gelehrter zu sein, um bei einigem Nachdenken zu erkennen, dass Schlag und Schlag doch etwas recht Verschiedenes sein kann. Was für ein Unterschied ist es doch, ob man einen Nagel mit einem Holzhammer oder mit einem eisernen einschlägt, ob der letztere an einem starren oder an einem elastischen Stiel befestigt ist! Man meint, weil der Stahlhammer schwerer sei als der hölzerne? Ein Gummischlauch ist viel leichter als eine gleichgroße Eisenstange, aber mit dem ersteren bringt man ganz andere Schlageffekte hervor als mit der letzteren. Allerdings nicht beim Einschlagen eines Nagels. Nein, da kommen ganz andere Einflüsse in Betracht, wovon die Wirkung abhängig ist, und das hat man eben bisher noch nicht in mathematische Regeln prägen können. Jedenfalls aber weiß jeder Schuljunge — d. h., jeder echte Junge, für den Dummheiten dazu da sind, dass sie gemacht werden — was für ein Unterschied zwischen einem ostindischen Bambusrohr und einem germanischen Haselnussstöckchen ist. Ei, so ein Haselnussstock zieht doch ganz anders! Ja, in dem ›es zieht‹ liegt es, da hat der Volksmund das Richtige getroffen.
Gelegentlich eines Mordes in einer englischen Stadt kam der Unterschied der Schlagobjekte aufs wissenschaftliche Tapet. Ein in den Dienst gehender Feuerwehrmann war tot und beraubt aufgefunden worden, mit total zertrümmertem Schädel, aber auf dem Kopfe hatte er noch den Metallhelm festgeschnallt, der ganz unverletzt war. An Totenschädeln, denen man solch einen Feuerwehrhelm aufsetzte, wurden Versuche angestellt. Eine Eisenstange, eine Axt lädierten wohl den Metallhelm, konnten ihn auch zertrümmern, aber der Schädel selbst blieb unversehrt oder wurde erst verletzt, wenn der Schutzhelm durchdrungen war. Anders, als man es mit einem Gummischlauch und dann mit einem Gummiknüppel probierte. Der Gummiknüppel ließ den Helm unbeschädigt, zertrümmerte dagegen den darunter liegenden Schädel. Wir wollen nicht bei dem verweilen, was die Gelehrten da alles von Elastizität, Anschmiegungsfähigkeit und Fortsetzung der Schlagwirkung in allen Molekülen vorbrachten, wodurch solch ein Phänomen ermöglicht wird. Wir bleiben bei dem ›es zieht‹, welche Wirksamkeit man am einfachsten an der flachen Hand studieren kann, in die man mit dem zu prüfenden Gegenstand hineinschlägt. Da sind die Kehle und das ganze Gesicht das feinste physikalische Messinstrument, je nachdem man dabei das ›Au!‹ oder ›Autsch!‹ sagt oder schreit oder brüllt und je nachdem man dabei Grimassen schneidet.
Eine Eisenstange oder ein Hammer hat da nicht viel zu sagen. Man schlage sich doch mit einem Hammer in die flach in die Luft gehaltene Hand. Da kann man schon einen tüchtigen Puff vertragen. Ein elastisches Stöckchen dürfte schon ein kleines ›Au!‹ hervorbringen. Ein viel intensiveres ›Au!‹ schon mit einer Grimasse erzeugt ein Gummischlauch (es kann auch Kautschuk sein). Noch besser ist ein elastischer Gummiknüppel. Nicht zu verachten ist die steife, aus Lederriemen zusammengeflochtene Hundepeitsche. Bei Totschlägern sehr beliebt ist der Ochsenziemer, wenn ihnen das Kapital fehlt, sich eine ungespaltene Walfischbarte, im kleinen Fischbein genannt, zuzulegen, das ist nämlich auch Teufelszeug. Am empfehlenswertesten für alle, die gern hauen, ist aber die Nilpferdpeitsche, von den Buren Schambock genannt. Doch soll gleich gesagt werden, dass es immer noch etwas Besseres gibt, wenn man nun einmal gern prügelt: das ist dieselbe Peitsche aus der Haut des Rhinozeros', leider nur sehr schwer zu haben.
Man muss einmal solch einen Schambock aus Rhinozeroshaut in der Hand gehabt haben, um glauben zu können, was damit zu machen ist. Mit solch einem fingerstarken, leichten Stöckchen ist mit spielenden Schlägen eine zolldicke Tischplatte kurz und klein geschlagen, was mit einer schweren Eisenstange gar nicht zu erzielen ist, und wenn man sie auch mit beiden Fäusten wie einen Schmiedehammer handhabt. Und soll einmal ein Physiker mit Zahlen erklären, woher gerade die Rhinozeroshaut einen so furchtbaren Schlageffekt besitzt. — — —
Jack bekam es zu sehen. Er hatte nicht nötig, seine eingestemmte Lanze zu benutzen.
Im ersten Zimmer saß noch der englische Riese auf seinem türkischen Riesengaul und fuchtelte schimpfend mit seinem durchsichtigen und goldberingten Stöckchen herum, und um ihn im Kreise lag am Boden ein Dutzend Araber mit zerschlagenen Knochen.
Doch noch immer waren genug vorhanden, welche den Schambock noch nicht gekostet hatten. Wie die Ameisen kribbelten sie um den Reiter herum, dabei ein wütendes Geschrei ausstoßend, krallten sich in seine Hose ein, um ihn vom Pferde zu reißen — sie hatten das Schicksal ihrer Kameraden nur noch nicht bemerkt, es ging alles viel zu schnell. Der Gegner hatte als Verteidigungsmittel nichts weiter als ein dünnes Spazierstöckchen; sie hatten es eben selbst noch nicht zu schmecken bekommen, und ihr eigenes Gebrüll übertönte das Wimmern und Schmerzgeheul der schon am Boden Liegenden. — Da traf die steife Rhinozerospeitsche abermals einen Kopf. Es war nicht anders, als ob man ein rohes Ei aufschlage, so splitterten die Schädelknochen und spritzten Blut und Hirn umher — das war gesehen worden, eine allgemeine Erstarrung — und jetzt hörte man das Wimmern und Schmerzgeheul der am Boden Liegenden, die nicht nur so einfach gestürzt waren — und der Riese, hoch zu Ross, blieb nicht still, er schimpfte und schlug weiter um sich, und wohin das dünne Stöckchen traf, da brachen Arm- und Schulterknochen und zersplitterten Schädel — und da kam die Erkenntnis, und wer noch dazu imstande war, der suchte unter gellendem Angstgeheul sein Heil in schnellster Flucht.
In diesem Augenblick aber kam Jack angesprengt, er sah nur noch den Schlussakt des seltsamen und furchtbaren Schauspiels, und so hatte er nicht mehr nötig, von seiner eingelegten Lanze Gebrauch zu machen.
»Ich habe das Kind — vorwärts, zurück!!«
Mr. Snob verstand dieses sich scheinbar widersprechende Kommando, er warf sein Pferd herum, nur durch den Vorraum, dann lag vor ihnen wieder die steile Treppe.
Jacks Rappstute hätte sie wohl wie eine Gämse hinunterspringen können, Mr. Snobs kolossaler Gaul war trotz aller Lobpreisungen seines türkischen Herrn vorsichtiger, und darauf nahm Jack Rücksicht, er hielt seine Nachtmär zurück.
Es war ein Glück für die beiden, dass in diesem Heiligtum hier oben keine Waffen getragen werden durften, sonst wären sie doch einfach von hinten weggeschossen worden — aber ebenso sollte es ein Glück für sie werden, dass sich die oben befindlichen Drusen nicht nur aus ein allgemeines Wutgeheul beschränkten, sondern dass man die Fliehenden auch verfolgte, allerdings noch immer in respektvoller Entfernung von ihnen bleibend. Jedenfalls aber drängte sich doch eine große Menschenmasse ihnen nach, die Treppe herab.
Dort, wo sich der Pferdestall befand, wo die Rampe begann, wurde es gefährlicher. Man wollte dem neuerwählten Emir, der sich so schmählich betragen hatte, und seinem Begleiter den Ausgang verlegen, es mochte ja alles auch hier unten schon bekannt geworden sein, und diese Gebirgsbewohner waren doch echte Beduinen, die zu Fuß nur halbe Menschen sind, schnell hatten sie sich auf ihre Rosse geschwungen, und den beiden die Treppe Herabreitenden starrte ein Lanzenwall entgegen.
Wohl waren die meisten auch mit Gewehren bewaffnet, sogar mit ganz modernen Hinterladern, mindestens hatten sie Pistolen im Gürtel — aber hinter den beiden war ja die ganze Treppe gedrängt mit Drusen besetzt, sie hätten zwischen ihre eigenen Kameraden geschossen, so wollten sie allein mit ihren Lanzen den Fliehenden den Ausgang versperren und sie töten, und das eben war das Glück der beiden. Sonst wären sie doch ganz einfach durch eine Salve niedergestreckt worden.
Jack wandte sich im Sattel und gab seinem Begleiter das Kind.
»Hier nehmt — es ist mein eigenes Leben — ich decke euch — und nun mir nach — durch, wir müssen durch!!«
Hätte der Engländer später erzählen sollen, was er damals sah, er hätte es nicht gekonnt. Er sah einen wütenden Achill, schlimmer als ein rasender Roland in die Reihen der Feinde brechen.
Die Lanze stoßfertig am rechten Arm, in jeder Hand einen Revolver, so stürmte Jack auf seiner Rappstute die letzten Stufen der steilen Treppe hinab, dem starrenden Lanzenwall entgegen, schon vorher ununterbrochen feuernd, und dann war er mitten drin zwischen den Lanzen, die ihm schon nichts mehr anhaben konnten, während er selbst mit der seinen, kurz gefasst, noch wie ein Fische spießender Harpunier arbeitete.
Ein Mann gegen mindestens fünfzig — und diese hatten sich vollkommen überrumpeln lassen, keiner war auch nur zu einem einzigen Lanzenstoße gekommen, auch wenn ihn keine unfehlbare Revolverkugel getroffen hatte. Ein furchtbarer Gott war mit Donner und Blitz über sie gekommen und zwischen sie gefahren; selbst seine Lanze verwandelte sich in einen feurigen Blitz, und auch sein Streitross war darauf abgerichtet, alles niederzuwerfen.
Mr. Snob hätte eigentlich nichts weiter zu tun brauchen, als Jack einfach nachzureiten, das Kind in seinen Armen wiegend, ihm ein Schlummerliedchen singend. Denn wer unverletzt hinter ihnen blieb, der war nicht mehr fähig, einen Stoß zu führen oder einen Schuss abzufeuern — er war geblendet, betäubt von dieser Erscheinung des schrecklichen Kriegsgottes.
Mr. Snob aber blieb doch nicht untätig, er half noch wacker nach, die gehauene Gasse zu verbreitern, und die Wirkung seines Schambocks erzeugte nur neuen Schrecken.
Sie waren durch. Die langstufige Rampe konnte auch der Riesengaul mit flüchtigem Huf nehmen, und ehe sich die hinter ihnen Gebliebenen aus ihrer Betäubung erholt hatten, an ihre Schusswaffen dachten, waren die beiden schon um die nächste Ecke herum, und nun kam Ecke nach Ecke.
Beduinen mit feindlichen Mienen begegneten ihnen noch genug, zu Pferd und zu Fuß. Aber wer nur die Waffe hob oder nach einer anderen Waffe griff, den hatte schon Jacks frisch geladener Revolver oder seine Haifischharpune unschädlich gemacht.
So erreichten sie das Freie, und am Ausgange trat ihnen niemand mehr entgegen. Noch ein kurzer Galopp durch die nächste Schlucht, und Jack hielt einmal, um sich das Kind geben zu lassen.
»Gott's Wetter!«, musste Mr. Snob bei dieser Gelegenheit seinem Staunen einmal Luft machen. »Sind Sie denn nur wirklich ein Mensch?!«
Jack gab ihm vorläufig darüber keine Auskunft. er drückte das Kind an sich.
»Meine Evangeline!«
Es wäre bald seine letzte Freude und sein letztes Wort gewesen. Aus der Seitenschlucht, neben der sie gerade hielten, sah Mr. Snob eine Lanzenspitze hervorkommen, einen langgestreckten Pferdehals, einen ganzen Beduinen...
Jacks Tod wäre besiegelt gewesen, und die Lanzenspitze hätte erst das Kind durchbohrt, es so an seinem Herzen festnagelnd.
Glücklicherweise hatte sich Mr. Snob mit der rechten Hand, die das rote Spazierstöckchen hielt, gerade am Kopfe gekratzt, so war der Schambock auch gerade in der richtigen Lage, Mr. Snob brauchte nicht erst zum Schlag auszuholen, und in dem Kinderköpfchen des Riesen steckte doch etwas anderes drin als nur ein Kindergehirn — mit Gedankenschnelle sauste der Schambock herab, noch ehe die Lanzenspitze das Kind berührt hatte — und Ross und Mann lagen am Boden.
Dem Beduinen war nur der Arm, der die Lanze geführt, zerschmettert, das Pferd war sofort tot — der Schambock hatte ihm den Hals gebrochen.
Sie waren wieder in Kabel el Tor eingetroffen. Mit kurzen Worten halte Jack seinem Schwiegervater berichtet. »Und Margot?«
»Was geht die mich an? Ich habe meine Evangeline wieder — nicht als Hellseherin, die nur Mariechen wiederverschaffen kann, sondern als mein Liebstes auf Erden.«
Eva konnte nicht viel erzählen. Sie war ganz freundlich behandelt worden, zärtlich von Margot, die immer von ihrem geliebten Jack gesprochen hatte, wie sie nun ihre Mutter werden wolle usw. Wie gesagt, viel konnte man aus dem Kinde nicht herausbringen, Jack selbst fragte gar nicht, und sehr bald verbot er seinem Schwiegervater dieses Ausforschen.
»Vater, kannst du dich denn gar nicht in die Lage des armen Kindes versetzen?! Es ist doch auch noch ganz erschöpft und verwirrt.«
Außerdem war jetzt zu Nebendingen gar keine Zeit mehr. Ein nach Norden gehender Dampfer zeigte sich, der sehr nahe längs der Küste fuhr; auf Jacks Geheiß signalisierte die Strandwache, und der Kapitän war bereit, Passagiere mitzunehmen, wenn es der Quarantänezustand erlaube.
Die See hatte sich wieder ziemlich beruhigt, und eine Viertelstunde später befand sich die ganze Gesellschaft wohlbehalten an Bord.
»Jack, willst du denn nicht gleich den Milchzahn von deinem Mariechen probieren?«, fragte Evangeline, als sie kaum ihre Kabine angewiesen erhalten hatte.
Es war merkwürdig, wie Jack immer zögerte, die Sehergabe des Kindes zu benutzen.
»Weißt du, wann du wieder in Wachschlaf fallen wirst?«
»Nein, ich selbst weiß das ja nie, auch wenn ich es gesagt habe. Ach, probiere es nur, es wird schon gehen, ich sehne mich ordentlich danach. Sieh, bei jener falschen Haarlocke war das etwas ganz anderes — ich dachte doch nie daran, dass du so betrogen worden seiest, aber — ich weiß nicht — ich nahm die Locke stets mit einem heimlichen Widerwillen in die Hand, es war wie eine Ahnung, dass hier etwas nicht richtig sein könne...«
»Du ahnungsvoller Engel!«, sagte Jack und küsste das Kind.
Dann war er bereit, das Experiment sofort vorzunehmen. Denn ein Experiment, zu dem Vorbereitungen nötig waren, musste es immer sein. Also nicht etwa, dass Eva sofort in Trance fiel, wenn sie nur Jacks Locke in die Hand nahm. Das wäre ja ein fürchterlich krankhafter Zustand gewesen. Dann wäre sie ja auch jedes Mal umgefallen, sobald Jack sie nur berührt hätte. Nein, vor allen Dingen musste ihr eigener Wille dabei sein, in Trance zu geraten, eine starke Sehnsucht, und dann war auch eine gewisse Vorbereitung nötig, sie musste sich ruhig hinlegen, all ihre Gedanken auf den Wunsch konzentrieren, jetzt hellsehend zu werden.
Diese Vorbereitungen wurden getroffen. Wie Jack dabei zumute war, lässt sich denken. Jetzt war der Moment gekommen, da er über Mariechen, die nun ihm wieder gehörte, wenn noch nicht dem Leibe, so doch schon wieder der Seele nach, nicht mehr getäuscht werden sollte!
»Gib mir den Zahn!«, flüsterte da Eva.
Sie hatte das in Gold gefasste Zähnchen ja schon in der Hand gehabt, es war ihre erste Frage gewesen, aber das war eben etwas ganz Anderes.
Jack drückte den kleinen Schmuckgegenstand in das kalte Händchen, schloss darüber die dünnen, durchsichtigen Fingerchen.
Einige Zeit verging. Nach und nach rötete sich ihr blasses Gesichtchen, Jack fühlte, wie das Blut in den abgestorbenen Arm zurückkehrte, und jetzt begann sie glücklich zu lächeln — alles Zeichen, dass sie schon hellsehend geworden war, und zwar erblickte sie ihr Wohlgefälliges.
Doch nie begann sie von selbst zu sprechen, sie musste immer gefragt werden. Und Jack rang mit sich, die Stimme versagte ihm vor Erregung.
»Was — was — siehst du, mein liebes Kind?«, brachte er endlich mühsam hervor.
»Ich sehe... sie«, lächelte das Kind immer glücklicher.
»Mariechen?«
»Ja, dein Mariechen.«
Dass sie es aber wirklich war, das konnte das Kind gar nicht wissen. Doch es hatte ja Mariechens Milchzahn in der Hand.
»Was tut sie?«
»Sie... jetzt zieht sie etwas aus der Brust — ach, es ist wieder die kleine Kapsel — sie schraubt etwas auf — sie hat eine kleine Erbse in der Hand — sie haucht darauf — ach, jetzt wird aus der alten Erbse ein wunderschönes Röschen...«
»Mariechen!!«, jubelte Jack auf.
Dass sie eben in diesem Moment an ihn dachte und sich davon überzeugte, dass er noch lebe, das war es, was den starken Manu ganz überwältigte.
»... sie hebt die Arme hoch, blickt zum Himmel empor — und wie glücklich sie aussieht — sie spricht — ich glaube, ich höre sie sprechen — mein Jack lebt noch, und er verlässt mich nicht, ich werde ihn wiedersehen, o, Gott, ich danke dir — und jetzt kniet sie nieder und betet...«
Und hier in der engen Kabine auf der anderen Hälfte der Erdkugel lag ebenfalls jemand auf den Knien und betete — der Gatte.
Dann wurde mit der Erforschung ihres Aufenthaltsortes fortgefahren. Nur das wusste man schon bestimmt, dass sich Mariechen noch auf der anderen Hälfte der Erdkugel, in Amerika befand, weil es hier schon Nacht war, und dort warf die Sonne Schatten.
»Wie sieht das Zimmer aus, in dem sie sich befindet?«
»Es ist noch ganz dasselbe — jetzt blickt sie zum Fenster hinaus — ach, das ist ja immer noch der schöne Palmengarten...«
Kein Zweifel, sie befand sich noch immer in demselben Hause zu New York, Regalia Street 13! Und ihre Verfolger jagten seit nun bald sieben Monaten halb um die Erde!
»Da weiß man wirklich nicht, ob man fluchen oder lachen soll«, sagte Mijnheer van Hyden.
»Weder fluchen noch lachen«, entgegnete Jack ernst, »wir wollen lieber Gott danken, dass Mariechen all unsere Strapazen erspart geblieben sind, und nun gar erst die, welche jene Schauspielerin durchzumachen hatte, die wir für Mariechen gehalten haben.« — —
Auf nach New York!
Die Reise wurde sehr verzögert, da man in Suez auf einen direkt nach New York gehenden Passagierdampfer warten musste. Es verging Tag auf Tag, und der schon längst angemeldete Dampfer wollte nicht kommen.
Viel schneller wäre man also gefahren, hätte man sich erst nach Genua oder Marseille begeben, wozu fortwährend Gelegenheit gewesen wäre. Gab man aber das Warten hier auf, so traf der Dampfer vielleicht in der nächsten Stunde ein. und dann hätte man sich wiederum geärgert.
Endlich traf der Schnelldampfer doch ein. Man hatte dadurch eine Woche verloren.
Mr. Snob verließ seine ägyptischen Beefsteaks, fuhr mit nach Amerika — nur Evas wegen. Er wollte dieses Kindes wunderbare Gabe näher studieren, wozu er in Kabel el Tor während der zwei Wochen keine Gelegenheit gehabt hatte, da Eva ja dort fast immer gefiebert hatte.
Jack wollte diese Experimentalstudien nicht zulassen, aber Eva selbst forderte ihn dazu auf, dabei beharrend, dass ihr dieser Zustand stets eine Erquickung sei, besonders wenn dabei auch ihr Hellsehen wirklich benutzt würde, und tatsächlich erholte sich das Kind immer mehr.
So experimentierte Mr. Snob so oft wie möglich mit ihr, und man musste zugeben, dass dieser ehemalige Glühstrumpffabrikant dabei Gedanken entwickelte, auf die ein Fachgelehrter wahrscheinlich gar nicht gekommen wäre.
Vor allen Dingen gab er dem in Trance befindlichen Kinde immer Körperleile von Tieren in die Hand, und es wurde immer wunderbarer, was für Resultate Mr. Snob da erzielte, über die er sorgfältig Buch führte. Denn das hellsehende Kind erblickte ja nicht nur das Tier selbst, sondern sah auch alles, was dieses sah. Mr. Snob fing einen Fisch, entnahm ihm einige Schuppen, gab diese dem in Trance liegenden Kinde in die Hand und ließ den Fisch wieder schwimmen. Das tat er bei einer Sardelle, bei einer Makrele, dann bei einem Fische, der sich in der tiefsten Meerestiefe aufhält, auch von einem das Schiff umschwärmenden Hai wusste er sich etwas zu verschaffen. Möwenfedern, ein Fliegenbein.
Und Eva erblickte nicht nur die Fliege in dem weit abliegenden Speisesalon auf dem Tisch, sondern sah auch alles, was diese Fliege sah, ebenso wie der in die Tiefe schießende Fisch, wie die sich in die Lüfte schwingende Möwe.
Im Grunde genommen erblickte Eva allerdings überhaupt nichts, und doch, sie sah alles, was jene Tiere sahen; aber sie vermochte es nicht mit Worten wiederzugeben. Das machte, sie konnte nicht zugleich mit dem Kopfe jener Tiere denken, weder mit dem der Fliege noch mit dem des Riesenhais. Ja, nach und nach begann sie zu schildern, was sie sah, ganz, ganz merkwürdiges, scheinbar sinnloses Zeug, sie erblickte überhaupt eine ganz andere Welt, und am bewundernswertesten vielleicht war dabei Mr. Snobs Scharfsinn, wie er in diesen Wahnsinn doch etwas Methode brachte.
Aber genug hiervon. Jedenfalls konnte auch Jack ununterbrochen diesen Offenbarungen aus einer uns verschlossenen Welt lauschen, obgleich wir selbst mitten in dieser Welt leben.
Dann kam wieder Jack an die Reihe, um Mariechen zu beobachten. Es änderte sich nichts. Außer zwei schwarzen Dienerinnen hatte sie keine Gesellschaft, sie speiste auch allein, schien aber immer heiteren Mutes zu sein.
Und noch etwas sollte Jack durch des Kindes Augen erkennen: Er durfte hoffen, seine Gattin als Mutter seines Kindes wieder in die Arme schließen zu können.
Jack wusste nicht, ob er sich darüber freuen oder grämen sollte. Nämlich weil er so spät hinkommen würde. Denn der amerikanische LuxusSchnelldampfer, der Vergnügungsreisende zurückbrachte, hatte mit Havarien aller Art zu kämpfen, kein Tag verging, an dem er nicht einige Stunden wegen irgendeiner Reparatur stoppen musste, und hinter Gibraltar wollte sich keine Gelegenheit mehr bieten, an Bord eines anderen Dampfers zu kommen, was auf hoher See überhaupt seine Schwierigkeiten hat.
Und da, nur noch drei Tage von New York entfernt, zeigte das Schicksal, dass es noch nicht gewillt sei, die Qualen des von ihm verfolgten Mannes zu beenden.
Wieder hatte der schwarzbärtige Herr, Monsieur Fleury oder wie er sich sonst nannte, sich dort in dem Hause abermals eingefunden. Er sprach mit Mariechen, und die Folge der Unterredung war, dass die junge Frau mit einigem Gepäck in einen Wagen stieg, und eine halbe Stunde später saß sie im Eisenbahnzug.
Und nach zwei Tagen, schon in Sicht von New York, erblickte Eva mit Mariechens Augen noch immer vorüberrasende Landschaften.
Wohin sie fuhr? Wo sie sich zurzeit befand? Ja, das freilich konnte das hellsehende Kind nicht mitteilen. Dem fernen Westen ging es zu.
»O Gott, o Gott, was habe ich denn getan, dass du mich so furchtbar hart strafst?«
Nur der Vater war es, der dies wimmerte. Der Gatte war eines Wimmerns vielleicht gar nicht mehr fähig. Wer aber Texas Jack von früher kannte, der musste glauben, dass der starke Mann wohl bald zusammenbrechen würde.
Der Dampfer näherte sich dem Hafen bei Anbruch der Nacht und würde während dieser auf Reede liegen bleiben. Die Passagiere, welche gleich an Land wollten, wurden von Dampffähren abgeholt.
Jack wollte an Bord bleiben. Was nützte es denn, wenn er sich an Land begab? Etwa nach der Regalia Street eilen, um sich dort wieder etwas vorlügen zu lassen, damit er auf eine falsche Spur gelenkt würde?
Und erst das Kind! Eva schlief wie ein Vögelchen ein, sobald es dunkelte.
Jack, der die Kleine nicht mehr aus den Augen ließ, neben ihr schlief, hatte sie zu Bett gebracht, wonach erst das Plauderviertelstündchen kam.
Mit dem so überaus sensitiven Kinde ging seit einiger Zeit wieder etwas vor sich, eine Umwandlung. Vor allen Dingen begann der tote Arm zu leben. Wenigstens zuzeiten. Auch wenn Eva schon aus der Trance erwacht war, blieb er noch lange warm und wie die Hand beweglich, stundenlang. Die Erwärmung trat manchmal von ganz allein ein, ohne dass dies irgend etwas mit ihren somnambulen Zuständen zu tun gehabt hätte. Für diese sagte sie die bestimmte Zeit noch immer voraus, aber für Mariechens Zahn war sie stets empfänglich.
Wenn das zarte Kind überhaupt je kränklich gewesen war, so schien es jetzt zu gesunden, und dabei wurde es trotzdem immer... durchsichtiger, anders kann man sich gar nicht ausdrücken. Eva schien sich auflösen zu wollen — gerade indem sie zum Leben erstarkte.
»Sieh, Jack, jetzt kann ich meinen linken Arm und die ganze Hand wieder bewegen, ganz wie die andere. Fühlst du, wie das Blut pocht? Wie kommt das nur?«
Sie benutzte die Beweglichkeit ihrer beiden Arme dazu, um sie zuerst um Jacks Nacken zu schlingen, und so schlief sie beim Plaudern mitten im Wort ein.
Mr. Snob trat in die schon erleuchtete Kabine.
»Es ist acht Minuten vor neun; Eva wird sogleich in Trance fallen.«
Sanft löste sich Jack aus der Umschlingung der Ärmchen, betrachtete das schlafende Kind.
Es war ein von blonden Locken eingerahmtes Engelsköpfchen, und so verklärt lächelte es auch.
»Sie gestatten doch, dass ich ein Experiment vornehme?«
»Warum nicht?«, entgegnete Jack mit müder Stimme, während er die mildernde Gaze über die elektrische Glühbirne zog.
»Ich will etwas ganz Eigenartiges versuchen, eine Locke von ihr selbst, aber mit Kombination...«
Mr. Snob schilderte weiter, was er beabsichtigte, während er seine Uhr beobachtete. Jack saß gedrückt auf einem Stuhl, hörte jenen wohl kaum sprechen.
An Deck rannten die Passagiere, Dampfboote legten bei und gaben ihrem riesigen Kollegen Stöße.
Mr. Snob war an das im Halbdunkel liegende Bett getreten, machte sich da zu schaffen.
»Was siehst du, mein Kind?«
Eine kleine Pause. Mr. Snob wiederholte seine Frage.
»Ach, wie schön, wie wunderwunderschön!«, erklang da aus dem Halbdunkel Evas verzückte Stimme.
»Was siehst du, mein Kind?«
»Ich sehe — ich sehe — ich weiß nicht... ach, das bin ich ja selbst!«
»Und was siehst du mit deinen Augen, mein liebes Kind?«
»O, wie schön, wie schön — diese Gärten! — Und diese Blumen! — Und diese vielen Kinderchen! — Die haben Flügel an den Schultern — ach, das sind Englein — und auch ich habe Flügel — und da ist meine Mutter — und mein Vater — und er hat seinen Arm wieder — und jetzt bin ich zwischen den Engelchen — o, Jack, wie ist es hier schön — Jack, mein Jack — ich — ich — mein lieber Jack...«
Da ward die Tür aufgerissen, van Hyden trat ein, ganz verstört.
»Ein Mann ist da — er will dich sprechen — unter vier Augen — ich weiß nicht, was er mir sonst zugeflüstert hat — es saust mir in den Ohren... Jack, Jack, unsere Gegner bieten uns einen Vergleich an, sie wollen uns Mariechen freiwillig zurückgeben!!«
Jack war aufgeschnellt. Und schon stand in der Kabine eine fremde Gestalt. Die hellgemachte Glühlampe beleuchtete einen einfach, aber anständig gekleideten Mann mit einem verlebten und dennoch höchst energischen Gesicht, und so kurz war auch seine Sprache.
»Mr. Johannes Dankwart, genannt Texas Jack?«
»Bin ich.«
»Kann ich hier frei sprechen?«
»Sprechen Sie!«
»Ich bin ein Mann, der mit dem Leben fertig ist, nichts zu verlieren hat, aber für seine Angehörigen, die er ruiniert hat, viel gewinnen kann.«
»Was soll das?«
»Sie verstehen nicht?«
»Doch. Sie kommen als Abgesandter der Männer, welche mir meine Gattin entführt haben?«
»Ja.«
»Sie haben nichts zu fürchten.«
»Man will Ihnen Ihre Gemahlin zurückgeben.«
»Unter gewissen Bedingungen.«
»Natürlich.«
»Nennen Sie diese!«
»Dass Sie von jeder Strafanzeige und von persönlicher Rache absehen, sich gar nicht mehr darum kümmern, wer die Entführer gewesen sein mögen — kurz, dass Sie die ganze Sache vergeben und vergessen.«
Furchtbar fuhr Jack empor.
»Vergeben?!«
»Dann nur vergessen.«
Jack blickte nach dem schlafenden Kinde, wie es noch immer so glücklich lächelte, ein kurzer Kampf, und wenn nicht der Christ, so hatte die Vernunft in ihm gesiegt.
»Ja, ich will vergessen.«
»Ihr einfaches Wort soll mir genügen.«
»Es genügt.«
»Und dann noch einen Handschlag!«
»Sie sollen ihn bekommen.«
»Nun weiter: dass Sie zur bestimmten Zeit, in etwa fünfzehn Monaten, den Maharattenschatz von Bentanga an einem bestimmten Orte abliefern, wofür Sie zehn Prozent erhalten.«
»Den Maharattenschatz von Bentanga?«, wiederholte Jack in grenzenlosem Staunen, und auch Mijnheer van Hyden horchte nicht schlecht auf.
Ein fremdes Wort bekam Jack übrigens nicht zu hören, sein Schwiegervater hatte ihm schon vor der Hochzeit ausführlich erzählt, was für ein bewegtes Leben Mariechen bereits hinter sich hatte, freilich ihr ganz unbewusst, und der Vater hatte seine einzige Tochter schon früher einmal verloren gehabt, allerdings nur für wenige Tage.
Mijnheer van Hyden hatte sich sein Vermögen auf Java verdient. Dort war Mariechen auch geboren worden. Als sie ein halbes Jahr alt gewesen, hatte van Hyden mit Frau und Kind als reicher Mann nach der Heimat zurückkehren wollen. Ausgeführt wurde der Plan auch, vorher aber sollte der Vater noch eine kleine Schreckenszeit durchmachen.
Auf Java brach ein Aufstand der malaiischen Bevölkerung aus. Van Hyden hatte sich von seiner Plantage, die schon verkauft war, noch mit knapper Not nach dem nächsten Fort, nach Bentanga retten können. Aber auch hier hätte ihn und seine Familie und alle anderen bald die fanatische Wut der Eingeborenen erreicht. Diese stürmten unausgesetzt, und einmal würden sie das Fort doch nehmen.
Noch ehe es so weit war, machte die holländische Garnison unter geschickter Führung einen tollkühnen Ausfall, und man schlug sich wirklich durch bis nach der rettenden Küste. Wenigstens auch van Hyden und Gattin gehörten zu den Überlebenden. Nur dass sie während des allgemeinen Wirrwarrs ihr Kind verloren hatten. Das aber fanden sie an der Küste wieder; eine Offiziersdame hatte sich der kleinen Marie angenommen.
»Ja, was denn für ein Maharattenschatz?«, staunte Jack.
»Der damals von Indien nach Java gekommen ist.«
»Ah, so, ich weiß«, sagte da van Hyden, und er gab mit kurzen Worten eine Erklärung.
Indien ist ja von jeher das Land der ›Schätze‹ gewesen, von vergrabenen, wie auch noch zutage liegenden mysteriösem Schätzen.
Ein solcher war auch der sogenannte Maharattenschatz, aus großen Diamanten, aus Goldklumpen von Kindeskopfgröße, aus den wunderbarsten Kleinodien und aus Gott weiß was bestehend.
»Das stimmt! Ich entsinne mich. Gerade damals ging das Gerücht, dieser Maharattenschatz sei wieder einmal gestohlen worden. Was aber haben wir mit dieser Fabel zu tun?«
»Es ist keine Fabel gewesen.«
»Und wenn nicht — was kümmert das mich oder meine Tochter?«
»Befand sich in jenem Fort nicht auch ein fremder Radscha, der auf der Reise begriffen war?«
»Ich glaube, ich entsinne mich, man machte viel Aufhebens mit ihm. Sein Name war Man — Man...«
»Manharangar.«
»Jawohl, Manharangar. Er fand bei dem Ausfall seinen Tod, ich selbst sah ihn stürzen.«
»Aber sein Geheimnis hat er für Eingeweihte zu hinterlassen gewusst.«
»Was für ein Geheimnis? Ich verstehe immer weniger.«
»Ich kann ganz offen sprechen, denn wir haben nichts zu fürchten. Ihre Gattin, Mr. Dankwart, ist für Sie trotz alledem unerreichbar...«
»Sprechen Sie, sprechen Sie! Was hat dies alles mit der Entführung meiner Frau zu tun?«, drängte Jack.
»Dieser Radscha Manharangar wusste, wo der Maharattenschatz vergraben liegt. Er sah seinen Tod kommen, oder er wollte doch auf alle Fälle dafür sorgen, dass sein Geheimnis nicht ganz verloren ginge, falls alles niedergemacht werden würde. Aber die Welt sollte erst nach einer Reihe von Jahren von seinem Geheimnis erfahren, aus einem Grunde, den ich selbst nicht kenne. Die Malaien schonen stets die Kinder. Waren im Fort Bentanga noch mehr solche kleine Kinder?«
»Wie ich mich entsinnen kann, nein. Halbwüchsige wohl, aber nicht so wie mein Mariechen.«
»Da hat Radscha Manharangar am Tage vor dem Ausfall Ihrer kleinen Tochter sein Testament auf den Rücken tätowiert.«
»Was hat er getan?!«, staunte van Hyden.
»Er hat Ihre kleine Tochter, das halbjährige Kind, für ein Stündchen der Wärterin abzulocken gewusst und hat dem kleinen Mädchen auf dem Rücken eintätowiert, wo der Maharattenschatz vergraben liegt, eine Zeichnung, einen Situationsplan mit erläuternden Worten.«
»Was? Meine Tochter soll aus dem Rücken eine Tätowierung haben?!«, staunte Mijnheer van Hyden immer mehr.
»Jawohl, ihr ganzer Rücken ist damit bedeckt.«
»I, keine Spur! Da müsste ich doch auch etwas davon wissen! Und du, Jack, doch auch!«
»Pardon — diese Tätowierung ist nicht sichtbar. Es dürfte Ihnen, der sich so lange in Indien aufgehalten hat, doch bekannt sein, dass die indischen Priester für das Tätowieren Farben besitzen, welche erst nach einer bestimmten Zeit sichtbar werden, und sie sind in dieser Kunst so weit, dass sie diese Zeit bis zum Jahr und fast bis zum Tage bestimmen können. Der Radscha wandte eine Tusche an, welche erst nach zwanzig Jahren zum Vorschein kommt. Und in fünfzehn Monaten sind die zwanzig Jahre verstrichen, dann kommt die Tätowierung klar zum Vorschein.«
Hiermit war das Rätsel gelöst, weswegen Mariechen entführt worden war.
»Woher ist dies bekannt geworden?«
»Das ist nicht meine Sache. Es hat sich eine Gesellschaft gebildet, um diesen Maharattenschatz zu heben. Nach langer Nachforschung fand man das kleine Mädchen wieder, dessen Rücken damals das Geheimnis anvertraut wurde. Es war unterdessen Ihre Gattin geworden, Mr. Dankwart. Nach zwei Jahren und einigen Monaten wäre die Tätowierung in blauer Farbe zum Vorschein gekommen, Sie hätten das doch natürlich einmal bemerkt, und wenn die in Sanskrit geschriebene Schrift auch nicht für jedermann lesbar ist, da erkundigt sich doch jeder — Sie hätten gewusst, wo der riesige Maharattenschatz vergraben liegt, Sie hätten ihn heben können. Deshalb wurde Ihnen die Gattin entführt. Über das vorliegende Unrecht habe ich nicht zu sprechen. Es handelt sich um einige hundert Millionen. Nach zwei Jahren und einigen Monaten hätten Sie Ihre Gattin unversehrt zurückerhalten...«
»Wo ist Mariechen jetzt?«, unterbrach Jack den Sprecher aufgeregt.
»Hier in New York.«
»Wie? Hier in New York?!«
»Ja, aber...«
»Sie ist doch in den letzten Tagen immer mit der Eisenbahn gefahren!«
»Ja, aber auch wieder zurück. Jene Gesellschaft, die man fast eine Aktiengesellschaft nennen könnte, hat eine Generalversammlung abgehalten, und man hat einen Entschluss gefasst. Man möchte sich mit Ihnen einigen, Mr. Dankwart! Sie haben eine ganz außerordentliche Energie gezeigt, Sie haben Dinge ausgeführt, welche...«
»Keine Schmeicheleien! Unter welchen Bedingungen will man mir meine Frau zurückgeben?«
Der Fremde musste aber erst noch etwas Anderes sagen, und es gehörte auch wirklich mit zur Sache.
»Sie hätten Ihre Gattin dennoch nicht wiederbekommen. Die Macht, welche jene Männer ausüben, ist eine ungeheure. Sie beherrschen die ganze Welt...«
»Mit ihrem Gelde«, schaltete van Hyden ein.
»Ja, mit ihrem Gelde. Jetzt wollte man die Entführte in einem verlassenen Bergwerk Zentralamerikas unterbringen. Die gute Behandlung, die der Dame bisher zuteil geworden, hätte sie dort freilich nicht gehabt. Daran sind Sie selbst schuld...«
»Ich?!«
»Wie man es nimmt. Jene Männer haben es sich schließlich anders überlegt. Warum sich nicht mit Ihnen einigen? Man traut Ihrem Worte. Und jene sind schließlich doch auch Menschen. Gerade jetzt begehrt Ihre Gattin aufs Heftigste nach Ihnen...«
»Sie ist in guter Hoffnung«, sagte Jack atemlos.
»Ja, sie erwartet in den nächsten Stunden ihre Niederkunft, und ich bin abgeschickt, Sie zu holen, Sie zu ihr zu führen, wenn Sie mir ein einfaches Ehrenwort ablegen, dass Sie von der Tätowierung...«
Der Fremde sprach noch weiter, aber Jack hörte nichts mehr. Er hatte nur eins gehört: Endlich, endlich hatte die Leidenszeit ein Ende! Er sollte ohne weitere Anstrengung sein Mariechen wiederbekommen, die Wiedervereinigung war schon so gut wie geschehen.
Und in diesem Augenblick dachte er noch an eine andere Person, welche vor allen Dingen an diesem seinem Glücke mit teilnehmen musste.
»Hörst du, Evangeline, wir haben unser Mariechen wieder!«
Das Bett wurde von dem unverblendeten Lichte getroffen. Das schlafende Kind lächelte noch immer wie ein verklärter Engel. Aber Jack sah noch etwas anderes. Evas rechter Arm, der gesunde, lag in recht unbequemer Stellung über dem Kopfe, das durfte nicht sein, das brachte das Blut in Stockung.
Jack trat hin, fasste das Händchen — und fuhr zurück, als habe er eine Natter berührt. Er fasste wieder zu, und immer mehr zitterten seine Hände, als er den ganzen Körper des Kindes betastete. Er legte seine Hand auf die kleine Brust... und dann brach er mit einem Schrei neben dem Bettchen des im Schlafe glücklich lächelnden Kindes zusammen.
Dieser Mann konnte sich ja nicht darüber täuschen, was für eine Art von Schlaf das war.
»Tot! Tot! Meine Evangeline ist tot!« — —
Eine Stunde später trat Jack vor ein anderes Bett, aus dem sich ihm unter schmerzvoller Seligkeit zwei Arme entgegenstreckten, die Arme seiner Gattin, und dann hielt er auf den seinen das Mägdlein, das sie ihm geschenkt hatte, und diese schmerzvolle Seligkeit erfüllte sein eigenes Herz — himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt.
Unter Tränen des unaussprechlichen Leides und unter Tränen der unaussprechlichen Freude hatten in dieser einen Stunde Tod und Leben einander die Hand gereicht.
E, in halbes Jahr später eröffnete Jack Dankwart in Amsterdam ein Reitinstitut, welches noch heute existiert und gegen welches die anderen gar nicht in Betracht kommen.
Jack musste arbeiten. Doch nicht etwa, um seinen Schmerz über Evangelines Verlust zu betäuben. Evangeline war gar nicht tot, wenigstens nicht für ihn. Das, was in dem kleinen Sarge lag, der von New York nach Amsterdam übergeführt und in dem Garten der Villa unter einem immergrünen Lebensbaum gebettet worden, das war nur der Teil, den die Erde jedem Menschen gibt und von ihm wieder zurückfordert. Evangeline selbst war wieder auferstanden, Tod und Neugeburt waren für sie eins gewesen, jetzt steckte die kleine Evangeline als Jacks Töchterchen im Wickelbett, körperlich urgesund geworden und daher sicher auch frei von einer anormalen Sehergabe.
Hätte man ihm das einmal abstreiten wollen, Jack hätte es sich nie ausreden lassen. Aber über solch ein Thema streitet man nicht, spricht man nicht einmal, das ist zu heilig.
Und merkwürdig! Diese kleine Evangeline schien auch ganz das Ebenbild der früheren werden zu wollen, obgleich die Mutter diese doch nie zu sehen bekommen hatte.
Ja, es gibt eben doch noch etwas Anderes als die Darwinsche Theorie. Da begegnet man auf Schritt und Tritt doch noch anderen Rätseln, die man mit dieser Erklärung der Natur nicht lösen kann. Und wir werden sie auch nimmer lösen.
Über das Vergangene wurde gar nicht mehr gesprochen. Jack war auf alle Bedingungen eingegangen, hatte darauf sein Ehrenwort gegeben, also durfte er auch über jene, die ihm so viel Leid zugefügt, keine Nachforschungen anstellen — also wurde davon überhaupt mit keinem Worte mehr gesprochen. Das war strenges Hausgebot.
In der Zeitung stand, dass die Drusen wieder einmal einen Aufstand gemacht hätten. Ihre heilige Hochburg in Sinai sei durch Verrat von türkischen Truppen genommen worden, dabei habe auch eine europäische Dame ihren Tod gefunden, welche dort schon seit langer Zeit von den Drusen gefangengehalten worden war, und in der Toten habe man keine andere erkannt als die Lady Ethel, die Tochter des Herzogs Yorkshire, welche vor nun bald anderthalb Jahren auf so rätselhafte Weise verschwunden war. Jedenfalls hatte sie sich mit Absicht heimlich entfernt.
Jeder las es in der Villa, jeder ahnte etwas — aber es wurde nicht darüber gesprochen, so wenig wie davon, was wohl aus jener Schauspielerin geworden sein mochte, die damals im Hause des Paschas zurückgeblieben war.
Mr. Snob war zu seinen ägyptischen Beefsteaks und Eiern zurückgekehrt — mehr wusste man nicht, und es genügte. Jack hatte den ganzen Tag mit Pferden und Kunden zu tun, und wenn das nicht der Fall war, dann hatte er zu Hause als Familienvater genug zu tun.
Und doch sollte der Frieden dieses glücklichen Heimes noch einmal gestört werden, und zwar wiederum durch eine Entführungsgeschichte. Allerdings nur während einer Nacht. Und diesmal war der Entführte und Verschwundene, dessentwegen man sich in dem friedlichen Hause so ängstigte und die ganze Polizei alarmiert werden musste, niemand anders als unser braver Klaus.
Klaus hatte natürlich seine Fatje geheiratet, Königin a. D. Hier ist wohl einmal ein ›natürlich‹ angebracht. Wir hätten auch von seiner ›Herzenskönigin‹ sprechen können, aber solch einen poetischen Ausdruck hätten die beiden höchstens übelgenommen. Ebenso natürlich waren beide noch im Hause. Von Fatje ist sonst nichts weiter zu sagen, als dass sie noch immer manchmal den Kopf verlor, besonders wenn ihr einmal ein Topf überkochte. Bei Klaus hingegen, der nach wie vor seinen Herrn rasierte und sich auch sonst im Hause nützlich machte, muss lobend hervorgehoben werden, dass er an Geisteskräften ganz bedeutend zugenommen hatte. Allerdings weniger durch eigene Schuld. Wenigstens nach Mijnheer van Hydens Ermessen.
Klaus hatte nämlich einmal eine Tasse mit phosphorsaurem Arsenik ausgetrunken, welche Lösung zum Töten von Ratten bestimmt gewesen war — geschadet hatte ihm das Rattengift durchaus nichts, ganz im Gegenteil, es hatte seinen stets gesegneten Appetit nur noch verstärkt, sodass er jetzt gar nicht mehr aus der Küche herauskam. Und außerdem hatte er seitdem schon Proben von großer Geisteskraft abgelegt. So z. B. hatte van Hyden einmal seinen Regenschirm irgendwo in der Stadt stehen lassen, Klaus war auf die Suche geschickt worden, und er hatte ihn richtig zurückgebracht. Ein andermal hatte er einen Brief in den Postkasten stecken sollen, hatte gemerkt, dass keine Briefmarke drauf war und hatte von ganz, ganz allein, durch eigenes Nachdenken dazu veranlasst, eine Briefmarke daraufgeklebt. Mijnheer van Hyden schrieb dies alles dem phosphorsauren Arsenik zu; denn Phosphorsäure ist bekanntlich ein sogenanntes ›Gehirnfutter‹, was aber niemand veranlassen soll, nun Phosphorhölzchen zu verzehren — Klaus tat es auch nicht.
Und dieser intelligente Diener sollte dem Hause entführt, geraubt werden!
Mijnheer van Hyden war nach der Stadt gefahren, um Einkäufe zu machen — kleine, aber viele. Als es Abend wurde, war Klaus mit Schachteln, Kistchen und Paketen über und über beladen.
»Wenn wir uns in dem Gedränge verlieren sollten«, hatte van Hyden in den belebten Straßen einmal gesagt, »so treffen wir uns auf dem Bahnhofe wieder, oder du kannst auch gleich nach Hause fahren, verstehst du?«
»Jawohl, Mijnheer.«
Aber ehe es so weit war, wollte van Hyden noch für seinen sofortigen Bedarf ein paar Zigarren kaufen, steuerte dem nächsten Tabaksladen zu.
»Du wartest hier vor der Tür, bis ich wieder herauskomme, verstanden?«
»Jawohl, Mijnheer.«
Gut, Papa van Hyden ging in den Laden, musste einige Minuten warten, suchte lange aus — und als er wieder heraustrat, blickte er sich vergeblich nach seinem Diener um.
»Na, der hat nicht so lange warten wollen, es wurde ihm schwer — der ist auf den Bahnhof gegangen, ist nach Hause gefahren. So gescheit wird er doch gewesen sein, wo er eine ganze Tasse Phosphorsäure ausgetrunken hat.«
Er traf einige gute Freunde, und so kam es, dass Papa van Hyden erst mit dem letzen Nachtzug oder gar mit dem ersten Morgenzuge nach Hause fuhr und wegen der ›Kinder‹ auf den Zehenspitzen die Treppe hinaufschlich.
Er konnte sich nicht einmal richtig ausschlafen. Zur Zeit, da im Hause alles lebendig wurde, ward auch er geweckt, und zwar sah er nur schreckensblasse Mienen.
»Wo ist Klaus? Wo hast du Klaus gelassen?«
Nach und nach kam Papa van Hydens Brummschädel die Erinnerung.
»Na, der ist doch vor mir nach Hause gefahren, mit deinem Federhut, mit deinem...«
»Klaus ist nicht da!«
Ja, Klaus war samt seinen zwei Dutzend Schachteln, Kistchen und Paketen verschwunden — Fatje heulte schon ein Oratorium.
Was tun? Auf dem Vorstadtbahnhof war der Vermisste nicht gesehen worden. Nach Amsterdam, nach der Polizei telefoniert! Die hatte den ›Geraubten‹ denn auch sehr bald gefunden, transportierte ihn samt seinem ganzen Frachtgepäck nach Hause.
Und wo war Klaus während der ganzen Nacht gewesen? Der hatte immer brav vor der Tür des Zigarrenladens auf seinen Herrn gewartet, die ganze Nacht, von oben bis unten mit Paketen beladen, bis ihn am anderen Morgen die Polizei ablöste. Dass die Tür und das ganze Geschäft geschlossen wurde, hatte ihn gar nicht irritiert.
Die Sache war nämlich die, dass das Zigarrengeschäft ein Eckladen gewesen war, und van Hyden hatte ihn auf der anderen Seite wieder verlassen, hatte sich deshalb vergeblich nach Klaus umgeschaut. »Ja, ich — ich — ich hatte doch vor der Tür warten sollen, bis Mijnheer wieder herauskäme.«
Im Grunde genommen hatte der brave Klaus ganz recht. Aber seitdem war das Renommee seiner Geisteskraft wieder vorbei, und Mijnheer van Hyden glaubte nicht mehr an die gehirnfördernde Wirkung von phosphorsaurem Rattengift.
Und doch sollte derselbe Klaus noch einmal eine geistige Anregung geben.
Der Morgen war angebrochen, an welchem Mariechen ihren zwanzigsten Geburtstag feierte, das heißt, an dem sie ihr zwanzigstes Jahr vollendete.
Jack war noch früher aufgestanden als sonst, um alles zu arrangieren. Zunächst ließ er sich von Klausens sanfter Hand rasieren.
Klaus strich das Messer auf dem Riemen, der eingeseifte Jack beobachtete ihn.
»Klaus, du hast etwas auf dem Herzen, du machst ein so geistreiches Gesicht!«
»Na, hat se denn was?«, platzte denn Klaus auch gleich heraus.
»Ob sie was hat? Wer denn?«
»Nu, Ihre Frau?«
»Meine Frau? Ob sie was hat?«
»Na ja, uff‹n Buckel! Haben Sie noch nicht nachgesehen? Heute ist sie doch zwanzig, da soll sie doch den ganzen Maharattenschatz uff‹n Buckel haben, lauter Säcke voll Diamanten und Goldklumpen usw. Haben Sie noch nicht nachgesehen? Gucken Sie nur gleich emal nach, sie wäscht sich gerade, ich habe schon vorhin durchs Schlüsselloch geguckt, aber ich konnte nischt sehn.«
Richtig! Jack hatte wirklich kaum noch daran gedacht. Übrigens war durchaus nicht gesagt, dass die Tätowierung gerade an ihrem zwanzigsten Geburtstage sichtbar werden musste.
Noch ehe Jack darüber weiter nachdenken konnte, kam die Morgenpost. Einer der ersten Briefe, die er erbrach, war aus New York, anonym, aber doch deutlich genug unterzeichnet — von jener ›Aktiengesellschaft‹.
Des letzten Teiles seiner Verpflichtungen sei Mr. Dankwart enthoben. Die Tätowierung auf dem Rücken seiner Gattin werde niemals zum Vorschein kommen, sie sei damals als Kind gar nicht tätowiert worden. Das habe man erst jetzt aus sicherster Quelle erfahren.
»lt was a mistake — es war ein Irrtum — I beg yor pardon — ich bitte Sie um Verzeihung!«
Es war ein Irrtum!!!
Nur ein einziges Mal lachte Jack grimmig auf. Dann konnte dieser Brief ihm nicht mehr die Geburtstagsstimmung verderben, so wenig wie den Anderen. Vielleicht bewirkte dieser Brief sogar das Gegenteil.
Sie gingen zusammen nach dem kleinen Grabe unter dem immergrünen Lebensbaum, um es zu schmücken, und wenn sie es nicht mit dem Munde sangen, so erklang es in ihren Herzen: das Hohelied der Liebe.
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.