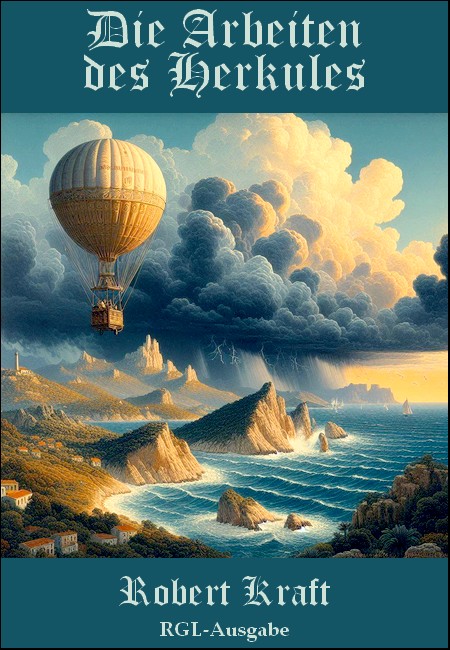
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.
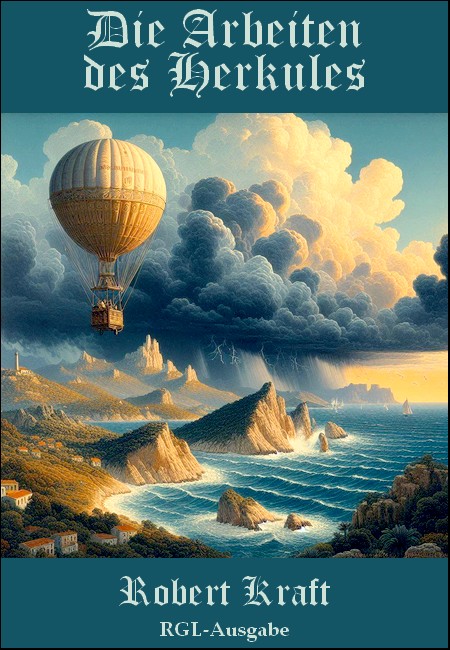
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software

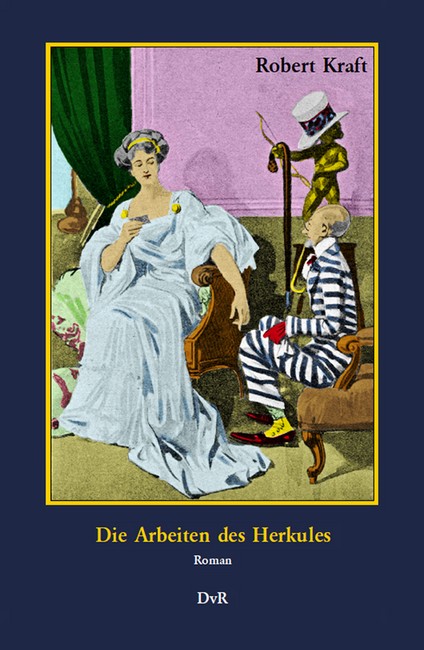
"Die Arbeiten des Herkules"
Verlag Dieter von Reeken, 2024

Die Arbeiten des Herkules
H.G. Münchmeyer G.m.b.H.,Niedersedlitz-Dresden
Ausgabe von 1924: Covergrafik von Georg Herting
Die vorliegende Neuausgabe enthält den ungekürzten Text des von Robert Kraft (1869—1916) verfassten Romans, der erstmals 1910 in 5 Lieferungen erschienen ist, unter Verwendung folgender Ausgabe:
Die Arbeiten des Herkules. Roman von Robert Kraft. In: Robert Kraft: Gesammelte Reise- und Abenteuer-Roman. Siebente Serie: Niedersedlitz-Dresden: H.G. Münchmeyer G.m.b.H. o.J. [1910]. 152 S. mit 5 Illustrationen von Adolf Wald.
Zu Robert Krafts Leben und Werk verweise ich auf die umfassende reich farbig illustrierte Bibliografie von Thomas Braatz[1], die ebenfalls farbig illustrierte Biografie von Walter Henle und Peter Richter[2], ein umfangreiches Buch von Arnulf Meifert [4-6] und auf die Tagungsbände zu den Robert-Kraft-Symposien.
[1] Thomas Braatz: Robert Kraft — Farbig illustrierte Bibliographie zum 100. Todestag. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer, 3., erweiterte Aufl. 2016. — 1032 S. mit über 1000 farbigen Abb.
[2] Walter Henle, Peter Richter: Unter den Augen der Sphinx. Leben und Werk Robert Krafts zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer 2005. — Das Buch ist vergriffen; eine Neuausgabe ist für 2025 geplant.
[3[ Arnulf Meifert: Robert Kraft. Avanturier und Selbstsucher. Eine Annäherung. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer 2018.
[4] Robert Kraft 1869—1916. 1. Robert-Kraft-Symposium. 15.—16.10.2016. Mit Beiträgen von Thomas Braatz, Arnulf Meifert, Achim Schnurrer sowie historischen Texten von Dr. S. Friedlaender und Robert Kraft. Leipzig: Thomas Braatz im Rahmen des Freundeskreises Science Fiction Leipzig 2016.
[5] Wenn ich König wäre! Robert Kraft zum 150. Geburtstag. 3. Robert-Kraft-Symposium. 12.—13.10.2018. Mit Beiträgen von Jakob Bleymehl, Gerhard W. Bleymehl, Thomas Braatz, Matthias Käther, Walter Mayrhofer, Arnulf Meifert, Karlheinz Steinmüller und Hans Wollschläger. A.a.O. 2019.
[6]. Robert-Kraft-Symposium. 16.04.2022. Serienheld Nobody. 100 Jahre Kraft-Film von Thomas Braatz, u. a. mit Beiträgen von Michael Bauer, Aurel Lupastean und Franziska Meifert. A.a.O. 2022.
Der im Original in Fraktur gesetzte Text ist in Antiqua (Garamond Standard) umgewandelt und an die seit 1996 geltenden neuen Rechtschreibregeln angepasst worden.
Offensichtliche Rechtschreibfehler und überholte Schreibweisen sind stillschweigend berichtigt worden.
Fußnoten mit Sternchen (*) stehen so auch im Originaltext, solche mit Zahlen in Klammern [] sind vom Herausgeber eingefügt worden.
Die Wiedergabequalität der Abbildungen war abhängig von der jeweiligen Druckqualität der Vorlagen. Da die den Lagen vorangestellten ganzseitigen Abbildungen in der vorliegenden Neuausgabe dem Fließtext räumlich zugeordnet werden konnten, ist auf die fast textgleichen Bildunterschriften verzichtet worden.
Für freundliche Unterstützung durch den Originaltext der Erstausgabe, für Bilder, Hinweise und die bibliografischen Anmerkungen bedanke ich mich bei Thomas Braatz, für die die Korrektur bei Ellen Radszat.
Jeder Frauenkenner, der nicht gerade für jungfräuliche Keuschheit und knospende Formen schwärmte, hielt Lady Marion Ramsay für das schönste Weib der Erde. Dabei würde sie nächstens das 40. Lebensjahr vollenden, was sie auch durchaus nicht verheimlichte. Zwar waren die Jahre an ihr, die schon als erblühende Jungfrau die ganze Männerwelt entflammt hatte, nicht spurlos vorübergegangen, das einst so zarte Mädchen war im Laufe dreier Ehen eine zur vollsten Üppigkeit entwickelte Juno geworden — aber gilt diese Göttin nicht als das Symbol der reifsten Frauenschönheit, die nicht mehr altern kann?
Doch nicht diese ihre blendende Schönheit, und auch nicht ihr Reichtum, war der Hauptgrund, dass die Salons ihres am Regent's Park gelegenen Palastes der Versammlungsort aller politischen und geistigen Größen Londons, welche England bedeutet, waren, gegen die in diesem Falle die Geldmacht erst an zweiter Stelle kommt. Denn Lady Marion Ramsay besaß selbst Geist genug, um eine solche Anziehungskraft auszuüben. Die zum dritten Male verwitwete Frau war unter Pseudonym eine berühmte Schriftstellerin, Romandichterin, und merkwürdig war, dass sie, ohne selbst exzentrisch zu sein, sich in den exzentrischsten Stoffen und Situationen und Charakteren gefiel, wobei sie eine glühende, unerschöpfliche Phantasie bewies.
Eine zweite Eigentümlichkeit all ihrer literarischen Arbeiten war, dass der Held stets ein Amerikaner, ein unverfälschter Yankee sein musste.
Doch hierzu war ja Grund genug vorhanden. Marion selbst war in New York geboren, und ihre Vorfahren hatten zu den ersten Ansiedlern Nordamerikas gehört.
Sie hatte ein bewegtes Leben hinter sich, aber so ehrenwert, wie das einer ehrbaren Frau nur sein kann.
Als das fünfzehnjährige Mädchen in der breiten Öffentlichkeit als die größte Schönheit New Yorks bekannt wurde, da war die Tochter des armen Handwerkers, die bisher nur im engsten Kreise mit ihrer Herrlichkeit gestrahlt hatte, schon mit einem kleinen Postbeamten verlobt gewesen, und weder die glänzendsten Anerbietungen von reichen Lüstlingen noch die von Varietébesitzern und dergleichen Unternehmern hatten ihre Treue erschüttern können, sie war dem Manne ihrer Wahl in sein dürftiges Heim gefolgt.
Wir haben vorhin schon gesagt, dass sie zum dritten Male Witwe war. Das ist nicht ganz richtig. Schon nach einem Jahre ward diese erste Ehe, eine echte Liebesheirat, auf gerichtlichem Wege wieder gelöst. Sie hatte sich einem ganz Unwürdigen hingegeben.
Umso edler war es, dass die mehr als zuvor Umschwärmte abermals einer natürlichen Regung ihres Herzens folgte, als sie wiederum einem einfachen Manne des Volkes die Hand zum Ehebunde reichte, einem sich mühselig durchs Leben ringenden Kaufmanne, und mit diesem zusammen nahm sie mutig und kraftvoll den Kampf gegen das Schicksal auf, führte ihn fünfzehn Jahre lang.
Endlich schien sich die Zukunft besser gestalten zu wollen — da raffte eine in New York ausgebrochene Typhusepidemie den Gatten und alle dieser so glücklichen Ehe entsprungenen Kinder innerhalb einer Woche dahin.
Und aus all diesem Unglück war das kraftvolle Weib nur umso schöner hervorgegangen!
Wieder begann das heißeste Ringen um sie, und obgleich das ideal veranlagte Weib abermals der Stimme des Herzens folgte, war es doch diesmal ein mit allen Gütern und Ehren der Erde reich gesegneter Mann, der sie heimführte — Lord George Ramsay.
So war sie vor acht Jahren nach England gekommen, und sie war auch in England geblieben, als vor einem Jahre nach glücklicher Ehe, die freilich kinderlos blieb, der Tod des Lords, der weit jünger gewesen war als sie, erfolgte.
Dabei war Lady Marion eine gute Amerikanerin geblieben. Wenn sie die Ehre und den Stolz ihrer Heimat verfocht, so war das das einzige, worin sie exzentrisch und leidenschaftlich, fast bis zur Heftigkeit, werden konnte. Ihre Heimat ging ihr über alles, gegenüber dem großen Amerika verblasste alles, Amerika war ihr das Land der Zukunft, das alles andere verschlingen würde.
Am stärksten drückte das einer ihrer Romane aus, ein Zukunftsroman. Die Russen waren von einer neuen mongolischen Völkerwanderung nach Westen gedrängt worden, von Süden her brachen die Tschechen siegreich in Europa ein, auch England war als letztes germanisches Bollwerk gefallen, und so gab es auf der Erde nur noch drei große Reiche: Germania, Slavia und Mongolia.
Ebenso gut aber hätte man Germania auch Amerika nennen können. Denn Amerika hatte das ganze Germanentum aufgesogen, von Amerika aus mussten die Germanen beginnen, die Erde wiederzuerobern — und da natürlich mussten die führenden Helden lauter Amerikaner, echte Yankees sein. — — —
Diese Schwärmerei Lady Ramsays für Amerika aber war durchaus kein Hinderungsgrund, dass sich die ersten Söhne Old Englands in den Salons der schönen Witwe versammelten. Sie wurde ja auch niemals persönlich. Freilich durfte man ihrem Chauvinismus, wenn sie einmal davon begann, auch nicht groß widersprechen, und noch mehr musste man der schönen Witwe gegenüber alle Heirats- und ähnliche Gedanken verbergen.
Es war in der zehnten Morgenstunde. Die Sonne küsste mit goldenem Schein den in voller Frühlingspracht stehenden Regent's Park und flutete in den grünen Salon, in dem sich zwei Damen befanden.
Es waren Lady Marion und ihre Gesellschafterin, mehr ihre intime Freundin, Miß Lucy Vernon, ein armes Mädchen, das sie einst bei sich aufgenommen hatte.
Beide befanden sich noch im Morgenkostüm, das allerdings an Eleganz nichts zu wünschen übrig ließ, und waren in einer eigentümlichen Beschäftigung begriffen.
Jede hatte eine Art von Rahmen in der Hand, wie man ihn zum Sticken benutzt, aber unbespannt, setzte ihn gegen die grüngoldene Tapete und schien nun innerhalb des Rahmens nach etwas zu suchen, auf diese Weise die ganze Wand abgehend, den Rahmen planmäßig immer weiterrückend, ihn aber nur in mittlerer Leibeshöhe haltend.
Das hatten sie nun schon eine Stunde so getrieben, bis Lady Marion endlich seufzend den Rahmen sinken ließ.
»Wieder einmal durch! Lassen Sie es gut sein, meine liebe Lucy, wir finden es doch nicht.«
»Haben Sie es auch wirklich hier im grünen Salon an die Wand geschrieben?«, fragte die Gesellschafterin.
»Hier im grünen Salon! Es kann sich auch nur um einen dieser drei Pfeiler handeln. Ich sehe die beiden noch so deutlich vor mir stehen.«
»Kommen Sie denn nicht auf das Sprichwort?«
»Es schwebt mir auf der Zunge — Ja — Jo ... nein, ich komme nicht wieder darauf. Na, lassen wir es! Ich kann dem armen Manne eben nicht helfen, so gerne ich's auch möchte. Die Morgenzeitung muss übrigens nun doch schon gekommen sein.«
Sie begaben sich in das angrenzende Zimmer, ein kleines, rot tapeziertes Boudoir, in dem die beiden das erste Frühstück eingenommen hatten.
Das Service war schon wieder fortgeräumt worden, dafür lag auf dem Tischchen jetzt eine Morgenzeitung, die Lieblingslektüre der beiden. Sie teilten sich in die Blätter, nahmen Platz, versenkten sich in die Tagesneuigkeiten, das Interessanteste sich gegenseitig mitteilend.
»Ach, Mister Herkules Piper!«, rief da Lady Marion. »Mister Herkules Piper ist in New York wieder aufgetaucht.«
»Mister Herkules Piper?«, wiederholte Lucy, und schon musste sie lächeln. »Was für ein seltsamer Name ist denn das?«
»Haben Sie denn noch nichts von diesem ... doch nein, wie sollten Sie denn? Damals waren Sie ja noch gar nicht geboren. Ja, das muss nun wenigstens schon ... vierundzwanzig Jahre her sein. Gott, wie die Zeit vergeht! Herkules Piper!«
Eine kleine Weile wie wehmütiges Nachdenken, dann aber trat immer stärker ein sonniges Lächeln in dem zauberhaft schönen Antlitz hervor, welches ebenso wie die ganze Gestalt einer näheren Beschreibung spottet, und dann fand sie auch Worte.
»Sein Vater war der Mann, der in New York, in ganz Amerika, das erste im Lande erzeugte Bier braute. Es war auch eine richtige Bierbrauergestalt. Ein ungeheuerer Fleischkoloss, und dabei führte dieser Mann den Vornamen Apollo. Passte zu ihm wie — wie ... na, wir können hier ja ohne Scheu ein etwas vulgäres Gleichnis gebrauchen — passte für ihn wie die Faust aufs Auge. Und ein ebensolcher Fleischkoloss war auch seine Gattin. Beide zugleich von riesenhafter Größe.
Als die beiden nun mit einem spätgeborenen Kinde beglückt wurden, einem Knaben, hielten sie es wohl für selbstverständlich, dass er nach den Eltern geraten müsse, und es soll anfangs auch ein ausnahmsweise strammer Bursche gewesen sein, und so wurde der Spross in stolzer Elternfreude Herkules genannt. Wir Amerikaner lieben ja überhaupt dergleichen klassische Namen, und das ganz mit Recht.
»Auf diese Weise aber soll man das Schicksal doch nicht herausfordern. Nach der Taufe schien sich der erst so kräftige Junge rückwärts entwickeln zu wollen. Vielleicht Krankheit! Doch von seiner ersten Jugend habe ich überhaupt nicht viel zu hören bekommen.
Als er zuerst von sich sprechen machte, war er etwa zwanzig Jahre alt. Er hatte seinen verstorbenen Vater beerbt, viele Millionen, und durch den Verkauf der riesigen Brauerei kamen noch weitere Millionen hinzu. Er sollte von seinem Vater sehr streng gehalten worden sein, nun aber legte mein Monsieur Herkules los.
Mit einem Herkules hatte der junge Mensch freilich wenig Ähnlichkeit. Eine kleine, schmächtige Gestalt, schon damals ganz ausgetrocknet, schon damals mit einer mächtigen Platte geziert, mit einer hohen Schulter, auch im Gesicht von der Natur verunstaltet.
Trotzdem wollte er seinem Namen Ehre machen, wollte ein göttergleicher Heros werden, sich durch seine Taten unsterblichen Ruhm erwerben. Nur mit seiner körperlichen Kraft durfte er da nicht vorgehen. Ich entsinne mich, wie er am Parkteich einmal von einem erzürnten Schwan, einem noch ganz jungen Tier, angefallen wurde, der ihm übel mitspielte, sehe das arme Menschlein noch mit seinem zerrissenen Höschen laufen, das eine Hosenbein rot, das andere blau ...«
»Was sagen Sie da?«, unterbrach die Gesellschafterin. »Die Hosenbeine verschiedenfarbig? Das war wohl einmal im Mittelalter Mode, aber auch in New York?«
»O nein. Monsieur Piper wollte sich eben als Dandy unsterblich machen. Faktisch, er trug ganz enge Beinkleider, schon dadurch der damaligen Mode Hohn sprechend, und außerdem das eine Hosenbein rot, das andere blau. Das kam dem gar nicht drauf an. Statt eines Hundes führte er hinter sich an einer Schnur eine dressierte Gans, deren weißes Gefieder er in allen Farben des Regenbogens angemalt hatte, und so trieb er tausend Kapriolen, und kein Tag verging, an dem man sich in New York nicht von einem neuen tollen Streich des Mister Herkules Piper hätte erzählen können. Ich selbst war dabei, als dort das erste Hundetheater gastierte, und wie nun Prinz Pudel und Fräulein Mops Hochzeit feierten, wie die beiden gravitätisch vor den Traualtar treten, hinter ihnen die Hochzeitsgäste, die Brautjungfern und Brautherren, lauter Hunde, alle auf zwei Beinen marschierend, alles so feierlich — da wirft der vorn in einer Loge sitzende Mister Herkules Piper plötzlich Schinkenknochen und Würste auf die Bühne, und wie da die Hunde aus der Rolle fielen ...«
Lady Marion lachte. Ihre Gesellschafterin, die sich diese Szene recht gut vorstellen konnte, lachte mit.
»Kurz, so verging kein Tag, an dem Herkules Piper nicht eine neue Tollheit ausgeführt hätte. Nicht immer konnte er seine Torheiten mit Geld gutmachen, ist deswegen oft eingesteckt worden, sollte manchmal gelyncht werden. Aber im Grunde genommen war er wohl kein schlechter Mensch, und er soll auch wirklich Witz, sogar Geist besessen haben. Davon hat er freilich wenig gezeigt, als er mir seine Liebeserklärung machte ...«
»Wie? So nahe ist er Ihnen getreten?!«, rief die Freundin erstaunt.
»Ach, wer mir damals zu diesem Zweck alles in den Weg gekommen ist, das weiß ich ja gar nicht mehr. Das war in meinem sechzehnten Jahre. Wenn ich nicht so brave Eltern gehabt hätte — wer weiß, was aus mir geworden wäre! Meine Mutter wusch für fremde Leute. Ich hatte wohl schon dieses komischen Männchens mir geltenden Kapriolen bemerkt, wenn ich ihm auf der Straße begegnete, aber gar nicht weiter darauf geachtet, nur darüber gelacht. Ich war ja so harmlos! Und die an mich gerichteten Briefe, die täglich stoßweise in die Wohnung kamen, ließen meine Eltern gar nicht in meine Hände gelangen.
Eines Tages nun brachten Männer den erwarteten Korb mit Wäsche. Er wurde auf den Boden getragen — und als ich allein davorstehe, mich eben bücke, da springt plötzlich aus der Wäsche eine menschliche Gestalt empor, Mister Herkules Piper in seinem Harlekinanzuge! Er fällt vor mir auf die Knie, macht mir im Handumdrehen eine Liebeserklärung, schwatzt etwas, ich solle von ihm irgendwelche Heldentaten verlangen, eines Herkules würdig, er wolle von New York nach San Francisco auf allen vieren laufen, oder wolle in drei Tagen einen ganzen Ochsen aufzehren ... ich hörte es ja kaum, und ehe er noch fertig war, kam schon mein Vater, und der neue Herkules zog es vor, lieber allein schnell die Treppe hinabzugehen, als umsonst hinunterbefördert zu werden.
Das ist meine persönliche Begegnung zu dem originellen Menschen gewesen. Denn originell war er, das muss man ihm lassen. Noch einige Streiche, und dann plötzlich war er verschwunden. Niemand wusste wohin. Und so ist er ganze vierundzwanzig Jahre verschollen gewesen. Oder auch nicht verschollen, denn sein Kapital, das er übrigens durchaus nicht angegriffen hatte, hat er immer verwaltet. Das heißt, für tot erklären konnte man ihn nicht. Nur, wo er sich eigentlich aufhielt, das konnte niemand erfahren. In dem großen New York vergisst man ja auch so leicht, und im übrigen war er ja auch gar nicht der Mann, dessen Verschwinden eine größere Sensation erweckt hätte. Hier aber teilt nun die Zeitung mit, dass Mister Herkules Piper nach vierundzwanzigjähriger Abwesenheit wieder in New York aufgetaucht ist, er soll noch ganz der alte sein ...«
Die elektrische Zimmerglocke schrillte mehrmals in besonderer Weise. Sie hatte gesagt, dass sich ein Besuch anmelden lasse. Verwundert blickten die beiden Damen einander an.
»Ein Besuch? Zu dieser frühen Morgenstunde? Wer könnte denn das sein?«
»Erwarten Sie niemand?«
»Keinen Menschen.«
Lady Marion rief durch ein Klingelzeichen den Diener. Dieser trat ein, brachte schon die Karte des sich zum Besuch Anmeldenden mit.
»Herkules Piper, New York!«, las sie mit größtem Staunen. »Da ist er ja schon selbst! Ja, was will er denn?«
»Der Herr bittet, der Lady seine Aufwartung machen zu dürfen«, meldete der Diener, kaum ein Lächeln unterdrücken könnend.
»Was haben Sie denn zu lachen?«, fragte denn auch Marion gleich.
»Verzeihung, weil — weil — er, er ist — er ist ...«
»Er ist wohl noch immer eine recht komische Figur?«
»Er sieht gerade aus wie — wie — wie ein Zebra.«
»Wie ein Zebra? Was soll das heißen?«
»Er hat auch einen Diener mitgebracht«, suchte der Lakai seine Herrin auf andere Gedanken zu bringen.
»Auch noch einen Diener mitgebracht? Zu solch einer ungewöhnlichen Stunde? Ohne vorherige Ankündigung seines Besuchs?«
Man muss nämlich wissen, wie schwer es ist, ohne Empfehlungsbrief und ohne Einladung in ein englisches Haus zu kommen, und wie streng da die Vorschriften sind.
»Nun, es ist eben Mister Herkules Piper«, sagte aber jetzt Lady Marion, nur ihr Morgenkleid etwas an sich ziehend, »mit dem muss man schon eine Ausnahme machen. Ich lasse den Herrn bitten.«
»In diesem Kostüm wollen Sie den Herrn empfangen?!«, stieß die Freundin wahrhaft entsetzt hervor.
»Ach, es ist eben Mister Herkules Piper, das entschuldigt alles, und wie Jonny ihn mit einem einzigen Wort beschreibt, danach scheint er sich während der vierundzwanzig Jahre nicht viel geändert zu haben.«
Aber Miss Lucy Vernon war nicht zu bewegen, dazubleiben, einen fremden Herrn im türkischen Morgenrock zu empfangen. Das war gar zu shocking, und wenn auch dieses orientalische Gewand sogar einer Sultanin als Staatskleid hätte dienen können. Sie floh davon — — — um hinter der Portiere hervor, vom Nebenzimmer aus, den seltsamen Kauz desto eingehender mustern zu können.
Die Tür ging auf, und ... ein zweibeiniges Zebra tänzelte herein.
Ja, er war noch ganz derselbe. Die vierundzwanzig Jahre hatten nur seine Haare noch mehr gelichtet, sonst noch immer keinen echten Herkules aus ihm gemacht, es war noch immer die kleine, spindeldürre Schneidergestalt, die linke Schulter ragte noch immer spitz in die Höhe, während die rechte herabhing, und ... vor allen Dingen aber müssen wir da erwähnen, dass es sehr für den Charakter der schönsten Frau der Erde sprach, wenn sie den hässlichsten Mann der Erde nicht näher beschrieben hatte.
Denn auf diesen Titel konnte Mister Herkules Piper vielleicht Anspruch machen. Doch wollen auch wir weiter nichts erwähnen, als dass die Nase zwischen den wimperlosen Schweinsaugen ganz nach rechts zeigte, und dass diese rechte Seite des glattrasierten Gesichtes ein einziges Feuermal war.
Wer sehr hässlich ist oder sonst ein körperliches Gebrechen hat, soll sich wohlweislich so unauffällig wie möglich kleiden. Mr. Herkules Piper befolgte gerade das Gegenteil dieses guten Rates.
Es ist ja wahr, dass Querstreifen eine dünne Gestalt dicker erscheinen lassen, während Längsstreifen eine kleine Gestalt vergrößern, nun war aber Mr. Piper sehr klein, und er hätte doch nicht gerade schwarze und weiße Querstreifen wählen sollen, und überdies noch sehr breite, so dass er akkurat wie ein auf den Hinterbeinen laufendes Zebra aussah. Außerdem ließ der prall sitzende Anzug seine fabelhafte Magerkeit doch umso mehr hervortreten.
Ebenso wenig verschönte das ins Auge geklemmte schwarzeingefasste Monokel an breiter Goldborte sein zur Hälfte weißes, zur anderen Hälfte rotes Gesicht. Auch die unheimlich langen und spitzen Schnabelschuhe von knallrotem Leder wären nicht nötig gewesen. Solche gewaltige Latschen mit nach oben gerichteten Spitzen hat ja gar kein irdischer Mensch. Die desgleichen knallroten Handschuhe mit blauen Borten hatte er sich wohl erst anfertigen lassen müssen, dazu kam noch ein ganz eigentümlicher Zylinder von weißer Farbe mit scheckigem Band, ferner als Spazierstock ein kolossaler Knüppel, dann ein ...
Doch wir wollen lieber aufhören, denn mit einer genauen Beschreibung dieses Kauzes würde man kaum fertig. Ein buntillustriertes Witzblatt hätte solch eine Karikatur gar nicht zu bringen wagen dürfen, das wäre doch gar zu übertrieben gewesen, und hier lief sie in Wirklichkeit auf der Straße herum. Freilich selbst im internationalen London würde sie wohl die ganze Straßenjugend nebst allen Hunden hinter sich haben.
Höchstens wollen wir noch erwähnen, dass er, um den Dandy voll zu machen, an den Fingern ein ganzes Arsenal Ringe trug, alle sehr kostbar, aber auch alle sehr seltsam. Desgleichen trug er nicht nur ein, sondern gleich eine ganze Masse Armbänder, und zum Beispiel, um nur noch ein Schmuckstück zu erwähnen, an dem grünen Schlips stak eine Nadel, die einen Totenkopf trug, und zwar einen echten, allerdings nicht den eines Menschen, sondern den eines kleinen Affen.
Und solcher Raritäten hätte man an dieser merkwürdigen Gestalt noch viele entdecken können, man hätte nur Zeit zur Musterung haben müssen.
Da wir schon von Hut und Stock gesprochen haben, musste der Besuch ihn auch mit ins Empfangszimmer genommen haben. Wolle der geneigte Leser aber deshalb an keine Ungezogenheit denken. Sonst hätte ihm wohl schon der wohlerzogene Diener diese beiden Gegenstände draußen abgenommen. In England werden nur Überzieher, Regenschirm und Gummischuhe im Vorraum abgelegt, Hut und Stock dagegen werden mit ins Empfangszimmer genommen, das ist eben strenge Vorschrift. Allerdings ist ein anderer Anzug dazu nötig, schwarzer Gehrock, unbedingt mit zwei Reihen Knöpfen, und andersfarbige Beinkleider, und auch ist die Besuchszeit nur zwischen 4 und 6 Uhr nachmittags. Merkwürdigerweise wird das trotzdem ›Vormittagsvisite‹ genannt, und das mochte Mr. Piper verwirrt gemacht haben, oder er war eben ein Yankee, ging seine eigenen Wege.
Sonst benahm sich das gestreifte Schneiderlein ganz gentlemanlike. Vorschriftsmäßig den rechten ausgezogenen Handschuh in der linken, Hut und Stock in der rechten Hand, so tänzelte er mit eleganten Schritten auf die am Fenster sitzende Dame zu, blieb zwei Schritt von ihr entfernt stehen und machte seine Verbeugung — nun wäre nicht nötig gewesen, dass er dabei zierlich den rechten Fuß mit der Spitze hinter den linken setzte, was einen so zimperlichen, urkomischen Eindruck machte, dass die hinter der Portiere stehende Miss Lucy beinahe laut herausgeplatzt wäre.
Also die Dame des Hauses war ruhig sitzen geblieben, wie die Sitte des Landes es erforderte.
»Mr. Piper?«
»Herkules Piper«, entgegnete die Diskantstimme mit Betonung des Vornamens, etwas durch die schiefe Nase sprechend.
»Sehr angenehm!«
Der Besuch war angenommen worden, konnte es sich nun ohne Umstände bequem machen und mit der Sprache herausrücken.
Zunächst aber blieb Mr. Piper noch stehen und sah sich suchend um. Jetzt war hier ein großer Fehler begangen worden. Der Diener hätte folgen sollen, um dem angenommenen Gaste sofort Hut und Stock abzunehmen. Aber der Lakai hatte es vorgezogen, gleich draußen zu bleiben. Er traute sich wohl nicht die Kraft zu, seine Lachmuskeln so in der Gewalt zu haben wie die hinter der Portiere stehende Lauscherin.
Doch im Nu wusste sich der Besucher zu helfen. Da stand auf einem Piedestal ein lebensgroßer Cupido aus schwarzer Bronze. Dem setzte Mr. Herkules Piper ganz einfach seinen weißen Zylinder auf, hing ihm den Krückstock an den ausgestreckten Arm — so, nun konnte er sich setzen. Dazu zog er zunächst nach amerikanischer Sitte seine Hosen etwas in die Höhe, noch etwas höher, so dass die unteren Enden fast bis an die Knie gingen und er zeigte, dass seine Storchbeine von durchbrochenen, in allen Farben des Regenbogens schillernden Seidenstrümpfen umschlossen, die mit kostbaren Strumpfbändern befestigt waren, und dann ließ er sich wie eine Ziehharmonika in einem niedrigen Fauteuil zusammenklappen, dass seine spitzen Knie in gefährlicher Weise hervorstachen.
Lady Marion hatte zuerst nach dem Cupido mit dem Zylinder und dem Knüppel geblickt. Sie machte eine krampfhafte Bewegung, dann hatte sie sich bezwungen, konnte ruhig auch die schillernden Sperlingswaden und die ungeheueren Schuhe anblicken.
»Was verschafft mir die Ehre Ihres werten Besuchs, Mr. Piper?«
»Mylady kennen doch gewiss die Sage vom Herkules.«
Oho, der fing ja gleich gut an!
»Die Sage vom Herkules?«
»Ich meine nicht mich selbst, Herkules Piper, sondern den alten Herkules, auf griechisch Herakles, der die zwölf Arbeiten leistete.«
»Ja, ja, ich weiß schon.«
»Ist Ihnen der Lebensgang dieses sagenhaften Helden bekannt?«
»O ja, gewiss.«
»Dann bitte, berichten Sie mir, was Sie von ihm wissen.«
Lady Marion biss sich einmal auf die Lippen — diesem Landsmann gegenüber musste sie eben einen Pflock oder gleich einige Pflöcke zurückstecken — dann ging sie auf das Thema ein und bewies, da sie sich, weil es ihr in der Jugend kaum möglich gewesen war, noch in späteren Jahren eine sehr gute Bildung angeeignet haben musste.
»Nun, Herkules war der Sohn der Alkmene und des Königs Amphitryon. In Wirklichkeit aber soll Zeus selbst der Vater gewesen sein. Dieser wollte seinem irdischen Sohne das mächtige argivische Reich zusprechen, das aber wusste seine Gattin Juno zu hintertreiben, und durch eine List, die ich mehr des Näheren weiß, wurde Eurystheus, der Sohn eines anderen Königs, Herrscher über jenes Land und dadurch zugleich auch über Herkules. Deshalb entschied Zeus dann dahin, dass Herkules, sobald er erwachsen sei, dem Eurystheus zwölf Arbeiten zu leisten habe, nach deren Erfüllung er von jener Oberherrschaft oder von seiner eigenen Hörigkeit befreit sein würde.
Schon die früheste Jugend des zukünftigen unüberwindlichen Helden ist mit den verschiedensten Sagen ausgeschmückt worden. Gleich nach seiner Geburt schickte ihm die zürnende Juno zwei ungeheuere Schlangen, die das Kind erwürgen sollten, aber das Baby griff seelenruhig zu und erwürgte die Ungeheuer. So werden noch verschiedene andere Taten aus jener Zeit erzählt. Das Kind bekam die ausgezeichnetsten Lehrer, in den Wissenschaften Linus und Chiron, im Bogenschießen Eurythus, in den Waffen und in der Kunst des Ringens Kastor. In seine Jünglingszeit fällt die bekannte und so schöne Sage vom Herkules am Scheidewege. Der nach Ehre strebende Jüngling wich der üppigen Lust und Freude aus und folgte dem Weibe im ehrbaren Gewande, der Tugend, die ihm Arbeit und Schweiß, dafür aber auch unsterblichen Ruhm verhieß ...«
»Genau so wie ich, genau so wie ich«, stimmte Mister Piper zufrieden kopfnickend bei, sein Monokel um den Finger schlenkernd. »Nun, bitte, fahren Sie fort!«
Das schöne Weib musste sich doch noch einmal auf die Lippen beißen, ehe es diesem Verlangen entsprechen konnte.
»Nach verschiedenen anderen Heldentaten kam die Zeit heran, dass sich Herkules dem Eurystheus zur Verfügung stellen sollte, und als erste Arbeit forderte dieser von ihm, dass er den nemeischen Löwen erlege. Es war dies ein ungeheuerer, unverwundbarer Löwe, der irgendwo im Peloponnes hauste. Herkules ging hin, fing den Löwen und trug ihn lebendig zu Eurystheus hin, der darüber ...«
»Pardon, er hat den Löwen gleich getötet, ihn erwürgt.«
»Aber Eurystheus war beim Anblick des Ungeheuers doch so erschrocken, dass er gleich in ein Fass flüchtete.«
»Jawohl, schon beim Anblick des toten Löwen.«
»Nun gut, mag er ihn gleich getötet haben. Die zweite Arbeit, die Eurystheus von ihm forderte, war, dass er — dass er ... nun kommt die kerynitische Hindin daran, nicht wahr?«
»Pardon, das war die vierte Arbeit. Die zweite bestand darin, dass er ...«
»Ach richtig, die Hydra! Das war ein drachenähnliches Ungeheuer, mit neun Köpfen, und wenn man einen abschlug, so wuchsen aus dem Stumpfe immer zwei wieder hervor, und der mittelste war überhaupt unsterblich. So ging es auch Herkules. Hatte er der Bestie ein Haupt abgeschlagen, so wuchsen aus dem Stumpf immer zwei neue Köpfe hervor, bis er mit Hilfe seines Dieners Jolaus die Stümpfe mit einem glühenden Baumstumpf ausbrannte, da hörte das Nachwachsen auf, und den unsterblichen Kopf vergrub er und wälzte einen schweren Stein darauf ...«
»Und bei dem Kampfe kam der Hydra noch ein riesenhafter Krebs zu Hilfe, der dem Herkules immer in die Waden kniff.«
»Jawohl«, lächelte die geschulmeisterte Lady, »aber diesen Krebs zermalmte er auch so nebenbei. Die dritte Arbeit bestand im Lebendigfangen eines riesigen Ebers ...«
»Des erymanthischen Ebers«, war der Schulmeister noch genauer.
»Jawohl, ich entsinne mich, des erymanthischen Ebers. Dieses Auftrages hatte sich Herkules schnell entledigt. Auf dem Rückweg mit dem Eber aber passierte ihm noch ein anderes Abenteuer. Er kam zu einem Zentauren, der in seiner Höhle ein Fass köstlichen Weines hatte. Dieses öffnete Herkules ohne Weiteres, trank davon — aber der abwesende Zentaur roch schon in weiter Ferne, was da passiert war, galoppierte mit seinen Pferdefüßen schnell zurück, brachte andere Zentauren mit. Doch Herkules machte kurzen Prozess mit ihnen, tötete alle diese menschlichen Ungeheuer mit seinen vergifteten Pfeilen.«
»Woher hatte er denn diese vergifteten Pfeile?«
»Er hatte seine eigenen Pfeile damals in das Blut der Hydra getaucht.«
»Sehr richtig. Fahren Sie fort! Und nun die vierte Arbeit?«
»Die bestand im Lebendigfangen der kerynitischen Hindin. Das war eine Hirschkuh mit goldenem Geweih und ehernen Füßen, der Artemis geheiligt, so schnell, dass kein Hund und Pferd sie einholen konnte. Herkules rannte ihr ein ganzes Jahr lang nach, bis er sie endlich einholte, einfing und sie dem Eurystheus brachte. Was aus ihr geworden ist, weiß ich nicht.«
»Ist auch ganz Nebensache. Und die fünfte Arbeit?«
»Ja, wollen Sie mir da nicht eine kleine Andeutung machen?«
»Die Stymphaliden.«
»Richtig! Das waren riesige Vögel mit ehernen Krallen, Flügeln und Schnäbeln, die auch ihre Federn wie Pfeile abschießen konnten, großen Schaden anrichteten, sogar Menschenfleisch fraßen. Herkules scheuchte sie aus dem Sumpfe, Stymphalus, mit einer Klapper heraus, die ihm die Göttin Athene dazu geschenkt hatte, und erlegte sie mit Pfeilen.
Dann sechstens, nun weiß ich wieder, denn diese Arbeit hat mir immer am besten gefallen, sollte er dem Eurystheus den Gürtel der asiatischen Amazonenkönigin Hippolyte bringen. Herkules setzte mit einigen Begleitern, darunter auch der Held Theseus, nach Asien über, wurde von den Amazonen zuerst freundlich empfangen, bald aber kam es zum Kampfe, und Herkules war so ungalant, die schöne Königin bei den Haaren vom Pferde zu reißen und ihr den Gürtel zu nehmen. Auf dem Rückwege verrichtete er noch verschiedene Nebenarbeiten ...«
»Lassen wir diese! Und die siebente Hauptarbeit?«
»Die hat mir weniger gefallen. Herkules sollte den Stall des Augias reinigen. In diesem Stalle hatten viele Jahre 3000 Rinder gestanden, und da gab es überhaupt keine Reinigung durch menschliche Kraft mehr. Aber Herkules wusste sich zu helfen, er leitete einen Strom ab, durch den Stall hindurch, und der hatte bald alles gründlich weggeschwemmt. Aber nun die achte Arbeit?«
»Der kretische Stier.«
»Ah so! Das war auch so ein heiliges Tier, das aber durch einen Götterfluch tobsüchtig geworden war. Der Stier verwüstete weit und breit die Insel Kreta. Herkules fing ihn, brachte ihn lebend zu Eurystheus, ließ ihn aber aus irgendeinem Grunde wieder laufen, sodass er noch vielen Schaden anrichtete und erst später von Theseus erlegt wurde.
Als neunte Arbeit sollte Herkules die Stuten des Diomedes holen. Das waren Pferde, die von dem König der Bistonen mit dem Fleische der Wanderer gefüttert wurden, die harmlos durch sein Land zogen. Den Diomedes hatte Herkules bald besiegt, er warf ihn seinen Pferden vor, konnte aber nicht verhindern, dass diese auch seine eigenen Kameraden zum Teil auffraßen. Doch bändigte er die Pferde, brachte sie dem Eurystheus, ließ sie aber ebenfalls wieder laufen, wonach sie von wilden Tieren zerrissen wurden. War es nicht so?«
»Ich bewundere Ihr treues Gedächtnis. Und die zehnte Arbeit?«
»Jetzt sollte er nicht Pferde, sondern wieder einmal Rinder holen, die des Geryon, des Königs von Erytheia, einer einsamen Insel im Ozean. Die roten Rinder wurden von dem Riesen Eurythion und dem zweiköpfigen Hunde Orthrus bewacht ...«
»Pardon — haben Sie diese Geschichte denn erst kürzlich gelesen, dass Sie all diese Namen noch so genau wissen?«
»Nein, das ist schon lange her, aber ich habe ein sehr gutes Gedächtnis.«
»Dann ist es ja geradezu fabelhaft. Bitte, fahren Sie fort.«
»Zunächst sammelte Herkules auf Kreta ein Heer, um mit diesem gegen jene Insel vorzugehen. Unterwegs rang er in Libyen mit dem Riesen Antäus, welcher stets mit frischen Kräften emporschnellte, sobald er die Erde berührte, die seine Mutter war. Als Herkules das merkte, warf er ihn nicht mehr zu Boden, sondern erwürgte ihn in der Luft. An der Grenze von Libyen und Europa errichtete Herkules die nach ihm benannten Säulen. Auf der Insel angekommen, hatte er Hirten und Hund bald bezwungen, trieb die Rinder davon. Auf dem Rückwege verrichtete er wieder viele Nebenarbeiten. Räuber überfielen ihn, ein Rind entfloh ihm und schwamm über ...«
»Bitte, bleiben Sie bei den Hauptarbeiten. Die elfte kommt daran.«
»Da sollte er aus der Unterwelt den Zerberus heraufholen, den Höllenhund, ein fürchterliches, dreiköpfiges Ungeheuer. Herkules brachte ihn richtig dem Eurystheus, der ihn aber zitternd bat, das Ungetüm schleunigst wieder an Ort und Stelle zu bringen.«
»Und die letzte Arbeit?«
»Das Holen der goldenen Äpfel der Hesperiden. Diese Aufgabe war um so schwieriger, als Herkules gar nicht wusste, wo die Gärten der Hesperiden zu suchen seien. Er irrte deswegen in der ganzen Welt umher, soweit diese damals bekannt war, kam nach zahllosen Abenteuern nach Ägypten, nach Arabien, überall Kämpfe mit Riesen und Ungeheuern bestehend, darunter auch das bekannte Abenteuer mit Atlas, der das Himmelsgewölbe auf den Schultern trug ...«
»Genug, ich will ja durchaus nicht Ihre Kenntnisse in der griechischen Mythologie prüfen. Also Herkules fand und brachte die goldenen Äpfel wirklich.«
»Jawohl, Eurystheus überließ sie ihm, und Herkules weihte sie der Athene, seiner Schutzgöttin, die ihm immer hilfreich zur Seite gestanden hatte.«
Mister Piper machte eine Bewegung, welche sagen sollte, dass jetzt ein Abschnitt kam.
»So, das waren die zwölf Arbeiten des Herkules.«
»Und darf ich Sie jetzt fragen, weshalb Sie mich deswegen examiniert haben?«, lächelte das schöne Weib.
»Sie werden sofort alles erfahren. Zunächst eine andere Frage: Halten Mylady dies alles für Tatsache?«
»O nein, das ist doch alles nur Fabel.«
»Weshalb glauben Sie das?«
»Nun, es mag ja sein, dass es in Griechenland in der vorhistorischen Zeit einen gewaltigen Helden gegeben hat, aber ... an so etwas wie eine Hydra und dergleichen glaube ich nicht.«

»Mylady, ich habe mir vorgenommen, dasselbe zu leisten, wie dieser griechische Herkules, ich, Mister Herkules Piper.«
Das große Wort war ausgesprochen — mit einer zierlichen Verbeugung hatte das gestreifte Schneiderlein es herausgebracht.
Während die hinter der Portiere lauschende und beobachtende Miss Vernon wieder einmal schnell ihr Taschentuch in den Mund stecken musste, brachte es Lady Marion fertig, ganz ernst zu bleiben.
»Ah, was Sie nicht sagen!«, stellte sie sich erstaunt.
»So ist es. Ob jener griechische Herkules seine Heldentaten wirklich ausgeführt hat, das ist sehr zweifelhaft, das ist eben nur Sage — ich aber, Herkules Piper aus New York, werde solche Arbeiten tatsächlich leisten. Noch nach Jahrtausenden soll man nicht an der Wahrheit zweifeln, dafür werde ich sorgen. Und zwar ist es mein Wunsch, möglichst genau dieselben Arbeiten zu vollbringen, die Herakles — wie ich ihn zum Unterschied von mir nennen will — ausgeführt hat. So ganz ist das natürlich nicht angängig. Heutzutage gibt es leider keine Hydras mehr, keine menschenfressenden Pferde. Nicht einmal so ein richtiger Riese ist mehr aufzutreiben, den ich erst aufheben muss, um ihn in der Luft zu erwürgen ...«
Das zebragestreifte Schneiderlein hatte dabei mit den Händen eine Bewegung in der Luft gemacht, als wolle er Fliegen haschen.
Jetzt musste Lady Marion doch ganz ernstlich mit ihrer Lachlust kämpfen. Ja, das war ganz das mutige Schneiderlein aus dem Märchen, das sich zum Helden berufen fühlte, weil es sieben Fliegen mit einem Schlage erlegt hatte.
»Es müssen daher für diese Arbeiten entsprechende andere Werte geschaffen werden«, fuhr der neue Herkules fort. »Wenn Ähnliches nicht mehr vorhanden ist, so muss man gleichwertige Arbeiten suchen — verstehen Mylady?«
»Ich verstehe, ich verstehe.«
»Deshalb wende ich mich an Sie. Aus einem doppelten, sogar aus einem dreifachen Grunde. Ich kann mir die Arbeiten doch nicht selbst auferlegen, ich könnte mir zu leichte aussuchen, das könnte man mir wenigstens vorwerfen, wenn nicht noch bei meinen Lebzeiten, so doch in Jahrtausenden. Also eine unparteiische Person muss mir diese zwölf Arbeiten aufgeben, und Sie sind mit einer so glühenden Phantasie begabt, wie Sie ja zur Genüge bewiesen haben, dass Sie immer eine denen des Herkules gleichwertige Aufgabe finden werden. Wenn es keinen neunköpfigen Drachen mehr gibt, so werden Sie schon ein entsprechendes Abenteuer finden, aus dem ich siegreich als amerikanischer Herkules hervorgehen kann. Als amerikanischer Herkules — ja, das ist der dritte Grund, weshalb ich mich gerade an die Lady Marion Ramsay wende. Amerika, das große, freie, herrliche Amerika soll es sein, welches den neuen Herkules geboren hat — der griechische Herkules soll gegen den amerikanischen des zwanzigsten Jahrhunderts erblassen. — Heute bekommt der Junge, der in der Schule die zwölf Arbeiten des griechischen Herkules nicht herbeten kann, vom Lehrer Prügel — und mein Stolz ist, dass dies auch in Bezug auf mich der Fall sein wird. — ,Junge, nun gibt es aber noch einen anderen Herkules, einen amerikanischen Herkules, wie hat der mit seinem vollen Namen geheißen?‹ — ,Mister Herkules Piper, Herr Lehrer.‹ — ,Wo ist der geboren?‹ — ,In New York, Herr Lehrer.‹ — ,Nun zähle mir die zwölf Arbeiten auf, die dieser Mister Herkules Piper geleistet hat, die Lady Marion Ramsay aufgab.‹ — Verstehen gnädige Mylady? So muss es nach Jahrtausenden in allen Schulen der Erde in allen Zungen erklingen.«
Mit Begeisterung hatte das gestreifte Schneiderlein gesprochen, während Lady Marion immer ... besser wurde.
»Ich verstehe, ich verstehe«, murmelte sie ganz gedrückt.
»Wollen Sie also mein Eurystheus sein?«
»Ja, o ja, warum nicht.«
»Gestatten Sie aber, dass ich Sie dann Lady Eurysthe nenne?«
»Wie Sie belieben.«
»Oder meine Königin Eurysthe, in deren Leibeigenschaft ich mich befinde, aus der ich mich durch zwölf Arbeiten freizukaufen habe.«
Das ward wirklich immer romantischer! Lady Marion kam gar nicht dazu, dies richtig zu genießen.
»Wie Sie wollen, wie Sie wollen!«, konnte sie bloß murmeln.
»Dann, o meine Königin Eurysthe, wollen Sie mir meine erste Arbeit aufgeben?«
Zunächst raffte sich die zur Königin avancierte Lady empor. Das Bewusstsein dessen, was hier eigentlich vorlag, kehrte ihr zurück, und da wollte sie der Sache erst einmal näher auf den Grund gehen.
»Also, Sie wollen dieselben Arbeiten verrichten wie Herkules?«
»Habe ich mich noch nicht deutlich genug ausgedrückt?«
»Doch, doch! Nun, die erste Arbeit wäre ja sehr einfach, da braucht nicht erst ein Äquivalent gesucht zu werden. Ich schicke Sie nach Afrika auf die Löwenjagd, Sie sollen einen Löwen erlegen.«
»O, Königin Eurysthe, das wäre doch etwas gar zu einfach, zu profan.«
»Wieso?«
»Nun, Herkules hat doch auch nicht einen x-beliebigen Löwen töten sollen, sondern gerade den nemeischen Löwen, ein fürchterliches Untier, noch dazu unverwundbar. Für diesen müssen Sie also einen Gleichwert schaffen, mit einem x-beliebigen Löwen ist es da nicht abgetan.«
»Ja, was für einen Löwen sollen Sie da aussuchen? Solche Überlöwen gibt es doch heutzutage nicht mehr.«
»Das ist eben Ihre Sache, da verlasse ich mich auf Ihre Phantasie.«
»Nein, da wüsste ich wirklich nichts«, meinte die Lady kopfschüttelnd.
»Nun, es gäbe schon Auswege. Man hört schon noch manchmal von einem Löwen, der unter den Herden der Eingeborenen enormen Schaden anrichtet, Menschen tötet, Kinder fortschleppt, und der der Anstrengungen aller schwarzen und weißen Jäger spottet. Noch mehr ist das oft in Indien mit einem Königstiger der Fall. Und ein Königstiger ist ja ein vollständiges Äquivalent für einen Löwen. Außerdem dürfte ich den Löwen oder Tiger doch natürlich nicht mit einem Gewehr erlegen, ihn totschießen, Gott bewahre, das wäre doch keine Kunst, das kann doch jeder dumme Junge!«
»Ja, wie denn sonst?«, fragte Königin Eurysthe mit einigem Staunen.
Sie mochte auch schon etwas ahnen, denn jetzt begann ihre Phantasie zu arbeiten.
»Nun, Herkules hat doch auch keinen Schießprügel gehabt, nur eine Keule.«
»Sie wollten solch einen Löwen nur mit der Keule totschlagen?«
»Ich verpflichte mich sogar zu noch mehr. Sie waren zuerst der Meinung, Herkules hätte dem Eurystheus den nemeischen Löwen lebendig gebracht — das war ein Irrtum, er hat ihn erdrosselt — aber gut, nehmen wir an, dass der griechische Herkules den nemeischen Löwen lebendig angeschleppt hat — well, auch ich werde den gefährlichsten Löwen oder Tiger, der in der Welt aufzutreiben ist, mit diesen meinen Händen lebendig fangen und ihn lebendig meiner Königin Eurysthe bringen.«
Mit immer größer werdenden Augen betrachtete die Lady das dürre Schneiderlein. Es sprach gar so sicher. War das nicht heller Wahnsinn, der jetzt bei ihm hervorbrach?
»Sie wollen einen Löwen lebendig fangen?«
»Gewiss!«
»Mit Schlingen und Netzen?«
»O nein, nur mit meinen Händen!«
»Ja, Mister Piper, wer sind Sie denn eigentlich, dass Sie so sprechen können?«, fragte die schöne Frau jetzt frei heraus, mit der Absicht, dieser Komödie endlich ein Ende zu machen.
»Ich bin eben der neue Herkules, der amerikanische Herkules.«
»Sind Sie aber auch zu solchen Taten befähigt?«
»Gewiss.«
»Haben Sie denn etwa wie jener griechische Heldenjüngling schon Proben Ihrer Titanenkraft gegeben?«
»Gewiss, massenhaft!«, war die unverfrorene Antwort.
»Darf man fragen, wie, wo und wann?«, begann die Lady jetzt frei zu lachen.
»Nun, Sie wissen doch, dass ich mich vierundzwanzig Jahre in die Einsamkeit zurückgezogen habe.«
»Und während dieser vierundzwanzig Jahre haben Sie sich wohl zum Herkules ausgebildet?«
»Allerdings.«
»Auf welche Weise denn, wenn ich fragen darf?«
»Das möchte ich allerdings mein Geheimnis bleiben lassen. Aber, bitte, fragen Sie doch nicht so, zweifeln Sie nicht mehr, sondern stellen Sie mich einfach auf die Probe, geben Sie mir die erste Arbeit auf, irgendwelche! Leiste ich sie nicht, dann können Sie mich ja einen jämmerlichen Prahlhans nennen — aber auch dann erst. So gerecht werden Sie doch sein.«
Es lag etwas in seinen Worten, in seinem Tone, dass die Lady immer stutziger wurde.
»Wenn ich Sie jetzt nach Afrika schicke, mir einen Löwen zu fangen — Sie werden hingehen und es tun, ihn mir lebendig bringen?«
»Gewiss doch.«
»Mit Ihren eigenen Händen werden Sie den König der Tiere fangen?«
»Mit meinen eigenen Händen. Das heißt ...«
Mister Piper hatte auch den linken Handschuh ausgezogen. Nachdenklich betrachtete er seine mit Ringen aller Art gepanzerten Finger, die zwar sehr mager, aber doch wohlgepflegt und überhaupt sehr fein waren — Damenhände.
»Das heißt, eigentlich doch nicht mit diesen meinen eigenen Händen. Sie müssen nur richtig verstehen.«
»Wie richtig verstehen?«
»Nun, ich bin doch überhaupt ganz modern — will auch ein moderner Herkules sein.«
»Was meinen Sie damit? Da verstehe ich Sie wirklich nicht.«
»Nun, die Zeiten haben sich doch inzwischen total geändert. Wenn früher ein König dem anderen den Krieg erklärte, so rückten die beiden nicht nur mit ins Feld, sondern sie stellten sich auch an die Spitze ihrer Krieger, ließen es womöglich zum Zweikampf zwischen sich kommen. Das ist heute doch ganz anders geworden.«
»Allerdings, aber was meinen Sie dabei mit Bezug auf Ihre Sache?«
»Heute halten sich die Könige im Hintergrund des Treffens, wenn sie nicht gleich ganz zu Hause bleiben. Das lassen sie alles ihre Generäle und Soldaten besorgen, und dennoch nimmt der eine König die Ehre des Sieges für sich in Anspruch, der andere muss die Schmach der Niederlage tragen.«
Immer größer wurden der Lady Augen, ihr scharfer Verstand begann jetzt schnell genug zu begreifen.
»Das soll doch nicht etwa heißen, dass Sie ... diese Arbeiten des Herkules von einem anderen verrichten lassen wollen?«
»So ist es, und wenn jener griechische Herkules heute wiederkäme, würde er auch nicht anders handeln. Die Zeiten haben sich eben unterdessen geändert — ich bin ein ganz moderner Herkules, werde mir doch nicht meine Finger schmutzig machen.«
Da lehnte sich die schöne Frau zurück und brach in ein Lachen aus, dass ihr die Tränen über die Wangen rannen.
»Das ist ja köstlich, das ist unbezahlbar!«, brachte sie nur hervor.
Endlich hatte sie sich wieder gefasst, während Mister Piper ganz gelassen geblieben war.
»Und wen wollen Sie dann die Arbeiten des Herkules verrichten lassen, um die Ehre und den unsterblichen Ruhm für sich selbst in Anspruch zu nehmen?«
»Meinen Diener.«
»Was für einen Diener?«
»Bitte, Mylady, wollen Sie das nicht komisch auffassen. Ich kann den unsterblichen Ruhm mit allem Recht für mich in Anspruch nehmen. Dieser mein Diener ist das Produkt meiner Erziehung, ich habe ihn innerhalb vierundzwanzig Jahren zum Herkules erzogen — ja, noch mehr, ich habe mich vierundzwanzig Jahre lang unausgesetzt mit ihm beschäftigt, bis ich ihn so weit hatte, wie ich ihn haben wollte — bis er fähig war, alle Arbeiten des griechischen Herkules zu verrichten, und hoffentlich noch viel mehr. Und was meinen Sie wohl, was mich das gekostet hat, und nicht nur Geld? Kein gerechtdenkender Mensch wird mir dann das eigentliche Verdienst abstreiten wollen. Wie gesagt, die Zeiten haben sich unterdessen eben geändert, ich bin ein ganz moderner Herkules — und dass ich mich deswegen mit fremden Federn schmücken will, davon ist trotz allem gar keine Rede.«
Starr sah die Lady den so ernsthaft Sprechenden an.
Ja, warum nicht? Mochte sie denken. Hat der Mann nicht schließlich ganz recht? Vorausgesetzt, dass es wirklich so wäre.
»Sie haben den Diener wohl gleich mitgebracht?«
»Er befindet sich im Vorzimmer.«
»Ach, so bringen Sie ihn doch herein!«
»Wenn Sie gestatten, o, meine Königin Eurysthe, werde ich Ihnen sofort das Produkt meiner vierundzwanzigjährigen Erziehung vorführen.«
Mister Herkules Piper hob seinen rechten Fuß und stampfte zweimal auf den Boden, gar nicht so derb, und es konnte nicht anders sein, als dass er unter oder in dem roten, unförmlichen Halbschuh eine Glocke hatte. Zwei sehr laute Glockentöne erschollen, und alsbald öffnete sich die Tür. Der Diener, der eigentliche Herkules, kam herein ... humpelte herein.
Ja, der zukünftige Löwenerdrossler und Drachentöter humpelte! Es war ein uralter Mann, mit langem, weißem Bart, das Gesicht schon ganz faltig, der, mit einem langen Bratenrock bekleidet, in seinen breiten Schuhen und sich auf einen Knotenstock stützend mit vor Altersschwäche geknickten Knien hereinschlich.
Erst traute Lady Marion ihren Augen nicht recht, dann hinderte sie nur die Ehrfurcht vor solch einem Alter, dass sie nicht in ein schallendes Gelächter ausbrach.
Der Greis war ziemlich nahe herangekommen, blieb stehen, Mister Piper machte, ohne hinzusehen, eine Handbewegung nach ihm hin.
»Nicht der Herkules selbst, sondern nur das Werkzeug des neuen Herkules, gewissermaßen seine von ihm untrennbare Kriegskeule ... das Produkt meiner Erziehung.«
Lady Marion hatte sich wieder erholt.
»Na, Mister Piper, nun machen Sie der Komödie wohl lieber ein Ende. Es ist überhaupt nicht hübsch von Ihnen, dass Sie auch mit solch einem ehrwürdigen Alter Ihre Narrenspossen treiben.«
»Alt? Der ist doch erst dreiundzwanzig Jahre. Denn ein Jahr brauchte ich zur Vorbereitung seiner Geburt. O, was meinen Sie wohl, wie sorgsam ich erst seine Eltern ausgesucht habe, wie ich das alles ... na, darüber darf ich in Damengesellschaft nicht sprechen ... und diese Ammen, die dieses Produkt meiner Erziehung gehabt hat! Nicht nur menschliche Ammen, sondern auch abwechselnd eine Löwin, eine Bärin, selbst die verschiedensten Arten von Schlangen haben ...«
»Ach, nun hören Sie endlich auf mit Ihrem Unsinn!«
»Sie glauben es nicht? Betrachten Sie zum Beispiel dort draußen den Baum. Und nun, o, du Produkt meiner Erziehung, beweise, dass ich dich unter anderem auch mit der gepulverten Haut eines Chamäleons und mit spanischen Fliegen gefüttert habe ... da sehen Sie die Wirkung meiner Worte, o, meine Königin Eurysthe!«
Bei seinen ersten Worten hatte der Yankee zum Fenster hinausgedeutet, das nach dem Park ging. Marion war mit den Augen der Richtung gefolgt, drei Sekunden später, allerhöchstens fünf Sekunden später blickte sie wieder nach dem alten Manne und ... die Lady prallte vor Schreck gleich mit dem ganzen Stuhl zurück.
Verschwunden war der alte, gebrechliche Mann, statt seiner stand jetzt auf derselben Stelle eine junge, schöne Dame, ein pompöses, weißes Spitzenkleid tragend; das lange, weiße Haar hatte sich in ein schwarzes, hochfrisiertes Toupet verwandelt, darauf thronte statt des alten, schäbigen Zylinders, den der Alte getragen hatte, ein breitrandiger Hut mit wallenden Straußenfedern, die großen Schuhe hatten sich in die zierlichsten Goldkäferschuhe verwandelt, der Knotenstock in einen eleganten Sonnenschirm ... es war eine tadellose Dame in vollster Jugendpracht, die in koketter Stellung dastand, das schöne Antlitz lächelnd der Lady zugewandt.
Man sieht ja auf der Varietébühne manches Staunenswerte von Verwandlungskünstlern ausgeführt, man begreift kaum, wie sie so schnell ihr Kostüm wechseln, sich überhaupt so verändern können, nun aber hier, in noch nicht fünf Sekunden wird aus einem alten Manne solch eine blendende Dame, dieser Wechsel der Toilette ...
»Das geht nicht mit natürlichen Dingen zu, das ist Zauberei!!«, stieß Lady Marion wahrhaft entsetzt hervor.
»Es gibt nichts Unnatürliches«, ließ sich Mister Piper gleichgültig vernehmen, »und darin eben bin ich, der moderne amerikanische Herkules, wiederum jenem griechischen Herkules bedeutend überlegen. Dieser Herkules lebte ja zu einer Zeit, wo solche Zaubereien noch möglich waren, der hatte auch seine Göttin Athene, die ihm immer beistand, wenn er in Nöten war — habe ich gar nicht nötig, mache ich alleine, ich bin ein Mann der eigenen Kraft, ich pfeife auf alle Göttinnen und dergleichen Hokuspokus ...«
»Ja, um Gottes Willen, wie ist denn das aber nur möglich?!«
»Einfach ein Produkt meiner vierundzwanzigjährigen Erziehung, ich habe ihm erst alles beigebracht. Nun zeige, o, du Produkt meiner Erziehung, dass ich dich nicht umsonst mit der Milch eines Kängurus und mit der italienischen Spinne, welche man Tarantella nennt, gefüttert habe, ebenso mit gepökelten Zungen von spanischen Nachtigallen.«
Kaum gesagt, so begann die liebreizende Dame ein spanisches Liedchen zu schmettern, hob kokett das weiße Spitzenröckchen, dass über den Goldkäferschuhchen die durchbrochenen Strümpfe und sogar die Spitzen der Unterkleider trotz deren Kürze zu sehen waren, drehte sich im Takte ihres faszinierenden Liedchens im Kreise, dabei mächtig die Beine schlenkernd — sang und tanzte die Tarantella.
Lady Marion geriet vor Staunen immer mehr außer sich.
»Stopp!«, kommandierte Mister Piper nach einer Weile, immer ohne hinzusehen, und es hatte etwas Automatisches an sich, wie die Dame plötzlich mit Tanzen und Singen aufhörte und wieder ganz bewegungslos dastand.
»Um Gottes willen, was für eine menschliche Person ist denn das nur!«, rief die Lady, dieses Automatische sehr wohl herausfühlend.
»Menschliche Person? Hm! Sehr die Frage, ob es überhaupt ein Mensch ist. Eben das Produkt meiner Erziehung, sozusagen von mir selbst erschaffen.«
»Aber die Verwandlung, diese blitzschnelle Verwandlung, wie war die nur möglich?!«
»Blitzschnell? O, das geht noch viel schneller. Bitte, wollen Sie einmal dorthin sehen? So, nun können Sie schon wieder zurückblicken.«
Er hatte den Blick der Lady wirklich kaum einen Moment nach der anderen Seite gelenkt, und als sie zurückblickte, war die pikante Tänzerin abermals verschwunden, statt ihrer stand ein junger Mann da, im schwarzen Jackettanzug, mit gelben Glacéhandschuhen, statt des schäbigen Zylinders, den der Alte getragen hatte, eine dunkle Reisemütze auf dem Kopfe ... überhaupt wieder ganz und gar anders gekleidet als der Alte, natürlich erst recht anders als die Tänzerin — es war ein eleganter Herr im Reiseanzug, mit ernstem, männlich-schönem Gesicht.
Wiederum war Lady Marion zuerst vor Schreck wie gelähmt. Denn diesmal konnte man wirklich von einer blitzartigen Schnelligkeit sprechen.
»Nein, das ist Zauberei!«
»Mitnichten, das ist das das Produkt meiner Erziehung.«
»Ja, wie macht er das bloß? So erklären Sie es mir doch!«
»Wie Sie befehlen. So, zeige, o du Produkt meiner Erziehung, in welcher Weise ich dir diese Verwandlungskünste beigebracht habe. Mache zuerst den alten Mann! Ganz langsam!«
Gut, der junge Mann zog zuerst seine Glacéhandschuhe ab, so ganz bedächtig, steckte sie ein, zog dafür ein Paar große Schuhe hervor, streifte diese über seine normalen Stiefel, nahm seine Mütze ab, drückte hinein, sie verlängerte sich, es ward ein Zylinder daraus, setzte eine weiße Perücke auf, band einen weißen Bart vor, alles aus den verschiedenen Taschen ziehend. Dann machte er sich an seinem schwarzen Jackett zu schaffen, ließ scheinbar das Futter oder zurückgeschlagenen Stoff heraus, so entstand der Bratenrock. Er entfernte Kragen und Schlips, band dafür ein schmutzigweißes Halstuch um, hatte eine Art Kapsel in der Hand, die er zur Röhre herausschob, so entstand der Knotenstock — und der alte Mann war fertig, der gebückt dastand.
»Nun, ist das nicht ganz einfach?«, wandte sich Mister Piper an die Lady.
»Ja, aber diese ungeheuere Schnelligkeit! Und dann aus diesem alten Manne solch eine elegante Dame zu machen!«
»Zeige, o du Produkt meiner Erziehung, wie du die junge Dame machst — wiederum ganz langsam. Verzeihen Sie aber, meine Königin Eurysthe, wenn Sie dabei einige intime Toilette zu sehen bekommen.«
Der alte Mann zog zunächst wieder seine Schuhe aus, und zwar gleich zwei Paar, denn er befand sich sofort in Goldkäferschuhen. Hierauf streifte er die schwarzen Hosenbeine bis über die Knie herauf, sodass die durchbrochenen Strümpfe sichtbar wurden, griff noch etwas nach und zog auch noch Spitzen hervor, darauf entfernte er Bart und weiße Perücke, und am interessantesten war vielleicht, wie er sich mit beiden Händen über das Gesicht strich, wonach aus diesem plötzlich alle Falten verschwunden waren, schöne, jugendfrische Züge wurden. Hierauf brachte er eine Damenfrisur zum Vorschein, nahm erst den Zylinder ab, stülpte ihn um, es wurde ein ganz breitrandiger Damenhut daraus. Mit einem Klappen sprangen einige Straußenfedern, die zusammengelegt gewesen sein mussten, auseinander, und hierauf ging es an die Hauptsache, an das Damenkleid.
Dazu zog er den ganzen Rock aus. Es zeigte sich, dass dieser inwendig weiß gefüttert war, aber auch nicht nur so einfach. Der Verwandlungskünstler zog hier und da. Überall kamen Spitzen und Bänder zum Vorschein, dieses verlängerte Kleid zog er an. Nun noch etwas über den Rock gestreift, dass ein Sonnenschirm daraus wurde — und jetzt war wieder die elegante junge Dame fertig.
»Fabelhaft, fabelhaft!!«, staunte Lady Marion.
Dabei aber hatte sie das Fabelhafteste vielleicht noch gar nicht bemerkt.
Das bestand nämlich darin, wie sich beim Zuknöpfen des Oberbeinkleides die Hüften des so stark erscheinenden Mannes zusammenzogen, wie er eine Taille bekam, die ein Mann überhaupt gar nicht besitzt, auch kein ›Damendarsteller‹ sie vorweisen kann, eine richtige Wespentaille, während sich gleichzeitig sein Brustkasten ohne weitere Hilfsmittel zu einer richtigen, vollen Damenbrust ausspannte.
Doch dies hatte Lady Marion vorläufig eben gar nicht beachtet, darüber sollte sie erst später staunen.
»Fabelhaft, fabelhaft!«, rief sie jetzt nur, über die allgemeine Verwandlung aufs Höchste erstaunt. »Ja, aber nun die ungeheuere Schnelligkeit!!«
»So entwickle jetzt dabei deine ganze Geschwindigkeit.«
Die Dame hob beide Hände, nahm mit diesen gewissermaßen einen Anlauf und ... legte los.
Was sie eigentlich tat, war nicht zu sehen, ist überhaupt nicht zu beschreiben.
Von der ganzen Gestalt war nicht mehr viel zu sehen, so wenig wie von irgend einem Gegenstand, etwas einem Lineal, welches man an einer Schnur im Kreise schwingt. Dermaßen schnell bewegte sie Hände und Arme, wohl auch die Füße, den ganzen Körper, um die einzelnen Kleidungsstücke wieder auszutauschen.
Etwas Weißes schwirrte durch die Luft, ging schnell in eine schwarze Farbe über und ... da stand eben wieder der alte Mann mit seinem Zylinder und den großen, breiten Schuhen da, sich auf seinen Knotenstock stützend.
Die Umwandlung hatte wiederum keine fünf Sekunden gedauert, und so machte Lady Marion erst recht ein Gesicht, als habe sie eine Vision gehabt.
»Ja, wie ist denn das nur möglich?!«
»Einfach Übung.«
»Nein, nein, das begreife ich nicht — wie will man sich denn so etwas durch Übung aneignen!«
»Warum denn nicht? Ist es denn mit dem Klavierspielen etwas Anderes? Man hat ausgerechnet, dass ein vollendeter Virtuose, wie Liszt oder Rubinstein, eine Tonleiter, einen Läufer über das ganze Klavier hinweg mit beiden Händen in noch nicht einer Zehntelsekunde macht. Nun nehmen Sie ein Kind an, das das Klavierspielen erst lernen will, oder es kann auch ein erwachsener Mann sein — er braucht zu demselben Läufer im Umfange eine halbe Minute, und da muss er erst den Fingersatz weghaben, wird sich zuerst auch noch oft genug vergreifen. Aber das geht immer schneller, und nun nehmen Sie an, er will auf das ganze übrige Klavierspiel verzichten, setzt seine Ehre darein, solch einen schnellen Läufer machen zu können — wenn er nun täglich zehn Stunden übt, sollte er nach einem Jahre nicht ebenfalls in einer Zehntelsekunde über die ganze Klaviatur rasen können, ohne einen Fehler in Ton und Fingersatz zu begehen?«
Das war eine echt amerikanische Idee, so ein Jahr lang täglich zehn Stunden auf dem Klavier einen Läufer zu üben — aber recht hatte Mister Herkules, Lady Marion musste ihm beistimmen.
»Und so hat auch dieser Herr sich das eingeübt?«
»Unter meiner Anleitung, von Kind an. Täglich musste er sein Kostüm wechseln, welches eine dreifache Veränderung zulässt; immer schneller und schneller wurden seine Handgriffe, immer seltener geschah ein Fehlgriff — nun, und wenn er das hunderttausendmal gemacht hat, so lässt sich schon solch eine Schnelligkeit erzielen.«
»Hunderttausendmal?«
»Vielleicht auch öfter. Gezählt habe ich es nicht.«
Die Lady musste doch etwas den Kopf schütteln. Das war nun auch ein Lebenszweck! Aber immerhin, das Resultat war doch überraschend, geradezu verblüffend.
»Ich möchte noch einmal sehen, wie er sich wieder in eine Dame verwandelt.«
»Tu es, o du Produkt meiner Erziehung!«, kommandierte Mr. Piper in pathetischem Tone.
Unkontrollierbare Bewegungen aller Gliedmaßen, des ganzen Körpers. Man glaubte zwanzig Hände in der Luft zu sehen, der schwarze Schein verwandelte sich in einen weißen, und mit einem Ruck stand wieder die elegante Dame mit dem Straußfederhut da.
»Fabelhaft, fabelhaft!!«, konnte Lady Marion nur immer wieder sagen.
Sie stand auf, um sich die Erscheinung in der Nähe zu betrachten.
Wir sagen mit Absicht ,Erscheinung‹; denn Marion hatte das Gefühl, als ob die schöne Dame mit dem lächelnden Antlitz nur ein Automat sei, welcher keine anderen Bewegungen als diesen Kostümwechsel ausführen könne. Doch sie gab sich diesen Gefühlen noch nicht hin, sprach es noch nicht aus, interessierte sich zunächst nur für die Kleidung selbst.
So sei als Einzelheit noch erwähnt, dass die Dame halblange und halbweite Ärmel trug, an den Unterarmen weiße, bis zum Handrücken reichende, durchbrochene Handschuhe, wie es damals Straßenmode war; die Finger waren mit einigen Ringen geschmückt.
»Der alte Mann trug doch keine Ringe.«
»Die gehören aber doch mit zur eleganten Dame.«
»So streift er sie ebenfalls so in aller Schnelligkeit erst an?«
»Selbstverständlich!«
»Aber wie sich der Gehrock in ein solches Kostüm verwandeln kann, in eine solche Taille mit halblangen und weiten Ärmeln — es ist mir unbegreiflich.«
»Ja, das ist meine eigene Erfindung.«
Mr. Piper stand ebenfalls auf, trat hin, erläuterte diese seine Erfindung näher, wie man alles zurückschlagen und herausziehen konnte, was aber nicht weiter zu beschreiben ist.
Als er dabei den einen Ärmel noch weiter zurückschlug, erkannte Lady Marion noch deutlicher, was für ein schöner, voller Frauenarm das war, zu dem auch die feinen, schlanken, wie aus Elfenbein gemeißelten Hände und Finger gehörten.
»Als junger Mann machte er mir einen so kräftigen Eindruck, da war er ganz anders gebaut, da hätte ich nimmermehr solch einen Frauenarm vermutet.«
»Ja, als junger Mann muss er auch ganz andere Arme haben, da ist er das eigentliche Werkzeug des modernen Herkules.«
»Wie? Sie wollen doch nicht etwa sagen, dass er auch seine Glieder verändern könnte?«
»Es wäre schlimm, wenn er das nicht könnte. Mit solchen Armen kann er schwerlich einen Riesen in der Luft erdrosseln, und es ist nicht nötig, dass er sich erst wieder in den jungen Mann verwandelt. Spanne deinen Arm an, o du Produkt meiner Erziehung.«
Die Dame streckte ihren Arm mit ganz zurückgeschlagenem Ärmel aus, und staunend sah Lady Marion, wie sich dieser Arm nach und nach zu verändern begann. Die fleischigen Rundungen verwandelten sich in starrende Muskeln, Adern und Sehnen traten wie dicke Drähte hervor — fast furchtsam blickte die Lady auf diesen Arm, der jetzt einem athletischen Riesen angehörte, einem wirklichen Herkules. Hand und Finger waren allerdings schlank und fein geblieben, aber auch sie starrten jetzt von Muskeln, und der Unterschied wirkte umso verblüffender, als der andere Arm dagegengehalten wurde, der seine Dameneigenschaften mit runden, sanften Linien behalten hatte.
»Ja, ist denn das nur ein irdischer Mensch, der so etwas fertig bringt?«, flüsterte die Lady mit noch immer furchtsamen Blicken.
»Wie man es nimmt. Auf so ganz natürliche Weise ist er ja nicht gezeugt worden. O, das hat mir gar viele Mühe gekostet, den in die Welt zu setzen.«
Lady Marion hatte nichts weiter gehört, der letzte Anblick beherrschte sie ganz.
»Es ist Ihr eigener Sohn?«
»O nein! Solche Fähigkeiten besitze ich gar nicht. Da sehen Sie wieder, wie bescheiden ich bin. Aber ehe ich das passende Paar gefunden hatte, wie ich es haben wollte — was mich das für Mühe gekostet hat ...«
»Wer sind denn ihre Eltern?«
»Seine Eltern — es ist ein Mann. Das, o, meine Königin, möchte ich noch mein Geheimnis bleiben lassen. Ich bitte um Verzeihung.«
»Wo ist er denn geboren?«
»Fernab auf dem Gipfel eines einsamen Berges — im höchsten Heiligtume eines uralten Volkes — mehr möchte ich nicht verraten.«
»Und Sie haben ihn wirklich mit — mit — der Milch verschiedener Tiere genährt?«
»Wie ich Ihnen sage. Nun, o du Produkt meiner Erziehung, mache dich wieder zum Manne, wie ich dich hauptsächlich zu gebrauchen gedenke.«
Bekleidungsgegenstände schwirrten durch die Luft — wieder stand der junge Mann im Reiseanzug da.
Lady Marion rieb sich die Stirn.
»Ich möchte fast glauben, dass ich nur träumte.«
»Aber warum denn? Ist das alles nicht ganz handgreiflich?«
»Ja eben — was Sie mir da erzählen, ist ja rein märchenhaft, und ich muss mich doch von der Tatsache überzeugen lassen.«
Als die Lady den jungen Mann jetzt noch eingehend betrachtete, kam ihr zum Bewusstsein, was sie vorhin nur undeutlich gefühlt hatte.
Wie der junge Mann so dastand, das schöne, männliche Antlitz, das mit dem der Dame wiederum gar keine Ähnlichkeit hatte, ebenso bewegungslos wie die ganze Gestalt, das Auge durchaus nicht starr, aber so gleichgültig, ob er sie anblickte oder an ihr vorbeisah, je nachdem sie stand ... die Beobachterin fühlte immer deutlicher, dass hier etwas fehlte, was sonst jeder Mensch besitzt, es ward ihr plötzlich ganz unheimlich zumute.
»Wie ist denn der Name dieses Herrn?«, flüsterte sie. »Sie haben ihn ja noch gar nicht vorgestellt.«
»Einen Namen hat dieses Produkt meiner Erziehung eigentlich noch gar nicht bekommen. Wissen Sie, er verdient im Grunde genommen gar keinen.«
»Er verdient keinen Namen? Wie soll ich das verstehen?«
»Es ist — es ist ... ja, da kann ich mich schwer ausdrücken ... Sie geben doch auch nicht einem Gegenstand, den Sie benutzen, einen Vornamen ... wohl einem Hunde, aber selbst für ihre Puppen haben die Kinder nicht immer besondere Vornamen ... verstehen Sie mich jetzt? Dieser Mensch ist ... ohne meinen Willen eine Null. Mein Wille erst galvanisiert ihn zum Leben, möchte ich sagen. Wollen Sie durchaus einen Namen haben ... gut, so heiße er fernerhin Nemo, er ist auch wirklich ein Niemand.«
»Mr. Piper, ich glaube, dann haben Sie an diesem Produkte Ihrer Schöpfung noch etwas vergessen.«
»Was sollte ich noch vergessen haben?«
»Die Seele.«
»Bah, Seele — an so etwas glaube ich nicht!«, war die ungeschminkte Antwort des Yankees. »Er hat Gehirn, hat Fleisch und Knochen und was sonst noch alles dazu gehört, um einem modernen Herkules als Werkzeug zu dienen, und dass er dazu brauchbar geworden ist, dafür habe ich gesorgt, und das genügt. Eine Seele braucht er nicht zu haben.«
Lady Marion raffte sich empor. Sie wollte die Sache nehmen, wie sie nun einmal lag.
»Was haben Sie diesem Ihrem Diener, der also Nemo heißen soll, denn nun alles beigebracht?«
»Alles, was ich dazu brauche, um die Arbeiten des Herkules ausführen zu können.«
»Das ist sehr allgemein ausgedrückt.«
»Ich finde nicht, o, meine Königin.«
»Dass er mit solchen Armen fähig ist, Löwen und Riesen zu bezwingen, glaube ich schon. Wie steht es denn aber mit seinen geistigen Eigenschaften?«
»Er hat Geist genug, um einem modernen Herkules als Keule dienen zu können.«
»Kann er denn ... halt, da fällt mir etwas ein. Ich hätte gleich eine Arbeit für ihn.«
»Für ihn? Für wen?«,
»Nun, eine Arbeit für diesen neuen Herkules, und es ist auch eine ganz moderne Arbeit.«
»Aber ich bitte Sie sehr — das ist kein Herkules, das ist Nemo, ein Niemand — der Herkules bin ich, das ist nur mein Werkzeug.«
»Ah so, ich verstehe«, lächelte Marion. »Trotzdem muss ich fragen: Ist dieser Mann allwissend? Oder soll ich lieber fragen: Sind Sie selbst allwissend? Durch diesen Ihren Diener?«
»Nun, machen wir da keinen solchen Unterschied, es würde doch zu weit führen. Nein, allwissend ist er nicht, das habe ich ihm nicht beibringen können, auch nicht, dass er Ihnen oder einem anderen Menschen die Zukunft offenbaren kann. Überhaupt nichts Un- oder Übernatürliches. Sonst kann er alles, was einem in jeder Hinsicht höchst begabten Menschen nur beizubringen ist. Wollen Sie ihn vielleicht auf seine Sprachkenntnisse hin prüfen? Denn die muss ein moderner Herkules, den seine Arbeiten jedenfalls in alle Weltteile führen, doch haben. Kenntnisse in der analytischen Mathematik sind dagegen hierzu weniger nötig.«
»Ihrer bedarf er auch nicht zu der Arbeit, die ich ihm oder Ihnen gleich aufgeben möchte.«
»Bitte sehr!«
»Es ist allerdings keine solche Heldentat, eines Herkules würdig ...«
»O, so betrachten wir sie gar nicht als Arbeit oder nur als eine solche Nebenarbeit, wie Herkules sie ja in Menge geleistet hat.«
»Der Fall ist kurz folgender: Eine mir bekannte junge Dame hat ein Verhältnis mit einem Herrn, zur größten Betrübnis ihrer Eltern, zur Betrübnis von uns allen, die wir es wohl mit ihr meinen. Es scheint ihr auch gar nicht vom Herzen zu kommen, sie muss geradezu unter einem hypnotischen Einfluss dieses Mannes stehen. Wenn wir nur wüssten, wie er mit ihr korrespondiert! Ja, postlagernd! Wir wissen sogar die Poststation, von der die die Briefe abholt. Es kommt uns nur darauf an, das Stichwort zu erfahren. Vorgestern Abend nun hatte ich hier eine Gesellschaft. Auch jener Mann war da. Als ich zufällig einmal dort drüben im grünen Salon bin, der nur ganz schwach erleuchtet ist, höre ich ein flüsterndes Gespräch. Jener Mann, ein Bösewicht, teilt einem Bekannten sein Geheimnis mit, nennt auch das Wort, unter dem der postlagernde Briefwechsel stattfindet. Meine Erregung ist eine zu große. Nur weil ich selbst ein grünes Kleid trage und dicht an der grünen Tapete stehe bemerken mich die beiden nicht, ich darf mich aber auch nicht rühren. Also, ich höre das Wort, einen fremden, mir bisher unbekannten Namen. Es gibt nämlich Namen, welche man kennt und doch nicht kennt. Und in demselben Moment habe ich die feste Überzeugung, dass ich mir diesen Namen nicht merken kann. Also ich lege sofort die Hand auf den Rücken und schreibe hier mit diesem Diamantring das Wort gegen die Wand, kritzle es in die Tapete ein. Es wird Spiegelschrift geworden sein, wohl sogar das Oberste zu unterst, wie ich mich später überzeugte, als ich diese Schreibweise noch einmal probierte. Macht nichts, das Wort war in die Wand eingegraben. Vergessen habe ich es denn auch richtig, komme nicht mehr darauf, obgleich es mir immer auf der Zunge liegt — und ebenso wenig kann ich die Schrift wiederfinden. Ich habe gestern mit meiner Gesellschafterin den ganzen Tag danach gesucht, wir sind systematisch die ganze Wand abgegangen, Quadratzoll für Quadratzoll, auch heute früh noch einmal — alles vergeblich, wir können das eingeritzte Wort nicht finden.«
»Werden denn die Buchstaben überhaupt sichtbar geworden sein?«
»Ganz sicher. Das muss ich wenigstens nach den anderen Versuchen annehmen. Ich fühlte ja auch, wie der Diamant in die Tapete eindrang.«
»In welcher Höhe ungefähr haben Sie geschrieben?«
Marion legte die Hand auf den Rücken und zeigte es.
»In welchem Zimmer war es? Wollen Sie mich hinführen?«
»Gleich hier nebenan.«
»Nun, o du Produkt meiner Erziehung«, wandte sich Monsieur Herkules Piper an den wie eine Statue dastehenden Diener, »du hast gehört, um was es sich handelt — nun zeige, dass du auch von einem Falken aufgesäugt worden bist.«
»Was sagen Sie da?«, lachte Marion, als sie bereits die Tür zum Nebenzimmer öffnete. »Von einem Falken aufgesäugt? Wie haben Sie denn das gemacht?«
»Habe ich denn das gesagt? Mit den Augen von Falken großgefüttert, meine ich natürlich.«
Nemo, wie wir ihn fernerhin nennen wollen, hatte den grünen Salon betreten, schritt bereits die Wand entlang, ziemlich schnell.
»Hierherum muss es gewesen sein«, sagte Marion, ungefähr die Mitte der linken Wand bezeichnend.
An dieser Stelle aber war Nemo bereits vorüber, und er kehrte auch nicht um, ging schnellen Schrittes weiter, die Augen auf die Tapete gerichtet, bis er mehr in der Nähe des Fensters stehen blieb, und mit ausgestrecktem Finger deutete er gegen die Wand.
Mit einem Sprunge, der nichts von ihren vierzig Jahren merken ließ, stand die schöne Frau neben ihm, und jetzt sah sie sofort die in die Tapete eingekritzelten Zeichen, brauchte nur etwas den Kopf zu senken, um die Spiegelschrift lesen zu können.
»Ju venalis — wahrhaftig, das war es!!«
Erstaunt blickte sie sich in dem Zimmer um.
»Aber so nahe am Fenster? Ich hätte doch darauf schwören mögen, dass ich dort in der Mitte gestanden habe.«
»Das Zimmer war halb dunkel, und Sie befanden sich in großer Erregung, sagten Sie ja selbst, da kann das schon passieren«, meinte Monsieur Piper.
Noch erstaunter blieb Marions Blick auf dem jungen Mann haften, der gelassen wie immer dastand.
»Ja, aber wie ist denn das möglich? Wir suchen tagelang die ganze Wand systematisch ab, alles, alles, wir finden's nicht — und Sie schreiten ganz schnell die Wand entlang — Sie finden es sofort — was für Augen müssen Sie haben!«
»Er ist eben das Produkt meiner vierundzwanzigjährigen Erziehung«, nahm Mister Herkules Piper die Ehre für sich in Anspruch. »Nun, meine gnädigste Königin Eurysthe, wollen wir nicht ...«
Ein Lärmen unterbrach den Sprecher, ein vielstimmiges Schreien. Es kam durch das in der ersten Etage liegende Fenster, neben dem sie gerade standen.
Es gewährte einen Ausblick in den Regent's Park, und da sahen sie die Menschen laufen. Alles rannte, der älteste Herr, der eben noch würdevoll spazieren gegangen war, schlenkerte plötzlich seine Beine. Die eleganteste Dame hätte wohl am liebsten die Beine unter die Arme genommen, und die Ammen und Kindermädchen jagten mit den Kinderwagen im Galopp davon.
Offenbar befand sich die Gefahr, vor der alles floh, im Hintergrunde des Parkes. Die Flucht ging nicht nach ein und derselben Richtung, jeder suchte nur aus jener Gegend zu kommen und irgendeinen Ausgang des Parkes zu gewinnen, und dazu wurde viel geschrien. Aber zu verstehen war nichts.
»Da ist etwas passiert!«, rief Lady Marion.
Ja, das lag wohl klar auf der Hand.
»Was mag das sein? Hören Sie nichts?«
Nein, die Rufe waren nicht zu unterscheiden.
»Gerade, als wenn dort hinten eine Dynamitbombe mit brennender Zündschnur läge.«
Da kam ein Diener mit schreckensbleichem Gesicht hereingestürzt.
»Jumbo ist ausgebrochen!!«
Als dieser Name genannt wurde, wusste Lady Marion alles, und da der neue Herkules nicht allwissend war, musste sie ihn aufklären, wozu nur wenige Worte nötig waren.
Im Regent's Park befindet sich der Londoner Zoologische Garten. Vor kurzer Zeit erst war ein neuer Löwe angekommen, direkt aus Afrika, ganz frisch gefangen, ein mächtiges Exemplar, noch in seiner ganzen Wildheit.
Wild gefangene Löwen sind heutzutage in zoologischen Gärten die größte Seltenheit, außerdem war dieser die lebendige Jagdbeute und das Geschenk eines beliebten Prinzen aus dem königlichen Hause — kurz, jeder gute Patriot war verpflichtet, sich Mister Jumbo anzusehen, und das prächtige Tier war es auch wirklich wert, wie es in finsterer Majestät dalag, so ganz anders als die samt und sonders in der Gefangenschaft geborenen Löwen, noch ein wirklicher König der Wildnis, wenn er auch hinter Eisenstangen stak. Mit welchem Unwillen er immer das gereichte Fleisch zu sich nahm, wie er seinen Wärter, der es ihm brachte, nicht kennen wollte, sondern ihn hasste.
Dazu kam, um sein Aussehen noch fürchterlicher zu machen, dass er von seinem Fang her eine tiefe Kopfwunde hatte, die noch nicht ganz geheilt war, und das mochte seine Laune nicht verbessern.
Diesem Jumbo war es gelungen, die Freiheit zu erlangen. Er hatte den Zoologischen Garten bereits verlassen, trieb sich im Parke umher. Viel mehr konnte der Diener auch nicht berichten, aber das war schon genug.
Als getreuer Diener des Hauses hatte er schon alle Parterrefenster mit den festen Jalousien geschlossen, die Türen selbstverständlich auch, und nun fragte er nur noch wegen einer allgemeinen Bewaffnung an, erinnerte auch an die alte Kanone, welche auf dem Boden stand, zu der allerdings Pulver und Granaten fehlten, aber vielleicht genüge schon ihr Anblick, um Mister Jumbo von einem Besuche des sonst so gastfreundlichen Hauses abzuhalten.
Marion hörte nicht weiter darauf, sie sah die Augen ihres einstigen Anbeters auf sich gerichtet, wie diese sie fragten, und sie verstand. Hoch atmete sie auf.
»Mister Piper, da wäre ja gleich die erste Arbeit für Sie.«
»Das denke ich auch.«
»Der nemeische Löwe!«
»Hoffentlich gibt er ihm an Furchtbarkeit nichts nach.«
»Auch unverwundbar ist er.«
»Unverwundbar? Wie meinen Königin Eurysthe das?«
»Nun, der Direktion des Zoologischen Gartens dürfte wenig daran gelegen sein, nur einen toten Löwen wiederzubekommen ...«
»Ah, ich verstehe! Gut, ich eile, diesen Löwen lebendig zu fangen, ihn lebendig zu Ihren Füßen niederzulegen. Nemo, o, du Produkt meiner Erziehung ... pfft!«
Der stumme Diener eilte hinaus, der Herkules selbst blieb zurück, ließ sich gleich in einen Fauteuil fallen — es war ein ganz moderner Herkules, der sich mit solchen Arbeiten nicht seine feinen Hände beschmutzen wollte.
Auch der Hausdiener hatte das Zimmer wieder verlassen, und jetzt mochte erst der Lady zum Bewusstsein kommen, was sie da verlangt hatte.
»Aber ob Ihr Diener auch ...«
»Bitte, o, meine Königin, seien Sie meinetwegen ganz unbesorgt, ich weiß, was ich mit meinem Handwerkszeug leisten kann. Ich möchte die Gelegenheit benutzen, um mit Ihnen noch etwas anderes zu erledigen.«
»Und das wäre?«
»Erinnern Sie sich, dass ich schon einmal vor Ihnen stand?«
»Ja.«
»Vor vierundzwanzig Jahren, in dem Bodenraum eines Londoner Hinterhauses.«
»Ich erinnere mich noch recht gut.«
»Ich war damals ein eitler Narr.«
Lady Marion verschmähte es, ihm zu sagen, dass er dies seinem Aussehen nach wahrscheinlich noch heute war.
»Und heute, nach vierundzwanzig Jahren, wiederhole ich denselben Antrag.«
»Was?!«
»Lady Ramsay, ich erlaube mir, Sie um Ihre Hand zu bitten.«
Der neue Herkules hatte sich wieder erhoben und hatte auch gleich seine Hand ausgestreckt.
»Mister Piper, scherzen Sie doch nicht!«
»Ich habe schon damals nicht gescherzt, und heute ist es mir noch ernster. Mylady, lassen Sie mich sprechen! Ich liebe Sie. Sie sind überhaupt das einzige Weib gewesen, das ich jemals geliebt habe. Und passen wir denn nicht ganz vortrefflich zusammen? Gibt es auf der ganzen Erde zwei andere Menschen, die so gut zusammenpassen wie wir beide? Nämlich insofern, als sich Gegensätze berühren. Sie sind die schönste Frau auf der Erde, ich bin der hässlichste Mann — also passen wir beide zusammen.«
Und so fuhr Mister Piper noch des Längeren fort, von seinen Ansichten über die Ehe im allgemeinen und seiner Liebe im besonderen zu sprechen — Worte, die schon mehr von Wahnsinn als nur von Narrheit diktiert waren.
Der kurze Inhalt seiner fast viertelstündigen Rede, wobei er sich durchaus nicht unterbrechen ließ, war der, dass sich Lady Marion Ramsay verpflichten sollte ihm die Hand zum Ehebunde zu reichen, sobald er als amerikanischer Herkules die zwölf Arbeiten, die ihm seine Königin Eurysthe auferlegen würde, zu ihrer vollsten Zufriedenheit ausgeführt hatte.
Dies alles deklamierte er nicht nur fließend vor, sondern dann brachte er auch noch einen großen Bogen Papier zum Vorschein, und es zeigte sich, dass er schon alles schriftlich aufgesetzt hatte, gewissenhaft in Paragrafen gegliedert, sogar mit dem heutigen Datum und seiner Unterschrift versehen, Lady Ramsay hatte nur noch ihren Namen darunter zu setzen.
Als sie ihn nicht unterbrechen konnte, hatte sie sich in das Unvermeidliche gefügt, bis sie sich schließlich zu amüsieren begann.
»Wenn Sie die von mir gestellten Aufgaben aber nun nicht lösen können?«, ging sie scheinbar darauf ein.
»Ich werde sie lösen.«
»Das ist doch zu viel behauptet. Wenn Sie Ihren Tod dabei finden?«
»Dann bin ich eben tot. Ist alles schon in diesem Kontrakt vorgesehen.«
»Ist denn Ihr Diener etwa unsterblich?«
»In dieser Beziehung ist er ein ganz irdischer Mensch.«
»Wenn nun Ihr Diener den Tod findet?«
»Dann ist der Kerl eben tot.«
»Ohne ihn können Sie doch auch nichts mehr machen.«
»Nein«, gab der moderne Herkules ganz ehrlich zu.
»Und was dann? Ich finde diesen Kontrakt doch etwas einseitig.«
»Durchaus nicht. Habe ich nicht schon ganz klar gesagt, dass Sie in diesem Falle mein Vermögen erhalten?«
»Haben Sie das schon gesagt? Also, es ist eine Wette?«
»Eine Wette, ganz richtig! Erfülle ich alle Bedingungen, die Sie mir stellen, so haben Sie mir die Hand zum Ehebund zu reichen. Erfülle ich sie nicht, so schieße ich mir eine Kugel durch den Kopf — Sie sind die Erbin meines aus sechs Millionen Dollar betragenden Vermögens. Das ist hier drin alles klipp und klar ausgedrückt.«
Die schöne Frau wurde immer erregter. Das Abenteuerliche, das Exzentrische der ganzen Sache reizte sie. Doch noch behielt ihre Vernunft die Oberhand.
»Nein, Mister Piper, ich finde, dass wir da ein recht frevelhaftes Spiel ...«
Sie kam nicht weiter. Die Tür hatte sich geöffnet, und was Marion da erblickte, veranlasste sie, mit einem gellenden Zetergeschrei die Flucht zu ergreifen. Aber sie fand den Weg bis zur nächsten Tür wohl noch zu weit, um dieser furchtbaren Gefahr zu entgehen, und so zog sie es vor, nach dem an der Wand stehenden Büffet zu eilen, und sie mochte schon wissen, dass sie in dem unteren Teile noch Platz fand, so riß sie die Türen auf, kroch hinein und zog die Türen hinter sich wieder zu.
Verfolgen wir nun den Weg, den Mister Nemo genommen hatte.
Als wäre er hier zu Hause, so eilte er durch Zimmerfluchten und Korridore, eine andere Treppe hinab, als die er heraufgekommen war, und erreichte richtig das hintere Tor, welches durch einen Garten in den Regent's Park führte.
Vor diesem Tore waren einige Diener und Dienerinnen versammelt, die sich hier für sicher genug hielten, um abwechselnd durch das Schlüsselloch nach dem Löwen zu spähen, ob er diesen Palast besuchen würde oder nicht, dabei eifrigst ihre Ansichten über den Fall austauschend.
»Auf!«
Nur dieses eine Wort kam aus des jungen Mannes Munde.
Lag es im Ton, oder lag es im Blick dieser starren Augen?
Kurz, kein einziger Widerspruch, keine einzige Warnung — sofort war der große Schlüssel zur Stelle, das schwere Tor ward etwas zurückgezogen, dann freilich schleunigst wieder zugeschlagen und der Schlüssel umgedreht.
Nemo befand sich im Freien, in dem nur schmalen Blumengarten. Das Gittertor war schon von hier aus zu sehen, und er eilte darauf zu.
Als er die Klinke drückte, zeigte sich, dass auch dieses Gittertor geschlossen war.
Ganz merkwürdig aber war nun, wie sich der junge Mann dabei verhielt. Im schnellsten Schritt hatte er das Gittertor erreicht, legte nur einmal die Hand auf die Klinke, ein Druck, ein Blick, und dann schnellte er schon an dem vier Meter hohen Gitter empor, oben mit gefährlichen Spitzen ausgestattet, voltigierte über diese hinweg und setzte im nächsten Augenblick auf der anderen Seite seinen Eilschritt fort.
Es war schade, dass Lady Marion dieses Kunststückchen nicht beobachtet hatte. Ihre Meinung über diesen ›Automaten‹ hätte sich auch noch in anderer Hinsicht geändert. Denn diese Leichtigkeit, mit welcher der Mann in die Höhe geschnellt war, über das spitze Gitter hinweg, diese Schnelligkeit, verbunden mit Ruhe und Eleganz — sie waren der Beweis für eine beispiellose körperliche Gewandtheit gewesen, wie sie auch der trainierteste Zirkusclown nicht besitzt.
Verödet lag der noch vor drei Minuten so belebt gewesene Park da. Nur in der Ferne bewegten sich um ein Zentrum von Büschen her menschliche Gestalten, dort war jedenfalls der Ausgangspunkt der Gefahr, dort war schon das Personal des Zoologischen Gartens an der Arbeit, den Flüchtling wieder einzufangen.
Nemo verwandelte seinen Eilschritt in einen Laufmarsch, kürzte den Weg über die Rasenfläche hinweg ab.
Der König der Wildnis, der seine ungenügend verschlossene Tür zu öffnen verstanden hatte, hatte sich vorläufig mit seiner Freiheit begnügt, hatte noch keinen Schaden angerichtet.
Nachdem er über die Mauer des Tiergartens gesprungen war, hatte er ein auf freier Wiese stehendes Boskett als günstigen Ort betrachtet, um hier erst einmal darüber nachzudenken, was er nun weiter mit seiner goldenen Freiheit beginnen könne. Jedenfalls war er auch durch den plötzlichen Wechsel der Situation nicht wenig verwirrt worden. Das ist ja immer bei gefangenen Raubtieren der Fall, die durch einen Zufall in die Freiheit gelangen — zum Glück für Menschen und Tiere. Wenn sie sich wieder an die Freiheit gewöhnt haben, wenn sich der Hunger einstellt, dann wird die Sache anders.
Das wussten natürlich auch die für diese Flucht verantwortlichen Männer. Und es galt überhaupt, den Löwen so schnell wie möglich unschädlich zu machen, lebendig oder tot. Wenn es Jumbo einfiel, schnell noch einen Familienvater auf- oder auch nur anzufressen, so konnte das für den ersatzpflichtigen Zoologischen Garten eine teure Geschichte werden, da war es doch noch besser, das kostbare Tier vorher zu töten. Zunächst freilich wollte man sein Möglichstes versuchen, es lebendig wieder zu fangen.
Solche Raubtierwärter sind natürlich keine Feiglinge. Ja, durch den ständigen Umgang mit Raubtieren artet ihr angeborener Mut zu einer Sorglosigkeit aus, die ihnen oft verhängnisvoll wird, und in gewissen Fällen, eben wenn ein Raubtier ausgebrochen und wieder eingefangen ist, trauen sie sich eine Erfahrung zu, die sie gar nicht besitzen.
Mit Spießen und mit Stangen und mehr noch mit Stricken und Netzen waren sie nach dem Boskett gezogen, geführt von dem Direktor, der allerdings etwas vom Löwenfang verstand, begleitet von anderen Männern, die schon oft genug mit dem Gewehr Löwen in der Wildnis gegenübergestanden hatten.
Das kleine Boskett war von dem klugen Jumbo sehr günstig für sich gewählt worden, ungünstig für seine Gegner. Er lag in einem kleinen Busche, durch dessen Zweige man noch sein gelbes Fell schimmern sah, aber es war unmöglich zu bestimmen, wo sich der Kopf und wo sich der Schwanz befand.
Während die bewaffneten Löwenjäger mit angeschlagenem Gewehr wachten, zogen die anderen unter Leitung des Direktors ihre Netze, und Jumbo begleitete diese Arbeit mit unheilvollem Knurren.
Schon war der Löwe ziemlich eingekreist, als er mit einem mächtigen Sprunge über das nächste, noch nicht ganz aufgerichtete Netz setzte. Er hatte die ganze Arbeit zuschanden gemacht und lag nun in einem ganz anderen Busche in ebenso vorzüglicher Deckung.
»Herr Direktor, wir geben lieber eine Salve auf ihn ab«, meinte einer, der ebenfalls etwas zu sagen hatte. »Wenn das Tier das Boskett verlässt — ich übernehme keine Verantwortung mehr.«
Der Direktor machte ein Gesicht, als wolle er im nächsten Augenblick in Tränen ausbrechen.
»Aber das herrliche, edle Tier!«
»In diesem Boskett ist ein Fang unmöglich.«
»So treiben wir ihn erst heraus.«
»Und wenn dann etwas passiert? Wir können es nicht ... zurück, zurück, was für ein Wahnsinniger ist denn das?!«
Dieser letzte Ruf galt dem jungen Manne im dunklen Reiseanzuge, der den Kreis der Wärter durchbrochen hatte und sich schon auf dem direkten Wege nach dem inneren Ringe des Bosketts befand.
»Zurück, zurück! Seid Ihr denn wahnsinnig?!«
Der junge Mann machte hinter sich nur eine beschwichtigende Handbewegung und schritt weiter, und nun war es überhaupt ausgeschlossen, dass man ihm etwa noch nachgesprungen wäre und ihn zurückgerissen hätte. Solche heftige Bewegung ließ sich der Löwe in seiner dichten Nähe jedenfalls nicht gefallen, da wäre er gesprungen, sah man doch schon, wie er mit dem Schweife den Boden peitschte.
»Ich weiß, das ist Signor Lorenzo, der italienische Löwenbändiger!«, rief da einer von denen, welche immer alles wissen.
Ein italienischer Löwenbändiger hatte für die nächste Zeit seine Gastspiele in London angekündigt, noch keiner hatte den ganz unbekannten Dompteur gesehen, er war wahrscheinlich noch gar nicht in London — gut aber, es war der italienische Löwenbändiger Signor Lorenzo, alle atmeten erleichtert auf — nämlich deshalb, weil sich einer gefunden hatte, der seine Haut zu Markte tragen wollte.
Dass es ihm gelingen würde, mit diesem Löwen fertig zu werden, daran glaubte ja niemand — oder es hatte eben ein Fremder eingegriffen, der dazu ein gewisses Recht hatte, ein moralisches Recht, und was nun weiter passierte — man hatte nicht mehr so viel Verantwortung wie zuvor.
Es war also nicht der italienische Löwenbändiger, sondern unser namenloser Unbekannter.
Langsam, aber mit festem, nie zögerndem Schritt ging er auf den inneren Ring des Bosketts zu, beobachtet von den atemlosen Zuschauern.
Da plötzlich ward aus dem Gebüsch der mächtige Kopf des Löwen sichtbar, über den Augen die wieder aufgebrochene Wunde, aus der Blut hervorsickerte, den Rachen mit den furchtbaren Zähnen halb geöffnet, und so röchelte er dumpf dem kecken Menschen entgegen.
Dieses Menschlein aber ließ sich nicht beirren, es setzte seinen Weg fort.
Jetzt schickte sich der Löwe zum Sprunge an, es war deutlich sichtbar, wenn auch sein sonstiger Leib nicht zu sehen war — und es war zu spät, dem Manne noch eine Warnung zuzurufen, wenn eine Kehle überhaupt noch einen Laut hervorgebracht hätte. Die allgemeine Spannung war eine gar zu ungeheuere.
Und der Mann ging noch immer vorwärts. Jetzt allerdings ganz langsam, Fuß vor Fuß setzend, und dabei die rechte Hand ausgestreckt.
So erreichte er den König der Tiere, der ihn noch immer in furchtbarer Weise anknurrte, aber nicht sprang.
Hätten die Zuschauer die Augen dieses Mannes sehen können, so würden sie gleich vom Hypnotischen Blick des Raubtierbändigers gesprochen haben.
Aber ob es so etwas wirklich gibt? Die einen behaupten es, während gerade die Sachverständigen nichts von solch einem hypnotischen Blick wissen wollen.
Doch sei dem, wie es sei — der junge Mann legte langsam, ganz langsam seine Hand auf den Kopf des Löwen, und dieser duldete es, wenn auch immer noch knurrend und fauchend.
Auch leise und sanft gesprochene Worte vernahm man, aber man verstand sie nicht.
Und dann sah man, wie sich die Finger der feinen Hand fest in die gelbe Mähne einkrallten — »go on my darling« — und plötzlich richtete sich der Löwe auf, trat in seiner ganzen gewaltigen Größe aus dem Gebüsch hervor, das Knurren verstummte — und willig ließ er sich von dem Manne davonführen, der sich neben ihm wie ein menschlicher Zwerg ausnahm.
Und so schritten die beiden davon, der König der Wildnis in angeborener Majestät, und neben ihm der junge Mann, seine rechte Hand in der gelben Mähne vergraben.
So passierten die beiden die Wärter und die anderen Männer, welche mehr vor Staunen als vor Furcht vor dem Löwen zurückwichen — vor Staunen, weil sie etwas ganz und gar Unbegreifliches schauten.
Wohl springt mancher Dompteur mit seinen Löwen wie mit Hunden um — aber hier lag doch etwas ganz, ganz anderes vor!
Es musste denn gerade sein, dass diese beiden schon in der afrikanischen Wildnis Freundschaft geschlossen hatten, anders konnte man es sich gar nicht denken.
Wiederum war ganz deutlich zu merken, dass der Löwe durchaus nicht so gutwillig folgte — ziehen ließ sich ein solches Raubtier natürlich auch nicht — er befand sich wie unter einem Banne, dem er unbedingt folgen musste — es lag eben etwas ganz Rätselhaftes, sogar Unheimliches vor.
Die beiden hatten die Leute schon hinter sich, und niemand dachte dran, dem Löwenbezwinger zuzurufen, dass er das Raubtier doch gleich in den schon mitgebrachten Käfigwagen geleiten solle, niemand wagte ihm zu folgen, alles blickte in stummem Staunen, wenn nicht mit Grausen den beiden nach.
Schnellen Schrittes führte Nemo den Löwen weiter, aber doch gemächlich, jetzt sogar die Wege benutzend.
Sein Ziel war wieder das Gittertor. In kaum zehn Minuten hatte er es erreicht. Aber direkt ging er doch nicht hin, schritt daran vorüber, bog in eine Seitenstraße ein, die nach der Hauptstraße führte.
Die letzten Menschen, die noch gewagt hatten, sich auf der Straße aufzuhalten, wohl von Jumbos Ausbruch noch gar nichts wissend, flohen beim Anblick des ungeheueren Löwen schreiend davon, dass er von einem Manne geführt wurde, konnte sie nicht beruhigen. Wenn sie die nächste Haustür verschlossen fanden, kletterten sie in ein noch aufstehendes Parterrefenster oder suchten die nächste Straßenecke zu gewinnen. Einer erklomm schleunigst einen Straßenbaum, ein anderer hielt einen Blitzableiter für sicherer oder bequemer.
Doch das Ziel war nicht mehr weit entfernt, welches sich Nemo gewählt hatte. Es war das vordere Tor des Palastes der Lady Ramsay.
Gehorsam und doch wie mit heimlichem Widerwillen folgte ihm der an der Mähne gepackte Löwe bis an dieses Tor.
Ehe Nemo den Knopf der elektrischen Klingel drückte, probierte er einmal die Klinke.
Hatten die Diener in sinnloser Angst den Schlüssel um- und wieder zurückgedreht? Oder wie war es sonst geschehen?
Gleichgültig — das Tor gab nach. Nemo betrat mit seinem unheimlichen Begleiter den Hausflur.
Einige Diener sahen die beiden kommen. Sie hatten gar nicht erst viel Zeit zum Schreien, sie flohen davon, riegelten sich anderswo ein.
So schritt der Bändiger mit seinem Löwen die teppichbelegte Treppe hinauf, durch einen Korridor, öffnete die Tür zum Vorzimmer, sonstige Türen brauchte er nicht mehr zu öffnen nur zuletzt noch eine ...
Und da also brach Lady Marion ihre Rede schnellstens ab, um sich schreiend in das Büfett zu verkriechen.
Nemo blieb stehen, der Löwe stieß ein heiseres Knurren aus, legte sich zu Füßen seines Bezwingers, blickte grimmig auf das zebragestreifte Menschlein, das jetzt in aller Gemütsruhe, nur drei Schritt von dem Löwen entfernt, das Monokel ins Auge pflanzte, um sich den König der Tiere näher zu betrachten.

»Gut gemacht. Nun, o, meine Königin Eurysthe, da haben Sie Ihren nemeischen Löwen. Sind Sie mit dieser meiner ersten Arbeit zufrieden? Nehmen Sie ihre Lösung als voll an?«
Aber Lady Marion war jetzt nicht in der Stimmung, sich auf eine derartige Unterhaltung einzulassen.
»Schaffen Sie das fürchterliche Tier wieder fort!!«, zeterte es in dem Büfett, dessen Türen von innen krampfhaft zugezogen wurden.
»Ganz wie meine Königin befiehlt. Nur erlaube ich mir, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass sich König Eurystheus, als Herkules den nemeischen Löwen angeschleppt brachte, in einem Fasse, nicht in einem Büfett verkroch. Allerdings herrscht zwischen einem Fasse und einem Büfett ja eine gewisse Verwandtschaft, aber für zunächst einmal würde ich doch vorschlagen, damit wir uns möglichst treu an das klassische Vorbild anlehnen, dass für solch einen Fall ein Fass vorhanden ist. Nun, Jonny, wie ging's?«
Mit diesen letzten Worten hatte er sich wieder an den jungen Mann gewandt, ganz gleichmütig, ohne von dem knurrenden Löwen irgendwelche Notiz zu nehmen.
Also, er hatte für seinen Diener doch einen Namen. Aber das brauchte nicht der eigentliche zu sein. John oder Jonny heißt in England jeder Diener, zumal, wenn man seinen Namen nicht kennt. Es ist dasselbe wie bei uns mit dem Johann.
Nemo oder Jonny erstattete mit kurzen Worten Bericht. Die Hauptsache war wohl für seinen Herrn, zu hören, dass schon Wärter da gewesen waren, das Tier wieder zu fangen.
»Hatten sie nicht gleich einen Käfig mitgebracht?«
»Jawohl, Sir, einen auf Rädern.«
»Der wird dann wohl noch dort sein. Sonst bringe ihn direkt in den Zoologischen Garten, zurück ins Affenhaus ... pfft!!«
Ein festerer Griff, und der Löwe erhob sich wieder, zum Abschied zum ersten Male ein donnerähnliches Brüllen, und beide waren zur Türe hinaus.
»Die Gefahr ist vorüber. Meiner Königin Eurysthes Majestät können ihr viereckiges Fass getrost wieder verlassen.«
Es dauerte noch einige Zeit, ehe die Lady dies zu tun wagte, und dann war sie erst recht außer sich, und zwar nicht mehr vor Schreck, auch nicht vor Scham, sondern vor Staunen.
»Er kennt diesen Löwen wirklich nicht?!
Zehnmal fragte sie es, und zehnmal versicherte Mister Herkules Piper, dass an so etwas ja gar nicht zu denken wäre.
»Ja, was für ein wunderbarer Mann ist das dann, dem die wilden Tiere gehorchen?!«
»Es ist das Produkt meiner vierundzwanzigjährigen Erziehung«, war die stereotype Antwort, und mehr ließ sich auch aus Mister Piper nicht herausbringen.
Aber Lady Marion wurde dadurch nicht beruhigt, ihre Aufregung wuchs nur immer mehr, in fast unbegreiflicher Weise. Der unberechenbare Frauencharakter brach bei ihr durch.
»Wunderbar, wunderbar!! Nun gut, dann gehe ich darauf ein — wenn dieser Mann wirklich ...«
Sie vollendete den Satz nicht. Auf dem Damenschreibtisch lag noch der Kontrakt, Feder und Tintenfass waren vorhanden — hastig ergriff die Lady die Feder, tauchte sie ein — mit einem Zuge hatte sie ihren Namen unter den seltsamen Kontrakt gesetzt.
»Da!!«
»Danke.«
Gelassen löschte Mister Herkules Pipes die nasse Schrift ab, gelassen steckte er den zusammengefalteten Bogen wieder ein.
In diesem Augenblick mochte der schönen Frau doch zur Besinnung kommen, was sie da eigentlich getan hatte. Sie bekam plötzlich einen ganz roten Kopf, aber ebenso schnell raffte sie sich empor.
»Es gilt — mag es kommen, wie es will!!«
»Selbstverständlich gilt es. Entweder ich erfülle die Aufgaben, die Sie mir stellen werden, dann sind Sie meine Gemahlin — oder Sie beerben mich als einen toten Mann.«
»Sprechen wir nicht mehr darüber ...«
»Hat auch keinen Zweck, bis das Ende erreicht ist, so oder so.«
»Ja, ich werde Sie sofort auf eine zweite Arbeit ausschicken.«
»Bitte sehr.«
»Und ich werde Sie begleiten.«
»Höchst angenehm.«
»Ich habe eine zweite Arbeit für Sie bereits gefunden, und zwar ist sie jener zweiten Herkulesarbeit vollkommen entsprechend.«
»Ah, das freut mich! Darf ich fragen, ob dieser Gedanke Ihnen soeben gekommen ist, während Sie dort drin in dem Büfett gesteckt haben?«
»Allerdings. Es überkam mich wie ein Blitz.«
»Dann würde ich doch vorschlagen, auch dieses Büfett mitzunehmen.«
»Was meinen Sie? Weshalb denn?«, fragte die Lady nur verwundert, nichts weiter.
»Nun, wenn Sie eines guten Gedankens bedürfen, dann brauchen Sie immer nur in das Büfett zu kriechen, dann haben Sie ihn sofort gefasst.«
Starr blickte die schöne Frau den Sprecher an. Aber dass hier Spott vorlag, darauf wäre kein Mensch gekommen. Dieser Kauz brachte das gar zu gelassen heraus. Es war eben ein spleeniger Yankee, wie er im Buche steht, und was soll man denn so einem übel nehmen?«
»Es ist überhaupt merkwürdig, dass wir nicht sofort daran gedacht haben«, fuhr die Lady ohne weiteres fort.
»An was gedacht?«
»Nun, dass wir ja eine ganz moderne Hydra haben.«
»Eine moderne Hydra?«
»Allerdings.«
»Ich verstehe nicht.«
»Haben Sie nichts von der sizilianischen Hydra gehört?«
»Ich kenne nur die lernäische Hydra, welche ihr Unwesen auf der Insel Argos trieb — sonst kenne ich nur eine sizilianische Vesper, eine sizilianische Bauernehre, ein Beefsteak à la Sizilien ...«
»Die Räuberbande, die sich jetzt auf Sizilien so bemerkbar macht, die sich den Namen ›Hydra‹ gegeben hat, die Hydra von Sizilien!«
»Ah so! Jetzt begreife ich den Zusammenhang. Aber sonst bin ich in der gegenwärtigen Weltgeschichte durchaus nicht orientiert, und ich bitte meine Königin, mich einweihen zu wollen.«
»Die Sache ist kurz folgende: Ein italienischer Leutnant namens Giuseppe Morelli, in Rom bei der königlichen Leibgarde stehend, wurde wegen eines auf den König geplanten Attentates und überhaupt wegen Verschwörung verurteilt, sollte erschossen werden, ist es eigentlich auch worden. Er ist ein geborener Sizilianer, und die Sizilianer haben ja von jeher von einer Wiederherstellung des sizilianischen Königreichs geträumt. Seine Erschießung fand wohl nur scheinbar statt, er floh nach seiner heimatlichen Insel, hat einige gleichgesinnte Männer um sich gesammelt — einige davon waren schon vorher professionelle Banditen — führt dort ganz einfach ein Räuberleben, plündert die Reisenden, erpresst von ihnen Lösegeld.
Um nun der Sache einen würdigeren Hintergrund zu geben, spricht er eben von einer Befreiung Siziliens von der italienischen Fremdherrschaft, will dadurch das Volk mehr auf seine Seite bekommen, dass man ihm überall Schutz gewährt, scheint aber damit wenig Glück zu haben. Das Volk ist nicht mehr für ein sizilianisches Königreich. Man verehrt und beschützt ihn höchstens so, wie man jeden kühnen Räuber dort bewundert und ihm eine Zuflucht gewährt.
Weiter hat der Räuberhauptmann seiner Bande einen klassischen Namen gegeben. Ein Zufall mag es gewesen sein, dass er gerade acht Gleichgesinnte um sich versammelte, sodass die ganze Bande also aus neun Köpfen besteht, und nun hat der gebildete Leutnant das Gleichnis von der neunköpfigen Hydra herausgeklügelt, welche das Land so lange verwüsten würde, bis es die Fremdherrschaft abgeschüttelt hat, und für jeden Kopf, den man abschlägt, würden zwei neue hervorwachsen.
Er selbst nennt sich das unsterbliche Haupt dieser Hydra, und dieser Leutnant Morelli hat auch insofern wirklich Grund dazu, als er von jeher mit dem Nimbus der Unverwundbarkeit umgeben gewesen ist. Seit seiner frühesten Kindheit werden da zahllose Märchen über ihn erzählt, oder sie kommen erst jetzt aufs Tapet, seit dieser Mann im Munde aller ist. Er soll als Kind vier Stockwerk hoch heruntergestürzt sein, eine halbe Stunde unter Wasser gelegen haben usw. usw., ohne dass ihm dies etwas geschadet habe. Die Ursache zu diesem Nimbus der Unverwundbarkeit mögen seine zahllosen Duelle sein, die er als Offizier ausgefochten hat, auf Säbel und Pistole, meist Liebeshändel, aus denen er immer unverletzt hervorgegangen ist. Dann vor allen Dingen auch der merkwürdige Umstand, wie er als zum Tode Verurteilter schon erschossen worden ist. Sieben Soldaten vollstreckten das Urteil an ihm, von sieben Kugeln getroffen, sank er zusammen, wurde als Toter begraben — und dann plötzlich tauchte er wieder auf, und als man das Grab untersuchte, fand man es leer. Er war eben wieder lebendig geworden.«
»Wie hat er denn das gemacht?«, fragte Mister Piper naiv.
»Na, da sind eben noch andere eingeweiht und mit auf seiner Seite gewesen. Die Soldaten haben nur mit Platzpatronen geschossen, der Arzt der den Tod konstatierte, ist bestochen gewesen, und bei dem Begräbnis wird man schon dafür gesorgt haben, dass er unter der Erde noch etwas Luft bekam.«
»Famos!«, nickte der neue Herkules zufrieden. »Das ist ja gerade die Hydra, die wir brauchen, und ich werde diesen unsterblichen Kopf schon in einer Weise begraben, dass er sich nicht wieder auspaddeln kann. Hat sich denn ein anderer der Köpfe schon einmal verdoppelt?«
»In dem letzten Artikel, der darüber berichtete — oder überhaupt der einzige, die ganze Sache spielt noch gar nicht so lange — war davon nichts erwähnt. Wohl aber wurde gesagt, dass diese Räuberbande bis jetzt aller Verfolgungen durch die Carabinieri gespottet hat. Bisher wurde der Sache wohl wenig Beachtung geschenkt, oder man hielt es nur für ein Märchen, für eine Zeitungsente, bis vor einer Woche der auf der Reise durch Sizilien begriffene Lord Chesholm mit seiner Tochter dieser Hydra in die Hände gefallen ist. Morelli fordert ein ungeheueres Lösegeld, wohl 100 000 Pfund. Alle Vermittlungen sind bisher erfolglos gewesen.«
»Wo haust diese Hydra?«
»In dem Hauptgebirge, welches durch ganz Sizilien geht, in der Nähe von Nicosia herum. Sie taucht aber überall auf, wo man sie am wenigsten vermutet. Die Verhandlungen gehen von Messina aus.«
»So werde ich mich sofort nach Messina begeben.«
»Ich denke auch, dass Sie an Ort und Stelle alles besser erfahren, als wenn Sie erst hier bei den Zeitungen oder sonst wo Erkundigungen einziehen.«
»Ich werde mich überhaupt nie mit Zeitungen abgeben, das ist eines Herkules ganz unwürdig. Also Königin Eurysthe wird ihren Leibeigenen begleiten?«
Die Lady blickte an der gestreiften Gestalt herab. Der griechische Herkules trug mit Vorliebe ein Löwenfell, der amerikanische Herkules schien die Haut eines Zebras vorzuziehen, und sie mochte an die Gesellschaft solch eines Reisebegleiters denken.
»Ich bin hier noch einige Tage gebunden. Würden Sie nicht schon nach Messina vorausreisen, um dort Erkundigungen einzuziehen? Wir treffen uns in einem Hotel.«
»Wie meine Königin befiehlt.«
»Zwei Tage nach Ihnen treffe ich dort ein. Sind Sie in Messina bekannt?«
»Ich persönlich nicht, aber ...«
In diesem Augenblick trat Nemo wieder ein.
»Herrgott, unseren Haupthelden hätten wir ja bald vergessen!«, rief die Lady bestürzt.
»Haupthelden?«, fragte Mister Piper. »Wie soll ich das verstehen?«
»Nun ja — ich weiß schon ... wo ist denn Jumbo geblieben?«
Den hatte Nemo einfach in den Käfigwagen abgeliefert, und ehe Lady Marion weitere staunende Fragen stellen konnte, machte Mister Piper eine Verbeugung.
»Dies war also meine erste Arbeit, die ich wohl zu Ihrer Zufriedenheit gelöst haben werde — auf Wiedersehen in Messina, wo Sie Zeuge davon sein sollen, mit welcher Leichtigkeit ich als moderner Herkules auch diese moderne Hydra trotz aller Unsterblichkeit erledigen werde.«
Sprach's und verließ mit seinem Diener den Salon, beim Gang durchs Nebenzimmer dem Cupido Stock und Hut abnehmend.
Die ganze sonst so friedliche Bergstadt Nicosia war mit Entsetzen erfüllt, wenn sich auch seitens eines gewissen Teiles der Bevölkerung etwas Schadenfreude oder doch mindestens Bewunderung für die kühnen Räuber beigesellte.
Wie sich die neun Banditen etabliert hatten, haben wir schon berichtet. Das war vor erst drei Wochen geschehen, und die Räuberbande hatte sich ganz modern durch Plakate angekündigt, die sie sich in irgendeiner Winkeldruckerei hatten anfertigen lassen, sie an Felswände neben besuchten Bergstraßen und sogar an die Häusermauern verschiedener Städte und Ortschaften klebend, und das übrige hatten Zuschriften an Zeitungen getan, unterzeichnet von Giuseppe Morelli als dem Capitano der ›Hydra‹, wie sich die Bande nannte, was alles mit dem nötigen Pomp im blühendsten italienischen Stile näher erläutert wurde.
Also die Bande hatte es sich zur Aufgabe gestellt, das alte sizilianische Königreich, auf dessen Geschichte wir uns aber hier durchaus nicht einlassen wollen, in seiner früheren Herrlichkeit wieder aufzurichten.
Doch schon hiermit hatten sie bei der ganzen Bevölkerung wenig Glück. Mit der Herrlichkeit des sizilianischen Königreiches, oder der beiden Königreiche Siziliens, wie es eigentlich heißen muss, ist es niemals weit hergewesen, immer nur Aussaugung der Bevölkerung durch diese Usurpatoren, sodass die Sizilianer nur zu froh gewesen sind, als sie dem italienischen Königreiche angegliedert wurden, und diese Misswirtschaft stand noch in zu gutem Andenken. Solche Pläne wurden nur ›oben‹ gesponnen, vielleicht gerade am meisten in Rom in den höchsten Kreisen, aber für das sizilianische Volk selbst war das nichts.
Unterdessen, kündigten die Plakate weiter an, müssten die Befreier Siziliens als Räuber leben, sie würden Reisende plündern oder festnehmen, hauptsächlich würden sie sich an Fremde halten, die in Sizilien gar nichts zu suchen hätten, die herrliche Insel höchstens als Spione bereisten, um die wirtschaftlichen Verhältnisse auszukundschaften, dann pekuniären Nutzen daraus zu ziehen, wie ja auch schon alle Minen in fremden, hauptsächlich in englischen Händen seien; aber da die meisten sizilianischen Nobili und sonstigen reichen Leute ebenfalls nicht besser wären, nur Feinde des ehrlichen Volkes, das sich im Schweiße seines Antlitzes nähre, so würde man auch gegen diese vorgehen, ohne Rücksicht auf die Person — und in alledem solle das Volk auf dem Lande wie in der Stadt die ›Hydra‹ tatkräftig unterstützen.
Hiermit war es nun wiederum nichts. Die neue Räuberbande hatte in der Wahl des Landes, dem sie ihre Talente widmen wollte, einen unglücklichen Griff getan.
In Sizilien ist die Blütezeit für das Räuberwesen schon längst vorbei. Die Verhältnisse wären zwar sehr günstig für Rinaldo Rinaldinis, aber die Bevölkerung ist zu klug, sie noch zu unterstützen. Sizilien ist zu sehr vom Fremdenbesuch abhängig, hat von den vielen Fremden zu große Vorteile. Die Hauptanziehungskraft ist der Ätna, und wer einmal so weit ist, der macht auch noch eine Reise quer durch Sizilien bis nach Palermo, und diese Reisenden müssen mächtig viel Geld sitzen lassen, zumal Engländer und Amerikaner.
Da werden die Sizilianer so töricht sein, und dazu helfen, dass diese Goldfische weggefangen werden, damit keine mehr kommen!
Nach Korsika hätte sich die neue Räuberbande wenden sollen! Korsika hat es zwar noch viel nötiger als Sizilien, aber dort steht nun einmal der Strauchdieb noch in Ansehen.
Auf Sizilien spielt der Räuber heutzutage keine andere Rolle als bei uns. In Deutschland taucht doch auch ab und zu ein Raubmörder auf, der sich lange Zeit allen Verfolgungen zu entziehen weiß. Auf einen solchen wird dann auch in Sizilien so lange Jagd gemacht, bis man ihn hat, tot oder lebendig, und jeder Hirt und jeder Bauer sucht sich die Prämie zu verdienen.
Nur einen Mann gab es in ganz Sizilien, den man noch als professionellen Banditen vom alten Schlage betrachten konnte, Gambero Rosso, oder auch in einem Worte zu schreiben. Die Bedeutung dieses Namens werden wir bald kennen lernen.
Es war ein entsprungener Sträfling, der schon seit zehn Jahren im Monte Dinamari, dem Hauptgebirgszug Siziliens, als Bandit sei Wesen trieb, und dessen man noch nicht habhaft hatte werden können, obgleich auf seinen Kopf bereits eine Prämie von 300 Lire stand. Das ist schließlich für einen echten Räuber gar nicht so viel. Aber der alte Gamberorosso war eben noch gar nicht zum Mörder geworden, hatte noch niemals einen Reisenden gefangengenommen, um von ihm Lösegeld zu erpressen — er arbeitete nur im Kleinen, am meisten stahl er Schafe, stieg in unbewachte Häuser ein, und einem einsamen Reisenden, an den er sich heranwagte, nahm er höchstens das Bargeld ab, von Papiergeld wollte er gar nichts wissen, auch nichts von Uhr und Pretiosen, denn für die hätte er keine Abnehmer gefunden.
Also schließlich ein ziemlich harmloser Räuber. Nur seine Schlauheit war bewundernswert, wie er sich niemals fangen ließ. Der ehemalige Wirt kannte hier jeden Weg und Steg, und zudem war er sehr vorsichtig, ging am liebsten immer rückwärts, was auch schon sein Name ausdrückte, wie wir später sehen werden.
In demselben Gebiet des Monte Dinamari hatten sich die neun Banditen angesiedelt.
Wenn für die Bevölkerung dabei etwas ganz Sensationelles war, so war es das, dass die meisten dieser neun Briganten Nobili waren, Edelleute, oder doch die Söhne von reichen oder geachteten Sizilianern, zum Teil direkt in der Bergstadt Nicosia geboren.
Da war vor allen Dingen der Capitano, der Giuseppe Morelli. Er war der Sohn des größten Steinbruchbesitzers. Und das mit seiner Unsterblichkeit oder doch mit seiner Unverwundbarkeit beruhte auf Tatsachen, darüber erzählte man sich noch heute in Nicosia und der weitesten Umgebung die wunderbarsten Geschichten.
Als halbjähriges Kind war er aus dem Fenster eines Häuschens gefallen, das hoch auf einem Felsen stand, zwanzig Meter tief war er hinabgestürzt, auf den harten Felsboden aufschlagend, und es hatte ihm nicht das geringste geschadet, nicht eine Hautabschürfung hatte er davongetragen.
Ein Jahr später war der kleine Giuseppe in den tiefen Bach gefallen, hatte, wenn auch nicht eine halbe Stunde, so doch fünf Minuten lang unter dem Wasser gelegen, sicher lange genug, um jeden anderen irdischen Menschen, ob Greis oder Kind, ins Jenseits zu befördern, und der kleine Giuseppe war sehr bald wieder zum Leben erwacht, war munter davongegangen oder gerutscht, als wenn nichts geschehen wäre.
In seinem vierten Jahre war Giuseppe von einem wütenden Stier aufgespießt, in die Luft geschleudert und zertrampelt worden, und nachdem der rasende Stier seine Wut an dem unglücklichen Kinde ausgelassen hatte, da ... hatte sich dieses, das eigentlich eine unförmliche Breimasse hätte sein sollen, einfach erhoben und war davongegangen, hatte nur ein bisschen Nasenbluten gehabt.
Solcher Unglücksfälle, aus denen er stets auf eine wunderbare Weise unversehrt hervorging, machte Morelli noch mehrere durch — und dann werden wohl auch die Leute noch einige hinzugemacht haben.
Aber die Leute hatten wohl recht, welche sagten, dass, wer sich nicht totstürzt und nicht ertrinkt und von keinem Büffel zertrampelt wird, für den Galgen geboren ist.
Denn ein Galgenstrick war er von jeher gewesen, und das änderte sich auch in der Armee nicht.
Der reiche Vater konnte ihn mit Hilfe von Protektion im königlichen Kadettenkorps unterbringen. Schon da hatte Giuseppe wieder seine Streiche gemacht, immer mit Lebensgefahr verbunden, die dem Unverwüstlichen aber nichts anhaben konnten. Dann als Leutnant beerbte er den verstorbenen Vater, da fing er erst recht zu wirtschaften an, bis er alles durchgebracht hatte, und dazwischen hauptsächlich Liebeshändel in Duellen, bei denen er stats unverwundet blieb, und dass es ihm selbst dabei nicht an den Kragen ging, hatte er nur dem Umstand zu verdanken, dass er — das unverdiente Schicksal der meisten Taugenichtse! — der ausgesprochene Liebling des Königs und des ganzen Hofes war.
Undank ist der Welt Lohn. Und was sollte man denn auch von solch einem Liederian anderes erwarten? Die Propheten sollten recht behalten. Nachdem das väterliche Vermögen verprasst war, wurde der Günstling zum Hochverräter, hatte sogar ein Attentat geplant, um durch eine allgemeine Revolution sich günstigere Lebensbedingungen zu schaffen.
Diesmal aber sollte es ihn fassen. Die meisten Verschwörer entkamen, nur nicht Giuseppe. Er kam vor ein Kriegsgericht, wurde zum Tode verurteilt, sieben Schüsse krachten, sein Leichnam wurde verscharrt.
So, nun hatte sich sein Schicksal erfüllt! Zwar nicht der Galgen, aber doch ein Henkerstod war sein Ende gewesen.
Nein, der Unsterbliche sollte seinen alten Ruf wahren!
Man wollte Leutnant Morelli wiedergesehen haben, und als man an der Richtstätte nachgrub, fand man sein Grab leer!
Auch gefeit gegen die sieben Kugeln war er gewesen! Oder er war eben in anderer Weise dem Leben erhalten geblieben.
Jedenfalls lebte er noch. In Sizilien tauchte er in eigener Person wieder auf, im Monte Dinamari, dicht neben seiner Heimatstadt. Auch einige jener Mitverschwörer, die sich der Verurteilung zum Tode rechtzeitig entzogen hatten, waren bei ihm. Diese schon proklamierten sich als Räuber — oder auch als Befreier Siziliens von der Fremdherrschaft.
Zunächst waren es fünf, und ihm gesellten sich noch vier junge Menschen aus Nicosia bei, verarmte Edelleute oder sonstige Tunichtgute, die alles zu gewinnen, aber nichts zu verlieren hatten.
Diese nen gründeten den Bund der ›Hydra‹. Genossen suchten sie nicht weiter, auf zusammengelaufenes Gesindel verzichteten sie; denn ihre Sache sei ›heilig‹, und, versicherten sie in ihren Anschlägen, sie brauchten auch keine neuen Anhänger, denn aus jedem Kopfe eines ihrer Mitglieder, das das Leben verlöre, würden zwei neue Kämpfer für das neue Königreich Sizilien hervorgehen, von ganz allein, das sei der Lauf des Schicksals — und wer das mit den sich verdoppelnden Köpfen nicht verstehe, der solle es sich gefälligst vom Pfarrer oder vom Bürgermeister oder vom Stadthauptmann von Nicosia erklären lassen.
So wurde in den Bekanntmachungen noch spöttisch hinzugesetzt. Räuberübermut!
Nun, diesem Verlangen entsprachen denn auch der Pfarrer und der Stadthauptmann. Der Bürgermeister konnte keine Aufklärung geben, weil er selber nicht wusste, was für eine Bewandtnis es mit der Hydra hatte. Dann war ja aber auch noch in Nicosia eine Zeitung, allerdings nur bei besonderer Gelegenheit erscheinend. Nun, eine solche war jetzt da, sie konnte sogar täglich erscheinen.
So erfuhr die Bevölkerung von Nicosia und Umgegend, was das mit der neunköpfigen Hydra zu bedeuten hatte. Die Aufklärer hatten auch gleich von Herkules erzählt und nicht hinzuzufügen vergessen, dass diese Hydra wohl bald ebenfalls ihren Herkules finden würde, wenn nicht in einem Berghirten, dann in der Gendarmerie. Das weltberühmte Bersaglieribataillon von Nicosia brauche deshalb wohl nicht erst ausgeschickt zu werden.
Die Sensation war also groß, weiter aber schenkte man der Sache keine ernstliche Beachtung.
Bis die neun Mann sich wirklich als Räuber zeigten, indem sie einige einsam stehende Häuser ausplünderten und Hirten Vieh wegnahmen.
Da wurde die Gendarmerie gegen sie ausgeschickt. Es kam nicht zum Kampfe, einfach deshalb nicht, weil die Beamten die Banditen gar nicht auftrieben. Die meisten von diesen waren doch in der Gegend geboren, und nun gar Giuseppe musste von seinen Jugendjahren her noch jeden Weg und Steg kennen.
Derartige Räubereien wurden fortgesetzt, und die Banditen waren nicht zu fassen, waren von den Gendarmen gar nicht zu erblicken.
Dieser Giuseppe aber hatte auch noch die Unverschämtheit, vor solch einer Verfolgung seiner Bande öffentlich zu warnen, wirklich durch öffentliche Plakate, lange würde er die bewaffnete Staatsmacht nicht mehr so schonen. Ferner versprach er Bezahlung der Sachen, die er genommen, nur müsse er sich erst Geld verschaffen.
Da wollten zwei Franzosen den Monte Dinamari besichtigen, sie ließen sich nicht warnen, man nahm es auch noch immer nicht so ernst, sonst hätten sie ja gar keinen Führer gefunden — nur der eine kehrte mit dem Führer zurück, der andere war von der modernen Hydra ins Felsenverlies gesperrt worden.
Zehntausend Francs Lösegeld!
Also jetzt fing die ganz regelrechte Banditenwirtschaft an!
Der Franzose war nur deshalb freigelassen worden, damit er diese Summe besorge.
Das geschah denn auch sehr bald, trotz des Widerspruches des Stadtkommandeurs, der schon zwei Dutzend Carabinieri ausgeschickt hatte.
Das Lösegeld war bereits beschafft und nach verabredeter Weise von den Banditen abgeholt worden; als Mittel, um die Briganten in eine Falle zu locken, wie es ja gewöhnlich geschieht, konnte dieses Geld also nicht mehr dienen.
Carabinieri aber wussten die Räuber auch so gut zu finden, es kam zum Kampfe und ... von den zwei Dutzend Soldaten kehrten nur dreizehn zurück, die anderen elf hatten von den Kugeln der Banditen ihren Tod gefunden oder lagen noch sich verblutend im Gebirge, und leider konnte keiner der Zurückkehrenden versichern, einen der Räuber fallen gesehen zu haben.
Jetzt war der Schreck groß. Dicht hinter jener Truppe war ein englisches Paar ins Gebirge aufgebrochen, Lord Chesholm und seine Tochter Anita. Man hatte die beiden noch weniger gewarnt, da man der festen Überzeugung gewesen war, dass die zwei Dutzend Karabinieri der Hydra den Garaus machen würden. Und da kehrte auch schon der Führer mit der Nachricht zurück, dass sich Lord Chesholm und seine Tochter gleichfalls in Giuseppes Gewalt befänden, und für diese beiden fordere er 100 000 Pfund Sterling oder zwei und eine halbe Million Lire. Der Bürgermeister oder der Stadtkommandant möge Sorge tragen, dass dies schnellstens nach der Heimat des Lords telegrafiert würde. Länger als eine Woche könne er nicht warten, dann würde er gegen die Gefangenen andere Maßregeln ergreifen, während sie vorläufig noch mit ausgesuchter Höflichkeit behandelt würden.
Da flammte der heilige Zorn der Bevölkerung der ganzen Bergstadt, die noch unter dem Eindrucke der Niederlage ihres Militärs stand, hoch empor. Dass Giuseppe als ritterlicher Räuber von dem französischen Lösegelde tatsächlich seine ersten Räubereien, an den Gebirgsbewohnern begangen, beglichen hatte, konnte daran nichts ändern.
Und man wusste, was man jetzt zu tun hatte, ehe von Palermo eine scharfe Weisung kam.
Die Elitegarde der ganzen italienischen Armee sind die Bersaglieri-Gebirgsschützen, so nach Tiroler oder Schweizer Art, aber doch noch anders.
Der Italiener ist durchaus kein solcher Sportsmann wie der Engländer, treibt keine solchen athletischen Übungen wir der Amerikaner, turnt nicht wie der Deutsche. Nur beim Militär will er das haben. Die italienische Kavallerie ist niemals von Bedeutung gewesen, und doch werden bei ihr haarsträubende equestrische[1] Kunststückchen eingeübt. So ist es auch mit diesen Bersaglieri. Sie werden samt und sonders zu halben oder vielmehr zu ganzen Athleten und Akrobaten ausgebildet, müssen mit vollem Gepäck, wozu auch das Fahrrad gehört, Stangen klettern, müssen auf dem Seile tanzen und dergleichen mehr.
[1] Reiterliche.
Ob dies für einen Krieg viel Zweck hat — diese akrobatische Ausbildung wird erst seit etwa zehn Jahren betrieben — hat die Erfahrung noch nicht gelehrt. Die Italiener behaupten es natürlich, sprechen von jedem Feind, der zu ihnen über die Alpen kommen will, wie von Kindern, und wenn man zum ersten Male diese Bersaglieri ihre Übungen ausführen sieht, sperrt man auch wirklich, mit Respekt zu sagen, Maul und Nase auf.
Die Bewohner der italienischen Bergstadt Nicosia standen nun seit der Gründung dieser Elitetruppe in dem unbestrittenen Rufe, immer die besten Bersaglieri geliefert zu haben, nicht nur für die Insel, sondern auch nach dem italienischen Festlande hinüber. Schon die Kinder übten sich für den zukünftigen Soldatenberuf ein, und wer nicht zu den Bersaglieri kam, galt nicht als Mann.
Es waren gegen dreihundert Mann in der Stadt, die fünf Jahre lang als Bersaglieri gedient hatten, fünfzig standen sowieso dabei, fünfzig andere schlossen sich freiwillig an.
Diese vierhundert Mann rückten als Rächer der sizilianischen Ehre ab, um der Bande den Garaus zu machen.
Zwei Tage blieben sie aus.
Und dann kam das Schreckliche.
Von den vierhundert Bersaglieri kehrte nicht die Hälfte zurück — mehr als zweihundert waren den Kugeln der neun Banditen zum Opfer gefallen.
Ganz gebrochen saß der Kommandant der befestigten Bergstadt vor seinem Pult.
Soeben hatte er den letzten Nachzügler vernommen, der sich verwundet nach der Garnison zurückgeschleppt hatte, und dieser konnte nur bestätigen, was schon andere berichtet hatten, nämlich, dass er alle neun Banditen wohlbehalten beisammen gesehen hatte.
Gleichzeitig war aus Palermo von der vorgesetzten Militärbehörde eine Depesche eingelaufen, in der der verantwortliche Kommandant, Major Savigni, ernstlich aufgefordert wurde, diesem Räuberwesen sofort ein Ende zu machen.
Jetzt musste der Kommandant erst von dieser vollständigen Niederlage des ihm unterstellten Militärs und der Miliz dorthin berichten.
Der schon bejahrte Bersaglieri Maggiore, der immer auf eine Versetzung verzichtet hatte, um hier für sein Vaterland die mustergültigsten Bergschützen ausbilden zu können, trug sich mit Selbstmordgedanken. Seine Ehre war verloren.
»O Zeus, wann endlich wirst du dieser Hydra einen Herkules schicken?!«, jammerte der Mann, dessen Bildung noch seinen militärischen Charakter zu übertreffen schien. Denn ein Offizier sollte eigentlich überhaupt nicht jammern.
Die Hauptsache aber war, dass sein Gebet alsbald erhört wurde.
Eine Ordonnanz trat ein, vor der sich der Weinende nicht zu genieren brauchte.
»Ein fremder Herr lässt sich melden.«
»Wer ist es? Ich bin jetzt für niemand zu sprechen.«
»Hier ist seine Karte.«
Der Major nahm sie, und staunend las er: Herkules Piper, New York.
Der erste Name war es natürlich, der dieses Staunen hervorbrachte, und wenn es auch nur war, weil er gerade an Herkules gedacht hatte, weil das überhaupt mit der Hydra zusammenhing. Sonst haben die Amerikaner ja oft genug solche verrückte Vornamen, oder sie stehlen dem klassischen Italien die Namen wie dem modernen Italien die alten Kunstschätze.
Herkules Piper! Sollte das ein Zeichen des Himmels sein?
»Kommt der Herr allein?«
»Er scheint allein zu sein.«
»Was wünscht er?«
»Den Signor Maggiore sprechen, mehr sagte er nicht.«
»Ich erwarte den Herrn.«
Der Kommandant wischte sich die Augen, zwirbelte seinen grauen Schnurrbart in die Höhe und war bereit zum Empfang.
Der Gemeldete trat ein. Es war ein bartloser, junger Herr im gelben Khaki-Anzug, wie er damals als Reisekostüm Mode geworden, und wie ein eleganter Reisender sah er auch aus. In der Saison konnte man solche Gestalten hier zu Dutzenden sehen.
»Signor Piper?«
»Das bin ich nicht.«
»Nicht?«
»Ich bin nur der Diener des Herrn, dessen Karte ich abgab.«
»Was soll das heißen?«
»Ich komme im Auftrage des Mister Piper.«
»Was wünschen Sie?«
»Mein Herr befiehlt mir, in seinem Namen die Räuberbande unschädlich zu machen, die sich Hydra nennt.«
Der Major betrachtete den jungen Mann näher. Er hatte nichts an ihm auszusetzen, aber ... an seinem Verstande begann er zu zweifeln.
»Wer ist denn Ihr Herr?«
»Mister Herkules Piper von New York.«
»Wo befindet er sich denn jetzt?«
»In Messina.«
»Was tut er denn da?«
»Er wartet auf die Ankunft einer Dame.«
»Welcher Dame?«
»Der Lady Marion Ramsay.«
»Ah, ist das eine Verwandte des Lords Chesholm?«
»Nicht dass ich wüsste.«
»Ja, dann verstehe ich nicht. Was wollen Sie eigentlich?«
»Die neun Banditen unschädlich machen, die hier ihr Unwesen treiben.«
»Doch nicht etwa Sie allein?«
»Ich allein.«
»Wie wollen Sie denn das anfangen?«
»Haben der Herr Major nicht gehört, wie Herkules die Hydra getötet hat?«
»Ja, die Sage kenne ich.«
»So werde auch ich tun. Ich bitte den Herrn Major lediglich um einen Führer, der mich in jene Gegend bringt, wo die Banditen zuletzt gesehen worden sind, da ich hier ganz unbekannt bin.«
Der Major schüttelte nur immer den Kopf. Jetzt glaubte er doch, es mit einem Wahnsinnigen zu tun zu haben. Aber er wollte darauf eingehen, wie man es einem Wahnsinnigen gegenüber immer tun muss.
»Also, Ihr Herr will die Hydra erlegen?«
»Jawohl.«
»Weil er mit Vornamen Herkules heißt, nicht wahr?«
»Ganz richtig.«
»Er hat von dieser Räuberbande gehört, die sich Hydra nennt, und nun hat er sich in den Kopf gesetzt, diese Hydra zu erlegen.«
»So wird es wohl sein.«
»Und da schickt er Sie erst voraus, um Erkundigungen einzuziehen.«
»Nein, er bleibt vielleicht in Messina, ich soll die Arbeit für ihn verrichten.«
»Das verstehe ich immer weniger.«
»Weil ich sein Diener bin, und im übrigen werden Sie es verstehen lernen.«
Der Kommandant, der auch Pässe auszustellen hatte, hatte mit Amerikanern schon Erfahrungen genug gemacht, und jetzt verließ ihn die Geduld.
»Machen Sie, dass Sie hinauskommen!«, wurde er grob.
Aber der junge Mann im Khaki-Anzuge ließ sich nicht einschüchtern.
»Herr Major, überlegen Sie doch. Ich verpflichte mich, diese ganze Räuberbande innerhalb eines Tages unschädlich zu machen, ich brauche nur einen Führer, der mich hinbringt.«
Der Kommandant stutzte doch wieder, diese Worte klangen gar zu sicher.
»Wie wollen Sie denn das nur anfangen?«
»Das muss allerdings mein Geheimnis bleiben — vorläufig wenigstens.«
»Sie wollen sich mit der Bande in einen Kampf einlassen?«
»Allerdings.«
»Wissen Sie, was soeben erst geschehen ist?«
»Ich bin über alles orientiert.«
»Die Niederlage der Bersaglieri!«
»Ich weiß alles.«
»Und Sie allein wollen die ganze Bande aufreiben?«
»Mit einem Male. Es ist nur nötig, dass erst der Lord und seine Tochter von ihnen entfernt werden, dass ich sie erst frei bekomme.«
»Ja, aber wie wollen Sie das erreichen?«
»Einfach, indem ich dem Hauptmann das Lösegeld bringe.«
»Ah, Sie bringen das Lösegeld?«
»Jawohl.«
»Das ist ja etwas ganz Anderes! So haben die Verwandten doch endlich bezahlt? Es wird auch die höchste Zeit, morgen ist der letzte Termin.«
»Nein, die Verwandten des Lords, dessen Vermögensverhältnisse der Capitano ganz überschätzt hat, zahlen es nicht.«
»Wer denn sonst?«
»Mein Herr legt es einstweilen aus.«
»Mister Piper?«
»Ja.«
»Nun, das bleibt sich ja gleich. Sie haben das Geld bei sich?«
»Ich habe es bei mir.«
»Zwei und eine halbe Milion Lire?«
»In Hundertlirescheinen, wie der Capitano es verlangte.«
»Dann ist das ja etwas ganz Anderes. Dann werden Sie auch sofort einen Führer bekommen.«
»So bitte ich darum. Natürlich darf nicht darüber gesprochen werden, was ich eigentlich beabsichtige.«
»Was beabsichtigen Sie hauptsächlich?«
»Diese Räuberbande zu vernichten.«
»Ja, dann hätten Sie doch gar nicht nötig gehabt, mir davon Mitteilung zu machen. Sie hätten sich doch gleich für den Überbringer des Lösegeldes ausgeben können.«
»Mein Herr befiehlt mir, von meinem eigentlichen Vorhaben Ihnen, dem Kommandanten, vorher Kenntnis zu geben.«
»Weshalb das?«
»Damit wir Zeugen haben, dass die Vernichtung der Räuberbande unser eigentliches Vorhaben war, was ja bald alle Welt erfahren wird.«
»Gut, ich verstehe«, flüsterte der Kommandant, der jetzt von einer großen Erregung befallen wurde. »Wenn wir aber nun hier belauscht worden wären?«
»Es ist ja niemand im Zimmer.«
»Wir können aber doch belauscht worden sein.«
»Nun, dann würde es auch nicht weiter schaden. Dann wüssten die Banditen eben schon, mit wem sie es zu tun bekommen«, lautete die gleichgültig gegebene Antwort.
Eine Viertelstunde später legte Nemo vor dem Gasthof, in dem er, mit der Bahn gekommen, abgestiegen war, einen schweren Mantelsack auf den Rücken eines Maultiers, stieg selbst in den Sattel und folgte dem zerlumpten Sizilianer, der sich zum Führer erboten hatte.
Dass der fremde Herr das Lösegeld für den Lord und seine Tochter brachte und dem Capitano der Räuberbande überliefern wollte, war irgendwie bekannt geworden, staunende Blicke waren auf den Mantelsack gerichtet, und die Hälfte aller Männer von ganz Nicosia wäre jetzt ebenfalls gern Banditen geworden.
Nur aus den Mauern der Städte heraus, dann begann die Macchia, der dem italienischen Gebirge eigentümliche Urwald, mehr ein Buschwald, am meisten bestehend aus Johannesbrotbäumen, Mastixsträuchern und Kreuzdorn, wozu an günstigeren Stellen besonders noch die Kermeseiche mit essbaren Eicheln und die Kastanie kommen.
Durch diesen sonst undurchdringlichen Buschwald führte der Saumweg steil bergauf, und man konnte noch deutlich die blutigen Spuren erkennen, welche die von den Banditen Heimgeschickten auf ihrem fluchtähnlichen Rückmarsch zurückgelassen hatten.
Der Lazzaroni hätte mit dem Herrn gar zu gern eine Unterhaltung angeknüpft, aber dieser ließ sich nicht darauf ein.
Immer wilder wurde das Gebirge. Gegen zehn Uhr morgens waren die beiden aufgebrochen, seit drei Stunden waren sie unterwegs. Der Schluchtenweg wurde von Bäumen überschattet, sodass sie vor der brennenden Sonne geschützt waren, rieselnde Bäche gab es überall.
Noch immer konnte man erkennen, dass auch die Bersaglieri hier marschiert waren.
»Signore, hier wollen wir rasten«, sagte der Führer.
»Ich bedarf keiner Ruhe, und mein Maultier auch noch nicht.«
»Aber ich bin hungrig.«
»Wo lagern die Banditen?«
»Wie soll ich das wissen?«
»Wie wirst du sie finden?«
»Die werden schon uns zu finden wissen.«
Der Führer warf sich einfach neben einer Quelle ins Gras, sicher, um die heißesten Stunden zu verschlafen, Nemo stieg ab, um zunächst sein Maultier zu tränken.
»Buon giorno Signore!«, erklang da eine Stimme, und der Führer schnellte wieder auf.
Über ihnen auf einem Felsvorsprung stand ein Mann, der allerdings verwahrlost genug aussah, aber doch nicht so wie ein echter italienischer Räuber gekleidet war. Sein Anzug war ehemals ein Sportkostüm gewesen.
Das Gewehr modernster Konstruktion hatte er nachlässig unter dem Arm, aber wohl schussbereit.
»Buon giorno!«, erwiderte Nemo nachgelassen den Gruß.
»Schönes Wetter heute!«
»Es dürfte noch Gewitter geben.«
»Ja, zumal für euch.«
»Wie meint Ihr das?«
»Wenn Sie Vergnügungsreisender sind, so erlaube ich mir die höfliche Frage, ob Sie genügend Reisegeld bei sich haben«, lächelte das Abenteurergesicht.
»Zwei und eine halbe Million Lire.«
»Was?!«
»Ich vermute doch, dass ich ein Mitglied der Hydra vor oder vielmehr über mir habe.«
»Sie bringen das Lösegeld für Lord Chesholm?«
»Und für seine Tochter.«
»Herr, warum sagen Sie das nicht gleich?!«
Der Bandit verschwand von seinem erhabenen Standort, trat gleich darauf seitwärts aus den Büschen hervor, ganz sorglos — ein Zeichen, dass er noch andere hinter sich hatte, die alles beobachteten, also auch wussten, dass die beiden allein kamen.
»Sie bringen das Lösegeld wirklich mit?«, fragte der Bandit nochmals mit funkelnden Augen.
»Wie ich Ihnen sage.«
»In Hundertlirescheinen?«
»Wie es gewünscht wurde.«
»Wo sind sie?«
»Hier, in meinem Mantelsack.«

»Hm, ich selbst kann nichts machen, darf sie Euch nicht abnehmen, auch die anderen nicht, die hier sind. Ihr müsst erst zum Capitano.«
»Und dann möchte ich doch auch erst den Lord Chesholm und seine Tochter sehen.«
»Selbstverständlich bekommt Ihr die ausgewechselt.«
»Es geht ihnen gut?«
»Die sind wohlbehalten.«
»Und guten Mutes?«
»Das wohl weniger. Sie haben nicht geglaubt, dass ... doch Ihr werdet ja selbst hören. Folgt mir!«
Es gesellten sich noch andere Banditen hinzu, der Weg wurde fortgesetzt.
Wir selbst wollen ihnen nicht folgen.
Eine Viertelstunde später passierte der Lazzaroni allein dieselbe Stelle, wo er hatte lagern wollen.
Man sah ihm an, wie schwer ihm der Rückweg ward, aber eine geheime Angst trieb ihn weiter, er wagte nicht einmal, sich umzublicken.
Als er es doch einmal tat, erscholl sofort von der Höhe herab eine drohende Stimme:
»Fort!! Und wenn du noch einmal stehen bleibst oder nur zurückblickst, hast du eine Kugel im Kopf!«
Der Lazzaroni machte, dass er weiterkam, ohne sich noch einmal umzublicken, und konnte in Nicosia nichts weiter berichten, als dass ihm von den Banditen befohlen worden sei, allein zurückzukehren, während der fremde Herr mit ihnen einen Tauschhandel vollzog.
Und wieder eine Stunde später passierte auch Nemo dieselbe Stelle, aber nicht allein, sondern in Gesellschaft eines anderen Herrn und einer jüngeren Dame, letztere auf einem Maultier sitzend, beide sehr derangiert aussehend, sonst aber wohlgemut.
Als sie am Nachmittag in der fünften Stunde Nicosia erreichten, stand ein von Palermo nach Messina durchgehender Zug gerade zur Abfahrt bereit.
»Diese Gelegenheit benutzen wir«, sagte Nemo, als er das aufgezogene Signal sah. »Schnell, dass wir ihn noch erreichen!«
Es gelang. Nur musste Nemo sein Maultier, welches er heute morgen gegen bares Geld gekauft hatte, im Stich lassen. Er nahm ihm den Mantelsack ab und trug ihn in das Coupé, für das Lord Chesholm schon die Billets gelöst hatte, und so ließ er das Maultier einfach auf der Straße stehen.
Natürlich war diese schnelle Reise auf vorherige Verabredung zwischen den dreien erfolgt. So schnell wie möglich abreisen, den nächsten Zug benutzen, war ausgemacht worden, und es hatte eben gerade ein Zug dagestanden.
Auf diese Weise kam die Bevölkerung von Nicosia um alle weiteren Mitteilungen, auch der Kommandant.
Der schüttelte den Kopf und wurde sehr ärgerlich. Hatte sich der Kerl erst als ein Herkules aufgespielt, der die Hydra vernichten wollte, und jetzt stellte sich heraus, dass er den Banditen einfach das Lösegeld gezahlt und dafür die beiden Gefangenen bekommen hatte.
Aber es sollte ganz anders gewesen sein, als sich der Kommandant träumen ließ.
Die drei hatten ein Coupé allein bekommen.
»Ich habe Ihr Ehrenwort, Mylord.«
»Sie haben es, und auch das meiner Tochter. Aber, Herr, wie soll ich Ihnen danken? Was für ein Mann sind Sie? Soll man Sie bewundern oder sich vor Ihnen entsetzen?«
Und mit solchen Augen blickten Vater und Tochter auch den Mann im Khakianzug an.
Der von Neapel kommende Dampfer fuhr in den Hafen von Messina ein.
Den Passagieren fiel unter den Geschäftigen und mehr noch Neugierigen, die auf dem palmengeschmückten Kai die Ankunft des Dampfers erwarteten, sofort die in schwarz und weiß gestreifte Männergestalt auf, die dort herumspazierte.
»Da, da — Mylady — da ist ja Ihr moderner Herkules! Wo ist denn Lady Ramsay?«
Marion dankte ihrem Gott, dass sie nicht mit Mister Piper zusammen gefahren war, sondern London zwei Tage später verlassen hatte.
Einen Zweck aber hatte diese ihre Zurückhaltung eigentlich nicht gehabt.
Die Kunde, wie der unbekannte Mann den ausgebrochenen Löwen gefangen und ihn zuerst in das Haus der Lady Ramsay gebracht, hatte sich doch sofort wie ein Lauffeuer durch ganz London verbreitet. Jetzt wusste es bereits die ganze Welt, soweit diese von Zeitungen beherrscht wird.
Von allen Seiten war Lady Marion mit neugierigen Fragen bestürmt worden, wer denn dieser rätselhafte Löwenbändiger gewesen sei, und sie hatte erzählt, sie konnte ja gar nicht anders — und wenn sie auch nur zu ihrer besten Freundin unter dem Siegel der Verschwiegenheit geplaudert hatte, was Mister Herkules beabsichtigte, was für einen Kontrakt er mit ihr geschlossen hatte, auf den sie wirklich eingegangen war, es hatte genügt, um dies alsbald alle Welt wissen zu lassen.
Also es hatte wenig genützt, dass sie zwei Tage später als Mister Piper abgefahren war. Ihre Reise nach Italien war ein einziges Befragen gewesen. Zum Glück erlaubten es ihre Mittel, dass sie ein ganzes Coupé für sich nehmen konnte. Dann aber war wieder der Dampfer gekommen, wo sie sich doch nicht ständig in ihre Kabine verkriechen konnte.
Kurz, Marion war der Verzweiflung nahe. Wäre es nicht vielleicht doch besser gewesen, sie hätte sich diesem Hanswurst gleich angeschlossen, wenn sie nun einmal mit dabei sein wollte, wenn er die sizilianische Hydra erlegte? Dann hätte man sich doch mit seiner eigenen bizarren Persönlichkeit beschäftigt.
Dass der neue Herkules aus Amerika hier in Sizilien den Kampf mit der Räuberbande, die sich Hydra nannte, aufnehmen wollte, ganz modern sich aber dazu einer anderen, hierzu erst ausgebildeten Person bedienend, war ebenfalls schon bekannt. Marion hatte eben ganz ausführlich geplaudert.
In Nicosia hatte man allerdings noch nichts davon gewusst, die ›ganze Welt‹ ist eben sehr groß, Nicosia hatte in diesem Falle nicht dazugehört.
Der Dampfer konnte nicht gleich landen. Vorher aber kamen schon kleine Boote heran, welche auch die Post und Zeitungen brachten.
Und da zeigte sich, dass der Stadtkommandant von Nicosia deswegen nicht so bekümmert zu sein hätte brauchen, dass er nur die furchtbare Niederlage seiner unbesiegbaren Bersaglieri der vorgesetzten Behörde melden musste. Die allwissenden Zeitungsreporter berichteten in den am Mittag in Messina herausgekommenen Blättern, darunter ein englisches, alles brühwarm.
Nun freilich änderte sich die Ansicht über diese sizilianische Hydra, welcher der neue Herkules zu Leibe rücken wollte. Ja, dann hatte er eine wirkliche Herkulesarbeit zu leisten.
Doch wir wollen uns nicht mehr mit den Meinungen des Publikums befassen, wir bleiben bei Lady Marion als der Königin Eurysthe.
Sie hatte sich zuletzt wieder in ihre Kabine eingeschlossen, sah durch das Fensterchen am Ufer die menschliche Zebragestalt, bekam von einem Steward mit der Nachricht, dass der Dampfer noch eine halbe Stunde auf Reede liegen bleiben müsse, auch eine englische Zeitung ausgehändigt.
Sie las den letzten Bericht, und immer mehr begannen ihre Augen zu leuchten.
»Fürwahr, wenn mein Herkules diese Hydra zur Strecke bringen kann, dann macht er sich wirklich einen unsterblichen Namen, und dann ist das keine törichte Spielerei mehr, auf die ich eingegangen zu sein ich schon oft bereut habe — dann macht er sich um die ganze Menschheit verdient — und ich mit ihm, dass ich ihm diese Arbeit auferlegt habe — und dann werde auch ich seinen Ruhm mit ihm teilen und mit mir wieder ganz Amerika!«
So machte sich bei ihr wieder die exzentrische, abenteuerlustige Amerikanerin bemerkbar, die sie im Grunde genommen doch war, nicht nur in ihren Schriften, und sie bereute nicht mehr, selbst nach Sizilien gegangen zu sein.
Der dienstbeflissene Steward kam noch einmal zurück.
Einige Boote wollten Passagiere an Land bringen, aber sie forderten horrende Preise, ließen auf sich bieten, wodurch die Preise immer mehr in die Höhe geschraubt wurden — aber da hätte vor allen Dingen der Kapitän dieses Dampfers zu bestimmen, und wenn die Lady wünsche ...
Marion war sofort bereit. Eine Viertelstunde später gehörte sie zu den Bevorzugten, welche schon jetzt das Land betraten. Für ihr Gepäck wurde gesorgt.
Mister Herkules Piper hatte sie kommen sehen, begrüßte seine Herrin öffentlich in seiner ganzen harlekinartigen Höflichkeit, welche Lady Marion so gefürchtet hatte.
»Ich logiere im Hotel Bristol. Hier ist bereits ein Wagen.«
Nichts hörte die Lady lieber als das. Der Wagen rollte davon.
»Die Hydra hat sich ja so furchtbar bemerkbar gemacht!«, eröffnete sie das Gespräch.
»Ja, mehr als 200 Bersaglieri haben daran glauben müssen, und die Hydra soll dabei noch immer keinen Kopf verloren haben«, entgegnete der Amerikaner in seiner nachlässigen Weise.
»Und dieses Zusammentreffen!«, fuhr die Lady fort. »Was man erst jetzt, da sich die Räuberbande bemerkbar macht, alles zu hören bekommt — das Haupt dieser Hydra scheint ja wirklich unsterblich zu sein! Und sogar einen Krebs hat er zu seinem Freunde, der ihm im Kampfe beisteht!«
»Einen Krebs?«, fragte Mister Piper verwundert, soweit dieser blasierte Yankee sich überhaupt wundern konnte.
»Gewiss, er hat doch einen Krebs zum Freund. Haben Sie sich denn unterdessen hier an Ort und Stelle gar nicht näher über die Verhältnisse orientiert?«
»O doch ... das heißt, mein Diener hat das tun müssen.«
»Nun, da ist doch schon früher ein Bandit vorhanden gewesen.«
»Ich glaube, davon habe ich wohl schon gehört. Wie war doch gleich sein Name?«
»Gamberorosso.«
»Richtig, Gamberorosso.«
»Und wissen Sie nicht, was dieser Name bedeutet?«
»Das ist eben ein italienischer Name wie jeder andere.«
»Nein, das ist nur ein Spitzname, der eine ganz besondere Bedeutung hat. Und Sie kennen die Übersetzung wirklich nicht?«
»Ich bedaure, nicht Italienisch zu können. Das ist ebenfalls Sache meines Dieners.«
»Ja, was haben Sie denn die ganze Zeit hier getrieben?«, wunderte sich Marion immer mehr.
»Mich schauderhaft gelangweilt — bis auf einige Stunden, die ich mit Whist spielen verbringen konnte. Wollen Sie mir nun nicht die Bedeutung dieses Namens erklären?«
»Nun, Gamberorosso heißt der rote Krebs. Vielleicht führt dieser alte Bandit wirklich den Namen Krebs — Gambero — oder er hat ihn wegen seiner Vorsicht bekommen, weil er immer rechtzeitig zu retirieren weiß — und das Eigenschaftswort ›rosso‹ hat man ihm wegen seiner roten Haare gegeben.«
»Ah, nun verstehe ich!«, rief Mister Piper mit einiger Lebhaftigkeit. »In der Tat ein merkwürdiges Zusammentreffen! Auch dem griechischen Herkules kam ja bei seinem Kampfe mit der Hydra ein großer Krebs zu Hilfe, und das Schicksal scheint gewillt zu sein, meine Arbeiten denen des griechischen Herkules möglichst ähnlich zu machen. Nun, mein Diener wird auch mit diesem Krebse schon fertig geworden sein.«
Verwundert horchte Marion auf. Sie hatte gewiss nicht recht gehört oder Mister Piper sich nicht richtig ausgedrückt.
»Schon fertig geworden sein?«, wiederholte sie. »Wie meinen Sie das?«
»Nun, der Kampf mit der Hydra ist ganz sicher schon beendet.«
»Be ... endet?!«
Gelassen zog der amerikanische Dandy seine diamantenbesetzte Uhr.
»Heute früh um sechs fuhr mein Diener ab. Halb neun traf er laut Fahrplan in Nicosia ein. Für seine Vorbereitungen gebe ich ihm eine Stunde. In vier Stunden muss er die Hydra aufgefunden haben. Sagen wir: um zwei Uhr hat der Kampf mit ihr begonnen, für den ich höchstens eine Stunde rechne. Jetzt ist es gleich um vier ... gewiss, mein Diener muss sich schon auf dem Rückweg nach Nicosia befinden, in Gesellschaft des befreiten Lords Chesholm und seiner Tochter.«
Ganz gleichmütig hatte das Mister Herkules Piper herdeklamiert, und es lässt sich denken, was für ein verblüfftes Gesicht jetzt erst Lady Marion machte.
»Was? Da wäre der Kampf mit der Hydra schon vorüber?!«
»Wie ich Ihnen vorrechnete, o meine Königin Eurysthe!«
»Ihr Diener hätte schon die ganze Mörderbande vernichtet?!«
»Unbedingt. Oder er hat meine Erziehung zuschanden gemacht, und dann kann er bei seiner Rückkehr etwas von mir zu hören bekommen.«
»Also, Sie wissen noch gar nichts Bestimmtes darüber, ob der Kampf auch schon wirklich stattgefunden hat?«, atmete das schöne Weib förmlich erleichtert auf.
»Bestimmtes allerdings noch nicht. Aber da besteht bei mir gar kein Zweifel, dass sich das Produkt meiner vierundzwanzigjährigen Erziehung bewährt hat.«
»So wäre Ihrer Ansicht nach der Kampf also schon vorüber?!«
»Ganz sicher!«
»Ihr Diener hätte bereits die Räuber ... getötet oder nur gefangen?«
»Getötet, getötet — mein griechischer Vorgänger hat die Hydra doch auch gleich totgeschlagen, und was soll man denn überhaupt mit solch einem Vieh sonst anstellen? Oder wäre es Ihnen lieber gewesen, wenn ich Ihnen die neun Räuber als Gefangene lebendig zurückgeführt hätte? Vielleicht nach London? Das hätten Sie allerdings gleich sagen müssen, o meine Königin Eurysthe, nun dürfte es zu spät sein — ist es ganz sicher zu spät. Und Tote wieder lebendig zu machen, das kann das Produkt meiner Erziehung allerdings nicht.«
Lady Marion hatte nur eins unter dem Rollen des Wagens gehört.
»Alle neun hat er getötet?!«
»Ohne Zweifel. Und den Herrn Krebs, falls sich dieser nach antiker Vorschrift mit in den Kampf mischt, natürlich ebenfalls.«
»Ihr Diener ganz allein?!«
»Er ganz allein. Höchstens dass er einen Führer brauchte.«
Wieder machte Lady Marion ein ganz anderes Gesicht.
»Ja, Mister Piper, was meinen Sie denn, weshalb ich eigentlich hierher nach Sizilien gekommen bin?!«
»Nun, nun — nun ... jeder Mensch macht doch gern einmal eine Reise.«
»Doch natürlich nur, um diesem Kampfe Ihres rätselhaften Dieners mit dieser modernen Hydra beizuwohnen!!«, rief das schöne Weib, dass die Straßenpassanten stehen blieben.
»Wollten Sie? Oh, das tut mir leid, das hätten Sie mir vorher sagen müssen«, erklang es bedauernd, wenn auch phlegmatisch genug zurück.
»Aber das ist doch ganz selbstverständlich!«
»Das finde ich nicht ganz so selbstverständlich. Ich bin doch auch nicht mit ins Gebirge gegangen, habe einfach meinem Diener Instruktionen gegeben, wie er die Hydra erlegen soll, und damit basta.«
»Ja, Sie, Sie — Sie sind doch auch gar keine ...« Marion brach ab, beherrschte sich.
»Also Sie betrachten die Vernichtung dieser Räuberbande als eine von Ihnen selbst geleistete Arbeit?«
»Das ist doch nun wirklich ganz selbstverständlich! Dieser Nemo ist das Produkt meiner ...«
»Nun gut, hierüber wollen wir uns nicht streiten Sie haben ihm auch Instruktionen gegeben, wie er die aus neun Räubern bestehende menschliche Hydra vernichten soll?«
»Gewiss, alles meine Erfindung, meine eigene Arbeit in geistiger und sogar in körperlicher Hinsicht. Die können zum Beispiel doch auch nicht verlangen, dass ihnen der Erfinder der Telegrafie jede Depesche selbst zuträgt. Denn ich bin eben ein ganz moderner Mensch, also auch ein moderner Herkules, und meine Arbeitsleistung lässt sich recht gut mit der Telegrafie, sogar mit drahtloser Telegrafie vergleichen ...«
»Schildern Sie mir lieber«, unterbrach Marion diese Auseinandersetzungen, »wie denn nun dieser Kampf mit der Räuberbande stattgefunden hat.«
»Ganz einfach. Ich habe meinem Jonny die 100 000 Pfund in Hundertlirescheinen mitgegeben, wie die Lösegeldsumme von dem Räuberhauptmann gefordert wurde ...«
»Ah, Sie haben Lord und Lady Chesholm erst ausgelöst?«, rief Marion und es klang etwas enttäuscht.
»Nur zum Schein, das war nur eine Kriegslist.«
»Wieso eine List?«
»Nun, damit die beiden Gefangenen nicht etwa ein Opfer des Kampfes wurden.«
»Ah, ich verstehe, ich verstehe!«
»Jawohl, mein Diener gab sich für einen Bevollmächtigten der Verwandten des Lords aus, er brachte das Lösegeld; nachdem der Austausch geschehen war, begann der eigentliche Kampf ...«
»Alle neun Mann gegen den einzigen?«, fragte das abenteuerlich veranlagte Weib mit förmlicher Gier.
»Alle neun oder sogar zehn Mann gegen einen Diener.«
»Das allerdings wohl nicht. Oder doch. Wie man's nimmt. Nachdem das Austauschen erledigt war, hat mein Jonny einfach eine Buttel hervorgezogen, eine Korbflasche mit als Stöpsel abschraubbarem Becher — ›Na da wollen wir daraufhin noch einen trinken‹, hat er gesagt, hat sich den ersten Becher eingeschenkt und ihn ausgetrunken, damit die Räuber nicht etwa dachten, dass er ihnen Gift beibringen wolle ...«
»Gift! Wer wird an so etwas denken!«, rief Marion.
»... hat vielleicht noch aus demselben Grunde dem Lord und seiner Tochter einen Becher kredenzt, dann kam ein Bandit nach dem andern dran, jeder leerte seinen kleinen Becher, sie schüttelten sich noch einmal die Hände, dann marschierten die drei ab ... und fünf Minuten später war die Hydra tot.«
Lady Marion machte vorläufig nur große Augen.
»Tot?«
»Mausetot!«, nickte der Yankee kaltblütig.
»Ja, woher denn?«
»Mein Jonny hat ihnen ganz einfach Gift beigebracht.«
»Gift?«
»Es war Strychnin, eine ganz besondere Zubereitung davon.«
»Aber wie will er es ihnen nur beigebracht haben?«
»Nun, aus der Korbflasche!«
»Ich denke, er selbst hat davon getrunken, auch die beiden anderen davon trinken lassen?«
»Ja, aber aus einer anderen Abteilung der Flasche. Es ist eine Vexierflasche. Drückt man einen Knopf, so fließt eine ganz gleich aussehende Flüssigkeit aus einer anderen Abteilung. Und diese weingeistige Lösung von Strychnin ist ebenfalls meine Erfindung, sie wirkt erst nach fünf Minuten, dann aber auch urplötzlich. Jonny wird sich mit den Befreiten schon beizeiten aus dem Staube gemacht haben, und da hatte keiner noch Zeit, ihnen nachzulaufen oder ihnen auch nur eine Kugel nachzusenden. Die fielen um wie die Fliegen.«
Jetzt erst begriff Marion, und sie ward ganz außer sich.
»Vergiftet, also vergiftet!! Und das nennen Sie einen Kampf?!«
»Weswegen denn nicht? Hat denn der griechische Herkules nicht ebenfalls sehr viel mit Gift gearbeitet? Sich hauptsächlich immer seiner vergifteten Pfeile bedient?«
Aber Marion ließ sich nicht so leicht beruhigen. Das romantisch veranlagte Weib hatte von einem Heldenkampf Mann gegen Mann geträumt, und jetzt offenbarte ihr dieser Yankee mit nüchternen Worten, auf welche hinterlistige Weise die ganze Räuberbande, die sizilianische Hydra, erlegt worden war — durch einen Gifttrank!
Marion machte aus ihrer Empörung kein Hehl. Mister Herkules Piper freilich blieb von ihren Worten ganz ungerührt.
»Ich bin eben ein moderner Herkules, und wenn Sie den Kampf in anderer Weise wünschten, so hätten Sie das vorher sagen müssen. Was finden Sie denn überhaupt so Schreckliches oder gar Feiges dabei, wie Sie sich ausdrückten? Hat sich Herkules nicht auch immer vergifteter Pfeile bedient, um den oder jenen Feind aus dem Wege zu räumen? Und was ist es denn heutzutage anderes, wenn man Wilden, die nur Lanzen und Pfeile haben, mit Gewehren und gar mit Maschinengewehren zu Leibe rückt?«
In gewissem Sinne hatte Mister Piper ja recht, darauf konnte Marion nichts erwidern. Nur mit einem geheimen Grauen betrachtete sie den hässlichen Mann, der an ihrer Seite saß, und zum ersten Male wieder erinnerte sie sich voll und ganz des Kontraktes, den sie mit ihm abgeschlossen hatte.
»Erklären Sie diese von mir gelöste Arbeit für gültig?«
»Es steht doch erst abzuwarten, ob auch wirklich alles so gekommen ist, wie Sie mir geschildert haben.«
»Ich schlage vor, wir fahren gleich selbst nach Nicosia. In einer halben Stunde geht ein Zug hin, Sie selbst sollen die tote Hydra besichtigen.«
»Die neun oder zehn vergifteten Menschen? Nein, nein!«, wehrte Marion fast entsetzt ab. »Die Bestätigung dieser Tatsache will ich lieber in meinem Hotel abwarten.«
Sie hatten dasselbe erreicht, und Marion sollte auch nicht lange auf diese Bestätigung warten. Der Telegraf trug sie bald durch alle Welt.
Als Nemo mit den beiden Befreiten nach Nicosia zurückgekommen war, hatte er sich sofort zu dem Stadtkommandanten begeben.
»Die Hydra ist tot! Kommt mit, wenn Ihr Euch davon überzeugen wollt.«
Noch an demselben Abend war die Hälfte der ganzen Einwohnerschaft von Nicosia aufgebrochen. Sie fanden zehn Menschen mit krampfhaft verzerrten Gesichtern vor einer Höhle liegen, tot, schon von Füchsen angegangen.
Nemo hielt nicht damit zurück, auf welche Weise er die ganze Räuberbande mit einem Schlage vom Leben zum Tode befördert hatte.
»Das hätten wir doch eigentlich auch machen können, den Banditen so einen Gifttrank beibringen«, hieß es dann.
Es war die alte Geschichte vom Ei des Kolumbus.
Am anderen Morgen stellte sich der geheimnisvolle Diener seinem Herrn in Messina wieder zur Verfügung.
Sein Bericht war schon nach der Stadt gekommen, er hatte dem nichts mehr hinzuzufügen, und im übrigen hatte sich alles genau so abgespielt, wie Mister Piper es geschildert hatte. Es war fast nicht anders, als wäre er selbst dabeigewesen.
Als Nemo, automatisch wie immer, seinem Herrn die den toten Banditen natürlich sofort abgenommenen 25 000 Hundertlirescheine, ein ganz umfangreiches Paket, zurückgab, blickte Lady Marion mit erneutem Grausen auf diese beiden Männer, und wieder musste sie an jenen Kontrakt denken.
»Erklären Sie also diese zweite mir gestellte Aufgabe für gelöst?«, wandte sich dann Mister Piper von neuem an sie.
Lady Marion kämpfte etwas nieder, raffte sich empor.
»Ich erkläre sie für gelöst!«
»Zu Ihrer Zufriedenheit?«
»Zu meiner Zufriedenheit!«
»Dass Sie später nicht etwa anderer Meinung werden!«
»Herr, wofür halten Sie mich?!«, versuchte die schöne Frau aufzubrausen, was ihr aber nur schwach gelang.
»So geben Sie mir die dritte Arbeit auf.«
»Die dritte Arbeit des Herkules war die, den erymanthischen Eber zu fangen.«
»Ganz recht.«
»Also lebendig sollte er ihn dem König Eurysthes bringen und tat es auch.«
»Nennen Sie mir solch einen Eber, und ich werde ihn lebendig meiner Königin Eurysthe bringen.«
»Da können Sie also nicht wieder ein Gift anwenden.«
»Ja, bin ich denn überhaupt ein professioneller Giftmischer?«
»Lassen wir das. Solch einen wütenden Eber weiß ich allerdings nicht.«
»Das ist ja auch gar nicht nötig, es braucht ja nur eine gleichwertige Arbeit zu sein, Sie brauchen sich ja auch nicht an die Reihenfolge zu halten. Darüber haben wir doch schon gesprochen.«
»Haben Sie von dem Fesselballon gehört, der in Kapstadt aufgestiegen und entflohen ist?«
»Wann ist das geschehen?«
»Vor etwa drei Monaten. Ein südlicher Wind hat ihn in das Innere Afrikas getrieben, in der Gondel befand sich ein Mann, ein Beamter der Kapstadter See- oder Sternwarte. Zwei Expeditionen die ausgerüstet wurden, ihn zu suchen, sind bereits resultatlos zurückgekehrt. Man hat Mister Harris schon als unauffindbar aufgegeben. Haben Sie davon wirklich gar nichts gehört?«
»Noch kein Wort!«
»In den Zeitungen haben doch spaltenlange Berichte darüber gestanden, es hat sich ein Komitee gebildet, das schon eine Summe von 11 000 Pfund zusammengebracht hat, als Prämie für den, der über den Verbleib des Ballons und des unglücklichen Aeronauten, der eine Mutter und eine Braut hinterlässt, berichten kann, sei dieser nun lebendig oder tot.«
»Ich lese überhaupt keine Zeitungen.«
»Halten Sie diese Aufgabe, mir über den Verbleib dieses Ballons und des Luftschiffers Kunde zu bringen, für gleichwertig mit dem Fang des erymanthischen Ebers?«
»Gleichwertig ist sie gewiss, wahrscheinlich sogar noch viel, viel schwerer zu lösen.«
»Ah, Sie halten diese Arbeit für schwer, für unausführbar?!«
Fast frohlockend hatte Marion es gerufen.
»Habe ich das etwa gesagt?«, entgegnete der moderne Herkules kalt. »Meine Königin Eurysthe befiehlt mir also, den durchgebrannten Fesselballon in Afrika aufzusuchen?«
»Das tue ich!«
»Angenommen! Ich werde diese Aufgabe zu lösen versuchen. Wenn von dem Ballon aber nun gar nichts mehr vorhanden ist?«
»Irgend etwas muss doch von ihm übrig geblieben sein.«
»Er kann ins Meer oder in ein afrikanisches Gewässer gestürzt sein, ein Haifisch oder ein Krokodil kann ihn verschlungen haben.«
»Ach, Sie moderner Herkules, machen Sie doch keine solche Flausen!«, fing Marion jetzt zu spotten an. »Ein Haifisch oder ein Krokodil soll solch eine mächtige Ballonhülle samt der Gondel verschlingen?«
»Er kann total verbrannt sein.«
»Dann bringen Sie mir etwas von der Asche, mit dem Beweis,dass diese wirklich von dem Ballon stammt. Und im Übrigen — hat etwa der griechische Herkules erst gefragt: ›Ja, wenn der erymanthische Eber aber nun nicht mehr lebt, wie soll ich dann die Aufgabe erfüllen, ihn lebendig zu bringen?‹«
»Können Sie mir beweisen, dass Herkules dies den König Eurysthes nicht erst gefragt hat?«, entgegnete Mister Piper mit unverwüstlichem Gleichmut. »Es ist doch sogar sehr wahrscheinlich, dass er das wirklich getan hat.«
»Machen Sie keine Flausen!«, wiederholte Lady Marion unmutig. »Überhaupt verlange ich ja nicht durchaus, dass Sie mir ihn lebendig bringen ...«
»Den Luftballon?«
»Den Aeronauten Mister Harris. Denn um diesen handelt es sich natürlich der Hauptsache nach. Verlieren wir uns nicht in leeren Wortspielereien. Sie wollen diesen verschollenen Aeronauten aufsuchen oder aber den sicheren Beweis, dass er seinen Tod gefunden hat. Verstehen Sie?«
»Ich verstehe. Und der Luftballon?«
»Ist schließlich Nebensache.«
Der neue Herkules machte eine seiner eckigen Verneigungen.
»Ich werde den Aeronauten bringen, lebendig oder tot, womöglich samt seinem Luftballon. Werden Sie mich wieder begleiten, wenigstens mir wieder nachfolgen bis Kapstadt?«
»O nein, nicht wieder! Ich begebe mich sofort nach London zurück.«
Noch eine Verbeugung, und der neue Herkules verließ mit seinem Diener das Hotelzimmer. Marion bekam die beiden in Messina nicht wieder zu sehen.
Es war am Anfang des neuen Jahres, als demnach auf der südlichen Hälfte unserer Erdkugel Hochsommer herrschte, als die Seewarte von Kapstadt, wie sie es oft tat, wieder einmal zu meteorologischen Forschungen ihren Fesselballon emporsandte.
Vierhundert Meter konnte er an einem Drahtseil emporsteigen, dann aber durfte bei vollster Gasfüllung die Gondel nur den geringsten Ballast enthalten, nur ein Mann konnte sich darin befinden.
Wie gewöhnlich bei solchen Aufstiegen, wurde zu diesem Ehrenposten Mister Francis Harris auserwählt, ein junger Gelehrter, Astronom, der sich der Meteorologie gewidmet hatte, staatlicher Beamter der Kapstadter Seewarte, sicher ihr einstiger Direktor.
Es war an einem herrlichen, ganz windstillen Morgen, als der mächtige Ballon seine letzte Rundung erhalten hatte.
Kleine Versuchsballons waren kerzengerade aufgestiegen, verharrten in der Atmosphäre ganz bewegungslos. Vierhundert Meter erreichten sie allerdings nicht, höchstens dreihundert.
Francis hatte seine zahlreichen Apparate und Instrumente in der Gondel schon geordnet, er verließ sie noch einmal.
In dem geschlossenen Hofe befanden sich nur Beamte der Seewarte; ferner hatte noch eine junge Dame Zutritt gefunden, Miss Malve Eckard, die öffentlich erklärte Braut des jungen Gelehrten. Außerdem hatte er noch seine Mutter in Kapstadt, aber die alte Frau war schon seit längeren Jahren gelähmt.
»All right?«
»All right, Sir!«, meldeten die Arbeiter, die in diesem letzten Augenblicke mehr zu sagen hatten als die gelehrten Aufseher.
»Na, Malve, dann ...«
Der junge Mann, der sich an seine Braut gewandt hatte, brach ab und fing plötzlich an zu lachen.
»Ich bin doch schon so manches Mal emporgefahren, Du warst stets dabei, und diesmal hätte ich Dir beinahe ein Lebewohl gewünscht. Aber was für ein Gesicht machst Du denn, Malve?«
Ja, die Braut war stets dabeigewesen, wenn ihr Verlobter in die Lüfte gegangen war, in Gesellschaft anderer oder allein. Das erstemal war sie sehr ängstlich gewesen, hatte sogar geweint, das zweitemal schon hatte sie den Ballon ganz gefasst aufsteigen sehen, der den Geliebten in die balkenlosen Lüfte entführte, und die folgenden vier Male hatte sie überhaupt keine Sorge mehr gehabt.
Es war ja auch gar nichts weiter dabei. Bei stürmischem oder sonst ungünstigem Wetter fand ein Aufstieg nicht statt, der Ballon, das Drahtseil und alles andere ward vorher aufs sorgfältigste geprüft, und was hatte es schließlich zu bedeuten, wenn das Seil einmal brach? Dann wurde die Reißleine gezogen, der sich entleerende Ballon sank schnell, und dass Mister Francis Harris auch ein geschickter Aeronaut war, der ganz allein landen konnte, hatte er ebenfalls schon zweimal bewiesen.
Das aber waren freie Fahrten gewesen. Ein Fesselballon war noch nie davongegangen. Nach zwei- bis vierstündigem Aufenthalt in den Lüften war Francis noch stets wohlbehalten zurückgekehrt, und einen Abschied von der Geliebten hatte es bisher überhaupt noch nie gegeben.
Und jetzt plötzlich ergriff das junge Mädchen krampfhaft die Hand ihres Verlobten, und dieselbe Angst drückten ihr Gesicht, ihr ganzes Wesen aus.
»Stieg nicht auf, Francis, nur heute nicht!«, stieß sie hervor.
»Ja, Malve, was ist denn mit Dir los?«, fragte er ganz bestürzt.
»Nur heute nicht, es passiert Dir etwas!«
»Was soll mir denn passieren? Und woher willst Du denn das überhaupt wissen?«
»Es ist heute Dein siebenter Aufstieg, und die Sieben ist eine Unglückszahl!«
Da begann er zu lachen.
»Na, Malve, verschone mich mit solchem Aberglauben! Die Sieben ist überhaupt eine heilige Zahl und gerade für mich immer günstig gewesen. Wenn Du sonst nichts weiter vorbringen kannst ...«
»Ich habe einen Traum gehabt ...«
»Ach, nun kommen gar Träume!«, lachte der junge Gelehrte.
»It is all right, Mister Harris!«, riefen diesmal die höheren Beamten.
Jetzt warf sich Malve sogar an seine Brust.
»Und ich lasse Dich nicht! Höre, was ich geträumt habe ...«
Er machte sich sanft, aber doch energisch von ihrer Umklammerung los.
»Erzähle mir den Traum, wenn ich wieder unten bin!«, lachte er. »Das wird ja die herrlichste Fahrt, die ich je gemacht habe.«
Mit diesen Worten sprang er in die Gondel.
»Let go!«
Es sah aus, als wollte Malve nacheilen — da begann sich schon das Drahtseil von der mächtigen Trommel abzuwickeln, im nächsten Augenblick befand sich die Gondel bereits in unerreichbarer Höhe.
»Er geht in den Tod, er geht in den Tod!«, erklang es noch einmal, und ohnmächtig brach Malve zusammen.
Sie wurde fortgetragen, schon deshalb, weil der ganze weitere Umkreis geräumt werden musste. Denn der Aeronaut hatte sofort von den vielen Sandsäcken , welche außen rings um die Gondel hingen, einen nach dem andren zu lösen begonnen. Je höher der Ballon stieg, desto mehr hatte er ja an dem schweren Drahtseil zu tragen und musste entsprechend erleichtert werden. Aber von vornherein ohne Ballast, hätte er gleich das Drahtseil sprengen können.
Als Malve unter den Bemühungen der Herren wieder zu sich kam, hatte der Ballon bereits seine höchste Höhe erreicht, Francis hatte noch zwei andere Drähte herabgelassen, die telefonische Verbindung war hergestellt, das schöne Wetter hatte sich nicht geändert, kein Wölkchen trübte den azurblauen Himmel, kerzengerade wie eine Stange stand das Drahtseil ohne die geringste Schwankung da.
Jetzt zeigte sich Malve ganz ruhig, lachte über sich selbst.
»Sie haben einen beängstigenden Traum gehabt?«
Nein, nicht einmal das. Das hätte sie nur vorgegeben, gestand sie selbst, um irgendeinen Grund zu haben, ihren Bräutigam von dieser Fahrt zurückzuhalten. Aber weswegen eigentlich, das wusste sie jetzt selbst nicht mehr. Es wäre wie ein innerer Drang gewesen, so zu sprechen und zu handeln.
Eben ein junges Mädchen — noch dazu verliebt und verlobt.
Nach drei Stunden sollte der Ballon wieder herabgeholt werden. Das Kommando erscholl, die Maschine begann zu keuchen, zog an.
Da, in den Lüften ein dumpfer Knall, wie ein weit entfernter Kanonenschuss, alles hielt unwillkürlich die Hände über den Kopf und stürmte in sinnloser Flucht davon, denn schon hatte man die aufrecht stehende Stange in sich zusammenbrechen sehen.
Das Drahtseil war kurz unterhalb der Gondel gerissen, eine Last von vielen Zentnern kam herabgesaust.
Kein Mensch kam zu Schaden. Das 400 Meter lange Seil bildete einen mächtigen Haufen.
Wer aber in die Höhe geschaut hatte, der hatte gesehen, wie der Ballon gleich einer riesigen Kanonenkugel in die Lüfte geschossen war — jetzt glich er nur noch einem Punkte im Äther. Auf 200 Meter musste man die Höhe mindestens schätzen, und nicht nur das, sondern der Ballon flog mit rasender Schnelligkeit dem Norden zu.
In der Atmosphäre gibt es ja immer verschiedene Strömungen. Innerhalb 500 Metern können sie sogar einander entgegengesetzt sein.
So raste dort oben, während hier über der Erde völlige Windstille herrschte, ein gewaltiger Sturm, den Sachverständige auf 20 bis 25 Meter in der Sekunde schätzten.
Während Malve vor einer eingebildeten Gefahr ohnmächtig zusammengebrochen war, zeigte sich das zarte Mädchen angesichts einer wirklichen, die dem Geliebten drohte, ganz gefasst.
Innerhalb weniger Minuten sah sie den winzigen Ballon im Luftmeer verschwinden, und sie schien den Versicherungen der Herren zu glauben, dass eine tatsächliche Gefahr gar nicht vorhanden sei, Mister Harris würde eben sofort das Ventil ziehen, später die Reißleine. Er verstände doch das Landen, nur könne man das Fallen des Ballons eben nicht mehr beobachten.
Man tat, was man tun konnte. Alle nördlichen Eisenbahnstationen wurden von der Flucht des Fesselballons telegrafisch benachrichtigt und zur Beobachtung aufgefordert, sogar nach Schoerkong, schon in der Wüste Kalahari liegend. Alle vorhandenen Automobile wurden zur Verfolgung des Flüchtlings ausgesandt.
»Wie weit ist Schoerkong von hier?«, fragte Malve ganz ruhig.
»Neunhundert Meilen, in der Luftlinie gerechnet.«
»Und welche Stärke soll der Sturm dort oben haben?«
»Zwanzig Meter in der Sekunde mindestens.«
»Wann könnte der Ballon Schoerkong dann erreicht haben?«
»In ... etwa zwanzig Stunden«, rechnete der Ingenieur ungefähr aus.
»Und Sie meinen, so weit könnte der Ballon kommen?«
»O nein, der hält das Gas keine zehn Stunden, und Mister Harris bringt ihn doch gleich zum Sinken, sodass er auch sofort wieder aus der Windregion herauskommt.«
Die Automobile kehrten zurück, und bis zum Abend war der Ballon von keinem der gefragten Eisenbahnstationen gesehen worden. Da muss man freilich mit Afrika rechnen, wo die Stationen nicht so dick gesät sind wie in Europa.
Wir fassen uns kurz. Von dem Ballon ward nichts wieder gesehen.
Dass er sich nur zehn Stunden in der Luft halten konnte, war auch nur ein ganz falsches Rechenexempel gewesen. Der Sturm kam herab bis zur Erdoberfläche, immer von Süden nach Norden rasend, und gesetzt den Fall, dem Aeronauten gelang es aus irgendeinem Grunde nicht, alles Gas herauszulassen oder die Hülle gleich ganz zu zerreißen, so konnte der Ballon als auf dem Boden hüpfender Ball viele Tage lang von dem Sturme vor sich hergetrieben werden, er konnte ganz Afrika von Süd nach Nord durchqueren.
Einer der Gründe, weshalb der Aeronaut die Ballonhülle nicht zerreißen konnte, war der, dass er sich überhaupt gleich nach der Katastrophe, nicht mehr in der Gondel befunden hatte. Er war durch das furchtbare Aufschnellen herausgeschleudert worden.
Seinen zerschmetterten Leichnam fand man allerdings nicht, aber auch schon dort in der Nähe von Kapstadt herrschten afrikanische Verhältnisse. Ach, was für große Gebiete gibt es da noch, die keines Menschen Fuß je begangen hat.
Man tat, was man tun konnte, was man tun musste. Die Regierung sandte eine Expedition aus, durch Sammlungen von Zeitungen und Gesellschaften wurden die Mittel für eine zweite aufgebracht, für die sichere Kunde über den Verbleib des Aeronauten eine Prämie von 10 000 Pfund Sterling ausgesetzt.
Beide Expeditionen kehrten aus dem Innern Afrikas resultatlos zurück. Es war ja überhaupt bloß eine formelle Sache gewesen, eine Pflicht der Menschlichkeit. Man konnte nur in allen Negerdörfern, die man berührte, und jeden einzelnen Menschen, dem man begegnete, fragen, ob von dem Ballon etwas gesehen worden sei. Dieses Fragen aber konnte leicht irreführen. Das Lügen und Aufschneiden der Neger ist ja bekannt. Wenn sie noch gar nicht wussten, was so ein Ballon sei, und man beschrieb es ihnen — jawohl, dann hatten alle den Flüchtling gesehen.
Nein, es war eben nichts!
Wenn nun Harris noch lebte, was konnte sein Schicksal sein? Vielleicht war er im Urwald, vielleicht in der Wüste gelandet, in der südlichen Kalahari oder auch in der nördlichen Sahara. Und er war nur mit einem belegten Butterbrot und drei Flaschen Selterswasser verproviantiert gewesen, hatte außer einem großen Messer und einem Beile zum Kappen der Taue keine Waffe bei sich gehabt.
Die dürftige Verproviantierung nur für einige Stunden, der Umstand, dass man also gar nicht mit einer Flucht des Fesselballons gerechnet hatte, das war allerdings ein großer Leichtsinn gewesen. Aber das ging nun nicht mehr zu ändern.
Man musste warten, ob der eventuell Gelandete selbst den Rückweg in irgendein kultiviertes Gebiet fand. Wer aber die Sache kannte und richtig denken konnte, der wartete nicht mehr.
Die alte Mutter und die jetzt bei ihr wohnende Braut warteten und hofften und beteten.
Nicht nur die drei Monate, wie Lady Marion gesagt, sondern schon vier Monate waren darüber vergangen.
Auf dem Hauptpostamt von Kapstadt nahm der das von Europa kommende Kabel bedienende Beamte ein Telegramm auf.
Es kam aus Messina, war an die größte Zeitung von Kapstadt gerichtet. Der sizilianische Berichterstatter teilte seinem Blatte ziemlich ausführlich mit, wie der neue Herkules, Mister Herkules Piper aus New York, mit Hilfe seines Dieners die Räuberbande, die sizilianische Hydra, vergiftet habe.
Über dieses letztere musste erst noch einiges erklärt werden.
Das Telegramm bestand ungefähr aus 200 Worten und kostete die doppelte Anzahl an Shillingen. Hatte nichts zu sagen. Das kann sich solch ein englisches Blatt, welches ganz Afrika beherrscht, leisten. Könnte es dies nicht, so würde es seine führende Stellung verlieren. So viel bringt da schon alltäglich eine Annonce ein, die ein Haarwuchsmittel oder etwas Ähnliches anpreist — auch in Afrika, soweit die englische Zunge klingt.
Die Aufnahme war beendet, die Beförderung erledigt.
Es war nach Schluss der obligatorischen Schalterstunden, die Telegrafenbeamten waren unter sich, hatten augenblicklich nichts zu tun.
Die Beamten müssen den Inhalt der Telegramme natürlich als Geheimnis bewahren, unter sich sprechen sie aber doch darüber.
»Da macht sich der amerikanische Herkules schon wieder bemerkbar«, sagte der betreffende Telegrafist, und er erzählte seinen Kollegen, was morgen in der Zeitung stehen würde.
Denn auch hier in Südafrika war der Mister Herkules Piper schon bekannt geworden, wie er die Taten seines griechischen Namensvetters nachmachen wollte, durch seinen Diener, wie dieser in London schon den entsprungenen Löwen gefangen, was für einen Kontrakt Mister Piper mit der Lady Marion geschlossen hatte, usw. usw.
Das hatte eben der Londoner Berichterstatter dem südafrikanischen Blatt schon auf telegrafischem Wege mitgeteilt, vor kaum acht Tagen.
»Das muss ja ein origineller Kauz sein, dieser Mister Herkules Piper«, hieß es.
»Was für eine Bewandtnis mag es nur mit diesem Diener haben?«
»Also als zweite Arbeit sollte er eine Räuberbande vernichten, die sich Hydra nannte — na ja, das stimmte wohl — und diese Aufgabe hat er auch wieder glücklich gelöst.«
»Da könnte er jetzt einmal hierher kommen um ...«
Wieder klingelte der Wecker — abermals meldete sich Messina in dem reichlich 1200 deutsche Meilen von hier entfernten Sizilien.
»An das Telegrafenamt Kapstadt. Anfrage mit bezahlter Antwort.«
Der hohe Beamte, welcher Antwort zu geben hatte, soweit er es verantworten konnte, kam. Anfragen geschäftlicher Natur und dergleichen beantwortete er natürlich nicht.
Das Verstandenzeichen war gegeben.
»Herkules Piper.«
Hoch horchten alle Beamten auf, welche ja das Klappern des Schreibrädchens gleich verstehen konnten.
»Telegrafenamt Kapstadt.«
»Fesselballon oder Francis Harris aufgefunden?«
Noch mehr horchte alles auf, und der eine Beamte hätte jetzt gar so gern sprechen mögen. Er hatte nämlich vorhin sagen wollen, dass das Aufsuchen dieses Ballons ja gleich so eine Arbeit für den neuen Herkules sei.
Nun, hierüber konnte der für solche Fälle angestellte Beamte Auskunft geben, deren Richtigkeit er zu verantworten vermochte.
Wie die Fragen von Messina, so wurden auch hier die Antworten des Beamten erst aufgeschrieben, ehe sie durch den Apparat gingen.
»Nein.«
»Keine Kunde davon?«
»Nein.«
»Nichts von dem Tod des Aeronauten erfahren? Sprechen Sie ganz ausführlich, ich bezahle alles.«
Die Beamten lächelten, zugleich aber drückten ihre Augen etwas wie Begeisterung, oder wie man es nun sonst nennen mag, aus. Es ist immer ein so merkwürdiges Gefühl, wenn man einen Menschen mit dem Gelde um sich werfen sieht, und man weiß, er kann es wirklich, das Geld spielt bei ihm gar keine Rolle.
»Nein, noch gar nichts wieder gehört.«
»Gut«, klapperte und schrieb das Rädchen und fuhr dann fort: »Wissen Sie, wo Miss Malve Eckard wohnt?«
»Ja.«
»Können Sie die Dame sofort an den Apparat holen lassen, dass ich mit ihr sprechen kann?«
»Will es probieren.«
»Ich bitte sehr darum«, ließ der Anfrager in Sizilien kein Wort aus.
Als sich der Beamte entfernt hatte, ging es in dem starkbesetzten Telegrafenzimmer wie in einem aufgestocherten Ameisenhaufen zu.
»Habe ich es vorhin nicht gleich gesagt ...«
Eine halbe Stunde verging. Dann betrat das Telegrafenzimmer eine blasse junge Dame, zitternd wie Espenlaub.
Sie wurde etwas instruiert, und mit einem Ruck war Malve ganz ruhig.
Die Verbindung mit Sizilien ward wieder hergestellt.
»Hier Herkules Piper.«
»Malve Eckard.«
»Aaaah«, musste auf dem Telegrafenamt in Messina ganz genau so telegrafiert werden, wie der Bezahlende niederschrieb. »Miss Malve Eckard, sehr angenehm, ehrt mich ungemein, Ihre werte Bekanntschaft zu machen. Darf ich mich nach Ihrem Befinden erkundigen?«
Sämtliche Beamte bissen sich auf die Lippen. Etwas verrückt war dieser amerikanische Herkules unbedingt. Das wurde eine teure Unterhaltung!
»Antworten Sie — antworten Sie nur ganz ausführlich«, ermunterte der vorstehende Beamte. »Der muss alles bezahlen, und er will es ja haben.«
»Danke sehr!«
»Es geht Ihnen gut?«
»Ja.«
»Freut mich aufrichtig. Haben Sie von Ihrem werten Herrn Bräutigam vielleicht einen alten Stiefel?«
Die Beamten blickten einander an. Sie alle hatten das tickende Schreibrädchen deutlich verstanden.
Malve stutzte, als sie die in richtiger Schrift schnell niedergeschriebene Frage las, ihr bleiches Antlitz rötete sich, sie trat zurück.
»So antworten Sie doch«, drängte der Beamte, »ob Sie von Ihrem Bräutigam, Mister Harris, einen alten Stiefel haben.«
»Nein, ich werde nicht antworten. Ich habe von diesem Mister Piper schon gehört, das ist ja ...«
Von Messina wurde gefragt, ob die Frage verstanden worden sei, eventuell um Kollation gebeten.
Dann kam genau dieselbe Frage noch einmal, sogar noch viel ausführlicher, was wieder extra bezahlt werden musste.
»Haben Sie von Ihrem Herrn Bräutigam einen alten Stiefel oder Schuh, den er längere Zeit getragen hat?«
»Ich hab's!«, rief ein Telegrafist. »Der will die Spur von Mister Harris mit einem Hunde verfolgen!«
»Durch die Lüfte?«, spottete ein anderer.
»Ja, aber wozu brauchte er sonst eine alte Fußbekleidung von ihm?«
»Antworten Sie, antworten Sie!«, drängte der Vorsteher. »Gewiss, der will die Verfolgung des entflohenen Ballons aufnehmen, und haben Sie denn noch nicht von diesem amerikanischen Herkules gehört?«
Ja, Malve hatte von ihm gelesen, wenigstens von der ersten geleisteten Arbeit und von der ganzen Einleitung, und sie dachte nicht mehr daran, dass jener sie verspotten wolle, man sah ganz deutlich, dass es wie ein sonniger Hoffnungsstrahl über ihr Gesicht huschte.
»Ja, wir haben Stiefel und Schuhe von ihm«, schrieb sie mit fester Hand nieder, was sofort nach Messina lief.
»Die er längere Zeit getragen hat?«, wurde dort immer noch einmal angefragt.
»Ja.«
»Heben Sie die gut auf. In zwei Monaten bin ich in Kapstadt. Empfehle mich sehr. Schluss.«
Eine Stunde später, nachdem dieses Gespräch zwischen Messina und Kapstadt beendet war, schiffte sich Lady Marion schon wieder nach Neapel ein.
Es ist dies die bequemste Verbindung nach Norden, die Seefahrt währt nur vierzehn Stunden.
Ihr Aufenthalt in Messina hatte nur eine Nacht gewährt, und sie dachte nicht daran, diese lange Reise weiter auszunützen — ihr Kopf wurde von ganz anderen Gedanken beherrscht, als dass sie jetzt dazu fähig gewesen wäre, italienische Landschaften zu bewundern.
Mister Piper und seinen Diener hatte sie, wie schon erwähnt, gar nicht wieder zu sehen bekommen, auch kein Verlangen danach getragen.
Der Dampfer fuhr nachmittags ab und kam am anderen Morgen in Neapel an. Marion verbrachte fast die ganze Nacht an Deck.
Das Schiff war schwach besetzt, nur wenige Passagiere genossen ebenfalls die herrliche Nacht an Deck. Neugierige wusste Marion von sich fernzuhalten, nur so nebenbei bemerkte sie, dass sie besonders von zwei Herren, offenbar Engländern, scharf beobachtet wurde.
Die beiden flüsterten immer miteinander, der eine nahm immer gewissermaßen einen Anlauf, sich der einsamen Dame zu nähern, wurde aber von dem anderen stets zurückgehalten, und Marion machte ihnen keinen Mut.
In Neapel suchte sie zunächst ein Hotel auf. Diesen Tag musste sie ruhen, möglichst schlafen.
Sie war noch nicht dazu gekommen, sich zu entkleiden, als ihr der Zimmerkellner in verschlossenem Kuvert eine Visitenkarte brachte.
Alexis Menzikow wünschte Lady Ramsay in ganz dringender Angelegenheit sofort zu sprechen — stand unter dem Namen auf Englisch mit Bleistift geschrieben.
In dringender Angelegenheit sprechen? Wer weist solch einen Besuch ab, wenn er nicht gerade eine für gewöhnlich unnahbare Person ist?
Der Herr mit dem russischen Namen hatte ein ganz englisches Gesicht, welches durchaus nicht vertrauenerweckend aussah — sehr energisch, aber auch sehr abgelebt, von Leidenschaften durchfurcht — und Marion erkannte in ihm sofort den einen der beiden Herren wieder, die sie auf dem Dampfer immer so beobachtet hatten, und zwar war es der, der den anderen immer zurückgehalten hatte.
»Was wünschen Sie?«
Lauernd ruhten die stechenden Augen auf der schönen Gestalt.
»Ich denke, wir können hier ganz ungestört sprechen.«
»Das können wir wohl, aber was wollen Sie mit Ihrer geheimnisvollen Einleitung? Bitte fassen Sie sich kurz, ich bin todmüde.«
»Gut, ganz kurz, sind Mylady mit dem Kontrakt einverstanden?«
»Mit welchem Kontrakte?«, wich Lady Marion vorläufig noch aus.
»Den Sie mit dem amerikanischen Herkules abgeschlossen haben.«
Marion war gleich bei ihren unangenehmsten Gedanken gefasst worden.
»Was wissen Sie denn davon?«
»Nun, es steht doch in allen Zeitungen.«
Ja, so war es leider.
»Sie werden diesem neuen Herkules zwölf Arbeiten aufgeben, und wenn er sie gelöst hat, werden Sie Mistress Piper heißen — den Titel einer Lady dürfen Sie allerdings weiterführen — Lady Piper.«
Mit einem Grinsen hatte es der elegant gekleidete Herr hervorgebracht.
Marion wurde immer unwilliger, die Röte der Entrüstung stieg ihr bis zur Schläfe empor. Zugleich aber wurde sie von einer unsäglichen Verzweiflung gepackt.
Ach, was hatte sie in ihrem ersten Enthusiasmus getan!
Aber sie wollte sich diesem fremden Manne gegenüber nicht schwach zeigen.
»Was geht das Sie an?«, fragte sie schroff.
»Sie sind höchst unglücklich darüber, diesen Kontrakt geschlossen zu haben.«
»Herr, wer sind Sie eigentlich, dass Sie so zu sprechen wagen?«
»Sie haben ja selbst verraten, dass Sie nicht gewillt sind, Lady Piper zu werden«, fuhr der Herr unbeirrt mit seinem höhnischen Lächeln fort.
»Ich verraten? Womit denn?«
»Nun, indem Sie ihm als dritte eine Arbeit aufgaben, von der Sie ganz bestimmt glaubten, dass der neue Herkules sie nicht lösen kann.«
Der Mann hatte die Wahrheit gesprochen. Mehr brauchen wir dem nicht hinzuzufügen.
Lady Marion wollte es natürlich nicht gelten lassen.
»Ich?! Ja, warum soll er denn den verschollenen Aeronauten nicht auffinden können?«
»Bitte, Mylady, geben Sie sich keine Mühe, mich zu täuschen, ich verstehe die Kunst, jeden Menschen zu durchschauen. Ich versichere Sie aber, dass dieser moderne Herkules den verschollenen Mister Harris dennoch auffinden wird, wenn nicht mehr lebendig, dann tot.«
Im Augenblick hatte Marion nur eins gehört, und sie sagte etwas, wodurch sie wieder verriet, dass sie so etwas wirklich nicht selbst geglaubt hatte.
»Wie will er denn das machen?!«, fuhr sie fast erschrocken empor.
»Das Wie kenne ich selbst noch nicht, ich weiß nur, was für Vorbereitungen er getroffen hat.«
»Nun?«
»Er hat sich sofort — gestern Nachmittag — mit Kapstadt in telegrafische Verbindung gesetzt, mit Miss Malve Eckard.«
»Wer ist denn das?«
»Die Braut des verschollenen Aeronauten.«
»Ah so, ich entsinne mich! Nun, und?«
»Und hat diese gefragt, ob sie eine alte Fußbekleidung von ihrem Bräutigam besitzt.«
»Eine alte Fußbekleidung?«, wiederholte Marion in ehrlichem Staunen.
»Einen alten Stiefel oder Schuh, den Harris längere Zeit getragen hat.«
»Ja, wozu denn das?«
»Um natürlich die Spur des Verschwundenen verfolgen zu können.«
»Etwa mit einem Hunde?«
»Vielleicht.«
»Durch die Lüfte eine Spur zu verfolgen?«, fragte Marion.
Der Herr zuckte die Achseln.
»Mir ist das ja selbst ein Rätsel, aber jedenfalls zeigt es, dass dieser Amerikaner schon einen bestimmten Plan hat und ganz sachgemäß vorgeht. Dann war sein Nächstes, dass er sich erkundigte, wann das erste Schiff nach Bombay geht, und als er erfuhr, dass er da den besten Anschluss in Brindisi hat, hat er sich sofort nach Brindisi eingeschifft, noch bevor Sie Ihren Dampfer bestiegen.«
»Er will nach Bombay?«
»Ohne jeden Zweifel.«
»Ja, aber was hat er denn in Bombay, in Indien zu suchen, wenn ihn seine Arbeit nach dem südlichen Afrika ruft?«
»Auch das weiß ich nicht, jedenfalls aber zeigt das wiederum, wie ganz planmäßig Mister Piper vorgeht. Das Geheimnisvolle dabei ist eben ein gewisser Beweis für seine Sicherheit. Außerdem hat er noch telegrafiert, dass er zwei Monate später in Kapstadt sein wird, Miss Eckart soll ihn erwarten. Also, gnädigste Mylady, machen Sie sich keine Hoffnung — dieser moderne Herkules wird mit Hilfe seines rätselhaften Dieners auch diese Aufgabe lösen, in einer Weise, die Sie als vollgültig anerkennen müssen.«
»Ja, aber wie nur?«, fragte Marion, bloß um etwas zu sagen.
»Er wird sie lösen, so oder so!«, entgegnete der Herr mit Betonung. »Und so wird er auch alle anderen neun Arbeiten vollbringen, welche Sie ihm aufgeben werden. Denn ich weiß, wer dieses menschliche Werkzeug ist, dessen er sich bedient, und diesem Nemo oder Jonny ist überhaupt nichts unmöglich.«
Jäh fuhr Marion empor. Ach, was hatten nicht schon die Zeitungen alles zusammenphantasiert, wer dieser rätselhafte Mann, dem sich die wilden Tiere gehorsam zu Füßen legten, sein könne, die tollsten Phantastereien waren schon ausgeheckt worden. Wir wollen uns gar nicht damit befassen.
»Wie? Sie wissen, wer dieser Mann ist?!«
»Ich weiß es.«
»Nun?«
»Tatsächlich das Produkt einer vierundzwanzigjährigen Erziehung dieses Mister Piper.«
»Da sagen Sie nichts Neues, diese Worte führt er ja selbst ständig im Munde.«
»Mehr werde auch ich nicht sagen.«
»Weshalb nicht?«
»Ich habe einen Grund dazu, dies als mein unverbrüchliches Geheimnis zu behalten. Aber ich weiß, wie er erzogen worden ist, von welchen Lehrern, auf welche seltsame, geheimnisvolle Weise — und ich weiß vor allen Dingen, was dieser Mann alles leisten kann. Und so sage ich Ihnen: mit Hilfe dieses geheimnisvollen Mannes wird Mister Piper alle Arbeiten leisten, alle, alle, welche Sie ihm auch aufgeben mögen. Die Sterne vom Himmel herunterholen kann er natürlich nicht, aber auf so etwas wird sich Mister Piper wohl auch nicht einlassen, und jeder Richter würde ihm da beistimmen, falls der Kontrakt einmal vor die Schranken des Gerichts kommen sollte.«
Höhnischer denn zuvor hatte der Herr seine Rede geschlossen.
Und wirklich, Marion schien mit einem Male ganz gebrochen zu sein, ein ächzender Laut entrang sich ihren Lippen, und siegesbewusst betrachtete der Fremde das schöne Weib.
»Ja, ja, Sie sind doch sehr unglücklich, auf einen derartigen Kontrakt eingegangen zu sein.«
Mit einem Ruck richtete sie sich wieder empor.
»Was wollen Sie eigentlich?«
»Ihnen helfen.«
»Inwiefern?«
»Dass dieser moderne Herkules oder vielmehr sein unbesiegbarer Diener Schiffbruch erleidet.«
»Schiffbruch?«
»Die eine oder andere Arbeit nicht erfüllen kann.«
»Wie wollen Sie das erwirken?«
»Das ist meine Sache.«
»Dessen wären Sie imstande?«
»Lernen Sie mich erst kennen.«
»Wer sind Sie?«
»Das Haupt einer Gesellschaft, welche die ganze Erde umspannt.«
Selbstbewusst hatte der Fremde es gesagt, und jäh zuckte Marion zusammen.
»Also, Sie wollen mir behilflich sein, dass ich ... dass Mister Piper ...«
»Dass Sie dereinst nicht den Namen einer Lady Piper anzunehmen brauchen.«
»Diese Hilfe werden Sie mir doch nicht umsonst gewähren.«
»Nein, das allerdings nicht«, grinste der andere.
»Was für einen Preis fordern Sie?«
»Sie werden auf rund eine Million Pfund geschätzt, Mylady.«
»Diese Schätzung dürfte so ziemlich richtig sein.«
»Wären Sie bereit, die Hälfte Ihres Vermögens zu opfern, um der Verpflichtungen ledig zu werden, die Sie dereinst gegen diesen spleenigen Yankee einzulösen haben?«
»Die Hälfte meines Vermögens? Eine halbe Million Pfund? Das ist doch etwas viel.«
»Ich finde nicht, wenn man nicht Lady Piper zu heißen braucht.«
»O, bis dahin ist noch lange Zeit.«
»Die wird schnell vergehen.«
»Ja, wie wollen Sie eigentlich hindernd in die Arbeiten eingreifen?«
»Das muss, wie gesagt, vorläufig meine Sache bleiben.«
»Ich wüsste ein sehr einfaches Mittel, um mir zu Hilfe zu kommen.«
»Und das wäre?«
»Unverwundbar wird dieser moderne Herkules wohl nicht sein.«
»Was wollen Sie damit sagen?«
»Wenn Sie mich nicht verstanden haben, möchte ich mich auch nicht deutlicher ausdrücken.«
»Nun gut, ich habe verstanden. Aber es ist gar viel, worauf Mylady anspielen. Und sehe ich denn wie ein Mörder aus?«
Marion blickte den Fremden schärfer an — und hätte bald mit einem Ja geantwortet.
»Also nicht so etwas wie Mord?«
Trotzig verschränkte der Herr die Arme vor der Brust.
»Well. Ich will offen sprechen. Sie haben es ganz richtig gedeutet. Ja, das Allereinfachste ist wohl, um eine Heirat zu verhindern, wenn man die eine Partei gleich ganz aus der Welt schafft. Und das zu tun erbiete ich mich mit meinen Gesellen.«
Da richtete sich die stolze Frau noch höher auf, und ihre Augen blitzten, als sie die Hand nach dem elektrischen Klingelknopf ausstreckte.
»Hinaus!! Mensch, welchen Vorschlag wagen Sie mir da zu machen! Wofür halten Sie mich eigentlich?!
Zur Mörderin soll ich werden, um einer Verpflichtung aus dem Wege zu gehen, und sei es auch die mir widerwärtigste?! Dessen halten Sie mich für fähig? Sehe ich denn so aus? Ein Glück, dass Sie mir diesen Vorschlag nicht schon an Bord des Dampfers gemacht haben, dort hätten Sie keine Zeit zur Flucht mehr gehabt, die ich Ihnen jetzt noch gewähre, nur um mit solch einem Mörderbuben nicht in den Mund aller zu kommen — aber nun hinaus, hinaus, oder ich ...«
Bis hierher hatte der Fremde sie sprechen lassen, jetzt trat er schnell zwischen sie und den weißen Knopf, mit vorgebeugtem Oberkörper, und noch höhnischer kam es zischend über seine Lippen:
»Nicht? Sie wollen nicht darauf eingehen? Ist Ihnen die Hälfte Ihres Vermögens zu viel, um sich von diesem menschlichen Scheusal zu befreien? Nun denn, ich werde wiederkommen — Sie erfassen die ganze Situation jetzt wahrscheinlich noch gar nicht richtig — denken vielleicht, die Sache wird sich noch auf andere Weise für Sie zum Guten wenden — aber jetzt werde ich selbst diesem Ihren Herkules behilflich sein, dass er seine Arbeiten vollenden kann — und wenn es so weit ist, wenn Sie mit dieser Ausgeburt von Hässlichkeit laut Kontrakt vor den Traualtar treten müssen, dann werde auch ich wieder Ihnen einen Kontrakt zur Unterschrift vorlegen — und da werden wir ja sehen, wie Sie dann sprechen, hahaha!!!«
Mit diesem höhnischen Gelächter war der Fremde zur Tür hinausgeeilt.
Richtig, zwei Monate später betrat Mister Herkules Piper in Kapstadt den afrikanischen Boden, sofort erkannt von jedermann, denn in diesem Zebraanzug, den er noch immer trug, hatten sein Konterfei unterdessen auch schon die in Kapstadt erscheinenden illustrierten Zeitungen gebracht, und außerdem hatte schon vor drei Wochen ein Berichterstatter aus Bombay nach Kapstadt telegrafiert, dass sich Mister Herkules Piper dorthin mit dem und dem Dampfer einschiffe, in Begleitung eines Dieners.
Die beiden hatten einen Abstecher ins Innere Indiens gemacht, das konnte der Reporter noch hinzufügen, aber was die dort getrieben hatten, das freilich wusste er nicht.
Die Passagiere des Dampfers hätten jetzt einiges Interessante erzählen können, aber Mister Piper und sein Diener waren die ersten, welche den am Kai angelegten Dampfer sofort verließen, durch die Hafenstraße marschierten, der Diener einen sehr großen Sack auf dem Rücken.
Alles blieb stehen, die ganze schwarze und weiße Straßenjugend hinter den beiden her, und Kapstadt hat die schlechteste Sorte von Straßenjugend noch nicht.
Das zweibeinige Zebra pflanzte sein Monokel ins Auge und wandte sich an den Nächsten.
»Äh, bitte, wo wohnt hier ...«
»Miss Eckard wohnt Prescot Street Nummer 58, ich bringe Sie hin!!!«, erklang es hundertstimmig im Chor, und nicht nur aus dem Munde der lieben Straßenjugend.
»Ich kalkuliere, dass ...«
»Mister Harris ist noch nicht gefunden, keine Spur davon!!!«, erklang es wieder so zusammen im Chor.
»Auch nicht ...«
»Auch nichts vom Ballon, noch gar nichts!!! Aber wie Miss Eckard Sie erwartet!!!«
Mister Piper wandelte in der Menschengasse weiter, zog aus der Brusttasche eine lange, schwarze Zigarre, steckte sie in den Mund und die Hände gleich wieder in die Hosentaschen.
»Jonny!«
Dicht hinter ihm ging der eigentliche Herkules, wieder einen Khakianzug tragend, beide Hände oben an dem zusammengeknoteten Ende des wahrscheinlich ziemlich gewichtigen Sackes, der freilich die kräftige Gestalt des jungen Mannes nicht im Mindesten beugte.
Jetzt war der gerufene mit zwei großen Schritten an seines Herrn Seite, löste die linke Hand von dem Sackknoten. Man sah ganz deutlich, dass er nichts darin hatte, näherte diese Hand der Zigarre des ruhig Weitergehenden — und plötzlich schlug aus dieser scheinbar ganz leeren Hand eine lange Flamme, wie aus den Fingerspitzen heraus, die Zigarre brannte, und Nemo, hinter seinen Herrn zurücktretend, legte wieder die linke Hand an den Sackknoten.
Alles starrte, alles staunte. Wer es nicht selbst gesehen hatte, bekam das Wunder zu hören. Es war ein einfaches Taschenspielerkunststückchen gewesen, bei diesen beiden Helden des Tages aber bekam es eine ganz besondere Bedeutung.
»Hier wohnt Miss Eckard!!!«, schrie die Menge und bildete vor einem Hause Spalier.
Die beiden die Treppe hinauf, und sie befanden sich in der Wohnung von Harris' Mutter, bei der also auch die Braut des Sohnes wohnte.
Ja, Malve hatte auf die Ankunft des neuen Herkules gewartet, und nicht minder die alte Mutter!!! Wie sich die beiden jetzt benahmen, wollen wir nicht schildern.
»Herkules Piper aus New York.«
»O Gott, o Gott!!!«
»Habe ich die Ehre, Miss Malve Eckard zu sehen?«
»Ich bin es«, hauchte die Gefragte.
»Und diese Dame?«
Er meinte die im Bett liegende Mistress Harris. Die Wohnung war nicht so ärmlich, dass es nur ein Schlafzimmer gegeben hätte, aber Mistress Harris hatte doch gleich mit beim Empfang sein wollen.
»Mistress Harris, die Mutter meines unglücklichen Bräutigams.«
»Sehr angenehm! Was fehlt der Dame, wenn ich fragen darf?«
»Gicht. Schon seit vielen Jahren.«
»Sehr bedauerlich. Jonny, kannst du die Gicht kurieren?«
Nemo hatte seinen Sack zu Boden gleiten lassen und stand steif wie ein Automat daneben.
»Ich kenne ein sehr gutes Mittel gegen Gicht, aber garantieren kann ich nicht«, wurde dieser Automat jetzt gesprächiger.
»Sehr bedauerlich. Sie gestatten doch, dass ich rauche?«
»Aber bitte sehr.«
»Noch nichts von Ihrem Herrn Bräutigam gehört?«
»Noch gar nichts wieder.«
»Sehr bedauerlich. Also Sie haben altes Schuhzeug, welches Ihr Herr Bräutigam längere Zeit getragen hat?«
In demselben Zimmer befand sich die Kiste, welche das ganze Arsenal des zurückgelassenen Schuhwerks enthielt.
»Welche Stiefel oder Schuhe hat er wohl am längsten getragen?«
Malve präsentierte ein Paar Kanonenstiefel.
»Diese trug er immer?«
»Mit Vorliebe.«
»Hm. Ein mächtiges Kaliber. Bei diesem Kanonenstiefel könnte der Heiducke bald bezecht wie eine Kanone sein. Was meinst du, Jonny?«
»Na, der verträgt schon einen Stiefel«, meinte der Gefragte gelassen. »Vielleicht aber ist ein Halbschuh vorhanden, den Mister Harris ebenfalls öfter getragen hat.«
»Können Sie mir solch einen Halbschuh empfehlen, gnädige Miss?«
Es lässt sich denken, was für ein Gesicht Malve bei diesen Worten machte. Sie begann schon wieder zu zweifeln.
»Hier diese Halbschuhe hat er auch viel getragen«, ging sie dann aber darauf ein.
Ja, das sah man den beiden Schuhen auch an, die hatten ihre Schuldigkeit getan.
»Bis zuletzt?«
»Nein, das allerdings wohl nicht, oder, Mutter ...«
Hilfesuchend blickte das junge Mädchen nach der alten Frau.
»Wann er sie getragen hat, darauf kommt auch gar nichts an«, mischte sich der Diener da einmal ungefragt ein. »Die Hauptsache ist, dass er sie recht lange getragen und sich darin wohlbefunden hat.«
»Hat sich Ihr Bräutigam in diesen Schuhen wohlbefunden?«
Jetzt wurde das junge Mädchen ganz und gar irre.
»O, mein Herr, ich glaube, Sie treiben nur ihren Spott mit mir.«
»Ich Spott mit Ihnen treiben? Fällt mir gar nicht ein, habe zu so etwas keine Zeit. Hat Ihr Herr Bräutigam keine Hühneraugen in diesen Schuhen gehabt?«
»Ich ... ich weiß nicht.«
»Denn mit Hühneraugen fühlt man sich nicht wohl.«
»Nein?«
»Haben Sie noch nie Hühneraugen gehabt?«
»Ich ... ich weiß nicht«, stotterte das arme Mädchen immer mehr.
»Wohl Ihnen, wenn Sie das nicht einmal wissen. Aber ich glaube fast, dieser Schuh dürfte kein Wasser halten. Hier auf der Seite hat er ein kleines und hier auf der anderen Seite ein großes Loch. Was meinst du, Jonny?«
Jonny trat heran, nahm den Halbschuh und betrachtete ihn mit Kennerblicken wie ein gelernter Schuster — oder wie ein Trödler.
»Diese Löcher sind nur äußerlich«, entschied er dann, »die lassen sich dichten.«
»So dichte sie, o, du Produkt meiner Erziehung.«
»Bitte Miss, wo ist hier die Wasserleitung?«
Fassungslos machte Malve die Führerin. Der Mann im Khakianzuge drehte den Leitungshahn auf und ließ den Schuh voll Wasser laufen. Ein klein wenig kam doch zu der einen Seite heraus.
»Das ist nicht schlimm«, meinte das menschliche Werkzeug des modernen Herkules, zeigend, dass es auch selbständig sprechen konnte, griff in die Tasche brachte ein Stück Wachs zum Vorschein und begann, die betreffende Stelle innen und außen zu verkleben.
»Sie wundern sich wohl etwas über diese Vorbereitungen?«, fuhr der Automat dabei fort, zeigend, dass er sogar lächeln konnte.
So ganz ohne Seele, wie Lady Marion gemeint, konnte er also doch wohl nicht sein.
»Ja, ist denn das nötig?«, fragte Malve schüchtern.
»Um Ihren Bräutigam zu finden? Ja, dazu ist unbedingt nötig, dass dieser Schuh Wasser hält. So, jetzt geht es. Es handelt sich nämlich darum, dass nicht zu viel von der kostbaren Flüssigkeit verloren geht, die wir sogleich zu einem ganz besonderen Experiment anwenden müssen.«
Unterdessen war Mister Piper an das Bett der Kranken getreten, geneigt, ihr eine Erklärung zu geben.
»Die Sache ist nämlich die: Ich habe ...«
Ein Poltern hinter ihm unterbrach ihn. Der Sack war umgefallen.
Mister Piper ging hin, nahm die Hände aus den Hosentaschen, richtete den Sack wieder auf, steckte die Hände in die Hosentaschen und begab sich an das Bett zurück.
»Die Sache ist nämlich die: Ich habe ...«
Ein neues Poltern — der Sack war abermals umgefallen. Und Mister Piper ging hin, nahm die Hände aus den Hosentaschen, richtete den Sack wieder auf und ging an das Bett zurück.
»Die Sache ist nämlich die: ich habe ...«
Da fiel der sack zum dritten Male um.
Jetzt aber ging Mister Piper nicht wieder hin, nahm gar nicht erst die Hände aus den Hosentaschen.
»Jonny!«
Soeben kam dieser mit dem wasserdicht gemachten Schuh aus der Küche, hinter ihm Malve.
»Jonny, jetzt ist der Sack dreimal hintereinander umgekippt, wenn das nun zum vierten Male passiert, dann ... verliere ich endlich die Geduld.«
Der Khakimann blickte gedankentief nach dem umgefallenen Sack.
»Saprimandschawadadscha!!«, rief er plötzlich, oder irgend solch ein Kauderwelsch, und ... mit einem Male richtete sich der Sack von ganz allein wieder auf.
Das Staunen der beiden Frauen lässt sich denken.
»Ja«, wandte sich Mister Piper wieder an Mistress Harris, »die Sache ist nämlich die: Ich habe ...«
Pardauz, da hatte der Sack schon wieder die Balance verloren.
»Saprimandschawadadscha!«, kommandierte Jonny, und gehorsam richtete sich der Sack wieder auf.
»Äh, nun schütte ihn gleich aus, das ist wohl das Allereinfachste«, meinte Mister Piper.
Sein Diener ging hin, schleifte den Sack bis in die Mitte der Stube, löste die Knoten, packte ihn ganz unten und kippte ihn vollends um, schüttelte ihn aus, wie man einen Mehlsack ausschüttet, und hervor kugelten einige in Stroh gehüllte Flaschen, ferner ein menschlicher Rumpf mit etlichen Gliedmaßen, aber nicht mit allen, die zu einem Menschen gehören, schließlich noch einige Flaschen in Strohhülsen, und dann war der Inhalt des Sackes erschöpft.
Mit maßlosem Staunen, wenn nicht mit Grausen, blickten die beiden Frauen auf den menschlichen Rumpf.
Es war wirklich ein solcher, einem alten, braunschwarzen Manne angehörend. Kopf und Arme und Hände waren vorhanden, aber die Beine fehlten dicht vom Rumpfe an. Da war der Rumpf wie eine Kugel geformt, nur unten eine glatte Fläche habend. Aber das Merkwürdigste war, dass dieser Rumpf nun auch noch einen ganz stattlichen Schmerbauch hatte. Bekleidet war er nicht, nicht einmal mit einem Feigenblatt, was er schließlich auch gar nicht nötig hatte.
Er lag so da, wie er gefallen war, halb auf der Seite, die Augen geschlossen.
Immer entsetzter blickten die beiden Frauen auf dieses Bild. Im Moment hatten sie den Zweck dieses Besuches ganz vergessen.
»Was — ist — denn — das?!«
»Ein indischer Fakir«, meinte Mister Herkules Piper gleichmütig.
»Ohne Beine?«
»Die hat er sich abgesägt.«
»Abgesägt?!«
»Oder abgeschnitten. So genau kann ich das nicht behaupten. Jedenfalls hat er sich nicht von dem Wagen des Dschaggernaut, oder wie der Kerl heißt, überfahren lassen, was die Fakire und auch noch andere mit Vorliebe tun, sondern er hat sich die Beine mit eigener Hand amputiert.«
»Weil er krank war?«, wurde noch immer ganz entsetzt gefragt.
»Nicht dass ich wüsste!«
»Ja, warum hat er sich denn da die Beine abgesägt?«
»Na, nur so! Weil's ihm Spaß machte. Oder um der Gottheit ein wohlgefälliges Opfer zu bringen. Eben aus allgemeiner Frömmigkeit.«

Malve hatte langsam ihr erstes Entsetzen überwunden, und das junge Mädchen war gebildet genug. Außerdem ist auch in Südafrika wie an der Ostküste das indische Element stark vertreten.
»Ich verstehe. Es ist eben ein indischer Fakir.«
»Ja, und nun läuft der Kerl nur noch auf seinen Händen herum. Und wie der laufen kann! Sie sollen's nur sehen. He, alter Junge!«
Lebendig war der menschliche Rumpf — der Mann schlief einfach, und jetzt fing er sogar zu schnarchen an.
Mister Piper trat ihm mit dem Fuße ungeniert in den Bauch, nicht eben hart, die Fußspitze drang aber doch tief in den Fettwanst ein. Der Mann brummte im Schlaf, begann mit den Augen zu zwinkern, schlug sie auf und rieb sie mit den unförmlichen Händen.
Verwundert schaute er sich um, dann richtete er sich auf, stemmte sich auf die Hände, sodass sein kugelrunder Leib frei zu schweben kam, und so marschierte er auf den Händen mit Leichtigkeit dorthin, wo in das Zimmer ein Strahl der Nachmittagssonne fiel. Hier ließ er sich auf seinen unten abgeplatteten und durch langes Sitzen hornig gewordenen Leib nieder und grunzte vergnügt.
»Ja«, sagte Mister Piper, »es ist mir nicht leicht geworden, den aus seiner Heimat zu entführen, da habe ich erst Titanenkämpfe zu bestehen gehabt, die mir Lady Ramsay eigentlich auch für volle Arbeiten anrechnen könnte.«
Dieses Marschieren des dicken Leibes war wiederum ein so seltsamer, sogar schrecklicher Anblick gewesen, dass Malve noch immer nicht an den eigentlichen Zweck des Besuches dachte.
»Wo ist denn dieser Mann beheimatet?«, flüsterte sie ängstlich.
»Mitten in Zentralindien, in einer Gegend, wo es mehr Tiger als Menschen und mehr Schlangen als Zöpfe in sämtlichen Mädchenpensionaten der Erde gibt. Der ganze Distrikt ist noch so gut wie völlig unbekannt — das heißt für uns Europäer, selbst für die in Indien ansässigen Engländer. Für die buddhistischen Inder aber steht dort ein berühmter Tempel, und das Allerheiligste darin ist oder war dieser Fakir, den ich glücklich daraus entführt habe. Freilich unter unsäglichen Schwierigkeiten, da hat es auch schon Herkulesarbeiten gegeben. Dieser Mann ist nämlich ein Hellseher. Das dürfte aber wohl keinem anderen weißen Menschen bekannt gewesen sein außer mir.«
Jedenfalls meinte Mister Piper immer seinen Diener, aber der war ja nur sein gewissermaßen von ihm selbst angefertigtes Handwerkszeug.
Doch Malve hatte nur eins gehört.
»Ein Hellseher?«
»Ja, er kann in die Ferne blicken. Dazu muss er sich aber erst besaufen. Oder es mag ja auch wirklich etwas dabei sein. Er muss ein Kleidungsstück haben, welches der Betreffende, den er sehen will, längere Zeit getragen hat, das tränkt er mit Rum — indischer Rum muss es unbedingt sein, behauptet er, aber wohl nur deshalb, weil er den am liebsten trinkt — dieses mit Rum getränkte Kleidungsstück nutscht und zutscht er nun aus, und das wiederholt er so lange, bis er ganz voll ist, dann blickt er starr auf das in Rum liegende Kleidungsstück, und nun sieht er in der spiegelnden Rumfläche, wo sich der einstige Träger dieses Kleidungsstückes zurzeit befindet, was er macht und so weiter, sieht jede seiner Bewegungen. Am einfachsten ist es, wenn man den Rum gleich in einen Schuh gießt, den der Betreffende lange Zeit getragen hat.«
Atemlos hatte Malve zugehört.
»Und das geht wirklich?«
»Tatsache! Ich habe mich oft genug davon überzeugt.«
»Wenn der Rum hier in den Schuh gegossen wird, so sieht er in der Flüssigkeit meinen Bräutigam?«
»Den, der diesen Schuh lange Zeit getragen hat.«
»Der Schuh gehört Francis.«
»Dann wird er auch diesen sehen. Das heißt, wenn er noch lebt.«
»Und wenn er sich nicht mehr am Leben befindet?«
»Dann sieht er in dem Rumspiegel eben nichts.«
»Schnell, schnell, machen wir dieses Experiment!!«, rief Malve außer sich.
Der Mann konnte dort sitzen bleiben, wo er saß, weitere Vorbereitungen waren nicht nötig.
Der Fakir sprach nur einen indischen Dialekt, den auch Mister Piper nicht verstand, wohl aber sein Diener. Dieser machte den Dolmetscher, übersetzte Wort für Wort, stellte auch eigene Fragen immer erst in Englisch, zeigte sich in dieser Verdolmetschung äußerst gewandt und schnell. Aber die Wiedergabe auf diese Weise wäre doch sehr langwierig, und so wollen wir es so schildern, als ob der Fakir selbst Englisch gesprochen hätte.
Bei der ganzen Prozedur war etwas Humoristisches, wofür die beiden Frauen jetzt freilich keinen Sinn hatten.
Eine der mitgebrachten Flaschen wurde entkorkt, der dichtgemachte Schuh bis an den Rand mit Rum gefüllt, der Fakir nahm ihn, blickte schmunzelnd hinein.
»Na, nun mal los, los, sauf zu!«, kommandierte Mister Piper, was von seinem sprachkundigen Diener übersetzt wurde, und zwar ganz gewissenhaft. Denn warum soll es nicht auch im Indischen solche Ausdrücke geben?
Der Fakir, der das Gelübde der Enthaltsamkeit von allen alkoholischen Getränken keinesfalls abgelegt hatte, ließ sich denn auch nicht lange nötigen, er setzte den Schuh an und saugte ihn aus bis auf die Nagelprobe, leckte sich schmunzelnd die dicken Lippen.
Der Schuh ward frisch gefüllt, wieder blickte der Mann auf die schimmernde Fläche, jetzt aber schon nicht mehr schmunzelnd.
»Siehst du etwas?«, wurde nach einer Weile gefragt.
»Ja.«
»Was siehst du?«
»Rum.«
»Das glaube ich wohl. Zeigt sich in der spiegelnden Fläche ein Bild?«
»Nichts.«
»Dann verschlucke den Spiegel.«
Es geschah, und der Schuh ward zum dritten Male gefüllt.
Jetzt aber, nachdem der Fakir schon mindestens einen Liter Rum im Leibe hatte — jeder Sachverständige hätte sich davor entsetzt, die beiden Frauen verstanden die Sache eben nicht so zu würdigen — wurde sein Auge starr, gläsern, nahm überhaupt einen ganz anderen Ausdruck an.
»Da — da ...«
»Was siehst du?«
»Einen Mann.«
»Wie sieht er aus?«, stieß die vor Erregung zitternde Malve hervor.
Dass es keinen Zweck hatte, selbst in die spiegelnde Fläche zu sehen, wusste sie von allein.
»Er hat einen großen Bart ...«
»Nur einen Schnurrbart?«, fragte Malve schnell.
»Einen ziemlich großen Vollbart«, verdolmetschte Nemo des Fakirs Erklärung.
»Francis trägt keinen Vollbart!«
»Nun, in den sechs Monaten kann er schon einen bekommen haben, wahrscheinlich wider seinen Willen«, meinte Mister Piper.
»Er ist ganz in Lumpen gehüllt ...«
»Das kann ebenso der Fall sein.«
»Er sitzt auf einem Steine — jetzt zieht er einen runden Gegenstand unter dem Rock hervor — es ist eine Uhr, wie die Faringis sie tragen — er blickt darauf ...«
»Und welche Zeit zeigt die Uhr?«, fragte Nemo hastig.
Aber dieser Fakir wusste nur, was eine Uhr sei, konnte davon die Zeit nicht ablesen, und ehe ihm das beigebracht wurde, hatte der Mann, mit dessen Augen der Hellsehende sah, den Blick schon wieder von der Uhr abgewendet. Diese selbst behielt er jedoch in der Hand.
»Der Fakir sieht alles, was auch Francis ... jener Mann sieht?«, fragte Malve atemlos.
»So ist es«, bestätigte Mister Piper, »er sieht die Person in dem glänzenden Spiegel und alles, was diese Person erblickt. Es ist wie ein Spiegelbild. Wie er freilich solch kleine Gegenstände erkennen kann, ist auch mir ein Rätsel. Das Ganze ist ja überhaupt ein Rätsel.«
»Und wie sieht die Uhr aus?«
Ja, da hätte dieser Mann erst wieder auf die Uhr blicken müssen.
»Jetzt sieht er nochmals auf die Uhr«, übersetzte Nemo das lallende Kauderwelsch des Fakirs.
»Und wie sieht die diese Uhr aus? Das Zifferblatt! Schnell, das Zifferblatt!«
Der Hellseher konnte ganz richtig ein Zifferblatt aus schillerndem Perlmutter beschreiben.
»Er ist es, es ist mein Francis!!«, rief da Malve in hellem Jubel.
Das war eine etwas voreilige Behauptung, andere Menschen können doch auch Uhren mit einem Zifferblatt aus Perlmutter besitzen — aber immerhin, in Verbindung mit diesem Schuh war nun wirklich jeder Zweifel beseitigt, dass jener Mann ein anderer sein könne als der verschollene Aeronaut.
Francis hatte sich erhoben, blickte um sich.
»Wasser, nichts als Wasser.
»Er befindet sich offenbar auf einer Insel.«
»Auf welcher?«
»Ja, Miss, wenn ich das schon wüsste! Das kann noch ein langwieriges Experiment werden. Aber nur Mut, wir wollen noch alles herausbekommen, was wir wissen müssen.«
Es war der sonst stumme Diener, der jetzt das Wort führte.
Weiter beschrieb der Fakir, dass die Insel, deren Umfang er aber durchaus nicht angeben konnte, mit Riffen von roter Farbe umgeben sei.
»Korallenriffe? Das ist sehr wichtig für uns. Dann befindet er sich auf keiner Insel in einem Süßwassersee, womit ja auch zu rechnen wäre, sondern auf einer Meerinsel, und zwar muss diese an der Ostseite Afrikas liegen.«
»Warum gerade an der Ostseite?«, fragte diesmal Mister Piper, die Überlegenheit seines Dieners hiermit anerkennend.
»Weil an der Westküste Afrikas gar keine Korallenbildung vorkommt, nur an der Ostküste. Freilich dürfen wir nicht so ganz gewiss mit der afrikanischen Region rechnen, der Ballon kann ja bis nach Asien hinübergeflogen sein.«
»Was? Bis nach Asien?!«
»Es ist alles in den Bereich der Möglichkeit zu ziehen:«
Der Fakir sah in dem flüssigen Spiegel einen anderen Mann, der sich dem Sitzenden nahte, mit ihm sprach.
Es war nach der Beschreibung des Hellsehers ein Neger, wahrscheinlich schon ziemlich alt, sehr groß und stark gebaut, vollständig nackt.
»Merkst du gar nichts Besonderes an ihm?«
»Nein — doch. Er trägt ein rotes Halsband.«
»Aus Korallen?«
Der Fakir beugte sich mit seinen gläsernen Augen tiefer über den Schuh, den er vor sich hin in beiden Händen hielt.
»Nein, keine Korallen — es ist nur eine Tätowierung, jetzt sehe ich es — eine rote Tätowierung, die aus lauter einzelnen Strichen besteht.«
»Dann ist es ein Komore!«, rief Nemo sofort. »Alle Komoren tätowieren sich solche rote Halsbänder, aber auch nur die Komoren, weshalb sie von den anderen Negerstämmen verspottet werden.«
»Was für ein Volk sind die Komoren?«, fragte sein Herr.
»Die Bewohner der Komoren-Inseln.«
»Und wo liegen die Komoren?«
»Zwischen Madagaskar und dem afrikanischen Festland«, erklärte auch Malve gleichzeitig mit dem manchmal geradezu allwissend erscheinenden Nemo. Jedenfalls waren seine Kenntnisse ganz erstaunlich.
»Auf nach den Komoren!«
Ein anderes Losungswort konnte es jetzt nicht geben.
Die Abreise verzögerte sich nur deshalb, weil, wie eine schnelle Erkundigung ergab, erst anderntags früh ein Dampfer von Kapstadt abging, der sie ungefähr in jene Gegend brachte — nach Majunga, an der Nordwestküste von Madagaskar gelegen, der bedeutendste Hafen dieser Insel.
So wurde der Fakir im Laufe des Tages noch weiter benutzt, was auch möglich war, wenn man ihn genügend mit Rum tränkte, der indessen durchaus kein indischer zu sein brauchte, und so konnte man noch weiter konstatieren, dass es ein nur sehr kleines, felsiges Eiland ohne jede Vegetation war, auf dem Harris wahrscheinlich mit jenem Neger hauste. Die beiden vertrugen sich gut, sammelten Möweneier und knieten an einer Spalte nieder, steckten den Kopf hinein — tranken offenbar dort angesammeltes Regenwasser.
Die anbrechende Dunkelheit machte den Beobachtungen ein Ende.
Die Fahrt nach Majunga, der sich natürlich auch Malve anschloss, währte sechs Tage. Der unterwegs befragte Fakir sah niemals etwas anderes. Die beiden sammelten Vogeleier, löschten ihren Durst an einer Bodenspalte, krochen Abends in eine Höhle.
Nur noch eine wichtige Entdeckung machte der Hellseher, so erblickte er dort in weiter, weiter Ferne den engbegrenzten Saum eines Landes, offenbar einer größeren Insel.
Ein Schiff bekam er niemals in Sicht, so sehnsüchtig er auch den ganzen Tag über das Meer abspähte, und er besaß offenbar nicht die Möglichkeit, mit Hilfe eines Kleidungsstückes eine Flagge herzustellen, die er aufpflanzen konnte; er hatte nicht einmal einen Stock. Auch war das kleine Eiland ganz flach, nur mit Felsblöcken bedeckt.
In Majunga hatte man damals nichts von einem Luftballon gesehen, wusste man nichts von zwei Robinsons, die auf einer Felsenklippe in der Nähe der Komorengruppe hausten.
Man musste diese Inseln selbst aufsuchen.
Aber schon vorher sollten die Sehenden einen Fingerzeig erhalten, der das Beste hoffen ließ.
Die Komoren bestehen aus vier größeren Inseln, allerdings keine mehr als 800 Quadratkilometer umfassend. Sie sind ziemlich fruchtbar, tragen besonders viele Kokosnusspalmen. Ferner ist jede der vier Inseln von einer Masse völlig steriler Felseneilande umgeben, die wieder von Korallenriffen eingeschlossen sind, die Schifffahrt höchst gefährlich machend.
Auf einer dieser Felsenklippen hatte man die Robinsons zu suchen.
Es war gerade die Zeit, zu der wie gewöhnlich in jedem Jahre einmal ein kleiner französischer Faktoreidampfer nach den Komoren abgehen wollte, um dort von den Eingeborenen Kopra einzusammeln, das von der Schale befreite Fleisch der Kokosnuss, aus dem Öl gepresst wird, hauptsächlich zur Seifenfabrikation.
In Majunga hatten die Erkundigung Einziehenden über die Komoren herzlich wenig erfahren können. So nahe diese auch liegen — man hat gar kein Interesse für sie. Es ist ja von dort nichts weiter zu holen als höchstens böse Krankheiten von degenerierten Eingeborenen.
Anders der französische Kapitän dieses Dampfers, ein höflicher, gebildeter Mann, der kannte die ganze Inselgruppe.
Mister Piper hatte sich ihm anvertraut. Warum sollte er auch nicht! Der verschwundene Aeronaut war schon so gut wie gefunden, damit war der schiefnäsige Yankee dem Traualtar, vor den er mit dem schönsten Weibe der Erde hintreten wollte, schon wieder einen Schritt näher gekommen, auch die Prämie von 10 000 Pfund brauchte er mit keinem mehr zu teilen.
»Das kann nur die Tohu-Klippe sein!«, rief der französische Kapitän sofort, nachdem er die Erklärungen staunend angehört hatte.
»Die Tohu-Klippe, wo liegt die?«
»Südlich von der Mohilla-Insel. Die Teufelsklippe — ein Name, der auf den Seekarten mehr als dreitausendmal wiederkehrt. Ja, dort könnte ein alter Komore hausen, der in dem schiffbrüchigen Aeronauten einen Gesellschafter gefunden hat.«
Er erzählte ausführlicher.
Schon ein Dutzend Jahre war es her, als ein Eingeborener auf Mohilla nach Besuch eines holländischen Schiffes von einer seltsamen, hier sonst ganz unbekannten Hautkrankheit befallen wurde. Das Fleisch wurde ganz weiß, die Haut blätterte sich in Schuppen ab. Offenbar war es Aussatz. Die Krankheit verbreitete sich nicht, aber die Eingeborenen hatten schon mit anderen ansteckenden Seuchen, welche die weißen Fremdlinge einschleppten, böse Erfahrungen gemacht.
Der Mann musste die Insel sofort verlassen. Doch wohin gehen? Ein anderes Land gab es ja gar nicht für den schon bejahrten Eingeborenen. Er entschloss sich, sich auf eine jener Felsenklippen zu begeben um dort Hungers zu sterben. Eine andere Art von Selbstmord gibt es für diese Neger nicht, und er wird auch nicht ausgeführt, so lange die Palmen noch Nüsse liefern.
Der Kranke bestieg also ein Boot, ruderte nach der Tohu-Klippe und war seitdem verschwunden. Er war dort eben verhungert, verschmachtet. Übrigens konnte er froh sein, dass die Teufelsklippe erst damals diesen Namen bekommen hatte.
Etwa acht Jahre später, jetzt vor drei Jahren, waren eingeborene Fischer zwischen jene gefährlichen Korallenriffe verschlagen worden, und da hatten sie auf der Tohu-Klippe einen Mann am Ufer stehen sehen, doch unbedingt jenen Aussätzigen.
Er hatte nicht gewinkt, und die abergläubischen Komoren wären auch nicht näher gekommen. Sie machten, dass sie wieder ihre heimatliche Insel erreichten.
Die Abfahrt des kleinen Dampfers ward möglichst beschleunigt, und schon am anderen Nachmittage befand er sich in jenen Gewässern.
Aber noch weit, weit ab musste er stoppen, als die Tohu-Klippe selbst mit dem besten Fernrohr erst als kleiner Klecks erschien.
Die Gegend ist wegen der Korallenbänke hier gar zu gefährlich, ein Boot wurde ausgesetzt, und wäre es nicht ganz ruhige See gewesen, so hätte auch dies nicht gewagt werden dürfen.
Dann aber, nach einstündiger Bootsfahrt, immer mit dem Senklot in der Hand, um nicht von einem spitzen Riff aufgeschlitzt zu werden, erkannte man durch das Fernrohr die beiden Männer, von denen der eine heftig einen Lappen schwenkte, und eine halbe Stunde später waren sie auch mit den bloßen Augen zu erkennen.
Und wieder eine halbe Stunde später stürzte sich jener Mann in das Meer und schwamm bis nach dem Korallengürtel, von wo er nur abgeholt zu werden brauchte — und Malve und Francis lagen einander in den Armen.
Das Boot steuerte zurück, ohne den alten Neger mitgenommen zu haben. Er war damals sehr schnell wieder gesundet, aber er beging nicht den Fehler, den Robinson Crusoe begangen hat — er hatte noch keine Lust, wieder zu den Menschen zurückzukehren.
Harris hatte nicht viel zu erzählen. Die Reißleine hatte versagt, er hatte in den Stricken emporklettern und die zähe Ballonhülle langsam mit dem Messer zerschneiden müssen, was aber auch nicht so leicht ist, wie es sich erzählen lässt.
Die ganze Nacht war der Ballon nach Norden geflogen, dann mehr nach Osten, und bei Anbruch des Tages hatte er das Meer unter sich gehabt.
Jetzt fiel der Ballon rasch, und als die Gondel das Wasser berührte, war Harris in der Nähe einer Insel, auf der er einen Menschen erblickte, abgesprungen.

Der noch einmal aufschießende Ballon verschwand schnell seinen Blicken, er selbst erreichte nach kurzem Schwimmen die Tohu-Klippe, ward von dem alten Neger freundlich aufgenommen und konnte nun mit diesem zusammen Robinson spielen.
Kein Gedanke daran, dass er hier jemals entdeckt würde. Hierher kam kein Schiff, kein Boot. Es müsste denn eben Zufall gewesen sein, und darauf hoffte Harris natürlich.
Möwen der verschiedensten Art, welche zu verschiedenen Zeiten brüteten, nisteten hier massenhaft, eine natürliche Zisterne war ständig mit Regenwasser gefüllt. Es war eben ein Brunnen.
So gingen sechs Monate hin, und nach noch einem Monat wäre Harris ebenso nackt herumgelaufen wie sein schwarzer Genosse.
Das war alles, was er zu erzählen hatte. Die Leidenszeit war vorbei, die beiden konnten nach Kapstadt zurückkehren und Hochzeit feiern, und nach den Flitterwochen nahm Mister Harris wieder seine Tätigkeit an der Seewarte auf, und zu seinem Ruhme sei gesagt, dass er trotz seines gefährlichen Abenteuers noch gar oft mit dem Fesselballon aufstieg, ohne dass sich seine junge Frau deshalb besonders ängstigte.
Mister Piper hatte sich über Sansibar durch den Suezkanal nach London begeben, und da er schlechte Verbindungen gehabt hatte, war ihm der Bericht über seine neuesten Erfolge von der anderen Seite der Erde herum vorausgeeilt.
Die telegrafische Berichterstattung war ja selbstverständlich schneller gewesen, aber selbst Briefe hatten ihn überholt.
Der moderne Herkules machte in der Villa der Lady Ramsay seine Verbeugung.
»Ich hoffe, dass Sie mit dem Ergebnis meiner dritten Arbeit zufrieden sind, o, meine Königin Eurysthe.«
»Es ist wunderbar, was ich da gehört habe, was in allen Zeitungen zu lesen ist. Wo ist denn Ihr Diener?«
»Im Vorzimmer, wohin er gehört.«
»Sie sind ungerecht.«
»Ich weiß, was Sie meinen. Nein, das ist nur mein Handwerkszeug, meine Keule, nichts weiter, und dabei bleibt es.«
»Nun gut. Und wo ist der geheimnisvolle Fakir, dieser Wundermann?«
»Ich hatte ihn in seine Heimat zurückbringen oder zurückschicken wollen, aber ... da ist etwas dazwischengekommen.«
»Was denn?«
»Die Mitreisenden haben während dieser Fahrt seine somnambule Fähigkeit zu stark benutzt.«
»Er ist erkrankt?«
»Er ist an Bord am Delirium gestorben und im Meer versenkt worden.«
»O weh! Was für ein unersetzlicher Verlust! Ja, wie sind Sie eigentlich zu diesem Wundermann gekommen?«
Mister Piper schilderte seine Abenteuer in Indien, die er bei der Entführung des Fakirs aus dem buddhistischen Heiligtume erlebt hatte, sich immer mit den Federn seines Dieners schmückend, er tat es aber so kurz und trocken, dass Lady Marion jedes Interesse daran verlor.
»Die vierte Arbeit, wenn ich bitten darf.«
Marion war schon seit einiger Zeit im Zimmer auf und ab gegangen.
»Ja, was für eine neue Arbeit soll ich Ihnen geben? Sie leisten sie ja doch.«
»Hoffentlich. Legen Sie mir nur keine zu leichte auf.«
»O, ich habe schon darüber nachgedacht, hatte ja Zeit dazu, habe Hunderte niedergeschrieben.«
»Nun bitte.«
»Die vierte Arbeit des Herkules war das Einfangen der kerynithischen Hindin.«
»Wissen Sie kein Reh oder einen Hirsch mit ehernen Füßen, dem ich ein ganzes Jahr nachrennen kann? Bei mir dauert es hoffentlich kürzere Zeit.«
»Das ist es eben. Arbeiten wüsste ich ja genug. In den Prärien Amerikas soll es ein weißes Pferd geben, so eine Art Geisterross, welches aller Bemühungen, es einzufangen, spottet ...«
»Ich werde Ihnen diesen Geisterschimmel lebendig bringen ...«
»Halt, halt! Lächelte Marion, denn Mister Piper hatte sich schon erhoben. »Das ist es eben, bei Ihnen geht alles so schnell und einfach zu. Oder ich könnte Sie nochmals nach Afrika schicken. Man soll ja kein Zebra zureiten können, Sie sollen eins fangen und mir hier zugeritten vorführen ...«
»Ich begebe mich sofort wieder nach Afrika.«
»Halt, halt, warten Sie nur noch etwas. Die drei Arbeiten, die Sie bisher geleistet haben, sind für die Menschheit nützlich gewesen. Sie haben einen ausgebrochenen Löwen rechtzeitig unschädlich gemacht, haben eine Räuberbande vernichtet, haben einen schon für tot Erklärten dem Leben und der Braut zurückgegeben. Ich möchte Ihnen weiter solche nützliche Arbeiten aufgeben.«
»So tun Sie es doch. Unbedingt nötig ist ja die Nützlichkeit allerdings nicht. Herkules hat auch nicht nur nützliche Arbeiten geleistet.«
»Ich dächte doch.«
»Durchaus nicht. Dass er den Zerberus aus der Unterwelt herausbrachte, hatte gar keinen Zweck, da befriedigte er nur eine Neugier des Eurystheus, und ihm den Gürtel der Amazonenkönigin zu bringen, das hatte ebenfalls gar keinen Zweck.«
»Ja, für letztere Arbeit hatte ich schon ein Äquivalent gefunden.«
»Bitte.«
»Als moderne Amazonen könnten die kriegerischen Weiber der Dahomeys gelten. Solch eine Anführerin wird wohl auch so etwas Ähnliches wie einen Gürtel haben, den könnten Sie mir holen ...«
»Ich begebe mich sofort dorthin, wo der Pfeffer wächst ...«
»Halt, halt, nur nicht so eilig!«, lachte jetzt das schöne Weib direkt. »Nein, nein, das ist alles zu einfach für Sie, das geht bei Ihnen viel zu schnell.«
»So befehlen Sie mir, dass ich Ihnen den Kaiser von China bringe.«
»Wie wollten Sie denn das anstellen?«
»Ich entführe ihn ganz einfach aus seiner Hofburg — die Kaiserinmutter dazu, wenn Sie es wünschen.«
»Was? Auch das würden Sie fertig bringen?!«
»Ich hoffe es — in allerkürzester Zeit.«
»Sehen Sie, es ist immer dasselbe: es ist für Sie alles zu einfach. Und außerdem hätte es ja gar keinen Zweck. Nein, ich habe eine andere Arbeit für Sie.«
»Bitte sehr.«
»Es soll eine internationale Gesellschaft geben — eine Gauner-, eine Verbrecherbande wollen wir gleich sagen. Haben Sie davon schon gehört?«
»O, solcher internationaler Verbrecherbanden mag es viele geben.«
»Aber ich habe eine kennen gelernt — wenigstens ihr Haupt.«
»Aha!«
»Ja, und ... diese trachtete sogar nach Ihrem Leben.«
»Nach meinem? Weshalb denn?«
Kurzerhand, allerdings etwas verlegen, erzählte Marion ihm ihre Unterredung mit dem Fremden in Messina. Nur eins verschwieg sie noch, vielleicht gerade die Hauptsache.
»Ah, bah«, sagte Mister Piper geringschätzend, nachdem sie geendet hatte, »auf solche Kleinigkeiten wollen wir uns doch gar nicht einlassen, das übergeben wir höchstens einem Detektiv. Einfach ein Erpressungsversuch. Aber ich sehe noch nicht ganz klar. Wie kommt er dazu, die Hälfte Ihres Vermögens zu fordern, wenn aus unserer Heirat nichts wird?«
Jetzt war deutlich zu sehen, wie das schöne Weib verlegen wurde.
»Nun — nun — er will die Heirat eben verhindern.«
»Ja, aber weswegen denn?«
»Damit — damit ...«
»Mylady, was haben Sie denn?«
»Was ich habe?«
»Sie sind so ... Sie sind doch mit unserem Kontrakt einverstanden.«
»Ich habe ihn ja unterschrieben.«
Scharf betrachtete der Yankee das schöne Weib, wie sie so zaghaft dastand.
»Aber Sie bereuen wohl, den Kontrakt unterschrieben zu haben?«
»Ich ... ich ...«
»Sprechen Sie offen!«
Aber sie sprach nicht, sie rang mit sich.
»Sind Sie nicht für die Idee eingenommen, dass es etwas ganz Sensationelles ist, wenn die schönste Frau der Erde den hässlichsten Mann heiratet?«
»O, mein Herr ...«
Lady Marion wandte sich der Türe zu, aber schnell war jener aufgesprungen und vertrat ihr den Weg.
»Hier haben Sie den Kontrakt zurück.«
Und schon hielt er ihr das Schriftstück hin.
Mit ungläubigem Staunen betrachtete sie ihn und das Papier.
»Es ist nicht möglich!!«
»Selbstverständlich. Dass Sie mich wirklich lieben können, das habe ich niemals geglaubt, dazu bin ich viel zu vernünftig — ich habe geglaubt, Sie seien nur für die ganze Idee eingenommen — und die Gattin des amerikanischen Herkules zu sein, das ist schließlich doch auch etwas wert. Aber einen Menschen wider seinen Willen zu etwas zwingen — zu einer Ehe — und nun gar Sie, die ich wirklich ... nichts liegt mir ferner. Bitte nehmen Sie den Kontrakt zurück!«
Mit zitternden Händen nahm Marion das verhängnisvolle Schriftstück, plötzlich entstürzten Tränen ihren Augen, ebenso schnell waren diese aber wieder versiegt, und dann richtete sie sich hoch auf, war wieder ganz ruhig, und ihre schönen Augen strahlten in noch ganz anderer Weise, als sie dem vor ihr Stehenden in das entstellte Gesicht blickte.
»Mister Piper — ich habe für jenen griechischen Herkules eigentlich nie eine besondere Bewunderung empfunden.«
»Nicht? Warum nicht?«, fragte das menschliche Zebra ruhig zurück, als wenn nichts geschehen wäre.
»Er war zu — zu ... brutal.«
»Hm, da dürften Sie vielleicht Recht haben.«
»Das, was man heutzutage einen Gentleman nennt, war er gewiss nicht.«
»Hm — den Damen gegenüber hat er sich wenigstens nie von einer besonders galanten Seite gezeigt.«
»Den neuen Herkules aber wird die Welt auch als einen tadellosen Gentleman preisen.«
Der zebragestreifte Herkules machte einer seiner merkwürdigsten Verbeugungen.
»Bin ich von jeher gewesen, wenn ich auch immer Schrullen im Kopfe gehabt habe.«
»Mister Piper, Sie sind ein Gentleman, ich — ich ... weiß nicht ...«
»Wenn Sie's nicht wissen, so lassen wir es. Genug davon. Also bitte, meine vierte Arbeit.«
»Wie? Sie wollen die Arbeiten trotzdem noch fortsetzen?«
»Selbstverständlich.«
»Ohne Belohnung?«
»Ist es nicht genug Belohnung, schon jetzt das Bewusstsein zu haben, dass die Kinderchen in der Schule dereinst vom Lehrer Haue bekommen, wenn sie die Arbeiten des amerikanischen Herkules nicht wie am Schnürchen herbeten können?«
»Das genügt Ihnen wirklich?«
»Und dann, dass Sie mit mir zufrieden sind«, setzte der Dandy mit einer Verbeugung hinzu.
»Mister Piper, Sie sind nicht nur ein Gentleman, sondern auch ein braver, ein guter Mann«, sagte Marion, ihm die Hand hinhaltend, und schon hatte sie wieder Tränen in den Augen.
Er hatte ihre Hand an seine Lippen geführt.
»Also genug davon. Diese Sache wäre erledigt. Bitte, die vierte Arbeit, o, meine Königin Eurysthe.«
Aber die schöne Frau schien gar nicht in der Stimmung zu sein, phantastische Aufträge zu erteilen, sie musste immer mehr mit dem Zurückhalten ihrer Tränen kämpfen.
Plötzlich wandte sie sich hastig der Tür zu.
»Fangen Sie meinen Papagei wieder ein«, sagte sie schluchzend und war hinaus.
Etwas verblüfft blickte der moderne Herkules ihr nach.
»Ihren Papagei einfangen? Ihr Papagei ist entflohen? Dann haben ihre Tränen wohl nur diesem Vieh gegolten? Aber auch gut, wird besorgt, obwohl das nicht als vierte Arbeit zu rechnen ist — es sei denn, dass dieser Papagei Menschen überfiele und sie mit ehernen Federn totschösse. Dann wäre es äquivalent mit der Vernichtung der Stymphaliden.«
Er begab sich in das Vorzimmer, wo der gehorsame Diener seiner wartete.
»Jonny, hasche den Papagei!«
»Welchen Papagei?«
»Der der Lady davongeflogen ist.«
»Ah so, deshalb das Leben im Park.«
In dem großen Garten war das ganze Hauspersonal auf der Jagd nach dem seinem Käfige entwichenen Papagei, der sich seiner Freiheit freute, von einem Baum zum anderen flog, und wenn jemand glaubte, er habe ihn, dann wechselte er seinen Standpunkt und sagte: »Lorrra ist schön — so schön — Mensch, ärgere dich nicht«, — oder so etwas Ähnliches.
Jonny verbot alles Spritzen und Schießen, wartete einige Zeit, bis sich der Vogel auf einem ersteigbaren Baume befand und dort zur Ruhe gekommen war, dann erkletterte er diesen Baum mit der Gewandtheit eines Affen, und man sah, wie er dem Vogel einfach den Finger unter den Leib schob und ihn dann fester in die Hand nahm.
Zuerst hatte sich der Papagei etwas gesträubt, war aber wie gebannt gewesen, hatte zuletzt nur nach der Hand gehackt.
Der menschliche Affe kehrte mit seiner Beute zurück, ohne seinen hellen Anzug im geringsten beschmutzt oder lädiert zu haben.
Nur einen Biss hatte Jonny am rechten Finger abbekommen, gar nicht von Bedeutung.
Der Papagei ward in seinen Bauer zurückexpediert, Mister Piper fragte noch einmal nach Lady Ramsay, diese sagte ihren besten Dank zurück, ließ sich aber entschuldigen.
Die beiden entfernten sich und ... ließen nichts wieder von sich hören. Wenigstens acht Tage blieb der moderne Herkules verschwunden.
Lady Marion zeigte während dieser Zeit ein recht seltsames Benehmen, empfing niemand, wollte auch von ihrer Freundin nichts wissen, hielt sich meist eingeschlossen.
Als sie wieder zum Vorschein kam, war ihre erste Frage, ob Mister Piper noch nicht wieder dagewesen sei, zeigte dann die größte Besorgnis. Man solle gleich Nachforschungen über seinen Verbleib halten.
»Mister Piper«, meldete da der Diener.
Marion hätte ihn kaum wiedererkannt. Sein Gesicht konnte er freilich wenig verändern, aber es lag doch ein ganz anderer, schwermütiger Ausdruck darin, und dann vor allen Dingen hatte er seinen Zebraanzug mit einem schwarzen vertauscht, der auch ganz zu seinem Gesicht passte.
»Mylady, ich komme, mich von Ihnen zu verabschieden.«
»Verabschieden?! Was ist Ihnen denn passiert?«
»Verabschieden als Mister Piper sowohl wie als Herkules. Ich habe meine Kriegskeule verloren.«
»Ihren Diener?«
»Ist tot. Ist gestern im St. George's Hospital an Blutvergiftung gestorben. An dem Biss, den ihm der Papagei beigebracht hat. Und Hauptherkules war er doch, das gestehe ich jetzt ganz offen, das war ja überhaupt immer ganz selbstverständlich.«
Marion war vollständig erschüttert. War es doch auch gerade ihr Papagei gewesen.
»Ich habe ihn für unverwundbar gehalten.«
»Ah bah, er war ein Mensch wie jeder andere. Jetzt liegt er schon unter der Erde. Aber sehen Sie, was ich mit dem nun noch alles vorhatte — und wie ich den nun habe erziehen lassen — nicht etwa in einem Lamakloster auf der obersten Spitze des Himalajas, wie die Zeitungen phantasieren — i, Gott bewahre, bei einer Artistentruppe — aber nun wie — mit welcher Sorgfalt und Liebe — gleich nach seiner Geburt ließ ich ihm alle Knochen brechen — noch vor drei Tagen konnte er sich mit dem Fuße auf dem Rücken kratzen — und dann noch sonst — was für Lehrer ich ihm gehalten habe — und dann die vielen Reisen in alle Welt — und dann erst schon die langen Vorbereitungen für seine Menschwerdung — und sein Vater war ein mathematischer Wunderknabe und seine Mutter eine akrobatische Schlangendame, die mit den Füßen Violine spielen konnte — und nun ist alles dahin, nur durch einen kleinen Biss von solch einem Vieh ...«
Mister Piper zog ein weißes, ganz normales Taschentuch hervor und tupfte sich damit die Augenwinkel.
»Ja, nun wollte ich mich verabschieden.«
Marion zeigte sich äußerst erregt, sie rang nach Worten.
»Es ist nur wegen der Wette — habe ich mich jetzt zu erschießen, dass Sie mein Vermögen bekommen?«
»Mister Piper, was sprechen Sie da!!«
»Ich weiß schon — ich hätte gar nicht erst fragen sollen. So leben Sie wohl.«
Auch Marion war aufgestanden, zeigte sich mit einem Male ganz gefasst, mit festen Augen blickte sie den hässlichen Menschen an.
»Wohin gehen Sie?«
»Nach Amerika — vergrabe mich irgendwo in die Einsamkeit, um meinen ungeschehenen Taten nachzuträumen.«
»Soll ich mit Ihnen gehen?«
»Auch Sie begeben sich wieder einmal in Ihre Heimat?«
»Es war schon längst meine Absicht. Aber ich meine, soll ich mich mit Ihnen in Ihre Einsamkeit vergraben — als Ihre Gattin?«
»Was?!«
»Stellen Sie sich nicht erstaunt, es kann Ihnen doch gar nicht so überraschend kommen. Mister Piper, Sie haben mich wirklich geliebt?«
»Ja, das habe ich«, gestand der ausrangierte Herkules mit der Hand auf dem Herzen.
»Und ich bin eine eigentümliche, eine höchst eigentümliche Frau. Vielleicht verkennt man mich. Ich aber kenne Sie jetzt. Ich habe mir schon Vorwürfe genug gemacht, dass ich einmal einen Menschen geringgeschätzt habe, weil er ein ... etwas absonderliches Gesicht, vielleicht auch etwas absonderliche Manieren hat. Aber damals, als Sie mir den Kontrakt zurückgaben, habe ich Ihr Herz gesehen. Und es war das bravste Herz, das ich je gesehen habe. Nein, ich will von unserem Kontrakt nicht zurücktreten. Und ich nehme die zwölf Arbeiten für erfüllt an. Oder ich erkläre mich eben schon mit den dreien zufrieden. Soll ich mit Ihnen gehen? Soll ich einmal Ihre Erziehung in meine Hände nehmen?«
»Wenn Sie wünschen, ich lege mich schon jetzt ganz in Ihre Hände, o, meine Königin Eurysthe«, sagte Mister Herkules und tat es sofort, beanspruchte auch gleich noch die Arme. — — — —
Einige Tage später löste Lady Ramsay ihren Hausstand auf und siedelte nach Amerika über, wohin Mister Piper schon vorausgereist war.
Gehört hat man von den beiden nicht wieder, und es ist auch besser so.
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.