
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software

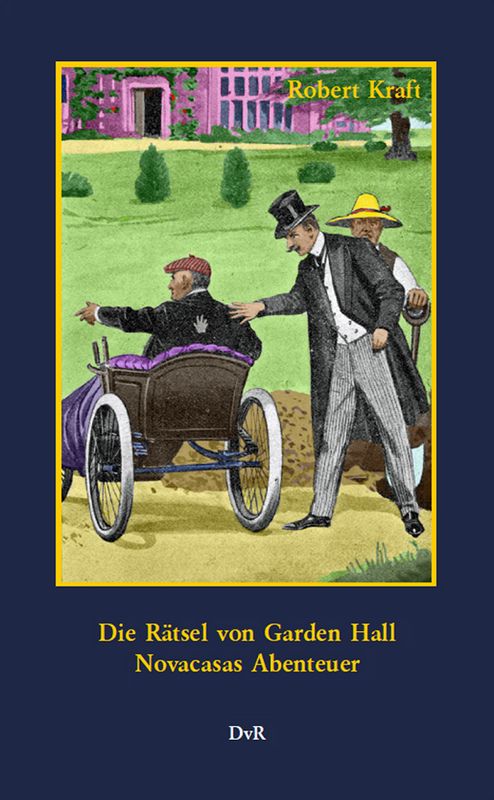
Verlag Dieter von Reeken, 2024
Die vorliegende Neuausgabe enthält den ungekürzten Text des von Robert Kraft (1869-1916) verfassten Romans Novacasas Abenteuer, die erstmals 1909 in 13 Lieferungen erschienen sind, unter Verwendung folgender Ausgabe:
Novacasas Abenteuer. Roman von Robert Kraft. In: Robert Kraft: Gesammelte Reise- und Abenteuer-Romane. Sechste Serie: Die Augen der Sphinx. Siebenter Band. Niedersedlitz-Dresden: H.G. Münchmeyer G.m.b.H. o.J. [1910]. 607 S. mit 26 Illustrationen von Adolf Wald.
Zu Robert Krafts Leben und Werk verweise ich auf die umfassende reich farbig illustrierte Bibliografie von Thomas Braatz(1), die ebenfalls farbig illustrierte Biografie von Walter Henle und Peter Richter(2), ein umfangreiches Buch von Arnulf Meifert (3) und auf die Tagungsbände zu den Robert-Kraft-Symposien (4).
(1) Thomas Braatz: Robert Kraft — Farbig illustrierte Bibliographie zum 100. Todestag. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer, 3., erweiterte Aufl. 2016. — 1032 S. mit über 1000 farbigen Abb.
(2) Walter Henle, Peter Richter: Unter den Augen der Sphinx. Leben und Werk Robert Krafts zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer 2005. — Das Buch ist vergriffen; eine Neuausgabe ist für 2025 geplant.
(3) Arnulf Meifert: Robert Kraft. Avanturier und Selbstsucher. Eine Annäherung. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer 2018.
(4) Robert Kraft 1869—1916. 1. Robert-Kraft-Symposium. 15.—16.10.2016. Mit Beiträgen von Thomas Braatz, Arnulf Meifert, Achim Schnurrer sowie historischen Texten von Dr. S. Friedlaender und Robert Kraft. Leipzig: Thomas Braatz im Rahmen des Freundeskreises Science Fiction Leipzig 2016; Wenn ich König wäre! Robert Kraft zum 150. Geburtstag. 3. Robert-Kraft-Symposium. 12.—13.10.2018. Mit Beiträgen von Jakob Bleymehl, Gerhard W. Bleymehl, Thomas Braatz, Matthias Käther, Walter Mayrhofer, Arnulf Meifert, Karlheinz Steinmüller und Hans Wollschläger. A.a. O. 2019; 4. Robert-KraftSymposium. 16.04.2022. Serienheld Nobody. 100 Jahre KraftFilm von Thomas Braatz, u. a. mit Beiträgen von Michael Bauer, Aurel Lupastean und Franziska Meifert. A.a.O. 2022.
Offensichtliche Rechtschreibfehler und überholte Schreibweisen sind stillschweigend berichtigt worden, z. B. ›Boller‹ in ›Poller‹, ›der Gehalt‹ in ›das Gehalt‹, ›paddeln‹ in ›buddeln‹, ›pulen‹ in ›pullen‹, ›Indier‹ in ›Inder‹, ›Sennor/Sennora/Sennorita/Don/Donna‹ in (spanisch) ›Señor/Señora/Señorita/Doña‹ bzw. (portugiesisch-brasilianisch) ›Senhor/Senhora/Senhorita/Dom/Dona‹, ›Wage‹ in ›Waage‹ usw.
Fußnoten mit Sternchen (*) stehen so auch im Originaltext, solche mit Zahlen in runden Klammern (1) sind vom Herausgeber eingefügt worden.
Die Wiedergabequalität der Abbildungen war abhängig von der jeweiligen Druckqualität der Vorlagen. Da die den Lagen vorangestellten ganzseitigen Abbildungen in der vorliegenden Neuausgabe dem Fließtext räumlich zugeordnet werden konnten, ist auf die fast textgleichen Bildunterschriften verzichtet worden.
Für freundliche Unterstützung durch den Originaltext der Erstausgabe, für Bilder, Hinweise und die bibliografischen Anmerkungen bedanke ich mich bei Thomas Braatz, für die die Korrektur bei Ellen Radszat.
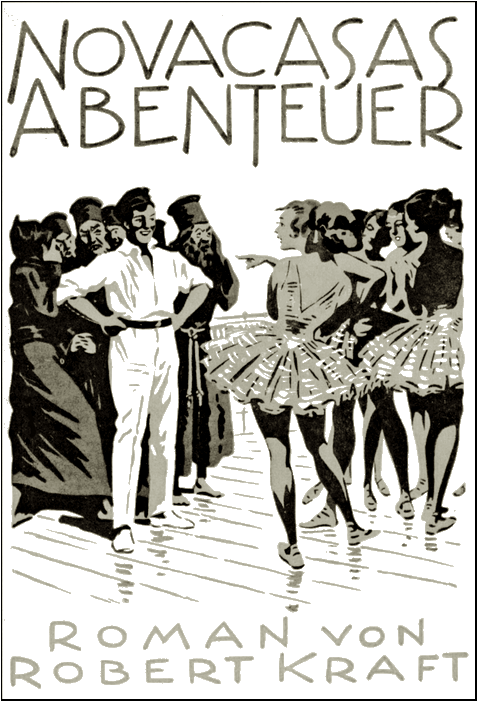
Novacasas Abenteuer. Roman von Robert Kraft. Dresden-
Niedersedlitz: H.G. Münchmeyer G.m.b.H. o.J. [1923],
Schutzumschlag, gezeichnet von Georg Hertting.
Ich habe meine Karriere in dieser Welt gar schnell gemacht. Und was für eine Karriere! In meinem achten Jahre wurde ich schon Leutnant im Garderegiment, im zehnten Hauptmann, und in einem Alter, da sich andere Jungen erst ihren zukünftigen Beruf wählen, war ich schon Kommandeur dieses Garderegiments und außerdem Chef eines spanischen, eines russischen und eines serbischen Regiments.
So darf man mir wohl glauben, dass ich wiederum zwei Jahre später kommandierender General gewesen wäre. Allein ich sattelte um — musste es auf höheren Befehl — trat zur Marine über, ins Kadettenkorps.
Und hier ging es bei mir nicht minder schnell als in der Armee. Als ich mündig erklärt wurde, im achtzehnten Jahre, war ich bereits Kapitän zur See mit vier dicken Goldstreifen auf den Ärmeln und Kommandant einer Panzerfregatte. Meine Beziehungen zum Lande hielt ich durch vier Automobile, sechs Maitressen und zehn Rennpferde aufrecht.
Nun weiß der geneigte Leser schon, woher diese schnelle Karriere. Weil mein Name im Hofkalender in den allerersten Reihen stand, in denen die Mitglieder der regierenden Häuser aufgezählt werden.
Allerdings muss ich auch erwähnen, dass ich in meiner Jugend nichts zu lachen gehabt habe. Von einer fröhlichen Kinderzeit habe ich nie etwas gewusst. Immer lernen, immer lernen, ein ewiges Einfüllen mit dem Nürnberger Trichter, und wenn ich auch schon als kleines Kind neben meiner Muttersprache durch Gouvernanten Französisch, Englisch und Italienisch erlernte, wozu später noch Russisch kam, so gab es doch noch genug, was mir nicht so spielend beigebracht werden konnte, und ich hatte als Leutnant den angestrengtesten Dienst eines gemeinen Soldaten tun und als Seekadett splissen und knoten lernen müssen, und alles andere, was dazu gehört.
Trotzdem — immer mehr kam mir zum Bewusstsein, dass ich doch nur eine Puppe, eine Götzenfigur sei, mit der man spiele. Ich tat meine Augen auf, und ich sah, wie man wahres Talent und wahres Verdienst zurücksetzte oder doch nur langsam Schritt für Schritt gehen ließ, weil... es im Hofkalender eben nicht in den ersten Reihen stand. Und da erfasste mich manchmal eine Scham vor mir selbst, ein unnennbarer Ekel vor der ganzen Welt.
Ein besonderer Vorfall ließ mich diese ganze Lüge und Hohlheit in ihrer wahren Gestalt erkennen, öffnete mir plötzlich die Augen.
Auf einem Spazierritt mit meinem Haushofmeister, wobei wir den dreißigjährigen Krieg wieder einmal durchnahmen, passierten wir ein Dorf. Da steht am Ententeich ein Kinderwagen, er kommt ins Rollen, fährt in den Teich hinein. Zeternd kommt eine Frau herbeigerannt. Ich aber bin schon aus dem Sattel, hole den Kinderwagen wieder heraus. Es waren nur drei Schritte, und das Wasser ging mir nicht einmal über die kurzen Reitstiefel. Belohnung. Große goldene Rettungsmedaille, und dann konnte man in allen Zeitungen lesen, wie ich mit Hintansetzung meines höchsteigenen Lebens mit den Wellen gerungen, bis ich das Kind dem Tode entrissen hatte, und so weiter.
Das Spaßhafteste aber war dabei, dass in dem Kinderwagen überhaupt kein Kind gewesen war! —
Ja, da stieg etwas wie ein unsagbarer Ekel in mir auf.
Noch etwas anderes kam hinzu.
Die Frühreife meines Geistes war eine künstliche, die meines Körpers eine natürliche. Schon mit achtzehn Jahren konnte mir niemand mehr ein Kraftstückchen vormachen. Und dass ich schon längst allen Glauben an Frauentugend verloren hatte, dafür hatte man reichlich gesorgt. trotzdem bin ich von jeher ein phantastischer, romantisch veranlagter Charakter gewesen, bin es geblieben.
Eines Nachts in Zivil durch die Straßen gehend, schützte ich eine junge Dame vor der Zudringlichkeit einiger Bürschchen. Sie war Schneidermamsell und hieß Klärchen. Und ich wurde ihr Egmont.
Ach, es war eine köstliche Zeit, die ich als vorgeblicher Kommis mit meinem Klärchen verlebte!
Und da reifte in mir der Entschluss. Eines Tages ging ich hin zur vorgesetzten und verwandtschaftlichen Stelle. So und so, ich will die und die heiraten, und ›Frau Fürschtin‹ kann die natürlich nicht werden, das weiß auch ich.
Der Skandal war groß. Man bat und flehte und drohte, sogar mit der Irrenanstalt — alles vergeblich! Und von mir wusste man, dass ich nicht umsonst drohte. Mit einem Federstrich verzichtete ich auf mein ganzes mütterliches Vermögen, schlug jede Rente aus, alles.
Zuletzt war nichts mehr zu machen.
»Nun gut! So wählen Sie sich einen bürgerlichen Namen. Womöglich einen recht allgemeinen, wenn Sie nun einmal unter der Menge verschwinden wollen. Wie wollen Sie fernerhin heißen?«
»Das ist mir ganz Gottlieb Schulze«, entgegnete ich.
»Gottlieb Schulze?«
»Jawohl, Gottlieb Schulze!«
»Und was für einen Beruf?«
»Arbeiter.«
»Was für ein Arbeiter?«
»Einfach Arbeiter. Wir sind alle Arbeiter. Das heißt jeder, der ein wirklicher Mensch sein will.«
Ich erhielt meinen Pass zugestellt, lautend auf den Namen Gottlieb Schulze, von Beruf... Gelegenheitsarbeiter. Richtig, so sollte es auch sein!
Ach, wie habe ich damals doch so von Herzen gelacht, ich, im Bewusstsein meiner unbändigen Kraft!
Die Stadt, in der Klärchen wohnte, war einige Stunden Eisenbahnfahrt entfernt, ich hatte noch immer erst einige Formalitäten zu erledigen — so schrieb ich ihr einen Eilbrief, offenbarte ihr alles, wer ich bisher gewesen, was ich ihr zuliebe getan, um sie als mein Weib vor den Altar zu führen, wie ich sie durch die Arbeit meiner Hände oder meines Kopfes ernähren wolle, als Schreiber oder als Steinklopfer, ganz gleichgültig — und so schwärmte ich weiter von unserem zukünftigen Glücke, das wir als Menschen unter Menschen genießen würden.
Der Brief ging ab. Am nächsten Tage folgte ich nach. Ach, mit welch seligen Glücksgefühlen näherte ich mich in der Abendstunde ihrer Wohnung, stieg die quietschende Treppe des Hinterhauses empor!
Ich fand nur einen Brief vor, den mir eine fremde Person gab. Ich sei ein Hansnarr! Ein Esel! Was ich denn eigentlich dächte! Und so weiter.
Dann erfuhr ich auch von anderen noch mehr. Sie hatte schon immer gewusst, wer ich in Wirklichkeit war. Hatte meine Maitresse werden wollen.
Bald darauf hörte ich zufällig, dass sie von einem alten Lebemanne ausgehalten wurde. — —
Das war der erste wirkliche Schlag, der mich in meinem jungen Leben traf. Mit blutendem Herzen wanderte ich ins Land hinein, ein ganz seltsames Unding von einem Menschen: Dem Körper nach ein Herkules, dem Herzen nach ein naives Kind, und das mit dem Kopfe eines alten, erfahrenen Mannes!
Weiß nicht, wie ich mich durchgeschlagen habe. Hatte wohl einiges Silbergeld in der Tasche. Weiß gar nicht mehr, wo ich schlief, und wo ich meinen Hunger stillte. Ich beobachtete mit geheimer Wonne, wie sich mein Herz langsam verblutete, und dann lehnte ich mich wohl manchmal gegen einen Baum und heulte.
Frische Seeluft und Teergeruch brachten mich wieder zur Besinnung. Die Blutung war gestillt. Ich sah mich in Triest, hatte Hunger und kein Kupferstück mehr in der Tasche.
Da lag ein englischer Segler, nahm Ladung ein.
»Braucht Ihr noch einen Matrosen, Käpten?«
»Seid Ihr Matrose?«
»Ja.«
Der Kapitän betrachtete mich wohlgefällig von oben bis unten, dann aber misstrauisch meine Hände.
»Hm, habt verdammt feine Hände!«
»Bin schon lange ohne Heuer — war im Krankenhause.«
»Zeigt mir mal Eure Papiere!«
Mechanisch griff ich in die Brusttasche, dachte scheu daran, dass ich ja nur als Gelegenheitsarbeiter ausgeschrieben war, und die Zeiten, da man ohne Papiere als Matrose fahren konnte, überhaupt Arbeit bekam, waren damals für Europa schon längst vorbei, das gab es nur noch in Amerika. Der Kapitän darf ohne Papiere keinen Mann annehmen, darf nicht irgendeinen Arbeiter als Matrosen anstellen, er macht sich dadurch strafbar.
Und ich suchte meinen Pass vergeblich, musste ihn verloren haben.
Keine Papiere? Was habt Ihr denn ausgefressen, eh? Aus welchem Zuchthaus entsprungen, eh?«
»Kapitän, ich habe meine Papiere wahrhaftig verloren...«
»Wo seid Ihr denn als Matrose gefahren?«
Ich nannte einige Schiffsnamen. Da wusste ich Bescheid. Ich hatte ja auch schon eine Reise um die Erde mitgemacht, war ja schon Kommandant einer Panzerfregatte gewesen. Davon durfte ich freilich nichts erwähnen.
Der Kapitän hörte überhaupt nur mit halbem Ohre zu.
»Schon gut, schon gut! Hier! Splisst mir mal die beiden Enden zusammen!«
Ich nahm eine Marlspike, hatte in drei Minuten das dicke Tau zusammengesplisst.
»Na, das versteht Ihr aus dem ff. Scheint doch kein Windbeutel zu sein. Ja, ich brauche noch ein paar Hände, und hier sind nur solche schmierige Italiener zu bekommen. Wie heißt Ihr?«
»Gottlieb Schulze.«
»So seht Ihr auch aus. Keine Papiere?«
»Gar keine!«
»Ja, Papiere müsst Ihr haben, sonst kann ich Euch nicht anmustern. Na, wartet mal!«
Er ging und kehrte mit einem abgegriffenen Seefahrtsbuche zurück.
»Da ist mir mal ein Matrose über Bord gewaschen worden. 's ist schon viele Jahre her. 's war ein Italiener, oder ein Korse — hier steht's. aus Brasidello bei Bastia. Ich schickte das Buch dann an seine Gemeinde, erhielt's aber als unbestellbar zurück. Das Nest war durch eine Sturmflut weggewaschen worden. Hab's also liegen lassen. Napoleon Bonaparte Novacasa hieß der Kerl. Das Signalement stimmt wohl. Augen blau, Haare blond, gelockt, Statur mittelgroß, sehr kräftig, breitschultrig, Alter... wie alt seid Ihr?«
»Fünfundzwanzig«, entgegnete ich zur Vorsicht, obgleich ich noch nicht zwanzig zählte.
»Na, dann stimmt ja alles. Italienisch braucht Ihr nicht sprechen zu können...«
»Ich kann ganz geläufig Italienisch, auch wie ein Korse schnarren.«
»Desto besser! Habt's aber gar nicht nötig. Ihr werdet bloß nach dem Namen gefragt, den müsst Ihr hinschreiben, wohin der Tintenkleckser mit dem Finger tippt. Also merkt's Euch: Napoleon Bonaparte Novacasa. Hier, so wird's geschrieben. Nun kommt mit nach dem Seemannsamt!«
Eine Viertelstunde später war ich als der korsische Matrose Napoleon Bonaparte Novacasa angeheuert.
O, wie ward mir zumute, als ich mir recht bewusst wurde, was für einen pompösen Namen ich fernerhin führen sollte!
Doch schließlich war ja gar nichts weiter dabei. Novacasa, Casanova — beides bedeutet ›neues Haus‹ unserem ›Neuhaus‹ entsprechend, was doch kein so seltener Name ist. So ist auch im Italienischen weder Novacasa noch Casanova selten. Im Adressbuch von Rom steht ersterer siebenunddreißig, letzterer sogar zweiundfünfzigmal. Freilich hat sich nur ein einziger Casanova unsterblich gemacht, Giovanni Jacopo de Seingalt Casanova, obgleich auch seine beiden Brüder, Battista und Francesco, ganz namhafte Maler gewesen sind, letzterer noch heute berühmt. Aber wenn man den Namen Casanova ausspricht, so denkt man selbstverständlich an jenen italienischen Abenteurer comme il faut, dessen Memoiren in sämtliche Kultursprachen der Erde übersetzt worden sind und immer wieder neu aufgelegt werden.
Hatte mich das Schicksal nun etwa dazu bestimmt, unter Verdrehung dieses Namens ein weiter Neuhaus zu werden?
Nun gut, ich war bereit, eine derartige Rolle zu spielen. Das passte auch alles so vortrefflich auf mich.
Sonst sei nur noch bemerkt, dass auch der ganze pompöse Name, Napoleon Bonaparte Novacasa, kein ungewöhnlicher ist, wenigstens nicht für einen Korsen. Fünfzig Prozent aller Korsen führen als den einen Vornamen entweder Napoleon oder Bonaparte, zehn Prozent gleich beide, in stolzer Erinnerung an den größten Sohn Korsikas. — —
Wir gingen mit Stückgut nach New York und von dort zurück mit Petroleum nach Konstantinopel, wo die ganze Mannschaft abgemustert wurde. Acht Monate hatte der Segelkasten zu dieser Fahrt gebraucht, ich erhielt hundertachtzig Dollar ausgezahlt, verjuxte das Geld wie meine Kollegen in der ersten Nacht in irgendeiner Räuberspelunke, so toll wie möglich. Denn das lernt man am leichtesten von der ganzen christlichen Seefahrt — das sauer verdiente Geld verjuxen.
Nachdem ich mich einen Tag und eine Nacht bei einem englischen Boarding-Master, dem ich meinen Kleidersack als Pfand für künftige Heuer übergeben, ausgeschlafen hatte, saß ich am folgenden Morgen in der Vorstadt Pera auf einer ungewaschenen Bank und schälte mir das Horn von den Händen, dabei mit meiner Rosamunde plaudernd, die neben mir saß...
Ach so, da muss ich erst sagen, wer Rosamunde eigentlich war!
Ein allerliebstes kleines, zierliches Dingelchen.
Ihre Haut war rosafarben mit himmelblauen Flecken, sie hatte Pfötchen wie die Gänsekiele, rosa war auch ihre Schnauze...
Das heißt, dass der geneigte Leser nicht etwa denkt, ich spräche von einer Dame! Nein, es war ein Hund, oder vielmehr eine Hündin. Vielleicht ein Windspiel, aber etwas ganz Apartes, und so winzig, dass ich es bequem in meine Rocktasche stecken konnte.
Es war am frühen Morgen gewesen, als ich das Haus des BoardingMasters verlassen hatte. Da hörte ich Hundegebell, und um die Ecke herum kam das zierliche Windspielchen und ihm nach einige jener räudigen Köter, welche alle Straßen Konstantinopels unsicher machen. Im nächsten Augenblick wäre das kleine Tier zerrissen gewesen.
Ich gab den ersten der verfolgenden Köter ein paar Tritte, sie kehrten heulend um, und damit hielt ich die Sache für erledigt.
Als ich damals den Schicksalsschlag erlitten hatte, den ich für den größten und schmerzlichsten hielt, der mich je treffen könnte, hatte ich den heiligsten Schwur abgelegt, mich nie, nie wieder an irgendein Wesen zu binden, weder menschliches noch sonstiges. Mit keiner Fliege wollte ich mehr Freundschaft schließen. Frei wollte ich sein, absolut frei!
So beachtete ich das Hündchen auch gar nicht weiter. Aber was sollte ich tun, wenn es immer so vor meinen Füßen herumschwänzelte und an mir empor sprang, als wenn es seinem Erretter danken wollte? Ich konnte dem winzigen Tierchen doch keinen Fußtritt geben, der es gleich getötet hätte!
So musste ich es bei mir dulden, und es begleitete mich unausgesetzt. Als ich mich auf die Bank setzte, sprang es ebenfalls schnell darauf, legte sein winziges Pfötchen auf mein Bein und schaute mich mit den klugen Augen bittend an und trieb allerhand Kapriolen — und mit einem Male war es in meine Rocktasche geschlüpft und schaute mit dem Köpfchen heraus, als müsste das so sein — und dann schlief es in meiner Tasche ein, und ich wagte deswegen nicht aufzustehen — und als es sein Nickerchen gemacht hatte, schlüpfte es wieder heraus und wollte wieder mit mir spielen.
Na, ich bin doch kein Unmensch. So betrachtete ich mir das Tierchen näher und fand immer mehr, wie reizend es doch war. Sicher ein kleines Fräulein.
Ein Halsband hatte es nicht um. Und da fing ich so zu fragen an, wie sie hieße, und wo sie zu Hause sei, und das kleine Fräulein schaute mich so verständnisvoll an und antwortete auf jede meiner Fragen mit einem Niesen, wobei es so merkwürdig das Köpfchen schüttelte, dass ich aus voller Kehle lachen musste.
So vertrieben wir beiden uns die Zeit, und ich rauchte dazu eine Pfeife und kaute meinen Tabak klein — auch so etwas, was man von Matrosen am allerschnellsten lernt und sich dann nicht wieder abgewöhnen kann.
Da kamen des Weges zwei Damen einher, zwei Bohnenstangen, äugten mich an.
»Ist es erlaubt, hier auch ein bisschen Platz zu nehmen?«, flötete mich die eine auf Deutsch an. Hier in Pera ist alles deutsch.
»Immerzu!«, brummte ich, mir ein neues Stück Tabak abbeißend.
Sie setzten sich, und jetzt fing das Hündchen, dem ich noch keinen Namen gegeben, mit denen zu spielen an.
»Ach, wie reizend — nein, wie süß!...«, und so weiter.
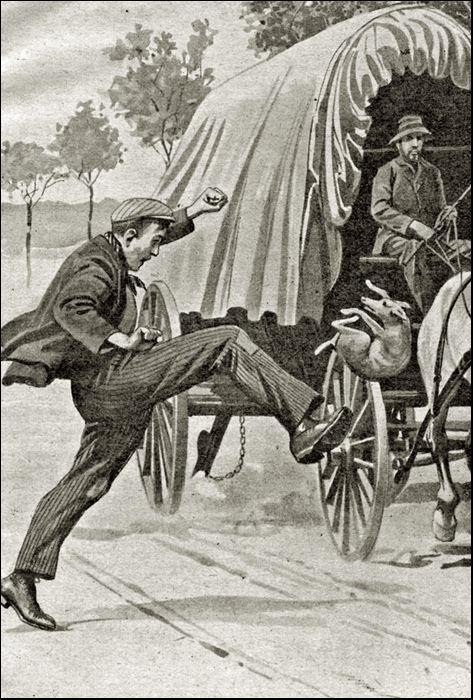
»Nein, sieh nur, Amanda, dieses süße Goscherl, dieser rosa Mund... ach, darf ich dem einmal einen Kuss geben?«
Und ehe ich hierzu die Erlaubnis erteilen konnte, hatte die Bohnenstange schon das Köpfchen des Tieres zwischen beide Hände genommen und drückte auf die kalte Schnauze andächtig einen langen Kuss.
Weiß der Teufel, ich wurde plötzlich ganz eifersüchtig! Mir hatte das schon immer nicht gepasst. Und nun gar — was hatte diese triefäugige Bohnenstange meinen Hund....
Halt, Gottlieb Schulze oder Napoleon Bonaparte Novacasa!! Was geht dich denn dieses Hundevieh an? Das ist doch gar nicht dein. Und überhaupt, hast du nicht einen heiligen Schwur getan, niemals wieder mit irgendeiner Seele anzubändeln? Und hast du hier nicht wiederum einen Beweis, wie treulos die ganze Welt ist? Erst errettest du den Hund, das Symbol der Treue, vorm sicheren Tode, wärmst ihn in deiner Tasche, und da braucht nur so eine alte Schachtel zu kommen, so lässt er sich von ihr küssen...
Also, ich sprang auf, steckte grimmig die Hände in die Hosentaschen und ging eiligst von dannen, froh, diesen aufdringlichen Gesellschafter wieder losgeworden zu sein. So redete ich mir wenigstens ein.
Aber siehe da, da scharwenzelte mir das Viehchen schon wieder vor den Füßen herum. Also seine Zuneigung zu mir war doch stärker als zu...
Nein, es sollte eben nicht sein!! Und in einem Anfall von Wut nahm ich das Tierchen vorn auf die Fußspitze und schleuderte es... direkt unter die Räder eines schweren Lastwagens, der in einer Staubwolke gerade einhergerasselt kam.
Herrgott im Himmel, wie mir plötzlich das Herz stehen blieb, als ich das kleine Tierchen unter den eisenbeschlagenen Rädern verschwinden sah! Das hatte ich natürlich nicht gewollt! Ich habe ja später noch so manchen Schreck erlebt, aber solch einen doch nicht wieder. Mir war nicht anders, als müsste ich mich selbst gleich vor den Lastwagen werfen, um mich zermalmen zu lassen, ich glaube sogar, ich hätte es wirklich getan — — aber ehe ich dazu kam, war der Wagen schon vorüber, und frisch und munter sprang mir aus der Staubwolke schon wieder das Hündchen entgegen.
Und da gab es nichts mehr mit einem heiligen Schwur, da habe ich das Tier aufgehoben und mit zitternden Händen das zarte Körperchen untersucht, und als ich so gar keine Verletzungen finden konnte, da kam es wie ein Gebet der Erlösung über mich, und da habe ich es ebenfalls auf das rosa, kalte und nasse Schnäuzchen geküsst und dabei wohl auch einige Tränen der Erleichterung vergossen. Und dann habe ich es zur Vorsicht in die Tasche gesteckt — und da war es eben mein Hund geworden. Und als ich daran dachte, wie die alte Schachtel mich gefragt hatte, ob sie das Hündchen auf sein rosa Mündchen küssen dürfe, habe ich es eben Rosamunde genannt. — —
»Seid Ihr Matrose?«, redete mich eine Viertestunde später ein Mann in blauen Sachen an.
»Jawohl.«
»Seid Ihr schon geheuert?«
»Nein.«
»Wollt Ihr bei mir mustern?«
»Worauf? Wohin?«
»Nach Thaso. Unter türkischer Flagge, ist aber eine österreichische Bark. Zweihundert Piaster den Monat.«
Das war nicht viel — fünfzig Mark — na, ich ging mit aufs Seemannsamt. Sofortige Abreise!
Es war eine italienische Feluke, der Kapitän ein Däne, die ganze Mannschaft bestand aus lauter zusammengelesenem Gesindel. Ich hatte einigen Vorschuss bekommen, mit dem ich vom BoardingMaster meinen Kleidersack einlöste. Als ich, diesen auf dem Rücken, dem Hafen zusteuerte, traf ich wieder den Kapitän, der mich zur Eile antrieb. Die Bark steche gleich in See.
Um mich her schwänzelte wieder Rosamunde.
»Ist das Euer Hund?«
»Jawohl, und ich hoffe, Ihr habt nichts dagegen, dass der mit an Bord kommt.«
»Na, so viel wird wohl noch übrig sein.«
Unterwegs fiel mir auf, dass ein paar Türken recht aufmerksam meinen Hund betrachteten, zusammen schnatterten und ihn dann an sich locken wollten. Aber Rosamunde ließ sich nicht locken.
So erreichten wir die Bark, machten alsbald alles klar, nach einer halben Stunde lösten wir die Trossen und setzten Segel.
Wir waren schon ein gut Stück zum Hafen hinaus, als ein kleines Dampfboot mit der türkischen Kriegsflagge uns nachgeschossen kam.
Der Kapitän und sein Steuermann wurden recht unruhig, und mir war überhaupt schon so vorgekommen, als ob an Bord etwas nicht richtig sei. Wahrscheinlich Konterbande oder dergleichen.
Der kleine Dampfer war keine hundert Meter mehr von uns entfernt, als er seine Fahrt verlangsamte, und das geschah wohl nicht freiwillig, sondern da musste an der Maschine etwas gebrochen sein, das Benehmen der Mannschaft war danach.
Auf dem Stern zeigte sich ein Offizier im Fes.
»Im Namen des Padischas«, schrie er uns auf Englisch zu, »stoppt, streicht die Segel! Ihr habt die Fatime gestohlen, den Lieblingshund der Walidesultana.«
»Ach, geh und häng dich!«, brummte der Kapitän, nichts weiter, ließ mehr Segel setzen, und schnell hatten wir auch das Ruderboot weit hinter uns, welches der kleine Dampfer ausgesetzt hatte.
»Gestohlen hast du den Hund?«, fragte mich der Kapitän nur einmal, und auch nicht sofort.
Ich berichtete, wie ich zu dem Hunde gekommen war.
»Never mind!«
Man soll den Toten nur Gutes nachreden, und da ich von der Mannschaft dieser Bark nichts Gutes zu erzählen weiß, so schweige ich ganz.
Einmal wollte der eine mit mir Krakeel anfangen, weil ihm meine Rosamunde den ganzen Zucker gemaust hatte — das Vieh stahl allerdings wie ein Rabe, da hatte er ja ganz recht — aber als er deshalb meine Rosamunde über Bord werfen wollte, machte ich ihm handgreiflich klar, was für Folgen das für ihn haben würde. Alle die Galgengesichter nahmen für ihn Partei, und da ich nicht einen nach dem anderen vornehmen konnte, weil sie gleich alle acht gegen mich losgingen, so vertobackte ich eben alle acht zusammen. Dann war wieder Frieden im Logis.
Unser Ziel war also Thaso, das alte Thasos, die nördlichste Insel im Ägäischen Meere. Die einzige Stadt darauf mit einem schlechten Hafen ist Panagia, sonst noch zehn ansehnliche Dörfer. Hauptausfuhrartikel ist Getreide, mehr noch Honig und Wachs. Das wollten auch wir mitnehmen. Hin brachten wir Salz. So hieß es wenigstens. Als aber einmal eine Salzkiste platzte, zeigte sich, dass darin nichts als schwedische Streichhölzer waren, lose, nicht in Schachteln verpackt. Und auf Streichhölzer steht in der Türkei ein noch viel höherer Zoll als auf Salz, obgleich auch das schon hoch genug verzollt werden muss. Aber wer paschen will, der zahlt lieber einen tüchtigen Zoll für eine Deckware, als dass er sich dabei erwischen lässt und dann alles verliert.
Am fünften Tage hatte die ›Kawassi‹' — das der Name unserer Bark — die Straße der Dardanellen hinter sich, nun ging es im freien Meer mit günstigem Südostwinde direkt auf das Ziel los.
Aber der günstige Wind wurde immer stärker und stärker, und bei Anbruch des Abends hatten wir den schönsten Sturm.
Nun ging es los. Eine fürchterliche Nacht! Beschreiben will ich sie nicht weiter, es wäre auch schwer. Der Kapitän hatte mich ans Ruder gestellt. In der linken Brusttasche hatte ich mein Seefahrtsbuch, in der rechten Rosamunde. Wir sahen es alle kommen, und ich am Ruder am deutlichsten.
Als die Bark wieder einmal mit dem Vorderteil aus der Gischt auftauchte, hatte sie keinen Fockmast mehr. Und ich hatte von seinem Abgange gar nichts bemerkt. Alles ein Pfeifen und ein Heulen in der Luft, die ganze Welt schien nur aus weißer Gischt zu bestehen. Und mit einem Male brauchte ich das Rad nicht mehr festzuhalten, es drehte sich spielend leicht. Das Gestänge oder die Pinne war gebrochen.
Und da hatte es für uns natürlich dreizehn geschlagen.
»Na, nun adé, Herr Gottlieb Schulze alias Signor Napoleon Bonaparte Novacasa!«, sagte ich mir noch, und dann hatte ich wohl noch das Steuerrad in der Hand, aber keinen Boden mehr unter den Füßen — ich hatte mich mit der ganzen Welt, die nur aus nasser Gischt bestand, brüderlich vereint.
Gerungen mit dem Tode habe ich nicht. Bin gleich hinübergeschlummert. Aber nicht in den Tod. Oder das Paradies oder sonstige Jenseits, in dem ich erwachte, sah recht irdisch aus.
Zunächst konstatierte ich, dass mein Erwachen dadurch befördert worden war, dass mir etwas Rauhes immer übers Gesicht leckte. Es war Rosamunde.
»Na, ich hab's ja immer gesagt, dass auch jede Hundeseele unsterblich ist.«
Dann richtete ich mich halb auf, rieb mir den etwas schmerzenden Kopf und schaute mich um. Ich lag zwischen Klippen, unter mir brandete das Meer, und über mir war Nadelwald. Und neben mir, nicht zu vergessen, Rosamunde und Schweden. Das heißt, schwedische Streichhölzer! Streichhölzer, wohin man auch blickte, der ganze Strand voll Streichhölzer, das ganze Meer voll Streichhölzer, die noch zu landen versuchten — — Millionen von Schweden — utan svafel ok phosphor — aber ein Geschäft war nicht mehr damit zu machen.
Ich, Rosamunde und die zahllosen Streichhölzchen — wir waren der letzte Rest der ›Kawassi‹. Denn sonst konnte ich auch keine Holzplanke erblicken.
Wo mochte ich mich befinden? Sicher an der Küste von Thaso. Denn wir waren gar nicht mehr so weit von dieser Insel entfernt gewesen, der Sturm musste uns direkt darauf zu getrieben haben.
Na, da wäre ich ja gleich am Ziele angelangt. Nur in etwas anderer Weise, als ich mir gedacht hatte. Die Hauptsache war, dass alle meine Knochen heil geblieben waren, wie ich mich jetzt überzeugte. Einige Hautabschürfungen, weiter nichts. Und Rosamunde hatte nicht einmal die. Aber Durst und Hunger hatte ich, mächtigen Hunger! Natürlich, die Katastrophe mochte um Mitternacht erfolgt sein, und jetzt stand die Sonne schon wieder ziemlich hoch am Himmel.
Ich kletterte die steilen Felsen empor, bis ich den Wald erreichte. Hier sah es aber gar nicht nach Getreide und Honig aus. Auf Thaso müsste es denn gerade sehr viele wilde Bienen geben. Aber wildes Getreide? Hier sah es sehr, sehr wild aus.
Eine Stunde lang kroch ich in dem abschüssigen Nadelwalde herum. Ich hatte manchmal weite Fernsichten, aber kein Haus, keine Hütte, kein Rauch, auch gar kein Baumstumpf, der eine Säge verraten hätte, war zu sehen.
Freilich, die Insel Thaso ist neun geografische Quadratmeilen groß, das ist schon ein Terrain!
Wieder verging eine Stunde. Meinen knurrenden Magen täuschte ich mit Beeren, die ich pflückte. Nicht einmal Kastanien entdeckte ich, die man doch sonst in diesen Gegenden überall findet, auch kein Johannisbrot, gar nichts. Nur einige lumpige Beeren und massenhaft Tannenzapfen.
Außerdem wurde jetzt mein Durst unerträglich.
Da schlug Rosamunde an, die immer auf eigene Faust umhergestrichen war, auf Eichhörnchen pirschend, aber dabei nicht kläffend, während sie jetzt wie eine echte Jungfer piepste.
Und sie kam sogar, mich zu holen, lud mich durch Sprünge ein, ihr zu folgen. Ich tat es, und bald lag vor mir eine reizende Idylle.
Neben einer Schlucht, in die sich ein klarer Bach ergoss, stand eine Reisighütte, an deren Wänden sich blühende Bohnen empor rankten, sich auch noch weiter von Baum zu Baum schlingend. In der Hütte kauerte am Boden ein in Schaffelle gehüllter Mann, der seinen Bauch betrachtete — das Idyllischste an der ganzen Idylle aber waren mir die zwei neben ihm stehenden Schüsseln, die eine mit zerklopftem Hartbrot, die andere mit türkischen Bohnen gefüllt, und zwar mit gekochten, was man ja gleich erkennen kann.
»He, guter Freund!«
Außer in allen mir geläufigen Sprachen konnte ich das auch auf griechisch und türkisch sagen. Aber der Mann betrachtete unentwegt seinen Bauch. Es war nämlich wirklich ganz auffällig, wie er das tat. Er lehnte sich nicht an, sondern hockte frei in der Mitte auf der nackten Erde, hatte seinen Kopf vorgeneigt und blickte direkt auf die Mitte seines nackten Leibes. Dabei schlief er nicht etwa, davon hatte ich mich schon überzeugt, er hatte die Augen geöffnet, sein Blick war ganz verzückt.
Nun, eben ein Anachoret, ein Eremit, der in stille Gottesbetrachtung versunken war! Ich befand mich ja in der Region der griechischkatholischen Kirche, welche dem Anachoretentum noch heute sehr günstig gesinnt ist. In einsamen Gegenden Griechenlands und des europäischen Orients kann man immer einmal auf einen frommen Einfiedler stoßen, der seinen Gottesdienst von stiller Beschaulichkeit bis zu den furchtbarsten Selbstpeinigungen treibt, und wenn er erst ›entdeckt‹ ist, dann wird seine Hütte oder Höhle bald zum Wallfahrtsort des gläubigen Volkes. Dass da auch viel mit geschäftlicher Spekulation gearbeitet wird, ist selbstverständlich.
Ich wandte mich zunächst dem Bache zu, schöpfte mit einer am Boden liegenden hölzernen Schale und löschte meinen Durst. Dann musste ich mich doch wieder dem Träumer widmen, ich wollte ihn nicht so ohne Weiteres seiner Speise berauben.
Der schwarze, üppig wuchernde Bart verhüllte noch gar kein so altes Gesicht, auch die nur spärlich von dem Schaffell bedeckte Gestalt war durch Entbehrungen noch nicht ausgemergelt.
»Erlaubst du, dass ich deine Mahlzeit mit dir teile?«
Keine Antwort! Ich rüttelte ihn an der Schulter. Da fiel der Kerl um, auch so im Liegen beharrlich seinen Nabel betrachtend. Ich richtete ihn wieder auf — da kippte er nach der anderen Seite um. Und ich konnte ihn auch nicht wieder zum Sitzen bringen, der Kerl hatte eben das Gleichgewicht verloren. Entweder er kippte nach einer Seite oder nach hinten über, wobei er immer die Beine gekreuzt behielt, als wären sie so gewachsen, und dabei beschaute er unentwegt mit verzücktem Blick seinen Nabel.
Unterdessen hatte Rosamunde schon an den Bohnen geschnobert, nieste verächtlich und machte sich dann über das zerkleinerte Hartbrot her, die Stückchen mit den Zähnchen aufknuspernd. Da musste ich mich beeilen. So schleifte ich den Mann etwas über den Boden, was ihn durchaus nicht verhinderte, verklärten Blickes seinen Nabel zu bewundern, lehnte ihn gegen die Reisigwand und zog mir das Bohnengericht zu Gemüte. Es war gesalzen, gepfeffert und mit Essig gesäuert, deshalb hatte Rosamunde es verschmäht.
Ich war noch im besten Essen begriffen, als ein Geräusch mich seitwärts blicken ließ. Der Anachoret war durch die Wand gebrochen, lag wieder einmal auf dem Rücken, die gekreuzten Beine in die Luft reckend, auch den Kopf etwas erhebend und so, selig lächelnd, seinen Nabel betrachtend.
Hätte ich nicht das lebenswarme Fleisch gefühlt, ihn nicht atmen sehen, so würde ich ihn für einen erstarrten Leichnam gehalten haben. Merkwürdig, was ein Mensch in seiner Frömmigkeit alles fertig bringt!
Ehe ich ihn wieder aufrichten konnte, schlug Rosamunde an, und ich sah durch den Wald zwei Männer kommen, drei, vier, immer mehr tauchten zwischen den Bäumen auf, lauter Mönche, alte und junge, in braunen Kutten, lange Stöcke in den Händen.
Also eine ganze Mönchsgesellschaft. Mich wunderte es nicht. Dann war hier eben ein Kloster in der Nähe, und die Brüder hatten sich aufgemacht, den noch strenger lebenden Waldeinsiedler zu besuchen. Sollte es auf der großen Insel Thaso nicht auch ein griechisches Kloster geben?
Die Mönche waren offenbar sehr erstaunt, mich hier zu sehen. Schnell war ich umringt, der ich noch immer die Holzschüssel in der einen Hand hielt und mit der anderen die sauren Bohnen heißhungrig zum Munde führte, ohne mich in dieser Beschäftigung stören zu lassen.
Die erst nur erstaunten Gesichter wurden immer drohender, was jedoch meinen Appetit nicht verminderte.
Ein weißbärtiger Mann redete mich in schroffem Tone in einer mir unbekannten Sprache an.
»Sprichst du Russisch?«, erklang es dann.
»Ja.«
»Was machst du hier?«
»Ich esse sauere Bohnen.«
»Woher kommst du?«
»Von dort unten.«
»Ja, wie kommst du denn aber hierher?«
»Ich habe Schiffbruch erlitten.«
»Schiffbruch? Wann?«
»Heute Nacht.«
»Wo?«
»Dort unten an der Küste. Und nun fuchtle mir nicht mit deinem Stocke so vor der Nase herum, Väterchen, sonst kann auch ich ausfallend werden.«
»Mensch, weißt du, mit wem du sprichst?«, schnob der Alte mich an, und die anderen erhoben schon ebenfalls ihre Knüppel.
»Mit einem rechten Grobian«, entgegnete ich kaltblütig, setzte nur meinen Fuß schon etwas in Bereitschaft.
»Mensch, weißt du denn, wo du dich hier befindest?«
»Ich kalkuliere, auf der Insel Thaso, wo es ja recht grobe Patrone in Mönchskutten zu geben scheint.«
»Auf der Insel Thaso? Auf dem heiligen Athos bist du!!«
Heiliger Gott! Die Hand mit den sauren Bohnen blieb in der Luft schweben.
Dann hatte der Sturm unsere Bark zehn Meilen westlich abgetrieben und dabei die Buchstaben verschoben. Denn Thaso und Athos — es sind doch genau dieselben Buchstaben.
Und ich hatte schon genug von dieser geheimnisvollen Mönchsrepublik gehört, die auf dem heiligen Athos besteht.
»Nun, ich bin Schiffbrüchiger, und ich weiß...«
Da fing Rosamunde an zu kläffen, hatte es auf die nackten Füße des Alten abgesehen.
»Ist das dein Hund?«
»Das ist mein Hund.«
Der Alte wollte das kleine Tier, das ihm ja nicht viel anhaben konnte, von sich abwehren — da erstarrte sein Blick — er bog sich weit vor, um mein Hündchen näher zu betrachten — es war, als ob er etwas Entsetzliches schaue...
»Das ist doch — nicht etwa — eine Hündin?!«
»Jawohl, das ist eine Hündin.«
Kaum hatte ich das gesagt, als der Spektakel losging.
»Eine Hündin, eine Hündin!!«, erklang es in allen Tonarten, und sämtliche Stöcke wurden gleichzeitig hochgeschwungen, um auf das Tierchen loszuschlagen.
Ich aber hatte Ähnliches nun schon erwartet, da ich einmal erfahren hatte, wo ich mich befand. Jetzt trat ich aus meiner Reserve heraus.
»O nein, das gibt es nicht!«, rief ich und klatschte dem ersten, der gerade losschlagen wollte, die ganzen sauren Bohnen ins Gesicht — die allgemeine Prügelei war fertig.

Jetzt wendeten sich alle die Knüppel gegen mich. Ich schlug und boxte um mich, aber da half mir alle meine Kunst nichts, das hier war etwas anderes als damals in dem engen Matrosenlogis. Meine Fäuste trafen hin und wieder zwar einen Widerstand, aber noch hageldichter prasselten die wuchtigen Stockhiebe auf mich nieder, ich fühlte noch einen Schlag über den Kopf, dass mir das Feuer aus den Augen spritzte, und an diesem gesegneten Tage verließ mich zum zweiten Male die Besinnung.
Als ich wieder zu mir kam, lag ich im Finstern. Bei meiner ersten Bewegung klirrten Ketten, und ich stellte fest, dass ich an Händen und Füßen gefesselt war. Aber jede Hand und jeder Fuß trug für sich eine Kette, welche seitwärts fortlief, also war ich wahrscheinlich zwischen Wänden gefesselt.
Da hatte ich doch einige Bewegungsfreiheit. Doch ich bewegte mich nicht viel. Alle Glieder schmerzten fürchterlich, nicht zum Mindesten der Kopf, um den ich, wie ich mich durch Tasten überzeugen konnte, einen feuchten Verband trug, der nach Wein oder Branntwein roch. Solcher Verbände musste ich noch mehrere am Körper haben, und zwar hatte man mir meine Sachen ausgezogen, offenbar trug ich eine Mönchskutte.
Sonst glaubte ich nicht, dass mir etwas kaputtgeschlagen sei. Ich konnte jedes einzelne Glied bewegen, Mund und Augen öffnen, auch die Nase schien verschont geblieben zu sein. Meine Unterlage war ziemlich weich.
Nette Mönche das!
Also auf dem Berge Athos befand ich mich!
Als ich zum ersten Male das Vorgebirge Athos erblickt hatte, gekrönt von der riesigen Athoskuppel mit der Basilia, der höchstgelegenen und heiligsten Kirche der morgenländischen Christenheit, hatte ich, ein Seekadett noch, über dieses Rom der griechischkatholischen Kirche ausführliche Belehrung erhalten, und ich hatte ja jetzt Zeit, mich in historischen Reminiszenzen zu ergehen.
Über die Spaltung der katholischen Kirche in die römische und in die griechische will ich hier nichts weiter sagen.
Um das Jahr 880 empfand ein konstantinopolitanischer Mönch namens Johannes Kolobus das Bedürfnis, das Kloster mit einer noch größeren Einsamkeit in Gottes freier Natur zu vertauschen. Das wilde Vorgebirge des Athos schien ihm hierzu am geeignetsten. Es ist eine sehr gebirgige Landzunge, zwanzig Stunden lang und fünf Stunden breit, die östlichste der drei Landzungen, welche sich von Mazedonien aus in das Ägäische Meer hineinrecken, durchsaus bewaldet.
Aber Kolobus war nicht der erste Anachoret, der sich hier niederließ. Er fand schon eine ganze Menge von Eremiten vor, die in frommer Beschaulichkeit lebten. Ihm gebührt nur das Verdienst, alle diese Einsiedler zu einer Gemeinschaft vereinigt zu haben, er baute das erste Kloster, das von Hieresso.
Zuerst hatten die neuen Klosterbewohner, die wohl wie gewöhnlich unverschämt genug auftraten und die besten Weidegründe und ergiebigsten Weinberge für sich beanspruchten, von den Urbewohnern des Vorgebirges viel zu leiden, andere Bischöfe wollten ihnen den Besitz streitig machen, bis der damalige Kaiser von Byzanz und Papst der ganzen griechischkatholischen Kirche, Basilius der Mazedonier, sich der Verfolgten annahm, zu ihren Gunsten Recht sprach.
Durch eine sogenannte goldene Bulle verordnete dieser Basilius, dass die Mönchsgemeinde des Berges Athos fernerhin unter ihrem eigenen, selbsterwählten Patriarchen stehen solle, und bis in alle Zukunft dürfe kein weltlicher oder geistlicher Mensch, kein Hirt und keine Herde die gottgeweihte Stätte und die geistlichen Übungen der frommen Väter stören. Und dieses Gebot gilt heute noch. Diese Mönchsrepublik steht in der ganzen Welt einzig da.
Zuerst hörte man von ihr sehr wenig, fünf Jahrhunderte lang. Wer sich dieser Mönchsgemeinschaft anschloss, kam nicht wieder heraus, war auf immer für die übrige Welt verschwunden. Bis sich um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts ein Mönch namens Barlaam entschloss, dem Berge Athos einen wissenschaftlichen Besuch abzustatten.
Der Zurückgekehrte konnte die schauerlichsten und geheimnisvollsten Geschichten erzählen. Schon damals waren bereits einundzwanzig Klöster vorhanden gewesen, die sich bisher auch noch nicht vermehrt haben. Die Hauptsache aber, wovon Barlaam berichtete, war: Die frommen Bewohner des Berges Athos trieben eine besondere Art von Askese. Durch stundenlanges Betrachten ihres Nabels setzten sie sich direkt mit Gott in Verbindung, der sich in ihrem Bauche als wunderbares Licht offenbarte, und in diesem Lichte wieder schauten sie alle Geheimnisse des Himmels und der Erden.
Auch Barlaam hatte beim Anblick seines Nabels dieses Licht geschaut und demnach in seinem Bauche alle Geheimnisse des Himmels und der Erde. Aber anderswo glückte dieses Experiment nicht, es musste unbedingt auf dem Berge Athos geschehen, und was für Geheimnisse des Himmels und der Erden er da gesehen hatte, das hatte er wohl vergessen.
Wolle der geneigte Leser verzeihen! Ich berichte, wie es die Historie erzählt. Es handelt sich um das vierzehnte Jahrhundert.
Der Aufruhr, den der Bericht des Mönches in der ganzen griechischkatholischen Welt vom einen bis zum anderen Ende hervorrief, war unbeschreiblich. So etwas können wir heutzutage wirklich nicht mehr begreifen.
In Konstantinopel kamen alle Patriarchen und Bischöfe zu einer Synode zusammen, sie pilgerten nach dem Berge Athos, auch sie setzten sich hin und betrachteten ihren Nabel — und richtig, auch sie schauten das wundersame Licht und alle Geheimnisse des Himmels und der Erden.
Es fand eine zweite Synode statt, auf der alles als Tatsache anerkannt und herausgeklügelt wurde, dass dieses Licht nichts anderes sein könne als das unerschaffene Licht des Berges Tabor, welches sich jetzt auf dem Berge Athos ›ektasiert‹ habe. Was das heißen soll, weiß ich nicht.(*) Die gelehrte Synode wusste es wahrscheinlich selber nicht. Jedenfalls handelt es sich dabei um eine missverstandene Bibelstelle.
(*) Das Wort bedeutet so viel wie sich ausbreiten, gewaltig ausdehnen, namentlich bei Hohlräumen, dass also die Leiber der Verzückten sich weit genug ausdehnen, um scheinbar das ganze Weltall in sich aufnehmen zu können. empfangen, und da muss etwas über die Einkünfte dieser Mönchsgemeinden gesagt werden.
Kurz und gut, auf dem Berge Athos wohnt seitdem das ektasierte Licht, einfach das heilige Licht, und wohnt noch heute da. Noch heute ist Athos für die ganze griechischkatholische Welt — und da kommt ganz Russland in Betracht! — der Sitz aller Gelehrsamkeit und Weisheit, obgleich es dort außer der Bibel kein einziges Buch gibt. Dort kommt alle Weisheit und Erkenntnis direkt aus dem Bauche der Mönche heraus.
Es sind also einundzwanzig Klöster, über die ganze Halbinsel verstreut. Was ich noch nicht kannte, habe ich noch kennen gelernt; ich möchte bei der Beschreibung Fremdwörter vermeiden. Der Abt hat unumschränkte Gewalt. Die Mönche wohnen in isolierten Zellen, in denen auch jeder selbst sein Essen kocht. Nur Gebet und Arbeit sind gemeinsam, und zwar wird auf dem Berge Athos äußerst fleißig gearbeitet. Was man braucht, wird selbst hergestellt; sehr viel Getreide, Wein, Rosinen und andere Erzeugnisse des Bodens werden auch ausgeführt.
Wer mit der strengen Klosterregel nicht zufrieden ist. der wird Anachoret. Aber das ist nicht so schlimm, wie es klingt. Er baut sich oder bekommt an einem idyllischen Plätzchen ein ganz hübsches Häuschen hingebaut, bei dem das Eremitenglöckchen niemals fehlt, legt einen Gemüsegarten und einen Weinberg an, darf Oliven, Walnüsse, Mandeln, Kastanien und Kirschen ziehen, ihren Ertrag genießen, hat seine eigene Traubenpresse zur Weinkelterei. Inwiefern also solch ein Anachoret es strenger hat als ein Klosterbewohner, ist nicht recht einzusehen. Es ist höchstens die Einsamkeit. Hinwiederum siedeln sich mehrere solcher Anachoreten beieinander an, bilden dann eine Art Genossenschaft.
Wirklich streng haben es die Mönche des dritten Grades, die seltsamerweise Troglodyten heißen, Höhlenbewohner, obgleich sie gar nicht in Höhlen hausen, sondern in meist nur aus Reisig gebauten Hütten, in denen sie allen Witterungseinflüssen preisgegeben sind. Sie dürfen nur Bohnen ziehen, außerdem erhalten sie wie die Anachoreten vom Kloster noch Hartbrot geliefert. In ihrer nicht Gott gewidmeten Freizeit fertigen sie hauptsächlich Rosenkränze und Amulette, mit denen ein schwunghafter Handel getrieben wird.
Denn an gewissen Tagen oder Wochen des Jahres pilgern den Isthmus ungezählte Tausende von Wallfahrern entlang, um auf der Athoskuppe in der Basilia, der Hauptkirche, in welcher der Patriarch residiert, den Segen zu
Einmal wird schon an der Ausfuhr von Getreide usw. genug verdient. Dann kommen die Almosen der Wallfahrer hinzu, welche tüchtig bluten müssen, und schließlich ist der heilige Berg die Zuflucht aller Großen und Reichen der ganzen griechischkatholischen Welt, also vor allen Dingen Russlands, welche des Weltlebens überdrüssig sind, ohne schon körperlich daraus scheiden zu wollen, und diese bringen dann all ihre Schätze mit, oder doch einen Teil, und legen sie zu Füßen des heiligen Basilius nieder.
Ferner kommen die zahllosen Vermächtnisse hinzu, welche aus aller Welt einlaufen, denn die Sündenvergebung des heiligen Basilius oder seines Stellvertreters ist die kräftigste, sein Segen öffnet direkt die Pforten des Himmels.
Das aber geht schon seit mehr als tausend Jahren so, und da kann man sich vorstellen, was für Schätze hier angehäuft sind! Oder man kann es sich vielmehr gar nicht vorstellen!
Früher war jedes Kloster völlig selbstständig, arbeitete für eigene Rechnung, jedes hatte seine eigenen Schätze. Da soll viel Mord und Totschlag vorgekommen sein, die Insassen der einzelnen Klöster befehdeten sich wie die Raubritter. Bis Kaiser Basilius auf der Athoskuppe die nach ihm benannte Kirche erbaute, das heißt, eine ganze Klosterstadt, in welcher der Patriarch über alle anderen Äbte herrscht, und hierher müssen auch alle Gelder und Schätze und was sonst noch einkommt, abgeliefert werden, hier haben sich alle Reichtümer zusammengehäuft.
Dreimal sind die Klöster geplündert worden, zweimal durch Sarazenen und einmal durch Türken. Man hat nichts gefunden. Vergebens hat man einen der Mönche nach dem anderen langsam zu Tode gemartert.
Und so ist es noch heute. Man sieht Geld und Kleinodien aller Art in die Klöster hineingehen, sie werden nach der Basilia gebracht, aber kein Uneingeweihter weiß, wo sie versteckt werden.
Es ist auch noch ein anderer Grund vorhanden, weshalb seit jener Zeit noch keine Macht wieder gewagt hat, den heiligen Berg anzugreifen, um sich etwa der dort aufgespeicherten Schätze zu bemächtigen. Das Vorgebirge gehört zur Türkei, die Klosterrepublik zahlt auch an die türkische Regierung einen Tribut — einen lächerlich geringen, gegenwärtig jährlich 600 Mark. Es ist eben nur eine Form. Aber nie würde die immer geldbedürftige Türkei wagen, diese Klostergemeinden zu plündern. Das würde einen heiligen Krieg der ganzen griechischkatholischen Welt entflammen. Denn es ist eben das größte Heiligtum auch für die Russen. Wohl ist der Zar zugleich das kirchliche Oberhaupt für Russland, aber an religiöser Macht steht er doch weit hinter dem Patriarchen von Athos zurück. Der Zar kann ja auch nicht einmal Sünden vergeben. Das kann nur der Priester, und der höchste ist der Patriarch von Athos.
Dieses ist das Mekka der morgenländischen Christenheit, das drückt wohl alles am deutlichsten aus. Auch der Sultan der Türkei ist mohammedanischer Papst, aber an religiösem Einfluss kann er sich doch nicht etwa mit dem Scherif von Mekka vergleichen, der ihn auch erst zum Sultan salbt, d. h., ihm das heilige Schwert umgürtet. —
Das war es, was ich von dieser Mönchsrepublik schon wusste.
Für meinen Fall sei noch erwähnt, was mir aber auch schon bekannt war, dass Schiffbrüchige — und an diesem steilen Vorgebirge scheitern ja genug Schiffe — von den Mönchen gastfreundlich aufgenommen, aber bei der ersten Gelegenheit über die Grenze gebracht werden.
Zweitens wird auf dem heiligen Berge kein weibliches Wesen geduldet, auch nicht unter den Haustieren. Man hat für die Feldarbeit und zum Transport nur Ochsen oder Stiere und männliche Maultiere, sonst keine Kuh, nicht einmal ein Huhn.
Daher also die furchtbare Entrüstung, als man das wahre Geschlecht meiner Rosamunde erkannte.
Eine Tür knarrte, ein Lichtstrahl huschte durch die Finsternis, und ich sah einen... Hallo! War das nicht ein junges Weib, eine Nonne?!
Allein alsbald sagte ich mir, dass ich mich da sehr leicht täuschen könnte, dass ich mich geradezu täuschen müsse.
Ich hatte gerade unter den griechischkatholischen Mönchen schon sehr viele solche Gestalten gesehen, die man leicht für ein Weib halten kannn.
Es sind brünette, bildschöne Gesichter, umrahmt von langen, schwarzen Locken, dazu herrliche Gestalten, mit hochgewölbter Brust, und die lange Kutte übt nun noch vollends die Täuschung aus, dass man es mit einem Weibe zu tun habe. Einmal hätte ich doch gleich meinen Kopf verwettet, dass ein griechischer Mönch ein Weib sei, es wurde unter uns Offizieren wirklich eine Wette daraus, wenn es auch nicht um den Kopf ging, und ich hätte ihn verloren — wir übermütigen jungen Leute zwangen das Mönchlein, uns augenscheinlich zu beweisen, dass es ein ganz tadelloser Mann war.
Solch eine Gestalt hatte ich jetzt wiederum vor mir. Eine wunderbare Erscheinung, gewachsen wie eine Tanne, das bartlose Gesicht wahrhaft bezaubernd schön, die schwarzen Locken wie Seide glänzend, und mit dieser hochgewölbten Brust hätte jede Jungfrau prunken können.
Aber ein Weib, eine Nonne hier in diesem heiligen Gebiete? Nein, ganz ausgeschlossen!
Es konnte kein gewöhnlicher Mönch sein. Seine braune Kutte war vom feinsten Tuche, und dann vor allen Dingen trug er einen Schmuck, dessen Wert sich gar nicht abschätzen ließ. Auf seiner Brust hing ein Kreuz von Spannenlänge, aus einem einzigen Stück roter Koralle bestehend, und ich wusste, wie selten und daher überaus kostbar ein so geformtes Stück Koralle ist, und dieses Kreuz hing an einer langen, sich um den Nacken schlingenden Schnur, die ganz aus haselnussgroßen Perlen bestand, und wiederum vermochte ich zu unterscheiden, dass es echte Perlen waren.
Nie wieder habe ich solche Perlen gesehen und werde sie wohl auch niemals wieder zu sehen bekommen. Was war gegen diese Schnur das ganze berühmte Perlengeschmeide der Königin von Italien! Eine einzige dieser Perlen repräsentierte den Wert eines ganzen Fürstentums!
Ferner schlang sich um Hals und Brust des Mönchs noch eine zweite Kette, aus lauter dicken Goldplatten bestehend, und jede einzelne diente wunderbaren Diamanten und anderen Edelsteinen der seltensten Art als Fassung, darunter Smaragde von der Größe eines Kirschkerns, ihr Wert ebenfalls einfach unschätzbar. Diese Kette verschwand auf der Brust unter der Kutte des Trägers.
Der so mit Schmuck überladene Mönch — obwohl es heilige Reliquien sein mochten — setzte die einfache Öllampe in eine Nische, rückte sie so, dass ihr spärlicher Schein mir voll ins Gesicht fiel, trat näher.
»Wie befindest du dich?«
Er hatte es auf italienisch gesagt. Beinahe hätte ich geschrieben: s i e — so, wie ich damals dachte.
Es war eine sonore Stimme — und dennoch, wie schmelzend das geklungen hatte — es war die Stimme eines Weibes!!
Dabei hatte es auch ängstlich geklungen, obgleich sie ein finsteres Gesicht zu machen suchte.
Doch nein, es war ein Mann, ich wollte mich nicht der Täuschung hingeben.
Nun, ich war gewappnet, ein Verhör zu bestehen. Oder ich selbst machte gleich den Frager.
»Wo ist Rosamunde?«
»Rosamunde?«
»Mein Hund.«
»Es war eine Hündin.«
»Nun gut, eine Hündin — wo ist sie?«
»Die Anachoreten haben sie erschlagen.«
Ich nahm diese Trauerbotschaft ziemlich gleichmütig auf. Der Tod ist das Los aller lebenden Wesen. Hätte ich ihn in ärgerlicher Aufwallung verschuldet, damals unter den Rädern des Lastwagens, so wäre das allerdings etwas ganz Anderes gewesen.
»Wie befindest du dich?«, wiederholte der Mönch, und wiederum klang es so unsagbar ängstlich.
»Auch mich hat man halbtot geschlagen.«
»Du hast es selbst verschuldet. Du schlugst die frommen Väter zuerst.«
»Weil sie meinen Hund schlugen.«
»Es war eine Hündin, und weißt du nicht, wo du dich hier befindest?«
»Auf dem Berge Athos.«
»Ist dir denn nicht bekannt, dass jedes weibliche Tier den heiligen Berg entheiligt?«
»Gibt es hier nicht auch weibliche Fliegen und Mücken?«
Aus dieser Frage erkennt man, dass ich den Mut und sogar den Humor noch nicht verloren hatte.
»Spotte nicht!«, erklang es drohend. »Fremdling, du hast zwei der frommen Väter getötet!«
Auch das ließ mich kalt.
»Es geschah in der Notwehr.«
»Weißt du, was dein Los ist?«
»Wahrscheinlich der Tod.«
»Entweder ich muss dich nach Konstantinopel schicken, und du wirst dort gerichtet und unfehlbar gehangen. Oder du kannst auch hier abgeurteilt werden. Aber der Tod ist gleichfalls dein Los.«
»So oder so — es ist mir gleichgültig.«
Der Mönch betrachtete mich mit offenbarem Staunen, wenn nicht mit Bewunderung. Aber bei mir war wahrhaftig von einer Effekthascherei gar keine Rede. Ohne je Gelegenheit gehabt zu haben, dem Tode ernstlich ins Auge zu schauen, hatte ich ihn doch noch nie gefürchtet. Ich bin von jeher Fatalist gewesen, habe immer geglaubt, dass kein Mensch seinem Schicksale entgehen kann.
»Dein Leben ist dir so wertlos?«
»Ich wüsste nicht, was mir es besonders begehrenswert erscheinen ließe.«
»Du bist noch so jung!«
»Fünfundzwanzig Jahre«, antwortete ich, fünf Jahre hinzulügend, was ich nach meinem falschen Pass ja musste, den man mir doch abgenommen hatte.
»Wo bist du geboren?«
»Das habt ihr sicher schon in meinem Seefahrtsbuche gelesen.«
Der Mönch richtete sich plötzlich hoch empor.
»Weißt du, Fremdling, wer vor dir steht?! Mit wem du sprichst?!«
»Mit einem Menschen.«
»Ich bin der Patriarch des Athos!«
»Das habe ich mir schon gedacht, im Übrigen aber kenne ich nicht einmal den Namen dieses Papstes der morgenländischen Christenheit.«
Lange blickte der junge Pfaffe mich an. Die erst so drohenden Züge des klassisch schönen Antlitzes wurden wieder ruhig.
»Du bist immer nur Matrose gewesen?«
»Nichts weiter.«
»Was waren deine Eltern?«
»Arme Fischerleute«, entgegnete ich aufs Geratewohl.
»Du sprichst nicht wie ein gewöhnlicher Matrose.«
»In meinem Seefahrtsbuche steht ja, wie weit ich in der Welt herumgekommen bin. Habe auch sonst etwas gelernt.«
»Wo?«
»Eben in der Welt. Habe immer meine Augen offen gehalten.«
»Du bist in besserer Gesellschaft verkehrt?«
»Auf Passagierdampfern.«
»Könntest du als Offizier fahren?«
»Dazu müsste ich erst mein Steuermannsexamen machen.«
»Könntest du das?«
»Sofort. Ich habe mir in meinen Freistunden alles angeeignet, was man dazu braucht. Gleich das Kapitänsexamen.«
Ich hatte mir nämlich überhaupt schon vorgenommen, bei der ersten Gelegenheit wirklich das Steuermanns- und Kapitänsexamen zu machen, mich irgendwo zur Prüfung zu melden. Denn immer als Matrose zu fahren, dazu hatte ich durchaus keine Lust. Eigentlich überhaupt nicht zum ständigen Seeleben. Kam ich aber einmal in die Lage, mir die Überfahrt zur See abzuverdienen, so wollte ich es doch lieber als Offizier denn als gewöhnlicher Arbeiter, und bestehen würde ich das Examen, das wusste ich. Die Hauptsache war, dass Napoleon Bonaparte Novacasa genügend Monate Seefahrzeit als Matrose hatte, schon mehr als sechzig, und einundzwanzig Monate als Matrose sind nach internationalen Vorschriften nur nötig, um zum Steuermannsexamen zugelassen zu werden. Das Kapitänsexamen ist dann nur noch eine Formalität. Freilich muss man da erst wieder einige Jahre als Steuermann, als erster, gefahren sein, ehe man die Stelle eines Kapitäns bekommt.
»Nun höre, Novacasa. ich werde dich absolvieren.«
»Das heißt mit anderen Worten: ich soll dem Leben erhalten bleiben?«
»So ist es.«
»Das höre ich schließlich ganz gern.«
»Natürlich unter gewissen Bedingungen.«
»Das habe ich mir gedacht.«
»Du bist römischkatholisch.«
»Dem Namen nach.«
»Wie meinst du?«
»Lassen wir das!«
»Ich weiß, was du meinst — du bist ein Ungläubiger.«
»Lassen wir das!«, wiederholte ich. »Ich ehre jede Religion, auch wenn ich selbst nicht daran glaube.«
»Ja, ich kenne euch, die ihr euch Freigeister nennt, und... es ist euere Sache. So wird es dir nicht schwer fallen, zu unserem Glauben überzutreten.«
Aha, ich hatte es mir ja gleich gedacht! Danach hatte ich ja gleich meine Antworten eingerichtet. An Mutterwitz hat es mir nie gefehlt.
»Ich soll die griechischkatholische Religion annehmen?«
»Ja. Es ist ja ganz derselbe Glaube, wie der deine, der einzige Unterschied ist nur der, dass wir Griechischen...«
»Ich weiß, ich weiß, ich kenne alles. Aber gib dir keine Mühe. Ich ehre den Glauben meiner Väter, ich ehre jeden anderen Glauben — doch selbst glauben werde ich nicht daran, und deshalb nehme ich auch keinen anderen an.«
»So sprichst du jetzt.«
»So werde ich immer sprechen.«
»Auch auf der Folterbank?«
»Probiere es!«
Ich sprach mit Überzeugung.
»Wenn du«, fuhr der ganz gediegene Pfaffe fort, »in der Türkei nun einmal in große Gefahr kämst, oder ich will einen Kriegsfall annehmen, du solltest auf Kundschaft ausgehen — — würdest du zögern, dich für einen Mohammedaner auszugeben, falls du alle Zeremonien kenntest?«
»Durchaus nicht.«
»Du würdest bei Allah und dem Propheten schwören?!«
»Ohne Zögern. Das ist doch etwas ganz Anderes. Aber wenn es darauf ankommt, wenn ich ergriffen und als Christ erkannt würde und ich sollte dann meinen Glauben abschwören und Allah und den Propheten Mohammed anerkennen — dann würde ich lieber den Feuertod erleiden als das tun.«
»Gut, ich verstehe dich, wir werden uns schnell einigen. Es ist bloß nötig, dass du dem Anschein nach, wenn es die Gelegenheit erfordert, dich für einen der Unsrigen ausgibst.«
»Damit wäre ich einverstanden. Nur das eine sage ich gleich: Ein Mönch werde ich nicht, weder Klosterbewohner noch Anachoret.«
»Weshalb nicht?«
»Das hielte ich keine acht Tage aus, auch nicht in der romantischsten Waldhütte — und nun gar so den ganzen Tag die Mitte meines Bauches zu betrachten — ich danke!«
Der junge Patriarch, der sich mir als Freidenker legitimiert hatte — und das ist gewöhnlich so — lächelte.
»Es wäre auch schade um dich. Und doch, die Kutte musst du tragen.«
»Ich verzichte. Dann ist mir ein Sarg schon lieber.«
»Könnte die Mönchskutte nicht vielleicht einmal gerade recht viel Freiheit gewähren?«
»Doch, das haben wir schon bei unseren Römischen. Aber ich als Beichtvater — hm!«
»Ich habe etwas ganz anderes mit dir vor. Du weißt wohl, dass wir einen starken Handel treiben. Aber nur über Land. Das heißt, da liegt dieser Handel in unseren eigenen Händen. Der zur See dagegen wird nur von griechischen, türkischen und sonstigen fremden Schiffen betrieben, welche regelmäßig kommen, um unser Getreide, unseren Wein und Honig und was wir sonst produzieren, abzuholen. Dabei erleiden wir einen großen Verlust, diese fremden Schiffseigentümer dürfen eben so hohe Preise fordern, wie sie wollen, wir können nicht abhandeln. Ist dir das bekannt?«
»Weshalb hat die so reiche Klostergemeinde nicht ihre eigenen Schiffe?«
»Weil... noch niemand daran gedacht hat. Warum hat China keine eigene Kauffahrtei, überlässt den ganzen Seehandel Fremden? Und es geht hier so konservativ zu wie in China. Ich aber will das ändern, eine neue Ära eröffnen. Willst du nun ein Schiff, das wir dir zur Verfügung stellen, mit Mönchen bemannen und diese zu Matrosen ausbilden?«
Ich hielt ja für selbstverständlich, dass diese Matrosen richtige Arbeitskostüme tragen würden; für den Augenblick aber sah ich lauter Mönche mit ihren Kutten in der Takelage herumklettern, und ich musste lachen.
»Gewiss, dazu bin ich bereit«, sagte ich dann, und so etwas war auch ganz nach meinem Geschmack.
»So hast du dein Leben gerettet, und hiermit absolviere ich dich...«
Der junge Patriarch hatte angesetzt, gegen mich ein Kreuz zu schlagen, hielt mitten in der Bewegung inne.
»Erst will ich noch einmal deine Verbände erneuern. Gebrochen hast du nichts, auch keine Wunde war zu sehen.«
Er trat dicht heran, öffnete meine Kutte, unter der ich nicht einmal ein Hemd trug, und begann, die verschiedenen Verbände zu lösen, meinen ganzen Körper mit einem in Wein getauchten Schwamm zu waschen. Alles Nötige war neben meinem Lager zu finden.
Der junge Mönch stand zwischen mir und der Lampe, ich konnte sein Gesicht nicht erkennen, aber ich fühlte förmlich, wie es glühte, und ich fühlte ja wirklich, wie heiß seine Hände waren, die sich mit meinem Körper beschäftigten, und wie sie zitterten. Kaum, dass sie frische Verbände anlegen, die Knoten schürzen konnten.
»Ich absolviere dich«, begann er dann wieder, das Zeichen des Kreuzes schlagend, worauf eine lange Formel in griechischer Sprache folgte, sodass ich sie nicht verstand, bis er mit den wieder italienisch gesprochenen Worten schloss.
»... und empfange von mir den heiligen Kuss der Versöhnung.«
Mit diesen Worten hatte er sich über mich gebeugt, immer näher kam mir sein heißer Atem, bis seine glühenden Lippen auf den meinen ruhten.
Es war ein Kuss, unter dem ich beinahe erstickt wäre. Ich musste mich wirklich wehren; wie eine halbe Betäubung überkam es mich, und als ich mich davon erholte, hatte er schon wieder die Zelle verlassen, die Lampe mit sich nehmend.
Es war ein Weib, ganz gewiss, es war ein Weib! Denn so kann nur ein Weib küssen, und außerdem... ich glaubte es ganz deutlich gefühlt zu haben, als ich abwehrend meine beiden Hände gegen seine Brust gestemmt hatte.
Was sollte ich davon denken? Der Patriarch, das Oberhaupt dieser weiberfeindlichen Mönchsrepublik, die nicht einmal ein weibliches Haustier duldete, selbst ein Weib!
Doch es ist alles schon dagewesen, sagte Ben Akiba, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Haben wir Römischen nicht dasselbe schon einmal gehabt?
Papst Johann VIII., im 9. Jahrhundert. Richtiger Päpstin Johanna. Sie war die Tochter eines von Karl dem Großen aus England berufenen Missionars, wurde zu Mainz (nach anderen zu Ingelheim) geboren, galt bald als ein Wunder der Gelehrsamkeit und Schönheit. Sie begann ein Verhältnis mit einem Mönch aus dem Kloster Fulda, entfloh mit diesem in männlicher Kleidung nach England, bereiste dann Frankreich, Italien und Griechenland, als männlicher Student überall die ersten Lehrer der Wissenschaft hörend, bis ihr Geliebter in Athen starb. Darauf ging sie nach Rom, legte unter dem Namen Johann Angelicus eine theologische Schule an, deren Ruf sich über die ganze damals bekannte Erde verbreitete. Nach dem Tode Leos IV. wurde sie einstimmig vom Klerus und vom Volke auf den päpstlichen Stuhl gesetzt und nannte sich Johann VIII. Zweiundeinhalb Jahre übte sie zur allgemeinen Zufriedenheit die päpstliche Herrschaft aus, bis sie während eines Umzuges durch die Stadt zwischen dem Amphitheater und der Clemenskirche niederkam, vor Scham auf der Stelle samt ihrem Kinde den Geist aufgebend. Man errichtete ihr dort eine Kapelle, die aber schon der nächste Papst wieder entfernen ließ, und noch heute wird dieser Platz von allen Prozessionen gemieden, umgangen. Um für die Zukunft einem derartigen Skandal vorzubeugen, musste sich bis zu Leo X. jeder Papst vor seiner Ordination einer besonderen Prüfung unterziehen, und der Erfolg ward durch den dreimaligen Ruf ›Habet! (er hat)‹ bekannt gegeben, woraus Klerus und anwesendes Volk mit einem ›Deo gratias! (Gott sei Dank)‹ antworteten. —
Ehe ich darüber nachzugrübeln brauchte, ob ich denn gefesselt hier im Finstern liegen bleiben sollte, erhielt ich schon wieder Besuch, diesmal von zwei bejahrten Mönchen.
»Du bist frei, Rajah!«
Rajah, nicht zu verwechseln mit dem indischen Radscha, heißt in der Türkei der Fremde, der durch einen besonderen Pass unter dem Schutze der türkischen Regierung steht, nicht unter dem des Gesandten oder Konsuls seines Landes.
Meine Fesseln wurden aufgeschlossen.
»Sind deine Verbände erneuert worden?«
»Ja, ein anderer Mönch, der vorhin hier war, hat es getan.«
Also ich war sehr vorsichtig, wollte nicht gleich sagen, dass es der Patriarch selbst gewesen war, ich hätte ihn kompromittieren können, obgleich er mich nicht gewarnt hatte.
»Ein Mönch? Trug er nicht ein großes, rotes Kreuz?«
»Das wohl.«
»Das war der Patriarch Johannes in eigener Person!«
Johannes hieß dieser Patriarch? Nun war es gut!
»Ja, unser Patriarch!«, fing der Alte wieder an und begann ihn zu preisen, was für ein guter, edler Mann das sei, auch den Geringsten betrachte er als seinen Bruder, und trotz seiner Jugend so grundgelehrt usw. — ein vom Himmel herabgestiegener Engel — als ich aber wissen wollte, wer dieser Patriarch sonst sei, woher er stamme, wurde der Alte einsilbig.
»Ich habe keine Befugnis, dir hierüber Auskunft zu geben, Rajah. Kannst du gehen?«
Alle Glieder schmerzten mich sehr, sonst aber war ich ganz bewegungsfähig.
Es ging durch lange, finstere Gänge und dann sehr viele Treppen hinauf, bis ich mich in einem oberirdisch angelegten Gebäude befand, in dem es recht ärmlich aussah. Weitere Gänge und Hallen, aber alles ganz nackt.
»Wo befinde ich mich hier?«
»Im Kloster der Basilia.«
Also hoch oben auf der Athoskuppe. Ich war während meiner Bewusstlosigkeit sehr weit getragen worden.
Es wurde mir ein geräumiges Zimmer mit fünf Meter hoher Decke angewiesen, ganz einfach eingerichtet. aber doch nichts an Bequemlichkeit vermissen lassend. Hier sollte ich mich zunächst einige Tage erholen. In dem mächtigen Kleiderspind fand ich Unterwäsche und alles, freilich musste ich mich in einen Mönch verwandeln.
Zunächst wurde mir eine sehr reichliche Mahlzeit gebracht, bei der Fleischspeisen sogar die Hauptrolle spielten, und dazu ein Wein, wie ich ihn nie wieder getrunken habe.
Nachdem ich gesättigt war, inspizierte ich erst einmal das vergitterte Fenster, wozu ich auf einen Stuhl steigen musste. Ein herrlicher Ausblick! Das blaue Meer, belebt von Dampfern und Seglern, und dichter unter mir eine üppige Vegetation von Platanen, Buchen, Zypressen, Kastanien und Lorbeerbäumen, zum Park geordnet, dazwischen wohlgepflegte Blumenbeete.
»Du bist hier kein Gefangener, Rajah Novacasa«, sagte hinter mir eine Stimme, als ich noch auf dem Stuhle stand und einmal an den starken Eisenstäben rüttelte, dabei erwägend, dass die mir nicht lange widerstehen sollten.
Es war ein älterer Mönch, der sich mir als Mandrit Hieronymos vorstellte. Mandrit ist gleichbedeutend mit Pater. Ich aber hätte ihn lieber Mandrill genannt, denn er sah aus wie ein böser Affe. Doch in Wirklichkeit war er ein herzensguter Mensch, wenn auch in allen diplomatischen Künsten geschult.
Er sei mein Berater, stände mir immer zur Verfügung, ich brauche nur dort den Klopfer an der Wand erschallen zu lassen.
Drei Tage verweilte ich noch in diesem Zimmer, konnte zwar frei aus- und eingehen, machte aber davon wenig Gebrauch. Meist lag ich im Bett, Pater Hieronymos leistete mir oft Gesellschaft. Von ihm erfuhr ich auch erst, was ich noch nicht gewusst hatte, nämlich dass diese Klosterrepublik noch eine andere Einnahmequelle hat, in Gestalt von Bettelmönchen, welche durch die ganze morgenländischchristliche Welt pilgern, Almosen einsammelnd, diese von Zeit zu Zeit ganz modern durch die Post an das Hauptkloster schickend.
»Wird dabei nicht auch etwas Politik getrieben?«
Wenn ich solche Fragen stellt zeigte der Alte seine ganze diplomatische Schlauheit. Wohl antwortete er mir scheinbar ganz sachgemäß, aber doch so, dass gar nichts daraus zu entnehmen war.
Übrigens habe ich nie etwas davon gehört, dass sich diese Mönchsrepublik in politische Dinge gemischt hat, daher eben ihr Geduldetsein, ohne feindliche Angriffe. Möglich aber ist es dennoch, sie lassen sich dabei nur nicht erwischen.
Unter diesen Bettelmönchen, erfuhr ich nun weiter, seien ja Seeleute genug, aber gerade die edelstgeborenen Mönche strebten nach der Ehre, die ersten zu sein, welche das erste eigene Schiff bemannten, den anderen dadurch ein Vorbild gebend, und alle diese 6000 Mönche, welche den Athos bevölkerten, wirklich in den Klöstern wohnten oder als Anachoreten und Asketen hausten, seien keine gewöhnlichen Menschen, entstammten vielmehr den vornehmsten oder doch reichsten Familien. Es ist eben gar nicht so einfach, in die Klostergemeinschaft zu kommen. Bettelmönch kann wohl jeder werden, aber der muss draußen herumstromern. In den Klöstern dürfen nicht mehr als 6000 registrierte Mönche sein, das ist strengste Vorschrift, und da sucht man sich eben feine Leute aus, die vor allen Dingen Geld mit hereinbringen. Die Mönchsrepublik hat auch anderwärts große Besitzungen, die unter eigener Verwaltung stehen. Unter diesen eigentlichen Mönchen sei kein einziger Seemann, wobei ja auch nur ehemalige Seeoffiziere in Betracht kommen könnten. Aber ich würde schon geeignetes Material unter den edelsten Jünglingen finden, hätte da die größte Auswahl.
Der Patriarch besuchte mich während dieser Zeit nicht. Doch der Alte gab mir über ihn willige Auskunft, und die Geschichte, die ich erfuhr, war schon romantisch genug — wenigstens mit meinen Augen betrachtet, da ich mir bereits meine eigene Ansicht gebildet hatte.
Er entstammte einem russischen Fürstengeschlechte, am Schwarzen Meere ansässig, dessen Namen ich sonst nicht nennen möchte. Johannes war der einzige Sohn, hatte von klein auf eine große Vorliebe für das Klosterleben gezeigt, war eben ein frommer Knabe gewesen und schon mit jungen Jahren in ein Kloster gekommen, in dem er sich auf alle Art ausgezeichnet, die höchste Gelehrsamkeit erlangt hatte — nach russischen Klosterbegriffen! — dazu sein Geld, sein Ansehen — kurz, schon im sechzehnten Jahre wurde er Prior dieses Klosters, es noch immer an Selbstkasteiung allen anderen zuvortuend. Aber der Wirkungskreis war ihm dort zu eng — vor zwei Jahren war er mit Genehmigung einer Synode nach Athos als Abt des Klosters St. Lavra versetzt worden. Schon ein halbes Jahr später wurde der alle anderen Menschen himmelhoch überragende Jüngling einstimmig zum Patriarchen der Mönchsrepublik gewählt, auf Lebenszeit. Jetzt war Johannes erst zweiundzwanzig Jahre alt.
So hatte mir Pater Hieronymos erzählt.
»Hatte er nicht auch eine Schwester?«, fragte ich.
»Woher weißt du das?«
»Mir ist, als ob ich von dieser russischen Fürstenfamilie schon einmal gehört hätte.«
»Das ist leicht möglich, da ist auch etwas sehr Trauriges passiert, es mag in allen Zeitungen gestanden haben. Ja, Johannes hatte eine Schwester, eine Zwillingsschwester, die Johanna genannt wurde. Es soll im Gegensatz zum Bruder ein sehr leichtfertiges Mädchen gewesen sein, und gerade als jener nach Hause kam, vor zwei Jahren, um nun von den Seinigen Abschied für immer zu nehmen, da der Patriarch dieses heilige Gebiet nie verlassen darf, verschwand Johanna. Sie war von einem französischen Abenteurer entführt worden. Man hat von den beiden nie wieder etwas gehört. Der Schmerz des Bruders um die geliebte Schwester soll grenzenlos gewesen sein.«
Ich bemerke, dass ich von dieser Entführungsgeschichte nie etwas gehört hatte, obwohl ich mich so stellte.
»Hat diese Johanna ihrem Bruder nicht sehr ähnlich gesehen?«
»Ich glaube, ja. Ich habe so erzählen hören. Die beiden glichen sich wie ein Ei dem anderen. Nur nicht dem Charakter nach. Wie gesagt, die Johanna soll schon in jüngeren Jahren ein höchst gottloses Leben geführt haben.«
Das war mir gleichgültig. Ich wusste genug.
Ganz, ganz vorsichtig spielte ich auf eine Päpstin Johanna an, aber der Alte verstand mich nicht, wusste davon nichts — trotz seines allwissenden Lichtes, das auch er zu erzeugen verstand.
Für mich aber bestand kein Zweifel mehr, dass die gottlose Schwester Johanna anstatt des frommen Bruders Johannes die Rolle eines Patriarchen von Athos übernommen hatte. Oder konnten nicht alle beide hier weilen und sich in das Amt des Patriarchen teilen? Auch möglich. Ich beschloss, diese Sache näher zu untersuchen, sobald ich Gelegenheit dazu hatte.
Die Person aber, die mich in der unterirdischen Zelle gewaschen und absolviert hatte — und wie absolviert! — war unbedingt ein Weib gewesen. — —
Am dritten Tage war ich völlig wieder hergestellt und begab mich unter Führung nach dem kleinen Hafen hinab, der zum Kloster St. Lavra gehört, auf der westlichen Seite des Vorgebirges gelegen.
Der Abstieg erforderte zwei Stunden. Ein sorgfältigst angelegter Weg führte hinab. Größere Steigungen wurden durch regelrechte Treppen überwunden, während nebenher für die Maultiere noch eine Rampe im Zickzack hinlief, immer durch herrliche Wälder und Weinanpflanzungen führend.
Vor dem Kloster waren sechsundzwanzig Mönche versammelt, die sich mir als zukünftige Matrosen zur Verfügung stellten. Aus den edelsten Geschlechtern mochten sie wohl alle stammen, aber lauter Jünglinge waren es durchaus nicht, mehr als die Hälfte waren vollreife Männer, darunter sogar zwei Greise, durch Selbstpeinigungen abgezehrte Gestalten mit asketischen Gesichtern, aus den tiefliegenden Augen eine ungeheuere Willenskraft hervorleuchtend, aber dennoch oder gerade deshalb einen noch recht kräftigen Eindruck machend. Den einen schätzte ich auf mindestens siebzig Jahre. Sein entblößter Arm zeigte keine Spur von Fleisch, war nur ein mit Pergamenthaut bedeckter Knochen, unter der die Adern und Sehnen starrten, und was für Knochen und was für Sehnen! Es war unheimlich anzuschauen.
Unter den Jünglingen wiederum waren zwei kaum dem Knabenalter entwachsene Bürschchen, dann aber auch ein mehr als Zwanzigjähriger, durch die ich in meiner Meinung fast wieder irre geworden wäre. Alle drei hätten recht gut als Mädchen durchgehen können.
Außer einem kleinen griechischen Segler, der Ladung einnahm, lag in dem Hafen noch ein kleines Vollschiff von hundertsechzig Tonnen. Also ein Segelschiff mit drei Masten, jeder mit voller Takelung. Das heißt, es hätte voll getakelt sein sollen. Der alte Kasten sah aber ganz jämmerlich aus, alles zerrissen und zersplissen. Wie ich erfuhr, war der morsche Trog erst vorgestern im nächsten Hafen billig gekauft worden, ein Dampfer hatte ihn hergeschleppt, er sollte als Schulschiff dienen.
Nun, wenn es sich darum handelte, Matrosen von Grund auf auszubilden, mit ihnen als Schiffsjungen anzufangen, die erst knoten und splissen lernen müssen, so erfüllte er auch ganz seinen Zweck. Auf hohe See durften wir mit diesem Wrack freilich nicht gehen.
Die sechsundzwanzig Mönche sagten mir ihre Namen, lauter heilige, ihre eigentlichen erfuhr ich nicht, und der Unterricht nahm seinen Anfang, erst theoretisch. Ich erläuterte das ganze Schiff, die Benennungen seiner einzelnen Teile, und zwar musste ich mich der englischen Sprache bedienen, die alle entweder vollkommen oder doch so ziemlich verstanden. Dass man lauter Englisch Sprechende ausgesucht hatte, gab mir ebenfalls zu denken. Das sah gar nicht danach aus, als solle dieses Mönchsschiff nur den Handel im Mittelländischen Meere betreiben.
Noch an demselben Tage nahm ich auch praktische Übungen vor, schickte die Kuttenträger die Wanten hinauf, ließ Ausbesserungen vornehmen. Es sah possierlich genug aus, wie die Kutten in der Takelage herumkletterten. Aber an so etwas gewöhnt man sich ja schnell, und ich selbst trug eine Mönchskutte.

Dass ich hier nicht anders auftreten könne, war mir schon vorher gesagt worden, dagegen hatte man mir auf mein Verlangen ohne Zögern wieder mein Seefahrtsbuch ausgehändigt.
Ich hatte ebenso gelehrige wie gewandte Schüler, der beste Turner war sogar das alte Knochengerippe. Er nahm es an Gelenkigkeit mit dem Jüngsten auf, und das war hier doch etwas ganz anderes als die Ausbildung von Schiffsjungen. In vier Wochen wollte ich aus ihnen perfekte Matrosen gemacht haben. Ob sie sich auch schon auf hoher See und gar im Sturm bewährten, das war natürlich sehr zweifelhaft, das muss erst die Gewohnheit mit sich bringen.
Am anderen Tage erschien der Patriarch mit Gefolge und beobachtete eine Stunde lang unsere Exerzitien, ohne mich einer Anrede zu würdigen. War es wirklich eine Päpstin Johanna? Fast hätte ich wieder irre werden können. Wenn nur der glühende Kuss nicht gewesen wäre, die Körperbeschaffenheit, die ich gefühlt hatte, wollte ich sonst durchgehen lassen.
Ich war in dem Kloster St. Lavra untergebracht worden, mein Zimmer war noch besser als das vorige im eigentlichen Athoskloster, nur das Essen behagte mir weniger. So gab es zum Nachtessen Tee und ein nicht allzu großes Weißbrot, nichts weiter, das war Klosterregel. Ich hätte ja vielleicht mehr verlangen können und auch bekommen, wollte aber doch lieber keine Ausnahme machen.
So wurde am zweiten Tage unserer Exerzitien, des fünften meines Hierseins, mir des Abends — aber es war erst gegen sieben Uhr, noch ganz hell — der Tee mit dem Brote auf mein Zimmer gebracht. Dann ergingen sich die Mönche stets noch im Garten, bis zur Abendandacht gerufen wurde, die ich nicht mitzumachen brauchte.
Als ich das Brötchen durchbrach, entdeckte ich sofort ein Papier, das hineingebacken war. Es war italienisch beschrieben, mit einer zierlichen Schrift.
Signore,
wenn Sie ein ebenso mitfühlendes wie mutiges Herz haben, so fahren Sie heute Nacht, wenn der Mond untergegangen ist, nach Skarpanto, der dem Hafen vorgelagerten Insel. Meine Wächter sind eingeweiht und werden Sie empfangen. Fürchten Sie nichts. Sagen Sie, Sie wollten fischen, man wird Sie nicht hindern. Ich erwarte Sie bestimmt.
Eine Unglückliche.
(Vernichten Sie diesen Zettel sofort, jede Entdeckung bedeutet meinen Tod).
Die Insel hatte ich schon gesehen, in einer Entfernung von etwa zwei Kilometern diesem Hafen vorgelagert, vielleicht nur hundert Meter lang — die Breite konnte ich nicht erkennen — mit einem kleinen Leuchtturm drauf, sonst dicht bewaldet, hoch genug, dass keine Woge darüber hinweggehen konnte.
Ich hatte nur einmal einen meiner Schüler gefragt, ob diese Insel mit zu der Mönchsrepublik gehöre — jawohl, dabei hatte ich gleich ihren Namen zu hören bekommen, sonst nichts weiter.
Auch von meinem Fenster aus konnte ich sie erblicken, ohne hier erst auf einen Stuhl steigen zu müssen, und während ich noch in ihren Anblick versunken war und überlegte, was für eine Unglückliche wohl auf dieser Insel hause, welche doch noch immer geweihter Boden war, trat Pater Hieronymos ein, um mit mir wie gewöhnlich noch ein Stündchen zu plaudern.
»Was für eine Insel ist das dort eigentlich?«
»Das ist Skarpanto mit dem Leuchtturm, der bei Nacht die Einfahrt zu unserem Hafen anzeigt.«
»Gehört die Insel mit zu der Klostergemeinschaft?«
»Jawohl, aber erst seit zwei Jahren. Früher musste der Leuchtturm von der türkischen Regierung unterhalten werden.«
»Das hat also erst der Patriarch Johannes veranlasst?«
»Ganz richtig. Er wünschte die Insel zu besitzen, hat die ursprüngliche Wildnis in einen Garten, in einen Park verwandeln lassen, in dem er sich manchmal ergeht.«
»Des Nachts«, ergänzte ich.
»Des Nachts? O nein. Höchstens einmal des Abends lässt er sich hinüberrudern. Aber noch vor Sonnenuntergang. Auch der Patriarch hat strenge Regeln innezuhalten, vielleicht die allerstrengsten. Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang muss er in der Basilia weilen, in seiner Zelle, die nichts weiter als ein hartes Bett enthält.«
Hierüber hatte ich freilich meine eigenen Gedanken. Der Pater schien aber diesmal die Wahrheit zu sprechen, d. h., er wusste es nicht anders.
»So sind jetzt Mönche als Leuchtturmwächter auf der Insel angestellt?«
»Nein, das nicht. Diese Insel war früher ein Verbannungsort für vornehme Eunuchen aus dem Serail in Konstantinopel. Weshalb sie hierher kamen, um als Leuchtturmwächter ihr Leben zu beschließen, weiß ich nicht — wohl eine alte Überlieferung. Bis vor zwei Jahren wurden sie sogar aus Konstantinopel mit Proviant versehen, jeden Monat musste deswegen ein Fahrzeug die doch immerhin ziemlich weite Reise machen. Jetzt werden sie von uns versorgt, das ist so ziemlich der einzige Unterschied. Quellwasser gibt es auf der Insel.«
»Wie viele solche Eunuchen sind denn auf Skarpanto?«
»Sieben Mann. Die Verbannung ist lebenslänglich. Es scheint ihnen aber ganz gut in ihrer Einsamkeit zu gefallen, keiner hat den Wunsch geäußert, die Insel wieder zu verlassen, wohl keiner denkt an Flucht, sie werden ja auch nicht bewacht. Dabei sind es zum Teil noch junge Männer. Aber eben Eunuchen, ohne jeden Ehrgeiz und ohne alles. Erst wenn so viele durch den Tod abgegangen sind, dass der Leuchtturm nicht mehr bedient werden kann, müssen die Verstorbenen durch Lebende ersetzt werden. Ob dann von uns Mönche drankommen, weiß ich nicht. Bis dahin ist ja auch noch lange Zeit.«
»Ist denn das Betreten der Insel einem Fremden erlaubt?«
»Ich weiß wirklich nicht, ob die Eunuchen ihn daran hindern würden. Solch ein Fall ist noch gar nicht vorgekommen.«
Die Sonne näherte sich dem Horizont. Der Pater verließ mich, um zur Abendmesse zu gehen, ohne mich gefragt zu haben, ob ich vielleicht die Absicht hätte, der Insel einen Besuch abzustatten.
Ich hatte in meinem Zimmer eine Lampe, hatte aber noch keinen Gebrauch davon gemacht, es gab ja hier nichts zu lesen. Der Prior hatte mir gesagt, dass ich völlig frei sei, nach Belieben aus- und ein gehen könne.
Ich wartete noch ein Weilchen, bis die Abendglocke zu läuten begann, dann verließ ich meine Zelle.
Die weiten Korridore waren durch Öllampen erhellt. Beim Durchschreiten begegnete mir hin und wieder ein Mönch, den irgendein Amt von der Abendmesse fernhielt. Er murmelte den Abendgruß, ohne mich weiter zu beachten.
Das nach dem Klosterhof führende Tor war noch offen. Auch im Hofe waren noch einige Mönche mit Aufräumungsarbeiten beschäftigt. Dass aber das ins Freie führende Tor schon geschlossen war, hielt ich für selbstverständlich.
So wandte ich mich nach der kleinen, abgesondert liegenden Wohnung des Pförtners, eines alten, freundlichen Mannes, den ich schon mehrmals während des Tages am Hafen hatte angeln sehen. Überhaupt wurde viel gefischt, regelrecht vom Boot aus mit Schleppnetzen, es gab täglich Fischspeisen. Die Mönche hatten es in diesem Fischereihandwerk zu einiger Geschicklichkeit gebracht, wenn sie mir auch nicht als gelernte Fischer erschienen. Sie machten sich gegenseitig noch immer auf gewisse Handgriffe aufmerksam, freuten sich über jeden geglückten Fang. Auch das Netzfischen wurde wohl nur als willkommener Sport in dem sonst ewigen Einerlei des Tages betrieben, es gehörte besondere Erlaubnis dazu, um daran teilnehmen zu dürfen.
Ich bat den Pförtner um eine Angel.
»Willst du noch angeln gehen? Ach, ich möchte, ich könnte auch des Nachts gehen, da beißen die Fische doch viel besser als am Tage«, sagte der Alte, als er mir die Angelgerätschaften aushändigte.
In diesem Augenblick gingen an dem Häuschen drei Mönche vorüber, Angelruten in den Händen, öffneten das Tor, das also noch nicht verschlafen war, und gingen hinaus.
»Die wollen auch in der Nacht angeln?«, fragte ich.
»Warum sollen sie denn nicht? Natürlich müssen sie die Erlaubnis dazu haben; hier gibt es auch Urlaub. Ja, ja«, setzte der Alte mit trübem Lächeln hinzu, »gerade wie beim Militär, und ich war auch einmal...«
Er brach wie erschrocken ab. Eine Vergangenheit darf es hier nicht geben, keiner weiß vom anderen, was er im früheren Leben gewesen ist, nicht einmal, was für einen weltlichen Namen er geführt hat.
»Du musst nach Skarpanto hinüberfahren«, fuhr der Pförtner fort, »auf der Nordseite, da wimmelt es von Makrelen.«
»Werden die Türken mich dort auch angeln lassen?«
»Ach, warum denn nicht? Du musst es versuchen.«
»Gehen auch diese Mönche hinüber?«
»Nein, das dürfen sie nicht. Wir dürfen diese Halbinsel, unser eigentliches Revier, nicht so ohne Weiteres verlassen. Dazu gehört eine besondere Erlaubnis, und die gibt es wegen des Angelns nicht. Auch ein Boot darf dazu während der Nacht nicht benutzt werden. Bei dir ist das ja etwas anderes.«
Der Alte sagte noch, dass er jetzt das Tor schließen müsse, ich brauche bei meiner Rückkehr nur zu klopfen, und ich entfernte mich.
Das erste Viertel des Mondes leuchtete mir auf dem kurzen Wege zum Hafen, in dem einige Ruderboote unangeschlossen lagen. Ich suchte mir das beste aus, ruderte langsam auf die spiegelglatte See hinaus, stehend, das Gesicht nach der Fahrtrichtung.
Bald lag das Eiland so nahe vor mir, dass ich alles mit bloßen Augen deutlich unterscheiden konnte. Die Steinufer stiegen steil gegen drei Meter empor, welche Höhe sich nicht ändern konnte, da im ganzen Mittelländischen Meere mit all seinen Abzweigungen ein Unterschied zwischen Ebbe und Flut kaum zu merken ist. So hoch geht hier auch keine Woge — mit Ausnahme, wenn der Himmel einmal anders denkt, wobei er eben alle Spatzen ersaufen lassen kann — vorgelagerte Klippen schienen ganz zu fehlen; oben war alles bis an den Rand dicht bewaldet. Der nur wenig über die Bäume emporragende Leuchtturm, mehr am Südwestufer stehend, war wegen des Mondscheins noch nicht erleuchtet.
Ich sollte erst nach Monduntergang kommen, gegen Mitternacht. Aber der Pförtner hatte ja selbst gesagt, ich solle mein Angelglück nur an der Insel versuchen. So umfuhr ich sie zunächst einmal.
Gegen hundert Meter lang und um die Hälfte schmaler. Als ich mich auf der Westseite befand, keine zehn Ruderschläge vom Ufer entfernt, sah ich auf dem Felsen eine menschliche Gestalt stehen, einen Mann in türkischer Kleidung. Der Mond beleuchtete sein pechschwarzes Antlitz, es war merkwürdig, wie es trotz seiner Schwärze glänzte, und ließ im Gürtel die Griffe von Pistolen und Dolchen blitzen.
»Eh, Mönchlein, was hast du hier zu schaffen?«, rief er mir auf türkisch zu, und ich verstand ihn, da sich in den letzten Wochen mein türkischer Wortschatz täglich vermehrt hatte.
»Parla italiano?«, fragte ich, anstatt eine Auskunft zu geben.
»Si, si, Signore«, erklang es zurück mit einer quäkenden Stimme, die mir gleich sagte, dass ich es mit einem Haremswächter zu tun hatte, vielleicht nicht einmal mit einem ehemaligen, sondern der Eunuch war immer noch ›in Diensten‹, und die abenteuerliche Gestalt mit dem schwarzen Wollkopf winkte mir, näher zu kommen. Mit wenigen Ruderschlägen hatte ich das Ufer erreicht.
»Du wirst doch erst um Mitternacht erwartet«, sagte der Neger, sich jetzt eines gebrochenen Italienisch bedienend. »Nun gut, es schadet nichts, Rajah, zumal du so vorsichtig warst, dich von dieser Seite zu nähern. Du wirst erwartet. Wirf mir das Seil zu, du musst etwas weiter hinauf, dort kann das Boot versteckt werden.«
Er zog das Boot am Ufer entlang, ich brauchte es nur abzusetzen. In der sonst glatten Felswand zeigte sich eine geräumige Öffnung, und als das Boot hineinglitt, schwang ich mich empor.
»Hast du das Briefchen sicher erhalten?«, war des Negers nächste Frage.
»Ich habe es sofort vernichtet.«
»Du wolltest angeln gehen?«
»Ja.«
»Hast du gesagt, wann du wieder zurück sein wolltest?«
»Gar nichts, und man hat mir auch gar keine Schwierigkeiten in den Weg gelegt.«
»Was für Schwierigkeiten?«
»Ich dachte es mir nicht so leicht, bei Nacht aus dem Kloster fortzukommen.«
»Warum sollte man dich nicht angeln gehen lassen? Folge mir, Rajah!«
Durch den Wald zogen sich gute Wege hin. Bald tauchte der Leuchtturm vor uns auf. Wir betraten ihn im Schatten durch eine Tür, die hinter mir gleich geschlossen wurde; ich befand mich in völliger Finsternis.
»Du fürchtest dich doch nicht, Rajah?«, fragte die quäkende Stimme.
»Was soll ich denn fürchten?«, entgegnete ich, dachte aber doch daran, dass ich mich da vielleicht auf ein Abenteuer eingelassen hatte, welches das Ende meines Lebens bedeuten könne. Inwiefern, das werde ich später berichten.
»Gib mir die Hand.«
»Weshalb brennst du kein Licht an?«
»Weil ich nicht darf.«
»Warum nicht?«
»Du wirst es erfahren!«
Hatte ich A gesagte, musste ich nun auch B sagen. Und hätte ich auch mein sicheres Ende vor Augen gehabt, so hätte ich mich deswegen doch nicht von diesem Abenteuer zurückschrecken lassen.
Die weiche Hand des Eunuchen führte mich; es ging durch eine zweite Tür, hinter der es nicht heller wurde, dann eine Treppe hinab, bei der ich einundzwanzig Stufen zählte.
Wieder eine Tür, ein kurzer Gang, nochmals knarrte eine Tür, ich wurde sanft etwas vorgeschoben, dann hörte ich einen eisernen Riegel gehen, und nun stand ich da in der Stockfinsternis.
Jetzt aber hatte ich keinen Steinboden mehr unter meinen mit Sandalen bekleideten Füßen, sondern einen weichen Teppich.
»Ist denn hier niemand?«
Keine Antwort. Ich tat vorsichtig einige Schritte, meine ausgestreckten Hände erreichten eine Wand oder tasteten vielmehr einen Teppich, der festen Widerstand fand, beim Herabgleiten fühlte ich am Boden Polster und Kissen liegen.
Also ein orientalisch ausgestatteter Raum!
Da war es mir, als ob sich jemand neben mir befände. Ich sah nichts, fühlte nichts, hörte kein Rauschen, keinen Atem gehen, aber... die menschliche Atmosphäre muss sich doch noch in anderer Weise äußern können. Ich konnte gleich schwören, dass sich dicht neben mir ein Weib befand, wenn auch nichts von Parfüm und dergleichen zu riechen war.
Und richtig... ›caro mio‹, erklang es da schon dicht neben mir mit zärtlichster Stimme, gleichzeitig legte sich ein warmer, weicher Arm um meinen Nacken, und ehe ich mich dessen versah, saß ich auf den Polstern.
Schon in der nächsten Minute wusste ich, dass ich Johanna, die Schwester des Patriarchen Johannes, in meinen Armen hielt, in den nächsten zehn Minuten hatte ich ihren ganzen Lebenslauf erfahren.
Einer von den beiden log: entweder hier die Johanna, oder der alte Pater Hieronymos.
Nach ihrer Erzählung war sie nämlich niemals ein ›gottloses, leichtfertiges Mädchen‹ gewesen, sondern ganz im Gegenteil, sie hatte schon von klein auf die stärkste Neigung zum frommen Klosterleben gehabt, danach war natürlich auch ihr ganzer Wandel beschaffen gewesen, aber da schon der Bruder ins Kloster gekommen war, so war es ausgeschlossen, dass die fürstlichen Eltern auch ihr zweites Kind auf diese Weise verloren. Vielmehr war Johanna schon mit einem nicht minder edlen russischen Fürsten, dessen Namen ich ebenfalls erfuhr, verlobt gewesen.
Nicht minder stark als ihre Sehnsucht nach dem Kloster aber war ihre Liebe zu dem Zwillingsbruder, mit dem sie aufgewachsen war. Untröstlich war sie gewesen, als dieser schon als Knabe ins Kloster gegangen. Doch damals hatte sie ihn wenigstens noch besuchen dürfen, er war auch manchmal nach Hause gekommen. Anders musste das werden, als er Patriarch von Athos werden sollte. Von hier an gab es keinen Besuch mehr, weibliche Wallfahrer werden nicht zugelassen, und auch in männlicher Verkleidung hätte sie den Patriarchen nur von Weitem sehen und anbeten können.
Als Johannes vor seiner Übersiedlung nach Athos noch einmal nach Hause gekommen war, hatte sich ihm die Schwester offenbart. Sie könne, ohne ihn ab und zu zu sehen, nicht leben, und der kluge Johannes wusste Rat. Die Schwester sagte mir gleich ganz offen, dass ihr Bruder gar nicht so gottesfürchtig sei, er schwärmte mehr für eine klösterliche Herrschaft. Also einfach ehrgeizig! Auf ein paar Sünden kam es ihm dabei nicht an.
Der junge Abt hatte sein zukünftiges Besitztum schon vorher inspiziert, und vor seiner endgültigen Übersiedlung ging er immer noch einmal erst als Besuch nach Athos, freilich schon als baldiger Herrscher. Diesmal machte er nähere Bekanntschaft mit den Eunuchen von Skarpanto, und solch ein Mann, der schon mit zwanzig Jahren der Papst der morgenländischen Christenheit ist, wird wohl Menschen zu behandeln und zu gewinnen verstehen, wahrscheinlich ein unvergleichlicher Hypnotiseur, wenn auch kein solcher Experimentator auf der Schaubühne, sondern etwa so ein gewaltiger Seelenbezauberer wie Cecil Rhodes einer war, der ja die größte Volksversammlung, und wenn sie seinen Plänen auch noch so feindlich gesinnt war, jeder einzelne ihn noch so hasste, in fünf Minuten zu seinem Willen umgestimmt hatte — — kurz, Johannes hatte die quäkenden Leuchtturmwärter sofort auf seiner Seite, ließ schon alles für den Aufenthalt seiner Schwester vorbereiten, bekam auch die ganze Insel in seinen Besitz.
Hierauf begab er sich wieder nach Hause, um für immer Abschied von den Seinigen zu nehmen. In dem fürstlichen Hause hielt sich gerade ein französischer Edelmann auf. Er wurde ins Vertrauen gezogen, für den Plan gewonnen. In aller Schnelligkeit wurde noch ein Briefwechsel nachgeholt, es musste später aussehen, als habe zwischen Johanna und dem Franzosen schon seit langem ein Liebesverhältnis bestanden.
Also, der Edelmann hatte Johanna entführt. Er brachte sie nach der mazedonischen Küste, von dort wurde sie von den Leuchtturmwächtern abgeholt, sie verschwand in den unterirdischen Gewölben der kleinen Insel, die schon seit ungezählten Jahrhunderten als Verbannungsort gedient hatte, manche Schandtat verdeckt haben mochte.
Hier lebte Johanna seit nun anderthalb Jahren, hin und wieder von ihrem Bruder besucht, bei Nacht sich in dem Park ergehend, nichts vermissend... bis auf eins.
Das Mädchen erzählte mir alles mit der naivsten Unschuld. Als das Weib in ihr erwacht war — etwas spät, erst in ihrem zwanzigsten Jahre — wurde eine andere Sehnsucht noch stärker als die nach frommer Beschaulichkeit, und der Bruder war ein gar arger Freigeist, er fand diese andere Sehnsucht bei der Schwester ganz selbstverständlich. Die türkischen Leuchtturmwärter und ehemaligen Haremswärter konnten freilich diese nicht stillen, und da musste man gar vorsichtig sein. Einen der Mönche einzuweihen, ihn zu Hilfe zu nehmen, das war ganz und gar ausgeschlossen. Von den Bewohnern des Athos durfte kein einziger eingeweiht werden, sonst war das ganze in tiefste Nacht gehüllte Geheimnis gefährdet, den noch hatte niemand drüben eine Ahnung, dass der Patriarch hier seine Schwester verborgen halte, dass diese Insel überhaupt ein Weib beherberge.
Da hatte mich das Meer an die heilige Küste geworfen, und als der junge Patriarch mich Bewusstlosen und blutrünstig Geschlagenen erblickte, da hatte er sofort gewusst, dass ich allein der Richtige für seine einsame Schwester sei.
Woher er das sofort gewusst hatte? Nun, einmal war er überhaupt ein unübertrefflicher Menschenkenner und Seelendurchschauer, der Betreffende konnte bei der Prüfung sogar schlafen, zweitens war es überhaupt ein Zeichen des Himmels; und vor allen Dingen kam noch das heilige Licht in Frage, das er ja nur aufleuchten zu lassen brauchte, indem er seinen Nabel betrachtete, um alle Geheimnisse Himmels und der Erden zu erkennen, also auch mich in meinem eigentlichen Charakter.
Nach meiner Ansicht hatte wohl das erstere den Ausschlag gegeben, dass ich gleich als Geliebter für seine einsame Schwester gewürdigt wurde. Außerdem mochte man auch keine große Auswahl haben. Das heißt, ich spreche jetzt so, als ob ich sonst der Erzählerin unbedingt Glauben schenkte.
Ich erklärte mich mit alledem ganz einverstanden, es durch Worte versichernd, die mir gar nicht so vom Herzen kamen, aber dieses mein Einverständnis doch auf andere Weise bezeugend.
»Du meinst, Johanna, ich soll dich nun jede Nacht besuchen?«
»Selbstverständlich, jede Nacht. Mit Ausnahme, wenn die See zu stürmisch ist, dass die Bootsfahrt gefährlich wird. Und nicht wahr, du Teuerster, Süßester, du wirst dein Leben schonen?«
»Werden diese nächtlichen Fahrten nicht zuletzt auffallen?«, fragte ich weiter, nachdem dieser Ausbruch von Zärtlichkeit wieder vorüber war.
»Was soll da auffallen? Du gehst eben jede Nacht angeln. Oder du kannst ja Freundschaft mit einem der Leuchtturmwärter geschlossen haben — du darfst das doch, du gehörst nicht mit zu der Klostergemeinde.«
»Man wird mit der Zeit wollen, dass ich ganz zu ihr übertrete.«
»Warum? Man kann dich nicht zwingen.«
»Wenn aber nun die sechsundzwanzig Mönche von mir zu Matrosen ausgebildet worden sind?«
»So bekommst du immer neue Schüler.«
Hierauf sagte ich nichts, wollte meinen heimlichen Widerstand nicht merken lassen, deshalb sprach ich auch nicht davon, dass ich ja mein Kapitänsexamen machen sollte, um ein Schiff auf See zu führen.
Ich fragte, warum wir denn immer im Finstern blieben, ob ich denn nicht einmal ihr Antlitz schauen dürfe, dessen Holdseligkeit doch jedenfalls ihrem ganzen Wesen entspräche.
»O, Gott, was denkst du!«, flüsterte sie wie erschrocken. »Da könnte uns doch jeder sehen!«
»Jeder sehen?«
»Nun, alle die Mönche, welche zurzeit das heilige Licht betrachten, und das geschieht am öftesten in der Nacht, da versetzt sich wohl jeder in diese Ekstase.«
»Und du meinst, da könnte uns jeder hier erblicken?«
»Ganz sicher!«
»Aber doch nur, wenn sie ihre Gedanken auf diese Insel konzentrieren, um zu ergründen, was hier wohl zurzeit vorgehen mag.«
»Nein, das ist ganz anders, ich kann es dir auch nicht erklären. In diesem Lichte wird das ganze Weltall mit einem einzigen Blicke umfasst. Verstehst du? Nein, du verstehst es nicht, ich kann es ja selbst nicht verstehen. Aber es ist so, verlasse dich darauf. Jeder, der jetzt das heilige Licht betrachtet, würde uns sofort hier erblicken, wenn wir ein Licht anzünden.«
»Aber wenn wir uns im Finstern befinden, kann man uns nicht erblicken?«
Nein, das war nicht möglich. Daraus konnte ich ja von dem heiligen Lichte von Tabor, das nach Athos verpflanzt worden war, nicht eben eine hohe Meinung gewinnen, das Mädchen wusste es mir aber doch ganz geschickt beizubringen. Gott ist das Licht selbst, ohne Licht kein Gott und so weiter, und wenn man nun einmal auf diese mystische Spekulation eingehen wollte, so hatte das ja auch etwas für sich.
Die Hauptsache also war, dass wir immer im Stockfinstern blieben.
Weiter erfuhr ich nun auch gleich noch, dass die Mönche in dem heiligen Lichte weder Vergangenheit noch Zukunft erblicken könnten, nur die Gegenwart, da aber auch alles, was irgendwo auf der Erde und im ganzen Weltall geschehe.
»Und wenn du bis an das Ende der Welt fliehen würdest, man könnte dich doch immer sehen«, schloss Johanna ihre Erklärungen.
Aha! Ich hatte die Andeutung verstanden. Sie war ja auch deutlich genug gewesen. Aber ich ließ mir nichts davon merken, und wenn ich darauf einging, so doch in ganz anderer Weise.
»Nur nicht, wenn ich mich im Dunkeln aufhalte«, suchte ich zu scherzen.
»Nein; aber ehe du an einen finsteren Ort gelangst, müsstest du doch erst das Tageslicht passieren. Übrigens scherze ich nicht, das mit dem aufklärenden Lichte ist Tatsache, ich musste mich oft genug davon überzeugen lassen. Denn auch ich zweifelte zuerst daran, verspottete es selbst.«
»Kannst auch du es erzeugen?«
»Nein, ich nicht, aber mein Bruder gab mir oft genug Beweise davon.«
»Ja, warum sollte ich denn fliehen?«, sagte ich jetzt mit möglichster Zärtlichkeit.
»Mein Novacasa!«
Und die Zärtlichkeit des Wortes ward wieder zur Tat.
So trieben wir es noch mehrere Stunden lang. Worüber wir uns sonst unterhielten, brauche ich nicht wiederzugeben. Ich war so prosaisch, nach und nach Hunger zu verspüren. Aber ich sagte lieber nichts davon.
Ein Pochen an der Tür unterbrach uns. Mitternacht sei vorüber, der Mond untergegangen. Der Wächter hielt es für seine Pflicht, uns dies mitzuteilen, und wir gehorchten dieser Aufforderung, ich sogar gern. Denn mein Magen begann hörbar zu knurren.
»Auf Wiedersehen morgen Nacht, mein einzigst Geliebter!«
Nachdem sich eine Tür geöffnet hatte, erfasste mich wieder die feste Hand des Eunuchen, ich ward hinaus- und hinaufgeleitet.
»Ich habe in dein Boot ein Dutzend frisch gefangene Makrelen getan.«
»Hast du sie nicht gleich gebraten?«
»Gebraten? Die sollst du doch gefangen haben!«
Ich gestand, ehe wir uns auf den Rückweg machten, meine irdische Schwäche.
»Warum hast du denn das nicht gleich der Dame gesagt? Hier braucht niemand Hunger zu leiden.«
Ich erhielt in einem Turmzimmer Brot, Honig, Früchte und geräuchertes Fleisch; bei dieser Mahlzeit durfte ich auch mittels des heiligen Lichtes gesehen werden, das Turmzimmer war erleuchtet.
Dann wurde mein Boot vorgeholt, das Sternenlicht genügte, um ohne Führung um die Insel herumzukommen, ich hätte auch den Hafen wiedergefunden, und zum Überfluss waren einige Räume des Hafenklosters immer erhellt, die Fenster dienten mir als Leitsterne.
Was ich unterwegs während des Ruderns alles dachte, will ich jetzt nicht schildern. Erwähnen will ich nur, dass ich mir zunächst überlegte, wie ich die Identität zwischen meiner Geliebten und dem Patriarchen feststellen könne. Dass Johannes für einen Mann etwas lange Haare und Johanna für ein Weib etwas kurze Haare hatte, daraus durfte ich noch gar nichts schließen. Darin konnte ich mich dennoch täuschen. Die Johanna auf der Insel, das war freilich ein Weib, da gab es nun keinen Irrtum mehr für mich.
Aber sonst — die Haare durften mich so wenig wie der ziemliche Gleichklang der Stimmen beeinflussen.
Doch wie feststellen, dass die beiden ein und dieselbe Person waren? Nun, ich wusste bald einen Rat, und zwar etwas Besseres, als dem Weibe eine Haarflechte abzuschneiden oder ihr etwa eine kleine Kratzwunde am Halse beizubringen. Da musste ich ja überhaupt sehr, sehr vorsichtig sein.
Es handelte sich nur noch darum, dass ich das Mittel, dessen ich bedurfte, in meine Hände bekam, und das sollte mir denn auch glücken.
Ich landete, legte die Fische in den Bastkorb, der sich schon im Boote befunden hatte, lieferte sie dem Pförtner ab und tat einen tiefen Schlaf, ohne einen Traum zu haben.
Am nächsten Morgen ließ ich wieder meine zum Teil achtzigjährigen Schiffsjungen exerzieren. Bei der ersten Gelegenheit klagte ich über Magenbeschwerden, und ich hatte es so eilig, dass ich nicht erst warten konnte, bis der Klosterarzt zu mir kam, sondern ich ließ mich gleich in die Klosterapotheke führen.
Der Bruder, der hier die Rolle eines Arztes spielte, hatte am ersten Tage meines Aufenthaltes im Kloster St. Lavra mir noch einmal einen Verband um meinen linken Unterarm gelegt, der einen besonders tüchtigen Hieb mit der scharfen Kante eines Stockes abbekommen hatte, dabei hatte ich erkannt, dass der Mann ein wirklicher Arzt war, und zwar nicht nur aus der Geschicklichkeit, mit der er den Verband erneuerte, sondern da hat man seine gewissen Kennzeichen, jedes erfahrene Auge wird doch einen Bereiter von einem Schullehrer und diesen von einem Arzt unterscheiden können, außerdem hatte er einen Gehilfen bei sich gehabt, mit dem er lateinische Worte wechselte, einige Medizinen nannte, hatte ihn auch nach der Apotheke geschickt, so dass ich wusste, dass eine solche vorhanden war.
Es war eine regelrechte Apotheke, in die ich geführt wurde. Ein großer Raum mit Regalen, alle mit Porzellanbüchsen besetzt, darauf lateinische Namen.
Und richtig, da war auch gleich, was ich suchte, mit einem Griff in erreichbarer Nähe: Lapis infernalis, das ist Höllenstein. Eigentlich hätte an der Büchse ja der lateinische Name für salpetersaures Silberoxid stehen müssen, also: Argentum nitricum, aber so ganz auf wissenschaftlicher Höhe stand diese Apotheke eines christlichmorgenländischen Klosters denn doch nicht. Von asa foedita, auf gut deutsch Teufelsdreck, der Extrakt einer in Persien wachsenden, scheußlich stinkenden Pflanze, ohne den kein orientalischer Hakim, Arzt, auskommen kann, war eine ganze Tonne vorhanden, und es gab auch getrocknete Eidechsenschwänze und dergleichen.
Die Hauptsache für mich aber war die Büchse mit Höllenstein, und dann nicht minder, dass der mich hierher führende Mönch nicht mit eingetreten war und dass auch sonst sich niemand in der Apotheke befand, die Tür geschlossen war.
Also schnell die Finger an der Kutte möglichst trocken gewischt, die Büchse leise geöffnet und ein Stückchen Höllenstein in die Tasche praktiziert.
Wäre in diesem Augenblick jemand eingetreten. so hätte ich meine Bewegungen sofort ganz verlangsamt und einfach gesagt, ich hätte eine Warze, die ich mit Höllenstein beizen wolle, es sei wohl erlaubt, ein Stängelchen zu nehmen. Und es war eine Tatsache, ich hatte seit einigen Tagen am rechten Handgelenk wirklich einen kleinen Ansatz zu einer Warze. Auf diese Weise hätte ich mir überhaupt etwas Höllenstein verschaffen können. Aber ich wollte so vorsichtig wie möglich sein — stehlen, ohne dass jemand darum wusste, war noch besser.
Der kleine Diebstahl war gelungen. Als der gelehrte Bruder eintrat — sein Name war sehr leicht zu behalten, er hieß Pater Lazarus — stand ich schon wieder weit entfernt von jenem Regal ruhig in der Mitte des Raumes.
Mir war schon bedeutend besser, ich zeigte die Zunge, der Pater und Bader meinte gleich ganz ehrlich, ein Freund des Aderlassens, wie es in jedem Kloster sehr üblich, sei ich wohl nicht, so erhielt ich nur ein Opiat, und die Sache war erledigt, ich kehrte zu meinen Schülern zurück.
Gleich darauf ward zum Mittagessen geläutet, das ich einsam in meiner Zelle einnahm. Das Stängelchen Höllenstein packte ich, um nicht, falls es feucht werden sollte, meine Tasche zu verbrennen, in etwas trockene Brotkrume ein. Denn Papier schien es hier gar nicht zu geben. (Hierbei erwähne ich, aber nur zum Zeichen, dass ich nichts vergesse, dass ich das Briefchen gestern auf der nächtlichen Fahrt in winzige Stückchen zerrissen dem Meere überliefert hatte. Wie es in das Brot hineingebacken worden war, danach hatte ich Johanna gar nicht gefragt, und hätte ich es getan, so würde ich solche Nebensachen doch gar nicht erst dem Leser mitteilen, da man darüber sonst die Hauptsache vergessen würde).
Am Nachmittage hob ich eine Vogelfeder auf und befestigte das Stängelchen Höllenstein in dem Kiel, die ätzende Substanz noch mit Brotkrume umhüllt haltend, und nach dem Abendessen, das ich mir diesmal hatte reichlicher als sonst geben lassen, ging ich wieder zum Angeln — zum Fischen im Trüben, sogar im Dunkeln.
Es war ganz wie in der vorigen Nacht. Worüber wir uns unterhielten, ist nicht von Belang. Ich war sehr vorsichtig mit meinen Fragen. Der Patriarch ließ sich nur am Tage nach der Insel rudern, des Nachts durfte er ja die Basilia mit keinem Schritt verlassen, und manchmal vergingen, wie Johanna mir sagte, Wochen, ehe er seiner Schwester ein Stündchen widmen könne, wobei er sich mit ihr natürlich ebenfalls im Finstern aufhalten müsse, da er ja sonst ebenfalls von jedem in Ekstase befindlichen Mönche im Scheine des heiligen Lichtes gesehen werden könne.
Was denn aus jenem Chevalier de Lormand geworden wäre, der sie damals entführt habe, scheinbar oder auch wirklich, da ja in diesem dennoch ein Mitwisser dieses Geheimnisses vorhanden sei?
Nein, eben nicht, denn dieser französische Edelmann sei auf der Rückfahrt von der Insel mit seinem Boote gekentert und ertrunken, vor den Augen des Bruders, ohne dass dieser ihn retten konnte.
Das waren so die Sachen, worüber wir sprachen, die ich erfuhr, und... ich dachte dazu mein Bestes.
Bei der ersten günstigsten Gelegenheit, als ich das liebeglühende Weib wieder einmal beim Schopfe hatte, feuchtete ich meine Fingerspitze an, drückte sie ihr unterhalb des linken Ohres an den Hals und dann weiter auf dieselbe Stelle den schon bereitgehaltenen Höllensteinstift. So, das genügte. Morgen musste Johanna an dieser Stelle einen schwarzen Punkt haben — und dann galt es, mich zu überzeugen, ob auch ihr Bruder, der Patriarch Johannes, an derselben Stelle solch einen schwarzen Fleck haben würde. Und an geistigreelle Gedankenübertragung, die sich auf realistische Dinge erstreckt, glaubte ich nicht — noch heute ist das nicht der Fall.
Johanna hatte von dieser Manipulation nicht das Geringste gemerkt, und wenn sie den schwarzen Fleck, der sich nicht wieder abwischen ließ, sondern erst nach einigen Tagen durch Bildung einer neuen Haut verging, im Spiegel bemerkte, so würde sie doch nicht an Höllenstein denken, am allerwenigsten aber, dass ich ihn erzeugt haben könnte.
Diesmal entfernte ich mich, als der Mond noch schien.
»Auf Wiedersehen morgen Nacht, mein einzigst Heißgeliebter!«
Ich fand wieder in meinem Boote Fische, die auch wirklich geangelt worden waren, lieferte sie dem mir gratulierenden Pförtner ab.
In dieser Nacht hatte ich einen merkwürdigen Traum. Ich sah den jungen Patriarchen in doppelter Gestalt, jede hatte auch unter dem linken Ohrläppchen einen schwarzen Fleck, sie leierten an einer mächtigen Schraube, deren Ende ich nicht sehen konnte — also war's eine richtige Schraube ohne Ende im buchstäblichen Sinne dieses Wortes.
Weiter ging der Traum nicht, für mich wurde diese Schraube von den beiden bis in alle Ewigkeit geleiert, und als ich erwachte, konnte ich mir diesen Traum recht wohl deuten.
Bei den Morgenexerzitien überlegte ich mir, auf welche Weise ich heute den Patriarchen sprechen könne Als ich noch so grübelte, kam er schon selbst anspaziert. Ohne mich selbst zu beachten, beobachtete er die Kletterübungen meiner bekutteten Matrosen, ich wusste einmal in seine Nähe zu kommen und... richtig, an dem entblößten Halse unterhalb des linken Ohres war ein schwarzes Fleckchen!
So, nun wusste ich genug! Wie der Patriarch, der des Nachts mit keinem Fuße seine oben auf der Athoskuppe gelegene Wohnung verlassen durfte, jeden Abend nach der Insel hinüberkam, konnte mir gleichgültig sein. Einfach ein unterirdischer, unterseeischer Tunnel! Innerhalb von tausend Jahren lässt sich doch etwas schaffen!
Und nun will ich schildern, was ich schon vorher gedacht hatte.
Johanna hatte mir nicht gesagt, dass sie schon früher ein ähnliches Verhältnis gehabt habe, wenn nicht auf dieser Insel, dann schon zu Hause, und ich hätte mich gehütet, eine derartige Frage zu stellen, brauchte es auch gar nicht — dieses Weib war bereits in alle Geheimnisse der Liebe durchaus eingeweiht gewesen, das hatte ich im ersten Augenblick gemerkt, da sie zum ersten Male die Arme um mich geschlungen hatte, und mit jeder Stunde, gestern und schon vorgestern, hatte ich das immer deutlicher empfunden. Der konnte man überhaupt nichts mehr vormachen.
Denn das verstand ich zu beurteilen, trotz meiner zwanzig Jahre. Man ist doch nicht umsonst schon mit acht Jahren Leutnant gewesen — und zwar nicht etwa nur von der Heilsarmee. Mit meinem achten Jahre hatte ich allerdings noch nicht begonnen, aber über die Liebesabenteuer oder Affären, die ich bereits mit meinem vierzehnten Jahre bestanden, könnte ich doch schon ein dickes Buch schreiben. Ich war eben ein ganz frühreifer Knabe gewesen, an Gelegenheit hatte es mir nicht gefehlt, und da hatte alle Wachsamkeit meiner Haushofmeister nichts genützt. Dass ich trotz alledem noch immer ein ganzer naiver Jüngling war, dem Herzen nach, hat bei alledem nichts zu sagen. Mein Herz war eben nie dabeigewesen — bis auf jenen letzten Fall, da mir das Schicksal eins ausgewischt hatte, wodurch ich zum Gottlieb Schulze und dann zum Napoleon Bonaparte Novacasa wurde.
Wer sagte mir denn aber, dass ich der erste sei, der mit Einverständnis des Patriarchen nach der Insel ging, um ihn selbst in weiblicher Gestalt als seine vorgebliche Schwester, die er selber war, zu beglücken? Jede Nacht gingen einige Mönche zum Angeln aus, und ich hatte sogar schon erfahren, dass bereits einige dabei verunglückt, d. h., nicht zurückgekehrt waren. Sie waren beim Angeln von der Klippe gestürzt oder sonst wie verunglückt, man hatte dann nicht einmal ihre Leiche gefunden. Konnte ein und der andere nicht unfreiwillig verschwunden sein, d. h., er hatte verschwinden müssen?
Und die Geschichte mit dem französischen Edelmann, wie der plötzlich ertrank, nachdem er seine Schuldigkeit getan hatte, das war auch so ein merkwürdiger Fall.
Dieser Patriarch sah allerdings durchaus nicht wie ein Mörder aus, aber... wie gesagt, trotz meines naiven Herzens hatte ich einen schon gar erfahrenen Kopf. Ich wusste bereits, wessen der Ehrgeiz alles fähig ist, wenn er den Menschen einmal gepackt hat!
Nicht Bruder Johannes, sondern Schwester Johanna hatte der erste Patriarch, der Papst der morgenländischen Christenheit werden wollen, war es wirklich geworden, und dass dieses Weib die allmächtige Stelle nicht verlieren wollte, weil es manchmal der Schwachheit seines Geschlechtes nachgab, war doch ganz selbstverständlich. Wenn Johanna wollte, konnte sie sogar alle ihre Taten, auch den scheußlichsten Mord, mit den ethischsten, mit den hochedelsten Motiven bemänteln. Denn was ist denn den Spitzfindigkeiten der Kirche unmöglich?
Wo aber war ihr Bruder geblieben?
Doch das konnte mir ganz gleichgültig sein, hier handelte es sich um meine eigene Person.
Kurz und gut, ich war felsenfest davon überzeugt, hielt es für ganz selbstverständlich, dass mich diese Päpstin Johanna sofort von der Erdoberfläche verschwinden lassen würde, wenn sie auch nur vermutete, dass ich selbst etwas von dieser Doppelrolle ahnen würde. Deshalb von allem Anfang meine größte Vorsicht, denn so etwas hatte ich mir eben gleich überlegt.
Es war aber auch gar nicht nötig, dass sie etwas von meiner Kenntnis erfuhr oder auch nur ahnte. Einmal muss doch jedes Liebesspiel enden, besonders wenn es so ohne wahre Herzensneigung getrieben wird. Wenn nicht morgen, dann übermorgen — wenn nicht in einem Jahre, dann in zehn. Von zehn Jahren war hier natürlich gar keine Rede. Und in jedem Falle morgen oder nach Jahren, wenn sie meiner überdrüssig? Dann musste ich doch ebenfalls von der Bildfläche verschwinden. Ich hatte übrigens schon deutlich genug bemerkt, dass dieses Weib zur Grausamkeit geneigt war. Es lag schon in den glühenden Küssen.
Diese türkischen Eunuchen, nur halbe Menschen, mochte sie durch irgendeine teuflische oder irdische Kunst völlig an sich gefesselt haben, die durften alles wissen. Aber sonst sicher kein anderer Mensch. Oder er musste von ihr wiederum so gefesselt werden, mehr noch der Seele nach als dem Körper. Und war ich denn etwa ein Mann, der sich von einem Weibe so fesseln ließ?
Kurz und gut, sage ich wiederum, meine Flucht war bereits eine beschlossene Sache. Jetzt war es noch Zeit, morgen vielleicht schon nicht mehr.
Nur noch einmal musste ich sie besuchen, um mich desto unauffälliger entfernen zu können, und das konnte doch erst nach dem Untergang des Mondes geschehen.
Also ich absolvierte meinen Tagesdienst, erzählte dem mir aufwartenden Bruder von einem ganz außerordentlichen Hunger, den ich heute Abend verspüre, steckte das ganze Abendbrot in die Tasche und ging wie gewöhnlich zum Angeln.
Im Laufe des Tages hatte ich beobachtet, wie zwei auf Fischfang ausgehende Boote auch Wasserfässchen mitgenommen hatten. Ich untersuchte die betreffenden Boote, nachdem ich mich überzeugt hatte, dass ich dabei schwerlich beobachtet werden konnte, fand richtig die Fässchen noch halbgefüllt, schüttete ihren Inhalt zusammen und nahm das volle in mein Boot.
Um neun Uhr landete ich an der Insel, wurde von dem schwarzen Wächter wie gewöhnlich empfangen und in das finstere Boudoir geführt.
Johanna war heute, am dritten Abend, ganz besonders zärtlich aufgelegt, und schon das allein hätte mich besorgt machen müssen. Denn ins Endlose lässt sich nichts steigern, alles Übermaß ist gefährlich, der zu straff gespannte Bogen bricht.
Und sagte ihr eine Ahnung etwas von meinem Vorhaben, dass sie mir solche Verwarnungen gab?
Es konnte ja nicht immer geküsst werden, und so fing sie wieder einmal von dem heiligen Lichte an, erzählte mir einige Beispiele, die ihr der Bruder gegeben habe, wie man in diesem unerklärlichen Lichte tatsächlich alles sehen könne, was auf der Erde passiere, unter anderem erzählte sie Folgendes:
Es war noch kein Jahr her, da hatte ein noch junger Mönch, der erst vor Kurzem in das Kloster eingetreten war, das Gelübde gebrochen, war, erfasst von Sehnsucht nach dem weltlichen Leben, geflohen, und es war ihm gelungen, heimlich davonzukommen. Nach Amerika hatte er sich gewandt, bis nach Kalifornien, was man wohl in Bezug auf das Vorgebirge Athos als das andere Ende der Welt bezeichnen darf. Dort hatte er alsbald die Tochter eines Plantagenbesitzers geheiratet, dort lebte er auf der weltentlegenen Farm unter anderem Namen, auch sein Aussehen hatte er total verändert.
»Allein was half es?«, lasse ich das Weib selbst erzählen. »Unsere Mönche brauchten ja nur in sich das heilige Licht zu erzeugen, so wussten sie sofort, wo sich Bruder Sybolus befand. Er hatte umsonst einen Selbstmord vorgetäuscht, sich hier scheinbar von einer Klippe gestürzt, einen Brief zurücklassend, in dem er von Lebensüberdruss sprach, auch dafür sorgend, dass man an der vorgeblichen Selbstmordstelle einige Kleidungsstücke von ihm fand. Ja, es wäre nicht einmal nötig gewesen, dass man ihn überhaupt vermisste. Man hätte zum Beispiel glauben können, er hätte sich für längere Zeit zu einer Bußübung in seine Zelle eingeschlossen. Nützt alles nichts, das heilige Licht ist allumfassend. Wer es erzeugen kann, der sieht sofort darin, was sich in der Welt ereignet, alles, alles, und da entgeht dem Asketen auch nicht das geringste Wesen, welches eure Gelehrten sonst nur durch das Mikroskop wahrnehmen können. Wie das möglich ist, wie das zu verstehen ist, das kann ich freilich nicht schildern. Es ist eben ein Gottschauen — ein Schauen durch Gott, dem ja nicht das Geringste entgeht, der auch jedes Haar auf deinem Haupte gezählt hat und es in seiner Hand hält. Kurz, Bruder Sybolus wurde in Amerika gesehen. Und was soll ich sagen? Vier Monate später war er schon wieder hier.«
»Freiwillig ist er wieder hergekommen?«, fragte ich.
»O nein. Sogar sehr, sehr unfreiwillig.«
»Wie denn?«
»Er wurde in einer Kiste hergeschickt.«
»In einer Kiste?«
»Jawohl. Du ahnst ja nicht die Macht, welche unsere morgenländische Kirche besitzt. Du hast noch nichts von dieser Macht gehört? Ja, das ist es eben, um so furchtbarer ist sie. Die römischkatholische Kirche hat ja schon genug von sich reden gemacht, sie hat die größte Macht besessen, die es je auf der Erde gab — heute wird schon an ihren Grundfesten gerüttelt. Die griechische Kirche hat in der Weltgeschichte nie eine besondere Rolle gespielt, mindestens doch nicht zu vergleichen mit der der römischen. Desto größer ist ihre innere Macht. Denn so ist es immer in der Welt, da könnte man wohl sogar von einem ehernen Naturgesetze sprechen. Je weniger ein Mensch oder überhaupt jede Existenz von sich reden macht, obwohl er sich seiner inneren Kraft bewusst ist, eine um so größere Kraft wird er ausüben, wenn auch nicht durch äußerliche Erfolge ersichtlich. Und eben das ist das Furchtbarste dabei. Auch das ist mystisch. Und die ganze Kraft der morgenländischen Kirche konzentriert sich hier in dieser Mönchsrepublik. Sie beherrscht tatsächlich die ganze Erde. Wenn du willst, brauchst du darin gar nichts Mystisches zu sehen. Es sind unsere Bettelmönche, welche die ganze Erde beherrschen, und nicht etwa nur in ihrer Kutte. Fliehe, wohin du willst, verstecke dich unter den Eskimos — auch dort haben wir unsere Leute, jedes unserer Winke gewärtig.«
Ich brauchte mein spöttisches Lächeln nicht zu verbergen. Es wurde ja nicht gesehen.
»Also in einer Kiste ist der Bruder Sybolus wieder hierher transportiert worden?«
»Jawohl, und da siehst du wiederum, dass gar nichts Mystisches dabei ist, es geht alles ganz natürlich zu. Bis auf das heilige Licht, in welchem die Mönche ja aber nicht einmal die Zukunft lesen können, während ihr in eueren europäischen Hauptstädten, in den Zentralen der realen Wissenschaften und geistigen Aufklärung, in jeder Straße eine Wahrsagerin habt, welche den Leuten aus plump bemalten Karten die Zukunft enthüllt, und vor den Häusern dieser Megären halten Equipagen, sie werden in die Paläste bestellt. Sind wir da nicht schließlich aufgeklärter?«
Ich wollte dem lieber nicht widersprechen, es hatte doch etwas für sich, was ich da zu hören bekam.
»Ja, wie kam denn aber der Mann in die Kiste?«
»Er wurde einfach hineingesteckt. Unsere Brüder in Kalifornien bekamen den Auftrag — dort und dort hält sich der entflohene Sybolus auf, schickt ihn heim — und sie gingen hin, lockten ihn aus seinem Hause, betäubten ihn, steckten ihn in eine Kiste und schickten ihn als Frachtgut hierher.«
»Als Frachtgut?«
»Gewiss.«
»Von Amerika bis hierher? Das ist doch eine gar weite Reise, Da muss der eingepackte Mann doch in der Kiste ersticken, vom Verhungern ganz abgesehen.«
»Novacasa, du sprichst nicht gerade überlegend. Oder du willst mich irremachen. Die Kiste könnte doch Luftlöcher haben, es kann ein Reisebegleiter dabei sein, der dem Manne hin und wieder Nahrung reicht. Aber das ist gar nicht der Fall. Du hast doch schon von indischen Fakiren gehört, die sich wochenlang lebendig begraben lassen. Das können aber auch arabische Derwische tun, die Tschuktschen verstehen ganz dieselbe Kunst, selbst auf russischen Dörfern wird diese Zeremonie von einfachen Bauern ausgeübt, aus fanatischer Schwärmerei. Es ist überhaupt ein orientalischer Kultus, aus alter Heidenzeit stammend. Und meinst du, dass wir, die orientalische Kirche, uns nicht damit befasst haben? Wir verstehen die Kunst, das Leben eines Menschen auf Jahre hinaus erlahmen zu lassen, sodass er einem Toten gleicht, und zu jeder Zeit können wir ihn wieder lebendig machen. Ich freilich kann es nicht. Es ist das spezielle Geheimnis der Klostergemeinde vom Athos, seit vielen Jahrhunderten ausgeübt.«
»Da kommt aber doch noch mancherlei in Betracht«, wandte ich immer wieder ein. »Vor allen Dingen die Zolluntersuchung....«
»O, Novacasa, was für ein ungläubiges oder sogar kleingläubiges Herz hast du! Lass dir doch den Bruder Sybolus zeigen, er ist ja hier, sprich mit ihm! Sein Hiersein ist also doch der Beweis, dass er wirklich hier eingetroffen ist. Zolluntersuchung! Läßt sich denn das nicht alles umgehen? Und können wir nicht auch unter den Zollbeamten aller Welt unsere Brüder haben? Ich weiß es nicht, aber wäre es nicht möglich?«
Dieses Gespräch war beendet.
Dass mich alles dies nicht bewog, meinen Fluchtplan aufzugeben, brauche ich wohl nicht erst zu versichern.
Ich spottete dieses heiligen Lichtes und dieser ganzen Kiste!
Ach, ich ahnte nicht, wie mir dieser Spott noch einmal vergehen sollte!
Ich sollte die furchtbare Macht, welche diese fast ganz unbekannte Klostergemeinde auf dem Berge Athos in aller Heimlichkeit tatsächlich ausübt, noch selbst kennen lernen! — —
Der Eunuch pochte. Ich hatte ihm vor meinem Eintritt in das Reich der Liebe gesagt, dass er uns diesmal erst gegen eins rufen sollte, zu welcher Zeit der Mond unterging.
»Nun gute Nacht, schlaf wohl, mein geliebter Freund, auf Wiedersehen morgen Abend!«
Es war der letzte Kuss, den ich ihr gab — ich hielt ihn für den letzten.
Die Nacht war ungewöhnlich finster. Schwarze Wolken verdeckten die Sterne. Aber die See war noch ganz ruhig, trotz eines leisen Windes, und der Ausbruch eines Unwetters war auch nicht zu fürchten. Alles sehr günstig für meine Flucht.
Jetzt hatte ich mich nach dem heute scheinenden Leuchtturm zu richten, und dort in der Ferne waren einige Fenster des Hafenklosters erhellt.
Ich ruderte ab. Da plötzlich erloschen die erleuchteten Fenster, erhellten sich nicht wieder. Nichts konnte mir erwünschter kommen. Hoffentlich blieben sie dunkel. Wurde meine Flucht bemerkt, das heißt, wurde ich zu lange vermisst, fand man mich im offenen Boote weit draußen im Meere, so konnte ich immer noch sagen, dass ich mich verirrt hätte. Denn das Leuchtturmfeuer allein genügte nicht, um sich orientieren zu können.
Also ich änderte meinen Kurs, steuerte nordwärts, ruderte mit Macht, und das die ganze Nacht hindurch.
Nach fünf Stunden graute der Morgen. Es war sehr neblig. Einen Kompass hatte ich ja nicht, hatte kein Licht gesehen, aber verirren konnte ich mich nicht, denn ich befand mich zwischen dem Vorgebirge Athos und der anderen, westlichen Landzunge, Langos genannt, von Hirten bewohnt, an der Küste von Fischern, und es handelte sich nur darum, dass ich diese westliche Landzunge erreichte, so weit nördlich wie möglich. Diese Richtung hatte ich ja ungefähr bestimmen können, musste nur immer den ursprünglichen Südostwind hinter mir haben, der sich wohl nicht so bald ändern würde. Ich war doch Seemann, wirklicher Seemann, nicht nur so eine Zierpuppe von Korvettenkapitän bloß der hohen Geburt wegen, das konnte ich also bestimmen. Nur nach Athos durfte ich nicht wieder hinüberkommen.
Also gegen sechs Uhr morgens begann der neblige Tage zu grauen. Keine Küste, kein Berg, nichts zu sehen. Da stieß mein Boot gegen etwas. Ich ging nach vorn, stach mit dem Ruder — es fand einen nachgebenden Widerstand, eine halbweiche Masse. Ich griff danach, fühlte Kleider — ich zog eine menschliche Leiche empor.

Ich musste erst ein gelindes Grauen überwinden, dann sagte ich mir, dass mir der Himmel hier vielleicht wunderbar zu Hilfe kam, und zog die Leiche völlig ins Boot.
Es war ein Mann, jedenfalls ein griechischer Matrose oder Fischer, der immer durch die schwarze, gestrickte Trikotjacke kenntlich ist. Er musste schon einige Tage im Wasser gelegen haben, sah scheußlich aus.
Nochmals ein Zusammenraffen aller Energie, und ich begann den Mann zu entkleiden. Papiere hatte er nicht in der Tasche, wohl aber am Gürtel ein langes Schiffsmesser in der Scheide, und das war besser als mein Tischmesser, das ich als einzige Waffe mitgenommen hatte.
Die Leinwandhosen passten mir, und glücklicherweise war es eben eine gestrickte Trikotjacke, die sich auch über meinen ganz anders gebauten Brustkasten und über meine Arme spannen konnte. Meine Unterkleidung behielt ich an, dafür bekleidete ich den toten Mann mit meiner Mönchskutte und überlieferte ihn so wieder dem nassen Elemente, in dem er der Natur seine Schuld genau so gut abzahlte wie in der Erde. Er war barfuß gewesen, auch ohne Kopfbedeckung, und nun verzichtete ich als griechischer Matrose auch auf die Sandalen.
Eine Stunde später lichtete sich der Nebel, und ich sah in einiger Entfernung ein Segelboot mit einem halben Dutzend arbeitenden Menschen, ein Netz hochziehend. Jetzt konnte ich im Westen auch eine Küste erblicken, im Hintergrunde Berge.
Es waren griechische Fischer von Langos. Ich gab mich für einen korsischen Matrosen aus, eben für den Napoleon Bonaparte Novacasa, erzählte von dem Schiffbruch der ›Kawassi‹ am Vorgebirge Athos, ich hätte ein Boot gefunden...
Die Fischer wollten meine Erklärung gar nicht hören, sondern waren herzlich erfreut, dass ich gleich mit zugriff, um das schwere Netz mit einzuziehen, was die sechs Mann sonst nicht fertiggebracht hätten, da ich, wie mir die Leute nachher versicherten, für vier Mann arbeitete. Übrigens war es kein so reichlicher Fischzug, sondern das Netz hatte sich voll Schlamm gesackt und wäre verloren gewesen, wenn ich nicht gekommen wäre.
Dann ging es der Küste zu. Wir hatten gegen eine Strömung furchtbar zu pullen, und da sich ein Manu die Hand arg gequetscht hatte, so war ich als Ruderknecht immer noch hochwillkommen.
Weitere Einzelheiten überspringe ich. In dem Fischerdorf lag ein kleiner Dampfer, der die Vorräte von getrockneten Fischen aufkaufte. Der Kapitän nahm mich an, es ging nach Saloniki. Hier musterte ich nach Neapel an, welches ich am neunten Tage meiner Flucht erreichte.
An das heilige Licht und an die geheimnisvolle Kiste dachte ich schon gar nicht mehr. Ich hatte ein famoses Abenteuer erlebt — basta!
Neapel ist ja nun eine andere Hafenstadt als Saloniki, da hat ein Seemann reichliche Auswahl. Aber wollte ich nicht an Land Beschäftigung für meine Hände suchen, so musste ich immer wieder als Matrose gehen. Einige Vorbereitungen gehörten immerhin noch dazu, ehe ich das Steuermannsexamen ablegen konnte, und ich hatte gerade so viel ausgezahlt bekommen, um mir das nötige Arbeitszeug anzuschaffen; auf Seestiefel und Ölzeug musste ich sogar verzichten, und für das, was mir dann noch übrig blieb, kaufte ich mir einige nautische Lehrbücher.
Ich kam sofort auf einem deutschen Dampfer an, der nach Pernambuco ging, von dort die Ostküste von Südamerika abklappernd. Kapitän Reimann war ein famoser Kerl. Er wollte mir, nachdem er mein Seefahrtsbuch gelesen und mich gemustert hatte, gar nicht glauben, dass ich ein französischitalienischer Korse sei, ich müsste doch unbedingt unverfälschtes germanisches Blut in meinen Adern haben. Aber es blieb mir ja nichts anderes übrig, als ihm zu versichern, dass ich wirklich der Matrose Napoleon Bonaparte Novacasa aus Brasidello bei Bastia auf Korsika sei, und ich hätte eben ein besonderes Sprachentalent, daher hätte ich mir auch die deutsche Sprache so leicht angeeignet.
Kapitän Reimann hätte mich sogar sehr gern als Bootsmann angenommen, dessen Stelle noch unbesetzt war. Aber ich war noch zu jung dazu. Denn da nützt keine körperliche Kraft, um sich bei der Mannschaft in Respekt zu setzen, da gibt nur das Alter den Ausschlag. Es wäre an Bord fortwährend zu Widersetzlichkeiten gegen mich gekommen.
So ging ich als Matrose mit. Hoffentlich das letzte Mal. In Rio de Janeiro gedachte ich mein Steuermannsexamen zu machen, obgleich ich gar nicht plante, mich ganz dem Seemannsberufe zu widmen.
Wir nahmen auch Passagiere mit. Das tut überhaupt jeder Frachtdampfer. Es sind immer einige Kabinen vorhanden, welche an Passagiere vermietet werden, als erstklassige, und es gibt genug Menschen, welche nicht gern mit einem eigentlichen Passagierdampfer fahren. Wenn auch das Geld bei ihnen gar keine Rolle spielt, ziehen sie aus gewissen Gründen doch einen einfachen Frachtdampfer vor, obgleich das gar nicht billiger ist, da die Reise viel länger dauert und sie für ihr Geld doch nicht solchen Luxus haben, manche Bequemlichkeit entbehren müssen. Ich würde als Passagier auch lieber mit einem Frachtdampfer fahren. Man ist da Hahn im Korbe. Die wenigen Mitreisenden bilden in der Kajüte eine wirkliche Familie. Man bringt sich seine eigenen Konserven und Buttels mit, bestellt beim Koch seine Leibspeisen. Der Dampfer stoppt auch einmal, um eine Jagd auf Delfine zu veranstalten. Man kann auf der Kommandobrücke seinen Grog trinken, lässt sich vom Kapitän und seinen Matrosen Geschichten erzählen, und das alles ist doch auf einem regulären Passagierdampfer ganz ausgeschlossen.
Die ›Helvetia‹ hatte drei Fremdenkabinen mit zusammen sechs Kojen. Sie waren von einer spanischbrasilianischen Herrschaft belegt, bestehend aus Dona Levala Goyaz und ihrem Neffen, Don Manuelo Ricalan, einer Kammerfrau und einer Kammerzofe, einem Kammerherrn und einem Kammerdiener.
Es war eine alte Dame mit einem Zahne. Denn dieser einzige Zahn war die Hauptsache an ihr, wenigstens für mich. Das gelbe Monstrum ragte in der Mitte des Mundes einen Zoll weit über die Unterlippe hervor, und wenn ich die Dame anblickte, so sah ich nur diesen Zahn und dachte mir mein Bestes.
Der Neffe war auch nicht mehr jung, hatte ein abgelebtes Gesicht, und sonst habe ich nur zu sagen, dass er mit dem Kammerherrn auf sehr vertrautem Fuße zu stehen schien.
Die ganze Mannschaft wurde gleich wegen dieser Passagiere instruiert, besonders wegen der Dona. Wir sollten uns absolut nicht um sie kümmern. Und wenn sie auch an Deck ausglitte und stürze, niemand dürfe sie anfassen. Nicht einmal nach ihr blicken. Sie sei menschenscheu, oder noch richtiger, eine rabiate Männerfeindin, wurde uns so im Vertrauen gesagt. War eine Anrede unvermeidlich, dann nicht Dona Goyaz oder nur Dona, sondern nur Dona Privilega. Das sei in der brasilianischen Republik ein stehengebliebener altspanischer Titel, etwa einer Reichsgräfin entsprechend. Das hinge damit zusammen, weil schon ihre Vorfahren im Innern Brasiliens eine Besitzung gehabt hatten, die dann zur Provinz erhoben wurde, deren Verwaltungskosten sie aus ihrer Tasche bezahlte, und diese ganze Provinz war noch immer Eigentum der unverheirateten alten Dame, größer als ganz Deutschland. Und was die nun alles sonst noch besaß: Bergwerke und dergleichen, Diamantenminen, und auch bares Vermögen, viele Millionen...
Na, ich stand nicht mehr in den allerersten Reihen des Hofkalenders, auch nicht in den allerletzten — ich war jetzt ein Matrose, der für die Arbeit seiner schwieligen Fäuste monatlich sechzig Mark bekam, und mit den Augen eines solchen schaute ich mir die alte Dame an.
Herrgott im Himmel, war das ein Ekel!! Von dem Hauzahne will ich nicht sprechen, dafür konnte sie nichts, und falsche Zähne sind nicht jedermanns Sache. Dass sie so klapperdürr war, dafür konnte sie noch weniger. Dass sie immer schwarz ging, war ihr Geschmack. Aber ein anderes Kleid hätte sie sich doch einmal kaufen können! Das hier war mindestens schon ein Vierteljahrhundert alt, alles aufgeschlitzt und voller Fett- und Dreckflecke! Und nun diese Spinnenfinger, diese langen, schmutzigen Nägel, noch schmutziger die ganze Hand! Und sie mochte auch ein Gelübde abgelegt haben, niemals ihr Gesicht mit Wasser und Seife in Berührung zu bringen. Das grausträhnige, wirre Haar schließlich voller... ich muss es sagen, so leid es mir tut... dick voller Läuse!
Sie hatte aber nicht etwa eine lange Seereise hinter sich, wo so etwas auch einmal in der besten Familie vorkommt, sondern sie hatte schon vier Wochen an Land geweilt, in den vornehmsten Hotels. Sie war in Rom gewesen, um sich vom Papst den Segen erteilen zu lassen. Nur deshalb hatte sie diese Reise gemacht. Und immer voller Läuse!
»Hätte ich das gewusst!«, hörte ich einmal den Kapitän außer sich zum ersten Offizier sagen. »Kann sich die mit allen ihren Millionen nicht einmal ein Büchschen Läusesalbe kaufen!«
Der Kapitän musste für die Mitnahme dieser Passagiere ein gutes Sümmchen in seine eigene Tasche stecken können, dass er überhaupt auf solche Bedingungen eingegangen war. Er hatte auch seine ganze Kajüte vermietet; wenigstens während der Hauptmahlzeiten durfte sie auch nicht von ihm betreten werden. Außerdem musste für diese Brasilianer extra gekocht werden, lauter präservierte Gemüse, soweit die mitgenommenen frischen nicht reichten, denn die Dona Privilega lebte mit ihrem Gefolge nur vegetarisch, und dabei hatte sie das allerbilligste Zeug eingekauft, halb verrottet. Alles musste in Olivenöl von der schlechtesten Sorte zubereitet werden, auch bei dem frischesten Seewind stank immer das ganze Schiff wie ein Tran auskochender Walfischfänger. Ferner durfte sich eine Stunde des Vormittags und eine Stunde des Nachmittags. wenn sich die Dona an der frischen Luft ergehen wollte, kein Mann an Deck zeigen, und wer das Schiff zu durchkreuzen hatte, musste seinen Weg unter Deck nehmen. War während dieser Zeit unumgängliche Arbeit an Deck nötig, so musste dies erst der Dona gemeldet werden, damit sie nur ja keinen fremden Mann zu Gesicht bekam. Und so gab es noch eine ganze Menge anderer Bedingungen, auf die der Kapitän eingegangen war, ohne vorauszusehen, wie schwer sie zu erfüllen sein würden.
Ein Matrose hatte mit der niedlichen Kammerzofe angebändelt. Sie erzählte ihm, wie's bei der zu Hause und auch sonst zuging. Ich kann's nicht wiedergeben. Die Feder sträubt sich dagegen. Ein Dreckigel erster Güte, und alles das nur aus Geiz, während sie andererseits doch wieder Geld genug hinauswarf.
Nur nicht für sich selbst. Sie sparte buchstäblich die Seife. Nur ihr Seelenheil ließ sie sich etwas kosten. Übrigens dauerte das Verhältnis zwischen meinem Maaten und der Kammerzofe nicht lange.
»Dee hädd ook Lüüs!!«
Wir bekamen sie alle zusammen. Wie hätte es denn auch anders sein sollen!
Eine Merkwürdigkeit muss ich noch berichten. Die brasilianische Gesellschaft war von Pernambuco mit einem Bremer Lloyddampfer nach Havre gefahren, von hier durch Europa nach Rom die Eisenbahn benutzend, und während der vierzehntägigen Seereise hatten sie immer Windstille gehabt, oder doch ganz ruhige See, von allen Mitreisenden hatte kein einziger auch nur einen Anflug von Seekrankheit bekommen. Das ereignet sich im Atlantischen Ozean bei so langer Dauer doch selten!
Und noch merkwürdiger! — Neptun und alle Windgötter mussten sich mit dieser Dona Privilega verbunden haben — oder sie gingen ihr ängstlich aus dem Wege — wir fuhren durch das Mittelländische Meer wie über einen Spiegel — wir waren schon drei Tage ans der Straße von Gibraltar heraus, und auch der Atlantische Ozean, der noch vor einer Woche furchtbar gewütet haben sollte, lag wieder wie ein Spiegel vor uns.
»Na, täuft (wartet) nur, morgen wird's schon kommen«, sagten wir, die wir etwas davon verstanden.
Und richtig! Der kaum merkliche Westwind wurde immer stärker; am nächsten Tage hatten wir einen ganz hübschen Seegang.
Die Stunde kam, in der sich die Dona Privilega an Deck erging, und wir erhielten zu unserer Verwunderung dennoch die Order, das Deck zu verlassen. Noch immer nicht seekrank? Na, es würde schon kommen!
Wir hatten an Deck nichts zu tun, ich war überhaupt von der Freiwache — wir zogen uns ins Logis zurück, schlossen die Tür, konnten aber durch ein Guckloch das ganze Deck überschauen, durften nur uns selbst nicht erblicken lassen.
Die alte Schachtel erschien, vergewisserte sich, dass sich der wachthabende Offizier und der Mann am Ruder auf der Brücke vorschriftsmäßig durch gezogene Leinwand unsichtbar gemacht hatten, und begann nun an Deck mit schnellen Schritten auf und ab zu fegen, und so oft wir es auch gesehen hatten, wir konnten uns doch unter heimlichem Kichern nicht satt daran sehen. Es sah nämlich wirklich drollig aus, wie die alte Hexe mit ihrem zerlumpten Kittel auf ihren abgelatschten Schuhen hin und her fegte, anders lässt es sich nicht bezeichnen, und dass es heute immer auf und ab ging, schien ihr ganz besonderes Vergnügen zu machen. Grinsend fletschte sie vor Vergnügen ihren einzigen Hauer, klatschte in die schmutzigen Spinnenfinger, dass man die Nägel klappern hörte, und trieb andere Kapriolen. Dazwischen fing sie auch einmal zu beten an, machte Knickse, kniete nieder und drehte den Rosenkranz.
Ganz richtig war es mit der nicht. Sie sollte 64 Jahre alt sein, so sah sie ja auch aus, machte aber sonst noch einen ganz rüstigen Eindruck, flink war sie wie ein Wiesel.
Wieder war sie niedergekniet, blieb diesmal recht lange liegen, endlich erhob sie sich schwerfällig, wankte, rutschte aus — und nun ging es los. Nicht über die Bordwand, sondern gleich so, wie sie lag — das ganze in Öl gekochte Sauerkraut kam wieder heraus, und jetzt mussten wir glauben, dass sie bei jeder Mahlzeit wie ein Scheunendrescher futterte — es war eine ganz unheimliche Menge, die sie herausbeförderte — und dann wälzte sie sich mit Behagen drin herum.
Bis jetzt konnten wir noch lachen. Bald aber wurde die Sache bedenklich. Ein ganz ansehnlicher Brecher kam über, das Deck überschwemmend, und dort kam noch ein ganz anderer angerollt, der konnte unter Umständen bei ihrer Magenleere die Dona Privilega mitnehmen.
Schon brüllte auch der Steuermann, die Dame zu bergen, ich stand dicht an der Tür, also ich musste sowieso der erste sein — und ich hinaus und die alte Schachtel gerade noch aus der Woge herausgeholt, mit der sie ganz sicher über Bord gegangen wäre.
Sie hing mir wie ein Bündel nasser Wäsche über dem Arm, hatte entdeckt, dass ihr Magen immer noch etwas enthielt, was sie mir jetzt auf die Hosenbeine spuckte. Was nun? Die Bootsmannspfeife schrillte, alle Mann an Deck, die Segel mussten festgemacht werden.

Nun, ich konnte die Dame nicht fahren lassen, trug sie nach der Kajüte, um sie den Händen ihrer dienstbaren Geister auszuliefern.
Jawohl! Eben als ich mit meiner Bürde die Kajüte betreten wollte, schoss mir, wie aus einer Kanone gefeuert, die Kammerzofe entgegen und hätte mir beinahe ihren ganzen Mageninhalt direkt ins Gesicht geklatscht, und in der Kajüte selbst lag der Don Manuelo auf seinem lieben Kammerherrn und taufte ihn mit in Öl gekochtem Sauerkraut, während die Kammerfrau mit dem Kammerdiener die Sache ganz still in einem Winkel abmachte, nur mit den dazu nötigen Orgeltönen.
Von denen war keine Hilfe zu erwarten. Ich rief den Steward, suchte ihn, fand ihn in der Pantry. Steht da der Kerl und füllt eine Punschterrine mit schon halbverdauten Pökelrippchen und Klößen! Und sogar Pflaumen hat er dabei, wo's doch heute gar keine gegeben hatte!!
»Ich — ich — sterb... ooohahahahaha!!!«
Das heißt, lachen konnte er nicht etwa.
So war ich ganz auf mich selber angewiesen. Als ich einmal versuchte, die Dona Privilega auf ihre abgelatschten Schuhe zu stellen, fiel sie sofort wieder um, verbarg ihr von Sechsbeinern wimmelndes Köpfchen an meiner Brust und bewies mir, dass sie noch immer genug Proviant im Magen habe, um ein Ferkelchen großzuziehen.
Ich schleifte sie in ihre Kabine. Herrgott, war da drin ein Gestank! Jetzt gab es bei mir aber auch kein Zaudern mehr. Bei der Seekrankheit hört ja überhaupt alles auf. Ach, Gott, was kommt da auf Passagierschiffen vor!
Die Kleider der Dona waren triefend nass. So konnte ich sie nicht in die Koje legen, und außerdem war sie stark geschnürt. Hätte sie gar nicht für so eitel gehalten. Also, ich knöpfte auf. Das Hemd — Himmelherrgott, sah das aus! Und was ich da sonst noch alles zu sehen bekam! Und wie das duftete! Ich wurde selber ganz seekrank.
Was ich als Korsett gehalten hatte, erwies sich als ein ganz gemeiner Strick, den sie fest um den Leib trug. Wahrscheinlich eine Reliquie, an dem Stricke hatte sich vielleicht ein Heiliger aufgehangen.
Ich machte, dass ich fertig wurde, suchte nicht erst nach einem anderen Hemd, legte das Knochengerippe so, wie Gott es erschaffen hatte, in die Koje, packte es mit wollenen Decken zu und eilte an Deck zur Arbeit.
Das Wetter wurde immer schlechter — wir bekamen von der ganzen Gesellschaft überhaupt niemand wieder zu sehen, kümmerten uns nicht darum, was sie trieben. Nur zufällig hörte ich einmal, dass die Dona Privilega ihre Koje überhaupt nicht wieder verließe. So erreichten wir Pernambuco. Meine Wache hatte einen langen Arbeitstag hinter sich, so schlief auch ich, als wir in den Hafen einliefen, und als ich wieder an Deck kam, hatte die spanische Gesellschaft das Schiff schon verlassen.
Wir wollten einige Fracht abgeben und andere einnehmen, vor allen Dingen auch Kohlen, was zwei Tage in Anspruch nehmen würde.
Es war am Abend des ersten Tages, ich war von der Freiwache, machte wie meine Maate Toilette, um dem Lande einen Besuch abzustatten, als mir ein Matrose von der Wache meldete, ich solle ›achterrut‹ zum Käpten kommen.
»Der Don ist auch wieder an Bord gekommen, mit einer fremden Dame.«
Ich achtete nicht weiter darauf, dachte nur an den Kapitän, was der mir zu sagen hätte.
In der Kajüte war richtig der Don Manuelo mit dem abgelebten Gesicht, außerdem noch eine jüngere, höchst elegante, wirklich hübsche Dame, der Kapitän machte soeben ein Kompliment vor ihnen.
»Hier ist der gewünschte Matrose. Novacasa, die Herrschaften möchten Euch sprechen.«
Der Kapitän sprach und hatte die Kajüte verlassen, mir zuvor unter einem Augenblinzeln noch einen Rippenstoß gebend, den ich mir nicht zu deuten wusste.
Don Manuelo pflanzte ein Monokel ins Auge, die Dame bediente sich einer Lorgnette, so beäugten die beiden mich, der ich mit der Mütze in der Hand neben der Tür stand, und es machte mir großen Spaß, in solch dienender Stellung mich so betrachten zu lassen.
»Ha, wenn ihr Menschlein wüsstet...«, dachte ich bei solchen Gelegenheiten immer.
»Ach, Sie sprechen Französisch?«, fing der Don zu näseln an.
Ich bejahte.
»Ach, mein lieber Freund — treten Sie doch mal näher!«
Ich marschierte gehorsam bis an den Tisch.
Nachdem mich die beiden in dieser Nähe genau gemustert hatten, tauschten sie verständnisvolle Blicke, nickten zufrieden, flüsterten miteinander, was ich nicht verstand. Spanisch war es wohl, doch das hätte ich verstehen, zur Not auch sprechen können — es musste ein besonderer Dialekt sein.
»Monsieur Napoleon Bonaparte«, begann der Don wieder zu näseln, jetzt aber in ganz feierlichem Tone, »ich habe Ihnen eine glänzende Offenbarung zu machen.«
»Mir eine glänzende Offenbarung? Da bin ich doch gespannt.«
Ich dachte im Augenblick an eine Anstellung an Land; die brauchten vielleicht einen handfesten Mann.
»Die Dona Privilega — Levala Goyaz — wünscht Sie — zu heiraten.«
Es war heraus. Ich hatte recht gehört, daran war gar kein Zweifel, und mir war doch gerade, als ob mir jemand mit einer Handspeiche ins Genick haute.
»Die die die — Dona Pripriprivilega — mimimich — heiraten?!«, konnte ich nur stottern.
»Jawohl. Die Sache ist folgende: Was für eine geschworene Männerfeindin die Dona Privilega bisher gewesen ist, haben Sie wohl schon gehört, mussten es ja selbst merken. Allein es hat eben nur die Gelegenheit gefehlt. Sie ist in Liebe zu Ihnen entbrannt.«
Ich hatte es wiederum ganz deutlich gehört — aber im Augenblick sah ich nur das klapperdürre Scheusal, wie ich es in die Koje legte, den einzigen Zahn wie ein Elefantenhauer zum Munde herausragend — von der sonstigen Sudelei will ich gar nichts erwähnen — und ich wurde immer fassungsloser.
»Ach nee, ach nööö — Sie scherzen doch nur!«
»Es ist so. Die Dona selbst sucht den Umschwung in ihren Gefühlen damit zu begründen, dass sie sagt, Sie hätten ihre jungfräuliche Ehre lädiert.«
Er gebrauchte wirklich diesen Ausdruck, die junge Dame nickte dazu gravitätisch, ich glaube sogar, sie wiederholte das Wort — mir aber kam dies alles im Augenblick durchaus nicht lächerlich vor.
»Ich — ihre jungfräuliche Ehre lädiert?!«, rief ich entsetzt.
»Haben Sie sie nicht angefasst und fortgetragen?«
»Das musste ich, weil....«
»Haben Sie sie nicht ausgezogen?«, stimmte jetzt auch die junge Dame ein.
»Sogar das Hemd?«, sekundierte ihr der Don.
»Das geschah doch nur aus Mitleid«, suchte ich mich jetzt zu verteidigen, »ich konnte sie doch nicht so....«
»Das bleibt sich ja alles ganz gleich«, fiel mir die Dame ins Wort. »Kurz, Dona Privilega bietet Ihnen ihre Hand an.«
Ich raffte mich energisch auf.
»Nich in die la main«, sagte ich, halb Deutsch, was aber wohl verstanden wurde.
»Sie schlagen ihre Hand aus?«
»Ich denke ja gar nicht daran, diese einzahnige Vogelscheuche zu heiraten.«
So, nun war es heraus. Es machte auf die beiden gar keinen Eindruck. Wer von ihnen zur Zeit sprach, ist gleichgültig.
»Wissen Sie auch, was Sie da ausschlagen?«
»Sie meinen wohl Geld?«, kam ich verständnisvoll entgegen.
»Ja, Geld und Geldeswert.«
»Und wenn dieses Gerippe ganz vergoldet wäre...«
»Eine Vergoldung reicht da nicht aus.«
»Und wenn jeder ihrer Knochen aus purem Golde bestände...«
»Das reicht bei der Dona Privilega noch immer nicht aus. Setzen Sie sich, lieber Herr.«
Ich hatte es auch sehr nötig — meine Knie versagten schon den Dienst.
»Lassen Sie sich erzählen, wer diese Dona Levala Goyaz ist!«
Und ich bekam es zu hören. Ich habe es schon geschildert. Jetzt aber, da ich saß, kehrten auch meine körperlichen wie geistigen Kräfte zurück, und ich vernahm, dass die beiden immer nur von dem 10 000 Quadratmeilen großen Landbesitz der Dame sprachen, von den vielen, vielen tausend Ochsen und Pferden, die nach einer Heirat alle mir gehören würden, aber gar nicht von den Gold- und Diamantenminen, nicht von den noch vorhandenen baren Millionen. Das fiel mir auf, so weit war ich jetzt doch wieder hergestellt.
»Erlauben Sie mal — Sie sprechen immer nur von Ackerbau und Viehzucht — die Dona Privilega besitzt doch auch Goldgruben und Diamantenminen.«
Nichts schien den beiden erfreulicher, als dass ich jetzt überhaupt auf das Thema einging. Freilich war bei mir von so etwas keine Rede. Ich hatte nur etwas gewittert — die beiden wollten mich doch aus irgendeine Weise übers Ohr hauen.
»Gewiss, gewiss, Goldgruben und Diamantenminen«, beeilten sich die beiden einstimmig zu versichern, »aus denen allein unsere Tante jährlich gegen eine Million Milreis bezieht.«
»Und das alles fällt mir zu?«
»Alles, alles — die ganze Provinz Goyaz mit allem, was sich darin befindet.«
»Es sollen doch auch noch einige Millionen Milreis bar vorhanden sein.«
Aha — jetzt kam der wunde Punkt — die beiden wechselten schon Blicke!
»Woher wissen Sie das?«
»Nun, ich habe es gehört.«
»Lassen Sie sich den ganzen Sachverhalt erklären.«
Und ich erhielt die Erklärung.
Dona Goyaz war eine alte Jungfer, diese beiden ihre nächsten Verwandten, Neffe und Nichte, die aber dereinst nichts erben würden, keinen Milreis und keinen Ochsenschwanz. Eben weil sie unverheiratet sterben wollte. Dann erbte der Staat die ganze Provinz, die Dame konnte gar nicht anders darüber verfügen, daher eben ›Dona Privilega‹. Sie hatte auf den ungeheueren Landbesitz nur Privilegien, und alles Übrige, was nicht zu diesem Grundbesitz gehörte, vor allen Dingen ihr bares Geld, hatte sie bereits der Kirche vermacht.
Dies alles änderte sich, sobald die Dona heiratete. Dann verfiel bei ihrem Tode die ganze Hinterlassenschaft dem Manne. Die Kirche hatte dann auch kein Anrecht mehr auf das ihr schon Vermachte, selbst wenn das ursprüngliche Testament nicht aufgehoben war, höchstens den vierten Teil hätte sie auf Prozesswegen noch erlangen können.
Das ist eben ein brasilianisches Gesetz, dass die Kirche nichts erben kann, kein Geschenk annehmen darf, solange einer der beiden Ehegatten noch lebt oder Kinder vorhanden sind. Eigentlich doch höchst eigentümlich in dem sonst bigotten Brasilien. Da hat man aber mit der Kirche schon so üble Erfahrungen gemacht, dass dieses Gesetz geschaffen worden ist.
»Kurz, eine Heirat der Dona Privilega hebt alle diese Bestimmungen, auch wenn sie sie selbst getroffen hat, wieder auf. Sie kann gar nicht mehr anders verfügen. Durch Heirat werden Sie Mitbesitzer der Provinz und des Geldes und von allem nach dem Tode der Dona der einzige Erbe. Verstehen Sie?«
O ja, ich verstand recht wohl — nur eins nicht.
»Weshalb sind Sie denn so interessiert, dass weder Staat noch Kirche erbt?«
Ja, ich hatte das Richtige getroffen, ich sah es gleich an den wieder gewechselten Blicken.
»Nun, dass weder Staat noch Kirche erbt, darauf kommt es uns weniger an. Es handelt sich um uns selbst. Sie gestatten wohl, dass auch wir einen kleinen Nutzen davon haben. Arrangieren wir die Sache so: Kommt die Heirat zustande, so erhalten Sie ja zunächst alles, wenigstens den Nießnutz — und nach dem Tode der Dona bekommen Sie die ganze Provinz Goyaz mit allem, was sich darin befindet — uns aber vermachen Sie das bare Vermögen und alles, was sonst noch außerhalb der Provinz Goyaz der Dona Privilega gehört. Und das machen wir sofort notariell aus — noch heute Abend. Es ist schon alles bereit dazu.«
Ich hatte Ähnliches erwartet, hatte mich aber auch unterdessen gewappnet.
»Wie kommen Sie eigentlich zu diesem Vorschlage?«, fing ich jetzt an.
»Wie wir dazu kommen?!«, fuhren die beiden empor.
»Ich denke, die Dona Privilega hat sich in mich verliebt?«
»Hat sie auch.«
»Ich denke, die Dona Privilega bietet mir ihre Hand an?«
»Tut sie auch.«
»Will mich heiraten?«
»Will sie auch.«
»Nun gut — was bin ich denn da Ihnen schuldig? Wie können Sie denn da von solch einer Teilung sprechen? Ich gehe einfach hin zu der Dona Privilega — hier hast du mich, sage ich — und fertig ist die Sache. Wie können Sie denn da eine solche Teilung verlangen?«
Die beiden entrüsteten sich nicht mehr, aber es war ein böses Lächeln, was sie jetzt gleichzeitig zeigten.
»Nein, mein geehrter Herr, so einfach ist die Sache nicht. Wissen Sie denn, wo sich die Dona Privilega befindet?«
»Ich werde sie schon finden.«
»Das werden sie eben nicht! So klug sind wir auch gewesen. Wir halten sie gefangen — wenn sie auch noch nichts davon weiß.«
»Dann ist das ja ein ganz gemeiner Gaunertrick!«, rief ich entrüstet.
Da lenkten sie wieder ein, appellierten an mein wirklich so weiches Herz, jammerten mir von ihrer eigenen Not vor, wie sie samt ihren unmündigen Kindern so furchtbar schwer mit einem grausamen Schicksal zu ringen hätten, wie die geizige Tante sie so ganz und gar im Stiche gelassen hätte usw. usw., und ob ich denn wolle, dass der Staat und die Kirche dieses ganze ungeheuere Vermögen schlucken sollten.
Und da hatten sie mich wirklich gefasst! Ich war schon allein von ihrer persönlichen Not gepackt worden, und nun gar Staat und Kirche erben — nein, das war das Letzte, was ich vertragen konnte.
Schon wollte ich meine Zusage geben, als vor meinen geistigen Augen wieder das weibliche Knochengerippe auftauchte, mit oder ohne Hemd — der Elefantenhauer und der kribbelnde Kopf blieben.
»Nein, nein, Sie verlangen etwas ganz Unmögliches von mir!!«, schrie ich in wahrer Verzweiflung. »Die heiraten? Niemals, lieber den Tod!«
Aber die beiden hatten schon gemerkt, wie ich bereits schwankend geworden war.
»Ach, das ist ja nur pro forma, die ist doch schon viel zu alt für eine wirkliche Ehe!«
»Hören Sie, das glaube ich nicht! Die ist noch gar nicht so alt!«
»Sie ist ja schon fünfundsechzig!«
»Die Sara war noch viel älter!«
»Ach, das ist bei der doch etwas ganz Anderes«
»Nein, nein, sie sieht noch ganz lebenskräftig aus!«
»Sie lebt kein Jahr mehr.«
»Sie überlebt vielleicht noch mich!«
»Wir wissen sogar ganz bestimmt, dass sie in diesem Jahre stirbt«, versicherten diese zärtlichen Verwandten.
»Woher wollen Sie denn das wissen?«
»Ich habe es mir von einer weisen Frau aus den Karten sagen lassen«, erklärte die Nichte.
»Und Professor Menton, der berühmte Londoner Astrologe, an den ich extra deswegen telegrafierte, hat es bestätigt«, setzte der Neffe hinzu.
»Außerdem hat es Doktor Trompa, den sie vor einem Vierteljahre konsultierte, uns selbst gesagt«, erklang es dann gemeinschaftlich, »sie hat die galoppierende Lungenschwindsucht, sie kommt noch in diesem Jahre unter die Erde.«
Auch noch die Schwindsucht, sogar die galoppierende! Herz, was begehrst du mehr?
Und die beiden ließen nicht locker. Es wäre gar nicht nötig gewesen, dass sie noch Champagner anfahren ließen. Ich konnte doch zehnmal so viel vertragen wie die beiden zusammen.
Ich will es gestehen — es ist ja keine so große Schande: In gewisser Hinsicht bin ich ein Schwächling.
Ich kann nicht Nein sagen. Wenn mich jemand beschwört, er könne nicht selig werden, wenn ich nicht meine Seele dem Teufel verschriebe — ich würde es tun... und noch etwas ganz Anderes.
Immer schwächer wurden meine Ausflüchte.
»Aber sie hat ja Läuse!«, rief ich verzweifelt.
»Die suchen Sie ihr ab, das gehört hier überhaupt zum guten Ton, die kriegen Sie übrigens selber noch«, wurde ich beruhigt.
Darin hatten sie auch ganz recht. Da liest man so viele Beschreibungen, die Land und Leute Spaniens schildern wollen. Das Charakteristischste fehlt aber dabei, wohl nur eine törichte Scham ist daran schuld. Ich bin in Madrid und in anderen spanischen Städten gewesen. Und da sieht man überall auf den Balkons der vornehmsten Häuser die feinsten Damen sitzen, die nichts weiter tun, als sich gegenseitig jene Tierchen abzulesen und sie mit graziöser Handbewegung auf die Straße zu werfen. Wer dem nicht beistimmen kann, ist nicht in Spanien gewesen, nicht einmal in Gibraltar. Das ist dort nichts Anderes, als wenn wir Mücken verscheuchen — und im Grunde genommen ist es auch nichts anderes! Kann man sich nicht vorstellen, dass es ein Land geben könnte, in dem eine Gesellschaft in Ohnmacht fallen würde, wenn es einem einfiele, sein Taschentuch zu ziehen und sich öffentlich die Nase zu schnäuzen? Das ist keine Parabel, sondern das war noch vor hundert Jahren Tatsache! Skandal, o, unerhörte Schande, seine Bedürfnisse so öffentlich zu verrichten! Es gibt auch einen Zukunftsroman, die Menschen haben den Mars erreicht, und die Marsbewohner sind außer sich vor sittlicher Entrüstung, dass die Menschen ganz öffentlich essen.(1) Der Hunger wird auf dem Mars in einem geheimen Kabinett gestillt.
(1) Gemeint ist offenbar der 1897 erschienene Roman Auf zwei Planeten von Kurd Laßwitz.
Doch an so etwas dachte ich damals nicht.
»Wenn sie mir aber nun beim ersten Kuss mit ihrem Zahne die Nase abbeißt?«, wehrte ich mich mit meiner letzten Widerstandskraft.
»Dann ruppen Sie ihr den Zahn vorher aus«, wurde mir geraten.
»Wenn sie sich das aber nun nicht gefallen lässt?«
»Dann schlagen Sie ihr den Zahn einfach ein.«
Solch einer Hartnäckigkeit war ich nicht gewachsen.
Ehe ich mich dessen noch versah, waren wir schon unterwegs. Mein Staatskleid hatte ich ja schon angehabt. Ich war wie betäubt, und daran konnte nicht das Gläschen Champagner schuld sein. Auch hineingegossen brauchten sie nichts zu haben. Es war eben meine verfl... Schwäche.
Eine Viertelstunde später befand ich mich bereits in einem erleuchteten Schreibzimmer vor einem Herrn mit einer Brille, der mir etwas Spanisches vorlas und mir dann die Stelle zeigte, wo ich meinen Namen hinsetzen sollte.
Napoleon Bonaparte Novacasa — da stand es.
»Heißen Dank, Señor Privilegor, welchen Ehrentitel Sie von jetzt ab führen. Nun wollen Sie doch gleich Ihre Braut aufsuchen?!«
Man schob mich in eine Droschke, ich befand mich in einem anderen Zimmer, und ich sah nur einen einzigen gelben Zahn von Zolllänge, der mir entgegenschwebte.
»Mein Novacasa, ach, wie ich mich schäme!«, knarrte das Loch, aus dem dieser Zahn hervorragte, und der leibhaftige Tod schlang seine Knochenarme um meinen Hals.
Dann saß ich, immer noch halb oder sogar ganz betäubt, auf einem Sofa und hatte auf meinem Schoße einen Haufen Lumpen mit Knochen, hörte etwas von jungfräulicher Scham und jungfräulichem Himmelsglück knarrend flüstern.
»Lass dich küssen, mein Einzigstgeliebter, der du allein meinen jungfräulichen Stolz zu bezwingen gewusst hast.«
»Aber mir nicht die Nase abbeißen!!!«
Ich weiß nicht, ob ich es wirklich geschrien oder nur gedacht habe. jedenfalls ging es gut ab — ich habe heute noch mein vollständiges Riechorgan.
»Nun will ich Toilette machen. Da darfst du noch nicht dabeisein — aber dann, aber dann...«
Sie fletschte kokettierend ihren Zahn, griff daran, als sie schon in der Türe stand, ich dachte, sie wollte ihn herausreißen und mir zuwerfen, aber es war nur ein Kusshändchen, und ich war allein.
Doch so ganz kam mir das gar nicht zum Bewusstsein. Ich lag ächzend auf dem Sofa, nur gezwungen, immer in den Haaren zu kratzen.
»Dieser Frackanzug wird Ihnen passen«, sagte irgend jemand, »er ist vom Oberkellner, der ein mächtig dicker Kerl ist. Hier ein Oberhemd, hier die Lackschuhe.«
Der Irgendjemand war mir auch bei der Toilette behilflich, hoste mich aus, hoste mich wieder an, stülpte das Oberhemd über meinen Kopf, knöpfte mir den Kragen an.
Ich tat alles ganz mechanisch oder ließ mir alles gefallen. Es musste mir doch etwas in dem Glas Champagner beigebracht worden sein. Ich war wie vor den Kopf geschlagen.
»So, tadellos! Nur die Beinkleider sind Ihnen etwas zu eng, sie sind hinten schon aufgeplatzt, aber das macht nichts, der Frack hängt ja drüber. So, da wollen wir abfahren!«
Ich saß abermals in einer Droschke, neben mir wieder der leibhaftige Tod, jetzt aber in einem weißen Gazekleid, durch das ich seine ganze Knochenstruktur bewundern konnte. In der knöchernen Faust hielt sie anstatt Hippe und Stundenglas ein Rosenbukett.
Eine weite Halle mit brennenden Kerzen, eigentümlich gekleidete Jungen, die rauchende Töpfe schwangen, Gesang... ich glaube gar, ich befand mich in einer Kirche!
»Willst du diese Jungfrau, Dona Privilega Levala Goyaz, als dein eheliches Weib anerkennen?«, fragte mich ein Kerl, der einen langen, schwarzen Schlafrock mit weißer Halskrause trug und der schon immer in mich hineinschwadroniert hatte.
Ich erhielt von hinten einen derben Knuff in den Rücken.
»Si, si, Señor«, wurde mir zugeflüstert.
»Jaaaa — zum Teufel denn, jaaaa!!!!«, schrie ich mit allem Aufgebot meiner Lungenkraft, ohne zu wissen, was man denn eigentlich von mir wolle.
»Amen!«, hieß es dann, Händeschütteln und Küsse, nicht nur von dem Elefantenzahne, und ich saß wieder im Wagen, diesmal allein mit dem Elefantenzahne.
»O, mein Napoleon Bonaparte, nun sind wir Mann und Frau!«
Gewiss, ich hatte den Schüttelfrost.
Dann war es wieder das Hotelzimmer.
»Mein Napoleon Bonaparte!«
Zwei knöcherne Arme krochen heran. Ich aber sah im ganzen Weltall weiter nichts als den mich anfletschenden riesengroßen Zahn.
»Die seligste Stunde naht — ich will nur erst noch einmal hinausgehen.«
Und ich sah den gelben Riesenzahn in nebliger Ferne entschweben.
Wie lange ich so in der Mitte des Zimmers gestanden und gedöst habe, weiß ich nicht. Nach und nach aber kam mir doch das Bewusstsein wieder — wenigstens in etwas. Mein Entschluss war sofort gefasst.
Ich ging ans Fenster, wirbelte es auf, um mich hinauszustürzen.
Aber vierte Etage? Nein, das war mir denn doch ein bisschen zu hoch. Ich hatte geglaubt, mich in der ersten Etage zu befinden, oder gar parterre, und da hätte mir ein Sturz weniger geschadet. Denn an einen Todessturz dachte ich nicht. Nur Flucht, Flucht, schleunigste Flucht!
Warum denn aber nicht zur Türe hinaus? Wenn mir die Neuvermählte, die Liebliche, in die Wege lief, dann wurde sie einfach zu Boden geschlagen.
Die Tür ging vor mir von selber auf, ich hob schon die Faust — vorläufig aber waren es nur Don Manuelo und seine Schwester.
»Ich kondoliere!«, sagte sie.
»Ich gratuliere!«, sagte er.
»Die kluge Frau hat es richtig in den Karten gelesen«, sagte sie.
»Professor Menton richtig in den Sternen«, sagte er.
»Auch Doktor Trompa braucht sich nicht geirrt zu haben«, sagte sie.
»Nein, aber an der Schwindsucht ist sie nicht gestorben«, sagte er.
»Sie ist soeben ins Klosett gefallen«, sagten alle beide.
Zwei Tage später befand ich mich auf dem Wege, um als anerkannter Erbe meinen Besitz von 10 000 Quadratmeilen anzutreten. Gestern hatten wir sie begraben. Es war Tatsache. Das Schicksal hatte mir das Allerschwerste erspart. Noch in der letzten Minute vor ihrer seligsten Stunde war sie ins Klosett gestürzt, was bei den Zuständen dieser Einrichtung in Pernambuco ganz leicht möglich ist. Als man sie fünf Minuten später aus der Kloake hervorgezogen, hatten nur noch die Insekten auf ihrem Haupte gelebt, sie selbst hatte schon ihre jungfräuliche Seele ausgehaucht gehabt.
Kapitän Reimann war mit beim Begräbnis.
»Mensch, Ihr habt ja ein fabelhaftes Glück!«, sagte er bei der ersten Gelegenheit zu mir.
Ich war unterdessen voll und ganz zum Bewusstsein erwacht, hatte Erkundigungen eingezogen — es hatte alles seine Richtigkeit, ich war Herr und Besitzer der Provinz Goyaz, hatte deswegen auf dem Rathause schon einige Förmlichkeiten erledigt, aber nicht die geringste Schwierigkeit dabei gehabt. Von allen Seinen wurde mir mehr gratuliert als kondoliert.
»Aber das bare Vermögen habe ich nicht bekommen, Herr Kapitän, das wissen Sie wohl.«
Wir befanden uns bereits auf dem Rückweg; von den Leidtragenden kümmerte sich sonst niemand weiter um mich.
»Das weiß ich, die drei Millionen Milreis, oder wie viel es sind, sind auf einer Bank in Rio angelegt, die gehen Sie gar nichts mehr an — na, da bleiben Ihnen aber immer noch die 10 000 Quadratmeilen Land — und wenn Sie für die Quadratmeile auch nur einen Taler bekommen — das sind 10 000 Taler — immer noch besser als nischt.«
»Sie meinen, da wäre die Quadratmeile, die geografische, nur einen Taler wert?«
»Oder nur einen Silbergroschen — immer noch besser als gar nischt.«
»Herr Kapitän, was wollen Sie damit eigentlich sagen?«, fragte ich etwas pikiert.
»Es ist doch sehr die Frage, ob Sie von diesem privilegierten Lande auch nur einen Quadratfuß verkaufen dürfen.«
»Da haben Sie allerdings recht. Aber da sind doch die vielen tausend Rinder und Pferde.«
»Ja, wenn Sie die nur verkaufen können.«
»Warum soll ich denn nicht? Das kann doch kein Privilegium des Staates sein.«
»Das schon, aber wissen Sie auch, wo Ihr Fürstentum liegt? Dort hin- ten...«, der Kapitän nahm nicht erst die Hände aus den Hosentaschen, sondern trat nur mit dem Fuße in die Luft, nach Sonnenuntergang, »... und ob Sie da auch einen Käufer finden. Denn da würde doch der Transport zu teuer.«
»Und wenn schon — dann bleiben mir doch noch immer die Gold- und Diamantengruben.«
»Ja, wenn wirklich Gold- und Diamantengruben darauf sind?«
»Na, ich denke, die Dona, was meine selige Gattin ist, hat daraus jährlich mehr als eine Million Milreis Einkünfte bezogen?!«
»Ja, aber haben Sie sich auch vergewissert, ob sich diese Minen wirklich in jener Provinz befinden?
Nicht vielleicht daneben oder sonst anderswo?«
»Die beiden haben es mir doch gesagt!«
»Haben Sie das auch schriftlich gesehen?«
»Nee, das allerdings nicht — ach, überhaupt, das ist nur ja ganz Wurscht! Wissen Sie, Kapitän, ich möchte mit Ihnen gerne einen trinken, aber ich habe soeben dem Totengräber den letzten Milreis von den beiden, die Sie nur gestern als Vorschuss gaben, in die Hand gedrückt...«
»Und Sie wissen wohl, dass Sie auch nichts weiter zu bekommen haben. Sie haben schon in Neapel einen ganzen Monat aufgenommen.«
»Das weiß ich...«
»Dann ist es gut. Sonst bezahle ich gern eins für Sie.«
Wir traten in die nächste Bar.
»Meinen Sie, Käpten, dass ich die ganze Erbschaft lieber fahren lasse?«
Nein, das meinte der verständige Mann nicht. Er hatte vorhin doch nur Spaß gemacht oder stark übertrieben. Ein ganz Bedeutendes sei das riesige Land natürlich auf alle Falle wert. Vielleicht dass ich mich gleich mit der Regierung einige, ihr die ganze Provinz abträte, und wenn auch nur 10 000 Milreis herauskämen.
So sprach der Kapitän, der ja nicht ahnte, wer ich einst gewesen war, was ich mit einem Federzug alles aufgegeben hatte — ebenfalls einige Milliönchen.
»Ja, ansehen wenigstens müssen Sie sich Ihr Fürstentum. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Brauchen Sie Geld? Mit einigem kann ich Ihnen ja...«
»Ich denke doch, ich, der Señor Privilegor Goyaz, werde Kredit haben.«
»Auf alle Fälle! So behüte Sie Gott, ich gehe mit Flut in See. Ihre Papiere haben Sie schon.«
Ich sah ihn nicht wieder, den braven Kapitän, der trotz seiner Kenntnis der Sachlage immer noch ganz falsch geurteilt haben sollte.
Als ich meinem Hotel zustrebte, rannte mir ein dicker, schäbig gekleideter Kerl entgegen.
»Ich bitte tausendmal um Verzeihung, Señor Privilegor«, fing er unter fortgesetzten Bücklingen an, »es gereicht mir zur höchsten Ehre, Señor Privilegor — so leid es mir auch tut...«
»Mensch, was wollen Sie eigentlich von mir? Nun heraus mit der Sprache!«
»Meinen Frackanzug und meine Lackschuhe — ich muss sogleich einer sehr vornehmen Herrschaft servieren — mein Hemd können Sie ja einstweilen noch anbehalten — auch meinen Kragen...«
Ach so, es war der Oberkellner meines Hotels! Er hatte mir unterdessen noch drei Kragen gegeben.
Ich ging ins Hotel, forderte meinen blauen Anzug. Nirgends zu finden. Unbedingt gestohlen. Ich rief den Wirt.
»Ja, geehrter Señor, haben Sie mir Ihren Anzug zum Aufheben gegeben?«
Das allerdings nicht, aber ich konnte hier doch nicht in Unterhosen bleiben. Denn der Oberkellner hatte es mit seinem Frackanzug höchst eilig gehabt.
»Es wird Ihnen sofort ein anderes Kostüm besorgt. Oder soll ich nach einem Maßschneider schicken? Lieferungszeit zwölf Stunden. Hier habe ich auch gleich Ihre Rechnung mitgebracht, gnädigster Señor Privilegor.«
Zwei Milreis für zweimalige Benutzung eines Zimmers — das war sehr billig, zumal für einen Señor Privilegor mit 10 000 Quadratmeilen Grundbesitz und zahllosen Ochsen und Pferden — — und dann 20 Milreis für ein Souper zu vier Gedecken, ohne Wein, fast 80 Mark — das war weniger billig, zumal dieses Hochzeitsmahl doch gar nicht genossen worden war.
Aber es war bestellt, alles schon zubereitet gewesen.
Dann hatte ich im ganzen noch für weitere 10 Milreis verzehrt, das konnte ja schließlich stimmen, und dann noch...
»Hier habe ich auch gleich die Rechnung für Ihre selige Frau Gemahlin mitgebracht.«
Mir war schon etwas schwül zumute geworden — da aber fiel mir ein, dass ich ja auch der Erbe alles dessen war, was die mit dem Tode Abgegangene sonst noch hinterlassen hatte.
Wir gingen hinüber in das andere Dachzimmer, das sie bewohnt hatte, ich immer in Oberhemd und Unterhosen, an den Füßen nur Strümpfe. Denn auch meine Stiefel waren abhanden gekommen... und die beiden großen Reisekoffer meiner Gattin desgleichen! Einfach verschwunden, gestohlen!
»Ich bedauere sehr, aber die Dona Privilega hat mir nichts in Verwahrung gegeben«, sagte der Wirt, und er mochte ja ganz in seinem Rechte sein.
Mir kamen diese pernambuconischen Verhältnisse nur noch etwas spanischer vor als die konstantinopolitanischen.
Doch, ein kleiner Reisekoffer war noch vorhanden, verschlossen, furchtbar verschnürt. Ich erbrach ihn kurzerhand. Lumpen, nichts als scheußliche Lumpen, die ich nicht anzurühren gewagt hätte. Der Wirt tat es, fühlte aber vergebens nach eingenähten Goldstücken und Diamanten, auch knistern wollte nichts.
»Die hat auch keine Diamanten gehabt«, entschied die Kammerzofe, die einzige, welche von der ganzen Gesellschaft noch vorhanden war.
»Aber Geld muss sie doch bei sich geführt haben.«
»Schwerlich! Ich sah, wie Don Ricolan immer alles bezahlte, wenn einmal etwas zu bezahlen war.«
»Wo ist denn der Don?«
»Verschwunden — samt seiner Schwester abgereist.«
»Und der Kammerherr, die Kammerdame, der Kammerdiener?«
Alles spurlos verschwunden, ohne von mir Abschied zu nehmen und... ohne ihre Rechnungen beglichen zu haben! Das war eben Sache der Dona Privilega, was ich gar nicht leugnen konnte — und jetzt war es die meine, was man mir klipp und klar beweisen konnte.
Ich will es kurz machen: Der Wirt forderte von mir rund 300 Milreis und die Kammerzofe außerdem noch rund 100 Milreis rückständigen Lohn. Und ich hatte nicht einmal Hosen, in deren Taschen ich hineingreifen konnte.
Das machte ich dem Wirt und der Kammerzofe ebenso klipp und klar, darauf pochend, dass ich ja noch 10 000 Quadratmeilen mit mindestens ebenso vielen Kuh- und Pferdeschwänzen besäße, ganz abgesehen von den Gold- und Diamantenminen.
Die hübsche Kammerzofe ließ sich denn auch damit vertrösten, blinzelte mir sogar vertraulich zu und trat mir unter dem Tisch auf den unbeschuhten Fuß, nicht jedoch der Wirt, oder der trat mich noch in ganz anderer Weise.
»Ich will mein Geld haben, Sie kommen nicht eher aus diesem Hause.«
»Männicken«, sagte ich, mitleidig die Jammergestalt betrachtend, »ich nicht aus Ihrem Hause kommen? Ich nehme Sie unter den Arm und lasse Sie verhungern.«
»Sie können Geld bekommen?«
»Ich hoffe doch.«
»Woher denn?«
»Nun, man wird mir doch Kredit geben, jedes Bankhaus.«
»Auf Ihren Grundbesitz in Goyaz hin?«
»Sie meinen nicht?«
»Ich versichere Ihnen, dass Sie daraufhin auch nicht 10 Reis geborgt bekommen.«
Mir ahnte schon etwas. Der Mann mochte die Verhältnisse besser kennen als ich.
Ich bot ihm einen Wechsel an, stieg von 1000 auf 10 000 Milreis. Wenn man so ein ganzes Land mit Gold- und Diamantengruben hat, kommt es einem doch gar nicht auf solche Lappalien an.
»Können Sie denn den Wechsel auch einlösen?«
»Ich hoffe doch, mein Fürstentum verkaufen zu können! Mindestens etliche tausend Kühe und Pferde!«
»Nein, darauf lasse ich mich nicht ein.«
Schließlich einigten wir uns trotzdem. Ich brauchte nur einfach einen Schein zu unterschreiben, wonach ich wegen des Diebstahls meiner Sachen keine Anzeige erstatten wolle, dann sollte ich dafür sogar noch ein ganzes Kostüm nebst Stiefeln und Hut erhalten.
Gut, ich unterschrieb, um allen Scherereien aus dem Wege zu gehen! Dieser Schurke von Wirt hatte sich doch gewiss schon schadlos gehalten.
Alsbald wurde mir denn auch das Kostüm gebracht. Es bestand aus einem abgetragenen Leinwandhöschen, das nur wenig über die Knie ging, aus einem Leinwandjäckchen, das ich erst etwas aufschlitzen musste, Manschetten dazu hätten reichlich einen Viertelmeter lang sein müssen, der Hut war eine neapolitanische Fischermütze mit Quaste dran, und statt der Schuhe erhielt ich ein Paar jener ungeheuren Holzschuhe, wie die holländischen Bauern und die brasilianischen Fischer sie tragen.

Dann wollte noch einmal der Oberkellner mit einer Rechnung für Leihgebühren und dergleichen kommen, aber ich brauchte nur den einen Holzschuh etwas zu heben, und er verschwand.
So verließ ich das Hotel, gerade wie ein Bäuerlein aus Urgroßvaters Zeiten aussehend, keinen Kupfer, sonst aber alle Papiere in der Tasche, die mich zum Señor Privilegor und Besitzer von 10 000 Quadratmeilen mit ebenso vielen Rindern und Pferden machten, ganz abgesehen von den Gold- und Diamantenminen, und klapperte in meinen Holzschuhen seelenvergnügt das Pflaster hinab. Ja, mir war wirklich äußerst fidel zumute, ich lachte manchmal aus vollem Halse, dass die Leute auf der Straße stehen blieben. Warum sollte ich auch nicht? Auf Geld und anderen Besitz kam es mir doch wahrhaftig nicht an, da hätte ich doch nicht erst alles aufzugeben brauchen. Im Gegenteil, ich empfand das als ein köstliches Abenteuerchen, so als Grundbesitzer eines Landes, größer als ganz Deutschland, im Gewande eines Bäuerleins herumbummeln zu müssen, keinen Heller in der Tasche, über kurz oder lang auf die öffentliche Mildtätigkeit angewiesen.
Aber für so schlimm hielt ich es doch noch nicht. Ich musste mich indessen schnell genug überzeugen lassen, dass es doch so war. Ich fand Leute, die mir reinen Wein einschenkten.
Der edle Don und seine Schwester hatten mich schmählich übers Ohr gehauen. Gruben gab es in der Provinz Goyaz wohl genug, aber nach Gold und Diamanten würde man darin vergebens suchen. Zwar hatte meine teure Gattin tatsächlich Gold- und Diamantenminen besessen, die ihr tatsächlich fast eine Million Milreis jährlich eingebracht hatten, doch die lagen in einem ganz anderen Distrikt, in der Provinz Minas Gerais, hatten mit der Provinz Goyaz gar nichts zu tun, und alles andere außer dieser Provinz Goyaz hatte ich ja den Geschwistern verschrieben. Wenn ich es nicht glaubte, so brauchte ich nur noch einmal zu jenem Notar zu gehen, ich konnte es schwarz auf weiß lesen. Ja, da stand es wirklich, ich hatte es unterschrieben.
Blieb mir nur noch die Provinz Goyaz, bevölkert von etwa tausend Menschen, auf zehn geografische Quadratmeilen kam einer, meist Viehhirten und einige wenige Ackerbauer, die ich als meine Untertanen betrachten konnte. Dann kamen noch einige Indianerstämme hinzu, Kopfzahl ganz unbekannt, die aber meine Herrschaft noch nicht anerkannten, vielmehr mit meinen Untertanen, die fast alle ebenfalls eine mehr und minder dunkle Haut hatten, in ständigem Kampfe lagen.
Ebenso ließ sich die Zahl der Pferde und besonders der Rinder gar nicht schätzen. Ich hörte von einigen zehntausend sprechen, der ganz sachgemäße Notar meinte, dort müssten mindestens hunderttausend Rinder weiden. Wem gehörten diese? Dem Papiere nach mir. Die dortigen Hirten aber hielten sie für ihr Eigentum. Die wussten noch gar nicht, dass sie nur meine Tagelöhner waren, und dazu hatten sie auch ein Recht, denn es war ihnen nie ein Tagelohn gezahlt worden. Sie hausten auf ihren Ranchos, jede Familie schlachtete täglich einen Ochsen, aus dem Leder wurde die Kleidung gefertigt. Was übrig blieb, wurde gegen Sachen ausgetauscht, die nicht selbst erzeugt werden konnten, hauptsächlich Waffen und Munition, die ihnen alljährlich eine Karawane brachte, gesalzene Felle zurücknehmend.
Von einer Ausfuhr konnte gar keine Rede sein. Um dorthin zu gelangen, konnte man von Pernambuco aus die Eisenbahn benutzen, mehr als hundert geografische Meilen. Oder man konnte auch den Rio Francisco hinauffahren, dann kam man noch etwas weiter nach Westen, bis nach der Hazienda Palao Arcado. Von hier bis nach den äußersten Grenzen meines Reiches waren es immer noch 40 geografische Meilen, alles entweder wasserlose Wüste oder undurchdringlicher Urwald, der sich auch noch viele, viele Meilen weit im Innern der Provinz Goyaz fortsetzte, ehe man die ersten Ranchos erreichte.
Die Handelskarawane, welche im Mai jeden Jahres diesen Weg machte — aber die Witterung musste dazu günstig sein, bei zu reichlichem oder zu knappem Regenfall blieb die Expedition für das betreffende Jahr aus — forderte und erhielt von meinen Untertanen für einen Revolver, der in Pernambuco zu anderthalb Milreis, noch nicht drei Mark, zu kaufen war, 20 bis 25 gesalzene Ochsenhäute, für eine Flasche Fuselschnaps durchschnittlich 40 Häute; ein Pfund Tabak kostete, nach Geld gerechnet, ungefähr 100 Mark. Unter solchen Verhältnissen war an eine Ausfuhr von Landesprodukten gar nicht zu denken. Die weite Entfernung steigerte bei dem Fehlen aller Verkehrsmittel die Preise ins Ungeheure. An ein Forttreiben von Pferden und Rindern war noch weniger zu denken. Es wäre alles unterwegs zugrunde gegangen, und überhaupt, was sind denn Pferde und Rinder in Brasilien wert! An der Küste erhält man den fettesten Ochsen schon für acht Mark!
Die Dona Privilega hatte allerdings inmitten der Provinz eine wohnlich eingerichtete Hazienda besessen, d. h. einer ihrer Ururahnen, sie selbst war nie hingekommen, sie hatte in einer Stadt in der Provinz Minas Gerais gewohnt. Von jenem uralten Herrenhaus würde wohl nicht mehr viel übrig geblieben sein.
So standen die Verhältnisse. Als ich dem Notar sagte, ich wolle mich hinbegeben, lachte er mich einfach aus. Da solle ich, wenn ich Kraft meiner gesiegelten Papiere als Herr auftreten wolle, nur gleich ein Regiment Kavallerie mitnehmen, das koste natürlich schrecklich viel Geld, und wie ich das Regiment hinbringen wolle, das überlasse er meiner Erfindungskraft. Trotzdem, ich wollte mir den Besitz ansehen, nur des Spaßes halber.
Wie ich mein Ziel erreichen wollte? Einfach auf meinen Holzschuhen! Immer nach Westen die Bahnschienen entlang, wenigstens 25 Meilen, wozu ich vier Tage gebrauchen würde. Gepumpt bekam ich auf meine Herrschaft hin keine 10 Reis, das wusste ich nun schon, aber vielleicht geschenkt, als Speise und Trank. Hier gab es ja noch Haziendas genug, gerade längs der Eisenbahn, Gastfreundschaft wird in Brasilien überall gewährt. Nach diesen 25 Meilen berührte die Eisenbahn den Rio Francisco. Es sollten jetzt noch Fährbote stromauf gehen, da fand ich vielleicht eine andere Gelegenheit zum Weiterkommen.
Also ich steckte die Hände in die Hosentaschen, die nicht einmal ein Messer enthielten, und machte mich auf die Reise.
Das erste Haus außerhalb der Stadt, in dem ich um eine milde Gabe vorsprach, war die Bretterbude eines Eisenbahnwärters.
»Ein armer Landesvater, der seit vier Wochen keinen warmen Löffelstiel mehr in den Leib bekommen hat«, betete ich mein Sprüchlein her.
Der Mann verstand mich nicht, entweder sprach ich ein zu schlechtes oder ein zu gutes Spanisch, d. h., der hier einheimische Dialekt fehlte.(1) Vielleicht war der Weichensteller auch taub, er machte einen recht idiotischen Eindruck, beachtete meine auffällige Erscheinung gar nicht — jedenfalls aber gab er mir sofort ein kleines Stück Maisbrot und ein mächtiges Stück geräuchertes Rindfleisch, an dem auch ein Wolf für zwei Tage genug gehabt hätte.
(1) Vielleicht liegt es auch daran, dass die Landessprache in Brasilien brasilianisches Portugiesisch war und ist.
Das war am Nachmittag in der dritten Stunde gewesen, dann sah ich nichts weiter als baumlose Prärie, durch die der doppelte Schienenstrang hinlief; in den nächsten drei Stunden überholte mich kein Zug, kam mir keiner entgegen. Nur in weiter Ferne grasende Rinderherden, sonst nichts, kein Mensch, und dann fing es an zu regnen, was vom Himmel herunter wollte.
Das hatte nicht in meinem Programm gestanden. Da aber tauchte vor mir schon eine Ansiedlung auf. Die Schienen überbrückten ein Flüsschen, auf dem einige Boote neben einem niedrigen, jedoch ziemlich umfangreichen Gebäude lagen.
Wie ich später erfuhr, sollte das eine Stadt sein, Santa Anna. In Wirklichkeit war es nur eine Schifferkneipe, zugleich allerdings auch Bahnstation. Landesprodukte werden vom Norden per Wasser hierher gebracht und gehen, wenn es sich lohnt, mit der Bahn weiter nach Pernambuco.
Die Dunkelheit brach an, als ich in strömendem Regen das Haus erreichte. In der Gaststube saßen einige Schiffer und andere Individuen, tranken argentinischen Wein, den ihnen ein hübsches junges Weib kredenzte.
»Ein armer Landesvater, der noch kein Schlafgeld hat.«
Hier verstand man mich, reagierte aber nicht darauf. Man fragte mich, woher ich sei, wohin ich wolle — Señor Privilegor Novacasa, der Besitzer der Provinz Goyaz — noch keiner schien etwas von der Provinz Goyaz gehört zu haben, nichts von der Dona Privilega — — man hielt mich wohl für einen Narren.
»Geh, Inez, bringe dem verrückten Hecht Brot und Wein!«
Die hübsche junge Frau in Nationaltracht brachte mir Brot und Wein an einen Nebentisch, und sie hatte mehr Interesse für mich.
»Novacasa heißt Ihr?«
»Napoleon Bonaparte Novacasa.«
»Dann seid Ihr wohl gar ein Korse?«
»Jawohl, aus Brasidello bei Bastia.«
»Und ich bin aus...«
Ich weiß nicht mehr, aus irgendeinem kleinen italienischen Neste bei Florenz. Also keine Spanierin, sondern eine Italienerin, darüber vergaß sie alle anderen Fragen, sie freute sich nur, einen Landsmann getroffen zu haben — denn der Korse gilt ja immer noch als Italiener, wenn er auch französischer Untertan ist — mit dem sie über heimatliche Verhältnisse plaudern konnte, über ihre Leibspeisen, Volksfeste und dergleichen.
An dem anderen Tische ging es lebhafter zu, ich fing gehässige Blicke auf, die Wirtin wurde gerufen, immer aufgeregter wurde die Stimmung.
»Du kannst nicht hier schlafen«, sagte sie zu mir, ohne sich wieder zu setzen.
»Weshalb nicht?«
»Ich bin Wittfrau — die Männer sind eifersüchtig.«
»Wo soll ich denn aber sonst schlafen?«
»Das geht mich nichts an, du musst das Haus sofort verlassen, die Schiffer wollen es.«
»Bei diesem Wetter, in das man keinen Hund jagen würde?«
»Ich kann dir nicht helfen, auch ich muss mich fügen, ich bin Wittfrau. Geh schnell, ehe Streit ausbricht.«
Jetzt aber bemerkte ich auch ihr Augenblinzeln, sie wollte mir etwas zuflüstern, ich musste nur bereit sein, es zu verstehen.
»Geh um das Haus herum, links herum! Ich erwarte dich«, hörte ich da auch wispern.
Dann forderte ste mich nochmals energisch auf, das Haus zu verlassen, und ich gehorchte, so schwer es mir auch wurde, weil ich lieber mit diesen rücksichtslosen Schuften noch ein Wörtchen geredet hätte.
Es war eine stockfinstere Nacht, es regnete noch immer Stricke und Bindfaden.
An der Hauswand mich entlangtastend, kam ich an eine Ecke, bog herum, blieb unter dem Schutze des Daches stehen.
Drinnen ging es immer wilder zu, es wurde gejohlt und gesungen. Die Männer mussten schon viel Wein getrunken haben.
Nicht lange, so hörte ich ein leises ›pst‹, gleichzeitig ward meine Hand erfasst, ich in eine Tür gezogen.
»Leise, leise! Wehe uns, wenn es bemerkt wird!«
Ich glaubte schon, dass die Wirtin gar viel riskierte, wenn sie mir bei sich ein heimliches Nachtquartier gewährte. Sollte es jedoch allein das Mitgefühl sein, dass sie keinen Menschen in diese Regennacht hinausjagen wollte?
»Hier herein — ganz leise — hier findet dich niemand, wenn sie auch suchen sollten. Aber ich darf mich jetzt nicht aufhalten. Lange treiben die's doch nicht mehr, dann liegt alles unterm Tisch, und dafür werde ich noch besonders sorgen.«
Sie hatte mich etwas vorgeschoben, bis meine Knie gegen die Kante eines Brettes stießen,
»Da leg dich hin und schlafe! Ich muss dich einschließen. Morgen früh lasse ich dich beizeiten wieder heraus.«
Die Hand verließ mich, ich hörte, wie ein Riegel vorgeschoben und noch ein Schlüssel umgedreht wurde.
Es war mir gar nicht recht behaglich zumute. In einem stockfinsteren Raume eingeschlossen, immer noch in ganz nassen Kleidern steckend — mir klapperten hörbar die Zähne aufeinander. Ich glaube, ich hatte etwas Fieber. Einen stärkeren Ausbruch fürchtete ich nicht, ich hatte eine eiserne Natur.
Ich fühlte eine Pritsche, mit sehr vielen Decken belegt, und nach kurzer Überlegung entkleidete ich mich bis aufs Hemd, legte meine Papiere unter das vorhandene Kopfkissen, wickelte mich in die Decken, deren ich noch genug zur weichen Unterlage hatte. Denn wenn ich auch nie verweichlicht gewesen bin, so habe ich doch immer ein weiches Bett einem harten vorgezogen.
Obgleich ich sehr müde gewesen war, mir auch ganz behaglich wurde, floh mich der Schlaf. Der Lärm in der Gaststube, hier noch deutlich zu hören, wurde immer wüster. Dann aber ließ er schnell nach, bis er gänzlich verstummte.
Eben war ich im Einschlafen begriffen, als, ohne dass ich die Tür oder den Riegel hatte gehen hören, eine nicht allzu weiche Hand über mein Gesicht strich.
»Schläfst du schon?«, flüsterte eine mir bereits bekannte Stimme. »Die sind alle total betrunken, dafür habe ich doch gesorgt, hihihi, vor morgen früh steht keiner auf, und sonst wachen die Hunde. Ich muss nur aufpassen. Wenn sie bellen, dann kommt ein Fremder.«
Es war die Florentiner Wittfrau, die mir für die Nacht Gesellschaft leisten wollte und es auch tat.
Ich erwachte. Wie lange ich geschlafen hatte, wusste ich nicht. Hier war es noch immer stockfinster. Neben mir lag noch das Weib, hatte mich im Schlafe zärtlich umschlungen.
Vor allen Dingen aber machte ich bei der ersten, kleinsten Bewegung der Beine eine unangenehme Entdeckung. Ich hatte Gliederreißen. Besonders in den Knien. Eigentlich mir etwas ganz Unbekanntes. Oder doch, ich kannte dieses vertrackte Gefühl, nur aus einer anderen Ursache entstanden als durch Erkältung oder sonst eine Krankheitserscheinung.
Ich kann nämlich, obgleich ich sonst durchaus nicht steifbeinig bin, nicht wie ein Türke mit gekreuzten Beinen niederhocken. Ich kann es wohl, aber schon nach ganz kurzem Sitzen in dieser Weise habe ich dann allemal für einige Zeit höllische Schmerzen in den Knien. Ich bin eben nicht zum Türken geboren. Ich hatte einmal bei einer Reise um die Erde als Kapitänleutnant und Mitvertreter meines Vaterlandes dem Kaiser von Siam einen Besuch abgestattet, da hatte ich anstandshalber zwei Stunden lang mit gekreuzten Beinen dahocken müssen. Während des Sitzens selbst hatte ich gar nichts verspürt, hatte mich dann aber kaum noch erheben können und war einen halben Tag wie gelähmt gewesen, hatte tatsächlich geglaubt, ich sei vom schmerzlichsten, unheilbaren Gliederreißen befallen. Bald freilich hatte ich nur darüber gelacht.
Genau solche Schmerzen in den Knien hatte ich auch jetzt. Und ich hatte doch nicht nach Türkenart gesessen, nicht einmal unbequem gelegen, etwa mit hochgezogenen Knien, lag noch jetzt lang ausgestreckt ganz bequem da. Aber die Knie schmerzten mich fürchterlich. Also das konnte nur echtes Gliederreißen fein, Rheumatismus! Sapperlot!
»Inez, schläfst du noch?«
Ja, sie schlief, atmete schwer. Ihr warmer Hauch streifte meine Wangen. Ich tastete nach ihrem Kopf — ihr Haar, das gestern Abend hübsch frisiert gewesen. war aufgegangen, ich fühlte, dass sie gelocktes und gar nicht so langes Haar hatte, fühlte beim Weiterstreichen ihr baumwollenes Kleid. Viel mehr hatte sie auch nicht an.
Das half alles nichts, ich musste sie wecken, auch wenn noch kein Hund gebellt haben sollte.
»Inez, wach auf! Wir verschlafen es.«
Da regte sie sich, der mich umschlingende Arm presste mich näher heran.
»Mein einziger Novacasa!«, flüsterte sie zärtlich.
Merkwürdig, wie sie gleich bei Besinnung war! Oder ich hatte eben auch den Inhalt ihrer Träume gebildet.
»Wir müssen ziemlich lange geschlafen haben — sieh nach, ob es nicht schon Tag ist.«
»Und was schadet das?«, erklang es unter Küssen.
»Teufel noch einmal, denke an die Schiffer!«
»An welche Schiffer?«
Sie war doch noch ganz schlaftrunken.
»An deine Gäste.«
»An was für Gäste?«
»Wach auf, wach auf! Du kannst dich und mich in die größte Gefahr bringen!«
»In was für eine Gefahr denn? Ach, mein Novacasa, du warst so lange fern von mir. Warum hattest du mich denn verlassen?«
Teufel noch einmal! Diese italienische Witib musste schon einmal einen anderen Liebhaber gehabt haben, der ebenfalls Novacasa geheißen hatte. Oder Gott wusste, was sie in ihrer Schlaftrunkenheit noch alles zusammenträumte.
»Wach auf, ich höre die Hunde bellen!!«
»Hunde? Wir haben hier doch gar keine Hunde.«
»Nun höre aber endlich auf! Weißt du denn gar nicht, wo du bist?«
»Auf meiner Insel.«
»Was, Insel! Du bist vielleicht früher einmal Insulanerin gewesen, jetzt bist du die Wirtin von Santa Anna.«
»Du träumst, mein Novacasa.«
»Na, nun hört doch alles auf! Erwache, erwache, ermanne oder erweibe dich, Inez!«
»Inez? Wie nennst du mich?«
»Na, du bist doch Inez, die Wirtin von Santa Anna. Nur deinen Zunamen hast du mir noch nicht genannt.«
»Du irrst, mein Novacasa.«
Ich wurde noch immer nicht stutzig. Die war eben ganz traumbefangen.
»Worin soll ich mich denn irren?«
»Ich bin nicht Inez, die Wirtin von Santa Anna.«
»Na, wer bist du denn sonst?«
»Ich bin Johanna!«
»Was?!«, konnte ich zunächst nur noch hervorstoßen.
»Ich bin Johanna, deine Geliebte, die Schwester des Patriarchen von Athos.«
Alle Wetter, jetzt freilich wurde ich stutzig und noch etwas ganz anderes.
Ich hatte noch zu keinem Menschen von meinem Abenteuer auf dem Athos erzählt, nicht einmal was angedeutet!
Woher konnte sie also diesen Namen wissen?
War sie eine Wahrträumerin? Oder... hatte ich etwa im Traume gesprochen?
»Woher in aller Welt weißt du...«
Ich brachte es gar nicht heraus.
»Worüber wunderst du dich, mein einzig Geliebter? Ich habe es dir doch im Voraus gesagt. Ja, ja, ich bin Johanna, die Schwester des Patriarchen, und du befindest dich hier schon wieder auf der Leuchtturminsel Skarpanto, nachdem ich mich ein Vierteljahr vergebens nach dir gesehnt habe.«
Ich kann nur sagen, dass ich vor Schreck mein Blut zu Eis erstarren fühlte. Aber es war eine besondere Art von Schreck. Nämlich weil ich glaubte, ich sei plötzlich wahnsinnig geworden, ich höre diese Worte nur in meiner Phantasie sprechen.
Mit zitternden Händen tastete ich wieder, um wenigstens einen Menschen zu fühlen.
»Ja, ja, ich bin deine Johanna. Es hat dir nichts genützt, dass du geflohen bist. Wir wussten sofort, wo du warst, wir sahen dich in Pernambuco, schon war unser Auftrag unterwegs, und in jenem Wirtshause von Santa Anna wurdest du erreicht, du wurdest, als du neben der koketten Witwe schliefst, betäubt, in eine Kiste verpackt und hierher geschickt...«
Da löste sich in mir das eiskalte Entsetzen in ein anderes auf. Wenn mir etwas sagte, dass ich die Wahrheit zu hören bekam, so war es der Schmerz in meinen Knien. Ich musste lange, lange Zeit zusammen gehockt gekauert haben. Eine Art von Wut packte mich, ich warf mich über das Weib, würgte es am Halse.
»Und wenn ihr wirklich solche Teufelskünste versteht, dann sollst du selbst wenigstens zur....«
Da fühlte ich einen Stich in meinem Handrücken, und in demselben Augenblick schwand mir auch das Bewusstsein — —
Abermals erwachte ich. Ich hatte keine Schmerzen mehr in den Knien, mein Kopf war klar, ich konnte mich auf alles besinnen.
Ehe ich dazu kam, Betrachtungen anzustellen, hörte ich schon wieder das Weib sprechen, das aber jetzt nicht mehr neben mir lag.
»Hast du dich ausgetobt, mein Novacasa?«
Ich sagte mir sofort, dass es das beste sei, ganz vernünftig zu sein.
»Es tut mir sehr leid, so heftig gewesen zu sein. Es ist mir gewesen, als sei ich mit einer Nadel in die Hand gestochen worden.«
»Ja, auf diese Weise habe ich dich betäubt und kann mich so immer deiner erwehren. Fürchte nichts, es hat für deine Gesundheit keine nachteiligen Folgen.«
»Ich fürchte überhaupt nichts — nur Gewissheit möchte ich haben.«
»So frage doch!«
»Ich befinde mich wirklich schon wieder auf der Leuchtturminsel Skarpanto?«
»Wenn du dich danach beträgst, wirst du dich bald mit eigenen Augen hiervon überzeugen können.«
»Was für ein Datum haben wir heute?«
»Den 10. November.«
Am 12. August war meine Flucht von hier erfolgt, am 17. September waren wir in Pernambuco eingetroffen.
»Ich bin in eine Kiste gepackt und hierher geschickt worden?«
»Wie ich dir schon sagte.«
»Wer hat mich betäubt?«
»Einer unserer Bettelmönche, die sich in Brasilien aufhalten.«
»Auch jene Wirtin gehörte zu der Sekte?«
»Nein, das wohl kaum.«
»Sie war aber mit daran beteiligt?«
»Ich glaube nicht. Auch sie wird beim Erwachen nicht gewusst haben, wohin du entschwunden warst. Übrigens frage mich nicht nach solchen Einzelheiten. Ich bin nicht allwissend wie mein Bruder, wie jeder andere unserer Mönche, der in sich das heilige Licht erzeugen kann, und so genau hat mir mein Bruder nicht alles mitgeteilt. Lass dir doch genügen, dass du wieder hier bist, dass ich dir also damals die Wahrheit erzählte.«
»Wie lange bin ich denn in der Kiste verpackt gewesen?«
»Etwa fünf Wochen, denn vier Wochen schon hat der Frachtdampfer gebraucht, der von Pernambuco nach Brindisi ging. Dann währte es nur noch wenige Tage, und mein Bruder konnte mir die Kiste ausliefern, ich konnte dich auspacken.«
Eine neue Eiseskälte überlief mich.
»Wie groß war die Kiste?«
»Groß genug, dass du eben hineingingst.«
»Wie ein Sarg gestaltet?«
»Nein, du musstest zusammengedrückt werden, mit hochgelegenen Beinen.«
Daher also diese Knieschmerzen, die ich jetzt übrigens gar nicht mehr empfand! Aber zweifeln konnte ich an nichts mehr, ich war höchstens noch wissbegierig.
»Ich empfinde gar keinen Hunger.«
»Er wird schon noch kommen. Doch sind ja alle deine Lebensfunktionen vollständig aufgehoben gewesen.«
»Weshalb hat man mich wieder hierher gebracht?«
»Frage nicht so töricht!«
Sie hatte recht.
»Was soll nun mit mir geschehen?«
»Du wirst jetzt deine Arbeit wieder aufnehme.«
»Was für eine Arbeit?«
»Die Ausbildung der sechsundzwanzig Mönche zu Matrosen.«
»Ist diese nicht fortgesetzt worden?«
»Nein, man hat sie unterbrochen.«
»Und wenn ich mich weigere?«
»So bist du des Todes.«
»Dann ziehe ich den Tod vor.«
Ich sprach mit ruhiger Überlegung, mein Entschluss war gefasst.
»Weshalb ziehst du den Tod vor?«, klang es kühl zurück.
»Du musst fragen, welchem Leben ich den Tod vorziehe. Einfach einem Sklavenleben! Nicht wahr, wenn ich wieder fliehe, so werde ich immer wieder hierher zurückgebracht?«
»Immer wieder!«
»So ist mir der Tod erwünschter. Ja, ich habe erkannt, dass eure Macht größer ist, als ich je zu glauben wagte, ich habe vergebens darüber gespottet. — Wenn nicht mit dem Himmel, dann seid ihr mit der Hölle im Bunde. Nun ist mir aber auch das ganze Leben verleidet. Was nützt es mir, wenn ich es nicht nach freiem Willen verwerten kann? Nein, da ziehe ich den Tod vor. Ich glaube, mehr brauche ich gar nicht zu sagen.«
Ich hatte aus vollster Überzeugung gesprochen.
Eine kleine Pause folgte.
»Novacasa!«, erklang es da leise und etwas zärtlich aus dem finsteren Winkel.
»Was gibt es? Ich habe gar nichts mehr zu sagen.«
»Aber ich. Wer behauptet denn, dass du unser Sklave seist?«
Schon begann ich aufzuhorchen.
»Überlege dir doch ganz ruhig, wie alles gekommen ist! Du wurdest schiffbrüchig an unseren heiligen Strand geworfen, begingst gleich zwei Totschläge...«
»In Notwehr.«
»Gleichgültig — hatte der Patriarch nicht das Recht und sogar die Pflicht, dich zur Aburteilung den zuständigen Gerichten auszuliefern?«
»Das hatte er«, musste ich zustimmen.
»Er hat aber auch das Recht, dich selbst abzuurteilen, nach freiem Ermessen, und er tat es. Er suchte schon lange einen Seemann, der einige von unseren Mönchen zu Matrosen ausbilden könnte. Fragte er dich nicht erst, ob du das wolltest?«
»Ja, er fragte mich so.«
»Und du?«
»Ich gab meine Zusage.«
»Worauf er dich von der Sünde des Totschlages absolvierte. Warst du hier nicht ein ganz freier Mann?«
»Ja, und man hat mich gut behandelt.«
»Nun also — aber bist du deinem Versprechen nachgekommen? Nicht langer als drei Tage hast du dich deinen Schülern gewidmet. Dann bist du heimlich davongeflohen.«
Im Augenblick sagte ich mir, dass ich vor allen Dingen durchaus nicht ahnen lassen dürfe, wie ich wusste, dass der Patriarch Johannes und Schwester Johanna ein und dieselbe Person waren. Dann konnte ich mein Leben vielleicht noch retten und alles noch zum Guten führen.
»Johanna, ich will ganz offen sein: Die Liebschaft mit dir machte mich furchtbar besorgt, das war der Grund, warum ich floh.«
»Inwiefern besorgt?«
»Ich hoffte, dir deshalb nicht erst eine Erklärung geben zu brauchen. Sieh, du wirst doch hier so gut wie gefangen gehalten, nur ganz heimlich durfte ich dich besuchen, und wenn auch mit Einverständnis deines Bruders, so sah ich doch immer ein böses Ende voraus...«
»Gut, gut, ich verstehe dich. Aber du hast mich betrogen.«
»Darin verstehe ich auch dich, wenn du mir diesen Vorwurf machst. Ja, ich versprach dir ein Wiederkommen, während ich schon die Flucht vorbereitet hatte. Doch versetze dich in meine Lage...«
»Liebst du mich?«, unterbrach sie mich in einfachem Ton.
»Glaubst du, dass man wirklich ein Weib lieb gewinnen kann, das man niemals sehen, nur im Dunkeln fühlen darf?«
»Ja, ich verstehe dich. Unser ganzes Verhältnis ist ein unnatürliches. Darüber brauchen wir kein Wort mehr zu verlieren. Du glaubtest, du würdest hier mit Gewalt zurückgehalten werden, falls du fort wolltest?«
»Ich musste es annehmen.«
»Du irrst.«
»Du sagtest es selbst: Und wenn ich bis an das Ende der Welt flöhe, die Mönche würden mich überall sehen und mich wieder zurückbringen.«
»Das war nicht so gemeint, ich hatte als Beispiel nur deine Person gewählt.«
»So kommen wir doch zur Hauptsache: Ich soll meine Freiheit wiederhaben?«
»Entledige dich deiner Verpflichtungen, und du kannst hingehen, wohin du willst.«
»Was für Verpflichtungen?«
»Die Ausbildung der Mönche.«
»Und dann?«
»Dann wird mein Bruder weiter mit dir darüber sprechen.«
»Er hat noch andere Aufträge?«
»Darüber habt ihr doch schon zusammen gesprochen. Du sollst dein Examen machen und die Führung unseres Schiffes übernehmen.«
»Und wenn ich nicht darauf eingehe?«
»Das brauchst du ja auch nicht. Das wäre ein ganz neuer Kontrakt, zu dem du doch nicht gezwungen wirst. Gehst du aber darauf ein, so musst du ihn auch halten. Du wirst für deine Dienste natürlich auch bezahlt, sehr gut sogar, du kannst fordern.«
Konnte man mir edelmütiger entgegenkommen? Und ich glaubte es, so unnatürlich auch alles war.
»Weißt du, was ich in Pernambuco erlebt habe?«
»Mein Bruder hat ja alles beobachtet, mir davon erzählt.«
»Hat er mich auch in einer Kirche gesehen?«
»Ja, und was wir uns vielleicht nicht erklären konnten, da das heilige Licht ja nicht direkt allwissend macht, das konnten uns die Bettelmönche berichten, die deine Kiste begleiteten.«
»Was habe ich denn da in jener Kirche getan?«
»Du hast eine Dona Privilega geheiratet — das steht ja auch in deinen Papieren.«
»Und das sagst du so ruhig?«
»Warum soll ich nicht?«
»Du bist nicht eifersüchtig?«, fragte ich jetzt direkt.
»Eifersüchtig?«, klang es kühl zurück. »Was heißt eifersüchtig? Doch darüber kann ich dir keine Rechenschaft geben. Ich bin ein seltsames Weib, ganz, ganz anders als die übrigen. Aber sage, habe ich dich je schwören lassen, mir treu zu sein? Habe ich dich überhaupt jemals gefragt, ob du mich wirklich liebst?«
»So brauche ich, wenn ich hier bleibe, dich auch nicht wieder zu besuchen?«
»Wie du willst. Zwingen werde ich dich nicht. Aber das vernimm: Wenn du irgend etwas verrätst, dann — erwarte Fürchterliches.«
»Ich denke nicht daran.«
»Ja, ich weiß, dass du auch während deiner Abwesenheit kein Wort über deine nächtlichen Abenteuer hast verlauten lassen, du bist ein ganzer Mann, und eben deswegen vertrauen wir dir noch immer und werden dir immer noch trauen. Doch das hat mein Bruder ja gleich gesagt, und er irrt sich nie.«
»Und wenn ich wiederkomme?«
»So bist du mir natürlich höchst angenehm.«
Ich wusste kaum noch, was ich von alledem denken sollte.
»Es liegt dir gar nicht so viel daran?«
»Frage nicht so — schließlich bin doch auch ich ein Weib und habe meine Ehre. Im hellen Tageslichte könnte ich gar nicht so sprechen.«
»So erlaube mir darüber nur noch eine Frage: Du lagst doch vorhin neben mir, hattest mich zärtlich umschlungen.«
»So nimm an, dass ich nur Komödie spielen wollte. Du solltest denken, du seiest noch in Brasilien, solltest mich für die Witwe halten — ich habe mich nur an deinem Erstaunen und Schreck geweidet.«
»So sind wir jetzt fertig?«
»Du kannst gehen. Es ist auch die beste Zeit, es ist kurz nach Mitternacht.«
»Wohin soll ich denn gehen?«
»Nun, in dein Boot, du kommst vom Fischfang.«
»Was? So soll ich tun, als sei das vergangene Vierteljahr gar nicht gewesen?!«
»Richtig, nimm das an!«
»Und was werden die Mönche dazu sagen?«
»Die werden nichts sagen, die haben überhaupt keinen eigenen Willen.«
»Sie sind von deinem Bruder instruiert worden?«
»Höchstwahrscheinlich.«
Es klopfte an der Tür.
»Mitternacht ist vorüber, der Mond untergegangen«, ließ sich eine quäkende Stimme vernehmen.
Ich machte es kurz, rang alles nieder, was mich überwältigen wollte, erhob mich.
»Auf Wiedersehen morgen Abend, meine teuerste Johanna, meine einzigst Geliebte!«
Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich das damals ganz mechanisch, wie aus dreimaliger Gewohnheit, oder in einem Anfall von Galgenhumor gesagt hatte. Gesagt habe ich es jedenfalls.
»Gut! Jetzt habe ich dein Versprechen schon wieder«, entgegnete es schnell aus der Finsternis.
»Aber es ist kein Versprechen für die Ewigkeit.«
»Nein, so etwas verlange ich auch gar nicht — nur für morgen Abend halte dein Wort!«
»Das lasse ich mir gefallen. Dann auch noch einen Abschiedskuss. du meine Heißgeliebte.«
Gewiss! Sofort umschlangen mich zwei weiche Arme, es fand noch eine herzhafte Küsserei statt.
»Nun lebe wohl, mein einziger Novacasa! Vergiss deine Papiere nicht, sie liegen unter dem Kopfkissen!«
Ich fand sie wirklich, auch sonst fühlte sich alles nicht anders an, als ob ich noch in der Räucherkammer der Schifferkneipe im brasilianischen Santa Anna sei, es war eben alles so arrangiert worden, deutlicher konnte ich ja in der Dunkelheit nichts unterscheiden. Auch eine Kutte hatte ich schon wieder an.
»Hier heraus!«
Eine weiche Hand geleitete mich einige Schritte, dann wurde sie von einer anderen abgelöst, ebenfalls weich, aber sehr fett, eine Tür schloss sich, eine andere ging auf, einige Schritte weiter, eine Treppe hinauf, und ich stand in dem hell erleuchteten Turmzimmer vor dem schwarzen Eunuchen mit seinem speckglänzenden Vollmondsgesichte.
»Schon wieder Fische im Boote, Effendi!«, grinste er.
»Na, was sagste denn dazu!«, musste ich mir doch erst einmal Luft machen.
»Was sagen dazu, Rajah Effendi? Feine Nacht heute, ganz ruhig.«
Ich folgte ihm durch den waldigen Garten, der Eunuch zog aus dem Versteck ein Boot hervor, ich trat versehentlich mit dem einen Fuße in einen Korb voll schlüpfriger Fische, und ich stemmte die Ruder ein.
Hinter mir brannte der Leuchtturm, vor mir leuchteten einige Fenster des Klosters St. Lavra, und als ich mich in der Mitte dieser beiden Lichtquellen befand, da ließ ich einmal die Ruder fahren und lachte — lachte, wie ich wohl noch nie gelacht hatte.
Wie würde man mich dort empfangen? Nun, ich würde ja sehen.
Ich erreichte den kleinen Hafen, band mein Boot an, nahm den Korb mit Fischen und ließ an dem Klostertor den Klopfer erschallen.
Der alte Pförtner öffnete.
»Nun, mein lieber Novacasa, wieder einen guten Fang gemacht?«
Also vortrefflich instruiert! Nicht das geringste Staunen, kein Wimperzucken. Ja, es geht doch nichts über solch eine Klosterdisziplin oder vielmehr Klosterzucht — denn unter Disziplin wird im Kloster etwas anderes verstanden, Kasteiung — diese Zucht geht wirklich noch über die strengste militärische Disziplin.
»Hier einen ganzen Korb voll«, entgegnete ich unverzagt, meine Makrelen präsentierend. »Aber, mein guter Freund, das Brötchen heute Abend hat nicht gereicht, ich habe noch rechten Hunger.«
Ich vergaß, dass ich ja vor einem Vierteljahre mir für den letzten Abend eine sehr reichliche Mahlzeit bestellt hatte.
»Du brauchst ja nur zu bestellen, die Klosterküche ist die ganze Nacht auf.«
Gut, ich ging den gewohnten Weg, den ich noch nicht vergessen hatte. Jede Zellentür hatte einen Klopfer, aber ich begegnete schon auf dem Korridore einem Mönch, der nach seinem besonderen Abzeichen Nachtwache zu gehen hatte, teilte ihm meine Wünsche mit, und zehn Minuten später wurde mir eine Lampe und eine vollbesetzte Platte nebst einer ganzen Flasche Wein gebracht.
Ich aß, mit keinem größeren Appetit, als wenn ich seit sechs Stunden nichts gegessen hätte, machte mir über dieses Rätsel auch keine Kopfschmerzen, dann legte ich mich auf mein ziemlich behagliches Bett und schlief den Schlaf des Gerechten, ohne wieder von einer Schraube ohne Ende zu träumen.
Am nächsten Morgen aber fragte ich mich ernsthaft, ob ich das alles nicht nur geträumt hätte, nämlich die ganze Flucht von hier, meine Reise nach und meine Abenteuer in Brasilien.
Doch ich brauchte ja nur einen Blick zum Fenster hinaus zu werfen. Wenn ich wirklich dies alles nur in einer einzigen Nacht geträumt hätte, so musste gestern Hochsommer gewesen sein, und über Nacht war Spätherbst geworden, schon mehr Anfang Winter. Alle Bäume und Büsche total entlaubt, auf den Bergen sah ich bereits Schnee liegen.
Außerdem stand es ja in meinen Papieren, in dem Heiratsschein, dass ich wirklich der Gatte der Dona Privilega gewesen war.
Fort mit allen zweifelnden Gedanken und die Sache genommen, wie sie nun einmal war!
Ich begab mich hinab zum Strande. Da lag der alte Segelkasten. da standen meine sechsundzwanzig Kuttenschüler, Knaben wie Greise und murmelten zur Begrüßung ihren Morgensegen.
Also denn mal los wieder, als wäre unterdessen nicht ein Vierteljahr verstrichen. Das war alles gestern gewesen.
Meine Schüler waren nicht geschickter und nicht ungeschickter, nicht klüger und nicht dümmer geworden.
Da kam der Patriarch. Noch ganz derselbe. Nur das schwarze Tüpfelchen unter dem linken Ohr war ihm unterdessen vergangen. Und dennoch — meine Geliebte! Oder nein, vielmehr — das hier war der Patriarch Johannes, erst drüben auf der Insel verwandelte er sich in seine eigene Schwester Johanna.
O, ich konnte mich schon vollkommen in diesen Gedanken hineinfinden.
»Guten Morgen, Novacasa!«
»Guten Morgen, Euer Hochehrwürden!«
»Bist du mit deinen Schülern zufrieden?«
»Sehr, Hochehrwürden!«
»Bis wann glaubst du sie vollkommen zu tüchtigen Matrosen ausgebildet zu haben?«
»In spätestens vier Wochen.«
»Das ginge ja sehr schnell.«
»Ja, mit dummen Schiffsjungen, welche den größten Teil ihrer Zeit über doch zu den niedrigsten Reinigungsarbeiten verwendet werden, ist das ja etwas ganz Anderes. Es ist ja auch mit jedem Handwerk so. Um schustern zu lernen, braucht man doch gewiss keine drei oder sogar vier Jahre. Nur darf man dabei nicht so viele Laufgänge zu besorgen haben, Kinderwarten und dergleichen. Und dann ist es doch ein Unterschied, ob man als halbreifer Knabe oder als erwachsener Mann etwas lernt, wenigstens bei solchen Sachen.«
»Du sprichst sehr wahr. Guten Morgen!«
»Guten Morgen, Euer Hochehrwürden!«
Am Abend ging ich wieder angeln — im Trüben, im Stockfinstern fischen.
Es war ganz genau dasselbe.
»Mein einzigst geliebter Novacasa!«
»Mein süßestes Mädchen!«
Und dann vier Stunden später:
»Auf Wiedersehen morgen Nacht, du mein teuerster Schatz.«
»Ach, dass wir so schnell scheiden müssen!«
»Du wirst morgen wiederkommen?«
»Na sicher.«
Und auf dem Heimwege beim Rudern lachte ich mir eins — aber ich kam am anderen Abend wieder, das war doch die Hauptsache.
So trieb ich es vier Wochen lang. Nur stürmisches Wetter ließ den nächtlichen Besuch aussetzen, und dann... verbrachte ich meist eine schlaflose Nacht, mich vor Sehnsucht abhärmend. Dabei war von eigentlicher Liebe, die vom Herzen kommt, gar keine Rede. Merkwürdig, aber es war so. Doch es war ja überhaupt eine ganz rätselhafte Geschichte, die wohl schwerlich ihresgleichen hat.
Nach noch nicht vier Wochen exerzierten meine Matrosen tadellos. Ich war mit dem alten Kasten in einen regelrechten Sturm hinausgefahren, hatte ihn glücklich wieder herausgebracht, und vor dem letzten Tage, an dem ich dem Patriarchen meine Mannschaft als tadellos ausgebildet melden wollte, machte ich noch eine nächtliche Fahrt, ebenfalls bei sehr stürmischem Wetter, und am frühen Morgen erlebten wir an der Küste einen regelrechten Schiffbruch, in dem der alte Trog zwar zugrunde, aus dem aber meine Leute als wahre Seehelden hervorgingen. Jeder hatte seine Pflicht bis zur letzten Sekunde getan, sich voll und ganz bewährt, und Hunderte von Zuschauern hatten es vom Ufer aus beobachtet.
Gerettet waren sie alle worden, noch ein glänzendes Manöver in zwei Booten, durch die Brandung gesetzt, und ich führte die sechsundzwanzig Matrosen in triefenden Kutten, an denen sich schon Eiszäpfchen bildeten, aber mit glühenden Köpfen dem Patriarchen vor, der am Ufer den Schiffbruch mit beobachtet hatte.
»Euer Hochehrwürden, meine Schüler sind zu den tüchtigsten Matrosen ausgebildet!«
Meine Geliebte konnte auch als Patriarch Johannes lächeln. Es war aber auch etwas Staunendes, Bewunderndes dabei.
»Das sagst du mir jetzt, wo ich soeben Zeuge geworden bin, wie ihr das Schiff scheitern ließt, dass nur noch einige Planken übrig geblieben sind?«
»Euer Hochehrwürden, wenn Sie so sprechen, dann muss ich Ihnen sagen, dass Sie von der christlichen Seefahrt einfach nichts verstehen. Dieses Schiff wäre verloren gewesen, und wenn auch alle Teufel...«
»Ruhig, ruhig, und ich weiß schon, ich verstehe dennoch etwas von der Seefahrt, vielleicht mehr, als du glaubst. Ja, ihr habt eine bewunderungswürdige Leistung vollbracht. Rajah Novacasa, ich möchte dich dann, wenn du dich erholt hast, auf der Basilia sprechen.«
»Erholung? Jeder meiner Leute ist noch vierundzwanzig Stunden arbeitsfähig.«
»So komm nach dem Mittagessen hinauf.«
Sprach's und wandte sich, ruhig und würdevoll wie immer, während die anderen Mönche etwas von ihrem anerzogenen Phlegma verloren, uns Ovationen brachten und als Sieger priesen, obgleich wir eine Niederlage erlitten hatten.
Nach dem Essen kletterte ich durch den entlaubten Wald empor, ward in einem ganz einfachen Zimmer von dem Patriarchen empfangen.
»Kein Wort darüber!!«, rief er mir gleich beim Eintritt streng oder doch warnend entgegen.
Ich verstand ihn sofort. Hier gab es keine Vergangenheit.
»Du hast dein Steuermannsexamen unterdessen noch nicht gemacht?«
»Nein.«
»Du wirst es bestehen können?«
»Sofort. Ich habe mich darauf vorbereitet.«
»Wo?«
»Auf dem...«
Eine Handbewegung schnitt mir das Wort ab. Übrigens musste er das alles wissen, denn ich hatte der ›Schwester‹ alles ganz ausführlich berichten müssen, bei meiner Erzählung, wie ich die alte Schachtel geheiratet hatte. Als ich sie nur schilderte, hatte sie sich totlachen wollen. Sie wollte Intimes und immer Intimeres erfahren, was wieder ein ganz besonderes Licht auf diese meine Geliebte im Finstern warf. Sie hörte eben solche pikante Geschichten gern, es konnte ihr gar nicht pikant genug kommen.
»Willst du jetzt dein Steuermannsexamen machen?«
»Sehr gern.«
»Kannst du auch gleich dein Kapitänsexamen machen?«
»Auch das.«
»Und dann kannst du sofort ein großes Seeschiff führen?«
»Gewiss!«
Über das alles hatte mich der Patriarch ja schon zur Genüge als ›Schwester‹ gefragt, das war jetzt alles nur noch Form.
»So höre: Es wäre mir am liebsten, wenn du diese Prüfung in Konstantinopel ablegtest, und zwar vor einem englischen Seemannsamt.«
»Das hatte auch ich vor, und das ist im Mittelländischen Meere auch nur in Konstantinopel oder in Alexandrien möglich, und ich habe mich speziell auf ein englisches Examen vorbereitet.«
»Gut, so gehst du jetzt nach Konstantinopel...«
»Halt! Da habe ich erst noch einen Einwand zu erheben.«
»Nun?«
»Ich möchte dieses Examen für mich selbst als freier Mann machen.«
»Gewiss doch«
»Nicht etwa, dass ich dann noch verpflichtet bin, in Ihren oder in den Diensten dieser Mönchsrepublik zu bleiben.«
»Du willst uns verlassen?«, fragte der junge ›Mann‹ ganz ruhig.
»Nein, das ist nicht gerade meine Absicht, aber... da muss man vorher eben erst einen Kontrakt schließen, wenn auch nur einen mündlichen.«
»Du hast recht, ich stimme dir vollkommen bei. Bist du bereit, dann ein Schiff mit den Matrosen, welche du selbst ausgebildet hast, für uns zu führen?«
»Zu welchen Bedingungen?«
»Stelle du sie selbst!«
»Ich fordere pro Monat dreißig Pfund Sterling, und das für Fahrt zu Fahrt.«
»Dreißig Pfund Sterling?! Das ist zu viel! Das ist das Gehalt des Kapitäns auf einem großen Passagierdampfer!«
»Was für ein Schiff soll ich führen?«
»Einen Segler von nur dreihundert Tonnen.«
»Tragen meine Matrosen Mönchskutten?«
»Gewiss, aller Welt soll gerade gezeigt werden, dass die Klosterrepublik von Athos jetzt ihr eigenes Schiff hat, wenn es auch unter griechischer Flagge fahren wird.«
»Und das eben sind die Gründe, die mich erst dazu bewegen, pro Monat dreißig Pfund zu fordern, während der Kapitän solch eines Seglers sonst kaum die Hälfte erhält.«
»Was für Gründe?«
»Bitte, wollen Sie ruhig erwägen. Jeder Seemann hat seinen Stolz, und auch ich bin ein echter Seemann. Ich gehöre nicht zu der Mönchsrepublik, werde niemals dazu gehören, selbst wenn ich bereit bin, als Kapitän ebenfalls eine Mönchskutte zu tragen. Aber schwer wird es mir im Anfang werden. Stellen Sie sich nur vor, wenn das Mönchsschiff den ersten Hafen anläuft, wenn die Matrosen in Kutten in der Takelage herumturnen, wie wir da gehänselt werden! Mögen Ihre Mönche davon ganz kalt gelassen werden, mir wird's anders ergehen. Mich wird es wurmen. Ich spreche ganz offen. Da ist die einzige Waffe, die ich gegen diesen Spott habe, dass ich wenigstens sagen kann ja, dafür erhalte ich aber auch noch einmal so viel Heuer wie ihr armen Kerls! Auch meine Matrosen bekommen doppelte Heuer! Meine Reederei ist die Mönchsrepublik vom Athos — versteht ihr? — das ist nicht so eine knauserige Reederei wie die eure, die euch nur wurmzerstochenes Hartbrot fressen lässt — pardon, ich spreche zu Seeleuten — das ist eine pikfeine Reederei, und die hat es auch dazu, die braucht nicht zu geizen...«
»Ich verstehe, ich verstehe«, lächelte der junge Patriarch, »und da muss ich dir vollkommen recht geben...«
»Und hat es diese Klostergemeinde etwa nicht wirklich dazu?«
»Ja, wir haben es dazu«, lächelte der Patriarch wieder.
»Na also! Dann aber auch heraus damit! Es wenigstens zeigen. Und das sage ich gleich: Wenn ich nun einmal Kapitän bin, dann will ich auch meinen Port und meinen Champagner in der Kajüte haben, um jeden Kapitän, der mich einmal besucht, standesgemäß bewirten zu können...«
»Du wirst wenig Besuch bekommen.«
»Herr, sind Sie wirklich Seemann gewesen?«
»Nein.«
»Dann können Sie da auch gar nicht mitsprechen. Und die Flügel beschneiden lasse ich mir nicht! Ich muss allen Höflichkeitspflichten nachkommen können, die unter uns Seeleuten die sogenannte Routine bilden, da kann ich nicht...«
»Schon gut, schon gut«, unterbrach mich der Patriarch, und je energischer ich sprach, desto bewundernder schaute er mich an, er vergaß, dies zu verbergen. »Du sollst ganz deinen freien Willen haben, und das umso mehr, weil wir dir vollkommen trauen. Nur eins wundert mich.«
»Was wäre das?«
»Du fragst gar nicht, wohin die Reise gehen soll?«
»Das, geehrter Herr, ist überhaupt nicht Sache des Kapitäns. Er stellt sich in den Dienst seiner Reederei, macht das ihm anvertraute Schiff klar, und erst kurz vor der Abfahrt erhält er seine Order, wohin er das Schiff zu bringen hat. Auch die Matrosen werden angemustert, ohne zu erfahren, wohin die Reise geht. Auf hohe See, weiter nichts. Und da gibt es unterwegs keine Frage: Ach, entschuldigen Sie gütigst, wohin kutschieren wir denn eigentlich? Ganz ausgeschlossen! Und so will ich das auch hier gehandhabt wissen. Ich betrachte Sie jetzt als meinen Reeder. Sie haben wohl auch schon gemerkt, dass ich Sie seitdem per Sie anrede.«
»Ausgezeichnet, gefällt mir immer besser! Auf wie lange Zeit würden Sie sich da verpflichten?«
»Auf ein halbes Jahr. Genügt das?«
»Vollkommen. Dann würden wir also einen neuen Kontrakt machen.«
»Wenn ich darauf eingehe.«
»Selbstverständlich. Nun aber noch eins! Würden Sie einen anderen über sich dulden?«
»An Bord meines Schiffes? Nein!«
»Nicht etwa als Kommandanten, sondern nur als... unseren Vertreter, der Ihnen sagt: Segeln Sie dahin, segeln Sie dorthin...«
»Ach so, einen Reederagenten, oder einen Frachtkapitän! Selbstverständlich. Nur in das Kommando hat er nicht dreinzureden.«
»Das ist ganz ausgeschlossen. So wären wir also einig. Wir sprechen noch des Näheren darüber.«
Ich war entlassen. Am Abend sah ich den Patriarchen als seine Schwester Johanna wieder — oder fühlte sie doch. Ich musste mir ein Lachen verbeißen, als sie sagte, ihr Bruder habe ihr den Inhalt unserer Unterredung in einem Briefe mitgeteilt. Der weibliche Patriarch aber stand auch ganz auf meiner Seite.
»So ist es richtig, so ist es richtig! Lass dir nichts gefallen!«, trat sie nach Weiberart auf.
Diesmal war es ein Abschied für lange, denn sie wusste bereits, dass ich morgen schon nach Konstantinopel gehen würde.
»Wir sehen uns wieder. Wirst du mir auch... ha, jetzt hast du gewiss gedacht, ich würde dich fragen, ob du mir treu bleiben wirst? Hahaha! Nein, nein, mein Novacasa, ich hoffe vielmehr, dass du mir bei deiner Rückkehr recht viele Liebesabenteuer erzählen kannst. Du wirst doch deinem berühmten Namenvetter keine Schande machen.«
Ein ganz eigentümliches Weib! Aber auch eins von der ganz gefährlichen Sorte.
Ich hatte generös hundert türkische Pfund erhalten, so ziemlich den englischen Pfund Sterling entsprechend, 2000 Mark. Zur Fahrt nach Konstantinopel benutzte ich einen kleinen griechischen Dampfer, der im Hafen von Athos gelegen hatte, und zwar ging ich nicht als Mönch mit, sondern aus dem Magazine eines Klosters war mir ein tadelloser Gentlemananzug zur Verfügung gestellt worden, sogar mit Seemannsschnitt, man schien hier mit allem versehen zu sein. Ich sah schon jetzt wie ein wohlbestallter Kapitän aus, nur die dicke goldene Uhrkette fehlte mir noch.
Ich meldete mich auf der englischen Abteilung des türkischen Seemannsamtes zum Steuermannsexamen, hatte die schriftliche und mündliche Prüfung in zwei Tagen unter zeitweiliger Gegenwart des englischen Generalkonsuls mit einem ›very good‹ bestanden. Die Kapitänsprüfung war dann nur noch eine Formsache.
»Haben Sie schon etwas in Aussicht?«, fragte mich der dicke Kapitän eines englischen Salondampfers, der als unparteiischer Schiedsrichter fungierte. »Sie könnten bei mir als Zweiter anmustern, Sie gefallen mir.«
Ich bedauerte, und zwar aufrichtig. Es war ein Vergnügungsdampfer, der um die Welt ging. Ich hatte schon so viel davon gehört, wie es auf solch einem großen Passagierdampfer zugehen sollte; ja, da kann man etwas erleben, und ich war auch früher nie auf einem Passagierdampfer gefahren. Bei einer Seereise hatte ich immer mein eigenes Kriegsschiff zur Verfügung gehabt — und darauf kann man nun weniger etwas erleben. Diese Herrschaften, die in den ersten Reihen des Hofkalenders stehen, wissen ja überhaupt gar nicht, was ›sich amüsieren‹ heißt — so wenig wie der Berliner, der nicht aus dem monotonen Häusermeere herausgekommen ist.
Ich spazierte auf der Straße, klimperte mit meinen Goldstücken in beiden Hosentaschen und überlegte mir, wie ich die am vernünftigsten, oder besser unvernünftigsten, in möglichst kurzer Zeit totschlagen könne. Wenn nicht als Matrose, dann als Kapitän. Aber totgeschlagen mussten sie auf alle Fälle werden. Viel Amüsement hatte ich ja in letzter Zeit nicht gehabt, und dann kam wieder eine lange Seereise. Eine Zehnpfundnote hatte ich schon extra in die innere Westentasche gesteckt, die genügte zur Heimkehr.
Da hörte ich hinter mir ein Geschrei — es kam etwas die Straße herauf, eine Sänfte mit der nötigen Begleitung, vornweg ein sackbehoster Kümmeltürke, der mit quäkender Stimme immer etwas brüllte und dazu einen goldenen Knüppel schwang, ab und zu einem Saumseligen, der nicht schnell genug auswich, eins über den Rücken ziehend.
Ich wollte ausweichen, aber ich konnte es beim besten Willen nicht, auf beiden Seiten der Straße drängte sich die Volksmasse, und ehe ich mich des versah, fühlte auch ich den Knüppel auf meinem Rücken.
Im nächsten Augenblick hatte ich den vergoldeten Stock zerbrochen und schlug dem Lümmel die beiden Enden um die Ohren.
Nicht nur aus dem Gefolge stürzten die Wächter auf mich los, schon mit geschwungenem Säbel, sondern auch aus der Volksmenge, und da konnte ich mich gar nicht viel wehren, ich wurde einfach, wie man sagt, ›zugedeckt‹.

Als ich wieder etwas zu mir kam, meine Fäuste gebrauchen wollte, waren diese schon auf dem Rücken befestigt, nicht nur mit Stricken, sondern gleich mit Fesseln. Unter einem Mordsskandal wurde ich vorwärtsgeschoben, dann war ich nur noch zwischen bewaffneten Türken. Es ging über einen Hof, und ich wurde in ein schwarzes Loch gestoßen, nicht aber, ohne dass man mir vorher meine sämtlichen Taschen mit einer fabelhaften Fertigkeit geplündert hätte.
»Na, das ist ja wieder eine nette Geschichte!«, seufzte ich, als ich mich gegen die Wand lehnte.
An dieser konnte ich einen halben Tag lehnen, ohne dass sich die Tür meiner finsteren Zelle öffnete. Dann aber kam doch jemand, ich wurde hervorgeholt, und beim Passieren der Tür hatte ich schon an jedem Fuße eine Kette, die in der Hand eines Wächters endete, sodass ich durch einen kurzen Ruck zu Fall gebracht werden konnte.
Ich kam vor den Kadi, der aber wie noch andere Männer oder Herren einen schwarzen Gehrockanzug trug, nur auf dem Kopfe einen roten Fes mit blauer Troddel, dafür aber keine Beine am Leibe hatte. Das heißt, ich konnte diese nicht sehen, weil die Herren alle hinter ihrem Tische mit gekreuzten Beinen auf den Stühlen hockten.
»Sprechen Sie Türkisch?«
»Nein.«
»Französisch?«
»Ja.«
»Wie heißen Sie?«
Ehe ich noch meinen Namen nennen konnte, stürzte ein echter Türke herein, der etwas brüllte, und ich ward sofort wieder abgeführt.
Es war eine besser erleuchtete Zelle, in der ich mich auch auf eine Pritsche setzen konnte — weniger gefiel mir, dass man die beiden Fußketten zuvor noch an der Wand in Ringen befestigt hatte.
Bald erschien ein echter Türke im langen, orientalischen Gewand.
»Wie heißen Sie?«, nahm der jetzt wieder das unterbrochene Verhör auf, sich gleichfalls des Französischen bedienend.
»Das steht in meinen Papieren, die man mir abgenommen hat.«
»Also, das sind Ihre Papiere?«
»Wessen sonst?«, blieb ich bei meinem Trotz.
»Sie heißen Napoleon Bonaparte Novacasa?«
»Da haben Sie ganz richtig gelesen.«
»Sie sind vor etwa vier Monaten mit einem türkischen Schiffe namens ›Kawassi‹ von Konstantinopel nach der Insel Thaso gefahren?«
»Stimmt alles — bis auf das, was Sie nichts angeht.«
»Ein Leugnen würde Ihnen auch gar nichts nützen.«
»Was soll ich denn leugnen?«
»Sie sind erkannt worden.«
»Was erkannt worden?«
Der alte Kümmeltürke holte weit aus.
»Sie haben«, fing er dann an, »damals, als Sie sich in Stambul aufhielten, einen Hund gestohlen.«
Himmelbombenelement!!! An meine Rosamunde hatte ich wirklich gar nicht mehr gedacht, auch hier in Konstantinopel nicht. Man muss nur bedenken, dass ich doch den Kopf mit meinem Examen voll hatte.
Jetzt aber fiel es mir nur zu deutlich ein. Auweh! Das sollte der Lieblingsschoßhund von der Sultaninmutter gewesen sein, und ich befand mich hier in einem noch nicht ganz zivilisierten Lande.
»Ich verlange, vor den Kadi geführt zu werden.«
Diese Forderung sagt wohl alles, woran ich im Augenblick dachte. Nur nicht so im geheimen abgeurteilt werden! Vor einem öffentlichen Gerichte konnte man mir ja nicht viel tun.
»Sie stehen bereits vor dem Untersuchungsrichter.«
»Das ist nicht wahr.«
»Sie haben einen Hund gestohlen?«
Na, leugnen half hier doch nichts, und vor allen Dingen wollte ich wissen, was man deswegen mit mir vorhatte, wie man hier den ganzen Fall auffasste. Nur erst Gewissheit!
»Es war eine Hündin.«
»Ganz richtig, Fatime, die Lieblingshündin der Sultanadina.«
»Das habe ich nicht gewusst, das hat mir das Vieh nicht gesagt...«
»Hören Sie nicht, was für eine Hündin das gewesen ist?!«, unterbrach mich der Türke drohend. »Sprechen Sie von der Lieblingshündin der Sultanadina mit dem gehörigen Respekt!!!«
»Ja, also ich wusste nicht, dass dieses gnädige Fräulein einen so hohen Rang einnahm, ihr liebliches Mündchen konnte es mir auch nicht sagen, und überhaupt habe ich sie gar nicht entführt, sondern das gnädige Fräulein ist freiwillig mit mir gegangen, ohne dass ich es überhaupt wollte.«
»Sie ist Ihnen nachgelaufen?«
»Ja, wenn man sich bei der Lieblingshündin der SultanaWalide so ausdrücken darf. Sie war so vernarrt in mich, dass sie dazu gleich alle viere benutzte.«
»Der SultanaWalide? Er gehörte der Sultanadina!«
»Ich bin leider in die Geheimnisse des Serails noch nicht so tief eingeweiht, um diesen Unterschied zu kennen.«
»Die SultanaWalide ist die Mutter des Sultans, die Sultanadina seine Lieblingsfrau.«
»Ah so! Dann ziehe ich die letztere der ersteren vor.«
Mein Humor war zurückgekehrt, ich machte mir aus gar nichts mehr etwas. Der Türke schien meine Bemerkung überhört zu haben.
»Es wurde der ›Kawassi‹ doch eine Kriegsjacht nachgeschickt, es wurde Ihnen nachgerufen, zu stoppen, den Hund herauszugeben.«
»Das ging mich gar nichts an, das war Sache des Kapitäns, und es war gar nicht möglich, die eben erst gesetzten Segel wieder zu streichen.«
»Nun gut! Es genügt schon, dass Sie so weit geständig sind. Was haben Sie mit dem Hunde gemacht?«
»Ihn sehr gut gepflegt.«
»Wo befindet er sich jetzt?«
»Im Hundeparadiese.«
»Wo?«
»Er ist tot — von fremden Leuten totgeschlagen worden.«
Meinem Richter genügte diese Erklärung, er wollte gar nicht die näheren Umstände wissen. Jetzt aber begannen seine Augen boshaft zu funkeln, das gefiel mir weniger.
»Sie haben gestanden, das genügt. Wissen Sie, was Ihr Los ist?«
»Das kann nicht schlimm sein.«
»Sie sind des Todes!«
Er hatte mir das im Tone einer interessanten Mitteilung gesagt.
»Weil ich den Hund mitgenommen habe, der mir nachgelaufen ist? Machen Sie sich doch nicht lächerlich, Mann!«
»Sie sind des Todes!«
»Ich verlange, vor den staatlichen Kadi geführt zu werden.«
»Wissen Sie, wo Sie sich hier befinden?«
»Nun?«
»Im Kubakan.«
»Kenne ich nicht. Was ist das?«
»Sie werden es erfahren. Diese Zelle hier mag freundlicher aussehen als die vorige, aber von hier aus dringt keiner Ihrer Hilferufe mehr in die Welt. Sie sind ganz einfach verschwunden.«
»Man wird mein Verschwinden schon bald genug bemerken.«
»Ah, bah! Wegen der kleinen Schlägerei heute werden Sie freigesprochen oder erhalten nur eine Geldstrafe, man entlässt Sie, das wird morgen in den französischen und englischen Zeitungen Stambuls stehen. Sie sind sogar auf der Straße gesehen und gesprochen worden, das lässt sich alles arrangieren — und dann findet man irgendwo Spuren von Ihnen, Kleidungsstücke, Ihre Papiere — Sie sind verunglück, ermordet worden.«
»Auch eine mir ähnliche Leiche wird präpariert, nicht?«, fragte ich mit Seelenruhe.
»Sehr richtig, auch das!«
»Und wozu das alles?«
»Sie fragen noch? Damit wir Sie hier unterdessen ruhig gefangen halten können — bis es der Sultanadina gefällt, sich an den Folterqualen dessen zu ergötzen, der ihr das Liebste auf Erden geraubt hat.«
Ich gab tatsächlich für mein Leben schon keinen Pfifferling mehr.
»War und ist ihr Liebstes auf der Erde nicht der Sultan?«, konnte ich noch spotten.
»Der Spott wird Ihnen schon noch vergehen. Sie sollen die Sultanadina schon noch kennen lernen, was für eine Phantasie sie besitzt.«
»Dann hätte sie Dichterin werden sollen.«
»Bonjour, monsieur«, wünschte der Kerl auch noch, als er ging.
Ich brauchte nicht weiter über mein Schicksal nachzugrübeln, ich kannte es bereits. Jetzt hatte es bei mir dreizehn geschlagen.
O, Rosamunde, Rosamunde!!
Dann dachte ich auch daran, dass die Mönche auf dem Athos mich jetzt sehen müssten, schon alles Vorhergegangene. Denn an der Geschichte mit dem heiligen Lichte schien doch etwas zu sein.
Freilich allmächtig waren sie nicht. Nicht einmal in der Zukunft konnten die Stümper lesen.
Es wurde mir Essen gebracht, so eine Art Gulasch, und ein Krug Wasser. Die Sachen wurden so auf die Pritsche gestellt, dass ich sie eben noch erreichen konnte. Zu nahe kam mir keiner.
Der Abend brach an, ich streckte mich auf der Pritsche aus, was meine Fußfesseln erlaubten. Meine Hände waren schon vorher, ehe ich zum ersten Richter kam, vorn gefesselt worden, ziemlich weit voneinander.
Noch ein Tag und eine Nacht vergingen. Ich wurde nur von einem Wärter besucht, der nur Essen brachte, meine Zelle reinigte, was auch sehr nötig war, sonst nichts.
Am dritten Tage kam wieder der reichgekleidete Türke mit den boshaften Augen an. Er sprach ein Französisch, dass man seine orientalische Kleidung ganz vergaß, hatte auch solch vulgäre oder populäre Ausdrücke.
Erst betrachtete er mich lange Zeit, leise den Kopf schüttelnd.
»Mensch, haben Sie ein Glück!!«
»Wieso?«
»Sie wären unfehlbar langsam zu Tode gemartert worden, die Sultanadina hat nun einmal an so etwas ihren Spaß.«
»Geschmacksache. Und jetzt hat die Dame diesen Geschmack geändert?«
»Wenigstens in Bezug auf Sie.«
»Das freut mich«, durfte ich jetzt wohl mit Recht sagen.
»Wissen Sie, wer in der Sänfte gesessen hat, dessen Trawaka Sie schlugen?«
»Doch nicht die Sultanadina?«
»Ja, eben die, und sie hat hinter den Vorhängen hervor Sie gesehen, Sie
haben ihr Wohlgefallen erregt, und nun hat sie erfahren, dass eben Sie auch ihren Hund weggefangen haben.«
»Ja. und was nun?«
»Die Sultanadina begehrt Sie.«
»Ich stehe der Dame ganz zur Verfügung«, sagte ich keck.
Wieder betrachtete der Kerl mich lange, wieder schüttelte er bedächtig sein beturbantes Haupt.
»Mensch, haben Sie ein Glück!!«, wiederholte er.
»Ja, ja, Glück muss der Mensch haben!«, fing ich jetzt auch noch zu protzen an.
»Eigentlich wollte man Sie langsam zu Tode schmoren — und jetzt sollen Sie nur noch kastriert werden!«
Der Türke hatte mich schon längst verlassen. Und ich saß auf meiner Pritsche. Ganz geknickt! Sollte ich auch nicht!
Der Tod, ja. Meinetwegen konnte er auch weh tun. Aber so etwas — nein!
Doch was half's, dass sich vor Entrüstung mein Innerstes nach außen kehrte? Das änderte an der Sache gar nichts. Und so etwas schien hier sehr fix zu gehen.
Schon kamen drei Kerls an, denen ich gleich an. sah, dass es menschliche Schweineschneider waren.
Ich war ausgesprungen und spannte meine Arme.
»Nun kommt mal her, und der erste...«
Bums, da war ich im Finstern. Ich stak bis zu den Füßen in einem Sack, der von der Decke herabgefallen sein musste, und nun war es vollends mit jedem Widerstande vorbei. Überdies schien die Leinwand am Kopfende noch mit einem Betäubungsmittel getränkt zu sein, ich roch es, das Bewusstsein verließ mich.
Als ich wieder zu mir kam, musste es schon geschehen sein. Ich lag mit festgeschnallten Armen und Beinen auf einer Planke, die doch sicher der Seziertisch war, außerdem fühlte ich es auch sonst gleich. Der Raum war finster.
Himmel, musste mir das in meinen alten Tagen oder auch jungen Jahren passieren! Wenn einmal, da hätte man das früher tun oder noch fünfzig Jahre damit warten sollen.
Doch mir war gar nicht humoristisch zumute. Ich suchte in meiner Verzweiflung Trost in historischen Beispielen, wie andere so etwas aufgefasst hatten, dachte an den edlen Abaelard.
»Entmannt!«, stöhnte ich.
»Stöhnen, mehr stöhnen!«, flüsterte mir da eine Fistelstimme zu, wie eine solche mit der Zeit auch ich annehmen würde, und zwar wirklich auf deutsch.
»O, ihr Schufte!«
»Abdallah nix Schuft sein, Abdallah schwarzer Hakim. Stöhnen, stöhnen — Wasser! Stöhnen Waaasser!«
Ich wusste wahrhaftig nicht, was der wollte, mir ging noch keine sonnige Ahnung auf.
»Du bist der Serailarzt, der mich entmannt hat. Aber ich sage dir, ich werde...«
»Nix entmannt«, flüsterte die Fistelstimme wieder in mein Ohr hinein, »nur so getan.«
Ha, jetzt hatte ich es gehört!
»Was? An mir wäre die Operation nicht vollzogen worden?!«
»O no, o no, nur so getan!«
»Aber ich fühle es doch!«
»Nur Einbildung, nur Einbildung. Kannst noch Kinder kriegen so viele, wie der Stör Eier hat.«
Das war ein Trost! In doppelter Hinsicht. Im alten Testamente werden immer Nachkommen gewünscht wie der Sand am Meer. Das ist allerdings ein bisschen reichlich. Wer kann die Sandkörner am Meeresstrande zählen? Beim Stör hat man es schon getan. Soll wohl bis auf fünf Millionen Eier kommen. Das ist wenigstens eine Zahl, die man noch aussprechen kann.
»Ich bin nicht entmannt?«, musste ich zuerst immer wieder fragen.
»Nein, nein. Nur so getan. Solltest Eunuch der Sultanadina werden, weil du ihren Lieblingshund gemopst, aber die Sultanadina will dich lieber so, wie du bist. Verstehst du?«
O ja, ich verstand, und schon wandelte mich die Lachlust an.
»Musst aber tun, als hättest du Fieber — zwei, drei Tage lang — musst Waaasser! stöhnen.«
»Waaaaaasser!!«, ächzte ich gehorsam.
»Hier, trink!«
Das Ende eines Schlauches ward mir in den Mund gesteckt, und als ich saugte, kam kühle Limonade.
»Darf ich weiter mit dir sprechen?«, flüsterte ich.
»Jetzt noch. Bis andere Hakims kommen.«
»Wer bist du?«
»Abdallah, der HakimEklabren, und wenn du im Serail nicht weißt, was du mit dem Golde beginnen sollst, wirst du des armen Abdallahs gedenken.«
Ich erfuhr von meinem Wärter, der besser Französisch als Deutsch sprach, Näheres. Die Hauptsache habe ich ja schon gesagt.
Die Lieblingsfrau des Sultans hatte den erwischten Bösewicht zum Ersatz ihrer Lieblingshündin als Eunuchen haben wollen. So hatte sie gesagt, als sie gehört hatte, dass der Dieb festgenommen worden sei, nachdem sie mich selbst schon gesehen hatte, in dem Straßentumulte. Aber da hatte sie eben gleich andere Gedanken gehabt, wie sie sich die Langeweile im Harem auf eine noch bessere Weise vertreiben könne, als nur, indem sie ihre Launen an einem Eunuchen ausließ. Ich mochte nicht der erste sein, bei dem dies auf solche Weise gehandhabt wurde.
Abdallah war ein schwarzer Unterarzt, er hatte die vorgebliche Operation mit dem Hauptarzte des Serails vollzogen, noch zwei Wärter waren zugegen gewesen. Wer sonst noch alles in die Intrige eingeweiht war, wusste auch Abdallah nicht. Das Beste war eben, ich spielte überhaupt immer die Rolle eines von Schmerzen und Fieber Geplagten, ohne Ausnahme gegen irgendeine Person.
So wurde ich mit Flüsterstimme instruiert, ganz genau, was für Wünsche ich zu äußern habe und so weiter. Hier hatte man doch Erfahrung in so etwas, wie in einer Kapaunerie.
Und als Kapaun wurde ich behandelt, wurde aufs beste verpflegt. Noch an demselben Tage kam ich in ein weiches Bett, erst nach drei Tagen in einen hellen Raum, aber noch mit gedämpftem Licht, erhielt neben stärkenden Medikamenten die ausgesuchtesten Speisen.
Am Tage kam alle Stunden der Hauptarzt und... ich musste diese eiserne Physiognomie unbedingt für die eines unverfälschten Engländers halten! Ganz kaltblutig demonstrierte er nach Abnahme des Verbandes an meinem Körper anderen mitgekommenen Ärzten, unverfälschte Türken, zum Teil auch Neger, den Fortgang der Heilung meiner Wunde, die mir gar nicht geschlagen worden war. Also auch die Eingeweihten unter sich machten aus der Phantasie Wirklichkeit, ich musste nur bewundern, wie niemals einer aus der Rolle fiel, wie die Schüler Fragen stellten. Dabei ging es ganz wissenschaftlich zu, auch die schwarzen Ärzte mussten regelrecht studiert haben.
Am meisten bewunderte ich immer den englischen Arzt, einen noch ziemlich jungen Mann, zur Wohlbeleibtheit geneigt, fett, ganz sicherlich ebenfalls entmannt, wenn dies auch nicht an seiner Stimme zu merken war. Aber dieses Gesicht! So schwammig und dennoch wie aus Erz gegossen! Ich kann nicht beschreiben, was dabei auf mich einen so furchtbaren Eindruck machte. Und ganz Fachmann, ganz Gelehrter, Forscher! Der war unbedingt nur aus Liebe zur Wissenschaft ins Serail gedrungen, und der Weg in dieses geheimnisvolle Frauenheim fordert von jedem Manne sein Opfer.
Im Gegensatz zu den anderen mit Schmuck aller Art überladenen Ärzten — weiter haben sie ja auch nichts — trug er nur einen einfachen Siegelring.
Dem durfte ich mich am allerwenigsten anvertrauen, das wusste ich sofort, und ich hätte doch so gern einen Eingeweihten um Rat gefragt, solange es noch möglich war.
Denn mit mir stand es trotz alledem höchst bedenklich. Ich hatte schon genug vom Serail des Sultans gehört, gerade ich. Es ist leichter aus dem Zuchthaus zu entspringen als aus dieser Frauenburg, wenn einer einmal darin verschwinden soll. Es gibt ja Eunuchen, Wächter, die genügend Freiheit haben, aber einem Leibdiener der Sultanadina würde man eine solche schwerlich gewähren, am wenigsten unter derartigen Umständen.
Jetzt aber durfte ich doch etwas mehr von dem heiligen Lichte und von der Macht und Schlauheit der Athosbrüder hoffen — und im Übrigen bedeutete es für mich ein interessantes Abenteuer, das ich in meinen Erinnerungen nicht hätte missen mögen.
Am fünften Tage wurde ich für geheilt erklärt, wenigstens für bewegungsfähig. Ich erhielt Unter- und Überkleider, keinen Kaftan, sondern Pumphosen und Jäckchen, alles aus Seide und reich gestickt.
Als ich mich einmal im Spiegel erblickte, musste ich mir sagen, dass ich einfach ›reizend‹ aussah. Hoffentlich sah die Sultanadina dementsprechend aus. Deshalb gefragt hatte ich noch nicht. Ich wollte lieber sehr vorsichtig sein.
Es war ein anderer Arzt, ein gelber Türke, der mir noch besondere Vorschriften gab, wie man sich als Eunuch zu verhalten hat, das heißt, ich will lieber deutlicher sprechen, als Entmannter, das Gebaren und so weiter. Denn charakteristische Eigenschaften treten da doch bald zutage. Die Natur lässt sich nicht spotten. Mit einem Stimmwechsel hatte ich vorläufig nichts zu tun. Der ist in späterem Alter überhaupt sehr fraglich. Selbst Appetitlosigkeit für die nächsten Tage wurde mir vorgeschrieben.
»Weißt du, was dir bevorsteht, wenn du entdeckt wirst?«
»Kein angenehmes Los.«
»Der Tod!«
»Das glaube ich wohl.«
»Und denke nicht etwa, dass du dich darauf berufen kannst, die Sultanadina selbst hätte um alles gewusst.«
»Na, ich glaube schon, dass sich die dabei nicht die Finger verbrennen wird.«
»Und auch wir können niemals zur Verantwortung gezogen werden. Du würdest ganz, ganz allein dastehen vor dem Richter.«
Ich hielt alles für möglich.
»Wie heiße ich als Eunuch?«
»Den Namen gibt dir die Sultanadina selbst.«
»Wie habe ich sie anzureden?«
»Das erfährst du alles an ganz anderer Stelle. Oder auch nicht. Die Sultanadina liebt Tiere.«
Oho! Aber ich verstand sofort, so geistreich bin ich. Gewiss, ich habe mir auch nie einen schon dressierten Hund angeschafft, er muss, selbst wenn er schon älter ist, noch ganz unbeleckt sein — eigene Erziehung, er muss sich aus sich selbst entwickeln, dann wird er ein wirklich guter Hund, dann nimmt er sogar die Charaktereigentümlichkeiten seines Herrn an.
Hier im Zimmer musste ich in eine Sänfte steigen, welche sich alsbald in schaukelnde Bewegung setzte.
Ich gewahrte in der Verplankung, wo ich auch die Teppiche oder den Stoff zurückschob, nicht die geringste Ritze, keine Ventilation, ich wäre erstickt, wäre die Sänfte nicht so geräumig gewesen, um für eine Viertelstunde genug Sauerstoff zu enthalten.
Die Sänfte wurde niedergesetzt, eine Klappe geöffnet, ich kroch nach Aufforderung heraus, befand mich in einem luxuriös eingerichteten Badezimmer. Jeden Tag war ich dreimal gebadet worden, gewaschen und mit wohlriechenden Salben eingeschmiert, auch kurz vor meinem Abgange wieder, ehe ich die Kleider angelegt hatte, und jetzt, nach einer Viertelstunde, wurde ich schon wieder in die Marmorwanne gesteckt.
Das waren aber zwei andere schwarze Badediener, die mich hier behandelten, und außerdem kamen noch zwei schwarze Weiber hinzu.
So wussten nun schon wieder vier andere Personen, wie es um mich Eunuchen beschaffen war, was mich aber durchaus nicht erfreuen konnte. Gerade diese Sorglosigkeit, dass so viele in das Geheimnis — und man kann da von einem furchtbaren Geheimnisse sprechen — eingeweiht waren, bewies mir, wie sicher hier solch ein Geheimnis behütet wurde. Ein Verrat war eben ganz ausgeschlossen.
Und bei diesen Bademeistern und Bademeisterinnen hier machte ich zufällig eine Entdeckung. Alle keine Zunge! Das war sicher auch bei meinen vorigen der Fall gewesen, es war mir nur nicht aufgefallen.
Jetzt, da ich es bei des einen Gähnen zufällig bemerkte, erkannte ich es nun auch gleich bei den anderen. Also sogar ein Zungenabschneiden gab es hier noch! Gott sollte mich bewahren.
Da trat wieder der Hauptarzt mit dem englischen Gesicht ein. Eine Handbewegung, und die vier schwarzen Geister ließen mich aus ihren Händen, verschwanden aus der Badestube.
Jetzt erwartete ich eine Erklärung, günstig oder ungünstig für mich. Aber es sollte etwas Anderes kommen.
Der Arzt tippte mir auf das linke Schulterblatt.
»Was ist das?«
»What do you mean, Sir?«
»Nix Englisch«, wehrte er sofort meine klug berechnete Frage ab und fuhr auf französisch fort: »Was haben Sie hier auf dem linken Schulterblatt?«
Ich wusste nichts davon.
»Ein Muttermal?«
»Nein, das ist kein Muttermal.«
Schon hatte er einen kleinen Taschenspiegel zur Hand, einen zweiten, wusste die beiden so geschickt zu halten, dass ich im Glase mein eigenes Schulterblatt sehen konnte.
Richtig! Da waren neun kleine blaue Punkte eintätowiert in besonderer Anordnung, ein Kreuz bildend, das eine Feld aber als Dreieck geschlossen.
Hatte keine Ahnung, wie die dahin gekommen waren.
»Sind die denn tätowiert?«
»Gewiss! Gehören Sie einer geheimen Sekte oder einer sonstigen geheimen Verbindung an?«
In diesem Augenblick blitzte es in meinen. Kopfe auf. Die Brüderschaft vom Athos! Ich war während einer meiner mehrmaligen Ohnmachten tätowiert worden! Na, wartet! Darüber wollte ich sie doch noch zur Rechenschaft ziehen! Solch eine Schändung braucht man sich nicht gefallen zu lassen.
Ich hütete mich indes, diese meine Erkenntnis zu offenbaren.
»Einer geheimen Sekte? Nein, Habe keine Ahnung. Diesel Zeichen muss mir aus irgendeinem Grunde schon als Kind eintätowiert worden sein, habe noch nicht das Geringste davon gewusst.«
Der Arzt gab sich mit dieser Erklärung zufrieden, rief die vier männlichen und weiblichen Badewärter wieder herein, die ihre Beschäftigung mit mir fortsetzten. Der Hauptarzt musste in diesen Räumen noch mehr Macht haben als in den vorigen. Er hatte das Mal an meinem Körper doch wahrscheinlich schon früher gesehen, hatte mit mir allein sein wollen, um mich deswegen im Vertrauen zu fragen, wozu ihm das Fehlen der Zunge bei den Zuhörern noch nicht genügte; aber erst hier konnte er andere Personen einmal hinausschicken, ohne dafür einen Grund angeben zu müssen. Er selbst entfernte sich wieder.
Nachdem ich abgetrocknet worden war, wurde ich abermals am ganzen Körper mit wohlriechenden Salben der verschiedensten Art eingeschmiert. Unter den Büchschen und Fläschchen, zum Teil höchst kostbar, mit ziseliertem Gold geschmückt, erblickte ich auch eine einfache Zinntube, die die französische Etikette einer Nizzaer Firma trug. Danach enthielt die Tube fünfzig Gramm reines Rosenöl, extrafein. Es musste erst eine Plombe gelöst werden, dann wurden die fünfzig Gramm bis zum letzten Tropfen auf meinem Leibe verrieben.
Ich habe es einmal gewusst, weiß es jetzt aber nicht mehr, bin gegenwärtig nicht in der Lage, darüber Erkundigungen einzuziehen, was das Pfund oder nur das Gramm reines Rosenöl kostet. Nur dessen erinnere ich mich noch, dass man zur Herstellung eines Pfundes von diesem Extrakt rund eine Viertelmillion Rosen braucht, zu einem Kilo dreitausend Kilo Rosenblätter! So wurde also jetzt an mir das ätherische Fett von zirka 25 000 Rosenblumen verschwendet, und dass diese fünfzig Gramm Rosenöl eine hübsche Summe kosteten. darf man wohl glauben. Gespart wurde hier keinesfalls wenigstens nicht bei meiner körperlichen Verschönerung.
Andere schwarze Diener und Dienerinnen erschienen, die noch sehen konnten, dass ich durchaus kein richtiger Eunuch war. Ich wurde angekleidet, wieder in ein anderes, noch weit kostbareres Kostüm als das vorige gesteckt, dann musste ich wieder in die Sänfte steigen, die keinen Ausblick bot, wieder wurde ich reichlich zehn Minuten fortgetragen.
Als ich die Sänfte verließ, befand ich mich... abermals in einem Badezimmer, wurde an diesem gesegneten Morgen innerhalb von noch nicht zwei Stunden zum dritten Male von geschäftigen Händen gebadet und von frischem eingesalbt, dann mit einem immer noch kostbarerem Gewand bekleidet, von Goldstickereien starrend, wozu jetzt auch noch Edelsteine kamen, besonders an den aus feinstem roten Leder gefertigten Schnallenschuhen.
Als ich, ein lebendiger Parfümerie- und Juwelierladen, wieder in meine Sänfte kroch, war ich der Überzeugung, dass ich nun in der vierten Badestube landen wurde. Allein auch hier waren aller guten Dinge drei, oder man hielt mich nun für genügend gereinigt und duftend.
Das Türchen öffnete sich. Ein Ruf! Ich kroch aus dem finsteren Loche heraus, kroch jedenfalls auch gleich durch eine Wand; denn als ich zurückblickte, war von der Sänfte nichts mehr zu sehen, ich sah nur noch einen Teppich herunterfallen.
Nein, in diesem ottomanischen Gemache befand sich ausnahmsweise keine Badewanne, dagegen saß da auf einem niedrigen Polster mit gekreuzten Beinen ein junges, sehr hübsches, aber auch sehr dickes Weib, offenbar, wenn nicht alles trog, eine reinrassige Französin, die sich soeben von einer schwarzen Dienerin, kaum weniger als die Herrin mit Schmuck beladen, eine Zigarette anbrennen ließ, während eine andere Schwarze in einem Glase ein Getränk zurechtbraute.
Es war hier so bestimmt erwartet worden, dass ich jetzt dort aus der Wand hervorkriechen musste, dass sich die drei durch mein Erscheinen gar nicht viel in ihren Beschäftigungen stören ließen. Neugierige Blicke trafen mich allerdings.
»Allah, was für ein schöner Mann!«, rief die eine Schwarze, was ich durchaus nicht als Selbstlob ausgefasst haben möchte, rührte aber weiter in ihrem Glase herum, und die türkische Französin nickte nur zufrieden und blies dazu den Rauch durch das zarte Näschen.
Dann einige mir unverständliche Worte, und die beiden Schwarzen verschwanden; ich war mit der Sultanadina allein.
Was soll ich sagen? Ich war ein Hund; etwas zu groß, um in ganzer Gestalt auf den Schoß genommen zu werden. Ja, die Sultanadina hatte sich einen Hund gekauft, der ihr Wohlgefallen erregt hatte. Denn man kann doch auch mit einem klugen Hunde recht gut plaudern, und so plauderte die Sultanadina mit mir, behandelte mich überhaupt wie einen klugen Hund, den sie sich zum Zeitvertreib angeschafft hatte.
Sechzehn Tage habe ich in ihrer Gesellschaft verweilt, und dieses Verhältnis hat sich nicht verändert. Mein Hundestall, allerdings ein ganz komfortables Boudoir, befand sich neben ihrer Zimmerflucht, ich musste ihr Tag und Nacht zur Verfügung stehen. Wenn sie mich haben wollte, so bediente sie sich statt einer Pfeife ihrer Hände, in die sie klatschte. Dann fütterte sie mich, steckte mir, da ich ja einer besonderen Hunderasse angehörte, eine Zigarette in den Mund, plauderte mit mir.
Warum soll ein einsamer, von aller Welt abgeschlossener Mensch, der andere ihm zur Gesellschaft beigegebene Menschen nicht als solche betrachten kann, nicht auch einem klugen Hunde sein Lebensschicksal erzählen? So erfuhr ich das der Sultanadina. Es war wenig genug, was ich zu hören bekam.
Sie war in Paris geboren und dort bis zu ihrem achten Jahre geblieben, hatte zwei Jahre die Schule besucht, hatte, wie sie mit Stolz ihrem menschlichen Hunde versicherte, damals auch schreiben und lesen können. Aber das hatte sie schon längst wieder vergessen. Ihre Erinnerung war überhaupt eine ganz schwache. Auf ihre Eltern und Geschwistern konnte sie sich kaum noch besinnen. Es war in der Familie wohl recht dürftig zugegangen. Dann hatte sie mit einem fremden Herrn eine lange Reise gemacht, war in Konstantinopel gelandet. Das sehr schöne Kind war einfach in den Harem des türkischen Sultans verkauft worden, oder doch ins Serail, zur vorläufigen Aufzucht.
Ach, was für Existenzen sind das doch! Man weiß nicht, ob man darüber lachen oder weinen soll.
Sie wusste nicht mehr recht, wie viele Jahre sie sich schon hier befand. Sie zählte nach Beiramfesten, deren sie vierzehn bis achtzehn mitgemacht hatte. Übrigens war sie gar keine legitime Gattin des Sultans. Sie war zur Odaliske erzogen worden, zur Tänzerin — wörtlich übersetzt heißt das aber Stubenmädchen — und als solche war es ihr allerdings gelungen, die besondere Gunst des Beherrschers aller Gläubigen zu erringen. Das heißt: für einen einzigen Tag — oder nur für einen ganz kleinen Bruchteil von vierundzwanzig Stunden. Das war vor drei Jahren gewesen, das wusste sie bestimmt, seitdem hatte sie den Sultan nie wieder gesehen, auch aus der Ferne nicht.
Die Frucht dieser Stunde war ein Sohn gewesen, und weil dessen Geburt nun nach dem Horoskop des Kaiserlichen Sterndeuters zu einer außerordentlich günstigen Stunde erfolgt war, nämlich zum Glück für den Vater ausschlagend, hatte sie den Ehrentitel Sultanadina erhalten, unter allen Odalisken die einzige, die ihn führte. Wäre diesem Namen noch ein Ka vorgesetzt, so wäre sie eine der sieben regelrechten Gattinnen gewesen, welche bekanntlich Kadinen oder Kadinas heißen. So war sie nur eine Dina, die erste der siebzig Odalisken, und darauf war sie maßlos stolz, ich musste jeden Tag mehrmals anhören, wie sie durch jene Liebesstunde mit dem Sultan dazu gekommen war.
Diesen selbst hatte sie also nie wieder gesehen, ebenso wenig ihren Sohn, der als kaiserlicher Prinz erzogen wurde — und das war ja eigentlich die Hauptsache, darein setzte sie auch ihren größten Stolz — als Sultanadina durfte sie nicht mehr mit den übrigen Odalisken zusammenkommen, mit keinem Menschen mehr, den man noch als wirklichen Menschen betrachten konnte.
So vegetierte sie dahin in einer Zimmerflucht von gegen vierzig Räumen, bedient von ebenso vielen Sklaven und Sklavinnen, rauchte Zigaretten und knabberte überzuckerte Rosenblätter. Sie sprach Französisch, weil unter den Odalisken früher einige französisch Sprechende gewesen waren, auch jetzt von ihren Sklavinnen eine diese Sprache konnte. Sonst war sie so gut wie Idiotin. Als Sultanadina war sie eine Art heiliges Hausgerümpel, das nun einmal laut uralter Order, vom Propheten gegeben, zum Serail gehörte. Jeden Donnerstag — Freitag ist der Sonntag der Mohammedaner — wurde sie des Nachmittags zwei Stunden lang in einer Sänfte durch die Straßen getragen, immer denselben vorgeschriebenen Weg. Da sah sie durch ein Guckloch der Sänfte etwas vom Leben der Außenwelt, sonst niemals. Die Sultanadina war nur auf ihre Gemächer angewiesen, durfte sich nicht einmal in einem Garten ergehen. Sie wusste nicht, in welchem Teile des großen Serails sie sich hier befand. Sie hatte sogar schon ihren Namen vergessen, den sie als Odaliske geführt hatte, denn jetzt war sie eben nur noch die Sultanadina.
Dennoch besaß sie eine gewisse Allmacht. Sie hatte auf der Straße Hunde gesehen, hatte sich Hunde gewünscht und deren drei bekommen, die ihr genügten. Hätte sie sich hundert Hunde gewünscht, hätte sie wahrscheinlich auch die bekommen. Vor vier Monaten war der eine, oder vielmehr eine Hündin, die Fatime, entwichen, und in Konstantinopel war die ganze Polizei, das ganze Militär in Bewegung gesetzt worden — um den Ausdruck Himmel und Hölle nicht zu gebrauchen — um das Tier wiederzubekommen, man hatte dem Schiff, an dessen Bord man es vermutete, eine kaiserliche Kriegsjacht nachgeschickt, was doch immerhin etwas heißen will.
Neulich, bei ihrem letzten Austragen, hatte sie gesehen, wie ein Mann, ein Franke, ihrer Sänfte nicht ausgewichen war und sogar den Vorläufer geschlagen hatte. Als sie nun gar erfuhr, dass ich derjenige war, der ihre Fatime entführt hatte, wäre mein Tod eine beschlossene Sache gewesen. Hier in ihren Gemächern wäre ich vor ihren Augen langsam zu Tode gefoltert worden. Ob hier schon früher solche Menschenquälereien veranstaltet worden waren, erfuhr ich nicht; aber man hatte es mir gesagt, und ich glaubte es, der war alles zuzutrauen.
Nun aber hatte ich, der Entführer ihres Hundes, ihr Wohlgefallen in besonderer Weise erregt. Sie forderte mich von dem höheren Beamten, der täglich nach den Wünschen der Sultanadina zu fragen hatte, zu ihrem Sklaven, und der Beamte hatte geantwortet, er wolle sehen, ob es möglich sei.
Ja, es war möglich gewesen. Ich war ja nur ein einfacher Seemann, der soeben erst sein Patent erhalten hatte. Wäre ich aber auch eine bekannte Persönlichkeit gewesen, ich glaube, man hätte mich dennoch ins Serail geschmuggelt. Wie man dies anfing, einen Menschen von der Bildfläche unauffällig verschwinden zu lassen, hatte man mir ja gesagt.
Die Sultanadina aber wollte keinen Eunuchen haben, sondern einen richtigen Mann, und dass man auch da ihrem Willen nachgab, das zeigte, welch eine gewaltige Macht sie trotz alledem besaß. Denn was für ein Menschenapparat musste aufgeboten werden, um diese Sache entgegen den strengen Verboten durchzuführen, wie sehr musste man da doch all diesen vielen Sklaven und Sklavinnen trauen, wie schien hier ein Verrat ganz und gar ausgeschlossen zu sein!
Kurz, auf diese Weise war ich unversehrt in das Allerheiligste des türkischen Heiligtums gekommen.
Ob die Sultanadina schon früher derartige ›Eunuchen‹ gehabt hatte, erfuhr ich nicht. Auf solche Fragen antwortete sie einfach nicht. Aber ich zweifelte nicht daran. Man hatte darin schon eine so große Übung gehabt — — —
So befand ich mich in irgendeiner Spezialabteilung des weitläufigen Serails als Ersatzmann des Sultans für die Kaiserliche Dina. Wie sehr sie mich sonst als minderwertiges Wesen betrachtete, zeigte am besten, dass sie mir einfach den Namen ihrer verloren gegangenen Lieblingshündin gab — Fatime — sie nannte mich einfach Fatime, ganz unbeirrt durch mein Geschlecht.
In den ersten drei Tagen ließ ich es mir ja gefallen. Das Abenteuer amüsierte mich. Dann aber wurde die Langeweile immer stärker, und mir kam die Erkenntnis der Hoffnungslosigkeit meiner Lage.
Vom dritten Tage an dachte ich an Flucht. Aber wie die ermöglichen? Scheinbar war es so einfach. Die schwarzen Sklaven und Sklavinnen betraten diese Zimmerflucht durch eine Wandöffnung. die nur mit einem Teppich verhangen war. Beim Zurückschlagen des Teppichs hatte ich einen langen Gang gesehen, durch Öllampen erleuchtet, wie überhaupt hier nur sehr wenige Räume spärliches Tageslicht durch oben angebrachte Fenster erhielten, die man bei dem Mangel an wirklichen Möbeln gar nicht erreichen konnte. Selbst wenn ich mich auf die Schultern eines großen Mannes geschwungen hätte, hätte ich die Gitterstäbe immer noch nicht fassen können.
Niemand hatte mir verboten, jenen Hauptausgang zu benutzen, niemand mich vor einer Flucht gewarnt, am wenigsten die Sultanadina. Verbietet man einem neuangeschafften Hunde, sich aus dem Hause zu entfernen? Nein, man sucht ihn durch gute Behandlung an sich zu fesseln, oder man bindet ihn erst einige Zeit an.
Daraus nun, dass ich weder gewarnt noch angebunden wurde, konnte ich schon viel schließen. Man hielt einfach eine Flucht von hier für ganz unmöglich.
Gut, da ich kein Verbot bekommen hatte, ging ich einmal auf Entdeckungsreisen, und zwar des Nachts, trat auf jenen Gang hinaus.
Sofort wuchsen vor mir aus dem Boden zwei riesenhafte Neger empor, außer Pistolen und Dolchen im Gürtel auch jeder eine furchtbare Peitsche in der Faust. Der eine setzte mir einfach seine Hand vor die Brust und drängte mich mit einer drohenden Bewegung zurück.
Ehe der Teppich wieder fiel, sah ich noch anderes: Den ganzen Korridor entlang wuchsen noch viele solcher schwarzen Wächter aus dem Boden empor.
Wie sollte da eine Flucht möglich sein? Zudem hatte ich schon genug vom Serail gehört, wenigstens von seiner Bauart. Das ist eine ganze Stadt für sich, von vielfachen Mauern umringt, jede einzelne aufs schärfste bewacht, und ohne Führer, der alle die Labyrinthwege und ebenso zahllose Losungsworte kennt, ist da gar kein Durchkommen.
Die geheime Wandtür, durch welche ich aus der Sänfte hereingekommen war, hatte ich wiedergefunden, aber was hätte es mir genützt, wenn ich sie zu öffnen verstanden hätte? Ich wäre nur in eine mir gänzlich unbekannte Welt gekommen.
Ich will den Leser nicht damit langweilen, mit was für Plänen ich meinen Kopf marterte, zumal ja doch keiner zur Ausführung kam.
Erwähnen will ich nur, dass ich meine größte Hoffnung darauf setzte, dass die Sultanadina wieder einmal in ihrer Sänfte spazieren getragen würde. Inwiefern mir das von Vorteil sein konnte, davon hatte ich selbst noch keine Ahnung — es war eben meine Hoffnung, es war nur, als hätte ich dann eine bessere Gelegenheit zur Flucht.
Aber die Zeit verging — ich war vollständig aus dem Kalender gekommen, hier kümmerte man sich gar nicht um die Namen der Tage, noch weniger um ein Datum — jedenfalls musste unterdessen ein Donnerstag gekommen sein, und die Sultanadina wollte ihre Zimmer nicht verlassen — bis sie einmal erklärte, dass in diesem heiligen Monat ihr Ausflug überhaupt unterbliebe. Erst in drei Wochen wollte sie sich wieder austragen lassen.
Es war am sechzehnten Tage. Das konnte ich mir aber erst später ausrechnen. Für mich war schon ein Vierteljahr vergangen. Doch will ich jetzt bei der richtigen Zeitrechnung bleiben.
Wie gesagt: Die ersten drei Tage hatte es mir ja ganz gut gefallen. Am vierten Tage wurde ich dieser ewigen Liebesspielerei überdrüssig, vom fünften Tage an sann ich auf Flucht.
Die Sultanadina wurde nicht so bald übersättigt. Aber auch ihre Glut begann nach und nach zu erlöschen, ich merkte es deutlich. Oder aber, sie wurde immer... verrückter. Mag das genügen! Am fünfzehnten Tage rief sie ihren zweibeinigen Hund gar nicht mehr zu sich, er konnte die ganze Zeit in einer Ecke liegen und, wenn er es fertig brachte, den Kopf zwischen die Hinterbeine stecken — heute erinnerte sie sich seiner wieder.
»Komm her, Fatime — ici!«
Ich gehorchte, schon ganz mechanisch.
»Leg dich hierher — kusch dich!«
Schon fühlte das Lieblingshündchen Fatime, dass doch eigentlich ein männlicher Köter war, und zwar keiner von der kleineren Sorte, sondern etwa ein Neufundländer, und ganz unbewusst entstieg meiner Brust ein Murren.
»Was knurrst du?«
Sie betrachtete mich tatsächlich immer als Hund.
»Ich habe nicht geknurrt.«
»Du hast geknurrt, Fatime!«
»Teufel noch einmal, soll man da auch nicht knurren!«, platzte ich los.
Aber diesen Widerstand ignorierte sie gänzlich. Keine Warnung, keine Frage! Ganz so, wie man einen Hund behandelt.
Sie kraulte in meinem Haar, erst sanft, dann schlangen sich ihre fetten Fingerchen immer fester in mein lockiges Haar.
»Tut das weh?«
Ja, es begann bereits weh zu tun. Aber ich presste die Lippen zusammen.
»Ich möchte dir einmal eine Haarsträhne ausreißen — so — so — na, da schrei doch, schrei doch...!«
Also auf diesem Standpunkt war sie jetzt angelangt! Wenn sie erst einmal so weit war, dann konnte das ja noch gut werden!
So weit aber wollte ich sie doch lieber nicht kommen lassen. Der Neufundländer hatte sich bereits in eine Bulldogge verwandelt, die manchmal selbst dem eigenen Herrn gefährlich werden kann.
Und ehe ich meinen Mund öffnete, um einen aufrichtig gemeinten Schmerzensschrei auszustoßen, drehte ich mich herum und.... haute der holdseligen Sultanadina eine an die geschminkte Wange, dass sie sich in ihrer hockenden Stellung gleich mehrmals umkugelte.

»Da, du infame Canaille!!«
Herrje, dieses Geschrei, dieses Gequieke!!
Im Nu wimmelte das Zimmer von schwarzen Gestalten. Ich hatte sie stehend erwartet. Einer gegen mindestens zwanzig. Mein erster Griff war nach einem der im Gürtel steckenden Dolche meines nächsten Gegners — da machte ich die Entdeckung, dass diese Waffen durch irgendeine Vorrichtung im Gürtel festgehalten wurden, sich nicht so ohne Weiteres herausziehen ließen.
Lange hielt ich mich natürlich mit dieser Untersuchung nicht auf. Ein wüstes Handgemenge entspann sich. Ich entsinne mich nur, dass ich dabei einmal der am Boden liegenden Sultanadina, die mehr Spektakel machte als wir alle zusammen, kräftig in den Bauch trat. Dann lag ich selbst am Boden, an Händen und Füßen gebunden, so wurde ich in einen finsteren Raum geschleift und in einen Winkel geschleudert.
Wie lange ich dort gelegen habe, weiß ich nicht. Ich erwartete, dass die Sultanadina kommen und das ungezogene Hündchen bestrafen — sich nach Weiberart rächen würde.
Ich wartete so lange, bis ich darüber einschlief.
Ein Schmerz ließ mich erwachen. Ich wurde derb an den Haaren gezogen. Bei meiner ersten Bewegung aber ward nachgelassen.
»Willst du nun artig sein, mein Hündchen, eeh?«
»Teufelsweib!«, knirschte ich.
Sie riss mich wiederum an den Haaren, wenn auch nicht allzu derb.
»Soll ich dir auch noch einen Beißkorb vorlegen?«
Da hatte ich meinen Entschluss gefasst. Sie hatte mich erst darauf gebracht.
Geliefert war ich doch sowieso, und da wollte ich es möglichst kurz machen, ihr doch wenigstens erst noch eine Lektion geben — ihr ein paar Finger abbeißen.
Ja, so grausam war ich. Aber man muss sich nur in meine Lage versetzen.
Also eine schnelle Bewegung des Kopfes! Ich hatte richtig ihre Hand, die noch in meinen Haaren wühlte, im Munde, zwischen den Zähnen, und nun...
»Novacasa, um Gott, ich bin's, Johanna!!«, kreische es da auf.
Ich hatte glücklicherweise noch nicht zugebissen, meine Zähne konnten höchstens erst leise Spuren hinterlassen haben.
Dieser Ruf hatte auf mich wie eine Momentbremse gewirkt.
»Was? Du wärest...«
»Jawohl, ich bin Johanna, und einen derartigen Scherz will ich doch lieber nicht mehr machen«, lachte es ärgerlich. »Ich glaube, du hättest mir den Finger abgebissen.«
»Ich hatte es sogar auf einige Finger abgesehen. Du bist's, Johanna?!«
»Zweifelst du daran?
»Nein, jetzt erkenne ich dich auch an der Stimme. Ich bin wieder auf Skarpanto?«
»Immer wieder auf der Leuchtturminsel«, erklang es zurück, und schon wurden mir die Fesseln gelöst.
Als ich mich streckte, fühlte ich in den Knien schon wieder das vermaledeite Gliederreißen!
»Wieder in einer Kiste?«
»Immer wieder in einer Kiste.«
Ein ganz unheimliches Gefühl beschlich mich, eine Art von Entsetzen — aber schon bei Weitem nicht so stark wie das erste Mal, da mir die Art meines Transportes offenbart wurde. Gleich darauf stellte sich sogar mein gewöhnlicher Humor ein.
»Sage, Johanna, wenn ich zur Reise immer eine Kiste benutzen soll — darf es da nicht wenigstens eine längere sein, in der ich mich richtig ausstrecken kann — so eine Art von Sarg? Er kann auch gepolstert sein.«
»Eine sargähnliche Kiste würde zu sehr auffallen, es muss doch jeder Verdacht vermieden werden.«
»Dann wenigstens eine Klavierkiste!«
»Du hast jetzt Interesse für solche Kleinigkeiten?«
»Das bedeutet für mich durchaus keine Kleinigkeit. Wie bin ich denn aus dem Serail herausgeholt worden?«
»Die in Ekstase befindlichen Mönche wussten immer, wo du warst, was dir passierte. Du wurdest niemals aus den Augen gelassen. Bei deiner Gefangennahme wurden sofort unsere Vertreter in Konstantinopel benachrichtigt. Aber schwer wurde es uns, dich aus dem Serail zu befreien.«
»Ja, wie wurde das ermöglicht?«
»Lass dir das von meinem Bruder erzählen...«
»Ich bezweifle, dass er das tun wird.«
»Da magst du allerdings recht haben. Er selbst schilderte es nur, aber ich bin mit alledem, was zum Verständnis dieser Vorgänge gehört, so wenig vertraut, dass ich so gut wie nichts verstand. Es musste auf besondere Weise vorgegangen werden, mit einem öffentlichen Einschreiten war da nichts zu erreichen. So groß unsere Macht auch ist — ein öffentliches Ansehen genießen die Klostergemeinden von Athos ja nicht. Desto größer ist unsere geheime Macht. mit der uns eigentlich auf dieser Erde nichts unerreichbar ist. Lass dir daran genügen, dass wir auch im Serail, im intimsten Haremsgemach, unsere Vertreter haben...«
»Mönche?«
»Jedenfalls zu uns gehörend.«
»Als Eunuchen?«
»Das weiß ich selbst nicht. Möglich wäre es schon. Du wurdest eben herausgeholt — betäubt und in eine Kiste gesteckt.
»Es war wohl die höchste Zeit?«
»Ja, wir haben hier die größte Sorge um dich ausgestanden. Wie gesagt, allmächtig sind auch wir nicht. Es gelang, dich noch rechtzeitig, noch im letzten Augenblick den Klauen dieses Weibes zu entreißen.
»Weißt du, was sie mit mir vorhatte?«
»Ich weiß nur, dass sie sich einige Ratten hatte fangen lassen.«
»Wozu Ratten?«
»Du kannst noch fragen? Diese üppige Odaliske wird in ihrer Einsamkeit schon Nahrung für ihre Phantasie haben, und es mag auch nicht das erste Mal sein, dass sie einen Menschen bei lebendigem Leibe von Ratten auffressen lässt.«
Ich konnte ein leises Schaudern doch nicht unterdrücken.
»Wie ist mein Verschwinden dort aufgenommen worden? Man kann in dem heiligen Lichte doch alles beobachten, was jetzt dort vor sich geht.«
»Zahlreiche Eunuchen sind deinetwegen geköpft worden...«
»Was du nicht sagst!«
»Beschwert das dein Gewissen?«
»O nein, durchaus nicht!«
»So lass dir das genügen. Überhaupt stelle nicht solche Fragen. Es ist ja mit dem Schauen im heiligen Lichte ganz anders, als du dir denkst, als ich selbst es mir vorstellen kann. Nur wenn man seine Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Person konzentriert, sieht man diese auch näher, alles, was sie treibt, und deinetwegen hatte mein Bruder mehrmals Versammlungen einberufen, alle Mönche mussten sich gemeinschaftlich bemühen, dich im heiligen Lichte zu erblicken.«
»Nun gut! Wie lange ist das eigentlich schon wieder her?«
Fast zwei Wochen hatte ich wieder in einer gesteckt.
»Und meine Papiere?«
»Alles ist schon wieder hier.«
»Auch mein Steuermanns- und mein Kapitänspatent?«
»Alles!«
»Woher hat man denn das bekommen?«
»Das wurde heimlich dem Archive der Polizei entnommen.«
»Auf welche Weise?«
»Das weiß ich selbst nicht. Nun aber erzähle mir ganz ausführlich, was du alles bei der Sultanadina erlebt hast!«
Ich erzählte stundenlang. Sie forderte mich durch immer neue Fragen auf, weitere Einzelheiten zu schildern, es konnte ihr nicht pikant genug kommen.
»Und was nun weiter?«, konnte ich endlich auch wieder über mein eigenes Schicksal fragen.
Unterdessen hatte ich auch, ohne besonderen Appetit zu verspüren, eine Mahlzeit eingenommen — aber immer im Finstern,
»Du bist eben wieder hier, nimmst deine Arbeit wieder auf, gehst demnächst mit deiner Mannschaft nach Athen. um dort ein schon gekauftes Schiff abzuholen, welches du fernerhin führen wirst. Mein Bruder wird dir schon alles sagen.«
»Da muss ich aber doch erst nach dem Festland hinüber, und das ist diesmal wohl nicht so einfach, wenn es kein Aufsehen erregen soll.«
»Bah, was heißt hier Aufsehen erregen! Aber du hast recht. Du befindest dich nämlich in der Basilia.«
»Drüben auf dem Festlande? Ich denke, ich bin auf der Leuchtturminsel!«
»Verstehe mich recht. Man glaubt allgemein, du seiest in der Basilia. Denn dort ist heute früh die Kiste, in der du die Reise machtest, abgeliefert worden. Nun aber wollte ich mir das Vergnügen nicht entgehen lassen, bei deinem Erwachen zugegen zu sein, ich wollte die Sultanadina spielen — so, wie damals die brasilianische Witib, du weißt schon. Es wäre mir diesmal beinahe übel bekommen. Ich ließ meinen Wunsch meinem Bruder zugehen, er kam gleich selbst, und gern war er mir zu Willen. Die Leuchtturmwärter werden ja sowieso von drüben aus versorgt, kaum vergeht ein Tag, an welchem nicht etwas herüberzuschaffen ist, und so wurdest du in eine der gewöhnlichen Proviantkisten gesteckt, so kamst du herüber.«
Sapperlot, was für Umstände deswegen! Und ich dachte schon wieder an einen unterirdischen, unterseeischen Tunnel.
»In einem Boot?«
»Gewiss! Wie sollst du denn sonst herübergekommen sein?«
Ich dachte mein Bestes.
»Und wie komme ich wieder hinüber?«
»Ganz auf dieselbe Weise. In einer Proviantkiste.«
»Als leere? Da dürfte wohl das Gewicht nicht ganz stimmen.«
»Weshalb leer? Es ist Hartbrot darin, welches den verwöhnten Leuchtturmwärtern nicht zusagt; sie schicken es zurück.«
»Nach der Basilia? Ich denke, die Insel wird von St. Lavra aus besorgt?«
»Gewiss, aber die Basilia steht mit diesem Kloster durch einen Tunnel in Verbindung. Im Übrigen lass das nur Sache meines Bruders sein, und wenn er einige Helfershelfer dazu nötig hat, so kann er diesen doch absolut vertrauen.«
Ich wollte lieber vorsichtig mit meinen Fragen sein, das Weib nahm schon einen recht ungeduldigen Ton an.
»Was haben wir eigentlich heute für ein...«
Das Wort ›Datum‹ brachte ich schon nicht mehr heraus, ich fühlte einen ganz leisen Stich im linken Handgelenk, und in demselben Augenblick schwand mir das Bewusstsein.
Es musste ein teuflisches Mittel sein, das diese Mönche anwandten, um einen Menschen zu betäuben.
Als ich erwachte, lag ich wohlgebettet in einem Raume, der das Tageslicht durch ein Fenster erhielt, das nur halb über der Erde lag.
Ein Klopfer war vorhanden. Ich ließ ihn schallen, und alsbald erschien ein Mönch, der mich mit gleichgültiger Miene nach meinen Wünschen fragte.
Ich muss noch nachträglich erwähnen, dass nur Johanna einige Instruktionen wegen meines späteren Erwachens erteilt hatte. Sie waren nicht nötig gewesen, so klug war ich von allein; deshalb habe ich gar nicht davon gesprochen.
»Wo bin ich denn hier?!«, stellte ich mich also grenzenlos erstaunt.
»In der Basilia.«
»Doch nicht auf Athos?!«
»Gewiss.«
»Ja, wie in aller Welt komme ich denn hierher?«
»Der Patriarch wird dir alles erklären, er will zu dir kommen, sobald du erwachst. Oder brauchst du erst den Arzt? Willst du zuvor etwas essen?«
»Nein, nein, den Patriarchen!!«
Dieser erschien alsbald.
Kein Wort darüber!!«, war wiederum das erste, was er mir zurief.
Er musste ja am besten wissen, wie ich schon eingeweiht worden war, und alles Nähere wollte er mir eben verschweigen.
Von seiner Schwester erwähnte er nie ein Wort.
»Wie befindest du dich?«
»Ganz wohl!«
»Bist du bereit, dich noch heute nach Athen einzuschiffen?«
»Sofort!«
»So bleibt alles beim Alten?«
»Gewiss!«
»Dann möchte ich dich nur noch um eins bitten: unseren Kontrakt zu verlängern.«
»Wie das?«
»Du hattest dich ein halbes Jahr in meine Dienste stellen wollen.«
»So war es ausgemacht.«
»Ich bitte dich, auf mindestens ein Jahr einzuwilligen. «
»Weshalb das?«
»Weil eine ziemlich weite Reise in Frage kommt. Ich will dir das erste Ziel unseres Schiffes nennen: Es ist der australische Archipel.«
Das war noch immer ein sehr weiter Begriff, aber ich wollte jetzt nicht mehr fragen.
»Die FidschiInseln«, setzte da der Patriarch von selbst noch hinzu.
Was in aller Welt hatten diese Klosterbrüder auf den FidschiInseln zu tun? Nun, vielleicht wollten sie einmal in Mission machen, obgleich die griechischkatholische Kirche sonst wohl gar keine Missionare ausschickt, überhaupt sehr wenig Proselytenmacherei treibt, und im Übrigen würde ich es ja erfahren.
»Bist du geneigt, den Kontrakt auf ein Jahr zu verlängern?«
»Gewiss!«
»Ich danke dir, und du sollst es nicht bereuen. Wenn die Hin- und Herreise aber nun länger als ein Jahr dauert?«
»Na, nach einem Jahre springe ich deshalb nicht gleich über Bord«, konnte ich schon wieder lachen. »Ich bringe das Schiff eben nach den FidschiInseln und wieder zurück.«
»Und wenn der Aufenthalt dort länger als vorausgesehen dauert?«
»Hat doch alles nichts zu sagen. Das sind ja ganz allgemeine Seemannsverhältnisse.«
»Gut, ich verstehe. Ich habe mich unterdessen auch etwas orientiert. Also, du begibst dich jetzt mit deiner Mannschaft nach Athen, wo ein neugekauftes Schiff zur Übernahme durch dich bereit liegt.«
»Ein Segler?«
»Selbstverständlich! Ein Vollschiff, aber nicht von 300 Tonnen, wie ich erst sagte, sondern von 500 Tonnen.«
»Wo ist es gebaut?«
»In Philadelphia; es hat seine erste Fahrt unter dem Sternenbanner gemacht, ist von uns gekauft worden, hat schon seinen Namen erhalten.«
»Wie ist es getauft worden?«
»Das ›Licht vom heiligen Berge‹.«
Ich will den griechischen Namen dafür gar nicht anführen, da ich ihn ja doch niemals gebrauchen werde. Für mich war mein Schiff einfach das ›Licht‹, und wollte ich ausführlicher sein, so nannte ich es ›Kirchenlicht‹, manchmal auch ein ›heiliges‹ vorsetzend, und bei guter Stimmung sprach ich auch von der ›Funzel‹.
»Es ist alles in tadellosem Zustande«, fuhr der Patriarch fort. »Proviant enthielt es noch für ein halbes Jahr, aber der ist bereits verkauft worden. Es soll ganz neu verproviantiert werden, und hierüber sollst du selbst bestimmen. Du erhältst deshalb noch besondere Vollmachten. Du sollst ganz freien Willen haben.«
Das war sehr nett.
»Nun handelt es sich aber noch um eins«, nahm ich jetzt das Wort, »mit die Hauptsache. Das Schiff soll nur von Mönchen bedient werden?«
»Ausschließlich von Mönchen unserer Klostergemeinde. Die, welche du selbst ausgebildet hast, andere kommen nicht darauf.«
»Ja, da fehlen aber noch die Steuerleute; ein Segler von 500 Tonnen braucht deren zwei, wenn ich nicht selbst Wache gehen soll.«
»Die beiden Steuerleute befinden sich bereits in Athen.«
»Wer denn?«, stutzte ich.
»Pater Perpetuos und Frater Rufos. Wen von beiden du zum ersten, wen zum zweiten Steuermann machst, soll deine Sache sein. Sie haben beide in Athen bereits ihr Steuermannsexamen abgelegt.«
Ich war ganz baff. Pater Perpetuos war einer von den steinalten Greisen, Frater Rufos ein mittelalter von meinen Matrosen, und dass es sich wirklich um diese handelte, ließ ich mir jetzt noch bestätigen.
»Ja, wie ist denn das nur möglich?!«
»Was soll dabei unmöglich sein?«, klang es kaltblutig zurück.
»Ich habe diese Mönche doch kaum erst zu Matrosen ausgebildet, vorher hatten die ja keine Ahnung von Seemannschaft!«
»Nun, du hast doch selbst davon gesprochen, wie man in späteren Jahren, wenn man sein ganzes Interesse darauf konzentriert, alles viel leichter lernt. Die beiden haben sich eben während deiner Abwesenheit zu Steuerleuten ausgebildet — haben alles studiert, was dazu nöiig ist. Ist denn das Steuermannsexamen gar so schlimm?«
Das allerdings nicht. Es gehören sogar höchst wenige Kenntnisse dazu. Einer, der das EinjährigFreiwilligenZeugnis hat, braucht die Steuermannsschule nur ein halbes Jahr zu besuchen, und er wird das Examen mit Glanz bestehen — wenn er nicht sonst auf den Kopf gefallen ist. Mathematik bis zu den Kubikwurzeln, Trigonometrie, Logarithmenrechnung — das ist eigentlich alles, was der Steuermann braucht. Mit deren Hilfe berechnet der Steuermann die schwierigsten Formeln, die in seinem Handbuche stehen und die er anzuwenden weiß. Wie diese Formeln entstanden sind, das weiß er freilich nicht, das hat er ja auch gar nicht nötig. So weit kommen die wenigsten Kapitäne. Das ist dann astronomisch.
Das heißt, muss hier eingeschaltet werden, das gilt nur für die Theorie. In der Praxis ist gar nicht daran zu denken, dass ein Abiturient vom Gymnasium das Steuermannsexamen machen könnte. Da fehlt ihm doch jede Praxis. Die könnte er sich hinwieder in einem halben Jahre aneignen.
»Sie haben das Steuermannsexamen bestanden?«, konnte ich nur fragen.
»Jeder einzelne mit Auszeichnung. Auch Frater Zephyros hat es gleich abgelegt. Es stände dir frei, ihn als dritten Steuermann zu benutzen.«
Der Mönch mit dem schönen Namen Zephyros war der allerjüngste von ihnen, ein sechzehnjähriger Knabe.
»Ja, aber um das Steuermannsexamen ablegen zu können, muss man doch nach internationalen Seegesetzen zwei Jahre Seefahrtszeit als Matrose nachweisen!«
Der Patriarch blinzelte wenig würdevoll, aber sehr pfiffig mit den Augen.
»O, das ist bei uns doch etwas anderes! Wir können eben manches ermöglichen. Zumal in Athen, in Griechenland!«
Ich musste es glauben.
»Und Pater Cyriacos geht mit dir als der sogenannte Reederkapitän, als mein Stellvertreter. Bist du damit einverstanden?«
Pater Cyriax war der allerälteste, er hatte wohl schon seine achtzig auf dem Rücken, aber dieses lebendige Gerippe war stark wie ein Bär und gelenkig wie ein Affe; ich habe schon einmal davon gesprochen.
»Den wollte ich zu meinem Bootsmann machen, der ist sogar der beste von allen!«
»Ich bitte, ihn als meinen Stellvertreter anzuerkennen.«
»Selbstverständlich!«
»Wenn er dich bittet, diesen oder jenen Hafen anzulaufen...«
»Ich weiß, was ich einem Reederkapitän schuldig bin.«
»Und mein Stellvertreter weiß, was er dem kommandierenden Schiffskapitän schuldig ist.«
Noch an demselben Tage schiffte ich mich mit meinen vierundzwanzig übriggebliebenen Leuten nach Athen ein.
Wie immer, wenn er gebraucht wurde, hatte auch diesmal ein kleiner griechischer Dampfer abfahrtbereit im Hafen gelegen.
Wir kamen in Athen an, ich wurde von dem alten Cyriax als dem Vertreter meiner Reederei empfangen, sah die ›Kirchenfunzel‹ liegen.
Doch nein, keinen Spott! Ein überaus stattliches Vollschiff, an jedem Maste eine Royalrahe, dabei der reine Schmuckkasten.
Ich hatte Kreditbriefe und alles mitbekommen. Ein griechischer Winkelbankier, dem ich keine fünf Groschen zugetraut hätte, zählte mir den schmierigen Tisch in seiner Budike wieder und wieder voll Goldstücke, ich brauchte bloß zu fordern.
Es wurde nur Ballast mitgenommen, Sand, außerdem hatte ich für Proviant zu sorgen, auf anderthalb Jahre, das war meine Sache, und ich kaufte ein.
O, es war herrlich! Ja, das ist doch noch etwas Anderes, als Korvettenkapitän oder selbst Admiral zu sein! So mag sich ungefähr die glückliche Braut vorkommen, wenn sie mit gespicktem Geldbeutel die zukünftige Wohnungseinrichtung kauft, als junge Hausfrau die ersten Einkäufe besorgt. Mag dieses Beispiel genügen, um zu zeigen, wie mir zumute war, als ich so den endlosen Proviantzettel zusammenstellte — gar nicht so einfach, das ist schon mehr eine Art Wissenschaft, für welche es auf der Marineschule auch besondere Stunden mit besonderen Lehrern gibt — und als ich dann von den zahllosen Schiffsmaklern überlaufen wurde.
Aber es ist nun einmal nichts vollkommen in der Welt. Das ganz Richtige war es jedenfalls noch nicht. Nur so ein halber Kram, Die drei Brüder und Väter hatten tatsächlich ein Steuermannspatent ausgestellt erhalten — wie das zuwege gekommen, ist mir ein Rätsel geblieben — sie machten sich auch während der Proviantaufnahme und sonstigen Manöver als beaufsichtigende Steuerleute tadellos; noch weniger wäre an meinen Matrosen auszusetzen gewesen, aber... sie trugen eben Mönchskutten! So wie auch ich.
Ach, dieses Staunen! Dieses Fragen! Aber auch dieser Spott!
Im Hafen von Athen lag ein deutsches Kriegsschiff. Matrosenwitz hatte gleich ein Liedchen auf uns gedichtet, gesungen nach der Melodie ›Die Wacht am Rhein‹... ich will es lieber nicht wiedergeben,
Dann ging es in See, und Staunen und Spott hinter uns, und unser letztes Manöver, das Ankerhieven und Segelsetzen, hatte vollends dazu beigetragen, das erstere zu vermehren, den letzteren verstummen zu lassen. Den deutschen Matrosen, die soeben ihr Spottlied angestimmt hatten, blieb der Ton im Halse stecken.
Freilich würden wir in jedem Hafen, den wir anliefen, mit neuem Spott empfangen werden — so lange, bis sich unser Ruf über die ganze Erde verbreitet hatte, wofür ja Zeitungen und mündliche Erzählungen von Seeleuten sorgten.
Von unserer sonstigen Reise habe ich nicht viel zu erzählen. Wir gingen nicht um Kap Hoorn herum, sondern durch den Suezkanal, dessen Benutzung damals noch 12 Francs pro Tonne kostete, sodass wir 6000 Francs zu zahlen hatten, wozu noch der Schleppdampfer für 24 Stunden kam. Heute beträgt der Passagepreis pro Tonne nur noch 5 Francs. Immerhin hat ein großer Passagierdampfer von 20 000 Tonnen noch heute für Benutzung des Suezkanals 100 000 Francs zu zahlen, für den Kopf eines jeden Passagiers weitere 5 Francs.
Während der Fahrt durch das Mittelmeer hatte ich meinen kaufmännischen Vorgesetzten, den Pater Cyriax, kaum bemerkt. Hier in Port Said trat er zum ersten Male auf, indem er fragte, was der Spaß koste, und dann für das geforderte Geld einen Scheck ausstellte, der anstandslos angenommen wurde. Ich selbst hatte noch in Athen in die Schiffskasse, unter meiner eigenen Verwaltung stehend, 5000 Francs bekommen.
Durch das Rote Meer, und dann ostwärts ahoi!
Hatte ich schon vorher gesagt, dass meine ganze Mannschaft tadellos war, ich also an ihr nichts zu tadeln hatte, so verbesserte sich jeder Einzelne doch noch immer mehr, Das war ja allerdings auch nötig gewesen. Ich hatte eben immer mit einer vierwöchentlichen Ausbildung rechnen müssen. Jedes andere Schiff, das meine Matrosen in der Takelage exerzieren sah, staunte über die Kuttenträger, aber Spott gab es schon jetzt nicht mehr. In der zehnten Woche kamen wir in den Ausläufer eines Taifuns, den manches andere Schiff nicht überstanden hätte, wir aber gingen siegreich daraus hervor, und mein wackeres Schiff nannte ich von jetzt ab in Gedanken nicht mehr geringschätzend die ›Funzel‹.
»Durch den malaiischen Archipel oder um Australien herum, Kapitän?«, fragte ich Meister Cyriax, den ich immer mit diesem Titel anredete, wie man ihn solch einem Reederagenten gewöhnlich zulegt.
»Nach Sydney, Herr Kapitän.«
»Wir wollen Sydney anlaufen?«, erlaubte ich mir zum ersten Male solch eine Frage.
Jawohl. Dann aber musste der Stellvertreter diese Order schon von allem Anfang gehabt haben. Denn auf übernatürliche Weise, etwa durch Erzeugung des heiligen Lichtes, konnten sich diese Mönche nicht mit ihren Brüdern auf Athos verständigen.
In der neunzehnten Woche nach unserer Abfahrt von Athen steuerte ich in den herrlichen Hafen von Sydney ein, der das schönste Panorama der Welt bildet. Ich war schon einmal in Sydney gewesen, und abermals wurde ich von einem Entzücken befallen, das sich fast in Tränen Luft machte, und ich konnte mich meinen Gefühlen unbehindert hingeben, denn wir hatten bei diesem Winde die denkbar einfachste Einfahrt.
»Wir brauchen wohl nicht erst auf Reede zu gehen?«
Nein, wir konnten direkt an der Kaimauer anlegen, segelten ohne fremde Hilfe an und hatten gleich wieder nur Staunen, keinen Spott für uns.
Schiffsagenten, Hausierer und ähnliche Individuen, eine Art von menschlichen Geiern, von denen es in jedem Hafen wimmelt, sammelten sich sofort am Kai, bereit, unser Schiff zu überfluten, wie es sonst allüberall in der Welt auch wirklich geschieht — ausgenommen in den australischen Häfen, und am allerwenigsten in Sydney. Dort wartet auch der Dreisteste erst auf die Erlaubnis, an Bord kommen zu dürfen.
Das ist eine eigentümliche Sache. Man merkt, dass man sich in einem Lande befindet, dessen Kultur und Gesetz von Verbrechern, wenn auch freigelassenen, begründet worden sind. Australien ist eine englische Kolonie, aber doch nur dem Namen nach. Die australischen Kolonien haben sich ganz selbstständig entwickelt, haben ihre eigenen Gesetze, und, will ich sagen, um den Nagel gleich auf den Kopf zu treffen, hier herrscht eine Waffen- und Schießfreiheit, wie man sie sonst nirgends auf der Welt findet. Auch der wilde Westen Nordamerikas lässt sich in dieser gesetzmäßig erlaubten Selbsthilfe gar nicht mit Australien vergleichen.
Ich will nur ein Beispiel anführen: In England wie in Amerika muss das an der Bar bestellte Getränk sofort bezahlt werden, in Australien ist das Geld sogar bei der Bestellung sofort hinzulegen. Ehe nichts daliegt, bekommt man nichts. Nun kann es ja aber doch einmal passieren, dass man etwas bekommt, ehe man das Geld hingelegt hat. Wenn der Gast da sein Glas hintergestürzt hat und gehen will, ohne Bezahlung, so ruft ihm der Wirt oder die Barmaid nach, und bleibt der Betreffende nicht stehen, so schießt ihm der Wirt oder die Barmaid sofort eine Revolverkugel in den Rücken, und das Gesetz spricht den Mörder frei. Selbsthilfe!
Das ist eine Tatfache, die jeder bestätigen wird, der Australien kennt. Das kommt täglich vor, ohne dass man sich darüber aufhält. Kaum eine Notiz in der Zeitung! Das Merkwürdigste dabei aber ist vielleicht, dass es genug Menschen gibt, welche sich solch einer Eventualität mit Absicht aussetzen, und sie haben es nicht etwa nötig, sondern sie setzen ihren Stolz darein, einen wegen seiner Schießerei berüchtigten Wirt um ein Glas Brandy zu prellen, gehen deshalb eine Wette ein, auf die Gefahr hin, dass ihnen das Rückgrat zerschmettert wird.
In Australien ist die Stehlerei zu Hause wie in keinem anderen Lande. Aber es ist eine ganz besondere Art von Stehlerei, mehr aus Ehrgeiz betrieben — abgesehen natürlich von den professionellen und Gelegenheitsdieben, deren es ja auch hier genug gibt.
Berüchtigt ist schon die nordamerikanische Straßenjugend, besonders die New Yorker, aber der australischen, speziell der von Sydney, kann sie doch nicht im Entferntesten das Wasser reichen. Wie kindlich harmlos ist dagegen etwa der Berliner Schusterjunge, der wohl bei uns das jugendliche Straßenelement repräsentieren soll.
Was die Straßenjungen in den australischen Häfen alles fertig bringen, was die alles wagen, das glaubt man nicht, wenn man es nicht selbst erlebt hat.
In den australischen Häfen ist jedes Schiff ›tabu‹, kein Fremder darf es ohne Erlaubnis betreten. Wer es tut, wird auf der Stelle niedergeschossen, vom Kapitän oder vom ersten Matrosen, der einen Revolver in der Hand hat, deshalb wird gar nicht erst eine Gerichtssitzung abgehalten. Da nun das Niederknallen nicht jedermanns Sache ist, so liefert die Polizei sofort beim Anlaufen des Schiffes einen oder mehrere Konstabler, die mit dem schussbereiten Revolver Tag und Nacht an Deck Wache gehen. Wer einen Fuß auf die Deckplanken setzt und nicht rechtzeitig beweisen kann, dass er hierzu ein Recht hat, wird einfach niedergeknallt.
Und solch eine furchtbare Rücksichtslosigkeit ist auch wirklich sehr nötig. Abgesehen von den Individuen, die es auf direkten Diebstahl abgesehen haben — beim Einlaufen eines neuen Schiffes setzt es sich die ganze liebe Straßenjugend in den Kopf, von diesem Schiffe etwas zu stehlen, nur aus Ehre, nur ein Endchen Bindfaden. Sie stehlen aber auch gleich eine ganze Kanone. Einmal über Deck gelaufen zu sein, gilt nur halb. Und bei diesem Vorhaben beweisen diese Bengels eine wahre Heldenhaftigkeit, die wirklich einer besseren Sache würdig wäre. Sie wissen, dass der Konstabler gnadenlos auf sie schießt, und nicht etwa blind, es sollen möglichst Kopfschüsse sein — macht nix, alle List wird aufgewandt, der Konstabler wird nach vorn gelockt, aber er weiß schon, dass jetzt einige Jungen von hinten an Deck klettern...
Es vergeht selten ein Tag, an dem nicht eine jugendliche Leiche in das Haus der Eltern abgeliefert wird. Und wie viele solche Bürschchen mögen mit Kugeln im Leibe oder in den Gliedern in der Schule sitzen, denen der Stolz verbietet, sich etwas davon merken zu lassen. Es ist tatsächlich etwas Heroisches dabei. Mich hat immer gewundert, dass man von solchen Fällen gar nichts in unseren Zeitungen liest. Doch es ist eben in Australien selbst etwas ganz Alltägliches.
Auch mir stellte sich sofort ein Polizeiwachtmeister vor, gleich einige Konstabler mitbringend, mir seine Dienste anbietend, und ich nahm, die Verhältnisse schon kennend, zwei der Leute an, für täglich zehn Schilling und Beköstigung aus der Kapitänskajüte. Verwarnungen oder Bitten, mit dem Revolver etwas zurückhaltender zu sein, als die ›gute Sitte‹ erfordert, hätten gar nichts genützt, ich wäre gar nicht verstanden worden.
Da machte sich am Kai noch ein alter Herr bemerkbar, der mir gleich durch sein asketisches Gesicht auffiel.
Richtig, der war von Meister Cyriax hier schon erwartet worden, und wenn er dem Mönche nicht bereits persönlich bekannt war, so hatte er sich eben durch besondere Zeichen zu erkennen gegeben.
»Es ist einer von den Unsrigen. Sie erlauben wohl, dass ich ihn in der Kajüte empfange?«
»Bitte sehr!
Der Mönch in Zivil kam an Bord, wurde von Meister Cyriax empfangen, sie gaben sich die Hände, wobei sicher wieder ein geheimes Zeichen gewechselt wurde, verschwanden in der Kajüte.
Als ich diese einmal betreten musste, waren sie nicht darin, sie hatten sich in des Mönchs Kabine zurückgezogen. Ich wusste nicht recht, was ich jetzt angeben sollte. Die Formalitäten wegen des Schiffes waren noch nicht zu erledigen, und durch die Anwesenheit eines Reederstellvertreters waren mir die Hände doch etwas gebunden, wenigstens im Hafen.
Doch nur zehn Minuten dauerte es, da wurde ich durch einen bekutteten Matrosen in die Kajüte gerufen, oder vielmehr gebeten. Der alte Cyriax befleißigte sich bei jeder Gelegenheit einer ungemeinen Höflichkeit, und das war gut so; als anständiger Mensch musste ich ihm dann ebenso begegnen.
Auch der alte, dürre Asket in Zivil befand sich natürlich in der Kajüte. Vorgestellt war ich ihm noch nicht worden.
»Darf der Herr hierbleiben?«
»Weshalb nicht?«
»Pater Sylvestros, der Bevollmächtigte der Klosterrepublik vom Athos.«
»Sehr angenehm.«
»Herr Kapitän, ich habe Ihnen eine Offenbarung zu machen.«
»Und?«
»Ich muss Sie entlassen.«
Ich war allerdings etwas baff.
»Weshalb denn?«
»Es ist deshalb vom Hauptquartier eine telegrafische Order an unseren Bevollmächtigten eingelaufen — Pater Sylvestros, willst du dem Herrn Kapitän...«
Eine Handbewegung von mir enthob jenen der Bemühung, erst in die Tasche zu greifen.
»Patriarch Johannes ist nämlich schwer erkrankt«, fuhr Cyriax fort.
Jetzt allerdings horchte ich hoch auf.
»Schwer erkrankt?«
»An Lungenentzündung. Man erwartet stündlich sein Ableben. Diese Depesche stammt von gestern; seitdem ist noch kein Telegramm wieder eingelaufen.«
Ich war doch stark erschüttert.
»Die provisorische Verwaltung der Klostergemeinde wünscht nun, dass Sie das Kommando dieses Schiffes abgeben.«
»Ich bin sofort bereit dazu. Natürlich verlange ich...«
»Gewiss! Sie erhalten Ihr Gehalt für ein volles Jahr, Sie dürfen auch eine angemessene Entschädigung beanspruchen.«
Ich hatte nur das halbe Jahresgehalt und das für einen Monat verlangen wollen. Jetzt aber nahm ich es ohne Bedenken für das volle Jahr an. Dieses Angebot hatte sich anstandshalber gehört, und ich hatte keinen Grund, es abzuschlagen.
»Ich schreibe Ihnen sofort einen Scheck über 360 Pfund Sterling auf unsere Bank hier aus«, sagte Meister Cyriax und zog schon sein Scheckbuch, mit dem er ganz gut umzugehen wusste.
»Ich soll das Schiff sofort verlassen?«
»Sobald es Ihnen irgendwie möglich ist, wenn ich bitten darf.«
Hier schien irgend etwas zu brennen.
»Dann allerdings möchte Sie erst noch einmal unter vier Augen sprechen, danach kann ich in fünf Minuten von Bord sein.«
»Pater Sylvestros, willst du so freundlich sein...«
Der Athosmönch im schwarzen Gehrock und Zylinder verließ sofort die Kajüte.
»Bitte sehr!«
»Auch Sie kennen doch wohl mein Abenteuer in Konstantinopel?«
»Ich weiß alles.«
»Auf welche Weise ich nach Athos zurückbefördert worden bin.«
»In einer Kiste. Ich weiß alles.«
»Ist Ihnen noch etwas anderes bekannt?«
»Ja, ich weiß, worauf Sie jetzt anspielen. Ja, ich weiß es — ich bin einer der wenigen, die darum wissen. Sie meinen Ihre Flucht nach Brasilien?«
»Ja.«
»Sie fürchten, dass Sie wieder einmal aus einem Schlafe in der Basilia erwachen könnten?«
Solch ein leichtes Verständnis ließ ich mir gefallen! Überhaupt ein ganz patenter Mensch, dieser alte Cyriax.
»Nein, Sie haben derartiges nicht zu fürchten. Das Verhältnis zwischen Ihnen und der Klosterrepublik ist von heute an vollständig gelöst.«
Es war doch ein großer Druck, der durch diese Erklärung plötzlich von mir wich. Etwas als Sklave hatte ich mich ja immer gefühlt.
Nun hatte ich nur noch eine Frage. Sie an Johanna zu richten, hatte ich bei unserem letzten Zusammensein vergessen, dann gar keine Zeit mehr dazu gehabt, Es war nicht erst nötig, dass ich meinen Oberkörper entblößte.
»Was hat eigentlich dieses Zeichen zu bedeuten?«
Mit Bleistift machte ich auf einem Stück Papier aus neun Punkten ein Kreuz, das rechte Feld oben als Dreieck geschlossen.
Ruhig betrachtete Cyriax die Zeichnung.
»Was soll das?«
»Sie kennen dieses Zeichen nicht?«
»Nein — ein besonderes Kreuz — was meinen Sie damit?«
»Ein solches Kreuz ist mir in der Basilia oder überhaupt während meines Aufenthaltes auf dem Athos, als ich einmal bewusstlos war, auf mein linkes Schulterblatt tätowiert worden.«
»Ja, warum denn das? Von wem denn?«
Ich hatte den Alten dabei immer scharf beobachtet. Dieses abgezehrte, asketische Gesicht war freilich keiner Bewegung fähig. Aber, glaubte ich, wollte er mich täuschen, so hätte er jetzt in seine letzte Frage doch künstliches Staunen gelegt, Nichts von alledem! Nein, dieser alte Mönch wusste wirklich nichts davon, ich traute ihm.
»Verzeihung, dann war es ein Irrtum von mir. Ich habe dieses Kreuz auf meiner linken Schulter erst kürzlich entdeckt, hatte vorher nichts davon gewusst und glaubte nun bestimmt, ich hätte es erst auf Athos erhalten. Aber es ist ja möglich, dass ich es immer schon gehabt habe.«
Meister Cyriax stellte weiter keine Frage deshalb, und das war wiederum ganz seinem Charakter entsprechend, es hätte mich höchstens misstrauisch machen können, wenn er es getan hätte. Solch ein alter, asketischer Mönch ist doch über manches erhaben.
Ich ging in meine Kabine, kleidete mich um, und zwar hatte ich in Athen auch für einen modernen Anzug gesorgt, packte meine Sachen zusammen und übergab sie einem Dienstmann mit der Adresse eines mir bekannten Hotels.
Den Scheck hatte ich schon erhalten; ich übergab dem Reederkapitän die Schiffskasse, und ohne weiteren Abschied von den Leuten verließ ich das Klosterschiff, welches als erster Kapitän ich zu führen die Ehre gehabt hatte.
Ich ahnte nicht, dass ich es noch einmal wiedersehen, immer noch einmal darauf Kapitän werden sollte — noch weniger aber ahnte ich ein anderes Wiedersehen, das mich in Sydney erwartete.
Zunächst stellte ich mich in dem Hotel vor, dann ging ich auf die Bank und verwandelte den Scheck über 360 Pfund Sterling in bare Münze oder doch in wechselfähigeres Papiergeld.
Wir waren am Nachmittag in der vierten Stunde eingelaufen, und nachdem ich in einer Restauration gut gespeist hatte, war es Abend geworden.
Ich schlenderte durch die Straßen und überlegte, wie ich die angerissene Nacht würdig oder unwürdig vollenden solle. Es war Sonnabend; in den Straßen wimmelte es von Kauf- und Vergnügungslustigen. Darin ähnelt Sydney doch sehr einer echt englischen Stadt. Ich glaubte mich sogar oftmals in London zu befinden, in der Marktstraße. Vor den offenen Auslagen der Fleischerläden standen die ›butchers‹ und sangen ununterbrochen ihr ›buy buy buy buy buy buy!!!‹, so hatte jeder Geschäftsinhaber seinen besonderen Ruf, um das Publikum zum Kaufen einzuladen, dazwischen im Rinnstein die fliegenden Verkaufsstellen mit Austern und anderen Muscheln, phantastisch herausstaffierte Wagen, auf denen Scharlatane mit wunderbarer Rednergabe ihre Pillen und sonstigen Allheilmittel anpriesen — alles genau wie in England, in London, und auch hier musste der Ehemann der holden Gattin den schweren Marktkorb nachtragen, auf dem anderen Arme womöglich noch das Baby, und dabei ging es während dieses abendlichen Einkaufens für die ganze Woche immer aus einer Kneipe in die andere, wobei das Baby auch stets seinen Schluck Whisky abbekam.
Natürlich, auch jene Gestalt dort an der Ecke fehlte nicht, die Italienerin im Nationalkostüm, mit dem bunten Kopftuch, neben sich den kleinen Holzkohlenofen, auf dem die Kastanien zischten.
»Roast chestnuts, maroni italiani, penny each, penny each dozen!!«
Es war ein ganz nettes Weib, ein bisschen zu braun, auch ein bisschen zu haarig, hatte sogar ein hübsches Dragonerbärtchen.
Das heißt, ich widmete ihr nur deshalb Aufmerksamkeit, weil ich so ein halber Philosoph bin, und im Augenblick dachte ich daran, wie dieses italienische Volk sich doch so in aller Welt herumtreibt, aber dabei wieder in ganz anderer Weise als der Deutsche, immer dieselben bleibend, niemals ihre Gewohnheiten ablegend, nicht einmal ihre Tracht, und das nicht nur aus Spekulationstrieb, sondern...
Meine philosophischen Betrachtungen verstummten, weil mich das braune Weib, von dem ich keine zehn Schritt mehr entfernt war, plötzlich so anstarrte. Und mit einem Male kam sie, den Kopf vorgereckt, auf mich zugeschlichen.
»Pepi, Peeepi!!«
Ich Unglücklicher ahnte nichts.
»Pepi, du willst mich wohl nicht kennen?!«
»Nein, Signora oder Signorina, Sie irren sich, ich kenne Sie nicht.«
Mit diesen Worten wandte ich mich von ihr ab.
Da aber stand sie mit einem Sprunge schon wieder vor mir, und wie sie die Arme in die Hüften stemmte, glich sie schon jetzt einer Furie, obgleich es noch gar nicht losgegangen war.
»Was, irren soll ich mich?! Du denkst, weil du hier so in feinen Kleidern herumspazierst? Na, mein Napoleon Bonaparte Novacasa, das wollen wir doch gleich einmal sehen, ob ich dich nicht als meinen Mann requirieren kann, der mich und seine fünf armen Kinder treulos verlassen hat. Konstabler, Konstabler!!!«
Himmelherrgott noch einmal, jetzt freilich war es mir wie Schuppen von den Augen gefallen!
Ich hatte doch eigentlich noch gar nicht an den Mann gedacht, dessen Namen ich widerrechtlich führte. Der war ja tot, über Bord gestürzt, auch sein Heimatdorf weggeschwemmt — ich hatte niemals daran gedacht, dass dieser Napoleon Bonaparte Novacasa verheiratet sein konnte, das steht ja im Seefahrtsbuch nicht — jetzt aber kam es mit fürchterlicher Gewissheit über mich — und jener Kapitän hatte doch gesagt, dass ich diesem Toten so ähnlich sah — wenn auch nicht wie ein Ei dem anderen, so genügte es doch wohl — vor allen Dingen aber hatte ich ja sein Seefahrtsbuch, ging jetzt auf seinen Namen — und ich kannte die australischen Verhältnisse — schon in England wird wenig Federlesens mit einem durchgegangenen Ehemanne gemacht, noch weniger in Amerika, am allerwenigsten aber in Australien...
Diese Erwägungen waren mir nur blitzähnlich durchs Hirn gezuckt, im Geiste sah ich schon alle die Verwicklungen, die mir bevorstanden, und ich hatte mich zur Flucht gewandt.
Es war das Klügste gewesen, das beste... wenn es mir geglückt wäre!
Aber es sollte eben nicht sein. Da erklang schon ihr gellender Ruf nach dem Konstabler. Und natürlich, wenn man einen braucht, ist keiner da, aber ganz sicher, wenn keiner nötig ist — wenigstens hier von meiner Seite aus betrachtet — kurz, da waren gleich zwei Wächter der öffentlichen Ordnung neben mir, hatten mich schon an den Armen gepackt, und außerdem war ich auch gleich von einer Menschenmauer umringt.
Und jetzt legte dieses Weib los!
»Der Lump — hat mich vor drei Jahren in Melbourne sitzen lassen — mit meinen fünf Kindern — und mein ganzes Erspartes hat er auch mitgenommen — vierzig Pfund — hungern hat er uns lassen — mit einer anderen ist er durchgegangen — der Haderlump...«
Ich weiß nicht, was sie alles zeterte, nur mit ihren braunen Fäusten dabei immer vor der Nase herumfuchtelnd.

»Ist das Ihre Frau?«, fragte mich der eine Konstabler.
»Jawohl, das ist meine Frau.«
Denn nun war mein Entschluss auch gefasst. Es gab hier gar keine andere Möglichkeit, als zu bejahen. Hätte ich es nicht getan, so hätte man mich einfach auf die Polizei geführt, meine Papiere wären revidiert worden, und da hätte sich doch eben erwiesen, dass ich Napoleon Bonaparte Novacasa war. Und nach amerikanischen wie nach australischen Gesetzen wird der Ehemann, der sich weigert, seine Familie zu ernähren, einfach ins Loch gesteckt.
Nein, hier musste ich meine Identität zugeben. Da hatte ich viel eher Gelegenheit, schnellstens wieder fortzukommen. Und mit dieser Aussicht war das doch übrigens ein ganz hübsches Abenteuerchen, das durfte ich mir doch gar nicht entgehen lassen.
»Wie heißen Sie?«, fragte der Konstabler die Italienerin.
»Julia Novacasa.«
So, nun wusste ich wenigstens, wie ich sie anzureden hatte.
»Wo wohnen Sie?«
»Run Street 47.«
»Und wie heißen Sie?«
»Napoleon Bonaparte Novacasa.«
»Was sind Sie?«
»Seemann.«
»Mann, seien Sie doch vernünftig, gehen Sie mit Ihrer Frau nach Hause.«
Da die Konstabler sahen, dass sich der wieder eingefangene Ehegatte in sein Schicksal fügte, gaben sie ihm nur noch diesen guten Rat, dann taten sie, als ob sie sich nicht mehr um uns beide kümmerten, suchten die Neugierigen auseinanderzutreiben, die uns noch immer als fester Wall umgaben.
»Pepi, mein Pepi! Wo bist du so lange gewesen?! Wie konntest du deine Julia und deine fünf armen Kinder so heimlich verlassen!!«
Mit diesen Worten hatte sich die Frau schluchzend und jauchzend an meinen Hals gehängt. Ich stand wie ein begossener Pudel da. Mir ward sogar weich ums Herz, obgleich ich die schadenfrohen Gesichter der Umstehenden sah, ihre spöttischen Bemerkungen hörte.
»Heilige Madonna, mein Ofen!!!«, erklang es dann kreischend.
Sie hatte doch ihre Kastanien und den ganzen Ofen im Stich gelassen. Als sie sich durch die Menge drängte, vergaß sie aber nicht, mich krampfhaft beim Arme zu nehmen.
Na, nach dem Ofen brauchte sie sich nicht erst wieder umzusehen. Der war natürlich schon längst gestohlen worden, samt Kastanien und glühenden Holzkohlen.
Sie nahm diesen Verlust nicht allzu tragisch.
»Wenn ich nur dich wiederhabe, mein Pepi, dann mag alles andere zum Teufel gehen«, sagte sie, zärtlich zu mir emporblickend, was mich wiederum ganz rührte.
»Lass nur, meine Julia, ich kaufe dir einen neuen Ofen.«
»Du hast Geld? Wie viel?«
Dabei aber bemerkte ich ein verdächtiges Auffunkeln in ihren Augen.
»Fast hundert Pfund«, entgegnete ich vorsichtig.
»O, dann sind wir ja fein heraus!«, jubelte sie. »Und wie vornehm du aussiehst! Gerade wie ein echter Gentleman. Nun komm mit nach Hause — ach, werden sich die Kinder freuen!«
Losgelassen hatte sie mich überhaupt noch nicht, und jetzt schleifte sie mich am Arme fort.
Ich hatte etwas Zeit zum Überlegen. Hatte mir jener Kapitän, der mir den Pass meines Doppelgängers gegeben, gesagt, vor wie vielen Jahren dieser über Bord gestürzt war? Ich wusste es nicht mehr. Anscheinend war dieser Novacasa aber doch nicht ertrunken. Anscheinend war er noch vor drei Jahren in Melbourne gewesen, was natürlich nicht in diesem seinen Seefahrtsbuche stehen konnte. Was konnte mir passieren, wenn ich jetzt vor Gericht angab, dass ich gar nicht dieser Novacasa sei, seinen Namen und seine Papiere zu Unrecht benutzt hatte?
Nein, es war doch besser, wenn ich seine Rolle weiterspielte. Von diesem Weibe würde ich mich schon bald wieder loszumachen wissen.
Ach, wie einfach stellte ich mir das vor, und wie sehr sollte ich mich geirrt haben!
Unterdessen schwatzte meine teure Gattin immer weiter.
»Wo bist du denn gewesen, mein Pepi?«
Ich musste sehr vorsichtig sein. Als Kapitän wollte ich mich lieber nicht ausgeben, durfte sie natürlich auch nicht in mein Seefahrtsbuch blicken lassen.
»Ich bin immer als Matrose gefahren.«
Glücklicherweise genügte ihr diese Auskunft. Sie hatte nur immer etwas anderes im Kopfe.
»Und hundert Pfund hast du mitgebracht?«
»So ziemlich«, entgegnete ich, in der Absicht, mich mit dieser Summe von meiner Ehehälfte wieder zu befreien.
»Na, dann ist dieses Luderleben ja zu Ende«, jauchzte sie. »Gepriesen sei die heilige Madonna! So, hier sind wir zu Hause. Halt, hier musst du erst noch etwas für die Kinder mitnehmen.«
Wir waren in das ärmste Viertel Sydneys gekommen. Sie zog mich, ohne mich einmal loszulassen, in einen kleinen, schmierigen Kolonialwarenladen, forderte Bonbons und Zuckerstängel und Sirup und Honig und anderes Zeug, immer vom Allerbilligsten, den Kunsthonig echtem vorziehend, aber immer gleich pfundweise, auch vom allgemeinsten Zuckerkram.
Ich bezahlte mit einigen Kronen; das Wechselgeld steckte sie ein, und schwerbepackt wie ein Maultier wurde ich weitergezogen.
Wir betraten ein baufälliges Haus, stiegen zwei Treppen hinauf, nach Polizeivorschrift schon mit Gas beleuchtet, und überall roch es nach verbranntem Olivenöl, ein ziemlich sicheres Zeichen, dass in diesen Wohnungen, aus denen Kindergeschrei erscholl, Italiener hausten. Julia schloss eine Tür auf.
Eine entsetzliche Atmosphäre von verbranntem Fett schlug mir entgegen, und nachdem sich mein Auge an den Qualm gewöhnt hatte, erblickte ich eine mit Lumpen und Abfällen aller Art angefüllte sonst ziemlich geräumige Kammer, in der zwei halbwüchsige Jungen mit dem Sortieren von Hadern und Knochen beschäftigt waren, während ein sechsjähriges Mädchen sich am glühenden Kochherd zu schaffen machte und gleichzeitig ein am Boden kriechendes Wurm, sowie ein anderes, das noch in der Wiege lag, beabsichtigte.
Nun wusste ich es. Meine fleißige Gattin betrieb außer ihrem Maronenhandel durch meine Kinder auch noch das Lumpensammeln.
»Kinder, der Vater ist wieder da!«
Die drei halbwüchsigen Kinder waren ganz nach der Mama geraten. Sie nahmen die Rückkehr des Vaters einfach als gegebene Tatsache, ohne sich weiter um Beweggründe zu kümmern.
»Hast du uns etwas mitgebracht?«
Das war der einzige Gedanke, und dann ließen sie fallen, was sie gerade in den Händen hatten, eine Eselskinnlade oder einen halben Kamm. Die niedliche Köchin ließ das Öl in der Pfanne in hellen Flammen brennen. Schon war ich auf den Stuhl niedergedrückt worden, und im nächsten Augenblick hatte ich die ganze Gesellschaft auf den Knien, denn meine Julia sorgte dafür, dass auch noch das einjährige Kind und das von wenigen Monaten hinzukamen. Was da alles geschwatzt, gejauchzt und gefragt wurde, kann ich unmöglich schildern.
Immer mehr kam eine halbe Betäubung über mich, teils infolge der schrecklichen Atmosphäre, teils infolge dieses Menschengewichts, das mich schon moralisch ganz niederdrückte.
Ich sah nur, wie die zehn schmutzigen Kinderhände in die Zuckersäcke griffen und sich die Mäuler vollstopften. Nicht anders verfuhren sie mit dem Sirup und Honig. Die Büchsen wurden aufgemacht, und nun einfach rin mit den Händen und sich das schmierige Zeug in den Mund gesteckt, und dann wieder mit denselben tropfenden Händen an mir in die Höhe gekrabbelt und den Sirup und Honig mir ins Gesicht und in die Haare geschmiert.
»Nun, mein Pepi, bist du glücklich?«
»Sehr, sehr!«, murmelte ich, jetzt auch schon halb blind, weil es das Einjährige gerade darauf abgesehen hatte, meine Augen mit Sirup und Zuckerhonig zuzukleistern.
»Nicht wahr, nun gehst du nicht wieder von uns fort?«
»Niemals, niemals!«
»Nun bleibst du für immer bei uns?«
»Immer, immer.«
»Sieh nur das reizende Baby, das ich dir geschenkt habe!«
Sie löste den wenige Monate alten Wurm, der sich an meinen Wangen festgeklebt hatte, von mir ab und schwenkte ihn durch die Luft, hielt ihn mir hin. Da stieg ein fragender Gedanke in mir auf, halb humoristisch, und nun konnte ich auch wieder klar denken.
»Ist das ein Mädchen?«
»Nein, ein Junge, und Napoleon habe ich ihn getauft, dir zu Ehren.«
»Und wie alt ist denn dieser kleine Schreihals hier?«
»Die Pepita? Ja, ja, da habe ich auch an dich gedacht, als ich die taufte, weil ich dich doch immer meinen Pepi nenne. Die ist auch erst fünfzehn Monate. Und Napoleon erst drei Monate.«
»Und ich bin doch drei Jahre von dir fort.«
»Ja, genau drei Jahre ist's her«, antwortete die Mutter noch in stolzem Glück, ganz in Betrachtung des lebendigen Sirupklumpens versunken.
»Und ich bin inzwischen doch nie wieder bei dir gewesen?«, versuchte ich vorsichtig Erkundigungen einzuziehen.
»Wie meinst du?«
»Wie lange bist du denn schon in Sydney?«, wurde ich noch vorsichtiger.
»Gleich, als du verschwandest, bin ich nach Sydney gegangen.«
»Das ist also schon drei Jahre her.«
»Ja, drei Jahre.«
»Und selbst Pepita hier ist erst ein und ein viertel Jahr alt.«
Jetzt wurde sie misstrauisch, so blickte sie mich an.
»Was willst du damit sagen?«
»Dass — hm — dann — hm — dann können diese beiden Jüngsten doch eigentlich nicht meine Kinder sein...«
O weh! Jetzt hatte sie verstanden. Schnell setzte sie das Jüngste auf den Boden, stemmte die Arme in die Hüften, und nun ging es wieder los.
»I du Haderlump!«, fing sie wieder zu keifen an. »Du willst mir wohl gar noch Vorwürfe machen! Du Strolch bist drei Jahre fort gewesen, und da willst du diese Kinder nicht einmal als die deinen anerkennen? Willst wohl gar wissen, wer ihr Vater ist? Du Stromer infamer denkst wohl gar, ich warte geduldig, bis du zurückkommst und...«
Und so ging es weiter. Na, ich bekam etwas Schönes zu hören!
»Ist das dein Kind? Ja oder nein!«, schrie sie mich zuletzt an, mir die Pepita unter die Nase haltend.
Meine Kraft war schon längst wieder gebrochen.
»Ja, es ist meine Tochter«, ächzte ich.
»Und bist du der Vater von diesem Baby?«
Dabei rieb sie mir den dreimonatigen besirupten Napoleon im Gesicht herum.
»Ich bekenne mich als seinen Vater«, stöhnte ich.
Mit dieser Erklärung war sie zufrieden, und dann kam gleich noch etwas anderes hinzu, sie auf andere Gedanken zu bringen.
»Mutter, Mutter, was Vater hier hat!«, jauchzten die anderen drei Kinder.
Sie hatten unterdessen mit ihren Siruphänden meine Taschen visitiert und brachten die Goldstücke zum Vorschein, immer mehr.
Auch Julia geriet außer sich vor Freude, wurde gleich darauf aber wiederum misstrauisch. Sie hatte die Goldstücke nämlich gezählt,
»Das sind aber doch viel mehr als hundert Pfund Sterling?«
Das stimmte — ich hatte mir noch mehr Gold geben lassen. Wenn sie jetzt nur nicht...«
Aber schon war es zu spät.
»Ha, du willst mir Geld verheimlichen, wie du es schon früher immer getan hast, du elender Lump! Zeig mal deine Taschen her!«
Da half kein Widerstreben, sie plünderte meine Taschen, fand auch alles Papiergeld, beraubte mich meiner ganzen Barschaft, immer noch ziemlich aus 360 Pfund bestehend.
Und ich wagte keinen Widerstand mehr. Denn ein schrecklicher Gedanke war mir gekommen. Sie hatte auch alle meine sonstigen Papiere ausgeräumt, darunter das Dokument, nach dem ich mit der Dona Privilega verheiratet war. Was für Verwicklungen konnten daraus entstehen, ganz abgesehen davon, dass die mich jetzt wegen Bigamie anzeigte — ins Loch kam ich zunächst sicherlich — aber es genügte schon vollkommen, dass mich diese meine holde Gattin, die nicht nur Haare unter der Nase, sondern auch auf den Zähnen hatte, deswegen allein vornahm! Es genügte, um jeden Widerstand meinerseits zu brechen.
Es ging noch gut ab. Wohl öffnete sie jedes Papier einmal, um hineinzublicken, aber nur, weil sie nach mehr Papiergeld suchte. Ich dachte nur gleich, dass sie gar nicht lesen könne, was sich dann auch bewahrheitete.
Sie machte mir weiter keine Vorwürfe, dass ich erst nur von hundert Pfund gesprochen hatte, ebenso wenig fragte sie, woher ich denn das viele Geld habe. Es genügte ihr, dass sie jetzt ›reich‹ war, und danach betrug sie sich, ganz berauscht.
»Hier, Antonio, hole noch eine Flasche Falerner, und dann, mein Pepi, wenn wir gegessen haben, gehen wir schlafen.«
Wenn Signora Julia Novacasa früher sparsam gewesen war, sodass sie es bis auf 40 Pfund gebracht hatte, so musste sie durch den unerwarteten Besitz von 360 Pfund Sterling in eine Art Rausch versetzt worden sein. Denn von Sparsamkeit war jetzt bei ihr nichts mehr zu merken.
Am anderen Morgen und auch oft genug in der Nacht hatte sie wohl Pläne geschmiedet, wie dieses ungeheuer viele Geld am besten anzulegen sei. Sie wollte die verschiedensten Geschäfte anfangen. Einmal Kolonialwaren, dann ein Lumpenhandel en gros, dann wieder war das Ziel ihrer Sehnsucht eine Kneipe — ,aber da wärst du ja doch dein bester Gast‹ — und so wurde am anderen Morgen beschlossen, für die ganze Familie erst einmal die sehr notwendig gewordenen Kleider zu kaufen. Auch ich hatte sie nötig, mein ganzer Anzug war ein Siruptuch geworden — und so etwas dürfe nicht wieder vorkommen.
Gut, so wanderten wir alle zusammen nach einem italienischen Kramladen, und meine Gattin war so rücksichtsvoll, mich das leichtere Baby tragen zu lassen, während sie die viel schwerere Pepita auf den Arm nahm, ohne dabei meinen eigenen fahren zu lassen.
Sie kaufte bei dem Trödler ein, also alte Sachen, möglichst billig, aber auch möglichst bunt, auch ich musste mich in einen waschechten Italiano verwandeln. Dazu behing sie sich noch mit einer Unmenge falscher Schmucksachen, und so ging es wieder auf die Straße.
Sie wollte sich und ihre ganze Familie in der neuen Kleidung zeigen, sie war einfach stolz auf mich, und als sie nun so neben mir herscharwenzelte, sich in den Hüften wiegend, dass sie wie eine Ente wackelte, wir beide je ein Kind tragend und dabei dennoch Arm in Arm, und hinter uns her die drei anderen herausgeputzten Kinder — ich schämte mich unsäglich.
Nötig hatte ich es eigentlich nicht. In Sydney gibt es Italiener genug, und das ist nun so der Charakter dieser Leute, schon etwas mit dem spanischen verwandt.
»,Jetzt speisen wir in einer Trattoria, das wird noch dranspendiert, dann sprechen wir über den Lumpenhandel.«
Nachdem ich mit langen Zähnen die öligen Speisen verzehrt, ging es wieder auf die Straße, um mich dem versammelten Volke zu zeigen.
Eine Reihe von Mietwagen brachte meine holde Gattin wieder auf einen anderen Gedanken:
»Jetzt machen wir noch eine Spazierfahrt in so einer Equipage, das wird noch dranspendiert, dann sprechen wir über den Lumpenhandel.«
Also fuhren wir alle zusammen zwei Stunden lang in einem zweispännigen Wagen, dann hatte sich wieder der Appetit eingestellt, es wurde also noch einmal in einer Trattoria gespeist, dann wurde immer noch einmal eine Equipagenfahrt spendiert — und so ging das weiter, und ich sah schon kommen, dass dies nicht eher aufhören würde, als bis der letzte Schilling verjuxt war.
Und so wurde es denn auch. Das Geld wurde immer freigebiger ausgeteilt, allerdings nicht an fremde Personen. Gäste gab es nicht. Aber sonst ging es immer großartiger zu. Nach Hause kamen wir überhaupt nicht mehr. Erst schliefen wir in einer italienischen Herberge, zuletzt im vornehmsten Hotel, speisten table d'hôte, mit sieben Gängen und Champagner, und so währte es keine vierzehn Tage, da waren die 360 Pfund sogar bis auf den letzten Penny durchgebracht.
Dabei aber war meine holde Gattin trotz aller Zecherei niemals so weit gewesen, dass ich ihr hätte aus den Fängen entwischen können, und da sie so etwas von mir fürchtete, begleitete sie mich auch nach dem geheimsten Örtchen.
»Na, nun habe ich gerade noch einen Sixpence — fünf Groschen — dafür kaufe ich den Kindern noch eine Zuckertüte, dann fangen wir aber ganz sicher unseren Lumpenhandel an.«
So geschah es. Zum ersten Male betraten wir wieder unsere Wohnung, und der Lumpenhandel begann. Das heißt, nicht en gros, wie ursprünglich geplant war, sondern ganz en detail. Die drei halbwüchsigen Kinder wurden wieder zum Lumpensammeln auf die Straße geschickt, meine Frau ging wieder als Kastanienverkäuferin — indem sie sich einen anderen Ofen anschaffte — entweder auf Kredit, oder sie mochte auch noch einiges Geld haben, was sie nicht angriff, nur das meine, ihr zufällig in den Schoß gefallene hatte verjubelt werden dürfen — und ich musste unterdessen zu Hause bleiben, die beiden kleinen Kinder warten, für die Zurückkommenden das Essen kochen und unterdessen Lumpen sortieren.
»Auf See gehst du mir nicht wieder, du bleibst hier zu Hause bei deiner Familie, wohin du gehörst! Verstanden?«
Sie schloss mich ein. Mir kam die Sache recht merkwürdig vor. War denn der wirkliche Novacasa so einer gewesen, der sich von solch einer wurmstichigen Tür zurückhalten ließ? Sonst gab es ja auch noch ein Fenster, und Decken waren genug vorhanden, um daraus ein Seil herzustellen, an dem man sich herablassen konnte.
Aber ich bekam schnell genug zu hören, wie die Sache stand; sie sagte es mir noch, ehe sie mich zum ersten Male allein ließ.
»Und denke nicht etwa, dass du mir wieder durchbrennen kannst. Ich habe es der Marietta und der Anita und allen anderen gesagt — sobald du hier aus der Türe trittst, rufen die den Konstabler, der dich auf die Wache bringt, und auch durchs Fenster sollst du mir nicht wieder gehen, dafür ist gesorgt.«
Also, sie hatte mir weibliche Hausbewohner zu Wächtern bestellt, durch irgendeine Kleinigkeit gewonnen. Und meine Gattin fühlte sich so sicher, dass sie nicht daran gedacht hatte, mir meine Papiere abzunehmen.
Trotzdem war meine Flucht natürlich eine beschlossene Sache. Dass ich hier einschlafen und wieder in der Basilia auf dem Berge Athos erwachen würde, darauf durfte ich ja nicht mehr hoffen. Übrigens meine ich das auch nur scherzhaft.
Trotzdem sollte mir wiederum von anderer Seite aus geholfen werden.
Am Nachmittag zuvor war das letzte von meinem Gelde ausgegeben worden, darauf waren wir gleich nach Hause gegangen, hatten die erste Nacht wieder in unserer Kammer verbracht. Heute Morgen gegen zehn hatten mich die drei halbwüchsigen Kinder und Julia verlassen, mit jener Ermahnung, mich und die beiden kleinen Kinder einschließend. Zu einer Entgegnung war ich gar nicht erst gekommen.
Nun saß ich unglücklicher Mensch mit den beiden kleinen Würmern da, mir meiner unwürdigen Lage recht wohl bewusst, ebenso aber auch, dass es gar nicht so einfach war, von hier unbemerkt fortzukommen.
Zum Sprengen der Tür brauchte ich ja nur einen leichten Druck, aber was half das, wenn ich aufmerksame Wächter hatte? Die Weiber riefen einfach einen Konstabler, und wie in Amerika, so haben eben auch in Australien die Weiber viel mehr Recht als die Männer, die Aufpasserinnen hätten schon dafür gesorgt, dass ich nach der Wache geführt worden wäre. Und Sydney liegt nicht mehr so nahe der Wildnis, in deren Büsche ich mich hätte schlagen können und mich schnell in einem Schiffe zu verkriechen, das gab es am helllichten Tage auch nicht, und zum Totschläger wollte ich wegen dieser dummen Geschichte doch nicht etwa werden.
In der Nacht hingegen waren meine Julia und die anderen Kinder schon wieder hier, letztere kehrten sicher schon mit Anbruch der Dunkelheit zurück.
Der Leser wird sagen: Ich hätte mir das einfach nicht gefallen lassen, hätte als Mann auftreten sollen. Jawohl, hat sich was! Es gibt Frauen, denen gegenüber alle Mannhaftigkeit versagt. Ich hatte diese haarige Italienerin bisher noch nicht einmal von ihrer allerschlechtesten Seite kennen gelernt, wusste aber bestimmt, dass sie noch auf eine ganz andere Weise auftreten konnte. Und wehe, wenn die sich in ihrem wahren Charakter offenbarte! Da hätte auch der energischste Wüterich nichts ausrichten können — oder er hätte über ihre Leiche gehen müssen.
Ich hatte eben den mir aufgedrängten Jüngsten zur Ruhe gebracht, hoffend, dass er nicht gleich wieder zu schreien anfinge, Pepita rutschte selbstvergnügt in der Stube herum, nun wollte ich richtig an das Überlegen des Kriegsplanes gehen, als leise an der Tür geklopft wurde.
»Wer ist da?«
»Bst!«, hörte ich es durch das Schlüsselloch kommen.
Ich ging hin, bückte mich — zu sehen war durch das Schlüsselloch nichts, wohl eben deshalb nicht, weil draußen jemand dicht davorstand, vielleicht seinen Kopf darangelegt hatte.
»Wer ist da?«
»Ich bin es, Anita — Ihre Nachbarin — Anita Caballo«, kam es flüsternd aus dem Schlüsselloch heraus.
Aha, eine meiner Aufpasserinnen!
»Was wünschen Sie?«
»Bst, nicht so laut! Wollen Sie wieder fort von hier?«
Hei, wie ich aufhorchte! Die Nachbarin war auf meiner Seite!
Im nächsten Augenblick aber sagte ich mir, dass ich sehr vorsichtig sein müsste. Das konnte auch eine Falle fein, Julia ließ durch eine Nachbarin meine Absichten prüfen.
»Ich bin eingeschlossen.«
»Na ja, ich weiß es. Wollen Sie fort? Ich lasse Sie heraus. Aber schnell muss es gehen, die Marietta ist gerade einmal fortgegangen.«
Es half alles nichts, da konnte ich doch nicht lange mit Vorsicht zurückhalten. Hier schien zwischen den Nachbarinnen eine Eifersucht vorzuliegen.
»Warum wollen Sie denn, dass ich fortgehe?«, fragte ich nur noch.
»Na, Sie werden sich doch nicht von dieser braunen Hexe einschließen lassen! Ich weiß ja alles.«
Ich freilich konnte nicht wissen, was die alles wusste.
»Ist Ihnen denn so viel daran gelegen, dass ich meiner Frau wieder durchgehe?«
»Gerade ihr zum Schur(1). Ich soll auf Sie aufpassen, aber ich tu's ihr gerade zum Schur.«
(1) ›Ihr zum Schur‹ bedeutet ›um sie zu ärgern‹.
Nun wusste ich genug. Richtig Eifersucht oder doch so etwas Ähnliches. Eben zwei Nachbarinnen, die äußerlich gute Freundinnen zu sein scheinen und innerlich sich spinnefeind sind.
»Aber schnell muss es gehen«, wurde wieder gedrängt. »Wenn die Marietta zurückkommt, ist es zu spät.«
»Können Sie die Tür öffnen?«
»Ja, mein großer Kommodenschlüssel passt.«
Aha, die hatte dieser Wohnung der guten Nachbarin bei deren und der Kinder Abwesenheit wohl schon öfter einen Besuch abgestattet.
»Ich bin bereit. Nur eine Minute noch.«
Ich holte mein altes Kostüm hervor, welches ich trotz aller Sirupflecke diesem italienischen vorzog, vergewisserte mich, dass ich meine Papiere bei mir hatte, war fertig.
Ein Schlüssel rasselte, vor mir stand ein Weib, welches den Namen ›braune Hexe‹ viel eher verdient hätte als meine Julia.
»Fort, fort!«, drängte sie augenblicklich. »Die heilige Jungfrau beschütze Sie.«
»Und wenn die Kinder schreien?«
»Sie sind eben entwischt, haben das Schloss zu öffnen verstanden, es auch wieder zugemacht. Denn ich schließe wieder zu. Und wenn Sie erwischt werden — verraten werden Sie mich nicht.«
»Gott behüte mich vor so etwas!«
Es war mein letztes Wort, das ich in diesem Hause sprach, und ich sollte auch nicht erfahren, was aus dieser ganzen Geschichte noch wurde. Vor allen Dingen hieß es, mich jetzt in Sicherheit bringen. Um meine beiden Koffer, die ich nach dem Hotel hatte tragen lassen, hatte ich mich noch nicht wieder gekümmert, hatte auch Julia nichts davon gesagt, gleich von vornherein ahnend, dass ich diese meine Sachen noch einmal gut gebrauchen könnte.
Allein so ganz richtig war meine Ahnung nicht gewesen. Bis nach jenem Hotel war noch ein gar weiter Weg, jeden Augenblick konnte ich von meiner Gattin oder von einem der drei unterwegs befindlichen Kinder gesehen werden, die Folgen davon wollte ich mir lieber gar nicht ausmalen, das hätte höchstens eine Straßenjagd geben können, und so, wie ich aussah, fuhr mich kein Mietskutscher ohne Vorausbezahlung in einem geschlossenen Wagen, und ich hatte keinen Penny in der Tasche.
Viel näher hatte ich es nach dem Seemannsamt, und in Sydney wie überhaupt in den australischen Häfen herrscht ständig großer Mangel an Seeleuten, fast in jeder Stunde des Tages werden für ein abgehendes Schiff, dessen Mannschaft desertiert ist, um in Australien ihr Glück zu suchen, neue Matrosen angemustert, zusammengesucht.
In zehn Minuten hatte ich glücklich das Seemannsamt erreicht. Schon unterwegs war ich angesprochen worden, ob ich Matrose sei, mehr noch war nach Heizern und Kohlenziehern die Nachfrage, aber ich wollte mir an Ort und Stelle dasjenige Schiff aussuchen, welches sobald wie möglich, noch zu dieser Stunde, die Anker lichtete. Die Anmusterung geschieht oft in der letzten Minute. Wenn ich meine Koffer nicht durch eine andere Person noch herbeischaffen konnte, so hatte auch das nicht viel zu sagen, dann kaufte ich mir von Schiffskameraden überflüssiges Zeug mit Abrechnung bei der Auszahlung.
Alle diese einzelnen Heuerzimmer waren mit Seeleuten überfüllt, und dennoch herrschte großer Mangel, sie hatten keine Lust, zu mustern. Wenn sie arbeiten wollten, konnten sie hier an Land mehr verdienen, so hoch die australische Heuer auch ist. Und trotzdem hatte ich Pech. Wie ich aus der aushängenden Liste ersah, fuhr zufällig kein Segler und Dampfer, der noch Leute brauchte, vor abends ab, nur ein einziger, ein Dampfer, der hatte es sogar höchst eilig, der wollte bei Mittagsflut in See gehen, und bis dahin war keine Stunde mehr. Aber Hände an Deck wurden gar nicht gesucht, die waren schon da, dagegen fehlte noch fast das ganze Heizerpersonal.
Mein Entschluss war gefasst. Bis zum Abend wartete ich nicht, mir brannte der Boden gar zu sehr unter den Füßen. Als Heizer konnte ich nicht gehen, das muss gelernt sein, dazu gehört auch eine Teufelsnatur, die man erst als Kohlenzieher bei Gelegenheit zu erproben hat.
So meldete ich mich als solcher, wurde sofort angenommen. Es ging wie auf einer Auktion zu. Nur immer fix, fix! Papiere vorgezeigt, unterschrieben und fertig!
»Wohin geht denn der Dampfer?«
»Auf hohe See.«
Es war eine dumme Frage von mir gewesen. Wie schon erwähnt, erfährt die Mannschaft bei der Anmusterung nie das Ziel. Entweder Küstenfahrt oder ›high sea‹. In den deutschen Häfen kommt noch ›Ost und Nord‹ hinzu, das heißt Ost- und Nordsee.
Dann fand sich noch ein ganzer Schub von Musterlustigen ein, darunter ein halbes Dutzend Deutsche, einstige Auswanderer, die in Australien nicht das gefunden hatten, was sie suchten, auch sonst nicht an Land bleiben wollten, eben Lust zur Seefahrt hatten. Oder sie gedachten kostenlos nach Deutschland zurückzukommen, wurden in ihrer Unkenntnis betrogen.
»Der Dampfer geht nach Hamburg?«, hörte ich sie fragen.
»Jawohl, nach Hamburg.«
Dann aber hörte ich zufällig, dass sein Ziel San Francisco war. Für jene, welche nach Deutschland wollten, wäre es zu spät gewesen, auch wenn sie es noch erfahren hätten, sie hatten schon unterschrieben, hatten sich mit Leib und Seele als Sklaven verkauft, wären bei einer Weigerung mit polizeilicher Gewalt an Bord gebracht worden, und im Heizraum und in den Kohlenbunkern wird man bald gewahr, dass man sich auch heute noch als Sklave verkaufen kann, und nicht nur körperlich, sondern sogar seelisch.
Jetzt war die Mannschaft vollzählig. Sie alle hatten ihre Bündel mitgebracht. Es ging sofort die wenigen Schritte nach dem Kai. Boote brachten uns nach dem weiter draußen liegenden Schiffe. Ein Dutzend Landarbeiter, die unterdessen gegen schweren Stundenlohn schon Dampf aufgemacht hatten, kehrten in denselben Booten zurück. Wir nahmen ihre abgegebene Arbeit auf, der letzte Pfiff, die Schraube begann sich zu drehen, und in den nächsten fünf Minuten hatten die, welche noch nie Kohlen gestochen hatten, erfahren, wie an Bord eines Dampfers diese Kunst mittelst Hüftriemens und Schippenstiels beigebracht wird. In der ersten Viertelstunde hatte der Oberheizer, ein Novascotiaman, der mit der Faust durch jede Tischplatte schlug, einen der Deutschen, einen professionellen Maurer, sonst ein ganz starker Kerl, totgeprügelt.
Drei Wochen sind wir gedampft. Ich habe erfahren, was es heißt, Kohlenzieher zu sein. Im Übrigen lässt sich das nicht weiter schildern, das kann man nur erleben. Und dabei war das ein Frachtdampfer, der nur zwölf Knoten machte, auf dem die Arbeit ein Kinderspiel gegen die auf einem großen Schnelldampfer bedeutete!
Am ersten Tage war es mir wie ein Vergnügen, die Kohlen einschippen und schleifen zu dürfen, nämlich ein Vergnügen insofern, als ich es überhaupt fertig brachte, während manch anderer Neuling schon zusammensank und wieder aufgeprügelt werden musste, wo doch gerade mir so etwas am allerwenigsten an der Wiege gesungen worden war, ich im Grunde genommen es auch wirklich nicht nötig hatte. Nur am Ende der dritten Wache wurde ich etwas schlapp, beim Antreten der vierten Wache fühlte ich mich ganz kreuzlahm und überhaupt vollständig elend, aber ich brachte meine vier Stunden noch fertig, gedachte nur mit Grausen der nächsten Wache — doch als diese kam, war alles schon vorüber, auch die furchtbarsten Rückenschmerzen, von jetzt an stand ich meinen ganzen Mann.
Ja, das brachte ich fertig, weil ich die Natur dazu besaß, den Körperbau. Aber ach, wie erging es den anderen Neulingen! Diese Prügel! Am vierten Tage waren von uns acht Kohlenziehern drei ausrangiert, lagen im Lazarett, unbrauchbar für immer, und jetzt mussten wir übrigen fünf auch noch die Arbeit dieser drei verrichten.
Sonst will ich von dieser Fahrt nichts weiter erwähnen. Eines Nachts, ich hatte die erste Wache, stoppte die Schraube, bald darauf rasselten die Anker herab.
»Frisco!«, rief ein Maschinist dem anderen zu.
Dass San Francisco unser Ziel war, hatten wir unterdessen ja schon erfahren, uns auch eben erst ausgerechnet, dass wir es am nächsten Mittag erreichen könnten. Zuletzt wurden ja überhaupt nur noch die Stunden berechnet.
Was? Wir sollten es fast sechsunddreißig Stunden eher erreicht haben? Nun, wohl uns!
Das Wachegehen hörte sofort auf, auch die Anderen mussten herabkommen, um die Kessel auszublasen.
Erst gegen acht kam ich an Deck, atmete mit Entzücken die köstliche Frühlingsluft ein.
Was, das Hafennest, das da vor uns lag, sollte San Francisco sein? Ich war noch nicht dort gewesen, und da hatte ich mir San Francisco doch ganz anders vorgestellt.
Es war auch gar nicht San Francisco, sondern Santa Baccera, ein Hafenstädtchen von fünftausend Einwohnern, siebzig geografische Meilen südlich der kalifornischen Hauptstadt gelegen.
Wir Schwarzkünstler brauchten uns nicht erst zu beraten, ob wir ein Recht hätten, schon hier das Schiff zu verlassen, denn es wurde uns gleich offenbart, dass wir sofort abgemustert würden. Weswegen, weiß ich nicht. Der Dampfer blieb eben vorläufig hier liegen.
Nun, uns Kohlenmenschen kam nichts erfreulicher als das. Eine Stunde später hatte ich mich wieder etwas renoviert, so dass ich eine anständige Speisewirtschaft betreten konnte, und hatte doch noch immer acht Dollar in der Tasche.
Ach, wie ich mich fühlte, als ich dann wieder durch die Straßen bummelte! So deutlich ich auch jetzt noch nachempfinde, was ich damals gefühlt habe, so wenig vermag ich es doch zu schildern. Ein unsäglicher Stolz und zugleich auch eine Glückseligkeit schwellte mein Herz. Weshalb? Weil ich drei Wochen mannhaft als Kohlenzieher gearbeitet hatte, ohne zusammenzubrechen, ohne einmal wirklich gemurrt, über mein Los gejammert zu haben. Mag das genügen, So etwas kann man eben nicht weiter beschreiben, noch weniger die Gründe dazu definieren.
Es war ein herrlicher Frühlingsmorgen — dazu noch kalifornischer Frühling! — ich war an den letzten Häusern des Städtchens angelangt, sah vor mir eine Allee mit blühenden Bäumen, links und rechts grüne Wiesen mit buntem Blumenschmuck — ich pilgerte die Allee entlang und hätte so mein ganzes Leben lang spazieren mögen.
Ehe ich mir dessen bewusst wurde, hatte ich mich schon einige Kilometer von der Stadt entfernt. Vorgeschobene Häuser oder gar Ortschaften gab es hier nicht, das alles mochte zu einer einzigen großen Farm gehören.
Die Straße machte eine Biegung, und ich hatte einen entzückenden Blick in ein Tal hinab. Denn die Gegend war hier gebirgig. Rechts, im Osten, das Felsengebirge, links das sich am Meere hinziehende Küstengebirge. Auch hier standen ab und zu einige mit dem Boden verwachsene Felsen.
Eben passierte ich solch eine kleine Felsgruppe, als mir ein eigentümlicher Geruch in die Nase stieg.
»Herrgott, woher kennst du schon diesen Geruch!«, sagte ich mir sofort. »Der ist dir doch bekannt — jawohl, das ist Tabak — aber... das riecht doch gerade wie, wie, wie...«
Plötzlich fühlte ich mich in eine Kaserne versetzt, in die Wachtstube, oder auch in eine Mannschaftsstube...
Ehe ich weiterkalkulieren konnte, sah ich den Erzeuger dieses Geruchs schon stehen. Hätte er sich aber nicht bewegt, so wäre er leicht meinen Blicken entgangen, denn er trug einen Anzug von ebenso schmutziggrauer Farbe wie die der Felsen, zwischen denen er stand.
Ich konnte ihn von der Seite sehen. Ein possierlicher Anblick! Es war ein Männchen, nicht mehr jung, das unter der Schirmmütze hervorsehende Haar wie der kurze am Kinn sorgfältig wegrasierte Backenbart schon etwas ergraut, und nun die Hauptsache, das Allerauffälligste: vorne einen Bauch und hinten einen Buckel!
Oder noch auffälliger war wohl, dass dieses Männchen aus einer langen Großvaterpfeife rauchte, mit Hornstiefel und Porzellankopf, und nicht einmal die Quaste fehlte an diesem Instrument.
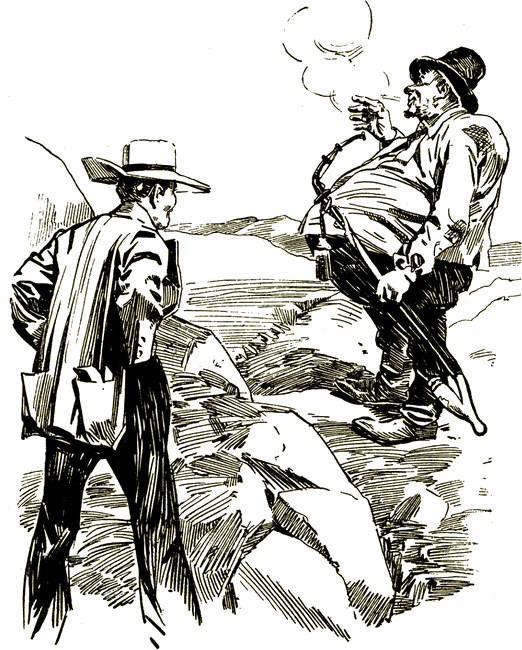
Dampfwölkchen in die stille Luft blasend, blickte er mit seinen freundlichen, stillvergnügten Augen, so stillvergnügt wie das ganze Gesicht, in das liebliche Tal hinab, dann nahm er bedächtig die Pfeifenspitze aus den Zähnen, und eben so bedächtig erklang es:
»Nee, nee, is das awwer scheen! Wennsch jetzt enn Fotografenabbarat hätte, das wird'ch abfotografiern.«
Das war in einer Weise hervorgekommen, dass ich in ein herzliches Lachen ausbrechen musste.
Bedächtig drehte er sich um, musterte mich, lehnte dann schnell die Pfeife, die ihm stehend reichlich bis an die Brust ging, an den Felsen, zog seine steife Mütze, wobei sich zeigte, dass er unter dieser noch eine Zipfelmütze trug, an der ebenfalls die Quaste nicht fehlte, und so trat er vor mich hin, die Mütze hinhaltend, mich mit einem demütigen Lächeln in dem guten, alten Gesichte von unten ansehend.
»Ä armer reisender Handwerksbursche. Wenn Se 'n mit enner gleen Gabe unterschtitzen genn.«
Ich war baff. Meine Lebenserfahrungen waren ja noch immer sehr gering. Ach, wie wird doch unsereiner über das eigentliche Wesen des Volkes im Dunkeln gelassen! Was für falsche Begriffe muss doch ein Landesvater bekommen, der auf seinen Reisen nur überall festlich geschmückte Städte mit ebensolchen Einwohnern in Sonntagsgewändern sieht, die ihm zujubeln! Was für ein falsches Bild über das Arbeiterleben wird er gewinnen, weil er beim Besuch von Fabriken diese ebenso immer nur festlich geschmückt findet, den sonst schmutzigsten Saal sauber gescheuert, jedes Kellerloch mit Blumen tapeziert, die Arbeiter und Arbeiterinnen womöglich in Sonntagsgewändern.
Mir war es ja nicht viel anders gegangen, und was ich bisher erlebt hatte, hatte nicht eben viel geholfen, mir richtige Begriffe von der Welt beizubringen. Ich will nur eins erwähnen, es passt nicht ganz hierher, und dennoch ist es ein ganz treffendes Beispiel, wenigstens für den, der versteht, was ich meine: Jeder andere Mann des Volkes hätte sich bei diesem Knastergeruch unwillkürlich sofort in eine gemütliche Großvaterstube versetzt gefühlt. Aber was wusste ich von so etwas? In meiner Seele konnte dieser Geruch nur das Bild einer Kasernenstube auslösen.
Ja, auch ich hatte schon etwas von reisenden Handwerksburschen gehört — märchenhaft — so wie die Großmutter den Kindern vom Prinzen erzählt, der unbedingt Trikothosen und einen Purpurmantel mit Hermelin und ein Federbarett haben muss.
Ehe ich zu einer Antwort kam, hatte das Männchen den Hut schon wieder zurückgezogen und ihn sich über die Zipfelmütze gestülpt.
»Ä, Sie ham wohl selwer nich viel«, meinte er mit seinem vergnüglichen Schmunzeln. »Entschuldigen Se gietigst, wenn ich Se angefochten hawe. Awwer ä Landser sin Se doch, gelle he?«
Ich hatte meine Reflexionen beendet, beschloss, dieses Männchen, das schon wieder seine dampfende Großvaterpfeife zwischen den Zähnen hatte, näher zu sondieren. Dabei konnte ich wohl viel lernen, hatte ich doch schon mehrere mir ganz fremde Worte gehört.
»Ein Landser?«
»Ä Landsmann, sagen die feinen Leute. Na, ich weeß schon, Sie schbrechen auch Deutsch.«
»Das wohl, aber ich bin ein Korse«, beharrte ich bei dem, was mir mein Seefahrtsbuch und meine sonstigen unterdessen angesammelten Papiere vorschrieben, bei denen ich, wie ich mir überlegt hatte, vorläufig doch lieber noch bleiben wollte.
Immer vergnügt schmunzelnd, blinzelte mich das alte Kerlchen von unten an.
»Ä, machen Se mir doch nischt weiß. Ä Gorse? Aus Gorsiga? Sie sin doch ämsogut ä Deutscher wie ich, gelle he?«
»Nein, nein, ich bin ein geborener Korse.«
»Un was warn denn Ihre werten Eltern, wenn'ch mir die Frage erloom darf?«
»Das waren korsische Fischersleute.«
Es tat mir fast leid, dieses Männchen so belügen zu müssen, aber es ging nicht anders. Jetzt gab er sich damit auch zufrieden.
»Nu da. Ja, ja, der Mensch gann sich errn. Sogar ich. Na ja, Zwern un errn, das reimt sich ja ooch. Nu, wie heeßen Se denn da, wenn'ch mir gietigst die Frage erloom darf?«
»Napoleon Bonaporte Novacasa«, deklamierte ich gewohnheitsgemäß her.
»Napoleon Bonabarte? Heern Se, da ham Se awwer enn scheen Nam, den halten Se mal feste. Un ich heiße Baldewin Frettwurscht. Ooch ä feiner Name, gelle he?«
Ich brauchte mir nicht lange zu überlegen, wie ich mit diesem Männchen, das mich trotz seiner Missgestalt ungemein sympathisch berührte, nähere Bekanntschaft machen könne, es kam mir gleich von selbst entgegen.
»Darf ich Sie zum Friehschtick einladen. Ich wollte grade friehschticken, bloß noch diese Feife ausrauchen.«
»Wenn ich Sie nicht beraube?«
»Beraum? Was heeßt beraum? Was sin Sie denn von Beruf, wenn Se mir giestigst die Frage geschtatten?«
»Ich bin Seemann. Eigentlich Deckhand, bin aber zuletzt als Kohlenzieher gefahren.«
Bedächtig und immer vergnügt lächelnd blies der Alte die Wolken vor sich hin, zuletzt mächtig paffend.
»Gohlnzieher? Ja, ich weeß. Ich wäre ooch gern Seemann geworden, wirde noch jetzt ganz gern ämal den Gohlnzieher schbieln.«
Ich sah mir das Männchen an — vorn einen ganz stattlichen Schmerbauch und hinten einen mächtigen Ast — ich hätte doch bald laut aufgelacht.
»Na, da gomm Se. So ä Rentjee wie ich wird doch enn armen Gohlnzieher zum Frieschtick einladen genn.«
Was, nun wollte der arme reisende Handwerksbursche wieder ein Rentier sein? Na ja, in gewissem Sinne hatte er da auch ganz recht. Ich bemerke noch, dass er einen etwas ärmlichen Eindruck machte. Sein Anzug aus grauschwarzem Lodenstoff war sauber, aber äußerst abgetragen, überall geflickt und gestopft, wenn auch so geschickt, dass man diese Reparaturen kaum erkannte, nur, wenn sie andersfarbig waren. Seine für die Ewigkeit berechneten Rosslederschuhe zeigten dicke Nägel und Eisen.
Ja, man hätte diesem Fechtbruder ganz gern etwas gegeben, er schien es nötig zu haben. Wenn nur der Schmerbauch nicht gewesen wäre. Und mit der langen Pfeife durfte er natürlich auch nicht kommen.
Er hatte die Pfeife ausgegossen, wir brauchten nur um den Felsen herumzugehen, so sah ich den Frühstückstisch schon gedeckt. Wirklich gedeckt! Auf einem glatten Steine lag eine alte, geflickte, aber schneeweiße Serviette, die sogar ein mit roter Seide wunderschön gesticktes Monogramm von den Buchstaben B F trug, und darauf lagen ein ansehnliches Stück Speck und ein großes Weißbrot, standen eine Flasche Rotwein und ein Zinnbecher.
Meister Frettwurst hatte seine ausgerauchte Pfeife an den Felsen gelehnt.
»Na, da gomm Se. Da is ooch ä Sitzfleckchen fier Sie, glei aus'n Boden gewachsen. Ja, wie der liewe Gott doch alles so scheen fier uns vorgerichtet hat. Alles, alles nur fier uns. Awwer wir missen aus een Becher trinken. Un Messer un Gabel gann'ch Ihnen ooch nich anbieten. Se ham doch ä eignes bei sich?«
Ja, das hatte ich, und was für eine Klinge! Das war aber auch so ziemlich das einzige, was ich in meinen Taschen Bemerkenswertes besaß.
Während sich Meister Frettwurst auf einen abgeplatteten Stein mir gegenüber niederließ, schien es mir, als ob er meinen Nickfänger mit einigem Misstrauen betrachte, dabei aber immer noch liebenswürdig lächelnd.
»Heern Se — nischt fier ungut — awwer enn Teller gann ich Ihnen ooch nich anbieten.«
»O, das hat doch gar nichts zu sagen...«
»Ich meene nur so — Se nehmen's mir doch nich iewel, wenn ich Sie drauf aufmerksam mache — dieses Dischduch is Sie nämlich ä deires Andenken von meiner Seligen — dass Sie mir nämlich nich neinschneiden — Sie nähm mir meine Offenheit doch nich iewel, gelle he?«
»Ganz im Gegenteil, ich liebe solche Offenheit«, lachte ich. »Nein, nein, haben Sie keine Bange, ich werde nicht hineinschneiden.«
Wir konnten loslegen. Aber erst betrachtete Meister Frettwurst noch aufmerksam den Tisch, den Speck und das Brot.
»Dreie — viere — fünfe... nu, da habb'ch ja noch enne ganze Bande zu Gaste!«
Er meinte einige Ameisen, die schon das Frühstück gewittert hatten, auf dem Speck und dem Brot herumkrochen.
Ich wollte ihm behilflich sein, die Insekten zu entfernen, schnippste die eine Ameise weg, eine andere zermürbte ich zwischen den Fingern — da hielt er schnell meine Hand fest.
»Nee nee«, sagte er ernst, obgleich immer noch so gemütlich, jetzt nur mehr bittend, »warum denn alles glei dodmachen? I, diese Dierchen wolln doch ooch läm. Se ham uns ja ooch nischt gedan! Un iewerhaupt, mir sin doch ooch weiter nischt. Hier, gommt, da habt'r ooch was.«
So redend, hatte er von dem Speck ein Stück Schwarte abgeschnitten, fegte die übrigen Ameisen darauf und setzte sie so an den Erdboden.
Und nicht etwa, dass ich darüber lachte! Es machte im Gegenteil einen ganz gewaltigen Eindruck auf mich. Ich bin so geartet, der Leser muss mich überhaupt noch näher kennen lernen.
Dieses Männchen übertraf ja noch jeden Buddhisten an Tierfreundlichkeit, und ich sollte auch sonst in ihm noch einen Philosophen kennen lernen, wie ich ihn von solch gesunder Weisheit noch in keinem Buche gefunden habe.
Wir ließen uns Speck und Brot schmecken, tranken gemeinschaftlich aus dem Zinnbecher den kalifornischen Rotwein.
»Also ä Gorse. Awwer Sie schprechen ä recht gutes Deitsch.«
»Ich bin viel mit Deutschen gefahren«, lächelte ich. Denn lächeln musste ich diesem Manne gegenüber immer.
»So so. Un was meen Se, wo ich herschdamme? Nadierlich aus Deitschland. Aber woher da, gelle he?«
»Sicher aus Sachsen.«
»Woher merken Se denn das?«
»Auch mit einem Sachsen bin ich längere Zeit zusammen gefahren.«
»Richtg — aus'n Vogtland, so bei Reichenbach herum.«
Aha, daher das ›gelle he‹! Ich hatte diesen fragenden Ausdruck, etwa einem ›nicht wahr‹ entsprechend, öfter von einem Soldaten gehört, der ebenfalls aus dem Vogtlande stammte.
»Ja, da bin'ch geboren un hawe ich ooch gelernt. Awer de greeßte Zeit meines Läwens hawe ich in Schande zugebracht.«
»In Schande?«, fragte ich verwundert.
»In Schande — an dr Elwe — hinter Dräsn.«
»Ach so — Schandau!«
»Jawohl, Schandau. Awer so heeßt's nur in Sommer. In Winter heeßt's Schande.«
»Wie meinen Sie das?«
»Nu, ganz eefach. Wenn Se Schande oder vielmehr Schandau genn, dann wissen Se doch ooch, dass das a feiner Badeort oder Gurort is, wo lauter feine Herrschaften hingomm, zumal Engländer un Amerikaner un Russen un so. Awwer bloß in Sommer. In Winter is alles dod. Da gnaubeln de Bärger derweile an Hungertuche. Sähn Se, un wenn nu de Eisenbahn von Dräsn gommt, in Sommer, da rufen de Schaffner: ›Schandauuuu — bitte, aussteigen, meine Herrschaften, bitte sehr, Schandauuuu — — — — awwer in Winter, wenn de zweete Glasse gar nich erscht uffgemacht zu wärn braucht, da brilln de Schaffner: ›Schande!!! Alles raus!!! Schande!!!‹«
Ich musste herzlich lachen. Abgesehen von dem sächsischen Dialekt lag es in der ganzen Vortragsweise. Das war ein geborener Schauspieler.
Überhaupt, mir fiel an dem Männchen, je länger ich es betrachtete, manches auf. Bucklige haben doch immer ihre eigene Physiognomie. Blasse, schmale, hagere Gesichter, sie sind engbrüstig — die physische Unvollkommenheit drückt sich in allem und jedem aus. Dieses runde Gesicht hier aber blühte, wenn es auch schon viele Fältchen hatte, wie ein rotwangiger Pfirsich, aus den blauen Augen leuchtete überschüssige Lebenskraft, von Engbrüstigkeit gar keine Rede, vielmehr recht breite Schultern, die Hände fleischig, und überhaupt hatte ich noch keinen Buckligen mit einem Bauche gesehen.
»Sie sind wirklich ein reisender Handwerksbursche?«
Ich will seinen sächsischen Dialekt nur wiedergeben, wenn es besonders angebracht ist.
»Ein echter, rechter Fechtbruder. Sie wollen über mich mehr hören? Da muss ich wohl erst mit meinem Namen beginnen. Haben Sie den Namen Frettwurst schon einmal gehört?«
»Mir ist so.«
»Ach was! Wo denn?«
»Ich glaube, einmal einen Kapitän kennen gelernt zu haben, der auch Frettwurst hieß.«
»Wissen Sie, woher der war?«
»Ich glaube, aus Kiel.«
»Schtimmt. In Kiel gibt's eine ganze Menge Frettwärschte. Lauter Kapitäns, oder doch Seeleute. Das ist alles eine Familie, wenn sie sich auch gar nicht mehr verwandt fühlen. Da ist einmal ein Kapitän gewesen, vor einigen hundert Jahren, zu einer Zeit, als man noch gar nicht solche Namen hatte, als diese erst gegeben wurden, nach Eigenschaften oder sonst bei Gelegenheiten, als die Schulzens und die Müllers entstanden — da war also ein Kapitän, ein alter Seebär, der de Wärschte über alles liebte, der auf einen Sitz gleich ein paar Pfund Wärschte auffressen konnte. Na, da wurde er eben der Kapitän Frettwurscht, das ist der Ahne und Gründer aller dieser Frettwärschte. Und von diesem stamme auch ich. Mein Großvater wusste das alles noch ganz genau zu erzählen. Wie der nach dem Vogtland gekommen ist, weiß ich aber nicht. Un was meen Se denn, was ich bin, gelle he?«
»Sie haben eine Profession gelernt?«
»Schneider. Ich war vierzig Jahre lang Schneidermeister. In Schande. Mein Vater war Schneidermeister — das heißt nur so'n Flickschneider, in Reichenbach — ich musste's auch werden. Wurde gar nicht weiter deshalb gefragt. Habe vier Lehrjahre bei ihm abgemacht. Mein Vater war als Handwerksbursche weit herumgekommen, hatte die ganze Welt bereist, zehn Jahre lang — oder doch ganz Europa, war bis nach Madrid und bis nach Petersburg gekommen, immer zu Fuß. Da erzählte er nun von seinen Abenteuern, wenn wir so von früh bis spät in die Nacht hinein auf unserem Tische hockten. Er erzählte mit Stolz, mit liebevoller Erinnerung, und dabei dennoch mit der Absicht, mir die Reiselust zu verleiden. Der regelmäßige Schluss war: ›Dass du mir nicht etwa auch so'n lausiger Walzbruder wirst, Baldewin.‹ Na, wie solche Erzählungen bei mir wirken mussten, können Sie sich denken. Lasst mich nur erst mein Gesellenstück machen, dachte ich. Ach, wenn so die Frühlingssonne in die dumpfe Stube schlüpfte, wie sehnte sich da mein junges Herz in die weite Welt hinaus!
Meine zweite heiße Sehnsucht, die mich ständig erfüllte, war eine lange Pfeife. Wenn sich mein Vater ein Ruhestündchen gönnte, setzte er sich in den Großvaterstuhl und rauchte eine lange Pfeife, und der Großvater brachte sie überhaupt nicht aus'n Maule, solange er lebte. Aber auch hieran knüpfte mein etwas kurioser Vater seine Ermahnungen. Ich sollte mir dieses Laster nicht erst angewöhnen. Und ich wurde gar streng erzogen. Als ich einmal geraucht hatte, und der Vater roch's, da gab's die jämmerlichste Keile. Na, lasst mich nur erst Geselle sein, dachte ich, dann setze ich mich auch in den Großvaterstuhl und rauche meine lange Pfeife. Oder lieber auf die Walze gehen? Da kann man aber doch nur eine kurze Pfeife rauchen. Und mein Ideal war eine lange. Lang musste sie unbedingt sein. Zwischen diesen beiden Idealen habe ich meine ganze Jugend verbracht, zwischen der langen Pfeife und der Walze.
Im vierten Jahre meiner Lehrzeit siedelten wir nach Schande über. Mein Vater hatte für einen Freund gebürgt, musste mit seinen paar Ersparnissen dort ein Haus übernehmen, um nicht alles zu verlieren, war dabei grimmig hereingefallen. Bald darauf starb er, wohl vor Kummer. Der Großvater war schon vorher abgefahren. Ich hatte mein Gesellenstück gemacht, aber weder aus der langen Pfeife noch aus der Wanderschaft wurde etwas. Ich hatte eine alte Mutter zu ernähren, und ich hatte mir schnell ausgerechnet, dass ich, wenn ich die Flickschneiderei auf eigene Rechnung betrieb, mehr verdiente, als wenn ich als Geselle ging. So blieb ich zu Hause. Und meine alte Mutter war sehr brustkrank geworden. Da durft'ch nicht rauchen. Und Zeit zum Ausgehen hatte ich nicht etwa.
Das ging noch fünf Jahre so fort. Ich war dreiundzwanzig, als die Mutter starb. So, nun hätte ich mir die lange Pfeife anbrennen können. Oder aber: auf die Wanderschaft gehen. Aber da kam etwas anderes dazwischen. Die Liebe! Ich hatte schon lange ein Mädchen gern. Sie war hübsch und hatte außerdem noch 10 000 Taler. Teufel noch einmal, soll man sich so etwas entgehen lassen! Nein, da hing ich doch lieber die Wanderschaft an den Nagel, blieb bei meinem ersten Ideal, bei der langen Pfeife, die konnte ich mir ja nun anbrennen, tat es auch.
Aber was meinen Sie? Kaum haben wir beide ja und der Pastor Amen gesagt, da zieht mir meine Frau die Hosen aus und zieht sie sich selber an. Verstehen Sie? Meine Amalie war so ein sanftes, sogar schüchternes Mädchen gewesen, aber kaum war sie meine Frau geworden, da merkte ich, dass ich die leibhaftige Teufelin geheiratet hatte. Das erste war, dass sie mir die lange Pfeife aus der Hand nahm. Hier wird nicht geraucht — basta! Sie lachen...«
»Bitte sehr, ich habe nicht einmal das geringste Lächeln gehabt«, verteidigte ich mich.
»Sehen Sie, ich bin nicht etwa ein schlapper Hanswurst, aber was tut man nicht um des lieben Friedens halber! Es gibt Frauen, gegen die einfach gar nicht anzukommen ist...«
»Ich weiß, ich weiß.«
»Sie sind wohl auch verheiratet?«
»Gewesen.«
»Glücklich?«
»Nein, ich werde wohl eine ebensolche Furie gehabt haben wie Sie.«
»Hatten Sie? Das erzählen Sie mir später einmal. Nein, eine Furie war meine Amalie eigentlich nicht. Aber sie wäre es sofort geworden, wenn ich nicht nachgegeben, mich auf die Hinterbeine gestellt hätte. Ich hab's ja probiert. Da war der Skandal fertig. Und sollte etwa unsere ganze Ehe ein Höllenleben werden? Nein, der Klügste gibt nach. Oder nennen Sie mich meinetwegen auch einen Pantoffelhelden. Kurz und gut, ich musste auch die lange Pfeife wieder an den Nagel hängen.
So haben wir achtunddreißig lange Jahre ein erträgliches Leben mit- oder nebeneinander geführt. Bis meine Alte starb. Vor drei Jahren. Kinder waren unserer Ehe nicht entsprungen. Glücklicherweise nicht. Sonst wäre ich immer wieder gefesselt gewesen. Denn meine Ideale waren unterdessen nicht schwächer geworden. Ich träumte noch immer von der Wanderschaft und von der langen Pfeife. Ja, ich bin ein närrischer Kauz. Anderseits wusste ich dennoch immer, was ich wollte. Ich habe eben warten gelernt. Und als meine Alte nun begraben war, da ging ich mit der langen Pfeife auf die Wanderschaft. Seit drei Jahren bin ich nun schon auf der Walze — als Fechtbruder — jetzt sehen Sie mich hier — und Sie sehen einen glücklichen Menschen.«
Ich konnte nur staunen. Ja, in dem, was ich da zu hören bekommen hatte, lag wirklich etwas Staunenswertes. Jedenfalls ein ganz, ganz seltsamer Charakter, dem man so leicht nicht wieder begegnet.
»Wie alt sind Sie denn da jetzt?«
»Vierundsechzig.«
»Was?«
»Na ja, rechnen Sie sich's doch aus, nach dem, was ich Ihnen vorhin erzählt habe.«
»Ich hätte Sie höchstens für vierzig gehalten — na, ich will fünfzig sagen.«
»Ja, ja, das macht die gute Haltung, und dass ich mich hielt, dafür hat schon meine Amalie gesorgt. Sonntags drei Glas Braunbier — weiter gab's nischt. Aber dann vor allen Dingen, mein lieber junger Freund, das Herz — das Herz macht die ganze Geschichte!«
Ja, sein kindlich gebliebenes Herz leuchtete ihm ja aus den Augen!
»Wo haben Sie sich nun da überall herumgetrieben?«
»In der Schweiz, bin durch ganz Italien und Frankreich gewandert, zwei Jahre lang. Von Marseille fuhr ich nach Amerika, nach New Orleans.«
»Und dann weiter?«
»Na, von New Orleans eben bis hierher. Durch ganz Louisiana, Texas, NeuMexiko und Arizona bis hierher, wo ich jetzt sitze.«
»Und das alles zu Fuß?«
»Wie denn sonst? Habe ja auch ziemlich ein Jahr dazu gebraucht.«
»Sie haben unterwegs manchmal gearbeitet?«
»I wo, werde ich! Ich habe in meinem Leben genug gearbeitet.«
»Ach so. Sie haben ja auch Vermögen. Nicht wahr?«
»Jawohl. 10 000 Taler. Wenn die Steuern und so weiter abgezogen sind, bleiben mir von den Zinsen gerade noch 365 Taler, pro Tag kann ich genau einen Taler verfressen. Ich habe auch Kreditbriefe mit, habe aber noch keinen Pfennig aufzunehmen brauchen.«
»Sie haben immer nur von der Gastfreundschaft gelebt?«
»Hier in Amerika, ja. Aber in Europa gibt es so etwas nicht. Ja, Gastfreundschaft auf der Polizeiwache oder im Spritzenhaus. Habe auch drin gesessen, gehört alles mit dazu.«
»Sie haben immer gebettelt — oder gefochten, wie Sie es nennen?«
»Immer. Das heißt, so richtig Klinkenputzen tu ich nicht. Nur bei Gelegenheit, mehr zum Spaß. Sonst weiß ich mein Geld auf andere Weise zu verdienen. Und zwar einen ganzen Haufen Geld — wenn nur Häuser und Leute da sind.«
»Wie verdienen Sie denn das Geld?«
»Nu, ich bin ähm ä musigalscher Handwerksbursche.«
»Ein musikalischer? Sie machen Musik?«
»Jawohl.«
»Womit denn?«
»Nu, mit mein Bauche.«
»Sie machen mit Ihrem Bauche Musik?«, lachte ich. »Wie fangen Sie denn das an?«
»Nu, ganz eefach so!«
Das Männchen stand auf, griff hinter sich, hatte plötzlich eine Kurbel in der Hand, steckte sie seitwärts, links, in seinen Bauch hinein, knöpfte auf der anderen einen Lappen ab, den ich für eine Taschenklappe gehalten, eine Klaviatur von zahlreichen weißen Knöpfen zeigte sich, links fing er an zu leiern, rechts fingerte er auf den Knöpfen herum, und... ›Ich weiß nicht, was soll es bedeuten‹, erklang es in den schönsten Orgeltönen aus dem Schmerbauche heraus, und nachdem dieses Leiblied der Deutschen beendet war, kam der Radetzkymarsch daran, und sogar Trommeln, Pauken und Posaunen hatte Herr Balduin Frettwurst in seinem Bauche.
Na, wie ich staunte, kann man sich denken. Dann bekam ich eine nähere Erklärung. Es war eine Drehharmonika, ein Instrument, welches man jetzt nicht mehr häufig findet, höchstens noch in Böhmen, bei ganz alten Bettelmusikanten. Es ist ein Mittelding zwischen Ziehharmonika und Leierkasten. Der Ton wird durch gepresste Luft erzeugt, ebenso wie beim Leierkasten, es hat wie dieser Orgelpfeifen, aber keine Walzen, sondern die Klappen werden wie bei der Ziehharmonika nach Willkür mit den Fingern geöffnet.
Der ingeniöse Schneidermeister hatte sich solch ein Instrument in Böhmen, an dessen Grenze er ja gewohnt hatte, vor Antritt seiner Wanderschaft gekauft, hatte Verbesserungen getroffen, trug den nicht sehr umfangreichen Leierkasten so, dass man glaubte, er habe einen stattlichen Schmerbauch.
Ja, es war wirklich eine ganz ingeniöse Idee. Wenn nicht schon damals, so habe ich doch später erkannt, dass ein Handwerksbursche oder sonst ein Globetrotter, auf gut deutsch Stromer und Vagabund, der die Arbeit scheut, der aber schließlich für seine Wanderlust nichts kann — dass ein solcher durch die ganze Welt kommt, ohne Not zu leiden, ohne auf direktes Betteln angewiesen zu sein, vielmehr überall als Gast wirklich hochwillkommen, wenn er irgendein Instrument bei sich hat und es spielen kann, sei es eine Flöte, eine Violine oder eine Ziehharmonika. Schon in allen Kulturländern wird er sich immer durchhelfen können, auf jedem Dorfe ist er willkommen, und je weiter er sich von der Kultur entfernt, desto freudiger wird der Spielmann empfangen, von den Beduinen der Wüste Sahara sowohl wie von den Feuerländern und den Eskimos.
Ich spreche aus Erfahrung. Ich kenne überhaupt noch viele Mittel, wie man sich ohne Geld durch die Welt schlagen kann, und zwar recht gut und angenehm — wenn man Witterungsunbilden und andere Strapazen nicht in Betracht zieht — ohne betteln zu müssen — ich will die einfachsten Mittel lieber gar nicht nennen, um niemand zu verführen. Ich will hier nur bei der Musik bleiben, vielleicht noch die Zeichnerei hinzufügen. Denn wer gut zeichnen kann, etwa gar porträtieren, dem steht ebenfalls die ganze Welt offen, er braucht nur einen Bleistift bei sich zu haben, nicht einmal den, er lässt ein Stück Holz verkohlen und malt an die Felswand, und überall wird er als Wundermann mit fürstlichen Ehren empfangen werden — und das umso mehr, je weiter er sich von der Kultur entfernt.
»Was meinen Sie denn, was ich damit verdient habe? So lange ich in der Schweiz, in Italien und Frankreich reiste, bin ich immer auf zehn Francs am Tage gekommen, und das im Durchschnitt gerechnet. Denn es gab ja auch genug Tage, wo ich keinen Sou bekam, weil eben keine Häuser oder keine Menschen da waren, ich bin doch selbst in Frankreich tagelang gewandert und habe kaum einen Hirten getroffen. Dafür kam es dann wieder. Ich konnte manchen Abend meine vierzig und sogar fünfzig Francs zählen, und das in wenigen Stunden eingesammelt. Ach was, eingesammelt! Mir zugeworfen, in die Taschen gesteckt wurden mir die Kupfer- und Silbermünzen, ich brauchte nur an meinem Bauche herumzuleiern.«
»Das glaube ich wohl, da müssen Sie wohl als armer reisender Handwerksbursche ein angenehmes Leben geführt haben«, lächelte ich.
»Ja, und ich brauchte mir nicht einmal etwas zu kaufen. Überall Gastfreundschaft. In größeren Städten habe ich mich freilich niemals länger aufgehalten, als um die Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Da wurde nicht musiziert. So einer bin ich nicht. Aber draußen auf dem Dorfe, ach, wie die sich freuten, wenn mein Bauch zu jodeln anfing! Des Abends wurde regelmäßig dazu getanzt, und jeder wollte die Ehre haben, mich bewirten zu dürfen, und dann natürlich immer mit dem Allerbesten, wie ich auch immer das weichste Bett oder den wärmsten Platz auf der Ofenbank bekam.«
»Was haben Sie denn da mit dem Gelde gemacht, wenn ich fragen darf? Nach Hause geschickt?«
»I wo! An wen denn? Ich habe kein Zuhause mehr, kein Kind und keine Katze, weiß keinen Verwandten, den ich zum Erben einsetzen möchte. Und wenn ich einmal nicht mehr kann — na, für mich ist ja gesorgt. Dann kann ich als Rentier noch immer gemütlich meinen Erinnerungen leben.«
»Ja, wie haben Sie denn da das eingenommene Geld verwertet?«
»Nu, da braucht man keine Sorge zu haben, wenn man das los sein will. Von einem Tag zum anderen behielt ich's niemals in der Hosentasche. Ich traf noch jeden Tag ein Haus, eine Hütte und darin einen Menschen, der es noch viel nötiger hatte als ich, dem der hungrige Magen nicht mit den besten Bissen vollgepfropft wurde, ohne dass er darum zu bitten brauchte — ach, ich habe manchen glücklichen Menschen gemacht — Hunderte — na ja, in drei Jahren!«
So sprach der fahrende, bettelnde Bauchmusikant. Und jetzt könnte ich wieder von den Tierchen sprechen, von denen jedes seinen nützlichen Zweck hat. Ich will es nicht. Damals drückte ich dem Männchen nur die Hand.
»Na, was wolln Se denn? Ich konnte das Geld doch gar nicht vertun, ich hatte ja alles, was ich brauchte, und wie gesagt, für wen soll ich denn sparen...«
»Schon gut, schon gut, Sie brauchen nicht noch nach einer Entschuldigung für Ihre edle Herzensgüte zu suchen. Und wie ist es Ihnen denn hier in Amerika ergangen?«
Ganz genau so war es gewesen, nur dass er größere Strecken zu durchwandern gehabt hatte, ehe er wieder einmal zu Menschen kam, denen er aus seinem Bauche heraus Musik vorleiern konnte.
»Nu, wie ich aber erscht hier aufgenommenen worden bin! Wie die staunten, wenn ich denen vorzuspielen begann, die manchmal überhaupt noch nicht wussten, was Musik ist! Da waren einmal solche Gau — Gau — Gau... na, wie heißen die Gerls, die zu Pferde sitzen und die Rinder hüten und egal schießen, wenn sie nicht besoffen sind?«
»Sie meinen wohl Cowboys.«
»Jawohl, Gaubeus. Ich denke doch, die werden ganz rapplig vor Freuden. Nu, da habe ich aber erst bekommen! Wenn se kein Geld hatten, was mehrschenteels der Fall war, dann warfen se mir alles andere zu, was sie hatten. Der eine schnallte doch gleich seinen...«
Das Männchen griff wieder hinter sich und hatte plötzlich einen riesigen, silbernen Sporn in der Hand, der ziemlich ein Pfund schwer sein mochte.
»Solches Zeig warfen se mir direktemang an den Gobb. Den Sporn will ich doch einmal zum Andenken mitnehmen. Ich hab mir'n auch ganz ehrlich verdient. Reichlich achzehn Stunden sind die Gerls herumgehobst, haben getanzt, freilich ohne Mächens, nur mit sich selber, un achzehn geschlagene Stunden lang habe ich an meinem Bauche herumleiern und herumfingern müssen.«
Ja, das konnte ich mir lebhaft vorstellen, für Cowboys, Holzfäller, Goldgräber und dergleichen weltverlassene Einsiedler musste solch ein lustiger Musikante etwas sein.
»Nur diesen einen Silbersporn haben Sie für die achtzehn Stunden bekommen?«
»O nee, was meinen Sie! Goldknebbe ham se mir an dn Gobb geworfen — ja ja, die trugen richtge Knöpfe aus richtgem Golde — die ham se einfach abgeschnitten und mir geschenkt — einige aber hatten ja auch wirkliches Geld — die stülpten einfach die Hosentaschen um, und was drin war, das bekam ich — und bei wem nischt rausfiel, der schenkte mir was anderes, sogar Messer und Pistolen, und da waren welche dabei, die mit Silber und sogar mit Gold beschlagen waren...«
»Ja ja, ich weiß schon. Und was haben Sie mit den Schätzen gemacht?«
»Mit dem Zeige? Das hab'ch nach der nächsten Stadt gebuckelt und dorten verkooft. Mag ja dabei mächtig übers Ohr gehauen worden sein, aber's war doch ein ganz hübscher Feng Geld.«
Dass er diesen ›hübschen Feng Geld‹ wieder unter die Armen verteilt hatte, erwähnte er gar nicht erst.
»Sind Sie auch mit Goldgräbern zusammengekommen?«
»Nee, das ähm nich. Die hoff'ch erscht hier in Kalifornien zu finden, und da bin'ch doch sehr geschbannt, weil'ch Gerstäckern und Bret Harte gelesen habe.«
»Haben Sie sonst recht viele Abenteuer erlebt?«
Nein, eben gar keine. Das war fast wunderbar. Man bedenke die Strecke, von New Orleans bis nach Kalifornien, das sind vierhundert geografische Meilen, gerade den wildesten Teil des wilden Westens durchquerend. Aber der Marsch des lustigen Musikanten war wie ein Spaziergang gewesen. Nicht nur, dass er überall mit offenen Armen aufgenommen worden war, sondern die Natur selbst schien mit ihm im Bunde gewesen zu sein. Er hatte tagelang Wüsten durchwandert, welche von den einheimischen, berittenen Indianern wegen ihres Wassermangels zu jeder Jahreszeit gefürchtet werden, er aber hatte niemals Durst gelitten, hatte immer noch rechtzeitig eine Quelle oder einen wasserhaltigen Kaktus oder einen Reisenden mit gefülltem Wasserschlauch gefunden, der ihn willig hatte trinken lassen, und wie Orpheus hatte er mit seinem Instrument geradezu eine geheimnisvolle Macht auf die wilden Tiere ausüben müssen, auf die vier- wie auf die zweibeinigen.
»Sind Sie denn niemals angefallen worden?«
»Nee, geen eenzges Mal. Ich hawwe mir das alles ganz andersch vorgeschtellt.«
Er selbst war nämlich gar nicht damit zufrieden, dass alles immer so harmlos abgelaufen, dass ihm überhaupt gar kein Abenteuer in den Weg gekommen war. Denn das alte Männchen war noch immer recht abenteuerlustig.
»Ob's vielleicht daher kommt, dass die immer denken, dass'ch enn Buckel hawe, und dass se da Mitleid mit mir hamm? Ich habe iewerhaubt schon öftersch daran gedacht, dass das mit mein Buckel doch eegentlich enne Sinde is, obschon ich'n ja gar nich desderwegen hawe.«
Ich stutzte — ich hatte etwas herausgehört.
»Wie? Sie haben gar keinen... Buckel?!«
»Ich? I wo! Ich bin schlankgewachsen wie ä Abbollo. Das ist bloß mein Felleisen, das ich uff'n Rücken habe, un ich trage ähm die Jacke drüber, die'ch mir desderwegen so weit gemacht hawe.«
Ja, nun war das Rätsel gelöst, weswegen das kleine Männchen so wenig die Physiognomie und das sonstige Aussehen eines Buckligen hatte!
»Und wie gesagt«, fuhr er fort, »nich etwa, dass ich's so machen will wie andre Bettler un solche Lumiche, die sich ginstlich zum Gribbel machen, oder so tun, als wenn se's wären, sich ä Been hochschniern un uff'n Schtelzfuß rumloofen — nee, ach nee, der liewe Gott soll mich bewahren, dass'ch solch enne Sinde begehn däde. Nee, ich hawe den Buckel aus'n ganz andern Grunde. Awwer... 's is schwer blausibel zu machen, ich weeß nich, ob Se mich verschtehn wärn. Sehn Se, ich bin iewerhaubt ä gurioser Gauz. Ich bin so ä alter Diftelbruder, der immer seine eegnen Gedanken hat. Sehn Se, wenn'ch so uff mei Schneidertisch hockte, mit gekreizten Been, un draußen schien so scheene de Sonne, und ich dachte an meine Wanderschaft, aus der nischt geworden war un ooch nischt wärn sollte — sehn Se, da bildete ich mir schteif un fest ein, ich hätte iewerhaubt geene Beene mehr — da bildete ich mir ein, ich wäre erscht neilich aus'n Fenster geschtärzt, drei Etagen hoch, oder ooch viere, un da hätt'ch beede Beene gebrochen, un se hätten mir wegambudiert wärn müssen — un sehn Se, das is doch immer noch besser, als wenn'ch glei dn ganzen Hals gebrochen hätte — un ich bin nu ähm so ä gurioser Gauz, das alles gonnt'ch mir so lebhaft einbilden, dass'ch sogar den liewen Gott dankte, dass'ch iewerhaupt noch lahm dad, wenn'ch ooch geene Beene mehr hatte. Un das macht'ch jeden Tag so, mindestens jeden Morgen, un immer wieder, wenn mir die scheene Sonne in meinen Herzen wehdun wollte, weil'ch nich naus gonnte — dann schtärzte ich mich in Gedanken immer wieder zum Fenster naus, drei Etagen hoch oder ooch viere, brach beede Beene un ließ se mir absägen — oder ließ se mir zur Abwechslung ooch ämal von än Lastwagen abfahrn — un dann gonnt'ch immer dn liewen Gott danken, dass'ch iewerhaupt nochlähm däde — awer freilich, ohne Beene gann mer doch nich draußen in dr Welt rumloofen — na, und sehn Se, uff diese eegendiemliche Weise bin ich iewer die ganzen värzg Jahre driewer nausgegomm, ohne dass'ch schwermiet'g wurde, dass'ch vielmehr mei junges Härze behalten hawe. Ich weeß nich, ob se mich verschtehn dun.«
O ja, ich verstand recht wohl. Und ich staunte!
Menschen, hat man schon einmal so etwas von praktischer Lebensweisheit gehört?!
Der schottische Philosoph Thomas Carlyle sagt in Bezug darauf, ob sich jemand glücklich oder unglücklich fühlt: Dummkopf, der Grund liegt einzig und allein in deiner Eitelkeit, in den Verdiensten, die du dir einbildest! Bilde dir ein, dass du verdienst, gehangen zu werden (was höchstwahrscheinlich der Fall ist), und du wirst es für ein Glück erachten, bloß erschossen zu werden. Bilde dir ein, dass du verdienst, an einem Haarseil aufgehängt zu werden, und es wird eine Wonne für dich sein, in Hanf zu sterben.
Mein kleiner Freund war ja aber noch gar nicht fertig.
»Un sehn Se, grade so war'sch mit mein Buckel und mit mein Bauch. Zuerst, als ich aufbrach, hatte ich den Leierkasten einfach vorn an einem Riemen hängen und auf dem Rücken mein Felleisen. Ich hatte von der ganzen Wanderei ja gar keine Erfahrung, keine Ahnung. Da hatte ich mir viel Nutzloses aufgepackt. Ich wollte möglichst behaglich leben, unterwegs nichts vermissen. Sie sehen's ja hier — sogar ein Tischtuch habe ich mitgenommen, um immer anständig zu essen. So schleppe ich noch manche mit. Dann vor allen Dingen kommt das viele Handwerkszeug hinzu, ich bin imstande, wenn mein Leierkasten einmal kaputt geht, ihn selber wieder zu reparieren.
Sehr bald wurde mir meine Last recht sauer, das schwere Felleisen sowohl wie der Leierkasten. Ich war schon nahe daran, mich bedeutend zu erleichtern, dachte sogar einmal daran, den großen Kasten abzuschaffen. Dann aber malte ich mir doch die Folgen aus. Wie würde ich es bereuen, auch nur das Geringste von alldem fortgegeben zu haben, was ich vorher so sorgfältig ausgewählt hatte!
Baldewin, sagt'ch mir da, bis klug, wenn der'sch ooch schwer fällt. Wenn dir der liewe Gott nu enn Bauch un enn Buckel gegähm hätte, gelle he? Gannst de enn Bauch un enn Buckel etwa ooch abschnalln und wegwerfen, gelle he? Nee, das gannst de nich. Na, un sehn Se, da habbsch mir enne andre Hose un enne Jacke gemacht, mei Leierkasten wurde unter die Hose geschteckt, un's Felleisen unter de Jacke. Ich bildete mir ein, vorne enn Bauch un hinten enn Buckel zu ham — un sehn Se, nu ging's mit eenmal, drei Jahre lang nu schon, un niemals wieder hawe ich geseifzt un geglagt — denn enn Bauch un enn Buckel, den der liewe Gott in seiner Giete hat wachsen lassen, gann mer doch nich abschnalln und wegschmeißen, gelle he?«
Ja, solch eine Weisheit konnte nur bewundert werden.
Unsere Mahlzeit war schon längst beendet, aber wir saßen noch immer auf dem idyllischen Fleckchen. Balduin Frettwurst hatte sich wieder seine lange Pfeife gestopft, wozu er nur hinter sich zu greifen brauchte, also in seinen falschen Buckel hinein, so hatte er Tabak in der Hand — es musste alles sehr praktisch eingerichtet sein — dampfte mächtig, widmete wieder einmal dem lieblichen Tale seine Aufmerksamkeit, das sich zu unseren Füßen ausbreitete.
»Nee, nee«, sagte er kopfschüttelnd, »is das awwer scheene! Wenn'ch en Fotografenabbarat hätte, das wärd'ch abfotografiern. Na, mei liewer Freind, wer sin Sie denn nu eegentlich?«
Ich war und blieb der korsische Matrose Napoleon Bonaparte Novacasa, der sich bis zum Kapitän emporgeschwungen hatte. Viel mehr brauchte ich nicht zu erzählen, Balduin Frettwurst wollte gar nichts weiter hören.
Mit listigem Blinzeln seiner freundlichen Augen hatte er den Anfang meiner Erzählung angehört.
»Ä, machen Se mir doch nischt vor«, unterbrach er mich sehr bald. »Sie sin doch ä Gawalier. Na ja, Sie meegen ja ä Seemann sin — meegen jetzt zuletzt als Gohlnzieher gefahren sin — ich gloowe alles — awwer so ä geweehnlicher Fischerschsohn aus Gorsiga sin Se nich. Na, lassen Se's nur gut sin, darinne bin ich ooch ä merkwirdger Gerl. Wenn Se Ihre Heemlichkeeten ham, dann solln Se se ooch fier sich behalten. Nichwahr, Sie ham Ihre Heemlichkeeten, gelle he?«
Was soll man gegen eine solche Offenheit tun? Da ist am besten, man ist selbst offen, und ich wollte es sein, allerdings in anderem Sinne — indem ich nämlich bejahte, dass ich meine Heimlichkeiten hätte.
»Na, da is es ja gut. Die Hauptsache is, dass Sie ä ehrlicher Gerl sin. Woher ich das weeß? Nu, weil ich's Ihnen ansehe. Ich ärre mich nämlich in geen Menschen. Un das habb'ch nich erscht uff dr Wanderschaft gelernt, das gonnt'ch schon uff mein Schneidertische. Das ist bei mir sozusagen enne Gabe. Also, Sie sin jetzt ohne Schtellung?«
Einen patenteren Menschen konnte man gar nicht finden! Es genügte ihm, dass ich mein Vorleben verschweigen wollte, ohne dass dem ein Verbrechen oder ein sonstiges Vergehen zu Grunde läge — und damit basta.
»Ja, ich habe heute abgemustert.«
»Und was wollen Sie denn nun anfangen?«
»Ich weiß es noch nicht.«
»Wie kommen Sie denn hierher?«
»Ich war nur etwas ins Freie gebummelt, von der schönen Frühlingssonne angelockt, die ich in den dunstigen Kohlenbunkern ja wenig genug zu sehen bekommen habe.«
»Un Geld ham Se wohl ooch nich viel?«
»Gerade acht Dollar habe ich in der Tasche«, lachte ich. »Das ist sehr wenig oder sehr viel, wie man's nimmt. Woher wollen Sie denn aber erkennen, dass ich in keiner gerade glänzenden pekuniären Lage bin? Ich habe doch einen ganz neuen Anzug an.«
»Ähm deshalb. Ich bin doch Schneider, habe mir doch auch schon ein bisschen die ameriganischen Schaufenster angesehen. Was ham Se denn fier den Anzug bezahlt? Zehn Dollarsch, gelle he?«
Der Preis stimmte ganz genau, und für zehn Dollar kann man in Amerika nicht viel von einem Anzuge verlangen. Es war der haltbarste, den ich in dem Konfektionsgeschäft für den billigen Preis hatte bekommen können.
»Er is Ihnen nämlich schon untern Ärmeln uffgeblatzt — un hinten guckt ooch schon's Hemde raus. Na, ich näh's Ihnen hernachens, un was Baldewin Frettwurscht flickt, das geht iewerhaubt nich wieder aus'n Leime. Da wolln Se nu wieder als Matrose oder Gohlnzieher gehen?«
Es blieb mir nicht viel anderes übrig — wenn ich nicht einen Posten als Steuermann bekommen konnte — an den eines Kapitäns war gar nicht zu denken.
»Hier in Santa Baccera?«
»Das wird wohl seine Schwierigkeiten haben. Ich muss froh sein, wenn ich in diesem Neste eine Gelegenheit finde, mich nach San Francisco rüberzuarbeiten.«
»Da will ich Ihnen einen Vorschlag machen.«
»Nun?«
»Gomm Se mit mir nach San Francisco — nadierlich ber bedes abostolorum — es sin ja bloß gleene sechzg oder sibbzg Meilen.«
Dabei sind aber deutsche oder geografische Meilen gemeint. Freilich, für den, der schon 400 hinter sich hatte, abgesehen von seiner Pilgerfahrt in Europa, war das nur eine Kleinigkeit.
»Sie brauchen nischt — absolut nischt. Ich fiddre Sie durch. Wissen Se, woran ich denke? Sehen Sie, ich habe noch keinen einzigen Freund gehabt, schon früher nicht, da hatte ich ja freilich auch gar keine Gelegenheit dazu, meine Alte hätte's gar nicht zugelassen — und wenn sich mir einer auf meiner Wanderschaft anschließen wollte — gab's nicht, ich wusste ihn immer abzuwimmeln. Ich bin nämlich einmal dabei grimmig reingefallen — will's gar nicht erzählen, nicht daran denken, 's ärgert mich, und ich mag mich nicht ärgern — und ich brauche auch nicht zweimal denselben Schaden zu erleiden, um klug zu werden. Aber ich bin gar kein solch einsamer Menschenhasser. Ich habe mir immer einen Gameraden gewünscht, mit dem ich zusammen schwatzen kann. Ich schwatze so gern. Wenn ich nur den Richtigen treffen täte! Und...«, Meister Frettwurst spuckte in seine Hand und schlug mir aufs Knie, dass es klatschte, »un ich gloowe, Sie sin der Richtige! Gomm Se mit mir, gelle he?«
Da brauchte es bei mir nicht viel Überlegung.
»Topp, ich komme mit!«
»Erscht mal bis nach San Francisco, dann wärn wir ja weiter sehen.«
»Na, das ist ja für den Anfang auch schon eine gute Strecke«, lachte ich.
»Un wenn's Ih'n gefällt, bromeniern mir so um de ganze Ärde. Ich orgle an mein Bauche rum und mache Musike, un Sie sammeln ein, un nadierlich wird dann briederlich gedeelt.«
»O, was das anbetrifft, darauf habe ich es nicht abgesehen...«
»Nu, das is doch ganz selbstverständlich, awwer dass Se das nich glei annehmen wolln, das zeigt wieder mal, dass sich Baldewin Frettwurscht in geen Menschen teischt. Sie sin ähm ä Gawalier. Un dann machen mir uns ooch ämal änn lustgen Tag. Denn ich fiehle mich nich etwa verpflichtet, immer den Armenvater zu schbieln. Ich hawe bloß niemals nich de geeignete Gesellschaft dazu gehabt Un dann, ich geschteh's ganz offen, is is ooch noch was andres dabei, warum ich Sie gern mitnehmen mechte. Nich etwa, dass ich mich färchten däde. Furcht gibt's bei Baldewin Frettwurschten nich. Nee, 's is was ganz andres. Sehn Se... schbrechen Sie Englisch?«
»So gut wie deutsch. Sie nicht?«
»Yes un no un Mixpickel of waterklosett un so, was'ch schon früher konnte, sonst weiter nischt.«
»Aber wo Sie sich schon ein Jahr lang im Englisch sprechenden Amerika aufhalten?«
»Ich bin ooch ä Jahr in Italjen un ä Jahr in Frankreich gewesen, un von Italienischen un Franzeeschen gann ich ooch nur gerade so's Allerneetgste, was mer braucht, um nich zu verhungern, un mit 'n Englischen geht's nu erscht recht nich...«
»Aber wie ist denn das möglich?«
»Nu ganz eefach, mer werd ähm immer älter, un da will solch fremdes Zeig nich mehr in den Gobb nein, wenn ich sonst ooch nich uff'n Gobb gefalln bin. Ich gann bloß Deitsch un Volapük...«
»Was, Sie können Volapük?!«, staunte ich.
»Ganz berfektemang.«
»Wie sind Sie denn dazu gekommen?«
»Nu, in meiner Jugend, da gam doch diese internationale Weltschbrache, wie man se nannte, grade uff, un sehn Se, ich trug mich immer mit dem Gedanken, ämal naus in de Welt zu machen, un da dacht'ch: De willst noch mal in der ganzen Welt rumbummeln, un eh de nu Englisch un Franzeesisch un Italienisch un Schbanisch lernst und sonst alle de Schbrachen, die se in dr ganzen Welt schbrechen, da lernst de eefach Volabüksch, dann verschteht dich jeder. Un da hab'ch ähm bei meiner Schneiderei Volabüksch gelernt. Ach ja, 'is enne ganz feine Schbrache, diese internationale Weltschbrache. Se hadd bloß een großen Fehler. Wissen Se welchen?«
»Und der wäre?«
»Dass se niemand gann. Sehn Se, da habb'ch nu mit greeßter Miehe enne internatzjonale Weltschbrache gelernt — un gee Luder gann se.«
Wiederum musste ich herzlich lachen.
Frettwurst goss und klopfte zum zweiten Male seine Pfeife aus.
»Ham Se viel Sachen in der Schtadt?«
»Alles, was ich besitze, trage ich bei mir«, zitierte ich des Bias, eines der sieben Weisen Griechenlands, Wahlspruch auf deutsch.
Ich besaß wirklich nicht einmal ein zweites Hemd. Was ich gehabt, mir unterwegs von Schiffskollegen verschafft hatte, war aufgebraucht worden, und ebenso hätte ich mch wieder auf einer zweiten Reise behelfen müssen.
»Da geht's Ihnen ja nich viel andersch als mir. Na, da gomm Se!«
Er warf die leere Flasche weg, ließ das Tischtuch mit dem Rest Speck und dem Becher hinter seinem Rücken verschwinden, nahm von der Pfeife Kopf, Hornstiefel und Mundstück ab, steckte diese Sachen gleichfalls in seinen künstlichen Buckel, schraubte dafür an das Weichselrohr eine Zwinge und einen Griff, und der Spazierstock war fertig.
Ich hatte mich also geirrt, wenn ich mir den musikalischen Handwerksburschen unterwegs immer mit der langen Großvaterpfeife in der Hand vorgestellt hatte.
Es war einige Minuten nach zehn, als wir aufbrachen. Ich selbst besaß keine Uhr mehr, wohl aber hatte mein Kamerad eine vorsintflutliche Zwiebel bei sich. Wir plauderten unausgesetzt. Er hatte ja selbst gesagt, dass er gern schwatze, sich hauptsächlich deshalb immer nach einem ›Gollegen‹ gesehnt habe. Wollte ich nun alles das wiedergeben, was wir während unseres Zusammenseins gesprochen haben, so würde daraus ein fünfzehnbändiges Konversationslexikon entstehen. Jedenfalls aber langweilte mich seine Schwätzerei durchaus nicht, im Gegenteil, ich hätte ihm mein ganzes Leben lang so zuhören können.
Nur die Chausseebäume hatten bald aufgehört, sonst war die gute Straße nach zwei Stunden noch genau dieselbe, ebenso die Gegend: links und rechts Gebirge, hier im ebenen Tal Wiesen und angebaute Felder, aber kein einziges Haus, keine Hütte, und auch begegnet war uns noch kein Mensch. Überholen konnten wir so leicht niemand, denn mein Begleiter behielt den Promenadenschritt bei, den er während seiner ganzen Wanderschaft angeschlagen hatte, und meine etwas längeren Beine mussten sich noch langsamer bewegen.
»Nun wollen wir uns aber bald nach einem Ruhefleckchen umsehen«, meinte Frettwurst, »ich bin gewohnt, von eins bis drei mein Mittagsnickerchen zu halten.«
Nichts war mir angenehmer zu hören als das. Die Mittagssonne brannte heiß, und für einen Menschen, der des Gehens ganz und gar ungewohnt geworden ist, haben zwei Stunden des langsamsten Promenierens schon etwas zu bedeuten. Ich war jetzt gewohnt, vier Stunden lang ununterbrochen mit gebücktem Rücken die schwerste Arbeit zu verrichten, dabei kohlengeschwängerte Luft zu atmen, aber wirklich, diese zwei Stunden Gehen hatten mich schon ganz bedeutend angegriffen. Dazu kam noch, dass mir durch das viele Sprechen die Kehle ganz trocken geworden war.
»Hier ist aber gar kein Haus zu sehen.«
»'s wird schon noch eens gomm. Oder mir lagern uns an enn Bache, das is mir iewerhaubt viel lieber.«
»Das sieht aber gar nicht danach aus, als ob hier ein Bach flösse.«
»Nu, das wäre doch das erschte Mal, dass ich mein Mittagsschläfchen nich an ennen Bache oder an enner Quelle abgehalten hätte.«
Frettwurst versicherte mir noch ausführlich, dass er während seiner Wanderung durch so ziemlich das ganze südliche Nordamerika, wozu er fast ein Jahr gebraucht, gegen Mittag noch immer an ein Wasser gekommen sei. Wenn ich mir die Gebiete vergegenwärtigte, die jener durchquert hatte, so schien mir das kaum glaublich, oder doch wunderbar. Denn an der Wahrheitsliebe dieses Mannes konnte ich durchaus nicht zweifeln.
»Haben Sie eine Karte bei sich?«
»Enne Garte? Heern Se, ich gann nur schwarzen Beter schbieln...«
»Ich meine eine Landkarte — eine Spezialkarte von dieser Gegend.«
»I wo, ich hawe niemals so enne Garte gehabt.«
»Haben Sie in Santa Baccera Erkundigungen über den Weg eingezogen?«
Nein, auch so etwas kannte Herr Balduin nicht. Immer ins Blaue hinein, nur nach der Himmelsrichtung gewandert — darin läge ja eben der größte Reiz des Vagabundenlebens, wie er mir ausführlich auseinandersetzte.
Darin mochte er ja ganz recht haben — gegenwärtig war es mir aber doch sehr unangenehm.
Eine halbe Stunde verging. Vor uns die weiße Landstraße, links und rechts Wiesen und Wälder, weiter hinten, von uns reichlich je drei Meilen entfernt, die beiden Gebirgszüge, sonst nichts.
»Heern Se, ich hawe rechten Durscht«, fing da mein Begleiter an.
»Ja, ich schon längst. Führen Sie kein Wasser mit sich?«
»Eegentlich ja — früher hatt'ch immer enne Gorbflasche mit Wasser.«
»Warum jetzt nicht mehr?«
»Weil Se mir neilich gabutt gebrochen is. Un iewerhaubt, ich hawe se ja niemals nich gebraucht.«
»Wir hätten uns in Santa Baccera besser ausrüsten sollen.«
»Awer wozu denn nur? Wo mir jetzt hier in Galifornien sin, wo doch schon alles gultiviert is?«
Das Männchen hatte durch sein fabelhaftes Glück, das ihm überallhin gefolgt war, eine so falsche Vorstellung von der Welt bekommen, dass mit ihm hierüber gar nicht zu diskutieren war.
Nach einer weiteren halben Stunde, als mir schon die Zunge zum Halse heraushing, sagte ich:
»Wäre es nicht besser, wenn wir nach Santa Baccera zurückwanderten?«
»Weshalb denne?«
»Wir könnten hier mitten in Ihrer gepriesenen Kultur auf der bestchaussierten Landstraße verschmachten.«
Er wollte es nicht glauben — hielt nicht für möglich, dass er einmal zur rechten Zeit kein Haus oder kein Wasser fände — obgleich diese ›rechte Zeit‹ schon langst vorüber war — und ein Umkehren gäbe es bei ihm ›iewerhaubt nich‹.
Wir sollten die wirklichen Qualen des Durstes auch nicht kennen lernen. Nur insofern konnte der Wandersmann, der bisher geradezu von einem fabelhaften Glücke verfolgt worden war, den neuen Begleiter nicht als einen Pechvogel betrachten. Wie er mir versicherte, war er heute zum allerersten Male nur um sein Mittagsschläfchen gekommen.
Es war gegen drei Uhr, also schon waren wir über fünf Stunden bei diesem Sonnenbrande unterwegs, als wir in der Ferne ein Haus erblickten, ein ganz stattliches.
Es war auch die höchste Zeit. Wir jammerten zwar nicht über den Durst, der einen den Hunger ganz vergessen ließ, Frettwurst litt aber sicher nicht weniger als ich.
Das Haus, eine große Villa in modernem Stile, lag rechts ganz abseits von der Landstraße, dann aber wurde diese von einem Wege gekreuzt, der durch schwere Wagen sehr zerfahren war.
Je näher wir kamen, desto mehr verschwand das Gebäude hinter einer hohen Mauer, die wir selbstverständlich erst später erkannten. Die Mauer war wenigstens vier Meter hoch und auf unserer Seite zweihundert Meter lang, nach den anderen Seiten konnten wir sie ja nicht abschätzen. Zuerst hatten wir Bäume erblickt, die beim Näherkommen natürlich ebenso für unsere Augen hinter der Mauer verschwanden, die sich übrigens noch als viel höher erwies, als wir angenommen hatten. Sie war genau vier und einen halben Meter hoch.
Wer hatte sich hier auf solche Weise von der Welt abgeschlossen? Es war doch jedenfalls eine Farm, zu der wahrscheinlich die sämtlichen umliegenden Felder und Wiesen gehörten, dies hier der Herrensitz mit den dazu nötigen Nebengebäuden, wozu aber solch eine außerordentlich hohe Mauer? Ganz auffallend war auch, dass sich noch immer nichts Lebendiges zeigen wollte, weder Mensch noch Tier. Wir hatten auf dem fünf Stunden langen Wege auch kein Rind, kein Pferd, kein Schaf auf den so üppigen Weiden gesehen.
»Heern Se, ich gloowe, mir sin hier in enner ganz verhexten Gegend, und das hier is ä verhextes Schloss.«
Ja, ich glaubte auch fast, dass dieses Haus unbewohnt sei. Es war alles gar zu still. Aber wo man solch ein Haus hinbaute, musste es doch auch Wasser geben, und das war uns jetzt die Hauptsache. Wir erreichten auf dem zerfahrenen Wege — und zwar waren einige Radspuren noch ganz frisch, was uns wieder auf eine andere Meinung brachte — das mächtige Eisentor, neben welchem ein Häuschen stand, wohl die Pförtnerwohnung, die sich hier einmal außerhalb befand.
Das eiserne Tor war geschlossen, ebenso die Tür des Häuschens, auch die Fenster mit Innenläden. Wir klopften vergebens — unbewohnt!
»Dann müssen wir über die Mauer.«
»Ja, dort drin werden wir schon Wasser finden.«
»Oder ob die das Haus wegen Wassermangels verlassen haben?«
»Die Spuren von Rädern und Pferdehufen hier sind doch noch ganz frisch.«
»Ja, da sind heute noch Menschen aus und ein gegangen.«
Wir donnerten nochmals gegen das eiserne Tor — weder Klingel noch Klopfer waren vorhanden — niemand meldete sich.
»Ob sich anderswo ein Tor befindet?«
Wir blickten die lange Mauer entlang — auf den anderen Seiten sah sie jedenfalls ebenso kahl wie hier aus.
»Wir müssen über die Mauer, wenn wir nicht verschmachten wollen«, sagte ich wieder.
»Ja, awwer wie gomm mer da nuff?«
Ein Beförderungsmittel war nicht zu erblicken. Trotzdem hielt ich das Übersteigen der Mauer nicht für allzu schwierig — wenigstens das Hinaufkommen, und dann konnte es auch nur einer von uns sein, wenigstens zunächst, Frettwurst.
Das außen angebaute Häuschen war nämlich so niedrig, dass ich den Rand des Daches im Sprunge ergreifen konnte, auch ein Prellstein war vorhanden. Wenn ich mich aber erst einmal auf dem Dache befand, so musste ich, mich hinlegend, den viel kleineren Frettwurst an den Händen nachziehen, hierauf stellte er sich auf meine Schultern — dann konnte wiederum er eben den Mauerrand erreichen.
»Werden Sie das auch fertig bringen? Sich dann emporziehen und hinaufschwingen?«
»Nu, wenn's weiter nischt is.«
»Na na, das ist gar nicht so einfach.«
»Heern Se, ich hawwe in'n Durnen immer de Eens mit ä Schternchen gehabbt.«
Es musste versucht werden, es blieb uns nichts anderes übrig. Ich war bald oben auf dem nur wenig schrägen Dache. Als ich zurückblickte, schnallte Frettwurst seinen Buckel ab, dann knöpfte er seinen Bauch auf und nahm den Leierkasten heraus, wobei ich die sinnreiche Art der Befestigung bewundern konnte.
Ich legte mich platt hin, konnte eben Frettwursts hochgehaltene Hände ergreifen — so zog ich ihn empor. Ich glaube, ich habe niemals mit meiner Kraft geprahlt — mancher andere Mann, wenn auch sonst ziemlich kräftig, hätte das aber wohl schwerlich fertig gebracht. Auch Frettwurst hatte darüber vorher seine Bedenken geäußert.
Nun kam das zweite Kunststückchen daran, wobei sich Meister Frettwurst, der auch ohne Bauch und Buckel gar nicht so schlank wie ›ä Abbollo‹ aussah, zumal ihm jetzt Bauch und Buckel als Falten um den Körper hingen, sich als Akrobat produzieren sollte. Und wirklich, das immer noch dicke Männchen war gewandter, als ich geglaubt hatte. Seine ganz ansehnlichen Muskeln hatte ich bereits gefühlt.
Also, ich duckte mich hin, Frettwurst kletterte auf meine Schultern, erst packte ich seine Hände, dann hielt er sich an der Mauer fest, so richtete ich mich wieder auf, und glücklicherweise konnte er auch mit den ausgestreckten Händen den Mauerrand noch erreichen.
»Na, nun machen Sie einen Klimmzug und dann hoch das Bein!«, kommandierte ich, bereit, an den Bratwurstbeinen nachzuschieben.
Aber Meister Frettwurst hatte es nicht so eilig, er fingerte an dem Mauerrand herum.
»Heern Se, mei Gutster, hier sein Schtacheln.«
»Was, Glasscherben?!«, rief ich erschrocken.
»Glasscherben wohl nich, aber Nägel, ganz schbitzge.«
O weh! Unsere Sache sah ja schon schlimm genug aus. Wenn Frettwurst oben war, so musste er auf der anderen Seite doch wieder herunter, und wenn er sich lang hinhängte, so hatte er immer noch drei Meter hinabzuspringen — gar keine so einfache Sache. Dann musste er im Hause oder sonst wo Umschau halten, ich selbst konnte ja vorläufig nicht hinauf und hinüber.
Diese Nägel aber verringerten auch die Aussicht, dass mein Begleiter allein hinüberkam.
Jetzt fing er an, sich emporzuziehen, hatte zwischen die Nägel greifen können, und als er mit dem Kopfe über die Mauer sah, fanden auch seine Fußspitzen Halt in einer Mauerspalte.
So hing er oben, hatte gar keine Eile.
»Na, wie sieht's denn drüben aus?«
»Heern Se, heern Se!!«
»Na, was gibt es denn?«
»Wenn'ch jetzt enn Fotografenabbarat hätte, das wird'ch abfotografier'n.«
»Sehen Sie etwas Besonderes?«
Statt mir zu antworten, schrie er mit Aufgebot all seiner Lungenkraft über die Mauer hinweg:
»Tenaf Volapük?!«
Ich lauschte. Keine Antwort kam. Dann schien Frettwurst wieder zu mir zu sprechen:
»Sehn Se, nu habbsch enne internationale Weltschbrache gelernt — un gee Luder gann se.«
»Ist denn ein Mensch zu sehen?«
»Ä Mensch nich, awwer ä Elefande.«
»Machen Sie doch keine Witze!«
»Nu, denken Se denn, ich genne geen Elefanden? Hinten ä Schwanz un vorne ä Schwanz — un hiem ä großes Ohr un driem ä großes Ohr — is das etwa gee Elefande?«
»Lassen Sie doch nur Ihren Unsinn...«
»Na, heern Se mal, un jetzt bricht das Luder mit sein Rissel Boomzweige — un da, ei Kreiz nochmal, das is ä... nee, zwee sin's — zwee Lehm!!«
»Was, Lehm?!«
»Jawohl, zwee Lehm. Wenn'ch jetzt enn Fotografenabbarat hätte, die wird'ch...«
»Sie meinen doch nicht etwa Löwen?!«
»Jawohl, Lööööben, zwee Schtick — un jetzt duckt sich das eene Luder — heerjesens, ä Reh, un was fier ä Vieh...«
Ich dachte nicht anders, als mein Kamerad habe dort oben plötzlich den Verstand verloren — oder habe ihn sich mit Bauch und Buckel abgeschnallt. Schnell sollte ich eines Anderen belehrt werden.
Plötzlich erscholl ein Laut, den ich als erfahrener Jäger nur zu gut kannte, der Todesschrei des Hirsches, ganz schrecklich anzuhören, aber noch viel lauter und schrecklicher, als der Hirsch ihn auszustoßen vermag, er mahnte mehr an den Todesschrei des Pferdes, den man in der Schlacht oft genug zu hören bekommt, und ich hatte ihn einmal vernommen, obgleich ich noch keine Schlacht mitgemacht hatte — und da wieder ein anderer Ton, wie ein Trompetengeschmetter, ganz seltsam fremd — da aber Frettwurst von einem Elefanten gesprochen hatte, wusste ich auch gleich, dass nur ein solcher den Ton ausgestoßen hatte — und dann noch unzählige andere Tierstimmen, unter denen ich auch das Geschnatter und jämmerliche Quieken von Affen unterscheiden konnte — dann das donnernde Brüllen eines Löwen, und alles war wieder still.
Frettwurst hatte sich oben nicht mehr halten können, hatte sich wieder heruntergelassen, und ich stand wie betäubt da.
»Hallo, was macht ihr denn dort oben?!«, erklang plötzlich eine fremde Stimme.
Es war ein Neger, der unten neben dem Häuschen stand, mit Hose und rotem Hemd bekleidet, und dummerstaunt zu uns emporsah.
Ich nahm Frettwursten schnell auf die Schultern, ließ ihn völlig herabgleiten.
Ehe ich dem Neger eine Antwort geben konnte, hatte sich der Schneider schon eingemischt.
»Tenas Volapük?«, rief er hinab.
»Na, was macht ihr denn da oben?«, erklang es auf Englisch zurück.
»Sehn Se«, musste sich der unverbesserliche Frettwurst erst wieder an mich wenden, »nu habbch enne internationale Weltschbrache gelernt, un gee Luder gann se — un wennch jetzt enn Fotografenabbarat hätte, den schwarzen Gerl mit sein dummen Gesichte wird'ch abfotografieren.«
»Was für ein Haus ist denn das?«, fragte ich jetzt.
»Ja, wie komm ihr denn dort hinauf?«, wurde immer wiederholt.
»Wir waren vor Durst und Hunger dem Tode nahe«, übertrieb ich sehr, »da kamen wir hier an das Tor, aber klopften vergebens, und da wollten wir erst einmal über die Mauer sehen, ob hier Menschen seien.«
»Na, kommt nur erst einmal herunter.«
Ganz freundlich hatte es der Neger gesagt, hatte auch gleich eine Leiter bei der Hand, die wir benutzten. Jetzt stand die Tür des Häuschens auf, wir blickten in ein Zimmer.
»Wir wollten hier nicht etwa einbrechen.«
»By Jove, das wäre euch auch schlecht bekommen«, grinste der Neger vergnügt.
»Was für ein ummauertes Haus ist denn das hier?«
»Das wisst ihr nicht?«
»Keine Ahnung!«
»Das weiß doch jedes Kind. Das ist der Tierpark des Misters Giblon.«
»In dem wilde Tiere ganz frei gehalten werden?«
»Ganz frei! Drei Elefanten, fünf Löwen, acht indische Tiger«, zählte der Neger stolz auf, und noch viel mehr, worauf ich später zu sprechen kommen werde.
So etwas hatte ich mir nach dem, was ich von Frettwurst erfahren und was ich dann mit eigenen Ohren gehört hatte, nun auch schon gedacht.
Damals gab es in Deutschland bei Hamburg noch keinen Hagenbeck'schen Tiergarten, in dem sich die Tiere ganz frei wie in der Wildnis bewegen können, also gar nicht zu vergleichen mit einem zoologischen Garten, wohl aber sollte solch ein Tierpark schon in Amerika existieren — s o l l t e , es hatte in der Zeitung gestanden, etwas unglaubwürdig. Ein reicher Mann sollte sich bei St. Louis einen solchen Tiergarten eingerichtet haben, weniger aus wissenschaftlichen Gründen als aus Freude an Grausamkeit. Wilde und zahme Tiere aller Art wurden zusammengesperrt, der Amerikaner ergötzte sich daran, wie die Raubtiere die wehrlosen auffraßen und sich auch gegenseitig anfielen, veranstaltete Kampfspiele und dergleichen. (Bei Hagenbeck ist von so etwas natürlich gar keine Rede, dieser Tiergarten dient nur wissenschaftlichen Zwecken.)
Das sollte also bei St. Louis gewesen sein. Dass sich hier in der Nähe von Santa Baccera einer in Wirklichkeit befand, davon hatte ich noch nichts gehört.
Ich erklärte Frettwursten, was ich vernommen hatte und wie ich mir selbst die Sache vorstellte.
Mein Kamerad geriet ganz aus dem Häuschen.
»Sabberlot, genn wir uns den Dierbark nich emal besehn?«
Ich hatte schon denselben Wunsch gehabt, äußerte ihn.
O nein, daran sei gar nicht zu denken. Da wären schon ganz andere Leute hier gewesen, sogar Fürsten, aber Mr. Giblon ließe keinen Menschen in sein Heiligtum blicken, nicht für alles Geld der Welt. Das eben sei seine Freude, dass er allein so etwas besäße, allein es sehen könne, und da gäbe es keine Ausnahme, sonst würde er ja von Besuchern überlaufen.
»Seit wann besteht denn dieser Tierpark?«
Gebaut war daran schon seit vielen Jahren worden, aber erst vor einem halben Jahre sei alles vollendet gewesen, dann kam auch gleich der Schiffstransport mit Tieren aller Art, über Santa Baccera.
Seit einem halben Jahre und noch länger hatte ich freilich nicht mehr viel von der Welt erfahren, und auch in Santa Baccera hatte ich mich gar nicht aufgehalten, auch Frettwurst nicht, und übrigens bildete dieser Tierpark, von dem die Stadt sonst gar nichts hatte, doch schon längst nicht mehr das Tagesgespräch, dass etwa die Spatzen von den Dächern davon gepfiffen hätten.
Zunächst wurde ich auch von einem anderen Gedanken beherrscht.
»Könnt Ihr uns nicht wenigstens etwas zu trinken geben?«
Der Neger hatte uns ständig prüfend betrachtet, immer die Hand an seiner hinteren Hosentasche, aus der ich dann den Kolben eines Revolvers hervorblicken sah. —
»O ja, das kann ich wohl, und ihr seht ja auch nicht aus wie Strauchdiebe. Kommt mit herein!«
Ich folgte ihm als erster in das Innere des Häuschens, und als ich Frettwurst nachkommen sah, war dieser schon wieder mit Bauch und Buckel ausgestattet, was überraschend schnell gegangen war.
»Hei, was ist denn das?!«, staunte denn auch der Neger, der vorhin die beiden umfangreichen Gegenstände, die am Boden gelegen hatten, gar nicht bemerkt zu haben schien. Oder aber er konnte sich diese Verwandlung eben nicht erklären, wie er überhaupt einen sehr beschränkten Eindruck machte.
Zuerst löschten Frettwurst und ich den Durst, wozu nur der Hahn einer Wasserleitung aufgedreht zu werden brauchte. Dann brachte der Sachse wortlos die Kurbel zum Vorschein, steckte sie in seinen Bauch und... »Im schwarzen Walfisch zu Askalon da kneipt' ein Mann drei Tag'« erklang es.
Das Negerlein war außer sich vor Staunen, fürchtete sich sogar. Es ging über seine Begriffe. Der vorhin ganz normale Mensch hatte plötzlich einen Buckel und einen Bauch bekommen, und aus diesem konnte er Musik herausleiern! Etwas Anderes gab es für ihn nicht.
»Das muss Massa — sehen, das muss Massa sehen!!«, rief er ein übers andere Mal, es mehr mit den Augen haltend, wie es ja auch genug, sogar ziemlich gebildete Menschen gibt, welche sich die Opern immer ›ansehen‹.
»Mr. Giblon?«
»Ja, ja, der muss...«
Das Negerlein brach ab und kratzte sich hinter den Ohren.
»Ach, der lässt ja durchaus keinen fremden Menschen herein, und heraus kommt er auch nicht. Ja, wenn ihr hier arbeiten wolltet...«
Mein sächsischer Kamerad schien doch wenigstens genug Englisch verstehen zu können.
»Heern Se, wolln mer hierbleim? Ich mach's. Enne Weile, nur zum Schbaße.«
»Es werden hier Arbeiter angenommen?«, fragte ich.
»Ja, es fehlen zwei — der Dan und der Bob sind gestern gefressen worden.«
Das kugelrunde Gesicht meines Partners wurde plötzlich ganz lang, und auch ich spitzte nicht schlecht die Ohren.
»Gefressen? Von wem denn?«
»Von einem Tiger. Dann kam auch noch ein Löwe dazu und fraß mit.«
»Heern Se, die wilden Diere wärn hier wohl mit Menschen gefiddert?!«
Ich sprach dieselbe Vermutung auf Englisch aus.
»Menschen? O nein! Die kriegen nur Pferde und Ochsen und Schafe — freilich lebendig — und ab und zu wird wohl auch einmal ein wertvolles Tier, etwa eine Gazelle oder gar ein kanadischer Hirsch, wie vorhin erst wieder, in den Park getrieben, damit Massa studieren kann, wie die Löwen und Tiger das Tier zerreißen.«
»Ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Erklärung, alle Hochachtung vor dem Wissensdrang Ihres Herrn — aber wie verhält es sich nun mit den beiden Dienern?«
»Die sind durch eigene Schuld verunglückt.«
»Wieso durch eigene Schuld? Ist das hier so leicht möglich?«
»Durchaus nicht. Es ist alles aufs Beste gesichert. Aber die Wärter werden mit der Zeit sorglos. Dan hatte eine Käfigtür nicht ordentlich geschlossen, und da ist ein Tiger über ihn gekommen, der auch gleich noch den Bob niederschlug. Es hat schwere Mühe gekostet, ihn wieder in Sicherheit zu bringen, zumal auch noch ein Löwe entsprungen war. Also, werdet ihr in Dienste treten?«
»Ja, wir wären schon bereit dazu.«
»Ich will es Mr. Giblon sagen. Jetzt sitzt er gerade auf seinem Observatorium, da darf er nicht gestört werden.«
»Was für ein Observatorium ist das?«
»Na, so ein Turm, der mitten im Parke steht. es gibt ihrer eine ganze Masse, man gelangt durch unterirdische Tunnel zu ihnen, und da sitzt Massa in Sicherheit und beobachtet, wie die wilden Tiere die Schafe und Ochsen zerfleischen und auffressen und sich untereinander bekämpfen. So ein Turm heißt ein Observatorium.«
Wahrhaftig, ich bekam immer größere Lust, mir diese Sache näher zu betrachten, wenn ich auch den Raubtierwärter spielen sollte. Vielleicht aber gelang es mir, dieses Mr. Giblon nähere Freundschaft zu gewinnen, dass ich selbst mehr den Zuschauer spielen durfte.
»Jawohl, wir sind beide bereit dazu.«
»Da müsst ihr aber noch etwas warten, bis der Herr wieder im Hause ist. Da wird geklingelt. Nee, wie ist denn das nur mit dem Bauche, der Musik macht?«
Eine Erklärung wollte er nicht haben, sondern nur die geheimnisvolle Musik hören. Meister Frettwurst spielte denn auch willig einige Lieder und Märsche. Der Neger brachte uns Essen, kaltes Fleisch und dergleichen, und während des Speisens und Musizierens konnte ich ihn noch etwas aushorchen.
Viel bekam ich nicht von ihm zu hören. Saul war auch erst seit zwei Monaten hier, wusste von seinem Herrn sonst gar nichts. Er war als Pförtner angestellt, aber nächstens sollte dieses außenstehende Häuschen abgebrochen werden. Jeden Tag wurden von Santa Baccera oder von nahen Farmen Pferde, Ochsen, Schafe und manchmal auch Schweine herangetrieben, als lebendiges Futter für die Bewohner des Tierparkes, soweit es nicht Pflanzenfresser waren. Dann öffnete sich das große Tor; hinter diesem aber befand sich erst noch ein geräumiges Gebäude, die Tiere und auch ganze Wagen sanken auf einem Fahrstuhl hinab in einen unterirdischen Gang, der nach den Hauptgebäuden führte. Denn ein Durchqueren des Parkes gab es natürlich nicht. Die wilden und alle anderen Tiere blieben Tag und Nacht im Freien, hatten sogar schon die Hälfte des letzten Winters durchgemacht, der im südlichen Teile Kaliforniens allerdings noch viel milder ist als in Süditalien.
Massa war ein sehr, sehr, sehr guter und natürlich ein furcht, furcht, furchtbar reicher Mann, außerdem so gescheit, dass er sogar eine Brille tragen musste... viel mehr konnte mir das Negerlein nicht berichten. Oder er kam nicht dazu, denn eine elektrische Klingel schellte.
»Massa ist vom Studieren zurück. Jetzt müssen alle Diener und Wärter zusammenkommen, sie erhalten ihre Unterweisung. Auch ich muss hin, ich bin hier gar nicht mehr Pförtner. Ihr müsst einstweilen hinaus, aber ich erzähle alles Massa, auch dass ihr hier antreten möchtet. Ich sage euch jedenfalls Bescheid.«
Wir verließen das Häuschen, der Neger blieb drin, schloss hinter sich die Tür ab.
Unsere Absicht, als Diener oder Wärter die Einrichtung dieses echten Wildparkes und das Treiben darin kennen zu lernen, veränderte sich auch während der Viertelstunde nicht, die wir draußen warten mussten.
»Wenn ich nur hin und wieder meine Feife rauchen gann, dann halt ich's schon eine gute Weile aus. Ja, das is grade so was fier mich, da gann mr doch wenigstens später was erzählen.«
Die Tür des Häuschens öffnete sich wieder, Saul erschien abermals.
»Ja, Mr. Giblon will euch sehen, weil ihr als Diener antreten wollt. Aber das sage ich euch gleich: Mit dem Bauche macht ihm keine Musik vor, das sei Kinderei, sagte er, als ich ihm davon erzählte.«
»Ginderei? Dem will ich seine Ginderei schon anschtreichen. Oder der hat ähm gee Gunstverschtändnis.«
Wir gingen wieder in das Häuschen, traten durch eine Tür, hinter welcher auch Saul verschwunden war, als er uns vorhin das Essen brachte, gleich darauf senkte sich die Diele als Fahrstuhl hinab.
Wir durchschritten einen elektrisch erleuchteten Gang, fuhren wieder empor, und fünf Minuten später standen wir vor Mr. Giblon.
Es war ein alter, weißhaariger Herr mit echtem Yankeegesicht, hager und eckig, wie die ganze Gestalt. Auf der Nase balancierte er eine goldene Brille mit außergewöhnlich großen Gläsern. Er machte ganz den Eindruck eines rücksichtslosen Geschäftsmannes, den der Yankee auch als Gelehrter zeigt. Mit aller Energie das einmal gesteckte Ziel zu erreichen suchen — weiter gibt es nichts — und dabei ist es gleichgültig, ob das Ziel ein voller Dollarsack oder die Erforschung des Sternenzeltes oder das Wesen Gottes oder die Verdauungsfunktion der Eingeweidewürmer ist.
»Sie wollen bei mir als Diener oder besser gesagt Tierwärter antreten?«
»Ja.«
»Was sind Sie?«
»Seemann — Schneider.«
»Ist einer von Ihnen Chauffeur?«
Es war die Frage eines Amerikaners, der ja keine Profession kennt, bei dem ständiges Umsatteln im Beruf sogar als Zeichen von Intelligenz gilt, und nicht mit Unrecht. Denn fühlt sich jemand in seinem Berufe zufrieden, verdient er damit genügend Geld, so bleibt er von selbst dabei, und im anderen Falle ist es doch nicht eben schlau, wenn er dabei verharrt.
Ich bejahte sofort. Ich hatte ja meine eigenen drei Automobile gehabt, hatte sie oft genug selbst gesteuert, mir aus mancher ›Panne‹ zu helfen gewusst.
Mr. Giblon stellte einige technische Fragen, die ich zu beantworten wusste, auch in englischer Sprache. Meine beiden Chauffeure waren Engländer gewesen.
»Ich werde Sie dann gleich prüfen. Das Gehalt beträgt bei freier Station monatlich zwanzig Dollar. Sie haben hier diesen Kontrakt zu unterschreiben. Ich werde ihn vorlesen.«
Danach mussten wir und unsere Erben auf alle Ansprüche verzichten, falls wir in den Diensten des Mr. Elias Giblon unsren Tod fänden oder arbeitsunfähig würden.
Es war eigentlich ein starkes Stückchen. In Amerika gibt es keine Unfallversicherung, zu welcher der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer verpflichtet wäre. Diese Sorge um die Zukunft tragen die Arbeiter unter sich, zu diesem Zwecke bilden sie einen Klub, das ist sogar die Hauptaufgabe des Klubs — ›club‹ ist ein keltisches Wort und war der Name eines Schildes mit Buckel oder Spitze, sowohl zum Abwehren als zum Zuschlagen zu gebrauchen — so wird die Versicherung gegen Tod und Unfall auch in England gehandhabt, und dabei kommt man in Amerika und England, nebenbei gesagt, gerade so weit wie in Deutschland; dieses familiäre Schutz- und Trutzbündnis zwischen den Arbeitern hat sogar seine hochideale Seite.
Es ist also sonst natürlich nicht üblich, dass man einen derartigen Kontrakt unterschreibt, laut dessen man für solche Möglichkeiten auf alle Ansprüche verzichtet, es war fast eine Beleidigung, warf auf diesen alten Herrn ein sehr schlechtes Licht.
Frettwurst schien dabei nichts zu empfinden, und ich sagte auch nichts — wir unterschrieben. Kündigung und dergleichen gab es nicht.
»Napoleon Bonaparte Novacasa — Balduin Frettwurst«, buchstabierte der Herr den letzten Namen mühsam. »Sind Sie schon einmal Tierwärter oder Arbeiter bei einem ähnlichen Unternehmen gewesen?«
»Nein.«
»Sie, Frettwurst, melden sich bei Mr. Henslick, er wird Ihnen Arbeit zuweisen — Sie anderer kommen mit mir.«
So wurden wir getrennt, und Frettwurst fand als Vormann einen Deutschen, mit dem es sich auch umgehen ließ.
Ohne noch zu fragen, wie wir hierher gekommen wären und ob wir Kleider zum Wechseln hätten führte Mr. Giblon mich in eine Garage, in der zwei Automobile standen. Sie hatten eine ganz besondere Konstruktion, es waren einfach auf Rädern ruhende Käfige, und zwar gingen die Seitenwände so tief hinab, die mit Pneumatiks versehenen Räder verdeckend, dass sie fast den Boden berührten. Sonst waren es regelrechte Automobile von zwanzig bis dreißig Pferdekräften.
»Zeigen Sie mir, dass Sie das Automobil bedienen können.«
Ich kroch in den Käfig hinein, nahm Platz auf dem Sitz, hatte mich schnell in die Steuervorrichtung gefunden, machte alles bereit, um das Automobil sofort in Gang zu setzen.
»Gut! Jetzt werde ich zunächst noch selbst steuern. Achten Sie auf die Wege, dass Sie sich bald allein zurechtfinden!«
Der alte Herr, einen Sportanzug tragend, kroch ebenfalls in den Käfig, schloss die Gittertür sorgfältig, nahm meinen Platz ein.
Dann breitete er vor sich und vor mir eine Karte aus, bunt bemalt.
»Das ist hier das OstObservatorium«, sagte er, auf einen schwarzen Kreis deutend. »Achten Sie auf den Weg. Wegweiser gibt es bei mir nicht.«
Wir fuhren zur Remise hinaus, passierten mehrere Tore, und nun bekam ich es zu sehen.
Es war ein tropischer Urwald, wohl meist mit Bäumen und anderen Pflanzen aus Brasilien, die sich in diesem kalifornischen Klima, wenn sie sich einmal akklimatisiert hatten, recht gut halten konnten, obwohl sie nicht ihre ganze Blütenpracht entwickelten.
Nirgends war von einer Pflege des Gartens etwas zu sehen, wohl aber, und das wirkte anfangs für das Auge sehr störend, zogen sich durch den Urwald kreuz und quer zahllose asphaltierte Wege hin, wie es auch die Karte angab, nicht unregelmäßig, sondern gerade oder doch im Zickzack, so dass man nirgends wie durch eine Schneise blicken konnte, wohl aber gab es keine Fläche von sechs Meter Länge und ebensolcher Breite, die nicht von solch einem Wege begrenzt worden wäre.
Auf diese Weise gab es hier keinen Fleck, der nicht mit dem Sicherheitsautomobil zu erreichen gewesen wäre, nur im dichtesten Gebüsch konnte sich ein Tier verstecken — und Tiere gab es nun hier genug.
Der Park enthielt zwei afrikanische und einen indischen Elefanten — ein zweiter indischer, ein zum Männchen gehörendes Weibchen, wurde dieser Tage erwartet — fünf Löwen, darunter ein asiatisches Paar, vier Königstiger und sieben andere, dreizehn Panther und Jaguare, Pumas und Geparden und ähnliches Raubgesindel, deren Zahlen ich vergessen habe. Wenn auch nicht alle Exemplare vorhanden waren, die ein großes Werk über Raubtiere aufzählt — nicht der hundertste Teil davon — so hatte doch jeder Erdteil seinen speziellen Vertreter geliefert.
Wollte ich versuchen, alles einzeln aufzuzählen, so würde ich doch die Hälfte vergessen. Denn aufgeschrieben habe ich mir damals nichts, hätte auch gar nichts Genaues erfahren können. Mr. Giblon war für mich, trotz unserer engen Gemeinschaft, unnahbar, und auch das übrige Personal konnte immer nur mit eigenen Augen beobachten und zählen.
So habe ich bei den Raubtieren gleich die Bären vergessen. Ich gewahrte einen kanadischen Grizzlybären, einen malaiischen Lippenbären und dann wieder sogar eine ganze Menge Eisbären, denen man an einer besonderen Stelle des Gartens durch weiß bemalte Felsblöcke Eis vortäuschen wollte.
Es war eine Akklimatisationsversuchsstation. Mr. Giblon, ein zoologischer Dilettant — wahrscheinlich aber ein sehr tüchtiger Gelehrter — wollte konstatieren, inwieweit man ein Tier an ein ganz anderes Klima gewöhnen kann, wie es sich dabei dem Körper und dem Charakter nach verändert. Nebenbei das Beobachten im Zustand völliger Freiheit.
Ich schicke gleich voraus, dass hierzu die Vorrichtungen trotz aller scheinbaren Großartigkeit zu mangelhaft waren. Das Terrain von 80 000 Quadratmetern war hierzu viel zu klein. Das Ganze war ja überhaupt schon an sich unnatürlich. In der Natur kommen Löwen und Königstiger gar nicht zusammen vor. Man sah es den Tieren sofort an, wie sie bei einer Begegnung nicht wussten, was sie miteinander anfangen sollten, sie wurden förmlich verlegen. Und diesen Tieren bleibt eine von Menschenhänden aufgeführte Mauer doch immer eine Mauer. In Hagenbecks Tierpark ist das Problem der Natürlichkeit viel glücklicher dadurch gelöst worden, dass die Grenzen durch unüberspringbare Gräben gezogen worden sind. Das sind doch für die Tiere wenigstens natürliche Grenzen. Dort sind auch nicht alle Tiere so bunt durcheinander gemischt, durchaus nicht.
Nun, Mr. Giblon war eben einer der ersten, der solche wissenschaftliche Versuche anstellte, er hatte noch keine von den Vorgängern überlieferten Erfahrungen, und so musste man ihm dennoch die Ehre lassen, hier etwas ganz Geniales geschaffen zu haben.
Ob so etwas ein der Menschheit nützlicher Beruf ist, darauf wollen wir uns nicht einlassen, sonst könnte man auch fragen: Wozu hat denn Alfred Brehm seine zehn Bände ›Tierleben‹ geschrieben? Hat das etwa irgendeinen nützlichen Zweck? Aber noch etwas Anderes: Es gibt genug Menschen, sogar sogenannte ›gebildete‹, welche nicht einsehen, was die Nordpolfahrer eigentlich bezwecken. Wozu brauchen wir zu wissen, wie es am Nordpol aussieht, da von dort ja doch nichts zu holen ist? Solch einem Manne muss man ganz ruhig antworten, aber auch nachdrücklich: Geehrter Herr, für Sie hat Kopernikus umsonst gelebt, für Sie hat Galilei umsonst im Inquisitionskerker geschmachtet. Also betrachten Sie immerhin den Mond als eine Laterne, die der liebe Gott extra Ihretwegen an den Himmel gehängt hat, damit Sie den Weg aus der Kneipe nach Hause finden.
Schließlich auch noch ein Witzchen: Dem Kommerzienrat Cohn wird ein Professor vorgestellt, Astronom, der berühmte Entdecker des jüngsten Kometen. »Ehrt mich sehr. Also Kometen entdecken Sie. Was bringt Ihnen denn nun so'n Komet ein?«
Wie solch ein harmloses Witzchen doch gleich die ganze Menschheit charakterisieren kann! — — — —
In einem von Raubtieren so dicht bevölkerten Parke konnten natürlich keine wehrlosen Tiere gehalten werden, mit Ausnahme von Affen aller Art, die sich nur vor dem Panther und anderem kletternden Raubzeug zu hüten hatten. Dann Schlangen aller Gattungen, sowohl Riesenschlangen als giftige. Auch ein großer Teich war vorhanden, in dem ich außer Krokodilen auch die Köpfe zweier Flusspferde sah. Und das eine von ihnen würde nächstens ein Junges werfen. Von anderem Zeug, Igeln, Stachelschweinen und dergleichen, will ich gar nicht sprechen. Ich musste alles selbst beobachten.
Gleich im Anfange sah ich durch den Wald einen Eisbären trotten, der mir einen recht kläglichen Eindruck machte. Er pfiff wohl auf dem letzten Loche, konnte das Klima nicht vertragen.
»Wie? Selbst Eisbären züchten Sie hier!«
»Achten Sie auf den Weg!«
Ich war zurechtgewiesen worden.
Gleich darauf attackierte uns ein Rhinozeros, ein mächtiges Vieh. Es trat plötzlich vor uns auf den Weg, ein Stutzen, dann senkte es auch sofort den Kopf, raste, das gewaltige Horn dicht über dem Boden, direkt auf uns los.

Ich gab uns fast schon für verloren. Das Biest rannte doch einfach den ganzen Käfigwagen über den Haufen.
Aber Mr. Giblon hatte das Automobil äußerst in seiner Gewalt.
»Geben Sie acht, wie man sich in einem solchen Falle benimmt«, konnte er auch noch ganz ruhig sagen, hatte im Nu das nur langsam fahrende Automobil zum Stillstand gebracht. Im nächsten Augenblick ging es zurück, schwenkte in einen Seitenweg ein, das Nashorn raste an uns vorüber, kümmerte sich nicht weiter um uns.
Mir hatten sich wirklich die Haare gesträubt. Und dann musste ich über die Kaltblütigkeit staunen, die der alte Herr gezeigt hatte. Es war für ihn nicht anders gewesen, als wenn man einer zischenden Gans aus dem Wege geht.
»Haben Sie es gesehen? Das müssen Sie lernen, wenn ich Sie als Chauffeur anstellen soll. Es ist nur Gewohnheit. Verliert man den Kopf, so ist man verloren; behält man ruhig Blut, so ist es eine Spielerei. Das Rhinozeros ist auch das einzige Tier, welches uns manchmal angreift. Aber es ist fast unsere eigene Schuld. Man muss immer gut aufpassen, ihm schon vorher aus dem Wege gehen. Das müssen Sie alles lernen, ehe Sie allein fahren können.«
»Kein anderes Tier greift den Käfigwagen an?«, fragte ich.
Auf solche Fragen zu antworten war Mr. Giblon stets bereit.
»Nein. Löwen, Tiger und alle anderen Raubtiere fürchten sich vor dem Automobil, würden es tun, auch wenn es nicht so knatterte. Ich werde mir übrigens bald ein anderes Fahrzeug zulegen. Nur noch in der Nähe des Sees müssen wir wegen der Nilpferde vorsichtig sein, zumal das eine trächtig ist. Wenn es erst geworfen hat, dürfen wir uns ihm gar nicht zu nähern wagen. Säugende Tiere sind überhaupt immer zu meiden. Oder man muss sich ihnen äußerst vorsichtig nähern. Ich werde Sie anleiten, Dann vielleicht sind noch Angriffe der Paviane zu fürchten. Die kenne ich noch nicht so genau, sie sind erst vor kurzer Zeit gekommen, müssen sich erst an die Umgebung gewöhnen. Und wo Sie eine Giftschlange sehen...«
Soeben kroch eine große, grüne Schlange über den Weg, Mr. Giblon lenkte zur Seite, nicht um ihr auszuweichen, sondern er überfuhr sie mit Absicht. Hinter uns lag das Reptil in seinen letzten Zuckungen.
»... da fahren Sie sie tot. Ich will die Giftschlangen wieder ausrotten. Wird sehr schwer fallen. War ein böser Irrtum von mir. Kennen Sie die Giftschlangen?«
»Nein — kaum, dass ich die deutsche Kreuzotter von einer Ringelnatter unterscheiden kann.«
»Sie werden es lernen. Dass Sie mir nicht die ungiftigen totfahren! Das war eine Grünotter, eine Unterart der australischen Schwarzotter, Pseudechis porphyreus.«
Während er extra deswegen, um mir die tote Schlange zu erläutern, noch einmal zurückfuhr, musste ich ihm die gehörten Namen wiederholen, und dann verstand er die Merkmale der Schlange auf eine Weise hervorzuheben, dass auch der dümmste Mensch sie von jetzt an erkannt hätte.
Ein ganz patenter Mann, dieser Mr. Goblin! Er, der keine Universität besucht hatte, außer den wissenschaftlichen Namen kein Latein konnte, verstand wahrscheinlich mehr als mancher Professor. Aber rücksichtslos! Weil ich sein Chauffeur werden sollte, der ihn hier im Parke herumkutschierte, gab er sich die größte Mühe, mich in alles einzuweihen — aber wenn ich ihn etwas fragte, was nicht direkt zur Sache gehörte, antwortete er einfach nicht, war wie taub.
»Werden Sie diese Schlange wiedererkennen?«
»Gewiss. Also von ihr gibt es auch eine schwarze Abart?«
Er hatte mich einfach nicht gehört. Solch eine schwarze Schlange gab es hier nicht, was brauchte ich das also da zu wissen?
Zunächst zeigte er mir die fünf Türme, die mit dem Wohnhause unterirdisch verbunden waren, von denen aus er besonders des Nachts die Tiere beobachtete, sogar mit elektrischen Scheinwerfern.
Er zeigte sie mir nur deshalb, damit ich sie selbstständig finden könnte. Sonst gab er keine Erklärung. Es waren eben hohe Türme, auf denen der Beobachter vor den Raubtieren gesichert war.
Auf dem Wege nach dem See sah ich ein anderes Automobil halten, in dessen Käfig sich vier Männer befanden, und mir fiel gleich auf, dass es anders beschaffen sein musste als das unsrige. In diesem Automobil fehlte nämlich der Boden, oder es war darin doch so viel freigelassen, dass sich zwei Männer bequem mit dem asphaltierten Wege beschäftigen konnten. Auf diese Weise war es möglich, die Wege auszubessern und sie von Unkraut zu befreien, ohne den Angriffen wilder Tiere ausgesetzt zu sein.
Gleich darauf kam uns noch ein zweites solches Automobil entgegen. Mr. Giblon befahl zu halten und hielt selbst.
»Wohin? Seid ihr schon fertig?«
»Nein, wir hören auf!«, klang es trotzig zurück.«
»Weshalb?«, fragte Giblon kalt.
»Das Rhinozeros hat uns schon wieder attackiert. Wir wollen unsere Knochen nicht für so'n lumpigen Lohn zu Markte tragen.«
»Feiglinge! Lasst euch auszahlen!«
Er fuhr unbekümmert weiter, der drohenden Worte nicht achtend, die hinter ihm erklangen. Ich verstand sie auch nicht.
»Sie sind Italiener?«, wurde der Yankee jetzt gesprächig.
»Korse.«
»Sind Sie weit in der Welt herumgekommen?«
»Ja — als Seemann.«
»Haben Sie in fremden Ländern gejagt?«
Ich verneinte, denn von Hasen- und Fuchsjagden wollte ich nicht erzählen.
»Ich muss das Rhinozeros abschaffen. Ist ein Einsiedler, wird immer bösartiger. Alle Leute desertieren mir, bekomme keine anderen. Abschießen möchte ich das wertvolle Tier nicht, will es ja auch sonst noch beobachten. Nur soll es hier nicht mehr frei umherlaufen. Fallgrube oder Schlinge. Geht aber nicht hinein. Habe deshalb einen Neger engagiert, der es verstehen wollte, hat aber nur renommiert. Haben Sie Erfindungsgabe? Überlegen sie sich's! Matrosen wissen ja mit Stricken umzugehen. Bezahle gut!«
O ja, das war etwas für mich. Mir behagte überhaupt die ganze Geschichte. Hier würde ich es einige Zeit aushalten können, zumal wenn man mir etwas freie Hand ließ.
Wir kutschierten noch stundenlang in dem Parke herum, ich sah in dem See die Flusspferde blasen, sah Krokodile und Riesenschildkröten schwimmen, eine legte ihre Eier ab und verscharrte sie im Sande — immer wieder gab es etwas Neues zu sehen, und das ging tagelang so fort.
Ich wurde der Chauffeur des Gelehrten, der sich ganz auf mich verließ, ungeachtet aller Gefahren nur beobachtete und ständig Notizen machte.
Interessante Experimente wurden genug angestellt. Wie die Hammel und Schweine den Raubtieren zum Opfer fielen, war mir bald nichts Neues mehr. Täglich wurden einige Dutzend von ihnen in den Wildpark getrieben, und zwar mussten sie ihren Weg durch einen der Türme nehmen, dass sie sich gleich mitten im Parke befanden.
Ob es eine Grausamkeit war, die harmlosen Tiere, welche erst unter den Schutz der Menschen gestellt worden waren und dadurch alle Selbstständigkeit verloren hatten, den Zähnen und Pranken von Raubtieren auszuliefern, darüber will ich nicht richten. Ich gewöhnte mich schnell an die blutigen Schauspiele, fand sie wirklich äußerst interessant, ohne dadurch verroht worden zu sein. Ich habe dergleichen Haustiere auf der Weide, auf dem Transport, in Schlachthäusern und selbst in Ställen noch viel mehr leiden sehen als hier, da ihre Angst und Qual doch immer nur sehr kurze Zeit dauerten — der Mensch ist doch das rücksichtsloseste Raubtier von allen, ich selbst könnte keinen Vogel, dessen Lebenselement das grenzenlose Reich der Luft ist, in einen Kubikfuß Raum einsperren, um mich an seinem Gesange, dem Ausdrucke einer ungestillten Sehnsucht, zu ergötzen, will aber nicht richten, wenn es andere tun, zu ihrem Vergnügen oder zum Zwecke der Forschung.
Und interessant war es wirklich, die wilden Raubtiere und ihre Schlachtopfer zu beobachten, wie sie sich diese streitig machten. Es fehlten nur noch die Geier, um das Bild zu vervollkommnen. Noch interessanter wurde es, wenn Rinder und Pferde in den Wildpark kamen. Die ergaben sich nicht immer so ohne Kampf in ihr Schicksal. Ich sah einen Panther von dem Horne eines Stieres aufgeschlitzt werden, und selbst ein Löwe bekam von einem mageren Gaule an den Kopf einen Fußtritt, der ihm den Appetit nach frischem Fleische für viele Tage vergehen ließ.
Unablässig ersann Mr. Giblon neue Experimente, um den Charakter und die Fähigkeiten der wilden Tiere, wie solcher, von deren Fleische sich jene nähren, zu prüfen. Von weither wurde ihm frischgefangenes Wild geliefert, Hirsche, Rehe und andere Tiere. Wie anders benahm sich doch schon ein wildes Schaf, etwa ein Mufflon, als ein unter dem Schutze der Menschen aufgewachsenes! Es wusste viele Tage lang allen Verfolgungen dieser Raubtiere zu entgehen, welche ihre Beute sämtlich mit einem Sprunge zu erreichen suchen, den Flüchtling niemals verfolgen. Sie schienen sich in diesem Wildpark, der für sie doch eine von Teufeln wimmelnde Hölle bedeuten musste, sogar häuslich einzurichten, gingen ruhig, wenn auch mit aller Vorsicht, ihrem Futter nach, und vor den gewaltigen Hauern eines sonst nur kleinen mexikanischen Wildschweines, das mit allen drei Ferkeln angekommen war, hatten auch die Tiger und Löwen einige Zeit Respekt. Wenn das Schwein mit gesträubten Borsten wütend auf den Gegner losrannte, der die Jungen bedrohte, da hielt auch kein Königstiger und selbst der blutdürstigste Panther nicht stand, suchte vielmehr mit eingekniffenem Schwanze das Weite. Seinem Schicksal entging freilich auch dieses Wildschwein nicht. Ein Ferkel nach dem anderen wurde ihm unversehens weggeholt, und dann saß ihm selbst eine nur kleine Wildkatze auf dem Nacken und machte ihm den Garaus.
Noch ganz anders aber ein spanischer Stier. Es sollte ein echt kastilischer sein, wie er zu den Stiergefechten verwendet wird, die auch in den kalifornischen Städten, in denen es viel spanisches Element gibt, noch immer abgehalten werden. Mr. Giblon hatte ihn aus San Francisco kommen lassen, mochte eine nette Summe für ihn bezahlt haben, war aber bei seinem Anblick grenzenlos enttäuscht. Er hatte an einen Kafferbüffel gedacht, auf dessen Rücken man sorglos durch jede Wildnis reiten kann, denn kein Löwe wagt ihn anzugreifen, und nun kam ein kleiner Ochse an, nicht größer als ein Mülleresel, mit winzigen Hörnern, von der langen Reise per Eisenbahn und Landstraße ausgehungert, mit mattem Blick, an einem Nasenringe seinem Führer wie ein Lamm folgend. Er wurde in einen Stall geprügelt und benahm sich darin auch weiter wie ein Schaf. Den enthusiastischen Versicherungen seines spanischen Führers, dass dieser kastilische Stier nur etwas Erholung brauche, dann würde er aus freiem Antriebe jeden Tiger und Löwen zum Kampfe herausfordern, glaubte niemand.
Aber es sollte doch wirklich so kommen. Am ersten Tage wollte er nichts fressen, blieb das demütige Schaf — am zweiten Tage fraß er eine ungeheuere Quantität Heu, sah plötzlich ganz anders aus, und am dritten Tage brach er durch die starke Tür seines Stalles, und niemand hätte ihn lebendig wieder fangen können.
Nach den verschiedensten Experimenten wurden die Tore zu dem Wildpark geöffnet, der Stier fand sofort den Weg zur vermeintlichen Freiheit, und von diesem Augenblick an war er unbestrittener Herr des ganzen Reviers. Sofort war er hinter einem Tiger her, der beim Anblick des struppigen Ungeheuers, das mit rotglühenden Augen, die kleinen, aber gefährlich spitzen Hörner dicht am Boden auf ihn losraste, schleunigst das Weite suchte, und der spanische Stier begnügte sich nicht mit diesem ersten Sieg, sondern immer hinter dem Tiger her, der freilich auch nicht daran dachte, Haken zu schlagen, was eben gegen seine Natur war. Aber noch mehr fiel das Raubtier aus der Rolle, als es zuletzt sogar aufbäumte, was es doch sonst nie tut. Dann erblickte der Stier einen Eisbären, eins der stärksten Exemplare, und in der nächsten Minute war dieser Eisbär, der sonst den stärksten Ochsen mit einem Schlage seiner Pranke fällte, siebartig durchlöchert, nur noch eine blutige Masse, auf welcher der kleine Stier herumtrampelte. Er war und blieb der gefürchtete Tyrann des Reviers. Auch der König der Tierwelt ging ihm ängstlich aus dem Wege, noch viel ängstlicher als Tiger und Panther. Selbst der Löwe lernte vor dem struppigen Ungeheuer schnell auf den nächsten Baumast springen, wo er allein gesichert war.
Es mag sein, dass sich die Raubtiere hier anders betrugen als in völliger Freiheit, jedenfalls aber erkannte man schon hier die Glaubwürdigkeit der Erzählungen, dass der Kafferbüffel keinen ebenbürtigen Gegner hat, dass sich der Jäger vor ihm mehr hüten muss als vor einer angeschossenen Löwin, die ihre Jungen verteidigt.
Nur einem Gegner war der spanische Stier nicht gewachsen, und dem sollte er auch bald zum Opfer fallen. Als er zum ersten Male das Rhinozeros erblickte, schien er diesem wohlweislich aus dem Wege gehen zu wollen. Aber das Nashorn, das beim Anblick jedes lebenden Wesens in Wut versetzt wurde, ging gleich auf ihn los, und da allerdings gab es auch bei dem Stiere, in dem der Spanier alle Tugenden der ritterlichen Vollkommenheit erblickt, kein Zurückgehen mehr. Also die beiden aufeinander los, und nun freilich war der brave Stier geliefert. Es klang, als ob zwei Kanonenkugeln zusammenprallten, der Stier wurde in die Höhe geschleudert und hatte im nächsten Augenblick das Horn des Rhinozerosses in der Brust, ward auch noch der ganzen Länge nach aufgeschlitzt. Das genügte dem Nashorn, es setzte seinen Lauf fort, um neue Opfer für seine blinde Wut zu suchen.

Denn dieses Rhinozeros war doch der eigentliche Teufel des ganzen Wildparkes. Ich lernte verstehen, weshalb Neger, Araber und Inder das Rhinozeros gar nicht als ein irdisches Wesen betrachten, sondern als eine Ausgeburt der Hölle. Und das ist nicht nur wegen der Gefährlichkeit seiner Jagd — kein Eingeborener Indiens oder Afrikas denkt daran, auf ein Nashorn Jagd zu machen — sondern auch wegen seiner ungeheueren Gefräßigkeit, weil solch ein Vieh in einer Nacht ein ganzes Feld, das eine große Familie für ein Jahr ernähren soll, abweidet oder durch Wälzen alles niederdrückt, und hiergegen gibt es keinen Schutz. Den Elefanten kann man vertreiben, nicht aber das Nashorn, das lässt sich eben nichts gefallen.
Sehr hübsch ist, wie die mohammedanischen Eingeborenen hierbei ihre Feigheit zu bemänteln wissen, wodurch aber doch auch die Furchtbarkeit dieses Tieres charakterisiert wird. Ich kann nur wiederholen, was Brehm erzählt.
»Der Elefant«, sagen sie, »ist ein gerechtes Tier, welches das Wort des gottgesandten Mohammed — über welchem der Friede des Allbarmherzigen sei — in Ehren hält und Schutzbriefe und andere erlaubte Mittel der Abwehr wohl achtet. Das Nashorn aber kümmert sich nicht im Geringsten um alle Amulette, welche unsere Geistlichen schreiben, und hätte der Prophet selbst sie geschrieben, um die Felder zu bewahren, und hierdurch beweist es, dass ihm das Wort des Wahrheitssprechenden und Allmächtigen vollkommen gleichgültig ist. Das Rhinozeros ist verbannt und verworfen vom Anfange an. Nicht der Herr, der Allerschaffende, hat es erschaffen, sondern der Teufel, der Allverderbende, und deshalb ist es den Gläubigen geraten, mit derartigen Wesen sich nicht einzulassen, wie wohl die Heiden und christlichen Ungläubigen zu tun pflegen. Der Muselmann gehe ihm ruhig und still aus dem Wege, damit er seine Seele nicht beschmutze oder Schaden an ihr nehme und verworfen werde am Tage des Herrn.«
So sprechen die Eingeborenen, wenn sie von einem Europäer zu einer Rhinozerosjagd aufgefordert werden. Sie wissen würdevoll abzulehnen. Und dabei gibt es unter diesen Eingeborenen solche, welche dem Löwen allein gegenüberzutreten wagen.
Unser männliches Nashorn war zur Zeit umso gefährlicher, weil es sich gerade in der Brunst befand. Ein Glück nur, dass es sich in seiner blinden Wut immer mit dem ersten Anlauf begnügte, niemals an eine Verfolgung dachte. Aber kein Arbeiter war mehr zu bewegen, in dem Sicherheitsautomobil die Wege zu säubern oder auszubessern. Wir beide, Mr. Giblon und ich, fuhren allerdings noch im Parke herum, aber wir orientierten uns erst, wo sich der vierbeinige Satan befand, außerdem musste auf jedem der fünf Türme immer eine Wache stehen, die uns seine Annäherung rechtzeitig meldete. Trotzdem wurden wir noch oft genug attackiert, und während ich immer besser lernte, dem Ungetüm auszuweichen, musste ich die Kaltblütigkeit des Yankees bewundern, wie er mir so vertraute, sich in seinen anderen Beobachtungen und Notizen gar nicht stören ließ.
»Haben Sie noch kein Mittel gefunden, wie wir das Rhinozeros in eine Falle locken?«, fragte er wohl einmal.
Ja, ich sann Tag und Nacht darüber nach, daraufhin beobachtete ich den Dickhäuter immer, und ein Plan begann in mir zu reifen.
Es mochte am zehnten Tage nach unserer Ankunft sein, als ich zum ersten Male meinen Kameraden wiedersah, ohne Buckel und Bauch, sonst aber sehr wohlgenährt. Er trieb gerade eine Herde Säue über den Hof.
»Na, Frettwurst, wie geht's denn?«
»Na, Se sehn's doch — Schweine treim. Schneidermeister und Schweinetreiber, 's fängt alles beedes mit'n Sch an un heert mit 'n r uff, un alles beedes hat in dr Mitte zwee Eier.«
Nachdem er erst so seinen Witz ausgelassen, merkte ich ihm an, dass er mir noch etwas im Vertrauen zu sagen habe, er blinzelte so mit den Augen, dämpfte auch seine Stimme.
»Heern Se, ich muss noch ä ärnstes Wort mit Sie reden — sähn Se sich vor den Mister Giblon vor, das is Sie ä Deifel...«
In diesem Augenblicke erschien Mr. Giblon auf dem Hofe; Frettwurst verstummte sofort und trieb seine Säue weiter.
»Mr. Novacasa, ich möchte Sie einmal sprechen.«
Die warnenden Worte meines Kameraden noch in den Ohren, ohne sie mir aber erklären zu können, folgte ich dem Herrn in eins seiner vielen Arbeitszimmer.
»Sie haben mein Vertrauen gewonnen. Ich bin sehr mit Ihnen zufrieden. Aber... ich möchte Ihnen noch einen anderen Vorschlag machen. Ich halte Sie für einen Mann, der den Tod nicht fürchtet.«
Was sollte diese Einleitung?
»Ja, dass ich gerade kein furchtsamer Mensch bin, haben Sie wohl schon gemerkt.«
»Ganz richtig. Sonst habe ich mich noch nicht um Ihre Personalien gekümmert. Sind Sie denn eigentlich verheiratet?«
»Ich war es, meine Frau ist gestorben.«
»Haben Sie Kinder?«
»Auch nicht.«
»So so. Sonst auch keine verwandte Person, für die Sie gern sorgen möchten?«
Weiß der Teufel — ich hatte etwas herausgehört! Auch das Wesen dieses Mannes fiel mir jetzt auf, er ging unruhig in dem Zimmer auf und ab, sich die knöchernen Hände reibend, mich manchmal mit seinen kalten Augen so listig von der Seite anschielend, was alles er sonst nie tat.
»Ja, ich habe eine Schwester, an die ich noch oft denke«, entgegnete ich aus dem Stegreif. Derartige ›Dichtungen‹ waren mir ja nun schon bald zur Gewohnheit geworden.
»In Korsika?«
»Ja, in Korsika.«
»Sie hat Kinder?«
»Eben an diese kleinen Würmer erinnere ich mich oft mit stiller Sehnsucht.«
»So so. Würden Sie ihnen bei Ihrem Tode gern eine beträchtliche Summe hinterlassen?«
Immer mehr begann ich zu stutzen. Wo wollte der hinaus?
»Bei meinem Tode?«
Mit einem Ruck ließ sich der Yankee auf einem Stuhle nieder, war plötzlich eisern.
»Ich will mich kurz fassen. Was ich mit diesem Tierparke bezwecke, haben Sie nun wohl schon gemerkt. Ich beobachte das Wesen und Treiben und den Charakter der wilden Tiere aller Länder bei allen Gelegenheiten. Was ich mir das kosten lasse, wissen Sie wohl auch. Nun fehlt mir bloß noch ein Mensch, den ich allein frei in dem Parke sich bewegen lasse. Ich möchte sehen, wie sich da die Raubtiere benehmen, ob sie den Herrn der Erde fürchten, wie es immer heißt, oder ob sie ihn gleich anfallen werden. Würden Sie es wagen?«
Ich war zuerst ganz baff.
»Sie meinen, ich soll da in dem Wildparke herumspazieren?!«
»Es ist ein Vorschlag. Erstens erweisen Sie dadurch der Wissenschaft den größten Dienst, ich werde dafür sorgen, dass Ihr Name in gelehrten Werken unsterblich wird — zweitens erhalten die, die Sie als Erben einsetzen, eine gewisse Summe, über deren Höhe wir ja sprechen können...«
»O nein, Mr. Giblon, ich habe nicht die geringste Lust, mich als solch ein Versuchskaninchen herzugeben.«
»Aber bedenken Sie doch...«
Er sprach noch mehr von dem unsterblichen Ruhm und dem Reichtum, den ich oder vielmehr meine Erben dabei gewinnen könnten, aber ich beharrte fest dabei, dass mir mein sterbliches Leben lieber sei als aller unsterblicher Nachruhm und eine zu hinterlassende Erbschaft.
Als er sah, wie fest ich in dieser Ansicht war, gab er sich übrigens gar nicht viel Mühe mehr.
»Nichts für ungut. Es war nur ein Vorschlag. Haben Sie eine Idee für den Rhinozerosfang?«
»Ja, ich werde gleich jetzt versuchen, eine Falle aufzubauen.«
»Ich wünsche Ihnen viel Glück, und Sie sollen eine Belohnung haben.«
So war ich wieder entlassen. Ich dachte mir nichts weiter dabei. Eben ein Yankee, der alles nach Dollars wog, auch jedes Menschenleben, außerdem noch ein Sonderling! Jedenfalls hatte er schon anderen Arbeitern einen derartigen Vorschlag gemacht, auch meinem Kameraden.
Diese Unterredung hatte in früher Nachmittagsstunde stattgefunden. Ich hatte unterdessen tatsächlich einen Plan zu einer Falle gefasst, in der ich diesen Teufelsbraten von Rhinozeros zu fangen gedachte, mittels Stricken, näher kann ich es nicht beschreiben, und ich gedachte, sofort an den Bau der Falle zu gehen. Dass Mr. Giblon heute nicht mehr mit mir in den Wildpark fahren würde, hatte er mir bereits gesagt, und ich hatte jenen schon wiederholt mit seiner Erlaubnis allein in einem Automobil besucht.
So wollte ich gleich jetzt ans Werk gehen, die Stricke hatte ich schon vorbereitet, aber ich brauchte eine Hilfe, suchte Frettwurst auf, offenbarte ihm mein Vorhaben, und er war ohne Weiteres bereit, mit mir zu gehen. Wie gut ich schon oft dem wütenden Rhinozeros auszuweichen verstanden, hatte er beobachtet, und furchtsam war Frettwurst nicht.
»Was wollte er denn vorhin von Ihnen?«
Ich erzählte es ihm.
»Genau denselben Vorschlag hat er auch mir gemacht! So e infamer Lumich!«
»Und deshalb wollten Sie mich warnen, dass ich nicht etwa darauf einginge?«, lachte ich.
»Na, wer auf solche Ideen kommt, dem ist doch alles zuzutrauen!«
Hiermit war zwischen uns diese Angelegenheit erledigt. Dagegen engagierte ich noch einen anderen Arbeiter, den ich schon als zuverlässigen Mann kannte, dass er auf einem Turme, zunächst jener Stelle, wo ich die Schlingen anzulegen gedachte, Wache halten solle, um uns das Nähern des Nashorns rechtzeitig zu melden.
Wir fuhren ab, Frettwurst und ich. Bald hatte ich die auserwählte Stelle erreicht, einen starken Ahornbaum, dessen tiefgehende Äste den besten Halt für die anzubringenden Schlingen boten. Der nächste Turm war keine dreißig Meter entfernt, wir selbst waren von dort deutlich sichtbar, wir sahen auch schon den Mann oben stehen, der die Umgegend noch viel weiter überblicken konnte.
Wir gingen an die Arbeit, und je mehr sie fortschritt, desto mehr wurde Frettwurst für meine Idee eingenommen. Denn zuerst hatte er mich wegen des Spinnennetzes ausgelacht, das ich herstellte, als ob sich da drin das mächtige Rhinozeros fangen würde. Aber es hatte schon etwas für sich.
So waren wir ganz in unsere Arbeit vertieft. Nebenbei erzählte mir Frettwurst, dass heute Abend wohl auch der Rest der noch vorhandenen Arbeiter den Dienst quittieren wolle. Sie hatten dieses Leben zwischen den Tieren satt, es gab hier so gar keine Gelegenheit, sich einmal zu amüsieren. Zur Fahrt nach Santa Baccera wollte Mr. Giblon kein Automobil hergeben.
»Jetzt binde ich mir diesen Schtrick an, dann will'ch mir errscht enne Feife... Napoleon, Napoleon, da gommt's Luder!!!«
Jawohl, da kam's an, das Rhinozeros, in voller Karriere, und ehe ich noch Zeit hatte, an den Hebelapparat zu springen, hatte unser Wagen schon einen Stoß empfangen, der ihn über den Haufen warf.
Aber das Automobil hatte doch ein bedeutendes Gewicht, das Tier mochte durch den Anprall selbst etwas betäubt worden sein, oder es war mit diesem Erfolg zufrieden, überhaupt ließ die Bestie es stets bei solch einem ersten Stoß bewenden — kurz, es schlug die Richtung ein, in die es durch den Anprall geworfen worden war, raste weiter, verschwand zwischen den Bäumen.
Also das ganze Automobil war umgekippt. Wir selbst waren ohne Schaden davongekommen. Der Käfig war zwar auf die Gittertür gefallen, aber auch auf der anderen Seite war noch eine vorhanden, die sich jetzt also über uns befand.
Als ich meine Glieder zusammengesucht und unverletzt gefunden hatte, musste ich zunächst meinem Unmut über den Wächter Luft machen, der so schlecht aufgepasst hatte. Er hätte das Rhinozeros kommen sehen müssen.
Da gewahrte ich, dass auf jenem Turme gar nicht mehr der Arbeiter stand, sondern Mr. Giblon, der uns gerade durch ein Opernglas betrachtete, obgleich die Entfernung gar keine so große war.
»He, Mr. Giblon, wo ist denn Sam?«
Phlegmatisch nahm der Yankee das Glas vom Auge.
»Ich brauchte ihn, zu einer Arbeit, übernahm seinen Posten!«, rief er zurück.
»Na, ich danke! Konnten Sie uns denn nicht warnen? Haben Sie das Vieh nicht kommen sehen?«
»I beg your pardon — blickte gerade nach einer anderen Richtung. Ist doch sonst alles gut abgelaufen, wie?«
»Das wohl, aber wie sollen wir nun wieder herauskommen?«
»Geht denn die obere Tür nicht zu öffnen?«
»Das schon, aber ich werde mich hüten, dies zu tun und herauszuspazieren!«
Wir hatten auch allen Grund, lieber in dem Käfig zu bleiben, bis wir abgeholt würden. Der Tierpark war ja so eng und so dicht bevölkert, dass man überall, wohin man auch blickte, ein Raubtier liegen oder kriechen sah. Bis zum Erscheinen des Nashorns hatten sich in einem Umkreis von zwanzig Schritten um uns zwei Löwen und ein halbes Dutzend andere Katzentiere gesonnt, und jetzt kehrten diese schon wieder auf ihr altes Fleckchen zurück, nur ein Königstiger zog es vor, uns noch näher auf den Leib zu rücken, legte sich keine fünf Schritt von uns entfernt nieder, leckte sich behaglich die Pranken. Diese Vertraulichkeit war ja auch so etwas, woraus man erkannte, dass sich diese Raubtiere hier doch nicht so ganz wie in der Freiheit fühlten.
»Herrjesens, so ä Biest!!«, schrie da Frettwurst auf.
Plötzlich war es von dem Ahornbaum, unter dem wir lagen, wie ein dicker Ast herabgefallen, und da hing dicht vor unserem Käfig eine Riesenschlange, eine indische Python, und züngelte durch die Gitterstäbe uns entgegen. Der Leib, der da herabhing, war reichlich vier Meter lang, und der hintere Körperteil, mit dem sie mehrmals einen dicken Ast umschlang, mochte nicht viel weniger messen.
In dem Tierpark waren noch mehrere Riesenschlangen vorhanden, von nur zwei Meter Länge bis zu neun oder gar zehn. Sie waren schwer zu beobachten und auch gar nicht zu fürchten. Diesen Riesenschlangen werden ja die ungeheuerlichsten Fabeln angedichtet. Ein gewissenhafter Forscher wie Alfred Brehm hat auch nicht einen einzigen Fall konstatieren können, dass eine Riesenschlange, amerikanische oder indische, wirklich einen lebendigen Menschen angegriffen und verschlungen hat.
Wenn man aber solch ein Ungeheuer dicht vor Augen hat, und zwar nicht nur solch ein elendes Exemplar, das in einer Kiste zwischen Decken und Wärmflaschen eben am Leben erhalten werden kann, dann ist man doch geneigt, lieber den Erzählungen der Eingeborenen und etwas aufschneidenden weißen Jägern zu glauben. Übrigens hat Brehm oft genug selbst zugeben müssen, dass er die Ehrlichkeitsliebe doch manchmal zu weit getrieben hat, dass es nicht immer weise ist, einzig und allein das zu glauben, was man mit eigenen Augen sehen und mit eigenen Händen packen kann. So hat Brehm bis in sein Alter auch die Existenz von riesenhaften Meerespolypen geleugnet, alle derartigen Erzählungen ins Reich der Fabel gewiesen, bis... er selbst bei Nizza ein derartiges fabelhaftes Ungetüm am Köder fing. Ein ehrliches Zugeständnis, dass man sich geirrt, macht nicht immer alles vorangegangene Leugnen und Spötteln wieder gut.
Kurz, ich prallte vor dem züngelnden Kopf nicht schlecht zurück. Dass durch die Gitterstäbe, die nur fünf bis sechs Zentimeter voneinander abstanden, dieser Kopf unmöglich hindurch konnte, vermochte mich auch nicht gleich zu beruhigen, Zudem öffnete die Schlange jetzt noch den Rachen, wohl nur, um einmal herzlich zu gähnen — dass Reptilien gähnen, kann man an jeder Eidechse beobachten — aber das Aufsperren dieses Rachens war ein derartig furchtbarer Anblick, dass ich mit einem Satze am anderen Ende des Käfigs stand, und dennoch traf mich noch hier ein so pestilenzialischer Lufthauch aus dem Rachen, dass mir doch fast gleich die Sinne vergehen wollten, und jetzt konnte ich begreifen, wie die Eingeborenen beider Kontinente behaupten, dass auch die Riesenschlangen giftig seien, nicht durch ihre Zähne, sondern mit einem Hauche ihres Atems alles Lebendige vergiften könnten. Es ist dazu gar nicht nötig, dass sie sich gerade in der Verdauungsperiode befinden.
Ich habe zur Schilderung unserer Lage reichlich eine Viertelstunde schreiben müssen. In Wirklichkeit spielte sich das natürlich alles in einem einzigen Augenblick ab. Herabfallen der Schlange, Züngeln, Gähnen und mein entsetztes Zurückspringen waren eins.
»Eine Waffe!!«, war mein erster Gedanke.
Eine solche hatte ich nie direkt bei mir gehabt, keinen Revolver, kein Jagdmesser. Aber in dem großen Wagenkasten befanden sich stets Waffen verschiedener Art, Revolver und leichte Schrotflinten, wie Donnerbüchsen schwersten Kalibers mit dazu gehöriger Munition. Die Versorgung dieses Waffenkastens war das Amt eines besonderen Arbeiters.
So sprang ich jetzt nach diesem Kasten, den gleichen Gedanken hatte wohl Frettwurst — nein, doch nicht, er griff neben diesen Verschlag, hob zu meinem Staunen, dessen ich doch noch etwas fähig war, seinen Leierkasten in die Höhe, von dessen Vorhandensein im Automobil ich gar nichts gewusst hatte, hatte sich mit einem Ruck den Tragriemen um den Nacken geworfen...
»Mädel ruck ruck ruck an meine griene Sei—ite, i hab di gar so gern, i mag di lei—ide...«
So spielte und sang Balduin Frettwurst der Schlange direkt in den noch immer geöffneten Rachen hinein, dabei ein so freundlich lächelndes Gesicht machend, wie es diesem Liedchen angemessen ist, und das war denn doch ein Anblick, dass ich erst einmal in ein schallendes Lachen ausbrechen musste.
Lange hielt ich mich freilich bei dieser humoristischen Stimmung nicht auf — »eine Waffe!«, war doch immer wieder mein nächster Gedanke, ich schlug den Deckel hoch — der Kasten war leer, keine einzige Waffe darin.
»Frettwurst, haben Sie einen Revolver?!«, schrie ich.
»Nee, nur enne Drehorgel. Awwer wenn'ch jetzt enn Fotografenabbarat hätte, das wird'ch zu gerne abfotografieren.«
»Mr. Giblon, wir haben keine einzige Waffe!!«, schrie ich hinüber.
»Was sagen Sie?«
»Hören Sie auf mit Ihrem Gejodel!«, herrschte ich meinen Kameraden an, der noch immer die Riesenschlange, die fortfuhr, in unseren Käfig zu züngeln, anleierte und ansang, und er hörte denn auch auf, sein Lied war sowieso beendet.
»Wir haben keine Waffen!!«, schrie ich nochmals und wurde jetzt verstanden.
»Im Kasten müssen doch welche sein.«
»Nein, keine einzige. Der Arbeiter hat sie wohl zum Putzen herausgenommen und nicht wieder hineingetan.«
Mr. Giblon zögerte auf seinem Turme recht lange, ehe er eine Antwort gab.
»Auch keinen eigenen Revolver?«
»Nein, gar nichts.«
»Gar nichts zum Schießen?«, vergewisserte sich der Yankee nochmals, was mir sofort etwas auffiel.
»Absolut nichts!«
Wieder eine lange Pause der Überlegung.
»Sie brauchen ja gar keine Waffen, Sie sind in dem Käfig doch ganz gesichert.«
Eigentlich hatte er recht, aber... Teufel noch einmal!
»Das Rhinozeros kommt nicht wieder«, fuhr Mr. Giblon von selbst fort.
»Woher wollen Sie denn das wissen?«
»Es ist in die Kiesgrube gestürzt, kann nicht wieder heraus.«
Auf der anderen Seite des Turmes, nach welcher Mr. Giblon schon immer geblickt hatte, befand sich eine Sandgrube, für Tiere angelegt, die sich gern im Sande wälzen. Wenn das Rhinozeros hineingestürzt war, dann glaubte ich schon, dass es mit seinem plumpen Leibe nicht wieder herauskonnte. Diesen Gefallen hätte es uns schon früher tun können, wenigstens fünf Minuten vorher.
»Mr. Giblon, holen Sie uns mit einem anderen Automobil ab!«
»Selbstverständlich!«
Aber eilig hatte es der Yankee hiermit nicht. Erst richtete er das Opernglas wieder lange nach der Sandgrube, dann wieder nach uns.
»Bitte, Mr. Giblon, beeilen Sie sich doch etwas!«
»Wozu denn?«
»Wir sitzen ja hier in einer ganz verdammten Patsche!«
»Aber wieso denn nur? Sie sind doch ganz sicher in dem Käfig.«
Endlich bequemte er sich doch zum Aufbruch, steckte bedächtig den Operngucker in das Futteral, verschwand von dem Turme.
Die Riesenschlange hatte sich wieder in die Höhe gezogen, auch ihren vorderen Körper um einen Ast geschlungen. Da lag sie, uns züngelnd mit ihren glitzernden Augen betrachtend.
»Die mechte uns zu gerne verschbeisen«, meinte Frettwurst.
»Mensch, wie kommen Sie denn zu Ihrem Leierkasten?«
»Nu, ich hawe ihn ähm mitgenomm. Wussten Se denn das nich? Ich dachte, wenn'ch so mit Sie alleene in dem Barke rumgutschiere, da geent'ch doch eegentlich a bisschen Musicke dazu machen, was das wohl uff die wilden Diere fier'n Eindruck machen dud. Heern Se, is das wahr, dass die Wilden ooch Schlangen verschbeisen dun, gelle he?«
»Gewiss, Schlangen werden von allen wilden Völkerschaften gegessen, und auch Europäer versichern, dass die meisten ein ganz gut schmeckendes Fleisch haben. Vor allen Dingen soll es immer so delikat weiß aussehen.«
»Nu awwer da — da mecht'ch doch diese Riesenschlange gebraten ham, awwer ganz — so ne Riesenbratwurscht fier finf Neigroschen.«
»Frettwurst, Sie machen Ihrem Namen alle Ehre«, lachte ich.
Er leierte und fingerte wieder an seiner Drehorgel, eine neue Melodie, er sang auch dazu, nach der Riesenschlange hinaufblinzelnd:
»Na, da gomme doch, gomme doch, kleiner Schäker, gomme doch, gomme doch, schbiel mit mir...«
Nicht die Riesenschlange kam, wohl aber, als hätte er diese Einladung auf sich bezogen, ein Löwe — oder vielmehr eine Löwin, eins der größten und schönsten Exemplare.
Es war hier eben doch nicht alles wie in der freien Wildnis. Die Raubtiere wussten, dass sie von den Menschen nichts zu fürchten hatten, gejagt wurden sie ja nicht, hatten sich auch schon an die Automobile gewöhnt.
Die Löwin kam bis dicht an den Käfig, äugte zu uns herein.
»Gomme doch, gomme doch, schbiel mit mir«, leierte und sang Frettwurst, und da richtete sich das Tier auch noch auf, blickte äußerst gutmütig auf uns.
»Sähn Se, ich bin dr reene Orfeis, gelle he? Ja, ja, de Macht der Musicke, 's is doch nich ganz so ohne. Na, de wunderscht dich wohl, dass de Sache jetzt mal umgedreht is, weil mir in'n Gäfig sitzen? Ham Se denn ooch Engdree bezahlt? Ja? Na da ist's ja gut. Meine hochgeehrten Herrschaften, Se sähn hier ä ganz eegentiemliches Raubdier, fier gewehnlich Mensch genannt, uff ladeinisch homo, un wenn'r noch gleene is, homungulus... na, was willst de denn, gelle he?«
Die aufgerichtete Löwin kratzte an den Stäben, bewegte dazu eigentümlich den Kopf.
»Sie sin wohl noch ä Freilein? Gelle he? Ich soll Sie wohl ä bis'ch garresie... herrjesens, so ä Luderbeen!«
Es war doch nicht zu spaßen mit dem Tiere. Es hatte Frettwurst zu fassen gesucht, zwischen den Stäben hindurch konnte die mächtige Pranke freilich nicht, aber die Krallen genügten schon, und diese hatten den Jackenärmel des Männchens im Nu total zerfetzt. Dazu ein schreckliches Knurren und Fauchen.

»Sehen Sie sich vor, Frettwurst, diesmal ist es noch gut abgelaufen«, warnte ich, nachdem ich mich überzeugt, dass er keine Kratzwunde abbekommen hatte. Denn der kleinste Riss konnte schon eine Blutvergiftung nach sich ziehen, weil solche Tiere doch immer mit Fleischresten besudelte Krallen haben — Leichengift — und das ist es ja eben, was alle von Raubtieren geschlagenen Wunden so furchtbar macht. Wenn sie keine Blutvergiftung nach sich ziehen, so brechen sie nach gewisser Zeit doch immer wieder auf. Mit Narben, die von Raubtiertatzen herrühren, können wohl sehr wenige Menschen prahlen, und dann sind sie gewiss in Behandlung von Eingeborenen gewesen, welche alle ihre Geheimmittel haben. Es ist dies eine Sache, die in Jugendschriften und dergleichen Literatur immer vergessen wird, und bei derartigen Jagderzählungen merkt man hieraus auch, ob sie auf Wahrheit beruhen oder erfunden sind.
»I, da wird'ch das ähm ooch mit zusammenflicken«, meinte Frettwurst, setzte sich sofort hin, brachte ein Nähzeug zum Vorschein und begann den Jackenärmel auszubessern, Die Löwin verharrte in ihrer aufgerichteten Stellung, schaute ihm zu, immer knurrend und fauchend, halb ihre Zähne zeigend. Gar so harmlos waren diese Tiere also doch nicht.
»Willst de fort? Willst de glei fort? Nich? Na warte, da will'ch mir errscht enne Feife schtobben, dann werd'ch ä andres Wärtchen mit dir schbrechen.«
Auch seinen Spazierstock hatte er mit ins Automobil gebracht, Porzellankopf und Stiefel und Spitze in der Tasche, selbst die Quaste mit der Schnur durfte nicht an der Großvaterpfeife fehlen. Aus seinem Bauche brachte er gleich zwei Schweinsblasen zum Vorschein, besah sich die beiden Sorten Tabak, stopfte, brannte an, dampfte mächtig.
»So, was sagst de denn nu, gelle he? Siehst de wohl!«
Er hatte der Löwin solch eine mächtige Wolke ins Gesicht geblasen, und urkomisch sah es aus, wie das Tier plötzlich herabfiel und mit eingezogenem Schwanze Reißaus nahm, dabei heftig niesend und auch noch einen anderen Laut von sich gebend, der akkurat wie ein Husten klang.
Ja, das war auch nicht zu verwundern. Bisher hatte die Großvaterpfeife immer einen gemütlichen, aromatisch riechenden Qualm von sich gegeben, aber dieser Tabak hier war ein Luderzeug erster Güte, der warf ja auch den handfestesten Mann um, wenn er nicht gerade auf diese Sorte geeicht war.
»Jaa, das ist Sie nämlich Kreller A B gemischt mit österreichischem Kommisstobak, den gann ooch gee Rhinozeros vertragen — sogar geens mit zwee Hernern uff dr Nase.«
»Mensch, blasen Sie den Qualm nach der Leeseite, das wird auch mir zu viel, obwohl ich die stärkste Zigarre vertrage — wie kommen Sie denn hier zu österreichischem Kommisstabak?«
»Nu, ich hawwe doch meinen ganzen Buckel davon voll.«
Er hatte sich, wie ich hörte, in Marseille von österreichischen Matrosen noch einmal reichlich mit seinem Leibfutter versorgt. Mit diesem Kommisstabak, der in Österreich gebaut wird, eine ganz reine, aber auch furchtbar schwere Sorte — die österreichischen Soldaten ›fassen‹ ihn mit oder sogar zum Teil statt der Löhnung — war er immer sehr sparsam umgegangen, anderen Knaster konnte er hier in Amerika ja genug bekommen, obgleich er hier nicht aus der langen Pfeife geraucht, ganz anders verarbeitet wird.
Sein umfangreiches Felleisen hatte er nicht mit ins Automobil gebracht, nur Drehorgel und Spazierstock mit der dazu nötigen Munition.
»Ja, wo bleibt denn aber Mr. Giblon?«
Da kam er schon, in einem kleineren Käfigautomobil.
»Sie haben wirklich gar keine Schusswaffe?«, war seine erste Frage, als er in einiger Entfernung von uns hielt.
Mir fiel diese Frage wiederum sehr auf, ich dachte jedoch im Augenblick, er wundere sich nur über meine Sorglosigkeit, obgleich wir ja noch gar keine Waffen gebraucht, keiner bedurft hatten.
»Keine einzige. Wie gesagt, der Arbeiter hat sie wohl zum Reinigen herausgenommen und nicht wieder hineingetan, ich habe mich davon nicht überzeugt, hielt es für selbstverständlich, dass sie sich drin befanden.«
»Sie haben auch keinen eigenen Revolver?«
»Auch nicht. Nur ein Taschenmesser.«
»Und der andere da?«
»Hat auch nur ein Taschenmesser«, entgegnete ich, wurde nun aber schon ungeduldig.
Eine Minute verstrich, und Mr. Giblon machte keine Anstalten, näher heranzufahren. Er schien uns mit Interesse zu betrachten.
»Sie müssen wohl etwas näher heranfahren.«
»Wozu?«
»Nun, um uns abzuholen, dass wir in Ihren Käfig steigen können. Hier kann jeder Schritt im Freien zum Verderben werden.«
»Hm.«
Wieder eine lange Pause. Der Yankee nahm die knöchernen Hände von dem Steuerrad und rieb sie sich.
»Sie würden nicht wagen, diese drei Schritte zu tun?«
»Was heißt da wagen, wenn man es nicht nötig hat!«, wurde ich immer ungeduldiger, ahnte aber sonst noch nichts.
»Es sind nur drei Schritte.«
»Nein, das sind sogar fünf — aber wenn es auch nur ein einziger wäre — Sie können doch dicht heranfahren.«
»Ich kann es wohl, aber ich tue es nicht«, klang es kalt zurück.
»Was?«, fuhr ich jetzt stutzend empor.
»Ich habe Ihnen doch vorhin einen Vorschlag gemacht.
»Was für einen Vorschlag?«
»Wie Sie sich oder für Ihre Erben eine stattliche Summe verdienen können.«
Nun allerdings wusste ich genug.
»Herr, Sie gedenken uns doch hier nicht etwa den wilden Tieren auszuliefern?!«
»Das beabsichtige ich allerdings, und jetzt hätte ich nicht erst nötig, Ihnen dafür eine Prämie anzubieten.«
»Mich ooch?«, fragte zunächst Frettwurst, während ich im Augenblick noch ganz starr war.
Dieser gelehrte Yankee schien auch etwas Deutsch zu verstehen, sogar den sächsischen Dialekt.
»Jawohl, Sie befinden sich ganz in der gleichen Lage, und auch Sie haben ja mein entgegenkommendes des Anerbieten zurückgewiesen — also Ihre eigene Schuld.«
»Herr, Sie wollen an uns zum Mörder werden?!«, fuhr ich wieder empor.
»A bah!«, war hierauf seine einzige Antwort, und jetzt fing er sogar zu grinsen an, während er sich die dünnen Hände rieb.
»Mir sin ähm Versuchsgarnickel«, ließ sich Frettwurst, der dabei seine Pfeife nicht ausgehen ließ, wieder vernehmen, »un ob die nu zwee oder vier Beene ham, das is dem doch ganz schnubbe. Der hat doch ooch nich umsonst solche schillernde Oogen.«
»Wie wollen Sie denn das anfangen, uns den wilden Tieren zum Fraße auszuliefern? Wie denken Sie sich denn das eigentlich?«, wurde ich jetzt ebenfalls spöttisch.
»Sie haben doch weder Wasser noch Proviant im Wagen.«
»Das allerdings nicht«, gab ich gleich unumwunden zu.
»Nun, Hunger und Durst werden Sie schon bald genug aus dem Käfig heraustreiben.«
»Sie wollen uns wohl einen Futternapf in einiger Entfernung hinsetzen?«
»Erraten, und ich werde dafür sorgen, dass Sie nicht gleich den ganzen Futternapf mit in den Käfig nehmen, sondern nur immer eine Handvoll herausholen können.«
»Mensch, Sie sind ja ein Scheusal!«, platzte ich jetzt los.
»Ich bin ein Mann der Wissenschaft und weiß, was ich dieser schuldig bin — meinetwegen auch als Scheusal«, erklang es ebenso höhnisch wie mit wirklichem Stolz zurück.
»Sie vergessen aber wohl die übrigen Diener und Arbeiter.«
»Was werden sich die um Sie kümmern, wenn Sie einige Tage und Nächte im Parke verweilen oder sich doch nicht im Hause zeigen?«
Er hatte recht, furchtbar recht! Ich habe von der Hausordnung noch gar nicht gesprochen. Sie war ganz amerikanisch, Niemand kümmerte sich um den anderen, zudem verweilten manchmal Diener als Begleiter des Gelehrten tage- und nächtelang in einem Turm, erhielten dort ihr Essen, wenn sie sich nicht gleich verproviantierten — genug, wir konnten hier tatsächlich solch einem Schicksal überlassen bleiben, ohne dass sich jemand um uns gekümmert hätte. Vom Hause aus konnten wir auch nicht erblickt werden, und verschwanden wir für immer — na, dann hatten wir eben in aller Stille unseren Abschied genommen — oder jene beiden Diener, unsere Vorgänger, waren ja auch ›durch eigene Schuld‹ den Raubtieren zum Opfer gefallen, und keiner von den anderen hatte einen Argwohn, dass es doch vielleicht nicht so ohne ›eigene Schuld‹ geschehen war. Jedenfalls fühlte sich der edle Yankee absolut sicher.
Wenn ich nun jetzt schnell die obere Tür öffnete und das andere Automobil zu erreichen suchte?
Torheit! Ehe ich dort war, hatte Giblon sein Fahrzeug schon längst wieder in schnellsten Gang gebracht, oder er schoss mich ganz einfach nieder.
»Tun Sie, was Sie für gut befinden«, sagte ich kurz.
»Un denken Se nur nich, dass mir fier immer hier hocken bleim wärn«, setzte Frettwurst noch hinzu.
»Das denke ich ebenfalls«, ergänzte nun auch ich, »und dann werden wir fürchterliche Abrechnung mit Ihnen halten.«
Auch der Yankee verzichtete auf weitere Erklärungen, er fuhr wieder davon.
»Na, was sagst de nu dazu?«, fing Frettwurst zu spielen an, und ich vernahm auch ganz deutlich die Worte dieses bekannten Gassenhauers.
»Ja, Frettwurst, wir sitzen da in einer ekligen Falle.«
»Nu, wieso denne?«
»Wissen Sie einen Rat, wie wir hier wieder herauskommen?«
»Nu, warum denn nich? Mir ham doch noch enne Tür.«
»Sie meinen, dass wir wagen dürfen, durch den ganzen Tierpark zu marschieren?«
Ja, Frettwurst hielt dies für weiter gar nichts. Er glaubte nicht daran, dass uns irgendein Tier anfallen würde. Mag dies als Beispiel für das genügen, worüber wir uns längere Zeit unterhielten. Gleichzeitig aber war Frettwurst auch der Meinung, dass wir von anderer Seite keine Hilfe zu erwarten hätten.
»Nun gut — wenn er aber nun die Tore geschlossen hält?«
»Das ist überhaupt der Fall. Wir müssen über die Mauer. Mit Hilfe von abgebrochenen Baumstämmen, da wegen der Affen wohl kein Baum dicht an dieser steht, werden wir dies schon bewerkstelligen können. Oder sollten wir das Automobil nicht aufrichten können?«
Das bezweifelte ich sehr. Das Ding war doch außerordentlich schwer, und ehe wir Hebebäume und dergleichen herstellten, konnten wir schon längst an der Mauer sein. Während jener Arbeit konnten wir doch ebenso gut gefressen werden. Außerdem war durch den schweren Sturz an der Maschinerie sicher etwas defekt geworden.
»Dann müssen wir eben über die Mauer«, entschied Frettwurst, dessen sächsischen Dialekt ich bei solchen ernsten Gelegenheiten nicht wiedergeben will. »Dazu aber warten wir wohl am besten die Nacht ab.«
Dem konnte ich nur beistimmen. Mr. Giblon hätte wohl unsere Flucht zu verhindern gewusst. Waren wir ihm doch jetzt nicht nur mehr interessante Versuchsobjekte, sondern konnten wir ihn doch nun auch schon des direkten Verbrechens anklagen.
»Oder ich wüsste auch noch ein anderes Mittel«, meinte Frettwurst nach einer Weile, während welcher er den letzten Rest seines Tabaks verpafft hatte, denn es stank jetzt mörderlich.
»Was für eins?«
»Hm, ich habe doch vorhin eine Flasche gesehen«, sagte er, sich am Boden des Käfigs umblickend.
Das stimmte, auch ich hatte sie gesehen — eine Seltersflasche, aber eine leere.
»Ah, da is se! Na, warten Se mal!«
Bedächtig nahm er von dem Pfeifenrohr den Hornstiefel ab und goss den Inhalt, eine braune Brühe, aber ziemlich dünnflüssig, reichlich ein halbes Schnittglas, in die Selterswasserflasche.
»So«, sagte er, die Flasche in seiner bedächtigen Weise wieder schließend und sie beiseite setzend.
»Was wollen Sie denn damit?«, fragte ich, förmlich entsetzt, aus einem Grunde, den man gleich hören wird.
»Den Schmand heb'ch mir uff.«
»Sie trinken ihn doch nicht etwa?«
»Ich? Nee, Sie? Awwer ich weeß schon, 's gibt Leite, die den Schmand aus'n Feifenschtiewel saufen dun.«
Ja, ich selbst war einmal Zeuge geworden, hatte einen Soldaten gesehen, der den Porzellanstiefel von seiner halblangen Tabakspfeife abnahm und sich die braune Sauce in einem Strahl mit Wohlbehagen in den Rachen laufen ließ, und dann hörte ich, dass dies besonders Fuhrleute täten, dass sie Wohlgeschmack an ihrem eigenen mit Nikotin durchsetzten Speichel fänden.
Aber gleich wurde ich eines anderen belehrt.
»Nee, das du ich nu nich. So weit bin'ch doch noch nich runter. Ich brieme ooch nich. Awwer schließlich — ieber'n Geschmack is nich zu schtreiten. Un Sie denken wohl, dass das Schbucke is?«
»Was denn sonst?«
»Nee, das is geene Schbucke«, wurde Meister Frettwurst jetzt in Bezug auf das Pfeiferauchen wissenschaftlich, »denn mer gann doch ooch so roochen, dass gee Drebbchen Schbucke in de Rehre gommt, und 's wird doch immer solche Sauce in'n Schtiewel sein.«
»Ja, was ist es denn sonst?«
»Das is nischt andersch als de Feichtggeet von dr atmosphärschen Luft. Die wird beim Einziehen, wenn sie durch den glühenden Tabak geht, noch mehr verflüchtigt und verdichtet sich dann in dem Rohre wieder zu Wasser, aber nur, wenn das Rohr lang genug ist. Je kürzer das Rohr, desto weniger wird sich im Stiefel ansammeln, und um so mehr, je länger es ist. Natürlich nimmt dieser Dampf, sobald er zu Wasser wird, auch viel Nikotin und andere Unreinlichkeiten in sich auf.«
So sprach Meister Frettwurst, aber immer in seinem sächsischen Dialekt, und ich hatte wiederum etwas gelernt, was ich noch nicht gewusst hatte. Der Mensch lernt eben nie aus. Übrigens gar nicht so uninteressant. Wenigstens vielleicht wissenswerter, als wenn man aus jedem schmutzigen Häufchen, frisch oder vertrocknet, sagen kann, welcher Vogel es hat fallen lassen. Und das ist nicht etwa ein Witz. Diese ›Wissenschaft‹ wurde im achtzehnten Jahrhundert und noch im Anfange des vorigen besonders von Geistlichen mit Leidenschaft betrieben.
»Ja, was hat aber nun dieser Schmand mit unserer Lage zu tun?«
»Heern Se mich nur an. Se wissen doch, dass ich geen Dierchen was zu leide dun gann.«
»Ja, das habe ich schon gemerkt.«
»Glaum Se da, dass'ch schon emmal än Menschen abgemorkst hawe?«
»Nein, das sieht Ihnen gar nicht ähnlich. Höchstens haben Sie ihm mit Ihrer Musik ein Loch in den Bauch geleiert.«
»Glaum Se awer, dass ich's dennoch fertg brächte?«
»Einen Menschen abzumorksen? Etwa den Mr. Giblon?«
»Ja. Das brächt'ch fertg. Awer de Abmorkserei will ich liewer Ihnen iewerlassen, ich hawe so gar geene Iwung dadrinnen, un vielleicht is 's ooch gar nich netg.«
Er setzte mir seinen Plan auseinander. Wenn Giblon mit seinem Automobil noch einmal hierherkäme, wollten wir ihn so nahe wie möglich herbeilocken, dann sollte ich schnell aus dem Käfig schlüpfen und zu ihm hinspringen, ihn zu fassen suchen...
So weit hatte ich schon dieselbe Idee gefasst gehabt, sie aber als unausführbar verworfen. Frettwurst wusste sie vielleicht möglich zu machen.
»Un ich hawe unterdessen mei Feifenrohr mit dem Schmand gefillt un blase ihm die ganze Sauce direktemang grade ganz genau in de Visasche, gelle he? Dass'r da nich mehr aus'n Ogen gucken gann, da druff gann ich Ihnen, wenn Se's winschen, Brief un Siegel gäm. Un wenn Se'n nicht richtig backen genn oder wenn er sich wehren will — na, was meen' S'n dazu, gelle he?«
Ja, ich war bereit, diesen Schuft auch mit meinem Messer abzunicken.
Wir warteten eine ganze Weile, aber kein Automobil wollte wiederkommen. Nur die Raubtiere wurden immer dreister, als ob sie schon wüssten, dass wir für sie zum Fraße bestimmt seien. Und sie hatten gestern und heute noch kein Futter bekommen, weder lebendes noch totes.
»Er hatte doch gesagt, er wollte uns... da ist er — auf dem Turme!«
Ja, da stand er, äugte uns durch den Operngucker an. Dann verschwand er, gleich darauf aber öffnete er unten die Turmtür, rollte ein Fass heraus, baute noch anderes auf, was wir nicht richtig unterscheiden konnten, verschwand wieder im Turm, hinter sich die Tür schließend.
Er selbst hatte sich also nicht gefürchtet, das Freie zu betreten. Freilich war das ja auch etwas ganz anderes als ein Spaziergang durch den Park. Die Umgebung des Turmes war ziemlich frei, er hatte sich ja erst vergewissern können, dass kein Raubtier in der Nähe war.
Wir brauchten nicht lange in Ungewissheit zu sein, denn bald kam er in seinem Automobil, aus der Richtung vom Hause her, nach dem er sich eben durch den Tunnel erst begeben hatte.
Wir hatten unsere letzte Beratung gehalten, waren bereit, ihn zu empfangen. Nur schade, dass er in einer noch größeren Entfernung hielt als das erste Mal, zehn Schritt weit ab.
»Wir müssen ihn näher locken«, flüsterte Frettwurst, Pfeifenrohr und die Flasche mit der deliziösen Sauce schon handbereit, »so weit gann'ch nich busten.«
»Haben Sie Ihre Ansicht unterdessen geändert?«, eröffnete Mr. Giblon das Gespräch.
»Ob wir uns den Raubtieren freiwillig ausliefern wollen? Nein, keiner von uns!«
»Ich bin noch immer bereit, eine hohe Prämie dafür zu zahlen.«
Der verwendete das Wort ›Prämie‹ so wie die Versicherungsgesellschaften, bei denen ich die Bedeutung auch nie recht verstanden habe. Oder man muss jede Versicherung, wie es das englische Gesetz auch wirklich tut, als eine Wette betrachten — und etwas Anderes ist es schließlich auch nicht. Ich behaupte, dass ich ein gewisses Alter nicht erreiche, eine andere Partei wettet dagegen, und wenn ich gewinne, hat sie eben zu zahlen.
»Geben Sie sich keine Mühe!«
»Denken Sie nicht etwa, dass ein Entkommen möglich ist, und ich habe auch keine Entdeckung zu fürchten. Sie sind einfach durch eigene Fahrlässigkeit den Raubtieren zum Opfer gefallen.«
»Dass Sie dies erwähnen, zeigt mir deutlich, dass Sie sich dennoch nicht so ganz sicher fühlen, und wenn Sie auch dem irdischen Richter entgehen sollten, ich glaube noch an einen anderen.«
Denn das tue ich — sonst würde ich gar nicht wagen, so etwas auszusprechen, am allerwenigsten, um mein erbärmliches bisschen Leben zu retten — und wenn ich mir diesen anderen Richter auch nicht als einen alten Mann auf dem Himmelsthrone sitzend vorstelle.
»Ah bah!«, lautete seine verächtliche Antwort. »Gut, so erfüllen Sie Ihren Zweck eben in anderer Weise. Dort vor der Tür des Turmes steht ein Fässchen mit Wasser, auch verschiedener Proviant befindet sich dort. Wenn Sie also Durst und Hunger haben, so begeben Sie sich nur hin. Es ist nicht nötig, dass Sie ein Gefäß mitnehmen, um sich von dort Vorrat an Wasser und Speisen zu holen. Es ist Vorsorge getroffen, dass Sie nur dort Ihren Durst löschen können, Sie müssen an einem Rohre saugen, und ebenso erhalten Sie wie aus einem Automaten immer nur ein wenig Brot und Fleisch.«
Ohne Weiteres ließ Giblon sein Automobil zurückgehen.
Bis jetzt hatte ich gesprochen, wie es meine ehrliche Überzeugung gewesen war, nun musste ich einlenken. Frettwurst sollte diese Rolle des flehenden Andersgesinnten nicht spielen, weil der Yankee doch vielleicht nicht genug Deutsch verstand.
»Mr. Giblon«, rief ich dem davonfahrenden Automobil mit möglichst kläglicher Stimme nach.
Es hielt noch einmal.
»Was wünschen Sie noch?«
»Können Sie es denn wirklich übers Herz bringen, uns solch einem fürchterlichen Schicksale auszuliefern?«
»Dumme Frage! Ich bin ein Diener der Wissenschaft und weiß, was ich ihr schuldig bin.«
»Ja, wenn es freilich so Ihr Ernst ist — dann denke ich doch lieber an eine mir liebe Person...«
»Nein, nein«, wurde ich unterbrochen, »jetzt ist es zu spät, ich habe meinen Entschluss nun schon gefasst, und den ändere ich prinzipiell nie, das schwächt jedes Mal die Energie. Nun werden Sie gezwungen, das zu tun, worauf Sie vorhin nicht freiwillig eingehen wollten. Überdies spare ich ja dabei mein Geld, es ist mir auch sonst viel interessanter.«
Und er fuhr weiter. Die List war missglückt. Ich hatte einen Kontrakt oder etwas Ähnliches fordern wollen, er hätte mir etwas überreichen sollen, wozu er ziemlich dicht an unseren Käfig kommen musste.
Na, dann gut, dann befreiten wir uns eben selbst und zogen diesen edlen Yankee noch zur Rechenschaft. So fasste es auch Frettwurst auf.
»Schweinehuuuund!!!«, rief er dem Davonfahrenden nach, und dann intonierte er auf seiner Drehorgel zum Abschied einen Gassenhauer, der damals entstanden war, mit so zynischem Inhalt, dass ich ihn nicht wiedergeben kann.
So, nun waren wir beide wieder hübsch beisammen. Frettwurst rauchte seinen Kommisstabak, ich kaute ihn als Ersatz von anderem, und dabei lösten wir gesprächsweise die tiefsten Menschheitsprobleme.
Giblon zeigte sich noch einmal auf dem Turme, dann sahen wir ihn nicht mehr. Dass er uns aber nicht aus dem Augen ließ, war selbstverständlich. Der Turm hatte Gucklöcher genug.
Einige Stunden waren vergangen, Frettwursts Uhr zeigte auf vier, als wir einander gestanden, Hunger zu haben und noch mehr Durst.
»Na, da schbazieren mir ganz eefach mal hin.«
Ich will nicht erörtern, was wir wegen dieses Spazierganges erwogen, wir hielten uns auch gar nicht lange damit auf, erst wollten wir einmal die obere Tür aufmachen... und da zeigte sich, dass wir auch unseren früheren Kriegsplan, wie ich schnell aus dem Käfig springen und den Yankee ergreifen sollte, gar nicht hätten ausführen können.
Die obere Gittertür ging nämlich nicht auf. Das Schloss, innen aufzuklinken, schien ganz in Ordnung zu sein, ließ sich aber eben nicht öffnen. Durch den heftigen Sturz musste etwas an dem inneren Mechanismus gebrochen sein. Das entdeckten wir erst jetzt, wir hatten ja noch gar nicht versucht, diese Tür zu öffnen.
Ich fasse mich kurz, will diese Episode schnell zu Ende bringen — zu einem Schlusse, den der geneigte Leser wohl schwerlich erwartet haben wird. Unsere Bemühungen, die Tür zu öffnen, blieben fruchtlos. Wir riefen nach Mr. Giblon — er ließ sich nicht sehen.
Wir taten alles, was Kraft und Geist leisten können, um die Tür zu öffnen, allein es wollte nicht gelingen. Der Abend brach an, der Durst wurde peinigend, und Mr. Giblon wollte auf oder an dem Turme nicht sichtbar werden.
Unterdessen hatten sich unsere Bemühungen geregelt. Ich hatte in dem Werkzeugkasten eine kleine Feile gefunden. Mit dem schon sehr stumpfen Instrument feilten wir abwechselnd die ganze Nacht hindurch. Ob uns Mr. Giblon hier lieber verschmachten sehen wollte, anstatt uns den wilden Tieren auszuliefern, war uns sehr gleichgültig. Wir wollten Wasser, Wasser, Wasser! Und dort stand ja ein ganzes Fass.
Der Morgen begann zu grauen, die Raubtierstimmen verstummten schon wieder, als wir an der letzten Eisenstange feilten, die uns den Weg zur Freiheit versperrte — zu einer Freiheit, die für uns vielleicht den Tod bedeutete. Aber dieser Möglichkeit sieht sich wohl jeder Ausbrecher gegenüber.
Die letzte Stange wurde beseitigt, wir rannten nach dem Turme, ohne vorher erst lange Besprechungen gehalten zu haben. Vor uns sprang ein Tiger auf und floh davon... mehr weiß ich nicht. Aber das weiß ich, dass ich, als wir das Wasserfass, aus dem eine Rohre hervorsah, erreicht hatten, allen Durst vergessen hatte.
Ein grässlicher Anblick erwartete uns.
Da lag, nicht weit entfernt von dem Turme, eine Riesenschlange, vielleicht sechs bis sieben Meter lang, und solche von zehn Metern Länge sind wirklich schon gemessen worden, auch wir hatten größere als diese hier — ihren hinteren Teil wand sie in krampfhaften Zuckungen, während der vordere Teil still lag, er war unförmlich angeschwollen, der Rachen fürchterlich weit aufgerissen... und aus diesem Rachen blickte Mr. Giblons Kopf!
Tot war er natürlich schon. Das Gesicht, wie der Erdboden rings herum, entsetzlich mit einem stinkenden Schleim überzogen. Und dennoch ganz deutlich noch erkennbar. Sogar die schottische Mütze, die er immer bis über die Ohren gezogen trug, hatte er noch auf dem Kopfe. Außerdem sahen aus dem Rachen noch seine beiden Hände, dicht neben dem Kopfe, den die Schlange als letzten Rest des ganzen Körpers unter fürchterlichen Anstrengungen hinterzuwürgen suchte, und bei jedem Druck quollen in dem Menschenkopfe die Augen hervor, die Hände schwankten auf und nieder, so mit den Bewegungen eines mauschelnden Juden, ganz, als wäre er noch lebendig... ein entsetzlicher Anblick!
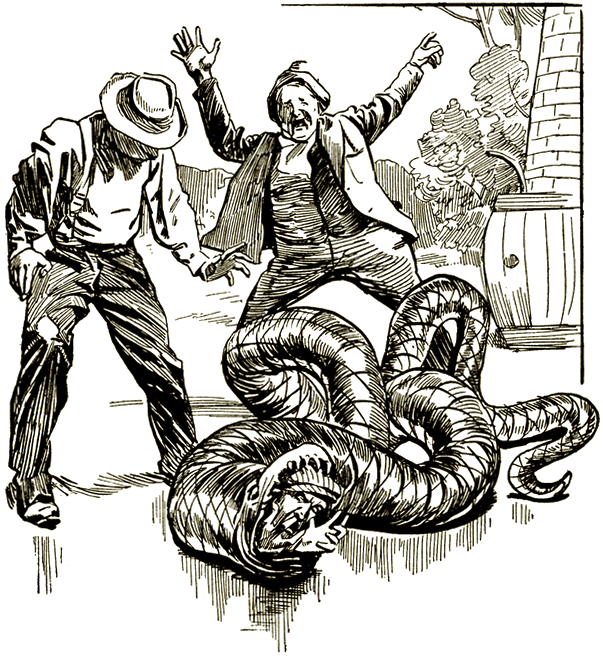
Wie war Mr. Giblon ein Opfer der Riesenschlange, die keinen lebendigen Menschen verschlingen soll, geworden? Nun, es war einfach genug. Er war einmal aus der Türe getreten, und die Riesenschlange lässt sich von den Menschen eben keine Vorschriften machen.
Wir stellten jetzt aber keine derartigen Erwägungen an. Die Turmtür war nur angelehnt, und wir dachten nicht daran, hier am Fasse unseren Durst zu löschen, sondern wir rannten durch den unterirdischen Tunnel nach dem Wohnhause.
Hier meldeten wir kurz, was man dort am Turme finden würde, dann schnallte Frettwurst seinen künstlichen Buckel an, stopfte sich den Leierkasten, der durch ein anderes Automobil geholt wurde, vorn in die Hose, und... wir waren reisefertig, machten von dieser Bereitschaft auch gleich Gebrauch. Es trieb uns etwas mit Macht von hinnen... ich weiß selbst nicht was.
Zeitungen habe ich damals nicht in die Hand bekommen. Erst viel später hörte ich, dass der Wildpark alsbald von einem reichen Sportsman gekauft wurde, der mit seinen Freunden nach und nach den ganzen Tierbestand abschoss.
So endete diese zehntägige Arbeitsperiode, die ich in meinen Erinnerungen nicht vermissen möchte.
Wir wanderten weiter auf San Francisco zu. Es war ja überhaupt erst der Anfang unserer gemeinsamen Reise gewesen. Da ich Frettwursten ausführlich habe erzählen lassen, auf welche Weise er walzte und musizierte, brauche ich nicht erst zu schildern, wie es uns erging, denn es war ganz genau dasselbe.
Wir wurden überall gastfreundlich aufgenommen, und wo Menschansammlungen waren, die über Geld verfügten, da heimsten wir gemünzten Lohn ein. Ja, es war ganz interessant, wir kamen mit Cowboys und mit Goldgräbern zusammen, aber ich wüsste nicht, was ich da Bemerkenswertes hervorheben sollte. Wenn wir Geld oder Goldstaub hatten, amüsierten wir uns einmal in der nächsten Stadt, und was übrig blieb, das gaben wir dem ersten Besten, der es nötiger hatte als wir. Dabei erlebte ich auch einige Liebesabenteuerchen, halte sie aber ebenso wenig für erwähnenswert,
Mir wurde die Geschichte nach und nach langweilig. Es wollte uns durchaus niemand anfallen, niemals wieder brauchten wir zu hungern und zu dursten. Ja, es wurde mir mit der Zeit langweilig. Das heißt, nicht die Gesellschaft Frettwursts. Ich glaube, dessen endlose Schwätzerei hätte ich nie überdrüssig bekommen. Aber ich sehnte mich nach etwas mehr Tätigkeit, oder überhaupt nach einer anderen Abwechslung, als dieses Vagabundenleben mit sich brachte. Es war am zwölften oder dreizehnten Tage unserer Reise, d. h., vom Aufbruch aus jenem Tierpark an gerechnet. Wir, die wir ja nur langsam bummelten, hatten erst die Hälfte der siebzig Meilen zurückgelegt, als wir einen kleinen See erreichten, für einen Teich zu groß, von wilden oder wahrscheinlicher zahmen Schwänen belebt, ziemlich in der Mitte eine bewaldete Insel, zwischen dem grünen Laub leuchteten weiße Mauern.
Es war ein herrschaftlicher Sitz. Wir befanden uns immer in ganz kultivierten Gegenden.
Lieblich aber war der Anblick. Balduin Frettwurst genoss ihn in seiner sinnigen Weise, indem er die Hände über seinen Kastenbauche faltete und stillvergnügt mit den Äuglein blinzelte, natürlich auch zuletzt in die nun schon klassisch gewordenen Worte ausbrechend:
»Nee, heern Se, is Sie das awwer scheene! Wenn'ch jetzt enn Fotografenabbarat hätte, das wird'ch abfotografiern!«
Ich hatte das mit dem ›abfotografiern‹ nun schon zum so und so viel hundertsten Male gehört, und dennoch fiel mir zum ersten Male die Frage ein:
»Ja, Teufel noch einmal, wenn Sie so gern fotografieren oder abfotografieren möchten, warum kaufen Sie sich denn nicht einen Fotografenapparat? Gelegenheit dazu haben Sie doch oft genug gehabt, und zu lernen ist das auch nicht so schwer, und Sie schleppen doch sonst genug unnützes Zeug mit sich herum!«
Meister Frettwurst blieb mir das Warum nicht schuldig.
»Warum ich mir geen Fotografenabbarat goofe? Nee, heern Se, sähn Se, wenn'ch errscht een hawwe, dann hätt'ch doch geen Wunsch mehr, een ham zu wollen, un dann wär doch's Vergniegen vorbei.«
Dunkel war der Rede Sinn — doch nicht so ganz für mich. Es ist gerade der griechische Philosoph Heraklit gewesen, den, man wegen seiner schwer zu verstehenden, symbolischen Schreibweise den Dunklen nennt — sein scharfsinnigster Ausleger ist der durch Anderes bekannter gewordene Ferdinand Lassalle — der mit eben denselben Gründen den Geiz zu entschuldigen sucht. Alle Sehnsucht, besonders auch die nach Genuss, ist ihm etwas Reales, solange sie unbefriedigt bleibt. Der Geizhals kann dadurch, dass er fortwährend Wünsche hat, diese aber nicht befriedigt, glücklich sein.
Balduin Frettwurst hatte Heraklit den Dunklen ganz sicher nicht gelesen, hatte diese Weisheit ganz allein aus sich selber geboren. Das Männchen wimmelte überhaupt von Weisheit wie ein Kadaver von Maden.
»Ach, wenn'ch die Insel hätte, was'ch da draus machen wollte!«, ließ sich Frettwurst dann weiter vernehmen.
»Nun, was würden Sie denn draus machen?«
»Nu, nich so ä Haus mit vier Wänden hinbaun un ohmdruff ä Dach.«
»Was denn sonst? Vielleicht ein Haus mit nur zwei Wänden?«
»Nee, gar gee Haus — enne Hehle wird'ch mir anlegen un Robinson schbieln.«
Und im Weitergehen wurde mir offenbar, dass dieses alte Männchen, welches demnächst zusammenschrumpeln würde, voll der idealistischsten und phantastischsten Robinsongedanken steckte, wie sie nur ein zehnjähriger Junge aushecken kann. Wirklich, von dieser Seite hatte ich Frettwursten noch gar nicht kennen gelernt. Jetzt aber legte er los, wurde gar nicht wieder fertig damit. Wie er eigentlich nur deshalb immer von der Wanderschaft geträumt habe, weil er hoffte, dereinst eine unbewohnte Insel zu entdecken oder sonst ein Fleckchen Erde, auf dem er sich als Robinson etablieren könne, und mit diesen Gedanken habe er sich immer und immer getragen, habe sich während der ganzen drei Jahre danach umgesehen, aber nirgends solch ein Fleckchen entdeckt, wo er selbst vor Entdeckung gesichert gewesen wäre, oder es habe an diesem oder jenem gefehlt.
Kurz und gut, Balduin Frettwursts Ideal war eine unbewohnte Insel im endlosen Ozean, auf der er sein Leben mit nicht gerade allzu viel Arbeit fristen könnte, nach der niemals ein Schiff hinkäme — aber ganz lieb wäre es ihm, wenn an ihr ein gescheitertes Schiff läge. Nur die ganze Mannschaft nebst sämtlichen Passagieren müsste schon ersoffen sein.
Nun, was mir das Männchen da stundenlang vorschwatzte, das war auch mein Ideal gewesen vom ersten Augenblick an, da ich als Kind den Robinson Crusoe gelesen, und... ich würde noch heute, da mir schon die Haare grau werden, so weit sie nicht ausgefallen sind, sofort mitmachen.
»Wissen Sie nich so enne Insel?«
»Ich bedauere, eine solche zur Zeit nicht auf Lager zu haben.«
»Ob's wohl iewerhaubt noch solche unentdeckte Inseln gibt? Vielleicht im Schtillen Ozean? Oder er braucht ja ooch gar nich so sehre schtill zu sin.«
Auf diese Weise ging es fort, bis wir in ein Städtchen kamen, in dem gerade ein Volksfest gefeiert wurde, wobei ich mit Frettwursts musikalischem Bauche reiche Beute machte.
Wir waren in den letzten zwei Tagen immer auf Gastfreundschaft angewiesen gewesen, und in dieser lieblichen Gegend schienen sich die Menschen ausschließlich von Speck und weißen Bohnen zu ernähren. Wir hatten in diesen zwei Tagen sechs bis achtmal Speck mit weißen Bohnen vorgesetzt bekommen, außerdem war hier Madame Temperentia zu Hause, es wurde nur heimlich gesoffen — kurz, wir sehnten uns nach Abwechslung.
In diesem Städtchen hatten wir, obgleich es nur zweihundert und einen halben Einwohner hatte, ja haben können, was das Herz und mehr noch der Magen begehrte, zumal wegen des Festes, aber wir wussten, dass wir, hätten wir uns erst einmal an einer Tafel niedergelassen, um für eigene Rechnung zu speisen, nicht so bald aufgehört hätten, und es widerstrebte uns stets, erst die Bettelpfennige einzukassieren und dann an demselben Orte die Schlemmer zu spielen.
Die nächste wirklich große Stadt war nur zwanzig Minuten mit der Eisenbahn entfernt. Aber Frettwurst wäre nicht zu bewegen gewesen, die Eisenbahn zu benutzen, und ich konnte es ihm nicht verdenken, nachdem er sich drei Jahre lang nur auf seine Füße verlassen hatte, solange er diese auf festen Boden setzen konnte.
So entschlossen wir uns, noch am späten Abend die zwei Stunden abzumarschieren. Vorher nahmen wir noch die freundliche Einladung eines Herrn zum Abendessen an. Sonst ist ja in Amerika die Gastfreundschaft durchaus nicht so großartig, dass man deshalb gleich auf offener Straße angesprochen wird, nun gar in einer Stadt, aber wir hatten eben immer Glück, und außerdem hatte der Herr auch noch etwas Besonderes mit uns vor, wie wir ja auch etwas Besonderes waren.
Er wohnte mit seiner Familie, deren Mitgliedern man, wie ihm selbst, gleich ansah, welchem Berufe sie nachgingen, in einem Privatlogis, und ausgerechnet wurden uns natürlich weiße Bohnen mit Speck vorgesetzt.
Während wir mit langen Zähnen kauten, offenbarte uns der Herr, ein amerikanischer Irländer, dass er eine Affenbude besitze, sie aber hier nicht eröffnet habe — er wollte Meister Frettwurst als musikalische Attraktion und mich als Affenbändiger oder so etwas engagieren. Wir lehnten dankend ab, wir waren in dergleichen Dingen ja schon gewitzigt, weshalb uns auch der süße Nachtisch entzogen wurde, der auf der Schüssel in der Hand der Gattin schon halb zur Türe hereingesehen hatte.
Wir rückten ab, mit acht bis zehn weißen Bohnengerichtet im Leibe, soweit sie nicht schon wieder verdaut waren, was ja aber bei den weißen Bohnen nicht so schnell geht. Unterwegs phantasierte Frettwurst noch immer von seiner Robinsoninsel und sonst ›ennem Fläckchen Ärde, wo mer nischt zu machen braucht, und wo een geener sieht‹, und ich schwatzte mit.
Wir ahnten nicht, wie bald sich unser ersehntes Ideal verwirklichen sollte, wenn auch in ganz anderer Weise, als wir es ausgemalt hatten, und in dieser Ahnungslosigkeit lag ja gerade der Reiz.
Aber wir sollten dazu noch einen dritten Mann bekommen, wozu ich gleich etwas vorausschicken will. Dieser dritte Mann war wiederum ein ganz seltsames Original des menschlichen Geschlechtes. War ich etwa ein bevorzugter Liebling der Götter, dass ich immer mit solchen Originalen zusammenkam? Durchaus nicht! Die Sache ist eben die, dass ich nur alles wirklich Bemerkenswerte schildere. Ich war während des einen Jahres, seit dem mein Vagabundenleben währte, doch schon mit vielen Hunderten, mit Tausenden von Menschen zusammengekommen, und wären Originale darunter gewesen, so hätte ich sie auch immer beschrieben. Also, bitte, keinen solchen Vorwurf!
Es war in der elften Stunde, als wir in der stillen, mondhellen Nacht die ansehnliche Stadt Lacrety erreichten. Zwar kaum dreitausend Einwohner, aber alles vorhanden, elektrische Straßenbahn und steinerner Zirkus und was man sonst in Europa nur in einer wirklichen Großstadt findet. Wir gingen ins erste beste Hotel. Allerdings nennt sich in Amerika jede Trinkbude Hotel, doch das war wirklich eins. Spiegelsaal und befrackte Kellner mit weißer Krawatte! Wie wir schtoobige Brüder aussahen, war hier in Amerika ganz egal. Die Hauptsache war, dass ich alle meine Taschen voll Geld hatte, Kupfer und kleine Silberstücke, aber auch mancher harte Dollar war dazwischen. Gezählt hatte ich die Einnahme noch nicht, ich machte mich gleich daran, ehe wir bestellten, und zählte vierunddreißig Dollar auf, und da wären wir willkommen gewesen, auch wenn wir direkt aus der Jauchengrube gekommen wären, man hätte uns höchstens ein separiertes Zimmer angewiesen, zumal ich gleich die Weinkarte bestellte. Aber wir sahen sonst ziemlich anständig aus.
Frettwurst hatte Bauchkasten und Buckel abgenommen, wir waren bereit, den noch unverdauten weißen Bohnen Gesellschaft zu geben, bestellten zu essen. Ich hatte, obgleich ich sonst gar nicht so bin, beim Anblick der Weinkarte plötzlich riesigen Appetit nach heimischen Gewächsen bekommen, bestellte eine Flasche Josephshöfer — Preis zwei Dollar, für amerikanische Verhältnisse gar nicht zu teuer, zumal er ganz gut war.
»Wein? Ei, Sie feines Luder. Da trink'ch ooch mal mit.«
Beim ersten Schlucke verzog Frettwurst den Mund.
»Der is ja ganz sauer! Awer sonst schmeckt's gut, da muss nur ä bisschen... heern Se, Gellner — Gellner — Herr Obergellner — sin Se doch so freindlich und bringen Se dn Zuckerdobb —Zucker, na Se wissen doch — sießen Zucker — Heern Se, Naboleon Bonaparte, was heeßt denn uff englisch eegentlich Zucker?«
Gut, Frettwurst versüßte sich den Josephshöfer mit klarem Zucker.
»Nu gucken Se blos mal unsern Gellner an, was der für enn langen Gärber un für gurze Beenchen hat. Grade wie ä Dackel.«
Ja, es war ganz auffallend. Frettwurst hatte es schon treffend bezeichnet. ein menschlicher Dackel, besonders da die kurzen Beinchen an dem im Gegensatz endlos langen Oberkörper auch noch krumm waren. Sonst ein ganz netter junger Mensch mit ernstem Gesicht, sehr aufmerksam.
»Sein Sie nich ä Deitscher?«, fragte Frettwurst ihn bei der nächsten Gelegenheit.
»Sehr wohl, mein Herr.«
Das war auch nicht schwer zu erraten, in Amerika sind neunzig Prozent von allen Kellnern Deutsche, nicht anders ist es in England — überhaupt alles Hotelpersonal.
Frettwurst wusste aber noch mehr.
»Aus Hannover, gelle he?«
»Sehr wohl, mein Herr.«
»Nu ich wusst's doch glei, weil Sie ooch im Englischen egal mit dr Ssstiefelsspitze an enn ssspitzigen Ststein ssstoßen. Wolln Se ä Glas mit uns trinken?«
»Danke sehr, mein Herr!«
Frettwurst war ja einfach verrückt — oder er kannte die amerikanischen Verhältnisse noch immer nicht — doch überhaupt, auch in Deutschland darf man wohl eine Kellnerin so einladen, doch niemals einen Kellner, und nun gar hier in Amerika...!
Der Kellner hatte ja auch gleich gedankt — jawohl, er hatte für die Einladung, ein Glas mitzutrinken, gedankt — und werde ich doch ganz starr, und wohl jeder andere Gast, der es sah, mit mir, als der Kellner wirklich einen Stuhl hervorzieht und, die Serviette unterem Arm, sich darauf niederlässt.
Aber er gab auch gleich eine Erklärung.
»Ich höre um zwölf auf — für immer — auf die paar Minuten kommt es ja nicht an. Da ist schon meine Ablösung.«
Dann war das etwas Anderes — obschon immer wieder echt amerikanisch.
»Sie heern um zwölfe uff?«
»Jawohl, mein Herr!«
»Fier immer?«
»Jawohl, mein Herr!«
»Na, da prost! Wolln Se ä bisschen Zucker neintun?«
Frettwurst hatte eingeschenkt, wir stießen alle drei an.
Dann trat die vorschriftsmäßige Pause ein, höchstens durch ein Räuspern unterbrochen. Wohl auch Frettwurst überlegte, was er jetzt sagen sollte, wenn er auch sonst nie um Worte verlegen war.
»Heern Se«, fing er dann wieder an, »Sie ham wohl was uff'n Herzen? Sie sehn so unglücklich aus.«
Auch mir war es in dieser einzigen Minute schon aufgefallen. Zunächst muss ich den jungen Mann etwas näher beschreiben. Wenn er so saß, machte er einen ganz normalen Eindruck, war allerdings sehr mager, sah aber dabei gesund aus, hatte wahre Bärenknochen, und dann musste ich sein Gebiss bewundern. Große, gesunde, blendend weiße Zähne, nur etwas auseinanderstehend — ein sogenanntes Wolfsgebiss. Als bedienender Kellner hatte er ein tadellos gewandtes Benehmen gezeigt, was ich zu beurteilen verstand — jetzt als Gast war er schüchtern, fast linkisch. Dies war an sich nicht auffallend, diese Umwandlung konnte ich mir erklären — aber unangenehm empfand ich, wie er während der Pause und schon vorher seine etwas hervorquellenden Augen in mein Schnitzel bohrte, und als er sich dabei beobachtet fühlte, wandte er seine Augen ab, und bohrte sie dafür in Frettwursts Beefsteak, mit einem Ausdruck, in dem sich Gier mit Wehmut paarte. Ja, der junge Mann sah direkt unglücklich aus, und außerdem...
»Heern Se, Sie ham wohl Hunger?«
Frettwurst hatte es erfasst.
»O, mein Herr...«
»Nu, beschtelln Se sich nur was.«
»O, mein Herr...«
»Nur zu! Hier ham Se de Garte.«
Er war sehr bescheiden, suchte sich mit offenbarer Absicht das Billigste aus, ein Haschee, so ein gehacktes Gemengsel von Lunge und Fleischresten, die allerdings nicht zum zweiten Male in der Küche verarbeitet werden dürfen. Immerhin bleibt es in einem zweifelhaften Restaurant ein zweifelhaftes Gericht.
Mit seiner ihm eigentümlichen Unverfrorenheit, um die ich ihn beneidete, weil sie niemals beleidigen konnte, holte Frettwurst den neuen Tischgast unterdessen aus. Eine Vorstellung gibt es in Amerika ja in den seltensten Fällen.
»Nu, wie heeßen Se denn eigentlich, wenn Se mir die Frage gietigst geschtatten?«
Balduin Frettwurst hätte diese Frage ruhig an eine Majestät richten können, sie wäre ihm nicht übel genommen worden, die Majestät hätte ihm willig geantwortet.
Oskar Müller, von Beruf Drogist, seit vier Jahren in Amerika, hatte sich schon in allen möglichen Professionen versucht...
Da kam das Haschee. Der Kellner a.D. griff zu Gabel und Messer, wollte essen, wie jeder kultivierte Mensch isst — nur das Zittern seiner Hände war eigentümlich — und dann diese Augen! Der erste Bissen wurde ganz regelrecht zu Munde geführt, auch noch der zweite — dann aber brach die Natur durch. Plötzlich verwandelte sich die Gabel in eine Dreckschleuder, die zwischen Mund und Teller hin und her pendelte, im Nu war der Teller geleert, desgleichen verschwanden wie durch Zauberei die Salzkartoffeln, dann kam das Brötchen daran, aus zwei Hälften bestehend, ungefähr in der Größe von Billardkugeln. Mr. Oskar Müller sperrte seinen Mund oder vielmehr Rachen auf, und erst jetzt bemerkte ich, was für einen Rachen er hatte, beim Sprechen war das auch gar nicht so zu merken. Eine der gebackenen Billardkugeln nach der anderen hinter das Gehege der jetzt fast furchtbar aussehenden Zähne geschoben, die aber gar nicht gebraucht wurden, ein Druck, ein Schluck, weg waren die beiden Semmeln, und mit demütig abbittenden Augen blickte Herr Müller zu uns empor, als wollte er sagen: »Entschuldigen Sie, es soll nicht wieder vorkommen.«
Na, ich staunte doch wie ein Kind im Zaubertheater. Und Frettwurst nicht minder.
»Nu awwer, heern Se... Sie ham wohl heite noch gar nischt gegessen?!«
»O, doch...«
»Awer wohl noch gee Abendbrot?«
»O, doch...«
Der Mann rang immer mehr mit seiner Verlegenheit, färbte sich purpurrot.
»Na, da essen Se nur noch was!«
»O, mein Herr...«
»Na, nur los! Das macht mir Schpaß. Hier, essen Se de ganze Schbeisegarte ab! Gennten Se das?«
»O ja! Warum denn nicht?«, lächelte der Mann schüchtern.
»De ganze Schbeisegarte abessen? 's ganze Brogramm? Von ohm bis unten? Nu, das mecht'ch doch mal sehen! Gellner — Sie da, Herr neier Obergellner, gomm Se mal her — hier, bringen Se mal alles, was hier uff der Karte schteht, eine Bortion nach der anderen — immer so fix, wie der da isst, dass mer nich immer warten missen — nur de Subben iewerhuppen mer — also mal los: Böff à la mode.«
Der neue Kellner lächelte verständnisvoll und eilte. So etwas kann auch in einem deutschen Restaurant vorkommen, wir befinden uns aber noch dazu in Amerika. Vor fünf Minuten waren zwei Gäste hereingekommen, wie Arbeiter gekleidet, welche bewiesen, dass die goldenen Zeiten, wie sie am köstlichsten Bret Harte geschildert hat, in Kalifornien noch immer nicht vorüber waren. Die beiden, wirkliche Arbeiter, sich aber sonst als Gentlemen betragend, bestellten Champagner, gleich einige Flaschen, verschmähten jedoch die Gläser, tranken aus den Eiskübeln, jeder aus seinem eigenen — tranken wohl eine Wette aus. So etwas ist denn doch wohl nur in einem amerikanischen Weinrestaurant möglich, nämlich besonders das, dass niemand etwas dabei findet.
Das Boeuf à la mode kam. Es war dieselbe Geschichte. Nur dass das ziemlich große Fleischstück in drei Teile zerschnitten wurde. Sonst auch nur immer ein Druck und Schluck, und der ungeheuere Rachen war immer bereit zu neuer Aufnahme. Und so ging es weiter. Der servierende Kellner hatte nur immer zu rennen. Und nicht nur die verschiedenen Fleischgerichte verschwanden auf diese zauberhafte Weise, sondern regelmäßig auch die dazugehörenden Salzkartoffeln und Zugemüse, desgleichen aber auch brachte der Kellner jedes Mal ein neues Brötchen, und auch die beiden gebackenen Billardkugeln wurden so verschluckt.
Ich kann nur sagen, dass ich es nicht geglaubt haben würde, hätte mir jemand so etwas erzählt. Ich habe einen ›Künstler‹ gesehen, den ›Mann mit dem Straußenmagen‹, der fraß Lampenzylinder und ganze Weingläser, Streichhölzer in Menge und einen Stiefel zur Hälfte, dazu trank er Benzin und Petroleum — aber was ich hier zu sehen bekam, das übertraf, wenn es auch ein ganz anderes Kunstgenre war, jene Gefräßigkeit doch noch bei Weitem.
Frettwurst unterlag demselben Zauber dieser Kunst.
»Nee, is es denn nur enne Menschenmeeglichgeet! Nee, so was läbt ja gar nich!«
Dann aber ging Frettwursts Kunstbegeisterung in ein anderes Gefühl über, er griff nach der Speisekarte, einem langen Zettel, der gegen fünfzig Gerichte aufzählte, und Mr. Müller war erst beim zehnten Gange, jedes Gericht kostete mindestens einen Dollar, und immer länger ward meines Kameraden Vollmondgesicht, als er konstatierte, dass unser Tischgast den zehnten Gang, eine gebratene Taube, mit demselben ungeschwächten Appetit verschlang, und zwar auch gleich die Knochen mit. Jetzt wandte er aber seine furchtbaren Zähne an, und er hätte mit diesen noch ganz andere Knochen zermalmt als Taubenknöchelchen.
»Nee, heernse Sie — heern Se uff, heern Se uff — das gann'ch nich bezahlen, mir sin doch geene reichen Greesusse!!«
Der Mann hielt erschrocken im Zermalmen der zweiten halben Taube, die er tatsächlich als einen einzigen Bissen in den Mund geschoben hatte, inne, dann drückte er sie mit einem Schluck hinter, wurde vor Verlegenheit wieder ganz rot.
»O, ich dachte...«
»Nee, heern Se — nahm Se's nich iewel — awwer das hatt'ch nich gedacht — nee, awwer das wird mir wärklich zu viel... nee, was is denn nur mit Ihnen los?!«
»Das ist wohl... krankhaft?«, fragte auch ich jetzt.
Ja, es war krankhaft. Oskar Müller erzählte es uns nach und nach. Es war viel Humoristisches dabei, wie er es vorbrachte, gerade infolge seiner stillen Wehmut, aber ich will es erst ganz sachlich wiedergeben.
Als Kind war sein Appetit normal gewesen, obgleich er schon immer den abnorm langen Oberleib gehabt hatte. Zum Glücke seiner Eltern, die in wenig günstigen Verhältnissen gelebt hatten, hatte er nicht mehr als ein anderes Kind gegessen. Erst in seiner Lehrzeit war es losgegangen. Sein erster Lehrherr, der den angehenden Drogisten in Kost und Logis genommen hatte, hatte gerichtlich gezwungen werden müssen, den kleinen Vielfraß drei Jahre bei sich zu behalten, Was Oskar in dieser Lehrzeit alles durchgemacht hatte, will ich gar nicht erst schildern, denn es war nichts im Vergleiche zu dem, was er dann als Gehilfe leiden musste, als er sich selbst zu ernähren hatte.
Einmal hatte ihn ein Arzt, eine ganze Kommission von Ärzten untersucht, hatte ihn tage, sogar wochenlang gefüttert, alles Eingehende und Ausgehende wägend und analysierend, und hatte konstatiert, dass dieser anormale Mensch täglich gegen zwölf Pfund feste Nahrung durch seinen Magen und die Därme gehen lassen musste, wenn er seinen Körper regelrecht ernähren wollte, und hierbei fühlte er sich noch niemals gesättigt. Erst bei Aufnahme von fünf bis sechs Pfund fester Stoffe konnte bei ihm das Gefühl des Sattseins eintreten, und solche Mahlzeiten hatte er täglich mindestens drei nötig.
Wir müssen etwas Nahrungschemie treiben. Der erwachsene Mensch braucht im Durchschnitt täglich zur Ergänzung seiner Lebenskraft 120 Gramm Eiweiß, 80 Gramm Fett und 420 Gramm Kohlenhydrate. Letztere liefern Stärkemehl und Zucker, beide können sich gegenseitig ersetzen, auf eine Weise, die wir noch nicht ergründet haben. Die Umwandlung von Stärke in Zucker haben wir ja auch in der Brennerei und Brauerei.
Nun aber muss dem tierischen wie dem pflanzlichen Körper alles, was er aufnehmen, verdauen soll, in einer gewissen Lösung geboten werden, deren Konzentration einen gewissen Prozentsatz nicht überschreiten darf. Sonst verdaut der Magen sie nicht, er kümmert sich gar nicht darum, scheidet auch die in der Lösung vorhandenen Nahrungsmittel unverdaut wieder aus. Oder er entnimmt der Lösung, die aber nicht nur Bouillon zu sein braucht, nur eben so viel Nährstoffe, wie ihm ein Gesetz vorschreibt.
Wie dies gemeint ist, erläutert am besten die Milch. Die Kuhmilch enthält 3,4 Prozent Eiweiß. Dieses wird vom menschlichen Magen unter normalen Verhältnissen, wenn nicht zu reichlicher Magensaft das flüssige Eiweiß zu schnell zu Käse gerinnen lässt, vollkommen verdaut, in den Körper, zunächst ins Blut übergeführt. Trinkt man also einen Liter Milch, so nimmt man in sein Blut 34 Gramm Eiweißstoffe auf. Kondensierte Milch enthält 12 Prozent Eiweiß. Um 34 Gramm Eiweiß zu erhalten, muss man also einen Liter Milch, 1000 Gramm, auf zirka 300 Gramm eindampfen. Wollte man aber nun diese 300 Gramm kondensierte Milch so trinken, so fiele es dem Magen gar nicht ein, die darin enthaltenen 34 Gramm Eiweiß anzunehmen, sie ins Blut zu befördern. Nein, auch aus dieser Lösung zieht er nur 3,4 Prozent heraus, oder vielleicht jetzt etwas mehr, jedenfalls geht der größte Teil unverdaut wieder ab. Die kondensierte Milch muss erst wieder auf den normalen Prozentsatz des Eiweißes von 3,4 Prozent verdünnt werden, dann saugt der Magen auch alles Eiweiß auf, und dasselbe und sogar umso viel lieber tut er es, wenn die Lösung noch viel mehr verdünnt wird. Und so ist es bei allem und jedem. Der Magen des Kindes ist wieder ganz anders eingerichtet, hat vor allen Dingen viel weniger Magensäure, die menschliche Muttermilch enthält auch nur 2,8 Prozent Eiweiß; deshalb scheidet der Magen des Säuglings unverdünnte Kuhmilch zur Hälfte unverdaut wieder aus, das heißt, die Hälfte des darin enthalten Eiweißes, wodurch eben der Durchfall entsteht. Rindfleisch enthält 20 Prozent Eiweiß, in dieser Lösung — denn Rindfleisch enthält etwa 72 Prozent Wasser — kann es der Magen des Erwachsenen verdauen, aber Fleischextrakt in unverdünntem Zustande ist absolut unverdaulich, wahrscheinlich, dass der Magen sich nicht einmal seine 20 Prozent herausholt.
Dies alles gilt natürlich auch für Fette und die anderen zur Ernährung nötigen Substanzen.
Nun ist aber nicht ein menschlicher Magen wie der andere beschaffen, das zeigt schon der Unterschied zwischen Säugling, Kind, Erwachsenem und Greis. Ferner ist auch der Magen jedes erwachsenen Menschen wieder auf einen bestimmten Prozentsatz geeicht, den er dem Nahrungsmittel entziehen kann. Der eine Magen weiß auch noch einer abgelegten Stiefelsohle etwas Eiweiß abzugewinnen, wie der Kuhmagen dem Stroh, ein anderer kann Milch selbst in ausgiebigster Verdünnung nicht vertragen.
Jene Ärzte nun hatten konstatiert, dass unser Drogist und Kellner hier einen Magen besaß, der in Verbindung mit den anderen nötigen Gedärmen nur den sechsten Teil des normalen Prozentsatzes an Eiweiß aus den Nahrungsmitteln zog und verdaute, den sonst ein normaler Magen verarbeitet, extrahiert, Bedarf der Mensch im Durchschnitt täglich eines halben Pfundes Fleisch, eines Pfundes Brot nebst einigem Zugemüse, so bedurfte Oskar Müller von alledem genau das Sechsfache, also drei Pfund Fleisch und sechs Pfund Brot und das sechsfache Gewicht des Zugemüses. Und nicht etwa, dass er seinem Riesenmagen nur Brot hätte bieten dürfen! Der Mensch lebt bekanntlich nicht von Brot allein, kann es nicht, denn er braucht zur Deckung des nötigen Eiweißbedarfs täglich fünf Pfund, diese Portion aber kann kein normaler Magen fassen. Außerdem fehlt da noch das notwendige Fett. Bei Brot allein — von Kartoffeln gar nicht zu sprechen — würde der Mensch bei lebendigem Leibe verhungern, Oskar Müller ebenso bei den dreißig Pfund Brot, die er demnach täglich nötig gehabt hätte, nur wegen des Eiweißes, und zur Aufnahme von dreißig Pfund Brot war denn doch auch sein Magen nicht geeicht.
Nun man kann sich vorstellen, wie es dem kärglich besoldeten Drogistengehilfen immer gegangen war! Er hatte in einem ständigen Kampfe mit seinem Magen gelegen. Ja, die fünfzig oder sechzig Mark, die er monatlich für Essen ausgeben konnte, reichten, um seinen Magen zu füllen, dass er das Gefühl der Sättigung empfand, da durfte aber das wertvollste Nahrungsmittel nur trockenes Brot sein, Kartoffeln waren noch billiger — und auf diese Weise hatte der junge Mann empfunden, wie man auch mit immer vollem Magen langsam verhungern kann. Als Drogist hatte er ja auch einen chemischen Kursus durchmachen müssen, wusste von selbst, woher es kam, dass er sich trotz des immer vollen Magens langsam verhungern fühlte.
So ging das nicht weiter. Er bedurfte derselben Nahrung, die jeder Arbeiter braucht, um arbeiten zu können. Die Natur lässt ihrer nicht spotten. Die Regel gilt: Wer nur Brot isst, hat bald nicht mehr die Kraft dazu, sich dieses Brot selbst zu bauen, es der Erde abzuringen. Es mag Ausnahmen geben — der heilige Peter von Alcantara hat nach glaubwürdigen Zeugen vierzig Jahre lang nur immer alle zwei Tage ein Stückchen Brot gegessen, sah infolgedessen auch wie aus Baumwurzeln geflochten aus — solche Ausnahmen gehören nicht hierher. Oskar Müller war kein ganz in Gott aufgehender Mensch, sondern ein Kerl mit ewigem Wolfshunger.
In Deutschland sah der junge Drogist keine Möglichkeit, seine Lage so weit zu verbessern, dass er sich von seinem Gehalte sättigen konnte. Bis dahin wäre er längst verhungert gewesen. Und es ist in Deutschland ja auch nicht so leicht, seinen Beruf zu wechseln. Welcher Bäcker oder besser Fleischer hätte denn den Drogistengehilfen als Lehrling oder als sonstige Arbeitskraft angenommen? Das war fast nur in Amerika möglich. Müller brachte die zur Überfahrt nötigen hundert Mark auf, widerstand unter verzweifelten Anstrengungen der Versuchung, sie lieber zu verfressen, fuhr nach Amerika.
Hier war es ihm ja etwas besser gegangen, aber das Richtige war es noch längst nicht. Er war in den vier Jahren alles Mögliche gewesen, d.h. immer in der Nahrungsmittelbranche. Beim Bäcker konnte er sich wohl satt essen, auch als Heizer oder Austräger, doch immer wieder nur an Brot, und welcher Fleischermeister lässt sich denn gefallen, dass ein Gehilfe täglich fünf Pfund Fleisch vertilgt! Ja, es kommt zwar nicht so drauf an, aber es hat doch alles seine Grenzen.
Am besten war es ihm noch immer als Tellerwäscher in den Hotels gegangen. Da konnte er alles aufessen, was aus den Speisesälen wieder in die Küche kam — also die Reste, das Hundefutter.
Aber auch hier konnte er niemals lange in einer Stellung bleiben. Man jagte ihn davon, wenn er seine Arbeit auch noch so geschickt und pflichtgetreu tat, wenn es auf das Hundefutter, das er verschlang, auch gar nicht ankam.
Er wurde eben wegen dieser seiner Gefräßigkeit immer entlassen. Das andere Personal amüsierte sich zuerst über den Vielfraß, bald aber ekelte es sich regelmäßig vor ihm.
»Dieses ekelhafte Schwein!«, hieß es immer alsbald, und da zum Telleraufwaschen ja kein besonderes Talent gehört, immer Ersatzmänner genug vorhanden sind, so wurde der Drogistengehilfe mit dem unersättlichen Heißhunger bald wieder davongejagt.
Jetzt kommen wir zu dem Hauptpunkt, weshalb ich bei diesem Heißhunger, einfach Gefräßigkeit genannt, so ausführlich verweilt, sie mit einiger Wissenschaftlichkeit zu ergründen versucht habe
.Ja, es ist wirklich nicht schön, wenn ein Mensch so furchtbar gefräßig ist, alles ohne Auswahl wie ein verhungerter Wolf verschlingt. Beim ersten Male, wenn man da zusieht, mag man sich darüber amüsieren, das zweite Mal noch sich wundern — beim dritten Male empfindet man gegen solch einen gierigen Menschen etwas wie Ekel, der immer mehr wächst.
Aber ich finde, dass das sehr ungerecht ist. Man muss eben alles ergründen oder doch zu ergründen suchen. Zwecklos ist nichts in der Welt. Es hat alles Zweck und Ursache. Es ist so leicht, die schlechte Gewohnheit eines Menschen, zu verdammen — wie viel edler ist es, alles zu entschuldigen, und hat man die wahre Ursache gefunden, so ist überhaupt gar keine Entschuldigung mehr nötig.
Was konnte denn der junge Mann dafür, dass ihm der liebe Gott oder die Natur einen solch langen Oberleib mit dementsprechendem Magen gegeben hatte, der das meiste wieder unverdaut von sich gab? Es gibt wieder andere Menschen, welche wie die Sperlinge essen, besonders Frauen, aber auch Arbeiter, und sie können sogar die schwerste Arbeit verrichten, und sie werden noch dick dabei. Dann spricht man von Mäßigkeit oder gar von Bescheidenheit. Das ist ja alles dummes Zeug. Diese Menschen haben eben einen kleinen Magen, der die Nährstoffe aus dem Speisebrei sehr gut auszuziehen weiß. Und das ist doch wahrhaftig nicht ihr Verdienst! Würde sich der Magensaft oder sonst etwas ändern, dann könnten und würden auch sie mit Vergnügen fünf Gänge hintereinander essen, worüber sie schon spotten, sehen sie es einmal, und wächst die Verdauungskraft in der angegebenen, zum Teil negativen Weise, dann müssten auch sie wie die Wölfe schlingen, und es wäre entschuldbar.
So tolerant denkt nun freilich die Menschheit im Allgemeinen nicht. Es ist die eigene Unwissenheit, Dummheit. Was aber hat das alles zu sagen! — Vor einem gefräßigen Menschen ekelt man sich eben bald, und so wurde auch das ›deutsche Schwein‹ immer schon nach einigen Tagen aus jeder Hotelküche gejagt.
Außerdem fühlte sich Oskar Müller als Telleraufwäscher durchaus nicht glücklich, auch nicht, wenn er seinen Magen mit Fleischüberresten angefüllt hatte. Gewiss, es ist etwas Menschenentwürdigendes dabei, es lässt sich nicht wegleugnen. Der junge Mann hatte doch eine ziemliche Bildung, hatte, mehr noch, Charakter. Er hatte Besseres gelernt, als nur Teller aufzuwaschen.
Am besten ging es ihm in Amerika auf der Wanderschaft von Farm zu Farm. Eine weise und gütige Natur hatte dafür gesorgt, dass dieser endlose Magensack — von dem Stoiker Epiktet mit Vorliebe auch Madensack genannt — den sie wohl in einer Katerstimmung etwas verpfuscht hatte, auch zwei und drei Tage lang ungefüllt bleiben konnte, ohne dass sein Besitzer deshalb gleich vor Hunger umfiel. Dann freilich musste das nachgeholt werden, und was da Herr Oskar Müller leisten konnte, das habe ich oft genug mit eigenen Augen gesehen. Und auf den Farmen konnte er sich ja dann satt essen, die einsamen Farmersleute staunten und freuten sich jedes Mal darüber — und ehe sie einen aufsteigenden Ekel vor solcher Gefräßigkeit bekamen, ehe sie den heißhungrigen Gast davonjagten, ging dieser schon von selbst, nach der nächsten Farm, wo sich das Spiel wiederholte.
So hätte sich Oskar Müller zeit seines Lebens in Amerika durchfressen können, manchmal hungernd, dann wieder unter Bravorufen und Lachen schlingend. Aber ein ehrenwerter Beruf war das natürlich auch nicht. Er verlotterte bei diesem Vagabundenleben total. Betteln konnte er nicht, und Geld und Kleidung gibt man in Amerika nicht freiwillig. Nein, das war auch nichts, vielleicht erst recht nichts.
So war er nach Lacrety gekommen, hatte erst als Holzträger gearbeitet, um sich Geld zu verschaffen, des Abends bis spät in die Nacht in einer Hotelküche noch nebenbei als Telleraufwäscher, um seinen Magen zu füllen, aber auf die Dauer hielt er das nicht aus. Er rieb sich bei dieser langen Arbeitszeit ganz auf, und so hatte er sich für das ersparte Geld einen schwarzen Kellneranzug gekauft, hatte auch wirklich in einem der ersten Hotels Stellung bekommen. Er hatte sich ja schon früher in diesem Berufe versucht, war wirklich ein tadelloser Kellner.
Aber es ging ihm hier wie überall. Spott und Verachtung seitens seiner Kollegen — er selbst brauchte deswegen nicht zu kündigen, er musste wegen seiner Gefräßigkeit heute um Mitternacht den Dienst aufgeben, war bereits wieder stellungslos — — — —
Viel, viel Humoristisches war dabei, wie der junge Mann von seinen Abenteuern erzählte, in die er durch seinen Magen gebracht worden war; gerade infolge der stillen Wehmut, mit der er erzählte und zu der er ja auch allen Grund hatte, klang es manchmal so urkomisch, dass ich mit mir ringen musste, um nicht hellauf zu lachen.
Außerdem kamen noch Frettwursts Witze hinzu, die er so trocken zu reißen verstand, wobei man niemals wusste, ob er sie mit Absicht hervorbrachte oder ob der Witz einer gewissen naiven Dummheit entsprang.
Ich will nur ein einziges Beispiel hiervon wiedergeben.
»Nu, wie is es denn da mit Ihrer Verdauung, wenn Se mir de Frage gietigst erlaum?«
»Ich habe eine Verdauung wie ein Wolf — nein, wie ein Geier. Ich kann tatsächlich die stärksten Knochen verdauen, wenn ich sie nur zu verschlucken vermag. Oder wenn ich sie nicht verdaue, so belästigen sie mich doch nicht im Geringsten. Und was die Schnelligkeit der Verdauung anbetrifft, so habe ich den Magen eines Stars. Ich spreche gerade von einem Star, weil wir einen solchen zu Hause hatten, den ich viel beobachtet habe. Der Star frisst schnell hintereinander hundert Mehlwürmer, und ehe er den zehnten frisst, geht der erste schon wieder ab, in der Form noch deutlich erkennbar, wenn auch völlig verdaut...«
»Mählwärmer?«, fiel ihm Frettwurst ins Wort. »Was gosten denn solche Mählwärmer?«
»Wir bezahlten für das Nößel einen Groschen.«
»Wie groß is denn so ä Nößel?«
»Nun — so etwa wie dieser Becher.«
»Un das gost enn Groschen? Nu, heern Se awwer, sin denn Mählwärmer so kräftig?«
»Ei gewiß, das ist doch Fleischnahrung!«
»Nu, wenn ooch schon — awwer fier'n Groschen gricht mer da doch mehr gehacktes Rindfleesch. Un ich verschtehe iewerhaubt nich, wie ä Mensch so uff Mählwärmer erbicht sein gann.«
»Ein Mensch?«
»Nu, Sie sagten doch, Sie schbeisten mit liewe Mählwärmer?«
»Ich? Ich habe doch nur den Star als Beispiel herangezogen!«
»Ach so, da entschuldigen Se nur gietigst — ich dachte, Sie verschbeisten ooch Mählwärmer, weil die besondersch gräft'g wärn!«
Da soll man nun ernst bleiben! Und wie mein Kamerad das nun hervorbrachte!
Doch Oskar Müller schien für Witz wenig Verständnis zu haben, verstand auch diesen so wenig, dass er sich durch den Verdacht, Mehlwürmer zu essen, nicht einmal gekränkt fühlte.
»Können Sie denn nicht als Schauesser öffentlich auftreten?«, fragte ich, nur um meine Gedanken abzulenken, dass ich nicht lachen musste, zugleich an jenen Menschen mit dem Straußenmagen denkend.
»Jawohl«, stimmte auch Frettwurst gleich bei, »oder in enn Restaurang, als ReglameEsser, Sie sitzen hinter der Fensterscheibe un essen immer de ganze Schbeisegarte auf und ab. So'n Hoteljee warn Se schon finden, gerade hier in Ameriga, 's muss nur eener emal uff so'n Gedanken gebracht wärn — das is doch de allerbeste Reglame, ooch viel billiger als Zeitungsannoncieren. Oder ooch wie mei Freind sagt — glei direktemang als menschlicher Vielfraß, in enner Bude, un so von Schtadt zu Schtadt ziehn. Ich glauwe, dann wirde Ihr Abbetit ooch noch ganz gut bezahlt.«
Wirklich, es war eine Idee, Müller fand das selbst. Wie wenig Erfindungsgabe er besaß, verriet er dadurch, dass er von allein noch nicht auf diesen doch so naheliegenden Gedanken gekommen war, und ein Impressario hatte sich ihm eben noch nicht genähert.
»Ja, das ginge wohl — ich glaub's — dann brauchte ich auch nie Hunger zu leiden — aber... mich so vor dem Publikum zu produzieren — es ist schließlich doch eine Krankheit — einen richtigen Beruf, der mich ehrlich ernährt, zöge ich vor.«
Auch hierin hatte er ganz recht, und dass er so dachte, gereichte ihm nur zu Ehre.
»Wissen Se was, Naboleon Bonabarte, mir nähm den jungen Mann mit uff unsere Reese, mir wärn'n schon geniegend durchfiddern, un dann wärn mir schon mal enne Geleegenheet finden, ihn ginstig unterzubringen.«
Auch ich fand diese Idee ganz ausgezeichnet — der arme Mann tat mir wirklich immer mehr leid — wir offenbarten ihm, wie wir uns durch die Welt schlugen, und es war auch nach seinem Geschmack, wenigsten vorläufig.
Wir übernachteten in dem Hotel, bezahlten natürlich auch ein Bett für unseren neuen Kameraden, ließen ihn am nächsten Morgen zum Frühstück wirklich einmal die ganze Speisekarte abessen, hätten ihn zu unserer eigenen Belustigung auch noch einmal denselben Weg zurücknehmen lassen, und er hätte es tatsächlich fertig gebracht — da aber, als wir zur Vorsicht erst einmal die Rechnung machten, stellte sich heraus, dass wir nach einem reichlichen Trinkgeld, in kleinen Silbermünzen bestehend, nur noch einen einzigen Dollar besaßen, und den wollten wir doch lieber in der Tasche behalten.
Ja, es ist kostspielig, zu dritt in einem feinen amerikanischen Hotel zu logieren, zumal wenn solch ein unheimlicher Esser dabei ist.
»Na, da wolln mir uns uff de Beene machen. Was ham Se denn fier Garderobe?«
Einige Wäsche, besonders Oberhemden — sonst nur diesen schwarzen Frackanzug. Was er an Kleidung früher besessen hatte, das hatte er nur gleich unter die Lumpen werfen können.
»Nu, da gomm Se nur so mit, jetzt kann ich Ihnen noch nischt Anderes goofen — un gerade so als Gellner mit Schwalmschwanz un der weißen Grawatte, das is recht wirksam.«
Herr Oskar Müller ging also wirklich als Dritter im Bunde, als Kellner im schwarzen Frack mit weißer Krawatte, mit auf die Walze, außerdem noch mit dem Zylinder auf dem Kopfe, in dem er sich bei seinem Engagement der Hotelverwaltung vorgestellt hatte, an den Füßen Lackschuhe.
Nun stelle man sich solch einen Fechtbruder vor! In Deutschland doch einfach ganz unmöglich, aber in Amerika gar nichts Auffallendes, wenigstens nichts Besonderes. Wie der Mensch sich kleidet, so geht er eben. Ich bin in Amerika einem armen reisenden Offizier begegnet, habe ihn dann in seiner noch gar nicht so sehr derangierten Uniform Mist ausladen sehen. Es war ein Leutnant von der Miliz, der keine Stellung und keinen anderen Anzug mehr hatte als diese seine Uniform.
Anfangs freilich kam es mir unsäglich spaßhaft vor, wie wir mit dem befrackten und behinderten Kellner in der Mitte auf der Landstraße ›tippelten‹, auf den Bauernhöfen um eine kleine Gabe vorsprachen, wie er mit dem Zylinder in der Hand für Frettwursts Bauchmusik von Tür zu Tür einsammeln ging.
Was mein eigenes Äußeres anbetrifft, so erwähne ich nachträglich, dass ich mir bald nach dem Verlassen jenes Tierparks am ersten geldergiebigen Tage einen dauerhaften Lodenanzug angeschafft hatte, mehr ein Jagdkostüm mit dazugehörigen Stiefeln. Mein billiger Anzug aus dem Konfektionsgeschäft war ja schnellstens in die Brüche gegangen. Außerdem hatte ich mir auch einen Revolver zugelegt, mit so langem Laufe, dass er mehr einem kurzen Stutzen glich, und ich hatte mit ihm uns auch schon einmal ein Wildbret verschafft.
Übrigens sollte unsere Wanderung zu dritt nur zwei Tage dauern, während welcher wir nur eine Stadt, drei kleinere Ansiedlungen und einige Farmhöfe abklepperten. Hunger zu leiden brauchte Müller bei uns also nicht. In jeder Ansiedlung und mehr noch auf jedem Bauernhof gab er gewissermaßen eine Gefräßigkeitsvorstellung, für die er bewundert und belacht wurde.
Das hatte er freilich schon früher gehabt. Bei uns war es aber doch etwas Anderes, in unserer Gesellschaft fühlte sich der bescheidene, sogar etwas schüchterne Mann nicht so gedrückt, und dann fütterten wir ihn in jener Stadt, durch die wir kamen, auch noch in anderer Weise heraus. Nur zu einem neuen Anzuge langte es noch nicht, was auch nichts zu sagen hatte, und ich selbst gewöhnte mich schnell genug an den seltsamen Anblick.
Es war am dritten Tage unseres Beisammenseins. Wir hatten am frühen Morgen das Farmhaus verlassen, das uns gastfreundlich während der Nacht beherbergt hatte, Müller verschlang zum Abschied noch einige Pfund Maisbrot und mindestens ein Pfund gekochtes Salzfleisch — jetzt waren wir schon wieder vier Stunden unterwegs, ohne eine Ansiedlung erblickt zu haben, als die Landstraße plötzlich an einem Sturzacker endete.
Wir fragten beim Abschied von unseren Gastgebern prinzipiell niemals nach dem Wege, wie weit die nächste Farm läge usw. Es hätte dies auch seine Schwierigkeit gehabt. So kultiviert Kalifornien sein mag, wie in Deutschland ist es denn doch nicht, und man kann sich auch im kultiviertesten Deutschland ganz gründlich verlaufen.
Dass Wege blind endeten, kam hier sehr häufig vor. Das waren eben von den Farmern selbst angelegte Straßen, zur Bestellung ihrer Felder, manchmal einfache Feldwege, ganz ausgefahren, manchmal aber sogar chaussiert, und doch hörten sie plötzlich auf.
Wir mussten eben immer auf gut Glück losmarschieren, uns nur möglichst nach Norden halten, sonst bloß auf auftauchende Gebäude, Rauch und Hundegebell acht geben. Menschen, die wir hätten fragen können, trafen wir immer äußerst wenig. Es war auch nicht die Zeit, dass Felder bestellt wurden.
Wir also über den Sturzacker hinweg, der gar kein Ende nehmen wollte, bis er endlich in Heide überging. Hier ließ es sich leichter marschieren, aber wir wussten auch immer weniger, wo wir uns befanden.
Alles Heide, manchmal Busch, hier und da ein Wäldchen — so ging das stundenlang fort, und mir und Frettwursten knurrte ganz grimmig der Magen. Wie es mit dem unseres unersättlichen Begleiters beschaffen war, wage ich nicht zu beurteilen.
Die Gegend wurde hügeliger, immer näher rückte der Gebirgszug, den wir ständig linkerhand hatten.
Nachdem wir unseren Durst an einem der Bäche gelöscht hatten, an denen zum Glück kein Mangel war, schlug ich vor, uns direkt nach links zu wenden, von einer größeren Höhe Umschau zu halten.
Wir taten es, hatten wieder eine Stunde zu marschieren, ehe wir uns wirklich im Gebirge befanden, und zufällig waren wir gerade in eine Einsattelung gekommen, die die langgestreckte Küstenkette durchquerte.
Ein wunderbarer Anblick erwartete uns, als wir um eine Ecke bogen. Das Küstengebirge musste es sein. Aber man darf nicht glauben, dass man auch wirklich dass Meer erblickte, wenn man den Kamm dieses Gebirges erklettert hatte. Das alles sind ja höchst unbestimmte Begriffe, in der Praxis sieht alles ganz anders aus als in der Theorie. Was heißt denn schone den Kamm eines Gebirges erklettern! Das ist doch alles voll Quertäler und Schluchten, und wenn man denkt, man ist oben, dann erhebt sich vor einem erst recht ein Bergkegel. Und was heißt da schließlich: Küstengebirge! Ja, dieses Gebirge zog sich längs der Küste des Großen oder Stillen Ozeans hin, so sah es auf der Karte aus, das wusste ich aus dem Kopfe, aber wie viele, viele Meilen konnte es vom Meere entfernt sein!
So urteilte der die geografischen und topografischen Verhältnisse kennende Mann, der ich wirklich war. Aber immer wieder sollte die Wirklichkeit alle Theorie zuschanden machen.
Es war eben wieder einmal gerade umgekehrt, wie ich gedacht hatte. Dicht unter uns brandete das Meer. In einer Tiefe von mindestens 200 Metern. Dabei befanden wir uns in einem tiefen Einschnitt des Gebirges, das zu unseren Seiten wieder jäh aufstieg.
Es war eine große Bucht, die hier an das Gebirge so nahe herantrat. Ich konnte mich an dem langentbehrten Anblickes des Meeres nicht lange ergötzen.
»Was is denn das da? Sieht das nich aggurat wie ä gabuttes Schiff aus, das da zwischen den Felsen glemmt?«
Ich brauchte nur der Richtung von Frettwursts Blicken zu folgen, und ich konnte es bestätigen. Es war ja auch deutlich genug zu sehen.
Dort unten, etwas rechts von uns, in einer wieder viel kleineren Bucht, in der aus irgendeinem Grunde das Wasser, welches ringsherum schäumte, spiegelglatt war oder doch zu sein schien, lag, noch außerhalb des Bereiches des Wassers zwischen Riffen oder vielmehr Felsen ein Wrack. Die Entfernung konnte täuschen, aber ich hielt es für ein ziemlich großes Schiff, mindestens 500 Tonnen, und ich konnte auch die drei Maststumpfe unterscheiden. Sonst schien es, von hier oben aus gesehen, ziemlich wohlerhalten zu sein. Wenigstens hatte es noch die vollständige Form eines Schiffes, von zersplitterten Teilen, Trümmern war nichts zu bemerken.Ich geriet sofort in die Aufregung, in die beim Anblick eines Wrackes wohl jeder Seemann kommt, auch wenn er sonst durchaus nicht geldgierig ist.
»Mensch, Frettwurst«, rief ich also ganz aufgeregt, »wenn das ein verlassenes Wrack ist, und wenn wir die ersten sind, die es finden, dann sind wir reiche Leute! «
»Dann gehört es uns?«, fragte Frettwurst aufmerksam.
Ich setzte ihm die internationalen Gesetze, die solche Angelegenheiten regeln, schnell auseinander.
Seegut oder Strandgut — es ist ganz genau dasselbe. Wer ein verlassenes Schiff findet, Wrack oder noch vollständig erhalten, dem gehört es. Es darf aber auch wirklich kein Mensch mehr darauf sein, weder von der Besatzung noch ein Fremder. Sonst gehört es eben dem anderen. Er muss das auf See treibende Fahrzeug aber natürlich auch an Land bugsieren. Verlässt er es, so ist es ja immer wieder herrenlos, und es nützt nichts, dass er seine Visitenkarte zurücklässt.
Dasselbe ist es, wenn ein Schiff, das von der Mannschaft verlassen wurde, an die Küste getrieben wird. Wer es zuerst findet, dem gehört es, mit allem, was sich zwischen den Planken befindet oder was sich dazwischen befunden hat, etwa herausgeschleudert worden ist, zerstreut umherliegt.
Bei Strandgut wird die Sache aber doch etwas komplizierter. Hier kann der glückliche Finder sich das Eigentumsrecht sichern, auch wenn er das Wrack verlässt. Er meldet den Fund der nächsten Behörde an, einem Dorfschulzen, es braucht auch gar kein solcher Beamter zu sein, es kann irgendein anderer Mensch sein, ein Bauer, wenn dieser nur glaubwürdig ist, und dann hat er die Angabe, hauptsächlich die der Zeit, wann er die Meldung in Empfang genommen hat, zu beschwören. Ist dem Finder schon ein anderer zuvorgekommen, der den Fund eher gemeldet hat — darauf kommt es an — dann hat natürlich dieser das Eigentumsrecht erworben.
Die Reederei des verlorenen Schiffes hat nur das Vorkaufsrecht, von dem Erlöse werden natürlich die manchmal sehr bedeutenden Bergungskosten abgezogen.
Ebenso natürlich ist es, dass um solche Wracks oft blutige Kämpfe entstehen, und wegen Strandguts ist schon mancher Meineid geschworen worden.
So hatte ich erklärt, während wir einen Abstieg suchten und auch fanden. Frettwurst, der doch sehr aufgeregt wurde, meinte, dass dann doch gleich wenigstens einer von uns nach der nächsten Ortschaft laufen sollte, nur um irgendeinen anderen Menschen aufzusuchen, der dann als Zeuge diente, dass wir die ersten Finder seien, aber ich machte ihm klar, dass wir doch erst konstatieren müssten, ob sich auch niemand mehr auf dem Wracke befände.
Wir stiegen hinab, verirrten uns in Schluchten, verloren ganz die Richtung, bis uns der Zufall zu Hilfe kam. Als wir aus einer Schlucht herauskletterten, lag dicht vor uns das mastenlose Schiff.
Es hatte sich in ziemlich normaler Lage zwischen die Felsen eingekeilt, nur der Kiel war total zerschmettert, sonst alles wohlerhalten — bis eben auf die abgebrochenen Masten, auch sonst war das Deck ganz glatt gewaschen, also fehlten auch die Boote.
Gegen zehn Meter befand es sich über dem Wasserspiegel, und zwar war jetzt die höchste Flut, und ebenso weit war es auch noch seitwärts von dem Wasserspiegel entfernt. Man sollte kaum glauben, dass eine Woge, und sei das Meer auch noch so stürmisch, bis zu einer derartigen Höhe reiche, auch gleich noch solch ein großes Schiff dorthinauf schleudern könne.
Wie es sonst hinaufgekommen war? Nun, eben durch den Wogenschlag. Aber wie, das konnte kein Mensch sagen, der es nicht beobachtet hatte. Das Meer spottet wie jedes andere Element aller menschlichen Berechnung.
Ich voltigierte über einen Felsen an Deck, eilte zuerst in die Kajüte.
Richtig, da war auf den Tisch ein starkes Blatt Papier genagelt, auf das der Kapitän seine letzte Mitteilung geschrieben hatte, indem er alle Schiffspapiere mitgenommen hatte.
Die ›Petrarka‹, dreimastige Bark, beheimatet in San Francisco, Kapitän Henry O'Byle mit sechsundzwanzig Mann Besatzung, unterwegs von San Francisco nach Acapulco. Am 11. Mai nachts furchtbarer Sturm. Alle drei Masten über Bord gegangen. Von den nachschleifenden Masten, die nicht rechtzeitig gekappt werden konnten, leck gerammt, wahrscheinlich schon vorher leck gebrochen.
Letzte Aufnahme gemacht am 11. Mai abends 6 Uhr 15: 26 — 18 — 57 nördlich, 123 — 5 — 13 westlich Greenwich. Es ist nachts zwei, wir gehen in die Boote. Wenig Hoffnung. Gruß an Nancy und Kinder. Kapitän Henry O'Byle.
Tieferschüttert blickte ich auf das letzte Dokument eines braven Seemannes, der dem Tode geweiht gewesen war, ihn auch sicher gefunden hatte.
Ich zerdrückte eine Träne im Auge, als Frettwurst neben mir stand.
»Na, gehört das Schiff uns? Ham Se was gemerkt, dass schon ein anderer hier war?«
»Ruhe — denken wir jetzt nicht an den schnöden Mammon — wenn nicht vor einem Grabe, so stehen wir hier doch vor einer Grabtafel — können Sie so viel Englisch lesen?«
Ja, er konnte es. Und ich hatte ihm unrecht getan, hatte ihn nur darauf aufmerksam zu machen brauchen. Nachdem er buchstabiert hatte, heulte das ehemalige Schneiderlein auf wie ein angeschlossener Kettenhund.
»Die Nancy, das is seine Frau, uuuääääh!!«
»Selbstverständlich.«
»Ich rühre nichts davon an, seine Frau und seine Ginder sollen alles griechen — uuuuäääh!«
Na, solch ein Gelübde brauchte man deswegen nicht abzulegen. Das ist alles Menschenschicksal. Frettwurst beruhigte sich bald so, wie ich mich schon beruhigt hatte.
»Ist schon jemand vor uns hier gewesen?«, bekam er auch gleich wieder materielle Gedanken.
Das konnte ich ja nicht wissen, jedenfalls war es aber nicht anzunehmen. Wer das Wrack gesehen hatte, der hätte es doch sicher auch betreten, wäre in die Kajüte gegangen und hätte unter dieses Dokument eine Bemerkung gesetzt, dass er sich für den ersten Finder des Wracks halte, so wie auch ich jetzt gleich tat. Frettwurst und der nachgekommene Müller mussten ihre Namen darunter setzen.
»Was is denn nu so ä Holzschiff eegentlich wert?«
»Wenn ich es auf 600 Tonnen schätze, so wäre es in Marseille als Brennholz vielleicht 2000 Taler wert, in New York 1000 Taler, hier aber keinen Pfennig.«
Frettwurst schaute mich mit großen Augen an.
»Warum denn nicht?«
»Weil das Holz hier in Kalifornien so billig ist, dass die Fortschaffungskosten nicht gedeckt werden würden.«
»In dem Schiffe muss aber doch auch etwas drin sein.«
»Ja, da gilt es erst zu untersuchen. Der Kapitän hat darüber nichts vermerkt, und wir wollen uns keine zu großen Hoffnungen machen. Es kann auch nur Ballast, Sand geladen haben.«
Frettwurst und Müller gingen, um das Innere des Schiffes zu untersuchen, während ich mich erst nach einem Sextanten und nautischen Handbüchern umsah, in der Instrumentenkammer auch alles tadellos erhalten vorhanden fand. Selbst die beiden Chronometer stimmten noch völlig überein. Heute hatten wir den 15. Mai, das Schiff war also erst vor vier Tagen verlassen worden, und diese Chronometer gehen gewöhnlich vierzehn Tage lang.
So begab ich mich an Deck, dorthin, wo ich unter dem Skylight in der Kajüte den einen, dicht an der Decke angebrachten Chronometer erblicken konnte, machte nach der schon ziemlich tief stehenden Sonne eine geografische Ortsbestimmung, zog dann eine Spezialkarte dieser Küstengegend zu Rate.
Danach befanden wir uns in der großen Bucht von Monterey, etwa acht geografische Meilen breit, an deren Enden die beiden Hafenstädtchen Monterey und Santa Cruz liegen (letzteres aber nicht zu verwechseln mit einem bekannteren Hafen dieses Namens in Mexiko, solche ›heilige Kreuze‹ gibt es überall, wo die spanische Zunge klingt, eine zahllose Menge), ungefähr zwanzig Meilen südlich von San Francisco und gegen zwölf Meilen östlich von jenem Punkte entfernt, wo Kapitän O'Byle seine letzte Aufnahme gemacht hatte. Sonst verzeichnete die sehr genaue Spezialkarte in dieser Bucht auch nicht das kleinste Fischerdörfchen, keinen Leuchtturm, kein einzelnes Haus, gar nichts.
Eben als ich dies konstatiert hatte, worüber fast eine Viertelstunde vergangen war, kam Frettwurst aus einer Luke herausgekrochen. Mit einem freudestrahlenden Gesicht.
»Wissen Se, womit das ganze Schiff vollgefrobbt is?«
»Nun?«
»Na, raden Se doch!«
»Nach Ihrem überirdisch verklärten Gesicht muss ich auf Diamanten schließen, oder doch auf Goldklumpen.«
»Nee, geene Diamanten und ooch geene Goldglumben. Was viel Besseres. 's is was zu essen. Un mir ham's so lange nich gehabbt. Nischt als Schbeck un weiße Bohnen.«
Ich bekam doch gleich einen kleinen Hexenschuss. In den letzten drei Tagen waren uns keine Bohnen mit Speck mehr vorgesetzt worden, aber ich dachte noch mit Grauen an die vorhergehenden Tage, fühlte noch immer die acht bis zehn Bohnengerichte im Magen.
Und es war Tatsache. Ich fand im Schreibpult des Kapitäns seine Korrespondenz, Rechnungen und dergleichen, wonach die ›Petrarka‹ mit 300 Tonnen weißen Bohnen und 200 Tonnen — immer Gewichttonnen zu 20 Zentnern — gesalzenem und geräuchertem Speck beladen war. Außerdem waren noch vorhanden 40 Tonnen Hartbrot, 30 Tonnen englischer Käse und — last not least — d. h. das letzte, nicht das schlechteste — 500 geräucherte Schinken.
Als ich dann an eine augenscheinliche Untersuchung dieser Ladung ging, fand ich unseren Oskar Müller vor einer offenen Tür stehen, hinter welcher sich die geräucherten Speckseiten als ein festgeschlossener Wall auftürmten, und Herr Oskar Müller war schon dabei, sich mit einem langen Messer in diese Speckwand einzubohren, alles, was er heraussäbelte, verschlingend, gleich Halbpfundstücke.
Mein nächster Weg führte mich zu den Bohnen — Bohnen, nichts als Bohnen, in Säcken verstaut —bis ich in den Laderaum kam, wo wieder die Fässer mit Salzspeck vorherrschten — und als ich dann mehr zur Oberwelt emporstieg, sah ich Herrn Oskar Müller vor einer anderen Tür stehen. Hier war der Eintritt durch übereinandergetürmte Käse von Mühlensteingröße verbarrikadiert, und infolgedessen hatte sich der ehemalige Drogist aus einer Speckmade in eine Käsemade verwandelt, suchte mit aller Gewalt sich in die halbweiche Mauer einzubohren.
Es war englischer Chesterkäse, wenn auch in Amerika gemacht, noch ganz frisch, aber schon mit der nötigen Ablagerung, und dieser englische Käse ist von fast unbegrenzter Haltbarkeit. Nur dass er mit der Zeit trocken wird, was eben seine Haltbarkeit bedingt.
Bei dieser Gelegenheit konnte ich auch konstatieren, dass an Bord dieses Schiffes ausnahmsweise jede Ratte und jede Maus fehlte. Es waren offene Löcher vorhanden, wo ich die Spuren dieser gefräßigen Vierbeiner, die sonst auf keinem Schiffe fehlen, oft genug zur Qual, zu einer Pest werden, sonst sicher bemerkt hätte. Dann fand ich auch eine quittierte Rechnung, wonach das Schiff vor der Einnahme dieser nur aus Fressalien bestehenden Ladung gründlich desinfiziert worden war, von professionellen Kammerjägern, eben wegen der Vernichtung dieses vierbeinigen Ungeziefers.
So ging ich noch von Laderaum zu Laderaum, als Meister Frettwurst anspaziert kam, unter dem Arme einen Dudelsack, auf dem er zu blasen schien, wenn es auch keine Melodie gab, keinen Ton — und in der Nähe erwies sich der vermeintliche Dudelsack als ein mächtiger Schinken, an dem Frettwurst vergnügt herumknabberte.
»Frettwurst, das ist allerdings ein Fang!«, rief ich. »Wissen Sie, was für ein Wert in dieser Ladung steckt?«
»Nee«, entgegnete Frettwurst mit kauendem Munde, beide Backentaschen vollgepfropft, und mit entschieden ablehnender Handbewegung. »Nee, hier wird nischt vergooft, das fressen mir alles alleene uff!«
»Ja, wenn uns nicht schon ein anderer zuvorgekommen ist.«
Der kauende Mund blieb erschrocken stehen.
»Meen Se, dass...?«
Ich wusste gar nichts. Es hieß abwarten, und Frettwurst wusste gleich einen anderen Rat.
»Awwer essen genn mir dann doch hier!«
»Selbstverständlich — so lange, bis einer kommt und uns beweist, dass er das Wrack schon vor uns gefunden hat — so lange steht uns alles frei.«
»Nu, da wollen nur uns nur wenigstens dazuhalten«, sagte Frettwurst und biss wie ein hungriger Wolf in den großen Schinken hinein.
Als ich nochmals die Kajüte untersuchte, kam ich aus gewissen Kennzeichen zu der definitiven Ansicht, dass hier noch kein anderer Mensch gewesen war. Er hätte sicher irgendeinen Beweis von seiner Anwesenheit hinterlassen.
Ich teilte dies Frettwurst mit, den ich zwischen den Felsen herumkrabbeln sah. Er hatte eine klare Quelle entdeckt, die aus einer Felsenspalte hervorsprudelte.
Er war außer sich vor Entzücken.
»Dann bleim mir hier, dann bleim mir hier!«, rief er ein übers andere Mal. »Sehn Se, da ham mir ja gleich, was mir uns immer winschten — hier genn mir Robinsons schbieln — wenn's och geene richtige Insel is — awwer sonst genn mir ganz ordentlich Robinsons schbieln, un 's Wrack, was ich immer haben wollte, is ja ooch gleich da.«
Ja, ohne dieses hätten wir es nicht lange hier aufhalten können.
Im Übrigen sagte auch mir Frettwursts Vorschlag sehr zu: hier einmal eine Zeitlang als Robinsons leben, als weltentfremdete Einsiedler, uns der Träumerei hingeben, ohne gestört zu werden, ohne arbeiten zu müssen — mit anderen Worten: uns hier einmal auf die faule Haut zu legen, so lange wir es aushielten.
Dass wir hier sobald ›entdeckt‹ würden, das war nicht zu befürchten. Ich machte eine Entdeckung, welche verriet, dass wir uns hier auf einem Fleckchen Erde befanden, das wahrscheinlich noch von keines Menschen Fuß betreten worden war.
An der Küste der kleinen Bucht wimmelte es nämlich von Gegenständen aller Art, die sich vielleicht seit Jahrhunderten hier angesammelt hatten. Schon jetzt bei Flut sah es hier unten abenteuerlich genug aus, und es musste nur erst die Ebbe kommen, um zu erkennen, was für eine ungeheure Menge von Raritäten hier angeschwemmt worden war.
Ich bemerke zunächst, dass es immer hier und da an der Küste eine Bucht gibt — oder es braucht auch gar keine Bucht zu sein — wo alles angeschwemmt wird, was in einem gewissen Umkreise, der vielleicht viele hundert Meilen beträgt, im Meere schwimmt. Das bewirken natürlich zumeist Meeresströmungen. Es gibt nicht allzu viel solche Stellen. Fast alles, was im Atlantischen Ozean schwimmt, wird durch den Golfstrom nach Island und Grönland getrieben. Wirft man in der Nähe von Kapstadt eine Flasche ins Meer, so kann man sicher sein, sie an der australischen Küste an einer gewissen Stelle, ebenfalls in einer Bucht, auf dem 26. Breitengrade gelegen, wiederzufinden. Diese Bucht, die wegen Mangels an Trinkwasser keine Besiedlung zulässt, wird deshalb von jedem vorbeifahrenden Schiffe abgesucht, hauptsächlich wegen der Flaschenpost — das sind Flaschen, in welche die Mannschaft von dem Untergange geweihten Schiffen ihre letzten Mitteilungen steckt.
Die Anziehungskraft, welche hier diese kleine Bucht ausübte, war nur eine geringe. Aus dem Fehlen von entwurzelten Baumstämmen, die sich besonders an der Küste von Island und Grönland in ungeheurer, aller Schätzung spottender Menge ansammeln, konnte dies allerdings nicht beurteilt werden. Denn hier herrscht meistens Westwind, Stürme kommen niemals aus Osten, also werden auch wenige entwurzelte Bäume ins Meer geworfen.
Aber auch Anderes, von Menschenhand bearbeitetes Treibholz, Schiffstrümmer und dergleichen, war nur wenig vorhanden. Desto mehr schwimmfähige Gegenstände lagen umher, welche einmal über Bord gefallen oder geworfen worden waren, von Schiffen, die in einiger Entfernung an der großen Bucht von Monterey vorübergefahren waren.
Und ich fand ein Kästchen, dessen Inhalt, Briefe, aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts stammte, also fast dreihundert Jahre schon lag dieses dauerhafte Holzkästchen hier, und zwar lag es so auffallend da, auf einem Felsen vor jeder Woge geborgen, und sein Aussehen war so in die Augen stechend, dass es unbedingt jeder hätte sofort sehen müssen.
Und dann wäre dieses Kästchen, von dem ich später ausführlicher sprechen werde, doch natürlich mitgenommen worden. Also konnte ich mit Gewissheit konstatieren, dass wir seit dreihundert Jahren die ersten Menschen waren, welche diesen Punkt der kalifornischen Küste betraten. Es war noch eine ganze Menge von anderen Gegenständen vorhanden, welche dasselbe aussagten — aber dieses Kästchen war das älteste und sprechendste Dokument.
Diese kleine Bucht war im Laufe der Jahrzehnte die wahre Schatzkammer geworden, wenn auch mehr für einen Raritätensammler. Immerhin, oder eben deshalb, alles, was sich hier angesammelt hatte, ließ sich verkaufen und repräsentierte einen außerordentlichen Wert.
Wie es möglich ist, dass das nicht ausgebeutet wurde, dass solch eine Bucht an der kalifornischen Küste, in der Nähe von San Francisco, zwischen zwei Hafenstädtchen oder doch Dörfern gelegen, der Menschheit unbekannt sein konnte?
Ja, du lieber Gott! Die kalifornische Küste ist gar lang. Gewiss, sie war geografisch aufgenommen, aber man muss nur wissen, wie das geschieht. Die Küsten aller Festländer der Erde sind aufgenommen, sonst könnten auf der Landkarte anstatt fester Linien doch nur Punkte eingetragen werden — unbekannt — terra incognita.
Das ist ja in Wirklichkeit alles ganz anders, als es sich der Laie denkt. Um eine Küste ganz genau aufzunehmen, müsste man doch Kilometer für Kilometer eine geografische Bestimmung machen, oder eigentlich sogar Meter für Meter, oder der Geometer müsste mit Messtisch und Messband die ganze Küste abwandeln.
Daran ist natürlich gar nicht zu denken. Das können nur Schiffe besorgen, welche mit Hilfe der Trigonometrie die Küstenformation bestimmen. Was sich da dem menschlichen Auge, wenn es auch mit dem Fernrohr bewaffnet ist, und daher auch aller Berechnung entzieht, lässt sich denken. Die emsigsten Geografen sind von jeher die Engländer gewesen — einfach, weil sie die größten Seefahrer sind, das meiste Interesse an guten Karten haben mussten — am sorgfältigsten haben sie natürlich die Küsten ihres eigenen Inselreiches ausgepeilt und berechnet — und dennoch bringt jede neue Küstenfahrt neue Entdeckungen. Besonders bei der Verfolgung von Schmugglern werden jeden Tag an der Küste Großbritanniens neue Buchten, neue von der Brandung ausgewaschene Höhlen entdeckt, und das wird nach hundert Jahren immer noch so sein. Bedenke man doch, dass man selbst mitten im kultiviertesten Deutschland, manchmal in der dichtesten Nähe einer großen Stadt, ab und zu immer wieder eine mächtige Höhle oder eine ähnliche Naturformation findet, von der man bisher noch gar nichts gewusst hat.
Nein, so einfach ist das nicht. Die Kenntnis, die wir von unserer Erde haben, wird häufig total überschätzt. Unser Wissen in dieser Hinsicht ist vielmehr herzlich gering.
Wie die Spezialkarte sagte, zogen sich quer durch die Bucht von Monterey Sandbänke, welche kaum ein Boot durchließen, die Bucht war, wie ich im Laufe der Zeit selbst bemerkte, äußerst fischarm, so hatten die Bewohner jener beiden Häfen, übrigens nur kleine Fischerdörfer, gar keine Ursache, sich in diese Küstengegend zu begeben. Und dasselbe galt für dieses Gebirge. Auch von ihm fand ich an Bord eine sehr genaue Spezialkarte, und der Pass, den wir benutzt hatten, war darauf gar nicht angegeben. Wir hatten ihn ganz zufällig gefunden, waren wahrscheinlich die ersten Menschen, die ihn begingen, und es konnten vielleicht noch tausend Jahre verstreichen, jeder Mensch war vielleicht schon mit Flügeln ausgestattet, ehe diese Ablagerungsstätte von Treibgut und die Reste eines ehemaligen, sehr großen Wracks hier durch Zufall entdeckt worden wären.
* Wir hatten die Nacht in weichen Kojen verbracht, dann begann die erste Tagesarbeit. Müller wühlte als menschliche Made in Speck und Käse, Frettwurst entwarf noch Robinsonpläne, fing schon an der Quelle zu zimmern und zu schaufeln an, wollte ein Bad bauen, und ich widmete mich der Untersuchung des angeschwemmten Strandgutes.
Was sich da alles angesammelt hatte, kann ich unmöglich aufzählen. Vor allen Dingen Flaschen und Konservenbüchsen in ungeheurer Menge. Natürlich alles leer oder doch nur mit einem geringen Rest des ehemaligen Inhaltes, sodass Flaschen und Büchsen schwimmen konnten. Waren sie voll, so hatten sie sich erst hier mit Seewasser gefüllt. Zu brauchen war von dem Inhalt nichts mehr. Ich bemerkte gleich, dass ich keine einzige Flaschenpost fand — keine der zugekorkten Flaschen enthielt einen Zettel mit einer Mitteilung. Ferner lag besonders auch eine Unzahl von Hüten umher. Ein Damenhut neuester Mode hatte Freundschaft mit einem vorsintflutlichen Zylinder geschlossen, und solcher altertümlicher Kopfbedeckungen waren noch viele da. Bis zur Entdeckung Amerikas reichten sie natürlich nicht, da waren sie denn doch dem Zahne der Zeit zum Opfer gefallen.
Dann Möbel! Tische und Stühle und Kleiderschränke und alles! Man hätte ein ganzes Haus damit ausstatten können. Aber man musste bei der Ebbe im Sande graben, um diese Schätze herauszubefördern. Ein aus dem weißen Strand hervorlugendes Stuhlbein hatte mich erst zum Graben veranlasst. Und was ich nun da im Laufe der Tage herausbeförderte! Und es waren wirklich Schätze dabei. So fand ich eine Kleidertruhe, wie es heutzutage gar keine mehr gibt, höchstens noch auf dem Lande findet man solche Kästen. Diese hier aber, aus vergangenen Jahrhunderten stammend, war überaus reich geschnitzt, der Deckel zeigte erhaben die Kreuzigung Christi, den Moment, wie die Kriegsknechte seine Kleider auswürfeln. Ich verstand nicht viel davon, aber das war sicher etwas ganz Kostbares, und nicht nur für den Raritätensammler.
Und dann Knochen! Und zwar fast nur menschliche. Totenschädel! Je tiefer ich grub, desto mehr nahm das Lager zu. Wenn auch nicht etwa so wie bei einem Massenbegräbnis. Sie lagen doch sehr zerstreut. Zwischen diesen Knochen fand ich im Laufe von vierzehn Tagen dreierlei: einen Goldring mit einem kleinen Rubin, eine altertümliche goldene Uhr und einen goldenen Schwertgriff, aber nur aus dünnen Platten bestehend, inwendig hohl.
Es waren eben Leichen von Ertrunkenen hierher gespült worden, und sie hatten doch noch Sachen in den Taschen gehabt, einer war noch mit seinem Schwerte umgürtet gewesen. Ich durfte wohl annehmen, dass die sich quer durch die Bucht ziehenden Sandbänke erst in neuerer Zeit entstanden waren, jetzt wurden vielleicht gar keine Leichen mehr angeschwemmt, weil die doch schon ziemlich tief gehen. Wenigstens fand ich keine modernen Gebrauchsgegenstände, wie Taschenmesser und dergleichen. Die Knochen lagen auch alle sehr tief gebettet.
Aller Stahl und alles andere Metall außer Gold war von dem Salzwasser zernagt worden, wohl sogar Silber. Der Schwertgriff war nur goldplattiert gewesen, die innere Füllung war herausgefressen worden. Als ich die goldene Uhr öffnete, fand ich darin statt der Räder nur einen braunen Schlamm.
Der wichtigste Fund war wohl das Kästchen, das von einer Woge hoch auf einen Felsen hinaufgeschleudert worden war. Es bestand aus Ebenholz, war sehr verwittert, sonst aber noch ganz gut erhalten, schön mit Gold ausgelegt. Ich erbrach es, fand zu meinem Staunen noch wohlerhaltene, wenn auch ganz vergilbte Papiere darin. Briefe, italienisch, datiert vom Jahre 1628 und 1629, aus Venedig. Besonders interessant waren sie nicht. Eine Frau berichtete ihrem auf Reisen befindlichen Manne, wie es zu Hause stände, über Klatsch und Tratsch der Nachbarn. Genau so wie heute. Auch gar nichts Interessantes. Den Mann redete sie Gaston an, sonst war sein Name nicht ersichtlich, ebenso wenig der ihre, auch nicht, wohin sie die Briefe adressiert hatte. Jedenfalls nicht nach Amerika. Immerhin ein höchst seltener Fund.
Also vierzehn Tage verweilten wir hier, ich immer im Sande grabend. Als ich am dritten oder vierten Tage zuerst den goldenen Ring fand, erklärend, dass man hier noch mehr solcher Kleinodien finden müsse, wurde Müllers Habgier rege, er widmete seine Arbeitskraft der Speck- und Käsekammer nur noch, wenn ihn der Hunger dazu trieb — mindestens alle zwei Stunden — sonst verwandelte er sich in einen Schatzgräber!
Aber während ich noch die Uhr und den Schwertgriff fand, entnahm Müller dem Schoße des Meeressandes nicht einmal ein hölzernes Taschenmesser, so sehr er auch im Schweiße seines Angesichtes schaufelte, bis er eine Woche später den heiligen Schwur ablegte, niemals wieder zwischen den Knochen zu wühlen, worauf er endgültig zu seinen Speck- und Käsekammern zurückkehrte. Er hatte schon ganz ansehnliche Löcher hineingefressen.
Frettwurst war unterdessen unablässig mit dem Bau seiner Badeeinrichtung beschäftigt. Er badete sich sehr gern, seitdem er aber einmal im Mittelländischen Meere von einer Qualle gebrannt worden war, war er nicht mehr zu bewegen, ins Meer zu steigen, wenn es auch hier gar keine Nesselquallen — übrigens ganz harmlose Tiere — zu geben schien.
Nach Verlauf der vierzehn Tage hatte Frettwurst denn glücklich eine Brause konstruiert, das Quellwasser musste durch ein Rohr in einen durchlöcherten Blechtopf laufen — alles ganz genial ausgedacht, nur schade, dass die Brause niemals funktionieren wollte.
»War denn eine Brause das erste, was Robinson unbedingt nötig hatte, dass er sich abduschen konnte?«, lachte ich.
»Dass weeß'ch nich, un das is mir iewerhaubt ganz egal — ich will jetzt erscht enne Brausche ham, un nu grade!«
Er sagte nämlich prinzipiell immer Brausche.
»Haben Sie denn hier schon eine Robinsonhöhle entdeckt?«
»Ich brauche geene Heehle, ich brauche erscht enne Brausche.«
»Sonst schlage ich vor, Sie können sich in einer der Speckkammern als Robinson etablieren, oder auch in einer der Käsekammern — Müller hat schon ganz geräumige Höhlen hineingefressen.«
»Ä Sie mit Ihren Schbeck un Gäse — ich will enne Brausche.«
»Ja, lieber Freund, das fangen Sie aber verkehrt an, das Wasser muss doch Druck haben...«
»Nee nee, sagen Se mir nischt, behalten Se Ihre Weisheit fier sich — das muss'ch alles ganz allene finden, sonst macht's mir geen Schbaß, un ich wäre schon noch uff'n Drichter gomm.«
»Wollen wir denn bis an unser Lebensende hierbleiben?«
Ja, Frettwurst war dazu bereit, und Müller, seitdem er sich wieder ausschließlich dem Speck und Käse widmete, nicht minder. Er hatte schon ausgerechnet, dass er hier hundert Jahre lang schlingen konnte, und dann waren noch immer die 300 Tonnen weiße Bohnen vorhanden.
Nun, wenn die beiden nicht an einen Verkauf dieser Schätze dachten, dann ich auch nicht. Dann hatten wir aber auch nicht nötig, unseren Fund anzuzeigen. Es musste sich zur Vorsicht nur immer jemand an Bord befinden, dann mochte kommen, wer da wollte — man konnte uns das Eigentumsrecht nicht streitig machen.
So waren zwei Wochen vergangen. Ich buddelte noch immer im Sande, hatte es noch nicht überdrüssig bekommen. Müller bohrte mit ungeschwächtem Appetit im Speck und Käse herum, fing jetzt schon mit Tunnels an, Frettwurst experimentierte an seiner ›Brausche‹.
»Naboleon Bonabarte, gomm Se mal her«, erklang da der Ruf, »aber fix, schrecklich fix, 's is was bassiert!«
Ich rannte schleunigst hin, unterwegs meinen Revolver entsichernd.
Als ich um die Felsenecke bog, die die Quelle von dem Wrack trennte, sah ich Frettwurst stehen, die Hände über dem Bäuchlein gefaltet, wenn dieses jetzt auch nicht den Leierkasten barg, und mit seligem Lächeln den oben an der Felswand angebrachten Kochtopf betrachtend, aus dessen durchlöchertem Boden das Wasser in Strahlen hervordrang.
»Was ist denn passiert?!«, rief ich erschrocken.
»Nu, Se sehn's doch. De Brausche geht. Nee, is das awwer scheene! Wenn'ch jetzt enn Fotografenabbarat hätte, das wird'ch abfotografieren. Un den Gerl da wird'ch ooch abfotografieren«, setzte Frettwurst noch hinzu.
Ich fuhr herum — da stand ein fremder Mann, ein Strolch, nur in Lumpen gehüllt, unter dem Arm eine moderne Doppelbüchse, und das verwetterte Gesicht drückte solch ein Gemisch von Staunen, Grimm und Hass aus, wie er uns anblickte, dass es des ›Abfotografierens‹ wirklich würdig gewesen wäre.
»Hallo!«, stieß er endlich hervor, nachdem er uns lange genug so angestarrt hatte.
»Wie kommt denn Ihr hierher?«, fragte ich meinerseits.
»Liegt hier nicht ein Wrack?«
»Ja, dort hinten. Und?«
»Wir haben's von oben gesehen.«
»Und?«
»Ihr habt's schon gefunden?«
»Jawohl.«
»Gottv...«
Ein fürchterlicher Fluch folgte. Ich habe in dieser Erzählung wohl manchen Fluch gebraucht, aber diesen wage ich nicht wiederzugeben.
Und ich konnte begreifen, was diesen Mann so furchtbar erregte. Er tat mir leid, ich konnte ihm indessen nicht helfen.
Er suchte sich zu beruhigen.
»Wann habt ihr das Wrack gefunden?«
Weshalb hätte ich nicht auf solche Fragen antworten sollen?
»Vor zwei Wochen.«
»Wo habt ihr es gemeldet?«
»Wir haben es noch gar nicht gemeldet«, entgegnete ich der Wahrheit gemäß, wenn das auch nicht gerade klug von mir war. Aber wer denkt auch immer gleich ans Schlimmste — ich am allerwenigsten.
»Was? Ihr hättet den Fund noch gar nicht angezeigt?!«
»Nein.«
»Weshalb denn nicht?«
»Wir haben das doch nicht so eilig. Das Wrack gehört eben uns, wir haben es zuerst gefunden, und damit basta.«
»Da habt ihr recht, dem ersten Finder gehört es«, stimmte der Strolch nach kurzem Besinnen bei. »Was für ein Schiff war es denn?«
»Eine Bark, die ›Petrarka‹ aus San Francisco.«
»Kenne ich nicht. Und der Kapitän?«
»Henry O'Byle.«
»Kenne ich nicht. Was hatte es denn geladen?«
»Sechshundert Tonnen Bohnen, Speck und Schinken und Käse.«
»Und das ist alles noch vorhanden?«
»Alles tadellos.«
»Ihr seid ein Glückspilz, Seid ihr nur zu zweit?«
»Noch ein dritter ist mit uns.«
»Wo ist denn der?«
»An Bord.«
»An Bord des Wracks?«
»Ja.«
»Und ihr seid wirklich nur drei Mann?«
»Fragt nicht so dumm. Weshalb sollte ich Euch denn einen vierten verschweigen?«
Jetzt antwortete ich natürlich schon längst aus dem Grunde so ausführlich, um den Strolch auszuhorchen, was der eigentlich vorhatte. Denn misstrauisch war ich nun schon längst geworden. Der Kerl sah auch danach aus.
»Ich kann nur nicht begreifen, weshalb ihr da noch keine Meldung gemacht habt.«
»Wozu denn nur? Wir haben es doch gar nicht so eilig. Es gefällt uns hier, wir amüsieren uns mit dem Speck und Käse.«
»Hm. Schließlich habt Ihr recht. Das Wrack kann Euch nicht streitig gemacht werden. Sonst noch was in dem Wrack gefunden?«
»Nichts Nennenswertes.«
»Kein Geld?«
Nein, wir hatten keinen roten Cent entdecken können, die Schiffskasse war mitgenommen worden. Ich sagte es ganz offen.
»Immerhin — sechshundert Tonnen Speck und Bohnen... wie habt Ihr denn das Wrack gefunden?«
»Wir sahen es von dort oben aus.«
»Hm. Wir auch«, brummte der Strolch gedankenvoll vor sich hin.
»Ihr seid mehrere?«, fragte ich jetzt.
Der Kerl fuhr aus seinen Gedanken empor.
»Wir? Ich bin ganz allein. Bin ein Tramp, suche Arbeit.«
Er wusste nicht, dass er vorhin ›wir‹ gesagt hatte, und ich machte ihn nicht darauf aufmerksam. Nur Frettwurst warf mir einen bedeutsamen, aber unauffälligen Blick zu. Auch er hatte schon längst etwas gemerkt. Wir mussten auf alles gefasst sein.
Der Strolch sah sich um.
»Von dort seid ihr hierher gekommen?«
»Ja, durch diesen Pass.«
»Gibt es hier noch einen anderen Ausgang?«
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Habt ihr ein Boot?«
»Auf dem Wrack war keins mehr vorhanden. Alles fortgespült.«
»Habt euch auch noch keins gebaut?«
»Nein. Wo denn?«
»Hm. Habe seit gestern keinen blutigen Bissen über meine Lippen gebracht, und wenn ihr so im Speck sitzt, könnt ihr mir wohl etwas vorsetzen.«
»Natürlich, warum nicht! Kommt mit! Aber denkt nicht etwa, dass Ihr durch Betreten des Wracks Euch ein Anrecht erwerbt.«
Der Mann lachte heiser.
»Haltet ihr mich für einen Narren? Ich weiß recht gut, wem das Wrack gehört. Ja, da ist nichts mehr zu machen, da sind wir... bin ich eben zu spät gekommen. Ich denke nämlich immer noch an meinen Hund, der mir gestern weggeschossen wurde.«
Der Mann ging mit uns. Nach den ersten Schritten zog er plötzlich einen Revolver und schoss zweimal in die Felsen hinein.
»Was sollte das?!«
»Dort saß ein Geier — kann diese Biesters nicht leiden.«
»Ich habe keinen Geier gesehen.«
»Nicht? Dann seid Ihr blind. Dort saß er, dort fliegt er ja noch. Habe ihn nur etwas gefledert.«
»Ihr müsst recht viel Munition haben.«
»Habe ich auch.«
Wir hatten das Wrack erreicht.
»Der Kerl hat was vor, dem is alles zuzutrauen«, flüsterte mir Frettwurst bei der ersten Gelegenheit zu.
Nur einige Blicke von mir genügten, um ihm zu sagen, wie ich auf der Hut war.
Ich ließ den Strolch mit Frettwurst allein in der Kajüte, ging, um Hartbrot und einen Schinken zu holen, hauptsächlich aber, um Müller schnell zu instruieren. Er musste an Deck Wache stehen.
Der Kerl aß mit Gier, stellte noch recht verfängliche Fragen, brach aber auch sehr bald wieder auf.
»Ja, da ist nichts zu machen, ich habe das Wrack eben zu spät gesehen. Na, einen Schinken könnt ihr mir wohl noch mitgeben.«
Er erhielt ihn, forderte auch noch Hartbrot, der Sack konnte ihm nicht groß genug werden.
»Mensch, das könnt Ihr ja gar nicht tragen«, sagte ich, als er sich in der Proviantkammer, die ebenfalls sehr reich ausgestattet war, selbst einschaufelte.
»Was? Das soll ich nicht tragen können?! Das sind doch keine zwanzig Pfund.«
»Nun ja, aber Ihr habt doch nicht nötig, Euch mit solch einer Last zu schleppen, hier in Kalifornien findet Ihr doch alle Nasen lang eine Farm.«
»Ich habe lieber meinen eigenen Proviant mit mir, und die paar Pfund belästigen mich gar nicht.«
Der Kerl wollte natürlich auch seine Kameraden verproviantieren. Er verließ uns ohne Abschiedsgruß, und im Gehen sah ich noch sein höhnisches Grinsen.
»Der hat noch andere bei sich, die legen sich jetzt auf die Lauer«, sagte Müller. Selbst dessen sonst ziemlich naiver Kopf hatte gleich das Richtige erkannt.
Wir saßen in einer fatalen Klemme. Der Bande, zu der dieser widerliche Kerl gehörte, war sicher alles zuzutrauen. Die legten sich in den Hinterhalt und schossen uns ganz einfach nieder, sobald wir uns an Deck zeigten. Und wir hatten keine Möglichkeit, diese Bucht zu verlassen, ohne uns den Gewehren der Schurken auszusetzen. Denn es führte nur jener eine Pass heraus, den die Banditen natürlich immer im Auge behielten, wenn sie sich nicht darin versteckt hielten, und links und rechts trat die steile Gebirgswand bis dicht ans Meer. Ein Boot besaßen wir ja auch nicht.
Wir hatten — oder ich will und muss die ganze Schuld auf mich nehmen — ich hatte kurz hintereinander drei oder noch mehr große Fehler begangen.
Erstens hätte ich diesen unseren Fund gleich der nächsten Behörde oder doch wenigstens einem einzigen vertrauenswerten Menschen mitteilen sollen. Statt dessen lagen wir nun schon zwei Wochen hier auf der faulen Haut und hatten immer noch keine Meldung erstattet. Wäre es geschehen, dann hätten die Banditen uns jetzt gar nichts mehr wollen können.
Oder ich hätte dem Kerl wenigstens nicht sagen sollen, dass wir diese Meldung unterlassen hatten!
Drittens hätte ich ihn nicht auch noch verproviantieren, ihn besser gleich als Geisel festhalten sollen.
So sprach ich ganz offen meine Schuld aus, stieß aber damit bei Frettwursten auf den kräftigsten Widerstand. Das harmlose Männchen zeigte sich plötzlich als ein von Prometheustrotz infizierter Held.
»Nee, das hätt'ch ooch nich gemacht — entschuldigen Se gietigst, Herr Naboleon Bonabarte, awwer was Se da schbrechen, es eefach Unsinn — nee, das Wrack is ähm unser, un da ward desderwägen gar nich geflunkert — den Lumichen wärd ähm nich nachgegähm, un da beißt de Maus gee Fädchen ab.«
Nun, wenn Schneidermeister Frettwurst so sprach, dann konnte ich gestehen, dass ich ganz genau so dachte, mir also keiner Schuld bewusst war — jawohl, so wurde eben hier ausgehalten, solange es uns hier gefiel, und sie sollten nur kommen!
Müller wurde deswegen gar nicht erst um seine Meinung befragt.
Trotzdem waren wir uns wohl bewusst, in einer Falle zu sitzen. Dass die Kerls im Hinterhalt lagen und jeden niederschossen, der sich an Deck oder sonst im Freien zeigte, daran war auch für Frettwurst gar kein Zweifel. Wir mussten trotz alledem auf heimliche Weise zu entkommen suchen, um noch jetzt eine Meldung über unseren Fund zu machen.
Aber wie von hier fortkommen? Nun, wir mussten uns eben ein Boot oder doch ein Floß zimmern, was unter Deck geschehen konnte. Auf diesem fuhren wir die Küste entlang, irgendwo musste die steile Felswand doch eine Unterbrechung haben, es konnte vorher auch etwas rekognosziert werden, wir hatten ja Zeit dazu.
»Errscht wolln mir awwer doch mal an Deck gehen. Am Ende denken mir doch falsch, un die Gerls sin gar nich mehr da.«
»Hören Sie, das wäre ein gefährliches Experiment!«, warnte ich.
»Nu, genn mir se denn nich so teischen, dass Se verraten, ob Se ooch wirklich uff uns schießen wolln?«
O ja, das konnten wir. Wir stellten einen Strohmann her, er bekam meine Jacke an, meine auffallende Mütze auf den Kopf, so schoben wir ihn langsam bis zur Brust durch eine Deckluke hinauf, uns selbst sorgfältig versteckt haltend.
Aber bis zur Brust kam er gar nicht hinauf. Kaum war oben der Kopf vollständig zu sehen, als auch schon ein Schuss krachte, oder wahrscheinlich deren zwei ziemlich gleichzeitig, der Knall zog sich etwas auseinander, und ich fühlte, wie eine Kugel durch den Strohmann schlug, hörte sie zu unseren Füßen aufklatschend in die Diele dringen.
Ich vergaß nicht, den Strohmann mit einem Ruck zurückzuziehen, sodass die Gegner recht wohl glauben konnten, er sei tödlich getroffen von der Leiter gestürzt. Einem lebendigen Menschen wäre es auch nicht anders gegangen. Die eine Kugel war durch Mütze und Kopf gegangen, die andere durch die Schulter.
»Ei Gottverbippg, solche Himmelsackermente!«, ließ sich Frettwurst vernehmen. »Schießen diese Gerle so mir nischt dir nischt unsern Schtrohmann dod!«
Im Grunde genommen aber war es Frettwursten ebenso wenig wie mir humoristisch zumute, es war nun eben einmal seine Ausdruckweise.
Ich selbst hatte auch nicht vergessen, laut aufzuschreien, und es kam mir vom Herzen, und wenn es auch ein Schrei der furchtbarsten Entrüstung war, so mochten die Gegner ihn doch für einen des Schmerzes oder des Todes halten.
Und gleichzeitig hatte ich, der ich etwas unter der Luke hervorlugte, noch etwas anderes beobachtet.
»Frettwurst, das mit dem Strohmanne müssen wir noch einmal tun!«
»Sie meinen, die sollen denken, dass sie uns einen nach dem andern totschießen?«
»Mögen sie denken, was sie wollen — ich habe gesehen, wo die Hunde liegen — wenigstens den einen sah ich im Anschlag — dort oben auf der Felswand, er ragte mit dem halben Oberkörper hervor.«
Frettwurst begriff sofort. Diesmal bekam der Strohmann seine Jacke an, auf den Kopf Frettwursts nicht minder auffallende Schirmmütze, er wurde zur Vorsicht an eine Stange gebunden, so sollte ihn Frettwurst wiederum durch eine Luke hinaufschieben, aber durch eine andere. Zu plump durften wir diese List nicht ausführen.
Alles war zur Ausführung bereit, ich hielt mich mit meinem Revolver neben einem offenen Bullauge, durch welches ich, wenn ich mich bückte, jene Stelle sehen konnte, auf der sich vorhin der eine Schütze gezeigt hatte.
»Nehm Se doch lieber enne Bichse, enne Flinte«, riet Frettwurst.
Ich zog jedoch meinen langläufigen Revolver vor, mit ihm hatte ich mich schon eingeschossen, und ich bin von je ein ausgezeichneter Pistolenschütze gewesen, habe manchen Tag verknallt.
Frettwurst ließ den Strohmann in die Höhe kriechen, und richtig, an genau derselben Stelle wie vorhin, in einer Höhe von etwa zwanzig Metern, tauchte dort oben auf der Felswand der obere Teil eines menschlichen Kopfes auf, ein ganzes Gesicht — ein Gewehrlauf schob sich vor, ein Arm, ein Rumpf
Mehr brauchte ich nicht, schon der Kopf hätte genügt. Mein Revolver krachte, und von dort oben sauste ein Gewehr herab, ein menschlicher Körper legte sich halb über die Felswand, blieb so liegen.
»Nummer eins!«, rief ich und sprang blitzschnell an ein anderes Bullauge, eben um meinen Schützenstand zu wechseln.
»Heern Se, den ham Se wohl glei durch'n Gobb geschossen, dass'r so gar nischt derbei sagte?«
Ja, es musste ein Kopfschuss gewesen sein. Wenn ich auf diese Entfernung ein solch klares Ziel hatte, dann war ich auch seiner sicher.
»Aufgepasst!«, flüsterte ich.
Ob Frettwurst den Strohmann schon wieder zurückgezogen hatte, wusste ich nicht — ich sah nur, dass dort oben der sonst regungslose Körper zurückgezogen wurde — und richtig, da tauchte in einiger Entfernung vom Felsrand wieder ein Kopf auf, und zum zweiten Male krachte mein Revolver.

»Nummer zwei! Auch diesmal garantiere ich für einen Kopfschuss!«
»Nu, da schießen Se nur so weiter«, ermunterte mich Frettwurst, »dann missen Se doch bald alle wärn.«
Ja, wir durften sogar hoffen, dass es überhaupt nur zwei gewesen waren. Einen Racheschrei hatte ich nicht gehört, der sonst bei solchen Gelegenheiten wohl gewöhnlich folgt, so wenig wie einen Todesschrei. Aber die Hoffnung, dass jener Kerl nur einen einzigen Genossen gehabt hatte, war doch sehr fraglich. Wir mussten abwarten, beobachten.
Stunden vergingen, und nichts zeigte sich. Von unserer Seite geschah freilich auch nichts.
»Probieren wir es noch einmal mit dem Strohmann«, schlug ich vor.
Die Puppe wurde wieder in anderer Weise ausstaffiert, durch eine Luke mit den Bewegungen eines emporkletternden Menschen hinaufgeschoben. Ich stand als Scharfschütze auf meinem Posten.
Aber kein Kopf wollte wieder auftauchen, auch von anderer Stelle fiel kein Schuss.
»Entweder es waren wirklich nur zwei, die wir beseitigt haben... «
»... oder se wolln nicht mehr uff unsre Bubben hubben«, ergänzte mich Frettwurst in sehr poetischer Weise, »wie wär'sch denn, wenn mir mal...«
Da donnerte ein Schuss. Ich mit einem Sprunge am Bullauge. Nichts zu sehen, auch kein Rauchwölkchen mehr.
»Da ist also wenigstens noch einer da — schade!«, sagte ich.
»Und heern Se, das war geene weiße Bohne, das war Sie enne blaue, die ich in den Leib begomm hawe.«
Ohne Verständnis schaute ich den Sprecher an. Frettwurst kam, im Munde die qualmende Großvaterpfeife, die er hier überhaupt selten aus den Zähnen gebracht hatte, langsam auf mich zu.
»Was sagten Sie da von einer blauen Bohne, die Sie in den Leib bekommen hätten?«
»Nu ja, in dn Bauch — ich glauwe, wenn'ch mei Leiergasten umgehabt hätte, dann...«
Mit einem Male sah ich, wie sich das vor Gesundheit strotzende Gesicht des kleinen dicken Männchens verfärbte, er ließ die Pfeife fallen, legte sich selbst daneben hin.
»Aus!«
Ich war starr, ich konnte es nicht begreifen! Wie er dieses ›aus!‹ gesagt hatte!
Dann freilich war ich mit einem Satz bei ihm.
»Frettwurst, um Gotteswillen, machen Sie keine Scherze!!«
»Sie denken, ich schbaße? Nee. Weiße Bohnen gann'ch verdaun, ja — aber so ne eenzge lumbge blaue Bohne — nee.«
Es fällt mir schwer, in dieser Situation seinen sächsischen Dialekt wiederzugeben, und doch muss es gerade jetzt sein. Denn es war eben Meister Baldewin Frettwurst, der als Held ohne Furcht und Tadel mir unter den Händen sterben sollte.
Ich habe einst gesagt, ich glaubte, den größten Schmerz meines Lebens schon durchgemacht zu haben — damals, als mich das Liebste auf Erden verriet — nein, hier an der kalifornischen Küste sollte ich einen noch viel, viel bittereren Schmerz durchleben — und doch wieder versüßt durch das Beispiel, zu sehen, wie ein echter Mann stirbt — und wenn's auch nur der Schneidermeister Baldewin Frettwurst aus Schande war — und eben dazu ist sein sächsischer Dialekt unbedingt nötig.
So weit war es freilich noch nicht. Ich wollte es überhaupt nicht glauben.
Ich hob ihn auf, trug ihn aufs Sofa in die Kajüte, da sah ich schon das angesengte Löchelchen. Ich schnitt ihm vorn die Sachen auf — da erblickte ich erst recht die Wunde.
Frettwurst war unvorsichtigerweise gerade unterhalb der Luke gegangen, der Feind hatte aufgepasst — die Kugel war ihm etwas links in den Leib gegangen, natürlich stark von oben nach unten, stak wohl in den Eingeweiden.
Bleich war Frettwurst, aber ganz gefasst, und wenn er Schmerzen verspürte — wahrscheinlich fürchterlichster Art — so war ihm doch davon nicht das Geringste anzumerken.
Fassungslos starrte ich auf das hässliche Löchelchen.
»Hinten is se nich wieder rausgegomm, das weeß'ch genau.«
»Die muss heraus!«, schrie ich außer mir, schon alle Folgen sehend, wenn die Kugel nicht entfernt wurde. Bei Zerreißung eines Darmes musste natürlich alsbald Blutvergiftung eintreten.
»Sin Sie Arzt? Oder verschtehn Se sonst was davon? Gähm Se sich geene Miehe, mit mir is es aus ' ich fiehle schon, wie mir langsam de Zehnschbitzen galt wärn.«
»Frettwurst, mein armer, lieber Frettwurst!«, heulte ich auf.
»Schrein Se nich so. Schbieln Se mir liewer was uff'n Leiergasten vor. Se wissen schon, mein Lieblingsschtick — Un eh mir scheiden missen...«
Ich stürzte davon, in die Instrumentenkammer — nicht etwa, um ein ärztliches Instrument zu holen, das hätte ich auch nur im Apothekenschrank gefunden — sondern um die Landkarte zu befragen.
Wozu? Um zu wissen, welches die nächste Stadt, der nächste Flecken war, in dem man einen Arzt, einen Chirurgen zu finden erwarten durfte.
Ich hatte ja schon einmal die Spezialkarte der Gegend studiert, und ich hatte mich nicht geirrt. Drei oder vier Meilen von hier entfernt befand sich das Städtchen Mannheim, doch sicher von Deutschen gegründet. In vier bis fünf Stunden konnte ich es erreicht haben, eine Last von anderthalb Zentnern auf dem Rücken sollte dabei meinen Lauf nicht verlangsamen — aber erst musste ich da durch jenen Pass.
Mein zweiter Sprung war nach dem Waschtisch, an dem noch das Handtuch hing, mit diesem hinauf an die Luke, es als Zeichen des Friedens oder doch der Kapitulation geschwungen.
Kaum zeigte ich meinen Oberkörper, als auch schon ein Schuss donnerte — von wo, wusste ich gar nicht, auf der Felswand sah ich nirgends ein Wölkchen aufsteigen — an meinem Kopfe pfiff eine Kugel vorbei, mein Ohr wie ein Feuerstrahl streifend.
Dennoch wankte und wich ich nicht.
»Ihr sollt das Wrack und alles haben«, schrie ich mit Aufgebot all meiner Lungenkraft. »Nur gebt uns freien Abzug, und ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen, euch niemals zu verraten!«
Ein Hohngelächter war die Antwort, und selbst Worte folgten.
»Dass wir Narren wären! Ihr seid uns da unten sicher, wir platzen einen nach dem anderen weg!«
Gleichzeitig wieder ein Doppelknall, wieder pfiff mir eine Kugel am Kopfe vorbei, eine zweite durchlöcherte das weiße Tuch dicht vor meiner Hand.
Dass mir die Banditen durch derartige Streif- und Kunstschüsse ihre Treffsicherheit beweisen wollten, daran war nicht zu denken, sie hatten mich eben dreimal gefehlt, und mich einer vierten Kugel auszusetzen, wäre Wahnsinn gewesen.
Ich begab mich zu Frettwurst zurück.
»Es sind mindestens noch zwei.«
»Nu, da wärn Sie mit die ooch schon noch fertig werden.«
»Aber ich kann Sie nicht nach der nächsten Stadt tragen, wie ich beabsichtigt hatte.«
»Wozu denn?«
»Die Kugel muss schleunigst durch eine Operation entfernt werden.«
»Nee, nee, mir gann gee Arzt nischt mehr helfen.«
»Und ich glaube es nicht!«, jammerte ich.
»Se wärn's ja erlähm.«
»Wie geht es Ihnen denn, mein armer Freund?«
»Nu, so lala — ich will nich grade glagen, gennte mir noch viel schlechter gehn. Ich schtelle mir immer vor, was das erscht fier ä Gefiehl sein muss, wenn ein mit'n Bajonett der ganze Bauch aufgeschlitzt wird.«
Was für Schmerzen er ausstand, war ihm dennoch anzusehen, obgleich er mit keiner Wimper zuckte. Aber er hatte plötzlich ein ganz anderes, sogar viel kleineres Gesicht bekommen — ein sicheres Zeichen für den, der schon öfters Sterbende beobachtet hat.
Und ich konnte ihm absolut nicht helfen, konnte ihn nur möglichst aufrecht betten, dann hatte er die wenigsten Schmerzen, das gestand er.
»Sie, Naboleon Bonabarte, ich mechte mei letztes Desdament machen.«
»Ach, machen Sie lieber keinen Sums!«
Aber ich sah bald ein, dass der Unsinn vielmehr auf meiner Seite lag. Ich durfte mir und ihm gar keine Hoffnung mehr machen.
»Gann ich mei letztes Desdament ooch hier machen, dass es ooch fier Deitschland giltig is?«
»Selbstverständlich.«
»Ooch fier Sachsen, sogar fier Schande?«
»Das bleibt sich doch ganz gleich«, konnte ich sogar lächeln.
Denn fürwahr, der verstand dem Tode alle Schrecken zu nehmen!
»Es müssen nur zwei Zeugen unterschreiben, und die sind ja vorhanden — Müller und ich. Selbst wer wir sind, bleibt sich dabei ganz gleichgültig. Wir sind zwei Menschen — und wenn wir Hottentotten wären.«
»Awer wenn'ch nun den einen von beiden oder gar alle beide zu Ärm einsetze?«
»Schadet nichts, auch dann können sie als Zeugen dienen.«
»Na, da wollen mir mal... Sin Se mal so freindlich, un holn Se Dinde un enn Federhalter mit enner Feder her un ä anschtändiges Schticke Babier, meeglichst ohne Fettflecke.«
Ich besorgte ihm das Gewünschte.
»Sie wollen doch nicht etwa uns zum Erben einsetzen?«, fragte ich vorher noch.
»Nu, warum denn nich? Ich hawe auf der Schandauer Bodenkreditbank ganz genau 10 000 Daler...«
»Haben Sie denn keine anderen Verwandten?«
»Gee eensges Luder.«
»Trotzdem — mich wenigstens lassen Sie dabei aus dem Spiele...«
»Nu, Sie sin doch ä armes Luder...«
»Trotzdem — vermachen Sie mir Ihre Pfeife, Ihr Felleisen... aber kein Geld.«
»Ja, ja, ich weeß schon, Geld macht nich glicklich — un iewerhaubt, 10 000 lumbge Daler, das is doch nischt fier ä Mann wie Sie — die verjuxen Sie in enner eenzgen Nacht, un dann bleim Se ooch noch de zerbrochnen Gläser schuldg. Na, dann vermach'ch die 10 000 Daler unserm Miller, ganz satt essen gann er sich zwar von den Zinsen ooch noch nich, er gann awwer doch wenigstens das Doppelte essen, als wenn'r nur de Hälfte begäme. Also nu mal los. Was schreib'ch denn drieber? Mei letztes Desdament, gelle he?«
»Sie meinen wohl: mein letzter Wille.«
»Ach ja, Sie ham recht: mei letzter Wille.«
Er fing an zu schreiben, und ich sah gleich, dass er ganz korrekt und orthografisch schrieb.
Oskar Müller stand daneben, er hatte es schon gehört, auch er schien sehr gerührt zu sein, was ihn aber nicht hinderte, dabei immer von einer riesigen, zweifingerdicken Käsescheibe abzubeißen, die er auch noch mit Butter bestrichen, mit Schinken belegt und mit Senf beschmiert hatte.
Der Erblasser hielt einmal mit Schreiben inne und warf ihm einen seiner Blicke zu, die nicht zu schildern sind.
»Heern Se, Sie, mei liewer Freind — awwer zu enner mit Schinken belegten Gäsebemme ohne Brot, un ooch noch Senf druff — dazu lang' de Zinsen von zehndausend Dalern nich!«
»Mum mum mum mum«, machte der mit beiden Backen Kauende.
»Na, lassen Se sich nur nich schteern — dann verfressen Se ähm 's Gabidal — Se wärn dann schon enn andern finden, der Sie wieder zum Universalärm einsetzt — wie heeßen Se denn nu eegentlich, un wo un wann sin Se denn geborn, un so, dass Se sich dann ooch legidimieren genn?«
Müller machte alle Angaben, und das ›letzte Desdament‹ war fertig.
Es war tadellos abgefasst. Wir unterschrieben, und Müller würde beim Antreten seiner Erbschaft, wenn er persönlich nach Deutschland ging, nicht die geringsten Schwierigkeiten haben.
»Frettwurst«, sagte ich, »wissen Sie, was Sie sind?«
»Ä guter Gerl — ich weeß schon, was Se sagen wolln! Awer, was wolln Se denn? Gann'ch denn etwa die zehntausend Daler mitnehm? Ich mecht's wohl, awer ich gann's nich. Wägen meiner Feife mach'ch nich erscht ä letztes Desdament — ä letzten Willn, wollt'ch sagen — was'ch sonst hawwe, das geheert ähm Ihnen. Awwer noch enne recht große Bitte hätt'ch an Sie.«
»Sprechen Sie sie aus, und wenn Sie auch das Unmöglichste verlangten...«
»Ich mechte gerne uff'n Monde begram wärn.«
»Was, auf dem Monde?«
»Gennten Se mich da begram? Nee? Sehn Se, ich darf ähm nich das Unmöglichste verlange. Nee, 's is ooch was ganz andersch, was recht Dummes. Sehn Se, da hab'ch mal gelesen, in meiner Jugend, da is emal ä Mann gewesen, der is geschtorm un begram worden, un wie se mal wieder nachgesehn ham, was'r eegentlich macht, da ham Se gesehn, dass'r wieder lebendig geworden is, finf oder sechs Wochen schbäder. Das heeßt, lewend'g war er dann nich mehr, awwer er is im Grabe un sogar im Sarge noch emal erwacht, hatte sich das ganze Gesicht zerkratzt un so. Sehn Se, un seitdem habb'ch immer Angst, wenn ich mal dod bin un begram werde, da gennt'ch dann widder lebendig werden, un wenn mer nu da unten so gar geene Luft begomm gann, wenn mer sich's ganze Gesichte uffkratzt — un iewerhaupt, wenn dann de Mählwärmer gomm un een uffknabbern — selbst wenn mer wärklich dod wäre — nee, — muss doch ä zu unangenähmes Gefiehl sin, gelle he?«
»Aber, mein lieber Frettwurst...«
»Lassen Se mich, ich weeß, wie's mit mir schteht. Verbrannt möcht'ch wärn. 's war schon mei Wunsch von kleenuff. Mit den Lumichen wärn Se schon noch fertig wärn, un wenn's ooch noch ä baar Dutzend sin, un Holz ham Se ja ooch genug — Se wärn mich verbrenn, gelle he?«
»O, Frettwurst, Frettwurst!«, jammerte ich.
»Das heeßt, erscht wenn'ch richtig dod bin.«
Da sah ich, wie sich sein Gesicht nochmals veränderte, und nicht zum Besseren, er streckte sich, ich sah es kommen — jedenfalls hatte er einen starken inneren Bluterguss gehabt, und sobald das Blut in die Lunge trat, war es aus mit ihm.
Mit einem Male griff er hastig nach meiner Hand und presste sie krampfhaft. So lag er einige Minuten mit geschlossenen Augen da, und als er sie wieder öffnete, waren sie plötzlich ganz groß und klar, und so, mit zur Decke gerichtetem Blick, begann er mit lächelnden Lippen zu flüstern.
»Da — da... o, ist das schön... die weißen Gestalten — Engel — mit Palmen in den Händen — sie winken mir — o, ist das schön, wunderschön... wenn'ch jetzt enn Fotografenabbarat hätte, das wird'ch ab....«
Da ging auch seine Seele ab. Er war genau so gestorben, wie er gelebt hatte.
Ich drückte ihm die Augen zu. Tränen hatte ich nicht.
Es begann zu dunkeln.
In der Ferne ein Wetterleuchten.
Ich zündete in der Kajüte die Hängelampe an, ohne an eine Vorsichtsmaßregel zu denken, nahm eine Handlampe, holte Holz herbei.
Das speicherte ich unter dem großen Kajütentisch auf, und als die Höhlung ganz gefüllt war, legte ich auf den Tisch Frettwursts Leiche, bahrte sie sorgsam auf.

Schüchtern, fast ängstlich hatte mich Müller immer beobachtet.
»Sie wollen ihn wohl gleich hier verbrennen?«, fragte er leise.
»Ja.«
»Da wird aber doch das ganze Schiff anbrennen?«
Wild fuhr ich gegen den Sprecher herum.
»Ja, dieses ganze Teufelswrack soll auch in Flammen aufgehen, mit allem, was sich drin befindet! Und wollen Sie mich etwa daran hindern?!«
Müller dachte nicht einmal an eine Entgegnung. Er bot mir seine Hilfe an, ich wies sie zurück.
Das Gewitter war herangekommen, die Blitze zuckten, immer mehr rollte der Donner.
Neben die Leiche stellte ich den Orgelkasten, legte das Felleisen hin, auch die Pfeife.
Ich wollte sie nicht haben, nicht sein Taschenmesser, keine einzige Erinnerung von ihm.
Hätte ich den Pfeifenstock, das Messer, jeden anderen Gegenstand nicht einmal verlieren können? Dann wäre er doch nur in andere Hände gekommen. Und ich hatte eine bessere Erinnerung an diesen Mann, die ich nicht verlieren, die mir niemand rauben konnte — in meinem Herzen.
Ich wollte über das Holz Petroleum gießen.
Petroleum? Es ist doch kein schöner Stoff. Es stinkt, mit offener Flamme brennend rußt es stark — die Leiche selbst hätte ich niemals mir Petroleum übergießen können.
Taten einige Speckseiten nicht dasselbe und dufteten dann viel lieblicher?
In diesem Augenblick dachte ich an etwas. An die Feuerbestattungen der alten Germanen, auch an indianische Begräbnisse, überhaupt an heidnische Gebrüuche.
Lag und liegt in manchen heidnischen Gebräuchen nicht etwas Gewaltiges, Erhabenes, wogegen die Zeremonien des Christentums erblassen?
Wenn der in der Schlacht gefallene Herzog bestattet wird, mit Waffen und Ross, mit Pracht und Glanz, und die besten seiner Krieger geben sich an seinem Grabe freiwillig den Tod, um seinen Einzug in Walhalla verherrlichen zu helfen... ah, es muss großartig gewesen sein!
Auch an andere heidnische Gebräuche dachte ich, an indianische, Schillers ›Nadowessiers Totenlied‹ fiel mir ein:
Seht, da sitzt er auf der Matte,
Aufrecht sitzt er da,
Mit dem Anstand, den er hatte,
Als er's Licht noch sah.
Doch wo ist die Kraft der Fäuste,
Wo des Atems Hauch,
Der noch jüngst zum großen Geiste
Blies der Pfeife Rauch?
Legt ihm unters Haupt die Beile,
Die er tapfer schwang,
Auch des Bären fette Keule,
Denn der Weg ist lang.
Das waren die Verse, die hier für mich in Betracht kamen.
Ganz unbewusst, aus eigenen Gefühlen heraus hatte ich schon so gehandelt. Jetzt, da ich an Beispiele dachte, konnte ich mein Werk noch verbessern.
Ich richtete ihn mehr auf, lehnte ihn mit dem Rücken gegen den Leierkasten, wie er so oft gesessen hatte, stopfte ihm die letzte Pfeife, gab sie ihm in die noch bewegliche Hand, steckte ihm die Spitze in den Mund.
Müller begann mich mit immer furchtsameren Blicken zu betrachten, mochte mich für irrsinnig halten — der Talkel!
Dann nahm ich wieder einiges Holz unter dem Tisch hervor, stopfte dafür Speckseiten und Schinken hinein, umgab mit solchen die ganze Leiche.
So. Das Werk war fertig. Das musste lieblich duften.
»Müller, kommt her!«
Ich setzte ihm auseinander, was ich beabsichtigte. Natürlich Feuer anlegen, das ganze Wrack in Flammen aufgehen lassen. Müller sollte sich beizeiten in Sicherheit bringen, musste zwischen den jetzt unaufhörlich zuckenden Blitzen eine Pause abwarten, sodass er im Schutze der Finsternis vom Wrack springen konnte.
»Wohin?«
»Dorthin nach der Felswand.«
»Und Sie? Sie wollen sich lebendig mit verbrennen?«
»Fällt mir ja gar nicht ein«, lachte ich heiser. »Nein, ich will lebendig bleiben, furchtbar lebendig! Versteht Ihr denn nicht, was ich beabsichtige? Auch ich schleiche mich davon, nachdem ich einen kleinen Brander gelegt habe. Die Banditen haben doch natürlich immer das Wrack im Auge, und erst recht, wenn es in hellen Flammen steht. Der Feuerschein wird sie blenden, ich selbst befinde mich dadurch mehr im Finstern, und... ich werde über sie kommen wie der Engel der Nacht!«
Müller war bereit, vom Wrack zu gehen. Wir warteten ab, bis es sich wieder einmal ausgeblitzt hatte, und unter dem prasselnden Donner stieg Müller schnell an Deck, ließ sich an der Strickleiter, die wir immer benutzt hatten, herabgleiten, und ich sah nichts mehr von ihm.
Wäre er bemerkt worden, so hätten die Banditen doch sicher auf ihn geschossen.
Nun kam ich daran. Zunächst natürlich musste ich den Brander legen. Hierzu hatte ich mir den Laderaum unter der Kajüte ausersehen, dort wollte ich allerdings leicht brennbares Zeug mit Petroleum tränken. War erst einmal ein großes Feuer, dann brannte auch das ganze von Sonne und Wind ausgedörrte Wrack schnellstens nieder, dafür sorgten schon die Schinken und Speckseiten.
Ob wohl je ein Toter auf solch einem kostbaren Scheiterhaufen verbrannt worden ist?
Doch, es ist viel Luxus damit getrieben worden, wie es noch heute in Indien geschieht.
Noch befand ich mich unter der Luke, ziemlich entfernt von der Kajüte, in der Frettwurst aufgebahrt lag, eben drehte ich mich um, um mich dorthin zu begeben — da plötzlich flammte es vor meinen Augen auf, gleichzeitig ein schmetterndes Krachen, dass mir Hören und Sehen verging...
»Der Blitz hat ins Wrack geschlagen!«
Das war mein nächster Gedanke, als ich mich wieder aufraffte, und da prasselten auch schon die Flammen empor, mitten aus dem Schiffe heraus, dort wo sich die Kajüte befand!
Kostbarere Leichenverbrennungen haben wohl schon stattgefunden, aber dass der Himmel selbst den Scheiterhaufen anzündete, gerade im verlangten Moment, das ist wohl noch nicht da gewesen, diese Ehre ward wohl nur meinem Freunde zuteil.
Doch solchen Erwägungen durfte ich mich nicht lange hingeben, tat es auch nicht. Schon war auch ich vom Wrack herabgesprungen, hatte mit drei Sätzen den Pass erreicht, in dessen Schatten ich gesichert war.
Alles andere wickelte sich überaus einfach ab. Allerdings war mir auch das Glück sehr günstig.
Jetzt befand ich mich im Finstern, und kaum war ich vorsichtig die Böschung emporgeklettert, als ich sie oben auf der Felswand schon liegen sah, die beiden letzten Banditen, das Gewehr im Anschlag, aber ganz geblendet von dem riesig aufflackernden Feuer.
Sie mochten erst jetzt richtig erkennen, was da eigentlich passiert war.
»Himmel und Hölle, da brennt ja das ganze Wrack!!«, schrie der eine.
»Der Blitz hat eingeschlagen, und wir haben umsonst hier gelauert!«, ergänzte der andere.
Jeder hatte sein letztes Wort gesprochen.
Noch ehe sie mich sahen, hatte ich beide niedergeschossen.
In der nächsten Stadt hatte ich mich von Müller getrennt. Er wollte nach San Francisco, um dort auf das Testament Kredit für die Heimreise nach Deutschland zu erhalten, ich wollte, da ich nun einmal hier war, das wirklich wilde Amerika kennen lernen, wozu ich mich aber von hier nach Osten schlagen musste, sodass man hier von einem ,WildOst‹ hätte sprechen können.
Teils nahm ich bei meiner Wanderung die Gastfreundschaft in Anspruch, teils lebte ich von der Jagdbeute, besonders wimmelte es hier von Truthühnern, welche ich allein mit dem Revolver erlegte, und als man wirklich schon von einer Wildnis sprechen konnte, als ich tagelang wandern musste, ehe ich an ein einsames Farmhaus kam, brauchte ich gar keine Büchse mehr, mein großkalibriger Revolver ersetzte eine solche vollkommen, ich hatte schon einen stattlichen Hirsch mit ihm auf hundert Meter Entfernung erlegt, es fehlte mir nur noch mehr Jägererfahrung, um vollständig ohne Gewehr auskommen zu können.
Übrigens sind Jäger, welche nur mit dem Revolver versehen auf die Pirsch gehen, in Amerika gar nicht so selten. Friedrich Gerstäcker berichtet von zwei echten Waldläufern, welche mit ihrem Revolver oder sogar nur mit einer Pistole sowohl jeden Vogel aus der Luft herabholten als auch dem grauen Bären den Todesschuss gaben.
Vierzehn Tage später befand ich mich im wildesten Teile Arizonas. Jagdabenteuer hatte ich schon zahlreiche erlebt, wenn ich sie auch nicht erzählenswert finde, aber das, worauf es mir hauptsächlich ankam, hatte ich noch nicht gefunden: Indianer.
Ja, Indianer hatte ich wohl schon genug gesehen, auch schon in Europa — und diese waren sogar ›echter‹ gewesen als die, die ich auf einigen Farmen getroffen hatte, als faulenzende Arbeiter oder saumselige Diener, mehr noch als Bettler, jedenfalls immer ganz verkommene Individuen, und eine mit Büchse bewaffnete Rothaut, der ich im Walde begegnete, war ein ganz moderner Jäger gewesen, nicht einmal so ein echter Trapper, von denen ich in Jugendschriften und auch in fachlichen Reisewerken gelesen hatte. Geben musste es ja solche Trapper, Wildtöter à la Lederstrumpf, Wald- und Prärieläufer, rote und weiße, sicher noch, gerade hier in Arizona, aber zu Gesicht bekommen hatte ich noch keinen, noch weniger ein ganzes Indianerdorf, wie es mein Wunsch war.
Die Aussicht, dass dieser endlich erfüllt werden würde, war vorhanden. Auf der letzten Farm, die ich vor drei Tagen mit meiner ganz einseitigen Gastfreundschaft beehrt hatte, hatte man mir gesagt, dass in den Kallumahügeln, zwei Tagemärsche östlich von jener Farm entfernt, ein Indianerstamm in voller Urwüchsigkeit hause, Pawnees, die vor einem halben Jahrhundert aus dem hohen Norden nach Arizona verpflanzt worden waren. In das spezielle IndianerTerritorinm waren sie nicht gekommen, weil sie dort wieder ihre alten Todfeinde getroffen hätten; man hatte Nachsicht mit ihnen gehabt; gerade ihnen hatte man im Norden den fruchtbarsten Boden weggenommen. Sie hatten sich, obschon sonst sehr kriegerisch, ohne Kampf gefügt, außerdem waren es ausgezeichnete Pferdezüchter, welchen Beruf sie im IndianerTerritorium wegen des Terrains und wegen diebischer Nachbarn gar nicht hätten ausüben können, während hier die Pferdehändler gute Geschäfte mit ihnen machten.
Dieser Stamm der Alpakokes zählte etwa hundert Köpfe, darunter dreißig Krieger, hatte sich in dem halben Jahrhundert weder vermehrt noch vermindert. Ihr Häuptling hieß Tohuwabohu, welches Wort etwa unserem Kladderadatsch entspricht. Den hatten ihm natürlich weiße Jäger spaßeshalber gegeben, er aber führte ihn mit Stolz — wenn er noch lebte. Sonst aber ganz waschechte Indianer, Pawnees, die sich nur auf dem Rücken des Pferdes wohl fühlen und dennoch die herrlichsten Läufer und Springer sind, ausschließlich von der Jagd lebend, die Pferdezucht zum Verkauf nur nebenbei treibend, dadurch reich geworden, aber ihren alten, urwüchsigen Sitten treu bleibend, die erhaltenen Goldstücke durchbohrend und sie ihren Weibern und Kindern in die Ohren und sonstwo hin hängend, friedliebend gegen die umwohnenden Farmer, in ihrem Jagdgebiet von einigen hundert Quadratmeilen allerdings keine Ansiedlung duldend, höchstens einmal ein Blassgesicht skalpierend, welches der Aufforderung, ihre Jagdgründe zu verlassen, nicht prompt nachkam — und dann hatten sie zu diesem Totschlag oder zu dieser Lynchjustiz ein tatsächliches Recht, das Gesetz stand auf ihrer Seite.
So hatte mir der alte, freundliche Farmer, ehemals ein oldenburgischer Bauer, der aber schon nicht mehr Deutsch konnte, ausführlich erzählt. Nur schade, dass er mir so gar nicht zu sagen vermochte, wo ich dieses Ideal von einem Indianerstamm finden könne — Ja, in den Kallumahügeln, zwei tüchtige oder drei mäßige Tagemärsche östlich von hier. Aber die Kallumahügel dehnten sich eben auf einige hundert Quadratmeilen aus, und die Alpakokes waren so echt, dass sie noch nichts von einem Dorfe wussten, sondern immer mit ihren Wigwams und ihrer ganzen Pferdezucht hin und her rutschten. Da hätte also auch kein Führer etwas genützt, abgesehen davon, dass jetzt zur Zeit der Ernte kein wegekundiger Arbeiter abkommen konnte, und keinem der verlodderten Indianer sei zu trauen, er würde mich bei der ersten Gelegenheit zu ermorden versuchen; übrigens wisse er vom Wege ebenso viel oder wenig wie ich.
»Nun, marschiert nur immer nach Osten! Ihr könnt die Kallumaberge gar nicht verpassen, und Wasser findet Ihr überall. Versteht Ihr das nicht zu finden, dann... hättet Ihr zu Hause hinterm Ofen bleiben müssen. Dann wäret Ihr ja aber schon gar nicht bis hierher gekommen. Und seid Ihr erst in den Jagdgründen der Alpakokes, dann wird Euch Tohuwabohu schon eher zu finden wissen als Ihr ihn.«
»Wieso? Was wollt Ihr damit sagen?«
»Na, Ihr müsst doch unterwegs Wild schießen, wenn Ihr nicht verhungern wollt...«
»Teufel noch einmal, ja!«, fiel ich dem Alten ins Wort, unwillkürlich in meine lockige Frisur fahrend. »Und Ihr sagt, wen diese Pawnees auf der Jagd betreffen, den murksen sie ab, ziehen ihm die Perücke vom Schopf, und dann halten sie ihm auch noch ihren polizeilichen Erlaubnisschein unter die Nase...«
»O nein, so schlimm ist das nicht«, beruhigte mich der Alte. »Schießt nur getrost, soviel Ihr bedürft, und wenn Ihr von einem Hirsche nur das beste Stück aus dem Rücken schneidet und das andere liegen lasst — darauf kommt es den Alpakokes auch nicht an, dort wimmelt es ja noch von Wild. Es ist nur wegen der Aasjägerei. Dort gibt es nämlich noch Büffel, und die freilich können sogar einen Millionär verleiten, einmal seinen Skalp zu riskieren, dass er sich dann rühmen kann, so und so viele Büffel niedergeknallt zu haben. Doch wegen einiger Hirsche hat niemand etwas zu fürchten, zu fürchten ist dort überhaupt nichts, er muss die Jagdgründe nur sofort verlassen, wenn es ihm geheißen wird. Und jedenfalls wissen die Alpakokes sofort, wenn sich ein fremder Jäger in ihrem Gebiet aufhält. Das grenzt fast an Zauberei, es ist, als ob sie seinen Atem meilenweit hören könnten. Denn er braucht gar keinen Schuss abgegeben zu haben, sie sind sofort auf seiner Spur und beobachten ihn, um zu wissen, wen sie vor sich haben.«
So und noch viel länger erzählte der geschwätzige Alte, und dann war er so freundlich, mir Pulver und Blei zu geben, dass ich meine verschossene Munition ergänzen konnte. Ich besaß drei Dutzend Patronenhülsen, die sich fast gar nicht abnutzten, auch zu meinem Revolver eine besondere Kugelgießzange, die Patronenfabrikation hatte ich bald gelernt, die verschossenen Kugeln konnte ich ja immer wieder umgießen, ausgenommen, wenn ich einmal ein Loch in die Luft geschossen hatte. Nur zum Ersatz des Pulvers musste ich immer so freigebige Menschen finden wie diesen Farmer.
Schon gestern früh hatte ich in östlicher Ferne niedrige Berge erblickt, doch offenbar die Kallumahügel, und diese schienen die merkwürdige Eigenschaft zu besitzen, dass sie sich immer mehr entfernten, je mehr man drauflos marschierte. Nach zehn Stunden konnte ich nicht das mindeste merken, dass ich ihnen näher gekommen sei, und über Nacht waren sie ebenso wenig von selbst näher an mich herangerückt.
An diesem Morgen des dritten Tages musste ich mich zunächst nach einem Frühstück umsehen. Ich hatte die Nacht am Saume eines Wäldchens verbracht, dem eine Quelle entsprang, die sich als kleiner Bach durch die jetzt vor mir im goldenen Morgensonnenschein liegende Prärie schlängelte.
Das sah nun allerdings wenig nach Frühstück aus. Das Präriegras war wegen des dürren Bodens, der aber eben diesen Bäumen zusagen mochte, ausnahmsweise kurz, dicht am Bachrand, erst einige Kilometer weiter, nahm es wieder zu, bis zur Manneshöhe, und natürlich ging alles Wild dort zur Tränke, wo es sich am sichersten fühlte, und wenn es mir dort wirklich gelang, etwas zu schießen, so hatte ich dort kein Holz, um mir die Beute zu braten, musste erst den weiten Weg hierher wieder zurück machen.
Frühstücken aber musste ich unbedingt. Mein gestriges Abendbrot, aus gedörrtem Fleisch bestehend, war schon recht dürftig gewesen.
Da, als ich mich nach dem südlichen Saume des Wäldchens begab, hatte ich einen wundersamen Anblick: ein Dorf von Präriehunden, und zwar ein ungeheures, ein unübersehbares Dorf lag vor mir.
Der amerikanische Präriehund hat gar nichts mit einem Hunde zu tun — nur dass er einen bellenden Laut von sich gibt — er ist ein echtes Murmeltier.
Der bekannte Romancier und Reiseschriftsteller Balduin Möllhausen hat von diesen Präriehunden eine unübertreffliche Schilderung gegeben, und so will ich aus dieser einige Stellen herausgreifen, anstatt selber eine Beschreibung zu versuchen.
Zu welcher unglaublichen Ausdehnung die ›Dörfer‹ dieser friedlichen Erdbewohner herangewachsen sind, davon kann man sich überzeugen, wenn man ununterbrochen tagelang zwischen den kleinen Hügeln hinzieht, deren jeder eine Wohnung zweier oder mehrer solcher Tiere bezeichnet. Die einzelnen Wohnungen sind gewöhnlich fünf bis sechs Meter voneinander entfernt, und jeder kleine Hügel, der sich vor dem Eingange derselben erhebt, mag aus einer guten Wagenladung Erde bestehen, die allmählich von den Bewohnern aus den unterirdischen Gängen ans Tageslicht befördert worden ist. Manche haben einen, andere dagegen zwei Eingänge. Ein festgetretener Pfad führt von einer Wohnung zur anderen, und es wird bei deren Anblick die Vermutung rege, dass eine innige Freundschaft unter diesen lebhaften, kleinen Tierchen herrschen muss...
Einen merkwürdigen Anblick gewährt solch eine Ansiedlung, wenn es glückt, von den Wachen unbeachtet, in ihre Nähe zu gelangen. So weit das Auge reicht, herrscht ein reges Leben und Treiben: Fast auf jedem Hügel sitzt aufrecht wie ein Eichhörnchen (aber bedeutend größer) das gelbbraune Murmeltier, das aufwärts stehende Schwänzchen ist in immerwährender Bewegung, und zu einem förmlichen Summen vereinigen sich die feinen bellenden Stimmchen der vielen Tausende. Nähert sich der Beschauer um einige Schritt, so vernimmt und unterscheidet er die tieferen Stimmen älterer und erfahrener Häupter, aber bald, wie mit einem Zauberschlage, ist alles Leben an der Oberfläche verschwunden. Nur hin und wieder ragt aus der Öffnung einer Höhle der Kopf eines Kundschafters hervor, welcher durch anhaltendes herausforderndes Bellen seine Angehörigen vor der gefährlichen Nähe eines Menschen warnt. Legt man sich alsdann nieder und beobachtet bewegungslos und geduldig die nächste Umgebung, so wird in kurzer Zeit der Wachtposten den Platz auf dem Hügel vor seiner Tür einnehmen und durch unausgesetztes Bellen seine Gefährten von dem Verschwinden der Gefahr in Kenntnis setzen. Er lockt einen nach dem anderen aus den dunklen Gängen auf die Oberfläche, wo alsbald das harmlose Treiben dieser geselligen Tiere von Neuem beginnt. Ein älteres Mitglied von sehr gesetztem Äußeren stattet einen Besuch bei dem Nachbar ab, welcher ihn auf seinem Hügel in aufrechter Stellung mit wedelndem Schwänzchen erwartet und dem Besucher an seiner Seite Platz macht.
Beide scheinen nun durch abwechselndes Bellen gegenseitig gleichsam Gedanken und Gefühle sich mitteilen zu wollen; fortwährend eifrig sich unterhaltend, verschwinden sie in der Wohnung, erscheinen nach kurzem Verweilen wieder, um gemeinschaftlich eine Wanderung zu einem entfernter lebenden Verwandten anzutreten, welcher nach gastfreundlicher Aufnahme an dem Spaziergange teilnimmt. Sie begegnen anderen; kurze, aber laute Begrüßungen finden statt, die Gesellschaft trennt sich, und jeder schlägt die Richtung nach der eigenen Wohnung ein. Stundenlang könnte man, ohne zu ermüden, das immerwährend wechselnde Schauspiel betrachten, und es darf nicht wundern, wenn der Wunsch rege wird, dieSprache der Tiere zu verstehen, um sich unter sie mischen und ihre geheimenDer bekannte Romancier Unterhaltungen belauschen zu können.
Diese sogar poesievolle Schilderung Möllhausens ist nicht zu übertreffen, und ich habe denn auch nur wenig noch hinzuzufügen.
Ich hatte auf meiner amerikanischen Wanderung schon mehrere solche Dörfer passiert, hatte die Tierchen aus der Ferne auch herumhuschen sehen, aber nie war es mir geglückt, sie beobachten zu können.
Hier, wo ich mich am Waldessaume verstecken konnte, gelang es mir. Zuerst verschwand bei meinem Anblick alles, aber als ich mich einige Zeit in meinem Versteck regungslos gehalten hatte, entwickelte sich vor meinen Augen das entzückende, oben geschilderte Dorfleben.
Ich kann nur sagen, dass ich mir ganz lebhaft einbilden konnte, wie die sich Besuchenden unten in der guten Stube eine Tasse Kaffee tranken und ein Pfeifchen dazu schmauchten, und die beiden jungen Tiere, die sich dort hinter dem Hügel trafen und in aufrechter Stellung sich umärmelten und sich küssten, die gingen gewiss auf verbotenen Wegen — mindestens waren sie noch nicht öffentlich verlobt, denn kaum tauchte ein älterer Dorfbewohner auf, als das Liebespärchen erschrocken auseinander fuhr und tat, als hätten sie schon immer hier harmlos Gras gefressen, und wie sich dann zu dem alten Dorfbewohner ein anderer beigesellte, wie der die Vorderpfoten, die Arme, in die Hüften stemmte und den Bauch herausreckte und mit seiner Stimme zu bellen begann, wie der andere antwortete, da hörte ich die beiden ganz deutlich sprechen:
»Nachbar, haben Sie es denn schon gehört?« — »Nee, was denn?« — »Nu, die Russen haben schon wieder...« — »Was, die Russen? Hören Sie, Nachbar, das müssen Sie mir bei einer Tasse Kaffee erzählen.«
Und die beiden verschwanden, sich immer eifrig unterhaltend, in einer Wohnung. Je länger ich dieses Schauspiel beobachtete, desto entzückender wurde es mir. Tagelang hätte ich da zuschauen können.
Aber, ach, wäre man nur nicht ein irdisches Wesen, welches des Leimes bedarf, um das bisschen Staub, aus dem der Körper besteht, mit der Seele zusammenzuhalten.
Ich hatte gehört, dass der Präriehund ein ausgezeichnetes Wildbret gibt, und — ich schäme mich, es zu gestehen — mein Revolver krachte. Im Feuer brach ein feister Herr zusammen, der mindestens im Gemeinderat gesessen hatte.
Im Nu war die ganze Gesellschaft wie weggeblasen. Ich eilte hin. Der Herr Gemeinderat hatte sich gerade die Stirn gerieben, ich hatte ihn zwischen den Augen getroffen und ihm infolgedessen auch die Vorderpfötchen zerschmettert.
Nun aber war auch alle Sentimentalität vorbei. Ich zog das kaninchengroße Tier ab, nach einer halben Stunde war der Braten über starkem Feuer gar genug, wenigstens für einen Jägergaumen. Das Fleisch war weiß, zart und etwas süß.
Mein Schmaus war ziemlich beendet, ich streute gerade auf die letzte Hinterkeule Salz, als ich erschrocken zurückfuhr.
Mir war es gewesen, als ob an meinen Augen etwas Dunkles vorbeigesaust wäre, wie ein Band — ich dachte an eine Schlange, die sich vom Baume herab auf mich stürzte — und da hatte die Schlange mich auch schon umschlungen, presste mir die Arme an den Körper — und als ich hinsah, war es eine Lederschlinge.
Dass es keine Schlange war, diente mir etwas zur Beruhigung, aber unangenehm war es mir doch, und die Lederschleife war von hinten so geschickt geworfen und der Moment so genau abgepasst worden, dass mir die Arme noch unterhalb der Ellbogen an den Leib geschnürt waren.
Und da stand auch schon vor mir ein Indianer, noch viel schöner als im schönsten Indianerschmöker mit neunfarbigem Bilderdruck, so echt, wie ich ihn mir im idealsten Traume gar nicht vorzustellen gewagt hatte.

Die Mokassins — um von unten anzufangen — von der Hand des Liebchens mit bunten Perlen bestickt, die prall sitzenden Lederbeinkleider mit roten Sehnen genäht und befranst, der nackte Oberkörper vorschriftsmäßig kupferrot und reichlich tätowiert, Adlernase und Falkenaugen und was noch alles dazu gehört, auf dem sonst nackten Schädel die tadellose Skalplocke mit der obligaten Adlerfeder, und schließlich im Gürtel einen Tomahawk, aus dem der Eigentümer sicher auch rauchen konnte, daran hängend der Medizin- und andere Beutel, ja, sogar einige von Blassgesichtern stammende Skalpe, von denen zwei mir leider einen noch recht frischen Eindruck machten.
Im Übrigen tatsächlich eine herrliche Kriegererscheinung, kraftstrotzend und dabei vom schönsten Ebenmaß der Glieder.
Das wäre alles recht gut und schön gewesen, da hatte ich ja, was ich immer gewünscht hatte — wenn man mir nur nicht die Arme festgeschnürt hätte, und das wurde jetzt von einer Hand, die mir über die Schulter langte — es stand also noch ein anderer hinter meinem Rücken — noch nach drücklicher besorgt, und das alles war in einem einzigen Moment geschehen.
»Uff!«
»Good morning, Sir.«
»Wer du sein?«, fragte der vor mir Stehende in gebrochenem Englisch, ohne meinen Morgengruß zu erwidern.
»Ich bin ein harmloser Jäger, der sich zum Frühstück ein Stück Wild geschossen hat, und ich habe gehört, dass dies die Alpakokes erlauben.«
»Yes.«
»Weshalb hast du mich da mit dem Lasso gefangen oder fangen lassen?«
»Du sein Menschenfresser.«
Natürlich hatte ich nicht richtig verstanden.
»Was soll ich sein?«
»Du sein Menschenfresser.«
Wenn ich richtig verstanden, so verstand dieser Indianer eben unter dem Worte Menschenfresser etwas ganz Anderes.
»Wieso soll ich denn nur ein Menschenfresser sein?«
»Du mein Großvater aufgefressen.«
»Was — ich — hätte — deinen — Großvater — aufgefressen?«, konnte ich nur staunen.
»Yes«, erklang es mit unerschütterlichem Ernste zurück.
»Aber bitte, ich habe gar nicht die Ehre gehabt, Ihren Herrn Großpapa zu kennen.«
»Yes, du mein Großvater aufgefressen — mein Großvater geschossen, Haut ab, braten, essen — hap hap hap — nur noch linkes Bein von meinem Großvater übrig.«
Der Indianer hatte eine leichte Bewegung gemacht, und ich blickte auf meine Hand, in der ich noch immer die angebratene Hinterkeule hatte, wie in der anderen das Salz.
Na, wer von uns beiden war denn nun verrückt, der oder ich?
»Was? Das soll das linke Hinterbein von deinem Großvater sein?«
»Yes.«
»Das ist die Hinterkeule von einem Präriehund.«
»Yes. Präriehund — Kalluma — Alpakoke — alles dasselbe. Du meinen Großvater gefressen.«
Da stutzte ich! Ich hatte erkannt, dass das große Tier in blauer Tätowierung auf der roten Brust einen Präriehund darstellte, aufrecht sitzend und sich die Nase putzend, und jetzt konnte ich mir noch anderes zusammenreimen, ich bin nicht schwer von Begriffen, und eine höchst unangenehme Ahnung beschlich mich.
»Ihr Alpakokes glaubt an Seelenwanderung?«
»Was sagt das Blassgesicht?«
»Wenn ein Alpakoke stirbt, so verwandelt er sich in einen Präriehund?«
»Howgh!«, bestätigte der rote Krieger mit tiefem Gaumenlaut. »Wenn Alpakoke im Kampfe oder auf der Jagd fällt, kommt er in die ewigen Jagdgründe — stirbt er ruhig im Alter, dann wird er Kalluma — Präriehund, Du hast meinen Großvater gefressen.«
Nun musste ich es wohl glauben. Hatte ich den Großvater des Indianers bis zum linken Hinterbein auf einem Sitz verspeist!
Ich hatte freilich noch niemals etwas davon gehört, dass auch nordamerikanische Indianer an Seelenwanderung glauben!
Aber etwas anderes fiel mir jetzt ein, und ich wunderte mich nur, dass ich mich nicht gleich erinnert hatte.
Ein ehemaliger sogenannter Freund von mir, der ebenfalls mit einem, ›auf, von und zu‹ ziemlich vorn im Hofkalender gestanden, hatte es mir erzählt. Seine Jagdleidenschaft hatte ihn bis nach Sibirien unter die Tungusen getrieben, und auch in der alten Welt kommen ja Murmeltiere verschiedener Art zahlreich vor, so ist es in Asien als Bobak vertreten.
Auch der Bobak legt solche kolossale Dörfer an; eine poesievolle Schilderung von ihrem Treiben hatte mir mein Freund zwar nicht gegeben, wohl aber etwas anderes Interessantes erzählt.
Einmal hatte er solch ein Murmeltier geschossen, brachte die Beute nach der Jurte, in der er als Gastfreund wohnte. Die Tungusen freuten sich über den feisten Braten, die Frau ging sofort an die Zubereitung, wurde aber von ihrem Manne ernsthaft gemahnt, zuvor ja recht sorgsam das Menschenfleisch davon abzusondern.
Auf die verwunderte Frage meines Freundes erfuhr er Folgendes:
Unter der Achsel des Murmeltieres findet man zwischen dem Fleische eine dünne, weißliche Masse, deren Genuss verboten ist, weil sie der Überrest des Menschen ist, welcher durch den Zorn des bösen Geistes in einen Bobak verwandelt wurde.
»Denn du musst wissen, Fremdling, dass alle Murmeltiere einst Menschen waren, von der Jagd lebten und ausgezeichnet schossen. Einst aber wurden sie übermütig, prahlten, jedes Tier, selbst den Vogel im Fluge, mit dem ersten Schusse töten zu können, und erzürnten damit den bösen Geist. Um sie zu strafen, trat dieser unter sie und befahl dem besten Schützen, eine fliegende Schwalbe mit der ersten Kugel herabzuschießen. Der dreiste Jäger lud und schoss; die Kugel riss der Schwalbe jedoch nur die Mitte des Schwanzes weg. Seit jener Zeit haben die Schwalben einen Gabelschwanz. Die übermütigen Jäger aber wurden zu Murmeltieren, und jenes weiße Fleisch ist noch richtiges Menschenfleisch. Deshalb schneiden wir es heraus.«
So weit die Tungusen. Und dabei glauben sie sonst durchaus nicht an Seelenwanderung. Es ist eben das menschenähnliche Treiben und Gebaren der Murmeltiere, was die wilden Völker zu dem Glauben verleitet, das müssten einmal Menschen gewesen sein, und die nordamerikanischen Indianer glaubten also dasselbe, oder wenigstens hier diese Alpakokes, welche das Murmeltier sogar als Totem führten, als Wappen.
»Woraus willst du denn erkennen, dass es gerade dein Großvater war, den ich verspeist habe?«, war meine nächste Frage.
Das heißt, mir war durchaus nicht humoristisch zumute. Ich wollte nur erst einmal Näheres hören, um vielleicht einen Ausweg aus dieser Kalamität zu finden.
»Kallumas alle Großväter von allen Alpakokes — Kallumas und Alpakokes ein und dasselbe«, lautete die Erklärung.
Es war also ganz schnuppe, welchen Großvater ich gegessen hatte.
»Was wird mir denn dafür geschehen, dass ich ein Kalluma geschossen und verzehrt habe?«
Statt einer mündlichen Antwort machte der rote Krieger nur einige Bewegungen, aber so furchtbar deutlich, dass ich mich schon am Marterpfahle stehen sah,
»Ja, konnte ich denn das wissen, dass diese Murmeltiere euere Großväter sind?! Dann solltet ihr vor jeder solcher Ansiedlung ein Plakat aufstellen.«
»Tohuwabohu wird über dich richten.«
Es war über dieses Thema des Kriegers letztes Wort. Ich wurde von hinten emporgezogen, zwei andere Indianer, nicht minder stolze Kriegererscheinungen, tauchten mit drei Pferden auf, nicht gerade schöne Tiere, dazu waren sie viel zu mager, aber jedenfalls waren sie schnell und außerordentlich ausdauernd, was bei Jagd- und Kriegspferden ja auch die Hauptsache ist.
Ich wurde auf das eine Pferd gehoben, man schnürte mir die Füße unter dem Leibe zusammen.
»Ich bin ein freier Mann, ich darf nicht gefesselt werden!«, suchte ich zu protestieren. Diese Alpakokes sollten sonst doch ganz friedliebend sein und mit der Regierung auf bestem Fuße stehen.
»Schweig! Geben wir dir nicht ein Pferd? Oder kannst du zu Fuß nebenher rennen? Wärest du ein gefangener Feind, so würden wir dich am Lasso nachschleifen.«
Die Pferde wurden sofort in Karriere gesetzt, und ich sah, dass ich schließlich dennoch ganz anständig behandelt wurde, indem man mich wenigstens beritten gemacht hatte.
Denn es waren drei Indianer, die nur drei Pferde gehabt hatten, so rannte der eine, dessen Pferd ich bekommen, nebenher, zwei Reiter hätte ein solches Tier wohl nicht auf die Dauer tragen können.
Und, Himmel, was konnte dieser Mensch rennen! Da bekam ich es zu sehen, was diese Pawnees, die sonst nur ungern den Sattel verlassen, sich zu Fuß so unbehilflich benehmen, im Grunde genommen doch für Läufer sind! Es ist dies aber ähnlich wie mit den Cowboys. Diese Ochsen- und Pferdehirten sind doch ebenfalls mehr Zentauren, aber bei allen Belustigungen spielen Wettrennen zu Fuß die Hauptrolle. Solche Gegensätze findet man ja überall. Auch England, das sonst doch ganz auf das Meer angewiesen ist, besitzt ja ebenfalls die beste Pferdezucht, hat die schnellsten Rennpferde.
Zwei Stunden lang sind wir in gestrecktem Galopp, wenn nicht in Karriere geritten, ohne Aufenthalt, und hat sich der rote Krieger, der nicht einmal gar so jung mehr war, neben uns gehalten, sogar noch das schwere Gewehr über der Schulter, mit gleichmäßig weitausgreifenden Sätzen, wohl mächtig schwitzend, sonst aber mit regelmäßig gehender Brust, und auch, als wir unser Ziel erreicht hatten, war ihm gar nichts anzumerken, dass er außer Atem gekommen sei. Es war das Erstaunlichste, was ich in dieser Beziehung je gesehen habe.
Ich hatte ja Zeit zum Überlegen. Wenn es da etwas zu überlegen gab. Also die Kallumahügel waren ganz einfach die Erdhaufen der Präriehunde. Jene vermeintlichen Hügel dort waren die himmelhohen Grenzberge von Arizona, deshalb hatte ich ihnen auch nicht näher kommen wollen, die waren noch einige Tagemärsche entfernt. Und der Präriehund hieß in der Pawneesprache Alpakoke, diese Indianer selbst nannten sich Murmeltiere.
Dass der Präriehund ihnen heilig war, hatte wohl der alte Farmer selbst nicht gewusst, sonst hätte er mich doch sicher gewarnt. Sonst werden die Präriehunde in Amerika allgemein gegessen. Das heißt, wenn man einen bekommt. Ich hatte schon gehört, wie außerordentlich schwer sie zu erlegen seien. In Schlingen und Fallen gehen sie absolut nicht, bei der Annäherung des Jägers verschwinden sie, auch ausgraben lassen sie sich nicht, die Benutzung eines Marders kennt man in Amerika nicht, und tödlich verwundete Tiere schleppen sich mit der letzten Kraft noch in die Höhle, ja, es wird sogar versichert — auch wieder etwas so Menschliches an diesem Tiere — dass der tot Liegenbleibende von den Kameraden noch rechtzeitig unter die Erde gezogen wird.
Ich hatte Glück gehabt. Es sollte mein Unglück werden. Das heißt, so tragisch fasste ich die Situation, in die ich geraten war, noch nicht auf.
Große Pferdeherden tauchten auf, einige Dutzend Wigwams, bei deren bunten Malereien auf den Lederwänden Murmeltiere, in allen möglichen ihrer possierlichen Stellungen, wiedergegeben, die Hauptrolle spielten. Kläffende Hunde begrüßten uns, sonst aber widmete auch das kleinste rotbraune Kind, das nackt herumlief, dem Gefangenen keinen einzigen Blick der Beachtung, und ebenso waren hier auch alle Frauen über jede Neugier erhaben.
Wir hielten vor einem Wigwam, die Füße wurden mir unter dem Pferdeleib losgeschnürt, ein nicht misszuverstehender Wink, ich stieg ab, dehnte die erstarrten Glieder, folgte dem einen der drei Indianer in den mit Fellen belegten, sonst leeren Wigwam hinein.
Hier löste er auch die Stricke an meinen Armen auf, hielt mir seinen Tomahawk dicht unter die Nase, fuhr, mich bedeutsam ansehend, mit dem Finger über die Schneide, deutete auf ein Bärenfell.
Es war überaus deutlich gewesen. Ich war ein freier Mann, durfte aber den Wigwam nicht verlassen, sonst bekam ich die Schärfen des Tomahawks zu kosten.
Überdies blieb der Krieger da, kauerte sich neben dem offengelassenen Eingang hin, ich nahm gleichfalls Platz.
Meinen Revolver hatte man mir gleich im Anfang abgenommen, sonst aber weiter nichts, nicht meine Taschen durchsucht, die doch noch einen anderen Revolver enthalten konnten. Darin also waren die Indianer ganz sorglos, oder sie verachteten eben die Möglichkeit, dass ich noch andere Waffen bei mir haben könnte.
Bald trat ein halbes Dutzend Krieger ein, der erste im federreichen Häuptlingsschmuck, schon ein alter Herr, aber von ungeschwächter Rüstigkeit. Er allein rauchte aus einem langen Kalumet, in seinem Gürtel bemerkte ich meinen landläufigen Revolver als einzige Waffe, die er trug.
Nach der weisen Lehre, dass man mit dem Hute in der Hand durch das ganze Land kommt, dass Höflichkeit überhaupt immer angebracht ist, hatte ich mich vor den Eintretenden erhoben. Und es war nicht nötig, dass ich mich erst jener praktischen Lehre erinnerte, ich war ganz unwillkürlich vor dem Häuptling aufgestanden.
Jener erste Indianer, den ich näher beschrieben habe, war für mich das Ideal eines roten Kriegers gewesen war, ein noch junger Mann; dieser Häuptling hier war ein alter Herr, und dennoch übertraf er jenen noch bei Weitem.
Alles Würde und wahrhafte Majestät, vom Scheitel bis zur Sohle ein geborener König, die von Narben förmlich zersetzte Brust verriet, was für ein Krieger und Jäger er einst gewesen und jedenfalls noch war. Sein Kalumet konnte er nur mit drei Fingern halten, und an der anderen fehlte gleichfalls einer, ebenso war sein Gesicht von furchtbaren Narben ganz gemustert, und was für ein Gesicht! — Dieser Adel in den eisernen Zügen! — Und erst diese Augen! — Dieses stolze Feuer, das von einer stählernen Willenskraft gebändigt wurde...
Ich kann es nicht beschreiben, nicht, was für einen kolossalen Eindruck dieser Mann auf mich machte. Es gab keinen europäischen Herrscher, mit dem ich nicht schon gesprochen hatte, ehrerbietig und mehr noch kordial — kein einziger hatte auf mich einen besonderen Eindruck gemacht — vor diesem Häuptling hier, der nur über dreißig Krieger und siebzig Frauen und Kinder gebot, war ich mit gleichen Füßen aufgesprungen.
Wie war denn dieser Mann zu dem lächerlich klingenden Namen Tohuwabohu gekommen?
Nun, diese hebräischen Worte lassen sich eben doch nicht so recht mit unserem Kladderadatsch übersetzen,oder aber dennoch, nur darf man dabei nicht an das politische Witzblatt mit dem burlesken Titelkopf denken.*)
Was heißt das eigentlich, kladderadatsch? Wenn einer einen Tisch mit dein ganzen Porzellangeschirr umwirft, dass es nur so kracht und prasselt, dann sagt man: kladderadatsch! Also ein wirres Durcheinander, ein Drunter und Drüber.
Und in diesem Sinne hatte der Häuptling der Alpakokes seinen Namen bekommen, einen wirklichen Ehrennamen. Sein bloßes Erscheinen genügte, auch die geordnetsten Reihen der Feinde in ein wirres Durcheinander zu bringen, auch die reguläre Kavallerie der Union hatte den seltsamen Zauber dieses roten Kriegsgottes noch kennen gelernt; deshalb hatte man mit ihm lieber Frieden geschlossen, um ihn gegen andere Indianer als Freund und Bundesgenossen auszuspielen, und wenn heute Herren aus Washington kamen, um mit ihm über Grenzregelungen oder sonstige politische Verwicklungen zu beraten, dann machte dieser rote Sohn der Wildnis durch ein Wort alle geschulte Spitzfindigkeit zuschanden, richtete auch durch seinen Geist ein Tohuwabohu(*), ein wirres Durcheinander an.
(*) Tohuwabohu heißt: wüst und leer! Diese Worte bilden den Anfang der hebräischen Bibel. Sie bedeuten also ein Chaos, ein Wirrwarr.
Ich selbst sollte es noch kennen lernen — aber dass dem wirklich so war, das empfand ich ganz unwillkürlich schon jetzt.
Der Häuptling hockte sich mit untergeschlagenen Füßen hin, die anderen im Halbkreis um ihn herum — ein herablassender Wink, und ich folgte dem allgemeinen Beispiele.
Wohl eine Viertelstunde verging. Der Häuptling rauchte wie ein Automat, die anderen blickten bewegungslos geradeaus. Ich glaube, wäre jetzt ein Erdbeben ausgebrochen, mit dem Untergange der Welt drohend, es hätte nichts an dieser Teilnahmslosigkeit geändert.
Endlich klopfte der Häuptling seine Pfeife aus, und ich wusste, dass diese bedeutsame Prozedur die Unterhaltung einleiten würde. Und richtig...
»Uff!«
Der Häuptling hatte gesprochen.
Fünf bis zehn Minuten Pause.
»Das Blassgesicht hat meinen Großvater gefressen.«
»Häuptling«, wollte ich meine Verteidigungsrede beginnen, »ich bin ein...«
Eine Handbewegung schnitt mir das Wort ab. Es war wirklich ganz merkwürdig, wie gebieterisch eine so geringfügige Handbewegung dieses Mannes war. Sie hätte auch die zungengeläufigste Xanthippe verstummen lassen, ohne ein Wörtchen der Widerrede.
»Wie hat das Blassgesicht meinen Großvater getötet?«
»Mit meinem Revolver.«
»Mit diesem hier?«
Er zog meinen Revolver aus seinem Gürtel.
»Ja.«
»Auf welche Entfernung?«
.Auf dreißig bis vierzig Yards.«
»Du lügst.«
Ich zuckte empor.
»Häuptling, ich bin dein Gefangener, und wenn du ein wirklicher Krieger bist, so wirst du meine Wehrlosigkeit nicht missbrauchen, um mich ungestraft beleidigen zu können!«
Drohend, entrüstet hatte ich es gerufen — und zugleich beschlich mich etwas wie eine bittere Enttäuschung.
Da merkte ich, wie das stahlblitzende Auge des alten Kriegers, das immer durchbohrend auf mir geruht hatte, plötzlich einen freundlichen Ausdruck annahm, und... ich hatte genug gesehen.
»I beg your pardon — ich bitte Sie um Entschuldigung«, wurde er jetzt ganz modern, ohne dadurch etwas an seiner Würde zu verlieren. »Hast du schon mehr Kallumas geschossen?«
»Es war der erste.«
»Auch wenn der Kalluma tödlich getroffen ist, verschwindet er doch mit dem letzten Todessprung in seine Höhle, und seine Freunde ziehen ihn tiefer, sodass er niemals zu bekommen ist.«
»Dass der Kalluma sehr schwer zu erlegen ist, habe ich wohl schon gehört, es aber noch nie probiert — ich weiß nur, dass der Kalluma, den ich schoss, im Feuer zusammenbrach. Ich sprang schnell hin und holte ihn.
»Wie trafst du ihn?«
Zwischen die Augen.«
»Auf dreißig bis vierzig Ellen mit diesem Revolver?«
»Ja.«
»Zufall!«
Ich zucke nur die Schultern.
»Das Blassgesicht behauptet, es könne einen Kalluma auf dreißig bis vierzig Ellen mit diesem Revolver zwischen den Augen durch den Kopf schießen?«
»Das habe ich nicht behauptet.«
Der Häuptling wog sinnend das Haupt.
»Das Blassgesicht ist vorsichtig und kein Prahler. Es soll uns zeigen, ob es immer so gut schießen kann.«
Sofort erhob sich ein Indianer und schlug den Zeltvorhang noch weiter zurück, auch die anderen standen auf; der Häuptling gab mir meinen Revolver, die Patronen hatte man mir im Gürtel gelassen.
»Das Blassgesicht wird uns eine Probe seiner Schießkunst geben.«
Als ich nach dem Ausgange blickte, sah ich jenen Indianer, einen Pfahl in der Hand, mit großen Schritten eine Strecke abmessen, etwa beim vierzigsten Schritte blieb er stehen — es mochte alles schon vorher abgemacht worden sein, viele Worte hatten die freilich nie nötig — er rammte den Pfahl in den Boden, legte einen roten, runden Gegenstand von der Größe einer Apfelsine darauf.
Die Strecke war so gewählt, dass die Kugel zwischen zwei Wigwams hindurch ins Freie gehen musste.
»Wird das Blassgesicht die rote Kugel treffen?«
»Das kann ich nicht vorher sagen.«
»Schieß!«
Ich streckte den Revolver aus und schoss im nämlichen Moment, anscheinend ohne gezielt zu haben.
Ich hatte auch wirklich nicht gezielt, und wer im Pistolenschießen bewandert ist, der weiß auch, was für eine eigentümliche Sache das ist. Worauf es dabei ankommt, das lässt sich gar nicht erklären. Jedenfalls weiß der erfahrene Pistolenschütze im Moment des Abdrücken: Ich treffe — oder ich treffe nicht.
Die rote Kugel zerstob in tausend Splitter — und ich hatte es vorher gewusst.
Es war deutlich zu merken, wie sich diese roten Krieger bemeistern mussten, um ihr Staunen zu unterdrücken. Denn wenn man diesen Söhnen des großen Geistes durch irgend etwas imponieren kann, so ist es durch einen guten Schuss. Das Fabelhafteste im Revolverschießen bekommt man ja von den nordamerikanischen Cowboys zu sehen, es ist buchstäblich wahr, dass sie einem tanzenden Manne die Stiefelhacken abschießen; aber das hat seine gewisse Grenze, diese Cowboys sind nur auf sechs bis zehn Schritt geeicht. Das kommt daher, dass sie sich überhaupt nur auf einen Nahkampf einlassen, zu Pferde jedes Wild einholen und dann erst niederknallen; auf größere Entfernungen hin ist ihre Treffsicherheit keine höhere als bei jedem anderen geübten Pistolenschützen.
Vielleicht auch fehlten hier in der weiteren Umgebung die Cowboys, oder eben die große Entfernung imponierte den Indianern — kurz, sie wären außer sich vor Staunen gewesen, hätten sie sich nicht so in der Gewalt gehabt.
Eine zweite rote Kugel ward auf den Pfahl gelegt, und nun wusste ich es schon mit aller Bestimmtheit: Ich zersplitterte sie wiederum.
Der Pfahl ward hundert Schritt weiter in den Boden gerammt und wieder mit einer roten Kugel gekrönt — es war ein in der Gegend wachsender kleiner Kürbis — diesmal zielte ich sorgfältig, meiner Sache nicht so gewiss — und doch, der Kürbis zersplitterte.
»Howgh!!«, erklang es im Chor.
»Sieht das Blassgesicht den Vogel...«
Ich sah ihn, eine Schwalbe, oder doch ein kleiner Vogel, der mit der Schnelligkeit einer Schwalbe dahinschoss, noch etwas hinter dem Pfahl und etwas höher — und schon krachte mein Revolver, und diesmal war es wieder ein ,Sackschu‹ gewesen, d. h. ich hätte ebenso gut mit einem Sacke über dem Kopfe, mit verbundenen Augen schießen können.
Der Vogel war plötzlich aus der Luft verschwunden gewesen. Knaben brachten ihn. Meine Kugel hatte ihm den Kopf vom Rumpfe getrennt.
Das allerdings war der reine Zufall gewesen. Aber was heißt Zufall? Entweder es ist, oder es ist nicht! Die roten Krieger vergaßen auch ihr ›Howgh‹; aber mit was für Blicken sie mich betrachteten! Wenn ich nicht ein Zauberer war, dann musste ich doch die große ›Medizin‹ besitzen.
Nur der alte Häuptling war über alle solche Schwächen erhaben.
»Es ist gut«, sagte er gelassen, als er mir den Revolver wieder aus der Hand nahm, »das Blassgesicht ist kein eitler Prahler, es wird auch wie ein Mann am Marterpfahl zu sterben wissen.«
Sprach's und wandelte samt seinem Gefolge von dannen.
O, das hätte nun freilich nicht kommen dürfen! Beweise ich mich da erst als Meisterkunstschütze, dass diese roten Krieger all ihre Selbstbeherrschung aufbieten müssen, um nicht ganz aus dem Hauschen zu geraten, ich denke doch, jetzt kommt die obligate Friedenspfeife, vielleicht auch werde ich zum Ehrenbürger dieses Wigwamdorfes ernannt — derweil sagt dieser Kerl, da ich so gut schießen könne, werde ich wohl auch mannhaft am Marterpfahl zu sterben wissen. O o o o o o!!!
Das mochte wohl für eine echte Rothaut mit einer Skalplocke eine Ehre sein, aber ich war doch ein blondlockiger Jüngling mit einer nur etwas von der Sonne gebräunten Haut.
Jetzt war ich ganz allein in dem Wigwam, in dem schwaches Dämmerlicht herrschte, weil der Vorhang herabgelassen war. Ich legte mich hin, um über mein Schicksal nachzugrübeln.
Ja, diese Alpakokes sollten doch aber ganz friedsame Menschen sein, mit der Regierung auf bestem Fuße stehen, wie konnten sie denn da...
»Hallo, Fremder!«, wurden meine Grübeleien gleich in der Einleitung unterbrochen.
Es war ein schon bejahrter Mann, der auf einem Beine und zwei Krücken hereingehumpelt kam, der Kleidung nach ein Trapper, der sich aber nun ausgetrappt hatte, das Gesicht so verwettert und verwittert, dass darin nichts von seinem Charakter zu lesen war, so wenig wie aus seinen Augen; denn mit dem einen schielte er, das andere hatte er mit einem schwarzen Pflaster gleich ganz zugeklebt.
Ich blieb ruhig liegen.
»Hallo, Fremder, das sieht bös für Euch aus.«
»Wenn Ihr mir keine freudigere Nachricht zu bringen habt, braucht Ihr mir das auch nicht erst zu sagen.«
»Ich kann beim besten Willen nichts für Euch tun.«
»Na also!«
»Ihr seid gerade zur unglücklichsten Zeit hierher gekommen.«
Der Alte ließ seine beiden Krücken fallen und setzte sich selbst dazwischen. Mir war sein Besuch doch nicht so ganz unangenehm — solange man lebt, hat man doch immer noch Hoffnung.
»Ihr seid wohl hier zu Hause?«, eröffnete ich die eigentliche Unterhaltung.
»Habe zwei Frauen hier — eigentlich sogar drei.«
»Gleich drei — so so.«
»Ja, und bei den Ipihons auch noch zwei, und bei den...«
Er zählte noch einige andere Indianerstämme auf, bei denen er überall verheiratet war, brachte so gegen zwanzig legitime Gattinnen zusammen. Anzahl der Kinder ihm gänzlich unbekannt.
Das heißt, das galt nur für früher. Vor fünf Jahren schon hatte ein befreundeter Alpakoke auf der Jagd ihn ins Bein geschossen, das Bein hatte ihm ›abgehackt‹ werden müssen, seitdem genoss er das Gnadenbrot, kam nicht mehr fort von hier, wusste deshalb auch nicht, was seine übrigen Weiber machten, die er alle im IndianerTerritorium hatte. Diese ganze Vergangenheit war ihm, wie alle Familienbande, zugleich mit seinem Beine abgehackt worden.
»Weshalb soll ich denn am Marterpfahl sterben?«
Ich erfuhr es. Der Alte setzte es mir mit der selben Seelenruhe auseinander, mit der ein Professor dem Kandidaten erklärt, warum er durchs Examen gerasselt ist.
Dass ich einen in ein Murmeltier verwandelten toten Großvater der Alpakokes geschossen und gefressen hatte, das hatte gar nichts zu sagen. Die Alpakokes selbst fraßen ihre eigenen Großväter, allerdings unter gewissen sie entsündigenden Zeremonien — wenn sie sie nur bekamen.
Nein, der Grund, weshalb ich büßen sollte, war ein ganz anderer. Vor drei Wochen waren einige Alpakokes mit einem Pferdetransport in Prescott gewesen, einer von ihnen war, um den Weg abzukürzen, über eine Wiese gegangen, ohne das Plakat zu lesen, dass das Betreten dieser Wiese, dem Fiskus gehörend, bei drei Dollar Strafe oder einen Tag Haft verboten war.
Es war eine Dummheit von einem neubackenen Konstabler, den roten Sohn der Wildnis deshalb zu arretieren. Da er aber die Arretierformel einmal ausgesprochen hatte, war nichts mehr daran zu ändern, der Alpakoke, der die drei Dollar nicht bezahlen wollte, weil er sie wahrscheinlich nicht hatte, musste mit zur Wache; aber so einfach ging das nicht, der rote Krieger beförderte einige Konstabler in die ewigen Jagdgefilde und folgte dann selbst nach — auch er wurde erschossen.
Der Häuptling der Alpakokes erhob regelrecht Klage, es kam zur regelrechten Gerichtsverhandlung. Merkwürdig war dabei — oder vielleicht im Gegenteil für diese Indianer ganz natürlich — dass sie nicht wegen des Todes ihres Kameraden Rechenschaft forderten. Der war nach ihren Begriffen im ehrlichen Kampfe gefallen, hatte ja noch zwei oder drei Gegner mit sich genommen. Nein, ihr Rechtsstreit drehte sich nur um das Betreten jener Wiese. Sie waren früher immer über diese Wiese gegangen, sie hatten es nicht anders gewusst, als dass dies erlaubt sei — also hatte der Alpakoke auch ganz ungerechterweise arretiert werden sollen.
Da aber zeigte der Mann des Gesetzes den roten Klägern den Paragrafen, Unkenntnis des Gesetzes schützt vor Strafe nicht.
Hierauf ritten die Alpakokes befriedigt nach Hause. Anscheinend befriedigt. Oder auch wirklich. Nun aber drehte Tohuwabohu den Spieß herum.
»Gut«, sagte er, »Unkenntnis des Gesetzes schützt vor Strafe nicht. Jetzt machen auch wir ein Gesetz, ohne dass wir nötig haben, es zu veröffentlichen. Wer von heute ab in unserem Jagdrevier ein Wild schießt, der wird gepfändet, und wer nun gar ein Kalluma tötet, das wir als einen verkörperten Toten unseres Stammes betrachten, der ist selbst des Todes, stirbt nach alter, guter Sitte am Marterpfahl. Ohne Ansehen der Person! Und wenn's der weiße Vater aus Washington ist! Unkenntnis des Gesetzes schützt vor Strafe nicht, basta! Der Häuptling der Alpakokes hat gesprochen.
»Gestern Abend ist der Beschluss am Beratungsfeuer gefasst worden, und du bist der erste, der dabei erwischt worden ist, wie er in den Jagdgründen der Alpakokes ein Tier getötet hat, noch dazu ein jetzt heiliggesprochenes Kalluma — du stirbst noch heute am Marterpfahl.«
Nun wusste ich es, und Unkenntnis des Gesetzes schützt vor Strafe nicht. In dieser Hinsicht brauchte ich gar nichts mehr zu sagen. Mein Interesse erstreckte sich jetzt nur noch auf andere Dinge.
»Mein Tod dürfte doch bekannt werden.«
»Gewiss.«
»Und obgleich ich kein Bürger der Union bin — glaubt man denn, das wird man diesen Alpakokes ungestraft hingehen lassen?«
»Gewiss nicht. Wir werden bald genug die Grenztruppen hier haben.«
»Nun und?«
»Dann kommt es eben zum Vernichtungskampf«
»Das heißt, zur Vernichtung der Alpakokes.«
»Sicher, das wissen die Alpakokes natürlich, und das wollen sie auch. Sieh, dieser Indianerstamm ist sowieso dem Untergange geweiht, wie wohl alle anderen. Seit fünfzig Jahren hat sich der Stamm nicht mehr vermehrt, in den letzten Jahren sogar stark verringert. Obgleich mehr Frauen als Männer vorhanden sind, sterben doch mehr als geboren werden. Und die Alpakokes wissen, dass der große Geist den Untergang aller seiner roten Kinder beschlossen hat. Er will sie in seinen ewigen Jagdgründen haben. Aber die tapferen Alpakokes haben keine Lust, so langsam dahinzusiechen und dann auch noch einmal ein mehrfaches Leben als Murmeltier durchmachen zu müssen, sie wollen als Männer im Kampfe sterben, um direkt in die ewigen Jagdgründe zu kommen, und so lassen sie sich eben von den Blassgesichtern den Krieg erklären.«
»Hätten da die Alpakokes nicht viel einfacher die nächste Farm überfallen können?«
»Nein, die Alpakokes sind ein gerechtes Volk, sie haben mit dem weißen Vater in Washington ein ewiges Freundschaftsbündnis geschlossen und haben ihr Wort noch niemals gebrochen. Die Blassgesichter müssen es sein, die den Kampf eröffnen.«
»Also das Betreten der grünen Wiese hatte als Vorwand herhalten müssen.
Leser, findest du das etwa lächerlich? Lies in der Weltgeschichte nach, betrachte unsere heutige Politik, da wirst du erkennen, aus welch nichtigen Gründen die zivilisiertesten Staaten sich gegenseitig den Krieg erklären oder erklären können.
Ein Monarch hat einmal schlechte Laune, er sagt dem Gesandten einer fremden Macht ein kurzes Wort, es braucht gar kein unhöfliches zu sein — der Krieg ist fertig, viele Tausende von Menschenleben werden deshalb geopfert.
Allerdings liegt ja dem immer eine tiefere Ursache zugrunde. Meist irgendein alter Hass, Revanchegedanken, am allermeisten Beutesucht. Denn das ist doch das A und O aller Kriege, und darüber kann man einen selbstständig denkenden Menschen mit allen politischen Spitzfindigkeiten nicht mehr hinwegtäuschen.
Nun will aber jeder Staat die Verantwortung für dieses Blutvergießen von sich abwälzen, er möchte als ›Gerechter vor Gott‹ dastehen, und deshalb werden solche nichtige Ursachen hervorgesucht, man produziert eine Beleidigung, die der andere Staat nur mit einer Kriegserklärung beantworten kann — und daraus entspringt dann die ungeheuerliche Tatsache, dass auf beiden Seiten ganz öffentlich zu Gott dem Allmächtigen um den ,Sieg für die gerechte Sache‹ gebetet wird, eine Tatsache, wegen der sich jeder ehrliche Mensch, die ganze Menschheit schämen muss. Raubt und plündert doch nach Herzenslust, das wird euch der allgütige Gott verzeihen, denn das liegt nun einmal in der menschlichen Natur und wird niemals ausgerottet werden — aber ruft nur wenigstens nicht den Segen Gottes dazu an. Diese Art von Kriegserklärungen ist ebenso gemein, wie wenn man einen trotz seiner Waffe so gut wie wehrlosen Offizier beleidigt, um ihn zu zwingen, einen entweder tot zu stechen oder seinen Dienst zu quittieren.
Der Häuptling der Alpakokes hatte die politische Finte der Blassgesichter angewendet, um als Selbstgerechter dazustehen. Freilich würde dadurch sein ganzes Volk zugrunde gehen. Aber was tat das? Das war gerade die Absicht dieser stoischen Indianer. Und tun dasselbe nicht ganz moderne Völker? Ziehen sie nicht den Heldentod der Sklaverei vor? So sind die Buren untergegangen, so ist schon manch anderes Volk als politische Nation von der Bildfläche verschwunden, und so werden noch viele andere verschwinden, — — —
»Du fürchtest dich doch nicht etwa vor dem Tode?«
»Vor dem Tode gerade nicht, aber... am Marterpfahl?«
»Da ist gar nichts weiter dabei, nur wenn sie dir Holzsplitterchen unter die Nägel bohren und dann anbrennen, das tut ein bisschen weh«, tröstete mich der Alte in aller Seelenruhe, und er schien es sogar aufrichtig zu meinen.
»Na, ich danke!«, war ich hingegen anderer Meinung.
»Dafür darfst du die Indianer aber doch auch verlachen, darfst sie feige Hunde nennen und anders beschimpfen, was du sonst nie dürftest, während du jetzt dafür als Held bewundert wirst. Ist das etwa nichts wert?«
Der Alte war schon so sehr Indianer geworden, dass man mit ihm über seine Ansichten gar nicht mehr streiten konnte.
»Hast du etwa selbst schon einmal am Marterpfahl gestanden?«
»Jawohl, einmal, bei den Sioux im Territorium.«
»Und wurdest gebrannt?«
»Aber tüchtig. Ein Jahr hat's gedauert, ehe meine verbrannten Füße wieder heilten.«
»Und auch Holzsplitterchen sind dir unter die Nägel gebohrt und angebrannt worden?«
»Sieh hier!«
Erst jetzt sah ich, dass der Alte gar keine Fingernägel mehr hatte.
»Und auch du hast nur deine Feinde verlacht und verspottet?«
»Und wie — und geschimpft habe ich — ha, das war eine Wollust!«
»Aber du kamst mit dem Leben davon?«
»Ja, meine Freunde erschienen noch rechtzeitig und befreiten mich.«
»Höre — allen Respekt vor solcher Selbstverleugnung — ja, es liegt etwas Heldenhaftes darin... lieber aber wäre mir dennoch, wenn auch mir ein Freund erschiene und mich befreite, und zwar rechtzeitig, ehe mir noch Feuer an die Sohlen und unter die Fingernägel gelegt wird.«
Eine Pause trat ein. Der Alte blickte sinnend vor sich hin und sah dann mich an. Und ich blickte ihn an. Das schielende Auge hatte keinen falschen Blick.
»Ja, ja, ich weiß schon«, erklang es endlich seufzend, mir gleich noch mehr Hoffnung machend. »Wenn man noch jung ist! Ich war schon damals ein alter Kerl.«
»Wie heißt du?«
»Old Jim.«
»Old Jim!«
In den Ton hatte ich es gelegt — und dabei auch meine Hand auf sein Knie.
»Ja, ja, ich weiß schon. Was bist du?«
»Seemann.«
»Seemann? Ich weiß, was das ist. Ich habe einmal einen Seemann getroffen, der noch niemals ein Gewehr abgedrückt hatte, und nicht einmal reiten konnte der Mensch.«
Ein alter Trapper war's, der so sprach.
»Und du kannst so gut schießen?«
»Ich habe es gelernt.«
»Und reiten kannst du?«
»Habe ich ebenfalls gelernt.«
»Ich glaube es nicht.«
Es lag etwas im Tone, was mich gleich stutzig machte, aber diesmal war ich doch schwer von Begriffen. Es war auch so ohne Weiteres gar nicht zu verstehen, worauf jener hinzielte.
»Was glaubst du nicht?«
»Dass du reiten kannst. Du wurdest ja auf das Pferd gebunden.«
»Dafür konnte ich doch nichts, ich war eben ein Gefangener.«
»Und ich glaube nicht, dass du reiten kannst.«
»Wenn ich es dir aber versichere? Was kommt dir denn dabei nur so unglaubhaft vor?«
»Wenn du ein Seemann bist, so kannst du auch nicht reiten. Kein Seemann kann reiten.«
Wild jagten mir die Gedanken durch den Kopf. Wild — nicht wirr! Sollte ich denn wirklich richtig ahnen?!
»Du musst mir erst beweisen, dass du wirklich reiten kannst.«
Ja, ich hatte es schon geahnt — und doch kam es mir jetzt fast unglaublich vor!
»Gib mir dein Pferd, ich werde es dir beweisen.«
»Ja, dass du entfliehst!«, erklang es spöttisch zurück, was mich aber schon nicht mehr beirrte.
»Und wenn ich dir verspreche, nicht zu entfliehen?«
»Du würdest mir dein Wort dafür verpfänden?«
»Ja.«
»Dann könnte ich dir ein Pferd geben, und zwar eins aus meiner eigenen Zucht, und mein Fahlhengst ist das schnellste im ganzen Stamm.«
Jetzt hatte ich genug gehört!
Aber da gab es für mich noch viele Rätsel zu lösen.
»Man würde mich auf ein Pferd steigen lassen?«
»Warum nicht?«
»Ungefesselt?«
»Selbstverständlich, sonst kann man doch nicht reiten, und es ist ein noch etwas ungebärdiges Tier.«
»Man würde das Pferd am Seile im Kreise gehen lassen?«
»O nein, das wäre doch kein richtiges Reiten,«
»Ganz frei?«
»Ganz frei. Du müsstest nach einem bestimmten Ziele reiten — und dort wieder umkehren.«
»In Begleitung von Indianern?«
»Wozu das?«
»Ich verstehe nicht.«
»Was verstehst du nicht?«
»Wie die Indianer so... sorglos sein könnten.«
»Ist das nicht ganz einfach? Du gibst mir dein Wort, dass du von dem Proberitt zurückkehrst. Ich glaube nicht, dass du reiten kannst, ich nenne dich einen Prahlhans. Deine Ehre musst du wiederherstellen können.«
»Und die Indianer würden wirklich auf so etwas eingehen?«
»Sie müssen. Das ist hier so Sitte.«
»Und wenn ich nun durchgehe?«
»Dann hast du dein Wort nicht gehalten.«
»Ja, was aber dann?«
»Dann komme natürlich ich statt deiner an den Marterpfahl. Ja, gewiss, solch eine Bürgschaft wollen die Alpakokes haben, das ist doch auch ganz natürlich.«
Ich blickte den Alten an. Wohl fünf Minuten lang. Was in diesen fünf Minuten alles durch meinen Kopf ging, will ich nicht schildern, kann es nicht. Dann reichte ich ihm die Hand.
»Old Jim!«
»Was willst du?«
»Du glaubst nicht, dass ich reiten kann?«
»Nein.«
»Ich werde es dir beweisen.«
»All right, ich werde dem Häuptling sagen, was wir abgemacht haben — ich hole den Fahlhengst.«
Und ohne ein Wort weiter zu verlieren, erhob sich der Alte mit einer Schnelligkeit, als hätte er noch zwei Jünglingsbeine, und verließ den Wigwam.
Eine Viertelstunde verging.
Ach, was habe ich in dieser Viertelstunde alles durchgemacht.
Der Alte trat wieder ein.
»All right. Komm! Halt! Ich bezeichne dir einen Baum — und dann immer geradeaus, Verstehst du?«
»Ich verstehe.«
»In zwei Stunden bist du zwischen lauter Farmen, bist gerettet.«
»Old Jim!«
Er aber nahm meine Hand, die ich ihm noch einmal geben wollte, nicht.
»Komm!«
Wir traten hinaus. Ein Indianerknabe hielt einen prachtvollen Hengst, ganz anders aussehend als die mageren Gäule, die ich bisher erblickt hatte, mit englischem Sattel belegt. Im Kreise standen einige rauchende Indianer, gleichmütig wie immer.
»Wir haben schon alles abgemacht, ich habe dein Wort, dass du zurückkehrst.«
»Du hast es.«
»Siehst du dort den einsamen Baum?«
»Ich sehe ihn.«
Er war gute drei Kilometer von hier entfernt.
»Um diesen reitest du herum. Go ahead, my boy!«
»Und du wirst wirklich statt meiner an den Marterpfahl gestellt?«, durfte ich noch einmal unbelauscht flüstern.
Der Alte zwinkerte listig mit seinem einzigen Auge.
»Ach wo, das ist nicht so schlimm — ich werde mich herausbeißen. Go ahead, my boy!«
Ich schwang mich in den Sattel, ritt davon, in Trab, Galopp und Karriere.
Auf der Hälfte des Weges blickte ich mich um. Dort zwischen den Wigwams standen die Indianer als winzige Figürchen, und noch immer hatten sie kein Pferd in ihrer Nähe.
So erreichte ich mein Ziel, den einsamen Baum, und... lenkte um, ritt zurück, stieg ab und betrat wieder meinen Wigwam.
Und bei diesem Schritte hatte ich den seligsten Augenblick meines Lebens!
Ja, damals empfand ich schon etwas von einer überirdischen Seligkeit — und da mit einem Male wusste ich, dass es doch nicht so ohne ist, als Märtyrer für eine ehrliche Überzeugung zu sterben, wie unsere christlichen Märtyrer auf dem Scheiterhaufen.
»Du bist ein Narr«, sagte Old Jim, als er wieder vor mich hintrat.
Da brach es einmal bei mir mit Macht hervor.
»Ich habe es nicht getan, weil ich dein edelmütiges Opfer nicht annehmen wollte, sondern um diesen roten Kriegern zu zeigen, was ein weißer Mann wert ist — und wenn ich auch am Marterpfahl vor Schmerzen brülle, weil ich ein empfindender Mensch bin — das wenigstens sollen sie nicht sagen, dass ich schnöden Verrat begangen habe und als ein wortbrüchiger Mann gestorben bin!!«
»Ja, du hast wie ein Mann gehandelt, und so wirst du auch wie ein Mann zu sterben wissen, selbst wenn du es dir jetzt noch nicht zutraust«, entgegnete Old Jim und entfernte sich.
Eine reichliche Fleischmahlzeit ward mir gebracht, und ich wusste, dass es meine Henkersmahlzeit war. Ich sollte nicht von Hunger geschwächt an den Marterpfahl kommen, um etwa eine Ausrede zu haben, wenn ich die Martern nicht ertrug, und anderseits sollte ich die Kraft haben, recht tüchtig zu brüllen, auf dass die Alpakokes den Repräsentanten des verhassten weißen Geschlechter noch mehr verachten konnten.
Das ist Indianerlogik. Das wusste ich.
Aber ich wusste ebenso ganz, ganz bestimmt, dass ich gerettet, wenigstens mir das Schlimmste erspart werden würde.
Woher ich das so ganz, ganz bestimmt wusste — ich kann und konnte es mir nicht sagen. Es war eine innere Stimme.
Und so fest glaubte ich dieser inneren Stimme, dass ich jeden anderen aufsteigenden Plan sofort mit Energie verwarf. Es hätte ja verschiedene Mittel gegeben, wenn nicht mein Leben zu retten, so doch wenigstens die Todesqual abzukürzen. Das nächstliegende wäre Selbstmord gewesen. Aber dieser Gedanke stieg mir gar nicht auf. Ich habe den Selbstmord immer als eine feige Handlung verworfen, ohne Ausnahme irgendeines zwingenden Grundes.
Ich war ja noch frei, hätte mich hinausstürzen können, besaß noch meinen Nickfänger, jeder andere schwere Gegenstand wäre eine noch bessere Waffe gewesen, und dass man mich nicht wieder lebendig hierher schleppte, dafür hätte ich schon gesorgt.
Aber ich hörte unausgesetzt die innere Stimme flüstern: Sei ruhig, vertraue mir, diesmal noch sollst du aus alledem unversehrt hervorgehen!
Und ich vertraute ihr.
Indianer kamen. Im Nu waren mir die Hände auf dem Rücken gebunden. Ich hatte zuerst gar nichts davon gemerkt. Darin hatten die etwas los.
Richtig! Dort in der Mitte des freien Platzes war ja schon der Marterpfahl errichtet, ein starker Baumstamm, noch breiter als mein Körper, und ich ward darangebunden.
Es ging alles ohne jede Zeremonie vor sich. Einige Reden, die geschwungen wurden, verstand ich nicht, und sie wurden ganz monoton vorgetragen.
Ein heulender Ton aus einem Ochsenhorn, und phlegmatisch kamen die Krieger herbeigebummelt, als sei es ihnen höchst unangenehm, meinetwegen aus ihrer faulen Ruhe gerissen worden zu sein, und nicht viel anders benahmen sich die Weiber und Kinder. In ihrem Innern sah es natürlich anders aus. Da brannte alles vor Begierde, das war doch eine traditionelle Handlung, und die meisten mochten einer solchen noch nicht einmal beigewohnt haben, kannten sie nur vom Hörensagen.
Zuerst traten gereifte Krieger vor, ließen Felle und Decken fallen, um Pfeil und Bogen besser handhaben zu können.
Denn Pfeil und Bogen sind bei allen nordamerikanischen Indianern noch immer bevorzugte Waffen, sie sind geheiligt, und auf der Büffeljagd wird noch immer lediglich der Pfeil gebraucht. Eben nach heiliger Tradition. Den immer seltener werdenden Büffel, das edelste Wild, mit der Büchse zu schießen, kommt dem Indianer so niederträchtig vor wie dem europäischen Weidmann das Schlingenstellen.
Die Pfeile sausten auf mich zu. Dass ich nicht verwundet werden durfte, wusste ich. Bald war ich von Pfeilschäften ganz eingerahmt, und hatte ich vielleicht anfangs etwas gezuckt, wenn ich so einen Pfeil mit Stahlspitze auf mich zugeschwirrt kommen sah, der nach meiner Berechnung in meiner Nase stecken bleiben musste, so hatte ich mich doch schnell an meine Lage gewöhnt. Auch jüngere Krieger bewiesen ihre Treffsicherheit, selbst Knaben. Sie zielten aber schon etwas weiter von mir ab, wobei sie jedoch auch nicht den Baumstamm verfehlen durften, und der Knabe, dessen Pfeil in die Ferne schwirrte, schlich ebenso beschämt davon wie der reife Krieger, der ein wenig meinen Hals geritzt hatte.
Dann kam das Schleudern der Tomahawks daran, und das sah noch ganz bedeutend gefährlicher aus, wenn die blitzenden Beile mit einer einmaligen Umdrehung herangesaust kamen. Aber auch daran hatte ich mich schnell gewöhnt, war selbst schon zum stoischen Indianer geworden. Schließlich wurde meine lockige Frisur noch mehr eingerissen, als sie es schon war, jedenfalls sollten meine Haare möglichst vom Kopfe abstehen. Sie waren nicht gar zu lang, und wieder hatte ich das Vergnügen, die blitzenden Beile auf mein Gesicht losfliegen zu sehen, dicht an meinem Kopfe vorbei, wo sie mit einem Ruck im Holze stecken blieben. Jeder Tomahawk sollte mir eine Locke abschneiden, und wenn hier auch kein Schießbuch geführt wurde, so würden die Krieger doch vom Häuptling ihr lobendes oder tadelndes Urteil zu hören bekommen, und schon jetzt schlichen wieder einige von ihnen beschämt von dannen. Glücklicherweise für mich aber waren ihre Wurfbeile immer weit von meinem Kopfe entfernt geblieben, kein Ohr wurde mir dabei abgenommen, obgleich ich das kalte Eisen manchmal meine Wange streifen fühlte.
Wirklich, es war ganz erstaunlich, wie diese Indianer ihren Tomahawk zu schleudern wussten! Freilich war ich jetzt nicht gerade in der Stimmung, diese Kunst so richtig zu bewundern.
Auch das Tomahawkwerfen, nur von erwachsenen Kriegern ausgeführt, war beendet. Wieder hielt der Häuptling eine längere Rede, und die Indianer schrien nach jedem Satze ›Howgh‹ und ›Uff‹, und die Weiber und die Kinder klatschten in die Hände.
Da sah ich zum ersten Male Old Jim auf seinen beiden Krücken auftauchen.
»Das Klatschen gilt dir, du wirst bewundert, du hast dich als ganzer Mann bewährt!«, rief er mir zu.
Ich war jetzt für dieses Lob wenig empfänglich, ich sah nur, wie Weiber und Kinder Reisig angeschleppt brachten, es zu meinen Füßen im engen Kreise um mich anhäuften, ab und zu ein Pechstückchen dazwischen und darauf legend.
»Sobald das Feuer brennt, kannst du mit Schimpfen beginnen, und die verstehen schon Englisch«, ließ sich Old Jim wieder vernehmen.
Ich blieb ihm die Antwort schuldig.
»Gott stehe mir bei!«, dachte ich nur mit innerlichem Ächzen.
Die innere Stimme aber, die mich erst so getröstet hatte, vernahm ich nicht mehr, und das eben war das Schlimme dabei.
Ein Krieger legte Feuer an, gleichzeitig begannen alle anderen einen monotonen Gesang.
Dichte Qualmwolken stiegen vor mir auf. Ich schimpfte nicht, sang nicht — ich fühlte nur, wie meine Jagdstiefel langsam warm wurden. Man hatte nicht für nötig befunden, sie mir auszuziehen. Umso länger dauerte der schöne Spaß.
Der Qualm wurde immer dicker, kaum konnte ich noch atmen, hingegen wollten meine Stiefel nicht wärmer werden.
Der Feuermeister kam wieder heran, der Brand war trotz der Pechstücke ausgegangen.

Da, als der Krieger schon wieder das Feuer schürte, kam in den Kreis ein altes Weib gehumpelt, zwar noch im Besitz ihrer beiden Beine, aber doch wie mein Freund Jim zwei Krücken benutzen müssend, und zwar war es eine Hexe von einer Hässlichkeit, wie ich sie nur fotografisch wiedergeben könnte. Das schönste an ihr war noch der obere Teil ihres Schädels, auf dem auch kein einziges Härchen mehr gedieh. Ein abschreckendes Bild! Meine erste Gattin, die Dona Privilega, war gegen diese Hexe noch ein Ideal von Schönheit gewesen.
Jetzt hielt diese alte Hexe mit gellender Stimme eine Rede, dabei wild ihre Krücken schwingend, und die Wirkung gleich ihrer ersten Worte war, dass der Brandmeister sofort das kleine Feuer mit dem Fuße wieder ausdrückte.
Aufmerksam hörte alles der keifenden Stimme zu, und immer beistimmender erklangen die ›Uffs‹ und die ›Howghs‹ der roten Zuhörer, immer wohlwollender blickte alles nach mir.
Wollte und konnte diese alte Hexe vielleicht meine Rettung bewirken? War sie die Vertreterin des Medizinmannes, den ich hier noch gar nicht gesehen hatte? Betrachtete sie den Zufall, dass das Feuer nicht brennen wollte, als ein Zeichen des großen Geistes, dass ich vom Tode verschont bleiben sollte?
Da, als die Hexe noch immer Rede und Krücken schwang, kam ein zweites Krückenpaar auf mich zu gehumpelt, welches Old Jim angehörte. Ganz kam er nicht heran, hielt sich etwas hinter mir.
»Mann, Ihr habt Glück«, flüsterte er mir zu, »Euer Mut wird belohnt — Ihr bleibt am Leben — die Schwester des Häuptlings begehrt Euch zum Manne«
So hörte ich Jim flüstern, und in mir stieg eine fürchterliche Ahnung auf, ich sah die uralte Hexe, die jetzt mit ihrer Krücke nach mir deutete und mit ihrem splitterfasernackten Schädel nach mir nickte.
»Doch nicht etwa die da?«
»Ja, ja, die Schwester des Häuptlings — sie will Euch heiraten — Mann, habt Ihr ein Glück...«
Mehr hörte ich nicht, plötzlich waren die ernsten Krieger wie umgewandelt, jubelnd sprangen sie auf mich zu, um mich loszubinden. Ach, wie ward mir da!! Hatte mich denn das Schicksal dazu verdammt, sämtliche weiblichen Exemplare des genus homo, die die Schöpfung in einer Katerlaune verpfuscht hatte, zu ehelichen?!
Das heißt, ganz offen gestanden: Ich zog es doch vor, dieses alte Scheusal in meine Arme zu schließen, als dass ich mir meine Stiefel noch heißer machen ließ.
Und dennoch — die Hexe war verschwunden, nur der Hexenschuss war mir geblieben.
Was mich der Häuptling gleich hier an Ort und Stelle alles fragte, weiß ich nicht recht mehr, nur, dass ich immer ja sagte.
»Will Treuwort einer der Unsrigen werden?«
»Ja.«
»Will Treuwort die Schwester des Häuptlings der Alpakokes heiraten?«
»Jaaa!!!«
Das waren wohl die Hauptfragen gewesen. Und alles Übrige ging ebenso schnell. Sofort wurden die Vorbereitungen zur Hochzeit getroffen, und in dem ganzen Lager brach ein Jubel aus, dessen ich diese würdevollen Indianer niemals für fähig gehalten hätte.
Viel trug dazu mit bei, dass soeben eine Jagdexpedition mit reicher Beute eintraf, aber nun war erst recht Anlass zu einem wirklichen Festschmaus gegeben.
Von einer eigentlichen Trauung ist bei den nordamerikanischen Indianern keine Rede. Sonst sind die Zeremonien bei allen Stämmen so ziemlich dieselben. Die Rolle des Altars spielt immer gewissermaßen das Bärenfell, unter welches das Brautpaar angesichts aller Krieger, Weiber und Kinder kriecht. Unter diesem Bärenfell verbringen die Neuvermählten ihre Flitterwochen oder doch Flittertage, denn einige Tage dauert die Geschichte immer, während welcher die Krieger im Kreise sitzen, sich der Fresserei hingebend, einmal schlafend und wieder Fleisch verschlingend, dabei das in der Mitte des Kreises liegende Bärenfell beobachtend, und da man von der Liebe allein doch nicht leben kann, so wird den Neuvermählten ab und zu eine Portion geröstetes Fleisch in ihr Hochzeitsgemach geschoben. Zum Vorschein dürfen sie auf keinen Fall kommen, und wie sie sich mit allen Bedürfnissen des Lebens abfinden, das ist ihre Sache.
So hatte ich in sachlichen Werken gelesen, und da wurde auf dem kurzen Rasenteppich auch schon ein mächtiges Bärenfell ausgebreitet, mit den Haaren nach oben, und mir, nachdem ich natürlich sofort losgebunden war, bedeutet, darunter zu kriechen.
Den alten Trapper bekam ich gar nicht wieder zu sehen, der Häuptling selbst gab mir einige Instruktionen, woraus ich erfuhr, dass bei den Alpakokes diese Zeremonie etwas anders gehandhabt wurde.
Danach kroch hier auch die Braut zuerst unter ihr eigenes Bärenfell. Diese Bärenfelle waren zwar schmiegsam, konnten sich aber doch nicht zusammenrollen, inwendig hatten sie Handhaben, sodass man beim Fortkriechen das Fell mit sich nahm, immer vollständig ausgebreitet, und nun krochen Braut und Bräutigam, jedes unter seinem Bärenfell, so lange in dem ziemlich weiten Kreise herum, bis sie sich zufällig gefunden hatten, worauf die beiden Felle etwas übereinander geschoben wurden, sodass sich das glückliche Paar für alle Ewigkeit vereinen konnte, unter dem Bärenfell wenigstens für einige Tage, bis die Zuschauer des Fressens überdrüssig waren.
Dann wurde von den Neuvermählten plötzlich die haarige Umhüllung abgerissen, und alles drosch mit Knüppeln auf sie los, ohne dass die beiden sich etwa wehren durften, noch weniger ausreißen, sondern in innigster Umschlingung liegen bleiben mussten, denn dadurch eben bewiesen sie ihre gegenseitige Treue fürs ganze Leben.
Na, gar zu sehr würden die Stammesgenossen schon nicht auf uns losdreschen, und sonst kam es diesen roten Helden ja auch nicht auf ein paar Knochenbrüche an.
So hatte mir der Häuptling erklärt, mit kurzen Worten, aber deutlich genug. Nur das letzte, das mit dem Prügeln, hatte ich nicht recht verstanden.
Ganz zufällig hörte ich, dass meine Braut, die alte Hexe, den ganz hübsch klingenden Namen Litlit führte. Vor achtzig bis hundert Jahren konnte sie ja auch wirklich eine Schönheit gewesen sein. Jedenfalls hatte sie diese mit ihren Haaren verloren. Sonst erfuhr ich gar nichts über sie, nicht, wie viele Männer sie schon durch ihre Liebe unter die Erde gebracht hatte usw. Nur das durfte mich einigermaßen trösten, dass ich wohl schwerlich viele kleine Kinder mit Wildbret zu versorgen hatte... halt, nicht voreilig! Es konnten ja auch noch unmündige Enkel oder gar Urenkel und Urururenkel vorhanden sein!
Ebenso wenig bekam ich meine holde Braut noch einmal zu sehen, und das ist ja eben der Witz bei der ganzen Sache, es soll eine große Überraschung geben, wenn sich die beiden Bärenfelle finden. Der männliche Bär hat dabei zu suchen, der bräutliche soll ausweichen.
Also ich kroch, wie ich ging und stand, unter mein Bärenfell und steckte die Hände in die in der Mitte befindlichen Schlingen.
O o o o o!! Jetzt kam mir doch erst richtig zum Bewusstsein, was mir da bevorstand. Ich dachte an die Krücken, an die beiden Beine, die ich unter dem durchsichtigen Röckchen der Alten hatte schimmern sehen und die sich an Umfang wenig von der hölzernen Krücke unterschieden hatten, ich dachte an den ratzekahlen Schädel und an noch manches andere. Und hier gab es kein solches Klosett wie in Brasilien, in das meine Ehehälfte noch zur rechten Zeit fallen konnte!
Wäre es nicht vielleicht doch besser gewesen, ich hätte mich am Marterpfahl langsam schmoren lassen? Doch nein, das dürrste Holz ist mir doch lieber, wenn es nur nicht brennt, wenigstens nicht an meinem Körper.
Oder ob ich hier unter meinem Bärenfell still liegen blieb, nicht auf die Suche ging? Nein, hatte ich nun einmal A gesagt, musste ich auch B sagen. Übrigens hätte mich dann doch die schüchterne Maid zu finden gewusst, wenn sie auch vor mir fliehen sollte. Aber man weiß ja, wie das gemacht wird, und dabei hat die Farbe nichts zu sagen, auch die Indianerinnen stammen von der Eva ab.
Also ich setzte mein Bärenfell in Bewegung, rutschte auf dem Grasteppich hin.
Wie lange ich so herumgerutscht bin, weiß ich nicht. Mir standen Herz und Atem und alles still, auch die Zeit.
Da war mir, als ob mein Bärenfell einen Widerstand fände, und das ausbrechende Jubelgeschrei der Indianer sagte mir vollends, dass ich mein Ziel gefunden hatte. Gleichzeitig wurde mein Fell am vorderen Ende etwas gelüftet und noch vorgezogen — so, jetzt lagen die Neuvermählten unter einer Bettdecke.
O, wie mir zumute war! Ich sah im Geiste immer nur die vier Krücken — zwei aus Holz, die beiden anderen aus Knochen.
Da ein Kichern! Jawohl, genau so kichern alle alten Hexen.
Aber das half alles nichts — nun, man los!
»Entschuldigen Sie —«, fing ich gewohnheitsmäßig an.
Wieder ein Kichern.
Ja, die hatte gut kichern. Ich kicherte nicht. Ich hatte sowieso unter dem dicken Fell schon mächtig geschwitzt, und jetzt wurde der Schweiß plötzlich eiskalt. Doch, wie gesagt, es half alles nichts, ich gab die Schlingen frei und kroch vorwärts, dorthin, wo ich meine bessere Hälfte im Ehebette vermutete.
Und da hatte ich sie auch schon! Wenigstens hatte ich zunächst einen Lappen in der Hand. Ich tastete weiter nach einer der vier Krücken und... fühlte statt ihrer junge, kräftige Glieder, tastete im nächsten Augenblick volles, reiches Haar.
Ich war ganz baff.
Entschuldigen Sie — sind Sie Litlit?«
»Yes«, wurde gekichert, und jetzt merkte ich, dass das doch eigentlich ein recht feines, liebliches Stimmchen war.
Ich tastete weiter — von Krücken gar keine Spur.
»Ja, wie alt bist du denn, Litlit?«
»Dreizehn Jahre.«
Wir hatten ja Zeit, uns auszusprechen, aber ich will es kurz machen.
Der alte Tohuwabohu hatte einen viel jüngeren Bruder gehabt, das hier war dessen jüngste Tochter, die dreizehnjährige Litlit, korrumpiert aus LittleLittle, das ist KleinKlein. Im Übrigen als Indianerin schon eine gereifte oder doch erblühte Jungfrau. Da die Indianer so etwas wie Nichte nicht kennen, galt sie als Schwester des Häuptlings. Ihre Großmutter hatte nur die Sprecherin für sie gemacht, aber auch wieder in Übereinstimmung mit dem ganzen Stamme. Das alles war nur eine zeremonielle Sache gewesen, und das ging noch viel weiter.
Old Jim war ein Filou. Ja, es stimmte, die Alpakokes waren in ihren Rechten schwer gekrankt worden, eben wegen jener Überschreitung der Wiese, sie hatten das Gesetz wirklich erlassen, dass in ihrem Jagdrevier von keinem Fremden mehr ein Stück Wild geschossen werden dürfe, und dass, wer gar ein Murmeltier töte, am Marterpfahl sterben müsse, aber gar so ernst schien es den Alpakokes gar nicht damit zu sein, sie hofften noch, dass dieser Rechtsstreit in Güte beigelegt werden würde, wenn man ihnen nur eine Genugtuung gab. Jetzt war diese Sache sogar schon bis nach Washington gegangen.
Als ich bei dem Verspeisen des Murmeltiers erwischt wurde, war ich allerdings gefangengenommen worden. Ja, an den Marterpfahl wäre ich sowieso gestellt worden, aber man hätte nur einmal ein Beispiel statuiert, ohne mich zu töten. Ich wäre mit dem Schrecken davongekommen.
Nun aber hatte den Indianern meine Treffsicherheit ganz mächtig imponiert. Sie hätten mich gern als einen der Ihrigen in den Stamm aufgenommen. Da musste ich aber erst geprüft werden, ob ich auch sonst dieser Ehre würdig war, und dies bewies ich noch nicht dadurch, dass ich Pfeile und Tomahawks ohne Wimperzucken auf mich zufliegen sah. Die Tugend, die der noch unverdorbene Indianer nach dem Ertragen jeden Schmerzes am höchsten schätzt, ist das Halten des gegebenen Wortes. Der alte Trapper kam nicht aus eigenem Antriebe zu mir, sondern er war von dem Häuptling instruiert. Er musste tun, als wolle er mir zur Flucht behilflich sein, bot mir ein Pferd an, und mein Wort galt, auch wenn es nicht direkt ausgesprochen war. Und hätte ich es nicht gehalten, wäre ich geflohen, so wäre es mir ganz traurig ergangen. Das Pferd war ausgezeichnet dressiert. Wohl hätte es sich von mir noch weiter reiten lassen, aber nur ein gellender Pfiff seitens seines Herrn, und ich hätte es nicht mehr von der Stelle gebracht, es hätte mich aus dem Sattel geworfen, jedenfalls wäre es zurückgelaufen, und wenn ich absprang, so hätte man mich gar bald eingeholt. Dann allerdings wäre es mir, wie gesagt, traurig ergangen.
Nun, ich war nicht wortbrüchig geworden, und der ganz auf Seiten der Indianer stehende alte Trapper hatte seine Rolle ebenso ausgezeichnet gespielt.
An den Marterpfahl war ich allerdings immer noch gekommen, aber auch hier hatte ich die Probe bestanden, und für diesen Fall war schon vorher beschlossene Sache gewesen, dass ich eine Jungfrau oder eine Witib aus dem Stamme heiraten sollte. Die Liebe kam dabei gar nicht in Betracht, sondern die ledigen Mädchen und Weiber hatten einfach das Los ziehen, mit Knöchelchen würfeln müssen, und mir Glückspilz war gerade die jugendliche Nichte des Häuptlings, die den Ehrentitel seiner Schwester führte, zugefallen. Dass ihre Großmutter die Marterprozedur unterbrach, für ihre Enkelin die Freiwerberin machte, war nur eine Zeremonie gewesen.
Sonst habe ich nur noch zu bemerken, dass es diesen Alpakokes höchst gleichgültig war, falls ich etwa schon anderswo eine Frau und einen Haufen Kinder hatte oder auch einen Haufen Frauen. Was für Ansichten die Indianer über solche Familienverhältnisse haben, das habe ich ja schon bei Old Jim geschildert. Jedenfalls hielten es die Alpakokes für ganz ausgeschlossen, dass irgendein Mensch die Ehre, durch Heirat ihr Stammesgenosse zu werden, ausschlagen könne. —
Dies alles erfuhr ich von meiner neuen jungen Gattin, die ganz vortrefflich Englisch sprach, und genügend Zeit, uns über so etwas zu unterhalten, hatten wir ja.
Denn drei Tage und drei Nächte währte ununterbrochen der Hochzeitsschmaus der im Kreise hockenden Indianer, und so lange blieben wir Neuvermählten auch unter dem Bärenfelle, ohne ein einziges Mal ans Sonnen- oder Sternenlicht zu kommen. Ja, meinetwegen hätte es noch viel länger dauern können, meine Enttäuschung war gar zu angenehmer Art, und es war auch wirklich ein reizendes Kind, welches das Knöchelspiel mir da zugeteilt hatte.
Ab und zu schob man uns eine gehörige Fleischportion unter das Fell, ab und zu wechselten wir auch unseren Platz, das heißt, verschoben gleich das ganze Ehebett, unter dem, nicht in dem wir lagen, denn so drei Tage und drei Nächte unter einem Bette auszuhalten, ohne einmal zum Vorschein kommen zu dürfen, das hat doch auch seine gewissen Unannehmlichkeiten.
Am dritten Tage — jetzt wurden mir die Glieder doch ein bisschen lahm — trommelte es auf unserer gemeinsamen Bettdecke herum, doch nicht Menschen verursachten diese Töne, sondern ein Platzregen. Die Indianer genierte dieser warme Regen ja wenig, wenn er auch platzte, die rieben sich den nackten Oberkörper einfach mit Fett ein, und die Haut blieb trocken — wir hingegen konnten jetzt nicht mehr unser Bett verschieben — oder wir hätten es wohl gekonnt, dann aber kamen wir auf das nasse Gras zu liegen, denn Unterbetten sind bei den indianischen Hochzeitsnächten prinzipiell ausgeschlossen.
Zum Glück aber hatten die roten Krieger jetzt die ganze Jagdbeute aufgezehrt, sie stimmten noch ein Lied an, welches das Ende dieser Feierlichkeit bedeutete. Das wusste ich aber nicht, Litlit wollte mich darauf aufmerksam machen, was uns jetzt bevorstände, sie kam nicht mehr dazu — plötzlich wurde das Bärenfell über uns weggerissen, und einmütig hauten einige Dutzend Krieger mit Stöcken auf uns ein.

Das heißt, es war gar nicht so schlimm, und auch wenn ich ein echter roter Krieger gewesen, wäre nicht derber zugeschlagen worden. Eine Ausnahme findet nur statt, wenn der rote Krieger mit der Herzallerliebsten schon ein intimeres Techtelmechtel gehabt hat, dem etwa gar schon ein Pfand der Liebe entsprungen ist. Dann soll zu diesem Schlusslied den beiden ganz gehörig der Takt geklopft werden, auf dass das Band der Ehe nur um so fester werde. Denn bei diesen Indianerstämmen hat man es wahrhaftig nicht nötig, hinter dem Rücken der Eltern ein Mädchen zu verführen. Man braucht ja mit ihr nur unter ein Bärenfell zu kriechen, das muss aber eben öffentlich geschehen. Ist nun freilich unter den Hochzeitgästen ein Nebenbuhler, dem das Mädchen vorher einen Korb gegeben hat, dann ist dem nicht zu verargen, wenn der sich einen solideren Knüppel besorgt und nachdrücklicher auf die beiden losdrischt.
Bei uns aber ging es ganz gemütlich zu. Ich wies am Leibe nur einige Schwielen auf, Knochen wurden mir nicht gebrochen, und dass ich, der ich von diesem Schlussakt der Hochzeitsfeierlichkeit noch keine Ahnung gehabt, mich nicht wehrte, dafür sorgte meine junge Gattin, indem sie mich fest umschlang.
Endlich war das Lied, dessen Melodie einige Ähnlichkeit mit ›Wir winden dir den Jungfernkranz‹ hatte, beendet. Nun wurde auch das Taktschlagen eingestellt, wir durften uns erheben.
So, jetzt waren wir richtig Manu und Frau — meine Einverleibung in den Stamm durch Tätowierung konnte erst in vierzehn Tagen geschehen, bei Neumond — und die erste häusliche Beschäftigung meiner jungen Gattin, die übrigens auch ein reizendes Gesichtchen besaß, war, dass sie mir meine Schwielen einsalbte.
Vierzehn Tage habe ich bei den Alpakokes zugebracht, habe mit ihnen gejagt und gefaulenzt.
Was aus dem Vernichtungskriege gegen die Blassgesichter werden sollte, erfuhr ich nicht, das wurde am Beratungsfeuer besprochen, an dem ich als untätowierter Krieger noch keinen Sitz hatte.
Mit meiner dreizehnjährigen Gattin war ich sehr, sehr zufrieden. Da aber, kurz vor dem Tage, an dem ich tätowiert werden sollte, wovor mir etwas graulte, geschah etwas sehr, sehr Trauriges.
Nicht, dass Litlit gestorben oder auch nur erkrankt wäre — nein, bei vollster Gesundheit brannte sie mir durch — mit einem anderen!
Sie hatte nämlich zuvor doch schon ein kleines Liebesverhältnis mit einem roten Jüngling gehabt, wenn es auch noch nicht zum intimeren Techtelmechtel gekommen war — gerade durch meine Belehrungen war die Unschuld zu der Überzeugung gekommen, dass doch eigentlich der rote Jüngling der richtige Mann für sie gewesen wäre.
Als ich von einem Jagdausflug, an dem die Hälfte aller Krieger teilgenommen hatte, zurückkehrte, fand ich meinen Wigwam vereinsamt. Aber schon war das Pferd zurückgekommen, auf dem die beiden bei Nacht und Nebel geflohen waren, auf der Satteldecke ein Stück Baumrinde befestigt, auf die allerhand bunte Figuren gemalt waren.
Die Indianer konnten diese Bildersprache lesen, Old Jim übersetzte sie mir.
Der rote Jüngling hielt sich mit meiner Frau in einem großen Gebüsch auf, zehn englische Meilen von hier entfernt, dorthin lud er mich zu einem Zweikampfe auf Leben und Tod ein. Ein Schleichkampf in der Nacht sollte es sein, jeder nur mit dem Messer bewaffnet, und wer den anderen tötete, der durfte ihm den Skalp nehmen und erhielt als Zugabe auch noch die Litlit.
Es wurmte mich ja etwas, dass die hübsche Litlit mir einen anderen vorgezogen hatte, mir, der ich mich bisher immer für einen bezaubernden Kerl gehalten hatte — na, schließlich fasste ich den Fall ebenso kaltblütig auf wie meine roten Stammesgenossen.
Die richtige Liebe war es eben auch meinerseits nicht gewesen — nichts so für die Ewigkeit.
Und was sollte ich nun tun?
»Ja, da ist nichts zu machen«, erklärte mir mein Mentor, der alte Trapper, »Ihr reitet noch heute Nachmittag hin nach dem Busche, dass Ihr mit Anbruch der Nacht dort seid. Euer Gegner wird sich schon bemerkbar machen, wenn auch nur durch einen Pfiff, dann nehmt Ihr Euer Messer, steigt vom Pferd und kriecht auf allen vieren durch den Busch. Der schwarze Rabe (so hieß der rote Jüngling) wird Euch zu überfallen suchen, und zwar von hinten, das ist bei diesem nächtlichen Schleichkampfe erlaubt, und dem müsst Ihr zuvorzukommen suchen, dass Ihr ihm von hinten kommt, oder meinetwegen auch von vorn — keinesfalls dürft Ihr Euch von ihm überraschen lassen, und wenn Ihr mit ihm zusammengeratet, dann geht eben die Messerstecherei los. Das ist doch ganz einfach.«
O ja, in gewissem Sinne war das ganz einfach — in anderem wieder nicht.
»Darf ich da wenigstens eine Lampe und Streichhölzer mitnehmen?«
»Was? Streichhölzer?«
Der Alte wusste gar nicht, was Streichhölzchen sind, und ich hatte auch nur ein Witzchen gemacht.
»Wenn ich nun diese Herausforderung nicht annehme?«
»Dann seid Ihr ein Feigling und werdet mit Schimpf und Schande davongejagt. Oder denkt Ihr etwa, dann werdet Ihr morgen noch tätowiert?«
»Und wenn ich Sieger bleibe?«
»Dann findet die Tätowierung natürlich in allen Ehren statt.«
»Und Litlit?«
»Die bringt Ihr wieder mit.«
»Und wenn sie nicht will?«
»Die will schon, verlasst Euch nur drauf. Wenn Ihr nur seinen Skalp habt!«
»Und wenn ich nun derjenige bin, der ohne Skalp zurückkommt?«
»Was?!«, rief der Alte. »Dann hat Euch der schwarze Rabe doch auch getötet!«
»Na ja, dann werde ich aber auch nicht mehr tätowiert.«
»Nee, Leichen tätowieren wir nicht.«
»Und was wird dann aus Litlit?«
»Dann kommt die eben mit dem schwarzen Raben zurück.«
»Und wenn wir uns gegenseitig abmurksen, welcher Fall doch auch eintreten kann?«
»Dann wird sich Litlit schon allein wieder hier einfinden.«
»Und was geschieht ihr?«
»Nischt!«
So, nun wusste ich alles.
Nach einem gesunden Nachmittagsschläfchen, in dem mich kein Todestraum gestört hatte, bewaffnete ich mich mit einem soliden Skalpiermesser, Old Jim zeigte mir noch einmal an einem toten Biber, wie man einem Menschen die angewachsene Perücke abzieht, und ich schwang mich auf den Gaul, den man mir für diesen Zweck zur Verfügung gestellt hatte — schon daran denkend, dass ich vielleicht nicht wiederkehren und auch mein Ross den Heimweg nicht finden könne — es war kein sehr edles Tier.
Ich ritt ganz allein, Zeugen gibt es bei solch einem indianischen Zweikampf nicht.
Drei Stunden hatte ich zu reiten, bis ich jenes nicht zu verfehlende Gehölz erreichte, ich brauchte nur immer dem Laufe eines Flüsschens zu folgen, auch sonst im Allgemeinen immer direkt nach Süden zu halten.
So ritt ich eine Stunde nach Süden, dann... schwenkte ich nach Westen ab, dorthin, wo San Francisco lag.
Weshalb? I, fiel mir doch gar nicht im Traum ein, da nächtlicherweile im stockfinsteren Busche herumzukriechen, um mich der Gefahr auszusetzen, mir von dem roten Jüngling meinen lockigen Skalp nehmen zu lassen!
Nein, da bin ich Philosoph. Das war mir die Litlit denn doch nicht wert. Und gesetzt nun den Fall, ich wäre derjenige, der dem anderen Leben und Skalp nahm?
Dann wäre ich morgen am ganzen Körper blau tätowiert worden und kam wiederum in so eine Schraube ohne Ende hinein.
Nein, da ließ ich lieber den Zweikampf Zweikampf sein und ritt nach San Francisco.
Was ich gewollt hatte, hatte ich ja erreicht. Ja, ich hatte das Leben und Treiben von waschechten Indianern zur Genüge kennen gelernt, die Litlit war eine ganz hübsche Zugabe gewesen. Ich hatte am Marterpfahl gestanden und hatte als Hauptperson eine indianische Hochzeitsfeierlichkeit mitgemacht, und das war alles so echt gewesen, dass mir beim Reiten noch jetzt die Schwielen weh taten.
Nein, nun hatte ich genug von diesem Spaße!
Und wenn ich noch heute einer Hochzeitsfeierlichkeit beiwohne, dann muss ich mich immer gerade im feierlichsten Moment auf die Lippen beißen, um nicht laut aufzulachen — denn dann muss ich an die Knüppel der Alpakokes und an meine Schwielen denken, und wie es wäre, wenn man solch einen Schlussknalleffekt der Trauung auch bei uns einführen würde!
In dem nächsten Städtchen, an einer Eisenbahnlinie gelegen, das ich am Abend des anderen Tages erreichte, verkaufte ich mein edles Ross, das Pfund für einen halben Groschen, erhielt für die vier Zentner fünf Dollar, und das war noch sehr gut bezahlt. Nun kann man sich vorstellen, was für ein verhungerter Klepper das gewesen war, den man mir zum Ritt nach dem Rendezvousplatz gegeben hatte. Natürlich hatte kein Pferdezüchter ihn als Zuchthengst gekauft, sondern der Rossschlächter, wobei ich aber betonen muss, dass aus meiner Rosinante nicht etwa Hackfleisch und Würstchen gemacht werden sollten, erstens darum nicht, weil in Amerika wie England auch der ärmste Schlucker kein Pferdefleisch isst, und zweitens, weil mein Ross überhaupt kein Fleisch an sich hatte. Hingegen gibt es in Amerika wie in England in jedem Städtchen einige Lädchen, welche Pferdefleisch für Hunde und Katzen verkaufen.
Die fünf Dollar reichten gerade hin, dass ich nach San Francisco mit der Eisenbahn fahren konnte und unterwegs nicht zu hungern brauchte.
Nun musste ich doch wohl wieder als Matrose gehen, wenn mir der Zufall nicht etwas Besseres zuschob, und auf diesen Zufall baute ich allerdings stark, empfand schon das als einen günstigen Fingerzeig, dass San Francisco augenblicklich mit heuerlosen Matrosen überfüllt war. Heizer und Kohlentrimmer wurden genug gesucht, aber davon hatte ich doch etwas die Nase voll bekommen.
Und wirklich, ein Heuerbaas bot mir die Stelle als zweiter Steuermann auf einem Schoner an, der längs der Ostküste hinsegeln sollte, nur musste ich erst auf seine Rückkunft warten, die in einigen Tagen erfolgen würde. Sein eigener Sohn nahm gegenwärtig diese Stelle ein, er wollte abmustern, und der Heuerbaas, dem ich für mein letztes Geld ein Glas Bier spendierte, hatte seinen Gefallen an mir gefunden. Bis dahin blieb ich bei ihm in Kost und Logis, war also vorläufig geborgen.
Dann hatte ich das Glück, einen Matrosen zu treffen, mit dem ich damals die Fahrt von Neapel nach Pernambuco gemacht hatte. Er hatte viel Geld in der Tasche, war ein ganz solider Kerl, der liederliche Gesellschaft mied; mich aber bewunderte er als einen abenteuerlichen Helden, hielt mich frei. Von meinen Abenteuern brauchte ich ihm nicht viel zu erzählen, der arme Kerl hörte sehr schwer, ich konnte ihm etwas Beliebiges ins Ohr brüllen.
Am zweiten Tage meines Aufenthaltes in San Francisco bummelten wir nach einer Vorstadt, in der ein ewiger Jahrmarkt mit Schaubuden etc. herrscht.
Eine von diesen zog meine besondere Aufmerksamkeit an.
»Immer herein, meine Herrschaften«, brüllte ein Kerl mit heiserer Stimme, abwechselnd Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch sprechend, »hier ist zu sehen das Wunder dieses Jahrhunderts, Kronos, jenem innerafrikanischen Negerstamme angehörend, den Polyphemen, die erst kürzlich von dem berühmten Professor Ulixes entdeckt worden sind. Diese Polypheme laufen, obgleich sie sonst ganz normalgebaute Menschen sind, noch heute in den Wildnissen Afrikas auf vier Beinen herum, sich von Schlangen, Vögeln und allem anderen, was da kreucht und fleucht, ernährend, ihre Beute im Fluge erhaschend und gleich roh verschlingend. Die größte Leckerei sind ihnen Ratten, womöglich solche mit recht vielen Trichinen. Ihr Heißhunger, von dem sie unausgesetzt geplagt werden, ist unglaublich. Auf einen Sitz zwanzig Pfund Fleisch aufzufressen, ist ihnen eine Kleinigkeit. Natürlich sind sie Menschenfresser, weshalb sie eben Polypheme genannt worden sind, und ihr Heißhunger ist so groß, dass sie nicht einmal ihre eigenen Kinder verschonen. Bei jeder neuen Geburt entspinnt sich ein furchtbarer Kampf zwischen Frau und Mann, welche erstere ihr Kind vor der Gefräßigkeit ihres Gatten schützen muss, und sie kann von Glück sagen, wenn sie nicht selbst von ihm aufgefressen wird. Kronos ist das einzige Exemplar, welches lebendig nach Amerika gekommen ist. Wir haben es zu einem ungeheueren Preise erworben. Dieser Kronos hat alle seine Kinder gleich bei der Geburt lebendig aufgefressen, im Laufe der Jahre mindestens ein Dutzend. Gleich beim ersten verspeiste er zum Nachtisch seine Schwiegermama. Als ihn Professor Ulixes sah, war er gerade dabei, seine Gattin zu verschlingen. Unterwegs säuberte er das ganze Schiff von Ratten, sie wie Pillen verschluckend... Ladies und Gentlemen, herrein, herrrein, herrrrein, sogleich wird die Fütterung beginnen, Sie werden sich mit eigenen Augen überzeugen, wie dieser Kronos zwanzig Pfund rohes Fleisch verschlingt, als Nachtisch ein halbes Dutzend Schlangen, Mäuse und Ratten, letztere möglichst trichinös, alles roh und ungebraten, und zum Schluss wird Mister Kronos zeigen, wie er ein lebendiges Kind zerreißt...«

So und anders schrie der Kerl, dabei immer mit einem Stöckchen auf ein Gemälde schlagend, welches in schreienden Farben den Mister Kronos darstellte.
Es war ein menschenähnliches Wesen, ein am ganzen Körper mit dichten Haaren bedeckter Neger, der auf allen vieren kroch, und was mir am allermeisten auffiel, das war die dackelähnliche Leibesbeschaffenheit, diese kurzen, krummen Beine — und was ich nun da zu hören bekam... ein schrecklicher Verdacht stieg in mir auf, ja, er war mir schon zur Gewissheit geworden.
»Hier wollen wir mal nein!«, brüllte ich meinem Kameraden ins Ohr.
Gut, wir bezahlten unseren Obolus und traten ein, nahmen gleich auf der vordersten Bank Platz. Die kleine Bühne war durch ein Gitter abgesperrt.
Als sich der Zuschauerraum gefüllt hatte, trabte das Scheusal auf die Bühne, wie gesagt, ein menschlicher Dackel, sehr geschickt auf allen vieren laufend, mit Haaren beklebt, das Gesicht schwarz angemalt — aber das half alles nichts, ich erkannte ihn doch gleich wieder, und überhaupt, dieser Heißhunger, der selbst die eigenen Kinder nicht verschonte... das war natürlich niemand anders als mein alter Freund, der Drogist Herr Oskar Müller!
So hatte er also doch noch einen Impressario gefunden, und was für einen!
Mir ward ganz weh zugute!
Auch er hatte mich natürlich sofort erkannt, aber keine Spur von Scham war ihm anzumerken, obgleich er doch früher davon gesprochen hatte, dass so etwas gegen seine Ehre ginge — er blinzelte mir vertraulich zu, dabei das vorschriftsmäßige Grunzen und Knurren nicht vergessend.
Der Bändiger erschien auf der Bühne, das menschliche Tier, das gegen ihn angehen wollte, erhielt ein paar mehr knallende als treffende Peitschenhiebe, eine große Schüssel mit blutigen Fleischfetzen ward gebracht. Nach amerikanischer Manier ward dem Publikum umständlich gezeigt, dass eine Waage richtig funktionierte, dass das Fleisch noch etwas mehr als zwanzig Pfund wog, die Fleischstreifen wurden dem Ungeheuer zugeworfen, das sie mit dem Maule auffing und hinunterschlang — wie eben Oskar Müller schlingen konnte.
Er vertilgte wirklich die ganzen zwanzig Pfund Fleisch. Es mochte ja ein Trick dabei sein — immerhin, es war ungeheuerlich.
»Jetzt wird Mister Kronos zum Nachtisch einige Schlangen und Ratten verspeisen. Hat jemand von den geehrten Herrschaften zufällig eine Schlange bei sich?«
Das Publikum lachte.
»Oder vielleicht eine lebendige Ratte, möglichst trichinös?«
Das Publikum lachte noch mehr.
»Na, dann muss ich selbst für eine sorgen. Ich habe erst vorhin eine gefangen, sie ist leider schon tot — sehen Sie hier die Trichinen drauf herumlaufen?«
Er zeigte die tote Ratte, das Publikum ekelte sich, lachte aber noch immer über diese blutigen Witze.
»Fang, Kronos!«
Und Mister Kronos fing die tote Ratte mit den Zähnen, zerriss sie auch mit Hilfe der Hände, ich sah das blutige Fleisch zum Vorschein kommen...
Ich hatte genug, ich ging hinaus, um draußen auf meinen Kameraden zu warten.
Armer Mensch!
Das Menschenfressertheater verwandelte sich in einen Flohzirkus. Es konnte diese Vorstellung mit Mister Kronos nur einmal täglich geben, weil dessen Appetit doch nur täglich einmal ein solch ungeheuerer war, und da hätten auch keine Zwangsmittel geholfen, denn was Müllers Magen einmal hatte, das gab er unter keinen Umständen wieder heraus.
Als sich mein Kamerad wieder zu mir gesellte, hatte ich meinen Entschluss unterdessen geändert. Ich wollte Müllern doch gern einmal sprechen.
Ich sprach mit dem Budiker, ich wäre ein alter Freund von Mister Kronos, hätte seine Bekanntschaft schon in Afrika gemacht — der Kerl zögerte, ließ sich aber doch bewegen, seinem Sklaven davon Mitteilung zu machen, auch meinen Namen hatte ich genannt. Nach fünf Minuten wurde ich hinter die Kulissen geführt.
Müller saß angezogen vor einer großen Schüssel Pflaumen, die er samt den Steinen verschluckte.
Er freute sich außerordentlich, mich wiederzusehen.
»Sie wundern sich wohl?«
»Ja, etwas.«
»Ja, sehen Sie...«
Er schilderte mir, wie er in die Fänge dieses Budenbesitzers geraten war, suchte sich auch zu entschuldigen... eben der nagende Hunger.
»Und denken Sie nicht etwa, dass das eine wirkliche Ratte ist, die ich da verschlinge.«
»Nicht?«
»O nein, wie werde ich! Das ist ein Stück rohes Rindfleisch, das nur in ein Rattenfell eingenäht ist, und das Fell esse ich nicht etwa mit, das behalte ich im Mund und spucke es dann wieder aus.«
Na, dann ging es ja. Und lebendige Kinder fraß er nicht einmal scheinbar, niemand vom Publikum wollte eins zu diesem Experiment hergeben.
»Na, wie ist es denn nun eigentlich mit der Erbschaft unseres guten, seligen Frettwurst?«
Erst jetzt wurde Müller sehr verlegen. Er hatte die Erbschaft hier in San Francisco an einen Juden, der sich telegrafisch davon überzeugt hatte, dass alles in Richtigkeit sei, verkauft.
»Für wie viel?«
»Für tausend Dollar. Das war freilich nur der achte Teil von dem, was die Erbschaft wert war, aber sehen Sie, ich hatte so gar kein Geld mehr, und der Hunger...«
Nein, deshalb brauchte er sich bei mir nicht zu entschuldigen, und beim seligen Frettwurst wäre es auch nicht nötig gewesen.
»Was haben Sie denn mit den tausend Dollar gemacht?«
»Nun, die habe ich natürlich vergessen.«
»Vergessen? Sie meinen wohl verfressen!«
»Ja, wenn man bei einem Menschen diesen Ausdruck gebrauchen darf.«
Heilige Unschuld! Übrigens war es auch von mir eine ganz naive Frage gewesen, was er mit dem Gelde gemacht habe.
»Aber ich bleibe nicht mehr lange dabei, ich mache bald eine feine Partie.«
»Sie heiraten? Wen denn?«
»Eine Hungerkünstlerin.«
Ich musste doch aus vollem Halse lachen.
»Da verzehren Sie wohl das, was die zusammenhungert?«
»O nein, und Sie brauchen gar nicht darüber zu lachen, das ist eine sehr vornehme und reiche Dame. Jetzt ist sie auch gar nicht mehr Hungerkünstlerin, ganz im Gegenteil. Sie speist jetzt fast ebenso viel wie ich, holt das nach, was sie früher versäumt hat. Aber sie ist früher wirklich Hungerkünstlerin gewesen, ist von Stadt zu Stadt gereist und hat sich überall vier Wochen und noch länger einmauern lassen, oder ist in eine große Glasflasche gekrochen und hat sich zustöpseln lassen, und das nur in den allerfeinsten Lokalen, wo sogar Offiziere verkehrten. Und was meinen Sie, was die mit ihrer Hungerei verdient hat?«
»Nun? Das so etwas bezahlt wird, weiß ich schon.«
»Bis zu dreihundert Dollar den Tag. Und sie ist immer sparsam gewesen. Die hat sich ein ganzes Vermögen zusammengespart. Und dann hat sie auch noch einen reichen Schweinehändler geheiratet, da bei Cincinnati herum, wo die Schweinerei ja zu Hause ist. Ja, die heirate ich jetzt, und dann fangen wir zusammen eine eigene Schweinezüchterei an. Die Erfahrung hat sie, und ich habe — ich habe — habe...«
»Den Hunger. Na, bei einer Schweinezüchterei werden Sie sich ja immer satt essen können.«
»Das denke ich auch, und auch sonst gefällt sie mir ganz gut. Ach ja, das wird eine ganz glückliche Ehe, passen Sie nur mal auf. Denn sehen Sie, erstens liebt sie mich wirklich, und zweitens ekelt sie sich nicht vor mir.«
Da soll ein Mensch nun ernst dabei bleiben.
»Wann findet die Hochzeit denn statt?«
Müller nahm einen Pflaumenkern, der allein noch in der Schüssel lag, und verschluckte ihn unaufgeknackt.
»Ja, das ist eben noch der Haken. Sie ist nicht etwa eine Witwe.«
»Nicht? Ich denke! Sie ist also geschieden?«
»Auch nicht.«
»Na, was denn sonst?«
»Sie will sich erst scheiden lassen. Meinetwegen, ich hab's ihr angetan. Und Grund zur Scheidung ist auch vorhanden. Ihr Mann hat nämlich Schweißfüße...«
Ich wünschte meinem alten Kameraden alles Glück und verabschiedete mich schnell.
Wie ich später erfuhr, hat er die geschiedene Schweinezüchterin dann wirklich geheiratet und war nun aller Sorge enthoben, aß alle drei Tage ein ganzes Schwein auf... mit möglichst vielen Trichinen.
Ich war richtig als zweiter Steuermann angekommen, aber nicht auf jenem Schoner, dessen Rückkehr sich verspätete, sondern auf einem anderen Segelschiff, das schon lange Zeit im Hafen gelegen hatte.
Der Heuerbaas hatte sein Wort halten wollen.
Als ich mich dem Kapitän vorstellte, nahm der ›Stolz von Amerika‹ die letzte Fracht ein, Stückgut, ich hörte noch, wie die Beamten vom Seemannsamt ihn für tadellos seetüchtig erklärten.
Eine Stunde später stachen wir in See, das Ziel war zunächst Valparaiso. Der Baas hatte mich für meine erste Monatsheuer ganz reichlich mit Kleidern ausgestattet, ein Sextant, den sonst jeder Steuermann selbst besitzen muss, wurde mir aus der Instrumentenkammer zur Verfügung gestellt.
Mein Debüt als Schiffsoffizier sollte nur sehr kurz sein. Kaum hatte der wie neu aussehende Holzkasten die Reede hinter sich, als er ganz mächtig zu lecken anfing.
Der Kapitän aber meinte, das habe nichts zu sagen, das ausgetrocknete Holz müsse nur erst verquellen.
Es musste unausgesetzt gepumpt werden, und immer klarer ward uns, dass es ein uralter Kasten war, dem die frische, dickaufgetragene Farbe die einzige Dichtigkeit gab.
Dennoch wollte der Kapitän nichts von einer Umkehr wissen, bis schon am anderen Tage die Katastrophe kam. Am späten Nachmittage sackte der ›Stolz von Amerika‹ im freundlichsten Abendsonnenscheine und bei stillster See weg wie ein vollgesogener Schwamm.
Jedenfalls war das Ganze nichts weiter als ein kleiner oder sogar sehr großer Versicherungsschwindel, so echt amerikanisch.
Wir hatten gerade noch Zeit, in die Boote zu kommen, so fix ging alles. Der Kapitän war dabei äußerst vergnügt. Ich war in die kleinste Jolle gegangen, zusammen mit vier Matrosen.
Schlimm war unsere Lage ja durchaus nicht. Das herrlichste Wetter und überall noch Schiffe in Sicht, wir hatten die Auswahl.
Da aber, als die Sonne unterging, stieg plötzlich ein undurchdringlicher Nebel auf, dass man kaum die Hand vor den Augen sehen konnte. Sofort hatten sich die drei Boote verloren, und von der Toplaterne eines Dampfers, den ich keine zwei Knoten vor mir gehabt hatte, war keine Spur mehr zu sehen.
Nun, da mussten wir schon aufpassen, dass wir von keinem Dampfer übersegelt wurden. Natürlich tutete jetzt alles, aber mit unserem Ausweichen war es doch schlecht bestellt. Außerdem war in unserem Wasserfässchen kein Wasser und in unserer Bootslaterne kein Öl.
Wir pullten drauf los, hörten hin und wieder ein Nebelhorn oder eine Dampfpfeife, manchmal mehrere gleichzeitig, sahen aber kein Licht.
Da mit einem Male tauchte dicht vor mir ein rotes Backbordlicht auf, ohne dass ich längere Zeit den geringsten Ton gehört hätte, gleichzeitig lichtete sich etwas der Nebel, und ich erkannte wenigstens einen Schiffsrumpf.
Im nächsten Moment stieß unsere Jolle direkt dagegen.
»Hallo, hallo!!«, schrie ich, »Boot in Not!«
Keine Antwort.
Das war ja seltsam. Offenbar war es doch ein Segler, jetzt fühlte ich auch das Holz. Eine Todesstille herrschte, dass man meinen Ruf eine Meile weit hören musste.
Ich schrie nochmals, immer wieder — keine Antwort. Dafür fing es jetzt an Deck zu tuten an.
»Die müssen uns doch gehört haben!«, meinten die Matrosen.
»Die wollen uns nicht aufnehmen«, meinte ein einzelner, »Oho, so etwas gibt's nicht, denen will ich die internationalen Seegesetze schon beibringen.«
Man hätte ja an einen Schmuggler denken können, aber das schien doch ein ganz großer Segler zu sein, und bei einem bösen Gewissen hätte er doch keine Lichter geführt.
So sprang ich darauf, ergriff ein Ruder und donnerte mit entsprechenden Worten gegen die Holzplanken.
Noch immer wollte sich nichts regen. Das wurde allerdings merkwürdig. War denn das Schiff ausgestorben? Aber wir befanden uns ja kaum zwei Tage von San Francisco entfernt, in der belebtesten Gegend, jedes andere Schiff hätte doch sofort bemerkt, wenn hier keine Hand mehr an Deck war, das lässt sich doch gerade bei einem Segler gleich erkennen, das steuerlose Schiff würde beim leisesten Windhauche stark hin und her schwanken. Außerdem war ja auch darauf getutet worden, und Tote tuten nicht mehr.
»Fahren wir um das ganze Schiff herum!«
Ich hatte es möglichst leise gesagt.
Wir fuhren herum, ich ließ nur die eine Seite rudern, mit der Hand das Boot absetzend. sodass ich mit der Hand immer am Schiffsrumpf entlang glitt. Und wirklich, als ich das grüne Steuerbordlicht wie ein Fünkchen in dem Nebel schimmern sah, berührte meine Hand ein herabhängendes Tau, und gerade, als ich es fasste, wurde es langsam in die Höhe gezogen!
Schnell packte ich fester zu, das Ziehen hielt einmal ein, dann ward ich, ohne klettern zu müssen, in die Höhe gezogen, und im nächsten Augenblick schwang ich mich über die Bordwand,
Ich sah einige schattengleiche Gestalten, welche bei meinem Anblick sofort und offenbar erschrocken verschwanden, nur eine blieb stehen. Näheres war von ihr in dem Nebel absolut nicht zu erkennen, obgleich ich nur einen Schritt von ihr entfernt stand.
»Hallo! Who are you?«, klang es erstaunt mir entgegen.
Ich stutzte! Kannte ich diese Stimme nicht?
Hatte ich die nicht schon einmal in meinem Leben gehört, war sie mir nicht vertraut geworden? Doch ich grübelte jetzt nicht weiter darüber nach.
»Das Erstaunen dürfte wohl ganz auf meiner Seite sein«, versetzte ich. »Habt Ihr mich denn nicht immer rufen hören?«
»Rufen?«
»Und dass ich gegen die Schiffsplanken donnerte, dass ein Toter hätte erwachen müssen?«
»Wir haben nichts gehört.«
»Na, nun macht mir doch nichts vor...«
»Hört, Mann, Ihr steht vor dem Kapitän!«, wurde ich unterbrochen, nicht drohend, sondern in ganz gelassenem Tone — und doch lag noch viel mehr darin als nur ein Drohen. »Wer seid Ihr? Wie kommt Ihr denn hierher?
»Wir sind fünf Mann, haben unser Schiff vor einer Stunde verloren.«
»Verloren? Wie?«
»Es leckte stark, sog sich voll wie ein Schwamm und sank.«
»Hört, Mann, das klingt kaum glaublich.«
»Na, zum Teufel noch einmal...«
»Lasst das Fluchen!!«
Oho, hier ging es ja recht heilig zu. Aber solcher ›heiligen Schiffe‹ gibt es viele, wir hatten zufällig eins erwischt.
»Na, Ihr könnt doch leicht genug erfahren, dass dem wirklich so ist, wie ich sagte.«
»Was?«
Ich nannte ihm die Namen und weitere Einzelheiten.
»Ihr seid nur fünf Mann?«
»Jawohl.«
Unterdessen hatten sich auch die anderen vier an Deck eingefunden.
»Nur Matrosen?«
»Nein, ich selbst bin oder war der zweite Steuermann.«
»So. Der Kapitän befand sich also in einem anderen Boote.«
»Wie ich sage. Wir haben uns im Nebel sofort verloren.«
»Kommt mit!«
Wir folgten, ich als erster, der Gestalt, von der noch immer kaum die Umrisse zu unterscheiden waren. Ich hatte vor mir in dem grauen Nebel immer nur einen dunkleren Fleck.
»Was für ein Schiff ist das?«, fragte ich einmal unterwegs.
Ich erhielt keine Antwort.
»So, kommt hier herein!«
Er stieß eine Tür auf. Heller Lichtschein flutete mir entgegen, und wenn auch hier schon Nebel eingedrungen war, so ließ sich doch noch alles deutlich kennen.
Ach, wie ward mir, als ich das Innere der Kajüte überblickte!
»Die Funzel!«
»Kapitän Novacasa!«, erklang es da auch schon neben mir.
»Pater Cyriax!!«, sagte ich.
Mein Staunen ob dieser Wiederbegegnung lässt sich denken. Mein ehemaliger Reederagent aber war noch immer derselbe, äußerlich wie innerlich. In dem asketischen Totenschädel rührte sich noch keine Muskel.
»Was Teufel... Pardon — warum wolltet ihr uns nicht aufnehmen?«
»Wir haben kein Rufen und kein Klopfen gehört«, lautete die Antwort.
Ich merkte gleich, dass ich hier als gänzlich Fremder behandelt werden sollte.
Dass Schiffbrüchige im offenen Boot zurückgewiesen wurden, das sah nun ja gerade solch einem christlichen Mönchsschiffe ähnlich, das doch jedenfalls wieder seine Heimlichkeiten hatte.
»Ihr werdet einstweilen versorgt und bei der ersten Gelegenheit an Land oder an Bord eines anderen Schiffes gebracht.«
Jetzt aber stieg mir doch etwas zu Kopf.
»Sind Sie inzwischen hier Kapitän geworden, Herr Cyriacos?«
»Nein, ich bin noch immer nur der Reederkapitän.«
»Einfach der Stellvertreter der Reederei, wollen wir lieber sagen.«
»Meinetwegen. Und?«
»Wer ist Kapitän dieses Schiffes?«
»Pater Dionysios.«
Ein Mann solchen Namens war nicht unter meiner Besatzung gewesen, ich wusste auch nicht, unter welchem Kapitän das Mönchsschiff damals Sydney verlassen hatte.
»Wo ist der Herr Kapitän?«
»Er schläft.«
»Bei diesem Nebel?«
»Was geht das Sie an?«
Oho!
»Hören Sie, mein Freund, Sie wissen doch, dass ich Kapitän bin.«
»Ich denke, Sie sind als zweiter Steuermann gefahren.«
»Das ist ganz gleich, und wenn ich auch zuletzt als Matrose gefahren wäre oder immer als Matrose — ich habe die Berechtigung zum Kapitän und bin es kraft meines Patentes wirklich. Das wissen Sie doch am allerbesten.«
Die erst stechend gewordenen Augen in dem Mumiengesicht wurden wieder eisigkalt.
»Nun, und?«
»Ich will als Kapitän behandelt werden.«
»Champagner haben wir leider nicht an Bord.«
»Lassen Sie Ihren Spott!«
»Ich spotte gar nicht. Was wünschen Sie eigentlich?«
»Ich möchte den Kapitän dieses Schiffes sprechen.«
»Er schläft.
»So wecken Sie ihn!«
»Ich darf nicht.«
»Warum nicht?«
»Der Kapitän hat Order gegeben, ihn nicht vor morgen früh zu wecken.«
»Bei diesem Nebel?«
»Als er sich hinlegte war noch kein Nebel, und er war durch zwei Nachtwachen übermüdet.«
»Wecken Sie ihn!«
»Nein!«
Ich wusste ja am allerbesten, wo sich die Kapitänskabine befand, sie ging von der Kajüte ab, ich schritt nach der Tür.
Schnell vertrat mir der Alte den Weg.
»Herr, was maßen Sie sich an?«
»Ich weiß, was ich tun darf. Ich will den Kapitän sprechen.«
»Er ist krank.«
»Ah so, nun ist er auf einmal krank!«
»Sehr krank!«
»Was hat er?«
»Influenza, als eine Folge der vielen Schlaflosigkeit.«
»Trotzdem möchte ich ihn sehen. Führen Sie mich zu ihm!«
»Ich kann es nicht erlauben.«
»Mit welchem Rechte?«
»Ich selbst bin Arzt.«
»Das ist mir ganz neu.«
»Wollen Sie mein ärztliches Doktordiplom sehen?«
»Wo haben Sie sich denn das erworben?«
»In Russland — auf der Petersburger Universität.«
Das musste ich und konnte ich wohl glauben.
»So ist der Kapitän gar nicht mehr fähig, das Schiff zu führen?«
»Nein.«
»Wer ist dann sein Stellvertreter.«
»Natürlich der erste Steuermann.«
»Rufen Sie ihn!«
Cyriax zog an einer Klingelschnur, und der Gerufene kam so schnell, dass er wohl schon an der Tür gestanden haben musste.
Ich hatte den Pater Perpetuus erwartet, der damals mein Erster gewesen war, auch schon ein Greis, statt dessen kam ein kaum dem Knabenalter entwachsener Knabe herein, Frater Zephyros, und ich habe bereits damals gesagt, dass auch ich diesen lieber zum ersten Steuermann gehabt hätte. Trotz seiner siebzehn Jahre war er ein ganzer Mann — hatte aber trotzdem die Selbstbeherrschung dieser Mönche gelernt.
»Ah, Frater Zephyros! Ich hoffe, Sie entsinnen sich noch meiner?«
»Sehr wohl, Herr Kapitän Novacasa«, erklang es zurück, und ich merkte gleich, dass dieser Jüngling in der Selbstbeherrschung noch große Fortschritte gemacht hatte. Auch sein Gesicht war merkwürdig steinern geworden, würde nächstens noch völlig starr werden.
»Wo ist denn Pater Perpetuus, der zu meiner Zeit erster Steuermann war?«
»Er ist vor zwei Monaten gestorben.«
»Ach! An Land?«
»Eine herabstürzende Rahe erschlug ihn.«
»Tut mir sehr leid. Und Frater Rufos, der damals mein Zweiter war?«
»Ist immer noch zweiter Steuermann.«
»Dann gratuliere ich Ihnen, dass Sie die Stelle des ersten Offiziers bekommen haben.«
»Danke sehr.«
»Also Sie müssen jetzt auch den Kapitän vertreten?«
»So ist es. Der Kapitän ist seit zwei Tagen sehr krank.«
»Haben Sie unterdessen Ihr Kapitänsexamen gemacht?«
»Nein. Trotzdem bin ich berechtigt... «
»Ich weiß. Sie wissen aber doch auch, dass ich, der ich das Kapitänspatent besitze, nach internationalen Seegesetzen nun als Kapitän die Führung dieses Schiffes zu übernehmen habe.«
So ist es. Ich habe dem kaum noch eine Erklärung hinzuzufügen. Wenn ein Kapitän zufällig an Bord eines Schiffes kommt, dem der führende Kapitän fehlt, so ist er berechtigt und verpflichtet, dessen Stelle mit aller Verantwortung zu übernehmen. Es gibt einige Ausnahmen betreffs der Nationalität. So wird der türkische Kapitän nicht als voll anerkannt, von einem chinesischen gar nicht zu sprechen, hingegen ist neuerdings der japanische Kapitän mit allen europäischen Kameraden gleichgestellt worden.
Das ist das Merkwürdige, was dem europäischen Scharfblick und überhaupt unserem Gebaren nicht eben zur Ehre gereicht! Noch vor zehn Jahren, damals, als die vereinigten europäischen Truppen, wenigstens durch viele Nationen vertreten, auch Amerikaner waren dabei, auf Peking vorrückten, um die belagerten Gesandtschaften zu befreien und die Meuterer zu bestrafen, wurde zum Beispiel in deutschen Zeitungen mit Hohnlachen die Meldung aufgenommen, ein japanischer General sollte den Oberbefehl über diese vereinigten Truppen erhalten.
Was? So ein schlitzäugiger Mongole, so ein halber Wilder, sollte deutsche, französische, englische und amerikanische Truppen kommandieren, unsere Offiziere sollten sich ihm fügen?!
Macht euch doch nicht lächerlich!
Und heute? Heute machen wir uns lächerlich mit unseren japanischen Gemäldeausstellungen, japanischen Theaterstücken, japanischen Ringkämpfern, japanischen Schlafröcken und japanischen Damenärmeln — alles Japan, Japan, Japan! Affen sind wir!!
Übrigens sei hierbei gleich bemerkt oder ins Gedächtnis zurückgerufen, wie damals auf dem Marsche nach Peking die an der Spitze marschierenden Japaner immer auf die nachkommenden deutschen Truppen warten mussten, sonst hätten die Japaner Peking einen Tag früher erreicht, den Deutschen folgten die Franzosen, und wäre es nach den Amerikanern gegangen, so wäre Peking überhaupt nie erreicht worden, die blieben gleich ganz liegen. Zuletzt allerdings wurde alles von der englischindischen Kavallerie überholt.
Und wo ist denn nun die ›Aufteilung Chinas‹ geblieben, des Kolosses auf tönernen Füßen, wovon die Zeitungen damals mit solcher Wollust phantasierten, schon warnend, dass Deutschland dabei nicht etwa zu kurz käme? Was ist denn nun daraus geworden?
Ha, wenn diese Zeitungsschreiberlein wüssten, was China zu bedeuten hat! — — —
Was in den beiden Pfaffen vor sich ging, sah ich, mit so großer Energie sie es auch zu verbergen suchten.
»Sie werden von diesem Rechte Gebrauch machen?«
»Selbstverständlich. Ich bin sogar direkt verpflichtet dazu, das könnte mich sonst mein Patent kosten. Na«, fuhr ich gemütlich fort, »wir kennen uns doch schon, sind doch gute Freunde gewesen — nun bringt mir mal das Logbuch her.«
Mit einem fast hörbaren Ruck richtete sich der alte Asket auf.
»Pater Dionysios ist tot!«
»Der Kapitän ist tot?«
»Ja. Heute vor sechs Tagen ist er an der Influenza gestorben.«
Ich fragte nicht, weshalb da vorher die Lüge, jetzt wurde ich erst recht sachlich, forderte das Logbuch — man brachte es mir.
Richtig, der erste Steuermann, hier der junge Fant, zeichnete seit sechs Tagen als stellvertretender Kapitän, und an jenem Tage hatte man den Kapitän als Leiche ins Meer versenkt, etwa 180 Meilen nordwestlich von hier.
Die vorhergehende Eintragung lautete: Kapitän Dionysios hat plötzlich heftiges Fieber bekommen. Influenza.
Nach vier Stunden war er gestorben, eine halbe Stunde später im Meere versenkt worden.
Fünf Minuten darauf hatte das Schiff Grüße mit einem englischen Dampfer gewechselt.
Dies alles muss bis zur Minute eingetragen werden. Das Logbuch ist das Heiligtum des Schiffes. Begeht er eine Fälschung, so verliert der Kapitän sein Patent für immer, wird außerdem wegen Urkundenfälschung mit Zuchthaus bestraft. Aber eine Fälschung ist kaum möglich. Das Logbuch hat besonderes Papier, eine besondere, unauslöschliche Tinte ist vorgeschrieben, die Zeilen müssen ganz voll geschrieben sein, kein Ausstreichen oder Darüberschreiben ist erlaubt, sondern nur Nachträge.
Der plötzliche Tod des Kapitäns kam mir recht seltsam vor, aber das war jetzt nicht meine Sache.
»Warum sagten Sie denn erst, der Kapitän sei nur krank?«, fragte ich nur noch.
»Herr Kapitän«, nahm der Alte sofort die Schuld auf sich, »ich wusste im Augenblick nicht, welche Rechte Sie haben, und es ist doch immer unangenehm, ein Schiff ohne Kapitän — ich glaubte...«
»Schon gut, schon gut«, unterbrach ich diese Entschuldigungen mit leisem Spott, »und für eine Lüge kann sich der ehrwürdige Pater ja sofort selbst dispensieren. Wo kommt das Schiff her, wo geht es hin?«
Von Monticello, am Columbia gelegen, der die Grenze zwischen Kalifornien und dem Staate Washington bildet — mit der Hauptstadt von Nordamerika, die nämlich nicht New York, sondern Washington ist, hat dieser Staat aber nichts zu tun — und jetzt sollte das Mönchsschiff zurück nach seiner Heimat.
»Was hat es in Monticello geladen?«
»Salzfleisch.«
»Wie viel?«
»Fünfhundert Tonnen.«
»Was sonst noch?«
»Nichts weiter.«
»Geben Sie mir die Schiffspapiere — geben Sie mir die sämtlichen Schlüssel.«
Wieder war es ein fast hörbarer Ruck, mit dem sich der Alte aufrichtete.
»Kapitän, hierzu haben Sie doch wohl kein...«
»Sie haben recht«, unterbrach ich ihn sofort, »ich bitte um Entschuldigung.«
Nein, die Schiffspapiere zu fordern, dazu hatte ich wirklich gar kein Recht. Ich hatte die nautische Führung des Schiffes zu übernehmen, alles andere ging mich gar nichts an. Sonst hätte ich mich ja geradezu als Justizbeamter aufgespielt.
Meine Voreiligkeit verdross mich etwas, ich schämte mich sogar.
»Aber Sie können die Schiffspapiere sehen, ich hole sie...«
»Nein, nein, ich werde keinen einzigen Blick hineintun«, rief ich, wiederum etwas zu voreilig.
»Bei uns ist alles in tadelloser Ordnung.«
»Das glaube ich schon.«
»Nein, das glauben Sie eben nicht!«
»Woraus schließen Sie das?«
»Sie hätten einen Grund dazu.«
»Welchen?«
»Nun, weil ich eben erst sagte, der Kapitän schliefe, dann, er sei krank, bis ich endlich gestand, dass er schon seit sechs Tagen tot sei. Aber es war mir höchst unangenehm...«
»Bitte, das ist ja schon alles erledigt.«
»Und es ist doch die stolzeste Freude für Frater Zephyros, trotz seiner Jugend schon als stellvertretender Kapitän das Schiff führen zu können...«
»Ich verstehe, ich verstehe, und es tut mir jetzt fast leid, dass mich der Zufall gerade auf dieses Schiff geführt hat. Aber das ist nun nicht mehr zu ändern, jetzt ist es meine unbedingte Pflicht, dieses Schiff unter meinem Kommando wenigstens bis zum nächsten Hafen zu führen. Welcher soll das sein? Hierüber haben Sie zu bestimmen.«
»Wir wollten eigentlich direkt nach Athos zurück, ohne noch einmal einen Hafen anzulaufen — so Gott will.«
»Das ist jetzt natürlich anders geworden. Welcher ist der nächste Hafen? Es fragt sich nur, ob in einem kleinen Hafennest auch ein Kapitän zu haben ist. Das beste ist wohl, wir kehren nach San Francisco zurück, der Wind dürfte dazu auch günstig werden.«
»Herr Kapitän«, ergriff da Zephyros das Wort, »gestatten Sie eine Frage: Könnten Sie nicht hier an Bord bleiben? Oder haben Sie etwas anderes vor?«
»Frei wäre ich wohl, aber gerade Ihnen möchte ich nicht...«
»Bitte, Herr Kapitän, gerade unter Ihrem Kommando möchte ich noch eine längere Reise machen, besonders um das gefährliche Kap Hoorn herum, und ich gestehe, dass mir vor dieser Fahrt etwas bangt.«
Ich hätte dem Jüngling, dem Knaben, die Hand drücken mögen. Er war der einzige von der ganzen Kuttengesellschaft, den ich damals in mein Herz geschlossen hatte. Allerdings hatte er sich unterdessen sehr verändert, auch sein Gesicht war, wie schon gesagt, jetzt verknöchert — immerhin, es waren offene Worte gewesen, ich hatte es auch in seinen Augen freudig aufleuchten sehen.
»Wenn Sie es wünschen, dann ist das etwas Anderes.«
»Ich bitte Sie sehr darum.«
»Gut, dann führe ich das Schiff bis nach seinem Heimathafen.«
»Abgemacht! Tragen wir das gleich ins Logbuch ein.«
»Halt! Und die vier Matrosen, die ich mitgebracht habe?«
Ich hatte ja wenig Zeit gehabt, die Mannschaft des gesunkenen Schiffes kennen zu lernen. Es war eine zusammengewürfelte Gesellschaft gewesen. Nicht einmal die Namen dieser vier kannte ich. Offenbar war der eine ein Skandinavier, die beiden anderen waren Engländer oder Amerikaner, der vierte war wohl ein Spanier — was sich dann auch bestätigte.
Und in diesem Augenblick, da es sich darum handelte, ob ich die vier bei der ersten Gelegenheit abschieben solle oder nicht, kam mir zum Bewusstsein, dass hier doch nicht alles in Ordnung sein könne. Abgesehen von dem Tode des Kapitäns — besonders, dass die mein Rufen und Klopfen nicht gehört haben wollten, wie sie noch versucht hatten, das herabhängende Tau hochzuziehen, dass sie also im offenen Boote Befindliche nicht hatten aufnehmen wollen — nein, hier war etwas nicht ganz koscher, und es konnte unter Umständen sehr gefährlich für mich werden, hier allein zu bleiben; meine vier Leute machten dagegen einen recht zuverlässigen Eindruck, besonders der baumlange Skandinavier...
Noch ehe ich mir richtig überlegt hatte, wie ich hier meinen Wunsch auf anständige Weise durchsetzen könne, kam mir schon Frater Zephyros entgegen, sich zuerst an den Pater wendend.
»Die vier fremden Matrosen können doch bei uns bleiben?«
»Gewiss, das wollte ich auch schon sagen«, entgegnete der Pater.
»Wenn sie bleiben wollen?«
Hiermit hätte eigentlich jedes Bedenken meinerseits schwinden müssen.
»Wollt ihr an Bord dieses Klosterschiffes bleiben?«, wandte ich mich an die vier Gesellen, die sich mit in der Kajüte befanden.
Alle vier waren sofort damit einverstanden. Die Unterredung war englisch geführt worden, sie hatten auch schon das Ziel und alles andere gehört. Das Fremdartige, auf solch einem Mönchsschiffe einmal zu arbeiten, mochte auch für den Stumpfsinnigsten großen Reiz haben.
Nur der eine fragte wegen der Heuer.
»Englische Heuer.«
Da waren sie erst recht einverstanden.
»Nun bloß noch eins«, begann Pater Cyriax wieder, »es ist wegen der Unterbringung dieser Leute. Sie kennen doch schon unsere Verhältnisse, Herr Kapitän, unser ganzes Bordleben, wir sind eben Mönche, griechischkatholische...«
»Diese vier sollen nicht in dem allgemeinen Matrosenlogis schlafen, wenn das hier so genannt werden darf?«
»Wenn ich darum bitten dürfte.«
»Selbstverständlich! Auch an den Mahlzeiten werden sie nicht teilnehmen. Ich weiß ja, wie es hier zugeht. Wegen ihrer Aufführung werde ich dann noch ein Wörtchen mit ihnen reden — oder es wird gar nicht nötig sein. Wo sonst sollen die vier da untergebracht werden?«
»Vielleicht gleich hier in der Kabine des verstorbenen ersten Steuermanns?«
Dessen Kabine ging ebenfalls von der Kajüte ab.
»Wenn es Sie nicht geniert, dass die vier immer durch die Kajüte gehen?«
»O, Sie wissen doch, dass Ihnen die Kajüte ganz allein zur Verfügung steht. Wenn Sie damit einverstanden sind?«
Ja, schon damals hatte der Reederkapitän, der doch das Recht dazu besaß, sich niemals in der Kajüte aufgehalten. Diese ganze Kuttengesellschaft stecke ja überhaupt immer zusammen, die Steuerleute aßen mit den Matrosen, vorher Gebete und Gesänge usw.
Und nichts konnte mir erwünschter sein, als dass ich diese vier behosten Matrosen, wenn man sich so ausdrücken darf, auch während ihrer Freizeit immer in meiner dichtesten Nähe hatte.
So war der Kontrakt geschlossen, Steuermann Zephyros machte ins Logbuch seine letzte Eintragung, wonach er mir das Kommando übergab, ich trug meine diesbezügliche Bemerkung ein.
Weiter erfuhr ich gleich noch, dass alle meine von mir damals ausgebildeten zweiundzwanzig Matrosen noch vorhanden waren — eigentlich waren es ja sechsundzwanzig gewesen, aber drei von ihnen waren doch Steuerleute geworden, der vierte der Reederagent — keiner war hinzugekommen.
Über die bisherige Fahrt des ›Lichtes vom Athos‹ konnte ich mir später erzählen lassen, das ging mich eigentlich überhaupt nichts an.
Ich trat einmal auf die Kommandobrücke, sah nach dem Rechten, alles war in tadellosem Zustande, ließ einmal alle Mann antreten, auch die Freiwache, grüßte sie als alte Bekannte, hielt sonst noch einen kleinen Speech, befahl, dass das Nebelhorn mehr gehandhabt würde, und begab mich in die Kajüte zurück.
Die vier Matrosen waren dabei, sich in der geräumigen Kabine des ersten Steuermanns einzurichten, wobei sie die Tür offen gelassen hatten. Zwei Kojen waren schon vorhanden, zwei andere ließen sich mit leichter Mühe anbringen, ihre Kleiderbündel hatten sie mitgebracht. Im Gegensatz zu den deutschen Matrosen halten die unter englischer Flagge fahrenden sehr wenig auf Zeug, auf Kleider und Wäsche, das mag auch praktischer sein.
Ich wollte die vier erst vornehmen, wusste ja noch nicht einmal, wie sie hießen. Da trat mir schon der Skandinavier entgegen, sicher ein Schwede. Wie gesagt, es war ein baumlanger, hünenhafter Kerl, überhaupt eine prächtige Erscheinung, wie eine Zeder gewachsen und mit Muskeln wie Kanonenkugeln, und das Gesicht, von etwas langen Flachshaaren umrahmt, von wahrhaft klassischer Schönheit, dabei eine hohe Intelligenz ausdrückend — was man nämlich bei solchen ›schönen‹ Gesichtern immer betonen möchte, wenn es der Fall ist. Sonst paart sich Schönheit nur zu oft mit Dummheit, zumal bei solchen männlichen Puppenköpfen.
Ich hatte mir schon vorher bei seinem Anblick manchmal gedacht, dass der noch junge Mann, aber doch schon dreißig, wohl einmal etwas Besseres gewesen sein müsse. Wahrscheinlich ein verlorener Sohn.
»Kapitän, ich möchte Euch sprechen«, sagte er mit leiser Stimme.
Er sprach ein tadelloses Englisch.
Aber zu einer Vertraulichkeit war ich nicht so schnell bereit. Gerade der Kapitän muss seine Unnahbarkeit bis ins Kleinste wahren, noch viel mehr als ein General gegen einen gewöhnlichen Soldaten, sonst ist er sofort verratzt. An Bord des Schiffes kommt nicht erst der kleine Finger in Betracht, dem die ganze Hand folgt, da muss man schon mit der Nagelspitze vorsichtig sein.
»Wozu?«
»Ich möchte Euch etwas unter vier Augen mitteilen.«
»Hm. Wie heißt du?«
»Swen Alvason.«
»Ein Schwede?«
»Ja.«
Ich öffnete die Kabine des Kapitäns. Sie war gar nicht verschlossen gewesen. Der erste Steuermann hatte sie als Stellvertreter nicht bezogen. Es sah alles ordentlich aus, aber etwas verstaubt. Der Staub stammte wohl von Monticello her.
»Kommt hier herein! Helft mir!«
Der Schwede trat ein, ich schloss die Tür.
»Nun?«
»Hier ist etwas nicht in Ordnung.«
»Weshalb nicht?«
»Erst sollte der Kapitän nur schlafen, dann nur krank sein, dann war er tot...«
»Hörtest du nicht, mit welchem Grunde sich der Reederagent entschuldigte?«
»Das wohl — aber auch, dass sie unser Rufen und Pochen nicht gehört haben wollen...«
»Nun, was meinst du?«
»Hier ist irgend etwas nicht in Ordnung.«
»Was könnte das sein?«
»Das müssen wir eben herauszubekommen suchen.«
»Wenn diese Mönche ein Geheimnis hätten, würden sie da auch euch vier Matrosen an Bord behalten haben, obwohl ich ihnen die Wahl stellte?«
»Kapitän, erlaubt mir erst eine offene Frage.«
»Ich erlaube die.«
»Ihr seid doch selbst stutzig geworden.«
»Allerdings«, gab ich zu.
»Und nun kann ich Euch noch etwas Anderes mitteilen, ich habe noch etwas Anderes beobachtet, was Euch entgangen sein dürfte.«
»Und das wäre?«, fragte ich, jetzt wirklich gespannt werdend.
»Die beiden standen doch immer ganz dicht nebeneinander.«
»Ja, das taten sie. Und?«
»Hatten die Hände in ihren langen Kuttenärmeln verborgen, gerade wie die Chinesen, und als sie sich nun entscheiden sollten, ob wir vier Matrosen hier bleiben sollten, da merkte ich, der ich seitwärts stand, wie die Hand des Alten aus dem Ärmel hervorschlüpfte, und wie er mit der Fingerspitze immer hinten in die Seite des Jungen tickte und strich, das war ganz offenbar eine geheime Sprache, so eine Art Telegrafieren, es kann ja auch ganz richtiges Morsen gewesen sein, und daraufhin war es der Junge, der sich gleich — Ihr wisst — mit der Frage an den Alten wendete: Die vier Matrosen können doch bei uns bleiben? Worauf der Alte bejahte. Das Ganze ging aber erst von diesem aus. Und dann haben sich die beiden immer so weiter durch geheime Zeichen verständigt, besonders erhielt der Junge immer seine Instruktionen, ehe er eine Frage stellte oder eine Antwort gab, und das haben die beiden also doch jedenfalls von allem Anfange so gemacht.«
Ja, es war wichtig genug für mich, was ich da erfuhr. Diese Heimlichkeit ließ wiederum auf vieles schließen, nur auf nichts Gutes.
»Und was meinst du?«, fragte ich zunächst.
»Wenn ich ganz offen sein darf?«
»Sprich leise!«
»Ich glaube fast, die wollen uns alle fünf abmurksen.«
Ich prallte fast zurück.
»Woraus — willst du — das — schließen?«, flüsterte ich.
»Ich habe so ein Gefühl, obgleich ich sonst durchaus nicht abergläubisch bin. Und überlegt Euch nur, was wir schon alles beobachtet haben! Gerade, weil sie uns vier Matrosen jetzt nicht gehen lassen wollen. Erst wollten sie uns nicht aufnehmen, zogen das letzte Tau ein — weil Ihr es aber noch erwischtet, war es zu spät, nun müssen wir auch alle an Bord bleiben und... ich glaube, Ihr versteht mehr, als ich ausdrücken kann.«
Er hatte recht — ich selbst konnte meinen immer größer werdenden Argwohn gar nicht definieren, ich hätte diese Mönche eigentlich niemals eines Mordes für fähig gehalten... und doch... der Mann hatte recht.
»Wenn da irgend etwas mit der Religion im Spiele ist, dann... halte ich diese Mönche zu allem fähig«, sagte der Schwede auch noch.
»Ich weiß, ich weiß. Nun gut. Instruiere deine Kameraden, soweit du es für gut findest...«
»Ja, und dass wir so zusammen bleiben sollen, das, glaube ich, hat auch seinen bestimmten Grund.«
»Und der wäre?«
»Die wollen uns belauschen, wie wir über die ganze Sache denken, was wir deshalb ausmachen.«
»Möglich«, erklärte ich nach kurzem Besinnen. »So weihe also deine Kameraden ein, mit möglichster Vorsicht, wir wollen auf der Hut sein — im übrigen müssen wir erst sehen, wie sich die Sache weiter entwickelt.«
Der Nebel wurde noch in der Nacht von einem frischen Nordwinde vertrieben, wir setzten Segel, das ›Licht vom heiligen Berge‹ nahm nach längerer Windstille seine Fahrt nach Süden wieder auf.
Einige Tage ereignete sich nichts Bemerkenswertes. Die Kuttenmatrosen waren noch so tüchtig, wie sie schon früher gewesen waren. Sie vertrugen sich mit meinen vier Leuten, die sich auch ganz anständig aufführten. Der Reederkapitän hatte schon früher niemals die Kajüte betreten. Der Leser entsinnt sich, dass er mich auch in Sydney erst gefragt hatte, ob er jenen fremden Herrn in seiner Kajüte empfangen dürfe.
Meister Cyriax kampierte zwar in einer Kabine, die sich ebenfalls im Hinterteil des Schiffes befand, neben der Kajüte, aber sie hatte ihren besonderen Eingang von Deck aus. Ich musste zu ihm gehen oder ihn zu mir bitten lassen, wenn ich ihn einmal sprechen wollte, denn sonst ließ er sich fast gar nicht sehen.
»Wer ist denn jetzt der Patriarch von Athos?«, fragte ich ihn bei solch einer Gelegenheit.
»Nun, immer noch Patriarch Johannes.«
»Was? So ist er damals also nicht gestorben?!«, rief ich überrascht.
»Nein, er hat sich wieder erholt, obgleich die Ärzte ihn schon aufgegeben hatten.«
»Was hat ihm denn gefehlt?«
»Es wurde mir sehr Spärliches darüber berichtet. Er soll einen Blutsturz gehabt haben, ist wohl auch jetzt noch sehr siech, aber ein Patriarchenwechsel ist jedenfalls nicht eingetreten.«
Es frappierte mich doch sehr, ihn noch am Leben zu wissen, sogar etwas wie Wehmut überkam mich. Ob er denn da als Johanna gar nicht mehr an mich...
Doch ich schlug mir jetzt solche Hirngespinste energisch aus dein Kopfe.
Wieder hatten wir eine Nacht mit dickem Nebel. Ich hielt die Mönche an, ebenso fleißig mit den Nebelhörnern zu tuten wie auf Gottes unerforschlichen Ratschluss zu bauen.
Es war in der dritten Stunde, der Morgen hätte schon dämmern können, wovon jetzt freilich nichts zu merken war, als ich in dichter Nähe eine Sirene heulen hörte, und da tauchte auch schon vor uns wie ein Glühwürmchen die Toplaterne eines Dampfers auf, oder vielleicht war es sogar der Lichtstrahl eines elektrischen Scheinwerfers, der aber diesen Nebel ebenfalls gar nicht durchdringen konnte. Ich sah die Katastrophe schon kommen, brüllte, dass meine Stimme unsere Hörnersignale und das Klatschen mit Brettern noch übertönte, und der Dampfer änderte denn auch im letzten Moment etwas seinen Kurs, strich aber noch so dicht an uns vorüber, dass ich jedes der erleuchteten Bullaugen zählen konnte, und dabei so schnell, dass er seine volle Fahrt wohl kaum etwas gemäßigt haben konnte. Wäre nicht eine so spiegelglatte See gewesen, so wären wir immer noch zusammengerammt.
Ich schickte dem Unhold, der, um seine fahrplanmäßige Zeit einzuhalten, bereit war, über Leichen zu gehen, meine besten Flüche nach. Zu erkennen war er natürlich nicht gewesen. Jedenfalls aber war es ein Passagierdampfer gewesen, denn gerade die riskieren doch immer das Tollste, eben wegen des Fahrplans.
Jetzt heulte die Dampfsirene ununterbrochen, was vor unserer Begegnung nicht der Fall gewesen war. Wohl zehn Minuten hörte ich sie noch — da mit einem Male auch gellende Pfiffe dazwischen, dann ein dumpfer Krach, und still war alles.
»Da hat er doch noch einen gerammt!!«
Fast ein jeder hatte diese Worte gerufen.
Wir lauschten.
O, wie einem in solchen Augenblicken zumute ist! Kein einziger Ton weiter. Wir hätten auch gar nichts weiter als die Sirene oder die Dampfpfeife hören können. Wenn der Passagierdampfer nur zwölf Knoten in der Stunde gemacht hatte, so hatte er sich in den zehn Minuten schon zwei englische Meilen von uns entfernt, und so weit reicht keine menschliche Stimme.
Aber warum kein Heulen, kein Pfiff mehr?
Da musste man annehmen, dass beide Parteien augenblicklich Opfer der Katastrophe geworden waren.
»Lasst uns für die Unglücklichen beten«, sagte Cyriax zu den ihm am nächsten stehenden Matrosen, und bis auf die, welche die Nebelhörner zu bedienen hatten, verschwanden sie alle unter der Back, die zur Kapelle eingerichtet war.
Beten — es war auch wirklich das Einzige, was wir für sie tun konnten. Wir waren bei dieser Windstille ja selbst festgenagelt, hätten beim besten Willen nicht helfen können.
Die höhersteigende Sonne saugte den Nebel hoch, und da sahen wir im Norden einen Dampfer kommen, der jetzt Signale gab, weil er das vollbesetzte Boot gesichtet hatte, das dort trieb.
Und dann auf der glatten Meeresfläche noch ein zweites Boot, uns viel näher, kaum noch eine Seemeile entfernt, ein großer Kutter, ebenfalls zum Brechen voll mit Menschen besetzt.
Dieser Kutter hielt direkt auf uns zu, mit bloßen Augen konnte ich vorläufig nur lebhaftes Tücherwinken unterscheiden.
»Kapitän, es kommt ein Nordwind auf!«, wandte sich da der alte Cyriax hastig an mich.
Natürlich hatte ich das schon bemerkt. Aber das ging den Reederagenten gar nichts an, und es war auch das erste Mal, dass er mich auf so etwas aufmerksam machte.
»Nun, und?«
»Den müssen wir doch benutzen.«
Es wurde immer seltsamer. Aber ich wusste ja ganz genau, was der Alte wollte.
»Sie haben wohl wieder Angst, die Schiffbrüchigen aufnehmen zu müssen?«
»Das haben wir doch auch gar nicht nötig, dort ist ja ein Dampfer...«
»Ja, der geht aber schon nach Norden.«
So war es in der Tat. Der Dampfer, das einzige Schiff, welches zu erblicken war, hatte jenes ihm nahe gewesene Boot unterdessen aufgenommen, jetzt steuerte er nach Norden, also sich von uns entfernend, und ich erkannte alsbald den Grund, indem ich durch das Fernrohr weiter nach Norden noch ein drittes Boot bemerkte.
»Der geht dorthin, wohin unser Segelschiff nicht kann, und jenes erste Boot überlässt er natürlich uns«, sagte ich.
»Aber der Dampfer kann doch auch noch dieses Boot aufnehmen!«, stieß der Alte hervor.
Ich schob mein Fernrohr zusammen, dass es krachte.
»Herr, ist diese Religion, der Sie angehören, denn eigentlich eine christliche?!«
»Ganz gewiss«, lautete auch noch die naive Antwort, .ich verstehe nur nicht, weshalb gerade wir die Schiffbrüchigen...«
»Wenn Sie das nicht verstehen, dann ist Ihnen nicht zu helfen«, unterbrach ich ihn kurz. »Diese Schiffbrüchigen werden von uns aufgenommen, und damit basta!«
»Aber sie werden bei erster Gelegenheit wieder von Bord gebracht.«
»Wir werden ja sehen, ob sich eine Gelegenheit dazu findet.«
»Wir können sie doch nicht bis nach Athos mitnehmen!«, jammerte der Alte immer weiter, und mir wurde das wirklich bald unverständlich.
»Na, nun halten Sie endlich die Luft an«, sagte ich deshalb und brachte wieder das Fernrohr in Positur.
»Das sind sechs Matrosen und ein Steurer, und... jawohl, lauter Weiber.«
»Weiber!«, kreischte der Alte neben mir auf, dass ich einmal nach ihm blickte, und er machte ein Gesicht, als habe der Erzengel Gabriel das jüngste Gericht verkündet.
»Nanu, was haben Sie denn?«
»Weiber?!«, erklang es noch einmal so.
»Jawohl, in dem Kutter befinden sich wenigstens zwei Dutzend Weiber.«
Der Alte stürzte davon, kehrte mit einem Fernrohr zurück.
»Bei allen Heiligen — lauter Weiber... und Sie denken, dass die etwa hier an Bord kommen?«
Der Alte hatte seine asketische Ruhe vollkommen verloren, zuletzt hatte er mich geradezu angeschnaubt.
»Mann, was fällt Ihnen denn ein?! Wenn Sie mich wie ein wütender Eber anlaufen, dann gebe ich Ihnen auch den Sauspieß! Jawohl, diese schiffbrüchigen Frauen kommen zu uns an Bord!«
Mit einem Male hatte der Alte seine eiserne Ruhe wieder.
»Das wird nicht geschehen!«
»Das werden wir ja sehen.«
Und im Kommandotone setzte ich hinzu:
»Klar bei den Solldavits!!!
Davits heißen die Kräne, in denen die Boote hängen. Ein Paar sind gewöhnlich frei, um ein fremdes Boot hieven zu können — die Solldavits, richtiger vielleicht mit einem l geschrieben, weil es wahrscheinlich von solo kommt.
Ehe ich noch sehen konnte, ob mein Befehl ausgeführt würde, trat mir der Alte mit über der Brust verschränkten Armen in den Weg.
»Das werden Sie nicht tun!«
»Was werde ich nicht tun?«
»Diese Frauen an Bord nehmen.«
»Warum nicht?«, konnte ich noch ganz ruhig fragen.
Denn ich wusste, dass es im nächsten Augenblick zur Katastrophe kommen konnte, vielleicht mussten ganz Unschuldige diesen Widerstand des Alten mit dem Leben bezahlen, und eben deshalb zwang ich mich noch einmal nieder.
»Sie wissen, dass jedes Schiff den Boden des Landes bedeutet, dessen Flagge es führt.«
»Das weiß ich, und dieses Schiff führt die griechische Flagge — warum sollen denn keine Frauen den Boden von Griechenland betreten?«
»Eben das sagt mir, dass Sie recht gut wissen, worauf es hier ankommt, Die Flagge hat für uns gar nichts zu sagen. Dieses Schiff hier ist ein Stück von unserem heiligen Berge selbst, der durch keinen Frauenfuß entweiht werden darf...«
»Und wenn nun schiffbrüchige Frauen an den heiligen Berg geworfen werden?«
»Das ist etwas anders, dann ist das Gottes Wille, dann haben wir unsere Zeremonien, um den entheiligten Boden wieder zu weihen...«
»Mann, der Sie ein Diener Gottes sein wollen, ich möchte Sie fast warnen, den Namen des Herrn in den Mund zu nehmen!«, rief ich mit immer gesteigerterem Unwillen. »Und was mich anbetrifft, so möchte ich doch lieber Feueranbeter werden, ehe ich zu Ihrer sogenannten Religion überträte. Ist es denn etwa nicht Gottes Wille, dass wir uns dieser unglücklichen Frauen annehmen?«
»Nein, solange die Möglichkeit vorhanden ist, dass sie anderswo Aufnahme finden...«
»Papperlapapp!«, rief ich, nun endlich die Geduld verlierend. »Diese schiffbrüchigen Frauen kommen zu uns an Bord, und damit basta, selbst wenn ich nicht mit der Möglichkeit rechnete, dass sich Verwundete darunter befinden, die der ersten Hilfe bedürfen. Sie kommen an Bord, und damit basta!«
Da löste Pater Cyriax die Verschränkung seiner Arme, um seine skelettartige Gestalt noch höher aufzurichten, und die Augen in dem Totenschädel nahmen einen unheimlich stechenden Ausdruck an.
»Sie kommen nicht an Bord dieses Schiffes!!!«
Meine nächste Entgegnung war, dass ich meinen Revolver zum Vorschein brachte.
»Wollen Sie mich etwa daran hindern?!«
»Ja! Diese Frauen kommen nicht an Bord! Und ich fürchte Ihre Waffe nicht!«
Ich wollte ihm zeigen, dass ich mich gar nicht um ihn kümmerte. Jetzt hatte ich es nur mit den bekutteten Matrosen zu tun, deren Verhalten musste für mich den Ausschlag geben.
»Klar bei den Solldavits!!«, kommandierte ich nochmals.
Die ganze Wache befand sich an Deck, die Freiwache gesellte sich noch hinzu, und die Mönche standen zusammen, ohne sich zu rühren, bald nach mir, bald nach ihrem kirchlichen Vorgesetzten blickend.
»Hört ihr nicht, ihr Hunde?! Klar bei den Solldavits!!«
Da kamen meine vier Matrosen herbeigeeilt, die in der Kajüte beim Frühstück gesessen hatten. Sie wussten sofort alles, hatten wohl auch schon alles gehört, und der Schwede zog sofort hinten aus der Hosentasche einen Revolver und baute sich neben mir auf, um mir wohl den Rucken freizuhalten, während die drei anderen nach den Solldavits sprangen, um mit gutem Beispiele voranzugehen.
Mit dem Verhalten des Schweden war ich einverstanden, nicht aber mit dem der anderen drei.
»Zurück da! Ihr seid von der Freiwache. Mein Kommando gilt allein den Mönchen. Und nun zum letzten Male: Klar bei den Solldavits, oder, bei Gottes Tod... «
Diese Worte rufend, war ich zum nächsten Kuttenträger hingesprungen und hielt ihm die Revolvermündung dicht gegen die Schläfe.
»Wehe, wer diesem Befehl nachkommt!!«, rief da auch noch Cyriax.
»Klar bei den Solldavits, eins...«
Ein griechisches Wort, das ich nicht verstand. In die Regungslosen kam Leben, Steuermann Zephyros war der erste, der nach den betreffenden Davits sprang, um die Taue klarzumachen, alle anderen folgten ihm nach, jeder bemühte sich, seine Hände noch anbringen zu können.
Da verwandelte sich der alte Cyriax plötzlich in einen Tobenden.
»Verflucht sollt ihr sein!«, heulte er auf, drohend beide geballten Hände schüttelnd. »Verflucht dieses ganze Schiff, zur Hölle soll es fahren...«
Er hatte wohl noch mehr auf dem Herzen, dach er verstummte plötzlich, wollte sich eilenden Fußes nach seiner Kabine begeben.
Mit einem Sprunge vertrat ich ihm den Weg, gleichzeitig meinen Matrosen winkend.
»Halt! Keinen Schritt weiter! Swen, Franz, Ned — hierher! Legt diesen Mann in Eisen!«
Das gelbe Mumiengesicht ward plötzlich aschgrau, und schon ward er gepackt.
»Was?! Was?! Weshalb das?!«
»Erstens, weil Ihr die Matrosen gegen mich, den Kapitän, aufzuwiegeln gesucht habt — das ist Anstiftung zur Meuterei! — und zweitens, weil ich Euch für fähig halte, das ganze Schiff in die Luft zu sprengen, ehe Ihr aus fanatischem Eifer duldet, dass es von einem Frauenfuß betreten wird. Ich weiß, was ich tue und was meine Pflicht ist. Fort mit ihm in die Arrestkammer, legt ihn in Eisen! Du, Swen, garantierst mir für ihn, bis ich selbst nach ihm sehe — stelle einen bewaffneten Posten vor die Tür!«
An den Armen gepackt, ward der Pater fortgeführt. Nur noch einen einzigen Blick hatte er mir zugeworfen, aber was für einen furchtbaren!
Ich kümmerte mich nicht mehr darum, wollte wieder zum Fernrohr greifen, hatte es nicht mehr nötig. Das Boot war unterdessen ganz nahe herangekommen.
Es waren achtzehn Weiber, die ich in dem großen Kutter zählte, gerade anderthalbes Dutzend, und wie ward mir nun, als ich ihre Kostümierung erkannte!
Nur eine einzige hatte einen Mantel an, alle übrigen waren so ziemlich unbekleidet — doch nicht etwa, dass sie im Hemd aus der Koje ins Boot gestürzt waren — nein, angezogen waren sie schon, nur nicht so, dass sie sich auf der Straße hätten sehen lassen können, hingegen produzierten sie sich so auf der Bühne...
Ich will es kurz machen: Es waren Balletteusen in ihren Kostümen, die zum größten Teil nur aus Trikots bestanden, wozu nur noch ein ganz kurzes, flitterbesetztes Gazekleidchen kam. Ganz regelrechte Balletteusen, frisch von der Tanzbühne kommend, nicht einmal ihre Frisur hatte viel gelitten — dagegen in dem Nebel sehr die geschminkten und gepuderten Gesichter, alle Farben waren ineinandergelaufen, wozu auch noch die ganze Verzweiflung kam, sodass sie jetzt nicht gerade einen sehr reizvollen Eindruck machten, obgleich es lauter hübsche, niedliche Mädchen waren.
Das Fallreep ward herabgelassen, die ganze Damengesellschaft kletterte gewandt herauf. Jammern und Händeringen, ein Geschnatter wie bei einer Gänseherde — Aus denen war doch jetzt nichts herauszubekommen. Ich erfuhr alles von dem Bootssteuerer, der an Bord des gesunkenen Schiffes erster Steuermann gewesen war.
Es war eine Gesellschaft englischer Balletteusen, zu ihren Tänzen zugleich singend, die eine Tournee quer durch Nordamerika gemacht hatten, von New York nach San Francisco die größeren Städte mitnehmend. Jetzt hatten sie sich nach Mexiko begeben wollen, zur Erholung der angegriffenen Nerven die Seereise wählend, deshalb auch keinen Passagierdampfer, sondern einen schnellen Frachtdampfer benutzend. Dass solche immer auch Passagiere mitnehmen, habe ich ja schon einmal gesagt, und der ›Everest‹ war eigens dazu eingerichtet gewesen.
Seit vier Tagen war der ,Everest' unterwegs. Ganz der Erholung durften die Tänzerinnen ihre Zeit nicht widmen. Die Führerin der Truppe, die selbst mitwirkte, war trotz ihrer Jugend und sonstigen Feschheit — und ich sollte Miss Lee noch näher kennen lernen — eine sehr energische Dame, die mit der Zeit geizte. Sie hatte ein neues Tanzarrangement ausgearbeitet, und wenn das Wetter es zuließ, musste ihr Ensemble an Deck oder in der großen, ihr zur Verfügung gestellten Kajüte üben. In dieser Nacht hatte eine Generalprobe stattgefunden — es waren ja überhaupt Nachtmäuse — alle Effekte sollten probiert werden, was umso besser ging, weil der Dampfer auch elektrisches Licht besaß. So hatten sich die Mädchen vollständig kostümieren und schminken, auch ihren Schmuck anlegen müssen — und als die Ballettratten, der Versicherung des Kapitäns vertrauend, dass solch ein Nebel für ihn und sein Schiff gar nichts zu bedeuten habe, im besten Tanzen und Singen gewesen waren, da hatte sich die Katastrophe ereignet.
Das heißt, das von den Balletteusen erfuhr ich erst nachträglich, zuerst wurde mir natürlich von der Katastrophe selbst sachlich berichtet.
Nun, der ›Everest‹ war eben von einem Dampfer gerammt worden, der urplötzlich, ohne vorheriges Warnungssignal, vor ihm aufgetaucht war. Man hatte wohl vorher das Heulen einer Sirene gehört, aber dann nichts mehr.
Wie der ›Everest‹ getroffen worden war, wusste der Steuermann absolut nicht zu sagen. Der Dampfer sank eben sehr schnell, aber doch gerade so viel Zeit lassend, dass man noch in die Boote kommen konnte. An ein Mitnehmen irgendwelcher Sachen war freilich nicht zu denken. Für weibliche Passagiere hatten sich die Balletteusen mustergültig betragen. Nur ihr gar zu großes Zusammenhalten, dass sie sich alle in ein und dasselbe Boot drängten, hätte bei schlechterem Wetter verhängnisvoll werden können. So war es ja noch gut abgegangen.
Was aus dem anderen Dampfer geworden war, wusste der Steuermann absolut nicht zu sagen. Entweder war er auf der Stelle gesunken oder hatte in schmählich feiger Weise das Weite gesucht. Seine Lichter waren plötzlich verschwunden gewesen, wozu er sich ja freilich bei diesem Nebel nur drei Meter zu entfernen brauchte. Jedenfalls hatte man auch kein Signal mehr von ihm gehört.
Im Ganzen hatte der ›Everest‹ drei Boote ausgesetzt, alles war gerettet.
Der andere Dampfer zeigte Flaggensignale, nur noch im schärfsten Fernrohre erkenntlich. Er meldete, wie viele Passagiere er aufgefischt hatte, und danach befanden sich wirklich alle anderen drüben an Bord. Nachdem ich gemeldet hatte, dass das dritte Boot von uns geborgen sei, signalisierte der Dampfer, der schon seinen Namen genannt hatte, weiter, dass er seine Fahrt nach San Francisco fortsetzen müsse, er feuere mt den letzten Kohlen — noch ein Gruß, und wir sahen ihn im Norden verschwinden. Ein anderes Schiff war nicht in Sicht, nichts von treibenden Trümmern zu sehen.
Jetzt erst erfuhr ich Näheres über die Balletteusen und konnte nun diesen meine ganze Aufmerksamkeit zuwenden.
Wie gesagt, wenn sie erst ihre mit Farbe verschmierten Gesichter gereinigt hatten, waren es sämtlich ganz reizende Geschöpfe. Und dann mussten sie sich auch erst beruhigen. Das ging noch immer wie in einer Gänseherde zu, über der der Habicht kreist. Dabei aber waren es doch echte Weiber — wenigstens solche von einer gewissen Sorte, will ich hinzufügen. Allen ihren Schmuck hatten sie am Leibe getragen, viel Geld mochten sie nicht in den Koffern gehabt haben, die Unternehmerin verfügte über ein Scheckbuch, und so bejammerten sie nur den Verlust ihrer Toiletten, was sie aber auch ganz gründlich taten.
Als ich mir nun diese tiefdekolletierten Ballettratten ansah und dann nach den Kuttenmatrosen blickte, wie diese Mönche, die wohl überhaupt noch nie solche Balletteusen gesehen hatten, dastanden, vor Entsetzen ob solch eines Anblicks dermaßen erstarrt, dass nur ein einziger imstande war, sich die Kapuze über den Kopf zu ziehen, auf dass er nicht erblinde, diesen Liebesdienst dann auch einem anderen erweisend... ich konnte mir nicht helfen, ich musste erst einmal in ein herzliches Lachen ausbrechen.
»Ja, Sie haben gut lachen! Wenn Sie nur so frören wie wir.«
»Sind Sie der Kapitän?«
»Was für Mönche sind denn das?«
»Was, das sind Matrosen?!«
»Ach, das ist doch nicht etwa das Klosterschiff vom Berge Athos?«
»Ach, wie entzückend, wie interessant!!!«
So und anders klang es durcheinander, und nachdem ich einmal als Kapitän erkannt worden war, hatte ich im Nu das anderthalb Dutzend Ballettratten an meinem Leibe hängen.
Ich brachte sie in die Kajüte. Die armen Mädels hatten es wirklich sehr nötig. Es war eine sehr kalte Nacht gewesen. Länger als eine Stunde waren die so gut wie Unbekleideten dem eisigen Nebel ausgesetzt gewesen. Gestern Nachmittag hatten sie die letzten zwei Stündchen geschlafen, das Nachtessen hatten sie erst nach jener Generalprobe einnehmen sollen. Sie waren ganz verhungert und froren mächtig.
Die Mönche mussten ihre Reservekutten hergeben, schon war auf mein Geheiß frischer Tee bereitet worden, ich ließ das Beste auftragen, was an Bord des sehr gut verproviantierten Schiffes vorhanden war, und kaum war der erste Hunger gestillt, so tat der heiße, mit nicht zu wenig Rum verbesserte Tee seine Schuldigkeit. Die Mädchen begannen in ihren Kutten immer mehr aufzutauen, fanden alles ganz reizend, himmlisch und entzückend.
»Hier bleiben wir, hier bleiben — nicht wahr, mein bester, liebster Kapitän, Sie bringen uns bis nach Mexiko?«
So wurde ich von anderthalb Dutzend Armpaaren umschmeichelt, dann hatten die Weiber Lust, gleich jetzt in den Mönchskutten ein Ballett aufzuführen; endlich aber siegte doch die Müdigkeit, sie verschwanden in den Fremdenkabinen oder wo sonst Platz war, nicht ohne mich noch mit Kusshändchen zu bombardieren.
Nur die eine war geblieben, die Unternehmerin, Miss Elisha Lee, ein ganz prachtvolles Frauenzimmerchen. Dabei aber Geschäftsweib durch und durch.
»Was ist Ihr Ziel, Herr Kapitän?«, eröffnete sie die Unterhaltung.
Ich schilderte ihr, wie ich selbst als Schiffbrüchiger hier an Bord sei, als Kapitän das Kommando übernommen hatte. Viel mehr war ja vorläufig nicht nötig.
»Wir segeln um Kap Hoorn herum nach dem Mittelmeer, nach Athos, und ich habe keine Veranlassung, einen Hafen aufzusuchen. Ich bringe Sie auf den nächsten Dampfer, der nach einem mexikanischen Hafen geht. Solche werden wir schon genug treffen.«
»Das ist es eben, worüber ich Sie sprechen möchte. Können Sie nicht selbst solch einen Hafen anlaufen?«
»Wozu das?«
»Es ist mir viel daran gelegen, möglichst lange auf diesem merkwürdigen Schiffe zu verweilen. Weshalb? Reklame. Ich habe von diesem Klosterschiffe schon gehört, das ist jetzt überhaupt weltbekannt geworden, auch Ihren Namen als den des ersten Kapitäns kennt schon jeder, und nun sind wir als Schiffbrüchige gerade von Ihnen aufgenommen worden, von dem Klosterschiffe — das ist ja die prachtvollste Reklame, die sich nur denken lässt. Denn gerade in Mexiko bin ich meiner Sache nicht so ganz sicher, ich gestehe es offen. Mexiko wird gerade schon von einer Konkurrenztruppe bereist. Aber wenn es nun heißt: Miss Elisha Lees fliegende und singende Tänzerinnen haben einen furchtbaren Schiffbruch erlitten, sind von dem einzig in der Welt dastehenden Klosterschiff der Mönchsrepublik Athos aufgefischt worden, das noch dazu wiederum unter dem Kommando des Kapitäns Novacasa stand, der nur unter den ungeheuerlichsten Schwierigkeiten, mit dem Revolver in der Hand, durchgesetzt hat, dass die Tänzerinnen auch an Bord bleiben durften, der sie bis nach Mexiko gebracht hat... ha, das wäre eine Reklame, die gar nicht mit Geld zu bezahlen wäre!«
Sie schmeichelte mir — aber im Übrigen hatte sie ganz recht.
»Nicht mit Geld zu bezahlen — wie man so sagt«, fuhr sie fort, »aber es lässt sich schon mit Geld bezahlen — oder in anderer Weise wieder gutmachen — eine Gefälligkeit ist der anderen wert... was fordern Sie dafür, wenn Sie selbst uns nach einem mexikanischen Hafen bringen?«
Und das wirklich prachtvolle Weib knöpfte die Mönchskutte auf, die ihr an sich schon reizend stand, beugte sich etwas vor, griff in den Busen, zog ein Scheckbuch halb hervor, beugte sich noch tiefer, und dabei blitzte sie mich mit ihren Karfunkelaugen an.
»O, Miss, von einer Bezahlung kann da gar keine Rede sein...«
»Nicht? Was verlangen Sie sonst?«
Na, wir wurden schon handelseinig.
Mein nächster Gang war zu Pater Cyriax, und mir war gar nicht so wohl bei dem Gange. Es war doch eben ein eigentümliches Schiff, auf dem ich mich befand, es war wirklich etwas wie eine Entweihung, was ich ihm antun wollte.
Vor der Tür der noch unter dem Zwischendeck liegenden Arrestzelle fand ich Franz und Ned stehen, mit Revolver und Entersäbel bewaffnet.
»Hat er sich gefügt?«
»Ja, und er ist auch ganz still.«
Ich ließ die Tür aufschließen, trat ein.
Es war eine von den bequemeren Arrestzellen, in die man einen Aufsässigen in Eisen legt, enthielt Tisch und Bank, die letztere war sogar gepolstert — über den Tisch freilich lief von Wand zu Wand eine starke Eisenstange, an die der Gefangene mit Ketten angeschlossen wurde, sodass er essen und sich auch hinlegen konnte, und so war es auch mit dem Alten geschehen.
Der ausgemergelte Asket hockte wie eine Mumie hinter seinem Tische, die angefesselten Hände wie zum Gebet zusammengelegt, die Augen geschlossen.
»Pater Cyriacos, es tut mir wirklich leid«, begann ich.
Er rührte sich nicht, öffnete nicht die Augen.
»Ich habe den Tänzerinnen versprochen, sie bis nach einem mexikanischen Hafen zu bringen, und da sie nun an Bord sind, hat das doch auch weiter nichts zu sagen...«
»Nein, nun hat das auch weiter nichts zu sagen«, wurde gemurmelt.
»Was meint Ihr damit?«
Die Augen wurden geöffnet, wie feurige Kohlen glühten sie in dem Mumienschädel.
»Dieses Schiff ist verflucht! Nie wieder wird es einen Hafen erreichen.«
»Ja, seht, Cyriax, wenn Ihr so sprecht, dann darf ich Euch auch nicht freigeben, was ich eigentlich vorhatte. Jetzt aber verstärkt sich nur mein Verdacht, dass Ihr das ganze Schiff in die Luft sprengen könntet.«
»Ich?«
»Ja, Ihr Oder Ihr braucht la nur ein Löchelchen in den Kiel zu schlagen, das genügt unter Umständen schon.«
»Nein, dieses Schiff soll nicht dem Untergange geweiht sein.«
»Was denn sonst?«
»Nenne es fernerhin Ahasver! Wie auf dem ewigen Juden soll auf ihm der Fluch liegen, dass es rastlos umherirrt auf dem endlosen Meere, ohne je einen Hafen erreichen zu können!«
Mit Wucht, mit der größten Feierlichkeit hatte er es gerufen — aber auf mich machte das sehr wenig Eindruck, ich fand es sogar lächerlich.
Offenbar hatte dieser russische Doktor der Medizin noch nie etwas von dem fliegenden Holländer gehört, sonst hätte er sein Schiff doch wenigstens mit diesem verglichen, nicht mit dem ewigen Juden, der jedenfalls wasserscheu gewesen ist.
»Aber sonst sollen wir alle am Leiben bleiben?«, fragte ich mit leisem Spott.
»Ja, auch Ihr sollt auf diesem geschändeten Schiff rastlos umherirren durch alle Meere, und das für immer und ewig!«
»Ohne jemals einen Hafen zu erreichen?«
»Das Land wird vor Euch wie vor der Pest zurückweichen, jede Woge soll Euch ins Meer zurückschleudern.«
»Nur deshalb, weil wir die Weiber an Bord genommen haben?«
»Nur deshalb, und es genügt. Und alle die Mönche trifft derselbe Fluch, weil sie dir gehorcht haben.«
»Blickst du in die Zukunft?«
»Ich bin es, der diesen Fluch ausgesprochen hat, und ich weiß jetzt, dass mein Gebet um Erfüllung erhört worden ist.«
»Ah so, das wollte ich nur noch vernehmen. Also du selbst hast erst diesen Fluch ausgesprochen! Nein, mein Freund, nun kommst du auch nicht wieder heraus aus dem Eisen. Ein Mensch, der sich mit solchen Flüchen trägt, dem ist auch alles andere zuzutrauen. Unterdessen kannst du etwas über Christi Gebote nachdenken, wie wir sogar unsere Feinde lieben sollen und dergleichen. Nein, da ist mir doch der roheste Matrose, der jede Minute sich und alle Welt verdammt, tausendmal lieber als solch ein pfäffischer Mönch — jener meint es ja gar nicht so, du aber sprichst solch einen furchtbaren Fluch mit voller Überlegung aus, bittest einen allgütigen Gott auch noch um Erhörung... schäme dich, Alter!«
So sprechend wandte ich mich wieder der Türe zu.
»Verflucht sollt ihr und das ganze Schiff sein, rastlos bis in alle Ewigkeit sollt ihr auf dem Meere umherirren, Amen!«
So klang es mir noch einmal nach. Es ließ mich ganz kalt, ich dachte bald gar nicht mehr daran.
Am Nachmittage kamen die Mägdlein wieder zum Vorschein, und bald waren sie vergnügter denn zuvor. Das war doch ein richtiges Schiff, meinten sie, ein ganz anderes als so ein schmutziger Dampfer. Es machte ihnen unsägliches Vergnügen, an den Wanten, die sie natürlich ›Strickleitern‹ nannten, empor zu klimmen, gerade als Mönche oder Nonnen. Die Mitteilung der Direktorin, dass sie auf diesem Segelschiffe nach einem mexikanischen Hafen gebracht würden, erregte den stürmischsten Jubel, ich wurde umhalst und abgeküsst, und bald war an Deck der schönste Cancan fertig. Die Mädels quirlten mit ihren Beinen in der Luft herum, dass die langen Kutten flogen, und schmetterten ihre pikanten Chansons, und dann wurden die Mönche in Angriff genommen.

Am meisten hatte ich ja über diese zu lachen, wenn ich es auch zu unterdrücken suchte.
Wie am Anfang erwähnt, waren die meisten Mönche, die sich dem Seemannsberufe gewidmet hatten, noch Jünglinge, und waren sie schon von klein auf zum Mönchsleben bestimmt gewesen, so waren sie auch noch nie in ein Theater gekommen, von einem Ballett gar nicht zu sprechen — kurz, sie sahen so etwas zum allerersten Male, und ihr Staunen war so groß, dass sie immer wieder vergaßen, die Kapuzen über die der Erblindung ausgesetzten Augen zu ziehen. Dann kam auch sonst noch die Schüchternheit hinzu, sie suchten zu fliehen, wurden aber von den tollen Mädels überall gefunden... es wäre zu spät gewesen, auch wenn ich es noch hätte verhindern wollen.
Ich will die Einzelheiten nicht schildern, kann es nicht.
Am Abend sah ich die Reaktion kommen. Die Mönche waren aus ihrem Taumel erwacht. Als um Mitternacht der erste Steuermann seine Wache antrat, suchte er mich im Kartenhaus auf.
Der knabenhafte Jüngling sah ganz verstört aus.
»O, Kapitän, Kapitän!«, stöhnte er, sich die Fäuste vor die tiefliegenden Augen schlagend.
»Was ist denn geschehen?«, stellte ich mich ganz erstaunt.
»Wir sind verflucht für immer!«
»Verflucht? Wieso denn?«
Ich dachte erst, der von dem Alten ausgesprochene Fluch wäre bekannt geworden, aber das war gar nicht der Fall, dieser Jüngling empfand den Fluch von ganz allein, und alle anderen mit ihm.
Der älteste von ihnen war der zweite Steuermann, ehemals ein Frater, unterdessen zum Pater gesalbt, also auch in religiöser Hinsicht ein Vorgesetzter aller Übrigen, aber der schon sechzigjährige Mann war den Lockungen einer dieser Sirenen zum Opfer gefallen, und da nun seine kirchliche Macht gar nichts mehr zu bedeuten hatte, hatte er die Meldung an den Kapitän dem knabenhaften ersten Steuermann überlassen, und dass dieser das Amt wirklich auf sich genommen hatte, fand ich nur umso männlicher von ihm.
»O, Kapitän, wenn Ihr wüsstet...«
»Na, ich weiß alles. Aber sagt, Zephyros, hätte ich es verhindern können?«
»Nein, das hättet Ihr nicht vermocht...«
»Ich hätte auf den Pater Cyriax hören, die Weiber gar nicht erst an Bord nehmen sollen...«
»O, sprecht nicht so — wir wissen ja ganz genau, was menschliche Pflicht ist — ganz gleichgültig, ob man Christ oder Jude oder Heide ist... o, wenn Ihr wüsstet, wie unglücklich wir alle zusammen sind, wie tief, tief, tief unglücklich!!!«
Und mit einem Male brach es hervor. Was dieser siebzehnjährige Jüngling mir innerhalb von fünf Minuten alles offenbarte, im Namen aller anderen, ich kann es gar nicht schildern. Er brachte ja auch immer nur ganz unzusammenhängende Sätze hervor.
Aber ich verstand. Und es war ein bodenloser Abgrund von Unglück, in den ich da blickte.
Der Leser versteht ebenfalls, und dann weiß er auch, dass man so etwas gar nicht wiedergeben kann.
Lauter Jünglinge aus den edelsten Familien, mit feurigem Blut, durch keine Entsagungskost geschwächt — und seit nun bald einem Jahre ließen sie sich den frischen Seewind um die Nase pfeifen... es hatte nur einmal solch einer Gelegenheit bedurft, die sie im Hafen natürlich nie bekamen, um alles über den Haufen zu werfen, was man ihnen durch Dressur beigebracht hatte.
Nur ein leises Kosten vom Glücke des irdischen Lebens — vielleicht nur ein an sich ganz harmloser Kuss — und es hatte genügt, um ihnen furchtbar klar zu machen, wie unglücklich sie doch alle zusammen waren.
»Wir können nicht zurück nach Athos!«
Das war selbstverständlich der Refrain.
Und ich war darauf vorbereitet gewesen.
»Dann müsst ihr eben alle zusammen im nächsten Hafen das Schiff verlassen.«
»Wie sollen wir denn das können!«
»Ich mustere euch vorschriftsmäßig ab.
»Das ist nicht möglich, Ihr kennt die Bestimmungen dieses Schiffes wohl noch nicht so gut wie wir.«
»Nun gut, dann desertiert ihr einfach. Hier in Amerika braucht ihr ja gar keine Seemannspapiere, die Hauptsache ist, dass ihr als Seeleute wirklich etwas könnt.«
»Ihr vergesst wohl eins ganz, Kapitän.«
»Was?«
»Und flöhen wir auch bis ans Ende der Welt, und versteckten wir uns auch, wohin kein Strahl der Sonne dringt — die heiligen Männer von Athos würden uns dennoch sehen.«
In ebenso niedergeschlagenem wie pathetischem Tone hatte der Jüngling es gesagt — oder es hatte auch etwas Deklamatorisches darin gelegen.
»Das steht wohl in eurem Katechismus?«
»Du sagst es.«
Ich hatte also gleich das Richtige geahnt.
»Zweifelst du daran, dass die Mönche vom Athos im heiligen Lichte wirklich alles sehen können?«, wurde ich noch gefragt.
Nein, ich hatte allen Grund, daran zu glauben. Ob der Knabe eigentlich wusste, wie es mir schon ergangen war?
»Habt Ihr selbst dieses Licht schon in Euch erzeugen können?«
»Ich kann es, tat es täglich. Auch ich habe darin alles, alles geschaut. Aber das ist nur auf dem heiligen Berge selbst möglich, und schildern kann man das überhaupt nicht.«
Ich bekam da nichts Neues zu hören.
»Ja, und wenn ihr Flüchtlinge nun dort im fernen Griechenland geschaut werdet, was dann?«
»Ihr könnt noch fragen, Kapitän?«
»Was fragen? Was meint Ihr?«
»Nun, seid Ihr nicht selbst einmal vom heiligen Berge geflohen? Jetzt darf ich darüber sprechen. Ja, es ist mir bekannt, nur die Zunge war mir bisher gebunden, jetzt ist das Band gelöst — mir zum Verderben. Also, Ihr wisst es ja selbst. Die Verbrüderung unserer Gemeinde umfasst die ganze Erde, es gibt nicht einen einzigen Flecken, keine Ansiedlung auf der Erde, nicht in der fernsten Wildnis, in der diese Klosterrepublik nicht einen Spion hätte, nur den Eingeweihten bekannt, zu denen ich nicht gehöre, niemand von uns — mit Ausnahme vielleicht des Paters Cyriacos. Aber bestimmt weiß ich das auch nicht. Also, wo wir uns auch befinden, wir werden im heiligen Lichte gesehen, und die Mönche werden Mittel und Wege wissen, uns... in einer Kiste wieder nach Athos zu befördern... uns alle zusammen... zur Bestrafung.«
Immer leiser hatte der Jüngling gesprochen.
»Welche Strafe erwartet euch da?«
»Eine fürchterliche.«
»Wisst Ihr nichts Näheres darüber?«
»Nein und ja. Was wäre weiter dabei, wenn sie meinen Leib folterten und brennten? Ich würde es hohnlachend ertragen. Aber diese Athosmönche haben geheime Machtmittel, welche den Widerstand auch des energischsten und heldenhaftesten Mannes brechen. Es muss geradezu Zauberei dabei sein. Ich habe einen Freund dabei gehabt — obgleich wir eigentlich gar keine Freunde haben dürfen — er wurde vom Geiste des Teufels erfasst, den ihr Freigeisterei nennt. Er wollte plötzlich nicht mehr an die Lehren der Mönche glauben, verhöhnte sie, forderte selbst sie auf, ihn zu martern, und ich wusste ganz, ganz bestimmt, dass er jede Marter ertragen würde, denn er war ein ganzer Mann durch und durch, und gleich als ersten Beweis streckte er seinen rechten Arm freiwillig ins Feuer und ließ ihn so mit begeistertem Lächeln für die Wahrheit, die er zu vertreten meinte, abschwälen. Die Mönche sagten nichts, sie pflegten ihn, heilten den Verstümmelten. Und als er wieder gesund war, wurde er in Gegenwart von uns Zöglingen ausgepeitscht, es war gar nicht so schlimm, und da sah ich denselben Mann, der sich freiwillig den Arm hatte langsam abbrennen lassen, sich unter den Peitschenschlägen winden, jämmerlich um Gnade winselnd, und dann hat er alles widerrufen. Wie geht das zu? Er war sonst noch immer derselbe. Wie haben die Mönche seinen Willen so brechen können? Es muss Zauberei dabei sein.«
»Weißt du, was Hypnose ist?«
Nein, Zephyros wusste es nicht, und da konnte ich ihm das auch nicht so ohne Weiteres erklären.
Meiner Meinung nach war der Mann hypnotisiert worden. In der Hypnose hatte man seinen körperlichen und seelischen Widerstand durch Suggestion gebrochen, was ja ebenso gut möglich ist, wie in der Hypnose die Energie zu stärken... allerdings eine sehr fragwürdige Stärkung.
»Ihr habt recht — es ist Zauberei gewesen, wie wir das Ding vorläufig nennen wollen, da wir über die Hypnotik so gut wie gar nichts wissen, nur die Resultate kennen. Ja, ich verstehe, warum ihr euch da vor einer Rückkehr fürchtet.«
»Nein, zurückgebracht dürfen wir niemals werden. Es gibt aber ein Mittel, um dem auszuweichen.«
»Und das wäre?«
»Ganz allmächtig ist die Klosterrepublik nicht etwa.«
»Nicht?«
»O nein. Dieses heilige Licht, in dem sie alles, was auf der Erde oder sogar in der ganzen Welt, wie die völlig Eingeweihten behaupten, erblicken, das ist das einzige, was nicht erklärt werden kann. Sonst geht ja alles ganz natürlich zu. Sie haben eben überall ihre Spione, und der Flüchtling, oder der, auf den sie es abgesehen haben, wird eben betäubt und in eine Kiste gepackt, so nach Athos zurückgeschickt. Doch das ist nicht immer so einfach. Diese irdische Macht hat eine Grenze. Wir müssen uns an einen Ort begeben, wohin nur der geistige Blick, nicht aber der reale Arm dieser Klostergesellschaft reicht.«
Der Jüngling, der wahrscheinlich in einem einzigen Augenblick, vielleicht nur durch einen einzigen Kuss zum Atheisten oder doch zum Freigeist geworden war, sprach ganz vernünftig. Er sprach im Namen aller.
»Wisst Ihr solch einen Ort?«
»Das wollte ich Euch eben fragen, Kapitän. Unsere Kenntnisse sind doch noch sehr beschränkt, wir haben kaum Sydney kennen gelernt. Wäre es im Innern von Australien nichts?«
»Hm. Ich verstehe, was ihr wollt«
»Eine noch von keinem Menschen betretene Gegend, in der wir uns ernähren können, das ist es.«
»Aber die Mönche würden euch auch dort schauen?«
»Sicher.«
»Und würden sofort wissen, wo ihr euch befindet?«
»Nein, das ist doch nicht so leicht, wenigstens wie ich es aus eigner Erfahrung kenne. Man sieht das Land und die Bäume und alles, was der zu Beobachtende sieht. Blickte er auf ein Straßenschild, so würden die auf Athos diesen Straßennamen mitlesen und so nach und nach bestimmen können, wo sich der Betreffende befindet. Aber wenn alle Erkennungszeichen fehlen, wissen auch die Beobachter nicht, wo sich jener befindet. Dass es Australien ist, würden sie höchstens aus den Gummibäumen erkennen. Aber auch nichts weiter. Denn so kluge und welterfahrene Köpfe dort auch sind, Männer, welche wiederholt die ganze Erde umfahren haben, vielleicht jeden Schlupfwinkel auf Erden kennen — es hat doch seine Grenzen.«
»Nun gut, so versucht doch in Australien euer Glück.«
»Aber wie ungesehen dorthin kommen? Die verfolgen uns doch im Geiste auf Schritt und Tritt.«
»Auch in der Nacht?«
»Nein, wenn es um uns herum finster ist, so können auch sie nichts sehen.«
»So müsst ihr bei Nacht wandern.«
»Meint Ihr, Kapitän, dass das möglich ist?«
Der Knabe hatte recht. Nein, es war nicht möglich. Das lässt sich alles besser planen als ausführen, Australien ist doch ein gar zu weiter Begriff, und dasselbe gilt für Afrika und alle anderen Erdteile.
»Und Ihr meint, die Mönche würden euch bis ins innere Australiens verfolgen und euch von dort wiederholen?«
»Unbedingt! Nur um ein Beispiel ihrer scheinbaren Allmacht zu statuieren.«
Ja, das war wohl die Hauptsache, und dazu würde diese Mönchsbande sicher nichts unversucht lassen.
»Oder wisst Ihr, Kapitän, nicht eine einsame Insel, die wir heimlich erreichen können? Wir haben darüber schon beraten. Die sagte uns mehr zu. Gibt es solche unentdeckte Inseln noch?«
»O ja, die gibt es noch, zumal in der Südsee. Massenhaft! Freilich sind sie schon von irgendeiner Macht annektiert, und hat sie auch noch keines Weißen Fuß betreten, so wird sie doch sofort wirklich in Besitz genommen, sobald man merkt, dass sich darauf Europäer niedergelassen und schon etwas vor sich gebracht haben.«
»So wäre auch das nichts«, seufzte der Jüngling.
»Nun, da würde sich doch schon etwas finden lassen«, tröstete ich. »Übrigens gäbe es da doch ein sehr einfaches Mittel, um nicht wieder als Frachtgut nach Athos zurückgeschickt zu werden.«
»Welches Mittel?«
»Dass man eines Abends einschläft, etwa hier in Amerika, und beim Erwachen befindet man sich plötzlich auf der anderen Hälfte der Erdkugel in einem Kloster von Athos, wie es mir selbst gegangen ist, das ist doch nur bei einer einzelnen Person möglich, oder bei zweien — aber wenn mehrere zusammen sind, die sich dem widersetzen wollen, da ist das doch nicht so leicht zu machen, und das umso weniger, in je einsamerer Gegend sie sich befinden. Wenn ihr 24 Männer euch im Herzen Australiens angesiedelt habt, in einer Oase, wie es solche dort sicher gibt, so habt ihr doch natürlich auch Waffen bei euch, und gehen euch die Patronen für die Gewehre aus, so werden einfach Lanzen und Pfeile und Bogen gefertigt... na, und nun sollen einmal solche Bettelmönche kommen und euch betäuben und in eine Kiste stecken wollen. Ihr braucht euch doch bloß nicht aus eurem Versteck herauslocken zu lassen.«
Mit blitzenden Augen richtete sich der Jüngling hoch empor.
»Niemals!! Dass wir lieber sterben, als uns nach Athos zurückbringen lassen, das ist bei uns bereits beschlossene Sache!«
»Auch im Kampfe zu sterben?«
»Auch im Kampfe! Denn wir haben mit einem Male erkannt, dass auch wir Menschen sind!«
Dass er noch das Wörtchen ›freie‹ davor setzte, war wirklich nicht nötig gewesen.
»Na, dann ist die Sache doch höchst einfach. Dann wehrt ihr euch eben dagegen, wenn man euch Gewalt antun will, wozu ihr auch das vollste Recht habt. Und wenn ihr so entschlossen seid, dann wollen wir bald solch ein idyllisches Fleckchen Erde gefunden haben, das vom Geiste der Freiheit durchhaucht ist, und dann sollen diese Klosterbrüder uns nur kommen.«
Ja, bei mir war es bereits beschlossen, mit diesen ihrer Kirche Abtrünnigen gemeinschaftliche Sache zu machen, und ich dachte im Augenblicke sogar stark an meine Besitzung in Goyaz, ob das nicht so ein geeignetes Fleckchen Erde sei, um sich in der Einsamkeit zu vergraben — ein Fleckchen Erde von 100 000 deutschen Quadratmeilen!
Der erste Steuermann war auf seinen Posten gegangen, ich hatte zuletzt ihm die Hand gedrückt, wollte weiter darüber nachdenken, als nach etwa zehn Minuten Zephyros noch einmal ins Kartenhaus kam, auch den zweiten Steuermann und einige Matrosen mitbringend. Sie waren gekommen, um mir ein Vertrauensvotum zu bringen, mir im Namen der ganzen Besatzung ihren Dank auszusprechen, und als ich sagte, dass ich gewillt sei, ihr Schicksal zu meinem eigenen zu machen, war der Jubel groß.
Ja, diese sonst so ernsten, schon mehr erstarrten Männer konnten mit einem Male wirklich aus vollem Herzen jubeln, was ich früher niemals für möglich gehalten hätte. Sie waren eben plötzlich ganz andere Menschen geworden. Das Bewusstsein, ein furchtbares Joch, das sie bisher geduldig getragen hatten, mit einem Ruck abgeschüttelt zu haben, hatte sie in eine Art Rausch gesetzt, und ich glaube, hätte ich jetzt den Vorschlag gemacht, wir wollten uns als Seeräuber etablieren, sie wären mit ebensolchem hellen Jubel darauf eingegangen.
So fand jetzt gleich eine gemeinsame Beratung statt. Ich ließ auch noch alle anderen Matrosen kommen, und da sah ich wieder einmal, wie zwecklos es ist, gerade die wichtigsten Schritte vorher lange zu überlegen. Die besten Einfälle kommen doch immer im entscheidenden Augenblick, wenn man sie gerade braucht.
Gerade als plötzlich der Gedanke, wie leicht es jetzt doch sei, aus diesen sonst sicher ganz ehrbaren Männern regelrechte Seeräuber zu machen, in mir aufstieg, gerade in diesem Augenblick sagte ich mir, dass wir doch lieber alle abenteuerlichen Pläne beiseite lassen wollten.
Warum uns denn in eine einsame Wildnis verkriechen und es eventuell auf einen Kampf um Tod und Leben ankommen lassen?
Nein, im Gegenteil, wir wollten vor aller Welt ganz offen auftreten. Wir begaben uns einfach unter den Schutz eines Staates. Am besten, da wir ihnen auch am nächsten waren, waren hierzu die Vereinigten Staaten von Nordamerika geeignet. Wir offenbarten uns gleich direkt dem Präsidenten. Dieser geistvolle, hochedle Mann würde uns schon verstehen. Er würde uns behilflich sein, in Nordamerika ein unseren Wünschen entsprechendes Stückchen Land zu finden, wohl einsam, aber doch nicht so ganz und gar weltabgeschlossen, und mit neuem Jubel erklärten sich die ehemaligen Mönche bereit, sich als ehrbare Ackerbauer und Viehzüchter niederzulassen. Ach, wie gern wollten sie im Schweiße ihres Angesichtes ihr Brot bauen, wenn sie sich nur als freie Männer fühlen durften — und dann sollten diese griechischen Mönche nur einmal wagen, unseren Frieden stören zu wollen! Da würden sie in noch etwas ganz anderes gesperrt als nur in eine Kiste, und das kraft der Gesetze der Vereinigten Staaten von Nordamerika.
»Und was wird aus dem Schiffe?«, wurde die Frage aufgeworfen.
Ich schlug vor, die Mädchen im nächsten amerikanischen Hafen abzusetzen, den wir in zwei Tagen erreichen konnten, und dann nach San Francisco zurückzukehren. Um nach New York zu gelangen, hätten wir ja um Kap Hoorn herumfahren müssen. Vielleicht konnten wir schon in San Francisco alles erreichen, sonst ging es eben per Bahn nach New York, falls wir den Präsidenten persönlich sprechen wollten, oder doch einer von uns. Das Schiff wurde einfach aufgegeben, wenn auch natürlich in gesetzlicher Form — falls eine vorgesehen ist.
»Und Pater Cyriacos?«
»Den geben wir gleichfalls mit auf«, lachte ich.
»Aber zu alledem brauchen wir doch auch Geld«, meinte der, der in dem allgemeinen Rausche den nüchternsten Kopf behalten hatte.
In der Schiffskasse befanden sich noch außer einem Scheckbuche bare 14 000 Dollar. An denen durften wir uns natürlich nicht vergreifen, keinen fremden Cent oder Centeswert durften wir uns aneignen, sonst gerieten wir von vornherein auf die schiefe Bahn. Und ebenso hatte keiner dieser Mönche einen roten Cent — mir ging es ja nicht viel anders — und auch was sie sonst an Kleidungsstücken und dergleichen besaßen, gehörte ja eigentlich nicht ihnen.
Nun, ich wusste Rat, wie wir uns Geld verschafften, falls wir wirklich solches brauchten. Ich habe über meine persönlichen Verhältnisse noch nie wieder gesprochen. Ja, ich hatte durch einen Federstrich auf mein ganzes Vermögen verzichtet, aber ich wusste, dass ich, wenn ich wirklich einmal Geld brauchte, solches sofort bekommen würde. So schlimm war es ja mit mir nicht bestellt, man hat nicht umsonst einmal in den ersten Reihen des Hofkalenders gestanden. Ich hatte Verwandte, die mich nie im Stiche lassen würden, und darunter waren solche, die über Einkünfte von Millionen verfügten. Ich wusste einen alten Onkel, der es sich noch immer zur Ehre angerechnet hätte, wenn ich ihn um eine Million angegangen wäre. Denn ich war doch damals nicht etwa ein ehrloser Schuft dadurch geworden, dass ich alles weggeworfen hatte.
Ich hatte noch nie an so etwas gedacht. Sonst wäre ich mir doch inkonsequent geworden. Hier aber lag einmal ein Fall vor, wo ich bereit war, meine alten Verbindungen zu benutzen.
Vorausgesetzt, dass es wirklich nötig war! Aber daran glaubte ich noch gar nicht. Wir mussten in San Francisco oder anderswo nur an die richtige Quelle kommen, die ich schon finden wollte. Amerika ist ja auch in anderer Hinsicht ein merkwürdiges Land — das heißt würdig zu merken, nämlich als Vorbild. In diesem Lande, in dem der Dollar alles ist, ist schon mancher in die Höhe gekommen, der es ohne einen Cent in der Tasche betreten hat. Vor allen Dingen gilt das für Bauern, die Farmer werden wollen. Nicht nur, dass jeder, der sich als zukünftiger Bürger registrieren lässt, noch heute nach freier Wahl sechzig Acker guten oder hundert Acker mittelmäßigen Bodens erhält, und zwar jeder Kopf der Familie, wobei auch schon der Kopf des Säuglings mitzählt, sondern es gibt auch eine ganze Menge Gesellschaften, Bankinstitute, welche solch einen Mann auch gleich pekuniär unterstützen, dass er sich die erste Blockhütte bauen, feldwirtschaftliche Maschinen, Zugtiere, Saatgut usw. anschaffen kann, und zwar wird das Geld zu ganz geringen Zinsen geliehen. Natürlich sehen sich die ihre Leute an, die wissen doch Arbeitshände ebenso gut wie den Charakter zu beurteilen, mit ihren tausendfältigen Erfahrungen, und hauptsächlich kommt natürlich der professionelle Bauer in Betracht. Und das ist nicht, abgesehen von einigen privaten Gesellschaften, pure Menschenfreundlichkeit, sondern das geht von der Regierung aus, der einzig daran gelegen ist, das noch brachliegende Land mit konsumkräftigen und steuerzahlenden Bürgern zu besiedeln.
Ganz besonders werden geschlossene Gesellschaften von Bauernfamilien unterstützt, die auch zusammenbleiben wollen, soziale Verbrüderungen und dergleichen, zu solchen hat man viel mehr Vertrauen als zu einzelnen Familien oder gar Personen — die besten Erfahrungen hat die Regierung der Vereinigten Staaten mit Gliedern religiöser Sekten gemacht, wie solche besonders Russland zahlreich nach Amerika hinüberschickt.
Natürlich ist das geliehene Geld ja sehr oft verloren, oft genug ist es von vornherein auf Schwindel abgesehen. Damit rechnet aber auch die Regierung, es gibt dafür im Budget einen besonderen Unterstützungsfond für Einwanderer, die Verluste sind gleich vorgesehen.
Diese statistischen Jahresberichte sind höchst interessant zu lesen. Ich habe einmal einen in der Hand gehabt, und da wurde betont, dass allein an solchen religiösen Sekten, gleichgültig, woher sie stammen, die Regierung noch nie einen Verlust gehabt hat, jede noch immer das geliehene Geld mit Zinsen pünktlich zurückzahlte. Dass soziale Kommunen mit Gütergemeinschaft usw. zusammenbrechen und dadurch zahlungsunfähig werden, schließlich ohne weitere eigene Schuld, das kommt sehr, sehr häufig vor. Aber noch keine einzige Kommune, die sich auf kirchlichen Grundsätzen aufbaute, ist in Amerika zugrunde gegangen, und hat sie sich schließlich in Wohlgefallen aufgelöst, so doch immer erst, nachdem sie allen Verpflichtungen nachgekommen war.
Nun waren wir allerdings keine religiöse Brudergemeinde mehr, eher das gerade Gegenteil. Trotzdem war ich meiner Sache sicher, dass uns die Regierung der Vereinigten Staaten, wenn wir ihr die Sache klarlegten, mit offenen Armen aufnehmen und uns jegliche Unterstützung zuteil werden lassen würde, ohne dass ich nötig hatte, meinen persönlichen Einfluss, so viel ich noch davon besaß, geltend zu machen.
So hatte ich auch nicht nötig, von diesem den Mönchen erst zu erzählen.
Die begeisterte Stimmung dauerte fort. Zu tun war an Deck und in der Takelage nichts, und so konnten die Matrosen schwärmen. Und sie schwärmten wie die Kinder — oder wie die Jünglinge, will ich sagen; die meisten waren ja auch wirklich solche.
Ach, wie sie sich das auszumalen wussten, so in einer freien Kolonie als freie Männer leben zu können, und dabei spielte immer die Arbeit die Hauptrolle. Was sie im Geiste schon alles bauten! Sie waren bereits bei einer Schule und merkwürdigerweise auch schon bei einer Kirche. Oder das war auch nicht so merkwürdig.
»Aber in ihr darf jeder beten, was er will.«
Da war es ja schon! Die hatten bereits instinktiv die Universalreligion erfunden, in welcher Gott wirklich das ist, was dieses persische Wort bedeutet: das Unfassbare. Übrigens drücken die Inder dasselbe ganz richtig durch Brahma aus. Brahma ist gar kein persönlicher Gott, wird überhaupt nicht verehrt.
»Ja, aber da müssen wir doch auch heiraten, sonst haben wir ja keine Kinder in die Schule zu schicken«, meinte eins von diesen großen Kindern, und sogleich wurden alle anderen ganz verlegen, erröteten sogar.
Dann aber stimmten sie dem Vorschlage nur umso eifriger bei.
»Gewiss, dann müssen wir auch heiraten. Nicht wahr, Herr Kapitän?«
Ich hatte meine Kapitänswürde einmal beiseite gelegt, jetzt durfte ich es.
»Ei freilich, dass ihr euch Frauen nehmt, das muss das Allererste sein.«
»Ja, aber wen denn?«
»Nun, da macht euch nur keine Sorge, die werden schon von ganz allein gelaufen kommen, wenn ihr selbst nur erst unter Dach und Fach seid, ein Bett habt und Frau und Kinder ernähren könnt.«
»Wie wäre es denn, wenn wir gleich hier die jungen Damen mitnähmen, die so gut tanzen und singen können?«, schlug einer vor.
Ich hätte mein Lachen doch beinahe dem begeisterten Sprecher in sein gerötetes Gesicht hineingeplatzt.
Fürwahr, die brauchten sehr notwendig einen Führer, der etwas von der Welt verstand, und zwar musste es ein durchaus ehrlicher Mensch sein, sonst wurde denen doch sofort Strumpf und Schuh ausgezogen und die Haut noch extra über die Ohren, und ich tat ein sehr gutes Werk, wenn ich zunächst bei ihnen blieb.
»Nein, meine lieben Jungen, diese Balletteusen sind nichts für euch — ihr braucht Hinterwäldlerfrauen, die tüchtig...«
Ein furchtbares Gekreisch unterbrach mich. Es kam aus der Kajüte. Wir alle hingestürzt.
Also diese Unterhaltung hatte um Mitternacht begonnen, jetzt war es erst in der dritten Stunde.
Die Balletteusen hatten sich, von dem Herumtollen während des ganzen Tages ziemlich ermüdet, zeitig zur Ruhe begeben, aber es waren eben Nachtmäuse, die in der Nacht absolut nicht schlafen konnten.
Nach Mitternacht war eine nach der anderen erwacht, und als sie das alle zusammen wussten, waren sie aus der Koje gekrochen, hatten in der Kajüte die Lampe angebrannt und nun beraten, wie man diesen angerissenen Nachmittag würdig vollenden könne.
So konnte ich mir das alles sofort erklären, nur noch nicht dieses Quieken und Kreischen, und die Frauenzimmer kamen an Deck gestürzt, als wäre ein Popanz hinter ihnen her.
Etwas gar zu Ungeheuerliches konnte auch nicht passiert sein, ich kannte die Tonleiter der weiblichen Stimme zur Genüge; das Gekreisch hier ungefähr, kalkulierte ich, mochte eine durch die Kajüte rennende Maus veranlasst haben — oder vielleicht auch zwei Mäuse, ja, vielleicht sogar eine Ratte — so genau war ich auf weibliches Kreischen geeicht... diese unerfahrenen Mönche freilich mussten gleich an Mord und Totschlag denken.
»Kapitän, Herr Kapitän!!!«
Na, was gibt's denn?«, fragte ich gemütlich, gleich vier der zitternden Geschöpfe in meinen Armen habend.
»Schrecklich — entsetzlich!«
»Ist vielleicht eine Maus durch die Kajüte gerannt?«
»Nein, eine Ratte!«
Na, hatte ich's nicht im Voraus gesagt? Aber ich verzichte auf die Ehre, deswegen unter die Propheten aufgenommen zu werden. Denn da ist, wie gesagt, gar keine Hexerei dabei, sondern nur Frauenkenntnis gehört dazu — und die allerdings besaß ich.
»Eine tote Ratte!«, wurde weiter gepiepst.
»Was, sogar eine tote Ratte ist's gewesen, die durch die Kajüte gelaufen ist?«, scherzte ich.
»Ich denke doch, 's ist ein Muff und fasse das Ding an.«
»Und wirft mir die tote Ratte ins Gesicht!«, weinte eine andere in meinen Armen.
»Na ja, ich dachte doch eben, es wäre ein Muff.«
Jetzt wurde ich aber doch etwas stutzig.
»Faktisch, in der Kajüte hat eine tote Ratte gelegen?«
»Dort — dort drin liegt sie ja noch.«
Ich ging in die Kajüte. Richtig, da lag neben dem Tisch am Boden eine tote Ratte, ein stattliches Exemplar. Sie konnte erst vor noch nicht langer Zeit verendet sein. Todesursache nicht zu erkennen.
Hm. Hat man auch im rattenverseuchtesten Hause schon einmal eine krepierte Ratte mitten im Zimmer liegend gefunden? Selbst wenn man Gift gelegt hat, an das sie wirklich einmal gehen — das Haus wird von ihnen befreit, Rattenleichen sind nicht zu finden, niemals!
»Habt ihr im Schiffe Rattengift gelegt?«, wandte ich mich an die Mönchsmatrosen.
Niemand wusste etwas davon.
»Oder sonst etwas getan, um Ratten vom Leben zum Tode zu befördern?«
Nein, nichts dergleichen.
»Und hier liegt noch eine andere!«, rief ein Matrose, aus einem dunklen Winkel eine zweite tote Ratte aufhebend.
Ein jäher Schreck durchzuckte mich, ein entsetzlicher Gedanke. Im nächsten Augenblick wollte ich mir weismachen, ihn gar nicht gehabt zu haben.
»Olga«, rief da eins der Mädchen, »was ist denn mit dir los? Wie siehst denn du aus?«
»Na, wie denn?«, fragte die jugendfrische Tänzerin, und sie konnte über die toten Ratten schon wieder lachen.
»Du kriegst doch mit einem Male lauter Pusteln im Gesicht?!«
»Ich? Du träumst wohl.«
Das Mädchen wollte nach dem Spiegel springen — plötzlich stockte ihr Fuß, sie sank auf den nächsten Stuhl, ließ Kopf und Arme hängen.
Da streckte einer der älteren Mönche seinen Arm nach ihr aus, und wie eine Stimme aus dem Grabe erklangen die Worte:
»Das — ist — die — Pest!!!« — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Die vielen Gedankenstriche bedeuten, dass ich kaum weiß, wie ich alles weiter schildern soll. Die Pest! Der schwarze Tod!
Schreckliches Wort!
Und mich hatte die Ahnung durchzuckt, als ich die beiden toten Ratten erblickte — schon bei der ersten — und bei der zweiten hätte es mir gleich zur Gewissheit werden sollen.
Wenn die Ratten erst öffentlich krepieren, angesichts der Menschen, oder wenn man nur ihre Leichen findet, dann ist auch sicher die Pest da. Wenn nicht die Erzeuger, so sind die Ratten doch die intensivsten Überträger dieser furchtbarsten aller Seuchen. Es ist geradezu, als ob Ratten die nähere Gesellschaft der Menschen aufsuchten, um vor deren Augen zu krepieren. Optimisten mögen dann sagen: um die Menschen vor der furchtbaren Gefahr zu warnen. Sie sollen da indessen nur auch das Mittel angeben, wie man sich vor ihr noch retten kann.
Wir taten, was wir tun konnten. Viele der orientalischen Mönche waren mit der Pest vertraut, aber das erste Mittel, welches sie angaben, war auch mir bekannt, dessen Kenntnis gehört sogar mit zum Kapitänsexamen im medizinischchirurgischen Fache, wobei man freilich nur als ein Doktor Eisenbarth ausgebildet zu sein braucht.
Die schon Erkrankten wie die Gesunden sofort mit Fett oder Öl einreiben, am ganzen Körper. Es ist nämlich eine allgemein bekannte Tatsache, dass bei epidemischen Ausbrüchen der Pest ganz selten solche Leute davon befallen werden, die viel mit Öl und Fett zu tun haben, was sich bis auf die Seifensieder erstreckt. Am meisten sollen die vor einer Ansteckung geschützt sein, die immer mit unentfetteter Schafwolle zu tun haben, und das sicherste Mittel, um selbst die schon ausgebrochene Pest wieder verschwinden zu lassen, soll sein, dass man den schon mit Beulen Bedeckten in solche Wolle packt. Aber sie muss noch ganz schweißig, fettig sein, schon gereinigte übt absolut keine Wirkung aus.
Wieso Fett und Öl da eine heilsame Kraft haben, ist gänzlich unbekannt. Was wissen wir denn überhaupt über die Pest! Bakterien, ja, Bazillen! Dann fangt sie doch!
Also, alles musste sich sofort mit Baumöl einreiben, gleich sämtliche Sachen wurden damit getränkt. Unterdessen ließ ich schon in der Kombüse den ganzen Vorrat von amerikanischem Schweineschmalz zusammenschmelzen, und als mir das noch nicht genügend erschien, wurden einige Salzfleischtonnen aufgeschlagen, das Fett ausgeschält, ausgelassen, und so stellte ich gleich ein ganzes Bad von flüssigwarmem Fett her, in das ich die Erkrankte bis an den Hals steckte, wieder mit allen Sachen, samt ihrer Mönchskutte.
Es half nichts. Nach noch nicht vierzehn Stunden war sie eine Leiche. Und wie sah das vor vierzehn Stunden noch so jugendschöne Mädchen aus! Diese Beulen, diese... lasst mich schweigen.
Und da lag schon eine zweite im sterben!
Aber nicht an der Pest. Die charakteristischen Pusteln und Beulen fehlten vollständig.
Wenn sie auch mit allen sonstigen charakteristischen Erscheinungen der Pest starb, die Pest war es nicht.
Was es sonst war? Was weiß ich?
Es gibt ein orientalisches Märchen.
Zwei Engel, von Allah mit Befehlen ausgeschickt, begegnen sich auf dem Wege zwischen Damaskus und Bagdad.
»Wo gehst du hin?«, fragt der eine Engel seinen Kollegen, der ein dunkles, finsteres Aussehen hat.
»Ich gehe nach Bagdad, um 5000 Menschen an der Pest sterben zu lassen.«
Nach einiger Zeit begegnen sich die beiden Engel wieder.
»Du sagtest doch, du hättest nur 5000 Menschen in Bagdad mit der Pest schlagen wollen, es sind aber doch 50 000 Menschen daran gestorben.«
»Nein«, entgegnet der Würgengel, »ich habe nur 5000 getötet — die übrigen 45 000 sind aus Furcht vor der Pest gestorben.«
Das ist es: die Furcht!
Ich habe das vorhin so einfach geschildert — wir rieben uns alle mit Öl ein.
Ach, wie es da zuging!
Drei Viertel von diesen Weibern waren doch gar nicht mehr fähig, diese Prozedur an sich selbst vorzunehmen, sie waren vor Entsetzen schon jetzt starre Leichen, nur dass sie noch atmeten.
Hinwiederum muss ich betonen, dass sich gerade unter den Weibern solche von heroischem Mute befanden. So griff die Direktorin unverzagt die von Pestbeulen bedeckte Kameradin mit an, und ebenso opferkühn und liebevoll bewiesen sich noch drei andere dieser Mädchen.
Bei den Mönchen trat stark orientalischer Fatalismus zutage, sie fügten sich schweigend in das Geschick, das Gott uns gesandt hatte, und ihre langjährige Dressur trug ja auch viel dazu bei, vielleicht kam auch mit in Betracht, dass ihnen das Wort ›Pest‹ gar nicht so neu war.
Ja, aber was half's?
Wir hatten auch die zweite Leiche, in einen Sack genäht und mit einigen Eisenstücken beschwert, auf ein Brett genagelt, dem Meere überliefert.
Ich saß in meiner Kabine und grübelte.
Und ich sah im Geiste den alten Mönch, der noch immer in der Arrestzelle in Eisen lag, und ich hörte ihn den Fluch aussprechen:
»Rastlos bis in alle Ewigkeit sollt ihr...«
Ich schlug mir diese geistige Vision schnellstens aus Auge und Ohr.
Nein, so weit waren wir denn doch noch nicht.
In den letzten sechs Stunden war kein neuer Fall eingetreten, weder von wirklicher noch von eingebildeter Pest.
Am nächsten Vormittag würden wir, wenn der Wind so günstig blieb, Alanka erreichen, einen ziemlich ansehnlichen Hafen der Republik Mexiko.
Natürlich mussten wir erst in Quarantäne liegen bleiben, weit draußen auf Reede, von Polizeibooten mit Sanitätsbeamten bewacht.
Auf wie lange? Je nachdem! Das kam ganz auf den Machtspruch der Hafenbehörde an, die sich aber gerade bei so etwas sehr nach der allgemeinen Volksstimmung zu richten hat. Eben weil die Furcht die Hauptursache der Ansteckung ist.
Vielleicht nur eine Woche lang, vielleicht aber auch ein Vierteljahr.
So dachte ich — ich, der ich ja auf diesem Gebiete auch noch keine Erfahrung hatte.
Ich dachte nämlich nur an pestverdächtige Schiffe, nur von solchen hatte ich schon gehört.
Ach, was sollte ich noch erleben!
Ich sollte noch kennen lernen, was es heißt, die wirkliche, schon ausgebrochene Pest an Bord zu haben!
Ein Pochen an der Tür unterbrach mein Grübeln, der erste Steuermann trat ein.
»Kapitän, ein Segler ist in Sicht, er signalisiert, dass er schon seit einigen Tagen den größten Wassermangel hat, die ganze Mannschaft ist dem Verschmachten nahe. Ob wir ihm einige Tonnen Wasser abgeben können.«
»Ja, selbstverständlich, aber... habt Ihr ihm denn schon zusignalisiert, dass wir die Pest an Bord haben?«
Der junge Mann erschrak.
»Müssen wir denn das?!
»Na selbstverständlich!
»Es sind doch gar keine Pestkranke mehr vorhanden.«
»Gegenwärtig wohl nicht, aber wissen wir denn, ob wir nicht schon alle die Pestbazillen im Blute haben? Gewiss, das müssen wir dem Schiffe erst melden.«
»Ja, dann können wir doch aber auch keinen Hafen anlaufen.«
»Wir müssen natürlich erst in Quarantäne gehen.«
»Und die Damen?«
»Die müssen natürlich auch so lange bei uns bleiben, da darf niemand von Bord.«
»Wenn wir nun aber gar nicht sagen, dass wir zwei Pestfälle an Bord gehabt haben, oder wenn wir irgendwo an der Küste heimlich landen, dass wir nur erst diese Damen, die sich ja schon zu Tode fürchten, absetzten und...«
Ich mag ein solches Gesicht gemacht haben, dass der junge Mensch ganz erschrocken abbrach.
Ja, ich war plötzlich ganz fassungslos.
»Mensch«, fuhr ich ihn dann an, ihn an der Schulter rüttelnd, »und wenn nun acht Tage später in Mexiko die Pest ausbricht, alles hinwegraffend — glaubt Ihr denn, ich hätte Zeit meines Lebens auch nur noch eine ruhige Sekunde?!«
Jetzt war es der erste Steuermann, der tödlich erschrak. Nein, eine so furchtbare Verantwortung wollte natürlich auch er nicht auf sich laden. Er hatte sich nur gar nichts weiter dabei gedacht, als er jenen Vorschlag machte, hatte nur in seiner jugendlichen Unbedachtsamkeit gesprochen.
»Jesus und alle Heiligen... nein, das will ich nicht!!!«, schrie er entsetzt.
»So geht hinauf und signalisiert dem hilfsbedürftigen Segelschiff, dass wir ihm wohl Wasser abgeben wollen, aber dass wir gestern zwei Fälle von echter Pest an Bord gehabt haben.
Ich ging selbst mit hinauf.
Die Flaggen kletterten in die Höhe.
Auf dem noch weit entfernten Schiffe, welches die Notflagge gehisst hatte, glaubte man wohl, nicht richtig verstanden zu haben.
»Ihr habt die Pest an Bord?«, wurde gefragt.
Wir zeigten die JaFlagge.
Da schwenkten drüben die Masten herum, das Schiff machte schleunigst, dass es aus unserer Atmosphäre kam.
Nein, da doch lieber verschmachten als an der Pest sterben! Gar so nahe mochte der Verschmachtungstod dort auch nicht sein, und da tauchte übrigens schon ein Dampfer auf. Aber das war für mich jetzt Nebensache, mich hatte etwas anderes stutzig gemacht.
Kaum hatte jener Segler noch einmal durch Flaggen gefragt, ob wir wirklich die Pest an Bord hätten, als ich, der ich dicht an der Backbordreling stand, unter mir ein schrilles Lachen hörte.
Es konnte nur aus dem offenen Bullauge — so heißen die kleinen, runden Schiffsfenster — herauskommen, und dieses gehörte zur Arrestzelle, der Lacher war also Pater Cyriax gewesen.
Er hatte zum Fenster hinausgeblickt, hatte die Flaggenfrage gesehen und sich sofort übersetzen können. Dieser alte Mönch, das erwähne ich erst jetzt, besaß nämlich ein fabelhaftes Gedächtnis. Jedes Flaggensignal, das er einmal gesehen hatte, kannte er für immer — ich glaube, er hatte bereits das ganze internationale Flaggenbuch im Kopfe.
Bisher hatte er noch nichts von dem Pestausbruch erfahren, ich hatte meine gewissen Gründe, es ihm zu verheimlichen — — jetzt wusste er es, auch wenn er unsere Bejahung nicht gesehen hätte.
Und nun dieses Lachen, das ich soeben gehört hatte — so heiser und doch so schrill und so furchtbar höhnisch... es kam mir gar nicht wieder aus den Ohren.
Wie von einer geheimen Gewalt getrieben, begab ich mich in die Arrestzelle, zum ersten Male wieder.
Pater Cyriax saß hinter seinem Tisch, regungslos wie immer, auch die Augen hatte er wieder geschlossen.
»Pater Cyriacos!«
Er hatte einmal die Augen geöffnet, nur für einen Moment, aber ein Blick voll von so furchtbarem Hohn und wonnigem Triumph hatte mich getroffen, dass ich es gar nicht beschreiben kann.
»Wie geht es Ihnen?«
Er hatte sicher geplant, seine unerschütterliche Rolle weiterzuspielen, vermochte es aber nicht, die Schadenfreude war doch zu groß.
»Hahaha, die Pest an Bord, die Pest an Bord, hahaha!!!«, hohnlachte er mich an.
Ich hätte ihm doch gleich ein paar in seine Mumienfratze schlagen können, hinwieder entsetzte ich mich fast vor diesem Gesichtsausdruck.
»Sie wissen es?«
»Die Pest an Bord, die Pest an Bord, hahaha!!«, hohnlachte er noch einmal. »Habe ich es denn nicht gleich gesagt? Verflucht sollt ihr sein, ihr und das ganze Schiff! Bis in alle Ewigkeit sollt ihr rastlos durch alle Meere kreuzen, das Land soll vor diesem verfluchten Schiffe zurückweichen!!«
»Na na, das ist nicht so schlimm. Ja, es sind zwei der Weiber an der Pest gestorben...«
»Jawohl, eben diese verfluchten Weiber haben euch die Pest an Bord gebracht!«
»O nein, es waren die Ratten...«
»Die Weiber, die Weiber, diese verfluchten Weiber!«
»Hört, Mann, seid Ihr denn nur wirklich ein Christ?«, brach bei mir jetzt der Zorn durch. »Was haben Euch denn nur diese unschuldigen Mädchen getan?«
»Unschuldig? Hahaha!!! Verflucht sollt ihr sein, bis in alle Ewigkeit, rastlos bis in alle Ewigkeit sollt ihr alle Meere...«
Ich war schon wieder draußen. Was hatte mich albernen Kerl nur dazu getrieben, diesen Mönch wieder aufzusuchen und ihm noch extra etwas von dem Falle mitzuteilen?
Am anderen Morgen bekamen wir Alanka in Sicht.
So schwer es mir wurde — ich musste meinen Pflichten nachkommen — ich führte an Top die gelbe Pestflagge.
Das Meer war hier ziemlich belebt, und wer uns sah, der änderte seinen Kurs, um uns einen Bogen beschreibend, selbst Segelschiffe führten deshalb die schwierigsten Manöver aus, und von dem Deck eines Passagierdampfers verschwanden die Leute plötzlich wie durch Zauberei, stürzten Hals über Kopf unter Deck.
Noch weit draußen auf der Reede, so weit, dass ich auf dem Signalturm der Seewarte durch das Fernrohr noch eben die Flaggen unterscheiden konnte, ließ ich die Segel streichen. Ein leiser Ostwind trieb uns noch ein wenig landeinwärts, aber das konnte ich nicht vermeiden, deshalb brauchten wir noch nicht die Anker fallen zu lassen, auf Segelschiffen, welche keinen Donkey, keine Hilfsdampfmaschine für solche Kraftarbeiten besitzen, ein höchst schwieriges Geschäft — sogar das Fallenlassen der Anker, ganz abgesehen vom Hieven.
Ich nannte durch Flaggen den Schiffsnamen und was sonst noch dazu gehört. Die gelbe Flagge war auf der Seewarte natürlich schon längst erkannt worden; das jetzt hochgehende Signal konnte nur mir gelten, das brauchte nicht erst besonders betont zu werden.
»Pest an Bord?«
»Gehabt.«
»Wann?«
»Seit zwei Tagen.«
»Tote?«
»Zwei.«
»Kranke?«
,Nein.«
»Tote Ratten?«
»Ja.«
»Ankern!«
Ich peilte einen Ankerplatz aus und legte mich fest.
Zwei, drei Stunden vergingen, und kein Sanitätsboot kam, kein neues Signal, gar nichts.
»Habt Ihr schon einmal solch einen Fall durchgemacht, Kapitän?«, fragte mich der erste Steuermann.
»Nein.«
»Wenn die uns nun hier einfach liegen lassen, sich gar nicht um uns kümmern?«
»Das dürfen sie doch nicht «
»Warum nicht?«
Ja, warum nicht? Da wusste ich keine Antwort.
Da kletterten an dem Signalmast der Seewarte abermals die bunten Lappen hoch, mein Schiff wurde angerufen.
Diesmal musste ich alles ausführlich erzählen, alles durch Flaggen; darüber verging eine halbe Stunde.
»Warten!«, hieß es dann.
»Wie lange?«, fragte ich noch an.
Man war so höflich mir eine Antwort zu geben, was man gar nicht nötig gehabt hätte
»Drei Tage«, lautete dann der Bescheid. »Jeden neuen Pestfall sofort melden.«
Drei Tage warten! Ich hielt es ja aus, aber die Damen! Wie die jammerten! Bis sie nicht mehr dazu imstande waren, teilnahmslos in den Ecken kauerten.
Freilich, es ist ja auch so schwer, so ein verpestetes Schiff zu behandeln. Es muss desinfiziert werden, und zwar unter behördlicher Aufsicht. Dazu müssen aber doch erst Sanitätsbeamte an Bord kommen. Und wenn die wieder an Land gehen, so können sie die Pestbazillen doch schon mitbringen, wenn sie selbst auch noch so oft desinfiziert werden — der Argwohn, die Angst ist nun einmal vorhanden, dass sie das ganze Land verseuchen können.
Die Seewarte hatte mir, ehe nur das Schiff behördlicherseits untersucht werden sollte, die lange Wartezeit diktiert, in der Hoffnung, dass ich nicht so lange warten, sondern lieber einen anderen, den nächsten Hafen aufsuchen würde. Was dessen Behörde tat, das ging ja diese hier nichts an — — wenn nicht noch ein Regierungsbefehl hinzukam.
Aber ich blieb. Drei Tage vergingen. Am vierten näherte sich uns ein kleines Dampfboot mit der Sanitätsflagge.
Dass kein neuer Pestfall vorgekommen war, auch sonst alles wohl an Bord sei, das hatte ich stündlich nach der Seewarte melden müssen; in der Nacht war deswegen durch farbige Lichter angefragt worden, heute morgen schon wieder dreimal durch Flaggen, das letzten Mal vor einer Viertelstunde.
In vorsichtiger Entfernung stoppte das Boot und fragte wiederum an, wie es an Bord stände. Ich ließ die Flaggen zum ›Alles wohl‹ zusammenstellen.
Da kam der zweite Steuermann angestürzt, mit ganz bleichem Gesicht.
»Kapitän, Kapitän!«
»Was gibt es?«
Ich wusste es ja schon. Eins der Mädchen hatte wieder die ersten Pusteln bekommen — ein neuer Fall von Pest!
Statt der beruhigenden Antwort ließ ich wieder die gelbe Flagge hochgehen — und zuvor hatte ich einen Knoten hineingeschlagen.
Das sagte genug. Das Sanitätsboot hielt sich gar nicht erst mit weiteren Fragen auf, es floh zurück, und noch ehe es den Hafen erreicht hatte, wurde ich schon von der Seewarte befragt.
»Ein neuer Pestfall?«
Ich musste es noch besonders gestehen, und fünf Minuten später kam der Befehl:
»Sofort Anker lichten! Reede verlassen!
Ich musste gehorchen, außerhalb des mexikanischen Wassers gehen, mich in etwa Kanonenschussweite vom Lande entfernen, und da konnte ich gleich noch weiter gehen.
Und als ich jenen Befehl erhalten hatte, da gellte unter mir aus dem Bullauge der Arrestzelle wieder das schrille, furchtbar höhnische Lachen des alten Mönchs. — — — — — — — — — — — —
Die dritte Leiche, vor wenigen Stunden noch ein blühendes Menschenleben, jetzt entsetzlich entstellt, war versenkt worden.
Mit gerungenen Händen kauerten die armen Mädchen da, verzweifelt vor sich hinstierend... und da bemerkte ich auch eine Umwandlung unter den Matrosen.
Der erste Enthusiasmus war schon längst vorbei, die Lage war ja ernst genug, jetzt aber blickten die Mönche in ganz besonderer Weise vor sich hin.
»Pater Cyriacos hat unser Schiff verflucht! Rastlos wie der ewige Jude müssen wir auf diesem Schiffe durch alle Meere irren, wir abtrünnigen Mönche, selbst ohne sterben zu können, von jetzt ab bis in alle Ewigkeit — Peter Cyriacos hat es gesagt!«
So hörte ich murmeln, nicht nur einmal.
O weh, so war das aus der Arrestzelle herausgekommen! Ich forschte nicht nach, wie es geschehen war. Es war ja einfach genug.
Ich nahm die Mönche vor.
»Torheit! Glaubt doch nicht an solche Gespenster! Dass die Pest ausbricht, das kann auf jedem Schiffe vorkommen. Kein menschlicher Fluch kann so etwas erzeugen, das wäre ja noch schöner. Ihr habt sie im letzten Hafen mit Ratten an Bord bekommen.«
Einigermaßen gelang es mir, die abergläubische Gesellschaft wieder aufzurichten.
»Ja, wohin aber nun?«
»Na, einfach nach einem anderen Hafen, wo es keine solche mexikanischen Angsthasen gibt. Man muss uns doch irgendwo aufnehmen, wir können doch nicht schließlich verhungern und verdursten. Wir wollen nach San Francisco gehen, dort gibt es ganz andere sanitäre Einrichtungen als hier, in dieser Hauptstadt des amerikanischen Westens pfeift überhaupt ein ganz anderer Wind.«
Einen Gehilfen bei diesem Bestreben, die Leute zu beruhigen, hatte ich auch an Zephyros. Der Jüngling war der einzige, der die Sache nicht tragisch nahm, dem Fluche des Paters auch keine Bedeutung schenkte.

Außerdem waren ja auch noch meine vier Matrosen sowie der fremde Steuermann, Frank mit Namen, und seine sechs Leute da, die wir aufgefischt hatten. Von diesen ist nichts weiter zu sagen, als dass sie das Verhängnis verwünschten, das sie an Bord dieses Pestschiffes geführt hatte, und drei von meinen Matrosen halfen ihnen redlich mit beim Fluchen. Sie holten alles nach, was sie an Bord des Mönchsschiffes bisher versäumt hatten.
Nur der Schwede bildete eine Ausnahme. Der stand mir in allem treulich bei und benahm sich überhaupt in einer Weise, dass ich ihn einmal fragte, was er denn früher gewesen sei.
»Ich bin vom Schiffsjungen an gefahren«, lautete Swens Antwort.
»Was war denn Ihr Vater?«
Ich redete ihn schon per Sie an, ganz unbewusst, das war es ja eben.
»Lehrer.«
»Sie müssen doch eine höhere Schule besucht haben.«
Ja, er war in Stockholm ins Gymnasium gegangen, bis zur Obersekunda. Er hatte immer Lust zur See gehabt, Vater hatte es nicht erlaubt — da war er bei Nacht und Nebel davongelaufen. Natürlich — man muss wirklich ›natürlich‹ sagen — hatte er beim Abschied einen Griff in des Vaters Kasse gemacht. Und ebenso natürlich war er dann der verlorene Sohn gewesen, womöglich mit dem Fluche des Vaters beladen.
Ach, wie vieler Knaben Los ist das! Glücklicherweise kümmert sich der Himmel erfahrungsgemäß nicht um die solchen Motiven entsprungenen Flüche, es ist nicht einmal nötig, dass der Mutter Segen sie aufhebt. Wenn jemand Prügel verdient, dann sind es diese kurzsichtigen Väter mit ihrer fluchwürdigen Engherzigkeit. So wird mancher brave Junge ganz unschuldig hinausgestoßen, wird von den Eltern geradezu erst zum Verbrecher gemacht. Denn in geordnete Verhältnisse kommt so ein jugendlicher Ausreißer natürlich nicht hinein, fast immer fällt er in die allerschlechtesten Hände. Und er kann doch nichts dafür, wenn Gott ihm solch eine Abenteuerlust, einen heißen Drang zur See und in die weite Welt gegeben hat. Denn was man da immer hört, von Verführung durch gewisse Jugendschriften, Indianerschmöker, Seeräubergeschichten und dergleichen, das ist doch alles Mumpitz. Das glaubt kein Mensch, der wirklich selbst denken kann — ihre Zahl mag allerdings nicht groß sein. Sonst schwatzt das eben einer dem anderen nach. Als es noch gar keine Druckerpresse gab, sind die Jungen schon genau so davongelaufen, waren die Väter genau so dumm und engherzig.
Wenn man einen solchen Kerl, der sich geistig und körperlich zum Seemannsberufe eignet, in geordneten Verhältnissen zur See abgehen lässt — weiß man denn gar nicht, was aus solch einem Jungen alles werden kann? Aber die Fühlung mit der Heimat, mit dem Elternhaufe muss er behalten!!!
Nein, das weiß man eben nicht! Man staunt wohl so einen Marineoffizier an, dem kein Landoffizier das Wasser reichen kann, mit 25 Jahren schon Kapitänleutnant, das ist Hauptmann, befähigt zum Führen eines Kanonenbootes, eines Torpedojägers, immer Geld in der Tasche, keine Schulden, der weiß nichts vom ewigen Dalles, braucht nicht immer nach einer reichen Frau zu suchen — man beobachtet mit heimlichem Neide solch einen Handelskapitän, wie der an Land auftritt; er ist auch wirklich ein kleiner König. Selbst ein sich ordentlich haltender Matrose ist ein Kerl, in dessen Gegenwart, wenn er spricht, alle Spießbürger das Maul halten... aber wenn der eigene Sohn Lust zur See hat, dann wird ihm klar gemacht, was für ein verbrecherisches Gesindel das Matrosenvolk ist, Vagabunden und Strolche, nicht würdig, auf dem Lande zu leben, der Abschaum der Menschheit, und so weiter, und so weiter.
Ja, es ist wirklich sehr nötig, dass man einmal darüber spricht! Kein anständiger Mensch — von einem Seemanne gar nicht zu sprechen, dem gegenüber wagen sie's ja auch gar nicht — darf solch eine Beschimpfung, die doch die ganze Nation betrifft, ruhig hinnehmen. Das ist nichts Anderes, als wenn jemand verächtlich über den Bauer spricht, der uns alle ernährt, und was für viele Faulenzer noch obendrein! Man muss solche Ansichten, engherziger Dummheit entspringend, bekämpfen, und das ganz energisch. Man müsste solch einen Geist gleich mit der Nase in den heißen Kaffee titschen und ihm die Tabakspfeife um die Ohren schlagen. Wo bekämst du denn diese dir unentbehrlichen Genüsse her, wenn nicht brave Teerjacken in Sturm und Wetter über alle Meere kreuzten?
Nein, ihr frischen Jungen, lasst euch nicht irre machen, wenn euch nach beendeter Schulzeit Unwissenheit und Engherzigkeit nicht zur See gehen lassen wollen. Hoch lebe Back- und Steuerbord! Zur See, da ist der Mann noch was wert! Der Seemannsberuf fordert noch immer den größten Mut und die größte Pflichttreue — und wie wenig Prozent von den Menschen bereit sind, für seinen Nächsten mit Hintansetzung des Lebens das Beste hinzugeben, was man geben kann, das zeigt, wie übervölkert die zivilisierten Länder sind, und wie groß der Mangel an Händen zur See ist — und auch an Köpfen, das heißt, an Gehirn. Denn wo sind denn unter den Marineoffizieren die hochklingenden Namen? Man findet verflucht wenige. Jaaa, das ist nicht so einfach wie bei der Kavallerie, in der Marine muss man noch mehr lernen als bei der Artillerie, sogar mehr noch als beim Ingenieurkorps. Da reicht die Kenntnis der erdphysikalischen Gesetze nicht aus, da kommt auch die Astronomie stark in Betracht, da wird mit fünfzehnstelligen Logarithmen gerechnet!
Und schließlich noch eins: Wenn du — was aber wohl erst in reiferen Jahren eintritt — von dem heißen Wunsche beseelt wirst, dich in einem fremden Erdteile als Kolonist niederzulassen, mitten in der Wildnis ein freies Farmerleben zu führen, wo kein Steuereintreiber hinkommt, so ein bisschen abenteuerlich dabei — tu es! Geh mit Gott! Lass dich nicht von anderen Menschen beeinflussen. Was für Menschen das sind, die dir abreden wollen? Herdenmenschen! Du aber bist ein Original, du sonderst dich als Einziger von hunderttausend Herdenmenschen ab. Dass dich diese Hunderttausend einen Narren nennen, ist selbstverständlich, so ist's immer gewesen. In Wirklichkeit aber ist es umgekehrt. Und dann wisse eins: Wenn du nur eine einzige Quadratrute unfruchtbaren Landes umgegraben und mit deinem Schweiße gedüngt hast, ehe du von den Wilden massakriert wirst oder am Fieber verreckst — du bist ein nützlicheres Mitglied der menschlichen Gesellschaft gewesen als so ein Pillendreher oder Schönheitstinkturenfabrikant, der in einem sechsstöckigen Hause viele hundert Arbeiter und Arbeiterinnen beschäftigt, du hast mehr geleistet als jeder Schnapsbrenner, der als Kommerzienrat mit Orden vorne und hinten behangen ist, du hast den Zweck erfüllt, wozu du auf die Erde gesetzt worden bist, du bist als Pionier, ja, als Führer der Menschheit den Heldentod gestorben — und die ewigen Sterne haben es gesehen! —
Doch nun genug davon! Mir läuft der Schweiß von der Stirn.
Der schwedische Lehrersohn hatte es noch nicht bis zum Steuermannsexamen gebracht, weil er seine Heuer immer versoffen hatte. Oder sonst verlumicht! Das erzählte er ganz offen. Ja, du lieber Gott, soll auch ein Matrose sparen!
Elf Tage lang mussten wir gegen ungünstigen Wind aufkreuzen, bis wir in der Nacht die Feuer von San Francisco erblickten.
Ein Pestfall war unterdessen nicht wieder vorgekommen, keine Andeutung davon. Da konnte man uns doch nicht mehr lange in Quarantäne behalten. Ich hatte sogar täglich im Logbuch vermerkt, dass sich keine Erkrankung irgend welcher Art bemerkbar gemacht hatte, auch die Ratten liefen ganz fidel und munter herum, und es sei nochmals bemerkt, dass jedes in das Logbuch eingetragene Wort als Eid gilt. Bei falscher Eintragung wird man so schwer bestraft wie bei vorsätzlichem Meineid.
Wenn ich das am nächsten Tage gemeldet hatte, kam einfach ein Sanitätsboot, das ganze Schiff wurde, noch draußen auf Reede, tüchtig ausgeräuchert, sodass auch gleich alle Mannschaft und Passagiere ausgeräuchert wurden, dann kamen die letzteren an Land, wurden noch eine kleine Weile im Hospitale isoliert und beobachtet, desgleichen wir, die Besatzung, und die Sache war wieder in Ordnung. Wenn wir dann nicht mehr an Bord zurückgingen, so war das unsere Sache.
So sagte ich mir in Gedanken, während ich das Ankermanöver leitete, noch im freien Wasser, auf Reede. Da kam die Tanzdirektorin auf mich zugestürzt.
»Kapitän, Kapitän!!«
Ach, diese böse Ahnung, als ich sie nur kommen sah!
»Doch nicht wieder...«
»Die Miss Lucy...«
Nun wusste aber auch ich bald nicht mehr, was daraus noch werden sollte!
Anstatt dass ich bei Sonnenaufgang etwas von den elf pestfreien Tagen signalisieren konnte, musste ich die gelbe Flagge mit einem Knoten hissen — und außerdem meldete mir noch Swen, der auf Wache gewesen, sogar gewissermaßen als mein Stellvertreter, dass um Mitternacht meine drei anderen Matrosen nebst den sechs fremden unter Steuermann Frank in einem Boote auf und davon gegangen waren. Sie hatten das Land in anderer Weise erreichen wollen, um nicht erst der Quarantäne unterworfen zu werden.
»Und das erfahre ich erst jetzt?!«
»Ich wollte Sie nicht deswegen wecken.«
»Ja, warum denn nicht? Habt ihr denn die Kerls nicht daran gehindert?!«
»Die Mönche taten es nicht, die fanden es ganz in der Ordnung, dass die Fremden von Bord gingen...«
»Und Ihr?«
»Ich dachte dasselbe.«
Ich konnte ihm keine Vorwürfe machen, auch nicht mit äußerlichen Worten, um die Würde des Kapitäns zu wahren.
»Was mögen die denn...«
Da schon wieder dieses schrille, furchtbar höhnische Lachen, aus dem offenen Bullauge der Arrestzelle kommend.
Die Signalwarte hatte mich angerufen, ausführlicher wissen wollend, ob die gelbe Flagge mit dem Knoten bedeuten solle, dass mein Schiff einen Pestkranken an Bord habe.
Pater Cyriax hatte die Frage gelesen, hatte mir durch sein Lachen wiederum seine Meinung gesagt.
Zunächst wurde ich, nachdem ich die bejahende Antwort diktiert hatte, von einem anderen Gedanken erfasst.
»Wer hält denn da jetzt vor der Arrestzelle Wache?!«
Ich hatte hierzu niemals Mönche zugelassen, sondern als Posten immer meine oder jene fremden Matrosen genommen, hatte hierfür meine guten Gründe.
»Ich habe zwei Mönche davor gestellt.«
»Die haben auch den Schlüssel?«, fragte ich fast erschrocken.
»Nein, den habe ich gleich an mich genommen, hier ist er.«
»Ah, sehr gut! Swen, Ihr seid ein Patentkerl...«
»Aber ich kam doch zu spät, konnte es nicht mehr verhindern.«
»Was konntet Ihr nicht verhindern?«, fuhr ich empor.
»Dass der zweite Steuermann, Pater Rufos, nicht doch die Arrestzelle betrat.«
»Verflucht!!«, entschlüpfte es mir.
»Die beiden Matrosen, die zuletzt davor gestanden hatten, verließen auf einen leisen Signalpfiff einfach ihren Posten, das war ja alles schon abgemachte Sache. Der eine hatte den Schlüssel in der Tasche, der zweite Steuermann erinnerte ihn daran, erhielt den Schlüssel. Daraufhin ist Pater Rufos sofort in die Arrestzelle gegangen und hat mit dem Gefangenen längere Zeit gesprochen. Ich erfuhr es erst hinterher — dann allerdings habe ich den Steuermann sofort hinausgejagt und mir den Schlüssel angeeignet. Es kam zwischen uns zu einer kleinen Szene — never mind.«
»Und was haben die beiden miteinander gesprochen?«
»Das weiß ich nicht. Ich kalkuliere, der zweite Steuermann möchte es Euch selbst sagen.«
Ja, so stand Pater Rufos auch da, etwas seitwärts, nur darauf wartend, dass ich mit dem Schweden fertig wäre, um mich dann zu attackieren — — und auch die anderen Kuttenmatrosen standen alle so eigentümlich herum, so gedrückt, ich merkte gleich, dass etwas nicht im Lote war. Nur Zephyros konnte ich nicht sehen. Er war wohl auf der Kommandobrücke.
»Es ist gut, Swen. Ihr könnt übrigens hier bleiben. Zweiter!!«
Pater Rufos kam angerückt, wie ein Hund, der Schläge fürchtet, und zwar wie ein Köter, der auch dem eigenen Herrn ab und zu die Zähne zeigt.
»Ihr habt mit dem Gefangenen gesprochen, Steuermann?«
»Darf ich das etwa nicht? Pater Cyriacos ist vor allen Dingen mein kirchlicher...«
»Halt, halt, halt, halt!!! Ich mache Euch doch gar keine Vorwürfe. Ich will nur wissen, was Ihr mit ihm gesprochen habt. Aber ändert Euer Betragen — ein bisschen offener und trotzdem zurückhaltender. Die Pest ändert an der Schiffsroutine nichts. Nun, was hat Euch der in Eisen liegende Reederagent gesagt? Ich hoffe, ich darf es erfahren.«
Der schon etwas ältliche Pater hatte sich aus seiner kriechend bissigen Haltung empor gerichtet.
»Ja, Ihr sollt es erfahren...«
»Immer kurz!«
»Diese Weiber müssen von Bord!«
»Selbstverständlich, sie müssen ins Hospital kommen, und wir alle mit.«
»Nein, wir nicht.«
»Was?«
»Sobald die Weiber von Bord sind, ist die Pest erloschen.«
»Wer sagt denn das?«
»Pater Cyriacos.«
»Woher will der es wissen?«
»Er hat es im prophetischen Geiste gesehen.«
»Der besitzt einen prophetischen Geist?«
»Sehr oft.«
»So. Das ist mir neu. Nur schade, dass die Hafenbehörde von San Francisco dem prophetischen Geiste keinen Glauben schenken wird.«
»Braucht es ja auch nicht.«
»Wie meint ihr das?«, blieb ich ganz ruhig.
»Wir geben nur die Weiber ab, dann ist der Fluch von uns genommen.«
»Und ihr? Wir?«
»Wir begeben uns nach Athos zurück.«
»So habt ihr euren Entschluss, in Amerika ehrsame Farmer zu werden, geändert?«
»Ja, einstimmig.«
»Das ist nicht wahr!«, erklang es von der Kommandobrücke herab.
Zephyros zeigte sich auf ihr.
»Was ist nicht wahr?«, fragte ich hinauf.
»Dass dieser Entschluss ein einstimmiger ist. Ich selbst stimme nicht mit bei, ich kehre nicht nach Athos zurück.«
Es gefiel mir sehr, dass der Jüngling, der sich sonst so feurig zeigte, jetzt ganz sachgemäß sprach, ohne jedes Pathos. Es wirkte nur umso mehr.
»Frater Zephyros hat da gar nichts zu sagen«, ließ sich der zweite Steuermann wieder vernehmen, »er ist Frater, nur als solcher kommt er hierbei in Betracht, hat nur eine Stimme. Sein Rang als erster Steuermann hat gar nichts zu sagen.«
Der Jüngling blieb ihm die Antwort schuldig, ging auf seinen Posten, auf dem er von hier aus unsichtbar war, und das gefiel mir wieder sehr an ihm.
»Also, ihr wollt euch nach Athos zurückbegeben?«, nahm ich wieder das Wort.
»Ja.«
»Und pater peccavi sagen — Vater, ich habe gesündigt, sei wieder gut mit mir?«
»Ja.«
»Wenn der Vater aber nicht sogleich wieder ganz gut mit euch ist, euch wenigstens erst — mit Respekt zu sagen — den Hintern tüchtig aushaut?«
»Dass wir bestraft werden, und zwar furchtbar, wissen wir. Wir müssen alle nicht nur wieder als unterste Klosterdiener anfangen, sondern auch die härtesten körperlichen Züchtigungen über uns ergehen lassen.«
»Ja, weshalb zieht ihr da nicht lieber ein freies Farmerleben vor?«
»Es wird uns nie gelingen,«
»Weshalb nicht?«
»Das Land nimmt uns nicht an.«
»Weshalb nicht?, muss ich da immer wieder fragen.«
»Pater Cyriacos hat seinen Fluch über uns ausgesprochen, und er nimmt ihn nicht zurück.«
»Was für einen Fluch?«, wollte ich noch einmal das Nähere hören.
»Rastlos bis in alle Ewigkeit müssen wir auf diesem Schiffe durch alle Meere kreuzen, das Land wird vor uns zurückweichen...«
»Schon gut, schon gut«, unterbrach ich die Deklamation. »Ihr meint, wir würden überhaupt nie wieder das Land betreten können?«
»Nie wieder.«
»Mit keinem Fuße?«
»Mit keinem Fuße.«
»Nun, diese Prophezeiung soll sehr bald zuschanden gemacht werden...«
»Niemals! Ich kenne Pater Cyriacos' Prophetengeist. Alles, alles ist noch immer in Erfüllung gegangen.«
»Das werden wir ja noch heute Morgen sehen. Nun aber erst etwas anderes. Die Damen kommen an Land, hierüber herrscht doch gar kein Zweifel. Dann hat der fluchende Prophet seinen Willen durchgesetzt, die ihm widerwärtigen Frauenzimmer sind von Bord, und so könnte er uns doch verzeihen.«
»Das ist ganz gleichgültig, so oder so.«
»Was meint ihr mit dem so oder so?«
»Würden wir sie nicht an Land bringen, so würden sie nach und nach sterben.«
»Nun gut, meinetwegen...«
»Woher kommt es denn, dass noch keiner von uns, auch keiner von den fremden Matrosen, also noch kein Mann an der Pest gestorben ist, nicht davon befallen wurde? Weshalb nur immer die Weiber?«
»Einfach ein Zufall, Frauen mögen für die Pest mehr disponiert...«
»Nein, weil eben nur die Weiber entfernt werden sollen, es ist Gottes Wille, wir selbst aber müssen bis in alle Ewigkeit...«
»Mann, unterbrecht mich nicht immer!!!«, wurde ich jetzt ungeduldig. »Und wenn Ihr in meiner Gegenwart noch einmal den Namen Gottes aussprecht, dann kriegt Ihr eins in die Schnauze! Verstanden?«
»Ja«, wurde ganz gelassen bestätigt.
»Also die Hauptsache ist: Pater Cyriax fordert, ihr sollt nach Athos zurückkehren?«
»Ja. Athos war ja überhaupt unser Ziel.«
»Und ihr... Lämmerschwänze wollt ohne Weiteres gehorchen?«
»Was bleibt uns Anderes übrig?«
»Nun gut! Aber wir müssen doch in Quarantäne gehen.«
»Wir kommen ins Hospital?«
»Na sicher!«
»Wir werden das Land mit keinem Fuße betreten — nicht eher als in Athos.«
»Ihr wollt euch weigern, hier das Land zu betreten? Mann, seht dort die Batterie! Wir erhalten den Befehl, dort und dort vor Anker zu gehen, wahrscheinlich an einem öden Küstenstrich, und sobald wir Miene machen, wieder die offene See zu gewinnen, knallt dort ein Kanonenschuss, und wenn wir dann noch nicht gehorchen, kommt eine Granate geflogen, die den Segenswunsch dieses edlen Paters, dass wir bis in alle Ewigkeit herumgondeln sollen, ohne leben und sterben zu können, alsbald zuschanden machen wird. Dieses Pestschiff wird in den Grund geschossen, wir ersaufen wie die Ratten. Das ist man der ganzen Menschheit schuldig, auch auf offener See sind und bleiben wir eine furchtbare Ansteckungsgefahr.«
»Wir werden nicht sterben.«
»Ihr meint, uns Pestverdächtige wird jemand auffischen? Da irrt Ihr Euch!«
»Wir werden niemals zu schwimmen brauchen. Dieses Schiff kann gar nicht in den Grund geschossen werden.«
»Ihr meint, die werden ihr Ziel verfehlen? Oho, passt mal auf, wie schnell das Gegenteil erfolgen wird. Denn hierbei hört jeder Scherz auf, da wird jede Drohung gleich ernst genommen.«
»Und ich sage Euch — mit allem Respekt, Herr Kapitän — wir werden mit keinem Fuße das Land betreten — nicht eher, als bis wir in Athos landen.«
»Nun, das werden wir ja gleich sehen. Vorläufig aber habe ich noch das Kommando, ich! — und es kommt mir gar nicht darauf an, einmal zu prüfen, ob ihr wirklich unsterblich seid, ob einer von euch auch gegen eine Revolverkugel gefeit ist.«
Drüben gingen wieder die Flaggen hoch, sie wollten Näheres wissen.
Ich musste berichten, dass die Pestkranke, die im Ölbad steckte, im sterben begriffen war, natürlich auch, dass zehn Matrosen schon im Boote das Land zu gewinnen versucht hatten. Ich hatte es nicht hindern können. Die Folgen musste ich als verantwortlicher Kapitän natürlich tragen. Aber das konnte nicht schlimm werden.
»Sind die zehn Matrosen vielleicht schon gefasst worden?«, fragte ich einmal außerdienstlich.
»Ja.«
Na, dann konnte ich erst recht beruhigt sein.
»Wie viele Passagiere sind an Bord?«
»Fünfzehn Damen.«
»Die Pestkranke mit einbegriffen?«
»Ja.«
»Wird sie sterben?«
»Ja.«
»Was ist euer Ziel?«
Mir kam diese Frage recht unverständlich vor. Ich nannte Athos.
»Habt ihr noch genug Proviant und Wasser, um dorthin zu gelangen?«
Diese Frage war mir noch viel, viel unverständlicher.
»Ja.«
»Das Sanitätsboot geht ab.«
Die Unterhaltung war beendet.
Ich hatte Zeit zum Nachdenken. Ich war ganz baff. Das sah doch fast aus, als ob...
Da sah ich schon den kleinen Dampfer mit der Sanitätsflagge kommen, das lenkte meine Gedanken ab.
Ich habe diese Sanitätsbeamten und Polizisten, die solche verseuchte Schiffe betreten müssen, stets bewundert. Was für furchtbaren Gefahren sind sie ständig ausgesetzt! Und da ist nicht etwa von einer besonderen Bezahlung die Rede, etwa so, wie in Cholerazeiten Krankenwärter und Totengräber hohe Prämien erhalten, weshalb sich meist lauter Vagabunden zur Verfügung stellen, denen am Leben nichts gelegen ist, die die Gelegenheit, sich einmal sogar nach gesetzlicher Vorschrift den Magen voll Schnaps pumpen zu dürfen, mit Freuden ergreifen. Diese Hafenbeamten können zwar dazu nicht kommandiert werden, sie müssen sich freiwillig zu diesem gefährlichen Dienst melden, und das ist es ja eben, jede Furcht vergrößert nur die Ansteckungsgefahr. Nur schade, dass sie da nicht besser als die anderen Beamten bezahlt werden. Hinwiederum ist eben eins vom anderen abhängig, diese Opferwilligkeit muss absolut aus dem Herzen kommen. Eben deshalb melden sich nur wirkliche Samariter, und höchst, höchst selten einmal, dass ein solcher ein Trinkgeld annimmt, während die anderen Hafenbeamten sonst immer die Hand auf dem Rücken offen halten. Es sind eben wirklich ganz andere, hochedle Charaktere, und dass sich solche gerade unter den niederen Beamten und Arbeitern finden, daran wird wohl kein Redlichgesinnter zweifeln.
Das schon von weitem nach Karbol duftende Boot legte bei, die von Karbol triefenden Männer stiegen an Deck, der höchste Sanitätsbeamte nahm das Protokoll auf.
Unterdessen starb die vierte Tänzerin. Auch ihre Leiche wurde an Land gebracht, um dort verbrannt zu werden. Denn nicht einmal auf offener Reede, die aber schon zum nationalen Gewässer gehört, durfte sie versenkt werden, so sehr fürchtete man die Ansteckungsgefahr. Dann nahm man die Tote lieber erst an Land und verbrannte sie dort, natürlich ganz, ganz abseits von allen menschlichen Wohnungen.
So glaubte ich wenigstens, der ich doch die Bestimmungen hierüber kannte. Das war alles zum Kapitänsexamen nötig gewesen.
Ich sollte mich aber irren, es sollte alles ganz anders kommen.
»Die Damen nehmen wir mit, nicht jedoch die Leiche, auch die nicht, welche schon im Verdachte der Ansteckung stehen. Die Damen müssen sich einer genauen ärztlichen Untersuchung unterwerfen.«
»Nanu, seit wann gibt es denn solche Bestimmungen?!«, rief ich überrascht, mich dabei noch nicht einmal richtig ausdrückend.
»Sie kennen diese neuen Bestimmungen noch nicht? Ja, das ist leicht begreiflich. Wir haben sie auch erst gestern bekommen, ich habe Ihnen ein Exemplar gleich mitgebracht. Hier ist es. Es sind die Bestimmungen der letzten internationalen Seekonferenz, die zu London getagt hat. Die größten Änderungen hat die Behandlung von Schiffen erfahren, die eine epidemische Krankheit an Bord haben oder auch nur dessen verdächtig sind.«
Ich hielt die umfangreiche Broschüre in der Hand, konnte jetzt nicht gleich nachlesen.
»Ja, was soll denn da aus der Leiche werden?«
»Die müssen sie mitnehmen, draußen im Meere versenken, mindestens acht Seemeilen von der Küste entfernt.«
»Mitnehmen?!«
»Gewiss.«
»Ja, kommen wir denn nicht in Quarantäne?«
»Nur die Passagiere, soweit sie noch gesund sind. Ein pestverdächtiges Schiff wird von keinem fremden Hafen mehr aufgenommen, es muss in seinen Heimathafen zurückkehren, der es natürlich annehmen muss. Sie haben sofort, nachdem Ihnen die Passagiere abgenommen sind, die Anker zu lichten und die Reede zu verlassen.«
Der zweite Steuermann befand sich mit in der Kajüte, ich blickte ihn an — und er mich — und ich sah seinen wahrhaft triumphierenden Blick, und in diesem Moment empfand ich gegen den Mönch etwas von dem Hasse des Besiegten gegen den Sieger.
»Ja, wenn aber nun das Schiff nicht genügend Proviant und Wasser hat, um seinen Heimathafen zu erreichen?«
»Dann natürlich muss es mit beidem versehen werden. Aber in den Hafen kommt es nicht, auch nicht sonst wie ans Land heran.«
Diesmal fühlte ich den triumphierenden Blick des Paters förmlich auf mir ruhen.
»Wenn es nun nicht mehr seetüchtig ist, um die Heimreise ausführen zu können?«
»Begutachtet die Prüfungskommission, dass es unheilbar wrack ist, wird es versenkt.«
»Und die Matrosen?«
»Na, die müssen dann natürlich an Land genommen werden.«
»Und wenn es zu reparieren ist?«
»Dann wird es auf die nächste Sandbank geschleppt und macht dort seine Quarantäne durch. Die Zeit dafür ist jetzt verdoppelt worden.«
»Das sind ja nette Bestimmungen!«
»Sind sie nicht gerade recht human?«
»Ja, doch«, musste ich schließlich beistimmen.
»Das gilt«, fuhr der Sanitätsbeamte fort, »aber nur für die regelrecht angemusterte Mannschaft. Sie sind doch erst selbst als Schiffbrüchiger hier an Bord gekommen, Herr Kapitän?«
Das hatte ich ja bereits nach der Seewarte signalisiert, die Meldung, dass ich nur stellvertretender Kapitän war, hatte mit das Allererste sein müssen.
»Dann werden Sie in diesem Falle auch mit zu den Passagieren gerechnet, ebenso jeder andere Matrose, der schiffbrüchig oder sonst wie während der Reise an Bord gekommen ist, und zwar auch dann, wenn er unterwegs, aber noch vor Ausbruch der Krankheit, einen sonst gültigen Musterungsvertrag unter der Hand abgeschlossen hat. Ausbruch von Pest usw. hebt diesen Vertrag wieder auf, der Matrose ist mit als Passagier zu betrachten, darf das Schiff verlassen, muss an Land genommen werden. Das steht alles ausführlich in den Bestimmungen, und ist das nicht sehr human, Herr Kapitän?«
»O doch! Also ich darf das Schiff verlassen?«
»Wie ich sage. Natürlich kommen Sie in Quarantäne, aber ganz komfortabel, ins Hospital.«
»Ja, wer soll denn das Schiff dann weiterführen? Ein Steuermann?«
»Nein, sobald ein Schiff einmal von einer Hafenbehörde erreichbar ist, muss es auch einen regelrechten Kapitän bekommen, falls dieser fehlt, gerade in solch einem Falle.«
»Ja, woher soll denn der aber kommen?«
»Man muss ihn suchen. O, hier in San Francisco gibt es schon stellenlose Kapitäne genug, die auch ein Pestschiff nicht fürchten. Natürlich wird eine höhere Heuer beansprucht.«
»Ja, hier in San Francisco — — wenn es aber in einem Hafen keinen solchen opferwilligen Kapitän gibt?«
»Dann wird ein Hafenbeamter, der das Kapitänspatent besitzt, was bei den höheren ja meist der Fall ist — auch ich habe es — einfach dazu kommandiert.«
Ich blickte den Sprecher an — es war ein grauhaariger Mann mit einem hässlichen Gesicht — von Pockennarben entstellt und die Nase ganz zerfressen — aber diese Augen, diese seelenvollen Augen!
Ich richtete mich empor.
»Nun, da braucht man nicht erst lange zu suchen. Ich bleibe selbstverständlich an Bord, bringe das Schiff in seinen Heimathafen.«
Der Sanitätsbeamte, aber kein Arzt, sondern ein echter Seemann, nur der Führer dieser Gesundheitskolonne, blickte mich an, und die schönen Augen leuchteten auf, dass sie das ganze, sonst so hässliche Gesicht verschönten.
»Ist das Ihr fester Entschluss?«
»Der sich nicht ändern wird.«
»Sie müssen hier unterschreiben.«
»Geben Sie her!«
»Und auch ich bleibe«, ließ sich da Swen vernehmen.
Ich reichte ihm übern Tisch mit herzlichem Drucke die Hand.
»Halt!«, rief da Pater Rufos mit pathetischer Armbewegung.
Der Beamte hielt mit Schreiben ein.
»Was wünschen Sie?«
»Ich protestiere!«
»Gegen was?«
»Dass Kapitän Novacasa fernerhin dieses Schiff führt.«
Ich sagte gar nichts, und das war auch das Beste. Dieser Beamte wusste schon, was er zu tun hatte, und er war doch auf meiner Seite.
»Mit welchem Rechte protestieren Sie hiergegen?«
»Ich bin geweihter Pater der Klosterrepublik vom heiligen Athos, dieses Schiff ist Eigentum dieser Klostergemeinde...«
»Das kommt hier gar nicht in Betracht, dieses Schiff steht wie jedes andere unter den internationalen Seegesetzen, die ich hier vertrete. Was für einen Rang bekleiden Sie hier?«
»Ich bin Steuermann.«
»Erster oder zweiter?«
»Zweiter.«
»Na, mit welchem Rechte sprechen Sie denn da so? Auch als erster hätten Sie ohne Weiteres keins. Oder besitzen Sie selbst das Kapitänspatent? In diesem Falle wäre es allerdings etwas Anderes, dann könnten Sie die Führung des Schiffes übernehmen. Sind Sie schon Kapitän?«
»Nein.«
»Oder haben Sie über diesen Kapitän eine Beschwerde vorzubringen?«
Der alte Pater, der aber nicht so furchtbar dürr war, marterte offenbar seinen Kopf ab, gegen mich etwas zu finden. Das war so offenbar, dass ich fast lachen musste.
»Nein«, musste er dann gestehen.
»Dass Kapitän Novacasa etwa unwürdig ist, dieses Schiff zu kommandieren?«, kam ihm der unparteiische Schiedsrichter auch noch zu Hilfe.
»Ja, er ist dessen unwürdig!«, sagte der fromme Pater jetzt plötzlich.
»Inwiefern?«
»Er flucht.«
»A bah! Das verstößt nicht gegen die internationalen Seegesetze, auch nicht gegen die des Landes, soweit die hier in Betracht kommen. Sonst können Sie nichts weiter gegen ihn vorbringen?«
»Er flucht gotteslästerlich.«
»Ein anderes Fluchen habe ich überhaupt noch nicht gehört.«
»Er flucht entsetzlich.«
»Das ist erstens nicht wahr«, mischte ich mich jetzt einmal ein, »und zweitens...«
»A bah!«, wurde auch ich unterbrochen von dem, der gar kein so einfacher Sanitätsbeamter war, wie ich dann erfuhr, sondern hier die Rolle eines Allmächtigen spielen durfte. »Vergeuden wir doch nicht die Zeit mit solchem larifari. Sie haben also nichts gegen ihn vorzubringen und so müssen Sie ihn auch als Kapitän annehmen. Seine Abweisung ist überhaupt nicht so einfach, wie Sie sich wohl denken. Da müsste erst der Bescheid der Reederei eingeholt werden...«
»Der Stellvertreter der Reederei ist hier an Bord!«, rief der Pater.
Der Beamte machte ein etwas verdutztes Gesicht.
»Ja. wo denn?«
»Er liegt in Eisen«, erklärte ich.
»In Eisen?! Warum denn?«
»Weil ich ihn in Verdacht hatte, dass er das Schiff versenken wollte.«
»Weshalb das?!«
»Aus Aberglauben, um eine Prophezeiung von sich selbst zu erfüllen.«
Der alte Herr war jedenfalls von leichten Begriffen — was mochte er nicht alles an Bord von zu unterziehenden Schiffen erlebt haben! Man muss nur bedenken, dass nach San Francisco sehr viele Dschunken und andere Schiffe mit chinesischen Auswanderern kommen, und wie man mit dieser Lügenbande umgehen muss! — und er war über weitere Neugier erhaben.
»Wenn der Stellvertreter der Reederei an Bord ist, so ist das eine andere Sache, der braucht Sie nicht als Kapitän anzunehmen, er kann Sie im nächsten Hafen entlassen, einen anderen verlangen, ohne einen Grund anzugeben.«
Wieder fühlte ich den höhnisch triumphierenden Blick des Paters.
»Aber er muss erst aus seiner Haft entlassen werden«, setzte der Beamte noch hinzu, und des Paters triumphierender Blick schwächte sich schon etwas ab.
»So entlassen Sie ihn!«, rief er sofort.
»Muss ich das?«
»Nein«, entgegnete der Beamte. »Doch was weiß ich! Das ist Ihre Sache. Sie müssen ja wissen, ob Sie den Mann freigeben dürfen oder nicht.«
»Kann er nicht gleich hier abgeurteilt werden?«
»Nein. Als Reederagent gehört er zur Besatzung, darf nicht an Land kommen, und vorläufig sind Sie hier noch Kapitän mit unumschränkter Vollmacht. Wenn Sie es für gut finden, so geben Sie den Arretierten frei, und nicht nur frei von Eisen. Wenn nicht, dann eben nicht.«
»Oho«, rief der Pater, »er muss ihn freigeben, er muss!!«
»Schweigen Sie, Steuermann« ermahnte der Beamte. »Diese Entscheidung ist ganz Sache des Kapitäns.«
Ja, nun aber war mein Entschluss auch gefasst! Eigentlich ist es doch nicht gerade angenehm, auf einem Pestschiffe zu sein. Hätte ich mit Ehren zurücktreten können, nicht feige fliehen, so hätte ich es ja auch getan, und so wäre es mir ganz recht gewesen, wenn mich Pater Cyriax nicht haben wollte, mich entließ, und dazu hätte ich ihn ja nur freizugeben brauchen.
Nein, nun aber gerade nicht! Nun wollte ich den Kampf mit dieser Mönchsbande doch zu Ende führen!
»Nein, er bleibt in Eisen!«
»Aber warum denn, Sie...«
»Ruhe, Steuermann!«, rief jetzt ich. »Er bleibt in Eisen, kein Wort weiter!!«
Der Pater kniff die Lippen zusammen und schwieg. Aber der Blick, der mich traf!
»Dann wäre dies ja in Ordnung«, sagte der Beamte, aufstehend. »Nun zu den Engländerinnen! Da hat der Arzt die Entscheidung zu fällen.«
Die armen Mädchen wurden untersucht. Es war nichts weiter dabei. Sie wurden alle ohne Symptome der Pest gefunden, kamen sofort ins Boot. Ach, es war vielleicht der traurigste Moment meines Lebens, dieser schnelle Abschied! Wie sie noch einmal nach der Leiche der Berufsgenossin blickten, die zurückblieb, um von uns weit draußen ins Meer versenkt zu werden!
»Sie brauchen keinen Proviant, kein Wasser?«, wandte sich der Beamte noch einmal an mich, ehe auch er das Boot bestieg.
»Nein, wir sind mit allem noch reichlich versehen.«
»Auch sonst nichts?«
»Gar nichts.«
»Glückliche Reise! Gott mit Ihnen und dem ganzen Schiffe!«
Das Dampfboot strebte dem Hafen zu. Es signalisierte nach der Seewarte, und da ging mir von dort auch schon der Befehl zu, sofort die Reede zu verlassen.
»Du hast gesiegt, Nazarener«, wandte ich mich an den Pater, den klassischen Ausspruch des Sonnenkaisers nicht gerade glücklich gebrauchend.
Der Pater zuckte die Achseln und wandte sich ab — und das fuhr mir nun gleich wieder in die Nase.
»Kommt doch noch einmal hierher! — Dieses Achselzucken verbitte ich mir, verstanden?«
Der Mönchssteuermann stand in seiner Kutte stramm wie ein Soldat.
»Also nach Athos? Hierüber könnt Ihr mit mir ganz offen sprechen. Aber Ihr sollt nicht über mich bedauernd die Achseln zucken.«
»Ja, nach Athos.«
»Gut, Euer Wille geschehe!«
Ich gab die Ankerkommandos — da fiel mein Blick auf den auf der Brücke stehenden Jüngling.
»Herrgott, Zephyros, Euch habe ich ja ganz vergessen!!«, rief ich erschrocken.
»Wieso, Herr Kapitän?«
»Ich wurde gefragt, ob ich von Bord wolle...«
»Ich weiß es, aber mir bleibt doch gar nichts Anderes übrig, als an Bord zu bleiben«, sagte Zephyros, als ich selbst stockte.
Ach, richtig! So einfach war das ja gar nicht! Da musste ich den Jüngling dann noch des Weiteren sprechen.
Wir hatten das offene Meer erreicht, außer Sichtweite des Landes wurde die Leiche des armen Mädchens dem feuchten Grabe übergeben. Ich bin sehr leicht zu Tränen zu rühren. Desto mehr aber ärgerte ich mich über die Mönche, die so teilnahmslos dabei blieben, ganz gedankenlos ihre Gebete hermurmelten. Ebenso gut konnten sie auch etwas anderes murmeln. Ich glaubte sogar schadenfrohe Blicke zu bemerken.
Nun, ich wollte die Burschen bei dieser Reise schon noch einmal hochnehmen!
Dann begab ich mich in die Arrestzelle.
Hier bekam ich erst recht etwas von einem triumphierenden Blicke zu sehen, so sehr der alte Asket ihn auch zu verbergen suchte, der sich sonst doch so in der Gewalt hatte.
»Wir sind in San Francisco nicht in Quarantäne genommen worden.«
»Ich weiß es.«
»Die Bestimmungen darüber sind geändert worden.«
»Ich weiß es.«
»Woher wollen Sie denn das wissen?«
»Ich weiß es.«
Na, meinetwegen mochte er allwissend sein.
»So bringe ich also das Schiff als Kapitän nach Athos zurück.«
»Es wird nie nach Athos kommen.«
»Warum denn nun noch nicht?«
»Solange Ihr und ein anderer Verfluchter an Bord seid — niemals.«
»Wer ist denn der andere Verfluchte?«, fragte ich zunächst.
»Frater Zephyros.«
»Was wisst Ihr denn von dem?«
»Er ist noch immer ein Abtrünniger, trägt sich noch immer mit Freiheitsgedanken.«
»Woher wisst Ihr das?«
»Ich weiß es.«
»Gut! Das könnt Ihr auch sehr leicht erfahren haben. Ihr habt ja jetzt Mönche als Wachen. Ich will sie nur wegnehmen, die brauchen hier nicht zu faulenzen. Oder ich wollte Euch überhaupt die Freiheit verkünden.«
»Das macht, wie Ihr wollt.«
»So bleiben wir zunächst bei mir. Ich bin so unbescheiden, mich zuerst um meine eigene Person zu kümmern. Ihr seid also nicht zufrieden mit mir?«
»Pater Rufos hat Euch ja gesagt, dass Ihr von Bord gehen solltet, und Ihr konntet es auch. Warum habt Ihr es denn nicht getan?«
»Wenn ich gegangen wäre, so hätte das Schiff doch einen anderen fremden Kapitän bekommen.«
»Nein.«
»Wiefo nicht?«
»Es hätte sich kein anderer gefunden.«
»Woher wollt Ihr denn das wissen?«
»Ich weiß es.«
»Seid Ihr denn wirklich hellsehend?«
»Ja, wenn ich will, wenn ich mich darauf vorbereite.«
»Wie tut Ihr denn das?«
»Indem ich längere Zeit nicht schlafe.«
»Und Ihr habt seit längerer Zeit nicht geschlafen?«
»Seit einer Woche nicht.«
Fast alle Mystiker behaupten, dass man sich durch Entziehung des Schlafes und der Nahrung künstlich zum hellsehenden Medium machen kann. Selbstverständlich müssen die natürlichen oder unnatürlichen Anlagen hierzu schon vorhanden sein. Ich will mich jedes Urteils hierüber enthalten, ich selbst habe noch keinen entscheidenden Beweis für das Hellsehen bekommen — jenes heilige Licht von Athos ausgenommen, aber ich meine hier solche Mediumschaft, wie sie die Spiritisten gebrauchen — dagegen will ich erwähnen, dass selbst staatliche Organe wie die Kriminalpolizei trotz aller Ungläubigkeit der wissenschaftlichen Kreise sich jetzt näher mit dieser Sache befassen. So zum Beispiel bei jenem geheimnisvollen Mord in dem Steinbruch bei Paris, wo die Pariser Polizei sich sogar einen hellsehenden Fakir direkt von Indien verschrieb — mit welchem Erfolge, das weiß ich allerdings nicht, habe dann von der Sache nichts mehr gehört. Es genügt mir auch schon, dass überhaupt sogar staatliche Institute dieser sonst so vielverlachten Hellseherei Beachtung schenken.
Ich hatte damals eine gesunde Natur, die sich verflucht wenig darum kümmerte, ob ein Hellsehen möglich sei oder nicht. War es nicht möglich — gut! War es möglich — auch gut! Was ging's mich an?
Ich brauchte nicht zu wissen, auf welche Nummer das große Los fiel oder wie die Aktien stehen, in der Politik oder sonst wo.
Gegessen hatte der alte Asket immer, allerdings so wenig wie stets, er verzehrte täglich nur eine Handvoll Reis und ein Stückchen Hartbrot, von dem ich am dritten Tage verhungert wäre — ob er geschlafen hatte, hatte ich nicht kontrolliert.
»Es hätte sich kein anderer Kapitän bereit erklärt, diesen Posten zu übernehmen?«
»Nein.«
»Dann wäre ein Hafenbeamter, der das Kapitänspatent besitzt, hierzu kommandiert worden.«
»Es wäre keiner gegangen.«
»Jener Beamte, der hier war, sofort.«
»Nein.«
»Weshalb nicht?«
»Das Schicksal wäre immer dazwischengetreten, wäre sein Wille auch noch so stark gewesen.«
»Na, meinetwegen. Nun aber habt ihr mich und werdet mich wohl auch behalten müssen, bis ich euch in Athos abgeliefert habe.«
»Wir werden den heiligen Boden nicht eher betreten, als bis du und der Verfluchte von Bord seid.«
»Mit dem Verfluchten meinst du also Zephyros. Was hat dir der Jüngling eigentlich getan?«
»Er hat der Kirche den Gehorsam gekündigt und verharrt dabei, und solange das der Fall ist, nehme ich nicht den Fluch von diesem Schiffe.«
»Das heißt, so lange müssen wir rastlos bis in alle Ewigkeit und so weiter, und so weiter.«
»Du sagst es. So lange soll dieses Schiff rastlos wie der ewige Jude umherirren.«
»Bis Zephyros wieder einer der eurigen ist?«
»Bis er als reumütiger Sünder zurückgekehrt ist und du freiwillig von Bord gegangen bist.«
»Na, meinetwegen. Das heißt nämlich, trotz aller deiner Flüche und Prophezeiungen werde ich auf meinem Posten verharren, zu dem ich mich durch mein Gewissen, durch Gott selbst berufen fühle. Ich bin nur ein schwacher Mensch, aber ich werde mein Möglichstes tun, dieses Schiff glücklich nach Athos zu bringen, wie es Euer und aller anderen Mönche Wunsch ist, und ich will doch sehen, ob ich nicht Euren Fluch in einen Segen verwandeln kann. Nun aber kann ich Euch auch nicht freigeben. Dass ich nach Eurer Meinung erst von Bord muss, ehe Ihr die Heimat erreichen könnt, darin höre ich eine versteckte Drohung...«
»Freiwillig musst du das Schiff verlassen, von der Verzweiflung getrieben, einsehend, dass gegen meinen Fluch nicht anzukämpfen ist.«
»Nein, nein, ich traue euch allen zusammen nicht. Wer mich kennt, der weiß auch, dass ich wahrhaftig kein Feigling bin, aber... Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ihr bleibt hier hübsch in Eisen liegen. Ihr habt es durch Euren Trotz selbst verschuldet.«
»Macht das, wie Ihr wollt.«
Ich ließ ihm das letzte Wort, ging — auch noch sein höhnisches Lachen schallte mir nach.
Einen Posten erforderte nur die Schiffsroutine, die Etikette, sonst war er nicht nötig. Ich hätte doch auch nur Swen und Zephyros abwechselnd vor die Tür stellen können, aber ich hatte ja den Schlüssel in der Tasche.
Ich rief Zephyros.
So und so, sagte ich ihm.
Der Jüngling wusste nicht recht, was er tun sollte. Nach Athos zurück ging er auf keinen Fall, zugleich aber schien mir, als ob auch er der fluchenden Prophezeiung des Paters Glauben schenke.
Darin konnte ich freilich keine Schwäche erkennen, sondern vielmehr einen prometheischen Trotz, der die Macht der Götter wohl kennt, sie aber verachtet, verhöhnt — »verflucht, verflucht, verflucht ihr Götterhunde«, wie Aischylos ihn rufen lässt.
Kennzeichnend für den edlen Charakter dieses siebzehnjährigen Knaben, der sich trotz aller sonstigen Willenskraft nicht aus den Ketten des Aberglaubens reißen konnte, war, dass er nur immer an mein Schicksal dachte, die Aufmerksamkeit von sich ablenken wollte, was ich recht wohl merkte.
»Ihr selbst dürft aber doch auch nicht nach Athos kommen, Kapitän?«
»Warum nicht?«
»Auch Ihr würdet der Rache der Mönche verfallen, man würde an Euch ein Beispiel dafür statuieren, was es heißt, Brüder des heiligen Berges zur Abtrünnigkeit zu verleiten.«
»Oho! Das sollte man nur wagen!«
»Lernt die Macht dieser Mönche nur erst kennen!«
»Ich würde mich eben hüten, selbst das Land zu betreten.«
»Lernt die Macht dieser Mönche nur erst kennen«, wiederholte er, und eigentlich hatte ich diese Macht ja schon zur Genüge kennen gelernt.
Aber auch mein Trotz bäumte sich dagegen auf. Ich ließ es darauf ankommen, immer noch einmal nach einem Schlafe in einem Kerker des fernen Vorgebirges zu erwachen.
»Sprechen wir doch lieber von Euch«, fuhr ich dann fort. »Ihr glaubt, der Fluch des Alten habe solch eine Kraft, dass Ihr dieses Schiff überhaupt nicht wieder verlassen könntet, dass es selbst nicht eher den Heimathafen gewinnen könnte, als bis Ihr zu Kreuze gekrochen seiet?«
Finster blickte der Jüngling vor sich hin.
»Ich weiß gar nichts«, murmelte er. »Aber wer sollte mich daran hindern, mir eine Kugel vor den Kopf zu knallen?«
»Das ist's, woran auch ich gedacht habe, was ich nur nicht aussprechen wollte. Da Ihr es selbst tut, so ist es etwas anderes. Natürlich ist davon keine Rede. Aber wer sollte Euch daran hindern? Und dann wäre die Prophezeiung des Alten ja gleich fehlgeschlagen, wenigstens in einer Hinsicht, fast in der Hauptsache.«
»Und was würde dann aus mir... dann?«
»Sagt, Zephyros — einen Himmel will ich Euch nicht abstreitig machen... aber glaubt Ihr an eine Hölle?«
Mit einem fast wilden Blicke sah mich der Jüngling an.
»Fragt Ihr als Kapitän oder als Mensch?«, stieß er hervor.
»Als Mensch, als Euer Kamerad.«
»Was schert's Euch?«
Ich verstand, was in diesen drei Wörtchen lag.
In früherer Zeit, als ich einmal durch den Korridor der Kaserne gegangen war, habe ich Soldaten beim Gewehrputzen singen hören: Und muss ich auch, und muss ich auch einst in der Hölle wimmern, so hat sich doch, so hat sich doch kein Mensch darum zu kümmern...
Das Singen wurde rasch unterdrückt... zu spät, ich hatte es schon gehört, und ich brachte das schreckliche Lied gar nicht wieder aus meinen Ohren heraus. Ja, schrecklich, entsetzlich — und doch so furchtbar schön, gerade in seiner Rohheit, von rohen Kehlen gebrüllt!
Na, jedenfalls war Zephyros auf meiner Seite, und er quartierte sich gleich in die Kajüte um, das heißt, in die Kabine des ersten Steuermanns, in die er ja überhaupt gehörte. Die Steuerleute hatten bisher im Matrosenlogis gehaust, es herrschte eben hier an Bord Klosterwirtschaft, und Athos ist ja speziell eine Mönchsrepublik, in der es noch weniger Unterschied im Range gibt als in anderen Klöstern. Hiermit war der Bruch offiziell vollzogen, das Tafeltuch war entzweigeschnitten, und alsbald, als Zephyros eigenhändig noch seine wenigen Sachen herübertrug, erschien denn auch der Zweite, bat, mich außerdienstlich sprechen zu dürfen.
»Was gibt es?«
»Wir bitten den Herrn Kapitän um Freilassung des Paters Cyriacos.«
»Wer, wir?«
»Die Fratres.«
»Fratres und Mönche gibt es hier nicht.«
»Die Mannschaft.«
»Nein. Ich will ihn aus den Eisen nehmen, aber aus der Arrestzelle kommt er nicht.«
»Herr Kapitän...«
»Es bleibt dabei!«
Demütig hatte Pater Rufos gesprochen, demütig ging er wieder — aber diese bösen Blicke!
Die Tage vergingen, ohne dass sich etwas Besonderes ereignete. Keine Spur von einer Neigung zur Meuterei. Aber... es lag förmlich in der Luft. Ich wenigstens hatte keine Stunde, in der ich nicht an eine ausbrechende Meuterei dachte, und dem schwedischen Matrosen ging es ebenso, wir hatten den Revolver immer entsichert in der Tasche. Dabei sagten wir uns jedoch auch immer, dass solche fromme Kuttenmatrosen ganz anders meutern mussten als regelrechte Teerjacken, da würde wohl einmal irgend etwas Furchtbares dazwischenplatzen, wie die Welt- oder Seegeschichte es noch niemals gesehen hatte.
Zwei Wochen später sichteten wir ein Eiland, das durch einen englischen Dichter unsterbliche Berühmtheit erlangt hat, das Ideal wohl eines jeden Knabenherzens: Juan Fernández, die RobinsonInsel.
Eines jeden Knabenherzens? Hottentottenkinder wissen nichts davon — und Zephyros auch nicht. Er entstammte einer reichen Patrizierfamilie in Athen, war schon mit dem vierten Jahre in ein Kloster gekommen, mit dem zwölften nach Athos. Warum, wusste er nicht. Vielleicht musste er eine Schuld der Eltern abbüßen, ich hörte so etwas heraus, sein edler Patriziervater hatte wohl einmal gesessen oder hätte sitzen müssen, die Pfaffen hatten ihn wahrscheinlich aus seiner Kalamität erlöst, denn von seinem Vater sagte Zephyros selbst, er ›schuldete der Kirche vielen, vielen Dank‹.
Die Bibel und andere Erbauungsschriften waren des Knaben und Jünglings einzige Lesebücher gewesen, er wusste noch gar nicht, was ein Roman sei, hatte noch nichts von Robinson Crusoe auch nur gehört.
Ich erzählte ihm die Geschichte des unsterblich gewordenen Inseleinsiedlers, die Dichtung des Engländers Daniel Defoe, wenn man sich auch förmlich krampfhaft bemüht hat, nachzuweisen, dass er hierzu Vorbilder gehabt habe, wie zum Beispiel das Tagebuch des Matrosen Selkirk, der allerdings zur Zeit Defoes tatsächlich auf einer einsamen Insel gefunden wurde, auf der er jahrelang gehaust hatte. Aber was tut's? Defoes Robinson Crusoe ist und bleibt das nach der Bibel am weitesten verbreitete Buch, übersetzt in alle zivilisierte Sprachen und in noch viele andere mehr, auch ins Chinesische, Japanische, Malaiische und Hindustanische, als Lesebuch in Indianerschulen mit den verschiedensten Dialekten benutzt, von den Orientalen die ›Perle des Abendlandes‹ genannt. Hakens fünfbändiger ›Katalog der Robinsonaden‹ zählt mehr als hundert allein deutscher Nachahmungen auf. Merkwürdig, was man da liest! Da hat es einen sächsischen, niedersächsischen, schlesischen, schwäbischen, kurpfälzischen, ostfriesischen usw. usw. Robinson gegeben, selbst Städte haben ihren eigenen Helden gehabt, unter vielen anderen gibt es einen Königsberger und einen Nürnberger Robinson, als kostbare Raritäten noch jetzt im Besitz von Bücherliebhabern, von denen Haken zweiundvierzig aufzählt, die Robinsonaden sammeln. Ferner erschien ein geistlicher, ein medizinischer, ein juristischer Robinson. Schuster, Schneider, Handschuhmacher mussten an einsamer Insel Schiffbruch leiden und ein Robinsonleben führen, fast jede Berufsart hat ihren Robinson bekommen. Als ein protestantischer Robinson erschien, folgten alsbald ein katholischer, ein reformierter, ein methodistischer Robinson nach. Sogar einen jüdischen Robinson gibt es.
Das sind aber nur die deutschen Nachahmungen. Dasselbe wiederholt sich in allen zivilisierten Sprachen. Auch die bulgarische, serbische, rumänische Literatur hat ihre eigenen Robinsons, abgesehen von der Übersetzung des echten Crusoe. Als Kuriosität sei ein englischer Robinson erwähnt, der beim Schiffbruch beide Arme verliert, erst seine Füße als Hände ausbilden muss. Das ließ aber einen ehrgeizigen Amerikaner nicht ruhen, der schnitt dem armen Kerl auch noch die Füße ab, jetzt musste sich der Robinson alles mit dem Munde herstellen. Es fehlt nur noch ein Robinson ohne Kopf.
So lässt es sich erklären, dass Haken, allerdings mit einiger Inhaltsangabe, aber nur ganz kurz und nur von den wichtigeren Erscheinungen, fünf dicke Bände gebraucht hat. Und ich kann verstehen, wie jemand das Lesen und Beurteilen all dieser Robinsonaden zu seinem speziellen Studium, ihr Sammeln zu seinem Lebenszweck machen kann.
Ebenso interessant ist es ja, wie all diese wirklich zahllosen Nachahmungen in den Orkus der Vergessenheit gesunken sind. Hier zeigt sich der Fluch, der auf jedem Diebstahle liegt, zu dem in milder Form auch die Nachahmung zu rechnen ist. Nur ganz, ganz wenige haben sich erhalten. Von deutschen Robinsonaden ›Insel Felsenburg‹ und der ›Schweizer Robinson‹. Der vielgelesene ›Sigismund Rüstig‹ ist englisch, von Kapitän Marryat.
Als Verehrer und Verteidiger von allem Originellen will ich noch erwähnen, dass nachgewiesen wurde, wie jener Matrose Selkirk kein Tagebuch geführt hat, weil er überhaupt nicht schreiben konnte — und ferner hat Defoe auch unmöglich von mündlichen Berichten dieses Mannes hören können, bevor er seinen Robinson Crusoe schrieb.
Mir war der ganze Entwicklungsgang des unfreiwilligen Inseleremiten noch lebhaft in der Erinnerung, noch mehr dem schwedischen Lehrersohn, dieser verstand auch noch besser zu erzählen als ich — und mit leuchtenden und immer heller strahlenden Augen lauschte uns der athenische Jüngling. Ja, es war mir zumute, als wenn ich einer armen, finsteren Seele das Evangelium verkündete, dessen zermalmender Kraft, der Kraft der Wahrheit, auch ein Thor und Odin nicht widerstehen konnten, und wie von solch einer nach Wahrheit hungernden Seele wurde auch unsere Erzählung förmlich aufgesogen.
Ich hatte Juan Fernández nicht zufällig in Sicht bekommen. Mit Absicht hatte ich meinen Kurs hierher genommen, denn auch ich hatte die RobinsonInsel noch nicht gesehen.
Nun lag sie vor uns, ein grünes, ziemlich bewaldetes Eiland, umsäumt von brandungsschäumenden Klippen, vor denen die Seekarten warnten, in der Mitte ein dreitausend Fuß hoher Berg, ein erloschener Vulkan, der sich noch nie wieder bemerkbar gemacht hat.
»Ist die Insel bewohnt?«, fragte Zephyros.
Ich hatte meine nautischen Handbücher bereits darüber befragt.
Unbewohnt! Gutes Quellwasser vorhanden, da und da in einem Tale zu finden, durch genaue Ortsberechnung bestimmt. Für Schiffe, denen der Proviant ganz ausgegangen ist, die nicht noch Zeit haben, die sechsundsechzig Meilen entfernte Küste von Chile aufzusuchen, sind wildwachsende Bananen und Kokosnüsse vorhanden — auch Kartoffeln, wenn man sie zu finden weiß — außerdem kann man frisches Fleisch erbeuten: Lamas, Papageien, Schildkröten.
Aber eine höchst beschwerliche Landung! Selbst für Boote ist die Küste nur in einer einzigen Bucht zugänglich im Nordwesten, früher Cumberland genannt, jetzt San Juan Bautista. Peilung so und so. Gefährlich!!! Gleich drei Kreuze!
Das nautische Konversationslexikon erzählte noch etwas mehr.
Eine zu Chile gehörende Insel, auf der Ende des 17. Jahrhunderts ein englischer Matrose Selkirk lange Jahre gehaust hat, weshalb man auch Defoes Phantasiedichtung hierher verlegt. Spuren der Tätigkeit dieses Robinsons sind nicht mehr vorhanden. Eine Höhle an der Ostseite des Berges wird wohl ganz willkürlich als seine ehemalige Behausung angenommen. Eine Expedition, die ein durch englische Nationalsammlung gestiftetes Denkmal für Defoe hier errichten wollte, konnte nicht landen, das Denkmal versank beim Kentern des Floßes im Meer. Soll sehr selten besucht werden. Im Jahre 1840 wurde die Insel von dem New Yorker Kaufmann George Bautiste auf längere Zeit gepachtet. Siedelte auf ihr, ein ethnografisches Experiment, fünfzig Familien SandwichInsulaner an. Im nächsten Jahre schon forderten diese, wieder fortgebracht zu werden. Seitdem unbewohnt.
»Aber wie kann denn nur ein so paradiesisches Eiland unbewohnt sein?!«, rief Zephyros.
Ja, warum! Weil es an der Küste oder sonst auf dem Festlande noch viel paradiesischere Fleckchen gab, wo man nicht so abgeschlossen war, und sie hatten auch noch keine Bewohner.
»Aber auf solch einer einsamen Insel als einziger Mensch zu leben, das muss ja herrlich sein!«
»Gibt es im Ägäischen Meere nicht auch noch Inselchen genug, welche Wasser und alles haben, als Wildbret auch immer Kaninchen, meist aber sogar Ziegen, und kein Mensch wohnt darauf, besucht sie auch nur?«
Freilich! Es ist immer das Ausländische, das Fremde, was reizt. Die griechischen Jungen werden wohl auch für Robinson schwärmen, aber an eine griechische Insel denken sie gar nicht, es muss unbedingt eine amerikanische oder sonst ein fernes Eiland sein.
»Kapitän, ich hätte eine Idee!«
»Nun?«
Aber ich wusste ja schon, was alles kommen würde.
»Wem gehört jetzt die Insel?«
Einem chilenischen Kaufmann, mehr stand nicht in dem Buche.
»Ihr hättet Lust, auf dieser Insel selbst den Robinson zu spielen?«
»Ja, das hätte ich.«
»Ich machte auch gleich mit«, sagte Swen.
»Und ich ebenfalls«, ergänzte ich.
»Ob man uns ungestört lassen würde?«
»Ja, bis man uns entdeckt hätte. Dann würde der Eigentümer sagen: Marsch herunter von meinem Grund und Boden!«
»Aber wenn er sieht, wie wir uns eingerichtet, was wir schon alles geschaffen haben, dann würde er uns vielleicht doch nicht herunterjagen«, meinte Zephyros.
O, du köstlich unschuldiger Jüngling! Ich widersprach ihm gar nicht, mochte er diesen himmlischen Glauben an den Charakter der Menschen behalten.
»Na, so leicht wird ein Robinson hier auch nicht entdeckt, wenn er nicht will, wenn er also keine Flaggen hisst und in der Nacht keine großen Feuer brennt. Und selbst da würde er nicht so leicht gesichtet werden. Die ganze Gegend hier ist so verrufen, dass jedes Schiff einen weiten Bogen um diese Insel beschreibt. Würde er aber entdeckt und abgeholt, so wäre es ihm jedenfalls sehr angenehm.«
»Weshalb?«
»Weil er unterdessen des Robinsonspielens überdrüssig geworden sein dürfte.«
»Das würde bei mir nie, nie der Fall sein!«, rief der Jüngling begeistert.
»Nun gut. Und Ihr wollt Euch wirklich hier als Robinson etablieren?«
»O, Kapitän, wenn ich dürfte!«
»Warum solltet Ihr nicht?«
»Ich bin hier erster Steuermann.«
»Allerdings, aber auf diesem Schiffe liegen doch Verhältnisse vor, die Ausnahmen gestatten. Es wäre nicht erst nötig, dass Ihr eine Tat fingiertet, wonach ich Euch in Eisen legen müsste. Euch auf Euren Wunsch hier lieber absetzte. Das wollte ich schon so verantworten. Ja, es reizt mich sogar. Nach der Prophezeiung des alten, verrückten Kerls sollt Ihr ja gezwungen sein, auf diesem Schiffe nach Athos zurückzukehren, und zwar freiwillig. Solange Ihr abtrünnig seid, ist das ganze Schiff gezwungen, rastlos durch alle Meere zu kreuzen, und Ihr selbst sollt keine Möglichkeit haben, es zu verlassen, das Land soll vor Euch zurückweichen, oder es soll Euch an Bord dieses verfluchten Schiffes zurückspeien, oder wie die fluchende Prophezeiung sonst lautete. Nun, hier wäre gleich Gelegenheit, einen guten Teil der Prophezeiung zuschanden zu machen. Bei dieser ruhigen See kann eine Landung keine Schwierigkeit bieten. Also, Ihr wollt uns wirklich verlassen?«
»Ja, ich will«
In diesem Augenblicke ertönte unter uns wieder das schrille, höhnische Lachen des Paters Cyriax.
Den Jüngling verließ alle Farbe, auch ich wurde sehr betroffen.
Das Fenster der Arrestzelle war zwar offen, aber wir standen doch ziemlich entfernt davon; es war ganz ausgeschlossen, dass uns der Gefangene hatte verstehen können, zumal wir auch immer ziemlich leise gesprochen hatten.
»Weiß der Teufel, was der gerade jetzt wieder zu lachen hat!«, sagte ich, um mich schnell wieder von einem aufsteigenden Aberglauben zu befreien.
Auch Zephyros hatte sich schnell wieder empor gerichtet, seine Augen flammten auf, die Wangen glühten.
»Und nun will ich gerade diese Insel betreten!«, rief er.
Noch einmal das schrille, furchtbar höhnische Gelächter, wie aus weiter Ferne kommend.
»Und auf ihr bleiben!!«, setzte Zephyros noch hinzu.
Da zum dritten Male das Gelächter.
»Und nun gerade!!«, rief der Jüngling, auch noch mit dem Fuße aufstampfend. Diesmal blieb das Lachen aus.
»So«, sagte ich, »aller guten Dinge sind drei. Wer weiß, worüber der gelacht hat. Einfach ein Zufall. Nun, da wollen wir uns bald nach einem Ankerplatz umsehen.«
»Aber Ihr geht doch mit, Kapitän!«
»Ich?!«
»Ihr sagtet doch vorhin, dass Ihr selbst die größte Lust dazu hättet.«
»Ja, die habe ich noch immer, aber es ist doch ganz ausgeschlossen, dass ich als Kapitän das Schiff verlasse. Das ist mit jedem Begriff von Pflicht ganz unvereinbar.«
»Dann gilt dasselbe von mir als dem ersten Steuermann.«
»Nein, bei Euch ist das doch wieder etwas ganz Anderes. Im Gegenteil, es ist das Beste, wenn Ihr von Bord kommt. Ihr seid hier geradezu ein Hemmschuh. Nur von mir kann keine Rede sein. Vielleicht besuche ich Euch später einmal, mache dann noch immer mit.«
»Ihr würdet wirklich gern auf dieser Insel zurückbleiben, Kapitän?«, fragte Swen.
»Wie gesagt, davon kann gar keine Rede sein.«
»Aber ich wüsste doch ein Mittel, wie Ihr von Bord kämet, ohne Pflicht und Gewissen zu verletzen.«
»Und das wäre?«
»Ihr könntet doch einmal an der Insel landen, sie betreten.«
»Warum denn nicht? Ich werde Zephyros sogar selbst hinbringen, werde die Insel näher besichtigen, einen Tag dafür opfern. Wer will mich denn daran hindern?«
Der schwedische Matrose schaute sich vorsichtig um, ehe er leise weitersprach:
»Werden die Mönche diese Gelegenheit nicht dazu benutzen, um Euch loszuwerden?«
»Wie das?«
»Indem sie mit dem Schiffe auf und davon gehen!«
Wahrhaftig, der Mann hatte recht! Ein Grund, dass das Boot ohne uns zurückruderte, dass das Schiff absegelte und nicht wieder zurückkam, wäre ja bald gefunden gewesen, auch ein solcher, den sie vor dem Seegericht hätten verantworten können.
Nur die Ankerkette brauchte zu brechen, das Boot zurückeilen, weil alle Hände nötig waren, und wir hatten direkt Nordwind. Wenn das Schiff eine gewisse Linie passiert hatte, konnte es überhaupt nicht wieder zurück; gegen den Wind anzukreuzen, das hat doch seine Grenzen, und ein Boot kommt nicht gegen die Strömung an.
Ja, ich war fest überzeugt, dass die Mönche sich auf diese Weise meines so unerwünschten Kommandos entledigen würden.
Indem ich hiermit rechnete, mich in dieser Hoffnung an Land begab, um auf gute Weise von dem Pestschiff fortzukommen, beging ich freilich eine Pflichtverletzung, wenigstens vor meinem eigenen Gewissen. Aber gar so feinfühlig darf man nicht sein, sonst würde man ja in dieser Welt überhaupt nie fertig.
Gut, dann aber auch schnell gehandelt! Es war sowieso die höchste Zeit, dass wir nicht zu weit abtrieben.
Es ward noch etwas mehr nach Westen gewendet, unterdessen eine geografische Ortsbestimmung gemacht, die Karten zu Rate gezogen, eine Untiefe mit Muschelgrund ausgelotet, und die beiden Anker rasselten herab.
So, nun hatten wir Zeit.
»Zweiter!«
»Herr Kapitän?«
»Der erste Steuermann geht von Bord.«
Ich hatte ja gar nicht nötig, das dem erst zu sagen — ich wollte nur einmal sehen, was für ein Gesicht er dazu machte.
Das war nun allerdings höchst verdutzt.
»Frater Zephyros geht von Bord?«
»Ja.«
»Wohin denn?«
»Dort auf jene Insel, auf der einst Robinson gelebt hat.«
»Robinson? Manuelo Robinson?«
Der hatte einmal jemand gekannt, der Manuelo Robinson geheißen hatte, und ich erzählte ihm nicht erst lange Geschichten.
»Frater Zephyros will sich wohl auf dieser Insel als Eremit ansiedeln?«, zeigte sich Pater Rufos jetzt aber doch leicht von Begriffen.
»Jetzt habt Ihr's erfasst.«
Da schallte schon wieder das höhnische Gelächter aus dem offenen Bullauge der Arrestzelle, obgleich uns der Gefangene jetzt erst recht nicht gehört haben konnte. Gott wusste, über was der immer zu lachen hatte.
In demselben Augenblicke richtete sich auch der Mönch auf, sein hageres Gesicht drückte einen bösen Triumph aus, so wie jenes Lachen klang.
»Niemals!!«
»Was niemals?«
»Niemals wird der Abtrünnige das Land betreten, solange der Fluch auf ihm ruht!«
Ich ärgerte mich schon, dass ich meiner Schwäche nachgegeben hatte, den Mönch verblüffen zu wollen.
»Es wird sich ja gleich zeigen, wie schön er an Land kommt.«
»Mag er auch das Land betreten können, weil dies eine Insel ist — er muss an Bord zurück, er muss!!«
Ich ließ ihm das letzte Wort, ohne dass ich dabei der Klügere gewesen war.
Wir packten in die Jolle, was ein Robinson braucht, der nicht ganz von vorn anfangen will. Handwerkszeug der verschiedensten Art, Nägel, Spaten und dergleichen, einen Ballen Segeltuch und anderes mehr. Das langte für drei Robinsons. Zephyros nahm auch seinen ganzen Kleidersack mit. Das aber durften Swen und ich nicht tun. Wir mussten doch wenigstens den Schein wahren, dass wir an Bord zurückkehren wollten, wenn das Schiff nicht auf und davon ging. Mindestens galt das für mich.
»Und Ihr, Swen?«, fragte ich bei der ersten Gelegenheit, als niemand uns hören konnte.
»Bleibt Ihr an Land, so bleibe auch ich. Geht Ihr an Bord zurück, so gehe ich mit.«
»Aber das habt Ihr nicht nötig. Wenn Ihr so große Lust habt, hier den Robinson zu spielen — ich gebe Euch frei.«
»Ja, meine Lust ist groß. Deshalb bin ich ja überhaupt zur See gegangen, um solche Abenteuer zu erleben, doch nicht nur, um mein tägliches Brot zu verdienen. Aber habt Ihr Euer Pflichtgefühl als Kapitän, so habe ich das meinige als Matrose. Ich verlasse Euch nicht, am wenigsten auf solch einem Schiffe, auf dem Tod und Meuterei lauern.«
So etwas zu hören, das erquickt! Ja, es gibt noch immer germanische Treue!
»Dann nehmt wenigstens Euren Kleidersack mit. Müssen wir zurück, so geht er eben wieder mit ins Boot.«
Dazu war Swen bereit, und da er so offen zeigte, dass auch er wahrscheinlich auf der Insel bleiben wollte, konnten wir für unsere Gewehre und Revolver auch entsprechend viel Munition mitnehmen. Denn für einen Ausflug hätte doch sonst ein gespickter Patronengürtel genügt.
Ich beorderte sechs Matrosen für die Jolle zum Rudern, übergab mit den nötigen Instruktionen dem zweiten Steuermann das Schiff als stellvertretendem Kapitän, trug dies gleich ins Logbuch ein, ebenso, dass der erste Steuermann das Schiff verließ, um auf Juan Fernández zu bleiben.
»Kapitän, könnt Ihr das auch verantworten?«, fragte Rufos, als ich dies noch eintrug,
Von einem anderen Kapitän hätte er ja nun etwas zu hören bekommen! Ich blieb ruhig.
»Ob ich den ersten Steuermann gehen lassen darf?«
»Ja.«
»Die Verhältnisse, in denen sich dieses Schiff befindet, lassen verschiedene Ausnahmen zu. Ja, ich kann es verantworten.«
Als ich dann die Kajüte verließ, hoffentlich für immer, sah ich Zephyros mit Rufos eifrigst sprechen. Rufos hatte als Pater seinem ihm kirchlich Untergebenen ins Gewissen geredet, doch hier zu bleiben, gehorsam nach Athos zurückzukehren — Zephyros hatte versucht, ihn und alle übrigen Mönche zu bewegen, dass sie sich doch alle zusammen auf diesem paradiesischen Eilande als Ansiedler niederließen.
Die Unterredung war natürlich ergebnislos verlaufen, jeder hatte seinen Kopf behalten.
Wir gingen ins Boot. Es war eine Höllenfahrt zwischen den schäumenden Klippen hindurch, ein einziges falsches Ruderkommando, und die Jolle wäre zertrümmert oder aufgeschlitzt worden. Aber die Mönche hatten das Pullen noch nicht verlernt, das ich ihnen an der Küste von Athos beigebracht hatte, nach und nach eine immer stärkere Brandung wählend, und sie schienen sich während meiner Abwesenheit in Übung erhalten zu haben, freiwillig oder der Not gehorchend. Swen sprach seine Bewunderung offen aus, er hätte da nicht mitmachen können. Kauffahrteimatrosen sind nämlich im Allgemeinen schlechte Ruderer, sie haben zu wenig Gelegenheit, sich darin zu üben. Nur Fischer und geborene Küstenseeleute verstehen die Brandung zu beherrschen. Alle übrigen müssen das Rudern in der Brandung erst in der Kriegsmarine lernen, es sei denn, dass sie einmal auf professionellen Schmugglern gefahren sind. Diese Kerls haben allerdings darin etwas los, nicht minder ihre Feinde, die Zollmatrosen. Oder man muss sehen, wenn sich die Mannschaften der Rettungsstationen nur üben. Es ist haarsträubend, wie die in die Brandung hineingehen.
So schlimm war es ja hier nicht, aber immer noch schlimm genug. Ich peilte unausgesetzt mit der Hakenstange, setzte von den Klippen ab, Swen war mir dabei behilflich, Zephyros träumte. Der gehörte ja schon nicht mehr zu uns, das Boot würde ohne ihn zurückgehen.
Glücklich erreichten wir die Bucht. Gefährliche Risse gab es hier nicht mehr, aber von einem ruhigen Wasser gar keine Ahnung. Draußen das Meer war ziemlich ruhig, hier jedoch rollte die See unaufhörlich, und zwar in ganz eigentümlicher Weise. Es war, als ob eine Strömung vom Lande ausginge. Die Ruderer mussten ihre ganze Kraft aufbieten, um vorwärts zukommen, und dann wieder wurde das Boot nach der Küste geschleudert, um im nächsten Augenblick zurückzuschießen. Gar keine Methode war in dieser Unordnung. Dass sich hier Robinson gebadet hat, glaube ich nicht.
Endlich fanden wir eine kleinere Bucht, mehr ein Loch, in dem es etwas ruhiger war. Aber von einem Landen konnte keine Rede sein. Es musste ständig auf Riemen gehalten werden, sonst wäre die Jolle aufs Land geschleudert worden, und da die Küste hier felsig war, wäre sie dabei jedenfalls zersplittert.
So hatte die Prophezeiung des krächzenden Unglücksraben doch einmal recht behalten. Ich hatte nämlich beabsichtigt, unser Gepäck von den Mönchsmatrosen an Land bringen zu lassen. Dann hätten sie doch festen Boden betreten, was ihnen ja nie wieder gelingen sollte.
Das aber jetzt von ihnen zu verlangen, wäre Frevel gewesen. Oder ich hätte das Boot verloren geben, ein anderes hätte uns als Schiffbrüchige abholen müssen. Und das war die Sache denn doch nicht wert, so halsstarrig war ich nicht.
Also jeder der Ruderer hatte mit seinem Riemen zu tun, während wir drei, die wir an Land wollten, ins Wasser sprangen, beladen mit allem, was wir mitnehmen wollten. Wir sprangen hinein, als uns das Wasser nur bis an die Knöchel ging — im nächsten Augenblick schlug die See uns über den Köpfen zusammen.
Dass das Boot hier liegen bleiben könnte, auf unsere Rückkehr wartend, daran war nicht zu denken. Auch wenn wir nur eine Stunde fortgeblieben wären.
Hierüber hatte ich schon mit dem Bootsmann gesprochen, Sylvester war sein Name, trotz seiner ziemlichen Jahre noch ein Frater, wegen irgendeines Vergehens im kirchlichen Avancement wiederholt übersprungen, aber der tüchtigste Bootsmann.
Zephyros und Swen hatten, mit dem Hauptgepäck beladen, glücklich das trockene Land erreicht, nur ich befand mich noch im Boote.
»Könnt Ihr die Jolle allein zurückbringen, Bootsmann?«
»Ay ay, Käpten«, lautete die ganz seemännisch gegebene Antwort des alten Mönchs.
»Ihr müsst uns aber auch wieder abholen, wenn ich das Signal gebe.«
»Ay ay, Käpten.«
»Wir werden wohl bis morgen bleiben, hoffentlich wird sich die See nicht verschlimmern.«
»Und wenn es die höchste See gäbe, was täte es?«, wurde der Alte jetzt etwas gesprächiger, obgleich er seine ganze Aufmerksamkeit auf das Boot und die Ruderer richten musste.
»Dann könntet Ihr uns nicht abholen.«
»Warum nicht?«
»Na, weil das Boot sonst unfehlbar zwischen den Klippen zerschellen würde.«
»Niemals. Oder wenn das Boot auch zerschellte, wir würden gerettet werden, auf irgendeine Weise. Wir können ja nicht sterben. Aber auch das Boot kann nicht zerschellen, es gehört doch zu dem verfluchten Schiffe.«
Ah so! Nun, wenn die Sache so stand, dann durfte ich auch mit gutem Gewissen das Boot allein zurückgehen lassen. O ja, es geht doch nichts über ein bisschen Abergauben, er kann sogar zum Heldentum begeistern.
Also, auch ich sprang mit dem letzten Rest von Zephyros' Gepäck über Bord, tauchte einmal unter, bis ich auf trockenem Boden stand.
Als ich mich umwandte, ging das Boot schon wieder mit voller Ruderkraft zurück, zehn Minuten hatte es zwischen den brandenden Riffen zu tun, dann befand es sich auf fast spiegelglattem Wasser; es erreichte das ankernde Schiff und wurde gehievt.
»Dieser Kuttenbootsmann ist doch ein tüchtiger Kerl, der versteht seine Sache«, meinte Swen in offener Bewunderung.
»Das Boot kann ja gar nicht scheitern, es kann ihm überhaupt nichts passieren, es gehört mit zu dem Schiffe, auf dem der Fluch des fliegenden Holländer liegt«, entgegnete ich.
»Ich habe gehört, wie der Bootsmann es vorhin zu Euch sagte. Nun, mögen Sie's glauben. Ich bewundere mehr den Bootsmann und die Mönche überhaupt, wie die pullen können.«
»Ob sie mit dem Schiffe davongehen werden?«, fragte Zephyros, der einen recht niedergeschlagenen Eindruck machte.
»Wir werden's ja erleben. Jetzt aber nicht solche Gedanken, Freunde, wir sind auf dem heiligen Boden der RobinsonInsel!«
So rief ich, und das freudige Leben kehrte zurück, das Bewusstsein, auf welch klassischem Boden wir uns befanden.
Wir schleppten die Sachen etwas mehr hinauf, wo sie auch vor der stärksten Flut gesichert waren, nahmen nur die Gewehre und einigen Proviant mit, machten uns auf den Weg.
Ich habe über unsere Expedition nicht viel zu sagen. Die Insel hatte die Vegetation des chilenischen Küstenlandes. Das ist aber noch keine tropische. Trotzdem musste sie auf einen Nordländer, der immer auf der eintönigen See liegt, den Eindruck eines Paradieses machen. Bananen wuchsen überall, die Büsche standen jedoch erst in Blüte, ebenso waren die Nüsse der Kokospalmen noch nicht reif. Dann darf es im Paradiese auch nicht solche ungeheuere Schwärme von Mücken geben, die uns Tag und Nacht furchtbar belästigten, uns total zerstachen. Mit dieser Mückenplage hatte ja schon Robinson seine liebe Not gehabt, und wir hatten die Pflanze noch nicht gefunden, mit deren Saft er sich einschmierte. Vorher hatte er sein Gesicht mit einer Pelzmaske verhüllt, wozu wir, hätten wir eine besessen, wenig Lust gehabt hätten, denn es war glühend heiß.
Hatten die Sandwichleute die Insel vielleicht wegen dieser Mückenplage so schnell wieder verlassen? Wollte vielleicht deshalb niemand etwas von dem einsamen Eiland wissen?
Trotzdem stimmte ich Zephyros bei, der immer begeisterter wurde, je weiter wir ins Innere vordrangen, und auch Swen änderte seine Ansicht nicht. Ja, hier würde es uns schon gefallen, und auch gegen die Mücken wollten wir uns schon schützen. Es ist gegen alles ein Kraut gewachsen — nur gegen den Tod nicht. Vor dem hilft, nach der Ansicht jener Mönche, nur ein Fluch.
Wir wanderten durch kleine Prärien und durch liebliche Hügeltäler. Ich machte mit dem Sextanten einige Sonnenaufnahmen, fand auf diese Weise die Quelle, erst einen Bach, den wir bis dahin verfolgten, wo er aus einer Felsspalte sprang.
Eine Höhle war nicht vorhanden, wohl aber sahen wir hier das erste vierfüßige Tier, nachdem wir zunächst, besonders in den Wäldchen, aus den verschiedensten Baumarten Amerikas bestehend, nur immer Papageien erblickt hatten, ein Lama, dann mehrere, zuletzt eine ganze Herde.
Die Tiere kannten schon das unheimliche Wesen, das auf zwei Beinen herumläuft und alles niederknallt, sogar sich gegenseitig — entsetzt flohen sie bei unserem Anblick davon. Aber schon hatten wir ihre Ansicht über uns bestätigt, Swen und ich hatten gleichzeitig auf das erste Lama geschossen, es stürzte verendet im Feuer nieder.

Wir hielten Mittagsrast und Mittagsmahl. Das Fleisch des Lamas ist sonst sehr gut, ebenso wie das des Kamels, nur darf es nicht frischschlachten sein. Das Fleisch dieses Lamas hier war infolgedessen hart wie das einer urgroßmütterlichen Kuh.
»Nun, da wollen wir gleich einmal an unseren Proviant denken.«
Das übrige Fleisch — und wir hatten nur sehr wenig vom Rücken gegessen — wurde in lange Streifen zerschnitten, am Feuer schnell geröstet oder mehr gedörrt und dann an einer möglichst zugigen Stelle aufgehangen. Raubtiere, die es wegholen konnten, gab es hier ja nicht.
Wir setzten unsere Forschungsexpedition fort. Aber irgendwelche Höhle, in der ein Robinson logiert hatte und sich wiederum darin einrichten konnte, fanden wir in den Basaltfelsen trotz ihres vulkanischen Ursprunges nicht. Dagegen entdeckten wir eine glatte Felswand, die ein halbes Dutzend eingemeißelte Namen aufwies, lauter englische. Vor sechs Jahren hatten Engländer und Amerikaner die RobinsonInsel besucht.
»Da müssen wir uns doch auch verewigen«, meinte Swen.
»Macht Ihr's, ich tu's nicht.«
»Weshalb nicht?«
»Die Felswände vollzukritzeln ist überhaupt nicht mein Fall. Wenn mein Name unsterblich werden soll, so muss das auf andere Weise, von fremder Hand geschehen. Hoffentlich kann ich ihn durch andere Arbeit mit dieser RobinsonInsel in Verbindung bringen.«
Da gab auch Swen seine Absicht auf. Er verstand mich. Ich finde es aufdringlich, wenn jeder Gottlieb Schulze — wie ja auch ich eigentlich hieß — seinen Namen an jeder erreichbaren Stelle einer Felswand anschmiert oder einmeißelt, um sich auf diese billige Weise unsterblich zu machen — ich finde es noch anders als nur aufdringlich.
Dass die Hoffnung, die ich vorhin angedeutet hatte, nämlich dass auch ich hier als Robinfon tätig sein könne, in Erfüllung gehen würde, dazu war für heute noch keine Aussicht.
Wir hatten unser Schiff stundenlang außer Sicht bekommen. Erst als die Sonne sich dem Horizont näherte, erblickten wir es von einem der Bergkegel aus, den wir erklettert hatten, wieder.
Die ›Funzel‹ lag ganz ruhig vor Anker.
»Ob sie wirklich nicht ohne uns davongehen wollen?«
»Ich glaube es dennoch. Sie werden die Nacht abwarten wollen, dass sie keine Zeugen haben, wie sie die Ankerketten reißen lassen — indem sie einfach die Anker hieven.«
Wir verbrachten die Nacht unter einem Felsvorsprung, konnten mit dem spärlichen Buschholz nur ein kleines Feuer unterhalten, suchten möglichst grünes Laub, um Rauch zu erzeugen, und wurden trotzdem von den Stechmücken halb aufgefressen.
An Schlaf war gar nicht zu denken, und wir sahen während der ganzen Nacht das Steuerbordlicht unseres Schiffes.
Am anderen Morgen, als ich nach kurzem Schlummer erwachte, lag es noch immer da.
»Swen, es ist nichts. Die Pfaffen wollen uns durchaus wiederhaben.«
»Und Ihr geht wieder an Bord, Kapitän?«
»Ich muss unbedingt.«
»Dann gehe ich mit Euch.«
»Aber ich gebe Euch frei, Ihr könnt hier bleiben.«
»Ach, nee — und wenn schon — diese verdammten Mücken!«
Er sprach aus meiner eigenen Seele. Ich hatte meinen Entschluss unterdessen schon geändert. Nein, diese Mücken waren wirklich unerträglich. So etwas von Mückenschwärmen hatte ich noch gar nicht gesehen. Am Orinoko konnten die Moskitos nicht schlimmer sein.
Einige Zeit hätte ich allerdings trotzdem ganz gern Robinson gespielt, anstatt wieder auf das verpestete Mönchsschiff gehen zu müssen. Dann aber hätte ich mich hier mehr dem Bootsbau als dem Ackerbau und der Viehzucht gewidmet, hätte mich bestrebt, auf das nächste vorübersegelnde Schiff zu gelangen. Da indes die Kirchenfunzel nicht davongegangen war und jetzt keine Hoffnung mehr bestand, dass sie es noch tun würde, so musste ich auch einem kürzeren Robinsonspiel entsagen.
Zephyros hingegen wurde seinem Entschlusse nicht untreu. Je mehr er von der Insel sah, desto entzückter ward er, schwärmte davon, was er hier und dort alles anlegen wollte.
Es war auch ganz merkwürdig, dass der Jüngling so gar nicht unter den Mücken zu leiden hatte. Wir, Swen und ich, saßen immer ganz voll von ihnen, sie stachen durch die dicksten Kleider, nur das Leder der Stiefel konnten sie nicht durchbohren. Zum Glück waren es nicht jene Moskiten, bei denen jeder Stich eine schmerzhafte Beule erzeugt, die auch noch ganz bösartig werden kann. Oder diesen hier fehlte die Aasnahrung, durch welche ihr Stich erst giftig wird. Immerhin, es genügte gerade.
Also, wie gesagt, Zephyros blieb von den Insekten ganz verschont. Sie summten ihn an und schwirrten wie erschrocken wieder ab. Es musste an seiner Hautausdünstung liegen, oder an seinem säuselnden Namen, oder er hatte nicht so süßes Blut wie wir beiden anderen.
Beim Rückmarsch nach der Küste passierten wir die Stelle, wo wir die Fleischschnitte aufgehangen hatten, reichlich ein Zentner. Es hing nichts mehr da. Zahllose Papageien stritten sich um die letzten Fetzen, obschon sie es wohl mehr darauf abgesehen hatten, die Fleischstreifen von dem Strick herabzureißen, sie duldeten auf ihrer Insel kein Werk von Menschenhand, und was am Boden lag, von den gefräßigen Vögeln gräulich beschmutzt, das hatten Millionen und Billionen von Mücken als Ablagerungsstätte ihrer Brut benutzt, das meiste war schon lebendig.
Dieser Anblick trug nicht dazu bei, unsere Vorliebe für die RobinsonInsel zu vermehren. Nur Zephyros wurde nicht entmutigt. Er beschrieb uns, wie er sich eine Speisekammer in den Felsen hauen wolle, mit Wasserkühlung, sprach auch schon von einer ganzen Badeeinrichtung mit Brause.
Sollte ich da nicht meines armen Freundes Frettwurst gedenken? Es verging überhaupt kein Tag, an dem ich nicht an den braven Kerl dachte, und hier auf dieser Insel hatte ich es lebhafter denn je getan.
Wenn auch er wohl nicht hier geblieben wäre — was hätte er doch für humoristische Bemerkungen gemacht! Nun, ihm war wohl — der rauchte jetzt in Walhalla als Mann und Held seine lange Pfeife, die ich ihm mitgegeben, leierte vielleicht der Heldentafelrunde etwas vor.
Zephyros wollte das Mönchsschiff gar nicht wiedersehen, und so verabschiedeten wir uns gleich an der Quelle, wo er sich niederzulassen gedachte, bis er eine Höhle gefunden haben würde.
Mir schien überhaupt, als ob es ihm ganz lieb sei, dass er ganz allein hier bleiben sollte, und wenn er ein echtes Eremiten- oder auch Robinsonleben führen wollte, so konnte ich ihm das nicht verdenken. Trotzdem fiel dem braven Jungen der Abschied von mir schwer, mir vielleicht noch mehr von ihm.
Wir ließen ihm auch unsere Waffen zurück, sodass er drei Gewehre und drei Revolver hatte, obgleich er versicherte, sich alsbald Pfeil und Bogen fertigen, überhaupt ohne Benutzung der Werkzeuge ganz von vorn anfangen zu wollen, und Swen und ich marschierten ab.
Solange wir uns zwischen den Felsen befanden, hatten wir noch immer Hoffnung, das Schiff könnte unterdessen verschwunden sein, oder wir könnten es doch jetzt schon in voller Fahrt erblicken, vielleicht mit keiner Möglichkeit, wieder zurückzukehren.
Aber nein, da lag die ,Funzel‹ noch immer ruhig vor Anker!
»Mich wundert, dass sie mich nicht im Stiche gelassen haben«, sagte ich.
»Die Prophezeiung lautet ja, dass Ihr freiwillig das Schiff verlassen müsst.«
»Ach was, Prophezeinng! Keiner der Mönche sollte ja nur wieder das Land betreten, und nun ist es bei Zephyros doch anders gekommen.«
»Nein, Zephyros zählt schon nicht mehr zu den Mönchen, er ist ein Abtrünniger.«
»Was, fangt Ihr nun auch schon an, Swen?!«
»Ich spreche nur die Ansicht der Mönche aus. Zephyros darf wohl an Land, muss aber zurück an Bord, zurück nach Athos, und zwar freiwillig.«
»Nun gut — das trifft eben jetzt nicht ein. Ich lichte sofort die Anker, und ich will doch sehen, wer mich daran hindern wird!«
»Freilich, infofern ist ein Paragraf in der Prophezeiung verletzt worden, nicht der unwichtigste, und ich bin doch gespannt, wie das diese spitzfindigen Mönche wieder auszulegen wissen, dass es aussieht, als ob sie immer noch Recht behalten hätten.«
Noch weit entfernt von der Küste, schwenkte ich mein Taschentuch. Das Zeichen wurde gesehen, ein Fragezeichen ging hoch, ich schwenkte mein Taschentuch bejahend, und alsbald wurde ein Boot herabgelassen, ging ab.
Ich wunderte mich noch immer, hätte nicht geglaubt, dass sie mich noch abholen würden. Bis zuletzt glaubte ich, es sei ein Scheinmanöver.
Aber das Boot kam heran, und als es sich zwischen den brandenden Riffen befand, geschah etwas, was mir noch heute ein Rätsel ist.
Wir standen dicht an der Küste, konnten alles ganz deutlich sehen. Das Boot steuerte denselben Kurs wie ich gestern, kam aber doch etwas davon ab. Mit einem Male sah ich, wie es sich mitten zwischen spitzen Riffen befand, es war von einer Woge hineingeschleudert worden — Swen schrie laut auf, ich desgleichen, Boot und Menschen waren rettungslos verloren, und wenn es auch nicht meine Freunde waren, man ist doch ein Mensch — da aber rollte die Jolle über die furchtbaren Riffe, die meterhoch aus der Gischt heraussahen, hinweg. Und nicht etwa wieder von einer Woge getragen! Nein, das Boot war gleichsam frei durch die Luft geschwebt.
»Was war denn das?!«, flüsterte Swen. »Das ging nicht mit natürlichen Dingen zu!!«
Wenn ich nicht an Zauberei glaube, so kann ich es mir heute noch nicht erklären. Entweder war es eine Vision gewesen, oder wir hatten eben die Woge, die das Boot über das Riff geschleudert hatte, aber nicht gefolgt war, nicht gesehen. Jedenfalls befand sich das mit sechs Mann besetzte Boot — wenn auf einer Seite zwei, auf der anderen Seite drei rudern, das tut auf hoher See gar nichts zur Sache — jetzt in der wohl noch rauen, aber viel ungefährlicheren Bucht, es rollte heran, hielt auf Riemen, wir wateten in das Wasser, ließen uns die Brandung mehrmals über den Kopf schlagen und befanden uns im Boot.
Das war mein Besuch auf der RobinsonInsel gewesen. Ohne jedes Bemerkenswerte. Aber das sollte ich erst noch erleben, wenn auch nur passiv.
Es war jetzt keine Zeit zur Unterhaltung, bis wir uns wieder auf freier, stiller See befanden.
»Nun, Zephyros ist auf der Insel und bleibt dort«, begann ich.
»Er kommt zurück«, entgegnete Sylvester, der Bootsmann.
»Zu uns an Bord?«
»Ja.«
»Ehe wir absegeln?«
»Was weiß ich? Er darf nicht auf der Insel bleiben, er muss zurück an Bord dieses verfluchten Schiffes, und zwar freiwillig muss er kommen.«
»Aber wenn er's nun nicht tut?«
»Er muss!«
Dieser Glaube an die Prophezeiung des alten Paters war geradezu bewundernswert. In Erfüllung würde sie freilich trotzdem nicht gehen. Doch auch ich wurde wirklich gespannt, wie sich die Mönche da herausfitzen würden.
So fing ich auch noch einmal zu Rufos davon an, ehe ich das Kommando zum Ankerhieven gab.
»Er muss zurückkommen, er darf nicht, kann nicht auf der Insel bleiben«, lautete auch seine Antwort.
»Aber, mein Gott, wir segeln jetzt ab! Und er kommt nicht zurück!!«
Da wieder das schrille, höhnische Gelächter aus der Arrestzelle, was mir stets durch Mark und Bein ging — weswegen, kann ich gar nicht schildern. Der Alte hatte eine so eigentümliche Art, zu lachen, ich glaube fast, er schlug sich dabei mit der Hand vor den Mund.
»Da! Hört Ihr, Kapitän? Pater Zyriacos gibt Euch die Antwort.«
»Hiev den Anker!«
Eine Viertelstunde später hatten wir den vollen Nordwind in den Segeln.
Als alles in Ordnung war, begab ich mich zu dem Gefangenen hinab. Den Schlüssel ließ ich jetzt den Mönchen, sie wussten sich ja doch mit ihrem Kirchenältesten in Verbindung zu setzen.
»Ich werde Euch freigeben.«
»Das macht, wie Ihr wollt.«
»Auch Ihr habt doch in Athen damals Euer Steuermannsexamen abgelegt.«
»Ja.«
»Ich biete Euch die Freiheit unter der Bedingung an, dass Ihr auf Wache als Steuermann geht.«
»Ihr meint, weil Frater Zephyros sich jetzt dort auf jener Insel befindet?«
»Ihr habt uns ja zu dritt im Boote fortfahren, nur zwei zurückkehren sehen.«
»Ich weiß es, auch ohne hingeblickt zu haben.«
»Nun gut! Ich gebe Euch die Freiheit, nicht weil ich zu bequem wäre, auf regelmäßige Wache mitzugehen...«
»Das habt Ihr gar nicht nötig.«
»Was habe ich nicht nötig?«
»Dass Ihr auf Wache geht. Zephyros kommt ja doch wieder an Bord zurück.«
Nun fing der auch noch an! Natürlich, das war ja der Hauptmacher!
»Lassen wir das! Der Jüngling bleibt auf der Insel...«
»Er bleibt nicht darauf, er muss zurück an Bord, ich will es!«
»Gut, trotzdem will ich Euch die Freiheit geben. Es hat keinen Zweck, dass Ihr hier unten sitzt, und denkt nicht etwa, dass ich Euch deswegen freigebe, weil ich mich...«
»Da kommt er ja schon wieder.«
»Wer kommt?«
»Zephyros. Er will an Bord zurück.«
Ich sah den Alten an. Der blickte, das Gesicht vom Fenster abgewendet, diesem überhaupt den Rücken zudrehend, starr vor sich hin. Jetzt schaute ich durch das Bullauge, das gerade der Insel, die wir gleich hinter uns hatten, zugekehrt war.
Und wahrhaftig, da sah ich den Jüngling über das freie Stück Prärie rennen, die bis an die Küste reichte, und zwar lief er, was er laufen konnte, dabei ein Tuch schwenkend, jetzt stürzte er, raffte sich wieder auf, schwenkte das Tuch, rannte weiter, stürzte nochmals, so unsicher war sein Rennen — so erreichte er das Ufer und... stürzte sich sofort in die Brandung hinein!
Ich hatte genug gesehen. Ich konnte mir nichts erklären, aber mehr brauchte ich nicht zu sehen.
Ich hinaus, vergaß die Tür abzuschließen, es hatte ja auch gar keinen Zweck, hinauf an Deck.
»Habt Ihr Zephyros gesehen?«, empfing mich Swen mit ganz erschrockenem Gesicht.
»Ja, ich sah ihn rennen — da muss etwas passiert sein!«
»Er hat sich ins Meer gestürzt!«
»Auch das sah ich noch — er ist verloren!«
»Da, da schwimmt er!!«, rief Pater Rufos, der bereits das Fernrohr benutzte.
Wahrhaftig, er war lebendig durch die Brandung gekommen, dort tauchte über dem stilleren Wasser sein Kopf auf, durch das Fernrohr sah ich sein verzweifeltes Schwimmen.
»Da ist etwas passiert — er will an Bord zurück!«, rief Swen.
In diesem Augenblick sah ich das höhnische Gesicht des zweiten Steuermanns — es konnte mich natürlich nicht davon abbringen, jenem zu Hilfe zu eilen.
Ich ließ die Segel streichen, noch in voller Fahrt ein Boot aussetzen, ging selbst mit hinein. Schon beim Absetzen merkte ich, dass das Boot vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre. Um die Insel herum kam von Norden her eine starke Strömung, sie führte uns den Schwimmer von ganz allein zu. Dann aber erkannte ich, dass wir doch allen Grund hatten, diesem schnellstens zu Hilfe zu kommen.
Schon tauchten in seiner Nähe überall aus dem Wasser dreieckige Flossen empor — Haifische, es wimmelte um ihn her von diesen Bestien.
»Wir kommen zu spät, er fällt den Haifischen zum Opfer!«, schrie ich.
»Sie tun ihm nichts, dürfen es nicht, er muss an Bord zurück«, entgegnete Bootsmann Sylvester mit jenem versteckten Hohn, der allen diesen Menschen eigen war, wenigstens den älteren, deren Herz wie der Körper verknöchert war. Ich hätte ihm mit dem Riemen in das grinsende Gesicht schlagen können, zog es aber vor, den Riemen als Ruder zu gebrauchen.
Wir begegneten einander. Das Meer wimmelte geradezu von Haifischen. Die Ungeheuer legten sich schon auf den Rücken, um mit dem weitgeöffneten Rachen ein Bein, einen Arm, den ganzen Körper zu fassen, und dass der Haifisch nicht zuschnappt, solange man heftige Bewegungen macht, ist eine sehr trügerische Behauptung. Ich habe einen Mann gesehen, im Roten Meere, der wie ein Hampelmann zappelte, und ein Hai holte ihn ohne Weiteres weg.
Aber diese Ungeheuer hier, bis zu sieben Meter Länge, begnügten sich, das Maul aufzureißen und sich auf die Seite zu legen, zuschnappen jedoch wollten sie nicht.
Jetzt hatten wir ihn erreicht. Wir schlugen auf die Meereshyänen los, wenigstens Swen und ich. Zephyros klammerte sich, das Gesicht ganz entstellt, an den Bootsrand.
Da sah ich, wie noch einmal ein Riesenhai angeschossen kam, im Nu hatte er des Jünglings jetzt ruhendes Bein erfasst, ließ es ganz im Schlunde verschwinden.
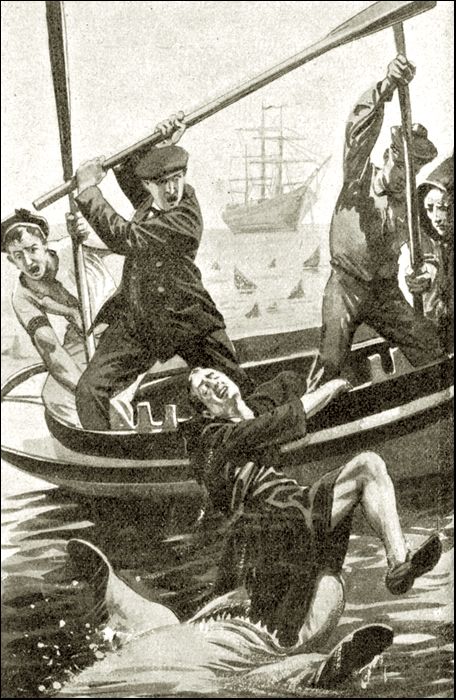
Ich schrie laut auf, holte zum Schlage mit dem Riemen aus.
Zu spät, das Bein war weg!
Das heißt, so dachte ich! Der Hai dachte anders. Er gab das Bein wieder frei, spie es förmlich wieder aus und schoss davon.
Dann lag Zephyros im Boot. Anscheinend hatte er von den Haifischzähnen nicht den geringsten Riss davongetragen.
Auch bewusstlos wurde er nicht, war aber ebenso wenig zum Sprechen zu bringen. Er keuchte und stöhnte nur.
Erst an Bord fand er seine Sprache wieder, die er zuerst richtig verloren zu haben schien, denn er hatte schon immer sprechen wollen, aber keinen verständlichen Laut hervorbringen können, wie er sich auch abgemüht hatte.
Auch jetzt brachte er zuerst nur unzusammenhängende Worte hervor, nachdem er einige Zeit in seiner Koje gelegen hatte.
»Christus... o, Jesus Christus!!«
»Habt Ihr denn etwas erlebt? Ist Euch etwas Besonderes begegnet?«
»O, mein Heiland... Jesus Christus!!«
»Beruhigt Euch erst wieder, sucht zu schlafen...«
»Nein, nein, bleibt hier... ich fürchte mich... ich fürchte mich... der Heiland... der Erlöser... der Gekreuzigte... mit seinen blutigen Malen!!«
Da merkte ich erst, dass er das Wort Christus und dergleichen nicht nur als geläufigen Ausdruck gebrauchte. Übrigens hatte dieser Jüngling das auch sonst nie getan.
»Euch ist der Heiland erschienen?«
»Ja... ja... der Gekreuzigte... mit seinen blutigen Malen... und er zeigte sie mir!«
»Wo denn?«
»Auf der Insel... in einer Höhle...«
»Ihr habt eine Höhle gefunden?«
»Ja... ja... gleich als Ihr fort wart... und kaum betrat ich sie, da erschien mir der Heiland.«
»Es war doch nicht etwa der Teufel?«, fragte ich naiv.
Ich dachte nämlich an einen Ziegenbock — auch Ziegen sollte es auf Juan Fernández geben — und ein harmloser Ziegenbock ist von Geistersehern und anderen gläubigen Seelen schon so oft mit dem Teufel identifiziert worden, dass meine Vermutung sehr nahe lag. Und so ein richtiger Ziegenbock hat ja auch etwas Mephistophelisches an sich, das Bocksbein, der Bart, die Hörner nicht zu vergessen — ja, sogar seine Physiognomie eignet sich am besten dazu, und schließlich auch sein Stoßen, wie er plötzlich mutwillig einen Menschen anfällt und ihn über den Haufen rennt.
»Es war doch nicht etwa der Teufel?«, fragte ich also.
»Nein, nein — Jesus Christus... es war der Heiland... der Gekreuzigte.«
»So erzählt doch ausführlicher, wenn Ihr dessen fähig seid.«
»Ich trat in die finstere Höhle... da ward es im Hintergrunde plötzlich ganz hell... und da stand ein Mensch... ein Gott... Jesus Christus... unser Heiland... im weißen Gewand... das goldene Haar von einem noch stärkeren Lichtschein umflossen... und ich sah seine Füße... blutig... von Nägeln durchbohrt... und er zeigte mir seine Hände... von blutigen Nägeln durchbohrt... und er drohte mir... oder winkte... und er sprach... und er sprach...«
»Was sagte er?«
»Er sprach nicht, und doch hörte ich ihn sprechen... gehe zurück in den Schoß deiner Kirche, als gehorsamer Sohn... gehe zurück an Bord deines Schiffes und wirf dich deinem Pater zu Füßen, bitte ihn um Verzeihung, und wie er dir verzeiht, so will auch ich dir verzeihen...«
Röchelnd schwieg der Fiebernde. Natürlich hatte er nur eine Vision gehabt. Der Jüngling, im Kloster erzogen, war gerade in den besten Jahren dazu. Aber ich wusste auch, dass ich ihn hiervon nie überzeugen würde. Ein anderer hätte es wohl versucht — ich tat es nicht erst. Und... ich wusste bereits, dass ich diesen Jüngling von Stund' an verloren hatte!
»Der Pater... wo ist der Pater...«
»Pater Cyriacos?«
»Ja... ja... ich muss ihn sprechen... ihm beichten...«
Da war es ja schon! Ach, mir wurde gar traurig zumute! Ich fühlte förmlich, wie mein Herz zu bluten begann.
Ich mache es kurz. Dies waren für mich noch viel, viel schmerzlichere Minuten als damals, da ich meinen Freund Frettwurst sterben sah. Der war doch wie ein Mann, sogar wie ein Held gestorben, und das war nur ein physischer Tod gewesen, dem wir alle unterworfen sind. Hier sah ich einen Jüngling mit den edelsten Anlagen geistig sterben!
Ich ließ Pater Cyriax aus seiner Zelle holen. Er weigerte sich, in die Kajüte zu kommen, in der ich atmete.
Zephyros hörte es, und er verlangte, in die Foxel gebracht zu werden, ins Matrosenlogis, das halb zur Kapelle eingerichtet war, in der er ja schon früher auch als erster Steuermann gehaust hatte.
Er war zu schwach zum Gehen, Mönche trugen ihn hin.
Wir standen dann noch oft zusammen auf der Kommandobrücke, aber... zwischen uns war eine unüberbrückbare Kluft.
Ich hatte verspielt. Die Kirche hatte wieder einmal gesiegt.
Wir segelten um Kap Hoorn, mitten im Winter; bei jedem Segelmanöver musste erst das Eis von den Rahen geklopft werden, immer das fürchterlichste Unwetter, aber bei uns brach nicht eine Stange.
Natürlich, auf diesem Schiffe ruhte ja noch der Fluch, erst in Athos wurde er von ihm genommen, wenn die Mönche Buße getan hatten.
Jetzt, da der letzte der Abtrünnigen reumütig in den Schoß der allein selig machenden Kirche zurückgekehrt war — jede Religion, jede Sekte besitzt dieses Privileg — war nur erst die Möglichkeit gegeben, dass das Schiff Athos überhaupt wieder erreichen konnte.
Wahrhaftig, hätte ich nicht allen Stolz zusammengenommen, ich wäre bald selbst in diesen Aberglauben versunken, Dem schwedischen Lehrersohne fiel dieser Kampf viel leichter, er hatte überhaupt eine viel leichtere Natur. Man nennt ja den Schweden den Franzosen des Nordens, und der Franzose steht für mich in einer Hinsicht, in freisinniggeistiger, auf bewundernswerter Höhe... Swen unterstützte mich in diesem meinem Kampfe.
Zehn Wochen später gingen wir auf der Reede von Athen vor Anker. Ich hatte mit Cyriax gesprochen.
Die Fracht war nicht nach Athen bestimmt, sondern direkt nach Athos, als Proviant für die Klöster.
Das Pökelfleisch war in Amerika so billig eingekauft worden, dass sich die weite Reise lohnte. Vielleicht auch waren noch andere Missionen dabei gewesen.
Aber der eigentliche Heimathafen des ›Lichtes vom heiligen Berge‹, wo es registriert war, war doch Athen, und ich hatte meine Pflicht getan, hatte es bis nach dem Heimathafen gebracht. Hier wollte ich von Bord gehen, Swen desgleichen.
Cyriax war damit ganz einverstanden. Hätte er jetzt noch eine spöttische Bemerkung gemacht, dass ich nun doch noch freiwillig von Bord ginge, dann hätte er zum Schlusse noch etwas von mir zu hören bekommen, wahrscheinlich auch mit einem Knalleffekt.
Er blieb ganz sachlich.
Wir signalisierten ausführlich. Auf einem Dampfboot kam ein Reederagent, der die Interessen der Klosterrepublik vertrat, ein wirklicher Mönch, dieser brachte auch gleich einen griechischen Kapitän mit, der aber in Zivil ging. In diesem Falle, da ich noch immer nur aushilfsweise Kapitän war, waren keine weiteren Förmlichkeiten nötig. Weil innerhalb dreier Monate kein Pestfall vorgekommen war, brauchte das, solange wir uns auf Reede befanden, gar nicht gemeldet zu werden. Die Sache muss doch einmal ein Ende nehmen.
Ich übergab dem neuen Kapitän Logbuch und Kommando. Cyriax, als Reederkapitän, stellte mir ein Zeugnis aus, wie ich es verdient hatte, zahlte mir 500 Dollar, die ich ebenso redlich verdient; ich hätte noch andere Ansprüche machen können, auch Swen erhielt seine englische Heuer, das Dampfboot brachte uns mit Kleidersack und Kiste an Land.
Hiermit war mein zweites Verhältnis mit dem Mönchsschiff beendet. Das sollte auch so bleiben. Aber in anderer Weise sollte ich noch an die Republik auf dem Athos erinnert werden.
»Was nun, Kapitän?«, fragte Swen, als wir uns in einem Restaurant gütlich taten.
Ohne dass wir ein Wort darüber gesprochen hätten, war doch zwischen uns ausgemacht, dass wir zusammen blieben, solange es das Schicksal bestimmte. Ohne Eidschwüre waren wir treue Freunde geworden.
Ich hatte nichts Besonderes vor, mochte jetzt auch gar nicht darüber nachgrübeln. Mir war recht elend zumute, ich wusste selbst nicht warum. Der beste Rotwein wollte mir nicht schmecken, gar nichts.
Der athenische Jüngling kam mir gar nicht aus dem Sinn. Ich wollte nicht an ihn denken — was ging mich denn der abergläubische Knabe an — und doch war es so.
»Ich dächte, Ihr hieltet Euer Geld zusammen und machtet erst einmal Euer Steuermannsexamen.«
»Daran habe ich selbst schon gedacht, und ich bin jetzt auch gar nicht in der Stimmung, mein Geld zu verjuchheien. Es ganz still in einer Ecke für mich zu versaufen — ja, das brächte ich vielleicht fertig.«
Dem Schweden ging es also ebenso wie mir. Wir beide hatten einen moralischen Kater, ohne den Grund richtig definieren zu können.
»Aber nicht hier in Athen. Ich möchte das Examen schon lieber in England ablegen, noch lieber in Stockholm. Heimat bleibt doch Heimat.«
»Gut, gehen wir nach Stockholm! Ich begleite Euch. Es ist ja ganz egal, wohin ich gehe.«
»Ich fürchte nur, wenn ich erst wieder richtige Seemannsatmosphäre atme, dürften alle meine guten Vorsätze wieder zum Teufel gehen. Ich brauchte bloß in die richtige Gesellschaft zu kommen. Meinetwegen nennt mich einen Waschlappen.«
»Das tue ich nicht — ich begreif's schon. Der Mönch, der dem Kloster entflieht, wird wohl nicht gleich in die Kirche laufen. Fahren wir per Eisenbahn. Dazu reicht's schon. Mein Geld steht Euch zur Verfügung, da brauchen wir doch kein Wort zu verlieren. Sonst setzen wir uns auf die Puffer. Nur eins möchte ich Euch gleich sagen. ich habe wenig Lust, bei der Kauffahrtei zu bleiben.«
»Was habt Ihr sonst vor?«
»Vorläufig noch gar nichts. Nur diese christliche Seefahrt... sie ist mir bis au die Halsbinde gestiegen.«
»Hört, Kapitän — wer einmal zur Seefahrt gegangen ist, der kommt nicht wieder davon weg. Wenigstens nicht solche Charaktere wie Ihr und ich. Man muss doch immer wieder aufs Salzwasser.«
»Da mögt Ihr schon recht haben. Ich sprach auch nur von der Kauffahrtei. Wie wär's, wenn wir uns daran erinnerten, dass den germanischen Rassen immer das Landsknechtswesen im Blute gesteckt hat? Wenn wir Dienste in der Kriegsmarine nähmen?«
Der Schwede horchte hoch auf.
»Die schwedische Marine wäre nichts für mich...«
»Und für mich die des Landes nichts, in dem ich das Licht der Welt erblickt habe. Wie wär's mit der nordamerikanischen Kriegsmarine? Dort braucht man solche Kerls, wie wir beide sind, gerade jetzt werden sie wie die Stecknadeln gesucht — ich könnte fast garantieren, dass wir beide, wenn nichts Bleiernes dazwischenkommt, in Jahresfrist Offiziere sind, und nicht nur kleine Leutnantchen, auch wenn wir als Matrosen anfangen sollten.«
Es stand nämlich damals der Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und Spanien vor der Tür. Für den, der die Verhältnisse kannte oder instinktiv fühlte, lag es förmlich in der Luft, obgleich die ›Maine‹ noch nicht explodiert war. Das war ja nur ein Vorwand, um den... Moralitätskrieg, möchte man sagen, endlich ausbrechen zu lassen.
Auf der einen Seite der jugendliche Riese in unbändigem Freiheitsdrange, der die Sklaverei abgeschafft hatte, der auch nichts von einer Staatsreligion wissen will — — auf der anderen Seite der altersschwache Jesuit, der seine Kolonien und alles, was damit in Berührung kam, in fluchwürdige Knechtschaft zu bringen suchte und darin festhielt.
In unbegreiflicher Kurzsichtigkeit hatte damals das deutsche Volk als einziges, eben verblendet durch noch kurzsichtigere Zeitungsschreiber, auf Seite Spaniens gestanden. Nicht aber die Deutschen, welche keine Zeitungen brauchen, welche die Welt aus eigner Anschauung kannten. Besonders also Seeleute. So gingen damals auch alle deutschen Seeleute, Matrosen und Heizer — und Deutsche waren die meisten — die nur irgendwie abkommen konnten, Herren ihres freien Willens waren, bei Ausbruch des Krieges sofort auf amerikanische Seite über, um auch mit diesen verfluchten Spaniolen das Leder zu versohlen.
Ich hatte also dasselbe vor, und Swen war sofort bereit, da mitzumachen. Was wir sonst noch alles planten, brauche ich nicht zu erzählen, da aus alledem nichts werden sollte.
So hatten wir uns beide in recht kriegerische Stimmung hineingezecht, verschwunden war mit einem Male aller Trübsinn, erst spät in der Nacht suchten wir etwas taumelnd in dem Hotel unser gemeinschaftliches Schlafzimmer auf.
Während des Schlafes stellte sich ein quälender Durst ein, der sich erst als Traum bemerkbar machte. Ich träumte nicht nur von einer Quelle, sondern lag plötzlich gleich in einem ganzen Wasserbassin, welches ich mich auszutrinken bemühte. Das Wasser war ziemlich warm, und es ging nicht so zu wie sonst gewöhnlich im Traume, dass man trinkt und trinkt, ohne den Durst löschen zu können, sondern ich wurde wirklich satt, ich fühlte, wie sich mein Leib vollpumpte, und das ward nach und nach im Traume so deutlich — ich erwachte.
Hallo!! Das war nicht nur ein Traum, sondern ich befand mich tatsächlich in lauem Wasser, das mir, lang ausgestreckt wie ich lag, über den ganzen Leib ging und bis dicht an den Mund des etwas höher liegenden Kopfes reichte.
So deutlich das auch war, sagte ich mir im nächsten Augenblicke, dass ich dennoch nur träume. Es gibt nämlich ein Scheinerwachen. Man träumt, erwacht zu sein, sagt sich, man sei bei völligein Bewusstsein, und dennoch ist es noch immer ein Traum, der sich plötzlich ganz verändert hat. Jeder, der seinen Schlaf und Traum beobachtet, wird das bestätigen können. Mir war es eine ganz bekannte Erscheinung, und merkwürdig, wie man in solch einem zweiten Traume, der einem ein Erwachen vorgaukelt, ganz vernünftig denken kann.
»I, ich träume ja immer noch«, sagte ich mir also mit lächelnder Gemütsruhe, »ich liege doch in meinem weichen Hotelbett, habe unter dem Kopfe doch keinen harten Stein, sondern ein weiches Kiss...«
Da schnellte ich gurgelnd und spuckend empor, — das Wasser war mir beim Sprechen in den Mund gekommen!
Jetzt freilich war es mit meiner Ansicht vorbei, das könne nur ein Scheinerwachen im Traume sein!
Das triefende Hemd klebte mir am nassen Körper, ich stand fast bis an die Knie in lauem Wasser.
Himmel, wohin war ich denn geraten?! War ich etwa ein Nachtwandler, der sich...
Da zuckte mir ein schrecklicher Gedanke durch den Kopf!
Sollte ich etwa wiederum...
In diesem Augenblicke traf ein blendender Lichtstrahl mein Gesicht, er kam aus einem Loche in der Wand, und in dieser Öffnung sah ich neben der Blendlaterne das höhnische Gesicht des... Paters Cyriax!
Es kam nicht unerwartet. Ich hatte es ja schon geahnt.
»Nun, Mr. Novacasa, mein sehr geehrter Herr Kapitän, wie befinden Sie sich?«
»Teufel!«, konnte ich beim Anblick dieser Teufelsfratze zunächst nur hervorstoßen.
Zugleich aber hielt ich Umschau, wozu der sich sehr verbreiternde Blendstrahl genügte. Ich befand mich in einem völlig runden Raume, dessen Durchmesser etwa fünf Meter betrug. Die schwarzen, triefenden Wände waren ganz nackt, nur dass gegenüber der Öffnung, in der sich das Gesicht des Paters zeigte, noch so ein Loch in der Wand vorhanden war, in Brusthöhe, viereckig, so groß, dass man zur Mühe den Kopf hindurch stecken konnte.
Die Decke war nicht zu erblicken, umso mehr interessierte mich der Boden, der reichlich einen Viertelmeter hoch mit lauwarmem Wasser bedeckt war.
Das war alles, was ich festzustellen vermochte. Höchstens noch, dass ich selbst nur mit einem Hemde bekleidet war, und zwar mit meinem eigenen, und dass ich eben bis zum Halse triefendnass war.
»Darf ich mich erkundigen, wie Sie geschlafen haben?«, fuhr die grinsende Teufelsfratze fort.
Was gibt es wohl Niederträchtigeres, als einen Wehrlosen, der sich in einer so miserablen Lage befindet, wie ich mich, auch noch zu verhöhnen!
Aber ich blieb kalt, sachlich, wollte möglichst viel zu erfahren suchen.
»Ich befinde mich hier wieder im Hauptkloster von Athos?«
»Erraten!«
»Ich bin wieder bewusstlos in einer Kiste hierher transportiert worden?«
»Erraten, Herr Kapitän! Diesmal aber hat man eine lange Kiste benutzt, damit Sie sich nicht wieder über Gelenkschmerzen in den Knien zu beklagen haben.«
Höhnischer und teuflischer konnte das Grinsen gar nicht sein! Ach, hätte ich den Kerl nur in einem Sprunge packen können! Aber er war vorsichtig!
Außerdem wollte ich doch erst noch etwas mehr erfahren.
»Was soll dieser Mummenschanz?«
»Das nennen Sie einen Mummenschanz?«
»Was hat man mit mir vor?«
»Das wirst du sehr bald erfahren, mein Sohn«, wurde der Pater jetzt salbungsvoll.
»Ich möchte den Patriarchen sprechen.«
»Gibt es nicht.«
»So weiß der Patriarch gar nicht um mein Hiersein.«
»Doch.«
»Nicht, in welcher Lage ich mich hier befinde.«
»Er weiß alles.«
»Sie wollen an mir hier eine persönliche Rache ausüben.«
»Wir wissen hier überhaupt nichts von Rache. Die Rache ist des Herrn!«
»Dass Sie doch an diesem frevelhaften Worte ersticken möchten!«
»Das ist ein sehr unchristlicher Wunsch, mein Sohn, so etwas musst du dir abgewöhnen, sonst wirst du noch hart dafür büßen.«
»Du willst mich martern!«
»O nein! Weshalb sollte ich dich martern?«
»Um deine Rache zu befriedigen. Dass du einen Hass auf mich hast, ist ja nur zu erklärlich.«
»Weshalb sollte ich dich hassen?«
»Wenn du es nicht wissen willst, kann ich es dir auch nicht erklären.«
»Sagte ich dir nicht schon, dass es so etwas wie Rache bei uns gar nicht gibt?«
»Das glaube euch der Teufel!«
»Mein Sohn, gewöhne dir solche Flüche ab, du wirst sonst hart dafür büßen müssen«
»Ich verlange den Patriarchen zu sprechen«, wiederholte ich.
»Gibt es nicht!«, erklang es ebenso wie vorhin zurück, und zwar in einem Tone, dass ich gleich wusste, ich brauchte mir keine weitere Mühe in dieser Hinsicht zu geben.
»Was hast du mit mir vor?«
»Nur ein kleines Experiment.«
»Was für ein Experiment?«
»Frater Zephyros erzählte dir doch einmal, wie wir jeden Willen zu brechen wissen.«
Also auch das wusste der Kerl! Nun, er hatte es eben damals erlauscht oder vielleicht auch nachträglich von Zephyros selbst zu erfahren bekommen. Dessen Wille war ja allerdings jetzt schon gebrochen.
»Nun, und?«
»Du bezweifeltest, dass uns so etwas möglich sei.«
»Eines jeden Menschen Willen zu brechen?«
»Ja.«
»Das weiß ich nicht mehr, ich glaube auch gar nicht, dass ich das bezweifelt habe.«
»Du sagtest, mittels jener Kunst, welche ihr Hypnotik nennt, sei das wohl möglich.«
»Ach, richtig! Ja, ich entsinne mich.«
»Ich weiß recht wohl, was Hypnotik ist.«
»Desto besser für dich, wenn du deine Kenntnisse so erweitert hast.«
»Aber wir besitzen noch ein ganz anderes Mittel, um eines jeden Menschen Willen zu brechen.«
»Welches?«
»Ein ganz natürliches.«
»Die Folter.«
»Wir foltern niemand.«
»Na, dann seid glücklich, so ein Mittel zu haben.«
»Wir werden es einmal bei dir anwenden.«
»Wozu?«
»Um deinen Willen zu brechen.«
»Versucht das!«
»Du wirst mir ohne eigenen Willen bedingungslos gehorchen.«
»Dir? Niemals!«
»Ich befehle dir, Selbstmord zu begehen.«
Ich stutzte denn doch! Wo sollte das hinaus?
»Was sagst du da?!«
»Ich befehle dir, Selbstmord zu begehen.«
»Weshalb?«
»Weil ich es will. Ich befehle es dir!«
»Auf welche Weise soll ich Selbstmord begehen?«
»Indem du dich ins Wasser legst und dich ertränkst.«
»In diesem flachen Wasser hier?«
»Ja.«
»Du bist irrsinnig, Pater.«
»Ich befehle es dir. Lege dich hin und ertränke dich!«
»Lass dich doch nicht auslachen!«
»Du willst es nicht tun?«
»Fällt mir ja gar nicht im Traume ein!«, konnte ich wirklich lachen.
»Und ich sage dir: du wirst dich freiwillig hinlegen und dich ertränken!«
»Niemals!«
»Ich nehme an, dass du mir hiermit dein Ehrenwort gegeben hast, auf das ihr ja so viel haltet.«
»Na, so war das allerdings nun gerade nicht gemeint...«
»Und du wirst sehen, wie schnell du dein Ehrenwort brichst.«
Jetzt allerdings hatte er mich gefasst! O über diese pfäffische Schlauheit!
»Ja, nun kannst du es auch als mein Ehrenwort auffassen.«
»Also, du wirst keinen Selbstmord begehen?«
»Auf mein Ehrenwort, nein! Freilich möchte ich nicht mein ganzes Leben lang...«
»Gib mir dein Ehrenwort nur auf sieben Tage.«
»Dass ich innerhalb von sieben Tagen keinen Selbstmord begehe?«
»Ja.«
»Und ich werde nicht gemartert?«
»Kein Härchen wird auf deinem Haupte gekrümmt.«
»Ja, weshalb soll ich denn dann Selbstmord begehen?«
»Weil du es hier nicht aushalten kannst.«
»Warum denn nicht?«
»Du wirst es erfahren.«
»Das Wasser wird wohl bis zum Sieden erhitzt?«
»Dass du verbrühst? Gott bewahre uns vor solcher Schandtat!«
»Nun gut, jetzt werde ich wirklich gespannt, was ihr eigentlich mit mir vorhabt.«
»Also, ich habe dein Ehrenwort, dass du innerhalb von sieben Tagen keinen Selbstmord begehst.«
»Du hast es.«
»Aber nicht nur, dass du dich nicht hinlegen darfst, um dich zu ertränken — du darfst auch in anderer Weise keinen Selbstmord begehen.«
»Wie soll denn der sonst noch erfolgen können?«
»Nun, indem du dir zum Beispiel den Kopf an der Mauer einrennst.«
»Ich denke ja gar nicht daran!«, lachte ich wirklich belustigt.
»Auch die Zunge darfst du nicht verschlucken.«
»Ich wünschte sehr, dass du mir dieses Experiment einmal vormachtest.«
»Dann erstickt man.«
»Eben deshalb wünsche ich, es von dir erst einmal vorgemacht zu sehen. Kurz und gut, ich werde mich nicht auf irgendeine Weise aus dieser Badewanne ins Jenseits befördern, für sieben Tage nicht, daraufhin hast du mein Ehrenwort. Denn ich bin wirklich gespannt, was ihr mit mir vorhabt. Das heißt, ihr wollt mich doch nicht Hungers sterben lassen?«
»Du sollst sogar sehr gut verpflegt werden. Wir wollen dich ja gerade am Leben erhalten.«
»Oder wird dieses Wasser etwa nach und nach erhitzt?«
»Wäre das nicht eine Marter?«, war die Gegenfrage.
»Na, was wollt ihr denn da nur eigentlich von mir?«
»Dich zwingen, dass du dein Ehrenwort brichst, indem du dich in diesem flachen Wasser freiwillig ertränkst — vor Ablauf der sieben Tage!«
»Ich verstehe nicht.«
»Du wirst es bald genug verstehen lernen. Oder aber: Du wirst einer der Unsrigen.«
»Was?!«
»Das heilige Mal trägst du ja schon an deinem Körper.«
»Was?!«, konnte ich nur wiederholen.
»Du trägst auf deiner linken Schulter das heilige Kreuz.«
Ja, jetzt wusste ich, was der wollte — die Tätowierung, aus Punkten bestehend, das eine Feld des Kreuzes geschlossen, worauf mich erst der englische Arzt im Serail zu Konstantinopel aufmerksam gemacht hatte.
»Das habt ihr mir eingestochen, als ich das erste Mal hier war, in bewusstlosem Zustande.«
»Wir?«
»Na, wer denn sonst, wenn das ein Zeichen von euch ist?«
»Wir denken nicht daran, solch einen furchtbaren Frevel zu begehen. Dieses Mal ist dir vom heiligen Geiste aufgedrückt worden.«
Es hatte gar keinen Zweck, mit diesem Jesuiten über so etwas zu streiten.
»So so, der heilige Geist hat mir dieses Kreuz eingestochen!«, sagte ich also nur. »Und was bedeutet das?«
»Dass du bestimmt bist, einer der Unsrigen zu werden.«
»Wer soll mich dazu bestimmt haben?«
»Gott selbst.«
»In diesem Falle werde ich dem Willen Gottes trotzen.«
»Vermessener Frevler! Nun, du wirst ja sehen, wie bald du uns bittest, dass wir dich als einen der Unsrigen aufnehmen.«
»Als Mönch dieser Klosterrepublik hier?«, lachte ich.
»Ja.«
»Niemals! Eher...«
»Selbstmord begehen darfst du nicht, daraufhin haben wir dein Ehrenwort«, kam er mir zu Hilfe, als ich stockte.
Da hatte man wieder die jesuitische Schlauheit! Also deshalb hatte ich mein Ehrenwort geben müssen, keinen Selbstmord begehen zu wollen!
»Ich kann durchaus nicht erkennen, wo hinaus du eigentlich willst.«
»Die Sache ist sehr einfach. Der heilige Geist hat dir das Zeichen eingedrückt, dass du bestimmt bist, einer der Unsrigen zu werden. Nun aber bist du ein verstockter Sünder, und der Übertritt zu uns muss ganz freiwillig geschehen; deshalb muss dir diese Verstocktheit erst genommen werden. Dazu sind wir verpflichtet, deshalb hat dich Gott erst zu uns geführt, damit wir dieses Zeichen an deinem Körper sähen und dir dann deine Verstocktheit austrieben.«
»Ah, nun verstehe ich!«, rief ich spöttisch. »Das heißt, der heilige Geist muss wirklich über mich gekommen sein, dass ich diesen Unsinn verstehen kann. Die Hauptsache ist also die, dass ihr aus mir einen Athosmönch machen wollt.«
»Du sagst es.«
»Na, da könnt ihr ja lange warten.«
»In spätestens sieben Tagen bist du einer der Unsrigen geworden.«
»Freiwillig, meinst du?«
»Ganz freiwillig!«
»Ich bin doch schon oft und lange genug bei euch gewesen, warum habt ihr denn da nicht schon früher solche Experimente mit mir gemacht?«
»Wir warteten immer, dass du deinen Wunsch äußern würdest, in unsere Gemeinschaft einzutreten. Du bist aber schlimmer als der schlimmste Heide, und da wir dies erkannt haben, ist es jetzt endlich unsere Pflicht, bei dir sanfte Gewalt anzuwenden.«
»Sanfte Gewalt? Das ist gut! Nennt ihr etwa hier dieses Fußbad eine sanfte Gewalt?«
»Nun, bereitet es dir Schmerzen? Ist es zu kalt? Oder zu heiß? Das kann reguliert werden.«
»Nein, es ist gerade so recht mollig. Hahaha, das ist ja eine tolle Geschichte! Also, mittels dieses ganz angenehmen Fußbades wollt ihr mich zwingen, dass ich innerhalb sieben Tagen entweder Selbstmord begehe oder freiwillig in euern Orden eintrete?«
»Jetzt hast du das EntwederOder ganz genau formuliert.«
»Na, da wollen wir einmal sehen, wie sich die Geschichte entwickeln wird.«
»Hast du Wünsche?«
»O ja, ich empfinde Hunger.«
»Du wirst sofort eine Mahlzeit erhalten. Willst du Wein oder Kaffee?«
»Zunächst wäre mir eine Tasse Kaffee recht angenehm. Nach meiner Berechnung oder überhaupt ist für mich jetzt Frühstückszeit.«
Das Gesicht und die Blendlaterne verschwanden; ich stand im Stockfinstern. Ich hatte Zeit zum Überlegen. Aber ich will nicht davon anfangen, was ich alles dachte, müsste ja nur wiederholen.
Einfach rätselhaft, wie die auf diese Weise meinen Willen brechen wollten!
Zunächst fühlte ich mich recht müde, das heißt, nur in den Beinen. Ausgeschlafen mochte ich während des langen Transportes, wenn ich diesmal auch nicht gerade wieder von Amerika gekommen war, ja haben, aber je länger man schläft oder nur liegt, desto fauler wird man bekanntlich.
So genügte es mir also nicht, mich an die Wand zu lehnen, die auch bedeutend kälter war als das Wasser, sondern ich setzte mich gleich ganz hin. So, wenn ich rechtwinklig saß, ging es mir nicht ganz bis zur Hälfte des Leibes. Der Seemann gehört auch zu denen, welche oftmals ein Maß kennen müssen, ohne einen Messstock zur Hand zu haben; ich kannte genau das Maß meiner gespannten Finger, und so konnte ich bestimmen, dass das Wasser genau zweiunddreißig Zentimeter hoch stand. Seine Temperatur mochte fünfundzwanzig Grad Celsius betragen, das ist recht warmes Fluss- oder Teichwasser. Wirklich ganz angenehm. Die Luft war kälter, und so zog ich es vor, mich lang auszustrecken, dass das Wasser auch noch über meine Brust ging, bis an den Hals. Sehr angenehm war ferner, dass die Wand unten ziemlich hoch abgeschrägt war, sodass ich eine ganz bequeme Kopfunterlage hatte. Federkissen gibt es in der Badewanne ja überhaupt nicht.
In dieser Lage war mir tatsächlich ganz behaglich zumute. Ich hatte ein bisschen Kater, vielleicht nur eine Folge des Betäubungsmittels, und diese Wassertemperatur war gerade recht angenehm, nicht zu kalt und nicht zu warm. Über meine Zukunft machte ich mir nicht die geringste Sorge, vor allen Dingen herrschte jetzt die Neugier vor, was man mit mir eigentlich plante.
Da hörte ich ein Geräusch über mir, und plötzlich ward es wieder hell. An der mindestens zehn Meter hohen Decke hing an einem Drahte eine Blendlaterne, sie ward von unsichtbaren Händen noch etwas hin und her gezogen, bis sie genau in der Mitte hing, sodass ihr nach unten sich verbreiternder Strahl die ganze Wasserfläche beleuchtete. Der aus dem Wandloch kommende Strahl vorhin hatte ja doch noch viel im Dunklen gelassen.
Na, wenn das die einzige Tortur sein sollte, dass man meine werte Person von oben beleuchtete, das konnte man sich ja noch gefallen lassen. Aber ich sollte ja überhaupt gar nicht gemartert werden.
»Hier, Herr Kapitän, ist Ihr Frühstück!«, erklang eine Stimme.
Aus dem Wandloche schob sich ein Brett, auf dem ich Teller, eine Kanne, eine Tasse und anderes stehen sah.
Ich erhob mich und ging hin. Auf der anderen Seite des Loches war es stockfinster, ich konnte nur eine Hand sehen, die draußen das Brett hielt. Es war eine andere gewesen als die des Meisters Cyriax.
»Soll ich das ganze Brett nehmen? Schwimmt es?«, fragte ich, schon mit einer großen Salamiwurst liebäugelnd.
»Sie haben recht, ich will Ihnen erst den Tisch hineingeben.«
Das Brett mit den appetitlichen Sachen ward noch einmal zurückgezogen, dafür kamen ein paar Bambusstöcke zum Vorschein.
Ich zog sie herein, brauchte gar keine Anweisung — die drei Beine ließen sich auseinander spreizen, eine Platte darauf, und der niedrige Tisch, nur von Stuhlhöhe, war fertig. Jedenfalls waren die hohlen Bambusbeine mit Blei gefüllt, wenigstens unten, sonst wären sie wohl geschwommen.
»Sie können sich, wenn Sie müde sind, auf den Tisch auch setzen, Herr Kapitän, er ist sehr fest«, belehrte mich der liebenswürdige Kerker- und Bademeister noch.
»Ja, ja, das ist ja eigentlich ein Stuhl, und in die Kerkerzelle gehört eigentlich sowohl ein Stuhl als ein Tisch.«
»Das ist keine Kerkerzelle.«
»Na, dann nennen Sie es eine Badewanne. Aber wenn man nun einmal in die Badewanne einen Tisch bekommt, kann man auch einen besonderen Stuhl verlangen.«
»Nein, es gibt nur diesen Tisch.«
»Na, dann nicht! Übrigens haben Sie schließlich recht. In einer Badewanne braucht man, wenn man darin speisen will, nur einen Tisch, und wenn man durchaus will, kann man sich auch draufsetzen.«
Unter solchen Gesprächen hatte ich meinen Stuhltisch aufgebaut, die Platte war noch reichlich fünf Zentimeter über dem Wasserspiegel, das Servierbrett hatte sich wieder hervorgeschoben, ich setzte das Geschirr auf den Tisch.
»Wenn Sie fertig sind und abräumen wollen, brauchen Sie nur zu rufen.«
»Schön, wird gemacht! Dann nur noch eins, Herr Bademeister. Könnten Sie nicht noch etwas warmes Wasser zulassen?«
»Ist es Ihnen zu kalt?«
»Etwas wärmer wäre mir angenehm. «
»Es wird sofort besorgt.«
Das Brett ward zurückgezogen,
»Halt!«, rief ich. »Auf welche Weise wird das Wasser angewärmt?«
»Sie werden es bemerken — oder auch nicht.«
»Was soll das heißen: oder auch nicht? Dass ich mich nicht etwa dabei verbrühe!«
»O nein, das wärmere Wasser wird nach und nach zugelassen.«
Die Sandalen entfernten sich schlürfend.
Ich hatte kein wärmeres Wasser nötig, sondern es war nur so eine Frage gewesen, um zu erfahren, auf welche Weise das Wasser hier zu- und abgelassen wurde. Es war ja nicht einmal etwas von einer Tür zu bemerken.
Nun, an eine Untersuchung meiner Zelle wollte ich später gehen. Jetzt setzte ich mich ins Wasser vor das Tischchen und ließ mir den Kaffee, das Weißbrot mit Butter und die verschiedenen kalten Fleischspeisen trefflich schmecken.
Dabei musste ich manchmal doch wirklich lachen. So im Wasser sitzend zu speisen, das war mir etwas ganz Neues. Von anderen gesehen hatte ich es allerdings schon öfter.
Wenn es so schädlich ist, mit vollem Magen zu baden, so kann es wohl auch nicht zuträglich sein, im Wasser zu essen. Davon schienen diese Mönche nichts zu wissen, die ja sonst um mein Wohlergehen so besorgt sein wollten. Und ich selbst glaube ebenfalls nicht an diese Doktrin der Ärzte und Volksmeinung. Ich habe schon zu viele Menschen gesehen, weiße und gelbe und braune und schwarze, die sich erst den Wanst vollschlugen und dann ins Wasser sprangen, in kaltes oder ziemlich warmes, freiwillig oder unfreiwillig, und nie habe ich einen Schlaganfall oder einen sonstigen Schaden an der Gesundheit beobachten können. Der Gesundheit förderlich mag es ja nicht gerade sein, so wenig wie jede andere körperliche und selbst geistige Arbeit, die mit vollem Magen verrichtet wird.
Das Frühstück war beendet.
»KüchenKerkerBademeister!«
Fast sofort machte er sich an dem Loche bemerkbar, er musste also wohl immer in der Nähe sein, schob das Brett hindurch. Ich setzte das Geschirr darauf.
»Ist Ihnen das Wasser jetzt warm genug?«
Ja, mir war wirklich gewesen, als ob das Wasser nach und nach wärmer geworden wäre.
»Es fließt immer zu?«
»Dort unten ist eine Röhre, aus der es kommt, dort oben fließt es wieder ab, sodass es immer gleichen Stand hat.«
»Dann stellen Sie es ab, es ist jetzt warm genug.«
»Wünschen Sie sonst noch etwas?«
»Vielleicht noch etwas zu lesen. Das Licht ist ja noch hell genug.«
»Herr Kapitän wissen ja selbst, dass Bücher das einzige sind, was es auf dem heiligen Berge nicht gibt.«
»Und wohl auch weibliche Gesellschaft!«
Er verschwand mit seinem Servierbrett.
Was sollte ich tun? Ich untersuchte etwas den Boden und die Wände, fand auf der Höhe des Niveaus ein kleines Loch, durch welches das Wasser abfloss; aus der anderen Seite ragte dicht am Boden das kurze Ende einer Röhre hervor, aus der warmes Wasser strömte. Bald aber ward der Zufluss abgestellt.
Nun hatte ich Zeit zum Grübeln. Wie wollte man mich in diesem lauen Fußbade, wo mir sonst so vortrefflich aufgewartet wurde, so mürbe machen, dass ich entweder Selbstmord beging oder freiwillig als Mönch in diese Mönchsrepublik eintrat? Und nicht etwa durch die Länge der Zeit wollte man mich kirre machen, sondern innerhalb der nächsten sieben Tage sollte sich das entscheiden. Das war mir einfach...
Doch wozu jetzt dieses Grübeln? Ich würde es ja erfahren.
So probierte ich zunächst in humoristischer Laune, die ich mir nicht so leicht verderben ließ, wie man denn in diesem seichten Wasser einen Selbstmord ermöglichen könne — Nun, dazu brauchte man sich mit ausgestoßenem Atem nur auf den Rücken zu legen, ganz energische Selbstmörder sollen es ja sogar fertig gebracht haben, sich im Waschbecken zu ersäufen — so weit probierte ich aber die Geschichte nicht, bei mir wurden bald Schwimmversuche daraus. Auf dem Rücken konnte ich recht gut schwimmen, ohne den Boden zu berühren; bald brachte ich es auch fertig, von einer Wand zur anderen zu schießen.
Diese Übungen hatten mich ermüdet. Anstatt mich auf den Stuhltisch zu setzen, zog ich es vor, mich auf den Boden hinzulegen, den Kopf gegen die schiefe Wandfläche, mich vom Wasser überfluten zu lassen.
Ob man auch so schlafen kann? Ja, warum denn nicht! Das ist jetzt sogar bei gewissen Krankheiten eine neue Heilweise, besonders bei großen Verbrennungen. Der Patient liegt ständig im Wasser, muss darin auch schlafen. Und wie sollte ich denn überhaupt sonst schlafen? Auf dem Stuhl? Der ging wegen der schiefen Ebene nicht bis dicht an die Wand. Außerdem war es in der freien Luft doch etwas kalt, ganz im Wasser bedeutend angenehmer.
So dachte ich, schloss die Augen und begann einzunicken.
Da traf mein Gesicht plötzlich mit ziemlicher Gewalt ein kalter Wasserstrahl.
Erschrocken sprang ich auf. Was war das gewesen? Zu merken war jetzt nichts mehr.
»Bademeister!«
»Sie wünschen, Herr Kapitän?«, erklang es alsbald.
»Solchen Unfug verbitte ich mir!«
»Was für einen Unfug?«
»Ich bin von oben mit Wasser übergossen worden.«
»Das wird immer geschehen, sobald Sie einschlafen wollen,«
In diesem Augenblicke wusste ich alles!
Im Mittelalter hatte diese Art von Folter einen besonderen, lateinischen Namen — ich kann mich seiner nicht mehr erinnern. Also, der Gefangene, dem ein Geständnis erpresst oder der sonst gepeinigt werden soll, darf nicht schlafen. Sobald er einschlafen will, wird er geweckt, gerüttelt, mit Wasser übergossen oder gebrannt. Auch bei dem unglücklichen, aber nicht ganz unschuldigen Freiherrn Friedrich von der Trenck wurde, als er zehn Jahre lang — von 1753 bis 1763 in den Magdeburger Schanzen schmachtete, dieses Verfahren angewendet. Mit welchem Erfolge und wie lange, wusste ich nicht. Jedenfalls nicht die ganzen zehn Jahre hindurch. Wahrscheinlich nur ab und zu zur Strafe.
Wie lange kann ein Mensch es wohl ohne Schlaf aushalten? Mir waren drei Beispiele von derartigen Versuchen bekannt.
Alexander der Große wollte nicht schlafen, nur ruhen, um seine Pläne nicht zu vergessen, sie auch in Gedanken nicht zu unterbrechen. Zu diesem Zwecke hielt er, wenn er lag, in der Hand eine eiserne Kugel, die er beim Einschlafen fallen ließ. Die Kugel stürzte in ein Metallbecken, das Geräusch weckte ihn.
Der zweite, von dem ich wusste, dass er den Schlaf als Zeitverschwendung zu überwinden suchte, war ebenfalls ein Großer, der alte Fritz. Der wollte den Schlaf nur durch Willenskraft überwinden.
Wie lange es diese beiden so getrieben haben, ist mir leider nicht bekannt. Schopenhauer sagt hierüber an einer Stelle, es sei doch unerklärlich, wie ein Mann wie Friedrich der Große die Bedeutung des Schlafes so gar nicht habe verstehen können. Ich meinesteils denke hierüber anders. Daher eben der Name ›der Große‹. Ich glaube auch gar nicht, dass der alte oder damals noch junge Fritz den großen Alexander nachzuahmen versucht hat, es würde aber auch nichts schaden, wenn er es getan hätte. Nur große Geister kommen überhaupt auf solche Ideen.
Das dritte mir bekannte Beispiel ist weniger historisch und großartig, aber dafür sachlich. Ich las es in den Zeitungen, und es wurde mir beglaubigt. Zu meiner Zeit wettete in Wien ein Cafékellner, sieben Tage und Nächte nicht zu schlafen. Durch unmäßigen Genuss von starkem Kaffee gewann er die Wette, hatte aber sein Nervensystem auch für immer ruiniert — — —
Diese Reflexionen zog ich erst später, führte sie auch in aller Gemütsruhe noch weiter aus, jetzt zuckten mir solche Erinnerungen an freiwillige oder unfreiwillige Schlaflosigkeit nur blitzartig durch den Kopf.
»Also, man will mich nicht schlafen lassen?«, rief ich. »Und ist das etwa keine Marter?!«
»Nein, das nennen wir keine Marter«, erklang es hinter mir mit bekannter Stimme.
An dem anderen Loche zeigte sich wieder die Teufelsfratze des Meisters Cyriax.
»Na, ich danke«, blieb ich ganz ruhig, jetzt und auch später.
»Ist das Wasser, welches dir ins Gesicht gegossen wird, sobald du einschlafen willst, vielleicht zu kalt? Dann wird wärmeres verwandt. Schmerzen oder auch nur Unannehmlichkeiten sollst du durchaus nicht haben.«
»Ihr seid und bleibt Jesuiten in griechischer Ausgabe, und wer die Macht hat, der hat auch das Recht, so will ich dich gar nicht erst eines Besseren zu belehren versuchen. Also, nicht schlafen wollt ihr mich lassen, das ist der ganze Witz!«
»Nein, du darfst nicht schlafen. Oder doch, du kannst schlafen. Nur musst du dir gefallen lassen, dass du dabei immer einen Wasserstrahl über den Kopf bekommst.«
»So so. Und das soll sieben Tage so gehandhabt werden?«
»Nein. Bis du entweder einer der Unsrigen geworden bist oder Selbstmord begangen und somit dein Ehrenwort gebrochen hast. Was für einen Empfang du dann im Jenseits zu erwarten hast, kannst du dir wohl auch vorstellen.«
»Nicht so ganz! Doch lassen wir das, bleiben wir zunächst auf dieser Erde. Ich denke, die Probe soll nur sieben Tage währen! Jetzt hast du wohl schon Lust, dein Wort zu brechen?«
»Durchaus nicht. Innerhalb sieben Tagen wird es sich entscheiden.«
»Das ist doch etwas ganz anderes, als was du vorhin sagtest.«
»Ich finde nicht.«
»Aber ich! Wenn ich nun nach sieben Tagen noch immer lebe und noch keine Lust habe, in euren Orden einzutreten, was dann?«
»Das kann nie geschehen!«
»Warum nicht?«
»Weil du ein Mensch bist, und kein Mensch kann es sieben Tage ohne Schlaf aushalten.«
»Na, das kommt doch erst auf einen Versuch an.«
»Dass das nicht möglich ist, wissen wir hier am allerbesten.«
»Nein, nein, Freundchen, so kommst du nicht davon. Wenn ich nach sieben Tagen weder Selbstmord begangen habe noch wünsche, in euren Orden einzutreten, was dann? Antworte aber nicht wieder, dass so etwas nicht möglich sei.«
»Gut! Dann sollst du frei sein!«
»Gut«, sagte auch ich. »Das ist also eine Art von Wette — die nehme ich an. Wenn man deinem Ehrenwort nur trauen dürfte!«
»Beim heiligen Athanasios, der unser Schutzpatron ist, er soll mir beim jüngsten Gericht die ewige Seligkeit absprechen, wenn du nicht freigelassen wirst, falls du nach sieben Tagen noch immer so verstockt bist.«
»Dieser Schwur lässt sich schon eher hören, obgleich noch immer... doch ich will nicht daran zweifeln. Aber, Freundchen, wie lang sind denn deine Tage und Nächte? Wie viele Stunden haben sie, und wie lang sind diese Stunden?«
»Wie meinst du?«
»Ich kann hier ja gar nicht kontrollieren, wann die sieben Tage um sind. Du kannst mir sonst was weismachen.«
»Du hältst uns für Lügner und Betrüger?«
»Pater, du sprichst mit einem Manne, der um sein Leben kämpft!«
»Gut, du sollst dich von unserer Ehrlichkeit überzeugen, sollst eine Uhr bekommen.«
Er verschwand von der Öffnung, aber ich hatte nicht viel Zeit, meinen Gedanken nachzuhängen, denn er kam gleich wieder, und zwar wurde es draußen jetzt hell.
»Siehst du die Uhr hier?«
Um das turmähnliche Gemäuer schien ein Gang zu laufen, ich sah ziemlich nahe der Öffnung eine Wand, Cyriax setzte in eine Nische eine Uhr, einen amerikanischen Wecker, wie er jetzt überall in der Welt zu kaufen ist.
Es war bald zwölf Uhr.
»Diese Uhr wird immer beleuchtet bleiben. Dass sie richtig geht, nicht etwa zu langsam, davon kannst du dich durch Sekundenzählen wohl bald überzeugen. Da du nie schläfst, kannst du ja auch mit den Tagen nicht in Irrtum kommen. Vor drei Stunden bist du erwacht, von da an wollen wir rechnen. Bist du damit einverstanden?«
»Gewiss, das sind ganz ehrliche Bedingungen.«
»Also von neun Uhr abends fängt es an...«
»Abends?«
»Es war vorhin nicht dein Frühstück, sondern dein Nachtessen. Heute über sieben Tage abends neun Uhr wollen wir weitersprechen... wenn du nicht bis dahin Selbstmord begangen oder unser Kreuz genommen hast.«
»Und wenn keins von beiden der Fall ist?«
»Dann soll sich diese Wasserzelle dir öffnen.«
»Ich bin absolut frei?«
»Absolut frei!«
»Kann gehen, wohin ich will?«
»Wohin du willst! Aber es ist undenkbar.«
»Das wird sich ja finden.«
»Hast du sonst noch Wünsche?«
»Nein.«
Der Pater entfernte sich, die tickende Uhr zurücklassend, die von einem seitwärts kommenden Lichtstrahl getroffen wurde.
So, jetzt hatten der große Alexander, der große Friedrich und der große Cafékellner ihren Nachahmer gefunden, denn es war bei mir ein ganz freudiger Entschluss, diese Probe zu machen, ob man sieben Tage und Nächte ohne Schlaf aushalten könne, nur der Wissenschaft halber, ganz abgesehen davon, dass ich eine Wette gewinnen wollte, wobei ich mir das Leben verdienen konnte. Und das Leben ist doch eine ganz hübsche Prämie.
Weshalb hatte man denn nur, um einen Menschen nicht schlafen zu lassen, da erst solche wässrige Vorkehrungen getroffen, die doch ziemlich kompliziert waren?
Nun, vielleicht war es doch eine ganz geistreiche Erfindung, das mit dem Wasserbassin. Die hatten doch schon ihre Erfahrungen; ich war jedenfalls nicht der erste, dem hier auf solche Weise der Wille gebrochen werden sollte.
Es ist ja gar nicht so einfach, einen übermüdeten Menschen am Schlafen zu verhindern. Am Kneiptisch kann man da manchmal solche Studien machen.
Da hilft alles nichts, schließlich schläft der Kerl doch ein.
Anders ist es ja freilich, wenn man ganz und gar rücksichtslos sein will. Wenn man jemand sticht oder gar brennt, so wird der wohl immer wieder erwachen.
Oder doch nicht? Wenn man chloroformiert ist, fühlt man ja auch keinen Schmerz. Ob der Chloroformierte wohl erwacht, wenn man ihn in kaltes Wasser taucht?
Ich hatte gelesen, dass im Mittelalter diese Art von Folter so gehandhabt wurde, dass der Betreffende mit bloßen Füßen nur auf einem kleinen freien Platz stehen konnte oder nur einen schmalen Streifen zum Promenieren hatte, der übrige Boden war mit spitzen Nägeln gespickt.
Das war doch eigentlich das einfachste Verfahren, einen Menschen am Schlafen zu verhindern. Aber ich sollte nicht gemartert, nicht verletzt werden. Ganz freiwillig, heil und unversehrt sollte ich meinen Wunsch äußern, in diese Klostergemeinschaft eintreten zu dürfen — oder Selbstmord begehen, indem ich mich hinlegte und so ertränkte.
O, über diese jesuitische Schlauheit! Fürwahr, ein raffinierteres Mittel konnte gar nicht ersonnen werden, um scheinbar in aller Harmlosigkeit eines Menschen Willen zu brechen, als eben hier in diesem flachen Wasserbassin.
Nun, ich wollte es probieren, siebenmal vierundzwanzig Stunden ohne Schlaf auszukommen. Jetzt erst zog ich alle jene Erinnerungen zu Rate, die ich schon vorhin angeführt habe.
Und ich wusste auch noch andere Beispiele von Schlaflosigkeit, die sich bei vollster Gesundheit offenbart. An Bord, besonders auf Kriegsschiffen, lernt man oft genug Menschen kennen, die tatsächlich über jedes Schlafbedürfnis erhaben sind. Man sieht sie während monatelanger Seereisen tatsächlich niemals schlafen. Es sind dies zumal die alten Bootsleute, die Deckoffiziere, im Range eines Feldwebels stehend, diese echten, alten, verwitterten Seebären.
An Bord von Kriegsschiffen ist der Mannschaft der Schlaf überhaupt äußerst spärlich zugemessen. Auf Handelsschiffen geht der Dienst regelmäßig wachenweise — vier Stunden Dienst und vier Stunden Freizeit — anders aber ist das auf Kriegsschiffen, während sie auf See sind. Bei Tage werden beide Wachen zugleich an Deck beschäftigt, erst in der Nacht gehen sie abwechselnd zur Hängematte. Auf diese Weise kann der Mann heute Nacht acht Stunden, morgen Nacht nur sechs Stunden schlafen. Das letztere erscheint sehr wenig, aber die Erfahrung hat gelehrt, dass es vollständig genügt. Und wie diese Kerls nun auch schlafen! Sie klettern in die Hängematte — weg sind sie.
Die älteren Unteroffiziere, zu denen also auch die Deckoffiziere gehören, benutzen aber nicht einmal diese Freizeit zum Schlaf. So ein Bootsmann hat durch Dienstalters- und Seefahrtszulage ein ganz schönes Gehalt, auf zweihundert Mark im Monat steht er sich immer, das geht noch viel höher, dabei alles vollständig frei — und nun muss man diese eisernen Naturen kennen, die überhaupt durch nichts zu ruinieren sind, die den stärksten Grog eimerweise trinken und dann ungerührt ihren Dienst tun... kurz und gut, viele dieser alten Unteroffiziere verbringen ihre ganze Freizeit in der Deckoffiziersmesse. Da werden Geschichten erzählt und wird das Blaue vom Himmel heruntergesoffen. Wer nicht mit eigenen Augen gesehen hat, was die leisten können, wird es nie glauben — dann geht es zum Dienst, dann wieder in die Messe an den Kneiptisch — und so treiben sie es monatelang, machen eine Reise um die Erde, ohne je in Koje oder Hängematte gekommen zu sein, ohne ein einziges Stündchen geschlafen zu haben.
Wenn man sie deswegen fragt, so lachen sie. Schlaf? Überwundene Schwäche!
Aber sie schlafen dennoch täglich ihr Quantum. Ich habe sie beobachtet, förmlich studiert. Sie schlafen im Stehen und Gehen, mit geschlossenen und sogar mit offenen Augen.
So ein alter Bootsmann hat die Nachtwache. Er marschiert an Deck oder auf der Kommandobrücke hin und her, mit genau abgezählten Schritten; auf genau demselben Punkte wendet er, und wenn das immer derselbe Bootsmann wäre, so müssten schließlich in den Deckplanken die Abdrücke seiner Stiefel zu sehen sein, derartig regelmäßig ist sein Gang, man kann beobachten, wie er beim so und sovielten Schritt den Fuß immer ganz genau auf dieselbe Stelle setzt, Hacke wie Spitze, und da kann das Schiff schlingern und tanzen und stampfen, wie es will, der breitbeinige Wanderer lässt sich nicht um eine Linie aus seiner Richtung bringen.
Ab und zu fragt er: »Was liegt an?« Der am Steuerrad stehende Matrose nennt den Kompassstrich. »Recht so.«
Nun muss der Bootsmann aber auch kontrollieren, ob der Mann nicht etwa flunkert und das Schiff hat abfallen lassen, dass es einen anderen Strich steuert.
So wirft der Bootsmann jedes Mal, wenn er an der Bussole vorüberkommt, einen Blick auf den Kompass. Und ist alles in Ordnung, so schläft er beim nächsten Schritt schon wieder, bis er abermals an die Bussole kommt.
Ja, der Mann schläft, schläft im Gehen und Drehen. Sie gestehen es ja auch selber ein. Sie können im Gehen schlafen. Beim so und sovielten Schritt, der sie zur Bussole bringt, sind sie munter, und zwar vollständig bei Sinnen, und stimmt der Kompass nicht bis auf die Linie, dann gibt's für den Matrosen ein Donnerwetter. Beim nächsten Schritt schlafen sie weiter. Und dennoch merken sie auch jede andere Unregelmäßigkeit, die etwa in der Takelage vorkommt. Das fühlen sie mit den Füßen, im Schiffe, das müssen die förmlich riechen.
Natürlich kann so etwas nicht von heute zu morgen gelernt werden. Dazu gehört eine zwanzig, dreißig- und vierzigjährige Dienstzeit. Diese alten Bootsleute sind ja überhaupt ganz andere Menschen geworden. Die können gar nicht mehr pensioniert werden. Die gehen an Land sofort zugrunde. Das weiß man in den maßgebenden Marinekreisen und behandelt sie danach. So ein alter Bootsmann ist doch auch gar nicht mit Gold zu bezahlen, in den Augen des Kapitäns, Admirals oder Korvettenkapitäns rangiert er höher als der höchste Wachoffizier. Denn bei so etwas hat doch kein Titel etwas zu sagen. Was der höchste Offizier niemals erlernen kann, das hat so ein alter Bootsmann im kleinen Finger. Er ist mit seinem Schiffe verschmolzen. Dieses ist für ihn kein toter Gegenstand, beide haben ein und denselben Herzschlag.
Auf diese Meisterschaft in der Zeitausnutzung bereiten sich auch die Matrosen schon vor, deren Ideal der Bootsmann ist. Jeder Matrose versteht, auf der Nachtwache im Stehen zu schlafen, mit dem Rücken an der Wand lehnend, an einem Pfeiler. Natürlich gibt es auch alte Offiziere genug, die es in dieser Hinsicht mit jedem Bootsmann aufnehmen. Den deutschen Admiral Schröder muss man gekannt haben! Das war auch so ein alter Seebär von echtem Schrot und Korn. Es genügte schon, zuzusehen, wenn er den Matrosen mit eigener Hand vormachte, wie man die Seestiefel richtig einschmiert. Solche alte Offiziere sind wieder die Ideale der jüngeren; schon die Kadetten ahmen solchen Vorbildern nach, und nicht nur »wie er sich räuspert, und wie er spuckt.« Erhaben werden über alle Schwächen der Landratten! Auch ich hatte es als Seekadett schon fertig gebracht, als die Kadettenwache zur Strafe eine Stunde in der Takelage verweilen musste, diese Stunde, weil ich ein Nächtchen hinter mir hatte, schlafend zu verbringen, in den Fußpferden mich festklammernd und mit dem Leibe über der Bramrahe hängend, und das bei wütend tanzendem Schiffe. Sehr stärkend ist solch ein Schlaf ja gerade nicht, aber doch besser als nichts.
Dies alles zog ich zu Rate, als ich mir überlegte, ob es möglich sei, sieben Tage und Nächte ohne Schlaf auszuharren, und beschloss, so einen alten Bootsmann oder Admiral zu spielen.
Meine erste Müdigkeit war wieder geschwunden. Zunächst kontrollierte ich die Uhr, zählte, ohne hinzusehen, sekundenweise bis dreihundert. Der Zeiger war richtig fünf Minuten weiter gerückt. Aber, Herrgott, was können einem da doch fünf Minuten lang werden!
Dann promenierte ich hin her, um mich an das Waten zu gewöhnen, mir die regelmäßigen Schritte, das Wenden auf dem gleichen Punkte einzuüben. Ob ich wohl so im Gehen schlafen konnte? Das würde sich erst zeigen, wenn es so weit war.
So vergingen sechs Stunden — höllisch langsam. Jetzt wäre es mir lieber gewesen, ich hätte keine Uhr gehabt. Weil sie nun aber einmal da war, musste ich auch immer wieder hinsehen, wenigstens nach so vielen Rundgängen.
Es war früh sechs Uhr geworden. Müde wurde ich noch immer nicht, nur in den Beinen, ich setzte mich manchmal. Statt der ersten mutigen Entschlossenheit hatte sich meiner die tiefste Bitternis bemächtigt. Wozu dies alles? Natürlich doch nur eine persönliche Rache dieses Pfaffen! Er wollte an mir sein Mütchen kühlen, mich demütigen. Ha, wenn ich diesen Kerl...!
Bemerkbar machte sich niemand. Aber dass ich ständig beobachtet wurde, war ja ganz selbstverständlich. Jedenfalls von oben.
Punkt sechs wurde dort die Lampe zurückgezogen, doch kam von der anderen Seite gleich eine neue zum Vorschein, mit bedeutend hellerem Lichte, die runde Zelle überflutend.
Ich rief den Kerkermeister. Cyriax erschien, er selbst brachte mir das geforderte Frühstück.
Als er das Brett durch das Loch schob, berechnete ich, ob ich seine Hand fassen könnte. Nein, der Kerl war äußerst vorsichtig.
Nach dem reichlichen Essen stellte sich bei mir merkliche Schlafmüdigkeit ein. Noch vor dem gedeckten Tischchen sitzend, fielen mir die Augen zu. Da klatschte mir auch schon ein kalter Wasserstrahl ins Gesicht.
Wütend sprang ich auf — wütend über mich selbst, dass ich es hatte so weit kommen lassen. Sie sollten das Weckmittel gar nicht nötig haben.
»Wer sagt denn, dass ich schlafen will?!«, schrie ich. »Darf ich denn nicht wenigstens einmal die Augen zumachen?«
»Nein«, erklang es von der Decke herab.
»Gar nicht die Augen zumachen?«
»Nein, dann bekommst du sofort den Wasserstrahl.«
»Canaillen!«
»Das wirst du büßen müssen!«
Ich gab das Geschirr ab und nahm meinen Spaziergang wieder auf. Die Müdigkeit schwand nicht.
So, dann konnte ich ja probieren, wie es so ein alter Bootsmann macht, und die konnten doch nicht vermuten, dass ich die Augen zu hatte, während ich hin und her ging.
Jawohl, die Theorie war ganz gut, auch der Vorsatz, aber die Praxis, die Praxis.
Immer langsamer wurde mein Schritt, die Augen fielen mir zu, und wenn das ja auch eigentlich zur Sache gehörte, so war es doch längst nicht das richtige. Ganz unbewusst hatte ich mich plötzlich auf das Stühlchen gesetzt, die Ellbogen auf die Knie gestemmt, den Kopf in die Hände...
Da traf ein Wasserstrahl mit solcher Wucht meinen Nacken, dass ich gleich vom Stühlchen ins Wasser fiel, zuerst mit dem Kopfe darunter kam.
Diesmal sprang ich nicht wütend, sondern ganz unwirsch auf.
Zunächst war die Müdigkeit wieder verschwunden. Nach drei Stunden stellte sie sich mit erneuter Kraft ein.
Ich will es kurz machen. Sechsundvierzig Stunden bin ich ohne Schlaf geblieben. Mit dem Spazierengehen im Schlafe war es nichts. Das muss wohl auf andere Weise nach und nach gelernt werden. Wiederholt stürzte ich dabei, schlug mir an der Wand das Gesicht blutig.
»Keinen Selbstmord begehen!«, erklang es dann hohnlachend. »Du darfst dir den Kopf nicht an der Wand einrennen, ich habe dein Ehrenwort.«
O, du Teufel!
Viele Dutzend Male warf mich der Wasserstrahl von dem Schemel herab, auf dem ich schon eingeschlafen war, und da ich stets, auch wenn ich schon im Wasser saß, vollends umkippte, war es natürlich mit dem Schlafen vorbei.

Ich lehnte mich gegen die Wand, wollte dem Wasserstrahl trotzen — gab es nicht. Ich wäre in diesem Wasserstrahle ertrunken.
Wie es mit mir stand, kann ich gar nicht schildern, mit keinen. Worte!
In den letzten Stunden beschäftigte sich mein fieberndes Hirn nur mit einem einzigen Gedanken: wie mich aus dieser grässlichen Lage befreien, um einmal schlafen, schlafen zu können!
Zur Erreichung dieses Zieles — das konnte mein Kopf, der mir immer wie eine feurige Kugel vorkam, auch noch ganz klar denken — gab es dreierlei Wege.
Entweder Selbstmord! Das wurde verworfen, so viel Energie besaß ich noch, von jenem Ehrgefühl diktiert, das auch jeder Marter trotzt.
Oder nachgeben! Ich erklärte mich bereit, in den Mönchsorden einzutreten. Dann aber hätte ich ebenso gut Selbstmord begehen können, dann war meine Ehre verspielt. Allerdings konnte ich das nur scheinbar tun, um später noch einige Freiheit zu erreichen und Rache auszuüben — Schuften gegenüber braucht man ja mit seiner Ehre nicht so empfindlich zu sein — aber immerhin, dieser Pater hätte triumphiert, hätte es auch später immer tun können, und wenn ich ihn auch schon in meinen Händen gehabt hätte — nein, das war ebenfalls nichts, ganz abgesehen davon, dass sich diese Pfaffen wohl vor einer Täuschung zu schützen wussten. Ich wäre ganz einfach in eine andere Kerkerzelle gesperrt worden, aber eben schon als Mönch, hätte Bußübungen tun müssen.
So blieb nur noch eins übrig, Selbsthilfe, Selbstbefreiung!
Wie ich mich aus eigner Kraft aus dieser Lage befreien konnte, daran arbeitete mein glühendes Hirn, und immer klarer wurde der Plan.
Ich war unterdessen zur Überzeugung gekommen, dass ich nur zwei Wächter haben konnte: Pater Cyriax und den anderen Mönch. Auch sein Gesicht bekam ich ja manchmal zu sehen, wenn er mir das Essen brachte, außerdem bemerkte ich dann an dem Brette immer einen verkrüppelten Finger. Nur diese zwei bedienten mich, offenbar besorgten sie auch oben das Auswechseln der brennenden Laterne, was regelmäßig früh um sechs und abends um sechs geschah.
Ich vermutete überhaupt stark, dass die anderen Mönche gar nichts von meinem Hiersein und von der Prozedur, die man mit mir vornahm, wussten, auch der Patriarch nicht. Pater Cyriax übte im Geheimen eine Privatrache aus. Glückte ihm das Experiment, wäre er vielleicht dann erst mit mir als einem neuen Gläubigen triumphierend hervorgetreten. Er hatte für seine Pläne einen Helfershelfer gewonnen, die beiden hielten sich jedenfalls hier versteckt, waren scheinbar aus dem Kloster verschwunden, vielleicht eine Reise vorgebend. Denn zusammen waren die beiden immer hier, das hatte ich in den zweimal vierundzwanzig Stunden konstatieren können. Fehlte der eine einmal einige Zeit, so schlief er jedenfalls.
Dass sich die beiden hier versteckt halten konnten, ohne dass das ganze Kloster davon wusste, dem widersprach allerdings die Tatsache, von deren Echtheit ich mich hatte überzeugen lassen müssen, dass die Mönche von Athos in einem ekstatischen Zustand jeden Menschen sehen können, den ste sehen wollen, es sei denn dass sich der Betreffende völlig im Finstern befand, und die beiden kamen oft genug im hellen Lampenlicht. Nun, da würde es schon eine Ausnahme, ein Schutzmittel geben, und Pater Cyriax war gewiss in alle Geheimnisse eingeweiht. Wie sich damals der Patriarch Johannes als Schwester Johanna nach der Leuchtturminsel begeben hatte, um die Nächte mit mir zu verbringen, das konnte doch auch nicht nur so einfach gewesen sein, dass sie sich immer im Dunklen hielt, da musste sie wohl noch eine andere Vorsichtsmaßregel getroffen haben, um nicht erblickt zu werden.
Doch mochte das sein, wie es wollte — ich war der festen Überzeugung, dass ich es nur mit zwei Mönchen zu tun hatte, und dass das ganze Kloster von ihrem Tun gar nichts wusste.
Was ich vorhatte? Nichts mehr und nichts weniger, als meine beiden Peiniger zu töten.
So einfach war das nun freilich nicht. Die wussten wohl schon, wie es in dem Kopfe eines Mannes aussieht, der auf diese Weise gemartert wird. Ich musste den Kerl, den ich abtun wollte, doch unbedingt erst in den Händen haben. Denn eins der Tischbeine nützte mir, obgleich durch seine Bleifüllung zum Totschläger wie geschaffen, gar nichts. Das Wandloch war viel zu klein, ich konnte nicht durchschlagen. Nein, ich musste unbedingt erst den einen in meine Zelle bekommen, hoffend, dass der andere ihn zu befreien suchen würde, dass ich auch ihn packen konnte, und dann... na, dann wollte ich mit den beiden schon fertig werden. Ha, das sollte eine Lust werden!
Aber die beiden rechneten eben schon mit so etwas. Sie waren äußerst vorsichtig. Das anderthalb Meter lange Brett wurde, nachdem es mit dem einen Ende in dem Loche ruhte, beim weiteren Vorschieben stets am äußersten anderen Ende angefasst; darin waren sie so konsequent, dass die Vorsicht nur zu deutlich zu erkennen war, und auf diese Weise war es mir gar nicht möglich, den Kerl zu fassen, ich hätte den Arm noch so weit ausrecken können. Wenn das Brett weit genug hereingeschoben war, dass ich das Geschirr abnehmen oder darauf setzen konnte, dann war das Ende mit den haltenden Händen noch immer einen Meter von mir entfernt, und so weit konnte ich nicht reichen.
Aber gerade mit diesem Brett gedachte ich ihnen den Garaus zu machen, wenigstens erst dem einen zur Einleitung.
Doch vorher noch eine andere Erwägung: Wenn es mir nun geglückt war, die beiden abzutun, was dann? Dann war ich durchaus nicht gerettet. Hier gab es keine Tür, ich war jedenfalls von oben in diesen Raum herabgelassen worden. Und kein Gedanke daran, dass ich eins der kleinen Mauerlöcher hätte erweitern können.
Nein, dem Tode verfallen war ich dann erst recht, gleichgültig, ob sonst jemand um mein Hiersein wusste oder nicht. Ganz besonders im letzteren Falle war ich ja dem Hungertode überliefert.
Aber was machte das? Nur einmal schlafen, schlafen, schlafen!! Und vorher der Genuss der Rache! Das war doch auch etwas wert!
Also, auf das Servierbrett stützte sich mein Plan, der mir endlich gekommen war. Doch ich will nur die Ausführung schildern, höchstens noch erwähnen, dass jene andere Wand, die ich durch das eine Loch erblickte, in deren Nische die Uhr stand, ebenfalls anderthalb Meter von meiner Kerkermauer entfernt war. Das Brett ging gerade durch den Gang, wurde deswegen immer etwas schief getragen. Vielleicht befand sich auf der anderen Seite solch eine Wand, aber das konnte ich nicht erkennen, dort war alles stockfinster, nur die Uhr wurde beleuchtet. So kam, um ja nicht fehlzugehen, diese eine Wandöffnung für mich in Betracht, und durch diese ward mir auch, seitdem dort das Licht war, immer das Essen gereicht.
Die Uhr zeigte auf sieben. Noch zwei Stunden, dann waren zweimal vierundzwanzig Stunden vollendet, von da an gerechnet, wo ich hier erwacht war.
Da war der Plan in meinem glühenden Gehirn zuckähnlich entstanden und auch gleich ganz klar durchdacht und für gut befunden worden.
Soeben gingen die beiden Mönche an der erleuchteten Seite vorüber. Das passte für mich vortrefflich. Cyriax blieb auch noch stehen. Erst als er sah, dass ich in der Mitte des Raumes stand, trat er näher an das Loch. Sonst, wenn ich nahe diesem stand, blieb er vorsichtig zurück oder schlich sich an das andere Loch.
»Willst du noch nichts essen?«
Alles schien mir entgegenzukommen. Ich hatte in den letzten vierundzwanzig Stunden jede Nahrung verweigert. Die furchtbare Müdigkeit verdrängte alle anderen Gefühle.
»Ja, etwas zu essen!«, stieß ich mit heiserer Stimme hervor.
»Sogleich!«
Cyriax entschwand meinen Blicken.
Ich stürzte wieder einmal, von einem Taumel ergriffen, blieb mit dem Kopfe gegen die schiefe Wand lehnen, bekam sofort eine kalte Dusche über den Kopf.
Sie wäre nicht nötig gewesen. Ich hatte nur einen Taumel gehabt. Jetzt kannte ich keine Müdigkeit mehr.
Also einer von ihnen war schon wieder oben. Jedenfalls der Mönch.
Doch nein, Pater Cyriax war es gewesen, der sich gleich wieder nach oben begeben hatte, um mir sofort auch die Dusche zu verabreichen, denn der Mönch schob jetzt das Ende des mit Geschirr bedeckten Brette herein, richtig durch das erleuchtete Loch, vorsichtig das äußerste Ende gefasst haltend.
So — gerade so wollte ich den Kerl haben, wie er jetzt stand, mit dem Rücken ziemlich nahe an der erleuchteten Wand stehend.
Ich legte meine Hände an das Brett, packte es, visierte noch einen Augenblick, und dann stieß ich mit voller Kraft zu.
Dass dabei das ganze Geschirr mit den schönen Sachen herunterfiel, war Nebensache — Hauptsache war, dass ich mit dem anderen Ende des Brettes genau seine Kehle getroffen hatte und ihn so gegen die Wand presste.
Und wie ich presste! Er wurde gleich ganz schwarz im Gesicht, die Augen quollen weit hervor, aber auch in dieser seiner Todesangst konnte er mit den Händen arbeiten und an dem Brette rütteln und sich stemmen, wie er wollte, mein Griff war fester.
Dort oben wurde natürlich sofort bemerkt, dass hier unten etwas nicht in Ordnung sein konnte, vielleicht konnte Cyriax auch auf der anderen Seite alles sehen, mindestens musste er gleich alles ahnen.
»Hund, verdammter!!«, wurde jetzt der fromme Pater dort oben im Himmel unhöflich.
Quatsch! — bekam ich einen kalten Wasserstrahl auf den Kopf, und zwar verharrte er dabei.
Ich hatte damit gerechnet. Ja sogar mit einem heißen. Aber wenn er auch kochend gewesen wäre — ich glaube, ich hätte mein Opfer nicht fahren lassen.
Doch es blieb bei dem kalten Wasserstrahle. Dort oben mochten sie kein heißes Wasser haben, nur unten. Und dieser kalte Wasserstrahl hatte für mich wenig zu sagen. Ich wendete nur den Kopf hin und her, dann wurde die Geschichte nicht schmerzend, was sonst bekanntlich sehr wohl der Fall ist, wenn immer ein und dieselbe Stelle des Kopfes getroffen wird. Früher wurden Negersklaven auf diese Weise gemartert.
Übrigens dauerte dieses Begießen nicht lange, höchstens eine halbe Minute — oder hierbei fehlt ja jede Zeitrechnung — dann hörte der Strahl auf, und da sah ich den Pater Cyriax schon durch den Gang gelaufen kommen.
Eine Minute konnte noch nicht vergangen sein, denn mein Mönch zappelte noch immer ganz lebhaft, und Luft konnte er auf keinen Fall bekommen, dafür sorgte ich schon. Sein Hals war so breit wie das Brett und dünn wie sein Halswirbel. Dünner konnte er gar nicht werden, obgleich ich mir die möglichste Mühe gab, ihm die Gurgel noch vollends durchzudrücken.
Zunächst versuchte der herbeigeeilte Pater das infame Brett von der bedrohten Gurgel zu beseitigen. Aber was er auch tat, da gab es nichts, ich stand wie ein Ast.
Als er das schnell genug einsah, gab er diese seine Bemühungen auf, ein Messer funkelte in seiner Hand, so stürzte er auf das Loch zu. In diesem befand sich das andere Ende des Brettes, das meine beiden Hände gefasst hielten, etwa in der Mitte des nicht allzu starken, aber soliden Mauerwerks. Offenbar wollte mich Cyriax in die Hände stechen, dass ich das Brett loslassen musste, aber so weit kam er gar nicht. Ich hatte ihn schon weit genug. Das Brett nur mit der linken Hand stemmend, ließ ich die rechte los, griff zu, hatte ihn auch richtig gleich bei der Gurgel erwischt.

So schmetterte ich seinen Kopf außen gegen die Mauer, und als ich genug geschmettert hatte, begann ich an dem Kopfe zu ziehen und zu reißen, zog so lange, bis ich ihn glücklich durch das Loch gezwängt hatte, obgleich in diesem noch meine Hand und mein Arm lag, denn das Brett wurde dabei nicht etwa fahren gelassen, und als ich das verhasste Pfaffengesicht glücklich drin in meiner Zelle hatte, da brach ich ihm vollends das Genick, brach es über der Mauerkante der Öffnung.
So, der war ganz sicher abgetan! Und was machte der andere? Ich konnte es nicht sehen, es steckte zu viel drin in dem Loche. So zwängte ich den Kopf wieder zurück. Der Körper des Paters fiel wie ein Sack um. Na, und mit dem anderen war es ebenfalls vorbei, ich konnte getrost das Brett zurückziehen. Ich tat es, und auch der Mönch fiel wie ein leerer Sack zusammen, um nicht wieder aufzustehen.
Es war geschehen. Ich hatte mein Ziel erreicht. Ich drehte mich um, legte mich ins Wasser, den Kopf gegen die schiefe Wandfläche — und war in demselben Augenblick weg.
Das Gefühl eisiger Kälte brachte mich zum Erwachen. Ja, das Wasser war sehr kalt geworden. Aber als ich mich erhoben hatte, fühlte ich mich trotzdem wie neugeboren.
Gleich war ich bei voller Besinnung. Ich trat an die Öffnung. Der Mönch lag noch in der früheren Stellung, und der Pater war so gestürzt, dass ich wenigstens seinen Kopf sehen konnte.
Die noch tickende Uhr zeigte die achte Stunde. Dass ich nur eine Stunde geschlafen hätte, davon konnte keine Rede sein. Fünfundzwanzig Stunden wiederum waren zu viel, dann wären doch sicher auch die unversorgten Lampen ausgegangen, und beide brannten noch. Dreizehn Stunden, das konnte stimmen. Nun, und in dreizehn Stunden kann man schon viel Schlaf nachholen. Ich fühlte mich wie neugeboren, mein Kopf war frei, mein Magen knurrte.
Sollte ich, mit solch frischen Kräften begabt, denn nun wirklich hier des Hungertodes...
Da fiel mein Blick auf eine schwarze Stange, welche von oben herabhing, dicht an der Wand.
Doch nein, es war ein Schlauch. Unten war ein kupfernes Mundstück dran.
Der spritzende Pater hatte nach Abstellen des Wassers, um dem Mönche zu Hilfe zu eilen, den Schlauch fallen lassen, wohl nicht wissend, dass er hier herein gestürzt war.
Ein Hoffnungsstrahl blitzte durch mein Hirn. Doch nicht voreilig sein, die Hoffnung war eine sehr, sehr trügerische.
Zagend schlich ich näher, mit zitternden Händen, von denen die rechte von der Würgerei an der Wand arg zerschunden war, griff ich nach dem Schlauche, zog daran.
O weh, er gab nach! Ich fühlte dabei förmlich alle Himmel über mir einstürzen.
Doch konnte er nicht vielleicht...
Ich zog weiter, und richtig, nachdem ich noch einige Meter heruntergezogen hatte, fand ich einen Widerstand. Der Schlauch war angeschraubt.
Nun handelte es sich bloß noch darum, ob diese Verschraubung fest genug war, mein ziemliches Körpergewicht zu tragen.
Ich begann, daran zu ziehen, stärker und immer stärker, Hand über Hand empor zu klettern, ganz, ganz vorsichtig, obgleich das gar keinen Zweck hatte, schon mehr, dass ich mich dabei mit den Füßen von der Wand abstützte.
Und der Schlauch trug mich, ich erreichte den Mauerrand, schwang mich hinauf.
Die Laterne, welche den Wasserturm erleuchtete, ließ durch Seitenöffnungen auch noch hier oben viel erkennen. Es war ein größeres, sehr hohes Gewölbe, in das dieser Wasserturm nur hineingebaut war. Hier oben war durch Bretter eine Galerie gebildet worden, eine Leiter führte hinab. Auf der Galerie stand ein großer Wassertank, daneben eine Kiste, mit geräucherten Fleischwaren und Zwieback gefüllt, wie ich solchen zuletzt immer statt des ersten Frischbrotes bekommen hatte. Dann noch ein Petroleumofen, ein Petroleumfässchen und anderes, was mich nicht weiter interessierte.
Ich brannte eine Handlampe an, stieg die Leiter hinab. Der schmale Gang führte um den ganzen Turm herum. Woher die Röhren kamen, durch welche das Wasser zu- und abfloss, dies war mir sehr gleichgültig. Am meisten interessierte mich die Tür, die sich in diesem Gange befand und mit einem großen Vorhängeschloss versehen war.
Ich wusste, wo ich den Schlüssel zu suchen hatte, fand ihn richtig in der Kuttentasche des Paters.
Hinter der Tür erstreckte sich abermals ein finsterer Gang. Jedenfalls alles Keller. Ehe ich ihn benutzte oder weiter untersuchte, zog ich die Kutte und die Sandalen des Mönchs an, nahm des Paters Dolchmesser, die einzige Waffe, die ich vorfand, sein ganzes Schlüsselbund, versah mich mit einigem Proviant, schnitt mir noch ein Stück von einem anderen Schlauche ab, das mir als Totschläger dienen sollte — so machte ich mich auf den Weg. Der erste Hunger war mir wieder vergangen.
Der Kellergang zweigte nach beiden Seiten ab. Doch nur der nach rechts zeigte in dem angesammelten Staube Spuren. Mit der frischgefüllten Laterne verfolgte ich ihn. Bald kam eine zweite Tür. Das Schlüsselbund des Paters öffnete auch diese. Ein ganzes Labyrinth von Gängen lag vor mir, aber zum Glücke war immer nur eine Spur vorhanden. Noch zwei weitere Türen hatte ich aufzuschließen, dann wehte mir frische Luft entgegen, und ich kannte diese Frische — Seeluft!
Noch einige Schritte, und ich befand mich im Freien. Über mir funkelten die Sterne des schon nächtlichen Septemberhimmels, vor mir spülte das Meer an einer flachen Küste, hinter mir führte der enge Gang in die hohen Felsen hinein.
Wo ich mich sonst befand, davon hatte ich keine Ahnung. Im Augenblick sah ich auch nur den mächtigen Dampfer, der kaum einen Kilometer von der Küste entfernt vorüberrauschte. Die Umrisse konnte ich nicht erkennen, nur die vielen erleuchteten Bullaugen erzählten von seiner Größe.
In weiter Ferne tauchte noch ein anderer solcher illuminierter Dampfer auf, beide tauschten durch farbige Lichter Signale aus, stellten sich einander vor.
Jener weit entfernte Dampfer war ein französisches Kriegsschiff, dieses hier ein englisches. Das konnte ich aus den farbigen Lichtern entziffern, die mittels einer elektrischen Tastatur ausgewechselt werden, das waren so stereotype Signale, die man im Kopfe hat. Den nächstfolgenden Schiffsnamen konnte ich nicht gleich übersetzen. Dann aber verstand ich wieder, als das englische Kriegsschiff kurz ausdrückte, es fahre unter Admiralsflagge, und zwar unter der eines Mitgliedes des englischen Königshauses.
Doch was ging mich das alles an? Die Hauptsache war für mich, dass es ein englischer Dampfer war, den ich durch Schwimmen wohl noch erreichen konnte, ehe er vorüber war. Denn er war doch noch etwas weit zurück. Bei einem türkischen oder griechischen Schiffe hätte ich es mir vielleicht noch etwas überlegt, bei einem englischen nicht, zumal bei einem Kriegsschiffe.
Also die Kutte wieder aus, alles zurückgelassen, sogar das etwas lange Hemd, mich ins Meer gestürzt.
Kaum hatte ich einige Stöße gemacht, als ich bemerkte, dass ich mich neben einem Küstenvorsprung befand, hinter dem eine starke Strömung hervorkam, und diese war so gütig, mich auch noch direkt nach dem Dampfer hinzutragen, das heißt, dass ich ihm noch etwas zuvorkommen musste.
So legte ich den Kilometer in höchstens zehn Minuten zurück, und da befand ich mich gerade seitwärts in Rufweite des Schiffes.
»Mann über Bord, Mann über Bord!!«, heulte ich, nicht ganz der Wahrheit entsprechend. Aber man kann ja auch von einem anderen Schiffe über Bord gefallen sein.
Mein Ruf war sofort gehört worden, augenblicklich stoppte der Dampfer, der elektrische Scheinwerfer wurde in Tätigkeit gesetzt.
Noch ehe ich ihn durch Zurufe zu dirigieren brauchte, war der Schwimmer schon entdeckt.
Ich war von der Strömung immer näher getrieben worden; man warf mir einen Rettungsring zu, der mir zu guter Letzt noch eine blutige Nase gab, ich wurde vollends herangezogen, eine Strickleiter stand zu meiner Verfügung.
In dem Augenblick, als ich mich so, wie mich der liebe Gott geschaffen hat, über die Bordwand schwang, sah ich an Deck unter der Kommandobrücke einen noch ziemlich jungen Mann stehen, in der Deckinterimsuniform der englischen Admirale.
Er hatte soeben von einem Offizier eine Meldung in Empfang genommen oder ihm einen Befehl gegeben.
»Zu Befehl, Königliche Hoheit«, sagte der Offizier und machte kehrt.
Von Offizieren und Matrosen umringt, stand ich dem Wasser in verschiedenster Gestalt entkommener und entstiegener Mann tiefatmend da.
Der Admiral kam auf mich zu.
Und wie ward mir da, als ich ihn mir näher besah.
Aber da machte auch schon der junge Admiral mit dem königlichen Blute eine Bewegung, als wollte er die Hände über dem Kopfe zusammenschlagen.
»Gott im Himmel, das ist ja der Herzog von...«
Er sprach meinen Namen aus.
Seit nun bald zwei Jahren strolchte ich als Napoleon Bonaparte Novacasa in aller Welt umher — zum ersten Male war ich erkannt worden, allerdings von meinem besten Duzfreunde.
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.