
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software

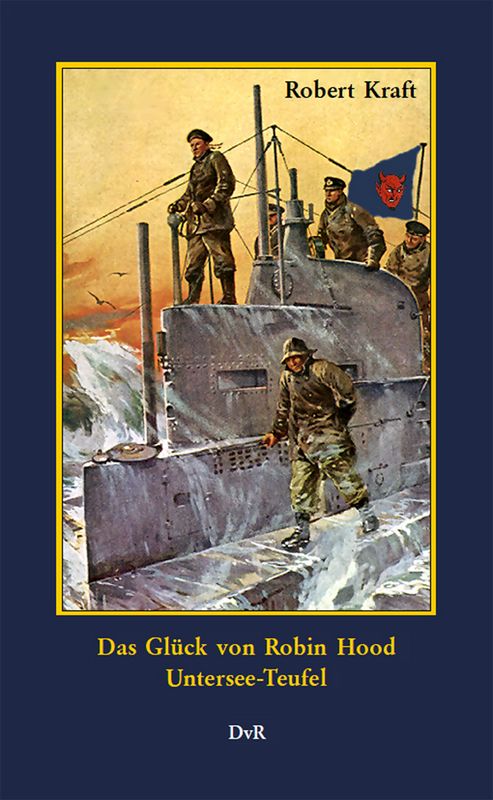
Verlag Dieter von Reeken, 2025
Die vorliegende Neuausgabe enthält den ungekürzten Text des von Robert Kraft (1869-1916) verfassten Romans Untersee-Teufel unter Verwendung folgender Buchausgabe:
Untersee-Teufel. Phantastischer Roman von Robert Kraft, verfasst unter dem Pseudonym Knut Larsen. Radebeul bei Dresden und Leipzig: Haupt & Hammon o.J. [1918], 349 S.
Offensichtliche Rechtschreibfehler und überholte Schreibweisen sind stillschweigend berichtigt worden. Die an mehreren Stellen im Roman verwendete (auch 1916 herabsetzende) Bezeichnung »Nigger« ist durch das ansonsten auch verwendete ›mildere‹ Wort »Neger« ersetzt worden, das damals (und noch Jahrzehnte danach) als ›neutral‹ empfunden wurde.
Den Roman Untersee-Teufel hat der am 10. Mai 1916 verstorbene Robert Kraft nicht mehr vollenden können. Er ist (wahrscheinlich von Johannes Jühling) bearbeitet worden. Welche von einem aufdringlich wirkenden Hurra-Patriotismus (das Wort »Hurra« kommt 22-mal vor) durchsetzten Textteile nicht von Kraft, sondern bis spätestens Mitte 1918 vom Bearbeiter verfasst worden sind, muss offen bleiben. Das Buch ist offenbar im Herbst 1918 noch vor dem Abschluss des Waffenstillstands am 11. November erschienen (1) und geprägt von Vorstellungen und Erwartungen des Autors von 1916 und des Bearbeiters von 1918. Manche Passagen lassen an die Südsee-Erlebnisse des legendären Kaperkapitäns Felix Graf von Luckner (1881-1966) und dem Hilfskreuzer ›Seeadler‹ von Ende 1916 (als Kraft schon am 10. Mai verstorben war) bis Ende 1917 mit Kaperungen, Gefangenschaft, Flucht und erneuter Gefangenschaft denken, doch sind die Abenteuer des ›Seeteufels‹(2) erst nach seiner Rückkehr nach Deutschland ab 1919 der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. Wahrscheinlich hätte Robert Kraft alias Knut Larsen mit weiteren U-Boot-Abenteuern durchaus Erfolg gehabt: Immerhin gab es vor und nach dem 2. Weltkrieg die von mehreren Autoren unter dem Pseudonym »Hans Warren« verfasste erfolgreiche Romanheftserie Jörn Farrow's U-Boot-Abenteuer.(3>
Zu Robert Krafts Leben und Werk insgesamt verweise ich auf die umfassende reich farbig illustrierte Bibliografie von Thomas Braatz(4), die ebenfalls farbig illustrierte Biografie von Walter Henle und Peter Richter(5), ein umfangreiches Buch von Arnulf Meifert(6) und auf die Tagungsbände(7-10) zu den Robert-Kraft-Symposien.
(1) Laut Ankündigung im Börsenblatt für den deutschen Buchhandel, 85. Jg., Nr. 211,vom 10. September 1918, S. 636.
(2) So auch der Titel seines ersten Buchs Seeteufel. Abenteuer aus meinem Leben. Leipzig: K. F. Koehler 1921, mehrere sehr hohe Auflagen über Jahrzehnte hinweg.
(3) Jörn Farrow's U-Boot-Abenteuer, 1932-1939. Berlin: Neues Verlagshaus für Volksliteratur 1932-1939, 357 Hefte; Bad Pyrmont: Neues Verlagshaus für Volksliteratur 1951-1960, 241 Hefte, überwiegend Neubearbeitungen der Vorkriegs-Serie.
(4) Thomas Braatz: Robert Kraft — Farbig illustrierte Bibliographie zum 100. Todestag. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer, 3., erweiterte Aufl. 2016. — 1032 S. mit über 1000 farbigen Abb.
(5) Walter Henle, Peter Richter: Unter den Augen der Sphinx. Leben und Werk Robert Krafts zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer 2005. — Das Buch ist vergriffen; eine Neuausgabe ist für 2026 geplant.
(6) Arnulf Meifert: Robert Kraft. Avanturier und Selbstsucher. Eine Annäherung. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer 2018.
(7) Robert Kraft 1869—1916. 1. Robert-Kraft-Symposium. 15.—16.10.2016. Leipzig: Thomas Braatz im Rahmen des Freundeskreises Science Fiction Leipzig, Leipzig 2016.
(8) Wenn ich König wäre! Robert Kraft zum 150. Geburtstag. 3. Robert-Kraft-Symposium. 12.—13.10.2018. A.a.O. 2019.
(9) 4. Robert-Kraft-Symposium. 16.04.2022. Serienheld Nobody. 100 Jahre Kraft-Film. A.a.O. 2022.
(10) 5. Robert-Kraft-Symposium. 15.10.2025. A. a. O. 2025.
Für freundliche Unterstützung durch den Originaltext und Bilder bedanke ich mich bei Thomas Braatz, für die Korrektur bei Ellen Radszat.
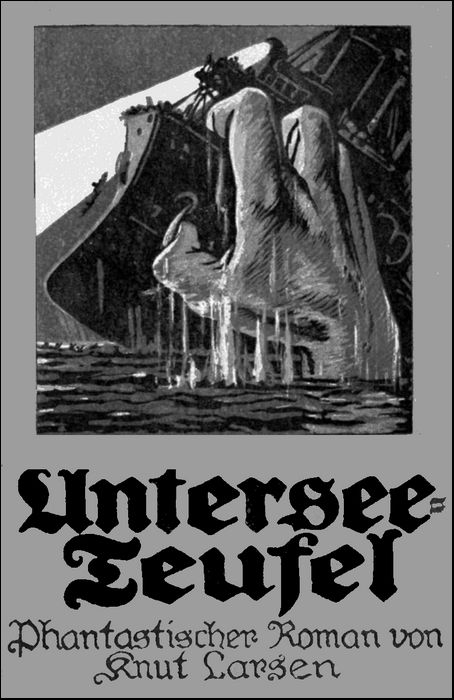
Untersee-Teufel. Phantastischer Roman von Knut Larsen
[Pseudonym von Robert Kraft]. Radebeul bei Dresden und Leipzig:
Haupt & Hammon 1918, Schutzumschlag-Vorderseite
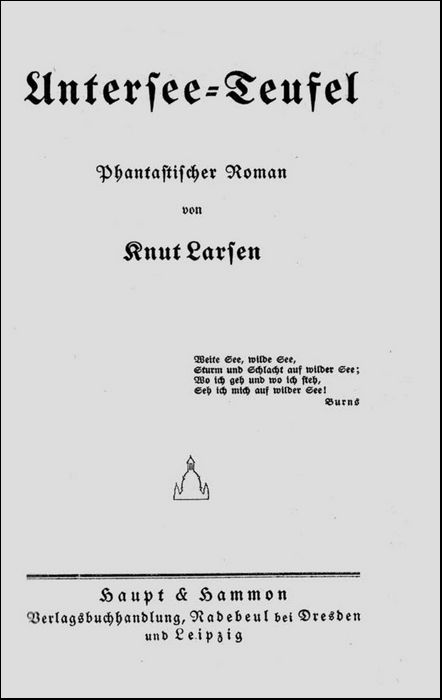
Untersee-Teufel. Phantastischer Roman von Knut Larsen
[Pseudonym von Robert Kraft]. Radebeul bei Dresden und Leipzig:
Haupt & Hammon 1918, Titelseite
Weite See, wilde See
Sturm und Schlacht auf wilder See;
Wo ich geh und wo ich steh,
Seh ich mich auf wilder See!
B u r n s
Alles kam sehr einfach. Der Kapitän, bei dem ich im September 1913 in Hamburg für zwei Jahre als zweiter Steuermann angemustert hatte, hieß Düwel. Keinem Menschen würde es einfallen, bei diesem Namen an den Höllenfürsten zu denken, denn er ist an der Waterkant ziemlich häufig, und niemand denkt an den richtigen Satan, wenn er etwa den Namen Manteuffel oder einen ähnlichen hört. Drollig war nur, dass sein Segler, eine Bark von 600 Tonnen, ausgerechnet den Namen ›Angela‹ führte, ein Engel, den der Teufel regiert. Das wird den Witz der Mannschaft herausfordern, dachte ich. Ich kenne doch meine Jungen von der Waterkant und weiß, dass bei ihnen der blutige Witz daheim ist.
Das Volk interessiert sich überhaupt lebhaft für den Teufel. Kein Wunder. Das Mittelalter ersann tiefsinnige Lehren über den Satanas, und die führenden Geister beschäftigten sich mit dem Wesen der Hölle und ihrer Regierung. Alles aber, was die Großen und Gebildeten denken, sickert in den folgenden Geschlechtern hinunter in die unteren Schichten des Volkes und wird von ihnen wiedergegeben, wie sie's verstanden und vergröberten. Was das Volk am meisten zur volksmäßigen Aussprache bringt, ist der Teufel und das Geschlechtsleben, letzteres, weil es seine nicht misszuverstehende Sprache vernimmt, ersterer, weil er ihm gelehrt wurde und er ihm gleich schrecklich interessant erschien. Wie viel heiliges Gottesleben aber unter dieser Aussprache tief im Volk schlummert, das kommt nur gelegentlich heraus und offenbart sich dann in Staunen erregenden Taten.
Redet mir bloß nicht vom rohen Schiffsvolk! Ihr seht es nur am Lande, wo es nach oft schweren Entbehrungen und todbringenden Kämpfen in Matrosenkneipen johlt und zecht, aber ich kenne es draußen in der ernsten Arbeit des Segelschiffs, von der die Besatzung der neuzeitlichen Dampfer oft keine Ahnung hat, denn ich bin heute selbst Schiffsoffizier und bin als Schiffsjunge und Matrose auf manchem Segler gefahren. Ich habe den Pulsschlag des Volkes gefühlt und bin stolz auf unser deutsches Schiffsvolk. Ich kenne auch das englische, französische, japanische und vieles mehr: Es gleicht keines unserem deutschen.
Vier Tage war ich schon bei Kapitän Düwel an Bord, ehe die eigentliche Anmusterung stattfand. Er sollte für längere Zeit mein Herr und König sein, ich seine rechte oder doch linke Hand, die ungestraft jeden niederschießen durfte, der es an Bord des Schiffes wagen würde, auch nur einen Finger gegen uns zu erheben. So will es das strenge Bordgesetz.
Unsereiner macht da seine Augen weit auf, denn eine Schiffsheuer ist eine ernste Sache; viel hängt ab vom Kapitän, viel von der Mannschaft, vom Schiff, vom Reeder, der Fahrt und ihren Zielen. Ausfragen kann man die Matrosen nicht, wenn man Offizier ist, das geht wider das ungeschriebene, unverbrüchliche Gesetz der Bordsitte, die man Bordroutine nennt.
Da ist man auf seine eigenen Augen angewiesen und hört auch mancherlei ungefragt.
Dass ich mit meinem Teufelskapitän welterschütternde Abenteuer erleben sollte, konnte ich damals natürlich nicht ahnen, aber die vier Tage genügten doch, mir zu zeigen, dass ich in meinem Kapitän eine Eigenart absonderlicher Urwüchsigkeit vor mir hatte, wie man sie sogar in Seemannskreisen selten findet.
Er war etwa Mitte der Fünfziger, ein kleiner, schmächtiger Mann mit steil abfallenden Schultern. Kühn geschwungene Säbelbeine ließen ihn noch kleiner erscheinen, aber die langen Gorillaarme mit den ungeheuerlichen Fäusten, die mit dichten rotbraunen Haaren besetzt waren und für die man schwerlich eine Handschuhnummer finden konnte, ließen auf ungewöhnliche Kraft schließen, und seine Elefantenfüße machten nicht den Eindruck, dass man das Kerlchen umwerfen könnte. Der hatte offenbar schon in manchem Seesturm festgestanden. Dieses ganze Wunder der Schöpfung wurde gekrönt durch ein übermächtiges Haupt, das borstig von einer rotbraunen Mähne umstanden war.
Niemand darf von einem solchen Seebären durchgeistigte Züge verlangen. Ein ziegelrotes, verwettertes Gesicht, das stark an einen Mops erinnerte, zeigte den Ausdruck geradezu unverschämter Gesundheit; Kinn und Wange waren fast immer mit wilden Bartstoppeln bedeckt, das ganze Äußere überhaupt stark vernachlässigt. Er trug an Bord seine ältesten Straßenanzüge auf und schien sie erst hergeben zu wollen, wenn keiner mehr konnte. Mir scheint sogar, er wusch sich nicht immer, wenigstens nicht sehr gern. Aber aus aller Wildheit konnten doch ein paar sehr gutmütige blaue Augen strahlen; nur schämte sich offenbar ihr Träger dieser ›Schwäche‹ und bestrebte sie durch finsteren Blick, mürrisches Wesen und polternde Worte zu verdunkeln. Umsonst, diese Vorspiegelung falscher Tatsachen misslang in der Regel und wirkte dann umso drolliger.
Dabei schien der Mann wahrhaft fromm und gottesfürchtig zu sein. Vor jeder Mahlzeit faltete er andächtig seine Hände und neigte sein Haupt, nur war er mit diesen innerlichen Seiten nie der Mannschaft aufdringlich. Es gibt Kapitäne, die Erbauungsstunden abhalten, den Sonntag mit Gottesdienst und Predigt feiern. Nicht immer entspricht diesem Gebaren die Wirklichkeit solcher Schiffsherren, aber bei Kapitän Düwel war keine Spur davon zu sehen. Er selbst fluchte nie oder nur in alleräußersten Notfällen. Wollte er seine Erregung in Worte kleiden, so hatte er's höchstens mit Trichinen zu tun, dann waren's aber gleich, wie es die Art dieser Tiere ist, Millionen Trichinen, ja sogar Millioooooonen Trichinen. Er hinderte aber niemanden am ernstlichen Fluchen, weder durch Verbote, noch durch Ermahnungen, noch durch Blicke oder Gebärden. Er selbst trank auch fast keinen Tropfen irgendeines alkoholischen Getränks, aber seine Leute erhielten jeden Tag ihr Glas Rum, nach schweren Anstrengungen sogar eine Sondergabe in Rum, ein Glas, das ja nicht zu klein sein durfte und das er selbst einschenkte. Dabei hielt er auf ausgezeichnetes Essen, wie man's leider selten auf einem Segler findet. Und doch ist gerade die Magenfrage bei dem Matrosen eine der wichtigsten, denn immer hat er Hunger. Immer. Natürlich gab's keinen Hasenbraten, aber doppelte Mengen von Butter, braunen Zucker nach Belieben, alle drei Tage Frischbrot. Kein Wunder, dass ich Mannschaften traf, die schon mehrere Fahrten mit ihm gemacht hatten.
Dabei hielt der Kapitän streng darauf, dass kein Schiffsjunge geschlagen wurde. Er selbst freilich fackelte nicht lange, denn er hatte eine Handfestigkeit, die seine Fäuste zu Kegelkugeln ballen konnte, und seine Tatzen vermochten einen Menschen wohl ohne Weiteres umzureißen. Unwillkürlich ward ich Zeuge, wie ein Matrose einem Angeheuerten die Geschichte von seinem Kameraden Jasper erzählte.
Jasper war Holländer, ein herkulischer Gesell, und hatte gegen den Kapitän eine recht widerspenstige Bemerkung gemacht. Ich hätte den Mann sofort in Eisen legen lassen, wäre es vor mir geschehen. Er hatte sich unbotmäßig gezeigt; das ist an Bord das schlimmste Verbrechen. Muss auch so sein. Kapitän Düwel hatte nur ein erstauntes Gesicht gemacht: »Wat wüll he?« Dabei allerdings hatte er schon mit der rechten Pranke ausgeholt. Der Matrose hatte ebenso den Arm erhoben, um die ihm offenbar zugedachte Backpfeife abzuwehren. Hätte er's nicht getan, so hätte er sie wahrscheinlich nicht bekommen. Nun aber erhielt er sie doch, und zwar gleich doppelt. Da half alle Abwehrkunst des sonst ausgezeichneten Boxers nichts. Wollte er sie links abwehren, so hatte er sie rechts, und dann kam sie wieder von links. Da war der Jasper, ein Heißsporn, wie sie zuweilen auch unter den fischblütigen Holländern vorkommen, zum Angriff übergegangen. Das hätte er noch weniger tun sollen, ganz abgesehen von den schweren gesetzlichen Folgen.
Er kam nicht weit. Das Männchen war noch viel mehr erstaunt: »Wat — du — du — mi?« — Ein blitzschneller Griff, das schmächtige kleine Krummbein hatte den Hünen gepackt und ihn so gegen die Kombüsenwand geschmettert, dass man nur staunen musste, dass weder Knochen noch Holzplanken brachen. Aber dem Koch waren alle Töpfe von der Wand gefallen, so wohlbefestigt sie auch gehangen hatten.
»Du Döskopp du!!«, grollte noch der Kapitän, dann hatte er sich umgedreht, ein frisches Stück Tabak abgebissen und war seelenruhig davongegangen. Jasper aber, obwohl alles andere als ein Feigling, war wie ein begossener Pudel davongeschlichen und wirklich ganz kopfscheu geworden.
Aber böse Folgen oder irgendeine Nachträglichkeit hatte die Sache für Jasper nicht gehabt. Eine Viertelstunde später besichtigte der Kapitän eine frische Takelung. Er war mit der Arbeit nicht ganz zufrieden.
»Wer hat das getakelt?«
»Jasper.«
»Jasper her!«
Der Matrose kam, das Gesicht voll düsterer Erwartung. Er war sonst ein sehr geschickter Arbeiter.
»Ganz gut gemacht, ganz sauber, aber doch nicht so, wie ich's haben will. Meine Angela ist eine gar saubere Dame — pass mal up, mien Söhn...«
Damit machte er dem Matrosen in aller Freundlichkeit die nötigen Handgriffe vor. —
Nein, er war schon ein ganz prächtiger Mensch, ein herrlicher Kapitän! Das konnte ich bald wahrnehmen. Man stelle sich einmal vor, man verdingt sich für lange Zeit auf solch einen Segler, und der Kapitän, Herr über Leib und in gewisser Hinsicht auch über die Seele seiner Leute, ist ein roher, gemeiner Kerl, der sie bis aufs Blut schindet, sie mit wurmzerfressenem Hartbrot. blau angelaufenem Speck und ranzigem Salzfleisch nebst Erbsen füttert, die mit keiner Sodazutat weichkochen — was will man dagegen tun? Ei, da kann einem die ›christliche Seefahrt‹, wie die Seeleute die Kauffahrteischifffahrt nennen, gewaltig leid werden.
Dieser Kapitän Düwel verlangte viel von seinen Leuten, manchmal sehr viel. Anspannung aller Kräfte bis zum Äußersten. Auch bei Windstille gab's keine Ruhe. Immer wurde gescheuert und gemalt. So wenig er selbst auf sein Äußeres hielt, das Schiffchen musste immer wie geleckt aussehen. Aber von unnötiger Quälerei war keine Spur. Für harte Arbeit erhielt man das bestmögliche Essen. Darauf freut sich unsereins ja immer am meisten.
Er selbst war als erster stets voran, sogar mit der Farbenquaste. Wer bei jeder Arbeit die Pfeife zwischen den Zähnen halten konnte, durfte es tun; Zeit gab's genug, dass man sein ›Zeug‹ (Kleider und Wäsche) in Ordnung halten konnte; niemals wurde man unnötig aus der Koje (Schlafstelle) geholt, worin manche Kapitäne etwas los haben; ungerechterweise fiel nie ein unfreundliches Wort — ach, da kann unsereins dankbar dafür sein, so dankbar.
Für diesen Mann sind wir später alle durchs Feuer und Wasser gegangen, im buchstäblichen Sinn, Jasper ebenso wie alle anderen, wie ich selbst. Das sagt genug.
Dass ich am rechten Platz war, empfand ich schon in den ersten vier Tagen, wenn er mir auch in der kurzen Zeit schon einige Millioooooonen Trichinen in den Leib gewünscht hatte. Der Kapitän Düwel war offenbar ein richtiger Seebär, ein echter Seglerkapitän von altem Schrot und Korn und ein wackerer Mensch.
Der Mann schien unverheiratet zu sein, ferner dünkte es mich auch, als haperte es an Geld. Die Kapitänskajüte der ›Angela‹ sah fast ärmlich aus, die Koje in seiner Schlafkammer war nicht besser als die eines Matrosen.
Das wäre meines Erachtens nicht nötig gewesen. Auf solchen Segelkästen sieht man zuweilen Einrichtungen, dass man staunt. Das ist ganz natürlich. Wer vom Leben nichts weiter hat als ein Segelschiffskapitän, der oft viele, viele Monate unterwegs ist, ohne Land zu sehen, richtet sich wenigstens gern behaglich ein, und viele lassen sich's etwas Erkleckliches kosten. Da sieht man zuweilen Salons, die sind tiptop. Geht einmal das Schiffchen unter — auch Luxusdampfer gehen unter! —, so schadet's auch nicht viel. Es ist doch alles versichert.
So viel sollte eigentlich bei der ›christlichen Seefahrt‹ herausspringen, dass es der Kapitän sich bequem machen kann, umso mehr, wenn man der Mannschaft doppelte Butteranteile geben konnte und nirgends Sparsamkeit oder Geiz durchblicken ließ. Vielleicht war er ein neuzeitlicher Diogenes zur See, der alles Überflüssige verachtete, ohne andere deshalb darben zu lassen. Wie er selbst aß, hatte ich noch nicht herausbekommen, denn als Kapitän speiste er natürlich allein, und ich konnte doch nicht etwa den Steward fragen oder gar in die Töpfe gucken.
Als ich eines Abends in einer Gastwirtschaft stehend am Schenktisch stand, hörte ich über die ›Angela‹ und ihren Kapitän sprechen, ohne mich natürlich am Gespräch zu beteiligen.
Es sei eine kleine Reederei, die noch vier andere solche Segler gehen hätte. Kapitän Düwel war Mitinhaber der Firma. Die ›Angela‹ fuhr er schon seit bald zwanzig Jahren. Sie sei offenbar für ihn das Geschöpf, an dem seine Seele hing. Als die Bark einmal an der schottischen Küste vom Sturm auf die Riffe zu getrieben wurde und schon unrettbar verloren schien, da sei er niedergekniet und habe betend ausgerufen: »Der Herr hat sie mir gegeben, der Herr hat sie mir genommen, der Name des Herrn sei gepriesen.« Schließlich war sie doch davongekommen. Aber der kleine Kapitän Düwel solle überhaupt sehr bibelfest sein und gern Bibelsprüche anwenden.
Davon hatte ich allerdings noch nichts gemerkt. Jedenfalls aber, wenn's am nötigen Betriebskapital fehlte, war Kapitän Düwel nicht der Mann, der die Ausgaben für seine Person belastete. —
Am Morgen des fünften Tages hieß es: »Aufs Seemannsamt zur Anmusterung! Und das plötzlich!«
Ich war den ganzen Morgen im Kielraum gewesen, wo geteert wurde. Danach sah ich aus, wollte mich erst waschen und ankleiden...
»Ihr habt wohl Trichinen im Kopf? Vorwärts! Die Leute können nachkommen, wir beide müssen zuerst da sein.«
Also gingen wir nach dem Seemannsamt. Die Sache war noch nicht ganz fertig, als mich der Kapitän beiseite nahm.
»Ich habe hier nichts mehr zu tun und muss nach Hause, wo mich etwas Dringendes erwartet. Wenn die Geschichte hier in Ordnung ist, dann bringt mir die Musterrollen in meine Wohnung! Und diese Aktenmappe hier dazu. Wisst Ihr, wo ich wohne? Da und da. Ihr kennt Euch in Hamburg nicht aus? Fahrt mit der und der Straßenbahn, steigt da und da aus...«
Es geschah. Eine Stunde später stand ich vor dem bezeichneten Hause. In dieser Stadtgegend haben einst die reichen Hamburger Kaufmannsgeschlechter, die Hansakönige, ihre Paläste gehabt. Die alten stolzen Häuser stehen noch heute. Sie werden aber mehr zu Kontorzwecken verwendet oder dienen als Niederlagen.
Vor solch einem ehrwürdigen Riefengebäude stand ich und zog die Klingel. Ein Schild sah ich nicht, aber Straße und Nummer stimmte. Jedenfalls hatte die kleine Reederei hier ihr Kontor, natürlich nur ein paar Räume, Kapitän Düwel auch seine Junggesellenwohnung, wenn er an Land war. Wenn er überhaupt so etwas wie eine Wohnung hatte.
In dem Riesentor wurde eine besonders eingelassene kleine Tür geöffnet; ein regelrecht gekleideter Herrschaftsdiener fragte nach meinem Begehr.
»Wohnt Kapitän Düwel hier?«
»Jawohl, der wohnt hier. Sie bringen die Schiffsrolle und die Aktenmappe? Der Herr Kapitän ist schon fortgegangen. Sie möchten sie oben abgeben. Kommen Sie mit!«
Er führte mich über den Hausflur, die Einfahrt. Was war das für eine Einfahrt! Da fuhr gewiss nie ein Lastfuhrwerk. Das sah ganz aus nach Gummirädern und Vollblutpferden. So war's wenigstens instand gehalten. Das hintere Tor stand offen und ließ in einen Garten sehen, den man dort freilich nicht vermutet hätte. Und was für ein wohlgepflegter Garten! Jetzt prangte er noch im letzten Sommerschmuck voll Blumenpracht, und, merkwürdig, er zeigte die seltensten Büsche und Bäume. Da vor dem reizenden orientalisch gehaltenen Gartenhaus plätscherte ein Springbrunnen in einem Marmorbecken. Er hätte ebenso in einem Palast in Tausendundeiner Nacht sprudeln können. Eine Freitreppe führte nach oben. Das waren doch echt persische Läufer, ein schmiedeeisernes reiches Geländer! An den Treppenabsätzen standen Marmorbildwerke, unten und oben mächtige Leuchter aus kunstvoller Schmiedearbeit. Nein, das Haus diente nicht für Kontorzwecke! Zwei Mädchen in sauberen Häubchen huschten vorüber, dann kamen gleich drei Diener, die einen schweren Teppich schleppten. Der musste unbedingt echt sein.
»Wo ist das gnädige Fräulein?«, fragte mein Führer. »Im ersten oder zweiten Stock?«
»Nein, die Herrschaften sind augenblicklich alle im dritten Stock.«
Also ging's drei Treppen hinauf. Überall herrschte die gleiche vornehme Pracht. Ich wurde in ein Zimmer geführt. Donnerwetter, sah es hier herrlich aus! Vornehme Ruhe und unaufdringlicher Glanz beherrschten das Ganze. Was mochte nur allein die Standuhr dort gekostet haben oder die behaglichen Ledermöbel oder der Riesenteppich, der das ganze Zimmer mit wohliger Behaglichkeit deckte! Und das konnte kaum das beste Zimmer sein. Sonst hätte man doch mich beteerten Matrosen, für den ich natürlich gehalten wurde, nicht hineingeführt.
Die Tür zum Nebenzimmer war offen. Auch dort herrschte die gleiche Pracht. Auf einem wunderbar weich tönenden Stutzflügel perlten Liszt'sche Rhapsodien, deren Wohllaut mich sehnsüchtig umfing. Wer mochte solche Kunst hervorbringen? Wie hatte ich mich überhaupt in dieses Feenreich verirrt?
Plötzlich rissen die Tonfolgen jäh ab, jemand sprach, und da erschien in der offenen Tür eine entzückende junge Dame, eine Schönheit, die mich noch mehr verlegen machte als der ganze Reichtum ihrer Umrahmung. Sie erschien mir wie das Juwel, das dieses Schmuckkästchen barg, war von herrlichem Wuchs, und auf ihrem lieblichen Antlitz glühte noch die Begeisterung, in die sie offenbar die Musik versetzt hatte. Mit strahlenden Augen, die man nie vergessen kann, sah sie mich unbefangen an, ein Mädchen, von dem ich begriff, dass man es nur einmal zu sehen brauchte, um nie mehr loszukommen. Was ist doch ein Weib! Eine Macht, die alle Männerkraft weit in Schatten stellt, ein Engel, der das Paradies öffnen kann, oder ein Teufel, mit dem man lachend zur Hölle geht. War das Kapitän Düwels...? Unmöglich.
Der jungen Dame fiel meine Verlegenheit offenbar gar nicht auf. Sie sah in mir die unbeholfene Teerjacke der ›Angela‹ und sagte freundlich und heiter:
»Nicht wahr, Sie bringen Musterrolle und Aktenmappe? Ich soll sie Ihnen abnehmen. Papa hat's so hinterlassen. Ich bin nämlich«, setzte sie launig und wichtig hinzu, »sein Geschäftsführer.«
»Entschuldigen Sie, das ist für Herrn Kapitän Düwel.«
»Gewiss, das ist mein Papa.«
»Ihr Pa — pa?«
»Aber sicher, Kapitän Düwel von der ›Angela‹ ist mein Vater. Glauben Sie es nur, die Papiere kommen schon in die richtigen Hände!«
Damit trat sie lachend auf mich zu, nahm mir ohne Weiteres meine Mappe aus der Hand und verschwand im Nebenzimmer. Ich stand da wie vom Blitz getroffen. Das war seine Tochter — Kapitän Düwels Tochter? — Dieses ganze Haus war Kapitän Düwels Eigentum, und der hauste auf einer Segelbark in der armseligsten Koje, in der je ein Kapitän seine Ruhe gesucht? —
Da hörte ich, wie dieselbe lustige Stimme im Nebenzimmer etwas leiser sagte: »Mama, das hat ein Matrose für Papa gebracht. Der muss erst etwas bekommen.«
»Ich weiß schon, es ist schon alles bestellt.«
Ich stand immer noch da wie ein Stock und starrte offenen Mundes nach der Türöffnung, wo das Wunder der Schöpfung verschwunden war. Da erschien im selben Rahmen eine ältere Dame. Ja, ja, das konnte nur die Mutter sein. Der gleiche Wuchs, die Gestalt vielleicht nicht mehr so biegsam, aber dieselben Augen, nicht so strahlend, aber dafür voll ungemeiner Güte und Freundlichkeit. Mütterliche Augen, zu denen man unbedingt Zutrauen fassen musste. Das war die nämliche Stirn mit den edlen Linien im zartesten Weiß, nur umrahmt statt von brauner Fülle mit silbergrauem, immer noch vollem Haar; fast waren es die gleichen Farben der Wangen, nur etwa 20 Jahre älter, und der gleiche Mund, ach der Mund!
Das war immer noch eine Schönheit, nur getaucht in unnahbare Majestät und unbeschreibliche Güte.
Sie sah offenbar meine Verlegenheit, denn ich fühlte, dass ich, der Steuermann Knut Larsen, der schon manchmal in Todesgefahr nicht gebebt hatte, rot wurde wie ein Schuljunge und kaum imstande war, eine Verbeugung oder irgendeine Bewegung zu machen. Aber ihr war das natürlich nicht verwunderlich. Sie sagte freundlich:
»Kommen Sie, setzen Sie sich! Sie werden erst eine kleine Erfrischung zu sich nehmen.«
Und weil ich mich nicht rührte, zog sie mir einen Ledersessel heran und wiederholte ihre Aufforderung, während ich Tölpel das alles geschehen ließ und ruhig zusah, wie sie eigenhändig den schweren Lehnstuhl heranschob.
In dem Augenblick erschien ein Diener mit einer silbernen Platte, die ein leckeres Frühstück zeigte. Die Dame nahm es ihm ab und bediente mich selbst.
Da endlich fand ich die Sprache und brachte verlegen heraus: »Gnädige Frau, ich muss an Bord zurück.«
»Ach, nein. So eilig haben Sie's gar nicht. Sagen Sie nur, dass Sie erst hier frühstücken mussten. Wir haben Sie nicht fortgelassen. Mein Mann ist ja gar nicht so streng. Das scheint nur so...«
Also das war seine Frau! Kapitän Düwel, das kleine krummbeinige Männlein mit dem unrasierten Mopsgesicht, hatte solch eine herrliche Frau! Ich fand mich noch nicht zurecht.
Die Dame sah es, wenn sie auch die Ursache nicht erraten konnte, und half mir freundlich:
»Also lassen Sie sich's recht gut schmecken! Wenn Sie fertig sind, gehen Sie nur auf den Gang, Sie werden den Weg schon finden. Ich danke Ihnen. Guten Morgen!«
Damit rauschte sie hinaus, und ich saß da vor einem großen Glas Portwein und einem Berg belegter Brötchen. Tiefsinnig begann ich zu kauen und zu schlucken. Schließlich ist das Essen auf dieser Welt das beste Mittel, den natürlichen Zusammenhang mit allen Dingen herzustellen. Darum heißt auch das erste Gebot in der Bibel: Du sollst essen! Und mit dem Essen gewöhnte auch ich mich an dieses unerwartete Paradies.
Ich blieb übrigens nicht lange allein. Ein Seekadett erschien und begrüßte mich. In ihm erkannte man gleich den Sohn meines Kapitäns. Das waren des Vaters Züge, aber von der Mutter hatte er den edlen Wuchs und jenen gewissen unbeschreiblichen Adel des Wesens.
»O, bitte, bleiben Sie nur sitzen«, begütigte er, als ich aufsprang. »Lassen Sie sich ja nicht stören! Ich wollte Sie nur etwas fragen. Der zweite Steuermann bei Ihnen heißt Knut Larsen, nicht wahr?«
»Jawohl, so heißt er.«
»Ist er schon lange auf Papas Schiff? Papa spricht ja nie von so etwas. Ich habe seinen Namen zufällig auf der Musterrolle gelesen.«
»Nein, er ist eben erst angetreten.«
»Wissen Sie auch, dass dieser Steuermann Reserveleutnant in der Marine ist?«
.,Jawohl, das ist mir bekannt.«
»Ist's ein umgänglicher Mensch? Ich muss ihn unbedingt sprechen.«
»Ach ja, es scheint so.«
»Dann werde ich ihn an Bord besuchen. Vielleicht können wir uns auch sonst wo treffen.«
»Das ist wirklich nicht nötig.«
..Nicht nötig?« —, stutzte der junge Mann.
»Sie können ja gleich mit ihm sprechen.«
»Gleich?...«
»Ich bin selbst der Steuermann Knut Larsen.«
Jetzt war die Verlegenheit und der Schreck endlich anderswo, und damit fand ich mich selbst wieder. Das Kadettchen klappte die Hacken zusammen und stammelte: »Verzeihen Sie, ich habe Sie nicht erkannt.«
»Das wundert mich nicht«, sagte ich lachend; »es ist auch nicht meine Schuld, dass ich in solchem Aufzug hier eindringen musste. Ich sehe wirklich nicht offiziersmäßig aus, aber augenblicklich bin ich dienstlich hier. Das entschuldigt mich wohl.«
Aber nun kam auch eine richtige Ungezwungenheit auf. Ich konnte alle Fragen des angehenden Seeoffiziers beantworten, und bald rief er Mutter und Schwester, sodass ein außerordentlich heiteres Zusammensein folgte, das die beiderseitige anfängliche Verlegenheit nunmehr in herzliche Freude umwandelte. Nur die Tochter behielt ihre Schüchternheit etwas länger, aber ich sah ihr doch an, dass sie im Innersten erfreut war. Sie hatte ja auch ohne Zweifel bemerkt, welch tiefen Eindruck sie auf mich gemacht, und so wenig sie sich am Gespräch beteiligte, schien es mir doch, als verstünden wir uns mit den Augen.
»Sie sind uns nun wirklich einige Genugtuung schuldig«, bemerkte die Frau des Hauses. »Wollen Sie nicht einen Abend mit uns verleben? Mein Mann ist tatsächlich in solchen Dingen zuweilen seltsam.«
»Gnädige Frau«, entgegnete ich, »erlauben Sie, dass ich nicht so rücksichtslos bin. Bis wir die Anker lichten, muss unbedingt ein Offizier an Bord sein. Der erste Steuermann fehlt noch, und Ihr Herr Gemahl müsste mich vertreten, wenn ich Ihrer gütigen Einladung Folge leistete. So gewissenlos kann ich aber nicht sein. Bedenken Sie, wie lange Trennungszeit Ihnen wieder bevorsteht!«
»Sie haben recht«, und ein leichter Schatten flog über ihre schönen Züge. Dann aber erhellten sie sich plötzlich:
»So bleiben Sie gleich und teilen unser Mittagsmahl! Mein Mann ist leider heute verhindert und wider seinen Willen an Bord. Sie können ihn dann am Abend für uns freimachen.«
»Und in diesem Anzug?«
»Erlauben Sie uns, den Menschen zu uns zu bitten und nicht den Anzug! Übrigens ist dieser Anzug ein Ehrenkleid. Ich traue Ihnen zu, dass Sie in solchem Anzug meinen Mann in Not und auch in den Tod begleiten würden.«
Da kam wieder ein tiefer Ernst über sie und uns alle. Ich erfasste ihre Hand und sagte feierlich: »Mein Gelöbnis, gnädige Frau, dass ich meinen Kapitän in Not und Tod nicht verlassen werde.« In Seemannskreisen macht man nicht viele Worte. In dieser Stunde hätte ich nicht mehr sagen können, aber wir fühlten alle, dass es aus tiefwahrem Herzen kam. Das genügt. Es schwebte um uns wie eine Ahnung, dass wir sehr Schwerem entgegengingen. Da sollten diese prachtvollen Menschen wissen, dass Knut Larsen seine Pflicht tun würde bis zum Äußersten.
Dann wurde es doch ein recht frohes Mahl. Die echte Freude kann sich nur aufbauen auf einem sehr ernsten Untergrund. Und ob ich voll Freude war! Was war dieses Erlebnis für ein Lichtblick in meinem ernsten Beruf! Augenblicke allein entscheiden Menschenleben. Augenblicke sind die Ewigkeiten, die unseres Daseins Zeiten regieren und entscheidend lenken. Meine 28 Jahre fassten voll glühender Begeisterung diesen Augenblick.
Im Hause des so streng enthaltsamen Kapitäns knallten die Sektpfropfen. Wir stießen an auf gute Fahrt, und als wir aufstanden, hatte ich der liebenswürdigen Frau mein ganzes Leben erzählt, von meiner Heimat, meinen Plänen und mancherlei Gefahren. Von dem Abwesenden wurde nicht ausdrücklich gesprochen, aber man fühlte seine Nähe. »Mein lieber Mann«, so erwähnte ihn die Hausfrau, »unser Papa«, sagten die Kinder. Und mir ging das Herz auf, ich vergaß Raum und Zeit, vergaß mein demütiges Aussehen und dachte nur: Also so ein bärbeißiger Heuchler ist dein gestrenger Kapitän. Aber wart'! Dir will ich alles Gute vergelten, was die Deinen heute an mir getan haben, so wahr ich Knut Larsen heiße.
Schließlich ein herzlicher Abschied, ein tiefer Blick aus den unergründlichen Augen der Tochter, ein leichter Händedruck — dann war ein Paradies für mich versunken. Ach was, versunken! Ein Paradies versinkt nie. Das lebt immerfort, es flüchtet nur manchmal aus der Außenwelt in das tiefste Innere. Dann ist's erst recht ein Paradies.
Träumend fand ich mich auf der Straße, ich schwebte, ich flog irgendwohin, nur mit dem einzigen Gedanken: Wie mag sie heißen? Kein Mädchenname war mir gut genug für sie. Leider hatte niemand ihren Namen genannt. Aber ich weiß, wie sie heißt, es kann nicht anders sein. Sie heißt überhaupt nicht, sie ist. Sie ist die eine, neben der es eine zweite nie gab, nie geben kann, nie geben wird, nie...
»Nanu«, hörte ich da plötzlich eine raue Stimme brüllen, »rammt mich da so ein Teerkasten und noch dazu — das ist mal kurios — das sieht ja gerade aus wie Knut Larsen! Hallo, Junge, Teerjacke, wat makst?«
Ja, ich war wirklich auf dem Jungfernstieg festgefahren an einem Koloss von sieben Schuh Höhe und entsprechender Takelung, als Kapitän schon auf zehn Knoten hin kenntlich. Ein väterlicher Freund übrigens, der mich als Schiffsjunge manchmal gebackpfeift hatte.
Langsam, aber umso sicherer fühlte ich wieder die Planke der seemännischen Wirklichkeit unter mir, während Jürgens losbrüllte, als gälte es, mitten auf dem Jungfernstieg einen Taifun zu überschreien:
»Wat, auf der ›Angela‹ bist du, beim Düwelskapitän? Ob ich ihn kenne? Hoho, hoho!!! Wir beide zusammen haben doch an der argentinischen Küste das Blaue vom Himmel heruntergepascht. Uns mit den Zollkutters herumgebalgt — piff, paff, piff, paff — Minen gelegt, — nicht zu knapp — ja, jetzt supt he Water — aber damals! Hoho! — den Grog aus Eimern — ein verwegener Bursche — der reine Satan — hoho, hoho! —«
»Mein Gott, Jürgens, brüllt doch nicht so! Ich verstehe ja alles, und wir sind nicht ganz allein auf der Straße!«
Der Hüne pustete und schnaubte wie ein Walross, dann wurde er langsam fähig, wie ein anderer Mensch zu sprechen. Bei ihm konnte ich auch nähere Auskunft erhalten.
»Kleine Reederei! Ja, groß ist sie nicht, hat nur fünf Segelkasten mit kaum zweitausend Tonnen fahren, die ›Angela‹ ist der größte. Was, Zahlungsschwierigkeiten?? Ungenügendes Betriebskapital?? Mensch, o Mensch, wer hat dir denn so ein Märchen aufgebunden? Diese Firma könnte sich neben die größten Reedereien stellen! Sie tut's nicht, sie will klein bleiben, will so nach und nach sanft einschlummern. Aber die befrachtet doch ihre Schiffe auf eigene Rechnung!! Was das zu bedeuten hat, das weißt du doch! Und alles bar! Ich bin einmal dabeigewesen — in Bahia — dreihundert Tonnen Kakao — sechsmalhunderttausend Milreis bar auf den Tisch — acht Wochen später waren hundertundfünfzigtausend Mark bar verdient! Käpten Düwel? Der war schon als Säugling millionenschwer! Und dann hat er auch noch ein amerikanisches Goldfischchen geheiratet! Du kennst seine Frau, die Angela? Wie er zu der gekommen ist? Hoho! Erspielt hat er sie. Erspielt, sage ich, mit der Fiedel. Ob der Violine spielen kann? — Junge, Junge, sag' ich dir — der spielt einem das Herz aus dem Leibe! Er sollte ja auch vollends ausgebildet werden, in Leipzig oder Wien, hatte schon immer die tüchtigsten Lehrer, die Stunde zwanzig Mark. Hoho! Was er für eine Schule besucht hat? Na, natürlich das Johanneum, das Gymnasium, wo soll denn der Sohn vom Senator Düwel sonst hingehen! Aber ebenso natürlich ist er aufs Salzwasser gegangen. Zwei Gebrüder Düwel waren es doch, die vor grauen Jahren dem Klaus Störtebeker endlich den Garaus machten und ihre Vaterstadt von der ganzen Seeräuberbande befreiten. Sie sind alle Seefahrer gewesen, die Düwels, das lässt sich nicht mehr aus dem Blut merzen. — Nee, jetzt spielt er nicht mehr, rührt keine Fiedel mehr an. Warum nicht? Ja, Junge, da muss mal was passiert sein. Das scheint mit seiner Heiraterei zusammenzuhängen. Das war überhaupt so eine romantische Liebesgeschichte. Du weißt doch, dass auch wir Deutschen so einen Johann Orth haben, einen Fürstensohn, der... man weiß nicht recht, er lebt im Exil, auf dem Wasser, nur auf seiner Jacht. Der ist damals mit der Angela, dem amerikanischen Goldfischchen, schon halb und halb verlobt gewesen. Na, scheint Ungnade geworden zu sein, Exil, was weiß ich! Aber er war fest aufs Verloben. Da kommt das kleine Säbelbein mit dem Mopsgesicht, fiedelt auf seiner Geige und... fiedelt das Goldfischchen und die gefeiertste New Yorker Schönheit dem Prinzen vor der Nase weg. Ja, wirklich! So ist's gewesen. Natürlich mit den nötigen Zutaten, die man nicht weiter kennt. Jedenfalls hat er seit dieser Zeit keine Fiedel mehr angerührt, und das ist nun schon mehr als zwanzig Jahre her. Wie der mit seiner Frau lebt, das hast du wohl gemerkt, wenn du in seinem Hause gewesen bist. Ein Herz und eine Seele! Übrigens solltest du den mal in Gesellschaft sehen, was das für ein feiner Kerl ist! Wenn der spricht, da lauscht alles. Da kann er auch auf dem Tisch oder einer freien Bühne stehen, da sieht kein Mensch mehr seine Säbelbeine, so kann der eine Gesellschaft hinreißen. Am glücklichsten freilich fühlt er sich bei seiner anderen Angela, an Bord seiner Bark. Da braucht er sich nicht immer zu waschen und kann sich den Stoppelbart stehen und den salzigen Wind um die Nase wehen lassen. 's ist halt ein ganz besonderer Kerl, dieser DüwelsKäpten, ein ganz besonderer. Hast du übrigens auch Fräulein Angela gesehen? Ganz die Mutter. Aber was schwatz' ich da! Höre, mien Jong, hier in diesem Hause gibt's in ganz Hamburg den besten Porter vom Fass, hallo!...«
Nein, daraus wurde nichts! Dienst ist Dienst. Ich machte mich schleunigst los und eilte an Bord. Jetzt wusste ich ja, was ich wissen wollte und noch vieles mehr. Also auch die hieß Angela. Natürlich. Das konnte gar nicht anders sein: Angela Düwel! Hm.
Mit vielen Entschuldigungen gewappnet kam ich an Bord. Auf ungezählte Millioooooonen Trichinen durfte ich schon gefasst sein. Aber der Käpten war noch gar nicht zurück.
Dagegen erwartete mich eine neue Überraschung.
Ich suchte den Steward, sah auf dem Kajütengang eine Tür offen, die bisher immer verschlossen gewesen war. Ich hatte auch nie versucht, sie zu öffnen. Ich wusste, dass es die Tür zur Kabine des ersten Steuermanns war. Jetzt fiel mir ein, dass hier achtern im Schiff allerdings noch ein größerer Raum vorhanden sein müsse. Die Kapitänskajüte war mir zu klein. Aber ich hatte in den vier Tagen anderes im Kopf gehabt und keine Zeit gefunden, über den Raummangel nachzudenken.
Also war mein Kamerad inzwischen angekommen, und da die Tür offen stand, trat ich ein, um mich ihm vorzustellen.
Aber da erlebte ich nochmals eine Überraschung wie am Morgen. Alle Wetter, war das ein Kajütensalon! Hier war alles da, was ich in der Kapitänskajüte vermisste. Und noch vieles mehr dazu. Das sah aus wie die Studierstube eines vornehmen Gelehrten. Die Wände waren mit Bücherborten besetzt, auch quer durch den Raum liefen Bücherreihen, Hunderte, vielleicht mehr als tausend Bände waren da aufgestapelt, eine großartige Bücherei. Am Boden gleich neben der Tür lag ein Buch. Ich hob's auf und las den Titel:
C. F. Gauß: Sechs Beweise des Fundamentaltheorems über quadratische Reste. Mit Anhang: Abhandlung über bestimmte Integrale zwischen imaginären Grenzen.
Donnerwetter! Unsereins ist ja genug mit Mathematik gefüttert worden. Mein Geschmack ist's gerade nicht. Soweit ich in der höheren Mathematik nicht unbedingt zu tun habe, da lat ich mien Näs von aff. Wenn ich nur den Namen des berühmten Braunschweigers Gauß höre, überläuft es mich schon kalt.
Da schien ja mein Kamerad ein unheimlich gelehrtes Haus zu sein.
Während ich aber das fürchterliche Buch wieder einzuordnen suche, fällt mein Blick auf den Schreibtisch, und da sehe ich — aber das kann doch nicht sein! Ich bin heute offenbar nicht mehr im richtigen Zustand. Nein, es ist kein Zweifel: ich sehe — Angela. Angela? Nein, doch wieder nicht. Das Brustbild des jungen, schönen, engelgleichen Mädchens kann meine Angela nicht sein. Die meine — so nenne ich sie schon — ist braun, diese schwarz. Und der Mund ist ein wenig anders. Es ist ähnlich, aber es ist nicht meine Angela. Es ist — wahrhaftig, es ist die Mutter. Frau Kapitän Düwel ist's, aber als zwanzigjähriges Mädchen. Wie schön sie ist!
Und hier in diesem Raum ihr Bild! Sonderbar. Und doch wieder nicht sonderbar.
Offenbar ist hier die gemeinsame Kajüte und der Arbeitsraum des Kapitäns und des ersten Steuermanns, der Schiffssalon! Neben dem Bild hängt in einem Glasbehälter eine Violine, ein altes, altes Holz mit gesprungenen Saiten...
Da kommt jemand durch die andere Tür, wo es noch weiter nach achtern geht. Ich sehe eine wundervoll eingerichtete Koje, einen prächtigen Waschtisch, von dem die Gestalt herkommt. Das ist offenbar mein Kamerad, und ich gehe ihm entgegen.
Aber nein, es ist der Steward, ein schon bejahrter Mann. Er scheint verdrießlich, mich hier zu sehen und macht den Versuch, mich unauffällig hinauszudrängen. Ich bin aber ganz arglos und frage:
»Wer haust denn hier?«
»Mister Rugby.«
Richtig, so hieß der erste Steuermann. Ein Amerikaner.
»Der treibt wohl Mathematik?«
»Jawohl, Mister Rugby schreibt immer.«
»Auch der Käpten?«
»Herr Kapitän Düwel? Nein.«
»Aber der hält sich doch wohl gewöhnlich hier auf?«
»Der Käpten? Der kommt nie in diese Kajüte herein, nie. Das ist die Kajüte von Mister Rugby, sein Studierzimmer, Herr Steuermann, ich muss die Tür verschließen.«
»Ist er denn nicht hier? Ich dachte, er sei schon gekommen.«
»Nein, Herr Steuermann, Mister Rugby ist noch nicht gekommen, und ich muss seine Kabine geschlossen halten.«
Merkwürdig, merkwürdig! Nachdenklich verließ ich den Raum. Wer mag dieser Mister Rugby sein? Bei ihm ist die Pracht und die Violine und — Angela! Und der Kapitän kommt nie hier herein! Was für Rätsel birgt doch die Welt überall, und wär's auch die kleine Welt einer winzigen Segelbark.
Am anderen Morgen in aller Frühe nahm uns ein Schlepper ins Tau. Der erste Steuermann war noch nicht an Bord.
Vor Cuxhaven lag ein englischer Dampfer von sehr vornehmem Äußeren, schien eine große Dampfjacht zu sein. Ein Boot löste sich ab und hielt auf uns zu.
»Da kommt he, der Mister Rugby«, hörte ich einen Matrosen zum anderen sagen. »'s ist doch merkwürdig! Das ist nun schon zum dritten Mal so. Immer geht Mister Rugby, wenn wir Anker legen, vor Cuxhaven von Bord, aber niemals an Land, immer nur auf einen anderen Dampfer. Ich glaube, der darf gar nicht an Land, wenigstens nicht auf deutschen Boden...«
»Ach, holt dien snoddriges Mul!«, wurde der Sprecher vom vorübergehenden Bootsmann jäh unterbrochen.
Dann kam er. Einiges Gepäck wurde an Bord gereicht.
Donnerwetter! War das ein prachtvoller Mensch! Eine hohe fürstliche Erscheinung mit einem graumelierten Vollbart, jede Bewegung königlich, im Blick eine Hoheit, dass jeder sich ohne Weiteres verneigte. Das also war unser erster Steuermann!
Der schönste Mann, den ich je gesehen habe, war Kaiser Friedrich in der Zeit, als er noch ›Unser Kronprinz‹ war. Ein Bild der Schönheit und Ritterlichkeit. Wenn der Mann den Degen zog und die Truppen damit grüßte, da fasste die Regimenter eine Begeisterung, dass sie zu jeder, auch der schwersten Leistung bereit waren. Als diese schier überirdische Titanenerscheinung an der Spitze der Gardekürassiere in Paris einzog, da hat er auch auf die grimmigsten Deutschenfresser und Deutschenhasser einen tiefen Eindruck gemacht. Noch nach Jahren hörte ich alte Franzosen mit bewundernder Ehrerbietung von ihm sprechen. Ich glaube, einen solchen Kaiser würden die Franzosen heute noch allen ihren Präsidenten vorziehen, wenn sie ihn nur bekämen.
An Kaiser Friedrich musste ich unwillkürlich denken, als Mister Rugby leicht und sicher über die Bark schritt.
Er trat grüßend auf den Kapitän zu: »Melde mich an Bord.«
Ein flüchtiger Antwortgruß. — »Steuerbord hat Wache.«
Ich war von der Backbordwache, der Kapitän vertrat den ersten Offizier.
Nach fünf Minuten kam dieser von achtern zurück. Er trug blaue Arbeitshosen und Flausrock und löste den Kapitän ab. Wir trafen zusammen. Ich stellte mich vor: »Larsen.«
»Rugby.«
Zwei große blaue Augen flammten mächtig auf und musterten mich. Ich fühlte, wie sie durch und durch gingen. Dann hielt er mir die Hand hin.
»Wir werden gut zusammen auskommen, Herr Kamerad.«
Herzlich klang es, herzlich drückte er meine Hand.
Wir hätten übrigens nicht viel Gelegenheit gehabt, uneins zu werden. Er ging seine Wache und ich die meine, wir sahen uns nur bei der Ablösung. So eng begrenzt ein Schiff ist, so kann man sich doch nirgends so aus dem Weg gehen wie hier, wenn man verschiedener Wache zugehört. Man geht dann stets aneinander vorbei. An Bord kennt man nicht Tag noch Nacht. Ununterbrochen wird von einem Teil der Mannschaft gearbeitet, ›gewacht‹. Bei uns gab's die sogenannte englische Wache, d. h. abwechselnd vier Stunden Dienst und vier Stunden Freizeit. In dieser wird gegessen, geschlafen, geflickt, wohl auch gelesen, der Mann hat jedenfalls im ganzen zwölf Stunden für sich. Das ist sehr viel Zeit. Die deutsche Wache gewährt nur acht Stunden Freizeit, das reicht gerade zum Schlafen aus. Da haben beide Wachen manchmal zusammen zu arbeiten. Bei Sturm und Seenot müssen natürlich alle Mann an Bord, da wird auch die ruhende Wache ›aufgepurrt‹, wie der Kunstausdruck lautet. Je nach den Vorstellungen, die ein Kapitän von Seenot hat, kann er dabei seine Leute sehr quälen. Es ist bezeichnend, dass man bei Kapitän Düwel, auf »›unserer‹ Angela«, für die ich nun auch begeistert war, die englische, mildere Wache bevorzugte und ohne ganz dringende Not die Leute nicht aufpurrte.
Ich muss hier doch unsere gesamte Mannschaft kurz vorstellen, weil jeder Einzelne in den ganz ungewöhnlichen Abenteuern, die unser harrten, nach seiner Art redlich seinen Mann gestellt hat.
An sich ist auch das kleinste Schiff eine Welt für sich, die noch durch die verschiedenen Wachen in zwei Teile zerfällt. Zwar nicht in eine Tag- und Nachtseite, wie die Welt da draußen, sondern in eine Steuerbord- und Backbordwache. Die andere Welt, in der die gewöhnlichen Menschen leben, versinkt fast ganz für den Seemann. Darum gewöhnt sich der Seemann so schwer wieder in sie ein und kann seine Sonderwelt kaum mehr lassen, wäre die andere auch noch so behaglich und angenehm. Es scheint, dass der Durchschnittsmensch eine Begrenztheit unbedingt nötig hat und dass er im Grenzenlosen erst gedeiht, wenn er als Geistwesen sehr hoch steht.
Auf einem Schiff aber ist alles besonders eng zusammengedrängt; Freud und Leid, Glück und Unglück, Liebe und Hass spielt sich alles zwischen den paar Planken ab; auch sie sind Bretter, die eine Welt bedeuten. Dafür schwimmt die so enge Welt in der Unermesslichkeit und Unbegrenztheit, unabhängig von Ort und Zeit, wie ein Stern im All. Es gibt nicht groß und klein in der Welt. Diese anscheinend kleine Welt ist genau so bedeutungsvoll wie jede andere.
Wie man sich da kennenlernt, was man da beobachten kann! Da sieht man erst, dass jeder einzelne Mensch, mag er auch noch so einfältig sein, im Grunde eine einzigartige Besonderheit ist. Gewiss ist's draußen in der weiten Welt ebenso wie in unserer engen, aber hier kommt auch das Kleinste zu voller Geltung und tritt auf als Riesengröße, als gleichberechtigte Größe. Das ist's, was bei uns so viel innere Befriedigung schafft.
Das hatte ich natürlich vorausgesehen, dass der Matrosenwitz sich ohne Weiteres des Gegensatzes Düwel und Angela bemächtigen werde. Das war umso leichter zum Ausdruck zu bringen, weil jeder Matrose mit dem Vornamen gerufen wird. Die Vatersnamen kennt man meistens gar nicht. Auch die Vornamen wechseln. Haben zwei Matrosen den gleichen, so wird der eine vom Offizier einer Wache einfach umgetauft. Außerdem führt jeder einen Spitznamen, der ihn meist treffend zeichnet oder irgendeine seiner Heldenrollen verewigt.
Demnach gab's auf der ›Angela‹ viele Teufel. Der Käpten musste doch seine richtigen Untertanen haben, und die Religion hat uns ja so viele Teufel gelehrt!
Da war in der Steuerbordwache der Matrose Rudolf. Er hatte einmal einen Brief erhalten von seiner Braut, hatte ihn liegen lassen, und andere hatten ihn gelesen. Er trug außen die Aufschrift: Herrn Rudolf Pelz, aber innen lautete es: Mein liebes Bubi! Da hieß er Bubi Pelz oder Pelzens Bubi, und damit war der B e e l z e b u b schon fertig. — Sein Kamerad in der Wache hieß Ferdinand Lukas oder Lukas Ferdinand. Aus ihm wurde ein L u z i f e r . — Der Leichtmatrose Hein, von dem ich öfter zu erzählen habe, war an Verwegenheit der reine S a t a n . Daher trug er diesen Ehrennamen. Er sah übrigens nicht danach aus. Das Salzwasser wollte ihn nicht beizen, er hatte fast ein Mädchengesicht trotz seiner achtzehn Jahre und war sanft und schüchtern, sehr bescheiden und errötete leicht. Er war freilich ein wenig schmuddelig, etwas sehr schmuddelig, fuhr schon seit vier Jahren, hatte aber merkwürdigerweise schon zweimal in sein Abgangszeugnis eine böse Bemerkung bekommen: »Bedarf sehr der Aufsicht.« Das ist keine gute Note, die durch ein ›Sehr gut‹ in Seemannschaft und Nüchternheit kaum wieder aufgehoben wird. Warum mochte wohl Kapitän Düwel diesen sanften Heinrich, dieses demütige Bürschchen aufgenommen haben? Es sollte später deutlich werden. — Dann gehörte noch zu dieser Wache der Matrose Jochen, genannt S o ß e n s n u t , weil er gar so schrecklich Tabak kaute, der Matrose Reinhard Claudius, genannt Reineclaude oder einfach P f l a u m e , und der Schiffsjunge Klas, genannt der B u t t e r l e c k e r , ein Name, der keiner Erklärung bedarf. Diese ganze Steuerbordwache stand unter dem Befehl von Mister Rugby, dem ersten Steuermann.
Ich selbst befehligte die Backbordwache und hatte unter mir den Matrosen Jasper Nydeek, den schon erwähnten Holländer. Man nannte ihn K a s p a r H a u s e r , vielleicht des Gleichklangs wegen, aber auch, weil er wirklich ein Kaspar Hauser war, von unbekannter Herkunft. Er war als neugeborenes Kind in Rotterdam am ›Nydeek‹ aufgefunden worden und hatte daher seinen amtlichen Namen erhalten. — Dann war da der Matrose Karl, genannt P i e p m a t z . Er schrieb sich Matz, man sagte ihm aber nach, er habe wirklich zuweilen einen Piepmatz im Kopf. — Ein echter Bayer hatte sich auch unter das Schiffsvolk verlaufen; die Süddeutschen sind keineswegs selten unter den Seeleuten. Es war der Matrose Sepp, genannt b a y e r i s c h e r H i e s l , auch T e c h t l - M e c h t l . — Ferner Alois, ein Österreicher, genannt K r u z i , weil man oft das Wort Kruzitürken oder bloß Kruzi von ihm vernahm. Er war ein sehr tüchtiger Matrose. — Dazu gehörten noch der Leichtmatrose Ubbo, der S c h n e e s i e b e r , ein wirklich leichter Matrose, dem man nicht viel zutraute, und der Schiffsjunge Hans, unser › N ä s w a t e r ‹ , der er wirklich war. Ein ganz gerissener Taugenichts.
Zu diesen 14 Mann der beiden Wachen kamen noch vier Unteroffiziere, die keine Wache gingen, sodass wir zusammen mit dem Kapitän 19 Mann waren.
Von den Unteroffizieren, die auf dem Segelschiff hervorragend wichtig sind und bei uns noch besonders wichtig werden sollten, muss ich ein kurzes Wort der Vorstellung sagen. Unter ihnen befand sich die Hauptperson der ganzen Geschichte, der Schiffskoch. Wie sein eigentlicher Name war, das wusste niemand, vielleicht er selber nicht. Wir nannten ihn Popanz, weil er ein Neger war, und zwar ein ganz pechschwarzer. Er glänzte geradezu, als sei er mit Spirituslack angestrichen. Häufiger noch hieß er A h a s v e r . Vielleicht schien der Name unter die Teufelsmannschaft gut zu passen, vielleicht kam's her von seinem ruhelosen und zappeligen Wesen. Das war nicht gewöhnliche Nervenschwäche, sondern ein ganz geheimnisvoller Zustand, der mir nie ganz deutlich wurde. Er musste beständig die Arme oder Beine schlenkern, mit den Händen ein unglaubliches Gebärdenspiel aufführen, und wenn er das nicht konnte, schnitt er Gesichter, die allerungeheuerlichsten; er verdrehte die Augen in unbeschreiblicher Weise, dass sie wie weiße Flecken aus dem pechschwarzen Gesicht leuchteten, oder er wackelte mit den Ohren wie ein Pferd. Sogar im Schlaf fanden seine Gliedmaßen und Züge keine Ruhe. Er selbst schien sich Bumbo zu nennen, wenigstens fügte er dieses Wort stets zu seiner kräftigsten Bejahung, die er bei jeder Gelegenheit gleich doppelt anwendete. Fragte man ihn: »Ist der Kaffee fertig, Ahasver?«, so antwortete er: »Ahl fertik, Massa, fertik, Bumbo auf Ehre, Bumbo auf Ehre!« Oder: »Ahasver, bist du eigentlich verheiratet?« — »Nie nix heiraten haben, Bumbo auf Ehre, Bumbo auf Ehre!«
In seinem Fach war er aber ein Künstler, wie es kaum einen zweiten gab. Er bekam nicht nur ohne Soda die härtesten Erbsen weich oder verstand aus Sohlenleder zarte Rindstücke zu braten. Er war auch geradezu schöpferisch tätig. Von tausend Kochkünsten will ich nur zwei erwähnen. Er konnte künstliche Eier herstellen, die man von natürlichen nicht unterscheiden konnte, weder im Aussehen noch im Geschmack. Außen die Schale, dann das Weiße und innen das Gelbe. Man konnte Hühnereier, Möweneier, Kiebitzeier bestellen, Bumbo schaffte innerhalb einer Stunde eine ganze Schüssel der gewünschten Eier, hartgekocht, weichgekocht, Spiegeleier, Rühreier, wie man's forderte. Nur ausbrüten ließen sich die Eier nicht, aber das wurde auf dem Schiff auch nicht verlangt. Hatte er aber natürliche Eier, so wusste er ihnen durch eine Einspritzung mit einer haarfeinen Röhre hundert verschiedene Geschmäcker zu geben, wahrhaft wunderbar. Ebenso verstand er, künstliche Austern herzustellen. Er hatte seine ständigen Austernschalen, die er mit irgendeiner geheimnisvollen Masse füllte, dass sie von den besten Holländern nicht zu unterscheiden waren. Nur angewachsen waren sie nicht und hatten keinen Bart.
Dieser Neger wusste wohl nicht, was er wert war. Es ist ja bekannt, dass es Hotels und reiche Leute gibt, die auf üppige Gastmähler halten, die solch gottbegnadeten Kochkünstlern, noch dazu, wenn sie über eigene Gedanken verfügen, geradezu fürstliche Gehälter zahlen. Köche, Tenöre und Jockeys stehen sich oft viel besser als Minister. Bumbo aber bekam eine Heuer von 100, sage einhundert Mark monatlich, wie ein gewöhnlicher Schiffskoch auf einem Segelkasten. Wusste er's nicht besser? —
Und doch hätte er's wissen müssen. Zuletzt, d. h. vor sechs Jahren, war er auf einem Mississippidampfer gefahren, einem Luxusdampfer, den reiche Farmer, Plantagenbesitzer und Fabrikherren benutzen, die einmal etwas besonders Gutes essen wollen. Dort hatte er im Monat dreihundert Dollar bekommen. Für Amerika ist das nicht einmal sehr viel. Aber Kapitän Düwel hatte ihn in New Orleans von dem Flussdampfer geholt, und nun machte er schon seine vierte große Reise auf der ›Angela‹ mit.
Wie war das möglich? Es gab nur eine Erklärung. Irgendeine Dankbarkeit oder sonstige Verbindlichkeit, die ihn an den Kapitän band. Denn für ihn wäre Bumbo durchs Feuer gegangen. Er fühlte sich auch sichtlich außerordentlich wohl auf der ›Angela‹. Er hätte gut einen Kochmaat haben können, einen Küchengehilfen, aber er brauchte keinen. Er machte alles allein. Ich hätte ihm anfangs stundenlang zusehen können, wenn er nur Kartoffeln schälte. Wie der Kerl das machte! Wie ein Kreisel lief die Kartoffel durch seine Finger, und wenn man glaubte, das Schälen finge nun an, so warf er die geschälte schon in den Wasserbottich und griff nach einer anderen. Und dabei ein unausgesetztes Zappeln und Gesichterschneiden, Augenverdrehen, Ohrenwackeln, auch Schwatzen, wenn er nur einen Zuhörer gefunden. Ein ganz befonderer Mensch, dieser Bumbo.
Auch die eigentlichen Unteroffiziere waren die ständigen Begleiter von Kapitän Düwel. Es schien, als ob eine geheime Anziehungskraft von dem Mann ausginge, die alle fesselte, die einmal mit ihm in Berührung gekommen waren. Da war der Bootsmann Peter Kwän, ein Finnländer, zugleich Schiffszimmermann, genannt P e t r o l e u m . Das kam nicht nur her von seinem Namen Peter, sondern auch von seinem Geschmack. Er trank alles, was irgendwie fettig war, mit Leidenschaft. Vielleicht nicht gerade Petroleum, aber noch das ranzigste Schmieröl, sogar dünne Ölfarbe schlürfte er mit Behagen. Er war fast ebenso breit wie hoch und klein wie der Kapitän und dabei von ungewöhnlicher Kraft.
Eine besondere Rolle spielte seit langen Jahren auch der Steward, ›Herr‹ Friedrich R a i m u n d . Er war Respektsperson und hatte keinen Beinamen, nur musste man ihn ›Herr‹ nennen. Ich hatte das anfangs nicht gewusst, niemand machte mich oder irgendwen darauf aufmerksam, aber unwillkürlich setzte er sich durch und flößte Achtung ein. Er war ein ruhiger, vernünftiger, älterer Mann, eben Herr Friedrich Raimund.
Vom Segelmacher, dem Sailmaker, hätte ich eigentlich früher sprechen sollen, aber es ist von ihm nicht viel zu sagen. Er war von uns allen der Vornehmste, hieß Kurt von Strassen, genannt der S t r o m e r , war aber ein Windbeutel erster Güte, übrigens in seinem Beruf ein tadelloser Arbeiter. Seiner adligen Familie war er vermutlich abhanden gekommen.
So. Das war die Schiffsmannschaft, 19 Mann. Wenn ich mir jeden Einzelnen jetzt nach unseren gemeinsamen Erlebnissen im Geist vorstelle, möchte ich über jeden ein besonderes Buch schreiben. Jeder war eine Eigenart. Aber so ist jede menschliche Gesellschaft. Man muss nur Augen haben, sie richtig zu sehen, Augen, welche die Werte sehen und nicht die Oberflächen. Ein Schiffsvolk unterscheidet sich vielleicht nur dadurch von sonstigen Gesellschaften, dass es immer gemeinsame Erlebnisse hat und dass in den schweren Augenblicken, deren es bei uns viele gibt, jeder unausweichlich seinen Mann stellen und damit sein Bestes offenbaren muss, wozu andere oft nicht die Gelegenheit haben. Aber wunderbar ist doch die ganze Welt und überaus wertvoll alle ihre Bewohner, auch wenn sie nicht sonderlich erkannt werden. Es gibt Augen, die sie richtig einzuschätzen wissen.

Wir segelten mit Stückgut, hauptsächlich Waren der Eisenarbeit und Webkunst, auch viele Lackfarben und sonstigen Chemikalien, um Kap Hoorn herum nach Valparaiso.
Die Mannschaft hatte Zeit, sich einzuleben und einander anzupassen. Was erlebt man ncht alles in vier Monaten Segelfahrt! Da lernt man den Menschen kennen. Da war der Leichtmatrose Hein, der sanfte Heinrich, ein Breslauer, der durchaus kein Platt sprechen wollte, dafür aber in seinem Hochdeutsch immer ungemein höflich war, sodass er zunächst den allgemeinen Spott hervorrief und ›sanfter Heinrich‹ genannt wurde.
»Seien Sie so freundlich, Herr Matrose« — »Entschuldigen Sie, bitte« — »Wollen Sie nicht die Güte haben« — und dergleichen Redensarten flossen ihm stets von den Lippen. Als wir aber auf hohe See kamen und man sah, wie er seine Arbeit verstand und ganz als Vollmatrose zu gebrauchen war, da hieß er bald der wilde Hein. Und als man merkte, dass die schlanke Gestalt mit stählernen Muskeln ausgestattet war und er sich als verwegener Turner entpuppte, da wurde er der tolle Hein. Schließlich lernte man ihn von seinen eigentlichen Seiten kennen. Wenn alles riss und brach, da fing Hein erst an, aus sich herauszugehen. Dann bekam er einen anderen Gesichtsausdruck, und mit kühler Ruhe und klarer Besonnenheit führte er das Tollkühnste und Unmöglichste aus. Da nannten sie ihn den Satan. Hatte er aber sein Stück vollbracht, dann sah er wieder aus wie ein unschuldiges Mädchen, und ein Lächeln kam, als wollte er sagen: »Entschuldigen Sie freundlichst, aber ich konnte das nicht mit ansehen, ich musste in die Todesgefahr hineinspringen.«
Meinen Herrn Kameraden Mister Rugby bekam ich nie zu sehen. War er im Dienst, so war ich in der Ruhe, und außer seiner Wache betrat er nie das Deck. Er saß hinter seinen Büchern und schien zu arbeiten. Dagegen war er öfter bei dem Kapitän in dessen Kajüte. Was die beiden zusammen sprachen, wusste ich natürlich nicht, und ein Lauscher bin ich nie gewesen. Es ist mir zu unmännlich. Aber einmal merkte ich doch, dass es da drin etwas lauter zuging. Fast klang's wie ein Schluchzen. Als dann der Kapitän auf den Gang trat, sah ich's ihm an. Wahrhaftig, er hatte geweint. Ich war tief, tief erschüttert. Wenn ich mir diesen eisernen Mann vorstellte und ihn weinend dachte, nein, das konnte ich nicht. Und doch musste es wahr sein. Was lagen da für Geheimnisse vor in den beiden Kajüten dieser Männer, deren eine der Kapitän nie betrat?
Aber was ging's mich an! Denn wenn ich beide zu sehen bekam, so geschah es in rein dienstlichem Verhältnis.
In Valparaiso wurde die ganze Ladung gelöscht. Geschäftlich sprach sich Kapitän Düwel niemals aus, aber Agenten kommen und gehen im Hafen auf ein Schiff; da hieß es, wir würden mit einer Gelegenheitsfracht nach Iquique gehen, um dort Salpeter zu nehmen. Aber daraus wurde nichts. Wir nahmen Sandballast und segelten nach Guayaquil. Wir erfuhren, nachdem das Geschäft abgeschlossen war, Kapitän Düwel habe dort 500 Tonnen Kakao gekauft. Alles war telegrafisch abgemacht worden. Und wie hatte da das Kabel gespielt!
Unser Käpten schien sich auf Kakao zu verstehen. Schon Jürgens in Hamburg hatte von einem großen Kakaogeschäft erzählt. Diesmal waren's gleich 500 Tonnen, das ist eine Million Pfund Sterling, die bar bezahlt waren. Es klingt viel. Aber was ist das im Welthandel! Der Staat Ecuador führt jährlich 15 Millionen Kilogramm Kakaobohnen aus und bildet noch nicht einmal das Haupterzeugnisland, wenn auch der Kakao 90 % seines eigenen Handels ausmacht. Erfreulich ist aber, dass Deutschland in dem dortigen Handelsverkehr an zweiter Stelle steht. Deutschland ist eine Macht in der Welt und soll's immer mehr werden, und wir Seeleute helfen dazu.
Aber ehe wir nach Guayaquil kamen, etwa auf dem 10. Breitengrad, erlebten wir einen Sturm, der das Schiff erbeben machte. Es war nicht unser erster. Wir hatten schon zwei gehörige Glanzleistungen Neptuns erlebt. Allein die ›Angela‹ war ein gutes, festes Schiffchen, dem ein Sturm so leicht nichts tat. Wir ließen uns ein paar Tage gehörig abschütteln, wurden zwar ein wenig außer Kurs geworfen, aber dann war's vorbei, und man konnte sich wieder auf Deck halten.
In der Nacht brach sich der Sturm, am Morgen war hohe See. Da sahen wir unweit das Wrack eines Seglers. Es war noch bemannt. An einem Maststumpf konnten die Schiffbrüchigen noch Notzeichen geben.
»Schoner ›Cleveland‹, Liverpool. Höchste Not.«
Das sahen wir freilich. Die Menschlein, die den Wogen preisgegeben waren, pumpten auf Tod und Leben, um nicht zu versinken. Es war ein furchtbarer Anblick. Furchtbar, weil wir ihnen nicht helfen konnten. Wir steuerten unter Sturmsegel, aber ihnen konnte überhaupt niemand helfen. Das Boot muss erst noch erfunden werden, das bei solchem Seegang aussetzen kann, ohne sofort zertrümmert zu sein. Von einem Dampfer ist's eher möglich. Da hängen die Boote in Davits, das sind Krane, an denen sie ausgeschwungen und herabgelassen werden können. Das gibt's bei dem Segelschiff nicht. Unsere lagen mittschiffs in sogenannten Klampen. Da ist nichts zu wollen.
Aber Menschen versinken zu sehen, ohne helfen zu können, ist entsetzlich.
Auch wenn's Engländer sind. Unser Kapitän liebte sie nicht. Ich auch nicht. Wer zur See fährt, kennt sie zu gut. Zwar hatte der Käpten nie ein Wort darüber fallen lassen, aber man merkt's doch. Wenn er einen Engländer sah oder die englische Flagge, wandte er sich ab. Er mochte sie nicht. Aber hier war's anders. Die Todgeweihten da drüben waren nicht mehr Engländer, sondern Menschen. Kapitän Düwel starrte und starrte hinüber. Er schien etwas nervös zu werden. Dann wandte er sich an Mister Rugby, der neben ihm stand:
»Franz, schöll dat nich gahn, schöllt wie't wagen?«
»Du bist wohl toll, Gustav« —, stieß der entsetzt hervor.
Das war das erste Mal, dass ich hörte, wie sie sich duzten. Sie verkehrten sonst ganz dienstlich. Da kann man den Kapitän nicht ›du‹ nennen.
Nein, wir konnten den Schiffbrüchigen nicht helfen, es wäre heller Wahnsinn gewesen. Zwar der Sturm flaute ab, es wurde ein mäßiger Wind draus, aber diese See! Natürlich die bekannten ›haushohen‹ Wellen, die gab's nicht. Die gibt's überhaupt nicht. Aber wer die See gesehen hat, der kennt sie, wer sie nicht gesehen hat, dem kann man sie nicht beschreiben. Es war wie ein irrsinnig gewordenes Hügelland, in dem Wasserberge und Wasserschlünde wild durcheinander quirlten, wo die Wogen gar nicht Zeit hatten, sich zu überstürzen, weil sie von neuen Strudeln aufgenommen wurden. Und uns warf's drin herum, jedes Boot wäre zerschellt.
Aber was tun? Den Verzweifelten da drüben ein tröstendes Wort zusenden, eine Hoffnung zuwinken, wo keine ist? — Sie mussten selbst wissen, dass keine Hoffnung war. Also nur keine billigen Trostworte!
Ja, es ist hart! Der Seemann muss zuweilen ein gar hartes Herz besitzen, und in diesem spielen sich Vorgänge ab, von denen andere Menschen keine Ahnung haben.
Wir drehten bei. Als wir abgetrieben wurden, setzten wir noch den Klüver. So gingen wir über Stag und kreuzten langsam auf, so gut es mit Sturmsegel möglich war. Wir wollten uns nicht lösen, ehe nicht jede Hoffnung begraben werden musste.
Da, hurra! Am Horizont steigt ein Rauchwölkchen auf. Ein Dampfer. Der kann eher helfen. Wenn er nur herankam! Wenn die da drüben sich nur über Wasser halten konnten!
Wir taten alles, um uns bemerkbar zu machen. Bis zum Flaggenknopf ging's hinauf, um einen Lappen zu schwenken. Und siehe da, es gelang. Der Dampfer drehte bei. Es war ein mächtiger Kasten mit drei Schornsteinen. Auch ein Engländer. Ein Post- und Personendampfer.
Es ist nicht leicht für einen Kapitän, beizudrehen und Zeit zu versäumen mit Rettung Schiffbrüchiger. Schon die Kohlen kosten viel, dann die Verspätung! Wenn's heißt ›überfällig‹, werden Dividendenbrüder und Reederei nervös. Es muss ja alles, was vorgeht, ins Logbuch eingetragen werden, und der Kapitän hat vor seinen Auftraggebern und der Versicherung, schlimmstenfalls auch vor dem Seegericht, die volle Verantwortung für alles. Würde es diesem Engländer lohnen, wegen des jämmerlichen Schonerwracks und der armseligen zehn Menschlein drauf außer Kurs gebracht zu werden? —
Ich kenne die Engländer als Seeleute gut. Der Wahrheit die Ehre! Die englischen Matrosen sind tüchtige Burschen, die fürchten sich vor Tod und Teufel nicht, wenn's gilt. Aber dennoch ist ebenso wahr, dass ein englischer Handelskapitän lieber deutsche Matrosen anmustert als seine Landsleute. Die Deutschen sind noch besser.
Aber diese wagten es. Vorsichtig umfuhren sie das Wrack, denn es konnte Tauwerk nachschleppen, das die Schiffsschrauben sehr gefährdet. Wir sahen, wie die Offiziere auf der Brücke in ernster Beratung standen. Dann hieß es offenbar: »Freiwillige vor!« Und ein Kutter wurde klargemacht. Es sprangen gleich einige Dutzend Matrosen heran.
Von diesen wurden acht ausgewählt.
Der Kutter ging zu Wasser. Natürlich ohne Besatzung.
Aber krach — weg war er.
Der zweite Kutter klar!
Wieder kam ein Boot an die Wellen, wieder zertrümmerten sie es an der Bordwand.
Neue Beratung.
Eine Jolle klar!
Der Kapitän hielt eine Ansprache.
Ein Matrose trat vor und grüßte.
Der Offizier gab ihm die Hand, der Matrose wandte sich und schüttelte einigen Kameraden die Hände, drehte sich weiter um, nahm stramme Haltung und blickte zur englischen Flagge auf, schwang sich auf die Reling und ins Boot.
Es ging zu Wasser.
Krach — weg war es!
Mit ihm der Mann.
Er hatte das Unheil kommen sehen, hatte die Hakenstange weggeworfen, war zurück ins Tauwerk gesprungen, aber auch das Boot war auswärts geschleudert worden, hatte ihn noch erreicht, ihm die Beine abgeschlagen, ihn zerquetscht und zermalmt. Im wilden Gischt war er versunken. Armer Junge! Arme Mutter! Aber ein Held bist du, ein namenloser Held. Die Ewigkeit wird deinen Namen nicht vergessen. Als Held bist du eingetreten.
»Unmöglich.«
Der Dampfer hatte getan, was er konnte. Es war unmöglich.
Und die Menschen drüben auf dem Wrack! Wie mochten die dem Dampfer nachblicken! Und weiter winkten sie. Nur immer mit einer Hand, die andere musste die Kurbel drehen auf Tod und Leben. Ja, glaubten die etwa, wir sollten ausführen, was dem Dampfer unmöglich war? Wir sollten ein Boot aus den Klampen heraus und zu Wasser bringen? — Es waren doch Seeleute. Die mussten doch wissen, wie's auf einer Segelbark aussieht. Die hatten doch nur dem Tod ins Auge zu sehen.
Ach ja, sie wussten alles. Sie wussten, dass es unmöglich sei. Aber der Strohhalm, der Strohhalm und der Ertrinkende! Der Mensch und seine Hoffnung! Er hofft, solange er lebt, und am Grabe pflanzt er sie neu auf.
Der Dampfer war aus dem Gesichtskreis verschwunden und mit ihm das letzte Rauchwölkchen.
Ein Stöhnen neben mir ließ mich den Kopf wenden.
Es war der Kapitän.
Sein sonst ziegelrotes Gesicht war fahl geworden. Aber plötzlich schoss dunkle Röte hinein, die Brust hob sich tief, unter den buschigen Augenbrauen brach ein Flammenmeer hervor. Er drehte sich halb um:
»Kinners, ick gläuw, et geiht doch! Kinners, wollen wir' s probieren?«
»Ja, Käpten!«, erklang es einstimmig aus einem Dutzend Kehlen. Dann folgte noch ein »Jau, jau«. Das kam von Ubbo, dem Leichtmatrosen, der Ostfriese war — geradeswegs ut Jeiver, jau, jau.
Also war's beschlossen Der erste Offizier schien eine Einwendung machen zu wollen, unterließ es aber rechtzeitig. Er hätte mehr als ein Dutzend Stimmen gegen sich gehabt. Auch die meine.
Die eine Jolle wurde klargemacht, die Bordwand an einer Stelle niedergelegt.
Nein, ich hatte nichts dagegen einzuwenden gehabt. Aber nun, als ich die Vorbereitungen sah und selbst mit Hand anlegte — Gott, o Gott, wie soll das gehen? Jetzt nur nicht lange denken, jetzt musste man rasch mit dem Leben abrechnen.
Bei uns hieß es nicht: Freiwillige vor! — »Jochen! Rudolf! Fred! Sepp!«, bestimmte der Kapitän.
Vier Mann waren zum Rudern nötig. Der Kapitän hatte eine sehr gute Auswahl getroffen. Das sah ich sofort. Nun fehlte noch der Mann zum Steuern.
Die blauen, strahlenden Augen unter den buschigen Brauen wanderten im Halbkreis herum und leuchteten die Umstehenden ab. Sie wanderten über den ersten Steuermann und blieben auf mir haften.
Mir stockte der Atem. Ich fühlte, wie mir das Blut siedend heiß zum Kopf schoss. Vertrauen in Lebensgefahr wiegt schwer.
Aber, o Schreck! Da verließ auch mich das Leuchten und haftete auf dem finnischen Bootsmann.
»Bootsen, Ihr stüert!«
Eine tiefe Bitterkeit stieg in mir auf. Aber recht so, recht so! Dieser alte, vierschrötige Seebär war doch am Ende mehr wert als ich junger Kerl, wenn's galt, ein Boot abzubringen.
Der Bootsmann kugelte sich davon — Himmel!, war der Kerl unförmlich, besonders wenn er so rannte. Er musste unbedingt noch einmal in seine Kabine, die er mit dem Segelmacher teilte, ganz gewiss, um erst noch einen guten Labe- und Krafttrunk aus der Ölbuttel zu tun — vielleicht mit en bäten Rum mang.
Ehe er wieder kam, spielte sich noch ein kleiner Vorgang ab. »Ein Edelknecht, sanft und keck, tritt aus der Knappen zagendem Chor«, sagt Schiller. Gezagt wurde hier freilich nicht, aber eine schüchterne Stimme rief: »Ach, Herr Kapitän, seien Sie doch so gut und erlauben Sie mir...«
»Du bleibst!!«
Zerknirscht trat der Knabe zurück. Da kam der Bootsmann Petroleum wieder. Ganz richtig mit einer fettigen Schnut. Aus den Mundwinkeln troff noch das Öl.
»Denn man tau!«
Bei uns war alles fertig. Wir konnten das Boot nicht erst ohne Besatzung aufs Wasser auszuschwingen versuchen. Ein Mann mindestens musste schon drin sein, um mit Hakenstange und Wricken sein Möglichstes zu tun, das Boot vor dem Zermalmtwerden an den Schiffsplanken zu bewahren.
Die vier Matrosen hingen in den Wanten, der Bootsmann stieg ein — dem Tode geweiht.
Niemals konnte ich glauben, dass es gelingen würde. Niemand glaubte dran. Aber jeder verstand auch, weshalb es der Kapitän versuchen wollte. Ehe das Äußerste nicht getan ist, hat ein Gewissen keine Ruhe. Für... später ist's wichtig. Der Mensch braucht inneren Frieden.
Der Kapitän stand und beobachtete die anrollenden und anprallenden Wellen. Sein ausgestreckter Arm ging auf und nieder, auf und nieder wie die Wogen. Auch die wilden Wellen haben ihre Gesetze. Nach drei hohen kommt eine kleinere. Oder eine noch, noch viel mächtigere. Man muss die kleinste abpassen.
Wieder auf, wieder nieder!
Jetzt, jetzt...
»Lot gahn!!«, brüllte der Befehl.
Das Boot wurde abgeschoben, auf einen schäumenden Wogenkamm hinauf, hinein in das fürchterliche Chaos.
Ja, ja, die ›kleinere‹ Welle war richtig getroffen. Aber sie war immer noch groß genug, auch den mächtigsten Schiffskörper wie eine hohle Nuss an einer Felswand zu zerdrücken.
Nein, es gelang nicht. Gott sei dir gnädig, Bootsmann! Kapitän Düwel wird daheim für dein Weib und deine Kinder sorgen. Das weißt du, ohne Versprechen und ohne Abschied.
Krach!!! Ein paar Planken und Splitter, dann waren auch diese nicht mehr zu sehen.
Und der Bootsmann? Den hatte es auch zerkrachen wollen, aber in dem Augenblick, als alles in Trümmer ging, war er wie mit der Sprungkraft eines Panthers empor geschnellt und hing unversehrt in den Wanten.
»Krrrruzitürken noch mal!«, sagte der Alois.
»Vrrrdammich ewig!«, sagte Petroleum.
»Den anderen Kutter klar!«, sagte Kapitän Düwel.
Es geschah. Wer wollte dem Kapitän widersprechen!
»Bootsen, Ihr müsst's anders probieren.«
»O tjo, dat heff ick mi gliks dacht.«
O Jammer, o Graus! Er ging zum zweiten Mal ins Boot, in den Tod. War nicht das Schicksal versucht, wenn er zum zweiten Mal...
»Lot gahn!!«
Wieder dort unten in der weißbrodelnden Wasserhölle der fürchterliche Kampf! Das Abbringen war doch erst die Vorbereitung zum entsetzlichen Ringen um das Leben der Schiffbrüchigen.
Krach!!, zersplitterte der Kutter.
Aber wieder der Panthersprung, und der Bootsmann hing unversehrt in den Wanten. Mir war's unfasslich, wie dieser dicke Affe sich den fletschenden Zähnen des sicheren Todes entwand.
Dieses Mal fluchte er nicht.
»Al wedder gaut gahn«, sagte er, und es klang fast feierlich.
Die anderen sagten nichts. Keiner fand ein Wort.
Und doch. Da hörte man eine tieferregte Stimme, die sich gleich den Wogen unten überschlagen wollte:
»Gottvrrrdammich ewig und mache mich blind!«
Der Kapitän hatte es heiser hervorgestoßen. Der Mann, der sonst die Hände faltete, hatte diesen fürchterlichen Fluch herausgeschrien. Ich will nicht beschreiben, wie er dabei aussah. Eine losgelassene ungebändigte Kraft, ein Prometheus, der den Kampf mit Himmel und Hölle aufnimmt. Man sah nicht mehr die krummen Säbelbeine und die kleine Gestalt. Man sah einen Titanen, der dem Zeus zu drohen wagte.
»Vrrrdammich ewig und mache mich blind! Klar den Kutter!! Hans, treck mi mal de Stäweln ut!«
Damit klammerte er sich an der Bordwand fest und hielt dem Jungen das erste Säbelbein hin, bekleidet mit einem langen Seestiefel.
In dem Augenblick schoss Mister Rugby auf ihn zu.
»Um Gottes willen, Gustav, was willst du tun?«
»Ok noch den letzten Kutter riskieren.«
»Was, du willst selber ins Boot!!«
»Tjo.«
»Das wirst du nicht tun!«
»Gah un hang' di!«
»Das darfst du nicht. Denk' an deine Kinder, an Angela...!«
»Segg ehr enn schönen Gruß, un se schall sick neben di uphangen! ' Na, Slüngel, ward dat bald?«
Die Stiefel waren von den Beinen herunter, das Boot aus den Klampen heraus und der erste Offizier in der Kajüte verschwunden.
Der Kutter war das größte Boot, bestimmt, bei der letzten Rettung die ganze Mannschaft möglicherweise aufzunehmen. Wie wird's erst dem Kutter ergehen!!
Der Kapitän stand barfuß oben auf der Reling, zählte die Wogen und schlug den Takt dazu.
»Lot gahn!!«
Er sprang erst hinein, als es abgeschoben wurde, gleichzeitig ergriff er den Riemen und begann mit Todesmut zu wricken. Man versteht darunter eine schraubenartige Bewegung, die mit einem einzelnen Ruder, das hinten am Boot in einer Rolle liegt, hervorgerufen wird, um loszukommen.
Also bis zum Wricken war es geglückt, und er hielt das Boot, obgleich es eigentlich war, als wolle ein einzelner Mensch sich einer Schneelawine entgegenstellen, um sie aufzuhalten. Jeden Augenblick musste es zerschellen.
»Jumpt!!«
Er hatte wahrhaftig die Oberhand über die Wogen erhalten, und die vier Matrosen konnten hinabspringen. Das heißt auch etwas, hinabspringen! Sie mussten es tun, während die Bark gerade auf See überging. Dadurch entstand an Luv (d. i. an der Windseite) eine Wassertiefe, die freilich annähernd sechs Meter zeigte.
Der einzig mögliche Sprung war immerhin ein gefährliches Wagnis.
Die vier Matrosen gehorchten dem Befehl und »jumpten« hinunter ins Boot. Aber gleichzeitig erschien eine fünfte Gestalt auf der Bordwand, löste sich und sprang ebenfalls hinab. Einen Augenblick sah ich das Antlitz des Springenden, während er an mir vorüberkam. Diesmal war es nicht das schüchterne, verlegene Antlitz, das er für gewöhnlich zeigte, sondern ein eisern entschlossenes wie Sankt Michael, als er dem Drachen zu Leibe rückte.
Hein war gerade auf den Kapitän drauf gesprungen, wenigstens gegen seine Brust. Dort schmiegte er sich einige Sekunden an, bis er abgeschüttelt und achtern ins Boot geschleudert wurde.
»O, du Satan!«
Es war übrigens ganz gut, dass die Ruderknechte einen Ersatzmann hatten, denn die anderen waren nicht so glücklich gesprungen. Der Jochen war auf den Boden des Kutters gefallen, und der Sepp war ihm mit seinen Stiefeln gerade ins Gesicht gesprungen und hatte ihm die Vorderzähne eingetreten. Tat nichts. Zum Pullen braucht man keine Zähne, und Jochen Soßensnut konnte seinen Tabak künftig ja auf den Kusen kauen. Rudolf hatte sich den linken Oberschenkelknochen zerschlagen; aber er hatte noch das andere Bein, um sich im Rudern festzustemmen. Schlimmer war's, dass Fred den rechten Arm gebrochen und den linken ausgekugelt hatte. Da war der Ersatzmann sehr gut. Denn es handelte sich um Tod und Leben. Kamen sie nicht los, so waren alle fünf Menschenleben rettungslos verloren.
»Pullt, Jungens, pullt!!!«, brüllte der Kapitän Er war blaurot vor Anstrengung.
Sie pullten, was sie pullen konnten, sie holten durch, dass sich die Riemen bogen, aber frei kamen sie nicht. Sie konnten sich gerade halten, aber dort, dort kam die Todeswoge angerast. Mir stand das Herz still, und die Haare sträubten sich.
»Pullt, Jungens, pullt, hoooolt... durch!«, brüllte unten der Kapitän. Er begann mit diesem heulenden Befehl schon den Takt anzugeben. Dann fing er im Takt zu heulen an. Ein Lied im Todesschrecken.
Es ist bekannt, dass zur See alle schweren Arbeiten, die gemeinsame Kräfte und Gleichmaß erfordern, singend verrichtet werden. Der Leitende regiert den Sprechgesang, und die Ausführenden fallen im Kehrreim ein. Dieser besteht meist nur in einem »Sing vallera« oder einem langgezogenen »ooooh, hoooo«. Jedenfalls ist es am meisten dem Jodeln zu vergleichen, ein Tönen mit Fistelstimme. Nur geschieht das Jodeln aus Lust, dieses aus furchtbarer Anstrengung. Jeder Aufschrei der Umstehenden oder des Arbeitenden selbst ist gleichsam ein Peitschenhieb für die Nerven, die ihr Äußerstes hergeben müssen. So wie man im Zirkus bei außerordentlichen Leistungen, wie Todessprüngen und dergleichen, Schreie und Schüsse ertönen lässt, um die Nervenkraft immer wieder einzustellen.
Ein solches Matrosenlied nennt man Shanty (1) . Es klingt englisch, aber noch nie hat mir ein Engländer das Wort erklären können. Ich vermute, dass es gut deutsch ist und eigentlich Schandlied heißt. Man wird an sich bei dem Seevolk keine zarten Lieder erwarten, aber diese Schelmenlieder sind uralt und urkräftig und werden je nach den Leistungen, zu denen sie herhalten müssen, immer gesalzener oder unflätiger. Es ist, als genüge die Kraft der Oberschicht nicht und müsse die allerunterste menschliche Schicht herausgewühlt werden, die rohe Kraft des Tieres, um das höchste Ausmaß von Anstrengung zu leisten. Der Seemann ist sich dessen natürlich nicht bewusst, aber es ist ebenso wie das Fluchen und Verfallen in viehische Kraftausdrücke ein Zurücksinken in längst überwundene Entwicklungsstufen menschlicher Sitte, um dieses Unterbewusstsein mit einzuspannen zur Erzielung höchster Kraftleistungen. Und ich weiß auch das Geheimnis, weshalb gerade Matrosen und alle Leute ähnlichen Berufs eine so fürchterlich rohe Sprache führen: Es fehlt ihnen in ihrer Einsamkeit der veredelnde Einfluss des Weibes.
(1) Im Original heißt es ›Shandy‹; die übliche Bezeichnung ›Shanty‹ hat ihren Ursprung offenbar im französischen Wort ›chanter‹ (›singen‹) und nicht in ›Schande‹.
Dem Käpten waren alle Adern geschwollen im blauroten Gesicht, als er seine Befehle zum Pullen noch durch einen Shanty steigerte:
De Düwel is mien bester Fründ...
Heulend und gellend nahm der Chor das Lied auf.
Ooooh, hooo, hooo!
Unten im Boot und auch hier oben bei uns kreischte, brüllte, pfiff alles mit, um den Rudernden den Takt anzugeben. Der Inhalt des Liedes kam keinem zum Bewusstsein!
Da waren sie im Takt, mächtig holten sie durch. Die fünf Meter langen Riemen aus Eschenholz bogen sich wie die Reitgerten.
Aber frei kamen sie nicht!! Schon hatten sie die dritte Woge überwunden, aber da raste die vierte heran, und das war nicht eine kleinere, sondern wie es zuweilen geht, eine noch größere, die ihnen Vernichtung bringen musste.
Nein, ausgehalten! ausgehalten! Oder...
»Puuullt, Jungens, puuullt!!!«, tobte der Kapitän. Dann brüllte er den zweiten Vers.
Ick heff tu Hus en böises Wief...
Kreischend nahm der Chor unten und oben auf.
Oooh — hooo — hooo!!!
Se hädd den Düwel in dem Lief
Und tanzt mit emm Jim Crow. —
Oooh — hooo — hooo!!
Und tanzt mit emm Jim Crow!
Wer nicht genug heulen oder bellen und die Stimme überschnappen lassen konnte, steckte einen oder zwei Finger in den Mund und pfiff den Takt dazu. Das Brausen und Branden der Wogen musste übertönt werden. Neben mir war Mister Rugby wieder erschienen. Bleich stierte er hinunter. Da nahm er drei Finger in den Mund, und gellend wie eine Lokomotive pfiff er hinab...
Da schmetterte in wilder Wut die Welle heran. Ist's aus??...
Der Kutter und seine Insassen waren übertrieft von der salzigen Flut, aber sie waren noch da. Und jetzt — o Wunder! — jetzt kamen sie frei. Wahrhaftig, der Kutter tanzte auf den Wogen unter dem lästerlichen Gesang. Wir atmeten auf und starrten in den schäumenden Gischt der Wellen. Das wussten wir, alles Weitere war gegen diese Kraftleistung nur Spielerei. Zwar verschwand zuweilen der Kutter in Abgründen und wälzte sich wieder zwischen Wellenbergen, er bog sich und schütterte, aber es gab keine Widerstandflächen mehr, an denen er zerschellen konnte.
Die wackeren Retter erreichten unter dem Tosen und Wüten der Wasserfluten das Wrack. Ein Seil stellte schnell die Verbindung her, und jeder Einzelne wurde durchs Wasser herübergezogen. Es waren zehn Mann. Für jeden ein Todesweg bis ins Boot. Aber nein! Da ist ja ein Weib dabei mit langen, triefenden Haaren, ein Weib in Männerkleidern! Und da trägt sie ein Bündel, ein lebendes Bündel — ihr Kind. Sie hat sich's beim Durchholen über den Kopf geschnürt. Gott sei Lob und Dank! Auch diese zwei Menschenleben kamen ins Boot.
Und nun nahte der Kutter wieder. Wieder tanzte und hüpfte er über die aufbäumenden Wasserberge, er sprang und versank und kam immer wieder, bis es den Meisterschluss galt, das Einholen ins Schiff. Da fand der Shanty seinen Schluss, aber jetzt klang's schon wie Sieg, es heulte nicht, es jauchzte im Überwindertrotz:
Wat schiert mi Fru, wat schiert mi Kind —
Oooh — hooo — hooo —
Ick smät se in de Waterpint
Und tanz' dazu Jim Crow! —
Oooh — hooo — hooo —
Und tanz' dazu Jim Crow!
Ja, es gelang. Der edelste Rettungswille und das wilde Tier im Menschen, beide vereinten ihre Kräfte und zwangen den tobenden Naturgewalten elf Menschenleben ab, des eigenen nicht achtend. Was tat's, dass Bein oder Arm oder Zähne gebrochen waren! Der Mensch war dem Menschen Lebensretter geworden. Wunderbarer Mensch! —
Manchmal ist es mir an Land ganz eigen zumute, wenn ich da einen sehe, der eine Rettungsmedaille trägt. Bei Seeleuten gibt's dergleichen Schmuckstückchen nicht, aber Rettungstaten, von denen der Binnenländer sich nichts träumen lässt. Es wäre wohl zu wünschen, dass die ehrbaren und tugendhaften Menschen zuweilen wüssten, zu was für Großtaten der Menschenliebe diese rohen Burschen mit ihren unflätigen Liedern fähig sind.
Sie wurden alle an Bord geholt, auch das Weib und der Säugling. Wieder ging's durch Wasser, die meisten musste man festbinden dazu, weil sie keine Hände mehr hatten, sich zu halten. Nur blutige Fetzen. Wer vier Tage und drei Nächte auf Tod und Leben die schwere Pumpe geleiert hat, der hat keine Haut mehr an der Hand.
Nach den Fahrgästen wurden die Ruderknechte geborgen. Die größten Schwierigkeiten bot das bei Fred mit seinen hilflosen Armen. Mit Rudolf ging's schon besser; er hatte ja nur das Bein gebrochen. Jochen riss selbst den letzten Vorderzahn heraus, weil er locker war, und pfropfte die Soßensnut gleich wieder voll Tabak. Sepp schrie schon unterwegs nach einem Schnaps, und Hein gab natürlich verachtungsvoll die Leine preis und ließ sich von einer Woge an Bord schwemmen. »Entschuldigen Sie, sie rutschte mir aus der Hand«, sagte er schüchtern.
Zuletzt sprang der Käpten auf, dann zerschellte der Kutter. Drüben sahen wir, wie das Wrack wegsackte.
Von den letzten Vorgängen war ich nicht mehr Zeuge. Ich weilte bereits in der Kajüte des ersten Offiziers, die als Krankenraum dienen sollte, und schiente, salbte, flickte unter den Augen Angelas. Fast schämte ich mich. Heute hatte ich mein Gelöbnis nicht halten können. Ich war nicht unter den Auserwählten, die des Mannes Gefahr teilten. Er hatte sich selbst geholfen. Aber auch meine Gelegenheit würde kommen.
Wir hatten bisher noch keinerlei Unglücksfälle an Bord gehabt, die Heilkenntnisse und wundärztliche Fähigkeiten von Kapitän oder Offizieren benötigten. Einen Unterricht darin müssen wir alle mitmachen. Bisher hatte es höchstens ein paar Quetschwunden und Hautschürfungen gegeben. Nun aber ging's in großem Ernst. Da merkte ich, mit welcher Geschicklichkeit Mister Rugby Schienen und Verbände anlegte und dass er auch einen Schrank voll Heilmittel und Werkzeuge besaß, der weit über die Schiffsvorschriften hinausging.
»Sie sind wohl Arzt, Mister Rugby?«
»Ich verstehe etwas davon«, war die ausweichende Antwort.
O, das war ein vollendeter Heilkünstler und Wundarzt. Ihm konnte ich nur einige geringe Handlangerdienste leisten. Das Zusammennähen einiger Fleischwunden überließ aber auch er dem Segelmacher, der das mit wunderbarer Feinheit besorgte und Menschenleiber so geschickt zu flicken verstand wie Segel. Also eilte ich an Deck, um meine Wache zu gehen.
Als ich auf den Schiffsgang trat, sah ich gerade den Kapitän ankommen. Er schwankte und taumelte in seine Kajüte hinein. Das waren nicht die Schlingerbewegungen des Schiffs, mochte es auch noch so bocken und stoßen.
War ihm etwas zugestoßen? Sollte ich den Steward rufen? Kurz entschlossen eilte ich ihm nach und trat von ihm unbemerkt in die angelehnte Tür. Da sah ich, wie der starke Mann zusammensank in äußerster Erschöpfung, ich sah aber auch, wie er vor der schlichten lederbezogenen Ruhebank niederkniete und leise und stammelnd herausbrachte:
»Zweites Buch Mosis, vierunddreißig, zehn.«
Der Shanty war versunken, der Mensch kam wieder auf. Sprachlos starrte ich auf den Knienden.
Da brach's bei ihm mit Gewalt hervor, halb Schluchzen, halb Jauchzen, er hob den Kopf, breitete die Arme gegen die Decke, das verwetterte Mopsgesicht begann zu strahlen wie in einer Verklärung, und inbrünstig wiederholte er mit lauter Stimme:
»Zweites Buch Mosis, vierunddreißig, zehn.«
Lautlos und tiefbetreten schloss ich die Tür und verließ das Heiligtum, das meine bloße Anwesenheit entweiht hatte. Die Bibelstelle aber ist meinem Gedächtnis unauslöschlich eingeprägt worden. Ich habe sie später nachgeschlagen und auswendig gelernt. Doch das war mir neu, eine Zeitersparnis im Gebet, die gewiss im Himmel auch angenehm empfunden wird, wenn statt vieler Worte aus inbrünstiger Herzenstiefe nichts kommt als eine — Ziffer. Dieser Beter kannte seine Bibel.
Und was steht denn nun in jenem Bibelvers? Ich bin so bösartig, es nicht zu sagen. Mag jeder Leser nur selber in seiner oder einer anderen Bibel nachschlagen, vielleicht tut's ihm gut!
Wir erreichten Guayaquil. Die Schiffbrüchigen kamen von Bord. Worte wurden nicht viele gewechselt. Das ist bei Seeleuten nicht Sitte. Aber als der Kapitän sein junges Weib mit ihrem Kindchen von Bord führte, da glänzten die Augen der Gehenden und der Bleibenden. Das eigentlich Feierliche liegt weit jenseits aller Worte.
Einige der Geretteten mussten übrigens in ein Krankenhaus geliefert werden, um ihre Hände auszuheilen. Unsere Knochenbrüchigen behielten wir an Bord. Sie lagen in ihren Hängematten gut verpackt. Alles würde tadellos heilen. Vielleicht behielt Rudolf eine Schwäche im Bein. Schadet nichts. Es gibt genug lahme Matrosen, die nichts an Tüchtigkeit eingebüßt haben. In Wirklichkeit heilte auch bei Rudolf alles ohne Folgen.
Das Einnehmen der 500 Tonnen Kakao verzögerte sich sehr. Ich bekam vierzehn Tage Urlaub und benutzte ihn zu einem Ausflug in die Anden nach Guito. Mister Rugby begleitete mich. Er war der liebenswürdigste Gesellschafter, ein reizender Kamerad, aber irgendwie näher kamen wir einander nicht.
Nach unserer Rückkehr hatten wir noch drei Wochen Zeit, ehe neu geladen war. Dann ging's nach Frisco, wie man San Francisco abgekürzt nennt, wo der Kakao verkauft wurde. Dafür wurde der ganze Bauch des Schiffes mit Tabak vollgestopft. Reiseziel Sydney.
Am 29. Juni waren wir klar, in See zu gehen, um den Stillen Ozean zu überqueren. Es war früh 8 Uhr, als wir am Kai die Trossen loswarfen. Da plötzlich ein Geschrei: »Extrablatt! Extrablatt!«
Wir können's gerade noch erwischen, ehe der Schlepper anzieht.
Der österreichisch-ungarische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin, die Herzogin von Hohenberg, in Sarajevo bei einer Wagenfahrt durch Bubenhand mit Revolverschüssen ermordet.
Wir waren alle erschüttert. Den tiefsten Eindruck machte diese üble Kunde auf unseren ersten Steuermann, den Amerikaner.
»Ach du armer, armer Franz Joseph!!«, rief er in furchtbarer Erregung.
Ja, was bleibt wohl diesem alten ehrwürdigen und geliebten Kaiser erspart auf diesem Wandelstern! Wenige Menschenleben sind so schwer wie dieses Leben auf dem Thron! —
Wir segeln und segeln! Es ging sehr langsam vorwärts. Immer mussten wir kreuzen. Während dreier voller Wochen bekommen wir nichts zu sehen als fünf kleine Segler in weiter Entfernung. Es ist eine einsame Gegend dort. Einmal zog eine Rauchwolke am Gesichtskreis vorüber, die einen Dampfer verriet. Aber er kam nicht auf. Einmal kamen wir in die Nähe der Koralleninseln, aber wir hielten uns weitab von ihren Riffen.
Endlich, etwa am 139. Längengrad, erreichten wir den Äquator. Da trat Windstille ein. Das ist ja in jenen Gegenden nichts Verwunderliches. Auch wir waren nicht überrascht, hatten aber gehofft, diese Gegend noch rechtzeitig durchfahren zu können. Allein die Windstille dauerte an und hielt uns 31 Tage am Fleck. Eine Flaumfeder wäre bei dieser Stille senkrecht herabgeschwebt. Der Mensch hat leider noch nicht gelernt, den Winden zu gebieten und ihre Kraft zu regeln. Was früher der Sturm zu viel hatte, hätte diese hoffnungslose Windstille in guten Segelwind umgewandelt.
Endlich, endlich, am 26. August, in früher Morgenstunde, kam ein leiser Hauch aus Nordost. Dieser Wind würde anhalten, also wurde alle Leinwand gesetzt, und bald blähten sich die Segel, und lustig gewann das Schiffchen Fahrt. Zur Feier der Stunde ließ Kapitän Düwel, der viel auf die Flagge hielt, am Heck die schwarzweißroten Farben wehen.
In drei Stunden hatten wir schon viele Knoten gemacht. Da taucht im Norden ein Dampfer auf, kommt schneller näher. Ein Kriegsschiff. Englischer Kreuzer, englische Flagge.
Ein Meldezeichen wird gesetzt.
»Streicht die Segel!«
»Die Trichinen sollt ihr kriegen, Millioooonen Trichinen!!!«
Der Kapitän liebte die Engländer an sich nicht. Dass sie ihm aber nach 31 Tagen den ersten Wind verdarben, dafür waren Millioooonen Trichinen eigentlich viel zu wenig.
Freilich konnte er solche Wünsche nur aussprechen. Gehorchen musste er. Wird ein Flaggenbefehl eines Kriegsschiffs nicht beachtet, so macht ein blinder Schuss zuerst darauf aufmerksam, hilft das nicht, so wird ein scharfer Schuss vor den Bug noch eindringlicher. So handhabt es nach allgemeinen Seegesetzen jedes Kriegsschiff, mag's englisch, türkisch oder chinesisch sein, und der Kauffahrer, sei's auch der größte Personendampfer, hat zu gehorchen. Natürlich muss auch das Kriegsschiff ausreichende Gründe für sein Vorgehen haben, die später vor dem Seegericht bestehen können. Freilich ein englischer ›Man of war‹ (Kriegsschiff) fragt im Allgemeinen wenig danach. Da geht Gewalt vor Recht.
Wir drehten also bei und geiten die Segel auf.
Unterdessen war der Kreuzer bis auf eine halbe Seemeile herangekommen. Er hätte neben uns anlegen können, aber er setzte einen Kutter aus mit zwei Offizieren, einem Leutnant und einem Kapitänleutnant.
Was wollten die von uns? Warum kamen sie, uns zu besuchen?
Nun, es brauchte nur auf einem der zahllosen Inselchen, über denen die englische Flagge weht, eine Meuterei ausgebrochen zu sein. Die Eingeborenen zeigten Waffen und Gewehre, von denen man nicht wusste, wie sie auf die Insel gekommen waren, so genügte das schon, dass jedes Handelsschiff in der Nähe der Inseln von einem wachsamen Kriegsschiff angehalten und auf Bannware untersucht wurde.
Es wäre auch denkbar gewesen, dass ein müßiges Kriegsschiff einer deutschen Bark einen Possen spielen wollte, um Englands Seeherrschaft ins volle Licht zu setzen. Was hat sich denn überhaupt so ein ›bloody damned German beggar‹ auf See herumzutreiben!
Der Kutter legte bei. Wir hatten das Fallreep herabgelassen, die Bordwand niedergelegt.
Der Kapitänleutnant tauchte als erster auf, ihm nach der Leutnant, dann noch vier Matrosen, umgeschnallt mit Entersäbel und Revolver.
»Good Morning!«
»Good Morning!«
Für den Deutschen ist's ganz selbstverständlich, dass er Englisch redet, wenn er Englisch angesprochen wird. So weit sind wir noch nicht, dass wir auch vom Ausländer verlangen, dass er Deutsch redet, wenn er etwas von uns will. Man sollte trotz aller Sprachenkenntnis vom Engländer verlangen, dass er sich unserer Sprache oder eines Dolmetschers bedient. Vielleicht kommen wir noch einmal so weit.
»Was ist das für ein Schiff?«, fragte der Offizier auf Englisch.
»Die ›Angela‹ von Hamburg.«
»Kapitän?«
»Kapitän Düwel. Bin ich.«
»Woher kommen Sie?«
»Von Frisco.«
»Wohin?«
»Sydney.«
»Ladung?«
»Vierhundertachtundzwanzig Tonnen Tabak und achtundsiebzig Tonnen Lebertran.«
Der Bootsmann Petroleum leckte sich schnell mit der Zunge um Kinn und Mundwinkel.
Der Offizier räusperte sich. Dann straffte er sich auf. »Im Namen Seiner Majestät des Königs. Ich erkläre dieses Schiff mit Ladung für gute Prise.«
Lautlose Stille.
Kapitän Düwel öffnete den Mund, aber es gelang ihm kein Ton. Er drehte den Kopf hin und her, der Hals wurde immer länger, als wäre er von Gummi, die Augen quollen heraus, endlich kam ein erlösendes:
»Wuuooaaat?«
»Ich erkläre dieses Schiff mit Ladung für gute Prise.«
Der Käpten hatte noch nicht verstanden. Wir alle nicht. Den Kopf drehte er nicht mehr, nur die Augen rollten noch, bis sie auf dem Kapitänleutnant haften blieben, aber von der Seite her, sodass das Ohr auf ihn gerichtet war und der Mund sich schief nach oben öffnete.
»Hä?! Schiff und Ladung gute Prise? I, Verehrtester, Sie haben wohl heute zum Frühstück trichinosen Schweinebraten... gute Prise? Na, wieso denn??«
»England ist mit Deutschland in Krieg getreten.«
Schweigen. Ein Schweigen des Todes. Dann der Kapitän:
»Bitte, in was ist England getreten?«
»In Krieg mit Deutschland.«
»Mit Deutschland? Gegen wen?«
»Gegen Deutschland. Am fünften August hat England an Deutschland den Krieg erklärt.«
Todesschweigen. Ich hörte das Ticken meiner Taschenuhr. Blick und Blut erstarrten. Keiner von uns war eines Wortes, einer Bewegung fähig.
Qualvolle Sekunden dehnten sich zu Ewigkeiten.
Endlich fiel ein Laut. Der Matrose Reinhard fand Bewegung und Worte und begann mit großer Gelassenheit:
»England hat Deutschland den Krieg erklärt?«
Dann kreuzte er langsam die Arme mit den aufgestreiften Hemdärmeln über der breiten Brust, und gutmütig, fast mitleidig erklang es: »Na tövt man, ju englisch Rackers, uns oll good Tirpitz wird ju schon wat lihrn.«
Damit hatte sich auch der Kapitän gefasst. »England — an — Deutschland — den Krieg erklärt? — Ja, warum denn nur?«
»Weil England die Neutralität Belgiens beschützt.«
Wieder drehte Käpten Düwel den Kopf mit seinem unbeschreiblichen Gesicht hin und her. »Hä? Neutralität Belgiens?«
»Deutschland hat alle Völkerrechte gebrochen, indem es in Belgien eingefallen ist.«
»Wuoat? In — in — in was ist Deutschland gefallen?«
»Die deutschen Truppen marschierten sofort durch Luxemburg und Belgien, um von dort Frankreich anzugreifen.«
Immer wieder eine Pause. Vielleicht waren's nur wenige Sekunden, uns dünkten's Ewigkeiten. Jedes Mal vernahm ich das Ticken meiner Taschenuhr. Immer lauter und drohender wurde dieses Ticken, bis ich Hammerschläge zu hören glaubte.
»Um — um — Frankreich — anzugreifen —?«, ließ sich dann wieder unser Käpten vernehmen.
»Frankreich befindet sich mit Deutschland im Krieg, und wir sind mit Frankreich verbündet.«
»Frankreich mit Deutschland im Krieg? — Na seit wann denn nur? — Weshalb denn?«
»Diesen Krieg hat Deutschland vom Zaun gebrochen. Am zweiten August hat Deutschland den Krieg erklärt.«
»Den Krieg erklärt? — An Frankreich? —«
»An Russland.«
»Russ — land... Russland — ooook?«
»Russland musste natürlich Serbien beistehen.«
Beistehen? bistahn? Ser... Serbien?«
»Gegen ÖsterreichUngarn.«
»Öst — Öst — Ungarn?«
»Natürlich haben sich auch Bulgaren, Rumänen, Griechen und Türken gegen Osterreich verbunden. Auch die Italiener haben bereits losgeschlagen, dürften jetzt schon in Wien eingerückt sein. Über Albanien weht die Flagge Montenegros.«
Das war zu toll, um nicht den Matrosenwitz zu entfesseln. Die fettige Stimme Jochen Soßensnuts ließ sich plötzlich aus dem Hintergrund vernehmen: »Wat maken denn nu de Eskimos un de Honoluluindianer?«
Kapitän Düwel hielt seine große Tatze vor sich hin, spreizte alle Finger und fing an, diese mit dem Daumen von der anderen Hand zu zählen:
»Montenegro — Ungarn — England — Deutschland — Griechenland — Russland — Rumänien — Frankreich — Serbien — Italien — Osterreich — Belgien — Türkei — Montenegro — das wären erst vierzehn. Oder habe ich noch etwas vergessen?«
»Tjo, Käpten«, ließ es sich aus dem Matrosenchor vernehmen, »Ihr habt Montenegro nur doppelt gezählt — dat zählt dreifach.«
Kapitän Düwel wandte sich wieder dem englischen Offizier zu, und mit einem wahrhaft kindlichen Lächeln fragte er von unten herauf: »I, Herr, Sie wollen uns doch nur Witze vormachen!«
»Sie zweifeln? Ja, ich glaube schon, dass es ungeheuerlich klingt, wenn man ahnungslos diese Kunde vernimmt. Ich werde Ihnen dann die Zeitungen vorlegen. Wenn Sie an Bord unseres Schiffes sind. Übrigens ist es gar nicht so schlimm...«
»Nicht so schlimm?«
»Ich meine, es ist alles bereits entschieden.«
»Alles bereits entschieden? — —«
»Gewiss. Die deutschen Heere an der Westgrenze sind vollkommnen geschlagen. Straßburg, Metz, ganz ElsassLothringen sind in französischem Besitz. Weiter geht der Siegeszug der Trikolore in das Herz Deutschlands hinein, soweit dieses überhaupt noch an Widerstand denken kann. Ganz Deutschland ist im ersten Ansturm der Russen von einer halben Million Kosaken überschwemmt worden. Berlin ist bereits Sitz der russischen Regierung. Man hatte sehr leichtes Spiel. In Berlin war sofort nach der Kriegserklärung die Revolution ausgebrochen, einmütig hatte sich das Volk erhoben, das kaiserliche Schloss wurde gestürmt, der Kaiser gefangen, er hat auf den Thron verzichtet.«
Es war wie das Donnern des Jüngsten Gerichts, was da kalt und geschäftsmäßig heruntererzählt wurde. Jedes Wort dröhnte in meinem Herzen. Alles in mir wurde in Scherben geschlagen, was je groß, erhebend, beglückend gewesen war. Nun mochte alles versinken.
Kapitän Düwel hob langsam die geballten Riesenfäuste und blickte zum Himmel, dann ließ er sie stöhnend sinken.
»Finis Germaniae«, ächzte er. »Der Himmel stürzt ein — — alle Himmel stürzen ein — — Millioooonen Himmel — — der Kaiser — der Kaiser gefangen — — verzichtet hat er, sagtet Ihr?«
»Ja, auf den Thron, durch seine Unterschrift. Er hat es nicht lange überlebt.«
»Nicht — lange — überlebt?!«
»Er ist tot — er beging Selbstmord.«
Immer wieder Todesstille — —
Oder meint ihr, wir hätten's nicht geglaubt?
Wie konnten wir an der Wahrheit dieser entsetzlichen Enthüllungen zweifeln!
Man bedenke, die wurden uns amtlich gemacht von einem englischen Offizier, im Namen seines Königs. Da drüben war ein Kriegsschiff, über dem die englische Flagge wehte. Es war das Königreich Britannien selbst, hier in der Südsee. Wie konnten wir da zweifeln? Der Offizier kann doch nicht hierher kommen, um Märchen zu erzählen! Er hätte sich ja vor seinen und unseren Leuten unsagbar lächerlich gemacht.
Der Mann war auch fest überzeugt von der Wahrheit seiner Mitteilungen. Das sah man ihm an. Er wusste, dass er Tatsachen berichtete. Was für ungeheuerliche Lügen von England aus damals verbreitet wurden und heute noch werden aus begreiflichen Gründen, zumal auf jener Hälfte der Erdkugel, angesichts der indischen Kolonialgebiete, das ist bis heute noch gar nicht offenbar geworden. Man braucht's nicht einmal ›Lügen‹ zu nennen. Es waren hoffnungsvolle Dichtungen freier Gestaltungskraft, Zukunftswechsel, die gleich als bare Münze ausgegeben und von den Gläubigen als solche genommen wurden. Und musste es nicht so sein? Hätte jemals ein Volk unter gleichen Umständen einem solchen Ansturm aller Völker Widerstand leisten können? Ein solcher Überfall ist in der Weltgeschichte noch nie gehört worden. Es war ja, als wie die Titanen den Himmel stürmten. Würden wir Götter sein, die sich solcher Heimsuchungen erwehren konnten?
Nein, wir mussten es glauben.
In Deutschland kann man sich nicht vorstellen, wie es den Deutschen im Ausland zumute war, die nichts, aber auch nichts als Lügen hörten und schließlich glauben mussten. Man denke nur an die bekannten französischen Postkarten, wie Deutschland aufgeteilt wurde. Es war nur ein sehr kleiner Schritt folgerechten Denkens, und die Aufteilung war schon geschehen.
Nein, wir zweifelten nicht. Anfangs nicht — solange sich die Berichterstatter in keine Widersprüche verwickelten! Dieser Offizier, ein hochgebildeter Mann, war sichtlich bewegt und erschüttert, als er die furchtbare Wirkung seiner Worte sah. Wie vielen mochte er's schon erzählt haben! Wer nur einen Funken Mitgefühl besitzt, muss tiefbewegt sein, wenn er einem anderen mitteilen muss, dass sein Vaterland und alles, was ihm lieb und teuer war, verloren ist. Armes, armes Deutschland.
»Ja, er ist tot — er beging Selbstmord«, — das ist auch bei einem Feind erschütternd.
Ein tiefes Stöhnen folgte seinen Worten. Es kam aus der Brust von Mister Rugby, der kreidebleich am Mastbaum lehnte und keines Wortes mächtig war. »Tot — tot — der Kaiser tot«, — ächzte der Amerikaner, »und der Kronprinz...?«
»Auch er — tot — Selbstmord!«
»Allmächtiger!«
»Und der Prinz Heinrich?« Der jetzt fragte, war Luzifer, der Matrose Fred. Er hatte während seiner Dienstzeit in der Marine eine Fahrt unter Befehl des hohen Herrn mitgemacht und schwärmte für den Hohenzollernadmiral noch mehr, als sonst in der deutschen Marine für ihn geschwärmt wird.
»Prinz Heinrich, der Bruder des Deutschen Kaisers? Auch er beging Selbstmord.«
Wieder eine Pause tiefster Erschütterung. Auch die Haltung des Offiziers war würdig und voll Teilnahme. Schließlich fiel doch der erste schwache Hoffnungsschimmer in die ganze Finsternis von Tod und Verderben. Dem Matrosen Rudolf oder Beelzebub schien eine Ahnung aufzugehen, der er Luft schaffen musste, und mit kläglicher Stimme wandte er sich an seinen Nachbar Hein und rief:
»Hein, o Hein — in Dütschland hebbt se sick al uphangt!«
Aber dieses erste Lichtchen grimmigen Humors verfehlte noch ganz seine Wirkung auf uns. Dazu lagen die Schatten der Verzweiflung zu schwer über uns.
Aus unserer inneren Nacht heraus stöhnte Alois in wildem Jammer:
»O Kruzi, o Kruzi, o Kruzi — Kruzi — Türken!! Die Italiener schon in... Wien!!«
»Noch nicht ganz«, gab der englische Offizier der Wahrheit die Ehre. »Es ist sogar wahrscheinlich, dass die Russen es eher erreichen.«
»Und was macht Bayern, was machen die Bayern?«, trotzte Sepp, der bayerische Hiesl. Sepp war ein ganz gewaltiger Jünger der ›christlichen Seefahrt‹ vor dem Mast. Er hatte eigentlich in München die Bäckerei erlernt, war dann davongelaufen und anfangs auf FischEwern gefahren. Da lernt man was — wenn man's dort aushält.
Breit und trotzig stand er vor dem Kapitänleutnant, der kühl und höflich zu jeder Auskunft bereit schien.
»Bayern? — Bayern hat sich sofort, als in Berlin die Kriegserklärung gegeben war, vom Deutschen Bund losgesagt. Als der bayerische König zaudern wollte, wurde er davongejagt. Die Bayern schlossen sich, wie es auch nicht anders möglich war, ebenso wie Sachsen, den Franzosen an...«
Weiter kam der Berichterstatter nicht Mit geballten Fäusten ging der bayerische Hiesl auf ihn los:
»Das lügst du, du verdammter Hund, jedes Wort aus deiner Fresse ist saumäßig verlogen, Luder damisches...«
Das Wort erstickte im Munde des Verteidigers der Ehre seines Vaterlandes. Er war freilich der einzige unter uns, der den ganzen Schwindel witterte und für die triebmäßig empfundene Wahrheit eintrat. Aber es sollte ihm auch das Los eines Zeugen der Wahrheit werden. Für Tätlichkeiten wider den Offizier, der im Namen seines Königs sprach, musste er sterben.
Während Sepp mit einem wahren Berserkergesicht, wutschnaubend, fluchend, mit geballten Fäusten auf den Offizier eindrang, hatte dieser blitzschnell seinen Browning erhoben, um kaltblütig diesen bayerischen Hiesl niederzuschießen. Er konnte gar nicht anders. Traf ihn die Eisenfaust des Rasenden, so war der getroffene Körperteil gewiss zerschmettert. Bayerische Fäuste verstehen das.
Wir alle waren viel zu bestürzt, der Augenblick war auch viel zu kurz, die Kämpfenden zu trennen. Die Kugel konnte auch ihr Ziel nicht verfehlen. Aber da geschah etwas ganz Unvorhergesehenes.
Der einzige von uns, der nicht im Kreise um den Offizier stand, um diese Schauermären anzuhören, war der Steward gewesen, Herr Raimund. Er war ein Sonderling. Mit dem Kapitän schien er sehr eng verknüpft zu sein, für uns war er so unnahbar wie der Kapitän selbst. Er war zwar gegen jeden Matrosen höflich und vielleicht freundlich, aber er war und blieb der ›Herr‹ Raimund.
Dieser hatte sich während der ganzen Unterredung offenbar in der Kapitänskajüte zu schaffen gemacht, und in dem Augenblick, als der Offizier seine Hand gegen Sepp erhob, hörte man einen dumpfen, grollenden Wutlaut, und wie ein Blitz schießt des Kapitäns riesengroßer Hund auf den Offizier los, legt ihm die Pranken auf die Schultern und fletscht wutheulend die Zähne. Es war ein prachtvolles Tier, pechschwarz mit einem schneeweißen Fleck auf der Brust. Wahrscheinlich war ihm die Sache schon lange verdächtig vorgekommen. Als er aber sah, dass ein fremder Mann die Hand erhob gegen Leute ›seines‹ Schiffs, dass der Kapitän offenbar sehr aufgeregt über den fremden Mann war, da sauste blitzschnell der mächtige Hundekiefer gegen den Eindringling. Niemand konnte es hindern. Aber ebenso schnell war auch der Offizier. Kaltblütig riss er den Browning herum, und der Schuss ging dem wütenden Tier zwischen die Rippen. Ein kurzes Schnappen. Er war offenbar ins Herz getroffen. Kraftlos sank die zottige Leiche zwischen Sepp und den Offizier.
O weh! Wir wussten, wie unser Käpten seinen langjährigen treuen Freund und Lebensgenossen liebte. Fast sah es aus, als sei der Kapitän selbst getroffen worden. Sein Gesicht ward ganz gelb und fahl, ein Zittern ging durch den ganzen Körper. Dann fuhr er wild gegen den Mörder seines Lieblings und ballte die gewaltigen Fäuste. Aber ebenso schnell fasste er sich. Da hörte ich zum zweiten Mal das gänzlich Unerwartete aus seinem Munde. Seine wilde Leidenschaft ballte sich in eine Ziffer zusammen, die er dem Offizier zuschleuderte. Seine ganze Wut entlud sich in den Worten: »Erstes Buch Mosis, vier, fünfzehn.« Dann wiederholte er seine Bibelstelle schon bedeutend ruhiger, die Fäuste sanken herab und öffneten sich. Der wildeste Sturm hatte ausgetobt, der Mann hatte sich wieder.
Ich glaube nicht, dass unser Käpten die ganze Bibel in dieser Weise gegenwärtig hatte, aber nachträglich ist mir sein Gedankengang deutlich geworden. Dieser Hund hatte einmal als ganz junges Vieh bei einer Rauferei seinen eigenen Bruder totgebissen, und der Kapitän hatte ihm als Brudermörder den Namen Kain beigelegt. Das vierte Kapitel des ersten MosesBuchs handelt aber von Kain, und im fünfzehnten Vers heißt es: »Wer Kain totschlägt, das soll siebenfältig gerochen werden.« Aber mir scheint, dass der Kapitän seine Stelle gar nicht als Drohung wider den Offizier meinte. Der Mann war ja ganz unschuldig, und jeder Mensch, wenn er nur die Besinnung hätte, würde so gehandelt haben. Nein, seine Gedanken waren durch das entsetzliche Erlebnis überhaupt in die Kaingeschichte geraten. Gerade dort heißt es unmittelbar vorher: »Siehe, du treibst mich heute aus dem Lande, ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir's gehen, dass mich totschlage, wer mich findet.« — Hatten wir das nicht eben erlebt? Waren wir nicht ausgetrieben aus allem, was uns lieb und teuer und heilig war? Waren wir nicht schon unstet und flüchtig auf Erden? Und da kam dieser fremde Kerl noch und nahm Schiff und Ladung! Mochte er auch das Leben nehmen! Weit schlimmer als Sterben ist des Vaterlands Verderben. Wir haben's innerlich erlebt, was uns in der Heimat kein Mensch nachfühlen kann. Denn dort ging's von Sieg zu Sieg, bei uns stürzte der Himmel ein.
Jedenfalls hatte die ganze Kaingeschichte die Spannung gelöst. Der Offizier, der so wütend angeschrien wurde, als er den toten Hund an sich herabsinken sah, starrte den Kapitän verständnislos an. Er begriff auch sofort, dass er von ihm keinen Angriff zu befürchten habe. Dann fragte er in maßlosem Erstaunen:
»What do you say? War das Ihr Hnnd? Ich bedaure, ich handelte in der Notwehr.«
Ein Anderer wäre anders aufgetreten und nicht ohne Recht. Aber der Kapitän hatte sich völlig wieder in der Gewalt:
»I beg your pardon, Sir. Nein, Sie haben ja nicht wissen können, dass der Hund Ihnen weiter nichts tun würde. An mir liegt die Schuld, dass er sich einmischen konnte. Ich bitte um Entschuldigung.«
Die Sache war damit erledigt. Die Hundeleiche wurde beiseite geschafft. Also jetzt war die Sachlage geklärt. Der kleine Zwischenfall hatte die denkbar größte Bedeutung für uns alle.
Erstlich hatte der Hund durch seinen Tod ein Menschenleben gerettet, das des Matrosen oder das des Engländers oder beide. Dann aber war das Entsetzliche zum Stillstand gekommen, und wir konnten wieder zur Besinnung und Überlegung gelangen. Sepp war natürlich sofort festgenommen worden. Auch er war zu sich gekommen. Man legte ihm nicht einmal Fesseln an. Ohne Zweifel, die Engländer wollten sich als Gentlemen zeigen und verstanden auch diesen Wutanfall.
Ich fuhr wie betäubt aus einem wilden Traum. Auch den Anderen ging es so. Es war freilich ein entsetzliches Erwachen. Aber es kam doch die klare Besinnung. Die Wirklichkeit war ja noch schrecklicher, als der Traum hätte sein können, aber sie schaffte wenigstens ruhige Überlegung.
Aber Krieg, Krieg — ein Weltkrieg war aufgeflammt!
Seit vier Wochen war der Krieg schon im vollen Gang, ohne dass wir eine Ahnung hatten!
Natürlich waren wir alle gediente Leute, die ohne Weiteres zu ihren Fahnen eilen mussten. Und wir saßen vier Wochen hier in der Südsee und scheuerten und malten an einem Holzkistchen, während das Vaterland in höchster Not ist!
Frankreich, England und Russland gegen Deutschland! Das war auch ohne Montenegro und die Republik San Marino gerade schrecklich genug.
Die Franzosen den Rhein überschritten; Kosakenhorden überfluten Deutschland; in Berlin Revolution und der Kaiser — der Kronprinz — es ist nicht auszusprechen! Immer wieder wurde es Nacht um uns und in uns. Ja, der Himmel war über uns eingestürzt. Aber wir — wir alten Soldaten — warum haben wir nicht gekämpft, geblutet, gerast wider diese Meuchelmörder? Wir stehen da, und die Schande tropft von uns herunter. Können wir solch unsagbare Schande überleben, wir, wir deutschen Soldaten?! —
Da löste sich drüben am Kreuzer eine Dampfbarkasse. Der Kapitänleutnant zog seine Uhr.
»Die ganze Besatzung kommt gefangen an Bord des ›Eagle‹. Ich gebe fünfzehn Minuten Zeit. Jeder kann mitnehmen, was er will. Außer Waffen und Sprengstoffen. Fünfzehn Minuten! Keine Minute mehr. Wer dann nicht fertig ist, geht so mit. Das muss auch für Sie gelten, Herr Kapitän. Wegen der Schiffspapiere sprechen wir dann. Erst machen Sie sich fertig, das Schiff zu verlassen! Vorwärts! Jetzt sind's nur noch vierzehn Minuten!«
Da war also nichts zu machen. Der Kapitän gab gleich selbst das Zeichen zum Aufbruch.
»Sellimankassavakauo, hilf mir beim Einpacken!«
Mit diesen Worten wandte sich Kapitän Düwel an den schwarzen Koch, ging in seine Kajüte, und Ahasver oder Mister Bumbo folgte ihm.
Merkwürdig, merkwürdig.
Elf Monate war ich doch schon an Bord gewesen. Da lernt man doch alles kennen. Käpten Düwel sprach wohl auch einmal den schwarzen Koch an oder redete von ihm. Da hieß er immer nur Ahasver. Nun hatte er auf einmal einen kilometerlangen Namen bekommen, der mir so geklungen hatte, wie ich ihn wiedergab: Sellimankassavakauo.
Aber mehr als das. Seit wann war es des Kochs Geschäft, bei dem Käpten persönliche Dienste zu leisten und ihm beim Einpacken zu helfen! Dieser schwarze Teufel hatte meines Wissens die Kapitänskajüte noch nie betreten. Er war stets nur in seiner Kombüse vom Kapitän angeredet worden. Da gehörte er auch hin, denn er war der Schiffskoch. Und nun musste ausgerechnet dieser für den Kapitän einpacken. Warum nicht der Steward, der ›Herr‹ Raimund? —
Merkwürdig, ganz merkwürdig.
Aber zum Besinnen war keine Zeit. Seeleute sind schnell entschlossen. Die Mannschaft stob auseinander. Jeder dachte an sein Zeug und eilte, seine paar Lumpen zu retten.
Nur ich konnte mich nicht entschließen. Ich war zu sehr überwältigt von allem, und nun drückte mir eine Frage aufs Herz. Wie ein Bleigewicht legte sich's auf mich. Was ging mich mein Zeug an, wenn das unklar blieb!
Ich trat also an den Engländer heran, grüßte höflich und begann:
»Gestatten Sie noch eine Frage...«
»Bitte?«
»Was macht denn die deutsche Kriegsflotte?«
Wir waren doch alle von der Marine, Reservemänner, wir Seeleute alle. Ich war Leutnant der Marine, und wer je gedient hat, der weiß, dass der Mann und besonders der Offizier seine Truppe nie vergessen kann, dass er mit der letzten Faser seines Herzens mit seinem Truppenteil verwachsen ist. Wir kannten doch die deutsche Flotte und ihren Geist, ihre Zucht, ihre Hoffnung, ihre...
Ein Lächeln flog über die kalten Züge des Engländers. Das erste, seit er unser Unglück hier ausgebreitet hatte. Dann sagte er laut und langsam:
»Deutsche Kriegsflotte?! Die gibt's nicht mehr.«
Alle hatten's noch gehört. Der Kapitän war mit einem Ruck stehengeblieben, hatte sich aber nicht gewandt. Nur den Kopf hielt er gesenkt, den ganzen Körper geduckt, als habe er nun erst den Hauptstreich erhalten, den letzten, niederschmetternden. Kein Mensch ahnt ja in der ganzen Welt, was uns Deutschen, uns Seeleuten die deutsche Flotte ist. Unser Stolz, unser Kleinod, unser Wahrzeichen, um das wir uns mit Gut und Blut, mit Leib und Leben scharen, das ist unsere Flotte. Die Welt muss erfahren, was deutsche Flotte heißt. Und dieses Kleinod, diese Summe von Zucht und Ehre und Ordnung, diese Zukunftsmacht, die unseren Mut stählte...
»Gibt's — nicht — mehr —?!«, hauchte ich.
»Die deutsche Kriegsflotte liegt längst auf dem Meeresgrunde. Am 10. August, fünf Tage nach der Kriegserklärung Englands, fand bei Helgoland eine Seeschlacht statt, an der das gesamte deutsche Nordseegeschwader, auch Teile der Ostseemacht teilnahmen. In drei Stunden endete die Schlacht mit einer gänzlichen Niederlage der Deutschen. War kleine Mühe. Was nicht auf Meeresboden liegt, wurde genommen oder ergab sich. Vielleicht irren noch einige Schiffchen auf dem Meere herum. Sie kommen nicht in Betracht.
Wilhelmshaven ist bereits in englischen Händen, Kiel in russischen, über Hamburg weht die dänische Flagge.«
So hatte er gesprochen. Er glaubte es auch selbst. Denn er hatte es ganz genau gelesen in der ›Calcutta Gazette‹. Wir sollten's nachher selbst lesen. Ich glaubte es schon jetzt. Was blieb mir übrig? —
Aber da stürzte der Himmel wahrhaftig für mich ein. Die Sonne erlosch, das Himmelsblau wurde Schwarz, kein Stern schien mehr, Donnerschläge und Hagel prasselten auf mich herab. Vor den Augen wurde es Nacht, die Ohren dröhnten. Lähmende Betäubung legte sich auf mich.
Ich weiß nicht, wie ich in meine Kabine gekommen bin. Ich fand mich, als ich Zeug in meine Kiste warf, weiß nicht was, gleichgültig was. Wenn die Welt untergegangen ist, braucht man auch keine Kleiderkiste mehr.
Dann sah ich mich wieder an Deck stehen. Da stand wirklich meine Kiste, daneben lag der Zeugsack — oder waren sie's nicht? Ich weiß es nicht. Neben mir sammelten sich die Anderen, manche kamen nach, eine geschlagene Schar, gehüllt in Schande, englische Gefangene, verdorben, gestorben...
Aber in diesem halbwachen Zustand, in dem ich natürlich alles sah, was um mich her vorging, ohne mir darüber Rechenschaft geben zu können, jedem Eindruck wehrlos preisgegeben, überkam mich plötzlich etwas Merkwürdiges, Unbeschreibliches. Es geht uns vielleicht im Schlaf so, wenn wir tief, tief hinuntergefallen sind im Traum, zerschmettert unten liegen und merken, dass wir noch gar nicht tot sind, sondern wohlig im Bett ruhen.
Kommt da wiegenden Ganges unser Segelmacher Kurt von Strassen — ich weiß nicht, ob er wirklich im Gothaer Kalender steht. Gebildet war er nicht, aber höchst pfiffig, gerissen, gerieben, ein Windbeutel erster Güte, in allen Wassern gewaschen, unser ›Stromer‹ — übrigens ein tüchtiger Kerl — also er kommt und schleift hinter sich seine Kleiderkiste in einem wunderbar genähten, hochfein gestickten Überzug aus Segeltuch. Fast sah's aus, als hätte er die Kiste in eine Altardecke gewickelt. Unter dem anderen Arm trägt er eine riesige Muschel. Ich kannte das Ding. An der mexikanischen Küste hatte der Segelmacher einmal Schiffbruch gelitten, unter großen Entbehrungen hatten die Angeschwemmten an der Küste lange aushalten müssen. Da hatte er die Riesenmuschel — eine Gienmuschel, Tridacna gigas — gefunden und ihren köstlichen Inhalt, der wie Hummer schmeckt, geschlürft. Die Muschel war etwa anderthalb Fuß lang, noch nicht einmal eine der größten, aber sie ist im Leben stark genug, eine menschliche Hand glatt abzuquetschen. Weil sie ihn nun vom Hungertode errettet hatte, nahm er die schöne Perlmutterschale, bearbeitete sie mit einem spitzen Stein und ritzte riesengroße Schriftzeichen ein, die von der dunklen Unterschicht aus in der weißen Perlmutter blaue Buchstaben zeigten. Da las ich des Segelmachers Verschen, wie ich's oft gelesen hatte, ohne etwas dabei zu denken. Aber Worte sind zuweilen wie Offenbarungsgewalten, die einen packen und schütteln können und stärker sind als die ganze sichtbare Umwelt. Worte können auch Gottes Geister sein, starke Engel, die sich in die unbedeutendsten Laute zu verkleiden vermögen. Deutschland in Feindeshand, die deutschen Heere geschlagen, die deutsche Flotte vernichtet, Deutschland aus der Weltgeschichte gestrichen, es gibt kein Deutschland mehr... das hatte mich betäubt. Und siehe, da hafteten meine Augen auf der Muschel und lasen und lasen und nahmen's auf als Offenbarung, als Gesicht, als Erlösung, was dort als schlichtes Erlebnis eines ungebildeten Schiffbrüchigen stand. Das lautete:
Solang der Himmel blau ist,
Geht der Deutsche nicht zugrund'!!
Amen!, rief's in mir. Das ist wahr, das ist gewiss wahr. Und wie von neuem Geist gefasst und gefüllt jauchzt es in mir auf, und in der übermächtigen Offenbarung fange ich an laut zu singen:
Solang der Himmel blau ist,
Geht der Deutsche nicht zugrund'!!
Die Leute blickten mich nicht schlecht an, als ich plötzlich jauchzte und jubelte. Die Engländer warfen mir misstrauische und besorgte Blicke zu wie einem, der von plötzlichem Wahnsinn gepackt ist. Die Unseren waren zu zerschlagen, um die Worte wirklich zu vernehmen.
Es war aber keine Zeit zu irgendwelchen Auseinandersetzungen. Der Käpten kam wieder. Hinter ihm trugen der Steward und Ahasver eine schwere Truhe.
Ja, das war doch merkwürdig. Da kam der schwarze Zappelmann wieder mit des Kapitäns Sachen. Sonst kümmerte er sich nicht um ihn. Wenn er wirklich noch eine Hilfe brauchte, warum nahm er nicht einen Matrosen? Es war mir ganz auffallend, sodass ich mit Singen aufhörte.
Da nahte auch noch ein Matrose, da noch der Schiffsjunge Hans, ›der Näswater‹, und schließlich eilte Meister Bumbo nochmals weg, kam dann mit seinem Gelump an, das ganz wie er selbst ausschaute. Es war keine Kiste, kein Koffer, kein Sack, sondern ein dickes rundes Ding, in Segeltuch genäht, sah aus wie eine riesige Hutschachtel oder Trommel oder Pauke. Viel konnte nicht drin sein. Es schien sehr leicht an Gewicht.
»Fertig?«
Wir waren klar, die ›Angela‹ zu verlassen.
»Herr Kapitän, übernehmen Sie die Verantwortung, dass sich Ihre Leute ruhig fügen, in die Barkasse und wieder an Bord gehen werden?«
»Jawohl, ich trete dafür ein«, sagte Kapitän Düwel, ohne sich zu besinnen, ohne auch nur einen Blick über seine versammelte Mannschaft zu werfen. Dieser Mann hatte seine Leute fest in der Hand. Sie hatten gehört, dass er für sie eintrat. Das genügte, dass auch sie ihre Schuldigkeit für ihn taten. Sein Wort war Befehl, sein Vertrauen eiserne Fessel.
»Niemand darf eine Waffe bei sich haben! Das Gepäck wird daraufhin drüben untersucht. Nach Waffen müsste ich eigentlich jetzt schon eine Leibesuntersuchung eintreten lassen. Herr Kapitän, ersparen Sie mir und Ihren Leuten eine peinliche Untersuchung!«
»Messer abgeben! Alle sonstigen Waffen und alles Waffenähnliche! Wohin?«
»Dort an Deck legen.«
Ein Scheidemesser hatte ja jeder am Leibriemen. Es wurde abgestreift oder blankgezogen und an eine bestimmte Stelle an Deck hingelegt. Das ging nicht ganz einfach und gleichmäßig. Einer tat's finster oder mürrisch, der Andere verächtlich, ein Dritter stieß es mit dem Fuß hin, einer warf's, dass es noch einmal klirrend empor sprang.
Es ist nicht leicht für den Mann, seine letzte Waffe herzugeben.
Es folgten noch einige Taschenmesser — bei Beelzebub kam sogar eine Pistole zum Vorschein, was streng verboten war —, Mister Rugby legte einen Browning und einen Dolch hin, ich einen Revolver und Nickfänger. Der Käpten schien nichts zu haben oder glaubte sich ausgeschlossen.
»Hat keiner mehr eine Waffe bei sich?«
Ein Matrose, der Alois, hatte lange in seiner Hosentasche herumgesucht und gewühlt. Schließlich brachte er wie zögernd ein Stückchen Bindfaden zum Vorschein, trug es feierlich und ängstlich zugleich, die Hand weit abgestreckt, seitwärts auf den Fußspitzen schleichend, zu den abgelegten Waffen, legte es sorgfältig nieder und tat darauf einen schnellen Satz zurück. Gerade dieses tiefernste, schweigsame Gebärdenspiel war unbeschreiblich wirkungsvoll. Der Kapitänleutnant verkniff sich ein Lachen, der jüngere Offizier lächelte deutlich, die englischen Matrosen lachten laut.
»Nichts mehr?«
»Ick gläuw, de Näswater hädd 'ne Klapperslang bi sick.«
Nein, niemand wollte mehr eine Waffe bei sich haben.
»Sepp!«, rief da Mister Rugby, »du hast doch immer einen Schlagring in der Tasche, ich weiß es!«
Des Bayern Kopf färbte sich dunkelrot, aber er griff in die Hosentasche und zog den stählernen Totschläger. durch den man die Finger stecken kann, heraus, schleuderte ihn an Deck, dass er klirrend hoch in die Höhe sprang und wieder aufschnellend über Bord ging.
»Sepp!, ist das alles — auf Ehre?«
Wieder bückte sich Sepp, streifte die Hosen auf und zog aus dem Stiefelschaft ein grifffestes Messer — Vereinszeichen nennen's die bayerischen Soldaten. Finster warf er's in großem Bogen unmittelbar ins Meer.
Allein nun war's auch fertig.
Oder nein? — Diesmal hatte der Käpten noch einen Verdacht, den er aussprach.
»Ahasver, dir hängt doch immer unter der Schürze dein Küchenmesser! Das ist auch eine Waffe.«
Aber da folgte ein unbeschreiblicher Vorgang. Der schwarze Koch, ein dürres, glänzendes Gerippe ans Haut und Knochen, trug immer weiße, sehr weite Hosen und eine weiße Ärmelschürze, die auch auf dem Rücken geschlossen war. Eine weiße Mütze auf seinem Wollschädel verschmähte er, ebenso jede Fußbekleidung.
Als ihn der Kapitän anrief, war er erschrocken zusammengefahren, einen Augenblick erstarrt, dann begannen alle Glieder zu zappeln, Arme, Hände, Finger, auch abwechselnd die Beine, Füße fuhren in der Luft herum, die Augen verdrehten sich, dass das Weiße aus dem schwarzen Gesicht herausleuchtete, und die grässlichsten Fratzen jagten sich zwischen seinen Wackelohren.
»Nix Messer, Massa, nix, nein gar nix, Bumbo auf Ehre, Bumbo auf Ehre...
Dabei hatte er schon hinter sich gegriffen und die Knöpfe seiner Schürze gelöst. Schnell streifte er sie ab, schlüpfte aus den Ärmeln, und siehe da, er trug überhaupt nichts auf seinem Oberkörper.
»Nix, Massa, rein gar nix, Bumbo auf Ehre, Bumbo auf Ehre...«
Aber während er noch diese Versicherungen in die Welt setzte, hatte er auch schon die weiten Hosen fallen lassen, trat aus ihnen heraus und stand nun daneben als dürres, klapperndes, zappelndes Gespenst, ein schwarz lackiertes Gerippe.
»Nix, Massa, rein gar nix, nix Messer, Bumbo auf Ehre, Bumbo auf Ehre...«
Und zum Beweis, dass er auch wirklich nichts habe, drehte er sich herum und zeigte seine schwarze Kehrseite, machte noch eine tiefe Verbeugung.
»Gar nix, Massa, Bumbo auf Ehre, Bumbo auf Ehre...«
Es gelang schließlich, ihn zu beruhigen. Er durfte sich anhosen und beschürzen, aber uns armen Teufeln war wenigstens zum ersten Mal wieder das herzliche Lachen gekommen. Der brave Bumbo hatte es hervorgezaubert.
Wir waren also bereit. Der traurige Zug ging in die Dampfbarkasse. Der englische Leutnant führte uns ab, der Kapitänleutnant blieb mit vier Matrosen an Bord der »Angela‹. Ebenso unser Kapitän Düwel.
Drüben fanden wir freilich einen sehr üblen Empfang. Einige bewaffnete Matrosen bildeten Spalier, es gab aber noch Hunderte andere, die als müßige Zuschauer herumlungerten und ihre gemeinen, gehässigen Bemerkungen machten.
»Bloody damned Germans« oder »You bloody beggars« schwirrte es um uns her. Wollen wir die armen Kerle, die rohen Matrosen, nicht beschuldigen! Die Schuld liegt ganz woanders. Das ist ja wahr. Die Engländer haben uns nie geliebt. Der Engländer liebt überhaupt niemanden. Er ist schlechthin unfähig, sich für irgendein Volk der Erde zu begeistern außer für sich selbst. Aber von einem Deutschenhass war doch in England nie die Rede vor dem Krieg. Das beweisen die vielen tausend Deutschen, die stets in England ungehindert ihrem Beruf nachgegangen sind, die vielen — ach so guten Englandreisenden, die jedes Jahr von den lieben Vettern da drüben lichterlohe Begeisterung herüberbrachten. Hat ein deutscher Mensch, hat nur ein deutscher Geschichtsprofessor jemals eine Ahnung gehabt, dass da drüben Deutschenhass sein könnte? — Im Volk war er auch nie. Der ist von oben her künstlich aufgepfropft worden von den neidischen Großkaufleuten, den heuchlerischen Ministern, den verlogenen Presseleuten wie — halt, ich will mein Papier nicht mit ihren Namen besudeln. Nein, das Volk hat uns nie gehasst. Aber ein Volk kann von Hass vergiftet werden. Wehe, wer ein Volk vergiftet! Der Hass kann ein Volk ins Verderben bringen. Dass diese armen Teufel hier, diese unwissenden Söldner, die jedenfalls zur Hefe des englischen Volks gehörten, ihrer Rohheit freien Lauf ließen, das hätte der Schiffsführer verhindern müssen. Er trug die Verantwortung für seine Leute. Uns war's gleichgültig. Das Unglück des Vaterlandes war auf unsere Seele gefallen, nun waren wir wehrlos und stumpf.
Es ging uns übrigens nachher gut. Eigentlich glänzend. Wir mussten sofort, allerdings ohne unsere Sachen mitnehmen zu dürfen, ins ›Purgatory‹ oder ›Fegefener‹. So heißt auf englischen Schiffen der Raum, in dem sich die Heizer und Kohlentrimmer waschen, wenn sie aus ihrer unterirdischen Hölle kommen.
Der große Raum lag über Deck auf Backbordseite hinter der Kommandobrücke. Er war groß genug, dass wir uns drin ergehen konnten, sauber, geruchlos. Er enthielt nichts als einige Ringe, die in die Eisenwände eingelassen waren.
Dort wurde uns gesagt, dass wir nur einstweilen eingeschlossen würden, spätestens heute Abend gebe es bessere Unterkunft. Wir sollten aber gleich zweites Frühstück bekommen, und damit wir zum Essen sitzen könnten, wurden uns Bretter und Stricke gebracht, dass wir uns mit Hilfe der Ringe Tische und Bänke aufschlagen konnten.
»Hängt euch aber nicht auf!«, hatte der Bootsmann gutmütig gebrummt, als er uns die Stricke einhändigte.
Dann wurde draußen der schwere Riegel vorgeschoben. Durch ein kleines Bullauge an der vorderen Wand war das mittlere Deck und die Kommandobrücke zu sehen, durch die Seitenfenster unsere Bark. Als wir das festgestellt hatten, machten wir uns an die Arbeit, und bankten (1) und backten. Back heißt an Bord der Tisch, aber auch die Schüssel, ferner das erhöhte Vorderteil des Schiffs. Backen und banken heißt in der Schiffssprache eigentlich das Einnehmen der Mahlzeit, das ›Schaffen‹, wie man es auf deutschen Handelsschiffen nennt.
(1) Im Original heißt es »baukten« statt »bankten« und (weiter unten) »bauken« statt »banken«; hier scheint ein Übertragungsfehler aus dem Manuskript beim Schriftsatz vorzuliegen.
Die Köpfe ließen wir freilich sehr hängen. In finsterem verdrossenen Schweigen wurde alles getan. Niemand sprach ein Wort. Jeder hatte genug mit sich selbst zu tun. Dazu bedurfte es Zeit. Nur einmal kam mir der Gedanke, dass wir doch nicht alle Deutsche wären.
»Sind Sie nicht Amerikaner, Mister Rugby?«
»Das bin ich wohl, ich habe auch einen Pass, aber ich bezweifle, dass er anerkannt wird. Er ist schon zu alt. Außerdem gehöre ich hierher.«
»Aber, Jasper, Sie sind doch Holländer?«
Dass Holland gegen England zu Felde zieht, ist ja ganz ausgeschlossen. Da wären doch Hollands Kolonien sofort futsch. Holland ist die gluckende Henne, die Entchen ausgebrütet hat und ängstlich am Ufer hin und her rennt, dass die lieben Kinderchen nicht davonschwimmen. Holland muss ducken, ducken vor England, sonst geht's ans Leben und ans Geld. Armes Holland!
»Ich bleibe, wo die Anderen sind«, sagte Jasper trotzig.
Na, da war's ja gut. Dass der Bootsmann ein Finnländer war, also ein Russe, vergaß ich im Augenblick. Ich sah durch die Luken, dass drüben ein Boot von der ›Angela‹ abstieß, das unseren Käpten mitbrachte. Er hatte als Hauptsache das Logbuch unterm Arm, das Schiffstagebuch.
Inzwischen brachte man das Frühstück. Hunger hat unsereins immer und freut sich auf jede Mahlzeit. Es war ausgezeichnet. Weißbrot, Tee mit Milch, Zucker. Die Marmelade von Orangen war etwas in Gärung und schmeckte ölig. Butter gab's selbstverständlich nicht. In jenen Breiten ist's sehr schwer, alles tadellos zu erhalten. Aber wir sahen jedenfalls, dass wir sehr anständig behandelt wurden. Zudem sollte es bald Mittagessen geben. Das Ganze war nur ein Zwischenimbiss.
Der Kreuzer ging näher an die Bark heran. Wir sahen, dass sie ins Schlepptau genommen wurde. Dann verschwand sie vor unseren Blicken. Es ging mit Volldampf voran. Die Planken erzitterten von der Schraube.
Stunden vergingen. Der Käpten blieb unsichtbar. Niemand störte uns, wir brauchten auch niemanden und saßen und pafften mächtig. Das hatte man uns gestattet. Dann kam doch etwas die Rede in Fluss, aber das Gespräch stockte bald und versank wieder. Aus lauter Traurigem kann man keine vernünftige Rede aufbauen, und irgendwelche Vorstellungen von dem Entsetzlichen konnten wir uns nicht machen. So brüteten wir still vor uns hin. Gefangene.
Dann kam Leben an Deck.
»Antreten zur Musterung!«
Im Deutschen nennt man das bei dem Landheer Appell. Mittagsappell. Wir zählten gegen 200 Mann, die antraten. Alle trugen Gewehre. Sogar die Heizer von der Freiwache wurden noch geholt und mussten umgeschnallt und mit ihren Schießeisen antreten. Wir kennen das so nicht, aber wir waren alte Soldaten, und deshalb erregte es unsere lebhafte Aufmerksamkeit. Vielleicht geschah es auch uns zu Ehren. Es waren doch Kriegsgefangene an Bord und eine vielleicht erste Siegesbeute im Schlepptau.
Der dicke Offizier, der mit den drei goldenen Ärmelstreifen als Korvettenkapitän kenntlich war, war sicher der Schiffsführer. Er hielt eine längere Ansprache, die wir nicht verstanden wegen der Entfernung und des Surrens der Eisenplatten.
Da endlich kam unser Käpten! Ein Offizier begleitete ihn. Unsere Tür wurde geöffnet. Natürlich standen Posten davor. Aber er trat ein ohne Begleitung.
»Wir kommen als Gefangene in ein Sammellager. Dort sollen schon einige hundert Deutsche sein, Seeleute und solche aus Indien. Wo das Lager ist, habe ich noch nicht herausbringen können. Du, Franz, wie ich dir schon sagte... dein amerikanischer Pass ist nicht in Ordnung. Du musst zunächst mit. Über den Holländer Jasper und den russischen Bootsen wird noch entschieden werden. Vorerst bleibt ihr hier alle beisammen, es muss erst für bessere Unterkunft gesorgt werden. Aber nun, Jungens... der Kapitän, ein ganz handlicher Mann, hat aus meinem Logbuch ersehen, dass wir damals die Mannschaft des englischen Schoners aufgepickt haben, die ganze Sache ist ihm ausführlich bekannt. Er wusste davon vorher, sodass ich gar nicht nötig hatte, viel davon zu erzählen, und... er weiß auch, dass ihr vorhin von den Sailors beschimpft worden seid, ist sehr ungehalten darüber und will das wieder gutmachen... Kommt man alle zusammen mit!«
Wir mussten antreten, wurden vor der Front aufgebaut, noch vor den Offizieren, der englische Kapitän hielt nochmals eine kleine Ansprache, uns zu Ehren:
»Leute, ihr seht vor euch deutsche Gefangene. Sie sind unsere Feinde. Aber diese Männer sind wackere Seeleute, sind Ehrenmänner. Sie sind's gewesen, die unter den ungeheuerlichsten Anstrengungen mit äußerster Lebensgefahr die Besatzung des englischen Schoners retteten. Wir sprechen ihnen unsere Hochachtung aus. England weiß auch seine Feinde zu ehren... Achtung! präsentiert das Gewehr!!!«
Trommelwirbel, mehr als 200 Mann präsentierten vor uns das Gewehr, die Offiziere senkten den Degen.
Diese Ehrung für die gefangenen Feinde war großartig und ritterlich. Ohne Zweifel. Auch England hat wackere Männer, die man hochachten kann. Dass diese hier die in diesem Kriege von der englischen Regierung getroffenen ungeheuerlichen Maßnahmen zu mildern suchten, soweit es ihre Vorschriften gestatteten, gereicht ihnen nur zur Ehre und ist wieder ein Beweis, dass der Hass nicht von Volk zu Volk geht, sondern künstlich erzeugt ist. Es ist doch unerhört und wider jede mühsam errungene menschliche Gesittung, dass in diesem Krieg friedliche Bürger, die an Feindseligkeit gegen das andere Volk nicht denken, an Freiheit und Eigentum und Leben geschädigt werden. Es ist eine ewige Schande Englands, dergleichen vernunftwidrige Waffen aus der Rüstkammer überwundener Jahrtausende herausgesucht zu haben. Warum? Aus Neid, aus Gier, aus Tiergesinnung, die so leicht hinter Frömmelei gedeiht. Aber zu Englands Ehre sei's trotzdem gesagt, dass es drüben Männer gibt, die ob solchen Vorgehens schamrot werden.
Aber diese wackeren Seeleute führten ihren Krieg mit aller irgend möglichen Ritterlichkeit.
Wir rückten zunächst wieder ab ins Fegefeuer und wurden natürlich eingeschlossen und bewacht. Aber man hatte unterdessen auch für uns ein Mittagessen aufgebackt, und dieses war ausgezeichnet. Es gab Pökelbraten mit Reis und Curry. Dazu Salzkartoffeln, Bataten und zum Schluss Pudding. Alles war vorzüglich.
Unter uns war keiner, der sich nicht sehr gehoben fühlte ob dieser Ehrung vor der Front und hinter ihr. Wenn auch manche Geister den Engländern gegenüber nicht ohne Ursache sehr viel Zweifel haben und immer besondere Nebenabsichten argwöhnen, so sprach sich doch niemand so aus. Alle fühlten sich geehrt und anerkannt.
Aber dass dies unter uns zum Ausdruck gekommen wäre, davon waren die Leute ebenso weit entfernt. Es waren doch Matrosen. Es waren Jan Maate. So nennt sich der deutsche Segelschiffsmatrose stolz im Gegensatz zu den Dampfermatrosen. Dieser Jan Maat ist ein ganz anderer Mensch. Er wird schon als Schiffsjunge dazu erzogen. Der Grundzug seines Wesens, wie er's zur Schau trägt, ist eine allgemeine mürrische Verdrießlichkeit. Möglichst alles verachten, möglichst wenig beachten, nichts darf Eindruck machen, alles muss tunlichst bemäkelt werden. Es gibt Menschen, die wirklich so sind, dem Jan Maat ist's anerzogen. Das ist seine Standesstimmung.
Auch dieser Ehrung, die allen so herzlich wohlgetan hatte, musste natürlich ein Dämpfer aufgesetzt werden.
Das ging nicht anders.
»Worum«, begann als erster der Matrose Karl, genannt der Piepmatz, mit kauendem Mund und verdrussmäßig mürrischem Gesicht, »worum hämm se denn nich ook mit Kanonen Salut schaten?«
»Ach wat«, nahm Fred ebenfalls kauend auf, »ach wat, ick schiet up de ganze Scheeterei.«
Er brachte das mit so drolligem Ernst heraus, dass Mister Rugby, der sonst ein sehr ernster, fast ein wenig melancholischer Mensch war, plötzlich Messer und Gabel hinlegte, sich zurückbog und aus vollem Halse lachte.
Das tat wohl in unserer Lage. Es war abermals ein herzliches Lachen, das wieder aufkam, aber auch das legte mir wieder den Gedanken nahe, dass Mister Rugby schwerlich je als Schiffsjunge und Matrose gefahren war, wie wir doch alle müssen. Sonst hätte auf ihn diese anrüchige Grobheit der Matrosen kaum solchen Eindruck gemacht. Unsereins ist's noch ganz anders gewöhnt.
Stunden vergingen. Schon mehrmals hatte ich den Posten draußen durch das Bullauge gebeten, er möge doch den Offizier daran erinnern, dass uns Zeitungen versprochen worden seien, auch Mister Rugby hatte es getan. Aber wir bekamen keine, unser Käpten ließ sich auch nicht blicken.
Vesper! Eine ganz vorzügliche Schokolade mit kondensierter Milch angerührt, Milch noch besonders, frisches Weißbrot und — wahrhaftig! — eisgekühlte Butter! Na, das ließen wir uns gefallen! Wer unsere Freude am Essen nicht versteht, der kennt sie eben nicht, die christliche Seefahrt. Ein verhungerter Landstreicher, dem der Sitz seiner Denkkraft in den Magen gerutscht ist, wird mich eher verstehen.
Plötzlich stopp! Unheimlich, wenn die Schraube, die die Planken erzittern macht, unvermittelt stehen bleibt. Wie ein Schweigen des Todes legt es sich auf das Schiff, während man draußen die Wogen rauschen hört.
Auf der Kommandobrücke lebhafte Bewegung. Schade, dass wir nichts verstehen konnten.
Dann kamen wieder zeitweilige Schraubenschläge. Die Fregatte führte verschiedene Bewegungen aus. Auf Backbord kam uns wieder die ›Angela‹ zu Gesicht, das Schlepptau wurde eingeholt. Man sah, dass auch die englischen Marinematrosen, die sich drüben an Bord befanden, in Bewegung kamen.
Da trat unser Käpten ein. Er sah erregt aus, fast verstört, so sehr er sich auch zu beherrschen suchte.
»Durch dieses Gewässer hin läuft ein englischer Funkspruch. Kriegsbefehl! Alle Men of war werden nach einem bestimmten Punkt zusammengezogen. Höchste Eile. Die Prise muss aufgegeben werden. Kinners...«, er atmete schwer, »Kinners, wenn innerhalb einer Viertelstunde kein Dampfer aufkommt, der unsere ›Angela‹ ins Schlepptau nimmt, dann... dann wird sie versenkt!«
Das musste freilich unserem Käpten ans Herz greifen! Es ging uns allen nahe. Wer mochte wissen, was der bereits versucht hatte, um Schiff und Ladung zu retten, oder was er sonst für Pläne hatte! Solch eine gute Prise ist für den Eigentümer nicht schlechthin verloren. Man kann sie zurückkaufen, wenn nicht selbst, so hat doch ein Kapitän, besonders wenn er zugleich Reeder ist, überall seine Geschäftsverbindungen, und Geld hatte ja Kapitän Düwel genug. Aber nun freilich...
Er raffte sich mit Macht zusammen, er dachte zunächst an uns, seine Mannschaft, seine ›Kinners‹.
»Es muss schon alles vorbereitet werden. Hat jemand von euch noch etwas drüben, was er mitnehmen will? Der englische Kapitän ist ganz entgegenkommend.«
Schweigen. Niemand meldete sich.
Da ließ sich der erste Steuermann vernehmen, nachdem er abgewartet, ob sich keiner von uns melden würde: »Meine Bücher, meine Papiere, meine Berechnungen, meine Kartenzeichnungen!«
»Ja freilich, Franz, davon habe ich schon zum Schiffsführer gesprochen. Das kommt alles herüber. Du darfst dabei sein. Aber... 's ist eine verdammte Geschichte... es wird alles untersucht... Gesagt habe ich natürlich nichts davon, was sie finden werden, aber wenn diese Engländer deine Küstenvermessungen sehen... Franz, gib dich keinen Hoffnungen hin, dass du sie behältst!«
»Hm. Allerdings schlimm. Na, dann nicht. Dann mögen sich die Engländer an den Früchten meiner zehnjährigen Arbeit freuen, die ich freilich anderen zugedacht hatte. Dann hätte ich das allerdings nicht so geheim zu halten brauchen. Nun, es lässt sich nichts ändern. Schließlich habe ich doch für die Wissenschaft, für die ganze Welt gearbeitet.«
Also noch eine Viertelstunde Zeit. Vielleicht konnte die ›Angela‹ doch noch gerettet werden. Aber klargemacht zum Versenken wurde schon alles.
Der Kreuzer legte dicht bei. Wir konnten aus den Bullaugen geradezu aufs Deck hinabsehen. Noch einmal wurde dienstlich gefragt, ob wir noch etwas herüberzunehmen hätten. Es meldete sich nur der erste Steuermann. Er durfte das Verlies verlassen und hinübergehen.
Die Übernahme begann. Einige Dutzend Matrosen standen zur Verfügung, die ganze Bücherei herüber zu befördern. Es war wirklich eine gar stattliche Anzahl Bände. Die Bücher wurden teils in Kisten, teils in Säcke verpackt, ganze Stöße wurden frei herübergetragen. Die englischen Offiziere begannen schon zu schnüffeln, am meisten der Kapitän. Schließlich verschwand er drüben in der Kajüte. In einer offenen Kiste sahen wir Stöße von beschriebenem Papier. Dann kamen ganze Bände mit eingehefteten handschriftlichen Arbeiten, endlich ganze Rollen mit Zeichnungen und Plänen. Schließlich wurde der ganze Schreibtisch an Deck getragen. Noch ehe er richtig dastand, bückte sich der Korvettenkapitän, der die Überführung selbst leitete und begleitete, klopfte mit dem Fingerknöchel, später auch mit einem Hammer hier und da am Schreibtisch herum, als suche er ein geheimes Fach. Da drin in der Kajüte schien überhaupt etwas Besonderes vorzugehen. Man merkte so allerlei. Die Offiziere flüsterten zusammen und tauschten bedeutungsvolle Blicke.
Auch Kapitän Düwel hatte sich noch Einiges herüberbringen lassen. Viel war's nicht. Die alte lederne Ruhebank und einen Stuhl. Er selbst trug zweierlei: unter dem einen Arm etwas Großes, Flaches, in Segeltuch eingenäht, unter dem anderen Arm einen alten Geigenkasten. Das erste war ganz sicher das Bild der Angela seiner Jugend. Ich atmete auf. Es war gut, dass die lebende Angela mit uns war, wenn die leblose versank.
Endlich war's geschehen. Alle Prisenmannschaften kamen herüber, die Fregatte machte sich wieder frei, ging etwa 300 Meter zurück und drehte bei. Breitseite stand gegen Breitseite.
Die Viertelstunde musste vergangen sein. Kein Rauchwölkchen verriet einen anderen Dampfer. Wir hätten es am Verhalten der Engländer bemerkt, denen es sicher nicht recht war, ein Schiff mit 420 Tonnen Tabak auf den Meeresboden zu versenken. England zahlt Prisengeld, einen gewissen Satz vom Verkauf der beschlagnahmten Beute. Jeder Matrose erhält sein Teil. Bei der Versenkung musste das alles wegfallen. Es gab ja nichts zu versteigern. Bei den versenkten Kriegsschiffen zählt man die Köpfe der getöteten Feinde und zahlt für jeden Belohnungen. So machen es auch die Vereinigten Staaten von Nordamerika, und es wurde noch im Krieg gegen Spanien so gehandhabt. Diese anmutige Sitte scheinen die Herren Yankees von den früheren Besitzern ihres Landes übernommen zu haben, von den Rothäuten. In richtigem Verstehen nennen die Matrosen dieses Geld ›Skalpgeld‹.
Da wurden Flaggenzeichen geschwungen. Drüben längsseit der Bark legte ein Boot an. Zwei Mann gingen an Bord. Jeder trug ein rundliches Ding, trug es sehr vorsichtig. Sprengbomben. Die beiden verschwanden in einer Luke, hatten sich den Weg zum Kielraum schon vorher gesucht. Endlich kamen sie wieder zum Vorschein, schnell ins Boot, schnell davongerudert.
So, nun leb' wohl, wackeres Schiff, ›Angela‹, Engel des Lichts! Wir hier im Fegefeuer grüßen dich zum letzten Mal. Leb' auch du wohl, du ferne, traute Angela! Werden wir uns je wiedersahen? — —
Eine Minute verstrich. Zwei Minuten, drei Minuten. Himmel und Hölle! Wie lang kann eine Minute werden! Sie wurde nicht nur uns im Fegefeuer so lang. Droben auf der Kommandobrücke, dem blauen Himmel so viel näher, gebärdeten sie sich auch so ungeduldig.
Schließlich waren's fünf Minuten. Da durfte es wohl als sicher gelten: Beide Sprengbomben hatten versagt! — Eine schien sich auf die andere verlassen zu haben. So und noch anders fingen die deutschen Matrosen im Fegefeuer schon an zu witzeln.
Aber was nun? Noch einmal hinüberkutschieren, neue Bomben legen? — Das geht nicht. Damit würde der Schiffsführer das Leben seiner Leute aufs Spiel setzen. Schließlich könnte es den Bomben doch einfallen, loszugehen.
Bööööööhhh!!!
Jetzt hatte es also geknallt. Nun kam auf der ›Angela‹ die übliche Feuergarbe und das Herumfliegen von Planken und sonstigen Schiffsteilen.
Aber siehe da! Es kam nicht. Unserer guten ›Angela‹ war nichts geschehen. Es konnte ihr gar nichts geschehen sein. Wir wussten doch, dass sie von einer Granate enden sollte, hatten die Vorbereitungen beobachtet, und eine Granate von 21 Zentimeter sieht man anfangs auch fliegen.
Aber diese Granate — wo ging die hin! Hoch, hoch über das Schiff flog sie weg, in ungemessener Ferne klatschte sie auf.
Und dabei lag das Schiff auf spiegelglatter See in einer Entfernung von höchstens 300 Meter.
Wir spotteten nicht darüber. Nicht wir, die wir etwas davon verstehen. Es ist keineswegs leicht, die großen neuzeitlichen Geschütze auf so kurze Entfernungen einzustellen. Darauf sind sie gar nicht eingerichtet. Es fängt erst bei 1000 Meter an, und da muss man noch große Erfahrung haben. Man kann sich da sehr irren und leicht viel zu hoch oder zu niedrig schießen.
Bööööööhhh!!!
Bravo! Diesmal war's ein Volltreffer, obgleich die Fregatte durch den ersten Schuss schon ziemlich ins Schwanken gekommen war. Die Granate war dem ›Engel‹ mitten zwischen die Rippen gejagt worden, genau mittschiffs in halber Höhe über der Wasserlinie.
Nur schade, dass außer dem Loch keine Wirkung zu verspüren war. Die Granate, für Panzerplatten bestimmt, war mit einer Anfangsgeschwindigkeit von rund 700 Meter durch die dünne Holzwand des Kauffahrers wie eine Büchsenkugel durch ein Blatt Papier gegangen und wahrscheinlich auf der anderen Seite herausgekommen, ohne zu zerspringen.
Das hatte ein Schuss sein sollen, der dem Schiffchen ein Loch unter der Wasserlinie beibrachte. Das ist sehr schwer zu erreichen. Eigentlich nur durch Zufall. Das Geschoss schlug schon eine gute Strecke vorher aufs Wasser auf, prallte ab und setzte in kühnem Sprung über die Bark hinweg, ziemlich dicht über der Bordwand.
Unser Engel schien wirklich ewiges Leben zu haben. Heil, Angela, du nahe und du ferne!
Zum vierten Mal böööhhte es. Wieder ein Treffer. Aber ganz hoch oben in der Takelung. Der Großmast war über der Oberbramrahe gekappt worden. Das war freilich ein böses ›Zu hoch‹, auch wenn die Fregatte schon bedenklich schlingerte. Offenbar war das Geschütz viel zu früh oder zu spät abgerissen worden. Dafür hätte es in der deutschen Marine mindestens drei Tage Mittelarrest gegeben.
Der Schiffsführer auf der Brücke kam immer mehr aus dem Häuschen.
Neue Befehle. Ein Torpedo sollte dran gewagt werden, diesem zähen Engel das Lebenslicht auszublasen.
Ein weißer Blasenstreifen glitt durch die blaue Flut.
O weh, o weh! Wo ging der hin!! Erst nahm er sein Ziel in ernstem Streben gerade auf. Aber plötzlich schwenkte er nach rechts ab und spazierte in fein geschwungenem Bogen weit, weit um den Bug herum. Das Steuer des Torpedos war entweder falsch eingestellt gewesen oder hatte sich unterwegs verschoben.
Nun fing die Sache an, uns zu belustigen. Es ist wunderbar in der Welt, wie neben die tiefste Trauer gleich das Lachen gepflanzt ist. Dieselben Engländer, die uns innerlich geschlagen hatten, mussten uns lachen machen. Ausgleichende Gerechtigkeit!
Ein zweiter Torpedo wurde entlassen. Der saß wirklich. Mittschiffs hatte er sich ehrlich eingebohrt, wie ihm aufgetragen war. Nur hatte er leider keine Wirkung irgendwelcher Art. Nicht einmal erschüttert war die Bark, noch weniger folgte der bekannte Knall der Zertrümmerung. Der Brave war leider ein Blindgänger gewesen und hatte versagt.
Der dicke Kapitän auf der Brücke raste vor Wut. Fettpolster und Schmerbauch gewährleisten nicht immer gelassene Ruhe.
Aber da zu allen guten Dingen drei gehören, so wurde sofort ein dritter Torpedo bestimmt, der ganz gewiss dem guten Engel den Garaus machen würde.
Aber o weh, o weh, o weh! Es musste sich im letzten Augenblick das Ablassrohr verschoben haben. Dieser dritte Schuss ging ganz gerade, aber weit, weit hinter der Bark vorbei.
Wer Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Unsere Jungen wieherten und tobten vor Vergnügen. Aber das durfte nicht sein. Der erste Steuermann war nach seiner Abberufung nicht zurückgekehrt, so standen die Leute unter meinem Befehl. Ich befahl und bat, den blutigen Witz zu zügeln, wenigstens draußen nichts merken zu lassen. Ich flehte sie geradezu an, und sie gehorchten. Mir zuliebe taten sie's. In einem Jahr kommt man sich sehr nahe, auch mit Untergebenen.
So machten sie ihre Witzchen unter sich. Das durften sie.
Nur eines geschah, und das schadete auch nichts. Der Matrose Hein fragte ganz ernsthaft bei Gelegenheit einen vorübergehenden Engländer: »Gestatten Sie bitte eine Frage: Wie lange Zeit hat es für die englische Flotte bedurft, um bei Helgoland die ganze deutsche Flotte auf den Meeresgrund zu versenken?« —
Der blieb die Antwort schuldig und hatte sich mit einem Fluche abgewandt.
Jetzt fehlte eigentlich nur, dass eine ganze Breitseite abgegeben wurde, um das elende Schiffchen da drüben verschwinden zu machen. Aber das ging doch nicht an. Ein vierter Torpedo sollte die schwere Arbeit vollenden. Er tat's auch. Es war aber kein Schauspiel für die Augen. Ein dumpfer Knall, eine kleine Wassererhebung. Dann sackte der Engel sachte weg und verschwand in der Unsichtbarkeit ohne Lärm und Getöse und Schnaufen. Ein Engel.
Es war ein teurer Scherz gewesen für Englands Flotte. Man kann es etwa auf 30—40 000 Mark berechnen. Die ›Angela‹ hatte auch im Tode ihren festen Wert. —
Volldampf voraus! Noch viel mehr als vorher. Äußerste Kraft! Die Eisenflanken zitterten und bebten, als wollten sie aus den Nieten gehen. Kurs schien Nordost zu Ost zu sein, soweit wir erkennen konnten.
Mister Rugby gesellte sich wieder zu uns. Als Gefangener. Er brachte ein dickes Paket mit. Die ›Calcutta Gazette‹. Die letzte Nummer war vom 22. August, die erste vom Anfang des Monats. Die meisten Nummern gab's mehrfach.
Wir stürzten uns drüber her. Das war freilich bös. Es stimmte alles, wie's der Kapitänleutnant gesagt hatte. Die Telegramme stammten freilich aus London, es waren aber auch solche von Kopenhagen und anderen neutralen Orten. Sie bestätigten alles Erzählte ausführlich und einhellig.
Im Westen und im Osten waren die deutschen Heere völlig geschlagen. Allein an Gefangenen war fast eine Million verlorengegangen. Die Russen hausten wirklich in Berlin. Eine Revolution hatte alles vorbereitet. Der Kaiser hatte abgedankt und Selbstmord begangen, desgleichen der Kronprinz, der Führer der Kriegspartei, die das ganze Unglück erst angezettelt hatte. So ging's weiter. Am 10. August war die große Seeschlacht bei Helgoland mit allen Einzelheiten geschildert. Konnten wir ahnen, dass das alles Hirngespinste seien, die als Wirklichkeiten zurechtgeschnitten waren? — Erst nach dem Krieg wird man erfahren, wie viele silberne Torpedos England geopfert hat, um seine indischen Kolonien und die ganze Welt, besonders hier das französische Indochina, in ein Lügenmeer zu versenken. Leise Bemerkungen unterbrachen die knisternde Stille.
»Hier steht's — — der Kaiser ist tot, hädd sich ne Kugel durch 'n Kopp schoten.«
»Wann?«
»Glicks am achten August.«
»Nee, kann nich stimmen — — am elften August hädd sick de Kaiserin, wat sien Fru is, von emm scheeden laten.«
»Denn hädd se sick nah sien Tod von emm scheeden laten.«
»Ja, aber am vierzehnten August ist der Kaiser doch an der Westfront, in Straßburg!«, erklang es von anderer Seite.
»Tot?«
»Nenee, kreuzfidel und munter.«
»In Straßburg? Das haben doch längst die Franzosen.«
Aha, ahaaa!! Jetzt entdeckten wir die ersten Ungereimtheiten. Hier stimmte etwas, stimmte vieles nicht! Und wir entdeckten immer mehr Widersprüche. Nicht gerade wichtige Dinge, aber doch von überwältigender Beweiskraft, dass hier gelogen war, dass sich die Balken bogen. Wie sagt doch Wagner im Faust? »Sie lispeln Englisch, wenn sie lügen.«
Wenn wir nur gewusst hätten, was da mit Farbe überdruckt war. Solcher Stellen gab's in jeder Nummer mehrere.
»Warten Sie, ich bin schon dabei, vielleicht gelingt's mir«, ließ sich da Mister Rugby vernehmen.
Er hatte sich in eine Ecke gequetscht, in der er von draußen durch das Bullauge nicht gesehen werden konnte, hielt ein Zeitungsblatt gegen das Licht und beäugte solch eine schwarzbedruckte Stelle durch eine Lupe, die er bei sich trug. Dann rieb er sie mit dem befeuchteten Finger, gebrauchte wieder die Lupe. Offenbar war er schon längere Zeit, unbeachtet von uns, so beschäftigt gewesen.
»Wenn ich doch ein scharfes Messerchen hätte...«
Da schlich sich der schwarze Koch heran, grinsend und die Augen verdrehend.
»Messerchen, Massa, scharfes Messerchen?«
»Ja, hast du eins?«
»Bumbo auf Ehre, Bumbo auf Ehre...«
Damit drehte sich Ahasver herum, machte einige Schritte gegen die Wand, immer mit zappelnden Bewegungen, mit den Händen in der Luft herumfuchtelnd, und als er zurückkam, hatte er ein Messerchen in der Hand. Nur wenige Zentimeter lang war das Dingelchen. Er klappte den Griff auf und reichte es Mister Rugby. Es schnitt wie Gift.
Niemand konnte wissen, wo der Kerl das Messerchen versteckt hatte. Ich dachte erst an sein wolliges Haar. Aber darin konnte er's kaum verbergen. Genug, er besaß es. Natürlich hatte die Sache ganz geheim gemacht werden müssen. Der Posten draußen hätte es nicht bemerken dürfen.
Mister Rugby schabte und kratzte in seinem Winkel, äugte gegen das Licht, nahm auch die Lupe. Wir sahen ihm mit gespanntester Aufmerksamkeit zu.
»Nun, bekommen Sie etwas heraus?«
»Bitte, lassen Sie mich erst ruhig gewähren, bis ich ein Ergebnis melden kann.«
Wir wandten unsere Aufmerksamkeit von ihm ab. Es war besser so wegen des Postens da draußen, bemerkten aber doch noch, dass er sich mit Bleistift und Papier Anmerkungen machte. Das war schon verheißungsvoll.
Unterdessen suchten wir weiter nach Unstimmigkeiten in den Berichten und fanden noch genug, wenn sie auch nicht von großem Belang waren. Der deutsche Kronprinz war irrsinnig geworden, nachdem er doch schon Selbstmord begangen, dann aber war er Führer des aus Belgien hinausgeworfenen Heeres — — — und so weiter.
Nach einer Viertelstunde erhob sich Mister Rugby. Er hatte auf dem halben Blatt Rapier schon recht viele Bemerkungen gemacht und zeigte ein wahrhaft feierliches Gesicht, als er mit gedämpfter Stimme begann:
»Leute, Kameraden! Ich will euch etwas erzählen. Ich bin so gut ein Deutscher wie ihr, wenn ich auch vorübergehend einmal amerikanischer Bürger geworden bin.
Einige von euch, die schon mehrere Fahrten auf der ›Angela‹ mit mir gemacht haben, werden beobachtet und vielleicht auch anderen erzählt haben, dass ich in Hamburg oder wo wir immer einen deutschen Hafen anliefen, stets von Bord ging und niemals deutschen Boden betreten habe.
Nein, ich darf ihn nicht betreten. Aber glaubt mir, dass ich mir nichts habe zuschulden kommen lassen, was dieses Verbot nach sich gezogen hätte! Sonst dürfte ich mich wohl nicht einmal in die Elb- und Wesermündung wagen, dürfte auch nicht auf einem deutschen Schiff weilen. Es ist vielmehr ein Versprechen, das ich einem anderen Menschen gegeben habe, bis zu einer gewissen Zeit deutschen Boden nicht mehr zu betreten. Es ist ein Gelübde, das ich mir selbst und einem anderen halte.
Leute! Und auch Sie, mein lieber Herr Kollege! Ihr habt mich in den langen Monaten unserer gemeinsamen Arbeit kennengelernt und wisst, dass mir Stolz und Prahlerei fern liegt. Deshalb werdet ihr mir glauben, wenn ich euch jetzt sage, dass ich dereinst zu den höchsten politischen und militärischen Kreisen Deutschlands in nahen Beziehungen stand. Das ist mit einiger Einschränkung auch jetzt noch der Fall.
Es ist etwas mehr als ein Jahr her. Da lagen wir mit der ›Angela‹ im Hafen von New York. Dort weilte gerade ein Deutscher, der in unserem Vaterland an sehr hoher und leitender Stelle steht. Dem die Landesverteidigung sehr wesentlich unterstellt ist, wenn auch die Öffentlichkeit das Nähere nicht weiß.
Mit diesem Mann hatte ich eine lange Unterredung, und es ist kein Vertrauensbruch, wenn ich euch jetzt einige Mitteilungen mache. Es ist jetzt die Gelegenheit, und ihr selbst seid wert, dass ihr etwas Näheres erfahrt. Ich will euch nach allem Schweren, was ihr heute gehört, erlebt und gelesen habt, was euch verzweifelt stimmen muss, mit fester Hoffnung und Zuversicht erfüllen.
Dieser Mann sprach zu mir, und auf sein Wort kann man sich eisern verlassen.
Er erklärte: Die führenden Kreise in Deutschland erwarten einen Krieg.
Niemals, sagte er, wird Deutschland den Frieden brechen, nie wird es auch nur einen Vorwand zu einem Krieg suchen, wir werden nachgiebig sein bis zum Äußersten, aber wir wissen auf das bestimmteste, dass dieser Krieg über kurz oder lang uns aufgezwungen wird.
Es wird ein Weltkrieg werden, wie die Weltgeschichte noch keinen gesehen hat.
Voraussichtlich wird Russland die Feindseligkeiten gegen Österreich eröffnen wegen der Balkanfrage.
Deutschlands Bündnispflicht ist es, Österreich beizustehen.
Darauf wartet nur Frankreich, dass Deutschlands Heeresmacht im Osten beschäftigt ist, um es im Westen zu überfallen.
Schon seit langer Zeit gehört England, seines germanischen Bluts vergessend, einem Geheimbund gegen uns an, den man Entente nennt, ja ist vielleicht sein eigentlicher Leiter. England ist erfüllt von Neid und Eifersucht gegen Deutschlands wachsende Macht, gegen Deutschlands Handel und Tüchtigkeit. Es wird also auf der Seite Russlands und Frankreichs stehen und uns zur See bekämpfen.
Zwar wird England anfangs, wenn Russland und Frankreich gegen uns vorgehen, erst die Versicherung einer wohlwollenden Neutralität geben. Aber es ist ganz ausgeschlossen, dass es diese aufrechterhalten kann oder will. Es wird uns nur sicher machen wollen, um uns desto heimtückischer zu überfallen. England kann nicht anders als lügen und heucheln und fürchtet uns heimlich.
Die Geheimarchive der Mächte sind uns nicht ganz verschlossen. Im gegebenen Zeitpunkt wird England einen Anlass finden, ebenfalls gegen uns vorzugehen. Bei dem geringsten Anerbieten etwa, das uns zur Nachgiebigkeit bestimmen soll, werden daher die Beziehungen mit England abgebrochen, um ihm jede Möglichkeit zu nehmen, seine sattsam bekannte Heimtücke gegen uns spielen zu lassen.
Wir haben mithin von vornherein mit drei Feinden zu rechnen, die über Deutschland herfallen werden: mit Russland, Frankreich und England.
Auf Italiens Hilfe können wir nicht zählen. Italien hat schon längst uns gegenüber eine gänzlich unzuverlässige Haltung eingenommen, ist möglicherweise durch bereits bestehende geheime Abmachungen gebunden. Aber auch ohne das ist es durch seine ganze Lage gefährdet und muss jedem Druck der großen Mächte nachgeben. Es würde von den englischen und französischen Flotten umlagert werden, die seine Städte alle in Trümmer legen könnten. Darum würde ÖsterreichUngarn von vornherein seine Kräfte, die es gegen Russland braucht, auch auf die italienische Grenze verteilen müssen. Es könnte uns also gegen Frankreich nicht beistehen.
So wird die Kriegslage im Anfang sein. Das wissen wir ganz bestimmt. Ob dann noch sonst wo die Kriegsfackel aufflammen wird, das wissen wir noch nicht, es ist auch nicht so wichtig. Nur das wissen wir, dass es ein furchtbar ernster Krieg sein wird. Unsere Lage wird verzweifelt und anscheinend hoffnungslos sein.
Aber, mein Freund, fuhr jener Mann fort, es wird alles ganz, ganz anders kommen, als sich's unsere Feinde und wohl auch die meisten Deutschen träumen lassen.
Dass Deutschland riesenstark ist, das weiß jeder Deutsche. Das wissen auch unsere Feinde.
Aber wie furchtbar stark Deutschland ist, das ahnen unsere Feinde nicht; davon kann auch die große Masse des deutschen Volkes nichts wissen.
Nein, kein einziger Deutscher, der nicht in die ganz geheimen Getriebe Einsicht hat, kann sich in seinen kühnsten Träumen eine Vorstellung von der wahren Kriegsmacht und Kampfbereitschaft Deutschlands machen.
Davon wissen nur allein wir, die wir das Reich in mehr als vierzigjähriger Stille und in rastloser Arbeit gerüstet haben, weil wir genau wussten, dass ein Krieg unvermeidlich sei. Moltke schon hat ihn vorausgesagt für die Zeit von nicht ganz einem halben Jahrhundert nach 1870.
Die Zeit ist jetzt gekommen, uns allen überraschend, nur nicht unserem Heer und unserer Flotte.
Mein Freund sagte mir. Seien Sie ganz unbesorgt um das Schicksal Deutschlands.
Unsere Feinde werden erschrecken und sich entsetzen über uns, schon in den allerersten Tagen, noch ehe die kleinste Plänkelei stattgefunden. Sie werden sich entsetzen allein über unsere Mobilmachung, die mit einer unheimlichen Schnelligkeit vor sich gehen wird, die niemand für möglich gehalten hat. Wer Deutschland anrührt, der wird eine Entladung von Kräften erleben, die ihn entsetzen werden.
Deutschland ist wie ein Felsen von Granit, der fähig ist, alle seine Feinde zu zermalmen, wenn er auf sie fällt, und er wird doch immer der Felsen bleiben. Unser Vaterland gleicht einer schwer geladenen elektrischen Batterie. Wo man sie anrührt, teilt sie furchtbare Schläge aus, aber immer neu sammelt sie ihre Kräfte. Das werden unsere Feinde erleben.
Es mag ja sein, dass wir anfangs zurückgedrängt oder zur Verteidigung gezwungen werden. Die Übermacht unserer Feinde ist ja unermesslich. Aber dann wird auch ein Unwetter über sie losbrechen, das verheerend für sie ist. Furchtbar, entsetzlich werden wir über sie kommen.
Habt ihr gehört? Eine halbe Million Kosaken! Was sind Kosaken gegen unsere Husaren, Ulanen, Dragoner! Wir werden ihnen etwas vorreiten! Jene sind halbwilde Horden, bei uns herrscht eine Ordnung, von der keiner der Feinde eine Ahnung hat. Aber Kosaken erst gegen deutsche Infanterie oder Artillerie — lächerlich!
Das werden auch die Franzosen erleben im Westen. Es mag ja sein, dass sie die Grenze anfangs überschreiten und an den Rhein gelangen. Aber dann wird das Schicksal sie ereilen. Davon ahnt England nichts. England wird freilich unser schwerster, zähester und unerbittlichster Gegner sein. Seine Kriegsflotte ist tadellos, ihre Führung und Besatzung ausgezeichnet. Wer England unterschätzt, der kennt die Welt sehr schlecht.
England wird uns furchtbar zu schaffen machen. Es wird unseren Handel lahmlegen, unsere Kolonien überfallen, unsere Seehäfen absperren, dass uns im Lande Hungersnot droht.
Aber, mein Freund, es wird sich dennoch zeigen, dass wir dem stolzen Albion gewachsen sind. Es stehen der Welt ungeheuerliche Überraschungen bevor. Wir verfügen über Erfindungen, von deren Tragweite niemand etwas weiß, deren Zusammenwirken nur ganz wenige Eingeweihte begreifen können. Außer unserer Luftflotte, mit der wir England jederzeit überfallen können, außer unseren vollendeten Unterseebooten haben wir noch Kriegsmaschinen, die ganz gehein. gehalten werden, vor denen unsere Feinde erbeben sollen, wenn sie Tod und Verderben in ihre Reihen bringen.
Ich darf darüber zu niemand sprechen, sagte mein Freund, auch zu Ihnen nicht, aber das sollen Sie wissen: Wir sind fertig, ganz fertig. Mag kommen, was da will. Lieber freilich lassen wir das Schwert in der Scheide, denn das wissen wir, dass es für uns und unsere österreichischen Freunde ein Kampf auf Tod und Leben, Sein oder Nichtsein wird. Aber wenn wir angegriffen werden, dann wird Deutschland als Sieger aus dem entsetzlichen Ringen hervorgehen, und wenn eine Welt voll Feinde wider uns anginge.
Verlassen Sie sich darauf: Wir siegen, wir siegen, wir siegen!!! Ich spreche als Verkünder der Wahrheit. Amen!«
Mister Rugby machte eine Pause. In atemloser Spannung hatten wir gelauscht. Mehr, mehr wollten wir hören. Diese Worte waren linder Balsam für unsere verwundeten Seelen. Wir fühlten die Macht der Wahrheit, die sich uns da enthüllte, und alle Lügen, die in diesen Blättern knisterten, fielen wirkungslos von uns ab. Die denkende Seele atmete wieder frei auf.
Da hob der erste Steuermann von Neuem an. Ein frohes Lächeln verklärte seine Züge. Fröhlich schwenkte er den Zettel in seiner Hand:
»Meine Freunde! Die Zeit ist offenbar gekommen. Der Weltkrieg ist ausgebrochen. Dass diese Weltvölker über uns hergefallen sind, das wird wahr sein.
Glaubt mir, ich selber war auch niedergeschmettert von der Botschaft des Engländers. Ich bin Rheinländer. Meine Ahnen haben für die Freiheit des deutschen Rheins gekämpft und geblutet. ›Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein‹, haben wir tausendfach geschworen als deutsche Jugend. Dass der in französischem Besitz sein sollte, für den unsere Väter Gut und Blut geopfert haben — als ich das anfangs las, da musste mir ja das Herz bluten und glauben musste ich's zunächst so wie ihr.
Ja, es warf mich schier zu Boden.
Aber dann las ich diese Zeitungen. Da fand ich gar bald Unstimmigkeiten, wie ihr auch.
Ferner sind hier überdruckte Stellen, die man offenbar nicht lesen soll. Hätten sie lauter Siege zu melden, wie der Engländer vorhin, so bedurften sie ja keines Überdrucks irgendeiner Nachricht. Wie euch aber der Augenschein lehrt, haben unsere Feinde sehr Vieles zu verheimlichen. Das macht mich jubeln und jauchzen.
Es ist mir auch bald gelungen, einige Berichte zu entziffern, Höret zunächst folgendes!
›Paris, 5. August. Die deutschen Truppen bei Lublinitz nahmen nach kurzem Gefecht Czenstochau. Auch die russischen Orte Bendzin und Kalisch wurden von deutschen Truppen besetzt.‹ Demnach stehen unsere Heere in Russland. Nicht umgekehrt. Weiter. ›Paris vom gleichen Tag. Bei Soldau — ebenfalls in Russland — wurden die deutschen Truppen von einer russischen Kavalleriebrigade angegriffen. Der Angriff brach im Feuer der deutschen Truppen unter großen Verlusten zusammen.‹ Wo sind also die berühmten Kosaken geblieben? — Die französische Drahtung muss aber zugeben, dass die russische Kavallerie noch an anderen Grenzorten geworfen wurde, ja dass der russische Grenzschutz bereits durchbrochen ist.
Hier, nachträglich: ›Der deutsche Kreuzer ,Augsburg‹ hat schon am 2. August den Kriegshafen Libau beschossen und Minen gelegt. Libau brennt...‹«
»Hurra!« —, erklang es da jubelnd im Fegefeuer.
»Sst, still! Es kommt noch ganz anders. ›London, 8. August. Der bewaffnete Bäderdampfer ,Königin Luise‹ ist in die Themsemündung eingedrungen und bat Minen gelegt. Der englische Kreuzer ,Amphion‹ ist auf eine der ausgestreuten Minen gelaufen und gesunken.‹«
»Hört, hört, in die Themsemündung eingedrungen!!«
»Sst, still!! ›London, 8. August. Lüttich ist von vier deutschen Brigaden unter General Emmich erstürmt worden, ist fest in deutschen Händen.‹ — ›Paris, 5. August. Die beiden deutschen Kriegsschiffe, die Algier bombardiert haben und leider unversehrt entkommen sind, sind die Kreuzer ,Goeben‹ und ,Breslau‹ gewesen...‹«
»Die ›Goeben‹ und die ›Breslau‹!! Dürfen wir nicht endlich einmal Hurra brüllen?!«
»Nein, Kinder. Erst will ich euch noch etwas anderes mitteilen. Hier ist eine Stelle, die man doppelt und dreifach schwarz überdruckt hat. Nur mit schwerer Mühe habe ich das Wesentliche entziffert, denn gerade auf diese Stelle hatte ich's abgesehen. Nun hört aber, wie es am Rhein steht, den die Franzosen überschritten haben wollen...«
Der Sprecher musste erst eine tiefe Erregung niederkämpfen, ehe er fortfahren konnte.
»Wir haben doch bisher nur feindliche Berichte gelesen. Aber unbegreiflicherweise hat sich in die Nummer vom 25. August auch der Bericht des deutschen Generalstabs vom 21. August verirrt. Der lautet: ›Unter Führung des Kronprinzen von Bayern haben Truppen aller deutschen Stämme gestern in Schlachten zwischen Metz und Vogesen einen Sieg erkämpft. Der mit starken Kräften in Lothringen vordringende Feind wurde auf der ganzen Linie unter schwersten Verlusten geschlagen. Viele tausend Gefangene und zahlreiche Geschütze sind ihm abgenommen worden. Der Gesamterfolg lässt sich noch nicht annähernd übersehen, da das Schlachtfeld einen größeren Raum einnimmt, als in den Kämpfen von 1870 unsere gesamte Armee in Anspruch nahm. Unsere Truppen, beseelt von unaufhaltsamem Drang nach vorwärts, folgen dem Feind und setzen den Kampf heute fort...‹ Und in derselben Nummer ein englischer Bericht: ›Die französischen Kräfte, die bei Metz den deutschen gegenüberstanden, werden auf acht Armeekorps festgestellt. Der Rückzug der Franzosen artete in vollkommene Flucht aus...!‹«
Der Leser brach ab. Seine Stimme versagte, seine Augen füllten sich mit Tränen. Er ließ das Papier fallen, nahm seine Mütze vom Kopf, fiel auf seine Knie, faltete die Hände, und eine wahre Verklärung kam über sein Antlitz. Dann sang er mit tiefer, prachtvoller Stimme:
Fest steht und treu die Wacht, die Wacht am Rhein!
Fest steht und treu die Wacht, die Wacht am Rhein.
Kein Hurra war erklungen. Feierlich umstanden wir den Knienden. Auch wir waren überwältigt. Da muss man auch niederknien und loben und danken. Da hat Gott geholfen. Der Herr ist ein starker Kriegsmann, sein Name sei gepriesen!
Dann aber nahmen wir den Sang auf, und aus dem Fegefeuer eines englischen Kriegsschiffes brauste jubelnd der deutsche Matrosensang:
Es braust ein Ruf wie Donnerhall,
Wie Schwertgeklirr und Wogenprall...
Unser Lied sollte nicht zu Ende kommen.
Der Schwur erschallt, die Woge rinnt,
Die Fahnen flattern hoch im Wind...
So weit waren wir. Da öffnete sich die Tür, und unser Käpten trat ein. Das musste schon eine wichtige Veranlassung sein. Einfache Besuche waren hier ganz ausgeschlossen. Gleichzeitig ging im Schiff eine Veränderung vor. Die Schraube ließ nach, das Zittern und Klappern im Schiff ebbte. Auch wir vermummten wie auf plötzlichen Befehl.
»Na, Jungens, ihr seid ja recht vergnügt hier?«
Mit kurzen Worten teilte der erste Steuermann, der sich inzwischen erhoben hatte, die Hauptsachen mit.
Über das ziegelrote Gesicht des Kapitäns huschte es wie ein froher Blitz. Dann war es wieder unbeweglich. Der Mann mochte noch schwer tragen an dem Verlust seiner geliebten ›Angela‹, den er vor einer Stunde mit hatte ansehen müssen.
»Hm. Ja. Großartig. Aber ganz überraschend kommt mir das doch nicht. Als ich nun zu ruhiger Überlegung und mir selbst kam, wurde mir klar, dass die uns nur etwas vorflunkern. Sie glauben es nämlich selber nicht so ganz. Dass die gesamte deutsche Kriegsflotte nur so in wenigen Stunden auf dem Meeresboden liegen kann, das ist auch diesen Seeleuten einigermaßen aufgefallen, wenn sie's auch so und nicht anders gehört und gelesen haben. Es muss auch sonst in diesen Breiten manches nicht stimmen. Ich möchte mein Urteil dahin zusammenfassen: Diese Engländer haben den Mund ungeheuer voll, aber mehr noch die Büxen.«
Dabei kniff er die Augen etwas ein, und ein flüchtiger Blick streifte uns.
»Ja, Jungens, was ich sagen wollte, es muss hier etwas nicht ganz stimmen. Funksprüche schwirren herum, und vorhin ist einer aufgefangen worden, dass alle Kriegsschiffe an einem uns natürlich geheimgehaltenen Sammelpunkt zusammengezogen werden. Da sollen auch keine Gefangenen dabei sein dürfen. Also kommen wir von Bord. Ein Dampfer ist in Sicht gekommen, der die englische Flagge zeigt. Man hat hin und her gewinkt, ohne dass die Fregatte ihre Fahrt gemäßigt hat, und es klappt alles. Der Dampfer geht nach Colombo und muss uns mitnehmen. In Colombo ist ein Sammellager für die Deutschen, die auf dem indischen Festland gefangengenommen wurden und die man nicht drüben behalten will. Alle werden dort festgenommen. Auch wir werden hingeschickt. Ob welche von uns als Neutrale anerkannt werden, das wird dort entschieden werden. Der russische Bootsen gilt übrigens als Finnländer auf einem deutschen Schiff für zweifelhaft und unsicher. Also: Alles klar zum Ausbooten! Rut!«
Wir waren ja fertig und brauchten nur unsere wenigen Habseligkeiten. Dort brachte man sie schon, die Kleiderkisten und Zeugsäcke.
»Und meine Bücher, meine sonstigen Sachen?«, fragte der erste Steuermann besorgt.
»Nee, Franz, mach' dir keine Hoffnung, dass du das mitbekommst — — ich habe getan, was ich tun konnte — — aber der Engländer lässt nicht mit sich reden. Der ist ganz kopfscheu geworden.«
Unseren Sachen sah man's an, dass sie durchwühlt worden waren. Doch waren sie wenigstens wieder verpackt und lagen geordnet an Deck. Unweit stand ein großer Dampfer. Er sah sehr stattlich aus, aber schmierig und verräuchert.
Der Kutter hielt schon bereit, uns aufzunehmen. Unsere Sachen wurden rücksichtslos hineingeworfen. Wir waren eben Gefangene. Bewaffnete Matrosen begleiteten uns. Wieder führte der Kapitänleutnant, der uns hergeleitet hatte.
»Übernehmen Sie für Ihre Leute die Verantwortung, dass sie keinen Widerstand leisten?«
»Was heißt Verantwortung«, begehrte unser Käpten auf, »was wollen Sie immer damit! Der Anmusterungsvertrag der Leute ist erloschen, als wir unser Schiff zwangsweise verließen. Kann nicht wenigstens mein erster Steuermann seine Bücher mitbekommen?«
»Also Sie übernehmen für das Verhalten Ihrer Leute keine Verantwortung?«
»Und mir liefern Sie wenigstens die alte Geige aus«, überhörte der Käpten die Frage des Engländers.
»Wenn Sie keine Gewähr leisten, werden Sie alle gebunden und gefesselt.«
»Tun Sie, was Sie nicht lassen können, und hängen Sie sich!«
Nun, zum Binden und Fesseln war's längst zu spät, denn wir saßen bereits alle im Kutter. Aber Kapitän Düwel bekam doch seine Geige und Mister Rugby das Bild. Mehr nicht. Die Angela ging also mit, dachte ich wehmütig. Ach du ferne, ferne Angela!
In fünf Minuten waren wir drüben. Die Matrosen hielten ihre geladenen Revolver in der Hand. Dann ging's an Deck das Fallreep hinauf. Dort wurden die Schwerverbrecher in Empfang genommen. So machte man's vor 2000 Jahren, wenn jemand das Verbrechen begangen hatte, zufällig zu einem Volk zu gehören, mit dem man im Krieg lag. Armseliges England!
Ja, ja, wir kamen auf ein englisches Deck. Lauter englische Gesichter ringsumher, ausnahmsweise in diesen Breiten kein Farbiger darunter. Man hatte die Matrosen und Heizer und Kohlentrimmer alle zusammen genommen. Wir konnten ja sehr gefährlich sein.
›Waterwitch of Aberdeen‹, lasen wir von Rettungsgürteln und Pützen (Holzeimern). Eigentlich war's ein Schotte. Das ist aber hier gleichgültig. Wer weiß, wie lange die ›Wasserhexe‹ nicht daheim gewesen war. Roh und verwahrlost genug schien sie. Besonders der Kapitän, ein echter John Bull, wie er im Buch steht, sah aus wie ein Viehtreiber. Einem Stall glich auch das ganze Schiff. War das ein Dreck hier! Es roch auch so eigentümlich. War's wirklich ein Cattleship, ein Viehdampfer? — Richtig, dort in den Ecken lagen noch ganze Dunghaufen. Die See schien lange nicht über Bord gespült zu haben, die Mannschaft noch weniger. Ich hatte doch gleich dem Kapitän angesehen, dass er mit Vieh zu tun hatte. Der Mannschaft auch. Es färbt immer etwas ab.
Der John Bull fluchte mörderisch.
»Ich bin für australische Schafe und Ochsen eingerichtet, auch für chinesische Schweine, aber nicht für deutsche!«
Natürlich half es ihm nichts. Er musste gehorchen.
Da machte er wenigstens sonst Schwierigkeiten.
»Sie müssen gebunden sein oder in den Ställen angeschlossen werden. Das bin ich meiner Reederei schuldig. Es handelt sich um die Sicherheit von Schiff und Mannschaft. Diesen blutigen Bestien ist alles zuzutrauen.«
Wenn einem Briten das Gewissen aufwacht, kann man immer auf eine sonderliche Gemeinheit rechnen. Dieser besann sich plötzlich auf seine Pflichten gegenüber seiner Reederei. Heute haben die Briten noch die Macht, und die Welt zittert vor ihnen, aber die Zeit ist nicht fern, da wird ihre Heuchelei sie zum Ekel und Abscheu aller Menschen machen, dass der britische Name überall verachtet ist, wo man ihn heute fürchtet.
Der Kapitänleutnant schien unschlüssig zu werden. Er blickte unsere Reihe entlang.
»Ich erkläre mich gegen jede unwürdige Behandlung!!«, rief Kapitän Düwel schneidend. »Von Binden darf gar keine Rede sein.«
»Ja, wenn Sie die Verantwortung übernehmen...«
»Dass Sie Milliooonen Trichinen kriegen mit Ihrer Verantwortung. Ich stelle fest, dass diese Männer mich nichts mehr angehen. Sie dürfen uns einsperren lassen, aber von Binden kann gar keine Rede sein und nun gar anketten! Das fehlte noch. Ich mache Sie für alle Folgen verantwortlich, die aus einer unwürdigen Behandlung deutscher Männer entstehen können. Verlassen Sie sich drauf!!«
O, unser Käpten wusste zu sprechen und zu betonen. Der Kapitänleutnant riss sich zusammen. Auch er kannte völkerrechtliche Bestimmungen.
»Nein, gebunden dürfen sie nicht werden. Wo wollt ihr sie unterbringen?«
John Bull musste sich fügen, wenn auch mit den nötigen Viehtreiberflüchen. Unsere Unterkunft war schon bestimmt. Unter der Back war die Segelkammer. Eine Luke wurde geöffnet und wir genötigt, einzeln, bewacht von Matrosen, die bereit waren, mit Handpiken auf uns loszuschlagen oder uns Messer in den Leib zu rennen, die steile Leiter hinabzuklettern.
Als ich mich anschickte, rückwärts hinabzusteigen, sah ich dort unter der Kommandobrücke zwei mongolische schlitzäugige Gesichter, die mit schadenfrohem Grinsen den Vorgang beobachteten. Es waren offenbar Japaner, wenn sie auch ganz europäisch gekleidet waren, die sicher nicht zur Mannschaft gehörten, sondern als Fahrgäste mitreisten. Das waren also auch unsere Feinde. Dass am 19. August der japanische Geschäftsträger in Berlin das bekannte Ultimatum wegen Kiautschou überreicht hatte, das wussten wir ebenfalls schon aus unserer Zeitung. Wir hatten's nur nicht beachtet, weil es uns zu unbedeutend erschien gegenüber all den Donnerschlägen, die uns getroffen hatten.
Die beiden Kerle hatten gut grinsen. Na, wartet nur, ihr gelben Schimpansen! Noch ist nicht aller Tage Abend.
Als wir in die Tiefe tauchten, ging gerade die Sonne unter. In diesen Breiten wird es in wenig Sekunden finstere Nacht. Ein ereignisreicher Tag lag hinter uns. Auf der ›Angela‹ war er begonnen, auf dem zweiten Gefangenenschiff ging er zur Küste. Unsere Sonne war schon am Morgen untergegangen, aber ein Licht lebendiger Hoffnung war am Abend aufgeleuchtet. Das sollte unsere Nacht erhellen. Vielleicht eine lange, bange Nacht. —
Unser Gefängnis lag noch unter der Wasserlinie. Also gab's keine Bullaugen. Eine Lampe bekamen wir nicht. Oben wurde die Luke schon wieder zugebolzt.
Wir tasteten uns schweigend in der Finsternis zurecht. Eine Erstickungsgefahr gab's nicht in dem leidlich großen Raum. Überall lagen zusammengerollte Segel. Auf ihnen konnten wir uns ausstrecken und uns einrichten, so gut es ging. Was für ein Verbrechen ist's doch, ein Deutscher zu sein! Oder war's vielleicht die Angst, die in unseren Peinigern alle britische Rohheit zum Erwachen brachte? —
Die Schiffsschraube ließ wieder die Planken erzittern. Unsere Fahrt begann. Was wird aus uns werden? —
»Na, nu wüllt wi en bäten slapen«, schlug ein Jan Maat vor. Nein, sie hatten den Kopf nicht verloren.
Was lag an uns! Drüben das Vaterland ging doch nicht unter. Das hatte unsere heutige Feierstunde uns gelehrt. Da kann man schon etwas tragen.
Aber zum Schlafen kam's doch nicht. Die Luke ward geöffnet, oben im Lampenschein zeigte sich ein Kopf.
»Es findet jetzt Gepäckuntersuchung statt«, hieß es höflich, fast freundlich. »Jeder wird einzeln heraufkommen, wie er aufgerufen wird. Das Gepäck wird euch nachher zugestellt. Dann gibt's Abendbrot. — Als erster: Kapitän Düwel.«
Der Käpten kletterte hinauf. Die Luke wurde wieder geschlossen. Aber es war doch wenigstens ein anderer Ton angeschlagen worden. Auch war viel wert, dass wir unser Zeug und Essen bekommen sollten.
Wieder öffnete sich die Luke:
»Mister Francis Rugby, erster Governor!«
Unsere Namensliste hatten sie also und gebrauchten sie. Die Mannschaft war ganz ruhig. Jeder wartete schweigend auf seinen Anruf.
»Mister Knut Larsen!«
Ich stieg hinauf. Ein Strolch, der sich dann als erster Offizier entpuppte, leuchtete mir mit der Lampe ins Gesicht. Vier Matrosen waren bereit, mir den Schädel einzuschlagen.
»Bitte, folgen Sie mir«, sagte der Strolch trotzdem höflich. Offenbar traute man den ›deutschen Bestien‹ nicht ganz und behandelte sie mit geziemender Vorsicht.
Schließlich hatten sie nicht unrecht.
Ich folgte dem ›Offizier‹ unter der Kommandobrücke durch in einen engen Gang zwischen Kombüse und einem Seitengelass. Da, als ich den Gang eben durchschritten habe, wird's plötzlich dunkel über mir. Ich merke, dass etwas Finsteres über mich gezogen wird, gleichzeitig werden meine Arme gepackt, Ketten klirren, und ich fühle eiserne Handschellen. Alles ging mit so abgepasster Schnelligkeit, dass ich keinen Gedanken fassen konnte.
»Ich protestiere«, wollte ich rufen, aber der Sack über meinem Kopf hinderte mich dran. Nun hörte die Höflichkeit auf. Ich wurde vorwärts gestoßen. Da ich wehrlos war, flammte der britische Mut auf. An einem unbekannten Ziel löste man die Handschellen, dafür schlang sich eine Kette um mein rechtes Handgelenk. Der Sack wurde mir vom Kopf gezogen.
Im schwachen Lampenschein sah ich mich in einem regelrechten Viehstall. Er war in ›Boxen‹ abgeteilt, offenbar für Rinder bestimmt. In jeder der schmalen Abteilungen waren Ringe, um bei schwerem Seegang die Tiere auch an den Füßen fesseln zu können. An solch einem Ring ward auch die Kette befestigt, die mein rechtes Handgelenk umspannte. Sie war so lang, dass ich gerade den Boden erreichen, also allenfalls liegen konnte, ohne die Hand in die Höhe halten zu müssen. Der Boden war mit faulem Stroh bedeckt und einer Düngerlage. Offenbar war seit dem letzten Viehversand nicht gereinigt worden, oder es hatten bis jetzt die Rinder hier gestanden und waren anderswo untergebracht.
Die Zwischenwände zwischen den Boxen waren geschlossen, aber immerhin durch Spalten unterbrochen. Ich sah, dass neben mir der Käpten angeschlossen war, jenseits von ihm der erste Steuermann.
Der Käpten protestierte nicht mehr. Er schwieg und ließ mit Würde geschehen, was die britischen Helden ersonnen hatten, die doch so gefürchteten Deutschen zu demütigen. Nichts kennzeichnet die Menschen und Völker so wie ihr Betragen gegen wehrlose Feinde. Nach dem Krieg wird man eine Seelenlehre der Kämpfenden auf Grund der schlichten Wirklichkeit aufstellen können. Wahrscheinlich wird dann das Geschwätz von ›großmütigen Nationen‹ sehr eingeschränkt werden.
Der erste Unteroffizier, der Bootsen, kam herein. Er wurde neben mir angekettet. Dann erschien Meister Bumbo mit dem Sack über dem Kopf. Er wurde genau mir gegenüber festgelegt. Dann der Segelmacher, der Steward, die Matrosen, alle, alle, wie die Schiffsliste sie ergab.
Es ging eigentlich sehr ruhig vor sich. Die Leute waren völlig ahnungslos und überrascht; sie glaubten, es ginge zum Abendbrot, dass sie an Widerstand nicht einmal denken konnten.
Aber jetzt hörte man draußen einen wilden Aufschrei, dem weitere folgten, die nicht so aus Wut wie der erste, sondern aus Schmerz ausgestoßen waren.
Da hatte sich also doch einer zur Wehr gesetzt. Wenn das nur nicht...
Richtig, es war der Sepp! Als er in der Box festgemacht wurde, schlugen seine Begleiter mit Fäusten auf ihn ein. Sepp hatte sich, wie später deutlich wurde, dem Sack und den Handsesseln freilich nicht entziehen können, hatte aber im gleichen Augenblick derartig mit den Füßen um sich getreten, dass er einem Matrosen einen tödlichen Tritt an den Leib beigebracht hatte.
Nachdem sie ihn weidlich geprügelt hatten, ließen sie den Übeltäter halbtot in seiner Box liegen. Wahrscheinlich lag er da besinnungslos mit zerschlagenen Knochen.
»Sepp!«, rief Kapitän Düwel gedämpft hinüber.
»Ay, Käpten«, erklang es sofort, etwas heiser.
»Wat makst?«
»Na, wat schall ick maken. Ick dös' en beten.«
»Bist du arg zerschlagen worden?«
»Ach, en Schmarrn«, klang's schon ganz vergnügt. »Wenn ick nur wüsst, wo ick mien Piep laten heff.«
Es liegt doch viel stilles Heldentum im Seemann, im Volk überhaupt. An diesem Wackern war meine Stimmung plötzlich ganz umgewandelt.
Nacheinander nahten die Übrigen. Die Ankömmlinge waren nun auch an den Füßen angekettet, und dasselbe geschah nunmehr auch mit uns.
»Lasst alles ganz ruhig geschehen«, mahnte der Kapitän, »alles ganz ruhig!«
Was hätten wir auch tun sollen! Unsere Peiniger traten immer mehrere Mann zugleich in jede Box, bereit, jeden mit dem Gummiknüppel niederzuschlagen, der den geringsten Widerstand geleistet hätte. Und ein Wort an diese edlen Briten zu verschwenden, wäre doch des deutschen Mannes unwürdig gewesen. Nein, mag die Eiterbeule von Feigheit und Heuchelei auslaufen in die Welt, solange die Giftstoffe da sind! Mag die Menschheit tragen, was sie so lange geduldet hat! Wir werden entweder die Welt freimachen von diesem Wesen oder ganz zugrunde gehen. Meine Rettung war es, dass ich etwa zwei kleine Schritte hin und her tun und mich niederlegen konnte. Dabei blieb der linke Arm frei. Doch drohten unsere Henker, auch den anschließen zu wollen.
Eben wurde der nächste in der Rangordnung, Ubbo der Schneesieber, angekettet. Da hörte man draußen einen entsetzlichen Schrei, furchtbar gellend, gleich darauf von einem Schmerzgeheul übertönt.
Nach Ubbo musste der tolle Hein kommen. Richtig, jetzt brachten sie schon den schlesischen Satan, offenbar hatte er die Schreie ausgestoßen oder verursacht.
Bei ihm war der Kunstgriff nicht geglückt. Er hatte schon bei dem Verlassen des Ganges gemerkt, dass ihm etwas geschehen sollte und war misstrauisch geworden. Es war also nicht gelungen, ihm den Sack überzustreifen. Seine Hände hatte man schon gefasst, aber ehe man die Arme auch packen konnte, war der aalglatte Jüngling noch aufgeschnellt, dem vor ihm stehenden Kapitän ins Gesicht gesprungen und hatte ihm die Nase abgebissen oder jedenfalls schwer verletzt. Das hatte die Schmerzensschreie verursacht.
»Es geschah nur aus Versehen«, entschuldigte er sich nachträglich, »ich hatte ihn eigentlich in die Kehle beißen wollen.«
Als ihn die Henkersknechte brachten, schlugen sie ihn nicht, sondern befestigten ihn ruhig in seiner Box an Füßen und beiden Händen. Sie waren selbst betreten vor Schreck, aber ihre Mienen kündeten Unheilvolles. Einer rief ihm im Weggehen zu:
»Na, mein Junge, du wirst ja morgen etwas erleben! Darauf kannst du dich verlassen.«
Wir erfuhren die Geschichte mehr von dem wachhabenden Matrosen als von dem Täter selbst. Der war wieder still und bescheiden, wie es seine Art war.
Das konnte allerdings für uns alle bös werden. Dass der verwundete Kapitän sein Mütchen an diesen deutschen Bestien kühlen würde, die so sicher angekettet waren, konnte man dem Briten schon zutrauen. Aber deshalb bekam Hein kein Wort des Vorwurfs zu hören.
Endlich waren wir alle neunzehn beisammen. Wir waren wenig aufgelegt zum Sprechen. Hätten's ja tun können. Der englische Matrose, der im Gang als Wache auf und ab ging, hätte es ruhig hören dürfen. Gefährlich waren wir angeketteten Gefangenen nicht mehr.
»Hein, hast du de Näs versluckt?«, hörte man da einen Jan Maat durch das Halbdunkel fragen.
Also der Humor war noch nicht ganz tot. Solange der Humor da ist, ist kein Mensch verloren. Erst wer den Humor verliert, der hat alles verloren.
Am schmerzlichsten war's für alle, dass man ihnen auch die Taschen umgekehrt und Pfeifen, Tabak, Streichhölzer, überhaupt alles entwendet hatte.
Die Zeit verstrich. Von dem versprochenen Abendbrot war nichts zu merken. Wohl aber bekamen wir Besuch. Die beiden gelben Japaner erschienen, gingen von Box zu Box, ließen einige deutsche Brocken fallen und fanden es für nötig, uns zu verhöhnen. Von Kiautschou freilich erfuhren wir nichts, aber einer zog ein Stück Würfelzucker aus der Tasche und bot es uns angeketteten Tieren an, natürlich, ohne uns sehr nahe zu kommen.
»Ssuckerchen, ssönes Ssuckerchen, wollen du habben?«
So kam er auch zu mir. Ich würdigte ihn keiner Beachtung. Niemand tat's. Nur in der Box mir schräg gegenüber ging Jochen Soßensnut auf den anmutigen Scherz ein, beugte sich tierartig vor, als wolle er das Gebotene mit den Lippen aufnehmen, und als sich der Japaner vorsichtig mit weit abgespreizten Fingern näherte, bekam er ins Gesicht eine solche braune Ladung Tabaksaft, dass die gelbe Fratze sich dunkelbraun färbte.
Es war nicht schön, aber verdient. Entsetzt prallte der Japs zurück. Ein blitzschneller Griff in seine Rocktasche. Nicht etwa nach Messer, Dolch oder Pistole, sondern nach dem — Taschentuch, mit dem er sich sein säuberlich abwischte. (Und das war auch sehr nötig, sonst wäre er schließlich noch darin ertrunken.)
Dann verschwand er schweigend. Nur einen Blick, einen bitterbösen Blick warf er noch zurück. Der verhieß auch für Jochen und wohl für uns alle nichts Gutes.
Schließlich kam doch das verheißene Abendessen. Man warf jedem ein wurmzerfressenes Stück Hartbrot auf seine Düngerunterlage und setzte daneben einen Napf Labskaus. Das ist ein berühmtes Seemannsgericht, das jeder kennt, der an der Waterkant war, gestampfte Kartoffeln mit Salzfleisch zusammengekocht, wozu gesalzene Gurken oder dergleichen gereicht werden. An sich schmeckt's vorzüglich. Dieses war versalzen und das Fleisch verdorben. Wollte man uns Durst erregen und kein Wasser reichen?
Jedenfalls war alles nur die Einleitung zu der Behandlung, die uns die edlen Briten zugedacht.
Die Nachtstunden schlichen dahin. Ich hatte mich auf mein ekles Lager gestreckt. Gestern war ich auf der ›Angela‹ eingeschlummert. Ich dachte an Angela, die auf weichen Teppichen geräuschlos wohnte, die so fern war, so unerreichbar fern, der helle Stern, von dem ein Strahl auch den Wurm im Schlamm trifft, ohne dass er's selbst weiß und merkt. Aber nein. Das konnte nicht sein. Ihre Gedanken mussten täglich bei uns weilen. Sie wusste, dass ihr Vater nicht verlassen wäre, solange ein Atemzug in mir war. Ihre Gedanken würden auch mich treffen.
Die Schiffsglocke glaste. Ich zählte zuletzt drei Doppelschläge. Elf Uhr.
Tiefe Stille. Einige Glückliche schnarchten. Der Wachtposten ging träge hin und her, zuweilen lehnte er irgendwo an einem Balken.
Ich dachte ans ferne Vaterland, für das wir hier gefangen lagen. Auch ein Heldentum. Aber das Vaterland war gerettet. Dass Deutschland nicht siegen könne, war völlig ausgeschlossen. Wenn wir auch jetzt das Nähere nicht wussten. Schließlich musste sich die Wahrheit auch in diesen Breiten, in der ganzen Welt bemerkbar machen. Ein geschlagenes England bedeutet Umgestaltung der ganzen Welt. Am Ende stehen wir jetzt in den Geburtswehen einer völlig neuen Zeit der Weltgeschichte. Es müsste denn sein, dass Deutschland untergeht. Aber Deutschland geht nicht unter. Das war immer das Schlussglied meiner Gedankenkette.
Da wurde meine Aufmerksamkeit auf mein Gegenüber gelenkt. Das war Meister Bumbo. Der schwarze Schiffskoch war herübergekommen, wie er die ›Angela‹ verlassen. Weiße Hose und Schürze. Aber den unteren Teil der Schürze hatte er wie eine Wurst zusammengerollt und sie sich als Gürtel um den Leib gewunden.
Jetzt lag er ausgestreckt. Dennoch musste er zappeln. Vielleicht schlief er. Dass der unruhige Ahasver auch im besten Schlaf alle Glieder herumschlenkerte, hatte mir schon der Bootsmann erzählt. Darum hatte er stets eine Kabine für sich allein gehabt, was sonst Unteroffizieren nicht zusteht. Aber er hätte jeden Schläfer gestört. Und wie er zappelte! Die Finger zuckten, die Knie schlotterten, die Beine zitterten. Dennoch klirrte keine Kette. Wo er angekettet war, hielten sich die Glieder ruhig. Ich konnte es deutlich erkennen, denn das Licht der Lampe fiel gerade in seine Box. Sein rechtes Handgelenk lag ganz still aus dem Stroh. Es war von der Kette umspannt. Aber die Finger krallten sich und streckten sich, als hätten sie Bach'sche Fugen zu spielen. Der ganze Arm zuckte und zitterte, aber die Kette klirrte nicht. Ebenso verschoben sich die Züge in dem pechschwarzen Gesicht unausgesetzt zu den unmöglichsten Fratzen, während die Augen geschlossen waren. Es musste doch wohl Nervenschwäche sein. Nur schien sie ihn nicht sonderlich zu belästigen. Er war stets guter und heiterer Laune.
Er schlief wirklich. Er fing sogar im Traum zu schwatzen an. Ein Gesang bildete sich.
Was mochte das für eine Sprache sein? Zuweilen klang's wie Französisch, aber ich verstand es nicht. Immer wieder kehrten die Worte, die wie Endreime eines Liedes klangen:
Oooooh Papaloa
Oooooh Mamaloa.
Dabei klang der Schluss immer wie das französische ›loi‹. Aber was bedeutete das: ›Vatergesetz?‹ — ›Muttergesetz?!‹ —
Ich zerbrach mir nicht weiter den Kopf. Irgendein Negergesang vielleicht französischen Ursprungs, obgleich Bumbo aus den Vereinigten Staaten stammte. Jetzt war er seit Jahren in Hamburg als deutscher Staatsbürger eingeschrieben.
»Sellimankassavakauo!!«, erklang es neben mir gebieterisch. So verstand ich wenigstens den Ausruf Kapitän Düwels.
Sofort verstummte der Gesang wie erschrocken, auch das Zucken, Zappeln und Gesichterschneiden hörte auf. Dafür begann plötzlich eine andere, fast unheimlichere Bewegung. Der Leib des schwarzen Negers geriet in Schwingungen wie eine bewegte See. Der Unterleib blähte sich auf wie eine Trommel und versank ebenso schnell zum Wellental. Dieses Zusammenziehen und Ausdehnen folgte sich überaus schnell, fast wie ein Zittern. Dann löste es sich wieder ab mit dem vorigen Zappeln und Gliederzucken.
Lange hatte ich diesem unheimlichen Gebärdenspiel zugesehen. Elf Uhr hatte es längst geschlagen. Vielleicht gelang es mir, einzuschlafen und Gedanken und Ereignisse des Tages zu vergessen. Angela! Da war ich wieder träumend angekommen, und die Wirklichkeit begann sich zu verwischen.
Auf einmal bekam ich einen leichten Stich von unten her in die Seite, auf der ich lag, etwa in die Achselhöhle.
Es war nicht schmerzhaft, auch kein eigentlicher Stich, aber eine nachdrückliche, empfindliche Bewegung.
Ich fuhr auf. Eine Schlange oder Ratte konnte es nicht sein. Da kam's wieder aus dem feuchten Stroh und noch einmal.
Was mochte das sein? Ich wälze mich zur Seite und grabe vorsichtig im Stroh. Unten ist eine Eisenplatte. Ein Loch von oder nach unten kann's nicht geben. Aber siehe! Da schiebt sich unter dem Stroh ein Stöckchen hervor. Ich fasse es und finde einen Widerstand. Am anderen Ende wird offenbar auch gezogen.
Ich räume also das Stroh weiter ab und verfolge den festgehaltenen Stock. Er läuft in der Richtung der Schiffswand und führt auf ein Speigatt. Das ist einfach ein Loch in der Schiffswand, bestimmt, etwaiges Reinigungswasser abließen zu lassen. Meist hat es außen oder innen eine bewegliche Klappe, die es verschließen kann. Immer offen stehende Löcher darf es in der Schiffswand natürlich nicht geben.
Es war so groß, dass man allenfalls eine Hand durchquetschen konnte, und in dieser Öffnung bewegte sich der Rohrstock hin und her. Schnell einen Blick nach dem Wachtposten. Der schien irgendwo zu schlafen. Dann bringe ich meinen Mund tunlichst nahe an das Loch und flüstere:
»Sst! Ist jemand da?«
Gleich kam eine deutsche Antwort, allerdings eine merkwürdige:
»Herr Le—le—leitnant, ge—ge—gennen Se mir noch?«
Mein Gott! Wo hatte ich diese Stimme schon gehört?
Ach richtig! Das war ja Pipifax, mein sächsischer Stubengenosse in meiner Dienstzeit.
Eigentlich hieß er Bifass. Die Familie mochte ursprünglich vom Rhein stammen, wo der Name häufig ist. Bifasser oder Beifasser ist ein Mann, der bei reicher Weinernte ein Beifass hat. Daher bildete sich das Wort Bifass zum Familiennamen aus. Wir hatten natürlich Pipifax daraus gemacht, weil bei dem ersten Appell, in dem jeder seinen Namen nennen musste, der unglückliche Stotterer vor dem Offizier nur herausbrachte:
»Bi—bi—bifass!«
»Wie heißen Sie? Wohl Bifass?«
Da konnte auch der ernste Kapitänleutnant ein Lächeln nicht unterdrücken. Für uns aber blieb er der Pipifax, zumal er noch das Glück hatte, aus Be—be—be—be—Berne, also aus Pirna an der Elbe, zu sein.
Diese Gestalt tauchte plötzlich vor meiner Erinnerung auf. Ein mittelgroßer, sehr magerer Kerl mit schlechter Haltung und Bäckerbeinen, ein strohblonder Kopf mit sehr großen, weit abstehenden Ohren, die Nase etwas nach Backbord verschoben, aber das ganze ausgemergelte, verlebte Gesicht von einem ewigen Lächeln und Feixen erleuchtet.
Er war noch vor Ende seiner Schulzeit daheim davongelaufen — der Vater war Droschkenkutscher —, und es war ihm geglückt, die weite See zu erreichen. Von Triest aus, nicht von der deutschen Waterkant. Er war viel zur See gefahren, ohne ein richtiger Seemann zu werden. Meist war er als Steward oder Koch — damals noch als Kochsmaat — gefahren. Aber überall nur halb und halb. Richtig warm wurde er nirgends an Bord, überall lief er von Bord. Dann hatte er sich in aller Herren Länder zigeunermäßig herumgetrieben, war in zwei Fremdenlegionen, der holländischen und französischen, eingetreten, aus beiden entkommen. Schon nach wenig Wochen.
Das war ein Herumtreiber, der in allen Wassern gewaschen und mit allen Hunden gehetzt war. Dieser war mein Dienstkamerad geworden. Das ist nämlich bei der deutschen Marine unverbrüchliches Gesetz, dass jeder Rekrut, auch der Einjährige, in der Kaserne wohnen muss, sobald man an Land ist.
Ich hatte gleich im Anfang eine gefährliche Kunst bei ihm kennengelernt. Ich besaß an meinem Schrank — meinem ›Spind‹ — ein Sicherheitsschloss von ganz besonderer Kniffligkeit und hatte den Schlüssel verloren, konnte mich also nicht zum Dienst fertig machen. Für Pipifax war das Kleinigkeit. Er nahm eine Haarnadel aus der Tasche, bog sie besonders, drehte ein Weilchen am Schloss herum und — auf war's. Später ließ ich einen neuen Schlüssel machen. Da erklärte der Kunstschlosser, es sei unmöglich, es mit einem Dietrich zu öffnen. Für Pipifax war's Kleinigkeit. Er behauptete feixend, er könne jedes, aber auch jedes Sicherheitsschloss mit einem Haken öffnen. Das sei seine Erfindung. Hm!
Was aber an Pipifax die bemerkenswerteste Eigenschaft war, das war seine unvergleichliche Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft unter allen Umständen. Er war nie ein Kriecher oder Schmeichler, aber die verkörperte Gefälligkeit gegen jedermann, sei er auch sein ärgster Feind.
Pipifax hatte einen, der ihn einmal schwer verprügelt hatte, ein roher Mensch. Damals hatte er nur in seinem rührenden Sächsisch gestottert: »Na wa—wa—warde nur, das wä—wä—wärschte noch bereien! —« und sich das Blut aus dem Gesicht gewischt.
Dieser Mensch hatte nach einer durchtobten Nacht und darauffolgender schwerer Dienstübung in Hitze, Regen und Schmutz einen Schlaganfall erlitten und lag tot in unserer Stube. Der Leutnant wurde gerufen. Er befahl den Toten liegen zu lassen, bis der Arzt käme. Nur säubern dürften wir ihn.
Da war's Pipifax gewesen, der sich des Leichnams annahm und niemanden zuließ. Er wusch, kämmte, rasierte den Kameraden, wusch ihn wieder, puderte ihn und richtete ihn her. Alles geschah mit seinem bekannten Lächeln, das hier beinah etwas Feierliches bekam, als er dem Toten den letzten Liebesdienst erwies.
Und ebenso hielt er's den Lebenden gegenüber. Mit jedem wollte er teilen, jedem helfen. Er war der denkbar beste Kamerad. Freilich fehlten ihm heimische Futterkisten, aber er hatte Geld mitgebracht und lebte gut. Sein Butternapf war stets gefüllt, seine Wurst stand jedem zur Verfügung. Als wir erst ausgehen durften, brachte er halbe Schnitzel, Beefsteaks, Täubchen, Brathühner, noch sehr brauchbare Schinkenknochen in Menge an. Alles für die Kameraden. Das wenigste für sich.
Wo er die herbekam? Nun, Pipifax hatte geradezu unheimliches Glück bei dem weiblichen Geschlecht. Was die an ihm fanden, habe ich nie begriffen, denn er war unansehnlich und eigentlich hässlich. Aber bekanntlich fragt danach die Liebe nicht. Er verkehrte aber nur mit Köchinnen allererster Häuser. Diese machten ihm die magenfreundlichsten Zuwendungen. Dabei bewunderte ich sein unnachahmliches Geschick, die vielen gleichzeitigen Liebschaften auseinander zu halten. Ich fragte ihn einmal, warum er die Verkäuferinnen in Bäcker, Wurst- und ähnlichen Läden verschmähe. »W—w—weil die alle m—m—mausen.« Die abgelegten halben Würste, Hühnchen und brauchbaren Schinkenknochen hielt er offenbar für regelmäßige Geschäftsanteile. Er brachte uns auch die feinsten Zigarren, rauchte aber selbst nur den gewöhnlichsten Knaster aus seiner Tonpfeife.
Er meldete sich als Koch und wurde es. Dazu gehört tadellose Führung. Da war es in seiner Abteilung eine wahre Lust, einmal in Arrest zu kommen — zu Vater Seemann, wie der Kunstausdruck lautet. Es war keineswegs leicht, etwas hineinzuschmuggeln. Wer etwa meinte, ein Kommissbrot aushöhlen, mit Butter füllen und wieder vorsichtig zukleben zu wollen, irrte sich. Vater Seemann und seine Gehilfen hatten den Kunstgriff, das Brot so wuchtig auf den Tisch zu werfen, dass jeder künstliche Deckel absprang.
Was Pipifax vorbereitet hatte, das hielt. Er hatte da auch seine eigene Erfindung, die abgelöste Rinde mit einer festen Masse wieder einzuzementieren und sowohl die eingebrachten wie die nachfolgenden Kommissbrote mit Butter, Wurst und Priemtabak aufzufüllen.
Das war sehr, sehr gefährlich. Kam's heraus, so saß er selbst im Loch und wurde schwer bestraft. Es brauchte nur ein unvorsichtiger Arrestant einmal eine Wurstschale liegen zu lassen. Aber Pipifax hatte allezeit ein geradezu unverschämtes Glück und wurde nicht erwischt.
So trieb er's drei Jahre. Ich war inzwischen Offizier geworden und sein Vorgesetzter. Da ich öfter die Küche zu beaufsichtigen hatte, kamen wir einander wieder näher. Er wurde vertraulich, ohne die Grenzen zu überschreiten. Beim Abschied aber wurde er vor Rührung ganz vertraulich:
»Herr Le—le—leitnant«, stotterte er, »wenn 'ch frei gomme, mit Sie me— me—mecht' ich mal fahrn. Dann woll'n mr mal zusamm sch—sch— schmuggln, und wenn mr an Land gehn, dann sch—sch—schtehln mr zusamm Färde. Na, da behiet Sie der liewe Go—go—gott!«
Das war Pipifax. Jahre lagen seit dieser Begegnung zurück. Ich hatte kaum mehr an ihn gedacht. Aber nun schraubte er durch dieses Speigatt sein unverkennbares sächsisches Stottern. Da stand er lebendig vor meinem Auge, und ich wusste auch, dieser allzeit Hilfsbereite würde das Äußerste für uns wagen. Es würde ihm auch gelingen.
Mit einen. Schlag war alle Schwermut weggeblasen. Die letzten Stunden waren doch recht niederschmetternd gewesen.
»Pipifax, bist du's?«
»Nu a—a—a—llemal«, stotterte es draußen. »Nur nicht so la—la—laut!«
Nein. Den Namen hatte ich fast gejauchzt. Aber der Posten hatte nichts bemerkt. Ein Schläfer mochte im Schlaf gesprochen haben. Neben mir der Bootsen sägte gerade Holz und war anscheinend an einen Knorren gekommen. Seine Säge gab fast pfeifende Laute von sich. Ach, wir angeketteten Gefangenen waren ja so ungefährlich!
Also machte ich durch mein Sprachrohr noch einige Feststellungen.
»Gehörst du zur Besatzung?«
»Ei cha. Ich bin do—do—doch der Goch. Awer ich segle unter falscher F—F—Flagge. Ich heeße doch Hektor O—O—Osgrave un bi—bi—bin ä Engländer.«
Dass dieser weltfahrende Seezigeuner ein tadelloses Englisch stotterte, wusste ich. Er fuhr also mit falschen Papieren.
»Wo bist du jetzt?«
»Nu, ich hä—hä—hänge doch butenbords in Sch—Sch—Schtricken.«
»Kannst du uns befreien?«
»Nu a—a—a—allemal, Herr Le—Le—Leitnant, das machn mr.«
Ach, wie das wirkte! Umarmen hätte ich diesen stotternden Rettungsengel mögen.
»Hast du schon einen Plan?«
»Nu nee. Hat der Herr Le—Le—Leitnant eenen uff der Pf—Pf—Pfanne?«
»Wir sind hier schwer gefesselt.«
»Nu, da—da—das weeß 'ch doch. Es muss a—a—aber f—f—fix gehn.«
»Warum?«
»Nu, weil der Junge dem Ga—Ga—Gabidän doch die Na—Na—Nase abgebissen hat.«
»Der Kapitän schnaubt wohl Rache?«
»Na, ich danke! Und wie noch! Das heeßt, sch—sch—schnauben gann er nich mehr. Awer morgen f—f—früh geht's los.«
»Was hat er mit uns vor?«
»Das weeß 'ch noch nich. Awer dem Ga—Ga—Gabidän Buller is alles zuzutraun.«
Also richtig hieß er Buller. Das hatte ich ihm doch gleich angesehen, dass er John Bull oder so ähnlich heißen würde.
»Der sch—sch—schind eich läbendich.«
»Ja, Pipifax, was machen wir da, um nicht lebendig geschunden zu werden?«
»Nu, das wolln wr sch—sch—schon machn. Wenn 'ch nur Gi—Gi—Gift hätte.«
»Gift??«
»Ja, Gift. Ich h—h—hadde mr Rattengift in Colon gegauft. Awer das gann mr wie Zucker fressen. Der Chinese hat mi—mi—mich ähm angesch—sch— schwindelt.«
Nun erfuhr ich, dass Pipifax in Colon von einem anderen Dampfer abgemustert und auf die ›Wasserhexe‹ übergegangen war, wieder als Koch. Die ›Wasserhexe‹ kam von London und war eines der wenigen Handelsschiffe gewesen, das schon den Panamakanal benutzt hatte. Als er anmusterte, war er schon der Engländer Hektor Osgrave gewesen und hatte sich die falschen Papiere ›besorgt‹. Auf englischen und amerikanischen Schiffen ist eine höhere Heuer. Darum gab er sich als Engländer aus, ohne dass ihm sein Gewissen geschlagen hatte. Inzwischen war der Krieg ausgebrochen. Da erwachte sein deutsches Gewissen, denn er musste sich auf einem deutschen Kriegsschiff stellen. Aber unter den eigenartigen Umständen des Weltkriegs gab er sich nicht zu erkennen. Es hätte auch keinen Zweck gehabt, da er ohne Weiteres gefangengenommen worden wäre. Vielmehr hatte er beschlossen, irgendeine Gelegenheit zu benutzen, zu entkommen. Dieser gerissene Bursche würde schon irgendeine passende Möglichkeit finden, seine vaterländischen Pflichten zu erfüllen.
Da kamen wir. Er hatte mich gleich erkannt, als ich das Schiff betrat, sich aber nicht zu erkennen gegeben. Im Gegenteil. Er hatte am meisten auf die bloody Germans geschimpft, bei den Ausschreitungen der beiden Matrosen hatte er die grässlichsten Racheflüche gehabt. Das entsetzliche Futter hatte er zubereitet. Die Deutschen seien nichts anderes wert. Auch jetzt hatte er sein Stöckchen wohlvorbereitet und mit einem Nagel versehen. Hätte man ihn bemerkt, wie er dort in den Stricken außenbords hing, so hätte er sich herausgeredet, er habe den Deutschen den Schlaf verderben wollen und sie mit Nägeln durch die Speigatts gepickt und beunruhigt.
Aber unser Plan war noch nicht fertig. Pipifax wusste nur, dass irgend etwas geschehen müsse.
»Oder«, fuhr er fort, »wenn 'ch nur an den A—A—Abodekerschrank gennte. Dann hätt 'ch wenigstens Morphium oder Obium.«
»Warum kannst du nicht zur Apotheke?«
Das hielt auch Pipifax für unmöglich, weil der Medizinschrank in der Schlafkabine des Kapitäns stand. Um ihn waren jetzt mehrere Menschen beschäftigt.
»Awer vielleicht geht's doch«, ermutigte er sich. Er wolle dem Kapitän einen kühlen Trunk anbieten, wofür er eine besondere Erfindung gemacht habe. Nur müsse er erst einmal in die ihm gänzlich unbekannte Kabine und mit ›ausbaldowern‹, wo eigentlich der Medizinschrank sei. Freilich, um 39 Mann in Betäubung zu versetzen, dazu noch die beiden Japaner, dazu bedurfte es schon einer ziemlichen Menge Morphium. Ich hielt es nun auch für das Beste, zunächst unseren Kapitän einzuweihen. Vielleicht kam ihm ein rettender Gedanke, wie wir von unseren Ketten frei werden und die Besatzung überwältigen könnten. Pipifax war ganz einverstanden. Er wusste schon, dass jener in der Box neben mir lag, dass auch dort ein Speigatt war.
»E—e—erzähl'n Se's ihm! In drei Minuten bin 'ch drieben.«
So lange Zeit brauchte er, um seine Stricke zu verschieben.
Kapitän Düwel lag ausgestreckt da und schien zu schlafen. Durch einen Spalt konnte ich ihn mit der Hand erreichen und stieß ihn leise an. Sofort war er munter und fragte leise: »Was gibt's?«
Ich berichtete ihm kurz.
»Dann ist mein Plan nicht nötig. Er wäre auch schwer auszuführen gewesen. Das ist ausgezeichnet. Aha — jetzt werde ich schon gestochen. Haltet Euch nur bereit!«
Er drehte sich um, schaffte sich einen Weg zum Speigatt. Ich hörte flüstern.
Bald wandte sich der Kapitän wieder zu mir.
»Alles in Ordnung. Wenn Gott will, sind wir morgen früh frei und Herren des Schiffs. Passt jetzt auf! Ahasver wird Euch etwas zuwerfen. Zwei Dinge. Ihr könnt sie besser auffangen als ich. — Sellimankassavakauo!«
Er hatte es nur mit leiser Stimme gezischt. Aber sofort sah ich, wie das Zucken und Zappeln meines Gegenübers erstarrte.
Es folgten noch einige Worte in einer mir fremden Sprache. Ahasver hob den Kopf und richtete sich halb auf.
Die Schritte des Wachtpostens kamen näher. Er schritt vorüber. Offenbar arglos.
Wieder leise Worte. Da sah ich, wie das schwarze Gerippe mit der Hand in den Mund griff. Dann wandte er sich halb um, aber noch immer bemerkte ich deutlich, dass er würgende Bewegungen machte. Der ganze Körper begann zu zucken.
»Fangt, was er Euch zuwirft«, flüsterte der Kapitän, »legt nur die Hand offen aus den Boden. Er wirft es schon hinein. Nur greift gleich zu.«
Ich öffnete die Hand. Da kam etwas geflogen. Ein Ei. Es war wie ein gewöhnliches Hühnerei. Nur braun.
»Opium?«, fragte ich, als ich's hinüberbeförderte.
»Ja. Wenigstens der Hauptsache nach, schon mehr Morphium in fester Form. Ein besonderes Erzeugnis, ganz geschmacklos und in Wasser löslich. Jetzt kommt noch ein Gegenstand. Es ist ein Messer und haarscharf.«
Wieder hatte der schwarze Koch gewürgt. Neben mir fiel das kleine Klappmesser ins Stroh, das ich am Nachmittag in der Hand des ersten Steuermanns gesehen. Beide Gegenstände hatte der Neger offenbar im Munde oder besser im Magen bei sich gehabt. Gesehen hab' ich's oft von Fakiren, auch auf Jahrmärkten, dass Menschen aus ihrem Innern die unglaublichsten Dinge herausbringen, wie Eier, Steine, Nägel, Scherben und ähnliche Leckerbissen. Wie sie das machen, war mir stets unerklärlich. Offenbar verstand auch Ahasver diese Künste.
Nun wusste ich auch, warum der Kapitän gerade ihn zum Einpacken in seine Kabine gerufen. Sein Magen musste ihm offenbar als Reisetasche dienen, in der er mitnahm, was er vielleicht für das bevorstehende Abenteuer gebrauchen konnte.
Der Kapitän schnitt von dem Ei ab, so viel er benötigte, reichte es durch das Speigatt, dann hatte ich wieder Messerchen und Ei, von dem freilich ein Viertel fehlte, ich warf's hinüber und sah noch, wie Ahasver es wieder in den Mund steckte, wenn er sich auch dabei abwandte.
»So, nun ist's in Ordnung«, sagte der Kapitän zu mir, nachdem er noch einmal das Speigatt als Sprachrohr benutzt harte. »Morgen früh, ehe es Tag wird, werden wir frei sein, wenn Gott es nicht anders beschließt. Am besten wäre es, das Betäubungsmittel im Tee des zweiten Frühstücks zu reichen, das auch der Kapitän und die japanischen Reisenden als erstes Frühstück einnehmen. Das ist um acht Uhr. Innerhalb von zwanzig Minuten wird dieser Tee von der ganzen Mannschaft getrunken. Die ablösende Wache beginnt mit diesem Frühstück zehn Minuten vor acht, die abgelöste fünf Minuten nach acht. Da besteht aber die Gefahr, dass der Kapitän seinen Rachegelüsten schon vorher nachgibt, bei Tagesanbruch. Also machen wir es schon um vier Uhr zum ersten Frühstück, zum Kaffee. Daran nimmt der Kapitän selten teil, die Japaner schlafen dann noch, aber das schadet nichts. Sie werden von unserem Retter eingeschlossen. Also schon halb fünf Uhr können wir die Nachricht erwarten, dass an Bord alles schläft. Dann werden wir von den Fesseln befreit. So Gott es will.«
So war er, unser Käpten. Keiner von denen, die stets von Gott sprechen. Tat er's aber, dann kam es aus offenem Herzen.
Wieder ging der Posten vorbei. Er war ganz arglos. Neben mir feilte der Bootsen gerade eine Eisenbahnschiene durch.
»Es wäre schließlich nicht nötig, die anderen einzuweihen, aber... wir wollen es ihnen nicht versagen. Sie sollen auch wissen, dass die Befreiung in sicherer Aussicht ist. Natürlich nicht ausführlich. Das Nähere brauchen sie nicht zu wissen. Sie sollen sich nur darauf gerichtet halten. Die Losung soll heißen: ›Morgen früh sind wir frei. Der Käpten hat's gesagt!‹ Dann sollen sie schlafen, aber Euch will ich noch einmal sprechen.«
Ich wandte mich zum Bootsmann, der allerdings schwer zu ermuntern war, ohne dass der Posten aufmerksam wurde. Er riss gerade 100 Meter Leinwand in einzelnen Absätzen durch und schien noch etliche Tausend vor sich zu haben. Endlich gelang es aber doch, ihn zu wecken. Er verstand sofort, und die frohe Botschaft schwirrte von Box zu Box, ohne nochmals auf die gleichen Schwierigkeiten zu stoßen.
»Wer ist dieser Mann?«, fragte der Kapitän.
Ich erzählte eine halbe Stunde von Pipifax.
»So, so. Er sollte lieber einen Engelsnamen haben. Nun, Stürmann, wollen wir auch noch ein paar Stunden schlafen.«
Der Kreis schloss sich. Mit dem Engelsnamen waren wir also wieder bei Angela angelangt, von der ich ausgegangen war. Jetzt sollte ich einschlafen. Es war schwer, diesem Befehl nachzukommen. Wir standen immerhin vor einem großen Wagnis. Würde es gelingen? — Wenn nun der Kapitän noch vor vier Uhr seine Rachepläne ausführte...
Aber es hatte keinen Zweck, solchen Möglichkeiten nachzuhängen. Wer wagen will, darf nicht an Nebensachen denken und allzu viele Möglichkeiten erörtern. Der Mensch muss Herr sein auch seiner Gedanken. — Ich dachte an Angela und warf die Möglichkeiten aus meinem Kopf heraus. Mit einiger Übung gelingt es immer, seine Einschlafgedanken zu meistern — ich dachte an Angela, und bald verschoben sich die Umrisse der Wirklichkeit.
Kettenklirren weckte mich. Ich hatte also fest geschlafen. Nun kam das Erwachen. Ein köstliches Erwachen, wenn Ketten abfallen und der Mensch frei wird!
Vor mir im Gange stand der Kapitän, ledig aller Fesseln, und streckte sich. »Jesaias zweiundfünfzig, zwei und drei«, hörte ich ihn murmeln. Eben wurde der erste Steuermann losgeschlossen. Dann trat ein Mensch mit großen, abstehenden Ohren in meine Box, um auch die Schlösser von meinen Fesseln feixend aufzuschließen. Er tat's ohne Schlüssel nach seiner eigenen Erfindung, und es ging schnell.
»A—a—all right, Herr Le—Le—Leitnant!«
Ja, ja, er war noch genau derselbe. Nur die Ohren schienen noch weiter abzustehen, der Mund noch größer geworden.
Es war wirklich alles in Ordnung. Es war mehr geschehen, als wir zu hoffen gewagt hatten. Kapitän Düwel hatte bei der Abmachung die Freiwächter vergessen, den Bootsmann, Zimmermann und die beiden Stewards der ›Wasserhexe‹. Pipifax hatte an alle gedacht. Die englischen Unteroffiziere hatte er in ihren Kabinen eingeschlossen, den Kapitän Buller in Schlaf gewiegt. Er hatte ihn halb vier Uhr in seiner Kabine stöhnen hören und ihm einen kühlen Trank eigener Erfindung gebracht mit den nötigen beruhigenden Zutaten.
Die Japaner konnte man nicht von außen einschließen. Die schlauen, misstrauischen Asiaten hatten Kabinen gewählt, die nur von innen verschließbar waren. Der eine von ihnen sollte ein ganz verzweifelter Bursche sein, der uns mit seinen japanischen Kunstgriffen noch sehr hätte zu schaffen machen können. Da hatte sie der Koch geweckt und ihnen eine stärkende Schokolade gebracht mit der Begründung, sie bedürften jetzt der Stärkung, in eimer halben Stunde würden sie etwas erleben. Der Kapitän ließe den deutschen Hund totpeitschen, mit dem anderen aber, der ihn gebissen, er noch ganz Besonderes vor.
Dafür waren die Japaner ohne Weiteres zu haben gewesen.
»Der Ga—Ga—Gabidän hätte auch wi—wi—wirklich so etwas gemacht. Er sch—sch—schprach von lebendig rösten.«
Die Mannschaft war vom Tee eingeschläfert. Eine Viertelstunde nach dem Genuss musste die Wirkung eintreten, erst langsam, dann mit plötzlicher Gewalt. Einen halben Tag währte die Macht des Mittels, dann hatte es außer einem Katzenjammer keine schädlichen Folgen.
Pipifax hatte einige umfallen und daliegen sehen. Auch unser Posten lag friedlich vor einer Box gleich auf den Eisenplatten.
Eben begann auch die Schiffsschraube einzuschlummern. Die Maschine wurde also nicht mehr bedient. Das Zittern der Planken wurde schwächer und schwächer, schließlich lief die Schraube ganz aus.
Inzwischen waren alle Ketten los. Wir verteilten unsere Leute in drei Abteilungen. Pipifax gab Anweisungen über die Lage der einzelnen Räume. Im Kartenhaus fand man die nötigen Waffen. Dann begannen wir planmäßig aufzuräumen.
Ich hatte eine kleine Abteilung zu führen, die zunächst die beiden Japaner in Sicherheit bringen sollte. Sie lagen in tiefem Schlaf in ihren Kojen und wurden gebunden.
Dann erwartete mich der Heiz- und Maschinenraum. Ich stieg hinab ins Reich der Nacht. Es war auch oben noch dunkel. Wir fanden die festgestellte Zahl der Heizer, Kohlenzieher und aller an der Maschine Beschäftigten, soweit sie zu der vorgeschriebenen Wache gehörten. Sie wurden gebunden und im Aschenhiv nach oben befördert. Zwei unserer Matrosen ließen wir unten, wieder die nötige Dampfspannung zu schaffen, wenn sie auch vorläufig nicht benutzt wurde.
Als ich wieder an Deck kam, hatte der erste Steuermann bereits die beiden Kabinen mit den Freiwächtern ausgenommen. Es war in aller Ruhe abgegangen. Der Bootsen hatte inzwischen mit dem größeren Teil der Leute alle Schläfer eingesammelt und auf Deck gelegt. Der Käpten war in der Kajüte des Kapitäns Buller. Ich sah auch diesen: Er lag schlafend in seiner Koje, das ganze Gesicht verbunden.
Die Gefesselten, die also meistens schliefen, wurden gut untergebracht. Nur einer würde nie mehr erwachen. Das war der Matrose, dem Sepp in den Leib getreten hatte. Er war bald darauf gestorben und hätte ohnehin heute sein Seemannsbegräbnis gefunden.
Kaum waren alle gezählt, so stieg die Sonne aus dem Meere und begrüßte uns als Herren der ›Wasserhexe‹, eines Schiffes von 4000 Tonnen.
Das war eine Freude! Es wurden schon allerlei kühne Pläne geschmiedet. Aber diese mussten schließlich durchberaten werden, ehe sie Wert hatten. Unsere Lage war an sich außerordentlich gefährlich.
Wichtiger war vor allem die Frage, was die ›Wasserhexe‹ in ihrem Bauch hatte. Ungefähr konnte Pipifax darüber berichten, das Genaue würde der Kapitän aus den Schiffspapieren feststellen.
Zunächst gab's wenigstens 1000 Tonnen Lebensmittel, meist Dauerwaren von Fleisch und Gemüse. Dazu eine Unzahl Mehlfässer für die englische Besatzung von Singapore und Colombo. Ferner mehrere Hundert Fässer Petroleum und schließlich ein ganzes Warenhaus. Wörtlich zu nehmen.
Naga Tenno heißt in Japan der Mann, der in Tokio und anderen Städten die Rolle spielt wie bei uns Wertheim oder Tietz. Er hat eines der größten Warenhäuser der Welt. Nun wollte er Zweiganstalten in Singapore und Colombo errichten, vielleicht auch in anderen Städten, die in Betracht kamen. Was er dazu nötig hatte, um auch den Geschmack der Europäer zu befriedigen, hatte er aus England bezogen, wenn es sich auch meist um deutsche Ware handelte. Die ›Wasserhexe‹ war bestimmt, alles das überzuführen, eine ungeheure Menge von Ballen und Kisten. Dabei sind 1000 Tonnen 2000 Zentner oder sechs bis sieben Eisenbahnwagen voll. Es konnte aber zwei- oder dreimal soviel Ware sein. Pipifax wusste es nicht genau.
Einer der begleitenden Japaner war zwar nicht Naga Tenno selbst, wohl aber sein Teilhaber, der den Einkauf in London, vielleicht auch in Deutschland, besorgt hatte und die Fracht begleitete. Denn überall an allen Küsten des stillen Weltmeers nisten sich die Japaner ein, um im gegebenen Augenblick das große Meer als japanisches Binnenmeer zu erklären und der englischen und amerikanischen Herrschaft ein Ende mit Schrecken zu bereiten. Die augenblickliche Freundschaft mit England ist für Japan nur ein JiuJitsu, ein japanisches Kampfmittel, den Gegner schnell wehrlos zu machen. Es ist keineswegs unmöglich, dass diese ehrgeizigen Pläne gelingen. Englands Weltrolle ist schon jetzt ausgespielt durch den Beginn des kurzsichtigsten Krieges, den es je unternommen. Immerhin kann ein Jahrhundert darüber vergehen. Aber Japan hat seine Sache gut vorbereitet. Außer den Waren dieser japanischen Vorkämpfer war noch allerlei Krimskrams geladen. Man nennt dergleichen Stückgut, Gelegenheitsfrachten aller Art. Der Schiffsbauch, der 4000 Tonnen schlucken konnte, war gefüllt bis zum Bersten.
So hatte Pipifax berichtet. Dann kam der Käpten. Es fand zunächst ein allgemeiner Kriegsrat statt, an dem alle teilnehmen mussten, auch die zwei Matrosen an der Maschine. Jeder wurde aufgefordert, seine Meinung zu sagen und mit Widersprüchen oder Vorschlägen nicht zurückzuhalten.
Unsere Lage war höchst bedenklich. Jedes am Gesichtskreis auftauchende Segel war fast sicher wieder ein Feind. Unter ›Segel‹ versteht der Seemann auch jeden Dampfer. Selbst der Weltbefehl für jeden Dampfer, der halten soll, lautet: ›Streicht die Segel!‹ Wir waren jetzt im Kriegszustand und hatten doppelte Wachsamkeit nötig. Auf diesen Linien fahren amerikanische Dampfer fast gar nicht, höchstens einige Holländer. Sonst nur Engländer und Japaner. Also Feinde.
Die Befreiung war gut und schön. Wir mussten aber wissen, was wir mit der Freiheit anzufangen hatten. Das Loslassen nützt nichts, wenn es nicht in nutzbringende Arbeit umgesetzt wird.
Die Frage im Kriegsrat war: Was fangen wir jetzt mit diesem Dampfer und den Gefangenen an? Wir sind auf der anderen Hälfte der Erdkugel, von Deutschland völlig abgeschnitten und möglicherweise auch von allen seinen Kolonien. Von Kiautschou und Samoa wussten wir's, vom afrikanischen Besitz vermuteten wir's.
Hätten wir genügend Kohlen in den Bunkern der ›Wasserhexe‹ vorgefunden, so hätten wir allenfalls die Fahrt um Afrika oder Kap Hoorn antreten können, wenn sie auch äußerst gefährlich war. Wir reichten mit unserem Brennstoff aber kaum bis Singapore, mussten vielleicht vorher eine Kohlenstelle anlaufen. Überall an Land und vorkommendenfalls auf See hatten wir uns nach unseren Papieren vor englischen Kriegsschiffen auszuweisen, und das ging nicht. Sie hätten uns einfach aufgeknüpft.
Wir hätten einen neutralen Hafen aufsuchen können. Der nächste wäre Batavia gewesen. Wir hätten auch irgendeinen amerikanischen Hafen anlaufen können. Aber dorthin war's weit, und aus keinem Hafen der Neutralen hätte man uns wieder herausgelassen. Und wenn man's tat, standen wir wieder vor der gleichen Frage wie jetzt.
Außerdem die südamerikanischen Staaten! Der Teufel mag ihnen trauen! Dort hat das Gesindel einen leichten Weg zur Regierung. Wenn da einige deutsche Dampfer mit wertvoller Ladung im Hafen lagen, konnte das allein Anlass werden, einen Kriegsgrund herauszusuchen und gefahrlos an Deutschland den Krieg zu erklären. Man brauchte nur einen deutschen Konsul zu beschimpfen und eine Ohrfeige als Gegenleistung einzustecken, und der Kriegsgrund war da! Man kann sich ja gar nicht vorstellen, welcher Mut diese Leute beseelt, wenn sie wissen, dass Deutschland die Hände gebunden sind und sie sich ungestraft an deutschem Eigentum vergehen können. Wenn ihre Presse außerdem so englisch bedient war wie die edle ›Calcutta Gazette‹, so war ja Zündstoff genug angehäuft, Mut und Begehrlichkeit zu wecken.
Es konnte schon sehr die Frage sein, was Nordamerika tun würde. In Nordamerika regiert englischer Geist, das Land ist durchseucht vom Dollarfieber. Nordamerika hat einmal eine große Zeit gehabt. Es hat die Freiheit auf seine Fahne geschrieben, edle Männer haben es geleitet und lange Zeit zu einem Hort der Freiheit gemacht. Aber diese Zeit ist längst vorbei. Damals hatte es sich unabhängig erklärt und nach schweren Kämpfen von England losgelöst. England musste die Unabhängigkeit anerkennen. Aber das kann ja England nicht, einen Bissen hergeben, den es einmal verschluckt hat. Verträge bestehen für England nur, solange es sie nicht brechen kann. England schlich in das befreite Land und eroberte seinen Geist und machte es ganz englisch, wie der ausgetriebene Geist im Evangelium, der seine frei gewordene alte Heimat liegen sah und sieben ärgere Geister nahm und sie von Neuem besetzte. Das freie Amerika wurde besetzt vom Dollarfieber und der Heuchelei und ist heute nichts als ein englisches Dominion. Vielleicht ist die Zeit nicht fern, wo es auch das Sternenbanner einziehen und im Osten ein zweites Kanada, im Westen japanischer Besitz wird. Es ist schön, frei zu werden. Man muss aber auch bestehen in der Freiheit.
Von Amerika hatten wir nichts zu hoffen. Wenn Deutschland wehrlos war, konnten da nicht auch die Yankees auf die stolzen deutschen Handelsdampfer ein Auge werfen und einen Kriegsgrund finden? Glaubt etwa jemand im Ernst an Edelmut oder Anstand in amerikanischer Politik? Haben die führenden Männer dort ihn je bewiesen, und wenn sie ihn hatten, waren sie nicht Drahtpuppen in den Händen ihrer Dollarkönige?
Was für gefährdete Werte deutsche Reedereien in aller Welt liegen hatten, davon konnten wir uns als Seeleute ein Bild machen. Sollten wir sie vermehren helfen?
Aber gesetzt, wir liefen bei den Neutralen einen Hafen an. Ob wir da für berechtigt angesehen wurden, diesen englischen Dampfer als gute Prise zu behalten, war doch sehr fraglich. Wahrscheinlicher war, dass diese edlen Hintermänner unserer Feinde ihn einfach wegnahmen. Wir waren Handelsleute, hatten gar nicht die Berechtigung zu kapern. Dazu gehört die Kriegsflagge und ein Kaperbrief irgendeiner anerkannten Macht. Fing aber ein neutraler Staat einen für ihn so gefahrlosen Krieg mit Deutschland an, so waren wir nichts mehr und nichts weniger als Seeräuber und wurden aufgehängt.
Das alles setzte uns Kapitän Düwel sachlich auseinander, und jeder hatte das Recht, seine Meinung zu sagen.
Da konnte Pipifax, der bisher geschwiegen hatte, seinen Mund nicht länger halten und stotterte heraus:
»Nu, da wär' mr ähm Bi—bi—raden, un wemmr nach Deitschland wolln, nu da gabern mr ähm Go—go—gohlenschiffe!!«
Das Wort war gefallen. Kapern. Ja, das wussten wir alle, dass ein Dampfer wie der unserige leicht mit jedem Segler fertig würde. Wir würden auch jeden gewöhnlichen Dampfer überwältigen können. Natürlich mussten wir unter englischer Flagge segeln, und Kohlenschiffe segeln in solchen Mengen um Kap Hoorn herum, dass wir nicht zu kurz kämen. Allein, das wussten wir auch, dass dieses Tun ohne Auftrag einer kriegführenden Macht, ohne richtigen Kaperbrief, Seeräuberei genannt wird, und für Seeräuberei wird man bestraft wie für Landräuberei. Man stellt sich außerhalb der Gesetze. Aber das Wort war aus der Mannschaft heraus gefallen. Der Kriegsrat musste Stellung dazu nehmen.
»Kinners«, nahm da der Kapitän das Wort, »wir können als einfache Handelsleute, die wir sind, nicht nach Deutschland gelangen. Es kommt also nunmehr der zweite Teil unserer Beratung dran. Diese wird an meiner Stelle der erste Steuermann leiten und euch die Sache zunächst in einer Rede auseinandersetzen. Ich weiß, was er euch sagen wird, und bin mit allem einverstanden. Ich muss aber jetzt noch einmal in die Kajüte gehen.«
Damit verschwand er, und Mister Rugby trat einen Schritt vor und begann:
»Leute! Kameraden! Lasst es mich euch ganz kurz sagen, wie unsere Lage ist. Wir haben keine Kohlen. Damit ist uns der Weg in die Heimat abgeschnitten. Ins Vaterland müssen wir aber eilen, weil wir alle gediente Leute sind, die sich im Krieg ohne Weiteres dem Heer oder der Marine zu stellen haben. Würde uns hier ein deutsches Kriegsschiff begegnen, so wäre die Frage erledigt. Wir würden uns dort zum Dienst melden, unsere Gefangenen übergeben, und das Kriegsschiff würde vermutlich den Dampfer versenken, da es ihn nicht als gute Prise nach Deutschland führen könnte. Es hätte auch die andere Möglichkeit, dieses Schiff als Hilfskreuzer auszurüsten und zum Kriegsschiff zu machen.
Es ist nach allem, was wir wissen, kaum anzunehmen, dass uns ein deutscher Dampfer begegnet. Wir haben auch nicht Zeit, einen zu suchen. Laufen wir einen neutralen Hafen an, so werden wir dort festgehalten und vermögen unserem Vaterland auch nichts zu nützen. Wir können ihm aber sehr viel nützen, wenn wir andere Schiffe anhalten, englische Schiffe, und diese kapern. Nur würden die feindlichen Mächte uns ohne gesetzlichen Ausweis nicht als Kriegführende, sondern als Räuber behandeln.
Kameraden, ein berühmter Engländer hat gesagt: Man muss dem Feind auf jede irgend denkbare Weise zu schaden suchen, gleichgültig, ob sie für gesetzlich gilt oder nicht. Denn Kriegführen heißt: dem Feinde schädlich sein. Von einem anderen habe ich's in der Zeitung vorhin gelesen: ›Es gibt jetzt keine Gesetze mehr. Wir haben nur treu zu sein gegen uns, gegen unsere Verbündeten, und Deutschland auszuhungern.‹ — Dass für Engländer keine Gesetze mehr gelten, das habt ihr gestern Abend und heute Nacht erlebt, und ausgehungert hätten sie uns auch. Warum sollen für Deutsche Gesetze gelten, die England missachtet? Ich frage euch also ganz einfach: Wollt ihr einen Seekrieg führen, auch wenn man uns nach dem Gesetz Seeräuber nennt und als solche behandelt?«
Ob sie wollten! Ein begeistertes Hurra war die Antwort. Keiner schloss sich aus, auch der Holländer Jasper nicht, der finnische Bootsmann nicht.
»Gut. Ich sehe euch an, wie ihr gesonnen seid. Ich weiß, der Deutsche fürchtet sich nicht, und dass wir ein gutes Gewissen haben, das weiß ich auch.
Für euch liegt nun die Sache so. Wir haben an Bord einen deutschen Offizier, den Leutnant der Marine Knut Larsen. Es hat zwar jeder von euch genau den gleichen Wunsch, seine Kräfte dem Vaterland zur Verfügung zu stellen. Aber ich möchte doch betonen, dass auch unser zweiter Steuermann als deutscher Offizier mit diesem Plan einverstanden ist. Mag man uns Piraten nennen, wir sind's nicht. Und für uns ist's die einzige Möglichkeit, ein deutsches Kriegsschiff zu erreichen und uns unter seinen Befehl zu stellen. Dann ist's mit dem Piratentum sofort vorbei. Dann sind wir deutscher Hilfskreuzer oder deutsche Marine.
Jetzt will ich aber auch von mir selbst sprechen. Ich habe euch schon gestern gesagt, dass ich guter Deutscher bin, wenn ich auch zeitweilig amerikanischer Bürger wurde unter einem fremden, angenommenem Namen. Ich darf den deutschen Boden nicht betreten, aber nur, weil ich freiwillig ein Versprechen geleistet habe. Es ist jedoch von vornherein bestimmt worden, dass dieses Versprechen nichts gilt, wenn das Vaterland in Gefahr ist, wenn Krieg ausbricht. Dann darf ich sofort deutschen Boden betreten. Und nun sollt ihr wissen: Ich bin auch deutscher Offizier, ich bin Stabsoffizier...«
Der Sprecher machte eine Pause. Ich sah, wie sein Blick erstarrte, und fühlte, wie er innerlich überlegte, als wollte er jedes Wort genau abwägen.
Als ich seinem Auge folgte, bemerkte ich, dass er es auf Pipifax richtete, der offenbar die Ursache der Pause war. Pipifax zeigte auf seinem Gesicht ein grenzenloses Staunen, dass er einen deutschen Stabsoffizier vor sich habe. Sein ewiges Lächeln hatte einem Ausdruck unerhörter Dämlichkeit Platz gemacht, der Mund war weit geöffnet, und die mächtigen Ohren schienen noch weiter vorgeklappt zu sein.
Aber Mister Rugby — so muss ich ihn ja weiter nennen, da er seinen eigentlichen Namen nicht zu sagen wünschte — fasste sich schnell und fuhr fort:
»Ihr alle kennt die Kriegsgesetze. Wir sind hier eine kleine Abteilung versprengter deutscher Soldaten. Da hat der älteste Vorgesetzte den Befehl zu übernehmen und auch vor dem Vaterland die Verantwortung für sein Tun zu tragen. In diesem Fall bin ich es und nach mir Herr Knut Larsen, der zweite Steuermann. Wir haben zwar nicht das Recht, euch etwas Ungesetzliches zu befehlen. Aber da dieser Weg, wie ihr selbst wisst und auch wollt, vorläufig der einzig gangbare ist, so werden wir euch auf ihm führen und für euch alle Verantwortung vor dem Vaterland übernehmen.
Aber nun lasst mich einen Schritt weitergehen. Gewiss. Auch ich sehne mich, nach Deutschland zu kommen und dort in die deutsche Wehr einzutreten. Als Freibeuter können wir auch vielleicht in die Heimat gelangen. Unser mitgebrachtes Schiff dürfte auch einen Wert für das Vaterland darstellen. Allein wir können unserem Vaterland noch ganz anders nützen, wenn wir vorläufig nicht zurückkehren. Wir können ihm hier nützen im indischen Weltmeer, indem wir die feindliche englische und japanische, möglicherweise auch französische Schifffahrt wenn nicht unterbrechen, so doch schädigen. Ja, wir wollen feindliche Schiffe wie dieses hier kapern, das weite Weltmeer steht uns als Kampfplatz zur Verfügung...«
Ein donnerndes Hurra unterbrach den Sprecher. Ein wahrer Jubel der Begeisterung machte sich Luft, die Mützen wurden geschwenkt, die Augen glühten! Das war's, was jeder im Stillen gedacht hatte. Die Worte des Steuermanns waren aus aller Herzen gesprochen und machten sie höher schlagen.
»Wir haben aber noch eine Möglichkeit. Gedenkt der letzten Nacht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich noch mehr deutsche Mannschaften auf den englischen Sklavenschiffen befinden, die angekettet und gemein behandelt in ihre Gefangenenlager geschleppt werden. Solche können wir befreien und ihre Henkersknechte der gerechten Bestrafung zuführen. Ja, wir können mit ihnen Schiffe bemannen, die uns jetzt feindlich sind. Wir können eine kleine Seemacht werden, die für Deutschland in diesen Breiten kämpft und dem Feind schon zu schaffen machen wird. Wir brauchen solche Befreiungstaten auch nicht dem Zufall zu überlassen. Wir könnten uns in neutralen Häfen nach Bewegungen feindlicher Schiffe erkundigen und ihnen den Weg verlegen. Kurz, die Möglichkeiten sind unbegrenzt...«
»Hurra! hurra! hurraaaa!« Auch ich musste in den allgemeinen Jubel mit einstimmen.
»Vielleicht können wir es sogar mit feindlichen Kriegsschiffen aufnehmen, wenn auch mit Hilfe von allerlei List. Und haben wir erst ein eigenes Kriegsschiff...«
»Hurra! hurra! hurraaaa!«
»Gut, Kameraden! Es wird gemacht. Auch unser Kapitän ist mit alledem einverstanden. Er wird, wenn ihr willens seid, wieder die Führung des Schiffs übernehmen...«
»Hip, hip, hip hurra für Käpten Düwel!«
»Aber nur unter einer Bedingung übernimmt Kapitän Düwel diese Führung, macht überhaupt Gemeinschaft mit uns in dieser Sache, und ich sage, es ist auch meine Bedingung, die ich stellen muss.
Macht nur nicht gleich so sauertöpfische Mienen, Kinder! Es ist kein Dämpfer, den ich da aufsetzen will.
Solange wir unter Handelsflagge segeln, solange stehen wir vor aller Welt als Piraten da, und was wir treiben, ist zunächst in den Augen der Welt Freibeuterei, wenn auch heute Kriegszustand ist und wir selbst ein gutes Gewissen dabei haben. Kehren wir glücklich in unsere Heimat zurück, so wird man uns dort nicht bestrafen. Man wird in uns die Helden sehen, die wir in ehrlicher Überzeugung und heller Kraft sind.
Wir werden unseren Krieg auch ritterlich führen, nicht, wie unsere Feinde getan haben. Wir sind keine Engländer, wir sind Deutsche. Wir werden auch unnütz kein Blut vergießen, und wenn wir feindliche Schiffe versenken müssen, nach Möglichkeit die Mannschaft bergen, wie wir's damals bei dem Wrack taten. Das ist bei uns ganz selbstverständlich.
Aber es ist etwas dabei. Es besteht die Gefahr, dass wir, wie unser Käpten sich ausdrückte, ›Kinkerlitzchen‹ treiben. Die deutsche Kriegsflagge dürfen wir unter keinen Umständen führen. Das verbietet uns das Gesetz, unter dem wir unverbrüchlich stehen wollen. Aber auch die deutsche Handelsflagge wollen wir nicht benutzen. Diese Bedingung ist's, die Kapitän Düwel uns stellt. Im Herzen werden wir stets Deutsche sein, aber in diesen unseren jetzigen Zustand, der vielleicht bald vorübergeht, wollen wir überhaupt die deutschen Farben nicht hineinziehen...«
»Na, da schaffen wir uns eine eigene Flagge an«, rief jemand und nahm mir damit die Worte vom Mund weg.
»Jawohl. Diesen Vorschlag wollte ich euch eben machen, im Namen des Kapitäns. Entwerft eure eigene Fahne! Ihr sollt ganz freies Spiel dabei haben.«
»Eine Flagge mit einem Teufel. Wir sind die Seeteufel!! Haben uns die Engländer die ›Angela‹ versenkt, so segeln wir mit der Flagge des Düwels!!«
»Das könnt ihr machen«, lächelte der erste Offizier. »Dagegen hat Kapitän Düwel gar nichts einzuwenden. Nennt euch Seeteufel, macht eine Teufelsflagge! Ihr Schrecken soll auf euern Feinden liegen. Wir wollen eure Flagge feierlich zu der unseren machen. Nur hat mich Kapitän Düwel beauftragt, euch zusagen: Wählt nicht gerade die rote Freibeuterfarbe! Das wäre ja gar nichts Eigenartiges. Und wir wollen ja keine Freibeuter sein und sind's auch nicht. Wir sind Kämpfer für unser Vaterland, wollen nur seine Flagge schonen für üble Nachrede. Rot darf dabei sein. Das schadet nichts. Aber es soll nicht die beherrschende Farbe sein. Und nun, Kinder — ich nenne euch so, weil ich manchem von euch Vater sein könnte —, da wir uns einig geworden sind, mache ich euch noch einige fröhliche Mitteilungen. Kapitän Düwel hat Kenntnis genommen vom Inhalt des Schiffes nach den Schiffspapieren. Es ist, als habe ein freundliches Geschick das alles vorausgesehen und uns diesen Dampfer, auf dem wir in Sklavenketten, nein, in Viehketten lagen, in die Hände gespielt. Gott verlässt keinen Deutschen. Dieser Dampfer hat nämlich unter seiner Ladung auch 1200 Tonnen Maschinen eingenommen für Singapore. Sie sind gut in Kisten verpackt und angezeigt als Maschinen für Landwirtschaft und Fabrikbetrieb, für Zucker und Baumwolle. So steht's in der amtlichen Erklärung. Aber unser Käpten hat bereits geheime Papiere gefunden. Nach diesen enthalten die großen schweren Kisten etwas ganz Anderes. Wie so oft, hat die englische Regierung auch hier gelogen und einen gewöhnlichen Handelsdampfer zur Verfrachtung von Kampfmitteln benutzt, um es recht geheim zu halten. Diese Kisten bergen in Wahrheit zehntausend englische Infanteriegewehre neuesten Musters für die Besatzungen von Singapore und Colombo...«
»Dunnerkeil!«, rief der Bayer.
»Und dazu drei Millionen Patronen.«
»Kommen auf jeden von uns fünfhundert Gewehre mit hundertfünfzigtausend Schuss, det jenügt«, rechnete uns da Beelzebub vor.
»Und ferner zwanzig Geschütze, darunter vier schwere, die zur Befestigung von Singapore dienen sollen. Dazu ausreichende Geschosse, Granaten, Hartguss, Kartuschen. Aber diese Kanonen sind keine einfachen Festungsgeschütze. Ohne Zweifel hat England sich lange auf den Krieg heimtückisch vorbereitet — es wäre nicht England, wenn's anders wäre. Diese Geschütze sind bestimmt, Handelsdampfer zu bewaffnen. Sie sind alle vom vierzölligen bis zum zwölfzölligen so eingerichtet, dass sie mit Leichtigkeit auf jedem Schiff aufgestellt werden können. Dazu ist alles vorhanden bis zur letzten Schraube und Niete.«
Hurra!! Das war eine Nachricht für uns altgediente Matrosen und Marineleute. Wir wussten, welche Bedeutung das für uns hatte. Wir konnten ja alle mit Geschützen umgehen.
»Ihr seht, Leute, es wäre an sich unsere Pflicht gewesen, die Ladung, die nur gegen Deutschland gerichtet sein kann, unbrauchbar zu machen. Aber wir werden sie brauchbar machen gegen England. In wenigen Tagen werden wir uns in ein schwerbewaffnetes Kriegsschiff verwandelt haben! Wir können uns ja nicht ohne Weiteres gegen einen regelrechten Man of war wagen. Dazu fehlt uns die Panzerung und die Schnelligkeit. Aber einen schwerbewaffneten Hilfskreuzer besitzen wir und können es mit jedem Handelsschiff, auch wenn es bewaffnet ist, getrost aufnehmen. Wir legen uns einfach in die Hauptlinien, unterbinden den Postverkehr zu den englischen und französischen Kolonien, wir... ach, was nur nicht alles machen! Nur müssen wir für mehr Hände sorgen.
Endlich etwas Anderes, Leute! Wollen wir diesen unseren Krieg führen, so müssen wir einen Hafen besitzen. Jedes Schiff bedarf eines Zufluchtsortes, eines Stützpunkts, an dem es sich immer wieder leistungsfähig machen kann. Wir könnten natürlich auch ohne solchen Wurzelgrund unsere Arbeit leisten. Kohlen, Lebensmittel, Trinkwasser liefert uns jedes Handelsschiff. Dennoch wäre es besser, einen sicheren Hafen zu besitzen. Ein neutraler Hafen kommt für uns nicht in Betracht. Wir brauchen ein sicheres Versteck, einen Schlupfwinkel, denn wir haben auch mit Gefangenen zu rechnen, die wir sicher unterbringen und ernähren müssen. Es wird nicht immer gelingen, sie auf andere Schiffe überzuführen und wegzuschicken. Es gibt viele Bedenken. Auch das Trinkwasser dürfte Not machen. Wir brauchen einen Kohlenplatz und vieles mehr.
Nun, Kameraden, ich will euch etwas offenbaren, was niemand weiß. Man sagt mit einigem Recht, es gäbe keine herrenlosen, unentdeckten Inseln mehr. Dennoch können solche jederzeit mitten im Weltmeer, besonders in diesen Breiten, entdeckt werden. Ich sage euch, es gibt Massen unentdeckter, unbewohnter Inselchen, Inseln, die vielleicht nie eines Menschen Fuß betrat, Inseln, die vielleicht erst im Entstehen sind. Es gibt auch gewaltige Inseln, deren Lage man wohl kennt, die aber niemand begehrt, weil dort nichts zu holen ist. Ohne Trinkwasser, ohne Pflanzenwuchs, ohne Kokospalmen — da nimmt auch kein Eingeborener sich die Mühe, seinen Ausleger an solche Plätze zu lenken.
Für unsere Lage ist's aber anders. Ich habe einmal eine Entdeckung gemacht. Durch Zufall fand ich ein Eiland von mehreren Quadratkilometern. Ich hatte eine eigene Jacht, eine Dampfjacht, und bin gerade in diesen Gewässern viel herumgefahren. Diese Insel hat freilich keinerlei Reize, aber sie besitzt einen ausgezeichneten Hafen, in dem eine ganze Reihe solcher Dampfer wie dieser Platz hätten, und sie hat Trinkwasser. Es ist freilich ganz versteckt, denn der vulkanische Lavaboden würde jeden Tropfen Wasser verschlucken, ein Brunnen wäre auch undenkbar. Allein dieses Trinkwasser verdankt sein Dasein einem merkwürdigen Geheimnis. Ich werde es euch erklären, wenn wir an Ort und Stelle sind. Denn diese Insel werden wir zur uneinnehmbaren Seefestung ausbauen, tatsächlich unbezwinglich. England hat uns dazu die Geschütze geliefert...«
»Hurraaa!!!«
»Unsere Geschütze reichen ebenso weit wie die der Kriegsschiffe. Sie könnten uns ja beschießen, haben aber kein Ziel. Sie selbst werden uns jedoch zum Ziel dienen. Doch davon später!
So. Das war's, was ich euch sagen wollte. Jetzt beratet euch untereinander. Besprecht alles, was ihr auf dem Herzen habt, auch wegen der Flagge. Ich werde jetzt dem Kapitän eure Zustimmung melden. Eure Freiheit wird freilich, wenn er das Kommando übernimmt, zu Ende sein. Denn wir haben gewaltig viel zu tun. Also, Herr Kamerad«, damit wandte sich der erste Steuermann zu mir, »treffen Sie jetzt, bitte, keinerlei Anordnungen. Überlassen Sie die Leute sich selber! Unsere alten Stellungen behalten wir bei.«
Er ging. Es tat mir wohl, dass er ausdrücklich bestimmte, unsere Stellungen blieben die gleichen. Er blieb erster, ich zweiter Steuermann. So gern ich mich ihm untergeordnet hätte, so blieben wir doch nebengeordnet, und es bezeugte seinen feinen Takt, dass er's so ließ. Aber unter den Jungens ging's los. Die waren in einem Freudentaumel, geradezu im Kriegsrausch. Es kann im Vaterland nicht anders gewesen sein, als die Kriegserklärungen von Ost und West und Süd und Nord einliefen. Wehe, wer Deutschland angreift und die teutonische Kriegsbegeisterung entfesselt!
Gleichzeitig dachte man aber lebhaft ans Frühstück.
Wir hatten redlich Hunger. Schon flatterte Ahasver in die Kombüse. Das war seine Ehre, seine Leute ganz allein zu versorgen. Mich lief Pipifax an. Er hatte noch ein ganz verdutztes Gesicht, es ging allmählich über ins Geheimnisvolle.
»We—we—we—er ist denn das?!«
»Mister Rugby, der erste Steuermann.«
»Den ha—ha—habe ich schon einmal gesehen.«
Und er berichtete: Vor einigen Jahren war's, in New York. Pipifax war zweiter Koch auf der Jacht des deutschen Gesandten. Auf dieser hatte ein kleines Fest stattgefunden, das bei aller anscheinenden Einfachheit doch einen politischen oder amtlichen Anstrich hatte. Viele Herren waren in voller Uniform erschienen. »U—u—und der da trug eine preiß'sche O—o— oberschtenuniform. Mir gam er gleich so bekannt vor, a—a—aber er trug den Bart damals anders.«
»Dabei ist doch gar nichts Wunderbares. Er hat ja selbst gesagt, dass er Stabsoffizier ist.«
»Nee, nee, Herr Le—le—leitnant, so eefach ist die Sache nich. Der als Gast des deitschen Gesandten...«
»Als Oberst wird er schon zu solchen Gelegenheiten eingeladen werden.«
»Nur als Oberscht? Nee, nee! Der wurde dort Ho—ho—hoheit angeredet oder...«
Meine Handbewegung schnitt dem Sprecher schnell das Wort ab. Ich schaute mich um. Niemand war in der Nähe.
»Hast du schon zu jemandem davon gesprochen?«
»Nee, nee, Herr Le—le—leitnant.«
»Dann schweigst du auch fernerhin! Hörst du, Pipifax? Uns geht das alles nichts an. Für uns ist er Mister Francis Rugby, unser erster Steuermann, so lange, bis er für gut befindet, uns selbst eine andere Aufklärung zu geben. Unter keinen Umständen darfst du etwas Anderes über ihn verbreiten.«
Er versprach's. Es war auch ein Dienstbefehl. Die Sache war damit erledigt. Der Kapitän kam. Er verlor über alle Abmachungen kein Wort und übernahm stillschweigend die Schiffsleitung.
Zuerst hieß es: Freiwillige vor! Wer meldet sich als Heizer und Kohlenzieher? Das war freilich etwas Anderes als damals die Rettung der Schiffbrüchigen. Nicht so gefährlich, aber vielleicht viel unangenehmer. Schon an sich ist's schwer, Heizer zu sein. Und wir waren in den Tropen!
Die ›Waterwitch‹ hatte zwölf Heizer, um volle Dampfspannung zu erhalten. Auf jeder Wache vier. Das zeigt allein, welch schwere Arbeit das ist. Jedenfalls konnte nicht die Rede davon sein, dass wir volle Fahrt machen wollten, 12 Knoten in der Stunde. Uns standen überhaupt nur acht Matrosen zur Verfügung. Mit dem Leichtmatrosen Ubbo war nicht viel anzufangen, und Hein konnte man dazu auch nicht brauchen. Es ist eine gar harte Arbeit, an die auch der stärkste Mann sich nur allmählich zu gewöhnen vermag, weil ganz ungewohnte Muskeln in Anspruch genommen werden, und der Rücken schmerzt in den ersten Tagen furchtbar. Auch das Kohlenstechen will gelernt sein.
Außerdem hatten wir an Deck genug zu tun. Die Gefangenen mussten bewacht werden, gerade weil wir sie nicht binden wollten. Die erste Fesselung konnte ja nur vorübergehend sein.
Freilich hätten wir die englischen Heizer weiter verwenden können. Der Gedanke tauchte auch auf, wurde aber sofort verworfen. Erstens hätte in den winkligen, finsteren Gängen jeder Mann dort unten einzeln bewacht werden müssen. Außerdem wollten wir die Gefangenen lieber nicht zu Frondiensten verwenden. Es waren Kriegsgefangene, keine Sträflinge. Sie waren in deutschen Händen. Da fehlt die englische Rohheit und muss fehlen.
Also wir mussten vorwärts zu kommen suchen, so gut es ging. Nur zwei Mann kletterten hinab, holten selbst ihre Kohlen heraus, schaufelten tüchtig nach, und wenn die nötige Dampfspannung erreicht war, trieben wir einige Meilen vorwärts, bis sich der Dampf erschöpft hatte. Anders ging's nicht, und wir hatten Zeit.
Die Übrigen machten zunächst einmal Reinschiff. Der Schmutz, der hier herrschte, war besonders für uns Jan Maate ein Gräuel. Das Schiff war ein Viehdampfer und dafür eingerichtet. Obgleich er andere Fracht hatte, hatte es doch seine alte Neigung nicht lassen können und einige hundert Rinder nach Colón aufgenommen für die Kanalarbeiter. Die Spuren dieser Ladung waren noch immer nicht beseitigt worden.
Wir arbeiteten mächtig mit Pützen und Besen. Ich genau so wie alle Anderen. Sogar Mister Rugby schwang den Wassereimer, der außenbords gefüllt wurde, weil die Dampfpumpe doch nur wieder Heizerkraft beansprucht hätte.
Dann kam ein geradezu glänzendes Frühstück. Zum ersten Mal speiste ich mit dem Kapitän und dem ersten Steuermann zusammen. Wir hatten eine geheime Beratung. Es handelte sich hauptsächlich um die Lage jener Insel, die unbedingt geheimgehalten werden sollte.
Dazu waren viele Gründe vorhanden, die Mister Rugby überzeugend entwickelte. Ich brauche sie nicht wiederzugeben. Jedenfalls wurde bestimmt, dass niemals die geografische Ortsbestimmung irgendeinem Anderen mitgeteilt werden sollte. Es durfte auch niemand von uns sie nur aufschreiben, damit ein solches Merkblatt nie in falsche Hände geraten konnte.
Von unseren Leuten hätte ja keiner eine geografische Ortsbestimmung machen können. Dazu gehört das Handhaben des Sextanten, die Berechnung der nötigen Formeln nach Handtabellen, Logarithmen und dergleichen. Aber es konnten solche Leute zu uns kommen. Es fahren genug Menschen als Matrosen, die längst ihre Steuermannsprüfung bestanden haben.
Sollten jemals solche bei uns eintreten, so musste ihnen das Ehrenwort abgenommen werden, dass sie nie eine derartige Ortsbestimmung machen wollten. Unser Schlupfwinkel musste ganz unbekannt bleiben. Es durfte auch in weitem Umkreis keine geografische Aufnahme veranstaltet werden. Ja, es wurde bestimmt, dass jeder seinen Sextanten, wenn er einen mitbrachte, abzuliefern hatte, um jede Möglichkeit zu beseitigen, in dieser Beziehung einem Verrat den Stoff zu liefern, mochte es beabsichtigt oder unbeabsichtigt sein.
Darüber sprachen wir am Frühstückstisch. Mir wurden diese Ziffern eingeprägt bis zur Zehntelminute, sodass ich sie unauslöschlich im Gedächtnis behielt. Mir allein sollte dieses Vertrauen geschenkt werden. Ich gab freiwillig mein Ehrenwort, meine Kenntnisse niemals auszusprechen oder niederzuschreiben, obgleich es mir nicht abgefordert wurde.
Ich darf unser neues Ziel darum auch nicht diesen Blättern anvertrauen. Ich werde nicht einmal den Kurs nennen, den wir einschlugen. Dafür kann ich anderes Wertvolles berichten. Jedenfalls fuhren wir mit frohem Mut, mit gutem Gewissen und im Bewusstsein, für unser teueres Vaterland zu kämpfen, dem geheimnisvollen Hafen zu.
Dann erwartete uns wieder schwere Arbeit.
Sechs Tage vergingen. Schneckengleich kroch der Dampfer dahin. Eine halbe Stunde Fahrt wechselte mit einer halben Stunde Pause, in der die nötige Dampfspannung erzeugt werden musste. So bewegten wir uns wenig vorwärts. Wir hatten auch Zeit.
Die ›Wasserhexe‹ war mit Funkvorrichtungen ausgerüstet. Wir befanden uns also jederzeit in der Lage, die Funksprüche aufzufangen, die das Weltmeer durchflogen, und konnten uns durch sie vor feindlichen Kriegsschiffen warnen lassen. Wir selbst verhielten uns ganz ruhig. Aber wir vernahmen auch nichts. Das Meer ist dort einsam.
Trotzdem hatten uns die sechs Tage in anderer Beziehung vorwärts gebracht. Weil wir nicht alle Mann an die Feueröfen schickten, waren bereits vier Geschütze an Deck aufgestellt, zwei fünfzöllige und zwei achtzöllige. Es war keine leichte Arbeit gewesen und nahm unser technisches Können in ungeahnter Weise in Anspruch. Solche Geschütze baut man nicht auf, wie ein Kind seine Kanonen gegen Bleisoldaten hinstellt. Wir wollten nicht nur schießen, sondern auch treffen. Da kam es bis auf den Millimeter an, um die Löcher zu bestimmen, die in die Eisenplatten des Schiffs zu bohren waren, und immer wieder musste gerechnet, gerichtet, geändert werden.
Es war eine harte Geduldsprobe gewesen. Dafür saßen aber schon die ersten Granaten, die wir auf eine schwimmende Scheibe in der Entfernung von 5000 Meter abgefeuert hatten. Wir waren recht zufrieden mit unseren Leistungen.
Trotzdem war es eine wichtige Frage für uns, ob wir dieses mächtige Fahrzeug ferner als unser Kriegsschiff benutzen konnten. Jedenfalls würde uns ein kleineres und schnelleres erwünschter sein, während die ›Wasserhexe‹ als Stationsschiff oder Kaserne dienen konnte. Es fehlte sehr an Menschenkraft für das große Schiff.
Aber wir hatten nicht umsonst gearbeitet, wir hatten viel Erfahrung gesammelt. Die Arbeit der sechs Tage würde künftig in weit kürzerer Frist gezwungen werden können. Das war zunächst das wichtigste Ergebnis.
Der Stille Ozean trägt seinen Namen mit Recht. Nicht, dass er nicht toben und wüten könnte. Im Gegenteil hat er Stürme, die alles sonstige Sturmwesen weit hinter sich zurücklassen, aber er ist einsam. Still liegt seine schier unermessliche Fläche. Zwischen Südamerika und Australien fehlen die Verbindungen überhaupt, die übrigen Dampferlinien sind wenig zahlreich. Man braucht nur ihren Lauf zu meiden und ist in Einsamkeit und Stille. Einmal sahen wir von Weitem ein Segel. Es zeigte die holländische Flagge. Wir ließen es natürlich unbelästigt. Es wäre auch die Frage gewesen, ob wir uns an einen Engländer oder sonstigen Feind herangewagt hätten. Noch waren wir nicht fertig. Auch wollten wir keinen fremden Dampfer ins Schlepptau nehmen. Dann wäre es noch langsamer gegangen. Etwas Anderes wäre es gewesen, wenn ein feindliches Schiff deutsche Gefangene an Bord oder auch nur mehrere Deutsche unter seiner Besatzung gehabt hätte. Dann hätten wir wohl jeden Kampf gewagt, denn wir brauchten Leute.
Daher blieben wir geduldig die ›Waterwitch‹ aus Aberdeen und zeigten auch der holländischen Brigg die englischen Farben, obgleich unsere Flagge schon fertig war.
Die Jungens hatten ihre Erfindungsgabe angestrengt, bis sie sich auf einen von vielen Entwürfen geeinigt hatten. Unsere Farben waren Blau und Rot. Ein blaues Meer, das von einem Seebeben aufgewühlt wird, aus dem rote Flammen hervorbrechen, welche die Gestalt eines gehörnten Teufels annehmen. Er war nur im Oberkörper sichtbar, hielt aber in der Krallenfaust einen Dreizack als Harpune. Also mehr ein Neptun, der ja schließlich auch eine Art Dämon ist. Das Schiff, gegen das der Dreizack gerichtet war, hatten sie klüglich weggelassen. Wir wollten eine Flagge, keine Briefmarke herstellen.
Unser Stromer hatte den Entwurf gefertigt und erwies sich dabei als wahrer Kunstmaler. Er hätte ebenso gut Plakatkünstler sein können wie Segelmacher. Ich war ehrlich überrascht von seiner Kunst, hatte mich auch absichtlich nicht hineingemischt.
Ebenso erging's Mister Rugby. Er erklärte: »Sinngemäßer hätte die Zeichnung gar nicht gemacht werden können. Unser künftiger Schlupfwinkel verdankt wirklich einem Seebeben und Vulkanausbruch sein Dasein.«
Der Kapitän billigte den Entwurf. Danach wurde die Flagge gearbeitet in zwei Ausfertigungen. Die eine malte man mit wasserfesten Farben, bei der anderen schnitt man die einzelnen Gestalten aus verschiedenfarbigem Tuch und nähte sie auf. Diese Arbeit hatte der Segelmacher mit besonderem Geschick geleistet. Dabei waren natürlich verschiedene Ballen des Warenhauses untersucht worden, um die nötigen Tuche zu finden.
Es war der siebente Tag unseres neuen Daseins. Er sollte für uns sehr bedeutungsvoll werden.
Früh acht Uhr übernahm ich die Backbordwache. Noch immer war das herrlichste Wetter, die See lag glatt wie ein Spiegel, als ich aus meiner Koje trat. Der erste Steuermann begab sich dann unter Deck und würde sich nicht eher wieder zeigen, bis er mich ablöste.
Auch der Kapitän hielt sich in der Kajüte auf.
Ich rechnete das mir von Mister Rugby übergebene ›Besteck‹ nach, d. h. die letzte geografische Ortsbestimmung. Da erklang der Ruf: »Ein Stow— away! Ein Stow—away!«
So nennt man in der Seemannssprache einen Menschen, der sich heimlich ins Schiff eingeschlichen, sich eigenmächtig ›verstaut‹ hat, um als blinder Reisender sich einzuschwärzen.
Dass man jetzt auf der ›Waterwitch‹ einen Reisenden finden konnte, der das Fahrgeld hinterzogen hatte, war einfach erstaunlich. Zehn Tage war das Schiff von Panama unterwegs gewesen, seit sieben Tagen waren wir die Herren — hatte der Mensch etwa von Konservenbüchsen gelebt, wo hatte er das Wasser her? Die Matrosen brachten den Sünder, den sie im Laderaum entdeckt haben wollten, aber wie sah er aus! Ein geckenhafter Stutzer in funkelnagelneuem schwarz- und weißgewürfelten Anzug, Bügelfalte mit roter Weste, schneeweiße Vatermörder bis an die Ohren, lang vorfallende Manschetten, tadelloser blanker Zylinder, Lackschuhe, dicke goldene Kette nebst Uhr, an der die dichtberingten Finger spielten: Wer war dieser Kerl mit dem flachsblonden Backenbart?
Einen Augenblick grübelte ich darüber nach, wie der Mensch in dieser Aufmachung drei Wochen verborgen geblieben sein konnte, und starrte und starrte den Ankömmling an. Jemand rief: »Häbbt Ji all so'n fien Stow— away sehn, Stürmann?«
Da gingen mir die Augen auf.
»Ach, das ist ja der Stromer!«
Und dann kam noch eine ganze Reihe höchst fein ausgestatteter Herren, die Handschuhe über die roten Seemannsfäuste gezwängt und goldene Uhren an sich baumeln hatten.
Das war ein Spaß für unsere allzeit zu Scherz aufgelegten Jungens! Sie hatten bei dem Aussuchen von Tuchen und Leinwand zum Verdecken der Schiffskanonen diese Warenhausballen entdeckt, und jemand hatte den Gedanken ausgesprochen: Der zweite Steuermann hat Wache, der Kapitän schläft noch. Da können wir's wagen.
Und ich freute mich. Nichts bezeugt den guten Geist einer Mannschaft mehr als goldenes Lachen in ernsten Zeiten der Arbeit und Gefahr. Mit Kopfhängern kann man nichts wagen, mit Lachern alles.
Dass sie sich trotzdem immer auf Posten wussten, bewies der nächste Augenblick.
»Da treibt etwas.«
Es schien nichts von Bedeutung zu sein, was da schwamm. Es war auf Steuerbord noch weit voraus und nicht zu erkennen. Immerhin musste es gemeldet werden. Hätte Kapitän Düwel es gesehen, ehe es ihm von anderer Seite gemeldet wurde, hätte es etwas gegeben. Es wäre ein Zeichen allgemeiner Unaufmerksamkeit gewesen.
Es wird viel ins Meer geworfen, aber wenig sieht man treiben. Selten wird eine Flaschenpost gefunden.
Ich lenkte das Ruder ein wenig nach Steuerbord. Wir mussten dicht dran vorüberkommen. Es schien ein Balken zu sein, der aufrecht im Wasser stand, doch erkannte ich bald oben ein Knie. Der Gegenstand hatte einen rechtwinklig gebogenen Ansatz. Ein sonderbares Ding, das so senkrecht schwimmen konnte.
»Da—da—das is ja ene Pe—Pe—Peri«, ließ sich da Pipifax neben mir vernehmen.
»Eine was? Eine Peri?«
»Nu allemal.«
»Was ist denn das — eine Peri?« Vor mir schwebte eine persische Fee, eine holde Teufelin, die wegen eines kleinen Fehltritts aus dem Paradies der Unschuld geworfen wurde, wie sie uns in Thomas Moores herrlicher Dichtung ›Lalla Rookh‹, später auch in Robert Schumanns Tonschöpfung ›Paradies und Peri‹ geschildert ist.
»Mensch, was verstehst du unter einer Peri, was willst du überhaupt hier mit der Peri?«
»Nu, das is doch de Peri von einer U—u—unterseeboot!«
Hallo!! Das war allerdings eine Erklärung.
»Du meinst ein Periskop?«
»Nu ja! Man nennt's ooch eine Be—be—berischgop.«
Er blieb bei seinem weiblichen Geschlecht. Er sagte auch »die« Unterseeboot und »die« Schiff, wie die Seeleute tun. Man sagt, es käme vom Englischen her, und hat die Regel aufgestellt, dass alles, was sich durch eigene Kraft bewegt, weiblich sei. Aber mir scheint, das hat tiefere Ursachen. Die Engländer sind doch auch Germanen, Angelsachsen, die einst in Ostfriesland saßen, und der Ostfriese sagt heut noch »die Schipp«, wie auch wir alle sagen: »die ›Friedrich der Große‹«, — »die ›Leipzig‹«, wenn wir ein Schiff meinen. Auch sucht man immer eine Dame, die solch ein Schiff weiht. Warum? Das ist die Erinnerung an die weihende Priesterin. Das Schiff war der Frau geheiligt. Es war die Gattin oder Mutter des Mannes, der er sich auf dem wilden Meer anvertraute, bei der er Ruhe und Sicherheit suchte. Es war seine ›Angela‹.
Ich hatte aber nicht Zeit, solchen Gedanken nachzuhängen, die immer zum gleichen Punkt zurückführten.
War dies das Periskop eines Unterseeboots, dann war das ja eine nette Überraschung. Es konnte nur ein feindliches sein und nur Böses für uns bedeuten. Jetzt sah ich's auch deutlich, dass es sich nicht etwa um ein gebogenes Ofenrohr oder dergleichen handelte. Zugleich stellte ich noch fest, dass das Periskop nicht auf uns gerichtet war und dass schwerlich ein Unterseeboot uns so nahe herankommen lassen würde. Da musste etwas nicht in Ordnung sein, sonst hätte es sich wohl anders bemerkbar gemacht, als nur ein Fühlhorn ausgestreckt. Oder war's nur ein abgebrochenes Periskop, das einsam im Meer trieb?
Doch nein. Wir sahen schon das ganze Fahrzeug liegen. Sein dunkler Rücken lag nahe unter dem Wasserspiegel. Es war ein mächtiges Ding. Ich schätzte es auf mindestens 80 Meter.
»Stopp!«
Der Kapitän erschien. Auch Mister Rugby kam sofort.
»Das ist tot! Ohne Besatzung. Das ist geschleppt worden und verlorengegangen!«
Richtig. Dort am Bug war ein Tau durch einen Ring geschoren. Das Tau war gebrochen, gerissen.
Eine kleine Beratung. Dann gingen wir ans Werk. Vorsichtig, ganz vorsichtig fuhren wir längsseit. Die beiden Winden wurden klargemacht, geeignete Haken angeseilt. Aus dem Rücken des Bootes gab's Ringe genug. Das Einhaken machte keine Schwierigkeiten. Das Boot war noch nicht zwei Meter unter Wasser. Die Haken konnten mit einer Stange gelenkt werden.
»Wer weiß mit einem Unterseeboot Bescheid?«, fragte der Kapitän.
Ich nicht. Im Allgemeinen wusste ich ja etwas vom Unterseeboot, aber ich hatte nie eines betreten. In der Marine wurde die Sache ziemlich geheimgehalten. Niemand wusste etwas Näheres. Doch einer meldete sich. Pipifax.
»Da—da—das ist eine Ho—ho—hollandboot —«, stotterte er.
»Du meinst, ein holländischer Typ?«
»Ja, eine Ho—ho—hollandboot. Das ist eine amerikanische Boot.«
Der Erfinder des ersten brauchbaren Unterseebootes war ein Amerikaner namens Holland.
»Woran willst du denn gleich erkennen. dass das ein amerikanisches Unterseeboot ist?«
»Nu, ich bi—bi—bin doch ein Vierteljahr in einer Holland gefahren als ä—ä—älektrischer Goch.«
»Was? Du bist auf einem amerikanischen Unterseeboot gefahren?«
»Nu allemal!«
Erst jetzt erfuhren wir, dass dieser Land- und Seezigeuner unterdessen auch in der amerikanischen Marine gedient hatte! Auf fünf Jahre hatte er sich verpflichten müssen, war aber schon nach einem halben Jahr heimlich davongelaufen. Von dieser Zeit hatte er die Hälfte auf einem Unterseeboot als Koch verbracht. Was das für uns zu bedeuten hatte, sollten wir bald erfahren. Ohne ihn wären wir überhaupt nicht fertig geworden und wären wahrscheinlich bei dem ersten Tauchen auf den Meeresgrund getrudelt, um dort für immer liegen zu bleiben.
Die Haken saßen. Gleichzeitig wurde das Boot angehoben. Da erlebten wir die erste Überraschung. Hui!, wie leicht das ging! Dazu wären die Dampfwinden gar nicht nötig gewesen. Das hätte man mit den Händen heraufziehen können. Nur zuletzt musste kräftiger gehievt werden, bis der etwas gewölbte Rücken über dem Wasser lag.
Bald standen wir drauf. Die Hauptluke war deutlich zu erkennen. Sie konnte von außen geöffnet werden. Der Verschluss wurde aufgeschraubt, der Deckel ging hoch. Wir prallten zurück. Ein heißer Brodem schlug uns entgegen. Dazu kam ein entsetzlicher Geruch. Verwesung.
»Da ist ein Unglück geschehen.« — — — Zwei Tage später lagen wir noch an derselben Stelle und beschäftigten uns mit dem Boot. Wir konnten noch nicht einmal ungefährdet eindringen.
Wir verwandelten die Dampfpumpe in einen Luftaussauger, um die giftigen Gase zu entfernen. Endlich am Abend des zweiten Tages verlöschte die eingeführte Laterne nicht mehr in der Stickluft. Sie beleuchtete eine Leiche, die an der steilen Treppe lehnte.
Am nächsten Tage wurde weiter gepumpt. Gleichzeitig wurde geschwefelt und mit Chlorkalk entgiftet. Der Bootsmann wurde angeseilt, um einzudringen. Fast hätte er seinen Wagemut mit dem Tod bezahlt. Halberstickt wurde er wieder emporgezogen. Aber schließlich gelang es doch einzudringen.
Wir krochen durch die engen Räume. 25 Leichen wurden gezählt. Sie waren in der beginnenden Verwesung. Ihre Todesursache konnten wir nicht feststellen. Nur Pipifax vermochte es. Der Untergang dieser Mannschaft war durch keinen technischen Fehler, keine Entladung irgendwelcher Art herbeigeführt worden, aber durch Leichtsinn. An der Vorrichtung, welche die durch Atmung und Verbrennung der Gase in den Maschinen entstandene Kohlensäure absaugte und presste, um sie zur Kühlung heißgewordener Maschinenteile zu verwerten, stand eine Schließklappe weit offen, und die Kohlensäure war frei entwichen und hatte das Innere des Bootes erfüllt. Ehe man das Ausströmen des giftigen Gases bemerkt hatte, war schon alles erstickt gewesen.
Dieses Unglück war, wie wir aus den Papieren berechnen konnten, vor etwa fünf Tagen eingetreten. Zwei Tage vorher war das Unterseeboot von dem Dampfer, der es geschleppt hatte, verloren worden.
Die Papiere, die wir in der Kapitänskajüte fanden, einem Raum, in dem man sich kaum umdrehen konnte, gaben weitere Aufschlüsse.
Das Unterseeboot war auf einer Werft in San Francisco erbaut worden im besonderen Auftrag des Erfinders. Die allgemeine HollandBauart wies zahlreiche Verbesserungen und Neuerungen auf. Bei einer Wasserverdrängung von etwa 1000 Tonnen war es 90 Meter lang, 7 Meter breit und 4 Meter tief. Die Heizung war nur für Petroleum eingerichtet; die Motoren entwickelten 2000 Pferdestärken, die das Boot über Wasser 20, unter Wasser 12 Knoten oder Seemeilen laufen ließen (1 Seemeile = 1855,11 Meter). Der Bewegungshalbmesser betrug 5000 Seemeilen; diese Strecke konnte das UBoot also zurücklegen, ohne seinen Heizstoff erneuern zu müssen. Das statische Tauchen — d. i. das Untertauchen durch Wasserballast — erfolgte innerhalb einer Minute. Das UBoot konnte 40 Stunden unter Wasser bleiben. Acht Abschussrohre waren angebracht und die ungewöhnlich große Anzahl von 60 Torpedos. Sonst sind 20 schon viel; aber hier hatte man anderswo gespart und Raum für 60 geschaffen. Im Allgemeinen kann man ein Unterseeboot von solchem Ausmaß auf 36—40 Mann Besatzung berechnen. Hier genügten 25 Mann. Endlich war der Panzerturm, der natürlich versenkbar war, mit zwei kleineren Revolverkanonen und einem schweren, siebenzölligen Geschütz ausgestattet. Das war allerdings eine große Neuerung. Dadurch konnte das Boot auch über Wasser tatkräftig in ein Gefecht eingreifen und einen Hafen beschießen.
Alles das hatte ich erst zu lernen. Es fiel mir nicht leicht, mich in die neue Aufgabe hineinzudenken. Es war keinem leicht.
Für uns war die neue Frage, was wir mit diesem amerikanischen Boot anfangen sollten. Sollten wir's ohne weiteres mit Beschlag belegen?
Aber die Schiffspapiere leiteten uns auch hier. Der Erfinder des Bootes war ein gewisser Richard Dragon. Er hatte es für eigene Rechnung erbauen lassen, um es der amerikanischen Marine zum Kauf anzubieten. Allein daraus war nichts geworden. Die englische Regierung hatte von dem glänzenden Boot, das schon zwei Probefahrten glücklich bestanden hatte, gehört und es sofort gekauft. Der ›Seadragon‹, wie der Erfinder das Boot sehr nett mit seinem Namen genannt hatte, also der ›Seedrache‹, war mit voller Besatzung, Ausrüstung und Bewaffnung auf dem Weg nach England gewesen und von einem englischen Kreuzer geschleppt worden. Natürlich hatte es durch den Kanal von Suez fahren sollen. Das Schleppseil war gebrochen, das Kriegsschiff hatte das Boot verloren, die Besatzung war dem Unglück zum Opfer gefallen.
Die englische Regierung hatte das Boot mit 150 000 Pfund Sterling (das sind 3 Millionen Mark) bezahlt.
Natürlich gehörte es jetzt uns!!
Hurra! Nun brach der Jubel erst noch einmal los! Und der Name ›Seedrache‹ passte gerade recht gut zu uns. Dass wir gar nichts mit ihm hätten unternehmen können oder wenigstens lange, lange Monate gebraucht hätten, um uns durch mühsame Versuche in seinen Gebrauch hineinzutasten, das ahnten wir damals noch nicht. Als wir so jubelten, wussten wir nicht, dass wir wahrscheinlich gleich beim ersten Tauchen verloren gewesen wären. Es sollte uns aber bald klar werden.
Mit dem ganzen Triebwerk, das wir da vor uns hatten, wussten wir zunächst nichts anzufangen. Das war ein ungeheuerliches Gewirr von Hebeln, Klappen, Drähten und sonstigen geheimnisvollen Getrieben. Wir standen davor wie die Kinder vor einer Dampfmaschine. Das muss mühevoll gelernt und verstanden werden. Das weiß auch die Marine. UBoote herzustellen, ist nicht so schwer, aber die Mannschaft dazu ausbilden, das ist sehr schwer.
Ein UBootFührer wird hundert- und tausendfach erprobt, ehe man ihm Schiff und Mannschaft anvertraut. Er wird auch nie von seinem Posten entfernt. Er ist mit seinem Tauchboot verwachsen wie der Reiter mit seinem Ross und noch viel, viel mehr. Er kennt die geringste Schwäche seines Fahrzeugs. Da versagen mathematische Berechnungen zuweilen vollständig. Er und die Mannschaft müssen alles im Griff haben. Alle Werkzeuge, die Menschenhand gemacht, haben Fehler und Ungenauigkeiten, denen man nur durch unendliche Übung zu begegnen lernt. Darum ist der UBootFührer gar nicht, die Mannschaft nur schwer ersetzlich. Deshalb gibt's auch da keine Versetzungen, nicht einmal Beförderung. Man kann den Führer durch Orden und Zulagen entschädigen, aber er bleibt immer der Kapitänleutnant seines UBoots. Darauf ist er stolz. Kommt dann seine Zeit, so kann er auch gleich die nächsten Dienstgrade überspringen.
In dieser Verlegenheit erhielt nochmals Pipifax für uns die Bedeutung eines rettenden Engels. Zwar war er nur Koch auf einem amerikanischen UBoot gewesen, aber doch ein Vierteljahr lang, und dieser Zigeuner war, was man einen Schnüffler nennt. An sich hervorragend für knifflige Dinge begabt, hatte er das Vierteljahr gut ausgenutzt, die ganze Anlage zu erfassen. Es war ja doch ein Hollandboot. Dort kannte er jeden Handgriff, und was ihm fremd war an dieser neuen Bauart, das hatte der verschmitzte Bursche bald erfasst.
Er wurde also unser Lehrer im UBootWesen. Ich als sein ehemaliger Vorgesetzter sagte ihm ausdrücklich, wir seien nun seine dummen Rekruten, die zum ersten Mal ein Gewehr in die Hand bekämen und von der kleinsten Schraube an lernen müssten, damit umzugehen. Jedes vorlaute Wort seitens der Matrosen wurde streng verboten, und Pipifax musste täglich unterrichten.
Er fand sich auch in diese ungewohnte Lage. Er ging vor unserer Reihe auf und ab und begann seinen Unterricht. Anfangs stotterte er stark, aber wenn er einmal in Zug gekommen war, hörte auch das Stottern auf oder milderte sich wenigstens. So erklärten bald die sächsischen Laute die Geheimnisse des amerikanischenglischen Unterseeboots.
Wir änderten zunächst unsere ganze Fahrtweise. Der ›Seedrache‹ wurde ins Schlepptau genommen. Dann ging alles, was nicht an Bord unbedingt erforderlich war, vor die Feuer oder schleppte Kohlen heran, bis Volldampf voraus gegeben werden konnte. Waren dann die Leute körperlich ermüdet und von der ungewohnten Arbeit erschöpft, so wurde alle Mannschaft aufs UBoot beordert zum Unterricht, wobei sie sich in körperlicher Ruhe wieder erholen konnten.
Zwei Tage später vermochte der ›Seedrache‹ die ›Wasserhexe‹ schon in eigener Kraft zu begleiten und zu umspielen. Petroleum hatten wir reichlich an Bord. Für ihn war also besser gesorgt als für uns.
Dann begannen die ersten Tauchversuche. Wie gefährlich sie sind, ahnt der Laie nicht.
Das Untertauchen geschieht, wie selbstverständlich ist, durch Einnehmen von Wasserballast. Jedes UBoot hat zweierlei Tanks (Wasserbehälter), die gleichmäßig über das ganze Schiff verteilt sind: die Haupt- und die Hilfsballasttanks. Sind die Haupttanks vollgelaufen, wobei die Luft nach außen entweicht, so ist die Schwimmfähigkeit des Bootes genau aufgehoben. Es müsste der Rechnung nach schon das kleinste Gewicht, schon wenige Pfund genügen, das Boot zum Sinken zu bringen. Dieses Sinken müsste aber ein ganz gleichmäßiges sein, das erst auf dem Meeresgrund sein Ziel findet.
In der Wirklichkeit muss es anders gehandhabt werden. Man lässt noch ein Mehr von Tragkraft von etwa 100 bis 150 Kilogramm bestehen. Dann schneidet das Verdeck gewöhnlich an der Wasseroberfläche ab. Nun lässt man Wasser in die Hilfstanks einlaufen, so weit als nötig ist, noch den letzten Auftrieb zu überwinden.
Dazu gehört eine außerordentliche Erfahrung und Sicherheit. Selten ist ja die Wasserfläche ganz glatt. Ist sie aber bewegt, so macht das fast gewichtslose Boot die kleinste Wellenbewegung mit und schaukelt wie eine Barke im Wasser nach vorn und hinten. Dadurch ändert sich beständig die Oberfläche des Wassers in den Tanks, Luftblasen entstehen, welche die ganze Berechnung empfindlich stören. Die Sinkkraft spottet überhaupt der Berechnung. Das kann alles nur durch große Erfahrung gelernt werden.
Dieses Boot konnte bis auf eine Tiefe von 30 Meter hinabgehen. Das ist sehr tief. Ein vierstöckiges Haus hat noch nicht 20 Meter Höhe. Wir konnten unser Boot also aus einer Tiefe von 30 Meter wieder heben, indem die Hilfstanks entleert wurden. Das geschieht durch Einlassen von Pressluft oder Auspumpen des Wassers durch den Elektromotor oder allenfalls durch Handpumpen.
Aber das hat seine Grenzen. Ist der Wasserdruck draußen stärker als die innen wirkende Kraft, so ist ein Auspumpen nicht mehr möglich, und das Boot sinkt in alle Abgründe der Meerestiefe. Bei uns war die Grenze bei 30 Meter. Hätten wir diese überschritten, so gelangten wir in die Tiefen des stillen Weltmeers von 5000 Meter und waren dort festgenagelt für ewig.
Allenfalls kann man noch Gewichtserleichterungen schaffen, wir konnten etwa den unten befestigten Anker lösen. Er wog 700 Kilogramm, aber das hat in solchen Tiefen des Wasserdrucks wenig zu sagen.
Nein, wenn wir je unsere Tiefe von 30 Meter überschritten, so waren wir rettungslos verloren. Von außen war keine Hilfe zu erwarten.
Das sind die Gefahren, die jedem UBoot drohen. Ich habe hier aber nur vom einfachen Tauchen, dem sogenannten statischen Tauchen, gesprochen, während das Boot ruht. Man kann aber auch während der Fahrt ein Untertauchen erzielen, indem man den vorderen Teil beschwert und die Schraube weiter arbeiten lässt. Dadurch wird aber die Sache noch viel verwickelter.
Wenn man trotzdem selten davon hört, dass ein UBoot auf diese Weise verloren geht, so kommt das nur daher, weil das Tauchen im seichteren Wasser so außerordentlich geübt wird, dass Führer und Mannschaft eine Sicherheit erlangen, die ein ungewolltes Untertauchen fast unmöglich machen.
Wir mussten überaus vorsichtig sein. Ehe wir in wirkliche Tiefen hinabgingen, hatten wir auch den geringsten Handgriff gründlich zu lernen, wollten wir nicht Schiff und Mannschaft aufs Äußerste gefährden.
Getaucht haben wir freilich bald. Aber nur wenige Meter tief. Dann lehnte Pipifax jede Verantwortung ab, wollte nicht einmal an Bord bleiben, wenn Versuche angestellt wurden. Das eigentliche Tauchen für den Ernstfall könne nur an Untiefen geübt werden. Dabei blieb er und hatte gewiss Recht. Wir mussten uns also zufrieden geben.
Dagegen versuchten wir's gleich mit zwei Torpedos. Im Torpedowesen hatte ich viel Erfahrung und war besonders darin ausgebildet worden. Der Matrose Luzifer war während seiner Dienstzeit sogar am Abschussrohr der Erste gewesen. Es ist auch hier die alte Geschichte: Was unsereins mit all seiner höheren Mathematik meist nicht im Kopf hat, bekommt der einfache Mann in die Hand.
Als Ziel dienten uns Bojen, wasserdichte, das sind Blechkisten, die etwas beschwert waren. Der erste Schuss wurde aus 300 Meter in gerader Richtung abgegeben. Er saß richtig. Bei dem zweiten musste der Torpedo auf 800 Meter Entfernung mit eingestelltem Steuer einen großen Bogen beschreiben. Unter der Hand Luzifers ging der bronzene Riesenfisch von mehreren Metern Länge ab, beschrieb seinen vorgeschriebenen Halbkreis und ließ die Boje unter einer Wasser- und Feuersäule verschwinden. Das war nicht Zufall, sondern Rechnung und Treffsicherheit.
Ein Torpedo bohrt sich nicht in sein Ziel ein. Es genügt ein heftiges Aufschlagen, ihn zur Entladung zu bringen. Damit hat er seine Arbeit getan. Von Einbohren ist keine Rede. Die Zerstörung wird bewirkt durch den Wasserdruck. In freier Luft würde ein Torpedo seinem Ziel, wenn es durch starke Eisenplatten geschützt ist, wenig schaden. Anders im Wasser. Da ist der sich fortpflanzende Druck so ungeheuer, dass er auch die stärksten Panzerplatten eindrückt.
Angenehm war, dass auch auf dem ›Seedrachen‹ die nötigen Funkvorrichtungen vorgesehen waren, wenn auch noch nicht eingebaut.
So hatten wir uns schon zu einer kleinen Kriegsmacht entwickelt. Ein winziges Geschwader, das für Deutschland am fernsten Ende der Erde kämpfen konnte.
Hurra!
An Gelegenheit zum Kampf sollte es nicht fehlen.
Heute Nachmittag würden wir unser Ziel erreichen. Morgens 10 Minuten vor 8 Uhr wurde ich vom Steward gepurrt, um meine Wache zu übernehmen. Wenn ich die Wache auch tatsächlich nicht ging, sondern mich zur Übung auf den ›Seedrachen‹ hinüberbegab, so mussten die Zeiten doch eingehalten werden.
Aber aus meinen UBootsÜbungen sollte heute nichts werden.
»Sie möchten gleich zum Herrn Kapitän in die Kajüte kommen«, meldete der Steward.
Ich schluckte meinen Kaffee und verschlang schnell ein paar Butterbrote. Dann trat ich bei dem Kapitän ein. Der ging erregt auf und ab und änderte diese Haltung auch nicht während unserer Unterredung.
»Stürmann«, begann er unvermittelt, »Ihr wisst doch, was drahtlose Telegrafie ist?«
»Gewiss, Herr Kapitän, ich hoffe sogar die Vorrichtung dazu auf dem ›Seedrachen‹ anbringen zu können.«
»Nein, so meine ich's nicht«, kam es ungeduldig. »Habt Ihr schon von den Vaudoux gehört?«
Nein. Ich wusste nichts. Ich verstand ›Wodus‹ wusste nicht, wie es geschrieben würde, und dachte ab besondere Schiffsarten.
»Nun, Vaudoux nennt man in Mexiko und ganz Mittelamerika die Schlangenanbeter. Sie heißen auch Teufelsanbeter, sind meist Neger, die den Schlangendienst aus Afrika mit herübergebracht oder von ihren Vorfahren geerbt haben. Am häufigsten sind sie noch auf Haiti, wo überhaupt alles schwarz ist. Habt Ihr noch nie von diesem Schlangendienst gehört, der besonders in Dahomey und an allen Küsten in Übung ist?«
Jawohl. Davon hatte ich schon gehört. Jetzt entsann ich mich auch des Wortes Vaudoux.
Meine Bestätigung genügte. Auf weitläufige Erörterungen ließ sich der Kapitän nicht ein.
»Nun sehen Sie. Unser Schiffskoch ist ein Vaudou gewesen. Er stammt von Haiti. Er war sogar ein Oberpriester. Man nennt sie dort Paparoi oder Vaterkönig, was sie aber dort ›Papaloi‹ aussprechen in ihrem französischen Kauderwelsch.«
Aha! aha! Jetzt wurde mir klar, warum er immer im Traum Papaloi und Mamaloi gesungen hatte! Käpten Düwel marschierte mit seinen Säbelbeinen noch hastiger durch die Kajüte. Jetzt nahm er die großen Hände vom Rücken und steckte sie in die Westentaschen, die danach beschaffen waren, solche Hände aufnehmen zu können. Das war bei ihm immer ein Zeichen großer Erregung.
»'s ist auch wirklich Teufelszeug, was diese Vaudoux treiben, scheußliches Wesen. Es soll Menschenschlächterei dabei sein. Man ist aber machtlos dagegen. Es geschieht alles in äußerster Heimlichkeit. Ja, unser Ahasver war ein Papaloi, ein Oberpriester. Er hat den Tod hundertfältig verdient, der Schlingel, und ich habe ihn nur versehentlich vom... na, lassen wir das! Stürmann, glaubt Ihr an Telepathie?«
Der Kapitän war mit einem Ruck vor mir stehen geblieben und sah mich aus seinen buschigen Brauen finster und misstrauisch zugleich an — offenbar wollte er eine gewisse Verzagtheit, die ihm peinlich war, bemänteln.
»Telepathie —!«, wiederholte ich verwundert, »Gedankenübertragung, Fernwirkung? Ja...«
»Lasst uns darüber nicht streiten! Ihr kennt die Telegrafie ohne Draht. Da schwingen elektrische Wellen, bis sie ein geeignetes Werkzeug finden, auf dem sie sich vernehmlich machen können. Es gibt noch feinere Werkzeuge als elektrische Wellen, auch Menschenseelen können in Schwingungen geraten und sich weithin vernehmlich machen, wenn sie den geeigneten Schallboden finden... Es ist vielleicht eine Sünde, die ich begehen will — ich weiß es nicht... naturgeschichtlich ist's mir ganz klar... Ich hatte mir aber fest vorgenommen, es nie wieder zu tun. Aber... wie die Sache nun liegt... ich muss Gewissheit haben... es handelt sich um Menschenleben... ich muss wissen, wie es um das Vaterland steht...«
Er hatte immer mehr stoßweise gesprochen, wie zu sich selbst. Seinen Spaziergang hatte er wieder aufgenommen. Nun blieb er wieder vor mir stehen und sah mich erregt an:
»Stürmann, glaubt Ihr, dass es Telepathie gibt?«
»Ich habe schon viel davon gelesen und gehört durch Menschen, denen ich unbedingt Glauben schenken möchte, aber selbst habe ich noch nichts Derartiges erlebt, wenn ich von Versuchen mit schlafwachen Menschen absehen will...«
»Ihr sollt es mit eigenen Augen und Ohren erleben, dass es dergleichen gibt. Die Sache ist aber folgende: Dieser Neger versteht, sich in einen Zustand der Verzückung zu versetzen, in dem sich anscheinend seine Seele von seinem Körper löst. Ich habe mich früher viel mit der Sache beschäftigt, mir mein eigenes Urteil darüber gebildet und will hier keine langen Erörterungen darüber machen. Kurz gesagt, Ahasver kann sich in diesem Zustand mit anderen Personen verständigen, wobei die Entfernung keine Rolle spielt. Er wird gleichsam zum Empfänger einer Art drahtloser Fernsprecherei. Es ist ihm aber nicht möglich, bei jeder Person den Anschluss herzustellen. Das ist auch verständlich. Außerdem gelingt es besser, wenn die angeredete Person schläft, sich also selbst in einem seelisch gelockerten Zustand befindet. Es ist freilich nicht unbedingt nötig. Ich habe früher mit ihm ganz verwickelte Versuche gemacht mit Hilfe eines erfahrenen Naturforschers auf streng wissenschaftlicher Grundlage, der jede Täuschung und Einbildung unmöglich zu machen wusste; und als Geber bei dem drahtlosen Verkehr benutzte ich meine Frau, von der ich damals Tausende von Meilen getrennt war. Wir haben erstaunliche Ergebnisse dabei erzielt, wenn auch solche Dinge besser unterlassen werden sollen.
Als mir das einmal recht zum Bewusstsein kam, brach ich diese Versuche ab und nahm mir fest vor, dergleichen nie wieder zu tun.
Ich werde heute meinem Vorsatz untreu. Aber ich muss um meiner Leute und unseres ganzen Verhaltens willen wissen, wie es in Deutschland aussieht. Wir können hier unmöglich Krieg auf eigene Faust führen, Schiffe, die dem friedlichen Handel nachgehen, versenken, Mannschaften gefangen nehmen, vielleicht auch Menschenleben aufs Spiel setzen, wenn wir nicht wissen, welche innere Berechtigung wir dazu haben, ob wir unser Tun jemals vor den deutschen Behörden verteidigen können. Nicht wahr, Ihr versteht mich, Stürmann?!«
»Sehr wohl, Herr Kapitän.«
»Gut. Meine Frau wird mir alles mitteilen, was ich wissen will und was sie überhaupt fähig ist zu sagen. Sie wird zwar im Schlaf befragt durch Vermittlung des Vaudou, durch seinen Mund und seine Seelenschwingungen. Sie kann aber dabei nicht mehr aussagen, als ihr in wachem Zustand bekannt ist. Auch das tut sie mit vollem Bewusstsein. Sie kann sogar veranlasst werden aufzustehen, etwa nach einer Zeitung zu greifen und mir vorzulesen. Sie hat auch nachher die Erinnerung daran. Aber es ist doch immer ein eigentümlicher halbwacher Zustand. Sie verstehen mich, Stürmann. Ich weiß, dass Ihre Bildung danach ist.«
Ich musste immer auf das kleine unansehnliche Männchen sehen mit dem ziegelroten, nichts weniger als geistreichen Gesicht, der sein Äußeres so vernachlässigte. Nun marschierte er erregt auf und ab, die ungewöhnlich großen und plumpen, stark behaarten Hände legte er bald auf den Rücken, bald schob er sie in die Westentasche. Dabei hatte er das Hamburger Johanneum besucht, eine gar berühmte Gelehrtenschule, hätte die Universität beziehen können und wälzte hier die tiefsinnigsten Rätselfragen der Seelenkunde und Naturwissenschaft. Wie gewaltig kann doch das Äußere eines Menschen täuschen!
»Die Sache ist nun die«, fuhr er fort, »dass Ahasver sich seit Jahren nicht mehr in den Zustand der Verzückung gebracht hat. Ich habe schon lange meine Versuche mit ihm aufgegeben. Allein tut er's nicht, hat es auch nie gern getan, denn die Sache strengt ihn ungeheuer an und kostet Nervenkraft. Ich habe ihm auch streng verboten, sich etwa von anderen Menschen zu irgendwelchen derartigen Versuchen benutzen zu lassen, und weiß, dass er mir gehorcht.
Infolge dieses langen Nichtgebrauchs hat er seine Gabe verloren. Er kann den Zustand der Verzückung nicht mehr finden. Sie wissen, was ich unter diesem — sagen wir jenseitigen — Zustand verstehe? Allein Ahasver besitzt schon noch diese besonderen Eigenschaften. Ich weiß es bestimmt. Er ist nur aus der Übung gekommen, die Fähigkeit ist eingeschlafen, kann aber wieder geweckt werden.
Seit einer Stunde beschäftige ich mich schon mit ihm, zusammen mit Mister Rugby, der ebenfalls in die Sache eingeweiht ist und die Versuche früher mit unternommen hat. Heute gelingt es uns nicht, den schwarzen Kerl in seinen dazu notwendigen Zustand zu bringen, soweit wir etwas dazu beitragen können. Es gehört sehr viel fremde Willenskraft dazu, den Zustand hervorzurufen. Das ist ja der Grund, weshalb man solche Versuche lieber unterlässt, weil Menschen innerlich vergewaltigt werden müssen, um sich richtig einstellen zu können. Ahasver hat alles bei sich, was er dazu braucht. Er hat seine Trommel, seine Schellen, seine Schlange, hat sie schon im eigenen Magen auf die richtige Wärmestufe gebracht, sich regelrecht angemalt, hat auch den festen Willen... aber es gelingt nicht. So quält er sich schon seit einer Stunde herum.
Dennoch muss es glücken. Ich weiß auch, woran es liegt, dass er jetzt versagt. Bei früheren Versuchen habe ich festgestellt, dass er am leichtesten durch Musik in Verzückung gerät, besonders durch die Töne von Streichinstrumenten, einer Geige. Ich spiele ein wenig die Geige...
Es kam zögernd heraus, und bei den letzten Worten fiel ein schneller, fast scheuer Blick auf mich.
»Ja, ich habe damals die Geige benutzt, und zwar immer das gleiche Lied gespielt, das ich für diesen Zweck... selbst zusammengebaut hatte. Wir nannten es gleich, um dem Kind einen Namen zu geben... das Schlangenlied. Sobald dieses Lied erklang, fiel Ahasver in Verzückung und immer leichter, je öfter sich der Versuch wiederholte.
Offenbar hatte er sich an dasselbe Lied, das Schlangenlied, gewöhnt. Nur darum gelingt es ihm jetzt nicht, weil er das Lied nicht hört. Es muss ihm aber auf der Geige vorgespielt werden. So behauptet er, und ich glaube es ihm schon. Aber die Sache ist die, dass ich... nicht mehr Geige spiele. Ich habe — hm — meinen Grund dazu. Ich spiele nicht mehr Geige.«
Die krummen Beine durchsäbelten schneller die Kajüte, die Hände gruben sich in die Westentaschen ein. Die Unterredung war dem Sprecher augenscheinlich höchst peinlich. Trotzdem musste sie auf ein gewisses Ziel hinsteuern, das ich mir schlechthin nicht vorstellen konnte.
»Und dennoch! Er will das Schlangenlied hören.
Ich habe es ihm vorgepfiffen. Ich kann pfeifen. Gut pfeifen. Mister Rugby hat eine Flöte und hat es ihm vorgeflötet, bis ihm der Atem ausging — es nützt alles nichts. Es müssen durchaus Geigenklänge sein, behauptet Ahasver.
Dazu bin ich nun nicht zu bewegen. Ich spiele die Geige nicht mehr. Habe meine Gründe dafür.
Es scheint also nicht zu gehen. Am unglücklichsten ist der schwarze Kerl selbst darüber. Er möchte mir ja so gern zu Willen sein und versucht es immer wieder mit allen möglichen anderen Mitteln. Wie gesagt, das Ganze läuft auf Stimmung hinaus. Es kommen allerlei Strömungen von Zuneigung mit in Betracht. Stürmann, habt Ihr schon gemerkt, dass dieser schwarze Koch eine besondere Zuneigung zu Euch hat? —«
Nein, davon hatte ich noch nichts wahrgenommen.
»Es ist doch so. So behauptet er jetzt. Also kurz gesagt, er schlägt vor, Ihr sollt dabei sein. In Gegenwart des zweiten Steuermanns würde er schon... wahnsinnig werden, wie er sagt. Also wollte ich Euch fragen, ob Ihr dazu bereit seid.«
»Der Sache beizuwohnen? Aber gewiss. Mit dem größten Vergnügen. Fordert man weiter nichts von mir? Das tue ich gern.«
»Nein, Ihr sollt weiter nichts tun, als dabei sein. Ahasver will Euch nur sehen, Eure Nähe fühlen. Das genüge vollständig. Na, da kommt mal mit!«
Der Sprecher schien aufzuatmen, dass er am Ende seiner langen Rede war. Sein Schreiten drückte eine behagliche Stimmung aus. Ich folgte ihm erwartungsvoll.
Wir betraten eine Kammer jenseits des Schiffsgangs.
Der mäßig große Raum war ganz leer, an der Decke hing eine Lampe, die mit einem leichten roten Tuch verhüllt war. Im ganzen Raum herrschte gedämpftes Rot. Mister Rugby und Ahasver waren schon anwesend.
Ahasver kauerte in einer Ecke. Vor sich hatte er seine Werkzeuge aufgebaut, hauptsächlich die große Trommel, in der ich sein einziges Gepäckstück gleich wieder erkannte. Früher war's mir wie eine riesige Hutschachtel erschienen. Die Trommel war mit Schellen besetzt und außen in eigentümlicher Weise bemalt. Es waren plumpe Tiergestalten, unter denen die Schlange vorherrschte. Die Malereien schienen ganz frisch aufgetragen zu sein. Neben der Trommel lagen eigentümlich geformte Schlegel und einige andere Dinge, die ich nicht klar unterscheiden konnte.
Aber wie sah er selbst aus! Zuerst sah ich ihn überhaupt nicht, sondern nur ein schauerliches weißes menschliches Knochengerüst. Es war auch eines. Der Neger war nämlich bis auf einen kleinen Schurz ganz nackt und verschwand gänzlich an der schwarzen Eisenwand seines Hintergrundes. Aber er hatte sich, wie der Kapitän sagte, vorschriftsmäßig bemalt, und zwar jeden Knochen auf seiner schwarzlackierten Haut in Weiß aufgetragen, sodass ein wirkliches Gerippe dastand.
Ein schauerlicher Anblick. Mit dem Totenschädel oben fing's an, dann kamen die Halswirbel, der Brustkasten, die Beine und alles bis zum untersten Zehenknochen. Er zeigte auch Knochenarme, hände und finger.
Besonders der Totenschädel war überaus naturwahr und geradezu erschreckend, da lebhafte Augen in den weißgemalten Höhlungen glühten, und die richtigen Zähne klapperten.
Mister Rugby nickte mir zu. Das Gerippe verbeugte sich zappelnd mehrmals. Dann begann gleich die Vorstellung ohne vermittelnde Erklärungen.
»Na, da wollen wir einmal sehen, wie es jetzt geht«, sagte Kapitän Düwel. »Also fange mal wieder an, Ahasver! Dein geliebter Stürmann ist nun da. Stellt Euch nur hierher oder wohin Ihr wollt, Stürmann! Es ist ganz gleich. Sprecht laut und unbedenklich, was Ihr zu sagen habt. Wir können uns richtig unterhalten. Das befördert eher die Stimmung, wenn ein gleichmäßiges Gespräch geführt wird. So machen's auch die Spiritisten, vor denen mich übrigens Gott bewahren soll. Der Vermittler will gar nicht das Ziel der gespannten Aufmerksamkeit sein. Das macht ihn nur verlegen und verdirbt ihm die Stimmung. — Na, Ahasver, da fange einmal an!«
Das Gerippe zappelte sich in die Ecke, dass man sich nur wunderte, die Knochen nicht klappern zu hören, kauerte sich nieder hinter die Trommel, das Gesicht nach uns gewandt, wurde ruhiger und blieb schließlich ganz still sitzen.
Nach einiger Zeit ging ein Ruck durch den ganzen Körper. Es folgten würgende Bewegungen. Ahasver griff sich in den Mund und brachte etwas Blitzendes zum Vorschein. Erst dachte ich wieder an jenes Messerchen, allein es war diesmal ein kleines flaches Behältnis.
Er öffnete es und entnahm ihm eine Zigarette. Mit Stahl und Feuerzeug, das neben der Trommel lag, brannte er sie an und begann hastig zu rauchen. Dabei zog er den Rauch tief ein in die Lunge. Ein starker betäubender Duft erfüllte das Zimmer.
»Es ist ein Räuchermittel«, erklärte der Käpten, »durch das er sich betäubt und die Nerven beeinflusst. Ja, ja, es ist sehr stark. Für uns, die wir nicht viel davon abbekommen, ist's ganz unschädlich. Anders freilich, wenn man es so tief einzieht, wie der da...«
Das dampfende Räucherwerk war bald aufgeraucht. Dann schient mir, als ob die Augen, die starr auf mich gerichtet waren, noch starrer glotzten.
Das Gerippe ergriff die Trommelschlegel, fing an auf der Pauke zu trommeln, ohne mich aus den Augen zu lassen, und schnitt dabei die fürchterlichsten Gesichter aus seinem beinernen Totenschädel heraus.
Es war ein eigenartiges Trommeln. Auch die Schellen am Außenrand kamen in rasselnde, klirrende Bewegung.
Etwa zehn Minuten währte das Trommeln. Dann verließen mich die Glotzaugen, nochmals ein Würgen, und aus dem Mund schlüpfte ein braunes Etwas geradenwegs auf das Paukenfell. Erst glaubte ich, es sei ein spannenlanger Wurm, der nun auf der Trommel herumkröche.
»Was ist das?!«, fragte ich mehr furchtsam als misstrauisch.
»Geht nur hin und beseht's Euch! Nur dürft Ihr's nicht gerade angreifen.«
Ich ging näher und betrachtete es vorsichtig. Es war wirklich ein Wurm von rostbrauner Farbe, aber kein lebendiger. Es war eine überaus kunstvolle Arbeit, aus kleinen, ausgebogenen näpfchenartigen Scheiben. Sie waren winzig klein und sehr dünn. Die größte hatte noch nicht den Durchmesser eines Zentimeters. Eine dünne Schnur verband sie innen, sodass sie sich in äußerster Beweglichkeit zusammenziehen und dehnen konnten. Sie schienen von Kupfer- oder Bronzeplättchen gemacht zu sein.
Das Ganze sollte wohl eine Schlange vorstellen, nur bestand der Kopf eigentlich aus vielen Köpfen, die im Kreise geordnet waren. Jeder hatte ein Paar Augen aus rotglitzernden Steinchen, aus Rubinen. Vielleicht waren's auch nur Glasaugen.
Aber diese metallene Schlange wurde lebendig unter dem eigenartigen Trommeln. Sie kroch zunächst auf dem Trommelfell herum, und es schien, als habe sie der Trommler ganz in der Gewalt. Die Scheibchen zogen sich zusammen und dehnten sich und ahmten naturgetreu die Bewegungen der Schlange nach.
Und es blieb nicht bei dem Kriechen. Das Trommeln wurde wilder und eindringlicher; zuerst hob sich der Kopf, dann folgte der halbe Oberkörper, fiel zurück, richtete sich wieder auf, zuckte hin und her und führte einen regelrechten Tanz auf.
Ich habe in Indien und Ägypten Brillen- und Aspisschlangen nach der Pfeife des Gauklers tanzen sehen. Das gleiche sah ich hier von der metallenen Schlange. Es waren genau dieselben Bewegungen, nur fehlte das Blähen des Halses, sonst war alles naturgetreu, ins Winzige übersetzt.
Eine Weile hatte Ahasver seine Schlange tanzen lassen, die er immer mit starren Augen betrachtete, dann beugte er den Oberkörper vor, senkte immer tiefer den Kopf, und immer höher richtete sich die kleine Schlange auf, bis sie nur noch auf der Schwanzspitze zu stehen schien und dennoch dabei den ganzen Leib streckte und in den Ringen zusammenzog.
Mir blieb's unbegreiflich, wie der schwarze Gaukler das fertig brachte, wenn ich auch wusste und oft gesehen hatte, was für Wirkungen geeignetes Trommeln auf straffgespanntem Fell hervorzubringen imstande ist, sobald die richtigen Tanzgestalten verwendet werden. Es schien Ahasver sehr anzustrengen. Er war schon ganz in Schweiß gebadet und hatte sich niedergeduckt.
Immer tiefer senkte er den Kopf. Wie einem Magneten folgte die Schlange seinem Mund, und da, als sie ihre höchste Länge erreicht hatte, streckte er dem rotäugigen Kopfgebilde die lange rote Zunge aus dem weißen Totenschädel entgegen und berührte den emporgereckten Kopf. Das ist der übliche Kuss, den die indischen und arabischen Schlangenbeschwörer immer ihrem Gewürm geben. Hier war offenbar doch der Höhepunkt der Handlung erreicht, und ein merkwürdiger Erfolg wurde sichtbar.
Das Trommeln und Rasseln und Klirren verstummte plötzlich, die Schlange sank zusammen. Ebenso ihr Beschwörer. Er glitt kraftlos zurück, bis die Wand ihm Halt gebot. Die Augen waren geschlossen, die Brust keuchte.
»Endlich, endlich!«, atmete Kapitän Düwel auf, indem er einige Schritte vortrat. »Ahasver, wo bist du?«
»Wo — mich — Massa — hinschickt«, kam es röchelnd und abgerissen aus dem Mund des Totenschädels. Dann setzte er schnell hinzu: »Bumbo auf Ehre, Bumbo auf Ehre.«
»Du sollst meine Wohnung aufsuchen, meine Frau sehen.«
»Ich bin — in deiner — Wohnung — bei deiner — Frau.«
»Du siehst sie?«
»Ja.«
»Wo ist sie?«
»Sie — liegt — im Bett.«
Da wir acht Uhr morgens hatten, musste es in Hamburg tief in der Nacht sein.
»Schläft sie?«
»Sie schläft. Bumbo auf Ehre.«
»Sage ihr, dass ich da bin und sie sprechen will.«
Einige Augenblicke vergingen. Der Neger atmete schwer. Zuweilen schien's mir, als ob der Atem ganz aussetze. Die Brust hob und senkte sich nicht mehr. Dafür begann der Unterleib sich zu dehnen und wie eine Kugel anzuschwellen. Aber der Atem in der Brust stockte.
Plötzlich eine neue Stimme:
»Gustav, bist du es?«
Seltsam. Das war nicht Bumbos Stimme, die da wie aus dem Hörer eines Fernsprechers kam. Der schwarze Koch bewegte kaum die Lippen, wenigstens musste ich sehr scharf hinsehen, um die leise, lallende Bewegung seiner Lippen zu erkennen.
Aber die Stimme kannte ich. Es war eine wohlklingende Frauenstimme, mit der ich mich in einer schönen Stunde unterhalten hatte. Es war unverkennbar Angelas Mutter. Auch der eigenartige Tonfall und die etwas fremdartige Aussprache mancher Buchstaben kennzeichneten deutlich die Sprecherin.
»Ich bin's, Angela«, flüsterte der Käpten.
»Du gebrauchst wieder einmal Ahasver? Ich hörte ihn schon lange im Halbschlaf trommeln und erwartete ihn. Wie geht's dir, Gustav?«
»Sehr gut. Auch sonst geht alles gut. Hast du meinen Brief aus Frisco bekommen?«
»Schon vor drei Wochen. Habt ihr Sydney noch nicht erreicht?«
»Nein, wir sind noch nahe am Äquator, haben mehr als vier Wochen Windstille gehabt, aber nun geht's mit Hurra vorwärts.«
Offenbar verheimlichte der Kapitän seiner Frau unsere Erlebnisse. Er wollte noch mit seiner Bark unterwegs sein. Warum sollte er auch seine Angehörigen daheim mit allen diesen Schrecken und Sorgen belasten, wenn sie ohnehin nicht helfen konnten? Sie erfuhren alles noch frühzeitig genug.
»Wie geht's den Kindern?«
»Sie sind wohlauf. Angela spricht oft von Euch, und Gustav ist in die Marine eingetreten. Natürlich. Du weißt doch, dass wir mitten im Krieg sind, mitten im Weltkrieg?«
»O ja, das weiß ich nun schon. Wir müssen auch sehr auf der Hut sein, dass wir keine Unannehmlichkeiten haben, gehen natürlich nun nicht nach Sydney, sondern nach einem neutralen Hafen. Doch, Angela, wir müssen uns beeilen. Du weißt, dass der Zustand Ahasvers nie lange währt, und ich muss unbedingt mehr über den Krieg erfahren, muss wissen, wie es mit Deutschland steht.«
Und wir erfuhren es. Ach, wie ging uns armen fernen Deutschen da das Herz auf! Wie Balsam tropften die köstlichen Nachrichten in unsere Sorgen! Wie klein und gering ist doch ein Einzelschicksal gegenüber dem großen des Vaterlands! Es gibt kein Glück, solange das Vaterland Not leidet, und alle Not ist vergessen, wenn die große Sache des Heimatlandes gedeiht!
Die Schläferin hatte nicht nötig, aufzustehen und in halbwachem Zustand Zeitungen vorzulesen. Sie hatte alles im Kopf und lebte alles mit wie eine echte deutsche Seemanns- und Kriegerfrau, obgleich ihre Wiege in Amerika gestanden. Ihre Ehe hatte sie aus der Heuchelei und Salbaderei der Yankees herausgerettet.
Mit der Vernichtung der deutschen Kriegsflotte bei Helgoland war's also nichts. Dagegen erfuhren wir von den unvergleichlichen Siegen im Westen, vom Fall der belgischen Festungen, vom Sieg bei St. Quentin am 28. August, wo die englischen Landtruppen vollständig geschlagen und Tausende von Gefangenen, viele Geschütze in unsere Hände gefallen waren; vom Vordringen bei Epinal, der Eroberung des größten Sperrforts Manonvillers.
Und im Osten! Generaloberst von Hindenburg — »Hindenburg, Hindenburg!«, jauchzte Mister Rugby — hatte die russische Armee, fünf volle Armeekorps, drei Kavalleriedivisionen in der Masurenschlacht geschlagen. Es war also nichts mit dem Märchen über Potsdam.
»Fünf Armeekorps und drei Kavalleriedivisionen!!«, wiederholte andächtig Käpten Düwel. »Ooooh, da kann man ja Millioooooonen Trichinen kriegen! Wie viele Gefangene gemacht?«
»Die Zahl ist von Tag zu Tag gewachsen, die Gesamtbeute lässt sich noch nicht übersehen. Zuletzt wurden mindestens 100 000 Gefangene gemeldet, 160 Geschütze. Was aber noch in Wäldern und Sümpfen steckt, das ist unabschätzbar. — Ebenso siegreich sind die Österreicher gegen die Russen. Nach neuntägiger erbitterter Schlacht erringt General Auffenberg zwischen Zamosz und Tyszowche einen ungeheuren Sieg.«
Mir traten die Freudentränen in die Augen. Kaum konnte ich meine Bewegung meistern. Nur hören, hören...
Wir haben ja über allem Hurraschreien nie gewusst, was uns das Vaterland ist!
»Wie weit sind wir noch von Paris?«
»General Hausen ist mit den sächsischen Truppen nur noch 40 Kilometer entfernt. Die französische Regierung ist bereits am 3. September von Paris nach Bordeaux übergesiedelt, geflüchtet.«
»Ooooh, du kriegst die Trichinen, Millioooooonen Trichinen!!! Ja, da ist der Krieg doch überhaupt bald zu Ende?«
»Nein, Gustav, das wird nicht sein.«
»Nee? Was meinst denn du?«
»Ich habe mit Hans Steen gesprochen.«
»Hast du? Ich wollte dich gleich nachher fragen, ob du mit ihm schon geredet hast. Nun, was meint Hans Steen dazu?«
»Hans Steen meinte, es wird ein Krieg werden, dessen Dauer nicht abzusehen ist. Auf einige Jahre müssten wir uns gefasst machen. Wir dürften an keinen Vergleich mit 1870 denken. Das sei damals gegen diesen Krieg nur wie ein ritterliches Kampfspiel gewesen. Diesmal handle es sich um Sein oder Nichtsein ganzer Völker und Staaten. Es sei auch mit der Einnahme von Paris nicht getan. Frankreich müsse eigentlich Großmacht zweiten Ranges werden und sich auch zu Gebietsabtretungen, mindestens bis zur Maas, aber auch zu Dünkirchen und Calais verstehen, damit endlich Ruhe werde vor diesem hasserfüllten Nachbarn, der künstlich in Zeitungen und sogar in den Schulen den Hass gegen Deutschland gezüchtet habe. Auf solche Bedingungen werde Frankreich nie eingehen. Also werde es ein Kampf bis zum letzten Mann und Ross. Darüber könnten Jahre vergehen. Ebenso kämpfe England um Sein oder Nichtsein. England sei unser schlimmster und zähester Feind. Es wolle Deutschlands ganzen Handel und Werktätigkeit vernichten und habe beschlossen, uns völlig auszuhungern, da es anders nicht siegen kann. Gelingt das nicht, so hat England überhaupt seine ganze Weltstellung verspielt. Dann ist's nur eine Frage der Zeit, dass das ungeheuere Weltreich zerbröckelt, wenn es ein Volk gibt, das ihm übermächtig war. Dann schwindet auch das Geheimnis von Englands Macht, die Furcht vor seinem Drohen. Und dann ist's am Ende. Also wird es Himmel und Hölle, jedenfalls alle Welt, auch Amerika, in Bewegung setzen, um sich gegen uns zu wehren, uns zu vernichten. Russland endlich mit seinem unerschöpflichen Völkermeer sei überhaupt nie ganz zu besiegen. Das schöpfe immer neue Kraft aus seinen Beständen an Volk und Land. So urteilte Hans Steen. Auf zwei bis drei Jahre müssten wir uns gefasst machen.«
Wir hatten es gehört. Kapitän Düwel senkte den Kopf.
»Dieser mein Freund, Hans Steen«, sagte er dann leise zu mir gewandt, »ist ein gotterleuchteter Mann. Er kümmert sich nicht um Politik, versteht auch nichts davon. Er ist mit seinen sechzig Jahren noch immer ein unschuldiges Kind. Darum hat ihn Gott erleuchtet, der es den Unmündigen und Kindern offenbart, aber den Klugen und Weltweisen verbirgt. Schon zweimal hat Hans Steen bewiesen, dass er mehr weiß als viele Staatsmänner und Zeitungsschreiber. Als es im Burenkrieg so günstig für die Afrikaner stand, dass alle Welt glaubte, die Engländer würden ins Meer gepeitscht werden, was sie reichlich verdient hatten, da sagte Hans Steen voraus, dass die Briten nicht ruhen würden, bis die Burenstaaten niedergezwungen wären. Und einige Jahre später, als alle Welt glaubte, Russland würde spielend mit dem winzigen Japan fertig, da war es dieses Kind mit weißem Haar, das voraussagte, Japan werde Schlag auf Schlag über Russland siegen. Damals wurde er verhöhnt und verspottet, bis alle Welt betreten schwieg. Er wird auch dieses Mal Recht behalten.«
Ahasver machte zuckende Bewegungen, sein Leib sank zusammen.
»Es ist vorbei, er erwacht.«
Aber Ahasver erwachte noch nicht, noch einmal begann sein Leib zu schwellen.
»Es ist nur vorübergehend. Vielleicht können wir es noch einmal benutzen. Willst du auch einmal mit ihr sprechen, Franz?«
»Wenn du gestattest. Ich bin hier, Angela.«
»Ach, mein lieber Francis«, erklang es sehr herzlich.
»Wir müssen uns beeilen, Ahasver wird gleich erwachen. Ich möchte gern noch etwas über den Krieg hören, aber keinen Schlachtenbericht. Wie war die Mobilmachung?«
»Wunderbar. Über alle Begriffe großartig. Eine Begeisterung, die kein Mensch geahnt hätte. Ein Volk, das solcher Begeisterung fähig ist kann nicht besiegt werden. Das hat auch der Deutsche Kaiser gesagt.«
»Was hat er gesagt? Erzähle!«
Eine kleine Pause.
»Ich glaube«, erklang die Frauenstimme wieder, »es war wohl sein erstes Wort, das er über den Krieg sprach, soweit es mir bekannt wurde. Er empfing die Reichstagsmitglieder, die einhellig und einstimmig alle Kriegsforderungen bewilligt hatten. Viele waren schon in feldgrauer Uniform, da überkam es ihn, und er sprach: ›Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche!‹ Dann richtete er sich auf: ›Wir werden siegen, weil wir müssen‹, — und er schloss, indem er die Faust ballte: ›Nun wollen wir sie aber dreschen!‹«
Wir drei sahen einander an. Wir hatten recht gehört. Der Kaiser hatte es gesagt. Es waren große starke Worte, wie sie zuweilen Menschen in den Mund gelegt werden, die für große Mengen die Verantwortung tragen. Das letzte klang auch urdeutsch und wirkte befreiend, belebend in seiner echten Kraft.
»Doch nein«, fuhr die Frauenstimme fort, »das allererste waren doch diese Worte nicht. Als sich am ersten Tag der Mobilmachung in Berlin das Volk vor dem Kaiserlichen Schloss drängte und ihn sehen wollte, der jetzt die Führung des Vaterlands in seine eigene Hand nahm, von dem so vieles abhing, da erschien er auf dem Söller und sprach zu der vieltausendköpfigen Menge: ›Geht jetzt nach Hause, kniet nieder und betet zu Gott dem Allmächtigen, dass er uns den Sieg verleihe!‹«
Wir hatten es vernommen drunten in der Südsee und schwiegen. Auch der Käpten sagte kein Wort. Ich aber dachte: Ob wohl auch der französische Präsident, der englische König, der russische Zar so zu der Menge gesprochen hatten, die ihnen doch sicherlich ebenfalls begeistert zujauchzte.
»Und dann«, erklang es weiter, »als der Kaiser sein Garderegiment ins Feld entließ, da zog er sein Schwert und rief: ›Ich ziehe mein Schwert, und meine Ehre verbietet mir, es eher wieder einzustecken, als bis ich meinen Feinden den Frieden diktiert habe...‹«
Es war das letzte, was wir von der schönen, beweglichen Frauenstimme vernehmen sollten.
Ein Ruck ging durch den schwarzen Körper Ahasvers, der geschwollene Leib sank plötzlich zusammen. Der Neger schlug die Augen auf und schaute verstört um sich. Die Leitung war unterbrochen.
»Bumbo auf Ehre, Bumbo auf Ehre!«, musste er als erstes mit seiner rauen, schnarrenden Stimme sagen.
Der Bann war gebrochen, der Neger war wieder da. Für längere Zeit ließ sich die Verbindung durch kein Mittel herstellen.
Es war genug, was wir zu hören bekamen. Mir war's ernst und feierlich zumute. Ich hatte den Herzschlag des Vaterlands gehört. Ich wusste, dass Deutschland unbeweglich ist.
Konnte es etwas Köstlicheres geben? Also so sah die Revolution in Berlin aus. Wie musste England lügen, um der Welt der Südsee die Wahrheit zu verbergen!
»Stürmann, sagt den Leuten nichts von dem, was Ihr hier erlebt und gehört habt! Ich werde es mir überlegen, wie ich ihnen die Siegesnachrichten in einfacher Weise beibringen kann.«
Wir hatten unser Ziel erreicht. Vor uns lag eine Insel — ein Berg, der aus dem Wasser ragte. Er sah sehr regelmäßig, kegelförmig aus und mochte etwa 300 Meter hoch sein.
So war wenigstens der erste Eindruck, den unsere Zufluchtsstätte von einiger Entfernung aus machte. Es war eigentlich keine gebirgige Insel, sondern ein aus dem Meer aufragender Bergkegel ziemlich regelmäßiger Form. Erst als wir näher kamen, gewahrten wir, dass sich ein flacher Strand um den Fuß des Berges herum zog, kaum 100 Meter breit, aber vollkommen kahl wie der Berg selbst, auf dem man auch mit dem stärksten Fernrohr keine Spur von Pflanzenwuchs bemerken konnte.
Dafür zeigte er schwarze Spalten und Risse, während der Strand heller war. Wir kamen von Osten her. Als wir aber südlich die Insel umfuhren, gewahrten wir, dass sich der Berg als Rücken nach Norden hin über die ganze Insel fortsetzte, aber weite und tiefe Täler frei ließ. Nach Westen zu lag dann noch ein sehr breiter Strand, der ganz flach war, aber ebenfalls keine Spur von Pflanzenwuchs zeigte. Offenbar fehlte die Hauptsache, das Wasser. Das Ganze mochte zwei bis drei Quadratmeilen groß sein, ein wirklich ödes Land, auf dem nichts zu holen war. Darum war's gänzlich unbewohnt, auch wohl unentdeckt. Es gibt nicht wenige solcher namenloser, unbekannter Inselchen in der unermesslichen Südsee.
In einer gewissen Entfernung von der Insel zeigte sich ringsum starke Brandung, ein Zeichen, dass sie außerdem mit einer Kette spitzer Korallenriffe umgeben war, die die Zufahrt unmöglich machte.
Als wir uns bei unserer Umfahrt der Westseite näherten, bemerkten wir, dass ein breites Tal von der Kette nach Westen zum Meer herablief und dort einen großen, natürlichen Hafen bildete. Er war zugänglich für das größte Seeschiff, und die Einfahrt war breit genug, um bei jedem Seegang die Einfahrt zu ermöglichen.
Noch herrschte ja klares Wetter und ruhige See, aber wir konnten schon Mister Rugby glauben und überzeugten uns bald durch den Augenschein, dass auch bei schwerer See für den Kundigen der Eingang leicht zu bewerkstelligen war. Das Hafenbecken war groß genug, um ein Dutzend solcher Schiffe wie die ›Wasserhexe‹ aufzunehmen und ihnen noch Spielraum zu lassen.
Mister Rugby lotste uns ein. Das Fahrwasser war frei und klar. Es war kaum nötig, dass besondere Lotsenführung angewandt wurde. Man konnte eine Tiefe von 15 bis 20 Meter deutlich erkennen.
Dann nahm uns das Hafenbecken auf. Hier waren wir allerdings vor jedem Sturm sicher. Im Osten schützte der Bergkegel, nach Süden die sehr zerklüftete Talwand, nach Norden ein steil ins Wasser abfallender Lavawall, der so senkrechte Wände zeigte, dass wir wie an einem natürlichen Kai anlegen konnten. Überall zeigten sich auch Ecken und Spitzen auf dem Wall, sodass unsere Taue befestigt werden konnten. Half man der Natur ein wenig nach, so war in kürzester Frist ein prachtvoller Kai herzustellen, der nach Norden steil zur großen Inselebene abfiel, nach Süden senkrechte Wände zum Hafen bildete. Die Einfahrt im Westen war verhältnismäßig schmal, weil der Lavawall sich etwas umbog. Selbst hohe Wellen mussten sich hieran brechen, weshalb das Becken bei jedem Sturm auch im Westen Schutz hatte. Ein prachtvoller und zugleich geräumiger Hafen.
Wir legten zunächst am Lavawall an und brachten die Gefangenen ans Land. Sie hatten sich auf dem Schiff ruhig verhalten und offenbar das Nutzlose eines Widerstands eingesehen. Wir hatten sie in drei Abteilungen untergebracht. Die Matrosen waren in der Segelkammer verwahrt, die uns als erster Aufenthalt gedient hatte, die Heizer und Kohlenzieher bewohnten einen anderen Raum, den Offizieren und den beiden Japanern war eine Kajüte an Deck angewiesen worden. Natürlich hatte man sie gut unter Verschluss gehalten, doch war ihnen ausreichende Nahrung und anständige Behandlung zuteil geworden. Keiner war gefesselt, wiewohl man ihnen das angedroht hatte, falls der leiseste Widerstand versucht würde. Offenbar hatten sie selbst eingesehen, wie wenig verdient diese Behandlung war, und das mochte am meisten dazu beigetragen haben, sie zu einem ruhigen Verhalten zu veranlassen. Dass wir ein Unterseeboot besaßen, war ihnen natürlich nicht entgangen, was wir aber weiter mit ihnen vorhatten, musste ihnen ganz dunkel bleiben.
Kapitän Düwel ließ sie zunächst auf dem Lavawall antreten und teilte ihnen mit, dass sie sich frei auf der Insel bewegen dürften, dass es ihnen aber verboten sei, den Wall zu betreten oder sich ihm auf weniger als 150 Meter zu nähern. An einer bestimmten Stelle würden ihnen täglich Lebensmittel und Wasser verabfolgt werden. Im Übrigen stünden sie unter dem Befehl ihres Kapitäns und ihrer Offiziere, die wiederum für die gesamte Mannschaft und ihr Verhalten verantwortlich gemacht wurden. Kapitän Bullers Nase war inzwischen verheilt, sodass er seinen Obliegenheiten nachkommen konnte.
Die ›Wasserhexe‹ hatte in der Ladung große Mengen von Holz und Brettern. Diese wurden zunächst gelöscht. Die Gefangenen bekamen Holz und Segeltuch zugeteilt, sich Unterkünfte zu schaffen. Dadurch waren sie von vornherein beschäftigt. Außerdem wurde ihnen ein Kohlenlager überwiesen und mehrere Fässer mit Trinkwasser, Kochgeschirr und Küchengerät; für die täglichen Lebensmittel wurde ein Ort der Abnahme bestimmt.
So hatten sie wieder zu tun, ihre Mahlzeiten zu bereiten. Nach Norden und Westen stand ihnen Land und Strand zur Verfügung, wenn auch das Land eine wasserlose und pflanzenlose Wüste war.
An Entkommen war nicht zu denken. Nach Süden war das Gebirge, das ein Ersteigen wegen seiner steil abfallenden Wände kaum möglich machte. Es hätte auch nichts genützt. Es bot höchstens Aussicht, aber kein Wasser noch Möglichkeiten zur Flucht. Über das Meer war jeder Weg abgeschnitten durch gefährliche Korallenbänke, und der Wall, wo ihnen die Lebensmittel verabreicht wurden, war bewacht. Zwei Mann genügten dort vollauf, auch selbst Hunderte zu bewachen. Außerdem standen auf dem Wall Maschinengewehre, die wir wohl zu bedienen verstanden. Sie sahen täglich unsere Schießübungen und waren damit vor jedem Überfallsversuch gewarnt. Aber selbst wenn sie die Wache aus dem Lavawall überwältigt hätten, so war für sie immer noch nichts gewonnen. Unser Schiff war in den Hafen gebracht worden. Sie hätten also nur vor einer Wasserfläche gestanden, und vom Schiff waren sie erst recht durch Maschinengewehre bedroht.
Die Gefangenenfrage war also glänzend gelöst, und bei ihrer großen Bewegungsfreiheit war ihre Lage keineswegs drückend. Stürme konnten allerdings, wenn sie von Norden oder Westen kamen, ihre Unterkünfte wegfegen. Auch das war kein Unglück, sie wurden dann neu gebaut. Zeit und Kräfte hatte man ja genug.
Mister Rugby hatte die ganze Insel genau durchforscht und kannte alle ihre Verhältnisse. Es lag im eigenen Vorteil der Gefangenen, sich nicht allzu weit vom Lager und Trinkwasser zu entfernen.
Für uns selbst bot die Insel noch andere Vorteile, deren wir bald innewurden. Die ›Wasserhexe‹ wurde zunächst wieder abgetaut, den ›Seedrachen‹ lösten wir und ließen ihn im Hafen treiben. Es konnte ihm vorläufig nichts geschehen. Dann lenkten wir mit einigen Schraubenschlägen an eine bestimmte Stelle der Felswand am Fuß des Bergkegels. Dort endete unsere Bucht in einen schmalen Wasserarm. An die Seitenwände konnten wir dicht heranfahren und wieder anlegen, fanden auch Vorsprünge genug, die Trossen zu befestigen.
Eine kleine Schlucht führte zum Fuß des Berges.
Aber siehe, die Bergwand öffnete sich. Hammer und Meißel brauchten nur wenig zu arbeiten, ein Gang zeigte sich, in den wir mit Lampen eintraten. Sehr bald aber erweiterte sich der Gang, und wir sahen zu unserem maßlosen Erstaunen, dass wir in einer ungeheuren Höhle standen, über der sich der Berg wölbte.
Das ganze Innere des Berges war hohl. Offenbar war er einstmals ein feuerspeiender Berg gewesen, und die Höhle war das Innere des Kraters, als hätte eine riesige Luftblase vorzeiten in der Lavamasse sich einen Weg nach oben gebahnt. Von oben fiel wirklich Tageslicht ein durch die Krateröffnung. Unten aber war das Meer eingedrungen und bedeckte den Boden der Höhle. Rings um diesen natürlichen See lief eine bald breitere, bald schmalere Rampe. Das war ein Ort, wie geschaffen, um unsere Waren aufzustapeln, Werkstätten zu errichten und noch viel mehr Dinge, als die ›Wasserhexe‹ barg, vor Sonne und Regen zu schützen.
Was aber den Hauptwert dieses hohlen Zuckerhuts ausmachte, war eine starke Quelle mit gutem Trinkwasser, die aus dem Felsen heruntersprang.
Diese Quelle verdankte auf der öden Insel ihre Entstehung den häufigen Regengüssen, an denen es ja in den Tropen nicht fehlt. Während man aber erwarten sollte, dass das Regenwasser in den zahlreichen Rissen der Lavamassen spurlos verschwindet, schien es sich hier in einem unterirdischen gemeinsamen Sammelbecken aufzuspeichern, das seinen Inhalt in den Bergkegel und dessen verborgenen See ergoss und als Quelle oder Wasserfall heraustrat.
Damit war die schwierigste Frage gelöst. Diese Quelle würde auch nie, nie versiegen. Mister Rugby hatte sie zu jeder Jahreszeit besucht, auch in der trockensten, und sie war stets so gelaufen wie jetzt. Damals war der Zugang zum Krater vom Hafen aus offen gewesen. Er hatte ihn aber, so oft er die Insel wieder verließ, mit Steinblöcken verlegt und weiterhin sogar vermauert, um sein Geheimnis zu wahren. Hier hatte er seinen eigenen Schlupfwinkel finden wollen, den er nun uns in Kriegsnot geöffnet hatte.
Viermal hatte er mit seiner Dampfjacht hier geweilt. Auf die Verschwiegenheit seiner Mannschaft hatte er rechnen können. Es waren auserlesene Leute gewesen. Von einer fünften Fahrt sollte die Jacht Rugbys freilich nicht zurückkehren. Er selbst hatte sich an der Fahrt nicht beteiligen können, aber die Jacht war verschollen, mit Mann und Maus untergegangen. Seitdem hatten sich die Pläne ihres Besitzers gewandelt. Aus dem Jachtbesitzer und Sportsmann war der erste Offizier eines Kauffahrers geworden.
Er hatte das der ganzen Mannschaft mitgeteilt. Wir sahen auch, welche Vorbereitungen er schon früher getroffen hatte. Auf der Rampe im Kraterinnern waren zahlreiche Kisten aufgestapelt. Ein großer Teil enthielt Lebensmittel in festverlöteten Blechkästen, ferner alles, was zur Hauswirtschaft nötig ist, Kupferdraht, Handwerkszeug, Leitungsrohre, Zement, kurz alles, was man bedarf, um für längeren Aufenthalt eine Zuflucht, für Seefahrten einen Stützpunkt zu schaffen.
Oben auf dem Berg hatte eine Beobachtungswarte mit Gebäude errichtet werden sollen, schon führte eine kupferne starke Leiter empor zur Kratermündung, das Kabel für Fernsprechleitung war bereits angebracht, auch die Batterie für die Drahtleitung war schon vorhanden, sie brauchte nur aufgestellt zu werden. Der Vorrat an Schwefelsäure und Eisenvitriol genügte.
Dennoch war das nicht das letzte Geheimnis des verschlossenen Sesams. Mister Rugby hatte uns schon in der Kajüte über Weiteres Mitteilungen gemacht. Jetzt sollte der Augenschein das Nähere beleuchten. An einer Stelle, nach Süden zu, wurde die Rampe um den See immer schmaler und hörte zuletzt auf. Dafür zeigte sich eine Spalte in der Wandung, die an sich nicht sonderlich aufgefallen wäre. Aber Mister Rugby hatte sie näher untersucht und festgestellt, dass sie sich nach unten stark erweiterte und dass hier die geheime Verbindung mit dem Meer zu suchen sei, der der Kratersee sein Dasein verdankte. Er behauptete, dass die Spalte unter Wasser bis sieben Meter Breite habe und somit einen unterseeischen Zugang zum Becken darstelle.
Das eröffnete für uns eine geradezu großartige Aussicht, die uns mit hellem Jubel erfüllte. Dann war doch das Kraterbecken der natürliche Hafen für unser UBoot. War die Zufahrt breit und tief genug, waren keine Ecken oder verborgene Klippen vorhanden, so konnten wir aus dem Meere hier einfahren, ungesehen, ohne irgendeine Möglichkeit der Verfolgung. Ebenso konnten wir auch hier ausbrechen, wenn etwa unser Hafen von feindlichen Kriegsschiffen belagert werden sollte.
Darüber mussten freilich erst noch genaue Feststellungen gemacht werden. Unverweilt nahm der erste Steuermann die Untersuchung in Angriff. An der Beantwortung dieser Frage hing für uns ungeheuer viel. Wenn das gelang, hatte der ›Seedrache‹ erst richtig seine Heimat, hatten die Seeteufel ihre Hölle gefunden.
Zwei Tauchanzüge waren vorhanden, tadellos imstande. Es waren Skaphanderanzüge, d. h. der Taucher trug auf dem Rücken in einer Art Blechranzen seinen ihm nötigen Luftvorrat. Das war Pressluft, von der dem Taucher durch eine sinnreiche Vorrichtung so viel zugeführt werden konnte, als er zum Atmen bedurfte. So war er unabhängig von einem begleitenden Schiff und konnte sich frei auf dem Meeresgrunde bewegen. Vier Stunden ermöglichte die Erfindung das Bleiben unter Wasser. Mit Spannung erwarteten wir das Ergebnis der Untersuchung.
Es währte eine halbe Stunde, da tauchte der Gummihelm, unter dem Mister Rugby arbeitete, wieder aus dem Wasser.
»Die unterseeische Zufahrt verläuft schnurgerade, sie ist an der schmalsten Stelle immer noch sieben Meter breit, und die Tiefe ist dieselbe wie im Hafen vorn, fünfzehn bis zwanzig Meter.«
Das war ja eine gewaltige Feststellung. Günstiger konnte die Sache für uns nicht liegen. Also ging's schleunig zurück.
Ein Boot der ›Wasserhexe‹ wurde klargemacht und der ›Seedrache‹, der irgendwo im Hafen lag, bestiegen.
Wir steuerten zum Hafen hinaus, bogen längs der Küste innerhalb der Korallenriffe in ruhigem Fahrwasser um und näherten uns dem Berge. Dort tauchte der erste Steuermann wieder unter, ebenso das Boot. Durch eine Linse im Bug des Boots konnten wir den Voranschreitenden gut sehen. Später vermochte man auch einen elektrischen Lichtstrahl hindurchzulassen, um die Einfahrt ohne Taucher zu beobachten. Dieses erste Mal gelangten wir vom Steuermann geführt richtig in das Innere des Kraters, wo der ›Seedrache‹ wieder auftauchte und an der Rampe vertäut wurde.
Eigentlich gehörten 25 Mann zu seiner Bedienung. Da war bei uns aber die Schießerei mit gerechnet und mancherlei, was in Notfällen entbehrlich war. Zu gewöhnlichen Übungen bedurften wir weit weniger Leute. In dem Kratersee war Raum genug, allerlei Bewegungen auszuführen, namentlich konnte das Tauchen so geübt werden, dass alle ihre Aufgabe genau lernten. Der Boden des Sees war nicht unter 20 Meter, das Tauchboot konnte auf 30 Meter Tiefe gehen. Es war somit jede Gefahr ausgeschlossen. Der ›Seedrache‹ hatte wirklich seinen sturmsicheren Hafen, der ihn völlig unsichtbar machte und feindliche Geschosse, sogar jede feindliche Verfolgung völlig ausschloss.
Ein dreifaches Hurra der Mannschaft dröhnte von der Kraterhölle zurück, als wir alles das festgestellt hatten.
Das Beste daran war, dass jede unserer Bewegungen auch unseren Gefangenen völlig verborgen blieb. Sie konnten hinter ihrem Lavawall, den keiner betreten durfte, schon den Hafen nicht überblicken, sahen nicht einmal etwas von der ›Wasserhexe‹. Von den Geheimnissen des Berges aber hatten sie schon gar keine Ahnung. Ungesehen konnte der ›Seedrache‹ aus und ein fahren. Die Gefangenen erblickten nie mehr als die Wache auf dem Lavawall. Ob wir anwesend oder unter Zurücklassung von nur zwei Wachtposten abwesend waren, konnten sie niemals feststellen, einen Überfall also nie unternehmen.
Ja, das war wohl ein Stützpunkt für unsere versprengte Schar Deutscher, wie er besser nicht gedacht werden konnte. Wehe, wer uns hier anzugreifen versuchte! Den Kratersee konnte kein Schiff erreichen, und wer uns im Hafen einschließen wollte, dem fielen wir mit dem Tauchboot in den Rücken.
Wer ein neues Land auf dieser Erde entdeckt, das niemandem gehört, der hat das Recht der Besetzung und Namengebung. Da es eigentlich Mister Rugby gehörte, so hatte dieser den Namen zu bestimmen. Er nannte es Düwelsland. Ein freudiger Beifall folgte seiner Eröffnung. Es sollte ein Teufelsland werden für alle unsere Feinde. Da es nach Kapitän Düwel genannt war, wussten wir, dass es auch seinen Schutzengel hatte: Uns sollte das Land ein Ersatz für die versenkte ›Angela‹ werden, eine deutsche Schutz- und Trutzburg des belagerten Deutschlands mitten in der Südsee.
Darum sollte es auch die deutsche Flagge tragen. Deutsches Land sollte es sein, ein deutscher Flottenstützpunkt gegen alle feindlichen Dampferlinien. Dazu hatten wir zweifellos das Recht. Das Kaperrecht musste uns bestritten werden, denn es war völkerrechtlich nicht haltbar, aber unser Recht, diese Insel für Deutschland in Besitz zu nehmen, konnte uns als Deutschen niemand streitig machen.
Also ließ Kapitän Düwel die Mannschaft feierlich antreten im besten Zeug, dann bestiegen wir den Berggipfel, um auf seiner Höhe eine wohlvorbereitete deutsche Flagge zu hissen. In einer kurzen feierlichen Ansprache wurde das Land für Deutschland in Besitz genommen. Dann teilte Kapitän Düwel den Mannschaften mit, er habe aus sicherer Quelle in Erfahrung gebracht, wie es in Wahrheit um Deutschland stehe. Die Erfolge im Westen, der Hindenburgsieg im Osten, das unerschütterte Bestehen der deutschen Kriegsflotte, die Begeisterung im Vaterland, das wurde dem lauschenden deutschen Ohr da oben auf dem Düwelsberg in der fernen Südsee verkündet. Unter den Klängen des Liedes »Deutschland, Deutschland über alles« stieg die Fahne empor und grüßte das neue deutsche Land. Es war ein mächtiges Segel von acht Quadratmeter, das wir aus wasserdichtem Stoff zusammengesetzt hatten und das weithin verkündete, dass die deutsche Flagge in der Südsee noch nicht eingezogen sei. Auch die Gefangenen mussten es sehen in ihrem Lager. Sie sollten wissen, dass sie unter deutscher Gewalt standen. Nun mochten vorüberfahrende Dampfer anlegen wollen, unser Wahrzeichen zu entfernen. Sie sollten nur kommen. Wir waren zum Empfang gerüstet.
Wenigstens glaubten wir's zu sein. Dass uns noch mancherlei fehlte, das machte erst die folgende Zeit offenbar. Es begann eine sehr ernste Arbeitszeit am Lande.
Zunächst mussten die Schiffsvorräte aus der ›Wasserhexe‹ gelöscht und am Kratersee, ›in der Hölle‹, wie der Raum genannt wurde, verstaut werden. Da waren vor allem die großen Petroleumvorräte, die dem ›Seedrachen‹ die Möglichkeit der Bewegung für Monate schafften. Mit der ›Wasserhexe‹ hätten wir keine Fahrt mehr machen können, da es an Kohlen gebrach und der Rest zum Kochen erforderlich war. Aber mit dem ›Seedrachen‹ konnten wir weite Fahrten wagen.
Dann wurde eine Wasserleitung gelegt bis ins Gefangenlager. Dadurch wurde der Verkehr wesentlich vereinfacht. Im Falle der Unbotmäßigkeit brauchten wir nur die Leitung zu unterbrechen. Der Lavawall war leicht gegen sie zu schützen.
Zur Verteidigung wurden ferner die vier großen Festungsgeschütze aufgestellt und an unsichtbaren Stellen der Felsen geborgen, sodass wir die See und die Zufahrt zum Hafen beherrschten.
Auf der Höhe des Teufelsbergs errichteten wir ein wetterfestes Beobachtungshaus und verbanden es mit dem Hafen und der Hölle durch eine Fernsprechleitung. Oben musste der Ausguck ständig bewacht werden. Der Aufstieg erfolgte innen auf der kupfernen Leiter. Einen Aufzug nahmen wir in Aussicht, doch musste er einstweilen hinter wichtigeren Arbeiten zurückstehen.
So vergingen wohl zwei Wochen in angestrengtester Arbeit, aber es war eine fröhliche Arbeit. Ein neues Schlupfnest wurde eingerichtet, eine deutsche Seefestung in der Südsee. Und es fehlte wirklich an nichts. Unsere Japaner hatten dafür gesorgt, dass alles da war, indem sie uns ein vollständiges Warenhaus bescherten. Das hatten die gelben Japse sich freilich nicht geträumt, dass die angeketteten Bestien den Spieß derart umkehren würden.
Schließlich machte der Kapitän noch eine wertvolle Erfindung, die unseren künftigen Streifzügen im Unterseeboot erst den rechten Wert verleihen sollte. Das war wirklich eine Teufelei, die da auf Düwelsland ausgedacht wurde.
Ohne Zweifel kennt der freundliche Leser jene kleinen Glasgestalten, die man kartesianische Teufel nennt. In meiner Jugend kam auf jeden Jahrmarkt ein Mann, der mit geringstem Anlagekapital einige Groschen mit ihnen zu verdienen suchte. Es sind gläserne Zierpüppchen mit Hörnern und Schweif, die einen Teufel darstellen.
Weil sie hohl sind, schwimmen sie in jeder Glasflasche aufrechtstehend nach oben. Wenn man aber die Flasche durch eine Blase verschließt und auf die Blase einen leichten Druck ausübt, so pflanzt sich der Druck fort auf die Luft oben in der Flasche, auf das Wasser und auf das Teufelchen — es sinkt. Es hat nämlich im Ende seines langen Schwanzes ein winziges Löchlein. Der Druck bewirkt, dass auch dort hinein ein Tröpfchen Wasser dringt. Das ist gerade genügend, das Püppchen so zu belasten, dass es sinkt. Nimmt man aber die Hand weg, so wird der Druck aufgehoben, das Teufelchen steigt wieder zur Oberfläche, weil das Wasser wieder aus der Öffnung heraustritt und das Ganze erleichtert. Ist das Schwanzende gebogen, so erfolgt auch eine drehende, tanzende Bewegung im Aufsteigen.
Dieses anmutige Spiel hat im 17. Jahrhundert der gelehrte französische Philosoph und Naturforscher Descartes ersonnen, um das Gesetz des Luftdrucks auf nette Art zu verdeutlichen. Es heißt nach ihm kartesianisches Teufelchen oder kartesianischer Taucher.
Warum sollte im 20. Jahrhundert nicht Kapitän Düwel diese Spielerei nachahmen und zu einer Kriegslist ausgestalten, um auch auf die Feinde Deutschlands einen Druck auszuüben?
Er nahm einen Blechkasten von etwa einem Meter Höhe und einem halben Meter Breite, der luftdicht geschlossen war bis aus ein kleines Loch am Boden. Im Wasser konnte er gerade schwimmen. Dieser Blechkasten war mit unserem Boot durch einen langen Schlauch von 50 Meter verbunden. Er war nur fingerdick und lief durch eine wasserdichte Stopfbüchse. Pressten wir nun Luft durch den Schlauch, so wurde im Blechkasten das Bodenwasser durch das Loch hinausgedrängt, und der Blechkasten stieg hoch; ließ der Druck nach, so drang das Wasser unten ein, und es sank. Es war also gerade umgekehrt wie bei dem kartesianischen Teufel.
Oben auf dem Blechkasten war ein rechtwinklig gebogenes Rohr befestigt, das gerade das Aussehen eines Periskops hatte. Das Periskop ist bei dem Unterseeboot einer der wichtigsten Bestandteile. Es ist das Auge des Boots. Durch eine sehr sinnreiche Linsenanordnung im Periskop kann der Beobachter die Meeresfläche übersehen, während das Boot unsichtbar ist. Wird das Periskop weggeschossen oder nur verletzt, so ist das Boot blind und wertlos. Wir täuschten also dem Feinde mit unserem Blechkasten und dem aufgenagelten Rohr ein Periskop vor, auf das er natürlich seine Schüsse richten würde, um sie dadurch von dem richtigen Periskop des ›Seedrachen‹ abzulenken, Um die Täuschung vollständig zu machen, brachten wir 10 Meter vom ersten Kasten entfernt noch einen zweiten an, der ebenso eingerichtet war, nur flatterte auf diesem unsere Fahne an Stelle des falschen Periskops, das der erste trug. Sie sollte den eigentlichen Körper des Unterseebootes vortäuschen.
Wie völlig uns die List gelang, sollte sich bald zeigen.
Wir haben dadurch unsere Feinde geblendet, bis ihnen die Augen übergingen, und unter dem Schutz dieser glücklichen Ablenkung feindlicher Geschosse konnten wir unser wirkliches Periskop ungestört benutzen.
So waren wir richtige Unterseeteufel geworden und wurden bald der Schrecken der Südsee, während unsere Feinde Deutschland ganz abgeschlossen wie eine belagerte Festung wähnten und ihre grenzenlosen Lügen die deutsche Schlachtflotte auf dem Meeresboden vor Helgoland begraben hatten.
Kaum zwei Wochen nach unserem Einzug in Düwelsland waren wir fertig. Wir hatten hart gearbeitet, aber die freudige Begeisterung hatte die Arbeit leicht gemacht. Man sollte daheim nie sagen, dass die auswärtigen Söhne in Mut, Tapferkeit und Freudigkeit den heimischen nachgestanden hätten.
Unsere deutsche Flagge flatterte lustig über dem Ausguck aus dem Teufelsberg. Unsere Geschütze waren gerichtet, unser ›Seedrache‹ klar: Nun konnten die Feinde kommen.
Aber es kam niemand. Unser vulkanisches Eiland hatte eine gar einsame Lage. Es liegt verlassen im weiten Weltmeer wie Sala y Gómez, wie die Osterinsel und die Weihnachtsinsel. Kein Segel, kein Rauchwölkchen erschien am Gesichtskreis, wie scharf wir auch Ausguck hielten, kein Feuer tauchte in der Nacht auf. Feuer nennt nämlich der Seemann die Lichter der Schiffe.
Also mussten wir den Gegner aufsuchen. Kämpfen wollten wir unbedingt. Kam die feindliche Welt nicht zu uns, so mussten wir zu ihr gehen. Es war vielleicht sogar besser, wenn unser Schlupfwinkel vorerst unbekannt blieb.
Natürlich hatten wir eifrig die Seekarten des Weltverkehrs vorgenommen und die wenigen Dampferlinien der Südsee ins Auge gefasst, soweit wir sie nicht auswendig wussten. Es gab eine Reihe von Linien, die ziemlich abseits von uns das Weltmeer kreuzten. Die meisten hatten San Francisco als Ausgangspunkt und Sydney als Ziel. Dazwischen werden Tahiti und die Fidschiinseln angelaufen. Nördlich von uns lag Seattle, Yokohama und Hongkong.
Befahren werden diese Linien meist von englischen und japanischen Dampfern. Amerikanische sind seltener und haben nicht regelmäßigen Dienst. Außerdem gab's zwei oder drei französische Linien, da auch die Franzosen Niederlassungen in Indien und in der Südsee haben. Die holländischen Niederlassungen lagen sehr fern von uns. Aber Japan, England, Frankreich, das waren unsere Hauptfeinde. Ihre Linien waren's, die wir brauchten.
Am Abend des fünfzehnten Tags war der ›Seedrache‹ bereit, seine heimatliche Hölle zu verlassen und die nächste Dampferlinie aufzusuchen, eine englische, die Frisco und Wellington verband. Sie war rund 300 Seemeilen von uns entfernt.
Vier Mann und ein Offizier mussten zurückbleiben, die Insel und besonders die Gefangenen zu bewachen. Diese durften gar nicht wissen, dass der ›Seedrache‹ auslief, konnten's auch nicht beobachten, da er durch den unterirdischen Graben ausfahren würde.
Also wer bleibt zurück? Freiwillige vor! Niemand meldete sich.
Es wurde bestimmt, dass das Los unter den Offizieren entscheide. Der Betroffene musste zurückbleiben und durfte sich vier Mann auswählen für den nötigen Wachtdienst.
Das Los traf mich. Innerlich brummte ich über mein Pech, äußerlich nahm ich die Entscheidung gefasst auf und wählte als die zuverlässigsten und tatkräftigsten Leute Jasper und Sepp aus. Es war immerhin ein verantwortungsvoller Posten, der uns zufiel. Als geschicktesten und beweglichsten Menschen erkor ich mir noch den Segelmacher, unseren Stromer, und um die Abfahrenden zu entlasten, behielt ich noch Ubbo, den Schneesieber, da. Er war ein Schwachkopf und hätte das Abenteuer der Davonziehenden, die immer noch 10 Mann weniger als eigentlich erforderlich waren, leicht gefährden können. Natürlich wussten die Gewählten mir keinen Dank. Besonders der bayerische Hiesl fluchte heimlich, wie nur ein bayerischer Matrose fluchen kann. Gegen mich durfte er sich's freilich nicht merken lassen, aber ganz unbemerkt blieb es mir doch nicht.
Der ›Seedrache‹ konnte die 300 Meilen allenfalls in 13 Stunden durchrasen. Wir schätzten seine Fahrt auf 24 Stunden. Dann musste er sich auf die Lauer legen, was auch mit einigen Tagen in die Rechnung gestellt wurde.
»In spätestens sieben Tagen sind wir zurück«, sagte Kapitän Düwel zu mir. »Wir müssen mehr Hände auftreiben, als wir haben. Das ist für uns die Hauptsache. Wenn ich nun höre, dass da und dort ein Schiff vermutet wird, das deutsche Gefangene an Bord hat, da muss ich natürlich zuerst alles tun, diese zu befreien. Aber, wie gesagt, in sieben Tagen erwartet uns bestimmt zurück, Stürmann. Und nun Gott befohlen!«
Und wenn der ›Seedrache‹ in sieben Tagen nicht zurück ist?
Ich stellte die Frage nicht. Sie wurde auch von keinem erörtert.
Man weiß nur, wann man weggeht, nie, wann man ankommt.
Unsere Lage war ernst genug. Was sollte aus den Zurückgebliebenen werden, wenn der ›Seedrache‹ überhaupt nicht wiederkam? In diesem Fall waren wir auf unser eigenes Nachdenken und unsere Tatkraft angewiesen.
Nachts elf Uhr tauchte der ›Seedrache‹ im dunklen Wasser der Hölle unter und — war verschwunden. Ich eilte mit schnellen Schritten hinaus auf die Beobachtungsstelle durch das enge Loch der Krateröffnung. Dort oben überblickte ich das Meer und sah die Feuer des davoneilenden Unterseeboots. Es hatte die Korallenriffe glücklich überwunden und zog in der Nähe der Hafeneinfahrt einen leuchtenden Streifen in die dunkle Nacht, hinein in die unermessliche Südsee. Dann war's verschwunden. Ich ahnte nicht, unter was für Umständen ich es wiedersehen sollte. Fahr wohl, du mutiges Schifflein! Trage deutsche Freiheit zu den Gefangenen! Gott schütze dich!
Oben hatte der Segelmacher die Wache. Am Morgen sollte ihn Ubbo ablösen. Sepp und Jasper wechselten in der Bewachung des Gefangenlagers.
Spät kam ich in meine Kabine an Bord der ›Wasserhexe‹. Ein Gefühl tiefster Einsamkeit überkam mich, seit das Toplicht am Panzerturm des ›Seedrachen‹ verschwunden war. Die Verantwortung für die Zurückgebliebenen, die Sorge um die Weggefahrenen fiel auf meine Seele wie eine schwere Last. Ich hatte in den letzten Tagen keine Zeit zur Besinnung gehabt. Tagsüber strenge Arbeit, nachts ein traumloser Schlaf. Aber nun kamen die Gedanken mit Macht. Es würde auch viel Zeit sein für Gedanken in den folgenden Tagen.
»Angela redet immer von euch«, hatte ihre Mutter durch Ahasver gesagt. »Von euch«, da musste auch ich eingeschlossen sein. Wenn sie ihres Vaters gedachte, musste auch ein kleines Erinnern in ihre Seele fallen an den Mann, der so feierlich gelobt, ihn bis in den Tod hinein zu schützen. Ob wir uns je wiedersehen würden? Wie hatte Hans Steen gesagt? Drei Jahre! Drei Jahre Weltkrieg, drei Jahre fern von der Heimat, drei Jahre Kampf auf Leben und Tod auf der einsamen Klippe im fernen Weltmeer! O Gott, was konnten die drei Jahre bedeuten!
Schadet nichts. Wer immer das Nächstliegende tut, der lebt in der Ewigkeit. Was gingen mich da die drei Jahre an? Und das Nächstliegende war meine harte Pflicht als Offizier. Sie sollte mich bereit finden. Ich sah im Geist einen hellen Stern in dunkler Nacht verschwinden; mit dem Gedanken an Angela versank vor mir die Wirklichkeit, und ein erquickender Schlaf umfing mich.
Mein Tag war reichlich besetzt. Zu einer bestimmten Stunde wurde den Gegangenen ihre Nahrung zugeteilt. Wasser hatten sie im Lager. Für die Blechkisten und Mehlsäcke hatten wir am Lavawall eine abschüssige Gleitbahn hergestellt, auf der ihnen das Nötige zugerollt wurde. Damit war erreicht, dass auch keiner der Unserigen zu ihnen hinabzusteigen brauchte. Für Ordnung unter sich mussten ihre eigenen Offiziere sorgen. Auf dem Wall war inzwischen ein Wachthäuschen errichtet worden, der ganze Wall war verebnet, sodass er leicht begangen, aber sehr schwer vom Lager aus erstiegen werden konnte. Das Ersteigen war an sich schon verboten. Neben dem Wachthause waren die Maschinengewehre aufgestellt.
Ich selbst war mit dem Wachthaus und dem Ausguck oben durch den Fernsprecher verbunden. Ich hauste an Bord der ›Wasserhexe‹, die an der Einfahrt zum Höllengang festgemacht war, von den Gefangenen also auch dann kaum erreicht werden konnte, wenn sie je den Wall erstiegen hätten. Der Zugang, den die Posten hatten, war schmal und sehr leicht mit Maschinengewehren zu bestreichen. Ein Mann genügte zur Verteidigung des Schiffs.
Die Fahne auf dem Berg ließ ich einziehen. Sie lag zusammengerollt neben der Ausguckstelle, ein wasserdichtes schweres Bündel. Wir konnten jetzt keinen feindlichen Besuch gebrauchen. Es war gut, dass unser Schlupfwinkel noch unbekannt war.
Das anfänglich schöne Wetter hatte inzwischen einem ziemlichen Sturm Platz gemacht. Am dritten Tag erreichte er eine Stärke, dass die See tief aufgewühlt wurde. Er kam geradeswegs von Norden. Unsere Gegangenen waren ihm schutzlos preisgegeben. Doch schlugen die Wogen nicht über den Strand. Sie wurden schon außen an den Korallenriffen gebrochen. Nur die Zelte und Hütten der Gefangenen wurden auseinandergerissen. Das schadete weiter nichts. Sie hatten Zeit, sie neu zu errichten. Ihnen selbst geschah nichts, was sie als Seeleute an Deck nicht viel schwerer durchzumachen gehabt hätten.
Wie aber würde unser ›Seedrache‹ den Sturm überdauern? Nun ist ja in einer Tiefe von 4 bis 5 Metern der Wellenschlag nicht mehr zu spüren. Dennoch war es besser, auf ein dauerndes Untertauchen des Bootes nicht zu rechnen. Aber Sorgen darf man sich nicht machen. Wer sich vor Möglichkeiten fürchtet, verliert allen Mut und ist unfähig, das Nächstliegende freudig zu erfüllen. Also fort mit den schweren Gedanken!
Der Mensch hat wohl die Fähigkeit, falsche Gedanken aus seinem Innern zu verbannen. Falsche Gedanken sind die Ursachen zu den schwersten Krankheiten, die sich dann irgendwo im Körper einnisten und ihre geheimen Entstehungsgründe zu sichtbarem Ausdruck bringen.
Die See glättete sich wieder. Aber da war schon der siebente Tag angebrochen, und vom ›Seedrachen‹ war keine Spur zu sehen.
Dafür tauchten mit einem Mal, als hätte der Sturm sie herbeigeführt, am Gesichtskreis recht häufig Segel und Rauchwolken auf. Es war geradezu, als wollten sie uns höhnen und herausfordern, da wir ihnen nichts mehr antun konnten. Sie blieben aber immerhin noch weit entfernt und hüteten sich vor den gefährlichen Klippen von Düwelsland.
Aber warum kamen sie gerade jetzt? Sollte der ›Seedrache‹ hilflos aufgefischt und unser Geheimnis verraten sein? Und wenn ein Schiff herankam — man konnte von Westen unschwer in unseren Hafen gelangen —, was taten wir dann?
Schwierige Lage, schwere Gedanken.
Oder sollte unser UBoot gesunken sein, genommen, gefangen?
»Sie werden schon noch kommen. Sie haben sich verspätet. Das geschieht leicht zur See«, — so sprachen wir, wenn überhaupt gesprochen wurde. Der Seemann ist wortkarg, aber tatkräftig.
Indessen versahen wir jeder unseren Dienst. Aber es wurde der achte, der neunte, der zehnte Tag, und der ›Seedrache‹ kam nicht, wie scharf wir auch spähten.
Was nun? —
Nach dem Sturm war eine drückende Stille gekommen. Heiß und schwül brannte die Sonne auf unseren schattenlosen Lavafelsen. Sehr heiß war's ja naturgemäß in diesen Breiten. Aber diese Schwüle war auch mir fremd. Ich hatte sie höchstens im Roten Meer so erlebt. Wie geschmolzenes Blei lag das Meer spiegelglatt. Es war, als ob die Glut an den Lungen sauge. Schwer lag's auf uns. Die Sorge machte es nicht leichter.
Trotzdem kletterte ich gegen Mittag hinauf auf den Krater. Vielleicht war es oben frischer. Unten am Höllensee herrschte trotz des ewigen Schattens unerhörte Stickluft.
Zum vierten Mal war ich heute oben. Die Unruhe konnte ich kaum mehr meistern.
Der Segelmacher hatte Wache. Aber was war das? Himmel und Hölle! Der Stromer schlief auf Wache. Unerhört. Er erwachte nicht einmal, als ich eintrat. Er lag auf der zusammengerollten Flagge und war nur durch Rütteln wach zu bekommen. Eigentlich war das auch gar nicht seine Art. Nun ja, er war ein Stromer, der den Kopf voll Narrenspossen hatte, aber seine Pflicht tat er stets mit größter Gewissenhaftigkeit. Und hier schlief er auf Wache!
»He, Sailmaker, seid Ihr von Sinnen, auf Wache zu schlafen?«
Er fuhr empor und blickte verstört um sich. Da bemerkte ich, wie elend der Mann aussah.
»Seid Ihr krank, Sailmaker?«
Er raffte sich auf. Ich sah ihm aber die Anstrengung an, mit der er sich zwang.
»I wo, Stürmann, ick und krank —«, versuchte er zu lachen. Aber er verzog nur das Gesicht, seine Zähne klapperten.
Er hatte Fieber. Er wollte nichts davon wissen, musste aber doch zugeben, dass ihn die Schwäche überwältigt hatte. Ich beorderte Ubbo zur Ablösung, die ohnehin bald erfolgt wäre, und gab ihm auf, auch möglicherweise die ganze Nacht oben zuzubringen. Dann nahm ich den Stromer hinab zu mir. Das hatte gerade noch gefehlt, dass mir einer krank wurde! Er hatte sehr hohes Fieber. Ich gab ihm Chinin ein und ließ ihn auf dem Schiff. Gegen zwei Uhr steigerte sich das Fieber, der Mann begann zu toben. Ich musste ihn also binden und legte ihn auf ein Lager in meiner Kajüte. Da war's noch am kühlsten. Aber dennoch war die Hitze und Schwüle kaum erträglich. Dann versuchte ich, kalte Umschläge auf seinen Kopf zu machen, aber Eis fehlte, und das Meerwasser war brühwarm wie von unterirdischem Feuer.
Nach drei Uhr früh pflegte das Fieber nachzulassen, um erst in den Abendstunden wieder zu steigen. Ich kletterte deshalb gegen neun Uhr morgens wieder auf den Kraterrand, um Ubbo abzulösen, dessen Schutz ich nun den Kranken anbefahl, um acht Uhr abends übernahm ich ihn selbst wieder. Das Fieber war nicht gewichen trotz aller Chiningaben und Umschläge.
Um zehn Uhr klingelte der Fernsprecher.
»Wer da?«
»Hier Ubbo. Stürmann, ich bleibe nicht mehr hier oben«, ruft der Schneesieber in weinerlichem Ton.
»Warum nicht?«
»Ich fürchte mich.«
»Nanu?«
»Hier spukt's.«
»Was? — Es spukt? —«
»Überall sind kleine blaue Flammen, das sind Gespenster...«
»Unsinn, Ubbo! Das sind nicht Gespenster, sondern Elmsfeuer. Hast du noch nie Elmsfeuer gesehen?«
Nein, die hatte der Junge noch nicht gesehen, wusste gar nicht, was das war, ließ sich auch nicht belehren, sondern heulte durch den Fernsprecher. Beinah wunderte ich mich, dass er seinen Posten nicht schon verlassen hatte. Offenbar fürchtete er sich vor den Gespenstern auf dem weiten finsteren Weg. Aber ich bestand darauf, dass er allein kam, denn den Kranken vermochte ich nicht ohne Beistand zu lassen, einen Posten von dem Gefangenlager konnte ich auch nicht zurückziehen.
Und der ›Seedrache‹ kam nicht.
Nach einer Viertelstunde erschien Ubbo, vor Angst selbst mehr Gespenst als Mensch. Es war mit ihm nichts anzufangen.
Ich übergab ihm den Kranken und besetzte selbst den Posten. Das hatte ich mir vorgenommen, unter keinen Umständen den Ausguck zu verlassen. Dort wurde genau Tagebuch geführt. Das wollte ich den Heinmkehrenden vorlegen.
Es war stockdunkel. Bleischwer brütete die Hitze über dem Eiland. In der Hölle war ein richtiger Höllenbrodem, der das Atmen kaum möglich machte. Auch oben war's nicht leichter.
Solch schwüle Stille ist meist der Vorbote der schweren Wetter, an denen die Südsee so reich ist.
Ein unbeschreiblicher Anblick erwartete mich oben. Das Wachthäuschen war sehr fest verankert, mit Winkeleisen und allerlei Vorkehrungen befestigt, stand auch leidlich sturmsicher da, weil der Krater erst einen kleinen Wall bildete auf der kreisrunden Ebene der Bergspitze. Im Schutz dieses Walles, den es nicht überragte, stand es.
Aber wie sah es aus! Jede Ecke, jeder Vorsprung war mit einem blauweißen Licht besetzt, an jedem Nagel saß ein Flämmchen. Sie waren von Fingerhutgröße, sie waren auch spannenlang. Hunderte und Hunderte saßen überall, dass es aussah wie festlich erleuchtet. Man konnte wirklich erschrecken vor dem bläulichen Flammenhaus mitten in stockdunkler Nacht. Kein Wunder, dass der dumme Junge geheult hatte. Es war ein schaurigschöner Anblick.
Auch mir kam ein Grausen an. Etwas Furchtbares lag in der Luft, eine schwere Ahnung erfüllte mich, als ich in Schweiß gebadet mich der Hütte näherte.
Innen brannte die Lampe. Die letzten Eintragungen im Wachtbuch betrafen die Ablösungen. Ich schrieb die Wachtübernahme und die ungewohnte Stunde ein. Dann stieg ich auf die Kiste, auf der die Flagge lag, öffnete auf dem Dach die Luke. Von dort konnte man den Kraterwall überblicken und bei Tag das Meer sehen.
War dort im Nordosten nicht ein Feuer? Sollte das die Toplaterne eines Dampfers sein? War es etwa der ›Seedrache‹? —
Weiter kam ich nicht. Ein entsetzliches Heulen, Pfeifen, Fauchen begann in der Luft, ein Feuermeer schien auf mich herabzustürzen, ein Krachen, Donnern, Toben — ich habe gar keine Zeit, mir Rechenschaft zu geben. Es packt mich, dreht mich, hebt mich, schleudert mich. Alles wirbelt um mich und ich drin...
Mehr weiß ich nicht. —
Hilfe!, wollte ich denken, aber das Bewusstsein schwand. Ich weiß heute noch nicht, für wie lange. — — —
Die ersten Spuren des wiederkehrenden Bewusstseins brachten mir nasse, plätschernde Gefühle. Irgendwo war Wasser und Meereswellen. Wo ich war? Keine Ahnung, auch keine Fähigkeit, klar zu werden.
Nur eines: Eine Windhose hat dich in die Höhe gerissen. Wahrscheinlich hat sie am Kraterloch ihren Ausgang genommen, und jetzt bist du irgendwohin geschleudert. Ins Meer.
Also schwimmen. Aber das ging nicht. Hände und Füße waren irgendwie festgehalten. War ich gefesselt? Träumte ich nur in meinem Bett? Es gibt solche Träume, aus denen man beruhigt erwacht.
War ich im Meer, warum schwamm ich, wenn ich doch gefesselt war? Etwas musste mich tragen, aber was?
So viel bemerkte ich, dass das Wasser um mich her immer noch wie Phosphor leuchtete, während es sonst stockfinster war. Es war alles nur wie ein Gedankenblitz. Man kann ja in Augenblicken Ewigkeiten durchleben. Da — ein neuer blendender Schein, ein furchtbarer Schlag, und wieder war ich versunken im Unbewussten. Wieder für unbekannte Zeit.
Dieses Mal fühlte ich, noch während die Augen geschlossen waren, dass mich der Kopf sehr schmerzte. Der Schmerz ging oberhalb von der rechten Schläfe aus. Aber ich schwebte und schwamm nicht mehr. Unter mir lag Hartes, Wehtuendes, das meinen Gliedern Schmerzen bereitete. Nur war ich immer noch gefesselt oder eingewickelt.
Dann versuchte ich die Augen zu öffnen. Es war Tag. Ein feiner, warmer Regen träufelte auf mich. Zu meinen Füßen brandete das Meer, aber nicht heftig. Die Brandung wurde durch Klippen erzeugt. Auf einer Klippe lag ich selbst. Und ich war eingewickelt in ein rotes Tuch, weiter setzte es sich weiß fort, dann kamen Fetzen schwarzen Tuchs.
Himmel, das war ja unsere Fahne! Auf der Fahne war der Stromer zusammengesunken. Sie lag doch auf der Kiste oben auf dem Teufelsberg, und auf der Kiste hatte ich zuletzt gestanden. Der Zusammenhang erwachte wieder. Offenbar hatte sich das schwere wasserdichte Flaggentuch um mich gelegt und wie in eine Blase eingehüllt, die nicht versinken konnte. Sie war ja 8 Quadratmeter groß und bestand aus Ölstoff. Sie hatte mir offenbar das Leben gerettet, während das Bretterhaus in Trümmer gegangen war.
Wie lange ich bewusstlos im Wasser getrieben hatte, ließ sich nicht feststellen. Meine Uhr stand. Jedenfalls befand ich mich am Leben. Es fragte sich nur, wie ich dieses Leben erhalten konnte.
An der rechten Schläfe hatte ich eine tüchtige Beule, weiter nichts. Die Schmerzen am Rücken waren verursacht durch die harte Unterlage des Felsens. Die Hände zeigten einige blutige Risse. Nichts von Bedeutung.
Aber wo war ich? Da war der Befund viel trauriger. Ich wickelte mich aus dem anhängenden, wasserschweren Ölstoff und richtete mich auf. Eine nackte Felsenklippe mit einigen vorgelagerten Riffen hatte mich aufgenommen. Nach wenigen Schritten hatte ich ihren Gipfel erstiegen. Drüben sah's geradeso aus. 10 Meter Durchmesser, 6 Meter über dem Meere. Das war mein neues Reich. Dem konnte ich ja auch einen Namen geben und, Hohn des Schicksals: Ich besaß sogar eine Flagge, wenn ich sie auch nicht aufziehen konnte. Das Weltmeer hat solche einsame Klippen, die für die Schifffahrt schwere Gefahren bilden. Glücklicherweise sind die Meere so groß, dass man leichter einen verlorenen Groschen im Acker findet, wenn man ackert, als auf solch eine einsame Klippe stößt, wenn man bei Nacht segelt.
Mir hatte sie das Leben gerettet. Merkwürdiges Glück! Wenn man's ein Glück nennen konnte!
Aber dennoch besserte sich meine Lage. Erstlich stellte ich fest, dass es gerade höchste Flut war. Wäre es Ebbe gewesen, so wäre ich nach einigen Stunden doch abgespült worden. Aber mit den fallenden Flut zeigte sich noch ein kleiner Strand. Auf ihm blieben einige Muscheln zurück, die mir Nahrung gaben. Dazu regnete es, es goss vom Himmel. Ich konnte Wasser aufsaugen auf meiner Fahne. Es blieben auch auf dem Felsen kleine Tümpel, aus denen ich trinken konnte. Die Hitze plagte mich auch nicht.
Aber wie lange währte Kühle und Wasservorrat unter dem Äquator? — Wäre es nicht besser gewesen, wenn das Meer mich verschlungen hätte?
Trotzdem, ich lebte, und solange der Mensch lebt, darf er keinesfalls verzweifeln. Das ist eine der wichtigsten Wahrheiten unseres Daseins. Iss Schnecken und lecke Regenwasser, solange du welches hast, aber verzweifle nicht!
Mein Ende war noch nicht gekommen. Ich sollte ein fast unmögliches Glück haben. Je schwieriger eines Menschen Lage ist, desto leichter besucht ihn das Glück.
Am Nachmittag des dritten Tags sah ich am westlichen Himmel ein Segel. Ein Rauchwölkchen tauchte auf.
Das war an sich noch kein Glück. Aber ein Wunder, ein unerklärliches Wunder war's, dass die Seefahrer mich bemerkten.
Mein Hemd und meine Hose knutschte ich zusammen und schwang dieses Zeichen, bis meine Arme erlahmten. Meine Flagge war letzte Nacht ins Meer gespült worden.
Der Dampfer kam näher. Jetzt musste man mich bemerkt haben. Er änderte seinen Lauf und hielt gerade auf die Klippe zu. Dann wurde ein Boot klargemacht. Der Dampfer drehte bei. O Gnade Gottes!
Es war ein winziger Dampfer. Ich schätzte ihn auf 300 Tonnen. Nun konnte ich auch am Heck seinen Namen lesen!
›Guillaume‹, Nuku Hiwa.
Hallo. Ein Franzose.
Jetzt erst kam mir wieder der Krieg zum Bewusstsein. Gerettet war ich, aber von Feinden. Gerettet, aber ein Gefangener.
Ich wusste, dass es eine Inselgruppe gibt, die Nuku Hiwa heißt. Die Inselchen heißen auch MendanaInseln. Wir Deutschen nennen sie MarquesasInseln, die Franzosen Les Marquises. Hätte ich das nicht gewusst, so hätte ich meine Steuermannsprüfung nicht bestanden. Ich wusste auch, dass diese Inseln französischer Besitz sind. Fiel ich als Deutscher in französische Hände, so war ich Gefangener. Der Deutschenhass ist ja bei den Franzosen, die in der Welt richtig ausgelüftet sind, nicht so maßlos wie in ihrer Heimat, wo er schon der Jugend schulmäßig eingeimpft wird und die lächerlichsten Formen annimmt. Ich konnte auf eine weit angenehmere Gefangenschaft rechnen als auf eine englische. Aber ich hatte nun mal keine Neigung, Gefangener zu sein.
Da kam das Boot schon heran. Eingeborene Ruderer und zwei echt französische Blassgesichter. Auch meine Überlegung war beendet.
Papiere besaß ich nicht. Ebenso wenig irgendeinen sonstigen Nachweis meines Deutschtums. Also hieß ich... sagen wir Eduard Snyder, war geborener Amerikaner, waschechter Yankee, Bürger der Vereinigten Staaten, Steuermann auf der Privatjacht des steinreichen Mister Miller aus New York gewesen, war vor drei Tagen über Bord gewaschen worden und hier auf dieser Klippe gelandet.
Mir sollte einmal jemand beweisen, dass ich nicht Mister Eduard Snyder aus New York sei! Ich konnte das fließendste Englisch durch die Nase quetschen, mich in jedem Sessel rekeln, Zeitungen lesen und die Beine auf den Tisch legen, und außerdem sollte mir jemand mitten in der Südsee beweisen, dass es in New York keinen steinreichen Mister Miller gäbe, der eine kleine Dampfjacht besaß namens ›Sunbeam‹. Meine Uhr hatte keine eingegrabenen Buchstaben, meine Kleider keine deutschen Schneidermarken. Ich hatte an alles gedacht.
Das Boot brachte mich schnell zum Dampfer. Die See war wieder spiegelglatt. Der Steuernde trug einen französischen Zwickbart, sah freilich nicht sehr vertrauenerweckend aus, fragte aber nur wenig: ob ich mein Schiff verloren hätte, wie lange ich hier gehaust habe — nicht mehr. Ich hatte absichtlich in gebrochenem Französisch geantwortet, um mein Amerikanertum umso glaubhafter zu machen.
An Bord empfing mich der Kapitän. Auch er war ein Franzose und machte einen sehr vorteilhaften Eindruck.
»Wer sind Sie?«
Jetzt musste meine Lüge beginnen.
Nein und nein und nein — hieß es da plötzlich in mir. Es gibt innere Stimmen, die mit solcher Macht reden können, dass vor ihnen alle Lügen zerfasern. Ich weiß nicht, ob alle Menschen sie hören, aber ich bin stets in entscheidenden Stunden meines Lebens von ihnen geleitet worden und zuweilen Wege gegangen, die anscheinend sehr töricht und wenig klug erschienen, die sich aber später stets als richtig erwiesen. Wehe mir, wollte ich meiner inneren Stimme nicht gehorchen! Ich würde allen Halt und alle Sicherheit verlieren und vielleicht mein bestes Gut dazu, meine innere Stimme, Führung und Leitung. Andere Menschen sind vielleicht anders gestellt, aber ich nicht. Ich weiß, dass ich hier gehorchen muss.
Und dann kam plötzlich die eigene Überlegung dazu. Sollte ich als Deutscher mein Deutschtum verleugnen aus feiger Angst und alle Kriegsjahre hindurch mich in ein ganzes Netz von Lügen verwickeln? Sollte ich mich schämen, ein Deutscher zu sein? Noch dazu, nachdem mich die deutsche Fahne vor dem Tod des Ertrinkens gerettet? Nimmermehr! Vielleicht wäre mir dieser plötzliche Entschluss nicht mit solcher Macht gekommen, wenn ich nicht gesehen hätte, dass dieser Kapitän ein wirklich anständiger Mensch war. Er war zunächst mein Lebensretter. Nein, ich wollte ihn nicht belügen.
Also stellte ich mich aufrecht hin, verschränkte die Arme über der Brust und, statt mich als Eduard Snyder vorzustellen, sagte ich frei und offen:
»Ich bin ein Deutscher. Ich heiße Knut Larsen und stamme aus Kiel.«
Kaum hatte ich's gesagt, so überkam mich eine stolze Freudigkeit, eine Freudigkeit, wie ich sie selten gehabt, ein so grenzenloses Glücksgefühl, wie es nur die Macht der Wahrheit verleihen kann, die innere Bestätigung: Jetzt hast du richtig gehandelt.
Der französische Kapitän, Monsieur Girard, war wirklich ein feiner Mann. Ich sah, wie ein Bedauern über seine Züge flog, aber nun war auch die Lage geklärt. Der Mann wusste, dass er von mir nur unbedingte Wahrheit hören würde: Mit meinem mutigen Bekenntnis hatte ich ihm gegenüber alle Sicherheit gewonnen, und die ist im Leben so unendlich viel wert. Nur die Wahrheit verleiht sie. Darum klage niemand, der sich unsicher fühlt. Die Wahrheit wird jedem Ruhe und Freudigkeit verleihen.
»Sie sind Deutscher«, vergewisserte er sich noch einmal, aber schon mit besorgtem Gesicht.
»Ich bin Deutscher.«
»Schade, dass Sie das gleich gesagt haben. Es wäre besser gewesen, wenn Sie das verschwiegen hätten.«
»Warum? Ich bin ja wirklich Deutscher.«
»Wissen Sie, dass Frankreich mit Deutschland in Krieg verwickelt ist?«
»Ich weiß es.«
»Meine Pflicht ist jetzt, Sie gefangen zu nehmen. Ich fahre nach Nuku Hiwa. Das ist eine französische Besitzung. Dort muss ich Sie abliefern. Ich darf Sie auch nicht vorher von Bord lassen. Sie müssen sich als meinen Gefangenen betrachten.«
»Ich habe es nicht anders erwartet. Tun Sie Ihre Pflicht! Die meinige war, Ihnen die Wahrheit zu sagen.«
So war ich Gefangener. Ich wurde freilich sehr angenehm behandelt. Ich war das Ereignis des Tages, die merkwürdige Unterbrechung des Einerleis für jene harmlosen Inseln. Sie hatten damit in den Krieg für ihren Teil eingegriffen und gleich einen deutschen Offizier gefangen. Das tat wohl und verbreitete über mein Dasein auf dem Schiff eine angenehme Behaglichkeit.
Das erste war, dass ich ein geradezu üppiges Mahl erhielt mit Vorspeisen von Lachs, Hummer, Kaviar und feurigen Getränken. Hunger hat der Seemann immer, und wenn man drei Tage von Seeschnecken gelebt hat, ist man für gutes Essen besonders aufgeschlossen. Ich ließ mich also nicht lange nötigen, sondern langte zu, als gälte es einen Vernichtungskrieg gegen alle französischen Schiffsvorräte.
Dann wies man mir eine Offizierskammer an, und dort tat ich einen wohligen, zwölfstündigen Schlaf. Meine Gefangenschaft begann jedenfalls sehr angenehm.
Als ich erwachte, fand ich eine passende, gute Kleidung vor. Dann setzte ich das durch den Schlaf unterbrochene Mahl fort. Diesmal leistete mir Monsieur Girard Gesellschaft, und bald hatten wir drei Flaschen Sekt den Hals gebrochen. Wir waren auf französischem Boden. Er hoffte und sprach unverhohlen aus, dass der unselige Krieg bald zu Ende und das besiegte Deutschland bald französische Provinz sein werde, damit wir endlich erführen, was Kultur und Zivilisation sei. Der Franzose bleibt sich immer gleich. Er leidet nun einmal an ungeheurer Eitelkeit und poltert diese ganz offen heraus. Eitle Menschen sind bequeme, auch gutmütige Menschen.
Man hüte sich, ihre Eitelkeit zu verletzen und wird stets gut mit ihnen auskommen. Darum kann der Deutsche leicht den Franzosen verstehen und wird gern sein Land besuchen, bringt auch schlechthin keinen Hass zuwege. Nur umgekehrt gibt's keinen Weg. Der Franzose wird nie deutsches Wesen begreifen, wird sich nie in Deutschland wohlfühlen und wird wohl immer seinen Hass bewahren. Das Törichtste wären Versuche zu einer deutschfranzösischen Verbrüderung. Wozu? Wir bedürfen ihrer nicht, den Franzosen ist sie ewig verschlossen.
Ich ließ mir's jedenfalls während dieser Ergüsse trefflich schmecken und hörte andächtig zu. Es hat mir stets eine gewisse Freude bereitet, die Seiltänzerkunststückchen menschlicher Beweisführungen als unbeteiligter Zuschauer zu beobachten. Die Menschen wissen ja gar nicht, wie unterhaltend sie sind.
Am meisten Anteilnahme hatte ich natürlich an den neuesten Nachrichten von den Weltkabeln. Das Schiff kam gerade von Honolulu. Das ist der Hauptplatz aller Kabel, die in der Südsee liegen. Ich erfuhr, dass in Deutschland die Hungersnot schon so groß war, dass man die Rinde von den Bäumen fraß, dass schon ganze Waldungen verwüstet waren, erfuhr schauerliche Einzelheiten vom Selbstmord des Kronprinzen, aber wozu soll ich das wiedergeben! Ich glaubte es doch nicht.
Es stimmte mich freudig. Wer so lügen muss wie die Engländer, der zittert heimlich vor dem Sieg der Wahrheit. Der hat sich selbst verloren gegeben.
Viel wichtiger war mir, was ich über Taiosae, die Hauptstadt von Nuku Hiwa, erfuhr, wohin ich als Gefangener abgeliefert werden musste.
Taiosae ist Hauptstadt und einzig möglicher Hafenort von Nuku Hiwa, der größten Insel in der Gruppe. Sie hat 982 Quadratkilometer und 1000 Einwohner. Dort wohnt der französische Statthalter.
Über ihn erzählte mir der Kapitän die drolligsten Geschichten, die mich umso mehr belustigten, als er sie mit vollem Ernst und gebührender Ehrfurcht vortrug. Er dachte nicht daran, ihn etwa lächerlich zu machen.
Vor etwa zwei Menschenaltern hatte der alte Monsieur Armand in Frankreich seinen Reichtum begründet durch den Vertrieb eines Hühneraugenmittels, dem sich bald Abführpillen zugesellten, und als er die Augen schloss, besaß er in der Nähe von Paris eine ganze Stadtanlage, in der Seifen, Riechstoffe, Schminken und allerlei Schönheitsmittel hergestellt wurden. Sein einziger Sohn Maurice erbte etwa 25 Millionen Franken.
Maurice war Offizier geworden, besaß aber nicht die dazu erforderlichen Eigenschaften und kam trotz seiner Millionen nicht recht vorwärts. Er verließ den Dienst und versuchte es mit der Politik. Dort ging's auch nicht so schnell, denn er hatte gehofft, Präsident der Republik zu werden. Er kam nicht einmal bis in die Kammer.
Da trat er in den Kolonialdienst, kam nach den MarquesasInseln, und hier gelang's ihm. Er wurde Gouverneur. Diesen Posten bekleidete er seit dreißig Jahren und hatte sich recht behaglich eingerichtet.
Er spielte hier, kurz gesagt, den König, und da er genug Geld hatte, auch kostspielige Neigungen zu befriedigen, richtete er sich häuslich ein, und Frankreich ließ ihn gewähren. Er war treuer Franzose, auch guter Republikaner für sein Heimatland und hielt sein Gebiet in tadelloser Ordnung. Was wollte man mehr!
In dreißig Jahren kann man mit reichlichen Geldmitteln mancherlei Schönes schaffen. Das hatte auch Herr Maurice Armand getan. Der Hafen von Taiosae wird von einem hohen, steilen Bergzug umrahmt. Da oben hatte der Gouverneur seinen Wohnsitz eingerichtet, den er Olympia nannte. Olympia war mit fürstlicher Pracht ausgestattet.
Dieses in den Felsen gehauene Schloss war auch als neuzeitliche Festung eingerichtet. Da der Herr Gouverneur von seiner Regierung keine Kanonen geliefert bekam, außer einigen vorsintflutlichen Böllern, hatte er auf eigene Kosten eine Menge Geschütze beschafft bis zu den schwersten Abmessungen und hatte seine Festung damit gespickt. Ebenso besaß er ein eigenes Kriegsschiff, eine stattliche Fregatte, die seine Befehle zwischen den Inselchen hin und her trug. Er hatte auch ein eigenes Heer von etwa 120 Mann, die er selbst kleidete und neuzeitlich bewaffnete. Frankreich hatte gegen all das nichts einzuwenden.
Er hielt auch einen eigenen Hofstaat. Wenn man Geld hat, finden sich immer Herren und Damen aus Paris und aller Welt, die gern mittun, und Monsieur Armand spielte insonderheit den Beschützer und Förderer von Kunst und Wissenschaft. Gelehrte, Künstler und Dichter fanden stets freundliche Aufnahme.
So berichtete der Kapitän des ›Guillaume‹. Er setzte dann hinzu, dass freilich dieser Selbstherrscher sehr unter dem Pantoffel stehe, und zwar nicht unter dem seiner Gattin. Diese sei im Gegenteil eine sehr bescheidene, einfache Frau gewesen. Wohl aber unter dem Pantoffel seiner einzigen Tochter, seines einzigen Kindes aus dieser Ehe.
Sie sei etwa achtzehn Jahre alt und führe eigentlich die Herrschaft. Sie habe über alles das letzte Wort, und der Papa sei ihr stets zu Willen. Alles komme für mich darauf an, welchen Eindruck ich auf Mademoiselle Lilly mache. Sie sei ein besonderer Mensch.
Auch der ›Guillaume‹ war Regierungsdampfer, ebenfalls auf Kosten des trefflichen Gouverneurs erbaut und erhalten. Er kam eben von Honolulu, wo er Einkäufe gemacht hatte für den Hofstaat des Selbstherrschers. Er hatte die feinsten Leckerbissen und die edelsten Weine an Bord, die auch dem Kapitän und seinen Offizieren und somit schließlich mir zugute kamen.
Honolulu ist ein Handelsplatz, an dem alles, was in der Welt käuflich ist, zu beschaffen ist, einer der wichtigsten Plätze der Südsee. Nun merkte ich auch, weshalb ich so vorzüglich aufgenommen wurde. Sollte ich einen guten Eindruck auf meine künftige Herrin machen, so war es wichtig, dass ich dem Kapitän Girard ein gutes Zeugnis ausstellte. Wenn nicht, schadete es auch weiter nichts; dann war es seiner Menschenfreundlichkeit eine Genugtuung, dass er das Los des Gefangenen tunlichst erleichtert hatte.
Ich würde übrigens voraussichtlich der einzige Gefangene auf Nuku Hiwa sein, wahrscheinlich in der ganzen Inselgruppe. Der Herr Gouverneur sei nicht gerade ein Deutschenfeind, aber natürlich als Franzose auch kein Deutschenfreund. Da er aber in seinem Bereich allmächtig sei, habe er niemals unter seiner Herrschaft einen Deutschen geduldet. Nur eine einzige Ausnahme sei vorhanden gewesen. Bei Kriegsausbruch habe er einen deutschen Finanzminister gehabt, der seit Langem wegen seiner geschäftlichen Begabung unentbehrlich gewesen sei. Er habe zwar nicht für einen Deutschen gelten wollen, sondern sich als Franzose ausgegeben, aber war doch nicht voller Staatsbürger der Republik geworden. Sein Name sei Nathan Lewison gewesen. Er musste auf Grund seiner Papiere nach der ganzen Strenge des Gesetzes behandelt werden, wurde gefangengesetzt, in sehr gelinde Gefangenschaft übrigens, sei aber bald darauf an einem Herzschlag gestorben, nachdem er schon vorher lange leidend gewesen war. Danach konnte ich mir denken, dass mich höchstwahrscheinlich der Gouverneur behalten und nicht irgendwohin ausliefern werde. Es war doch gewiss ein Wohlgefühl für ihn, einen Gefangenen vorzeigen zu können, noch dazu einen, den sein eigener Regierungsdampfer aufgebracht hatte. Darüber ließ sich auch ein trefflicher Bericht nach Paris schreiben. Berichten ist ja die Seligkeit und der Lebenszweck der Beamten.
Freilich hatte ich dem Kapitän keine Mitteilung gemacht, dass ich von Düwelsland abgespült worden war, ebenso wenig von der ›Wasserhexe‹, der ›Angela‹ und meinen Kameraden.
Diese Verschleierung hielt ich aufrecht, um nicht die Sicherheit meiner Freunde zu gefährden. Mich selbst wollte ich als Deutschen bekennen; meine Freunde nicht zu verraten, hielt ich für berechtigte Kriegshandlung. Also blieb ich bei der Jacht des reichen New Yorker Millionärs Mister Miller und berichtete, dass ich dort als Steuermann über Bord gewaschen sei.
Das war alles recht schön, und ich wäre auch mit meinem Schicksal nicht unzufrieden gewesen, wenn mich nicht die Sorge um den ›Seedrachen‹ und die Zurückgebliebenen auf der Teufelsinsel gequält hätte. Kam das Unterseeboot nicht zurück — wie sollten meine vier Mann, von denen einer schwerkrank war, mit den Gefangenen fertig werden? Wie sollte es ihnen weiter ergehen? —
Oder sollte ich doch alles offen erzählen und vielleicht die Überlebenden dadurch retten? Dann wären sie gefangen und dem Hohn und der Gemeinheit der vereinigten Engländer und Japaner ausgesetzt worden. Nein. Darüber hatte ich noch immer Zeit nachzudenken. Darüber konnte ich noch besondere Entschlüsse fassen, wenn ich selbst erst auf der Insel war.
Monsieur Girard mochte mir ansehen, dass mich mancherlei bedrückte. Er musste glauben, dass meine Sorge meiner nächsten Zukunft gelte, und versuchte, mich zu trösten.
»Sie werden es ganz ausgezeichnet in Ihrer Gefangenschaft haben, davon bin ich überzeugt. Der Herr Gouverneur ist ein sehr, sehr feiner und hochherziger Mann. Freilich nach außen gibt er sich gern als Eisenfresser. Es wäre ganz gut möglich, dass Sie zunächst in ein unterirdisches Verlies kommen und auf Stroh gelegt werden. Das ist so seine Art. Lassen Sie sich das ruhig gefallen! Nach ganz kurzer Zeit wird er Sie mit Wohltaten überhäufen. Er will Sie für diese erst richtig empfänglich machen.
Übrigens kommt alles, wie gesagt, auf Mademoiselle Lilly an. Sie wird sich sehr bald um Sie kümmern, denn sie kümmert sich um alles. Gelingt es Ihnen bei ihr, dann werden Sie wie ein Fürst leben und von Gefangenschaft nichts merken.«
Also Fräulein Lilly sollte mein Schicksal sein. Und Angela? —
In zweieinhalb Tagen hatten wir unser Ziel erreicht. Der ›Guillaume‹ fuhr 12 Knoten in der Stunde, ein Zeichen, dass er ein sehr gutes Schiff war. Mitten in der Nacht sahen wir die Hafenlichter von Taiosae. Wir gingen auf der Reede vor Anker. Erst mit der aufsteigenden Sonne fuhren wir ein.
Ein entzückendes Bild breitete sich vor uns aus. Der Süden hatte seine ganze Herrlichkeit in Palmen und üppigem Grün über das reizende Eiland ausgestreut. Der Hafen lag halbkreisförmig von beträchtlichen Bergen eingeschlossen, in köstliches Grün gebettet. Offenbar spendeten die Berge reichlich Wasser. Bis auf die Bergspitzen hinauf kletterten die Landhäuser und versteckten ihre weißen Mauern unter Palmen. Überall waren Terrassen angelegt, die üppige Gärten vermuten ließen.
Die Stadt selbst sah freilich mehr nach Eingeborenendorf aus, doch waren am Hafen einzelne stattliche Gebäude, anscheinend Speicher oder Kasernen, die einen Marktplatz umschlossen, sodass man immerhin den Eindruck einer Stadt bekam.
Das alles hatte Maurice Armand im Laufe der Zeit geschaffen. Es war sein Lebenswerk, was vor uns ausgebreitet lag, und es war anscheinend gut gelungen.
Ein eigentümlicher Anblick waren allerdings die mit Palmenblättern gedeckten Hütten neben den hohen Steingebäuden. Aber sie dienten eher zur Verschönerung des Ganzen. Alles schien sauber gehalten, und durch die schlichten Laubhütten kam ein echt südlicher Lebenszug in die steinernen Würfel. Nein, es war ein Paradies der Südsee, was hier mit viel Geschmack in der üppigen Natur des Landes geschaffen war. Hier konnte man schon leben, wenn man nicht Gefangener war, sondern frei zu schalten und über bedeutende Mittel zu verfügen vermochte.
Kapitän Girard erklärte mir den Zweck der Gebäude. Da war zunächst ein Wasserturm; durch Maschinen wurde das Wasser bis oben hinauf in die Festung gepumpt, und es speiste auch alle Gärten und Häuser auf den zahlreichen künstlichen Erdstufen, die sich staffelförmig den Berg hinanzogen. Aber der Turm glich mehr einer Moschee mit einem Minarett als einem öden Zweckgebäude. Da war auch das Gaswerk; neben den üblichen großen Gaszylindern lag ein künstlerischer Bau, der die Wohnungen der Beamten und Oberarbeiter enthielt; saubere Arbeitshäuschen umgaben das Ganze. Am Marktplatz stand das stattliche Rathaus, ein entzückender Bau mit Turm und Uhr, dessen runde Fenster weit ins Meer blickten. Ein von Steinsäulen getragener Emporenbau gewährte einen Überblick über den ganzen Marktplatz und schuf zu ebener Erde einen schattigen Eingang, der auch als Warteraum dienen mochte. In den Flügeln lagen anscheinend die Amtszimmer des Regierenden.
Dem Rathaus entsprach eine Kunsthalle, in der alle Merkwürdigkeiten der Südsee gesammelt wurden. Sie galt als Mustersammlung für Erforschung des Volkstums und sollte durch ihre Vollständigkeit von hohem Wert sein, ein Anziehungspunkt für den Völkerforscher ebenso wie für den Naturforscher.
Ja, Maurice Armand war fleißig gewesen, und eigentlich hatte er das alles seiner Regierung geschenkt, denn es war auf staatlichem Grund und Boden errichtet.
Im Hafen selbst lagen nur einige kleinere Fahrzeuge. Das größte war ein Dampfer von den Ausmaßen des ›Guillaume‹, ebenfalls Regierungsdampfer, d. h. Eigentum des Gouverneurs. Eine Dampfjacht sei abwesend, erklärte der Kapitän, und der ›Agamemnon‹, eine Fregatte von 1500 Tonnen, kreuze um die ganze Inselgruppe als Kriegsschutz.
Am Strande selbst aber gab es noch ganz stattliche Batterien, deren Geschützrohre man blitzen sah. Auf dem Platz vor einer Kaserne machte eine Abteilung Rothosen ihre Übungen.
Das Stattlichste von allem aber war die Festung oben, die zugleich das Schloss des Gouverneurs war. Zu ihm strebten die Landhäuser und Gärten aufwärts, wie eine Versammlung von Fürsten und Herren, die im Thronsaal den Allerhöchsten Worten und Befehlen lauschen. Den Berg krönte an sich eine steil nach dem Meer abfallende Felsenwand. In dieser war das Schloss eingehauen, aber das Düstere eines solchen Felsenbaus war aufgehoben durch eine künstlich aufgebaute Vorderseite mit Gärten, in die zahlreiche Erker und Vortritte hinabblickten. Das Ganze musste ein sehr kühler und sicherer Aufenthalt sein. Das erhabene Schloss da oben sollte auch mein Ziel werden. Unmittelbar vor der Einfahrt, während ich tief berührt von den Erklärungen des Kapitäns dieses südliche Prachtgemälde betrachtete, wurde ich unter Deck genötigt und in meiner Kammer eingesperrt. Sogar der eiserne Deckel am Bullauge war herabgelassen, und zum ersten Mal fühlte ich wirklich, dass ich Gefangener war. Das elektrische Licht ersetzte den funkelnden Sonnenglanz draußen nur dürftig.
Merkwürdig. Erst hatte mir Monsieur Girard alles erklärt, und jetzt wurde es so geflissentlich meinen Augen entzogen. Jedenfalls musste er mich unter tunlichst ernsten Formen einbringen, die er auf See als Schiffsherr mildern konnte, am Lande streng wahren musste.
Ich hörte, wie der Dampfer anlegte und vertäut wurde. Schritte gingen über Deck, die übliche Unruhe einer Landung breitete sich über den Dampfer. Dann kamen feste Tritte in den Gang gegen meine Kammer, geräuschvoll wurde aufgeschlossen, und vor mir stand ein blutjunger Leutnant in sehr buntem Waffenrock, roter Hose, Schleppsäbel und vielen Orden, begleitet von vier Gewappneten mit aufgepflanztem Seitengewehr. Er grüßte militärisch, dann entschuldigte er sich mit gemessener Höflichkeit, dass er mir die Augen verbinden müsse, ich sei Gefangener der Französischen Republik.
Ich ließ es ruhig geschehen. Kein Staat braucht sich von Fremden in seine Geheimnisse blicken zu lassen. Ganz konnte ich freilich den Eindruck des Schauspielerischen nicht unterdrücken. Die Gebärde der Wichtigkeit war jedenfalls nicht überwältigend. Innerlich musste ich doch lächeln über den großen Kraftaufwand, den die Französische Republik in ihren hiesigen Vertretern um meine kleine Person für nötig erachtete. Es ist aber ganz angenehm, wenn man ›der‹ Gefangene eines Landes ist.
Die Soldaten geleiteten mich. Wir gingen über Straßenpflaster. Schließlich schien's durch Gewölbe zu gehen. Wände gaben den Schall der Tritte dumpf wieder. Irgendwo knarrte es. Ich musste stehenbleiben. Dann wurde ich in einen Raum genötigt. Ein Fahrstuhl hob mich auf. Es ging hoch. Sehr hoch. Immer noch höher. Da schien ja das Tal mit der Bergspitze durch einen Drahtseilaufzug verbunden zu sein. Dann ging's wieder durch einen langen Gang. Die Binde wurde mir abgenommen.
Ich stand in einer Schreibstube. Drei uniformierte Schreiber vernahmen mich und schrieben mit beamtenmäßiger Wichtigkeit meine Aussagen nieder. Der Staat ist ein Tier, das mit beschriebenen Papieren gefüttert werden muss. Dann ist er befähigt, unablässig gestempelte Papiere auf seine Untertanen auszuspeien. Das Ganze heißt Regierung. Ich merkte bald, wie ungeheuer in Nuku Hiwa regiert wurde.
Plötzlich sprang alles auf und stand kerzengerade. Ein großer dicker Herr war eingetreten. Schlohweißes Haar und Zwickbart. Der Schnurrbart hatte gewaltige Abmaße und stand weit ab. Unter buschigen weißen Augenbrauen funkelten grimmig tiefschwarze Augen. Die eckige, faltenreiche Stirn wurde überdacht von kurz geschorenem, aufwärts gesträubtem Haar. Eine stattliche Herrschergestalt ohne Zweifel. Nach meinem Empfinden wurde der Eindruck etwas verwischt durch einen gar zu prächtigen Waffenrock, der den Eingetretenen als französischen Obersten kennzeichnete, aber in den Tropen offenbar üppigere Formen angenommen hatte, als daheim gestattet war. An der Seite klirrte ein gewaltiges Schlachtschwert, dessen Scheide und Griff von Gold und Edelsteinen funkelten.
Er maß mich mit einem finsteren, durchbohrenden Blick und ließ sich die Niederschrift meiner Aussagen vorlesen.
Dann sagte er drohend, grimmig:
»Sie sind mein Gefangener, Gefangener der Französischen Republik.«
»Sehr wohl, Sire, ich schicke mich in das Unvermeidliche.«
Mit dem ›Sire‹ hatte ich's anscheinend gut getroffen. Sicher hatte er keinen Anspruch auf den Titel, aber sichtlich tat er ihm wohl. Er wurde freundlicher.
Er erklärte, Frankreich sei ein großmütiges Land. Ich würde meinem Stande gemäß behandelt werden. Er erwarte aber, dass ich keinerlei Fluchtversuch mache und mich in alle Anordnungen ohne Widerrede füge. Bei dem geringsten Versuch, auszubrechen, sei mir eine Kugel oder ein Bajonettstich sicher. Schon wenn man mir nur einen Versuch oder Plan, zu entfliehen, nachweise, würde eine verschärfte Behandlung eintreten. Ich würde dann als Verbrecher, nicht als Kriegsgefangener gehalten.
So wurde ich abgeführt. Ein alter Wachtmeister brachte mich in eine Zelle, die eine Treppe höher lag. Es war eine richtige Gefangenzelle, eine nackte Felsenkammer, die nichts enthielt als einen Holzschemel.
Ich brauchte aber nur wenig mehr als eine Viertelstunde hier zu verweilen, dann durfte ich die für mich bestimmten Räume beziehen. Diese sahen allerdings nicht nach Gefängnis aus.
Mein eigentliches Zimmer betrat man durch ein helles Gemach, in dessen Mitte ein Tisch stand. Außerdem enthielt es nichts als vier kahle Wände. Der Wachtmeister erklärte, dass ich dieses Vorzimmer nur betreten dürfte, um meine Speisen in Empfang zu nehmen. Es würde vorher angeklopft. Dann dürfe ich sie abholen und nach beendeter Mahlzeit die Geschirre dort absetzen. Außerdem werde die Tür verschlossen gehalten.
Mein Zimmer aber war auf das Prächtigste eingerichtet. An den Wänden hingen kostbare Teppiche, auf der Diele lagen weiche wundervolle Matten. Eine große Ruhebank mit Teppichen und vielen Kissen nahm eine Wand ein. In der Mitte war ein Arbeitstisch mit angenehmen, bequemen Stühlen, links öffnete sich ein Baderaum, der nicht minder prächtig war. Waschtisch und Bad mit Hähnen für warmes und kaltes Wasser, diese selbst aus buntem Marmor, dessen Fliesen auch Boden und Wände bedeckten, dazu ein Strahlbad von oben, unten und an der Seite, kurz, alle erdenkliche Bequemlichkeit. Am Fußboden war ein Ablauf für das Wasser. Im Zimmer selbst stand außerdem noch ein Schrank mit Kleidern, einige Schubkästen mit blütenweißer Wäsche, bequemen Sandalen. Alles stehe mir zur freien Benutzung. Dreimal dürfe ich täglich baden und brauche mit Wasser nicht zu sparen.
Der Baderaum schien in den Felsen gehauen zu sein und hatte nur einen Abzug in der Wand für Luft, im Fußboden für Wasser. Im Übrigen wurde er elektrisch erleuchtet.
Das Eigentümlichste war, dass eine Wand meines Zimmers aus einem kostbaren schmiedeeisernen Gitter bestand, das den Blick in ein ebensolches Gemach gestattete, an das sich weitere Räumlichkeiten anzuschließen schienen. Auch das mir sichtbare hatte eine köstliche Ruhebank. Das Licht kam von einem Austritt ins Freie, einem sehr breiten Raum, der ebenfalls durch ein eisernes Gitter in zwei Teile zerfiel und auch nach vorn vergittert war. Nur war letzteres bauchig nach außen ausgebogen, wie es in morgenländischen Harems Sitte ist, dass man wohl hinaussehen, aber nicht von außen gesehen werden konnte.
Ohne Zweifel befand ich mich in einem Haremszimmer. Der Austritt ins Freie war selbst von der Größe eines Zimmers und hatte einen märchenhaften Ausblick auf das Meer, die Stadt und den ganzen feenhaften Talkessel. Hätten die Gitter nicht an die Gefangenschaft gemahnt, so konnte ich jedenfalls sagen, dass ich in meinem Leben nicht so herrlich gewohnt hätte, auch wohl nie wieder so wohnen werde.
Bewegungsfreiheit hatte ich genügend. Das Söllerzimmer war groß und ermöglichte es mir, auf und ab zu gehen. Es enthielt behagliche Korbsessel und einen Rundblick, den ich nie vergessen werde. Stunden und Stunden konnte ich zubringen mit dem Blick in die blaue Ferne und die entzückende Nähe.
Ich war also wirklich in Olympia, im Schloss des Selbstherrschers von Nuku Hiwa. Die Rückseite schien Fels zu sein, der Söller gehörte zum Anbau der Vorderseite. Eine Treppe tiefer lagen die Wohnräume des Gouverneurs und die geheimen Amtszimmer. In einem solchen hatte man mich verhört. Trat man von unten ins Freie, so kam man auf eine große Bergstaffel, die einen Garten aufwies. Ein Brunnen plätscherte, die Gewächse waren alle niedrig gehalten, um die Aussicht nicht zu verdecken.
Ein Posten ging auf und ab am Rande des Gartens. Er warf zuweilen Blicke nach meinem Söller. Vermutlich war nur dort ein Fluchtversuch möglich. Die andere Möglichkeit bot nur der Aufzug, innen im Felsen, der jedenfalls noch schwerer bewacht war.
Ich dachte nicht an Flucht. Allerdings beschäftigte ich mich innerlich viel mit meinen Freunden. Aber von der Insel zu fliehen, war wohl völlig ausgeschlossen.
Außerdem ging's mir sehr gut. Es schien, dass ich aus der Küche des Gouverneurs verköstigt wurde. Drei warme Mahlzeiten mit zwei Fleischgängen und einem Fischgang nebst allen erdenklichen Beigaben wurden in der Kammer neben meinem Zimmer aufgestellt. Ferner gab's erstes Frühstück, bei dem ich zwischen Kaffee, Tee und Schokolade wählen durfte, und nachmittags einen Kaffee. Mehrere Kistchen verschiedener Zigarren standen mir zu freiem Gebrauch zur Verfügung.
Damit war für das leibliche Wohlergehen alles gegeben, was kühnste Träume eines Gefangenen ausmacht. Das ist sehr wesentlich. Man soll das Essen und Trinken nicht unterschätzen. Es gehört zu den wichtigsten Dingen im Leben und bildet die heiligste Ordnung Gottes und der Natur. Es handelt sich nur darum, wie sich der Mensch dabei benimmt. Ich habe stets mit freudiger Dankbarkeit alles gegessen, was ich hatte. Ich aß Schnecken auf der Klippe, aber hier war ich froh an meiner Gefangenkost.
Auch sonst war man gegen mich sehr freundlich. Man erfüllte mir jeden Wunsch, den ich dem alten Wachtmeister aussprach. Ich bekam Papier und Schreibgelegenheit, erhielt auch Bücher. Einmal bat ich um ein Fernglas, meine schöne Aussicht näher zu beäugen; sofort schickte man mir einen Krimstecher. Ich erbat ein Schnitzmesser; man gab es mir zu dauerndem Gebrauch.
Unter den Büchern waren verschiedene Geschmacksrichtungen vorgesehen. Es gab leichte französische Romane. Die mochte ich nicht. Ich fand aber auch eine französische Ausgabe der BhagavadGita von E. Burnouf, Nancy 1861.
Dieses köstliche Buch, dieses Juwel unter dem Schrifttum, von dem Wilhelm von Humboldt sagte: »Ich danke Gott, dass er mich so lange leben ließ, um dieses Gedicht noch zu lesen« — wurde auch mir der Freund in der Einsamkeit. Immer wieder las ich dieses uralte Heldengedicht mit seiner wunderbaren Weisheit, die heute noch nicht veraltet ist und so recht in den Weltkrieg hineinpasst.
So verging mir die Zeit angenehm. Von Neugierigen wurde ich nicht belästigt. Nur am ersten Tag erschienen einige Offiziere mit ihren Damen jenseits des Gitters, um ein gleichgültiges Gespräch mit mir zu führen. Aber sie verschwanden bald. Außer dem alten Wachtmeister sah ich niemand bei mir.
Umso mehr bemerkte ich den Gouverneur unter mir und hörte ihn sein Reich regieren. Er schien sogar geflissentlich seine Regierung in den Garten verlegt zu haben, der sich unter meinem Ausblick ausbreitete. Es war, als ob er besonders für mich regierte, als sollte ich Gelegenheit haben, Einblicke in die Musterwirtschaft der französischen Südseeniederlassung zu bekommen, um später dem aufhorchenden Europa davon Mitteilung machen zu können.
Die eigentlichen Arbeitsräume mochten innen im Schloss, also gerade unter mir liegen, aber draußen hatte er einen Schreibtisch stehen, den ich durch mein Gitter sehen konnte. Hier arbeitete er den größten Teil des Tages, oft auch der Nacht, hier empfing er Offiziere und seine Minister und plauderte die geheimsten Angelegenheiten seiner Regierung aus. Das alles geschah in so lautem, fast brüllendem Ton, dass ich's hören musste, ob ich nun wollte oder nicht.
Zuweilen speiste er auch in diesem Gartenraum. Dabei leistete ihm eine alte Dame Gesellschaft, die nach dem Kraftaufwand seiner Tischgespräche halb taub zu sein schien, und dieser entwickelte er seine politischen Anschauungen über den Weltkrieg. Die neuesten Siegesnachrichten der französischen Heere konnte er mir — denn ich wusste ganz genau, dass er nur zu mir redete — leider nicht auftischen. Die hatte ich schon auf dem Dampfer gehört, und europäische Post bekam er nur alle sechs Wochen mit dem gleichen Dampfer, der mich hergebracht. Dafür aber wurde die ganze Zukunft Deutschlands liebevoll zerpflückt. Es wurde täglich zwischen Frankreich, Russland und England verteilt. Also, lieb Vaterland, kannst ruhig sein! Auf Nuku Hiwa ist dein Schicksal längst entschieden.
Ich hörte auch die Familiengeheimnisse. Er war ein echter Franzose, der nicht anders kann, als sich spreizen und großsprechen. Ich finde, dass dies harmlose und behagliche Menschen sind. Namentlich als Tischnachbarn habe ich sie gern. Man braucht ihnen nicht zu antworten, das Gespräch stockt nie, und man wird gut satt dabei; was bei Tisch die Hauptsache ist.
Der Gouverneur offenbarte also seiner Schwester, dass Mademoiselle Lilly für einige Tage verreist sei, aber bald auf der Dampfjacht der Regierung zurückkehre und dass sie so gut wie verlobt sei mit dem Herzog von Aricosta, der die erste Anwartschaft aus den künftigen Königsthron von Albanien habe. Die Schwester schien alles das nicht zu wissen, und damit sie's besser verstünde, brüllte er's ihr bei Tisch zu. Mademoiselle Lilly werde sehr erstaunt sein, dass ein gefangener Offizier so nahe bei ihren Gemächern einquartiert sei, aber bei dem lebhaften Anteil, den sie an allen Angelegenheiten der Regierung nehme, werde sie die getroffenen Maßnahmen billigen.
So. Da wusste ich also, dass mein Schicksal von morgen ab in den Händen von Mademoiselle Lilly liegen würde, denn heute Nacht sollte sie ankommen. Da Frauen nur mit dem Herzen zu denken pflegen, kam also alles darauf an, wie dieses Herz sich zu mir stellen werde. Ein Zuviel ist ebenso wenig angenehm wie in meinem Falle ein Zuwenig. Wappnen wir uns also mit Geduld und Ruhe auf die achtzehnjährige Schönheit! Je kühler der Mann einer Frau gegenübertritt, desto größeren Eindruck ruft er hervor.
Ich streckte mich abends auf meine Ruhebank aus. Wie überall im Süden gab's auch bei mir kein Bett. Auch der Europäer gewöhnt sich leicht daran, nachts angekleidet, in irgendeinen behaglichen Schlafrock gehüllt, der Ruhe zu pflegen. Es währte aber nicht lange, so ertönten Begrüßungsschüsse aus den Batterien am Strand. Die Armand'sche Regierungsjacht lief in den Hafen ein. Bald kam der ganze Termitenbau, in dem wir wohnten, in Aufregung. Man hörte gehen, Türen schlagen und endlich eine laute weibliche Stimme, die so unglaublich schnell sprach, dass ich kein Wort verstand, so gut ich das Französische sonst beherrschte. Und wunderbar: Die laute Stimme des Gouverneurs, die tagsüber regiert hatte, war plötzlich kleinlaut geworden. Vielleicht war die Tochter nicht so schwerhörig wie die Schwester. Oder hatte er seine Regierungsgewalt abgegeben? —
Der nächste Tag sollte alles klarmachen. Ich hatte gerade mein Frühstück beendet und genoss das entzückende Landschaftsbild in der strahlenden Vormittagssonne, die so liebliche Farben auf Berg und Tal und Meer zu zeichnen verstand, als der Gouverneur mit seiner Tochter im Nebenraum erschien und mich ihr vorstellte. Ich sprang auf und verbeugte mich tief und war allerdings überrascht, eine blühende Schönheit vor mir zu sehen. Es war ganz des Vaters stattliche Gestalt, die mit unglaublicher Sicherheit auftrat. Man konnte sie wohl eine Schönheit nennen, wenngleich eine Schönheit, die nicht jedermanns Geschmack ist. Sie war tief dunkel und hatte pechschwarzes Haar, kühn geschwungene, ein wenig starke Augenbrauen. Die Nase war fast zu groß und stark gebogen. In dem dunklen Gesicht war unter der Nase eine noch tiefere Färbung zu sehen, die auch auf der Wange kleine Ableger gemacht hatte.
Dabei eine sprühende Lebhaftigkeit, die keinen Widerspruch aufkommen zu lassen schien und ebenso wild in Hingebung wie in Hass sein konnte. Es lag beinah etwas Zigeunerhaftes in diesem Wesen, und man hatte den Eindruck, dass die Schönheit sehr leicht umkippen und in ein vorzeitiges Alter hineinwelken könnte.
Sie war in ein lilafarbenes Sammetgewand gehüllt, das sie weit umwallte und in geradezu ausschweifenden Farben schwelgte. Zitronengelbe Aufschläge an Hals und Ärmeln, um die Hüften einen feuerroten Schuppengürtel, an dem eine grüne Tasche hing. Das erinnerte wieder an Zigeunerblut. Dazu kam viel altertümlicher Silberschmuck am Hals, den Handgelenken, Fingern und im dunklen Haar. Eine Silberspange hielt an der Brust das Gewand zusammen.
Warum trug die reiche Millionenerbin Silberschmuck? Ja, warum tragen überhaupt die Zigeuner nur Silber? Es war unstreitig Zigeunerblut.
Sie betrachtete mich während der Vorstellung mit starrer Aufmerksamkeit aus nachtschwarzen Augen. Gerade diese Augen waren es, die mir fast unheimlich erschienen. Ich übersah die wilde Farbensymphonie, die ganze Schönheitsfrage. Ich blieb gebannt an diesen alles beherrschenden Augen hängen, die halb neugierig, halb drohend funkelten und die ganze Person in ihren Nachtschleier einzuhüllen schienen.
Dabei hatte ich einen Gedanken, der sich zum Wort formte. Dieses Wort hieß Lilith. Ich hatte einmal gelesen von der altjüdischen Sage der Lilith, der ›Nächtlichen‹, die eine Tochter der Hölle und ein Nachtgespenst war, das Kinder schreckte. Mit Adam sollte sie eine geheime Verbindung eingegangen sein, und eine Menge böser Geister sei daraus hervorgegangen.
Ja, sie hatte etwas Dämonisches, das man fürchten konnte. In ihrer Gegenwart schien kein Gedanke an Angela möglich zu sein. Diese Augen bedeuteten etwas, und ich zergrübelte mir den Sinn, was sie bedeuten könnten. Sie hatten etwas Bannendes, beinah Krankmachendes.
»Vielleicht wünschest du einige Fragen an den Gefangenen zu richten«, erklärte sehr bald der Papa. »Du weißt, ich habe unten zu tun.«
Damit empfahl er sich, während Lilith zurückblieb. Sie hatte geschwiegen bei der Vorstellung und mich nur eines leichten Kopfnickens gewürdigt; umso tiefer und eindringlicher hatte sie mich betrachtet.
Nun war ich mit ihr allein durch ein Gitter getrennt, das ich mehr als Schutz für mich als für sie empfand. Es begann sofort ein lebhaftes Verhör, das aber bald einem angeregten Plaudern Platz machte. Ich musste ihr alle meine Lebensumstände, meine ganze Geschichte erzählen. Natürlich wollte sie nach Frauenart wissen, ob ich verlobt sei und im Herzen gebunden. Das ist immer die Hauptsorge. Es befriedigte sie sichtlich, dass ich an dergleichen zu denken nie Zeit gehabt hatte, dass also meine Gefangenschaft auch niemandem zu Herzen gehen werde.
Dann verschwand sie in den Nebenräumen, die ich nicht übersehen konnte, kehrte aber bald mit einem Kästchen Zigaretten wieder. Ich reichte ihr Feuer durch das Gitter. Sie nahm es mir mit ihren zarten, wohlgepflegten Händen ab und bot mir auch an. Ich bat, mir zu gestatten, Zigarren zu rauchen. Es wurde beifällig gewährt, und dann schien es, als ob Lilith sich überhaupt hier häuslich einzurichten gedenke.
Sie warf einen Blick auf meinen Arbeitstisch und fragte, was ich gelesen hätte. Ich erzählte von der BhagavadGita. Da wurde sie lebhaft, auch sie schien die Romane Frankreichs nicht sonderlich zu schätzen. Jedenfalls war sie sehr gebildet.
»Nun sagen Sie mir, was Ihnen als Deutschem ab der BhagavadGita am meisten Eindruck machte!«
»Vor allem die tiefinnige gläubige Gesinnung und Hoheit, die aus dem Ganzen redet. Das Werk ist doch vorbuddhistisch, reicht also um Jahrtausende zurück und ist an religiöser Duldung heute noch nicht völlig erreicht. Da redet die höchste Gottheit, aber sie erkennt auch andere Götter an und duldet sie als Wege, die doch schließlich zu ihr selbst führen. Sie verhüllt sich auch Andersgläubigen nicht, weil sie alle als im Grunde zu sich gehörig betrachtet. Darf ich Euer Hoheit einige Verse lesen?«
Die ›Hoheit‹ schien auch ihr wohl zu tun, und sie hörte aufmerksam zu.
»Krischna spricht:
Die, denen Gier das Wissen raubt, die gehn zu andern Göttern hin,
Halten an manche Regel sich — sie lenkt die eigene Natur.
Doch welche Gottheit einer auch im Glauben zu verehren strebt —
Ich sehe seinen Glauben an und weis' ihm zu den rechten Platz.
Wenn er im festen Glauben strebt nach s e i n e s Gottes Huld und Gnad',
Dann wird zuteil ihm, was er wünscht, denn gern wend' ich ihm Gutes zu. —
Das, Hoheit, ist weltgroß gedacht. Der uralte Sänger wusste schon, dass Gott ein Vater aller Menschen ist. Würde es nicht möglich sein, von diesem gottgroßen Gesichtspunkt aus jedem menschlichen Weg Duldung zu gewähren? Alle Religionen sind doch aus tiefstem, heiligstem Menschensehnen entsprossen, ihre echten Bekenner sind wahrhaft fromme Menschen, aber ihre Formen, Gebärden, Gedanken, Bekenntnisse sind verschieden. Warum quälen die Menschen sich um dieser kleinen Verschiedenheiten willen, die doch nur an der Oberfläche liegen? Gott duldet alle diese Dinge. Sie sind für den Menschen notwendig als Erziehungsmittel, als Werdestufen. Warum können wir sie aneinander nicht dulden? Weil wir Gottes Gedanken nicht verstehen. Schließlich müssen die kleinen Unterschiede doch abfallen. Nicht durch Feuer und Schwert, auch nicht mit der Geistesgewalt der Überredung und Umformung, sondern durch das Erleben immer neuer, immer tieferer Wahrheiten. Alle Menschen gehören zu Gott, dem Einen, und Gott gehört allen Menschen. Sie wachsen alle der Einheit entgegen. Sollen wir nicht Geduld, Glauben, Hoffnung, Freudigkeit haben auf die endliche Einheit hin? Wer am größten ist in der Duldung und Liebe, der hat die stärksten Waffen für Gott. Das wusste der alte Sänger und Prophet schon vor Jahrtausenden. Mir scheint, wir haben's vergessen.«
»Merkwürdig, Herr Gefangener, dass Sie aus dem Gedicht die religiöse Duldsamkeit herauslesen. Wenn Sie recht haben, so müsste man ebenso für Duldsamkeit der Völker und Staaten eintreten. Das sind dann doch auch nur Dinge, die an der Oberfläche liegen. Sie wissen aber, dass die BhagavadGita ein Kampfgesang ist, der den Krieg verteidigt, sogar den Krieg gegen die Blutsverwandten. Die religiöse Duldsamkeit ist uns hier nicht schwer. Wir sind zu nahe an Indien gelegen. Warum lesen Sie nicht die Duldung der Völker heraus, mein Herr Deutscher?«
»Ich finde nicht, dass das Heldengedicht den Krieg als solchen verherrlicht«, antwortete ich, unberührt durch die etwas spöttische und hochmütige Anspielung. »Der Krieg steht hier unter dem höheren Gesichtspunkt, dem der Einzelne sich zu beugen hat: Tu deine Pflicht, nach dem Erfolg des Handelns frage nicht! — Ich sehe darin den eigentlichen Gehalt des Gedichts.«
»So war's wohl auch Deutschlands Pflicht, Frankreich plötzlich mit Krieg zu überfallen?«
»Hoheit, ich weiß von diesem Krieg nichts. Als ich Deutschland vor Jahresfrist verließ, war man dort allgemein ganz arglos. Wir lieben Frankreich und haben nie anderes gewünscht, als mit unseren viel bewunderten Nachbarn in Frieden zu leben. Aber wir wissen auch, dass man uns dort nicht liebt und dass Frankreich seit mehr als vierzig Jahren auf Rache wider uns sinnt.«
»Und diese friedlichen, liebenden Nachbarn fanden für notwendig, uns den Krieg zu erklären!«
»Eine Kriegserklärung, Hoheit, ist eine Formsache. Den Krieg veranlasst nicht immer der, der ihn erklärt. So viel ich von hier aus sehen kann, drohte uns ein Überfall Russlands. Wer dann den Krieg e r k l ä r t hat, ist ja ganz gleichgültig. Mit Russland war Frankreich tatsächlich in den Krieg eingetreten. Es ist nicht anzunehmen, dass beide Länder sich nicht vorher sehr genau verständigt hätten. Wenn dann wirklich Deutschland den Krieg formell erklärte, war es eine Verteidigung, aber kein Überfall.«
»Und was haben Sie im Krieg getan?«
»Ich weiß vom Krieg erst seit sehr kurzer Zeit und bin im Kriege nur Kriegsgefangener.«
»Armer Mann«, lächelte sie, »aber was würden Sie tun, wenn Sie frei wären?«
»Meine Pflicht, Hoheit. Ich bin deutscher Offizier.«
»Würden Sie zu entfliehen trachten?«
»Ich würde es tun, wenn ich Aussicht auf Erfolg hätte. Aber mitten im Weltmeer enfliehen wollen, wäre an sich Torheit. Ein Offizier darf keine Tollheiten begehen.«
»Und Sie würden gegen Frankreich kämpfen?«
»Wenn es sein muss, ja. Ich liebe, ich bewundere Frankreich. Ich verhalte mich auch duldsam gegen alle Menschen. Aber wenn das Vaterland in Gefahr ist, so habe ich bedingungslos zu kämpfen wie der Held Arjuna — nicht eigentlich g e g e n Frankreich oder irgendwen, aber f ü r Deutschland.«
»Und Ihre Religion gestattet das?«
»Sie befiehlt: Tu deine Pflicht! Nach dem Erfolg des Handelns frage nicht! Immer das Nächstliegende tun, heißt immer im Heute leben, heißt ewig leben. Das ist meine Glaubenspflicht. Ich bin als Deutscher geboren, habe als Deutscher gedient, habe auch als Deutscher zu kämpfen, solange Deutschland kämpft. Wenn es einmal mit allem Krieg auf Erden zu Ende ist, werde auch ich mich freuen, jedem fremden Volksgenossen die Hand reichen zu dürfen. Nein, ich glaube, kein Mensch in Deutschland hasst Frankreich oder Russland. Das können wir nicht. Aber kämpfen werden wir, wenn's sein muss, bis zum letzten Blutstropfen.«
So kamen wir tief ins Gespräch, und die Stunden enteilten. Heute regierte der Gouverneur weit geräuschloser, um die Tochter schien sich niemand zu kümmern. Ich hätte unser Zusammensein hinter Gittern beinah als Feierstunde empfunden, wenn die rätselhaften, nachtschwarzen Funkelaugen mit dem etwas starren Blick mich nicht beklommen gemacht hätten. Irgend etwas bedeuteten sie, und ich wusste nicht, was.
Gegen Mittag empfahl sich die Hoheit huldvoller, als sie gekommen. Ich nahm mein zweites Bad zur Kühlung an dem heißen Tag und wählte die beste Kleidung aus meinem Schrank. Ohne Zweifel würde mein Besuch bald wiederkehren.
Heute fand die Familientafel nicht auf dem Vorplatz statt, Deutschland wurde nicht zerstückelt, wohl aber hörte ich eine unglaublich flinke Zunge, die das ganze Mahl geräuschvoll beherrschte. Ich kannte die Stimme. Bei mir hatte sie nur vernünftig gesprochen, hatte auch schweigen können. Ich stellte das mit Genugtuung fest.
Aber etwas ganz Merkwürdiges geschah. Als meine Essensstunde kam, klopfte es leise an meiner Tür, und statt des Wachtmeisters erschien ein farbiger Bedienter, der mir mit einer Verbeugung in gutem Französisch mitteilte, dass für mich aufgetragen sei. Staunend folgte ich ihm in das Nebenzimmer und sah, dass es eine merkwürdige Veränderung durchgemacht hatte. Es war verwandelt in einen höchst prunkvollen Speiseraum. Der Tisch war mit weißem Linnen herrschaftlich gedeckt, ein Diener stand mit einem silbernen Auftragbrett da und bediente mich feierlich und schweigsam, goss mir Wein ein, sodass ich wirklich wie ein Fürst lebte.
Ein anderer war unterdessen in mein Badezimmer gegangen und hatte es aufgeräumt, auch mein Wohnzimmer war in Ordnung gebracht. Man hatte mir anfangs bedeutet, dass ich das alles selbst zu tun hätte. Heute wurde ich bedient: Lilith! Frauen haben einen merkwürdigen Scharfblick für die Bedürfnisse der Behaglichkeit. Draußen vor meinem Esszimmer nahm der Wachtmeister die geräuschlosen Diener wieder in Empfang. Er selbst betrat meine Räume nicht mehr. Man erleichterte noch mehr meine Gefangenschaft. Lilith!
Das blieb auch so für den Nachmittag. Der Diener erschien, nachdem ich meine übliche Ruhestunde gehalten, und brachte mir Kaffee und besonders feine Zigarren und verschwand geräuschlos, wie er gekommen. Mein Speisezimmer war aber nicht mehr abgeschlossen.
Später kam Lilith und setzte sich mir rauchend und plaudernd im anderen Zimmer gegenüber.
»Ich danke Euer Hoheit für die gütige Aufmerksamkeit, die mich vergessen lässt, dass ich Gefangener bin.«
»Sie sind Offizier, mein Herr, und haben Anspruch, als solcher behandelt zu werden, das ist alles. Ich hoffe, dass man es hier nie vergessen wird. Sie werden keinen Fluchtversuch machen?«
»Nein, Hoheit.«
»Ich halte für möglich, dass Ihnen auch größere Freiheit gewährt wird. Ihre Tür ist nicht mehr verschlossen. Sie werden das Vertrauen nicht missbrauchen. Ich möchte Ihnen gelegentlich sogar die anderen Inseln der Gruppe zeigen. Sie sollen sehen, wie Frankreich arbeitet.«
»Ich werde nur dankbar sein und wünsche Frankreich überall solche Vertreter wie den Beherrscher dieser Insel.«
Damit war das Gespräch wieder im Gang. Lilith war weder herablassend noch spöttisch, sondern ganz kameradschaftlich, so sehr wir natürlich alle Formen wahrten. Ich erfuhr manches von den Inseln und dem französischen Regiment darauf. Sie lebte offenbar ganz in den Plänen ihres Vaters, und diese waren gut. Das sah man überall.
Dann kam Besuch. Der Gouverneur trat ein mit mehreren Damen, offenbar, um seinen Gefangenen vorzuführen. Aber da fuhr Lilith auf mit der ganzen Leidenschaft, die aus ihren Nachtaugen funkeln konnte. Mit sich überstürzenden Worten in rasender Schnelligkeit erklärte sie den Damen, dass Offiziere keine Schaustätte für unpassende Neugier seien, und tat das mit solcher Kraft, dass die Besucherinnen ebenso schnell wie schweigend verschwanden, und der Papa mit.
Einige Male ging sie erregt auf und ab, dann verschwand auch sie in den anstoßenden Gemächern. Aber ich hatte den Eindruck ihrer Nähe. Ich fühlte sie halb beklommen. Irgend etwas Geheimnisvolles lag auf ihr und ihrer offenkundigen Machtstellung. Es flackerte in ihren Augen. Aber ich erriet es nicht. Ich sollte es bald erleben.
Es war eine wundervolle Nacht. Ich saß lange auf meinem Aussichtsplatz und starrte in das geheimnisvoll vergoldete Meer und die blinkenden Landhäuser am Berg, die teils in leuchtendem Weiß lagen, teils in tiefem Schatten sich duckten. Meine wunderliche Lage kam mir schwer zum Bewusstsein. Was tat ich hier in diesem vergoldeten Käfig, während das Vaterland aus tausend Wunden blutete? Wie ging's den Kameraden auf Düwelsland? Was war aus der Besatzung des ›Seedrachen‹ geworden?
Sollte ich am Ende doch zu fliehen versuchen? Aber wie könnte ich Düwelsland erreichen? Fast unwahrscheinlich war's auch, nach Deutschland zu kommen. und etwas hielt mich ab. Gerade das Vertrauen, das man mir hier schenkte, hielt mich fester, als Schloss und Riegel vermocht hätten.
Lilith hatte doch etwas Dämonisches. Sie wusste zu halten und zu fesseln. Ja, fesselte sie mich? — Da eilten die Gedanken weit, weit über das Meer hinüber und sahen in ein Paar lieblich unschuldige Augen. Das waren doch andere Sterne als diese nächtlichen Irrsterne. O nein, wer einer Angela dient, den kann eine Lilith nicht blenden.
Spät suchte ich mein Lager auf. Eine Weile durchschwirrten die Gedanken durcheinander. Dann verschoben sie sich und verschwanden.
Da hatte ich einen wunderlichen Traum. Mir träumte, der schwarze Koch säße als ›Papaloi‹ vor seiner großen Trommel und ließe darauf unter Schellengerassel die kupferne Schlange tanzen. Er wollte sich in Verzückung bringen, aber es gelang ihm nicht. Er hatte sich schon ganz abgemüht und war tief in Schweiß gebadet.
»Es geht nicht Massa, Bumbo auf Ehre, Bumbo auf Ehre. Ihr müsst das Schlangenlied spielen, Bumbo auf Ehre.«
Und da sah ich plötzlich die enge Schiffskammer im roten Ampellicht und sah auch den Kapitän Düwel. Er hatte in der Hand eine alte Geige, gerade wie ich sie in dem Glaskasten gesehen hatte. Ich hörte ihn auch sprechen:
»Nein, ich spiele nicht mehr, ich tu's einmal nicht.« Es war ganz wie damals, und er legte Fiedel und Fiedelbogen weg.
Aber was war das? Da hörte ich auch Mister Rugbys Stimme deutlich und unverkennbar: »Du musst diesmal deinem Vorsatz untreu werden. Du darfst es. Ich entbinde dich deines Versprechens. Ich darf's, denn mir hast du's gegeben.«
»Nein, ich spiele nicht!«, wiederholte Kapitän Düwel erregt.
»Gustav, du musst das Schlangenlied spielen. Es gilt ein Menschenleben.«
Lange wehrte sich der Kapitän. Aber plötzlich sah ich, dass er die Fiedel ergriff, er zog neue Saiten ein, und dann begann ein Lied, eine Töneflut, ein so zauberhaftes Singen und Klagen, Jauchzen und Grollen, wie man's nur im Traum hören kann.
Es war eine Weise, die ich nicht annähernd mit irgendeiner je gehörten in Einklang bringen konnte, die ich nie vernommen. Es war furchtbar wild und berauschend, ein Zigeunerlied, das an Ungarn erinnerte, aber dennoch war nichts Ungarisches dabei. Es ging durch alle Nerven und drang durch Mark und Bein, und dann wurde es lind und leis, ach, so leise! Dann zwang es Lachen und Weinen zugleich herbei. Lust und Schmerz waren nicht mehr zu unterscheiden, es war ein Weben und Schweben, ein Neigen und Beugen, ein Ziehen und Fliegen bis in unendliche, leichte Höhen, und dann ein Fallen in dämmernde Abgründe.
Wunderbar, was man im Traum erleben kann! Träumend wunderte ich mich über meinen Traum. Ich wusste, dass ich träumte, und wunderte mich, dass es nicht Wirklichkeit war.
Und es war eine richtige Weise, wenn ich sie auch noch nie gehört. Es war kein Wasserfall von Tönen, nein, es sang voll zartester Sehnsucht, voll heißen Begehrens, voll tobenden Trotzes. Es sang wirklich, und dann wurde es Tanz. Ich sah den Kapitän geigen und geigen, sah die große behaarte Bärentatze auf und nieder steigen, es kamen wilde Doppeltöne, zuweilen schien es, als sprächen alle Saiten zugleich an. Und er wippte mit dem vorgesetzten Fuß, der Oberkörper folgte dem Reigen, während das Auge starr auf den Trommler gerichtet war. Der keuchte und schwitzte, rasend flogen die Trommelwirbel.
Das Lied schien zu Ende. Ein jäher Missklang brach es ab, aber nein, es löste sich in goldenem Zusammenklang, es begann von Neuem immer die gleiche Weise, schrecklich wild, ohrbetäubend, nervenerschütternd und so voll heißer Sehnsucht, dass der Atem stockte...
Ja, ich fühlte, dass der Atem stockte, dass meine Brust sich ungestüm hob und senkte, und in plötzlichem Schreck erwachte ich.
Es war ein Traum. Aber noch hörte ich die Weise, die ich nie vernommen. Ich bin für Töne nicht empfindlich und kann mir nur schwer eine Tonfolge merken, aber diese klang in mir nach in allen ihren wundersamen Biegungen und Wendungen.
Aber da geschah das Wunderbarste. War's denn wirklich ein Traum?
Ein Geräusch aus dem Nebenzimmer ließ mich den Kopf heben. Der Vollmond lag jetzt hinter der Gitterwand, und in seinem Schein stand Lilith in ihrem bunten, losen Gewand. Ihre Augen waren geschlossen, ihre Gestalt vom Mondlicht übergossen.
War sie mondsüchtig?
Da bewegte sie sich langsam. Sie tanzte. Tanzte, wie Morgenländer tanzen, mit Gliederzucken und Beugen des ganzen Leibes.
Ich hörte immer noch das wunderbare Lied nachklingen. Aber siehe, Lilith tanzte in seinem Takt. Die Farben des Lieds spielten in den Bewegungen ihres Körpers, die Leidenschaft und das süße Sehnen, alles bildete sie nach, im gleichen Schritt mit der Weise des Kapitäns. Sie tanzte nach Tönen, die ich hörte.
Hörte sie diese auch? —
Jetzt kamen drei rasende Läufer vom tiefen G bis hinauf in die höchsten Lagen, und siehe: Lilith hatte sich geduckt und hob und schraubte sich in die Höhe, bis sie wieder tief hinuntersank. Genau wie das Lied.
Kein Zweifel. Sie hörte es. Es war kein Traum. Aber was? —
Und nun war's vorbei. Ich wollte mir die Weise wiederholen. Es gelang mir nicht. Sie war wie ausgelöscht aus meinen Gedanken.
Auch Lilith stand erstarrt und breitete die Arme aus. Sie tanzte nicht mehr. Dann kam sie ans Gitter, fasste dieses, beugte sich vor, bis ihre Stirn es berührte, und rief:
»Bumbo auf Ehre, Massa, Bumbo auf Ehre.«
Aber das war nicht ihre Stimme. Das war die raue, schnarrende Stimme unseres Kochs.
Aber ehe ich noch denken und überlegen konnte, hub sie aufs Neue an:
»Dass du die Trichinen kriegst, Millioooonen Trichinen!«
Das war der Kapitän. Unverkennbar. Das war sein Tonfall, seine Stimme. Das konnte nur er sein.
Und das Wunder ging weiter. Lilith sprach mit Ahasvers, mit des Kapitäns, sogar mit Mister Rugbys Stimme. Sie war Schalltrichter, Fernsprechleitung. Ihr Ich war ausgeschaltet. Durch ihren Mund kamen Funksprüche.
»Ich bin bei ihm«, — das war Ahasver.
»Ach, ist es dir gelungen?«, — das war Käpten Düwel.
»Ich habe ihn schon längst gefunden.«
»Tot?«
»Er lebt.«
»Und das sagst du jetzt erst, Halunke?«
»Er schlief, aber ich konnte es nicht unterscheiden. Er konnte auch tot sein. Jetzt ist er aufgewacht.«
»Er lebt! Gelobt sei Gott! Gelobt sei Gott! Kannst du mit ihm sprechen?«
»Nein. Ich konnte ihn nicht einmal wecken.«
»Kannst du dich ihm bemerkbar machen?«
»Ja — durch einen — Anderen.«
»Durch wen?«
»Still, Massa, Bumbo auf Ehre, Bumbo auf Ehre... — Es ist jemand bei ihm — ich habe ihn besessen.«
»Wer ist's?«
»Ich weiß nicht. Eine Frau. Ich fühle auf meinem Kopf lange Haare.«
Dann kam eine Pause. Lilith bewegte die Lippen, aber ich hörte nichts mehr. Dann vernahm ich plötzlich des Kapitäns tiefe Stimme:
»Steuermann Larsen!«
»Ich bin hier«, flüsterte ich atemlos.
Aber so leise ich sprach, war es doch vernehmlich. Auch die Mondsüchtige sprach nicht allzu laut.
»Gepriesen sei Gott, dass Ihr noch lebt!«
»Wo seid Ihr, Käpten?«
»Still, lasst mich erst fragen. Ahasver kann jeden Augenblick wieder erwachen, und zum zweiten Mal geht's nicht so leicht. Wo seid Ihr?«
»In Taiosae, Hafen von Nuku Hiwa, MarquesasInseln — im Schloss des Gouverneurs.«
»Ach, Nuku Hiwa — — ich weiß. Franz, deine Karte heraus! — Wie kommt Ihr dahin?«
»Als Gefangener. Ich bin von einem Franzosen aufgefischt und hier abgeliefert worden.«
Ich berichtete dann auf Wunsch des Kapitäns ausführlicher über meine Erlebnisse vom Teufelsberg bis hierher. Dann wurde ich unterbrochen, indem Mister Rugby dem Kapitän seine Messungen mitteilte. Dieses Gespräch verstand ich aber nicht. Plötzlich rief der Kapitän wieder:
»Sechshundert Seemeilen. Heute ist Montag. Spätestens Donnerstag können wir dort sein.«
Wild pochte mir das Herz.
»Wie werdet Ihr als Gefangener behandelt?«
»Ausgezeichnet. Ich lebe wie ein Fürst. Ich bin der einzige Gefangene, der Stolz der ganzen Niederlassung. Ich kann wirklich über nichts klagen.«
»Das ist gut. Dann werde ich auch anständig sein.«
»Ihr wollt mich befreien?«
»Na, das ist doch selbstverständlich!«, erklang es mit rauem Lachen aus dem Mund des schönen Mädchens. »Oder wollt Ihr vielleicht nicht befreit sein? Vielleicht geht's Euch dort besser als hier!«
»Aber Käpten! Ihr wollt mich frei machen? Ja, wie könnt Ihr denn das?«
»Das wird sich finden. Das hängt ganz von diesem Gouverneur ab. Ich werde ja möglichst schonend vorgehen, weil er ein sehr anständiger Kerl zu sein scheint, aber herausgeben muss er Euch natürlich, und da soll nicht lange gefackelt werden. Wollt Ihr nun auch noch etwas fragen, so beeilt Euch. Ahasver scheint gleich wieder zu erwachen.«
»Wo seid Ihr, Käpten?«
»In unserem Schlupfwinkel. An Bord der ›Wasserhexe‹.«
»Mit dem ›Seedrachen‹?«
»Aber gewiss.«
»Was machen die Zurückgebliebenen?«
»Es geht allen gut.«
»Der Segelmacher war sehr krank...«
»Der ist wieder wohlauf.«
»Wann kamt Ihr zurück?«
»Erst vor einer Stunde. Mein Erstes war natürlich, dass ich hörte, wie Ihr samt dem ganzen Wachthaus davongegangen seid. Durch die Lüfte. Seitdem quäle ich mich mit dem schwarzen Kerl herum.«
»Ihr wart so lange fort?!«
»Ja, fast vier Wochen. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Wir haben schwere Havarie gehabt, außerdem haben wir auch viele...«
Die Sprecherin brach plötzlich ab und zuckte zusammen. Dann ließ sie die Arme fallen, dass sie schlaff an ihr herunterhingen. Sie stand nunmehr im Mondschatten. Der Eingang zu den rückwärtigen Gemächern wurde stark beleuchtet. Da wandte sie sich und verschwand in der offenen Tür, durch die sie den Nebenraum betreten. Dort schienen ihre Gemächer zu sein, in denen sie sich unausgesetzt aufhielt, von denen aus sie mich jederzeit aufsuchen und überraschen konnte.
Also mondsüchtig war sie. Das war das Geheimnis ihrer Augen! Darum war sie offenbar fähig, Empfänger der Fernsprüche Ahasvers zu werden. Er war der Sender, sie der Empfänger und wir die Sprechenden. Und beide Werkzeuge wussten nichts davon!
Merkwürdig, merkwürdig!
Wie wenig ist doch das Seelenleben und auch das körperliche Leben des Menschen erforscht! Dass wir es hier mit rein natürlichen Vorgängen zu tun haben, die in unserer Natur einfach begründet sind, darüber besteht für mich kein Zweifel. Nur sind sie noch nicht erforscht und festgestellt. Verborgen bleiben werden sie nicht.
Die Freude hatte mich lange nicht einschlafen lassen. Dann machte die Natur ihre Rechte geltend, und am Morgen erwachte ich später als gewöhnlich. Ich hatte offenbar das erste leise Klopfen meines Dieners überhört, der mir das Frühstück bringen wollte.
Langsam kam ich zu mir. War's ein Traum gewesen? Nein, gewiss nicht! Ach, diese Freude, diese unbeschreibliche Freude! Wie herrlich ist doch eine große Freude, die ins Leben fällt! Wollte Kapitän Düwel hier erscheinen und meine Herausgabe fordern, so war das ein Sieg Deutschlands in der Südsee, so hatte er inzwischen Großes erlebt, das ihm dazu die Macht und das Recht gab. Ich konnte innerlich nur jubeln und jauchzen.
Im späten Vormittag erschien Lilith jenseits des Gitters. Sie kam aus ihren Gemächern im Nebenraum, der durch einen Vorhang von ihren rückwärtigen Räumen geschieden war. Sie schien nichts zu wissen von der Begegnung in der Nacht. Ich begrüßte sie mit allen Formen der Höflichkeit, und bald waren wir im angenehmsten Plaudern. Sie hatte offenbar viel gelesen und viel gedacht, und ich gewann den Eindruck, dass ihr seltsames Wesen, abgesehen von ihrer krankhaften Veranlagung, auch mit einer gewissen inneren Vereinsamung in Zusammenhang stand. Sie war ohne Mutter aufgewachsen, hatte vom Vater die Tatkraft und das selbstherrliche Wesen geerbt und an der Tante jedenfalls keine geeignete mütterliche Leitung erlebt. Wen hatte sie sonst? Schmeichler und innerlich haltlose Menschen, die als Schmarotzer das glänzende Hofleben ihres Vaters genossen und auf das junge Mädchen jedenfalls keinen günstigen Einfluss ausüben konnten.
Ich gab mich ihr gerade und einfach, war vielleicht der erste Mensch, der ihr nicht schmeichelte. Das wurde mir von jetzt ab umso leichter, als ich mich schon innerlich frei fühlte und auch das Bewusstsein der Gefangenschaft nicht mehr empfand. Sie hatte mir auch äußerlich alle Demütigungen weggerückt. Es war kein Zweifel, dass sie beabsichtigte, mir auch noch größere Bewegungsfreiheit zu verschaffen.
Auch am Nachmittag weilte sie mehrere Stunden neben mir. Ich nannte sie »Hoheit«, sie nannte mich nicht mehr »Herr Deutscher« oder »Herr Gefangener«, sondern einfach »Monsieur« und behandelte mich als Offizier. Auch über Krieg und Staatsangelegenheiten sprachen wir nicht mehr, wohl aber über tiefe, allgemein menschliche oder wissenschaftliche Fragen. Namentlich nach dem Seewesen der Deutschen erkundigte sie sich, und sie zeigte gute Kenntnisse auch in mathematischen Dingen, soweit sie die Schifffahrt berührten. Anscheinend hatte sie oft genug auf den Kommandobrücken der kleinen Flotte der Inselgruppe gestanden und dort Vieles gelernt, vielleicht sogar die Führung eines Schiffes. Über alle Verhältnisse der Inseln und auch der Eingeborenen war sie genau unterrichtet.
Unter uns regierte der Herr Gouverneur etwas gedämpfter als am ersten Tag. Er arbeitete aber noch immer mehr im Freien als in den Innenräumen, sodass ich seine Befehle und die ihm überbrachten Meldungen unschwer hören konnte.
Der Mittwoch kam. Würde sich mein Schicksal heute entscheiden? Lilith war mir mehr ein guter Kamerad geworden, jedenfalls der angenehmste Gefängniswärter, den man sich denken konnte. Gleichwohl hielten wir beide streng auf Innehaltung aller den Umständen angemessenen Formen. Von irgendwelchem vertraulicheren Ton war keine Rede, aber wir fühlten, dass wir einander vertrauten, wenn wir auch nie das Bewusstsein verloren, Angehörige zweier Mächte zu sein, die miteinander im Krieg lagen.
Von Kapitän Düwel war nichts zu sehen. Dafür machte sich im Hafen und in der Stadt eine größere Lebhaftigkeit bemerkbar. Es schien, als seien Funksprüche aufgefangen worden, welche die friedliche Stille der weltfernen Insel beunruhigten. Es wurden Schießübungen vorgenommen nach Seescheiben, und die Leute schossen gut. Sogar die Geschütze, die bei uns oben angebracht waren, dröhnten und trafen. Man schaffte in Mengen Geschosse nach den Strandbatterien. Jedenfalls rüstete man sich für alle Möglichkeiten. Aber kein Rauchwölkchen zeigte sich am Meer, soweit ich es zu überblicken vermochte. Freilich konnte ich nicht beobachten, was jenseits der beiden Vorgebirge, die den Hafen umschlossen, vor sich ging.
Donnerstag Morgen. Schwerer Nebel. Eine Morgendämmerung kroch herauf, die man in diesen Breiten eigentlich nicht kennt. Der Nebel hatte sie verursacht. Ich sah nichts vom Hafen. Einige Dampfpfeifen heulten herauf. Heute spätestens sollten sie kommen. Würden sie kommen?
Ach, diese Gedanken, diese bangen und sehnenden Gedanken! Sie hatten mich schon die ganze Nacht gequält. Sie trieben mich zeitig vor der Sonne auf meinen Ausblick, und der war vom Nebel verhängt. Schreckliches Warten.
Der Gouverneur begann unten zu arbeiten. Er regierte wie gewöhnlich. Meldungen kamen, Befehle gingen. Alles gleichgültige Dinge.
Jetzt trat aus dem Felsen ein junger Offizier. Das war der Adjutant. Derselbe, der mich festgenommen hatte. Ich kannte sie schon alle. Er grüßte seinen Herrn.
»Sire, die ›Helena‹ ist eingelaufen.«
»Gut. Bringt sie etwas Neues mit?«
Der Gouverneur machte sich eine Anmerkung. Er erwartete keine besondere Meldung. Aber dem Offizier sah ich an, dass er etwas Besonderes zu berichten habe.
»Ein ganz außerordentlicher Vorgang! Der Dampfer ist nicht weit vom Hafen von einem Unterseeboot angehalten worden. Kapitän Jerôme hat einen Brief erhalten.«
Der Gouverneur fuhr auf. Mir stockte der Atem.
»Von einem Unterseeboot? — Einem englischen?«
»Kein englisches, Sire.«
»Ein amerikanisches, ein japanisches? Ein anderes kann doch nicht in Frage kommen. Oder sollte es ein — französisches —?«
»Es war sehr nebelig, Sire. Der Rumpf des sehr großen Fahrzeugs war kaum zu unterscheiden. Aber dann erkannte man doch die Flagge, die es zeigte. Eine ganz seltsame Flagge. Ein roter Teufel, der aus einem blauen Meer auftaucht...«
»Was? Und welches Volkes Farben?«
»Eine andere Flagge war nicht zu sehen, nur die mit dem roten Teufel.«
»Ja, was soll denn das für ein Unterseeboot sein?«
»Das wird in dem Schreiben stehen. Kapitän Jerôme lässt sich melden, um es persönlich zu übergeben.«
Ich zitterte vor Aufregung und Erwartung.
»Wo ist der Kapitän?«
Ein vierschrötiger Mann trat aus dem Felsen. Man sah ihm den Bretagner an. Vorsichtig trug er einen großen weißen Briefumschlag mit einem roten Siegel in der Hand.
»Was ist das mit dem Unterseeboot? — War es denn wirklich ein Unterseeboot?«
Dabei erfasste der Gouverneur, ohne die Antwort abzuwarten, erregt den Brief, schnitt ihn mit der Papierschere auf, während der Kapitän nochmals berichtete, was der Offizier schon gemeldet.
Der Gouverneur las das Schreiben, deutlich vernehmbar, wie er es immer tat. Es war in tadellosem Französisch geschrieben und lautete:
An Seine Exzellenz den Gouverneur von Nuku Hiwa,
Herrn Oberst Maurice Armand in Taiosae.
Mein Herr!
In Ihrer Gefangenschaft befindet sich mein Steuermann Knut Larsen. Ich ersuche Sie höflich, ihn sofort freizugeben und zum Zeichen Ihres Einverständnisses sogleich nach Empfang dieses Schreibens ein Flaggenzeichen zu hissen oder, falls noch Nebel herrschen sollte, drei Kanonenschüsse zu lösen. Nach Aufheben des Nebels wollen Sie die Güte haben, Herrn Larsen durch eines Ihrer Fahrzeuge oder ein Fischerboot auf das Meer hinausbringen zu lassen, nur zwei Seemeilen vom Hafeneingang entfernt, wo ich ihn in Empfang nehmen werde. Sie können ihm auch ein kleines Boot geben. Es wird Ihnen vergütet werden. Seine Ankunft erwarte ich bestimmt um zehn Uhr. Bis dahin wird sich der Nebel sicher verzogen haben. Es würde mir leid sein, wenn Sie auf meinen höflichen Vorschlag nicht eingehen. Ich würde mich dann veranlasst sehen, die Freigabe des Herrn Larsen zu erzwingen. Spätestens zehn Uhr müsste ich mit der Beschießung von Taiosae beginnen, falls Herr Larsen bis dahin nicht bei mir an Bord ist.
In vorzüglicher Hochachtung
Gustav Düwel,
Kapitän des ›Seedrachen‹ unter eigener Flagge.
Der Gouverneur ließ den Brief sinken. Mit offenem Mund musterte er die vor ihm Stehenden. Endlich brachte er heraus:
»Was? — Bom — bom — bombardieren will der uns? Uns? — Ja, womit denn?«
»Sire«, antwortete der Kapitän, »das Schiff ist ein sehr großes Unterseeboot und gut bestückt.«
Der Gouverneur war sprachlos. Dann beugte er sich zurück und sah zu mir empor. Unsere Blicke trafen sich.
»Wer ist denn das, dieser Kapitän Duval?«, rief er herauf.
»Düwel, Sire, Düwel; — diable.«
»Kennen Sie den?«
»Gewiss, Sire, das ist mein Kapitän. Ich war und bin sein Steuermann!«
»Ich denke, Sie sind...«
Er brach ab. Zornesröte stieg in sein Antlitz. Dann eilte er ins Schloss und erschien bald jenseits meines Gitters, und ein wildes Unwetter brach los:
»Der Kerl ist wohl verrückt geworden?«
»Käpten Düwel? Der hat noch nie eine Spur von Irrsinn gezeigt.«
»Hieß denn der Kapitän der amerikanischen Jacht nicht anders?«
»Sire, ich war auf keiner amerikanischen Jacht. Ich fuhr auf einem deutschen Segler, der ›Angela‹. Wir wurden von einem englischen Kreuzer gekapert und auf der englischen ›Waterwitch‹ als Gefangene untergebracht. Aber es gelang uns, uns zu befreien. Wir überwältigten die Besatzung.«
Dann erzählte ich vom ›Seedrachen‹ und schloss:
»Ich wusste nicht, ob mein Kapitän gestatten würde, alle diese Mitteilungen zur Niederschrift zu geben. Darum hielt ich mich verpflichtet, sie zu verschweigen. Wir stehen im Krieg. Seit unserer Befreiung führen wir unseren eigenen Krieg gegen England, gegen die Entente.«
»Und was hat der ›Seedrache‹ bisher getrieben?«
»Das weiß ich nicht. Ich bin sehr bald weggespült worden.«
»Wie lange waren Sie drauf?«
»Etwa eine Woche.«
»Was habt ihr in der Zeit immer gemacht?«
»Wir sind herumgefahren, nach feindlichen Schiffen zu fahnden, haben aber in diesen einsamen Gewässern kein einziges getroffen.«
»Ihr hättet es angegriffen?«
»Gewiss. Es konnte ja deutsche Gefangene an Bord haben. Wir hätten es ohne Weiteres torpediert.«
»Was?«, tobte der alte Herr. »Piraten seid ihr, Seeräuber, aufgeknüpft werden müsstet ihr alle zusammen.«
»Ich weiß, Sire, dass uns alle Welt dafür halten wird. Wir sind's aber nicht. Wir rauben nicht. Wir kämpfen, wie man uns bekämpft. Nur die gesetzliche Deckung haben wir nicht. Noch nicht. Wir werden sie erlangen, sobald es uns gelingt, zu irgendeinem deutschen Geschwader zu stoßen.«
»Päh, deutsches Geschwader! Gibt's ja gar nicht mehr. Führt ihr etwa die Kriegsflagge?«
»Die deutsche? Nein. Wir führen überhaupt nicht die deutschen Farben. Wir haben unsere eigene Flagge gewählt, blaurot, den Teufel im Schilde.«
»Warum führt ihr nicht die deutsche Flagge?«
»Um wenigstens unser Vaterland vor dem Vorwurf der Piraterie zu bewahren.«
»Und wenn ihr auch einen Kaperbrief hättet, wenn ihr die deutsche Kriegsflagge führen dürftet — ihr seid doch Piraten. Alle Deutschen sind Piraten, Banditen, Bluthunde, Schw... — — alle Deutschen. Hören Sie's? Alle Deutschen ohne Ausnahme.«
Seine Stimme erstickte vor Wut. Er stampfte und tobte.
»Aufhängen soll man sie alle, diese Schufte, diese...«
Er bebte vor Zorn und hatte jede Selbstbeherrschung verloren. Eine dicke Ader war unter seinem buschigen Haar geschwollen. Wild funkelten seine Augen. Wie ein Raubtier keuchte er hinter seinem Gitter.
»Sire, ich verstehe Ihre Erregung. Ich mache Sie aber darauf aufmerksam, dass jetzt keine Zeit zu verlieren ist. Es müssen drei Kanonenschüsse abgegeben werden. Kapitän Düwel ist nicht der Mann, leere Drohungen auszustoßen.«
Er blickte mich starr an.
»Was? Hohohoho — hahahaha!!«
Er begann unbändig zu lachen. Es dröhnte in dem Gemach. Dann stierte er mich an, bleich vor Wut:
»Drohen wollen Sie mir, Sie Wurm, Sie deutsches Schw...«
»Herr«, verging mir endlich die Geduld, »Sie vergessen, dass ich deutscher Offizier bin. Kommen Sie hier herein, wiederholen Sie hier Ihre Worte, aber nicht jenseits eines schützenden Eisengitters! Es ist Feigheit, da drüben mit Worten zu schimpfen wie ein Straßenflegel!«
Das half. Er besann sich, machte kehrt und verschwand. Krachend fiel die nach außen führende Tür ins Schloss.
Ich blieb allein... Auch unten zeigte sich niemand. Lilith war unsichtbar.
Draußen leuchtete heller Sonnenschein. Das Meer und der Hafen lag noch in tiefem Nebel. Ich war ruhig und gefasst. Mochten sie immerhin noch ihre Wut an mir austoben. Meine Befreiung nahte dennoch.
Da lärmte ein dumpfer Kanonenschuss aus dem brausenden Nebel da unten. War's ein Warnungsschuss des ›Seedrachen‹, mit dem er Bejahung heischte? Ich wusste es nicht. Die Zustimmung blieb jedenfalls aus. Heute schien überhaupt hier nicht regiert zu werden.
Langsam und träge schlich die Zeit hin. Endlich kam von Süden her ein frische Brise auf und fegte den Nebel von Stadt und Hafen und Meer. Bis weit hinaus lag glänzender goldener Sonnenschein über der blauen See.
Am Hafen war alles wie immer. An den Strandgeschützen zeigte sich kein erhöhtes Leben. Gruppen von Menschen standen umher wie immer und schwatzten. Nicht einmal eine Erwartung konnte man aus ihren Bewegungen lesen.
Ich suchte mit dem Fernglas das Meer ab, so weit ich's überblicken konnte. Nichts war zu sehen. Der Zeiger der Uhr unten zeigte neun Uhr.
Oder doch! Ganz hinten war ein dunkler Punkt. Er entwickelte sich bald zur Linie, dann wurde das Fahrzeug wieder zum Punkt. Kein Zweifel, da kreuzte ein Schiff. Aber die Entfernung betrug mindestens 20 Kilometer. So weit konnte man gar nicht schießen.
Aber plötzlich kam Leben in die Gruppen am Hafen. Man zeigte, schrie, lärmte. Der Lärm drang bis zu mir herauf.
Da erst gewahrte ich, dass der Lärm nichts mit dem kreuzenden Punkt da draußen zu tun hatte. Kaum 3 Kilometer vom Hafeneingang entfernt war aus dem stillen, blauen Wasser eine schwarze Kreisfläche aufgetaucht, und auf dieser erhob sich seitwärts am Rande eine kurze Stange. Daran flatterte eine blaurote Flagge mit einem roten Teufel, der mit Neptuns Dreizack über dem Meere stand.
Das Oberdeck des Panzerturms! Wie kannte ich's! Auch ohne Flagge hätte ich gewusst, dass es der ›Seedrache‹ war.
Das Folgende ging alles Schlag auf Schlag mit einer Schnelligkeit, die man im Erzählen nicht wiedergeben kann. Zunächst ging die Teufelsflagge nieder. Sieben bunte Lappen kletterten auf den Signalmast.
Ich kannte die wichtigsten Flaggenzeichen auswendig. Diese konnte ich nicht lesen.
Jetzt gingen am Lande auf dem Signalmast der Seewarte die Flaggen hoch. Erst das Zeichen »Verstanden«, dann acht andere, die ich nicht lesen konnte.
Neue Zeichen bei dem ›Seedrachen‹. Neue Antwort bei der Hafenwarte.
Viermal flatterten die Flaggenzeichen hier und drüben. Dann verschwand die stumme Sprache.
Böööööh!!!
Unten im Hafen hatte ein Geschütz gesprochen. Ich sah die Granate fliegen. Sie schlug aufs Wasser, prallte ab, machte zwei Sätze und verschwand. Viel zu hoch. Viel zu weit rechts.
Der ›Seedrache‹ zog die Teufelsflagge und setzte sich in Fahrt.
Böööööhhh!!! Böööööhhh!!
Jetzt hatte unten gleich eine ganze Batterie gebrüllt. Der Donner hallte von den Bergen wider. Drei Granaten hatten ihr Ziel erreicht. Die Franzosen schossen ausgezeichnet. Das heißt, sie hatten ihr Ziel erreicht, aber damit noch lange nicht den Panzerturm des ›Seedrachen‹. Der war bei dem ersten Schuss getaucht, aber die blaurote Flagge war wieder emporgekommen, nur etwas abseits. Dorthin hatten die Kanoniere gezielt. Kaum aber war ihre Salve abgegangen, so tauchte der echte Panzerturm auf, das Dach schob sich auseinander, ein dickes Rohr ward sichtbar, ein Feuerstrom...
Bumm!!
Ehe der Ton noch herausdrang, war der stählerne Vogel schon an Ort und Stelle. Unten auf dem Marktplatz ein Krachen, Schreien, Feuerschein, Dampfsäule.
Ein Steingebäude zerfiel in zwei Hälften. Aus dem Riss schlugen Flammen auf.
Aber jetzt kam Leben in die Massen da unten. Sie stoben auseinander. Im Augenblick war der Platz wie gefegt. Das hatten die nicht gedacht, dass da draußen gleich solcher Ernst gemacht würde.
Eine wütende Abwehrschießerei setzte ein. Umsonst. Bald hier, bald da tauchte die blaurote Fahne auf, und plötzlich zeigte sich dazwischen das Geschützrohr, dann spie es sein Feuer, und in den nächsten Augenblicken war es wieder verschwunden, um ganz anderswo aufzutauchen.
Geradezu unheimlich war die Treffsicherheit des siebenzölligen Mörsers. In 15 Sekunden lässt sich kein solches Geschütz herumschwenken und wieder einstellen, vom Zielsuchen gar nicht zu reden.
Ich kannte das Geheimnis der Schützen. Aber in der Stadt musste es geradezu wie Zauberei und Teufelswerk wirken.
Denn der ›Seedrache‹ bot natürlich als Ziel immer den falschen Turm. Unterdessen fuhr das richtige Schiff unter Wasser hin, steckte sein sehendes Fühlhorn unbeobachtet heraus. Der Mörser wurde in aller Ruhe eingestellt, und wenn's so weit war, versank der falsche Turm, der richtige tauchte auf, gab seine Ladung ab und verschwand. Gleich drauf erschien irgendwo der falsche wieder, der den Strandgeschützen ein ruhiges Ziel bot.
Und auf dem Strande zerbrach Haus auf Haus. Das Eingeborenendorf flammte lichterloh auf. Der Wasserturm ward getroffen. Ein mächtiger Strom stürzte ins Meer. Das Gaswerk flog mit furchtbarem Krachen in die Luft. Eine Granate zersprang mitten unter den Geschützen am Strande.
Halt ein, Gouverneur! Willst du dein ganzes Lebenswerk zusammenschießen lassen, um eines lumpigen Gefangenen willen?
Ich begriff nicht, warum man nicht nachgab. Aber bei mir zeigte sich niemand. Ich hörte niemanden, Lilith blieb verschwunden. Ich konnte niemand erreichen.
Plötzlich lautes Jubelgeschrei der Soldaten. Alles winkt, deutet, rennt nach dem Vorgebirge, das mir die Aussicht verdeckte.
Nun sah ich, weshalb der Gouverneur nicht nachgeben wollte.
Ich sah es reichlich spät. Sahen's die Unsrigen auch?
Dort hinter dem Vorgebirge kam es herangerauscht. Ein englisches Kriegsschiff mit englischer Flagge, ein gewaltiger Koloss.
Aber dabei blieb's nicht. Da folgte ja noch eine gepanzerte Korvette und da im Kielwasser noch eine Fregatte, ein Franzose!
Gott im Himmel, stehe den Meinen bei!
Offenbar war diese Seemacht drahtlich verständigt und schon längst von des Gouverneurs Räumen aus gesichtet worden. Sie sollte Nuku Hiwa von den Unterseeteufeln befreien.
Flaggen spielten hin und her. Drüben wussten sie, was vorging. Die von Geschützen starrenden Ungeheuer rasten heran, die Mannschaft klar zum Gefecht.
Nur der Feind musste noch gesichtet und festgestellt werden.
Ja, was nun, was nun?
Mir stand das Herz still. Der Atem versagte.
Ich sah das Ungeheuerlichste, was ich je im Leben sah, Größeres, als was ein Seemann sich ausmalen kann.
Mit schäumendem Bug stürmten die eisernen Ungeheuer heran. Aber plötzlich, ganz deutlich, ein weißer Streifen im blauen Wasser wie ein zielbewusster Pfeil. Jetzt ist er am englischen Flaggschiff, eine riesige Wassersäule steigt auf, ein entsetzliches Krachen, der Koloss bäumt sich wild auf, dann senkt sich das Heck, der Bug hebt sich hoch in die Luft, und kampflos sackt das Ungetüm weg. Ein Wasserstrudel bezeichnet den Ort, wo es eben noch war. Schwimmende Köpfe, Schiffstrümmer bedecken den Umkreis.
England hat ein Kriegsschiff weniger.
Furchtbarer Anblick! Arme Schwimmer! Die englische Korvette stoppt wie entsetzt, schwingt Boote aus, will auffischen...
Sie kommt nicht dazu. Sie spaltet sich in zwei Teile. Die Mannschaft brüllt auf, man glaubt's bis hierher zu hören...
Der Franzose kommt an die Unglücksstelle. Er will Hilfe schaffen. Aber ich sehe nur eine Wassersäule. Mit einem Krachen geht die ganze Korvette in die Luft. Gegen Unterseeboote sind die stolzen Kriegsschiffe, die das Weltmeer bisher beherrschten, wehrlos.
Aber nahen da nicht neue Feinde? Zwei neue ›Men of war‹ sind auf dem Platz erschienen. Sollen sie ihren Genossen nachsinken oder doch den ›Seedrachen‹ überwältigen?
Mit der Schnelligkeit eines Eilzugs kommen sie heran. Von Norden rasen sie daher. Voran ein Torpedoboot, dicht nach ihm ein großes Kanonenboot, das offenbar als Torpedojäger dient. Vorn am Bug ist ein Riesengeschütz, ein Fünfunddreißigzentimeter.
Regungslos, kaum atmend, starre ich auf das Bild.
Was sehe ich da? Täusche ich mich? Träume ich?
Auf jedem Heck weht die blaurote Teufelsfahne.
Ich suche eine Erklärung und zermartere mein Hirn. Aber da ist nichts zu erklären.
Der ›Seedrache‹ ist nicht mehr allein. Er hat die vier Wochen gut ausgenutzt und hat ein feindliches Torpedoboot und ein Kanonenboot erobert, die ihm nun dienstbar sind und das UBoot in die Schlacht begleitet haben.
Das war die natürlichste Erklärung. Offenbar waren das die schwarzen Punkte gewesen, die ich vorher in der Ferne hatte kreuzen sehen.
Wunderbar! wunderbar!
In kaum einer Viertelstunde waren drei gewaltige Kriegsschiffe versunken und lagen auf dem Boden der Südsee, erlegt von einem winzigen Feind, dem Teufelskapitän, der allerdings den Teufel im Leibe hatte.
Die Ankömmlinge blieben nicht lange untätig. Sie schwangen Boote aus und retteten, was an schwimmenden Mannschaften zu retten war. Auch die Fischerboote gingen in See und beteiligten sich am Werk.
Da polterten laute Schritte in den Nebenraum. Der Gouverneur stürzte herein, händeringend, verzweifelt, heulend, weinend. Bleich wie eine Säule von schneeweißem Marmor folgte ihm Lilith. Sie war keiner Worte mächtig.
»Herr, machen Sie ein Ende, machen Sie ein Ende!«
»Sire, das liegt nur an Ihnen, nicht an mir. Zeigen Sie unverzüglich die weiße Fahne, geben Sie das Zeichen, dass Sie einverstanden sind: Kein Schuss wird mehr fallen. Ich habe es Ihnen gleich gesagt.«
»Laufen Sie, Herr, eilen Sie, nur schonen Sie meinen ›Agamemnon‹! Ach, schonen Sie mein schönes Schiff!«
Ich sah, was er meinte. Um das Vorgebirge bog eine Fregatte, die den Kreuzerwimpel zeigte, die französische Trikolore, ein zierliches Schiffchen. Es war das Kleinod des Gouverneurs. Das wollte, musste er retten. Ganz arglos kam es um die Ecke. Offenbar hatte niemand daran gedacht, ihm die nötigen Mitteilungen zuzuschicken.
Man schien unten ganz den Kopf verloren zu haben. Es war auch alles viel zu schnell gegangen. Aber als der Gouverneur sein eigenes Schiffchen in die Gefahr rennen sah, da war's mit aller Haltung vorbei.
Böööööhhh!!!
Das Kanonenboot unten hatte gesprochen. Auf dem Marktplatz war eine Riesengranate krepiert. Tod und Verderben verbreitend. Rundum stürzten Häuser ein.
Das Torpedoboot beschrieb einen Bogen, auch dem neuen Gegner den Weg zu verlegen, falls er schneller war als der ›Seedrache‹.
Es war wirklich höchste Zeit.
»Retten Sie meinen ›Agamemnon‹, Herr, eilen Sie —«, jammerte der stattliche Mann in der Oberstenuniform.
»So ziehen Sie doch sofort die weiße Flagge, ich kann ja hier gar nichts tun!«
Endlich begriff er. Er stürzte hinaus.
Es musste durch den Fernsprecher hinuntergerufen werden.
Vielleicht hatte man's schon von selbst getan.
Auf dem Turm der Seewarte kroch die weiße Fahne empor. Dann folgte ein zusammengesetztes Flaggenzeichen.
Alsbald tauchte der Panzerturm des UBoots in die Höhe. Auch dort wurden Flaggen aufgezogen.
Lilith lehnte bleich und stumm am Eisengitter.
»Mein Herr, Sie sind frei! O es ist entsetzlich! Mein armer Vater!«
Ein Offizier trat bei mir ein. Stumm verbeugte ich mich vor der Dame, die ich achten und schätzen gelernt. Dann folgte ich meinem Führer zum Aufzug. Wir glitten durch den Felsenschacht hinab. Ich war frei. — —
Ein kleiner Dampfer brachte mich an Bord des Kanonenboots. Durch Flaggenzeichen war ihm das befohlen worden. Der ›Seedrache‹ war schon ziemlich weit entfernt. Einen wehmütigen Blick warf ich nach Taiosae zurück. Eigentlich war den braven Menschen da oben im Schlosse übel gelohnt worden. Aber das ist der Krieg, der entsetzliche Krieg, den die englische Rohheit über die ganze Welt ausgegossen hat. Kapitän Düwel hätte der Stadt kein Leids getan, wenn man mich gutwillig ausgeliefert und sich nicht auf englische Hilfe verlassen hätte. Und war es kriegsmäßig notwendig gewesen, harmlose Kauffahrer, die mit Tabak in der Südsee handelten, in Ketten zu legen und ihr Schiff zu zerstören? — Nach Jahrhunderten noch wird man sich an die Stirn greifen und sagen: Wie war's möglich, dass das zwanzigste Jahrhundert so viel Gemeinheit ausschäumen konnte, dass ein Krieg alle erreichbaren Werte zerstörte und auch die friedlichen Menschen, ja selbst Weiber und Kinder, in Mitleidenschaft zog? Und die Antwort wird lauten: So geht's, wenn ein Volk seine Raubgier durch Frömmigkeit zu verdecken sucht. Gott lässt sich nicht spotten. Er lässt die ganze Rohheit offenbar werden, dass sich nichts mehr verdecken und verheucheln lässt.
Wir legten am Kanonenboot an. Kein einziges bekanntes Gesicht begrüßte mich. Es waren lauter fremde Leute. Und dennoch nicht Fremde. Unverkennbar Deutsche! Einige Männer schon ziemlich bejahrt, aber alle rüstig.
»Das sind wohl Reservisten und Seewehr?«, fragte ich.
»Und Landsturm, und Landsturm!«
Ein junger Mann, anscheinend ein Offizier, führte mich in die kleine Kabine, und es währte nicht lange, so trat Mister Rugby ein. Er freute sich sichtlich, mich wiederzusehen, und schüttelte mir kräftig die Hand. Ich war kaum eines Wortes mächtig.
Die Schiffsplanken zitterten. Wir hatten beide Zeit, ein kräftiges Frühstück wurde aufgetragen. Dann saßen wir bei einer Flasche Porter und einer Zigarre einander gegenüber. Ich musste ihm ganz genau Bericht erstatten und verschwieg ihm nichts. Auch nicht das nächtliche Erlebnis mit Lilith.
»Ja, mein lieber Herr Kamerad. Man kann in vier Wochen manchmal mehr erleben als in Jahren. Hoffentlich tut's Ihnen nicht leid, so jäh von Ihrer schönen Kerkermeisterin weggerissen worden zu sein... Wir waren nicht wenig erschrocken, als uns bei unserer Rückkehr gemeldet wurde, dass Sie samt der Seewarte ins Meer gespült seien, und Sie wissen, was für Mittel Kapitän Düwel angewandt hat, Ihrer wieder habhaft zu werden. Für jeden hätte er das nicht getan. Betrachten Sie es als Zeichen, dass er sich Ihnen besonders verbunden fühlt! Sie stehen bei ihm in hohem Ansehen.
Wie Sie sehen, haben auch wir inzwischen Schicksale erlebt, die mindestens ebenso wunderbar sind wie Ihre Errettung. Sie waren heute Zeuge, dass wir zwei Engländer und einen Franzosen niederrangen. Und Sie befinden sich auf einem englischen Schiff, das wir genommen haben, ein zweites folgt uns. Wir sind aber außerdem die Besitzer eines großen englischen Kriegsschiffs. Ich weiß nicht, ob Sie erraten werden, welchen Namen es trägt?«
Mein Blick weilte bereits seit einiger Zeit auf seinem Schreibtisch, der mit Büchern bedeckt war, deren Einbände mir bekannt schienen:
»Doch nicht des ›Eagle‹?«
»Jawohl, so ist's. Unser alter Freund, der ›Eagle‹, gehört jetzt uns. Sie sehen die erwünschte Beute, die wir gemacht haben. Die Früchte meiner jahrelangen Arbeit sind gerettet. Das ist auch die Ursache, dass wir Ihnen unser gegebenes Wort nicht halten konnten und statt einer Woche vier ausbleiben mussten. Wir hatten auch allerdings ein nicht ganz unbedeutendes Unglück mit dem ›Seedrachen‹.
Doch lassen Sie sich erzählen! Der ›Eagle‹ war allerdings das erste Schiff, das uns begegnete. Sie wissen, dass wir die Funkeinrichtung auf dem ›Seedrachen‹ eingebaut hatten, aber natürlich benutzten wir sie nur als Empfänger, nicht als Geber. Das führte uns bald auf die Spur des ›Eagle‹. Schon am ersten Tag nach unserer Abfahrt.
Wir sahen am fernen Gesichtskreis zwei Mastspitzen und fuhren in voller Fahrt drauf zu. Es war unnötig zu eilen. Der Dampfer lag ganz still. Wir näherten uns unter Wasser und beobachteten ihn durch das Periskop. Da sahen wir zu unserem Erstaunen, dass er überhaupt nicht im freien Meere lag, sondern in der Lagune einer Koralleninsel. Sie war flach und öde, wie unser Düwelsland, offenbar wasserlos.
Vorsichtig umfuhren wir das Eiland, und bald bemerkten wir, dass die Fregatte in der Lagune einen kleinen Schaden ausbesserte. Zwei Taucher arbeiteten. Es schienen nur einige Nieten außenbords unter Wasser ausgebessert zu werden. Wir bemerkten aber, dass die Lagune nur eine einzige schmale Zufahrt hatte. Der ›Eagle‹ war also in eine Mausefalle gegangen, in der er unrettbar verloren war. Wir brauchten nur außen zu warten und hätten ihm bei der Ausfahrt einen Torpedo zugesandt. Aber es sollte viel besser kommen.
Es war Abend, als wir unsere Feststellungen vollendet hatten. In derselben Nacht fingen wir drei Matrosen ab, die außerhalb der Lagune auf Fischfang gegangen waren. Wir nahmen sie ganz unbeobachtet gefangen und erfuhren von ihnen etwas, was für uns höchste Bedeutung hatte. Es kam ganz zufällig heraus.
Auf dem ›Eagle‹ war das Trinkwasser sehr knapp geworden. Der Vorrat konnte höchstens für acht Tage ausreichen, länger aber nicht. Auf der Insel gab's kein Wasser. Eine Vorrichtung, Seewasser zum Trinken brauchbar zu machen, war in das etwas veraltete Muster nicht eingebaut worden. Auch die Kessel wurden mit Seewasser gespeist. Innerhalb von spätestens acht Tagen musste also das Schiff herauskommen und uns in die Hände fallen.
Am anderen Tag machten wir uns sofort bemerkbar und forderten durch Flaggenzeichen auf, sich uns zu ergeben. Ebenso natürlich war eine schroffe Ablehnung.
Nach einigen Stunden schon waren die Fehler verbessert. Der ›Eagle‹ gab Dampf, seinen geschützten Hafen zu verlassen, uns zum Trotz.
Er konnte ja gar nichts anderes tun. Ein englisches Kriegsschiff wird sich doch nicht einem unbekannten Unterseeboot, das eine Teufelsflagge führt, ergeben! Es konnte auch nicht ewig in seiner Lagune liegenbleiben. Es musste also heraus...«
»Gaben Sie sich ihm nicht zu erkennen?«
»Nein. Diese Überraschung hatten wir uns noch vorbehalten. Wir hatten die Gesichter unserer drei Gefangenen gesehen, als sie uns erkannten, und hätten gern diese Freude auch bei der übrigen Besatzung durchlebt. Also die Fregatte verließ mit Volldampf die Lagune. Das war leichtfertig, aber für sie das einzige Mittel, an dem lauernden Feind draußen vorüber zu sausen. Und da kam das Unglück. Schon nach den ersten Schraubenschlägen geriet der ›Eagle‹ auf Grund und saß fest. Bei der Klarheit des Wassers war das eigentlich ganz unmöglich, aber bei dem Übereifer geschah's doch. Die nächste Springflut, die ihn losmachen konnte, nahte erst nach drei Wochen.
Nun sandte der ›Eagle‹ drahtlose Funksprüche in die Welt. Wir fingen sie natürlich auch auf. Festgerannt da und da für drei Wochen, Wasser nur für höchstens acht Tage. Sofortige Hilfe. Vor dem Lagunenausgang lauert ein deutsches Unterseeboot.
Das waren also wir. Natürlich mussten wir Deutsche sein. Andere kamen ja nicht in Betracht. Es musste aber von uns die Rede sein, damit nicht etwa ein argloser Handelsdampfer kam und von uns vernichtet wurde. Dass das einem ›Man of war‹ ebenso geschehen konnte, war klar. Aber ein solches Kriegsschiff ist wenigstens zum Kampf da.
Der Funkspruch wurde auch aufgefangen. Am anderen Morgen in aller Frühe kam gleich ein ganzes englisches Geschwader von Torpedobooten und Torpedojägern, zusammen fünf Stück. Zwei Torpedoboote und ein Jäger fuhren gleich in die Lagune hinein. Zwei blieben außen als Wache. Diese zwei haben wir sofort torpediert. Es ging ganz ausgezeichnet. Man kann ja bis jetzt UBooten noch gar nicht wirksam begegnen. Das einzige wird immer schleunige Flucht sein. Aber das wussten die noch nicht. In einer Viertelstunde waren beide erledigt.
Da kam ein Torpedoboot aus der Lagune heraus. Es wurde geknackt wie seine Kameraden. Nun sank denen drinnen der Mut. Sie wagten nicht mehr herauszukommen. Außerdem hatten wir doch Minen an Bord. Diese wurden in den langen Lagunenkanal gelegt von Tauchern, hauptsächlich von mir. Es lagen gleich sechs hintereinander.
Unsere drei Gefangenen hatten das alles gesehen. Jetzt schickten wir einen von ihnen hinüber, um selbst zu erzählen, was der Schiffe wartete, wenn sie etwa heraus wollten. Sie waren rettungslos festgenagelt.
Es kamen nun aber noch rund hundertundfünfzig Mann dazu, die sich von den vernichteten Booten durch Schwimmen auf die Insel gerettet und ebenfalls kein Wasser zum Trinken hatten. Nur das Kanonenboot besaß eine regelrechte Destilliervorrichtung, aber für fünfhundert Mann reichte das keineswegs aus.
So wurde das Ende nur ein wenig in die Länge gezogen. Weiter nichts. Wieder arbeiteten die Funksprüche. Nach zwei Tagen kam eine englische Korvette von achttausend Tonnen. Wir haben sie versenkt. Vierhundert Mann retteten sich schwimmend auf das Koralleneiland. Neue Trinkwasserverbraucher.
Immer verzweifelter wurde die Lage der Eingeschlossenen. Zehn Tage haben sie sich gehalten. Zuletzt gab's nur noch Bier und Selterswasser. Das ging natürlich nicht lange.
Am elften Tage beging der Korvettenkapitän Hyman, der Führer des ,Eagle‹, Selbstmord. Er hatte das Schiff in die Luft sprengen wollen, war aber daran verhindert worden und schoss sich eine Kugel durch den Kopf. Die Durstqualen hatten an sich schon Meutereigedanken ausgelöst. Da vergeht auch die stramme Zucht eines Kriegsschiffes.
Dann wurde verhandelt. Ein Offizier kam an Bord. Es war wieder jener Kapitänleutnant, dessen Bekanntschaft wir schon auf der ›Angela‹ gemacht hatten. Das Wiedersehen war unbeschreiblich. Er war starr und fast sprachlos vor Beklemmung. Bei der Verhandlung erfuhren wir, dass sich meine Bücherei und alles sonstige Eigentum noch an Bord des ›Eagle‹ befanden. Das war eine große Freude und Überraschung. Kapitän Düwel wäre bereit gewesen, das ganze Schiff freizugeben, wenn mir nur diese Sachen ausgehändigt würden. Aber ich habe dieses Angebot zurückgewiesen. So weit waren wir doch immer Kriegführende, dass ich keinen Sondervorteil aus der Lage zu ziehen mich berechtigt fühlte. Die Sachen hatte ich auch längst verloren gegeben. Darum bestanden wir schließlich auf bedingungsloser Übergabe.
Die Verhandlung hatte zunächst kein Ergebnis. Neue Hilferufe des ›Eagle‹. In ihnen verschwieg er die Anwesenheit des UBootes. Es konnten jetzt also auch Handelsdampfer kommen.
Schon am anderen Tag erschien ein großer englischer Postdampfer, ein mächtiger Kasten. Der konnte alle Durstigen mit Wasser tränken. Es war aber nur Wasser auf unsere Mühle. Wir machten uns sofort heran, verlegten ihm den Weg und befahlen: Entweder bleibst du hier liegen, wie wir dir vorschreiben, oder du hast in der nächsten Minute einen Torpedo im Leib, dass du auf Meeresgrund fährst. Der Kapitän schien schon allerlei üble Erfahrungen gemacht zu haben. Er gab sofort nach und blieb liegen. Das war er auch seiner Reederei schuldig.
Aber nun kam die freudigste Überraschung. Er hatte an Bord hundertneunundsiebzig deutsche Gefangene, lauter kriegsfähige Männer, Reservisten der Land- und Seewehr, die aus Neuseeland aufgesammelt waren und nun in ein Sammellager gebracht werden sollten. Das war's gerade, was wir brauchten. Fast die Hälfte waren Seeleute. Ein Dutzend Auserlesene kam gleich auf den ›Seedrachen‹, sodass wir die Besatzung nun vollzählig hatten. Die nötigen Mundvorräte wurden auch von dem Engländer übernommen.
Nun konnten wir weitere Bedingungen stellen. Hier liegt ein großer Dampfer. Er hat Wasser genug für euch alle. Er soll euch aufnehmen, dass ihr frei sein sollt, aber die drei Schiffe gehören uns. Wenn ihr sie in die Luft sprengt oder unbrauchbar macht, dann nehmen wir einfach den Postdampfer, und euch lassen wir verschmachten.
Ich weiß nicht, ob wir die Drohung auch ausgeführt hätten. Jedenfalls wirkte sie. Auch der Heldenmut hat seine Grenzen, und die Leute waren vom Durst schon recht mürbe geworden. Einen Tag dauerte die Überlegung. Dann war der Widerstand gebrochen. Der Postdampfer bekam neue Mannschaft an Bord. Die deutschen Gefangenen gingen an Bord des ›Eagle‹ und der beiden Boote.
Dann durfte der Postdampfer abfahren. Der ›Eagle‹ aber muss noch dort zurückbleiben, bis die nächste Springflut eintritt. Mit den beiden Booten gingen wir nun nach Düwelsland zurück.
Sie können sich denken, Herr Kamerad, was wir wegen der Zurückgebliebenen für Sorge ausgestanden hatten. Aber wir konnten nicht anders handeln, und Sie sind ja auch ohne uns sehr gut fertig geworden. Unsere Gefangenen hatten keine Ahnung, dass nur vier Wächter da waren. Sie waren ja ausgezeichnet verhindert, irgendwelche Beobachtungen zu machen, und auch nach Ihrem Verschwinden hat jeder Mann seine Pflicht getan. Dem Segelmacher haben Ihre Chiningaben bald das Fieber vertrieben.
Das Weitere wissen Sie. Mit den beiden Booten sind wir mit Volldampf herübergejagt. Das war zugleich eine treffliche Übungsfahrt. Jetzt warten unserer aber neue, große Aufgaben. Dazu bedürfen wir unbedingt Ihrer Mithilfe.«
Der schlichte Bericht von Mister Rugby hatte mich tief erschüttert. Um mich durch Arbeit zu sammeln, war das erste, dass ich ihm seine Wache abnahm.
Am Donnerstag waren wir in See gegangen. Am Sonnabend fuhren wir in den Hafen von Düwelsland ein.
Kapitän Düwel empfing mich mit großer Herzlichkeit, wie er sie sonst nie an den Tag legte. Die alten Gesichter der Teufelsmannschaft leuchteten auf. Ich fühlte mich glücklich und geborgen.
Dann folgte eine Beratung im engsten Verein zwischen dem Kapitän, Mister Rugby und mir.
»Meine Herren«, begann der Kapitän mit ungewohnter Feierlichkeit, »wir können dieses Leben nicht weiterführen. Wir müssen mindestens ein klares, vaterländisches Ziel haben, das wir allen unseren Mannschaften und auch den vorhandenen Offizieren vorlegen können. Wir dürfen nicht den hundertsiebzig Mann, die dazugekommen sind, zumuten, unter der Teufelsflagge zu fahren. Das geht einfach nicht. Ebenso wenig dürfen wir unter deutscher Kriegsflagge segeln. Dazu haben wir kein Recht. Wir müssen uns also hier zunächst verständigen. Da bleibt weiter nichts übrig, als dass wir aus den befreiten Gefangenen zunächst alle Offiziere der Land- und Seemacht herauslesen und die ganze Sache militärisch einrichten. Der Rangälteste ist der Oberbefehlshaber auf der Insel und bestimmt zugleich, wer die Führung der Schiffe zu übernehmen hat. Diesen Zustand halten wir dann aufrecht, bis wir Anschluss an ein deutsches Geschwader gefunden haben. Ohne Zweifel gibt's noch irgendwo deutsche Kriegsschiffe oder Hilfskreuzer, denen übergeben wir die Insel und Schiffe und Mannschaften. Wir müssen sie aber aufsuchen. Der Kapitän bestimmt dann, unter welcher Flagge gesegelt werden soll. Es kommt vielleicht die englische in Betracht, vielleicht auch die Teufelsflagge. Auf jeden Fall muss jeder Mann wissen, dass das nur etwas Vorläufiges ist bis wir den Anschluss an die Kriegsmacht finden. Der Rangälteste ist ohne Zweifel Mister Rugby. Er muss also die Oberleitung übernehmen.«
»Ich bin einverstanden«, entgegnete der erste Steuermann. »Es darf keinerlei Zweifel oder Unsicherheit herrschen. Wir haben auch die Aufgabe, den ›Eagle‹ herzuführen. Ich werde also hierbleiben und alles einrichten, und Sie übernehmen die beiden Schiffe, die den ›Eagle‹ freimachen sollen. Dann bringen wir das Kriegsschiff ebenfalls hier im Hafen unter und müssen mit aller Macht versuchen, den Anschluss zu finden. Jedenfalls müssen alle Mannschaften versammelt werden und volle Klarheit bekommen.«
So geschah's. In der Hölle fand eine große Musterung und Beratung statt. Es waren unter uns noch 12 Offiziere, meist Seeleute, ohne die zwei, die auf dem ›Eagle‹Wrack als Prisenkommando zurückgeblieben waren. ›Oberst‹ Rugby — so nannte er sich — übernahm die Führung. Er hielt eine Ansprache, dass wir als versprengter Haufe Deutscher ja uns baldmöglichst der großen Meeresmacht des Vaterlands anschließen müssten, dass es aber unter den obwaltenden Umständen nur möglich sei, irgendein deutsches Geschwader aufzusuchen, da auch der Zugang zu allen Kolonien verlegt sein dürfte. Immerhin müssten alle den Kriegsgesetzen unterstehen und würden vorläufig als selbstständig arbeitender Truppenteil, als vorgeschobene Weltpatrouille angesehen.
Dann wurden die Mannschaften eingeteilt in Landtruppen, die den Wachtdienst und die Bedienung der Geschütze übernahmen, und in Seetruppen, die den einzelnen Fahrzeugen zugeteilt wurden. Die allgemeine Kaserne war die ›Wasserhexe‹. Sie war zugleich der Sitz des Oberbefehlshabers. Nur blieben natürlich die Mannschaften des ›Seedrachen‹ und der Kanonenboote auf ihren Schiffen.
Ich bekam den Oberbefehl über das Kanonenboot und den Auftrag, unter Führung von Kapitän Düwel, der den ›Seedrachen‹ übernahm, für die Bergung des ›Eagle‹ zu sorgen. Auf Düwelsland wurde unter Hurra die deutsche Flagge gehisst. Die Flaggenführung auf den Schiffen unterstand dem Geschwaderchef. Das war in meinem Fall Kapitän Düwel.
Am folgenden Tag schon fuhren wir aus, um nach dem ›Eagle‹ zu sehen. Ich war also der Kapitän eines englischen Kanonenboots geworden. Von den alten Mannschaften waren bei mir Jasper, Sepp und Luzifer, Pipifax fuhr als Koch, der Stromer als Bootsmann. Als Steuermann hatte ich einen Steuermann der Befreiten, aus denen auch die übrige Mannschaft ergänzt war.
Wir hatten herrliche Fahrt und näherten uns am folgenden Tag der Lagune, die unser Reiseziel war, als am westlichen Horizont ein Dampfer aufkam. Sofort signalisierte mir Kapitän Düwel, dass wir auf ihn zuhalten und ihn womöglich zwischen uns nehmen sollten.
Es gelang, da der Dampfer, der südlichen Kurs verfolgte, bedeutend langsamer fuhr als wir. Ich schätzte ihn auf etwa 8000 Tonnen.
Wir zeigten ihm die englische Kriegsflagge. Es war auch ein Engländer. ›John Burns‹ aus Dover.
»Ladung?«
»Kohlen.«
»Reiseziel?«
»Sydney. Wir haben auch Gefangene an Bord, die wir von einem Kriegsschiff übernehmen mussten, um sie dort ins Sammellager zu bringen.«
Hurra. Das war's, was wir brauchten.
»Wie viele Gefangene?«
»Achtzig Mann. Deutsche.«
Der ›Seedrache‹ gab den Befehl:
»Das Kanonenboot übernimmt die Gefangenen, um sie an Bord des ›Eagle‹ zu bringen. Es wird beilegen.«
Niemand war froher als der Kapitän des ›John Burns‹. Arglos stoppte er. Ich fuhr heran und sah, wie der ›Seedrache‹ sich von der anderen Seite näherte und auf zwei Kilometer Entfernung liegen blieb. Unterdessen kam ich dicht heran.
Da ging auf dem ›Seedrachen‹ die Teufelsfahne hoch. Wir sahen, wie sich Entsetzen auf den Gesichtern der Besatzung malte. Alles lief wild durcheinander an Deck.
»Wer seid ihr?«, schrie der Kapitän herüber.
»Deutsche. ›John Burns‹ ist gute Prise«, gab ich fröhlich zurück. Damit fuhr ich heran und schickte mich an, beizulegen. Wütende Gesichter. Flüche. Aber mehr nicht. Dann betraten meine Jungen mit Revolvern das Deck des Kohlenschiffs. Niemand dachte an Widerstand.
Ich erklärte die ganze Besatzung als gefangen und setzte dazu:
»Das Los, das ihr den Deutschen bereitet habt, genau das soll euch werden. Vielleicht also ein sehr gutes. Wo sind die Gefangenen?«
Ein schmutziges Verlies unter Deck wurde geöffnet. In einem einzigen Raum waren alle ohne Unterschied des Ranges zusammengepfercht.
Aber der Jubel, als deutsche Landsleute eindrangen und die allgemeine Freiheit verkündet wurde!
Es waren die Besatzungen von drei Kauffahrteifahrern, die der Krieg überrascht hatte und die von den Engländern aufgebracht waren. Ein Kriegsschiff hatte sie übernommen, musste sie aber einer kleinen Havarie wegen an den Kohlenfahrer abgeben. Hier waren sie zwar nicht angeschlossen worden wie wir, hatten's aber schlecht genug gehabt. Der englische Kapitän entschuldigte sich mit mangelnden Vorräten.
»Das wird sich alles herausstellen, Herr Kapitän. Vorläufig wird Ihre ganze Mannschaft und Sie selbst hier untergebracht.«
Dann übernahm ich das Schiff und setzte den rangältesten Kapitän als Führer ein, mit dem Befehl, sich uns anzuschließen. Es war ein alter Hamburger Seebär, guter Bekannter von Kapitän Düwel. Er brauchte lange Zeit, sich hineinzufinden, dass sein Freund Düwel ihn befreit habe.
Der ›Seedrache‹ gab das Zeichen, nun nach der Lagune zu halten. ›John Burns‹ fuhr in der Mitte, ich am Schluss. So waren wir wieder ein Geschwader und hatten, was wir so nötig brauchten, Kohlen für uns und den ›Eagle‹.
Der ,Eagle‹ machte uns keinerlei Schwierigkeit. Wir erreichten ihn vor Eintritt der erwarteten Springflut. An Bord war alles wohl, und wir bekamen ihn unschwer flott. Eine leichte Havarie konnte durch Taucher ausgebessert werden.
Die deutsche Mannschaft kam uns sehr erwünscht. Es waren alles gediente Seeleute, mehrere Offiziere darunter. Als sie hörten, dass wir eine deutsche Kriegsabteilung seien, mit einem festen Ausgangshafen, nahm der Jubel kein Ende.
Es wurden aber gleich die Kriegsgesetze verkündigt, die Mannschaft wurde auf den ›Eagle‹ und das Kohlenschiff verteilt. Dann bekamen die beiden Schiffe Befehl, nach Düwelsland zu fahren, wo sie sich von dem Zerstörer einlotsen lassen sollten.
Kapitän Düwel und ich wollten uns aufmachen, ein deutsches Kriegsschiff zu suchen. Wir wussten, dass es keine ungefährliche Fahrt war.
Es war der letzte Abend an Bord des ›Eagle‹. Viel hatten wir erlebt, seit wir das Kriegsschiff zum ersten Mal als Gefangene betraten. Draußen vor der Einfahrt zur Lagune lag das Kanonenboot und der ›Seedrache‹. Sie mochten Wache halten gegen einen etwaigen Überfall, aber es war keiner zu fürchten. Wir lagen zu weit außerhalb der üblichen Dampferlinien und wären jedenfalls durch feindliche Funksprüche gewarnt worden.
Wir vier Kapitäne saßen bei einem guten Glas Rotwein und prachtvollen Zigarren beisammen, dem Erbe von Kapitän Hyman, und besprachen unsere bevorstehende Trennung. Mit Tagesanbruch sollten ›Eagle‹ und ›John Burns‹ die Lagune verlassen, um nach Düwelsland zu steuern.
»Dass Ihr Mut habt, Kapitän Larsen, weiß ich. Wir haben aber eine schwere Aufgabe vor uns«, begann Kapitän Düwel. »Wir müssen einen feindlichen Hafen anlaufen. Dort wird man am besten über deutsche Kriegsschiffe, die etwa noch in der Nähe kreuzen, unterrichtet sein, und wir müssen so viel Glück haben, dass wir jedem englischen ›Man of war‹ aus dem Weg gehen. Wenigstens möchten wir in unserem Hafen auf keinen stoßen. Im offenen Meer brauchen wir einen Kampf nicht zu scheuen. Auf unsere Leute dürfen wir uns verlassen.«
»Und welches Ziel habt Ihr im Auge, Käpten? Ich werde mit ganzer Seele meinen Mann stellen und stehe auch ein für meine Leute.«
»Ich weiß, ich weiß. Unser nächster Hafen von Bedeutung ist Yokohama. Wir zeigen die englische Flagge und erkundigen uns nach deutschen Kriegsschiffen, haben geheime Befehle, können uns nicht aufhalten und so weiter. Die Sache ist nun die. Wir dürfen nicht beide in den Hafen. Sonst könnten wir in einer Mausefalle sitzen. Ihr müsst also allein einfahren. Ich decke Euch inzwischen den Rückzug und jage jedem etwa herbeieilenden Kriegsschiff einen Torpedo in den Bauch. Wenn Ihr innerhalb einer bestimmten Zeit nicht herauskommt, so fahre ich ein, und dann Gnade Gott dem Hafen und der Stadt! Ich gebe Euch noch den Bootsen mit. Dann habt Ihr eine Reihe zuverlässiger Leute, und dann behüt Euch Gott.«
»Aber gewiss, Käpten Düwel. Was möglich ist, werde ich tun. Übrigens kenne ich Yokohama, kann mich im Bedarfsfall auch auf Japanisch ein wenig verständigen.«
Und wir fuhren. Der ,Eagle‹ und ›John Burns‹ wurden mit aller Vorsicht bei Tagesanbruch aus der Laguneneinfahrt gebracht. Dann wandten sie sich südwärts, während wir auf Yokohama dampften.
An einem strahlenden Nachmittag fuhr ich unter englischer Flagge in die schmale Straße ein, in deren hinterstem Winkel Tokio liegt. Der berühmte Fudschijama, der schöne Schneeberg Japans, erhob sich im Hintergrund. Der ›Seedrache‹ lag draußen, um mir den Rückzug zu decken. Ein Gewimmel zahlloser Barken belebte das Meer. Wo wir vorüberkamen, wurde gewinkt und »Bansai!« gerufen. Einige harmlose Kauffahrer, Japaner, begegneten mir. Die Ankunft eines englischen Kriegsfahrzeugs erregte kein sonderliches Aufsehen. Wir waren ja Verbündete.
Unablässig musterte ich die Gestade nach japanischen oder englischen Kriegsschiffen. Die Luft war rein. Auch der Hafen von Yokohama schien friedlich. Größere Fahrzeuge lagen zwar da, allein es waren nur Handelsschiffe, einige Amerikaner waren darunter, die meisten aber wohl Japaner.
Vorsichtig näherten wir uns dem Kai. Ich hatte alle unsere Leute genau unterrichtet. Jeder Mann stand auf seinem Posten und wusste genau, was er zu tun hatte. Wir hielten uns unter vollem Dampf, um jeden Augenblick zur Abfahrt bereit zu sein. So legten wir an.
Die Japaner sind überaus höflich. Die Hafenpolizei kam heran und beglückwünschte uns zur guten Fahrt. Ich bat, dem Hafenkommandanten meine Ankunft zu melden. Der Herr erschien selbst, und bald saßen wir in meiner Kajüte in harmlosem Geplauder. Er sprach ein tadelloses Englisch. Es wurden die üblichen Höflichkeitsformeln gewechselt. Dann berichtete ich von meinem Befehl.
Ich sei Vorposten eines größeren Geschwaders, das die Aufgabe habe, die See von Deutschen zu säubern. Ob ihm bekannt sei, wo man noch deutsche Kriegsschiffe vermuten könne.
Aber gewiss, erklärte er eifrig. Es müssten noch mehrere deutsche Hilfskreuzer südlich in chinesischen Gewässern sein, möglicherweise auch noch weiter südlich. Bereits werde eifrig Jagd gemacht auf sie, aber noch sei keine Nachricht vom Erfolg eingelaufen. In chinesischen Häfen seien übrigens viele Schiffe festgehalten, die dort Zuflucht gesucht hätten. »Aber«, setzte er mit verschmitztem Lächeln hinzu, »ich denke, wir werden in China bald jedem Deutschen den Aufenthalt unmöglich gemacht haben.«
»Wieso?« —, erwiderte ich arglos.
»Ja, sehen Sie, alle europäischen Staaten sind jetzt überreich beschäftigt mit der Niederzwingung Deutschlands. Wir sind Englands Freunde und Verbündete. Es ist selbstverständlich, dass wir unseren Freunden den Rücken decken und ihm seine Aufgaben in China so gut wie möglich erleichtern. Wir verstehen mit China deutlich zu reden und werden dafür Sorge tragen, dass ihm alle etwaige Deutschfreundlichkeit vergeht.«
»Halten Sie die für so groß?«
»Das gerade nicht, aber es ist besser, wenn hier im Osten Deutschland und jede andere Macht überhaupt ausgeschaltet wird. Das kann doch nur verwirrend wirken auf die ohnehin der Ordnung bedürftigen chinesischen Zustände. Jedenfalls sollten England und Japan Hand in Hand arbeiten, und da unsere Freunde im Westen so stark beschäftigt sind, ist's doch nur recht und billig, dass wir hier als ihre Freunde auftreten und alles in unserem gemeinsamen Interesse ordnen.«
Ach ja, ich verstand den gelben Schimpansen mit dem ewig lächelnden Gesicht. Damals hatte Japan schon recht gründlich angefangen, in China auf seine Weise Ordnung zu stiften.
»Und weiter bedürfte überhaupt manches der Neuordnung. Dass Deutsche sich auf Inseln der Südsee festgesetzt hatten, war eine Beleidigung für Japan und England. Nun, die Sache ist erledigt. Es wird nicht wieder vorkommen. Aber was meinen Sie zu Holland? Zwischen Ihrem und unserem Besitz sind große und reiche holländische Inseln eingeschoben. Holland versteht nicht, sie zu bewirtschaften. Unruhen und Aufstände der Eingeborenen sind an der Tagesordnung. Und gerade diese Inseln trennen unseren Machtbereich. Wir sind Freunde. Wir wollen gerade darum nicht, dass irgend jemand zwischen uns steht. Es ist sehr zu beklagen, dass Holland sich nicht auf Seite der Deutschen schlägt, sondern sich neutral verhält. Wir könnten euch in diesem Fall einen großen Gefallen tun und Holland hier angreifen, während ihr es dort in seiner Heimat besetzt.«
»Verehrter Herr, Sie haben große Pläne, aber noch sind wir weit entfernt davon, sie verwirklichen zu können.«
»Weit? —— Das hängt von euch ab. Die deutsche Flotte liegt auf dem Meeresgrund. England hat Belgien und Hamburg besetzt. Ist es so schwierig, einige Truppen in Holland einrücken zu lassen? Unsere Flotte wartet nur auf das Zeichen und wird die holländischen Inseln beschlagnahmen, damit zwischen uns kein Fremdkörper bleibt. Wir können nach dem Krieg unter uns die Sache regeln. Jetzt hat der Westen das Wort. Nach dem Kriege wird der Osten reden.«
»Und Amerika?«
»Ach, mit Amerika ist es sehr einfach. Es ist zu groß und zu wenig geschlossen, verfügt auch über nicht genügende Truppen und Schiffe. Amerika hat unermessliche Aufgaben im eigenen Lande, in Mexiko. Der Panamakanal stürzt beständig ein und ist im Ernstfall sicher nicht zu benutzen. Wir können Amerika einen großen Dienst erweisen, wenn wir ihm die Ordnung auf den Philippinen abnehmen. Auf diesen Inseln sind eigentlich nur wenige Hafenplätze besetzt. Die Inseln friedlich zu durchdringen, Ordnung und neues Leben zu schaffen, das wäre eine Aufgabe, der eigentlich nur Japan gewachsen ist. Überhaupt...«
Ich hätte gern noch länger zugehört, wie hier japanische Zukunft als größte Selbstverständlichkeit auseinandergelegt wurde. Aber ein furchtbarer Lärm auf Deck unterbrach jäh unsere friedliche Teilung der Welt.
Böses ahnend eilte ich hinauf und hörte dort kräftige deutsche Flüche. Der Mensch flucht immer in seiner Muttersprache. Draußen standen ein Engländer und mehrere japanische Polizeibeamte, die stürmisch zum Hafenkommandanten begehrten. Ich hörte nur: »Deutsche sind's! — Ich hab's gleich gesagt. — Falsche Flagge! — Deutsches Kanonenboot!«
Eine Menge Volks lief am Kai zusammen. Alles brüllte, johlte, suchte an Deck zu dringen, während unsere Jungens schnell das Laufbrett eingezogen hatten und ihrerseits um die Eindringlinge einen fluchenden Knäuel bildeten.
»Sofort Taue kappen!«, kommandierte ich. »Bootsmann — ausfahren, während ich hier Ordnung schaffe!«
Einige schnelle Befehle flogen unseren Jungen ohne Weiteres zu. Die beiden Taue, die uns mit dem Kai verbanden, wurden abgehackt. Den Fall hatte ich schon vorgesehen. Dann bat ich mit aller Höflichkeit die Herren in die Kajüte. Aber der Engländer tobte und schrie, die Polizisten drangen auf mich ein, und eben erschien das erstaunte Gesicht des Hafenkommandanten, um zu fragen, was los wäre. Am Kai johlte die Menge. Man verstand sein eigenes Wort nicht.
Mit einigen kräftigen Stößen beruhigte ich zunächst die Polizisten und packte dann den Engländer, dem ich die Faust ins Gesicht setzte, dass er verstummte. Trotzdem versuchte er noch allerlei Bewegungen, obwohl ihm das Blut von der Nase troff.
»Wenn Ihr nicht augenblicklich Ruhe haltet, lasse ich Euch in Eisen legen. Ihr seid an Bord eines Kriegsschiffes!«
Der Hafenkommandant wandte sich zunächst an einen Polizisten, was eigentlich los sei.
Er berichtete, der Engländer behaupte, dies sei ein deutsches Schiff voll deutscher Leute, und habe das Eingreifen der Polizei verlangt.
»Wo sind Eure Deutschen?«, warf ich dazwischen, hatte aber gleichzeitig beobachtet, dass der Bootsmann langsam gewendet hatte und bereit war, Volldampf voraus zu geben.
»Wollt ihr leugnen, dass ihr Deutsche seid?«, brüllte jetzt der Engländer. »Der Matrose dort hat's selbst gesagt.«
In diesem Augenblick begannen die Schiffsplanken zu erzittern.
»Ich denke gar nicht dran zu leugnen, bin Euch überhaupt keine Rechenschaft schuldig. Wer seid Ihr eigentlich?«
»Mein Herr«, begann nun der Japaner, »was bedeutet das? Euer Schiff fährt!«
Mit anscheinendem Verwundern blickte ich mich um.
»Ja, es scheint so.«
»Verrat, Verrat ist das« —, tobten nun der Engländer und die Polizei.
Aber blitzschnell hatte ich meinen Revolver gezogen und sah, wie meine Jungen sich bereit stellten.
»Warum erregt ihr euch denn so? Ich werde jeden, der den geringsten Widerstand leistet, auf der Stelle niederschießen. Redet ruhig einer nach dem anderen! Ihr sollt alle Aufklärung haben.«
Das Boot raste durch den Hafen, an den Kauffahrern vorüber. Wäre die johlende Menge nicht gewesen, hätte jedermann geglaubt, es handle sich um eine kleine Spazierfahrt, die der Hafenkommandant auf dem Kanonenboot einer befreundeten Macht unternehme.
Der begriff langsam.
»Seid ihr wirklich Deutsche?«, fragte er.
»Gewiss, mein Herr. Aber wir segeln nicht unter deutscher Flagge, sondern unter eigener. Und diese englische weht noch, weil wir das Boot erobert haben.«
»Ihr habt das Boot er...«
»Gewiss. Erobert. Es hat sich ergeben. Es kam unseren Unterseebooten zu nah und konnte nicht ausweichen.«
»Und die Besatzung?«
»Die Besatzung haben wir einem Postdampfer übergeben.«
»Mein Herr, was habt Ihr vor! Was bedeutet das alles?!«
»O, ich bedaure unendlich, dass ich Euch Unbequemlichkeiten mache. Ich wollte im Gegenteil Euren liebenswürdigen Besuch erwidern. Aber dieser Tölpel hier ist schuld, dass wir so schnell aufbrechen müssen. Und nun erlaubt mir eine Bemerkung! Es ist sehr wohl möglich, dass vom Hafen aus die beiden Batterien, die wir passieren müssen, benachrichtigt werden, uns zu beschießen. Ich würde es ihnen nicht raten, denn auch wir können antworten. Aber gerade darum halte ich's für wünschenswert, dass alle die Herren, Ihr und Eure Untergebenen, genau hier stehenbleiben. Man wird ja Eure Abzeichen erkennen und sich über Eure Anwesenheit beruhigen. Wenn Ihr mich bis an der zweiten Batterie vorüber begleitet, verspreche ich Euch dafür, dass Ihr heil und unangefochten nach Yokohama zurückkommt. Bereitet Ihr irgendwelche Schwierigkeiten, so steht Euch mindestens eine lange Gefangenschaft bevor, wahrscheinlich ist's Euer Tod. Bitte, seht Euch um! Hier ist augenblicklich jeder Widerstand Wahnsinn.«
Der Japaner stand sprachlos und stierte bald mich, bald seine Untergebenen, bald meine Leute an. Aber der Engländer fand sich sofort in die Lage.
»Well«, sagte er, »Ihr habt recht, bleiben wir hier stehen! Schade, dass Ihr Eure Kraft gerade an meiner Nase erprobt habt. Ihr könnt sehr gut boxen, mein Herr.«
Dann sollte er sich vor: Mister Steepy. Er sprach ebenso geläufig Deutsch wie Japanisch und gehörte zu der Klasse von Menschen, die man mit dem Sammelnamen Agenten bezeichnet. Es gibt Agenten, die an sich ehrenwerte Leute sind. Meist sind's kleine Kaufleute, die in den Gebieten braver Bürgerlichkeit vermitteln und Geschäfte abschließen. Steigt man aber höher hinauf, so vermeiden sie den Namen Agent, und dann trifft man allerdings auf eine Meute der jämmerlichsten Bande, die es in der Menschheit gibt. Leider scheinen sie unentbehrlich zu sein. Alle Regierungen arbeiten mit ihnen, man findet sie in den Polizeiverwaltungen, der Börse, der Presse, überall. Mister Steepy war der Agent Englands in Yokohama. Von ihm hatte ich schon mancherlei gehört. Eigentlich ›arbeitete‹ er im Börsenwesen, vermittelte Staatsanleihen und überhaupt große Geldgeschäfte. Aber er betrieb außerdem geheimen Opiumhandel, nahm auch die Maske eines Bücherliebhabers an, kannte ganze Büchereien, Teppiche, Altertümer, Briefmarken und verwertete sie wieder anderswo in Kreisen, die nicht gern in schmierige Läden gehen und doch Liebhaber sind und Geld haben.
Mister Steepy hatte ein Gesicht wie ein Geier. Oben ganz kahl mit einer krausen Nase, die immer im Winde hing. Am beweglichsten waren seine Augen. Er sah immer alles, was um ihn vorging, auch wenn er scheinbar die Augen gesenkt und in ein Buch vertieft hielt. plötzlich öffnete sich im eifrigsten Lesen irgendein Augendeckel. Ein misstrauisches Auge musterte die Umgebung und verschwand ebenso schnell. Dabei wackelten ständig alle Glieder, auch der Kopf wackelte, die Sprache quiekte. Er behauptete, er habe sich dieses Gliederzucken bei einer Krankheit zugezogen. Aber nie konnte man wissen, ob er die Wahrheit sprach.
Seine Hauptfähigkeit war das Auskundschaften und dann die plötzliche Überraschung des Gegners. Überraschend warf er dem Handelnden einen Preis zu in einem Augenblick, in dem er nicht gut nein sagen konnte. Hatte er einen Menschen völlig umlauert, so kannte er seine Schwächen, und danach richtete er seinen Betrug ein. Denn jeder Verkehr mit Mister Steepy endete damit, dass der Andere irgendwo und wie betrogen war. Und zwar in der verbindlichsten Form. So, dass jeder den Verlust gar nicht anmeldete, weil er sich bei der Verfolgung irgendwie lächerlich machen oder peinliche Unannehmlichkeiten erleben würde.
Augenblicklich hatte Mister Steepy den mehr oder weniger gesetzlichen Großhandel aufgegeben und gab sich als Schieber in der Politik. ›Diplomat‹ nannte er sich gern. Denn neben seiner Raubgier plagte ihn ein unbezähmbarer Ehrgeiz. Die eigentlichen Diplomaten ließen ihn zwar stundenlang im Vorzimmer warten und nahmen ihn dann oft gar nicht an. Jeder, der Mister Steepy näher kannte, seufzte auf, wenn er mit dem Kerl nichts mehr zu tun hatte. Aber kein Misserfolg störte ihn, und als anständiger Mensch fühlte er sich nur äußerlich. Da allerdings sehr. Er konnte sehr gewandt auftreten, war fast stets gut gekleidet, gab sich als Millionär und wusste mit jedem zu jeder Zeit anzuknüpfen. Oft trat er als Menschenfreund auf oder als Überbringer wichtigster Neuigkeiten, als Vertreter dergleichen Liebhaberei; kurz, er war unerschöpflich. Dann überschlug er bei jedem seiner Opfer, wie viel man wohl herausholen könnte, und irrte sich nie. Sobald er seine Summe herausgezogen hatte, erlahmte seine Anteilnahme, und er schnürte ein neues Opfer ein.
Diesen edlen Zeitgenossen hatte England in Yokohama als politischen Agenten. Er überwachte Presse, Schiffe, Handel und Stimmung des Landes, kannte alle irgendwie wichtigen Menschen, schmeichelte, wedelte, war überall unentbehrlich und wurde selbstverständlich vorzüglich dafür bezahlt. Für die Zeit nach dem Kriege hatte er schon eine Unzahl Geschäfte dabei angeknüpft. Auch heute hatte sich Mister Steepy schnüffelnd und spürend dem Kanonenboot genähert, hatte erst alle Leute gemustert und offenbar irgendeinen kleinen Verdacht geschöpft. Mit der ihm eigenen Unverfrorenheit war er über das Laufbrett geschlüpft. Aber da wehrte ihn der Matrose Hein ab. Mister Steepy jedoch behauptete, zum Hafenkommandanten zu gehören. Die Polizeidiener, die auf Deck standen und auf ihren Herrn warteten, nickten eifrig. Aber dann war er in einem unbewachten Augenblick von hinten an Luzifer herangetreten, tippte ihn leise auf die Schulter und sagte auf gut Deutsch: »Sie, Männeken, da ham Se was fallen lassen.« Luzifer hatte sich sofort gebückt, worauf der Engländer lächelnd fragte: »Die anderen sind wohl auch Deutsche?«, worauf Luzifer mit einem kräftigen Fluch das zappelnde wohlgekleidete Männchen gepackt hatte und gute Miene machte, es kurzerhand hinüber auf den Kai zu werfen. Aber da hatten sich die Polizisten eingemischt, andere Matrosen waren dazugesprungen, und Mister Steepy schrie aus vollem Hals: »Deutsche! Deutsche!« So war der Knäuel entstanden.
Jetzt, da sein kostbares Leben bedroht war, hatte sich der alte Schieber ohne Weiteres in die veränderte Sachlage gefunden. Er mochte die Überrumpelung des Boots und Yokohamas an sich als großartig empfinden. Wenigstens entsprach das Ganze seinem Geschmack. Da er nun nicht mehr als Retter Englands und Japans auftreten konnte, suchte er sofort die näheren Umstände des Handstreichs zu ermitteln und half so dem Hafenkommandanten langsam in das Verstehen der Wirklichkeit zurück. Mister Steepy hätte ebenso gern mit uns ein Geschäft eingeleitet wie gegen uns, wenn er nur seinen Vorteil dabei hatte.
Augenblicklich war sein Vorteil, harmlos und gesellig zu sein, also war er's. So rasten wir an die erste Batterie heran. Mister Steepy winkte freundlich hinauf. Hatte man oben Böses gegen uns vor, so wurden wir jedenfalls scharf durch Gläser beobachtet, und da sah man den Hafenkommandanten und die Polizei friedlich und harmlos an Deck stehen. Man beschoss uns nicht.
Der Japaner verhielt sich schweigend und verbarg seinen Ärger nach Art seines Volkes hinter Seelenruhe. Ich machte ihn auf die Ufer aufmerksam und bezeichnete ihm einen Punkt vor uns, an dem ich ihn absetzen würde. Bei der großen Belebtheit der Fahrstraße war es leicht möglich, ein entgegenkommendes Fahrzeug dazu zu veranlassen, die Herren mit zurückzunehmen. So kamen wir unangefochten aus dem Bereich der zweiten Batterie und damit in die Nähe des ›Seedrachen‹. Vor feindlichen Kriegsschiffen fürchteten wir uns nicht. Sie sind wehrlos gegen UBoote. Dann übergaben wir unsere gefangenen Herren einem einlaufenden Japaner und verabschiedeten uns höflich mit bestem Dank für die Fingerzeige betreffend die deutschen Kriegsschiffe. Mister Steepy vermochte sogar, mir bei der Trennung die Hand zu drücken. Eine wohlgepflegte Hand mit gekrümmten Fingern und großen Nägeln streckte er mir hin, ich vermied aber, sie zu sehen. Mir verursacht die Berührung solcher Kerle und Schieber körperliches Unbehagen.
Zum Abschied zeigten wir den Heimkehrenden unsere blaurote Fahne und erstatteten bald dem ›Seedrachen‹ Bericht über das kleine Abenteuer.
»Dann ist's ja gut, Käpten Larsen, dass Ihr die Kerle nicht mitgebracht habt. Wir haben schon Esser genug«, bemerkte Kapitän Düwel trocken. »Aber nun ist's um so wichtiger, dass wir bald Anschluss an die Deutschen finden. Jetzt wird die ganze verfügbare japanische Flotte auch noch auf unseren Fersen sein. In einer Art wollen wir es sogar wünschen«, setzte er nachdenklich, wie für sich selbst, hinzu. »Sie sollen nur kommen! Psalm achtundfünfzig, sieben!«
Wir folgten nun eifrig dem Rat von Yokohama und suchten die chinesischen Gewässer ab, fuhren weiter südlich, fingen alle Funksprüche auf. Vergeblich.
Dabei bemühten wir uns tunlichst, Kämpfe zu vermeiden. Es lag uns dran, erst unsere ganze Lage zu klären. Dann sollte freilich ein Kampf beginnen, der den gelben und weißen Engländern auf die Nerven fallen würde.
Da wir durch Funksprüche nichts erfuhren, beschlossen wir wieder einmal einen Dampfer anzuhalten. Ein großer englischer Kasten näherte sich. Er hatte drei Schornsteine und etwa 15 000 Tonnen. Als er das Kanonenboot sah, änderte er ein wenig den Kurs, aber ich hatte es doch gleich bemerkt, und das kam mir verdächtig vor.
»Drauf!«, befahl der ›Seedrache‹, der in ziemlichem Abstand fuhr. Wir richteten es so ein, dass der Dampfer, der den ›Seedrachen‹ anscheinend nicht bemerkt hatte, weil er zu sehr mit uns beschäftigt war, in unsere Mitte kommen musste. Der ›Seedrache‹ war versunken.
Ich gab ihm einen Schuss vor den Bug und befahl ihm zu stoppen.
Der Dampfer hieß ›Abraham Jefferson‹ aus Northshields. Also ein Engländer.
Flaggen stiegen bei uns hoch: »Streicht die Segel!«
Der Dampfer stand.
»Alles in die Boote! Fünfzehn Minuten Zeit! Dann wird ›Abraham Jefferson‹ torpediert.«
»Von wem?«, wurde gefragt.
»Von uns.«
»Was für eine Flagge?«
»Unsere eigene.«
Gleichzeitig ließ ich den blauroten Teufel flattern und sah, dass auch Kapitän Düwel hoch ging und unsere Fahne zeigte.
»Wer seid ihr?«
»Deutsche, aber eigene Flagge.«
Pause. Die Minuten vergingen. Wir drängten zur Eile.
In diesem Augenblick ging drüben die englische Fahne nieder. Dafür kam eine andere auf.
Wahrhaftig! Da wehte die deutsche Kriegsflagge.
Dann kam noch der Wimpel dazu. Gleichzeitig fiel eine Maskierung, und ein schwer gerüstetes Kriegsschiff wurde sichtbar.
Deutsche Kriegsflagge! Endlich gefunden! Mir kamen die Freudentränen in die Augen.
Ich meldete: »Wir sind alle deutsche Reservisten, die sich in den Dienst des Vaterlands stellen wollen. Wir melden uns zur Stelle.«
»Kommt herüber!«
Der ›Seedrache‹ eilte heran. Die Teufelsfahne fiel. Es war ein großer Post- und Personendampfer, schwer bewaffnet, der von vornherein als Hilfskreuzer bestimmt war und hier in der Südsee als Kriegsschiff auftrat. ›Abraham Jefferson‹ und die ganze Aufmachung war natürlich nur Kriegslist. Näheres darf ich nicht sagen. Über Kriegsschiffe darf man nichts schreiben, solange der Krieg nicht beendet ist. Zunge und Feder sind mir gebunden.
Kopfschüttelnd vernahm der Kapitän unseren Bericht. Einen Kaperbrief konnte er nicht ausstellen, wohl aber die deutsche Kriegsflagge, falls wir uns bedingungslos seiner Führung unterstellten.
»Bedingungslos«, erklärte Kapitän Düwel. »Dazu unsere ganze Land- und Seemacht, unseren Hafen, Vorräte und Schiffe!«
»Nanu?«, fragte der Korvettenkapitän verwundert.
Dann erfuhr er von der ›Wasserhexe‹, dem Torpedobootzerstörer, dem ›Eagle‹, ›John Burns‹, von Düwelsland, dem Gefangenlager und dem deutschen Obersten.
»Ihr habt gut gearbeitet. Aber besser ist's, ihr seid nicht Seeräuber mit der Teufelsfahne, sondern gute Deutsche.«
Nun fuhren wir zu dritt nach Düwelsland. Dort wurden ›die gesamten Land- und Seestreitkräfte Seiner Majestät in der Südsee‹ vereidigt. Und nun begann unser Krieg, der bald der Schrecken der Küsten Indiens und Japans wurde. Man wird von uns hören, wenn der Krieg beendet ist. Dann aber!!
Ob Sie meine Niederschrift erhalten werden, ist ungewiss. Nur so viel zur Erklärung. Morgen früh geht ein Streifkommando ab, das die Aufgabe hat, die Verbindung mit der Heimat herzustellen. Ob es sein Ziel erreicht, steht nicht in unserer Hand. Es gibt nur einen Weg. Die Mannschaften müssen Indien umsegeln bis über Aden hinaus und in Arabien den Weg durch die Türkei nach Konstantinopel zu gewinnen suchen.
Den Männern, denen dieser gefahrvolle Weg beschieden ist — sie haben sich freiwillig gemeldet —, gebe ich diese Schrift mit. Kommt sie wirklich in Ihre Hand, so machen Sie ein Buch daraus, wenn sie Ihnen dessen wert erscheint. Sie sei ein ferner Gruß an das kämpfende und ausharrende Deutschland.
Ich hoffe auf frohes Wiedersehen nach dem Krieg.
Mit deutschem Gruß
Frühjahr 1916
Knut Larsen.
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.